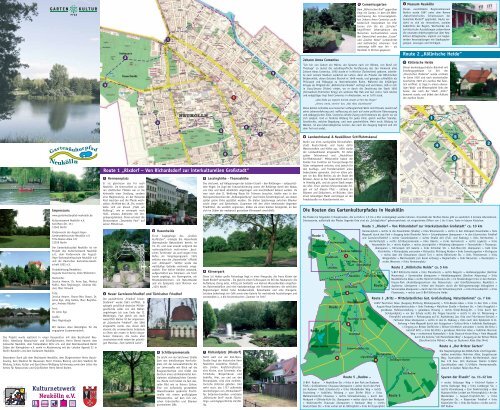Flyer - Gartenkulturpfad Neukölln
Flyer - Gartenkulturpfad Neukölln
Flyer - Gartenkulturpfad Neukölln
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Gartenkulturpfad</strong><br />
<strong>Neukölln</strong><br />
Impressum:<br />
www.gartenkulturpfad-neukoelln.de<br />
Kulturnetzwerk <strong>Neukölln</strong> e.V.<br />
Karl-Marx-Str. 131<br />
12043 Berlin<br />
Förderverein der August-Heyn-<br />
Gartenarbeitsschule <strong>Neukölln</strong> e.V.<br />
Fritz-Reuter-Allee 121<br />
12359 Berlin<br />
Der <strong>Gartenkulturpfad</strong> <strong>Neukölln</strong> ist ein<br />
Projekt des Kulturnetzwerk <strong>Neukölln</strong><br />
e.V., dem Förderverein der August-<br />
Heyn-Gartenarbeitsschule <strong>Neukölln</strong> e.V.<br />
und der Deutschen Gartenbau-Gesellschaft<br />
1822 e.V.<br />
Projektleitung/Redaktion:<br />
Auguste Kuschnerow, Anke Widenhorn<br />
Recherche:<br />
Jessica Amann, Dr. Anne Ego, Markus<br />
Kobin, Marc Reginbogin, Andreas Rülcker,<br />
Marc Vorwerk<br />
Foto:<br />
Jessica Amann, Bruno-Otto Braun, Dr.<br />
Anne Ego, Jörg Kantel, Marc Reginbogin,<br />
Andreas Rülcker<br />
Text:<br />
Dr. Anne Ego<br />
Grafik:<br />
Marc Reginbogin<br />
Wir danken allen Beteiligten für die<br />
engagierte Zusammenarbeit.<br />
Das Projekt wurde realisiert in enger Kooperation mit dem Bezirksamt <strong>Neukölln</strong>,<br />
Abteilung Naturschutz- und Grünflächenamt, Herrn Bernd Kanert; dem<br />
Jobcenter <strong>Neukölln</strong>, dem Freilandlabor Britz e.V. und dem Bezirksverband Berlin<br />
Süden der Kleingärtner e.V. sowie in Abstimmung mit der Lokalen Agenda 21 in<br />
Berlin <strong>Neukölln</strong> und dem Kulturamt <strong>Neukölln</strong>.<br />
Besonderer Dank gilt dem Bezirksamt <strong>Neukölln</strong>, dem Bürgermeister Heinz Buschkowsky,<br />
dem Stadtrat für Bauwesen Herrn Thomas Blesing und dem Stadtrat für<br />
Bildung, Schule, Kultur und Sport Herrn Wolfgang Schimmang sowie dem Leiter des<br />
Amtes für Naturschutz und Grünflächen Herrn Bernd Kanert.<br />
3<br />
2<br />
Columbia<br />
1 Hermannplatz<br />
Er ist gleichsam das Tor nach<br />
<strong>Neukölln</strong>. Im Unterschied zu anderen<br />
städtischen Plätzen war er nie<br />
Keimzelle einer Siedlung, sondern<br />
eine Wegkreuzung, an der Reisende<br />
Rast machten und die Pferde wechselten.<br />
Ab Mitte des 19. Jhs. entwikkelte<br />
sich um diesen „Platz am<br />
Rollkrug“, wie er seinerzeit noch<br />
hieß, urbanes Ambiente mit Vergnügungslokalen.<br />
Daran erinnert die<br />
Bronzestatue „Tanzendes Paar“ auf<br />
seiner Mittelinsel.<br />
3<br />
Neuer Garnisonsfriedhof und Türkischer Friedhof<br />
Der parkähnliche „Friedhof Columbiadamm“<br />
wurde 1861 eröffnet. Er<br />
spiegelt preußisch-deutsche Militärgeschichte<br />
wider von den Befreiungskriegen<br />
bis zum Ende des II.<br />
Weltkrieges. Fast gleich alt, doch<br />
wesentlich kleiner ist der angrenzende<br />
„Islamische Friedhof“, der 1866<br />
eingeweiht wurde. Aus dieser Zeit<br />
stammt die ornamentierte Grabsäule<br />
zu Ehren der ersten in Berlin begrabenen<br />
Osmanen, die heute eher<br />
unscheinbar wirkt neben der prächtigen<br />
Moschee „Türk Sehitlik Camii“.<br />
4<br />
1<br />
Straße<br />
Route 1 „Rixdorf – Von Richardsdorf zur interkulturellen Großstadt“<br />
2 Hasenheide<br />
Einst Jagdgehege des „Großen<br />
Kurfürsten“, erlangte die Hasenheide<br />
überregionale Bekanntheit bereits im<br />
19. Jh, und zwar sowohl aufgrund des<br />
nationalpolitisch motivierten „deutschen<br />
Turnfestes“ als auch wegen ihres<br />
Rufes als Vergnügungspark. 1925<br />
erklärte man die „Hasenheide“ offiziell<br />
zum „Volkspark". Seither wurde das<br />
weitläufige Gelände mehrmals umgestaltet:<br />
Eine kleine Anhöhe entstand,<br />
aufgeschüttet aus Trümmern, ein Teich<br />
wurde angelegt, ein Rosengarten, ein<br />
Rhododendronhain, ein Naturtheater<br />
und ein Spielplatz nach Motiven von<br />
„1001 Nacht“.<br />
4 Schillerpromenade<br />
Sie reicht von der Selchower Straße<br />
über den kreisförmigen Herrfurthplatz<br />
mit der Genezarethkirche bis<br />
zur Leinestraße mit Blick auf die<br />
Baugewerkschule und bildet das<br />
Zentrum eines als Nobelviertel konzipierten<br />
städtebaulichen Ensembles.<br />
Heute noch bietet sie fast dasselbe<br />
Bild wie zu Kaisers Zeiten:<br />
Eine von aufwendig gestalteten<br />
Häuserfassaden gesäumte Prachtstraße<br />
mit einem großzügigem<br />
Mittelstreifen, auf dem sich zwischen<br />
Grünstreifen und Bäumen<br />
promenieren läßt.<br />
allee<br />
Straße<br />
5<br />
6<br />
1<br />
8<br />
5 Lessinghöhe - Thomashöhe<br />
Das sind zwei, auf Ablagerungen der letzten Eiszeit – den Rollbergen – aufgeschüttete<br />
Hügel: Im Zuge der Industrialisierung waren die Rollberge durch den Abbau<br />
von Kies und Sand allmählich abgetragen und anschließend bebaut worden. Da<br />
man nach dem II. Weltkrieg Raum für Trümmer brauchte, häufte man in den<br />
Kleingartenkolonien der „Rollbergsiedlung“ zwei kleine Schutthügel auf, aus denen<br />
später grüne Parks gestaltet wurden. Sie bieten Spazierwege zwischen Bäumen<br />
sowie Liege- und Spielwiesen. Zusammen mit den dicht beieinander liegenden<br />
Friedhöfen, die westlich angrenzen, bilden sie einen breiten Grüngürtel, an den<br />
sich im Süden der neobarock gestaltete Körnerpark anschließt.<br />
6 Körnerpark<br />
Diese 3,6 Hektar große Parkanlage liegt in einer Kiesgrube, die Franz Körner der<br />
Stadt Rixdorf vermachte . Sie gleicht einem Schlosspark im Stil des Neubarock: die<br />
Aufteilung streng axial, mittig ein beidseits von kleinen Wasserkanälen eingefasstes<br />
Rasenmedaillon und eine Kaskadenanlage mit Fontänenbecken; die seitlichen<br />
Begrenzungen bilden hohe Arkadenwände, Balustraden und eine Orangerie.<br />
Letztere beherbergt ein Café sowie eine Galerie für wechselnde Ausstellungen und<br />
veranstaltet u. a die Konzertwochen „Sommer im Park“.<br />
7 Richardplatz (Rixdorf)<br />
Nicht weit von der Karl-Marx-<br />
Straße liegt der historische Kern<br />
<strong>Neukölln</strong>s respektive Rixdorfs –<br />
alte Linden, Kopfsteinpflaster,<br />
eine Kirche, eine Schmiede, eine<br />
Trinkhalle, Bürgerhäuser und<br />
Gehöfte. Hier, am und um den<br />
Richardplatz, wird eine architektonische<br />
Zeitreise geboten. Und<br />
mehr noch: das 1737 außerhalb<br />
des Dorfangers von „Richardsdorf“<br />
für Exilanten-Familien errichtete<br />
„Böhmische Dorf“ macht Flüchtlings-<br />
und Asylgeschichte sinnfällig.<br />
7<br />
9<br />
8 Comeniusgarten<br />
Dem „Böhmischen Dorf“ gegenüber<br />
liegt ein Garten, in dem die Weltanschauung<br />
des Universalgelehrten<br />
Johann Amos Comenius architektonisch<br />
interpretiert ist: Hier<br />
lassen sich die als „Schulen“<br />
begriffenen Lebensphasen des<br />
Menschen nachvollziehen sowie<br />
der Unterschied zwischen „Erster“<br />
und „Zweiter Natur“ (unberührter<br />
und kultivierter) erkennen. Und<br />
unterwegs trifft man ihn – als<br />
Denkmal in Bronze gegossen.<br />
Johann Amos Comenius<br />
"Ich bin von Geburt ein Mähre, der Sprache nach ein Böhme, von Beruf ein<br />
Theologe" so lautet die autobiografische Kurzfassung des Jan Komensk alias<br />
Johann Amos Comenius. 1592 wurde er in Nivnice (Tschechien) geboren, arbeitete<br />
nach seinem Studium zunächst als Lehrer, dann als Priester der Böhmischen<br />
Brüderunität, deren (letzter) Bischof er 1648 wurde, und gelangte schließlich als<br />
Philosoph und Pädagoge zu internationalem Ruhm. Während des 30jährigen<br />
Krieges als Mitglied der „Böhmischen Brüder“ verfolgt und vertrieben, ließ er sich<br />
in Lissa/Leszno (Polen) nieder, wo er durch die Zerstörung der Stadt 1656<br />
(Schwedisch-Polnischer Krieg) ein weiteres Mal Hab und Gut verlor. Sein letztes<br />
und endgültiges Asyl fand Comenius in Amsterdam, wo er 1670 starb.<br />
„Alles fließe aus eigenem Antrieb, Gewalt sei fern den Dingen“<br />
„Omnes, omnia, omnino“ bzw. „Alle, Alles, allumfassend“<br />
Diese beiden Leitsätze aus Comenius‘ umfangreichem Werk sind Hinweis sowohl auf<br />
seine Lebenserfahrung und -auffassung als auch auf seine politische Überzeugung<br />
und pädagogischen Ziele. Comenius lehnte Zwang und Intoleranz ab, gleich wo sie<br />
sich zeigten. Und er forderte Bildung für jedes Kind, gleich welchen Standes,<br />
Geschlechts, welcher Begabung, und zwar ganzheitliche. Mehr noch: Bildung ist<br />
Werden, ist also lebenslängliches Lernen, das nach der Zeugung beginnt und mit<br />
dem Tod erst endet.<br />
9 Landwehrkanal & <strong>Neukölln</strong>er Schiffahrtskanal<br />
Berlin war einst zweitgrößte Binnenhafenstadt<br />
Deutschlands und baute dafür<br />
Wasserstraßen und Häfen aus. 1850 wurde<br />
der Landwehrkanal eingeweiht, 50 Jahre<br />
später Teltowkanal und „<strong>Neukölln</strong>er<br />
Schiffahrtskanal“. Mittlerweile haben die<br />
Kanäle ihre Funktion als Transportwege für<br />
Güter weitgehend verloren, sind jedoch für<br />
den Ausflugs- und Fremdenverkehr umso<br />
bedeutsamer geworden. Und vor allem prägen<br />
sie das Bild Berlins als der Stadt der<br />
Brücken, deren es hier bekanntlich mehr als<br />
in Venedig gibt, und als grüne Stadt wegen<br />
der Ufer. Einer solchen Uferpromenade folgen<br />
wir auf diesem Pfad – entlang an<br />
Bäumen und Sträuchern, an Brücken, über<br />
einen lebendigen Markt und biegen an der<br />
Friedelstraße ins Künstlerviertel ein.<br />
Die Routen des <strong>Gartenkulturpfad</strong>es in <strong>Neukölln</strong><br />
Grenz-<br />
1<br />
Sonnen- allee<br />
<strong>Neukölln</strong>ische Allee<br />
Sie finden im folgenden 5 Hauptrouten, die zu Fuß in 1,5 bis 4 Std. zurückgelegt werden können. Innerhalb der fünften Route gibt es zusätzlich 2 kürzere Alternativen.<br />
Interessante, außerhalb des Pfades liegende Orte sind als „Schlaglichter“ gekennzeichnet: rot eingerahmte Ziffern von 1 bis 5 bzw. Texte in blauen Kästchen.<br />
Route 1 „Rixdorf – Von Richardsdorf zur interkulturellen Großstadt“ ca. 10 km<br />
U<br />
Hermannplatz > rechts in die Hasenheide (Straße) > links Wissmannstr. > rechts in den Volkspark Hasenheide > freie<br />
Route 1<br />
U<br />
Wegwahl durch den Park > Ausgang beim Rixdorfer Teich > Columbiadamm überqueren > in den Islamischen Friedhof<br />
und Garnsionsfriedhof > rechts Columbiadamm > rechts Straße 645 (Fuß- und Radweg) > links Herrfurthstr. ><br />
UHermannplatz<br />
Hasenheide<br />
Herrfurthplatz > rechts Schillerpromenade > links Okerstr. > Links Hermannstr. > rechts Leykestr. > links<br />
Neuwedeller Str. > rechts Kopfstr. > rechts Lessinghöhe > Mittelweg überqueren > Thomashöhe > Thomasstr.<br />
überqueren > Körnerpark mit Galerie > links Schierker Str. > Karl-Marx-Str. überqueren > halb links<br />
URathaus<br />
<strong>Neukölln</strong><br />
Kirchhofstr. > Richardplatz umrunden > Richardstr. Richtung Norden > links Comeniusgarten > Kirchgasse<br />
U<br />
Boddinstr.<br />
1<br />
> rechts über die Streuwiesen (durch Tor) > rechts Böhmische Str. > links Thiemannstr. > links<br />
Weigandufer > Weichselplatz (am Kanal entlang) > Maybachufer > links Nansenstr. > Reuterplatz ><br />
UKarl-Marx-Str.<br />
rechts Weserstr. > links Hermannplatz<br />
U<br />
Leinestr.<br />
Sonnenallee<br />
S<br />
Route 2 „Köllnische Heide“ ca. 5 km<br />
S<br />
U<br />
S<br />
<strong>Neukölln</strong><br />
U<br />
Hermannstr.<br />
U<br />
Grenzallee<br />
S<br />
Köllnische Heide<br />
Route 2<br />
S-Bhf Köllnische Heide > links Planetenstr. > rechts Wegastr. > Heidekampgraben (Berliner<br />
Mauerweg) > Sonnenallee überqueren > Heidekampgraben (Berliner Mauerweg) > links<br />
<strong>Neukölln</strong>ische Allee > rechts Heinrich-Schlusnus-Str. > im Straßenbogen links in den Herbert-<br />
Krause-Park (Ausbildungszentrum des Naturschutz- und Grünflächenamtes <strong>Neukölln</strong>) ><br />
Jupiterstr. überqueren > hinter den Häusern durch die Kleingartenanlage Volksgärten ><br />
Sonnenallee überqueren > durch den Von der Schulenburg Park –> links Drosselbartstr. > links<br />
2<br />
Planetenstr. > rechts zum S-Bhf Köllnische Heide<br />
Route 3<br />
Blaschkoallee<br />
U<br />
Route 3 „Britz – Mittelalterliches Gut, Großsiedlung, Naturdenkmal“ ca. 7 km<br />
U-Bhf Parchimer Allee (Ausgang Richtung Bildungswerk) > Fritz-Reuter-Allee > links in den Park > links<br />
August-Heyn-Gartenarbeitsschule > links Parkweg > Malchiner Straße > Rambow Str. > links Krugpfuhl ><br />
geradeaus Hufeisensiedlung > geradeaus Hüsung > rechts Onkel-Bräsig-Str. > links durch den<br />
Schulparkplatz > vor der Schule rechts die Treppe herunter > rechts in den kl. Wiesenweg ><br />
U<br />
Parchimer Allee<br />
Fennpfuhl umrunden > Parkausgang auf kl. Asphaltweg (zw. Kita und Fritz-Karsen-Schule) ><br />
Fulhamer Allee überqueren > rechts in den kl. Radweg > links nach dem Spielplatz in kl.<br />
3<br />
Parkweg > freie Wegwahl durch den Gutsgarten > Schloss Britz > halblinks Backbergstr.<br />
> Eingang zur Britzer Dorfkirche > Britzer Kirchteich umrunden > rechts Alt-Britz ><br />
Route 4<br />
U<br />
Britz Süd<br />
Gutshof Britz > links Alt-Britz > geradeaus Mohriner Allee > halblinks Massiner<br />
Weg > rechterhand Roetepfuhl > links Deutsch-Krone-Ring > freie Wegwahl<br />
durch die Kolonie "Am Marienfelder Weg" > Ausgang an der Britzer Mühle<br />
(Stechhan’sche Mühle) > Weg zur Buckower Allee (Bus M44)<br />
Britzer Garten<br />
5<br />
U<br />
Johannisthaler Str.<br />
U<br />
Lipschitzallee U U<br />
Wutzkyallee<br />
4 Zwickauer Damm<br />
4<br />
5<br />
3<br />
Route 4 „Der Britzer Garten“<br />
Die Haupteingänge des BUGA-Parks sind folgendermaßen<br />
erreichbar: Mohriner Allee, Sangerhauser<br />
Weg, Tauernallee: U-Bahn Alt-Mariendorf, dann<br />
Bus 179 bzw. 181; Buckower Damm: U-Bahn<br />
Lipschitzallee oder S-/U-Bahn Hermannstraße,<br />
danach in beiden Fällen Bus M44.<br />
Route 5 „Rudow – Spuren der Eiszeit“ ca. 11-12 km<br />
U-Bhf Rudow > <strong>Neukölln</strong>er Str. > links in den Park am Rudower<br />
Fließ > Großziethener Chaussee überqueren > weiter durch den Park<br />
am Rudower Fließ (Erlenbruch) > links Rhodeländer Weg > rechts<br />
Gockelweg > halblinks Feldweg > zum Dörfer Blick > links<br />
Waßmannsdorfer Chaussee > rechts Schneehuhnweg > durch den<br />
Nordpark > Elfriede-Kuhr-Str. überqueren > weiter durch den Nordpark<br />
> Waltersdorfer Chaussee überqueren > Narkauer Weg > rechts<br />
Deutschtaler Str. > links vorbei am kl. Röthepfuhl > links Am Espenpfuhl<br />
Route 5<br />
1 Museum <strong>Neukölln</strong><br />
Dieses zweitälteste Regionalmuseum<br />
Berlins wurde 1897 unter dem Namen<br />
„Naturhistorisches Schulmuseum der<br />
Gemeinde Rixdorf“ gegründet. Heute versteht<br />
es sich als innovatives, soziales<br />
Gedächtnis der Region. Wechselnde kulturhistorische<br />
Ausstellungen präsentieren<br />
die neuesten Arbeitsergebnisse über <strong>Neukölln</strong>er<br />
Alltagskultur, ergänzt von begleitenden<br />
Veranstaltungen wie Stadtspaziergängen,<br />
Lesungen und Vorträgen.<br />
Route 2 „Köllnische Heide“<br />
1<br />
Köllnische Heide<br />
Dieser denkmalgeschützte Bahnhof mit<br />
Empfangsgebäude im Stil der<br />
„Klassischen Moderne“ wurde erstmals<br />
im Jahre 1920 und nach wechselvoller<br />
Geschichte 1993 ein zweites Mal feierlich<br />
eröffnet. Er liegt in einem ehemaligen<br />
Wald- und Wiesengebiet links der<br />
Spree, das nach der Stadt „Cölln“<br />
benannt wurde, und bildet den Auftakt<br />
der zweiten Route.<br />
U<br />
Alt-Rudow<br />
> rechts Ostburger Weg > Kirchhof Rudow ><br />
rechts Ostburger Weg > links Lettberger Str. ><br />
rechts Künnekeweg > Zum Dankmarsteig > über<br />
Rudower Höhe (vorbei am Priesterpfuhl) > An der<br />
Werderlake > August-Froehlich-Str. > links<br />
Köpenicker Str. > Köpenicker Friedhof > links<br />
Köpenicker Str. > links Alt-Rudow > rechts zum U-<br />
Bhf Rudow<br />
2
2 Heidekampgraben<br />
Er war zu DDR-Zeiten Grenzfluss und<br />
„grüne Wand“. Nach der Wiedervereinigung<br />
wurde der Grünzug am Heidekampgraben<br />
gelichtet und zugleich naturnah<br />
weiterentwickelt. Pfade und Fußgängerbrücken<br />
über den Graben wurden angelegt<br />
sowie der Mauerweg für Radfahrer und<br />
Spaziergänger. Eine besondere Attraktion<br />
ist der Naturerkundungspfad des Freilandlabors<br />
Britz mit Infostationen, wo kleine<br />
Forscher sich Einblick in ökologische<br />
Zusammenhänge verschaffen können.<br />
4 Volksgarten<br />
Volksgarten ist nicht gleich Volksgarten:<br />
Der Spaziergänger, der weniger Lust auf<br />
Gartenästhetik mit Wasserspielen,<br />
Denkmalen und Pavillons hat, sucht am<br />
besten eine der 94 <strong>Neukölln</strong>er Kleingartenkolonien<br />
auf – zum Beispiel den<br />
„Volksgarten“. Laubenhäuser sind zwar<br />
nicht zu finden, aber die Tradition alter<br />
Bauerngärtchen, in denen man auf kleinen<br />
Parzellen Obst, Gemüse und<br />
Zierpflanzen kultiviert, Kleintieren noch<br />
Raum lässt und Vögeln geeignete<br />
Nistplätze bietet.<br />
1 2 August-Heyn-Gartenarbeitsschule<br />
Sie ist Naturparadies und zugleich<br />
erlebnis- und umweltpädagogischer<br />
Lernort, in dem Großstadtkinder heimische<br />
Flora und Fauna erkunden und verantwortlichen<br />
Umgang mit Natur lernen<br />
können. Hier finden sie Sträucher,<br />
Bäume, Blumen, Gemüsebeete, ein<br />
Getreidefeld und Teiche, sogar eine<br />
kleine Schafherde lebt hier. Zudem stehen<br />
eine Solar- und eine Regenwasser-<br />
Aufbereitungsanlage sowie ein Steinbackofen<br />
zur Verfügung.<br />
3 Herbert-Krause-Park<br />
Diese Grünanlage wurde von auszubildenden<br />
Landschaftsgärtnern gestaltet<br />
und trägt den Namen Herbert Krauses,<br />
der 1974-96 Leiter des Naturschutzund<br />
Grünflächenamtes war. Im Mittelpunkt<br />
des Parks liegt der „Saale-Stein“,<br />
ein Geschenk der Stadt Hof. Darum<br />
herum findet der Besucher Bänke und<br />
Staudenbeete. Wer Lust auf mehr oder<br />
besondere Raritäten hat, geht ins Ausbildungszentrum<br />
des NGA: Koniferenwäldchen,<br />
Heidegarten, japanische<br />
Bäume und nicht zu vergessen – der<br />
Mammutbaum.<br />
5 Von der Schulenburg Park<br />
Diese Grünanlage, benannt nach Rudolf<br />
Wilhelm Graf von der Schulenburg, gab es<br />
bereits zur Zeit der Weimarer Republik.<br />
Älter noch als der gartenarchitektonische<br />
Entwurf ist der sog. Märchenbrunnen am<br />
großen Wasserbecken, den wir in der Mitte<br />
des Parks finden: Vom Bildhauer Ernst<br />
Moritz Geyger entworfen, dann fast zwei<br />
Jahrzehnte eingelagert, wurde er 1935<br />
erstmals aufgestellt. Nach wiederholten<br />
Beschädigungen und Reparaturen dieses<br />
Brunnens schritt man 2001 zu einer<br />
umfassenden Restauration und stellte das<br />
historische Wasserbild wieder her.<br />
2 Teltowkanal<br />
„Endlich wird niemand leugnen können, daß der Kanal auch in Britz zur<br />
Verschönerung des Landschaftsbildes und zur allgemeinen Belebung der Gegend<br />
wesentlich beträgt“, so die „Britzer Wochenschau“ 1911. Jetzt ist dieser 38 km<br />
lange Verbindungskanal zwischen Havel und Spree 100 Jahre alt. Er durchfließt<br />
<strong>Neukölln</strong>, mündet in die Dahme und streckenweise sind seine Ufer mit Fußgängerund<br />
Radwegen ausgestattet.<br />
3 Britz-Buckow-Rudow-Grünzug<br />
Dieser Grünzug knüpft historisch an Lennés „projektierte Schmuck- und Grenzzüge“<br />
an, die von Berlins Mitte ausgehend quasi sternförmig in die Vororte laufen sollten.<br />
Als in der Nachkriegszeit die Großsiedlung „Britz-Buckow-Rudow“ (BBR, später<br />
„Gropiusstadt“) konzipiert wurde, plante man als entscheidendes Strukturelement<br />
einen breiten, über der U-Bahn-Trasse verlaufenden Grünzug. Er zieht sich<br />
von „Britz Süd“ entlang der Stationen der Linie 7 bis „Rudow“.<br />
Route 4 „Der Britzer Garten“<br />
Dieser 87 ha große Landschaftspark wurde anlässlich der Bundesgartenschau 1985<br />
angelegt und im Jahr 2002 zu einem der zehn schönsten Gärten Deutschlands<br />
gewählt. Im Zentrum liegt die großzügige Seenlandschaft mit Stränden, Buchten,<br />
Brücken, drei bis zu 18 m hohen Aussichtshügeln und Quellen, die Bachläufe und<br />
Wasserfälle speisen. Und ringsum gruppieren sich Themengärten, Spiellandschaften<br />
für die Kleinen, ausgedehnte Liegewiesen, weitläufige Spazierwege, Biotope,<br />
Wälder. Bauten und Kunstwerke sind in die jeweils räumliche Gegebenheit eingebettet<br />
und die angrenzenden Areale abwechslungsreich modelliert. Wer sich<br />
zunächst einen Überblick verschaffen will, kann bei schönem Wetter die<br />
Museumsbahn für eine knapp einstündige Rundfahrt nehmen. Während des<br />
Sommers gibt es an den Wochenenden<br />
Kindertheater und übers ganze Jahr<br />
verteilt diverse Feste und Veranstaltungen:<br />
Walpurgisnacht, Sommersonnenwendfest,<br />
Drachenfeste oder St.<br />
Martins-Umzüge, Klassik-Open-Air. Der<br />
Park kostet geringen Eintrittspreis, für<br />
Kleinkinder und Behinderte ist der<br />
Eintritt frei.<br />
Route 3 „Britz – Mittelalterliches Gut, ...“<br />
3 4 Krugpfuhl und Hufeisenteich<br />
Zwei Pfuhle, von denen einer naturgeschichtlich,<br />
der andere siedlungshistorisch<br />
interessant ist. Der „Krugpfuhl“<br />
liegt in einer Grünanlage und zählt zu<br />
den Naturdenkmalen, der „Hufeisenteich“<br />
in der Siedlung gleichen<br />
Namens. Letzterer war bereits in der<br />
Jungsteinzeit Zentrum eines Dorfes.<br />
Danach wechselten Perioden der<br />
Verwilderung und kultureller Prägung.<br />
Mohriner<br />
13<br />
Grade-<br />
12<br />
Hufeisensiedlung<br />
Rationalität, Wirtschaftlichkeit und<br />
Sozialrefom mit der Idee der Gartenstadt<br />
zu verschmelzen, war die Idee des<br />
„Neuen Bauens“. Sie wurde beispielhaft<br />
umgesetzt in der Großsiedlung westlich<br />
der Fritz-Reuter-Allee: Im Zentrum steht<br />
ein Wohnblock in Form eines Hufeisens,<br />
an dessen offener Stelle ein ovaler Pfuhl<br />
liegt, und an dessen geschlossenem<br />
Bogen ein rautenförmiger Straßenplatz<br />
anschließt. Unübersehbar ist dabei<br />
Bruno Tauts Vorliebe für Farben,<br />
Formen, Kontraste.<br />
7 8 9 10 11 Schloß Britz<br />
Es feierte vor Kurzem sein 300jähriges<br />
Jubiläum, dieses Gutshaus eines<br />
der besterhaltenen Rittergüter<br />
Berlins. Der Adelssitz wird urkundlich<br />
erstmals 1375 unter dem Namen<br />
„Britzik“ erwähnt. Das heutige Herrenhaus<br />
stammt aus dem 15. Jh. Seit<br />
der Zeit hat das Gut mehrmals den<br />
Besitzer gewechselt und das Gebäude<br />
sein Aussehen: Aus dem 1547 gebauten<br />
Lehmfachwerkbau war bis zum Jahr 1883 ein kleines Schloss mit Turm im Stil<br />
der Neo-Renaissance geworden. Wie das Gutshaus änderte sich auch das<br />
Erscheinungsbild des Parks: Erhielt er im 18. Jh. den geometrischen Zuschnitt des<br />
Barock, so im 19. Jh. zunächst die des Biedermeier, dann die eines Landschaftsgartens<br />
mit geschwungenen Wegen und exotischen Pflanzen. Das Guts-Ensemble<br />
hatte während des Krieges durch Bombenschäden und danach durch bauliche<br />
Eingriffe gelitten. Anlässlich der BUGA wurde der Zustand von 1883 rekonstruiert.<br />
Seit 1988 stehen Schloss und Park dem Publikum wieder offen.<br />
4<br />
5<br />
6 Fennpfuhl<br />
Eingebettet in einen Grünzug liegt<br />
einer der größten Pfuhle <strong>Neukölln</strong>s.<br />
Ehedem verlandet, ist der Fennpfuhl<br />
heute wieder ein Feuchtbiotop<br />
und genießt den Schutz eines<br />
Naturdenkmals ebenso wie der<br />
Findling, der im „Ehrenhain“ am<br />
Fennpfuhl liegt. Eine Beobachtungsplattform<br />
ermöglicht den Zugang<br />
zum Wasser.<br />
Tempelhofer<br />
14<br />
Damm<br />
15<br />
10<br />
9<br />
Britzer-<br />
13 Am Marienfelder Weg<br />
Direkt an den „Britzer Garten“ schließt<br />
sich östlich die „Kolonie am Marienfelder<br />
Weg“ an. Es handelt sich um eine<br />
dauerhaft gesicherte Kleingartenkolonie.<br />
Südlich wird sie begrenzt von der<br />
„Blütenachse“, einem der Eingänge in<br />
den BUGA-Park. Überquert man diesen<br />
Weg, so gelangt man in die „Kolonie<br />
zur Windmühle“, an deren südöstlichem<br />
Ausgang man die „Stechhansche<br />
Mühle“ findet, während südwestlich der<br />
„Parkfriedhof <strong>Neukölln</strong>“ angrenzt.<br />
5 Buckower Dorfkirche<br />
Diese spätromanische Kirche wurde um<br />
1220 errichtet und später mehrmals<br />
umgestaltet. Mitte des 16. Jhs. unterteilte<br />
man entsprechend dem Stil der Gotik<br />
das flachgedeckte Langhaus durch eine<br />
Säulenreihe in zwei Schiffe. Die Ausmalungen<br />
im Kreuzrippengewölbe sind<br />
noch in blassen Fragmenten erkennbar.<br />
Zwei der Glocken im Turm stammen aus<br />
dem Mittelalter: Die größere wurde 1322<br />
gegossen, die kleinere und ältere stammt<br />
aus dem Jahr 1250 und kann nur per<br />
Hand geläutet werden.<br />
8<br />
11<br />
7<br />
3<br />
6<br />
5<br />
12 Roetepfuhl<br />
Der Name dieses zwischen der<br />
Mohriner Allee und Massiner Weg<br />
liegenden Pfuhls weist auf seine<br />
frühere Nutzung bei der Textilherstellung<br />
hin. Heute ist er mit seinen<br />
Röhricht- und Unterwasserpflanzen<br />
ein Biotop für Fische und<br />
Amphibien. Das 23100 qm große<br />
Gebiet „Roetepfuhl und Umgebung“<br />
steht unter Naturschutz.<br />
14 Britzer Mühle<br />
Diese 20 Meter hohe Galerie-Holländerwindmühle<br />
wurde 1865 gebaut und bis<br />
1936 mit Windkraft betrieben, danach<br />
mit Dieselmotor. Anlässlich der Bundesgartenschau<br />
im Jahre 1985 wurde die im<br />
Krieg teilweise zerstörte Mühle nach<br />
Originalunterlagen rekonstruiert und im<br />
Februar 1987 wieder das erste Getreide<br />
gemahlen. Heute ist die Mühle am<br />
„Britzer Garten“ Ausbildungsstätte für<br />
Hobby-Windmüller und sogar Ort für<br />
standesamtliche Trauung und anschließende<br />
„Vermehlung“.<br />
4<br />
2<br />
1<br />
3<br />
Buschkrug- allee<br />
Allee<br />
Zwickauer<br />
Groß-Ziethener<br />
3<br />
2<br />
<strong>Neukölln</strong>er<br />
Route 5 „Rudow – auf den Spuren der Eiszeit“<br />
1 2<br />
Rudower Fließ<br />
Entlang dieser eiszeitlichen Abflussrinne,<br />
die vom Rudower Dorfkern zur<br />
Stadtgrenze verläuft, wechseln trockene<br />
und feuchte Biotope. Nach dem II.<br />
Weltkrieg hatte sie zur Einleitung von<br />
Abwässern gedient und war teilversiegelt.<br />
1983 wurde mit dem Rückbau<br />
begonnen und für die Entwicklung<br />
natürlicher Ufervegetation gesorgt.<br />
3 Dörferblick<br />
Von hier aus sieht man bei klarem<br />
Wetter die nahegelegenen Dörfer<br />
Brandenburgs – daher der Name. Es<br />
handelt sich um den baumfreien Gipfel<br />
eines Trümmerberges, der mit seinen 86<br />
m Höhe zu den prominenten<br />
Erhebungen Berlins zählt und einst als<br />
geeignete Aussichtsplattform für den<br />
begehrten „Blick nach drüben“ diente.<br />
5 Rudower Pfuhle<br />
Durchquert der Spaziergänger den<br />
„Südpark“, so wird er östlich der Waltersdorfer<br />
Chaussee das Naturdenkmal<br />
„Klarpfuhl“ finden. Passiert er den<br />
„Nordpark“, so gelangt er in die frei<br />
zugänglichen Landschaftsschutzgebiete<br />
„Espenpfuhl“, der künstlich angelegt<br />
wurde, und „Röthepfuhl“, einer der zwei<br />
ältesten eiszeitlichen Pfuhle <strong>Neukölln</strong>s.<br />
2<br />
10<br />
4 Das Frauenviertel<br />
In diesem 1996 erbauten Rudower<br />
Neubauviertel sind sämtliche Straßen<br />
und Plätze nach wegweisenden Frauen<br />
aus Politik, Wissenschaft und Kultur<br />
benannt. Begrenzt wird das Viertel vom<br />
„Nordpark“ mit Erlebnisspielplätzen<br />
und Themenparks einerseits und dem<br />
„Südpark“ mit Wiesen, Hecken, Gehölzen,<br />
Promenadenwegen andererseits.<br />
6 8 Friedhöfe in Rudow<br />
Entlang des Rudower Pfades liegen drei<br />
Friedhöfe: Erstens der „Kirchhof Rudow“,<br />
ein 64.512 qm großer, seit 1958 belegter<br />
Parkfriedhof. Zweitens ein Alleequartiersfriedhof<br />
an der Köpenicker Straße, der<br />
neben seiner eigentlichen Bestimmung<br />
vor allem als Biotop schätzenswert ist.<br />
Drittens der kleine, seit dem Mittelalter<br />
genutzte Dorffriedhof „Alt-Rudow“.<br />
9<br />
1<br />
11<br />
8<br />
4a<br />
4b<br />
7 Rudower Höhe<br />
Dieser in den 1950er Jahren aufgeschüttete,<br />
70 m hohe Trümmerberg im<br />
Süden Rudows ist ein beliebtes<br />
Ausflugsziel mit Spielplatz, Rodelbahn<br />
und Aussichtsplattform. Nordwestlich<br />
der „Rudower Höhe“ liegt das<br />
Naturdenkmal „Priesterpfuhl“, an dessen<br />
Ufern Schilf, Böschung und<br />
Grauerlen wachsen; nordöstlich stehen<br />
Reste der mit großflächigen Graffiti<br />
verschönerten Hinterlandmauer.<br />
5<br />
6<br />
Chaussee<br />
9 Alt-Rudow<br />
In diesem Dorf findet der Besucher<br />
einige orts- und architekturgeschichtlich<br />
bedeutende Gebäude: Entlang der<br />
Köpenicker Str. die im 14. Jh. errichtete<br />
Feldsteinkirche und ein Ensemble<br />
von Backsteingebäuden aus dem 19.<br />
Jh. (Gemeindehaus, Küsterei). In der<br />
Straße Alt-Rudow stehen der Dorfkrug<br />
mit Ställen sowie die um 1890 im Stil<br />
der Neugotik errichtete Schule und ein<br />
1820 gebautes Büdnerhaus.<br />
11 Kattenpfuhl<br />
Biegt der Spaziergänger vor dem Rudower<br />
Friedhof (6) links ein in die Deutschtaler<br />
Straße oder Am Espenpfuhl bis zum Neudecker<br />
Weg, so trifft er auf die Senke mit<br />
dem „Kattenpfuhl“, einem typischen<br />
Feldpfuhl mit einstmals beweideter Umgebung.<br />
Hier endete früher der Meskengraben.<br />
Seit den 1930er Jahren dient der<br />
Pfuhl als Regenwassersammelbecken und<br />
fällt daher nicht mehr trocken. Dieses<br />
Naturdenkmal mit Wiesen und Gehölzen<br />
ist allerdings eingezäunt.<br />
10<br />
neu angelegter Park<br />
Rudow Alt-Glienicke<br />
Meskengraben & Pfuhle<br />
Möchte der Wanderer die Route abkürzen,<br />
so bieten sich die Wege durch die<br />
„Siedlung an der Waßmannsdorfer<br />
Chaussee“ an (vor dem „Nordpark“<br />
abbiegen). Hier findet er das jüngste<br />
der <strong>Neukölln</strong>er Toteislöcher – den zwischen<br />
800 v. Chr. und 1150 n. Chr. entstandenen<br />
„Lolopfuhl“. Nördlich (ab<br />
Bartschiner Str.) kann er dem Meskengraben<br />
folgen, ebenfalls ein eiszeitliches<br />
Relikt, das allerdings jetzt erst<br />
renaturiert wurde. Schließlich gelangt<br />
er zu den beiden mit Röhricht und<br />
Gehölz umgebenen „Rohrpfuhlen“.<br />
7