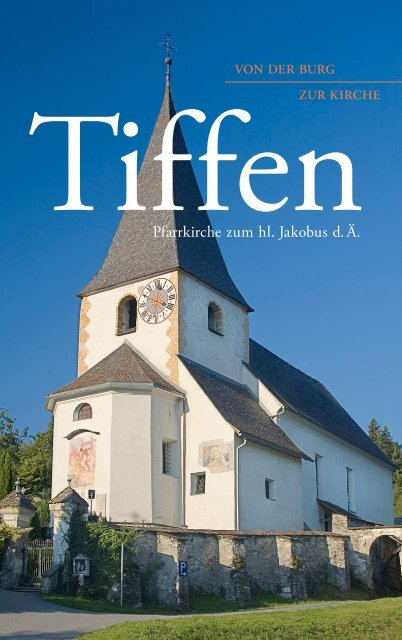als PDF laden - Roland Dreger
als PDF laden - Roland Dreger
als PDF laden - Roland Dreger
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
VON DER BURG<br />
ZUR KIRCHE<br />
Tiffen<br />
Pfarrkirche zum hl. Jakobus d. Ä.
Impressum<br />
Herausgeber: Röm.-kath. Pfarrgemeinde Tiffen<br />
Idee, Konzeption: Diakon Josef Stotter<br />
Text: Kurt <strong>Dreger</strong><br />
Fotos, Grafiken, Layout: <strong>Roland</strong> <strong>Dreger</strong><br />
Druck: Tiebeldruck, Feldkirchen i. Ktn.<br />
Alle Rechte vorbehalten.<br />
1. Auflage, 2008<br />
© Röm.-kath. Pfarrgemeinde Tiffen<br />
Liebe Besucher unseres<br />
Gotteshauses!<br />
Es freut uns, dass Sie unsere schöne und altehrwürdige<br />
Pfarrkirche besichtigen. Dieser Kirchenführer<br />
soll Ihnen dabei eine Hilfe sein.<br />
Pfarrer Kienzl, der von 1973 – 2001 hier gewirkt<br />
hat, hat so wie seine Nachfolger, unter großer<br />
Beteiligung der gesamten Bevölkerung von<br />
Tiffen, mit Hilfe finanzieller Zuwendungen der<br />
öffentlichen Hand und der Diözese Gurk mit viel<br />
Sachkenntnis das große bauliche Erbe um die<br />
Pfarrkirche am Berg gehütet:<br />
Die Kirchenfassade und das Langhaus wurden<br />
erneuert (2003). Der Rundturm am Friedhof<br />
wurde ergänzt und mit einem Kegeldach versehen,<br />
die Friedhofsmauer wurde saniert und der Friedhofsbereich<br />
durch eine neu gezogene Mauer<br />
erweitert. Im alten Pfarrhof wurde im Kellergeschoss,<br />
das vom Parkplatz her zugänglich ist,<br />
ein Aufbahrungsraum errichtet, der auch <strong>als</strong><br />
Gebetsraum gelungen ist.<br />
1
Das Ensemble um die Kirche erfordert weiterhin<br />
einen beachtlichen Aufwand an Erhaltung und<br />
Pflege und der Zustand gibt Zeugnis davon, dass<br />
diese Aufgabe von der Pfarrgemeinde umsichtig<br />
wahrgenommen wird.<br />
An der Filialkirche St. Margarethen erfolgten<br />
2007 – 2008 Außenrenovierungsarbeiten. Das Dach<br />
und der Turm wurden mit neuen Steinplatten<br />
eingedeckt und die Fassade erneuert.<br />
Darüber hinaus gibt es ein vielfältiges und sehr<br />
lebendiges Geschehen in der Pfarre. Es wird nicht<br />
bloß die bauliche Substanz gehütet. Vielmehr ist<br />
diese selbst Zeuge dafür, dass die Glaubenssubstanz<br />
in der Pfarrgemeinde im Bau aus lebendigen<br />
Steinen präsent bleibt. Auch daran haben Pfarrer<br />
Kienzl und seine Nachfolger Dechant Hofer<br />
(2001 – 2005) und Dechant Luxbacher (seit 2005)<br />
mit Diakon Stotter (seit 2001) und dem Pfarrgemeinderat<br />
sowie engagierten Laien begeistert und<br />
im Vertrauen auf Gottes Hilfe gearbeitet.<br />
Guter Gottesdienstbesuch an Sonn- und<br />
Feiertagen, Aufmerksamkeit für einsame, kranke<br />
oder alte Mitmenschen, Kindergruppen, eine kleine<br />
feine Ministrantenschar, die weitum bekannte<br />
Jugendsinggruppe »VOICES«, die sich so wie das<br />
Frauensextett »MIRIAM« gerne an der<br />
Mitgestaltung der hl. Messe oder bei Andachten<br />
beteiligen, sind Zeichen einer lebendigen Pfarrgemeinde.<br />
Insgesamt ist die Pfarre ein Integrationsfaktor für<br />
die verschiedenen Ortsteile und ein wichtiger und<br />
anerkannter Koordinator der ansässigen Vereine,<br />
die sich gerne auch bei kirchlichen Festen und<br />
Veranstaltungen beteiligen. Der Glaube soll dabei<br />
stets das Brauchtum durchwirken und auch immer<br />
neu öffnen auf den Einzelnen hin.<br />
Ein besonderes Anliegen für die Zukunft ist die<br />
Renovierung der Orgel.<br />
Liebe Besucher!<br />
Wenn Sie in Ehrfurcht und Stille in unser Gotteshaus<br />
gekommen sind, wo der Herr in unserer<br />
Mitte wohnt, verweilen Sie zu einem kurzen Gebet<br />
für Lebende und Verstorbene, für Verwandte und<br />
Fernstehende.<br />
Dass unser Gotteshaus Sie erfreut und Gottes<br />
Segen Sie begleitet, wünschen Ihnen die<br />
Mitglieder der Pfarre Tiffen.<br />
2 3
Pfarrkirche Tiffen<br />
Erstmalige Erwähnung findet das dem hl. Jakobus dem<br />
Älteren geweihte Gotteshaus <strong>als</strong> Eigenkirche des bedeutenden<br />
Kärntner Herrschergeschlechts der Eppensteiner<br />
in einer in die Sechzigerjahre des 11. Jh. datierten<br />
Urkunde 1 (»Ecclesia ad Tiuina«) im Zusammenhang mit<br />
der Übergabe von Zehentrechten durch Marchwart von<br />
Eppenstein an den Salzburger Erzbischof Gebhard 2 .<br />
Die Kirche selbst (oder ein Vorgängerbau?) dürfte aber<br />
älter sein. 3 Urkundlich wird die Kirche bereits in der<br />
1. Hälfte des 12. Jh. <strong>als</strong> Pfarre 4 bzw. Pfarrkirche 5<br />
bezeichnet.<br />
Nachdem ein Pfarrer (noch ohne Namensnennung)<br />
in einem Schreiben von Papst Innozenz III. aus dem<br />
Jahr 1206 genannt wird, 6 ist 1215 »Ioannes plebanus de<br />
Tyuen« der erste Seelsorger, den wir namentlich kennen. 7<br />
In einer in das Jahr 1207 datierten Urkunde, 8 in der der<br />
Salzburger Erzbischof Eberhard II. die Übergabe des<br />
Kirchenzehents von Tiffen (»Tiuene«) an das steirische<br />
Kloster Admont bestätigte, 9 wird der Kirchensprengel<br />
angeführt. Nachdem zuvor bereits einige Gebiete<br />
abgetreten worden waren, umfasste dieser unter anderem<br />
(noch) das gesamte obere Gurktal bis Rottenstein (östlich<br />
von Kleinkirchheim), das Himmelberger Becken, die<br />
Äußere Teuchen und das nördliche Ossiacher Seeufer bis<br />
Bodensdorf. 10 Bis 1786 verliehen die Salzburger Erzbischöfe<br />
die Tiffner Pfarrpfründe 11 und besetzten (mit<br />
zeitlichen Unterbrechungen) die kirchlichen Ämter.<br />
Nach der Diözesanregulierung unter Joseph II. im Jahre<br />
1787 übernahmen die Gurker Bischöfe die geistliche<br />
Oberhoheit.<br />
Bereits die Römer beteten vermutlich auf der Anhöhe<br />
westlich der Kirche 12 zu ihren Göttern Jupiter Optimus<br />
Maximus (ihm war der Tempel geweiht) und Hercules<br />
Augustus. Möglicherweise wurde hier auch eine keltische<br />
Abb. 1<br />
Innenansicht der<br />
Pfarrkirche (Blick<br />
Richtung Osten)<br />
5
Gottheit verehrt. 13 Zahlreiche <strong>als</strong> Spolien erhaltene<br />
Inschriften und Grabbaureliefs 14 weisen auf die<br />
Bedeutung des Ortes Tiffen bereits in dieser Zeit hin.<br />
»Tibinium« 15 (Tiffen), an einer Römerstraße gelegen, 16<br />
war vermutlich auch eine Außenstelle der Bergwerksverwaltung<br />
von Virunum, in der ein Bergassessor seinen<br />
Sitz gehabt haben könnte (entsprechende Inschriften<br />
deuten darauf hin) 17 .<br />
Vom vermuteten Vorgängerbau der Kirche wissen<br />
wir nichts. Die Bausubstanz der Langhausmauern<br />
stammt wahrscheinlich aus dem 11. Jh. (Achsenknick<br />
nach Süden zwischen Langhaus und Turm) 18 – spätestens<br />
aber aus dem Anfang des 12. Jh. 19 Es handelte sich um<br />
eine überdurchschnittlich große romanische Saalkirche,<br />
deren (heute vermauerte) Rundbogenfenster an der<br />
Nordwand und über dem Westportal noch andeutungsweise<br />
zu erkennen sind. Anstelle des heute zu sehenden,<br />
spätbarocken Chores befand sich eine Apsis. 20 Auch<br />
ein (Blätter-)Kapitell, das neben dem Westportal <strong>als</strong><br />
Weihwasserbecken Verwendung gefunden hat, stammt<br />
aus dieser Zeit. Der dreigeschossige Chorturm (große<br />
Glocke aus dem Jahr 1495) wurde um die Mitte des 12. Jh.<br />
angebaut. 21 Zwischen der Mitte und dem dritten Viertel<br />
des 15. Jh. erfolgte ein Umbau des Langhauses in eine<br />
zweischiffige Halle mit Netzrippengewölbe. 22 Aus dieser<br />
Zeit stammt vermutlich auch der Sakristeizubau im<br />
Osten. Im Jahre 1785 wurde ein kreuzgewölbter Chor<br />
angebaut. 23 Ein Votivbild an der nördlichen Langhausmauer<br />
weist auf den damaligen Pfarrer Franz Ignaz<br />
Grittner hin, unter dessen Ägide dieser (letzte) Ausbau<br />
der Kirche stattgefunden hat. Von außen präsentiert<br />
sich die Kirche heute mit den gemalten ockerfarbigen<br />
Eckquadern, wie sie nach 1787 ausgesehen hat. 24<br />
Der Kirchenbau bildete einst mit dem nördlich<br />
gelegenen alten Pfarrhof eine Einheit. Das westliche Tor<br />
6 7<br />
Abb. 2<br />
Fresko der hl. Barbara<br />
von Thomas von<br />
Villach (um 1470)
Abb. 3<br />
Hochaltar mit bild-<br />
licher Darstellung des<br />
hl. Jakobus (errichtet<br />
1758)<br />
war <strong>als</strong> Torturm ausgebildet, von dem noch eine Schießscharte<br />
zu erkennen ist. 25 In diesem im Kern mittelalterlichen<br />
Bau 26 ist im ehemaligen Speisesaal noch eine<br />
Renaissancedecke aus dem Beginn des 16. Jh. erhalten. 27<br />
In der Aufbahrungsstube (Eingang im Osten) befindet<br />
sich ein 1987 von Prof. Hans Piccottini geschaffenes<br />
Mosaik (»Tiffner Auferstehung«).<br />
Die Pfarre Tiffen war während des<br />
gesamten Mittelalters ein bedeutendes<br />
Seelsorgezentrum. Einst für<br />
acht Filialkirchen verantwortlich,<br />
behielt sie ihre Bedeutung auch in der<br />
Neuzeit bei. Anfang des 16. Jh. findet<br />
beispielsweise eine St. Jakobsbruderschaft<br />
urkundliche Erwähnung 28 und<br />
1757 ist eine Kaplanskollektur nach-<br />
zuweisen 29 . In einem Schematismus<br />
der Erzdiözese Salzburg aus dem Jahre<br />
1772 ist Tiffen, dem Archidiakonat<br />
Friesach unterstehend, <strong>als</strong> Dekanat<br />
angeführt 30 und in einer vor 1811<br />
datierten Landkarte des »Decanat<br />
Feldkirchen« ist Tiffen <strong>als</strong> »Dekanatspfarre«,<br />
<strong>als</strong> »Hauptgotteshaus« des<br />
Sprengels eingezeichnet 31 .<br />
Auf der Anhöhe westlich der<br />
Kirche, dem »Púrpal« (Burgstall von<br />
Tiffen), 32 auf dem sich eine spätantike<br />
befestigte Höhensiedlung aus dem 4. – 6. Jh. annehmen<br />
lässt, befand sich die im Jahre 1163 erstm<strong>als</strong> 33 urkundlich<br />
erwähnte Burg »Tyuen« 34 , deren Reste in den Jahren<br />
2002 und 2003 im Auftrag des Landesmuseums Kärnten<br />
teilweise ausgegraben wurden 35 . Mit der genannten<br />
Urkunde schenkte Patriarch Ulrich II. von Aquileja (mit<br />
seinen Eltern) die Herrschaft Tiffen (»castri de Tyuen«)<br />
zusammen mit anderen Gütern der Aquilejer Kirche.<br />
In der gebotenen Kürze kann auf die wechselvolle<br />
Besitzgeschichte der Burg bzw. Herrschaft Tiffen nicht<br />
eingegangen werden. Von Aquileja (dessen Lehnshoheit<br />
später in Vergessenheit geriet) verpfändet oder <strong>als</strong><br />
Lehen vergeben, saßen dort verschiedene Burgherren.<br />
Darunter befinden sich auch so klingende Namen der<br />
mittelalterlichen Kärntner Geschichte wie die Aufensteiner<br />
oder Kraiger, Letztere von 1369 bis 1550. 36 Im Jahre<br />
1293 wurde die Burg während einer Auseinandersetzung<br />
des Salzburger Erzbischofs, dem sich der Patriarch<br />
anschloss, mit Herzog Meinhard II. von Görz-Tirol<br />
zerstört, jedoch – wegen ihrer wichtigen Lage – bald wieder<br />
aufgebaut. 37 Sie wachte über einen über den Kirchhügel<br />
verlaufenden Handelsweg, der von Nord nach Süd<br />
entlang des Ossiacher Sees verlief. In der Mautstation in<br />
Tiffen wurden die über den Zammelsberg transportierten<br />
Waren erfasst. 38 Im Laufe des 17. Jh. verfiel die Burg<br />
zusehends. 39 Heute ist nichts mehr von ihr zu sehen.<br />
Künstlerische Ausstattung der Kirche<br />
Hochaltar<br />
Spätbarock, errichtet nach 1758 (Jahr der Chorerweiterung)<br />
mit Opfergang; Fassung 1764 bzw. 1771 40 1<br />
.<br />
Altarblatt: Darstellung des hl. Jakobus in Pilgertracht,<br />
oben Dreifaltigkeitsdarstellung, Schnitzfiguren der<br />
Heiligen Christophorus und Sebastian, über den<br />
Opferumgangsbögen Florian und Valentin (Abb. 3).<br />
Kreuzaltar (linker Seitenaltar)<br />
Errichtet um 1720. 41 8<br />
Darstellung Christi am Kreuz,<br />
darunter Seelen im Fegefeuer, an der Seite Maria und<br />
Johannes.<br />
8 9
Abb. 4<br />
Predella (zur Votivtafel<br />
rechte Seite) mit<br />
Widmungsinschrift<br />
des Stifters Leonhard<br />
Meichsner<br />
Abb. 5<br />
Votivtafel »Tiffner<br />
Auferstehung« von<br />
Melchior von<br />
St. Paul (?) (1530)<br />
Marienaltar 3 (rechter Seitenaltar)<br />
Errichtet um 1710. 42 Oben bildliche Darstellung des hl.<br />
Josef (mit Lilie), daneben hl. Elisabeth (Mutter Johannes’<br />
des Täufers), hl. Anna (Mutter Marias), darunter Maria<br />
<strong>als</strong> Himmelskönigin mit Joachim (Vater Marias, dargestellt<br />
mit Wurfschaufelstab der Hirten) und Zacharias<br />
(Vater Johannes’ des Täufers, dargestellt <strong>als</strong> Priester mit<br />
Rauchfass). 43<br />
Ehemaliger Hauptaltar<br />
In diesem Zusammenhang ist auf den – um 1510 entstandenen<br />
– ehemaligen Hauptaltar der Kirche<br />
hinzuweisen, der im Kärntner Landesmuseum zu sehen<br />
ist. 44 Sein Ausstattungsprogramm steht im Zeichen des<br />
Pilgerschutzes, indem unter anderem die wichtigsten<br />
Schutzheiligen für Reisende dargestellt werden (Jakobus<br />
der Ältere, Christophorus). In den Altarflügeln eine<br />
Reliefdarstellung einer spanischen Jakobslegende, in der<br />
über die Errettung eines unschuldig wegen Diebstahls<br />
verurteilten Pilgers durch<br />
den heiligen Jakobus berichtet<br />
wird. Nachdem der<br />
Richter den Erzäh lungen<br />
der Eltern des Ver urteilten,<br />
sie haben den Sohn am<br />
Galgen lebend vorgefunden, keinen Glauben schenkt,<br />
fliegen die gebratenen Hühner lebendig vom Teller auf.<br />
Bei der lokalen Sage der »Tauben von Tiffen« handelt es<br />
sich um »eine ortsspezifische Umdeutung der spanischen<br />
Version vom Hühnerwunder in eine lokale Taubenlegende«,<br />
entstanden in der zweiten Hälfte des 19. Jh. 45<br />
»Tiffner Auferstehung« 7<br />
(Votivbild linke /<br />
nördliche Langhauswand über Seitenportal, Abb. 5).<br />
Vermutlich Hauptbild eines Altaraufsatzes. Darstellung<br />
10 11
19<br />
N<br />
18<br />
O<br />
W<br />
10 m<br />
S<br />
16<br />
17<br />
15<br />
8<br />
7<br />
6<br />
11<br />
10<br />
9<br />
14<br />
1<br />
2<br />
20<br />
21<br />
3<br />
4<br />
5<br />
12<br />
13<br />
1 Hochaltar<br />
2 Fresko hl. Helena<br />
3 Marienaltar<br />
4 Fresko hl. Georg<br />
5 Kanzel<br />
6 Gemälde Anbetung / Kreuzigung<br />
7 Votivtafel »Tiffner Auferstehung«<br />
8 Kreuzaltar<br />
9 Fresko hl. Barbara<br />
10 Malerei Dreikönigszug / Schutzmantelmadonna /<br />
Veronika-Tuch<br />
11 Ehemaliges romanisches Rundbogenportal<br />
mit Teil eines römischen Weihealtars<br />
12 Romanisches Kapitel (Weihwasserbecken)<br />
Spolie Panther / Löwe mit Kantharos<br />
13 Römersteine mit tanzenden Mänaden und Satyr<br />
14 Kriegerdenkmal mit Lobisser-Fresko<br />
15 Fresko hl. Christophorus<br />
16 Kreuzwegfresken<br />
17 Ehemaliger Torturm<br />
18 »Alter« Pfarrhof (»Messnerhaus«)<br />
19 Eingang Aufbahrungsstube (Mosaik<br />
»Tiffner Auferstehung«)<br />
20 »Neuer« Pfarrhof (Geburtshaus<br />
Switbert Lobisser, 1878 – 1943)<br />
21 Jakobsbrunnen<br />
Lageplan und Grundriss<br />
Mariengrotte <br />
Púrpal (Burgberg)
Abb. 6<br />
Darstellung des<br />
hl. Christophorus<br />
(2. Hälfte des 15. Jh.)<br />
an der östlichen<br />
Sakristei(außen)wand<br />
der Auferstehung Christi<br />
(1530). Maler: Melchior aus<br />
St. Paul (?). Predella<br />
(Abb. 4) mit Widmungsinschrift<br />
des Stifters<br />
Leonhard Meichsner /<br />
Meixner († 1540), Pfleger<br />
von Tiffen. 47<br />
Kanzel<br />
Errichtet um 1770. Schalldach:<br />
Darstellung von<br />
Moses mit Gesetzestafeln.<br />
Rückwand: Darstellung<br />
der drei theologischen<br />
Tugenden Anker (Hoffnung), Kreuz (Glaube) und Herz<br />
(Liebe). Kanzelkorb: figürliche Darstellung Christi<br />
(links stehend mit Schlüssel) und Petrus’ (rechts kniend<br />
mit ausgestreckten Armen, Mt. 16,19). In der Mitte<br />
Reliefkartusche mit Darstellung einer Kirche auf einem<br />
Felsen (Mt. 16,18). 46<br />
5<br />
Nordwand Presbyterium / Chor<br />
Gemälde: Kindermord, Abschied von Herodes (?),<br />
Zug (?) und Anbetung der Heiligen drei Könige. Rechts<br />
neben der Sakristeitür: Schutzmantelmadonna (um<br />
1400). Über der Sakristeitür Darstellung des Schweißtuchs<br />
der Veronika, dessen Stifter, ein »Marchard<br />
de Hemmelberg«, 1396 mit Schloss und Landgericht<br />
Himmelberg belehnt wurde. 48<br />
10<br />
An der Nordwand weiters Statue des hl. Jakobus<br />
(Abb. 7). An der Südwand Statue des hl. Rochus, auch<br />
er unter anderem Patron der Pilger und Reisenden<br />
bzw. Fürbitter gegen die Pest. Beide aus dem 17. Jh. 49<br />
Triumphbogen<br />
Rankenornamentik, früheste (frühgotische) Bemalung<br />
des Chors. 50 In den Triumphbogenlaibungen<br />
Darstellungen der hl. Helena (mit Kreuz)<br />
und der hl. Barbara (mit Turm, Abb. 2).<br />
Um 1470 (– 1480) 51 von Thomas (Artula)<br />
von Villach (* um 1435/1450, † nach<br />
1520) 52 .<br />
Deckenmalereien<br />
In den Dreipässen des Rippengewölbes 26<br />
Brustbilder (Halbfiguren) von Heiligen. Von<br />
vorne (Altarraum) beginnend: Die vier<br />
lateinischen Kirchenväter Gregor, Ambrosius,<br />
Hieronymus und Augustinus (jeweils mit Spruchbändern<br />
bezeichnet). Florian, Anna, Katharina,<br />
Barbara, Magdalena, David (restauriert). In der<br />
Mitte: Auferstandener, Rupert, Heiliger mit<br />
Buch, Erasmus, Ulrich, Martin, Jakobus der Ältere,<br />
Nikolaus. Über dem hölzernen Orgelchor: Sebastian,<br />
weibliche Heilige, Georg, Christophorus, Ursula,<br />
Dorothea, Oswald, Odilia. 53 Über dem östlichen Pfeiler:<br />
Kreuzigung mit Maria und Johannes in<br />
zeitgenössischen Trachten (1. Viertel des 16. Jh.) 54 .<br />
Gemälderest Nordwand 6<br />
Durch Fensterausbruch zerstört; Anbetung des<br />
Kindes oder Kreuzigungsdarstellung. Die teilweise<br />
erhaltene Bildunterschrift weist Leonhard Meichsner /<br />
Meixner (im Jahre 1519) <strong>als</strong> Stifter aus, dessen Wappen<br />
(vier Doppellilien) darunter noch zu erkennen ist.<br />
Östliche Sakristei(aussen)wand 15<br />
(Abb. 6)<br />
Darstellung des hl. Christophorus mit Baumstamm, in<br />
dessen grüner Blätterkrone das Nest eines Pelikans zu<br />
Abb. 7<br />
Statue des<br />
hl. Jakobus des<br />
Älteren (17. Jh.)<br />
14 15
Abb. 8<br />
Fries eines römischen<br />
Grabbaus an der<br />
westlichen Außen-<br />
mauer der Kirche<br />
Abb. 9<br />
Relief eines römischen<br />
Grabbaus (tanzende<br />
Mänade) an der<br />
südlichen Außenwand<br />
erkennen ist, der seine Brust öffnet, um mit seinem Blut<br />
die Jungen zu tränken – ein Hinweis auf den Opfertod<br />
Christi (2. Hälfte des 15. Jh.) 56 .<br />
Gemälde Südwand<br />
Durch Pfeiler zerstörte Darstellung des hl. Georg<br />
(Ritter im Panzerhemd) aus dem 1. Viertel des 15. Jh. 55<br />
4<br />
Hinzuweisen ist noch auf die auf Nord- und Südwand<br />
befindlichen Apostel- bzw. Weihekreuze.<br />
Östliche Aussenwand des Chores<br />
Kriegerdenkmal mit Fresko (»Christus mit sterbenden<br />
Soldaten«) von Suitbert Lobisser (1878 im neuen<br />
Pfarrhaus geboren), geweiht 1935 57 14<br />
20<br />
.<br />
Nördliche Kirchhofmauer<br />
Auf der Ende des 15. Jh. im Zuge der Türkenbedrohung<br />
errichteten Wehrmauer, die jedoch nie ihre Bewährungsprobe<br />
zu bestehen hatte,<br />
befinden sich Reste von<br />
Wandmalereien, die einst<br />
die gesamte Mauer<br />
bedeckten. Links Christus<br />
am Ölberg kniend, auf<br />
einen in einer Wolke<br />
erscheinenden Engel mit<br />
Kelch blickend (17. Jh.). Rechts Christus im Gebet,<br />
daneben die schlafenden Jünger. Im Hintergrund Judas<br />
mit den Häschern (16. Jh.). 58<br />
16<br />
Die Römersteine<br />
Bei den in der Kirche eingemauerten römischen<br />
Spolien handelt es sich zum Großteil um Überreste von<br />
Grabbaureliefs. Entsprechend auch die auf das Jenseits<br />
verweisende Ikonographie.<br />
16 17
Abb. 10<br />
Panoramablick mit<br />
Pfarrkirche, »neuem«<br />
Pfarrhof und Friedhofsmauer<br />
Rechts neben dem Hauptportal 12 (Westseite)<br />
Fries eines Grabbaus mit der Darstellung eines Kraters 59<br />
oder Kantharos 60 zwischen zwei Panthern (diese<br />
symbolisieren die Hoffnung auf Wiedergeburt); rechts<br />
davon ein Löwe (Grabwächter) 61 (Abb. 8).<br />
Links neben dem Hauptportal<br />
Oberer Teil eines römischen Weihealtars (Teil eines<br />
heute vermauerten, romanischen Rundbogenport<strong>als</strong>) 62 ,<br />
geweiht »den ehrwürdigen alten (Göttinnen) –<br />
Sena[bos] Aug(ustis)« (vermutlich 211 – 235 n. Chr.).<br />
Gestiftet von einem Legionsschreiber der II. Italischen<br />
Legion (Firminus oder Firminius) und einem<br />
Mitarbeiter des Statthalters (Claudius Secundus oder<br />
Severus). 63<br />
Südseite der Kirche<br />
13<br />
Satyr mit Pedum 64 und großer Traube. 65 Darüber<br />
tanzende Mänade mit Tympanum 66 und Stab. 67 Links<br />
11<br />
ebenfalls eine Darstellung einer tanzenden Mänade<br />
(Abb. 9), deren über den Kopf gehaltene Hände zwei<br />
kleine Schallbecken halten. Diese Figuren entstammen<br />
dem dionysischen Sagenkreis, dessen Ikonographie in<br />
Norikum ab ca. 180 n. Chr. anzutreffen ist, und<br />
drücken die Hoffnung auf Überwindung des Todes<br />
sowie die »Liebe, Lebensfreude, Ekstase und glückliche<br />
Seligkeit« des Jenseits aus. 68<br />
Weiters an der südlichen Außenmauer zu finden: Fries<br />
eines Grabbaues mit der Darstellung zweier Windhunde,<br />
die einen Hasen packen.<br />
18 19
Abb. 11<br />
Filialkirche<br />
St. Margarethen<br />
im Ortszentrum<br />
von Tiffen<br />
Filialkirche St. Margarethen<br />
Das Gotteshaus (Abb. 11) befindet sich mitten im Ort<br />
unter einer jahrhundertealten Linde. Die Ursprünge<br />
liegen vermutlich im Mittelalter. 69 Über dem südlichen<br />
Fenster ist andeutungsweise noch ein (romanischer?)<br />
Rundbogen zu erkennen. Der kleine Glockenturm<br />
wurde im Jahr 1876 errichtet und 1897 wurde im Norden<br />
eine Sakristei angebaut. 70<br />
An der südlichen Außenwand befindet sich eine<br />
Darstellung der heiligen Margareta von Antiochia, mit<br />
einer Lanze einen Drachen tötend, und der heiligen<br />
Katharina mit einem Rad <strong>als</strong> Attribut. Der Hochaltar<br />
– datiert um 1720 – ist mit einer Statue der hl.<br />
Margareta und barock überschnitzten, spätgotischen<br />
Figuren der heiligen Katharina und Barbara ausgestattet.<br />
Erwähnenswert auch die floral bemalte Flachdecke<br />
(vermutlich) aus dem 17. Jh. 71<br />
Anmerkungen:<br />
1 MDC (Monumenta Historica Ducatus Carinthiae) II 328. Martin<br />
ZIRKL, Der Vertrag zwischen Erzbischof Gebhard und den<br />
Eppensteinern über Zehente und Pfarrechte (Diplomarbeit<br />
Graz 1984).<br />
2 Wilhelm WADL, Die verfälschte Arnulfurkunde vom<br />
26. Dezember 888 und die Frühgeschichte der Stadt Feldkirchen,<br />
in: Carinthia I 178 (1988) 55 – 83. Markwart übergibt<br />
»partem suam de ecclesia ad Tiuina cum clerico ibidem famulante<br />
et ipsius beneficio atque manicipiis …« – »… seinen Anteil (am<br />
Pfarr sprengel) der Pfarrkirche zu Tiffen mit den dort dienenden<br />
Priester, seinem Gut und seinen Hörigen …«.<br />
3 Vermutlich stand an diesem Ort bereits im Zuge der von<br />
Aquileja ausgehenden Christianisierung im 4. Jh. n. Chr. ein<br />
Gotteshaus, das durch den Einfall der Slawen vernichtet<br />
worden sein dürfte. Auch im Gefolge der im 8. und 9. Jh. von<br />
Salzburg aus erfolgten Mission könnte eine Kirche in Tiffen<br />
errichtet worden sein. Ilse SPIELVOGEL-BODO, Der Ossiacher See<br />
zwischen gestern und heute (Klagenfurt 1993).<br />
20 21
4 Eigenständiger Seelsorgebezirk u. a. mit Tauf- und Begräbnisrecht<br />
(vgl. Tropper, Vom Missionsgebiet zum Landesbistum).<br />
5 MDC III 610 (»… matricem ecclesiam Tiuin …«). Österr. Akademie der<br />
Wissenschaften (Hg.), Erläuterungen zum Historischen Atlas der<br />
österreichischen Alpenländer II. Abt. 8. Teil 3 (Klagenfurt 1959).<br />
6 MDC IV/1 1585.<br />
7 MDC IV/1 1713.<br />
8 MDC IV/1 1599.<br />
9 Die Schenkung des Tiffner Kirchenzehents an Admont ist bereits in<br />
einem Verzeichnis aus dem Jahre 1074 angeführt (MDC III 408).<br />
10 Wilhelm WADL, Die verfälschte Arnulfurkunde.<br />
11 Hermann RAINER, Zur Geschichte der katholischen Pfarren in der<br />
Gemeinde Steindorf, in: Alfred MITTERER, Steindorf am Ossiacher See.<br />
Chronik einer Gemeinde (Klagenfurt 1997) 161 – 207.<br />
12 Lt. DOLENZ/FLÜGEL/ÖLLINGER in Rudolfinum 2003: »in unmittelbarer<br />
oder mittelbarer Umgebung des Púrp<strong>als</strong>«.<br />
13 Heimo DOLENZ, Patrizia DE BERNARDO STEMPEL, Sena[bos]. Eine<br />
norische Gottheit aus Tiffen, in: Herbert HEFTNER (Hg.), Ad fontes!<br />
Festschrift für Gerhard Dobesch zum fünfundsechzigsten Geburtstag<br />
am 15. September 2004 dargebracht von Kollegen, Schülern<br />
und Freunden (Wien 2004).<br />
14 Gernot PICCOTTINI (Hg.), Archäologischer Atlas von Kärnten<br />
(Klagenfurt 1989).<br />
15 Julia FEINIG, Die römerzeitlich genutzten Marmorsteinbrüche in<br />
Kärnten (Diplomarbeit, Wien 2001).<br />
16 Paul Siegfried LEBER, Die römische Glant<strong>als</strong>traße und deren Fortsetzung<br />
bis zum Görtschitztal und nach Villach, Santicum (= Aus<br />
Kärntens römischer Vergangenheit 6, Klagenfurt 1976).<br />
17 DOLENZ/DE BERNARDO STEMPEL, Sena[bos].<br />
18 Wilhelm DEUER, Johannes GRABMAYER, Transromanica. Auf den<br />
Spuren der Romanik in Kärnten (Klagenfurt 2008).<br />
19 Gorazd ŽIVKOVIČ, Die romanischen Chorturmkirchen und deren<br />
Nachfolgebauten in Kärnten (Diplomarbeit Wien 1993).<br />
20 Älteste Ansicht von Tiffen aus der Zeit um 1620 aus der »Khevenhüller-Chronik«,<br />
Abbildung in: MITTERER, Steindorf.<br />
21 Gorazd ŽIVKOVIČ, Die romanischen Chorturmkirchen.<br />
22 Gottfried BIEDERMANN, Karin LEITNER, Gotik in Kärnten (= Die<br />
Kunstgeschichte Kärntens, Klagenfurt 2001).<br />
23 Karl GINHART, Die Kunstdenkmäler der politischen Expositur Feld-<br />
kirchen (Klagenfurt 1931).<br />
24 Dehio Kärnten (3. Aufl. 2001).<br />
25 Karl KAFKA, Wehrkirchen Kärntens (= Kärntens Burgen und<br />
Schlösser 4/1, 2, Wien 1971/72).<br />
26 Dehio Kärnten (3. Aufl. 2001).<br />
27 Pfr. Ignaz KIENZL, Vergangenheit und Gegenwart, in: Jahresbericht<br />
Bundeshandelsakademie und -handelsschule Feldkirchen (Schul-<br />
jahr 1974/75) 7 – 9.<br />
28 Kärntner Landesarchiv, A 1640 (1502-02-20).<br />
29 Hermann RAINER, Zur Geschichte der katholischen Pfarren in der<br />
Gemeinde Steindorf.<br />
30 Peter G. TROPPER, Vom Missionsgebiet zum Landesbistum.<br />
Organisation und Administration der katholischen Kirche in Kärnten<br />
von Chorbischof Modestus bis zu Bischof Köstner (Klagenfurt 1996).<br />
31 Peter G. TROPPER, Zur kirchlichen Topographie und Statistik der<br />
Diözese Gurk unter Fürstbischof Franz Xaver von Salm, in: Aufklärer<br />
– Kardinal – Patriot Franz Xaver von Salm. Ausstellungskatalog<br />
(Klagenfurt 1993) 43 – 45 und 78 – 79.<br />
32 Eberhard KRANZMAYER, Ortsnamenbuch von Kärnten (= AGT 51,<br />
Klagenfurt 1958).<br />
33 In zwei Urkunden aus dem Jahr 1136 wird ein »Reinhalem de Tiuen«<br />
bzw. »Reginhalm de Tiuene« <strong>als</strong> Zeuge angeführt (MDC I 89, 90).<br />
Wenn der Beiname den Stammsitz bezeichnet, handelt es sich<br />
dabei um die früheste urkundl. Erwähnung.<br />
34 MDC III 1061.<br />
35 Heimo DOLENZ, Christof FLÜGEL, Christof ÖLLERER, Die Rettungsgrabungen<br />
auf dem »Púrpal« in Tiffen im Jahre 2002, in: Rudolfinum.<br />
Jahrbuch des Landesmuseums Kärnten 2002 (Klagenfurt 2003)<br />
141 – 151; DIES., Die Rettungsgrabungen auf dem »Púrpal« in Tiffen im<br />
Jahre 2003, in: Rudolfinum. Jahrbuch des Landesmuseums Kärnten<br />
2003 (Klagenfurt 2004) 173 – 179. DORFGEMEINSCHAFT TIFFEN (Hg.),<br />
Tevinia. Licht in Tiffens finsteres Mittelalter (o. O. 2004).<br />
36 Claudia FRÄSS-EHRFELD, Geschichte Kärntens. Das Mittelalter<br />
(Klagenfurt 1984).<br />
37 Franz X. KOHLA, Gustav Adolf von METNITZ, Gotbert MORO, Kärntens<br />
Burgen, Schlösser, Ansitze und wehrhafte Stätten (= Aus Forschung<br />
und Kunst 17, Klagenfurt 1973). Herrmann WIESSNER, Gerhard<br />
SEEBACH, Burgen und Schlösser in Kärnten 2. Klagenfurt, Feldkirchen,<br />
Völkermarkt (Klagenfurt, 2. Aufl. 1980).<br />
38 Franz HUTER, Handbuch der historischen Stätten Österreich. Bd. 2.<br />
Alpenländer mit Südtirol (Stuttgart 1966). Siehe auch MDC X 817<br />
(Urkunde aus 1376), MDC XI 278 (Urkunde aus 1453, »… mawt ze<br />
Tifen …«).<br />
39 Lt. einem kirchlichen Visitationsbericht aus dem Jahre 1615 stand<br />
sie zum Teil noch. Es wurde die Verbringung des Altares, der bereits<br />
profanierten Burgkapelle in die Pfarrkirche angeordnet (KAFKA,<br />
Wehrkirchen Kärntens).<br />
40 Dehio Kärnten (3. Aufl. 2001).<br />
41 Eva FRODL-KRAFT, Gerbert FRODL, Marianne FRODL-SCHNEEMANN,<br />
Kärntner Kunststätten (Salzburg 2005). Das am Altar angeführte<br />
Jahr 1885 bezeichnet den Zeitpunkt der Vergoldung.
42 Ebd. Das am Altar angeführte Jahr 1885 bezeichnet den Zeitpunkt<br />
der Vergoldung.<br />
43 Hiltgart L. KELLER, Reclams Lexikon der Heiligen und der biblischen<br />
Gestalten (Stuttgart, 8. Aufl. 1996).<br />
44 Otto DEMUS, Die spätgotischen Altäre Kärntens (Klagenfurt 1991).<br />
Janez HÖFLER, Die Tafelmalerei der Dürerzeit in Kärnten (Klagenfurt<br />
1998).<br />
45 Robert WLATTNIG, Jakobusaltar aus Tiffen, in: Car. I (1994) 380.<br />
46 Barbara KIENZL, Die barocken Kanzeln in Kärnten (= Das Kärntner<br />
Landesarchiv 13, Klagenfurt 1986).<br />
47 Janez HÖFLER, Die Tafelmalerei der Dürerzeit in Kärnten (Klagenfurt<br />
1989).<br />
48 Janez HÖFLER, Die gotische Malerei Villachs (= Neues aus Alt-Villach,<br />
Villach 1982).<br />
49 Dehio Kärnten (3. Aufl. 2001).<br />
50 Janez HÖFLER, Die gotische Malerei Villachs.<br />
51 Dehio Kärnten (3. Aufl. 2001).<br />
52 Arthur ROSENAUER (Hg.), Spätmittelalter und Renaissance<br />
(= Geschichte der Bildenden Kunst in Österreich, Bd. 3, München<br />
u. a. 2003).<br />
53 Walter FRODL, Die gotische Wandmalerei in Kärnten (Klagenfurt<br />
1944).<br />
54 Dehio Kärnten (3. Aufl. 2001).<br />
55 Ebd.<br />
56 Mag. Karin KARGL (Bundesdenkmalamt Klagenfurt).<br />
57 Hermann RAINER, Zur Geschichte der katholischen Pfarren in der<br />
Gemeinde Steindorf.<br />
58 Bundesdenkmalamt Klagenfurt (Zl. 1694/1/99).<br />
59 Mischgefäß für Wein.<br />
60 Weitbauchiger, doppelhenkeliger Becher.<br />
61 Elisabeth WALDE, Im herrlichen Glanze Roms. Die Bilderwelt der<br />
Römersteine in Österreich (Innsbruck 2005).<br />
62 Bundesdenkmalamt Klagenfurt (GZ 1230/5/2002).<br />
63 Heimo DOLENZ, Patrizia DE BERNARDO STEMPEL, Sena[bos].<br />
64 Der über die Schulter gelegte Stock mit Päckchen.<br />
65 Elisabeth WALDE, Im herrlichen Glanze Roms.<br />
66 Handpauke.<br />
67 http://www.ubi-erat-lupa.org (Abfrage vom 24. März 2008).<br />
68 Elisabeth WALDE, Im herrlichen Glanze Roms.<br />
69 Karl GINHART, Die Kunstdenkmäler der politischen Expositur Feld -<br />
kirchen.<br />
70 Pfr. Ignaz KIENZL, Gedenkschrift für St. Margarethen im Dorfe Tiffen.<br />
Abschrift der Gedenkschrift von 1895 und Weiterführung bis 1975<br />
(unpubl. 1975).<br />
71 Dehio Kärnten (3. Aufl. 2001).<br />
Die Herausgabe dieses Kirchenführers ermöglichen dankenswerter<br />
Weise nachstehende Personen und Firmen:<br />
Arnold Lukas, Restaurator, Klagenfurt<br />
Bäckerei Schieder, Feldkirchen<br />
Bürgermeisterin Marialuise Mittermüller<br />
Kulturreferent GV Kurt Wolf<br />
Veicht-Gfrerer Markus, Dachdecker- und Spenglermeister Feldkirchen<br />
Gasthaus Gfrerer Lipp, Nadling<br />
Gasthaus Huber, Tiffen<br />
Gasthaus Feinwirt, Bichl<br />
Frühstückspension u. Taxi Walcher, Tiffen<br />
Raiffeisenbank Ossiachersee<br />
Sparkasse Feldkirchen<br />
Volksbank Feldkirchen<br />
Mag. Robert Huber, Steuerberater, Feldkirchen<br />
Thomas Rauchenwald, Tiffen<br />
Wieland Herbert, Steinmetzmeister, Feldkirchen<br />
Perdau Peter, Limonadenerzeugung, Getränke, Feldkirchen<br />
Stieglbräu, Thaler Alfred<br />
Tiebeldruck – Tiebelkurier, Feldkirchen<br />
Teuffenbach, Gärtnerei, Steindorf<br />
UNIQA Versicherung, Jakob Bergmann<br />
Wedenig Blumen-Meisterfloristik, Feldkirchen<br />
Wedenigs Gärtnerei, Feldkirchen/Sonnrain<br />
Riepl Josef, Installationstechnik, Tiffen<br />
Sägewerk Ritscher, Langacker<br />
Dr. Pietsch, Zahnarzt, Feldkirchen<br />
KÜCHEN TREFFner, Feldkirchen<br />
ZÜRICH Versicherung, Josef Hölbling<br />
BM Martin Huber, Planungsbüro, Steindorf<br />
Linder Hermann, Rasenmäher Motorsägen, Sonnrain 34<br />
Pirker Tischlerei Trafik Design, Unterberg<br />
NIMO Feldkirchen<br />
Baumeister Ing. <strong>Roland</strong> Fürstler<br />
Gasthof Göderle Reinhold jun., Rabensdorf<br />
Otto Hoffmann, Elektrotechnik, Feldkirchen<br />
Ihr Frisör Höfferer, Himmelberg<br />
Rudolf Konec, Tischlermeister, Feldkirchen<br />
Andrea Bergmann, Kleine Zeitung<br />
Bergner Gebhard, Kunstschmied, Pichlern<br />
Unser Lagerhaus, Feldkirchen<br />
Hopfgartner, Blitzschutzanlagen, Spittal a. d. Drau<br />
Buschenschenke Ruppnig, Liebetig<br />
Buttazoni GmbH, Stahlbau, Himmelberg<br />
Bestattung Feldkirchen<br />
Franz Zechner, SYNTHESA Chemie GmbH<br />
MAZDA NUSSER, Feldkirchen<br />
Apotheke Salvator, Hauptplatz Feldkirchen<br />
Zaucher Johann, Landmaschinentechnik, Sonnrain<br />
HUBER Entsorgungs GmbH., Feldkirchen
Tiffen 2008