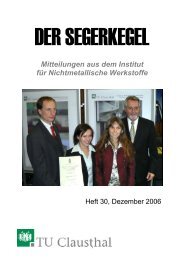der segerkegel - Institut für Nichtmetallische Werkstoffe - TU Clausthal
der segerkegel - Institut für Nichtmetallische Werkstoffe - TU Clausthal
der segerkegel - Institut für Nichtmetallische Werkstoffe - TU Clausthal
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
DER SEGERKEGEL
Ausgabe Nr. 25<br />
Dezember 2001<br />
Informatione n aus dem<br />
<strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Nichtmetallische</strong><br />
<strong>Werkstoffe</strong><br />
<strong>der</strong> <strong>TU</strong> <strong>Clausthal</strong><br />
Redaktion: Professur <strong>für</strong> Glas
Inhalts verzeichnis<br />
1 Informatione n des <strong>Institut</strong>sleiters<br />
2 Nachrufe<br />
3 Mitteilungen <strong>der</strong> Professur <strong>für</strong> Ingenieur keramik<br />
3.1 Forschungstätigkeit<br />
3.2 Vorträge<br />
3.3 Veröffentlichungen<br />
3.4 Studien - und Doktorarbeiten<br />
3.5 Sonstiges<br />
4 Mitteilungen <strong>der</strong> Professur <strong>für</strong> Glas<br />
4.1 Forschungstätigkeit<br />
4.2 Vorträge und Reisen<br />
4.3 Veröffentlichungen<br />
4.4 Studien - , Diplom - und Doktorarbeiten<br />
4.5 Sonstiges<br />
5 Mitteilungen <strong>der</strong> Professur <strong>für</strong> Bindemittel und Baustoffe<br />
5.1 Forschungstätigkeit<br />
5.2 Vorträge<br />
5.3 Veröffentlichungen<br />
1<br />
3<br />
7<br />
7<br />
8<br />
8<br />
9<br />
12<br />
19<br />
19<br />
20<br />
22<br />
23<br />
34<br />
40<br />
40<br />
41<br />
41
5.4 Studien - , Diplom - und Doktorarbeiten<br />
5.5 Sonstiges<br />
6 Mitteilungen <strong>der</strong> Materialprüfanstalt<br />
6.1 Allgemeines<br />
6.2 Forschung und Entwicklung<br />
6.3 Vorträge und Reisen<br />
6.4 Veröffentlichungen<br />
6.5 Sonstiges<br />
7 Aus <strong>Institut</strong> und Hochschule<br />
7.1 Große Herbstexkursion 2000<br />
7.2 <strong>Institut</strong>s weih nachtsfeier 2000<br />
7.3 <strong>Institut</strong>s - und MPA- Wan<strong>der</strong>tag 2001<br />
7.4 Sonstiges<br />
43<br />
50<br />
57<br />
57<br />
57<br />
59<br />
59<br />
59<br />
62<br />
62<br />
68<br />
69<br />
72
– 1 –<br />
1 Informationen des <strong>Institut</strong>sleiters<br />
<strong>Institut</strong> Quo Vadis?<br />
Liebe Ehemalige und Freunde des <strong>Institut</strong>s,<br />
die Technische Universität <strong>Clausthal</strong> befindet sich <strong>der</strong>zeit in mehrfacher<br />
Hinsicht im Umbruch:<br />
• Abnahme <strong>der</strong> Zahl <strong>der</strong> Studenten in den traditionellen ingenieur - und<br />
naturwis senschaftlichen Fächern, da<strong>für</strong> Zunahme z. B. in den Bereichen<br />
Informatik und Wirtschaft;<br />
• Emeritierung bzw. Pensionieru ng sehr vieler Professoren innerhalb<br />
kurzer Zeit, insbeson <strong>der</strong>e auch <strong>der</strong> in <strong>der</strong> Einwerbung von Drittmitteln<br />
erfolgreichen. Die Berufungs verfa hren werden im allgemeinen zwar<br />
zügig geführt, ein Einbruch in <strong>der</strong> Übergangszeit ist unver m eidlich.<br />
Dies birgt aber auch die Chance eines guten Neubeginns in sich.<br />
• Anstehende Verän<strong>der</strong> ung <strong>der</strong> gesetzlichen Grundlagen durch<br />
Novellierung von Hochschulrah m e ngesetz (HRG) und<br />
Nie<strong>der</strong>sächsische m Hochschulgesetz (NHG). Abgesehen von<br />
grundlegenden Verän<strong>der</strong>ungen in <strong>der</strong> Personalstru k t u r, u. a. durch<br />
Wegfallen <strong>der</strong> Assistentenstellen und Einführung sogenannter Ju -<br />
niorprofessu r e n, sollen die Hochschulen in Zukunft gemäß politische m<br />
Willen wie Wirtschaftsbetriebe durch einen Vorstand (Präsidium) und<br />
einen Aufsichtsrat (externes Gremium), evtl. sogar in <strong>der</strong> Rechtsform<br />
einer Stiftung, gesteuert wer den. Ob dies alles wirklich besser ist?<br />
Wie Sie den folgenden Ausführungen bitte entnehmen wollen, läuft unser<br />
<strong>Institut</strong> z. Z. ganz gut, auch wenn wir – trotz vieler Maßnah me n – mit <strong>der</strong><br />
Zahl unserer Fachstu denten nach wie vor nicht zufrieden sein können.<br />
Wie Sie sicher noch aus eigener Erfahrung wissen, besitzt unser <strong>Institut</strong><br />
eine gut bestückte Fachbibliothek. Lei<strong>der</strong> fehlt uns geeignetes Personal,
– 2 –<br />
den umfangreiche n Bestand nach neueste n Gesichtspun k t e n zu erfassen<br />
und auch eine Querbezie hung zur Universitätsbibliothek herzus tellen. Wir<br />
wollen hier einen Neuanfang mit einer geeigneten<br />
studentische n Hilfskraft wagen, die aus Spenden anläßlich <strong>der</strong> 50- Jahr-<br />
Feier des <strong>Institut</strong>s vergütet wird. Dabei können wir auf die Hilfe von Frau<br />
Dipl.- Ing. Bärbel Wemheuer, Steine und Erden- Absolventin des Jahres<br />
1984, bauen, die seit kurze m stellvertrete n de Leiterin <strong>der</strong><br />
Universitäts bibliothe k ist. Wir fangen zu nächst mit <strong>der</strong> Glasliteratur an.<br />
Zum Abschluß ein Hinweis in eigener Sache. Ich werde am 30. September<br />
2002 altersbedingt aus dem aktiven Dienst des Landes Nie<strong>der</strong>sachsen<br />
ausscheiden. Erfreulicherweise ist das Berufungs verfahre n meiner<br />
Nachfolge bisher glatt gelaufen und <strong>der</strong> Minister <strong>für</strong> Wissenschaft und<br />
Kultur des Landes Nie<strong>der</strong>sachsen hat Herrn Priv.- Doz. Dr.- Ing. habil.<br />
Joachim Deubener, BAM/<strong>TU</strong> Berlin, den Ruf auf die C4- Professur Glas und<br />
Glastechnologie erteilt. Wir alle hoffen auf einen rasche n und guten<br />
Abschluß <strong>der</strong> Verhandlunge n. Dazu möchte ich Ihnen auch mitteilen, daß<br />
das <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> die Zeit vom 18. bis 20. Juli 2002 ein Ehemaligentreffen<br />
plant, das u. a. auch in diesem Zusammen ha n g steht. Wir werden das<br />
Program m dieses Tref fens rechtzeitig im neuen Jahr versende n.<br />
Mit freundlichen Grüßen<br />
Ihr<br />
(Univ.- Prof. Dr. G. H. Frischat)<br />
PS: Wir erbitten auch diesmal wie<strong>der</strong> eine Spende zur Deckung <strong>der</strong><br />
Unkosten. Auf Wunsch wird Ihnen eine Zuwendungsbesc heinigung<br />
erteilt.
2 Nachrufe<br />
Nachruf Gerda Herrmann<br />
– 3 –<br />
Es gibt nur wenige Menschen, die mit dem <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Nichtmetallische</strong><br />
<strong>Werkstoffe</strong> so eng und so lange verbunden gewesen sind wie „Fräulein<br />
Herrma nn" - von engeren Mitarbei tern auch „Hermine" genannt. Als<br />
Chefsekretärin hat sie Generationen von Mitarbeitern mit geprägt, so daß<br />
es mir ein Anliegen ist, ihr einen ausführlichere n Nachruf zu widmen als<br />
allgemein üblich.<br />
Gerda Herrmann wurde am 24.10.1912 in Erkner bei Berlin geboren und<br />
ihre Familie zog nach ihrem Abitur 1928 nach Dresden. Dort besuchte sie<br />
die höhere Handelsschule und begann ihre<br />
Berufstätigkeit 1931 als Sekretärin bei Herrn<br />
Dr.- Ing. Lehmann – dem damali gen Leiter <strong>der</strong><br />
Versuchsa nstalt Villeroy und Boch und späteren<br />
Leiter <strong>der</strong> Steingutfabrik des Konzerns.<br />
Nach Kriegsende blieb sie weiterhin Sekretärin<br />
bei Dr. Lehmann, <strong>der</strong> in Meißen und Berlin ein<br />
Ingenieur büro führte. Ende 1950 zogen beide<br />
nach Goslar (Chemisches Laboratoriu m <strong>für</strong><br />
Tonindustrie Berlin - Goslar).<br />
Inzwischen wurde an <strong>der</strong> damaligen Bergakade mie <strong>Clausthal</strong> <strong>der</strong><br />
Lehrstuhl <strong>für</strong> Steine und Erden eingerichtet und Dr.- Ing. Hans Lehmann<br />
als Ordinarius berufen. Der offizielle Wech sel an die Bergakade mie<br />
erfolgte <strong>für</strong> Fräulein Herrman n erst zum 1.1.1954. In den folgenden<br />
Jahren hat sie bis zu ihrem Ausscheiden aus Altersgrü n d e n 1974 als<br />
Chefsekretärin den Aufbau <strong>der</strong> Studienrichtung Steine und Erden und den<br />
<strong>Institut</strong>s neubau 1959 sowie die Blütezeit des <strong>Institut</strong>es mit Einrichtung<br />
weiterer Lehrstühle (Scholze, Traustel, Hennicke, Frischat) und den<br />
Anstieg <strong>der</strong> Studente nza hl auf 150 Steine und Erden- Leute miterlebt und<br />
mitgestaltet.<br />
Nach ihrem offiziellen Berufsleben hat Gerda Herrman n noch bis 1980 <strong>für</strong><br />
Prof. Lehmann gearbeitet, hat dann in <strong>der</strong> methodistische n Kirche in
– 4 –<br />
<strong>Clausthal</strong> die Finanzen geführt und ist 1999 nach Dresden in ein<br />
Altenheim übergesiedelt, um im Nahbereich ihrer Verwandtschaft zu sein.<br />
Am 29. März 2001 ist Gerda Herrmann nach kurzer Krankheit verstor be n,<br />
nachde m sie im Herbst 2000 nochmal <strong>für</strong> einen Tag in <strong>Clausthal</strong> gewesen<br />
ist.<br />
So ist ein arbeitsreiches Leben mit viel Pflichterfüllung und geringen<br />
persönlichen Ansprüche n zu Ende gegangen, und all denen, die sie gut<br />
gekannt haben, bleibt die Erinne rung an eine gemeinsa me Zeit und an eine<br />
Frau, die stets <strong>für</strong> an<strong>der</strong>e da war und viel Gutes in dieser Welt getan hat.<br />
Es reihen sich viele Erinnerunge n aneinan<strong>der</strong>. Unvergeß lich ist mir ihr<br />
50igster Geburtstag am 24.10.1962, ein Tag an dem <strong>der</strong> „Chef“ auf Dienst -<br />
reise war. Es war eine tolle improvisierte Geburtstagsfeier, so weit ich<br />
mich erinnere das einzige Mal, daß die Abwesen heit des Chefs genutzt<br />
wurde, die Arbeit beiseite zu schieben.<br />
Wenn „Ehemalige" diese Zeilen lesen, werden sich Generatione n von<br />
Oberingenieuren, Assistenten und Mitarbeiter an diese Zeit mit „Hermine"<br />
erinnern und ihrer dankbar<br />
geden ken.<br />
P. Thorma n n<br />
Nachruf Erich Gläsner<br />
Am 14. April 2000 haben wir noch den 80igsten Geburtstag von Erich<br />
Gläsner im Alten heim in Zellerfeld gefeiert. Wir, das waren seine Tochter<br />
mit Familie, einige Freunde und eine kleine Abordnung aus dem <strong>Institut</strong>.<br />
Es ging ihm in den letzten Jahren gesund heitlich nicht gut, und als im<br />
Oktober 2000 seine Tochter Jutta in Selb nach kurzer, schwerer Krankheit<br />
starb, war es mit seinem Lebens willen vorbei. Erich Gläsner verstarb im<br />
Dezembe r 2000.<br />
Erich Gläsner war 22 Jahre lang Leiter <strong>der</strong> <strong>Institut</strong>s wer kstatt und hat sich<br />
in dieser Zeit große Verdienste erworben. Trotz hoher Anfor<strong>der</strong>unge n, die<br />
er an seine Mitarbeiter stellte, war er sicher <strong>der</strong> beliebteste Vorgesetzte<br />
und Mitarbeiter im <strong>Institut</strong>. Sein Wirken war von Hilfsbereitschaft und<br />
Freundlichkeit und von großer Gerechtigkeit geprägt. Seine große
– 5 –<br />
Beliebtheit kam auch in seinem<br />
Abschiedsgeschen k 1983 zum Ausdruck<br />
anläßlich seiner Pensionieru ng. Die Mitarbeiter<br />
des <strong>Institut</strong>es hatten ihm unter Einbeziehu ng<br />
einiger Ehemaliger Studenten und Mitarbeiter<br />
ein Erinnerungsalbu m zusam m e ngestellt, das<br />
auch in <strong>der</strong> <strong>Institut</strong>sgeschichte einmalig ist und<br />
ihm viel Freude bereitet hat. Ich nehme dies<br />
zum Anlaß, aus Erich Gläsners Lebenslauf und<br />
aus seiner <strong>Institut</strong>szeit et was ausführlicher zu<br />
berichten. Erich Gläsner wurde am 14. April<br />
1920 in <strong>Clausthal</strong> geboren und hat dort und in Andreas berg seine Jugend<br />
erlebt. Nach seiner Ausbildung als Maschinenschlos se r und Mechaniker<br />
wurde er 1939 zur Marine eingezogen und war bis Kriegsende technischer<br />
Ingenieur und<br />
U- Bootfahrer. Trotz vieler Feindfahrte n und mehrerer Bootsverluste<br />
erlebte er das Kriegs ende in englischer Gefangensc haft.<br />
Nach Rückkehr in die Heimat wurde er im April 1947 bei <strong>der</strong> Firma<br />
Sprenger in Andreasbe rg angestellt und mit <strong>der</strong> Entwicklung elektrischer<br />
Geräte beauftragt. So entstand <strong>der</strong> weltbekannte Heizlüfter Astron, <strong>der</strong> in<br />
seiner Einfachheit und Zuverlässigkeit Jahrzehnte produziert wurde. 1949<br />
heiratete er Waltraut Stannach aus Pommer n und beruflich stieg er zum<br />
Produktio nschef <strong>für</strong> 120 Mitarbeiter auf. 1961 zog er nach <strong>Clausthal</strong> und<br />
besetzte die Stelle eines Werkstatt m eisters am <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> Steine und<br />
Erden, dem heutigen <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Nichtmetallische</strong> <strong>Werkstoffe</strong>. Seit diesem<br />
Jahr kenne ich Erich Gläsner, und mich verbindet mit ihm eine<br />
erlebnisreiche Zeit sowohl beruflich als auch privat, und unsere<br />
Freundschaft ist <strong>für</strong> mich lebenswerte Erinnerung. Zehn Jahre lang haben<br />
wir gemeinsa m in einem Haus gewohnt, viele Autos zu samme n repariert,<br />
sind mit unseren Familien gemeinsa m in den Urlaub gefahren und haben<br />
später auch tragische Ereignisse gemeinsa m getragen.<br />
Seine einzige Tochter Jutta wurde Lehrerin und heiratete Dr.- Ing. Axel<br />
Müller- Zell. Die bei den Enkel waren Gläsners ganzer Stolz, und die<br />
wenigen Besuche im weit entfernten Selb waren beson<strong>der</strong>e Erlebnisse.
– 6 –<br />
Nach dem Tod seiner Frau 1995 lebte Erich Gläsner dann allein in seiner<br />
Wohnung bis er 1998 dann in das Altenheim umzog. Wenn ich ihn<br />
besuchte war die Freude stets groß, und wenn es um Kriegserlebnisse, um<br />
U- Boote o<strong>der</strong> um Motor rä<strong>der</strong> und Autos und unsere damit verbunde ne n<br />
Erinnerunge n ging, lebte er auf und erzählte. Natürlich kam bei solchen<br />
Gespräche n auch das <strong>Institut</strong> nicht zu kurz, und im gemeinsa m e n<br />
Erzählen wurden dann die Persönlichkeite n wie Lehmann, Traustel,<br />
Gatzke, Hennicke, Dutz, Ohnem üller, Kienow und viele an<strong>der</strong>e wie<strong>der</strong><br />
lebendig. Erich Gläsner war ein sehr korrekte r und beliebter Vorgesetzter<br />
mit außeror dentlichen technische n Fähigkeiten. So war er maßgeblich<br />
beteiligt an technische n Konstruktione n <strong>für</strong> die Raumfahrtforsc h u ng im<br />
Rahmen <strong>der</strong> Arbeitsgruppe Glas. Er war stets hilfsbereit und sehr<br />
konsequent in seinen Entscheidunge n, was ihm den Nimbus eines<br />
väterlichen Freun des eingebracht hat. Und so wollen wir ihn auch in<br />
Erinnerung behalten und ihm ein ehren des Andenke n bewahre n.<br />
P. Thorma n n
– 7 –<br />
Heinz – <strong>der</strong> letzte „Fax“ von <strong>Clausthal</strong> – ist tot<br />
Am 7. Oktober 2001 verstarb Heinz Schuhmacher, <strong>der</strong> vielen ehemaligen<br />
Steine und Erden – Leuten aus <strong>der</strong> Zeit <strong>der</strong> 70er Jahre wohl noch gut in<br />
Erinnerung ist.<br />
Heinz Herman n Hans Schuhmacher war sein<br />
voller Name, aber bekannt war er uns als „Heinz<br />
– <strong>der</strong> letzte Fax in <strong>Clausthal</strong>“!<br />
Am 27. Februar 1921 wurde Heinz Schuhmac her<br />
in <strong>Clausthal</strong> (noch vor dem Zusam m e n s c hlu ß<br />
von <strong>Clausthal</strong> und Zellerfeld!) geboren. Hier<br />
besuchte er die Volksschule und erlernte dann<br />
das Handwerk des Elektrikers bei <strong>der</strong> Firma<br />
Borrma nn, <strong>der</strong> er – mit Ausnah m e <strong>der</strong> Kriegsjahre – von 1935 bis 1948<br />
treu war. In den folgenden zwei Jahrzehnten war er u.a. im Erzbergwerk<br />
Grund und <strong>der</strong> Firma Imperial in Osterode tätig, bis er dann 1971 bei <strong>der</strong><br />
Amtlichen Materialprüfanstalt <strong>für</strong> Steine und Erden seinen letzten<br />
beruflichen Abschnitt begann.<br />
In dieser Zeit, die auch geprägt war durch seine Hausmeistertä tigkeit als<br />
„Fax“ bei zwei <strong>Clausthal</strong>er Verbindu ngen, bewies er oft seinen Witz und<br />
seine Lebensfreude durch Kontakte zu Berufskollegen wie Studenten und<br />
war stets zu Späßen aufgelegt.<br />
Der Übergang in den Ruhestand Anfang <strong>der</strong> 80er Jahre war bereits<br />
überschattet von <strong>der</strong> schweren Krankheit seiner Frau, mit <strong>der</strong> er mehr als<br />
50 Jahre verheiratet war und die er bis zuletzt liebevoll begleitet hat.<br />
Heinz – Du letzter Fax von <strong>Clausthal</strong> – wir werden Dich nicht vergesse n!<br />
H. Dörr
– 8 –
– 7 –<br />
3. Mitteilungen <strong>der</strong> Professur <strong>für</strong> Ingenieurkeramik<br />
3.1 Forschungstätigkeit<br />
Neue <strong>Werkstoffe</strong><br />
• Schmelzinfiltration von TiAl- und Mg- Legierungen in Kohlewerkst offe und<br />
poröse s SiC.<br />
DFG- Projekt, Bearbeiter: A. Bertram.<br />
• Kontinuierliche Schmelzinfiltration zellularer SiC- Keramiken aus natürliche m<br />
Korn.<br />
Alfred Krupp von Bohlen und Halbach - Stiftung.<br />
Neue Technologien<br />
• Nie<strong>der</strong>te m p e ratursintern von Si3N4.<br />
DFG- Projekt, Bearbeiter: T. Prescher.<br />
• Kontinuierliche s Sintern von Si3N4.<br />
AiF- Projekt, Bearbeiter: T. Prescher.<br />
• Si/(B)/C/N - Polymere als Laminierhilfs mittel <strong>für</strong> die Herstellung von<br />
Si3N4- Vielschichtbauteilen in Folienbauweise.<br />
DFG- Projekt, Bearbeiter: B. Bitterlich.<br />
• Elektrop h or etische Beschichtung von SiC- Fasern mit kopräzipitativ gefällten<br />
PZT- Pulvern.<br />
Bearbeiter: Jung - Wook Kim.<br />
• Recycling von Porzellanpress m a s s e n.<br />
BMBF- Projekt, Bearbeiter A. Bertram.<br />
Rechnerunterstützte Verfahren<br />
• Lasersintern von Porzellan.<br />
AiF- Projekt Bearbeiter: T. Krause.<br />
• Laser- Materie- Wechselwirk u n g unter Reinrau m b e dingu n gen.<br />
Bearbeiter: Dr. J. Günster.<br />
• Laserbehan dlu ng von Hydroxylapatiten.<br />
Betreuer: S. Engler.<br />
Industrielle Kooperationspartner mit materieller und finanzieller Unterstützung<br />
des <strong>Institut</strong>s
– 8 –<br />
ANCeram GmbH & Co. KG, Bindlach; BHS Tabletop AG, Selb; CeramTec AG,<br />
Marktredwitz; Ceraplan GmbH, Erkersreuth; DaimlerChry sler, Ulm; Halden -<br />
wanger GmbH & Co. KG, Waldkraibu rg; KPCL Deutschlan d GmbH, Selb; Rosenthal<br />
AG, Selb; Schunk Kohlenstofftec hnik GmbH, Gießen; SiCeram GmbH, Jena; Sie-<br />
mens AG, München; SKW Trostberg AG, Trostberg; Villeroy & Boch AG, Mettlach;<br />
Wacker Chemie GmbH, Burghau se n.<br />
Drittmittelaufkommen seit 1997<br />
1997<br />
1998<br />
1999<br />
2000<br />
2001<br />
DM<br />
DM<br />
DM<br />
DM<br />
DM<br />
90.600,00 440.600,00 770.600,00 694.000,00 1.199.000<br />
3.2 Vorträge<br />
J. G. Heinrich<br />
New Ceramic Materials for Key Technologies in Germany.<br />
First Iranian Symposiu m on Science and Technologie, Teheran (Iran), 9.- 10. Jan.<br />
2001<br />
J. G. Heinrich<br />
Wissenschaft und Technologie – ein Wi<strong>der</strong>spruch?<br />
Ehrenkolloq uiu m <strong>für</strong> Hubertu s Reh, FH Höhr - Grenzhausen, 29. März 2001<br />
T. Krause, S. Engler, J. Günster, J. G. Heinrich<br />
Lagenweise Schlickerdeposition (LSD) zum Lasersintern von Porzellan.<br />
Fachauss ch u s s Werkstoffan wendung, <strong>Clausthal</strong>, 10. Mai 2001<br />
T. Krause<br />
Lasersintern von Porzellan.<br />
AiF- Forsch u ngs v o r h a b e n 12067 N, <strong>Clausthal</strong>, 19. Juni 2001<br />
J. Günster<br />
Wohldefinierte nanoskalige Nukleationskeime durch Facettierung <strong>der</strong> (111) Oberflä -<br />
che von TiC.<br />
<strong>Institut</strong>skolloquiu m, <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> Physik und Physikalische Technologien, <strong>TU</strong><br />
<strong>Clausthal</strong>, Mai 2001<br />
3.3 Veröffentlichungen<br />
Zeitschriften<br />
S. Meier, J. G. Heinrich<br />
Contribution on the Processing – Microstructure – Properties Relationship of Mo-<br />
Si2/SiC- Composites.<br />
J. Am. Ceram. Soc. (submitted for publication).<br />
J. Günster, R. Görke, J. G. Heinrich, R. Souda
– 9 –<br />
Pulsed laser ablation of dense sintered AlN und AIN pow<strong>der</strong> samples studied by timeof-<br />
flight mass spectroscopy.<br />
Appl. Surf. Sci. 173 (2001), 76- 83.<br />
B. Bitterlich, L. Peters, C. Soldan, J. G. Heinrich<br />
Präkeramische Polymere als Laminiersysteme <strong>für</strong> die Herstellung von AlN- Vielschichtbauteilen<br />
in Folienbauweise.<br />
cfi / Ber. DKG. 78 (2001), E 19 – E 23.<br />
B. Bitterlich, J. G. Heinrich<br />
Aqueous Tape Casting of Silicon Nitride.<br />
J. Europ. Ceram. Soc. (submitted for publication).<br />
S. Abdul - Maula, R. Görke, W. Hinrichs<br />
Analysensiebe – die neue ISD 3310.<br />
GIT Labor - Fachzeitschrift 5 (2001), 526 - 528.<br />
Bücher<br />
J. G. Heinrich, F. Aldinger (eds)<br />
Ceramic Materials and Components for Engines.<br />
Wiley- VCH Verlag Weinheim, New York, Chichester, 2001<br />
CD- ROM<br />
J. G. Heinrich, A. Bertram<br />
Heterogene Gleichgewichte.<br />
Vorlesungs m a n u s k ript 2001.<br />
Patente<br />
T. Krause, S. Engler, J. Günster, J. G. Heinrich<br />
Lagenweise Schlickererdeposition (LSD) zum Lasersintern keramischer Materialien.<br />
Patentan m eldung 2001.101 28 664.3<br />
J. Günster, J. G. Heinrich, S. Rastätter, R. Riedel<br />
Aufbau dreidimensionaler keramischer Strukturen durch lokale Polymerisation eines<br />
präkeramischen Polymers.<br />
Patentan m eldung 2001.<br />
3.4 Studien- und Doktorarbeiten<br />
Barbara Strömann<br />
Korrosionsverhalten ausgewählter nichtoxidischer <strong>Werkstoffe</strong> in einer Fa-<br />
serglasschmelze im Vergleich zu herkömmlichen chromoxidhaltigen Steinen.<br />
Studienarbeit; Betreuer: Prof. Dr. J. G. Heinrich, Dr. I. Elstner (Wiesbaden)
– 10 –<br />
Für die Auskleidung von Glaswanne n, in denen Schmelzen <strong>für</strong> die Faser -<br />
glasherstellung hergestellt werden, werden Feuerfeststeine mit einer<br />
beson<strong>der</strong> s guten Korrosionsbe ständigkeit verwendet. Diese sogenannte n<br />
Palisadensteine enthalten Chromoxid und stehen deshalb wegen ihrer<br />
umwelt - und gesundheitssc hä digenden Wirkung in <strong>der</strong> Kritik.<br />
In dieser Arbeit werden Untersuc hunge n an einigen nichtoxidke ra -<br />
mischen Materialien durchgeführt, die aufgrund ihrer extrem hohen Dich -<br />
ten eine hohe Korrosions bes tändigkeit haben könnten. Es handelt sich um<br />
die Materialien Aluminium nitrid, Siliciumnitrid, Siliciumcarbid, Bornitrid<br />
und Borcarbid, die von unterschiedlichen Herstellern zur Verfügung ge -<br />
stellt wurden. Zum Vergleich wird eine Probe des herkö m mlichen Chrom -<br />
korundmaterials mitgetestet. Im Laufe <strong>der</strong> Arbeit hat sich herausgestellt,<br />
daß die meisten Materialien weniger von <strong>der</strong> 1500 °C heißen Glas -<br />
schmelze, als von <strong>der</strong> oxidierende n Atmosphär e darüber angegriffen<br />
werden. Bei den Proben aus Borcarbid und Bornitrid mußte sogar auf den<br />
eigentlichen Korrosionstes t verzichtet werden, da sie <strong>der</strong> ausgewählten<br />
Prüftem peratur nicht standhielten.<br />
Abschließe nd kann man sagen, dass die getesteten Nichtoxidkeramike n<br />
<strong>für</strong> den Einsatzbereich an <strong>der</strong> Grenzfläche zwischen Glasschmelze und<br />
Luft nicht geeignet sind, da es bei den herrsche n de n Temperaturen sofort<br />
zu starker Oxidation kommt. Da es ebenfalls schwierig ist großfor matige<br />
Steine mit <strong>der</strong>artigen Dichten herzustellen, ist zu prüfen, ob man diese<br />
Materialien eventuell im Badbereich zu Verbesserung <strong>der</strong> Oberflächen<br />
an<strong>der</strong>er feuerfester Steine verwenden kann.<br />
Ulrike Wolf<br />
Der Einfluß unterschiedlicher Ausgangspulver auf das Sinterverhalten und die<br />
Wärmeleitfähigkeit von Siliciumnitrid.<br />
Studienarbeit; Betreuer: Prof. Dr. J. G. Heinrich, Dipl.- Ing T. Prescher<br />
Im Rahmen dieser Arbeit wurden aus zwei verschiedenen Siliciumnitrid -<br />
Ausgangs pulve r n Proben hergestellt und gesintert, um diese anschließe n d<br />
auf ihre Wärmeleitfähigkeit zu unters uchen und zu vergleichen. Dies ge -<br />
schah im Hinblick auf die Verwend u ng als keramische Kochplatte. Für
– 11 –<br />
diese Anwendung hat sich eine Wärmeleitfähigkeit von 20 W/m K als<br />
optimal erwiesen (Firmeninformation SILDURIT).<br />
Die Ausgangspulve r (UBE- SN- E10, SILZOT HQ) wurde n zu Schlicker ver -<br />
arbeitet, in einer Kugelmühle gemahlen und mit Sinteradditiven (Y2O 3,<br />
Al 2O 3) und organische m Bin<strong>der</strong> versetzt. Nach <strong>der</strong> Verarbeitung zu Sprüh -<br />
korn erfolgte die Formgebung durch einaxiales Vorpressen und<br />
kaltisostatisches Nachpressen. Die spezifische Oberfläche des Sprühkor n s<br />
und die Gründichte <strong>der</strong> Proben wurde ermittelt. Nach dem Ausheizen des<br />
organischen Bin<strong>der</strong>s wurden Sinterversuc he im HT- Dilatometer und im<br />
Drucksinte rofen bei verschiedenen Temperat u re n durchgeführt. An -<br />
schließend erfolgte die Bestimmung <strong>der</strong> Rohdichte des hergestellten Ma-<br />
terials sowie die Messung <strong>der</strong> spezifischen Wärmekapazität und <strong>der</strong> Tem -<br />
peraturleitfähigkeit mittels Laser- Flash- Methode bei 25 °C, 200 °C und 400<br />
°C. Aus diesen Werten errechnet sich die Wärmeleitfähigkeit <strong>der</strong> Proben.<br />
Die höchsten Rohdichten von 3,2 g/cm ³ wurden mit dem Ausgangs p ulver<br />
UBE- SN- E10 bei Sintertemperature n von 1760 °C und 1780 °C erreicht. Bei<br />
niedrigeren Sintertemperature n zeigte das SILZOT HQ die besseren Werte.<br />
Aus diesem gröbere n Ausgangs pulver entstand ein Gefüge mit größeren<br />
Körner n und damit auch weniger Korngrenzen. Deshalb wurde die<br />
höchste Wärmeleitfähigkeit von bis zu 20 W/m K bei Raumte mperat u r an<br />
Proben aus<br />
SILZOT HQ bestim mt. So wurden mit dem kostengü nstigeren Aus -<br />
gangspulver bereits die gewünsc hte n Werte erreicht. Im Hinblick auf eine<br />
weitere Kostenred u zierung bei <strong>der</strong> Herstellung von Si3N4- Bauteilen wird<br />
<strong>der</strong> Einsatz von kontinuierlichen Sinteraggregaten vorgeschlagen.<br />
J.- W. Kim<br />
Elektrophoretische Beschichtung von SiC- Fasern mit kopräzipitativ gefällten<br />
PZT- Pulvern.<br />
Dissertation; Referenten: Heinrich/Leers<br />
Unter dem Stichwort Adaptronik wurden in den letzten Jahren weltweit<br />
große Anstrengu nge n unterno m m e n, um mit piezokera misc hen Folien<br />
o<strong>der</strong> Fasern durch aktive o<strong>der</strong> passive Schwingungsdä m pfung
– 12 –<br />
Schwingungserregungen durch Luft- o<strong>der</strong> Körperschall zu kompe nsieren.<br />
Mit Hilfe <strong>der</strong> Sol- Gel- Technik können piezokera mische Fasern mit einigen<br />
Zentimeter n Länge hergestellt werden. Durch elektrophoretische Be-<br />
schichtung von SiC- Fasern lassen sich dagegen theoretisch Endlosfasern<br />
mit gleichmä ßigen Oberflächen und Schichtdicke n fertigen. Außerdem<br />
können die schlechten mechanische n Eigenschaften von PZT- Fasern<br />
kompensiert werden. Voraussetzung dazu ist allerdings die Erniedrigung<br />
<strong>der</strong> Sinterte mperat ur piezokera mischer Standardp ulver, da sonst die SiC-<br />
Fasern durch Reaktionen mit den Oxiden aufgelöst würden. Dazu wurden<br />
sinteraktive PZT- Pulver durch ein Kopräzipitationsverfa hren aus preis -<br />
werten wässrigen Metall- Nitrat - Salzlösunge n hergestellt. Danach erfolgte<br />
die elektrop horetische Beschichtu ng <strong>der</strong> SiC- Fasern aus einer Suspension<br />
mit 97,5 Vol.- % Acetylaceton und 2,5 Vol.- % Aceton und einem Feststoff -<br />
gehalt > 0,5 Gew.- % bei einer Spannung > 30 V. Die Zugabe geringer<br />
Mengen an Jod (0,01 g Jod/200 ml Lösung) führt zu Keto- Änol- Re -<br />
aktionen und damit zu einer sehr glatten abgeschiedene n Schicht mit<br />
dichter Teilchen - packung. Bei einer konstanten elektrische n Spannung<br />
von 50 V und einer Abscheidezeit von 90 sec konnte eine Schichtdicke<br />
von 16 μm erreicht werden. Durch eine Temperaturbeha n dlung bei 1175 °<br />
C in oxidieren<strong>der</strong> Atmosphäre wurden die Oxide in die piezokera mische<br />
Peroskitstr u k t u r umgewa ndelt. Die dielektrische Hysterese zeigt mit ab -<br />
nehme n <strong>der</strong> Schichtdicke eine geringer werdende Remanenz, d.h. einen<br />
schmaler werdenden dielektrischen Hystereseverlauf. Mit steigen<strong>der</strong> Syn -<br />
thesedauer (> 20 min) nimmt die remanente Polarisation ab.
3.5 Sonstiges<br />
Installation Reinraum<br />
(Goslarsche Zeitung, 16. November<br />
2000)<br />
Ein riesiger Kran war erfor<strong>der</strong>lich, um<br />
am <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Nichtmetallische</strong> Werk -<br />
stoffe einen Reinrau m - Container <strong>der</strong><br />
Firma Weiss Klimatechnik zu in -<br />
stallieren. In dem Container, <strong>der</strong> eine<br />
Grundfläche von ca. 50 m 2 hat, sollten<br />
an <strong>der</strong> Professur <strong>für</strong> Ingenieurkera mi k<br />
unter extrem sauberen Bedingungen<br />
biokera misc he Materialien und hoch -<br />
reine <strong>Werkstoffe</strong> <strong>für</strong> die Elektronik<br />
durch Laserstrahlu ng bearbeitet<br />
werden. Diese international richtung s -<br />
– 13 –<br />
weisenden Forschungs projekte werden teilweise durch die Deutsche For -<br />
schungs gemein schaft und durch Industriekooperation geför<strong>der</strong>t.<br />
„Fast sechs Jahre um die Einrichtung gekämpft“<br />
(Goslarsche Zeitung, 15. Dezember 2000)<br />
„Wie fotografieren Sie eigentlich einen Reinrau m?“ wollte <strong>TU</strong> Kanzler Dr. Peter<br />
Kickartz von <strong>der</strong> GZ bei <strong>der</strong> Einweihung im <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Nichtmetallische</strong> Werk -<br />
stoffe wissen. Dieser Reinrau m gibt in <strong>der</strong> Tat optisch wenig her, interessa n ter<br />
ist aber, was von Jahresbeginn 2001 an die wissensc h aftlichen Mitarbeiter Tobi -<br />
as Krause, Dr. Jens Günster und Sven Engler dort forschen werden. Um das an -<br />
schaulich zu zeigen, hatten sie eine Laseranlage im Labor aufgebaut, und die ließ<br />
sich gut fotografieren.<br />
Präz io nsarbe it m it de m gro ß e n<br />
Re inraum - Container am Haken<br />
Prof. Dr. J. G. Heinrich, Professur <strong>für</strong> Ingenieurkeramik, freute sich, dass nach<br />
fast sechsjährigen Verhandlungen dieser Raum, ein Container, <strong>der</strong> an das In -<br />
stitutsgebä u d e „angeflansc ht“ wurde, nun betriebs b ereit ist. Während <strong>der</strong><br />
Verhandlungszeit haben sich Projekte, die dort durchgefü hrt werden sollten,<br />
zwar zerschlagen, jedoch gibt es einen umfangreichen Industrieauftrag – das Vo -
– 14 –<br />
lumen beträgt eine halbe Million DM – <strong>für</strong> das dieser Reinrau m samt Installation<br />
maßgesc h n eid ert ist. „Wir beschäftigen uns mit <strong>der</strong> Herstellung von hochreinen<br />
<strong>Werkstoffe</strong>n <strong>für</strong> die Information stec h n ologie“, umschrieb Heinrich das Vor -<br />
haben .<br />
Kanzler Dr. Kickartz erkundigt sich bei Prof. Heinrich nach<br />
Einzelheiten <strong>der</strong> Reinraum- Installation<br />
Als wichtigen Baustein <strong>für</strong> die <strong>TU</strong> als Forschungsuni v er sität bezeichnete <strong>der</strong><br />
Kanzler die neue Einrichtu ng. „Dieses <strong>Institut</strong> verdient Vertrauen, es gehört zu<br />
den großen Forsch u ngsin stituten“, erklärte er. Stets genügen d Forschungspro -<br />
jekte wünschte dem Reinrau m <strong>der</strong> geschäftsfü h rende <strong>Institut</strong>sleiter Prof. Dr. A.<br />
Wolter.<br />
Selektives Lasersintern v on Keramik auf <strong>der</strong> Hanno ver Messe 2 0 0 1<br />
(<strong>TU</strong>Contact Nr. 8, Juni 2001)<br />
Das <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Nichtmetallische</strong> <strong>Werkstoffe</strong>, Professur <strong>für</strong> Ingenieur keramik,<br />
Prof. Dr. Jürgen G. Heinrich, stellte auf <strong>der</strong> diesjährigen Hannover Messe vom
– 15 –<br />
23.- 28. April aus dem Forschungsschwerp u n k t „Rapid Prototyping“ die Ergeb -<br />
nisse des Vorhabens zum selektiven Lasersinter n von Keramik aus.<br />
In allen Sparten <strong>der</strong> industriellen Fertigung werden neue Produk te in<br />
wachse n d e m Maß unter Einsatz von Rapid Prototy ping Verfahren entwickelt.<br />
Dies verkürzt die Zeitspanne von <strong>der</strong> Entwicklu ng bis zur Produkteinfü hr u n g<br />
(„time to market“), senkt Formenkosten und erhöht die Wettbewer b sfähigkeit<br />
eines Unterneh m e n s auf dem Markt erheblich.<br />
Messestand <strong>der</strong> Professur <strong>für</strong> Ingenieurkeramik mit <strong>der</strong> Standbesetzung<br />
E. Salahi, T. Prescher, T. Krause, A. Maghsoudipour (v.l.n.r.)<br />
Im Forschungssc h w e r p u n k t „Rapid Prototyping“ am <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Nichtmetallische</strong><br />
<strong>Werkstoffe</strong> <strong>der</strong> <strong>TU</strong> <strong>Clausthal</strong> wird daher an <strong>der</strong> Entwicklung von Verfahren zum<br />
Aufbau keramischer Prototypen durch gezielten Einsatz von EDV und neuen<br />
Technologien gearbeitet.<br />
Durch selektive s Lasersintern wird <strong>der</strong> Aufwan d <strong>der</strong> Modell- und Formenher -<br />
stellung <strong>für</strong> komplexe keramisc he Körper drastisch verringert. Zunächst werden<br />
mit dem 3D- CAD- System Unigraphics Modelle im Rechner erstellt, in Schichten<br />
gesch nitten und als NC- Datensatz exportiert. Da<strong>für</strong> werden Standard Progra m -<br />
module angewe n de t. In den Lasersintera nlagen werden diese Datensätze von<br />
einem Postprozessor weiter verarbeitet und zum sukzessiven Aufbau von kera -<br />
mischen Prototypen verwen det.
– 16 –<br />
Das in wässriger Suspensio n aufbereitete Pulver (<strong>der</strong> Schlicker) wird mit Hilfe<br />
eines Roboters auf einem geheizten Objekttisch in einer Lage von wenigen zehn -<br />
tel Millimetern aufgebracht. Anschließ en d wird die Schichtinformation des<br />
herzu stellenden Bauteils mit dem Laser selektiv auf die so aufgebaute Pulver -<br />
schicht abgebildet. Der Roboter verfährt um eine Schichtdicke nach oben, eine<br />
weitere Pulverlage wird aufgetrage n und <strong>der</strong> Laserproze ß beginnt von neuem.<br />
Nach Abbildung aller Schichten kann <strong>der</strong> Prototy p aus dem Pulver herausgelö st<br />
werden und gegebenenfalls weiteren Behandlungs sc h ritten, dem finishing, un -<br />
terzogen werden. Im Fall <strong>der</strong> Porzellanher stellung wird es sich dabei um eine<br />
Nachsinteru ng zur weiteren Verdichtu ng und Verfestigung des lasergesinterten<br />
Bauteils sowie um die Glasierung des Bauteils handeln.
– 17 –<br />
Angewandte Forschung steht im Mittelpunkt<br />
(cfi/Ber. DKG 78)<br />
Vor fast sechs Jahren hat Prof. Dr. J. G. Heinrich nach langjähriger Industrietätig -<br />
keit die Professur <strong>für</strong> Ingenieurkera mi k am <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Nichtmetallische</strong> Werk -<br />
stoffe <strong>der</strong> <strong>TU</strong> <strong>Clausthal</strong> überno m m e n. Derzeit ist er auch amtieren<strong>der</strong> Dekan des<br />
Fachbereichs Physik, Metallurgie und Werkstoffwis se n s c h afte n. Im ersten Ab -<br />
schnitt seiner Tätigkeit stande n zunäch st sehr praktische Aufgaben, wie die<br />
Renovierung und Ausrüstu ng des Labors, Vortragsräu me und Arbeitszim m e r.<br />
Weiterhin die Wie<strong>der</strong>beleb u ng von Industrie - Kontakten und das Erneuern von<br />
Beziehungen zu an<strong>der</strong>en Forschungsein richt u ngen.<br />
Enge Partnerschaft mit <strong>der</strong> Industrie<br />
Die Drittmittelaufko m m e n von Projekten, die seit 1997 gestartet wurden, be -<br />
laufen sich auf ca. DM 3,5 Mio. Das größte Projekt ist ein neues vom BMBF ge -<br />
för<strong>der</strong>tes Projekt mit einem Volumen von DM 6,7 Mio zum Thema „Recycling<br />
von Porzellanpre s s m a s s e n“. Die Industriepartner sind hier BHS Tabletop AG,<br />
KPCL Deutsc hlan d GmbH und Rosenthal AG. Interessant sind in diesem Zu -<br />
samme n h a n g sicher auch die kürzlich angeschafften Geräte: CO 2- und Nd:YAG-<br />
Laser, kontinuierlicher Schutzgasofe n und Mitsubishi - sowie ABB- Roboter.<br />
Außerde m wurde ein Reinrau m installiert.<br />
Dr. Schwerdtfeger (Wacker Che -<br />
mie Burghausen) und Dr. Blu-<br />
menberg (Deutsche Keramische<br />
Gesellschaft) im Gespräch mit<br />
Dipl.- Ing. Tobias Krause am<br />
„Tatort“ bei <strong>der</strong> Abschluss -<br />
präsentation des AiF- Vor-<br />
habens „Lasersintern von<br />
Porzellan“.<br />
Bei <strong>der</strong> Abschluss p räsentatio n des AiF- Vorhabens „Lasersintern von Porzellan“<br />
im Juni 2001 wurde <strong>der</strong> enge Industrieko n takt bei den Arbeiten verdeutlicht<br />
(Projektp art ner: Ceraplan, KPCL Deutschlan d, Rosenthal, Villeroy & Boch, Wacker
– 18 –<br />
Chemie). Es wurde die lagenweise Schlickerdeposition (LSD) zum selektiven La-<br />
sersintern entwickelt. Damit können ohne Modell- und Formen h erstellu ng Pro -<br />
totypen entwickelt werden. Das Verfahren wurde inzwische n zum Patent ange -<br />
meldet. Die Erkenntnis se dieser Arbeiten sollen nun auch auf an<strong>der</strong>e <strong>Werkstoffe</strong><br />
übertragen werden. Hier wird gezeigt, dass Erkenntnis se, die mit klassische n<br />
Porzellanmassen gewonnen wurde n, auch auf <strong>Werkstoffe</strong> <strong>der</strong> Technischen Kera -<br />
mik übertragen und adaptiert werden könne n. Somit sind Synergien zwischen<br />
Ingenieurkera mik und traditioneller Keramik möglich.<br />
Internationalität<br />
Die internatio nale Kommu nikation mit Wissenschaftlern wird vom <strong>Institut</strong> nicht<br />
nur durch die Aufnah me von auslän dischen Gaststudente n und die aktive Teil -<br />
nahme an internationalen Symposien umgesetz t. Im November 2000 wurde von<br />
<strong>der</strong> Deutsche n Keramischen Gesellschaft unter <strong>der</strong> Leitung von Prof. Heinrich<br />
das 7. International Symposiu m <strong>für</strong> „Keramische <strong>Werkstoffe</strong> und Komponente n<br />
im Motorenba u“ in Goslar initiiert. Es nahme n 250 Wissenschaftler aus Europa,<br />
den USA, China, Japan und Korea daran teil. Die Nachfolgeko nfere n z wird im<br />
Jahr 2003 von <strong>der</strong> Amerikanisc he n Gesellschaft ausgerichtet. Nach <strong>der</strong> geleiste -<br />
ten Aufbauarbeit ist in <strong>Clausthal</strong> eine Kompetenz <strong>für</strong> angewandte Forschung auf<br />
nationaler und internationaler Ebene vorhan d e n.<br />
Hier kann man intensiv forschen – Iranische Doktoranden <strong>für</strong> sechs Monate zu<br />
Gast<br />
(Goslarsche Zeitung, 10. April 2001)<br />
Vor über 25 Jahren promo vierte Fattollah Moztarzadeh bei Prof. Dr. H.- W.<br />
Hennicke im <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Nichtmetallische</strong> <strong>Werkstoffe</strong>. Heute ist er selbst<br />
Professor und lehrt am MERC Materials & Energy Research Centre in Teheran<br />
(Iran). Und jetzt sind seine Doktora n den Amir Maghsou dipour und<br />
Esmail Salahi in <strong>der</strong> Arbeits gruppe von Prof. Dr. J. G.<br />
Heinrich, Prof. Hennickes Nachfolger, zu Gast. „<strong>Clausthal</strong> ist ein wun<strong>der</strong>bare r<br />
Ort, um sich intensiv <strong>der</strong> Forschung zu widmen“, sagen beide übereinsti m m e n d.<br />
„Die Menschen sind überall freundlich und hilfsbereit.“ Amir Maghsoudi po u r<br />
und Esmail Salahi arbeiten hart. Auch am Wochenende sind sie oft im Labor,<br />
denn ihr Stipendiu m des iranischen Staates ist - mit <strong>der</strong> Option auf eine dreimo -<br />
natige Verlängeru ng - auf sechs Monate begrenzt. Amir Maghsou dipour befasst<br />
sich mit <strong>der</strong> Herstellung eines Verbundwerkstoffes aus Aluminium nitrid und
– 19 –<br />
Aluminium o xid. Nichtoxidische Keramiken wie Aluminiu m nitride besitzen hohe<br />
Bindungskräfte. Deren Wärmeleitfähigkeit ist höher als die oxidischer Kerami -<br />
ken. Oberhalb von 800 °C setzt bei Aluminiu m nitriden eine merkliche Oxidation<br />
ein. Als Grenze <strong>der</strong> Einsatzte m p e ratur <strong>für</strong> Aluminium nitride unter oxidieren<strong>der</strong><br />
Atmos p h äre gilt daher eine Temperatur von 1000 °C. Der neue AlN- Al 2O 3- Ver -<br />
bundwerkstoff soll die hohe thermisc he Leitfähigkeit des Aluminiu m nitrids be -<br />
halten, zugleich soll durch die Zugabe von Al 2O 3- Körnern <strong>der</strong>en Anfälligkeit<br />
gegenüber Oxidation „ausgemerzt“ werden. So könnte n sie noch besser im<br />
Hochtemperaturbereich als Wärmetau s cher eingesetzt werden. Esmail Salahi<br />
mischt Aluminiu m nitrid - und Aluminiu m p a rtikel in einer Lösung. Nach <strong>der</strong><br />
Trocknung sind die Aluminiu m nitrid p artikel von feinen Aluminiu m k ö r n er n um -<br />
geben. Am ir Maghsoudipour Das Pulver (links) wird unter und Stickstoffat mosphäre gesintert. Die Parameter -<br />
Esmail Salahi bereiten de n<br />
Partikelgröße, <strong>der</strong>en Oberflächenbeschaffenheit, Additive während <strong>der</strong> Sinterung<br />
Boden <strong>für</strong> w eite re iranis che<br />
(Calzium Gastw is sens - chaftler.<br />
und Yttriumoxid sowie Seltene Erden), die Sintertemperatur und<br />
Sinterat mosphäre bestim men das Eigenschafts p rofil. „Wir freuen uns schon auf<br />
die guten Doktoranden von Esmail Salahi und Amir Maghso udip o u r in fünf -<br />
undzwan zig Jahren“, sagt ihr Betreuer im <strong>Institut</strong> Dr. rer. nat. Jens Günster.<br />
„Weitere iranische Stipendiaten sind uns willkom me n.“<br />
Exkursion zum Tonziegelwerk Jacobi<br />
Exkursion zur Jacobi Tonwerke GmbH in Bilshausen im Rahmen <strong>der</strong> Vorlesung<br />
„Werkstoffk u n d e Glas–Keramik–Binde mittel, Teil Keramik“ am 17. Juli 2001<br />
Bei strahlen de m Sonnensc h ein sind wir, dreizehn Studente n / i n n e n, Professor<br />
Heinrich und drei Mitarbeiter in <strong>Clausthal</strong> gestartet, um die Dachziegelpro d u k ti -<br />
on <strong>der</strong> Jacobi Tonwerke GmbH in Bilshausen zu besuchen. Von Osterode über<br />
Schwiegers h au se n und Wulften kommend, sind schon aus <strong>der</strong> Ferne die hohen<br />
Schornsteine <strong>der</strong> Ziegelei am Ortseingang Bilshause n s zu sehen. Auch heute gilt<br />
noch, daß ein langes Gebäude mit einem Schornstein am Ende mit hoher Wahr -<br />
scheinlichkeit eine Ziegelei ist. Im Werk angeko m m e n wurden wir von Herrn<br />
Schrö<strong>der</strong>, Werksleiter und Ehemaliger des Steine und Erden <strong>Institut</strong>s (jetzt INW),<br />
wie immer überaus freundlich begrü ßt und sofort, zur Stärkung nach <strong>der</strong> langen<br />
Fahrt, zu einem Imbiß gebeten. Während wir uns stärkte n, zeigte uns Herr<br />
Schrö<strong>der</strong> einen Film über die Jacobi Tonwerke GmbH, d.h. über die Werke, wirt -<br />
schaftliche Daten und den Produktions p r o ze s s, bis hin zu Anwend u n g s b ei -<br />
spielen <strong>der</strong> verschiede nen Dachziegelformen. Im Anschluss folgte eine ausgie -
– 20 –<br />
bige Diskus sio n über die Ziegelindustrie, die Keramikindustrie allgemein, sowie<br />
die Forschung und Studiensituation am <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Nichtmetallische</strong> <strong>Werkstoffe</strong><br />
in <strong>Clausthal</strong>. Beson<strong>der</strong>s freute sich Herr Schrö<strong>der</strong>, dass sich Professor Heinrich<br />
von <strong>der</strong> Hochleistung s k e ra mi k in die „Nie<strong>der</strong>ungen <strong>der</strong> Keramik“ begeben hat<br />
und eine Exkursion in eine Ziegelei mit seinen Studente n durchführt. Es ist jedes<br />
Mal eine Freude zu erleben, mit welche m Spaß und Witz Herr Schrö<strong>der</strong> seine<br />
Gäste betreut. Natürlich durften auch alte Anekdote n aus seiner <strong>Clausthal</strong>er Stu -<br />
dentenzeit nicht fehlen, z.B. die von einem <strong>Clausthal</strong>er Professor, <strong>der</strong> immer sei -<br />
nen Hund vorm Schreibtisch liegen hatte, <strong>der</strong> Prüflinge regelmä ßig in die Hose<br />
biß. Die Prüflinge durften nichts gegen den Hund sagen, um nicht durch die Prü -<br />
fung zu fallen. Zum Glück hat sich die Situation <strong>für</strong> unsere heutigen Studenten<br />
grundlegen d geän<strong>der</strong>t. Professor Heinrichs Hund ist die meiste Zeit zu Hause<br />
und würde auch nur in die Schuhe <strong>der</strong> Prüflinge beißen. Inzwischen war auch<br />
Herr Aschoff, ein Mitarbeiter Herrn Schrö<strong>der</strong>s zu uns gestoßen, um an <strong>der</strong><br />
Diskus sio n teilzune h me n und die Besuchergrup p e gemeinsa m mit Herrn<br />
Schrö<strong>der</strong> durch das Werk zu führen. Wir besichtigten das Labor, die Formenher -<br />
stellung, die Aufbereitung, die Formgebu n g, sahen das Engobieren <strong>der</strong> Ziegel und<br />
den weiteren Weg <strong>der</strong> Ziegel, bis sie fertig gebrannt den jeweiligen Tunnelofen<br />
verlassen und verpackt werden. Den Besuchern wurde ein sehr mo<strong>der</strong>nes und<br />
großes Werk zur Dachziegelpr od u k tio n gezeigt. Wir möchten uns auf diesem<br />
Weg noch einmal recht herzlich bei Herrn Schrö<strong>der</strong>, Herrn Aschoff und <strong>der</strong> Jaco -<br />
bi Tonwerke GmbH <strong>für</strong> die freundliche und informative Betreuung bedan ke n<br />
und würden uns freuen auch nach Herrn Schrö<strong>der</strong>s Ruhestand wie<strong>der</strong> einmal<br />
eine Exkursion mit unseren Studenten zu Jacobi in Bilshausen durchführen zu<br />
können. (Bericht: Andre Bertram)
– 21 –<br />
Herr Schrö<strong>der</strong> (2. v. l.), Herr Aschoff (5. v. l.), Foto: Bertram.<br />
Teilneh mer an <strong>der</strong> Exkursion: Prof. Jürgen G. Heinrich, Dipl.- Ing. Andre Bertram,<br />
Dipl.- Ing. Bernd Bitterlich, Dipl.- Ing. Torsten Prescher, Ulrike Wolf, Katja Raben -<br />
eck, Kerstin Rohlfs, Stefan Schmitz, Sebastian Palm, Thomas Rüdden klau, Tho -<br />
mas Belzer, Rostislaw Olejnik, Michael Gold, Stephan Sickman n, Christoph Vogt,<br />
Arthur Melchior, Alexan<strong>der</strong> Newirko we z.<br />
Personelle Verän<strong>der</strong>ungen<br />
Ausgeschie de ne Mitarbeiter: Rainer Bosse<br />
Neu angeschaffte Geräte<br />
• Reinrau m<br />
• 3 kW CO 2- Laser<br />
Dr.- Ing. Sabine Meier
– 19 –<br />
4. Mitteilungen <strong>der</strong> Professur <strong>für</strong> Glas<br />
4.1 Forschungstätigkeit<br />
• AFM- und STM-Untersuchungen an Glasoberflächen unter definierten<br />
Bedingungen (DFG-Normalverfahren),<br />
• Texturen in glaskeramischen <strong>Werkstoffe</strong>n (DFG-Normalverfahren),<br />
• Interdiffusionsprozesse bei <strong>der</strong> Herstellung von dünnen Sol-Gel-Beschichtungen<br />
auf Glassubstraten (DFG-Normalverfahren),<br />
• Strukturelle und kinetische Aspekte des Einbaus von Wasser in silicatische Schmelzen<br />
und Gläser (DFG-SPP Bildung, Transport und Differenzierung von Silicatschmelzen),<br />
• Zinn im Floatglas (AiF/Hüttentechnische Vereinigung <strong>der</strong> Deutschen<br />
Glasindustrie, Frankfurt),<br />
• Ursachen <strong>der</strong> Korrosion von Emails durch gas- und dampfförmige Komponenten<br />
und Kondensate (AiF/Deutscher Email-Verband, Hagen),<br />
• Entwicklung von Quarzglastiegeln (Zusammenarbeit mit <strong>der</strong> Fa. Heraeus Quarzglas<br />
GmbH & Co KG, Hanau),<br />
• Transportprozesse in Schwermetallfluoridgläsern (DFG-Normalverfahren),<br />
• Herstellung von nichtsilicatischen Oxidgläsern mittels Sol-Gel-Verfahren und<br />
kernmagnetische Verfolgung von Kinetik und Strukturbildung von <strong>der</strong><br />
molekularen Lösung bis zum Material (DFG-Programmgruppe),<br />
• On Line in situ-Laserspektroskopie <strong>der</strong> Ofenatmosphäre von Glasschmelzöfen<br />
(AiF/Hüttentechnische Vereinigung <strong>der</strong> Deutschen Glasindustrie Frankfurt),<br />
• Untersuchungen an porösen Antireflexschichten auf Duran (Zusammenarbeit mit <strong>der</strong><br />
Fa. Schott-Rohrglas GmbH, Mitterteich),<br />
• Materialwissenschaftliche Untersuchungen an römischen Bleiglasuren<br />
(Forschungsstipendium <strong>der</strong> Fritz Thyssen-Stiftung).
4.2 Vorträge und Reisen<br />
– 20 –<br />
G. Heide (V), J.-F. Poggemann, G. H. Frischat<br />
Direkte Abbildung einer Kieselglasbruchfläche mit atomarer Auflösung.<br />
11.10.2000, XXI. Arbeitstagung des Arbeitskreises Nichtkristalline und partiellkristalline<br />
Strukturen, Deutsche Gesellschaft <strong>für</strong> Kristallographie, Wolfersdorf/Jena.<br />
G. Heide<br />
Problems with the water analysis with SNMS of corroded and sol-gel coated glass.<br />
20.10.2000 INA-Anwen<strong>der</strong>treffen im Forschungszentrum Karlsruhe.<br />
M. Leschik (V), G. Heide, G. H. Frischat, H. Behrends<br />
Massenspektroskopische und IR-mikroskopische Bestimmung <strong>der</strong> Wasserdiffusion in<br />
rhyolithischen Gläsern.<br />
23.11.2000, DFG-SPP „Bildung, Transport und Differenzierung von Silicatschmelzen“,<br />
Bornheim-Walterberg.<br />
A. Goß (V), J.-F. Poggemann (V), E. Rädlein (V), K. Wilm, R. Heidrich, G. Helsch<br />
Beson<strong>der</strong>heiten <strong>der</strong> Rasterkraftmikroskopie an Gläsern.<br />
22. und 23.2.2001, 2. Workshop Rasterkraftmikroskopie in <strong>der</strong> Werkstoffwissenschaft,<br />
Braunschweig.<br />
G. H. Frischat<br />
Determiniation of glass homogeneity by the Christiansen-Shelyubskii method.<br />
5. und 6.3.2001, Seminare bei Pittsburgh Plate Glass Industries, Inc., Pittsburgh, PA,<br />
Lexington, NC, und Shelby, NC, USA.<br />
G. Heide<br />
Strukturelle Klassifikation natürlicher Gläser.<br />
21.3.2001, FA I <strong>der</strong> DGG, Würzburg.<br />
G. Heide<br />
Liefert das AFM Strukturinformationen? – Untersuchungen an Glasoberflächen -.<br />
26.4.2001, Kolloquium <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> Keramische <strong>Werkstoffe</strong>, Technische Universität<br />
Bergakademie Freiberg.<br />
G. H. Frischat<br />
Ionentransport in Gläsern und an Glasoberflächen.<br />
3.5.2001, Kolloquium im Son<strong>der</strong>forschungsbereich 458, Universität Münster.<br />
A. Goß (V), E. Rädlein, G. H. Frischat<br />
AFM-Studie an Glasbruchflächen in Luft und in einer Flüssigkeitsmeßzelle.<br />
21. – 23.5.2001, 75. Glastechnische Tagung, Wernigerode.<br />
D. Moseler (V), G. Heide, G. H. Frischat<br />
AFM-Analyse des Bloom-Effektes bei Floatgläsern.<br />
21. – 23.5.2001, 75. Glastechnische Tagung, Wernigerode.
– 21 –<br />
G. Helsch (V), G. H. Frischat, K. Helming<br />
Texturen im System Li2O-Al2O3-SiO2: Charakterisierung und Eigenschaften.<br />
21. – 23.5.2001, 75. Glastechnische Tagung, Wernigerode.<br />
G. Heide, S. Schwarzer, G. H. Frischat<br />
Modellierung <strong>der</strong> Fe 2+ - und Fe 3+ -Profile in Floatglas (Poster).<br />
21. – 23.5.2001, 75. Glastechnische Tagung, Wernigerode.<br />
G. Heide, G. H. Frischat<br />
Glastechnische Untersuchungen an Proben aus einem massigen Obsidianstrom (Poster).<br />
21. – 23.5.2001, 75. Glastechnische Tagung, Wernigerode.<br />
G. H. Frischat<br />
Structure of glass seen by atomic force microscopy (invited).<br />
30.5.2001, Workshop „Structure of Glass“, Harakopio University, Athen, Griechenland.<br />
G. H. Frischat<br />
Innovative sol-gel coatings on glass (invited).<br />
14.6.2001, International Conference on Sol-Gel Materials, Rokosowo Castle, Polen.<br />
E. Olbrich, G. H. Frischat (V)<br />
Aqueous corrosion of granulated glassy blast furnace slags.<br />
1. – 6.7.2001, XIX th Intern. Congr. Glass, Edinburgh, Scotland.<br />
G. Heide (V), G. H. Frischat, B. Müller, G. Klöß<br />
Structural classification of natural glasses.<br />
1. – 6.7.2001, XIX th Intern. Congr. Glass, Edinburgh, Scotland.<br />
A. Helebrant (V), K. Polnicka, G. Heide<br />
Experimental simulation of final stages of glass corrosion.<br />
1. – 6.7.2001, XIX th Intern. Congr. Glass, Edinburgh, Scotland.<br />
S. Schwarzer, G. Heide, D. Moseler, C. Müller-Fildebrandt, G. H. Frischat<br />
Tin in float glass: a qualitative model to explain the tin hump and the simulation of iron<br />
profiles (Poster).<br />
1. – 6.7.2001, XIX th Intern. Congr. Glass, Edinburgh, Scotland.<br />
G. Heide (V), G. H. Klöß<br />
Was ist Glas? – Zur Systematik nichtkristalliner Festkörper.<br />
17. – 20.9.2001, XXII. Arbeitstagung Arbeitskreis Nichtkristalline und partiellkristalline<br />
Strukturen, Wolfersdorf.<br />
G. H. Frischat<br />
Was sieht man mit dem Atomkraftmikroskop auf <strong>der</strong> Glasoberfläche? (invited)<br />
17. – 20.9.2001, XXII. Arbeitstagung Arbeitskreis Nichtkristalline und partiellkristalline<br />
Strukturen, Wolfersdorf.
– 22 –<br />
G. Helsch (V), G. Heide, G. H. Frischat<br />
Keramische Sol-Gel-Schichten auf Glas.<br />
26. und 27.9.2001, Glas und Keramik – Synergien <strong>für</strong> Innovationen. Gemeinsame<br />
Veranstaltung des FA I <strong>der</strong> DGG, des FA 1 <strong>der</strong> DKG, des DGG-Glasforums und <strong>der</strong> BAM,<br />
Berlin.<br />
4.3 Veröffentlichungen<br />
G. H. Frischat<br />
Zwanzig Jahre Weltraumforschung über Glas.<br />
In: M. H. Keller, P. R. Sahm (Herausg.): Bilanzsymposium Forschung unter<br />
Weltraumbedingungen, Nor<strong>der</strong>ney 1998, Wissenschaftliche Projektführung RWTH Aachen,<br />
2000, 317 – 321.<br />
B. Radomski, G. H. Frischat, P. Hellmold<br />
Korrosion von Emails durch gas- und dampfförmige Komponenten und Kondensate.<br />
Mitteil. DEV 48 (2000), 93 – 101.<br />
G. H. Frischat<br />
Diffusion in glasses and glass melts.<br />
In: Mass and Charge Transport in Inorganic Materials: Fundamentals to Devices. P.<br />
Vincenzini, V. Buscaglia (Eds.), Techna Srl, I-48018 Faenza, 2000, 319 – 328.<br />
G. Heide, C. Müller-Fildebrandt, D. Moseler, G. H. Frischat, W. Meisel, A. Maldener, A.<br />
Zouine-Thimm, F. Rauch<br />
Tin in float glass: A diffusion-reaction model based on surface analysis explains the tin hump.<br />
Glastech. Ber. Glass Sci. Technol. 73 C2 (2000), 321- 330.<br />
G. Alper, C. Römer-Strehl, A. K. Schuster<br />
Die Keramik <strong>der</strong> mittelalterlichen Bergbau- und Hüttensiedlung am Johanneser Kurhaus bei<br />
<strong>Clausthal</strong>-Zellerfeld – Untersuchungen zur Herkunft und Technologie, insbeson<strong>der</strong>e <strong>der</strong><br />
glasierten Irdenware.<br />
Ber. Denkmalpflege Nie<strong>der</strong>s. 20 (2000), Nr. 4, 179 – 188.<br />
J.-F. Poggemann, A. Goß, G. Heide, E. Rädlein, G. H. Frischat<br />
Direct view of the structure of a silica glass fracture surface.<br />
J. Non-Cryst. Solids 281 (2001), 221 – 226.<br />
G. H. Frischat<br />
Gas bubbles in glass melts un<strong>der</strong> microgravity.<br />
Proc. 1 st Int. Symp. Micrograv. Res. & Appl. Phys. Sci. & Biotechnol., Sorrento 2000 (ESA<br />
SP-454, 2001), 475 – 479.<br />
E. Olbrich, G. H. Frischat<br />
Corrosion of granulated glassy blast furnace slags in aqueous solutions.<br />
Glastech. Ber. Glass Sci. Technol. 74 (2001), 86 – 96.
– 23 –<br />
G. H. Frischat, C. Müller-Fildebrandt, D. Moseler, G. Heide<br />
On the origin of the tin hump in several float glasses.<br />
J. Non-Cryst. Solids 283 (2001), 246 – 249.<br />
G. H. Frischat, B. Hueber, B. Ramdohr<br />
Chemical stability of ZrF4- and AlF3-based heavy metal fluoride glasses in water.<br />
J. Non-Cryst. Solids 284 (2001), 105 – 109.<br />
K. Bange, O. An<strong>der</strong>son, F. Rauch, P. Lehuédé, E. Rädlein, N. Tadokoro, P. Mazzoldi, V.<br />
Rigato, K. Matsumoto, M. Farnworth<br />
Multi-method characterization of soda-lime glass corrosion. Part 1. Analysis techniques and<br />
corrosion in liquid water.<br />
Glastech. Ber. Glass Sci. Technol. 74 (2001), 127 – 141.<br />
K. Heide, G. Heide, G. Kloess<br />
Glass chemistry of tektites.<br />
Planetary and Space Science 49 (2001), 839 – 844.<br />
4.4 Studien-, Diplom- und Doktorarbeiten<br />
A. Herbst<br />
Zur Korrosion von Flint<br />
Diplomarbeit; Betreuer: Frischat/Heide<br />
Flint ist ein natürliches Material, das durch Lösungs- und Fällungsreaktionen aus Meerwasser<br />
entstanden ist. Es wird allgemein als ein nichtkristalliner Festkörper betrachtet, <strong>der</strong><br />
hauptsächlich aus SiO2 besteht.<br />
In dieser Arbeit wird das Korrosionsverhalten von Flint untersucht. Dazu wird das Material<br />
zunächst phasenanalytisch untersucht und es werden einige physikalische Eigenschaften und<br />
chemische Zusammensetzungen bestimmt. Die Phasenanalyse wird mit <strong>der</strong> Debye-Scherrer-<br />
Methode und dem Bragg-Brentano-Verfahren durchgeführt. Hier wird neben einer Glasphase<br />
auch eine kristalline Phase erkannt. Diese hat einen Anteil von etwa 56 % bezogen auf die<br />
Gesamtmasse. Eine quantitative Analyse mit <strong>der</strong> RFA bestätigte Werte aus <strong>der</strong> Literatur, daß<br />
Flint weitere Elemente nur in Spuren o<strong>der</strong> untergeordneten Mengen enthält. Durch die<br />
Korrosionsversuche zeigte sich die Schwierigkeit <strong>der</strong> Übertragbarkeit kinetischer Modelle<br />
vom Kieselglas auf natürliche Materialien.<br />
Kristalline und glasartige Phasen sind inhomogen im Flint verteilt. Eine Reduzierung wurde<br />
erreicht, indem die Probe gemahlen wurde. Für die Korrosionsversuche wurde eine<br />
Kornfraktion 0,315 mm < d < 0,500 mm abgesiebt. Dadurch ergibt sich eine bestimmbare
– 24 –<br />
reaktive Oberfläche. Die Korrosion von Flint muß analog zu dem Modell <strong>der</strong> Korrosion von<br />
Kieselglas in mehrere Abschnitte aufgeteilt werden, die ineinan<strong>der</strong> übergehen. Messungen <strong>der</strong><br />
Verän<strong>der</strong>ungen <strong>der</strong> Flintoberfläche zeigen nach einer Phase <strong>der</strong> Auflösung vermutlich eine<br />
Gelschicht, welche aus <strong>der</strong> Korrosionslösung gefällt sein muß. Diese neu gebildete Schicht<br />
wird allerdings im weiteren Verlauf <strong>der</strong> Korrosion selbst wie<strong>der</strong> gelöst. Insgesamt ist das<br />
Korrosionsverhalten von Flint dem von Quarz ähnlicher als dem von Kieselglas.<br />
L. Wondraczek<br />
Entwicklung eines Glas-Polycarbonat-Gradientenwerkstoffes<br />
Diplomarbeit; Betreuer: Frischat, Heide/Weidenfeller, Ziegmann (PuK, <strong>TU</strong> <strong>Clausthal</strong>)<br />
S. Cramer von Clausbruch<br />
Kristallisation, Gefüge und Eigenschaften ausgesuchter Gläser und Glaskeramiken im<br />
System SiO2-Li2O-ZnO-K2O-P2O5<br />
Dissertation; Referenten: Frischat/Höland (Ivoclar, Liechtenstein)<br />
Im Rahmen <strong>der</strong> Dissertation wurde das Kristallisationsverhalten ausgesuchter Gläser des<br />
Mehrkomponentensystems SiO2-Li2O-ZnO-K2O-P2O5 mittels Hochtemperatur-<br />
Röntgendiffraktometrie und Differenzthermoanalyse untersucht. Ausgehend von einem<br />
Modellglas mit <strong>der</strong> molaren Zusammensetzung 63,2 SiO2, 29,1 Li2O, 3,3 ZnO, 2,9 K2O und<br />
1,5 P2O5 wurden 20 Gläser erschmolzen, wobei die Anteile <strong>der</strong> einzelnen Glaskomponenten<br />
systematisch variiert wurden. Die Glaszusammensetzungen beeinflußten maßgeblich die<br />
Bildungen und Auflösungen von metastabilen und stabilen Phasen im Temperaturbereich von<br />
400 °C bis 1100 °C. Im Rahmen <strong>der</strong> Untersuchungsreihen wurden die Kristallphasen<br />
Lithiumdisilicat, Lithiummetasilicat, Lithiumorthophospat, Cristobalit und Quarz in<br />
unterschiedlichen Phasenfolgen detektiert. Phasenbildungen, -wachstum und -umwandlungen<br />
im frühen Kristallisationsstadium konnten durch Morphologieän<strong>der</strong>ungen anhand<br />
atomkraftmikroskopischer Begleituntersuchungen nachgewiesen und mit den Ergebnissen <strong>der</strong><br />
röntgendiffraktometrischen Untersuchungen korreliert werden.
– 25 –<br />
Quantitative Untersuchungen zur Kristallisationskinetik von Gläsern mit variiertem P2O5-<br />
Gehalt von 1,5 bis 2,5 Mol% zeigten ein Kristallwachstum nach dem Prinzip <strong>der</strong> Ostwald-<br />
Reifung und Wachstumsraten im Anfangsstadium von ca. 0,3 bis 0,4 µm/min auf.<br />
Die Gefüge <strong>der</strong> Glaskeramiken nach einer einstufigen Keramisierungsbehandlung wurden<br />
mittels REM-Aufnahmen an geätzten Proben charakterisiert. Für die angestrebten<br />
feinkristallinen, homogenen Gefüge stabförmiger Li2Si2O5-Kristalle mit guten mechanischen<br />
und optischen Eigenschaften waren minimale Gehalte von 1,0 Mol% P2O5 und 1,5 Mol% K2O<br />
notwendig. Hohe K2O-Gehalte (≥ 4,5 Mol%) wirkten sich negativ auf die Gefügeentwicklung<br />
aus.<br />
Von den 20 untersuchten Glaskeramiken konnten 17 über ein Heißpreßverfahren zu<br />
Probekörpern weiterverarbeitet werden, <strong>der</strong>en mechanische und optische Eigenschaften<br />
bestimmt wurden. Die Zusammensetzungsvariationen bedingten mittlere Biegefestigkeiten<br />
zwischen 224 MPa und 675 MPa, wobei sich niedrige P2O5-, hohe K2O- sowie hohe ZnO-<br />
Gehalte negativ auswirkten. Die linearen thermischen Ausdehnungskoeffizienten <strong>der</strong><br />
Preßglaskeramiken lagen zwischen 11,0 10 6 /K und 13,2 10 -6 /K. Es wurde ein<br />
Transluzenzvergleich nach BS 5612 angestellt, wobei sich, bei Probendicken von 1,0 mm,<br />
Kontrastwerte zwischen 0,3 und 0,8 ergaben. Dies weist, bei Grenzwerten dieser Methode<br />
von 0 und 1, auf den hohen Einfluß <strong>der</strong> Zusammensetzungsvariation hin.<br />
Die mittels Bildanalyse an REM-Aufnahmen ermittelten Li2Si2O5-Kristallphasenanteile <strong>der</strong><br />
Preßglaskeramiken lagen zwischen 50 Vol.% und 71 Vol.%, wobei niedrige und hohe P2O5-<br />
Gehalte die niedrigsten Kristallinitäten bedingten.<br />
Ein direkter Morphologievergleich <strong>der</strong> Preßglaskeramiken mit den korrespondierenden<br />
Glaskeramiken zeigte, daß, bedingt durch die zusätzliche Temperaturbehandlung und den<br />
viskosen Fließvorgang, die Kristallgrößen leicht anstiegen und sich eine erhöhte Orientierung<br />
<strong>der</strong> Kristalle in Fließrichtung einstellte.<br />
C. Müller-Fildebrandt<br />
Wechselwirkung von Zinnschmelze und Floatglas<br />
Dissertation; Referenten: Frischat/Rädlein (Universität Bayreuth)<br />
Für die Herstellung von Flachglas wird die Glasschmelze mit ca. 1050 °C auf eine metallische<br />
Zinnschmelze ausgegossen und breitet sich zu einem gleichmäßigen Band aus. Durch die<br />
Feuerpolitur <strong>der</strong> Oberseite und die Auflage <strong>der</strong> Glasschmelze auf einer Zinnschmelze kommt<br />
es zu Unterschieden zwischen beiden Seiten des Glases (Feuerseite/Zinnbadseite). Zinn<br />
diffundiert in Form von Sn 2+ aus <strong>der</strong> Zinnschmelze ins Glas (Zinnbadseite). Die Sn 2+ -Ionen
– 26 –<br />
können bei <strong>der</strong> thermischen Weiterverarbeitung des Glases in oxidieren<strong>der</strong> Atmosphäre durch<br />
Biegen o<strong>der</strong> Beschichten zu Sn 4+ -Ionen aufoxidiert werden. Dadurch än<strong>der</strong>t sich <strong>der</strong><br />
thermische Ausdehnungskoeffizient, die Oberfläche wird wellig und erscheint milchig trübe<br />
o<strong>der</strong> bläulich schimmernd. Diese unerwünschte und unkontrollierte Erscheinung wird Bloom-<br />
Effekt genannt.<br />
Des weiteren zeigt das Zinn-Tiefenprofil bei einigen Floatgläsern eine charakteristische<br />
Anreicherung, die sich als Zinn-Peak (Zinnanomalie) in einigen Mikrometern Tiefe bei steil<br />
abfallendem Profilverlauf äußert. Im Gegensatz dazu zeigt die Feuerseite dies nicht.<br />
Im Rahmen dieser Arbeit wurden verschiedene Alkali-Erdalkali-Silicatgläser und<br />
Borosilicatgläser mit variierendem Eisenoxid- und Sulfatgehalt, die nach dem Floatverfahren<br />
hergestellt wurden, untersucht. Die vier Millimeter dicken Gläser stammten aus <strong>der</strong> Mitte des<br />
Glasbandes. Die oberfächenanalytische Untersuchung erfolgte in zwei Tiefenbereichen.<br />
Zur Klärung <strong>der</strong> Ursache <strong>der</strong> Zinnanomalie, <strong>der</strong> dabei ablaufenden Reaktionsmechanismen<br />
und Transportprozesse <strong>der</strong> beteiligten Elemente im Nanometer- und Mikrometerbereich,<br />
wurden Tiefenprofile mit den Methoden <strong>der</strong> Sekundärneutralteilchen-Massenspektrometrie<br />
(SNMS), Elektronenstrahlmikroanalyse (ESMA) und Rutherford-Rückstreu-Spektrometrie<br />
(RBS) gemessen. Die so gewonnenen Tiefenprofile geben Aufschluß über die Zinnverteilung<br />
unmittelbar unterhalb <strong>der</strong> nahen Oberfläche und im Glasinneren. Die Zinn-Tiefenprofile im<br />
Mikrometerbereich wurden an <strong>der</strong> Querschnittsfläche <strong>der</strong> Gläser ausgehend von <strong>der</strong> Zinnbad-<br />
bzw. Feuerseitenkante bestimmt. Diese unterscheiden sich je nach Eisenoxidgehalt des Glases<br />
in ihrer Profilgestalt, in den Werten maximaler Zinnkonzentration und Zinneindringtiefe.<br />
Damit können zwei Profiltypen nachgewiesen werden:<br />
• Tiefenprofile ohne Mikrometer-Zinnpeak, welche sich wie<strong>der</strong>um in kurze und lange Zinn-<br />
Tiefenprofile unterscheiden lassen,<br />
• Tiefenprofile mit Mikrometer-Zinnpeak im Bereich von 5 bis 7 µm.<br />
Die Feuerseite, die nicht in direktem Kontakt mit <strong>der</strong> Zinnschmelze stand, weist neben <strong>der</strong><br />
Zinnanreicherung im ppm-Bereich eine starke Anreicherung von Schwefel auf.<br />
An in Mikrometer-Schritten abgeätzten Glasproben wurden RBS-Untersuchungen<br />
durchgeführt, welche ähnlich wie ESMA den Mikrometer-Zinnpeak in einer Tiefe von 5 bis 7<br />
µm nachweisen.<br />
Mittels RBS- und SNMS-Untersuchungen im Bereich unterhalb <strong>der</strong> nahen Oberfläche <strong>der</strong><br />
Zinnbadseite <strong>der</strong> Gläser wurde dort eine hohe Zinnanreicherung bis in eine Tiefe von ca. 300<br />
nm nachgewiesen. Die Anfangskonzentration an Zinn in Nanometertiefe ist bei allen Gläsern<br />
deutlich höher als im Mikrometerbereich. Ebenso ist eine Verarmung <strong>der</strong> ein- und<br />
zweiwertigen Kationen des Glases bis in eine Tiefe von ca. 50 bis 70 nm zu verzeichnen.
– 27 –<br />
An <strong>der</strong> Feuerseite kann ähnlich wie im Mikrometerbereich eine hohe Schwefelanreicherung<br />
nachgewiesen werden. Eine ausgeprägte Anreicherung von Zinn wurde nicht festgestellt.<br />
Ergänzt werden diese genannten tiefenanalytischen Verfahren durch Untersuchungen mit <strong>der</strong><br />
Konversions-Elektronen-Mössbauer-Spektroskopie (CEMS). Damit werden CEMS-<br />
Tiefenprofile des Verhältnisses Sn 4+ /Sn 2+ im Glas erfaßt.<br />
Auf <strong>der</strong> Grundlage dieser Daten wurde die Massebilanz <strong>der</strong> Elemente Zinn, Eisen und<br />
Schwefel sowie <strong>der</strong> vorhandenen Kationen im Nanometer- bzw. Mikrometerbereich<br />
aufgestellt und geklärt, welche Elemente am Interdiffusions- bzw. Diffusionsprozeß beteiligt<br />
sind.<br />
Aus den so gewonnenen Ergebnissen wird ein qualitatives Diffusions-Reaktions-Modell<br />
entwickelt, das die Bildung <strong>der</strong> Zinnanomalie im Mikrometerbereich erklärt. Zur<br />
quantitativen Formulierung <strong>der</strong> analytisch gewonnenen Meßdaten aus ESMA- und SNMS-<br />
Untersuchungen wurden kinetische Parameter, die Interdiffusions- und Diffusionsprozesse<br />
<strong>der</strong> relevanten Elemente beschreiben, ermittelt. Die Berechnung erfolgte auf <strong>der</strong> Grundlage<br />
<strong>der</strong> Lösung<br />
des 2. Fickschen Gesetzes mit einer Fehlerfunktion. Dadurch konnten effektive<br />
Diffusionskoeffizienten im Nanometer- und Mikrometerbereich ermittelt werden. Die<br />
Größenordnung <strong>der</strong> Diffusionskoeffizienten in den beiden Tiefenbereichen unterscheidet sich<br />
stark. Während im Nanometerbereich effektive Diffusionskoeffizienten von 10 -13 cm 2 s -1<br />
ermittelt wurden, lagen diese Werte im Mikrometerbereich bei 10 -10 cm 2 s -1 .<br />
Mit dieser Kombination von Analysemethoden war es möglich, umfassende, sich ergänzende<br />
Ergebnisse zu den Diffusionsprozessen im Mikrometerbereich und den<br />
Interdiffusionsprozessen im Nanometerbereich zu erhalten und die Wechselwirkung zwischen<br />
Zinnschmelze und Floatglas während des Floatprozesses, des Abkühlens und des Temperns<br />
zu klären.
M. Wagner<br />
– 28 –<br />
Haftung kunsthistorischer Emails auf Edelmetallegierungen<br />
Dissertation; Referenten: Frischat/Hellmold (Deutscher Emailverband, Hagen)<br />
Seit etwa 10 – 15 Jahren werden im Grünen Gewölbe in Dresden gravierende Schäden an den<br />
emaillierten, barocken Pretiosen <strong>der</strong> Gebr. Dinglinger beobachtet. Speziell die transluziden,<br />
grünen Emails springen ab und die blauen zeigen Korrosionserscheinungen wie<br />
Krustenbildung. Die getrübten, türkisen Emails sind relativ wenig geschädigt. Als<br />
Schadensursachen gelten gasförmige Emissionen aus Vitrinenbaumaterialien bzw. den<br />
Ausstellungsstücken.<br />
Im Rahmen dieser Arbeit wurden speziell die Haftfestigkeit und die Haftmechanismen <strong>der</strong><br />
historischen Emails auf Edelmetallen untersucht. Dazu wurden nach chemischen Analysen<br />
von Originalen Modellemails hergestellt und eine miniaturisierte Haftfestigkeitsprüfmethode<br />
(Tiefziehversuch) entwickelt. Damit konnte bestätigt werden, daß die im Grünen Gewölbe<br />
beobachteten emailspezifischen Schadensbil<strong>der</strong> von verschiedenen Haftfestigkeiten geprägt<br />
werden. Mikroskopische Untersuchungen ergaben, daß je nach Metallegierung verschiedene<br />
Haftmechanismen vorliegen. Für Emaillierungen auf Cu wurde eine haftvermittelnde<br />
Oxidschicht neben einer direkten Haftung am Metall beobachtet. Emaillierungen auf<br />
Schmuckgold weisen mit zunehmendem Cu- und abnehmendem Ag-Gehalt des Metalls<br />
größere Haftfestigkeiten auf, da durch starke Verzun<strong>der</strong>ungsvorgänge vermehrt Ankerstellen<br />
existierten.<br />
Auch die Zusammensetzung des Emails ist <strong>für</strong> die Haftung von Bedeutung. PbO reichert sich<br />
beim türkisen Email an <strong>der</strong> Email/Metallgrenzfläche an und wirkt haftvermittelnd; während<br />
Na2O-Anreicherungen, entstanden durch Auslaugungsprozesse beim Anrühren <strong>der</strong><br />
Emailschlicker (Böhmer-Hennicke-Modell), an <strong>der</strong> Email/Metallgrenzfläche eine chemische<br />
Korrosion unterstützen.<br />
UV/VIS- sowie ESR-Spektroskopie bewiesen die Übereinstimmung <strong>der</strong> Original- und<br />
Modellemails und halfen mit Hilfe von Struktur-Eigenschaftsbeziehungen emailspezifisch<br />
hydrolytische Beständigkeiten, mechanische Eigenschaften, das Schmelzverhalten und das<br />
Schadensausmaß im Grünen Gewölbe zu deuten. Eine durch Zwischenoxide stabilisierte<br />
Glasstruktur mit hoher chemischer Beständigkeit reagiert spröde und weist aufgrund geringer<br />
KIc-Werte eine nur geringe Schadenstoleranz auf (grünes Email) während eine weiche<br />
Glasstruktur (blaues Email) und kristalline Ausscheidungen (türkises Email) die<br />
Rißausbreitung minimieren.
– 29 –<br />
Wichtig <strong>für</strong> das Schadensausmaß sind vor allem die Spannungszustände, die durch die<br />
Geometrie, Emailschichtdicke und Korrosion des Konteremails beeinflußt werden.<br />
Versuche zur lokalen Fixierung von Modellemails mittels CO2- und Nd:YAG-Laser führten<br />
zu keinem positiven Ergebnis. Aufgrund des spontanen Energieeintrags <strong>der</strong> Laser wurden<br />
verschiedene Emailschädigungen (Risse, Aufkochen, Verdampfen, Farbumschlag usw.)<br />
beobachtet. Eine Vorwärmung <strong>der</strong> Proben könnte die Spannungsprobleme minimieren, jedoch<br />
wäre das <strong>für</strong> kunsthistorische Objekte unzumutbar.<br />
Als Konservierungsmittel wurden sowohl ein Metacrylatharz, Paraloid B72, als auch ein<br />
Hybridpolymer, Glas-ORMOCER, bezüglich Ritzfähigkeit und Haftung untersucht. Dabei<br />
zeigte das Metacrylatharz bessere Hafteigenschaften beson<strong>der</strong>s auf feucht schmierigen<br />
Glasoberflächen als das Hybridpolymer.<br />
D. Moseler<br />
Rasterkraftmikroskopische Untersuchungen von Floatgläsern und des Bloom-Effekts<br />
Dissertation; Referenten: Frischat/Rädlein (Universität Bayreuth)<br />
Flachglas wird heute überwiegend nach dem Floatglasverfahren hergestellt. Dabei wird die<br />
Glasschmelze auf eine metallische Zinnschmelze gegossen, worauf sie sich zu einem<br />
homogenen Glasband ausbreitet. Durch den Kontakt <strong>der</strong> Glasschmelze mit dem flüssigen<br />
Zinn kommt es zu Diffusionsprozessen, bei welchen vor allem Sn 2+ in die Glasoberfläche<br />
hineinwan<strong>der</strong>t. Bei thermischer Nachbehandlung <strong>der</strong> Glasscheibe wird Sn 2+ zu Sn 4+<br />
aufoxidiert. Das kann zu einer Än<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Glasstruktur und damit zu einer sehr starken<br />
Än<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> thermischen Ausdehnung führen. Beim Abkühlen wird die Glasoberfläche<br />
wellig, was zu einem milchig trüben bis irisierend schimmernden Aussehen führt. Dies<br />
bezeichnet man als Bloom-Effekt.<br />
Die Rasterkraftmikroskopie wurde eingesetzt, um die Auswirkung des Zinns auf die<br />
Topographie von Floatgläsern zu bestimmen. Die Untersuchung erfolgte an Kalkna-<br />
tronsilicatfloatgläsern mit unterschiedlichen Eisengehalten und Borosilicatfloatgläsern. Dabei<br />
standen die Analyse <strong>der</strong> Bruchflächen und <strong>der</strong> getemperten Zinnbadseiten im Vor<strong>der</strong>grund.<br />
Vergleichend wurden die Bruchflächen natürlicher Gläser betrachtet, um zu prüfen, welchen<br />
Einfluß unterschiedliche Entstehungsbedingungen auf die Topographie <strong>der</strong> Oberflächen<br />
haben. Im Gegensatz zu technischen Gläsern ist die Glasbildung hier entwe<strong>der</strong> schockartig<br />
(z. B. Tektite) o<strong>der</strong> erfolgt über extrem große Zeiträume aus Schmelzen (z. B. vulkanische<br />
Gläser) o<strong>der</strong> aus Lösungen (z. B. Opale).
– 30 –<br />
Trotz eines massiven Zinneintrags von bis zu 7 Ma-% in <strong>der</strong> äußersten Oberfläche und zum<br />
Teil 1 – 2 Ma-% bis in eine Tiefe von über 5 μm konnten keine durch das Zinn verursachten<br />
Inhomogenitäten wie Ausscheidungen, Auskristallisationen, Entmischungen o<strong>der</strong> Poren<br />
beobachtet werden. Die <strong>für</strong> das Glashügelmuster des zinnhaltigen Oberflächenbereichs<br />
ermittelten Durchmesser und Höhen lagen bei 50 – 100 nm bzw. 1 – 2 nm und die<br />
Rauhigkeiten bei 0,6 – 0,8 nm. Sie unterschieden sich im Rahmen <strong>der</strong> Meßgenauigkeit nicht<br />
von denen im Glasinnern. Die Bruchflächen <strong>der</strong> aus <strong>der</strong> Schmelze entstandenen natürlichen<br />
Gläsern weisen keine deutlichen Unterschiede in <strong>der</strong> Topographie gegenüber den technischen<br />
Gläsern auf. Aus Lösungen entstandene natürliche Gläser sind dahingegen deutlich durch ihr<br />
ausgeprägteres und teilweise vielfach größeres Hügelmuster gekennzeichnet. Daraus ergeben<br />
sich neue Aspekte zur Interpretation des Glasmusters.<br />
An den wärmebehandelten Floatgläsern zeigte sich, daß das Ausmaß und Aussehen des<br />
Blooms und damit <strong>der</strong> Oberflächenwelligkeit von <strong>der</strong> Glasart, dem Eisengehalt, <strong>der</strong> Größe <strong>der</strong><br />
getemperten Probe, <strong>der</strong>en Geometrie und dem Meßort sowie dem Temperprogramm abhängt.<br />
Nur die eisenarmen Kalknatronsilicatgläser zeigten eine Tendenz zum Bloom. Die Welligkeit<br />
stieg mit <strong>der</strong> Größe <strong>der</strong> Probe. Rechteckige Proben neigten im Gegensatz zu quadratischen zu<br />
entlang den Seiten ausgerichteten Wellenformationen. Bei einer 10 x 10 cm 2 großen Probe<br />
war die Rauhigkeit am Rand 20 – 30 % kleiner als in <strong>der</strong> Mitte. Mit steigen<strong>der</strong> Temperatur<br />
und Haltezeit erfolgte eine Zunahme <strong>der</strong> Welligkeit. In diesem Zusammenhang wurde die<br />
Entstehung des Bloom-Effekts im Detail neu diskutiert.<br />
B. Radomski<br />
Korrosion von Emails durch gas- und dampfförmige Komponenten und Kondensate<br />
Dissertation; Referenten: Frischat/Hellmold (Deutscher Emailverband, Hagen)<br />
Verschraubte, emaillierte Großbehälter werden zunehmend in <strong>der</strong> Abwassertechnologie<br />
aufgrund ihres geringen Preises und <strong>der</strong> guten Reinigungsmöglichkeiten eingesetzt. Über dem<br />
Flüssigkeitsspiegel <strong>der</strong> Großbehälter kam es zu Schadensfällen, <strong>der</strong>en Ursache abschließend<br />
nicht geklärt werden konnte. Eine mögliche Schadensursache könnte die Korrosion durch<br />
Gasangriff sein, insbeson<strong>der</strong>e durch H2S, CO2 und H2O. Bioinduzierte Anfangsphasen <strong>der</strong><br />
Korrosion sowie Montage- und Materialfehler sind in den Diskussionen <strong>der</strong><br />
Schadensursachen zu berücksichtigen.<br />
Ein konzipierter Versuchsaufbau ermöglicht die Bewitterung <strong>der</strong> Emailplatten mit<br />
verschiedenen Gasatmosphären (Gasgemische aus H2S, CO2, H2O und O2 in Stickstoff) bei<br />
unterschiedlichen Temperaturen (40 – 60 °C) und atmosphärischen H2O-Gehalten (40 – 60 %
– 31 –<br />
relative Feuchtigkeit) im ungeschädigten sowie im mechanisch (Schlagbeanspruchung) o<strong>der</strong><br />
chemisch (H2SO4-Ätzen) vorgeschädigten Zustand.<br />
Die grundlegenden Untersuchungen wurden an einem grünen konventionellen Zwei-<br />
schichtemail durchgeführt. Die Versuchsparameter, die zur Korrosion führen, wurden<br />
anschließend auf ein blaues Einschichtemail und ein grünes, konventionelles Zwei-<br />
schichtemail, das zusätzlich noch mit einem chemisch resistenten Transparentemail<br />
überzogen ist, übertragen.<br />
Die Emailplatten wurden mittels Glanzmessungen, Lichtmikroskopie, Reflexionsspek-<br />
troskopie und Gravimetrie vor und nach <strong>der</strong> Bewitterung charakterisiert. An den<br />
Auslauglösungen erfolgte eine pH-Wert Messung sowie eine qualitative und quantitative<br />
Analyse <strong>der</strong> ausgelaugten Emailkomponenten unter Anwendung <strong>der</strong> Ionenchromatographie.<br />
Das Einschichtemail weist nur eine relativ hohe Beständigkeit gegenüber H2S-haltigen<br />
Korrosionsmedien aus, zeigt aber eine geringe Beständigkeit nach einer chemischen<br />
Vorschädigung durch Schwefelsäure. Das Zweischichtemail zeigt – auch bei chemischer<br />
Vorschädigung – eine hohe Resistenz gegenüber allen untersuchten Korrosionsmedien, wenn<br />
keine Emaillierfehler (offene Poren, oberflächennahe Blasen), mechanische Schädigungen<br />
(Schlag- und zu hohe Spannungsbeanspruchung) o<strong>der</strong> stahlbedingte Fehler (Fischschuppen)<br />
vorliegen. Das Dreischichtemail erweist sich als das korrosionsbeständigste Email und zeigt<br />
bei den durchgeführten Bewitterungen die höchste Stabilität.<br />
Eine Emaillierung <strong>der</strong> Behälter mit fehlerfreien Dreischichtemails ist die sicherste Methode,<br />
um Korrosionsschäden durch gas- und dampfförmige Medien zu vermeiden. Weiterhin muß<br />
zwecks Ausschluß von mechanischen Schädem bei Zusammenbau <strong>der</strong> Behälter eine<br />
fehlerfreie und sachgerechte Montage gewährleistet sein.
A. Goß<br />
– 32 –<br />
Rasterkraftmikroskopische Untersuchungen von silicatischen Glas-oberflächen an Luft<br />
und in Flüssigkeiten<br />
Dissertation; Referenten: Frischat/Rädlein (Universität Bayreuth)<br />
In dieser Arbeit wurden chemische Verän<strong>der</strong>ungen auf frischen silicatischen<br />
Glasbruchflächen durch Reaktionen mit den Bestandteilen <strong>der</strong> Luft (Wasserdampf und<br />
gasförmige Bestandteile) und mit Flüssigkeiten mit dem Rasterkraftmikroskop (AFM) im<br />
Kontaktmodus direkt abgebildet.<br />
Als Probenmaterial dienten selbst erschmolzene und kommerzielle Gläser. Um die<br />
Vergleichbarkeit <strong>der</strong> Oberflächentopographien zu gewährleisten, erfolgten die Unter-<br />
suchungen ausschließlich im Bruchspiegel, <strong>der</strong> glattesten Zone einer Bruchfläche.<br />
Unmittelbar nach dem Bruch zeigten alle Gläser ein charakteristisches Hügelmuster mit<br />
runden o<strong>der</strong> etwas langgestreckten Hügeln ohne scharfe Abgrenzungen, <strong>der</strong>en typische<br />
Durchmesser bei mehreren 10 nm und <strong>der</strong>en Höhen unter 1 nm liegen. Die rms-Rauhigkeit<br />
liegt ebenfalls etwas unter 1 nm. Mit zunehmen<strong>der</strong> Probenalterung wurden jedoch infolge <strong>der</strong><br />
Reaktionen mit dem umgebenden Medium deutliche Unterschiede auf den Oberflächen<br />
sichtbar, die die chemische Beständigkeit des jeweiligen Probenmaterials wi<strong>der</strong>spiegeln.<br />
Auf korrosionsanfälligen Kali-Kalk-Silicatglasbruchflächen konnte an Luft in situ die<br />
Entwicklung verschiedener Reaktionsprodukte beobachtet werden. Bereits nach wenigen<br />
Minuten wurde ein leichte Vergrößerung des Hügelmusters sichtbar, die auf die selektive<br />
Auslaugung von Kalium-Ionen sowie die Anreicherung von OH- bzw. H 2 O in <strong>der</strong> Oberfläche<br />
zurückgeführt wird. Die durch dieses Aufquellen <strong>der</strong> Oberfläche entstandene<br />
Reaktionsschicht wird als Gelschicht bezeichnet. Einige Stunden später zeigt die Oberfläche<br />
eine zunehmende Glättung, und es bildeten sich zusätzlich an einigen Stellen kleine Tropfen<br />
(∅ ca. 250 nm, Höhe 10 bis 20 nm), <strong>der</strong>en Entstehung mit partiellen Kaliumanreicherungen<br />
begründet wird. Mit zunehmen<strong>der</strong> Reaktionsdauer werden diese Tropfen immer größer, weil<br />
zum einen mehrere kleine Tropfen zu einem großen zusammenwachsen und zum an<strong>der</strong>en<br />
weiteres Wasser in die Tropfen, die vermutlich mit hygroskopischem KOH angereichert sind,<br />
eingebaut wird. Da <strong>der</strong> Benetzungswinkel zwischen den Tropfen und <strong>der</strong> Gelschicht mit ca. 3º<br />
nur sehr gering ist, ist davon auszugehen, daß sich die Chemie von Schicht und Tropfen nur<br />
wenig unterscheidet. Außerdem konnte durch längeres „Hämmern“ mit <strong>der</strong> AFM-Spitze auf<br />
einem Tropfen dessen reversible Verformbarkeit nachgewiesen werden. Die Tropfen sind<br />
demnach nicht so flüssig wie Wasser, aber weicher als das Glas => Geltropfen.
– 33 –<br />
Mehrere Tage später zeigten sich in einigen Geltropfen sogar scharfkantige<br />
Reaktionsprodukte, die als Kristallite gedeutet werden und auf die Reaktion mit SO 2 und<br />
CO 2 aus <strong>der</strong> Luft zu KCO 3 und K 2 SO 4 zurückgeführt werden.<br />
Bei Untersuchungen von Kali-Kalk-Silicatglas in Wasser wurde ebenfalls die schnelle<br />
Entwicklung einer Gelschicht beobachtet, die sich kaum von <strong>der</strong> an Luft entwickelten Schicht<br />
unterscheidet. Geltropfen- und Kristallitbildung fanden dagegen nicht statt. Die ausgelaugten<br />
Kalium-Ionen werden durch das überschüssige Wasser von <strong>der</strong> Oberfläche weggespült und<br />
stehen somit nicht mehr <strong>für</strong> weitere Reaktionen zur Verfügung. Die Oberflächentopographie<br />
einer mehrere Tage in Wasser gelagerten Bruchfläche konnte deshalb auch nicht von einer<br />
nur wenige Minuten alten Bruchfläche unterschieden werden. Dies bedeutet jedoch nicht, daß<br />
auch in einigen nm Tiefe keine Verän<strong>der</strong>ungen stattfanden. SNMS-Tiefenprofile einer<br />
frischen und einer sieben Tage in 20 ºC kaltem Wasser gelagerten Bruchfläche wiesen die<br />
Verarmung an Kalium- und Calcium-Ionen bis in eine Tiefe von 10 bzw. 40 nm nach.<br />
Von entscheiden<strong>der</strong> Bedeutung war bei diesen Untersuchungen, ob die AFM-Spitze kurz<br />
(Minuten) o<strong>der</strong> lang (Stunden) auf einem Probenort gescannt hat. Durch eine lange Scandauer<br />
erfuhr die Oberfläche an dieser Stelle eine deutliche Glättung. Das ursprüngliche<br />
Hügelmuster, welches in <strong>der</strong> näheren Umgebung dieses Probenortes weiterhin zu erkennen<br />
war, war gänzlich verschwunden, da durch die AFM-Spitze Teile <strong>der</strong> Gelschicht vom<br />
Untergrund gelöst und „Täler“ des Hügelmusters zugeschoben wurden.<br />
Bei Beobachtungen auf chemisch wesentlich beständigeren Gläsern, wie Kalk-Natron-<br />
Alumo-Silicatglas und Kieselglas, zeigte sich, daß die Oberfläche sowohl an Luft als auch in<br />
Wasser nach mehreren Tagen noch keine Reaktionsschicht aufweist. Der Vergleich zwischen<br />
Untersuchungen an Luft und in Wasser verdeutlicht deshalb auch den Einfluß <strong>der</strong><br />
Kapillarkräfte zwischen AFM-Spitze und Probe. Sie können an Luft nicht vermieden werden,<br />
überlagern die Nahfeldwechselwirkungskräfte (vor allem Coulomb- und Van-<strong>der</strong>-Waals-<br />
Kräfte) und sind demzufolge ein wesentlicher Grund da<strong>für</strong>, daß an Luft keine atomare<br />
Auflösung auf Glas erzielt werden kann.<br />
Um die Kapillarkräfte zu vermeiden, wird die AFM-Spitze vollständig in Flüssigkeit<br />
eingetaucht. Auch die Van-<strong>der</strong>-Waals-Kräfte sind in Flüssigkeiten schwächer. Da<strong>für</strong> tritt<br />
jedoch die pH-Wert abhängige langreichweitige elektrostatische Doppelschichtabstoßung auf.<br />
Da die Oberflächentopographie bei den Untersuchungen in Wasser aber dennoch ein etwas<br />
kleineres Hügelmuster zeigt als an Luft, ist davon auszugehen, daß <strong>der</strong> Einfluß <strong>der</strong><br />
elektrostatischen Doppelschichtabstoßung weniger bedeutsam ist als <strong>der</strong> <strong>der</strong> Kapillarkräfte.<br />
Um eine systematische Abhängigkeit zwischen Glaszusammensetzung und Hügelmuster-
– 34 –<br />
dimension festzustellen, wurden Kalk-Natron-Alumo-Silicatgläser mit variierendem<br />
Al 3+ /Na + -Verhältnis erschmolzen, d. h. mit unterschiedlicher Anzahl an Trennstellen-<br />
sauerstoffen. Die Topographien zeigten leichte Unterschiede und die Tendenz, daß mit<br />
zunehmen<strong>der</strong> Anzahl an Trennstellen das typische Hügelmuster größer wurde.<br />
4.5 Sonstiges<br />
Fellowship <strong>für</strong> Professor Frischat verliehen<br />
Die Society of Glass Technology, England, hatte Prof. Dr. Günter H. Frischat, <strong>Institut</strong> <strong>für</strong><br />
<strong>Nichtmetallische</strong> <strong>Werkstoffe</strong>, Technische Universität <strong>Clausthal</strong>, bereits im vorigen Jahr zum<br />
Fellow gewählt. Das Überreichen <strong>der</strong> Ernennungsurkunde fand vor kurzem im Rahmen des<br />
19. Internationalen Glaskongresses statt, <strong>der</strong> von <strong>der</strong> Society of Glass Technology in<br />
Edinburgh, Schottland, veranstaltet wurde. An diesem internationalen Kongress nahmen über<br />
800 Glaswissenschaftler und -techniker teil und bildeten einen würdigen Rahmen <strong>für</strong> die<br />
Zeremonie. Prof. Frischat erhielt während einer Feier die Urkunde vom Präsidenten <strong>der</strong><br />
Society of Glass Technology Mr. John Hen<strong>der</strong>son überreicht.<br />
Der Präsident <strong>der</strong> Society of Glass Technology, John Hen<strong>der</strong>son (r.)<br />
bei <strong>der</strong> Übergabe <strong>der</strong> Ernennungsurkunde an Prof. Frischat.<br />
Aus: Goslarsche Zeitung vom 8. August 2001
Messeteilnahme<br />
– 35 –<br />
Teilnahme vom 23. bis 28. Oktober 2000 an <strong>der</strong> GLASSTEC, Düsseldorf, im Rahmen des<br />
DGG-Gemeinschaftsstandes mit diversen Postern, u. a.<br />
• Glasforschung an <strong>der</strong> <strong>TU</strong> <strong>Clausthal</strong>,<br />
• Zinn im Floatglas,<br />
• Antireflexionsschichten,<br />
• Direkte Abbildung <strong>der</strong> Struktur von Kieselglasbruchflächen.<br />
Das Fernsehen berichtete<br />
Die wissenschaftliche Mit-arbeiterin<br />
Dipl.-Ing. Kirsten Wilm informierte<br />
Messebesucher über aktuelle<br />
Projekte wie Antireflexionsschichten,Strukturuntersuchungen<br />
mit hochauflösen<strong>der</strong><br />
Atomkraftmikroskopie o<strong>der</strong><br />
zum Problem Zinn in Floatglas.<br />
Außerdem verteilte sie<br />
Studieninformationen.<br />
Am 17./18. Februar 2001 veranstaltete <strong>der</strong> Fachbereich Physik, Metallurgie und<br />
Werkstoffwissenschaften ein Wochenendseminar <strong>für</strong> Schüler zum Thema „Physikalische<br />
Technologien: Grundlage mo<strong>der</strong>ner Werkstoffwissenschaften“. Der Norddeutsche Rundfunk<br />
nahm dies zum Anlaß einer ausführlichen Fernsehsendung am 22. Februar 2001, in <strong>der</strong> er die<br />
Schüler bei Experimenten in <strong>der</strong> Professur <strong>für</strong> Glas mit <strong>der</strong> TV-Kamera beobachtete.<br />
Kameramann Kersten<br />
Hüttner (l.) berät sich mit<br />
<strong>der</strong> NDR-Redakteurin<br />
Antje Wöhnke und Dr.-<br />
Ing. Roland Heidrich<br />
über die nächste Dreheinstellung.<br />
Foto: Goß
75. Glastechnischen Tagung<br />
– 36 –<br />
Aus Anlaß <strong>der</strong> 75. Glastechnischen Tagung, die vom 21. bis 23. Mai 2001 in Wernigerode<br />
stattfand, wurde von ca. 50 Tagungsteilnehmern ein Besuch im <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Nichtmetallische</strong><br />
<strong>Werkstoffe</strong> durchgeführt. Neben einer Vorstellung des <strong>Institut</strong>es und insbeson<strong>der</strong>e <strong>der</strong><br />
Glasarbeiten wurden folgende Stationen besichtigt:<br />
• Sol-Gel-Labor (Beschichtungen),<br />
• SNMS-Labor (Nanoanalytik),<br />
• AFM-Labor (Topographische Nanoanalytik),<br />
• Lasersintern von Keramiken (Professur <strong>für</strong> Ingenieurkeramik).<br />
Eine Exkursion zu<br />
Frau Dr. Helsch erläutert den Besuchern die Tauchbeschichtungsanlage.<br />
Um die Erkenntnisse <strong>der</strong> Vorlesung „Technologie des Glases I“ zu vertiefen, bot Herr<br />
Professor Frischat den Studierenden eine Exkursion an. Neben den Hörerinnen und Hörern<br />
<strong>der</strong> Vorlesung waren auch wissenschaftliche Mitarbeiter/innen an einer Besichtigung <strong>der</strong><br />
Glashütte interessiert, so daß am 10. Juli 2001 um 8 Uhr c.t. eine 15köpfige Gruppe per Bus<br />
vom Parkplatz <strong>der</strong> Alten Mensa startete.<br />
Bei bestem Wetter und ohne Verkehrsstau erreichten wir unser Ziel: Die Glashütte<br />
„Nienburger Glas“. Nach dem freundlichen Empfang durch den technischen Direktor Herrn<br />
Professor Barklage-Hilgefort (bekannt aus „Technologie des Glases II“) erhielt je<strong>der</strong> von uns<br />
als Begrüßungspräsent eine schwarze Baseballmütze mit dem Nienburger (siehe<br />
Gruppenphoto). Im Konferenzraum des Werkes gab uns Herr Professor Barklage-Hilgefort<br />
mit einem Vortrag Einblicke in die Firmengeschichte und das Leistungsangebot <strong>der</strong><br />
Nienburger Glashütte.<br />
Die Geschichte
– 37 –<br />
1891 Gründung <strong>der</strong> Wilhelmshütte <strong>für</strong> Grünglas.<br />
1910 Brauerei Beck & Co. wird Kommanditist. (Heute ist Nienburger Glas 100%ige<br />
Tochter <strong>der</strong> Brauerei Beck & Co.)<br />
1984 Kauf des Glaswerkes Wahlstedt führt zur Jahreskapazität von 1 Milliarde<br />
Hohlglasverpackungen.<br />
1989 Übernahme des Glaswerkes Schleiden/Eifel mit einer Tageskapazität von etwa<br />
400 000 Getränkeflaschen.<br />
1991 Stralauer Glashütte GmbH wird 100%ige Tochter.<br />
1995 Inbetriebnahme des neuen Werkes Neuenhagen bei Berlin.<br />
Die Werke<br />
Die vier logistisch optimal angebundenen Produktionsstandorte Nienburg (Nie<strong>der</strong>sachsen),<br />
Neuenhagen (Berlin), Wahlstedt (Schleswig-Holstein) und Schleiden (Eifel) sichern eine<br />
ständige Versorgungsgarantie sowie Kundennähe.<br />
Nienburger Glas ist seit 1996 zertifiziert nach DIN EN ISO 9001 und praktiziert ein HACCP 1 -<br />
System nach den Grundsätzen <strong>der</strong> Hygieneverordnung. Derzeit wird ein Umweltmanagement-<br />
System nach <strong>der</strong> weltweit gültigen DIN EN ISO 14001 eingeführt. Ziel ist es, die<br />
Zertifizierung <strong>für</strong> alle 4 Werke Mitte 2002 abgeschlossen zu haben. Qualitäts- und<br />
Umweltmanagement werden dann verbunden zu einem Integrierten Managementsystem<br />
(IMS).<br />
Das Werk ist seit über 25 Jahren Vorreiter des Recycling-Gedankens mit einem<br />
Scherbeneinsatz von heute bis zu 85%. Innovationen, die aus Nienburg stammen, sind z.B.<br />
die Rohstoffvorwärmung sowie energie- und schadstoffreduzierende Schmelztechniken.<br />
Damit versucht Nienburger Glas, die Belastung <strong>der</strong> Umwelt durch die Produktion so gering<br />
wie möglich zu halten und mit natürlichen Ressourcen sparsam umzugehen. Die Philosophie<br />
von Nienburger Glas: Den Schutz <strong>der</strong> Umwelt neben den wirtschaftlichen Zielen gleichrangig<br />
zu behandeln.<br />
Das Produktspektrum<br />
Nienburger Glas produziert ein breites Sortiment an Flaschen und Gläsern <strong>für</strong> die Getränke-,<br />
Nahrungs- und Genußmittelindustrie:<br />
• Weithalsgläser von 125 – 2 650 ml,<br />
• Flaschen von 200 – 1 500 ml,<br />
• Farben: Grün, Weiß, Braun und zahlreiche Son<strong>der</strong>farben,<br />
• Breites Gewichtsspektrum mit gezielt leichtgewichtiger Produktion.<br />
Neben den Standardglasverpackungen in marktkonformen Farben, Formen und Größen<br />
produziert Nienburger Glas nach individuellen Wünschen Kleinserien und<br />
Spezialanfertigungen in Son<strong>der</strong>farben und Son<strong>der</strong>formen.<br />
Fazit: Nienburger Glas konzentriert sich auf das Kerngeschäft: die Glasfertigung nach dem<br />
neuesten Stand <strong>der</strong> Technologie.<br />
1 Hazard = Gefährdung, Gefahr <strong>für</strong> die Gesundheit; Analysis = Analyse, Untersuchung <strong>der</strong> Gefährdung;<br />
Critical = kritisch, entscheidend <strong>für</strong> die Beherrschung; Control = Lenkung, Überwachung <strong>der</strong> Bedingungen;<br />
Point = Punktstelle im Verfahrensablauf.
Die Besichtigung<br />
– 38 –<br />
Nach dieser einstündigen, sehr interessanten Einführung gingen wir zum eigentlichen Teil<br />
unseres Besuches über. Zur Besichtigung des Werkes wurde unsere Schar in zwei<br />
Besuchergruppen aufgeteilt. Mit Herrn Dipl.-Ing. Schaefer, Leiter <strong>der</strong> Abteilung Umwelt und<br />
Sicherheit, stand neben Herrn Professor Barklage-Hilgefort ein zweiter kompetenter<br />
Fachmann zur Verfügung.<br />
Ausgangspunkte waren die Halden des Recyclingglases und das Gemengehaus. Die<br />
eingesetzten Rohstoffe und das Recyclingglas (heute <strong>der</strong> Hauptrohstoff) werden nach<br />
spezifizierten Vorgaben angeliefert und bei Wareneingang in Stichproben überprüft. Die<br />
Zusammensetzung <strong>der</strong> Rohstoffe mit dem Recyclingglas (das Gemenge) ist in Rezepturen<br />
festgelegt.<br />
Die Mischung und Zuführung des Gemenges in die Schmelzwanne sowie <strong>der</strong> gesamte<br />
Schmelzprozeß erfolgt prozeßgesteuert und wird zentral überwacht. Die Schmelze läuft<br />
geläutert und homogenisiert über die Speiserinnen (Fee<strong>der</strong>) zu den Produktionsmaschinen.<br />
Dabei wird die Temperatur durch Regelung auf den Produktionsprozeß abgestimmt.<br />
In <strong>der</strong> Produktionsmaschine erfolgt die Formung des Postens (Schmelztropfens) zum fertigen<br />
Behälter. Nach <strong>der</strong> Formgebung werden die Behälter zur Verbesserung <strong>der</strong> Qualität vergütet,<br />
gekühlt, in Packanlagen palettiert und versandfertig eingeschweißt.<br />
Während <strong>der</strong> Arbeitsgänge werden die Prozeßdaten kontinuierlich erfaßt und abgespeichert,<br />
um Ursachen <strong>für</strong> Störungen je<strong>der</strong>zeit zu erkennen und gegebenenfalls entsprechenden<br />
Maßnahmen ergreifen zu können. An den Artikeln erfolgt eine 100%-Inspektion durch<br />
Prüfmaschinen sowie durch zusätzliche Stichproben und Labormessungen. Alle Prüfdaten<br />
werden in das von Nienburger Glas entwickelte System AFIS (Artikel-Fehler-Informations-<br />
System) eingegeben und ausgewertet. Somit erfolgt eine Qualitätslenkung <strong>der</strong> Glasbehälter<br />
durch geregelte Kommunikation zwischen <strong>der</strong> Produktion und <strong>der</strong> Prüfung.<br />
Beim abschließenden schmackhaften Mittagessen gab uns Herr Professor Barklage-Hilgefort<br />
die Möglichkeit, offen gebliebene Fragen zu klären. So wurden sämtliche Unklarheiten<br />
geduldig und ausführlich beantwortet. Jetzt wissen wir auch, welche Bedeutung <strong>der</strong><br />
Buchstabe W in <strong>der</strong> nikolaushausartigen Hüttenmarke hat (siehe 1891 unter „Die<br />
Geschichte“). Gestärkt traten wir unsere Rückreise nach <strong>Clausthal</strong> an, welches wir um 16:30<br />
Uhr erreichten.
– 39 –<br />
Gruppenphoto mit dem Exkursionsleiter Herrn Professor Frischat (r.) und dem<br />
technischen Direktor Herrn Professor Barklage-Hilgefort (2. v. r.).<br />
Rückblickend bedanken wir uns ganz herzlich <strong>für</strong> die lehrreiche und ausführliche<br />
Besichtigung <strong>der</strong> Nienburger Glashütte und vor allem bei unseren Betreuern Herrn Prof.<br />
Barklage-Hilgefort und Herrn Dipl.-Ing. Schaefer mit einem freundlichen <strong>Clausthal</strong>er „Glück<br />
auf!“. (Bericht: Roland Heidrich)<br />
Gäste<br />
Herr Myroslaw Zapukhlyak, Precarysathian University Ivano-Frankivsk, Ukraine, IEASTE-<br />
Student vom 1.11.2000 – 31.12.2000.<br />
Herr Dipl.-Ing. Sergei Proskourine, Akademie <strong>für</strong> Baustoffe Belgorod, Rußland, DAAD-<br />
Stipendiat ab 1.10.2000.<br />
Frau Dipl.-Ing. Gabriela Kejmarova, <strong>Institut</strong>e of Chemnical Technology, Department of Glass<br />
and Ceramics, Prag, Tschechien, vom 1. April bis 31. September 2001, im Rahmen eines<br />
ERASMUS-Stipendiums.<br />
Personelle Verän<strong>der</strong>ungen<br />
Neue Mitarbeiter: Dipl.-Ing. Milada Zimova<br />
Dr. rer. nat. Birgit Jendrzok<br />
Dipl.-Ing. Marta Kryzak<br />
Dipl.-Chem. Lars Hoyer<br />
Dipl.-Ing. Lothar Wondraczek<br />
Ausgeschiedene Mitarbeiter: Dr.-Ing. Doris Moseler<br />
Dr. rer. nat. Birgit Jendrzok<br />
Dr.-Ing. Bettina Radomski<br />
Dr.-Ing. Annette Goß
– 40 –<br />
5 Mitteilungen <strong>der</strong> Professur <strong>für</strong> Bindemittel und Baustoffe<br />
5.1 Forschungstätigkeit<br />
Die Arbeitsgruppe Bindemittel und Baustoffe hatte ihren<br />
Arbeitsschwerpunkt im Jahr 00/01 im Aufbau von Großgeräten. Es<br />
handelt sich um eine ESCA (Elektronenspektro m e t rie zur Chemische n<br />
Analyse) und ein Massens pektrometer mit Knudsenzelle (KEMS). Diese<br />
Großgeräte werden vor allen Dingen da<strong>für</strong> eingesetzt, Nebenbestandteile<br />
und Nebenreaktione n bei Bindemittelherstellproz es sen aufzuklären.<br />
Aktuelle Beispiele sind das Verhalten des Magnesiums im REA- Gips und<br />
daraus hergestellten Gipsprodukte n o<strong>der</strong> die Verdampfu ngs - und<br />
Kondensations k r eisläufe von Alkali- Salzen in Zementdre hofena nlagen.<br />
Weitere Forschungsar beiten sind unten wie<strong>der</strong>gegebe n, soweit in ihrem<br />
Rahmen Studien - , Diplom - und Doktorarbeiten abgeschloss en wurden.<br />
Wichtige laufende Forschungsthe m e n sind darüber hinaus:<br />
• Auswirku nge n des Sekundärstoffeinsatze s in Zement - u.<br />
Kalkbren nanlage n,<br />
• Entwicklung eines Testbrennve rfahre n s <strong>für</strong> die Einstellung <strong>der</strong><br />
Branntkalkreaktivität,<br />
• Verbesseru ng <strong>der</strong> Eigenschaften von Magnesitbin<strong>der</strong> n,<br />
• Weiterent wicklung zerstör u ngsfreier Prüfverfahre n <strong>für</strong> die<br />
Mörtelfestigkeit,<br />
• Entwicklung eines künstlichen Zuschlages zum Test <strong>der</strong> Alkali-<br />
Kieselsäure - Reaktion,<br />
• Untersuc hungen zur Textur, Festigkeit und Wasserbeständigkeit von<br />
historische n Gipsmörteln,<br />
• Konfektionierung von Abfallgipsen <strong>für</strong> die Zement m a hlung,<br />
zerstörungsf reie Porosimetrie und Microstru ktura n alyse<br />
• Untersuc hungen zum Treibpote ntial von CMC- Kleistern
– 41 –<br />
Zur Finanzieru ng <strong>der</strong> Arbeiten wurden Mittel <strong>der</strong> DFG und <strong>der</strong><br />
Bindemittel - Industriever bände eingeworbe n. Ferner wurden in<br />
erhebliche m Umfang bilaterale Industrie - Forschungs projekte<br />
durchgeführt.
5.2 Vorträge<br />
– 42 –<br />
Prof. Dr. A. Wolter<br />
Hydraulisch gebundene <strong>Werkstoffe</strong> von den Römern bis zum<br />
selbstverdichtenden Beton<br />
Feierliche Immatrikulation in <strong>Clausthal</strong> WS 2000 / 2 0 0 1, 27. Oktober 2000<br />
Prof. Dr. A. Wolter<br />
Einsatz von Abfallstoffen in <strong>der</strong> Steine- Erden- Industrie<br />
FOGI Seminar, 24.11.2000<br />
Prof. Dr. A. Wolter<br />
Technische Voraussetzungen <strong>für</strong> den Sekundärstoffeinsatz in <strong>der</strong><br />
Zementindustrie<br />
2. Readymix Umweltforu m, Rü<strong>der</strong>sdorf, 12.06.2001<br />
Prof. Dr. A. Wolter<br />
Minor constituent recirculation in kiln systems<br />
European Cement Conference 2001, Dresden, 10- 13 September 2001<br />
U. Ahlers<br />
Korrosion von Baustoffen<br />
Vortrag an <strong>der</strong> FH Oldenburg, 20.04.2001<br />
U. Ahlers<br />
Massige Betonbauteile in chemisch aggressiver Umgebung u.<br />
Carbonatisierung von Beton<br />
Vortrag an <strong>der</strong> FH Lippe, 23.05.2001<br />
5.3 Veröffentlichungen<br />
• Prof. Dr. A. Wolter<br />
Aus Schlacke wird Beton<br />
Praxis <strong>der</strong> Naturwissensc haften, Heft 4/50 2001, Seite 32- 35<br />
• Prof. Dr. I. Odler et al.<br />
J. Skalny; I. Odler and F. Young<br />
Discussion of the paper "Sulfate attack or is it" by W.G. Hyme and B.<br />
Mather<br />
Cem. Concr. Res. 30, 161- 162 (2000)<br />
I. Odler<br />
Special Inorganic Cements,<br />
published by E&FN SPON London and New York (2000)<br />
I. Odler<br />
Discussion of the paper "A model for the microstructure of calcium silicate<br />
hydrate in cement pastes" By H.M. Jennings<br />
Cem. Concr. Res. 30, 1337- 1338 (2000)<br />
I. Odler
– 43 –<br />
Book review: Jaques Marchand and Jan P. Skalny (eds.): Sulfate Attack<br />
Mechanism<br />
published by the American Ceramic Society, Westerville OH,<br />
Cem. Concr. Res. 30, 1343 (2000)<br />
K.- C. Werner, Y. Chen and I. Odler:<br />
Investigations on stress corrosion in hardened cement pastes<br />
Cem. Concr. Res. 30, 1443- 1451 (2000)<br />
P. Vanis and I. Odler:<br />
Properties of cement compacts produced by isostatic compaction<br />
Adv. Cem. Res. 13, 17- 19 (2000)<br />
H. Vaupel and I. Odler:<br />
Discussion of the paper "Microstructural investigations on aerated<br />
concrete" by B. N. Naryanan and K. Ramamurthy<br />
Cem. Concr. Res. 31, 153 (2001)<br />
J. Skalny, J. Gebauer and I. Odler (eds.):<br />
Calcium Hydroxide in Concrete<br />
262 p. published by the American Ceramic Society, Westerville OH<br />
(2001)<br />
I. Odler<br />
Free lime content and unsoundness of cement,<br />
in: Skalny et. al. (eds.) Calcium Hydroxide in Concrete, Am. Ceram. Soc.<br />
Westerville OH, pp. 237.244 (2001)<br />
• Prof. Odlers Buch über „Special Inorganic Cements“<br />
Schon im Jahr 2000 erschien im Londoner Verlag E & FN SPON ein<br />
Fachbuch über Zemente und Bin<strong>der</strong>, die nur <strong>für</strong> spezielle Zwecke<br />
gebraucht werden, chemische Beson<strong>der</strong>heiten aufweisen o<strong>der</strong> ganz<br />
neue Entwicklungs ansätze darstellen. Es<br />
behandelt also insbeson <strong>der</strong>e jene Bindemittel,<br />
die in den klassischen Standardwerken immer<br />
zu kurz kommen. Beson<strong>der</strong>s bemer ke n s w e r t<br />
sind die Kapitel über<br />
• Portlandzemente mit besonde re n<br />
Eigenschaften,<br />
• aktivierte Belitzemente,<br />
• alkaliaktivierte Flugaschebin<strong>der</strong>,<br />
• Tonerdez e m e n te,
• schnellerstarrende Zemente,<br />
• Quellzemente,<br />
– 44 –<br />
• Dentalzemente und Tiefbohrze m e n t e,<br />
um nur einige Überschriften zu nennen. Außer, daß Prof. Odler einige<br />
Kapitel selbst verfaßt hat, ist er Herausgeber und zugleich treibende<br />
Kraft beim Zustandko m m e n dieses Buches. In bester US-<br />
Amerikanischer - Tradition ist es ihm damit gelungen, seine lange und<br />
breit angelegte Erfahrung auf dem Gebiet <strong>der</strong> Zementchemie, speziell<br />
auch <strong>der</strong> Son<strong>der</strong>ze m e n te <strong>für</strong> die Fachwelt verfügbar zu machen.<br />
Dieses Verdienst muß um so höher bewertet werden, als Prof. Odler in<br />
den vergange ne n Jahren zeitweise gesund heitlich sehr zu kämpfen<br />
hatte.<br />
IVAN ODLER: „Special Inorganic Cements“<br />
Prof. Wolter<br />
5.4 Studien- , Diplom- und Doktorarbeiten<br />
Ulrike Wolf<br />
Mo<strong>der</strong>n Concrete Technology 8,<br />
E & FN SPOHN London und New York 2000,<br />
ISBN 0- 419- 22790 - 3, Preis ca. DM 200,- -<br />
Umstellung und Wie<strong>der</strong>inbetriebnahme einer Mehrkammermischanlage<br />
Studienarbeit, Betreuer: Prof. Wolter, Dr. R. Mathai<br />
Diese Arbeit beschreibt die Steuerungsu m s tellung und einige<br />
Umbaumaß n a h m e n in dem Mehrka m m e r mi sc hsilo <strong>der</strong> Firma Walhalla<br />
Kalk GmbH & Co. KG in Regensburg im Zuge <strong>der</strong> Zusam m e nlegung <strong>der</strong><br />
Werke Funk und Büechl. Teil <strong>der</strong> Gesamtumstellung ist auch die Än<strong>der</strong>ung<br />
<strong>der</strong> Versandab wicklung, die örtlich verlegt wurde, um sie zentral an einer<br />
Stelle zu haben. Die Abwicklung des Produkt versandes wurde zusätzlich<br />
von Barcodes auf ein mo<strong>der</strong>nes Identkarten - System umgestellt.
– 45 –<br />
Es wird die Situation <strong>der</strong> Anlage vor <strong>der</strong> Umstellung beschriebe n, indem<br />
die Abläufe dargestellt und auf die Probleme hingewiesen wird. Es folgt<br />
die Beschreibung <strong>der</strong> erwünsc hten Situation nach <strong>der</strong> Umstellung auf eine<br />
neue Steuerungssoft ware. Es wurden folgende Vorteile erwartet:<br />
• Beseitigung von bisher auftreten den Problemen durch<br />
Umbaumaß n a h m e n<br />
• Zentralisierung <strong>der</strong> Auftragsabwicklung <strong>für</strong> beide Werke<br />
• Möglichkeit zur Optimierung <strong>der</strong> Mischerleistung<br />
• Zentralisierung <strong>der</strong> Steuer - und Bedieneinheiten <strong>für</strong> beide<br />
Mischanlagen und <strong>der</strong> Öfen vom Werkteil Funk<br />
• Arbeiten mit einer neuen erweiterungsfähigen Software<br />
Im Zuge <strong>der</strong> Vorbereitunge n wurde eine Mischgütebes tim m u n g<br />
vorgeno m m e n, um die benötigten Mischzeiten und Mischerdre hzahle n<br />
einschätze n und neu überdenken zu können. Anschließend wird die<br />
Organisation und Bearbeitung <strong>der</strong> Mischrezepte in <strong>der</strong> neuen<br />
Steuerungssoft ware, dem Chargenführu ngssyste m von Heidelberger<br />
Zement, dargelegt. Es folgt die Beschreibung <strong>der</strong> Inbetriebna h m e und <strong>der</strong><br />
Situation nach <strong>der</strong> Umstellung mit den Ergebnisse n.<br />
Grundlegend kann man sagen, daß das Projekt erfolgreich verlaufen ist.<br />
Des Weiteren werden einige Vorschläge <strong>für</strong> Umbauma ß n a h m e n, die eine<br />
Verbesseru ng <strong>der</strong> Arbeit mit dem Mehrka m m e r m ischsilo bedeuten<br />
könnte n, diskutiert. Dazu gehören beispielsweise die Anschaffung<br />
größerer Waagen, die Än<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Silobelegung o<strong>der</strong> <strong>der</strong> Umbau <strong>der</strong><br />
Silozellen zu "Restentleersilos".<br />
Christoph Baum<br />
Visualisierung des Hydratationsmechanismus von Branntkalken<br />
Diplomarbeit, Betreuer: Prof. Wolter, U. Ahlers<br />
Drei unterschiedlich gebrannte Kalke (ein Weichbrand, ein Mittelbrand<br />
und ein Hartbrand) waren jeweils in die Fraktione n < 1 mm, 1- 5 mm und<br />
5- 10 mm aufzuteilen, um sie dann bezüglich ihrer physikalische n und<br />
chemischen Eigenschaften charakterisieren zu können. Ziel <strong>der</strong> Arbeit war
– 46 –<br />
die bildliche Darstellung des Hydratations m e c hanis m u s (Beginn und<br />
Fortschritt) von Branntkalke n. Dazu wurden die Kalke in flüssiger und<br />
über die Dampfphase gelöscht. Die Löschreaktion sollte entwe<strong>der</strong><br />
abgestoppt o<strong>der</strong> durch geeignete Zusätze zum Löschwasser soweit<br />
verlangsamt werde n, daß es zu einer Teilhydratation <strong>der</strong> Proben kommt.<br />
Die Gefügeverän <strong>der</strong>ungen bei <strong>der</strong> Reaktion von CaO zu Ca(OH) 2 standen<br />
dabei im Mittelpunkt des Interesses, insbeson<strong>der</strong>e <strong>für</strong> den Vergleich <strong>der</strong><br />
Kalke untereinan<strong>der</strong>.<br />
Der Trockenlösch p r ozess wird in <strong>der</strong> Literatur durch konkur riere n d e<br />
Reaktionen sowohl in <strong>der</strong> flüssigen als auch in <strong>der</strong> Dampfphas e<br />
beschriebe n. Dabei soll sich <strong>der</strong> Mechanism us mit zuneh m e n d e m<br />
Brenngra d in Richtung Lösungskristallisation verschiebe n. Bei extreme n<br />
Weichbränden kom mt die Vergrießung über die Dampfphase hinzu.<br />
Unter den gewählten Bedingungen in dieser Arbeit konnte beobachtet<br />
werden, daß die Reaktion von Branntkalk zu Calciumhydroxid primär,<br />
sowohl beim Weichbrand als auch beim Hartbran d, über die Oberfläche<br />
abläuft. Die Vergröber ung des Hydrates mit zuneh m e n d e m Brenngrad des<br />
Branntkalkes resultiert direkt aus <strong>der</strong> Primärkristallitgröße des<br />
Branntkalkes, welche den Brenngrad definiert. Die Lösungskristallisation,<br />
wie sie von<br />
K. Schweden als Primärrea ktion in <strong>der</strong> flüssigen Phase beschriebe n wird,<br />
war unter o.g. Laborbedingungen nur von untergeord n e ter Bedeutung,<br />
wenn jedoch beobachtet, war sie immer mit <strong>der</strong> Bildung ausgeprägter<br />
Calciumhydroxidkristalle verbunden. Es ist jedoch nicht eindeutig zu<br />
klären, ob diese Kristalle durch heterogene Keimbildung an <strong>der</strong><br />
Oberfläche entstanden o<strong>der</strong> durch das Eindampfen <strong>der</strong> flüssigen Phase<br />
auf die Oberfläche aufgebracht wurde n. Die Löschversuche in einem<br />
Überschu ß an Alkohol führten dazu, daß das Wasser genau wie bei <strong>der</strong><br />
Löschung unter definierter Luftfeuchte direkt an die Branntkalkoberfläche<br />
herangeführt wurde und in allen Fällen eine topoche mische Reaktion an<br />
<strong>der</strong> Oberfläche stattfand. Selbst die Versuche unter dem ESEM zeigten<br />
vergleichbare Ergebnisse, obwohl unter diesen Bedingunge n <strong>der</strong> Kontakt<br />
<strong>der</strong> Branntkalkkörner mit flüssigem Wasser sehr groß war. Es wurde ein<br />
möglicher Reaktionsweg schematisch dargestellt, welcher die Entstehu ng
– 47 –<br />
und das diffusionsgesteuer te Wachstu m einer Gelschicht bis hin zum<br />
Abscheren <strong>der</strong> entstandenen Hydratpartikel vom Branntkalk beschreibt.<br />
Thomas Sievert<br />
Konzeption einer Prüfstandsapparatur zur zerstörungsfreien<br />
Festigkeitsbestimmung<br />
an Mörtelprismen<br />
Diplomarbeit; Betreuer: Prof. Wolter, U. Ahlers<br />
Die Bestimmu ng <strong>der</strong> Druckfestigkeit an Mörtelprismen gemäß DIN EN<br />
196- 1 ist mit einem hohen Aufwand hinsichtlich <strong>der</strong> Herstellung und<br />
Prüfung <strong>der</strong> Prismen verbunden. Diese Arbeit zeigt die Möglichkeit auf,<br />
die Druckfestigkeit an Mörtelpris me n mit Hilfe <strong>der</strong> Ultraschallprüfung<br />
zerstörungsf rei zu ermitteln. Im Rahmen einer Automatisieru ng des<br />
Prüfverfa hre ns ist eine eindeutige Probenkennzeichnung und<br />
Identifikation mit Hilfe von RFID- Systemen o<strong>der</strong> über die Lage <strong>der</strong><br />
Prismen im Wasserbecken sicherzustellen.<br />
Die Ein- und Auslagerung <strong>der</strong> Prüfkörper erfolgt über ein Robotersyste m,<br />
welches auf einer Linearachse die Front <strong>der</strong> Wasserbecken abfahre n kann;<br />
mit Hilfe des Greifarms des Roboters kann die Breite (y- Achse) und Tiefe<br />
(z- Achse) <strong>der</strong> Wasserbecke n erreicht werden. Nach <strong>der</strong> Einlagerung<br />
werden die Koordinaten des Lagerplatzes (x und y) mit <strong>der</strong> Probenu m m e r<br />
zur späteren Identifikation abgespeichert.<br />
Zum Zeitpunkt <strong>der</strong> Auslagerung erhält <strong>der</strong> Roboter über den<br />
Steuerungsrec h ne r einen Befehl und fährt zu den entsprechende n<br />
Koordinaten des zu prüfende n Prismas. Über eine am Arm des Roboters<br />
angebrachte Antenne werden die am Prisma befestigten Datenträger unter<br />
Wasser ausgelesen und eindeutig identifiziert. Die <strong>für</strong> die späteren<br />
Bestimmungen nötige Gewichtsko n s t a n z kann über das Abtropfen des<br />
Wassers o<strong>der</strong> über einen Druckluftsto ß erreicht werden. Nach Erreichen<br />
<strong>der</strong> Gewichts ko nstanz gelangen die Prismen zu den jeweiligen<br />
Messstellen. An den Messplätzen erfolgt die Bestimmu ng von Masse,<br />
Prüfkörperdi m e n sion, und Grundreso na n zfrequenzen. Die Ergebnisse sind<br />
über eine RS 232 Schnittstelle an einen Computer zu senden und <strong>der</strong><br />
jeweiligen Probenum m e r und Prüfzeit zuzuor d ne n. Anhand <strong>der</strong>
– 48 –<br />
Messdaten kann die Festigkeit über die zuvor erstellten Korrelationen in<br />
Abhängigkeit <strong>der</strong> Zementsorte errechnet werden.<br />
Die zuvor erstellten Korrelationen bestehen zwischen dem dynamische n<br />
Elastizitäts m o d ule n, welche aus <strong>der</strong> Resonanzfrequenz, <strong>der</strong> Prüfrohdichte<br />
und den Abmessu ngen berechnet werden, und den zerstörend<br />
bestimmte n Druckfestigkeiten. Durch die erstellten Funktione n erreichen<br />
die Korrelationskoeffizienten zwischen zerstöre nd und zerstöru ngsfrei<br />
ermittelten Druckfestigkeiten durchsch nittlich 99,2 %. Aus den<br />
Druckfestigkeit lassen sich die Biegezugfestigkeiten abschätze n.<br />
Aufgrund des zerstöru ngsf r eien Prüfverfahrens kann die Anzahl <strong>der</strong><br />
Prüfkörper über den Gesamtzeitrau m deutlich gesenkt werden. Des<br />
weiteren kann beliebig oft gemessen werden, wodurch die Möglichkeit<br />
besteht, die Festigkeitsverläufe genauer abzubilden.<br />
B. Strömann<br />
Min<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> SO2- Emissionen durch Optimierung <strong>der</strong> Kalkhydrataufgabe<br />
in einer Drehofenanlage<br />
Diplomarbeit; Betreuer: Prof. Wolter, M. Becker (Teutonia Zement AG), Dr.<br />
R. Mathai<br />
Wie in allen industriellen Bereichen ist auch bei <strong>der</strong> Zementhe rstellung die<br />
Reduzierung von Emissionen ein wichtiger Aspekt im Bereich des<br />
Umweltschutzes. Einerseits müssen die von den Umweltbehörde n<br />
vorgegebenen Grenzwerte eingehalten werden, an<strong>der</strong>er s eits muß man<br />
kostengü nstig produzieren, um wettbewe r b sfähig zu bleiben. Es gibt eine<br />
Reihe von Verfahren, die speziell die SO2- Emission vermin<strong>der</strong>n, sich<br />
jedoch bei <strong>der</strong> Zementherstellung als zu kostspielig erweisen. Ein<br />
Verfahren, das sich in <strong>der</strong> Zementindustrie durchgesetzt hat, ist das<br />
Trockenabsorptionsverfa hren. Hierbei wird Kalkhydra t als SO2-<br />
Absorptionsmittel in den Abgasstro m geführt<br />
In dieser Arbeit werden zunächst die Grundlagen <strong>der</strong> SO2- Emission und<br />
- Min<strong>der</strong>ung beschrieben. Die Eigenschaften und Wirkungen des<br />
Kalkhydrates bei <strong>der</strong> SO2- Absorption werden betrachtet. Mit Hilfe <strong>der</strong><br />
ther modyna m ische n Daten <strong>der</strong> einzelnen Komponente n wird eine
– 49 –<br />
Aussage darüber gemacht, welche <strong>der</strong> vielen möglichen Reaktione n<br />
wahrscheinlich ablaufen.<br />
Nach einer Beschreibung <strong>der</strong> Ofenlinie und <strong>der</strong> Anlage zur<br />
Kalkhydratdosier ung bei <strong>der</strong> Teutonia Zementwerk AG folgen<br />
Ausführu nge n zu den im Rahmen dieser Arbeit durchgeführte n<br />
Versuchen und die Darstellung <strong>der</strong> Ergebnisse. Es erfolgten im<br />
Versuchs zeitra u m Messungen während <strong>der</strong> beiden Betriebsz ustände<br />
Verbund - und Direktbetrieb sowie mit verschiedenen Aufgabemenge n an<br />
Kalkhydrat.<br />
Bereits nach wenigen Versuchstage n fiel auf, daß es Unregelmä ßigkeiten<br />
bei <strong>der</strong> Dosierung des Hydrates gibt. Hieraus lassen sich teilweise die SO2-<br />
Spitzen im Reingas erklären.<br />
Die Frage nach dem optimalen Aufgabeort ist nicht absolut zu<br />
beantw orten. Tendenziell finden sich Vorteile im Verbund bet rieb <strong>für</strong> die<br />
Aufgabe mit dem Rohmehl. Eine eindeutige Aussage ist jedoch erst<br />
möglich, wenn hier<strong>für</strong> genügend Versuche mit einer ausreichen den Dauer<br />
durchgeführt werden.<br />
Eine Verbesserung <strong>der</strong> Anlage <strong>für</strong> die Kalkhydratsdosierung wäre somit<br />
<strong>der</strong> erste Schritt <strong>für</strong> die Optimieru ng <strong>der</strong> Kalkhydrataufgabe. Daran<br />
anschließe n d würden zusätzliche Versuche mit unterschiedlichen<br />
Aufgabestellen Aufschluß über eine weitere Einspar möglichkeit<br />
Ute Zunzer<br />
Umsetzung <strong>der</strong> organischen Bestandteile des Rohmaterials beim<br />
Klinkerbrennprozeß<br />
Doktorarbeit; Betreuer: Prof. Wolter, Prof. Sprung<br />
Ziel <strong>der</strong> vorliegende n Arbeit war es, die Umsetzung <strong>der</strong> organischen<br />
Bestandteile des Rohmaterials unter den beim Klinkerbren n p r o z e ß<br />
herrsche nden Randbedingungen zu untersuche n. Neben Art und Menge<br />
<strong>der</strong> in verschiedene n Rohmaterialien vorliegenden organischen<br />
Bestandteile standen als wesentliche Untersuc hungspara m e t er die<br />
Temperaturen und Sauerstoffgehalte bei <strong>der</strong> Vorwärm u n g sowie die<br />
Vorwär m erbauart im Vor<strong>der</strong>grun d.
– 50 –<br />
Eine charakteristische Größe, die den<br />
Gehalt an organische n Verbindu ngen<br />
in den zum Klinkerbre n n e n<br />
eingesetzte n Rohmaterialien<br />
beschreibt, ist <strong>der</strong> Gehalt an<br />
Gesamtko hlenstoff (Total Organic<br />
Carbon (TOC)). Die im Rahmen<br />
dieser Arbeit untersuchten<br />
Ofenme hlmisc hungen wiesen TOC-<br />
Gehalte zwischen 0,07 und 0,5 M.- %<br />
auf. Dies entspricht ca. 1,1 bis 7,8 g Kohlenstoff / k g Klinker, die dem<br />
Ofensyste m über die Rohmaterialien zugeführt werden.<br />
Durch Laboruntersuc h u n g e n in einem Rohrofen konnte gezeigt werden,<br />
daß sich die im Ofenmehl vorliegenden organischen Verbindungen zwei<br />
unterschiedlichen Kategorien zuordnen lassen. Zu unterscheide n sind<br />
leichtflüchtige organische Bestandteile (VOC), die im Temperat urbereich<br />
von 250 bis 550 °C gasförmig freigesetzt werde n und Restkoks, <strong>der</strong> erst<br />
bei höheren Temperaturen umgesetzt wird. Als Bestandteile des VOC<br />
wurden u.a. Methan, kurzkettige Kohlenwas serstoffe und einfache<br />
Aromaten ermittelt. Bei Anwesen heit von Sauerstoff führt sowohl die<br />
Oxidation <strong>der</strong> gasför migen organischen Verbindu ngen als auch <strong>der</strong> Abbau<br />
des Restkokses bei Temperature n unter 700 °C zur Entstehung von<br />
Kohlenmonoxid. Eine Variation des Sauerstoffgehaltes im überströ me n d e n<br />
Gasstro m zeigte, daß durch eine Erhöhung des Luftüberschusses über den<br />
Mindestbe da rf hinaus keine signifikante Än<strong>der</strong>ung des gebildeten Anteils<br />
an Kohlenmo n oxid erreicht werden kann. Der Anteil <strong>der</strong> flüchtigen<br />
organischen Verbindunge n, die aus dem Rohmaterial freigesetzt werden,<br />
nimmt dagegen mit steigende m Sauerstoffgehalt geringfügig ab. Die<br />
Verringer u ng <strong>der</strong> VOC- Bildung verläuft mit steigende m Sauerstoffgehalt<br />
allerdings asymptotisc h, so daß bei O 2- Gehalten über 1,5 Vol.- % im<br />
Gasstro m nur noch ein geringer Effekt erzielt wird.<br />
Vergleichende Betriebsunter s uchungen an Zyklonvor w ä r m e r a nlage n<br />
bestätigen, den im Laborvers uch gefundenen Temperaturbereich, in dem<br />
die Umsetzung <strong>der</strong> organischen Bestandteile des Rohmaterials stattfindet.
– 51 –<br />
Wie im Laborversuch beeinflußt eine Erhöhung des Sauerstoffgehaltes<br />
über den Mindestbedarf hinaus im Zyklonvorwärme r die<br />
rohmaterialbedingte CO- und VOC- Bildung nicht. Bei hohen TOC-<br />
Gehalten im Ofenme hl und geringem Luftüberschuß zeigte sich jedoch,<br />
daß ein höheres Sauerstoff angebot die Umsetzung von VOC zu CO<br />
begünstigt und damit die VOC- Emission verringert wird. In<br />
Drehofenanlagen mit Rostvorwär m e r erfolgt die Umsetzung des TOC im<br />
wesentlichen erst bei den Temperaturen in <strong>der</strong> Heißka m m e r. Da sowohl<br />
die Bildung als auch <strong>der</strong> Abbau von Kohlenmonoxid in <strong>der</strong> Heißka m m e r<br />
stattfinden können, ist eine Bilanzierung <strong>der</strong> rohmate rialbedingten CO-<br />
Bildung an Rostvor wä r m e r a nlage n nur möglich, wenn im Dreh ofeneinlauf<br />
praktisch kein verbren n u ngsbe dingtes CO vorliegt. Darüber hinaus ist die<br />
Aufheizgeschwindigkeit <strong>der</strong> Granalien in <strong>der</strong> Heißka m m e r <strong>für</strong> die<br />
Umsetzungsre a ktionen von Bedeutung. Der Vergleich <strong>der</strong> Labor- und<br />
Betriebsergebnis se ergab, daß anhand <strong>der</strong> Laboruntersuchungen eine<br />
Abschätzung <strong>der</strong> rohmaterialbedingte n CO- und VOC- Bildung an<br />
Zyklonvorwärme r a nlagen möglich ist. Die an Rostvor wä r m e r a nlage n<br />
vorliegende n anlagens pezifischen Gegebenheiten sind in <strong>der</strong> Labor -<br />
apparatur nur unter bestim m ten Voraussetzunge n zu simulieren und<br />
daher nicht allgemeingültig übertragbar.<br />
Insgesa mt wurde durch die Labor- und Betriebsver suche gezeigt, daß die<br />
organischen Bestandteile des Rohmaterials beim Klinkerbren n p r oze ß<br />
einen wesentlichen Beitrag zur Kohlenmonoxid - und Gesamtko hlenstoff -<br />
emission von Drehofena nlagen <strong>der</strong> Zementindustrie liefern.<br />
A. Ehrenberg<br />
Zur Optimierung <strong>der</strong> Korngrößenverteilung von hüttensandhaltigen<br />
Zementen<br />
Doktorarbeit; Betreuer: Prof. Wolter, Prof. Geiseler<br />
Ziel <strong>der</strong> Arbeit war es, die Korngrößen ve r t eilung hüttensandhaltiger<br />
Zemente so zu opti mie ren, daß eine signifikante Steigerung <strong>der</strong> Festigkeit<br />
nach 1 und 2 Tagen bei nur wenig verän <strong>der</strong>te n Festigkeiten nach 28 und<br />
91 Tagen erhalten wird. Gleichzeitig sollten die Verarbeitungseigen -
– 52 –<br />
schaften <strong>der</strong> Zemente, vor allem <strong>der</strong>en Wasserans pruch, nicht beein -<br />
trächtigt werden.<br />
Der übliche Weg zur Steigerung <strong>der</strong><br />
Anfangsfestigkeit von<br />
Portlandhütte n - und Hochofen -<br />
zemente n ist eine erhöhte<br />
Feinmahlung des Zements. Dieser<br />
Weg ist jedoch mit verschie denen<br />
Nach teilen verbunden. In<br />
umfangreiche n zement - und<br />
mörteltechnische n Untersu chungen an<br />
verschie denen Hüttensa n de n und<br />
Klinkern mit sehr verschiede nen<br />
Korngrö ßenverteilungen und bei<br />
unter schiedli chen Hüttensa n d / Klinker - Verhältnissen konnte<br />
gezeigt werden, daß eine konsequente An hebung des Anteils <strong>der</strong><br />
Hüttensan df ra ktionen < 2 µm im Zement notwendig ist, um eine signifi -<br />
kante Steige rung <strong>der</strong> Anfangsfestigkeit um etwa 200 - 300 % zu erreichen.<br />
In Abhängigkeit von ver schiedene n Einflußpara m e tern, wie z. B. <strong>der</strong><br />
chemischen Zusam mensetz u ng und <strong>der</strong> Grund fein heit des Hüt tensands<br />
sowie des Klinkers, ist hierzu ein Anteil von Feinsthüttensa n d<br />
≥ 10.000 cm² / g in Höhe von etwa 20 M.- % des Zements notwendig. Der<br />
Zementanteil > 20 µm spielt in dem üblicher weise betrachtete n Zeitrau m<br />
<strong>der</strong> Zementerhärtung eine untergeordnete Rolle. Er kann daher durch<br />
relativ gro ben Hüttensandgrie ß gebildet werden. Durch ihre Mischung<br />
kann eine Korngrö ßen verteilung einge stellt wer den, die einer<br />
Ausfallkörn u n g ähnelt. Aus verarbei tungstech nischen Gründen ist es not -<br />
wendig, diese Ausfallkör nung im mittle ren Kornbereich durch die<br />
Klinkerko m ponente so zu ergän zen, daß eine breite Korn -<br />
größenverteilung des Zements ent steht. Derartig zusam me n ge setzte<br />
Zemente weisen trotz wesent lich erhöhter spezi fischer Oberflächen<br />
keinen erhöhten Was seran spruch auf.<br />
Die Bestimmu ng <strong>der</strong> Hydratationswär m e und des che misch gebunde nen<br />
Wassers zeigen eine hohe Reaktivität des Feinsthüttensa n d s. Porositäts -
– 53 –<br />
mes sungen und REM- Untersuchungen belegen eine Gefügeverdichtung,<br />
insbe son<strong>der</strong>e in <strong>der</strong> kriti schen Über gangszone um die Zuschlagkörner<br />
herum. Zur Beschreibung <strong>der</strong> Korngrö ß e n v e r tei lung kann die RRSB-<br />
Darstellung verwe ndet werden, die bei gewichteter linearer Regression<br />
<strong>der</strong> Meß werte eine gute Charakterisier u ng ermöglicht.<br />
5.5 Sonstiges<br />
Neue Geräte<br />
• ESCA<br />
Nachdem wir im Dezember 1999<br />
das Kernstück des ESCA- Gerätes<br />
aus dem Physikalische n <strong>Institut</strong> in<br />
unser <strong>Institut</strong> transportiert hatten,<br />
sollte es aufgrund <strong>der</strong> Bürokratie<br />
und an<strong>der</strong>er Hemmnisse noch<br />
einige Monate dauern, bis das<br />
notwendige Zubehör angeschafft<br />
war und wir mit <strong>der</strong> ESCA<br />
Meßergebnisse erzielen konnten.<br />
Die Elektrone n s pektroskopie <strong>für</strong><br />
Chemi sche Analysen ist eine<br />
wichtige physika lische Methode,<br />
um chemische Bindungen differen -<br />
ziert nachzu weisen.<br />
Die Probenoberfläche wird dabei mit Röntgen strahlung bestrahlt.<br />
Aufgrund des Photo effektes werden dann Elektronen von <strong>der</strong> Probe<br />
emittiert. Die kinetische Energie <strong>der</strong> Elek tronen ergibt sich aus <strong>der</strong><br />
Energie <strong>der</strong> Röntgen strahlen minus <strong>der</strong> Bindungs energie <strong>der</strong> Elektronen<br />
<strong>der</strong> entspreche n d e n Probe. Analysiert man nun die Energie <strong>der</strong> Photo -<br />
elektronen mit Hilfe des Elektrone n analysators, erhält man dadurch ein<br />
Bild von den Bindungsenergien <strong>der</strong> Elektronen <strong>der</strong> jeweiligen Probe. Da<br />
jedes Element durch seine Bindungsenergien eindeutig identifiziert
– 54 –<br />
werden kann und chemische Bindungen eine Verschiebung <strong>der</strong> Energien<br />
verursachen, können diese auch zum Teil mittels ESCA identifiziert<br />
werden.<br />
Ein Forschungsprojekt, welches mit Hilfe <strong>der</strong> ESCA durchgeführt wird,<br />
besteht darin, Magnesium im Rauchgas - Entschwefelungsgips zu<br />
analysieren. Es konnte bereits nachgewiesen werden, daß das Magnesium<br />
im Gips in vier verschiedene n Bindungsarte n vorliegt.<br />
Ulrike Ahlers<br />
• Knudsen - Effusions - Massenspektrometer<br />
Neben <strong>der</strong> ESCA hat die Arbeitsgruppe<br />
BuB ein weiteres Großgerät, das<br />
Knudsen - Effusions -<br />
Massenspe k t r o m e ter (KEMS) in<br />
Betrieb genomme n, um unseren<br />
<strong>Werkstoffe</strong>n weitere Geheimnisse zu<br />
entlocken.<br />
Die Kundsen'sche Methode <strong>der</strong><br />
Molekül- Effusion dient <strong>der</strong><br />
Bestimmung kleiner Dampfdr üc ke<br />
im Hochtem p eraturbereich. Die KEMS<br />
beruht auf <strong>der</strong> Effusion eines<br />
Molekularstra hls aus einer kleinen<br />
Öffnung eines isother m e n Behälters, <strong>der</strong><br />
Knudsenzelle. Hierin befindet sich eine Probe bei<br />
vorgegebener und konstanter Temperat ur. Die Zelle wird mittels eines<br />
Glühfadens und bei höherer Temperat ur durch Elektronenbesc h u ß<br />
erhitzt. Aus dem Probematerial effundieren Moleküle, die sich im Vakuum<br />
(freie Weglänge >> als die Dimension <strong>der</strong> Zelle) unbehinde rt bewegen und<br />
statistisch durch die kleine Öffnung entweiche n. Dieser gerichtete Strahl,<br />
<strong>der</strong> Molekularstra hl, gelangt in die Ionisationsq uelle, wo ein Teil <strong>der</strong><br />
Moleküle ionisiert wird. Diese werden im nachgeschaltete n Magnetfeld -<br />
Massenspe k trometer selektiv detektiert. Aus <strong>der</strong> Intensität <strong>der</strong> Signale
– 55 –<br />
und <strong>der</strong> Temperat ur in <strong>der</strong> Probezelle kann dann <strong>der</strong> Partialdruc k <strong>der</strong><br />
Verbindung ermittelt werden.<br />
Die Aufbauphas e war im September soweit abgeschlossen, daß mit <strong>der</strong><br />
Untersuc hung einfacher Verbindungen wie beispielsweise KCl und K2O<br />
begonne n werden konnte. Das Ziel ist es das Verdam pf ungsverhalten <strong>der</strong><br />
kreislaufrelevante n Verbindu ngen beim Zementklinker brennen zu<br />
untersuchen und so die Kreisläufe besser zu verstehen. Der Entstehu ng<br />
<strong>der</strong> Kreisläufe bzw. <strong>der</strong>en Wachstu m könnte dann gezielt entgegen<br />
gewirkt werden, so daß sich hieraus positive Effekte wie verringerter<br />
Brennstoffbe darf (durch Vermeidung unnötigen Stoff- und<br />
Energietransports), höhere Verfügbarkeit und geringere Emissionen<br />
ergeben.<br />
Robert Mathai<br />
Beirat <strong>der</strong> Professur <strong>für</strong> Bindemittel und Baustoffe<br />
Dem Beirat gehören z.Z. die Herren Prof. Sprung (VDZ), Dr. Schaefer<br />
(Bundesverband Kalk) und Dr. Kroboth (VDZ, Bundesverband Gips) an.<br />
Der Beirat trat am 13.06.2001 in <strong>Clausthal</strong> zu seiner diesjährigen<br />
regulären Sitzung zusam m e n. Neben <strong>der</strong> Präsentation <strong>der</strong> aktuellen<br />
Forschungst h e m e n war die zukünftige Ausrichtu ng des Studiums wie<br />
auch des Lehrstuhls <strong>für</strong> Bindemittel und Baustoffe ein wichtiges Thema<br />
und wie immer die miserable Nachfragesituation auf Seiten <strong>der</strong> Studenten.<br />
Exkursionen<br />
Exkursionsbericht 2. Juli 2001<br />
Tagesexkursion <strong>der</strong> AG BuB nach Bernburg, Magdeburg und Flechtingen<br />
Die zweite Tagesexkursion <strong>der</strong> AG BuB im SS 2001 führte Professor<br />
Wolter, seine Mitarbeiter (Ulrike Ahlers, Barbara Strömann, Alexan<strong>der</strong><br />
Lechner, Robert Mathai) und mehrere Studenten (Anne Dittmar, Tamara<br />
Wippich, Frank Assel, Jan Korf) zunächst nach Bernburg ins Zementwerk<br />
<strong>der</strong> Firma Schwenk. Die mo<strong>der</strong> ne Ofenlinie 6 ist mit dem einzigen 6-<br />
stufigen Zyklonvor w ä r m e r in Deutschland ausgerüstet. Die Anlage wurde<br />
1992 errichtet und ist <strong>für</strong> 4.500 tato ausgelegt. Durch das Werk führten
– 56 –<br />
uns die ehemaligen <strong>Clausthal</strong>er Frau Rö<strong>der</strong> und Herr Dr. Werner.<br />
Aufgrund des Ofenstillstandes eröffnete sich die Möglichkeit den Kühler<br />
zu begehen und Einblicke in den Ofen und die Mahlaggregate zu erhalten.<br />
Als nächste Station fuhren wir mit dem Institusbus nach Magdeburg zur<br />
“BBW Recycling Mittelelbe”, wo Baustoffe von Gebäudeabrisse n (Ziegel,<br />
Beton, Steine, Erde) und Straßena ufbruch recycelt werden. Der<br />
“Bauschutt” wird möglichst sortenrein abgekippt, gebrochen, mehrfach<br />
abgesiebt und zum Teil sogar gewasche n. Die bei <strong>der</strong> ersten Siebung<br />
anfallende Feinfraktion (0- 16mm) wird als Füllmaterial verwen det, das<br />
weitere, aufbereitete Material wird z.B. <strong>für</strong> Tragschichten eingesetzt.<br />
Stoffe wie Eisen und schwimmf ä hige Stoffe (vor allem Holz) werden<br />
quantitativ ausgehalten und einer getrennten Verwertung zugeführt.<br />
Die Anlage wird seit 1993 betrieben, hat einen jährlichen Durchsatz von<br />
ca. 200.000 t und zeigt, wie qualitativ hochwertig Baustoffe<br />
wie<strong>der</strong>aufbereitet werden könne n.<br />
Unsere letzte Station führte uns nach<br />
Flechtingen zu den Haniel<br />
Baustoffwerken. An diesem Standort<br />
wird im Tagebau Schotter und<br />
Edelsplitt gewonnen. Das Material wird<br />
auf fünf Sohlen abgebaut und einem<br />
Kegelbrecher zugeführt. Der Versand<br />
des Materials erfolgt über die Straße,<br />
die Schiene und über den<br />
nahegelegenen Kanal. Das<br />
Einzugsgebiet erstreckt sich in<br />
Richtung Norden, von Berlin bis<br />
Hamburg. Jährlich werden hier ca. 2 Mio t Schotter, beispielsweise <strong>für</strong> den<br />
Bau von Gleisanlagen gewonnen.<br />
Wir bedanken uns <strong>für</strong> die interessa nten Führungen und die gute<br />
Bewirtung und freuen uns auf den nächsten Besuch.<br />
Robert Mathai
– 57 –<br />
Studentenexkursion in das Kraftwerk Lippendorf bei Leipzig und das<br />
nahegelegene Gips werk v on Lafarge am 11. Juni 2 0 01 im Rahmen <strong>der</strong><br />
Vorlesungsreihe "Technologie <strong>der</strong> Bindemittel"<br />
Teilnehmer: Tamara Wippich, Anne Dittmar, Jan Korf, Christoph Baum,<br />
Robert Mathai, Barbara Strömann, Ulrike Ahlers, Prof. Wolter<br />
In aller Frühe starteten wir mit unsere m <strong>Institut</strong>s bus in <strong>Clausthal</strong>, um -<br />
abgesehe n von einer Frühstüc kspause - nach einer fünfstündigen<br />
"Nonstop" - Tour bei Lafarge anzuko m m e n.<br />
Die Firma Lafarge hat quasi parallel zum Kraftwer ksneuba u direkt auf<br />
dem Gelände <strong>der</strong> Vereinigten Energiewer ke AG südlich von Leipzig bei<br />
Lippendorf ihr neues Werk errichtet, wo die Calcinierung des im<br />
Kraftwerk anfallenden REA- Gipses durch zwei unterschiedliche<br />
Verfahren erfolgt:<br />
Mit einem Gipskocher wird Beta- Halbhydrat hergestellt, das in Lippendorf<br />
hauptsächlich <strong>für</strong> die Herstellung <strong>der</strong> Gipskartonplatten weiterverar beitet<br />
wird. Das Gipskartonplatten w e r k steht in direkter Nähe des Kochers, so<br />
daß quasi keine Transportwege notwendig sind.<br />
Zur Alpha - Halbhydratherstellung steht in Lippendorf <strong>der</strong>zeit nur eine<br />
Pilotanlage zur Verfügung. Alpha- Gipse finden beispielsweise zur<br />
Herstellung von Misch- und von Formengipse n Anwendung.<br />
Die VEAG unter hält in Lippendorf eine Abteilung <strong>für</strong> Öffentlichkeitsarbeit,<br />
die Interessierten eine Besichtigung des<br />
Kraftwerkes ermöglicht, wobei hier fast<br />
täglich Besuchergrup pen eintreffen. Wem <strong>der</strong><br />
Rundgang durch das Kraftwerk allzu viele<br />
Fragen offenläßt, <strong>der</strong> hat im Informationszentru m<br />
hervorragende Möglichkeiten, die technische n<br />
Funktionsprinzipien zu verstehen.<br />
Für uns stand natürlich die Rauchgasentschwefelung<br />
und somit die REA- Gips- Entstehu ng im Mittelpun k t des<br />
Interesses. Am eindrucksvollste n war <strong>für</strong> uns wohl<br />
<strong>der</strong> Blick gen Himmel aus dem Inneren eines<br />
Kühltur mes. So sind wir sicher alle nachhaltig fasziniert von den<br />
gigantische n Dimensionen <strong>der</strong> Bauwerke mo<strong>der</strong> ner Kraftwerke.
Ulrike Ahlers<br />
– 58 –<br />
Exkursion zu m Tag <strong>der</strong> offenen Gips - Steinbrüche am 23. Juni 2001<br />
Am Samstag den 23. Juni hat sich die Arbeitsgruppe „Bindemittel und<br />
Baustoffe“ aufgemacht und ist <strong>der</strong> Einladung <strong>der</strong> Arbeitsgemeinschaft<br />
Harzer Gipswerke gefolgt. Auf dem Program m stand die Besichtigung von<br />
Steinbrüchen im Südharz <strong>der</strong> Firmen Krone Gips in Osterode, BPB Formul a in<br />
Walkenried und Südharzer Gipswerke in Ellrich. Die Arbeitsgemeinschaft<br />
Harzer Gipswerke nutzte diesen Tag, <strong>der</strong> Bevölkerung zu zeigen, wie und<br />
wo <strong>der</strong> Naturgips abgebaut wird, welche Produkte hieraus hergestellt<br />
werden und was mit den Steinbrüc he n geschieht, wenn <strong>der</strong> Abbau<br />
beendet ist. Die Steinbrüche werden rekultiviert bzw. „Mutter Natur“<br />
zurückgegebe n. Bereits nach kurzer Zeit wachsen hier zum Teil exotische<br />
Pflanzen und es entsteht Lebensrau m <strong>für</strong> seltene Tierarten.<br />
Das Wetter zeigte sich nicht von <strong>der</strong> sommerlichsten Seite, trotzde m<br />
waren viele Bürger <strong>der</strong> Region <strong>der</strong> Einladung gefolgt und schlen<strong>der</strong>ten<br />
durch die Steinbrüche und labten sich an den zahlreichen Grill- und<br />
Bierstände n.<br />
Im Bild : Fr au Reck , Her r Dr . Math ai, Fr au<br />
Str öm an n , Pr of. Wolter , Her r Bau m , Her r<br />
Lech n er u n d Fr au Ah ler s.<br />
Blick aus dem Inneren eines<br />
Kühltur mes.<br />
Wir erweiterten unser<br />
Program m um einen<br />
kulinarische n Abstecher ins<br />
Herzberger Schloßcafé und<br />
fuhren am Abend noch<br />
einmal nach Osterode. Dort<br />
besuchte n wir die Burgruine,<br />
um über die mehr o<strong>der</strong><br />
weniger erfolgreichen<br />
Maßnah m e n, die den Verfall<br />
<strong>der</strong> Ruine stoppen sollen, zu fachsimpeln. (Bericht: R. Mathai)
– 59 –<br />
Vorträge v on Gästen aus <strong>der</strong> Industrie o<strong>der</strong> an<strong>der</strong>en Universitäten im<br />
Rahmen des Donnerstagsseminars am INW<br />
Während <strong>der</strong> Vorlesungszeit finden bekanntlich unsere<br />
Donnerstagsseminare statt. Dabei halten nicht nur Studenten Vorträge zu<br />
den Themenbereichen Glas- Keramik - Bindemittel. In diesem Rahmen<br />
werden auch Gäste eingeladen, die ihre Forschungssc h w e r p u n k t e o<strong>der</strong><br />
spezielle Themen ihrer praktische n Tätigkeiten vorstellen.<br />
So begrü ßten wir am 26. Oktober 2000 Herrn Manfred Steinbrecher ,<br />
Inhaber <strong>der</strong> gleichna migen Firma.<br />
Herr Steinbrecher arbeitet insbeson<strong>der</strong>e im Bereich <strong>der</strong> Denkmalpflege<br />
und restauriert kunsthistorische Gipsestrich- , Stuck - und<br />
Keramikfu ß b ö de n, betreibt Mauerwer ks - und Putzsanierung, führt<br />
Befundsuntersuc h u n gen durch und doku me ntiert diese. Das<br />
Vortragsthe m a hieß Historischer Gipsmörtel in Mitteldeutschland .<br />
Herr Steinbrecher behandelte hierbei insbeson <strong>der</strong>e die Themen:<br />
Gipsmörtelgeschichte, Natursteine, modifizierte historische Gipsmörtel<br />
und historische technische Einrichtunge n, Versuche <strong>der</strong> Rekonstru k tion<br />
historischer Gipsmörtel und stellte uns den "hauseigenen"<br />
Steinbrechermörtel vor.<br />
Am 19. April 2001 hatten wir Herrn Dr. Bernhard Middendorf bei uns zu<br />
Gast. Herr Middendorf arbeitet <strong>der</strong>zeit an <strong>der</strong> Gesamthochsch ule Kassel<br />
im Fachgebiet Baustoffkunde / Amt liche Baustoff - und Betonprüfstelle F.<br />
In seinem Vortrag mit dem Titel Verän<strong>der</strong>unge n <strong>der</strong> Mikrostr u ktur CaSO 4-<br />
gebundener Baustoffe durch Zusatzmittel und bei Bewitterung stellte uns<br />
Herr Middendorf ein Teilgebiet seiner Forschung vor.<br />
So wurde an praktischen Beispielen anschaulich dargestellt, welche<br />
mikrostrukturellen Verän<strong>der</strong>u ngen an CaSO 4- gebundenen Baustoffen<br />
durch Einwirkunge n verschiede ner Zusatzmittel auftrete n und wie sich<br />
diese auf bauphysikalische Eigenschaften auswirke n. Es wurden Gefüge<br />
historischer und langzeitbewitterte r Gipsmörtel den unbewitterten
– 60 –<br />
Proben gegenübergestellt mit dem Ziel, die hohe Wasserresiste nz von<br />
Gipsmörtel aus dem Außenbereich historische r Bauwerke zu erklären.<br />
Beide Vorträge fanden auch bei Vertreter n <strong>der</strong> Gipsindustrie große<br />
Resonanz.<br />
Deshalb planen wir auch im Winterse mester 2001 / 2 002 Vorträge<br />
auswärtiger Gäste bei unsere m Donnerstagsse mi nar, die übrigens im<br />
allgemeine n nicht vor 17.00 Uhr beginnen, um die Teilnahme von<br />
Vertretern aus <strong>der</strong> Industrie zu erleichter n. In diesem Semester werden<br />
uns Herr Dr. Bartha von <strong>der</strong> Firma Refratechnik und Herr Dr. Fischer von<br />
<strong>der</strong> Bauhaus - Universität Weimar besuchen.<br />
Leser des Segerkegels, die auch in unsere n Verteiler <strong>für</strong> die Einladungen<br />
dieser Vortrags veranstaltungen aufgeno m m e n werden möchten, melden<br />
sich bitte telefonisch bei unserer Sekretärin, Frau Reck, unter 05323 - 72<br />
2028 o<strong>der</strong> per E- mail unter marianne.reck@tu - clausthal.de .<br />
Ulrike Ahlers<br />
In die AG BuB eingetretene Mitarbeiter<br />
Frau Dipl.- Ing. Barbara Ströma nn<br />
Herr Dipl.- Ing. Stefan Follner<br />
Aus <strong>der</strong> AG BuB ausgetretene Mitarbeiter<br />
Herr Dr. Robert Mathai
– 57 –<br />
6. Mitteilungen <strong>der</strong> Materialprüfanstalt<br />
6.1 Allgemeines<br />
Die Umstrukturierung <strong>der</strong> Materialprüfu ng in Nie<strong>der</strong>sachsen, die 1998 zur<br />
Bildung von fünf Landesbetriebe n in Hannover, Braunschweig und<br />
<strong>Clausthal</strong> führte, wird beschleunigt fortgesetzt. Nachdem die MPAen<br />
eigene Wirtschaftspläne erstellen und eine kaufmä n nische Buchführung<br />
eingeführt haben, ist <strong>der</strong> nächste Schritt weit dramatischer: Nach<br />
<strong>der</strong>zeitiger Beschlusslage soll die Zuführu ng von etatisierten<br />
Finanz mitteln <strong>für</strong> alle Betriebe ab 2006 vollständig eingestellt werden,<br />
obwohl klar ist, dass keine Materialprüfanstalt in diesem Zeitraum in <strong>der</strong><br />
Lage sein wird, sich selbst zu finanzieren. Die nächsten Jahre, in denen<br />
bereits eine sukzessive Reduzieru ng <strong>der</strong> Subventione n praktiziert werden<br />
soll, werden daher <strong>für</strong> die Materialprüfanstalte n von existenzieller<br />
Bedeutung sein.<br />
Trotz dieses Damoklessc hwertes, das auch über <strong>der</strong> MPA <strong>Clausthal</strong> hängt,<br />
wird weiter über Möglichkeiten nachgedacht, wie die bestehe nde Raumnot<br />
gelin<strong>der</strong>t werden kann. Nachdem ein Umzug, im Gespräch waren die alte<br />
Mensa und Teile des ehemaligen <strong>Institut</strong>s <strong>für</strong> Erdölforschung, aus<br />
finanziellen Gründen nicht möglich war, werden nun weitere Szenarien<br />
diskutiert. Letztlich schränkt ein Fortbestehe n dieses Problems auch die<br />
Möglichkeiten zur Verringeru ng <strong>der</strong> Subventione n ein.<br />
6.2 Forschung und Entwicklung
– 58 –<br />
Schwerpun k t <strong>der</strong> Forschung, die die MPA <strong>der</strong>zeit nur mit geringem<br />
Aufwand betreibt, sind weiterhin Fragen zur Präzision und Unsicherheit<br />
von Prüfergebnisse n. Anfang 2001 wurde ein weiterer Ringvers uch (78<br />
Laboratorien aus Deutschland, Österreich, <strong>der</strong> Schweiz und Slowenien)<br />
abgeschlos sen, die die Bestimmu ng <strong>der</strong> Kornfor m von Mineralstoffen<br />
nach DIN EN 933- 4 zum Inhalt hatte. Dieser Parameter stellt <strong>für</strong> ein<br />
Mineralgemisch, das im Straßenba u o<strong>der</strong> <strong>für</strong> die Herstellung von Beton<br />
verwen det werden soll, ein bedeuts a mes Kriterium dar, da es<br />
Eigenschaften wie Verdichtu ngswilligkeit und Bindemittelbedarf<br />
beeinflusst. Körner mit kubische m o<strong>der</strong> gedrungene m Habitus lassen sich<br />
leichter verarbeiten als solche aus plattigen o<strong>der</strong> spießigen Bestandteilen.<br />
Aufgrund <strong>der</strong> größeren Oberfläche von länglichen Körner steigt <strong>der</strong><br />
Bindemittelbedarf, was Auswirkunge n auf die Baustoffkosten hat.<br />
Halbquantitative Prüfunge n <strong>der</strong> Kornform könne n in vielen Fällen bereits<br />
per Augenschein bei entsprechen<strong>der</strong> Erfahrung vorgeno m m e n werden.<br />
Für Eignungs - und Überwachungsprüfungen von Mineralstoffen reichen<br />
solche Verfahren im allgemeinen nicht aus. Quantitative Kennzahlen<br />
lassen sich mit Hilfe zweier europäischer Normen, die <strong>für</strong> die Prüfung <strong>der</strong><br />
geometrische n Eigenschaften von Gesteinskörnunge n erarbeitet wurden,<br />
ermitteln, <strong>der</strong> Plattigkeitskennzahl nach EN 933- 3 und <strong>der</strong><br />
Kornfor mkennza hl nach EN 933- 4. Die Prüfung <strong>der</strong> Plattigkeit (Grundlage<br />
ist eine französische Norm) erfolgt durch Siebung mit Analysensieben zur<br />
Darstellung einer festgelegten Kornklasse. Nachfolgend wird auf einem<br />
Stabsieb mit geringerer Nenn - Schlitzweite gesiebt. Bei <strong>der</strong> Bestimm u ng<br />
<strong>der</strong> Kornfor m k e n n z a hl (Grundlage ist eine deutsche Norm) wird anstelle<br />
des Stabsiebes ein Kornfor m - Messschieber verwendet, mit dem das<br />
Verhältnis von größter Länge zur geringste n Dicke ermittelt wird. Dieses<br />
Prüfverfa hre n beruht auf einem Prüfverfahre n nach <strong>der</strong> zurückgezogenen<br />
DIN 52114. Da sich damit beide Prüfprinzipien deutlich untersc heiden,<br />
sind die Ergebnisse nur eingeschrä n kt miteinan<strong>der</strong> vergleichbar.<br />
Als Ergebnis wurde festgestellt, dass mit dem Prüfverfa hren zur<br />
Ermittlung <strong>der</strong> Kornfor m ke n n z a hl Splitt und Edelsplitt im Bereich von 15
– 59 –<br />
M.- % ≤ SI ≤ 25 M.- % nicht hinreichen d sicher unterschiede n werden. Bei SI<br />
> 40 M.- % ist eine gesicherte Entscheidu ng über die Gebrauchstauglichkeit<br />
<strong>der</strong> Gesteinskörn u n g im Straßenbau nur eingeschrä n kt möglich. Die<br />
Präzision des Plattigkeitsprüfu ng ist besser. In den Ringversuc hsdaten<br />
war zudem eine subjektive Komponente zu beobachte n: Mehrheitlich<br />
neigten Prüflaboratorien dazu entwe<strong>der</strong> über o<strong>der</strong> unter dem<br />
Gesamt mittelwert liegende Prüfergebnisse zu ermitteln. Ein signifikanter<br />
Unterschied zwischen akkreditierten und nicht akkreditierten<br />
Laboratorien wurde nicht festgestellt. Die Ergebnisse des Laborvergleichs<br />
wurden am 6. März 2001 im <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Nichtmetallische</strong> <strong>Werkstoffe</strong><br />
vorgestellt und mit den Teilneh mern diskutiert.<br />
Außerde m konnte n die Arbeiten zur Kalibrierung von Analysensieben mit<br />
einem formellen Kompetenz nac h w eis abgeschlosse n werden. Seit Mai<br />
2001 ist die MPA <strong>Clausthal</strong> als eines <strong>der</strong> ersten Laboratorien weltweit <strong>für</strong><br />
Prüfungen nach den neuen Normen ISO 3310 Teil 1 (Metalldrahtgew ebe)<br />
und Teil 2 (Lochbleche) akkreditiert. Die MPA befasst sich weiterhin mit<br />
diesem Themenko m plex in <strong>der</strong> Projektgruppe ‚Ausmessen von<br />
Drahtgewebe‘, <strong>der</strong>en konstituierende Sitzung am 3. Juli 2001 im <strong>Institut</strong><br />
<strong>für</strong> <strong>Nichtmetallische</strong> <strong>Werkstoffe</strong> stattfand. In diesem Gremium sind auch<br />
Hersteller von Drahtgewe ben vertreten.<br />
6.3 Vorträge und Reisen<br />
Hinrichs, W.<br />
Rückführung und Messunsicherheit bei mechanisch- technologischen<br />
Prüfungen<br />
DAR- EUROLAB- Seminar ‚ISO/IEC 17025 <strong>für</strong> Anwen<strong>der</strong>‘<br />
Berlin, 20. März 2001<br />
6.4 Veröffentlichungen<br />
Akkreditierung <strong>für</strong> die Kalibrierung von Analysensieben / Accreditation for<br />
the calibration of analytical sieves<br />
Technische Neuheiten / New Technical Developments in:<br />
Ziegelindustrie International / Brick and Tile Industr y International<br />
9/2001, 61- 62
– 60 –<br />
Hinrichs, W.<br />
Die Bestimmung <strong>der</strong> Kornform nach DIN EN 933 Teil 4 – Ergebnisse eines<br />
Ringversuchs<br />
Die Schweizer Baustoff - Industrie /L’Industrie Suisse des Matériaux de<br />
Construction 32<br />
(2001) 4, 6- 9<br />
Hinrichs, W.<br />
Die Bestimmung <strong>der</strong> Kornform nach DIN EN 933 Teil 4<br />
Die Naturstein - Industrie 37 (2001) 6, 6- 10<br />
Abdul- Maula, S.; Görke, R.; Hinrichs, W.<br />
Analysensiebe – Die neue ISO 3310<br />
GIT Fachzeitschrift <strong>für</strong> Labortechnik 45 (2001) 5, 426- 428<br />
Hinrichs, W.<br />
Ringversuch Kornform RV 7<br />
Projektbericht, <strong>Clausthal</strong> - Zellerfeld, April 2001<br />
Hinrichs, W.<br />
Rückführung und Messunsicherheit bei mechanisch- technologischen<br />
Prüfungen<br />
Tagungsba n d DAR- EUROLAB- Seminar ‚ISO/IEC 17025 <strong>für</strong> Anwen<strong>der</strong>‘<br />
Berlin, 20. März 2001<br />
6.5 Sonstiges<br />
Die MPA <strong>Clausthal</strong> wurde Anfang 2001 als Prüf- , Überwachungs - und<br />
Zertifizierungs stelle bei <strong>der</strong> EU- Kommission notifiziert (Kenn- Nr. 0915).<br />
Auf <strong>der</strong> Grundlage dieser Notifizierung darf die MPA im<br />
Konfor mitätsnac h w eisverfahre n <strong>für</strong> Bauprodu k te tätig werden. Der<br />
Anerkennungsbereich umfasst eine Reihe von Produkten, wie z.B.<br />
Schornsteine, hydraulische Tragschichtbin<strong>der</strong> im Straßenba u und<br />
Oberflächenschutzsyste m e <strong>für</strong> Betonbauteile und Betonersatzsysteme. Die<br />
neue Rechtslage wird sich nicht unmittelbar auf die finanzielle Situation<br />
<strong>der</strong> MPA auswirken können, da bislang kaum Technische Spezifikatione n<br />
vorliegen, die <strong>für</strong> eine Aufnah me dieser Tätigkeit erfor<strong>der</strong>lich sind. Die<br />
Beantragung <strong>der</strong> Notifizierung hatte daher eher strategischen Charakter.<br />
Die MPA beschäftigt sich seit Jahren mit <strong>der</strong> Unsicher heit von<br />
Prüfergeb nissen und hat solche Resultate auch in <strong>der</strong> Prüfung im Haus,<br />
vor allem bei <strong>der</strong> Validierung, verwendet. Aufgrund dieser Erfahrungen<br />
wurde Dr. Hinrichs im Oktober 2000 vom Deutschen Akkreditieru ngsrat
– 61 –<br />
(DAR), <strong>der</strong> Dachorganisation von Akkreditierungs - stellen in Deutschland,<br />
Österreich und <strong>der</strong> Schweiz, <strong>für</strong> das Expertengre mi u m ‚Uncertainty of<br />
measure m e nt in testing‘ <strong>der</strong> European Co- operation for Accreditation (EA)<br />
benannt. Die Gruppe, an <strong>der</strong>en Diskussione n sich auch außereuropäische<br />
Organisationen beteiligen, soll ein Dokument erarbeiten, anhand dessen<br />
eine Harmonisieru ng <strong>der</strong> Anfor<strong>der</strong>unge n an die Angabe von<br />
Messunsicher heite n auf <strong>der</strong> Grundlage <strong>der</strong> ISO/IEC 17025 (Norm <strong>für</strong> den<br />
Kompetenz n ac h w eis von Laboratorien) erfolgen kann. Gleichzeitig soll<br />
das Gremium kritische Fragen zu diesem Thema diskutieren, die einer<br />
grunds ät zlichen Klärung bedürfen.<br />
Am 25./26. Juni 2001 fand im <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Nichtmetallische</strong> <strong>Werkstoffe</strong> die<br />
11. Sitzung des Arbeitsausschusses ‚PÜZ- Stellen SIB nach Bauregelliste‘<br />
statt. Dabei handelt es sich um ein Gremium, in dem alle Prüf- ,<br />
Überwachungs - und Zertifizierungss tellen <strong>für</strong> Bauprodukte versam m elt<br />
sind, die <strong>für</strong> die Sanierung und Instandsetzung von Beton eingesetzt<br />
werden. Gegenstand <strong>der</strong> Diskussione n ist <strong>der</strong> Erfahrungsaustausch <strong>der</strong><br />
auf diesem Gebiet tätigen Stellen. Er soll sicherstellen, dass diese<br />
Bauproduktgruppe nach einheitlichen Maßstäben geprüft, überwacht und<br />
zertifiziert wird. Der zentrale Diskussions p u n k t waren bislang Fragen zur<br />
Erstellung allgemeiner bauaufsichtlicher Prüfzeugnisse (abP), die die<br />
Grundlage <strong>für</strong> die Produktzertifizieru ng bilden. Bundes weit liegen<br />
inzwischen über 150 abP <strong>für</strong> Betonersatz - , Oberflächenschutz - und<br />
Rissfüllprodukte vor, die nach den Vereinbaru ngen dieses<br />
Arbeitsaussch usses in Zusam me narbeit mit dem Deutschen <strong>Institut</strong> <strong>für</strong><br />
Bautechnik, Berlin und <strong>der</strong> Bundesanstalt <strong>für</strong> Straßenwesen, Bergisch<br />
Gladbach erstellt wurden.<br />
Prüfverfahren <strong>für</strong> Siebgewebe entwickelt<br />
Dreijähriges Projekt abgeschlossen<br />
Die Materialprüfanstalt <strong>für</strong> <strong>Nichtmetallische</strong> <strong>Werkstoffe</strong> (MPA <strong>Clausthal</strong>)<br />
hat in einem dreijährigen Projekt ein Prüfverfahre n <strong>für</strong> Siebgewebe bis<br />
zur Marktreife entwickelt. Der Prüfstelle wurde daher vor kurze m als<br />
erstem Laboratoriu m in Deutschland eine Akkreditieru ng <strong>für</strong> diese Art<br />
von Prüfungen erteilt. Damit wird die Fachkompete n z international
– 62 –<br />
anerkan nt. Die Untersuchungs m e t h o de wurde in Zusam menar beit mit<br />
einem namhaften Produzenten von Metalldrahtgeweben aus Westfalen<br />
und dem <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Nichtmetallische</strong> <strong>Werkstoffe</strong> verwirklicht.<br />
Dr. Samir Abdul- Maula, Reinhard Görke und <strong>der</strong> Leiter <strong>der</strong> Prüfstelle Dr.<br />
Wilfried Hinrichs vor <strong>der</strong> neuentwickelten Anlage (v.l.n.r.)<br />
Es handelt sich um ein Verfahren zur Kalibrierung von Sieben, die in<br />
vielen Bereichen <strong>der</strong> Labortechnik benötigt werden. Die MPA baute da<strong>für</strong><br />
eine mehrdime nsional bewegliche Apparatur <strong>für</strong> mikrosko pische<br />
Aufnah me n und führte umfangreiche Tests unter Beteiligung von über<br />
hun<strong>der</strong>t Labors aus Deutschland und dem europäische n Ausland durch.<br />
Dabei war vor allem <strong>der</strong> Nachweis wichtig, dass eine messtechnische<br />
Überprüfung von Sieben auch wirklich zu sichereren Ergebnissen bei<br />
Analysensiebungen führt. Das war in diesem Fall beson<strong>der</strong> s wichtig, weil<br />
die Kosten <strong>für</strong> die Kalibrierung hoch sind im Verhältnis zu den einfachen<br />
Prüfungen, wie sie z.B. <strong>für</strong> Baustoffe durchgeführt werden.<br />
Das <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Nichtmetallische</strong> <strong>Werkstoffe</strong> erarbeitete die Messsoftware,<br />
während <strong>der</strong> Drahtgew ebe h ersteller das notwendige Know - how über<br />
Siebe zur Verfügung stellte. Aufgrund <strong>der</strong> Bedeutung <strong>der</strong><br />
Analysensiebung <strong>für</strong> die Laborpraxis wurde bereits eine Vielzahl von
– 63 –<br />
Produkt zertifikate n <strong>für</strong> Kunden erstellt. Die mit dem Projekt gemachte n<br />
Erfahrunge n sind zum Teil in die internationale Normung eingeflossen.<br />
Aus: Goslarsche Zeitung, 03. Juli 2001
– 62 –<br />
7 Aus <strong>Institut</strong> und Hochschule<br />
7.1 Große Herbstexkursion 2000<br />
Unter <strong>der</strong> Leitung von Herrn Prof. Frischat ging es am Sonntagnach mittag<br />
bei herrlichste m Wetter mit einem nicht mehr ganz taufrischen Clubbus<br />
auf die Reise. Unser Busfahrer mußte allerdings schon in <strong>Clausthal</strong> von<br />
<strong>der</strong> günstigsten Fahrt route überzeugt werden, brachte uns danach aber<br />
ohne weitere Wi<strong>der</strong>worte unsere m Ziel Mainz entgegen. Währenddessen<br />
wurde das Wetter immer clausthalerischer, also grauer und wolkiger. In<br />
Mainz angeko m m e n, war es erstens dunkel und zweitens regnete es in<br />
Strömen, also ganz wie in <strong>Clausthal</strong>.<br />
Wenigstens hatten die Organisatore n Dr. Roland Heidrich und Ulf Hoff -<br />
mann mit <strong>der</strong> Auswahl <strong>der</strong> Mainzer Jugendherberge als „Basislager“ <strong>für</strong><br />
die Exkursions woc he eine gute Wahl getroffen. Alles renoviert, Zimmer<br />
mit eigenem Bad und ein eigener Hausschlüssel <strong>für</strong> jeden waren schon<br />
ganz angenehm. In einigen Zimmern gab es sogar eine schöne Aussicht<br />
auf den Rhein.<br />
Und – <strong>Clausthal</strong> ist eben überall – wir wurden von zwei Ehemaligen (Frau<br />
Ulrike Beer und Herr Stefan Priller) schon an <strong>der</strong> Jugendherberge in Emp -<br />
fang genomme n und in den Augustinerkeller in <strong>der</strong> Mainzer Innensta dt<br />
geführt, wo ein großer Tisch <strong>für</strong> das Abendessen reserviert war. Nicht nur<br />
Flammkuche n und Fe<strong>der</strong>weißer waren ausgezeichnet.<br />
Auch die Wahl von Mainz als Ort <strong>für</strong> das Basislager war sehr vorteilhaft,<br />
weil die Innensta dt erstens sehr schön ist (Dom, Chagall- Fenster in <strong>der</strong><br />
Kirche St. Stephan, Fußgängerzo ne / A u g u s tinerstra ß e) und zweitens<br />
einiges bietet, um die anstrengende n Exkursionstage in gemütlicher<br />
Runde ausklingen zu lassen.
– 63 –<br />
Neben dem schon erwähnten Augustiner keller sind hier beson<strong>der</strong>s das<br />
Brauhaus Eisgrub mit selbstgebra ute m Meterbier und die Weinstube Lösch<br />
zu nennen, sowie auch zwei Irish Pubs.<br />
Aber Obacht! Da es den Anschein hat, daß es sich <strong>der</strong> gemeine Mainzer<br />
schon ab dem frühen Nachmittag bei Bier o<strong>der</strong> Wein gemütlich macht, ist<br />
rechtzeitiges Erscheinen o<strong>der</strong> Tischreser vierung dringend angeraten und<br />
<strong>für</strong> den Weg zurück zur Jugendhe r berge sind ca. DM 14,- <strong>für</strong> ein Taxi o<strong>der</strong><br />
ca. DM 4,- <strong>für</strong> den Bus o<strong>der</strong> ca. 20 Minuten Fußweg einzuplane n.Wobei <strong>der</strong><br />
Fußweg am Rhein entlang, über die Fußgänger - / Eisenbahnbrücke und<br />
dann hinauf durch den Bürgerpark, auf jeden Fall seinen Reiz hat.<br />
Kommen wir nun zum Besuchsprogram m. Hier im Überblick:<br />
Vormittag<br />
Nachmittag<br />
Montag,<br />
den 09.10.<br />
Veitsch-<br />
Radex<br />
Bericht:<br />
Haas<br />
Oberland<br />
Glas<br />
Bericht:<br />
Trai- Ukos<br />
Dienstag,<br />
den 10.10.<br />
Schott Glas<br />
Bericht:<br />
Ritter<br />
Heidelberg<br />
er Zement<br />
Bericht:<br />
Fakhiri<br />
Mittwoch,<br />
den 11.10.<br />
Chamotte-<br />
& Tonwerk<br />
Kurt<br />
Hagenburger<br />
Bericht:<br />
Wolf<br />
Corning<br />
Bericht:<br />
Leschik<br />
Donnerstag<br />
,<br />
den 12.10.<br />
Glashütte<br />
Budenheim<br />
Bericht:<br />
Buksak<br />
Kulturpro -<br />
gram m<br />
Kloster<br />
Eberbach<br />
Bericht:<br />
Wilm<br />
Freitag,<br />
den 13.10.<br />
Otto<br />
Schott-<br />
Forschungs<br />
-<br />
zentrum<br />
Bericht:<br />
Krzyzak<br />
Heimfahrt<br />
Da zu den Firmenbes uche n jeweils Einzelberichte vorliegen, sollen an<br />
dieser Stelle nur einige allgemeinere Punkte erwähnt werden. Wichtig ist<br />
natürlich immer die Qualität <strong>der</strong> Führung und die Bewirtung.<br />
Den Beginn des Besuchsprogra m m e s bildete die Firma Veitsch - Radex. Mit<br />
herrlicher Aussicht auf das nie in Betrieb gegangene KKW Mühlheim - Kär -<br />
lich befindet sie sich in Urmitz bei Koblenz. Auf <strong>der</strong> Fahrt dorthin gab es<br />
sogar ein paar schöne Blicke auf das Moseltal zu erhaschen.<br />
In <strong>der</strong> Firma bekame n wir einen Einblick in die Fertigung und den Einsatz<br />
von Feuerfestmaterialien, sowie die Einbindung <strong>der</strong> Firma in einen Kon -<br />
zern und die daraus resultierenden Anfor<strong>der</strong>u nge n und Än<strong>der</strong>unge n.
– 64 –<br />
Während <strong>der</strong> Diskussion, <strong>für</strong> die sogar gleich mehrere Herren bereit<br />
standen, wurde berichtet, daß es im Konzern sogar eine ganze <strong>Clausthal</strong>er<br />
„Fraktion“ gibt. Also, auch hier ist <strong>Clausthal</strong>! Es gab eine Getränkeauswahl<br />
von Kaffee bis Apfelsaft und ein ordentliches Mittagessen in <strong>der</strong> Kantine.<br />
Die nächste Station war Oberland Glas in Wirges, wo wir von Herrn Dr.<br />
Franek (ebenfalls ein ehemaliger <strong>Clausthal</strong>er) mit inzwischen reichlich Be-<br />
rufserfahru n g begrüßt wurden. Hier gab es eine recht mo<strong>der</strong>ne Hohlglas -<br />
fertigung nebst Qualitäts ko ntrolle und vollautomatischem Versandlager<br />
zu sehen, außer de m die Herstellung von Glasbausteinen inklusive „Cat<br />
scratch“ - Problematik. Einen Glasbaustein bekamen wir sogar <strong>für</strong> die In -<br />
stitutssa m mlung. Alles unter Haarnetzpflicht.<br />
Oberland gehört zur Saint Gobain - Gruppe und über die wurde ein Video<br />
vorgeführt, in welchem auch wie<strong>der</strong> eine ehemalige <strong>Clausthal</strong>erin zu se -<br />
hen war. <strong>Clausthal</strong> ist echt überall. Informative Betreuung und gute Be-<br />
wirtung waren selbstverständlich.<br />
Am Dienstag konnten wir etwas länger schlafen, weil die erste Station –<br />
Schott Glas in<br />
Mainz – quasi direkt vor <strong>der</strong> Haustür lag. Auch bei Schott gab es natürlich<br />
<strong>Clausthal</strong>er...<br />
Schott war die Firma mit <strong>der</strong> am professionellsten gemachten Führung.<br />
Man merkte, daß bei Schott häufiger Besucher zu Gast sind. So gab es z.B.<br />
nur hier Funkkopf hörer, damit währen d <strong>der</strong> Führung durch den Betrieb<br />
je<strong>der</strong> die Erklärungen des Betreuers hören konnte. Es wurde haupt -<br />
sächlich die Bearbeitung von Spezialglas und Glaskera mik und die Ferti -<br />
gung von TV- Bildröhre n gezeigt. Dazu ein Film und als Abschlu ß die<br />
Schott- Produktschau. Insgesa mt also ein Überblick über das was Schott<br />
ist und tut.<br />
Lei<strong>der</strong> waren bei <strong>der</strong> Betriebsführ u ng gerade die interessantesten Be-<br />
arbeitungsmasc hine n hinter Vorhängen versteckt. Die Bewirtung war gut<br />
und zum Abschied gab es <strong>für</strong> jeden eine Tüte mit Informationsmaterial<br />
und einer kleinen Blumenvas e.
– 65 –<br />
Ein kurzes Stück außerhalb von Mainz direkt am Rhein lag das Besichti -<br />
gungsziel <strong>für</strong> den Nachmittag: Das Werk Weisenau <strong>der</strong> Heidelberger Ze-<br />
mentwer ke. Hier wurden wir von einem jüngeren Betriebsleiter und dem<br />
Leiter des Labors (einem „alten Hasen“) kompetent und freundlich betreut.<br />
Es gab die übliche Vorstellung des Unterneh m e n s und eine Führung über<br />
das Betriebsgelände inklusive Geländeeinlage mit blauem Baggersee. Ein<br />
Kamerablick in den Drehrohrofen war so etwa das spektakulärste was es<br />
zu sehen gab. Zum Ausgleich zauberten Sonne und Regen einen herrlichen<br />
Regenbogen an den Himmel. Als Abendbrot wurde eine Brühwurst von<br />
wirklich stattlichem Kaliber und Wein vom firmeneigenen Weinberg ser -<br />
viert.<br />
Eine Autobahnfahrt bei trübem Regenwetter brachte uns am Mittwoch -<br />
morgen zum Chamotte - und Tonwerk Kurt Hagenburger in Grünstadt.<br />
D.h. erstmal brachte sie uns an eine Stelle, wo mal ein Chamotte - und<br />
Tonwerk gewesen ist. Dank fachkundiger Auskunft eines Einheimische n<br />
erreichten wir schließlich doch unser Ziel.<br />
Die Firma Hagenburger stellt Feuerfest materialien <strong>für</strong> verschiede nste<br />
Anwendungen her und ist im Gegensatz zu allen bisher besuchten Firmen<br />
ein mittelständischer Betrieb in Familienbesitz. Weshalb wir die Ehre<br />
hatten, vom Chef und Eigentümer, Herrn Dr. Hagenburger persönlich be -<br />
treut zu werden. Obendrein ist auch Dr. Hagenburger in <strong>Clausthal</strong> zur<br />
„Schule“ gegangen. Also, auch hier ist <strong>Clausthal</strong>.<br />
Diesmal war aber we<strong>der</strong> die Vorstellung des Betriebes noch <strong>der</strong> Rundgang<br />
wirklich wichtig, son<strong>der</strong>n vielmehr die Sorge um den iranische n Gast Is-<br />
mael Salahi in unserer Exkursionsgr u p pe, <strong>der</strong> kurz nach Beginn unseres<br />
Besuchs mit Verdacht auf Nierenkolik ins Kranken haus gebracht werden<br />
mußte. Dank ärztlicher Kunst, <strong>der</strong> tatkräftigen Unterstützung durch die<br />
Firma Hagenburge r, <strong>der</strong> guten Beziehungen von Frau Bruns im heimatli -<br />
chen <strong>Institut</strong>ss ekre tariat zur AOK und Roland Heidrich, <strong>der</strong> alles per<br />
Handy im Griff hatte, konnten wir unseren Iraner am Nachmittag auf <strong>der</strong><br />
Rückfahrt nach Mainz mit wesentlich mehr Farbe im Gesicht wie<strong>der</strong> in<br />
Empfang nehmen.
– 66 –<br />
Ihm war es wohl „wurscht“, aber eines <strong>der</strong> kulinarische n Highlights hat<br />
unser iranischer Freund verpa ßt, nämlich das von Herrn Dr. Hagenburger<br />
spendierte Mittagessen in <strong>der</strong> Strausswirtsc haft im Weingut Helmut<br />
Schubing in Bockenheim. In urgemütlicher Atmosphäre wurde dort ausge -<br />
zeichneter Wein kredenzt und dazu wirklich lecker zubereitete Pfälzer<br />
Spezialitäten von Saumagen bis Bratwurst serviert. Wer hätte erwartet,<br />
daß Saumagen so gut schmecken kann?<br />
Gut gestärkt stiegen wir wie<strong>der</strong> in den Bus und fuhren Richtung<br />
Kaiserslautern. Den Fußballfan wird interessieren, daß es lei<strong>der</strong> nur einen<br />
kurzen Blick von <strong>der</strong> Autobahn aus auf den „Betze“ gab, weil unser Ziel,<br />
die Firma Corning, außer halb von Kaiserslautern ziemlich auf <strong>der</strong> grünen<br />
Wiese angesiedelt ist. Durch die nahegelegene US- Basis spürte man einen<br />
Hauch von Amerika in <strong>der</strong> Gegend. Als große US- amerikanische Firma hat<br />
man sich daher wahrscheinlich nicht zufällig mit seinem Zweigwerk hier<br />
nie<strong>der</strong> gelassen.<br />
Das Werk ist ziemlich neu und kann durchaus als High Tech- Betrieb be -<br />
zeichnet werden, <strong>der</strong> einzig und allein Keramiks ubstrate <strong>für</strong> Auto- Abgas -<br />
katalysatore n herstellt. Das aber mit höchster Effizienz.<br />
Zunächst wurde uns von Herrn Krause (kein <strong>Clausthal</strong>er) freundlich und<br />
kompetent <strong>der</strong> Corning Konzern insgesamt und dann speziell die Kataly -<br />
satorfertigung vorgestellt. Zur Stärkung gab es Kaffee, das nun schon ge -<br />
wohnte Saftangebot und Kekse. Anschließend ging es von Anfang bis<br />
Ende des Produktionsweges durch den Betrieb. Es wurde alles erklärt und<br />
auch auf Fragen eingegange n soweit nicht wichtiges Know How betroffen<br />
war. Am Ende des Rundganges bekam je<strong>der</strong> einen Cookie, also eine<br />
Scheibe von einem Katalysatorträger, die durchaus Ähnlichkeit mit<br />
Waffelgebäck hat.<br />
Am Donnerstag schien die Sonne, als wir uns auf den kurzen Weg zur<br />
Glashütte Budenheim machten. Hier hatten wir es mit einem etwas be -<br />
jahrteren Hohlglas - Produktionsbetrieb zu tun (kein Betreuer aus Claust -<br />
hal!), wo es eigentlich wenig neues zu sehen gab. Mit Ausnah m e einer<br />
stillgelegten aber nicht abgebauten Glaswanne, in die wir sogar hinein ge -
– 67 –<br />
hen konnte n. Dies war allerdings mal ein Einblick den es wirklich nur<br />
sehr selten gibt. Man kam sich in etwa vor wie in einer Tropfsteinhöhle<br />
mit einem zu gefrorene n See darin. Nur war <strong>der</strong> „See“ aus Glas und die<br />
„Tropfsteine“ bestanden aus angesch molzene m Feuerfest material. Sehr<br />
eindrucksvoll war auch <strong>der</strong> starke Abtrag <strong>der</strong> Ausmaueru n g in Höhe <strong>der</strong><br />
Spülkante zu sehen. Kurz und gut, hier war <strong>der</strong> adäquate Hintergr u nd <strong>für</strong><br />
ein Gruppenfoto.<br />
Unsere nächste Etappe führte uns zu dem ehemaligen Zisterzienserkloster<br />
und jetzigen Staatsweingut Eberbach, wo wir ausgezeichnet und in sehr<br />
gediegener Atmosphäre unser Mittagessen zu uns nahmen.<br />
Kloster Eberbach war <strong>der</strong> Kulturteil unserer Exkursion und hatte mit Glas<br />
nur insoweit zu tun, als je<strong>der</strong> eines bekam, um bei <strong>der</strong> von Frau Françoise<br />
Schütz sehr unterhaltsa m und fachkundig geführten Schlen<strong>der</strong>weinprobe<br />
die verschiede nen Lagen und Qualitäten schlürfen zu können.<br />
Eine Weinprobe kombiniert mit einer Besichtigung, also zu jedem Wein ein<br />
an<strong>der</strong>es Ambiente bis hin zum Messwein in <strong>der</strong> Klosterkirche, ist wirklich<br />
eine angenehme Art Kultur zu genießen und wärms te n s zu empfehlen.<br />
Klar, daß anschließe n d auch <strong>der</strong> Weinverka uf guten Umsatz zu verzeich -<br />
nen hatte.<br />
Am letzten Morgen (es war Freitag <strong>der</strong> 13.) hieß es nach dem Frühstüc k<br />
Klamotten packen, alles wie<strong>der</strong> in den Bus laden und auf zum letzten<br />
Besichtigungste r min. Wobei <strong>der</strong> Busfahrer losfuhr ohne den Kofferrau m<br />
zu schließen. Nur <strong>der</strong> Aufmerksamkeit <strong>der</strong> Passagiere in <strong>der</strong> letzten Reihe<br />
war es zu verdanke n, daß unser Gepäck nicht gleichmäßig in Mainz ver -<br />
teilt wurde. Vor allem um den Wein wäre es schade gewesen. Weiteres<br />
Pech blieb uns zum Glück erspart.<br />
Das Schott Forschungszentru m auf dem Lerchenberg, gleich neben den<br />
Funkhäusern von ZDF und SAT1 war unser letztes Besichtigungsziel. Hier<br />
begrü ßte uns in Frau Beer auch wie<strong>der</strong> eine <strong>Clausthal</strong>er Absolventin. Nach<br />
einem kleinen Einführu ngsvort r ag von Frau Beer wurde uns ein neues,<br />
sehr gut ausgestattetes Forschungsze nt r u m gezeigt und einige inter -
– 68 –<br />
essante Forschungsprojekte vorgestellt. Es schloß sich eine aufschlu ß r ei -<br />
che Diskussion an.<br />
Gestärkt durch ein ausgezeichnetes Mittagessen in <strong>der</strong> nagelneuen Kan -<br />
tine hieß es dann „auf nach Norden in die rauhen Harzer Höhen!“ ...<br />
...die unser Bus nach überstande n e r Fahrt durch die „Hölle“ bei Northeim<br />
mit dem letzten Schnaufer im ersten Gang erklom m, um uns schließlich<br />
wie<strong>der</strong> in <strong>Clausthal</strong> abzuliefern.<br />
Beson<strong>der</strong>s erwähnt seien an dieser Stelle noch einmal Dr. Roland Heidrich<br />
und<br />
Dipl.- Ing. Ulf Hoffmann, die nicht nur <strong>für</strong> die gelungene Organisation <strong>der</strong><br />
Exkursion sorgten, son<strong>der</strong> n sich auch noch als „Scouts“ betätigen mußte n,<br />
weil sonst <strong>der</strong> Busfahrer selbst beim fünften Mal den Weg durch Mainz<br />
nicht gefunde n hätte, von an<strong>der</strong>en Zielen gar nicht zu reden.<br />
Es sei ihnen mit einem kernigen „Glück auf“ gedankt, ebenso wie Herrn<br />
Prof. Frischat <strong>für</strong> die freundliche Übernahme <strong>der</strong> Exkursionsleitung. (Be-<br />
richt: T. Peter)
– 69 –<br />
Die Exkursionsgru p pe in einer stillgelegten Schmelzwanne.<br />
7.2 <strong>Institut</strong>sweihnachtsfeier 2000<br />
Die Weihnachtsfeier 2000 wurde von <strong>der</strong> Arbeitsgruppe Bindemittel und<br />
Baustoffe vorbereitet und fand am 13. Dezember statt. Neu war in diesem<br />
Jahr, daß ein Kuchen - und Keksbackwettbe w e r b stattfand. Mitarbeiter des<br />
<strong>Institut</strong>s konnten sich in eine Liste eintragen und dann zur Feier ihre<br />
eigenen Kreationen mitbringe n. Die Jury bestand aus den Mitspielern<br />
selbst.<br />
Um 15 Uhr startete die Feier im dekorierte n Seminarrau m des <strong>Institut</strong>es.<br />
Zur musikalischen Untermalung <strong>der</strong> Weihnachtsfeier trugen Herr Dr. Dörr<br />
und Herr Lechner auf Violine und Klarinette bei und natürlich alle Mit-<br />
Im Bild: Herr Lechner u n d Herr Dr.<br />
arbeiter durch ihren Dörr.<br />
herrlichen Gesang.
– 70 –<br />
Nach einem kurzen „offiziellen Teil“ wurden Kaffee, Tee und Kuchen ge -<br />
nossen und auch die mitgebrachten Leckereien bewertet. Dabei waren<br />
Kriterien wie etwa: „Die Härte (gemessen mit Fingernageleindruc k tiefe)<br />
läßt Gebisse ganz“ o<strong>der</strong> „Farbgebung erinnert an Adventssch m uc k“, maß -<br />
gebend. Die meisten Punkte konnte Frau Ahlers erzielen und als Gewinn -<br />
prämie durfte sie noch ein extra Stück ihres prämierte n Kuchens essen.<br />
Nachdem auch die letzten Brösel <strong>der</strong> an<strong>der</strong>en hervorragen den Bäckereien<br />
vertilgt waren, folgte auf den gemütlichen Teil <strong>der</strong> Feier <strong>der</strong> noch gemüt -<br />
lichere. Selbstge mac hter Glühwein wurde genossen und ein von Frau Ah -<br />
lers vorbereitetes Memory gespielt - man sah die angestrengten Köpfe<br />
rauchen.<br />
Der harte Kern sang später noch ein paar Lie<strong>der</strong> mit Gitarrenbegleitung<br />
und zu guter Letzt wurde Pizza bestellt, was inzwischen ein fixer<br />
Bestandteil <strong>der</strong> Feier geworde n ist. Gegen 23 Uhr wurde grob aufgeräu mt<br />
und <strong>der</strong> Rest fleißigen Helfern des nächsten Tages überlassen.<br />
Alexan<strong>der</strong> Lechner
– 71 –<br />
7.3 <strong>Institut</strong>s- und MPA- Wan<strong>der</strong>tag 2001<br />
Am 25. September 2001 fand <strong>der</strong> gemeinsa me Wan<strong>der</strong>tag des <strong>Institut</strong>s<br />
und <strong>der</strong> MPA statt. Die Teil -<br />
nehmerz a hl war in diesem<br />
Jahr rekordverdächtig, denn<br />
es hatten sich 38 Personen<br />
am Kronenplatz einge -<br />
funden, um pünktlich gegen<br />
kurz nach halb neun mit<br />
dem Linienbus nach Al-<br />
tenau - Silberhütte zu<br />
starten, wo bereits Frau<br />
Bruns auf die Wan<strong>der</strong>er<br />
wartete. Viele hatten sich in<br />
Anbetracht des Wetters <strong>der</strong> vorangegange nen Tage mit Regenschir m e n<br />
ausgerüstet, die zum Glück nicht benötigt wurden und somit nur zur Fit -<br />
ness <strong>der</strong> Besitzer beitrugen. Bei angeneh m kühlen Temperaturen zeigte<br />
sich im Laufe des Tages immer öfter die Sonne und zu warme Tempera -<br />
turen wären auch nicht gut gewesen, da uns noch warm genug werden<br />
sollte. Nun ging es los. Entlang des Ufers <strong>der</strong> Okertalsperre wan<strong>der</strong>ten wir<br />
erst am Rand <strong>der</strong> Vorsperre, dann ca. zwei Kilometer entlang <strong>der</strong> Haupt -<br />
sperre bis zum Kleinen Ahrendsberg. Unterwegs verfielen nach wenigen<br />
Metern bereits Ulrike Ahlers und Milada Zimova dem Pilzfieber, das wäh -<br />
rend <strong>der</strong> gesamte n Wan<strong>der</strong>ung nicht geheilt werden konnte. Die Pausen<br />
wurden aber regelmä ßig genutzt, um Bonbons zu verteilen und immer<br />
wie<strong>der</strong> war <strong>der</strong> Ruf „Tooorsten“ zu verneh me n, <strong>der</strong> daraufhin herbeieilte,<br />
um, einem Bernhardiner gleich, die Flasche mit dem Obstbran d hervor zu -<br />
holen und die Stimmung einiger MPA- Mitarbeiter noch weiter ver -<br />
besserte, was eigentlich gar nicht mehr möglich schien. Die in <strong>der</strong> Zwi -<br />
schenzeit gesam melten Pilze erweckte n in einigen Fällen bei manch einem<br />
den Eindruck, daß nach dem Genuß <strong>der</strong> Pilze auch nur noch <strong>der</strong> Ruf nach<br />
Torsten helfen würde. Nachdem wir uns auf den ersten Kilometer n warm -<br />
gewan<strong>der</strong>t hatten, wurde es Zeit <strong>für</strong> eine kleine Steigerung in Form eines<br />
Anstiegs über ca. 1 km Länge, bei einem Höhenunterschied von 120 m,<br />
um den ersten Rastplatz <strong>der</strong> Wan<strong>der</strong>ung am Waldjugendhei m Ahrends -<br />
berg zu erreichen. Das Teilnehmerfeld zog sich, wie bei
– 72 –<br />
<strong>der</strong> Tour de France auf <strong>der</strong> ersten Alpenetappe, gewaltig in die Länge, aber<br />
schließlich erreichten doch alle das erste Ziel und hatten die stillen Flüche<br />
auch bereits wie<strong>der</strong>, in Vorfreude auf den kleinen Imbiß, vergesse n.<br />
Angrenzend an das Waldjugend heim Ahrendsberg wurde eine Grillhütte<br />
und eine weitere Sitzgelegenheit im Freien bezogen. Mit einer gesunden<br />
Gesichtsfarbe sind daraufhin die mitgebrachten Brote, Würste und sons -<br />
tigen Stärkungen aus den<br />
Rucksäcken hervorgeholt<br />
und die gesammelten Pilze<br />
bestaunt worden. Einige<br />
Wan<strong>der</strong>er nutzten <strong>der</strong>weil<br />
die Gelegenheit, um im<br />
Waldjugendhei m Pilse(ner)<br />
zu suchen und wurden<br />
schnell fündig.<br />
Gestärkt konnten wir nun in<br />
einem Quiz unsere geistigen<br />
Fähigkeiten unter Beweis<br />
stellen, bei dem verschiede ne heimische und weniger heimische<br />
Baumarten anhand ihrer Blätter bzw. Nadeln erkannt und den entspre -<br />
chenden Namen zugeord net werde n sollten. Obwohl wir mitten im Wald<br />
saßen, erkannten einige die Baumarten vor lauter Wald nicht mehr. Es<br />
wäre einfacher gewesen wenn die Förster ein paar Douglasien und Bergul -<br />
men an unseren Wan<strong>der</strong>weg<br />
gepflanzt hätten. Die Nord -<br />
manntanne kann ten viele be -<br />
stimmt noch von Weihnach -<br />
ten. Alle sonst gefragten Bäu -<br />
me waren, <strong>für</strong> jemande n <strong>der</strong><br />
im Harz lebt, zu bewältigen<br />
und zur Not konnte ein Zweig<br />
aus dem angrenze n d e n Wald<br />
vergleichend herangezogen<br />
werden. Das Quiz fiel trotz -<br />
dem sehr gut aus, weshalb<br />
wenige Fehler nicht zu einer Urkunde reichten. Gleich vier größere
Gruppen überzeugten mit null<br />
Fehlern.<br />
– 73 –<br />
Nach einer längeren Rast ging es auf dem Salzstieg weiter, bis wir, nach<br />
etwas mehr als drei Kilometern, Richtung Westen zur Käste abgeboge n<br />
sind, die wir pünktlich zum Mittagessen erreichten. Nach dem Essen er -<br />
folgte die Siegerehrung <strong>für</strong> das Quiz, wo sich die Gewinner über eine<br />
Urkunde und Sachpreise in Form von je drei Likörfläschchen je siegrei -<br />
cher Gruppe freuen durften. Nach <strong>der</strong> Besteigung <strong>der</strong> Kästeklippen, die<br />
absolut harmlos <strong>für</strong> uns, inzwischen aufstieggeübte Wan<strong>der</strong>er, verlief, bot<br />
sich ein herrlicher Blick über das Okertal, die angrenze n de n Bergrücken,<br />
hinweg über die unter uns liegenden Klippen, bis hinunter nach Oker. Vor<br />
uns war die Felsformation „Der Alte vom Berg“, eine Laune <strong>der</strong> Natur in<br />
Form eines menschliche n Kopfes im Profil, aus Granit zu erkennen.<br />
Viele hatten zuerst nur das<br />
Hinweisschild neben<br />
Professor Frischat gesehen<br />
und schmunzelten, als<br />
Professor Frischat auf sich<br />
wies. Von den Kästeklippen<br />
ging die Wan<strong>der</strong>ung weiter,<br />
vorbei an <strong>der</strong> Hexenküc he<br />
und <strong>der</strong> Mausefalle, bis zur<br />
Feigenbau m s klippe. Alle -<br />
samt sehenswerte Fels -<br />
formationen aus Granit mit<br />
typischer Wollsackver witter u ng. An <strong>der</strong> Feigenbaumsklippe bot sich uns<br />
noch einmal ein schöner Blick über das Okertal, bevor wir uns auf den<br />
Abstieg Richtung Romkerhaller Wasserfall, machten. Eine ungeplante<br />
Än<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Abstiegsroute, aus Rücksicht na h m e auf Fuß- und Kniege -<br />
schädigte, erwies sich als längerer Umweg, um letztendlich doch den stei -<br />
len, teilweise nassen Geröllweg ins Tal nehmen zu müssen. Da wir aber<br />
ohnehin noch Zeit hatten, bis wir vom bestellten Bus in Romkerhalle<br />
abgeholt werden konnten, kam <strong>der</strong> kleine Umweg im strahlende n Sonnen -<br />
schein am Berghang <strong>der</strong> Großen Romke sehr gelegen. Nach und nach er -<br />
reichten alle Teilneh mer den bereitstehe n d e n Bus, so daß wir gegen<br />
viertel vor fünf in <strong>Clausthal</strong> eintrafen. Es war wie<strong>der</strong> einmal ein ge -<br />
lungener <strong>Institut</strong>s - und MPA- Wan<strong>der</strong>tag, den Reinhard Görke, unterstützt
durch Angelika Mühlhan<br />
und Torsten Prescher,<br />
perfekt vorbereitet hat.<br />
Bericht: Andre Bertram<br />
– 74 –
7.4 Sonstiges<br />
Dr.- Ing. Peter Thormann 70 Jahre<br />
– 75 –<br />
Am 17.07.2001 vollendete Dr. Peter Thorma n n sein 70. Lebensjahr. Ehe -<br />
malige, <strong>Institut</strong>sange hörige und Freunde gratulierten ihm, <strong>der</strong> sich bester<br />
Gesundheit erfreut, zu seinem Ehrentag. Peter Thormann ist in den<br />
vergangene n Jahren <strong>der</strong> Harzregion treu geblieben. Nach seinem Abitur<br />
am Ratsgym n a siu m Goslar begann er 1951 sein Studium im Fachgebiet<br />
Steine und Erden an <strong>der</strong> damaligen Bergakade mie <strong>Clausthal</strong>. In dieser Zeit<br />
hatte er in insgesa mt dreijähriger praktischer Tätigkeit elf verschiedene,<br />
einschlägige Betriebe <strong>der</strong> Steine - und Erdenindust rie kennengelernt. Nach<br />
Abschluss seines Studiums war er ein Jahr als Projektingenieur bei <strong>der</strong><br />
Weserhütte AG in Bad Oeynhausen tätig und ging 1958 als wissensc haftli -<br />
cher Assistent an das <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> Steine und Erden zu Prof. Lehmann nach<br />
<strong>Clausthal</strong> zurück, wo er zunächst maßgeblich am Aufbau des neuen In -<br />
stituts <strong>für</strong> Steine und Erden in <strong>der</strong> Zehntnerstra ß e beteiligt war. Seine<br />
Promotion, die er 1964 mit <strong>der</strong> Benotung „sehr gut“ abschloss, hatte Un -<br />
tersuchungen über den Einfluss <strong>der</strong> Kalksteingrö ß e auf die Klinker mine -<br />
ralbildung zum Inhalt. Seit 1963 bis zu seinem Ausscheide n aus dem ak -<br />
tiven Dienst 1996 war er Oberingenieur am <strong>Institut</strong>. In dieser Zeit war er<br />
aktiv an Vorlesunge n und Seminaren (Technologie und Grundlagen <strong>der</strong><br />
NAW, Gewinnu ng und Aufbereitung, Projektierung von Anlagen <strong>der</strong><br />
Steine- und Erdenindustrie) beteiligt. Er war langjähriges Mitglied des<br />
Redaktionsausschusses <strong>der</strong> Tonindustrie - Zeitung und Keramischen<br />
Rundscha u und Fachberater des Taschenbuches <strong>für</strong> Grubenbea m te <strong>für</strong><br />
den Bereich „Tagebautechni k“.<br />
15 Jahre lang war Peter Thormann aktiv in verschiede nen Ausschüssen<br />
und Arbeitskreise n des Fachnor me n a usschusses Materialprüfung (FNM)<br />
zur Erarbeitung von deutschen und europäische n Normen tätig. Neun<br />
Kontakt - Studienve ra nstaltu nge n <strong>für</strong> Führungskräfte aus Industrie und<br />
Wirtschaft hat er zusam me n mit den Professore n Lehmann, Hennicke, Locher,<br />
Leschonski und Jeschar organisiert und geleitet. Schon früh erkann -<br />
te er die Notwendigkeit, Schüler <strong>für</strong> ein Ingenieurstu diu m zu interessieren<br />
und gab in den Jahren 1975 - 96 Unterricht in Technologie an <strong>der</strong> hiesigen<br />
Robert - Koch- Schule <strong>für</strong> die Fachgebiete Werkstoffku n d e, Glas – Keramik<br />
– Baustoffe. Ein beson<strong>der</strong>es Anliegen war <strong>für</strong> ihn die För<strong>der</strong>ung des Nach -<br />
wuchses. Die Aufstellung von Ausbildungspläne n (Blätter zur Berufs -<br />
kunde <strong>der</strong> Steine- und Erdenindustrie) sowie die langjährige Studienbera -<br />
tung und Studentenbetreuu ng waren bei ihm in guten Händen. Im Jahre<br />
1978 gab er zusam me n mit Prof. Hennicke erstmalig den „Segerkegel“<br />
heraus, um unsere Ehemaligen über die jährliche Tätigkeit des <strong>Institut</strong>es<br />
<strong>für</strong> <strong>Nichtmetallische</strong> <strong>Werkstoffe</strong> und <strong>der</strong> <strong>TU</strong> <strong>Clausthal</strong> zu informieren und
– 76 –<br />
um damit den wichtigen Kontakt zur einschlägigen Industrie aufrecht zu<br />
erhalten und zu för<strong>der</strong>n.<br />
Rückblicke nd haben das <strong>Institut</strong> und seine Ehemaligen Peter Thorma n n<br />
<strong>für</strong> seinen langjährigen aktiven Einsatz viel zu verdanke n.<br />
Wir wünschen Peter Thormann <strong>für</strong> die kommende n Jahre vor allem<br />
Gesundheit und den Erhalt seiner sportlichen Aktivitäten, um möglichst<br />
noch lange auch seinem ungewöhnlichen Hobby, Motorradfahren auf Old -<br />
timern (Horex, Honda, BMW) nachgehen zu könne n.<br />
K.- J. Leers
18.08.200<br />
1<br />
– 77 –<br />
„Ist das irgend etwas mit Töpfern?“<br />
In <strong>Clausthal</strong>- Zellerfeld werden Fachleute <strong>für</strong> <strong>Werkstoffe</strong> ausgebildet /<br />
Kleine Lerngruppen / Von Volker Hagemeister<br />
Professor Albrecht Wolter weiß gar nicht, wo er beginnen soll, wenn er<br />
nach den Vorteilen eines Studiums bei ihm ge fragt wird. „Ich brauche zum<br />
Beispiel über haupt keine Zeiten <strong>für</strong> Sprechstu n de n fest zulegen, da ich so -<br />
wieso ständig <strong>für</strong> jeden Studenten erreichbar bin.“ Was zunächs t an einer<br />
deutschen Universität undenkbar erscheint, funktioniert an <strong>der</strong><br />
Technischen Universität <strong>Clausthal</strong> - Zellerfeld tatsäch lich. Denn Studenten<br />
sind Mangelware bei Professor Wolter. 34 zählt <strong>der</strong>zeit sein Fach bereich;<br />
<strong>für</strong> sie sind drei Professoren zustän dig. „Glas, Keramik, Bindemittel“ heißt<br />
<strong>der</strong> Studiengang, und es ist sogar schon ein mal vorgeko m m e n, daß sich in<br />
einem Seme ster niemand da<strong>für</strong> eingeschrieben hat. „Die meisten jungen<br />
Leute orientieren sich bei <strong>der</strong> Studienwahl an ihren Freun den, so daß es<br />
immer wie<strong>der</strong> Modefächer gibt. Scheinbar bedeutungslose Fächer wie un -<br />
seres sind recht unbeka nnt, ob wohl dahinter große Wirtschaftszweige wie<br />
Keramik - , Glas- und Zementind u strie stehen“, klagt Wolter.<br />
Auch Studente n berichten von Schwierig keiten, die Wahl ihres Studienfa -<br />
ches Freun den zu erklären. „Ob das irgend was mit Töpfern ist, wurde ich<br />
immer gefragt“, be richtet eine Studentin, die ursprünglich Phy sik stu -<br />
dieren wollte, ehe ihre Lehrerin sie auf den Studienga ng in <strong>Clausthal</strong> -<br />
Zeller feld aufmer ksa m machte. Bei vielen ihrer Kommilitonen war das fa -<br />
miliäre Umfeld entscheidend <strong>für</strong> die Wahl von „Glas, Kera mik, Binde -<br />
mittel“; viele Söhne und Töch ter von Firmeninhabern <strong>der</strong> Branche sind<br />
unter den Studenten. „Die guten Chancen auf dem Arbeitsmar kt haben<br />
letztlich den Ausschlag gegeben“, begründet ein Stu dent, dessen Eltern<br />
kein Zementwerk besit zen, seine Wahl.<br />
„Jede Woche ruft hier jemand an und fragt, ob ich nicht einen Absol -<br />
venten habe“, sagt <strong>der</strong> <strong>für</strong> den Keramikbe reich zuständige Professor<br />
Jürgen Heinrich. Nacht Überzeugung von Wolter könnten jährlich 100 Ab -<br />
solventen in <strong>der</strong> Industrie unterge bracht werden; es gibt <strong>der</strong>zeit aber nur
– 78 –<br />
etwa 20. Neben <strong>Clausthal</strong> - Zellerfeld wird das Fach an deutsche n Universi -<br />
täten nur noch in Aachen und Freiberg angeboten. Hinter dem Oberbegriff<br />
Bindemittel verberge n sich Stoffe wie Zement, Kalk, Gips und Beton. Das<br />
Fach gehört zu den Werkstoffwissensc hafte n und soll die angehenden Di-<br />
plomingenieure dazu befähigen, in <strong>der</strong> Industrie benötigte Materialien zu<br />
verbessern und zu entwickeln. Ob Forschung, Betriebsleitung, Qualitäts -<br />
kontrolle, aber auch Beratertätigkeiten o<strong>der</strong> die Arbeit <strong>für</strong> staatliche<br />
Überwachungs - und Prüfstellen — die Möglichkeiten nach dem Studium<br />
sind groß.<br />
„Ein Interesse an den Naturwisse nsc haften sollten die Studente n schon<br />
mitbringen“, beschreibt Wolter die Anfor<strong>der</strong> u nge n. Im vierse me st rigen<br />
Grundstudium gemeinsa m mit Ingenieuren an<strong>der</strong>er Fachrich tungen<br />
werden Grundlagen wie Mathema tik, Physik, Chemie und Elektrotechnik<br />
un terrichtet. Im auf fünf Semester angelegten Hauptstudiu m erfolgt die<br />
Spezialisierung auf einzelne <strong>Werkstoffe</strong>. Ein Industriepra k tikum von<br />
mindestens 26 Wochen Dauer ist vorgeschrieben. Nach dem Studium ist<br />
eine Promotion möglich.<br />
Weil „Glas, Keramik, Bindemittel“ stark nach „old economy“ klingt, be -<br />
tonen die <strong>Clausthal</strong>er Wissenschaftler gerne die Bedeutung ihres Faches<br />
<strong>für</strong> die „new econo my“. Ihr <strong>Institut</strong> verfügt über einen Reinrau m, <strong>der</strong><br />
nicht mit Schuhen betreten wer den darf und nicht von ungefähr an die<br />
Pro duktion von Computerchips erinnert: Hier werden Keramiken erprobt,<br />
die als Träger - material <strong>für</strong> die Siliciumplatten während des Chipherstel -<br />
lungsprozes ses dienen. Ein großer oranger Roboter bewegt das Materi al;<br />
ein Laser erhitzt es an genau festgeleg ten Stellen. Im Eingang des <strong>Institut</strong>s<br />
wird in einer kleinen Ausstellung daran erinnert, daß hier entwickelte<br />
Materialien wie Spezi algläser auch schon im Space Shuttle gete stet<br />
wurden. Die Maschinenhalle sieht dage gen eher nach „old economy“ aus:<br />
Drei Stu denten in Blaumännern stehen vor einem großen, grauen Ofen, in<br />
dem sie Glas bren nen. Diese kleinen Lerngruppe n werden von den Stu -<br />
denten gerüh m t, aber etwas vol ler könnte es nach ihrem Geschmack<br />
schon manch m al sein. Bei spezielleren Vorlesun gen im Hauptstudiu m<br />
komme es schon mal vor, daß man allein mit dem Professor sei, und<br />
einige Seminare fänden nur alle zwei Jahre statt, um eine ausreichende<br />
Teilneh merzahl sicherzustellen.<br />
„Lei<strong>der</strong> waren die Ingenieur be r ufe jahre lang wegen <strong>der</strong> Krise im Ma-<br />
schinenba u out, aber so langsam scheint sich <strong>der</strong> Trend zu drehen“, sagt<br />
Wolter. In Schulen und bei Messen rührt er die Werbetrom m el <strong>für</strong> das<br />
Fach und auch <strong>für</strong> den Ort, denn <strong>Clausthal</strong> - Zellerfeld klingt <strong>für</strong> viele po -
– 79 –<br />
tentielle Stu denten nicht gerade verlocken d. „Im ersten Semester habe ich<br />
gedacht, ich gehe hier ein“, berichtet eine Studentin aus Dort mund. Claus -<br />
thal- Zellerfeld hat 15 000 Ein wohner, davon sind 2700 Studenten <strong>der</strong><br />
1775 als Bergbauakade mie gegründeten Universität. Die nächste Disko<br />
o<strong>der</strong> ein Theater ist meilenweit entfernt, aber da<strong>für</strong> ist im Ort alles zu Fuß<br />
erreichbar. Von <strong>der</strong> neuen Mensa aus blickt man auf den Broc ken, und <strong>für</strong><br />
jeden Studente n gibt es einen Wohnheimplatz mit Internetanschlu ß. Alle<br />
loben den guten Zusam m e n h alt: „Hier kann man nur gemeinsam etwas<br />
auf die Beine stellen“, sagt ein Student aus dem Ruhr gebiet. Das<br />
funktioniere auch ausgezeich net; es gebe einen Filmclub, Theatergrup pen<br />
und eine eigene „Love Parade“. Außer dem seien die Sportmöglichkeiten<br />
wie <strong>für</strong> Skifahren im Harz hervor r agen d. „Man kommt hier auf jeden Fall<br />
aber auch zum Studieren.“<br />
Aus: Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 18. August 2001
Gleich zwei Dekane auf einmal<br />
– 80 –<br />
Obwohl erst wenige Jahre im Amt, sahen sich Prof. Heinrich und Prof.<br />
Wolter im April 2001 in die Lage versetzt, Dekanspflichten zu über -<br />
nehme n. Prof. Heinrich <strong>für</strong> den Fachbereich Physik, Metallurgie und<br />
Werkstoffwissenschaften und Prof. Wolter <strong>für</strong> die Fakultät <strong>für</strong> Bergbau,<br />
Hüttenwe sen und Maschinenwesen. Die Wahl erfolgte <strong>für</strong> zwei Jahre.<br />
Neben hoher zusätzlicher Arbeitsbelastung sind mit diesen Ämtern aber<br />
auch Gestaltungs m öglichkeiten verbunde n, die den Werkstoffwisse n -<br />
schaften insgesamt und dem <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Nichtmetallische</strong> <strong>Werkstoffe</strong> zu -<br />
gute kom me n werden.<br />
Doppelsieg beim Campuslauf<br />
Das INW- Running Team war auch in diesem Jahr, beim 12. <strong>Clausthal</strong>er<br />
Campuslauf, erfolgreich. Zwar haben wir nicht wie im vergangene n Jahr<br />
die zahlenmä ßig stärkste Mannschaft gestellt, da<strong>für</strong> aber den Sieger und<br />
Zweitplazierten beim Leistungslauf über 5 Runden (15 km).<br />
Bei schönem, zum Laufen nicht zu heißem o<strong>der</strong> kalten Wetter, wurden<br />
rund 200 Athleten, sowohl Hobbyläufer, die nur eine Runde absolvieren<br />
wollten, als auch die ambitionierte n Hobbyläufer (3 Runden) und die Leis -<br />
tungsläufer über fünf (Herren) bzw. drei (Damen) Runden auf die Strecke<br />
geschickt. Gelaufen wird traditionell auf einem 3km langen Rundkurs<br />
durch das Feldgrabe nge biet, gespickt mit Anstiegen im Bereich <strong>der</strong> Agri -<br />
colastra ße (Kreuzung Walther - Nernst - Str. bzw. Leibnizstr.) und dem Weg<br />
zwischen Geologie /Geop h y si k und dem <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> Physikalische Chemie.<br />
Bereits in <strong>der</strong> 1. Runde zog sich das Feld weit auseinan<strong>der</strong> und ein Trio<br />
konnte sich absetzen. Lothar Wondraczek fiel als erster dem Tempodiktat<br />
von Robert Mathai zum Opfer, in Runde 4 war es auch um Daniel Langer<br />
geschehe n. Robert Mathai lief das Rennen “nach Hause” und siegte in<br />
einer Zeit von 1h03min. Der zweite INW- Läufer beim Leistungslauf war<br />
Jens Günster. Als Daniel Langer den Kontakt zum Führenden hat abreiße n<br />
lassen müssen, nutzte er die Chance und lief zu ihm auf. Gemeinsa m er -<br />
reichten sie, nur 41 Sekunden nach dem Sieger, das Ziel.<br />
Neben den Hobby - und Leistungsläufen hat sich inzwische n auch ein<br />
Bambinilauf <strong>für</strong> den Nachwuc hs und ein Inlinerwett be w e r b entlang <strong>der</strong><br />
Leibnizstra ße etabliert.
– 81 –<br />
Die Mitarbeiter unseres <strong>Institut</strong>s zählen auch sonst zu den sportliche n in<br />
<strong>Clausthal</strong>. Jeden Montag bieten wir einen Frühsport unter dem Motto FIT<br />
IN DEN TAG an, wobei die Beweglichkeit und die Rumpfkräftigung im<br />
Vor<strong>der</strong>gr u nd stehen. Einige Mitarbeiter bevorzuge n Ballspiele o<strong>der</strong><br />
erkunden das Umfeld von <strong>Clausthal</strong> in Jogging - o<strong>der</strong> Trekkingschu he n.<br />
Wie<strong>der</strong> an<strong>der</strong>e gehen Radfahren, Schwimmen, Segeln o<strong>der</strong> Tauchen.<br />
Robert Mathai
Fit in die Woche<br />
– 82 –<br />
Seit einem Jahr trifft sich eine Gruppe von <strong>Institut</strong>smitglie<strong>der</strong>n Montag<br />
morgens um 7:15 Uhr zur "Wochenanfa ngsgy m n a s tik". Jeweils 15 min.<br />
dienen dem Aufwär men, dann <strong>der</strong> Kräftigung und anschließe nd <strong>der</strong><br />
Dehnung und Entspannung von zumeist nur einseitig beanspruchte n<br />
Muskelpartien, vor allem im Nacken, Rücken, Bauch und Oberschenkelbe -<br />
reich. Diese 3/4 Std. ist eine Wohltat <strong>für</strong> alle "Schreibtischtäter". Im An -<br />
schluß kann man direkt im Sportinstitut duschen und danach in <strong>der</strong> Cafe -<br />
terria <strong>der</strong> neuen Mensa frühstüc ken. Der etwas an<strong>der</strong>e Start in den<br />
Montagmorge n!!!<br />
Möglich geworden ist diese Veranstaltung dadurc h, daß Herr Dr. Mathai<br />
eine entsprec hende Trainerausbildung besitzt. Er verfügt über ein schier<br />
unerschöpflichen Schatz an Kräftigungs - und Dehnübungen. Da er zum 1.<br />
Oktober 2001 in die Industrie gewechselt ist, ist die Fortführu ng dieser<br />
Veranstaltung noch ungewiß.<br />
Prof. Dr. A. Wolter<br />
<strong>TU</strong> <strong>Clausthal</strong> erneut im DFG- Ranking in den Ingenieurwissenschaften auf<br />
Platz 1
– 83 –<br />
„Wer wirbt am erfolgreichste n Forschungsgel<strong>der</strong> ein?“, fragt die Deutsche<br />
Forschungsgemeinschaft sich selbst und legte, nun schon zum zweiten<br />
Mal, die Übersicht <strong>der</strong> DFG- Bewilligungen an Hochschulen und außeruni -<br />
versitäre n Forschungseinrichtungen, diesmal <strong>für</strong> den Zeitraum von 1996<br />
bis 1998, vor. Und, gleichfalls wie beim ersten Mal, nimmt die Technische<br />
Universität <strong>Clausthal</strong> eine Spitzenstellung in den Ingenieur wissenschafte n<br />
ein: Bezogen auf die Zahl <strong>der</strong> Professoren den vierten Platz, bezogen auf<br />
die an ihr tätigen Wissenschaftler in den Ingenieurdisziplinen gemeinsa m<br />
mit <strong>der</strong> <strong>TU</strong> Hamburg - Harburg den ersten Platz.<br />
In ihrem Vorwort zu dem Bericht schreiben <strong>der</strong> Präsident <strong>der</strong> Deutschen<br />
Forschungsgemeinschaft Professor Dr. Ernst Ludwig Winnacker und <strong>der</strong><br />
Präsident <strong>der</strong> Hochschulrektorenkonferenz Professor Dr. Klaus Landfried:<br />
„Der Begriff ,Leistungsorientierte Mittelzuweisu ng ´ hat in <strong>der</strong> Hochschul -<br />
und Forschungs politik steigende Konjunkt ur... Aufgabe aller dieser Gre -<br />
mien ist es letztlich, die Verteilung <strong>der</strong> Ressourcen an Kriterien <strong>der</strong> Quali -<br />
tät und Leistung orientieren zu helfen.“ Da<strong>für</strong> müßten die Stärken und<br />
Schwächen einer Universität mit möglichst vielen, objektiven Indikatoren,<br />
Qualitätsmer k m ale n, gemessen werden. „Das Volumen <strong>der</strong> Mittel, das die<br />
Wissenschaftlerinne n und Wissenschaftler einer Universität im Wettbe -<br />
werb mit allen an<strong>der</strong>en bei <strong>der</strong> DFG einwerben ist ein wichtiger Indikator<br />
<strong>für</strong> Initiativbereitschaft, Aktivität und Erfolg in <strong>der</strong> Forschung.“<br />
Ein syste matischer Zusamme n h a n g zeigt sich im Vergleich mit <strong>der</strong> Auf -<br />
stellung <strong>der</strong> Alexan<strong>der</strong> von Humboldt - Stiftung aus dem Mai dieses Jahres.<br />
„Wohin gehen die ausländischen Spitzenforscher?“ Die DFG schreibt in ih -<br />
rem Bericht auf Seite 43: „ Die Übersicht über die Zielorte und Gastinstitu -<br />
tionen von Humboldt Forschungsstipe n diaten und - preisträger n <strong>der</strong> Jahre<br />
1995 bis 1999 zeigt, daß sich die Hälfte aller von <strong>der</strong> AvH geför<strong>der</strong>te n<br />
Spitzenwisse nschaftler ebenfalls auf nur 20 Universitäten in Deutschland<br />
konzentriert. 18 dieser Hochschulen sind identisch mit den „Top 20“ des<br />
hier vorgestellten DFG- Hochschul - Rankings. Zwischen <strong>der</strong> Attraktivität<br />
<strong>für</strong> internationale Gastwissensc haftler und <strong>der</strong> DFG- Forschungsaktivität<br />
besteht demnach ein sehr enger Zusamme n ha n g.“ In dem Ranking <strong>der</strong><br />
Alexan<strong>der</strong> von Humboldt - Stiftung nahm die <strong>TU</strong> <strong>Clausthal</strong>, gerechnet in
– 84 –<br />
<strong>der</strong> Darstellung pro <strong>der</strong> an einer Universität tätigen Professoren, den<br />
vierten Platz ein.<br />
Aus: <strong>TU</strong> Contact 2001 Nr. 7<br />
Neue Mensa im Feldgrabengebiet nach mehrfachen Verzögerungen eröff -<br />
net<br />
Der 16 Mio. DM teure Bau an <strong>der</strong> Leibnizstra ß e im Feldgrabengebiet dürfte<br />
eines <strong>der</strong> am gründlichste n geplanten Gebäude in <strong>der</strong> jüngeren Geschichte<br />
des Oberharze s sein. Am Freitag wurde die neue Mensa – deutlich später<br />
als ursprünglich vorgesehe n – im Beisein von rund 300 Gästen aus allen<br />
Bereichen des öffentlichen Lebens feierlich eröffnet.<br />
Nach den Begrüßungsreden folgte <strong>der</strong> Ansturm <strong>der</strong> Ehrengäste und <strong>der</strong><br />
Studente n an <strong>der</strong> Essensausgabe. Die hochmo<strong>der</strong> ne Küche bietet den Mit-<br />
arbeitern des Studenten w e r k s angeneh m e Arbeitsbedingunge n. In <strong>der</strong> al-<br />
ten Mensa hatten die vom Leiter des Studentenwerks, Peter Zimmermann,<br />
als engagierte Mannschaft gelobten Mitarbeiter zeitweise bei Tempera -<br />
turen von 35 Grad und einer Luftfeuchtigkeit von 99 Prozent arbeiten<br />
müssen.<br />
Neben dem einmaligen Blick lobten die Redner die allgemein als gelungen<br />
gepriesene Architektur des Gebäudes. Das lichtdurchflutete und mit viel<br />
Holz gestaltete Gebäude lässt keinen Gedanke n an einen Zweckbau auf -<br />
kommen. Das Studentenwerk wirbt mit dem Spruch „Deutschlands einzige<br />
Mensa mit Brockenblick“.<br />
Die Studente n erhalten keine festgelegten Menüs mehr, son<strong>der</strong>n können<br />
sich ihr Essen zusam m e n s t ellen – eine Anlehnung an die Modularisierung<br />
<strong>der</strong> Studiengänge, wie Prorektor Hans - Peter Beck von <strong>der</strong> <strong>TU</strong> in einem<br />
Scherz meinte. Bezahlt wird nicht mehr mit Bargeld, son<strong>der</strong> n mit Chip -<br />
karte. Das Gebäude verfügt über eine Bühne <strong>für</strong> Musik und Theater und<br />
eignet sich daher auch als kultureller Treffpunkt.<br />
Aus: Goslarsche Zeitung vom 15.09.2000
– 85 –<br />
Die „Mutter <strong>der</strong> Studenten" Gertrud Gayer wurde verabschiedet<br />
Gertrud Gayer ist 35 Jahre lang mehr<br />
als die Seele des <strong>TU</strong> Prüfungsa m t es<br />
gewesen. Sie war eine <strong>Institut</strong>ion, die<br />
sich persönlich um ihre Schützlinge<br />
kümmerte. Am 11. August dankte n<br />
Studentinnen <strong>der</strong> Verbindu ng Oreja -<br />
des, in welcher Frau Gayer Ehrenmit -<br />
glied ist, sowie Studenten, Ehemalige<br />
und Professore n <strong>der</strong> „Mutter <strong>der</strong> Stu -<br />
denten" an ihrem letzten Arbeitstag<br />
mit einer Abholung, wie sie <strong>Clausthal</strong> selten erlebt hat. (Text und Bild:<br />
Helga Meier- Cortés)<br />
Aus: <strong>TU</strong> Contact 2000 Nr.7
– 86 –<br />
Glockenturm <strong>der</strong> <strong>TU</strong> <strong>Clausthal</strong> am neuen Standort eingeweiht<br />
Wie an<strong>der</strong>s, als mit dem Steigerlied könnte ein Symbol wie <strong>der</strong> Glocken -<br />
turm <strong>der</strong> <strong>TU</strong> <strong>Clausthal</strong> sich bemerk bar machen? Am Donnerstag erklang<br />
diese bekannte Melodie erstmals vom neuen Standort im Feldgrabengebiet<br />
zur offiziellen Einweihung. Wie <strong>der</strong> Leiter des Staatshochbaua m t e s Harz<br />
Ernst Glazik erinnerte, sei es die dritte Einweihung, die dieser Turm nun<br />
feiere.<br />
Nach einem Aufsehen erregenden Transport wurde <strong>der</strong> ca. 10 Meter Hohe<br />
Turm im November 1956 neben <strong>der</strong> Aula aufgestellt. Er war ein Geschenk<br />
des Bochumer Vereins zur Einweihung des <strong>Institut</strong>es <strong>für</strong> Eisenhütten -<br />
kunde und Gießereiwese n. Das Geschenk sorgte aber nicht überall <strong>für</strong><br />
Freude. Anlieger fühlten sich nämlich durch das häufige „Gebimmel“ be -<br />
lästigt. Man suchte einen neuen Standort und verpflanzte den Turm dann<br />
zwei Jahre später in die Spittelwiesen. Und dort führte er bald ein Dorn -<br />
röschendasein, denn Bäume und Buschwer k hüllten ihn immer mehr in<br />
ihren dichten grünen Laubmantel. An sich war das ganz gut so, denn die<br />
Kunststoffplatten, die die 25 Glocken schützten, wurden nach und nach<br />
vom Zahn <strong>der</strong> Zeit stark angenagt. Der Glockentur m geriet immer mehr in<br />
Vergessen heit, und „Neu- <strong>Clausthal</strong>er“ wussten meist gar nichts von sei -<br />
ner Existenz.<br />
Nicht zuletzt weil die GZ immer mal wie<strong>der</strong> „bohrte“ und diesen Glocken -<br />
turm in Erinnerung brachte, wie <strong>TU</strong>- Kanzler Dr. Peter Kickartz am<br />
Donnerstag erwähnte, habe sich die <strong>TU</strong> dieses Turmes angenom m e n.<br />
Kickartz machte das Thema zu seinem beson<strong>der</strong>e n Anliegen. Neue Stand -<br />
orte wurden ausgeguckt und verworfen, bis man ihn richtig in den Mittel -<br />
punkt des Uni- Lebens, nämlich ins Feldgrabengebiet rücken wollte. Doch<br />
die Umsetzung <strong>der</strong> Idee scheiterte am schnöden Mammon, bis das Minis -<br />
terium <strong>für</strong> Wissenschaft und Kultur <strong>der</strong> <strong>TU</strong> zu ihrem 225- jährigen Jubilä -<br />
um im letzten Jahr 300.000 DM zum Erhalt dieses Kulturde nk m als<br />
schenkte.<br />
Der Turm wurde aufwändig restauriert und steht nun inmitten einer Are -<br />
na. Ob er nun schön ist o<strong>der</strong> nicht, darüber kann man geteilter Meinung
– 87 –<br />
sein, auf jeden Fall ist er etwas Beson<strong>der</strong>es. Und das soll er in Zukunft<br />
noch mehr werde n. Glazik wünschte, dass <strong>der</strong> Turm bei Abholungen<br />
frisch gebackener Doctores so im Mittelpunkt stehen möge, wie das<br />
Gänseliesel in Göttingen. Fragt sich nur, wer küsst den Turm, denn das ist<br />
beim Gänseliesel „Muss“ <strong>für</strong> die Promovierte n. In <strong>Clausthal</strong> wird es wohl<br />
„Lied statt Kuss“ heißen, und da<strong>für</strong>, dass das klappt, sorgt Dr. Friedrich<br />
Balck, <strong>der</strong> schon <strong>für</strong> das Zellerfel<strong>der</strong> Glockens piel die entspreche n de EDV<br />
erstellte. Rund 400 Lie<strong>der</strong> stehen <strong>für</strong> den Glockentur m zur Auswahl. Und<br />
gewählt werden darf bei Abholunge n. Ansonsten solle dreimal am Tag das<br />
Glockenspiel erklingen, teilte <strong>der</strong> Kanzler mit. Und zwar um 9 Uhr, weil<br />
die Blockarbeitszeit beginne, um 12 Uhr, damit man das Mittagessen nicht<br />
vergesse und um 17 Uhr zum offiziellen Dienstschlus s, damit man auch<br />
den nicht verpasse. Ein „Wunschko n zert“ außer <strong>der</strong> Reihe gab es dann<br />
zum Abschluss <strong>der</strong> offiziellen Übergabe.<br />
Aus: Goslarsche Zeitung vom 06.07.2001<br />
Gelungene <strong>TU</strong>- und City- Fete<br />
Zur gemeinsa men Freude gerieten am Sonntag das 2. Berg- und Hoch -<br />
schulfest <strong>der</strong> <strong>TU</strong> <strong>Clausthal</strong> und <strong>der</strong> verkaufsoffene Sonntag <strong>der</strong> Cityge -<br />
meinschaft. Die nach dem Riesenerfolg des Jazz- Frühschoppe ns zum<br />
225- jährigen Hochschuljubiläum vor einem Jahr vielfach gewünschte<br />
Neuauflage vereinte im Innenhof des <strong>TU</strong>- Hauptgebäu des studentische<br />
Gemeinschaften und Burschenschafte n, <strong>TU</strong>- Mitarbeiter, „August Ey und<br />
Freunde“ sowie viele Bergstädte r und Besucher von außerhalb, die zwi -<br />
schen den Geschäften und Ständen <strong>der</strong> belebten „Roe“ und jenen des Hof -<br />
festes hin und her pilgerten, hier ein Steak und dort ein Nudelgericht bei<br />
<strong>der</strong> chinesischen o<strong>der</strong> Gebäck bei <strong>der</strong> islamische n Studente nge m einschaft<br />
verzehrten, die Geosam mlung bewun<strong>der</strong>ten und das vielseitige Musikpro -<br />
gramm genossen.<br />
Dieses wurde präsentiert vom Neuen Berghornistencorps, das auch schon<br />
den Umzug angeführt hatte, dem Kammerchor <strong>der</strong> <strong>TU</strong>, den Harzwald -<br />
sänger n Buntenboc k und natürlich von „Mainstrea m Unlimited“, <strong>der</strong> Band
– 88 –<br />
von Dr. Peter Dietz, die wie<strong>der</strong> mit fetzigem Jazz zur Hochform auflief.<br />
Zur Freude <strong>der</strong> Organisatore n vom AStA trübte kein Regentröpfchen den –<br />
wie Rektor Prof. Dr. Ernst Schaumann bemerkte – „<strong>für</strong> <strong>Clausthal</strong>er<br />
Verhältnisse geradezu blauen“ Himmel.<br />
„Drauße n“ auf <strong>der</strong> Roe mo<strong>der</strong>ierte Peter Weiss mit gewohnte m Schwung<br />
zusam me n mit Henrik Eine die Preisverleihu ng des City- Quiz’, dessen<br />
Preise (viele Gutscheine sowie ein Paar Inliner, einen Cityroller und ein<br />
Mountainbike) die 31 Geschäftsleute <strong>der</strong> Citygemeinschaft spendiert<br />
hatten. 350 Karten lagen in <strong>der</strong> „Waschtro m m el“, die meisten Preise<br />
gingen an <strong>Clausthal</strong>er und drei nach „außerhalb“.<br />
Aus: Goslarsche Zeitung vom 10.06.2001
An alle Ehemaligen<br />
– 89 –<br />
Sehr geehrte Absolventinne n und Absolvente n!<br />
Die Technische Universität <strong>Clausthal</strong> möchte den Kontakt zu ihren Absol -<br />
venten intensivieren. Sie sind uns als Ratgeber aus <strong>der</strong> Praxis und als Bot -<br />
schafter <strong>der</strong> Universität ein wertvoller Partner.<br />
Daher bitte ich Sie, uns Ihren Studiengang, Ihren Abschluß (Diplom /Pro -<br />
motion), das Jahr des Studienabschlusses und Ihre eMail- Adresse mitzu -<br />
teilen, wenn Sie in Zukunft<br />
• Nachrichten aus dem Leben <strong>der</strong> Hochschule (Forschung, Lehre und<br />
Personalia) sowie<br />
• Einladungen zu wissenschaftlichen Tagungen und Weiterbildungs -<br />
kursen<br />
auf diesem Wege erhalten möchten.<br />
Der Kontakt soll keine Einbahnstra ß e bleiben. So sind Sie herzlich einge -<br />
laden als Autoren <strong>der</strong> Universitäts zeitschrift <strong>TU</strong> Contact uns Ihre Erfah -<br />
rungen mitzuteilen, o<strong>der</strong> auch direkt sich an uns mit Ihren Anregunge n zu<br />
wenden.<br />
Rückantwort bitte an:<br />
Jochen Brinkma n n M.A.<br />
Pressestelle <strong>der</strong> <strong>TU</strong> <strong>Clausthal</strong><br />
Gerhard - Rauschenbac h - Straße 4<br />
38678 <strong>Clausthal</strong> - Zellerfeld<br />
Fax: 05323 / 72- 7759<br />
eMail: brink m a n n@tu - clausthal.de
– 90 –<br />
Technische Universität <strong>Clausthal</strong><br />
Pressestelle<br />
Herrn Jochen Brinkmann M. A.<br />
Gerhard Rauschenbach - Straße 4<br />
38678 <strong>Clausthal</strong>- Zellerfeld<br />
per Fax: 05323 / 72- 7759<br />
( ) Ja, ich möchte gerne in Zukunft Nachrichten <strong>der</strong> <strong>TU</strong><br />
<strong>Clausthal</strong> an<br />
meine eMail- Adresse ........................................................erhalten.<br />
Ich habe im Jahr .................. mein Studium an <strong>der</strong> <strong>TU</strong> <strong>Clausthal</strong><br />
mit<br />
( ) dem Diplom im<br />
Studiengang ...........................................................<br />
( ) <strong>der</strong> Promotion bei Herrn /Frau<br />
Professor...........................................<br />
abgeschlosse n.<br />
...................................................................................<br />
Titel, Name, Vorname<br />
...................................................................................<br />
Datum, Ort Unterschrift
– 91 –


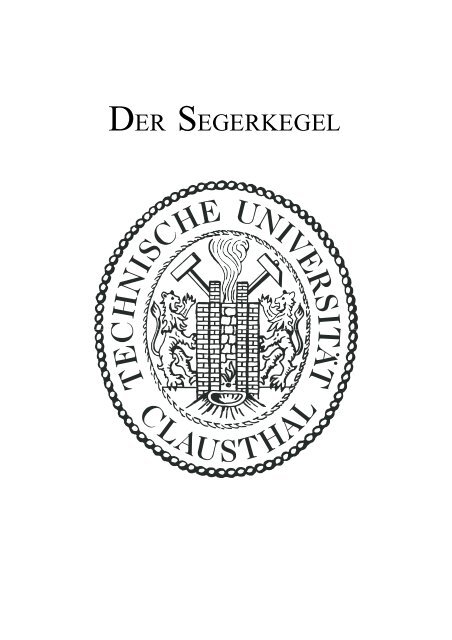
![Segerkegel 2013 [PDF, 3,9MB] - Institut für Nichtmetallische Werkstoffe](https://img.yumpu.com/51625206/1/184x260/segerkegel-2013-pdf-39mb-institut-fur-nichtmetallische-werkstoffe.jpg?quality=85)

![Segerkegel 2002 [PDF, 1.8MB] - Institut für Nichtmetallische ...](https://img.yumpu.com/6797085/1/184x260/segerkegel-2002-pdf-18mb-institut-fur-nichtmetallische-.jpg?quality=85)