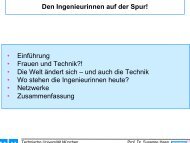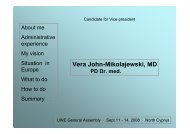Aktenplan des Arbeitskreisarchivs
Aktenplan des Arbeitskreisarchivs
Aktenplan des Arbeitskreisarchivs
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
20 Jahre auf dem Weg zur Chancengleichheit<br />
Auszug aus der Festrede von Maren Heinzerling anlässlich der 20-Jahrfeier <strong>des</strong> Arbeitskreises<br />
‚Frauen in Naturwissenschaft und Technik‘ am 6.10.2006<br />
1. Der Anfang im Jahre 1986<br />
Im günstigsten Fall wurden wir Ingenieurinnen in den 80-er Jahren als „belebende Farbtupfer“ in einer<br />
grau-braunen Männerwelt bezeichnet. Wir hatten als tapfere Einzelkämpferinnen bei einer Übermacht<br />
männlicher Kommilitonen und in weitgehend Damen-Toiletten-freien Technischen Hochschulen<br />
studiert; wir hatten die Hörsäle in Begleitung von unserem Geschlecht gewidmeten, fröhlichen<br />
Pfeifkonzerten betreten und um Praktikantenplätze kämpfen müssen. Eine Berufsbezeichnung gab es<br />
noch nicht für uns: wir waren „Ingenieure“ mit dem Zusatz „weiblichen Geschlechts“. Weibliche<br />
Vorbilder hatten wir natürlich auch nicht; wir studierten und handelten nach dem Indianermotto: Was<br />
Dich nicht umbringt, macht Dich stark.<br />
Und wir wurden stark.<br />
100 von uns trafen sich im April 1986 auf Einladung der damaligen 1.Vorsitzenden <strong>des</strong> Deutschen<br />
Akademikerinnenbun<strong>des</strong>, unserer unvergessenen Ursula Huffmann, in Bonn zu einer<br />
Wochenendtagung über das Thema „Frauen in Naturwissenschaft und Technik“.<br />
Die meisten trafen hier das 1.Mal in ihrem Leben auf eine Kollegin.<br />
Die erste Kollegin, die ich traf, war Barbara Leyendecker, eine zierliche Person in einem feuerroten<br />
Kostüm. Man sah ihr die ungeheure Energie und das unerschütterliche Durchhaltevermögen nicht an.<br />
Die Tagung machte klar, die Situation von Frauen in Naturwissenschaft und Technik muss dringend<br />
verbessert werden. Und so beschlossen Ursula Huffmann und Barbara Leyendecker, einen<br />
Arbeitskreis zu gründen.<br />
Schon auf seiner konstituierenden Sitzung definierte der Arbeitskreis drei Hauptziele<br />
• Veränderung der Mädchen-Erziehung in Schule und Elternhaus<br />
• Unterstützung von jungen Frauen in Ausbildung, Studium und Beruf sowie<br />
• Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie durch angemessene staatliche,<br />
betriebliche und gesellschaftliche Rahmenbedingungen.<br />
In den folgenden 20 Jahren verfolgte der Arbeitskreis diese Ziele mit einer Vielzahl erfolgreicher<br />
Projekte. 16 Jahre wurde er von Barbara Leyendecker geleitet; seit 2002 ist Sabine Hartel-Schenk<br />
Sprecherin <strong>des</strong> Arbeitskreises. In all diesen Jahren hatten wir viele und gute Ideen, an denen wir uns<br />
begeisterten. Doch lernten wir bei der Umsetzung recht eindringlich, wie wichtig eine ausreichende<br />
Finanzierung und die Akquisition einflussreicher Mitstreiter sind.<br />
Im Folgenden werde ich über unsere wichtigsten Projekte berichten und fange mit den Projekten für<br />
Schülerinnen an.<br />
2. Projekte zur Werbung von Schülerinnen für<br />
technische und naturwissenschaftliche Studiengänge<br />
Wir Ingenieurinnen wollten mehr naturwissenschaftlich begabte Schülerinnen dafür begeistern, ein<br />
technisch-naturwissenschaftliches Studium zu ergreifen. Dazu mussten wir den Mädchen die<br />
Tätigkeitsfelder von Ingenieurinnen und Physikerinnen erläutern und das Vertrauen vermitteln,<br />
dass sie gerade mit einem solchen Studium ein breites Berufsfeld vorfinden würden.<br />
Wir mussten zudem das Selbstbewusstsein der Schülerinnen stärken, denn es war damit zu<br />
rechnen, dass Familienmitglieder und Freunde Bedenken gegen einen derartigen, damals noch recht<br />
ungewöhnlichen Berufswunsch äußern würden.<br />
Biographien bedeutender Frauen sollten dazu beitragen. Entsprechende Biographien wie die über die<br />
Atomphysikerin Marie Curie, über die Fliegerinnnen Hanna Reitsch und Amelia Earhart, über die<br />
Biologin und Malerin Sibylle Merian haben wir seit 1991 immer wieder begutachtet und für<br />
Schulbibliotheken, für Lehrerinnen und Eltern zusammengestellt.<br />
Sybille Krummacher gewann seinerzeit das Forschungszentrum Jülich für die Finanzierung von<br />
Sonderdrucken unserer Bücherlisten und Besprechungen. Inzwischen können die Buchtitel mit<br />
kurzen Inhaltsangaben dank Gerda Thieler-Mevissen auch im Internet abgerufen werden.<br />
1
1990 wurde das Pilotprojekt „1. Münchner-Mädchen-Technik-Tag“ aus der Taufe gehoben.<br />
Wichtiger Geburtshelfer war die Personalabteilung der Luft- und Raumfahrtfirma MBB, jetzt EADS, in<br />
der ich damals arbeitete. MBB gewann acht weitere bayrische Großfirmen für das Projekt (Audi,<br />
Bosch, BMW, Dornier, IBM, MTU, Siemens, Stadtwerke München). Damit war die Finanzierung<br />
sichergestellt. Die beteiligten Firmen benannten zusätzliche, kompetente und engagierte<br />
Ingenieurinnen für die Diskussionen mit den Schülerinnen und bewilligten mir sogar eine Praktikantin<br />
für die Projektarbeit, Ingrid Kardinal, heute promovierte Physikerin am Europäischen Patentamt.<br />
Projektleiterin Maren Heinzerling mit<br />
Daniela Heldig, Ingrid Kardinal, Sylvia Kegel und Andrea Bör geb. Hundhammer<br />
bei einer Konzeptbesprechung zum 1. Münchner-Mädchen-Technik-Tag / Frühjahr 1990<br />
Die Idee <strong>des</strong> Mädchen-Technik-Tages war folgende: Gymnasiastinnen der 11. bis 13.Jahrgangsstufen<br />
sollten<br />
• Ingenieurinnen und Studentinnen technischer Fachrichtungen kennen lernen, und zwar<br />
„Ingenieurinnen zum Anfassen“ nicht Ausnahmefrauen, die nur Respekt einflößen aber nicht zur<br />
Nachahmung ermuntern;<br />
• die Mädchen sollten sich mit Ingenieurinnen über berufliche und persönliche Erfahrungen<br />
unterhalten können;<br />
• sie sollten außerdem mit Vertreterinnen von Hochschulen, Firmen und <strong>des</strong> Arbeitsamtes über<br />
Ausbildungsfragen und Möglichkeiten der Berufsausübung sprechen können.<br />
Mein Glück als Projektleiterin war es, dass ich zwei sehr engagierte Mathematik- und<br />
Physikstudienrätinnen, Adelinde Schinabeck und Hanna Mehler, kannte, die auf die unbedingte<br />
Einbeziehung der Schulbehörde hinwiesen.<br />
Also schrieb MBB an das Kultusministerium und erreichte damit, dass wir über die<br />
Ministerialbeauftragten der Lan<strong>des</strong>hauptstadt München Schülerinnen aller Münchner Gymnasien zu<br />
unserer Veranstaltung einladen, Werbung dafür machen und auch den Anmeldungsrücklauf abwickeln<br />
konnten.<br />
Ich sage Ihnen: ES WURDE EIN UNBESCHREIBLICHER ERFOLG.<br />
250 Schülerinnen kamen (mehr konnten wir in dem gemieteten Saal gar nicht unterbringen), lauschten<br />
hochgespannt, diskutierten mit uns, stellten gescheite Fragen und waren einfach ungeheuer<br />
interessiert. Die Firmenvertreter waren begeistert und ich verbrachte meine Osterfeiertage damit, eine<br />
Anleitung zur Durchführung von Mädchen-Technik-Tagen nieder zu schreiben, um diese Art der<br />
Werbung für Technik-geprägte Berufsausbildungen von Mädchen publik zu machen.<br />
2
Arno Evers, ein Kollege von mir in der MBB-Öffentlichkeitsarbeit, verhalf mir zu 200 gedruckten<br />
Exemplaren meiner Anleitung, die durch unser Netzwerk verteilt wurden. Allein in den nächsten 3<br />
darauffolgenden Jahren wurden bun<strong>des</strong>weit 13 weitere Mädchen-Technik-Tage nach dem ‚Münchner<br />
Konzept‘ durchgeführt. Veranstalter waren Gymnasien, Großfirmen, Stiftungen und Verbände.<br />
Auf Grund dieser Erfahrungen und eingehender Studien wurde das ‚Münchner Konzept‘ modifiziert;<br />
man stellte zudem fest, dass die Werbung für Technik-geprägte Berufe erfolgreicher ist, wenn sie vor<br />
der Pubertät erfolgt, also vor einer geschlechtsspezifischen Polarisierung. Aus unseren einstigen<br />
Mädchen-Technik-Tagen entwickelte sich der seit einigen Jahren bun<strong>des</strong>weit durchgeführte,<br />
ungeheuer erfolgreiche Girls‘ Day, an dem auch das Kompetenzzentrum Bielefeld höchst aktiv<br />
beteiligt ist. Selbstverständlich stehen wir Ingenieurinnen vom Arbeitskreis für derartige<br />
Werbeveranstaltungen auch weiterhin gern zur Verfügung.<br />
1. Münchner-Mädchen-Technik-Tag 10.03.1990<br />
1. Augsburger Mädchen – Technik – Tag 01.12.1990<br />
2. Münchner-Mädchen-Technik Tag 02.03.1991<br />
INFOTAG<br />
Frauen – Chance für die Technik<br />
Technik – Chance für die Frauen<br />
09.03.1991<br />
1. Hamburger Mädchen – Technik - Tag 06.04.1991<br />
1. Mädchen – Technik – Tag Berlin 20.04.1991<br />
1. Mädchen – Technik – Tag Schweinfurt 02.05.1991<br />
1. Rosenheimer Mädchen - Technik – Tag 03.05.1991<br />
1. Stuttgarter Mädchen – Technik – Tag 19.10.1991<br />
Schulprojekttag Straubing 08.03.1991<br />
1. Deutscher Mädchen – Technik –Tag<br />
auf der top 91 /Düsseldorf im Rahmen der Veranstaltung<br />
„Frau + Technik“<br />
22.06.1991<br />
2. Frauen – Technik – Tag für Nordbayern in Erlangen 04.04.1992<br />
3. Münchner – Mädchen - Technik - Tag 07.03.1992<br />
4. Münchner – Mädchen - Technik - Tag 06.03.1993<br />
Die folgenden Mädchen-Technik-Tage wurden vom<br />
AK nicht mehr erfasst.<br />
Mädchen-Technik-Tage in den Jahren 1990 bis 1993 nach dem „Münchner Konzept“<br />
Ich komme zu unserem 2. Punkt, zu den Projekten für Studentinnen und Berufsanfängerinnen.<br />
3. Projekte für Studentinnen<br />
Es war natürlich nicht damit getan, mehr Mädchen für technisch-naturwissenschaftliche Studiengänge<br />
zu gewinnen, wir mussten den Mädchen auch zu einer vernünftigen Studien- und Berufsplanung<br />
verhelfen.<br />
Eine Tatsache kam uns bei der Betreuung von Studentinnen technischer Fachrichtungen zugute.<br />
1984 hatte die Bun<strong>des</strong>republik das UNO-Übereinkommen zur Beseitigung der Frauen-Diskriminierung<br />
ratifiziert. Daraus ergab sich Ende der 80-er Jahre die Einführung von Frauenbeauftragten an allen<br />
deutschen Hochschulen und Universitäten. In den Technischen Hochschulen entstand das Problem,<br />
dass manche Lehrstühle überhaupt keine Frauen beschäftigten, dort gab es dann männliche<br />
Frauenbeauftragte; aber ob männlich oder weiblich, alle Frauenbeauftragten standen vor der Frage:<br />
Auf welche Weise können wir mit den bewilligten Mitteln etwas gegen die Diskriminierung von Frauen<br />
an unseren Hochschulen tun? Wo setzen wir an?<br />
3
Tagung der Frauenbeauftragten an Bayrischen Hochschulen im Dez. 1989:<br />
Prof. Dr. Ursula Schrag / FH München, Studentin der Elektrotechnik Sylvia Kegel, Helga Ebeling<br />
vom BM für Bildung und Wissenschaft / Bonn<br />
Wir waren brauchbare Ansprechpartnerinnen für diese noch ratlosen Frauenbeauftragten und boten<br />
uns für erste Mentoring-Aufgaben an:<br />
• Kontakte zu unseren Firmen, Vermittlung von Diplomarbeiten, von Praktikumsplätzen und<br />
Ferienjobs<br />
• Unterstützung bei der Studien- und Berufsplanung sowie<br />
• Hilfe beim Berufseinstieg.<br />
Wir stellten eine Broschüre „Stellungssuche ?? - Tipps von Frau zu Frau“ zusammen; wir<br />
initiierten Bewerbungskurse für Berufseinsteigerinnen; wir gaben Literaturlisten zum Thema „Frauen<br />
in Naturwissenschaft und Technik“ heraus.<br />
In München starteten wir im Sommersemester 1990 unter der Leitung der Frauenbeauftragten<br />
Cornelia Deltz-Höger, Rita Fehle und Susanne Spielvogel eine Vortragsreihe „Studium – und<br />
danach?“, in der Ingenieurinnen in der Technischen Universität Vorträge aus ihrer Berufspraxis<br />
hielten. In der Fachhochschule München wurde diese Reihe von Frau Prof. Ursula Schrag betreut.<br />
• Diese Vorträge hatten den Vorteil, dass Studentinnen und Studenten ein aktuelles, praxisnahes<br />
Spektrum über unterschiedliche Branchen und Tätigkeitsbereiche hinweg aufgezeigt bekamen und<br />
sich so bei der Wahl ihrer Studienfächer konkret darauf ausrichten konnten.<br />
• Zum Zweiten hatten wir durch diese Vorträge Zugang zu Studentinnen, stellten ihnen mit unseren<br />
Vorträgen greifbare Berufsbilder vor und knüpften persönliche Kontakte; die jungen Studenten<br />
dagegen wurden schon mal mit der Tatsache vertraut gemacht, dass sie eventuell im Verlaufe ihres<br />
Berufslebens weiblichen Chefs unterstellt werden würden und zudem<br />
• brachte es den vortragenden Frauen Reputation in ihren Firmen ein; die Firmen wurden<br />
aufmerksam auf ihre Ingenieurinnen. Sie unterstützten diese Vorträge gern, war es doch für sie eine<br />
ziemlich effektive und preiswerte Personalwerbung.<br />
Der Großteil unserer damaligen Pionieraktivitäten ist inzwischen durch Mentoring-Programme<br />
abgedeckt, die fest an den Hochschulen und Technischen Universitäten etabliert sind und weit über<br />
das hinaus gehen, was wir damals leisten konnten. Aber wir haben, denke ich, einen wichtigen Anfang<br />
gemacht.<br />
4
Und nun komme ich in meinem Bericht zu den Projekten für Ingenieurinnen, also für uns selbst.<br />
4. Projekte für Ingenieurinnen<br />
Unseren größten Coup landeten wir, genauer gesagt: landete Barbara Leyendecker in den Jahren<br />
1988, 1989 und 1990 mit dem Stand „Frau + Technik“ auf der Hannover Industriemesse. Und das<br />
kam so.<br />
Als Barbara Leyendecker im Jahre 1987 schwanger wurde, stellte sie in ihrer ruhigen Art fest:<br />
„Jetzt habe ich Zeit, jetzt können wir auf die Hannover Messe gehen und zeigen, dass es uns gibt.“<br />
Sie schätzte den Aufwand ab, kam auf 38.000,-DM, holte sich im August 1987 die Einwilligung der<br />
DAB-Bun<strong>des</strong>vorsitzenden Ursula Huffmann und der Schatzmeisterin Anneliese Schackert, machte<br />
sich an die Beschaffung <strong>des</strong> Gel<strong>des</strong> und trieb auch uns an, in unseren Firmen aktiv zu werden. Dank<br />
Barbaras Verbindungen schlossen sich drei weitere Ingenieurinnenverbände unserem Projekt an:<br />
• Der Ausschuss „Frauen im Ingenieurberuf“ im Verein Deutscher Ingenieure (VDI) mit Jutta<br />
Saatweber und Chris Schuth<br />
• Der deutsche ingenieurinnenbund (dib) mit Karin Diegelmann und<br />
• Der Verband Deutscher Elektrotechniker (VDE) mit Kirstin Eppmann.<br />
Birgit Breuel, Niedersächsische<br />
Finanzministerin und Aufsichtsratvorsitzende<br />
der Deutschen Messe-AG<br />
Maren<br />
Heinzerling/DAB<br />
Barbara Leyendecker/DAB<br />
mit Sohn Martin<br />
Dr. Ursula<br />
Huffmann/DAB<br />
Prof. Dr. Rita Süssmuth, Ministerin für<br />
Jugend, Familie, Frauen und Gesundheit<br />
Prominenter Besuch auf unserem Stand ‚Frau + Technik‘ auf der Hannover Industriemesse 1988<br />
Die erste und damit entscheidende Finanzierungszusage kam von der IBM-Frauenbeauftragten<br />
Hildegard Fleck. IBM sponserte das Projekt mit 20.000,- DM. Der Anfang war gemacht.<br />
Es folgten die Firmen MBB, Audi, SEL, Bayer-Leverkusen, MAN Roland Druckmaschinen, Krupp Atlas<br />
Elektronik, mehrere mittelständische Betriebe aus dem Kölner Raum sowie der Verband der Metallund<br />
Elektroindustrie Gesamtmetall. Insgesamt brachten wir 41.000,- DM in bar und zusätzlich<br />
10.000,- DM als Sachspenden zusammen.<br />
5
Nun waren wir alle in die Pflicht genommen. 50 Frauen stellten sich für einen kontinuierlich und<br />
kompetent besetzten Standdienst zur Verfügung, berieten Väter, berieten Studentinnen und zeigten<br />
den Industrievertretern, dass es durchaus Frauen im Ingenieurberuf gibt und was sie leisten können.<br />
DAS ECHO AUF UNSEREN STAND WAR ENORM.<br />
Er weckte die Neugier der Prominenz, selbst Bun<strong>des</strong>kanzler Helmut Kohl, Bun<strong>des</strong>ministerin Rita<br />
Süssmuth und die damalige Niedersächsische Finanzministerin Birgit Breuel kamen vorbei. Die<br />
Zeitungen überschlugen sich und texteten: Frauen machen mobil - Technik in zarter Hand - Vorurteile<br />
sollen abgebaut werden - Wo bleibt Frau Maschinenbau? - Sie zeigten Köpfchen statt Bein - Frauen<br />
an die Front - usw. Star aller Fotografen war der kleine Martin. Er schien auf dem Arm seines Vaters<br />
Willi das lebende Beispiel für ein partnerschaftliches und gelungenes Teilen von Familieaufgaben zu<br />
sein ... und er lächelte.<br />
Die Akzeptanz von Ingenieurinnen hat durch diesen Stand einen ungeheuren Schub bekommen.<br />
Niemand sprach mehr von „Ingenieuren weiblichen Geschlechts“; über Nacht waren wir zu<br />
„Ingenieurinnen“ geworden, umso nachhaltiger als wir 1989 und 1990 ein zweites und drittes Mal mit<br />
unserem viel beachteten Stand auf der Hannover Messe vertreten waren.<br />
Die Messe-Projekte hatten uns über Verbandsgrenzen hinweg zu einer Solidargemeinschaft der<br />
Ingenieurinnen zusammen geschmiedet. Fortan setzten wir uns gemeinsam für eine Verbesserung<br />
der Vereinbarkeit von Beruf und Familie ein.<br />
Auf dem Ingenieurstag <strong>des</strong> VDI in Aachen stellten wir 1989 erstmalig einen sogenannten Lebensund<br />
Berufsplan für Ingenieurinnen vor. Gerade im Ingenieursberuf mit seinen ständigen<br />
technischen Weiterentwicklungen ist eine jahrelange Unterbrechung der Berufstätigkeit extrem<br />
schädlich. Eine durchgehende Berufstätigkeit von Ingenieurinnen ist aber nur dann möglich, wenn die<br />
staatlichen, gesellschaftlichen und betrieblichen Rahmenbedingungen dazu beitragen. Das heißt:<br />
• der Staat muss ausreichend Kinderbetreuungsmöglichkeiten schaffen<br />
• die Familienaufgaben müssen partnerschaftlich geteilt werden<br />
• die Firmen müssen familienfreundliche Arbeitszeitregelungen anbieten.<br />
mit Altersteilzeit<br />
Ingenieurin<br />
Ingenieur<br />
Lebens- und Berufsplan für Ingenieurinnen und Ingenieure bei partnerschaftlicher Teilung der Familienaufgaben durch<br />
Teilzeit<br />
Wir formulierten einen Forderungskatalog zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie, den wir u.a.<br />
bei allen öffentlichen Auftritten verteilten, der Bun<strong>des</strong>anstalt für Arbeit erläuterten und an den<br />
damaligen Bun<strong>des</strong>minister für Wirtschaft, Dr. Helmut Haussmann, zusammen mit über 200<br />
Unterschriften schickten. Unsere Forderungen tauchten daraufhin zwar zunehmend in politischen<br />
Reden auf, aber die Umsetzung war zäh. Erst sinkende Geburtenzahlen scheinen jetzt die<br />
verantwortlichen PolitikerInnen aufzuschrecken. So hat es beispielsweise 16 Jahre gedauert, bis in<br />
Deutschland ein Elterngeld eingeführt wurde.<br />
Birgit Zich und ich, wir stürzten uns auf das Thema „Teilzeit für Frauen und Männer“. Wir<br />
analysierten die Realisierungsmöglichkeiten in einzelnen Firmen, stellten die Vorteile von<br />
Teilzeitregelungen für Arbeitgeber heraus und kämpften um mehr Akzeptanz von Teilzeit. Auf der<br />
Internationalen Konferenz der University Women in Helsinki boten wir 1989 einen Workshop über<br />
Part Time an; es wurde ein Workshop mit spannenden Diskussionen und vielfältigen Anregungen. In<br />
diesem Workshop erarbeiteten wir weitere Alternativen und Strategien, u.a. auch die „Altersteilzeit“,<br />
die wir besonders für älter werdende Manager propagierten.<br />
6
In den folgenden Jahren nahmen Teilzeitregelungen zu; eine wichtige Voraussetzung war dabei die<br />
elektronischen Datenverarbeitung. Der diskriminierende Ausdruck „Halbtagsjob“ wurde durch das<br />
neutrale Wort „Teilzeitarbeit“ ersetzt, mit flexiblen Regelungen versehen und aufgewertet. Die<br />
Verbreitung hängt aber immer noch eng von der jeweiligen Wirtschaftslage ab. Auch wenn wir viel zur<br />
Teilzeit-Akzeptanz beigetragen haben, hier gibt es weiterhin einiges zu tun; wir müssen uns nur immer<br />
wieder klar machen: Technik wird im Team entwickelt – also in Arbeitsteilung.<br />
5. Die Wende<br />
Die Wende 1989 wurde zu einer Zäsur für unseren Arbeitskreis.<br />
Wir hatten uns von den stets als gleichberechtigt herausgestellten ostdeutschen Kolleginnen eine<br />
Verbesserung der Rahmenbedingungen in Westdeutschland erhofft, insbesondere eine<br />
Verbesserung der Kinderbetreuungs-Angebote.<br />
Doch dann verschlechterte sich die Wirtschaftslage; gerade die ostdeutschen Ingenieurinnen und<br />
Naturwissenschaftlerinnen, die ihren Beruf mit einer solchen Selbstverständlichkeit ausgeübt hatten,<br />
bekamen die Arbeitsmarktprobleme verstärkt zu spüren. Wir westdeutschen Ingenieurinnen konnten<br />
nur bedingt helfen, denn auch in Westdeutschland wurden Ingenieure entlassen.<br />
Wir hatten lediglich mehr Erfahrung mit unserem Eigenmarketing; wir versuchten, unseren<br />
ostdeutschen Kolleginnen klar zu machen, dass allzu große Bescheidenheit zwar äußerst<br />
sympathisch, aber im Berufsleben nicht förderlich ist.<br />
Zum besseren gegenseitigen Verständnis und um die positiven Aspekte beider Systeme besser<br />
heraus zu arbeiten, bildeten wir „Ost-West-Tandems“: Jeweils eine Ingenieurin aus einem alten und<br />
eine aus einem neuen Bun<strong>des</strong>land tauschten Erfahrungen aus, gaben sich gegenseitig bei beruflichen<br />
und menschlichen Problemen Hilfestellung und lernten von einander.<br />
Wir analysierten die unterschiedlichen Lebensläufe und Chancen. Die Ergebnisse stellten Birgit Zich<br />
und Manuela Queitsch 1992 einem weltweiten Publikum in dem Workshop „Frauenleben in Ost und<br />
West“ auf der Welt-Konferenz der University Women in Stanford / USA vor.<br />
1992 starteten wir darüber hinaus eine Biographie-Aktion „Ost interviewt West und West interviewt<br />
Ost“, die wir noch fortsetzen wollen.<br />
6. Künftige Aktivitäten <strong>des</strong> Arbeitskreises<br />
Inzwischen hat sich der Frauenanteil in den sogenannten harten Ingenieursfächern Maschinenbau<br />
und Elektrotechnik zwar nicht auf das einstige paritätische DDR-Niveau erhöht, er ist aber immerhin<br />
von dem einen Prozent während meiner Studienzeit auf nunmehr 10% gestiegen. Das sehe ich als<br />
einen großen Erfolg an. Doch bis wir in Deutschland einen angemessenen Frauenanteil von etwa<br />
40% in diesen Studiengängen erreichen, sind weitere Anstrengungen notwendig.<br />
Mädchen müssen auch weiterhin verstärkt zu einer nachhaltigen, möglichst technischnaturwissenschaftlich<br />
geprägten Berufswahl ermutigt werden. Neben den erfolgreichen Girls‘ Days<br />
sollten naturwissenschaftliche Interessen schon im Kindergartenalter durch Experimentieren geweckt<br />
werden. Ergänzend zu den ins Leben gerufenen professionellen Ansätzen erscheint es uns wichtig,<br />
auch im privaten Bereich initiativ zu werden und diese Idee allgemein publik zu machen.<br />
Bärbel Strübing beispielsweise besucht bereits seit 2003 Kindergärten in Rostock, um mit den Kindern<br />
chemische und physikalische Experimente durchzuführen.<br />
Aerodynamisches Paradoxon: Bläst man über<br />
das um einen Bleistift gewickelte Papier<br />
hinweg, hebt es sich, anstatt nach unten<br />
gedrückt zu werden<br />
Quelle: Vortrag „Physikalische Experimente für<br />
Kinder“ am 9.2.06 in der TFH Berlin<br />
von Maren Heinzerling und Nora Toutaoui<br />
7
Es gibt eine Vielzahl von hervorragenden Anleitungsbüchern zum Experimentieren, die man in<br />
jeder Kinderbuchabteilung findet und die wir in der nächsten Konsensausgabe vorstellen wollen. Mit<br />
Hilfe dieser Bücher sollen Frauen und Männer dazu angeregt werden, mit den eigenen Kindern, mit<br />
Enkeln, Patenkindern und Besuchskinder fröhlich und neugierig zu experimentieren und auf diese<br />
Weise nachhaltiges Interesse an Technik und Naturwissenschaften noch vor Schuleintritt zu wecken.<br />
7. Eine persönliche Bilanz<br />
Die Anfangsjahre unserer Arbeit waren ungeheuer spannend und völliges Neuland für uns<br />
Ingenieurinnen. Ich habe daher unsere Briefe, Reden, Aufrufe, Protokolle und Forderungen aus der<br />
noch internetlosen Zeit von 1986 bis 1993 in einem Archiv zusammengestellt. Dieses Archiv stelle<br />
ich Interessentinnen gern zur Verfügung. Ich denke für soziologische Untersuchungen der<br />
Frauenbewegung im technischen Umfeld könnte es hilfreich sein und interessante Aspekte aufzeigen.<br />
Zum Abschluss meiner Ausführungen erlaube ich mir noch einen Hinweis, der mir am Herzen liegt:<br />
Wir haben uns 20 Jahre lang in diesem Arbeitskreis nicht nur höchst ehrenamtlich und ehrenvoll für<br />
eine Verbesserung der Gesellschaft engagiert, wir haben dabei auch einiges für uns selbst profitiert<br />
und gelernt. Last but not least haben wir miteinander viel Spaß gehabt. Es sind nachhaltige<br />
Freundschaften entstanden, denn erfolgreiche Projekte schweißen einfach zusammen.<br />
Hinten: Dr.Bärbel Strübing, Maren Heinzerling, Barbara Leyendecker, Dr.Sabine Hartel-Schenk, Birgit Zich<br />
Vorn: Dr.Petra Hennecke, Dr.Gerda Thieler-Mevissen, Dr.Brigitta Schober, Helene Haun, Manuele Queitsch<br />
Der Arbeitskreis ‚Frauen in Naturwissenschaft und Technik“ trifft sich 2x im Jahr.<br />
Interessentinnen wenden sich bitte an<br />
Dr.Sabine Hartel-Schenk, E-Mail: ArbeitskreisFIT@aol.com<br />
8
.<br />
Initiativen <strong>des</strong> AK für<br />
Schülerinnen<br />
Konzeptentwicklung u.<br />
Vorbereitung <strong>des</strong><br />
1. Münchner-Mädchen<br />
Technik-Tages 10.3.1990<br />
Teilnehmende Schülerinnen<br />
<strong>des</strong> 1. MMT mit<br />
Adressen<br />
Anschriften der beteiligten<br />
Firmen, Verbände,<br />
Ingenieurinnen, Hochschulen,<br />
Studentinnen<br />
sowie Gäste, Lehrerinnen,<br />
Politikerinnen<br />
PR-Texte<br />
Durchführung <strong>des</strong> 1. MMT<br />
Veranstaltungs-Dokumentation,<br />
Presseresonanz<br />
Briefwechsel zum 1.MMT<br />
Unterlagen zu Mädchen-<br />
Technik-Tagen in anderen<br />
Städten, nach gleichem<br />
Konzept wie der 1.MMT<br />
Werbung von Schülerinnen<br />
für techn. Berufe nach<br />
verschiedenen Konzepten<br />
Werbung für<br />
Technikakzeptanz und<br />
techn. Berufe in Schulen<br />
Unterlagen Schule &<br />
Wirtschaft<br />
<strong>Aktenplan</strong> <strong>des</strong> <strong>Arbeitskreisarchivs</strong><br />
1. Übersichtsordner<br />
DAB-Gründungstagung, Protokolle <strong>des</strong> AK von 1986 bis 1993<br />
Übersichten der in separaten Ordnern dokumentierten<br />
Einzelaktivitäten, kennzeichnende Einzelunterlagen<br />
2. Werbung von<br />
Schülerinnen für techn. Berufe<br />
2.1<br />
2.2<br />
2.3<br />
2.4<br />
2.5<br />
2.6<br />
2.7<br />
2.8<br />
2.9<br />
3. Unterstützung von<br />
Studentinnen u.Studenten<br />
Initiativen <strong>des</strong> AK für<br />
Studentinnen<br />
Situation von<br />
Studentinnen<br />
Infos von Staat und<br />
Industrie für Studierende<br />
techn. Fachrichtungen<br />
Info-Broschüren für<br />
Studierende technischer<br />
Fachrichtungen<br />
3.1<br />
3.2<br />
3.3<br />
3.4<br />
1<br />
Initiativen <strong>des</strong> AK zur<br />
Verbesserung der<br />
staatl. und betrieblichen<br />
Rahmenbedingungen<br />
Initiativen zur Akzeptanz<br />
weiblicher Berufstätigkeit +<br />
Kompetenzsteigerung von<br />
Ingenieurinnen<br />
Zeitungsartikel zum Thema<br />
Akzeptanz u. Arbeitsbedingungen<br />
von<br />
Ingenieurinnen<br />
Stand auf der Hannover<br />
Messe zur Akzeptanzsteigerung<br />
von<br />
Ingenieurinnen (1988-90)<br />
Initiativen <strong>des</strong> AK für Teilzeit –<br />
Regelungen für<br />
Ingenieurinnen<br />
Teilzeitregelungen in<br />
verschiedenen Bereichen<br />
(Industrie, öffentl. Dienst,<br />
Banken)<br />
Archivordner in Ottobrunn bei München<br />
E-Mail: maren.heinzerling@planet-interkom.de<br />
4. Förderung der Anliegen von<br />
Ingenieurinnen<br />
9<br />
4.1<br />
4.2<br />
4.3<br />
4.4<br />
4.5<br />
4.6