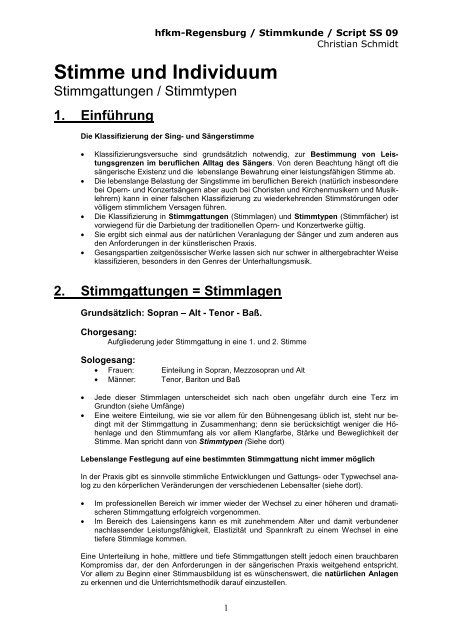Script - Stimme und Individuum
Script - Stimme und Individuum
Script - Stimme und Individuum
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
hfkm-Regensburg / Stimmk<strong>und</strong>e / <strong>Script</strong> SS 09<br />
Christian Schmidt<br />
<strong>Stimme</strong> <strong>und</strong> <strong>Individuum</strong><br />
Stimmgattungen / Stimmtypen<br />
1. Einführung<br />
Die Klassifizierung der Sing- <strong>und</strong> Sängerstimme<br />
• Klassifizierungsversuche sind gr<strong>und</strong>sätzlich notwendig, zur Bestimmung von Leistungsgrenzen<br />
im beruflichen Alltag des Sängers. Von deren Beachtung hängt oft die<br />
sängerische Existenz <strong>und</strong> die lebenslange Bewahrung einer leistungsfähigen <strong>Stimme</strong> ab.<br />
• Die lebenslange Belastung der Singstimme im beruflichen Bereich (natürlich insbesondere<br />
bei Opern- <strong>und</strong> Konzertsängern aber auch bei Choristen <strong>und</strong> Kirchenmusikern <strong>und</strong> Musiklehrern)<br />
kann in einer falschen Klassifizierung zu wiederkehrenden Stimmstörungen oder<br />
völligem stimmlichem Versagen führen.<br />
• Die Klassifizierung in Stimmgattungen (Stimmlagen) <strong>und</strong> Stimmtypen (Stimmfächer) ist<br />
vorwiegend für die Darbietung der traditionellen Opern- <strong>und</strong> Konzertwerke gültig.<br />
• Sie ergibt sich einmal aus der natürlichen Veranlagung der Sänger <strong>und</strong> zum anderen aus<br />
den Anforderungen in der künstlerischen Praxis.<br />
• Gesangspartien zeitgenössischer Werke lassen sich nur schwer in althergebrachter Weise<br />
klassifizieren, besonders in den Genres der Unterhaltungsmusik.<br />
2. Stimmgattungen = Stimmlagen<br />
Gr<strong>und</strong>sätzlich: Sopran – Alt - Tenor - Baß.<br />
Chorgesang:<br />
Aufgliederung jeder Stimmgattung in eine 1. <strong>und</strong> 2. <strong>Stimme</strong><br />
Sologesang:<br />
• Frauen: Einteilung in Sopran, Mezzosopran <strong>und</strong> Alt<br />
• Männer: Tenor, Bariton <strong>und</strong> Baß<br />
• Jede dieser Stimmlagen unterscheidet sich nach oben ungefähr durch eine Terz im<br />
Gr<strong>und</strong>ton (siehe Umfänge)<br />
• Eine weitere Einteilung, wie sie vor allem für den Bühnengesang üblich ist, steht nur bedingt<br />
mit der Stimmgattung in Zusammenhang; denn sie berücksichtigt weniger die Höhenlage<br />
<strong>und</strong> den Stimmumfang als vor allem Klangfarbe, Stärke <strong>und</strong> Beweglichkeit der<br />
<strong>Stimme</strong>. Man spricht dann von Stimmtypen (Siehe dort)<br />
Lebenslange Festlegung auf eine bestimmten Stimmgattung nicht immer möglich<br />
In der Praxis gibt es sinnvolle stimmliche Entwicklungen <strong>und</strong> Gattungs- oder Typwechsel analog<br />
zu den körperlichen Veränderungen der verschiedenen Lebensalter (siehe dort).<br />
• Im professionellen Bereich wir immer wieder der Wechsel zu einer höheren <strong>und</strong> dramatischeren<br />
Stimmgattung erfolgreich vorgenommen.<br />
• Im Bereich des Laiensingens kann es mit zunehmendem Alter <strong>und</strong> damit verb<strong>und</strong>ener<br />
nachlassender Leistungsfähigkeit, Elastizität <strong>und</strong> Spannkraft zu einem Wechsel in eine<br />
tiefere Stimmlage kommen.<br />
Eine Unterteilung in hohe, mittlere <strong>und</strong> tiefe Stimmgattungen stellt jedoch einen brauchbaren<br />
Kompromiss dar, der den Anforderungen in der sängerischen Praxis weitgehend entspricht.<br />
Vor allem zu Beginn einer Stimmausbildung ist es wünschenswert, die natürlichen Anlagen<br />
zu erkennen <strong>und</strong> die Unterrichtsmethodik darauf einzustellen.<br />
1
Bewertet werden zuallererst<br />
hfkm-Regensburg / Stimmk<strong>und</strong>e / <strong>Script</strong> SS 09<br />
Christian Schmidt<br />
• Tonhöhenumfang<br />
• Timbre<br />
• Sprechstimmlage<br />
Aber gerade bei Anfängern mit ihren gesangstechnisch noch wenig ausgebildeten <strong>Stimme</strong>n<br />
treten oft Schwierigkeiten auf, weil Tonhöhenumfang <strong>und</strong> sängerische Klangbildung noch nicht<br />
voll entwickelt sind oder sogar einem Klangideal »nachgesungen« wird, das nicht den eigenen<br />
natürlichen Voraussetzungen entspricht. Wenn ein solches Klangideal fixiert ist, haben Gesangspädagogen<br />
mitunter Schwierigkeiten, die natürliche Stimmveranlagung zu erkennen.<br />
Gr<strong>und</strong>sätzlich lässt sich nur aus der Kombination verschiedener Merkmale ein einigermaßen<br />
verlässliches Urteil bilden.<br />
2.1. Medizinisch phoniatrische Klassifizierungsmöglichkeiten:<br />
Anatomische Kriterien<br />
• Körperbau<br />
• Ansatzrohr<br />
• Kehlkopf<br />
• Stimmlippen<br />
• nachteilige Faktoren<br />
2<br />
Funktionelle Kriterien<br />
• Untere Stimmgrenze<br />
• Kaustimme<br />
• phonischer Nullpunkt,<br />
• mittlere Sprechstimmlage<br />
• Stimmumfang, Tonhöhenumfang<br />
• mittlere Stimmlage<br />
• Timbre (vorherrschende persönliche Klangfarbe)<br />
• Verteilung der Register<br />
2.1.1. Anatomische (biologische) Kriterien:<br />
Konstitution, Körperbau, Habitus<br />
Dimensionen <strong>und</strong> Form von Kehlkopf <strong>und</strong> Ansatzrohr<br />
Hormonelle Einflüsse (sie können die Stimmgattung mitbedingen)<br />
Körpergröße:<br />
• Es finden sich mit zunehmender Körpergröße tiefere <strong>Stimme</strong>n<br />
• Bei den Frauen treten die Unterschiede weniger hervor als bei den Männern<br />
Gesichtsform:<br />
• Das Gesicht des Tenors tendiert dahin, mehr r<strong>und</strong>lich zu sein<br />
• je tiefer die <strong>Stimme</strong>, umso länglicher werden die Gesichtszüge.<br />
Hals:<br />
• Das Genick ist mehr schlank bei Sängern mit tiefer <strong>Stimme</strong>, während solche mit hoher<br />
<strong>Stimme</strong> ganz allgemein kurze Nacken haben, <strong>und</strong> je breiter der Nacken, umso kräftiger ist<br />
die <strong>Stimme</strong>.<br />
Brustkorb:<br />
• Der Brustkorb der Tenöre erscheint mehr quadratisch, tief von vorn nach hinten<br />
• Die Träger tiefer <strong>Stimme</strong>n haben einen langen Brustkasten, der relativ flach ist. Das hat<br />
eine schmalere Oberfläche des Zwerchfells bei Sängern mit tiefer als mit hoher <strong>Stimme</strong><br />
zur Folge.<br />
Habitus:<br />
• Besonders bei tiefen Frauenstimmen tritt mitunter eine Tendenz zu männlichem Habitus<br />
hervor<br />
• bei hohen Tenören deuten sich manchmal weibliche Züge an.<br />
Ansatzrohr:<br />
• Größere Räume des Ansatzrohres entsprechen tiefen Stimmlagen<br />
• Kleinere Räume weisen auf hohe hin.
hfkm-Regensburg / Stimmk<strong>und</strong>e / <strong>Script</strong> SS 09<br />
Christian Schmidt<br />
Resonanzhöhlen:<br />
• Große, umfangreiche Resonanzhöhlen entsprechen den tiefen Stimmlagen<br />
• Kleinere Resonanzhöhlen entsprechen den hohen Stimmlagen<br />
Luftröhre:<br />
• Die Luftröhre erscheint bei Betrachtung mit dem Kehlkopfspiegel weit <strong>und</strong> gerade beim<br />
Bassisten<br />
• Je höher die Stimmlage, desto weniger weit kann man in die Luftröhre hineinsehen<br />
• Weit offene Morgagnische Ventrikel charakterisieren oft mächtige <strong>Stimme</strong>n<br />
Kehlkopf:<br />
• Bei Bassisten erscheint er sehr groß in allen seinen Dimensionen (tastbar)<br />
• Bei den mittleren <strong>Stimme</strong>n erscheint er kleiner frontal <strong>und</strong> der Winkel des Schildknorpels<br />
breiter<br />
• Die höchsten <strong>Stimme</strong>n haben einen ger<strong>und</strong>eten Adamsapfel <strong>und</strong> die kleinsten Dimensionen<br />
• Ganz allgemein hat der Kehlkopf den größten Abstand vom Rachen bei den tiefen <strong>Stimme</strong>n<br />
<strong>und</strong> steht höher bei höherer Stimmlage<br />
• Ein an jugendlicher <strong>Stimme</strong> erhobener Bef<strong>und</strong> kann mit deren Reifung Änderungen erfahren;<br />
es finden sich Größenverschiebungen am Ansatzrohr wie am Stimmapparat selbst.<br />
Stimmlippen<br />
• Bei langen Stimmlippen eine Tendenz zu tieferer Stimmlage<br />
• Bei kurzen eine Tendenz zu höherer Stimmlage<br />
� Die Stimmlippenlänge nimmt bei den tieferen <strong>Stimme</strong>n gegenüber den höheren<br />
zu. Auch hier drückt sich die Beziehung bei den Frauen nicht so deutlich aus wie<br />
bei Männern.<br />
• Man hat nachgewiesen, dass man die Stimmlippenlänge nicht exakt messen kann, weil<br />
sie von verschiedenen Faktoren (u. a. Tonhöhe) abhängig ist. In der Literatur wird für einen<br />
Baß bei Entspannung in Ruhe (Abduktion) eine Gesamtlänge von 24—25 mm angegeben;<br />
diese nimmt zum Sopran hin immer mehr ab, so dass bei hohen <strong>Stimme</strong>n nur<br />
noch 14—17 mm Stimmlippenlänge gemessen wurde.<br />
Nachteilige Faktoren:<br />
Es gibt Merkmale des Körperbaus (z.B. Asymmetrien im Kehlkopf) die als Zeichen einer<br />
schlechten Belastbarkeit des Stimmorgans gelten <strong>und</strong> deshalb für ein Berufssängertum fast<br />
immer als prognostisch ungünstig anzusehen sind.<br />
Während für die Tonhöhe die Stimmlippen <strong>und</strong> ihre Schwingungsverhältnisse verantwortlich<br />
sind, wird das Timbre von Form <strong>und</strong> Größe des Rachens, von der Weite des Kehlraums <strong>und</strong><br />
von der Gaumenform bestimmt<br />
• Ein weiter Abstand zwischen dem Zäpfchen <strong>und</strong> der Rachenhinterwand spricht für einen<br />
großen Resonanzraum, besonders nützlich für den Bassisten<br />
• Ein enger oberer Rachen ist bei allen Stimmgattungen der Güte der Gesangsstimme<br />
abträglich<br />
• Eine dicke <strong>und</strong> besonders im hinteren Teil sich hochwölbende Zunge, die die Weite besonders<br />
des mittleren Rachens behindert, ist meist die Ursache für das sog. „Knödeln„<br />
<strong>und</strong> kann die artikulatorische Beweglichkeit beeinträchtigen<br />
3
hfkm-Regensburg / Stimmk<strong>und</strong>e / <strong>Script</strong> SS 09<br />
Christian Schmidt<br />
• Ein schlankes Zäpfchen (Uvula), ganz gleich welcher Länge, sieht man häufig bei hohen<br />
<strong>Stimme</strong>n, während beim Baß sich meist eine breit ansetzende Uvula findet.<br />
• Eine breite flache Gaumenform gibt ein dunkles Timbre, <strong>und</strong> ein hoher, steiler, spitzförmiger<br />
Gaumen färbt die <strong>Stimme</strong> hell.<br />
Dabei ist man jedoch vor Überraschungen nicht sicher <strong>und</strong> muss sich manchmal über die<br />
starke Diskrepanz zwischen Stimmlippenbef<strong>und</strong> <strong>und</strong> Timbre der <strong>Stimme</strong> w<strong>und</strong>ern.<br />
Die sängerischen Entwicklung ist abzuwarten <strong>und</strong> nach einiger Zeit erneut zu überprüfen<br />
Vor allem in Grenzfällen ist enge Zusammenarbeit zwischen Gesangspädagogen <strong>und</strong> Stimmärzten<br />
angeraten<br />
Man bewertet zwar auch - im Zusammenhang mit anderen Merkmalen - Körperbau <strong>und</strong> -<br />
größe, Stimmlippenlänge, mittlere Sprechstimmlage <strong>und</strong> Timbre beim Sprechen <strong>und</strong> Singen,<br />
gibt letztendlich aber den subjektiven Eindrücken <strong>und</strong> gewachsener Hörerfahrung einen ausreichend<br />
großen Spielraum.<br />
2.1.2. Funktionelle Kriterien<br />
Phonischer Nullpunkt<br />
Kaustimme<br />
Indifferenzlage<br />
Stimmumfang<br />
Mittlere Stimmlage<br />
Registergrenzen<br />
Timbre<br />
Untere Stimmgrenze:<br />
• Der tiefste Ton einer <strong>Stimme</strong>, ihr phonischer Nullpunkt ist genetisch festgelegt <strong>und</strong> deshalb<br />
spätestens nach Abschluss des Wachstums unveränderlich. Er ergibt wichtigen Aufschluss<br />
über den Stimmtypus.<br />
Kaustimme:<br />
• Die Wesensverwandtschaft von Kau- <strong>und</strong> Artikulationsbewegungen führt zur Definition der<br />
sogenannten Kaustimme. Sie zeichnet sich aus durch tiefe, gelöste <strong>und</strong> volle Stimmgebung<br />
<strong>und</strong> liegt etwa eine Terz tiefer als die Indifferenzlage.<br />
• Die Lage der Kaustimme zeigt - wie die mittlere Sprechstimmlage - bei den Männern deutlichere<br />
Unterschiede als bei den Frauen.<br />
Indifferenzlage (auch mittlere Sprechstimmlage):<br />
• Mit Indifferenzlage ist unter Physiologischen Bedingungen derjenige Tonhöhenbereich<br />
innerhalb des Stimmumfanges gemeint, in dem mit geringstem Kraftaufwand anhaltend<br />
<strong>und</strong> mühelos gesprochen werden kann. Er liegt im unteren Drittel des Stimmumfanges,<br />
eine Quarte bis Quinte über der unteren Grenze.<br />
• Personen, die hoch sprechen besitzen stets auch eine hohe Singstimme.<br />
• Tiefer Sprechende können einer tieferen Stimmlage angehören, aber feste Zusammenhänge<br />
gibt es dabei nicht.<br />
• Sie ist ein guter Anhaltspunkt, jedoch sind die Unterschiede bei den Frauenstimmen nicht<br />
so deutlich ausgeprägt wie bei den Männerstimmen.<br />
• Sie kann infolge unvollständiger Mutation oder unzweckmäßigem Stimmgebrauch überhöht<br />
sein; hierdurch kann es zur Fehlbeurteilung kommen<br />
Stimmumfang:<br />
• Er trägt anfänglich nur wenig zur Klassifizierung bei, hängt er doch weitgehend vom Trainingsstand<br />
<strong>und</strong> natürlich der funktionierenden Technik eines Stimmorgans ab.<br />
• Bei den Stimmumfängen müssen wir solche sog. Durchschnittsstimmen von den künstlerisch<br />
verwertbaren <strong>Stimme</strong>n unterscheiden. Nach neueren Erkenntnissen erreicht die<br />
Durchschnittsstimme ganz allgemein nicht den Umfang von 2 Oktaven. Während bei den<br />
Kinderstimmen zwischen Sopran, Mezzo <strong>und</strong> Alt in den oberen Tongrenzen Unterschiede<br />
von einer Terz g2/e2/c2 gef<strong>und</strong>en werden, ist in der gleichen Lage der Erwachsenenstimme<br />
nur ein Ton Unterschied g2, f2, e2. Zwischen den Durchschnittsstimmen <strong>und</strong> den<br />
Kunstgesangsstimmen bestehen in den für die einzelnen Stimmgattungen verlangten<br />
4
hfkm-Regensburg / Stimmk<strong>und</strong>e / <strong>Script</strong> SS 09<br />
Christian Schmidt<br />
Stimmumfängen große Unterschiede. Allgemein kann man sagen, dass die Grenzen des<br />
oberen Stimmumfangs bei den Durchschnittsstimmen um eine Terz bis eine Sext tiefer<br />
liegen, als bisher beschrieben wurde, während die unteren Tongrenzen etwa gleich<br />
geblieben sind.<br />
• Alt- <strong>und</strong> Baritonstimmen weisen die kleinsten Umfänge auf<br />
Mittlere Stimmlage:<br />
• Die mittlere Stimmlage, d. h. die Mitte zwischen dem höchsten <strong>und</strong> dem tiefsten Ton, kann<br />
zur Bestimmung herangezogen werden<br />
Registergrenzen:<br />
• Nach Registergrenzen sind keine eindeutigen Festlegungen möglich, allein die obere<br />
Grenze des Brustregisters, am ehesten bestimmbar, lässt sich unter Vorbehalt bei der<br />
Klassifizierung verwenden. Die Klangfarbe wird häufig überbewertet, kann aber für den<br />
Erfahrenen aufschlussreich sein. Immer muss man bedenken, dass der Stimmklang willkürlich<br />
aufgehellt <strong>und</strong> verdunkelt werden kann.<br />
Neben der Bestimmung bezüglich der Stimmgattung ebenfalls wichtig:<br />
• das Wohlbefinden während des Singens<br />
• der Grad der Anstrengung<br />
• Missempfindungen <strong>und</strong> Hustenreiz<br />
• der Zeitpunkt der <strong>Stimme</strong>rmüdung<br />
• die Dauer der Erholung<br />
• die Tendenz zu sek<strong>und</strong>är organischen Veränderungen (Phonationsverdickungen)<br />
Überprüfung des Berufssängers durch einen Phoniater durch Erstellung regelmäßig Sing- <strong>und</strong><br />
Sprechstimmprofile, um die Merkmale Tonhöhen- <strong>und</strong> Dynamikumfang sowie Klangfähigkeit<br />
der <strong>Stimme</strong> vokalabhängig in eine Gesamtbeurteilung ein-beziehen zu können.<br />
3. Stimmtypen = Stimmfächer<br />
Die Einteilung der Stimmtypen gilt überwiegend für Bühnensolisten (professionelle Sänger)<br />
<strong>und</strong> hat sich erst Ende des 18. Jahrh<strong>und</strong>erts mit der stimmlichen Spezialisierung auf bestimmte<br />
Partien herausgebildet.<br />
Auch hier erweist es sich als schwierig, sängerische Individualität zu typisieren, ein gewisser<br />
persönlichen Spielraum muss erhalten bleiben.<br />
Stimmtypen beziehen sich nur bedingt auf die Stimmgattung <strong>und</strong> berücksichtigen weniger Höhe<br />
<strong>und</strong> Umfang der <strong>Stimme</strong> als vielmehr ihre<br />
»Struktur«<br />
Stärke, Klangfarbe, Beweglichkeit, Akzentuierungsmöglichkeiten,<br />
Expansivität, Vibrato, Einsatz <strong>und</strong> Absatz.<br />
Auch: Atemkraft, Gestalt, körperliche Gewandtheit,<br />
Persönlichkeitsstruktur, Temperament,<br />
Ausdrucksvermögen (psychische Voraussetzungen für eine sängerische Aufgabe)<br />
Grenzen zwischen den Stimmgattungen sind fließend.<br />
Festlegungen erfolgen häufig zu einem Zeitpunkt, wo die körperliche Entwicklung des Einzuschätzenden<br />
noch nicht abgeschlossen ist <strong>und</strong> bestimmte sachliche Merkmale der <strong>Stimme</strong><br />
durch die Ausbildung noch verändert werden können, <strong>und</strong> auch weil gewisse Wunschvorstellungen<br />
von Sänger <strong>und</strong> Pädagogen die Entscheidung erschweren.<br />
5
hfkm-Regensburg / Stimmk<strong>und</strong>e / <strong>Script</strong> SS 09<br />
Christian Schmidt<br />
Die einzelnen Typen ergeben sich demnach aus:<br />
• individuellen Besonderheiten der körperlichen, psychischen <strong>und</strong> stimmlichen Veranlagung<br />
<strong>und</strong> Leistungsfähigkeit<br />
• Anforderungen in der praktischen künstlerischen Arbeit<br />
3.2. Einteilung:<br />
Sopran: Soubrette, lyrischer Sopran, jugendlich-dramatischer Sopran. Zwischenfach, hochdramatischer<br />
Sopran, Koloratursopran, dramatischer Koloratursopran<br />
Mezzosopran<br />
Alt: Spielalt, dramatischer Alt<br />
Tenor: Tenorbuffo, Charaktertenor, lyrischer Tenor, jugendlicher Heldentenor, Zwischenfach,<br />
schwerer Heldentenor<br />
Bariton: Spielbariton, lyrischer Bariton, Charakterbariton, Zwischenfach, Heldenbariton<br />
Baß: Baßbuffo, seriöser Baß, Spielbaß, Charakterbaß<br />
unabhängig von Geschlecht <strong>und</strong> Stimmgattung<br />
ergeben sich folgende Stimmtypen:<br />
• Spiel oder Buffotyp<br />
• Charaktertyp<br />
• lyrischer oder seriöser Typ<br />
• spezieller Koloraturtyp für die hohe Frauenstimme<br />
• dramatischer oder heldischer Typ<br />
6