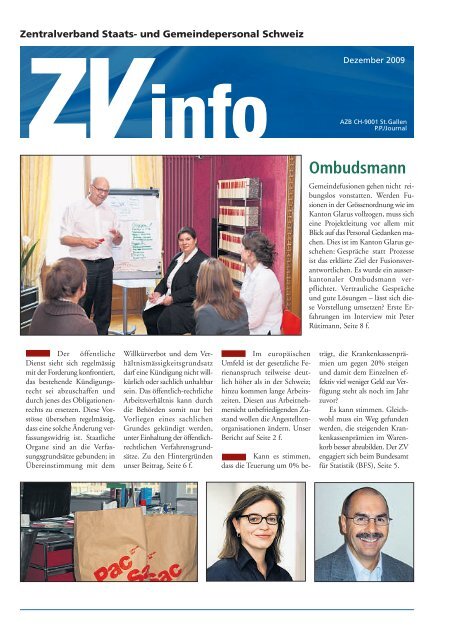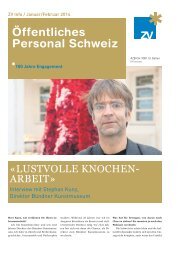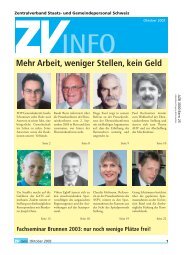ZVinfo 12 09:ZV-Info - Zentralverband Öffentliches Personal Schweiz
ZVinfo 12 09:ZV-Info - Zentralverband Öffentliches Personal Schweiz
ZVinfo 12 09:ZV-Info - Zentralverband Öffentliches Personal Schweiz
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Zentralverband</strong> Staats- und Gemeindepersonal <strong>Schweiz</strong><br />
Der öffentliche<br />
Dienst sieht sich regelmässig<br />
mit der Forderung konfrontiert,<br />
das bestehende Kündigungsrecht<br />
sei abzuschaffen und<br />
durch jenes des Obligationenrechts<br />
zu ersetzen. Diese Vorstösse<br />
übersehen regelmässig,<br />
dass eine solche Änderung verfassungswidrig<br />
ist. Staatliche<br />
Organe sind an die Verfassungsgrundsätze<br />
gebunden; in<br />
Übereinstimmung mit dem<br />
Willkürverbot und dem Verhältnismässigkeitsgrundsatz<br />
darf eine Kündigung nicht willkürlich<br />
oder sachlich unhaltbar<br />
sein. Das öffentlich-rechtliche<br />
Arbeitsverhältnis kann durch<br />
die Behörden somit nur bei<br />
Vorliegen eines sachlichen<br />
Grundes gekündigt werden,<br />
unter Einhaltung der öffentlichrechtlichenVerfahrensgrundsätze.<br />
Zu den Hintergründen<br />
unser Beitrag, Seite 6 f.<br />
Im europäischen<br />
Umfeld ist der gesetzliche Ferienanspruch<br />
teilweise deutlich<br />
höher als in der <strong>Schweiz</strong>;<br />
hinzu kommen lange Arbeitszeiten.<br />
Diesen aus Arbeitnehmersicht<br />
unbefriedigenden Zustand<br />
wollen die Angestelltenorganisationen<br />
ändern. Unser<br />
Bericht auf Seite 2 f.<br />
Kann es stimmen,<br />
dass die Teuerung um 0% be-<br />
Dezember 20<strong>09</strong><br />
AZB CH-9001 St.Gallen<br />
P.P./Journal<br />
Ombudsmann<br />
Gemeindefusionen gehen nicht reibungslos<br />
vonstatten. Werden Fusionen<br />
in der Grössenordnung wie im<br />
Kanton Glarus vollzogen, muss sich<br />
eine Projektleitung vor allem mit<br />
Blick auf das <strong>Personal</strong> Gedanken machen.<br />
Dies ist im Kanton Glarus geschehen:<br />
Gespräche statt Prozesse<br />
ist das erklärte Ziel der Fusionsverantwortlichen.<br />
Es wurde ein ausserkantonaler<br />
Ombudsmann verpflichtet.<br />
Vertrauliche Gespräche<br />
und gute Lösungen –lässt sich diese<br />
Vorstellung umsetzen? Erste Erfahrungen<br />
im Interview mit Peter<br />
Rütimann, Seite 8 f.<br />
trägt, die Krankenkassenprämien<br />
um gegen 20% steigen<br />
und damit dem Einzelnen effektiv<br />
viel weniger Geld zur Verfügung<br />
steht als noch im Jahr<br />
zuvor?<br />
Es kann stimmen. Gleichwohl<br />
muss ein Weg gefunden<br />
werden, die steigenden Krankenkassenprämien<br />
im Warenkorb<br />
besser abzubilden. Der <strong>ZV</strong><br />
engagiert sich beim Bundesamt<br />
für Statistik (BFS), Seite 5.
FERIEN<br />
<strong>Schweiz</strong>er Arbeitnehmende haben im internationalen Vergleich<br />
die kürzesten Ferien und die längsten Arbeitszeiten. Die Angestelltenorganisationen<br />
möchten dies ändern.<br />
Der gesetzliche Ferienanspruch<br />
in der <strong>Schweiz</strong> beträgt vier Wochen,<br />
für Arbeitnehmende unter<br />
20 Jahren sind es fünf Wochen.<br />
Mit dieser Regelung – und weil sie<br />
auch bei der Anzahl Feiertage abfällt<br />
– ist die <strong>Schweiz</strong> das Schlusslicht<br />
in Europa. Zu diesem Ergebnis<br />
kommt eine im Oktober<br />
veröffentlichte Studie des Beratungsunternehmens<br />
Mercer, welches<br />
die Ferien- und Feiertagsregelungen<br />
in über 40 Ländern<br />
weltweit untersucht hat: In allen<br />
europäischen Ländern liegt der ge-<br />
INHALT<br />
Freizeit für <strong>Schweiz</strong>er Arbeitnehmende:<br />
Kein Ferienparadies Seite 2<br />
Impressum Seite 4<br />
Aus der Verbandsarbeit: Landesindex der<br />
Konsumentenpreise und Krankenversicherungsprämien Seite 5<br />
Alles, was Recht ist:<br />
Kündigungsregelung im öffentlichen Dienst Seite 6<br />
Gemeindefusion Kanton Glarus:<br />
setzliche Ferienanspruch teilweise<br />
deutlich höher als in der <strong>Schweiz</strong>.<br />
Der gesetzliche Anspruch ist<br />
das eine, das andere ist die Realität,<br />
und dort sieht es häufig etwas<br />
besser aus:<br />
Viele Arbeitnehmende profitieren<br />
von einem Gesamtarbeitsvertrag<br />
oder einer firmeninternen<br />
Regelung, die deutlich über das gesetzliche<br />
Minimum hinausgehen<br />
und fünf Wochen Ferien nicht nur<br />
für die unter 20-Jährigen verfügen,<br />
sondern für sämtliche Mitarbeitenden.<br />
Interview mit dem Ombudsmann Seite 8<br />
Freizeit für <strong>Schweiz</strong>er Arbeitnehmende:<br />
Kein Ferienparadies<br />
Unmut bei Polizei und Pflegepersonal<br />
Am Standard der Privatwirtschaft<br />
mit fünf Wochen Ferien orientiert<br />
sich auch die kantonalzürcherische<br />
Volksinitiative «Für faire Ferien»,<br />
die am 21. Oktober 20<strong>09</strong> bei der<br />
Justizdirektion eingereicht wurde.<br />
Die Unterschriften kamen laut<br />
Willy Rüegg, Leiter Berufspolitik<br />
des KV Zürich, innerhalb eines<br />
halben Jahres zusammen. Die Initiative<br />
verlangt für das <strong>Personal</strong>,<br />
das rund um die Uhr im Dienste<br />
der Öffentlichkeit steht, fünf Wo-<br />
Die <strong>Schweiz</strong>er Lohnlandschaft 2008 Seite 10<br />
VGB-Lohnverhandlungen: Enttäuschendes<br />
Therese Jäggi<br />
chen Ferien im Minimum. Weil<br />
die Initiative einen Mindestanspruch<br />
von wenigstens fünf Wochen<br />
Ferien im kantonalen <strong>Personal</strong>gesetz<br />
festschreiben will, stammt<br />
denn auch die Mehrzahl der Unterschriften<br />
aus den Gemeinden<br />
des Kantons Zürich, den Regionalen<br />
Arbeitsvermittlungszentren,<br />
dem kantonalen Strassenunterhalt,<br />
von Polizistinnen und Polizisten<br />
sowie vom Pflegepersonal.<br />
Bei diesen beiden letzten Gruppen<br />
macht Willy Rüegg denn<br />
auch den grössten Unmut aus: «Sie<br />
Resultat für das Bundespersonal Seite <strong>12</strong><br />
<strong>ZV</strong>-Lohnvergleich: Fünfter Teil Seite 13<br />
Baselstädtischer Angestellten-Verband Seite 19<br />
Staats- und Gemeindepersonalverband Obwalden Seite 20<br />
Landesindex der Konsumentenpreise Seite 22<br />
Stadtpersonalverband Luzern Seite 23<br />
2 Dezember 20<strong>09</strong> <strong>12</strong>/<strong>09</strong>
FERIEN<br />
müssen konstant mit wenig <strong>Personal</strong><br />
arbeiten und können nicht<br />
einmal ihre Überzeit kompensieren.<br />
Das geht auf die Dauer an die<br />
Substanz.» Die Einführung der<br />
fünften Ferienwoche als Mindestmass<br />
im Kanton hätte seiner<br />
Meinung nach wiederum Signalwirkung<br />
auf jene Privatbetriebe,<br />
die wie der Kanton Zürich immer<br />
noch bloss vier Wochen Ferien gewähren.<br />
Ohne Gegenvorschlag muss<br />
die Initiative spätestens Anfang<br />
April 20<strong>12</strong> vors Volk. So lange<br />
wollen der VPOD und der KV<br />
Zürich aber nicht zuwarten, denn<br />
rund um den Kanton Zürich sind<br />
die Ferienbedingungen verbessert<br />
worden: zum Beispiel in den Kantonen<br />
Schaffhausen, Thurgau und<br />
Aargau. Der VPOD und der KV<br />
Zürich verlangen vom Kanton<br />
Zürich, dass auf nächstes Jahr als<br />
erster Schritt zwei zusätzliche Ferientage<br />
für alle eingeführt werden.<br />
«Wir möchten damit Hand bieten<br />
für eine flexible Einführung», sagt<br />
Rüegg. In der Stadt Zürich forderten<br />
die <strong>Personal</strong>verbände schon<br />
letztes Jahr eine zusätzliche Ferienwoche,<br />
doch lehnte der Finanzvorstand<br />
Martin Vollenwyder das<br />
Anliegen wegen der Krise vorläufig<br />
ab. Hingegen handelte der<br />
KV Zürich laut Willy Rüegg im<br />
Rahmen der Sozialpartnerschaft<br />
mit dem Verband der Zürcher<br />
Handelsfirmen, dem 2300 Firmen<br />
angeschlossen sind, einen solchen<br />
Vertrag aus. Die fünfte Ferienwoche<br />
wurde zwischen 2002 und<br />
2006 schrittweise eingeführt.<br />
Grosse Unterschiede<br />
Noch etwas weiter mit der Forderung<br />
nach mehr Ferien geht der<br />
Gewerkschaftsdachverband Travail<br />
Suisse. Er reichte am 26.<br />
Juni die eidgenössische Volksinitiative<br />
«6 Wochen Ferien für<br />
alle» ein. Die Initiative fordert die<br />
schrittweise Erhöhung des gesetzlichen<br />
Minimums an bezahl-<br />
<strong>12</strong>/<strong>09</strong><br />
In der <strong>Schweiz</strong> weniger Ferien als im restlichen Europa<br />
ten Ferien pro Jahr von vier auf<br />
sechs Wochen.<br />
Störend finden die Initianten,<br />
dass es bezüglich der verschiedensten<br />
Kriterien grosse Unterschiede<br />
gibt. So reicht das Spektrum<br />
bei den Branchen von 4 Ferienwochen<br />
(Land- und Forstwirtschaft)<br />
bis zu 5,1 Wochen<br />
(Kredit- und Versicherungsgewerbe)<br />
(siehe Tabelle). Unterschiede<br />
gibt es auch beim Alter<br />
der Arbeitnehmenden. Die Altersklasse<br />
der 21- bis 49-Jährigen<br />
hat im Schnitt 4,8 Wochen Ferien.<br />
Das ist fast eine Woche weniger als<br />
die Altersklasse der 50- bis 64-Jährigen.<br />
Diese haben im<br />
Schnitt rund 5,6 Wochen<br />
Ferien. Grosse Unterschiede<br />
stellt Travail Suisse<br />
auch bei den Gesamtarbeitsverträgen<br />
fest. So<br />
ergab ihre Auswertung,<br />
dass noch immer zahlreiche<br />
Gesamtarbeitsverträge<br />
nicht über das gesetzliche<br />
Minimum hinausgehen.<br />
Veränderung der Arbeit<br />
Neben der Ungleichheit<br />
argumentiert der Gewerkschaftsdachverband<br />
mit der zunehmenden Belastung.<br />
Technologischer Wandel, Globalisierung<br />
und lange Rezessionsphasen<br />
hätten Konsequenzen für<br />
die Arbeitnehmenden: «Verdichtung<br />
und Intensivierung der Arbeit,<br />
Erhöhung des Arbeitsrhythmus,<br />
steigender Zeitdruck, ständige<br />
Anpassungsbereitschaft und<br />
absolute Verfügbarkeit.»<br />
Laut Hansueli Schütz, Ressortleiter<br />
Wirtschafts- und Sozialpolitik<br />
beim KV <strong>Schweiz</strong>, greift<br />
die Initiative ein wichtiges Problem<br />
auf. Sechs statt vier Wochen wären<br />
seiner Meinung nach eine Lösung,<br />
welche sich auf die Lebens-<br />
qualität von Arbeitnehmenden<br />
sehr positiv auswirken würde, aber<br />
die Rahmenbedingungen müssten<br />
noch erheblich verbessert werden.<br />
«Heute sind es erst vor allem<br />
grössere Unternehmen, die im<br />
Minimum 5 Wochen Ferien gewähren,<br />
im KMU-Bereich und bei<br />
der öffentlichen Hand gilt dies leider<br />
noch nicht überall», bedauert<br />
Schütz.<br />
Bei der 6-Wochen-Initiative<br />
fehlt es seiner Meinung nach noch<br />
an Varianten zur Ausgestaltung. So<br />
müsste es beispielsweise möglich<br />
sein, dass jemand eine Ferienwoche<br />
jährlich im Hinblick auf ein<br />
Dezember 20<strong>09</strong> 3
FERIEN<br />
Sabbatical auf einem Langzeitferienkonto<br />
deponiert.<br />
Weiter sind Vorstellungen<br />
und Modelle nötig,<br />
wie die 6. Ferienwoche<br />
durch zusätzliche Kapazitäten<br />
kompensiert werden<br />
könnte. «Wenn die zusätzlichen<br />
Ferien zulasten der<br />
Kollegen gehen oder wenn<br />
jemand vor oder nach seinen<br />
Ferien umso mehr arbeiten<br />
muss, dann ist das<br />
eigentliche Ziel der Initiative,<br />
die Erholung, gefährdet.»<br />
Die konkrete Ausgestaltung<br />
müssen aber laut<br />
Schütz die Sozialpartner<br />
übernehmen.<br />
Mit GAV mehr Ferien<br />
«Arbeitnehmende, die einem GAV<br />
unterstehen, profitieren in der<br />
Regel von mehr Ferien als die anderen»,<br />
sagt Barbara Gisi, Leiterin<br />
Angestelltenpolitik beim KV<br />
<strong>Schweiz</strong>. Dies geht hervor aus einer<br />
Übersicht über die Ferienvereinbarungen<br />
der vom KV <strong>Schweiz</strong><br />
ausgehandelten gesamtschweizerischen<br />
GAV, Vereinbarungen und<br />
Empfehlungen. Mindestens fünf<br />
IMPRESSUM<br />
HERAUSGEBER<br />
<strong>Zentralverband</strong> Staats- und Gemeindepersonal <strong>Schweiz</strong> (<strong>ZV</strong>)<br />
Postscheckkonto Aarau 50-7075-3<br />
Präsident: Urs Stauffer<br />
Pianostrasse 32, 2503 Biel<br />
Tel. G032 326 23 25, Fax G 032 326 13 94<br />
Tel. P032 341 43 <strong>09</strong><br />
E-Mail: urs.stauffer@fin.be.ch<br />
VERBANDSSEKRETARIAT<br />
Dr. Michael Merker<br />
Langhaus 3<br />
Postfach 1863, 5401 Baden<br />
Tel. 056 204 02 90, Fax 056 204 02 91<br />
E-Mail: zentral@zentral.ch<br />
REDAKTION / LAYOUT<br />
Sandra Wittich und Michael Merker<br />
Langhaus 3, Postfach 1863, 5401 Baden<br />
Tel. 056 204 02 90, Fax 056 204 02 91<br />
E-Mail: zentral@zentral.ch<br />
www.zentral.ch<br />
Wochen Ferien sind in acht GAV<br />
und Vereinbarungen festgeschrieben<br />
(Migros, Coop, Globus-Gruppe,<br />
MEM-Industrie, Bankangestellte,<br />
Holzbau, Swissport International<br />
AG, Zürich, <strong>Schweiz</strong>erisches<br />
Bauhauptgewerbe), und acht<br />
bewegen sich mit 22 oder 23 Tagen<br />
über dem gesetzlichen Minimum<br />
(Versicherungen Innendienst,<br />
Versicherungen Aussendienst,<br />
SR Technics, Cargologic,<br />
ANZEIGENVERKAUF<br />
St. Galler Tagblatt AG, <strong><strong>ZV</strong>info</strong><br />
Daniel Noger<br />
Fürstenlandstrasse <strong>12</strong>2<br />
9001 St. Gallen<br />
Tel. G: 071 272 73 51 Fax G: 071 272 75 29<br />
E-Mail: d.noger@tagblattmedien.ch<br />
ABOSERVICE<br />
St. Galler Tagblatt AG, <strong><strong>ZV</strong>info</strong><br />
Fürstenlandstrasse <strong>12</strong>2<br />
9001 St. Gallen<br />
Tel. G: 071 272 71 83 Fax G: 071 272 73 84<br />
E-Mail: zvinfo@tagblattmedien.ch<br />
DRUCK UND VERSAND<br />
St. Galler Tagblatt AG<br />
Fürstenlandstrasse <strong>12</strong>2<br />
9001 St. Gallen<br />
Avireal AG, Swissport <strong>Schweiz</strong><br />
AG, Basel, GAV Bodenpersonal<br />
Swiss Intern. Air Lines, Temporäre<br />
Angestellte). Am grosszügigsten<br />
sind die Detailhändler Coop und<br />
Migros. Ausser fünf Wochen für<br />
alle gewähren sie sechs Wochen Ferien<br />
für Angestellte bis 20 Jahre sowie<br />
für 50- bis 59-Jährige und zusätzliche<br />
Ferientage ab dem 60. Altersjahr<br />
bzw. für langjährige Firmentreue.<br />
AUFLAGE<br />
Auch Barbara Gisi ist<br />
der Meinung, dass Ferien<br />
mit zunehmendem<br />
Druck und Stress eine<br />
hohe Bedeutung zukommt.<br />
«Die Leute leisten<br />
immer mehr, also<br />
braucht es auch mehr<br />
Erholungsphasen.» Das<br />
OR sieht zwei Wochen<br />
am Stück vor, besser wären<br />
aber ihrer Meinung<br />
nach drei Wochen, während<br />
deren man sich<br />
physisch und mental erholt<br />
und seine Batterien<br />
wieder neu laden kann.<br />
Wichtig sei auch, dass<br />
man nicht ständig per<br />
Handy oder E-Mail erreichbar<br />
sein müsse. In<br />
den Ferien sollte man sich laut Barbara<br />
Gisi Zeit nehmen für sich selber,<br />
den Partner / die Partnerin<br />
oder die Familie und sich während<br />
dieser Phase weitgehend von der<br />
Firma abgrenzen.<br />
26 327 Exemplare<br />
(WEMF-beglaubigt 2008 / 20<strong>09</strong>)<br />
REDAKTIONSSCHLUSS<br />
Therese Jäggi,<br />
Context-Redaktorin,<br />
KV <strong>Schweiz</strong><br />
Nr. Red. Schluss Erscheint<br />
1/2 • 10 11. 01. 10 27. 01. 10<br />
3 • 10 15. 02. 10 03. 03. 10<br />
4 • 10 15. 03. 10 31. 03. 10<br />
5 • 10 26. 04. 10 <strong>12</strong>. 05. 10<br />
6 • 10 25. 05. 10 <strong>09</strong>. 06. 10<br />
7/8 • 10 02. 08. 10 18. 08. 10<br />
9 • 10 23. 08. 10 08. <strong>09</strong>. 10<br />
10 • 10 20. <strong>09</strong>. 10 06. 10. 10<br />
11 • 10 02. 11. 10 17. 11. 10<br />
<strong>12</strong> • 10 29. 11. 10 15. <strong>12</strong>. 10<br />
4 Dezember 20<strong>09</strong> <strong>12</strong>/<strong>09</strong>
AUS DER VERBANDSARBEIT<br />
<strong>12</strong>/<strong>09</strong><br />
Landesindex der Konsumentenpreise<br />
und Krankenversicherungsprämien<br />
Viele unserer Mitglieder stellen uns heute die Frage, warum die<br />
Krankenversicherungsprämien im Landesindex der Konsumentenpreise<br />
(LIK) nicht enthalten sind. Unsere Antwort lautete<br />
stets: Weil die Medikamente, die Arztkosten etc. alle im LIK enthalten<br />
sind, können die Prämien, mit denen diese Kosten bezahlt<br />
werden, nicht auch noch im LIK enthalten sein. Sonst würden die<br />
Elemente der Gesundheitskosten doppelt gezählt.<br />
Die starken Prämienerhöhungen<br />
der Krankenkassen und der scheinbar<br />
geringe Zuwachs des LIK<br />
führten dazu, dass wir vom Bundesamt<br />
für Statistik (BFS) einige<br />
<strong>Info</strong>rmationen zu der eingangs<br />
gestellten Frage einholten. Die<br />
Antwort des BFS bestätigte und<br />
präzisierte unsere Aussage. Im<br />
LIK ist unter Gesundheitspflege<br />
mit einer Gewichtung von<br />
14,075% im Jahr 20<strong>09</strong> Folgendes<br />
zusammengefasst:<br />
• Medikamente<br />
• Sanitätsmaterial<br />
• Medizinische Apparate und<br />
Geräte<br />
• Ärztliche und zahnärztliche<br />
Leistungen<br />
• Andere Gesundheitskosten<br />
• Spitalleistungen<br />
Dazu in der Antwort: «Der Warenkorbbereich<br />
der Gesundheitspflege<br />
wird im LIK mit den durch<br />
die Haushalte direkt bezahlten<br />
Leistungen und den Prämienausgaben<br />
für die Krankenversicherungen<br />
gewichtet.<br />
Die Prämienausgaben werden<br />
im LIK bei Gewichtung also sehr<br />
wohl berücksichtigt. Welche der<br />
beiden Finanzierungsweisen den<br />
grösseren Anteil an den Gesundheitskosten<br />
trägt, spielt in diesem<br />
Zusammenhang keine Rolle…»<br />
«Prämien beinhalten neben einer<br />
Preiskomponente auch eine Mengenkomponente.<br />
Der eigentliche Gegenstand<br />
der Preisstatistik ist indessen die<br />
Entwicklung der Preise, weshalb<br />
diese gesondert und unbeeinflusst<br />
von allfälligen Mengenänderungen<br />
betrachtet werden müssen.»<br />
Zusätzlicher Krankenversicherungsprämienindex<br />
Als Ergänzung zum LIK berechnet<br />
das BFS seit 1999 auch einen<br />
Krankenversicherungsprämienindex<br />
(KVPI).<br />
Wir haben uns eine Gegenüberstellung<br />
von Teuerung, LIK<br />
und KVPI für die Jahre 2005<br />
(Einführung des neuen LIK) und<br />
2008 erlaubt, welche Sie der untenstehenden<br />
Tabelle entnehmen<br />
können.<br />
Wir fragen uns, wie denn der<br />
erwähnte Anteil der Prämienausgaben<br />
in den Warenkorbbereich<br />
Gesundheitsausgaben einfliesst.<br />
Ferner ist uns nicht klar, wie<br />
der Einfluss der Gesundheitspflege<br />
dermassen rückläufig sein kann,<br />
wenn doch die Teuerung bei KVPI<br />
fast doppelt so stark ist wie die<br />
Teuerung des Warenkorbes (der<br />
LIK für Gesundheitspflege für<br />
20<strong>09</strong> ist sogar 14,075%, also<br />
nochmals tiefer gewichtet!).<br />
Wir werden diese Unklarheiten<br />
mit dem BFS abklären und in<br />
Vergleich Landesindex der Konsumentenpreise<br />
und Krankenversicherungsprämienindex<br />
2006 2008 Änderung<br />
Teuerung Dez. 2005 = 100% 99,8% 102.0% +2,2%<br />
LIK Gewichtung Gesundheitspflege:<br />
Anteil am Warenkorb 16,719% 14,467% –2,252%<br />
KVPI 136,7% 142,5% +4,24%<br />
Rudolf Brosi<br />
einem späteren Bericht darüber informieren.<br />
Relevanz für Löhne?<br />
Wir messen unsere Löhne stets mit<br />
dem Teuerungsindex, der identisch<br />
mit dem LIK ist. Die Aussage, im<br />
LIK seien nur die Preise, nicht aber<br />
die Mengen enthalten, wirft die<br />
Frage auf, ob denn der LIK die<br />
Entwicklung der Lebenshaltungskosten<br />
genügend genau widerspiegelt,<br />
um seine ihm zufallende<br />
Rolle in der Entwicklung der<br />
Gehälter wahrzunehmen.<br />
Ruedi Brosi<br />
Dezember 20<strong>09</strong> 5
ALLES, WAS RECHT IST<br />
Dr. Michael Merker<br />
Rechtsanwalt<br />
1. Allgemeines zum öffentlichen<br />
Dienstrecht<br />
Das öffentliche Dienstrecht umfasst<br />
die Beamten- bzw. <strong>Personal</strong>gesetze<br />
und weitere dienstrechtliche<br />
Erlasse des Bundes, der Kantone,<br />
der Gemeinden und anderer<br />
öffentlich-rechtlicher Organisationen.<br />
Als Arbeitgeber tritt dabei<br />
stets der Staat bzw. eine öffentlichrechtliche<br />
Organisation auf. Arbeitnehmerin<br />
ist eine Privatperson.<br />
Dieses Verhältnis zwischen der<br />
öffentlichen Hand und Privaten ist<br />
ein besonderes Rechtsverhältnis,<br />
genannt Sonderstatusverhältnis.<br />
Die betroffene Privatperson<br />
steht in einer engeren Rechtsbeziehung<br />
zum Staat als die<br />
übrigen Menschen. Dadurch<br />
können sich für die Privatperson<br />
besondere Pflichten und Einschränkungen<br />
ergeben.<br />
Der Staat ist aber grundsätzlich<br />
auch gegenüber seinen<br />
Angestellten trotz des engeren<br />
Rechtsverhältnisses an die<br />
Grundrechte der schweizerischen<br />
Bundesverfassung (BV;<br />
SR 101) und an die allgemeinen<br />
Grundsätze des staatlichen Han-<br />
Kündigungsregelung<br />
im öffentlichen Dienstrecht<br />
In einzelnen Kantonen wird erwogen, das <strong>Personal</strong>recht anzupassen.<br />
Die bestehenden Kündigungsbestimmungen sollen ersetzt<br />
werden durch die obligationenrechtlichen Vorschriften.<br />
Eine solche Angleichung des öffentlichen Dienstrechts ans Privatrecht<br />
ist bundesverfassungswidrig.<br />
Die staatlichen Organe sind an die Verfassungsgrundsätze gebunden.<br />
In Übereinstimmung mit dem Willkürverbot und dem<br />
Verhältnismässigkeitsgrundsatz darf eine Kündigung nicht willkürlich<br />
oder sachlich unhaltbar sein. Das öffentlich-rechtliche<br />
Arbeitsverhältnis kann von Seiten der Behörde somit nur bei Vorliegen<br />
eines sachlichen Grundes gekündigt werden. Dem oder der<br />
Angestellten ist vorgängig das rechtliche Gehör zu gewähren.<br />
delns gebunden. Die vom Staat zu<br />
beachtenden Grundsätze sind insbesondere<br />
das Legalitätsprinzip, die<br />
Rechtsgleichheit, das öffentliche<br />
Interesse, das Verhältnismässigkeitsgebot<br />
und der Grundsatz von<br />
Treu und Glauben, insbesondere<br />
das Willkürverbot. Daraus folgt,<br />
dass der Staat in der Begründung,<br />
Ausgestaltung und auch Beendigung<br />
des Arbeitsverhältnisses mit<br />
der Privatperson nicht völlig frei<br />
ist. Dies ist auch beim Erlass eines<br />
neuen <strong>Personal</strong>gesetzes bzw. bei der<br />
Neuregelung des öffentlich-rechtlichen<br />
Arbeitsverhältnisses im Rah-<br />
men eines bestehenden Gesetzes<br />
stets zu berücksichtigen.<br />
2. Allgemeines zum Arbeitsverhältnis<br />
nach Obligationenrecht<br />
(OR; SR 220)<br />
Im schweizerischen Privatrecht<br />
gilt das Prinzip der Vertragsfreiheit.<br />
Im Gegensatz zum öffentlichen<br />
Dienstrecht sind in diesen Fällen<br />
sowohl die Arbeitnehmer als auch<br />
die Arbeitgeber Privatpersonen.<br />
Abgesehen vom Diskriminierungsverbot<br />
gemäss Art. 8 BV ist<br />
der private Arbeitgeber bzw. die<br />
private Arbeitgeberin (nachfol-<br />
Bettina Lienhard<br />
lic. iur.<br />
gend: der Arbeitgeber) nicht an die<br />
Grundrechte und andere Verfassungsgrundsätze<br />
gebunden.<br />
Der Arbeitgeber kann grundsätzlich<br />
frei entscheiden, mit welcher<br />
Person er einen Arbeitsvertrag<br />
abschliesst. Im Rahmen gewisser<br />
Schranken (Arbeitsgesetz; OR)<br />
können die Parteien das Arbeitsverhältnis<br />
frei ausgestalten.<br />
Auch eine Kündigung ist generell<br />
ohne weiteres zulässig, solange<br />
die Fristen nach OR eingehalten<br />
werden, keine missbräuchliche<br />
Kündigung (Art. 336 OR)<br />
und keine Kündigung zur Unzeit<br />
(Art. 336c OR) vorliegt. Die Kündigung<br />
bedarf folglich keiner besonderen<br />
Gründe (vgl. BGE 132<br />
III 115, E. 2.1). Der private Arbeitgeber<br />
ist weder an den Grundsatz<br />
von Treu und Glauben noch<br />
ans Verhältnismässigkeitsprinzip<br />
gebunden. Es herrscht der Grundsatz<br />
der Kündigungsfreiheit (vgl.<br />
Roger Rudolph, Aktuelle Fragen<br />
im Arbeitsrecht: Neuere Entwicklungen<br />
zum sachlichen Kündigungsschutz,<br />
TREX 20<strong>09</strong>, Ausgabe<br />
3, S. 152; BGE <strong>12</strong>4 II 53,<br />
56).<br />
6 Dezember 20<strong>09</strong> <strong>12</strong>/<strong>09</strong>
ALLES, WAS RECHT IST<br />
3. Kündigungsvoraussetzungen<br />
im öffentlichen Dienstrecht<br />
a. Sachlicher Grund<br />
Bereits aus obiger Gegenüberstellung<br />
ergibt sich, dass das Arbeitsverhältnis<br />
im öffentlichen Dienstrecht<br />
wesentliche Unterschiede<br />
zum privatrechtlichen Arbeitsverhältnis<br />
aufweist. Dem öffentlichen<br />
Dienstrecht ist der Grundsatz<br />
der Kündigungsfreiheit unbekannt.<br />
Zwar liegt eine Kündigung<br />
des Arbeitsverhältnisses im<br />
Ermessen der die Privatperson beschäftigenden<br />
Behörde. Die Bindung<br />
an das Verhältnismässigkeitsgebot<br />
gemäss Art. 5 Abs. 2 BV<br />
und das Willkürverbot gemäss<br />
Art. 9 BV gebieten aber eine<br />
pflichtgemässe Ausübung dieses<br />
Ermessens. Dies führt zu dem<br />
seit langem allgemein anerkannten<br />
Grundsatz, dass ein öffentlichrechtliches<br />
Arbeitsverhältnis von<br />
Seiten des Staates nur bei Vorliegen<br />
eines sachlichen Grundes gekündigt<br />
werden kann (vgl. Tomas<br />
Poledna, Annäherungen ans Obligationenrecht,<br />
in: Helbling/Poledna<br />
[Hrsg.], <strong>Personal</strong>recht des öffentlichen<br />
Dienstes, Stämpfli Verlag<br />
AG Bern, 1999, S. 228; Tobias<br />
Jaag, Das öffentlich-rechtliche<br />
Dienstverhältnis im Bund und<br />
im Kanton Zürich – ausgewählte<br />
Fragen, ZBl 1994, S. 433 ff.,<br />
463; Verwaltungsgericht des Kantons<br />
St.Gallen, SGGVP 2006, S.<br />
46; Urteil des Bundesgerichts vom<br />
24. August 20<strong>09</strong>, 8C_340/20<strong>09</strong> E. 2;<br />
BGE <strong>12</strong>4 II 53, 56; Peter Köfer,<br />
Das Recht des Staatspersonals im<br />
Kanton Aargau, Keller Verlag Aarau<br />
1980, S. 118; Matthias Michel,<br />
Beamtenstatus im Wandel, Schulthess<br />
Polygraphischer Verlag Zürich,<br />
1998, S. 297 f.).<br />
Das Bundesgericht bezeichnet<br />
generell nur offensichtlich bzw.<br />
schlechthin unhaltbare Verfügungen<br />
als willkürlich (vgl. z.B. BGE<br />
<strong>12</strong>3 I 5, 119 Ia 177); bei der Kündigung<br />
von öffentlich-rechtlichen<br />
<strong>12</strong>/<strong>09</strong><br />
Arbeitsverhältnissen legt das Bundesgericht<br />
indes strengere Massstäbe<br />
an. Willkürlich ist in diesem<br />
Fall schon jeder sachlich nicht<br />
vertretbare Entscheid, was sich<br />
einerseits aus dem Willkürverbot<br />
gemäss Art. 9 BV ergibt, andererseits<br />
aber auch aus den allgemeinen<br />
Ermessensschranken wie der<br />
Rechtsgleichheit, dem Verhältnismässigkeitsgrundsatz<br />
und dem<br />
Prinzip von Treu und Glauben<br />
(vgl. Matthias Michel, a.a.O.,<br />
S. 298, Fn. 34). Diese Prinzipien<br />
gelten auch ohne ausdrückliche<br />
Wiedergabe in den gesetzlichen<br />
Kündigungsbestimmungen<br />
(vgl. Verwaltungsgericht<br />
des Kantons<br />
Luzern, LGVE<br />
1999 II 3, E. 6 c).<br />
Der sachliche (oder<br />
triftige) Grund muss<br />
nicht die Stärke bzw.<br />
das Ausmass eines<br />
wichtigen Grundes erreichen,<br />
welcher ein<br />
Fortdauern des Dienstverhältnissesunzumutbar<br />
machen würde.<br />
Einen solch qualifizierten<br />
Grund setzt nur<br />
die ausserordentliche<br />
Kündigung voraus (vgl.<br />
Matthias Michel, a.a.O., S. 299).<br />
Es genügt, wenn die Kündigung<br />
angesichts des Verhaltens des oder<br />
der Angestellten als vertretbare<br />
Massnahme erscheint und dem öffentlichen<br />
Interesse, insbesondere<br />
demjenigen an einer gut funktionierenden<br />
Verwaltung, entspricht<br />
(vgl. Matthias Michel, a.a.O.,<br />
S. 299 f.). Die Kündigung darf<br />
nicht willkürlich oder sachlich unhaltbar<br />
sein (BGE 99 Ib <strong>12</strong>9, 136).<br />
Als Beispiele für sachliche Gründe<br />
können folgende Umstände genannt<br />
werden: gesundheitliche<br />
Probleme, unbefriedigendes Verhalten,<br />
betriebliche Gründe (Aufheben<br />
der Stelle), charakterliche<br />
Mängel, erhebliche Störung der<br />
Arbeitsgemeinschaft (Matthias<br />
Michel, a.a.O., S. 300; Tobias<br />
Jaag, a.a.O., S. 463).<br />
Aufgrund der Bindung des<br />
Staates an die genannten Grundsätze<br />
bzw. an die Grundrechte<br />
nach BV ist eine Übernahme der<br />
obligationenrechtlichen Kündigungsbestimmungen<br />
ins öffentlich-rechtliche<br />
Dienstrecht nicht zulässig<br />
bzw. schlicht nicht möglich.<br />
b. Rechtliches Gehör<br />
Ein weiteres Rechtsprinzip, das<br />
vom Staat beachtet werden muss,<br />
ist die Gewährung des rechtlichen<br />
Gehörs. Das rechtliche Ge-<br />
hör ist auch im Zusammenhang<br />
mit einer Kündigung eines öffentlich-rechtlichenArbeitsverhältnisses<br />
sicherzustellen. Ein allgemeiner<br />
Anspruch auf vorgängige<br />
Anhörung bzw. Stellungnahme<br />
zu den Kündigungsgründen ergibt<br />
sich aus Art. 29 Abs. 2 BV. Durch<br />
die Kündigung des Dienstverhältnisses<br />
greift der Staat in die<br />
Rechtsstellung des bzw. der Angestellten<br />
ein. Den Staat trifft daher<br />
die Pflicht, seinem bzw. seiner<br />
Angestellten die Gründe der Kündigung<br />
bekannt zu geben und<br />
diesem bzw. dieser die Möglichkeit<br />
zu gewähren, sich dazu zu äussern<br />
(vgl. Tobias Jaag, a.a.O., S. 466;<br />
Verwaltungsgericht des Kantons<br />
St.Gallen, SGGVP 2006, S. 46).<br />
4. Fazit<br />
Die staatlichen Organe sind an die<br />
rechtsstaatlichen Grundprinzipien<br />
wie das Prinzip von Treu und<br />
Glauben, insbesondere das Willkürverbot,<br />
den Verhältnismässigkeitsgrundsatz,<br />
die Rechtsgleichheit,<br />
das Legalitätsprinzip und<br />
das öffentliche Interesse gebunden.<br />
Ihr Handeln ist geprägt von den<br />
genannten Grundsätzen, die auch<br />
in Zusammenhang mit einer Kündigung<br />
beachtet werden müssen.<br />
Daraus folgt, dass eine Kündigung<br />
im öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnis<br />
durch die Behörde nur<br />
bei Vorliegen eines sachlichen<br />
Grundes sowie nach Gewährung<br />
des rechtlichen Gehörs ausgesprochen<br />
werden darf. Die Kündigungsfreiheit<br />
ist dem öffentlichen<br />
Dienstrecht unbekannt. Eine<br />
entsprechende Regelung im <strong>Personal</strong>recht<br />
der Kantone wäre bundesverfassungswidrig.<br />
Die Frage, ob die obligationenrechtlichenKündigungsvorschriften<br />
ins öffentliche Dienstrecht<br />
übernommen werden sollen<br />
bzw. können, kann und muss daher<br />
ohne Zweifel und abschliessend<br />
verneint werden.<br />
Dr. iur. Michael Merker<br />
lic. iur. Bettina Lienhard<br />
Dezember 20<strong>09</strong> 7
BERATUNG<br />
Im Zeitpunkt des Erscheinens dieser Ausgabe der <strong><strong>ZV</strong>info</strong> ist die<br />
Bewerbungsfrist für die 75 Kaderstellen für die drei neuen Gemeinden<br />
Glarus Nord, Glarus und Glarus Süd abgelaufen. Im Interview<br />
mit dem Präsidenten des Verbandes des Glarner Staatsund<br />
Gemeindepersonals und der <strong><strong>ZV</strong>info</strong> beantwortet der Ombudsmann,<br />
Rechtsanwalt Peter Rütimann aus Winterthur, Fragen<br />
zu seiner Arbeit.<br />
Ombudsmann und Rechtsanwalt Peter Rütimann<br />
Kurt Reifler: Herr Rütimann,<br />
wann wurden Sie von wem angefragt,<br />
als Ombudsmann für die<br />
Gemeindestrukturreform zu arbeiten?<br />
Peter Rütimann: Im Zusammenhang<br />
mit der Neuorganisation<br />
der Winterthurer Ombudsstelle,<br />
die ich als Präsident des<br />
Grossen Gemeinderats leitete und<br />
die mich mit verschiedenen Ombudsstellen<br />
in Kontakt brachte,<br />
wurde man auf mich aufmerksam.<br />
Als praktizierender Anwalt, Mediator,<br />
Supervisionsberater und<br />
Gemeindefusion im Kanton Glarus<br />
Braucht das Gemeindepersonal<br />
den Ombudsmann?<br />
Präsident des WinterthurerPolizeibeamtenverbands<br />
brachte ich<br />
überdies einige Erfahrung<br />
auf diesem Gebiet<br />
mit.<br />
<strong><strong>ZV</strong>info</strong>: Was ist Ihre konkrete<br />
Aufgabe?<br />
Peter Rütimann: In<br />
den Sozialen Grundsätzen<br />
der Projektleitung der<br />
Gemeindestrukturreform<br />
ist explizit eine Ombudsstelle<br />
für personelle<br />
Konflikte, Unsicherheiten<br />
oder Misstrauen von<br />
Angestellten gegenüber<br />
der Verwaltung vorgesehen.<br />
Diese Aufgabe nehme ich nach<br />
bestem Wissen und Gewissen<br />
wahr.<br />
Kurt Reifler:Was ist Ihre Motivation<br />
für diese wohl recht schwierige<br />
Aufgabe?<br />
Peter Rütimann: Die Ombudsfunktion<br />
kann tatsächlich<br />
recht anspruchsvoll sein. In einem<br />
Konfliktfall ist es für alle Beteiligten<br />
allerdings viel angenehmer, auf<br />
dem Gesprächsweg nach einer<br />
Lösung zu suchen, als vor Gericht<br />
einen Prozess mit allen Risiken auszutragen.<br />
Da kann ich einen wertvollen<br />
Beitrag leisten.<br />
Kurt Reifler: Welche Bedeutung<br />
hat die Ombudsstelle für das Projekt<br />
der Glarner Gemeindestrukturreform?<br />
Peter Rütimann: Schon nur<br />
die Tatsache, dass es eine solche<br />
Stelle gibt, ist für das <strong>Personal</strong> wertvoll.<br />
Es gibt zwar innerhalb der<br />
Projektorganisation für jeden Angestellten<br />
die Möglichkeit, sich beraten<br />
zu lassen. Wegen der kleinräumigen<br />
Verhältnisse im Glarnerland<br />
ist es aber dennoch wichtig,<br />
dass es ausserhalb der Verwaltung<br />
einen Ansprechpartner gibt,<br />
mit dem ein vertrauliches Gespräch<br />
möglich ist und der dank<br />
seiner Erfahrung mit neuen oder<br />
anderen Lösungsvorschlägen zu<br />
Verbesserungen beitragen kann.<br />
<strong><strong>ZV</strong>info</strong>: Haben Sie ein konkretes<br />
Beispiel, welche Verbesserungsvorschläge<br />
Sie beim Projekt der<br />
Glarner Gemeindestrukturreform<br />
bereits einbringen konnten?<br />
Peter Rütimann: Bis anhin<br />
gab es am Projekt nichts zu verbessern,<br />
die Arbeit der Projektlei-<br />
Kurt Reifler<br />
tung ist sehr umsichtig. Meine Anregungen<br />
richteten sich mehrheitlich<br />
an Vorgesetzte im Zusammenhang<br />
mit dem professionellen<br />
Umgang mit ihrem <strong>Personal</strong>.<br />
<strong><strong>ZV</strong>info</strong>: Hatten Sie bereits früher<br />
ähnliche Mandate?<br />
Peter Rütimann: Ich bin regelmässig<br />
im öffentlichen Bereich<br />
tätig, wo ich politische oder kirchliche<br />
Gemeindebehörden in der<br />
Zusammenarbeit oder auf gemeinsame<br />
Ziele hin coache. Das<br />
Aushandeln von gemeinsamen<br />
Zielen ist eine sehr spannende<br />
Alternative zur blossen Streitschlichtung<br />
im Rahmen einer Mediation.<br />
Kurt Reifler: Gibt es etwas Spezielles<br />
bei diesem Mandat, wenn<br />
Sie es mit früheren Mandaten<br />
vergleichen?<br />
Peter Rütimann: Die kleinräumigen<br />
Verhältnisse im Kanton<br />
Glarus sind schon eine Besonderheit.<br />
Jeder kennt jeden, und<br />
manchmal frage ich mich, ob sich<br />
in diesen kleinräumigen Verhältnissen<br />
auch jedermann traut, in einem<br />
Konfliktfall den Ombuds-<br />
8 Dezember 20<strong>09</strong> <strong>12</strong>/<strong>09</strong>
BERATUNG<br />
mann zu konsultieren, wenn er<br />
nicht schon selber erlebt hat, dass<br />
gut gelöste Konflikte keine Wunden<br />
hinterlassen müssen.<br />
Kurt Reifler: Auf welchen gesetzlichen<br />
oder anderen Grundlagen<br />
arbeiten Sie?<br />
Peter Rütimann: Konkret bin<br />
ich im Rahmen eines Mandatsvertrags<br />
für die kantonale Projektleitung<br />
tätig. Ich habe Wert<br />
darauf gelegt, dass unsere Ombudsstelle<br />
örtlich ausserhalb der<br />
kantonalen Verwaltung angesiedelt<br />
ist.<br />
Kurt Reifler: Nachdem Ihr Engagement<br />
ursprünglich nur bis Ende<br />
2010 geplant war, haben am<br />
13. Oktober 20<strong>09</strong> die Kantonale<br />
Projektleitung und der Regierungsrat<br />
einem Antrag des Verbandes<br />
des Glarner Staats- und<br />
Gemeindepersonals VGSG zugestimmt,<br />
Ihr Mandat bis Ende<br />
2011 zu verlängern. Zusätzlich<br />
können auch Kantonsangestellte<br />
Ihre Dienste in Anspruch nehmen.<br />
Wie sind Sie gegenüber dieser<br />
Verlängerung und Erweiterung<br />
eingestellt? Was sind allenfalls die<br />
Vorteile und für wen?<br />
Peter Rütimann: Die Zusammenarbeitsverhältnisse<br />
in den neuen<br />
Gemeindestrukturen und das<br />
Zusammenführen verschiedener<br />
Betriebskulturen werden auch im<br />
Jahr 2011 noch nicht abgeschlossen<br />
sein. Gut zu wissen, dass aufkeimende<br />
Konflikte oder Unverträglichkeiten<br />
notfalls über einen<br />
professionellen Vermittler rasch<br />
und in einem guten Umfeld angegangen<br />
werden können. Die<br />
Ausweitung der Ombudsaufgaben<br />
auf die kantonale Verwaltung<br />
würde ich als direkten Beitrag<br />
des Regierungsrats zur Steigerung<br />
der Arbeitsplatzqualität seiner Angestellten<br />
beurteilen.<br />
<strong><strong>ZV</strong>info</strong>: Besteht Ihres Erachtens allenfalls<br />
die Möglichkeit oder das<br />
<strong>12</strong>/<strong>09</strong><br />
Bedürfnis nach einer weiteren<br />
Verlängerung des Mandats?<br />
Oder anders formuliert: Was<br />
halten Sie von einer fixen Einrichtung<br />
einer Ombudsstelle für<br />
die Glarner Gemeinde- und Kantonsangestellten?<br />
Peter Rütimann: Eine solche<br />
Stelle ist sehr zu begrüssen, da<br />
schon nur die Möglichkeit, auf einen<br />
aussenstehenden und damit<br />
unbelasteten Gesprächspartner zugreifen<br />
zu können, sehr wertvoll<br />
ist, denn im überschaubaren Kanton<br />
Glarus ist die soziale Kontrolle<br />
generell sehr gross; am Arbeitsplatz<br />
und im Privaten.<br />
Kurt Reifler: Bis Juni 20<strong>09</strong> hatten<br />
Sie erst zwei Fälle zu bearbeiten<br />
und einige telefonische Anfragen<br />
zu beantworten.<br />
Wie sieht die Situation heute<br />
aus?<br />
Peter Rütimann: Die Situation<br />
ist nach wie vor eher ruhig, obwohl<br />
die Fallzahl mittlerweile etwas zugenommen<br />
hat.<br />
Es ist zu wünschen, dass die Situation<br />
auch mit den ersten <strong>Personal</strong>entscheiden<br />
so ruhig bleibt,<br />
weil für alle Angestellten eine gute<br />
Lösung gefunden wird.<br />
Kurt Reifler: Können Sie den Angestellten<br />
und den verantwortlichen<br />
Personen des Arbeitgebers<br />
Empfehlungen abgeben, damit es<br />
zu möglichst wenigen Konfliktsituationen<br />
kommt?<br />
Peter Rütimann: Wenn ich<br />
von einem Entscheid betroffen<br />
bin, der mich ärgert, frage ich mich<br />
jeweils, ob mir die Sache so wichtig<br />
ist, dass ich aktiv werde. Da<br />
spielen verschiedene Aspekte wie<br />
Wertschätzung, Arbeitsplatzsicherheit<br />
und meine Werteordnung<br />
immer ganz unterschiedlich<br />
hinein. Wenn ich mich entschlossen<br />
habe, etwas nicht zu<br />
akzeptieren, dann wende ich mich<br />
gut vorbereitet an die richtige<br />
Person, nenne die Dinge in aller<br />
Freundlichkeit beim Namen und<br />
gehe davon aus, dass mein Gegenüber<br />
mit guten Gegenargumenten<br />
antworten wird. Ich versuche,<br />
mit kooperativen Lösungsvorschlägen<br />
am Ball zu bleiben,<br />
bis sich eine für mich akzeptable<br />
Lösung gefunden hat. Die-<br />
ses Rezept lässt sich ohne weiteres<br />
für Arbeitgebende wie für Arbeitnehmende<br />
verallgemeinern.<br />
Kurt Reifler: Fliessen Ihre Erfahrungen<br />
mit zu bearbeitenden Fällen<br />
in irgendeiner Form in die<br />
weiteren Bewerbungs- und Rekrutierungsprozesse<br />
ein?<br />
Oder anders gesagt: Findet<br />
ein regelmässiger Austausch mit<br />
der Anstellungsbehörde statt?<br />
Peter Rütimann: Ich nehme an<br />
den regelmässigen Sitzungen des<br />
<strong>Personal</strong>bereichs der Projektleitung<br />
teil und melde mich zu<br />
Wort, wenn meine Wahrnehmung<br />
von der Projektleitung abweicht.<br />
Ich habe überdies einen direkten<br />
Draht zur Projektleiterin, Frau<br />
Landammann Dürst, aufbauen<br />
können, der mir in entscheidenden<br />
Momenten jederzeit offen steht.<br />
Kurt Reifler, <strong><strong>ZV</strong>info</strong>: Herr Rütimann,<br />
wir danken Ihnen für das<br />
Gespräch.<br />
Interview<br />
Sandra Wittich<br />
und Kurt Reifler<br />
Dezember 20<strong>09</strong> 9
LÖHNE<br />
<strong>Schweiz</strong>erische Lohnstrukturerhebung 2008: Erste Ergebnisse<br />
Die <strong>Schweiz</strong>er Lohnlandschaft 2008<br />
Im Jahr 2008 belief sich der Medianlohn in der <strong>Schweiz</strong> auf<br />
5823 Franken. Bei den Stellen mit höchstem Anforderungsniveau<br />
öffnete sich die Lohnschere weiter, während die Lohnunterschiede<br />
bei Stellen mit tiefem Anforderungsniveau stabil blieben.<br />
Die Löhne der Topmanager legten insbesondere im Finanzsektor<br />
kräftig zu. Der Anteil der Tieflohnstellen nimmt seit 2000 stetig<br />
ab. Dies geht aus den ersten Ergebnissen der schweizerischen<br />
Lohnstrukturerhebung 2008 des Bundesamtes für Statistik (BFS)<br />
hervor.<br />
Zunehmende Lohnunterschiede<br />
zwischen den Branchen<br />
2008 belief sich der monatliche<br />
Bruttomedianlohn in der <strong>Schweiz</strong><br />
auf 5823 Franken. Die 10 Prozent<br />
am schlechtesten bezahlten Lohnempfängerinnen<br />
und -empfänger<br />
verdienten weniger als 3848 Franken<br />
pro Monat, während die 10<br />
Prozent am besten bezahlten einen<br />
Lohn von mehr als 10538 Franken<br />
erzielten. Die Lohnverteilung innerhalb<br />
der Arbeitnehmenden blieb<br />
im Vergleich zu 2006 insgesamt stabil,<br />
allerdings ist bei den Stellen mit<br />
dem höchsten Anforderungsniveau<br />
seit 2002 eine zunehmende<br />
Öffnung der Lohnschere zu beobachten.<br />
Die Löhne variieren stark<br />
nach Branchen. Das Lohngefälle<br />
zwischen den Branchen hat gegenüber<br />
2006 zugenommen, bedingt<br />
insbesondere durch die stark<br />
gestiegenen Löhne im Finanzsektor<br />
und in Produktionsbereichen mit<br />
hoher Wertschöpfung. Deutlich<br />
über dem <strong>Schweiz</strong>er Medianlohn<br />
lagen die Saläre in der chemischen<br />
Industrie (7774 Franken), im Bereich<br />
Forschung und Entwicklung<br />
(8061 Franken) und bei den Banken<br />
(9<strong>12</strong>7 Franken). Am unteren<br />
Ende der Lohnskala finden sich das<br />
Textilgewerbe (5026 Franken), die<br />
Herstellung von Lederwaren und<br />
Schuhen (4259 Franken) und die<br />
persönlichen Dienstleistungen<br />
(3683 Franken).<br />
Bonusanteil steigt<br />
Über ein Viertel (27,6%) der<br />
Arbeitnehmenden in der <strong>Schweiz</strong><br />
erhält Boni (zusätzlich zum<br />
Grundlohn ausbezahlte Jahresprämien).<br />
Der Durchschnitt der<br />
jährlich ausbezahlten Boni steigt<br />
seit 10 Jahren regelmässig an,<br />
von 6852 Franken brutto im<br />
Jahr 1998 auf 13068 Franken im<br />
Jahr 2008. Der Anteil der Arbeitnehmenden,<br />
die Boni empfangen,<br />
und die Summe dieser variablen<br />
Lohnkomponente differieren<br />
stark je nach Branche und<br />
Anforderungsniveau des Arbeitsplatzes.<br />
Nahezu drei Viertel der<br />
Erwerbstätigen im Bankensektor<br />
beziehen Boni von durchschnittlich<br />
45300 Franken (in<br />
Stellen mit höchster Anforderungsstufe:<br />
139500 Franken).<br />
Im Versicherungsgewerbe erhielten<br />
67,7 Prozent der Erwerbstätigen<br />
eine Bonuszahlung von<br />
durchschnittlich 19380 Franken<br />
(in der höchsten Anforderungsstufe:<br />
55020 Franken). Ganz anders<br />
sind die Anteile beispielsweise<br />
im Detailhandel, wo 17,1 Prozent<br />
der Erwerbstätigen Boni in der<br />
Höhe von durchschnittlich 5280<br />
Franken beziehen (in der höchsten<br />
Anforderungsstufe: 21144<br />
Franken). Im untersten Anforderungsniveau<br />
betrugen die Boni<br />
im Durchschnitt für alle Branchen<br />
2820 Franken.<br />
Topmanager-Löhne klaffen<br />
weit auseinander<br />
Bezogen auf alle Branchen verdienen<br />
die Topmanager (definiert als<br />
die einkommensstärksten 10 Prozent<br />
der oberen Kader) über<br />
23942 Franken brutto pro Monat.<br />
Allerdings unterscheidet sich das<br />
Lohnniveau der Topmanager je<br />
nach Branche deutlich: So erhielten<br />
die bestbezahlten oberen Kader in<br />
der chemischen Industrie über<br />
38073 Franken, bei den Dienstleistungen<br />
für Kredit- und Versicherungsgewerbe<br />
47469 Franken und<br />
in den Banken 58333 Franken. Am<br />
niedrigsten ist das Lohnniveau der<br />
Topmanager in Branchen wie der<br />
öffentlichen Verwaltung (19523<br />
Franken), dem Detailhandel (14707<br />
Franken), dem Baugewerbe (13585<br />
Franken) oder dem Gastgewerbe<br />
(9965 Franken). Am stärksten zugelegt<br />
haben die Löhne der Topmanager<br />
zwischen 2006 und 2008<br />
im Bankensektor, um 38,8 Prozent,<br />
gegenüber 11,5 Prozent für alle<br />
Branchen zusammen.<br />
Kontinuierlicher Rückgang<br />
der Tieflohnstellen<br />
Der Anteil der Vollzeitstellen, die<br />
mit weniger als 3500 Franken<br />
10 Dezember 20<strong>09</strong> <strong>12</strong>/<strong>09</strong>
LÖHNE<br />
brutto pro Monat entlöhnt werden,<br />
ist weiter zurückgegangen: Er<br />
sank von 6,2 Prozent im Jahr<br />
2006 auf 5,4 Prozent im Jahr<br />
2008. Im gleichen Zeitraum hat<br />
sich auch der Anteil der Arbeitsstellen<br />
mit einem monatlichen<br />
Bruttolohn von unter 4000 Franken<br />
von 14,1 Prozent auf <strong>12</strong>,4<br />
Prozent verringert. Allerdings variiert<br />
der Prozentsatz der Tieflohnstellen<br />
(Bruttolohn unter<br />
3500 Franken) je nach Wirtschaftsbranche<br />
stark. Im Detailhandel<br />
betrug er 8,5 Prozent, im<br />
Gastgewerbe 23,1 Prozent und<br />
bei den persönlichen Dienstleistungen<br />
gar 40,6 Prozent. Demgegenüber<br />
belief er sich bei der<br />
Herstellung von Präzisionsinstrumenten<br />
und Uhren auf 4,0 Prozent,<br />
im Gesundheitswesen auf<br />
2,9 Prozent und bei den Ver-<br />
<strong>12</strong>/<strong>09</strong><br />
sicherungen auf 0,7 Prozent.<br />
Die Zahl der Tieflohnbezügerinnen<br />
und -bezüger in der <strong>Schweiz</strong><br />
ist von 199300 im Jahr 2006 auf<br />
182600 im Jahr 2008 zurückgegangen.<br />
Nachfrage nach hochqualifizierten<br />
ausländischen Arbeitskräften<br />
treibt Löhne in die Höhe<br />
An Stellen mit höchstem Anforderungsniveau<br />
erhielten ausländische<br />
Arbeitnehmende im Schnitt<br />
mehr Lohn als <strong>Schweiz</strong>er Arbeitskräfte,<br />
durchschnittlich 11765<br />
Franken gegenüber 10777 Franken.<br />
Zudem zeigt sich, dass die<br />
Lohnunterschiede zwischen ausländischen<br />
und schweizerischen<br />
Arbeitskräften auf höchstem Anforderungsniveau<br />
je nach Aufenthaltsstatus<br />
signifikant variieren:<br />
Niedergelassene Ausländer und<br />
Ausländerinnen (C-Bewilligung)<br />
verdienen im Schnitt 861 Franken<br />
mehr als <strong>Schweiz</strong>erinnen und<br />
<strong>Schweiz</strong>er. Kurzaufenthalter (L-Bewilligung)<br />
haben einen Lohnvorsprung<br />
von <strong>12</strong>35 Franken und<br />
Aufenthalter (B-Bewilligung) einen<br />
solchen von 2256 Franken. Lediglich<br />
die Grenzgänger (G-Bewilligung)<br />
verdienen etwas weniger<br />
als ihre <strong>Schweiz</strong>er Kolleginnen<br />
und Kollegen. Auf Stellen mit<br />
tiefem Anforderungsniveau verdienen<br />
<strong>Schweiz</strong>er Arbeitnehmende<br />
hingegen systematisch mehr als<br />
ihre ausländischen Kolleginnen<br />
und Kollegen: Ihr Vorsprung auf<br />
die Grenzgänger (G-Bewilligung)<br />
beträgt 279 Franken, auf die Aufenthalter<br />
(B-Bewilligung) 616<br />
Franken und auf die Kurzaufenthalter<br />
(L-Bewilligung) 1045 Franken.<br />
Regionale Lohnhierarchie:<br />
Zürich an der Spitze<br />
Die <strong>Schweiz</strong>er Löhne variieren auch<br />
in räumlicher Hinsicht. Das höchste<br />
Lohnniveau für Stellen auf der<br />
obersten Anforderungsstufe findet<br />
sich regelmässig in den Regionen<br />
Zürich (<strong>12</strong>667 Franken), Nordwestschweiz<br />
(BS, BL, AG) mit<br />
11651 Franken sowie in der Genferseeregion<br />
(VD, VS, GE) mit<br />
10833 Franken. DasTessin liegt stets<br />
am unteren Ende der Lohnpyramide<br />
mit Löhnen von 8667 Franken im<br />
höchsten beziehungsweise 3901<br />
Franken im tiefsten Anforderungsniveau.<br />
Diese regionalen Lohnunterschiede<br />
erklären sich teilweise<br />
durch die räumliche Konzentration<br />
von Wirtschaftsbranchen mit<br />
hoher Wertschöpfung und durch<br />
regionale Differenzen in der Struktur<br />
der Anforderungsniveaus.<br />
Dezember 20<strong>09</strong> 11
LÖHNE<br />
Das erzielte Resultat von 0,6% Lohnerhöhung ohne Anpassung<br />
der Renten, ohne Gratis-SBB-GA, ohne Erhöhung der Ferien und<br />
der Gewährung eines Ausbildungsurlaubes, ohne Unterstützung<br />
bei der familienergänzenden Kinderbetreuung muss insgesamt<br />
als enttäuschend betrachtet werden.<br />
Bereits die Vorankündigungen der<br />
geplanten Sparmassnahmen anfangs<br />
November liessen für die Verhandlungen<br />
nichts Gutes ahnen.<br />
Für die nächsten Jahre dürfte der<br />
Spielraum mit der kontinuierlichen<br />
Herabsetzung der Budgetposten<br />
für das <strong>Personal</strong> noch enger<br />
werden. Trotzdem hat der<br />
PVB etwas erreicht: Denn immerhin<br />
ist wenig besser als nichts!<br />
Eine Delegation von Rentnern<br />
und Rentnerinnen der Verhandlungsgemeinschaft<br />
des Bundes<br />
konnte Bundespräsident Merz<br />
zu Beginn der Verhandlungen<br />
4500 sogenannte «Graue Karten»<br />
übergeben. Mit dieser Aktion for-<br />
VGB-Lohnverhandlungen mit Bundespräsident Merz<br />
dern die Pensionierten den Bundesrat<br />
auf, den seit 2005 aufgelaufenen<br />
Kaufkraftverlust auszugleichen<br />
oder mindestens eine<br />
Einmalleistung zu gewähren. Die<br />
Zusicherung, dass diese Forderung<br />
in einer Arbeitsgruppe geprüft<br />
werde, bedeutet gleichzeitig<br />
keine Massnahmen für das Jahr<br />
2010.<br />
In seinem Eingangsvotum erläuterte<br />
Bundespräsident Merz<br />
die schwierige Situation bei den<br />
Steuereingängen, die seit dem<br />
September erstmals wieder rückläufig<br />
sind. Auch für die Bundessteuer<br />
wird mit geringeren Einnahmen<br />
gerechnet.<br />
Enttäuschendes Resultat<br />
für das Bundespersonal<br />
In der Finanzplanung ab 2011<br />
dürften durch die rückläufigen<br />
Einnahmen, die geplanten Steuererleichterungen<br />
und die vorgezogenen<br />
Investitionen zukünftige<br />
Lohnmassnahmen de facto gestrichen<br />
werden. Die geplanten<br />
Querschnittmassnahmen beim<br />
<strong>Personal</strong> und der <strong>Info</strong>rmatik werden<br />
einschneidende Konsequenzen<br />
haben. Die <strong>Personal</strong>kosten sollen<br />
gemäss Aussage Merz reduziert<br />
werden, jedoch nur zu Lasten des<br />
«Mengengerüstes» und nur mit der<br />
Ausnutzung der natürlichen Fluktuation.<br />
Die Massnahmen sollen<br />
sozialverträglich umgesetzt werden.<br />
Als besonders ungerecht finden<br />
Foto: PVB<br />
Bundespräsident Hans-Rudolf Merz und die Verhandlungsgemeinschaft Bundespersonal: Einigung bei 0,6% Lohnerhöhung<br />
wir, dass die Kosten von rund 300<br />
Mio. CHF, die bedingt durch die<br />
verschiedenen Arbeitszeitmodelle<br />
aufgelaufen sind, auch noch dem<br />
<strong>Personal</strong>budget zur Last gelegt<br />
werden. Wir hatten uns schon<br />
im letzten Jahr erfolglos gegen<br />
die Verweigerung des Bezugs von<br />
Treueprämien in Ferien gewehrt.<br />
Angeblich sind seit den letzten<br />
Entlastungsprogrammen mit dem<br />
massiven Stellenabbau wieder 700<br />
neue Stellen geschaffen worden.<br />
Vermutlich weil das Parlament<br />
den Bundesangestellten laufend<br />
neue Aufgaben aufbürdet, ohne<br />
dabei endlich eine wirksame Aufgabenverzichtsplanung<br />
an die<br />
Hand zu nehmen. Neue Aufgaben<br />
und Stellen schaffen fällt offensichtlich<br />
bedeutend leichter, als im<br />
Nachgang die Verantwortung dafür<br />
zu übernehmen. Alleine beim<br />
Bundesamt Astra wurden rund<br />
250 neue Stellen durch eine Umverteilung<br />
der Aufgaben von den<br />
Kantonen zum Bund geschaffen.<br />
Den ausufernden Aufwand von externen<br />
Beratern in der Verwaltung<br />
einzudämmen, wäre vielleicht auch<br />
eine Massnahme mit grossen finanziellen<br />
Auswirkungen.<br />
Fred Scholl, PVB<br />
<strong>12</strong> Dezember 20<strong>09</strong> <strong>12</strong>/<strong>09</strong>
LOHNVERGLEICH<br />
Die hier publizierten Löhne repräsentieren<br />
einen guten Querschnitt durch<br />
die Staats- und Gemeindefunktionen<br />
des mittleren Kaders. Enthalten sind<br />
Gehälter aus Verwaltung, Polizei, Gemeinden,<br />
Lehrerschaft und Spitälern,<br />
wobei auch das Handwerk nicht fehlt.<br />
Schlüssel zur Lohnstatistik 20<strong>09</strong> des <strong>ZV</strong><br />
Nr. Kanton: Änderung gegenüber 2008<br />
1 Solothurn 2,7% total TZ + Reallohnzulage generell<br />
2 Zug 2,54% TZ + 2% Real + 1% individuell<br />
3 St. Gallen 3,0% TZ / Reallohnzulage<br />
4 Zürich 1,7% TZ + 1,9% individuell<br />
5 Glarus 2,0% TZ + 1% individuell<br />
6 Aargau 1,8% TZ generell + 1% individuell + 0,5% einmalige Prämien<br />
7 Ostschweizer Kt. 2,5% TZ + 1% individuell<br />
8 Bern 2,8% TZ / Reallohnzulage generell<br />
10 Obwalden 2,2% TZ / Real + 0,8% leistungsorientiert + 0,2% Leistungsprämie<br />
11 Ostschweizer Kt. 2,0% TZ + 1% individuell<br />
<strong>12</strong> Genf Neuanpassungen: Minima + 10,7%, Maxima + 8,88%<br />
13 Jura Pflegepersonal + 2,8%<br />
14 Wallis 2,7% TZ<br />
15 Waadt Réajusté<br />
16 Tessin 1,5% TZ<br />
Nr. Gemeinde:<br />
1 Stadt Luzern 1,5% TZ + 1% individuell<br />
2 Stadt im Kt. Bern 1,5% TZ + 0,7% individuell (Beförderungen)<br />
3 Frauenfeld 1,5% TZ + 1% Reallohnzulage generell<br />
4 Stadt Zürich 0,3% TZ + 1,2% individuell + 0,9% Prämien<br />
5 Bündner Gemeinde 1,5% TZ + Stufenanstieg im Mittel 1%<br />
6 Olten 1,5% TZ<br />
7 Romanshorn 2,5% TZ + 1% individuell + 0,5% Leistungsprämien<br />
9 Einsiedeln 1,45% TZ + 0,9% individuell<br />
10 Lausanne 1,45% TZ<br />
11 Sion 0,8% TZ<br />
<strong>12</strong> Freiburg / Fribourg 2,05% TZ<br />
13 Delémont 2,6% TZ<br />
14 Montreux 2,6% TZ<br />
15 Zentralschweizer Gemeinde 1,8% TZ<br />
<strong>ZV</strong>-Lohnvergleich: Fünfter Teil<br />
Alle aufgeführten Berufe erfordern eine<br />
mehr oder weniger anspruchsvolle,<br />
aber solide Grundausbildung. Der Vergleich<br />
der zugeordneten Gehälter sagt<br />
vielleicht etwas über die Wertung in<br />
der Bevölkerung betreffend Frauenberufe,<br />
Handwerk, Polizei etc. aus?<br />
Bemerkungen:<br />
Die in den Tabellen nachgeführten<br />
Anpassungen sind fett gedruckt.<br />
Alle Zahlen sind per 20<strong>09</strong> aufgerechnet.<br />
Wo dies nicht der Fall ist,<br />
steht eine Bemerkung.<br />
Die Gehälter der Lehrkräfte stammen<br />
in der Regel aus einer aktuellen<br />
Datei des LCH.<br />
Lommiswil, Mai 20<strong>09</strong><br />
Rudolf Brosi<br />
Ruedi Brosi<br />
<strong>12</strong>/<strong>09</strong> Dezember 20<strong>09</strong> 13
LOHNVERGLEICH<br />
Steuerrevisor/Steuerrevisorin<br />
Funktionsprofil<br />
Veranlagt selbständig Erwerbende und einfache Gesellschaften. Führt fachlich einen zugeteilten Revisionsassistenten.<br />
Erfüllt Aufgaben wie:<br />
a) Buchprüfungen und Revisionen<br />
b) Prüfen von Einschätzungsgrundlagen<br />
c) Verhandeln, schriftlich und mündlich, mit Steuerpflichtigen<br />
d) Erledigen von Einsprachen und Steuerbussen<br />
e) Mitarbeit in Steuerkommissionen<br />
Ausbildung/Anforderungen<br />
• Kaufmännische Ausbildung<br />
• Diplom dipl. Buchhalter<br />
• 2Jahre Erfahrung<br />
Gehalt: Bei 100% Pensum, inkl. 13. Monatslohn und Teuerungszulage, ohne Sonderzulagen, im Berichtsjahr.<br />
Kantone 1. Dienstjahr 11. Dienstjahr Maximum nach X DJ Arbeitszeit / Wo angerechnete DJ* Bemerkungen<br />
1 87 101 1<strong>09</strong> 068 130 650 16 42 1 dazu 0% bis 5% Leistungszuschlag<br />
2 105 076 <strong>12</strong>8 529 42<br />
3 1<strong>12</strong> 772 138 710 8 42 mittlere Lohnklasse des Bereichs<br />
4 95 527 <strong>12</strong>1 268 138 322 20 42<br />
5 83 6<strong>09</strong> 110 365 134 103 15–20 42 5<br />
6 1<strong>12</strong> 993 158 190 42<br />
7 90 753 145 210 42<br />
8 89 630 152 562 25–35 42<br />
9<br />
10 75 010 98 644 <strong>12</strong>0 016 42<br />
11 73 646 113 942<br />
<strong>12</strong><br />
13<br />
Gde 4 85 966 103 392 105 <strong>09</strong>0 15 42 1<br />
Gde 10 85 265 <strong>12</strong>0 640<br />
* Minimum der angerechneten Dienstjahre bei voller Ausbildung<br />
Bild: Trix Niederau/St.Galler Tagblatt<br />
14 Dezember 20<strong>09</strong> <strong>12</strong>/<strong>09</strong>
LOHNVERGLEICH<br />
Polizei Postenchef/Postenchefin<br />
Funktionsprofil<br />
Erledigt Aufgaben im Bereich:<br />
a) staatlicher Sicherheits- und Ordnungsdienst<br />
b ) Führungsaufgaben<br />
Ausbildung/Anforderungen<br />
• Abgeschlossene Berufslehre / Einjährige Polizeianwärterschule / Unteroffiziersschule<br />
• Mehrjährige Erfahrung im Polizeidienst<br />
• Physische und psychische Belastbarkeit<br />
• Hohe Kompetenz- und Entscheidfähigkeit<br />
• Rang: Wachtmeister / Korporal<br />
Gehalt: Bei 100% Pensum, inkl. 13. Monatslohn und Teuerungszulage, ohne Sonderzulagen, im Berichtsjahr.<br />
Gemeinde 1. Dienstjahr 11. Dienstjahr Maximum nach X DJ Arbeitszeit / Wo angerechnete DJ* Bemerkungen<br />
1 86 575 96 <strong>09</strong>9 118 925 20–25 42<br />
2<br />
3<br />
4 108 625 115 151 115 151 42 7<br />
5 92 499 93 <strong>12</strong>7 1<strong>12</strong> 264 20 42 6<br />
6 80 892 111 661 111 661 10 42<br />
7<br />
8<br />
9<br />
10 90 765 114 527 <strong>12</strong>0 593 37 40 0<br />
11 94 048 <strong>12</strong>2 518 130 785 42 Lt. Pol.<br />
<strong>12</strong> 69 077 93 415 103 144 Sergent<br />
13 84 203 100 278 111 833 40 Sergent<br />
14<br />
Kantone 1. Dienstjahr 11. Dienstjahr Maximum nach X DJ Arbeitszeit / Wo angerechnete DJ* Bemerkungen<br />
1 1<strong>12</strong> 646 16 42 1 dazu 0% bis 5% Leistungszuschlag<br />
2 105 076 <strong>12</strong>8 539 42<br />
3 99 211 138 710 8 42 mittlere Lohnklasse des Bereichs<br />
4 97 948 100 680 Wm mbA 42 Wachmeister<br />
5 97 785 113 604 15 42<br />
6 87 822 <strong>12</strong>2 950 42<br />
7 77 935 <strong>12</strong>4 683 42 Kleine Polizeistation plus Inkonv.<br />
7 84 107 134 569 42 Grosse Polizeistation plus Inkonv.<br />
8 70 671 113 072 25-35 42<br />
9<br />
10<br />
11 73 646 113 942<br />
<strong>12</strong><br />
13 75 524 97 871 Pro Mt. Fr. 265.– Inkonv. + Fr. 430.– Wohnzulage<br />
14<br />
* Minimum der angerechneten Dienstjahre bei voller Ausbildung<br />
Bild: Urs Bucher/St.Galler Tagblatt<br />
<strong>12</strong>/<strong>09</strong> Dezember 20<strong>09</strong> 15
LOHNVERGLEICH<br />
Hauswart/Hauswartin für Schulanlagen<br />
Funktionsprofil<br />
Erledigt alle Arbeiten, die bei der Betreuung eines Gebäudes anfallen, wie:<br />
a) Wartung sämtlicher Anlagen, Räumlichkeiten und Ausrüstungen<br />
b) tägliche Kontrollen<br />
c) Verantwortung für die Schliessordnung<br />
Ausbildung/Anforderungen<br />
• Handwerklicher Abschluss mit Diplom<br />
• Kooperationsfähigkeit mit Schüler- und Lehrerschaft<br />
Gehalt: Bei 100% Pensum, inkl. 13. Monatslohn und Teuerungszulage, ohne Sonderzulagen, im Berichtsjahr.<br />
Gemeinden 1. Dienstjahr 11. Dienstjahr Maximum nach X DJ Arbeitszeit / Wo angerechnete DJ* Bemerkungen<br />
1 62 745 78 430 81 567 15–20 42<br />
2 62 448 86 949 15–20 41 3840.– Wohnsitzzulage pro Jahr<br />
3 72 163 88 502 nach Leistung Rathaus 43 1. DJ inkl. 5% LL; 11. DJ inkl. 20% LL + 10% Erf.<br />
4 78 393 94 267 95 815 15 42<br />
5 58 552 70 642 76 297 20 42 10<br />
6 64 079 89 791 89 791 10 42<br />
7<br />
8<br />
9 56 567 77 081 92 624 45 42,5 0<br />
10 61 136 72 576<br />
11 58 346 76 434 81 684 42<br />
<strong>12</strong> 58 375 78 013 85 862 20 40<br />
13 65 924 76 875 82 300 40 1<br />
14 57 508 86 208 42 1–3 11. DJ abhängig von der Bewertung<br />
15 52 086 67 718 83 350 26 42 4<br />
16<br />
Kantone 1. Dienstjahr 11. Dienstjahr Maximum nach X DJ Arbeitszeit / Wo angerechnete DJ* Bemerkungen<br />
1 58 805 80 816 88 162 16 42 1 dazu 0% bis 5% Leistungszuschlag<br />
2 65 436 84 819 42<br />
3 69 186 85 <strong>09</strong>7 8 42 mittlere Lohnklasse des Bereichs<br />
4 67 019 85 865 96 341 20 42 Hausmeister/in<br />
5 54 055 71 353 83 116 15–20 42 4<br />
6 62 846 87 984 42<br />
7 62 010 99 216 42<br />
8 54 354 95 566 25–35 42<br />
9<br />
10 54 600 70 434 87 360 42<br />
11 62 430 96 379<br />
<strong>12</strong><br />
13<br />
14<br />
* Minimum der angerechneten Dienstjahre bei voller Ausbildung<br />
Bild: Urs Jaudas/St.Galler Tagblatt<br />
16 Dezember 20<strong>09</strong> <strong>12</strong>/<strong>09</strong>
LOHNVERGLEICH<br />
Gemeindeschreiber/Gemeindeschreiberin<br />
Funktionsprofil<br />
Leitet die Gemeindekanzlei und ist Bindeglied zwischen Gemeinderat, Kommissionen und Bevölkerung.<br />
Erledigt Arbeiten gemäss Gemeindegesetz wie:<br />
a) Führen verschiedener Ämter, Kontrollen und Stimmregister<br />
b) Ausführen von Anträgen, Berichten und Vereinbarungen<br />
c) Protokollführung an Gemeindeversammlungen und Gemeinderatssitzungen<br />
d) <strong>Personal</strong>führung usw.<br />
e) Stellvertretung des Finanzverwalters / -verwalterin<br />
Ausbildung/Anforderungen<br />
• Kaufmännische Berufslehre, Verwaltungslehre oder Diplomhandelsschule<br />
• Talent für Organisation, Kommunikation und Korrespondenz<br />
• 2Fremdsprachen in Wort und Schrift<br />
Gehalt: Bei 100% Pensum, inkl. 13. Monatslohn und Teuerungszulage, ohne Sonderzulagen, im Berichtsjahr.<br />
Gemeinden 1. Dienstjahr 11. Dienstjahr Maximum nach X DJ Arbeitszeit / Wo angerechnete DJ* Bemerkungen<br />
1<br />
2<br />
3 142 870 175 234 nach Leistung 43 1. DJ inkl. 5% LL; 11. DJ inkl. 20% LL + 10% Erf.<br />
4<br />
5 116 636 148 <strong>12</strong>2 174 914 20 43 14 Per 1.1.07 plus 1 Funktionsklasse<br />
6 <strong>12</strong>7 668 177 340 177 340 10 42<br />
7 113 563 159 202 42<br />
8<br />
9 100 876 137 457 165 168 45 42,5 5<br />
10 <strong>12</strong>8 088 194 383<br />
11 <strong>12</strong>8 <strong>09</strong>5 167 <strong>12</strong>0 178 450 42 Avocat<br />
<strong>12</strong> <strong>12</strong>4 713 162 853 178 107 20 40<br />
13 99 079 <strong>12</strong>3 194 135 249 40 2<br />
14 <strong>12</strong>8 132 184 557 42 1–3 11. DJ abhängig von der Bewertung<br />
15 102 642 133 436 164 228 26 42 8 keine Abgeltung der Überstunden<br />
16<br />
* Minimum der angerechneten Dienstjahre bei voller Ausbildung<br />
Bild: Susann Basler/St.Galler Tagblatt<br />
<strong>12</strong>/<strong>09</strong> Dezember 20<strong>09</strong> 17
LOHNVERGLEICH<br />
Pflegefachperson II<br />
Funktionsprofil<br />
a) Erledigt selbständig alle Arbeiten im Pflegedienst und übernimmt Verantwortung für die Behandlungspflege<br />
nach Anordnung der Ärzte<br />
b) Führt Gespräche mit Patienten und deren Angehörigen und pflegt interdisziplinäre Kontakte<br />
c) Bildet Pflegeschüler aus<br />
Ausbildung/Anforderungen<br />
• 3- bis 4-jährige Ausbildung mit SRK-Diplom<br />
• Schicht-, Sonntags-, Feiertags- und Pikettdienst Bild: Meinrad Schade/St.Galler Tagblatt<br />
Kantone 1. Dienstjahr 11. Dienstjahr Maximum nach X DJ Arbeitszeit / Wo angerechnete DJ* Inkonvenienzzulagen<br />
1 68 008 97 155 17 42 Fr. 5.65/h, dazu 0% bis 5% Leistungszuschlag<br />
2 65 2<strong>09</strong> 98 577 30 42 Sa / So / Nacht: Fr. 5.– / Std.<br />
3 63 965 97 515 42 Fr. 6.– / Std. von 19.00 –7.00 Uhr + Sa, So<br />
4 71 082 90 544 102 266 20 42<br />
5<br />
6<br />
7 66 930 115 566 42 47.50 Sa / So / 28.– Pi / 16.50 Spät/Na. Komp. 20%<br />
8 65 538 108 106 25–35 42<br />
9<br />
10<br />
11<br />
<strong>12</strong> 88 391 119 511<br />
13 64 922 87 659<br />
14 72 790 101 906<br />
15 68 530 107 288<br />
16 61 924 86 034<br />
Gde 3 68 972 84 588 abh. Leistung 43 1. DJ inkl. 5% LL; 11. DJ inkl. 20% LL + 10% Erf.<br />
Gde 10 65 290 86 710<br />
* Minimum der angerechneten Dienstjahre bei voller Ausbildung<br />
Primarlehrer/Primarlehrerin<br />
Kantone 1. Dienstjahr 11. Dienstjahr Maximum nach X DJ Schulwochen Lektionen / Woche Bemerkungen<br />
1 78 970 106 525 118 361 16 39 29 zusätzlich 2 x 45 Min. Präsenzzeit<br />
2 76 657 1<strong>09</strong> 084 <strong>12</strong>3 061 24 38 / 39 30 Lehrpers. der 6. Primarklasse 29 Lektionen zu 45 Min.<br />
3 71 423 94 464 116 582 27 40 30 28 Lektionen + 100 Min. Präsenzzeit<br />
4 80 047 102 560 144 576 37 39 / 40 28 / 29<br />
5 72 656 94 798 110 367 26 39 28 + 2 Präsenzlektionen<br />
6 75 040 93 258 <strong>12</strong>0 064 37 39 29<br />
7 77 953 <strong>12</strong>4 683 39 29 / 30 Tiefer für Klassenlehrperson + 1 Teamstd. + allf. Gdezulage max. 5%<br />
8 72 383 114 183 30 36 / 39 38 / 30<br />
9<br />
10 68 433 86 911 97 529 39 29<br />
11 71 <strong>12</strong>0 93 228 111 801 30 39 / 40 31<br />
<strong>12</strong> 89 749 1<strong>12</strong> 138 <strong>12</strong>0 934 21 39 28<br />
13 65 571 88 957 102 324 15 39 28<br />
14 73 230 106 184 24 38 33<br />
15 73 991 92 103 107 288 24,5 38 / 39 28<br />
16 71 695 93 501 97 570 13 36,5 32<br />
18 Dezember 20<strong>09</strong> <strong>12</strong>/<strong>09</strong>
BASEL-STADT<br />
KANTON<br />
BASEL-STADT<br />
BASELSTÄDTISCHER ANGESTELLTENVERBAND<br />
WICHTIGE DATEN FÜR BAV-MITGLIEDER<br />
GRUPPE PENSIONIERTE:<br />
Pensioniertenausflug 2010: Donnerstag, 27. Mai 2010<br />
(ganzer Tag)<br />
Pensionierten-Stamm 2010<br />
Dienstag, 2. Februar 2010 Dienstag, 30. März 2010<br />
Dienstag, 29. Juni 2010 Dienstag, 24. August 2010<br />
Dienstag, 19. Oktober 2010 Dienstag, 7. Dezember 2010<br />
Restaurant Stadthof, Gerbergasse 84 (am Barfüsserplatz)<br />
im 1. Stock ab 15.00 Uhr bis ca. 17.30 Uhr<br />
HERZLICHE GRATULATION<br />
Mit dieser Ausgabe der <strong><strong>ZV</strong>info</strong> gratulieren wir folgenden Verbandsmitgliedern:<br />
zum 100. Geburtstag<br />
Frau Charlotte Plüss, ehemalige Mitarbeiterin Allg. Gewerbeschule<br />
(am 20. Januar 2010)<br />
zum 95. Geburtstag<br />
Herrn Dr. Fritz Lützelmann, ehemaliger Vorsteher Erbschaftsamt<br />
(am 6. Januar 2010)<br />
zum 80. Geburtstag<br />
Herrn Ernst Losch, ehemaliger Mitarbeiter Motorfahrzeugkontrolle<br />
(am 17. Dezember 20<strong>09</strong>)<br />
Herrn Ernst Meyer-Völlmin, ehemaliger Mitarbeiter IWB (am<br />
19. Dezember 20<strong>09</strong>)<br />
Frau Irene Bösiger, ehemalige Mitarbeiterin Schularztteam<br />
(am 15. Januar 2010)<br />
Wir wünschen den Jubilarinnen und Jubilaren alles Gute, verbunden<br />
mit unserem herzlichen Dank für ihre langjährige<br />
Treue zum BAV.<br />
KONTAKTMÖGLICHKEITEN SEKRETARIAT BAV<br />
Postadresse: St. Alban-Vorstadt 21, 4052 Basel<br />
Telefon 061 272 4511, Fax 061 272 45 35<br />
E-Mail: info@bav-bs.ch, Homepage: www.bav-bs.ch<br />
Jahresrückblick 20<strong>09</strong><br />
Auch im Jahre 20<strong>09</strong> war der BAV in den verschiedensten Bereichen<br />
des Anstellungsverhältnisses im Kanton Basel-Stadt tätig.<br />
Hauptschwerpunkt bildeten dabei die umfangreichen Diskussionen<br />
rund um das per 1. Januar 2008 in Kraft getretene neue<br />
Pensionskassengesetz. Daneben wurden die Arbeiten für eine Änderung<br />
der Verbandsstrukturen fortgeführt und – wie üblich –<br />
rund 300 Anfragen rechtlicher Art von Mitgliedern des BAV beantwortet.<br />
I. Sanierung der Pensionskasse<br />
Basel-Stadt<br />
Über die Problematik im Zusammenhang<br />
mit der notwendig gewordenen<br />
Sanierung der Pensionskasse<br />
Basel-Stadt wurde bereits<br />
in zahlreichen Ausgaben der <strong><strong>ZV</strong>info</strong><br />
berichtet. Der aktuelle Stand<br />
stellt sich so dar, dass ein Ratschlag<br />
der Regierung vorliegt, wonach die<br />
per 1. Januar 20<strong>09</strong> bestehende<br />
Deckungslücke vollständig ausfinanziert<br />
werden und sich Arbeitgeber<br />
und Arbeitnehmer (Aktive<br />
und Pensionierte) je hälftig daran<br />
beteiligen sollen. Im Herbst des<br />
Jahres 20<strong>09</strong> wurde das Geschäft<br />
der Wirtschafts- und Abgabekommission<br />
(WAK) des Grossen<br />
Rates zur Behandlung übergeben.<br />
Dem Vernehmen nach sind die<br />
entsprechenden Arbeiten noch<br />
nicht abgeschlossen, weshalb die<br />
ursprünglich für Dezember 20<strong>09</strong><br />
geplante Behandlung im Grossen<br />
Rat nicht stattfinden kann,<br />
sondern verschoben werden muss.<br />
Der BAV hat sowohl gegenüber<br />
den Mitgliedern des Grossen<br />
Rates als auch gegenüber den Regierungsräten<br />
Stellung bezogen<br />
und dargelegt, weshalb der regierungsrätliche<br />
Ratschlag nicht akzeptabel<br />
ist (vgl. hiezu Ausgabe der<br />
<strong><strong>ZV</strong>info</strong> vom September 20<strong>09</strong>).<br />
II. Neuordnung Abgeordnetenversammlung<br />
Verbandsintern haben sich die<br />
Verantwortlichen des BAV Ge-<br />
Dr. Georg Schürmann<br />
danken über eine Neuordnung<br />
der Abgeordnetenversammlung<br />
gemacht. Im Rahmen der Strukturrevision<br />
aus dem Jahre 2007<br />
wurde beschlossen, die Versammlung<br />
der Abgeordneten nur noch<br />
ein Mal jährlich durchzuführen;<br />
dies zum einen, da es zunehmend<br />
schwieriger geworden ist, Personen<br />
für das Abgeordnetenamt zu gewinnen,<br />
was dazu führte, dass<br />
keine vollständige Abdeckung<br />
über sämtliche Departemente und<br />
Betriebe mehr vorhanden war.<br />
Zum andern hat die zunehmend<br />
moderne Kommunikation dazu<br />
geführt, dass sich der Bedarf an der<br />
Durchführung von Sitzungen reduziert<br />
hat.<br />
Eine aus verschiedenen Mitgliedern<br />
des BAV zusammengesetzte<br />
Arbeitsgruppe hat daraufhin<br />
einen Lösungsvorschlag erarbeitet,<br />
wonach die bisherigen statutarischen<br />
Aufgaben der Abgeordnetenversammlung<br />
durch einen neu<br />
zu schaffenden sogenannten Beirat<br />
erfüllt werden sollen, in wel-<br />
<strong>12</strong>/<strong>09</strong> Dezember 20<strong>09</strong> 19
BASEL-STADT<br />
chem 6 bis 8 Mitglieder Einsitz<br />
haben sollen. Genannter Beirat<br />
soll mit einem Recht auf Antragstellung<br />
und Einsitznahme<br />
im Vorstand ausgestattet werden,<br />
wobei das Hauptziel darin<br />
besteht, die Bindung zwischen<br />
Vorstand und Mitgliedern<br />
weiter zu verbessern (vgl. nebenstehendes<br />
Schema).<br />
Das Projekt soll zunächst<br />
in einer Versuchsphase von zwei<br />
Jahren geprüft werden; anschliessend<br />
soll über die definitive<br />
Implementierung entschieden<br />
werden.<br />
III. Rechtsschutzfälle<br />
Neben dem beschriebenen<br />
Hauptthema «Sanierung der<br />
Pensionskasse» und weiteren<br />
Arbeiten im Zusammenhang<br />
mit den Anstellungsbedingungen<br />
(beispielsweise Änderung<br />
der Arbeitszeitverordnung, flächendeckende<br />
Einführung des<br />
Projektes Case Management,<br />
Überprüfung der Lohnsystematik,<br />
Übertritt der Sozialhilfe zum Kanton<br />
Basel-Stadt u.a.) bestand die<br />
Haupttätigkeit des Verbandes wiederum<br />
in der Beantwortung und<br />
Behandlung verschiedenster individueller<br />
Anfragen rechtlicher<br />
KANTON<br />
OBWALDEN<br />
Art. Es hat sich gezeigt, dass der<br />
Druck auf die Mitarbeiterinnen<br />
und Mitarbeiter weiter zugenommen<br />
hat, ohne dass gleichzeitig die<br />
Anstellungsbedingungen nachhaltig<br />
verbessert worden wären.<br />
Mit der aktuell stattfindenden<br />
politischen Diskussion über ein<br />
weiteres Sparpaket ist zu befürchten,<br />
dass sich diese Tendenz wei-<br />
STAATS- UND GEMEINDEPERSONALVERBAND<br />
OBWALDEN<br />
ter verstärken wird. Der BAV<br />
wird auch weiterhin nicht nur<br />
diesen Tendenzen entgegenwirken,<br />
sondern sich auch aktiv für<br />
eine Verbesserung der Anstellungsbedingungen<br />
einsetzen.<br />
Abschliessend möchte sich das<br />
Sekretariat des BAV bei sämtlichen<br />
Mitgliedern für ihre Treue zum<br />
Verband bedanken und wünscht<br />
Protokoll der<br />
59. Hauptversammlung<br />
vom 15. September 20<strong>09</strong>, 18.00 bis 19.00 Uhr,<br />
Konferenzsaal Rathaus, Sarnen<br />
Anwesend:16 Personen<br />
Vorsitz: Karl Flury und Lydia<br />
Hümbeli, Co-Präsidium<br />
Protokoll: Andreas Bacher<br />
Traktanden:<br />
1. Begrüssung<br />
2. Genehmigung Protokoll der<br />
Hauptversammlung vom 9.<br />
ihnen sowie sämtlichen Leserinnen<br />
und Lesern eine geruhsame Weihnachtszeit<br />
und alles Gute für das<br />
kommende Jahr.<br />
Dr. Georg Schürmann<br />
Sekretär des BAV, Advokat<br />
September 2008 (siehe <strong><strong>ZV</strong>info</strong><br />
10/08)<br />
3. Jahresbericht des Präsidiums<br />
4. Jahresrechnung, Revisorenbericht,<br />
Rechnungsgenehmigung<br />
5. Genehmigung des Voranschlages,<br />
Festsetzung des Jahresbeitrages<br />
6. Statutenrevision<br />
20 Dezember 20<strong>09</strong> <strong>12</strong>/<strong>09</strong>
OBWALDEN<br />
7. Jahresprogramm<br />
8. Verschiedenes<br />
1. Begrüssung<br />
Co-Präsidentin Lydia Hümbeli<br />
heisst 16 Mitglieder zur 59.<br />
Hauptversammlung willkommen.<br />
Namentlich begrüsst sie Regierungsrat<br />
Hans Wallimann, Vorsteher<br />
des Finanzdepartements,<br />
und Joe Amrhein, Leiter <strong>Personal</strong>amt.<br />
Der Verband bedankt<br />
sich für das Gastrecht im schönen<br />
Konferenzsaal des Rathauses.<br />
Es sind Entschuldigungen von<br />
24 Verbandsmitgliedern eingegangen.<br />
Die Einladung zur Versammlung<br />
wurde rechtzeitig verschickt.<br />
Aus dem Kreis der Mitglieder<br />
gingen keine Anträge ein.<br />
Die Traktandenliste wird genehmigt.<br />
Als Stimmenzähler wird<br />
Jakob Grünenfelder gewählt.<br />
2. Genehmigung Protokoll<br />
der Hauptversammlung<br />
vom 9. September 2008<br />
Das Protokoll der Hauptversammlung<br />
2008 wurde in der<br />
<strong><strong>ZV</strong>info</strong>, Ausgabe Oktober 2008,<br />
publiziert. Es wird genehmigt und<br />
dem Verfasser Rolf Kaufmann<br />
verdankt.<br />
3. Jahresbericht des Präsidiums<br />
Co-Präsident Karl Flury verweist<br />
auf den schriftlichen Jahresbericht<br />
2008/20<strong>09</strong>. Dieser deckt<br />
den Zeitraum von der letzten<br />
Hauptversammlung bis zum Sommer<br />
20<strong>09</strong> ab. Der Bericht wurde<br />
allen Mitgliedern als Beilage mit<br />
der Einladung zur Hauptversammlung<br />
zugestellt.<br />
Karl Flury erwähnt in mündlichen<br />
Ausführungen folgende,<br />
aus seiner Sicht wichtigen Punkte:<br />
Kommunikation:<br />
Der Verband hat eine eigene Mailadresse,<br />
sie lautet:<br />
personalverband@ow.ch.<br />
Sozialpartnerschaft:<br />
Ergänzend zu den Ausführungen<br />
gemäss Jahresbericht hält Karl<br />
Flury fest, dass der Staats- und Gemeindepersonalverband<br />
(SGPV)<br />
Obwalden in den letzten Tagen<br />
eine Stellungnahme zur Revision<br />
der IV abgegeben hat.<br />
Der Verband lehnt sich an die<br />
Positionierung des Volkswirtschaftsdepartements<br />
an.<br />
Lohnsystem:<br />
Speziell erwähnt Karl Flury den<br />
von Seiten des Finanzdepartements<br />
wohlwollend aufgenommenen<br />
Vorschlag des SGPV,<br />
das vor 10 Jahren eingeführte<br />
Lohnsystem im Sinne eines Rückblicks<br />
zu würdigen. Sind die damals<br />
gesteckten Ziele erreicht? Ist<br />
das System praktikabel und fair?<br />
Dank:<br />
Der Co-Präsident dankt allen, die<br />
sich für die Mitarbeitenden in<br />
der öffentlichen Verwaltung einsetzen.<br />
Insbesondere dankt er dem<br />
anwesenden Vorsteher des Finanzdepartements,<br />
Regierungsrat<br />
Hans Wallimann, und dem Leiter<br />
des <strong>Personal</strong>amts, Joe Amrhein.<br />
Ein Dank geht auch an die <strong>Personal</strong>verantwortlichen<br />
in den Gemeinden<br />
und an die Mitglieder des<br />
Vorstandes.<br />
Josef Enz verdankt dem Co-Präsidium<br />
den Bericht und die grosse<br />
Arbeit.<br />
Mit Applaus genehmigt die<br />
Versammlung den Jahresbericht<br />
2008/20<strong>09</strong> und honoriert das Engagement<br />
des Co-Präsidiums.<br />
4. Jahresrechnung, Revisorenbericht,Rechnungsgenehmigung<br />
Die Jahresrechnung 2008 umfasst<br />
das Kalenderjahr 2008. Sie<br />
schliesst bei Einnahmen von<br />
CHF 6<strong>09</strong>1.95 und Ausgaben von<br />
CHF 5050.10 mit Mehreinnah-<br />
men von CHF 1041.85 ab. Das<br />
Vermögen per Ende 2008 beläuft<br />
sich auf CHF 74<strong>09</strong>.05.<br />
Die Rechnungsrevisoren Ruth<br />
Ettlin und Peter Fanger haben<br />
die Rechnung 2008 geprüft und<br />
können bestätigen, dass alle Belege<br />
vorhanden sind und mit den<br />
Buchungen übereinstimmen.<br />
Ruth Ettlin beantragt, die vorliegende<br />
Jahresrechnung 2008<br />
und den Abschluss per 31.<strong>12</strong>.2008<br />
zu genehmigen und dem Vorstand,<br />
unter bester Verdankung der<br />
geleisteten Dienste, Entlastung zu<br />
erteilen.<br />
Die Rechnung wird einstimmig<br />
genehmigt und dem Kassier<br />
für die kompetente Arbeit der<br />
beste Dank ausgesprochen.<br />
5. Genehmigung des Voranschlages,<br />
Festsetzung des<br />
Jahresbeitrages<br />
Kassier Karl Flury erläutert das<br />
Budget für das Jahr 20<strong>09</strong>. Es sieht<br />
bei Einnahmen von CHF 6<strong>12</strong>0.00<br />
und Ausgaben von CHF 5950.00<br />
Mehreinnahmen von CHF 170.00<br />
vor.<br />
Das Budget enthält unter Diverses<br />
Ausgaben im Umfang von<br />
CHF 1500.00 für Aktionen im<br />
Rahmen des Jahresprogrammes.<br />
Ohne Gegenstimme wird der<br />
Voranschlag 20<strong>09</strong> von den Anwesenden<br />
genehmigt. Der Jahresbeitrag<br />
wird auf CHF 25.00 belassen.<br />
6. Statutenrevision<br />
Lydia Hümbeli erläutert anhand<br />
einer Präsentation die Überarbeitung<br />
der Statuten. Nach 24 Jahren<br />
drängte sich eine Aktualisierung<br />
auf.<br />
Die Revision hatte folgende Zielsetzung:<br />
• schlanke Statuten<br />
• Alles, was bereits im ZGB<br />
(Art. 60 bis 79) geregelt ist, soll<br />
in den Statuten nicht wiederholt<br />
werden.<br />
Was ist neu:<br />
• Mitglieder können neu auch<br />
die Mitarbeitenden der öffentlich-rechtlichen<br />
und gemischtwirtschaftlichenKörperschaften<br />
und Anstalten des<br />
Kantons oder der Gemeinden<br />
werden.<br />
• Der SGPV hat keine Delegierten<br />
mehr. Alle Aufgaben<br />
werden durch den Vorstand<br />
wahrgenommen.<br />
• Die Mitgliederversammlung<br />
löst die Hauptversammlung<br />
ab.<br />
• Die Statuten sind an diejenigen<br />
des <strong>ZV</strong> angepasst.<br />
• Es erfolgten diverse sprachliche<br />
Anpassungen.<br />
Diskussion / Fragen:<br />
Art. 8: Stellenwechsel in die Privatwirtschaft<br />
führt nicht zu Austritt<br />
aus Verband. Die austretende<br />
Person kann frei entscheiden, ob<br />
sie im SGPV Mitglied bleiben<br />
will. In den alten Statuten war ein<br />
Austritt vorgesehen.<br />
Die Versammlung dankt dem<br />
Vorstand für die neu vorgelegten<br />
Statuten. Sie sind kurz und prägnant.<br />
Die neuen Statuten werden<br />
auf Antrag des Vorstands durch die<br />
Versammlung einstimmig genehmigt.<br />
7. Jahresprogramm<br />
Der Vorstand richtet an die Versammlung<br />
die Anfrage, ob die<br />
früher durchgeführten Feierabendveranstaltungen<br />
und Betriebsbesichtigungen<br />
wieder aufgenommen<br />
werden sollen und ob<br />
es konkrete Vorschläge gibt.<br />
Verschiedene Anwesende sprechen<br />
sich grundsätzlich für ein Angebot<br />
in dieser Richtung aus.<br />
Denkbar sind Besichtigungen einzelner<br />
Betriebe, aber zum Beispiel<br />
auch die Präsentation der örtlichen<br />
Betriebe durch den Gewerbeverein.<br />
<strong>12</strong>/<strong>09</strong> Dezember 20<strong>09</strong> 21
OBWALDEN<br />
Nach Ansicht des Vorstandes<br />
kann eine Veranstaltung auch die<br />
Form eines «internen Besuches» eines<br />
kantonalen Amtes oder einer<br />
gemeindlichen Organisation haben.<br />
Dies wird von der Versammlung<br />
begrüsst und es wird<br />
angeregt, eine solche Veranstaltung<br />
mit der Mitgliederversammlung zu<br />
verknüpfen.<br />
Der Vorstand dankt für die Ideen<br />
und wird sie aufnehmen.<br />
8. Verschiedenes<br />
Regierungsrat Hans Wallimann<br />
dankt dem Vorstand für die lancierte<br />
Attraktivitätssteigerung und<br />
hofft auf ein grösseres Engagement<br />
aus dem Kreis der Mitarbeitenden.<br />
Zudem lobt er die gute Zusammenarbeit<br />
zwischen seinem Department<br />
und dem Vorstand des<br />
SGPV. Die vergangene Lohnrunde<br />
war ein guter Schritt.<br />
Mit Blick auf die bevorstehende<br />
Lohnrunde kann er festhalten,<br />
dass der Regierungsrat an<br />
der heutigen Sitzung den Voranschlag<br />
2010 zuhanden des Kantonsrats<br />
verabschiedet hat. Es ist in<br />
Anbetracht der aktuellen Lage<br />
keine generelle, aber eine individuelle<br />
Lohnerhöhung von 1,0<br />
Prozent vorgeschlagen.<br />
Er darf auch die Grüsse und<br />
den Dank des Regierungsrates für<br />
die Leistungen der Mitarbeitenden<br />
überbringen.<br />
Im Sinne eines Ausblicks hält<br />
Hans Wallimann fest, dass die<br />
Lösung der immer steigenden<br />
Aufgabenfülle nicht über die Aufstockung<br />
der personellen Ressourcen,<br />
sondern über eine Aufgabenpriorisierung<br />
aufgrund der<br />
verfügbaren Ressourcen erfolgen<br />
muss. Das Ausmass und die gewünschte<br />
Erledigung der Aufgaben<br />
haben ein Mass angenommen,<br />
das nicht mehr gesund ist. Die<br />
Grenzen der Belastbarkeit der Verwaltung<br />
müssen von der Gesellschaft<br />
akzeptiert werden. Wir<br />
müssen wegkommen vom Per-<br />
fektionismus. Guter Wille allein<br />
löst die Probleme nicht. Er dankt<br />
für die gute Zusammenarbeit.<br />
Karl Flury dankt dem kantonalen<br />
Führungsstab für die Sensibilisierung<br />
bezüglich der möglichen<br />
Gefährdung durch die Grippe<br />
A/H1N1. Das Bundesamt für<br />
Gesundheit empfehle bei Verdachtsfällen<br />
zu Hause zu bleiben<br />
und nur in zwingenden Fällen zum<br />
Arzt zu gehen. Demgegenüber<br />
fordert der Kanton als Arbeitgeber<br />
ein Arztzeugnis bei Absenzen von<br />
mehr als drei Tagen.<br />
Joe Amrhein erklärt, dass sich<br />
das <strong>Personal</strong>amt diese Überlegung<br />
auch gemacht habe. Es wurde<br />
aber entschieden, die bisherige<br />
Regelung auf zusehen hin beizubehalten.<br />
Bei sich eskalierender<br />
Entwicklung würde das <strong>Personal</strong>amt<br />
handeln.<br />
Karl Flury schliesst die Mitgliederversammlung<br />
mit einem<br />
Dank an alle Anwesenden für das<br />
Erscheinen. Im Anschluss an die<br />
Versammlung freut er sich auf<br />
gute Begegnungen und Gespräche<br />
im Lotus Garden.<br />
22 Dezember 20<strong>09</strong><br />
6060 Sarnen,<br />
21. September 20<strong>09</strong><br />
Der Protokollführer:<br />
Andreas Bacher<br />
Landesindex der Konsumentenpreise<br />
Berechnet vom Bundesamt für Statistik, Bern<br />
Jahr Jan. Febr. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez.<br />
Basis Mai 1993 = 100<br />
1993 … … … … 100,0 100,0 99,9 100,4 100,3 100,4 100,3 100,4<br />
1994 100,5 100,9 100,9 101,0 100,4 100,5 100,5 100,9 100,9 100,9 100,8 100,8<br />
1995 101,5 102,5 102,5 102,6 102,4 102,6 102,5 102,9 103,0 102,8 102,8 102,8<br />
1996 103,1 103,3 103,4 103,5 103,2 103,4 103,2 103,5 103,5 103,7 103,5 103,6<br />
1997 103,9 104,1 104,0 104,1 103,8 103,9 103,7 104,0 104,0 104,0 103,9 104,0<br />
1998 104,0 104,1 104,0 104,1 103,8 104,0 103,8 104,1 104,0 104,0 103,8 103,8<br />
1999 104,0 104,4 104,5 104,7 104,4 104,6 104,6 105,1 105,3 105,3 105,2 105,6<br />
2000 105,7 106,1 106,0 106,1 106,1 106,5 106,6 106,3 106,8 106,7 107,2 107,1<br />
2001 107,1 106,9 107,1 107,4 108,0 108,2 108,0 107,4 107,5 107,4 107,5 107,5<br />
2002 107,6 107,6 107,6 108,6 108,7 108,5 107,9 107,9 108,1 108,7 108,5 108,4<br />
2003 108,5 108,6 1<strong>09</strong>,1 1<strong>09</strong>,3 1<strong>09</strong>,1 1<strong>09</strong>,1 108,2 108,5 108,6 1<strong>09</strong>,2 1<strong>09</strong>,1 1<strong>09</strong>,1<br />
2004 108,7 108,7 1<strong>09</strong>,0 1<strong>09</strong>,9 110,1 110,3 1<strong>09</strong>,2 1<strong>09</strong>,6 1<strong>09</strong>,6 110,6 110,7 110,5<br />
2005 110,0 110,3 110,5 111,4 111,3 111,1 110,5 110,6 111,1 111,5 111,8 111,6<br />
Basis Dezember 2005 = 100<br />
2006 99,8 100,1 100,0 100,9 101,1 101,0 100,4 100,5 100,3 100,7 100,6 100,6<br />
2007 99,9 100,1 100,2 101,3 101,6 101,7 101,1 101,0 101,1 101,9 102,4 102,6<br />
2008 102,3 102,5 102,8 103,6 104,5 104,6 104,2 103,9 104,0 104,6 103,9 103,4<br />
20<strong>09</strong> 102,5 102,7 102,4 103,3 103,5 103,6 103,0 103,1 103,1 103,7 103,9<br />
Stadt Zürich (Ermittlung nach Mitte des Monats)<br />
Jahr Jan. Febr. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez.<br />
1999 143,2 143,8 144,0 144,2 144,0 144,1 144,1 144,7 145,0 144,9 144,7 145,2<br />
Basis Mai 1993 = 100<br />
2001 106,4 106,3 106,5 106,7 107,3 107,5 107,3 106,8 107,0 106,9 106,9 106,9<br />
2002 107,0 107,0 107,0 107,8 107,8 107,7 107,9 107,9 107,3 107,7 107,6 107,5<br />
2003 107,6 107,8 108,2 108,4 108,1 108,1 107.0 107,4 107,4 107,9 107,7 107,7<br />
2004 107,3 107,3 107,5 108,4 108,7 108,9 107,8 1<strong>09</strong>,6 1<strong>09</strong>,6 110,6 110,7 110,5<br />
2005 110,0 110,3 110,5 111,4 1<strong>09</strong>,6 1<strong>09</strong>,6 1<strong>09</strong>,0 1<strong>09</strong>,2 1<strong>09</strong>,2 1<strong>09</strong>,7 1<strong>09</strong>,7 110,1<br />
Basis Dezember 2005 = 100<br />
2006 99,8 99,9 99,8 100,6 100,8 100,8 100,0 100,2 100,0 100,3 100,2 100,2<br />
2007 99,7 99,8 99,9 101,0 101,2 101,3 100,7 100,7 100,7 101,5 102,4 102,3<br />
2008 102,0 102,1 102,5 103,2 104,2 104,4 104,0 103,8 103,9 104,4 103,8 103,3<br />
20<strong>09</strong> 102,4 102,5 102,1 103,1 103,2 103,4 102,7 102,9 102,9 103,5 103,7<br />
Kanton Basel-Stadt<br />
Jahr Jan. Febr. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez.<br />
1999 146,3 146,7 146,8 147,0 146,7 147,1 147,0 147,4 147,5 147,5 147,4 147,9<br />
Basis Mai 1993 = 100<br />
2000 106,0 106,1 106, 1 106,0 106,0 106,4 106,5 106,2 106,8 106,6 107,1 107,0<br />
2001 106,8 106,7 106,8 107,3 107,9 108,1 107,9 107,4 107,6 107,4 107,4 107,3<br />
2002 107,6 107,6 107,6 108,4 108,5 108,3 107,8 107,8 107,9 108,5 108,4 108,3<br />
2003 108,3 108,5 1<strong>09</strong>,0 1<strong>09</strong>,1 1<strong>09</strong>,0 1<strong>09</strong>,0 108,0 108,2 108,4 1<strong>09</strong>,1 108,9 108,9<br />
2004 108,5 108,4 108,7 1<strong>09</strong>,8 110,0 110,3 1<strong>09</strong>,2 1<strong>09</strong>,4 1<strong>09</strong>,4 110,5 110,6 110,5<br />
2005 110.0 110,3 110,6 111,5 111,4 111,1 110,7 110,9 111,4 1<strong>12</strong>,3 111,9 111,8<br />
Basis Dezember 2005 = 100<br />
2006 99,9 100,1 100,1 100,9 101,0 101,0 100,3 100,4 100,2 100,6 100,5 100,5<br />
2007 99,9 99,9 100,0 101,1 101,3 101,3 100,8 100,7 100,8 101,7 102,3 102,6<br />
2008 102,3 102,4 102,7 103,5 104,3 104,4 104,0 103,7 103,8 104,4 103,9 103,4<br />
20<strong>09</strong> 102,6 102,7 102,4 103,3 103,4 103,6 102,8 103,0 103,0 103,7 103,9<br />
Indexzahlen für Konsumentenpreise können auch telefonisch (Automaten) abgerufen werden.<br />
CH: Telefon <strong>09</strong>00 55 66 55 ZH-Stadt: Tel. 044-250 48 <strong>09</strong> BS-Stadt: Tel. 061-267 87 33<br />
<strong>12</strong>/<strong>09</strong>
LUZERN<br />
KANTON<br />
LUZERN<br />
STADTPERSONALVERBAND LUZERN<br />
Verbandsausflug 20<strong>09</strong><br />
zur Rega-Einsatzbasis<br />
Der Verbandsausflug des Stadtpersonalverbandes<br />
Luzern führte<br />
dieses Jahr nach Erstfeld zur Rega-<br />
Einsatzbasis Uri. Am 7. und 8.<br />
September 20<strong>09</strong> durfte je eine<br />
Gruppe mit rund 50 Verbandsmitgliedern<br />
die Basis besuchen<br />
gehen. Mit einem Reisecar wurden<br />
wir bequem nach Erstfeld chauffiert.<br />
Dort führte uns der technische<br />
Leiter der Rega-Basis, Herr<br />
Endlich war der Heli zum Bestaunen gelandet.<br />
Rolf Winiger, in das Métier der<br />
fliegenden Retter ein. Während der<br />
Präsentation startete der dort stationierte<br />
Heli gleich mehrere Male<br />
zu einem Einsatz –Action pur!<br />
Nach der Führung gab es ein feines<br />
Nachtessen und Ausklingen<br />
des Abends im Restaurant Allmendhuisli<br />
in Stans.<br />
Josef Zimmermann<br />
Neueintritte<br />
Wir heissen unsere neuen Mitglieder herzlich willkommen:<br />
• Amrein Marie-Louise, Immobilien<br />
• Brünisholz Yolanda, BID<br />
• Iten Doris, STA<br />
• Kündig Lukas, FD<br />
• Pfaffenlehner Roman, AV<br />
• Portmann Gaby, FD<br />
• Sauter Peter, Uttenberg<br />
• Seeholzer Aline, ewl<br />
• Weibel Patrick, Umweltschutz<br />
• Willener Pascale, BA<br />
• Ziegler Roland, SOD<br />
• Zurfluh Christian, ewl<br />
Gemütliches Beisammensein mit Nachtessen als Abschluss des Ausfluges.<br />
Rolf Liniger von der Rega demonstriert das Notfallset der Flughelfer.<br />
<strong>12</strong>/<strong>09</strong> Dezember 20<strong>09</strong> 23
Wer kennt es nicht? Das graue Wetter schlägt aufs Gemüt, die<br />
Stimmung schwankt und schlimmstenfalls erwischt man eine Erkältung<br />
oder gar einen Grippevirus. Doch was dagegen tun? Viel<br />
Schlaf, genügend Bewegung, frische Luft und gesunde Ernährung<br />
stärken die Abwehrkräfte und sorgen für gute Stimmung.<br />
Die gute Nachricht für jene, die<br />
besonders im Winter nicht zu<br />
den begeisterten Sportlern gehören:<br />
Bereits mit einem 30-minütigen<br />
Spaziergang tun Sie sich<br />
selbst etwas Gutes.<br />
Die Bewegung an der frischen<br />
Luft wirkt anregend, hilft nach<br />
oder während einem anstrengenden<br />
Arbeitstag abzuschalten und<br />
gleichzeitig wird das Immunsystem<br />
gestärkt. Sind der innere Schweinehund<br />
erst mal überwunden und<br />
die ersten zügigen Schritte gemacht,<br />
sind Kälte und Nässe mit<br />
der richtigen Kleidung gar nicht so<br />
schlimm.<br />
Ein Spaziergang bei Tageslicht<br />
gibt dem Körper zudem die Möglichkeit,<br />
an der Sonne Vitamin D<br />
zu tanken.<br />
Richtige Ernährung im Winter<br />
Eine gesunde und ausgewogene<br />
Ernährung hält den Körper fit und<br />
kann sogar den Ausbruch einer Erkältung<br />
verhindern. Gemüse und<br />
Obst kann nicht genug gegessen<br />
werden, denn sie enthalten die Vitamine,<br />
die das Immunsystem stärken<br />
und unserem Körper helfen,<br />
gesund durch die kalten Tage zu<br />
kommen.<br />
An der Spitze der Vitaminlieferanten<br />
liegt die Kiwi – sie enthält<br />
fast doppelt so viel an Vitamin C<br />
wie eine Orange sowie weitere<br />
wichtige Mineralien und Ballaststoffe,<br />
was sie zu einer perfekten<br />
Zwischenmahlzeit macht. Wichtige<br />
Vitamin-E-Lieferanten sind<br />
Nüsse, Mandeln, Avocados, Weizenkeimöl,<br />
Leinsamen und Knollensellerie,<br />
die auf dem winterlichen<br />
Speisezettel nicht fehlen dürfen,<br />
denn sie regen die Antikörper<br />
im Blut an, welche zur Bekämpfung<br />
von Infektionen von Bedeutung<br />
sind.<br />
Fachleute empfehlen zudem,<br />
vermehrt kohlehydrathaltige und<br />
damit energiespendende Lebensmittel<br />
wie Pasta und Reis zu sich<br />
zu nehmen.<br />
Entspannung und Erholung<br />
Um gesund und fit zu bleiben,<br />
muss neben dem Körper auch<br />
der Geist gepflegt werden. Gönnen<br />
Sie sich deshalb genügend Schlaf,<br />
lustige und entspannende Stunden<br />
mit Freunden (Lachen entspannt)<br />
Fit durch den Winter!?<br />
oder einen Besuch in der Sauna.<br />
Letzterer trägt nicht nur zur Entspannung<br />
bei, sondern bringt<br />
auch den Stoffwechsel in Schwung.<br />
Das richtige Klima im Büro<br />
Ein optimales Raumklima trägt im<br />
Winter ebenfalls zum Wohlbefinden<br />
bei. Wichtig ist, die Büros<br />
mehrmals täglich gut durchzulüften.<br />
Die Temperatur sollte idealerweise<br />
zwischen 21 und 22 Grad<br />
Der <strong>ZV</strong> wünscht seinen Mitgliedern<br />
eine schöne Adventszeit, frohe Festtage<br />
und alles Gute im neuen Jahr!<br />
liegen, die Luftfeuchtigkeit um die<br />
50 Prozent. Ist letztere zu tief, führt<br />
dies zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen<br />
wie trockene<br />
Nase(nschleimhäute) oder Augenreizungen.<br />
Gegen die trockene<br />
Heizungsluft können neben Luftbefeuchter<br />
auch Pflanzen regulierend<br />
wirken.<br />
Sandra Wittich<br />
24 Dezember 20<strong>09</strong> <strong>12</strong>/<strong>09</strong>