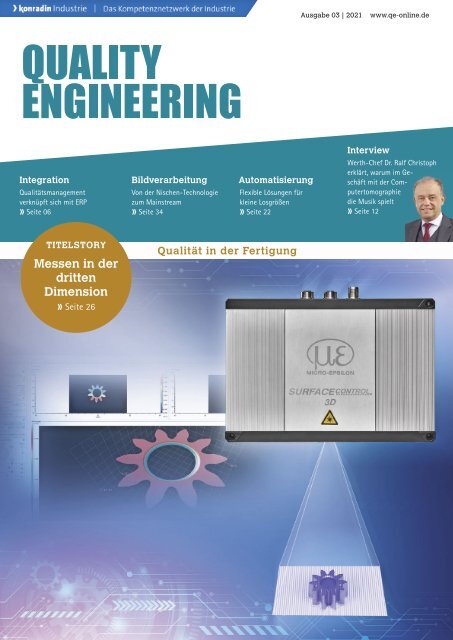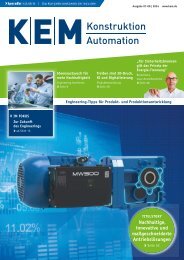Quality Engineering 03.2021
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Ausgabe 03 | 2021<br />
www.qe-online.de<br />
Interview<br />
Integration<br />
Qualitätsmanagement<br />
verknüpft sich mit ERP<br />
» Seite 06<br />
Bildverarbeitung<br />
Von der Nischen-Technologie<br />
zum Mainstream<br />
» Seite 34<br />
Automatisierung<br />
Flexible Lösungen für<br />
kleine Losgrößen<br />
» Seite 22<br />
Werth-Chef Dr. Ralf Christoph<br />
erklärt, warum im Geschäft<br />
mit der Computertomographie<br />
die Musik spielt<br />
» Seite 12<br />
TITELSTORY<br />
Messen in der<br />
dritten<br />
Dimension<br />
» Seite 26<br />
Qualität in der Fertigung
Industrie<br />
Das Kompetenznetzwerk der Industrie<br />
24. Anwenderforum<br />
Additive<br />
Produktionstechnologie<br />
10. Juni 2021,<br />
DIGITAL EDITION<br />
Digital-<br />
Event!<br />
Der steigende Reifegrad der<br />
additiven Fertigung ermöglicht<br />
den immer stärkeren<br />
Einsatz dieser Technologie in der industriellen Fertigung.<br />
Freuen Sie sich auf spannende Vorträge von<br />
Herstellern und Anwendern sowie auf hochkarätige<br />
Keynote-Speaker! Die Veranstaltung beleuchtet die<br />
additve Fertigung sowohl metall- als auch kunststoffseitig.<br />
Additive Fertigung<br />
mit Metall als<br />
Innovationstreiber<br />
10. Juni 2021 |<br />
09:30 – 12:45 Uhr<br />
Wie additive Kunststoffverfahren<br />
den<br />
Markt erobern<br />
10. Juni 2021 |<br />
13:30 – 16:05 Uhr<br />
Sichern Sie sich jetzt ihren kostenfreie Teilnahmeplatz<br />
unter additive.industrie.de/anwenderforum-2021.<br />
Auf Austausch müssen Sie dabei nicht<br />
verzichten: Beteiligen Sie sich gerne mit Ihren<br />
Fragen an die Referenten via Chat.<br />
Wir freuen uns auf Sie!<br />
Bild: Fraunhofer IPA<br />
2 <strong>Quality</strong> <strong>Engineering</strong> » 03|2021
» EDITORIAL<br />
Generationswechsel<br />
Wir befinden uns nach wie vor in turbulenten und aufregenden Zeiten.<br />
Auch bei der <strong>Quality</strong> <strong>Engineering</strong> gibt es Neuigkeiten: Der langjährige<br />
Chefredakteur des Industrieanzeiger, der Beschaffung Aktuell und der<br />
<strong>Quality</strong> <strong>Engineering</strong>, Werner Götz, wird im Juni nach insgesamt bald 27<br />
Jahren im Konradin-Verlag in den wohlverdienten Ruhestand wechseln<br />
und ich, Alexander Gölz, werde seine Nachfolge antreten. Daher möchte<br />
ich dieses Editorial nutzen, um mich Ihnen kurz vorzustellen.<br />
Begonnen hat meine journalistische Tätigkeit im Jahr 2012 in der<br />
Industrieanzeiger- Redaktion in Form eines zwei-jährigen Volontariats. Im<br />
Anschluss war ich für den Industrieanzeiger und die Schwesterzeitschrift<br />
„Beschaffung aktuell“ als Redakteur mit den Ressorts Intralogistik, Arbeitsschutz<br />
und C-Teile-Management tätig. Die vergangenen zwei Jahre hatte<br />
ich die Position als Chefredakteur der Onlineredaktion Industrie inne.<br />
Ich freue mich auf die kommenden Aufgaben und darauf gemeinsam mit<br />
dem QE-Team um Sabine Koll, Markus Strehlitz und Uwe Schoppen, Sie,<br />
liebe Leserinnen und Leser, weiterhin über Trends und Neuheiten rund um<br />
die Qualitätssicherung auf dem Laufenden zu halten.<br />
In dieser Ausgabe möchte ich Ihnen insbesondere unser Fokusthema „Automatisierte<br />
Qualitätssicherung empfehlen (ab Seite 22). Des Weiteren beleuchten<br />
wir im Special „Bildverarbeitung“ (ab Seite 33) ein Rolle-zu-<br />
Rolle-Inspektionssystem für Barrierefolien am Fraunhofer FEP, welches<br />
mittels Hyperspektral-Bildgebung und Künstlicher Intelligenz Folien für<br />
organische Leuchtdioden (OLED) oder Solarzellen (OPV) überprüft.<br />
Zu guter Letzt empfehle ich Ihnen noch ein Interview (Seite 12) mit Dr.<br />
Ralf Christoph, Geschäftsführer von Werth Messtechnik, über die Auswirkungen<br />
der Corona-Krise. So viel sei verraten: Die Talsohle ist bei Werth<br />
durchschritten und die Nachfrage zieht wieder an. Vor allem im Geschäft<br />
mit der Computertomographie (CT) spiele die Musik. Viel Spaß beim Lesen!<br />
ScopeCheck ® FB<br />
in Multi-Z-Achsen-Bauweise zur<br />
perfekten Integration von Multisensorik<br />
Produktneuheiten 2021<br />
Multisensorik und<br />
<br />
TomoScope ® XS FOV 500<br />
für schnelle Messergebnisse in<br />
Fertigung und Messraum<br />
Alexander Gölz<br />
Chefredakteur<br />
<strong>Quality</strong> <strong>Engineering</strong><br />
alexander.goelz@konradin.de<br />
Folgen Sie uns auch auf diesen Kanälen<br />
Twitter:<br />
@Redaktion_QE<br />
LinkedIn:<br />
hier.pro/DFqYU<br />
Werth Messtechnik GmbH<br />
Siemensstraße 19<br />
35394 Gießen, Deutschland<br />
mail@werth.de<br />
Tel. +49 641 7938-0<br />
<strong>Quality</strong> <strong>Engineering</strong> » 03|2021 3
» INHALT 03 2021 40. JAHRGANG<br />
IM FOKUS<br />
Automatisierte<br />
Qualitätssicherung<br />
schreitet<br />
Automatisierungslösungen<br />
decken<br />
voran<br />
Fehler frühzeitig auf<br />
» Seite 22<br />
– nicht nur in der Großserie.<br />
Gefordert sind schnelle<br />
sowie flexible Systeme.<br />
Bild: Wenzel<br />
MANAGEMENT<br />
Integration<br />
QM- und ERP-Software –<br />
Speziallösung oder alles aus einer Hand? 06<br />
Alles was Recht ist<br />
Rückruf – ein Begriff und seine<br />
oft ungenaue Verwendung 09<br />
Kooperationsprojekt<br />
QI-Digital soll die deutsche<br />
Qualitätsinfrastruktur digitalisieren 10<br />
Werth-Chef im Interview<br />
Ralf Christoph über die aktuellen Geschäftsaussichten<br />
und die Bedeutung der Computertomographie 12<br />
Personal & Karriere<br />
Fachkräftemangel – Unternehmen müssen sich<br />
auf vielfältige Bewerbergruppen einlassen 15<br />
Messmittel<br />
Regelmäßige Überprüfung sorgt<br />
für mehr Sicherheit 16<br />
Eine Redaktion – zwei Meinungen<br />
Wie viel Kontrolle braucht es im Privatleben? 18<br />
DQS-Konferenz<br />
Remote Audits gewinnen in der Pandemie<br />
an Bedeutung 20<br />
IM FOKUS:<br />
AUTOMATISIERUNG<br />
Trendbericht<br />
Automatisierte Messtechnik lohnt sich<br />
auch bei kleinen Losgrößen 22<br />
Lasertriangulation<br />
Neue 3D-Sensoren beschleunigen<br />
die Oberflächenmessung 26<br />
Optische Messtechnik<br />
Roboter mit Weißlichtsensor reduziert<br />
Zykluszeiten bei Automobilzulieferer 30<br />
BILDVERARBEITUNG<br />
Interview mit Fraunhofer-Vision-Experte<br />
Michael Sackewitz sieht Forschungsboom<br />
in der Bildverarbeitung 34<br />
Digitalmikroskop<br />
Visioner 1 liefert tiefenscharfe<br />
Bilder in Echtzeit 36<br />
Oberflächenrauheit<br />
Vorteile der Weißlichtinterferometrie lassen<br />
sich jetzt auch direkt in der Fertigung nutzen 40<br />
Schallvisualisierung<br />
Akustische Kameras unterstützen Maschinenbauer<br />
bei der Qualitätssicherung 42<br />
Schutzmaskenproduktion<br />
System mit Künstlicher Intelligenz<br />
übernimmt die Qualitätskontrolle 44<br />
Verpackungskomponenten<br />
Kameraverbund prüft 100 %<br />
und in Hochgeschwindigkeit 46<br />
TECHNIK<br />
Prüfung biomedizinischer Teile<br />
Die Integration einer Torsionsfähigkeit in<br />
ein axialdynamisches Prüfsystem bietet Vorteile 48<br />
Betriebsfestigkeit<br />
Software berechnet Lebensdauer von Zahnrädern 50<br />
Elektromobilität<br />
Zwei Testsysteme prüfen und<br />
messen Steuerplatinen 52<br />
News und Produkte 53<br />
4 <strong>Quality</strong> <strong>Engineering</strong> » 03|2021
Bild: exentia/stock.adobe.com/<strong>Quality</strong> <strong>Engineering</strong><br />
Kooperationsprojekt QI-Digital gestartet: Deutschland denkt<br />
Qualitätssicherung digital.<br />
» Seite 10<br />
Bild: Zeiss<br />
Mit dem Digitalmikroskop Visioner 1 lassen sich Proben bis zu einer Tiefe<br />
von 69 mm inspizieren.<br />
» Seite 36<br />
QUALITY WORLD<br />
Umweltverschmutzung<br />
Forschungsprojekt etabliert Prüfkriterien<br />
zur Bestimmung von Mikroplastik im Boden 57<br />
Firmenindex 59<br />
Impressum 59<br />
FOLGEN SIE UNS AUCH AUF DIESEN KANÄLEN:<br />
Twitter:<br />
@Redaktion_QE<br />
LinkedIn:<br />
hier.pro/DFqYU<br />
Ein Unternehmen von <strong>Quality</strong> Vision International<br />
Der größte optische Multisensorkonzern der Welt<br />
<strong>Quality</strong> 65719 <strong>Engineering</strong> Hofheim-Wallau » 03|2021 5<br />
T: 06122/9968-0 • www.ogpgmbh.de
» MANAGEMENT<br />
Ein Puzzle-Teil von<br />
vielen – es existiert<br />
ein breites Spektrum<br />
an Systemen, mit<br />
denen sich Qualitätsmanagement-Software<br />
verbindet.<br />
Bild: alphaspirit/stock.adobe.com<br />
Integration von QM- und ERP-Software<br />
Speziallösung oder alles<br />
aus einer Hand?<br />
Die Beteiligung von Proalpha an Böhme & Weihs sorgt für eine enge Verzahnung<br />
von ERP und Qualitätsmanagement-Software – mit Vorteilen für die Anwender,<br />
wie die beiden Firmenchefs behaupten. Auch andere Anbieter setzen auf<br />
Integration, wollen aber unabhängig bleiben.<br />
» Markus Strehlitz<br />
Wir fokussieren uns auf die Fertigungsindustrie.<br />
Das Qualitätsmanagement<br />
ist für unsere Kunden extrem<br />
relevant“, sagt Eric Verniaut, CEO des ERP-<br />
Anbieters Proalpha. Damit gibt er die Antwort<br />
auf die Frage, warum sich sein Unternehmen<br />
vor kurzem an dem CAQ-Spezialisten<br />
Böhme & Weihs beteiligt hat. Proalpha<br />
soll sich zu einer Innovationsplattform<br />
für die fertigende Industrie im Mittelstand<br />
entwickeln. Und Qualitätsmanagement<br />
ist ein Baustein dieser Strategie.<br />
Mit einem einfachen QM-Modul, wie es<br />
andere ERP-Anbieter in ihre Lösung integriert<br />
haben, sei es nicht getan, so Verniaut.<br />
„Gerade CAQ ist ein sehr spezifischer<br />
Bereich, in dem tiefes Normen- und Prozesswissen<br />
entscheidend sind. Das können<br />
wir allein nicht abdecken.“ Mit Böhme<br />
& Weihs will Verniaut daher das Proalpha-Portfolio<br />
um eine Expertenlösung<br />
erweitern. „Wir wollen Best of Suite mit<br />
Best of Breed verbinden.“<br />
Nutzer sollen zur Migration<br />
bewegt werden<br />
Die Einbindung der Technologie von Böhme<br />
& Weihs in die ERP-Lösung soll nahtlos<br />
sein. Diese wird von der Prozessintegration<br />
bis zu einer Integration der Nutzeroberfläche<br />
reichen, so der Plan. „Die<br />
Anwender werden nicht mal merken,<br />
wenn sie das ERP verlassen und in die<br />
Böhme-&-Weihs-Applikation wechseln“,<br />
sagt der CEO.<br />
Ziel ist es, sukzessive alle Proalpha-<br />
Kunden, die zur Zeit noch eine andere<br />
Qualitätsmanagement-Software nutzen,<br />
zu einer Migration nach Böhme & Weihs<br />
zu bewegen. Das soll laut Verniaut im<br />
Laufe eines „vernünftigen Zeitraums“<br />
passieren. Gerade für Unternehmen, die<br />
mit der Komplexität einer Integration<br />
nicht umgehen können, sei die enge Verknüpfung<br />
von ERP und CAQ interessant.<br />
„Das wird die Entscheidung, zu Böhme &<br />
Weihs zu wechseln, deutlich beeinflussen“,<br />
glaubt Verniaut.<br />
6 <strong>Quality</strong> <strong>Engineering</strong> » 03|2021
Volle Einblicke<br />
im 3D-Druck.<br />
Machen Sie das<br />
Unsichtbare sichtbar.<br />
ZEISS X-Ray Series<br />
Von der Inspektion des Pulvers bis hin zur Überprüfung<br />
der Maßhaltigkeit und Defekteanalyse des<br />
3D-gedruckten Bauteils bieten die Röntgensysteme<br />
von ZEISS volle Einblicke. Jetzt entdecken!<br />
zeiss.de/x-ray<br />
<strong>Quality</strong> <strong>Engineering</strong> » 03|2021 7
» MANAGEMENT<br />
„Gerade CAQ ist ein sehr spezifischer Bereich, in dem tiefes Normen- und<br />
Prozesswissen entscheidend sind. Wir wollen Best of Suite mit Best of Breed<br />
verbinden“, sagt Eric Verniaut, CEO von Proalpha.<br />
Bild: Proalpha<br />
Das Konzept, ERP- und QM-Software miteinander zu nutzen, hänge immer<br />
auch von den individuellen Gegebenheiten eines Unternehmens ab, meint<br />
Iris Bruns, Geschäftsführerin von Consense.<br />
Bild: Consense<br />
„Böhme & Weihs wird aber weiterhin<br />
vollständig unabhängig im Markt agieren“,<br />
sagt Professor Norbert Böhme, Geschäftsführer<br />
des CAQ-Spezialisten. Die<br />
Lösung werde auch weiterhin Schnittstellen<br />
zu anderen ERP-Systemen bereit stellen.<br />
Das sei schon allein deshalb notwendig,<br />
weil Unternehmen häufig mit mehreren<br />
unterschiedlichen ERP-Systemen arbeiten<br />
– zum Beispiel abhängig von Werk<br />
zu Werk. „Uns fällt dann oft die Aufgabe<br />
zu, für eine Synchronisation zu sorgen“,<br />
so Böhme.<br />
Jeder muss mit dem System<br />
arbeiten können<br />
Auch andere Anbieter betonen, wie wichtig<br />
ein offener Ansatz ist. „Wir schaffen in<br />
unseren Projekten immer die notwendigen<br />
Schnittstellen und verlinken aus unseren<br />
Prozessen in alle Systeme, mit denen<br />
operativ gearbeitet wird“, sagt Dr. Iris<br />
Bruns, Geschäftsführerin von Consense.<br />
Hieraus werden auch Kennzahlen generiert,<br />
aufbereitet und kommuniziert.“<br />
Das Konzept, ERP- und QM-Software<br />
miteinander zu nutzen, hängt ihrer Meinung<br />
nach immer auch von den individuellen<br />
Gegebenheiten eines Unternehmens<br />
ab. „Qualitätsmanagement ist ein Thema,<br />
das wirklich jeden Mitarbeiter erreichen<br />
muss“, so Bruns. „Jeder einzelne sollte die<br />
Möglichkeit haben, die Inhalte eines QM-<br />
Systems schnell verfügbar zu haben – und<br />
dies in einer einfachen und verständlichen<br />
Weise, sodass jeder mit dem System<br />
arbeiten kann.“ Daher sei die Informati-<br />
»Der Markt hat Bedarf<br />
an unabhängigen<br />
Anbietern«<br />
Michael Flunkert, Babtec<br />
onsaufbereitung ganz entscheidend für<br />
die Akzeptanz eines Qualitätsmanagement-Systems.<br />
Böhme sieht gerade im Thema Prozesse<br />
ein wichtiges Argument für die Integration<br />
von Proalpha und Böhme & Weihs.<br />
„Für uns ist es eine sehr angenehme Art,<br />
eine Integration auf direktem Weg zu<br />
schaffen.“ Normalerweise müsse sich der<br />
Anwender überlegen, welche Abläufe er<br />
benötigt. „Nun muss er nicht mehr darüber<br />
nachdenken, weil er eine Standardintegration<br />
mit den entsprechenden Abläufen<br />
erhält“, so Böhme.<br />
Auch MES oder Messmittel<br />
brauchen Anbindung<br />
Michael Flunkert, Geschäftsführer von<br />
Babtec, ist jedoch der Ansicht, dass im<br />
Markt einen Bedarf an unabhängigen Anbietern<br />
von Qualitätsmanagement-Software<br />
gibt. „Anwender suchen nach der<br />
besten Lösung, die sie dabei unterstützt,<br />
ihre Qualität dauerhaft zu stärken. Diese<br />
Entscheidung möchten sie nicht von der<br />
Wahl des ERP-Anbieters abhängig machen.“<br />
Er betont, wie wichtig die Integration<br />
von Qualitätsmanagement-Software mit<br />
den verschiedenen Systemen im Unternehmen<br />
ist. „Die beste Konnektivität der<br />
besten Fachapplikationen für die jeweiligen<br />
Fachabteilungen – also Best of Breed<br />
– ist für uns der einzig richtige Ansatz,<br />
um den Anwender mit hohem Qualitätsanspruch<br />
bestmöglich in seinen Prozessen<br />
zu unterstützen.“ Die Konnektivität zum<br />
ERP-System sei in nahezu allen Projekten<br />
selbstverständlich und eine klassische<br />
Marktanforderung. „Darüber hinaus existiert<br />
jedoch ein breites Spektrum an weiteren<br />
Systemen, welche anzubinden sind<br />
– zum Beispiel MES, CAD, PLM, Messmittel<br />
oder -maschinen.“<br />
Qualitätsmanagement ist<br />
keine Randdisziplin<br />
Grundsätzlich sieht er die Stellung des<br />
Qualitätsmanagement mitten im Unternehmen<br />
verankert. „Es ist keine Randdisziplin,<br />
sondern mischt überall mit und<br />
kann eine führende Rolle bei der Erkennung<br />
und Umsetzung relevanter Entwicklungen<br />
im Unternehmen spielen.“ Das Bewusstsein,<br />
dass Qualitätsmanagement eine<br />
elementare Aufgabe der Firmenführung<br />
darstellt, sei als Trend deutlich<br />
wahrnehmbar.<br />
Die Bedeutung des Qualitätsmanagements<br />
im Unternehmen wächst nach<br />
Meinung von Proalpha-CEO Verniaut gerade<br />
durch die Verknüpfung von ERP und<br />
CAQ. „Diese enge Verzahnung wird sich<br />
als ein wesentlicher Bestandteil der digitalen<br />
Transformation in der Fabrik durchsetzen.“<br />
8 <strong>Quality</strong> <strong>Engineering</strong> » 03|2021
Sprachliche Ungenauigkeit<br />
Was bedeutet „Rückruf“?<br />
Die Folge unsicherer Bauteile kann ein Rückruf sein. Doch dieser Begriff wird<br />
aus juristischer Sicht nicht immer korrekt verwendet. Die sprachliche Ungenauigkeit<br />
zeigt sich dann im Lieferantenregress und kann Auswirkungen darauf haben, ob<br />
Versicherungsschutz in Betracht kommt oder nicht.<br />
Wenn es mal dicke kommt, kommt es meistens<br />
dicker: Mangelhafte Stückzahlen beim Kunden,<br />
die über das „akzeptable“ Grundrauschen hinausgehen,<br />
haben häufig komplexe Folgen. Je nach<br />
Industrie und Vertragswesen findet man sich (als Lieferant)<br />
schnell in komplizierten Abläufen des Kostenregresses<br />
wieder – mal ganz abgesehen von der stets<br />
umfangreichen Klärung der technischen Ursachen<br />
und Abstellmaßnahmen sowie der Verantwortung<br />
hierfür.<br />
Im Extremfall geht der Kunde in den Markt: Er<br />
warnt oder ruft zurück, still oder öffentlich. Teilweise<br />
aus Image- oder Qualitätsmarkengründen, teils aber<br />
auch aus Sicherheitsgründen. Im Lieferantenregress<br />
wird dann gerne alles in einen Topf geworfen und mit<br />
einem Alles-oder-nichts-Ansatz die aufkommenden<br />
Kosten moniert. Schließlich hat aus Kundensicht der<br />
Lieferant mit seinem mangelhaften Bauteil die Ursache<br />
für die Maßnahme gesetzt – ob sie nun „übertrieben“<br />
war oder nicht.<br />
Spätestens dann wird sich der Lieferant mit seiner<br />
Versicherung auseinandersetzen – was er aufgrund<br />
entsprechender Obliegenheiten aus dem Versicherungsverhältnis<br />
schon deutlich eher tun sollte – und<br />
die Frage klären müssen, ob denn eine passende Versicherung<br />
vorliegt, was sie überhaupt deckt und welche<br />
Voraussetzungen es zu erfüllen gilt. Hierbei<br />
kommt oft zum Vorschein, dass der Begriff des<br />
„Rückrufs“ auf technischer Ebene für nahezu alle<br />
proaktiven Marktmaßnahmen genutzt wird – auf<br />
Kunden- wie auch Lieferantenseite. Die Versicherer<br />
und Juristen haben diesbezüglich aber ein deutlich<br />
anderes Verständnis.<br />
Der Rückruf ist beispielsweise in § 2 Nr. 26 ProdSG<br />
definiert als „jede Maßnahme, die darauf abzielt, die<br />
Rückgabe eines dem Endverbraucher bereitgestellten<br />
Produkts zu erwirken“. Die Funktion des Rückrufs als<br />
solche ist hingegen nicht direkt definiert. Aus den<br />
entsprechenden Folgevorschriften des ProdSG (z.B. §<br />
6 Abs.2 ProdSG) sowie in zivilrechtlicher Sicht aus<br />
der Rechtsprechung zu § 823 Abs. 1 BGB (der die<br />
entsprechende Rechtsgrundlage für Pflicht zu<br />
Marktmaßnahmen bildet) ergibt sich, dass der<br />
„Rückruf“ im rechtlichen Sinne als Gefahrbeseitigungsmaßnahme<br />
verstanden wird, nicht als Mittel<br />
zur Imagepflege.<br />
Es ist nicht untersagt, Marktmaßnahmen zur<br />
Imagepflege als Rückruf zu bezeichnen. Die Konsequenz<br />
dieser sprachlichen Ungenauigkeit zeigt sich<br />
vielmehr im eingangs<br />
erwähnten Regress, und<br />
dort oft (erst) bei der<br />
Aufarbeitung der häufig<br />
ernüchternden Versicherungslage.<br />
Die Musterbedingungen<br />
des Gesamtverbandes<br />
der<br />
Deutschen Versicherungswirtschaft<br />
(GDV),<br />
die nahezu allen deutschen<br />
Versicherungspolicen<br />
zugrunde liegen,<br />
definieren im Bereich<br />
der KFZ-Rückrufkostenversicherung<br />
den Rückruf<br />
als „die auf gesetzli-<br />
von Reusch Rechtsanwälte<br />
Daniel Wuhrmann<br />
cher Verpflichtung beruhende<br />
Aufforderung […]<br />
rechtlichen Themen.<br />
liefert regelmäßige Beiträge zu<br />
an KFZ-Halter, ihre Fahrzeuge<br />
[…] zu bringen<br />
www.reuschlaw.de<br />
[…]“. Mit dem Verweis<br />
auf die gesetzliche<br />
Grundlage schließt sich der Kreis zur Gefahrbeseitigungsmaßnahme,<br />
umfasst allerdings in Ausnahmefällen<br />
– insbesondere in den USA – auch den Rückruf<br />
wegen technischer Non-Compliance.<br />
Was hilft diese Erkenntnis? Sie ist ganz entscheidend<br />
für das Verständnis, ob überhaupt Versicherungsschutz<br />
in Betracht kommt oder nicht. Zudem<br />
hilft sie, in Diskussionen mit dem Kunden die Rechtsgrundlage,<br />
auch im Verhältnis Kunde-Lieferant, besser<br />
einordnen und diskutieren zu können. Passen Vertragsinhalte<br />
im Kundenverhältnis auf der einen und<br />
Versicherungslage auf der anderen Seite nicht zueinander,<br />
gibt dies zudem Anlass, über etwaige Anpassungen<br />
beider nachzudenken.<br />
Alles was Recht ist<br />
Bild: Reusch Rechtsanwälte<br />
<strong>Quality</strong> <strong>Engineering</strong> » 03|2021 9
» MANAGEMENT<br />
Kooperationsprojekt QI-Digital gestartet<br />
Deutschland denkt<br />
Qualitätssicherung digital<br />
Die deutsche Qualitätsinfrastruktur soll digital werden, also Standardisierung,<br />
Normen- und Messwesen, Prüfdienstleistungen, Akkreditierung sowie die<br />
Zertifizierung des Qualitätsmanagements. Die beteiligten Akteure haben<br />
kürzlich für das Projekt QI-Digital den Startschuss gegeben.<br />
» Sabine Koll<br />
Professor Frank Härtig,<br />
Vizepräsident der PTB<br />
(groß im Bild) gehörte<br />
zum Kreis derer, die<br />
den Startschuss für<br />
QI-Digital gaben.<br />
Bild: exentia/stock.adobe.com/<strong>Quality</strong> <strong>Engineering</strong><br />
„Wir sehen die Qualitätsinfrastruktur als ganz wesentlichen<br />
Baustein des Qualitäts-Ökosystems und<br />
damit letztlich auch für die Wettbewerbsfähigkeit<br />
der Unternehmen im Land sowie für die Menschen<br />
im Hinblick auf Verbraucherschutz und Sicherheit“,<br />
sagte Ole Janssen, Leiter der Unterabteilung „Innovations-<br />
und Technologiepolitik“ im Bundesministerium<br />
für Wirtschaft und Energie (BMWI) zu Beginn der<br />
virtuellen Podiumsdiskussion, mit der QI-Digital<br />
während der Hannover Messe im April 2021 gestartet<br />
wurde. „Messwesen, Normen und Standardisierung,<br />
Konformitätsbewertung sowie Akkreditierung<br />
müssen im digitalen Zeitalter auf der Höhe der Zeit<br />
sein. Dafür brauchen wir die Digitalisierung innerhalb<br />
der einzelnen Organisationen der Qualitätsinfrastruktur,<br />
aber wir brauchen durch die hohe Komplexität<br />
auch die Teamleistung der Akteure“, so Janssen<br />
weiter. Das BMWI hat für QI-Digital die Bundesanstalt<br />
für Materialforschung und -prüfung (BAM),<br />
die Deutsche Akkreditierungsstelle (Dakks), das Deutsche<br />
Institut für Normung (DIN), die Deutsche Kommission<br />
Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik<br />
(DKE) und die Physikalisch-Technische Bundesanstalt<br />
(PTB) an einen Tisch gebracht:<br />
Doch was genau steckt hinter QI-Digital? Dakks-<br />
Geschäftsführer Dr. Stephan Finke verwies auf die<br />
10 <strong>Quality</strong> <strong>Engineering</strong> » 03|2021
Digitalisierung von Akkreditierungen und Kalibierscheinen:<br />
„Der digitale Kalibrierschein dient künftig<br />
nicht nur dem Nachweis der meteorologischen Rückführung,<br />
sondern er bietet durch die Maschinenlesbarkeit<br />
deutlich mehr Möglichkeiten. Dieses Projekt<br />
ist schon sehr weit fortgeschritten.“<br />
„Digitale maschinenlesbare Zertifikate und Cloud-<br />
Lösungen wie die Metrology Cloud sind nur der Anfang“,<br />
machte Professor Frank Härtig, Vizepräsident<br />
der PTB, klar. „Wir müssen auch die komplexen Prozessabläufe<br />
hinter der funktionierenden Qualitätsinfrastruktur<br />
schneller, effizienter<br />
und agiler machen. Digitalisierung<br />
ist daher nur die notwendige<br />
Voraussetzung.“ Auch<br />
die Produkte und Dienstleistungen<br />
entwickeln sich laut<br />
Härtig im Zuge der Digitalisierung<br />
rasant weiter. „Das stellt<br />
auch die Messtechnik vor neue<br />
Herausforderungen. So erhalten nicht nur einzelne<br />
Messgeräte Anbindung ans Internet, sondern es greifen<br />
auch ganze Systeme ineinander – wie etwa bei<br />
Smart Production. Diese basieren auf hunderten oder<br />
gar tausenden vernetzter Messgeräte.“<br />
Daneben befasst sich die PTB mit dem Einsatz von<br />
Künstlicher Intelligenz (KI) – im Rahmen von QI-Digital<br />
zunächst bei Medizinprodukten. Dabei geht es<br />
um die Vertrauenswürdigkeit und Verlässlichkeit der<br />
KI-Verfahren. „Nur so kann aus KI Made in Germany<br />
ein international anerkanntes Qualitätssiegel werden,<br />
das auf unseren europäischen Rechtsstandards<br />
beruht – und damit diese Produkte weltweit konkurrenzfähig<br />
macht“, so Härtig.<br />
„Die deutsche Industrie ist sehr innovativ, auch<br />
was die Entwicklung digitaler Verfahren und Produkte<br />
betrifft. Damit diese am Markt angenommen werden,<br />
braucht es Vertrauen in deren Sicherheit – denn<br />
erst Sicherheit macht Märkte. Dafür benötigen wir<br />
eine moderne und effiziente Qualitätssicherung –<br />
und das ist die Vision von QI-Digital“, bestätigte<br />
auch BAM-Präsident Professor Ulrich Panne. „Es ist<br />
unser Ziel, praxisnahe Lösungen für die Bedarfe der<br />
Wirtschaft zu entwickeln.“ Er nannte das Beispiel der<br />
Qualitätssicherung in der additiven Fertigung. Hier<br />
baut die BAM gemeinsam mit den Partnern im Rahmen<br />
von QI-Digital ein offenes Kompetenzzentrum<br />
für kleine und mittlere Unternehmen auf, bei dem die<br />
gesamte Messkette abgebildet wird. Denn gerade<br />
diese Zielgruppe benötige praktikable und kostengünstige<br />
Lösungen. Panne: „Diese Beispiel zeigt den<br />
gesamtheitlichen Ansatz des QI-Digital-Konsortiums<br />
über die technische Entwicklung über die Entwicklung<br />
smarter Standards bis hin zur Zertifizierung.“<br />
»QI-Digital schafft die<br />
Basis für eine moderne<br />
und effiziente<br />
Qualitätssicherung.«<br />
Professor Ulrich Panne, BAM<br />
Auch Christoph Winterhalter, Vorsitzender des<br />
DIN-Vorstands betonte, QI-Digital gemeinsam mit<br />
der Industrie voranbringen zu wollen. Daher werde es<br />
neue, angepasste Normen für Meteorologie, Akkreditierung<br />
und Konformitätsbewertung geben. „Wir<br />
müssen es schaffen, die Digitalisierung und die Entwicklung<br />
der Qualitätssicherung organisations- und<br />
ressortübergreifend zu gestalten – auf internationaler<br />
Ebene“, sagte Winterhalter. „QI-Digital kann zum<br />
Game-Changer von vielen weiteren Themen werden<br />
–- etwa der Umsetzbarkeit des Lieferkettengesetzes<br />
oder der Circular Economy.<br />
Denn wir wissen, wie man im<br />
Digitalen Qualität sicherstellt.<br />
Insofern ist QI-Digital eine<br />
Einladung an alle Stakeholder<br />
in Deutschland und in Europa,<br />
uns zum Vorreiter im Handling<br />
der digitalen Transformation<br />
zu machen. Es geht darum,<br />
auch in der digitalen Welt Qualität zu sichern und<br />
damit Vertrauen in neue Technologien zu schaffen.“<br />
„Wenn Anwendungen und Produkte sowie Produktprüfungen<br />
voll digital ablaufen, muss natürlich<br />
auch die Norm folgen und komplett digital vorliegen“,<br />
ergänzte DKE-Geschäftsführer Michael Teigeler.<br />
Man arbeite seit einiger Zeit an der Digitalisierung<br />
der Normung und habe gemeinsam mit dem<br />
DIN die Initiative digitaler Standard (Ides) gegründet.<br />
Die Idee dahinter: Weg vom bedrucktem Papier hin<br />
zu digitalen Inhalten, die in Datenbanken liegen. Teigeler:<br />
„Man könnte fast sagen: Die Anwendung von<br />
Normen ist dann erst erfolgreich, wenn man das fertige<br />
Produkt in den Händen hält und die Norm darin<br />
eingeflossen ist, ohne dass man es gemerkt hat.“<br />
Webhinweis<br />
Wie das digitale Kalibrierzertifikat und<br />
der digitale Workflow für metrologische<br />
Dienstleistungen funktionieren, zeigt die<br />
PTB in diesen beiden Videos:<br />
http://hier.pro/iBrBH<br />
http://hier.pro/LVmW9<br />
<strong>Quality</strong> <strong>Engineering</strong> » 03|2021 11
» MANAGEMENT » Interview<br />
Dr. Ralf Christoph, Werth Messtechnik<br />
„Wir machen Computertomo graphie<br />
wirtschaftlicher“<br />
Durch die Corona- und die Automotive-Krise verbuchte Werth im vergangenen Jahr<br />
erstmals seit langem kein zweistelliges Umsatzplus. Doch allmählich zieht die<br />
Nachfrage laut Geschäftsführer Dr. Ralf Christoph wieder an. Vor allem im Geschäft<br />
mit der Computertomographie (CT) spiele die Musik.<br />
» Sabine Koll<br />
Herr Dr. Christoph, wie sah bei Werth<br />
das vergangene Geschäftsjahr aus?<br />
Welchen Einfluss hatte die Corona-<br />
Pandemie auf das Geschäft?<br />
Durch die Krise im Automobilbereich und<br />
die ersten Auswirkungen von Covid 19<br />
können wir für 2020, anders als in den Jahren<br />
davor, leider keine zweistelligen Zuwachsraten<br />
vermelden. Durch die gute<br />
Ausgangslage war es uns jedoch möglich,<br />
die Effekte weitgehend zu kompensieren.<br />
Eine besondere Herausforderung stellten<br />
die Einschränkungen durch das Stornieren<br />
praktisch aller Messen dar. Auch unsere<br />
Service-Aktivitäten waren durch Reiseund<br />
Zugangsbeschränkungen behindert. So<br />
dürfen zum Beispiel unsere chinesischen<br />
Mitarbeiter noch immer nicht für Schulungen<br />
zu uns nach Deutschland einreisen.<br />
Auch wir mussten einiges mit Kurzarbeit<br />
kompensieren. Positives kann man der gesamten<br />
Situation sicher kaum abgewinnen.<br />
Gibt es Unterschiede in Bezug auf die<br />
globalen Märkte und auf einzelne<br />
Branchen?<br />
Werth-Geschäftsführer Dr. Ralf Christoph treibt die Weiterentwicklung der Röntgen-CT weiter<br />
voran. Dazu gehört auch die Möglichkeit der Simulation mit der Messsoftware Winwerth.<br />
Bild: Werth<br />
Insbesondere das internationale Geschäft<br />
ist durch die globalen Beschränkungen<br />
hinsichtlich Reisen und anderer Aktivitäten<br />
stark behindert. Das Inlandsgeschäft<br />
ist bei uns weniger betroffen, nicht zuletzt<br />
durch Zuwachs im Bereich CT.<br />
Welches sind die wichtigsten Märkte<br />
für Werth?<br />
12 <strong>Quality</strong> <strong>Engineering</strong> » 03|2021
Deutschland ist nach wie vor unser größter<br />
Einzelmarkt. Dahinter folgen gleichauf<br />
China und die USA. Das US-Geschäft lief<br />
vor allem vor der Corona-Pandemie sehr<br />
gut, wurde in den vergangenen zwölf Monaten<br />
natürlich leicht ausgebremst, zieht<br />
nun aber wieder an. Der chinesische<br />
Markt ist im Moment noch relativ ruhig.<br />
Wir sind aber optimistisch, dass er bald<br />
wieder anziehen wird.<br />
Wie haben sich Umsatz und Auftragseingang<br />
in den ersten Monaten<br />
2021 entwickelt?<br />
Wir haben den Eindruck, dass<br />
die Talsohle zwischenzeitlich<br />
durchschritten ist und es langsam<br />
wieder etwas aufwärts<br />
geht.<br />
Wie nehmen Sie im Moment die Nachfrage<br />
aus der Automobilindustrie wahr?<br />
Welchen Stellenwert hat die Branche<br />
für Werth? Welche Ihrer Lösungen sind<br />
für den Strukturwandel zur E-Mobilität<br />
geeignet?<br />
Prinzipiell sind hierfür sowohl Multisensorik<br />
als auch CT geeignet. Die Automobilindustrie<br />
hat jedoch in der letzten Zeit<br />
sehr zurückhaltend investiert, es kommen<br />
dennoch einzelne Projekte die mit der<br />
Umstellung auf Elektroantriebe zusammenhängen.<br />
Insgesamt sind wir jedoch<br />
unter den gegebenen Bedingungen froh,<br />
dass wir nicht so stark von der Automobilwirtschaft<br />
abhängig sind.<br />
Ist die Nachfrage aus der Medizintechnik<br />
gestiegen?<br />
Die Nachfrage im Bereich Medizintechnik<br />
steigt seit einigen Jahren. Mit der Coronakrise<br />
hat dies wahrscheinlich weniger<br />
zu tun. Im Gegenteil – es gab auch in<br />
dieser Branche negative Effekte durch die<br />
Pandemie. Viele medizinische Behandlungen<br />
wurden aufgrund von Vorsicht<br />
oder Beschränkungen nicht durchgeführt<br />
und somit ist die Nachfrage nach bestimmten<br />
Produkten gesunken. Insgesamt<br />
ist diese Branche jedoch ein Wachstumsmarkt.<br />
Welche anderen Branchen sind für Ihr<br />
Unternehmen wichtig?<br />
Unsere Koordinatenmessgeräte sind aufgrund<br />
ihrer Flexibilität im gesamten verarbeitenden<br />
Gewerbe vertreten. Neben<br />
der Medizintechnik und Automobilindustrie<br />
ist für uns die Telekommunikation<br />
und die Konsumgüterproduktion besonders<br />
wichtig. Der größte Anteil stammt<br />
jedoch von den vielen anderen Wirtschaftszweigen.<br />
»Wir reduzieren die Kosten beim<br />
CT-Betrieb kontinuierlich durch die<br />
Weiterentwicklung von röntgen -<br />
spezifischen Komponenten.«<br />
Die Messtechnik wandert in beziehungsweise<br />
an die Fertigung. Ist das ein<br />
Thema für Werth? Und was bedeutet<br />
das konkret für Ihre Messtechnik?<br />
Für einen großen Teil unserer Anwendungen<br />
trifft dies zu. Unsere Messgeräte werden<br />
in diesem Zusammenhang zum Beispiel<br />
durch Robotertechnik mit Fertigungsstraßen<br />
verbunden. Das Lösen von<br />
Problemen wie Verschmutzung und Temperaturschwankungen<br />
stellen hierbei besondere<br />
Herausforderungen dar. Auch ist<br />
die Bedienerphilosophie auf die Mitarbeiter<br />
in der Fertigung anzupassen. Insgesamt<br />
sind die Erwartungen der Anwender<br />
an die Inline-Messtechnik sehr hoch, zum<br />
Teil auch unrealistisch – auch wenn sich<br />
die Messgeschwindigkeit in der Koordinatenmesstechnik<br />
mit CT innerhalb weniger<br />
Jahre um circa den Faktor 10 erhöht hat.<br />
Ist Multisensorik ein Thema für die Fertigung?<br />
Wenn ja – welche Voraussetzungen<br />
müssen die Messgeräte in dem<br />
Fall erfüllen?<br />
Multisensorik ist insbesondere dann ein<br />
Thema, wenn es um das schnelle Messen<br />
ausgewählter Merkmale mit hoher Genauigkeit<br />
geht. Hier hat die Kombination<br />
zwischen verschiedenen optischen Sensoren<br />
und der konventionellen taktilen<br />
Messtechnik ihre Vorteile. Auch die Kombination<br />
der Multisensorik mit CT kommt<br />
zum Einsatz<br />
Bei der CT haben Sie sich in jüngster<br />
Zeit vor allem auf kleine Werkstücke<br />
fokussiert. Mit welchem Erfolg?<br />
Ja, wir haben uns in den vergangenen<br />
zwei Jahren bei Neuentwicklungen vorrangig<br />
auf kleinere CT-Geräte konzentriert.<br />
Wir haben hier Nachholbedarf gesehen,<br />
der sich hauptsächlich auf die<br />
Wirtschaftlichkeit der Systeme<br />
bezieht. Daher haben wir in<br />
der jüngsten Zeit insbesondere<br />
Geräte mit hoher Verfügbarkeit<br />
zum akzeptablen Preis<br />
realisiert. Mit unserem aktuellen<br />
Tomoscope XS FOV haben<br />
wir erneut einiges erreicht.<br />
Mit etwas mehr als 100.000 Euro liegt der<br />
Preis deutlich unter dem vergleichbarer<br />
Geräte. Genauigkeitsfragen wurden dabei<br />
entsprechend des Rufs unseres Unternehmens<br />
nicht vernachlässigt.<br />
Sie haben gemeinsam mit Partnern die<br />
Röhrentechnik optimiert. Sind hier oder<br />
bei anderen Komponenten noch weitere<br />
Fortschritte zu erwarten?<br />
Unsere bevorzugt eingesetzten Röntgenquellen<br />
zeichnen sich im Vergleich zu anderen<br />
durch etwa fünffache Leistung –<br />
und somit Messgeschwindigkeit – bei<br />
gleicher Auflösung aus. In den letzten<br />
Jahren haben wir uns auch auf Verschleißreduzierung<br />
konzentriert und<br />
konnten den Wartungszyklus für die<br />
meisten Varianten auf zwölf Monate, wie<br />
in der Koordinatenmesstechnik üblich,<br />
verlängern. Durch Reduzierung der Stillstandszeiten<br />
und der Serviceaufwände<br />
trägt dies zur Kostensenkung bei. Der<br />
Schwerpunkt liegt sicher auch für die Zukunft<br />
in der Weiterentwicklung der röntgenspezifischen<br />
Komponenten.<br />
Inwiefern ist die Simulation bei CTs<br />
mittlerweile ein Thema für die Kunden?<br />
Was bieten Sie hier an?<br />
In der aktuellen Version unserer Messsoftware<br />
Winwerth, die gerade in den<br />
<strong>Quality</strong> <strong>Engineering</strong> » 03|2021 13
» MANAGEMENT » Interview<br />
Markt eingeführt wird , ist die weitgehend<br />
vollständige Simulation der CT integriert.<br />
Dies dient unter anderem dazu,<br />
schon bei der Offline-Programmierung<br />
die verschiedenen Effekte zu visualisieren.<br />
Ausgehend von zum Beispiel CAD-<br />
Daten kann der Anwender den Einfluss<br />
der Parameter-Einstellung bewerten. Im<br />
Ergebnis sind die Programme für das<br />
Koordinatenmessgerät mit CT fertig, bevor<br />
die ersten Werkstücke produziert<br />
werden.<br />
Eines der neuen Produkte<br />
von Werth ist<br />
das Koordinatenmessgeräte<br />
Scopecheck FB,<br />
das nun mit drei unabhängigen<br />
Z-Achsen zur<br />
Verfügung steht.<br />
Auch andere Unternehmen haben den<br />
CT-Bereich in den vergangenen Jahren<br />
aus- beziehungsweise aufgebaut.<br />
Wächst der Markt für CTs? Wenn ja, für<br />
welche Anwendungsfelder vor allem?<br />
Bild: Werth<br />
Wir waren zwar im Jahr 2005 die ersten<br />
mit einem speziell für die Koordinatenmesstechnik<br />
entwickelten Gerät mit<br />
Röntgen-CT, allein bleibt man bei so einer<br />
Technik jedoch leider nie. Der Wettbewerb<br />
befruchtet allerdings auch das Geschäft.<br />
Aus unserer Sicht wächst der<br />
Markt für Koordinatenmesstechnik mit CT<br />
in vielen Feldern, insbesondere aber im<br />
Bereich der Kunststofffertigung.<br />
Die Qualitätssicherung additiv gefertigter<br />
Bauteile ist ein Bereich, in dem<br />
CTs ihre Vorteile ausspielen. Warum ist<br />
das so aus Ihrer Sicht?<br />
Die additive Fertigung und die Koordinatenmesstechnik<br />
mit Röntgen-CT könnte<br />
man gut als Zwillinge bezeichnen. Beide<br />
Technologien bieten die Besonderheit,<br />
dass komplexe Werkstücke nahezu ohne<br />
Einschränkungen produziert beziehungsweise<br />
gemessen werden können. Hinterschnitte<br />
und Hohlräume stellen kein nennenswertes<br />
Problem dar. Auch der Detaillierungsgrad<br />
der Werkstücke erhöht den<br />
Aufwand nur gering. Alternative Messtechnik<br />
mit vergleichbarer Qualität ist,<br />
zumindest für den Innenbereich der<br />
Werkstücke, aus unserer Sicht derzeit<br />
nicht verfügbar. Optische Verfahren sind<br />
für einige Fälle einsetzbar, jedoch aufgrund<br />
des Wirkprinzips etwas eingeschränkt.<br />
Mit Licht kann man nicht um<br />
die Ecke sehen.<br />
Vor allem in der industriellen Bildverarbeitung<br />
ist die Nutzung von Künstlicher<br />
Intelligenz (KI) bereits in der Praxis angekommen.<br />
Wo sehen Sie Potenzial für<br />
KI in der Messtechnik?<br />
Wir befassen uns seit einigen Jahren in<br />
Forschung und Entwicklung mit dem Thema<br />
Künstliche Intelligenz. Aktuell setzen<br />
wir KI zum Beispiel für Algorithmen im<br />
Bereich der Röntgen-CT ein, etwa für die<br />
Artefakte-Korrektur. Hier ist sicher in der<br />
Zukunft noch einiges zu erwarten.<br />
Auch Automation ist ein großes Thema<br />
für die Anwender in der Qualitätssicherung.<br />
In wie weit ist dies aktuell und<br />
künftig ein Thema für Werth?<br />
Wie vorhin schon erwähnt, ist die Integration<br />
unserer Koordinatenmessgeräte<br />
ein wichtiger Themenschwerpunkt. Insbesondere<br />
im Bereich der CT ist hier einiges<br />
in Bewegung.<br />
Wo sehen Sie den Platz von Werth in<br />
einem Markt, in dem die größten Player<br />
durch Zukäufe weiter wachsen? Eröffnet<br />
das für Sie neue Chancen?<br />
Wir haben es in den vergangenen Jahren<br />
geschafft, auch ohne Zukäufe meist mit<br />
zweistelligen Raten zu wachsen. Innovationen<br />
und das flexible Eingehen auf Kun-<br />
denwünsche sind oft wichtiger als die Unternehmensgröße.<br />
Wir prüfen auch regelmäßig,<br />
ob Akquisitionen für uns infrage<br />
kommen. Doch sind wir dabei vorsichtig,<br />
weil es im Zuge der Integration eines neuen<br />
Unternehmens immer zu Reibungsverlusten<br />
kommt. Für die Innovationsrate<br />
insgesamt bleibt es wichtig, wirtschaftliche<br />
Rahmenbedingungen so zu gestalten,<br />
dass mittelständische Unternehmen gestärkt<br />
werden. Wir hoffen, dass die Politik<br />
hier die richtigen Wege geht.<br />
Die Control fällt in diesem Jahr erneut<br />
aus. Was sind Ihre beiden wichtigsten<br />
Neuentwicklungen, die Sie dort vorgestellt<br />
hätten?<br />
Die Absage der Control bedauert das<br />
Werth-Team sehr. Als „Messeneuheit“<br />
bringen wir jetzt zwei Messgeräte auf den<br />
Markt. Zum einen gibt es eine neue Version<br />
des Tomoscope XS FOV, also eines<br />
kompakten Geräts mit CT. Hier haben wir<br />
insbesondere wieder die Anforderungen<br />
an das Preis-Leistungsverhältnis berücksichtigt<br />
und sowohl die Leistung als auch<br />
die Auflösung verbessert. Im Bereich der<br />
Multisensor-Koordinatenmesstechnik<br />
gibt es mit dem neuen Scopecheck FB außerdem<br />
ein Gerät mit drei unabhängigen<br />
Z-Achsen. Hierdurch ist der ergonomische<br />
Einsatz verschiedener Sensorprinzipien<br />
gewährleistet.<br />
14 <strong>Quality</strong> <strong>Engineering</strong> » 03|2021
Fachkräftesicherung<br />
Personalmangel<br />
erfordert Umdenken<br />
Noch immer herrscht in Deutschland Fachkräftemangel – aus<br />
verschiedenen Gründen. Um diesem zu begegnen, müssen<br />
Unternehmen sich auf vielfältige Bewerbergruppen einlassen<br />
und den einzelnen Arbeitsplatz attraktiv gestalten.<br />
Deutschlandweit fehlt es an Fachkräften,<br />
speziell in den MINT-Berufen<br />
(Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft<br />
und Technik) und dem Gesundheitswesen.<br />
Aber auch im Handwerk und im<br />
Maschinenbau herrscht Personalmangel.<br />
Ein Grund für die sich immer weiter zuspitzende<br />
Situation in Deutschland ist der<br />
demografische Wandel: Die geburtenstarken<br />
Jahrgänge der Nachkriegszeit gehen<br />
nun langsam in den Ruhestand, die nachrückende<br />
Anzahl jüngerer Arbeitnehmer<br />
ist dagegen wesentlich geringer. Ein weiteres<br />
Problem ist, dass heutzutage wesentlich<br />
mehr Schüler das Abitur machen<br />
und im Anschluss studieren wollen. Somit<br />
wird es in den Ausbildungsberufen immer<br />
schwieriger, geeignete Nachwuchskräfte<br />
zu finden und zu motivieren.<br />
Die Corona-Krise hat auch ihren Beitrag<br />
dazu geleistet, dass 2020 deutschlandweit<br />
die Anzahl der dualen Berufsausbildungen<br />
laut Statistischem Bundesamt<br />
um rund 9,4 % auf rund 465.200 zurückgegangen<br />
ist.<br />
Welche Potenziale zur Gewinnung von<br />
Fachkräften stehen zur Verfügung? Eine<br />
Möglichkeit ist die vermehrte Beschäftigung<br />
von Frauen. Aufgrund familiärer<br />
Strukturen arbeiten diese heutzutage<br />
teilweise gar nicht oder nur in Teilzeit. Die<br />
Mehrzahl dieser Frauen verfügt jedoch<br />
über eine ausgezeichnete Ausbildung, es<br />
fehlt aber an attraktiven Möglichkeiten<br />
der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.<br />
Eine weitere Möglichkeit besteht darin,<br />
jüngere Mitarbeiter von Know-how und<br />
Erfahrung der Älteren durch enge Zusammenarbeit<br />
voneinander profitieren zu lassen.<br />
Aber auch ungelernte Arbeitskräfte,<br />
Menschen mit Migrationshintergrund<br />
oder Behinderung sowie Menschen aus<br />
dem Ausland sollten noch stärker beachtet<br />
werden, indem sowohl von Seiten der<br />
Unternehmen wie auch der Regierung<br />
entsprechende Aus- und Umschulungsprogramme,<br />
Arbeitserlaubnis etcetera angeboten<br />
werden.<br />
Personal & Karriere<br />
Die Beratungsgruppe wirth +<br />
partner informiert regelmäßig<br />
über Personal und Karriere.<br />
www.wirth-partner.com<br />
Die Autorin:<br />
Sabine Zapf<br />
Es gibt unterschiedliche Wege, wie man<br />
dem Fachkräftemangel begegnen kann.<br />
Unternehmen müssen lernen umzudenken<br />
und sich sowohl auf vielfältige Bewerbergruppen<br />
einlassen, als auch den<br />
einzelnen Arbeitsplatz attraktiv gestalten,<br />
um den Mitarbeiter im Unternehmen zu<br />
halten beziehungsweise zu gewinnen.<br />
Bild: wirth + partner<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<strong>Quality</strong> <strong>Engineering</strong> » 03|2021 15
Topometric-Mitarbeiter Simon Koch bereitet<br />
die Messmittelüberwachung mit einem Kugelmaßstab<br />
vor. Dieser wird für die Prüfung an<br />
unterschiedlichen Positionen innerhalb des<br />
Messvolumens platziert.<br />
Bild: Topometric<br />
Messmittelüberwachungen für mehr Sicherheit<br />
Messmittel unter der Lupe<br />
Für eine dauerhaft verlässliche Aussagekraft von Messmitteln müssen diese<br />
hinsichtlich Qualität, Zuverlässigkeit und Einsatzfähigkeit regelmäßig überprüft<br />
werden. Damit wird sichergestellt, dass diese auch nach längerem Einsatz den<br />
angegebenen Herstellerspezifikationen entsprechen.<br />
Maren Röding<br />
Pressearbeit<br />
Topometric<br />
www.topometric.de<br />
Offizielle Zertifizierungen wie etwa ISO 9001 erfordern<br />
eine periodische Überprüfung der<br />
Messmittel. Bei vielen Anwendern hat sich dabei ein<br />
Zwei-Jahres-Rhythmus durchgesetzt. Bei besonders<br />
kritischen Anwendungen oder anfälligen Systemen<br />
wird jährlich geprüft. Für Geräte, die im Außendienst<br />
eingesetzt werden oder durch eine Spedition transportiert<br />
werden, sind ebenfalls kürzere Prüfabstände<br />
empfehlenswert. Ein Messmittel muss gemäß der<br />
Herstellerspezifikationen funktionsfähig und für die<br />
jeweilige Messaufgabe geeignet sein. Es gilt laut Zertifizierungs-<br />
und Akkreditierungsrichtlinien<br />
dann als funktionsfähig, wenn es<br />
regelmäßig und rückführbar überprüft<br />
wird. Für die meisten Messverfahren<br />
sind VDI/VDE oder DIN EN ISO-Normen<br />
vorgegeben. Dabei werden eindeutig definierte<br />
Merkmale wie Kugeldurchmesser<br />
mit den Grenzwerten der Messsystems<br />
verglichen. Ein Messmittel gilt als überwacht,<br />
wenn es die Grenzwerte einhält.<br />
Neben der formalen Funktionsfähigkeit muss das<br />
Messmittel auch für die jeweilige Aufgabe hinsichtlich<br />
der erforderlichen Präzision und Wiederholbarkeit geeignet<br />
sein. Korrekte Messungen brauchen sinnvoll aufeinander<br />
abgestimmte Messvorgaben und Messpläne.<br />
„Es ist bereits im Vorfeld die Zusammenarbeit mit erfahrenen<br />
Messspezialisten ratsam, welche die Planung<br />
der Messprozesse sowie die Erstellung von Vorgaben<br />
und Plänen beratend unterstützen“, erklärt Stefan Findeis,<br />
Abteilungsleiter Optische Messtechnik bei Topometric.<br />
Auf die Überprüfung optischer Systeme ausgerichtet,<br />
hat der Messdienstleister schon mehrere hundert<br />
Messgeräte unterschiedlicher Anbieter geprüft –<br />
sowohl Einzelsensoriken in der optischen Messtechnik<br />
als auch deren Verbund in automatisierten Messzellen.<br />
Bei einem Streifenlichtsensor zum Beispiel werden<br />
die Werte mit einem Kugelnormal mit den vom Her-<br />
16 <strong>Quality</strong> <strong>Engineering</strong> » 03|2021
MANAGEMENT «<br />
steller oder Betreiber bestimmten Grenzwerten verglichen.<br />
Die Überprüfung des Messsystems umfasst<br />
Sensor, Messvolumen und Kalibrierplatte. Für die<br />
Überwachung müssen gleichbleibende Umgebungsbedingungen<br />
gegeben sein. Dazu zählen Temperatur,<br />
Lichtbedingungen, Staub, Vibrationen. Die Topometric-Ingenieure<br />
starten mit einer Sichtprüfung der zu<br />
überprüfenden Elemente, sodass bestehende Probleme<br />
oder Unregelmäßigkeiten gleich zu Beginn bekannt<br />
sind und Lösungswege für spätere Anwendungen<br />
skizziert werden können. Es folgt die eigentliche<br />
Prüfung durch einen Prüfartefakt – also etwa einen<br />
Messbalken. Dieser wird in mehreren Messreihen in<br />
mindestens zehn unterschiedlichen Aufnahmepositionen<br />
gemessen. Diese Messdaten werden durch das<br />
in der Messgeräte-Software enthaltene VDI-Modul<br />
berechnet und mit den Soll-Daten verglichen.<br />
Bewegen sich die Daten innerhalb der vorgeschriebenen<br />
Grenzwerte, erstellt Topometric ein Zertifikat,<br />
das die erfolgreiche Überprüfung in Anlehnung an<br />
VDI/VDE 2634 (Blatt 1 für Photogrammetrie beziehungsweise<br />
Blatt 3 für Sensorik) bestätigt. In einem<br />
Überwachungsprotokoll, das zum Beispiel bei internen<br />
Audits als Zertifizierung herangezogen wird,<br />
werden die gemessenen Werte detailliert aufgeführt.<br />
Auf dem geprüften Messsystem wird ein Prüfsiegel<br />
angebracht, das die ordnungsgemäßen Zustand bestätigt.<br />
Damit die Überwachungen auf nationale<br />
Normen rückführbar sind, lässt Topometric die eigenen<br />
Prüfkörper regelmäßig durch ein akkreditiertes<br />
Dakks-Kalibrierlabor zertifizieren.<br />
Eigener Standard für<br />
Robotermesszellen<br />
Bei Robotermesszellen stimmt Topometric die jeweiligen<br />
Prüfanforderungen mit dem Anwender ab und<br />
führt diese zu einem individuell definierten Ablaufplan<br />
zusammen. Diese Vorgehensweise hat sich unter<br />
anderem bei der Prüfung großvolumiger Automatisierungsanlagen<br />
mit optischer Messtechnik für Flugzeugteile<br />
mit Abmessungen von 6 m x 4 m bewährt.<br />
„Bisher existiert für die Überwachung von optischen<br />
Messzellen mit Roboterführung keine verbindliche<br />
Norm. Wir haben deshalb dafür einen Topometric-<br />
Standard entwickelt, der sich an den Normen der<br />
VDI/VDE 2634 und DIN EN ISO 10360–2 orientiert“,<br />
erklärt Daniel Sigel, Teamleiter Messmittelüberwachung.<br />
Bevor die Messzelle überprüft wird, müssen<br />
die einzelnen Systemkomponenten wie Sensor, Kalibierobjekt,<br />
Photogrammetriesystem und Maßstäbe<br />
gemäß VDI/VDE überwacht worden sein. Für jede<br />
Messreihe erfolgt eine separate Photogrammetrie,<br />
wobei die Temperaturen aufgezeichnet werden und<br />
in die Auswertung einfließen.<br />
Zukunft sicher<br />
gestalten<br />
Die Welt sicherer, komfortabler und nachhaltiger<br />
zu machen, ist ein Kernbeitrag von<br />
Materialwissenschaft und Werkstofftechnik.<br />
Shimadzu Testmaschinen geben Forschung,<br />
Entwicklung und Qualitätskontrolle die<br />
Gewissheit für belastbare Ergebnisse und das<br />
seit über 100 Jahren. Die heutigen Techno -<br />
logien umfassen:<br />
• Statische Materialprüftechnik<br />
• Dynamische Materialprüftechnik<br />
• Härteprüfung<br />
• High-Speed Kamera-Systeme<br />
www.shimadzu.de/materialprüftechnik<br />
<strong>Quality</strong> <strong>Engineering</strong> » 03|2021 17
Bild: Pixel-Shot/stock.adobe.com<br />
Stromsparen ja oder nein, um die<br />
Kosten unter Kontrolle zu haben –<br />
in vielen Haushalten gibt es dazu<br />
widersprüchliche Meinungen.<br />
Eine Redaktion – zwei Meinungen<br />
Alles unter Kontrolle?<br />
In der Industrie sorgt die Überwachung von Messmitteln für mehr Sicherheit.<br />
Auch im Privatleben gibt es viele Gelegenheiten zu Kontrollaktionen. Doch<br />
sind diese immer sinnvoll? Die Redaktion von <strong>Quality</strong> <strong>Engineering</strong> hat dazu<br />
unterschiedliche Meinungen.<br />
Bild: Studioline Photography<br />
Sabine Koll, Redaktion<br />
<strong>Quality</strong> <strong>Engineering</strong>,<br />
bevorzugt das Chaos<br />
und plädiert für weniger<br />
die Kontrolle.<br />
Mein kreatives Chaos ist<br />
wenig kompatibel mit<br />
den regelmäßigen Kontrollmaßnahmen,<br />
die mein Mann<br />
in vielen Bereichen für das<br />
Überleben für absolut notwendig<br />
hält. Das Auto einmal<br />
im Jahr in die Inspektion zu<br />
bringen, sehe ich ja noch ein –<br />
aber auch nur, weil es am Ende<br />
der Leasingzeit ansonsten finanzielle<br />
Einbußen gibt. Aber<br />
warum muss man zum Beispiel<br />
die Küchenmesser bitteschön<br />
in einem festen Rhythmus schärfen? Oder warum<br />
ohne Not überprüfen, ob der Akku im Zauberstab<br />
noch genügend Saft hat? Es reicht doch, wenn<br />
ich das Messer schärfe, wenn ich den Eindruck habe,<br />
dass das Zwiebelschneiden auch schon mal leichter<br />
von der Hand ging. Und wenn der Zauberstab mitten<br />
im Suppepürieren die Arbeit einstellt, dauert es mit<br />
dem Abendessen eben noch ein paar Minuten – bis<br />
der Akku wieder ein wenig Strom getankt hat. Es gibt<br />
vor allem im Arbeitsleben so viele feste Prozesse und<br />
Musts, dass ich in der Freizeit doch gerne ein wenig<br />
Chaos habe. Und notfalls sorgt der Kontrolletti an<br />
meiner Seite für Ordnung.<br />
Ein Freund von mir ist ein<br />
Kontrollfreak. Ein Lieblingsüberwachungsobjekt<br />
für<br />
ihn sind Steckerleisten. Er unternimmt<br />
mehr oder weniger<br />
regelmäßig Kontrollgänge<br />
durchs Haus, um sicherzugehen,<br />
dass jede Leiste ausgeschaltet<br />
ist, wenn die mit ihr Redaktion <strong>Quality</strong><br />
Markus Strehlitz,<br />
verbundenen Geräte nicht in <strong>Engineering</strong>, hat<br />
Betrieb sind. Auch Geschirrspülmaschinen<br />
werden von im Freundeskreis.<br />
einen Kotrollfreak<br />
ihm einer ständigen Kontrolle<br />
unterzogen. Man kann sich<br />
stets darauf verlassen, dass er die verschmutzten<br />
Tassen oder Teller neu ordnet, nachdem ein Familienmitglied<br />
diese in die Maschine geräumt hat. Ziel ist<br />
es, das Gerät möglichst effizient zu nutzen. Sein<br />
Handeln hat leider auch immer etwas Erzieherisches<br />
und ist mit Lektionen in Sachen Energieeffizienz verbunden.<br />
Das nervt natürlich. Aber wenn man über die<br />
Oberlehrer-Attitüde hinweg sieht, muss man ihm<br />
Recht geben. Ich weiß nicht, ob es an dem Kontrollzwang<br />
liegt, aber mein Freund erhält in der Regel alle<br />
zwölf Monate Geld von seinem Energieversorger zurück.<br />
Und in Bezug auf Nachhaltigkeit hat er mit seiner<br />
Pedanterie auch die besseren Argumente.<br />
Bild: Tom Oettle<br />
18 <strong>Quality</strong> <strong>Engineering</strong> » 03|2021
ADVERTORIAL<br />
Der Capability Sixpack bietet eine schnelle grafische Analyse Ihres Prozesses.<br />
Vielfältige Business- und Solutions-Analytics-Graphen<br />
Mit ADDITIVE – zur Qualität<br />
Höhere Gewinne bei sinkenden Produktkosten! Vor dieser Umsetzung steht täglich eine<br />
Vielzahl an Unternehmen jeder Branche. Aber wo kann wirklich etwas eingespart und<br />
können Prozesse optimiert werden, ohne die Qualität der Produkte zu „gefährden“?<br />
Die Antwort bietet ein datengestützter Qualitätsverbesserungsprozess.<br />
Prozesse müssen zahlreiche Richtlinien und<br />
Anforderungen zuverlässig erfüllen und stets<br />
einen gleichbleibenden Standard liefern. Zudem<br />
müssen die Prozesse reproduzierbar sein. Nicht<br />
zuletzt fallen oftmals große Datenmengen an,<br />
die zu analysieren und spezifizieren sind.<br />
Genau hier bietet ADDITIVE mit den Softwaresystemen<br />
Minitab, OriginPro und Mathematica Lösungen<br />
zur Qualitätssicherung und Qualitätsverbesserung<br />
sowie Big-Data-Analysen, Business Analytics,<br />
Predictive Analytics und Predictive Maintenance,<br />
unterstützt durch Machine-Learning-Algorithmen<br />
und untermauert durch ein umfassendes<br />
Schulungs- und Dienstleistungsangebot.<br />
Die ADDITIVE Soft- und Hardware für Technik<br />
und Wissenschaft GmbH ist seit über 30 Jahren<br />
ein Systemhaus, das aus Standardprodukten<br />
und individuellen Ingenieurdienstleistungen Lösungen<br />
für Messtechnik und technische, wissenschaftliche<br />
Anwendungen erstellt. Von der<br />
einfachen Softwarelösung per Standardprodukt<br />
über kleinere und mittlere Desktopanwendungen<br />
bis zu kompletten Enterprise-Lösungen bietet<br />
ADDITIVE die entsprechenden Lösungen mit<br />
maßgeschneiderten Applikationsprojekten und<br />
Full-Service-Konzepten an.<br />
Weitere Informationen unter:<br />
www.additive-net.de/software<br />
Sprechen Sie mit uns unter 06172–5905–30<br />
oder info@additive-net.de über das Potential<br />
Ihrer Daten.<br />
KONTAKT<br />
ADDITIVE<br />
Soft- und Hardware für Technik<br />
und Wissenschaft GmbH<br />
Max-Planck-Straße 22b, D-61381 Friedrichsdorf<br />
Ansprechpartner: Lisa Schreiber, Master of Science<br />
Telefon: +49 (0)6172 5905–141<br />
E-Mail: lisa.schreiber@additive-net.de<br />
www.additive-net.de<br />
<strong>Quality</strong> <strong>Engineering</strong> » 03|2021 19
» MANAGEMENT<br />
Funktionierende<br />
Konferenzsysteme<br />
sind eine wichtige<br />
Voraussetzung für<br />
Remote Audits.<br />
Bild: apinan/stock.adobe.com<br />
Audits aus der Ferne<br />
Neue digitale Realität<br />
Remote Audits gewinnen an Bedeutung – gepusht durch die aktuelle Krise.<br />
So lautet die Botschaft einer Konferenz und einer Studie der DQS zu dem Thema.<br />
In Kombination mit der Vor-Ort-Auditierung könnte ihnen die Zukunft gehören.<br />
» Markus Strehlitz<br />
Remote Audits sind der Beginn eines umfassenden<br />
Wandels“, sagte Ingo Rübenach, Sprecher<br />
der DQS-Geschäftsführung, auf der Konferenz Rem-<br />
Audit. Auf der virtuellen Veranstaltung diskutierten<br />
Experten auf Einladung der DQS drei Tage lang über<br />
die Möglichkeiten von Remote Audits – also Audits,<br />
die nicht vor Ort, sondern mithilfe von entsprechenden<br />
Technologien aus der Ferne durchgeführt werden.<br />
Mit seinem Statement machte Rübenach gleich<br />
zu Beginn deutlich, dass diese Form der Audits Teil<br />
des allgemeinen digitalen Wandels sind.<br />
Durch die Corona-Pandemie haben die Audits aus<br />
der Ferne einen großen Schub bekommen, wie DQS-<br />
Geschäftsführer Michael Drechsel hervorhob. „Remote<br />
Audits wurden innerhalb eines Jahres Teil einer<br />
neuen Realität“, so Drechsel. So habe die DQS allein<br />
im ersten Quartal 2021 in Zusammenhang mit dem<br />
Regelwerk IATF 16949 mehr als 2.500 Audit-Tage remote<br />
durchgeführt<br />
Wie sehr die Bedeutung von Remote Audits in den<br />
vergangenen Monaten angewachsen ist, belegt auch<br />
eine Umfrage der DQS. Bereits 2019 hatte das Zertifizierungsunternehmen<br />
seine Kunden zu Remote Audits<br />
befragt. Ein Jahr später wurde eine weitere Studie<br />
zu dem Thema durchgeführt. Dieses Mal richtete<br />
sich die Umfrage aber nur an Unternehmen, die 2020<br />
bereits ein Remote Audit ganz oder teilweise durchgeführt<br />
hatten.<br />
Das waren 150 Firmen, wie Frank Graichen berichtete,<br />
der die Studienergebnisse auf der DQS-Konferenz<br />
vorstellte. 37 % davon gaben an, Audits im Rahmen<br />
einer Zertifizierung vollständig remote umgesetzt<br />
zu haben. Bei 63 % war dies in Teilen der Fall.<br />
Für die meisten davon scheint dies funktioniert zu<br />
haben. Denn 80 % der befragten DQS-Kunden empfinden<br />
Remote Audits und Audits vor Ort als gleichwertig.<br />
9 % halten die Audits aus der Ferne sogar für<br />
besser. Als Vorteile nannten die Befragten unter an-<br />
20 <strong>Quality</strong> <strong>Engineering</strong> » 03|2021
derem, dass Remote Audits flexibler und zielführender,<br />
weniger kosten-, zeit- und energieintensiv sowie<br />
umweltschonender seien.<br />
Vor allem Unterstützungs-, Management- und<br />
Führungsprozesse sehen die Befragten als geeignet<br />
für eine Auditierung aus der Ferne. Das Gleiche gilt<br />
für administrative und vollständig digitalisierte Prozesse.<br />
Die Studie zeigt aber auch die Grenzen von Remote<br />
Audits. So sehen die Studienteilnehmer zum Beispiel<br />
komplexe Fertigungsprozesse dafür als ungeeignet.<br />
Auch Fälle, in denen Begutachtungen vor Ort<br />
notwendig sind, kommen für Remote Audits eher<br />
nicht in Frage.<br />
Zudem zeigt die Umfrage auch, dass bestimmte<br />
Voraussetzungen gegeben sein müssen. Dazu zählen<br />
etwa geeignete Technik und eine passende Infrastruktur<br />
wie zum Beispiel funktionierende Konferenzsysteme.<br />
Auch müsse die Informationssicherheit<br />
gewährleistet sein.<br />
Graichen geht daher davon aus, dass Remote Audits<br />
die herkömmliche Form nicht vollständig erset-<br />
Digital <strong>Quality</strong> Space<br />
Am 24. Juni lädt die DQS zum Online-Kongress Digital<br />
<strong>Quality</strong> Space 2.0 – dem Treffpunkt rund um<br />
Prozesse, Managementsysteme, Normen und Audits.<br />
Zielgruppe sind Geschäftsführer, Verantwortliche<br />
für Managementsysteme und interne Audits<br />
sowie Produktions- und Werkleiter.<br />
Infos und Anmeldung:<br />
http://hier.pro/MbQ7Y<br />
zen werden. Stattdessen sieht er hybride Audits als<br />
optimale Variante. Dabei werden Audits aus der Ferne<br />
und solche vor Ort miteinander kombiniert. „Hybride<br />
Audits gewinnen an Zustimmung und könnten<br />
ein Zukunftsmodell sein“, so Graichen.<br />
<strong>Quality</strong> <strong>Engineering</strong> » 03|2021 21
IM FOKUS » Automatisierung<br />
Bild: Wenzel<br />
Automatisierte Lösungen<br />
gewährleisten, dass<br />
Fehlerquellen frühzeitig<br />
identifiziert werden.<br />
Automatisierungstrends<br />
Effizienz auch<br />
bei Losgröße 1<br />
Die Automatisierung in der Messtechnik schreitet weiter voran, wie<br />
eine Umfrage unter Branchenexperten zeigt. Selbst bei kleinere Losgrößen<br />
können entsprechende Technologien Nutzen bringen. Gefordert<br />
sind dafür einfache und flexible Lösungen. Und die Anbieter arbeiten<br />
daran, dass diese auch ohne großen Aufwand einsetzbar sind.<br />
» Markus Strehlitz und Sabine Koll<br />
22 <strong>Quality</strong> <strong>Engineering</strong> » 03|2021
Die Nachfrage nach Automatisierungslösungen<br />
in der Messtechnik wächst. Das ist die einhellige<br />
Meinung von Experten, wenn sie zu diesem Thema<br />
befragt werden. „Früher wurden im Messraum einzelne<br />
Teile unter optimalen Bedingungen gemessen“,<br />
sagt etwa Thomas Werner Leiter des Produktmanagements<br />
bei Wenzel. „Inzwischen wird viel mehr gemessen,<br />
die Toleranzen werden enger und die Serienproduktion<br />
immer perfekter.“ Die Anbieter müssten<br />
im Wettbewerb unter hohem Kostendruck perfekt<br />
Teile mit geringer Varianz herstellen.<br />
Mit einer automatisierten Qualitätssicherung tragen<br />
viele Unternehmen diesen Anforderungen Rechnung.<br />
Für den wirtschaftlichen Erfolg im Produktionsumfeld<br />
spiele diese eine zentrale Rolle, so Carsten<br />
Reich, Director Automation bei GOM. „Automatisierte<br />
Lösungen gewährleisten, dass Fehlerquellen frühzeitig<br />
identifiziert und zuvor definierte Qualitätsanforderungen<br />
an ein Produkt erfüllt werden.“ Das Risiko<br />
der Ausschussproduktion und Stillstände in der<br />
Produktion würden entsprechend auf ein Minimum<br />
reduziert.<br />
Grundsätzlich lohne sich die Automatisierung,<br />
wenn ein Return On Investment (ROI) vorhanden ist,<br />
wie Jérôme-Alexandre Lavoie hervorhebt, Produktmanager<br />
bei Creaform. „Wenn beim Vergleich der<br />
manuellen Aufgaben, die durch Automatisierung ersetzt<br />
werden sollen, der ROI positiv ist, wird es interessant,<br />
auf Automatisierung umzusteigen.“ Dabei<br />
geht es nicht mehr nur um Massenproduktion. Auch<br />
bei kleineren Losgrößen ergeben automatisierte Lösungen<br />
einen Sinn.<br />
Effiziente Lösungen für<br />
die Werkstückbeschickung<br />
Gefordert seien dabei schnelle und sehr flexible Systeme<br />
wie zum Beispiel multisensorische Koordinatenmessgeräte,<br />
sagt Maximilian Wiedemann, der als<br />
Global Product Manager bei Zeiss Industrial Metrology<br />
für Koordinatenmesstechnik zuständig ist. Er berichtet,<br />
dass Zeiss etwa bei der Werkstückbeschickung<br />
der Messgeräte auch bei geringen Losgrößen<br />
effiziente Automatisierungslösungen bereit stelle.<br />
„Hierzu werden beispielsweise fahrerlose Transportsysteme<br />
eingesetzt, die bedarfsgerecht die richtigen<br />
Werkstücke am entsprechenden Messgerät bereitstellen.“<br />
Auch nach Meinung von Lavoie spreche die zunehmende<br />
Individualisierung der Fertigung nicht gegen<br />
die Automatisierung in der Messtechnik. Die heutigen<br />
Lösungen könnten problemlos die Produktion<br />
mit geringen Stückzahlen bei vielen verschiedenen<br />
Bauteilen bewältigen. „Selbst bei kleineren Losgrößen<br />
können hochqualifizierte Techniker, die, anstatt<br />
ein Teil selbst zu messen, einem Roboter diese Aufgabe<br />
übertragen, dazu beitragen, einen Mehrwert<br />
für ihr Unternehmen schaffen.“<br />
Doch ein Selbstläufer ist die Automatisierung<br />
in diesen Fällen nicht. Zwar ist es AUSWAHL<br />
für die Messlösung laut Werner erst einmal<br />
unerheblich, ob immer die gleichen<br />
Firmen können bei<br />
ihren Automatisierungsprojekten<br />
auf System -<br />
oder verschiedene Teile gemessen werden.<br />
„Für jedes zusätzliche Teil werden<br />
integratoren oder<br />
jedoch neue Messprogramme oder<br />
Komplett lösungen der<br />
Werkstückaufnahmen benötigt. Der gesamte<br />
Prozess muss automatisierbar sein.<br />
Hersteller setzen.<br />
Das setzt zumindest eine gewisse Ähnlichkeit<br />
der Bauteile voraus, damit das Messsystem, der<br />
Messbereich und die Sensorik passen.“<br />
Programmierung auf Knopfdruck<br />
Grundsätzlich müssen auch die eingesetzten Technologien<br />
bestimmte Anforderungen erfüllen, wenn Automatisierungsprojekte<br />
erfolgreich gestaltet werden<br />
sollen. Dazu zählt unter anderem die einfache Bedienbarkeit<br />
beziehungsweise Nutzbarkeit der eingesetzten<br />
Systeme. Dies ist laut Lavoie der Schlüssel<br />
zur Einführung der Automatisierung in der Qualitätssicherung.<br />
„Um diesem Bedarf gerecht zu werden,<br />
wird eine digitale Off- und Online-Programmierung<br />
hierbei nun eher zu einem Muss als ein Nice to have“,<br />
so der Creaform-Manager. Als Beispiel nennt er den<br />
hauseigenen robotergeführten 3D-Scanner Metrascan-R,<br />
der inklusive der Software mit integrierter Of-<br />
Bild: Creaform<br />
Jérôme-Alexandre<br />
Lavoie, Creaform, sieht<br />
die einfache Nutzbarkeit<br />
der eingesetzten<br />
Systeme als Schlüssel<br />
zur Einführung der<br />
Automatisierung in der<br />
Qualitätssicherung.<br />
<strong>Quality</strong> <strong>Engineering</strong> » 03|2021 23
IM FOKUS » Automatisierung<br />
Anbieter wie GOM<br />
versprechen, dass<br />
Anwender keine Ro -<br />
boterfachkenntnisse<br />
mehr benötigen.<br />
Bild: GOM<br />
Algorithmen helfen beim<br />
Closed Loop<br />
Wie wichtig das Thema Automatisierung für die Anbieter<br />
ist, zeigt sich etwa darin, dass sich bei Wenzel<br />
sogar eine eigene Task Force darum kümmert. „Unsere<br />
Messmaschinen sind bereits für den Einsatz in Fertigungslinien<br />
und Automationslösungen vorgerüstet“,<br />
so Werner.<br />
Zeiss sieht sich bei diesem Thema als Gesamtlösungs-Anbieter.<br />
„Die Automatisierung erfolgt aus einer<br />
Hand“, sagt Wiedemann. Die Kunden erhielten<br />
mit Zeiss einen Ansprechpartner, „der die Kompatibiflineprogrammierung<br />
ein breites Spektrum an Anwendungen<br />
abdecken könne.<br />
Auch GOM-Mann Reich sieht eine einfache und<br />
schnelle Programmierung als Erfolgsfaktor. So erfolge<br />
etwa die Programmierung der Roboter in dem<br />
3D-Koordinatenmesssystem Atos Scanbox einfach<br />
auf Knopfdruck in einem virtuellen Messraum. Dieser<br />
bestehe aus Roboter, Sensor, Kollisionselementen,<br />
Bauteil sowie Messplan und berechne für sämtliche<br />
Prüfmerkmale und CAD-Oberflächen die erforderlichen<br />
Sensorpositionen und Roboterpfade. „Der Anwender<br />
benötigt keine Roboterfachkenntnisse.“<br />
Endnutzer bleibt in der<br />
Verantwortung<br />
Wenn es darum, die Automatisierung im Unternehmen<br />
umzusetzen, kommen traditionell Systemintegratoren<br />
ins Spiel. Sie kümmern sich um das Zelldesign,<br />
den Materialaufbau, die Installation, die Programmierung<br />
und die Schulung. In den vergangenen<br />
Jahren gibt es laut Lavoie aber die Entwicklung, dass<br />
die Hersteller von Messgeräten schon schlüsselfertige<br />
Lösungen entwickeln. Diese würden direkt vom<br />
Hersteller der Messtechnik aufgebaut, sodass kein<br />
Systemintegrator erforderlich ist.<br />
Doch er warnt: „In beiden Fällen wäre es ein Fehler<br />
zu glauben, dass die Endbenutzer keine Verantwortung<br />
tragen. Die Bereitstellung einer automatisierten<br />
Lösung innerhalb einer Organisation ist ein Projekt<br />
und erfordert eine gute Kommunikation mit allen<br />
Stakeholdern oder Mitarbeitern, die mit der Maschine<br />
interagieren.“<br />
Auch Reich berichtet, dass schlüsselfertige Lösungen<br />
verstärkt nachgefragt werden. GOM habe auf<br />
diese Entwicklung reagiert. „Durch die Einfachheit<br />
der Systeme können die Anwender unsere automatisierten<br />
Messsysteme nach erfolgter Produktschulung<br />
selbst betreiben, teachen und damit messen.“<br />
Wenzel-Experte Werner hat die Erfahrung gemacht,<br />
dass vor allem die Produktionsplaner in den<br />
Unternehmen die Ansprechpartner seien. „Wir als<br />
Messtechnik-Hersteller nehmen dann unsere Automatisierungspartner<br />
mit ins Boot. Die andere Variante<br />
ist, dass komplette Produktionslinien angefragt<br />
werden und wir als Partner für die Integration einer<br />
automatisierten Messzelle beziehungsweise Messmaschine<br />
verantwortlich sind.“ Die Automatisierungsprojekte<br />
sind laut Werner meist sehr individuell<br />
und unterliegen oftmals hohen Geheimhaltungsrichtlinien,<br />
da sich die Fertiger nicht in die Karten<br />
schauen lassen wollen.<br />
24 <strong>Quality</strong> <strong>Engineering</strong> » 03|2021
Maximilian Wiedemann von Zeiss setzt auf<br />
schnelle und flexible Systeme wie multisensorische<br />
Koordinatenmessgeräte.<br />
Bild: Zeiss<br />
Laut Carsten Reich von GOM reduziert die Automatisierung<br />
das Risiko der Ausschussproduktion und<br />
die Stillstände in der Produktion auf ein Minimum.<br />
Bild: GOM<br />
Bei Wenzel kümmert sich eine Task Force um das<br />
Thema Automatisierung, wie Thomas Werner berichtet.<br />
Bild: Wenzel<br />
lität aller Komponenten sicherstellt und den reibungslosen<br />
Ablauf der Automation gewährleistet“.<br />
Ist eine Automatisierungslösung erst einmal umgesetzt,<br />
gilt es für Unternehmen, daraus den entsprechenden<br />
Nutzen zu ziehen und die Produktion zu<br />
optimieren. Ein langfristiges Ziel könnte dann auch<br />
der Closed Loop sein – also die Mess- und Prüfergebnisse<br />
wieder in den Fertigungsprozess zurückzuspielen,<br />
um gegebenenfalls nachzusteuern.<br />
Das Konzept wird seit einiger Zeit in der Branche<br />
diskutiert, ist für viele Anwenderunternehmen aber<br />
derzeit sicherlich noch eher ein Thema für die Zukunft.<br />
Gleichwohl beschäftigen sich Anbieter wie<br />
Wenzel schon konkret damit. „Wir liefern die Soll-<br />
Ist-Abweichung an eine Statistik-Datenbank. Mit<br />
dem Ergebnis kann die Produktion dann entsprechend<br />
nachjustiert werden. Sind gewisse Eingriffsgrenzen<br />
erreicht, kann der Bediener reagieren“, erklärt<br />
Werner.<br />
Doch dies sei kein leichtes Unterfangen. „Es ist<br />
umso komplizierter, je komplexer das Bauteil ist.“ Eine<br />
Herausforderung ist es laut Werner, wenn Messund<br />
Produktionsmaschine unterschiedliche Koordinatensysteme<br />
und Achsen haben. Dafür würden Algorithmen<br />
benötigt, die bei der Umrechnung helfen,<br />
damit die Bearbeitungsmaschine umgestellt werden<br />
kann. „Der Aufwand hilft aber in jedem Fall die Fertigungsprozesse<br />
zu optimieren.“<br />
Statistische Analysen im Qualitätsmanagement<br />
Wir bieten Ihnen Lösungen für diverse<br />
statistische Problemstellungen:<br />
1990-2020<br />
JAHRE<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
www.additive-minitab.de/qe<br />
<strong>Quality</strong> <strong>Engineering</strong> » 03|2021 25
IM FOKUS » Automatisierung<br />
Der 3D-Snapshot-Ssensor<br />
Surfacecontrol 3D 3500<br />
eignet sich für Geometrie-,<br />
Form- und Oberflächenprüfungen.<br />
Bild: Micro-Epsilon<br />
Neue Lasertriangulationssensoren für Oberflächenmessungen<br />
Die dritte Dimension<br />
Die optische Triangulation eignet sich für hochauflösende Geometrie- und Oberflächenmessungen<br />
an Bauteilen mit diffus-reflektierender oder hochglänzender<br />
Oberfläche. Neue 3D-Sensoren von Micro-Epsilon erfassen das Messobjekt per<br />
Single-Snapshot, sodass schnelle automatisierte Prüfungen möglich sind.<br />
Leonhard Geupel<br />
Vertrieb 2D/3D<br />
Optische Messtechnik<br />
Micro-Epsilon<br />
www.micro-epsilon.de<br />
Ihren Ursprung hat die geometrische Triangulation<br />
als Verfahren in der Geodäsie. Landvermesser haben<br />
bereits im Mittelalter ganze Staaten mit Dreiecksnetzen<br />
überzogen und so Flächen<br />
und Entfernungen bestimmt. Die hochpräzise<br />
Abstandsmessung mit optischer<br />
Triangulation basiert auf einem ähnlichen<br />
Prinzip: Dabei wird ein Lichtpunkt<br />
auf eine Oberfläche projiziert und<br />
gleichzeitig von einer Sensorzeile unter<br />
einem definierten Winkelversatz aufgenommen.<br />
Mit dem festen Abstand zwischen<br />
Projektor und Sensorzeile sowie der Position<br />
des Punktes auf der Sensorzeile lässt sich durch einfache<br />
Trigonometrie der Abstand zwischen Sensor<br />
und Oberfläche sehr genau bestimmen.<br />
Das Messprinzip der optischen Triangulation lässt<br />
sich auch auf zwei oder sogar auf drei Dimensionen<br />
übertragen. Dabei misst der Sensor nicht nur den Abstand<br />
zu einem einzelnen Punkt auf einer Oberfläche,<br />
sondern es werden die Abstände zu allen Oberflächenpunkten<br />
innerhalb des Messfelds simultan erfasst.<br />
Statt eines einzelnen Punkts wird dazu eine<br />
Folge verschiedener Streifenmuster auf die Oberflä-<br />
26 <strong>Quality</strong> <strong>Engineering</strong> » 03|2021
che projiziert. Kameras nehmen das Muster auf. Aus<br />
den Daten lässt sich dann eine 3D-Punktewolke berechnen.<br />
Nach diesem Prinzip arbeitet der neue Surfacecontrol<br />
3D 3500 von Micro-Epsilon: Ein Matrix-<br />
Projektor projiziert die Folge verschiedener Streifenmuster<br />
auf die Oberfläche des Messobjekts. Das diffus<br />
reflektierte Licht der Muster wird mit zwei Kameras<br />
erfasst. Aus den aufgenommenen Bildfolgen und<br />
der Kenntnisse der Anordnung der beiden Kameras<br />
zueinander und zum Projektor berechnet der zum<br />
Sensor gehörende Rechner die dreidimensionale<br />
Oberfläche des Prüfobjekts.<br />
Der Surfacecontrol 3D 3500 ist in zwei Versionen<br />
erhältlich, die entweder eine Fläche von 50 mm x 80<br />
mm oder von 120 mm x 75 mm vermessen können –<br />
und zwar sehr präzise: Die Genauigkeit der Höhenmessung<br />
in z-Richtung liegt je nach Modell bei 1 μm<br />
oder 2 μm, die Wiederholpräzision bei bis zu 0,4 μm.<br />
Webhinweis<br />
Mehr zum Snapshot-Sensor Surfacecontrol 3D<br />
3500 erfährt man in diesem Paper von<br />
Micro-Epsilon:<br />
http://hier.pro/4Zl5b<br />
Für Inline-Messungen<br />
mit hoher Geschwindigkeit<br />
Neben der hohen Präzision standen für Micro-Epsilon<br />
bei der Entwicklung zwei Eigenschaften besonders<br />
im Fokus. Da der Sensor vor allem für die Inline-<br />
Qualitätskontrolle eingesetzt werden soll, muss die<br />
Messung sehr schnell erfolgen. Außerdem ist die industrietaugliche<br />
Ausstattung wichtig, hierzu gehört<br />
unter anderem die einfache Integration in die Anwendung<br />
und passende Schnittstellen. Neben Gigabit<br />
Ethernet (Gige Vision/Genicam) sind auch Profinet,<br />
Ethercat und Ethernet/IP möglich. Hinzu kommen<br />
vier parametrierbare digitale I/Os, die sich beispielsweise<br />
als Trigger oder zur Ausgabe von Sensorzuständen<br />
verwenden lassen. Der kompakte vollintegrierte<br />
Sensor ist in einem industrieoptimierten Gehäuse<br />
untergebracht und kommt mit einer passiven<br />
Kühlung aus, wodurch die hohe Schutzart IP67 erreicht<br />
wird. Drei Montagebohrungen ermöglichen<br />
mit den passenden Zentrierhülsen die reproduzierbare<br />
Montage in der Anwendung.<br />
Zahlreiche Fertigungsprozesse arbeiten etwa im Sekundentakt.<br />
Entsprechend muss die 3D-Vermessung<br />
des Messobjekts in einer einzigen schnellen Aufnahme<br />
erfolgen. In dieser Zeit darf sich das Messobjekt nicht<br />
bewegen. Beim Surfacecontrol 3D 3500 sind die Projektion<br />
der bis zu 20 verschiedenen Streifenmuster<br />
und die Aufnahme durch die beiden Kameras je nach<br />
Messaufgabe in etwa 0,2 bis 0,4 s erledigt. Im Anschluss<br />
übernimmt der Rechner die Berechnung der<br />
3D-Punktewolke. Das Messobjekt kann dabei bereits<br />
MACHEN SIE SCHALL<br />
SICHTBAR<br />
ERKENNEN SIE DIE URSACHEN AKUSTISCHER<br />
PROBLEME – SCHNELL UND EFFEKTIV.<br />
Mit Sound Scannern von Seven Bel können Sie<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
www.sevenbel.com<br />
<strong>Quality</strong> <strong>Engineering</strong> » 03|2021 27
IM FOKUS » Automatisierung<br />
Die Software 3D-Inspect<br />
ist intuitiv zu<br />
bedienen und bietet<br />
dabei einen großen<br />
Funktionsumfang.<br />
Bild: Micro-Epsilon<br />
Software für Parametrierung und<br />
Messdaten-Aufnahme<br />
Außerdem liefert Micro-Epsilon zusammen mit dem<br />
Sensor die Software 3D Inspect, die zur Sensorparametrierung<br />
und zur Umsetzung industrieller Messaufgaben<br />
dient. Die Software überträgt die Messdaten<br />
vom Sensor über Ethernet und stellt diese dreidimensional<br />
dar. Fertig definierte Messprogramme vereinfachen<br />
die Auswertung der Messdaten. Damit ist<br />
diese Software sehr leistungsstark und trotzdem sehr<br />
intuitiv zu bedienen. Umfassende Möglichkeiten für<br />
die Detektion und Analyse von Oberflächen hat der<br />
Anwender mit der Software Surfacecontrol Defmap3D.<br />
Sie beinhaltet alle Komponenten und Verfahren<br />
für die Einrichtung, Konfiguration und Auswertung<br />
für die Oberflächenprüfung. Der große Funktiweitertransportiert<br />
werden, um Platz für das nächste<br />
Werkstück zu machen. Pro Sekunde kann der Sensor<br />
bis zu 2,2 Mio. 3D-Punkte liefern.<br />
Die Punktewolke ist innerhalb<br />
einer Sekunde berechnet<br />
Die Verarbeitungszeit zu einer 3D-Punktewolke ist<br />
stark von den Messparametern und der Komplexität<br />
des Messobjekts abhängig. Dank eines optimierten<br />
Algorithmus für die Verarbeitung ist die Punktewolkenberechnung<br />
beim Surfacecontrol 3D 3500 in der<br />
Regel nach knapp 1 s abgeschlossen, so dass sich der<br />
Sensor sehr gut für Applikationen der Qualitätssicherung<br />
in Fertigungsprozessen eignet, in denen mit<br />
entsprechenden Taktraten produziert wird.<br />
Ein Beispiel für eine Anwendung, bei der eine automatisierte<br />
Inline-Geometrie-, Form- und Oberflächenvermessung<br />
notwendig ist, ist etwa die Leiterplattenfertigung,<br />
bei der die Ebenheit überprüft wird.<br />
Nach der Bestückung von Leiterplatten lassen sich<br />
mit dem neuen Sensor Bestückungsfehler erkennen.<br />
Typisch ist der sogenannte Tombstone-Effekt, bei<br />
dem sich kleine SMD-Bauteile während des Lötens<br />
aufrichten und dadurch nur auf einer Seite kontaktiert<br />
werden. Durch die 3D-Oberflächenmessung fällt<br />
dies sofort auf, da die Oberflächen von Bauteil und<br />
Leiterplatte nicht mehr exakt parallel zueinander<br />
sind. Die hierfür notwendige Präzision von wenigen<br />
Mikrometern kann der Surfacecontrol 3D 3500 sicherstellen.<br />
Auch bei dicht bestückten Leiterplatten<br />
werden solche Fehlbestückungen zuverlässig und<br />
schnell erkannt.<br />
Um den 3D-Sensor zu integrieren, stehen dem Anwender<br />
mehrere Möglichkeiten offen. Zunächst ist<br />
dies die Software 3D-View, die ein komfortables Benutzerinterface<br />
bereitstellt, mit dem die Surfacecontrol-Sensoren<br />
angesprochen werden können. Die<br />
Software ermöglicht die schnelle Inbetriebnahme<br />
und Evaluierung des Sensors. So können Parameter<br />
eingestellt und optimiert oder die korrekte Positionierung<br />
von Messobjekt und Sensor sichergestellt<br />
werden. Die Datenaufnahme kann direkt aus der<br />
Software gestartet werden.<br />
Bei der Nietprüfung<br />
erfasst der Surfacecontrol<br />
die Höhe und<br />
Verkippung sowie die<br />
Breite und Position<br />
des Niets.<br />
Bild: Micro-Epsilon<br />
Der 3D-Snapshot-Sensor<br />
Surfacecontrol 3D 3500<br />
detektiert und bewertet<br />
Ausbrüche auf Kupplungsscheiben.<br />
Bild: Micro-Epsilon<br />
28 <strong>Quality</strong> <strong>Engineering</strong> » 03|2021
onsumfang unterstützt gleichermaßen die Analyse<br />
von Einzelteilen, die Messung kleiner Serien sowie<br />
die robotergestützte Inspektion mehrerer Messfelder.<br />
Wenn der Anwender eine alternative Bildverarbeitungslösung<br />
verwendet oder selber entwickeln<br />
möchte, steht ein umfangreiches SDK zur Verfügung.<br />
Dieses basiert auf den Industriestandards Gige Vision<br />
und Genicam und stellt zahlreiche Funktionsblöcke<br />
zur Verfügung. Eine C/ C++/ C# Bibliothek mit zahlreichen<br />
Beispielprogrammen und Dokumentationen<br />
unterstützt bei der Softwareentwicklung. Der Zugriff<br />
auf den Sensor über Gige Vision ist auch ohne SDK<br />
mit einer Genicam-konformen Software von Drittanbietern<br />
möglich.<br />
Wenn es reflektiert<br />
Bild: Micro-Epsilon<br />
Defekte unter einem 1 μm erkennt Reflectcontrol in einer Zeit von weniger<br />
als 2 s – hier am Beispiel eines Wafers.<br />
Gezielt für spiegelnde und glänzende Oberflächen eignet<br />
sich das hochgenaue 3D-Oberfächeninspektionssystem Reflectcontrol.<br />
Der Sensor erfasst Ebenheitsabweichungen im<br />
Bereich weniger Mikrometer. Er kann stationär zur Überwachung<br />
der Fertigungslinie oder für die Inline-Inspektion am<br />
Roboter eingesetzt werden. Hierzu wird ein Streifenmuster<br />
auf dem Display generiert, welches über die Oberfläche des<br />
Messobjekts in die Kameras des Sensors gespiegelt wird.<br />
Abweichungen auf der Oberfläche verursachen Verzerrungen<br />
im Streifenmuster, die mit der Software ausgewertet<br />
werden. Die Vorteile zeigen sich besonders in der zuverlässigen<br />
Detektion kleinster Defekte unter einem 1 μm und einer<br />
Inspektionsrate von < 2 s pro Messposition. Die Software-Anbindung<br />
erfolgt über das Micro-Epsilon 3D-SDK,<br />
basierend auf den Industriestandards Gige Vision und Genicam.<br />
Reflectcontrol basiert auf der gleichen Softwareplattform<br />
wie Surfacecontrol.<br />
<strong>Quality</strong> <strong>Engineering</strong> » 03|2021 29
IM FOKUS » Automatisierung<br />
Mit einem 3D-Sensor<br />
am Arm wird der Roboter<br />
zu einer flexiblen<br />
Messmaschine, die sich<br />
leicht an wechselnde<br />
Produkte und Umgebungen<br />
anpassen lässt.<br />
Bild: ABB<br />
Optische Messtechnik verkürzt die Zykluszeiten bei Benteler<br />
Roboter mit Argusaugen<br />
Der Automobilzulieferer Benteler hat sich in seinem Werk im spanischen Vigo<br />
von der klassischen Koordinatenmessmaschine verabschiedet und setzt auf<br />
optische Messtechnik. Ein Roboter des Herstellers ABB mit einem 3D-Weißlichtsensor<br />
am Arm sorgt jetzt für kürzere Zykluszeiten und weniger Ausschuss.<br />
» Uwe Schoppen<br />
Bild: Benteler<br />
Der Roboter führt bei<br />
Benteler die typischen<br />
Messungen durch, die<br />
zuvor mit einem Koordinatenmessgerät<br />
umgesetzt<br />
wurden.<br />
Benteler ist ein führendes Unternehmen, das Produkte,<br />
Systeme und Dienstleistungen für die Automobil-,<br />
Energie- und Maschinenbaubranche entwickelt,<br />
produziert und vertreibt. Die Automotive-Sparte<br />
des Unternehmens beschäftigt rund 26.000 Mitarbeiter,<br />
die in 75 Werken<br />
in 24 Ländern tätig sind.<br />
Zum Portfolio gehören<br />
maßgeschneiderte Lösungen<br />
für die Autobauer<br />
wie Module für Fahrwerk,<br />
Karosserie, Motor und<br />
Abgassystem. Geliefert<br />
werden auch Lösungen<br />
für Elektrofahrzeuge.<br />
Die Qualitätskontrolle ist bei Benteler ein zentraler<br />
Bereich, der konsequent weiterentwickelt wird. Das<br />
Unternehmen investiert deswegen in die Optimierung<br />
seiner Prozesse und nutzt digitale Technologien,<br />
um hohe Qualität bieten zu können. Am Standort in<br />
Vigo in Westspanien wurde bislang ein traditioneller<br />
Ansatz verfolgt und die Qualität der Teile mit einer<br />
»Die 3DQI-Technik wurde<br />
in Automobilanwendungen<br />
entwickelt und getestet.«<br />
Tanja Vainio, ABB Robotics<br />
Koordinatenmessmaschine sichergestellt. Benteler<br />
war jedoch der Ansicht, dass sich der Prozess in zwei<br />
Punkten verbessern ließe. Erstens sollte die Zeit für<br />
die Inspektion verkürzt und zweitens die Qualität der<br />
erfassten Daten verbessert werden. Schließlich haben<br />
sich die Verantwortlichen<br />
dazu entschieden,<br />
das Konzept grundsätzlich<br />
zu ändern.<br />
Der Prozess wurde vom<br />
Messraum in den Produktionsbereich<br />
verlagert<br />
und es kam eine Qualitätssicherungs-Lösung<br />
mit einem Roboter des<br />
Herstellers ABB zum Einsatz, an dessen Arm ein<br />
3D-Weißlichtsensor montiert ist. Mit digitalen Scans<br />
sollte fortan die Inspektion optimiert werden. Die<br />
Sensoren können Defekte an einem gefertigten Teil<br />
mit hoher Genauigkeit erkennen (siehe auch Kasten).<br />
Die Technik gehört zum Portfolio von ABB und nutzt<br />
das industrielle Internet der Dinge. Dadurch wird ein<br />
30 <strong>Quality</strong> <strong>Engineering</strong> » 03|2021
hoher Automatisierungsgrad mit moderner Datenanalyse<br />
möglich, was insgesamt die flexible Fertigung<br />
und die Produktionsprozesse bei Benteler fördert.<br />
Auf diese Weise will der Zulieferer die zahlreichen<br />
Produktvarianten und kundenspezifischen Anpassungen<br />
in kleineren Losen optimieren, die Produktivität<br />
verbessern und sich so einen Wettbewerbsvorteil<br />
verschaffen.<br />
Die 3D-Weißlichtsensoren können für die Offlineund<br />
Inline-Inspektion gleichermaßen eingesetzt werden.<br />
Benteler entschied sich für die Installation der<br />
Offline-Inspektionslösung. Das System führt die typischen<br />
Messungen durch, die zuvor mit dem Koordinatenmessgerät<br />
umgesetzt wurden und erstellt dabei<br />
Kontrollberichte, die intern genutzt, aber auch dem<br />
Kunden zur Verfügung gestellt werden. Die Integration<br />
eines Roboters mit der 3D-Messtechnik bietet dabei<br />
eine hohe Erfassungsgeschwindigkeit und dadurch<br />
mehr Messungen als mit der alten Lösung.<br />
Vom Konzept her arbeitet die Lösung wie eine Fertigungszelle,<br />
wobei der Schwerpunkt auf einem hohen<br />
Durchsatz liegt. Zu diesem Zweck wurden zwei<br />
Messtische installiert. Ein zweiter Roboter belädt<br />
und entlädt die Messwerkzeuge einschließlich der zu<br />
messenden Teile automatisch entsprechend der vom<br />
Bediener erstellten Produktionswarteschlange. Auf<br />
diese Weise wird eine kontinuierliche Messung möglich,<br />
was die Produktivität erhöht.<br />
Benteler hat zudem drei Inline-Zellen installiert, in<br />
denen strukturelle Sicherheitsteile wie Hinterachse<br />
und Motorhalterung gemessen werden. An dieser<br />
Stelle kommt die gleiche Technik mit angepasster<br />
Funktionalität zum Einsatz. Auch hier werden am Ende<br />
der Produktionslinie die 3D-Geometrien der Bauteile<br />
mit optischer, berührungsloser Abtastung gemessen<br />
und auf traditionelle, mechanische Kontrollwerkzeuge<br />
verzichtet. Alle Teile werden im kontinuierlichen Modus<br />
einer 3D-Maßkontrolle unterzogen, wodurch sich<br />
mögliche Fehler effizient identifizieren lassen.<br />
Mit der 3D-Visionlösung lassen sich nach eigenen<br />
Angaben in der Zeit, die eine Koordinatenmessmaschine<br />
für die Kontrolle eines 3D-Punktes braucht, bis<br />
zu fünf Millionen 3D-Punkte prüfen, ohne das Bauteil<br />
zu berühren. Ein weiterer Vorteil ist, dass jedes einzelne<br />
Teil inspiziert werden kann. Oft verlassen sich<br />
Fertigungsbetriebe auf die statistische Qualitätskontrolle,<br />
bei der Stichproben genommen werden. Das<br />
kann jedoch dazu führen, dass sich der gleiche Fehler<br />
in vielen Produkten wiederholt, bevor er entdeckt<br />
wird. Die Folge sind teure Nacharbeit und Ausschuss.<br />
Mit einer kontinuierlichen Kontrolle aller Teile<br />
werden solche kostspieligen Risiken vermieden. Tier-<br />
1-Automobilzulieferer wie Benteler, bei denen die<br />
Prozesse kontinuierlich weiterentwickelt werden,<br />
können mit der digitalisierten 3D-Inspektionslösung<br />
ihre Qualität gegenüber großen Automobilherstellern<br />
validieren, deren Qualitätsanforderungen ebenso<br />
hoch sind.<br />
Weißlichtsensor erstellt<br />
digitales Modell<br />
Die skalierbare Roboterzelle von ABB für die 3D-Qualitätsinspektion<br />
(3DQI) erkennt Mängel an Bauteilen, die<br />
weniger als halb so dick sind wie ein menschliches<br />
Haar. Die Lösung ist konzipiert für Anwendungen im<br />
Automobilbau, in der Luft- und Raumfahrt sowie im<br />
Schwermaschinenbau und Baugewerbe. Zu den Vorteilen<br />
der Zelle gehört die Kombination aus hoher Geschwindigkeit,<br />
einer Genauigkeit von unter 100 μm<br />
und Flexibilität, denn dank des modularen Aufbaus<br />
lässt sich die Lösung genau auf die Bedürfnisse des<br />
Anwenders zuschneiden.<br />
3DQI ist für Offline-Prüfstationen konzipiert. Mit einem<br />
optischen 3D-Weißlichtsensor, der Millionen von<br />
3D-Punkten pro Aufnahme abtastet, wird ein detailliertes,<br />
digitales Modell des zu prüfenden Teils erstellt.<br />
Dies wiederum kann mit den CAD-Daten abgeglichen<br />
werden. Die Abläufe sind nach eigenen Angaben um<br />
den Faktor zehn schneller als bei Koordinatenmessgeräten.<br />
Jeder Roboter, der 20 kg oder mehr tragen kann,<br />
lässt sich mit dem Sensor nachrüsten. Der Sensor ist<br />
dabei mit marktüblichen Robotern, Verfahrachsen und<br />
Drehtischen kompatibel. So gibt es bei den Abmessungen<br />
der zu prüfenden Teile keine Beschränkungen. Die<br />
Lösung bietet zudem eine umfassende Echtzeit-Datenanalyse.<br />
Digitale Aufzeichnungen unterstützen die<br />
Rückverfolgbarkeit, die in den anvisierten Branchen<br />
erforderlich ist.<br />
Bild: ABB<br />
<strong>Quality</strong> <strong>Engineering</strong> » 03|2021 31
Industrie<br />
fachjobs24.de – hier finden Arbeitgeber<br />
qualifizierte Fach- und<br />
Führungskräfte<br />
Sprechen Sie Nutzer von Branchen-Fachmedien an:<br />
die Interessierten und Engagierten ihres Fachs<br />
Erreichen Sie die Wechselwilligen, schon bevor<br />
sie zu aktiven Suchern werden<br />
Für optimales Personalmarketing: Präsentieren Sie<br />
sich als attraktiver Arbeitgeber der Branche<br />
EINFACH,<br />
SCHNELL UND<br />
FÜR NUR<br />
199€<br />
Preis zzgl. MwSt<br />
Einzigartiges Netzwerk zielgruppenspezifischer Branchen-Channels<br />
Augenoptik Handwerk Architektur<br />
Arbeitswelt<br />
Wissen<br />
34 Online-Partner<br />
32 <strong>Quality</strong> <strong>Engineering</strong> » 03|2021<br />
28 Print-Partner<br />
Das Stellenportal für Ihren Erfolg!
SPECIAL<br />
» Bildverarbeitung<br />
Vision-Technologien erweitern stetig ihre Möglichkeiten<br />
und erobern neue Anwendungen in der<br />
Qualitätssicherung. Dazu trägt auch der Einsatz von<br />
Künstlicher Intelligenz bei.<br />
Interview<br />
Fraunhofer Vision: „Forschungsboom<br />
treibt Bildverarbeitung an“<br />
» Seite 34<br />
Digitalmikroskopie<br />
Visioner 1 liefert tiefenscharfe<br />
Bilder in Echtzeit<br />
» Seite 36<br />
Oberflächenrauheit<br />
Weißlichtinterferometrie<br />
direkt in der Fertigung<br />
» Seite 40<br />
Schallvisualisierung<br />
Akustische Kameras schützen<br />
vor Gesundheitsschädigungen<br />
» Seite 42<br />
Schutzmasken<br />
Künstliche Intelligenz<br />
übernimmt Qualitätskontrolle<br />
» Seite 44<br />
Hyperspektral-Bildgebung und KI sind die Basis des Rolle-zu-Rolle-Inspektionssystems für Barrierefolien am<br />
Fraunhofer FEP. Die Folien werden etwa für organische Leuchtdioden (OLED) oder Solarzellen (OPV) benötigt.<br />
Bild: Ronald Bonß<br />
Verpackungs -<br />
komponenten<br />
Kameraverbund prüft 100 %<br />
und in Hochgeschwindigkeit<br />
» Seite 46
SPECIAL » Interview<br />
Bildverarbeitung auf dem Sprung zur Mainstream-Technologie<br />
„Wir stehen vor einer neuen Ära“<br />
Für Michael Sackewitz, Koordinator des Fraunhofer Geschäftsbereichs Vision, ist die<br />
industrielle Bildverarbeitung derzeit von einem beispiellosen Forschungsboom<br />
getrieben. Die Nischen-Lösungen von einst entwickeln sich dank Machine Learning<br />
zur Mainstream-Technologie.<br />
» Uwe Schoppen<br />
Herr Sackewitz, was morgen die Welt<br />
verändern soll, muss heute entwickelt<br />
werden. Ist es denn möglich, künftige<br />
Anforderungen an die Bildverarbeitung<br />
zu erkennen, um bereits heute die richtigen<br />
Entwicklungsweichen zu stellen?<br />
Für eine robuste Vorausschau müssen wir<br />
uns systematisch, intensiv und nachvollziehbar<br />
mit den relevanten Einflussfaktoren<br />
und Akteuren auseinandersetzen. Danach<br />
gilt es, die gefundenen Zusammenhänge<br />
und Wechselwirkungen hinsichtlich<br />
Plausibilität und Konsistenz zu überprüfen.<br />
Am Ende erkennt man, dass viele<br />
Dinge in der Zukunft heute bereits strukturell<br />
vorgeprägt sind und eine Einschätzung<br />
der Entwicklung zulassen.<br />
Wird die Bildverarbeitung künftig noch<br />
näher an den Herstellungsprozess rücken?<br />
Dieser Trend ist unübersehbar. Nur so lassen<br />
sich Qualitätsabweichungen bereits bei<br />
der Entstehung erkennen und frühzeitig<br />
korrigieren. Ein zentrales Kriterium für die<br />
Zukunftsfähigkeit von Bildverarbeitungslösungen<br />
ist deswegen die einfache Integration<br />
in den Prozess. Miniaturisierung, Modularität<br />
und insbesondere die Flexibilität<br />
sind die Trends der nächsten Jahre.<br />
Wird die Bildverarbeitung in den kommenden<br />
Jahren mehr fertigungssteuernde<br />
Aufgaben übernehmen?<br />
Vision-Experte Michael Sackewitz: „Eine einfache Bedienung ist für die Anwender von Bildverarbeitungs-Systemen<br />
oft wichtiger als der Wunsch nach mehr Leistung.“<br />
Bild: Fraunhofer<br />
Vision-Systeme werden künftig komplexere<br />
Aufgaben übernehmen als die automatisierte<br />
Erfassung ausgewählter Inspektionsdaten<br />
an isolierten Überwachungspunkten.<br />
34 <strong>Quality</strong> <strong>Engineering</strong> » 03|2021
Die Systeme werden als Sinnesorgane einer<br />
vernetzten Produktion nahezu in Echtzeit<br />
die Material-, Produkt- und Prozessdaten<br />
zur Verfügung stellen und auswerten.<br />
Die Bildverarbeitung übernimmt damit<br />
zunehmend fertigungssteuernde Aufgaben.<br />
Die Mess- und Automatisierungstechnik<br />
verschmelzen dabei zusehends.<br />
Werden in Zukunft immer mehr Sensortypen<br />
miteinander kombiniert?<br />
Sensoren werden leistungsfähiger und die<br />
Kombination unterschiedlicher Sensortypen<br />
vielfältiger. Die smarten Datenlieferanten<br />
können zudem in das Innere vieler<br />
Objekte hineinschauen. So lassen sich<br />
Strukturen, aber auch optische und stoffliche<br />
Eigenschaften erfassen. Die Ergebnisse<br />
werden direkt bildgebend ausgewertet<br />
und visualisiert, wodurch sie sich<br />
leichter interpretieren lassen. Die Gefahr<br />
einer Fehldeutung verringert sich.<br />
Welche Herausforderungen wird es in<br />
Zukunft beim Datenhandling geben?<br />
Wie werden die gewonnenen Messdaten<br />
sinnvollerweise aufbereitet und<br />
verarbeitet?<br />
Die Herausforderung wird sein, alle Daten<br />
über ein Produkt entlang des gesamten<br />
Produktions- und Lebenszyklus konsistent<br />
zusammenzuführen. Dafür brauchen wir<br />
standardisierte Schnittstellen und einheitliche<br />
Datenmodelle, mit denen sich<br />
multimodale Sensordaten fusionieren und<br />
über alle Informationsebenen hinweg<br />
austauschen lassen. Die wesentliche Aufgabe<br />
besteht darin, die Datenströme aus<br />
verschiedenen Quellen und Formaten örtlich<br />
und zeitlich zu synchronisieren und in<br />
einem gemeinsamen Koordinatensystem<br />
gegeneinander auszurichten. Die Herausforderung<br />
liegt somit in der vollständigen<br />
horizontalen und vertikalen Integration.<br />
Es gibt heute bereits Standards im Rahmen<br />
von Industrie 4.0 wie etwas der offene<br />
Schnittstellenstandard OPC-UA.<br />
Wird sich die Bildverarbeitung künftig<br />
automatisch der Messaufgabe und der<br />
Messumgebung anpassen können?<br />
Welche Rolle spielt dabei der Bediener?<br />
Mess- und Prüfsysteme von morgen werden<br />
nicht mehr auf feste Arbeitsschritte<br />
oder Aufgaben ausgelegt sein, sondern<br />
werden sich an verschiedene Randbedingungen<br />
wie Prüfinhalte, Fehlerklassen<br />
oder Gestalt der Prüfobjekte frei anpassen<br />
lassen. Im Idealfall sind die Systeme so<br />
schlau, dass sie die Aufgabe ohne jeglichen<br />
Bedienereingriff übernehmen können.<br />
Hinzu kommen weitere Funktionen<br />
wie Selbstüberwachung, Störungserkennung,<br />
Störungsdiagnose, Selbstkalibrierung<br />
und Rekonfiguration.<br />
»Vision-Systeme<br />
werden die<br />
Sinnesorgane einer<br />
vernetzten Produktion<br />
und übernehmen<br />
dabei zunehmend<br />
fertigungssteuernde<br />
Aufgaben.«<br />
Sind kleine, integrierte Vision-Systeme<br />
die Stars von morgen?<br />
Embedded-Vision-Systeme gewinnen weiter<br />
an Bedeutung. Die flexiblen All-in-one-<br />
Lösungen sind mit kognitiver Sensorik, modernen<br />
Algorithmen, einem integrierten<br />
Rechner und einem Betriebssystem ausgestattet.<br />
Und das alles in einem Gehäuse.<br />
Die Technologie reduziert die Hardwarekosten<br />
von Vision-Systemen signifikant.<br />
Das klassische Single-PC-basierte System<br />
wird zunehmend in den Hintergrund treten.<br />
Welche Bedeutung hat Machine Learning<br />
für die Bildverarbeitung?<br />
Machine Learning, kurz ML, führt derzeit<br />
zu einem regelrechten Umbruch. Wir stehen<br />
in der Bildverarbeitung vor einer neuen<br />
Ära. Die Algorithmen, die dahinterstehen,<br />
können anhand von Beispielbildern<br />
lernen und eigenständig Daten analysieren<br />
und klassifizieren. Die Zutaten für die<br />
Rezeptur sind vorhanden, sprich hohe und<br />
billige Rechenleistung, Softwarebibliotheken<br />
sowie große annotierte Trainingsdatensätze.<br />
Trainieren statt Programmieren<br />
könnte die Devise der Zukunft lauten.<br />
Die ML-basierte Bildverarbeitung wird in<br />
viele neue Anwendungsbereiche vorstoßen,<br />
wo klassische Ansätze teuer, langsam,<br />
unflexibel und ineffizient sind. So<br />
gesehen wird die Bildverarbeitung getrieben<br />
von einem beispiellosen Forschungsboom<br />
und entwickelt sich derzeit von der<br />
klassischen Nischen-Lösung zur Mainstream-Technologie.<br />
Welche Aufgaben könnten Vision-Systeme<br />
mit Machine Learning lösen, die<br />
heute noch nicht lösbar sind?<br />
Machine Learning wird sich im praktischen<br />
Einsatz dort widerspiegeln, wo maschinelles<br />
Bildverstehen gefragt ist. Unzählige<br />
Anwendungen sind denkbar, viele<br />
liegen auch jenseits der Fabrikgrenzen<br />
wie etwa beim Handel. Ein Beispiel ist die<br />
automatische Kasse, wo Waren auf dem<br />
Kassenband über einen Video-Livestream<br />
markerfrei identifiziert und abgerechnet<br />
werden. Im industriellen Sektor könnte<br />
Machine Learning neue Möglichkeiten für<br />
die prädiktive Wartung eröffnen. Dadurch<br />
lassen sich Maschinenausfälle besser vorhersagen<br />
und so vorausschauend vermeiden.<br />
Die Lerndaten wären in diesem Fall<br />
dann keine Bilder, sondern repräsentative<br />
akustische Muster.<br />
Welche Rolle wird die einfache Bedienung<br />
von Vision-Systemen in Zukunft<br />
haben?<br />
Eine entscheidende. Eine einfache Bedienung<br />
ist für die Anwender oft sogar wichtiger<br />
als der Wunsch nach mehr Leistung.<br />
Die Vision-Systeme müssen in Zukunft so<br />
einfach gestaltet sein, dass auch Laien sie<br />
intuitiv bedienen können. Die stärksten<br />
Impulse kommen aus dem Consumerbereich.<br />
Insbesondere die technische Entwicklung<br />
der Smartphones beflügelt die<br />
Erwartungshaltung der Nutzer.<br />
<strong>Quality</strong> <strong>Engineering</strong> » 03|2021 35
Mit dem Digitalmikroskop Visioner 1<br />
lassen sich Proben bis zu einer Tiefe<br />
von 69 mm inspizieren, ohne dabei<br />
das optische System verfahren oder die<br />
Probe erneut fokussieren zu müssen.<br />
Bild: Zeiss<br />
Zeiss schlägt ein neues Kapitel in der Mikroskopie auf<br />
Die Physik sauber ausgetrickst<br />
Auch Zeiss kann die Gesetzte der Optik nicht brechen – aber umgehen. Mit dem<br />
Visioner 1 bringt das Unternehmen ein Digitalmikroskop auf den Markt, das<br />
tiefenscharfe Bilder in Echtzeit liefert. Dafür mussten die Spezialisten aus Jena<br />
ganz tief in die Entwicklungskiste greifen, denn physikalisch ist das eigentlich<br />
gar nicht möglich.<br />
» Uwe Schoppen<br />
Die Mikroskopie ist das Herzstück von Zeiss“,<br />
sagt Dr. Robert Zarnetta, der das Geschäftsfeld<br />
Industrial Microscopy Solutions bei Zeiss Industrial<br />
<strong>Quality</strong> Solutions leitet. „Die Technik haben wir in der<br />
Vergangenheit immer wieder an neue Grenzen geführt.“<br />
Und diesmal sogar noch ein Stückchen weiter.<br />
Bedarf am neuesten Wurf von Zeiss ist reichlich<br />
vorhanden, denn in der Mikroskopie gibt es schon<br />
immer ein Problem. Wenn der Anwender eine Probe<br />
vergrößert, um feine Details sehen zu können,<br />
nimmt die Tiefenschärfe des Bildes<br />
ab und er sieht immer nur einen kleinen<br />
Bereich deutlich. Beim Prüfen<br />
von Leiterplatten zum Beispiel ist<br />
das ein Problem, weil hier oft<br />
Merkmale in unterschiedlichen<br />
Höhen kontrolliert werden müssen.<br />
Aber auch bei anderen Anwendungen<br />
ist dieser physikalische<br />
ENDLICH<br />
Das Problem mit der<br />
Tiefenschärfe ist so alt<br />
wie das Mikroskop: 175<br />
Jahre. Jetzt ist es endlich<br />
gelöst - dank<br />
schneller Rechner.<br />
Effekt hinderlich und die Gefahr groß, dass Defekte,<br />
Verunreinigungen oder Produktionsfehler übersehen<br />
werden und die Inspektion dadurch unvollständig ist.<br />
Bislang musste sich der Mitarbeiter zu Fuß aus der<br />
Misere helfen, immer wieder nachfokussieren und<br />
die verschiedenen Ebenen zusammenführen, um am<br />
Ende ein Bild mit erweiterter Tiefenschärfe zu bekommen.<br />
„Damit ist das Problem zwar gelöst, aber<br />
die Vorgehensweise ist komplex und kostet viel Zeit“,<br />
stellt Zarnetta fest.<br />
Die Lösung des Problems ist eine virtuelle<br />
Linse, die aus kleinen Spiegelelementen<br />
aufgebaut ist, die sich in<br />
alle Richtungen frei bewegen lassen<br />
(siehe auch Kasten). In der<br />
Praxis wird die Linse permanent<br />
auf verschiedene Bereiche fokussiert<br />
und zwar so schnell, dass das<br />
menschliche Auge davon nichts<br />
36 <strong>Quality</strong> <strong>Engineering</strong> » 03|2021
Bildverarbeitung « SPECIAL<br />
merkt. Der Anwender schaltet das Mikroskop an, hat<br />
sofort ein tiefenscharfes Bild und kann frei über die<br />
Probe navigieren. „Ich kann das Werkstück drehen<br />
und kippen, auch mal von der Seite drauf schauen<br />
und verliere dabei nie den Fokus“, versichert Zarnetta.<br />
Das ist eine ganz neue Herangehensweise an die<br />
optische Inspektion. Der Mitarbeiter muss sich keine<br />
Gedanken mehr machen, wie er das Bauteil führen<br />
muss, damit er alle entscheidenden Stellen scharf<br />
sieht, sondern er kann sich auf seine eigentliche Aufgabe<br />
konzentrieren. Das neue Digitalmikroskop<br />
kommt nach Ansicht von Zarnetta zum richtigen<br />
Zeitpunkt auf dem Markt, denn die Bauteile werden<br />
immer kleiner, die Beschichtungen filigraner und die<br />
Kombination aus verschiedenen Materialien komplexer.<br />
„Sei es die Gratbildung im Spitzguss oder Elektronikbauteile,<br />
die Anforderungen wachsen mit jedem<br />
Tag“, so Zarnetta.<br />
Wegen der Corona-Pandemie fand die Produkteinführung<br />
im Herbst rein digital statt. Alle Eigenschaften<br />
des neuen Digitalmikroskops sind auf den Internetseiten<br />
von Zeiss verfügbar. Vor allem aus der Me-<br />
„Der Unterschied ist wirklich erstaunlich“<br />
Bild: Reliance Precision<br />
Das Digitalmikroskop Visioner 1 hat die Inspektion komplexer Teile bei Reliance Precision<br />
wesentlich vereinfacht und zugleich beschleunigt.<br />
Erste Pilotkunden konnten das<br />
neue Digitalmikroskop Visioner 1<br />
bereits im täglichen Einsatz nutzen.<br />
Einer davon ist Reliance Precision<br />
mit Sitz im englischen Huddersfield.<br />
Das <strong>Engineering</strong>-Unternehmen versteht<br />
sich als zentrale Anlaufstelle<br />
für den Konstrukteur. Das Portfolio<br />
reicht von der einfachen Schraube<br />
bis hin zu kompletten Baugruppen<br />
für Dreh- und Linearbewegungen.<br />
In der täglichen Praxis werden dabei<br />
komplexe Formen bearbeitet.<br />
Die Produkte zeichnen sich aus<br />
durch Variantenvielfalt, geringe<br />
Stückzahlen und eine hohe Präzision.<br />
Die Anforderungen an die optische<br />
Inspektion sind hoch, denn<br />
nur so kann sichergestellt werden,<br />
dass keine Fremdkörper die Qualität<br />
der Produkte beeinträchtigen.<br />
Die Inspektion mit Stereomikroskopen<br />
war für die Mitarbeiter in der<br />
Vergangenheit mühsam und zeitintensiv,<br />
da verschiedene Abschnitte<br />
der Bauteile immer wieder neu fokussiert,<br />
einzeln abgebildet und<br />
schließlich zu Berichten zusammengefasst<br />
werden mussten.<br />
Während einer Produktpräsentation<br />
von Zeiss UK lernten die Engländer<br />
das neue Digitalmikroskop Visioner<br />
1 kennen und hatten auch<br />
die Gelegenheit, das Gerät ausgiebig<br />
zu testen. Das erste, was den<br />
Engländern dabei auffiel, war natürlich<br />
die durchgehende Tiefenschärfe.<br />
„Mit dem Visioner 1 können<br />
wir eine Inspektionsaufgabe<br />
manchmal mit einem einzigen Bild<br />
erledigen“, freut sich David Torr,<br />
Head of Metrology bei Reliance<br />
Precision. „Wenn man diese Technik<br />
zum ersten Mal bei Produkten<br />
nutzt, die man bisher nur durch ein<br />
übliches Stereomikroskop gesehen<br />
hat, dann ist der Unterschied wirklich<br />
erstaunlich. Und wenn wir einen<br />
interessanten Bereich identifiziert<br />
haben, können wir sogar<br />
grundlegende Messungen durchführen.“<br />
Mit dem neuen Digitalmikroskop<br />
von Zeiss haben die Spezialisten<br />
von Reliance Precision bislang gute<br />
Erfahrungen gesammelt. „Mit<br />
dem System können wir die Effizienz<br />
der visuellen Inspektionen<br />
und der qualitativen Beurteilungen<br />
enorm steigern“, fasst David Torr<br />
zusammen. „Wir erfassen mehr Details<br />
in einem Bild, können Routinen<br />
programmieren und profitieren<br />
nicht zuletzt von der besseren Bedienerergonomie.“<br />
<strong>Quality</strong> <strong>Engineering</strong> » 03|2021 37
SPECIAL » Bildverarbeitung<br />
dizintechnik erreichten Zeiss viele Anfragen, denn in<br />
diesem Bereich sind die Anforderungen besonders<br />
hoch und Hundertprozent-Kontrollen keine Seltenheit.<br />
Jedes Bauteil, das im Körper implantiert wird –<br />
sei es ein Stent, ein Spinal Cord Implant für die Rückenmarkstimulation<br />
oder ein Hüftgelenk – wird inspiziert<br />
und frei gegeben. „Für die Mitarbeiter wird<br />
der Alltag durch unsere neue Technik leichter und<br />
das führt automatisch zu einem höheren Durchsatz“,<br />
versichert Zarnetta.<br />
Scharf bis in die letzte Ecke<br />
Mit dem neuen Digitalmikroskop Visioner 1 hebt<br />
Zeiss die Möglichkeiten der Inspektion auf ein<br />
neues Niveau, denn der Anwender kann damit<br />
bei der Qualitätskontrolle in der Fertigung erstmals<br />
die Probe dank einer erweiterten Tiefenschärfe<br />
erstmals vollständig in Echtzeit scharf sehen.<br />
Der Schlüssel für diesen Fortschritt liegt in<br />
einem mikro-elektro-mechanischen System, das<br />
aus einem Komplex kleiner Spiegel mit einer Größe<br />
von 100 x 100 μm besteht. Diese lassen sich individuell<br />
einstellen, um virtuelle Linsen mit verschiedenen<br />
Krümmungen und damit Fokussierebenen<br />
zu generieren. Dadurch kann das Digitalmikroskop<br />
jeden Punkt der Probe scharf abbilden.<br />
Das eigentlich revolutionäre daran ist, dass<br />
die Mikro-Spiegel so schnell eingestellt werden<br />
können, dass die Bilddarstellung für den Nutzer<br />
in Echtzeit abläuft. Das Ergebnis ist eine erweiterte<br />
Tiefenschärfe, mit der sich Proben bis zu einer<br />
Tiefe von 69 mm inspizieren lassen, ohne dabei<br />
das optische System verfahren oder die Probe erneut<br />
fokussieren zu müssen. Alle 3D-Informationen<br />
der Probe sind auf einen Blick sichtbar und<br />
ermöglichen so eine schnelle und zuverlässige<br />
Inspektion.<br />
Bild: Zeiss<br />
Dr. Robert Zarnetta<br />
leitet das Geschäftsfeld<br />
Industrial<br />
Microscopy<br />
Solutions bei Zeiss<br />
Industrial <strong>Quality</strong><br />
Solutions<br />
Herr Dr. Zarnetta, wie alt ist eigentlich<br />
das Problem der unzureichenden<br />
Tiefenschärfe?<br />
So alt wie die Mikroskopie, 175 Jahre.<br />
Der Konflikt ist begründet in den Gesetzen<br />
der Optik. Mit steigender Vergrößerung<br />
sinkt die Tiefenschärfe, das<br />
ist einfach so.<br />
Und warum mussten wir so lange<br />
warten, bis es endlich eine Lösung<br />
für dieses Problem gibt?<br />
Weil keiner die Gesetze der Optik brechen<br />
kann, wir können Sie nur umgehen.<br />
Und das erfordert in diesem Fall<br />
über 15 Jahre Forschung und Entwicklung,<br />
moderne Halbleiterfertigung<br />
und Rechner der neuesten Generation.<br />
Nur so lassen sich die immensen<br />
Datenmengen schnell genug<br />
verarbeiten.<br />
Was war die eigentliche Herausforderung<br />
bei der Lösung des Problems?<br />
Im direkten Vergleich wird deutlich, welche Erleichterung die<br />
erweiterte Tiefenschärfe dem Mitarbeiter beschert.<br />
Bild: Zeiss<br />
Ein ganz aktueller Anwendungsfall ist die Inspektion<br />
von Injektionsnadeln. „Jeder von uns wird hoffentlich<br />
bald Bekanntschaft mit so einer Nadel machen“,<br />
sagt Zarnetta. „Da ist uns allen daran gelegen,<br />
dass die sauber geschliffen sind und wir bei der Impfung<br />
keinen Schmerz verspüren.“ Die Nadeln werden<br />
deshalb einer stringenten Qualitätskontrolle unterzogen.<br />
Früher musste der Mitarbeiter die feine Probe<br />
immer so lange führen, bis er endlich jedes Detail<br />
scharf gesehen hatte und er sagen konnte, dass alles<br />
38 <strong>Quality</strong> <strong>Engineering</strong> » 03|2021
„Die Technik ist ausgereift und sehr robust“<br />
Eindeutig die Hardware. Insbesondere<br />
die Herstellung der Mikro-Spiegel war<br />
eine Herausforderung . Diese müssen<br />
sich in alle Raumrichtungen bewegen<br />
können, also Drehen nach vorne und<br />
hinten, links und rechts und Verschieben<br />
nach oben und unten. Die Spiegelelemente<br />
müssen quasi freischwebend<br />
gelagert werden. Nur so lassen<br />
sie sich individuell ansteuern und bewegen.<br />
Wie viele Mikro-Spiegel sind es<br />
überhaupt?<br />
Das hängt vom Design ab, aber es<br />
sind Hunderte. Jeder Mikro-Spiegel<br />
hat nur eine Fläche von 0,1 mal 0,1<br />
Millimeter.<br />
Die schnelle Ansteuerung der einzelnen<br />
Spiegel ist sicher auch nicht<br />
einfach.<br />
Kann man so sagen. Damit die einzelnen<br />
Spiegelelemente verschiedene<br />
optische Oberflächen bilden können,<br />
die eine perfekte Abbildung der Probe<br />
ermöglichen, müssen diese präzise<br />
ausgerichtet werden. Kleinste<br />
Schwankungen im Produktionsprozess<br />
der Spiegel sind grundsätzlich nicht<br />
zu vermeiden, so dass jedes Element<br />
separat kalibriert und dann auch individuell<br />
angesteuert wird.<br />
Was ist das eigentlich Revolutionäre<br />
am Visioner 1?<br />
Es gibt schon lange die Möglichkeit,<br />
tiefenscharfe Bilder durch die Verrechnung<br />
von Bildern zu erhalten, die<br />
mit unterschiedlichen Fokusebenen<br />
aufgenommen wurden. Das dauert allerdings<br />
mehrere Sekunden bis Minuten,<br />
ist also für die Inspektion von<br />
Bauteilen nicht zu gebrauchen. Der<br />
Visioner 1 ermöglicht nun zum ersten<br />
Mal die Inspektion von kleinen Bauteilen<br />
bei hoher Vergrößerung mit erweiterter<br />
Tiefenschärfe in Echtzeit inklusive<br />
instantaner Dokumentation.<br />
Das Nachfokussieren fällt weg und es<br />
werden potenziell weniger Fehler<br />
übersehen.<br />
Der Aufbau der virtuellen Linse<br />
macht in der Phantasie einen eher<br />
filigranen Eindruck. Ist die Technik<br />
denn anfällig?<br />
Nein, denn es gibt keine mechanisch<br />
bewegten Teile. Die Spiegel werden<br />
nur elektrostatisch ausgelenkt und<br />
dabei von einer sehr dünnen, aber<br />
stabilen Membran gehalten. Entsprechende<br />
Module sind seit Jahren rund<br />
um die Uhr in Inline-Anwendungen<br />
im Einsatz. Deswegen können wir sagen,<br />
dass die Technik ausgereift und<br />
sehr robust ist.<br />
Wie sieht es aus mit Erschütterung<br />
und Temperaturschwankungen? Das<br />
sind die typischen Bedingungen, wie<br />
sie im praktischen Umfeld auftreten<br />
können.<br />
Das ist alles kein Problem. Die Spiegelelemente<br />
sind sehr klein und deswegen<br />
auch sehr leicht. Es gibt also<br />
wenig bewegte Masse, die erschüttert<br />
werden könnte. Und damit auch wenig<br />
Material für thermische Ausdehnungsunterschiede.<br />
Daher zeigen die<br />
Systeme eine hervorragende Schockbeständigkeit<br />
und sind temperaturstabil.<br />
Sie können das Digitalmikroskop<br />
problemlos in der Produktion<br />
einsetzen.<br />
Wie haben die ersten Anwender auf<br />
die neue Technik reagiert?<br />
Es ist schon faszinierend zu sehen,<br />
dass sich viele Kunden sozusagen damit<br />
abgefunden hatten, mit den Limitierungen<br />
bestehender Mikroskop-<br />
Lösungen auf immer zu leben. Wir<br />
übrigens auch. Deswegen sind sie nun<br />
um so überraschter, dass es auf einmal<br />
eine Lösung für das Problem gibt.<br />
Damit hatte keiner wirklich gerechnet.<br />
Für viele ergeben sich plötzlich<br />
völlig neue Möglichkeiten, ihre Inspektionsaufgaben<br />
anzugehen und effektiver<br />
zu arbeiten.<br />
in Ordnung ist. „Beim Visioner 1 hält er die Nadel<br />
drunter, bekommt das komplette Bild und macht einen<br />
Haken dran“, fasst Zarnetta zusammen.<br />
Zum neuen Digitalmikroskop liefert Zeiss ein workflow-orientiertes<br />
Softwaresystem, das die Inspektion<br />
und Dokumentation deutlich vereinfachen soll. Das<br />
ist besonders relevant für stark regulierte Branchen<br />
mit umfangreichen Nachweispflichten wie der Automobilbau,<br />
die Luft- und Raumfahrt oder die Medizintechnik.<br />
Diese Branchen sind darauf angewiesen,<br />
dass GxP-Richtlinien eingehalten werden. „Mit unserem<br />
neuen Produkt lösen wir ein fundamentales Problem<br />
in der Mikroskopie“, fasst Robert Zarnetta zusammen.<br />
„Damit unmittelbar verbunden ist ein praktischer<br />
Nutzen für unsere Kunden, denn sie können<br />
mit der neuen Technik die Produktivität steigern und<br />
sie haben eine höhere Gewissheit bei ihren Inspektionsergebnissen.“<br />
<strong>Quality</strong> <strong>Engineering</strong> » 03|2021 39
Bild: Polytec/ssguy/www.shutterstock.com<br />
3D-Messung der Oberflächenrauheit mit Weißlicht-Interferometrie<br />
Im Takt der Produktion<br />
Weißlicht-Interferometer bieten kurze Messzeiten und eine hohe<br />
Reproduzierbarkeit. Sie arbeiten zudem berührungslos. Diese Vorteile lassen<br />
sich jetzt auch bei Messungen der Oberflächenrauheit direkt in der laufenden<br />
Fertigung nutzen, etwa für die Qualitätskontrolle oder Prozessüberwachung.<br />
Die Interferometrie ist eine sehr genaue<br />
Messmethode, die je nach<br />
Konfiguration ganz unterschiedliche Aufgaben<br />
lösen kann. Der Abstand von der<br />
Erde zum Mond beispielsweise lässt sich<br />
ebenso mit hoher Genauigkeit bestimmen<br />
wie die Oberflächenrauheit industrieller<br />
Bild: Polytec<br />
Dr. Özgür Tan<br />
strategisches Produktmarketing<br />
optische<br />
Messsysteme<br />
Polytec<br />
www.polytec.com<br />
Produkte mit Auflösungen im Nanometerbereich.<br />
Letztere spielt bei vielen Produkten<br />
eine wichtige Rolle, da sie sowohl mechanisches<br />
als auch elektrisches oder<br />
chemisches Verhalten beeinflussen können.<br />
Informationen über die Ebenheit<br />
oder Rauheit bilden deshalb eine wichtige<br />
Grundlage für Optimierungen und geben<br />
Auskunft über die Produktqualität. Mit ihrer<br />
Hilfe lassen sich zum Beispiel Reibung<br />
erhöhen oder vermindern, Verschleiß minimieren,<br />
die Unempfindlichkeit gegenüber<br />
äußeren Einflüssen steigern oder die<br />
Leitfähigkeit verbessern. Sie kann sogar<br />
zur Prozessüberwachung genutzt werden,<br />
denn geometrische Oberflächeneigenschaften<br />
liefern auch Hinweise auf Werkzeugverschleiß,<br />
optimierungsbedürftige<br />
Maschinenparameter oder Vibrationen.<br />
Die Produktoberfläche wird dadurch<br />
quasi zum „Fingerabdruck“ des Herstellungsprozesses.<br />
Dabei lässt sich eine Höhenauflösung<br />
bis zu 0,1 nm realisieren.<br />
Das ist deutlich besser als bei anderen op-<br />
tischen Messmethoden. Im Gegensatz zu<br />
Verfahren mit Fokus-Variation oder konfokaler<br />
Mikroskopie bleibt bei Weißlicht-<br />
Interferometern die hohe laterale Auflösung<br />
auch bei Messfeldern von einigen<br />
Quadratzentimetern Größe erhalten.<br />
Moderne Weißlicht-Interferometer<br />
nutzen die Interferenzeffekte, die bei der<br />
Überlagerung des vom Messobjekt reflektierten<br />
Lichts mit einem Referenzsignal<br />
auftreten. Das Messverfahren basiert auf<br />
dem Prinzip des Michelson-Interferometers,<br />
wobei der optische Aufbau eine<br />
Lichtquelle mit einer Kohärenzlänge im<br />
Mikrometer-Bereich enthält. An einem<br />
Strahlteiler wird der kollimierte – also gerade<br />
gerichtete beziehungsweise parallelisierte<br />
– Lichtstrahl in Mess- und Referenzstrahl<br />
aufgeteilt. Der Messstrahl trifft<br />
das Messobjekt, der Referenzstrahl einen<br />
Spiegel. Das vom Spiegel und Messobjekt<br />
jeweils zurückgeworfene Licht wird am<br />
Strahlteiler überlagert und auf eine Kamera<br />
abgebildet. Stimmt der optische<br />
40 <strong>Quality</strong> <strong>Engineering</strong> » 03|2021
Bildverarbeitung « SPECIAL<br />
Inline-Anwendungen in der Fertigung<br />
erfordern hohe Genauigkeit und möglichst<br />
kurze Messzeiten. Das neue<br />
Topmap Rapid View erfüllt hier die<br />
sehr hohen Anforderungen.<br />
Der optische Aufbau<br />
eines Weißlichtinterferometers<br />
Weg für einen Objektpunkt im Messarm<br />
mit dem Weg im Referenzarm überein,<br />
kommt es für alle Wellenlängen im Spektrum<br />
der Lichtquelle zu einer konstruktiven<br />
Interferenz. Das Kamerapixel des betreffenden<br />
Objektpunkts hat dann die<br />
maximale Intensität. Für Objektpunkte,<br />
die diese Bedingung nicht erfüllen, hat<br />
das zugeordnete Kamerapixel eine niedrigere<br />
Intensität.<br />
Geräte mit telezentrischem Aufbau erlauben<br />
damit eine simultane Vermessung<br />
mehrerer Punkte und erfassen so die Topografie<br />
großer Flächen in einem einzigen<br />
Messvorgang und innerhalb einer kurzen<br />
Messzeit. Wenn dagegen eine hohe laterale<br />
Auflösung gefordert ist, bieten sich<br />
mikroskopbasierte Systeme an, bei denen<br />
der optische Aufbau samt dem Referenzarm<br />
in das Objektiv integriert ist.<br />
Inline-Messtechnik ist schnell,<br />
präzise und flexibel integrierbar<br />
Mit den Weißlicht-Interferometern der<br />
Topmap-Familie bietet Polytec für unterschiedliche<br />
Anwendungsfelder bereits seit<br />
etlichen Jahren passende Messsysteme<br />
an. Typische Anwendungen sind Ebenheits-<br />
oder Wölbungsmessungen oder die<br />
Detektion von Formabweichungen. Die<br />
mikroskopbasierten Ausführungen Micro<br />
View und Micro View+ bieten eine besonders<br />
hohe laterale Auflösung und das<br />
dank spezieller Scanning-Technologie<br />
(Continous Scanning Technology) über<br />
den gesamten vertikalen Messbereich von<br />
100 mm. Damit sind sehr detaillierte<br />
Messungen möglich, etwa um Mikrostrukturen<br />
auf Waferoberflächen zu detektieren,<br />
die Mikrostrukturen bei Druckverfahren<br />
zu analysieren oder um Oberflächenrauheiten<br />
optischer Komponenten<br />
zu bestimmen.<br />
Insbesondere für die Anwendungen in<br />
der laufenden Fertigung, wo hohe Genauigkeit<br />
und möglichst kurze Messzeiten gefordert<br />
sind, hat Polytec die Produktfamilie<br />
um Topmap Rapid View erweitert. Je<br />
nach Aufgabe und Messbereich sind<br />
Messzeiten im Sekundenbereich realisierba.<br />
Bei einem Höhenmessbereich von<br />
400 μm eignet sich das mikroskopbasierte<br />
System mit seiner hohen lateralen Auflösung<br />
für präzise Inline-Rauheitsmessungen.<br />
Gescannt wird in Echtzeit unter Nutzung<br />
komplexer Algorithmen auf Grafikkarten.<br />
Verkleinert man das Bildfeld, kann<br />
die Bildwiederholungsfrequenz bis auf<br />
3 kHz beschleunigt werden. Das Weißlicht-Interferometer<br />
erkennt feinste Oberflächenstrukturen<br />
und hält mit schnellen<br />
Fertigungstakten Schritt. Da es sehr kompakt<br />
baut, lässt es sich gut in die Fertigungslinie<br />
integrieren. Der Messkopf kann<br />
zudem wie ein Sensor separat montiert<br />
und damit flexibel positioniert werden.<br />
Dank vieler Exportmöglichkeiten können<br />
die 3D-Messdaten der Weißlicht-Interferometer<br />
mit jeder geeigneten Auswertesoftware<br />
bearbeitet werden.<br />
Besonders einfach und praxisgerecht<br />
wird der Umgang<br />
allerdings mit der speziell<br />
für diese Polytec-Topografie-<br />
Messsysteme entwickelten TMS<br />
Software, die zahlreiche Möglichkeiten<br />
bietet, um die Messergebnisse<br />
zügig und ISO-konform<br />
auszuwerten. „Messrezepte“<br />
beispielsweise erleichtern<br />
Routineaufgaben. Hier lassen<br />
sich die Einstellungen für die<br />
Datenaufnahme – zum Beispiel<br />
Messposition, Beleuchtungsein-<br />
Bild: Polytec<br />
stellungen, Kameraparameter – zusammen<br />
mit Auswerteparametern (wie etwa Nachbearbeitungsschritte,<br />
Visualisierungs- oder<br />
Exportmöglichkeiten) für spezielle Messaufgaben<br />
definieren und abspeichern. Somit<br />
werden aus komplexen Oberflächenanalysen<br />
einfache Ein-Klick-Lösungen. Das<br />
spart besonders im Produktionsumfeld<br />
Zeit, vermeidet Bedienfehler und auch<br />
Nicht-Fachleute können mit den Messsystemen<br />
arbeiten. Die Bauteillage innerhalb<br />
des Messfelds wird automatisch erfasst<br />
und der Bediener kann die Messung mit einem<br />
einfachen Mausklick starten. Darüber<br />
hinaus sind Änderungen innerhalb eines<br />
vorhandenen Rezepts mit einem zusätzlichen<br />
Tool einfach zu überwachen. So lassen<br />
sich erwünschte und unerwünschte<br />
Änderungen leicht nachvollziehen, was einen<br />
wesentlichen Beitrag zur Nachverfolgbarkeit<br />
der Produktion leisten kann.<br />
Webhinweis<br />
Zu den Hintergründen der Entwicklung<br />
der Topmap-Produktfamilie und<br />
warum ein Friseur für die Produkteinführung<br />
notwendig war, berichtet Özgür<br />
Tan in diesem Video von Polytec:<br />
http://hier.pro/NWhsp<br />
<strong>Quality</strong> <strong>Engineering</strong> » 03|2021 41
SPECIAL » Bildverarbeitung<br />
Akustische Kameras für die Schallvisualisierung<br />
Daher kommt der Lärm<br />
70 dB oder 7 Bel daueräquivalenter Schalldruckpegel ist jener Grenzwert, der<br />
für den Menschen als langfristig gesundheitsschädigend gilt. Nicht nur deshalb<br />
ist es wichtig, die Geräusche von Produkten zu überprüfen. Möglich ist das<br />
durch die Visualisierung des Schalls mit Hilfe akustischer Kameras.<br />
Die Schallvisualisierung<br />
mit dem Sound<br />
Scanner P132 von<br />
Seven Bel ermöglichte<br />
eine schnellere Inbetriebnahme<br />
einer Sondermaschine<br />
von Fill.<br />
Bild: Seven Bel<br />
Michael Andessner<br />
Chief Sales Officer<br />
Seven Bel<br />
www.sevenbel.com<br />
Akustische Kameras zur Schallvisualisierung kosten<br />
bislang viel, sind nur begrenzt mobil einsatzfähig<br />
und ohne Expertenwissen nur schwer zu<br />
bedienen. Eine neue Technologie von Seven Bel beseitigt<br />
viele dieser Problemstellungen, während keine<br />
Abstriche in der Bildqualität gemacht<br />
werden. Ein beweglicher Sensor scannt<br />
dabei das Schallfeld auf einer Kreisfläche<br />
ab. Durch das Zusammenspiel von<br />
Rotation und Software können mit nur<br />
Bild: Seven Bel<br />
fünf verbauten Mikrofonen bis zu 480<br />
virtuelle Mikrofonpositionen simuliert<br />
werden, die zu hochgenauen Mess -<br />
ergebnissen beitragen. Vergleichbare<br />
Geräte sind in der Regel mit knapp über<br />
100 Mikrofonen ausgestattet.<br />
Nach dem Messvorgang werden in<br />
der dazugehörigen mobilen App Schallquellen<br />
sowie akustisch problematische<br />
Stellen ähnlich wie bei einer Wärmebildkamera auf<br />
dem Foto oder Video angezeigt. Die akustischen Bilder<br />
können direkt am Handy des Anwenders analysiert<br />
und mit Kollegen, Partnern oder Kunden in Form<br />
von automatisch generierten Berichten geteilt werden.<br />
Bei Entwicklung des Messsystems hat Seven Bel<br />
speziell darauf Wert gelegt, dass der Anwender<br />
schnell zu Ergebnissen gelangt. Bis akustische Messergebnisse<br />
vorliegen, dauert es mit den Instrumenten<br />
inklusive Aufbauzeit für das Messsystem weniger als<br />
3 min. Weitere Alleinstellungsmerkmale sind die hohe<br />
Bildqualität sowie die Einfachheit, mit der das<br />
System zu bedienen ist. Zusätzlich sprechen Mobilität<br />
und die hohe Kostenattraktivität im Vergleich zu<br />
Konkurrenzprodukten für Seven Bel. Die Sound Scanner<br />
stehen in zwei Größen zur Verfügung: Die längere<br />
Variante, der Sound Scanner P132, liefert zuverlässige<br />
Messergebnisse besonders bei tieffrequentem<br />
Schall von industriell relevanten Applikationen. Der<br />
42 <strong>Quality</strong> <strong>Engineering</strong> » 03|2021
Sound Scanner P50, die kürzere Variante, lässt sich<br />
auch in räumlich beengten Verhältnissen wie zum<br />
Beispiel in Fahrzeugkabinen einsetzen.<br />
„Immer wieder sind Kunden erstaunt darüber, wie<br />
schnell und genau Schallquellen durch unsere Technologie<br />
identifiziert und analysiert werden können“,<br />
sagt Seven-Bel-Geschäftsführer Thomas Rittenschober.<br />
Der wirtschaftliche Nutzen akustischer Bilder für<br />
Anwender ist enorm. Oft werden in der Produktentwicklung<br />
in Form von langwierigen Trial-and-Error<br />
Prozessen Wochen damit verbracht, Lärmprobleme in<br />
den Griff zu bekommen.<br />
Kann man Schallquellen jedoch<br />
orten, so wissen die<br />
Verantwortlichen sofort,<br />
wo man ansetzen muss, um<br />
die jeweils passende Lösung<br />
zu finden. Auch im<br />
Bereich Qualitätskontrolle<br />
und Instandhaltung ist das<br />
Messsystem einsetzbar: So können akustische<br />
Schwachstellen an Produkten in der Fertigung einfach<br />
lokalisiert und entsprechende Maßnahmen abgeleitet<br />
werden.<br />
»An zwei Schallquellen<br />
hätten selbst unsere<br />
erfahrensten Techniker<br />
nie gedacht.«<br />
Matthias Gamisch, Fill<br />
Unbekannten Geräuschen in der<br />
Maschine auf der Spur<br />
Das Beispiel des oberösterreichischen Spezialmaschinenbauers<br />
Fill zeigt, wie sich mit dem akustischen<br />
Messsystem Zeit und Kosten einsparen lassen. Bei Maschinen,<br />
die Profile aus Aluminium produzieren, verstärken<br />
Hohlräume in den Profilen Schwingungen<br />
manchmal auf eine höchst eigenwillige Art. Die Geräusche,<br />
die dabei entstehen, sind zwar deutlich hörbar,<br />
doch lassen sie sich oft nicht genau orten. Matthias<br />
Gamisch, Sales Manager bei Fill, hat erst unlängst<br />
einen solchen Fall erlebt: Während der Abnahme<br />
machte die Maschine ein Geräusch, das niemand<br />
identifizieren konnte. Leise, aber doch klar wahrnehmbar.<br />
Ausgerechnet dieser Kunde wünschte aber aufgrund<br />
der räumlichen Gegebenheiten in seiner Fabrik<br />
eine maximale Lärmreduktion. „Für solche Fälle gibt es<br />
eigentlich eine simple Standardlösung: Man umhüllt<br />
die gesamte Maschine mit einer Schallschutzverkleidung<br />
und die Sache ist erledigt“, so Gamisch.<br />
Die Verkleidung braucht allerdings Platz, was in<br />
beengten Produktionshallen zu einem Problem werden<br />
kann. Bei der Maschine, die Fill lieferte, war eine<br />
Ummantelung aber noch aus einem anderen Grund<br />
keine Option: Zu einem der wichtigen Features der<br />
Maschine gehört nämlich ein Fenster, das Einblick in<br />
ihr Inneres erlaubt, ein Spezialwunsch des Kunden.<br />
Bei einer Schutzverkleidung hätte das Fenster mit<br />
verkleidet werden müssen. Für Fälle, wo eine Verkleidung<br />
nicht in Frage kommt, gibt es natürlich auch eine<br />
Lösung. Die ist allerdings mehr als aufwendig:<br />
Man baut auf mehr oder minder begründeten Verdacht<br />
Komponenten aus, prüft, ob sie möglicherweise<br />
den Schall verursachen, baut sie wieder ein, baut<br />
die nächsten aus, bis man den Fehler findet. Oder<br />
auch nicht. Man kann auch versuchen, mit einem<br />
Mikrofon über die Maschine streichen, das Geräusch<br />
aufnehmen und hoffen, dass dort, wo das Geräusch<br />
am lautesten ist, sich auch tatsächlich die Schallquelle<br />
befindet. „Das funktioniert leider sehr bedingt,<br />
denn Schall wird sehr leicht<br />
abgelenkt und dringt nur<br />
selten von der Stelle, an der<br />
er entsteht, direkt nach außen“,<br />
erklärt Gamisch.<br />
Zum Glück kannte er eine<br />
Alternative: den Einsatz<br />
von akustischen Kameras.<br />
„Wir hatten schon vorher<br />
losen Kontakt zu Seven Bel. Jetzt kam der Moment,<br />
um deren Sound Scanner einmal in einer Reallife-Situation<br />
auszuprobieren.“ Das Ergebnis war gleich<br />
mehrfach eine Überraschung. Innerhalb eines Nachmittags<br />
waren die vier entscheidenden Schallquellen<br />
identifiziert. Vor allem aber: „Zwei davon hätten wir<br />
vielleicht auch ohne die Kamera gefunden, die waren<br />
letztlich logisch. Aber an die zwei anderen hätten<br />
selbst unsere erfahrensten Techniker nie gedacht“, so<br />
Garmisch Die Zeitersparnis war immens: Nach rund<br />
einer Woche, in der die ungewünschten Schallquellen<br />
durch eine verbesserte Konstruktion ausgeschalten<br />
wurden, kam die Akustikkamera von Seven Bel<br />
noch einmal zum Einsatz, und dokumentierte auch<br />
für den Kunden, dass nun alles in grünem Bereich<br />
war. Der Fall konnte somit nach nicht einmal zwei<br />
Wochen als gelöst ad acta gelegt werden.<br />
Intelligent Testing<br />
Für Ihre kleinen großen<br />
Herausforderungen<br />
www.zwickroell.com<br />
zwickiLine bis 5 kN<br />
Manchmal sind es die kleinen Details die den Unterschied<br />
ausmachen. Egal wie klein oder groß die Prüfherausforderung<br />
ist, die Prüfmaschine zwickiLine eignet sich für<br />
die Forschung und Entwicklung genauso hervorragend<br />
wie für die laufende Qualitätssicherung.<br />
<strong>Quality</strong> <strong>Engineering</strong> » 03|2021 43
SPECIAL » Bildverarbeitung<br />
Prüfung von Mund-Nasen-Schutzmasken<br />
Smart und sofort einsatzbereit<br />
Ein Hersteller von FFP2-Schutzmasken setzt seit Kurzem das autonome Bildverarbeitungssystem<br />
S70 von Inspekto für die Qualitätsprüfung ein. Das mit KI<br />
ausgerüstete System stellt sicher, dass die Masken den Spezifikationen entsprechen<br />
und die Fertigungslinie während der Produktion nicht beschädigt wird.<br />
Bei der nun realisierten Qualitätsprüfung von<br />
FFP2-Schutzmasken bestand die Aufgabe darin, Fehler<br />
an den mit Ultraschall geschweißten Masken, am<br />
metallischen Nasenbügel, am Firmen- und CE-Logo<br />
sowie an den verschweißten Bändern sicher zu erkennen.<br />
Die Inspektion des metallischen Nasenbügels<br />
ist dabei von entscheidender Bedeutung, da defekte<br />
Metallstreifen die Schneidemaschine in der Produktionslinie<br />
dauerhaft beschädigen könnten.<br />
Fehler an den mit Ultraschall<br />
geschweißten<br />
Masken, am metallischen<br />
Nasenbügel, am<br />
Firmen- und CE-Logo<br />
sowie an den verschweißten<br />
Bändern<br />
werden sicher erkannt.<br />
Peter Stiefenhöfer<br />
im Auftrag von<br />
Inspekto<br />
www.inspekto.com<br />
Bild: Inspekto<br />
Univent Medical ist ein deutscher Hersteller von<br />
FFP2-Mund-Nasen-Schutzmasken mit Sitz in<br />
Villingen-Schwenningen. Um die Qualität der Masken<br />
in einer neuen Produktionslinie sicherzustellen,<br />
nutzt das Unternehmen das System S70 von Inspekto.<br />
Dieses ist laut Anbieter das erste eigenständige,<br />
sofort einsatzbare Bildverarbeitungssystem zur industriellen<br />
Qualitätssicherung. Im Gegensatz zu herkömmlichen<br />
Bildverarbeitungslösungen, die maßgeschneidert<br />
sind und einen komplexen, langen und<br />
zeitaufwändigen Integrationsprozess erfordern, ist<br />
S70 ein vollständig konfiguriertes Gerät, das sofort<br />
einsatzbereit ist und nur die Integration in die Produktionslinie<br />
erfordert.<br />
Diese Eigenschaft macht das Produkt<br />
ideal für Hersteller, die schnell eine zuverlässige<br />
Lösung für die Qualitätssicherung<br />
benötigen, ohne die Vorlaufzeiten<br />
herkömmlicher Bildverarbeitungsprojekte<br />
abwarten zu müssen, deren Entwicklung<br />
und Integration häufig mehrere<br />
Wochen oder sogar Monate dauert.<br />
System muss sich einfach<br />
bedienen lassen<br />
„Eine manuelle Inspektion weist unweigerlich eine<br />
sehr hohe Fehlerrate auf, was bei der Produktion von<br />
kritischen Schutzausrüstungen wie Mund-Nasen-<br />
Schutzmasken nicht akzeptabel ist“, erklärt Jürgen<br />
Eichinger, Betriebsleiter bei Univent Medical. „Qualität<br />
steht im Mittelpunkt unserer gesamten Fertigung.<br />
Deshalb benötigten wir eine flexible Bildverarbeitungslösung,<br />
die schnell einzurichten und einfach<br />
zu bedienen ist. Mit Inspekto haben wir den idealen<br />
Partner für diese Aufgabe gefunden.“<br />
S70 arbeite dabei nicht produktspezifisch, sondern<br />
lerne die Eigenschaften eines neuen Produkts autonom<br />
in etwa einer Stunde aus nur 20 Gutteilen, wie<br />
Vanessa Pfau berichtet, Managerin für den Inspekto-<br />
Standort in Deutschland. Alle Anomalien würden danach<br />
während der Inspektion angezeigt.<br />
Zusätzlich zu dem durch das Zeigen von Gutteilen<br />
erzeugten Toleranzraum hat der Anwender die Möglichkeit,<br />
Grenzmuster nachlernen zu lassen, die noch<br />
zulässig sind, aber vom Idealzustand abweichen. Dieses<br />
Nachlernen ist sehr einfach möglich, da weder<br />
zusätzliche Hardware noch Software benötigt wird,<br />
und eine Anpassung in unter einer Minute möglich<br />
ist. Diese Optimierung kann auch retrospektiv durchgeführt<br />
werden, da Bilder der Inspektionen lokal vorgehalten<br />
werden. Das erlaubt dem Anwender, das<br />
System schon innerhalb einer Stunde nach Erhalt<br />
produktiv zu nutzen.<br />
Bei Univent Medical haben diese Möglichkeiten<br />
der Technologie zu positiven Ergebnissen geführt.<br />
Mit dem System lässt sich eine genaue und zuverläs-<br />
44 <strong>Quality</strong> <strong>Engineering</strong> » 03|2021
Incircuit-Funktionstestsysteme,<br />
Adaptionen, Kabeltester<br />
sige Qualitätssicherung durchführen. Masken, die<br />
Defekte in den untersuchten Bereichen oder fehlerhafte<br />
Metallstreifen aufweisen, werden zuverlässig<br />
erkannt.<br />
Drei parallel arbeitende KI-Module<br />
sorgen für schnelle Anpassung<br />
S70 arbeitet dabei auch mit künstlicher Intelligenz<br />
(KI). Das System umfasst drei unabhängige, parallel<br />
arbeitenden KI-Module, die nicht jeweils neu konstruiert<br />
werden müssen, sondern bereits auf dem<br />
System vorhanden sind. Mit dieser Systemarchitektur<br />
ist es möglich, die Inspektion durch das bloße Zeigen<br />
von Gutteilen anzupassen und sofort einzusetzen.<br />
Zudem wird künstliche Intelligenz auch zur optischen<br />
Einrichtung und der Lageerkennung eingesetzt.<br />
Daher können auch Benutzer, die über keine<br />
Kenntnisse industrieller Bildverarbeitung verfügen,<br />
das System erfolgreich in der Produktion platzieren.<br />
»S70 lernt die<br />
Eigenschaften eines<br />
neuen Produkts autonom<br />
in etwa einer Stunde<br />
aus nur 20 Gutteilen.«<br />
Vanessa Pfau, Inspekto<br />
WINGS-FERNSTUDIUM<br />
Testsysteme für elektronische Flachbaugruppen,<br />
Module und Geräte für die Qualitätssicherung<br />
Incircuit- und Funktionstest, Boundary Scan,<br />
Mehrfachnutzentest, Paralleltest (auch Flashen),<br />
Displaytest, EOL<br />
praxisnahe und anwenderfreundliche Testprogrammerstellung,<br />
hohe Prüfschärfe und Prüftiefe<br />
breitestes Spektrum an Produkten für das automatische<br />
Testen aus eigener Entwicklung<br />
Stand-alone und Inline-Einsatz<br />
manuelle und pneumatische Adaptionen<br />
Niederhaltersysteme für bis zu 1000 gefederte<br />
Kontaktstifte<br />
austauschbare Adapterplatten (Nadelbett)<br />
langlebig und geringe Folgekosten<br />
MCT192 Kabel- und Backplanetester mit 192<br />
Messkanälen<br />
Teststecker für viele gängige Kabel<br />
optionales Lochrasterfeld<br />
Prüfprogrammerstellung mit Autolern von einem<br />
<br />
REINHARDT<br />
System- und Messelectronic GmbH<br />
Bergstr. 33 D-86911 Diessen Tel. 08196 934100 Fax 08196 7005<br />
E-Mail: info@reinhardt-testsystem.de http://www.reinhardt-testsystem.de<br />
1773770-3.indd 1 26.04.21 11:21<br />
Ein Zusatznutzen ist die Möglichkeit, spontane Adhoc-Prüfungen<br />
schnell und sicher implementieren zu<br />
können, um akute Produktionsprobleme zu analysieren<br />
oder Änderungen am Produktionsprozess zu bewerten.<br />
Aufgrund der autonomen Architektur unterstützt<br />
das S70 hierbei sowohl den Inline- als auch<br />
den Offline-Betrieb.<br />
„Wir sind sehr stolz darauf, Teil der Bemühungen<br />
zu sein, die enorme Nachfrage nach hochwertigen<br />
Schutzmasken in diesen turbulenten Zeiten zu befriedigen“,<br />
sagt Ofer Nir, CEO von Inspekto. „Eines der<br />
Ziele von Inspekto ist es, allen kleinen und großen<br />
Herstellern solcher Schutzausrüstungen eine erstklassige<br />
automatisierte Lösung für ihre Qualitätssicherung<br />
zu ermöglichen.“<br />
Die Anlage bei Univent Medical wurde mit Mitteln<br />
der Deutschen Bundesregierung entwickelt. „Mit S70<br />
war es sehr schnell möglich, die Eigenschaften von<br />
FFP2-Masken anzutrainieren“, so Vanessa Pfau. „Bei<br />
künftigen Produktionswechseln sind diese Systeme<br />
jedoch in der Lage, auch völlig andere Produkte zu<br />
prüfen.“<br />
Master <strong>Quality</strong> Management<br />
Technisches QM für Ingenieure<br />
<br />
<br />
9 Studienstandorte bundesweit<br />
Master of <strong>Engineering</strong> (M.Eng.)<br />
Das Original seit 2008.<br />
wings.de/mqm<br />
<strong>Quality</strong> <strong>Engineering</strong> » 03|2021 45
Pharmazeutische Gummistopfen<br />
werden als<br />
sicherer Verschluss für<br />
Ampullen verwendet.<br />
Bild: Simac Masic<br />
Qualitätskontrolle von Verpackungskomponenten für Pharmaprodukte<br />
Kameraverbund prüft in High-Speed<br />
Die Inspektionssysteme von Simac Masic sichern die Qualität von<br />
Gummistopfen und Kolben, die für Arzneimittelfläschchen und Spritzen<br />
verwendet werden. Die eingesetzte Bildverarbeitungstechnik wurde gemeinsam<br />
mit Stemmer Imaging entwickelt und ermöglicht eine 100-Prozent-Kontrolle von<br />
mehr als 700 Objekten pro Minute.<br />
Denis Bulgin<br />
im Auftrag von<br />
Stemmer Imaging<br />
www.stemmer-imaging.com<br />
Jahr für Jahr werden für die pharmazeutische Industrie<br />
enorme Mengen an Gummistopfen und<br />
Kolben in verschiedensten Größen aus den unterschiedlichsten<br />
Elastomeren hergestellt. Diese Stopfen<br />
dienen zum Verschließen von Arzneimittelfläschchen<br />
und werden mit einer Aluminiumkappe fixiert.<br />
Dabei handelt es sich um Hohlstopfen, durch<br />
den zur Entnahme des Medikaments<br />
eine Spritzennadel<br />
eingeführt wird.<br />
Eine der wichtigsten Anforderungen<br />
in der pharmazeutischen<br />
Industrie ist<br />
sicherzustellen, dass diese<br />
Komponenten keinerlei Defekte<br />
oder Verunreinigungen aufweisen. Die vollautomatischen<br />
Inspektionssysteme der IM-Serie des<br />
»Die Fehler -<br />
erkennungsrate liegt<br />
bei über 99 %.«<br />
Roberto Griguoli, Simac Masic<br />
niederländischen Unternehmens<br />
Simac Masic wurden speziell für<br />
diese Aufgabenstellung konzipiert.<br />
Dabei werden High-Speed-Bildverarbeitungssysteme<br />
mit mehreren<br />
Kameras eingesetzt, die in Zusammenarbeit<br />
mit Stemmer Imaging<br />
entwickelt wurden. Die Systeme<br />
der IM-Serie sind für die Qualitätskontrolle von<br />
Gummistopfen und Kolben und für den Einsatz in einer<br />
Reinraumumgebung der ISO-Klasse 5 konzipiert.<br />
Sie sind modular aufgebaut und bestehen aus einem<br />
Zuführungssystem, zwei Bildverarbeitungsstationen<br />
mit Farbkameras, einem Metalldetektor, einem automatischen<br />
Probenauswurf an zwei Positionen sowie<br />
der Option zur Integration zusätzlicher<br />
Module für Dimensionsmessung<br />
und Beschichtungsprüfung.<br />
Die Prüfteile bewegen sich<br />
kontinuierlich durch die beiden<br />
Bildverarbeitungsstationen und<br />
den Metalldetektor, wobei fehlerhafte<br />
Produkte entweder nach der ersten Prüfstation<br />
oder nach der zweiten Inspektion und dem Metalldetektor<br />
automatisch ausgeschleust werden. Die Stopfen<br />
oder Kolben werden an einem Ende der Maschine<br />
zugeführt und am anderen automatisch in verschiedene<br />
Behälter für Gutteile, Schlechtteile und Stichproben<br />
sortiert. Beide Komponenten können in derselben<br />
Maschine inspiziert werden, wobei die eingesetzten<br />
Zuführungssysteme das flexible Handling<br />
vom 0,5-ml-Kolben bis hin zum Stopfen mit 32 mm<br />
46 <strong>Quality</strong> <strong>Engineering</strong> » 03|2021
Bildverarbeitung « SPECIAL<br />
Durchmesser erlauben. Das System ist in der Lage, je<br />
nach Ausführung der Komponenten mehr als als 700<br />
Objekte pro Minute zu inspizieren.<br />
Anspruchsvolle Inspektion<br />
In der ersten Bildverarbeitungsstation sind zwei<br />
hochauflösende Kameras im Einsatz, welche die<br />
Oberseite des Stopfens und die steilen Innenwände<br />
des Hohlstopfens auf Defekte wie zum Beispiel Markierungen,<br />
kosmetische Defekte, Einschlüsse, Dellen,<br />
Partikelablagerungen oder Fasern untersuchen. Die<br />
Inspektion des Hohlraums sowie der Innenwände des<br />
Stopfens ist besonders anspruchsvoll und erfordert<br />
neben einer präzisen Positionierung auch die sorgfältige<br />
Auswahl der Beleuchtung und entsprechende<br />
Objektive.<br />
Ein ähnlicher Ansatz wird für die Kolben verwendet.<br />
Da deren Hohlräume jedoch wesentlich kleiner<br />
sind, wird eine Kamera mit Weitwinkelobjektiv eingesetzt.<br />
Die Stopfen und Kolben werden aus einer Vielzahl<br />
von Elastomergemischen hergestellt. Hier sollen<br />
Farbkameras sicherstellen, dass helle Farbfehler<br />
auf hellen Produktgemischen identifiziert werden können.<br />
Ein Druckluftauswerfer bläst alle Teile, die diese<br />
Prüfung nicht bestehen, in einen Ausschussbehälter.<br />
Die zweite Prüfstation besteht aus einem kompakten<br />
Arrangement aus mehreren Kameras. Vier davon<br />
sind um das Prüfobjekt herum angeordnet, um alle<br />
Seitenflächen vollständig zu erfassen. Eine weitere<br />
Kamera ist nach unten gerichtet und bildet die Oberseite<br />
des Stopfens ab. Alle Inspektionen werden<br />
gleichzeitig ausgelöst. Zudem bietet die Kameraanordnung<br />
Platz für optionale Kameras zur Dimensionsmessung<br />
und Prüfung von Oberflächenbeschichtungen.<br />
Bewegungen lassen sich einfrieren<br />
Der hohe Prüfdurchsatz stellt besondere Anforderungen<br />
an die Bilderfassung und -verarbeitung sowie an<br />
die Datenauswertung und -speicherung. Das hochauflösende<br />
Bildverarbeitungssystem liefert kontrastreiche<br />
Bilder mit geringer geometrischer Verzerrung,<br />
so dass kleinste Defekte identifiziert werden können.<br />
Die für jede Kamera verwendeten individuellen Beleuchtungen<br />
werden im gepulsten Overdrive-Modus<br />
betrieben. Dadurch lässt sich die Bewegung der Prüfteile<br />
einfrieren, um Bildunschärfe zu vermeiden, und<br />
gleichzeitig eine ausreichende Lichtintensität für die<br />
in Hochgeschwindigkeits-Prozessen üblichen kurzen<br />
Shutter-Zeiten zu erzielen. Die Kameras sind mit<br />
leistungsstarken Windows-10-basierten Industrie-<br />
PCs vernetzt, die mit der gleichen Bildverarbeitungssoftware<br />
arbeiten, mit der auch die Anwendungen<br />
entwickelt werden.<br />
„Die Fehlererkennungsrate liegt bei über 99 %,<br />
wobei die aktuellen Inspektionsgeschwindigkeiten<br />
durch das mechanische Zuführungssystem begrenzt<br />
sind – das Bildverarbeitungssystem könnte durchaus<br />
eine höhere Inspektionsrate bewältigen“, sagt Roberto<br />
Griguoli, Manager <strong>Engineering</strong> bei Simac Masic.<br />
„Darüber hinaus können wir Zusatzmodule für die Inspektion<br />
anbieten und sind immer gerne bereit, mit<br />
unseren Kunden über ihre spezifischen Anforderungen<br />
zu sprechen und gegebenenfalls zusätzliche Anpassungen<br />
vorzunehmen. Wir bieten unseren Kunden<br />
umfassenden Support, bei Bedarf auch einen Remote-Zugriff<br />
zur Überwachung des Maschinenstatus.“<br />
Bild: Simac Masic<br />
Webhinweis<br />
Dieses Video zeigt das Inspektionssystem<br />
und die Bildverarbeitung in Aktion:<br />
http://hier.pro/GqnWQ<br />
Die IM-Serie von<br />
Simac wurde speziell<br />
zur automatisierten<br />
Inspektion von pharmazeutischen<br />
Gummistopfen<br />
entwickelt.<br />
<strong>Quality</strong> <strong>Engineering</strong> » 03|2021 47
» TECHNIK<br />
Materialprüfungen<br />
Flexibler mit zwei Achsen<br />
Die Integration einer Torsionsfähigkeit in ein axialdynamisches Prüfsystem<br />
bietet Vorteile bei der Prüfung und Modellvalidierung biomedizinischer Teile<br />
während des gesamten Konstruktionszyklus. Die Bedingungen, denen etwa<br />
Knochenschrauben später ausgesetzt sind, lassen sich so besser nachbilden.<br />
Die mechanische Charakterisierung medizinischer<br />
Knochenschrauben wird typischerweise<br />
gemäß ASTM F543 – 17 durchgeführt wird. Die Norm<br />
beschreibt die Verfahren von vier separaten Tests zur<br />
vergleichenden Bewertung der Torsions- und Zugeigenschaften<br />
von medizinischen Knochenschrauben,<br />
die zur Charakterisierung ihrer Haltbarkeit während<br />
und nach dem Einbringen dienen.<br />
Das erste Prüfverfahren dient zur Ermittlung der<br />
Torsionsstreckgrenze und des Bruchdrehmoments<br />
von Schrauben, während das zweite zur Ermittlung<br />
der maximalen Eindreh- und Ausdrehmomente verwendet<br />
wird. Dies ist entscheidend für das Verständnis<br />
der sicheren Betriebsbedingungen während der<br />
Probe und Spannvorrichtung für den<br />
Eindrehmomenttest einer medizinischen<br />
Knochenschraube in Knochenersatzmaterial<br />
im Rahmen der Prüfung<br />
nach ASTM F543.<br />
Bild: Instron<br />
Operation ohne Risiko für das Bauteil, die Werkzeuge<br />
oder den Patienten.<br />
Das dritte Verfahren bestimmt die axiale Auszugskraft<br />
und hilft dabei, die Trag- oder Klemmkapazität<br />
für die Platte zu modellieren, die damit befestigt<br />
werden soll. Test 4 in der Norm wird speziell für eine<br />
Untergruppe von selbstschneidenden Schrauben verwendet,<br />
um eine „Selbstschneidekraft“ zu ermitteln –<br />
die Kraft, die erforderlich ist, um das anfängliche<br />
„Einbeißen“ der Schraube in ein Knochenersatzmaterial<br />
zu erreichen.<br />
Insgesamt erfordert diese Gruppe von Tests verschiedene<br />
Arten der präzisen und komplexen Regelung<br />
und Messung der axialen und torsionalen Belastung.<br />
Am Beispiel der „selbstschneidenden Kraft“ bedeutet<br />
dies das Aufbringen und Messen einer variablen<br />
axialen Belastung sowie einer Rotation und eines<br />
Drehmoments. Das heißt, die Kraft, mit der die<br />
Schraube in das Knochenersatzmaterial gepresst<br />
wird, wird erhöht, während sie gleichzeitig gedreht<br />
wird, bis die Selbstschneidekraft erreicht ist. Aus der<br />
Betrachtung der Testdaten von drei Sensoren können<br />
Tests als erfolgreich oder als Misserfolg gewertet<br />
werden, wobei eine Zeitersparnis möglich ist, wenn<br />
die Testdaten live betrachtet werden können. Ein<br />
„Selbstschneiden“ liegt dann vor, wenn auf einen<br />
schnellen Abfall der Axiallast direkt ein Anstieg des<br />
Drehmomentwertes folgt, verbunden mit einem stetigen<br />
Anstieg der axialen Verschiebung.<br />
Bei anspruchsvollen Normen wie der ASTM F543<br />
würde eine einaxiale Ausführung den Einsatz von<br />
mehr als einem Prüfgerät erfordern. Mit einem vollständig<br />
regelbaren kombinierten Axial-Torsions-System<br />
kann der Benutzer jedoch nahtlos von Prüfung 1<br />
bis 4 übergehen, wobei nur eine geringfügige Anpassung<br />
der Spannvorrichtung erforderlich ist.<br />
Toby Lane<br />
Biomedizinischer<br />
Anwendungsingenieur<br />
Instron<br />
www.instron.de<br />
Bild: Instron<br />
Viele Normen schreiben Prüfungen<br />
in zwei Achsen vor<br />
Die Vielfalt der Normen und Anwendungen, die eine<br />
Prüfung in zwei Achsen zur Validierung erfordern,<br />
geht über Knochenschrauben aber weit hinaus. So<br />
gibt es zum Beispiel die ASTM F1717 für Wirbelsäu-<br />
48 <strong>Quality</strong> <strong>Engineering</strong> » 03|2021
lenkäfige, die im Körper sowohl Scherkräften als<br />
auch Zug- und Druckbelastungen ausgesetzt sind,<br />
oder auch die ISO 11608 und ISO 11040 für die Prüfung<br />
von Dosierwahlschaltern an Injektionspens und<br />
Autoinjektoren, bei denen die kombinierte biaxiale<br />
Regelung durch eine intelligente Steuerung der Aktuatorbewegung,<br />
die eine Feder im Betrieb genau<br />
nachahmt, weitergeführt wird. Darüber hinaus gibt<br />
es weitere Anforderungen für die Industrie wie etwa<br />
die ASTM D7860–1 für kindersichere und nicht-kindersichere<br />
Verpackungen wie Tablettenbehälter.<br />
Über die bloße Einhaltung von Prüfstandards hinaus<br />
können Unternehmen, die ihre interne Produktverifizierung<br />
so nah wie möglich an die Lebensdauer<br />
heranführen, die Zeit bis zur Produktfreigabe drastisch<br />
verkürzen. Einige FDA-Richtlinien zur Produktentwicklung<br />
betonen ausdrücklich die Notwendigkeit<br />
und den Nutzen eines hierarchischen Ansatzes<br />
beim Testen, Modellieren und Validieren, angefangen<br />
bei den Materialien über die Strukturelemente, bevor<br />
das gesamte Bauteil betrachtet wird. Daher haben<br />
sich viele Tests vom einfachen „Auf und Ab“ oder<br />
„Drehen nach links und rechts“ weiterentwickelt.<br />
Das Diagramm zeigt die Bedingungen eines abgeschlossenen Selbstgewindeschneidens als<br />
Teil des vierten Tests in ASTM F543. Sobald die erforderliche Axiallast erreicht ist,<br />
beginnen die Messwerte für das Drehmoment und die axiale Verschiebung gleichzeitig zu<br />
steigen, was zu einem schnellen Abfall der Axiallast führt.<br />
Prüfsysteme arbeiten<br />
ohne Hydraulik<br />
Die Integration einer Torsionsfähigkeit in ein axialdynamisches<br />
Prüfsystem, wie bei der Electropuls-Baureihe<br />
von Instron umgesetzt, bietet die Möglichkeit,<br />
die Bedingungen, denen biomedizinische Geräte im<br />
Betrieb ausgesetzt sind, besser nachzubilden. Je vielseitiger<br />
ein einzelnes Prüfsystem ist, desto besser<br />
und größer ist der Nutzen für biomedizinische Labore.<br />
Dies gilt insbesondere für elektrodynamische Systeme,<br />
die einfach über eine Steckdose angeschlossen<br />
werden und keine Hydrauliköl-Versorgung benötigen.<br />
Hydrauliköl kann viele Polymere und Beschichtungen<br />
im Labor oder auf den Prüfkörpern selbst beschädigen<br />
und ist außerdem schädlich oder giftig für Gewebe<br />
und Zellkulturen.<br />
Mit ihrem leisen, ölfreien Betrieb und ihrem geringen<br />
Platzbedarf sind die Systeme laborfreundlicher<br />
als ihre servohydraulischen Pendants. Integrierte<br />
elektrodynamische Systeme haben außerdem einen<br />
viel geringeren Energiebedarf als hydraulische Pumpen,<br />
was zu geringeren Betriebskosten und einer reduzierten<br />
CO 2<br />
-Bilanz führt. Die Möglichkeit, alle Prüfungen<br />
mit einem einzigen System durchzuführen,<br />
spart daher Zeit, Platz und Geld.<br />
Die Prüfgeräte der Electropuls-Baureihe verfügen<br />
über eine sehr hohe dynamische Leistungsfähigkeit,<br />
die mit hohen Datenerfassungsraten, adaptiven<br />
Funktionen innerhalb der Controller-Firmware und<br />
der Möglichkeit, zusätzliche Sensoren für die Aktuatorsteuerung<br />
zu verwenden, die optimale Versuchssteuerung<br />
ermöglicht. Die Rechenleistung ermöglicht<br />
außerdem, dass kundenspezifische Berechnungen für<br />
jeden Zyklus „live“ ausgeführt werden können. Dies<br />
hat Vorteile bei der Reduzierung der Notwendigkeit<br />
von Nach-Test-Arbeit, unterstützt aber auch ausgeklügelte<br />
Regelalgorithmen und nicht standardisierte<br />
Wellenformen, was bedeutet, dass die Testergebnisse<br />
viel mehr Erkenntnisse bieten können als nur grundlegende<br />
mechanische Eigenschaften.<br />
Einige Hersteller von Wearables beispielsweise haben<br />
sich dafür entschieden, Tests auf der Basis von<br />
Energieabsorptions-Feedback zu steuern. In ähnlicher<br />
Weise können spezielle Schuhe und Prothesen<br />
buchstäblich auf Herz und Nieren geprüft werden,<br />
basierend auf Aufzeichnungen der täglichen Bewegungen<br />
des Benutzers, die als Wellenformdaten verwendet<br />
werden.<br />
Webhinweis<br />
Wie sich mit Electropuls-System E3000 Tests<br />
an metallischen Knochenschrauben nach<br />
ASTM F543 durchführen lassen, erklärt Instron<br />
in diesem Video:<br />
http://hier.pro/hSbbr<br />
Bild: Instron<br />
<strong>Quality</strong> <strong>Engineering</strong> » 03|2021 49
Die Auslegung von<br />
Kegelrädern ist eine<br />
komplexe Aufgabe.<br />
Der Entwicklungsin -<br />
genieur muss dabei<br />
viele gegensätzliche<br />
Zielsetzungen berücksichtigen.<br />
Bild: Klingelnberg<br />
Betriebsfestigkeit von Zahnrädern<br />
Berechnung statt Dauerlauf?<br />
Das Prüfen der Betriebsfestigkeit ist bei Zahnrädern aufwendig. Nun lässt sich<br />
deren Lebensdauer je nach Auslegung mit einer Software berechnen. Das Tool<br />
von Klingelnberg basiert auf Forschungs- und Entwicklungsarbeiten zur<br />
Lebensdauerberechnung von Werkstoffen.<br />
Die Auslegung von Kegelrädern ist eine<br />
komplexe Aufgabe. Im Gegensatz<br />
zu Stirnrädern wird immer ein Zahnradpaar<br />
entworfen. Der Entwicklungsingenieur<br />
muss viele gegensätzliche Zielsetzungen<br />
berücksichtigen. Dazu gehören<br />
unter anderem die Mindestabmessungen,<br />
Bild: Klingelnberg<br />
Dr. Hartmuth Müller<br />
Head of Technology<br />
and Innovation<br />
Klingelnberg<br />
www.klingelnberg.com<br />
maximale Tragfähigkeit, Geräuschminderung<br />
und Herstellbarkeit auf den Maschinen<br />
in der Produktion.<br />
Ein Aspekt bleibt dabei häufig im Hintergrund:<br />
Wie ist es um die Betriebsfestigkeit<br />
des Zahnrads bestellt? Wenn die<br />
maximale Belastung auf einem Zahn<br />
nicht die Belastungsgrenzen des Werkstoffs<br />
überschreitet, kehrt der Zahn wieder<br />
in seinen Anfangszustand zurück,<br />
nachdem die Last nicht mehr anliegt. Diese<br />
Annahme ist für mehrere hundert Belastungen<br />
zutreffend. Wenn man jedoch<br />
von mehreren Millionen Belastungen<br />
spricht, dann treten Schäden an der Verzahnung<br />
bereits bei Belastungen weit unter<br />
den Belastungsgrenzen des Werkstoffs<br />
auf. Dieses Phänomen wird als Ermüdung<br />
bezeichnet. Das Prüfen der Betriebsfestigkeit<br />
ist eine zentrale Kompetenz von<br />
OEMs und Tier1-Lieferanten von Zahnrädern<br />
und erfolgt durch zeitaufwändiges<br />
Prüfen von Getrieben.<br />
Diese Prüfungen werden mit einem empirisch<br />
definierten Lastkollektiv ausgeführt,<br />
welches dieselben Schäden bewirkt,<br />
wie sie unter realen Einsatzbedingungen<br />
in der Praxis entstehen. Eine der Maschinen,<br />
die für diese Dauerlaufprüfungen an<br />
Kegelrädern eingesetzt werden, ist der<br />
Oerlikon Kegelrad-Prüfstand TS 30.<br />
Doch die Prüfung jeder Auslegung ist<br />
mit hohem Kosten- und Zeitaufwand verbunden.<br />
Daher hat Klingelnberg hat sein<br />
Softwarepaket Kimos (Klingelnberg Integrated<br />
Manufacturing of Spiral Bevel Gears)<br />
um ein Modul zur Berechnung der<br />
Lebensdauer eines Kegel- oder Hypoidradsatzes<br />
erweitert – sowohl für die Auslegung<br />
von Face Hobbing als auch von<br />
Face Milling. Das Tool basiert auf den<br />
neuesten F&E-Arbeiten zur Lebensdauerberechnung<br />
von Werkstoffen.<br />
Für die Berechnung der Betriebsfestigkeit<br />
eines Kegelrads müssen drei grundlegende<br />
Elemente bekannt sein: die präzise<br />
50 <strong>Quality</strong> <strong>Engineering</strong> » 03|2021
Form der Verzahnung, die Eigenschaften<br />
des Werkstoffs und das Laufverhalten des<br />
Radsatzes. Alle diese Elemente werden in<br />
Kimos berücksichtigt. Die Berechnung der<br />
Betriebsfestigkeit erfolgt mithilfe der Miner-Regel<br />
auf Basis der linearen Schadensakkumulationshypothese.<br />
Eine Kombination aus dem Lastkollektiv,<br />
der Belastungskonzentration auf der<br />
Zahnflankenoberfläche sowie der Biegebelastung<br />
im Zahnfuß und den zyklischen<br />
Spannungsdehnungseigenschaften des<br />
Werkstoffs ermöglichen eine Vorhersage<br />
der Schadensakkumulation eines Zahnradpaars.<br />
Wenn die Summe der Schadensakkumulation<br />
für Grübchen und Zahnbruch<br />
vorliegt, lässt sich die Lebensdauer<br />
des Kegelradsatzes durch Kimos berechnen.<br />
Um ein Lastkollektiv mit einer sehr begrenzten<br />
Anzahl an Lastfällen zu erzeugen,<br />
muss eine der Zählmethoden für die<br />
Lastzyklen verwendet werden. Wenn mit<br />
realen Lastbedingungen begonnen wird,<br />
die viele verschiedene Lastzyklen wie beispielsweise<br />
das Rainflow-Zählverfahren<br />
umfassen, können diese zyklischen Ereignisse<br />
gezählt werden. Dadurch ist es möglich,<br />
reale Einsatzbelastungszyklen mit einer<br />
stark begrenzten Anzahl an Lastfällen<br />
in ein Lastkollektiv umzuwandeln.<br />
Es stellt sich die Frage, ob die Berechnung<br />
der Lebensdauer von Zahnrädern künftig<br />
Dauerlaufprüfungen ersetzen kann. Die<br />
Antwort lautet eindeutig nein. Die Berechnung<br />
der Betriebsfestigkeit ermöglicht<br />
jedoch das sehr effektive Vergleichen<br />
verschiedener Auslegungen. Die erwartete<br />
Lebensdauer eines Zahnradpaars<br />
kann ziemlich präzise bewertet werden,<br />
wenn Daten zur Dauerlaufprüfung für eine<br />
der Auslegungen vorliegen. Deshalb<br />
befähigt Kimos den Entwicklungsingenieur,<br />
eine Auslegung zu erstellen, die<br />
nicht nur die Anforderungen hinsichtlich<br />
Geometrie und Geräuschentwicklung erfüllt,<br />
sondern auch die Ermüdungslebensdauer<br />
berücksichtigt.<br />
Ein Beispiel (siehe Bilder rechts) zeigt<br />
zwei Auslegungen mit denselben Abmessungsdaten,<br />
aber unterschiedlichen Modifikationen<br />
der Zahnflankenform. Die<br />
Zahnrad-Daten sind z=13/38 Zähne, der<br />
äußere Teilkreisdurchmesser des Tellerrads<br />
ist 250 mm und der Hypoid-Achsversatz<br />
beträgt 20 mm. Eine Auslegung hat<br />
eine Lebensdauer von circa 14.000 h, die<br />
durch die Zahnfuß-Spannung am Ritzel<br />
begrenzt ist, während die andere Auslegung<br />
eine Lebensdauer von rund 34.000 h<br />
zeigt, wobei auch hier die berechnete<br />
Ausfallursache der Zahnbruch am Ritzel<br />
sein wird.<br />
Kimos befähigt den Entwicklungsingenieur<br />
somit, nicht nur das Geräuschverhalten<br />
und die Lasttragfähigkeit, sondern<br />
vielmehr die Lebensdauer eines Radsatzes<br />
für gegebene Lastfälle zu optimieren. Dies<br />
eröffnet neue Potenziale bei der Leichtbauweise<br />
und ermöglicht effizientere und<br />
robustere Zahnradauslegungen.<br />
Vergleich verschiedener<br />
Auslegungen ist möglich<br />
Lastkollektiv und Wöhlerkurven der Verzahnung ohne und mit Zahnflankenmodifikation: Das<br />
Beispiel zeigt zwei Auslegungen mit denselben Abmessungsdaten, aber unterschiedlichen Modifikationen<br />
der Zahnflankenform. Die Zahnrad-Daten sind z=13/38 Zähne, der äußere Teilkreisdurchmesser<br />
des Tellerrads ist 250 mm und der Hypoid-Achsversatz beträgt 20 mm. Die obere<br />
Auslegung hat eine Lebensdauer von circa 14.000 h, die durch die Zahnfuß-Spannung am Ritzel<br />
begrenzt ist, während die untere Auslegung eine Lebensdauer von rund 34.000 h zeigt, wobei<br />
auch hier die berechnete Ausfallursache der Zahnbruch am Ritzel sein wird.<br />
Bild: Klingelnberg<br />
<strong>Quality</strong> <strong>Engineering</strong> » 03|2021 51
» TECHNIK<br />
Steuerplatinen für die Elektromobilität<br />
Testen unter hoher Spannung<br />
Für einen Hersteller elektronischer Thermosysteme, die für die Temperaturregulierung<br />
und Entfeuchtung im Pkw-Innenraum sowie für die Enteisung der<br />
Scheiben sorgen, hat MCD Elektronik zwei zusammengehörige Testsysteme<br />
entwickelt. Mit diesen werden die Steuerplatinen geprüft und gemessen.<br />
» Tobias Stange, Marketing Coordinator, MCD Elektronik<br />
Elektronische Thermosysteme haben<br />
mit der Elektromobilität Einzug in<br />
die Automobilbranche gehalten. Deren<br />
Steuerplatinen müssen einerseits funktional<br />
geprüft und andererseits vermessen<br />
werden, um einen dauerhaften Wirkungsgrad<br />
von bis zu 95 % zu gewährleisten.<br />
Gleichzeitig übernimmt die Steuerplatine<br />
auch das Batteriemanagement. Dabei<br />
wird die Autobatterie permanent auf Betriebstemperatur<br />
gehalten, um der Kälteempfindlichkeit<br />
bei niedrigen Außentemperaturen<br />
vorzubeugen.<br />
Der End-Of-Line Tester von MCD Elektronik,<br />
der im VTS-Standard modular aufgebaut<br />
ist, prüft die PCBs funktional, was<br />
unter anderem Schaltungsvorgänge mit<br />
bis zu 500 V beinhaltet. Dies stellt die<br />
Durch die Prüfung der Steuerplatinen<br />
mit zwei Stationen wird ein Wirkungsgrad<br />
von bis zu 95 % erreicht.<br />
Spannung des Hochvolt-Bordnetzes im<br />
Automobil dar. Für die Steuerung des<br />
Thermosystems im Fahrzeug werden Bedienelemente<br />
und Taster in der Mittelkonsole<br />
implementiert, die mit der Steuerplatine<br />
per LIN-Protokoll kommunizieren.<br />
Da diese Bedienelemente während<br />
der Produktion noch nicht angeschlossen<br />
sind, simuliert das von MCD entwickelte<br />
LIN-CAN-Remote-Modul im Testsystem<br />
die Schaltungen der Bedienelemente im<br />
Dauerlauf. Darüber hinaus wird auch die<br />
Kommunikation mit den Heizelementen<br />
durch den EOLT simuliert, um die verlustfreie<br />
Leistungsübergabe von maximal 7<br />
kW zu verifizieren.<br />
Damit es hierbei nicht zu Leistungsverlusten<br />
kommt, müssen auf der Platine<br />
Bi<br />
ild : MCD Elektronik<br />
verbaute Bipolartransistoren mit isolierter<br />
Gate-Elektrode (IGBTs) positionsgenau<br />
vermessen werden. Denn nur bei exakter<br />
Lage der angelöteten IGBTs können die<br />
Kühlflächen später bei der Verbauung<br />
ganzheitlich kontaktiert werden. Diese<br />
Vermessung übernimmt die zweite Teststation<br />
mit einem integrierten Laser-Profilsensor<br />
der Firma Keyence. Der Sensor<br />
misst mit einer Genauigkeit von 0,005<br />
mm und erkennt falsch positionierte Elemente<br />
vor der Verbauung. Wäre dies nicht<br />
gewährleistet, könnte eine nicht abgeführte<br />
Verlustleistung zur Zerstörung des<br />
Moduls und damit zu einem Ausfall des<br />
Heizsystems führen.<br />
Für Sebastian Faaß aus der Hardware<br />
Application von MCD Elektronik war die<br />
Entwicklung in vielerlei Hinsicht ein sensibles<br />
Projekt: „Durch die hohen Spannungen,<br />
mit der Autobatterie und Heizsystem<br />
in<br />
die Fahrzeugarchitektur eingebunden<br />
sind, sind diverse Hochspan-<br />
nungssicherheitseinrichtungen innerhalb<br />
der Testadaptionen notwendig. Um dabei<br />
sowohl die Entwicklungsingenieure im<br />
Aufbau als auch das Testpersonal im späteren<br />
Betrieb ausreichend zu schützen,<br />
wurden mehrere Sicherheitsmechanismen<br />
in das System integriert.“ So muss zu je-<br />
der Zeit gewährleistet werden, dass keine<br />
Schaltung mit 500 V durchgeführt wird,<br />
während Türen oder Adapterhauben geöffnet<br />
sind. Aus diesem Grund wurden al-<br />
le Verriegelungen mit Kontaktsicherungen<br />
versehen, die über ein zertifiziertes Si-<br />
miteinander gekoppelt<br />
cherheitssystem<br />
sind. Ist eine Verriegelung nicht aktiv oder<br />
besteht eine potentielle Fehlbedienung,<br />
kann der<br />
Testprozess nicht durchgeführt<br />
werden.<br />
52 <strong>Quality</strong> <strong>Engineering</strong> » 03|2021
NEWS & PRODUKTE «<br />
Modulares Prüfsystem<br />
Verkürzt die Umrüstzeiten<br />
Für Wirbelstrom- und optische Prüfungen<br />
an Bauteilen wie Schrauben oder Bolzen<br />
eignet sich das modulare System Mexs<br />
400 von Law NDT. Die Standard-Variante<br />
besteht aus zwei gegenüberliegenden<br />
Modulschächten und kann vor Ort auf<br />
den Einsatz von bis zu zehn vorgefertigten<br />
und standardisierten Modulen erweitert<br />
werden. Bevorstehende Prüfaufgaben<br />
für neue Produkte werden mit dem Kunden<br />
im Vorfeld besprochen und projektiert.<br />
Die Module werden dann von Law<br />
NDT vorgerüstet. Bei der Mexs 400 hat<br />
Law NDT den herkömmlichen Teller mit<br />
seinen immer größer werdenden Durchmessern<br />
durch eine ovale Transportstrecke<br />
ersetzt. Und aus den bekannten, fest<br />
installierten Prüfstationen wurden einzelne,<br />
flexible Module, die jederzeit in die<br />
Anlage eingeschoben werden können.<br />
Diese melden sich vollautomatisch im<br />
System an. Durch den modularen Aufbau<br />
und die Trennung zwischen Materialtransport<br />
und Messsystem können erstmals<br />
auch mehrere verschiedene Produkte<br />
gleichzeitig in einem Prozess geprüft<br />
werden. Man ist nur abhängig von der<br />
Anzahl der Modulplätze sowie der montierten<br />
Zuführ- und Auswurfplätze. Engstellen<br />
im Teilefluss werden bei der Mexs<br />
400 durch die Zuführung auf einer durchgehenden<br />
Ebene von der Führungsschiene<br />
zum Transportsystem eliminiert.<br />
Bild: Law NDT<br />
Bildverarbeitung<br />
KI-Software als Beschleuniger bei der Metall-Inspektion<br />
Bild: Covision Lab<br />
Die Software Covision <strong>Quality</strong> von Covison<br />
Lab automatisiert und skaliert die<br />
Qualitätskontrolle an Metallen<br />
durch den Einsatz von Künstlicher<br />
Intelligenz (KI). Genauer gesagt,<br />
werden dabei Computer Vision<br />
und Deep Learning Technologie<br />
genutzt. Durch den Einsatz<br />
von „Unsupervised Learning“<br />
(Deutsch: Unüberwachtes Lernen)<br />
kann die Software in kurzer<br />
Zeit ein fehlerfreies Metallteil<br />
von einem fehlerhaftem Metallteil unterscheiden.<br />
Durch den darauffolgenden Einsatz von<br />
„Transfer Learning“ (Deutsch: Übertragendem<br />
Lernen) können diese bereits gewonnen<br />
Erkenntnisse auf andere Metallteile<br />
übertragen werden. Die Software<br />
verbessert sich selbst dadurch kontinuierlich.<br />
Der für die Inbetriebnahme des Bildverarbeitungssystems<br />
benötigte Zeitaufwand<br />
lässt sich mit der Software pro Metallteil<br />
von zwei Wochen im Durchschnitt auf<br />
zwei Tage reduzieren.<br />
Additive Fertigung<br />
Wenn Neutronenstrahlen Spannungen messen<br />
Die Bundesanstalt für Materialforschung<br />
und -prüfung (BAM) hat die inneren<br />
Spannungen additiv gefertigter Teile erstmals<br />
zerstörungsfrei an komplexen Bauteilen<br />
gemessen – und zwar mit einem<br />
Neutronenstrahl. Gelungen ist dies an<br />
Gasturbinenschaufeln aus einer Nickel-<br />
Legierung. Durch den lokalen Wärmeeintrag<br />
des Lasers und die schnelle Abkühlung<br />
entstehen im Fertigungsprozess<br />
Spannungen im Material. Eliminieren lassen<br />
sich diese bislang durch nachträgliche<br />
Wärmebehandlung. Doch die kostet<br />
Zeit und Geld. Feststellen lassen sich die<br />
Spannungen durch Röntgenstrahlen,<br />
doch die dringen nicht tief ins Bauteil ein<br />
und sie stoßen bei filigranen Hohlstrukturen<br />
aufgrund der geometrischen Komplexität<br />
an ihre Grenzen.<br />
Neutronenstrahlen hingegen dringen tiefer<br />
ein und werden an spannungsreichen<br />
Stellen von der Gitterstruktur der Atome<br />
auf charakteristische Weise gebeugt. Entscheidend<br />
war, die Messpunkte mit Computertomografie<br />
möglichst genau zu lokalisieren.<br />
Sie konnten unter Beschuss<br />
mit Neutronen exakt verortet werden und<br />
damit auch die Spannungen. In einem<br />
nächsten Schritt will die BAM herausfinden,<br />
welche Parameter während des<br />
3D-Drucks zu Spannungen führen können.<br />
Bild: BAM<br />
<strong>Quality</strong> <strong>Engineering</strong> » 03|2021 53
» NEWS & PRODUKTE<br />
Machine Learning<br />
KI-Plattform mit Amazon Web Services<br />
Eine neue KI-Plattform für Machine Vision<br />
von Basler basiert auf den Services für<br />
künstliche Intelligenz und maschinelles<br />
Lernen (KI/ML) von Amazon Web Services<br />
(AWS). Sie ermöglicht Kunden den reibungslosen<br />
Einsatz von KI-basierten Anwendungen<br />
etwa im Bereich Qualitätskontrolle.<br />
Die Plattform umfasst eine Basler-Kamera,<br />
eine Embedded-Processing-<br />
Einheit mit allem notwendigen Zubehör<br />
und Baslers Pylon-Camera-Software-<br />
Suite. Sie verfügt außerdem über einen<br />
vollständig integrierten Edge-to-Cloud-<br />
Software-Stack einschließlich<br />
des AWS Panorama Device SDK.<br />
Baslers KI-Plattform für Machine<br />
Vision schließt die Lücke zwischen<br />
Cloud-Dienstleistungen<br />
und lokaler Bildverarbeitung. Sie<br />
integriert Vision-Hardware und<br />
Edge Computing mit Cloud-Services<br />
und stellt so End-to-End-<br />
Lösungen für maschinelles Lernen<br />
bereit. Mit der Integration<br />
des Panorama-Device-SDK von AWS ermöglicht<br />
die Plattform die Nutzung einer<br />
einheitlichen Architektur, um verschiedene<br />
Anwendungsbereiche zu adressieren.<br />
Bild: Basler<br />
Koordinatenmesstechnik<br />
Computertomografie wird schneller und besser<br />
Dem Forschungsprojekt<br />
Advanct<br />
(Advanced Computed<br />
Tomgraphy for<br />
dimensional and<br />
surface measurements<br />
in industry)<br />
ist es gelungen,<br />
Qualität und Geschwindigkeit<br />
der<br />
Koordinatenmesstechnik mit Computertomografie<br />
(CT) deutlich zu verbessern.<br />
Dies beinhaltet eine Genauigkeitssteige-<br />
Bild: PTB<br />
rung um einen Faktor von 2 bis 8 und eine<br />
Reduzierung der Messzeit auf einige Minuten.<br />
Die Forscher gehen davon aus,<br />
dass diese Fortschritte die Anwendungen<br />
der CT-Technologie erheblich erweitern<br />
werden. Zu den Schwerpunkten der Arbeiten<br />
der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt<br />
(PTB) innerhalb des Projektes<br />
gehört unter anderem die Entwicklung<br />
besserer Methoden zur Einmessung von<br />
CT-Systemen, um die Genauigkeit von CT-<br />
Messungen zu steigern. Außerdem geht<br />
es um die Korrektur von Messabweichun-<br />
gen, die durch Effekte in der Röntgenquelle<br />
und im Detektor entstehen. Auch<br />
werden verbesserte Verfahren zur Messung<br />
von Freiform- und Multimaterial-<br />
Objekten entwickelt sowie eine verbesserte<br />
Schätzung der Messunsicherheit.<br />
Die Projektverantwortlichen erhoffen sich<br />
durch die Ergebnisse von Advanct vor allem<br />
eine Stärkung der europäischen Hersteller<br />
von hochentwickelten Präzisionsteilen<br />
und -systemen, die fortschrittliche<br />
Messmöglichkeiten für Qualitätskontrolle<br />
und Entwicklung benötigen.<br />
Bildverarbeitung<br />
Breiter Wellenlängenbereich in einer Kamera<br />
Die neuen Kameras Exo 990, Exo 991 und<br />
FXO 990 von SVS-Vistek decken einen extrem<br />
breiten Wellenlängenbereich vom<br />
sichtbaren Vis- bis in den unsichtbaren<br />
Swir-Bereich ab. Sie sind außerdem kostengünstig<br />
und in der Anwendung mit<br />
Gen-Icam-Interface so einfach wie ganz<br />
normale Industriekameras. Die Kombination<br />
des herkömmlichen sichtbaren Wellenlängenbereichs<br />
mit dem NIR-Bereich<br />
in einer einzigen Kamera führt zu geringeren<br />
Kosten beim Aufbau von Inspektionssystemen.<br />
Sowohl die Exo 990 als auch die FXO 990<br />
Kamera liefern Bilder mit 1,3 MP Auflösung<br />
(1280 x 1024 Pixel). Die Exo 991 Kamera<br />
eignet sich mit ihrem 0,3 MP-Sensor<br />
(640 x 512 Pixel) für Anwendungen<br />
mit geringeren Anforderungen an die<br />
Auflösung.<br />
Die Pixelgröße von nur 5 μm führt zu einem<br />
kompakten Sensorformat mit einer<br />
Diagonalen von nur 8,2 mm (Exo 990,<br />
FXO 990) beziehungsweise 4,1 mm (Exo<br />
991) und ermöglicht dadurch den Einsatz<br />
kleiner, kostengünstiger Objektive.<br />
Bild: SVS-Vistek<br />
54 <strong>Quality</strong> <strong>Engineering</strong> » 03|2021
Fertigungsmesstechnik<br />
100 statische Messungen in 2 Sekunden<br />
Das optische Highspeed-Formmesssystem<br />
Roundtracer Flash von Mitutoyo erreicht<br />
den Messbereich durch die Kaskadierung<br />
mehrerer feststehender 2D-Kameras. Dabei<br />
werden Bilder von unterschiedlichen<br />
Sensoren aufgenommen und dann zu einem<br />
einzigen Werkstückbild zusammengefügt,<br />
das keinerlei Brüche oder Lücken<br />
an den Übergängen aufweist. Der Roundtracer<br />
Flash kann Werkstücke mit einer<br />
Länge von bis zu 300 mm messen, ohne<br />
dass eine vertikale Bewegung der Sensoren<br />
oder des Werkstücks notwendig ist.<br />
Die Messung erfolgt nahezu<br />
verzögerungsfrei. Das Gerät<br />
kann 100 statische Messungen<br />
in gerade einmal 2 s durchführen<br />
– wobei es keine Rolle<br />
spielt, wie die Messabschnitte<br />
entlang des Werkstücks verteilt<br />
sind. Da die Erfassung der<br />
2D-Bilder keine Bewegung<br />
entlang der Z-Achse erfordert,<br />
bleibt die Konsistenz der Profile und<br />
Werkstückgeometrien über Millionen von<br />
Zyklen hinweg stabil. Dieser schonenden<br />
Funktionsweise ist es auch zu verdanken,<br />
dass sich die Wartungsmaßnahmen auf ein<br />
absolutes Mindestmaß beschränken.<br />
Bild: Mitutoyo<br />
3D-Laserscanner<br />
Für Laser Tracker und mobile Messarme gleichermaßen<br />
Bild: Hexagon<br />
Der Absolute Scanner AS1 von Hexagon<br />
kombiniert hohe Präzision mit einer automatisierbaren<br />
Datenerfassungsrate von<br />
1,2 Mio. Punkten pro Sekunde. Der neue<br />
Laserscanner bietet zudem eine hohe Interoperabilität,<br />
da er als erster Scanner<br />
sowohl mit Laser Tracker- als auch mobilen<br />
Messarm-Systemen zum Einsatz<br />
kommt. Bei der Verwendung mit einem<br />
Leica Absolute Tracker AT960 liefert der<br />
AS1 Scanning-Genauigkeiten von bis zu<br />
50 μm aus 30 m Entfernung – und das sowohl<br />
im handgeführten als auch automatisierten<br />
Betrieb. Für kleine Anwendungen<br />
lässt sich die AS1-Scannereinheit leicht<br />
an vorhandenen Absolute Arm-Systemen<br />
mit sieben Achsen der aktuellen Generation<br />
befestigen. Diese Konfiguration eignet<br />
sich dann für die Durchführung präziser<br />
Scans sowie die Erfassung schwer zugänglicher<br />
Bereiche in einem Messvolumen<br />
zwischen 2 und 4,5 m im Durchmesser.<br />
Seine Tracker-Funktionalität basiert<br />
auf der neuen handgeführten Positioniereinheit<br />
Absolute Positioner AP21. Mit<br />
dessen Hilfe erfasst der Tracker AT960<br />
sämtliche Positions- und Orientierungsinformationen<br />
für den Scanner. Der AS1<br />
lässt sich mithilfe des kinematischen Tasteranschlusses<br />
rasch am AP21 montieren.<br />
3D-Sensor für transparente Objekte<br />
Der thermischen Signatur auf der Spur<br />
Mit dem MWIR-3D-Sensor des Fraunhofer<br />
IOF lassen sich selbst transparente Gegenstände<br />
dreidimensional scannen. Auch<br />
können die Oberflächen glänzend metallisch<br />
oder tiefschwarz sein. Ein vorheriges<br />
Überziehen mit Lack ist nicht notwendig.<br />
Das Verfahren eignet sich aufgrund der<br />
Größe des Messfelds sowie der Auflösung<br />
und der Geschwindigkeit auch für die<br />
Qualitätskontrolle in Produktionsprozessen.<br />
Möglich ist dies, weil die Forscher die<br />
Wärmestrahlung für die 3D-Erfassung<br />
nutzbar gemacht haben. Sie bezeichnen<br />
die Methode als „3D-Sensorik im thermischen<br />
Infrarot“. Herzstück des Systems ist<br />
ein energiereicher CO 2<br />
-Laser, mit dem das<br />
Messobjekt bestrahlt wird. Mit speziellen<br />
Linsen für hohe Leistungsdichten wird der<br />
Laserstrahl auf eine das gesamte Objekt<br />
vertikal beleuchtende Linie ausgeweitet.<br />
Für ein hochauflösendes Messergebnis<br />
wird die Linie in einer abgestimmten Sequenz<br />
über das Objekt bewegt. Das Messobjekt<br />
absorbiert die Energie des Laserlichts<br />
und emittiert sie zum Teil wieder.<br />
Zwei Wärmebildkameras analysieren die<br />
Bild: Fraunhofer IOF<br />
thermische Signatur, die der Infrarotstreifen<br />
auf dem Objekt hinterlässt, aus zwei<br />
Perspektiven. Aus den Informationen errechnet<br />
eine Software räumliche Bildpunkte<br />
und fügt sie zu den Abmessungen<br />
des Messobjekts zusammen.<br />
<strong>Quality</strong> <strong>Engineering</strong> » 03|2021 55
» NEWS & PRODUKTE<br />
Bildverarbeitung<br />
Vereinfachte Prüfungen in 3D<br />
Bild: Cognex<br />
Mit dem 3D-Vision-System In-Sight<br />
3D-L4000 macht Cognex die Inspektion<br />
von Teilen in 3D jetzt so einfach wie mit<br />
einer 2D-Smartkamera. Während die optische<br />
Prüfung in 3D bisher mit hohem<br />
Programmieraufwand bei gleichzeitig geringem<br />
Nutzen verbunden war, bringt das<br />
neue Embedded-Vision-System eine bessere<br />
Bildqualität, vereinfachte Anwendungsentwicklung<br />
und eine breite Palette<br />
echter 3D-Prüftools<br />
mit sich.<br />
Die Smart-Kamera<br />
ermöglicht es Anwendern,<br />
eine<br />
Reihe von Inline-<br />
Prüf-, Führ- und Messan- wendungen<br />
an automatisierten Produktionslinien<br />
schnell, präzise und kostengünstig zu lösen.<br />
Das System bietet eine umfangreiche<br />
Suite von 3D-Vision-Tools,<br />
die dank der vertrauten und<br />
robusten In-Sight-Spreadsheet-<br />
Umgebung genauso einfach zu<br />
bedienen sind wie die industrieerprobten<br />
2D-Vision-Tools von Cognex. Die patentierte<br />
speckle-freie blaue Laseroptik<br />
ist darüber hinaus eine Branchenneuheit,<br />
welche die Erfassung qualitativ hochwertiger<br />
3D-Bilder ermöglicht.<br />
Fertigungsmesstechnik<br />
Große Bauteile schnell vermessen<br />
Das lückenlose 3D-Scanning großer Bauteile<br />
ist mit dem 3D-Multisensor-System<br />
Z-Scan von Senswork in der Produktion<br />
möglich. Das modulare Konzept erlaubt<br />
eine direkte Integration in verschiedene<br />
Fertigungsprozesse zur schnellen Bewertung<br />
der Maßhaltigkeit. Dank mehrerer<br />
Triangulationssensoren mit freier räumlicher<br />
Anordnung ermöglicht das System<br />
eine fast abschattungsfreie Erfassung und<br />
3D-Vermessung großer Bauteile. Es eignet<br />
sich für Inline- und Offline-Messungen.<br />
Es besteht aus einer hochpräzisen Linearachse<br />
und einem Multisensor-Kopf mit<br />
bis zu acht Profilscannern. Durch die Neigung<br />
der Sensoren sowohl quer zu Transportrichtung<br />
als auch in Transportrichtung<br />
sowie das Flippen von Sensoren zueinander<br />
können auch optisch schwer zugängliche<br />
Bereiche wie Hinterschneidungen<br />
erfasst werden. Dank der Anordnung<br />
der Sensoren ergibt sich eine freie Punktewolke<br />
mit beliebiger räumlicher Anordnung<br />
und Dichte der Punkte. Vergleichbar<br />
ist diese Punktekonstellation mit den angetasteten<br />
Punkten eines Koordinatenmessgeräts,<br />
die Anzahl der Messzahl liegt<br />
jedoch um ein Vielfaches höher. Die Scan-<br />
zeit je Bauteil liegt bei rund 5 s. Pro Scan<br />
werden bis zu 20 Mio. Messpunkte erzeugt<br />
und verarbeitet.<br />
Bild: Senswork<br />
Branchenzahlen<br />
Längenmesstechnik 2021 gut gestartet<br />
Laut der Fachabteilung Längenmesstechnik<br />
im VDMA hat die Branche nach zwei<br />
wirtschaftlich harten Jahren ein gutes<br />
erstes Quartal 2021 erzielt. Bereits zum<br />
Jahresende 2020 hatte sich die Auftragslage<br />
der Unternehmen aufgehellt. Diese<br />
Entwicklung setzte sich im neuen Jahr<br />
fort. Die Auftragseingänge stiegen in den<br />
ersten beiden Monaten um 13 % im Vergleich<br />
zum Vorjahreszeitraum. Wichtige<br />
Impulsgeber für die gute Entwicklung<br />
sind China und die USA, auch der europäische<br />
Markt zeigt sich wieder mit besseren<br />
Geschäftsaussichten. Vor diesem<br />
Hintergrund werden die Unternehmen der<br />
Mess- und Prüftechnik voraussichtlich bis<br />
zur Jahresmitte den Anteil der Kurzarbeit<br />
zurückfahren. Insgesamt blicken alle Unternehmen<br />
verhalten optimistisch in das<br />
Jahr 2021. Die Entwicklung hängt laut<br />
VDMA wesentlich vom weiteren Verlauf<br />
und der Bewältigung der Corona-Pandemie<br />
ab. Insgesamt erwarten die Firmen<br />
der Mess- und Prüftechnik für 2021 wieder<br />
ein moderates Wachstum im einstelligen<br />
Bereich.<br />
„Unsere Branche fasst wieder Tritt. Die<br />
Herausforderungen sind dabei nicht weniger<br />
geworden, denn die Transformationsprozesse<br />
in unseren Kundenbranchen<br />
sind vielseitig und haben direkten Einfluss<br />
auf unsere Produkte und Services“, sagt<br />
Dr. Evelin Arnold, Hexagon Metrology und<br />
Vorsitzende der VDMA-Fachabteilung<br />
Längenmesstechnik. Gutes Beispiel dafür<br />
sei eine der wichtigsten Kundenbranchen<br />
der Mess- und Prüftechnik, die Automobil-<br />
und deren Zulieferindustrie. Zwar<br />
werde der klassische Verbrennungsmotor<br />
mit CO 2<br />
-neutralen, sauberen Kraftstoffen<br />
auch künftig eine wichtige Rolle spielen,<br />
Gleiches gilt für Hybridantriebe und rein<br />
elektrische Antriebe, doch die Anforderungen<br />
an Prüfmittel und Prüfverfahren<br />
werden sich verändern.<br />
56 <strong>Quality</strong> <strong>Engineering</strong> » 03|2021
QUALITY WORLD «<br />
Analytik im Forschungsprojekt Imulch<br />
Mikro- und Makroplastik<br />
in Böden auf der Spur<br />
Auf Böden oder Feldern verbleibende Kunststoffe könnten ähnliche Auswirkungen<br />
auf die Umwelt haben wie etwa Kunststoffe in Meeren, Flüssen oder Seen.<br />
Im Forschungsprojekt Imulch ist es nun gelungen, die ersten drei Prüfkriterien<br />
zur Bestimmung von Mikroplastik im Ökosystem Boden zu etablieren.<br />
» Sebastian Hagedorn, Presse, Fraunhofer Umsicht<br />
Bisher gibt es keine validen Messmethoden,<br />
um die Fragen zur Menge, Art oder<br />
Auswirkung von Kunstoffen auf das Ökosystem<br />
Boden zu beantworten. Daher<br />
entwickeln Wissenschaftler des Projekts<br />
Imulch einen Prüfstand zur Untersuchung<br />
von insgesamt neun Kriterien. Dabei haben<br />
sie folgende Untersuchungskriterien<br />
entwickelt und im Prüfstand etabliert:<br />
Identifizierung, Quantifizierung, Typisierung<br />
und Morphologiebestimmung, Verwitterung,<br />
Verbreitung, Anreicherung,<br />
Verlagerung, Bodenfunktion und Ökotoxizität.<br />
Inzwischen ist es Forschern des Instituts<br />
für Energie- und Umwelttechnik,<br />
dem Fraunhofer-Institut für Umwelt-, Sicherheits-<br />
und Energietechnik Umsicht<br />
und der Firma Fischer, Spezialist für Raman-Mikrospektroskopie,<br />
gelungen, die<br />
ersten drei von neun Charakterisierungsmethoden<br />
von Mikroplastik im Ökosystem<br />
Boden zu etablieren.<br />
Zur Identifizierung, Quantifizierung<br />
und zur Typisierung von Mikroplastik in<br />
Böden haben sie zwei Methoden etabliert:<br />
die Thermoextraktions-Desorptions-<br />
Gaschromatographie-Massenspektrometrie<br />
(TED-GC-MS) und die konfokale Raman-Mikroskopie.<br />
Mit der TED-GC-MS<br />
kann die Menge sowie der Typ eines Polymers<br />
in Böden schnell und effizient bestimmt<br />
werden. Dafür wurden zunächst<br />
drei Kunststoffarten – Polyethylen (PE),<br />
Polybutylenadipat-terephthalat (PBAT)<br />
und Polylactid (PLA) – verwendet. Für die<br />
Validierung der Messmethode wurden<br />
Bodenproben mit den verschiedenen Polymeren<br />
vermischt und hinsichtlich ihrer<br />
Wiederfindungsrate analysiert. Dabei lag<br />
die Wiederfindungsrate zwischen 90 und<br />
95 % für PLA/PBAT und 107 bis 110 % für<br />
PE, womit die TED-GC-MS erfolgreich für<br />
die Bestimmung von Polymeren in Böden<br />
im Prüfstand etabliert werden konnte.<br />
Für Größenverteilung und<br />
Form der Partikel<br />
Mit der Raman-Mikroskopie lassen sich<br />
ebenfalls der Polymertyp und zusätzlich<br />
noch die Größenverteilung und die Form<br />
der Partikel bestimmen. Allerdings ist für<br />
diese Form der Untersuchung der Partikel<br />
eine umfangreiche Probenvorbereitung<br />
notwendig, um störende Hintergrundpartikel<br />
wie Bodenbestandteile oder Pflanzenteile<br />
weitgehend zu entfernen. Dazu<br />
wird die Probe zunächst chemisch gereinigt<br />
und filtriert. Danach werden lichtmikroskopische<br />
Bilder der Filteroberflächen<br />
aufgenommen und eine softwarebasierte<br />
Partikelerkennung mithilfe kontrastba-<br />
Bild: David/stock.adobe.com<br />
Bisher gab es keine validen<br />
Messmethoden,<br />
um die Fragen zur<br />
Menge, Art oder Auswirkung<br />
von Kunstoffen<br />
auf das Ökosystem<br />
Boden zu beantworten.<br />
sierter Bildauswertung durchgeführt. Die<br />
Größenverteilung sowie die Form der Partikel<br />
lassen sich bereits aus diesen Daten<br />
erkennen. Um allerdings herauszufinden,<br />
ob es sich bei einem Partikel tatsächlich<br />
um ein Kunststoffteilchen handelt, also<br />
zur chemischen Identifizierung anhand<br />
der Molekülstruktur, werden die gefundenen<br />
Partikel einzeln angesteuert und ramanspektroskopisch<br />
untersucht. Die<br />
Kombination beider Methoden ermöglicht<br />
eine massenbasierte Quantifizierung, eine<br />
eindeutige Identifizierung und die Bestimmung<br />
der Größenverteilung der Mikroplastikpartikel.<br />
Zudem erforscht Imulch, wie Kunststoffe<br />
im Boden verwittern, wie sich die Partikel<br />
im Boden verbreiten und welche Auswirkungen<br />
Kunststoffe auf Organismen,<br />
Bodenfunktion, Wässer aus Drainagesystemen<br />
und angrenzende Gewässer haben.<br />
Auch wird eine Ökobilanz der Umweltverträglichkeit<br />
von Folien erstellt.<br />
<strong>Quality</strong> <strong>Engineering</strong> » 03|2021 57
<strong>Quality</strong> <strong>Engineering</strong> präsentiert Ihnen<br />
Partner für Qualitätssicherung.<br />
Hier finden Sie leistungsstarke Lieferanten, Dienstleister und kompetente lösungsorientierte<br />
Partner der Industrie!<br />
Analysetechnik Bildverarbeitung<br />
Messtechnik Messmaschinen<br />
Messgeräte Mikroskope Messroboter<br />
Steuerungen Prüfanlagen<br />
Werkstoffprüfung Software<br />
Dienstleistungen Weiterbildung<br />
Fakten zu Unternehmen, Details zum Angebots- und Leistungs spektrum finden Sie im<br />
Firmenverzeichnis auf qe-online.de.<br />
Unter folgendem Link gelangen Sie zur Übersicht aller Online-Firmenprofile.<br />
Bookmark!<br />
www.qe-online.de/firmenverzeichnis<br />
QUALITÄTSMANAGEMENT<br />
WISSEN<br />
Babtec: Die Software für Qualität<br />
www.babtec.de<br />
Wirksames Qualitätsmanagement für nachhaltigen<br />
Unternehmenserfolg. Seit mehr als 25 Jahren sichern<br />
Unternehmen aus allen Branchen mit Softwarelösungen<br />
von Babtec die Qualität ihrer Prozesse und Produkte.<br />
Die Software für Qualität. Die QM-Software BabtecQ<br />
bietet zahlreiche Module vom APQP Projektmanagement<br />
bis zur Warenausgangsprüfung, mit denen alle<br />
Anforderungen aus DIN EN ISO 9001, IATF 16949 sowie<br />
Richtlinien nach AIAG und VDA erfüllt werden.<br />
Das Netzwerk für Qualität. Mit der cloudbasierten<br />
Plattform BabtecQube erfolgt die Auflösung von<br />
Unternehmensgrenzen zugunsten einer kooperativen<br />
Qualitätsarbeit entlang der gesamten Lieferkette – mit<br />
dem Ziel einer <strong>Quality</strong> Supply Chain.<br />
QUALITY ENGINEERING<br />
www.direktabo.de<br />
QUALITY ENGINEERING <strong>Quality</strong> <strong>Engineering</strong> präsentiert<br />
markt- und anwendungsorientiert die Themen<br />
Qualitätsmanagement und Qualitätssicherung sowie<br />
Fertigungsmesstechnik.<br />
Tolle Angebote unter www.direktabo.de<br />
Fakten zu Unternehmen, Details zu<br />
Angebots- und Leistungsspektrum finden<br />
Sie im Firmenverzeichnis auf qe-online.de<br />
Unter folgendem Link gelangen Sie zur<br />
Übersicht aller Online-Firmenprofile.<br />
Bookmark!<br />
www.qe-online.de/firmenverzeichnis<br />
58 <strong>Quality</strong> <strong>Engineering</strong> » 03|2021
IMPRESSUM<br />
FIRMENINDEX (Redaktion/Anzeige)<br />
ISSN 1436-2457<br />
Herausgeberin:<br />
Katja Kohlhammer<br />
Verlag<br />
Konradin-Verlag Robert Kohlhammer GmbH<br />
Ernst-Mey-Straße 8,<br />
70771 Leinfelden-Echterdingen, Germany<br />
Geschäftsführer: Peter Dilger<br />
Verlagsleiter: Peter Dilger<br />
Redaktion:<br />
Chefredakteur:<br />
Dipl.-Ing. (FH) Werner Götz, Phone +49 711 7594-451<br />
Redakteure:<br />
Sabine Koll, Uwe Schoppen, Markus Strehlitz<br />
E-Mail: qe.redaktion@konradin.de<br />
Redaktionsassistenz:<br />
Daniela Engel, Phone +49 711 7594-452<br />
E-Mail: daniela.engel@konradin.de<br />
Layout:<br />
Michael Kienzle, Phone +49 711 7594-258<br />
Gesamtanzeigenleiter:<br />
Joachim Linckh, Phone +49 711 7594-565<br />
E-Mail: joachim.linckh@konradin.de<br />
Zurzeit gilt Anzeigenpreisliste Nr. 39 vom 1.10.2020<br />
Auftragsmanagement:<br />
Annemarie Olender, Phone +49 711 7594-319<br />
Leserservice<br />
<strong>Quality</strong> <strong>Engineering</strong> +49 711 7252–209<br />
E-Mail: konradinversand@zenit-presse.de<br />
<strong>Quality</strong> <strong>Engineering</strong> erscheint 5 x jährlich. Bezugs preise:<br />
Inland 68,50 € inkl. Versand kosten und MwSt.; Ausland:<br />
68,50,- € inkl. Versandkosten. Einzelverkaufspreis: 13,80 €<br />
inkl. MwSt., zzgl.Versandkosten.<br />
Sofern die Lieferung nicht für einen bestimmten Zeitraum<br />
bestellt war, läuft das Abonnement bis auf Widerruf.<br />
Bezugszeit: Das Abonnement kann erstmals vier Wochen<br />
zum Ende des ersten Bezugsjahres gekündigt werden. Nach<br />
Ablauf des ersten Jahres gilt eine Kündigungsfrist von jeweils<br />
vier Wochen zum Quartalsende. Bei Nichterscheinen<br />
aus technischen Gründen oder höherer Gewalt entsteht kein<br />
Anspruch auf Ersatz.<br />
Auslandsvertretungen:<br />
Großbritannien: Jens Smith Partnership, The Court, Long<br />
Sutton, GB-Hook, Hampshire RG29 1TA, Phone 01256<br />
862589, Fax 01256 862182, E-Mail: jsp@trademedia.info;<br />
USA: D.A. Fox Advertising Sales, Inc. Detlef Fox, 5 Penn Plaza,<br />
19th Floor, New York, NY 10001, Phone +1 212 8963881,<br />
Fax +1 212 6293988, detleffox@com cast.net<br />
Gekennzeichnete Artikel stellen die Meinung des Autors,<br />
nicht unbedingt die der Redaktion dar. Für unverlangt<br />
eingesandte Berichte keine Gewähr.<br />
Eingesandte Manuskripte unterliegen der evtl. redak tionellen<br />
Kürzung oder Erweiterung. Korrekturabzüge können leider<br />
nicht zur Verfügung gestellt werden.<br />
Alle in <strong>Quality</strong> <strong>Engineering</strong> erscheinenden Beiträge sind<br />
urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, auch Übersetzungen,<br />
vorbehalten. Reproduktionen, gleich welcher Art, nur<br />
mit schriftlicher Genehmigung des Verlages.<br />
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Stuttgart.<br />
Druck:<br />
Konradin Druck GmbH, Leinfelden-Echterdingen<br />
Printed in Germany<br />
© 2021 by Konradin-Verlag Robert Kohlhammer GmbH,<br />
Leinfelden-Echterdingen<br />
ABB 30<br />
Additive 19, 25<br />
Babtec 6, 58<br />
Basler 54<br />
Benteler 30<br />
Böhme & Weihs 6<br />
Bundesanstalt für Materialforschung<br />
und -prüfung (BAM) 10, 53<br />
Bundesministerium für Wirtschaft<br />
und Energie (BMWI) 10<br />
Cognex 56<br />
Consense 6<br />
Covison Lab 53<br />
Creaform 22<br />
Deutsche Akkreditierungsstelle 10<br />
Deutsche Kommission Elektrotechnik<br />
Elektronik Informationstechnik (DKE) 10<br />
Deutsches Institut für Normung (DIN) 10<br />
DQS 20<br />
Fraunhofer Umsicht 57<br />
Fraunhofer Vision 34<br />
Fraunhofer IOF 55<br />
GOM 22<br />
Hexagon 55<br />
Inspekto 44<br />
Instron 48<br />
IQM Tools 15<br />
Keyence 52<br />
Klingelnberg 50<br />
Law NDT 53<br />
LDT Dosiertechnik 21<br />
MCD Elektronik 29, 52<br />
Wo Qualität drauf steht,<br />
ist auch Qualität drin.<br />
Micro-Epsilon 26<br />
Mitutoyo 55<br />
OGP Meßtechnik 5<br />
Physikalisch-Technische<br />
Bundesanstalt (PTB) 10, 54<br />
Polytec 40<br />
Proalpha 6<br />
Reinhardt System- und<br />
Messelectronic 45<br />
Reliance Precision 37<br />
Reusch Rechtsanwälte 9<br />
Senswork 56<br />
Seven Bel 27, 42<br />
Shimadzu 17<br />
Sonoro Audio 60<br />
Stemmer Imaging 46<br />
SVS-Vistek 54<br />
Topometric 16<br />
Wenzel 22<br />
Werth Messtechnik 3, 12<br />
Wings Wismar International<br />
Graduation Services 45<br />
wirth + partner 15<br />
Zeiss 7, 22, 36<br />
Zwickroell 43<br />
Vier Ausgaben im Jahr sorgen für maximalen Lesenutzen<br />
und Leselust. QUALITY ENGINEERING widmet sich seit<br />
2013 ausschließlich und umfangreich der Story hinter der<br />
Firma, dem Produkt oder der Lösung, aber auch den Strategien<br />
und Problemen rund um die Qualität.<br />
www.qe-online.de<br />
Kooperationspartner:<br />
AFQ Akademie für<br />
Qualitätsmanagement<br />
<strong>Quality</strong> <strong>Engineering</strong> » 03|2021 59
MAESTRO<br />
DER DIRIGENT FÜR IHR WOHNZIMMER<br />
State-of-the-Art-Design, erstklassige Verarbeitung und unverwechselbare Klangqualität.<br />
Der smarte HiFi-Receiver ist ein echtes Allround-Talent mit genug Leistung, um selbst hohe<br />
Anforderungen einfach zu bedienen. Gemeinsam mit unseren ORCHESTRA Lautsprechern<br />
sind sie das ideale Ensemble für Ihr Wohnzimmer.<br />
Mehr Informationen zum MAESTRO finden Sie auf sonoro.de<br />
GERMAN AUDIO<br />
AND<br />
60<br />
DESIGN<br />
<strong>Quality</strong> <strong>Engineering</strong> » 03|2021