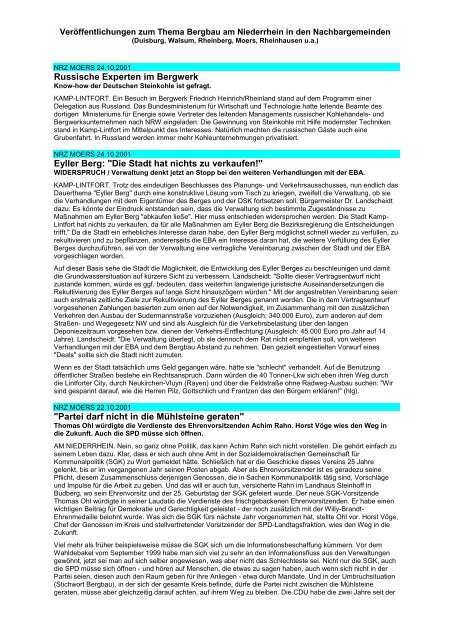Eyller Berg: "Die Stadt hat nichts zu - BiB
Eyller Berg: "Die Stadt hat nichts zu - BiB
Eyller Berg: "Die Stadt hat nichts zu - BiB
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Veröffentlichungen <strong>zu</strong>m Thema <strong>Berg</strong>bau am Niederrhein in den Nachbargemeinden<br />
(Duisburg, Walsum, Rheinberg, Moers, Rheinhausen u.a.)<br />
NRZ MOERS 24.10.2001<br />
Russische Experten im <strong>Berg</strong>werk<br />
Know-how der Deutschen Steinkohle ist gefragt.<br />
KAMP-LINTFORT. Ein Besuch im <strong>Berg</strong>werk Friedrich Heinrich/Rheinland stand auf dem Programm einer<br />
Delegation aus Russland. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie <strong>hat</strong>te leitende Beamte des<br />
dortigen Ministeriums für Energie sowie Vertreter des leitenden Managements russischer Kohlehandels- und<br />
<strong>Berg</strong>werksunternehmen nach NRW eingeladen. <strong>Die</strong> Gewinnung von Steinkohle mit Hilfe modernster Techniken<br />
stand in Kamp-Lintfort im Mittelpunkt des Interesses. Natürlich machten die russischen Gäste auch eine<br />
Grubenfahrt. In Russland werden immer mehr Kohleunternehmungen privatisiert.<br />
NRZ MOERS 24.10.2001<br />
<strong>Eyller</strong> <strong>Berg</strong>: "<strong>Die</strong> <strong>Stadt</strong> <strong>hat</strong> <strong>nichts</strong> <strong>zu</strong> verkaufen!"<br />
WIDERSPRUCH / Verwaltung denkt jetzt an Stopp bei den weiteren Verhandlungen mit der EBA.<br />
KAMP-LINTFORT. Trotz des eindeutigen Beschlusses des Planungs- und Verkehrsausschusses, nun endlich das<br />
Dauerthema "<strong>Eyller</strong> <strong>Berg</strong>" durch eine konstruktive Lösung vom Tisch <strong>zu</strong> kriegen, zweifelt die Verwaltung, ob sie<br />
die Verhandlungen mit dem Eigentümer des <strong>Berg</strong>es und der DSK fortsetzen soll. Bürgermeister Dr. Landscheidt<br />
da<strong>zu</strong>: Es könnte der Eindruck entstanden sein, dass die Verwaltung sich bestimmte Zugeständnisse <strong>zu</strong><br />
Maßnahmen am <strong>Eyller</strong> <strong>Berg</strong> "abkaufen ließe". Hier muss entschieden widersprochen werden. <strong>Die</strong> <strong>Stadt</strong> Kamp-<br />
Lintfort <strong>hat</strong> <strong>nichts</strong> <strong>zu</strong> verkaufen, da für alle Maßnahmen am <strong>Eyller</strong> <strong>Berg</strong> die Bezirksregierung die Entscheidungen<br />
trifft." Da die <strong>Stadt</strong> ein erhebliches Interesse daran habe, den <strong>Eyller</strong> <strong>Berg</strong> möglichst schnell wieder <strong>zu</strong> verfüllen, <strong>zu</strong><br />
rekultivieren und <strong>zu</strong> bepflanzen, andererseits die EBA ein Interesse daran <strong>hat</strong>, die weitere Verfüllung des <strong>Eyller</strong><br />
<strong>Berg</strong>es durch<strong>zu</strong>führen, sei von der Verwaltung eine vertragliche Vereinbarung zwischen der <strong>Stadt</strong> und der EBA<br />
vorgeschlagen worden.<br />
Auf dieser Basis sehe die <strong>Stadt</strong> die Möglichkeit, die Entwicklung des <strong>Eyller</strong> <strong>Berg</strong>es <strong>zu</strong> beschleunigen und damit<br />
die Grundwassersituation auf kürzere Sicht <strong>zu</strong> verbessern. Landscheidt: "Sollte dieser Vertragsentwurf nicht<br />
<strong>zu</strong>stande kommen, würde es ggf. bedeuten, dass weiterhin langwierige juristische Auseinanderset<strong>zu</strong>ngen die<br />
Rekultivierung des <strong>Eyller</strong> <strong>Berg</strong>es auf lange Sicht hinauszögern würden." Mit der angestrebten Vereinbarung seien<br />
auch erstmals zeitliche Ziele <strong>zu</strong>r Rekultivierung des <strong>Eyller</strong> <strong>Berg</strong>es genannt worden. <strong>Die</strong> in dem Vertragsentwurf<br />
vorgesehenen Zahlungen basierten <strong>zu</strong>m einen auf der Notwendigkeit, im Zusammenhang mit den <strong>zu</strong>sätzlichen<br />
Verkehren den Ausbau der Sudermannstraße vor<strong>zu</strong>ziehen (Ausgleich: 340.000 Euro), <strong>zu</strong>m anderen auf dem<br />
Straßen- und Wegegesetz NW und sind als Ausgleich für die Verkehrsbelastung über den langen<br />
Deponiezeitraum vorgesehen bzw. dienen der Verkehrs-Entflechtung (Ausgleich: 45.000 Euro pro Jahr auf 14<br />
Jahre). Landscheidt: "<strong>Die</strong> Verwaltung überlegt, ob sie dennoch dem Rat nicht empfehlen soll, von weiteren<br />
Verhandlungen mit der EBA und dem <strong>Berg</strong>bau Abstand <strong>zu</strong> nehmen. Den gezielt eingestielten Vorwurf eines<br />
"Deals" sollte sich die <strong>Stadt</strong> nicht <strong>zu</strong>muten.<br />
Wenn es der <strong>Stadt</strong> tatsächlich ums Geld gegangen wäre, hätte sie "schlecht" verhandelt. Auf die Benut<strong>zu</strong>ng<br />
öffentlicher Straßen bestehe ein Rechtsanspruch. Dann würden die 40 Tonner-Lkw sich eben ihren Weg durch<br />
die Lintforter City, durch Neukirchen-Vluyn (Rayen) und über die Feldstraße ohne Radweg-Ausbau suchen: "Wir<br />
sind gespannt darauf, wie die Herren Pilz, Gottschlich und Frantzen das den Bürgern erklären!" (hlg).<br />
NRZ MOERS 22.10.2001<br />
"Partei darf nicht in die Mühlsteine geraten"<br />
Thomas Ohl würdigte die Verdienste des Ehrenvorsitzenden Achim Rahn. Horst Vöge wies den Weg in<br />
die Zukunft. Auch die SPD müsse sich öffnen.<br />
AM NIEDERRHEIN. Nein, so ganz ohne Politik, das kann Achim Rahn sich nicht vorstellen. <strong>Die</strong> gehört einfach <strong>zu</strong><br />
seinem Leben da<strong>zu</strong>. Klar, dass er sich auch ohne Amt in der Sozialdemokratischen Gemeinschaft für<br />
Kommunalpolitik (SGK) <strong>zu</strong> Wort gemeldet hätte. Schließlich <strong>hat</strong> er die Geschicke dieses Vereins 25 Jahre<br />
gelenkt, bis er im vergangenen Jahr seinen Posten abgab. Aber als Ehrenvorsitzender ist es gerade<strong>zu</strong> seine<br />
Pflicht, diesem Zusammenschluss derjenigen Genossen, die in Sachen Kommunalpolitik tätig sind, Vorschläge<br />
und Impulse für die Arbeit <strong>zu</strong> geben. Und das will er auch tun, versicherte Rahn im Landhaus Steinhoff in<br />
Budberg, wo sein Ehrenvorsitz und der 25. Geburtstag der SGK gefeiert wurde. Der neue SGK-Vorsitzende<br />
Thomas Ohl würdigte in seiner Laudatio die Verdienste des frischgebackenen Ehrenvorsitzenden. Er habe einen<br />
wichtigen Beitrag für Demokratie und Gerechtigkeit geleistet - der noch <strong>zu</strong>sätzlich mit der Willy-Brandt-<br />
Ehrenmedaille belohnt wurde. Was sich die SGK fürs nächste Jahr vorgenommen <strong>hat</strong>, stellte Ohl vor. Horst Vöge,<br />
Chef der Genossen im Kreis und stellvertretender Vorsitzender der SPD-Landtagsfraktion, wies den Weg in die<br />
Zukunft.<br />
Viel mehr als früher beispielsweise müsse die SGK sich um die Informationsbeschaffung kümmern. Vor dem<br />
Wahldebakel vom September 1999 habe man sich viel <strong>zu</strong> sehr an den Informationsfluss aus den Verwaltungen<br />
gewöhnt, jetzt sei man auf sich selber angewiesen, was aber nicht das Schlechteste sei. Nicht nur die SGK, auch<br />
die SPD müsse sich öffnen - und hören auf Menschen, die etwas <strong>zu</strong> sagen haben, auch wenn sich nicht in der<br />
Partei seien, diesen auch den Raum geben für ihre Anliegen - etwa durch Mandate. Und in der Umbruchsituation<br />
(Stichwort <strong>Berg</strong>bau), in der sich der gesamte Kreis befinde, dürfe die Partei nicht zwischen die Mühlsteine<br />
geraten, müsse aber gleichzeitig darauf achten, auf ihrem Weg <strong>zu</strong> bleiben. <strong>Die</strong> CDU habe die zwei Jahre seit der
Kommunalwahl damit verbracht, sich als Wahlsieger <strong>zu</strong> feiern und als neue Machthaber <strong>zu</strong> fühlen, ungeachtet<br />
der veränderten äußeren Rahmenbedingungen. (cf)<br />
NRZ RHEINBERG 22.10.2001<br />
KURZ GEMELDET<br />
Schutzverband lädt ein.<br />
Um die Weiterführung des Anhörungsverfahrens <strong>zu</strong>m Rahmenbetriebsplan Walsum und um<br />
Vereinsangelegenheiten geht es am Mittwoch, 24. Oktober, wenn der Hochwasserschutzverband<br />
Vorstandsmitglieder und Sachberater in die Gaststätte "van Bebber" in Birten einlädt. Beginn: 16 Uhr.<br />
Beirat tagt.<br />
Der Landschaftsbeirat des Kreises Wesel tagt am kommenden Montag, 29. Oktober, 15 Uhr, im Sit<strong>zu</strong>ngsraum<br />
007 des Kreishauses in Wesel. Auf der Tagesordnung steht unter anderem das Thema Landschaftsplanung und<br />
hierbei die Bildung einer Arbeitsgruppe.<br />
Vorstellung Landschaftsplan.<br />
Im Xantener Schützenhaus beginnt heute um 19 Uhr die öffentliche Auftaktveranstaltung <strong>zu</strong>r Aufstellung des<br />
Landschaftsplans Sonsbeck/Xanten. Ziel ist es, umfassend über den Planungsverlauf und die Inhalte der<br />
Landschaftsplanung <strong>zu</strong> informieren und erste Kontakte her<strong>zu</strong>stellen.<br />
NRZ RHEINBERG 21.10.2001<br />
Ohne Politik gehts nicht<br />
Achim Rahn ist Ehrenvorsitzender der SGK. 25 Jahre <strong>hat</strong> er die Geschicke geleitet. Auch jetzt will er<br />
weiter Impulse für die Arbeit geben.<br />
RHEINBERG. Nein, so ganz ohne Politik, das kann Achim Rahn sich nicht vorstellen. <strong>Die</strong> gehört einfach <strong>zu</strong><br />
seinem Leben da<strong>zu</strong>.<br />
Klar, dass er sich auch ohne Amt in der Sozialdemokratischen Gemeinschaft für Kommunalpolitik (SGK) <strong>zu</strong> Wort<br />
gemeldet hätte. Schließlich <strong>hat</strong> er die Geschicke dieses Vereins 25 Jahre gelenkt, bis er im vergangenen Jahr<br />
seinen Posten abgab. Aber als Ehrenvorsitzender ist es gerade<strong>zu</strong> seine Pflicht, diesem Zusammenschluss<br />
derjenigen Genossen, die in Sachen Kommunalpolitik tätig sind, Vorschläge und Impulse für die Arbeit <strong>zu</strong> geben.<br />
Und das will er auch tun, versicherte Rahn gestern im Landhaus Steinhoff in Budberg, wo sein Ehrenvorsitz und<br />
der 25. Geburtstag der SGK gefeiert wurde. Der neue SGK-Vorsitzende Thomas Ohl würdigte in seiner Laudatio<br />
die Verdienste des frischgebackenen Ehrenvorsitzenden. Er habe einen wichtigen Beitrag für Demokratie und<br />
Gerechtigkeit geleistet - der noch <strong>zu</strong>sätzlich mit der Willy-Brandt-Ehrenmedaille belohnt wurde. Was sich die SGK<br />
fürs nächste Jahr vorgenommen <strong>hat</strong>, stellte Ohl vor (wir berichteten), Horst Vöge, Chef der Genossen im Kreis<br />
und stellvertretender Vorsitzender der SPD-Landtagsfraktion, wies den Weg in die Zukunft. Viel mehr als früher<br />
beispielsweise müsse die SGK sich um die Informationsbeschaffung kümmern. Vor dem Wahldebakel vom<br />
September 1999 habe man sich viel <strong>zu</strong> sehr an den Informationsfluss aus den Verwaltungen gewöhnt, jetzt sei<br />
man auf sich selber angewiesen, was aber nicht das Schlechteste sei. Nicht nur die SGK, auch die SPD müsse<br />
sich öffnen – und hören auf Menschen, die etwas <strong>zu</strong> sagen haben, auch wenn sich nicht in der Partei seien,<br />
diesen auch den Raum geben für ihre Anliegen - etwa durch Mandate.<br />
Und in der Umbruchsituation (Stichwort <strong>Berg</strong>bau), in der sich der gesamte Kreis befinde, dürfe die Partei nicht<br />
zwischen die Mühlsteine geraten, müsse aber gleichzeitig darauf achten, auf ihrem Weg <strong>zu</strong> bleiben. <strong>Die</strong> CDU<br />
habe die zwei Jahre seit der Kommunalwahl damit verbracht, sich als Wahlsieger <strong>zu</strong> feiern und als neue<br />
Machthaber <strong>zu</strong> fühlen, ungeachtet der veränderten äußeren Rahmenbedingungen. (cf)<br />
NRZ RHEINBERG 21.10.2001<br />
Flutwellen und Deichbrüche<br />
Hochwasserschutzverband informierte über mögliche <strong>Berg</strong>schäden.<br />
RHEINBERG. 280 Kilometer Deich schützen die Bewohner links und rechts des Rheins. "Davon entsprechen 100<br />
Kilometer nicht den Normen", erklärt Hans-Peter Feldmann, Vorsitzender des Schutzverbandes Niederrhein HSV-<br />
N. 100 Kilometer, die noch nicht saniert oder aufgehöht sind. An diesen Stellen würde der Deich bei Hochwasser<br />
schneller brechen, als anderswo. Besonders, wenn er durch den <strong>Berg</strong>bau weiter absinkt und beschädigt wird.<br />
"Dann leben wir in einem großräumigen Katastrophengebiet", sagt Feldmann. "Das soll keine Panikmache sein",<br />
stellte der Xantener am Freitagabend im evangelischen Gemeindehaus Annaberg klar. Doch Berechnungen<br />
hätten gezeigt, welche Gebiete bei Hochwasser und unsicheren Deichen betroffen wären. Teile von Rheinberg<br />
gehören da<strong>zu</strong>. Wie hoch das Wasser dann steht, ist unklar. "Im Kartenmaterial stimmen die Höhenangaben<br />
schon lange nicht mehr, durch den <strong>Berg</strong>bau liegen alle Gebiete um einige Meter tiefer." Und sollte der<br />
Rahmenbetriebsplan (RBP) des <strong>Berg</strong>werks Walsum genehmigt werden, so werden es noch ein paar Meter mehr.<br />
Gemeinsam mit Werner Raue von der Schutzgemeinschaft <strong>Berg</strong>bau stellte Feldmann den rund 60 Zuhörern nicht<br />
nur die Auswirkungen vor, sondern informierte auch über das laufende Verfahren in Sachen RBP Walsum. Das<br />
Anhörungsverfahren, <strong>zu</strong>rzeit ausgesetzt, wird Ende Oktober fortgeführt. Bis Jahresende, so vermutet Raue, wird
es noch dauern. Dann entscheidet die Bezirksregierung, ob Kohle abgebaut werden darf. Sollte der RBP<br />
abgelehnt werden, so droht jedoch weiter Gefahr. "Dann kommt der RBP von Friedrich-Heinrich Rheinland auf<br />
den Tisch", sagt Raue. Und sollte der genehmigt werden, sinkt Rheinberg weiter ab. Anhand von Skizzen machte<br />
Feldmann deutlich, was bei Hochwasser passieren kann. "Eine Flutwelle bis nach Xanten entspricht der Realität."<br />
Und weil Teile von Rheinberg recht tief liegen, wird das Wasser nicht sofort wieder abfließen. Dass der Deich<br />
reißt, ist für Feldmann sicher. "Teilweise sind die Deiche nur mit <strong>Berg</strong>ematerial gebaut, das sich nicht ausdehnt,<br />
sondern bricht", erläuterte er. Und auch Jahrhunderthochwasser gebe es in letzter Zeit immer häufiger. (dg.)<br />
NRZ MOERS 19.10.2001<br />
Ihr könnt diese <strong>Stadt</strong> verändern<br />
ZUR SACHE<br />
Journalist fordert die Energiewende jetzt.<br />
Der Referent Franz Alt war in einigen seiner Äußerungen schon fast radikal. In diesen Kriegszeiten malte er ein<br />
Szenario an die Wand, welches manchen seiner Zuhörer Angstschauer über den Rücken gejagt haben mag: Es<br />
werde <strong>zu</strong> furchtbaren Kriegen um die letzten Energie-Ressourcen dieser Erde kommen. Wie sagte der Journalist<br />
Alt: "Der 11. September ist nur ein harmloses Vorspiel, wenn nicht bald alle Menschen auf dieser Erde ein<br />
schönes Leben haben können." Harte Worte. Vor allem, weil er werben wollte für die friedlichste Energie<br />
überhaupt: Sonne und Wind.<br />
Er spielte auch mit der Angst der Menschen, wenn er sagte, dass wohl Kernkraftwerke, niemals aber<br />
Sonnendächer die Ziele von Terroristen sein würden. Jedoch ist er sich einer Tatsache wohl bewusst: Man kann<br />
die Leute am besten am Geldbeutel packen. Und so machte er seinem Moerser Publikum die finanziellen Vorteile<br />
schmackhaft, köderte sie mit der Tatsache: "<strong>Die</strong> Sonne schickt uns keine Rechnung." Der Vortrag war drastisch<br />
in seinen Schlussfolgerungen - und sie sind logisch.<br />
<strong>Die</strong> Energiewende muss kommen. Erneuerbare Energien schaffen Arbeitsplätze - der <strong>Berg</strong>bau ist ein<br />
Auslaufmodell. Von uns allen hängt es jetzt ab, wann die Energiewende kommt. Wir haben nicht mehr viel Zeit.<br />
Wenn schon die Ölmultis in Solarenergie investieren, muss uns das doch <strong>zu</strong> denken geben. Wie sagte Franz Alt:<br />
"Wenn es aus der Gesellschaft kommt, könnt ihr diese <strong>Stadt</strong> verändern." Packen wir es an, besser heute als<br />
morgen. Sonst mag es schon <strong>zu</strong> spät sein. HARRY SEELHOFF<br />
NRZ MOERS 19.10.2001<br />
Sogar Gates investiert in Solaraktien<br />
UNIVERSITÄTSWOCHEN / Franz Alt forderte in der Sparkasse Moers eine sofortige Wende hin <strong>zu</strong><br />
Sonnen- und Windenergie.<br />
MOERS. Mit Franz Alt, bekannt durch das ARD-Magazins "Report", <strong>hat</strong>ten die Sparkasse und die Gerhard-<br />
Mercator-Universität einen exzellenten Redner und ausgewiesenen Experten in Sachen erneuerbare Energien<br />
gewonnen. Der Abend in der Schalterhalle der Sparkasse war ein Erfolg.<br />
Das Fazit: Alt macht schlau. Seine Überzeugung: Nur mit ökologischer Energie retten wir die Weltwirtschaft und<br />
bewahren den Frieden. Seine Warnung: Uns erwartet das größte Gemetzel der Menschheitsgeschichte, wenn wir<br />
keine neue Energie bekommen. Seine Prognose: Solar- und Windenergie schaffen in den nächsten Jahren<br />
hunderttausende Arbeitsplätze in Deutschland. Seine Frage: Warum wohl investiert Bill Gates massiv in<br />
Solaraktien?<br />
Das Öl der Welt reicht nur noch für 40 Jahre<br />
<strong>Die</strong> Antwort ist denkbar einfach: Weil es sich rechnet. Bill Gates hält das größte deutsche Solaraktienpaket.<br />
Staunend vernahmen die Zuhörer, dass auch Mineralölkonzerne voll auf erneuerbare Energien setzen. Shell<br />
unterhält das größte Biomasse-Heizkraftwerk in Europa, besitzt eine Fabrik für Solarzellen und wird noch etliche<br />
bauen. <strong>Die</strong> Mineralölbosse wissen genau, dass ihnen der Stoff ausgeht. Öl reicht noch für 40, Gas für 46, Uran<br />
für 60, Kohle für 100 Jahre, so der Weltenergierat. Und was dann, fragte Alt? Ohne Energie ist der<br />
Wirtschaftsstandort Deutschland am Ende. Mit Wind- und Sonnenenergie blüht er aber auf. "Und was machen<br />
wir?" Seine Frage beantwortete der Journalist und Buchautor Alt selbst: "Garzweiler II." Das sei katastrophale<br />
Industriepolitik; Kohle sei ein Auslaufmodell. 6000 Windräder würden ganz Garz-weiler ersetzen. Der Ölkonzern<br />
Shell prognostiziert, dass im Jahre 2060 nur noch acht Prozent des Energiebedarfs mit Öl gedeckt wird, 65<br />
Prozent aber mit erneuerbarer Energie. Schon bald könnten 50 Prozent des deutschen Energiebedarfs mit<br />
Windkraft gedeckt werden. Wissenschaftler der Uni Kassel haben jetzt ein Verfahren entwickelt, "Windräder auf<br />
dem Meeresboden" <strong>zu</strong> installieren - die Meeresströmung liefert Strom. Zudem könne jeder kostenlose Energie<br />
nutzen: "<strong>Die</strong> Sonne schickt uns keine Rechnung." Er selbst würde monatlich 1 000 Mark vom Energieversorger<br />
bekommen, denn seine Solaranlage auf dem Dach liefere zwei mal so viel Strom, wie er selbst verbrauche.<br />
Energie-Nebeneinnahmen statt Energie-Zusatzkosten. Und auf Solardächer verüben Terroristen keine<br />
Anschläge, gab der Journalist <strong>zu</strong> bedenken, auf Kernkraftwerke schon. Hatte Sparkassendirektor Karl-Heinz<br />
Tenter in seinen Begrüßungsworten eine Investition in die Sonnenenergie gefordert, weil es <strong>zu</strong>m Frieden beiträgt,<br />
so gab Alt der Sparkasse einen Rat mit auf den Weg: "Wenn ich die Sparkasse wäre würde ich mir überlegen,<br />
meine Kunden mit Zinsvorteilen von ein bis zwei Prozent <strong>zu</strong> locken und <strong>zu</strong>m ökologischen Bauen <strong>zu</strong> bringen."<br />
HARRY SEELHOFF
NRZ MOERS 19.10.2001<br />
Abbau unter Rheurdt: Zum Jahresende ist Feierabend<br />
BERGSCHÄDEN / Gemeindeverwaltung fürchtet um das Kanalnetz - Entwarnung für die Bürger hinter der<br />
Rathausstraße.<br />
RHEURDT. Eine gute und eine schlechtere Nachricht für die <strong>Berg</strong>schaden geplagten Bewohner des Ökodorfes.<br />
<strong>Die</strong> gute: Zum Ende des Jahres wird der Kohleabbau unter dem Ort eingestellt. Wenig erfreulicher Anlass ist die<br />
vorzeitige Schließung Niederbergs. Schlechte Meldung: <strong>Die</strong> Gemeindeverwaltung befürchtet dadurch Schäden<br />
am Kanalsystem des Ortes. Das teilte Bürgermeister Karl-Heinz Rickers auf Anfrage mit.<br />
Endgültig Schluss<br />
Der Bürgermeister sprach vor zwei Tagen mit Markschieder Mehlmann von der Zeche Niederberg sowie mit drei<br />
Mitabeitern der <strong>Berg</strong>schadensabteilung in Homberg. "Ende des Jahres ist endgültig Schluss", berichtet er. Das<br />
bedeutet im Klartext, dass die unterirdischen Aktivitäten der DSK (von Westen nach Osten) an der Rathausstraße<br />
Halt machen. Für den Laien überraschend: "Wir hätten es eigentlich lieber gesehen, wenn man den Abbau in<br />
zwei Bauhöhen planmäßig, also noch sechs Monate länger, Richtung Osten bis <strong>zu</strong>m Klärwerk weitergeführt<br />
hätte", erläutert Rickers. Denn: "Jetzt fürchten wir Probleme durch <strong>zu</strong> wenig Kanalgefälle." <strong>Die</strong> Höhenlage der<br />
Kanäle werde vermutlich verändert, es werde wahrscheinlich auch Beschädigungen wie Risse usw. in den<br />
Rohren geben. "Auch die DSK <strong>hat</strong> entsprechende Berechnungen angestellt."<br />
<strong>Die</strong> Rheurdter kennen das vom ersten Flöz, das von 1991 bis 98 abgebaut wurde. Da gab es bereits<br />
Schwierigkeiten, so dass ein Kanal zeitweise sogar mittels Dauer-Saugrohr <strong>zu</strong>m Fließen gebracht werden<br />
musste. Ähnliches fürchtet man auch jetzt. "Bei der Deutschen Steinkohle <strong>hat</strong> man fest <strong>zu</strong>gesagt, schnell <strong>zu</strong><br />
reagieren, wenns irgendwo kneifen sollte." Vorsorglich werden im nächsten Frühjahr die Kanäle von der DSK<br />
vermessen. Im Sommer wird mittels Spezialroboter erforscht, wie es in den Rohren aussieht.<br />
"Danach wird ein Sanierungskonzept erstellt." Freuen werden sich trotz der Bedenken der Verwaltung etliche<br />
Rheurdter. <strong>Die</strong> einen, weil die <strong>Berg</strong>schäden nun doch ein frühzeitigeres Ende finden (wir berichteten).<br />
Dabei gilt generell: 95 Prozent der Senkungen werden innerhalb von sechs bis 12 Monaten überirdisch sichtbar.<br />
Erleichtert werden vor allem die Rheurdter sein, die auf der anderen, der östlichen Seite der Rathausstraße<br />
wohnen. Sie <strong>hat</strong>ten sich im Geiste schon auf <strong>Berg</strong>schäden eingestellt und können jetzt aufatmen. KLARA<br />
HELMES<br />
NRZ MOERS 18.10.2001<br />
Kurs <strong>zu</strong>m Informatiker<br />
Zwei Jahre dauert die Ausbildung bei der RAG BILDUNG GmbH.<br />
KAMP-LINTFORT. Gut ausgebildete Kräfte für den Markt der Informationstechnologie sind gefragt. Daher bietet<br />
die RAG-Bildung GmbH <strong>zu</strong>sammen mit dem Arbeitsamt eine Qualifizierung <strong>zu</strong>m Fachinformatiker oder <strong>zu</strong>r<br />
Fachinformatikerin ab dem 3. Dezember an. Es gibt eine zweimonatige Vorschaltmaßnahme, es schließt sich die<br />
zweijährige Umschulung an, die <strong>zu</strong>r IHK-Prüfung führt. Auch ein sechmonatiges Betriebspraktikum gehört <strong>zu</strong>r<br />
Ausbildung. Fachinformatiker analysieren, planen und realisieren Informationssysteme und führen neue oder<br />
modifizierte Systeme in der IT-Technik ein. Mit der Umschulung werden vor allem Arbeitssuchende mit<br />
abgeschlossener Berufsausbildung angesprochen. Unter Umständen können die Kosten vom Arbeitsamt<br />
übernommen werden. Informationen gibt es am Mittwoch, 24. Oktober, ab 14 Uhr im Bildungszentrum, Bendsteg<br />
38, Tel: 929864.<br />
NRZ RHEINBERG 18.10.2001<br />
Bauarbeiten sollen bis Anfang 2003 dauern<br />
Verkehrsführung wird größtenteils einspurig mit Ampeln geregelt.<br />
RHEINBERG. In der kommenden Woche wird die <strong>Stadt</strong> Rheinberg die vom <strong>Berg</strong>bau beschädigten Kanäle<br />
erneuern. Gebaut wird in der Rheinberger Straße, zwischen der Straße "Am Keltenfeld" und an den im Bereich<br />
des nördlichen Ortausganges von Budberg gelegenen Pumpanlage sowie in Teilbereichen der Bischof-Roß-<br />
Straße und der Rheinkamper Straße. <strong>Die</strong> Arbeiten werden überwiegend an der "offenen Straße" vorgenommen.<br />
Deshalb wird es <strong>zu</strong> Verkehrsbehinderungen kommen. Lediglich zwischen der Kreu<strong>zu</strong>ng Bischof-Roß-<br />
/Rheinberger Straße und der Pumpanlage Budberg wird der Kanal teilweise hydraulisch unterm Asphalt saniert.<br />
Es ist geplant, den Straßenverkehr in der Rheinberger- und der Rheinkamper Straße einspurig fließen <strong>zu</strong> lassen,<br />
geregelt durch Ampeln. Auch die Zufahrten für die Anlieger sollen gesichert werden. In der Bischof-Roß-Straße ist<br />
eine kurzzeitige Vollsperrung vorgesehen, wobei die privaten Grundstücke erreichbar bleiben. <strong>Die</strong> Arbeiten<br />
werden voraussichtlich bis Anfang des Jahres 2003 andauern.<br />
NRZ MOERS 17.10.2001
Glückauf, der Peter kommt<br />
SPD-Fraktionschef Struck besuchte das Moerser Arbeitslosenzentrum und sprach im Haus Friesen. Für<br />
den <strong>Berg</strong>bau eine vernünftige Regelung versprochen.<br />
MOERS. "Glückauf, der Steiger kommt", tönte es aus dem Lautsprecher - und Peter Struck kam. Der<br />
Fraktionschef der SPD im Bundestag <strong>hat</strong>te ein Heimspiel in Repelen. Ein voll besetztes Haus Friesen. Mit<br />
Stehplätzen mussten einige Besucher sogar vorlieb nehmen. Ortsvereinsvorsitzender Karl-Heinz Reimann freute<br />
sich über die Peters im Doppelpack, Struck nämlich und der Bundestagsabgeordnete Peter Enders. Enders<br />
wiederum freute sich, nach vier Ministern nun abermals einen prominenten Bundespolitiker in seinem Wahlkreis<br />
präsentieren <strong>zu</strong> können. Auch die drei "Es" waren im Saal Friesen beisammen: Enders und seine<br />
voraussichtlichen Herausforderer Eidam und Ehrmann, die den amtierenden Abgeordneten gerne beerben<br />
möchten. Auch das Publikum freute sich, bot ihnen der Ortsverein doch eine lockere Programmabfolge.<br />
Nur eine knapp 30-minüte Rede Strucks und dann eine Talkrunde mit Wilfried Woller (Bezirksleiter der IGBCE),<br />
Bernd Scheid (AWO) und Michael Rittberger vom Moerser Arbeitslosenzentrum (MALZ). Eine lockere Abfolge<br />
zwar, aber mit ernsten Themen: Arbeitsplätze, Arbeitslosigkeit, Dumping-Löhne. Vor der Saal-Veranstaltung <strong>hat</strong>te<br />
Struck beim MALZ in der Homberger Straße vorbeigeschaut und dort über das "Job-Aktiv-Gesetz" diskutiert, der<br />
Absicht, Arbeitslose <strong>zu</strong> fördern und von ihnen etwas <strong>zu</strong> fordern.<br />
Wenn jetzt auch die Außenpolitik und die innere Sicherheit im Vordergrund stehe, werde, so Struck gestern, die<br />
Arbeitsmarktpolitik erste Priorität behalten. Struck rechnet mit einem Konjunkturaufschwung im ersten Vierteljahr<br />
2002. Wenn auch die Arbeitslosenzahl nicht so <strong>zu</strong>rück gegangen sei, wie es sich die Regierung erhoffte, werde<br />
sie im Wahljahr dennoch bessere Zahlen vorweisen als <strong>zu</strong>letzt Kanzler Kohl. Den <strong>Berg</strong>leuten im Saal versprach<br />
Struck, dass Berlin mit der Europäischen Kommission und dem Koalitionspartner "eine vernünftige Regelung für<br />
die Kohle finden" werde. Auch ein Bekenntnis <strong>zu</strong>m Koalitionspartner legte der Vorsitzende der SPD-<br />
Bundestagsfraktion ab: "Wir möchten gerne eine Fortset<strong>zu</strong>ng der Koalition."<br />
RUDOLF PIZMOHT<br />
NRZ OBERHAUSEN 17.10.2001<br />
Gegen den Störfall unter der Idylle<br />
ERDGASSPEICHER / EVO muss die Anwohner der Brache Vondern jetzt über mögliche Gefahren<br />
informieren.<br />
OSTERFELD. Drei Jahre, nachdem hier rund 2,4 Kilometer Rohrleitungen verbuddelt wurden, ist längst Gras<br />
und Gestrüpp drüber gewachsen. Das ist ganz im Sinne der EVO, die östlich der Osterfelder Straße bis <strong>zu</strong> 360<br />
000 Kubikmeter Erdgas unterirdisch lagern kann. Und es ist gut für ein wunderschön verwildertes Stück der<br />
"Route Industrienatur": die Brache Vondern zwischen Emscher und Emscherschnellweg, wo bis in die 1930erJahre<br />
die Zeche Vondern Kohle förderte.<br />
(Ver-)Ordnung muss sein<br />
Von besagter "Rohrleitungsanlage <strong>zu</strong>r Optimierung der Gasdarbietung" - wie der Erdgasspeicher offiziell tituliert<br />
wird - nahm eigentlich keiner mehr Notiz. Doch: Ab heute werden Anwohner des Umfeldes Vondernbrache mit<br />
der Nase drauf gestoßen. Das sei so, sagt die EVO, weil die Störfallverordnung nach dem<br />
Bundesimmissionschutzgesetz (kurz: "BimschG") es verlange. (Ver-)Ordnung muss sein: Das Staatliche<br />
Umweltamt prüfte die Anlage erneut, obwohl die seit ihrer Inbetriebnahme im Herbst 1998 völlig störungsfrei<br />
gelaufen war. "Ergebnis, wie <strong>zu</strong> erwarten: Alles in Ordnung", so Dr. Reinhold Poggemann, Leiter der EVO-<br />
Energienetze.<br />
Dennoch: Da Erdgas wegen seiner Entzündbarkeit ein Gefahrgut ist, selbst wenn man es in Rohren vergraben<br />
<strong>hat</strong>, sind gewisse Vorschriften ein<strong>zu</strong>halten. Da<strong>zu</strong> gehört auch die Information der Bevölkerung nach der<br />
Störfallverordnung. So flattert den Haushalten im Bereich Osterfelder, Schloss-, Armin- und Ripshorster Straße<br />
ab heute ein buntes Faltblatt <strong>zu</strong>. Darin informiert das Unternehmen über seine Erdgasversorgung allgemein und<br />
die Erdgasröhrenanlage im Besonderen. Dann folgen Aussagen der Berufsfeuerwehr, allgemeine Hinweise auf<br />
mögliche Gefahren und – Schritt für Schritt - Verhaltensmaßregeln bei Eintritt eines Störfalls in der Anlage. Kaum<br />
vorstellbar, dass es hier gefährlich sein soll, wo sich die Natur zwischen A 42 und Emscher und rund um einige<br />
Hochspannungsmasten ihr Terrain längst <strong>zu</strong>rückerobert <strong>hat</strong>. Dem Kommunalverband Ruhrgebiet (KVR) war das<br />
Refugium übrigens ein eigenes Faltblatt wert; Titel: "Mahlzeit!" - eine Beschreibung der Pflanzenwelt auf der<br />
Brache Vondern. HEINZ INGENSIEP<br />
NRZ EMMERICH 17.10.2001<br />
Reeserschanz vom Meer umschlungen<br />
Um das Rheinhochwasser vor Rees ab<strong>zu</strong>schwächen, plant das Wasser- und Schifffahrtsamt den Bau<br />
einer linksrheinischen Flutmulde.<br />
REES/NIEDERMÖRMTER. Gestern noch <strong>hat</strong> Ute Bruckwilder den Ort besucht, wo ihr Elterhaus stand, auf<br />
Reeser- schanz, und auf dem ehemaligen Grundstück ihrer Eltern Blumen gepfückt. "Meine Eltern wohnen jetzt in<br />
Rees mitten in der <strong>Stadt</strong>. Besonders meine Mutter leidet noch sehr unter dem Um<strong>zu</strong>g auf die andere Rheinseite.
Einen alten Baum verpflanzt man nicht." Gerne hätten die Kinder für ihre Eltern eine Wohnung mit Rheinblick<br />
besorgt, aber <strong>zu</strong> jener Zeit gab es <strong>nichts</strong> Adäquates. "Nach dem Um<strong>zu</strong>g ist meine Mutter sehr krank geworden.<br />
Im Moment geht es ihr etwas besser.<br />
Ich möchte sie gerne, solange die Fähre noch <strong>zu</strong>r Reeserschanz übersetzt, im Rollstuhl hinüber<strong>zu</strong>fahren." Wo<br />
einst das Gasthaus stand, ist längst Gras gewachsen. Vor genau drei Jahren musste Ferdinand Sandhövel seine<br />
Gaststätte "Reeserschanz" schließen, vor zwei Jahren, auch im Oktober, fiel sie der Abrissbirne <strong>zu</strong>m Opfer. Sie<br />
wich dem Wassermanagement, das Reeserschanz unumwindbar auf den Leib rückte. Schon seit 20 Jahren<br />
bereitet der Rheinverlauf vor Rees der Wasser- und Schifffahrtsbehörde Sorge. Besonders bei Hochwasser.<br />
Starke Erosionen haben in der Rheinschleife zwischen Vynen und Rees <strong>zu</strong> einem extremen Hochwasserengpass<br />
geführt. Das Wasser muss sich durch ein enges Flussbett quälen. So drückt es unaufhaltsam gegen die Reeser<br />
<strong>Stadt</strong>mauer. "Da hilft nur ein linksrheinischer Abfluss, der die Erosionen und die enorme Vertiefung in die<br />
Flusssohle vermindert", waren sich die Aufsichtsbehörden einig. Sie diskutierten zwei Modelle: eine<br />
Vorlandvertiefung oder eine Flutmulde.<br />
Das Wasser- und Schifffahrtsamt Duisburg mit Außenstelle in Wesel als Träger des Vorhabens <strong>hat</strong> die<br />
Flutmuldenlösung präferiert, weil sie sich als ökologisch und wasserhydraulisch wirkungsvoller erwiesen habe. Es<br />
wird noch in diesem Jahr die Planfeststellungsunterlagen an die Wasser- und Schifffahrtsdirektion Münster<br />
weiterleiten. "Wir erwarten im nächsten Jahr den Beschluss, dann kann 2003 gebaut werden", vermutet Birgitta<br />
Beul, Leiterin des Wasser- und Schifffahrtsamtes Wesel. Es wird linksrheinisch eine Mulde ausgehoben, die vis a<br />
vis der Haffener Baggerlöcher beginnt, uferfern verläuft und kurz vor der Einfahrt in den Xantener Yachthafen<br />
wieder in den Rhein führt. <strong>Die</strong>se Mulde, bei Mittelwasser 120 Meter breit und vier Meter tief, wird immer Wasser<br />
führen. Sinkt der Wasserstand auf Mittelwasser plus 80 Zentimeter, was an etwa 200 Tagen im Jahr der Fall ist,<br />
ist das dann entstehende "Eiland" über Überlaufschwellen bedingt <strong>zu</strong>gänglich. Durch die Flutmulde erhält der<br />
Rhein eine breitere Abflussmöglichkeit, der Druck wird von der <strong>Stadt</strong>mauer genommen und der Rhein muss nicht<br />
mehr auf Grund der ständigen Vertiefungen mit Steinen aufgefüllt werden. Mit der Flutmulde entfällt dann aber<br />
auch der Fähranleger Reeserschanz. Hierfür will das Wasser- und Schifffahrtsamt ein neues linksrheinisches<br />
Plätzchen, angebunden an einen Radweg, finden. Und auch die Zufahrt <strong>zu</strong>m Xantener Yachthafen wird erhalten<br />
bleiben. Ferdinand Sandhövel fehlen am meisten seine Sangesfreunde vom "Abendstern" Niedermörmter. Einmal<br />
im Monat besucht er sie. Doch wenn das "Rääße Pöntje" ins Winterquartier geht, wird der Weg weit - über den<br />
Rhein. ELISABETH HANF<br />
NRZ EMMERICH 17.10.2001<br />
Höhe bleibt unangetastet<br />
Deichverlegung <strong>hat</strong> keine Auswirkungen auf Rheinpromenade.<br />
EMMERICH. <strong>Die</strong> Nachricht über die geplante Deichverlegung in Warbeyen <strong>hat</strong> einige Anwohner der<br />
Rheinpromenade aufhorchen lassen. Besonders die Aussicht, dass der Emmericher Pegel bei Hochwasser um<br />
fünf bis 20 Zentimeter niedriger ausfallen könnte (die NRZ berichtete), macht die Anlieger mobil. Ihr Anliegen<br />
schilderten sie jetzt in einem Brief an die Obere Wasserbehörde bei der Bezirksregierung. Das<br />
Bemessungshochwasser von 19,10 Meter sei überholt, so die Anwohner: "Alle Schutzanlagen können in der<br />
Höhe reduziert, und da der Druck geringer wird, kann außerdem in der Stärke reduziert werden.<br />
Beides muss im Interesse der Bürger unbedingt geschehen, weil es Vorteile für sie mit sich bringt. Der Blick auf<br />
den Strom wird weniger eingeschränkt. Außerdem lassen sich erhebliche Kosten einsparen, die sonst von den<br />
Bürgern mit auf<strong>zu</strong>bringen wären." Bei Oberregierungsrat Udo Hasselberg, <strong>zu</strong>ständig für den Hochwasserschutz in<br />
Emmerich und die Deichverlegung in Warbeyen, stoßen die Emmericher damit allerdings auf wenig Verständnis.<br />
Eine "gewisse Verringerung der Hochwasserwelle" in Emmerich will der Dezernent für Hochwasserschutz bei der<br />
Bezirksregierung nicht ausschließen. "Wir gehen aber davon aus, dass auch bei einer etwas niedrigeren Welle<br />
der geplante Schutz angemessen und richtig ist."<br />
<strong>Die</strong> Überlegungen bezüglich Warbeyen seien nicht neu, so Hasselberg. <strong>Die</strong> mögliche Deichverlegung sei schon<br />
bei den Planungen für den Hochwasserschutz in Emmerich bekannt gewesen. Der Planfeststellungsbescheid<br />
wird in wenigen Wochen vorliegen, so der Oberregierungsrat. Darin würden zwar einige Änderungswünsche der<br />
Anwohner berücksichtigt. <strong>Die</strong> Höhe des Hochwasserschutzes bleibt jedoch unverändert. (cos)<br />
NRZ MOERS 17.10.2001<br />
Gehöft bis unters Dach zersägt<br />
Schon vor Beginn des Kohleabbaus baute die Deutsche Steinkohle Dehnungsfugen ins Haus ein.<br />
RHEURDT. Pastor Derrix schildert weiter: "Als der jüngste schlimme Erdknall ganz Rheurdt erzittern ließ, rannten<br />
die Arbeiter panikartig aus der Kirche. Sie dachten, alles bricht <strong>zu</strong>sammen", schildert der Pastor die Heftigkeit, mit<br />
der sich die Erdspannungen unter Tage entladen.<br />
"An die normalen Knälle <strong>hat</strong> man sich ja schon gewöhnt..." <strong>Die</strong> Handwerker der Deutschen Steinkohle bzw. der<br />
<strong>Berg</strong>schadensabteilung kommen mit unschöner Regelmäßigkeit nach Rheurdt, um wenigstens die gröbsten<br />
Schäden <strong>zu</strong> flicken: Über dem Beichtstuhl der Kirche, unter und über den Fenstern, auch Platten am Boden
heben sich hier oder da. Mulmig wirds dem Pastor und seinen "Schäfchen", wenn sie nach oben blicken:<br />
"Wirkliche Angst machen uns die vielen Risse im Deckengewölbe...", meint Derrix besorgt und hofft im Stillen,<br />
dass bei den vorsorglichen Messungen der Fachleute auch alles mit rechten Dingen <strong>zu</strong>geht...<br />
Nicht anders ergeht es der Familie Bürgers. Ihr Hof, auf dem man sich auf Rinder<strong>zu</strong>cht spezialisiert <strong>hat</strong>, liegt gar<br />
nicht so weit von der Kirche entfernt an der Kaplaneistraße 1. Eine Tafel des Denkmalpflegers zeugt vom<br />
beispielhaften Wert des Gehöftes, 1786 erbaut. "Schon lange, bevor es mit dem Abbau losging, kamen die<br />
Handwerker <strong>zu</strong> uns und haben das ganze Gehöft an verschiedenen Stellen bis unters Dach zersägt, um<br />
Dehnungsfugen ein<strong>zu</strong>bauen", schildert Maria Bürgers. In den Räumen wurden schon neue Decken und Böden<br />
eingezogen, Wände wurden neu verputzt. Eine Schande: "Jetzt zeigt die einzige alte Stuckdecke im Haus die<br />
ersten Risse."<br />
Und: "Mich würde wirklich mal interessieren, wie viel Geld der <strong>Berg</strong>bau allein schon in unser Haus gesteckt <strong>hat</strong>..."<br />
Inzwischen wurde wegen des Dauer-Grundwassers in einigen Kellern an der Kaplaneistraße eine Anlage von der<br />
Lineg gebaut. <strong>Die</strong> Tatsache, dass die Lineg das Wasser in mancher Kuhle seit geraumer Zeit in die<br />
Gegenrichtung fließen läßt, zeugt ebenfalls von <strong>Berg</strong>schäden. Übrigens, 400 Millionen Mark gibt die DSK jährlich<br />
für diese Schäden aus. Bei der Gemeinde <strong>hat</strong> man an den drei Info-Abenden mit der DSK und den Bürgern<br />
festgestellt: "Wenns um die Regulierung der Schäden geht, beklagen sich die wenigsten Leute. Trotzdem ist der<br />
Ärger groß, wenn die Schäden nicht abreißen", so Klaus Kleinenkuhnen. Vielleicht aber ist die Bedrohung in<br />
Rheurdt ja bald vorbei. "Wir erfahren demnächst von der DSK, ob man nach der Schließung Niederbergs<br />
überhaupt unter Rheurdt weiter abbauen will", so Kleinenkuhnen. (Klara Helmes) FORTSETZUNG VON SEITE 1<br />
NRZ MOERS 17.10.2001<br />
Wertvolle Gebäude bedroht<br />
Auch denkmalgeschützte Gebäude wie die schöne Kirche St. Nikolaus oder der sehenswerte Hof der<br />
Familie Bürgers werden nicht verschont.<br />
RHEURDT. Seit einigen Jahren schon geht der <strong>Berg</strong>bau unter dem Ökodorf um. Seither gibt es immer wieder<br />
Klagen der Bürger, denn markerschütternde Erdknälle lassen oft die Tassen in den Schränken der Einwohner<br />
tanzen. Erst vor etwa zwei Wochen donnerte und rappelte es unter Rheurdt wieder derartig, dass mancher<br />
denken konnte, das Ende aller Tage sei gekommen. Besonders ärgerlich: die immer häufiger auftretenden<br />
<strong>Berg</strong>schäden. Viele Häuser wurden inzwischen schon notdürftig repariert. Wir haben uns in zwei besonders<br />
wertvollen Gebäude in Rheurdt umgesehen, nämlich in der Pfarrkirche St. Nikolaus und auf dem Hof der Familie<br />
Bürgers. Beide sind denkmalgeschützte Bauten. Doch das schützte sie nicht vor den tückischen <strong>Berg</strong>schäden.<br />
Pastor Norbert Derrix liebt die schöne Kirche. "Sie ist 1885 eingesegnet worden." Das Gotteshaus wurde im<br />
neugotischen Stil erbaut, sieben Jahre brauchte man damals dafür. Besonders wertvoll sind die schönen alten,<br />
bleiverglasten Fenster. "Sie werden hier keine Kirche im Umkreis mit solchen Fenstern finden. Nach dem Krieg<br />
wurden die Fenster, die zerborsten waren, nach den Originalvorlagen erneuert."<br />
Doch inzwischen machen sich die Gemeindemitglieder Sorgen, was ihre Kirche angeht. "Es fing mit einigen<br />
kleinen Rissen an. Doch inzwischen wissen wir, dass die Risse später tiefer und größer werden, bis der Putz von<br />
den Wänden fällt. Dann wirds gefährlich."<br />
Weniger gefährlich, aber dafür um so spektakulärer sind die breiten Risse unter einigen Fenstern, durch die man<br />
ganz deutlich nach draußen blicken kann. <strong>Die</strong> Deutsche Steinkohle weiß um den Wert der Kirche. Überall <strong>hat</strong><br />
man Vermessungspunkte in den Wänden angebracht. "Oft kommen Fachleute und stellen Messungen an. Ich<br />
finde das wenig beruhigend..." KLARA HELMES<br />
NRZ WESEL 17.10.2001<br />
KURZ GEMELDET<br />
Thema <strong>Berg</strong>bau.<br />
<strong>Die</strong> durch die Abbautätigkeit der Schachtanlage Lohberg/Osterfeld hervorgerufenen Erderschütterungen macht<br />
die CDU Hünxe am Montag, 22. Oktober, ab 19 Uhr in der Bruckhausener Gaststätte "Haus Lindekamp" <strong>zu</strong>m<br />
Thema. Referent ist Peter Fischer, Markscheider des Verbundbergwerks.<br />
NRZ WESEL 16.10.2001<br />
Keller sollen trocken bleiben<br />
In Werrich verlängert die LINEG die Druckleitung über den Banndeich. <strong>Die</strong> Anwohner müssen mit<br />
Behinderungen rechnen.<br />
WESEL. <strong>Die</strong> Keller in Werrich sollen in der bald beginnenden Hochwasser-Periode trocken bleiben. Deshalb<br />
verlegt die Linksniederrheinische Entwässerungsgenossenschaft LINEG ab nächster Woche die Druckleitung<br />
entlang des Eyländer Weges bis über den Banndeich. Sie bittet die Anwohner um Verständnis, dass während der<br />
Bauzeit bis Ende Januar 2002 Belästigungen entstehen. In den vergangenen Jahren war es in Werrich immer
wieder <strong>zu</strong> Kellerüberflutungen durch ansteigendes Grundwasser gekommen. Ursachen waren neben dem<br />
Rheinhochwasser auch die durch Salzabbau verursachten Bodensenkungen.<br />
Als Gegenmaßnahme wurden Brunnen und Druckrohrleitungen gebaut, die im Zusammenhang mit der<br />
Deichrückverlegung <strong>zu</strong>nächst provisorisch verlängert wurden.<br />
NRZ MOERS 15.10.2001<br />
Das Prozessrisiko ist ziemlich gross<br />
ABFALLBEHANDLUNGSANLAGE / Verwaltung schlägt einen Vertrag mit Zeitplan für den <strong>Eyller</strong> <strong>Berg</strong> vor.<br />
KAMP-LINTFORT. Ein neues Kapitel in der unendlichen Geschichte "Mülldeponie <strong>Eyller</strong> <strong>Berg</strong>" will die <strong>Stadt</strong><br />
Kamp-Lintfort aufschlagen. Hatte der <strong>Stadt</strong>rat im Juni 1999 noch klipp und klar gesagt, die "<strong>Stadt</strong> lehnt die<br />
Errichtung und den Betrieb einer Abfallbehandlungsanlage ab", so schlägt die Verwaltung jetzt vor, dieser Anlage<br />
<strong>zu</strong><strong>zu</strong>stimmen und sich gleichzeitig mit den Betreibern auf einen Zeitplan und einen Vertrag <strong>zu</strong> einigen, die das<br />
Ende des Deponiebetriebes und eine Rekultivierung in Etappen festschreiben.<br />
Denn die <strong>Stadt</strong> habe ein erhebliches Interesse daran, dass der <strong>Eyller</strong> <strong>Berg</strong> möglichst schnell wiederverfüllt,<br />
rekultiviert und bepflanzt wird, heißt es in einer Beschlussvorlage für den Planungs- und Verkehrsausschuss, der<br />
am 23. Oktober tagen wird. Kamp-Lintfort, so der Vorschlag, solle sich mit der "<strong>Eyller</strong> <strong>Berg</strong> Abfallgesellschaft"<br />
(EBA) darauf einigen, dass der <strong>Eyller</strong> <strong>Berg</strong> bis <strong>zu</strong>m Jahre 2007 <strong>zu</strong> 50 Prozent rekultiviert ist. Bis <strong>zu</strong>m Jahre 2010<br />
sollen 80 Prozent und bis <strong>zu</strong>m Jahre 2020 die restlichen Flächen rekultiviert und bepflanzt sein. In dieser Zeit<br />
erwarte die <strong>Stadt</strong> regelmäßige Informationen über die Aktivitäten am <strong>Eyller</strong> <strong>Berg</strong>.<br />
Durch Zulassung der Abfallbehandlungsanlage könnten <strong>zu</strong>sätzlich 20 000 Kubikmeter jährlich auf dem Eyler <strong>Berg</strong><br />
abgelagert werden. <strong>Die</strong> Laufzeit der Deponie würde dadurch um etwa zwölf Jahre reduziert gegenüber einem<br />
Deponiebetrieb ohne Vorbehandlung. Für einen Zeitraum von rund 2,5 Jahren wäre dann aber auch mit einer<br />
maximalen Belastung von 42 Transporten pro Tag, insgesamt also mit 84 Lkw pro Tag <strong>zu</strong> rechnen. Soweit Kamp-<br />
Lintfort betroffen sei, sollten die Transporte über die A 57 (Abfahrt Rheinberg), B 510, Feldstraße <strong>zu</strong>m <strong>Eyller</strong> <strong>Berg</strong><br />
geführt werden. Allerdings könne die Feldstraße diese Belastung im jetzigen Zustand nicht verkraften. Es werden<br />
Konfliktsituationen mit Radfahrern und Fußgängern erwartet, so daß nunmehr der Radweg an der Feldstraße<br />
gebaut werden und ihre Fahrbahn einen bituminösen Belag erhalten sollte, heißt es in der Vorlage der<br />
Verwaltung. <strong>Die</strong> Verwaltung rät <strong>zu</strong> einer solchen Vereinbarung, weil sie u.a. befürchtet, sonst könnten langwierige<br />
juristische Verfahren die Wiederherstellung des <strong>Berg</strong>es langfristig verzögern. Sie weist auch darauf hin, dass die<br />
Bezirksregierung Düsseldorf die 1999 geäußerten Bedenken der <strong>Stadt</strong> gegen den Betrieb einer Verwertungs- und<br />
Behandlungsanlage für feste Abfälle nicht teilt.<br />
Düsseldorf habe im Gegenteil sogar darauf hingewiesen, dass die EBA einen Rechtsanspruch auf eine<br />
Genehmigung habe. In einer Stellungnahme <strong>zu</strong>r Verwaltungsvorlage erklärte jetzt das fraktionslose Ratsmitglied<br />
Bernd Ueffing, die EBA erhalte mit einer solchen Vereinbarung das Recht, die Deponiefläche nach Süden <strong>zu</strong><br />
erweitern und in Nähe des Landgasthauses "Zur Grenze" mit Sondermüll <strong>zu</strong> verfüllen. Eine EBA-Verpflichtung <strong>zu</strong>r<br />
Rekultivierung in festgelegten Fristen klinge zwar nicht schlecht, doch seien alle bisherigen Versprechungen <strong>zu</strong>r<br />
Rekultivierung nicht eingehalten worden. Der <strong>Eyller</strong> <strong>Berg</strong> <strong>hat</strong> eine lange Geschichte als Gewinnungsstätte für<br />
Sand und Kies und dann als Gelände, das mit Schlämmen und Gestein des <strong>Berg</strong>baus sowie mit Hausmüll erst<br />
verfüllt und dann aufgeschüttet wurde. Schon ab 1906 begann die Aussandung und Auskiesung durch den<br />
<strong>Berg</strong>bau, der die westliche Hälfte des <strong>Berg</strong>es anschließend verfüllte.<br />
Im östlichen Teil des <strong>Berg</strong>es betrieb die <strong>Stadt</strong> Kamp-Lintfort ab 1960 eine Mülldeponie, die 1975 eingestellt<br />
wurde. Ab 1976 folgte die Firma von Eerde und Ossendot GmbH als Deponiebetreiberin. Sie <strong>hat</strong>te vom <strong>Berg</strong>bau<br />
die Deponierechte übernommen, die den ganzen <strong>Berg</strong> umfassen. (piz-)<br />
NRZ EMMERICH 14.10.2001<br />
Deich soll bis <strong>zu</strong> 150 Meter <strong>zu</strong>rück verlegt werden<br />
HOCHWASSERSCHUTZ / Deichverband Xanten-Kleve muss noch wegen der Grundstücke verhandeln<br />
und rechnet mit Einigung.<br />
KLEVE/EMMERICH. Der Deich zwischen Rheinbrücke und der Überlaufschwelle soll um bis <strong>zu</strong> 150 Meter <strong>zu</strong>rück<br />
verlegt werden, wodurch der Emmericher Rheinpegel abgesenkt würde (die NRZ berichtete). Größtenteils verläuft<br />
der Hochwasserschutz über Gebiet, das im Besitz des Deichverbandes Xanten-Kleve ist. Nur zwischen<br />
Rheinbrücke und dem Grundstück an der ehemaligen Ziegelei muss der Verband noch um Grundstücke<br />
verhandeln. "Hier gehe ich von einer Einigung aus", erklärte Horst Terfehr, Geschäftsführer des Deichverbandes<br />
Xanten-Kleve. Man benötigte ein Gebiet von zwei Landwirten. <strong>Die</strong> seien im Prinzip bereit, "es kommt aber noch<br />
auf Feinheiten an." Sie sollen Ersatzflächen erhalten. Sind die Verträge formuliert, könnten sie unterschrieben<br />
werden, sobald die Mittel des Landes da seien. "Frühestens im nächsten Jahr" sei das, vermutet Terfehr. Zuletzt<br />
<strong>hat</strong>te der Deichverband das drei Hektar große Gelände der Alten Ziegelei erworben. Das Land bezahlte den<br />
Bodenpreis von 350 000 Mark. Für den Abriss der Ziegelei legte das Land nochmals eine halbe Million Mark
drauf. Und eben die Ziegelei war in den 60-er Jahren der Grund dafür, dass der Deich am Oraniendeich wie eine<br />
Nase in Richtung Rhein neigt. Damals war die Ziegelei noch in Betrieb, konnte nicht verlagert werden.(M.V.)<br />
NRZ RHEINBERG 12.10.2001<br />
Deiche sind Thema - immer mittwochs<br />
KREIS WESEL. Der Hochwasserschutzverband Niederrhein will ab November regelmäßige Sprechstunden<br />
anbieten, um den Menschen in den Hochwasser gefährdeten Gebieten Rede und Antwort <strong>zu</strong> stehen. <strong>Die</strong>se<br />
Sprechstunde soll jeweils am zweiten Mittwoch im Monat stattfinden.<br />
Der erste Termin ist der 14. November von 16 bis 18 Uhr in der Gaststätte van Bebber in Birten. In der<br />
kommenden Woche setzt der Hochwasserschutzverband seine Reihe von Informationsveranstaltungen am linken<br />
Niederrhein fort. Am Mittwoch, 17. Oktober, sind Vorsitzender Hans-Peter Feldmann und seine Mitstreiter um<br />
19.30 Uhr in Moers-Bornheim im Hotel-Restaurant "Haus Niederrhein" an der B 57 <strong>zu</strong> Gast, am Freitag, 19.<br />
Oktober, geht es dann im evangelischen Gemeindehaus in Rheinberg-Annaberg, Grote Gert 50, 19.30 Uhr, um<br />
das Thema Hochwasser.<br />
<strong>Die</strong> Sicherheit der im potentiellen Überschwemmungsgebiet lebenden Menschen <strong>hat</strong> sich der<br />
Hochwasserschutzverband, der sich erst vor kurzem gegründet <strong>hat</strong>, auf seine Fahnen geschrieben. Bei den<br />
Diskussionsrunden wird es deshalb unter anderem auch um die Auswirkungen der Rahmenbetriebspläne der<br />
<strong>Berg</strong>werke Walsum und Friedrich Heinrich gehen. Wer vorher Fragen <strong>zu</strong>m Thema <strong>hat</strong> oder sich generell über den<br />
Hochwasserschutzverband Niederrhein informieren will, kann Hans-Peter Feldmann anrufen: Tel: 02801/6584.<br />
NRZ EMMERICH 12.10.2001<br />
Rosenhofsee schafft Probleme<br />
Umweltamt erwartet in diesem Tagen Pläne für die Bauabschnitte I bis III des Deichs in Haffen.<br />
HAFFEN. Dem Rosenhof-See und dem Lohrwardt-See fehlt die natürliche Festigkeit am Ufer. <strong>Die</strong> Böschung<br />
rutscht. <strong>Die</strong>s geschieht, weil dort der Kies abgegraben wurde. Wenn nun in diesem Bereich der Deich - wie<br />
geplant - rückverlegt wird, müssen die Uferbereiche wieder verfestigt werden - mit Kies <strong>zu</strong>m Beispiel. "Das ist<br />
aber teuer", gibt Hans Nebelung, Leiter des Staatlichen Umweltamtes Krefeld, Außenstelle Kleve, <strong>zu</strong> bedenken.<br />
Daher denkt er über eine alternative Lösung nach. Das könnte beispielsweise eine Spundwand sein. "<strong>Die</strong> muss<br />
nicht aus Metall bestehen, sie könnte auch aus Ton sein", sagt er. Entschieden ist das aber noch nicht. Alles<br />
muss noch einmal durchgerechnet werden. Noch liegen die Pläne für die Abschnitte eins bis drei vom Stummen<br />
Deich bis <strong>zu</strong>m Dornerwardtweg ihm nicht vor. Aber Neblung weiß längst, an welchen Stellen es Probleme gibt.<br />
"Wir stehen ja in ständigen Kontakt mit Deichschau und dem Planungsbüro Gewecke und Partner". Neblung<br />
erwartet in den nächsten Tagen einen Brief von der Düsseldorfer Bezirksregierung mit der Bitte um die<br />
technische Prüfung des Planungs-Entwurfs.<br />
Es geht dabei darum, ob die Höhen eingehalten worden sind, ob die baulichen Maßnahmen verträglich in die<br />
Landschaft passen. Neblung und sein Team haben aber auch darauf <strong>zu</strong> achten, dass alles möglichst<br />
wirtschaftlich abgewickelt wird. Auch die Grundstücksfragen sind noch nicht endgültig geklärt. Noch nicht mit allen<br />
Besitzern der Gehöfte und Einfamilienhäuser im Bereich der beiden Seen konnte eine Lösung gefunden werden.<br />
"Es laufen noch diverse Verhandlungen", weiß Hans Nebelung, der bei den Verhandlungen manchmal mit am<br />
Tisch sitzt. Weiter ist die Deichschau Haffen-Mehr im Planungsabschnitt vier, der an der Deichauffahrt K 7<br />
beginnt und oberhalb des Lohrwardt-Sees endet. "Hier laufen bereits die Ausschreibungen", so Birgit<br />
Buschenhenki vom Staatlichen Umweltamt aus Kleve, die die Maßnahme betreut. <strong>Die</strong> Aufträge <strong>zu</strong>r<br />
Deichrückverlegung sollen im Januar vergeben werden. Baubeginn, schätzt Nebelung, wird Ende März und<br />
Anfang April sein. Hier soll der Deich rückverlegt und verbreitert werden. Auf der Deichkrone soll ein Radweg<br />
entstehen, am Lohrwardtsee wird der Radler über Dornerwardt- und Bruckdaelweg in Richtung Ortskern fahren<br />
können. Der Lindtackerweg wie auch die K7 sollen weiterhin den Autoverkehr aufnehmen. MARIA RAUDSZUS<br />
NRZ KLEVE 12.10.2001<br />
Deich abgraben und neu anlegen<br />
Verband: Vorland tiefer legen ist billiger als Retentionsräume.<br />
KREIS KLEVE. Der Deich zwischen Xanten-Beek und Kleve-Spoykanal soll auf einer Strecke von 37 Kilometern<br />
saniert werden. 1988 wurde mit den ersten Untersuchungen da<strong>zu</strong> begonnen. 1992 startete die Sanierung. Fertig<br />
mit seinen Arbeiten ist der Deichverband Xanten-Kleve als Träger mittlerweile bei Grieth und Schenkenschanz.<br />
Für eine Sanierung gibt es aus Sicht des Verbandes gute Gründe. So sei der Deich nicht hoch genug, erklärt<br />
Horst Terfehr. "50 bis 80 Zentimeter fehlen ihm." Auch Deichverteidigungswege gibts nicht. Ohne sie sei der<br />
Deich bei Hochwasser aber nicht erreichbar. Schließlich brauche man eine breitere Deichkrone und flachere<br />
Böschungen. "Das ist für die Statik wichtig", so Terfehr. Viel Arbeit wartet noch auf alle Beteiligten. "Wir graben<br />
alles ab und bauen den Deich dann neu auf", sagt Terfehr mit Blick auf einige Streckenabschnitte. Mindestens die<br />
zweifache Bodenmenge benötige man. Wenn das Land NRW die Mittel zügig bereit stelle, könne man in zehn<br />
Jahren mit der Deichsanierung fertig sein. Würde das Geld aber weiter nur "tröpfeln", so Terfehr, "werden es 15<br />
Jahre." <strong>Die</strong> komplette Sanierung koste 150 Millionen Mark. Davon müssten 20 Prozent, also 30 Millionen Mark
die Beitragszahler des Verbandes tragen. Aus Sicht von mehreren Initiativen <strong>zu</strong> viel Geld. Das Land soll mehr<br />
zahlen. Bisherige Anstrengungen blieben aber erfolglos. Jetzt habe man den Klageweg über die<br />
Beitragsbescheide gewählt. <strong>Die</strong> Initiativen, so Terfehr, beriefen sich unter anderem darauf, dass der Rhein<br />
Bundessache sei, dann müsse der Hochwasserschutz es auch sein. Ebenfalls umstritten ist der Polder<br />
Bylerward.<br />
Landesumweltministerin Bärbel Höhn wolle ihn als Retentionsraum, also als Überschwemmungsgebiet. "Wir vom<br />
Deichverband sind auch für Retentionsräume, aber sie müssen volkswirtschaftlich vertretbar sein", findet Terfehr.<br />
Und immerhin koste das Vorhaben bis <strong>zu</strong> 300 Millionen Mark. Solange man aber mit der Deichsanierung nicht<br />
fertig sei, solle man nicht schon mit dem Retentionsraum beginnen. "Wir sollten das Deichvorland um ein bis drei<br />
Meter tiefer legen." Den Sand könne man wiederum für den Deichbau verwenden. Vom Wasservolumen her wäre<br />
das "der gleiche Effekt". Und: "Das kostet nur 30 Millionen Mark",so der Verbands-Geschäftsführer. (M.V.)<br />
NRZ KLEVE 12.10.2001<br />
Rhein wurde ins Bett gezwungen<br />
Deichverbände sind "älteste Bürgerinitiative". Lehm als Schutzwall heute <strong>zu</strong> teuer - man nimmt Sand.<br />
KREIS KLEVE. Mehr Land sollte in Besitz genommen werden. Sie vergaben Deichrechte und -briefe. 1343 wurde<br />
das "Privilegium Civitatis Cranenburgenis", ein Vertrag über die Besiedlung des Kranenburger Bruchs,<br />
geschlossen. Er wurde vom Grafen <strong>Die</strong>trich IX. von Kleve bestätigt.<br />
<strong>Die</strong> Bewohner durften deichen, wirtschaften und bezahlten etwas weniger Steuern. Mit dem Beginn der großen<br />
Schifffahrt nach 1800 starteten die Niederrheiner damit, das Rheinufer systematisch <strong>zu</strong> befestigen und den Strom<br />
in sein Bett <strong>zu</strong> zwingen. Es entstanden Banndeiche entlang des Rheines.<br />
Niederungen wurden künstlich entwässert. Auch ein Rezept <strong>zu</strong>m Schutz vor Hochwasser: die Begradigung des<br />
Rheins. "<strong>Die</strong> Kurven waren früher wesentlich geschwungener", so Terfehr. Anders als heute verlief der Fluss bis<br />
ins 15. Jahrhundert hinein von Rees nach Rosau, Grietherbusch, an Grieth vorbei in Richtung Huisberden und<br />
von da aus nach Emmerich. <strong>Die</strong> Folge: <strong>Die</strong> <strong>Stadt</strong> Rees wurde entlastet. Früher floss das Wasser von Vater Rhein<br />
auf die <strong>Stadt</strong> <strong>zu</strong> und dann links vorbei - bei Hochwasser auch an der anderen Seite vorbei: Rees wurde dann <strong>zu</strong><br />
einer Insel.<br />
<strong>Die</strong> Zeche zahlten dann alle<br />
<strong>Die</strong> Wartung und der Bau der Deiche kostete viel Mühe. Nach einem erfolgreichen Deichgang war die Freude bei<br />
allen groß. Und dann wurde, so ist es überliefert, gerne mal gezecht. <strong>Die</strong> "Dycken-Ordnung" von 1575 verbot<br />
das. Wohl mit Blick darauf, dass die Zeche einiger Menschen von der ganzen Gemeinschaft bezahlt wurde. Auch<br />
das war damals geltendes Recht: Wenn der Hochwasserschutz es erforderte, durfte der Dachstuhl eines Hauses<br />
abgerissen werden. "Es ist aber nicht bekannt, ob das auch mal gemacht worden ist", ergänzt Terfehr. Kleinere<br />
Deichschauen wuchsen <strong>zu</strong> immer größeren. Seit rund 600 Jahren gibt es Deichverbände. Sie selbst verstehen<br />
sich als die älteste "Bürgerinitiative" im Lande - mit vielen ehrenamtlichen Mitarbeitern - so wie der Deichgräf.<br />
Heute <strong>hat</strong> sich vieles gewandelt. Pferde ziehen keinen Lehm oder Sand mehr <strong>zu</strong> den Deichen. Kleine<br />
Güterwagen lösten sie ab, seit 1950 rollt das Material per Lkw heran. Und die Deiche werden nicht mehr komplett<br />
aus fast wasser-undurchlässigen Lehmböden errichtet. Mittlerweile <strong>zu</strong> teuer. Für die Stützkörper der Deiche wird<br />
Sand genutzt. Von 1962 bis 1965 wurde für 90 Millionen Mark ein Deich zwischen Grieth und Griethausen sowie<br />
Schöpfwerke gebaut. Landunter in Warbeyen gabs nun nicht mehr. Andere Deiche taten andernorts ihr Übriges.<br />
Doch 1993 und 1995 schwappte der Rhein über die Promenade in Emmerich und erinnerte die Menschen an<br />
seine Kraft.<br />
NRZ MOERS 12.10.2001<br />
Werksleiter: Das kriegen wir hin<br />
Gestern Belegschaftsversammlung auf Niederberg. Kumpel auf Friedrich Heinrich fuhren eine Stunde<br />
später in die Grube. Betriebsrat: Verset<strong>zu</strong>ngspläne rasch auf den Tisch.<br />
AM NIEDERRHEIN. Gestern informierten die Betriebsräte und Werksleitungen die Mitarbeiter der Zechen<br />
Niederberg und Friedrich Heinrich über den Vorschlag des DSK-Vorstandes, die Kohleförderung in Neukirchen-<br />
Vluyn bereits <strong>zu</strong>m 31. Dezember ein<strong>zu</strong>stellen (wir berichteten). Auf Niederberg in Neukirchen-Vluyn fand um 13<br />
Uhr eine Belegschaftsversammlung statt.<br />
In Kamp-Lintfort fuhren die Kumpel eine Stunde später in die Grube. Zuerst holten sie sich im Lichthof der<br />
Schachtanlage Friedrich Heinrich Informationen über die neue Lage. "Der Vorstand hält sein Wort nicht, er hält<br />
sich nicht an die Abmachungen. Wir wollen jetzt nicht arbeitslos werden. Hoffentlich ist auf anderen <strong>Berg</strong>werken<br />
noch Platz für uns!" Das sei der Tenor der Reaktionen bei den Kumpeln gewesen, schildert<br />
Betriebsratsvorsitzender Friedhelm Vogt die Stimmung auf Friedrich Heinrich. Schließlich, so Vogt, habe der<br />
Vorstand <strong>zu</strong>gesichert, dass an dem Fahrplan bis <strong>zu</strong>r ursprünglich geplanten Niederberg-Schließung am 30. Juni<br />
2002 nicht gerüttelt werde. Alles Makulatur. 1999 <strong>hat</strong>te der Aufsichtsrat die angekündigte <strong>Berg</strong>werkskonzentration<br />
mit der Bedingung verknüpft, dass dafür zwischenzeitlich eine "qualifizierte Personalplanung" erstellt wird. Solche<br />
Qualitäten suchen die Kumpel auf Niederberg und Friedrich Heinrich, die am Standort Kamp-Lintfort <strong>zu</strong>m
<strong>Berg</strong>werk West <strong>zu</strong>sammengelegt werden sollen, bislang vergeblich. Noch keiner von den 1300 "überzähligen"<br />
<strong>Berg</strong>leuten weiß, wo sein <strong>zu</strong>künftiger Arbeitsplatz sein wird. Für qualifizierte Planung spricht auch nicht, dass das<br />
<strong>Berg</strong>werk, das 1300 Mitarbeiter <strong>zu</strong> viel <strong>hat</strong>, quasi bis <strong>zu</strong>letzt noch schubweise <strong>Berg</strong>leute von anderen Anlagen der<br />
DSK übernehmen musste. "Erst letzten Montag habe ich hier noch achtzig neue Kollegen von der Anlage<br />
Blumenthal AV begrüßt", wundert sich Vogt. Schon dieses Tohuwabohus wegen glaube er nicht, dass beim DSK-<br />
Vorstand in Herne fertige Verset<strong>zu</strong>ngpläne in der Schublade liegen. Von fertigen Plänen über die<br />
"Bewegungsströme" zwischen den <strong>Berg</strong>werken wusste gestern auch Karl-Heinz Stenmanns <strong>nichts</strong>. Der<br />
stellvertretende Werksleiter auf Friedrich Heinrich glaubt aber: "Das kriegen wir hin!" Auch wenn der von neun<br />
Monaten auf nur noch drei Monate geschrumpfte Zeitraum für die Personalplanung sehr eng geworden sei, wie<br />
Stenmanns einräumt. Er gibt aber <strong>zu</strong> bedenken, dass die DSK im Jahr 2000 insgesamt 11 000 und im laufenden<br />
Jahr noch einmal zwischen 4000 und 6000 Arbeitsplätze abbauen musste. Rund 1000 der noch 1600 Mitarbeiter<br />
auf Niederberg waren gestern mittag auf der Belegschaftsversammlung.<br />
Sie hätten die Informationen über die vorgezogene Schließung ihres Schachtes gefasst aufgenommen, berichtete<br />
Betriebsratsvorsitzender Hardy Prill. Ein Grund für die beschleunigte Konzentration sei auch, dass das kalkulierte<br />
Betriebsergebnis auf Niederberg in diesem Jahr nicht erreicht wird, habe die Werksleitung auf der Versammlung<br />
erklärt. Der Betriebsrat erwarte jetzt, dass der Verlegungsplan für die <strong>Berg</strong>leute möglichst rasch auf den Tisch<br />
kommt. Er gehe davon aus, dass die betroffenen Frauen und Männer nicht erst unter dem Weihnachtsbaum<br />
erfahren, wo ihr künftiger Arbeitsplatz sein wird. Hardy Prill geht auch davon aus, dass die linksrheinisch<br />
wohnenden <strong>Berg</strong>leute beim <strong>Berg</strong>werk West in Kamp-Lintfort und die rechtsrheinischen einen wohnungsnäheren<br />
Arbeitsplatz erhalten werden. Schützenhilfe für die vorgezogene Stillegung erhielt der DSK-Vorstand von NRW-<br />
Wirtschaftsminister Schwanhold: "<strong>Die</strong>se betriebswirtschaftliche Optimierungsmaßnahme stellt weder die<br />
Kohlevereinbarung von 1997 noch den sozialverträglichen Anpassungsprozess in Frage." RUDOLF PIZMOHT<br />
NRZ KLEVE 12.10.2001<br />
Den Hof aufs Poll gebaut<br />
Seit 600 Jahren gibt es Schutz vor den Fluten am Rhein.<br />
Wissel und Rindern waren erste "Inseln", die von mutigen Menschen mit Muskelkraft angelegt wurden.<br />
Später halfen Pferde.<br />
KREIS KLEVE. Der Rhein war für die Menschen immer Verlockung und Gefahr <strong>zu</strong>gleich. Im Mittelalter trauten sie<br />
sich in die Niederungen - fettige, lehmige Böden versprachen den Siedlern viele Nährstoffe. Aber immer wieder<br />
machten Hochwasser das Gepflanzte und Erbaute <strong>zu</strong>nichte. "<strong>Die</strong> Menschen wurden manches Mal überrascht, es<br />
gab Tote und innerhalb einer Nacht konnte alles weg sein", erzählt Horst Terfehr, Geschäftsführer des<br />
Deichverbandes Xanten-Kleve. Doch die Bewohner nahmen die Herausforderung immer wieder an. Mit dem<br />
Deichbau. Einen echten Hochwasserschutz am Rhein gibt es nun seit rund 600 Jahren. Horst Terfehr blickt im<br />
Schöpfwerk Warbeyen auf den Oraniendeich. "Früher war hier alles flach und eben", sagt er. Deiche? <strong>Die</strong><br />
kannten die Menschen am Niederrhein im frühen Mittelalter noch nicht. Sie siedelten <strong>zu</strong>nächst auf den Anhöhen.<br />
Auf Sandrücken, die sich durch Ablagerungen des Rheins und durch das Gletschergeröll aus der Eiszeit gebildet<br />
<strong>hat</strong>ten. So wie in Zyfflich, Brienen und Wissel. "Das waren aber nur wenige Flächen. Irgendwann reichten sie<br />
nicht mehr aus", so Terfehr. <strong>Die</strong> Menschen nahmen das Zepter in die Hand, denn sie wollten sich nicht damit<br />
abfinden, dass sich der Rhein zwischen Eltenberg und dem Klever <strong>Berg</strong> auf sieben Kilometern mit seinem<br />
Hochwasser frei bewegen kann. Sie schütteten Boden an - ein Poll, auf dem sie ihren Hof bauten, entstand.<br />
In Salmorth tragen heute noch Höfe das Wort "Poll" in ihrem Namen. Wie <strong>zu</strong>m Beispiel der Möwenpoll. <strong>Die</strong><br />
Niederrheiner gaben sich damit noch nicht <strong>zu</strong>frieden, sie wurden mutiger. Sie bauten Ringwälle, wodurch<br />
Rheininseln und Warde entstanden. <strong>Die</strong> Wälle in Wissel und Rindern gehören <strong>zu</strong> den ältesten. Sie gehen auf das<br />
neunte Jahrhundert <strong>zu</strong>rück. Doch die Eindeichungen wurden größer und größer. Ringdeiche entstanden. In<br />
Griethausen und Kellen etwa. Alles, was <strong>zu</strong> einer Kirchengemeinde gehörte, wurde ringsherum geschützt. In<br />
Huisberden und Warbeyen sind für den aufmerksamen Beobachter noch kleine Bruchstücke dieser<br />
Vergangenheit <strong>zu</strong> sehen.<br />
"1966 wurden sie aber planiert", erinnert sich Terfehr. Zunächst schufen die Bewohner Deiche mit der eigenen<br />
Muskelkraft, Schaufel und Karre. Um 1200 setzte man verstärkt auf die Hilfe von Pferden, was auch bis ins 19.<br />
Jahrhundert so blieb. <strong>Die</strong> Landgewinnung war ganz im Sinne der Obrigkeit. MICHAEL VEHRESCHILD<br />
NRZ MOERS 12.10.2001<br />
Schützenhilfe für Kohle-Vorstand<br />
Minister Schwanhold: Kohlevereinbarung und sozialverträgliche Anpassung werden nicht in Frage gestellt. Noch<br />
keiner von den 1300 "überzähligen" <strong>Berg</strong>leuten weiß, wo sein <strong>zu</strong>künftiger Arbeitsplatz sein wird. Für qualifizierte<br />
Planung spricht auch nicht, dass das <strong>Berg</strong>werk, das 1300 Mitarbeiter <strong>zu</strong> viel <strong>hat</strong>, quasi bis <strong>zu</strong>letzt noch<br />
schubweise <strong>Berg</strong>leute von anderen Anlagen der DSK übernehmen musste. "Erst letzten Montag habe ich hier<br />
noch achtzig neue Kollegen von der Anlage Blumenthal AV begrüßt",<br />
wundert sich Vogt. Schon dieses Tohuwabohus wegen glaube er nicht, dass beim DSK-Vorstand in Herne fertige<br />
Verset<strong>zu</strong>ngpläne in der Schublade liegen. Von fertigen Plänen über die "Bewegungsströme" zwischen den<br />
<strong>Berg</strong>werken wußte gestern auch Karl-Heinz Stenmanns <strong>nichts</strong>. Der stellvertretende Werksleiter auf Friedrich
Heinrich glaubt aber: "Das kriegen wir hin!" Auch wenn der von neun Monaten auf nur noch drei Monate<br />
geschrumpfte Zeitraum für die Personalplanung sehr eng geworden sei, wie Stenmanns einräumt. Er gibt aber <strong>zu</strong><br />
bedenken, dass die DSK im Jahr 2000 insgesamt 11 000 und im laufenden Jahr noch einmal zwischen 4000 und<br />
6000 Arbeitsplätze abbauen musste. Rund 1000 der noch 1600 Mitarbeiter auf Niederberg waren gestern mittag<br />
auf der Belegschaftsversammlung. Sie hätten die Informationen über die vorgezogene Schließung ihres<br />
Schachtes gefasst aufgenommen, berichtete Betriebsratsvorsitzender Hardy Prill. Ein Grund für die beschleunigte<br />
Konzentration sei auch, dass das kalkulierte Betriebsergebnis auf Niederberg in diesem Jahr nicht erreicht wird,<br />
habe die Werksleitung auf der Versammlung erklärt. Der Betriebsrat erwarte jetzt, dass der Verlegungsplan für<br />
die <strong>Berg</strong>leute möglichst rasch auf den Tisch kommt. Er gehe davon aus, dass die betroffenen Frauen und Männer<br />
nicht erst unter dem Weihnachtsbaum erfahren, wo ihr künftiger Arbeitsplatz sein wird. Hardy Prill geht auch<br />
davon aus, dass die linksrheinisch wohnenden <strong>Berg</strong>leute beim <strong>Berg</strong>werk West in Kamp-Lintfort und die<br />
rechtsrheinischen einen wohnungsnäheren Arbeitsplatz erhalten werden. Schützenhilfe für die vorgezogene<br />
Stillegung erhielt der DSK-Vorstand von NRW-Wirtschaftsminister Schwanhold: "<strong>Die</strong>se betriebswirtschaftliche<br />
Optimierungsmaßnahme stellt weder die Kohlevereinbarung von 1997 noch den sozialverträglichen<br />
Anpassungsprozess in Frage." (piz-) FORTSETZUNG VON SEITE 1<br />
NRZ DUISBURG 12.10.2001<br />
BRIEFE AN DIE REDAKTION<br />
"Natur mit künstlichen Wällen"<br />
"<strong>Die</strong> Überflutungsrisiken werden von der DSK sehr ernst genommen, das sagt schon der Vorschlag, aus dem<br />
Eisenbahndamm der Strecke Walsum-Voerde-Spellen einen ,Schlafdeich <strong>zu</strong> bauen. Aber die<br />
Sicherheitsvorschläge gehen noch weiter: Aldenrade, 200-Meter-Wall, 1400-Meter-Wall zwischen <strong>Berg</strong>werk<br />
Walsum und Südhafen, Emscherdeich zwischen Rhein und Eisenbahndamm, Bahndamm auf dem Steag-<br />
Gelände zwischen Rhein- und Eisenbahndamm Walsum-Wesel.<br />
Kein Abbau im Dinslakener Graben, dafür bessere Grundwasser-Fließrichtung.<br />
Der Gedanke an eine Umwelt mit künstlichen Wällen ist unerträglich; das wäre ein Frevel an der Natur. Eine<br />
Gänsehaut müssen Naturschützer bekommen, wenn sie in der NRZ die Alternative lesen: ,Nut<strong>zu</strong>ng des<br />
Wohnungswaldes bei Hochwasser als eingedeichten Retentionsraum. Das wäre eine Dunstwanne und kein Wald<br />
mehr. Der Steuerzahler würde die Zerstörung einer intakten Umwelt bezahlen. Ich habe den Eindruck, die DSK ist<br />
der Auffassung, hier leben Menschen mit einem generellen Denkverbot. Allein die ökologische Nische, der<br />
Eisenbahndamm, Strecke Walsum-Voerde-Spellen, mit hohen alten Bäumen und dichtem Bewuchs ginge<br />
verloren. Ein Refugium für viele Vogelarten und eine nicht <strong>zu</strong> unterschätzende CO2-Senke. Es würde Jahrzehnte<br />
dauern, ehe Ersatzpflan<strong>zu</strong>ngen für entsprechenden Ausgleich sorgen. An das Baudesaster darf man gar nicht<br />
denken. Was aber noch gravierender ist: Alle Menschen, die westlich des Bahndammes wohnen, würden <strong>zu</strong><br />
Polderopfern."<br />
NRZ MOERS 11.10.2001<br />
Den Mitarbeitern Klarheit schuldig<br />
ZUR SACHE<br />
Schließung der Schachtanlage Niederberg Etwas eigenartig ist die Nachricht, die die Deutsche Steinkohle AG<br />
über die gestrige Sit<strong>zu</strong>ng des Aufsichtsrates an die Medien schickte: Der Vorstand schlägt eine vorgezogene<br />
Schließung der Zeche Niederberg schom <strong>zu</strong>m 31. Dezember vor. Der Aufsichtsrat wird über den Vorschlag aber<br />
auch erst in seiner Dezembersit<strong>zu</strong>ng formell beschließen.Zwischen Aufsichtsratsbeschluss und<br />
Zechenschließung lägen dann nur wenige Tage im Dezember. Bis dahin könnte niemand mit Bestimmtheit sagen:<br />
Niederberg wird ein halbes Jahr früher <strong>zu</strong>gemacht. Klarheit sieht anders aus. Klarheit ist die DSK ihren 5100<br />
Mitarbeitern auf Niederberg und Friedrich Heinrich aber schuldig.<br />
Erst recht den 1300 Kumpeln, die nicht bleiben können. Bis heute weiß noch keiner von ihnen, wo sein künftiger<br />
Arbeitsplatz sein wird, klagte gestern der Betriebsrat.<br />
Bisher habe Friedrich Heinrich in Kamp-Lintfort sogar noch Personal aufgenommen statt abgegeben. Wenn das<br />
so ist, dann klingt die DSK-Aussage, der Prozess der Zusammenlegung sei soweit fortgeschritten, dass man die<br />
"kostensparende Konzentration" beschleunigen könne, nicht besonders überzeugend. RUDOLF PIZMOHT<br />
NRZ RHEINBERG 11.10.2001<br />
Betroffenheit als Druckmittel?<br />
Elf Häuser in Obermörmter betroffen. FBI: "Unwirtschaftliche Pläne".<br />
XANTEN. Elf Wohnhäuser sind in Obermörmter von einer möglichen Deichrückverlegung betroffen. Das sind elf<br />
<strong>zu</strong>viel, machte die Freie Bürger-Initiative Xanten (FBI) bei einer Versammlung in Obermörmter noch einmal<br />
deutlich. Vorsitzender Herbert Dissen wies darauf hin, dass der Rat der <strong>Stadt</strong> Xanten einstimmig nein <strong>zu</strong> diesem<br />
Vorhaben gesagt habe. Retentionsflächen müssten nicht dort geschaffen werden, wo Häuser stehen.
Dissen: "Unbewohnte Flächen gibt es auf der anderen Rheinseite." Ein solches Vorgehen, wie in Obermörmter<br />
geplant, sei überhaupt nicht wirtschaftlich. Stattdessen müssten die vorhandenen Deiche erhöhte werden. Der<br />
Vorsitzende des Hochwasserschutzverbandes Niederrhein (HSV-N), Hans-Peter Feldmann aus Xanten, betonte<br />
die Bedeutung der Einspruchsmöglichkeiten der Bürger.<br />
Kommunale Einwände, das habe man beim Deich in Birten gesehen, seien so gut wie zwecklos. "Wichtig und<br />
gewichtig ist die persönliche Betroffenheit", so Feldmann. Im Übrigen geißelte er die Deichrückverlegung als<br />
"puren Blödsinn". Dadurch würden etwa 200 Kubikmeter Raum gewonnen, der ohnehin im Ernstfall in Windeseile<br />
voll mit Wasser sei. Wie Dissen forderte auch Feldmann, dass die Kosten für Deichsicherheit und -bauten nicht<br />
den Deichverbänden und damit deren Mitgliedern aufgebrummt werden dürften. <strong>Die</strong>s sei Aufgabe von Land und<br />
Bund und eine Regelung, die einzigartig in der Bundesrepublik sei. <strong>Die</strong> Bewohner der Region seien mit den<br />
Kosten und den Gefahren des Hochwassers belastet. <strong>Die</strong> Niederländer hätten bereits angekündigt, um ihre<br />
Gebiete <strong>zu</strong> retten, müssten die Polder am Niederrhein eben geflutet werden. Feldmann: "Wir sind das<br />
Notüberlaufbecken der Nation." (cf)<br />
NRZ MOERS 11.10.2001<br />
Spende aus Familienfest<br />
KAMP-LINTFORT. Den Erlös des Familienfestes spendete die Belegschaft des <strong>Berg</strong>werks Friedrich<br />
Heinrich/Rheinland für einen guten Zweck. <strong>Die</strong> Kamp-Lintforter Vereine "Initiative Integration" und "Freizeit für<br />
Behinderte"<br />
erhielten jeweils 1804,50 Mark für Projekte, die behinderten Menschen <strong>zu</strong>gute kommen sollen. Für die "Initiative<br />
Integration" nahm Gunhild Sartingen (vorne, 2.v.r.) den Scheck entgegen. Erwin Pinno (vorne, 2.v.l.) vom Verein<br />
"Freizeit für Behinderte" freute sich ebenso.<br />
<strong>Die</strong> Schecks überreichten Personal- und Sozialdirektor Peter Ermlich (vorne r.), Betriebsratsvorsitzender<br />
Friedhelm Vogt (vorne l.) sowie Mitarbeiter Karl Momber und Ralf Borkenhäuser (hinten v.l.). (DSK-Foto:<br />
D.Klingenburg)<br />
NRZ MOERS 11.10.2001<br />
Besuch Rheinpreussens lohnt sich<br />
<strong>Die</strong> Anlage mit ihren historischen Gebäuden ist sehenswert. Jeden Sonntag können sich Besucher auch<br />
im dortigen Museum umschauen. Von Grund auf renoviert.<br />
MOERS. <strong>Die</strong> Industriebrache steckt im Keller: Nur noch eine Bilderausstellung erinnert daran, wie es auf der<br />
ehemaligen Schachtanlage Rheinpreussen IV in Moers vor der Restaurierung aussah. Viel <strong>hat</strong> sich getan. Heute<br />
sind die Gebäude kaum wieder <strong>zu</strong> erkennen, eröffnete doch vor knapp einem Jahr ein kleines Museum im alten<br />
Maschinenhaus.<br />
Auch heute noch wird getüftelt<br />
Doch damit war die Arbeit der vielen Helfer noch nicht beendet. Auch heute wird noch an der alten<br />
Fördermaschine getüftelt, gewienert und geschraubt. Besonders aktiv ist der Grafschafter Museums- und<br />
Geschichtsverein, dessen Mitglieder sich liebevoll um die alte Anlage im Moerser <strong>Stadt</strong>teil Hochstraß kümmern.<br />
Alles von Grund auf renoviert<br />
Schon auf dem Außengelände kann man sich davon überzeugen, dass die alte Schachtanlage sehenswert ist.<br />
<strong>Die</strong> historischen Gebäude sind von Grund auf renoviert, mittendrin ragt das alte Doppelbockfördergerüst in den<br />
Himmel. Sogar die Förderseile hängen auf einer Seite noch an den Seilscheiben. <strong>Die</strong> führen direkt ins<br />
Maschinenhaus, wo sich nicht nur eingefleischte <strong>Berg</strong>baufans wohlfühlen. <strong>Die</strong> Fördermaschine ist nicht mehr in<br />
Betrieb, doch auf die typischen Geräusche vor der Seilfahrt brauchen die Besucher nicht <strong>zu</strong> verzichten. <strong>Die</strong><br />
kommen nämlich vom Tonband und lassen den Gast schnell vermuten, er sei gerade auf einem <strong>Berg</strong>werk, das<br />
noch fleißig Kohle fördert. Für die Vereinsmitglieder gibt es immer etwas <strong>zu</strong> tun. Peter Seidel bastelt <strong>zu</strong>rzeit<br />
kräftig an der mächtigen Fördermaschine. Wenn sich ihre Räder schon nicht mehr drehen, dann soll wenigstens<br />
der Teufenanzeiger funktionieren. Mit Hilfe eines elektrischen Antriebs sollen die Zeiger bald wieder in Gang<br />
kommen, auch wenn es in Wirklichkeit keinen einzigen Meter mehr in die Tiefe geht. Während Peter Seidel das<br />
Handwerkliche erledigt, <strong>hat</strong> sich Karl Heinz Tepper ganz andere Gedanken gemacht. Unter dem Titel<br />
"Meilensteine" stellt er verschiedene Broschüren <strong>zu</strong>sammen, in denen der ehemalige Leiter des Elektrobetriebes<br />
vom <strong>Berg</strong>werk Rheinland ausführlich die Technik verschiedener Maschinen auf Rheinpreussen erklärt.<br />
<strong>Die</strong> Helfer freuen sich<br />
<strong>Die</strong> Helfer um den Vorsitzenden Alexander Eichholz freuen sich über Interessenten, die sich an der Pflege der<br />
Anlage beteiligen wollen. Wer mitarbeiten möchte, kann sich beim Vorsitzenden (02841- 30056) melden. Wer als<br />
Besucher kommen will: Sonntags von 14 bis 17 Uhr ist die alte Maschinenhalle für Interessierte geöffnet.<br />
(Christian Böse)
NRZ MOERS 11.10.2001<br />
THEMA DES TAGES<br />
Zeche Niederberg soll früher schließen<br />
Letzte Schicht schon am 31. Dezember.<br />
NEUKIRCHEN-VLUYN. <strong>Die</strong> Zeche Niederberg soll schon <strong>zu</strong>m 31. Dezember geschlossen werden, wenn der<br />
Aufsichtsrat der Deutschen Steinkohle AG (DSK) in seiner Dezember-Sit<strong>zu</strong>ng dem Vorschlag des<br />
Unternehmensvorstandes formell folgt. Ursprünglich <strong>hat</strong>ten DSK und Ruhrkohle AG (RAG) die Einstellung der<br />
Förderung auf Niederberg erst <strong>zu</strong>m 30. Juni 2002 vorgesehen. <strong>Die</strong> beiden Schachtanlagen Niederberg und<br />
Friedrich Heinrich in Kamp-Lintfort sollen <strong>zu</strong>m 1. Januar 2002 <strong>zu</strong>m "Verbundbergwerk West" am Standort Kamp-<br />
Lintfort <strong>zu</strong>sammengelegt werden. Beide <strong>Berg</strong>werke <strong>zu</strong>sammen haben heute 5100 Mitarbeiter. Für das<br />
Verbundbergwerk West sind nur noch 3800 <strong>Berg</strong>leute vorgesehen. Für 1300 Mitarbeiter müsste der Zeitplan für<br />
Verset<strong>zu</strong>ngen an andere Schachtanlagen beschleunigt werden. Betriebsratsvorsitzender Friedhelm Vogt fragt<br />
sich, wie das bewerkstelligt werden kann: "<strong>Die</strong> gesamte Planung ist auf den 30. Juni abgesstellt. Heute weiß noch<br />
keiner der betroffenen Kollegen wo er künftig arbeiten wird. Wir geraten mit der Personalplanung ganz schön ins<br />
Schwimmen." Er befürchtet auch, dass sich diese Situation negativ auf die Kostenplanung für das künftige<br />
<strong>Berg</strong>werk West auswirken wird. Dagegen heißt es in einer Pressemitteilung der DSK, der Prozess "sei<br />
mittlerweile so weit fortgeschritten, dass die kostensparende Konzentration früher als ursprünglich geplant<br />
möglich wird." (piz-)<br />
NRZ DUISBURG 11.10.2001<br />
Rheinkai bietet der Kohle viel Platz<br />
Nach Aufbau des Krans soll Anlage im November in <strong>Die</strong>nst gehen. Kohle statt Erz wird der bald 20 Jahre alte<br />
Hafen-Kran in seinen Greifer nehmen, der jetzt am neuen Importkohle-Terminal errichtet wurde. Der Kran tat<br />
lange Jahre auf der Erzinsel in Ruhrort <strong>Die</strong>nst. Seit wenigen Tagen steht der Riese auf dem nagelneuen 300<br />
Meter langen Rheinkai in Hochfeld. Techniker setzten gestern den Ausleger wieder in den Drehkranz, die<br />
vollständige Montage dauert aber noch vierzehn Tagen. Geplant ist, die Kohle-Umschlageinrichtung Mitte<br />
November in Betrieb <strong>zu</strong> nehmen.<br />
Eine Million Tonnen Jahresumschlag<br />
<strong>Die</strong> drei Hektar große Fläche gehört wie die Kaianlage der Hafengesellschaft "duisport". <strong>Die</strong> Harpen Transport<br />
AG (HTAG), eine Tochter der Harpen AG Dortmund, <strong>hat</strong> die Fläche gepachtet und in den Aufbau des Krans, die<br />
Anlage einer Berieselungsanlage und ein kleines Sozialgebäude rund 2,5 Millionen Mark investiert, wie HTAG-<br />
Sprecher Volker Seefeldt gestern erläuterte.<br />
Zu der Terminal-Betreibergesellschaft "Masslog GmbH" gehören neben Harpen eine gemeinsame Gesellschaft<br />
der Häfen Duisburg und Amsterdam (30 Prozent) und die IO Martrade Holding Management GmbH Düsseldorf<br />
(19,9 %). Erstes Ziel ist es, in Hochfeld künftig gut eine Million Tonnen Importkohle im Jahr um<strong>zu</strong>schlagen, so<br />
Seefeldt. Und darauf auf<strong>zu</strong>bauen. "Wir wollen mit dem erwarteten Anstieg der Importkohle nach Deutschland<br />
wachsen", betont der Unternehmenssprecher. Allgemein wird erwartet, dass sich die jährliche Importkohle-menge<br />
von heute 33 Millionen Tonnen bis 2005 auf 40 bis 45 Millionen Tonnen erhöht. 2005 ist auch das Jahr, in dem<br />
eine neue Festlegung der heimischen Kohleförderung beginnt. Da mit einem Rückgang <strong>zu</strong> rechnen ist, wird die<br />
Importmenge weiter wachsen. Sechs von zehn Tonnen Importkohle kommen über die sogenannten ARA-Häfen<br />
(Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen) nach Deutschland.<br />
In Duisburg soll ein wachsender Anteil weiterverteilt werden - für 2001 geht man noch von sieben Millionen<br />
Tonnen aus. Von der neuen Anlage in Hochfeld laufen die Kohletransporte <strong>zu</strong> über 90 Prozent, so Seefeldt, per<br />
Schiene weiter, vor allem <strong>zu</strong> den deutschen Kraftwerken. Was nicht sofort gebraucht wird, kann hier<br />
zwischengelagert werden. (ama)<br />
NRZ KLEVE 10.10.2001<br />
Verhandlungen mit zwei Landwirten laufen<br />
HOCHWASSERSCHUTZ / Verband benötigt noch eine Fläche für die Rückverlegung des Deiches bei<br />
Warbeyen.<br />
WARBEYEN. Der Deich zwischen Rheinbrücke und der Überlaufschwelle soll um bis <strong>zu</strong> 150 Meter <strong>zu</strong>rückverlegt<br />
werden (die NRZ berichtete), wodurch der Emmericher Rheinpegel abgesenkt würde. Größtenteils verläuft der<br />
Hochwasserschutz über Gebiet, das im Besitz des Deichverbandes Xanten-Kleve ist. Nur zwischen Brücke und<br />
der ehemaligen Ziegelei muss der Verband noch um Grundstücke verhandeln. "Hier gehe ich von einer Einigung<br />
aus", erklärte Horst Terfehr, Geschäftsführer des Deichverbandes Xanten-Kleve. Man benötigte ein Gebiet von<br />
zwei Landwirten. <strong>Die</strong> seien im Prinzip bereit, "es kommt aber noch auf Feinheiten an." Sie sollen Ersatzflächen<br />
erhalten. Sind die Verträge formuliert, könnten sie unterschrieben werden, sobald die Mittel des Landes da seien.<br />
"Frühestens im nächsten Jahr" sei das, vermutet Terfehr. Zuletzt <strong>hat</strong>te der Deichverband das drei Hektar große<br />
Gelände der Alten Ziegelei erworben. Das Land bezahlte den Bodenpreis von 350 000 Mark. Für den Abriss der<br />
Ziegelei legte das Land nochmals eine halbe Million Mark drauf. Und eben die Ziegelei war in den 60er Jahren<br />
der Grund dafür, dass der Deich hier am Oraniendeich wie eine Nase in Richtung Rhein neigt. "Seinerzeit gab es
keine Möglichkeit, die Ziegelei <strong>zu</strong> verlagern, denn sie war damals in Betrieb", erinnert sich Terfehr. Gerne hätte<br />
man schon damals den Deich hier in dem Bereich gehabt, wo die Ziegelei stand. Über die Pläne, den Deich im<br />
Bereich Warbeyen <strong>zu</strong>rück<strong>zu</strong>verlegen, "weiß die Ortschaft im Grunde genommen Bescheid", so Terfehr. Und es<br />
habe "keine negativen Äußerungen gegeben." (M.V.)<br />
NRZ EMMERICH 10.10.2001<br />
"Wann kommt das Wasser?"<br />
Mitten auf der Rheinpromenade in Höhe des Lokals "Alte Rheinfähre" wurden probeweise Stützen und<br />
Mobilelemente montiert und die Dichtigkeit der Mauer getestet.<br />
EMMERICH. "Wann kommt denn das Wasser", quengelt der sechsjährige Ser<strong>hat</strong>. Doch der Knirps muss sich<br />
gedulden. Denn so ein erster Probe-Aufbau der mobilen Hochwasserschutz-Elemente braucht eben seine Zeit.<br />
Gestern an der "Alten Rheinfähre".<br />
Mit Verspätung wegen eines Staus am Kölner Ring liefert die Spezialfirma IBS aus dem bayrischen Thierhaupten<br />
die Aluprofile an. Dann, gegen 11.30 Uhr, kann der Test endlich beginnen. Unterstützt von Feuerwehrmännern<br />
setzt die Firma IBS Balken für Balken die Schutzmauer <strong>zu</strong>sammen. "<strong>Die</strong> Dichtigkeitsprüfung ist Auflage der<br />
Genehmigungsbehörde", sagt Heinz Walter, stellvertretender Deichgräf der Deichschau Emmerich. Sie ist die<br />
Bauherrin der Hochwassersanierung, die für diesen ersten Planungsabschnitt ca. 1,1 Millionen Mark investiert.<br />
Beim aufwändigen Auf- und Abbau schauen besonders die Bauhofmitarbeiter aufmerksam <strong>zu</strong>. Schließlich sollen<br />
sie später diesen Job übernehmen: Im Ernstfall, aber auch bei der alljährlich vorgeschriebenen Übung. In rund<br />
einer Stunde, so IBS-Bauleiter Werner Hartung, sei die Montage <strong>zu</strong> schaffen. Weil kein Hochwasser ist, muss der<br />
flüssige Härtetest simuliert werden. Nachdem die acht senkrechten Stützen montiert und die meisten der 180<br />
Dämmbalken für die 28 Meter breite Doppelsicherung eingezogen sind, ruft Werner Hartung oben auf der Mauer:<br />
"Alles okay", worauf der stellvertretende Lösch<strong>zu</strong>gführer Martin Bettray per Funk seinen Kameraden an Bord des<br />
Löschbootes das Signal gibt, die Pumpen an<strong>zu</strong>schmeißen. Und schon bahnt sich das Wasser seinen Weg durch<br />
zwei Schläuche. Rund 50 000 Liter werden in die Doppelreihe mit Aluprofilen gepumpt. Eine Doppelsicherung<br />
wird verlangt, wenn der Mobilschutz höher als einen Meter ausfällt. Und hier, mitten auf der Straße, können die<br />
mobilen Elemente bis auf 2,80 Meter gestapelt werden. Auch die Dämmbalken saugen sich voll Wasser und<br />
erzeugen so den gewünschten Gegendruck nach unten. Kleinere Leckagen bereiten Hartung keine Sorgen, sie<br />
werden abgedichtet. "Test bestanden", lautet der Tenor. Alle Mobilelemente will die Deichschau später in einer<br />
neuen Halle an der Deichstraße einlagern, sagte Rudolf Feldmann. Aber erst, wenn die Planfeststellung für den<br />
Abschnitt 2, die eigentliche Rheinpromenade, durch ist. Wenn in den nächsten Wochen die Bezirksregierung den<br />
sofortigen Voll<strong>zu</strong>g anordnet, dürfte während der vierwöchigen Offenlage mit einigen Klagen <strong>zu</strong> rechnen sein, die<br />
dann vom Verwaltungsgericht im Eilverfahren behandelt werden müssen. Und der kleine Ser<strong>hat</strong> ? Er war etwas<br />
betrübt. Weil er gestern keine Fische gesehen <strong>hat</strong>. NORBERT KOHNEN (Text) und DIRK SCHUSTER (Fotos)<br />
NRZ RHEINBERG 09.10.2001<br />
Gruben<strong>zu</strong>g ist endlich komplett<br />
Spielplatz an der Straße "Zum Rhein" ist beliebter Anziehungspunkt für Kinder und Jugendliche.<br />
RHEINBERG-EVERSAEL.Zu einem beliebten Anziehungspunkt für Kinder und Jugendliche <strong>hat</strong> sich inzwischen<br />
der Spielplatz an der Straße "Zum Rhein" in Eversael entwickelt. An dieser Situation ganz und gar nicht<br />
unschuldig ist Robert Meier, der sich selbst als Koordinator für attraktivitätssteigernde Maßnahmen auf dem<br />
immerhin 2000 Quadratmeter großen städtischen Areal versteht. Immer wieder ist der engagierte Vater von fünf<br />
Söhnen im Einsatz, um die vielen Details <strong>zu</strong> organisieren und auch andere Bürger <strong>zu</strong>r tatkräftigen Mithilfe <strong>zu</strong><br />
gewinnen. Sichtbares Zeichen dieser Überzeugungsarbeit ist vor allem ein Original-Gruben<strong>zu</strong>g aus dem Jahre<br />
1930, der im <strong>Berg</strong>werk Walsum ausgedient <strong>hat</strong>te.<br />
Verbindungen <strong>zu</strong>m <strong>Berg</strong>bau genutzt<br />
Meier, der 21 Jahre lang im <strong>Berg</strong>bau tätig war, davon zehn Jahre in der Schachtanlage Walsum, konnte seine<br />
beruflichen Verbindungen nutzen. Bereits 1999 äußerte er in einem Schreiben an Werkschef Wolfgang Traut<br />
gesteigertes Interesse daran, eine nicht mehr benötigte Lok plus Personenwaggon käuflich <strong>zu</strong> erwerben. Doch es<br />
dauerte eine ganze Weile, bis der Eversaeler grünes Licht von der anderen Rheinseite bekam. <strong>Die</strong> Lok machte<br />
einen hervorragenden Eindruck. Denn eigens für eine Präsentation auf der Weltausstellung "Expo" in Hannover<br />
war das betagte Gefährt aufgemöbelt worden.<br />
Lok begeisterte schon auf der "Expo"<br />
Der Personenwaggon war dagegen in einem miserablen Zustand", erinnert sich Meier. Gemeinsam mit einem<br />
Vertreter der <strong>Stadt</strong> und einem Prüfer vom TÜV begutachtete er das Gefährt, das ehedem bis <strong>zu</strong> zehn Kumpel<br />
beförderte, auf dem <strong>Berg</strong>werksgelände. Vom Technischen Überwachungsverein gabs hernach eine Liste von<br />
Änderungshinweisen, um eventuelle Verlet<strong>zu</strong>ngsgefahren von vornherein <strong>zu</strong> vermeiden. Das reichte von der<br />
Entrostung über die Entfernung schwerer beweglicher Teile bis hin <strong>zu</strong>r Anweisung, die Schiebetüren des vier<br />
Meter langen und 80 Zentimeter breiten Waggons fest<strong>zu</strong>schweißen. Mit Hilfe von Deichgräf Viktor Paeßens und<br />
kostenlosem Einsatz der Firma Centrans wurde derweil an der Straße "Zum Rhein" Acker- in Spielfläche<br />
umgewandelt. Sodann platzierte man mit vereinten Kräften einen neun Meter langen Schienenstrang auf einem<br />
Schotter- und Kiesfundament. Im Frühsommer konnte die schwere Lok <strong>zu</strong>m Spielareal transportiert werden.
Dafür stellte die Eversaeler Firma Blastik unentgeltlich einen Lkw mit Tieflader <strong>zu</strong>r Verfügung. Zugleich wurde der<br />
Personenwaggon <strong>zu</strong> einem alten Ziegeleigelände geschafft und dort zwischengelagert.<br />
Waggon wurde in der Werft aufgemöbelt<br />
Nächste Station des überdachten Anhägers war die Meidericher Schiffswerft, wo auch die Firma Palmiri tätig ist.<br />
<strong>Die</strong>ses Unternehmen, das unter anderem für die Entrostung von Wassergefährten sorgt, konnte Robert Meier als<br />
weiteren Sponsor gewinnen.<br />
Und das Palmiri-Team war sehr flott. "Innerhalb von 14 Tagen war der Personenwaggon gesandstrahlt,<br />
feuerverzinkt und grundiert", resümiert der rührige Eversaeler Koordinator anerkennend. Nach dem Blitz-Service<br />
wurde das insgesamt zehn Meter lange Zug-Duo endlich vor Ort komplettiert.<br />
Für den abschließenden Anstrich des Duos begeisterte Robert Meier die Jugendabteilung der Eversaeler<br />
Bürgerschützen. Farbe, Pinsel und Schutzanzüge für diesen Einsatz spendierte der Rheinberger Malermeister<br />
Axel Rust.<br />
"Es fehlt nur noch ein größeres Spielgerät"<br />
Jetzt wetteifert das Zuggespann in freundlichem Blau mit der Streetballanlage um die Wette. Tischtennisplatte,<br />
Sandkastenbereich, Kletterstämme und zwei Sitzbänke gehören ebenso <strong>zu</strong>m Spielplatz. Meier stellt fest: "Es fehlt<br />
nur noch ein größeres Spielgerät." ULRICH ERNENPUTSCH<br />
NRZ RHEINBERG 09.10.2001<br />
Karten taugen nicht für den Ernstfall<br />
HOCHWASSERSCHUTZ / Verband setzt Reihe von Info-Abenden fort. Kritikpunkt: <strong>Berg</strong>senkungen werden<br />
nicht erfasst.<br />
RHEINBERG. Wer Katastrophenszenarien simulieren will, braucht vor allem eines: aktuelle Zahlen. Dass es beim<br />
Hochwasser gerade hieran hapert, ist vielen überhaupt nicht klar, <strong>hat</strong> der Hochwasserschutzverband Niederrhein<br />
(HSV-N) in dieser Woche wieder einmal festgestellt. Am Montag <strong>hat</strong>te der neue Verband in die Gaststätte "Zur<br />
Alten Mühle" in Budberg eingeladen. Etwa 35 Interessierte waren gekommen - und die hörten eine Menge<br />
Neuigkeiten, ist sich HSV-Vorsitzender Hans-Peter Feldmann aus Xanten sicher. Beispiel Zahlenmaterial: <strong>Die</strong><br />
Karten mit den so genannten aktuellen Geländehöhen, so Feldmann, berücksichtigten nicht die <strong>Berg</strong>senkungen<br />
der vergangenen Jahrzehnte. <strong>Die</strong>s sei in der Runde auf großes Unverständnis gestoßen, "das darf doch nicht<br />
sein". In Budberg ging es - wie schon bei der ersten Informationsveranstaltung des Hochwasserschutzverbandes<br />
vor einer Woche in Birten - erneut um das verhängnisvolle Wechselspiel von <strong>Berg</strong>bau und Standsicherheit der<br />
Deiche. Der Deichverband Orsoy sei vertreten gewesen, er habe sich vehement gegen eine Ausdehnung des<br />
Kohleabbaus wie im Rahmenbetriebsplan vorgesehen ausgesprochen. <strong>Die</strong> Sicherheit der Deiche und damit der<br />
Bevölkerung müsse oberstes Ziel sein.<br />
Sorgen bereiten den engagierten Bürgern vom Hochwasserschutzverband die jüngsten Aussagen von NRW-<br />
Ministerpräsident Wolfgang Clement, der den <strong>Berg</strong>leuten praktisch eine – politische - Bestandsgarantie gegeben<br />
habe. Auch hier müsse mit vereinten Kräften gekämpft werden, wies Feldmann auf das Bündnis mit den<br />
zahlreichen Gegnern des Rahmenbetriebsplanes hin. Wichtig sei, sich immer wieder die Realitäten eines<br />
Ernstfalls vor Augen <strong>zu</strong> halten. Denn es seien wesentlich mehr Gebiete von Überschwemmung gefährdet als<br />
offiziell immer angegeben. So müsste sich die Umweltverträglichkeitsprüfung im Zuge des Rahmenbetriebsplans<br />
auch auf Flächen ausweiten, die nicht unmittelbar vom Kohleabbau betroffen sind. Das war vor einer Woche<br />
schon deutlich geworden: "Wenn in Orsoy der Deich bricht", <strong>hat</strong>te Feldmann erklärt, "dann ist das Wasser auch<br />
ganz schnell in Xanten." Wer Fragen <strong>zu</strong>m Thema <strong>hat</strong>: Ab November gibt es an jedem zweiten Mittwoch eine Art<br />
Bürgersprechstunde des Verbands bei van Bebber in Xanten-Birten. Weitere Infos auch bei Hans-Peter<br />
Feldmann: Tel: 02801/6584. (cf)<br />
NRZ KLEVE/EMMERICH 09.10.2001<br />
"Badewanne" für Vater Rhein wird größer<br />
Durch Deichverlegung in Warbeyen würde Emmericher Pegel fallen.<br />
EMMERICH. Bisher <strong>hat</strong> der Deich in Höhe der früheren Ziegelei von Warbeyen den Hochwasserschützern eine<br />
lange Nase gezeigt. Denn dort ragt er näher an den Rhein heran als anderswo. <strong>Die</strong>se "Ecke" soll verschwinden,<br />
der Rhein von der Brücke bis <strong>zu</strong>r Überlaufschwelle durch einen neuen Deichverlauf begradigt werden. Damit<br />
bekäme "Vater Rhein" mehr Platz, um sich aus<strong>zu</strong>breiten.<br />
"<strong>Die</strong> Badewanne wird größer", sagt Horst Terfehr, Geschäftsführer des Deichverbandes Xanten-Kleve. Und das<br />
<strong>hat</strong> Folgen für den Wasserspiegel des Emmericher Pegels. Der werde nämlich abgesenkt und damit der<br />
Hochwasserschutz auf der anderen Rheinseite "entlastet", so Terfehr. Das könnten fünf bis 20 Zentimeter sein:<br />
"Das müssen Berechnungen noch ergeben." Damit wird nun begonnen. "Wir haben jetzt den Planungsauftrag<br />
erteilt, die Rückverlegungstrasse und damit den neuen Deichverlauf <strong>zu</strong> erarbeiten." <strong>Die</strong> Ingenieuraufträge für eine<br />
halbe Million Mark wurden vergeben - das Land bezahlt sie. Untersucht wird etwa, wie sich der Wasserspiegel<br />
verändern wird, wie durchlässig die Kiesschichten sind und wie dick die fast wasserundurchlässigen<br />
Lehmschichten sind. Hin<strong>zu</strong> kämen, so Terfehr, die Umweltverträglichkeits- sowie die Flora-Fauna-Habitat (FFH)-<br />
Untersuchungen.
Bis Ende 2002 könnten sie beendet sein. Dann könne man - wenn die Ergebnisse der Untersuchungen nicht<br />
dagegen sprächen - in die Planfeststellung gehen.<br />
Wenn alles optimal verlaufe, werde 2004 mit der Deichrückverlegung um bis <strong>zu</strong> 150 Metern auf einer Strecke von<br />
zwei Kilometern begonnen. Nach einem Jahr könne man fertig sein. Im günstigsten Falle koste die<br />
Deichverlegung dem Land zehn Millionen Mark. Noch unklar ist, ob die linksrheinische Straße "Oraniendeich" auf<br />
dem Deich oder daneben verlaufen soll. MICHAEL VEHRESCHILD<br />
NRZ WESEL 09.10.2001<br />
Der Pleitegeier kreist<br />
90 Unternehmen aus dem Kreis Wesel standen in den ersten sechs Monaten dieses Jahres vor dem<br />
Konkurs - und damit ein Drittel mehr als im ersten Halbjahr 2000.<br />
KREIS WESEL. Der Pleitegeier kreist über hiesigen Gefilden und wirft bedrohliche Sc<strong>hat</strong>ten auf die heimische<br />
Wirtschaft: <strong>Die</strong> Zahl der Unternehmen, die in der ersten Hälfte dieses Jahres Insolvenzverfahren beantragt<br />
haben, ist im Vergleich <strong>zu</strong>m Vorjahreszeitraum um mehr als ein Drittel gestiegen. Insgesamt 90 Betriebe im Kreis<br />
Wesel sahen sich nach einer Statistik des Landesamtes für Datenverarbeitung mit der drohenden oder<br />
tatsächlichen Zahlungsunfähigkeit konfrontiert.<br />
Keine überraschende Entwicklung<br />
Eine Entwicklung, die die Kreishandwerkerschaft nicht überrascht. "Wir haben schon vor einem Jahr auf die<br />
bedrohliche Lage aufmerksam gemacht", so Geschäftsführer Josef Lettgen. Besonders das Baugewerbe stecke<br />
in der Misere: "Wir kriegen hier ständig Anrufe von Firmen, die ihre Mitarbeiter entlassen oder auf Kurzarbeit<br />
setzen müssen." <strong>Die</strong> derzeitige schlechte konjunkturelle Entwicklung sorge für leere Auftragsbücher. "Und wenn<br />
Aufträge kommen", so klagen <strong>zu</strong>m Beispiel Dachdecker, "dann sind die Preise kaputt." Manche Betriebe<br />
übernehmen Jobs, die keine Gewinne abwerfen - nur um die laufenden Kosten decken <strong>zu</strong> können. "Auf Dauer<br />
können die Firmen aber nicht davon leben", so Lettgen. Der Landespolitik wirft Josef Lettgen, Geschäftsführer der<br />
Kreishandwerkerschaft, vor, mit dem klassischen Konjunkturmotor, der öffentlichen Hand, derzeit eine <strong>zu</strong> ruhige<br />
Kugel <strong>zu</strong> schieben. Hier müssten entschiedenere Impulse in Form von Investitionen gegeben werden. Auch auf<br />
lokaler Ebene sei die Politik in dieser Form gefordert. Ebenfalls Sorge macht Lettgen die Entwicklung im <strong>Berg</strong>bau:<br />
"Wenn die Zeche Walsum geschlossen wird, <strong>hat</strong> das mit Sicherheit auch Auswirkungen auf unsere Handwerker."<br />
Für die Deutsche Steinkohle AG (DSK) seien auch heute noch viele Kreis Weseler Betriebe aus dem Metall- und<br />
Elektrogewerbe tätig.<br />
Auf Kreisebene macht man sich anscheinend über die Entwicklung nicht all<strong>zu</strong> viele Gedanken: "Nein, wir haben<br />
keine Meinung da<strong>zu</strong>", so Kreissprecher Johannes Kremer und verweist auf die Duisburger Industrie- und<br />
Handelskammer. Deren stellvertretender Hauptgeschäftsführer Theodor Friedhoff kann sich die Zunahme nur<br />
durch die "allgemeine Wirtschaftslage" erklären, die besonders das Bau- und Grundstücksgewerbe treffe. Und<br />
erläutert, dass sich die Anzahl der Beschäftigten im Baugewerbe im Laufe der letzten fünf Jahre um ein Drittel<br />
vermindert habe. Und: 70 Prozent der Bauunternehmen sehen die Aussichten als schlecht an. <strong>Die</strong> Steigerung der<br />
Insolvenzverfahren läge im Kreis Wesel mit 36,4 Prozent über dem Landesdurchschnitt von 23 Prozent. In dieser<br />
Zeit der düsteren Nachrichten für den Mittelstand dürfte die Meldung ein Lichtblick sein, dass NRW-<br />
Ministerpräsident Clement jetzt ein 12-Punkte-Programm <strong>zu</strong>r Investitionsförderung vorgelegt <strong>hat</strong>. Damit, so<br />
Clement, solle vor allem die mittelständische Wirtschaft gestärkt werden, die "<strong>zu</strong> Recht als Motor für Wachstum<br />
und Beschäftigung, Qualifikation und Innovation bezeichnet werden" könne. Freude dürfte den mittelständischen<br />
Unternehmen im Kreisgebiet vor allem machen, dass es für die Kommunen Investitionsanreize beim Thema<br />
Schulmodernisierung geben soll.<br />
MEINUNG DER INNUNG: Heyo Schönwälder ist mächtig sauer. Der Obermeister der Baugewerbs-Innung im<br />
Kreis Wesel <strong>hat</strong> es satt, dass die Bundesregierung der Großindustrie "ständig Zucker in den Hintern bläst". So<br />
wie im Falle Philipp Holzmann: <strong>Die</strong> EU-Freigabe der staatlichen Beihilfen für die Sanierung des Baukonzerns sei<br />
eine "Verhöhnung des Mittelstandes". Seit Jahren schon kämpfe nämlich der Mittelstand ums nackte Überleben<br />
und "kein Berliner Hahn" krähe danach. Dagegen würden Steuergelder bei dem lediglich auf<br />
Öffentlichkeitswirkung gerichteten Versuch verschwendet, einen durch Missmanagement ins Schleudern<br />
geratenen Großkonzern <strong>zu</strong> retten. "Eine Unverschämtheit der Bundesregierung", ärgert sich Schönwälder. JAN<br />
JESSEN<br />
NRZ DUISBURG 09.10.2001<br />
Minister bekennt sich <strong>zu</strong>m Steinkohlebergbau<br />
Harald Schartau sagte <strong>Berg</strong>leuten in Walsum seine Unterstüt<strong>zu</strong>ng <strong>zu</strong>. Gleichzeitig suchte er das Gespräch mit<br />
<strong>Berg</strong>bau-Gegnern. Versöhnen statt spalten - so war die Devise von Johannes Rau als Landesvater in NRW. Von<br />
seinem Nachfolger Wolfgang Clement <strong>hat</strong> man derlei nicht gehört. Aber auf Harald Schartau, Arbeits- und<br />
Sozialminister, trifft das durchaus <strong>zu</strong>. Und Schartau wird als Nachfolger von Clement gehandelt. "Niemand <strong>hat</strong> mir<br />
bisher so <strong>zu</strong>gehört wie sie." Renate Winzer-Lang steht auf dem Hamborner Altmarkt und erklärt Minister Harald<br />
Schartau, warum sie gegen den Kohleabbau unter den Deichen und unter bewohntem Gebiet ist. "Leute, die vor<br />
mir stehen und sagen ,Ich habe Angst, nehme ich immer ernst", erwidert Schartau. Er verspricht, sich für<br />
Gesprächstermine in Düsseldorf ein<strong>zu</strong>setzen. Man müsse ja miteinander reden. <strong>Die</strong> Bürgerinitiative ist dankbar,<br />
nicht gleich wieder in eine Radikalen- und Spinnerecke abgedrängt worden <strong>zu</strong> sein, wo sie aber imagemäßig
wohl angesiedelt wird. Und man hört Schartaus mahnende Worte: "Tragt eure Sorgen so vor, dass die anderen<br />
nicht gleich verschreckt werden." Und: "Auch wenn die Entscheidung für den Rahmenbetriebsplan ausfallen<br />
sollte: Wir müssen danach auch weiterhin miteinander leben."<br />
Tischtuch nicht zerschneiden<br />
So ähnlich <strong>hat</strong> er das auch den <strong>Berg</strong>leuten in Walsum kurz <strong>zu</strong>vor gesagt ("Wir dürfen das gemeinsame Tischtuch<br />
nicht zerschneiden") und Zustimmung bekommen. Aber auch hier spricht der IG-Metaller und gebürtige<br />
Duisburger die Sprache der <strong>Berg</strong>leute: "Wie muss sich ein Kumpel fühlen, der sich unter Tage den Arsch<br />
aufreisst, um Kohlen <strong>zu</strong> pflücken, und Übertage hören muss: Gebt denen doch 100 000 Mark und macht den Pütt<br />
dicht." Und als er dann das Bekenntnis der Landesregierung <strong>zu</strong>r Steinkohle und dem nationalen Energiesockel<br />
erneuert, mutmaßt, der Rahmenbetriebsplan werde wohl genehmigt, da findet der Beifall kein Ende.<br />
Wie diese Einstellung mit seinem Bekenntnis <strong>zu</strong>r Unabhängigkeit der Genehmigungsbehörde passt, verrät er<br />
nicht. Dass der Minister so viel Zeit <strong>hat</strong>, hängt mit der engen Beziehung <strong>zu</strong> Peter Gasse <strong>zu</strong>sammen. Gasse,<br />
NRW-Bezirksleiter IG Metall, <strong>hat</strong>te wegen Arbeitsüberlastung sein Landtagsmandat niedergelegt. Schartau <strong>hat</strong>te<br />
Gasse versprochen, er werde sich um den Wahlkreis kümmern. Das tat er auf Einladung der Hamborner SPD in<br />
Begleitung des Landtagsabgeordneten Ralf Jäger ausgiebig, besichtigte nicht nur Gewerbegebiete, sondern auch<br />
den Hamborner Wochenmarkt, beschenkte die Frauen mit Topf-Blumen, kaufte ein paar Äpfel, informierte sich<br />
nach einem Fußmarsch <strong>zu</strong>m Abschluss im neuen Bildungszentrum der Arbeiterwohlfahrt über die Arbeit und<br />
versprach Hilfestellung aus Düsseldorf: "Aber die Details müsst ihr hier vor Ort klären." GERHARD KLINKHARDT<br />
NRZ WESEL 09.10.2001<br />
Der <strong>Berg</strong>bau als Auftraggeber<br />
Kreishandwerkerschaft fordert politisches Engagement.<br />
Der Landespolitik wirft Josef Lettgen, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft, vor, mit dem klassischen<br />
Konjunkturmotor, der öffentlichen Hand, derzeit eine <strong>zu</strong> ruhige Kugel <strong>zu</strong> schieben. Hier müssten entschiedenere<br />
Impulse in Form von Investitionen gegeben werden.<br />
Auch auf lokaler Ebene sei die Politik in dieser Form gefordert. Ebenfalls Sorge macht Lettgen die Entwicklung im<br />
<strong>Berg</strong>bau: "Wenn die Zeche Walsum geschlossen wird, <strong>hat</strong> das mit Sicherheit auch Auswirkungen auf unsere<br />
Handwerker." Für die Deutsche Steinkohle AG (DSK) seien auch heute noch viele Kreis Weseler Betriebe aus<br />
dem Metall- und Elektrogewerbe tätig. Auf Kreisebene macht man sich anscheinend über die Entwicklung nicht<br />
all<strong>zu</strong> viele Gedanken: "Nein, wir haben keine Meinung da<strong>zu</strong>", so Kreissprecher Johannes Kremer und verweist<br />
auf die Duisburger Industrie- und Handelskammer. Deren stellvertretender Hauptgeschäftsführer Theodor<br />
Friedhoff kann sich die Zunahme nur durch die "allgemeine Wirtschaftslage" erklären, die besonders das Bauund<br />
Grundstücksgewerbe treffe. Und erläutert, dass sich die Anzahl der Beschäftigten im Baugewerbe im Laufe<br />
der letzten fünf Jahre um ein Drittel vermindert habe. Und: 70 Prozent der Bauunternehmen sehen die Aussichten<br />
als schlecht an. <strong>Die</strong> Steigerung der Insolvenzverfahren läge im Kreis Wesel mit 36,4 Prozent über dem<br />
Landesdurchschnitt von 23 Prozent. In dieser Zeit der düsteren Nachrichten für den Mittelstand dürfte die<br />
Meldung ein Lichtblick sein, dass NRW-Ministerpräsident Clement jetzt ein 12-Punkte-Programm <strong>zu</strong>r<br />
Investitionsförderung vorgelegt <strong>hat</strong>. Damit, so Clement, solle vor allem die mittelständische Wirtschaft gestärkt<br />
werden, die "<strong>zu</strong> Recht als Motor für Wachstum und Beschäftigung, Qualifikation und Innovation bezeichnet<br />
werden" könne.<br />
Freude dürfte den mittelständischen Unternehmen im Kreisgebiet vor allem machen, dass es für die Kommunen<br />
Investitionsanreize beim Thema Schulmodernisierung geben soll. (jes) <strong>Die</strong> unverschämte Bundesregierung<br />
Fortset<strong>zu</strong>ng von Seite 1<br />
NRZ WESEL 09.10.2001<br />
Das Theater und die Kohle<br />
<strong>Die</strong> Burghofbühne feierte ihren Festakt <strong>zu</strong>m 50. Geburtstag in der Lohnhalle der Zeche Lohberg mit NRW-<br />
Kulturminister Michael Vesper.<br />
KREIS WESEL. Es war eine Szenerie wie vom Drehbuch diktiert. Auf dem Podium im <strong>Berg</strong>werk Lohberg<br />
sprachen wichtige Leute über ein wichtiges Thema, im Hintergrund klingelte fast pausenlos ein Telefon, und als<br />
das Streichquartett des Orchesters Oberhausen den Rednern auch noch was vorgeigte, flog oben im ersten<br />
Stock eine Tür auf. Ein bärtiges Fragezeichen, um die Augen noch ein kohlenschwarzer Rand, lünkerte über die<br />
Reling: Musik in der Lohnhalle? Am <strong>Die</strong>nstag Morgen? So ein Theater: <strong>Die</strong> Burghofbühne feierte ihren Festakt<br />
<strong>zu</strong>m 50. Geburtstag an ihrer Geburtsstätte, auf der Zeche. Wo auf Kohle gesprochen wird, wird auch über Kohle<br />
gesprochen. Erst recht, wenn fünf Jahrzehnte Landesbühne <strong>zu</strong>rück gelegt sind. Bürgermeisterin Sabine Weiss<br />
erinnerte daran, wie Kathrin Türks und Walter Rolshoven im Sommer 1951 bei <strong>Berg</strong>werksdirektor Hoffmann<br />
anfragten, ob genug Kohle da sei, um ein eigenes Theater <strong>zu</strong> gründen. Zuerst war genug da, in den Jahrzehnten<br />
danach oft nicht mehr. "Es <strong>hat</strong> bei der Burghofbühne alles gegeben", resümierte Sabine Weiss, "nur eines nicht:<br />
Geld im Überfluss". Aber immerhin - wenn Geld wirklich den Charakter verderbe, "dann ist das Theater ein<br />
leuchtendes Beispiel für Charakterfestigkeit und Moral."
Immerhin schuldenfrei<br />
"Den Charakter verderben wir gerne", konterte NRW-Kulturminister Michael Vesper, und erinnerte daran, dass<br />
das Land exakt 53,74 Prozent des Etats für die Burghofbühne beisteuert. <strong>Die</strong> Unverzichtbarkeit für das Land<br />
Nordrhein-Westfalen, für den Kreis und für Dinslaken sah der Intendant Alexander Schnell jedoch dadurch<br />
bestätigt, "dass so viele gratulieren". Schnell wünschte sich, "dass unsere Aufführungen auch so gut besucht<br />
würden". Denn damit hätte das Landestheater eine Sorge weniger.<br />
Seit der letzten Krise 1999, die - wie 1985 und 1991 - beinahe <strong>zu</strong>r Auflösung des Theaters geführt hätte, ist die<br />
Burghofbühne nun schuldenfrei. Ein Mittel, sich in der kulturellen Landschaft <strong>zu</strong> behaupten, sei für ihn ein Zitat,<br />
das Kathrin Türks in den sechziger Jahren prägte: Theater sei da<strong>zu</strong> da, die Werte des Menschen transparent <strong>zu</strong><br />
machen, und das gelinge nur, wenn es sich um engen Kontakt <strong>zu</strong> den Menschen bemühe.<br />
Wichtig für den Ruf und die Entwicklung sei auch das Jugend- und Kindertheater, dem sich die Burghofbühne<br />
widmet, betonte Vesper. Denn: "In der medialen Spaßgesellschaft ist das Theater für die Jugendlichen ein<br />
kultureller Aspekt, der nicht vernachlässigt werden sollte." GERARD DOMBROWSKI<br />
NRZ MOERS 08.10.2001<br />
BRIEFE AN DIE REDAKTION<br />
Arbeitsplätze vernichtet<br />
Es ist erschreckend, wie schnell <strong>zu</strong>kunftsorientierte Arbeitsplätze innerhalb von nur einem Jahr vernichtet werden.<br />
<strong>Die</strong> Verursacher müssen schnellstens <strong>zu</strong>r Verantwortung gezogen werden. Sie haben Steuermittel von mehreren<br />
Millionen Mark fehlgeleitet. Sie haben auch Arbeitnehmer unter falschen Vorausset<strong>zu</strong>ngen gelockt, dass sie dort<br />
einen angeblichen sicheren Arbeitsplatz für die Zukunft haben. Es darf nicht passieren, dass die Arbeitnehmer<br />
mal wieder die Zeche bezahlen. Hier ist die Politik gefragt, die in Gesprächen mit dem Arbeitgeber T-Mobil sehr<br />
deutlich machen muss, dass der Standort in Kamp-Lintfort nicht geschlossen werden darf. Alle<br />
Mobilfunkgesellschaften haben in den <strong>zu</strong>rückliegenden Jahren hohe Gewinne erwirtschaftet.<br />
Sie können mir nicht weismachen, dass jetzt kein Geld da ist, damit Arbeitsplätze gesichert werden können. Wir<br />
sehen an solchen Entscheidungen, wie schwierig es ist in einer <strong>Berg</strong>bauregion, Zukunftsarbeitsplätze für den<br />
Strukturwandel <strong>zu</strong>r Verfügung <strong>zu</strong> stellen. <strong>Die</strong> Schließung des Call-Centers <strong>hat</strong> auch gravierende Auswirkungen<br />
auf den <strong>Berg</strong>bau, der ja politisch gewollt einen rapiden Personalabbau bis 2005 betreiben muss. Wir sehen am<br />
Beispiel T-Mobil, dass wir alles daran setzen müssen in unserer Region noch vorhandene Arbeitsplätze langfristig<br />
<strong>zu</strong> erhalten, damit der Niederrhein nicht das "Armenhaus des Landes NRW" wird.<br />
NRZ DUISBURG 08.10.2001<br />
<strong>BiB</strong>: DSK zieht falsche Schlüsse<br />
Wenig überzeugt zeigt sich die Bürgerinitiative <strong>Berg</strong>baubetroffener, <strong>BiB</strong>, von den 16 000 Unterschriften, die die<br />
Walsumer <strong>Berg</strong>leute "pro Abbau" gesammelt haben. Fest stehe, so Vorsitzender Friedrichs, "dass nur 8000<br />
Bürgerinnen und Bürger aus Dinslaken, Duisburg, Rheinberg und Voerde unterzeichnet haben. Ein mageres<br />
Ergebnis, wenn man bedenkt, dass in dieser Region 5000 Arbeitsplätze direkt im <strong>Berg</strong>bau bestehen." <strong>Die</strong><br />
Behauptung, die Bevölkerung stimme dem Abbau <strong>zu</strong>, sei falsch.<br />
NRZ RHEINBERG 05.10.2001<br />
KURZ GEMELDET<br />
<strong>Die</strong> FBI in Obermörmter.<br />
<strong>Die</strong> Freie Bürger-Initiative (FBI) Xanten will am <strong>Die</strong>nstag, 9. Oktober, mit den Obermörmtern diskutieren. Themen<br />
sollen unter anderem Kanalbauten und Deich sein, aber auch für alles andere ist die FBI offen. <strong>Die</strong><br />
Bürgerversammlung beginnt um 19.30Uhr in der Gaststätte Schmidtchen, Kirchend 12.<br />
NRZ DUISBURG 05.10.2001<br />
Güterbahnstrecke könnte "Verteidigungslinie" bilden<br />
Umweltdezernat sieht Gutachten <strong>zu</strong>r Deichsicherheit als stichhaltig, fordert aber stärkere Beteiligung bei<br />
Sonderbetriebsplänen. Der "Schlafdeich" ist laut Walsums <strong>Berg</strong>werksdirektor Traud eine Ergän<strong>zu</strong>ng, die sich aus<br />
den Anregungen der Träger öffentlicher Belange ergab. Dabei könnte der Damm der Eisenbahnstrecke Walsum-<br />
Spellen als Ersatzdeich, als "zweite Verteidigungslinie", genutzt werden. Zudem könnte die Fläche zwischen<br />
Rhein und Bahnstrecke mehrfach unterteilt werden. Als Auffangraum. "Solche Dinge", betonte Traud, "gibt es<br />
unabhängig von den Überlegungen <strong>zu</strong>m Rahmenbetriebsplan. Das ist nicht aus der Trickkiste geholt."
Planungsausschuss berät am 25. Oktober<br />
Weiterhin sind die Steinkohlevertreter aber der Überzeugung, dass die Rheindeiche auf jeden Fall halten<br />
werden.Volker Staege, Leiter der Abteilung Raumplanung / Liegenschaftren: "Wir haben im Rahmenbetriebsplan<br />
nachgewiesen, dass die Deiche standsicher sind." In Duisburg werden sich die Mitglieder des<br />
Planungsausschusses am 25. Oktober mit den Erkenntnissen befassen, die das Umweltdezernat aus den<br />
Unterlagen der DSK gewonnen <strong>hat</strong>. <strong>Die</strong> sind laut Dezernent Peter Greulich "sehr umfangreich". Sie bergen<br />
allerdings kaum Neuerungen in der Bewertung der Deichsicherheit. "Wir kommen", so Greulich, "bis jetzt <strong>zu</strong> dem<br />
Ergebnis, dass das vom Grundsatz her machbar ist." <strong>Die</strong> politische Wertung, ob die Eingriffe und der Aufwand<br />
(Kontrolle der Deiche, Riss-überwachung, Reparatur) gerechtfertigt seien, müsse dem Rat überlassen werden.<br />
Der tagt erst im Dezember. Deshalb betrachtet der Umweltdezernent das Votum des Planungsausschusses als<br />
Votum für den Erörterungstermin.<br />
Allerdings ist Greulich der Überzeugung, dass die beteiligten Kommunen bei den Sonderbetriebsplänen "stärker<br />
beteiligt werden müssen". Bisher habe es da aus Sicht der Genehmigungsbehörde eine sehr reservierte Haltung<br />
gegeben. (put) Fortset<strong>zu</strong>ng von Seite 1<br />
NRZ DUISBURG 05.10.2001<br />
16 000 Unterschriften pro Abbau<br />
Ministerpräsident nahm Ordner entgegen. Arbeitsminister Schartau besucht Walsumer <strong>Berg</strong>werk am <strong>Die</strong>nstag.<br />
<strong>Die</strong> Belegschaft des <strong>Berg</strong>werks Walsum <strong>hat</strong> in den vergangenen Wochen eifrig gesammelt. Über 16 000<br />
Unterschriften.<br />
Am Donnerstag übergaben <strong>Berg</strong>leute, Betriebsräte und Vertreter der IGBCE Ministerpräsident Wolfgang Clement<br />
in Düsseldorf drei dicke Ordner mit dem "Ja <strong>zu</strong>m deutschen Steinkohlenbergbau - Ja <strong>zu</strong> Rahmenbetriebsplänen."<br />
Mehr als die Hälfte der Unterschriften stamme aus dem Einwirkungsbereich des <strong>zu</strong>r Erörterung stehenden<br />
Rahmenbetriebsplans. Unterschrieben hätten nicht nur <strong>Berg</strong>leute und deren Angehörige, sondern auch Bürger<br />
und Zulieferer, betonte gestern der Betriebsratsvorsitzende Michael Hörning. Es sei das Ziel gewesen, mehr<br />
Unterschriften <strong>zu</strong> erreichen als es Einwendungen gebe, so der BR-Chef.<br />
Ministerpräsident Clement habe sich bei dem Zusammentreffen für den Deutschen Steinkohlebergbau<br />
ausgesprochen, <strong>zu</strong>gleich aber betont, die Landesregierung werde keinerlei Einfluss auf die Bezirksregierungen<br />
ausüben. NRW-Arbeitsminister Harald Schartau wird am kommenden <strong>Die</strong>nstagmorgen seinen Duisburg-Besuch<br />
<strong>zu</strong>m Abstecher aufs <strong>Berg</strong>werk nutzen.<br />
Knapp vier Wochen vor Wiederaufnahme der Erörterung <strong>zu</strong>m Rahmenbetriebsplan (ab 31. Oktober in der Rhein-<br />
Ruhr-Halle), sagte gestern <strong>Berg</strong>werksdirektor Wolfgang Traud: "Es ist in unserem Interesse, dass wir möglichst<br />
zügig <strong>zu</strong>r Sache kommen. Alles andere bringt so viele Emotionen mit sich, dass man unseren und den Belangen<br />
der Bürger nicht gerecht werden kann." Zumal das <strong>Berg</strong>werk <strong>zu</strong>m Jahresbeginn das Ja <strong>zu</strong>m Rahmenplan<br />
benötigt und schon 33 Millionen Mark in neues Gerät gesteckt habe. Eine Verzögerung ins dritte oder vierte<br />
Quartal 2002 könnte das <strong>Berg</strong>werk in arge Nöte bringen. Am Rahmenplan bis 2019 will die DSK freilich<br />
festhalten, wenn auch mit Modifikationen wie etwa einer <strong>zu</strong>m "Schlafdeich" (wir berichteten) ausgebauten<br />
Bahnstrecke. (put)<br />
NRZ RHEINBERG 05.10.2001<br />
KURZ GEMELDET<br />
<strong>Die</strong> FBI in Obermörmter.<br />
<strong>Die</strong> Freie Bürger-Initiative (FBI) Xanten will am <strong>Die</strong>nstag, 9. Oktober, mit den Obermörmtern diskutieren. Themen<br />
sollen unter anderem Kanalbauten und Deich sein, aber auch für alles andere ist die FBI offen. <strong>Die</strong><br />
Bürgerversammlung beginnt um 19.30Uhr in der Gaststätte Schmidtchen, Kirchend 12.<br />
NRZ MOERS 04.10.2001<br />
Pilotbergwerk für die Ausbildung <strong>zu</strong>m Mec<strong>hat</strong>roniker<br />
FRIEDRICH HEINRICH / RHEINLAND / Erste Schicht liegt hinter neuen Aus<strong>zu</strong>bildenden. Rekordhalter in<br />
Deutschland. KAMP-LINTFORT. Gleich zwei Neuerungen gab es bei der Begrüßung der Aus<strong>zu</strong>bildenden auf<br />
dem <strong>Berg</strong>werk Friedrich Heinrich/Rheinland. Zum ersten Mal starten Aus<strong>zu</strong>bildende für das neue Berufsbild des<br />
Mec<strong>hat</strong>ronikers. Außerdem wurden die Ausbildungsplätze von Niederberg und Friedrich Heinrich/ Rheinland<br />
erstmals gemeinsam in Kamp-Lintfort angelegt. Für die Ausbildung <strong>hat</strong> damit die neue Ära des künftigen<br />
<strong>Berg</strong>werkes West schon begonnen. Auf dem Kamp-Lintforter <strong>Berg</strong>werk gibt es die meisten Ausbildungsplätze im<br />
gesamten deutschen Steinkohlebergbau: 81 neue, davon 34 Aus<strong>zu</strong>bildende <strong>zu</strong>m Industriemechaniker, 25 <strong>zu</strong>m<br />
Energieelektroniker und 22 <strong>zu</strong>m Mec<strong>hat</strong>roniker. Ausbildungsleiter Hans Pittgens: "Unser <strong>Berg</strong>werk und die Zeche<br />
Prosper Haniel in Bottrop sind die beiden Pilotbergwerke, auf denen erstmals die Ausbildung <strong>zu</strong>m Mec<strong>hat</strong>roniker<br />
durchgeführt wird." Den Ausbildungsstart bezeichnete Sozialdirektor Peter Ermlich als "ein wichtiges Signal nach
draußen". Betriebsratsvorsitzender Friedhelm Vogt und Kenan Akay von der Jugend- und<br />
Aus<strong>zu</strong>bildendenvertretung betonten deren Bedeutung als Partner aller Mitarbeiter und A<strong>zu</strong>bis. Wolfgang Koschei,<br />
stellvertretender Leiter des RAG Bildung Berufskollegs West, ergänzte mit Blick auf das duale System: "<strong>Die</strong> enge<br />
Zusammenarbeit zwischen Schule und Betrieb ist eine gute Vorausset<strong>zu</strong>ng für einen hervorragenden Abschluss."<br />
Dr. Lothar Wagner, der Leiter der Berufsbildung, ermunterte die Jugendlichen <strong>zu</strong>m Abschluss <strong>zu</strong>r Diskussion und<br />
<strong>zu</strong>r konstruktiven Mitarbeit. "Wenn es Probleme gibt, dann meldet Euch. Denn nur sprechenden Menschen kann<br />
geholfen werden."<br />
NRZ NIEDERRHEIN 03.10.2001<br />
Wenn der Halde ein Licht aufgeht<br />
Der bekannte Zero-Künstler Otto Piene <strong>hat</strong> sich etwas Feines für Moers ausgedacht. Es ist hoch, rot und leuchtet<br />
im Dunkeln. Der Zweite Weltkrieg war vorbei. Otto Piene <strong>hat</strong>te nur einen Wunsch - nach Hause <strong>zu</strong> kommen,<br />
schnell. Er schritt über eine Brücke, unter ihm die Elbe, "sie war glatt wie ein Spiegel." Darin die Sonne. In dieser<br />
Reflexion sah Piene symbolisch den Übergang in den Frieden. Ein Erlebnis, dass ihn nie mehr losließ. Licht ist<br />
nicht fort<strong>zu</strong>denken aus der Kunst Pienes. Nun wünscht er sich, dass dem Niederrhein eines aufgehen möge.<br />
Nach seinem Entwurf.<br />
Performances des Zero-Künstlers<br />
Januar 1999 zeichnete er die erste Skizze. Wie er sich einen "Lichtturm für Moers" vorstellt, ist derzeit in der<br />
städtischen Galerie Peschkenhaus an der Meerstraße 1 erhellt. Gleichzeitig gibt die Schau einen Einblick in frühe<br />
Zeichnungen und Performances des bekannten Zero-Künstlers, der meist in den USA lebt. Zeitweilig leitete er in<br />
Cambridge, Massachusetts, das Center for Advanced Visual Studies (CAVS), am Institut für Technology (MIT),<br />
einem Vorbild hiesiger Medienhochschulen. Einst florierte am Niederrhein der Kohlebergbau. Heute <strong>hat</strong> er nur<br />
mehr absehbare Zukunft. Wenn die Kumpel ihre Grubenlampen löschen, bleibt eine künstliche Landschaft<br />
<strong>zu</strong>rück. Eine hügelige, die eine atemberaubende Aussicht <strong>zu</strong>lässt auf eine Region, die sich verändert. So verblüfft<br />
der Blick von der Halde Rheinpreussen, die eine 800 Meter lange, 60 Meter hohe Grenze zieht, zwischen<br />
Niederrhein und Ruhrgebiet. Für diesen <strong>Berg</strong> <strong>hat</strong> der 73-Jährige das Projekt vorgesehen. Wie ein Leuchtturm, der<br />
Schiffen den Weg weist, steht er da, Pienes Lichtturm. <strong>Die</strong> von dem englischen Wissenschaftler Sir Humphrey<br />
Davy 1815 erfundene, höchst ästhetische Sicherheits- und Wetterlampe, inspirierte den gebürtigen Westfalen <strong>zu</strong><br />
seinem Objekt. 20 bis 25 Meter hoch soll es sich über der Halde erheben. Denkmal für eine Epoche, die sich dem<br />
Ende <strong>zu</strong>neigt. Vor 150 Jahren öffnete sich an dieser Stelle durch Franz Haniel das erste Bohrloch am<br />
Niederrhein. Millionen von Menschen standen in der Kohle- und Stahlindustrie an Rhein und Ruhr in Lohn und<br />
Brot. Auch an diese Männer wird die geplante Landmarke erinnern. Längst sind nicht alle technischen Fragen<br />
geklärt. Was Statik und Sicherheit betrifft, wird der Entwurf noch durch viele Expertenhände wandern. Vermutlich<br />
wird es im Inneren des Turms eine Treppe <strong>zu</strong> einer verglasten Aussichtsplattform geben. Hier soll Raum sein für<br />
Aktionen. Rubinrotes Licht wird gen Himmel leuchten. Auch der Hügel soll in gleißendem Rot glimmen.<br />
Gleichsam glühend wie brennende Kohle und erhitzter Stahl. Aber auch wie die Feuerbilder Pienes, die seit den<br />
späten 50ern wichtiger Aspekt seines Schaffens sind.<br />
Konrad Gappa gründete Förderverein<br />
"Ich bin sehr froh, dass ich nicht allein als Künstler und Spinner dastehe", sagt Piene mit stillem, erfahrenen<br />
Lächeln. "Es gibt Resonanz." Der Dinslakener Ingenieur Konrad Gappa ist Feuer und Flamme für das Projekt und<br />
<strong>hat</strong> einen "Förderverein Landmarke Grubenlampe" aus dem Boden gestampft. Der bemüht sich um Spenden,<br />
damit der kühne Entwurf in den nächsten Jahren umgesetzt werden kann (www.landmarke-grubenlampe.de).<br />
Auch das Land NRW <strong>hat</strong> eine großzügige finanzielle Beteiligung <strong>zu</strong>gesagt. <strong>Die</strong> Realisierung der lichten Plastik<br />
wird mit etwa zwei Millionen Mark beziffert. Was die Galerie Peschkenhaus bis 18. November ausbreitet, ist<br />
faszinierend.<br />
Ein besonderer Höhepunkt ist der Dachboden. Dort <strong>hat</strong> Piene mit einem Assistenten einen Licht-raum installiert.<br />
Dunkel ists, aber es wird Licht, doch nur teilweise. Hier möchte der Besucher verweilen, dem Flug imaginärer<br />
Planeten hinterherträumen und Lichtskulpturen bewundern. Einfach zauberhaft, Herr Piene. Di bis Fr 12 bis 18<br />
Uhr. Sa 11 bis 14 Uhr und so 11 bis 17 Uhr. KATJA PELZER<br />
NRZ Rheinberg 02.10.2001<br />
Wenn viele Druck machen, bewegt sich was<br />
HOCHWASSER / Neuer Verband eröffnet eine Serie von Infoveranstaltungen am linken Niederrhein –<br />
Mitglieder gesucht.<br />
XANTEN/RHEINBERG. Aufklären, aufklären, aufklären, ach ja, und noch einmal aufklären - das <strong>hat</strong> sich der neue<br />
Hochwasserschutzverband Niederrhein auf seine Fahnen geschrieben. Am Montag haben Vorsitzender Hans-<br />
Peter Feldmann und seine Mannschaft damit angefangen – im gut gefüllten Saal bei van Bebber in Birten. Auftakt<br />
einer ganzen Reihe von Infoveranstaltungen am linken Niederrhein. Der nächste Termin: Montag, 8. Oktober,<br />
19.30 Uhr, "Zur Alten Mühle" in Budberg. Sicherheit geht über alles steht ganz oben auf der Prioritätenliste von<br />
Feldmann. Hier dürfen keine Abstriche gemacht werden, hier müssen Risikofaktoren reduziert werden. Ein<br />
Knackpunkt: das Kompetenzgerangel der verschiedenen verantwortlichen Stellen von Deichverband bis hin <strong>zu</strong><br />
mehreren Ministerien. Das gehört in eine Hand, fordert der Verband. Zur Risikominderung gehört nach Ansicht
der engagierten Bürger auch, unter den Deichen keinen <strong>Berg</strong>bau <strong>zu</strong><strong>zu</strong>lassen. Etliche seien durch Verwendung<br />
von billigem Baumaterial ohnehin nicht sicher, <strong>Berg</strong>senkungen täten dann ihr Übriges. Feldmann betont<br />
ausdrücklich, dass der Rahmenbetriebsplan für das <strong>Berg</strong>werk Walsum auch Xanten betreffe. Wenn der Plan<br />
durchkommt, unter dem Rhein abgebaut wird und in Orsoy der Deich bricht, dann sei das Wasser schnell in<br />
Xanten. Denn der linke Niederrhein sei ein einziger großer Polder, es fehlten Querdeiche, die wie Riegel das<br />
Wasser aufhalten könnten.<br />
Mangelhaftes Karten- und Zahlenmaterial <strong>hat</strong> Feldmann, der mit anderen wegen der Konzentration auf Reeser<br />
Probleme den Schutzverband Niederrhein verlassen und die neue Organisation gegründet <strong>hat</strong>, bei den Behörden<br />
ausgemacht. Das fängt bei fehlenden Höhenkarten an und hört bei den Kubikmeterzahlen der <strong>zu</strong> erwartenden<br />
Wassermengen noch lange nicht auf. Gar nicht berücksichtigt seien beispielsweise künftige klimatische<br />
Entwicklungen (Stichwort: Treibhauseffekt, steigende Pegelstände).<br />
<strong>Die</strong> Kritiker, die der streitbaren Truppe früher Panikmache vorgeworfen haben, sind - angesichts jüngst<br />
vorgelegter Gutachten (wir berichteten) - verstummt. Aber die gewünschte Unterstüt<strong>zu</strong>ng von Seiten der Politik<br />
bleibt aus, kritisiert Feldmann. Jetzt sollen <strong>zu</strong>nächst Bürgermeister und Landrätin an einen Tisch geholt werden.<br />
Nur der Protest vieler Bürger bringe die Politik auf Trab. Da beherzigt Feldmann den Rat eines Vertreters beim<br />
Staatlichen Umweltamt. Als der auf den fehlenden Katastrophenschutzplan für den Kreis Wesel angesprochen<br />
wurde, bekamen die beiden den Rat: "Machen Sie doch mal ordentlich Theater und Druck, dann gibts den auch<br />
endlich." Auf den Mann wird Feldmann wohl hören. (cf)<br />
---<br />
NRZ Moers 02.10.2001<br />
25 Meter hohe Grubenlampe<br />
Projekt des internationalen Künstlers Otto Piene für die Halde Rheinpreussen ist schon weit gediehen.<br />
Peschkenhaus stellt Objekte, Skizzen und Bilder <strong>zu</strong>m "Lichtturm" aus.<br />
MOERS. Auf der Halde Rheinpreussen fehlt noch was. Zwischen "Yellow-Marker" an den Fördertürmen der Zeche Friedrich-<br />
Heinrich in Kamp-Lintfort und der Zeche Nöhnen im Osten wächst eine stattliche Zahl von "Landmarken", künstlerisch<br />
gestalteten Wahrzeichen des Reviers, heran. Für die Halde Rheinpreussen macht sich jetzt ein internationales künstlerisches<br />
Schwergewicht stark. Otto Piene, der Mann mit den "Sky Events", plant seit Januar 1999 an einem 25 Meter hohen Lichtturm für<br />
die Halde, angelehnt an die Form einer Grubenlampe. Dass sein Projekt Zukunft <strong>hat</strong>, scheint schon fast gesichert. Der Moerser<br />
Kulturdezernent Gerd Bultmann <strong>hat</strong> schon Förder<strong>zu</strong>sagen aus Düsseldorf vernommen. Er rechnet mit Kosten um die zwei<br />
Millionen Mark.<br />
Rotglühende Halde<br />
Was es an Skizzen, gemalten Vorlagen, gesammelten Objekten (Grubenlampen), Berechnungen in Sachen "Lichtturm für<br />
Moers" gibt, wird ab heute in der städtischen Galerie Peschkenhaus <strong>zu</strong> sehen sein. Daneben gewinnt der Besucher Zugang <strong>zu</strong><br />
einigen früheren Werken und Projekten des heute vorwiegend in den USA lebenden Künstlers Otto Piene. Der heute 73-Jährige<br />
<strong>hat</strong>te 1957 <strong>zu</strong>sammen mit dem befreundeten Heinz Mack die Gruppe "Zero" gegründet, später stieß noch Uecker da<strong>zu</strong>.<br />
Anfangs zeigt er Raster- und Rauchzeichnungen, in den 60-ern wendet er sich der Arbeit an Lichtplastiken und Lichträumen <strong>zu</strong><br />
(einer wurde im Dachgeschoss des Peschkenhauses installiert). Seine ersten Sky Events erfolgen in den USA, nachdem Piene<br />
1968 an das Center for Advanced Visual Studies am MIT eingeladen worden war. Er wird dessen Direktor. "Ein Atelier habe ich<br />
heute noch in Düsseldorf", sagte gestern Piene im Peschkenhaus, wo er sein Projekt vorstellte. Rot soll die Halde aufleuchten,<br />
ist seine Vision, die Farbe der Energie aus glühender Kohle und flüssigem Stahl: "So rot, wie wir sie kriegen können". Als<br />
Lichtzeichen konzentriert er sich auf die Form der Grubenlampe. Ein besseres Symbol für die Region kann er sich gar nicht<br />
vorstellen. Mitstreiter in dem Projekt ist der "Förderkreis Landmarke Grubenlampe", der heute 2000 kooperierende Mitglieder (z.<br />
B. Knappenvereine etc.) <strong>hat</strong>. Der Ingenieur Konrad Gappa aus Dinslaken war es gewesen, der auf den Starkünstler<br />
<strong>zu</strong>gegangen war, um ihn mit der Halde Rheinpreussen vertraut <strong>zu</strong> machen. Piene rechnet mit weiteren Jahren, die ins Land<br />
gehen, bis seine Vision Wirklichkeit werden kann. KARL DANIEL<br />
NRZ Moers 02.10.2001<br />
Strukturwandel ist nicht leicht<br />
"Mit Bedauern müssen wir feststellen, was mit T-Mobil in Kamp-Lintfort passiert. Anhand der Situation von T-Mobile können wir<br />
aber auch erkennen, dass der Strukturwandel gerade in unserer Region doch nicht so leicht ist, wie man es sich gedacht <strong>hat</strong>.<br />
Vor ca. einem halben Jahr <strong>hat</strong> das T-Mobile den Betrieb aufgenommen, jetzt müssen wir mit Enttäuschen feststellen, dass der<br />
Betrieb schon wieder geschlossen wird. Viele haben eine persönliche Chance gesehen, dass sie hier einen <strong>zu</strong>kunftsorientierten<br />
Job haben, aber diese Chance ist zerplatzt wie eine Seifenblase. Am Freitag, 21. September, bei der Aktion " Eine Lichterkette<br />
für das Call-Center", nachdem ein Herr Buchholz (Bereichsleiter T-Mobil) vor die Belegschaft getreten ist, habe ich mir die<br />
Frage gestellt, wieviel wohl ein Mensch in einem solchen Unternehmen wert ist? Das Auftreten von Herrn Buchholz deutet für<br />
mich auf keine weitere Gesprächsbereitschaft hin, aber das spiegelt ja auch die schnelle Entscheidung über die Schließung von<br />
T-Mobil wieder - nach dem Motto: "Keine Mark Gewinn, dann machen wir den Laden eben dicht". <strong>Die</strong> Frage, was mit den<br />
Beschäftigten passiert, stellt sich hierbei wohl keiner der Verantwortlichen. Trotz allem muss weiter an einem Strukturwandel<br />
gearbeitet werden. An vielen Stellen wird für neue Arbeitsplätze gekämpft. Ich hoffe, dass wir auch weiterhin für den Erhalt von<br />
Arbeits- und Ausbildungsplätzen kämpfen werden. Deshalb möchte ich daran erinnern, dass die DSK und hier besonders das<br />
<strong>Berg</strong>werk Friedrich Heinrich/Rheinland in Kamp-Lintfort der Betrieb ist, der die meisten Beschäftigten <strong>hat</strong> und außerdem der<br />
größte Ausbildungsbetrieb am Ort ist. Strukturwandel am Ort <strong>zu</strong> betreiben, bedeutet für mich miteinander und nicht<br />
gegeneinander <strong>zu</strong> arbeiten.<br />
NRZ Oberhausen 01.10.2001<br />
Kohle muss "im Rahmen" bleiben<br />
CDU-Bundestagsabgeordnete Marie-Luise Dött bezieht Stellung <strong>zu</strong>m Rahmenbetriebsplan Walsum.<br />
Plädoyer für "faires Verfahren". Der so genannte "Rahmenbetriebsplan <strong>Berg</strong>werk Walsum" sorgt in der Politik für reichlich<br />
Diskussionsstoff. Da<strong>zu</strong> bezog die CDU-Bundestagsabgeordnete Marie-Luise Dött, die demnächst auch in Dinslaken kandidiert,
Stellung <strong>zu</strong> den SPD-Plänen, den Steinkohleabbau bis 2015 <strong>zu</strong> erhalten. Das Vorhaben der Sozialdemokraten sei nicht tragbar,<br />
da es sich weder ökologisch noch ökonomisch durchsetzen lasse, wenn der vom <strong>Berg</strong>bau betroffenen Bevölkerung keine<br />
Zugeständnisse gemacht würden, so Dött. Sie machte darauf aufmerksam, dass der Versuch, den Kohleabbau "über die Köpfe<br />
der Menschen hinweg" durch<strong>zu</strong>setzen, bei einem Großteil der Niederrheiner auf Ablehnung stoße. Hin<strong>zu</strong> komme, dass die<br />
Kohlesubventionen der EU nach 2005 "in den Sternen" stünden. Daher müssten dringend "innovative Ausweicharbeitsplätze"<br />
geschaffen werden. Dött plädiert für ein "faires Verfahren rund um den Walsumer Rahmenbetriebsplan, bei dem ein Konsens<br />
zwischen Bürger und <strong>Berg</strong>bau sowie Ökologie und Ökonomie gefunden werden kann". (maha)<br />
Rheinische Post, Rheinberg 28.09.2001<br />
Unter Rheindeich nein, unter Annaberg eventuell<br />
SPD nicht generell gegen den Abbau<br />
RHEINBERG (RP). Das von den Deichverbänden Friemersheim, Orsoy und Poll bei der Technischen Universität<br />
Aachen in Auftrag gegebene Gutachten <strong>zu</strong> möglichen Überflutungsszenarien am Niederrhein spielte auch in der<br />
Rheinberger Hauptausschusssit<strong>zu</strong>ng eine Rolle. <strong>Die</strong> <strong>Stadt</strong>verwaltung soll im Rahmen einer Erörterung des<br />
Rahmenbetriebsplans Walsum ergänzend vortragen, was sich an Konsequenzen aus besagtem Gutachten ergibt<br />
- darauf pochten die Politiker jetzt.<br />
Unter den Rheindeichen<br />
Darüber hinaus sollen die neuesten Informationen der LINEG miteinfließen. Im Sinne eines vorsorgenden<br />
Schutzes der Bevölkerung sei der <strong>Berg</strong>bau unter den Rheindeichen sowie unter bestehenden und geplanten<br />
Siedlungsbereichen ab<strong>zu</strong>lehnen. <strong>Die</strong> Rheindeiche spielen deshalb eine Rolle, weil die Walsumer bereits bis unter<br />
Eversael und Orsoyerberg vorgedrungen sind. <strong>Die</strong>sen Punkt empfahl der Hauptausschuss einstimmig dem Rat.<br />
Nicht einstimmig fiel ein entsprechender Beschlussvorschlag <strong>zu</strong>m Rahmenbetriebsplan für das <strong>Berg</strong>werk<br />
Friedrich-Heinrich aus - diesmal stimmte die SPD nicht mit. Vorsitzender Siegfried Zilske führte aus, dass seine<br />
Fraktion nicht grundsätzlich gegen einen Kohleabbau unter dem Rheinberger <strong>Stadt</strong>gebiet sei. Konkret geht es um<br />
den geplanten Abbau unter dem Annaberg.<br />
Studie aktualisieren<br />
Einstimmigkeit herrschte jedoch wieder, als es um einen letzten Punkt <strong>zu</strong> diesen Themen ging: <strong>Die</strong> <strong>Stadt</strong><br />
Rheinberg soll fordern, dass eine Sicherheitsstudie aktualisiert wird. In dieser Studie soll dargestellt werden, in<br />
welchem Umfang das Rheinberger <strong>Stadt</strong>gebiet im Falle eines Deichbruchs von Überflutungen betroffen wäre.<br />
Von UWE PLIEN<br />
Rheinische Post, Rheinberg 29.8.2001<br />
Kein Ja <strong>zu</strong>m Abbau<br />
RHEINBERG (RP). <strong>Die</strong> Deutsche Steinkohle-AG (DSK) präsentierte die modifizierte Grote-Gert-Schule am<br />
Annaberg als Beispiel für ein vor <strong>Berg</strong>schäden erfolgreich geschütztes Gebäude. RP-Mitarbeiter Martin<br />
Schmitt sprach mit Baudezernent Klaus Henne über dieses Thema.<br />
Der Widerstand am Annaberg gegen die Planungen der DSK ist bekannt. Wieso wird dann öffentliches Eigentum<br />
<strong>zu</strong>r Präsentation von "prophylaktischen Maßnahmen <strong>zu</strong>r Verfügung gestellt?<br />
Der <strong>Stadt</strong>rat <strong>hat</strong> Ende 1999 Einspruch gegen den Rahmenbetriebsplan des <strong>Berg</strong>werks Friedrich-Heinrich<br />
erhoben. <strong>Die</strong> Verwaltung ist demnach damit beauftragt, dem Ratsbeschluss entsprechend vor<strong>zu</strong>gehen.<br />
<strong>Die</strong> Zustimmung <strong>zu</strong>r Durchführung solcher Prophylaxemaßnahmen bedeutet ganz klar keine gleichzeitige<br />
Zustimmung <strong>zu</strong>m Kohleabbau.<br />
Wird durch diese Unterstüt<strong>zu</strong>ng des <strong>Berg</strong>baus nicht trotzdem der Anspruch der Schutzgemeinschaft an Sie, den<br />
Protest mit<strong>zu</strong>tragen, wortwörtlich untergraben?<br />
Das ist auf keinen Fall so. Es handelt sich nicht um eine Unterstüt<strong>zu</strong>ng des <strong>Berg</strong>baus, unsere Aufgabe als<br />
Verwaltung ist es auch, Schaden von öffentlichem und privatem Eigentum der <strong>Stadt</strong> ab<strong>zu</strong>wenden. Auch darin<br />
liegt unsere Verantwortung den Bürgern gegenüber.<br />
Sehen Sie hinter den Maßnahmen mehr als eine PR-Aktion?<br />
Ja, ganz eindeutig. Sollte es trotz der nachvollziehbaren Widerstände doch <strong>zu</strong> Abbaumaßnahmen am Annaberg<br />
kommen, wären so schon im vorhinein die Gebäude gegen mögliche Beeinträchtigungen geschützt.<br />
Wer <strong>hat</strong> den Umbau an der Schule eigentlich genehmigt?<br />
<strong>Die</strong> Entscheidungskompetenz für solche Maßnahmen obliegt der Verwaltung. Wir haben uns allerdings vorher mit<br />
der Politik abgestimmt und sind <strong>zu</strong> dem Ergebnis gelangt, die Prophylaxemaßnahmen durchführen lassen.<br />
Sehen Sie keinen Widerspruch darin, als Rat bzw. Verwaltung auf der einen Seite Einspruch gegen den<br />
Rahmenbetriebsplan ein<strong>zu</strong>reichen, auf der anderen Seite aber mit der DSK hinsichtlich Gebäudesicherung <strong>zu</strong><br />
kooperieren?
Nein, sehe ich nicht. Es steht jedem Hauseigentümer frei, die Prophylaxe machen <strong>zu</strong> lassen oder ab<strong>zu</strong>lehnen.<br />
Wir entschlossen uns bereits jetzt <strong>zu</strong> diesem Schritt, da wir gerade im Fall eines Schulgebäudes größere<br />
Baumaßnahmen nur in der Ferienzeit durchführen lassen können, um den Schulbetrieb nicht <strong>zu</strong> beeinträchtigen.<br />
Aber ich sage hier noch einmal ganz ausdrücklich: Rat und Verwaltung haben dem Rahmenbetriebsplan damit<br />
keineswegs die Zustimmung erteilt.<br />
NRZ Duisburg 27.09.2001<br />
"Wir kennen die Gefahren nicht"<br />
Bürgerinitiative BIB fordert, die Laufzeit des neuen Rahmenbetriebsplanes für die Zeche Walsum vorerst auf zehn<br />
Jahre <strong>zu</strong> begrenzen.<br />
"Wir stehen auch auf der Seite der <strong>Berg</strong>leute", sagt Lothar Ipach. Der Walsumer ist aktiv in der Bürgerinitiative<br />
<strong>Berg</strong>baubetroffener (BIB), die rund 1400 Mitglieder zählt. Ipach vermutet, dass viele Walsumer nicht wissen, "welche Gefahren<br />
durch den Rahmenbetriebsplan auf sie <strong>zu</strong>kommen". <strong>Die</strong> Abbau-Pläne des <strong>Berg</strong>werkes Walsum für die nächsten 20 Jahre sollen<br />
Ende Oktober erneut beraten werden.<br />
Ipach fordert, den Rahmenbetriebsplan auf zehn Jahre <strong>zu</strong> begrenzen. Keiner wisse, was in 20 Jahren im <strong>Berg</strong>bau los sei. DSK<br />
und Plan-Gegner sollten "sich gegenseitig sagen, was ihnen auf den Lippen brennt". So wisse<br />
man noch immer nicht, "wann wo was abgebaut wird".<br />
Von einer Hauptforderung der BIB mag Ipach nicht abrücken: Dem Verzicht auf den Kohleabbau unter Deichen und<br />
Wohngebieten. Er könne sich vorstellen, dass in Runde zwei der Anhörung "nur noch am ersten oder zweiten Tag"<br />
Verfahrensfragen im Mittelpunkt stehen werden.(cs)<br />
NRZ Rheinberg 26.09.2001<br />
Jede Menge Infos <strong>zu</strong>m Deich<br />
XANTEN. Was sagen Gutachten <strong>zu</strong>r Standsicherheit der Deiche aus, welche Handlungsspielräume haben Bürger, wenn es um<br />
Deiche geht? Das sind zwei von vielen Fragen, die bei der ersten Bürgerversammlung des Hochwasserschutzverbands<br />
Niederrhein am Montag, 1. Oktober, 20 Uhr, in der Gaststätte van Bebber in Birten geklärt werden sollen.<br />
Der neue Hochwasserschutzverband Niederrhein (HSV-N) <strong>hat</strong>te bereits kurz nach seiner Gründung Mitte September eine<br />
Reihe von Informationsveranstaltungen <strong>zu</strong>m Thema Hochwasser in den verschiedenen Ortschaften angekündigt, um auf seine<br />
Belange aufmerksam <strong>zu</strong> machen. Ein zentrales Thema am Montag in Birten dürfte eine erfolgreiche Klage aus Voerde gegen<br />
die Gebührenbescheide des Deichverbands Mehrum sein. Vorsitzender des noch jungen HSV-N ist der Xantener Hans-Peter<br />
Feldmann, der genau wie sein Stellvertreter Gerd Gatermann aus Voerde seine Vorstandsposition im Schutzverband<br />
Niederrhein jetzt aufgegeben <strong>hat</strong>.<br />
NRZ Rheinberg 26.09.2001<br />
<strong>Stadt</strong> will <strong>Berg</strong>bau bremsen<br />
Nur die SPD-Fraktion war gegen ein generelles "Nein". Düsseldorfer Bezirksregierung signalisierte Zustimmung für<br />
einen SB-Markt in der Ortschaft Millingen.<br />
RHEINBERG. <strong>Die</strong> Ergebnisse der Deichbruchszenarien, die die Deichverbände Orsoy, Poll und Friemersheim (wie berichtet)<br />
bei der Technischen Hochschule Aachen in Auftrag gegeben <strong>hat</strong>ten, nahm gestern auch der Hauptausschuss <strong>zu</strong>m Anlass,<br />
einen Kohleabbau unter den Rheindeichen sowie unterhalb bestehender und geplanter Siedlungsbereiche ab<strong>zu</strong>lehnen.<br />
Während die SPD beim Rahmenbetriebsplan des <strong>Berg</strong>werks Walsum mit dieser Gangart keine Probleme <strong>hat</strong>te, ging<br />
ihr das generelle "Nein" im Hinblick auf den Rahmenbetriebsplan des Verbundbergwerks Friedrich-Heinrich/Rheinland<br />
<strong>zu</strong> weit. <strong>Die</strong>s jedenfalls brachte Siegfried Zilske <strong>zu</strong>m Ausdruck. Andererseits <strong>hat</strong>te der Fraktionssprecher vor wenigen Wochen<br />
verdeutlicht, dass auch die Sozialdemokraten einer Kohle-Gewinnung unter dem Annaberg entgegentreten<br />
wollen.<br />
Aktualisierung der Sicherheitsstudie gefordert<br />
Einigkeit gab es wiederum bei der Forderung <strong>zu</strong> den Walsumer Plänen, dass die Sicherheitsstudie auf den aktuellen Stand<br />
gebracht und die Auswirkung eines Deichbruchs auf das gesamte Rheinberger <strong>Stadt</strong>gebiet dargestellt werden soll. Frohe<br />
Kunde <strong>hat</strong>te der erste Beigeordnete Klaus-<strong>Die</strong>ter Henne parat, der den Politikern mitteilte, dass die Bezirksregierung einer<br />
Flächennut<strong>zu</strong>ngsplanänderung in Millingen und mithin der gewünschten Ausweisung eines SB-Marktes in dieser Ortschaft<br />
<strong>zu</strong>stimmt. Beim öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) sah Zilske Rheinberg - <strong>zu</strong>sammen mit drei weiteren Kommunen im<br />
Kreis - auf der Verliererseite. Denn während anderswo die kalkulierten Kosten sinkende Tendenz aufweisen, <strong>hat</strong> Berka mit einer<br />
Mehrbelastung von 248 894 Mark <strong>zu</strong> rechnen. Jürgen Bartsch (Bündnisgrüne) hielt dagegen, dass die <strong>Stadt</strong> zwar künftig<br />
proportional am schlechtesten im Kreis abschneide, doch dafür bislang vom Umlageverfahren profitiert habe. Bürgermeisterin<br />
Ute Schreyer gab <strong>zu</strong> bedenken, dass es mit der Einbindung des Schülerspezialverkehrs in den ÖPNV bereits gelungen sei, die<br />
Ortschaften verstärkt in das Liniennetz ein<strong>zu</strong>binden. Ortschaften verstärkt ins Liniennetz eingebunden<br />
Auch Kämmerer Hans-Theo Mennicken wollte mit Hinweis auf das Leistungsangebot nicht der Verlierer-Vision folgen.<br />
Alle Fraktionen sind bestrebt, weitere Verbesserungen beim ÖPNV <strong>zu</strong> erreichen. Wo dies möglich ist und was es kostet,<br />
darüber soll Anfang Oktober mit der NIAG gesprochen werden. ULRICH ERNENPUTSCH<br />
NRZ Duisburg 23.09.2001<br />
Zeche Walsum: Sorge um Arbeitsplätze<br />
Am 31. Oktober steht in der Rhein-Ruhr-Halle die zweite Runde der Anhörung <strong>zu</strong>m Rahmenbetriebsplan für das Kohlebergwerk<br />
Walsum bevor: Derweil macht sich der Bezirksvorsteher Heinz Plückelmann (SPD) Sorgen um die Zukunft des Betriebes. "<strong>Die</strong><br />
Anhörung ist wichtig für die Perspektiven des <strong>Berg</strong>werks und auch wichtig für die Deutsche Steinkohle AG (DSK)", so<br />
Plückelmann. Er gibt <strong>zu</strong> bedenken, dass das <strong>Berg</strong>werk Walsum einer der größten Arbeitgeber der <strong>Stadt</strong> ist.<br />
Wenn der von der DSK vorgelegte Rahmenbetriebsplan nicht genehmigt werde, so Plückelmann, dann bedeute das das Aus für<br />
die Zeche: "Das wäre eine Katastrophe."<br />
Mit der zweiten Runde - die erste wurde vor allem von Diskussionen über Verfahrensfragen beherrscht - verbindet der Politiker<br />
die Hoffnung, "dass man endlich <strong>zu</strong>r Sache kommt". Sollten die beteiligten Bürgerinitiativen weiterhin die Taktik verfolgen, durch<br />
Verfahrensanträge die Anhörung <strong>zu</strong> verschleppen, "dann sollten sie sich nicht mehr ,Betroffene sondern
,Gegner nennen", meint Plückelmann in Anspielung auf "BIB", die "Bürgerinitiative <strong>Berg</strong>bau-Betroffener".<br />
Man müsse langsam <strong>zu</strong>r Tagesordnung übergehen, so der SPD-Politiker, denn für das <strong>Berg</strong>werk werde es eng.<br />
Bereits <strong>zu</strong> Beginn des kommenden Jahres wolle die DSK mit dem Abbau von Arbeitsplätzen in den Bereichen beginnen, die<br />
durch den bislang gültigen Rahmenbetriebsplan nicht mehr abgedeckt sind. (chris)<br />
NRZ Rheinberg 17.09.2001<br />
"Mit politischer Hintertür"<br />
Rheinberger Grüne sehen ihre Haltung <strong>zu</strong>r Rahmenbetriebsplanung des <strong>Berg</strong>baus in ein verzerrtes Bild<br />
gerückt.<br />
RHEINBERG. Jürgen Bartsch äußert in einer Pressemitteilung die Auffassung, dass der CDU-<strong>Stadt</strong>verbandsvorsitzende<br />
Bartels jüngst ein verzerrtes Bild vom Verhalten der Bündnisgrünen geliefert habe. Denn diese hätten in einem eigenen Antrag<br />
gefordert, einen Kohleabbau unter den Siedlungsschwerpunkten am Annaberg und in Alpsray ab<strong>zu</strong>lehnen. Am schließlich<br />
mehrheitlich gefassten Beschluss kritisieren die Grünen, dass einerseits vollmundig ein Kohleabbau unter ganz Rheinberg<br />
verneint werde. Doch andererseits versuche man in elf weiteren Punkten Vorkehrungen für den Fall <strong>zu</strong> treffen, dass die<br />
Abbaupläne des <strong>Berg</strong>baus doch <strong>zu</strong>m Zuge kommen. Bartsch: "<strong>Die</strong>s war ein Beschluss mit politischer Hintertür."<br />
Kein Verständnis <strong>hat</strong> der Fraktionssprecher für die Diskussion um die <strong>Berg</strong>sicherungsmaßnahme an der Grundschule<br />
Grote Gert. Denn nicht das Schild der DSK sei der entscheidende Punkt, sondern die Durchführung der Sicherungsmaßnahme.<br />
Bartsch: "Und dafür <strong>hat</strong> doch, anders als die Bündnisgrünen, auch die CDU plädiert, oder?"<br />
NRZ Rheinberg 12.09.2001<br />
Mündige Bürger vernachlässigt<br />
KREIS WESEL. Volle Zustimmung <strong>zu</strong>r Kritik des Alt-Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker, dass die Parteien Probleme<br />
für ihren Machtkampf instrumentalisierten, anstatt um Lösungen <strong>zu</strong> ringen, gibt Hans-Peter Feldmann vom<br />
Hochwasserschutzverband Niederrhein. So sei nicht <strong>zu</strong> verkennen, dass z.B. die jahrzehntelange Favorisierung der Steinkohle<br />
den Blick für die Folgen verschleiere, den der Abbau für die Region habe. <strong>Die</strong> bisher eher verharmlosende Bewertung von<br />
Überschwemmungsgefahren bekomme durch die Offenlegung von Gutachten <strong>zu</strong>m Rahmenbetriebsplan<br />
des <strong>Berg</strong>werks Walsum eine ganz andere Dimension. Auch deshalb, weil alle Träger öffentlicher Belange sich gegen weitere<br />
Risikoerhöhungen an der Rheinschiene ausgesprochen hätten. "Doch ohne die politische und rechtliche Umset<strong>zu</strong>ng sind diese<br />
Aussagen wirkungslos", so Feldmann. Es werde auch deutlich, dass das bestehende Gefahrenpotenzial gerade für den<br />
linksrheinischen Polder erheblicher höher sei als bisher bekannt. Mündige Bürger griffen diese Probleme auf. "Doch wer glaubt,<br />
dass die gewählten Bürgervertreter, sich dieses Themas mit Sachverstand annehmen und risikomindernde Maßnahmen<br />
angehen, der irrte bisher."<br />
NRZ Moers 07.09.2001<br />
Takkt kommt nicht aus dem Takt ZUR SACHE<br />
<strong>Die</strong> guten und die schlechten Nachrichten<br />
Na , wer sagt es denn. Es gibt auch gute Nachrichten aus Kamp-Lintfort. <strong>Die</strong> Takkt-Tochter Kaiser + Kraft Europa investierte in<br />
den Ausbau des weithin sichtbaren Logistikzentrums rund 17 Millionen Euro. Doch man kann nicht umhin, auch einen Blick in<br />
die Nachbarschaft <strong>zu</strong> werfen. Siemens lieferte in letzter Zeit eher negative denn gute Schlagzeilen.<br />
Rigoros wurden Zeitverträge, die abgelaufen waren, nicht verlängert. Plötzlich saßen die Damen, die auf Zeit arbeiteten, auf der<br />
Straße. Nun versucht eine neu installierte Agentur, sie in neue Arbeit <strong>zu</strong> vermitteln - allerdings bleibt da manche<br />
Lohnvorstellung unerfüllt.<br />
Im <strong>Berg</strong>bau, immerhin noch der größte Arbeitgeber in Kamp-Lintfort, werden demnächst die Weichen neu gestellt.<br />
Dann geht es um die Frage, arbeitet "Friedrich-Heinrich" rentabel? Davon hängt nämlich die Frage weiterer Subventionen in<br />
den nächsten Jahren ab. Der noch <strong>zu</strong> erörternde Rahmenbetriebsplan sorgt auf seine Weise dafür, dass ein Keil zwischen<br />
<strong>Berg</strong>leuten und Umweltschützern sowie Häuslebauer getrieben wird. Und dann noch die Bauwirtschaft, die mehr und mehr<br />
schwächelt. Am Niederrhein sollen gar 9 000 Arbeitnehmer betroffen sein. Wohlgemerkt: <strong>Die</strong> Gründe dafür liegen nicht im Miss-<br />
Management, sondern sind Auswirkung meist überregionaler Entwicklungen.<br />
Wie schön, dass die Takkt-Tochter nicht aus dem Takt kommt. HEINZ-LEO GARDENIER<br />
NRZ Rheinberg 07.09.2001<br />
Schutzverband kritisiert Spundwandbau<br />
XANTEN-BIRTEN. Sorgen bereitet dem Vorsitzenden des Schutzverbandes Niederrhein, Hans-Peter Feldmann,<br />
die Verkehrssituation am Banndeich an der Birtener B 57 <strong>zu</strong>r kommenden Rübenernte. Seit kurzem laufen auf der<br />
Bundesstraße die Vorbereitungen für den Bau einer Spundwand (wir berichteten). "Dass dann auch die B 57, als Deich-<br />
Verteidigungsweg für Schwerlaster und die Aufstellung der mobilen Schutzwand gegen Hochwasser dienen soll, ist für die<br />
Verkehrsteilnehmer nicht vorstellbar", beklagt er und fragt, ob über diese Verkehrssituation, die im November bis März<br />
<strong>zu</strong>sätzlich von Rübentransportern belastet wird, nachgedacht worden ist. "Darf eine vielbefahrene Straße überhaupt als<br />
Deichverteidigungsweg genutzt werden?" Wenn das verneint würde, solle schleunigst der Spundwandbau an der geplanten<br />
Trasse gestoppt werden. "Dann lassen sich auch die Forderungen des Xantener <strong>Stadt</strong>rates erfüllen, ohne das der Rechtsweg<br />
ergriffen wird", nennt Feldmann die Vorteile. Zudem könne stattdessen ein Rad- und Fußweg errichtet werden, der ein Gewinn<br />
für die ganze Region sei.<br />
NRZ Rheinberg 07.09.2001<br />
CDU will Aufklärung <strong>zu</strong>r DSK-Werbung<br />
RHEINBERG. <strong>Die</strong> Vorwürfe, die Peter Röger gegen Rat und Verwaltung erhob, wies Jürgen Bartsch (wie berichtet) <strong>zu</strong>rück.<br />
Damit erntet der Fraktionssprecher der Bündnisgrünen die Zustimmung von Heinz-<strong>Die</strong>ter Bartels. Doch <strong>zu</strong>gleich zeigt der<br />
Vorsitzende des CDU-<strong>Stadt</strong>verbands Verständnis dafür, dass die an der Grundschule Groote Gert stattgefundenen<br />
vorsorglichen Sicherungsmaßnahmen vor Ort Irritationen ausgelöst haben. "Hervorgerufen wurden diese Irritationen aber vor<br />
allem durch eine, mit den Sanierungsmaßnahmen in Verbindung stehende, massive Werbekampagne durch die DSK." Von<br />
dieser Kampagne sei die Rheinberger Politik nicht informiert worden und daher gebe es noch Aufklärungsbedarf. "Zustimmung<br />
hätte den Bürgern mehr genutzt" Bartels betont, dass die CDU einer solchen Werbung nicht <strong>zu</strong>gestimmt hätte.
Zum Hinweis von Bartsch auf den Ratsbeschluss gegen einen Steinkohlenabbau unter Annaberg erinnert der CDU-Mann<br />
daran, dass der Bündnisgrüne und dessen Fraktion diesem Beschluss nicht <strong>zu</strong>gestimmt hätten. Bartels: "<strong>Die</strong>s aber hätte den<br />
Bürgerinnen und Bürgern, welche gegen den Steinkohlenabbau unter Annaberg sind, mehr genutzt als seine jetzige Position als<br />
Bedenkenträger."<br />
Wenn Bartsch richtigerweise feststelle, dass der von der FDP und CDU getragene Ratsbeschluss nach wie vor gültig sei, dann<br />
solle er fairerweise auch vor die Bürgerschaft treten und offenbaren, "wir von den Bündnis 90/<strong>Die</strong> Grünen waren nicht mit<br />
dabei".<br />
NRZ Mantel 07.09.2001<br />
Stützpfeiler brechen weg<br />
Der deutschen Steinkohle brechen entscheidende Stützpfeiler weg. Bundeswirtschaftsminister Werner Müller darf für sich in<br />
Anspruch nehmen, dabei kräftig mit<strong>zu</strong>helfen. Bisher war bei der Kohle immer wieder von Eintracht und Gemeinsamkeit<br />
zwischen Bund und Land die Rede.<br />
Angesichts der neuen Milliardenlasten, die Müller dem Kohleland NRW aufhalsen will, dürfte das nun Geschichte sein.<br />
Vertrauen <strong>hat</strong> für die Kumpel immer wieder eine ganz besondere Rolle gespielt. Denn trotz aller politischen<br />
Auseinanderset<strong>zu</strong>ngen durften die <strong>Berg</strong>leute an Rhein, Ruhr und Saar bisher darauf bauen, dass die Politik daran arbeitet,<br />
beim schmerzhaften Schrumpfungsprozess die schlimmsten Härten ab<strong>zu</strong>fangen. Der notwendige Arbeitsplatzabbau sollte<br />
sozialverträglich, also ohne Kündigungen, angegangen werden. Zumindest dieser Grundkonsens mit den politisch<br />
Verantwortlichen <strong>hat</strong>te Wert – auch über Parteigrenzen hinweg. Müller verlässt nun diesen Weg. Er läutet mit seiner Forderung<br />
den Rück<strong>zu</strong>g der Bundespolitik in Sachen Kohle ein. Ohne ausreichende Mittel vom Bund stehen zehntausende von<br />
Arbeitsplätzen auf der Kippe, droht wirtschaftlicher Niedergang.<br />
Auch Kohlegegnern muss klar sein, dass ein abruptes Aus für den <strong>Berg</strong>bau keine sinnvolle Lösung sein kann, wenn man den<br />
Strukturwandel ernst nimmt und dem Ruhrgebiet eine Zukunftschance wahren will. Ohne Geld fehlt die Zeit da<strong>zu</strong>.<br />
RUBEN THIEL<br />
NRZ Mantel 07.09.2001<br />
Müller plant Rück<strong>zu</strong>g aus <strong>Berg</strong>bauhilfe<br />
Der Bundeswirtschaftsminister möchte dem Land die Hauptlast aufbürden.<br />
BERLIN. <strong>Die</strong> Kumpel an Rhein und Ruhr müssen wieder zittern: Bundeswirtschaftsminister Werner Müller (parteilos) will die<br />
Subventionen des Bundes für die Förderung der heimischen Steinkohle ab 2006 drastisch kürzen. Nach dem Modell der<br />
Werftenbeihilfe werde der Bund dann nur noch ein Drittel der Abbauhilfen zahlen. Zwei Drittel müsse das Land NRW<br />
übernehmen.<br />
Gegenwärtig zahlt der Bund rund 85 Prozent der jährlichen Kohlesubventionen von 7,8 Milliarden Mark, die bis <strong>zu</strong>m Jahr 2005<br />
auf etwa 5,5 Milliarden Mark sinken sollen. Für die Kohle könnte der Vorstoß des Ministers einen Einbruch der Förderung und<br />
den Verlust tausender Arbeitsplätze nach sich ziehen. Müller: "Je mehr NRW zahlt, umso mehr Steinkohle kann abgebaut<br />
werden."<br />
Der <strong>Berg</strong>bau geht ab 2006 von staatlichen Subventionen von 3,5 Milliarden Mark jährlich für die laufende Förderung aus.<br />
Gemessen daran würde nach Müllers Ankündigung der Anteil des Bundes auf knapp über eine Milliarde Mark sinken. <strong>Die</strong><br />
Staatskanzlei in Düsseldorf zeigte sich gestern überrascht. "<strong>Die</strong> offizielle Position der Bundesregierung ist eine andere", hieß es<br />
dort auf Anfrage. Ende 2005 läuft die Vereinbarung zwischen Bundesregierung und Steinkohlebergbau über die<br />
Subventionierung der Kohleförderung aus. 1997 war ursprünglich vereinbart worden, dass dann noch 30 Millionen Tonnen<br />
gefördert werden sollen. Tatsächlich wird der Abbau auf 26 Millionen Tonnen sinken. Wirtschaftsminister Müller rechnet<br />
damit, dass in der Zeit nach 2005 die Steinkohleförderung auf unter 20 Millionen Tonnen jährlich sinkt. Aus Sicht von RAG-Chef<br />
Karl Starzacher sind dagegen 22 Millionen Tonnen Kohleförderung pro Jahr für einen leistungs- und lebensfähigen <strong>Berg</strong>bau<br />
notwendig. Müller zeigte sich außerdem skeptisch, eine Verlängerung der Steinkohleförderung über das Jahr 2010 bei der EU-<br />
Kommission in Brüssel durch<strong>zu</strong>setzen. Der jetzige Vorschlag der EU-Energiekommissarin de Palacio für eine<br />
Anschlussregelung des EGKS-Vertrages sieht eine Befristung der Subventionen bis 2007 vor. <strong>Die</strong> unrentabelsten Zechen<br />
müssen bis dahin schließen. Dann soll im Rahmen eines Energieberichtes die Notwendigkeit staatlicher Absatzhilfen bis 2010<br />
überprüft werden. Müller: "Das Interesse außerhalb Deutschlands an der Steinkohle<br />
ist gering." (NRZ) LOTHAR KLEIN<br />
NRZ Rheinberg 05.09.2001<br />
ZUR SACHE: Abhilfe ist überfällig<br />
Ihre Kräfte bündeln wollen der Schutzverband Niederrhein und die Schutzgemeinschaft <strong>Berg</strong>bau, um dem Kampf für einen<br />
verbesserten Schutz der Bürger dieser Region vor den <strong>zu</strong>nehmenden Hochwassergefahren mehr Nachdruck <strong>zu</strong> verleihen.<br />
Schleierhaft ist allerdings, warum neben dem neuen Verband die bisherigen Gemeinschaften weiter bestehen bleiben. Denn<br />
<strong>zu</strong>gleich heben die Initiatoren die enge thematische Verzahnung zwischen Kohleabbau, Deichsicherheit und<br />
Katastrophenplanung hervor. So besteht die Gefahr, dass die Aktivitäten doppelt und dreifach laufen und letztlich zerfasern.<br />
Grundsätzlich ist den Bürgergemeinschaften <strong>zu</strong> verdanken, dass sie das Bewusstsein für die wachsende Gefährdung der<br />
Niederrheiner geschärft haben. Folgerichtig legen sie auch den Finger auf die seit langem herrschende Schwachstelle einer<br />
völlig un<strong>zu</strong>reichenden Katastrophenplanung. Hier ist Abhilfe wahrlich überfällig. ULRICH ERNENPUTSCH<br />
NRZ Rheinberg 05.09.2001<br />
Am Deich trennen sich die Wege<br />
<strong>Stadt</strong> soll an der Anbindung des Lensingswegs an die L 460 festhalten.<br />
XANTEN. Beibehalten will die <strong>Stadt</strong> die direkte Anbindung des Lensingsweges an die L 460, die nach Vorstellung des<br />
Deichverbandes Poll im Zuge der Errichtung des rheinfernen Deiches an der Bislicher Insel komplett entfallen soll. Stattdessen<br />
entstand eine Anbindung, die einen weiten Bogen über landwirtschaftliche Flächen schlägt, später auf den Deich stößt und<br />
dann in die Gindericher Straße mündet. <strong>Die</strong>se städtische Straße muss nun die höhere Belastung durch landwirtschaftliche<br />
Fahrzeuge aufnehmen. <strong>Die</strong> in dieser Form vorgenommene Wegführung ist so aber nicht im Planfeststellungsbeschluss<br />
ausgewiesen. Einen Antrag auf Änderung <strong>hat</strong> der Deichverband erst nachträglich im Juni an die Bezirksregierung gestellt.<br />
<strong>Die</strong>ser Antrag und die Stellungnahme der <strong>Stadt</strong> da<strong>zu</strong> waren jetzt Thema im Umwelt- und Planungsausschuss. Der lehnte die<br />
Vorstellungen ab und folgte damit dem Beschlussvorschlag der Verwaltung. Der sieht vor, den Lensingsweg rheinseitig <strong>zu</strong><br />
erhalten und am Deichfuß auf die Deichkrone <strong>zu</strong> führen. Damit würde gleichzeitig die angestrebte Nut<strong>zu</strong>ng der Deichkrone als
Radwanderweg möglich. "Damit hätte man zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen können", so Bauamtsleiter Christian<br />
Schaudig.<br />
Ein wichtiger Schritt auch im Hinblick auf die geplante Fernradwegeverbindung Rotterdam-Basel und die gewünschte<br />
Anbindung an den Weseler Teil des Deiches, erklärt Schaudig. In einer Vereinbarung will die <strong>Stadt</strong> mit dem Deichverband die<br />
öffentliche Nut<strong>zu</strong>ng des Deichverteidigungsweges bzw. der Deichkrone als Fuß- und Radweg festlegen. Im Gegen<strong>zu</strong>g würde<br />
die <strong>Stadt</strong> die Verkehrssicherungspflicht für den Deichverteidigungsweg, sprich Reinigung und Kontrolle, übernehmen. Nach<br />
dem Ratsbeschluss soll dem Deichverband die Vereinbarung vorgelegt werden.<br />
Als faulen Kompromiss kritisiert der FBI-Fraktionsvorsitzende Herbert Dissen, dass die <strong>Stadt</strong> mit Abschluss der Vereinbarung<br />
auf ihr Widerspruchsrecht gegen die erste Planänderung des Deichbaus Bislicher Insel verzichten will. Der<br />
Rat <strong>hat</strong>te im November beschlossen, eine Zustimmung <strong>zu</strong>r Planänderung an fünf Bedingungen <strong>zu</strong> knüpfen. <strong>Die</strong> seien nicht<br />
erfüllt worden, so Dissen. Darunter die Maßgabe, anstatt einer hohen, oberirdischen Mauer mobile Hochwasserschutzwände <strong>zu</strong><br />
installieren, um so den Blick auf den Rhein <strong>zu</strong> gewähren. Dissen: "Es muss der Rechtsweg beschritten werden." PETRA<br />
KESSLER<br />
NRZ Rheinberg 05.09.2001<br />
Risiken bewusst machen<br />
Der neue "Hochwasserschutzverband Niederrhein" will das Thema <strong>Berg</strong>bau und die Folgen für den Hochwasserschutz<br />
in der Region stärker ins Blickfeld rücken.<br />
KREIS WESEL. "Wir müssen alle Kräfte bündeln, um die Thematik weiter voran<strong>zu</strong>treiben", betonte gestern Hans-Peter<br />
Feldmann. Und so hob der Vorsitzende des Schutzverbands Niederrhein gemeinsam mit dem Vorsitzenden der<br />
Schutzgemeinschaft <strong>Berg</strong>bau, Werner Raue, den "Hochwasserschutzverband<br />
Niederrhein" aus der Taufe. <strong>Die</strong> neue Gemeinschaft soll da<strong>zu</strong> dienen, die vielfältigen Risiken für den Hochwasserschutz in<br />
dieser Region <strong>zu</strong> beleuchten und bewusst <strong>zu</strong> machen. Zugleich möchte man die Bürger verstärkt in die Aktivitäten einbinden.<br />
Feldmann verdeutlichte, dass es linksrheinisch um ein rund 800 Quadratkilometer großes Flutungsgebiet gehe. Hier sei in den<br />
<strong>zu</strong>rückliegenden Jahrzehnten - aufgrund des untertägigen Kohle- und Salzabbaus - "eine riesige Geländewanne entstanden,<br />
aus der das Wasser nicht mehr abfließen kann". Damit existiere ein großes Gefahrenpotenzial für annähernd 500 000<br />
Menschen. <strong>Die</strong> Deiche am Niederrhein seien erst <strong>zu</strong> 50 Prozent saniert. Doch bei der bisherigen Finanz-Regelung werde die<br />
Sicherheit durch die Streckung von Haushaltsmitteln verwässert. Werner Raue erhob daher die Forderung: "Der Bund soll<br />
seinen hoheitlichen Aufgaben <strong>zu</strong>m Schutz des Rheins im vollen Umfang nachkommen."<br />
Schließlich sei dieser Fluss eine Wasserstraße von bundesweiter Bedeutung. Mit einiger Genugtuung registrierten die beiden<br />
Vereinsgründer, dass sich bei den Anhörungen <strong>zu</strong>m Rahmenbetriebsplan des <strong>Berg</strong>werks Walsum die Träger kommunaler<br />
Belange eindeutig gegen weitere Schädigungen des Hochwasserschutzes aussprachen. Den Versicherungen des <strong>Berg</strong>baus,<br />
dass die infolge des Kohleabbaus entstehenden Risse im Deich nicht stärker als einen Zentimeter ausfallen und beherrschbar<br />
seien, will Raue nicht vertrauen. "Hier sind Probleme vorhanden und die müssen von Fachleuten weiter untersucht werden. Wir<br />
wollen Gefährdungen entgegentreten und dies nicht mit Scharf- und Panikmacherei."<br />
Bruchstückhafte Katastrophenplanung<br />
Als skandalös beurteilte Hans-Peter Feldmann die Tatsache, dass die Katastrophenplanung im Kreis bisher nur bruchstückhaft<br />
ist. "Es liegt nur eine Karte von Solvay vor, die auf Grundlagen beruht, die 80 oder 100 Jahre alt sind." Man wisse nicht genau,<br />
ob man im Überschwemmungsfall die Bürger aus dem ersten Stock oder gar vom Dach retten müsse. Feldmann wusste <strong>zu</strong><br />
berichten, dass der Kreis noch auf das Gutachten warte, das (wie berichtet) die Deichverbände bei der Technischen<br />
Hochschule Aachen in Auftrag gaben und das auf aktuelleren Daten <strong>zu</strong> den inzwischen eingetretenen Gelände-Niveaus fußt.<br />
Gleichwohl erklärte Feldmann, dass die Gutachter bei ihren verschiedenen Deichbruch-Szenarien von <strong>zu</strong> optimistischen<br />
Vorausset<strong>zu</strong>ngen ausgegangen und weit gravierendere Überflutungen <strong>zu</strong> erwarten seien. Kritik übte Raue an der Deutschen<br />
Steinkohle. Denn das <strong>Berg</strong>werk Friedrich-Heinrich/Rheinland versuche, schon in 2003 mit der Fettkohle-Gewinnung<br />
unter Rheinberg <strong>zu</strong> beginnen. Bislang habe man den Start ab Ende 2003 datiert. Raue wertete dies nicht gerade als<br />
vertrauenbildende Maßnahme. Er appellierte an den <strong>Berg</strong>bau, künftig auf den Kohleabbau unter Rhein und Deichen sowie unter<br />
dicht besiedelten Gebieten <strong>zu</strong> verzichten. Der neue Hochwasserschutzverband will sich u.a. für sichere Deiche sowie<br />
Querriegel, einheitliches Flussmanagement und klare Regeln <strong>zu</strong>r Abfederung von Folgelasten einsetzen, die <strong>Berg</strong>bau und<br />
Überflutungen verursachen. ULRICH ERNENPUTSCH<br />
NRZ Moers 05.09.2001<br />
Briefe an die Redaktion<br />
Subventionen umleiten<br />
In dem DSK-Treff mit Politikern <strong>hat</strong> der <strong>Berg</strong>bau wieder einmal in seiner arroganten Art ("an jedem Standort wird weiter<br />
gefördert") bezüglich der vom Steuerzahler geleisteten Pfründe kein volkwirtschaftliches Sachverständnis gezeigt. Was haben<br />
wir vom <strong>Berg</strong>bau? Ein Produkt was überteuert ist, Schäden an Häusern Straßen und Gewässer, riesiger Landverbrauch für<br />
riesige Halden und Luftverschmut<strong>zu</strong>ngen bei der Verbrennung. Es wird höchste Zeit, dass die Milliarden Mark Subventionen<br />
umgeleitet und in <strong>zu</strong>kunftorientierte Projekte eingesetzt werden wie <strong>zu</strong>m Beispiel: die Sanierung der maroden Kanäle, durch<br />
Schlaglöcher beschädigte Straßen, PCB geschädigte Schulen und öffentliche Gebäude.<br />
Es braucht kein <strong>Berg</strong>mann entlassen <strong>zu</strong> werden, da ein guter <strong>Berg</strong>arbeiter auch ein guter Bauarbeiter ist. Arbeitslos würden<br />
höchstens die vom Steuerzahler überzahlten Funktionäre, die sich mit Händen und Füßen gegen jede Veränderung sträuben.<br />
Weshalb muss der <strong>Berg</strong>bau 500 Aus<strong>zu</strong>bildende einstellen, die in der Bauwirtschaft dringend gesucht werden und zweifellos<br />
bessere Zukunftsperspektiven hätten als im <strong>Berg</strong>bau. Es handelt sich alles um Probleme der Grünen! Wo bleibt die Öko-Partei?<br />
Schwatzen immer, handeln nimmer?<br />
NRZ Moers 05.09.2001<br />
Der Dreck-Weg-Tag war einfach <strong>zu</strong> teuer<br />
Der Bau-, Grünflächen- und Umweltausschuss schaute auf die Kosten.<br />
NEUKIRCHEN-VLUYN. In der Ausschusssit<strong>zu</strong>ng stand unter anderem der zweite Dreck-Weg-Tag <strong>zu</strong>r Debatte. <strong>Die</strong>sen<br />
Aktionstag wird es nun nicht geben, denn er war schlichtweg <strong>zu</strong> teuer für die <strong>Stadt</strong>. Immerhin hätte er über 24 000 Mark<br />
gekostet. Ein weiteres Ergebnis der Sit<strong>zu</strong>ng: Der Marktplatz Vluyn wird auch weiterhin als Parkplatz <strong>zu</strong>r Verfügung stehen. <strong>Die</strong><br />
Kanalbauarbeiten an dem Platz werden noch in diesem Jahr begonnen. Ebenfalls im Ausschuss diskutiert: der
Rahmenbetriebsplan des <strong>Berg</strong>werks Walsum. In Sachen Hochwasserschutz werden die Interessen der <strong>Stadt</strong> durch den Kreis<br />
gut vertreten, so die Meinung im Ausschuss.<br />
NRZ Moers 04.09.2001<br />
Kandidat baut aufs Einvernehmen<br />
Siggi Ehrmann <strong>hat</strong> sich offiziell beworben. Ortsvereinschef Edmund Goer will aber keine Vorabstimmung im Kreis. Am<br />
14. September gehts nach Krefeld.<br />
AM NIEDERRHEIN. Siggi Ehrmann wills machen. "Es ist mein Entschluss, für die SPD bei der Bundestagswahl 2002 <strong>zu</strong><br />
kandidieren", sagte er gestern im "Cafe Nacke" in Neukirchen-Vluyn.<br />
Und warum? "Weil ich es mir <strong>zu</strong>traue", so der 49-Jährige, der als Personal-Dezernent im Moerser Rathaus arbeitet. Zahlreiche<br />
Freunde hätten ihm <strong>zu</strong>geraten, darunter auch der einstige Abgeordnete und Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland, Dr.<br />
Jürgen Schmude. Seinem Ortsverein in Neukirchen-Vluyn stellte Ehrmann sein Ansinnen Montagabend vor. "Wir stärken ihn in<br />
seiner Absicht", so gestern Ortsvereinschef Edmund Goer. Gleichwohl halten sich die dortigen Genossen an die kreisweite<br />
Regelung, dass man den Delegierten keine Wahlempfehlung mit auf den Weg geben will. "Wir wollen ein faires Verfahren", so<br />
Goer. Und er zielt damit auf Parteichef Vöge, der eine Vorentscheidung auf einen Kandidaten im Kreis Wesel fordert. "So kann<br />
man mit den Krefeldern nicht umgehen", meint Goer da<strong>zu</strong>. Und er kann sich bereits vorstellen, dass man bei der<br />
Wahlkreiskonferenz nur noch die beiden Erstplatzierten in den zweiten Wahlgang schickt. Ein taktischer Schach<strong>zu</strong>g, "der auf<br />
die übrigen Kandidaten Eindruck machen dürfte", so Goer. Im gleichen Zuge setzt Ehrmann auf Einvernehmen mit den<br />
Genossen in der Seidenstadt (wo er sich am 14. September vorstellen wird). "<strong>Die</strong> Menschen in Moers,<br />
Neukirchen-Vluyn sowie Krefeld haben zwar andere Prägungen, aber in allen Städte sind die Arbeitsmarktzahlen bedenklich",<br />
so der Kandidat. Da gebe es viel <strong>zu</strong> tun. Auf die Frage, was er vom hiesigen <strong>Berg</strong>bau halte, meinte Ehrmann:<br />
"Das ist ein wichtiger Faktor für die Region, ein Sockel muss auf jeden Fall eine Zukunft haben." Den Genossen in Neukirchen-<br />
Vluyn werden sich die drei Kandidaten (Ehrmann, Eidam und Enders) am 21. September präsentieren. Und zwar alphabetisch.<br />
Da alle drei mit E beginnen, ist nun der zweite Buchstabe entscheidend. Ehrmann ist danach der erste Mann... MANFRED<br />
LACHNIET<br />
NRZ Rheinhausen 02.09.2001<br />
Umweltanwalt will das <strong>Berg</strong>werk stoppen<br />
FRIEDRICH-HEINRICH / Kall sagt: Abbau unter Tage verhindert den Strukturwandel. "Nutzen alle Instrumente des <strong>Berg</strong>rechts."<br />
Der bekannte Umweltanwalt Klaus Kall will dem Kamp-Lintforter <strong>Berg</strong>werk Friedrich-Heinrich <strong>zu</strong> Leibe rücken. Kall bereitet<br />
nämlich gerade einen "Antrag auf Widerruf des <strong>Berg</strong>werkeigentums" vor. Was das im Klartext bedeutet,<br />
erläuterte er der Redaktion: "Wo der <strong>Berg</strong>bau sich untertägig umtreibt, verhindert er über Tage den wichtigen Strukturwandel.<br />
So lange unten gebuddelt wird, siedeln sich oben keine <strong>zu</strong>kunftsträchtigen Firmen an", so Kall. <strong>Die</strong> öffentlichen Flächen seien<br />
<strong>zu</strong> wertvoll, als dass sie durch den <strong>Berg</strong>bau blockiert werden dürften. Zumal der <strong>Berg</strong>bau keine wirtschaftlichen Gewinne<br />
erziele.<br />
Als Beispiel nennt er Kapellen, "wo auch dreißig Jahre nach dem untertägigen Stillstand immer noch <strong>nichts</strong> geschieht", so Kall,<br />
der in Moers lebt und seine Kanzlei an der feinen Königsallee in Düsseldorf <strong>hat</strong>. Für Friedrich-Heinrich fordert er dringend eine<br />
Umweltverträglichkeitsprüfung.<br />
"Doch beim Oberbergamt <strong>hat</strong> man dafür wohl keine Kapazitäten frei, da muss erst der Rahmenbetriebsplan Walsum erledigt<br />
werden", glaubt der Anwalt, der eine große Reihe von bergbau-geschädigten Anwohnern vertritt. "Mir ist wichtig, dass man nicht<br />
erst diskutiert, wenn <strong>Berg</strong>schäden auftreten, sondern viel früher. Wir müssen uns Gedanken machen, ob wir uns die<br />
Auswirkungen des <strong>Berg</strong>baus leisten können", so Kall. Auf den Einwand der Redaktion, dass auf zahlreichen Abbaugebieten<br />
sehr wohl neue Betriebe entstanden sind, meinte Kall: "Sensible Firmen, etwa aus der Hochtechnologie, würden sich auf<br />
unsicherem Terrain nicht ansiedeln. Sie müssen ja Folgeschäden befürchten. Allenfalls entstehen Büros." Kall meinte<br />
weiter: "Wir werden alle Instrumentarien des Bundesberggesetzes nutzen, um die Aktivitäten der Deutschen Steinkohle<br />
<strong>zu</strong> stoppen. Es gibt keinen wirtschaftlichen Wandel, solange der <strong>Berg</strong>bau aktiv ist." (Manfred Lachniet)<br />
NRZ Moers 31.08.2001<br />
<strong>Berg</strong>bau ist optimistisch<br />
Vorstandsvorsitzender Tönjes <strong>zu</strong>m Genehmigungsverfahren Rahmenbetriebsplan Friedrich-Heinrich : "Er liegtuns<br />
sehr am Herzen". Gemeinsam Lösung finden.<br />
KAMP-LINTFORT. Der <strong>Berg</strong>bau sieht weiterhin Chancen für die Region Linker Niederrhein: "Wir sind optimistisch. Das ist auch<br />
ganz wichtig für die Belegschaften. Für sie ist es <strong>zu</strong>rzeit eine nicht gerade einfache Situation", sagte gestern der<br />
Vorstandsvorsitzende der Deutschen Steinkohle (DSK) Bernd Tönjes im Knappenheim an der Schulstraße. Für ihn war der<br />
Besuch auf der linken Niederrheinseite eine Premiere. Anlass war das Treffen der DSK mit über 70 Politikern, darunter den vier<br />
Bürgermeistern der Städte Moers, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg <strong>zu</strong>m Thema "Rahmenbetriebsplan".<br />
Landrätin Amend-Glantschig war auch eingeladen, <strong>hat</strong>te aber abgesagt: "Sie <strong>hat</strong>te uns ja die Gesprächsbereitschaft<br />
aufgekündigt, was wir außerordentlich bedauert haben." Doch mittlerweile gibt es einen Briefkontakt, "so dass wir davon<br />
ausgehen, dass wir in nicht all<strong>zu</strong> ferner Zukunft ein Gespräch haben werden." Tönjes machte den Zuhörern gegenüber deutlich,<br />
"dass uns das Genehmigungsverfahren Friedrich-Heinrich doch sehr am Herzen liegt." Doch weder auf das<br />
Erörterungsverfahren Walsum noch auf die Offenlegung des Rahmenbetriebsplanes am linken Niederrhein habe die DSK einen<br />
Einfluss. Der genaue Termin für Friedrich-Heinrich stehe noch nicht fest: "<strong>Die</strong>s <strong>zu</strong> terminieren, ist Hoheit der Bezirksregierung."<br />
Insofern machte Tönjes klar, dass die DSK noch gar nicht sagen könnte, was sie an eventuellen Zugeständnissen ein<strong>zu</strong>gehen<br />
gedenke. Das werde sich noch zeigen. Er stellte jedoch bei den Politikern eine "Betroffenheit" fest, dass der <strong>Berg</strong>bau Probleme<br />
verursache. "Wir müssen da gemeinsam eine Lösung finden !" <strong>Die</strong> DSK ist bemüht, für jedes <strong>Berg</strong>werk einen positiven<br />
Bescheid in der Hinsicht <strong>zu</strong> bewirken, dass an jedem Standort weiter gefördert werden kann. HEINZ-LEO GARDENIER<br />
NRZ Rheinberg 29.08.2001<br />
Markt-Workshop stieß nicht auf Begeisterung<br />
Verwaltung und Politiker unterstrichen Notwendigkeit für Sicherungsmaßnahmen an der Grundschule Grote Gert.<br />
RHEINBERG. "Hier ist es schöner geworden", stellte gestern Jürgen Grossmann, Hausmeister der Grundschule Grote Gert,<br />
fest. Bauausschussmitglieder von SPD und Grünen ließen sich vor Ort vom Ersten Beigeordneten Klaus-<strong>Die</strong>ter Henne und<br />
Hochbauamtsleiter Horst Profe vorstellen, was der <strong>Berg</strong>bau im Rahmen der Sicherheits-Prophylaxe an dem Schulbau<br />
durchführen ließ. So wurde der Pausengang über Dehnungsfugen vom Hauptgebäude abgekoppelt. Zwei weitere Fugen fügte
man in Gang- und Überdachungsbereich und zwischen den Stützpfeilern wurden Betonkopplungsbalken eingesetzt. Schöner<br />
Nebeneffekt für die <strong>Stadt</strong> war, dass der <strong>Berg</strong>bau <strong>zu</strong>gleich triste Bürgersteigplatten durch Pflastersteine ersetzte sowie einen Teil<br />
des Pausenganges verbreiterte und mit neuen Kantensteinen versah. <strong>Die</strong> vorherige Einfassung war recht unfallträchtig<br />
und hätte ohnedies alsbald ersetzt werden müssen.<br />
Darüber hinaus ließ sich der <strong>Berg</strong>bau auch <strong>zu</strong> Anstricharbeiten bewegen. Henne betonte: "Wir haben hier eine wesentliche<br />
Wertverbesserung bekommen." Zugleich stellte er klar, dass die <strong>Stadt</strong> das Angebot des <strong>Berg</strong>baus angenommen habe, weil sie<br />
als Schulträger sicherstellen müsse, dass das Gebäude immer benutzbar sei. In der Bauausschuss-Sit<strong>zu</strong>ng erklärte Stefan<br />
Feltes, dass die CDU der Ortsbesichtigung ferngeblieben sei, um die emotional aufgeladene Stimmung in der Anliegerschaft<br />
nicht weiter auf<strong>zu</strong>heizen. Feltes sowie Siegfried Zilske (SPD) unterstrichen, dass es vorrangiges Ziel sei, den Kohleabbau unter<br />
Annaberg <strong>zu</strong> verhindern. Doch mit Blick auf die Schutzgemeinschaft <strong>Berg</strong>bau bezeichnete es der SPD-Mann als falsch und<br />
fahrlässig, die Bewohner <strong>zu</strong> ermuntern, auf vorsorgliche Sicherungsmaßnahmen <strong>zu</strong> verzichten. Der Erste Beigeordnete<br />
erinnerte daran, dass die Verwaltung schon bei der Bürgerinformation deutlich gemacht habe, dass die Entscheidung <strong>zu</strong>r<br />
Prophylaxe keine Zustimmung <strong>zu</strong>m Kohleabbau bedeute. Der Antrag des <strong>Stadt</strong>marketings, Gelder <strong>zu</strong>r Durchführung eines<br />
Workshops bereit<strong>zu</strong>stellen, in dem Ideen <strong>zu</strong>r Marktplatz-Aktivierung entwickelt werden sollen, fand im Ausschuss kein<br />
ermutigendes Echo. So befand Zilske, dass die Markt-Umgestaltung derzeit kein realistisches Ziel sei und eine freie, informelle<br />
Gruppe nicht über die Mittelverwendung entscheiden könne. Hans-Jürgen Wollny (Grüne) sah die Gefahr, dass die Regie bei<br />
der City-Entwicklung <strong>zu</strong> sehr in Richtung <strong>Stadt</strong>marketing abdriften könne. Dagegen gab Feltes <strong>zu</strong> bedenken, dass der Prozess<br />
des <strong>Stadt</strong>marketings ein neuer Weg sei, der angenommen werde und den man nicht sofort deckeln dürfe. <strong>Die</strong> CDU-Mehrheit<br />
beschloss, dass die Antragsteller ein konkretes Konzept vorlegen<br />
sollen. ULRICH ERNENPUTSCH<br />
NRZ Niederrhein 30.08.2001<br />
BRIEF AN DIE REDAKTION<br />
Zum Artikel "Sorgen" (Thema <strong>Berg</strong>bau) vom 29. August schreibt Matthias Jung, Pfarrer aus Voerde: Ich habe es nicht so<br />
empfunden, als hätten sich Veranstalter und Präses um eine klare Position gedrückt. Im Gegenteil: Präses Kock stellte klar,<br />
dass es sowohl auf der Seite der <strong>Berg</strong>leute und ihrer Familien als auch auf der Seite der von <strong>Berg</strong>schäden Betroffenen<br />
berechtigte Anliegen und Interessen gibt. Angesichts der öffentlichen Diskussion in den letzten Monaten <strong>hat</strong>te ich manchmal<br />
den Eindruck, als gäbe es berechtigte Interessen nur bei denen, die sich um die Sicherheit der Deiche und ihrer Häuser sorgen.<br />
Doch auch die <strong>Berg</strong>leute und ihre Familien haben ein Recht darauf <strong>zu</strong> erfahren, wie es für sie in Zukunft weitergeht. Insofern<br />
waren die Worte des Präses sowohl ein klares "Ja" für die Kumpel vor Ort als auch für die Sorgen derer, die vor <strong>Berg</strong>schäden<br />
Angst haben. (...)<br />
NRZ Rheinberg 28.08.2001<br />
Böden auf dem Prüfstand<br />
Hermann Becker ging den Folgen des <strong>Berg</strong>baus nach und erteilte Lehm, Ton und <strong>Berg</strong>ematerial keine guten Noten.<br />
RHEINBERG. Hauptberuflich ist der Rheinberger <strong>Stadt</strong>brandmeister Hermann Becker als Sachverständiger für den TÜV-<br />
Süddeutschland tätig. Baucontrolling, Qualitätssicherung, Sicherheit sowie Gesundheitskoordination sind die zentralen Themen,<br />
die ihn immer wieder kreuz und quer durch Nordrhein-Westfalen treiben. Sein Studium <strong>zu</strong>m Ingenieur im Fachbereich<br />
Grundbau absolvierte Becker an der Essener Universität. Für seine Diplomarbeit wählte er ein Thema, das für<br />
ihn nicht nur naheliegend war, sondern auch die Bürger am Niederrhein in <strong>zu</strong>nehmendem Maße bewegt. Der Budberger<br />
untersuchte die Rissbildung in Flussdeichen, die durch den untertägigen Abbau von Bodenschätzen hervorgerufen<br />
werden. Da<strong>zu</strong> studierte er sehr eingehend die vorhandenen Quellen in der Fachliteratur. Parallel da<strong>zu</strong> war er den Zerrungen<br />
und Pressungen im Bereich des Orsoyer Rheindeichs auf der Spur. "Ich habe nur geguckt, wo der <strong>Berg</strong>bau hergeht." Becker<br />
brauchte nicht lange <strong>zu</strong> suchen, da ihm der Bereich sehr vertraut ist. Schließlich ist er schon seit fünf Jahren im Vorstand des<br />
Orsoyer Deichverbands aktiv. Doch der interessanteste Aspekt seiner Diplomarbeit sind die Versuchsreihen mit verschiedenen<br />
Böden, die der dreifache Vater simulierten Zerrungen unterzog. Dabei ging er vor allem der Frage nach,<br />
ob es natürliche Stoffe gibt, die die Spannungen im Hochwasser-Schutzwall besonders gut ausgleichen können.<br />
Am Ende der Versuchsreihen konnte der Tester Kies und Sand die besten Noten erteilen, <strong>zu</strong>mal diese Stoffe auch positiv durch<br />
einen Selbstverschluss-Mechanismus aufgefallen waren, der sich gewissermaßen heilend auf Risse auswirkt. Andererseits<br />
stellte Hermann Becker fest, dass Lehm, Tone und auch Waschberge weniger geeignet sind, weil diese Stoffe eine hohe<br />
Festigkeit aufweisen und folglich nicht mit Nachgiebigkeit glänzen.<br />
<strong>Die</strong> Tatsache, dass im Orsoyer Deich auch reichlich <strong>Berg</strong>ematerial verarbeitet ist, <strong>hat</strong> Becker nicht <strong>zu</strong> seiner Diplomarbeit<br />
verleitet. Er versichert: "Ich wollte das Thema aus ingenieurtechnischer Sicht behandeln."<br />
ULRICH ERNENPUTSCH<br />
NRZ Niederrhein 28.08.2001<br />
Sorgen<br />
Ein klares "Ja" für die Kumpel vor Ort: Das trauen sich nur noch die wenigsten.<br />
MOERS. Immerhin 1000 Menschen nahmen am Montag Abend an der Veranstaltung des Arbeitskreises Kirche und <strong>Berg</strong>bau<br />
teil. Prominenter Gast: Präses Manfred Kock. Unüberhör- und sehbar: 450 Biker, die auf die Sorgen der <strong>Berg</strong>leute aufmerksam<br />
machten. Allein: So klar wie damals, im Winter 1996/97, als eine Mahnwache am Kreuz auf dem Pattberg Wind und Wetter<br />
trotzte - so klar für die Kohle in der Region bezogen diesmal die wenigsten Stellung. Schon der Titel der Veranstaltung eiert ein<br />
bisschen um die klare Position herum: "In Sorge um die Region - Zukunft nur Gemeinsam". Auch der Präses selbst predigte<br />
angesichts der bröckelnden Solidarität mit den <strong>Berg</strong>leuten in beide Richtungen: "Gegensätzliche Interessen müssen<br />
ausgeglichen werden". Also sowohl die der Kumpel, als auch die derer, die unter <strong>Berg</strong>schäden leiden müssten.<br />
Nikolaus Schneider, Superintendent des Kirchenkreises Moers <strong>zu</strong> Zeiten der Mahnwachen, brachte es auf den Punkt: "Obwohl<br />
es damals kalt war, innerlich war uns warm. Heute ist das Wetter sehr warm, aber viel kälter ist die Stimmung geworden." Er<br />
traute sich, klar <strong>zu</strong> antworten: "Energie für unser Land ist wie Blut für unseren Körper. Wir brauchen die Energiesicherheit."<br />
Vertreter beider Konfessionen aus Voerde und Spellen, die nach Moers gekommen waren, hielten dagegen: Eine Flagge mit<br />
der Aufforderung, auch an die Bewahrung der Schöpfung <strong>zu</strong> denken.<br />
NRZ Moers 28.08.2001<br />
"<strong>Die</strong> Stimmung ist sehr viel kälter geworden"<br />
Es geht um Preis und die Arbeitssicherheit. "Nicht einseitig polemisch". Ingendahl: "Sind gewohnt <strong>zu</strong> kämpfen."
AM NIEDERRHEIN. Zahlreiche Stimmen gab es am Rande des Besuchs von Manfred Kock, Präses der ev. Kirche im<br />
Rheinland. So sagte MdL Fritz Kollertz, Vorstandsmitglied der IGBCE, mit Blick auf Entscheidungen der EU-Kommission der<br />
Redaktion auf dem Pattberg: "Unsere Energieabhängigkeit in Grenzen <strong>zu</strong> halten, das geht nicht ohne die deutsche Steinkohle".<br />
Was versteht er denn unter einem "rentabel arbeitenden <strong>Berg</strong>werk"? Antwort: "Es muß die technischen Möglichkeiten haben,<br />
um unter vernünftigen Bedingungen nicht nur den Kohlepreis, sondern auch die Arbeitssicherheit<br />
<strong>zu</strong> berücksichtigen." Nikolaus Schneider, der damalige Superintendent des Kirchenkreises Moers und heutige Vize-<br />
Ratsvorsitzender der Evangelischen Kirche, sagte an der Mahnwache: "Energie für unser Land ist wie Blut für unseren Körper.<br />
Wir brauchen die Energiesicherheit." Er erinnerte an das Weihnachtsfest von 1996: "Obwohl es damals noch so kalt war,<br />
innerlich war uns warm. Heute ist das Wetter sehr warm, aber sehr viel kälter ist die Stimmung geworden". Ludger Ingendahl,<br />
BGA-Betriebsrat Friedrich-Heinrich, warnte vor den rund 1000 Zuhörern beim Thema "Rahmenbetriebspläne" davor, die Dinge<br />
nicht einseitig polemisch <strong>zu</strong> kommentieren. Problematisch sei es, für einen Ausgleich aller Interessen <strong>zu</strong> sorgen.<br />
Und da appellierte er an die Politiker, dafür <strong>zu</strong> sorgen. Doch auch die Kumpel seien gewohnt <strong>zu</strong> kämpfen. Zur Redaktion: "<strong>Die</strong><br />
Veranstaltung auf dem Pattberg war von vornherein nur für einen kleinen Kreis geplant." Auf dem Pattberg zeigten auch zwei<br />
Vertreter der evangelischen und katholischen Kirchengemeinden Voerde, Spellen, eine große Flagge mit der Aufforderung,<br />
auch an die Bewahrung der Schöpfung <strong>zu</strong> denken: "Gerade darauf wollen wir hier auf dem Pattberg aufmerksam machen!"<br />
Der Meerbecker St. Barbara-Pfarrer Bernhard Lauer, der die Idee <strong>hat</strong>te, diese neue Skulptur aus Kreuz und Schlegel <strong>zu</strong><br />
schaffen, fügte beide Teile in der Christuskirche <strong>zu</strong>sammen. Doch diese Form aus Holz war nur ein Modell. Aus<strong>zu</strong>bildende der<br />
Schachtanlage "Friedrich-Heinrich" werden aus Metallrahmen und Kupferplatten die Großform schaffen. HEINZ-LEO<br />
GARDENIER<br />
NRZ Rheinberg 28.08.2001<br />
Keine Pauschalurteile<br />
<strong>Die</strong> Grünen haben sich gegen städtische Sicherungsmaßnahmen ausgesprochen.<br />
RHEINBERG. Jürgen Bartsch, Fraktionssprecher Bündnis 90/<strong>Die</strong> Grünen, wehrt sich gegen die pauschale Aburteilung der<br />
Rheinberger Politiker, die Peter Röger in einem Leserbrief in seinen Augen vornimmt. <strong>Die</strong> Fraktion Bündnis 90/<strong>Die</strong> Grünen habe<br />
nämlich nicht für Untersuchungen plädiert, um <strong>Berg</strong>eschadenssicherungsmaßnahmen an der Grote-Gert-Schule vor<strong>zu</strong>bereiten.<br />
Vielmehr habe<br />
seine Fraktion darauf hingewiesen, dass ein solches Vorgehen einen hohen symbolischen Wert habe. <strong>Die</strong> Glaubwürdigkeit<br />
des Ratsbeschlusses, der sich gegen den Rahmenbetriebsplan des <strong>Berg</strong>werks Friedrich-Heinrich und damit gegen<br />
<strong>Berg</strong>senkungen im Bereich Annaberg ausgesprochen habe, würde durch Schadenssicherungsmaßnahmen durch die <strong>Stadt</strong><br />
untergraben. Für diese Haltung, so Bartsch, habe man keine Zustimmung gefunden, sondern musste sich Fahrlässigkeit<br />
vorwerfen lassen.<br />
NRZ Moers 27.08.2001<br />
<strong>Berg</strong>bau: Jetzt andere Zeiten ZUR SACHE<br />
Akzeptanz des Steinkohlenabbaus <strong>hat</strong> gelitten<br />
Nichts hätte deutlicher als die gestrige Veranstaltung des Arbeitskreises "Kirche und <strong>Berg</strong>bau" zeigen können, dass das<br />
Interesse der Niederrheiner am Erhalt des deutschen <strong>Berg</strong>baus doch stark gesunken ist. Wie stark war noch der Zulauf vor vier<br />
Jahren, als die Christuskirche "besetzt" worden war. Und das nicht einen Tag oder zwei Wochen lang, sondern Monate.<br />
Politiker jeglicher Parteien <strong>hat</strong>ten sich damals blicken lassen. Doch traurig <strong>zu</strong> sehen, wie sich gestern Nachmittag nur eine<br />
kleine Menschenmenge am Kreuz auf dem Pattberg blicken ließ.<br />
Ebenso auf Niederberg. <strong>Die</strong> Akzeptanz des <strong>Berg</strong>baus <strong>hat</strong> doch sehr gelitten. Pfarrer Wagener münzte das auf die Kumpel: "<strong>Die</strong><br />
Seele des <strong>Berg</strong>mannes ist beschädigt!" Dafür ließ der Geistliche Bratkus-Fünderich durchblicken: <strong>Die</strong> DSK bzw. die RAG solle<br />
nicht immer nur auf Bilanzen schauen. Wenn keine Fördermittel mehr da seien, zöge sie sich einfach <strong>zu</strong>rück. Ihre Töchterfirmen<br />
solle die Ruhrkohle doch <strong>zu</strong> Industrieansiedlungen hier vor Ort antreiben. <strong>Die</strong>ser Pfarrer <strong>hat</strong> Recht. <strong>Die</strong> Ruhrkohle kommt<br />
zwangsläufig dahin, <strong>zu</strong> überlegen, ob sie ihr gewaltiges Abbauprogramm noch weiter so betreiben will. Der Widerstand in der<br />
Bevölkerung wächst. Generell gilt es, die Auseinanderset<strong>zu</strong>ng nicht emotional <strong>zu</strong> führen. Auch die DSK muß endlich Einsicht<br />
zeigen. HEINZ-LEO GARDENIER<br />
NRZ Moers 27.08.2001<br />
Präses Kock: "Es darf keine Sieger und Besiegte geben"<br />
Rund 1000 Menschen kamen <strong>zu</strong>r Großveranstaltung des Arbeitskreises Kirche und <strong>Berg</strong>bau. Geistliche predigten auf<br />
dem Pattberg. 450 Biker nach Niederberg.<br />
KAMP-LINTFORT. <strong>Die</strong> Schachtanlage "Friedrich-Heinrich" kennt Präses Manfred Kock, der Vorsitzende des Rates der<br />
Evangelischen Kirche in Deutschland, bereits. Vor vier Jahren war er hier gewesen, um für den Erhalt der Arbeitsplätze der<br />
Kumpel ein<strong>zu</strong>treten. Gestern war es nicht anders. Bevor es mit der Veranstaltung "In Sorge um die Region - Zukunft nur<br />
Gemeinsam" losging, fuhr der Präses in 1000 Meter Tiefe hinab <strong>zu</strong>m Flöz Girondelle, um mit Kumpeln im Streckenvortrieb über<br />
die jetzige Arbeitsplatzsituation <strong>zu</strong> sprechen. Neu an der Grubenfahrt war für den Geistlichen, dass er die Transport-"<strong>Die</strong>sel-<br />
Katze" kennenlernte und damit zwei Kilometer weit durch die düstere <strong>Berg</strong>welt chauffiert wurde. Wieder ans Tageslicht<br />
<strong>zu</strong>rückgekehrt führte Kock seine Gespräche mit Vertretern der Werksleitung, des Betriebsrates und der IGBCE fort. Der<br />
ökumenische Arbeitskreis "Kirche und <strong>Berg</strong>bau" <strong>hat</strong>te dies organisiert.<br />
Dann ging es in einer Eskorte <strong>zu</strong>m Pattberg. Dort <strong>hat</strong>te vor zehn Jahren der Pattberg-Gottesdienst stattgefunden - aus Anlaß<br />
der damals ständig anhaltenden Auseinanderset<strong>zu</strong>ngen um den Fortbestand des deutschen Steinkohlenbergbaus.<br />
Musikalisch umrahmt wurde das "Gipfel-Programm" von Vorträgen des Knappenchores Rheinland und des Posaunenchores<br />
Repelen. 40 Kumpel mit IGBCE-Flaggen sowie Vertreter verschiedenster Organisationen waren im Bus hochgefahren<br />
worden. Doch waren es längst nicht so viele wie beim damaligen Gottesdienst vor zehn Jahren. Pfarrer Hans Jürgen Wagener<br />
erinnerte daran, dass seinerzeit das Kreuz auf dem Pattberg aus Sorge um die Zukunft errichtet worden sei, das sei heute nicht<br />
viel anders. Und Pfarrer Heinrich Bösing: "<strong>Die</strong>se gemeinsame Sorge um die Region <strong>hat</strong> uns <strong>zu</strong>sammengeführt. Wir bringen dies<br />
mit Blick auf Gott <strong>zu</strong>m Ausdruck als Garanten für die Würde des Menschen!" Immerhin: "<strong>Die</strong> Seele der <strong>Berg</strong>leute ist<br />
beschädigt". Pfarrer Uwe-Jens Bratkus-Fünderich forderte, die DSK bzw. RAG mit ihren vielen Firmen sollten für<br />
Industrieansiedlungen hier am linken Niederrhein sorgen.<br />
Derweil kurvten rund 450 Biker von Lintfort <strong>zu</strong>r Schachtanlage Niederberg, wo sie von relativ wenigen Menschen empfangen<br />
wurden. Schon während der Treffen auf dem Pattberg und auf Niederberg wurde jeweils ein Teil des neuen<br />
Kreuzes präsentiert, das endlich vor der Christuskirche aufgestellt werden soll. Nach dem Treff an der ehemaligen
Mahnwache ging es <strong>zu</strong>r Christuskirche. Dort sagte der Präses in seiner Predigt: "Das Dilemma ist: <strong>Die</strong> einen leben vom<br />
<strong>Berg</strong>bau und wissen, wie stark er reduziert wird. Andere leiden unter den Folgen des <strong>Berg</strong>baus.<br />
Sie erleben in ihrer Region die <strong>Berg</strong>schäden, sie fühlen sich ohnmächtig, wenn es um die Einschät<strong>zu</strong>ng der Folgen geht. Solch<br />
gegensätzliche Interessen müssen ausgeglichen werden. Es darf keine Sieger und Besiegte geben."<br />
<strong>Die</strong> Predigt wurde nach draußen übertragen. KOMMENTAR<br />
HEINZ-LEO GARDENIER<br />
NRZ Moers 26.08.2001<br />
"Jetzt kräftig in die Hände spucken!"<br />
BETRIEBSVERSAMMLUNG / Vier Monate sind täglich 16 000 Tonnen Kohle <strong>zu</strong> fördern.<br />
KAMP-LINTFORT. Produktions-Betriebsdirektor Stenmans machte in seiner Rede vor den <strong>Berg</strong>leuten klar, dass sie auf<br />
"Friedrich-Heinrich" in den kommenden restlichen vier Monaten dieses Jahres noch kräftig in die Hände spucken müssten.<br />
Täglich seien noch über 16 000 Tonnen Kohle <strong>zu</strong> fördern, um auf den Jahresdurchschnitt von 12 500 Tonnen Kohle täglich <strong>zu</strong><br />
kommen. Weitere Planungen bezüglich des neuen <strong>Berg</strong>werks West: Am 1. September wird die Abteilung Berufsbildung auf<br />
Friedrich-Heinrich <strong>zu</strong>sammengeführt, bei der Personalabteilung wurde der 1. Oktober terminiert. Ab dem 1.Januar 2002 wird es<br />
eine Werksleitung von Friedrich-Heinrich und Niederberg geben. Ziel sei es, im kommenden Jahr die Förderung auf Niederberg<br />
ein<strong>zu</strong>stellen und die Schächte bis Jahresende <strong>zu</strong> verfüllen. Ab 1.1.03 laufe dann komplett alles über Friedrich-Heinrich-<br />
Rheinland. Stand <strong>zu</strong>m neuen Rahmenbetriebsplan: Den ursprünglichen Zeitplan hätte die Bezirksregierung Arnsberg nicht<br />
eingehalten. Er sollte in diesem Sommer schon öffentlich ausgelegt werden. Stenmans: "<strong>Die</strong> Bezirksregierung sieht sich aber<br />
nicht in der Lage, die Erörterung des Rahmenbetriebsplanes Walsum und hier die öffentliche Auslegung parallel laufen <strong>zu</strong><br />
lassen. In der kommenden Woche soll deshalb nochmals ein Gespräch stattfinden. Es ist aber ungewiß, was dabei<br />
herauskommt!" Der jetzige Rahmenbetriebsplan von Friedrich-Heinrich läuft Ende 2003 aus. Bis dahin muß über den neuen<br />
entschieden sein. Stenmans sagte, beim Moerser <strong>Berg</strong>amt liege jetzt ein Antrag vor, einen <strong>zu</strong>gelassenen Betriebsplan<br />
<strong>zu</strong>rück<strong>zu</strong>nehmen: "Das <strong>Berg</strong>amt selbst wird aber nicht einen von ihm selbst <strong>zu</strong>gelassenen Betriebsplan <strong>zu</strong>rücknehmen. Der<br />
Antrag wurde weitergeleitet an die Bezirksregierung!" Betriebsratsvorsitzender Vogt machte gegenüber den <strong>Berg</strong>leuten klar,<br />
dass ein lebensfähiger Steinkohlenbergbau bis weit nach 2015 existieren müsse. Man setze auf den Energiesockel.<br />
KOMMENTAR. - HEINZ-LEO GARDENIER<br />
NRZ Moers 26.08.2001<br />
Der <strong>Berg</strong>bau und die Rentabilität<br />
Kumpel brauchen endlich Gewissheit.<br />
Der Betriebsratsvorsitzende der Schachtanlage Friedrich-Heinrich/Rheinland, Friedhelm Vogt, machte es gestern versteckt<br />
deutlich, wie die Stimmungslage bei den Kumpeln ist: "Es kamen 900 von ihnen <strong>zu</strong>r Versammlung. Das Interesse ist noch<br />
groß!" Noch! In Anbetracht der nahe<strong>zu</strong> täglich aus Brüssel auftauchenden EU-Stellungnahmen werden die <strong>Berg</strong>leute allmählich<br />
mürbe, auf die Zukunft ihres Berufes <strong>zu</strong> bauen. Fakt ist: <strong>Die</strong> <strong>Berg</strong>werke, die "unrentabel" sind, werden nur noch bis 2007<br />
gefördert werden,. Von 2007 bis 2010 haben die "rentablen" Schachtanlagen Anspruch auf EU-Förderung. Doch was heißt<br />
"rentabel", was "unrentabel?"<br />
Wenn man bedenkt, dass der Weltmarktpreis <strong>zu</strong>r Zeit bei 107,91 DM je Tonne Kohle liegt, so sind die 260<br />
DM pro Tonne deutscher Steinkohle unverhältnismäßig teuer. Wie will man da <strong>zu</strong>r Rentabilität kommen? "Rentabel"<br />
kann aber auch eine wesentliche Kostensenkung der laufenden Betriebe bedeuten, eine Verbesserung der Wirtschaftlichkeit.<br />
Doch in welchem Maße? <strong>Die</strong> <strong>Berg</strong>leute brauchen unbedingt Gewißheit, wie es weitergehen soll, ob im künftigen Energiesockel<br />
auch die deutsche Steinkohle enthalten sein wird. Hin<strong>zu</strong> kommt noch die Diskussion um die Rahmenbetriebspläne. Der Frust<br />
der Kumpel greift um sich. HEINZ-LEO GARDENIER<br />
NRZ Moers 24.08.2001<br />
"CDU: <strong>Berg</strong>bau ist kein Auslaufmodell"<br />
KAMP-LINTFORT. Zur Vorstellung und Erörterung des Rahmenbetriebsplanes der Zeche Friedrich Heinrich/<br />
Rheinland <strong>hat</strong>te die CDU ihre Mitglieder ins Knappenheim eingeladen. <strong>Berg</strong>werksdirektor Reinhard Fox ging u.a.<br />
auf die Frage des weiteren Fortbestandes dieses für die <strong>Stadt</strong> "wichtigen Wirtschaftspotentials" ein. "<strong>Die</strong> Zukunft des<br />
Steinkohlenbergbaus wird nicht in Deutschland entschieden, es ist eine europäische Entscheidung darüber, ob und wann in den<br />
deutschen Steinkohlenbergwerken die Lichter ausgehen", sagte CDU-Vorsitzender Dr. Olaf Löttgen. Er forderte ein schlüssiges<br />
Energiekonzept, in das die Kohle als nationaler Eigenenergiesockel eingebettet sei. Immer noch seien 3600 <strong>Berg</strong>leute auf<br />
Friedrich-Heinrich. Löttgen hob die persönliche Sympathie für die <strong>Berg</strong>leute hervor, die Lintforter CDU sei sich ihrer<br />
Verantwortung für die Menschen im <strong>Berg</strong>bau bewusst. Dabei erteilte der CDU-Vorsitzende all jenen eine Absage, die den<br />
<strong>Berg</strong>bau <strong>zu</strong>m Schaden auch anderer Geschäftsbereiche voreilig und unnötig bereits als "Auslaufmodell" eingestuft<br />
hätten. Das <strong>Berg</strong>werk Friedrich-Heinrich sei immer noch mit das größte Wirtschaftspotential für die <strong>Stadt</strong> und diese Region.<br />
Fox selbst erläuterte den für den weiteren Abbau erforderlichen Rahmenbetriebsplan.<br />
Er bedauerte, das der Kohleabbau nicht ohne <strong>Berg</strong>senkungen bzw. Set<strong>zu</strong>ngen und nicht ohne die dabei erforderlichen<br />
Grundwasserabsenkungen erfolgen könne. Allerdings seien auch durch geeignete Sicherungsmaßnahmen bereits im Vorfeld<br />
des Abbaus Schäden <strong>zu</strong> mindern oder gar <strong>zu</strong> vermeiden: "Wir werden von unserer Seite aus alles Mögliche tun, um die trotz<br />
dieser Vorkehrungen eintretenden Schäden so gering wie möglich <strong>zu</strong> halten." Er versprach eine rechtzeitige Information und<br />
eine schnelle sowie verbesserte Schadensregelung durch Bürgerbüros.<br />
Löttgen und Fox waren sich einig: "Nicht Abhängigkeit, sondern gegenseitiges Vertrauen und Verständnis zwischen<br />
Bürgern und ihren <strong>Berg</strong>leuten sind Vorausset<strong>zu</strong>ng für eine gemeinsame Zukunft. Wie können wir aus Europa Hilfe für diese<br />
Region erwarten, wenn wir in der Dache nicht eins sind?"<br />
NRZ Moers 24.08.2001<br />
Anwalt Kall will das <strong>Berg</strong>werk stoppen<br />
FRIEDRICH-HEINRICH / Er sagt: Abbau unter Tage verhindert den Strukturwandel. "Nutzen alle Instrumente des<br />
<strong>Berg</strong>rechts."<br />
AM NIEDERRHEIN. Der bekannte Umweltanwalt Klaus Kall will dem <strong>Berg</strong>werk Friedrich-Heinrich <strong>zu</strong> Leibe rücken.<br />
Kall bereitet nämlich gerade einen "Antrag auf Widerruf des <strong>Berg</strong>werkeigentums" vor. Was das im Klartext bedeutet, erläuterte<br />
er der Redaktion: "Wo der <strong>Berg</strong>bau sich untertägig umtreibt, verhindert er über Tage den wichtigen Strukturwandel. So lange
unten gebuddelt wird, siedeln sich oben keine <strong>zu</strong>kunftsträchtigen Firmen an", so Kall. <strong>Die</strong> öffentlichen Flächen seien <strong>zu</strong> wertvoll,<br />
als dass sie durch den <strong>Berg</strong>bau blockiert werden dürften. Zumal der <strong>Berg</strong>bau keine wirtschaftlichen Gewinne erziele.<br />
Als Beispiel nennt er Kapellen, "wo auch dreißig Jahre nach dem untertägigen Stillstand immer noch <strong>nichts</strong> geschieht", so Kall,<br />
der in Moers lebt und seine Kanzlei an der feinen Königsallee in Düsseldorf <strong>hat</strong>. Für Friedrich-Heinrich fordert er dringend eine<br />
Umweltverträglichkeitsprüfung. "Doch beim Oberbergamt <strong>hat</strong> man dafür wohl keine Kapazitäten frei, da muss erst der<br />
Rahmenbetriebsplan Walsum erledigt werden", glaubt der Anwalt, der eine große Reihe von bergbau-geschädigten Anwohnern<br />
vertritt. "Mir ist wichtig, dass man nicht erst diskutiert, wenn <strong>Berg</strong>schäden auftreten, sondern viel früher. Wir müssen uns<br />
Gedanken machen, ob wir uns die Auswirkungen des <strong>Berg</strong>baus leisten können", so Kall. Auf den Einwand der Redakion, dass<br />
auf zahlreichen Abbaugebieten sehr wohl neue Betriebe entstanden sind, meinte Kall: "Sensible Firmen, etwa<br />
aus der Hochtechnologie, würden sich auf unsicherem Terrain nicht ansiedeln. Sie müssen ja Folgeschäden befürchten.<br />
Allenfalls entstehen Büros." Kall meinte weiter: "Wir werden alle Instrumentarien des Bundesberggesetzes nutzen, um die<br />
Aktivitäten der Deutschen Steinkohle <strong>zu</strong> stoppen. Es gibt keinen wirtschaftlichen Wandel, solange der <strong>Berg</strong>bau aktiv ist."<br />
(Manfred Lachniet)<br />
NRZ Niederrhein 24.08.2001<br />
Beten oder bekämpfen: <strong>Berg</strong>bau scheidet<br />
Rechtsanwalt Kall sorgt sich um die überirdische Nut<strong>zu</strong>ng, solange unter Tage gearbeitet wird. Kirche sorgt sich um<br />
Kumpel.<br />
KAMP-LINTFORT. Ehrgeizige Pläne verfolgt Rechtsanwalt Klaus Kall. Der Vertreter vieler <strong>Berg</strong>baugeschädigter bereitet einen<br />
Antrag auf Widerruf des <strong>Berg</strong>werkeigentums vor. <strong>Die</strong> Idee dahinter: Überall dort, wo der <strong>Berg</strong>bau unter Tage buddelt, siedelten<br />
sich überirdisch keine <strong>zu</strong>kunftsträchtigen Firmen an. Der <strong>Berg</strong>bau blockiere damit den Strukturwandel. Als Beispiel nennt er<br />
Kapellen.<br />
Dort würde selbst 30 Jahre nach Stillstand der Arbeiten <strong>nichts</strong> geschehen. "Wir müssen uns Gedanken machen, ob wir uns die<br />
Auswirkungen des <strong>Berg</strong>baus leisten können", sagt Kall. Und fordert für das Werk Friedrich-Heinrich eine<br />
Umweltverträglichkeitsprüfung.<br />
Andere Sorgen <strong>hat</strong> die Kirche. Vor zehn Jahren beteten Gläubige auf dem Pattberg in Repelen für den Erhalt der Arbeitsplätze,<br />
am kommenden Montag erinnert der Arbeitskreis Kirche und <strong>Berg</strong>bau daran, dass die Probleme der Region aktuell sind.<br />
Um 17.30 Uhr maschieren Gläubige auf den Pattberg, zeitgleich gedenkt eine Gruppe auf dem Parkplatz Niederberg<br />
an den Arbeitskampf der Kumpel. Um 19 Uhr heißt es "Hand in Hand" <strong>zu</strong>r Christuskirche. Dort hält Manfred Kock,<br />
Ratsvorsitzender der ev. Kirche in Deutschland, die Predigt im ökumenischen Gemeinschaftsgottesdienst.<br />
NRZ Moers 24.08.2001<br />
VOR DEM PRÄSES-BESUCH Gemeinsam nachdenken über die Zukunft<br />
PATTBERG-<br />
GOTTESDIENST / "In Sorge um die Region". Gespräch mit Pfarrer Ziebuhr.<br />
KAMP-LINTFORT. Zehn Jahre ist es her. Damals kamen Tausende aus Sorge um den Fortbestand des <strong>Berg</strong>baus <strong>zu</strong>m Moerser<br />
Pattberg. Zum Solidaritäts-Gottesdienst der evangelischen Kirche. Aus Anlass des 10. Jahrestages und aufgrund des ständig<br />
anhaltenden Streits um die Zukunft des Steinkohlebergbaus besucht Manfred Kock, Präsident der evangelischen Kirche im<br />
Rheinland, nun am Montag, 27. August, die Kumpels am Niederrhein.<br />
Nach der Grubenfahrt im Friedrich-Heinrich-<strong>Berg</strong>werk steigt in der Christuskirche Kamp-Lintfort ein Gottesdienst mit dem Titel<br />
"In Sorge um die Region". Michael Ziebuhr ist Gemeindepfarrer in Kamp-Lintfort. Und <strong>hat</strong> diesen Gottesdienst mitorganisiert.<br />
Der 44-Jährige verspricht sich sehr viel davon: "Wir wollen an diesem Tag gemeinsam über die Zukunft nachdenken", sagt der<br />
Geistliche in beruhigendem Tonfall. "Und versuchen, das Verständnis zwischen den Gegnern und den Befürwortern des<br />
Steinkohleabbaus ein wenig <strong>zu</strong> fördern. Schließlich ist es ein Part unserer Kirche, mit den Menschen <strong>zu</strong> reden und sie<br />
<strong>zu</strong>sammen <strong>zu</strong> fügen."<br />
Seelsorger knüpft die Kontakte<br />
Pfarrer Ziebuhr und die Gemeinde Kamp-Lintfort fanden vor etwa fünfeinhalb Jahren <strong>zu</strong>sammen. Seitdem ist der gebürtige<br />
Essener mit Verwaltungsangelegenheiten beschäftigt und als Seelsorger tätig. Vor allem bei den gebeutelten <strong>Berg</strong>leuten.<br />
Jedoch nicht, dies betont er, im therapeutischen Sinne: "<strong>Die</strong> Männer rufen nicht bei mir an und erzählen mir von ihren Nöten<br />
und Ängsten. Ich knüpfe vielmehr bei anderen Gelegenheiten wie Kindstaufen oder Hochzeiten Kontakte <strong>zu</strong> den Kumpels.<br />
Man kommt ins Gespräch, sieht sich hin und wieder auf der Straße, begleitet sich gegenseitig in gewisser Weise." Nicht nur,<br />
weil seine Frau Barbara den Namen der <strong>Berg</strong>arbeiter-Schutzheiligen trägt, ist Michael Ziebuhr für diese Aufgabe prädestiniert.<br />
Weil er eine ganz andere Beziehung <strong>zu</strong>r Arbeitswelt <strong>hat</strong>, als viele seiner Kollegen. Bevor er das Theologiestudium in Angriff<br />
nahm, absolvierte der jetzige Gottesmann nämlich eine kaufmännische Ausbildung in der Stahlindustrie. Sein Vater war sogar<br />
unter Tage beschäftigt, musste sich aber während der ersten großen Krise im <strong>Berg</strong>bau<br />
1967 nach einem neuen Job umschauen. "Ich habe den Strukturwandel in unserer Region so<strong>zu</strong>sagen am eigenen Leib<br />
erfahren", erinnert sich Ziebuhr.<br />
Apropos Strukturwandel. Den betrachtet der evangelische Pfarrer mit gemischten Gefühlen. Ziebuhr: "Einerseits gehen dadurch<br />
viele Arbeitsplätze verloren, auf der anderen Seite werden neue geschaffen. Doch die Arbeit an sich und die Einstellung ändert<br />
sich. <strong>Berg</strong>leute haben sich immer mit ihrem Job hundertprozentig identifiziert, nach dem Motto ich gehe <strong>zu</strong>r Hütte. So etwas ist<br />
in einer Firma wie Siemens nicht mehr vorstellbar. <strong>Die</strong>s passt eben <strong>zu</strong> unserer Ex-und-Hopp-Gesellschaft." "Kumpel" Ziebuhr<br />
ist indes jemand, der sich mit seiner Tätigkeit völlig identizifiert. "Es ist oft sehr stressig", gesteht er, "aber auch sehr spannend,<br />
weil jeder Tag unterschiedlich verläuft. Ich treffe viele Menschen, <strong>Berg</strong>leute oder Personen aus anderen sozialen Schichten. Mir<br />
macht das Arbeiten mit Menschen eben viel Freude." STEPHAN WAPPNER<br />
NRZ Moers 24.08.2001<br />
Gegen neue Rahmenbetriebspläne<br />
MOERS. Nach Ansicht der Moerser FDP-<strong>Stadt</strong>verband-Vorsitzenden Heidelinde Heller benötigt der <strong>Berg</strong>bau keine neuen<br />
Rahmenbetriebspläne mehr, die eine Laufzeit von 20 Jahren und länger in die Zukunft haben: "In 20 Jahren werden alle<br />
<strong>Berg</strong>leute einer Tätigkeit nachgehen, die mit Kohle <strong>nichts</strong> mehr, und mit <strong>Berg</strong>bau eventuell auf einer anderen Ebene <strong>zu</strong> tun <strong>hat</strong>."<br />
<strong>Die</strong> FDP Moers fordert ebenso wie die FDP-Landtagsfraktion seit langem, dass die Subventionen für die Kohle in den<br />
Strukturwandel am Niederrhein fließen müßten, damit die Menschen eine Zukunft haben. "Wir müssen damit aufhören, den<br />
Rhein <strong>zu</strong> untergraben und damit das Leben und Eigentum der Menschen am Niederrhein in höchstem Maße <strong>zu</strong> gefährden."
NRZ Niederrhein 24.08.2001<br />
Gebührenbescheide rechtswidrig<br />
AM NIEDERRHEIN. Niederlage des Deichstuhls des Deichverbandes Mehrum vor dem Verwaltungsgericht Düsseldorf. <strong>Die</strong><br />
Kammer stellte <strong>zu</strong> vier Musterklagen von Deichverbandsmitgliedern fest, dass die Gebührenveranlagungen rechtswidrig<br />
seien: keine Ermächtigungsgrundlage. <strong>Die</strong> Ermittlung korrekter Beiträge sei jeder Kontrolle entzogen worden.<br />
Beiträge für Normalmitglieder seien nach Einheitswert ermittelt worden, für Unternehmen oder öffentliche Einrichtungen nach<br />
Schät<strong>zu</strong>ng. Deichbau, der nur dem <strong>Berg</strong>bau diene, sei nicht umlagefähig auf Zwangsmitglieder des Deichverbandes.<br />
Rheinische Post, Rheinberg 23.8.2001<br />
Deichbruch-Szenario:<br />
Meterhoch unter Wasser<br />
RHEINBERG / ALPEN / XANTEN (RP). Klartext spricht die Fraktion der Rheinberger Bündnisgrünen: "<strong>Die</strong><br />
Deutsche Steinkohle soll die Rahmenbetriebspläne für die <strong>Berg</strong>werke Walsum und West <strong>zu</strong>rückziehen."<br />
Stattdessen sollen die Kohle-Schürfer zeitlich wesentlich begrenztere Neuplanungen vorlegen, "die die für<br />
Mensch und Natur gefährlichen Bereiche wie Wohngebiete, Deiche und Industrieflächen ausklammern."<br />
Grüne: <strong>Berg</strong>bau soll Pläne ändern<br />
Das unterstrich gestern Abend Fraktionssprecher Jürgen Bartsch gegenüber der RP. Das Anliegen der Grünen:<br />
Der <strong>Berg</strong>bau solle das Gefährdungspotenzial nicht noch vergrößern, das durch den gerade bekannt gewordenen<br />
Abschlussbericht der RWTH Aachen deutlich werde. Anhand einer hydrodynamischen Simulation seien dabei<br />
neun mögliche Deichbruchszenarien von Friemersheim bis nach Xanten untersucht worden.<br />
Bartsch fasst <strong>zu</strong>sammen: "<strong>Die</strong> Auswirkungen für Mensch und Natur wären weitreichend und verheerend,<br />
insbesondere bei Deichbrüchen südlich und nördlich von Orsoy." Große Flächen entlang des Rheins bis Alpen<br />
oder sogar westlich von Kamp-Lintfort würden meterhoch unter Wasser stehen. Bartsch nach Einblick ins<br />
Gutachten: "In Rheinberg blieben allein Teile des Annabergs und Millingen vom Hochwasser verschont."<br />
Dabei berücksichtige diese Simulation nicht die künftigen <strong>Berg</strong>senkungen von z.B. fünf Metern am Annaberg. "Im<br />
Katastrophenfall würde bei Verwirklichung der Abbaupläne unter diesem <strong>Stadt</strong>teil möglicherweise auch dort kein<br />
Schutz vor den Fluten mehr <strong>zu</strong> finden sein", fürchtet der Fraktionssprecher.<br />
Von RAINER KAUSSEN<br />
NRZ Moers 21.08.2001<br />
Sieben Windräder sollen noch in diesem Jahr Strom produzieren<br />
Schon Anfang November sollen sich die Rotoren im Bereich von Kengen erstmals drehen. Geschäftsführer wirbt um<br />
Investoren und stellt eine gute Rendite für das Kapital in Aussicht.<br />
RHEURDT. "Noch in diesem Jahr sollen die Windkraftanlagen Strom liefern." Das kündigte gestern Klaus Schulze Langenhorst<br />
an. Der 34-Jährige, der sich selbst als Initiator bezeichnet, gab den Zeitplan für die Kengener Region vor: Noch im August<br />
beginnt eine Straelener Firma mit den "Zuwegungen", dann folgen die Fundamente . Danach werden die Kabel verlegt. Ende<br />
Oktober bringen Tieflader die Windräder, die bis Anfang November stehen sollen. "<strong>Die</strong> Anlagen werden für die Nachbarn<br />
geräuschmäßig keine Belästigung verursachen, ist Schulze Langenhorst überzeugt. <strong>Die</strong> Optik sei, räumt er ein,<br />
Geschmackssache. Man könne<br />
es "nicht allen recht machen". Es gebe aber auch Rheurdter, die sich auf die Windräder freuten, auch unter denen, die davon<br />
finanziell nicht profitierten.<br />
<strong>Die</strong>se Bürger machten sich aber eben nicht in den Bürgerversammlungen Luft oder schrieben meist keine Leserbriefe. Für die<br />
Windkraftanlage will Schulze Langenhorst am 29. August ab 19 Uhr in der Gaststätte Winters werben. Dann sucht er<br />
Investoren, die sich mit Beträgen ab 6000 Euro beteiligen wollen. Er muss in der Gemeinde oder anderswo 6 Millionen Mark<br />
<strong>zu</strong>sammenbekommen. Das Investitionsvolumen einschließlich Fremdkapital beträgt 22,5 Millionen Mark. In Rheurdt rechnet er<br />
mit 40 bis 50 Investoren.<br />
Im Prospekt, der für die Anlage wirbt, stellt er eine Verzinsung von 8 bis 10 Prozent in Aussicht. Mehr, als <strong>zu</strong>r Zeit mit vielen<br />
anderen Kapitalanlagen <strong>zu</strong> erreichen ist. Dafür sei das Risiko eben auch etwas höher. Denn man müsse sehen, wie<br />
reparaturaufwendig die Windkraftanlagen seien. Es werde mit einer Betriebsdauer von 30 Jahren kalkuliert, seine Rechnung<br />
basiere vorsichtiger auf 20 Jahren. Für die Wartung der Anlagen sei die Arbeitskraft von etwa zwei Personen nötig, die dann<br />
allerdings auch andere Windräder betreuten. Klaus Schulze Langenhorst, geprüfter Landwirt, <strong>hat</strong> schon vor fünf Jahren auf dem<br />
eigenen Gladbecker Betrieb Windkraftanlagen aufgestellt. Er hält den Betrag von 17,8 Pfennig, den er je Kilowattstunde erhält,<br />
für angemessen. "Außer der Förderung für die Anlagen gibt es keine Billigkredite. Wenn man berücksichtigt, das<br />
beim Kohlestrom die Subventionen für den <strong>Berg</strong>bau und das Geld für <strong>Berg</strong>schäden nicht im Preis drin sind, wenn man beim<br />
Atomstrom bedenkt, wie teuer dieser bei ausreichenden Versicherungssummen wäre, wenn man weiß, das es für<br />
Photovoltaikstrom 99 Pfennig je Kilowattstunde gibt, ist der Preis für Windenergie angemessen."<br />
NORBERT KÖPPERN<br />
NRZ Rheinberg 21.08.2001<br />
BRIEFE AN DIE REDAKTION<br />
Klare Absage an ein Annatal<br />
Dass der <strong>Berg</strong>bau seine Planung bezüglich des Abbaus unter Annaberg beschleunigen möchte, ist verständlich. Dass er durch<br />
eigene Gutachter den Hausbesitzern am Annaberg Analysen anbietet, um so genannte "Prophylaxe-Maßnahmen" noch vor der<br />
Genehmigung eines Rahmenbetriebsplans durchführen <strong>zu</strong> können, ist anrüchig, aber in Anbetracht der Tatsache, dass den
<strong>Berg</strong>bau zeitlich der Schuh drückt, ebenfalls noch verständlich. Dass jedoch die Betroffenen im Gebiet Annaberg mehrheitlich<br />
diesem unfrommen Wunsch keine Unterstüt<strong>zu</strong>ng geben wollen, ist bei einer Informationsveranstaltung der DSK im April in der<br />
Niederrhein-Messe klar geworden. <strong>Die</strong> überwiegende Anzahl der Teilnehmer aus dem Gebiet Annaberg wollen erstmal das<br />
Erörterungs- und Genehmigungsverfahren (frühesten im nächsten Jahr beginnend) abwarten, um dann - nach eventueller<br />
Genehmigung - die Beurteilung, welche "prophylaktischen Maßnahmen" an den Gebäuden vorgenommen werden sollen, einem<br />
neutralen Gutachter <strong>zu</strong> überlassen. Überflüssig <strong>zu</strong> sagen , dass in besagter Infoveranstaltung den Plänen des <strong>Berg</strong>baus, den<br />
Annaberg durch Absenkungen um bis <strong>zu</strong> 5,5 Meter <strong>zu</strong>m Annatal <strong>zu</strong> machen, eine klare Absage erteilt wurde. Eile ist daher bei<br />
den Betroffenen nicht das Gebot der Stunde. Nahm man bei dieser Informationsveranstaltung die<br />
große Zurückhaltung der Rheinberger Verwaltung (Bürgermeisterin Ute Schreyer und technischer Dezernent Klaus-<strong>Die</strong>ter<br />
Henne) noch erstaunt <strong>zu</strong>r Kenntnis, so wird jetzt nach den schon durchgeführten "prophylaktischen Maßnahmen" an der Grote-<br />
Gert-Schule klar: <strong>Die</strong> Verwaltung Rheinbergs sieht sich wohl gar nicht an der Spitze der Bürgerinnen und Bürger des<br />
Annabergs, um den drohenden <strong>Berg</strong>-Schaden von diesen ab<strong>zu</strong>wenden, sondern sie sieht sich vermutlich in erster Linie in der<br />
Verantwortung, dem <strong>Berg</strong>bau die Steine aus dem Weg <strong>zu</strong> räumen. Das allerdings ist nicht im Sinne des Wählerauftrages, der<br />
verlangt, dass die Verwaltung Schaden von der <strong>Stadt</strong> und ihren Bürgerinnen und Bürgern abwenden soll. <strong>Die</strong><br />
Bürgerinnen/Wählerinnen und Bürger/Wähler werden es der Verwaltung eines Tages <strong>zu</strong> danken wissen.<br />
NRZ Rheinberg 21.08.2001<br />
Bezirksregierung sucht Halle für Planerörterung<br />
AM NIEDERRHEIN. Bis nach den Sommerferien ist die Erörterung <strong>zu</strong>m Rahmenbetriebsplan des <strong>Berg</strong>werks Walsum<br />
bekanntlich unterbrochen worden. Wie es aussieht, werden die Kontrahenten noch einige Zeit über den Akten brüten können.<br />
Derzeit ist nicht absehbar, wann es weitergeht. Das Problem ist der Tagungsort, betonte Siegfried Uwe Behrendt, der Sprecher<br />
der Abteilung <strong>Berg</strong>bau und Energie in der <strong>zu</strong>ständigen Bezirksregierung Arnsberg. Gesucht wird eine Halle, die über einen<br />
längeren Zeitraum, vor allem aber ohne Unterbrechung, gemietet werden kann. "Es nutzt <strong>nichts</strong>", so unterstrich<br />
Behrendt, "wenn wir nach Tagen alles wieder abbauen müssen, um es dann wieder auf<strong>zu</strong>bauen."<br />
Halle sollte nah am betroffenen Gebiet liegen<br />
<strong>Die</strong> Suche wurde inzwischen auf das ganze Ruhrgebiet und darüber hinaus ausgedehnt. Das ist laut Behrendt durchaus<br />
wörtlich <strong>zu</strong> nehmen. "Wir haben im Westen an der niederländischen Grenze angefangen und in Dortmund aufgehört." Bisher<br />
ohne Erfolg. Wobei Behrendt allerdings einräumt, dass es sinnvoller wäre, den Ort der Erörterung möglichst nah an die<br />
betroffenen Gebiete um Walsum, Dinslaken, Rheinberg und Voerde herum <strong>zu</strong> legen. Nur: "Das Ganze gestaltet sich schwierig."<br />
In diesem Monat werde es auf keinen Fall weiter gehen, wahrscheinlich nicht einmal vor Mitte September, da der Fortgang der<br />
Erörterung schließlich umfänglich angekündigt werden müsse, wenn denn eine Halle gefunden ist. (put)<br />
NRZ Rheinhausen 21.08.2001<br />
Kirche sorgt sich um Region<br />
Montag lädt der Arbeitskreis "Kirche und <strong>Berg</strong>bau" <strong>zu</strong>m Aktionstag.<br />
Viele werden sich noch an den Gottesdienst vor zehn Jahren auf dem Pattberg in Repelen erinnern, als die schwierigen Zeiten<br />
im <strong>Berg</strong>bau auf einen Höhepunkt nach dem anderen <strong>zu</strong>steuerten und die Kumpel, auch am linken Niederrhein, um ihren<br />
Arbeitsplatz bangen mussten. Tausende von Menschen kamen damals <strong>zu</strong>sammen. Kämpften um den Erhalt ihrer Jobs. Daran<br />
will der Arbeitskreis "Kirche und <strong>Berg</strong>bau" erinnern und veranstaltet "aus Sorge um die Region" am Montag, 27. August, einen<br />
Aktionstag . "Es ist keine Revival-Veranstaltung", sagt Pfarrer Jürgen Widera, "sondern uns geht es auch um die Fragen. Was<br />
ist in diesen zehn Jahren passiert? Was wird aus uns?" Um 17.30 Uhr ist Start: Dann geht’s <strong>zu</strong>nächst <strong>zu</strong>m Pattberg, auf dem an<br />
den Gottesdienst vor zehn Jahren erinnert wird. Zeitgleich wird auf dem Parkplatz der Zeche Niederberg an den Arbeitskampf<br />
der Kumpel gedacht. Beide Gruppen, die vom Pattberg und die von Niederberg, treffen sich um 18.30 Uhr an der ehemaligen<br />
Mahnwache am Kamp-Lintforter <strong>Stadt</strong>platz. Um 19 Uhr heißt es dann: "Hand in Hand" <strong>zu</strong>r Christuskirche gehen, wo um 19.30<br />
Uhr unter dem Motto "Zukunft nur Gemeinsam" ein ökumenischer Solidaritätsgottesdienst stattfinden wird. <strong>Die</strong> Predigt hält<br />
Manfred Kock, Ratsvorsitzender der Evangelischen Kirche in Deutschland. <strong>Die</strong> Musik kommt von Virus D., Lightning Souls und<br />
dem Ruanda-Chor.<br />
Im Anschluss daran wird eine Ausstellung präsentiert, es gibt ein Musikprogramm und Imbiss. Zu einer Extra-Aktion<br />
werden die Motorradfahrer eingeladen: Sie starten mit ihren Maschinen von Kamp-Lintfort nach Niederberg, fahren dann <strong>zu</strong>m<br />
Pattberg und <strong>zu</strong>rück in die <strong>Berg</strong>baustadt. Der katholische Pfarrer Bernhard Lauer aus Meerbeck <strong>hat</strong>te die Idee <strong>zu</strong>m Bau einer<br />
Skulptur: Sie wird hergestellt aus dem Symbol der Christenheit, dem Kreuz, verbunden mit dem Hammer als Symbol für den<br />
<strong>Berg</strong>bau. A<strong>zu</strong>bis von "Friedrich-Heinrich/Rheinland" setzen dieses Kunstwerk aus einem Metallrahmen und Kupferplatten<br />
<strong>zu</strong>sammen. Es findet seinen Platz vor der Kamp-Lintforter Christuskirche.<br />
IGBCE-Bezirksleiter Woller hob hervor, dass auch die Kirchen beim Kampf der <strong>Berg</strong>leute eine große Rolle gespielt haben: "Sie<br />
haben da<strong>zu</strong> beigetragen, dass die Jobs Bestand haben." HEINZ-LEO GARDENIER<br />
Rheinische Post, Moers/Kamp-Lintfort 21.8.2001<br />
Gedenkgottesdienst zehn Jahre nach dem Pattberg - <strong>zu</strong>m Start der Rahmenbetriebsplan-Debatte<br />
Präses mit Hammer und Schlegel<br />
MOERS/KAMP-LINTFORT (RP). Pünktlich <strong>zu</strong>m für diesen Herbst geplanten Erörterungsbeginn des umstrittenen<br />
Rahmenbetriebsplans für das <strong>Berg</strong>werk Friedrich Heinrich plant ein Arbeitskreis "Kirche und <strong>Berg</strong>bau" mit der<br />
Kohle-Gewerkschaft IGBCE, <strong>Berg</strong>werksbeschäftigten und direkter DSK-Unterstüt<strong>zu</strong>ng für den kommenden<br />
Montag eine "Gedenkveranstaltung" <strong>zu</strong>m zehnten Jahrestag des Pattberggottesdienstes 1991. Prominentester<br />
Teilnehmer: Manfred Kock, Präses der evangelischen Kirche im Rheinland und Ratsvorsitzender der<br />
evangelischen Kirche Deutschlands.<br />
<strong>Die</strong> Organisatoren bestreiten den Zusammenhang <strong>zu</strong>r aktuellen Diskussion um die Zechen-Pläne - und sprechen<br />
von einem Zeichen gegen eine "entsolidarisierte Gesellschaft". Heute wie damals soll die Veranstaltung unter<br />
dem Titel "In Sorge um die Region" stehen. Der Pattberg, an dem es vor zehn Jahren um das letzte Moerser
<strong>Berg</strong>werk ging, kommt in der machtvollen und ganz auf den Kamp-Lintforter Pütt ausgerichteten Demonstration<br />
nur am Rande vor.<br />
Dort wie auf dem Parkplatz der Zeche Niederberg soll es kurze Andachten geben, Kock soll von Neukirchen-<br />
Vluyn, nicht von Moers aus mit symbolträchtigem Gepäck nach Kamp-Lintfort starten. Aus einem monumentalen<br />
Hammer und einem Schlegel soll vor der Kamp-Lintforter Christus-Kirche im Sc<strong>hat</strong>ten des <strong>Berg</strong>werks eine Kreuz-<br />
Skulptur <strong>zu</strong>sammengesetzt werden, in der der Schlegel das Kreuz stützt. Das 2,7 Meter große Monument wird<br />
von den Aus<strong>zu</strong>bildenden der Zeche aus Kupferblech in einem Metallrahmen <strong>zu</strong>sammen gebaut. Motorradfahrer<br />
aus der Region sollen Kock als Eskorte nach Kamp-Lintfort bringen.<br />
Für die IGBCE lässt Wilfried Wollner keinen Zweifel daran, wie er das Verhältnis <strong>zu</strong> den Kirchen sieht: "Das ist<br />
eine Ehe, die wir eingegangen sind, um für die Menschen <strong>zu</strong> kämpfen." Für die IGBCE schließt das den<br />
Rahmenbetriebsplan ein. Wollner: "Aber sicher. Und wir wollen nicht nur einmal gemeinsam da stehen." <strong>Die</strong> klare<br />
Zuordnung scheuen die beteiligten Pfarrer: "Wir sehen das nicht als Vorausentscheidung für eine Position <strong>zu</strong>m<br />
Rahmenbetriebsplan, die Kirche wird keine einheitliche Position haben", meint der Pfarrer der Christus-Kirche,<br />
Michael Ziebuhr.<br />
Für das katholische Dekanat Moers tut sich sein Asberger Dechant Achim Klaschka nicht leichter. Selbst in der<br />
Zechensiedlung aufgewachsen, der Vater unter Tage beschäftigt, befindet der Priester: "Kirche und <strong>Berg</strong>leute,<br />
das ist ein Verhältnis von der Tradition für die Zukunft: Seite an Seite." Pfarrer Jürgen Widera vom evangelischen<br />
"Kirchlichen <strong>Die</strong>nst in der Arbeitswelt" vollendet den Spagat: Für die Arbeitsplätze brauche es den Rahmenplan,<br />
aber im Einklang mit den Ansprüchen der Natur. ULLI TÜCKMANTEL<br />
NRZ Moers 20.08.2001<br />
Aus Sorge um die Region<br />
AKTION NÄCHSTEN MONTAG / Gottesdienst mit Manfred Kock.<br />
KAMP-LINTFORT. Viele werden sich noch an den Gottesdienst vor zehn Jahren auf dem Pattberg in Repelen erinnern, als die<br />
schwierigen Zeiten im <strong>Berg</strong>bau auf einen Höhepunkt nach dem anderen <strong>zu</strong>steuerten und die <strong>Berg</strong>leute, auch hier am linken<br />
Niederrhein, Angst um um ihren Arbeitsplatz haben mußten. Damals kamen tausende von Menschen <strong>zu</strong>sammen, die um den<br />
Erhalt der Jobs kämpften. Genau daran will der Arbeitskreis "Kirche und <strong>Berg</strong>bau" jetzt erinnern und veranstaltet "aus Sorge um<br />
die Region" am kommenden Montag, 27. August, einen Aktionstag . "Es ist dies keine Revival-Veranstaltung", sagte gestern<br />
Pfarrer Jürgen Widera, "sondern uns geht es auch um die Fragen. Was ist in diesen zehn Jahren passiert? Was wird aus uns?"<br />
Um 17.30 Uhr ist Start: Dann gehts <strong>zu</strong>nächst <strong>zu</strong>m Pattberg, auf dem an den Gottesdienst vor zehn Jahren erinnert wird.<br />
Zeitgleich wird auf dem Parkplatz Niederberg an den Arbeitskampf der Kumpel gedacht. Beide Gruppen, die vom Pattberg und<br />
die von Niederberg, treffen sich dann um 18.30 Uhr an der ehemaligen Mahnwache am <strong>Stadt</strong>platz (vor dem Realkaufhaus). Um<br />
19 Uhr heißt es dann: "Hand in Hand" <strong>zu</strong>r Christuskirche gehen, wo um 19.30 Uhr unter dem Motto "Zukunft nur Gemeinsam"<br />
ein ökumenischer Solidaritätsgottesdienst stattfindet. <strong>Die</strong> Predigt hält Manfred Kock, Ratsvorsitzender der Evangelischen Kirche<br />
in Deutschland. <strong>Die</strong> Musik kommt von Virus D, Lightning Souls und dem Ruanda-Chor. Im Anschluss daran wird eine<br />
Ausstellung präsentiert, es gibt ein Musikprogramm und Imbiss. Zu einer Extra-Aktion werden die Motorradfahrer eingeladen:<br />
Sie starten mit ihren Maschinen von Kamp-Lintfort nach Niederberg, fahren dann <strong>zu</strong>m Pattberg und <strong>zu</strong>rück in die <strong>Berg</strong>baustadt.<br />
Der Meerbecker Pfarrer Lauer <strong>hat</strong>te die Idee <strong>zu</strong>m Bau einer Skulptur: Sie wird hergestellt aus dem Symbol der Christenheit,<br />
dem Kreuz, verbunden mit dem Hammer als Symbol für den <strong>Berg</strong>bau. A<strong>zu</strong>bis von "Friedrich-Heinrich" setzen dieses Kunstwerk<br />
aus einem Metallrahmen und Kupferplatten <strong>zu</strong>sammen. Es findet seinen Platz vor der Christuskirche. IGBCE-Bezirksleiter<br />
Woller hob hervor, dass u.a. die Kirchen eine Rolle beim Kampf der <strong>Berg</strong>leute gespielt haben: "Sie haben da<strong>zu</strong> beigetragen,<br />
dass die Jobs Bestand haben". SIEHE KOMMENTAR<br />
HEINZ-LEO GARDENIER<br />
NRZ Moers 20.08.2001<br />
BRIEFE AN DIE REDAKTION<br />
<strong>Berg</strong>werk ist keine Autofabrik<br />
Wer schützt uns vor solchen Politikern? Unglaublich, wie sich die Landrätin Frau Amend-Glantschnig und Herr Terwische von<br />
der FDP verhalten. <strong>Die</strong> Landrätin tut so, als sei sie nicht über die Dinge <strong>zu</strong>m Rahmenbetriebsplan des <strong>Berg</strong>werkes Friedrich<br />
Heinrich/Rheinland und den Planungen des <strong>zu</strong>künftigen <strong>Berg</strong>werks West informiert.<br />
Und Herr Terwische macht wieder einmal deutlich, dass der FDP sämtliche Sachkompetenz fehlt. Frau Amend-Glantschnig<br />
leidet wahrscheinlich an der "Kohlkrankkeit" des Vergessens, oder warum kann sie sich nicht an Informationsgesprächen<br />
mit Herrn Fox erinnern. Mit ihr <strong>hat</strong> mehr als ein Gespräch stattgefunden. Auch bei ihrer Grubenfahrt auf Friedrich<br />
Heinrich wurden alle Fragen erörtert. <strong>Die</strong> Informations- und Wanderausstellung, die der Öffentlichkeit Informationen geben,<br />
wurde der Landrätin vorgestellt und erläutert.<br />
Auch andere Äußerungen von der Landrätin sind nicht nachvollziehbar. Zum Beispiel warum die <strong>Berg</strong>werke Walsum und<br />
Friedrich Heinrich eigenständige Rahmenbetriebspläne einreichen. Frau Amend-Glantschnig, auch das wurde erklärt, und als<br />
Rechtsanwältin müßten Sie eigentlich Gesetzbücher lesen und verstehen können. Warum die eingereichten<br />
Rahmenbetriebspläne eine lange Laufzeit haben müssen, auch das ist erklärbar. Der Rahmenbetriebsplan Friedrich Heinrich ist<br />
fast zehn Jahre in Arbeit.<br />
Der <strong>Berg</strong>bau ist keine Autofabrik. Selbst die Entwicklung eines PKW dauert zwei bis drei Jahre. Herr Terwische beweist mit<br />
seinen Äußerungen, wie sachkundig er und die FDP sind. Sonst würde er nicht von einem Durchschnittsalter von 33 Jahren<br />
reden und wie wichtig die Facharbeiter aus dem <strong>Berg</strong>bau für den Markt sind. Erstens, dass Durchschnittsalter der Beschäftigten<br />
im <strong>Berg</strong>bau liegt schon fast bei 40 Jahren. Denn der Belegschaftsanpassungsprozess führte da<strong>zu</strong>, dass die jungen Mitarbeiter<br />
den <strong>Berg</strong>bau verlassen werden und schon weitestgehend den <strong>Berg</strong>bau verlassen haben. Zweitens, die Facharbeiter werden am<br />
Markt gebraucht. Dann bitte schön auch Arbeitsplätze für die Mitarbeiter ab oder über 40 Jahre. Fragen sie doch mal die<br />
Kollegen, die sich in anderen Unternehmen beworben haben "warum sie abgelehnt worden sind".<br />
Also, Frau Landrätin und Herr Terwische, es ist leicht sich einfach aus Gesprächen aus<strong>zu</strong>klinken. Aber Sie beide haben eine<br />
besondere Verantwortung für alle Betroffenen. Nehmen Sie ihre Aufgaben im Sinne aller Betroffenen wahr. Sorgen Sie für eine<br />
sachliche Diskussion. Zeigen Sie, das Sie es Wert sind in solche Ämter gewählt worden <strong>zu</strong> sein.
NRZ Moers 20.08.2001<br />
Kirche in einem Boot mit Kumpeln<br />
10 Jahre nach dem Pattberggottesdienst<br />
Wir alle wissen noch, wie 1991 die Rufe nach Subventionskür<strong>zu</strong>ngen im <strong>Berg</strong>bau immer lauter wurden. Gerade die FDP stellte<br />
lautstark Forderungen nach Kür<strong>zu</strong>ngen auf. In der Folgezeit mussten die Kumpel immer wieder um den Erhalt ihrer<br />
Arbeitsplätze fürchten. Immer größer wurde die Bedrohung. Zechen wurden geschlossen, die Belegschaften radikal<br />
runtergefahren. Höhepunkt war seinerzeit das Solidaritätsband, das vom Niederrhein bis tief ins Ruhrgebiet von tausenden von<br />
Menschen geknüpft wurde. <strong>Die</strong> NRZ rief die große Aktion "Kinder malen für Kumpel" ins Leben, die mit einer Riesenausstellung<br />
in der Lohnhalle von Friedrich-Heinrich und der Teilnahme zahlreicher Politiker, an der Spitze der Ministerpräsident, ihren<br />
Höhepunkt fand. In diesen unruhigen Zeiten wurde der Arbeitskreis "Kirche und <strong>Berg</strong>bau" gegründet. Dass die Kirchenvertreter<br />
immer noch auf ihre Grundforderung auf Erhalt der Arbeitsplätze im <strong>Berg</strong>bau bestehen, ist lobenswert und nachvollziehbar.<br />
Geht es doch darum, dass die Menschen am Niederrhein weiterhin ihren Job behalten und ihre Familien ernähren können.<br />
Schon jetzt drängen sich zahlreiche Kumpel in die Schuldnerberatungsstellen. Doch die Zeiten haben sich auch geändert. <strong>Die</strong><br />
Rahmenbetriebspläne haben dafür gesorgt, dass der <strong>Berg</strong>bau mehr und mehr Freunde verliert. Geht es doch darum, dass<br />
diese Pläne nicht mehr so groß dimensioniert sein müssen, weil in Zukunft die Bedeutung der Steinkohle weiter<br />
runtergeschraubt<br />
wird. Närrisch wäre es jedoch, wollte man aus diesem Grund die Absicht von Kirche und Gewerkschaften, an den<br />
Pattberggottesdienst vor 10 Jahren <strong>zu</strong> erinnern, in Frage stellen. Denn die haben mit den Rahmenbetriebsplänen <strong>nichts</strong> direkt<br />
<strong>zu</strong> tun. Das ist Sache der DSK. Dem Arbeitskreis gehts allein um den Erhalt der Kumpel-Jobs.<br />
HEINZ-LEO GARDENIER<br />
NRZ Rheinberg 20.08.2001<br />
BRIEFE AN DIE REDAKTION<br />
Der Niederrhein - bald ein Biotop?<br />
"Bingo!" Da <strong>hat</strong> die DSK mit Hilfe der Verwaltung und dem Hauptausschuss einen Volltreffer gelandet. Sie durfte die Anna-<br />
Schule "absichern". Deckenträger wurden mit Drähten verbunden und die Bodenplatte unter der Erde in zwei Teile geschnitten.<br />
Demnächst Rödeldrähte in allen Wohnzimmern, und die Kinder in der Anna-Schule können bei Schieflage der Bodenplatten<br />
nach zwei Seiten Murmeln spielen. Da sollten die Rheinberger nicht zögern. Ein Event! Lassen Sie sich ruhig von der Zeche ihr<br />
Haus durchschneiden. Herrn Ingenieur Knoke werden die "Gutachter"-Honorare auf des Bürgers Kosten erfreuen.<br />
Und wenn die Häuser eines Tages schief stehen und die Wände auseinanderbrechen, dann haben die Bürger endlich den<br />
Durchblick, auf den auf Steuerzahlers Kosten die DSK mit ihrem Druckerzeugnis "Durchblick" heute schon die Rheinberger<br />
vorbereiten will. Viel schlimmer ist in diesen Tagen die Haltung der Verwaltung und Politiker. In der Verwaltung gibt es keine<br />
Fachleute, und deshalb nickte der Hauptausschuss das ab, was ihm die Verwaltung erzählte. Mögliche Schäden sollen<br />
von der Anna-Schule abgehalten werden. Der psychologische Schaden für die verunsicherten Bürger ist ungleich höher. Und<br />
die Schäden, die bei einem tatsächlichen Abbau entständen, <strong>hat</strong> kein Mensch gegengerechnet.<br />
Annaberg und Rheinberg im Grundwasser, bei Deichbruch überflutet. Pumpstationen auf ewig <strong>zu</strong>r Grundwassersenkung.<br />
Umkippende Abwasserleitungen mit städtischen Pumpstationen, zerstörte Straßen, zerstörte Häuser, eine Landschaft, über die<br />
die Landesregierung heute schon nachdenkt, ob die Bürger dieser Gebiete nicht ausgesiedelt werden sollen. Der Niederrhein<br />
ein großes Biotop. Ein Eldorado für Naturfreunde! Und wie arbeitet die Verwaltung an der Verhinderung dieses Raubbaus an<br />
der Natur und dem Lebensraum vieler tausend Bürger? Hat sie sich eines kompetenten und qualifizierten Juristen auf<br />
Beschluss der Politiker versichert, um <strong>zu</strong> wissen , ob es Sinn macht, die Anna-Schule <strong>zu</strong> "sichern"? Hat sie ein unparteiisches<br />
Gutachten erstellen lassen? Nein! <strong>Die</strong> Schutzgemeinschaft <strong>Berg</strong>bau Rheinberg e.V. <strong>hat</strong> längst einen engagierten und<br />
qualifizierten Rechtsanwalt in ihren <strong>Die</strong>nsten. Aber die Verwaltung fragt niemanden der in Rheinberg ansässigen kompetenten<br />
Bürger, um sich Fachwissen an<strong>zu</strong>eignen, denn das könnte vielleicht <strong>zu</strong>r Verhinderung des Abbaus unter Rheinberg führen.<br />
Und so wurschteln sie alle weiter. <strong>Die</strong> einen, weil sie Politik in der Verwaltung machen, die anderen, weil sie Politik "für" die<br />
Rheinberger machen. Dabei ist längst erkennbar, dass bei gemeinsamen Aktionen von Politikern, Verwaltung und<br />
Schutzgemeinschaft der <strong>Berg</strong>bau unter Rheinberg verhindert werden kann.<br />
NRZ Duisburg 19.08.2001<br />
Deiche müssen erhöht werden<br />
Gutachten geht von der Machbarkeit der neuen Deichhöhen aus.<br />
"Aufgrund von <strong>Berg</strong>senkungen im Deichbereich wurde und wird es erforderlich sein, den Deich auf<strong>zu</strong>höhen, damit das<br />
Schutzziel weiterhin erfüllt werden kann."<br />
<strong>Die</strong>s meldet die Deutsche Steinkohle (DSK) im Zusammenhang mit den geplanten Abgrabungen und der <strong>zu</strong> erwartenden<br />
<strong>Berg</strong>senkung unter den <strong>Stadt</strong>teilen Walsum und Baerl.<br />
Kohleabbau unter Walsum und Baerl<br />
Im Zuge der Aufstellung des Rahmenbetriebsplanes für Walsum war es <strong>zu</strong> massiven Protesten aus der Bevölkerung (wir<br />
berichteten) gekommen. Neben dem Problem des Bautenschutzes befürchten Experten steigende Hochwassergefahren durch<br />
eine Senkung der Rheinsohle bis <strong>zu</strong> zehn Metern. Bei Baerl wurde der Deich erst <strong>zu</strong>r Jahreswende 2000/2001 erhöht. Zum<br />
ersten Mal räumt die DSK in ihrer Zeitschrift "Durchblick" (Ausgabe Niederrhein) jetzt ein, dass die Rheindeiche über dem<br />
Abbaugebiet auf ein noch nie dagewesenes Niveau erhöht werden müssen. DSK-Originalton: "Gutachter kommen in allen<br />
Bereichen <strong>zu</strong> dem Ergebnis, dass die Deiche auch mit den <strong>zu</strong> erwartenden Deichhöhen den Sicherheitsstandards entsprechend<br />
baubar sind." Im Speziellen wurden die Standorte Hasenfeld, südlich Stapp sowie der Bereich Mehrum untersucht. Wie<br />
vorgeschrieben, beziehen sich alle Untersuchungen des genannten Gutachtens auf einen dauerhaft durchnässten Deich.<br />
Geprüft wurde auch das Problem der Rissbildung im Bereich der Abbauränder (Unstetigkeitszonen): <strong>Die</strong> Deutsche Steinkohle<br />
AG geht davon aus, dass es Risse im Rheindeich geben wird.<br />
Gutachten: Risse sind beherrschar<br />
Das von der DSK zitierte Gutachten kommt schließlich <strong>zu</strong> dem Schluss, "dass auch durch Unstetigkeitszonen verursachte<br />
Risse im Deichkörper beherrschbar sind." Da<strong>zu</strong> soll ein Drainagesystem landseitig gebaut werden, das Auswaschungen<br />
verhindern soll. CHRISTOPH GIRSCHIK<br />
NRZ Moers 19.08.2001
Steinkohle will Deiche bei Baerl erhöhen<br />
AM NIEDERRHEIN. "Aufgrund von <strong>Berg</strong>senkungen im Deichbereich wurde und wird es erforderlich sein, den Deich<br />
auf<strong>zu</strong>höhen, damit das Schutzziel weiterhin erfüllt werden kann." <strong>Die</strong>s meldet die Deutsche Steinkohle (DSK) <strong>zu</strong>m geplanten<br />
Abbau und der <strong>zu</strong> erwartenden <strong>Berg</strong>senkung unter Walsum und unter Baerl. Im Zuge der Aufstellung des<br />
Rahmenbetriebsplanes für Walsum war es <strong>zu</strong> massiven Protesten aus der Bevölkerung (wir berichteten) gekommen. Neben<br />
dem Problem des Bautenschutzes befürchten Experten steigende Hochwassergefahren durch eine Senkung der Rheinsohle bis<br />
<strong>zu</strong> zehn Metern.<br />
Bei Baerl wurde der Deich erst <strong>zu</strong>r Jahreswende erhöht. Nun räumt die DSK in ihrer Zeitschrift "Durchblick" (Ausgabe<br />
Niederrhein) jetzt ein, dass die Rheindeiche über dem Abbaugebiet auf ein noch nie dagewesenes Niveau erhöht werden<br />
müssen. DSK-Originalton: "Gutachter kommen in allen Bereichen <strong>zu</strong> dem Ergebnis, dass die Deiche auch mit den <strong>zu</strong><br />
erwartenden Deichhöhen den Sicherheitsstandards entsprechend baubar sind." Im Speziellen wurden die Standorte Hasenfeld,<br />
südlich Stapp sowie der Bereich Mehrum untersucht. Wie vorgeschrieben, beziehen sich alle Untersuchungen des genannten<br />
Gutachtens auf einen dauerhaft durchnässten Deich. Geprüft wurde auch das Problem der Rissbildung im Bereich der<br />
Abbauränder (Unstetigkeitszonen): <strong>Die</strong> DSK geht davon aus, dass es Risse im Rheindeich geben wird. Das Gutachten kommt<br />
<strong>zu</strong> dem Schluss, "dass auch durch Unstetigkeitszonen verursachte Risse im Deichkörper beherrschbar sind." Da<strong>zu</strong> soll ein<br />
Drainagesystem landseitig gebaut werden, das Auswaschungen verhindern soll, wie es weiter heißt. (cig)<br />
NRZ Rheinhausen 19.08.2001<br />
<strong>Berg</strong>senkung: Deiche müssen erhöht werden<br />
HOCHWASSERGEFAHR: Gutachten geht von der Machbarkeit der neuen Deichhöhen aus. Risse in den<br />
Unstetigkeitszonen.<br />
"Aufgrund von <strong>Berg</strong>senkungen im Deichbereich wurde und wird es erforderlich sein, den Deich auf<strong>zu</strong>höhen, damit das<br />
Schutzziel weiterhin erfüllt werden kann." <strong>Die</strong>s meldet die Deutsche Steinkohle (DSK) im Zusammenhang mit den geplanten<br />
Abgrabungen und der <strong>zu</strong> erwartenden <strong>Berg</strong>senkung unter Walsum und unter Baerl. Im Zuge der Aufstellung des<br />
Rahmenbetriebsplanes für Walsum war es <strong>zu</strong> massiven Protesten aus der Bevölkerung (wir berichteten) gekommen. Neben<br />
dem Problem des Bautenschutzes befürchten Experten steigende Hochwassergefahren durch eine Senkung der Rheinsohle bis<br />
<strong>zu</strong> zehn Metern. Bei Baerl wurde der Deich erst <strong>zu</strong>r Jahreswende erhöht.<br />
Zum ersten Mal räumt die DSK in ihrer Zeitschrift "Durchblick" (Ausgabe Niederrhein) jetzt ein, dass die Rheindeiche über dem<br />
Abbaugebiet auf ein noch nie dagewesenes Niveau erhöht werden müssen. DSK-Originalton: "Gutachter kommen in allen<br />
Bereichen <strong>zu</strong> dem Ergebnis, dass die Deiche auch mit den <strong>zu</strong> erwartenden Deichhöhen den Sicherheitsstandards entsprechend<br />
baubar sind."<br />
Im Speziellen wurden die Standorte Hasenfeld, südlich Stapp sowie der Bereich Mehrum untersucht. Wie vorgeschrieben,<br />
beziehen sich alle Untersuchungen des genannten Gutachtens auf einen dauerhaft durchnässten Deich. Geprüft wurde auch<br />
das Problem der Rissbildung im Bereich der Abbauränder (Unstetigkeitszonen): <strong>Die</strong> DSK geht davon aus, dass es Risse im<br />
Rheindeich geben wird. Das Gutachten kommt <strong>zu</strong> dem Schluss, "dass auch durch Unstetigkeitszonen verursachte Risse im<br />
Deichkörper beherrschbar sind." Da<strong>zu</strong> soll ein Drainagesystem landseitig gebaut werden, das Auswaschungen verhinden soll.<br />
CHRISTOPH GIRSCHIK<br />
NRZ Duisburg 17.08.2001<br />
Für Erörterung fehlt eine Halle<br />
Noch ist ungewiss, wann weiter über Walsums Rahmenbetriebsplan beraten wird.<br />
Bis nach den Sommerferien ist die Erörterung <strong>zu</strong>m Rahmenbetriebsplan des <strong>Berg</strong>werks Walsum bekanntlich unterbrochen<br />
worden. Wie es aussieht, werden die Kontrahenten noch einige Zeit über den Akten brüten können. Derzeit ist nicht absehbar,<br />
wann es weiter geht. Das Problem<br />
ist der Tagungsort, betonte Siegfried Uwe Behrendt, der Sprecher der Abteilung <strong>Berg</strong>bau und Energie in der <strong>zu</strong>ständigen<br />
Bezirksregierung Arnsberg, gestern gegenüber der NRZ. Gesucht wird eine Halle, die über einen längeren Zeitraum, vor allem<br />
aber ohne Unterbrechung, gemietet werden kann. "Es nutzt <strong>nichts</strong>", so Behrendt, "wenn wir nach zwei Tagen alles wieder<br />
abbauen müssen, um es dann wieder auf<strong>zu</strong>bauen." <strong>Die</strong> Suche wurde inzwischen auf das ganze Ruhrgebiet und darüber hinaus<br />
ausgedehnt.<br />
Das ist laut Behrendt durchaus wörtlich <strong>zu</strong> nehmen. "Wir haben im Westen an der niederländischen Grenze angefangen und in<br />
Dortmund aufgehört." Bisher ohne Erfolg. Wobei Behrendt allerdings einräumt, dass es sinnvoller wäre, den Ort der Erörterung<br />
möglichst nah an die betroffenen Gebiete um Walsum, Dinslaken und Voerde herum <strong>zu</strong> legen. Nur: "Das Ganze gestaltet sich<br />
schwierig." In diesem Monat werde es auf keinen Fall weiter gehen, wahrscheinlich nicht einmal vor Mitte September, da der<br />
Fortgang der Erörterung schließlich umfänglich angekündigt werden müsse, wenn denn eine Halle gefunden ist. (put)<br />
NRZ Rheinberg 15.08.2001<br />
Ein intaktes Haus braucht Bewegung<br />
DSK stellt vorbeugende Maßnahmen gegen <strong>Berg</strong>schäden an der Grundschule Grote Geert vor.<br />
RHEINBERG. Ohne Bewegung geht es nicht. Sonst gibts Kleinholz. Und das kostet. Kein Wunder, dass die Deutsche<br />
Steinkohle (DSK) daran interessiert ist, Hausbesitzern, die ihre vier Wände über potentiellen Abgrabungsgebieten errichtet<br />
haben, lieber auf Prophylaxe setzt als nachträglich <strong>Berg</strong>schäden <strong>zu</strong> reparieren. Deshalb ist ein von der DSK beauftragtes<br />
Ingenieurbüro <strong>zu</strong>rzeit im Rheinberger <strong>Stadt</strong>gebiet unterwegs, um in den Bereichen, wo laut Rahmenbetriebsplan künftig<br />
abgegraben wird, Häuser <strong>zu</strong> begutachten und - wenns gewünscht wird - mit den Hausbesitzern bauliche Veränderungen<br />
ab<strong>zu</strong>sprechen.<br />
Im Kern gehts um eins: Häusern, Säulen etc. Luft <strong>zu</strong> verschaffen, damit sie im Ernstfall Bewegungsmöglichkeiten haben. 450<br />
betroffene Haushalte gibt es im Bereich Annaberg, haben Diplom-Ingenieur Randolf Knoke und seine Mitarbeiter ermittelt.<br />
Damit deren Bewohner sich überhaupt eine Vorstellung davon machen können, was auf sie <strong>zu</strong>kommen kann, ist die<br />
Grundschule Grote Gert als Demonstrationsobjekt ausgesucht worden. Hier <strong>hat</strong> Knokes Team die ersten Arbeiten fertig. Zum<br />
Beispiel liegen unter den Außengängen dicke Stahlbetonplatten. <strong>Die</strong> können sich - bei <strong>Berg</strong>senkungen durch den Kohleabbau<br />
- hoch schieben. Das muss nicht sein: <strong>Die</strong> Platten wurden komplett durchgeschnitten und Fugen eingesetzt. Sie bekommen so<br />
Bewegungsmöglichkeiten, wie Heinz Pöller, Oberbauleiter für das linksrheinische DSK-Gebiet erklärt. Oder: Bei<br />
Entspannungsbohrungen werden an Hauswänden entlang Hohlräume in der Erde geschaffen, die mit Torf aufgefüllt werden -<br />
auch der reagiert auf Bewegungen, passt sich an, sagen die Fachleute.
Stück für Stück wird das Rheinberger <strong>Stadt</strong>gebiet erfasst. In Millingen beispielsweise waren es 230 Haushalte, 40 davon haben<br />
sich bei der DSK gemeldet und Prophylaxe angefordert. Kostenpunkt: etwa 5000 Mark pro Objekt. <strong>Berg</strong>schäden im Nachhinein<br />
<strong>zu</strong> beseitigen, sei auf jeden Fall teurer. Wieviele sich im Bereich Annaberg, wo im nächsten Jahr die Bauten beginnen sollen,<br />
melden, da<strong>zu</strong> gab es gestern noch keine Zahlen. Schließlich leben dort auch etliche Gegner des Rahmenbetriebsplans für<br />
Friedrich Heinrich/Rheinland. Ob die auf Kooperation setzen, ist fraglich. Wer Fragen <strong>zu</strong> dem Komplex <strong>hat</strong>, kann sich an die<br />
DSK-Hotline, Tel: 0800/2727271, wenden. (cf)<br />
NRZ Moers 14.08.2001<br />
BRIEFE AN DIE REDAKTION<br />
Hausfrauen sind keine Ja-Sager<br />
"Herr Rechtsanwalt Terwische, Sie sind nicht nur ins Fettnäpfchen getreten, sondern in Gedanken und Taten fern jeglicher<br />
Realität. Wer Hausfrauen und Rentner als Ja-Sager und Nickermänner bezeichnet, steht nicht mitten im Leben, sondern im<br />
Abseits. Hausfrauen haben in den meisten Fällen einen Beruf erlernt und ausgeübt. Ich habe noch keinen kennengelernt, der<br />
nach der Schule Rentner geworden ist. Ich bin über 30 Jahre im <strong>Berg</strong>bau beschäftigt und kein Lobbyist, sondern kämpfe für den<br />
Erhalt der Arbeitsplätze im <strong>Berg</strong>bau. In meinem Wahlkreis bin ich mit absoluter Mehrheit in den Rat der <strong>Stadt</strong> Moers gewählt<br />
worden und setze mich dort für die Bürgerinnen und Bürger ein, was man von FDP-Politikern nicht behaupten kann.<br />
Denn Sie sind über die Liste in den Rat gerutscht. Neuerdings scheint es populär <strong>zu</strong> sein, den <strong>Berg</strong>bau bei jeder Gelegenheit<br />
ins negative Licht <strong>zu</strong> rücken. Sie haben bewiesen, dass Sie weder Sozial- noch Fachkompetenz besitzen. Das Abnicken und<br />
Nein-Sagen kommt bei der nächsten Wahl bestimmt."<br />
NRZ Duisburg 13.08.2001<br />
BRIEFE AN DIE REDAKTION<br />
"Wir lebten am Ende im Loch"<br />
"Zum Thema Bodensenkung - <strong>Berg</strong>bau möchte ich darstellen, wie meine Familie es erlebte: Mein Vater wurde 1898 auf der<br />
Kurfürstenstraße 177 geboren. Zur damaligen Zeit hieß es Opp denn <strong>Berg</strong> (Auf dem <strong>Berg</strong>). Heute müsste man sagen ,Im Loch.<br />
1929 baute mein Vater das Haus Kurfürstenstraße 162. Nach wenigen Jahren standen die Keller unter Wasser. 1936, <strong>zu</strong><br />
meinem Schulanfang, stand unser Garten unter Wasser. Im Jahre 1939 wurde zwecks Errichtung eines Entwässerungsgrabens<br />
mit Pumpstation, ein elf Meter breiter Streifen quer durch unser Grundstück enteignet. Seit dieser Zeit wird der<br />
Grundwasserspiegel durch Abpumpen auf einer bestimmten Höhe gehalten.<br />
Im Oktober 1944 wurde diese Pumpstation durch Bomben zerstört, das Drama nahm seinen Lauf. Von Oktober 1944 bis <strong>zu</strong>m<br />
Sommer 1945 entstand ein riesiger See, der Teile der Nord-, Kurfürsten- und Sonnenstraße überschwemmte. An meinem Haus<br />
Kurfürstenstraße 162 betrug der Wasserstand 2,5 Meter. Mit Hilfe eines Krans konnte man auf das Dach des Schützenhauses<br />
gelangen.<br />
Messungen an meinem Haus (Grundstück) ergaben von 1928 bis 1980 weit über 10 Meter Bodensenkungen. <strong>Die</strong> Hochbahn<br />
Gutehoffnungshütte Sterkrade-Walsum Hafen wurde um zwölf Meter erhöht, da die Züge nicht mehr aus dem Loch an der<br />
Kurfürstenstraße kamen. Man kann nur hoffen, dass <strong>zu</strong>r heutigen Zeit kein längerer Stromausfall mehr entsteht, da auch ohne<br />
Hochwasser und Dammbruch am Rhein der Wasserstand an der Kurfürstenstraße bei mehr als zwei Metern liegen würde."<br />
NRZ Moers 09.08.2001<br />
BRIEFE AN DIE REDAKTION<br />
Leichtfertiges Handeln<br />
Mit großem Schrecken haben meine Familie und ich in der Zeitung lesen müssen, dass unsere Landrätin Birgit Amend-<br />
Glantschnig die Gespräche mit der Deutschen Steinkohle (DSK) aufgekündigt <strong>hat</strong>. In Gesprächen mit meinen Nachbarn <strong>hat</strong><br />
diese Äußerung große Sorge hervorgerufen.<br />
Besonders wir Bürger von türkischer Abstammung sehen mit Sorge dieser Entwicklung entgegen. Wenn es um Arbeitsplätze<br />
geht, stehen wir sowieso immer hinten an. In Moers-Repelen leben etwa 3400 Menschen türkischer Abstammung. Sie arbeiten<br />
überwiegend im Steinkohlenbergbau.<br />
Frau Landrätin, jeder hier am Niederrhein weiß, wie schwer es ist, einen Arbeitsplatz <strong>zu</strong> bekommen. Gerade deshalb kann ich<br />
Ihr leichtfertiges Handeln nicht nachvollziehen. Es stehen sehr viele Arbeitsplätze auf dem Spiel. Alternativen gibt es nur<br />
wenige. Wir <strong>Berg</strong>leute und unsere Familien brauchen aber eine Perspektive für die Zukunft. Können Sie, Frau Landrätin,<br />
unseren Kindern eine Ausbildungsplatz garantieren? Ich glaube nicht. Deshalb fordere ich Sie auf, sich für alle Menschen<br />
unserer Region ein<strong>zu</strong>setzen. Leichtfertig Arbeitsplätze aufs Spiel <strong>zu</strong> setzen, kann nicht der Wille der Politik sein.<br />
NRZ Moers 07.08.2001<br />
BRIEFE AN DIE REDAKTION<br />
Stehvermögen für Glantschnig<br />
Ich möchte mich hier einmal als unabhängiger Bürger da<strong>zu</strong> äußern: Das Verhalten der Landrätin in dieser Frage halte ich für<br />
absolut gerechtfertigt im Sinne der Allgemeinheit, das heißt auch für die bergbaugeschädigten Bürger. <strong>Die</strong> Kernfrage ist doch:<br />
"Wo<strong>zu</strong> brauchen wir Rahmenbetriebspläne, die fast bis in die Ewigkeit reichen überhaupt noch?" Tatsache ist, dass die<br />
deutsche Steinkohle entgegen allen Lobbyistenaussagen nicht mehr gebraucht wird. Falls die Betroffenen dieser Aussage nicht<br />
<strong>zu</strong>stimmen können, sollen sie doch mal <strong>zu</strong>r Durchset<strong>zu</strong>ng des Rahmenbetriebsplanes streiken, um <strong>zu</strong> sehen, was passiert... Es<br />
wird Kohle etwa <strong>zu</strong> einem Drittel des Preises importiert. In einer Zuschrift werden die <strong>Berg</strong>bausubventionen gegenüber<br />
Steuererleichterungen für die übrige Wirtschaft total heruntergespielt.<br />
Der Verfasser übersieht dabei, dass <strong>Berg</strong>bausubventionen verloren sind - jedoch Subventionen und Steuererleichterungen<br />
für andere Industriezweige der Schaffung von Arbeitsplätzen dienen. Des weiteren wird der zügige Arbeitsplatzabbau durch die<br />
Deutsche Steinkohle zwischen 1997 und 2005 hervorgehoben. <strong>Die</strong>s geschieht nicht aus der Überzeugung: Denn es werden in<br />
2001 noch Mitarbeiter für 25-jährige Betriebs<strong>zu</strong>gehörigkeit öffentlich geehrt und sie erhalten wahrscheinlich auch eine<br />
Treuegeldprämie. In solcher Situation müßten alle Mitarbeiter, die infolge Eigeninitiative ausscheiden, eine Prämie erhalten,<br />
nicht die "Aussitzer", die 1976 während der schon vorhandenen Krise in den <strong>Berg</strong>bau eintraten. Hieraus kann man erkennen,<br />
dass die DSK und die Gewerkschaften nur auf starken Druck von außen die Personalreduzierung betreiben. Der Abbau der<br />
Arbeitsplätze ist für den Einzelnen und die Region schlimm genug, jedoch kommen alle <strong>Berg</strong>baubeschäftigten<br />
bis heute in den Genuss eines sozialverträglichen Arbeitsplatzabbaues. <strong>Die</strong>ses Privileg kann bisher kein Beschäftigter in<br />
anderen Industriezweigen vorweisen.<br />
Auch die vielgescholtene Landrätin will nicht daran rütteln. Ich halte die Zurückhaltung von Frau Amend-Glantschnig
für berechtigt und wünsche ihr viel Stehvermögen <strong>zu</strong>m Wohle der vom <strong>zu</strong>künftigen Kohleabbau geschädigten Bürger.<br />
NRZ Duisburg 06.08.2001<br />
BRIEFE AN DIE REDAKTION<br />
"Gegner dieses Abbauplans"<br />
"Anscheinend <strong>hat</strong> auch der Kreisvorsitzende des DGB, Rainer Bischoff, die Problematik um den Rahmenbetriebsplan<br />
(RBP) des <strong>Berg</strong>werks Walsum bisher noch nicht verstanden. Hier geht es nicht nur allein um moralische Argumente. <strong>Die</strong><br />
politische <strong>Berg</strong>baulobby <strong>hat</strong> es bisher geschickt verstanden, das Feindbild des <strong>Berg</strong>baugegners den <strong>Berg</strong>leuten <strong>zu</strong> vermitteln.<br />
<strong>Die</strong> ist das eigentliche Unmoralische an der bisherigen Diskussion um den RBP. <strong>Die</strong> betroffenen Bürger und Mitglieder der<br />
Bürgerinitiativen sind Gegner dieses Rahmenbetriebsplanes und nicht Gegner des <strong>Berg</strong>baus oder der <strong>Berg</strong>leute. Ebenso halten<br />
die Bezirksregierung Düsseldorf, das Staatliche Umweltamt Krefeld, die Städte Dinslaken und Voerde und die<br />
Naturschutzverbände den Rahmenbetriebsplan für nicht genehmigungsfähig oder nur durch erhebliche Auflagen für akzeptabel.<br />
Selbst die <strong>Stadt</strong> Duisburg erklärte während des Erörterungsverfahren, ihre bisherige positive Position nicht länger aufrecht<br />
erhalten <strong>zu</strong> können. (...) <strong>Die</strong> Auswirkungen des RBP auf Mensch, Umwelt und Natur sind so gravierend, dass niemand es<br />
<strong>zu</strong>lassen darf, dass dieses beschriebene Abbauvorhaben so umgesetzt wird. Dass die <strong>Berg</strong>leute der Zeche Walsum Angst um<br />
ihre Arbeitsplätze haben, versteht sich von selbst. Fragt man aber nach der sozialen Verantwortung und den damit<br />
verbundenen Zukunftsperspektiven, kann die Antwort nur von der Landesregierung kommen. (...)"<br />
NRZ Moers 05.08.2001<br />
"Hoffen auf Minister"<br />
Das Moerser Arbeitslosenzentrum kritisiert Landrätin, CDU und Siemens.<br />
AM NIEDERRHEIN. <strong>Die</strong> Äußerungen der Landrätin <strong>zu</strong>m <strong>Berg</strong>bau und die Reaktion von Industriepfarrer Widera (wir berichteten<br />
am Samstag) haben Michael Rittberger, den Geschäftsführer des Moerser Arbeitslosenzentrums, auf den Plan gerufen. "Widera<br />
<strong>hat</strong> recht, wenn er Besonnenheit in der Diskussion um die Abbaupläne einfordert. Nur unter einer verantwortlichen politischen<br />
Moderation wird es <strong>zu</strong> Entscheidungen kommen", sagt er. Landrätin Amend-Glantschnig habe sich da selbst aus der<br />
Verantwortung genommen. Rittberger kritisiert indes auch CDU-Kreisfraktionschef Schmitz, der beim Thema <strong>Berg</strong>bau sieht,<br />
dass "der Wind sich gedreht" habe. Rittberger da<strong>zu</strong>: "Bei der Diskussion geht es um den Verlust von etlichen Arbeitsplätzen. In<br />
unserer Region Wesel, Krefeld und Duisburg haben wir jetzt schon 100 000 Arbeitslose." Struktuwandel gehe seiner Meinung<br />
nach mit der dauerhaften Vernichtung von bestehenden Arbeitsplätzen sowie der Schaffung von neuen Jobs einher. "Letztere<br />
könnten dann so aussehen wie bei der Firma Siemens in Kamp-Lintfort, wo Menschen um ihren Arbeitsplatz bangen. Da wird<br />
ein Stellenmodell nach rein wirtschaftlichen Interessen ausprobiert, wir nennen das Siemens-Jojo. <strong>Die</strong> Politik <strong>hat</strong> sich hier<br />
offenbar ausgeklinkt. Bleibt <strong>zu</strong> hoffen, dass NRW-Arbeitsminister Schartau, der am 10. August Kamp-Lintfort besucht, die<br />
passende Antworten <strong>hat</strong>. (M.L.)<br />
NRZ Moers 03.08.2001<br />
Pfarrer: Landrätin braucht Geist der Besonnenheit<br />
CDU-Kreisvorsitzender Dr. Schmitz will den Termin auf Freidrich-Heinrich aber auf jeden Fall wahrnehmen.<br />
AM NIEDERRHEIN. Pfarrer Widera schreibt weiter an die Landrätin: "Ich hätte mir gewünscht, die oberste Vertreterin aller<br />
Bürger und Bürgerinnen in dieser Region hätte versucht, in dieser Frage ausgleichend <strong>zu</strong> wirken und würde mit allen<br />
Konfliktparteien im Gespräch bleiben." - <strong>Die</strong> von Amend-Glantschnig kritisierte mangelhafte Transparenz bei der öffentlichen<br />
Darstellung der Abbaupläne kann der Industriepfarrer indes teilen - jedoch nur in der Vergangenheit. "Da haben wir mit dem<br />
Kirchenkreis Dinslaken ein deutliches Positionspapier <strong>zu</strong>m Rahmenbetriebsplan für Walsum verfasst", so Widera.<br />
Mittlerweile hält er die Kritik aber nicht mehr für <strong>zu</strong>treffend. "Im Gegenteil: In den letzten Monaten haben ich und andere<br />
kirchliche Verantwortliche verschiedene Gespräche geführt mit Vertretern der DSK und der Gewerkschaften wie auch der<br />
Bürgerinitiative BIB. In all diesen Zusammenhängen sind wir durchweg auf große Offenheit und Informationsbereitschaft<br />
gestoßen." Bislang habe es die Kirche vermieden, in der Frage der Rahmenbetriebspläne einseitig Partei <strong>zu</strong> ergreifen. Den<br />
Grundkonflikt zwischen Ökologie und Arbeit könne man nicht einfach nach einer Seite hin auflösen, so Widera: "Wir sind<br />
allerdings der Meinung, dass unsere Region auf einen lebendigen <strong>Berg</strong>bau <strong>zu</strong>mindest mittelfristig nicht verzichten kann.<br />
Entlassungen vermeiden und den Strukturwandel sozialverträglich gestalten - diese Forderung, für die viele Tausend Menschen<br />
auf die Straße gegangen sind, ist nach wie vor gültig." Widera fordert von der Landrätin daher einen "Geist der Besonnenheit"<br />
und zitiert damit 2. Timotheus 1,7. - Populismus und Scharfmacherei sei nicht gefragt, vielmehr ein sachlicher und fairer<br />
Umgang. CDU-Kreisvorsitzender Dr. Hans-Georg Schmitz meinte gestern <strong>zu</strong>r Redaktion: "<strong>Die</strong> Landrätin <strong>hat</strong> mit<br />
ihrer Kritik auf den Rahmenbetriebsplan Walsum gezielt, und sie steht damit voll <strong>zu</strong>m Kreistagsbeschluss. Bei aller Sympathie<br />
für die <strong>Berg</strong>leute sehen wir aber auch, dass der Wind sich bei dem Thema gedreht <strong>hat</strong>. Der <strong>Berg</strong>bau erzielt mehr Transparenz<br />
nicht dadurch, dass er einfach mehr Öffentlichkeitsarbeit betreibt." Zu der Termin-Absage der Landrätin auf Friedrich-Heinrich<br />
am 31. August meinte Schmitz: "Ich geh da auf jeden Fall hin." (M.L.) FORTSETZUNG VON SEITE 1<br />
NRZ Moers 03.08.2001<br />
"Öl ins Feuer gießen"<br />
Evangelische Kirche schreibt offenen Brief an Landrätin Amend-Glantschnig.<br />
AM NIEDERRHEIN. Nun <strong>hat</strong> sich Landrätin Birgit Amend-Glantschnig (CDU) auch noch den Unmut der Evangelischen Kirche<br />
<strong>zu</strong>gezogen. Ihre Äußerungen über den <strong>Berg</strong>bau in dieser Zeitung haben Industriepfarrer Jürgen Widera "sehr irritiert", wie er ihr<br />
in einem offenen Brief schrieb. Und weiter: "Ist es angemessen, wenn die Landrätin in dieser heiklen Situation Öl<br />
ins Feuer gießt?<br />
NRZ Rheinhausen 02.08.2001<br />
Keine Rücksicht auf den Bezirk genommen<br />
"Wie sollen sich die Anwohner der <strong>Stadt</strong>teile in dem Bezirk Homberg/Ruhrort/Baerl über den Rahmenbetriebsplan der Zeche<br />
Walsum informieren", fragt Jürgen Beckert vom Ortsverband des Bündnis 90/<strong>Die</strong> Grünen in Duisburg-West. Beckert stellt fest,<br />
dass auf die Anwohner im linksrheinischen Nachbarbezirk keine Rücksicht genommen werde: "<strong>Die</strong> Ortsteile auf der linken<br />
Rheinseite sind mindestens genau so betroffen wie Walsum." Gerade die neu ausgelegten <strong>zu</strong>sätzlichen Studien <strong>zu</strong>r
Trinkwassergewinnung, <strong>Berg</strong>senkung, Deichaufhöhung und Naturschutzfragen seien für die linksrheinischen Gebiete, für das<br />
Binsheimer Feld, den Ortsteil Binsheim und Teile von Baerl von größter Bedeutung.<br />
Beteiligung nur halbherzig<br />
Beckert bemängelt, dass auch die Pläne für die Thyssen-Kokerei in Homberg nicht ausgelegt werden, obwohl die nächste<br />
Wohnbebauung keine 500 Meter entfernt sei. Beckert: Wieder einmal wird die Beteiligung der Öffentlichkeit nur halbherzig<br />
betrieben. Beckert fordert, dass die Pläne <strong>zu</strong>m Rahmenbetriebsplan der Zeche Walsum auch im Bezirksamt Homberg<br />
ausgelegt werden: "Unser <strong>zu</strong>ständiges Bezirksamt liegt in Homberg. Wer soll <strong>zu</strong>r Einsichtnahme der Informationen nach<br />
Walsum fahren und da<strong>zu</strong> noch in der Hauptferienzeit? " Beckert fordert, dass auf die linksrheinischen Flächen besonders<br />
Rücksicht genommen wird, da sie als Wohngebiete, landwirtschaftliche Flächen und Flächen <strong>zu</strong>r Naherholung genutzt werden.<br />
(cig)<br />
NRZ Moers 02.08.2001<br />
BRIEFE AN DIE REDAKTION<br />
Beschämend und traurig<br />
Als <strong>Berg</strong>mann in der vierten Generation auf der Schachtanlage Friedrich-Heinrich/Rheinland, finde ich es sehr beschämend<br />
und sehr traurig, dass eine vom Volk gewählte Landrätin sich so negativ über den <strong>Berg</strong>bau äußern kann. Gerade in unserer<br />
Region, wo der <strong>Berg</strong>bau über Jahrzehnte Menschen ernährte und immer noch ernährt, müsste eine Landrätin in einer so<br />
verantwortungsvollen Position, voll und mit Leib und Seele hinter uns <strong>Berg</strong>leuten stehen. Viele junge Familien leiden seit<br />
Jahren unter der ungewissen Zukunft des <strong>Berg</strong>baus. Meine Bitte an sie, Frau Landrätin: Ändern Sie Ihre negative Haltung und<br />
kämpfen Sie mit uns Seite an Seite für den Erhalt unserer Arbeitsplätze.<br />
Rheinische Post, Rheinberg 02.08.2001<br />
FDP <strong>zu</strong>m <strong>Berg</strong>bau<br />
"Irrsinn ohne Beispiel"<br />
RHEINBERG (RP). <strong>Die</strong> letzte Informationsveranstaltung über den Rahmenbetriebsplan des <strong>Berg</strong>werkes Friedrich<br />
Heinrich / Rheinland fand ohne die Liberalen statt. Michael Terwiesche, FDP-Vorsitzender im Kreis Wesel, teilte<br />
<strong>Berg</strong>werksdirektor Fox mit, dass die FDP-Kreistagsfraktion mit ihm bereits am 22. Mai 2001 die Situation des<br />
heimischen Steinkohlebergbaus erörtert habe.<br />
In diesem Zusammenhang machte Terwiesche nochmals die Position der FDP in Sachen <strong>Berg</strong>bau klar: "Wir<br />
wollen spätestens <strong>zu</strong>m Jahre 2005 eine Beendigung der Verschwendung von Steuermittel, also Geld, welches<br />
die Bürgerinnen und Bürger sowie andere Unternehmen zahlen müssen, für den deutschen Steinkohlebergbau."<br />
Es sei "ein Irrsinn ohne Beispiel, dass etwa für die Bildung und Ausbildung unserer Jugend, die<br />
Verkehrsinfrastruktur oder Polizei und Justiz keine ausreichenden finanziellen Mittel <strong>zu</strong>r Verfügung gestellt<br />
werden, dafür aber ein umweltzerstörender und nicht wettbewerbsfähiger Energieträger wie die Steinkohle von<br />
der SPD aus wahltaktischen Gründen verhätschelt wird, weil die Sozialdemokraten hoffen, ein <strong>Berg</strong>mann wähle<br />
rot bis ans Ende seine Tage.<br />
Laut Terwiesche trete die FDP dafür ein, den für den Zeitraum 2001 bis einschließlich 2005 vorgesehenen<br />
Gesamtbetrag an Subventionen <strong>zu</strong> halbieren. Zur Umset<strong>zu</strong>ng der durch die Subventionskür<strong>zu</strong>ngen bedingten<br />
Personal-Anpassungsmaßnahmen könnten zwar betriebsbedingte Kündigungen nicht mehr ausgeschlossen<br />
werden. "<strong>Die</strong> damit verbundene Problematik wird aber dadurch abgeschwächt, dass unter anderem in Handwerk<br />
und Gewerbe etliche tausend Facharbeitsplätze nicht besetzt werden können. Dafür stünden die im Schnitt 33jährigen<br />
Mitarbeiter des <strong>Berg</strong>baus <strong>zu</strong>r Verfügung."<br />
NRZ Moers 01.08.2001<br />
FDP kann die Landrätin verstehen<br />
MOERS. Wenn die Landrätin mit dem <strong>Berg</strong>bau <strong>zu</strong>nächst nicht mehr sprechen will (wir berichteten) - dann findet die Moerser<br />
FDP-Ratsfrau Heidelinde Heller das verständlich, "aber nicht nützlich für die betroffenen Bürger", wie Heller gestern schrieb.<br />
Und weiter meint sie: "Als ich Ende der 70-er Jahre erstmals meine Erfahrungen mit dem <strong>Berg</strong>bau machte, sollte man es als<br />
Gnade empfinden, dass er überhaupt mit einem sprach. <strong>Die</strong>s <strong>hat</strong> sich inzwischen gründlich geändert. Durfte der <strong>Berg</strong>bau<br />
damals ohne Vorankündigung und ungestraft das Eigentum seiner vertikalen Nachbarn zerstören, so muss er das heute vorher<br />
mitteilen und Schäden verhindern." Gleichwohl sei es laut Heller noch so, dass man Änderungswünsche zwar anbringen könne,<br />
diese aber letztendlich <strong>nichts</strong> bewirkten. Ihrer Ansicht nach sei es etwa nicht richtig, dass unter Annaberg drei Bauhöhen<br />
übereinander gebaut würden.<br />
NRZ Moers 01.08.2001<br />
BRIEFE AN DIE REDAKTION<br />
"Landrätin muss für alle da sein"<br />
Als <strong>Berg</strong>mann, der auf dem <strong>Berg</strong>werk Friedrich Heinrich/Rheinland beschäftigt ist, und Bürger, der mit seiner Familie im Kreis<br />
Wesel lebt, bin ich entsetzt darüber wie leichtfertig unsere Landrätin Birgit Amend-Glantschnig mit <strong>Berg</strong>leuten und deren<br />
Familien umgeht und ihnen das Gefühl vermittelt, sie seien Menschen zweiter Klasse. Bisher war ich der Meinung, dass eine<br />
Landrätin oder Landrat sich neutral für alle Bürger ein<strong>zu</strong>setzen <strong>hat</strong>. Leider muss ich feststellen, dass es unserer Landrätin<br />
schon <strong>zu</strong>viel ist, das einfache Gespräch <strong>zu</strong> suchen. Ich fordere unsere Landrätin auf, die Gespräche mit der Deutschen<br />
Steinkohle mit vollen Einsatz auf<strong>zu</strong>nehmen und nicht die Probleme in Sachen Rahmenbetriebspläne einfach aus<strong>zu</strong>sitzen wie es<br />
<strong>zu</strong>r Zeit in Ihrer Politik üblich ist. Für eine Landrätin sollte es doch klar sein, welchen Wirtschaftsfaktor der <strong>Berg</strong>bau in dieser<br />
Region <strong>hat</strong>. Es betrifft nicht nur den <strong>Berg</strong>bau, sondern auch eine große Anzahl von <strong>Berg</strong>bauabhängigen Firmen und Kaufleuten.<br />
NRZ Moers 01.08.2001
BRIEFE AN DIE REDAKTION<br />
"Erschüttert über Aussagen"<br />
Ich bin erschüttert über die Aussagen von Landrätin Amend-Glantschnig. Das <strong>Berg</strong>werk Friedrich Heinrich/Rheinland, in Person<br />
unseres Werksleiters Fox, <strong>hat</strong>te im Februar das erste Gespräch mit der Landrätin anberaumt. Seit dem gab es weitere<br />
Gespräche und Informationen unter anderem auch mit der Landrätin des Kreisel. So im März, als sie ihre erste Grubenfahrt<br />
überhaupt auf Friedrich Heinrich machte, und danach im Beisein der Bürgermeister von Kamp-Lintfort, Moers, Rheinberg und<br />
Neukirchen-Vluyn die Wanderausstellung <strong>zu</strong>m Rahmenbetriebsplan in der Lohnhalle eröffnete. Dort erhielt Sie weitere<br />
Informationen über die Notwendigkeit des Abbaus unter Annaberg, denn nach dem Scopingtermin 1996 <strong>hat</strong>te das <strong>Berg</strong>werk<br />
seine Pläne verändert und die Solvaywerke und den historischen <strong>Stadt</strong>kern von Rheinberg aus den Abbauplänen<br />
herausgenommen. Weitere Änderungen, so wurde im März deutlich gemacht, sind nicht möglich und gefährden die Zukunft von<br />
Friedrich Heinrich. Weiterhin wurde im April in Rheinberg mit einer Bürgerinformationsveranstaltung der Dialog vor Ort<br />
fortgesetzt. Unter anderem werden <strong>zu</strong>künftig in den betroffenen Abbaugebieten Bürgerbüros eingerichtet, so wie schon <strong>zu</strong>r Zeit<br />
in Rayen geschehen. Im Mai diesen Jahres wurde von der Deutschen Steinkohle in Homberg ein neues Servicecenter<br />
<strong>Berg</strong>schäden eröffnet. Hier wurde deutlich, dass die DSK die Anregungen der Bürger aufnimmt und schnell reagiert. Mit der<br />
Informationsbroschüre Durchblick wurde auch die Kommunikation mit allen Haushalten der Region vertieft. Als Leiterin der<br />
Entwicklungsagentur Wirtschaft im Kreis Wesel, sollte Sie die Wirtschaftskraft <strong>Berg</strong>bau kennen. Ich fordere Sie auf, reden Sie<br />
weiterhin mit den <strong>Berg</strong>leuten und dem <strong>Berg</strong>bau und helfen Sie mit, dass das <strong>zu</strong>künftige <strong>Berg</strong>werk West als wichtiger<br />
Wirtschaftsfaktor für den Kreis Wesel den Rahmenbetriebsplan bekommt und die dort beschäftigten Menschen des <strong>Berg</strong>werkes<br />
und der Zuliefererbetriebe Arbeit und Brot behalten.<br />
NRZ Moers 01.08.2001<br />
BRIEFE AN DIE REDAKTION<br />
"Kurzfristig gehts nicht"<br />
Welche Kohlenlore ist denn der Landrätin Amend-Glantschnig über den Fuß gefahren, um sich so negativ über den <strong>Berg</strong>bau<br />
am Niederrhein <strong>zu</strong> äußern? Auch bis <strong>zu</strong>r Landrätin muss es sich doch herumgesprochen haben, dass man mit kurzfristigen<br />
Rahmenbetriebsplänen keinen <strong>Berg</strong>bau betreiben kann. <strong>Die</strong> Zahlen zeigen deutlich wie groß der Wirtschaftsfaktor <strong>Berg</strong>bau am<br />
Niederrhein ist. Vielleicht sollte sich Frau Amend-Glantschnig mal den Waren<strong>zu</strong>fluss auf dem <strong>Berg</strong>werk Friedrich-Heinrich in<br />
Kamp-Lintfort anschauen. Das wäre besser, als sich meiner Meinung nach unqualifiziert und schlecht informiert<br />
<strong>zu</strong> äußern.<br />
NRZ Moers 01.08.2001<br />
BRIEFE AN DIE REDAKTION<br />
"Rück<strong>zu</strong>g ins Schneckenhaus"<br />
Als Beschäftigter von Friedrich Heinrich/Rheinland und Bewohner des Kreises Wesel muss ich mit großem Entsetzen<br />
feststellen, wie sich unsere Landrätin mit der aktuellen Situation des <strong>Berg</strong>baus im allgemeinen, aber nicht <strong>zu</strong>letzt in unserer<br />
Region, beschäftigt. Für unsere Landrätin sollte es doch klar sein, welcher Wirtschaftsfaktor der <strong>Berg</strong>bau in unserer Region ist.<br />
Wir haben natürlich auch noch andere Betriebe, die hier eine Wirtschaftskraft darstellen, gerade deshalb erwarte ich von<br />
unserer Landrätin, gleichwohl welcher Partei sie angehört, dass sie keine Klassifizierung von Menschen, Arbeiterinnen sowie<br />
Arbeiter vornimmt. Wir, die Beschäftigten im <strong>Berg</strong>bau sind nicht Menschen zweiter Klasse und schon gar nicht die Schmarotzer<br />
der Nation. Deshalb erwarte ich von Ihnen vollen Einsatz für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in dieser Region.<br />
Nun <strong>zu</strong>m Punkt "keine ausreichende Information vom <strong>Berg</strong>bau" oder wie ich es bezeichne "Ihren Rück<strong>zu</strong>g ins Schneckenhaus".<br />
Seit Anfang 2001 sucht der <strong>Berg</strong>bau, speziell das <strong>Berg</strong>werk Friedrich Heinrich/Rheinland, den Kontakt mit Politik und Bürgern in<br />
der Region. Ich habe in der vergangenen Zeit die Presseberichte <strong>zu</strong>m <strong>Berg</strong>bau sehr aufmerksam verfolgt. Hierbei fällt auf das<br />
Sie Frau Landrätin, an mehreren Veranstaltungen wie <strong>zu</strong>m Beispiel Grubenfahrt auf dem <strong>Berg</strong>werk Friedrich Heinrich mit<br />
anschließender Ausstellungseröffnung <strong>zu</strong>m Rahmenbetriebsplan, Informationsveranstaltungen und sogar auf der<br />
Niederrheinkonferenz in Walsum, teilgenommen haben. Es stellt sich mir hier die Frage, ob dies für eine Landrätin und<br />
Rechtsanwältin mit gutem Auffassungsvermögen nicht Aufklärung und Information genug ist.<br />
NRZ Moers 01.08.2001<br />
BRIEFE AN DIE REDAKTION<br />
"Subventionen gibts überall"<br />
"Wenn die Landrätin in den Rhein springt, wird Herr Terwische ihr bestimmt folgen. Will Frau Amend-Glanschnik nicht an<br />
Gesprächen mit der DSK teilnehmen, klinkt Terwische sich auch aus. Seit wann sind Politiker so verschlossen? Eine<br />
Eigenschaft, die mir bei Politikern völlig unbekannt ist. Mit Verschlossenheit und Funkstille kann man keine Politik betreiben.<br />
Sind diese Leute nicht fehl am Platz? Hat Terwische nicht gewußt, dass die DSK Subventionen und die Anzahl Mitarbeiter von<br />
1997 bis 2005 halbieren wird? Dass Subventionen für die mittelständischen Unternehmen um ein vielfaches höher sind als die<br />
der DSK, dürfte auch Terwische bekannt sein. Aber da die FDP ihre Politik auf diese Bevölkerungsschicht <strong>zu</strong>schneidet, wird es<br />
ihm wohl entfallen sein. Denn Steuererleichterungen- und Erlässe sind <strong>nichts</strong> anderes als versteckte Subventionen. Würden<br />
allen Branchen, die Subventionen erhalten, die Gelder um den gleichen Prozentsatz gekürzt wie bei der DSK, könnte die<br />
Bundesregierung bis 2005 ca. 114 Mrd. DM einsparen. Desweiteren sollte Herr Terwische sich den Kommentar "Mag die<br />
Landrätin keine Kumpel?" in der NRZ vom 27. Juli <strong>zu</strong> Gemüte führen. Danach wird er hoffentlich feststellen, wie wichtig es für<br />
die Region ist, an weiteren Gesprächen teil<strong>zu</strong>nehmen.“<br />
Rheinische Post, Rheinberg 01.08.2001<br />
FDP kommt nicht <strong>zu</strong> Informationsveranstaltung über Rahmenbetriebsplan<br />
"Kohle-Lage schon besprochen"<br />
Über den Rahmenbetriebs- plan für Friedrich-Heinrich wird Ende August gesprochen - allerdings ohne die<br />
FDP.<br />
RHEINBERG (RP). <strong>Die</strong> Informationsveranstaltung am 31. August über den Rahmenbetriebsplan des <strong>Berg</strong>werkes<br />
Friedrich Heinrich / Rheinland, der u.a. Kohleabbau unter dem großen Wohngebiet am Rheinberger Annaberg
vorsieht, wird ohne die Liberalen stattfinden. Das teilte Michael Terwiesche, FDP-Vorsitzender im Kreis Wesel,<br />
<strong>Berg</strong>werksdirektor Fox gestern mit.<br />
<strong>Die</strong> blau-gelbe Kreistagsfraktion habe mit Fox bereits am 22. Mai die Situation des heimischen<br />
Steinkohlebergbaus erörtert. In diesem Zusammenhang machte Terwiesche nochmals die Position der FDP in<br />
Sachen <strong>Berg</strong>bau klar: "Wir wollen spätestens <strong>zu</strong>m Jahre 2005 eine Beendigung der Verschwendung von<br />
Steuermitteln - also Geld, das die Bürgerinnen und Bürger sowie andere Unternehmen zahlen müssen - für den<br />
deutschen Steinkohlebergbau."<br />
"Ab 2005 keine Subventionen"<br />
Es sei "ein Irrsinn ohne Beispiel, dass etwa für die Bildung und Ausbildung unserer Jugend, die<br />
Verkehrsinfrastruktur oder Polizei und Justiz keine ausreichenden finanziellen Mittel <strong>zu</strong>r Verfügung gestellt<br />
werden, dafür aber ein umweltzerstörender und nicht wettbewerbsfähiger Energieträger wie die Steinkohle von<br />
der SPD aus wahltaktischen Gründen verhätschelt wird, weil die Sozialdemokraten hoffen, ein <strong>Berg</strong>mann wähle<br />
rot bis ans Ende seine Tage." Laut Terwiesche trete die FDP ferner dafür ein, den für den Zeitraum 2001 bis<br />
einschließlich 2005 vorgesehenen Gesamtbetrag an Subventionen <strong>zu</strong> halbieren.<br />
NRZ Moers 27.07.2001<br />
BRIEFE AN DIE REDAKTION<br />
<strong>Berg</strong>bau: Jetzt die Hosen runter<br />
"Der <strong>Berg</strong>bau geht nicht auf Bürger <strong>zu</strong>! Endlich lassen unsere Politiker die Hosen, im Fall der Landrätin, die Röcke runter. Erst<br />
Peter Enders mit seinen Negativ-Äußerungen, nun Amend-Glantschnig. Ich frage mich, was die im Februar auf Friedrich<br />
Heinrich/Rheinland gemacht <strong>hat</strong>? Wohl das selbe, was Politiker seit langem machen. Dösen und nur mit einem Ohr <strong>zu</strong>hören.<br />
Wenn die Landrätin etwas nicht verstanden <strong>hat</strong> - warum fragt sie nicht nach? Ist sie sich <strong>zu</strong> gut dafür? Wenn sie mit offenen<br />
Augen durch unser <strong>Berg</strong>baugebiet gehen würde, würde Sie sehen, dass vom <strong>Berg</strong>werk eine Wanderausstellung unterwegs ist.<br />
Auf dieser werden alle Zukunftspläne des Werks offen dargestellt. Unter anderem bei Real in Kamp-Lintfort. Und außerdem,<br />
Frau Landrätin: Sie haben Ihre Schäfchen im Trockenen. Schauen Sie mal nach Siemens oder Praktiker oder <strong>zu</strong>r Pflugfabrik<br />
nach Alpen oder, oder..."<br />
NRZ Wesel 27.07.2001<br />
<strong>Berg</strong>bau muss sich bewegen<br />
KREIS WESEL. Der <strong>Berg</strong>bau muss sich auf die Bürger <strong>zu</strong> bewegen, fordert Landrätin Birgit Amend-Glantschnig angesichts der<br />
aktuellen Auseinanderset<strong>zu</strong>ng um den Rahmenbetriebsplan für das Walsumer <strong>Berg</strong>werk. Sie selbst habe bei Gesprächen<br />
keinerlei Reaktionen der Deutschen Steinkohle AG festgestellt. Außerdem, so die Landrätin weiter, sei überhaupt nicht<br />
nachvollziehbar, warum Rahmenbetriebspläne eine Laufzeit von 20 Jahren hätten und dass vier neben einander existierten, die<br />
nicht abgestimmt seien.<br />
NRZ Mantel 25.07.2001<br />
Kohle: Erster Schritt für mehr Sicherheit<br />
EU-Kommission verlängert Regeln für weitere Beihilfen. Bundesregierung <strong>zu</strong>frieden.<br />
BRÜSSEL/DÜSSELDORF. Staatliche Beihilfen <strong>zu</strong>r Schließung unrentabler Kohle-Zechen soll es nach dem Willen der EU-<br />
Kommission nur noch bis Ende 2007 geben. Zum Aufbau eines Energiesockels, mit dem die Versorgung der Bevölkerung in<br />
Krisenzeiten gesichert werden soll, will die Brüsseler Behörde aber Subventionen für rentable <strong>Berg</strong>werke mindestens bis Ende<br />
2010 gestatten. <strong>Die</strong>s wurde gestern in Brüssel beschlossen. Bundeswirtschaftsminister Werner Müller und sein nordrheinwestfälischer<br />
Amtskollege Ernst Schwanhold begrüßten den Beschluss. "Der erste Schritt in Richtung Neuregelung der<br />
Steinkohlebeihilfen ist getan", betonte Müller. Schwanhold erklärte, mit dem Beschluss sei eine frühzeitige Vorbereitung der<br />
notwendigen Diskussion im EU-Ministerrat möglich. Auch der Vorsitzende der Industriegewerkschaft <strong>Berg</strong>bau, Chemie, Energie<br />
(IGBCE), Hubertus Schmoldt, nannte die Einigung in Brüssel einen ersten Schritt "<strong>zu</strong>r Sicherung der Kohle". Gleichzeitig<br />
erneuerte Schmoldt die Forderung seiner Organisation nach einem nationalen Energiesockel. <strong>Die</strong> Vorlage der EU-Kommission<br />
muss von den Mitgliedstaaten abgesegnet werden. Das Abkommen soll den 2002 ablaufenden Vertrag der Europäischen<br />
Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS) aus dem Jahr 1951 ersetzen. <strong>Die</strong> Kommission erklärte zwar: "Trotz aller<br />
Anstrengungen <strong>zu</strong>r Modernisierung, Rationalisierung und Umstrukturierung ist der größte Teil der gemeinschaftlichen<br />
Steinkohleproduktion gegenüber den Einfuhren aus Drittländern nicht wettbewerbsfähig." Dennoch müsse beim Aufbau eines<br />
Energiesockels die Kohle berücksichtigt werden. Wie es mit den Beihilfen nach 2010 weitergehen soll, bleibt in dem Beschluss<br />
der Kommission jedoch offen.<br />
NRZ Moers 24.07.2001<br />
Skeptisch über Zukunft der deutschen Steinkohle<br />
Bundestagsabgeordneter Peter Enders (SPD) erklärt, warum er - nicht nur - bei der EU Gefahren für unseren <strong>Berg</strong>bau<br />
sieht. "Kohlekompromiss soll eingehalten werden."<br />
AM NIEDERRHEIN. Skeptisch äußert sich Peter Enders MdB (SPD) <strong>zu</strong> den Chancen des deutschen Steinkohlebergbaus für<br />
die Zukunft über das Jahr 2005 hinaus. In einem Schreiben an den Betriebsrat der Schachtanlage Friedrich Heinrich/Rheinland<br />
erläuterte der Abgeordnete jüngst gegenüber Friedhelm Vogt seine Einstellung. "Wie die Geschehnisse mit den<br />
Rahmenbetriebsplänen hier<strong>zu</strong>lande und die Verwaltungsgerichtsverfahren im Saarland zeigen, wird es für den <strong>Berg</strong>bau immer<br />
schwieriger," erklärt Enders: "Ich will nicht ausschließen, dass deutsche Gerichte den Gesetzgeber irgendwann zwingen, das<br />
Bundesberggesetz dahingehend <strong>zu</strong> ändern, dass betroffene Grundstückseigentümer nicht mehr nur auf Schadenersatz<br />
verwiesen werden." Enders: Verschiedene Länder werden weiterhin darauf hin arbeiten, dass durch Streichung der deutschen<br />
Steinkohle eine Senkung des CO2-Ausstoßes erreicht werden könnte. Hier laute das Argument: wenn schon Steinkohle, dann<br />
nicht subventioniert. Nach wie vor sei es deutsche Politik, in Brüssel wenigstens einen Energiesockel <strong>zu</strong> vereinbaren, in dessen<br />
Rahmen die einzelnen Mitgliedsländer die Primärenergieträger fördern können. Enders: "Ich habe mich gefreut, dass im
Grünbuch der EU die Versorgungssicherheit erwähnt wird - in der Vergangenheit die wichtigste Begründung für die<br />
Dauersubventionen im deutschen <strong>Berg</strong>bau. Doch wir wissen alle, dass diese Argumentation mit jedem weiteren Jahr nach dem<br />
Ende des Kalten Krieges schwächer wird." Negativ für Deutschland: Der künftige Kommissar in Brüssel steht nicht auf der<br />
Seite der deutschen Subventionen; Subventionsfragen unterliegen keinem Veto-Vorbehalt; Bei der EU-Osterweiterung kommt<br />
ein bedeutendes Kohleförderland hin<strong>zu</strong>; EU-Staaten wie Frankreich lassen ihre <strong>Berg</strong>bauförderung auslaufen, besonders<br />
negativ ist Großbritannien eingestellt. "Trotz meiner Skepsis will ich, dass der Kohlekompromiss eingehalten wird. Dennoch<br />
werbe ich dafür, dass die alternativen Beschäftigungsmöglichkeiten für <strong>Berg</strong>leute weiter entwickelt werden, auch wenn es dabei<br />
Rückschläge gibt," erklärte Enders abschließend. (da)<br />
NRZ Duisburg 24.07.2001<br />
Methan schoss aus dem Schacht<br />
Bei den Erkundungsarbeiten am Füllschacht in Marxloh (wir berichteten) schoss plötzlich eine Riesenmenge Grubengas an die<br />
Oberfläche. <strong>Die</strong> Arbeiten wurden sofort eingestellt und die Bohrstelle mit einer zwölf Meter dicken Betonschicht abgedichtet.<br />
<strong>Die</strong> Arbeiter waren in etwa zwölf Meter Tiefe auf eine Betonplatte gestoßen, die mit Grundwasser bedeckt war. Mit einer<br />
Fallbirne bearbeiteten sie die Betonplatte, um auf 20 Meter Tiefe <strong>zu</strong> kommen, wo eine weitere Arbeitsplattform vermutet wurde.<br />
Plötzlich verschwand das Wasser im Untergrund. Aus dem Loch schossen 60 Kubikmeter Grubengas pro Minute. Wegen der<br />
umfangreichen Sicherungsmaßnahmen gab es keine Gefährdung der Beteiligten, betonte Klaus Jägersberg von der<br />
Bezirksregierung Arnsberg. Gefahr für die Nachbarschaft bestehe nicht, so Jägersberg. Gas sei inzwischen weder im Garten<br />
noch in den Häusern nachweisbar. Bislang <strong>hat</strong> die Aktion eine halbe Million Mark verschlungen. (GK)<br />
NRZ Wesel 23.07.2001<br />
<strong>Berg</strong>bau: Senkung bis <strong>zu</strong> elf Metern<br />
HÜNXE. Mit dem genehmigten Rahmenbetriebsplan der<br />
Zeche Prosper Haniel in Bottrop, der den Kohleabbau bis 2019 prognostiziert, werden sich Waldgebiete in den Bereichen<br />
Bottrop-Kirchhellen, Dinslaken und Hünxe erheblich verändern. Das ist nicht nur die Meinung des Kommunalverbandes<br />
Ruhrgebiet, dem die Kirchheller Heide gehört. Hier ist von <strong>Berg</strong>senkungen bis <strong>zu</strong> 11,5 Metern die Rede. Auch der angrenzende<br />
Hiesfelder Wald und die Schwarze Heide gehören <strong>zu</strong> den Gebieten, in denen die Erdoberfläche durch den <strong>Berg</strong>bau deutlich<br />
andere Formen annehmen wird. Aber: <strong>Die</strong> Auswirkungen sollen reduziert werden. Gerade um die Natur <strong>zu</strong> optimieren, Gebiete<br />
<strong>zu</strong> renaturieren und Wälder auf<strong>zu</strong>forsten, streben <strong>Berg</strong>bau, Kommunen und federführend das Land Nordrhein-Westfalen noch<br />
für das laufende Jahr die Einrichtung einer Landschaftsentwicklungs-Agentur an. Schwerpunkte sollen sein: Freizeit und<br />
Erholung, stille Erholung, Natur- und Landschaftsentwicklung. Erste Gespräche zwischen den Beteiligten haben bereits<br />
stattgefunden. Sie sollen nach den Sommerferien fortgesetzt werden. <strong>Die</strong> Deutsche Steinkohle (DSK) "<strong>hat</strong> Vorschläge<br />
erarbeitet, unter anderem ein gesamt-räumliches Entwicklungskozept für die Kirchheller Heide dargestellt", sagte Stefan Stocks,<br />
Markscheider auf Prosper Haniel. Auch er hält Ersatzmaßnahmen für nötig - im Rahmen einer großen Bandbreite, die eine<br />
Landschaftsentwicklungs-Agentur umfasst. Stichworte dafür sind: Landschaftsentwicklungspläne, Flächenmanagement, Öko-<br />
Pool (Punktesystem). In jedem Fall müssten die Belange von Forst, Freizeit, Erholung und Umwelt berücksichtigt werden,<br />
unterstreicht er. (Peter Neier)<br />
NRZ Oberhausen 22.07.2001<br />
Kirchheller Heide wird absacken<br />
Mit dem genehmigten Rahmenbetriebsplan der Bottroper Zecher Prosper Haniel, der den Kohleabbau bis 2019 prognostiziert,<br />
werden sich Waldgebiete in der Umgebung erheblich verändern. Das ist auch die Meinung des Kommunalverbandes<br />
Ruhrgebiet, dem die Kirchheller Heide gehört. Hier ist von <strong>Berg</strong>senkungen bis <strong>zu</strong> 11,5 Metern die Rede. Auch der angrenzende<br />
Hiesfelder Wald und die Schwarze Heide gehören <strong>zu</strong> den Gebieten, in denen sich die Erdoberfläche durch den <strong>Berg</strong>bau<br />
verändern wird. <strong>Die</strong> Auswirkungen sollen aber begrenzt werden. Da<strong>zu</strong> streben <strong>Berg</strong>bau, Kommunen und das Land die<br />
Errichtung einer Landschafts-Entwicklungs-Agentur an, die noch dieses Jahr an den Start gehen soll. (Peter Neier)<br />
Rheinische Post, Wesel 20.07.2001<br />
Rahmenbetriebsplan<br />
Kommunen sollen nicht beteiligt werden<br />
KREIS WESEL (RP). <strong>Die</strong> Bezirksregierung Arnsberg lehnt eine Beteiligung weiterer Städte und Gemeinden am<br />
Planfeststellungsverfahren <strong>zu</strong>r Zulassung des Rahmenbetriebsplanes für das <strong>Berg</strong>werk Walsum ab. <strong>Die</strong>s <strong>hat</strong> sie<br />
dem Kreis mit Schreiben vom 16. Juli mitgeteilt. Danach wird die Auffassung des Kreises, Kamp-Lintfort,<br />
Neukirchen-Vluyn, Wesel, Xanten, Alpen und Sonsbeck am Verfahren <strong>zu</strong> beteiligen, nicht geteilt. "<strong>Die</strong> Gebiete<br />
der o. a. Städte und Gemeinden werden vom Einwirkungsbereich des geplanten Abbaus nicht erfasst", schreibt<br />
die Bezirksregierung.<br />
Weiter wird ausgeführt, dass es unter dem Gesichtspunkt des Hochwasserschutzes ausschließlich darauf<br />
ankomme, "ob ggf. <strong>zu</strong> erhöhende Deiche standsicher hergestellt werden können. <strong>Die</strong> Betrachtung anderer,<br />
außerhalb des <strong>Berg</strong>bauvorhabens liegender Beeinträchtigungsursachen bleibt dem Vorhaben der<br />
Deichertüchtigung und damit dem wasserrechtlichen Planfeststellungsverfahren vorbehalten.<br />
<strong>Die</strong>s gilt insbesondere für Fragen der Überflutungsbereiche und des Katastrophenschutzes." Der Kreis Wesel ist<br />
jedoch weiterhin der Auffassung, dass trotz dieser aufgezeigten Gründe eine Beteiligung der genannten Städte<br />
und Gemeinden sinnvoll ist, weil nur durch eine möglichst breite Beteiligung die auch vom <strong>Berg</strong>bau gewünschte<br />
Akzeptanz <strong>zu</strong> erreichen ist.<br />
• Der Rahmenbetriebsplan Walsum wird vom 25. Juli bis <strong>zu</strong>m Ende der Anhörung im Zimmer 109 des<br />
Neuen Rathauses in Moers öffentlich ausgelegt. Montags bis mittwochs acht bis zwölf und 13 bis 16<br />
Uhr, donnerstags acht bis zwölf und 13 bis 17 Uhr, freitags acht bis 14 Uhr.
NRZ Rheinberg 08.07.2001<br />
Widerstand gegen Deichverlegung<br />
Schutzverband warb in Obermörmter um Unterstüt<strong>zu</strong>ng beim Einsatz gegen die Sanierungspläne.<br />
XANTEN. <strong>Die</strong> Anwohner des Rheindeichs in Obermörmter und Vynen sind sauer: der Deich soll aufgrund partieller Schäden im<br />
Bereich ihres Wohngebietes gleich komplett abgerissen und versetzt wieder neu aufgebaut werden. <strong>Die</strong>ser Verlegung würden<br />
allerdings elf Wohnhäuser <strong>zu</strong>m Opfer fallen. Ganz <strong>zu</strong> schweigen von den horrenden Kosten, die nicht <strong>zu</strong>letzt von den<br />
Anwohnern getragen werden müssten. Grund genug also für die Betroffenen, auf die Barrikaden <strong>zu</strong> gehen. Unterstützt werden<br />
sie dabei vom Schutzverband Niederrhein (SVN), der sich nicht nur den Erhalt des Lebensraumes, sondern auch den Schutz<br />
der Bürger vor den etwaigen Kosten auf die Fahnen geschrieben <strong>hat</strong>.<br />
Einspruchsfrist läuft noch bis <strong>zu</strong>m 16. Juli<br />
Um die Einspruchsfrist am 16. Juli nicht ungenutzt vergehen <strong>zu</strong> lassen, lud der SVN <strong>zu</strong> einer Versammlung in die Gaststätte<br />
"Am Schnitzelchen" in Obermörmter ein. Dort wurden die betroffenen Bürger über die geplanten Veränderungen informiert und<br />
<strong>hat</strong>ten gleichzeitig die Möglichkeit, weitere begründete Einsprüche gegen die geplante Verlegung <strong>zu</strong> formulieren. Ein<br />
allgemeiner Brief an die Bezirksregierung Düsseldorf mit etlichen begründeten Einwendungen gegen die geplanten<br />
Maßnahmen liegt bereits vor. <strong>Die</strong> wenigen Bürger, die <strong>zu</strong>r Versammlung erschienen, sorgten sich jedoch <strong>zu</strong>m Teil mehr um ihre<br />
eigene Sicherheit als um die bevorstehenden Kosten, die sich auf 7,2 Millionen Mark pro Kilometer erneuertem Deich belaufen<br />
würden. Auch der SVN nennt zwar als oberste Priorität die hundertprozentige Sicherheit der Anwohner, setzt dagegen aber<br />
vielmehr auf eine gezielte Reparatur der Stellen, an denen die Standsicherheit des Deiches gefährdet ist. SVN setzt auf<br />
gezielte Reparaturmaßnahmen<br />
Hans-Peter Feldmann, Vorsitzender des SVN, appellierte deshalb an die betroffenen Bürger <strong>zu</strong>r Mithilfe: "Wenn wir uns nicht<br />
wehren, wird die Planung verwirklicht." Gleichzeitig machte er seinem Unmut über die Arbeit des Deichverbandes Luft: "Der<br />
Deichverband muss sparsam mit den Geldern umgehen. <strong>Die</strong> Bürger sind es, die auf weite Sicht die Schulden tragen müssten."<br />
Weiterhin betonte er, dass die zahlreiche Teilnahme der Bürger unverzichtbar sei. Eine weitere Versammlung des SVN <strong>zu</strong>m<br />
gleichen Thema findet <strong>Die</strong>nstag, 10.Juli, ab 20 Uhr in der Gaststätte "Wienemann" in Vynen statt.<br />
NRZ Moers 06.07.2001<br />
Interessen werden geschützt<br />
MELDUNG DES TAGES<br />
MOERS. Zur Berichterstattung der jüngsten Tage um die potentielle Hochwassergefährdung durch den <strong>Berg</strong>bau am<br />
Niederrhein nimmt jetzt die <strong>Stadt</strong> Stellung: Beim Hochwasserschutz werden die Interessen der <strong>Stadt</strong> und ihrer Bevölkerung<br />
vertreten durch die Deichverbände Friemersheim und Orsoy sowie das Staatliche Umweltamt Krefeld und den Kreis Wesel.<br />
Das NRW-Umweltministerium <strong>hat</strong> die Hochwasserschadenspotentiale am Rhein durch eine Studie untersuchen lassen, an der<br />
das Umweltamt Krefeld beteiligt war. <strong>Die</strong> <strong>Stadt</strong> teilt die Einschät<strong>zu</strong>ng des Umweltamtes, dass die Problematik bisher nach<br />
Recht und Gesetz abgearbeitet wird und weiterhin abgearbeitet werden muss. <strong>Die</strong>s garantiert auch, dass die Interessen der<br />
<strong>Stadt</strong> und der Einwohner geschützt werden. <strong>Die</strong> <strong>Stadt</strong> hält enge Kontakte <strong>zu</strong> den Nachbargemeinden und allen<br />
Deichverbänden und Behörden.<br />
NRZ Moers 06.07.2001<br />
2002 ist der Förderturm weg<br />
Sprengung ist nicht möglich. Der Abriss beginnt Anfang des kommenden Jahres.<br />
MOERS. Nicht viele Leute, eigentlich nur die Anwohner, werden sich noch erinnern, als Lastwagen in den 60-er, Beginn der 70er<br />
Jahre "Schlange" auf den Zufahrtsstraßen <strong>zu</strong>r Zeche Rheinpreussen standen, um auf Kohle <strong>zu</strong> warten. Betroffen über die<br />
<strong>Berg</strong>werksstraße hinaus war damals die Tervoortstraße, auf der sich bis <strong>zu</strong>r Liebrechtstraße die Kohlentransporter stauten.<br />
Lange ist es her, dass die Kohle wegging wie warme Semmeln. Heut<strong>zu</strong>tage geht die Diskussion um den Abbau der<br />
Subventionen für den <strong>Berg</strong>bau unaufhörlich weiter.<br />
Teufarbeiten begannen 1958<br />
Kurzer Blick <strong>zu</strong>rück: 1958 begannen die Teufarbeiten des Schachtes 9 auf dem Gelände der damals eigenständigen<br />
Schachtanlage Rheinpreussen. 1990 wurde Rheinpreussen <strong>zu</strong>gemacht. Bald verschwindet ein letztes Relikt von der<br />
Oberfläche: Der Förderturm von Schacht 9. Zuvor war es nötig, den 650 Meter tiefen Schacht <strong>zu</strong> verfüllen. Zwei Wochen<br />
dauerte dies. Eine Vollverfüllung war aber nicht zwingend: In 300 Metern Teufe <strong>hat</strong>ten <strong>Berg</strong>leute eine massive Bühne<br />
aufgebaut, ein aus schweren Stahlträgern bestehendes Widerlager. Der eingebrachte Betonpfropfen trägt sich selbst. <strong>Die</strong><br />
Bühne dient als <strong>zu</strong>sätzliches Sicherheitselement. Den Entschluss für diese Teilverfüllung fällten Gutachter. Als<br />
Entscheidungshilfen spielten die Wirtschaftlichkeit der Maßnahme, die bergmännischen Randbedingungen wie Wasser<strong>zu</strong>läufe,<br />
Tiefe des Sumpfes, Trockenheit des Schachtes eine große Rolle. Rund 12 000 Festkubikmeter Verfüllmaterial flossen in den<br />
7,30 Meter im Durchmesser messenden Schacht. Täglich brachten jeweils 200 Lkw Zuschlagstoffe wie Rheinsand, Rheinkies<br />
und Brechmix <strong>zu</strong>m Standort Rheinpreussen. Zwei Radlader füllten kontinuierlich den Behälter für die Zuschlagstoffe der<br />
Verfüllanlage. Mit einer Leistung von bis <strong>zu</strong> 1,5 Kubikmeter pro Minute transportierte anschließend ein bis <strong>zu</strong>r Schachtmitte<br />
ragendes Förderband den Beton in den Schacht. Zu Beginn des kommenden Jahres soll also auch der gemauerte Förderturm<br />
abgerissen werden. Da die örtlichen Gegebenheiten eine Sprengung verbieten, muss der Turm Stein für Stein abgetragen<br />
werden - mit entsprechendem Gerät obendrauf. 2002 soll das Gelände von Schacht 9 dann anders genutzt werden können.<br />
NRZ Rheinhausen 06.07.2001<br />
Bricht der Deich, gibt es viele Tote<br />
Der Schutzverband Niederrhein befürchtet schlimmes Szenario. <strong>Die</strong> Landschaft würde überflutet. Warum ist es am Rhein so<br />
schön? Weil die Menschen so lustig ..., heißt es. Doch damit dürfte Schluss sein, wenn das Szenario eintritt, vor dem die<br />
Schutzgemeinschaft <strong>Berg</strong>bau und der Schutzverband Niederrhein nicht müde werden <strong>zu</strong> warnen. Durch das Wirken der Zechen<br />
Walsum, Friedrich-Heinrich und auch des Salzbergwerkes Solvay in Rheinberg, so Hans-Peter Feldmann, Vorsitzender der<br />
Schutzgemeinschaft Niederrhein, sei die gesamte Fläche von Krefeld über Baerl bis Xanten betroffen. Ein Gebiet, in dem rund<br />
300 000 Menschen wohnen. "<strong>Die</strong> Leute kennen gar nicht die Problematik. Bei einem Deichbruch - und selbst an neuen<br />
Deichkörpern wie in Mehrum sind Rissbildungen deutlich erkennbar - sind etliche tausend Tote <strong>zu</strong> befürchten."<br />
Das ganze Gelände ist abgesunken
In diesem Zusammenhang erinnert sich Feldmann an die Flutkatastrophe von 1926, als das Wasser in Moers bis bei<br />
"Steinschen" vor der Theke stand. "Und das Gelände ist mittlerweile noch einmal um 10 bis 15 Meter gesunken." Außerdem<br />
müssten auf Ewigkeit Millionen von Kubikmeter Wasser abgepumpt werden, was ein weiteres Absinken des Geländes <strong>zu</strong>r Folge<br />
habe. Aktueller Anlass ist die Erörterung des Rahmenbetriebsplans des <strong>Berg</strong>werks Walsum, die erstmal vertagt wurde. Der<br />
Unmut vieler Menschen über den künftigen Kohleabbau der Zeche im Norden schwappt auch auf die linke Rheinseite über.<br />
Genau wie der Rhein, wenn man sich die Ausmaße vorstellt, die das Umweltministerium für ein 200-jährliches Hochwasser<br />
beschreibt. Denn bei einem möglichen Deichbruch würde ein großer Teil des linken Niederrheins überflutet werden. Ob im Fall<br />
Walsum, wo durch die Verzögerung das <strong>Berg</strong>werk existenziell bedroht ist, noch einmal ein Termin anberaumt wird, steht nach<br />
Ansicht von Umweltanwalt Klaus Kall in den Sternen. <strong>Die</strong> Erfahrung zeige, dass damit meist das Ende eingeläutet werde.<br />
Ähnliche Gefahren sieht Werner Raue von der Schutzgemeinschaft auch auf Friedrich-Heinrich in Kamp-Lintfort <strong>zu</strong>kommen:<br />
"<strong>Die</strong> haben mit ihrem Rahmenbetriebsplan schon zwei Jahre verloren." So fehle dort jeder Hinweis, dass es <strong>zu</strong><br />
Überschwemmungen kommen kann. "<strong>Die</strong> Bedrohung ist schon da, der <strong>Berg</strong>bau verschlimmert die Situation nur." Dabei suchen<br />
Raue & Co. durchaus den Kompromiss. Und sie sind nicht mehr allein. Sowohl die Bezirksregierung Düsseldorf als auch das<br />
Staatliche Umweltamt in Krefeld stützen diese Position und sprachen dem Walsumer Rahmenbetriebsplan die Erörterungsreife<br />
ab. Ziel sei es, den Abbau unter dicht besiedelten Gegenden <strong>zu</strong> verhindern. Dafür brauche man aber die Unterstüt<strong>zu</strong>ng von<br />
allen Seiten. (uwe/mawo)<br />
NRZ Moers 06.07.2001<br />
BRIEFE AN DIE REDAKTION<br />
Deichbruch-Szenario schürt Angst<br />
Mit großer Verwunderung haben wir diesen Bericht gelesen. Da werden Ängste geschürt, um persönliche Interessen<br />
durch<strong>zu</strong>setzen. Wir sind auch erstaunt, wie die Herren mit 9500 Arbeitsplätzen und noch einmal so vielen in abhängigen<br />
Betrieben umgehen. <strong>Die</strong> Idee, <strong>Berg</strong>bauartikel nach Polen <strong>zu</strong> verkaufen, ist nicht <strong>zu</strong> überbieten. Der polnische <strong>Berg</strong>bau wartet<br />
sicher nur darauf, den <strong>Berg</strong>leuten hier Arbeit <strong>zu</strong> verschaffen. Wir fragen uns auch, welche Interessen die Herren Feldmann und<br />
Raue als ehemalige <strong>Berg</strong>baubeschäftigte verfolgen. Sind ihnen im Berufsleben etwa nicht alle Wünsche erfüllt worden ? Wir<br />
wünschen den Herren dennoch viele Jahre Zufriedenheit mit ihren Knappschaftsrenten.<br />
NRZ Rheinhausen 06.07.2001<br />
ZUR SACHE<br />
1000 Jahre lang pumpen<br />
Beim Thema "<strong>Berg</strong>bau" erleben wir <strong>zu</strong>r Zeit einen Paradigmenwechsel. Stellungnahmen gegen den <strong>Berg</strong>bau, die noch vor<br />
wenigen Jahren in dieser Kohle- und Stahl-Region tabu waren, sind heute an jeder Ecke <strong>zu</strong> haben. Weil immer weniger<br />
Arbeitsplätze vom <strong>Berg</strong>bau abhängen, dürfen heute die Kosten und andere Folgen der Kohleförderung wie mögliche<br />
Deichbrüche aufgezeigt werden. <strong>Die</strong>ser Schnitt durch einen Traditionsstrang bedeutet auch den Bruch mit einer Identität, die<br />
die Menschen an Rhein und Ruhr geprägt <strong>hat</strong>. <strong>Die</strong> Deutsche Steinkohle AG macht es den Kritikern dabei leicht: <strong>Die</strong><br />
Notwendigkeit einer neuen Abbaustrecke konnte bei der Erörterung des Rahmenbetriebsplanes für das <strong>Berg</strong>werk Walsum nicht<br />
hinreichend dargelegt werden. Das muss sie aber, weil sich der Blick heute in die Zukunft richtet. Denn eines ist gewiss: Wegen<br />
der Niveau-Absenkung der Oberfläche müsste noch mehr Grundwasser gepumpt werden als schon heute - 1000 Jahre lang.<br />
Der <strong>Berg</strong>bau und die Folgekosten<br />
NRZ Rheinhausen 06.07.2001<br />
Bricht der Deich, gibt es viele Tote<br />
Der Schutzverband Niederrhein befürchtet schlimmes Szenario. <strong>Die</strong> Landschaft würde überflutet. Warum ist es am Rhein so<br />
schön? Weil die Menschen so lustig ..., heißt es. Doch damit dürfte Schluss sein, wenn das Szenario eintritt, vor dem die<br />
Schutzgemeinschaft <strong>Berg</strong>bau und der Schutzverband Niederrhein nicht müde werden <strong>zu</strong> warnen. Durch das Wirken der Zechen<br />
Walsum, Friedrich-Heinrich und auch des Salzbergwerkes Solvay in Rheinberg, so Hans-Peter Feldmann, Vorsitzender der<br />
Schutzgemeinschaft Niederrhein, sei die gesamte Fläche von Krefeld über Baerl bis Xanten betroffen. Ein Gebiet, in dem rund<br />
300 000 Menschen wohnen. "<strong>Die</strong> Leute kennen gar nicht die Problematik. Bei einem Deichbruch - und selbst an neuen<br />
Deichkörpern wie in Mehrum sind Rissbildungen deutlich erkennbar - sind etliche tausend Tote <strong>zu</strong> befürchten."<br />
Das ganze Gelände ist abgesunken<br />
In diesem Zusammenhang erinnert sich Feldmann an die Flutkatastrophe von 1926, als das Wasser in Moers bis bei<br />
"Steinschen" vor der Theke stand. "Und das Gelände ist mittlerweile noch einmal um 10 bis 15 Meter gesunken." Außerdem<br />
müssten auf Ewigkeit Millionen von Kubikmeter Wasser abgepumpt werden, was ein weiteres Absinken des Geländes <strong>zu</strong>r Folge<br />
habe. Aktueller Anlass ist die Erörterung des Rahmenbetriebsplans des <strong>Berg</strong>werks Walsum, die erstmal vertagt wurde. Der<br />
Unmut vieler Menschen über den künftigen Kohleabbau der Zeche im Norden schwappt auch auf die linke Rheinseite über.<br />
Genau wie der Rhein, wenn man sich die Ausmaße vorstellt, die das Umweltministerium für ein 200-jährliches Hochwasser<br />
beschreibt. Denn bei einem möglichen Deichbruch würde ein großer Teil des linken Niederrheins überflutet werden. Ob im Fall<br />
Walsum, wo durch die Verzögerung das <strong>Berg</strong>werk existenziell bedroht ist, noch einmal ein Termin anberaumt wird, steht nach<br />
Ansicht von Umweltanwalt Klaus Kall in den Sternen. <strong>Die</strong> Erfahrung zeige, dass damit meist das Ende eingeläutet werde.<br />
Ähnliche Gefahren sieht Werner Raue von der Schutzgemeinschaft auch auf Friedrich-Heinrich in Kamp-Lintfort <strong>zu</strong>kommen:<br />
"<strong>Die</strong> haben mit ihrem Rahmenbetriebsplan schon zwei Jahre verloren." So fehle dort jeder Hinweis, dass es <strong>zu</strong><br />
Überschwemmungen kommen kann. "<strong>Die</strong> Bedrohung ist schon da, der <strong>Berg</strong>bau verschlimmert die Situation nur." Dabei suchen<br />
Raue & Co. durchaus den Kompromiss. Und sie sind nicht mehr allein. Sowohl die Bezirksregierung Düsseldorf als auch das<br />
Staatliche Umweltamt in Krefeld stützen diese Position und sprachen dem Walsumer Rahmenbetriebsplan die Erörterungsreife<br />
ab. Ziel sei es, den Abbau unter dicht besiedelten Gegenden <strong>zu</strong> verhindern. Dafür brauche man aber die Unterstüt<strong>zu</strong>ng von<br />
allen Seiten. (uwe/mawo)<br />
Rheinische Post, Kamp-Lintfort 06.07.2001<br />
Nach Walsum sehen Bürgerinitiativen den Kamp-Lintforter<br />
Rahmenbetriebsplan scheitern<br />
<strong>Berg</strong>werk West: Anfang vom Ende?
KAMP-LINTFORT (RP). Nach der Unterbrechung der Rahmenbetriebsplan-Erörterung für das rechtsrheinische<br />
<strong>Berg</strong>werk Walsum bereiten sich die Bürgerinitiativen nun auf die Verteidigung des linken Niederrheins gegen den<br />
Rahmenbetriebsplan der Kamp-Lintforter Zeche Friedrich Heinrich vor. "Ich bin sehr optimistisch, dass in Walsum<br />
noch etwas passiert und Kamp-Lintfort seine Pläne aufgeben muss", sagte der Vorsitzende der<br />
Schutzgemeinschaft <strong>Berg</strong>bau, Werner Raue, gestern bei einem Pressegespräch in Rheinberg: "Über der Zeche<br />
schwebt wie in Walsum das Risiko des Deichbruchs. Der Plan muss <strong>zu</strong>rückgenommen werden."<br />
Von ULLI TÜCKMANTEL<br />
<strong>Die</strong> Haltung der <strong>Stadt</strong> Moers, die Gefahr einer Hochwasserkatastrophe (RP vom Montag) <strong>zu</strong> ignorieren,<br />
kommentierte Raue mit Unverständnis: "<strong>Die</strong> haben wohl entschieden: Wir schlafen so lange weiter, bis das<br />
Wasser uns kalt macht." Der Moerser Umweltanwalt Klaus Kall, der die Initiativen vertritt, will nun auch mit<br />
<strong>Berg</strong>recht gegen die Abbaupläne <strong>zu</strong> Felde ziehen: "<strong>Die</strong> DSK <strong>hat</strong> nicht glaubhaft gemacht, dass sie in den<br />
geplanten Feldern wirtschaftlich Kohle gewinnen kann. Daher ist das ihr verliehene <strong>Berg</strong>werkseigentum <strong>zu</strong><br />
widerrufen."<br />
"DSK-Söldner" Vöge und Roth<br />
Er gehe nicht davon aus, so Kall gestern, dass der Walsumer Erörterungstermin tatsächlich fortgesetzt wird: "Es<br />
steht meines Erachtens in den Sternen. Es könnte auch der Ende sein." Befriedigt stellte Kall nochmals fest, dass<br />
sich bisher nicht die Strippenzieher, sondern Recht und Gesetz durchgesetzt hätten. <strong>Die</strong> Voerder und Kamp-<br />
Lintforter SPD-Landtagsabgeordneten Horst Vöge und Wolfgang Roth nannte Kall "DSK-Söldner". Kall, selbst<br />
SPD-Mitglied, erklärte, er buchstabiere SPD nicht als "Subventionspartei Deutschlands."<br />
Moers im Großpolder<br />
<strong>Die</strong> Argumente, die sowohl die Schutzgemeinschaft <strong>Berg</strong>bau (SGB) als auch die Schutzgemeinschaft Niederrhein<br />
(SVN) gegen den Rahmenbetriebsplan für das künftige <strong>Berg</strong>werk West vorbringen, decken sich mit den<br />
Walsumer Einwänden. Der SVN-Vorsitzende Hans-Peter Feldmann: "Ich war selbst im <strong>Berg</strong>bau beschäftigt,<br />
<strong>zu</strong>letzt auf Friedrich-Heinrich.<br />
Wir haben da über alles mögliche nachgedacht, nur nie über Hochwasser." Auch Feldmann staunt über die<br />
Sorglosigkeit im Moerser Rathaus: "Zwischen Krefeld und Xanten ist ein Großpolder in einer Geländewanne<br />
entstanden, aus der das Hochwasser gar nicht mehr abfließen könnte. In Moers beträgt die Überstauung sechs<br />
bis acht Meter."<br />
Deshalb hätte Feldmann jetzt gern mal einen Antwort auf einen Bürgerantrag <strong>zu</strong>m Hochwasserschutz, der seit<br />
Oktober 1999 bei der <strong>Stadt</strong> Moers versauert. Derweil ist Raue guter Dinge, dass der Kamp-Lintforter<br />
Rahmenbetriebsplan kippt: "Seit August letzten Jahres liegt der Antrag im Keller des früheren<br />
Landesoberbergsamts. <strong>Die</strong> Anregung, ihn komplett <strong>zu</strong> überarbeiten und neu ein<strong>zu</strong>reichen, <strong>hat</strong> das <strong>Berg</strong>werk<br />
ignoriert.<br />
Das wird es <strong>Berg</strong>werk im Erörterungsverfahren bitter bereuen. Ich kann das aus unserer Sicht begrüßen, aber<br />
aus Sicht der Kohle nicht verstehen." Schon jetzt habe die Kamp-Lintforter Zeche zwei Jahre verloren, den<br />
Hochwasserschutz nicht berücksichtigt und einen Plan vorgelegt, der trotz anderer Felder dicht besiedeltes<br />
Gebiet untergraben soll. Raue: "Ich sage damit nicht, dass Friedrich Heinrich geschlossen wird." <strong>Die</strong> DSK wolle<br />
erst nach der Bundestagswahl sagen, welche Zechen sie schließt.<br />
NRZ Rheinberg 05.07.2001<br />
Kommt die Flut, ist Schluss mit lustig<br />
Schutzgemeinschaften warnen eindringlich vor Gefahren des Kohleabbaus.<br />
AM NIEDERRHEIN. Warum ist es am Rhein so schön? Weil die Menschen so lustig . . . , heißt es. Doch damit dürfte wohl<br />
Schluss sein, wenn das Szenario eintritt, vor dem die Schutzgemeinschaft <strong>Berg</strong>bau Rheinberg und der Schutzverband<br />
Niederrhein nicht müde werden <strong>zu</strong> warnen. Aktueller Anlass ist die Erörterung des Rahmenbetriebsplans des <strong>Berg</strong>werks<br />
Walsum, die jetzt erst mal vertagt wurde. <strong>Die</strong> Vorsitzenden, Werner Raue und Hans-Peter Feldmann <strong>hat</strong>ten gestern <strong>zu</strong> einem<br />
Pressegespräch geladen, an dem auch Klaus Kall, Rechtsbeistand der Schutzgemeinschaft teilnahm, um die Auswirkungen des<br />
<strong>zu</strong>künftigen Steinkohleabbaus am linken Niederrhein vor<strong>zu</strong>stellen. Um die Relation Schutz von Arbeitsplätzen gegenüber<br />
Schutz von Menschen und Lebensraum <strong>zu</strong> verdeutlichen, legte Schutzgemeinschaft-Vorsitzender Werner Raue eigene<br />
Berechnungen auf den Tisch. Demnach sei nach der derzeitigen Planung bis Ende 2005 auf den Schachtanlagen Friedrich-<br />
Heinrich, Lohberg und Walsum von einer Gesamtbelegschaft von 9500 aus<strong>zu</strong>gehen. 3000 davon kämen nicht aus dem Kreis<br />
Wesel. So entspreche dann der Beschäftigungsanteil der Erwerbstätigen im <strong>Berg</strong>bau im Kreis Wesel gerade mal drei Prozent.<br />
Auch dass die Zulieferer Schaden nehmen könnten, lässt er nicht gelten: "Andere Länder wie Polen, wo die dreifache Menge<br />
wie in Deutschland abgebaut wird, haben riesigen Modernisierungsbedarf. Das ist ein idealer Markt für die<br />
Ausrüstungsindustrie." Andererseits, so Hans-Peter Feldmann seien durch das Wirken von Walsum, Friedrich-Heinrich und<br />
auch des Salzbergwerkes Solvay die gesamte Fläche von Krefeld bis Xanten betroffen. Eine Wanne, in der rund 300 000<br />
Menschen wohnen. Feldmann: "<strong>Die</strong> Leute kennen gar nicht die Problematik. Bei einem Deichbruch - und selbst an neuen<br />
Deichkörpern wie in Mehrum sind Rissbildungen deutlich erkennbar - sind etliche tausende Tote <strong>zu</strong> befürchten." Er erinnerte in<br />
diesem Zusammenhang an die Flutkatastrophe von 1926, als das Wasser in Moers bis <strong>zu</strong>r "Steinschen-Kreu<strong>zu</strong>ng" stand. "Und<br />
das Gelände ist mittlerweile noch einmal um 10 bis 15 Meter gesunken." Außerdem müsse auf Ewigkeit Millionen Liter Wasser<br />
abgepumpt werden, was ein weiteres Absinken des Geländes <strong>zu</strong>r Folge habe. Ob im Fall Walsum, wo durch die Verzögerung<br />
das <strong>Berg</strong>werk existenziell bedroht ist, noch einmal ein Erörterungstermin anberaumt wird, steht nach Ansicht von Klaus Kall in<br />
den Sternen. <strong>Die</strong> Erfahrung zeige, dass damit meist das Ende eingeläutet werde. Ähnliche Gefahren sieht Werner Raue auch<br />
auf Friedrich-Heinrich <strong>zu</strong>kommen: "<strong>Die</strong> haben mit ihrem Rahmenbetriebsplan schon zwei Jahre verloren." So fehle dort jeder
Hinweis, dass es <strong>zu</strong> Überschwemmungen kommen kann. Dabei suchen Raue & Co. durchaus den Kompromiss. Das Ziel sei,<br />
das Hochwasserrisiko <strong>zu</strong> bannen und den Abbau unter dicht besiedelten Gegenden wie Rheinberg - 30 Prozent der begehrten<br />
Kohle liegt unter bebauten Gebieten - <strong>zu</strong> verhindern. dafür brauche es Unterstüt<strong>zu</strong>ng von allen Seiten. Underberg habe da<br />
schon eine Zusage gegeben. Klaus Kall will den <strong>Berg</strong>bau noch mit anderen rechtlichen Instrumenten in die Zange nehmen:<br />
"Das so genannte <strong>Berg</strong>werkseigentum ist wegen Unwirtschaftlichkeit <strong>zu</strong> widerrufen. <strong>Die</strong>s ist so im Paragrafen 13 des<br />
<strong>Berg</strong>gesetzes festgelegt."<br />
NRZ Moers 05.07.2001<br />
"Bei Deichbruch Tote <strong>zu</strong> befürchten"<br />
Schutzverband Niederrhein befürchtet schlimmes Szenario. Kommentar über Moers: "<strong>Die</strong> schlafen weiter".<br />
AM NIEDERRHEIN. Warum ist es am Rhein so schön? Weil die Menschen so lustig . . ., heißt es. Doch damit dürfte wohl<br />
Schluss sein, wenn das Szenario eintritt, vor dem die Schutzgemeinschaft <strong>Berg</strong>bau Rheinberg und der Schutzverband<br />
Niederrhein nicht müde werden <strong>zu</strong> warnen. Aktueller Anlass ist die Erörterung des Rahmenbetriebsplans des <strong>Berg</strong>werks<br />
Walsum, die jetzt erst mal vertagt wurde. <strong>Die</strong> Vorsitzenden, Werner Raue und Hans-Peter Feldmann, <strong>hat</strong>ten gestern <strong>zu</strong> einem<br />
Pressegespräch geladen, an dem auch Klaus Kall, Rechtsbeistand der Schutzgemeinschaft teilnahm, um die Auswirkungen des<br />
<strong>zu</strong>künftigen Steinkohleabbaus am linken Niederrhein vor<strong>zu</strong>stellen.<br />
Eigene Rechnung aufgemacht<br />
Um die Relation Schutz von Arbeitsplätzen gegenüber Schutz von Menschen und Lebensraum <strong>zu</strong> verdeutlichen, legte<br />
Schutzgemeinschaft-Vorsitzender Werner Raue eigene Berechnungen auf den Tisch. Demnach sei nach der derzeitigen<br />
Planung bis Ende 2005 auf den Schachtanlagen Friedrich-Heinrich, Lohberg und Walsum von einer Gesamtbelegschaft von<br />
9500 aus<strong>zu</strong>gehen. 3000 davon kämen nicht aus dem Kreis Wesel. So entspreche dann der Beschäftigungsanteil der<br />
Erwerbstätigen im <strong>Berg</strong>bau im Kreis Wesel gerade mal drei Prozent. Auch dass die Zulieferer Schaden nehmen könnten, lässt<br />
er nicht gelten: "Andere Länder wie Polen, wo die dreifache Menge wie in Deutschland abgebaut wird, haben riesigen<br />
Modernisierungsbedarf. Das ist ein idealer Markt für die Ausrüstungsindustrie." Andererseits, so Hans-Peter Feldmann seien<br />
durch das Wirken von Walsum, Friedrich-Heinrich und auch des Salzbergwerkes Solvay die gesamte Fläche von Krefeld bis<br />
Xanten betroffen. Ein Gebiet, in dem rund 300 000 Menschen wohnen. Feldmann: "<strong>Die</strong> Leute kennen gar nicht die Problematik.<br />
Bei einem Deichbruch - und selbst an neuen Deichkörpern wie in Mehrum sind Rissbildungen deutlich erkennbar - sind etliche<br />
tausende Tote <strong>zu</strong> befürchten."<br />
Flutkatastrophe von 1926<br />
Er erinnerte in diesem Zusammenhang an die Flutkatastrophe von 1926, als das Wasser in Moers bis bei "Steinschen" vor der<br />
Theke stand. "Und das Gelände ist mittlerweile noch einmal um 10 bis 15 Meter gesunken." Außerdem müsse auf Ewigkeit<br />
Millionen von Kubikmeter Wasser abgepumpt werden, was ein weiteres Absinken des Geländes <strong>zu</strong>r Folge habe. Dass da der<br />
Moerser Beigeordnete Wusthoff von Panikmache und keinen Handlungsbedarf sprach (wir berichteten), kommentierten die<br />
Anwesenden unisono: "<strong>Die</strong> schlafen weiter." Ob im Fall Walsum, wo durch die Verzögerung das <strong>Berg</strong>werk existenziell bedroht<br />
ist, noch einmal ein Erörterungstermin anberaumt wird, steht nach Ansicht von Klaus Kall in den Sternen. <strong>Die</strong> Erfahrung zeige,<br />
dass damit meist das Ende eingeläutet werde. Ähnliche Gefahren sieht Werner Raue auch auf Friedrich-Heinrich <strong>zu</strong>kommen:<br />
"<strong>Die</strong> haben mit ihrem Rahmenbetriebsplan schon zwei Jahre verloren." So fehle dort jeder Hinweis, dass es <strong>zu</strong><br />
Überschwemmungen kommen kann. Dabei suchen Raue & Co. durchaus den Kompromiss. Das Ziel sei, das Hochwasserrisiko<br />
<strong>zu</strong> bannen und den Abbau unter dicht besiedelten Gegenden wie Rheinberg - 30 Prozent der begehrten Kohle liegt unter<br />
bebauten Gebieten - <strong>zu</strong> verhindern. dafür brauche es Unterstüt<strong>zu</strong>ng von allen Seiten. Underberg habe da schon eine Zusage<br />
gegeben. (uwe).<br />
NRZ Niederrhein 05.07.2001<br />
Kreis: Geplanter Kohleabbau betrifft noch mehr Kommunen<br />
AM NIEDERRHEIN. Vom geplanten Kohleabbau des <strong>Berg</strong>werks Walsum sind auch linksrheinische Kommunen betroffen.<br />
Darauf <strong>hat</strong> der Kreis Wesel bei einem Erörterungstermin <strong>zu</strong>m Rahmenbetriebsplan hingewiesen. Folgerichtig müssten auch<br />
Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn, Wesel, Xanten, Alpen und Sonsbeck an der Erörterung beteiligt werden. Denn bei einem<br />
möglichen Deichbruch innerhalb des Wirkungsbereichs der Zeche Walsum bestehe auch für diese Kommunen eine Gefahr.<br />
Träger öffentlicher Belange und Experten des Katastrophenschutzes hätten kürzlich dargelegt, dass das Risiko eines<br />
Deichbruchs bei untertägigem Steinkohlebergbau und Erhöhung der Deiche grundsätzlich steige. Damit entstehe wegen der<br />
vorhandenen großflächigen Polder eine Betroffenheit über den bisherigen Untersuchungsraum hinaus.<br />
NRZ Moers 04.07.2001<br />
<strong>Berg</strong>bau im Erklärungsnotstand<br />
ZUR SACHE Rahmenbetriebsplan sorgt viele Niederrheiner.<br />
<strong>Die</strong> Emotionen bei der Erörterung <strong>zu</strong>m Rahmenbetriebsplan für das <strong>Berg</strong>werk Walsum schlagen hohe Wellen. <strong>Die</strong> Gefahr<br />
besteht, dass die hochbrandende Diskussion um das Pro und Contra auch über den Rhein <strong>zu</strong>m linken Niederrhein<br />
rüberschwappt. Jetzt verlangt der Kreis, dass auch Städte wie Kamp-Lintfort, Moers oder Neukirchen-Vluyn beteiligt werden.<br />
Denn eine "Risikobetrachtung" brachte es ans Tageslicht: Für den Fall eines Deichbruchs seien auch die genannten Städte<br />
wegen des untertägigen Steinkohlebergbaus direkt betroffen. Man muss sich vorstellen: Moers, Neukirchen-Vluyn, Kamp-<br />
Lintfort aber auch Alpen unter Wasser. Gut, wer will behaupten, das solche Gefahren einfach aus<strong>zu</strong>schließen sind? Nur: Wenn<br />
die Diskussion darum in einem Meer unsachgemäßer Vermutungen und Behauptungen tobt, dann "Gute-Nacht" <strong>Berg</strong>bau !<br />
Insofern sollte der <strong>Berg</strong>bau als Verursacher alles tun, für Aufklärung <strong>zu</strong> sorgen. Und er sollte ehrlich genug sein, dann wirklich<br />
den Rück<strong>zu</strong>g an<strong>zu</strong>treten. Lange Zeit wird es ihn ja nun wirklich nicht mehr in diesen Ausmaßen geben. Der Strukturwandel<br />
nimmt konkrete Formen an, und die Deutsche Steinkohle <strong>hat</strong> genug andere Pfründe...<br />
NRZ Moers 04.07.2001<br />
Deichbruchgefahr fordert Städte<br />
Der Kreis Wesel <strong>hat</strong> beim Erörterungstermin "Rahmenbetriebsplan fürs <strong>Berg</strong>werk Walsum" darauf hingewiesen, dass auch noch<br />
weitere Kommunen im Kreis Wesel, die von der Planung betroffen sind, auch beteiligt werden sollen. Knochen müssen <strong>zu</strong>rück<br />
ins Grab Das im Boden der Vluyner Kirche aufgetauchte Pastorengrab muss wieder hergestellt werden. Das ist das Urteil des<br />
Bodendenkmalpflegers. Er war entsetzt über die Zerstörung. <strong>Die</strong> Kirchengemeinde ist sauer auf Museumsleiter Wilhelm Maas.
NRZ Moers 04.07.2001<br />
Deichbruchgefahr fordert Städte<br />
Erörterungstermin für die benachbarte Zeche Walsum. Auch linksrheinische Kommunen sollen sich äußern.<br />
AM NIEDERRHEIN. Der Unmut vieler Menschen über den künftigen Kohleabbau der Zeche Walsum schwappt auch auf die<br />
linke Rheinseite über. Der Kreis Wesel <strong>hat</strong> beim Erörterungstermin "Rahmenbetriebsplan fürs <strong>Berg</strong>werk Walsum" darauf<br />
hingewiesen, dass weitere Kommunen im Kreis von der Planung betroffen sind, die man daher auch beteiligen solle. Genannt<br />
werden Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn, Wesel, Xanten, Alpen und Sonsbeck. Grund: Bei einem eventuell möglichen<br />
Deichbruch innerhalb des Wirkungsbereiches der Zeche Walsum seien diese Kommunen direkt betroffen. Der Moerser<br />
Beigeordnete Wusthoff meinte gestern: "Da wird viel mit Ängsten gearbeitet, in Moers jedenfalls sehen wir keinen<br />
Handlungsbedarf."<br />
NRZ Moers 29.06.2001<br />
<strong>Berg</strong>bau soll für Bettenkamp zahlen<br />
<strong>Die</strong> Deutsche Steinkohle soll für die Verseuchung des Bettenkamper Meeres aufkommen. <strong>Die</strong>s fordern die Freunde des<br />
Naturfreibades, die jetzt einen neuen Vorstand wählten. Auch Klaus Kall gehört künftig da<strong>zu</strong>. Auf die <strong>Stadt</strong> wird Druck ausgeübt.<br />
FBG startet Bürgerbefragung Um sich grundsätzliches Wissen für das neue <strong>Stadt</strong>marketing-Konzept <strong>zu</strong> beschaffen, startet die<br />
freie Bürgergemeinschaft Kamp-Lintfort eine große Bürgerbefragung. Es sind Aktionen geplant, Fragebögen werden an die<br />
Passanten verteilt.<br />
Text<br />
NRZ Moers 29.06.2001<br />
Unabhängig lebt es sich besser<br />
Und die Bürger haben auch was davon Es gibt doch noch gute Nachrichten. Um 21 Prozent senkt der örtliche Energieversorger<br />
ENNI ab morgen seine Gaspreise. Da dürfen sich die Gaskunden freuen. Der Durchschnittshaushalt soll rund 350 Mark im Jahr<br />
weniger zahlen. Natürlich macht die Senkung die Erhöhung vom Jahresbeginn teils wieder wett. Dennoch bleibt hervor<strong>zu</strong>heben,<br />
dass der Versorger vor Ort rasch und bürgernah reagiert. Ob das auch so wäre, wenn ENNI dem Rathaus gehörte? Wohl nicht.<br />
<strong>Die</strong> Beamten hätten ob der knappen Kassenlage die Gas-Einnahmen ganz sicher in den Schuldentopf versenkt. Und<br />
überhaupt: ENNI ist ein modernes Unternehmen. Es <strong>hat</strong> ihm gut getan, dass es 1985 aus der <strong>Stadt</strong>verwaltung herausgelöst,<br />
dann erst in einen Eigenbetrieb und dann in eine GmbH umgewandelt worden ist. Und die Mitarbeiter sind froh, dass sie nun in<br />
einer florierenden Firma arbeiten, die mitunter sogar die Preise senken kann. Daher ist das politische Gezeter um den<br />
Betriebshof nicht mehr nach<strong>zu</strong>vollziehen. Zur Klarstellung sollte nicht vergessen werden, dass sämtliche Fraktionen für<br />
Veränderungen sind. Beschlossen ist, dass der Betriebshof ab 2002 ein Eigenbetrieb sein soll. Mit einem Chef, der dem<br />
mittelständischen Betrieb neue Strukturen verpassen soll. Gesichert ist dabei die Mitbestimmung, <strong>zu</strong>dem steht die Zusage der<br />
<strong>Stadt</strong>spitze, dass niemand entlassen werden soll. Wo anders, bitteschön, gibt es derartig komfortable Verhältnisse?<br />
In der Privatwirtschaft herrschen ganz andere Töne. Zum Beispiel im <strong>Berg</strong>bau. <strong>Die</strong> Kumpel von Friedrich-Heinrich und auf<br />
Niederberg verfolgen in diesen Tagen sehr genau die Anhörung <strong>zu</strong>m Rahmenbetriebsplan im benachbarten Walsum. <strong>Die</strong><br />
Anhörung muss in der Rhein-Ruhr-Halle stattfinden, weil derartig viele Bürger Einsprüche gegen die Abbaupläne erhoben<br />
haben. Sie fürchten, dass ihre Häuser reißen und der Rheindeich brechen könnte. So viel Gegenwind <strong>hat</strong> der <strong>Berg</strong>bau noch nie<br />
erlebt. In den DSK-Chefetagen <strong>hat</strong> dies <strong>zu</strong> einem Umdenken geführt. Offenheit ist die neue Losung. Auch linksrheinisch <strong>hat</strong><br />
man da<strong>zu</strong>gelernt und legt die Pläne für die beiden <strong>Berg</strong>werke seitdem öffentlich aus. Drastische Einschnitte in die Oberfläche<br />
wird man sich nicht mehr leisten können. Dann wäre es auch hier<strong>zu</strong>lande mit der Ruhe vorbei.<br />
NRZ Duisburg 29.06.2001<br />
"Plückelmann soll sein Amt ruhen lassen"<br />
<strong>Die</strong> CDU-Bezirksfraktion Walsum <strong>hat</strong> Bezirksvorsteher Heinz Plückelmann aufgefordert, vorübergehend sein Amt ruhen <strong>zu</strong><br />
lassen. Wie für jeden anderen Bürger gelte für den SPD-Politiker <strong>zu</strong>nächst die Unschuldsvermutung, heißt es in einem<br />
Schreiben. Fest stehe aber, dass das Auto Plückelmanns im Einsatz war, als Plakate der <strong>Berg</strong>bau-Gegner von Unbekannten<br />
entfernt wurden. Sollte sich herausstellen, dass Heinz Plückelmann an dem <strong>Die</strong>bstahl mittelbar und unmittelbar beteiligt war,<br />
müsse der SPD-Politiker von seinem Amt <strong>zu</strong>rücktreten, fordert die CDU-Fraktion.<br />
NRZ Rheinberg 28.06.2001<br />
Ein neuer Eklat beim Erörterungstermin<br />
Alle "Träger öffentlicher Belange" üben scharfe Kritik an der Verhandlungsführung der Bezirksregierung Arnsberg.<br />
AM NIEDERRHEIN. Am Ende des sechsten Verhandlungstages <strong>hat</strong> der Erörterungstermin für den Rahmenbetriebsplan der<br />
Schachtanlage Walsum dort geendet, wo er am Donnerstag <strong>zu</strong>vor begonnen <strong>hat</strong>: in einer Flut von Befangenheits- und<br />
Geschäftsordnungsanträgen. Und die Erörterung selbst, so stellte es der Vertreter der <strong>Stadt</strong> Rheinberg fest, ist nicht einmal am<br />
Horizont erkennbar. Immerhin: <strong>Die</strong> Bezirksregierung Arnsberg kann die Halle jetzt bis <strong>zu</strong>m 19. Juli nutzen. Ob überhaupt<br />
Erörterungsreife besteht, wurde seit Mittwoch Nachmittag diskutiert. Neben den Bürgerinitiativen verneinten das auch sämtliche<br />
Träger öffentlicher Belange. Rechtsanwalt Kall meinte gar, die Bezirksregierung hätte längst das <strong>Berg</strong>recht entziehen müssen,<br />
weil die Wirtschaftlichkeit für den Abbau nicht gegeben sei. Das Betriebsplanverfahren hätte nicht eingeleitet werden dürfen,<br />
denn der Abbau gehe <strong>zu</strong> Lasten der Allgemeinheit. Vorsorge gegen Gefahren für Menschen und Sachgüter sei nicht getroffen<br />
worden. Fast sämtliche Untersuchungen <strong>zu</strong> Umweltrisiken fehlten dem Voerder Rechtsamtsleiter Dr. Steffen Himmelmann. Der<br />
Landschaftsplan enthalte nur nicht nachvollziehbare Behauptungen. Neue Gutachten lägen vor, die erst gesichtet und bewertet<br />
werden müssten. So liege keine Erörterungsreife vor. Sein Planungsamts-Kollege Seidel ergänzte um neu eingebrachte<br />
Aussagen <strong>zu</strong> Hochwasserrisiken. Weil sie nicht ausgelegen hätten, fehle geforderte Anstoßwirkung auf Betroffene.<br />
Völkerrecht missachtet?<br />
<strong>Die</strong> potenziellen Überflutungsflächen hinter den Deichen nehmen nach den Walsumer Plänen um 20 Prozent <strong>zu</strong>. Nach<br />
völkerrechtlichen Vereinbarungen der Rheinanliegerstaaten sollen sie aber bis 2005 um 10 Prozent <strong>zu</strong>rückgehen, verdeutlichte<br />
Jürgen Trapp (Bezirksregierung Düsseldorf). Dem Einwand des DSK-Chefmarkscheiders Dr. Emanuel Grün, die Deiche seien<br />
sicher, hielt er entgegen, es gehe nicht um die Standsicherheit, sondern die Vergrößerung des Risikopotenzials. Der<br />
Feststellung von Bernd Isselhorst (Staatliches Umweltamt Krefeld) , weltweit kenne er keine höheren Deiche, folgte<br />
Einwenderprotest: "Wir wollen keine Versuchskaninchen sein." Zum Eklat kam es nach der Mittagspause, als
Verhandlungsleiterin Dorothea Schuk erklärte, nicht mehr die Erörterungsreife diskutieren, sondern in die Tagesordnung<br />
einsteigen <strong>zu</strong> wollen, um die Verhandlung zielführend fort<strong>zu</strong>setzen. Betrug und Rechtsbeugung warf ihr <strong>BiB</strong>-Vorsitzender<br />
Rechtsanwalt Klaus Friedrichs vor. Obwohl er dem Mäßigungsgebot unterliege, kritisierte Dr. Himmelmann Verlet<strong>zu</strong>ng der<br />
kommunalen Selbstverwaltung und Planungshoheit, Eingriffe in städtebauliche Belange.<br />
NRZ Duisburg 27.06.2001<br />
Unbekannte beschmierten Kanzlei-Schild<br />
<strong>Berg</strong>werksdirektor Traud verurteilt Beschädigung bei Bürgerinitiativen-Anwalt.<br />
Für die <strong>Berg</strong>leute gehts um alles: Bereits im nächsten Jahr soll nach dem neuen Rahmenbetriebsplan im <strong>Berg</strong>werk Walsum<br />
Kohle gefördert werden können. Dass sie derzeit wenig Freunde haben und auch die Anhörung nicht wie gewünscht verläuft,<br />
<strong>hat</strong> einige Heißsporne da<strong>zu</strong> veranlasst, sich an der Praxis von Rechtsanwalt Klaus Friedrichs <strong>zu</strong> vergreifen. Das Praxisschild<br />
des Bürgeriniativen-Anwalts wurde mit der Aufschrift "Walsum" verschmiert. Damit habe der Moerser <strong>Berg</strong>amtsleiter Eberhard<br />
Mogk doch noch mit seinem Aufruf Erfolg gehabt, man solle Rädelsführer Friedrichs "einen Besuch abstatten".<br />
Befangenheitsanträge wurden abgelehnt<br />
Für die Aktion fanden sich während der Anhörung keine Sympathisanten. Versammlungsleiterin Dorothea Schuk nannte das<br />
Geschehen "unerhört" und <strong>Berg</strong>werksdirektor Wolfgang Traud kündigte personelle Konsequenzen an, wenn sich herausstelle,<br />
dass es sich um Mitarbeiter des <strong>Berg</strong>werks Walsum handelt: "Der fliegt raus." Vom Tisch sind die Befangenheitsanträge, die<br />
sich gegen die Versammlungsleiterin Dorothea Schuk richteten. <strong>Die</strong> ersten Sachdiskussionen gestern erstreckten sich auf die<br />
Sicherheit der Rheindeiche und den Fall eines Deichbruchs. Während die Katastrophenschützer der Düsseldorfer<br />
Bezirksregierung meinten, bei einem Deichbruch könne man die Menschen retten, <strong>hat</strong>te eine Übung der Feuerwehr die<br />
Befürchtung von 10 000 Toten laut werden lassen. Schließlich haben die ersten Übungen unter derzeit nicht mehr existierenden<br />
Bedingungen stattgefunden: Heute ist der Rhein schon zwei Meter höher und viele Bereiche des Rheinhinterlandes liegen unter<br />
Flußniveau. Bemängelt wurde auch die ungenaue Darstellung der Pläne. Eine Einwenderin: "Mein Haus fehlt. Wer auf den Plan<br />
schaut, denkt, da sind nur Wiesen, die absaufen." <strong>Die</strong> Anhörung in der Rhein-Ruhr-Halle wird am heutigen Donnerstag um 10<br />
Uhr vorgesetzt. (gk)<br />
NRZ Duisburg 26.06.2001<br />
Plückelmann verteidigt sich: "Privatsache!"<br />
Ratsherr Bernarding und Jusos stellen sich hinter Walsumer Bezirksvorsteher. Ob er selbst in seinem Auto saß und damit direkt<br />
am <strong>Die</strong>bstahl von Plakaten der Initiative <strong>Berg</strong>bau-Betroffener beteiligt war - da<strong>zu</strong> will sich Heinz Plückelmann nach wie vor nicht<br />
äußern. Der Walsumer Bezirksvorsteher wehrt sich aber vehement dagegen, dass der Vorfall mit seinem Amt in Verbindung<br />
gebracht wird: "Auch ich habe noch ein Privatleben", sagte der SPD-Politiker der NRZ. Auf Nachfrage erklärte er ausdrücklich,<br />
dass er die Angelegenheit als "Privatsache" ansieht. Rückendeckung erhält Plückelmann vom Walsumer SPD-Ratsherrn Willi<br />
Bernarding und den Jusos, welche die von einigen CDU-Bezirkspolitikern erhobenen Rücktrittsforderungen gegen den<br />
Bezirksvorsteher <strong>zu</strong>rückweisen. "Nach unserer Meinung sollte erst der Sachverhalt aufgeklärt werden, bevor man überlegt,<br />
welche Konsequenzen <strong>zu</strong> ziehen sind", schreibt Juso-Chef Soeren Link, ein Walsumer. Für die Walsumer Jusos ist<br />
Plückelmanns Rücktritt keine Zwangläufigkeit - "selbst wenn sich die bisherigen Pressemitteilungen bewahrheiten". Ratsherr<br />
Bernarding rät den CDU-Politikern, dass sie "nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen" sollen. Plückelmann habe große<br />
Verdienste um Walsum. Kritikwürdig findet Bernarding das Verhalten der <strong>Berg</strong>baugegner: "Schlimm, was da für Ausdrücke in<br />
der Anhörung gefallen sind!" <strong>Die</strong> <strong>Berg</strong>bau-Gegner sollten nicht wie "Rattenfänger durch die Gegend ziehen": Walsum habe 70<br />
Jahre mit und vom <strong>Berg</strong>bau gelebt. (dum)<br />
NRZ Duisburg 26.06.2001<br />
Duisburgs positive Position ist "nicht länger haltbar"<br />
Deutsche Steinkohle führte <strong>zu</strong>sätzliche Informationen ins Verfahren für den Rahmenbetriebsplan der Zeche Walsum ein. Der<br />
gestrige Vormittag beim Erörterungstermin für den Rahmenbetriebsplan der Zeche Walsum war noch durch die bekannte<br />
Geschäftsordnungsschlacht bestimmt. Verhandlungsleiterin Dorothea Schuk kassierte die Befangenheitsanträge Nummer<br />
sechs bis zehn (die heute entschieden werden). Doch nachmittags gelang es Schuk, sich mit der Bürgerinitiative <strong>zu</strong><br />
verständigen. Zunächst wird nun geklärt, ob der Rahmenbetriebsplan jetzt überhaupt erörtert werden kann. "Nein" - darin waren<br />
sich die Vertreter der Kommunen, Naturschutzverbände und der Bezirksregierung Düsseldorf einig. Auch die bislang positive<br />
Position Duisburgs ist "nicht länger haltbar", erklärte Michael Alberts vom Planungsamt.<br />
Auswirkungen auf Trinkwasser ungeklärt<br />
Grund für den Umschwung: <strong>Die</strong> Deutsche Steinkohle (DSK) habe soeben erst sieben dicke Ordner mit <strong>zu</strong>sätzlichen<br />
Informationen ins Verfahren eingeführt, die gelesen und bewertet werden müssten. Ungeklärt sei auch, welche Auswirkungen<br />
der Kohleabbau für Trinkwasser und Deichsicherheit habe. Aus Sicht der DSK ist der Rahmenbetriebsplan dagegen<br />
erörterungsfähig. In 70 Jahren <strong>Berg</strong>bau hätten sich die Deiche als sicher erwiesen, sagte Chefmarkscheider Emanuel Grün.<br />
Anerkannte Gutachter hätten alle Probleme auf 2000 Textseiten analysiert. <strong>Die</strong> neuen Unterlagen nannte Grün eine "nur<br />
informatorische Ergän<strong>zu</strong>ng". Jürgen Trapp von der Bezirksregierung Düsseldorf kritisierte dagegen, dass das<br />
Gefährdungspotenzial durch die Überspülung abgesenkter Gebiete bei Hochwasser nicht ausreichend berücksichtigt sei. Trapp:<br />
"Ist es verantwortbar, für 20 Jahre <strong>Berg</strong>bau Tausende Menschen auf Ewig und drei Tage der Gefahr für Leib und Leben<br />
aus<strong>zu</strong>setzen?" (wit)<br />
NRZ Duisburg 26.06.2001<br />
Kohle-Plan nicht <strong>zu</strong> genehmigen<br />
Der gestrige vierte Erörterungstag über den Rahmenbetriebsplan für das <strong>Berg</strong>werk Walsum war kein guter Tag für die Zeche.<br />
Erstmals wurde auch inhaltlich diskutiert, und dabei hagelte es negative Stellungnahmen von den Sachverständigen der<br />
betroffenen Städte und insbesondere der Bezirksregierung Düsseldorf. Der Kernsatz in der Stellungnahme der<br />
Aufsichtsbehörde lautet: "Der beantragte Rahmenbetriebsplan ist nicht genehmigungsfähig." Stehend applaudierten die rund<br />
200 Bürger, die <strong>zu</strong>r Anhörung in die Rhein-Ruhr-Halle gekommen waren, den Ausführungen von Jürgen Trapp, Dezernent für<br />
<strong>Berg</strong>bau und Energie bei der Bezirksregierung. <strong>Die</strong> Auswirkungen des Vorhabens auf Mensch und Natur seien nicht in<br />
ausreichendem Maße untersucht, kritisierte Trapp. Welche Flächen etwa durch die Erhöhung der Deiche verbraucht, welche<br />
Häuser dafür abgerissen werden müssten, werde nicht erörtert. (wit) 2. LOKALSEITE
NRZ Duisburg 25.06.2001<br />
Antrag, endlich <strong>zu</strong>r Sache <strong>zu</strong> kommen<br />
Der dritte Diskussionstag <strong>zu</strong>m Rahmenbetriebsplan blieb ohne inhaltliche Aussage. Zermürbendes Warten ohne inhaltliche<br />
Auseinanderset<strong>zu</strong>ng kennzeichnete den dritten Tag bei der Erörterung des Rahmenbetriebsplanes. Eine halbe Stunde nach<br />
Eröffnung wurde die Sit<strong>zu</strong>ng bis 14 Uhr unterbrochen. Zuvor wurde über die Anträge von Freitagabend entschieden. <strong>Die</strong><br />
Ablehnung der Öffentlichkeit sorgte für Pfiffe. Auch die Forderung, drei Tage pro Woche und Samstag als Anhörungstag<br />
fest<strong>zu</strong>legen, um Berufstätigen eine Chance als Zuhörer <strong>zu</strong> geben, musste Verhandlungsleiterin Dorothea Schuk abweisen. <strong>Die</strong><br />
Zwangspause brachte eine Anfrage der Initiative Kies wider Willen. Sie möchte die in das Verfahren eingeführten und<br />
vorhandenen Unterlagen verglichen haben. <strong>Die</strong> Mittagspause verlängerte sich schließlich um eine weitere Stunde, während<br />
hinter den Kulissen der Rhein-Ruhr-Halle drei Volljuristen über den Forderungen brüteten, wie über einen Befangenheitsantrag<br />
gegen Schuk. "Mein <strong>Die</strong>nstvorgesetzter <strong>hat</strong> mit keine Mitteilung gemacht. Wir verhandeln unter Vorbehalt weiter", setzte sie<br />
sich gegen drastische Unmutsrufe durch. Pfiffig: Ein Antrag, endlich in Sachfragen ein<strong>zu</strong>steigen. Den konnte Schuk nicht<br />
<strong>zu</strong>lassen, <strong>zu</strong>nächst müssen alle Verfahrensfragen <strong>zu</strong>r Geschäftsordnung geklärt werden. (uj)<br />
NRZ Duisburg 25.06.2001<br />
Plakate-Klau: Plückelmann in Bedrängnis<br />
Ratsherr Adolf Sauerland und die Bezirksvertreter Georg Nühlen und Rudolf Schellöh (alle CDU) haben Walsums<br />
Bezirksvorsteher Heinz Plückelmann (SPD) <strong>zu</strong>m Rücktritt aufgefordert. Anlass ist der <strong>Die</strong>bstahl von Plakaten der<br />
Bürgerinitiative <strong>Berg</strong>bau-Betroffener. Zeugen <strong>hat</strong>ten beobachtet, wie die ordnungsgemäß aufgehängten Plakate von<br />
Unbekannten gestohlen wurden. <strong>Die</strong> Täter fuhren in Plückelmanns Auto davon. Dass es sich tatsächlich um seinen Wagen<br />
handelte, <strong>hat</strong> der Bezirksvorsteher eingeräumt (die NRZ berichtete). <strong>Die</strong> Polizei ermittelt. Dem Vernehmen nach <strong>hat</strong> sich<br />
Plückelmann einen Anwalt genommen. Elmar Klein, der Vorsitzende der CDU-Fraktion, fordert umfassende Aufklärung vom<br />
Bezirksvorsteher. Er verweist darauf, dass es noch keinen offiziellen Beschluss der CDU-Fraktion in dieser Sache gibt. (dum)<br />
NRZ Moers 22.06.2001<br />
Im Anflug auf den Strukturwandel<br />
ZUR SACHE<br />
Regional-Flughafen lässt auf mehr Jobs hoffen Bei der Erörterung neuer Abbauvorhaben des <strong>Berg</strong>baus in der Hamborner<br />
Rhein-Ruhr-Halle war die Stimmung sehr gereizt: <strong>Die</strong> Kohlepläne sorgen für Aufruhr am Niederrhein. In Zeiten rückschreitender<br />
Subventionen fragen sich viele Bürger: Muß es denn so weit kommen, dass der <strong>Berg</strong>bau immer mehr um sich greift ?<br />
Jahrzehntelang <strong>hat</strong> dieser <strong>Berg</strong>bau zwar für Arbeitsplätze in dieser Region gesorgt. Es wäre aber falsch, nur noch daran<br />
fest<strong>zu</strong>halten und von der Vergangenheit <strong>zu</strong> zehren. Man kann die <strong>Berg</strong>leute doch nicht für dumm verkaufen und ihnen<br />
immerwährende Stabilität ihrer Arbeitsplätze verkaufen. Wichtiger als je <strong>zu</strong>vor ist es deshalb, den Strukturwandel voran <strong>zu</strong><br />
treiben. Da kommt gerade die Nachricht <strong>zu</strong>recht, dass der Regierungspräsident die Startflagge für den Regionalflughafen<br />
hochgehoben <strong>hat</strong>. Und dieses Mega-Projekt mit immerhin 150 Millionen Investitionskosten soll auch 2000 Jobs bringen. Der<br />
ehemalige stellvertretende Landrat Albert Holzhauer hätte sich sehr ändern müssen, hätte er jetzt die Chance fallengelassen,<br />
mit der Deutschen Steinkohle darüber <strong>zu</strong> verhandeln, so viele wie mögliche Kumpel im neuen Eu-regionalen Zentrum für<br />
Luftverkehr, Logistik und Gewerbe in Weeze unter <strong>zu</strong> bringen. Von 60 Jobs, die bereits verplant sind, ist die Rede. Und da<br />
Betriebsbeginn des Flughafens schon in einer Woche ist, dürften bald sehr viel mehr hin<strong>zu</strong> kommen. Fazit aus diesem positiven<br />
Beispiel für den Strukturwandel: Es gilt, keine Möglichkeit außer Acht <strong>zu</strong> lassen, die vom Arbeitsplatz-Verlust bedrohten<br />
<strong>Berg</strong>leute anderswo unter <strong>zu</strong> bringen. Oft genug fehlen ihnen selbst die Gelegenheiten, entsprechende neue Arbeitsplätze <strong>zu</strong><br />
bekommen. Sie selbst sollten nun die Initiative ergreifen und sich nach Weeze-Laarbruch erkundigen.<br />
NRZ Rheinberg 22.06.2001<br />
<strong>Die</strong> Anhörung tritt auf der Stelle<br />
Gestern kamen nur noch 350 Einwender und Betroffene. Keine Begren<strong>zu</strong>ng der Erörterungstage.<br />
AM NIEDERRHEIN. In der Sache keinen Schritt vorangekommen ist die Erörterung über den Rahmenbetriebsplan Walsum<br />
gestern in der Rhein-Ruhr-Halle. Ganztägig befasste man sich erneut mit Anträgen <strong>zu</strong>r Geschäftsordnung. Bisher ist nicht<br />
einmal der Eintritt in die vorläufige Tagesordnung gelungen. Nachgelassen <strong>hat</strong> das Interesse. Es kamen nur noch 350<br />
Einwender und Betroffene. Befangenheitsanträge gegen die Verhandlungsführerin Regierungsdirektorin Dorothea Schuk wegen<br />
Mißtrauens gegen die von ihr praktizierte Verhandlungsführung wurden <strong>zu</strong>rückgewiesen, ebenso die Unterstellung politischer<br />
Einflussnahme, die gefälschter und manipulierter Einwenderlisten. Stattgegeben wurde dem Antrag auf Wortprotokoll. Ein teurer<br />
Spaß: <strong>Die</strong> Stenografen kosten je 1000 Mark pro Stunde. Mit unterschiedlichen Begründungen wurden mehrfach neue Anträge<br />
gestellt auf Ausset<strong>zu</strong>ng des Erörterungstermins. Sie kamen sowohl von Trägern öffentlicher Belange (u.a. Kreis Wesel) als<br />
auch Verbänden. Vor allem wurde der Wunsch geäußert, die von DSK nachgereichten Gutachten vor allem <strong>zu</strong> Deichsicherheit<br />
und Hochwasserschutz in die Hände <strong>zu</strong> bekommen, um sie ein<strong>zu</strong>sehen und durch eigene Gutachter <strong>zu</strong> überprüfen. Alle<br />
wurden abgelehnt. <strong>Die</strong> Gutachter würden im Rahmen der Tagesordnung ausführlich vortragen und könnten befragt werden vor<br />
Einstieg in die Erörterung. Abgelehnt wurden erneut auch Anträge auf Begren<strong>zu</strong>ng der wöchentlichen Erörterungstage, weil<br />
Berufstätige keine Chance hätten auf Teilnahme an fünf Tagen. Vor allem die Kreisbauernschaft argumentierte, ein Landwirt<br />
könne seinen Hof nicht liegen lassen. Den Erörterungstermin aus<strong>zu</strong>setzen, weil der Rahmenbetriebsplan in beantragter Form<br />
bergrechtlich nicht genehmigungsfähig sei, forderte Dr. Helmut Lang, selbst ehemaliger <strong>Berg</strong>ingenieur. <strong>Die</strong> Walsumer<br />
Förderung spiele mit 0,5 Prozent Anteil <strong>zu</strong>dem keine Rolle für den nationalen Energiebedarf. Er warnte <strong>zu</strong>dem: Ohne<br />
Subventionen sei der <strong>Berg</strong>bau bankrott, es gebe keine Reserven für Schadensregulierungen. Zurückgewiesen. Lange Pausen<br />
<strong>zu</strong>r Überprüfung, Beratung und Entscheidung der über 90 Anträge ließen Zeit für viel Informationsaustausch zwischen den<br />
Beteiligten. Bekannt wurden dabei (bergschadenbedingte?) Schäden an Drei-Kammer-Systemen von Häusern und der<br />
Jauchegrube eines Bauerns im Trinkwasserschutzgebiet des Wasserwerks Löhnen. Der Kreis als untere Wasserbehörde ist<br />
eingeschaltet. Voerder Politiker gaben sich gestern besorgt. Zum Eklat kam es kurz nach 17 Uhr. Rechtsanwalt Klaus Kall<br />
forderte endlich eine Entscheidung über einen mehrfach gestellten Antrag auf Herstellung der Öffentlichkeit. <strong>Die</strong> DSK <strong>hat</strong>te<br />
<strong>zu</strong>gestimmt. <strong>Die</strong>sen Antrag, so die Verhandlungsführerin, habe Kall aber noch immer nicht unterschrieben. Kall hingegen<br />
konnte nachweisen, dass ihm bereits die von Dorothea Schuk gegengezeichnete Kopie des angenommenen Antrags vorlag.<br />
Aufgebrachte Einwender verließen daraufhin - von Kall deutlich da<strong>zu</strong> ermuntert - unter Protest die Halle. Im Foyer sammelten<br />
sie anschließend Unterschriften für einen Protestbrief an den Regierungspräsidenten in Arnsberg. Kall stellte in Aussicht, dass<br />
die Initiativen am Montag in die inhaltliche Diskussion ein<strong>zu</strong>steigen bereit seien. Im Gespräch wiederholte er den Vorwurf, der
Erörterungstermin würde von höchster Stelle in der Düsseldorfer Landesregierung ferngesteuert. Seine Quelle war gestern nicht<br />
mehr überprüfbar.<br />
NRZ Niederrhein 22.06.2001<br />
Verfahrensgeplänkel<br />
Zur Sachdiskussion fand niemand beim Erörterungstermin <strong>zu</strong>m <strong>Berg</strong>werk Walsum.<br />
DUISBURG. Es ging weiter, wie es am Vortag geendet <strong>hat</strong>te beim Erörterungstermin <strong>zu</strong>m Rahmenbetriebsplan des <strong>Berg</strong>werks<br />
Walsum. <strong>Die</strong> erhitzten Gemüter <strong>hat</strong>ten sich kaum abgekühlt. Pfiffe, "Wir sind das Volk"-Rufe und Tiraden unterhalb der<br />
Gürtellinie, juristische Züge, neue Anträge auf Ausset<strong>zu</strong>ng des Verfahrens. <strong>Die</strong> Bürgerinitiative <strong>Berg</strong>baugeschädigter forderte<br />
einen neuen Rahmenbetriebsplan. Nur von 2003 bis 2005. Unter anderem, weil die Zukunft der hoch subventionierten<br />
Steinkohle darüber hinaus ungewiss sei. Als beschlossen wurde, über jeden Antrag sofort <strong>zu</strong> entscheiden, gab es wegen der<br />
ständigen Beratungspausen weitere Löcher im Zeitplan. Viel Verfahrensgeplänkel. <strong>Die</strong>ses wurde freilich von Kohlegegnern<br />
bitter gewürzt. Sie griffen die Vorsitzende frontal an. Einer verstieg sich da<strong>zu</strong>, über sie ein selbst erstelltes "Psychogramm"<br />
vor<strong>zu</strong>tragen. Tief in die Kiste griff auch Helmut Lang (<strong>BiB</strong>), der nicht nur ein "Lehrstück an Undemokratie" beklagte, sondern<br />
auch die Vorsitzende Dorothea Schuk <strong>zu</strong>m Gehen aufforderte: "Ziehen Sie die persönlichen Konsequenzen, sonst ist Ihnen<br />
unsere Verachtung sicher." Es wurde geholzt wie in der Fußball-Kreisklasse. Den Weg in die Sachdiskussion fanden die<br />
Beteiligten auch gestern nicht. Montag, 10 Uhr, geht es mit der Erörterung in der Rhein-Ruhr-Halle weiter. (put)<br />
NRZ Duisburg 22.06.2001<br />
Kohlegegner ließen Anträge und bittere Vorwürfe hageln<br />
Auch der zweite Tag der Erörterung stand im Zeichen juristischen Gezerres. Beginn der Sachdiskussion ungewiss. Dorothea<br />
Schuk war auch am zweiten Tag Vorsitzende der Erörterung <strong>zu</strong>m Rahmenbetriebsplan des <strong>Berg</strong>werkes Walsum. Gegen ihre<br />
Unparteilichkeit sprächen keine objektiven Gründe, <strong>hat</strong> ihr <strong>Die</strong>nstvorgesetzter entschieden. Damit war der Versuch zweier<br />
Anwälte gescheitert, die Regierungsdirektorin aus dem Verfahren <strong>zu</strong> schießen. Ansonsten ging es weiter, wie es am Vortag<br />
geendet <strong>hat</strong>te. <strong>Die</strong>smal allerdings mit deutlich weniger Anwesenden. Rund 350 mögen es gewesen sein. <strong>Die</strong> erhitzten Gemüter<br />
<strong>hat</strong>ten sich kaum abgekühlt. Pfiffe, "Wir sind das Volk"-Rufe und Tiraden unterhalb der Gürtellinie, juristische Züge, neue<br />
Anträge auf Ausset<strong>zu</strong>ng des Verfahrens, bis die nachgereichten Unterlagen der DSK allen vorliegen und von allen geprüft sind.<br />
Erneut kam auch der Antrag, nur zwei Mal pro Woche plus samstags <strong>zu</strong> tagen, damit Berufstätige dabei sein können. <strong>Die</strong><br />
Bürgerinitiative <strong>Berg</strong>baugeschädigter forderte einen neuen Rahmenbetriebsplan, der nur von 2003 bis 2005 zieht. Unter<br />
anderem, weil die Zukunft der hoch subventionierten Steinkohle darüber hinaus ungewiss sei. Dass schließlich entschieden<br />
wurde, über jeden Antrag sofort <strong>zu</strong> entscheiden, riss wegen der nun ständigen Beratungspausen weitere Löcher in den<br />
Zeitplan. Viel Verfahrensgeplänkel. <strong>Die</strong>ses wurde freilich von mehreren Interessenvertretern der Kohlegegner bitter gewürzt. Sie<br />
griffen die Vorsitzende frontal an. Einer verstieg sich da<strong>zu</strong>, über sie ein selbst erstelltes "Psychogramm" vor<strong>zu</strong>tragen. Tief in die<br />
Kiste griff auch Helmut Lang (<strong>BiB</strong>), der nicht nur ein "Lehrstück an Undemokratie" beklagte, sondern Dorothea Schuk auch <strong>zu</strong>m<br />
Gehen aufforderte: "Ziehen Sie die persönlichen Konsequenzen, sonst ist Ihnen unsere Verachtung sicher." Es wurde geholzt<br />
wie in der Fußball-Kreisklasse. Den Weg in die Sachdiskussion fanden die Beteiligten auch gestern nicht. Montag, 10 Uhr, geht<br />
die Erörterung in der Rhein-Ruhr-Halle weiter. (put)<br />
NRZ Moers 22.06.2001<br />
Flughafen soll auch Kumpeln Jobs bieten<br />
Verhandlungen mit der DSK laufen schon.<br />
AM NIEDERRHEIN. Das "Grünlicht" für eines der größten Projekte in der Niederrhein-Region, den "Flughafen Niederrhein" in<br />
Weeze-Laarbruch kann auch den Strukturwandel in Zeiten des schrumpfenden Steinkohlenbergbaus weiter vorantreiben. <strong>Die</strong>se<br />
Meinung vertritt der Rheurdter Albert Holzhauer, der Aufsichtsratvorsitzende der Flughafen Niederrhein Gmbh. "Wir rechnen mit<br />
der Schaffung von 2000 Jobs in den nächsten zehn Jahren und hoffen, das sich die Aufträge von dort weit in diese Region<br />
auswirken werden." Für ihn ist dies die große Chance für den Niederrhein: "Sieben Jahre haben wir darum gekämpft. Jetzt <strong>hat</strong><br />
es endlich geklappt." Holzhauer weiter: "Wir stehen in Verhandlungen mit der Deutschen Steinkohle, Arbeitsplatzprofile <strong>zu</strong><br />
suchen, um Umschulungen der <strong>Berg</strong>leute der bald schließenden Schachtanlage Niederberg und anderer betroffenen Zechen <strong>zu</strong><br />
ermöglichen. Beim Flughafen Dortmund <strong>hat</strong> man beispielsweise mit <strong>Berg</strong>mechanikern gute Erfahrungen gemacht. Ich erwarte<br />
ähnliche Synergieeffekte und mit mir die deutsche Steinkohle!" Bekanntlich wird die Produktion auf Niederberg in Neukirchen-<br />
Vluyn im Herbst eingestellt, das Personal wir sukzessive reduziert: "Eine große Chance für das in Verbindung mit dem Ausbau<br />
des Flughafens Weeze geplante "Euregionale Zentrum für Luftverkehr, Logistik und Gewerbe". Holzhauer nannte gestern<br />
Einzelheiten <strong>zu</strong>m geplanten Regionalflughafen. Der Flughafenbetrieb soll schon am 1. Juli losgehen: "Dann kann natürlich noch<br />
nicht geflogen werden, weil ja die Infrastruktur fehlt. Was wir nun dringend brauchen: der Terminal ist noch <strong>zu</strong> bauen, eine<br />
riesige Feuerwehr muß her" Auch da rechnet Holzhauer mit Hilfe der Schachtanlage Niederberg: "Vielleicht können wir deren<br />
Feuerwehr übernehmen!" Der offiziele Flugverkehr soll, so Holzhauer, Anfang 2002 starten. Immerhin: 49 000 Flugbewegungen<br />
jährlich, ein Mix aus Fracht, Touristik und Linienverkehr, prognostiziert der Aufsichtsratsvorsitzende. Da<strong>zu</strong> ist viel Geld<br />
erforderlich. <strong>Die</strong> Privatwirtschaft sei gefragt: Immerhin gehe es um ca. 150 Millionen Mark.<br />
NRZ Rheinberg 21.06.2001<br />
Klaus Kall drohte mit 2677 Anträgen<br />
Knapp 600 Einwender kamen <strong>zu</strong>r Anhörung. Gestern ging es vor allem um die Verfahrensfragen.<br />
AM NIEDERRHEIN. Es herrschte ein ruppiger Umgangston, es fielen Worte,<br />
die den Tatbestand der Beleidigung erfüllten. Es wurde mit Strafanzeigen bei der Staatsanwalt gedroht. Aber auch<br />
Gegenmaßnahmen der Bezirksregierung in Aussicht gestellt. In der Sache aber kam die Erörterung des Rahmenbetriebsplanes<br />
der Schachtanlage Walsum nicht in Gang. Bis 18 Uhr ging es nur um Verfahrensfragen und Anträge. Anträge vor allem der<br />
Anwälte der Bürgerinitiativen - bis hin <strong>zu</strong>r Ausset<strong>zu</strong>ng des Termins, Verschiebung um mindestens zwei Monate und Rücktritt<br />
bzw. Abset<strong>zu</strong>ng der den Termin leitenden Regierungsdirektorin Dorothea Schuk von der Bezirksregierung Arnsberg wegen<br />
Befangenheit. Heute um 10 Uhr geht es weiter. Vor dem Halleneingang demonstrierten am Morgen Kumpel und ihre Kinder mit<br />
Transparenten. Sie reklamierten ihr Recht auf Arbeit. Grüppchenweise kamen die Einwender - knapp 600. Viele Voerder<br />
mussten feststellen, dass sie in den Namenslisten gar nicht registriert waren. Als Betroffene bekamen sie Zugang. Ihr Problem:<br />
Waren ihre Bedenken und Anregungen gar nicht in das Verfahren eingeflossen, obwohl sie ihre Einwendungen im Rathaus<br />
abgegeben <strong>hat</strong>ten, dort registriert waren und Beamte des Rathauses die gesammelten Einwendungen nach Dortmund gebracht<br />
<strong>hat</strong>ten? Waren sie unter den Tisch gefallen? <strong>Die</strong> Prüfung konnte gestern nicht abgeschlossen werden. Planungsamtsleiter
Seidel sah allein darin einen Unterbrechungsgrund. Mit "2677 Anträgen" <strong>zu</strong> Verfahrensfragen drohte der für die Rheinberger<br />
Bürgerinitiative tätige Rechtsanwalt Klaus Kall. Es begann mit Zulassung der Presse, nicht nur selektierter Journalisten,<br />
weitergehend Herstellung der allgemeinen Öffentlichkeit, Forderung nach Wort- statt Ergebnisprotokoll wegen der<br />
Dokumentationspflicht. Sein Voerder Kollege Klaus Friedrichs wollte nicht <strong>zu</strong>rückstehen, widersprach der ordnungsgemäßen<br />
Verfahrenseröffnung, sah Einwendungen nicht berücksichtigt, selbst seine eigenen vier nicht. Als später Listen mit seinem<br />
Namen auftauchten, sprach er von Manipulation, Fälschungen, beschuldigte die Verhandlungsführerin der Lüge. Er schob noch<br />
die Unfähigkeit nach und forderte sie auf, ihren Hut <strong>zu</strong> nehmen. Erhebliche Bedenken kamen aber auch von der<br />
Bezirksregierung Düsseldorf, dem Staatlichen Umweltamt Krefeld, der Kreisverwaltung Wesel und den Städten Dinslaken,<br />
Voerde und Rheinberg. Am 6. Juni nämlich <strong>hat</strong>te die DSK Unterlagen vor allem <strong>zu</strong>r Deichsicherheit und dem Hochwasserschutz<br />
nachgereicht, die nicht an alle verfahrensbeteiligten Behörden weitergeleitet worden waren. Planungsamtsleiter Rudorf<br />
(Dinslaken) forderte ein neues Offenlegungsverfahren, Dr. Himmelmann (Rechtsamt Voerde) wollte die Akten über Nacht<br />
mitnehmen, die angebotene Akteneinsicht während der Erörterung reichte ihm nicht, darin sah er das Gebot der fairen<br />
Verhandlung verletzt. Mehrfach wurde die ordnungsmäße Verhandlungsführung bezweifelt, Besorgnis der Befangenheit<br />
geäußert und Parteinahme für die DSK auf politische Weisung vom "Minister der Kumpel, nicht Wirtschaftsminister" (Kall),<br />
gemeint: Ernst Schwanhold. Über die Befangenheitsanträge (von Kall und Friedrichs) soll heute entschieden werden. Sämtliche<br />
Anträge der Behörden, Bürgerinitiativen und Verbände auf Unterbrechung und Vertagung wurden <strong>zu</strong>rückgewiesen mit der<br />
Begründung, die nachgereichten Unterlagen böten substanziell <strong>nichts</strong> Neues.<br />
NRZ Duisburg 21.06.2001<br />
Emotionen kochten hoch<br />
Einwender und Betroffene verfolgten den ersten Tag der Erörterung <strong>zu</strong>m Rahmenbetriebsplan Walsum. Juristische<br />
Scharmützel, lange Beratungspausen, kaum Entscheidungen. "Wir sind keine Umweltzerstörer. Wir sichern Energie für die<br />
Zukunft." Etwa 30 <strong>Berg</strong>leute <strong>hat</strong>ten sich gestern früh, vor dem Start der Erörterung <strong>zu</strong>m Rahmenbetriebsplan, vor der Rhein-<br />
Ruhr-Halle postiert. Drinnen ließen rund 540 Einwender und Betroffene, Vertreter der Kommunen, vor allem aber die Anwälte<br />
Klaus Kall und Klaus Friedrichs, der <strong>BiB</strong>-Vorsitzende, einen anderen Wind wehen. Von Beginn an deckten sie die vom<br />
Regierungspräsidium Arnsberg entsandte Regierungsdirektorin und Vorsitzende Dorothea Schuk mit Bei- und Anträgen ein:<br />
Zulassung der kompletten Öffentlichkeit, Wortprotokolle, Vorwürfe der Manipulation, Nichtvorlage des jüngsten DSK-Gutachtens<br />
<strong>zu</strong> Dei- chen und Naturschutz. "Kumpanei mit der Kohle" wurde Schuk und ihrer Behörde mehrfach vorgeworfen.<br />
Deichbruchgefahr und <strong>Berg</strong>schäden spielten gerade als Untermauerung der Anträge eine Rolle. Acht Stunden lang wogte das<br />
juristische Gezerre, wurden Anträge abgewiesen, neue gestellt. Rund ein Dutzend Antragsteller, auch von Seiten der Träger<br />
öffentlicher Belange, forderte vehement und wortreich die Ausset<strong>zu</strong>ng der Erörterung.<br />
Vorwurf der Befangenheit<br />
Immer wieder wurde die Sit<strong>zu</strong>ng lange unterbrochen. Zuletzt prasselten zwei Befangenheitsanträge auf die Vorsitzende nieder.<br />
Ihr Vorgesetzter wird bis <strong>zu</strong>m Neustart heute um 10 Uhr entscheiden müssen. <strong>Die</strong> Emotionen schwappten endgültig über, als<br />
Dorothea Schuk die Ausset<strong>zu</strong>ng ablehnte. Minutenlang ging die Begründung in wütenden Rufen unter: Schiebung, Skandal<br />
oder "Wir trauen Ihnen nicht" waren noch die freundlicheren. Emotion pur. Wie in der Boxbude. "Mir schlägt das Herz bis <strong>zu</strong>m<br />
Halse", empörte sich einer. <strong>Die</strong> in Kompaniestärke angetretene DSK-Riege kam nur einmal <strong>zu</strong> Wort. Nein, gegen die<br />
Anwesenheit der Presse sei man nicht. (put)<br />
NRZ Mantel, Seite 3 21.06.2001<br />
Ein Antrag, noch ein Antrag - acht Stunden lang<br />
<strong>Die</strong> Anwälte der Gegner sprengten den ersten Anhörungstermin <strong>zu</strong>m Rahmenbetriebsplan des <strong>Berg</strong>werks Walsum. Sie<br />
hielten die Regierungsdirektorin, die die Anhörung leitete, für befangen.<br />
DUISBURG. Dorothea Schuk war nicht <strong>zu</strong> beneiden. Zwar waren am ersten Erörterungstag <strong>zu</strong>m Rahmenbetriebsplan des<br />
<strong>Berg</strong>werks Walsum nur gut 500 - und nicht wie erwartet 3000 oder gar 5000 - Bürger erschienen, doch kam die zarte<br />
Arnsberger Regierungsdirektorin gegen die aufgebrachte Menge kaum an. Dabei ging es in der Rhein-Ruhr-Halle gar nicht<br />
einmal richtig <strong>zu</strong>r Sache. Kein einziges Wort fiel <strong>zu</strong> möglichen Auswirkungen des geplanten Kohleabbaus unter dem Rhein und<br />
Teilen der Städte Dinslaken, Voerde und Duisburg. <strong>Die</strong> Gefahr eines Deichbruchs, drohende <strong>Berg</strong>schäden, aber auch die<br />
Sicherung von 3600 Arbeitsplätzen in Walsum spielten <strong>zu</strong>nächst keine Rolle. Vielmehr wurden acht Stunden lang von<br />
Bürgerinitiativen Anträge <strong>zu</strong>r Geschäftsordnung eingebracht und von der Regierungsdirektorin dann postwendend<br />
<strong>zu</strong>rückgewiesen.<br />
Kein Wort von der Deutschen Steinkohle<br />
Für das <strong>Berg</strong>werk Walsum geht es um den Fortbestand. Klar, dass die Deutsche Steinkohle (DSK) mit geballtem Sachverstand<br />
in Duisburg <strong>zu</strong>gegen war. Doch niemand sagte ein Wort. Es kam gar nicht so weit - die Anwälte der Bürger-initiative <strong>Berg</strong>bau-<br />
Betroffener sprengten mit ihrer Antragsflut den ersten von sieben geplanten Erörterungsterminen. Schon nach 15 Minuten<br />
musste Dorothea Schuk die Sit<strong>zu</strong>ng unterbrechen, nachdem Streit darüber entbrannt war, ob die Öffentlichkeit <strong>zu</strong> dieser<br />
Veranstaltung <strong>zu</strong>gelassen werden sollte. Das wird sie nicht, beschloss die Beamtin. Auch wird es kein Wortprotokoll geben, was<br />
viele Bürger forderten. "Wir trauen ihnen nicht", schallte es Dorothea Schuk aus dem Saal entgegen - und es sollte nicht die<br />
einzige Unmutsäußerung an diesem Tag bleiben. "Unfähig", "Lügnerin", "gehört gekreuzigt": Manche Zwischenrufe waren doch<br />
sehr beleidigend. Auch der Versuch der Anwälte, den Termin gänzlich <strong>zu</strong> kippen, scheiterte. <strong>Die</strong> öffentliche Auslegung der<br />
DSK-Pläne im Walsumer Rathaus sei "zwar nicht glücklich, aber rechtlich einwandfrei" abgelaufen, erklärte Dorothea Schuk.<br />
Und Unterlagen, die die DSK in letzter Sekunde eingereicht <strong>hat</strong>te und somit nicht allen Betroffenen <strong>zu</strong>gegangen waren, stufte<br />
sie als "nicht neu" ein. Tumulte im Saal, Verärgerung auf der Anwaltsbank - da kam der Befangenheitsantrag der<br />
Bürgerinitiative gegen die Regierungsdirektorin nicht überraschend. "<strong>Die</strong> Behörde ist <strong>zu</strong>m Instrument des <strong>Berg</strong>baus<br />
verkommen", schimpfte Anwalt Klaus Kall. Über das Gesuch <strong>hat</strong> die für <strong>Berg</strong>baufragen <strong>zu</strong>ständige Bezirksregierung im fernen<br />
Sauerland jedoch noch nicht entschieden. Dorothea Schuk wird sich also <strong>zu</strong>mindest heute noch mit den aufgebrachten<br />
Niederrheinern auseinandersetzen müssen, vielleicht endlich auch mit deren Sorgen und Nöten. Immerhin liegen 13 000<br />
schriftliche Einwände gegen den Rahmenbetriebsplan vor. (NRZ)<br />
NRZ Duisburg 20.06.2001<br />
BIB-Plakate gestohlen<br />
Männer entstiegen dem Wagen von Bezirksvorsteher Plückelmann und griffen <strong>zu</strong>. Ermittlungen führt die Polizei in Walsum: Dort<br />
wurden 50 genehmigte Plakate ("So nicht, DSK") der Bürgerinitiative <strong>Berg</strong>baubetroffener am Niederrhein (<strong>BiB</strong>) abgenommen
und gestohlen. Zeugen sahen, dass die <strong>Die</strong>be einen Mercedes fuhren. Sie notierten die Nummer. Pikant: Das Auto ist auf<br />
Walsums Bezirksvorsteher Heinz <strong>Die</strong>ter Plückelmann (SPD) <strong>zu</strong>gelassen. Er ist Ex-Betriebsratschef der Schachtanlage Walsum<br />
und PS-Direktor bei der DSK. BIB-Vorsitzender Klaus Friedrichs forderte sofort Sanktionen von Polizei und Staatsanwaltschaft<br />
wegen des "undemokratisches Verhaltens" der Fahrzeuginsassen. Gegenüber der NRZ räumte Plückelmann ein, dass es sein<br />
Wagen war ("Ich war nicht in Urlaub"). Weiter wollte er sich nicht äußern.<br />
NRZ Rheinberg 20.06.2001<br />
Lösung nur mit Kompromissen<br />
Kumpel forderte die Verhinderung einer Spaltung zwischen den <strong>Berg</strong>leuten und der Bevölkerung.<br />
RHEINBERG. Heiß her ging es bei einer Diskussionsrunde <strong>zu</strong>m Thema "Hat der <strong>Berg</strong>bau in Rheinberg Zukunft?", die von den<br />
Grünen veranstaltet wurde. "Der <strong>Berg</strong>bau ist ein besonders akutes Thema", so Fritz Ettwig, Mitglied der Rheinberger Grünen<br />
und des Umweltausschusses. In Recklinghausen etwa wurde schon wieder eine Zeche geschlossen und bis 2006 soll die Zahl<br />
der <strong>Berg</strong>arbeiter bis auf gut 30 000 gesenkt werden. Bevor es jedoch um die Konsequenzen, die sich daraus für die<br />
Rheinberger Bürgerschaft ergeben könnten, ging, erläuterte <strong>zu</strong>nächst Rainer Priggen, Landtagsabgeordneter der Grünen in<br />
NRW, die nationale und internationale Situation des Steinkohlebergbaus. Eine besondere Brisanz erhält das Thema <strong>Berg</strong>bau in<br />
Deutschland vor allem dadurch, dass der europäische Vertrag <strong>zu</strong> Kohle und Stahl, der die Zulässigkeit von Beihilfen für Kohle<br />
regelt, demnächst ausläuft. <strong>Die</strong> Kohlesubventionen wie auch das Personal sollen nämlich in den nächsten fünf Jahren stark<br />
dezimiert werden. Das soll laut Priggen in einem "sozialverträglichen Anpassungsprozess" geschehen. Klar, dass die<br />
betroffenen Arbeiter das Ganze nicht so locker sehen können. So machte <strong>zu</strong>m Beispiel Michael May, der selbst Kumpel ist,<br />
darauf aufmerksam, dass man die Sache doch nicht <strong>zu</strong> sehr mit den berühmten rosa Wölkchen betrachten sollte. Immerhin<br />
dürfte es für einen Arbeiter Mitte 40 nicht grade einfach sein, noch einen anderen Job <strong>zu</strong> finden. Darüber hinaus forderte May,<br />
dass die Spaltung zwischen <strong>Berg</strong>leuten und Bevölkerung unbedingt abgelehnt werden muss. Denn da liegt das nächste<br />
Problem. <strong>Die</strong> Bürger, die in den Gebieten wohnen, unter denen abgebaut wird, befürchten <strong>zu</strong> Recht, dass ihre Häuser vom<br />
<strong>Berg</strong>bau im wahrsten Sinne des Wortes "tiefer gelegt" werden. Für die Belange der Bürger setzt sich in Rheinberg besonders<br />
Werner Raue ein, der als zweiter Referent des Abends erläuterte, was besonders den Anwohnern im Bereich von Annaberg<br />
und Alpsray blüht, wenn der neue Rahmenbetriebsplan des <strong>Berg</strong>werks Friedrich-Heinrich/Rheinland genehmigt wird. <strong>Die</strong> Zeche<br />
Walsum plant außerdem, im Bereich der Rheindeiche ab<strong>zu</strong>bauen, die dadurch über fünf Meter gesenkt werden würden. Auch<br />
da wurden natürlich Stimmen seitens der Bürger laut. Heißt es dann bald Land unter in Rheinberg? Für Werner Raue jedenfalls<br />
ist klar: beide Seiten müssen Kompromisse eingehen, sonst ist dieses Problem wohl nie <strong>zu</strong> lösen.<br />
NRZ Moers 15.06.2001<br />
Rohre wie im <strong>Berg</strong>bau verlegen<br />
Grundwasser muss abgepumpt werden. Der Verkehr soll weiterlaufen.<br />
MOERS. <strong>Die</strong> größte und wohl auch komplizierteste Kanalbaustelle der letzten Jahrzehnte wird <strong>zu</strong>r Zeit auf der Römerstraße<br />
eingerichtet. Was das Ganze nicht einfach macht: Das Grundwasser steht hier sehr hoch und muss abgepumpt werden.<br />
Riesige oberirdische Rohre ziehen sich am Realparkplatz vorbei bis über die Franz-Haniel-Straße. Tiefbauamtsleiter Lutz<br />
Hormes sieht für die ausführende Arbeitsgemeinschaft Maas/Fenners trotzdem keine Probleme. Doch der offizielle Spatenstich<br />
lässt auf sich warten. Bei großem Regen könnte das Grundwasser weiter ansteigen. Für diesen Fall gibt es ein weiteres<br />
Speicherbecken an der Franz-Haniel-Straße, das die Wassermassen aufnehmen wird. Letztendlich wird das Wasser dann in<br />
den Aubruchsgraben abgepumpt. Sind diese Schwierigkeiten erst beseitigt, kann mit der Verlegung der Kanalrohre zwischen<br />
Kirschenallee und Homberger Straße bis <strong>zu</strong>r Geschwister-Scholl-Gessamtschule begonnen werden. Lutz Hormes: "Da der<br />
Verkehr auf der vielbefahrenen Römerstraße weiterlaufen muss, um kein Verkehrschaos <strong>zu</strong> bekommen, werden die Kanalrohre<br />
bergmännisch in Stollen vorangetrieben." Oben könnten dann die die Autos, wenn auch mit Einschränkungen weiterfahren.<br />
Anschließend wird die Baustelle weiter in die Homberger Straße bis <strong>zu</strong>m Geldermannshof wandern. Hier wird das<br />
herkömmliche Verfahren mit Baugruben angewandt. Der Tiefbauamtsleiter hofft, dass es <strong>zu</strong> wenigen Beschränkungen kommt,<br />
"weil die Straße breit genug ist." 22 Millionen Mark wird die Kanalbaumaßnahme kosten, im Jahre 2006 hofft man fertig <strong>zu</strong> sein.<br />
Vor Beginn der Arbeiten wurden zahlreiche Bodenuntersuchungen vorgenommen. Der alte Kanal war schon kurz nach dem<br />
Krieg fertiggestellt worden. (Uwe Krumm)<br />
NRZ Duisburg 13.06.2001<br />
Bürger für dumm verkauft<br />
"<strong>Die</strong> Bürger werden immer noch für dumm verkauf und nicht genügend informiert. Es ist der Führungsspitze der DSK und den<br />
Politikern egal, welchen Schaden Bürger und die Natur hinnehmen müssen, falls der Rahmenbetriebsplan genehmigt wird,<br />
obwohl es genug Gutachten gegen den Plan gibt. Auch den <strong>Berg</strong>leuten wird ein sicherer Arbeitsplatz versprochen, statt diese<br />
durch Umschulungsmaßnahmen <strong>zu</strong> unterstützen und auf den Auslauf des Kohleabbaus vor<strong>zu</strong>bereiten."<br />
NRZ Duisburg 12.06.2001<br />
Aufmarsch gegen die Kohle<br />
Am 21. Juni beginnt der Erörterungstermin <strong>zu</strong>m geplanten Kohleabbau unter dem <strong>Stadt</strong>gebiet. Bezirksregierung versichert:<br />
"Bürger sollen <strong>zu</strong> Wort kommen." Für das <strong>Berg</strong>werk Walsum geht es um den Fortbestand, während Zehntausende von Bürgern<br />
ihr Eigenheim absinken und einreißen sehen. Am Donnerstag, 21. Juni, läuft der größte Erörterungstermin an, der jemals in<br />
Nordrhein-Westfalen abgehalten wurde. Der Anlass ist in Walsum, Voerde und Dinslaken bekannt - und bei einem Großteil der<br />
Bevölkerung gefürchtet: Der <strong>Berg</strong>bau kehrt auf die rechte Rheinseite <strong>zu</strong>rück, die Deutsche Steinkohle AG (DSK) will wieder<br />
unter den <strong>Stadt</strong>gebieten abbauen. Befürworter und Gegner bereiten sich jetzt auf den Erörterungstermin <strong>zu</strong>m neuen<br />
Rahmenbetriebsplan in der Rhein-Ruhr-Halle vor.<br />
Schachtanlage kämpft um Weiterbetrieb<br />
Auch bei der Bezirksregierung Arnsberg wird an der Dramaturgie gefeilt. "Wir sind der Moderator zwischen dem Antragsteller<br />
und den Einwändern" erklärt man in der Abteilung 8 (<strong>Berg</strong>bau und Energie). Pressesprecher Siegfried Uwe Behrendt betont:<br />
"Der Bürger soll <strong>zu</strong> Wort kommen." Für den Erörterungstermin am 21. Juni in der Hamborner Rhein-Ruhr-Halle gelten klare<br />
Verfahrensregeln. Siegfried Uwe Behrendt von der Bezirksregierung Arnsberg im früheren Landesoberbergamt erläutert sie:<br />
"Zutritt <strong>zu</strong> dieser nicht öffentlichen Veranstaltung haben diejenigen, die Einwändungen gegen den Rahmenbetriebsplan<br />
gemacht haben und alle Betroffenen." Und das sind: "<strong>Die</strong>jenigen Bürger, die im Einwirkungsbereich des neuen Kohleabbaus<br />
leben." Deshalb liegen am Eingang Listen mit den <strong>Stadt</strong>teilen und Straßennamen aus, die <strong>zu</strong>m vorgesehenen Abbaugebiet und
dem oberirdisch betroffenen Bereich gehören. Dort wird nachgesehen, alle Bürger müssen ihren Personalausweis mitbringen.<br />
<strong>Die</strong> Presse bekommt, so Beh-rendt, erst dann Zutritt, wenn kein Beteiligter sich dagegen ausspricht. Der Erörterungstermin<br />
dient da<strong>zu</strong>, "der plan-feststellenden Behörde vertiefte Erkenntnisse aus Sicht der Träger öffentlicher Belange, wie Kommunen<br />
oder Naturschutzverbände, und der Bürger <strong>zu</strong> vermitteln". Und diese Erkenntnisse würden in die Entscheidungsfindung<br />
eingehen, erklärt der Behördensprecher.<br />
Halle für eine Woche gemietet<br />
<strong>Die</strong> Bürgerinitiative <strong>Berg</strong>baubetroffener am Niederrhein (BIB) aus Walsum und den Nachbarstädten bereitete sich am<br />
Montagabend mit einer Informationsveranstaltung auf den Termin vor. Gut 100 Bürger kamen. Dort hieß es, alle vorgetragenen<br />
Einwändungen müssten geprüft werden, alle Beschwerden und Anregungen sollten vorgetragen werden, um für ein eventuelles<br />
Gerichtsverfahren gerüstet <strong>zu</strong> sein. Sprecher Lothar Ipach kündigte an, dass die Bürgerinitiative selbst die kritischen Punkte<br />
vortragen werde. Erwartet wird, dass es eine große Beteiligung geben wird. Ipach: "Wir rechnen mit 2000 Beteiligten." Kein<br />
Problem, sagt die Bezirksregierung. <strong>Die</strong> Halle ist für eine Woche gemietet, für gut 3000 Besucher stehen Plätze <strong>zu</strong>r Verfügung.<br />
"Wir rechnen mit mehreren Tagen und werden eine Tagesordnung nach sachlichen Gesichtspunkten vorlegen", so Behrendt.<br />
Wie es der Zufall will, lädt die Deutsche Steinkohle am Montag <strong>zu</strong> einer großen Niederrhein-Konferenz im <strong>Berg</strong>werk Walsum<br />
ein. (ama)<br />
NRZ Moers 12.06.2001<br />
BRIEFE AN DIE REDAKTION<br />
Arroganz der Steinkohle<br />
Mit Erstaunen lese ich, dass die DSK, nachdem ihr (nach meiner Meinung <strong>zu</strong>recht) mittlerweile von allen Seiten der Wind arg<br />
ins Gesicht bläst, neuerdings den Dialog und letztendlich die Akzeptanz der Bevölkerung sucht. Das war in den vergangenen<br />
Jahren mitnichten der Fall, wie ich am eigenen Leib erfahren mußte. Konkret: Da meine Beschwerde über den mitunter ganze<br />
Nächte andauernden Lärm des <strong>Berg</strong>eumladebunkers auf dem ehemaligen Pattberggelände den damaligen Tagesbetriebsleiter<br />
der Zeche Friedrich Heinrich-Rheinland völlig kalt ließ, und die gleiche Beschwerde beim <strong>Berg</strong>amt Moers darin gipfelte, die DSK<br />
mit einer Lärmmessung <strong>zu</strong> beauftragen (als würde man den Einbrecher die Aufklärung seines eigenen Einbruchs durchführen<br />
lassen), das Ergebnis der Messung natürlich <strong>zu</strong> Gunsten des Betreibers ausfiel, ließ ich dem damaligen Betriebsleiter der<br />
Zeche eine Unterschriftenliste mit mehr als 100 Eintragungen von Anwohnern <strong>zu</strong>kommen. Abgesehen davon, dass in dem<br />
anschließenden Antwortschreiben der DSK von einer Beschwerde meinerseits aus dem Jahr 1997 die Rede war - die ich aber<br />
erstmalig (!) im Frühjahr 1998 geäußert habe? wurde darin, im Grundtenor, schlichtweg behauptet, dass es <strong>zu</strong> keiner Zeit seit<br />
meiner ersten Beschwerde jemals eine Lärmbelästigung gegeben habe. <strong>Die</strong> Arroganz, mit der die DSK über die Beschwerde<br />
von weit mehr als hundert Anwohner hinwegging, ist kaum <strong>zu</strong> überbieten, insbesondere deshalb, da die Nacht, in der sie die<br />
Lärmmessung durchführte, gezeigt <strong>hat</strong>, dass mit etwas gutem Willen Abhilfe geschafft werden könnte. Vor diesem Hintergrund<br />
hege ich die Befürchtung, ja ich bin mir sogar sicher, dass die neuerliche Werbung des <strong>Berg</strong>baus um Unterstüt<strong>zu</strong>ng und<br />
Akzeptanz in der Bevölkerung in Wirklichkeit von purer Heuchelei getragen wird. Eine ähnliche Einschät<strong>zu</strong>ng hegt im übrigen<br />
auch Klaus Kall, Rechtsanwalt und Interessenvertreter der "Schutzgemeinschaft <strong>Berg</strong>bau". Es wird Zeit, dass auch ein <strong>Berg</strong>bau<br />
sich wie alle anderen Wirtschaftszweige dem globalen Wettbewerb mit all seinen Vor- und Nachteilen stellt und ihm die bis dato<br />
genehme und bequeme Sonderbehandlung entzogen wird.<br />
NRZ Rheinhausen 13.06.2001<br />
Bürger für dumm verkauft<br />
"<strong>Die</strong> Bürger werden immer noch für dumm verkauf und nicht genügend informiert. Es ist der Führungsspitze der DSK und den<br />
Politikern egal, welchen Schaden Bürger und die Natur hinnehmen müssen, falls der Rahmenbetriebsplan genehmigt wird,<br />
obwohl es genug Gutachten gegen den Plan gibt. Auch den <strong>Berg</strong>leuten wird ein sicherer Arbeitsplatz versprochen, statt diese<br />
durch Umschulungsmaßnahmen <strong>zu</strong> unterstützen und auf den Auslauf des Kohleabbaus vor<strong>zu</strong>bereiten."<br />
NRZ Oberhausen 10.06.2001<br />
Von Protesten überrascht<br />
In den nächsten Monaten beginnen die Anhörungen <strong>zu</strong>m Rahmenbetriebsplan. Schwerer als der Personalabbau könnte aber<br />
die politische Auseinanderset<strong>zu</strong>ng über die Zukunft der Zeche wiegen: Im dritten oder vierten Quartal, so Schächter, beginnen<br />
die öffentlichen Anhörungen <strong>zu</strong>m Rahmenbetriebsplan. "Von den heftigen Reaktionen der Anwohner in Duisburg-Walsum<br />
wurden auch wir überrascht", erklärt Jörg Buhren-Ortmann, Vorsitzender des Betriebsrates. Ähnliche Proteste erwarte man in<br />
Lohberg-Osterfeld nicht. Grund: In Walsum soll künftig auch dort gefördert werden, wo bislang kein Abbau stattfand. Schächter:<br />
"In Lohberg hingegen fördern wir seit 90 Jahren, die Bürger wissen, was sie erwartet." Wenig Einfluss <strong>hat</strong> die Direktion auf die<br />
Entscheidungen in Berlin und Brüssel, was den Kohle-Abbau nach 2005 betrifft. Schächter: "Wir hoffen, bis <strong>zu</strong>r Bundestagswahl<br />
entsprechende Gespräche mit den Politikern <strong>zu</strong> führen." (hag)<br />
NRZ Oberhausen 10.06.2001<br />
300 Kumpel müssen dieses Jahr noch gehen<br />
<strong>Die</strong> kommenden Monate werden nicht einfach für die Zeche Lohberg-Osterfeld. <strong>Die</strong> kommenden Monate werden für das<br />
<strong>Berg</strong>werk Lohberg-Osterfeld nicht einfach. Zum Einen muss die Zeche weitere 300 Stellen bis Jahresende streichen. Zum<br />
Anderen beginnt bald die öffentliche Anhörung des Rahmenbetriebsplanes für Lohberg, heftige Proteste wie in Duisburg-<br />
Walsum könnten möglich sein. Auf der gestrigen Betriebsversammlung gab sich der scheidende Zechen-Direktor Norbert<br />
Schächter aber <strong>zu</strong>versichtlich: "Das <strong>Berg</strong>werk ist modern und für die Zukunft gerüstet."<br />
Fördermenge pro Mann ist enorm gestiegen<br />
Es war die letzte Versammlung für den 48-Jährigen. Am 25. Juni wird Jürgen Schwarze, derzeit Direktor des <strong>Berg</strong>werks Lippe,<br />
die Geschäftsleitung übernehmen (die NRZ berichtete). Seinem Nachfolger hinterlässt Schächter eine Zeche, die immer noch<br />
die Folgen des Umbruchs bewältigen muss. Als Norbert Schächter vor sieben Jahren sein Amt antrat, gab es vier Schächte,<br />
heute sind es nur noch zwei. 1994 betrug die Förderung auf Lohberg-Osterfeld noch 13 000 Tonnen Kokskohle pro Tag,<br />
inzwischen sind es rund 9000 Tonnen. Dafür ist aber die Fördermenge pro Mann und Schicht enorm gestiegen: von 4,2 auf 6<br />
Tonnen. Der Personalabbau läuft weiterhin gemäß den DSK-Vorgaben. Von den derzeit 3314 Stellen werden bis Jahresende<br />
rund 300 Jobs gestrichen. Zum Vergleich: 1994 arbeiteten noch 5042 Kumpel auf der Zeche. 38 A<strong>zu</strong>bis sollen dieses Jahr<br />
übernommen werden. Eine gute Nachricht für den Betrieb: Thyssen-Krupp-Stahl will für den geplanten Hochofen Schwelgern<br />
weiterhin auf Kokskohle aus Lohberg-Osterfeld setzen, sagte Schächter. "Wir haben entsprechende Signale erhalten." (hag)
NRZ Duisburg 05.06.2001<br />
Initiative malt arge Folgen aus<br />
Bürgerinitiative <strong>Berg</strong>baubetroffener lud <strong>zu</strong>r Infoveranstaltung über Abbau unter Walsum. Der Abbau ohne Blasversatz <strong>hat</strong><br />
schlimmere Folgen als die meisten ahnen, warnte Rainer Lenau von der Bürgerinitiative <strong>Berg</strong>baubetroffener am Niederrhein<br />
(BIB) jetzt bei einer Info-Veranstaltung in der Gaststätte Zum Johanniter in Alt-Walsum 200 erschütterte Zuhörer.<br />
Vergleich mit Problemen im Saarland<br />
Der Erörterungstermin für den umstrittenen Rahmenbetriebsplan des <strong>Berg</strong>werks Walsum rückt näher (die NRZ berichtete), die<br />
verbleibende Zeit nutzt die BIB, um Aufklärungsarbeit über das Ausmaß der <strong>zu</strong> erwartenden Schäden <strong>zu</strong> leisten und die<br />
Betroffenen <strong>zu</strong> mobilisieren. So werde es auch in Walsum aussehen, malte Lenau nach einem Filmbeitrag über das Dorf<br />
Fürstenhausen im Saarland eine düstere Zukunft. Dort müssen Menschen in Container ausweichen, einige Häuser sind durch<br />
die <strong>Berg</strong>schäden, Risse in den Häuserwänden und Schäden am Fundament nahe<strong>zu</strong> abbruchreif. Das ganze Dorf ist eine<br />
einzige Baustelle. In die Fundamente werden Federpakete eingebaut, die jede Woche gewartet werden. Eine Zumutung für die<br />
Bewohner. Laut BIB belaufen sich in besonderen Fällen die Sanierungskosten für ein Haus im Wert von 200 000 Mark auf 1,2<br />
Millionen. <strong>Die</strong>se Szenarien drohen auch hier, sagte Lenau. In Alt-Walsum würden sich die <strong>Berg</strong>schäden in den nächsten Jahren<br />
dramatisch vermehren, denn die Abbaubestrebungen gingen in 1000 Meter Tiefe unter die neu bebauten Wohngebiete hinter<br />
der Kaiserstraße. <strong>Die</strong> Informationen stammen aus den Aus<strong>zu</strong>gskopien der offiziellen Planungsunterlagen für den<br />
Sonderbetriebsplan unter den Deichen, erklärte BIB-Vorsitzender Karl Friedrichs. <strong>Die</strong>se gäben auch Auskunft über die<br />
Senkungen vom 1. Dezember 2000 bis <strong>zu</strong>m 31. Dezember 2007: 2,5 bis 4,5 Meter, 80 Prozent seien im ersten Jahr <strong>zu</strong><br />
erwarten.<br />
Trichterförmige Absenkungen<br />
Friedrichs machte den <strong>Berg</strong>senkungs-Prozess transparent. Es sei keineswegs so, dass dieser nur direkt unter den abgebauten<br />
Stellen <strong>zu</strong> erwarten sei. Vielmehr wirke sich der Abbau ohne Blasversatz trichterförmig aus. Sackt das Erdreich ab, was es ganz<br />
sicher tun wird, bestätigte der Geologe Dr. Helmut Lang die Ausführungen des BIB-Vorsitzenden, werden noch Wohngebiete im<br />
Umkreis von über 2,5 Kilometern betroffen sein. Nicht vergessen dürfe man auch die Grundwasser-Problematik. Am ganzen<br />
Niederrhein werden derzeit über 300 Millionen Kubikmeter Grundwasser abgepumpt, das nicht mehr <strong>zu</strong>m Rhein abfließen kann.<br />
Durch den Abbau unter Dinslaken, Voerde und Walsum kämen 50 Millionen cbm hin<strong>zu</strong>. Friedrichs: "Wie die DSK das alles<br />
bezahlen will, kann sie uns allen ja beim Erörterungstermin erklären." (be)<br />
NRZ Duisburg 04.06.2001<br />
Sie sind Männer der ersten Stunde<br />
<strong>Die</strong> ersten <strong>Berg</strong>leute kamen 1961 nach Duisburg - Sonntag trafen sie sich wieder. Einträchtig saßen die acht türkischen Männer<br />
am Pfingstsonntag im Cafe Cinema an der Mülheimer Straße und tranken Tee. Ein historisches Treffen - geladen <strong>hat</strong>ten die<br />
Grünen. Denn die Türken sind Pioniere, "Männer der ersten Stunde". <strong>Die</strong> acht gehören <strong>zu</strong> den 93 ersten türkischen<br />
"Gastarbeitern", die vor 40 Jahren nach Duisburg kamen, um hier im <strong>Berg</strong>bau <strong>zu</strong> arbeiten. Das war am 23. Juni 1961. Zu dieser<br />
Zeit gab es im Ruhrgebiet <strong>zu</strong> wenig Männer für die Arbeit unter Tage. Also <strong>hat</strong>te das <strong>Berg</strong>werk Westende in Hamborn einen<br />
Gesandten nach Ankara geschickt, um dort türkische Kräfte an<strong>zu</strong>werben.<br />
Mit "guten Händen" nach Deutschland<br />
Osman Kurucu <strong>hat</strong>te damals während der Arbeit davon erfahren. "Ich habe gehört, man müsse sich schnell bewerben, wenn<br />
man nach Deutschland will", erzählt er. In türkisch. Eine Presse-Kollegin übersetzt. "Wir wurden zweimal untersucht", erinnert<br />
sich Ali Adigüzel. "Ja genau, die haben sich auch die Hände angeguckt, ob die <strong>zu</strong>r Arbeit gut waren", pflichtet ihm Sabri Aydin<br />
bei und lacht. Seine Hände waren gut, er durfte nach Deutschland. "Wir kamen an einem Freitag an", weiß der 66-Jährige noch<br />
heute. Mit Musik und großen Reden wurden sie damals begrüßt. Am Montag ging es dann sofort an die Arbeit. <strong>Die</strong> Gastarbeiter<br />
<strong>hat</strong>ten sich <strong>zu</strong>nächst für ein Jahr in Hamborn verpflichtet. In der ersten Zeit wohnten sie in einem Wohnheim an der<br />
Steigerstraße. Für das Werk war das praktisch und billig - für die türkischen Männer gut, weil sie sich so gegenseitig Mut<br />
machen konnten. Schließlich kamen sie alle allein. Ihre Familien holten die damals jungen Arbeiter erst später nach. Fatime<br />
Dogan gehörte 1962 <strong>zu</strong> den ersten Frauen, die ihren Männern nach Deutschland folgten. "Ich <strong>hat</strong>te großes Heimweh" erinnert<br />
sich die 67-Jährige. Zwar knüpfte sie bald Kontakte <strong>zu</strong> den deutschen Nachbarn. Sie lebte aber in ständiger Sorge um ihren<br />
Mann. Denn die Arbeit war gefährlich, das wusste sie. "Wir gingen sofort unter Tage", erinnert sich Sabri Aydin. In die 6. Sohle,<br />
etwa 600 Meter tief. Damals <strong>hat</strong>ten alle gemeldet, bereits im <strong>Berg</strong>bau gearbeitet <strong>zu</strong> haben. Von den acht Männern waren aber<br />
nur fünf <strong>Berg</strong>leute. Und nur wenige sind dem <strong>Berg</strong>bau bis <strong>zu</strong>r Rente treu geblieben. Beim Erzählen sind die Pioniere kaum <strong>zu</strong><br />
bremsen. Jeder <strong>hat</strong> seine eigene Geschichte, sein eigenes Schicksal. Lachend erinnern sie sich an die erste Zeit im fremden<br />
Land, die ersten Einkäufe und die Missverständnisse. Mittlerweile ist Deutschland für sie <strong>zu</strong> ihrer ersten Heimat geworden.<br />
(sovo)<br />
NRZ Moers 31.05.2001<br />
Erinnerung an die Solidarität<br />
ZUR SACHE Viele können sich noch gut daran erinnern, als in der Lintforter Christuskiche wochenlang für den Erhalt des<br />
<strong>Berg</strong>baus demonstriert wurde. Politiker aus <strong>Stadt</strong>, Land und Bund bekundeten ihre Solidarität. Kirche und <strong>Berg</strong>bau saßen in<br />
einem Boot. Das ist kaum fünf Jahre her. Lintfort kam über Nacht in die Schlagzeilen. Dann wendete sich plötzlich alles <strong>zu</strong>m<br />
Guten. Vorerst. Es wurden Absprachen getroffen, die Jobs der Kumpel waren gesichert, wenn auch unter Vorgabe, die<br />
Arbeitsplätze sozialverträglich ab<strong>zu</strong>bauen. Bislang gaben sich auch alle Beteiligten große Mühe da<strong>zu</strong>. Und jetzt soll mit einem<br />
Sternmarsch wieder daran erinnert werden. <strong>Die</strong>s scheint aber weniger eine Erinnerung daran <strong>zu</strong> sein als vielmehr schon erste<br />
neue Hilferufe. Denn wieder rücken schwarze Wolken an. Wie lange sind die Jobs und Subventionen noch gesichert? Nicht<br />
aus<strong>zu</strong>denken, was mit dieser Region passiert, wenn es "Friedrich-Heinrich" treffen sollte...<br />
NRZ Moers 30.05.2001<br />
Sternmarsch mit vielen Kumpeln<br />
Solidaritätsveranstaltung "Kirche und <strong>Berg</strong>bau" kommt. Zeche will künftig die vom Steinkohle-Abbau betroffenen<br />
Bürger besser informieren. "Durchblick" wird an Haushalte verteilt.<br />
KAMP-LINTFORT. Mit einem Sternmarsch vom Pattberg <strong>zu</strong>r Mahnwache in Lintfort soll am 27. August wieder eine neue<br />
Solidaritätsveranstaltung "Kirche und <strong>Berg</strong>bau" am linken Niederrhein stattfinden. Darauf wiesen gestern der Werksleiter von<br />
"Friedrich-Heinrich", Reinhard Fox, und Betriebsratsvorsitzender Vogt hin: "Vor zehn Jahren wurde das Kreuz auf dem Pattberg
aufgestellt, es war dies ein erstes gemeinsames Vorgehen von Kirche und <strong>Berg</strong>bau." In der Folgezeit machte die Christuskirche<br />
in Kamp-Lintfort Schlagzeilen. Außerdem: Der Steinkohlenbergbau will die Bürger besser informieren. <strong>Die</strong> "Deutsche<br />
Steinkohle" <strong>hat</strong> deshalb eine Dialog- und Serviceinitiative vorgestellt. Geworben werden soll für den Fortbestand des deutschen<br />
Steinkohlebergbaus. Betroffen ist da auch die Schachtanlage "Friedrich-Heinrich" mit ihren Abbaubereichen. Der Lintforter<br />
Werksleiter Fox und Markscheider Norbert Ballhaus erläuterten ihrerseits, was die Kampagne für die Menschen am linken<br />
Niederrhein bedeutet: "Bereits seit dem 30. April dieses Jahres stehen rund 160 Mitarbeiter in Homberg den von den<br />
Auswirkungen betroffenen Menschen mit Rat und Tat <strong>zu</strong>r Seite. In Spitzenzeiten gab es schon täglich bis <strong>zu</strong> 400 Anrufe. "Wir<br />
können da gute Erfolge verzeichnen. Es sind nur Profis am Werk, die rund um die Uhr arbeiten. <strong>Die</strong> Daten werden direkt in<br />
einen PC eingegeben." Doch es passiert auch, dass nicht in allen Fällen im entsprechend kurzen Zeitraum nachgegangen wird.<br />
Nach einer Woche sollte nämlich immer ein erster Kontakt stattfinden, dann wird ein Termin verabredet und vor Ort<br />
Begutachtung und Regulierung vorgenommen werden. Vierteljährlich erscheint nun die <strong>Berg</strong>bau-Zeitschrift "Durchblick", die an<br />
alle Haushalte im Umfeld der einzelnen <strong>Berg</strong>werke verteilt werden soll. Damit soll der Kontakt <strong>zu</strong> ihnen hergestellt werden. <strong>Die</strong><br />
Lintforter Zeche ist selbst mit Beiträgen im Mittelteil der Zeitschrift vertreten: "Wir erhöhen damit sicherlich die Akzeptanz des<br />
<strong>Berg</strong>baus in der Bürgerschaft. <strong>Die</strong> Zeitschrift soll u.a. in Lintfort, Rheurdt, Alpsray, Rayen und Rheinberg verteilt werden.<br />
Rahmenbetriebspläne: <strong>Die</strong> Ausstellung im Lintforter Rathaus wird ab- und im Vereinsheim Rayener <strong>Berg</strong> aufgebaut. Auf die<br />
Entscheidung der Aufsichtsbehörde <strong>zu</strong>m Rahmenbetriebsplan für die Schachtanlage Friedrich-Heinrich wird sehnlichst<br />
gewartet. Der jetzige Plan ist bis 2003, also noch anderthalb Jahre gültig. Was ist, wenn bis dahin keine Entscheidung getroffen<br />
wird? "Dann müssen wir <strong>zu</strong>r Kurzarbeit greifen oder auch Kündigungen." Daran denkt aber keiner<br />
NRZ Moers 29.05.2001<br />
Auf dem Rücken der <strong>Berg</strong>leute<br />
Auslaufbergbau? Nur weil sich EU Politiker in innerdeutsche Kohlepolitik einmischen, will eine sterbende Partei wie die FDP<br />
Schlagzeilen auf dem Rücken der <strong>Berg</strong>leute machen und propagiert eine Kür<strong>zu</strong>ng der Kohlebeihilfen bis gegen null. Nach dem<br />
Kohlekompromiss von 1997 wurde den <strong>Berg</strong>leuten im Rahmen der Energiesicherheit eine klare Aussage an die Hand gegeben,<br />
wie die Planungssicherheit im Deutschen Steinkohlenbergbau für die nächsten Jahre aus<strong>zu</strong>sehen <strong>hat</strong>. Bis heute <strong>hat</strong> der<br />
<strong>Berg</strong>bau alle Vorgaben unter größter Kraftanstrengung erfüllt. Zumal es Verträge und feste Zusagen gibt, an welche die<br />
<strong>Berg</strong>leute sich halten. Meinen die FDP- Politiker denn, wenn es keinen <strong>Berg</strong>bau in Deutschland mehr gibt, dass die Importkohle<br />
weiterhin so preiswert am Markt angeboten wird? Sie sollten ihre Hausaufgaben machen und eine gesamtwirtschaftliche<br />
Betrachtung vornehmen, <strong>zu</strong> der neben einer großen Zahl von Arbeitslosen das aufaddieren von Energiesicherheit gehört. Ein<br />
Herr M. springt auch nicht ohne Fallschirm, nur weil er gerade das Geld anderweitig benötigt. Eine Partei, die solche Aussagen<br />
trifft, ist für mich nicht förderungswürdig - keine Stimme und keinen Pfennig!<br />
NRZ Rheinberg 25.05.2001<br />
Nächste Woche auf <strong>zu</strong>m Anwalt<br />
<strong>Die</strong> meisten wollen gegen Abrisspläne am Deich Einspruch erheben. Nicht so exponiert wie Ralf Lieven in Obermörmter und<br />
Ilka Trapp in Vynen wohnen Bettina und Uwe Hapich am Rheindamm. "Unser Haus steht noch nicht einmal in der<br />
Sicherheitszone 1 oder 2", erklärt Bettina Hapich. "Wir wollten nicht in einer Wohnsiedlung leben und haben uns deshalb für das<br />
alleinstehende Haus am Rheindamm entschieden", sagt sie weiter. Hoffnung, dass ihnen der Deichverband ein ebenbürtiges<br />
Gebäude anbieten könnte, <strong>hat</strong> sie nicht: "Nächste Woche nehmen wir uns einen Rechtsanwalt", zeigen auch die Hapichs, dass<br />
sie nicht ohne Widerstand die Wohnung am Deich räumen wollen. Deichgräf Johannes Heisterkamp <strong>hat</strong>te am Montag in einer<br />
Bürgerversammlung (wir berichteten) zwar versprochen, dass den elf Hauseigentümern ein gutes, vielleicht sogar deichnahes<br />
Ersatzangebot gemacht werden soll. Keiner werde gezwungen sein, den Heimatort <strong>zu</strong> verlassen. Der Deichverband wisse, dass<br />
"der Abriss von elf Häusern kein Kinderspiel ist. Den meisten fehlt offensichtlich auch der Glaube, dass es ein adäquates<br />
Angebot sein wird. Neues hätten sie auf der Versammlung am Montag auch nicht erfahren. "Wie will der Deichgräf Heisterkamp<br />
das denn machen mit dem guten Angebot für alle Elf?" fragt sich Bärbel van Loock. Sie werde mit ihrer Familie jetzt erst einmal<br />
Einspruch gegen die Planfeststellung erheben: "Ob wir bei einer Abweisung des Einspruches klagen werden, wissen wir noch<br />
nicht."