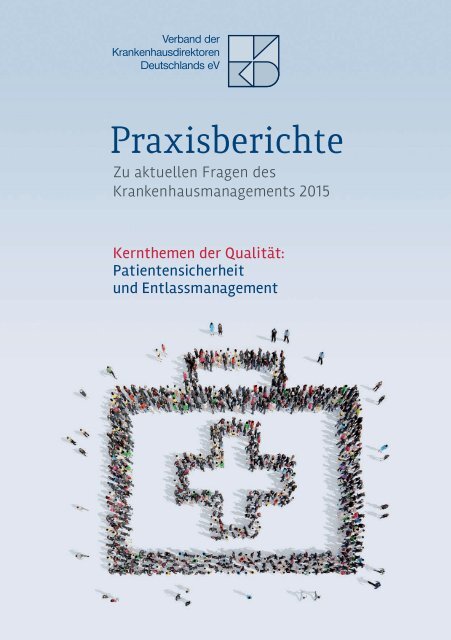VKD-Praxisberichte 2015
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Praxisberichte</strong><br />
Zu aktuellen Fragen des<br />
Krankenhausmanagements <strong>2015</strong><br />
Kernthemen der Qualität:<br />
Patientensicherheit<br />
und Entlassmanagement
Herausgeber:<br />
Verband der<br />
Krankenhausdirektoren<br />
Deutschlands e.V.<br />
Geschäftsstelle <strong>VKD</strong><br />
Oranienburger Straße 17<br />
D-10178 Berlin<br />
Telefon (030) 28 88 59 – 14<br />
Telefax (030) 28 88 59 – 15<br />
Internet: www.vkd-online.de<br />
ISBN 978-3-00-050612-3
Editorial<br />
Patienten im Krankenhaus erwarten Heilung und<br />
Linderung. Häufig haben sie durch ihre Krankheit<br />
das Gefühl, in einer mit Risiken behafteten<br />
Lebenssituation zu sein. Werden die Ärzte und<br />
Pflegenden mir helfen können? Ich bin sicher:<br />
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den<br />
Kliniken tun ihr Bestes. Das uralte ethische Gebot<br />
der Mediziner, zuallererst keinen Schaden<br />
anzurichten (primum nihil nocere), gilt auch für<br />
das ganze Krankenhaus. Die Sicherheit unserer<br />
Patienten hat oberste Priorität und ist auch eine<br />
Frage der Organisation und des Managements.<br />
Diese Sicherheit hat zahlreiche Facetten, zumal<br />
Krankenhäuser heute komplexe Unternehmen<br />
mit vielen Schnittstellen sind, die Risiken beinhalten<br />
können. Dazu gehört nicht nur die immer<br />
wieder in der Öffentlichkeit kommentierte<br />
Hygiene. Dazu gehören sichere Prozesse im OP<br />
und überall in einer Klinik, eine funktionierende<br />
Kommunikation zwischen Fach- und Berufsgruppen,<br />
ganz wesentlich auch die Arzneimittelsicherheit,<br />
aber auch die Sicherheit von Medizintechnik<br />
und IT.<br />
Die Krankenhäuser stellen sich aktiv diesen Themen.<br />
Ihr umfangreiches Qualitätsmanagement<br />
ist in seiner Detailliertheit und auch Transparenz<br />
nach innen und außen ein wesentlicher Faktor<br />
zur stetigen Verbesserung aller Leistungen und<br />
damit gleichzeitig der Patientensicherheit. Sie<br />
vergleichen sich aktiv, um vom Besseren zu lernen.<br />
Sie befragen Patienten, einweisende Ärzte<br />
und Mitarbeiter. Seit Jahren werden sowohl von<br />
den Ärztekammern als auch den Krankenkassen<br />
Fehlerstatistiken geführt und veröffentlicht.<br />
Viele Kliniken haben ein so genanntes CIRS, ein<br />
Meldesystem für Beinahe-Fehler, eingeführt, um<br />
kritische Ereignisse bereits im Vorfeld verhindern<br />
und daraus auch deren Vermeidung lernen<br />
zu können. Handlungsempfehlungen zu sicherheitsrelevanten<br />
Themen gibt es vom Aktionsbündnis<br />
Patientensicherheit, das im Jahr 2005<br />
gegründet wurde. Das sind nur einige Beispiele.<br />
Patientensicherheit endet aber nicht an der<br />
Krankenhaustür. Der Erfolg einer Behandlung<br />
hat oft auch damit zu tun, was danach passiert.<br />
Ein strukturiertes Entlassmanagement ist seit<br />
2012 gesetzliche Pflicht für Krankenhäuser. In<br />
vielen Kliniken wurde bereits in den Jahren davor<br />
der Krankenhaus-Sozialdienst personell aufgestockt<br />
und professionalisierte sich. Die Organisation<br />
des »Danach« beginnt in vielen Fällen<br />
bereits bei der Aufnahme eines Patienten. Die<br />
Verweildauern haben sich im Vergleich zu Vorjahren<br />
deutlich verkürzt. Das bedeutet, hier sehr<br />
schnell aktiv werden zu müssen.<br />
Dabei stoßen die Verantwortlichen allerdings<br />
häufig auf Lücken in den anderen Behandlungssektoren.<br />
Entlassmanagement muss, um tatsächlich<br />
wirksam zu sein, zu einem gegenseitigen<br />
Verlegungsmanagement werden, das auch<br />
die anderen Bereiche – niedergelassene Ärzte,<br />
ambulante Pflegedienste, Pflegeheime und andere<br />
Beteiligte in eine gesetzliche Pflicht nimmt.<br />
Davon sind wir allerdings noch weit entfernt.<br />
Vergleichbare Qualitätskriterien gibt es bisher<br />
kaum. Wir in den Krankenhäusern wüssten sehr<br />
gern mehr über die Qualität und Patientensicherheit<br />
in der ambulanten medizinischen und<br />
pflegerischen Welt, um guten Gewissens unsere<br />
Patienten dorthin entlassen zu können. Dort, wo<br />
es Lücken in der ambulanten Versorgung gibt,<br />
würden die Krankenhäuser gern selbst die Weiterbehandlung<br />
übernehmen. Dafür fehlen aber<br />
die gesetzlichen Grundlagen.<br />
Beispiele dafür, wie Krankenhäuser für die Sicherheit<br />
ihrer Patienten und auch für deren<br />
Weiterbetreuung sorgen, werden in den <strong>Praxisberichte</strong>n<br />
dieses Jahres vorgestellt. Dabei geht<br />
es u.a. um Themen, die auch in der Öffentlichkeit<br />
immer wieder zum Teil sehr skandalisiert<br />
dargestellt werden – etwa um Hygiene und Arzneimittelsicherheit<br />
- aber auch um die besonderen<br />
Bedingungen in psychiatrischen Kliniken,<br />
um den strategischen Aufbau von Sektor übergreifenden<br />
Strukturen, um die Einbeziehung von<br />
Angehörigen, die helfen, Behandlungserfolge zu<br />
stabilisieren und zu sichern.<br />
Ich freue mich daher, dass dem teilweise schiefen<br />
Bild, das Versicherte und Kranke irritiert, engagierte<br />
Ärzte und Pflegende auf Dauer demotiviert,<br />
hier etwas Handfestes entgegengesetzt<br />
wird.<br />
Dr. Josef Düllings<br />
Präsident des Verbandes<br />
der Krankenhausdirektoren<br />
Deutschlands<br />
1<br />
<strong>VKD</strong>-<strong>Praxisberichte</strong> <strong>2015</strong> | Patientensicherheit und Entlassmanagement
Ein wesentliches Ziel des Verbandes der Krankenhausdirektoren<br />
Deutschlands ist der Know-<br />
How-Transfer, das Lernen voneinander. Dem<br />
dienen auch die Berichte aus der Praxis, die nun<br />
schon zum 10. Mal erscheinen. In einer Zeit des<br />
immer härteren Wettbewerbs auch der Krankenhäuser<br />
untereinander zeigen sie, dass der Sinn<br />
und die Aufgabe eines Krankenhauses dennoch<br />
immer auf das Wohl und die Sicherheit unserer<br />
Patienten gerichtet sind. Sie stehen an erster<br />
Stelle.<br />
Den Lesern der <strong>Praxisberichte</strong> wünsche ich eine<br />
anregende Lektüre. Den Autorinnen und Autoren<br />
danke ich für die interessanten Einblicke.<br />
Ihr<br />
Dr. Josef Düllings<br />
2<br />
<strong>VKD</strong>-<strong>Praxisberichte</strong> <strong>2015</strong> | Patientensicherheit und Entlassmanagement
Kernthemen der Qualität:<br />
Patientensicherheit<br />
und Entlassmanagement<br />
Inhaltsverzeichnis<br />
Patientensicherheit<br />
Safety first in einem komplexen System<br />
Qualität und Patientensicherheit sind zentrale Kompetenzen der Krankenhäuser<br />
Gabriele Kirchner, Geschäftsführerin des Verbandes der Krankenhausdirektoren Deutschlands . . . . . . . . . . . . . . . Seite 7<br />
Wir warten nicht erst auf eine Hygiene-Initiative!<br />
Die Bodden-Kliniken Ribnitz-Damgarten haben ein umfassendes Hygienemanagement etabliert<br />
Dr. Falko Milsky, Geschäftsführer der Boddenkliniken Ribnitz-Damgarten GmbH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seite 11<br />
Das Ziel: Eine funktionierende Sicherheitskultur<br />
Aufbau eines Medizinischen Risikomanagements im Krankenhaus Märkisch-Oderland<br />
Angela Krug, Geschäftsführerin Krankenhaus Märkisch-Oderland Strausberg/Wriezen<br />
Katharina Paul, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Krankenhaus Märkisch-Oderland Strausberg/Wriezen . . Seite 16<br />
Der etwas andere Blick auf die Patientensicherheit<br />
Großes Engagement in den psychiatrischen und psychosomatischen Einrichtungen<br />
trotz wachsender wirtschaftlicher Unsicherheit<br />
Holger Höhmann, Kaufmännischer Direktor und Vorstandsvorsitzender der LVR-Klinik Langenfeld,<br />
Vorsitzender der Fachgruppe Psychiatrische Krankenhäuser im Verband der Krankenhausdirektoren<br />
Deutschlands (<strong>VKD</strong>) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seite 19<br />
Der Erfolg: Aufbau einer positiven Fehlerkultur<br />
Erfahrungen mit Risikomanagement und Critical Incident Reporting System (CIRS)<br />
im Psychiatrischen Fachkrankenhaus<br />
Dr. Annette Egloff, Qualitätsmanagement, Asklepios Fachklinikum Göttingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seite 22<br />
Medikationsfehler sind vermeidbare Risiken<br />
AMTS - wichtiges Thema für unsere Krankenhäuser<br />
Dr.rer.nat. Albrecht Eisert, Chefapotheker, Apotheke Uniklinik RWTH Aachen<br />
Rebekka Lenssen, Fachapothekerin für Klinische Pharmazie, Apotheke Uniklinik RWTH Aachen<br />
Peter Asché, Kaufmännischer Direktor Uniklinik RWTH Aachen, Vizepräsident des Verbandes<br />
der Krankenhausdirektoren Deutschlands . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seite 27<br />
<strong>VKD</strong>-<strong>Praxisberichte</strong> <strong>2015</strong> | Patientensicherheit und Entlassmanagement 3
Medikationsprozess optimal gestaltet<br />
Projekt zur Arzneimitteltherapiesicherheit mit hohem Nutzen für die Patienten<br />
Adelheid May, Geschäftsführerin, Susanne Graudenz, Pflegedirektorin, Birte Jerkel, Apothekerin,<br />
Mechthild Wenke, Fachapothekerin für Klinische Pharmazie, Apothekenleitung,<br />
Asklepios Harzkliniken GmbH, Goslar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seite 34<br />
Der Demenzkoordinator im Akutkrankenhaus<br />
Wie kann die Versorgung von Menschen mit Demenz im klinischen Alltag verbessert werden? –<br />
Bericht über ein Modellprojekt<br />
Maud Beste, Geschäftsführerin des Klinikums Gütersloh,<br />
Verena Beckmann, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Klinikums Güterloh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seite 38<br />
Das Anti-Delir-Konzept – ein Notdienst für Demenzkranke<br />
Krankenhäuser benötigen Strategien für betroffene Patienten<br />
Kerstin Ganskopf, Geschäftsführerin des Sankt Elisabeth Krankenhauses Eutin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seite 41<br />
Entlassmanagement<br />
Entlassmanagement erfordert Kooperation auf allen Seiten<br />
Die meisten Krankenhäuser arbeiten bereits nach festen Standards –<br />
Lücken gibt es an den Schnittstellen<br />
Horst Defren, Geschäftsführer der Kliniken Essen-Mitte Evang. Huyssens-Stiftung/Knappschaft GmbH . . . . . Seite 49<br />
Projektbezogene Partnerschaften<br />
Strategie als Grundlage eines integrierten Gesundheitsunternehmens<br />
Dipl.-Kfm. Hans-Jürgen Winkelmann, Geschäftsführer der St. Marien-Krankenhaus Siegen gem. GmbH<br />
Dipl.-Volksw. Dr. rer. pol. Christian Stoffers, Leiter Referat Kommunikation & Marketing der St. Marien-<br />
Krankenhaus Siegen gem. GmbH, Vertr. Professur & Dozent im Fach Marketing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seite 54<br />
Gibt es Hoffnung beim Entlassmanagement?<br />
Ein gemeinschaftlicher neuer Versuch im Einbecker BürgerSpital<br />
Hans-Martin Kuhlmann, Kaufmännischer Geschäftsführer, Einbecker BürgerSpital, Einbeck<br />
Markus Krahforst, Hochschule Osnabrück . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seite 59<br />
Verlegungsmanagement: Krankenhaus - Pflegeeinrichtung – Krankenhaus<br />
Strukturierte Überleitung sichert Weiterversorgung und Behandlungsergebnisse<br />
Franz Hartinger, Einrichtungsleiter Alten- und Pflegeheim Klinikum Ingolstadt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seite 65<br />
Familiale Pflege – der Übergang vom psychiatrischen Krankenhaus<br />
in die häusliche Pflege<br />
Unterstützung für pflegende Angehörige: Beraten – Begleiten – Schulen - Trainieren<br />
Silke Ludowisy-Dehl, Pflegedirektorin, LVR-Klinik Langenfeld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seite 69<br />
Impressum ................................................................................................... Seite 73<br />
4<br />
<strong>VKD</strong>-<strong>Praxisberichte</strong> <strong>2015</strong> | Patientensicherheit und Entlassmanagement
Patientensicherheit<br />
<strong>VKD</strong>-<strong>Praxisberichte</strong> <strong>2015</strong> | Patientensicherheit und Entlassmanagement 5
6<br />
<strong>VKD</strong>-<strong>Praxisberichte</strong> <strong>2015</strong> | Patientensicherheit und Entlassmanagement
Safety first<br />
in einem komplexen System<br />
Paentensicherheit<br />
Qualität und Patientensicherheit sind zentrale Kompetenzen der Krankenhäuser<br />
Gesetzlich verpflichtet<br />
Krankenhäuser in Deutschland sind zur Installation eines einrichtungsinternen<br />
Qualitäts- und patientenorientierten Beschwerdemanagements verpflichtet (§ 135a<br />
Abs. 2 Nr. 2 SGB V). Sie müssen außerdem einen Beauftragten für das Risikomanagement<br />
haben (§137 Abs. 1d SGB V). Ein anonymes Meldesystem für Beinahe-Fehler<br />
und kritische Ereignisse (CIRS) soll eingeführt werden. Ziel ist die Verbesserung der<br />
Patientensicherheit.<br />
Seit dem Jahr 2005 müssen Krankenhäuser in Deutschland regelmäßig strukturierte<br />
Qualitätsberichte veröffentlichen(§ 137a Abs. 2 Nr. 4 SGB V).<br />
Jährlich finden in deutschen Krankenhäusern<br />
mehr als 18,7 Mio. Menschen medizinische<br />
Hilfe. Hinzu kommt eine große Zahl von Patienten,<br />
die ambulant behandelt werden - in<br />
den Notaufnahmen, in Institutsambulanzen,<br />
in ambulanten OP-Zentren. Sie alle befinden<br />
sich in einer durch die Krankheit besonderen<br />
persönlichen Situation. Sie vertrauen zu Recht<br />
darauf, dass auf ihre Sicherheit das besondere<br />
Augenmerk aller Mitarbeiterinnen und<br />
Mitarbeiter gerichtet ist. Patientensicherheit<br />
ist im Krankenhaus ein besonders hohes Gut<br />
– auch wenn das in der Öffentlichkeit häufig<br />
anders dargestellt wird. Es wird viel Kraft<br />
darauf verwendet, sie im komplexen System<br />
einer Klinik zu gewährleisten. Eine Fülle von<br />
Faktoren spielt dabei eine Rolle – Sicherheit<br />
der Medizintechnik zum Beispiel oder die<br />
sicheren Übergaben innerhalb und zwischen<br />
den Berufsgruppen - Faktoren, die ein Patient<br />
oft gar nicht wahrnimmt, die aber zu seiner<br />
Sicherheit beachtet werden müssen.<br />
Krankenhäuser in Deutschland haben in den<br />
vergangenen Jahren eine stabile, gesetzlich<br />
vorgeschriebene Qualitätssicherung aufgebaut.<br />
Sie unterziehen sich in diesem Zusammenhang<br />
permanenten Qualitätsprüfungen, deren Ergebnisse<br />
veröffentlicht werden. Auffälligkeiten<br />
werden dabei erkannt und es wird darauf entsprechend<br />
reagiert. Im Mittelpunkt steht dabei<br />
immer die Qualität der medizinischen Behandlung<br />
– also die Sicherheit der Patienten.<br />
Ebenfalls gesetzlich gefordert ist der Aufbau<br />
eines strukturierten Qualitätsmanagements,<br />
das auf das Funktionieren von Prozessen und<br />
Strukturen gerichtet ist – auch dies ist eine<br />
wichtige Voraussetzung dafür, dass am Ende<br />
auch die medizinische Qualität stimmt.<br />
Hinzu kommen in den meisten Kliniken freiwillige<br />
Zertifizierungen des gesamten Krankenhauses<br />
und einzelner Abteilungen. Organzentren<br />
müssen zudem von den medizinischen<br />
Fachgesellschaften zertifiziert werden. Alle<br />
diese Zertifikate werden nach wenigen Jahren<br />
erneut überprüft. Auch die nichtmedizinischen<br />
Bereiche der Krankenhäuser, wie etwa Küchen<br />
und Labore – müssen ihre Arbeit überprüfen<br />
lassen. Mehr als 500 Krankenhäuser sind von<br />
der Kooperation für Transparenz und Qualität<br />
KTQ in der Regel bereits mehrfach und nach<br />
immer weiter verschärften und erweiterten<br />
Anforderungen zertifiziert worden. Es gibt<br />
Stillfreundliche Krankenhäuser, zertifiziert von<br />
der WHO, es gibt Krankenhäuser, die besonders<br />
viel für Diabetiker tun, zertifiziert von der<br />
Deutschen Diabetes-Gesellschaft, es gibt Qualitätssiegel<br />
von Krankenkassen, zahlreiche Zertifikate<br />
von medizinischen Fachgesellschaften<br />
und vieles mehr.<br />
Alle diese unterschiedlichen Zertifikate zeigen<br />
den Patienten, den niedergelassenen Ärzten,<br />
anderen Partnern der Krankenhäuser und der<br />
Öffentlichkeit, dass eine Klinik nicht nur die<br />
vom Gesetzgeber verlangte Qualitätssicherung<br />
betreibt, damit alle Qualitätsanforderungen<br />
erfüllt, zu denen auch die medizinische Behandlung<br />
gehört, sondern darüber hinaus weitere<br />
Anstrengungen unternimmt, interne Pro-<br />
Gabriele Kirchner<br />
Geschäftsführerin<br />
des Verbandes der<br />
Krankenhausdirektoren<br />
Deutschlands (<strong>VKD</strong>)<br />
»Patientensicherheit gehört<br />
zu den wesentlichen Kompetenzen<br />
der Krankenhäuser<br />
in Deutschland. Um sich<br />
hier ständig weiter zu<br />
verbessern, haben sie in<br />
den vergangenen Jahren<br />
viel Kraft und Engagement<br />
investiert – und dies sehr<br />
erfolgreich. Das zeigen zum<br />
Beispiel die jährlich veröffentlichten<br />
Ergebnisse der<br />
externen Qualitätssicherung.<br />
Das Krankenhausmanagement<br />
sieht eine vorrangige<br />
Aufgabe auch darin, entsprechende<br />
Bedingungen<br />
dafür zu schaffen.«<br />
Gabriele Kirchner<br />
<strong>VKD</strong>-<strong>Praxisberichte</strong> <strong>2015</strong> | Patientensicherheit und Entlassmanagement 7
Paentensicherheit<br />
zesse so zu organisieren und zu steuern, dass<br />
diese medizinische Behandlung möglichst optimal<br />
abläuft. Dabei geht es auch um Fragen<br />
der Sicherheit, zu der ganz wesentlich u.a die<br />
Hygiene und die Arzneimitteltherapiesicherheit<br />
gehören.<br />
Im komplexen Zusammenspiel aller Bereiche<br />
und Abteilungen in einem Krankenhaus rund um<br />
das Wohl und die Sicherheit der Patienten kann<br />
aber dennoch vieles nicht nach »Schema F«<br />
ablaufen. Nicht nur, weil es hier immer auch<br />
auf den einzelnen Menschen, seine Ausbildung,<br />
sein Engagement, durchaus auch seinen<br />
emotionalen Zuschnitt ankommt. Das betrifft<br />
zudem nicht nur die Mitarbeiter, sondern auch<br />
die Patienten.<br />
Der Druck ist gestiegen<br />
Gut funktionierende Abläufe, das Beachten fester<br />
Regeln, eine moderne Ausstattung stoßen an<br />
Grenzen, wenn zu wenig Personal da ist, um steigende<br />
Patientenzahlen zu versorgen. Seit Jahren<br />
werden in unseren Kliniken mehr Menschen<br />
und vor allem auch mehr ältere Menschen behandelt<br />
und gepflegt. Der Wettbewerb, der mit<br />
Einführung von Fallpauschalen (DRG) ausgelöst<br />
wurde, hat nicht nur zu mehr Transparenz<br />
über das Geschehen in den Krankenhäusern<br />
geführt. Er hat auch den Druck auf Häuser und<br />
Mitarbeiter enorm erhöht. Gleichzeitig fahren<br />
die Bundesländer seit Jahren ihre Investitionsmittel<br />
für die Krankenhäuser erheblich zurück<br />
und brechen damit kontinuierlich das Gesetz<br />
– eine Tatsache, die nun sogar durch ein Bundesgesetz<br />
– das im Gesetzgebungsverfahren<br />
befindliche Krankenhaus-Strukturgesetz – legalisiert<br />
werden soll. Tarifsteigerungen wiederum<br />
wurden und werden von den Krankenkassen<br />
nicht finanziert. Das alles führte dazu, dass die<br />
Häuser gezwungen waren, Personal abzubauen.<br />
Dennoch ist die Anzahl der Behandlungsfehler<br />
laut der jährlich herausgegebenen Statistiken<br />
von Ärztekammern und Krankenkassen nahezu<br />
über die Jahre unverändert auf einem niedrigen<br />
Niveau geblieben. Das zeigt, dass in den Krankenhäusern<br />
trotz schwieriger Bedingungen<br />
enorme Anstrengungen unternommen werden,<br />
klinische Risiken zu minimieren und Fehler zu<br />
vermeiden.<br />
Multiprofessionelle und Sektor<br />
übergreifende Ansätze notwendig<br />
Nicht alle Aspekte der Patientensicherheit finden<br />
sich in den diesjährigen Berichten des <strong>VKD</strong><br />
aus der Krankenhauspraxis, die im Folgenden<br />
veröffentlicht sind. Vorrangig behandelt werden<br />
Fragen der Hygiene, Arzneimitteltherapiesicherheit,<br />
des CIRS sowie der Sicherheit<br />
dementer Patienten, mit denen die Krankenhäuser<br />
zunehmend konfrontiert sind und die<br />
besondere Bedingungen und Prozesse – auch<br />
über die Krankenhausgrenzen hinaus – erfordern.<br />
Alle diese Beispiele zeigen, dass es künftig<br />
multiprofessioneller Ansätze und der Kooperation<br />
aller Beteiligten, einschließlich der<br />
Angehörigen, bedarf, um Patientensicherheit<br />
über die gesamte Behandlungskette hin zu garantieren.<br />
Denn zur Patientensicherheit gehört<br />
eben wesentlich auch, dass dieses Ergebnis<br />
nachhaltig ist. Entlassmanagement ist eine gesetzliche<br />
Pflicht der Krankenhäuser. In diesem<br />
Zusammenhang verweise ich auf den Beitrag<br />
von Horst Defren zu diesem durchaus schwierigen<br />
Thema.<br />
Erfahrungsaustausch<br />
als wichtige Aufgabe<br />
Seit vielen Jahren sind Arbeitsgruppen in den<br />
Krankenhäusern auch im Rahmen von <strong>VKD</strong>-Initiativen<br />
dabei, sich mit der Verbesserung ganz<br />
bestimmter Aspekte der Patientensicherheit zu<br />
beschäftigen.<br />
So haben sich Teams um den Golden Helix<br />
Award, den ältesten Qualitätspreis im deutschen<br />
und europäischen Gesundheitswesen, in<br />
den immerhin 20 Jahren seines Bestehens immer<br />
wieder mit solchen Projekten beworben.<br />
Der <strong>VKD</strong> ist Träger des Preises.<br />
Nur einige Beispiele: Druckgeschwüren bei<br />
Patienten vorzubeugen – das war das Ziel des<br />
Siegerteams 1994. Die Sieger im Jahr 2000 haben<br />
sich intensiv mit unerwünschten Arzneimittelwirkungen<br />
beschäftigt. Um die Therapiesicherheit<br />
für Sondenpatienten ging es einem<br />
Finalistenteam im Jahr 2008. Auch ein modernes<br />
Notaufnahme-Management sorgt für mehr<br />
Patientensicherheit – wie es im Siegerprojekt<br />
2011 präsentiert wurde. Und das Besondere:<br />
Alle diese Projekte aus 20 Jahren mussten<br />
Sicherheits-Check vor der Operation<br />
Vor Einleitung einer Narkose, vor dem ersten Schnitt und bevor der Patient wieder<br />
aus dem Operationssaal gefahren wird, sollten 19 von der WHO festgelegte Punkte<br />
durch das Team abgefragt werden. Diese Sicherheits-Checkliste (Safe Surgery Saves<br />
Lives Study Group) gehört bereits in vielen Krankenhäusern zur OP-Routine und hat<br />
sich nachweisbar auf die Fehlerquoten in diesem Bereich ausgewirkt.<br />
8<br />
<strong>VKD</strong>-<strong>Praxisberichte</strong> <strong>2015</strong> | Patientensicherheit und Entlassmanagement
nachvollziehbar sein und an anderen Krankenhäusern<br />
oder auch Pflegeheimen wiederholt<br />
werden können. Aus der Praxis für die Praxis.<br />
Auch das Langzeitprojekt »Entscheiderfabrik<br />
– Unternehmenserfolg durch optimalen IT-<br />
Einsatz«, zu dessen Gründern der <strong>VKD</strong> gehört,<br />
fokussiert sich nicht allein auf die Technik. Sie<br />
ist Mittel zum Zweck. Ziele der Teams aus Krankenhäusern,<br />
IT-Firmen und Beratungsunternehmen<br />
sind immer Verbesserungen in Prozessen<br />
und damit in der Regel auch die Sicherheit<br />
der Patienten.<br />
Auch hierfür nur einige, wenige Beispiele: So<br />
hat sich eine Projektgruppe im Jahr 2010 mit<br />
dem krankenhausübergreifenden, standardisierten<br />
und patientennahen Informationsaustausch<br />
befasst – eine Voraussetzung dafür,<br />
dass wirklich sämtliche Daten fallbezogen und<br />
mit lebenslanger Sicht auf den jeweiligen Patienten<br />
im Krankenhaus und auch bei eingebundenen<br />
externen Partnern möglich ist – und<br />
dadurch Risiken vermindert werden. Im Jahr<br />
2013 ging es in einem Projekt um Teleradiologie<br />
– denn die Geschwindigkeit des Austauschs<br />
medizinischer Informationen entscheidet nicht<br />
selten über den Erfolg einer Therapie und damit<br />
auch die Sicherheit der betroffenen Patienten.<br />
Im Jahr 2012 wurden digitale Patienten-Aufklärungsbögen<br />
u.a. als Vorbereitung für das vor<br />
einer Operation notwendige Gespräch mit dem<br />
Anästhesisten vorgestellt.<br />
Erfahrungsaustausch hilft,<br />
Fehler zu vermeiden<br />
Auch die jährlichen Berichte aus der Krankenhauspraxis<br />
fügen sich in dieses Bild, dass in<br />
den Kliniken viel für die Verbesserung der Sicherheitskultur<br />
getan wird. Denn wo Menschen<br />
arbeiten, wo sie zudem häufig unter Zeitdruck<br />
in einem komplexen System arbeiten, passieren<br />
Fehler, kommt es zu unerwünschten Ereignissen.<br />
Diese möglichst zu verhindern – das ist<br />
die Herausforderung. Das ist das Ziel aller Anstrengungen<br />
in Medizin und Pflege, aber auch<br />
in allen anderen Bereichen des Krankenhauses<br />
– und nicht zuletzt im Management, das nicht<br />
nur für Organisation und Prozesse zuständig<br />
ist, sondern auch für ein angstfreies Arbeiten<br />
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Nur so<br />
entsteht eine positive Unternehmenskultur, in<br />
der es nicht um Schuldzuweisungen, sondern<br />
um Verbesserungen und die Vermeidung von<br />
Fehlern und um das Lernen daraus geht.<br />
Gesellschaftliche Aufgabe<br />
Nicht zu vergessen ist dabei aber auch, dass<br />
unser komplexes Gesundheitssystem inzwischen<br />
an einem Punkt angekommen ist, wo sein<br />
Ordnungsrahmen ernsthaft auf den Prüfstand<br />
gestellt werden sollte.<br />
Eine Qualitätsinitiative auszurufen, wie es derzeit<br />
die Politik tut, genügt nicht. Künftig müssen<br />
Bund und Länder, wenn sie ihrerseits mehr<br />
für Qualität und Sicherheit sorgen wollen, eine<br />
ausreichende Finanzierung der Krankenhäuser<br />
garantieren. Nur so können die benötigten<br />
Mitarbeiter und auch die notwendige moderne<br />
Infrastruktur auf Dauer bereitgestellt werden.<br />
Gleichzeitig müssen in den Ländern regionale<br />
Konzepte entwickelt werden, die sämtliche Beteiligte<br />
– Krankenhäuser und ambulante Ärzte,<br />
Ärztezentren, Krankenkassen, Pflegedienste<br />
und -heime, Rehakliniken, Physiotherapeuten,<br />
Sozialdienste und alle, die präventiv tätig sind,<br />
mit einbeziehen. Hier müssen schließlich auch<br />
neue Qualitätsindikatoren ansetzen. Das ist vor<br />
allem angesichts der demografischen Entwicklung<br />
notwendig, die andere Krankheiten in den<br />
Fokus rückt, als sie heute z.B. in der externen<br />
Qualitätssicherung noch die Hauptrolle spielen.<br />
Einen springender Punkt in der Sektor übergreifenden<br />
Behandlung und Betreuung der Menschen,<br />
die in ihrer Mehrzahl vermutlich chronisch<br />
kranke alte Patienten sein werden – und<br />
heute schon vielfach sind - stellen aber auch<br />
die sehr unterschiedlichen Vergütungssysteme<br />
dar, die immer wieder notwendige Entwicklungen<br />
verhindern. Die sektorale Gliederung<br />
unseres Gesundheitssystems mit ihren unterschiedlichen<br />
Finanzierungs- und Qualitätssicherungssystemen<br />
ist nicht nur teuer, sondern<br />
auch für die Sicherheit der Patienten kontraproduktiv.<br />
Kritisch zu sehen ist auch die Tatsache, dass<br />
es seit Jahren im Bereich der Telemedizin über<br />
Modellprojekte nicht hinausgeht. Sie eröffnet<br />
viele Möglichkeiten der Kooperation und sorgt<br />
auch für mehr Sicherheit von Patienten gerade<br />
in ländlichen Regionen.<br />
Telemedizinische Überwachung könnte zudem<br />
dazu beitragen, Kinikaufenthalte zu verkürzen.<br />
Nicht zuletzt liegt in der Nutzung von Telemedizin<br />
auch eine Möglichkeit, an manchen Stellen<br />
die schwierige Personalsituation etwas zu<br />
entspannen. Insgesamt aber fehlt es hier noch<br />
an den entsprechenden modernen gesetzlichen<br />
Rahmenbedingungen.<br />
Echter Strukturwandel, auf die Zukunft ausgerichtete<br />
Qualitätssicherung und Patientensicherheit<br />
sind eine gesamtgesellschaftliche<br />
Aufgabe, die nicht allein von den Krankenhäu-<br />
Paentensicherheit<br />
<strong>VKD</strong>-<strong>Praxisberichte</strong> <strong>2015</strong> | Patientensicherheit und Entlassmanagement 9
Paentensicherheit<br />
sern geleistet werden kann – und wenn man das<br />
Thema ernst nimmt, auch nicht nur von ihnen<br />
geleistet werden sollte.<br />
Aktionsbündnis Patientensicherheit<br />
Das Aktionsbündnis Patientensicherheit e.V., im April 2005 gegründet, setzt sich für<br />
eine sichere Gesundheitsversorgung und in diesem Zusammenhang für die Erforschung,<br />
Entwicklung und Verbreitung dazu geeigneter Methoden ein. Die Grundregeln,<br />
die sich das Bündnis gegeben hat, entsprechen auch den Intentionen des <strong>VKD</strong>,<br />
der sich u.a. ebenfalls für eine Vernetzung von Fachkompetenzen und Sektoren sowie<br />
für große Praxisnähe einsetzt ( »von der Praxis für die Praxis«). An vielen Projekten<br />
und Initiativen des APS beteiligen sich zahlreiche Krankenhäuser. So haben<br />
im Rahmen der Kampagne »Saubere Hände« (Stand Juli <strong>2015</strong>) 915 Krankenhäuser<br />
und Rehakliniken mit Früh-Reha sowie 75 Rehabilitationskliniken ohne Früh-Reha<br />
eine Zertifizierung erreicht. Ziel ist dabei, die Händehygiene in den Einrichtungen zu<br />
fördern. Die Zahl der Infektionen kann damit deutlich gesenkt werden.<br />
Eine weitere Initiative ist der Aufbau des Krankenhaus-CIRS-Netzes Deutschland.<br />
Hier können Beinahe-Schäden berichtet und bewertet werden, aus denen andere<br />
lernen können. Bis zum Juni <strong>2015</strong> waren 90 Fälle gemeldet und 12 Fälle des Monats<br />
veröffentlicht worden.<br />
Das Bündnis gibt die Ergebnisse seiner verschiedenen Arbeitsgruppen als Handlungsempfehlungen<br />
heraus. So hat die Arbeitsgruppe Medikationssicherheit eine<br />
Checkliste zur Arzneitherapiesicherheit im Krankenhaus erarbeitet. Eine Arbeitsgruppe<br />
zum Thema »Patientensicherheit im Alter« hat sich u.a. mit dem Teilaspekt<br />
»Sturzprävention im Krankenhaus« befasst und dafür Handlungsempfehlungen<br />
herausgegeben.<br />
Quelle und weitere Informationen unter www.aps-ev.de<br />
10<br />
<strong>VKD</strong>-<strong>Praxisberichte</strong> <strong>2015</strong> | Patientensicherheit und Entlassmanagement
Wir warten nicht erst<br />
auf eine Hygiene-Initiative!<br />
Die Bodden-Kliniken Ribnitz-Damgarten haben ein umfassendes<br />
Hygienemanagement etabliert<br />
Paentensicherheit<br />
Die Bodden-Kliniken Ribnitz-Damgarten GmbH ist gemeinnütziger Träger von<br />
13 sozialen Einrichtungen des Landkreises Vorpommern-Rügen (Mecklenburg-Vorpommern).<br />
Das Krankenhaus der Grund- und Regelversorgung verfügt über 184 Betten<br />
in den Fachgebieten Innere Medizin, Orthopädie / Unfallchirurgie, Allgemein- /<br />
Viszeralchirurgie, HNO-Heilkunde und Intensivmedizin. Jährlich werden etwa 15.800<br />
Patienten versorgt, davon etwa 7.100 stationär.<br />
Es vergeht fast kein Tag, an dem nicht in den<br />
Medien über »Hygieneskandale« in Kliniken<br />
berichtet wird. Über die umfassenden Aktivitäten,<br />
welche die deutschen Krankenhäuser<br />
bereits jetzt unternehmen, um ein umfassendes<br />
Hygienemanagement zu sichern, findet<br />
man leider viel zu wenige Informationen.<br />
Um dem Thema mehr Beachtung zu schenken,<br />
sollten die Einrichtungen nicht auf eine »von<br />
außen« gestartete Initiative warten, sondern<br />
in die Offensive gehen und die eigene Arbeit<br />
auf diesem Gebiet transparenter machen. Die<br />
Krankenhausleitung der Bodden-Kliniken<br />
Ribnitz-Damgarten hat bereits vor rund acht<br />
Jahren, weit vor der verschärften Gesetzgebung<br />
in Bezug auf den Infektionsschutz,<br />
umfangreiche Maßnahmen dafür eingeleitet<br />
und ein umfassendes Hygiene-Management<br />
installiert. Die Basis dafür bildete gut qualifiziertes<br />
Fachpersonal.<br />
Die Krankenhausleitung der Bodden-Kliniken<br />
Ribnitz-Damgarten hat etwa drei Jahre vor der<br />
im Jahre 2011 in Bezug auf den Infektionsschutz<br />
deutlich verschärften Gesetzgebung umfangreiche<br />
Maßnahmen eingeleitet, um ein umfassendes<br />
Hygienemanagement zu etablieren. Die<br />
Basis dafür bildet gut qualifiziertes Fachpersonal.<br />
Während dieses bereits hauptberuflich<br />
in den großen Klinken der Maximalversorgung,<br />
insbesondere in den Universitätsklinika, Flächen<br />
deckend eingesetzt wurde, war es in den<br />
kleineren Einrichtungen der Grund- und Regelversorgung<br />
eher die Ausnahme. Wir gehörten<br />
dazu, indem wir deutlich vor dem Erlass entsprechender<br />
Personalvorgaben und -refinanzierungen<br />
in die Ausbildung von hygienebeauftragten<br />
Ärzten und Pflegekräften sowie einer<br />
Hygienefachkraft investiert haben. Hinzu kam<br />
der Einsatz eines externen Hygienefacharztes.<br />
Uns ist bewusst geworden, dass eventuelle,<br />
durch Hygienemängel entstandene Schäden für<br />
unsere Patienten und die Einrichtung viel größer<br />
sind, als an dieser Stelle mögliche Kosteneinsparungen.<br />
Neben der Ausbildung ging es beim Einsatz des<br />
Fachpersonals darum, zügig Hygieneordnung<br />
und -pläne zu erarbeiten und deren Einhaltung<br />
umzusetzen. Dabei wurde schnell klar, dass<br />
Hygieneprobleme vielfältige Ursachen haben.<br />
Durch die Konzentration auf die wesentlichsten<br />
lässt sich jedoch schnell ein gutes Hygieneregime<br />
etablieren. Dazu gehörten bei uns:<br />
• Überwachung einer umfassenden Händedesinfektion<br />
• intensive fachgerechte Reinigung bzw. Desinfektion<br />
der baulichen und medizintechnischen<br />
Infrastruktur<br />
• Vermeidung, Analyse und Überwachung von<br />
Infektionen durch multiresistente Erreger<br />
(u. a. MRSA).<br />
Umsetzungsbeispiel<br />
Händedesinfektion<br />
Durch die frühzeitige Beteiligung an der bundesweiten<br />
Aktion »Saubere Hände« stand die<br />
umfassende fachgerechte Händedesinfektion<br />
im Fokus unserer Hygieneaktivitäten. Diese<br />
Maßnahme lässt sich durch laufende Schulungen<br />
und Überwachungen mit relativ geringen<br />
Kosten umsetzen. Dies fängt bereits bei der<br />
Einstellung neuer Mitarbeiter an. Die 15 Auszubildenden,<br />
die jährlich Ihre Tätigkeit bei uns<br />
beginnen, erhalten gleich zu Beginn eine umfassende<br />
Hygieneschulung durch die Hygienefachkraft.<br />
Es gibt einen ständigen Austausch zu<br />
Hygienefragen mit der hauptamtlichen Praxisanleiterin<br />
und auch immer wieder Rückfragen<br />
Dr. Falko Milski<br />
MBA, Geschäftsführer der<br />
Bodden-Kliniken Ribnitz-<br />
Damgarten GmbH,<br />
Pressesprecher des Verbandes<br />
der Krankenhausdirektoren<br />
Deutschlands<br />
(<strong>VKD</strong>)<br />
»Unser wichtigster Faktor<br />
in Sachen Hygiene ist ein<br />
motivierter, gut geschulter<br />
Mitarbeiter, der die Bereitschaft<br />
und die Zeit zur<br />
Umsetzung der notwendigen<br />
Hygienemaßnahmen hat.«<br />
Dr. Falko Milski<br />
<strong>VKD</strong>-<strong>Praxisberichte</strong> <strong>2015</strong> | Patientensicherheit und Entlassmanagement 11
Paentensicherheit<br />
Die Auszubildenden<br />
kontrollieren am Tag<br />
des Schülers<br />
das Fachpersonal.<br />
Foto: Bodden-Kliniken<br />
Ribnitz-Damgarten<br />
von interessierten Schülern, insbesondere aus<br />
deren Hygieneteam. Am jährlich durchgeführten<br />
»Tag des Schülers«, an dem die Auszubildenden<br />
das Stationsregime unter Aufsicht<br />
führen, kontrollieren sie - oftmals mit großer<br />
Leidenschaft - das Fachpersonal. Seit 2010<br />
nehmen wir darüber hinaus am bundesweiten<br />
Projekt des Robert-Koch-Instituts zur Überwachung<br />
des Händedesinfektionsmittelverbrauchs<br />
auf Stations- und Funktionsbereichsebene<br />
(sog. »HAND-KISS«) teil. Dies ermöglicht<br />
uns einen Vergleich mit den anderen teilnehmenden<br />
Einrichtungen deutschlandweit.<br />
Umsetzungsbeispiel Reinigung<br />
In Zeiten von Kosteneinsparungen und damit<br />
verbundenen Auslagerungen von Dienstleistungen<br />
haben wir uns nach einem kurzzeitigen<br />
Outsourcing dafür entschieden, wieder eine<br />
eigene, gut strukturierte Reinigungsabteilung<br />
zu betreiben. Eine gegenüber dem Marktumfeld<br />
deutlich bessere Vergütung sorgte für mehr<br />
Engagement und eine sehr geringe Fluktuation.<br />
Dadurch war es möglich, die Bereichskenntnis<br />
zu erhöhen und auch hier für ein entsprechendes<br />
Fachwissen im Hinblick auf die Flächendesinfektion<br />
zu sorgen. Dazu gehören u. a. ein<br />
Hygieneaudit, welches unser Hygienefacharzt<br />
mit der Leiterin der Reinigungsabteilung<br />
durchführt, die jährliche Fortbildungsveranstaltung,<br />
welche die Hygienefachkraft für das<br />
Reinigungs- und das Servicepersonal zur Bettenaufbereitung<br />
durchführt und Patientenbefragungen<br />
zur Zufriedenheit im Hinblick auf die<br />
Sauberkeit.<br />
Der Leiter Medizintechnik analysiert und dokumentiert<br />
eventuelle Hygienemängel an den<br />
Geräten und deren Zubehör, z. B. Sonden. Der<br />
Patient definiert Hygiene vor allem über Sauberkeit.<br />
Umsetzungsbeispiel<br />
Aufnahmescreening<br />
In unserem Haus gibt es ein gut funktionierendes<br />
Aufnahmescreening auf das MRSA<br />
(Methicillin-resistenter Staphylococcus aureus).<br />
Diese inzwischen in der Öffentlichkeit<br />
am meisten diskutierten Bakterien können<br />
gegen das Antibiotikum Methicillin und auch<br />
die meisten anderen Antibiotika resistent, also<br />
unempfindlich, werden. Die meisten Patienten<br />
werden bei uns seit vielen Jahren gleich in der<br />
Notaufnahme nach dem Risikoprofil der Kommission<br />
für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention<br />
(KRINKO) gescreent.<br />
Das betrifft folgende Patienten:<br />
- Verlegungen aus Altenheimen<br />
- Verlegung aus anderen Krankenhäusern/<br />
Rehabilitationseinrichtungen<br />
- Patienten, die während eines stationären<br />
Aufenthaltes Kontakt zu MRSA Trägern hatten<br />
(z. B. Unterbringung im selben Zimmer)<br />
- Patienten mit einem stationären Aufenthalt<br />
(> 3 Tage) in den zurückliegenden 12 Monaten<br />
- Auslandsanamnese (Patienten mit Krankenhausaufenthalt<br />
im Ausland innerhalb der<br />
letzten 12 Monate)<br />
- Patienten mit chronischer Pflegebedürftigkeit<br />
- Patienten mit liegenden Zugängen (z. B. Trachealkanüle,<br />
PEG-Sonde, Blasenkatheter),<br />
- Dialysepflichtigkeit,<br />
- Hautulcus, Gangrän, chronische Wunden,<br />
tiefe Weichteilinfektionen,<br />
- Patienten, die (beruflich) direkten Kontakt<br />
zu Tieren in der landwirtschaftlichen Tiermast<br />
haben.<br />
Von der Hygienefachkraft werden Krankheitserreger<br />
mit speziellen Resistenzen und Multiresistenzen<br />
sowie die erforderlichen Patientendaten<br />
dazu erfasst. Das Zusammentragen<br />
aller notwendigen Informationen zu bestimmten<br />
Patienten kann sehr zeitaufwändig sein,<br />
ist aber unerlässlich, um Zusammenhänge<br />
beurteilen zu können. Die Auswertung der infektionsrelevanten<br />
Zahlen zeigt, dass in unserem<br />
Haus keine Probleme bestehen. Durch das<br />
umfangreiche Screening werden Patienten mit<br />
multiresistenten Erregern frühzeitig erkannt<br />
und isoliert, so dass es zu keiner Übertragung<br />
im Haus kommen kann.<br />
12<br />
<strong>VKD</strong>-<strong>Praxisberichte</strong> <strong>2015</strong> | Patientensicherheit und Entlassmanagement
Paentensicherheit<br />
Durch diese einfache Maßnahme ist es uns gelungen,<br />
95 Prozent aller Patienten mit einem<br />
MRSA schon bei der Aufnahme im Krankenhaus<br />
zu erkennen. Auch andere Problemkeime mit<br />
sehr hohen Antibiotikaresistenzen sind bei uns<br />
nur noch ganz gering vorhanden. Bei ca. 7.100<br />
stationären Patienten in 2014 wurden lediglich<br />
26 Patienten mit multiresistenten Keimen aufgenommen.<br />
Dabei gab es durch die Einhaltung<br />
der Basishygiene keine Übertragung auf andere<br />
Patienten.<br />
Erfolgreiches Antibiotika-<br />
Management<br />
Ein positiver Nebeneffekt der guten Krankenhaushygiene<br />
ist die deutliche Senkung des<br />
Antibiotikaverbrauches in unserer Klinik.<br />
Im Zusammenhang mit der Antibiotikaresistenzproblematik<br />
sind gut geschulte Ärzte eine<br />
wichtige Basis. Eine gute Zusammenarbeit mit<br />
den einweisenden Ärzten und anderen medizinischen-<br />
oder Pflegeeinrichtungen ist hier<br />
von Bedeutung. Der Patient "durchwandert" all<br />
diese Stationen oft mehrfach. Unser Haus hat<br />
häufig Patienten aus Reha-Einrichtungen oder<br />
Pflegeheimen. Diese Patienten bergen, bedingt<br />
durch ihre Krankengeschichte, ein Risikopotenzial<br />
für die Verbreitung von multiresistenten<br />
Erregern. Die Gabe bestimmter Medikamente,<br />
wie z. B. Breitbandantibiotika, kann die Bildung<br />
von Resistenzen begünstigen bzw. die Vermehrung<br />
schon vorhandener Erreger fördern.<br />
Das Antibiotika-Management wird von unserer<br />
leitenden Oberärztin der Intensivstation<br />
durchgeführt. Dazu gehört auch eine detaillierte<br />
Infektionserfassung ihrer Station im Rahmen<br />
des RKI-ITS-KISS. Durch regelmäßige Auswertungen<br />
und Schulungen wurden in 2014<br />
deutlich weniger Antibiotika verordnet und<br />
auch der Einsatz von Reserveantibiotika konnte<br />
gegenüber dem Vorjahr deutlich gesenkt<br />
werden. Dies ist ein nicht zu unterschätzender<br />
Kosteneinsparungsfaktor.<br />
Information und Aufklärung<br />
Neben einem seit vielen Jahren wachsenden<br />
Verständnis unserer Beschäftigten für unser<br />
Hygienemanagement stellen wir auch - aufgrund<br />
der großen Verunsicherung - ein verstärktes<br />
Interesse der Öffentlichkeit nach Informationen<br />
auf diesem Gebiet fest. Im Rahmen<br />
eines Projektes zum Kennenlernen des eigenen<br />
Körpers und der Hygiene war im Juni <strong>2015</strong> eine<br />
Kindergartengruppe bei uns zu Gast.<br />
Wir freuen uns sehr über ein meist sehr aufmerksames<br />
Publikum. Hier müssen wir jedoch<br />
beachten, dass wir aufklären, allgemeinverständlich<br />
erklären und keine Angst verbreiten.<br />
Der Patient möchte ausreichend informiert<br />
werden und kann in diesem Zusammenhang<br />
auch durch eigenes positives Verhalten zum<br />
Genesungserfolg beitragen. Inzwischen sehen<br />
wir vermehrt Patienten und Angehörige, welche<br />
die im Eingangsbereich und auf den Fluren<br />
unseres Hauses installierten Händedesinfektionsgelegenheiten<br />
nutzen.<br />
Der Patient sollte wissen, dass multiresistente<br />
Erreger prinzipiell überall vorkommen können.<br />
Eine bloße Besiedlung mit diesen Erregern hat<br />
keinen Krankheitswert. Kann der Erreger in den<br />
Körper eindringen und sich hier vermehren,<br />
kann es zu einer Erkrankung durch diesen Erreger<br />
kommen. Hier spielen häufig auch patienteneigene<br />
Faktoren eine Rolle. Das heißt, wenn<br />
die Abwehrlage des Patienten durch chronische<br />
Erkrankungen, hohes Alter, Wunden oder<br />
ein akutes Krankheitsgeschehen gestört ist,<br />
kommt es häufiger zu einer Erkrankung durch<br />
diese Erreger. Das ist der entscheidende Punkt,<br />
warum im Krankenhaus häufiger Erkrankungen<br />
durch diese Erreger ausgelöst werden. Entweder<br />
der Patient kommt schon schwerkrank zu<br />
uns oder er wird in seiner Abwehrlage durch invasive<br />
Maßnahmen (operative Eingriffe, Injektionen,<br />
Gefäßzugänge wie Flexylen, Katheter)<br />
geschwächt oder eine Eintrittspforte für den<br />
Erreger wird geschaffen.<br />
Der Patient muss daher auch wissen, dass<br />
nicht jede Infektion vermeidbar ist. Besonders<br />
bei Risikopatienten sind es oft die eigenen<br />
Krankheitserreger, die sich im Rahmen der<br />
Krankenhausbehandlung vermehren und eine<br />
zusätzliche Infektion auslösen können. Es gibt<br />
kein Krankenhaus ohne Krankheitserreger, zu<br />
denen auch antibiotikaresistente Erreger wie<br />
MRSA oder MRGN gehören. Unsere Aufgabe ist<br />
es, durch geeignete Hygienemaßnahmen, deren<br />
Verbreitung und Übertragung zu verhindern.<br />
Berichte in den Medien haben viele Menschen<br />
verunsichert, ohne wirklich aufzuklären. Das<br />
hat zum Beispiel auch bei uns dazu geführt,<br />
dass es häufig Probleme gab, Patienten, die mit<br />
Krankheitserreger besiedelt waren, in Pflegeeinrichtungen<br />
zu verlegen. Das zeigt, dass es<br />
auch beim Pflegepersonal der Heime noch Aufklärungsbedarf<br />
gibt. Taxifahrer haben sich geweigert<br />
Patienten, die mit MRSA besiedelt waren,<br />
zu transportieren. Hier haben wir dann das<br />
Gesundheitsamt um Hilfe gebeten. Doch eine<br />
Besiedlung mit einem Krankheitserreger rechtfertigt<br />
nun einmal keinen Krankentransport.<br />
Am wichtigsten sind die Mitarbeiter<br />
Allerdings ist ein Krankenhaus auch, bedingt<br />
durch viele kranke Patienten, konzentriert an<br />
<strong>VKD</strong>-<strong>Praxisberichte</strong> <strong>2015</strong> | Patientensicherheit und Entlassmanagement 13
Paentensicherheit<br />
diesem Ort, ein »Treffpunkt« für Krankheitserreger<br />
aller Art. Deshalb muss bei allen Maßnahmen<br />
am Patienten auf die Einhaltung der Hygiene,<br />
vor allem der Händehygiene, aber auch der<br />
hygienisch korrekte Umgang mit Medikamenten<br />
und Instrumenten geachtet werden, damit es<br />
zu keiner Übertragung kommen kann. Eine Verbreitung<br />
aller Krankheitserreger, auch der nicht<br />
resistenten, muss im Krankenhaus unterbunden<br />
werden. Dazu dienen Maßnahmen wie Reinigung,<br />
Desinfektion, Sterilisation. Regelmäßig<br />
erfolgen mikrobiologische Kontrollen durch<br />
das Labor des Landesamtes für Gesundheit und<br />
Soziales Mecklenburg-Vorpommern (LAGuS),<br />
z. B. Untersuchung der Endoskope, des Trinkwassers,<br />
der medizinischen Gase, der Betten usw.<br />
Diese Kontrollen sind gleichzeitig eine Qualitätskontrolle<br />
und zeigen uns eventuelle<br />
Schwachstellen, die wir dann beheben können.<br />
Unser wichtigster Faktor in Sachen Hygiene ist<br />
ein motivierter, gut geschulter Mitarbeiter, der<br />
die Bereitschaft und die Zeit zur Umsetzung der<br />
notwendigen Hygienemaßnahmen hat.<br />
Gesetze geben nur den Rahmen<br />
Es gibt inzwischen eine ganze Reihe von neuen<br />
Gesetzen, Gesetzesänderungen und Regelungen<br />
zur Krankenhaushygiene. Bundesgesundheitsminister<br />
Hermann Gröhe hat mit einem<br />
10-Punkte-Plan vom März <strong>2015</strong> den Themen<br />
Vermeidung behandlungsassoziierter Infektionen<br />
und Antibiotika-Resistenzen nochmals<br />
Nachdruck verliehen. Das ist aber nur der vorgegebene<br />
Rahmen. Der Erfolg ist von der Umsetzung<br />
in den jeweiligen Einrichtungen abhängig.<br />
Durch interdisziplinäre Zusammenarbeit<br />
können wir in unserem Unternehmen ein sehr<br />
hohes Maß an Patientensicherheit bieten und<br />
unsere Infektionszahlen auf einem deutschlandweit<br />
gesehen sehr niedrigen Niveau halten.<br />
Ganz nach dem Motto »Tue Gutes und rede<br />
darüber!« sollte man aber gute Ergebnisse auf<br />
keinen Fall für sich behalten. Transparenz sorgt<br />
für Vertrauen der Patienten und der Öffentlichkeit<br />
in unser Krankenhaus.<br />
Hygienefachkraft Birgit Jacob erklärt einer Kindergartengruppe Hygienemaßnahmen.<br />
Foto: Bodden-Kliniken Ribnitz-Damgarten<br />
14<br />
<strong>VKD</strong>-<strong>Praxisberichte</strong> <strong>2015</strong> | Patientensicherheit und Entlassmanagement
Paentensicherheit<br />
Hintergrund<br />
Obwohl die Krankenhaushygiene in den letzten Jahren nicht nur immer stärker im<br />
Fokus der Medien sondern auch der Fachwelt steht, ist es erstaunlich, dass es kaum<br />
eine konkrete Datenlage dazu gibt. Selbst in den offiziellen Verlautbarungen und Statistiken<br />
werden die Angaben meist grob, d. h. mit einer großen Schwankungsbreite,<br />
geschätzt. Nach den Veröffentlichungen sollen jährlich zwischen 400.000 und<br />
800.000 (!) im Krankenhaus erworbene Infektionen auftreten. 10.000 bis 25.000<br />
Patienten sollen pro Jahr daran versterben. Dies zeigt, dass dringender Handlungsbedarf<br />
im Hinblick auf eine Versachlichung dieses Themas besteht. Solange es keine<br />
belastbaren Statistiken für Deutschland insgesamt gibt, sollten die Krankenhäuser<br />
die eigenen Hygieneaktivitäten und Ergebnisse transparenter machen, z. B. auf der<br />
Klinik-Internetpräsenz oder in der Regionalpresse.<br />
Öffentliche Wahrnehmung und Wirklichkeit<br />
Durch die umfassende Berichterstattung beim vereinzelten Auftreten von Hygienemängeln<br />
muss in der Bevölkerung der Eindruck entstehen, dass viele - wenn<br />
nicht sogar fast alle - der rund 2.000 Kliniken in Deutschland davon betroffen sind.<br />
Dadurch ist die Verunsicherung in der Bevölkerung und speziell die Angst vor einem<br />
Klinikaufenthalt und deren Folgen groß.<br />
In Bezug auf die Anzahl der jährlich in den Krankenhäusern behandelten Fälle liegt<br />
der Anteil derer mit stationär erworbenen (nosokomialen) Infektionen bei bis zu<br />
fünf Prozent. Es wird in der öffentlichen Diskussion überwiegend der Eindruck<br />
vermittelt, dass alle diese Infektionen vermeidbar wären, wenn nur ein umfassendes<br />
Hygieneregime umgesetzt würde. Nach Expertenmeinungen lässt sich jedoch nur<br />
etwa ein Drittel wirklich verhindern.<br />
Diesem täglichen »Kampf gegen die Keime« stellen sich die Krankenhäuser in<br />
zunehmendem Maße, wie der Bericht der Bundesregierung über nosokomiale Infektionen<br />
und Erreger mit speziellen Resistenzen und Multiresistenzen vom 18.12.2014<br />
zeigt. Danach ist die seit der ersten in Deutschland repräsentativ durchgeführten<br />
Erhebung im Jahre 1994 relativ konstante und im internationalen Vergleich recht<br />
niedrige Häufigkeit der nosokomialen Infektionen Hinweis dafür, dass es in den<br />
zurückliegenden Jahren nicht zu einem grundsätzlichen Anstieg der nosokomialen<br />
Infektionsrate für die Patienten gekommen ist. Dabei ist außerdem noch zu berücksichtigen,<br />
dass die Zahl der in Deutschland vollstationär behandelten Patienten<br />
kontinuierlich bis heute angestiegen ist (von 15,5 Millionen im Jahr 1994 auf 18,8<br />
Millionen im Jahr 2013).<br />
<strong>VKD</strong>-<strong>Praxisberichte</strong> <strong>2015</strong> | Patientensicherheit und Entlassmanagement 15
Paentensicherheit<br />
Das Ziel:<br />
Eine funktionierende Sicherheitskultur<br />
Aufbau eines Medizinischen Risikomanagements im Krankenhaus Märkisch-Oderland<br />
Die Krankenhaus Märkisch-Oderland GmbH mit ihren Standorten in Strausberg<br />
und Wriezen ist ein Krankenhaus der Grundversorgung mit 320 Bettenplätzen in<br />
den Fachrichtungen Chirurgie (Allgemein- und Unfallchirurgie, Orthopädie), Innere<br />
Medizin und Gynäkologie/Geburtshilfe. Es bietet den Patienten in der Region spezialisierte<br />
und zertifizierte Leistungen im Darmzentrum, im Endoprothetik-Zentrum<br />
und im Taumazentrum an. Das Krankenhaus ist als eines der ersten in Deutschland<br />
als Klinik für Diabetespatienten geeignet zertifiziert.<br />
Angela Krug<br />
Geschäftsführerin Krankenhaus<br />
Märkisch-Oderland<br />
Strausberg / Wriezen<br />
Katharina Paul<br />
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit,<br />
Krankenhaus<br />
Märkisch-Oderland Strausberg<br />
/ Wriezen<br />
Gegründet wurde das Haus in Strausberg, im Berliner Randgebiet, im Jahr 1955.<br />
Im Jahr 2000 erfolgte die Fusion der Krankenhäuser Strausberg und Wriezen. Träger<br />
ist der Landkreis Märkisch-Oderland. Es werden in beiden Betriebsteilen insgesamt<br />
570 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. Jährlich behandeln und versorgen<br />
sie 14.000 stationäre und 14.000 ambulante Patienten. Die Verweildauer beträgt<br />
sieben Tage.<br />
Das Krankenhaus ist ein Hochrisikobereich.<br />
Deshalb sind auch im Krankenhaus Märkisch-Oderland<br />
alle Anstrengungen im medizinischen<br />
Qualitätsmanagement auf die Sicherheit<br />
der Patienten ausgerichtet. Es nutzt<br />
dabei u.a. Erfahrungen anderer Krankenhäuser<br />
des Clinotel-Verbundes, in dem es Mitglied<br />
ist. Die Einführung eines strukturierten<br />
Risikomanagements liegt im Interesse jedes<br />
Krankenhauses. Dazu gehören u.a. ein strukturiertes<br />
Fehlermeldesystem, eine offene,<br />
konstruktive Kommunikation im Haus, das<br />
Team-Time-Out vor jeder Operation und die<br />
Arzneimitteltherapiesicherheit.<br />
Das Krankenhaus Märkisch-Oderland setzt sich<br />
für eine verbesserte Patientensicherheit in seinen<br />
Häusern ein. Dafür hat es sich die Hilfe aus<br />
dem Clinotel-Verbund geholt, in dem es selbst<br />
Mitglied ist. »Wir wollen von den Erfahrungen<br />
der anderen Krankenhäuser profitieren. Deshalb<br />
bot sich die Einbeziehung entsprechender<br />
Erfahrungen des Clinotel-Verbundes an«, so<br />
Dr. med. Steffen König, Chefarzt der Klinik für<br />
Unfall- und wiederherstellende Chirurgie. Clinotel<br />
beschäftigt sich intensiv mit dem Thema<br />
und hat einen Auditplan entwickelt. Es kommt<br />
hinzu, dass der Gemeinsame Bundesausschuss<br />
neue Richtlinien zu »grundsätzlichen Anforderungen<br />
eines einrichtungsinternen Qualitätsmanagement«<br />
herausgegeben hat. Die GBA-<br />
Richtlinie hat den Druck auf die Krankenhäuser<br />
verschärft. Prinzipiell ist die Einführung eines<br />
strukturierten Risikomanagements grundlegendes<br />
Interesse jedes Krankenhauses.<br />
In einer gemeinsamen Veranstaltung mit dem<br />
Clinotel-Verbund wurden im November 2014<br />
Fragen zur Organisation, Umsetzung und Strategie<br />
eines Risikomanagements besprochen.<br />
Risikobereiche wurden herausgearbeitet, Zuständigkeiten<br />
festgelegt und Verantwortliche<br />
benannt. Außerdem wurden Ziele formuliert,<br />
die in einem bestimmten Zeitraum umgesetzt<br />
werden müssen.<br />
Um diese Ziele zu erreichen, wurden vier Arbeitsgruppen<br />
gebildet, die sich unter anderem<br />
mit der Einführung eines Frühwarnsystems namens<br />
CIRS beschäftigen. Dieses EDV gestützte<br />
System erfasst Beinahe-Fehler und identifiziert<br />
so Risikopotenziale in der Patientenversorgung.<br />
Damit sind vor allem Fehler gemeint,<br />
die noch einmal abgewendet werden konnten.<br />
Dazu gehören Fehler in der Teamarbeit und<br />
in der Kommunikation. Hier kommt es erfahrungsgemäß<br />
zu den meisten Missverständnissen.<br />
Jeder Mitarbeiter der Krankenhaus Märkisch-Oderland<br />
GmbH ist berechtigt, anonym<br />
Beinahe-Fehler zu melden und damit die Patientensicherheit<br />
zu optimieren. Dieses System<br />
ersetzt aber nicht eine gute Kommunikationsstruktur<br />
im Haus. Wenn Fehler oder Beinahe-<br />
Fehler passieren, sollte neben der Meldung im<br />
System offen in den Teams über die Situation<br />
diskutiert werden.<br />
16<br />
<strong>VKD</strong>-<strong>Praxisberichte</strong> <strong>2015</strong> | Patientensicherheit und Entlassmanagement
Wichtig:<br />
Eine offene Diskussionskultur<br />
Durch die Erfahrungen, die in den hauseigenen<br />
Zentren, wie Darmzentrum MOL und Endoprothetik-Zentrum<br />
gemacht wurden, beschäftigt<br />
sich die zweite Gruppe mit der offenen Diskussionskultur<br />
im Haus. Im Einzelnen sollen die<br />
positiven Erfahrungen mit Morbiditäts- und<br />
Mortalitätskonferenzen in diesen Bereichen<br />
auf das gesamte Haus ausgedehnt werden. Bei<br />
diesen Konferenzen soll es zu einer intensiven<br />
und qualifizierten Diskussion innerhalb des<br />
professionellen therapeutischen Teams kommen.<br />
Damit sollen Fehler, unsichere Handlungen<br />
und Systemfaktoren herausgearbeitet und<br />
es soll aus ihnen gelernt werden. Das Ziel ist ein<br />
interdisziplinärer, hierarchiefreier Dialog zur<br />
kontinuierlichen Verbesserung der Arbeitsweise<br />
und der Abläufe im Klinikalltag. Die Leiter<br />
der einzelnen Abteilungen sind für die Umsetzung<br />
zuständig.<br />
Team-Time-Out vor jeder OP<br />
Das gleiche gilt für die Checkliste Team-Time-<br />
Out, die normalerweise vor Operationen zum<br />
Einsatz kommt. Bevor der Chirurg das Skalpell<br />
überhaupt in die Hand nimmt, werden die Identität<br />
des Patienten und der Eingriff nochmals<br />
detailliert durchgesprochen und die wesentlichen<br />
Schritte erläutert. Außerdem ist es auch<br />
im Krankenhaus Märkisch-Oderland üblich, die<br />
zu operierenden Extremitäten zu kennzeichnen.<br />
Noch auf der Station, wenn der Patient noch<br />
nicht narkotisiert ist, überprüft das Pflegepersonal<br />
die Markierung. Im OP geschieht das ein<br />
weiteres Mal. Stimmen die Kennzeichnungen<br />
mit Krankenakte und Aufklärungsbogen überein,<br />
wird der Eingriff vorgenommen. Nach der<br />
Operation zählen die Mitarbeiter der Pflege die<br />
Instrumente, Tupfer usw. und prüfen die Anzahl<br />
auf Vollständigkeit.<br />
Die dritte Arbeitsgruppe wertet die Erfahrungen<br />
mit dieser Checkliste, die sich an den<br />
Empfehlungen des Aktionsbündnisses Patientensicherheit<br />
orientiert, aus, ermittelt Optimierungspotenzial<br />
und überprüft, ob sich diese<br />
Checkliste auch auf andere Bereiche des Hauses<br />
übertragen lässt. Ein möglicher Bereich, in<br />
dem diese Checkliste noch eingesetzt werden<br />
kann, ist die invasive Funktionsdiagnostik – Endoskopie<br />
und Angiographie.<br />
Identifikationssicherheit<br />
durch Patientenarmbänder<br />
Um eine einwandfreie Identifizierung der Patienten<br />
zu gewährleisten, bekommt jeder Patient<br />
bei der Krankenhauseinweisung ein Patientenarmband.<br />
Diese Identifikationshilfe ist besonders<br />
für Menschen gedacht, die sich nicht klar<br />
äußern können. Das Armband ist versehen mit<br />
den Angaben des Patienten – sein Name, der<br />
Betriebsteil und die Abteilung, in der er behandelt<br />
wird, Aufnahme- und Geburtsdatum. So ist<br />
die eindeutige Identifikation der Person vor<br />
diagnostischen, therapeutischen Maßnahmen<br />
oder Verordnungen jederzeit und überall im<br />
Krankenhaus gegeben. Diese Maßnahme findet<br />
schon seit mehreren Jahren Anwendung. Nur<br />
sehr wenige Patienten lehnen es ab, das Armband<br />
zu tragen.<br />
Arzneimittelsicherheit<br />
gewährleisten<br />
Die vierte Gruppe setzt sich mit der Arzneimittelsicherheit<br />
auseinander. Es soll immer gewährleistet<br />
sein, dass jeder Patient das für ihn<br />
zutreffende, in der richtigen Dosierung und auf<br />
seine individuelle Verträglichkeit abgestimmte<br />
Medikament bekommt. Verschiedene Möglichkeiten<br />
der Medikamentenbeschriftung und<br />
-ausgabe werden in der Gruppe besprochen.<br />
Vorgesehen ist bereits die Einführung eines<br />
Computerprogramms, das den behandelnden<br />
Arzt insbesondere auf Interaktionen aufmerksam<br />
macht.<br />
Clinotel wird dieses Projekt weiter begleiten,<br />
so dass sichergestellt ist, dass am Ende ein<br />
strukturiertes und systematisches Risikomanagement<br />
im Krankenhaus Märkisch-Oderland<br />
eingerichtet ist und auch funktioniert.<br />
Paentensicherheit<br />
Dr. med. Steffen König,<br />
Chefarzt der Klinik für<br />
Unfall- und<br />
wiederherstellende<br />
Chirurgie<br />
Foto: Krankenhaus<br />
Märkisch-Oderland<br />
»Fehler, unsichere Handlungen<br />
und Systemfaktoren<br />
sollen herausgearbeitet und<br />
es soll aus ihnen gelernt<br />
werden«<br />
Dr. med. Steffen König<br />
<strong>VKD</strong>-<strong>Praxisberichte</strong> <strong>2015</strong> | Patientensicherheit und Entlassmanagement 17
Paentensicherheit<br />
Hintergrund<br />
Das am 26. Februar 2013 in Kraft getretene Patientenrechtegesetz soll die Position<br />
der Patienten gegenüber Leistungserbringern wie Ärzten, Krankenhäusern und<br />
Krankenkassen stärken. Das Patientenrechtegesetz bündelt frühere formulierte Patientenrechte<br />
und verbessert die Stellung der Patienten im Gesundheitssystem. Es verpflichtet<br />
niedergelassene Ärzte und Krankenhäuser, Fehler, die bei der Behandlung<br />
unterlaufen oder beinahe unterlaufen sind, zu dokumentieren und auszuwerten. Auf<br />
diese Weise sollen Risiken erkannt und minimiert werden. Der Gemeinsame Bundesausschuss<br />
formulierte daraufhin Richtlinien, die bestimmen, dass Krankenhäuser<br />
eine Risikostrategie festlegen, ein Risikomanagement aufbauen und dessen Pflege<br />
aktiv unterstützen, einen Informationsaustausch gewährleisten, Verantwortliche<br />
benennen und die Mitarbeiter regelmäßig informieren.<br />
Das Krankenhaus Märkisch-Oderland, Standort Wriezen<br />
Foto: Krankenhaus Märkisch-Oderland<br />
Das Krankenhaus Märkisch-Oderland in Strausberg<br />
Foto: Krankenhaus Märkisch-Oderland<br />
18<br />
<strong>VKD</strong>-<strong>Praxisberichte</strong> <strong>2015</strong> | Patientensicherheit und Entlassmanagement
Paentensicherheit<br />
Der etwas andere Blick<br />
auf die Patientensicherheit<br />
Großes Engagement in den psychiatrischen und psychosomatischen Einrichtungen<br />
trotz wachsender wirtschaftlicher Unsicherheit<br />
In Deutschland gibt es 247 psychiatrische Fachkliniken sowie 742 psychiatrische<br />
Fachabteilungen mit insgesamt 67.942 Betten. Die durchschnittliche<br />
Verweildauer beträgt rund 21 Tage, die Bettenauslastung beträgt über 90 Pozent.<br />
Jährlich werden 756.366 Patienten behandelt.<br />
Das Thema Patientensicherheit hat für die<br />
psychiatrischen und psychosomatischen<br />
Krankenhäuser und Abteilungen einen hohen<br />
Stellenwert. Gerade in den vergangenen<br />
Jahren sind hier die Anstrengungen deutlich<br />
gewachsen. Die Bedingungen, unter denen<br />
die Einrichtungen arbeiten, haben sich allerdings<br />
nachweislich keinesfalls verbessert. Im<br />
Gegenteil. Für die Zukunft sehen viele Geschäftsführer<br />
keine positiven Veränderungen.<br />
Auch die psychiatrischen und psychosomatischen<br />
Krankenhäuser in Deutschland sind<br />
verpflichtet, ein klinisches Risikomanagement<br />
einzuführen. Ein zentrales Kriterium ist dabei<br />
die Patientensicherheit. Gleichzeitig sehen sie<br />
sich einer seit Jahren stetig steigenden Zahl von<br />
Patienten gegenüber.<br />
Die Daten der gesetzlichen Krankenkassen zeigen<br />
seit Jahrzehnten ein Ansteigen psychischer<br />
Erkrankungen. Sie stellen heute die zweithäufigste<br />
Diagnosegruppe für Krankschreibung<br />
oder sogar Arbeitsunfähigkeit (BKK Gesundheitsreport<br />
2014) dar. Deutlich länger als bei<br />
anderen Krankheiten ist auch die Krankheitsdauer<br />
– sie beträgt rund 40 Tage. Die Patientenzahlen<br />
nehmen zu. Gegenteilig haben sich<br />
die Verweildauern entwickelt. Damit ist der<br />
Druck auf das Personal erheblich angestiegen.<br />
Dennoch sind viele psychiatrische und psychosomatische<br />
Einrichtungen intensiv dabei,<br />
Maßnahmen zur Patientensicherheit und Schadensprävention<br />
umzusetzen oder haben dies<br />
bereits getan. Dazu gehört u.a. die Einführung<br />
eines Meldesystems für Beinahe-Fehler (CIRS),<br />
wie es im folgenden Beitrag von Dr. Annette<br />
Egloff aus der Asklepios Psychiatrie Niedersachsen<br />
GmbH geschildert wird. Auch die<br />
Transparenz über die geleistete Qualität gegenüber<br />
Patienten und Zuweisern spielt eine<br />
zunehmende Rolle. Das wird u.a. deutlich in der<br />
Teilnahme von schon 23 psychiatrischen Kliniken<br />
am erst kürzlich installierten Portal »Qualitätskliniken.de«.<br />
Um die Nachhaltigkeit der Behandlung und<br />
damit auch die Sicherheit der Patienten nach<br />
der Entlassung aus der Klinik zu organisieren,<br />
ist ein strukturiertes, professionelles Entlassmanagement<br />
für psychiatrische Kliniken besonders<br />
schwer umzusetzen – nicht nur wegen<br />
der Defizite im ambulanten Bereich. Einbezogen<br />
werden müssen auch die Angehörigen, die<br />
ansonsten häufig mit der Situation überfordert<br />
sind. Das zeigt der Beitrag von Silke Ludowisy-<br />
Dehl, Pflegedirektorin in der LVR-Klinik Langenfeld,<br />
in diesen <strong>Praxisberichte</strong>n. Gerade für<br />
chronisch psychisch Kranke ist ein Sektor übergreifendes,<br />
multiprofessionelles und gut koordiniertes<br />
Betreuungsangebot wichtig.<br />
Unterschiede zu Akutkliniken<br />
Patientensicherheit in psychiatrischen und<br />
psychosomatischen Einrichtungen zu garantieren<br />
und zu verbessern unterscheidet sich<br />
in vielen Aspekten deutlich von denen somatischer<br />
Krankenhäuser. Dabei geht es nicht wie<br />
dort in erster Linie um Operationsfehler oder<br />
Risiken durch Medizintechnik und Geräte. Es<br />
geht um eine ganzheitliche Sicht auf den einzelnen<br />
Patienten, um sichere Prozesse, Sicherheitsvorkehrungen<br />
in geschützten Bereichen,<br />
um die Verhinderung von Eigen- und Fremdgefährdung,<br />
um Deeskalationskonzepte, Medikamentensicherheit<br />
und um die strukturierte<br />
interprofessionelle Zusammenarbeit, u.a. mit<br />
regelhaften Team- und Fallbesprechungen.<br />
So resultieren die wichtigsten Schadensursachen<br />
in der Psychiatrie laut Ecclesia Versicherungsdienst<br />
2012 aus Aufsichtsverletzungen<br />
und falsch durchgeführten Therapien. Es folgen<br />
fehlerhafte Medikamentenverabreichung,<br />
Stürze und Überwachungsfehler.<br />
Holger Höhmann<br />
Kaufmännischer Direktor<br />
und Vorstandsvorsitzender<br />
der LVR-Klinik Langenfeld,<br />
Vorsitzender der<br />
Fachgruppe Psychiatrische<br />
Krankenhäuser im Verband<br />
der Krankenhausdirektoren<br />
Deutschlands (<strong>VKD</strong>)<br />
»Die wirtschaftliche Entwicklung,<br />
die steigenden<br />
Patientenzahlen und die<br />
hohe Belastung der Mitarbeiterinnen<br />
und Mitarbeiter<br />
haben unmittelbaren Einfluss<br />
auf Fragen der Patientensicherheit.<br />
Nicht alles<br />
lässt sich durch permanent<br />
hohes Engagement auffangen.<br />
Das sollte auch die<br />
Politik erkennen.«<br />
Holger Höhmann<br />
<strong>VKD</strong>-<strong>Praxisberichte</strong> <strong>2015</strong> | Patientensicherheit und Entlassmanagement 19
Paentensicherheit<br />
Die Einschätzung des Versicherungsdienstleisters<br />
hatte 2010 auch bereits eine umfangreiche<br />
Befragung zum Stand der Einführung eines klinischen<br />
Risikomanagements (kRM) durch das<br />
Institut für Patientensicherheit der Universität<br />
Köln unter Teilnahme des Deutschen Krankenhausinstituts<br />
im Auftrag des Aktionsbündnisses<br />
Patientensicherheit gezeigt.<br />
Diese erste Befragung zur Einführung des kRM<br />
hatte gezeigt, dass nach eigenen Einschätzungen<br />
auch der psychiatrischen Krankenhäuser in<br />
vielen Bereichen des klinischen Risikomanagements<br />
Verbesserungspotenzial gesehen wurde.<br />
Gleichzeitig wurde aber auch deutlich, dass<br />
dieser Bereich ein spezifisches Risikoprofil hat.<br />
So spielten die Maßnahmen, die sich auf Infektionsschutz,<br />
OP-Management, Simulationstraining<br />
bezogen, eine untergeordnete Rolle. Das<br />
Thema Arzneimitteltherapiesicherheit dagegen<br />
hatte einen deutlich höheren Stellenwert und<br />
wurde vielfach bereits strukturiert angegangen.<br />
Auf die Frage nach den zwei vermutlich wichtigsten<br />
Risikoschwerpunkten, auszuwählen aus<br />
einer vorgegebenen Liste, wurde von den Befragten<br />
aus den psychiatrischen Krankenhäusern<br />
die Arzneimitteltherapie auch als Hauptschwerpunkt<br />
genannt. Einen vorderen Platz<br />
nahmen ebenfalls Stürze und Diagnosefehler<br />
ein. Was seitdem in punkto Patientensicherheit<br />
umgesetzt worden ist, wird die erneute Erhebung<br />
zeigen, die zum Einführungsstand des klinischen<br />
Risikomanagements in diesem Jahr von<br />
März bis Ende Juni durchgeführt wurde.<br />
Schwierige wirtschaftliche Lage<br />
Die Aktivitäten zum klinischen Risikomanagement<br />
finden allerdings in einer Situation statt,<br />
die durch die Einführung des neuen Entgeltsystems<br />
für psychiatrische und psychosomatische<br />
Einrichtungen (PEPP) nach dem Muster der<br />
DRGs geprägt ist. Das aktuelle PSYCHiatrie Barometer<br />
des Deutschen Krankenhausinstituts<br />
(DKI) aus diesem Jahr dokumentiert die deutliche<br />
Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage<br />
der Häuser und Abteilungen in diesem Bereich.<br />
Danach beurteilen 42 Prozent der psychiatrischen<br />
Fachkrankenhäuser in Deutschland ihre<br />
derzeitige wirtschaftliche Situation als unbefriedigend.<br />
Im vergangenen Jahr lag dieser Wert<br />
noch bei 10 Prozent. Dramatischer kann eine<br />
Entwicklung kaum sein. Auch die Zukunftsaussichten<br />
werden negativ beurteilt. Mehr als zwei<br />
Drittel der Befragten rechnen auch in diesem<br />
Jahr nicht mit einer Verbesserung.<br />
Alarmierend für die Situation in der Zukunft ist<br />
überdies, dass ausgerechnet die Einrichtungen,<br />
die optional das neue Entgeltsystem (PEPP)<br />
bereits anwenden, ihre wirtschaftliche Lage<br />
tendenziell noch deutlich schlechter einschätzen,<br />
als jene, die noch nicht umgestiegen sind.<br />
Die allgemeine Unsicherheit bezüglich der Auswirkungen<br />
ist laut der Befragung erheblich. Der<br />
Unmut über die hohen Kontrolllasten, denen<br />
die Umstiegshäuser durch Krankenkassen und<br />
MDK ausgesetzt sind, ist ebenfalls sehr groß<br />
und hat zu Protesten geführt. Die damit verbundenen<br />
Dokumentationspflichten bedeuten<br />
auch, dass weniger Zeit für die Betreuung und<br />
Behandlung der Patienten zur Verfügung steht<br />
– und dies in einem Bereich, in dem es gerade<br />
darauf besonders ankommt.<br />
Die wirtschaftliche Entwicklung, die steigenden<br />
Patientenzahlen und die hohe Belastung der<br />
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben unmittelbaren<br />
Einfluss auf Fragen der Patientensicherheit.<br />
Nicht alles lässt sich durch permanent<br />
hohes Engagement auffangen. Das sollte<br />
auch die Politik erkennen.<br />
Die Fachgruppe Psychiatrie des Verbandes der<br />
Krankenhausdirektoren Deutschlands hat sich<br />
mit dem Thema Finanzierung und Qualität der<br />
stationären Psychiatrie und Psychosomatik<br />
immer wieder intensiv beschäftigt und sich<br />
gemeinsam mit anderen Verbänden deutlich<br />
zum neuen Finanzierungssystem positioniert.<br />
Auch wenn es sich dabei um ein so genanntes<br />
lernendes System handeln soll, sehen wir darin<br />
auch nach den erfolgten Modifikationen erhebliche<br />
Gefahren für unsere Kliniken und die<br />
Behandlung der Patienten – damit auch deren<br />
Sicherheit.<br />
Seit Jahrzehnten nimmt die Zahl der psychischen Erkrankungen in Deutschland<br />
und damit auch die der entsprechenden Fehltage zu. In 2012 waren es laut Bundesanstalt<br />
für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin rund 60 Millionen. Psychische<br />
Erkrankungen sind heute die zweithäufigste Diagnosegruppe für Krankschreibung<br />
oder sogar Arbeitsunfähigkeit (BKK Gesundheitsreport 2014). Deutlich länger als bei<br />
anderen Krankheiten ist auch die Krankheitsdauer – sie beträgt rund 40 Tage. Neben<br />
den allgemeinen Folgen für die Wirtschaft, u.a. durch erhebliche Produktionsausfallkosten,<br />
betragen die direkten Krankheitskosten laut Bundesanstalt für Arbeitsschutz<br />
und Arbeitsmedizin rund 16 Mrd. Euro jährlich.<br />
20<br />
<strong>VKD</strong>-<strong>Praxisberichte</strong> <strong>2015</strong> | Patientensicherheit und Entlassmanagement
Paentensicherheit<br />
Kritisch sieht unsere Fachgruppe u.a., dass das<br />
PEPP-System die derzeitige Unterfinanzierung<br />
des Personals – Basis ist die Psychiatrie-Personalverordnung<br />
(Psch-PV), die schon aktuell<br />
im Durchschnitt nur zu etwa 90 Prozent erfüllt<br />
wird – teilweise als Grundlage nimmt und damit<br />
eine weitere Unterfinanzierung in diesem<br />
wichtigen Bereich fortscheibt. Für das Thema<br />
Patientensicherheit, das eng mit der Personalbesetzung<br />
zusammenhängt, ist das fatal, zumal<br />
in den vergangenen Jahren personalintensive<br />
Therapien zugenommen haben und es entsprechende<br />
S3-Leitlinien dafür gibt, die zu beachten<br />
sind.<br />
Tunnelblick der Politik<br />
Kritisch muss gesehen werden, dass leider offenbar<br />
auch im Bereich der Psychiatrie und<br />
Psychosomatik der Fokus der Politik in punkto<br />
Patientensicherheit vor allem auf die stationäre<br />
Versorgung gerichtet ist. Eine gut funktionierende,<br />
qualitätsgeprüfte ambulante psychiatrische<br />
und psychosomatische Versorgung der<br />
Patienten spielt aber für die Patientensicherheit<br />
eine erhebliche Rolle. Die Unterversorgung<br />
im ambulanten Bereich, nicht nur in ländlichen<br />
Regionen, sondern auch in Städten, mit zum<br />
Teil mehrwöchigen, ja monatelangen Wartezeiten<br />
ist geeignet, den Behandlungserfolg in den<br />
stationären Einrichtungen wieder in Frage zu<br />
stellen, da eine notwendige Weiterbehandlung<br />
nicht garantiert werden kann. Die Pflicht der<br />
Häuser, diesen Übergang durch ein Entlassmanagement<br />
zu steuern, läuft hier ins Leere. Auch<br />
das ist ein wesentlicher Aspekt der Patientensicherheit.<br />
Hinzu kommt, dass die ambulante Unterversorgung<br />
zur Verschleppung auch psychischer<br />
Krankheiten und schließlich zum Krankenhausaufenthalt<br />
führt, der ursprünglich nicht<br />
notwendig gewesen wäre. Damit steigt die Zahl<br />
der stationären Fälle. Von 2005 bis 2013 stiegen<br />
sie um 37 Prozent. Mit Umsetzung des PEPP, u.a.<br />
mit einer Degression der Kostenerstattung bei<br />
längeren Liegezeiten, werden die Verweildauern<br />
vermutlich weiter verkürzt werden. Diese<br />
Entwicklung provoziert unnötige »Drehtüreffekte«<br />
mit Wiedereinweisungen, die zudem mit<br />
einer weiteren Belastung des Personals verbunden<br />
ist und dient ebenfalls nicht der Patientensicherheit.<br />
Der PEPP-Entgeltkatalog ist, wie das DRG-System, ein leistungsorientiertes, pauschalierendes<br />
Vergütungssystem. Die Vergütung erfolgt hier tagesbezogen. Deutsche<br />
Krankenhausgesellschaft (DKG), Verband der Privaten Krankenversicherung (PKV)<br />
und Spitzenverband der Krankenkassen haben sich für <strong>2015</strong> auf einen Entgeltkatalog<br />
für psychiatrische und psychosomatische Einrichtungen geeinigt. Seit 2013 können<br />
diese Einrichtungen optional ihre Leistungen nach dem PEPP-Katalog abrechnen. Das<br />
erfolgt bis 2018 bugetneutral, ab 2019 beginnt die so genannte Konvergenzphase des<br />
Systems. In 2013 war noch geplant, die Konvergenzphase bereits in 2017 zu starten.<br />
Dies konnte, auch durch den erheblichen Einsatz der wissenschaftlichen Fachgesellschaften<br />
und der Verbände sowie der DWG, um zwei Jahre nach hinten verschoben<br />
werden.<br />
Laut DKG ist der PEPP-Katalog ein Kompromiss. Er soll ein lernendes System sein.<br />
Ein Weiterentwicklungsprozess müsse angestoßen werden, wenn nötig, sei nachzubessern.<br />
<strong>VKD</strong>-<strong>Praxisberichte</strong> <strong>2015</strong> | Patientensicherheit und Entlassmanagement 21
Paentensicherheit<br />
Der Erfolg:<br />
Aufbau einer positiven Fehlerkultur<br />
Erfahrungen mit Risikomanagement und Critical Incident Reporting System (CIRS)<br />
im Psychiatrischen Fachkrankenhaus<br />
Das Asklepios Fachklinikum Göttingen verfügt über aktuell 486 Betten mit 428<br />
vollstationären und 58 teilstationären Plätzen in fünf Fachabteilungen Akutpsychiatrie<br />
sowie Tageskliniken, Institutsambulanz, und zusätzlich eine Klinik für Forensische<br />
Psychiatrie mit 63 Betten.<br />
Das Asklepios Fachklinikum Tiefenbrunn hält 182 Betten vor. Es gibt drei Fachabteilungen<br />
Psychotherapie für Erwachsene, Kinder- und Jugend-Psychiatrie und Psychotherapie,<br />
Psychosomatik sowie eine Institutsambulanz.<br />
Dr. Annette Egloff<br />
Qualitätsmanagement,<br />
Asklepios Fachklinikum<br />
Göttingen<br />
»CIRS ist präventiv auf<br />
die lernende Organisation<br />
ausgerichtet mit der steten<br />
Überlegung, wie Fehler<br />
zukünftig vermieden werden<br />
können.«<br />
Dr. Annette Egloff<br />
Patientensicherheit findet ein zunehmendes<br />
öffentliches, fachliches und politisches Interesse.<br />
Die Optimierung der Patientensicherheit<br />
ist seit 2014 ein Ziel der Initiative »gesundheitsziele.de«.<br />
In den Unternehmen der Gesundheitsversorgung<br />
hat sich die ursprüngliche<br />
Fehlerkultur zur Sicherheitskultur weiterentwickelt.<br />
Im Folgenden soll über die<br />
speziellen Anforderungen und Erfahrungen in<br />
zwei psychiatrischen Fachkrankenhäusern<br />
der Asklepios Psychiatrie Niedersachsen<br />
GmbH berichtet werden.<br />
Bereits 2013 wurde der Asklepios Standard CIRS<br />
als Fehlermelde- und Lernsystem im Asklepios<br />
Fachklinikum Göttingen und im Asklepios Fachklinikum<br />
Tiefenbrunn eingeführt.<br />
In den beiden Einrichtungen liegen langjährige<br />
Erfahrungen zur Erfassung und Analyse jedweder<br />
so genannter »Besonderer Vorkommnisse«<br />
vor. Mit der Einführung von CIRS sollte eine zusätzliche<br />
Ausrichtung auf eine Prävention mit<br />
frühzeitiger Erkennung von Fehlern, offener<br />
Kommunikation / transparentem Umgang und<br />
Lernkultur erfolgen. Das Meldesystem wurde an<br />
das bestehende Qualitäts- und Risikomanagement<br />
angegliedert.<br />
Unterschied zur Somatik:<br />
der ganzheitliche Ansatz<br />
Im Vergleich zur Somatik sind Unterschiede<br />
implizit und resultieren beispielsweise aus dem<br />
somatischen Fokus von Diagnostik und Therapie<br />
auf relevante Organsysteme mit fachspezifischen<br />
Prozeduren. Fehler können hier durch<br />
menschliche und technische Einflüsse passieren.<br />
Differenziert wird üblicherweise in Organisationsfehler,<br />
Behandlungsfehler, Aufklärungsfehler,<br />
Dokumentationsfehler, Gerätefehler.<br />
Psychiatrie zielt dagegen auf die Minderung der<br />
psychopathologischen Symptomatik, das seelische<br />
Wohlbefinden und Krankheitsverständnis<br />
sowie soziale (Re-)Integration des betroffenen<br />
Klienten und verfolgt damit einen ganzheitlichen<br />
Ansatz.<br />
Die Angebote in psychiatrischen Krankenhäusern<br />
werden entscheidend geprägt durch die<br />
ausgewählten / möglichen Therapieverfahren<br />
und letztlich bestimmt auf der Beziehungsebene<br />
Patient – Therapeut, wobei Auswahl und<br />
Passung individuell erfolgen und von multiplen<br />
Kriterien abhängen. Erleben und Bewertung<br />
von Patienten sind höchst subjektiv und<br />
beeinflusst von der psychopathologischen<br />
Symptomatik auf Patientenseite, wie von Gegenübertragung<br />
und psychischer Verfassung<br />
auf Seiten der Behandler.<br />
Unsere Erfahrungen zeigen, dass insbesondere<br />
Fehlermeldungen zu Struktur und Prozessen<br />
erfolgen, während die Bewertung zur Ergebnisqualität<br />
für den Therapieerfolg individuell in<br />
der direkten Kommunikation zwischen Therapeut<br />
und Patienten erfolgt und bearbeitet wird.<br />
Der Asklepios-Standard<br />
CIRS ist ein EDV-gestütztes Erfassungssystem<br />
für Fehler, unerwünschte Ereignisse und Beinahe-Schäden,<br />
welches auf die Analyse von Fehlerketten<br />
und die Prävention zukünftiger Fehler<br />
ausgerichtet ist. Betroffene können sowohl Patientinnen<br />
und Patienten als auch Mitarbeiterinnen<br />
und Mitarbeiter sein.<br />
22<br />
<strong>VKD</strong>-<strong>Praxisberichte</strong> <strong>2015</strong> | Patientensicherheit und Entlassmanagement
Paentensicherheit<br />
Der Asklepios-Standard CIRS gilt gleichermaßen<br />
für somatische und psychiatrische Kliniken.<br />
Vorausgesetzt werden:<br />
• Freiwilligkeit der Meldung,<br />
• Sanktionsfreiheit,<br />
• Anonymität der Eingabe,<br />
• Vertraulichkeit bei der Bearbeitung,<br />
• unabhängiges Berichtssystem,<br />
• Analyse und Maßnahmenableitung durch<br />
Expertenteam,<br />
• Transparenz und Feedback zum Bericht,<br />
• definierte Aufbau- und Ablauforganisation,<br />
• Evaluation.<br />
CIRS ist keine Komplikationsstatistik, d. h., es<br />
werden keine bereits entstandenen Schäden,<br />
welche ggf. haftungsrelevant sein können, gemeldet.<br />
Im Intranet der genannten Einrichtungen befindet<br />
sich ein Link zum CIRS-Meldeformular;<br />
dieser kann von den klinikinternen Rechnern<br />
aus genutzt werden.<br />
Abgefragt wird:<br />
• Was ist passiert?<br />
• Wie ist es zu dem Ereignis gekommen?<br />
• Wie könnte es in Zukunft vermieden werden?<br />
Die Verantwortung trägt die Führung des Krankenhauses.<br />
Jede Klinik bildet einen Meldekreis.<br />
Zum CIRS-Team gehören Anonymisierer, jeweils<br />
Arzt und Pflegekraft als CIRS-Beauftragte für<br />
die Bearbeitung jeder Meldung, das Analyseteam<br />
als berufs- und bereichsübergreifend<br />
besetztes Gremium und der Bereich Qualitätsmanagement<br />
für Controlling, Evaluation, Koordination.<br />
Erfassung und Auswertung erfolgen über das<br />
CIRS-Analysetool mit organisierter Auswertung,<br />
Analyse, Risikobewertung mit Einschätzung<br />
der Eintrittswahrscheinlichkeit und Fehlerschwere<br />
(als Risikoprioritätszahl), mit Ableitung<br />
von Verbesserungsmaßnahmen und einem<br />
Rückmeldesystem.<br />
Die Meldungen werden folgenden Kategorien<br />
zugeordnet:<br />
• Medikamente<br />
• Geräte / Technik / Bau<br />
• Mensch / Organisation<br />
Die Maßnahmenplanung unterscheidet zwischen<br />
abteilungsinterner und abteilungsübergreifender<br />
Relevanz und umfasst<br />
• Kommunikation / Gespräch<br />
• Schulung<br />
• Verfahrensanweisung<br />
• Prozessoptimierung<br />
• Veränderung der Ausstattung / Neuanschaffung<br />
/ bauliche Maßnahmen<br />
Erfahrungen nach zweijähriger Anwendung<br />
Aus den Erfahrungen nach über zweijähriger<br />
Anwendung an den zwei Standorten der Asklepios<br />
Psychiatrie Niedersachsen GmbH können<br />
wir Folgendes berichten (s. Tabellen 1 und 2):<br />
Tabelle 1: Übersicht der CIRS Fälle (bislang n= 120 Eingaben)<br />
2013<br />
2014<br />
zwei Monate <strong>2015</strong><br />
Stand: 17.02. <strong>2015</strong><br />
AF Göttingen<br />
63 Eingaben<br />
(davon 17 für Betriebliches<br />
Vorschlagswesen)<br />
22 Eingaben<br />
(davon 9 für Betriebliches<br />
Vorschlagswesen)<br />
9 Eingaben<br />
(davon 3 für Betriebliches<br />
Vorschlagswesen)<br />
AF Tiefenbrunn<br />
20 Eingaben<br />
(davon 2 für Betriebliches<br />
Vorschlagswesen)<br />
5 Eingaben<br />
(davon 2 für Betriebliches<br />
Vorschlagswesen)<br />
1 Eingabe<br />
(davon 0 für Betriebliches<br />
Vorschlagswesen)<br />
<strong>VKD</strong>-<strong>Praxisberichte</strong> <strong>2015</strong> | Patientensicherheit und Entlassmanagement 23
Paentensicherheit<br />
Als Vertreter von zwei großen psychiatrischen<br />
Standorten haben wir untersucht, inwieweit<br />
– möglicherweise psychiatrieassoziierte -<br />
Schwerpunkte bei CIRS-Meldungen bestehen.<br />
In der Einführungsphase galt es zunächst, die<br />
Mitarbeiterschaft zu schulen und zur Nutzung<br />
zu motivieren.<br />
In den hiesigen psychiatrischen Krankenhäusern<br />
wurden am häufigsten CIRS-Fälle aus der<br />
Kategorie Mensch / Organisation (n=49), nachfolgend<br />
23 Fälle der Kategorie Geräte / Technik /<br />
Bau und 10 Fälle der Kategorie Medikamente<br />
zugeordnet. Da Mehrfachnennungen möglich<br />
waren, ist die Zuordnung nicht eindeutig auszuwerten.<br />
Mehrfachmeldungen gab es zu:<br />
• Verwechslung von Medikamenten beim Verordnen,<br />
bei Bereitstellung, Kontrolle oder<br />
Verabreichen, z. B.<br />
– Patientenverwechslung bei Ausgabe der<br />
Medikation<br />
– Missverständliche Angaben bei der Dosierung<br />
von Medikamenten (ml / mg, Stückzahl<br />
/ mg), Verwechslung von optisch<br />
ähnlichen Verpackungen<br />
• Missverständnisse oder Kommunikationsprobleme<br />
bezüglich Absprachen, Verordnungen,<br />
Entscheidungen:<br />
– Verwechslung von Patienten bei Diagnostik<br />
– Unklare Absprachen in Bezug auf Abläufe<br />
(z.B. Hygiene-Management)<br />
Tabelle 2: Klinikübergreifend konnten folgende CIRS-Fälle kommuniziert werden<br />
(5 von 120= 4,2%, veröffentlicht in Mitarbeiterzeitung / Newsletter):<br />
CIRS-Meldung<br />
Abgabe von Medikamenten - hier<br />
der sog. Mitnahmemedikation -,<br />
dabei waren die vorbereitende Pflegekraft<br />
und die ausgebende Pflegekraft<br />
nicht identisch. Der Tagesriegel<br />
eines Patienten wurde mit falschem<br />
Namen versehen.<br />
Abgeleitete Maßnahme<br />
Anwendung des Standards zum Umgang<br />
mit Medikamenten (6 R-Regel).<br />
Versorgung von nicht bekannten<br />
Patienten mit Risiko, dass es in<br />
Vertretungssituationen bzw. bei<br />
Aushilfstätigkeiten zu fehlerhaftem<br />
Handeln kommt, hier zu Patientenverwechslungen.<br />
Anwendung des Medikamentenstandards.<br />
Zuordnung des Gesichtes<br />
zum Patientenfoto anhand der Gesundheitskarte<br />
in der Krankenakte,<br />
ggf. Armbändchen mit Patientenidentifikationsnummern<br />
einführen.<br />
Auslösen des PNA-Alarms (Personennotruf)<br />
statt Notruf 333 (für<br />
medizinischen Notfall), Folge: Notfallausrüstung<br />
fehlte beim Einsatz.<br />
Schulungen zum Notfallmanagement<br />
auf den Stationen werden<br />
wiederholt angeboten und Prüfungen<br />
zum Kenntnisstand der Mitarbeiter<br />
zur Notrufregelung werden<br />
durchgeführt.<br />
Verletzungsgefahr für Patienten<br />
aufgrund von Bau- und Reinigungsmängeln<br />
sowie ausstehenden Reparaturen<br />
an Trainingsgeräten.<br />
Einführung eines neuen Fixiersystems<br />
zur Anwendung bei Zwangsmaßnahmen,<br />
vorübergehend gab<br />
es im Hause zwei unterschiedliche<br />
Fixiersysteme mit verschiedenen<br />
Magnetschlüsseln.<br />
Listen im MTT-Raum und in der<br />
Turnhalle mit dem Namen der Aufsichtsperson,<br />
Anzahl der Nutzer/<br />
innen, Uhrzeit der Nutzung. Prüfliste<br />
für die ordnungsgemäße Nutzung<br />
der Trainingsgeräte in der Abteilung<br />
Physiotherapie.<br />
Vereinheitlichung der Fixiersysteme<br />
im Hause und Schulung der<br />
Mitarbeiter zur Anwendung.<br />
24<br />
<strong>VKD</strong>-<strong>Praxisberichte</strong> <strong>2015</strong> | Patientensicherheit und Entlassmanagement
Paentensicherheit<br />
Die Auswertung zu Eintrittswahrscheinlichkeit<br />
und Fehlerschwere (als Risikoprioritätszahl)<br />
ergab, dass die Meldungen am häufigsten als<br />
sehr schwer, weniger häufig als schwer und<br />
selten als äußerst schwer bewertet wurden. Für<br />
alle Eingaben konnten Maßnahmen abgeleitet<br />
und kommuniziert werden.<br />
Zudem fiel auf, dass im ersten Jahr nach CIRS-<br />
Einführung insgesamt 19 von 83 Eingaben (23%)<br />
dem Beschwerdemanagement zugeordnet werden<br />
mussten und im zweiten Jahr sogar 11 von<br />
27 Meldungen (41%). Das CIRS Meldesystem<br />
wird offenbar als anonymes Meldesystem für<br />
Beschwerden genutzt, wenngleich ein einrichtungsinternes<br />
Beschwerdemanagementsystem<br />
etabliert ist. Die Umwidmung der Eingaben<br />
wurde gleichermaßen kommuniziert, erscheint<br />
aber eine fortgesetzte Praxis. Intern wurde diskutiert,<br />
inwieweit die sichergestellte Anonymität<br />
hier eine Rolle spielt.<br />
Psychiatrierelevante, fachspezifische Risiken<br />
bei der Behandlung von Patienten mit kognitiven<br />
Defiziten (u.a. Demenz-Erkrankte, Psychose-Kranke<br />
und intoxikierte Patienten) oder<br />
auch nicht vorgenommene oder unklare Einschätzung<br />
von Selbst-/ Fremdgefährdung haben<br />
nur in Einzelfällen Risiken und Maßnahmen<br />
beeinflusst und führten nicht gehäuft zu CIRS-<br />
Meldungen, sondern werden weiterhin über<br />
»Besondere Vorkommnisse« erfasst.<br />
Keine Unterschiede zur Somatik<br />
bei CIRS-Nutzung<br />
Klinikübergreifende Evaluationen ergaben,<br />
dass bei der Nutzung des Meldesystems und<br />
der Analyse der CIRS-Fälle die gleichen Problematiken<br />
relevant waren, wie sie auch aus<br />
den somatischen Kliniken im Konzern berichtet<br />
werden.<br />
Klinikübergreifend werden auf Konzern-Ebene<br />
folgende Aspekte diskutiert:<br />
• Sind Durchdringungsgrad und Kenntnisstand<br />
zu CIRS ausreichend?<br />
• Ist die Mitarbeiterschaft ausreichend geschult?<br />
• Wird CIRS angemessen von der Führung unterstützt?<br />
• Sind Rückmeldung zu Ergebnissen und Evaluation<br />
ausreichend (transparent)?<br />
• Inwieweit erfolgt eine Abgrenzung von Eingaben,<br />
die dem Beschwerdemanagement zuzuordnen<br />
sind?<br />
• Wie erfolgt die Umsetzung von Maßnahmenableitung<br />
mit Angemessenheit und Passung<br />
zum jeweiligen Fall?<br />
• Wie erfolgt die Umsetzung der Rückmeldungen<br />
an die beteiligten Bereiche?<br />
• Was passiert bei vergleichsweise seltenen<br />
Meldungen?<br />
• Wie wird CIRS »aktiv« genutzt?<br />
Intern wurde reflektiert, inwieweit das CIRS<br />
mit der vorgegebenen Struktur nicht selbst<br />
dazu beiträgt, dass Berichte über somatischrelevante<br />
Probleme bevorzugt gemeldet werden<br />
und Probleme aus konkreten therapeutischen<br />
Interaktionen mit den Patienten eher der<br />
ebenfalls bewährten Aufarbeitung in Balint-<br />
Gruppen, Team-Supervisionen etc. vorbehalten<br />
bleiben.<br />
Fazit<br />
Der Asklepios Standard CIRS konnte erfolgreich<br />
an zwei psychiatrischen Standorten der<br />
Asklepios Psychiatrie Niedersachen GmbH eingeführt<br />
werden. Mit bislang 120 Eingaben wird<br />
das Meldesystem kontinuierlich im klinischen<br />
Alltag genutzt.<br />
CIRS ist präventiv auf die lernende Organisation<br />
ausgerichtet, mit der steten Überlegung, wie<br />
Fehler zukünftig vermieden werden können.<br />
Der Erfolg von CIRS besteht im Aufbau einer<br />
positiven Fehlerkultur: Es wird nicht gefragt,<br />
»wer«, sondern »was« führt zu Fehlern. Dabei<br />
ist wesentlich, dass folgende Maximen umgesetzt<br />
werden:<br />
Vertrauen schaffen, offene Kommunikationskultur,<br />
offener Umgang mit Kritik, kontinuierlicher<br />
Verbesserungsprozess, es gibt keine<br />
»dummen« Fragen, Fragen werden nie »zur<br />
falschen Zeit« gestellt, Fragen sind jederzeit<br />
möglich und erwünscht.<br />
Im CIRS werden nicht der Mensch und das persönliche<br />
Versagen in den Fokus gesetzt oder<br />
sanktioniert, sondern alle relevanten Bereiche<br />
in gegenseitiger Beeinflussung analysiert, um<br />
auch organisatorische, technische oder soziale<br />
Fehlerquellen identifizieren und eliminieren zu<br />
können.<br />
In den beschriebenen Einrichtungen sind wesentliche<br />
Voraussetzungen dazu:<br />
• Die Führungskräfte unterstützen aktiv den<br />
CIRS-Prozess als Bestandteil von Risikomanagement<br />
und die Maßnahmenumsetzung.<br />
• Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind<br />
über Ziele, Grundsätze und Struktur des CIRS<br />
informiert bzw. geschult.<br />
• Das System wird genutzt, aus Fehlern wird<br />
gelernt, Maßnahmen werden abgeleitet,<br />
Risiken werden frühzeitig erkannt und minimiert.<br />
<strong>VKD</strong>-<strong>Praxisberichte</strong> <strong>2015</strong> | Patientensicherheit und Entlassmanagement 25
Paentensicherheit<br />
Mit der Einführung eines Fehlermelde- und<br />
Lernsystem kann eine vertrauensvolle und<br />
transparente Fehlerkultur geschaffen werden,<br />
um durch Risikomanagement eine tatsächliche<br />
Fehlerreduktion zu bewirken. Damit werden die<br />
Patienten- und Mitarbeitersicherheit erhöht.<br />
Unsere Auswertungen in psychiatrischen Fachkliniken<br />
über zwei Jahre ergaben, dass Meldungen<br />
vorrangig auf Struktur- und Prozessebene<br />
erfolgen. Wir gehen davon aus, dass hier<br />
Fehler fassbarer sind, wohingegen die Beziehungsebene<br />
in der Arzt-Patienten-Interaktion<br />
subjektiv erlebt und individuell therapeutisch<br />
bearbeitet wird.<br />
Mängel in der Patientenversorgung Fehlerquellen<br />
dar. Vielfach wurde die Problematik<br />
Arbeitsverdichtung und reduzierte Personalressourcen<br />
angesprochen.<br />
Es bleibt abzuwarten, inwieweit strukturelle<br />
und prozessuale Weiterentwicklungen im Gesundheitswesen<br />
zukünftig die Abläufe vereinfachen<br />
und potenziell sicherer machen können.<br />
Aus Sicht des Qualitätsmanagements scheint<br />
dieses denkbar auf der Strukturebene mit der<br />
Unterstützung der Dokumentation durch digitale<br />
Anwendungen sowie auf der Prozessebene<br />
mit der Weiterentwicklung von Behandlungspfaden.<br />
Neben auffälligen Häufungen von Meldungen<br />
zu Medikationsfehlern stellen organisatorische<br />
Literatur / Quellen<br />
Asklepios Standard CIRS,<br />
mitgeltende Dokumente und Präsentationen, Konzernabteilung Qualitätsmanagement,<br />
A. Budde, R. Heuzeroth, 2011<br />
QM-Richtlinie Krankenhäuser des GBA,<br />
2014 (Einführung RM und Fehlermeldesystems ist neben der Implementierung<br />
eines QMS verpflichtend)<br />
https://www.g-ba.de/.../39.../2014-01-23_KQM-RL_137-1d_BAnz.pdf<br />
CNE.fortbildung,<br />
1.<strong>2015</strong>, J. Hammerschmidt, Zur Sicherheit, Aus Fehlern lernen, Thieme Verlag, Stuttgart<br />
Internet<br />
www.gvg.org<br />
www.apk-ev.de<br />
www.aktionsbuendnis-patientensicherheit.de<br />
26<br />
<strong>VKD</strong>-<strong>Praxisberichte</strong> <strong>2015</strong> | Patientensicherheit und Entlassmanagement
Medikationsfehler<br />
sind vermeidbare Risiken<br />
AMTS - wichtiges Thema für unsere Krankenhäuser<br />
Paentensicherheit<br />
Dr. rer. nat. Albrecht Eisert<br />
Chefapotheker, Apotheke<br />
Uniklinik RWTH Aachen<br />
Rebekka Lenssen<br />
Fachapothekerin für Klinische<br />
Pharmazie, Apotheke<br />
Uniklinik RWTH Aachen<br />
Peter Asché<br />
Kaufmännischer Direktor<br />
Uniklinik RWTH Aachen,<br />
Vizepräsident des Verbandes<br />
der Krankenhausdirektoren<br />
Deutschlands<br />
Die Uniklinik RWTH Aachen verbindet als Supramaximalversorger Medizin und<br />
Pflege, Lehre und Forschung auf internationalem Niveau. Mit 34 Fachkliniken,<br />
27 Instituten und fünf fachübergreifenden Einheiten wird das gesamte medizinische<br />
Spektrum abgedeckt. Rund 6000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter versorgen<br />
jährlich rund 45.000 stationäre und 200.000 ambulante Patienten. Es werden rund<br />
1.400 Betten vorgehalten.<br />
Die Arzneimitteltherapiesicherheit (AMTS)<br />
hat zum Ziel, unerwünschte Arzneimittelereignisse<br />
zu vermeiden. Damit ist die AMTS ein<br />
zentraler Punkt der Patientensicherheit, die<br />
zunehmend in den Fokus der Öffentlichkeit<br />
und des Gesetzgebers gerückt ist. Im Medikationsprozess,<br />
von der Aufnahme bis zur<br />
Entlassung eines Patienten und von der Anamnese<br />
bis zum Therapiemonitoring, sind viele<br />
Aspekte zur Arzneimitteltherapiesicherheit<br />
zu beachten. Einige Beispiele und Maßnahmen<br />
aus der Uniklinik RWTH Aachen werden<br />
in nachfolgendem Artikel vorgestellt.<br />
Als Kohn et al. Im Jahr 2000 in den USA »To err is<br />
human« publizierten, begann eine neue Ära der<br />
Patientensicherheit [1]. Ein zentraler Punkt der<br />
Patientensicherheit ist die Arzneimitteltherapiesicherheit<br />
(AMTS). Die Arzneimitteltherapie,<br />
besonders von Patienten im Krankenhaus, setzt<br />
sich häufig aus einer Vielzahl von Arzneimitteln<br />
zusammen und birgt daher ein hohes Potenzial<br />
für Fehler im Medikationsprozess. Nach Hochrechnungen<br />
von Hauck und Zhao birgt ein Krankenhausaufenthalt<br />
ein 5,5-prozentiges Risiko<br />
für den Patienten, ein unerwünschtes Arzneimittelereignis<br />
zu erleiden, jede weitere Nacht<br />
im stationären Aufenthalt erhöht dieses zusätzlich<br />
um 0,5 Prozent [2].<br />
Die Arzneimitteltherapiesicherheit »ist die Gesamtheit<br />
der Maßnahmen zur Gewährleistung<br />
eines optimalen Medikationsprozesses mit dem<br />
Ziel, Medikationsfehler und damit vermeidbare<br />
Risiken für den Patienten bei der Arzneimitteltherapie<br />
zu verringern [3].<br />
Der Medikationsprozess umfasst danach alle<br />
Schritte in der Arzneimitteltherapie und wird<br />
wie folgt definiert:<br />
»Arzneimittelanamnese<br />
Verordnung/Verschreiben<br />
Patienteninformation<br />
Selbstmedikation<br />
»Wesentliche Punkte sind<br />
die Sensibilisierung für<br />
Risiken im Medikationsprozess<br />
und die dauerhafte<br />
Implementierung von<br />
Maßnahmen zur AMTS<br />
im Krankenhaus.«<br />
Rebekka Lenssen<br />
<strong>VKD</strong>-<strong>Praxisberichte</strong> <strong>2015</strong> | Patientensicherheit und Entlassmanagement 27
Paentensicherheit<br />
Verteilung/Abgabe<br />
Anwendung (Applikation/Einnahme)<br />
Dokumentation<br />
Therapie-Überwachung/AMTS-Prüfung<br />
Kommunikation/Abstimmung<br />
Ergebnisbewertung« [3].<br />
Daraus lässt sich ableiten, dass viele Berufsgruppen,<br />
im Krankenhaus insbesondere Ärztinnen<br />
und Ärzte, Pflegerinnen und Pfleger,<br />
Apothekerinnen und Apotheker, und vor allem<br />
Patientinnen und Patienten, an diesem Medikationsprozess<br />
beteiligt sind.<br />
Um die AMTS in Deutschland zu verbessern,<br />
wurde 2007 der erste Aktionsplan AMTS vom<br />
Bundesministerium für Gesundheit veröffentlicht.<br />
Bis heute wurde dieser kontinuierlich fortgeschrieben,<br />
derzeit in der dritten Auflage [4].<br />
Risiken vor allem an Schnittstellen<br />
Nicht nur während des Krankenhausaufenthaltes,<br />
sondern auch an der Schnittstelle zum ambulanten<br />
Bereich und zu weiterversorgenden<br />
stationären Einrichtungen, z.B. Reha-Kliniken,<br />
lauern Risiken. Auch Verlegungen innerhalb eines<br />
Krankenhauses, z.B. von Intensivstation auf<br />
Normalstation, sind Schnittstellen mit hohem<br />
Risikoprofil. An jeder dieser Schnittstellen ist<br />
eine richtige und vollständige Übergabe der<br />
Informationen, im Hinblick auf die AMTS insbesondere<br />
ein vollständiger und richtiger Medikationsplan,<br />
essentiell. Auf allen Ebenen ist<br />
daher eine gute Abstimmung und Zusammenarbeit<br />
sowie technische Vernetzung über Berufs-und<br />
Sektorengrenzen hinweg von enormer<br />
Bedeutung.<br />
AMTS im Krankenhaus<br />
Alle Schritte im Medikationsprozess bergen Risiken<br />
für Medikationsfehler. Durch eine unvollständige<br />
Arzneimittelanamnese oder auch die<br />
Angabe falscher Arzneimittel können für den<br />
Patienten wichtige Arzneimittel in der stationären<br />
Medikation fehlen, der Patient nicht ausreichend<br />
therapiert sein oder es können sogar<br />
unerwünschte Wirkungen auftreten. Fehlende<br />
oder unklare Angaben zum Patienten, (z.B.<br />
Größe und Gewicht bei der Dosisberechnung<br />
von Zytostatika), handschriftlich unleserliche<br />
Verordnungen, kontraindizierte Arzneimittel,<br />
falsches »Stellen« der Arzneimittel oder auch<br />
Doppelverordnungen können den Patienten gefährden.<br />
Die Uniklinik RHTW Aachen<br />
Des Weiteren sind zu spät bestellte Arzneimittel,<br />
Abgabe eines falschen Arzneimittels, Verwechselungen<br />
durch look- oder sound-alike<br />
Arzneimittel und fehlerhafter Transport Fehlermöglichkeiten.<br />
Auch die Vorbereitung und<br />
Applikation von Arzneimitteln bergen Risiken.<br />
Fehlerquellen können zum Beispiel die inkorrekte<br />
Zubereitung eines Arzneimittels mit einem<br />
falschen Lösungsmittel, mit falschem Volumen,<br />
die zu lange Lagerung eines aufgelösten<br />
Arzneimittels, fehlende Aseptik in der Zubereitung<br />
oder eine unzureichende Etikettierung<br />
sein. Auch das Mörsern oder Teilen von dafür<br />
nicht vorgesehenen Arzneimitteln, beispielsweise<br />
bei der Applikation von Arzneimitteln<br />
bei Patienten über eine Sonde, kann zu Fehlern<br />
führen.<br />
Perfusorenetiketten<br />
Foto: Uniklinik RWTH Aachen<br />
28<br />
<strong>VKD</strong>-<strong>Praxisberichte</strong> <strong>2015</strong> | Patientensicherheit und Entlassmanagement
Paentensicherheit<br />
Der Medikationsprozess ist aber auch gefährdet<br />
durch fehlendes Entlassmanagement, fehlende<br />
Information zu neu angesetzten Arzneimitteln,<br />
Weiterverordnung trotz nicht mehr<br />
bestehender Indikation. Zudem ist eine ausreichende<br />
Versorgung des Patienten, z.B. über das<br />
Wochenende, mit Arzneimitteln für eine kontinuierliche<br />
Weiterversorgung wichtig. Wesentliche<br />
Punkte sind die Sensibilisierung für Risiken<br />
im Medikationsprozess und die dauerhafte<br />
Implementierung von Maßnahmen zur AMTS im<br />
Krankenhaus.<br />
Multiprofessionelle Aufgabe<br />
Die Arzneimitteltherapie im Krankenhaus ist<br />
eine multiprofessionelle Aufgabe – daher ist<br />
auch das Thema AMTS für alle am Medikationsprozess<br />
Beteiligten relevant. Gemeinsames Ziel<br />
sollte daher sein, den Medikationsprozess optimal<br />
zu organisieren und zu strukturieren, um<br />
Risiken zu minimieren.<br />
Die Uniklinik RWTH Aachen (UKA) implementiert<br />
nach und nach die Handlungsempfehlungen<br />
des Aktionsbündnisses Patientensicherheit<br />
e.V. im Krankenhaus. Auch konsiliarische<br />
Anfragen zur Arzneimitteltherapie werden von<br />
den Kliniken an die Apotheke gerichtet. Im Bereich<br />
der Forschung wird in einigen Projekten<br />
die AMTS-Thematik aufgegriffen und die Implementierung<br />
von Maßnahmen wissenschaftlich<br />
begleitet. Regelmäßige Schulungen des Personals<br />
zur AMTS ergänzen die Aktivitäten.<br />
Beispielhaft werden nachfolgend einige Aktionen<br />
und Maßnahmen zur Arzneimitteltherapiesicherheit<br />
am UKA vorgestellt.<br />
Hochrisiko- Arzneimittel<br />
Internationale Untersuchungen beschreiben<br />
einige Arzneimittel mit einem hohen Risiko<br />
für unerwünschte Arzneimittelereignisse. Das<br />
»Institute of Safe Medication Practices« in den<br />
USA führt auf seiner Liste zu »High-Alert Medications<br />
in Acute Care Settings« Arzneistoffgruppen<br />
und einzelne Arzneistoffe auf, die ein<br />
erhöhtes Risiko bergen, einen Schaden beim<br />
Patienten auszulösen, wenn sie fehlerhaft genutzt<br />
werden. Hierzu gehören zum Beispiel Antithrombotika,<br />
hoch konzentrierte Kaliumlösungen<br />
zur intravenösen Anwendung oder auch<br />
oral appliziertes Methotrexat in der nichtonkologischen<br />
Anwendung [5].<br />
Auch Arzneimittel, die ein von der täglichen<br />
Einnahme abweichendes Applikationsschema<br />
aufweisen (z.B. einmal wöchentliche Gabe),<br />
sind in der Regel mit einem höheren Risiko für<br />
Medikationsfehler und ggf. schwerwiegenden<br />
Folgen für den Patienten behaftet. Eine konsequente<br />
Wahrnehmung solcher Hochrisikoarzneimittel<br />
in Medikationsprofilen von allen am<br />
Medikationsprozess Beteiligten ist daher von<br />
äußerster Wichtigkeit.<br />
Für einzelne dieser Hochrisikoarzneimittel<br />
wurden und werden im Rahmen des erwähnten<br />
Aktionsplans zur AMTS in Deutschland Handlungsempfehlungen<br />
zum Umgang damit entwickelt.<br />
Beispielhaft sei die bereits erschienene<br />
Empfehlung zu oral angewendetem Methotrexat<br />
in der einmal wöchentlichen Gabe, herausgegeben<br />
vom Aktionsbündnis Patientensicherheit<br />
e.V., erwähnt. Am UKA wurden nach<br />
Beschluss der AMK die Empfehlungen zum<br />
Umgang mit oral appliziertem Methotrexat im<br />
gesamten Haus umgesetzt.<br />
Arzneimittelanamnese im interdisziplinären<br />
Aufnahmeprozess<br />
Die Arzneimittel-Anamnese findet in der Regel<br />
bei der ärztlichen Aufnahme des Patienten<br />
statt. Da ein zu Beginn eingeschlichener Fehler<br />
in der Medikation während der Krankenhausbehandlung<br />
unentdeckt bleiben kann, ist es<br />
sinnvoll, besonderen Wert auf eine korrekte<br />
Anamnese zu legen. Auch die WHO schenkt im<br />
High 5s Projekt »Medication Reconciliation«<br />
(MedRec), also dem systematischen Abgleich<br />
der vorbestehenden Medikation mit der stationär<br />
verordneten Medikation, große Beachtung.<br />
In diesem Projekt wird zunächst anhand eines<br />
standardisierten Arbeitsablaufs (SOP) die Arzneimittelanamnese<br />
strukturiert durchgeführt.<br />
Hierfür werden verschiedene Quellen genutzt,<br />
um einen möglichst vollständigen Medikationsplan<br />
(»best possible medication history«)<br />
zu erhalten. Als Informationsquellen dienen z.B.<br />
Unterlagen des Patienten in Form von mitgebrachten<br />
Medikationsplänen, alte Arztbriefe,<br />
handgeschriebene Zettel, Arzneimittel-Verpackungen<br />
sowie mündliche Angaben der Patienten<br />
bzw. Angehörigen. Der anschließende<br />
Abgleich mit der derzeit ärztlichen Verordnung<br />
im Krankenhaus deckt mögliche Diskrepanzen<br />
auf, die somit direkt zu Beginn des Aufenthaltes<br />
korrigiert werden können [6]. Als interdisziplinäre<br />
Aufgabe sind am MedRec-Prozess<br />
v.a. Ärztinnen und Ärzte, Pflegerinnen<br />
und Pfleger sowie Apothekerinnen<br />
und Apotheker beteiligt<br />
Ob eine zusätzliche AMTS-<br />
Prüfung - also eine ausführliche<br />
Überprüfung zur Dosierung,<br />
zu Dosisanpassungen<br />
an z.B. Organfunktionen, Kontraindikationen,<br />
zu unerwünschten<br />
Wirkungen, Arzneimittelinteraktionen,<br />
Vorschläge zum aut idem bzw. aut<br />
<strong>VKD</strong>-<strong>Praxisberichte</strong> <strong>2015</strong> | Patientensicherheit und Entlassmanagement 29
Paentensicherheit<br />
simile Austausch von Arzneimitteln - einen<br />
zusätzlichen Nutzen hat, wird derzeit in einer<br />
Studie am UKA untersucht. Die AMTS-Prüfung<br />
der Medikation wird in diesem Projekt als<br />
Dienstleistung von der Apotheke übernommen.<br />
Eine weitere Möglichkeit, die AMTS Schnittstellen<br />
zu optimieren, ist das Einführen eines einheitlichen<br />
Medikationsplans, wie er im Rahmen<br />
des Aktionsplans AMTS entwickelt wurde.<br />
Ist dieser Medikationsplan in aktueller und<br />
vollständiger Version, z.B. bei Krankenhausaufnahme,<br />
vorhanden, sind viele Informationen<br />
sofort verfügbar, die sonst häufig fehlen<br />
(z.B. Darreichungsformen, Arzneimittel aus der<br />
Selbstmedikation des Patienten).<br />
Einsatz von CDSS /CPOE als Prozessunterstützung<br />
bei der Arzneimittel-<br />
Information<br />
Der Einsatz von handschriftlichen »Patientenkurven«<br />
ist bei einer eventuell schlecht lesbaren<br />
Handschrift mit einem hohen Risiko für<br />
Übertragungsfehler oder Interpretationsfehler<br />
verbunden. Durch eine elektronische Verschreibung<br />
kann das Problem der Nicht-Lesbarkeit<br />
umgangen werden.<br />
Im immer komplexer werdenden Klinikalltag<br />
kann ein CDSS (Clinical decision support system)<br />
bzw. eine CPOE (computerized physician<br />
order entry) den Medikationsprozess unterstützen<br />
und damit auch zur Patientensicherheit<br />
beitragen. Obwohl Untersuchungen über<br />
die Wirksamkeit eines CPOE-Einsatzes widersprüchlich<br />
sind, empfiehlt das Aktionsbündnis<br />
Patientensicherheit den Einsatz. Neben der<br />
eindeutigen Verordnung können unterschiedliche<br />
Wissensdatenbanken, die in einem solchen<br />
Programm hinterlegt oder verknüpft sein können,<br />
Dosisadaptionen bei Organinsuffizienzen<br />
vorschlagen, klinisch orientierte Warnungen<br />
oder Hinweise bei spezifischen Arzneimitteln<br />
(z.B. Einsatz im Alter) ausgeben und somit den<br />
Anwender bei Therapieentscheidungen unterstützen.<br />
Häufig beinhalten diese Datenbanken<br />
auch Hinweise zu Betäubungsmitteln, chargendokumentationspflichtigen<br />
Arzneimitteln, Medizinprodukten,<br />
Arzneimitteln in der Schwangerschaft,<br />
Mörserbarkeit von Arzneimitteln,<br />
Äquivalenztabellen, CMR-Arzneimitteln, aber<br />
auch »ökonomische« Informationen zur Vergütung<br />
(ZE/NUB-Arzneimittel).<br />
Im UKA ist ein CPOE auf den psychiatrischen<br />
Stationen beispielhaft implementiert worden<br />
und soll schrittweise ausgeweitet werden.<br />
Das Vorhandensein eines CPOE/CDSS<br />
ersetzt jedoch nicht eine sichere Organisation<br />
des Medikationsprozesses, wie z.B. die<br />
richtige Eingabe der Informationen in das<br />
System und eine sorgfältige Pflege der hinterlegten<br />
und eingegebenen Informationen.<br />
Einkauf und Lagerung<br />
als Beitrag zur AMTS<br />
Besonders in den letzten Jahren hat die Lieferunsicherheit<br />
im Arzneimittelbereich stark<br />
zugenommen. Eine Krankenhausapotheke in<br />
der Schweiz berichtete allein für das Jahr 2012<br />
von 269 aufgetretenen Lieferengpässen [7]. Daher<br />
ist die sorgfältige Auswahl der Lieferanten<br />
bereits beim Einkauf entscheidend. Ebenso wie<br />
die Lieferfähigkeit ist die Qualität der Präparate<br />
von hoher Relevanz. So kann die Nicht-Wirksamkeit<br />
eines Arzneimittels schwerwiegende<br />
Folgen für den Patienten haben und auch einen<br />
längeren Krankenhausaufenthalt erforderlich<br />
machen.<br />
Lieferengpässe oder –ausfälle, insbesondere in<br />
der Häufigkeit, wie sie in der letzten Zeit auftreten,<br />
sind jedoch kaum vorhersehbar. Daher<br />
30<br />
<strong>VKD</strong>-<strong>Praxisberichte</strong> <strong>2015</strong> | Patientensicherheit und Entlassmanagement
Paentensicherheit<br />
Apothekerinnen bei der<br />
AMTS Prüfung auf Station<br />
Foto: Uniklinik RWTH Aachen<br />
muss von Seiten der Apotheke auf diese Vorfälle<br />
in geeigneter Weise reagiert werden. Dazu<br />
gehört eine strukturierte Kommunikation mit<br />
den zu beliefernden Stationen. Hierbei sind vor<br />
allem die Umstellung auf Alternativpräparate<br />
und der zeitliche Horizont der Lieferfähigkeit<br />
wesentliche Punkte.<br />
Bei Sonderanforderungen, die individuell für<br />
einen Patienten bestellt wurden, werden die<br />
Arzneimittel mit dem Namen des Patienten<br />
versehen, um Verwechslungen zu vermeiden.<br />
Bei einem Austausch von Arzneimitteln mit<br />
gleichem Wirkstoff wird ein entsprechender<br />
Hinweis zur Wirkstoffgleichheit gegeben. Diese<br />
Maßnahmen tragen zu einer lückenlosen Arzneimittelversorgung<br />
der Patienten bei.<br />
Jedes Arzneimittel, das zu einem Fehler führt,<br />
aber auch jedes Arzneimittel, das unnötiger<br />
Weise wegen eines Kommunikationsproblems<br />
innerhalb des Krankenhauses eingekauft wird,<br />
führt auch zu vermeidbaren Kosten. Das zwingt<br />
ein Haus, Kommunikationswege gut abzustimmen.<br />
Applikation von Arzneimitteln und<br />
applikationsfertige Zubereitungen<br />
Bei der Applikation von Arzneimitteln ist eine<br />
Reihe von Aspekten zu beachten. Nicht nur<br />
die richtige Einnahme einer Tablette (z.B. Einnahmezeitpunkt<br />
vor, zu oder nach dem Essen),<br />
sondern auch die vielen verschiedenen verfügbaren<br />
Applikationsformen wie inhalative<br />
(z.B. Dosieraerosole, »Asthmasprays«) oder<br />
parenterale Arzneiformen (wirkstoffhaltige<br />
Pflaster, subcutan zu applizierende Spritzen,<br />
intravenös zu applizierende Infusionen oder Injektionen)<br />
bedürfen einiger Hinweise zu deren<br />
korrekter Anwendung.<br />
Daher finden im Aachener Uniklinikum regelmäßige<br />
Schulungen im Rahmen der internen<br />
Fort- und Weiterbildung des Personals zu speziellen<br />
Arzneiformen statt.<br />
Im Krankenhaus kommen naturgemäß viele<br />
Parenteralia zum Einsatz. Nach einem Bericht<br />
der »American Society of Health System Pharmacists«<br />
führen Fehler bei der Anwendung von<br />
Parenteralia dreimal häufiger zu einem Gesundheitsschaden<br />
oder zum Tod eines Patienten<br />
als andere Arzneimittelfehler [8]. Sowohl<br />
die Zubereitung, die Dosierung als auch die<br />
Applikation können hierbei fehleranfällig sein.<br />
Eine Möglichkeit, solche Fehler bei intravenösen<br />
Arzneimitteln zu reduzieren oder zu vermeiden,<br />
sind in der Apotheke vorbereitete ready-to-use<br />
und ready-to-administer Produkte.<br />
Die Lösungen müssen nicht mehr z.B. weiter<br />
verdünnt, sondern können direkt aufgezogen<br />
und appliziert werden.<br />
Die Zubereitung von CMR-Stoffen, wie die Zytostatikazubereitung,<br />
findet seit langem in<br />
Krankenhausapotheken unter dem Vier-Augen-<br />
Prinzip und unter Reinraumbedingungen statt<br />
- was die Arzneimittelsicherheit der Patienten,<br />
aber auch die Sicherheit des Personals, gewährt.<br />
Zudem werden von einigen Apotheken – auch<br />
der Apotheke der Uniklinik RWTH Aachen - ap-<br />
<strong>VKD</strong>-<strong>Praxisberichte</strong> <strong>2015</strong> | Patientensicherheit und Entlassmanagement 31
Paentensicherheit<br />
plikationsfertige Perfusoren zur Verfügung gestellt.<br />
Eine aseptische Herstellung mit dem Vier-Augen-Prinzip<br />
in der Apotheke unter Reinraumbedingungen<br />
reduziert zudem die mikrobielle<br />
Kontamination auf Station [9].<br />
Um Verwechslungen von Arzneimittelzubereitungen<br />
in Spritzen zu vermeiden, ist eine<br />
eindeutige Kennzeichnung und Beschriftung<br />
der Spritzen essentiell. Hierfür wurde von der<br />
Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für<br />
Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) in Kooperation<br />
mit vielen weiteren Fachgesellschaften<br />
die farbkodierte Etikettierung nach der ISO-<br />
Norm 26825 erweitert [10]. Die farblich unterstützte<br />
Etikettierung und Beschriftung der<br />
Zubereitungen und die Einführung von Standardkonzentrationen<br />
erhöht auch an der Uniklinik<br />
RWTH vor allem in der Intensivmedizin<br />
die AMTS.<br />
Fazit<br />
Die AMTS ist ein wesentlicher Bestandteil der<br />
Patientensicherheit, somit des Qualitätsmanagements<br />
und - nebenbei bemerkt - auch aus<br />
haftungsrechtlicher Sicht von höchster Relevanz.<br />
Der Medikationsprozess besteht aus mehreren<br />
Schritten, an dem verschiedene Professionen<br />
im Krankenhaus, u.a. Ärzte, Pflegekräfte<br />
und Apotheker, beteiligt sind. AMTS in diesem<br />
Prozess zu gewährleisten ist daher ein multiprofessionelles<br />
Thema. Geeignete Maßnahmen<br />
zur AMTS sind wesentliche Bausteine, um die<br />
Patientensicherheit in den Krankenhäusern<br />
zu gewährleisten und unnötige Folgekosten<br />
für das Gesundheitssystem zu vermeiden. In<br />
der Uniklinik RWTH Aachen werden sämtliche<br />
Maßnahmen und Prozesse zur AMTS regelmäßig<br />
evaluiert, um auch in diesem wichtigen Bereich<br />
eine stetige Verbesserung zu ermöglichen.<br />
Applikationsfertige Perfusoren<br />
Foto: Uniklinik RWTH Aachen<br />
Das Aktionsbündnis Patientensicherheit e.V. hat einige Maßnahmen zur Verbesserung<br />
der Arzneimitteltherapiesicherheit im Krankenhaus Anfang diesen Jahres<br />
herausgegeben (vgl. Seidling, Lenssen ZEFQ 2014; Link APS). Hier finden sich Basismaßnahmen<br />
und Maßnahmen im Medikationsprozess [Seidling und Lenssen für die<br />
AG AMTS des Aktionsbündnis Patientensicherheit e.V. Empfehlungen zur Arzneimitteltherapiesicherheit<br />
im Krankenhaus. ZEFQ 2014; 108(1): 44-48; Aktionsbündnis<br />
Patientensicherheit e.V. (Hrsg.) Arbeitsgruppe Arzneimitteltherapiesicherheit des<br />
Aktionsbündnis Patientensicherheit e.V. Arzneimitteltherapiesicherheit im Krankenhaus:<br />
Neuauflage der Checkliste zur AMTS im Krankenhaus der AG Arzneimitteltherapiesicherheit<br />
des Aktionsbündnis Patientensicherheit. <strong>2015</strong>.<br />
Verfügbar unter: http://www.aps-ev.de/fileadmin/fuerRedakteur/PDFs/Handlungsempfehlungen/Arzneimitteltherapiesicherheit/HE_AMTS_Hinweis.pdf].<br />
Farbkodierte Etikettierung<br />
nach ISO 26825<br />
Foto: Uniklinik<br />
RWTH Aachen<br />
32<br />
<strong>VKD</strong>-<strong>Praxisberichte</strong> <strong>2015</strong> | Patientensicherheit und Entlassmanagement
Paentensicherheit<br />
Patientenschulung und<br />
Arzneimittel-Anamnese<br />
Foto: Uniklinik<br />
RWTH Aachen<br />
Apothekerinnen bei<br />
der Stationsbegehung<br />
Foto: Uniklinik<br />
RWTH Aachen<br />
Literatur<br />
[1] Kohn LT et al. To err is human. Washington, D.C.: National Academic Press: 2000<br />
[2] Hauck K, Zhao X. How dangerous is a day in hospital? A model of adverse events and length of<br />
stay for medical inpatients. Med Care 2011;49: 1068-1075<br />
[3] Koordinierungsgruppe zur Umsetzung und Fortschreibung des Aktionsplanes des Bundesministeriums<br />
für Gesundheit zur Verbesserung der Arzneimitteltherapiesicherheit in Deutschland<br />
(Aktionsplan AMTS). Definitionen zu Pharmakovigilanz und Arzneimitteltherapiesicherheit.<br />
Krankenhauspharmazie 2014; 35:425-428<br />
[4] Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft http://www.akdae.de/AMTS/index.html<br />
[5] Institute for Safe Medication Practices (ISMP). ISMP List of high-alert medications in acute<br />
care settings. 2014. Verfügbar unter: https:// www.ismp.org/tools/highalertmedications.pdf]<br />
[6] Ärztliches Zentrum für Qualität in der Medizin. Action on Patient Safety: High 5s. Getting started<br />
kit. Deutsche Version. Sicherstellung der richtigen Medikation bei Übergängen im Behandlungsprozess<br />
– Medication Reconciliation - . 2011<br />
[7] Zeggel et al. Krankenhauspharmazie 2014; 35: 275-80<br />
[8] Proceedings of a summit on preventing patient harm and death from i.v. medication errors.<br />
Am J Health-Syst Pharm 2008,65:2367-79<br />
[9] van Graforst JP, Foudraine NA, Nooteboom f, Crombach WH et al. Unexpected high risk of contamination<br />
with staphylococci species attributable to standard preparation of syringes for<br />
continuous intravenous drug administration in a simulation model in intensive care units Critcare<br />
Med 2002;30:833-6<br />
[10] DIVI. Empfehlung zur Kennzeichnung von Spritzen in der Intensiv- und Notfallmedizin 2012<br />
– erste Überarbeitung des »DIVI-Standards«. 2012. Verfügbar unter: http://www.divi.de/ima<br />
ges/Dokumente/Empfehlungen/Spritzenetiketten/DIVI-Etiketten-Empfehlung_2012_07_02.<br />
pdf.<br />
<strong>VKD</strong>-<strong>Praxisberichte</strong> <strong>2015</strong> | Patientensicherheit und Entlassmanagement 33
Paentensicherheit<br />
Medikationsprozess<br />
optimal gestaltet<br />
Projekt zur Arzneimitteltherapiesicherheit mit hohem Nutzen für die Patienten<br />
Adelheid May<br />
Geschäftsführerin der<br />
Asklepios Harzkliniken<br />
GmbH, Goslar<br />
Susanne Graudenz<br />
Pflegedirektorin der<br />
Asklepios Harzkliniken<br />
GmbH, Goslar<br />
Birte Jerkel<br />
Apothekerin der Asklepios<br />
Harzkliniken GmbH, Goslar<br />
Mechthild Wenke<br />
Fachapothekerin für Klinische<br />
Pharmazie, Apothekenleitung,<br />
Asklepios Harzkliniken<br />
GmbH, Goslar<br />
»Wenn wir die Patientensicherheit<br />
erhöhen wollen,<br />
müssen wir auch den<br />
Medikationsprozess im<br />
Auge haben. Diesen Prozess<br />
optimal zu gestalten und zu<br />
überwachen verhindert<br />
unerwünschte Ereignisse,<br />
nutzt damit den Patienten,<br />
führt zu höherer Qualität<br />
und ist daher auch wirtschaftlich<br />
ein Gewinn für<br />
unser Krankenhaus.«<br />
Adelheid May<br />
Zur Asklepios Harzkliniken GmbH gehören die Krankenhäuser in Goslar, Bad<br />
Harzburg und Clausthal-Zellerfeld. Die Asklepios Harzklinik Goslar bietet als Akutversorger<br />
310 Bettplätze in den Kliniken für Innere Medizin mit den Behandlungsschwerpunkten<br />
Kardiologie, Angiologie, Pulmonologie, Diabetologie, Gastroenterologie sowie<br />
der Onkologie und Hämatologie. Die strukturierte Behandlung von Brustkrebs erfolgt in<br />
einem interdisziplinär konzipierten Brustzentrum. Weitere Schwerpunkte in Goslar sind<br />
die Abteilungen für Gefäßchirurgie Phlebologie und endovaskuläre Chirurgie, sowie die<br />
Allgemein-, Viszeral- und Thoraxchirurgie, deren Koloproktologie und Endoskopie von<br />
der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie als Kompetenzzentrum ausgewiesen wurde.<br />
Die Klinik für Unfall-, Wiederherstellungs- und Handchirurgie ist die einzige Fachabteilung<br />
für die Versorgung Unfallverletzter im Landkreis und regionales Traumazentrum,<br />
das zum TraumaNetzwerk Göttingen/Kassel gehört.<br />
In Goslar werden ca. 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt.<br />
Die Klinik in Goslar ist u.a. Mitglied im Aktionsbündnis Patientensicherheit und Mitglied<br />
bei Qualitätskliniken.de.<br />
Arzneimitteltherapiesicherheit (AMTS) ist Teil<br />
der Patientensicherheit. Wichtigstes Ziel ist,<br />
die Patienten vor vermeidbaren Schäden im<br />
Rahmen der Arzneimitteltherapie zu schützen.<br />
Dazu gehört die Vermeidung von Medikations-/Applikationsfehlern,<br />
die Reduzierung<br />
der Antibiose-Dauer und auch die Vermeidung<br />
von Fehldosierungen und Doppelverordnungen.<br />
Es geht dabei um ein komplexes<br />
Geschehen, an dem verschiedene Berufsgruppen<br />
beteiligt sind. Die Relevanz für den klinischen<br />
Alltag ist als sehr hoch zu bewerten,<br />
denn auch die Fachberatung durch pharmazeutisches<br />
Personal stellt eine wertvolle Unterstützung<br />
für die Arbeit der Mediziner und<br />
Pflegekräfte in diesem Bereich dar. In der<br />
Asklepios Klinik Goslar wurde ein entsprechendes<br />
Konzept in einer Pilotstation der Unfallchirurgie<br />
umgesetzt. Erste Ergebnisse der<br />
Evaluation liegen vor.<br />
Beim Stellen von Medikamenten sind Aufmerksamkeit<br />
und hohe Konzentration notwendig.<br />
Störungen sind zu vermeiden. Die Tätigkeit<br />
34<br />
<strong>VKD</strong>-<strong>Praxisberichte</strong> <strong>2015</strong> | Patientensicherheit und Entlassmanagement
Paentensicherheit<br />
muss ohne Unterbrechungen in einem Arbeitsgang<br />
durchgeführt werden.<br />
Die bisher gelebte Praxis in der Asklepios Harzklinik<br />
in Goslar berücksichtigte diese Forderungen<br />
nur zum Teil. Seit geraumer Zeit wurden<br />
hier im Nachtdienst die Medikamente gestellt.<br />
Zwar sind in der Nacht Störungen weniger häufig<br />
als am Tage, Konzentration und Aufmerksamkeit<br />
sind arbeitsmedizinisch betrachtet<br />
aber im Nachtdienst nicht so ausgeprägt wie im<br />
Tagdienst. Ebenso ist im Nachtdienst ein Stellen<br />
bei fehlender Medikation bzw. fehlender Information<br />
zu einer Umstellung auf die Hauslistenpräparate<br />
nicht möglich. Der Patient erhält<br />
in diesen Fällen sein Arzneimittel verspätet.<br />
Aus diesen Gründen wurde nach Strategien gesucht,<br />
das Stellen von Medikamenten aus dem<br />
Nachtdienst herauszulösen und diese Tätigkeit<br />
am Tag, selbst bei größtem Arbeitsanfall, fachgerecht<br />
durchzuführen.<br />
Pharmazeutisch Technische Assistentinnen<br />
(PTA) verfügen über die notwendigen Fachkenntnisse,<br />
in hoher Qualität das Stellen der<br />
Medikamente zu übernehmen. Dies anerkennend<br />
wurden sie im Rahmen des Konzeptes<br />
»Arzneimittelsicherheit durch Delegation des<br />
Richtens von Medikamenten an Pharmazeutisch-Technische<br />
Assistenten mit unterstützender<br />
Beratung durch Apotheker« mit dieser<br />
Tätigkeit betraut. Das Projekt wurde in einer Pilotstation<br />
der Unfallchirurgie umgesetzt.<br />
Was sollte erreicht werden?<br />
Ziel des Projektes war zunächst die Reduzierung<br />
von Medikationsfehlern. Durch die Einbindung<br />
der Apotheke in das Projektteam wurde<br />
außerdem eine intensive Fachberatung durch<br />
Krankenhausapotheker ermöglicht. So sollten<br />
Wechselwirkungen von verschiedenen Medikamenten<br />
schneller erkannt und möglichst<br />
verhindert werden. Sich aufhebende Wirkungen<br />
von Medikamenten sollten ausgeschlossen<br />
werden. Zur Fehlervermeidung war das konsequente<br />
Einhalten des Vier-Augen-Prinzips ein<br />
wesentlicher Punkt. Derselbe Mitarbeiter, der<br />
die Medikamente richtet, sollte diese nicht<br />
auch verabreichen.<br />
Ein innovativer Ansatz innerhalb des Projektes<br />
war, das Richten von Medikamenten organisatorisch<br />
aus dem Stationsalltag herauszulösen<br />
und an die PTA zu verlagern, so dass ein störungsfreies<br />
Arbeiten möglich ist. Eine examinierte<br />
PTA hat zudem ein umfassendes Wissen<br />
über Arzneimittel und ihre Anwendung, das in<br />
den Prozess des Stellens der Medikation einfließen<br />
kann.<br />
Eine weitere Aufgabe war neben dem Richten<br />
der Medikation auch die Prüfung der Hausmedikation<br />
bzw. klinikärztlichen Verordnung<br />
des Patienten auf Plausibilität und ggf. ein<br />
Umstellen auf Hauslistenpräparate. Falls notwendig,<br />
konnten Empfehlungen zum Absetzen<br />
von Medikamenten bzw. einen Wechsel auf geeignetere<br />
Präparate gegeben werden. Geprüft<br />
werden sollte neben möglichen Wechselwirkungen<br />
auch die Eignung der gewählten Medikation<br />
für spezielle Patientengruppen (z.B.<br />
geriatrische Patienten) und die Plausibilität<br />
der Dosierung im Hinblick auf Zulassung, Nieren-<br />
und Leberfunktion. Bei Resorptionsstörungen<br />
(Sondenpatienten, Kurzdarmsyndrom,<br />
Schluckbeschwerden etc.) sollten ausdrücklich<br />
Empfehlungen zu alternativen Arzneiformen<br />
bzw. Präparaten durch die PTA oder den Apotheker<br />
ausgesprochen werden.<br />
Für geplant zu behandelnde Patienten fand<br />
vorab ein pharmazeutisches Konsil durch einen<br />
Apotheker statt. Nach ärztlicher Freigabe der<br />
Apothekerempfehlung erfolgte die Umsetzung<br />
in die tägliche Medikation im Krankenhaus.<br />
Das Vorgehen<br />
Nachdem das Konzept des Projektes aufgestellt<br />
war, wurde es in einer Pilotstation im Fachbereich<br />
Unfallchirurgie gestartet. Erste Ergebnisse<br />
der Evaluation können vorgelegt werden.<br />
Am Projekt waren die Leiterin der Apotheke und<br />
ein Stationsapotheker, der Chefarzt, die Pflegedirektorin,<br />
die Stationsleitung, eine PTA sowie<br />
ein Vertreter des Betriebsrates beteiligt.<br />
Das Projekt wurde in folgenden Schritten<br />
geplant und durchgeführt:<br />
1. Erarbeitung einer Tagesstruktur für den Einsatz<br />
der PTA und des klinisch tätigen Apothekers<br />
2. Angleichung der Visiten- und Anordnungszeiten<br />
des ärztlichen Dienstes<br />
3. Entwurf Dokumentationssystem für Anordnung,<br />
Richten und Verabreichen<br />
a. Anpassung der Dienstanweisung<br />
Medikation<br />
b. Zwei- bis dreimonatige Testphase auf<br />
einer Station<br />
c. Evaluation<br />
4. Vorstellung der Ergebnisse in der Krankenhausleitung<br />
5. Entscheidung zum Roll-Out im gesamten<br />
Haus<br />
Ein besonderes Augenmerk wurde auf die Dokumentation<br />
der Anordnungen von Medikamenten<br />
durch den behandelnden Arzt gelegt.<br />
Eigentlich bekannte Grundanforderungen, wie<br />
<strong>VKD</strong>-<strong>Praxisberichte</strong> <strong>2015</strong> | Patientensicherheit und Entlassmanagement 35
Paentensicherheit<br />
die Lesbarkeit der Anordnung, die Eindeutigkeit<br />
von Dosierung und Verabreichungsform<br />
sowie die Klarheit der Verabreichungszeiträume,<br />
wurden eingefordert und überprüft. Jede<br />
Anordnung musste vom verordnenden Arzt signiert<br />
werden. Wurden Medikamente abgesetzt<br />
oder verändert, war dies im Dokumentationssystem<br />
ebenfalls eindeutig zu kennzeichnen.<br />
Die Erprobungsphase in der Pilotstation der<br />
Klinik für Unfallchirurgie in der Asklepios Harzklinik<br />
in Goslar begann am 27. April <strong>2015</strong> und<br />
sollte über zwei bis drei Monate dauern. Der<br />
Stellenbedarf für die 52 Betten führende Station<br />
wurde auf ca. 0,4 VK PTA und 0,2 VK Apotheker<br />
geschätzt.<br />
Während der Erprobung wurden folgende<br />
Tätigkeiten der PTA zugeordnet:<br />
• Stellen der Medikation: Orale Arzneiformen<br />
inkl. Betäubungsmitteln (BtM)<br />
• Umstellen der Medikation auf Hauslistenpräparate:<br />
aut idem und aut simile (nach<br />
durch die Arzneimittelkommission frei gegebenen<br />
Äquivalenzdosentabellen), Dokumentation<br />
erfolgt direkt in der Kurve, ggf. Empfehlungen<br />
alternativer Arzneiformen oder<br />
Applikationszeiten (In der »Kurve« werden<br />
die wichtigsten Parameter und Maßnahmen<br />
für jeden Patienten dokumentiert. Sie ist<br />
wichtige Information für weitere Entscheidungen<br />
und diagnostische Maßnahmen.)<br />
• Plausibilitätskontrolle von der in der Kurve<br />
angegebenen Medikation in Hinblick auf<br />
Verfügbarkeit und Dosierung der Präparate,<br />
ggf. Abgleich mit Medikationsplänen des<br />
Patienten, Rücksprache mit Patient, Hausarzt<br />
oder Pflegeeinrichtung<br />
• Pharmazeutisches Konsil durch einen Apotheker<br />
bei allen Neuaufnahmen<br />
• Informationen an den Arzt werden im Verordnungsblatt<br />
der Kurve in grüner Schrift<br />
eingetragen und mit einem Stempel »Empfehlung<br />
Apotheke« versehen. Durch Kleben<br />
eines Post-It werden dem Arzt neue Informationen<br />
kenntlich gemacht. Nach Abzeichnen<br />
durch den Arzt erfolgt die Übernahme in<br />
das Medikationsblatt der Kurve durch die<br />
PTA und ggf. Veränderung des Stellplans.<br />
Alle Umstellungen unterliegen einer täglichen<br />
Plausibilitätskontrolle durch einen<br />
Apotheker<br />
Trotz guter Organisation müssen einige Tätigkeiten<br />
bei den Pflegekräften verbleiben.<br />
Dazu gehören folgende:<br />
• Stellen von Tropfen, Präparaten mit Haltbarkeitseinschränkungen<br />
nach Ausblistern<br />
und Arzneimitteln zur Beeinflussung der<br />
Blutgerinnung ( z.B. Phenprocoumon)<br />
• Bedarfsmedikation<br />
• Zubereiten parenteraler Applikationsformen<br />
• Stellen der Medikamente von Spätaufnahmen<br />
• 4-Augen-Prinzip: Zählen der Tabletten im<br />
Abgleich mit der Kurve bei Verabreichung –<br />
Abzeichnen in der Kurve<br />
Die Ergebnisse<br />
Während der Projektphase wurden sämtliche<br />
Interventionen, wie Umstellungen und Nachfragen,<br />
dokumentiert und evaluiert. Die Interventionen<br />
wurden mit AKDA-DokuPIK - Unterstützung<br />
nach dem Algorithmus des National Coordinating<br />
Council for Medication Error Reporting<br />
and Prevention (NCC-MERP) bewertet. Außerdem<br />
wurde der Zeitaufwand je Patient erhoben.<br />
Er lag für die PTA bei vier bis fünfeinhalb<br />
Minuten je Patient und für den Apotheker bei<br />
Fehlerquellen<br />
Prof. Dr. Dr. Wilfried von Eiff kommt 2008 mit dem Centrum für Krankenhausmanagement<br />
an der Westfälischen Universität in Münster zu folgenden Schlüssen:<br />
• In Krankenhäusern sind 35 Prozent aller Fehlereignisse, also Schädigungen des<br />
Patienten, auf Medikamentenirrtümer zurückzuführen.<br />
• Dabei sind die häufigsten Fehlerquellen mit 39 bis 49 Prozent die ärztliche Verschreibung.<br />
Bei 11 bis 12 Prozent ist es die falsch interpretierte Handschrift, bei<br />
11 bis 14 Prozent entstehen Fehler bei der Medikamentenausgabe und bei 26 bis<br />
38 Prozent treten Fehler beim Verabreichen der Medikamente auf.<br />
• Arzneimittelkomplikationen wirken sich mit durchschnittlich 1,7 Tagen als<br />
Liegezeitverlängerung aus, sie erhöhen die Kosten und schädigen den Ruf des<br />
Krankenhauses.<br />
36<br />
<strong>VKD</strong>-<strong>Praxisberichte</strong> <strong>2015</strong> | Patientensicherheit und Entlassmanagement
Paentensicherheit<br />
drei Minuten je Patient. Pharmazeutische Konsile<br />
wurden in der Projektphase auf die Neuaufnahmen<br />
beschränkt. Ökonomische Effekte,<br />
z.B. durch Absetzen nicht erstattungsfähiger<br />
Präparate, Lagerwertreduktion der Station und<br />
Synergieeffekte, wurden nicht evaluiert. Die Ergebnisse<br />
sind in der Tabelle »Dokumentation<br />
zum Projekt Arzneimittelsicherheit« nochmals<br />
dargestellt.<br />
Dokumentation<br />
zum Projekt<br />
Arzneimittelsicherheit<br />
Quelle:<br />
Asklepios Harzkliniken<br />
GmbH<br />
Fazit:<br />
2,5 Prozent aller verordneten Arzneimittel unterliegen<br />
notwendigen Interventionen. Davon<br />
sind 17,22 Prozent aller Patienten betroffen. Die<br />
Interventionen haben ökonomische bzw. pharmakologisch/medizinische<br />
Gründe, diese im<br />
Verhältnis 50:50. Das Projekt hat einen deutlichen<br />
Beitrag zur Erhöhung der Patientensicherheit<br />
geleistet. Die ökonomischen Effekte<br />
sind im weiteren Fortgang des Projektes zu<br />
evaluieren.<br />
• PTA als Versorgungsassistent – neben den<br />
Tätigkeiten im Projekt übernimmt die PTA<br />
auch das Bestellen und die Lagerverwaltung<br />
der Arzneimittel auf Station<br />
Nach erfolgreicher Pilotierung ist geplant, dieses<br />
Verfahren im gesamten Haus anzuwenden.<br />
Ausblick:<br />
Das Projekt dient als Vorbereitung für weitere<br />
Maßnahmen zur Erhöhung der Patientensicherheit<br />
im Zusammenhang mit der Arzneimitteltherapie:<br />
• Einführung elektronischer Medikationssoftware<br />
(ID Pharma, Meona u.a.)<br />
• Einführung eines pharmazeutischen Konsils<br />
als Dienstleistung für alle Fachbereiche<br />
• Unterstützung durch den Apotheker in der<br />
Umsetzung von hausinternen Leitlinien, z.B.<br />
einer rationalen Antibiotikatherapie<br />
• Stellen von Kurzinfusionen mit zugehörigem<br />
Lösungsmittel und Laufzeit-Empfehlung<br />
Das Projektteam der Asklepios Harzklinik Goslar<br />
Foto: Asklepios Harzkliniken GmbH<br />
<strong>VKD</strong>-<strong>Praxisberichte</strong> <strong>2015</strong> | Patientensicherheit und Entlassmanagement 37
Paentensicherheit<br />
Der Demenzkoordinator<br />
im Akutkrankenhaus<br />
Wie kann die Versorgung von Menschen mit Demenz im klinischen Alltag verbessert<br />
werden? – Bericht über ein Modellprojekt<br />
Das Klinikum Gütersloh ist ein Krankenhaus der Schwerpunktversorgung und<br />
verfügt über 474 Betten in 14 Fachkliniken und einer Belegabteilung. Rund 1.000<br />
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter versorgen jährlich etwa 19.000 stationäre und<br />
34.000 ambulante Patienten.<br />
Im Jahr 2014 als Onkologisches Zentrum zertifiziert, setzt das Klinikum Gütersloh<br />
einen Schwerpunkt in der Behandlung von Krebspatienten. Darüber hinaus verfügt<br />
das Krankenhaus über ein zertifiziertes Gefäßzentrum sowie eine leistungsstarke<br />
Kardiologie mit eigenem Herzkatheterlabor und angegliederter Einheit für elektrophysiologische<br />
Eingriffe. Mit diesen Möglichkeiten bildet das Klinikum Gütersloh<br />
ein Kompetenzzentrum für Herz- und Gefäßerkrankungen.<br />
Maud Beste<br />
Geschäftsführerin<br />
des Klinikums Gütersloh<br />
Verena Beckmann<br />
Presse- und<br />
Öffentlichkeitsarbeit,<br />
Klinikum Gütersloh<br />
Die Versorgung von Menschen mit Demenz ist<br />
im Akutkrankenhaus eine besondere Herausforderung.<br />
Das Klinikum Gütersloh und das<br />
LWL-Klinikum Gütersloh beschreiten mittels<br />
einer Kooperation neue Wege, um den Bedürfnissen<br />
dieser Patienten besser gerecht werden<br />
zu können. Innerhalb eines Modellprojektes<br />
beschäftigen sie einen Demenzkoordinator,<br />
der einerseits im direkten Patientenkontakt<br />
tätig ist und anderseits die Mitarbeiterinnen<br />
und Mitarbeiter im Umgang mit Betroffenen<br />
schult. Dieses praxisnahe Projekt zeigt neue<br />
Ideen in der Versorgungsstruktur, die nur interdisziplinär<br />
beschritten werden können. Die<br />
Bürgerstiftung Gütersloh finanziert das Projekt<br />
über drei Jahre hinweg mit einem Betrag<br />
von 90.000 Euro.<br />
Die Zahl der Patienten mit demenziellen Veränderungen<br />
in Akutkrankenhäusern wächst<br />
stetig, ihre Demenz ist in der Wahrnehmung der<br />
somatisch geprägten Mitarbeiter oft jedoch nur<br />
eine Randerscheinung, die ggf. den reibungslosen<br />
Ablauf behindert.<br />
Benjamin Volmar (31) ist nah dran an diesen<br />
Patienten, die der besonderen Fürsorge bedürfen<br />
und rückt sie in den Fokus. Als ausgebildeter<br />
Fachkrankenpfleger der Altersmedizin und nach<br />
dem Studium der Psychiatrischen Pflege hat er<br />
zum 01.04.<strong>2015</strong> die Stelle eines Demenzkoordinators<br />
im Klinikum Gütersloh übernommen.<br />
Ziel dieser Stelle ist die Optimierung der Versorgung<br />
von Patienten mit Demenz während<br />
der stationären Behandlung. Denn besonders<br />
für sie kann ein Krankenhausaufenthalt verwirrend<br />
sein: Fremde Zimmer, Flure und Menschen<br />
führen oft zu einer Verschlechterung der Symptome.<br />
Häufig brauchen sie länger, wenn sie<br />
sich zum Beispiel von einem Beinbruch erholen<br />
müssen und die Demenz-Erkrankung gar nicht<br />
im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit steht. Ärzte<br />
und Pflegekräfte können dieser Herausforderung<br />
in einem Akutkrankenhaus derzeit kaum<br />
gerecht werden.<br />
Täglich besucht Benjamin Volmar die Stationen<br />
im Klinikum. Er erkundigt sich bei den Pflegenden<br />
nach Patienten, deren Verhalten auf<br />
eine Demenz oder einen Verwirrtheitszustand<br />
schließen lassen. Als speziell ausgebildete<br />
Fachkraft macht er sich dann ein eigenes Bild,<br />
stellt gezielt Fragen, führt bei Bedarf leitliniengetreue<br />
Tests durch und spricht ggf. Empfehlungen<br />
für die weitere Versorgung aus.<br />
»Benjamin Volmar ist mit seinem spezifischen<br />
Fachwissen eine große Unterstützung für das<br />
Klinikum«, sagt Pflegedirektor Jens Alberti.<br />
»Das neue Projekt hat Vorbild-Charakter für<br />
andere Krankenhäuser.« Patienten mit einer<br />
Demenz oder einer Tendenz zu einem sogenannten<br />
Delir können frühzeitig erkannt und<br />
ihren Bedürfnissen entsprechend gezielt behandelt<br />
werden.<br />
Schulungen für Ärzte<br />
und Pflegekräfte<br />
Als Demenzkoordinator bietet Benjamin Volmar<br />
berufsgruppenübergreifende Fortbildungen im<br />
38<br />
<strong>VKD</strong>-<strong>Praxisberichte</strong> <strong>2015</strong> | Patientensicherheit und Entlassmanagement
Paentensicherheit<br />
Demenzkoordinator<br />
Benjamin Volmar<br />
Welche Patienten könnten unter einer Demenz leiden?<br />
Der Demenzkoordinator erkundigt sich auf Station.<br />
Klinikum Gütersloh an, die auf dem Konzept<br />
»Lern von Mir!« der Fachhochschule der Diakonie<br />
aufbauen. Dies ist ein personenzentrierter<br />
Ansatz, der bei den Mitarbeitern des Klinikums<br />
ein Verständnis für die Demenzerkrankung erzeugt<br />
und sie im Umgang mit den Betroffenen<br />
bezüglich ihrer Bedürfnisse sensibilisiert. Dabei<br />
wird der Schwerpunkt auf die Persönlichkeit<br />
des Menschen mit Demenz gelegt. Durch<br />
die ganzheitliche Wahrnehmung werden die<br />
Äußerungen und Bedürfnisse des Patienten<br />
dezidiert betrachtet und in einen persönlichen<br />
Kontext gebracht. Die Themen sind sehr weit<br />
gefächert und reichen von der Delirprävention<br />
und -früherkennung bis hin zu Versorgungsfragen<br />
rund um die Demenzerkrankung. So werden<br />
die besonderen Bedürfnisse der Menschen mit<br />
Demenz besser wahrgenommen und können in<br />
die Behandlung einfließen.<br />
»Demenz ist ein Thema, das uns als Stiftung aktuell<br />
sehr bewegt und unsere Gesellschaft vor<br />
große Herausforderungen stellt«, sagt Brigitte<br />
Büscher, Sprecherin der Bürgerstiftung. »Wir<br />
fördern dieses Projekt mit 90.000 Euro, verteilt<br />
über drei Jahre, weil mit der Kompetenz von<br />
Benjamin Volmar der Umgang mit dem Thema<br />
weiter professionalisiert wird.« Der Demenzkoordinator<br />
hat als Mitarbeiter der gerontopsychiatrischen<br />
Ambulanz des LWL-Klinikums Gütersloh<br />
seinen festen Arbeitsplatz am Klinikum<br />
Gütersloh. Aktuell sind dort die Stationen 3 und<br />
18 der Gefäßchirurgie und der Pneumologie sowie<br />
die Zentrale Notaufnahme als Pilotbereiche<br />
vorgesehen.<br />
Den Blick auf den<br />
einzelnen Menschen richten<br />
Wichtig ist es laut Volmar, dass diese Patienten<br />
während des Klinikaufenthaltes von den immer<br />
gleichen Mitarbeitern betreut würden, die sie<br />
gut kennen.<br />
Benjamin Volmar sensibilisiert auch in den Gesprächen mit Pflegenden<br />
für die besonderen Bedürfnisse der Patienten mit<br />
einer Demenz.<br />
Welche Patienten könnten unter einer Demenz leiden?<br />
Der Demenzkoordinator erkundigt sich auf Station.<br />
Fotos: Klinikum Gütersloh<br />
<strong>VKD</strong>-<strong>Praxisberichte</strong> <strong>2015</strong> | Patientensicherheit und Entlassmanagement 39
Paentensicherheit<br />
Ehrenamtliche Patientenbegleiter<br />
kümmern sich ebenfalls<br />
gezielt um Menschen mit<br />
Demenz und schenken ihnen<br />
auf den Stationen Zeit und<br />
Aufmerksamkeit.<br />
Foto: Klinikum Gütersloh<br />
Viele Menschen mit Demenz verfügen über eigene<br />
Verhaltensmuster, die ohne Kenntnis der<br />
Person und ihrer Biografie nicht gedeutet werden<br />
können. Diese individuellen Persönlichkeitsmerkmale<br />
müssen im Akutkrankenhaus<br />
erfasst und in die Versorgungsplanung einbezogen<br />
werden.<br />
Für alle Patienten mit Demenz werden individuelle<br />
Interventionen geplant und angewendet.<br />
Dabei spielen nichtmedikamentöse Behandlungsstrategien,<br />
insbesondere im kommunikativen<br />
Bereich, eine entscheidende Rolle. So<br />
können validierende oder realitätsorientierende<br />
Ansätze unterschiedliche Ergebnisse im<br />
Patientenkontakt erzeugen und sollen bewusst<br />
von den versorgenden Ärzten und Pflegekräften<br />
eingesetzt werden. Während der validierende<br />
Ansatz verstehend und empathisch ist, setzt<br />
der realitätsorientierende Ansatz auf Faktenwissen<br />
und wird von Menschen mit Demenz<br />
häufig als konfrontativ wahrgenommen. Diese<br />
Kenntnisse werden in den Fortbildungen, sowie<br />
niederschwellig im klinischen Alltag durch den<br />
Demenzkoordinator, vermittelt. Verschiedene<br />
Interventionsstrategien zeigt Benjamin Volmar<br />
in seinem Fortbildungsangebot den Mitarbeitern<br />
alltags- und praxisnah am Patientenbett.<br />
Darüber hinaus gibt Volmar Tipps für die Gestaltung<br />
der Patientenzimmer und Flure, entwickelt<br />
Ideen für Prozessveränderungen oder<br />
spezifische Betreuungsangebote. Im Einzelfall<br />
berät der Demenzkoordinator auch Angehörige.<br />
Angehörige geben<br />
wichtige Informationen<br />
Die Angehörigen spielen in der umfassenden<br />
Versorgung eines Demenzpatienten eine wesentliche<br />
Rolle. Sie können wichtige Auskünfte<br />
über die Biografie und die Persönlichkeit<br />
des Menschen mit Demenz geben und dadurch<br />
kommunikative Zugangsmöglichkeiten<br />
schaffen. Zudem können sie als vertraute<br />
Person beruhigend auf den Menschen mit Demenz<br />
einwirken. Das Augenmerk liegt auf der<br />
Kenntnis der alltäglichen Verhaltensweisen<br />
der Patienten. Ein Mensch mit Demenz wird<br />
sich beispielsweise anders verhalten, wenn er<br />
Schmerzen hat. Auch, wenn er dies nicht gezielt<br />
äußern kann. Hier können die Angehörigen<br />
wichtige Informanten für das Versorgungsteam<br />
sein und entsprechende Hinweise geben.<br />
Durch den Krankenhausaufenthalt ergeben<br />
sich für die Patienten und deren Angehörige<br />
im Anschluss häufig Versorgungsprobleme, die<br />
bewältigt werden müssen. Der Demenzkoordinator<br />
ist auch für die Zeit nach dem Krankenhausaufenthalt<br />
hinaus Ansprechpartner und<br />
kann Empfehlungen für die Weiterbehandlung<br />
aussprechen. Dabei deckt Benjamin Volmar eine<br />
Schnittstelle zwischen dem Klinikum Gütersloh<br />
und der Gerontopsychiatrischen Ambulanz der<br />
LWL-Klinik Gütersloh ab. Er ist in der Gerontopsychiatrischen<br />
Ambulanz unter der Leitung<br />
von Chefarzt Bernd Meißnest angestellt und<br />
vermittelt das Expertenwissen aus der Ambulanz<br />
in das Akutkrankenhaus. Diese Expertise<br />
kann auf vielerlei Arten genutzt werden.<br />
So kann er einerseits gerontopsychiatrische<br />
Konsile vermitteln, aber auch andere Dienstleistungen<br />
der LWL-Klinik, wie den Kontakt zur<br />
psychiatrischen Pflege, einbeziehen.<br />
»Wir bekommen sehr viele positive Rückmeldungen<br />
von unseren Mitarbeitern und auch<br />
von den Angehörigen«, berichtet Pflegedirektor<br />
Jens Alberti über die ersten Monate des neuen<br />
Projekts. Von der Aufnahme bis über die<br />
Entlassung hinaus werden die Besonderheiten<br />
von Menschen mit Demenz viel stärker berücksichtigt.<br />
»Der Demenz-Koordinator ist eine wertvolle<br />
Ergänzung zu den ehrenamtlichen Patientenbegleitern,<br />
die sich auch gezielt um Menschen<br />
mit Demenz kümmern und ihnen auf den Stationen<br />
Zeit und Aufmerksamkeit schenken«,<br />
sagt Brigitte Büscher, Sprecherin der Bürgerstiftung<br />
Gütersloh. Das Projekt unter der Leitung<br />
von Demenz-Coach Katja Plock wird von<br />
der Bürgerstiftung schon seit dem Jahr 2013<br />
unterstützt und läuft, getragen von vielen qualifizierten<br />
Ehrenamtlichen, mit großem Erfolg.<br />
Dieses Angebot wird jetzt durch den Demenz-<br />
Koordinator Benjamin Volmar auf professioneller<br />
Ebene ergänzt.<br />
»Viele Menschen mit<br />
Demenz verfügen über<br />
eigene Verhaltensmuster, die<br />
ohne Kenntnis der Person<br />
und ihrer Biografie nicht<br />
gedeutet werden können.<br />
Diese individuellen Persönlichkeitsmerkmale<br />
müssen<br />
im Akutkrankenhaus erfasst<br />
und in die Versorgungsplanung<br />
einbezogen werden«<br />
Benjamin Volmar,<br />
Demenzkoordinator<br />
40<br />
<strong>VKD</strong>-<strong>Praxisberichte</strong> <strong>2015</strong> | Patientensicherheit und Entlassmanagement
Das Anti-Delir-Konzept<br />
– ein Notdienst für Demenzkranke<br />
Krankenhäuser benötigen Strategien für betroffene Patienten<br />
Paentensicherheit<br />
Das im Jahr 1932 von der Ordensgemeinschaft der Schwestern von der<br />
heiligen Elisabeth gegründete Sankt Elisabeth Krankenhaus Eutin ist ein Fachkrankenhaus<br />
für Innere Medizin mit 86 Planbetten, davon 54 Betten in der Fachabteilung<br />
Geriatrie sowie 32 Betten in der Inneren Medizin, von denen 12 Betten der<br />
Palliativstation zugeordnet sind. Das Geriatriezentrum mit den Schwerpunkten<br />
Postakute Medizin chronisch kranker und multimorbider Patienten, Postoperative<br />
Behandlung und Ambulante Geriatrische Versorgung (AGV) erbringt sowohl akutstationäre<br />
als auch ambulante Behandlungen. Es werden Patienten aus anderen<br />
Kliniken weiterbehandelt und auch unmittelbar direkt aus dem häuslichen Bereich<br />
aufgenommen. Es besteht zudem ein Bereich der Ambulanten Geriatrischen Versorgung.<br />
Das Einzugsgebiet ist überregional, weil viele spezialisierte Leistungen, z.B. ein<br />
spezialisiertes Wundmanagement und eine breitgefächerte Diagnostik, angeboten<br />
werden.<br />
Der Schwerpunkt der Behandlungen liegt überwiegend im therapeutischen Bereich.<br />
Das Krankenhaus ist eng mit ambulanten Pflegediensten und Altenpflegeeinrichtungen,<br />
konsiliarärztlichen Begleitungen aus der Universitätsklinik Lübeck sowie<br />
der Vital-Kliniken – Klinik Buchenholm in Bad Malente vernetzt, so dass auch eine<br />
einheitliche Behandlungsqualität der Patienten vor und nach dem stationären Aufenthalt<br />
gesichert ist.<br />
Das Krankenhaus gehört zum Vinzenz-Verbund und ist Teil des Landesverbandes<br />
Geriatrie.<br />
Kerstin Ganskopf<br />
Geschäftsführerin des Sankt<br />
Elisabeth Krankenhauses<br />
Eutin, Vorsitzende der<br />
Landesgruppe Schleswig-<br />
Holstein des Verbandes<br />
der Krankenhausdirektoren<br />
Deutschlands (<strong>VKD</strong>)<br />
Einen bundesweit einmaligen Notdienst für<br />
Demenzkranke hat das Sankt Elisabeth Krankenhaus<br />
in Eutin eingerichtet. Das seit rund<br />
anderthalb Jahren funktionierende Anti-Delir-Konzept<br />
bewahrt die betroffenen Patienten<br />
vor den oft schweren Folgen eines Delirs,<br />
der damit verbundenen Verschlechterung<br />
ihres Zustands und verhindert häufig sogar<br />
dessen Entstehung. Es dient damit der Sicherheit<br />
der Patienten und auch dem Erfolg der<br />
Behandlung insgesamt. Das Krankenhaus ist<br />
auf die Behandlung von Menschen mit Demenz<br />
spezialisiert. Das Konzept kann aber<br />
auch für andere Akutkrankenhäuser Anregung<br />
für den Umgang mit der überall zunehmenden<br />
Zahl dementer Patienten und ihrer<br />
Angehörigen sein.<br />
Das Sankt Elisabeth Krankenhaus in Eutin verfügt<br />
bereits seit 2012 über eine Schwerpunktstation<br />
mit 12 Plätzen für Patienten mit kognitiven<br />
Einschränkungen. In der Regel sind sie<br />
hier sehr gut zu versorgen. Wenn allerdings<br />
bei einem der Patienten ein Delir hinzukommt,<br />
ändert sich das. Die Betroffenen sind dann extrem<br />
unruhig, zeigen Hinlauftendenzen, sind<br />
zum Teil aggressiv. Der Betreuungsbedarf steigt<br />
deutlich an.<br />
Im Fall eines Delirs ist in vielen Krankenhäusern<br />
dieser deutlich erhöhte Betreuungsaufwand<br />
nicht zu leisten. Daher müssen die betroffenen<br />
Patienten zu ihrer Beruhigung und<br />
zu ihrem eigenen Schutz sowie zum Schutz der<br />
anderen Patienten häufig sediert, eventuell<br />
auch fixiert werden. Durch diese Maßnahmen<br />
verschlechtert sich aber oft der Zustand der<br />
Betroffenen – eine fatale Situation, denn sie<br />
sind ja im Krankenhaus, weil sie hier Hilfe und<br />
Heilung erhoffen.<br />
Das Konzept<br />
Insbesondere durch Patienten mit einer akuten<br />
Verwirrtheit (Delir) werden die gewohnten<br />
Abläufe im Krankenhaus zum Teil stark beeinträchtigt.<br />
Auch auf einer Schwerpunktstation<br />
für Menschen mit Demenz sind dann zusätzliche<br />
Strategien und Optionen notwendig, den<br />
»Die Zahl der Patienten mit<br />
Demenz nimmt zu und sie<br />
haben Anspruch auf eine optimale<br />
Behandlung wie alle<br />
anderen Patienten auch. Es<br />
ist daher erforderlich, sich<br />
darauf einzustellen und entsprechendes<br />
Wissen und die<br />
notwendigen Fähigkeiten zu<br />
erwerben und zu erweitern.«<br />
Kerstin Ganskopf<br />
<strong>VKD</strong>-<strong>Praxisberichte</strong> <strong>2015</strong> | Patientensicherheit und Entlassmanagement 41
Paentensicherheit<br />
besonderen Bedarf abzufangen. Das seit April<br />
2014 praktizierte Anti-Delir-Konzept des<br />
Sankt Elisabeth-Krankenhauses durchbricht<br />
die Spirale aus chemischer und mechanischer<br />
Fixierung. Es kann sogar dazu beitragen, solche<br />
Zustände zu verhindern. Dafür stellt das<br />
Krankenhaus, wenn nötig, eine Eins-zu-Eins-<br />
Betreuung sicher. Eine ausreichende personelle<br />
Substituierung des Geschehens muss auch<br />
nachts gewährleistet sein, möchte man nicht<br />
ausschließlich mit Fixierungen, Sedierungen<br />
oder der Weiterverlegung in die Psychiatrie reagieren.<br />
Entscheidend ist dabei aber auch das<br />
in der Geriatrie übliche und notwendige Zusammenspiel<br />
aller Berufsgruppen. In der Regel<br />
kann dann nach zwei bis drei Tagen der Patient<br />
wieder in den normalen Tagesrhythmus der<br />
Station übernommen werden.<br />
Das Konzept ist ein weiterer Baustein zur verbesserten<br />
Versorgung älterer, dementer Menschen<br />
– und dies nicht nur im Krankenhaus<br />
selbst, sondern in der Region. In einem akuten<br />
Verwirrtheitszustand werden von Angehörigen,<br />
Betreuern oder anderen Helfern schnell falsche<br />
Entscheidungen getroffen, die schwerwiegende<br />
Folgen für die Betroffenen haben können.<br />
Deshalb bietet das Krankenhaus im Rahmen<br />
des Anti-Delir-Konzeptes nicht nur für seine<br />
Patienten mit Demenz und Delir die Möglichkeit,<br />
die Folgen zu mildern. Auch niedergelassene<br />
Ärzte und andere Kliniken haben die Möglichkeit,<br />
Patienten schnell ins Sankt Elisabeth<br />
Krankenhaus einzuweisen, wenn es auf der eigenen<br />
Station oder zu Hause „nicht mehr geht“.<br />
Die Arbeitsweise wurde auch dem Rettungsdienst,<br />
der Polizei und dem Sozialpsychologischen<br />
Dienst vorgestellt und das Vorgehen auf<br />
der Arbeitsebene konzertiert.<br />
Umfangreiches Beratungsangebot<br />
Im Sankt Elisabeth Krankenhaus wurde außerdem<br />
ein umfangreiches Beratungs- und Veranstaltungsangebot<br />
in Sachen Demenz etabliert.<br />
Es steht auch Menschen offen, deren demente<br />
Angehörige keine Patienten des Krankenhauses<br />
sind. Dies trägt zur engen Anbindung an die Region<br />
bei und wird gut in Anspruch genommen.<br />
Etwa vierteljährlich finden über das Eutiner<br />
Demenz Forum – anerkannt im Bundesmodellprogramm<br />
der lokalen Allianzen für Menschen<br />
mit Demenz - Veranstaltungen mit wechselnden<br />
Referenten statt, die sich im Wesentlichen<br />
an Angehörige richten. Die Beratung kann, je<br />
nach Struktur, von den Sozialdiensten bzw. dem<br />
Entlassungsmanagement nach entsprechender<br />
Schulung mit übernommen werden. Hausöffnende,<br />
kooperationsstärkende Felder können<br />
hierüber ebenfalls generiert werden. Die Beteiligung<br />
an und Förderung von regionalen und<br />
überregionalen Projekten mit Know-how stärkt<br />
den fachübergreifenden und multidisziplinären<br />
Austausch auch ins Krankenhaus hinein.<br />
Die ambulante Erweiterung des Themas Demenz,<br />
ausgehend von der Schwerpunktstation<br />
für Menschen mit Demenz und zugehöriger<br />
Anti-Delir-Bereitschaft sowie dem Eutiner Demenz<br />
Forum bietet umfassende Möglichkeiten<br />
für die Menschen der Region in Sachen Demenz.<br />
Zum Anti-Delir-Konzept gehören u.a.:<br />
• eine möglichst Eins-zu-Eins-Betreuung<br />
betroffener Patienten<br />
• ein gut ausgebildetes, multidisziplinäres<br />
Geriatrieteam<br />
• räumliche Voraussetzungen<br />
• eine Anti-Delir-Bereitschaft<br />
• speziell geschulte Mitarbeiter<br />
• Einbeziehung der Angehörigen<br />
• Einbeziehung von Sozialdiensten, Rettungsdiensten<br />
und Feuerwehr<br />
Unsere Erfahrung aus rund anderthalb Jahren<br />
Arbeit mit dem Konzept: Keine bzw. deutlich<br />
weniger Sedierungen und Fixierungen, mehr<br />
Ruhe in den Stationsabläufen, kürzere Verweildauern<br />
bei den dementen Patienten.<br />
Geriatrische Medizin heißt fächerübergreifende<br />
Patienten-Fürsorge<br />
Die Geriatrie beschäftigt sich sowohl mit der Inneren Medizin, als auch der Orthopädie,<br />
Neurologie und Psychiatrie. Gerade bei alten Menschen treten oft mehrere<br />
Krankheiten zugleich auf, die vielfältig miteinander verflochten sind – sie sind<br />
multimorbid. Aus diesem Grund ist gerade hier die fächerübergreifende Zusammenarbeit<br />
ein Muss.<br />
42<br />
<strong>VKD</strong>-<strong>Praxisberichte</strong> <strong>2015</strong> | Patientensicherheit und Entlassmanagement
Paentensicherheit<br />
Das Sankt Elisabeth<br />
Krankenhaus<br />
Stationsbbad<br />
im Sankt Elisabeth<br />
Krankenhaus<br />
Fotos: Sankt Elisabeth<br />
Krankenhaus<br />
Demente Patienten<br />
im Versorgungsalltag<br />
Patienten mit Demenz reagieren besonders<br />
sensibel und problematisch auf die Behandlungsschieflage,<br />
welche unter anderem durch<br />
die Einführung der DRGs verschärft wurde. Sie<br />
können sich ohnehin kaum den Abläufen des<br />
Krankenhauses anpassen, haben Probleme mit<br />
den vielen und fremden Personen, können sich<br />
schlecht orientieren und treffen auf eine für sie<br />
chaotisch wirkende Geräuschkulisse.<br />
Das oft ungewöhnliche Verhalten der Patienten<br />
und die stark eingeschränkten Möglichkeiten,<br />
sich dem stationären Setting anzupassen,<br />
mitunter völlig fehlende Einsicht in die Notwendigkeit<br />
einer Behandlung, führen zu starken<br />
Mehrbelastungen im Versorgungsalltag.<br />
Auch Gefahren und nicht zuletzt mangelhafte<br />
Behandlungsergebnisse mit teilweise schweren<br />
und negativen Folgen für die Patienten sind die<br />
Konsequenzen.<br />
Aber nicht nur die Patienten sind im Krankenhaus<br />
häufig mit einer für sie unangenehmen,<br />
schwierigen Situation konfrontiert. Auch die<br />
oftmals intensiv mit der Betreuung und Pflege<br />
befassten Angehörigen zeigen sich schnell unzufrieden,<br />
wenn sie auf die Inkompatibilitäten des<br />
»Systems Krankenhaus« mit den Bedürfnissen<br />
ihrer verwirrten Angehörigen stoßen. Die entsprechenden<br />
Beschwerden können den Ruf der<br />
Einrichtung denn auch nachhaltig schädigen.<br />
Herausforderungen und Chance<br />
National sowie international richten sich Krankenhäuser<br />
vereinzelt bereits mit Schwerpunktstationen<br />
auf diese besondere Patientengruppe<br />
ein. Dabei lässt sich bislang kein einheitlicher<br />
Standard, keine einheitliche Vorgehensweise<br />
feststellen. Die Behandlung dementer Patienten<br />
erfordert ein erhebliches Maß an Flexibilität,<br />
Zeit und auch strukturelle Veränderungen,<br />
die nicht überall geleistet werden können.<br />
Möglicher Weise kann und braucht aber auch<br />
nicht jedes Krankenhaus eine Schwerpunktstation<br />
für diese besondere Patientenklientel.<br />
Dennoch bleibt die Tatsache: Die Zahl der Patienten<br />
mit Demenz nimmt zu und sie haben Anspruch<br />
auf eine optimale Behandlung wie alle<br />
anderen Patienten auch. Es ist daher erforderlich,<br />
sich darauf einzustellen und entsprechendes<br />
Wissen und die notwendigen Fähigkeiten zu<br />
erwerben und zu erweitern.<br />
Dies beginnt nicht etwa mit und auf einer eigenen<br />
Station, sondern muss sich bereits im Aufnahmemanagement<br />
widerspiegeln. Fortbildungen<br />
für die Krankenhausmitarbeiter sind dabei<br />
sicher ein Grundbaustein, werden mittelfristig<br />
aber nicht ausreichen. Weitere Veränderungen<br />
sind notwendig.<br />
Grundsätzlich ist zu konstatieren, dass das benötigte<br />
Wissen zum Thema Demenz und Krankenhaus<br />
vielfach vorhanden ist. Die Umsetzung<br />
<strong>VKD</strong>-<strong>Praxisberichte</strong> <strong>2015</strong> | Patientensicherheit und Entlassmanagement 43
Paentensicherheit<br />
gestaltet sich jedoch oft - auch aufgrund der<br />
mangelnden finanziellen Unterstützung -<br />
schwierig. Kleine, durchaus wirkungsvolle Verbesserungen<br />
können aber bereits ohne teure<br />
Umbauten verwirklicht werden. Dazu gehört an<br />
erster Stelle die Fortbildung und Schulung von<br />
Mitarbeitern zum Umgang mit dementen Menschen<br />
und deren besonderen Bedürfnissen. Dies<br />
kann auch der wesentliche Faktor sein, der zu<br />
einem Mehr an Mitarbeiterzufriedenheit führt.<br />
Auch die sachliche Ausstattung spielt natürlich<br />
eine Rolle – z.B. die Möglichkeit, Patienten mit<br />
Demenz im Krankenhaus zu beschäftigen und<br />
Beschäftigung zuzulassen.<br />
Ein Krankenhaus, das die Thematik offensiv<br />
anpackt, kann sich nicht nur marktstrategisch<br />
mit einem möglichen Alleinstellungsmerkmal<br />
in einer Region positionieren. Auch in Zeiten<br />
knapper personeller Ressourcen können positive<br />
Effekte für die Personalpflege dabei herauskommen.<br />
Informierte und gut geschulte<br />
Mitarbeiter sind handlungsfähiger und sicherer<br />
im Umgang mit den betreffenden Patienten.<br />
Angepasste Rahmenbedingungen und das Bewusstsein,<br />
mit solchen Situationen professionell<br />
umgehen zu können, steigern die Zufriedenheit<br />
und stärken den Ruf bei Angehörigen<br />
und Zuweisern. Nicht zuletzt wird das Behandlungsergebnis<br />
verbessert, denn Patienten mit<br />
Demenz können nur eingeschränkt und im Falle<br />
eines Delirs zunächst überhaupt nicht bei diagnostischen<br />
und therapeutischen Maßnahmen<br />
mitwirken.<br />
Die Patientenklientel ist da. Im Krankenhaus<br />
muss daher die Entscheidung getroffen werden,<br />
wie gezielt diese Gruppe angesprochen werden<br />
sollte. Will man erreichen, dass Patienten<br />
aufgrund der Demenzfreundlichkeit des Krankenhauses<br />
gezielt zugewiesen werden? Grundsätzlich<br />
gilt jedoch, ob mit oder ohne gezielte<br />
Ansprache wird die Zahl der Patienten, die<br />
als Nebendiagnose eine Demenz haben, in den<br />
kommenden Jahren weiter zunehmen. Das bestätigt<br />
auch die eigene Erfahrung. Aspekte von<br />
Fortbildung und Ausstattungen sind daher für<br />
alle Krankenhäuser interessant. Sie unterscheiden<br />
sich letztlich eher in Umfang und Aufwand<br />
als in der Notwendigkeit.<br />
Thema Sicherheit<br />
gesondert betrachten<br />
Bevor jedoch komplexe und möglicherweise<br />
langwierige grundsätzliche Veränderungsprozesse<br />
initiiert werden, sollte der Bedarf hausintern<br />
und auch innerhalb der Region analysiert<br />
werden. Strukturdaten zur Verteilung und<br />
Häufigkeit von Demenzerkrankungen in einer<br />
Region können zumindest abgeschätzt werden,<br />
um den mittelfristigen Bedarf an Spezialisierung<br />
einplanen zu können.<br />
Das Thema Sicherheit muss dabei mit und ohne<br />
Schwerpunktstation gesondert betrachtet<br />
werden. Patienten mit Demenz haben häufig<br />
größte Orientierungsschwierigkeiten und –einschränkungen.<br />
Es kann daher dazu kommen,<br />
dass sie absichtlich oder unabsichtlich die<br />
Station oder gar die Klinik verlassen und umherirren<br />
oder gezielt versuchen, nach Hause zu<br />
laufen. Diesem Fall kann durch Technikeinsatz<br />
einerseits vorgebeugt werden, andererseits ist<br />
im Gesamtbetrieb eine erhöhte Sensibilität und<br />
Kommunikationsleistung gefragt, um zu verhindern,<br />
dass Patienten mit Demenz zu Schaden<br />
kommen.<br />
Schon vor der Einführung der DRGs ist es im<br />
Klinikbetrieb nicht leicht gewesen, den besonderen<br />
Ansprüchen dementer Patienten gerecht<br />
zu werden. Insbesondere die Straffung von Arbeitsabläufen<br />
seit Einführung der Fallpauschalen<br />
steht einer bedarfsgerechten Versorgung<br />
von Patienten mit Demenz entgegen und bildet<br />
den gebotenen Aufwand nicht ab.<br />
Ansätze zur Verbesserung der Situation von<br />
Patienten mit Demenz im Krankenhaus, der<br />
Verbesserung der Behandlungsergebnisse und<br />
auch der Mitarbeiterzufriedenheit liegen vor<br />
allem in<br />
• der räumlichen Gestaltung<br />
• der materiellen Ausstattung<br />
• der Mitarbeiterschulung<br />
• der Strukturierung von Abläufen und möglicher<br />
Wahrung von Versorgungskontinuität<br />
• der Überprüfung der Sicherheitsaspekte<br />
• der gezielten Angehörigenarbeit und Angehörigeneinbindung<br />
Vernetzung aller<br />
beteiligten Bereiche<br />
Die Zusammenarbeit mit sozialpsychiatrischen<br />
Diensten, Amtsärzten, Alzheimergesellschaften<br />
und Beratungsstellen sowie niedrigschwelligen<br />
Betreuungsangeboten, Tages- und Dauerpflegeeinrichtungen<br />
sind persistent. In die Zukunft<br />
gerichtet kann vom Krankenhaus für eine Region<br />
jedoch ein weiteres, speziell Menschen mit<br />
Demenz und ihre Familien unterstützendes Angebot<br />
ausgehen.<br />
Dies könnte in seiner Struktur insbesondere die<br />
Arbeit niedergelassener Haus- und Fachärzte<br />
unterstützen, in dem das demenzfreundliche<br />
Krankenhaus als spezialisierter Ansprechpartner<br />
auftritt. Dabei kann es nicht darum gehen,<br />
44<br />
<strong>VKD</strong>-<strong>Praxisberichte</strong> <strong>2015</strong> | Patientensicherheit und Entlassmanagement
Paentensicherheit<br />
pflegerische Maßnahmen vor Ort durchzuführen<br />
oder hausärztliche Leistungen zu ersetzen.<br />
Vielmehr könnte ein ergänzendes Angebot für<br />
den ambulanten Bereich die Intervention beinhalten,<br />
die verhaltensbedingte Aufnahmen ins<br />
Krankenhaus vermeiden hilft.<br />
Wenn für die häufig hochbelasteten pflegenden<br />
Angehörigen die Situation nicht mehr haltbar<br />
ist, könnte ein informierter Bereitschaftsarzt<br />
entsprechend einen »Verhaltensdienst«<br />
zur kurzfristigen Unterstützung anfordern, der<br />
die akute Belastungssituation entschärft und<br />
gemeinsam mit den Angehörigen eine passende<br />
Lösung sucht.<br />
Eine besondere Stärke eines solchen Point-of-<br />
Care-Systems müsste die hohe Reaktionsgeschwindigkeit,<br />
eben abweichend von anderen<br />
Beratungsangeboten, sein.<br />
Der Aufbau eines Dienstes, ähnlich der Spezialisierten<br />
Ambulanten Palliativversorgung,<br />
scheint möglich und sinnvoll.<br />
Fazit<br />
Sowohl präventive als auch kurative Behandlungen<br />
haben bisher keine entscheidende Aussicht<br />
auf Erfolg im Sinne der Therapie einer<br />
(primär-degenerativen) Demenz als solcher<br />
gebracht. Demenzerkrankungen bleiben hinsichtlich<br />
von Krankenhausbehandlungen in<br />
erster Linie ein Versorgungsproblem – die meisten<br />
Patienten kommen nicht zur Behandlung<br />
ihrer Demenz in eine Klinik. Vielmehr sind andere<br />
somatische Erkrankungen oder Traumata<br />
Ursache der stationären Aufnahme.<br />
Der demographische Wandel bringt es mit sich,<br />
dass immer mehr Menschen, die einer Krankenhausbehandlung<br />
bedürfen, alt oder sogar<br />
hochaltrig sind. Der Anteil der über 75jährigen<br />
behandelten Patienten lag im Jahr 2000 noch<br />
bei 18 Prozent. 2012 waren es bereits 25 Prozent<br />
(Krankenhausstatistik des Bundes). Bis 2030<br />
wird etwa jede fünfte Krankenhausbehandlung<br />
in Deutschland auf über 80jährige entfallen,<br />
so die Schätzungen. In absoluten Zahlen stieg<br />
der Anteil von über 64jährigen Patienten im<br />
Krankenhaus zwischen 2000 und 2010 um eine<br />
Million Fälle. Da Demenzerkrankungen altersassoziiert<br />
sind, steigt auch die Zahl der Patienten<br />
mit Demenz im Krankenhaus. Während die<br />
Kodierwirklichkeit lediglich in 0,2 Prozent der<br />
Fälle Patienten mit Demenz ausweist (Kirchen-<br />
Peters 2010), lassen nationale und internationale<br />
Studien von ca. 10 Prozent aller Krankenhausfälle<br />
mit einer Demenz ausgehen. Jedes<br />
Krankenhaus sollte sich darauf vorbereiten.<br />
Mehr als 100 Gäste konnten am 25. März dieses Jahres zur Eröffnung der neuen Tagesklinik<br />
begrüßt werden. Unter ihnen war auch Kristin Alheit, Gesundheitsministerin in Schleswig-Holstein, die<br />
erklärte, die Tagesklinik Eutin stehe beispielhaft für die Umsetzung des Geriatriekonzeptes des Landes.<br />
Foto: Sankt Elisabeth Krankenhaus<br />
<strong>VKD</strong>-<strong>Praxisberichte</strong> <strong>2015</strong> | Patientensicherheit und Entlassmanagement 45
4<br />
<strong>VKD</strong>-<strong>Praxisberichte</strong> <strong>2015</strong> | Patientensicherheit und Entlassmanagement
Entlassmanagement<br />
<strong>VKD</strong>-<strong>Praxisberichte</strong> <strong>2015</strong> | Patientensicherheit und Entlassmanagement 47
48<br />
<strong>VKD</strong>-<strong>Praxisberichte</strong> <strong>2015</strong> | Patientensicherheit und Entlassmanagement
Entlassmanagement erfordert<br />
Kooperation auf allen Seiten<br />
Die meisten Krankenhäuser arbeiten bereits nach festen Standards –<br />
Lücken gibt es an den Schnittstellen<br />
Entlassmanagement<br />
Schon das GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz (2007) ergänzte den Paragrafen<br />
11, Abs. 4 des SGB V dahingehend, dass Versicherte einen Anspruch auf Versorgungsmanagement<br />
beim Übergang in verschiedene Leistungsbereiche haben. Das<br />
GKV-Versorgungsstrukturgesetz (2012) nahm eine Ergänzung zum Paragrafen 39<br />
Abs. 1 SGB V vor und legte fest, dass die Krankenhausbehandlung auch ein Entlassmanagement<br />
zur Lösung von Problemen beim Übergang in die Versorgung nach<br />
dem Klinikaufenthalt beinhaltet. Damit wurde das Entlassmanagement zum Teil des<br />
Behandlungsvertrages zwischen Patient und Krankenhaus. Die Maßnahmen des Entlassmanagements<br />
im Einzelnen werden zwischen Landeskrankenhausgesellschaften<br />
und Krankenkassen auf Länderebene geregelt.<br />
In den deutschen Krankenhäusern ist ein<br />
Entlassmanagement für die Patienten gelebte<br />
tägliche Praxis und ein wichtiger Teil<br />
der Qualitätssicherung und des Qualitätsmanagements.<br />
Der Gesetzgeber hat die diesbezüglichen<br />
Regelungen in 2007 und in 2012<br />
präzisiert. Entlassmanagement ist als Teil der<br />
stationären Behandlung zu verstehen und der<br />
Übergang in die Versorgung danach zu organisieren.<br />
Die Krankenhäuser haben sich darauf<br />
grundsätzlich eingestellt und vielfach<br />
auch qualifizierte personelle Aufstockungen<br />
vorgenommen. Dennoch ist es nicht immer<br />
einfach, die gesetzlichen Regelungen umzusetzen.<br />
Der Fachausschuss für Betriebswirtschaft<br />
des <strong>VKD</strong> (FABW) hat sich mit diesem<br />
Thema mehrfach beschäftigt.<br />
Ein strukturiertes, professionelles Entlassmanagement<br />
ist Teil der stationären Krankenhausbehandlung.<br />
So hat es der Gesetzgeber festgelegt.<br />
Wenn diese Pflicht auch bisher nur sehr<br />
einseitig für den stationären Sektor präzisiert<br />
ist, so ist sie dennoch auch in den Augen des<br />
Krankenhausmanagements sehr sinnvoll. Eine<br />
strukturierte Entlassung nützt den Patienten,<br />
denn sie sorgt dafür, dass eine notwendige<br />
Weiterbehandlung gesichert wird und das Behandlungsergebnis<br />
nachhaltig ist. Sie ist darüber<br />
hinaus auch wirtschaftlich sinnvoll für<br />
das Krankenhaus, denn die Patienten müssen<br />
nicht unnötig lange dort bleiben. Wiedereinweisungen,<br />
die Patienten erneut belasten und<br />
dem Krankenhaus darüber hinaus auch nicht<br />
vergütet werden, so genannte Drehtüreffekte,<br />
werden vermieden.<br />
Auf gutem Weg<br />
Eine Bestandsaufnahme durch das Deutsche<br />
Krankenhausinstitut im Frühjahr 2013 zum<br />
Entlassmanagement im Auftrag der Deutschen<br />
Krankenhausgesellschaft (DKG) zeigte, dass die<br />
Krankenhäuser hier auf einem sehr guten Weg<br />
sind. Entlassmanagement – so stellen es die<br />
Autoren fest – ist in den Krankenhäusern gelebte<br />
Praxis. Gegenüber früheren Befragungen<br />
seien deutliche Verbesserungen der krankenhausinternen<br />
Organisation im Entlassmanagement<br />
festgestellt worden. Gleichzeitig wurden<br />
Probleme identifiziert, die auch durch den<br />
Fachausschuss für Betriebswirtschaft des <strong>VKD</strong><br />
in ähnlicher Weise bestätigt wurden.<br />
Das DKI hatte u.a. nach Standards und der Organisation<br />
des Entlassmanagements gefragt,<br />
nach Kooperationen mit Nachversorgern sowie<br />
nach Problemen an den Schnittstellen der Sektoren.<br />
An der Vollerhebung unter Allgemeinkrankenhäusern<br />
über 50 Betten hatten 673<br />
Häuser – also 43 Prozent – teilgenommen.<br />
Bereits drei von vier Krankenhäusern arbeiteten<br />
demnach seit zwei Jahren beim Entlassmanagement<br />
nach festen Standards, zwei Drittel<br />
verfügten über spezielle Organisationseinheiten/Stellen<br />
für das Entlassmanagement, 80<br />
Prozent beschäftigten speziell qualifizierte<br />
Fachkräfte dafür. Außerdem existierten regelmäßige<br />
Fallbesprechungen in multiprofessionellen<br />
Teams.<br />
Regelhaft oder zumindest häufig kooperiert<br />
wurde vor allem mit stationären Reha-Einrich-<br />
Horst Defren<br />
Geschäftsführer der<br />
Kliniken Essen-Mitte<br />
Evang. Huyssens-Stiftung/Knappschaft<br />
GmbH,<br />
Vorsitzender des Fachausschusses<br />
für Betriebswirtschaft<br />
(FABW) des<br />
Verbandes der Krankenhausdirektoren<br />
Deutschlands<br />
(<strong>VKD</strong>)<br />
»Angesichts der wachsenden<br />
Zahl älterer Patienten mit<br />
den typischen Beschwerden<br />
und Krankheitsbildern muss<br />
aus dem Entlassmanagement<br />
ein generelles Verlegungsmanagement<br />
- besser:<br />
Überleitungsmanagement<br />
- werden, das alle Sektoren<br />
gleichermaßen einbindet.«<br />
Horst Defren<br />
<strong>VKD</strong>-<strong>Praxisberichte</strong> <strong>2015</strong> | Patientensicherheit und Entlassmanagement 49
Entlassmanagement<br />
tungen sowie ambulanten und stationären<br />
Pflegeeinrichtungen, wenn es um Patienten<br />
mit besonderem poststationärem Pflege- und<br />
Versorgungsbedarf ging. In gut jedem zweiten<br />
Krankenhaus fand bei diesen Patienten auch<br />
eine Kooperation mit niedergelassenen Ärzten<br />
statt.<br />
An regionalen Initiativen, sofern existent, beteiligen<br />
sich fast 90 Prozent der dortigen Krankenhäuser.<br />
Nicht zu übersehen war und ist nach wie vor<br />
aber auch, dass es Probleme gibt. Während offenbar<br />
weniger Probleme in der Anschlussversorgung<br />
mit Heil- und Hilfsmitteln bestehen,<br />
berichteten viele Häuser in der Befragung über<br />
Schwierigkeiten, eine fachärztliche Weiterversorgung<br />
durch zu lange Wartezeiten auf einen<br />
Termin (34,6 Prozent immer oder häufig, 33,6<br />
Prozent manchmal) oder lange Anfahrtswege<br />
(22,5 Prozent stets oder häufig, 33,3 Prozent<br />
manchmal) zu organisieren. Als Problemfeld<br />
in der Zusammenarbeit mit niedergelassenen<br />
Ärzten wurde zudem gesehen, dass vielfach<br />
die notwendigen Unterlagen nicht zeitnah zur<br />
Verfügung standen. Häufig war die Kontaktaufnahme<br />
schwierig (48,1 Prozent).<br />
Mitglieder des Fachausschusses für Betriebswirtschaft<br />
haben sich mit dem Thema Entlassmanagement<br />
ebenfalls beschäftigt und ihre<br />
Erfahrungen aus den eigenen Krankenhausunternehmen<br />
eingebracht, die zum Teil sicher<br />
typisch für viele Krankenhäuser sind.<br />
Immer weniger Lotsen?<br />
So wurde u.a. konstatiert, dass gerade nachgeordnete<br />
Leistungserbringer der Notwendigkeit,<br />
Patienten auch kurzfristig in die nachfolgenden<br />
Sektoren des Gesundheitswesens (ambulant<br />
wie stationär) zügig aufzunehmen, häufig nicht<br />
in geeigneter Form entsprechen könnten. Die<br />
Folge seien Versorgungsprobleme bzw. unzufriedene<br />
Patienten und andere an dem Prozess<br />
Beteiligte. So hätten beispielsweise Arztpraxen<br />
zu gewissen Entlassungszeiten geschlossen<br />
(z.B. Mittwoch- bzw. Freitagnachmittag). Damit<br />
komme es im Hinblick auf die Verordnung weiterer<br />
Heil- und Hilfsmittel zu Verzögerungen.<br />
Würden Patienten z.B. freitags entlassen, könnten<br />
viele Patienten frühestens montags die<br />
Arztpraxen aufsuchen. Alternativ müssten die<br />
Betroffenen regional bedingte lange Fahrzeiten<br />
in Kauf nehmen. Hier hat der Gesetzgeber kürzlich<br />
mit dem GKV-Versorgungsstärkungsgesetz<br />
aber Verbesserungen eingeleitet und das Verordnungsrecht<br />
für Krankenhäuser im Rahmen<br />
des Entlassmanagements erweitert. So dürfen<br />
sie nun zur Sicherstellung einer durchgehenden<br />
Versorgung mit Arzneimitteln eine Packung mit<br />
dem kleinsten Packungsgrößenkennzeichen<br />
verordnen.<br />
Ein Eindruck des FABW war zudem, dass sich in<br />
Bezug auf strukturelle Gesichtspunkte immer<br />
mehr Leistungserbringer im hausärztlichen Bereich<br />
ihrer Gesamtverantwortung für den »Patienten<br />
und für den Prozess« entziehen. Man<br />
nehme den Hausarzt als »Lotsen« so gut wie<br />
gar nicht mehr wahr.<br />
Problem: Zum Teil lange Wartezeit<br />
auf Anschlussbehandlungen<br />
Im Rahmen der DKI-Umfrage ging es auch um<br />
die Verfügbarkeit von Anschlussbehandlungen<br />
nach einer Kostenzusage bzw. Pflegeeinstufung.<br />
In stationären und ambulanten Reha-<br />
Einrichtungen sowie vollstationären Pflegeeinrichtungen<br />
gab es damit zu rund 15 Prozent<br />
manchmal, zu 4,4 Prozent selten, zum Teil nie<br />
Schwierigkeiten. Die Unterbringung in einer<br />
Tagespflege war für 26,6 Prozent nur manchmal,<br />
für 13,1 Prozent der Befragten nur selten<br />
oder nie verfügbar. Plätze in stationären Hospizen<br />
standen zu 31,4 Prozent manchmal, für<br />
18,8 Prozent der Krankenhäuser selten oder<br />
nie zur Verfügung. In ein ambulantes Hospiz/<br />
SAPV konnten Patienten zu 16 Prozent nur<br />
manchmal, zu 11,5 Prozent nur selten oder nie<br />
entlassen werden. Insgesamt aber wurde dieser<br />
Bereich von den Befragten nicht als das größte<br />
Problem gesehen.<br />
Einige Mitglieder des FABW hatten hier andere<br />
Erfahrungen. So teilte ein Geschäftsführer<br />
mit, ein Grund, dass Patienten nicht entlassen<br />
werden könnten, seien immer wieder fehlende<br />
Pflegeheimplätze. Laut der Sozialarbeiterin<br />
seines Hauses lasse sich dieses Problem oft<br />
»nur über Umwege« lösen. Auch komme es immer<br />
öfter vor, dass ambulante Pflegedienste<br />
keine freien Kapazitäten hätten oder kein Pflegedienst<br />
im Ort des Patienten tätig sei.<br />
Aus einem anderen Krankenhaus wurde positiv<br />
berichtet, dass einige ambulante Pflegedienste<br />
in der Region von ihrem Management her<br />
in der Lage seien, Patienten auch kurzfristig<br />
zu übernehmen. Dies treffe aber nicht auf alle<br />
Anbieter im ambulanten Bereich zu. Es komme<br />
zu Absagen oder Verspätungen bis hin zu einer<br />
Verlängerung des Krankenhausaufenthalts. Im<br />
Bereich der stationären Altenhilfe entstünden<br />
Überleitungsprobleme gerade bei Neuaufnahmen<br />
aufgrund des hohen bürokratischen Aufwandes<br />
für die Alten- und Pflegeheime.<br />
Inzwischen gebe es auch immer öfter Schwierigkeiten,<br />
noch ambulante Dienste zu finden,<br />
die »kleinere« Behandlungspflege übernehmen.<br />
50<br />
<strong>VKD</strong>-<strong>Praxisberichte</strong> <strong>2015</strong> | Patientensicherheit und Entlassmanagement
Verzögerungen auch<br />
durch Krankenkassen<br />
Krankenkassen sollten laut Gesetz das Entlassmanagement<br />
unterstützen. Die Erfahrungen<br />
der Krankenhäuser zeigen nicht selten das Gegenteil<br />
– Verzögerungen. So galt bisher die Verordnung<br />
häuslicher Krankenpflege durch einen<br />
Krankenhausarzt nur für höchstens drei Tage.<br />
Danach benötigte der Patient eine Verordnung<br />
des Hausarztes. Manche Krankenkassen erkannten<br />
aber, wie die Pflegedienstleiterin eines<br />
Krankenhauses mitteilte, schon die Verordnung<br />
des Klinikarztes nicht an. Der Patient war daher<br />
gezwungen, noch am Tag seiner Entlassung<br />
den Hausarzt aufzusuchen. Wenn er Pech hatte,<br />
sei das ein Mittwoch, ein Freitag oder Feiertag<br />
und die Praxis geschlossen. Auch hier sieht das<br />
GKV-Versorgungsstärkungsgesetz Verbesserungen<br />
vor. Bei der Verordnung maßgeblicher<br />
ambulanter Leistungen sind die Krankenhäuser<br />
nun für einen Zeitraum von sieben Tagen den<br />
Vertragsärzten gleichgestellt.<br />
Viele Patienten würden erst in den Wochen<br />
nach ihrer Entlassung zu Hause vom MDK begutachtet,<br />
bräuchten aber die Hilfe eines Pflegedienstes<br />
sofort, so eine weitere Kritik. Das<br />
bedeute, der Patient müsse eine finanzielle<br />
Verpflichtung eingehen ohne zu wissen, ob er<br />
die Kosten von der Krankenkasse erstattet bekomme.<br />
Die Entlassung von Patienten in einer palliativen<br />
Situation verzögere sich zum Teil, weil der<br />
von den Krankenkassen anerkannte Träger für<br />
die SAPV keine freien Kapazitäten habe. Die<br />
stationäre Palliativbetreuung verzögere sich<br />
zum Teil sogar für längere Zeit, weil auch hier<br />
Kapazitäten fehlten.<br />
Über Wartezeiten für Kostenzusagen bzw.<br />
Pflegeinstufungen für eine Weiter- oder Anschlussbehandlung<br />
berichteten in der DKI-<br />
Befragung immerhin ebenfalls zwischen 54<br />
und 67 Prozent der Krankenhäuser. Rund die<br />
Hälfte der benötigten Zusagen war nach einer<br />
Woche verfügbar. Allerdings wartete doch die<br />
andere Hälfte bis zu zwei Wochen und länger.<br />
Angesichts der durchschnittlichen Verweildauer<br />
von 7,6 Tagen ist in diesen Fällen oft schon<br />
der Anschluss nicht mehr nahtlos möglich.<br />
Die Einstufung der Pflegeversicherung durch<br />
den Medizinischen Dienst der Krankenkassen<br />
erfolgte zu fast 40 Prozent nicht vor dem geplanten<br />
Entlassungstermin. Auch hierin besteht<br />
ein Grund für verzögerte Anschlussbehandlungen.<br />
Nur in 17,2 Prozent war das standardmäßig<br />
noch vor der Entlassung der Fall, in 17,5 Prozent<br />
immerhin häufig.<br />
Problematisch sind offenbar auch die unterschiedlichen<br />
Genehmigungsverfahren für<br />
Heil- und Hilfsmittel der Krankenkassen. Das<br />
jedenfalls war die Aussage von 65,3 Prozent der<br />
befragten Krankenhäuser. Fast alle Befragten<br />
wünschten sich hier ein einheitliches kassenübergreifendes<br />
Verfahren. Das ist bis heute ein<br />
unerfüllter Wunsch geblieben, wie die Informationen<br />
aus Krankenhäusern der FABW-Mitglieder<br />
deutlich machten.<br />
Verbesserungspotenzial sahen viele Teilnehmer<br />
der Befragung in einer Standardisierung<br />
des Entlassmanagements vor allem mit den<br />
niedergelassenen Ärzten und in einer weiteren<br />
Verbesserung des Informationsflusses zwischen<br />
Krankenhaus und Nachversorgern. Sorgen<br />
machte ihnen die Anschlussversorgung<br />
mit Medikamenten, die fehlende Finanzierung,<br />
wenn Medikamente mitgegeben wurden, sowie<br />
die Tatsache, dass die Krankenhausärzte keine<br />
Verordnungsmöglichkeiten hatten. Diese letzteren<br />
Sorgen sollte es künftig nicht mehr geben.<br />
Zeitraubend seien häufig die Überleitung bzw.<br />
Entlassung der Patienten in Reha-Einrichtungen<br />
(z.B. in eine Anschlussheilbehandlung, AHB)<br />
durch teilweise umständliche Antragsverfahren.<br />
Auch hier wurde der Wunsch nach einer Vereinheitlichung,<br />
einem vereinfachten Verfahren<br />
und einheitliche Formulare der Reha-Einrichtungen<br />
geäußert.<br />
Entlassmanagement<br />
»Die gesetzliche Pflicht,<br />
Entlassmanagement als Teil<br />
der Krankenhausbehandlung<br />
zu sehen, würde im Übrigen<br />
auch eine ausreichende Vergütung<br />
für diesen wichtigen<br />
Bereich mit seinen qualifizierten<br />
personellen Kräften<br />
erfordern. Daran fehlt es.«<br />
Horst Defren<br />
Das Verordnungsrecht für Krankenhäuser im Rahmen des Entlassmanagements<br />
wird mit dem GKV-Versorgungsstärkungsgesetz erweitert. Um eine durchgehende<br />
Versorgung der Patienten mit Arzneimitteln zu gewährleisten, dürfen Krankenhäuser<br />
nun eine Packung mit dem kleinsten Packungsgrößenkennzeichen verordnen.<br />
Bei der Verordnung maßgeblicher ambulanter Leistungen werden sie den Vertragsärzten<br />
für einen Zeitraum von jeweils sieben Tagen gleichgestellt. Sie unterliegen<br />
damit auch den gleichen leistungsrechtlichen Vorgaben und Wirtschaftlichkeitsbestimmungen.<br />
Die Einzelheiten zum Entlassmanagement (Voraussetzung, Art und<br />
Umfang), werden in einer dreiseitigen Vereinbarung gemäß § 115 SGB V festgelegt.<br />
<strong>VKD</strong>-<strong>Praxisberichte</strong> <strong>2015</strong> | Patientensicherheit und Entlassmanagement 51
Entlassmanagement<br />
Entlassmanagement beginnt<br />
mit der Aufnahme<br />
Um die Zeit des Krankenhausaufenthalts effektiv<br />
nutzen zu können, beginnt Entlassmanagement<br />
bereits bei der Aufnahme eines Patienten<br />
ins Krankenhaus. Das ist angesichts sinkender<br />
Verweildauern sowie Lücken in den nachbehandelnden<br />
Sektoren, etwa bei den Fachärzten,<br />
notwendiger denn je. Die Frage ist, wie weit hier<br />
die Pflicht des Krankenhauses, z.B. für die Organisation<br />
eines entsprechenden Termins, geht.<br />
Falls das also nicht gelingt – muss der Patient<br />
länger im Krankenhaus bleiben? Und kann dies<br />
dann als Fehlbelegung durch den MDK gewertet<br />
werden? Das Gesetz besagt, dass die jeweiligen<br />
Leistungserbringer in den verschiedenen<br />
Sektoren sich die erforderlichen Informationen<br />
übermitteln müssen. Sie seien dabei von den<br />
Krankenkassen zu unterstützen. Wie weit es<br />
diese Unterstützung tatsächlich gibt, ist bisher<br />
meines Wissens nicht evaluiert worden.<br />
Ohne Frage gibt es innerhalb der Krankenhäuser<br />
ebenfalls noch Verbesserungsmöglichkeiten,<br />
wie u.a. die nachfolgend berichteten Praxisprojekte<br />
demonstrieren. Auch im FABW war<br />
Konsens, dass Verzögerungen im Bereich der<br />
Aufnahme bzw. Entlassung neben den externen<br />
Ursachen auch auf »hausgemachte« Probleme<br />
zurückgeführt werden können. So sei zum Beispiel<br />
die zeitnahe Entlassung direkt abhängig<br />
von einer gut organisierten Arztbriefschreibung,<br />
einem effektiven Bettenmanagement und<br />
einer interdisziplinären Kooperation.<br />
Ein strukturiertes Entlassmanagement umzusetzen<br />
ist keine triviale Aufgabe und muss viele<br />
Partner intern und extern einbinden.<br />
Fazit<br />
Die seinerzeit in der DKI-Befragung genannten<br />
größten Probleme in der Zusammenarbeit<br />
mit externen Partnern haben sich offenbar bis<br />
heute nicht wesentlich gelöst. Dazu gehörten<br />
u.a. fehlende Kostenzusagen, unklare Zuständigkeiten,<br />
mangelhafte Kommunikation und<br />
Information sowie eine nicht zeitnahe Verfügbarkeit<br />
von Kapazitäten. Auch kurzfristige Entlassungen<br />
und fehlende Standards trugen dazu<br />
bei, dass das Entlassmanagement nicht funktionierte.<br />
Letzteres müssen sich die Krankenhäuser<br />
sicher auch selbst zuschreiben.<br />
Angesichts der wachsenden Zahl älterer Patienten<br />
mit den typischen Beschwerden und<br />
Krankheitsbildern muss aus dem Entlassmanagement<br />
ein generelles Verlegungsmanagement<br />
- besser: Überleitungsmanagement<br />
- werden, das alle Sektoren gleichermaßen<br />
einbindet. Viele ältere Patienten sind chronisch<br />
krank, häufig multimorbid und müssen ambulant<br />
regelmäßig medizinisch betreut werden. Es<br />
geht dabei nicht nur um eine wenige Tage dauernde<br />
Anschlussversorgung. Die Organisation<br />
dieser nachfolgenden Versorgung ist oft sehr<br />
aufwändig und muss mehrere Partner einbinden.<br />
Gleichzeitig ist die Zeit, die dem Krankenhaus<br />
dafür zur Verfügung steht, deutlich kürzer<br />
geworden. Oft steht keine Familie bereit, die ei-<br />
Kein einheitliches Vorgehen der Kassen<br />
Als Ursachen für Schwierigkeiten bei der rechtzeitigen Bereitstellung von Hilfsmitteln<br />
bis zur Entlassung eines Patienten wurde aus Krankenhäusern der FABW-Mitglieder<br />
u.a. genannt, dass bei einigen Krankenkassen die beauftragten Sanitätshäuser<br />
Hilfsmittel aus einem Hilfsmittelpool anfordern müssten, die dann vor Ort auch<br />
noch aufzuarbeiten seien. Das koste Zeit. Auch Verträge und Vorgehensweisen der<br />
Kassen seien sehr unterschiedlich. So müsse bei einigen die Hilfsmittelverordnung<br />
direkt an die Kasse geschickt werden, die dann das Sanitätshaus beauftrage. Dieses<br />
sei oft ein bundesweit agierendes Unternehmen, in dem Informationen bezüglich<br />
der Ansprechpartner und Lieferung verloren gingen und Nachfragen dadurch erschwert<br />
seien. Andere Kassen forderten zunächst einen Kostenvoranschlag durch<br />
ein Sanitätshaus. Sende das Krankenhaus die Verordnung dann an einen Anbieter<br />
vor Ort, dürfe dieser unter Umständen nicht für alle Kassen Hilfsmittel liefern. Diese<br />
Beziehung zwischen Krankenhäusern, Kassen und Sanitätshäusern unterliege einem<br />
ständigen Wandel.<br />
Die Gewährung mancher Hilfsmittel sei wiederum an bestimmte Voraussetzungen<br />
gebunden, die zunächst erfüllt werden müssten. So erhalte ein Patient ein Pflegebett<br />
nur dann, wenn er mindestens in Pflegestufe 1 eingestuft sei. Anderenfalls<br />
müsse der MDK zunächst den Patienten daraufhin begutachten und dann über die<br />
Bewilligung des Bettes entscheiden. Eine solche Genehmigung sei aber sehr selten<br />
und nehme außerdem oft mehrere Tage in Anspruch.<br />
52<br />
<strong>VKD</strong>-<strong>Praxisberichte</strong> <strong>2015</strong> | Patientensicherheit und Entlassmanagement
Entlassmanagement<br />
nen Teil der Organisation übernehmen könnte.<br />
Hier ist der strukturierte Kontakt zwischen den<br />
behandelnden Ärzten, den Pflegeeinrichtungen<br />
und dem Krankenhaus wesentlicher Bestandteil<br />
einer nachhaltigen, kontinuierlichen Betreuung.<br />
Die zunehmende Zahl dementer Patienten<br />
erfordert ebenfalls nicht nur von Seiten<br />
des Krankenhauses ein strukturiertes Entlassmanagement,<br />
sondern zwingend von den betreuenden<br />
Einrichtungen umfangreiche Informationen,<br />
die standardisiert übergeben werden<br />
müssen. Essenziell ist ebenfalls die Einbindung<br />
pflegender Angehöriger. Das zeigen einige der<br />
nachfolgenden Beiträge ebenfalls.<br />
Die gesetzliche Pflicht, Entlassmanagement<br />
als Teil der Krankenhausbehandlung zu sehen,<br />
würde im Übrigen auch eine ausreichende Vergütung<br />
für diesen wichtigen Bereich mit seinen<br />
qualifizierten personellen Kräften erfordern.<br />
Daran fehlt es. Der Mehraufwand, der sich daraus<br />
ergibt, wird von den Krankenkassen nicht<br />
bezahlt. In die Fallpauschalen ist er ebenfalls<br />
nicht eingepreist.<br />
Verengte Sicht auf ein Sektor übergreifendes Problem<br />
Ein strukturiertes Überleitungsmanagement aller Leistungserbringer würde zum<br />
Beispiel bedeuten, dass die Resistenzbildung von Bakterien gegen Antibiotika nicht<br />
auf ein Krankenhaus-Hygiene-Problem verengt wird, wie es derzeit oft geschieht.<br />
Hierbei spricht man von multiresistenten Keimen.<br />
Viele Patienten bringen selbst Keime mit in die Klinik, die dann im Krankenhaus<br />
eine Infektion auslösen können. Krankenhäuser untersuchen natürlich Patienten<br />
bestimmter Risikogruppen generell auf derartige Keime. Es wäre jedoch deutlich<br />
sinnvoller, dies bereits vor geplanten stationären Aufenthalten durch niedergelassene<br />
Ärzte vornehmen und die Betroffenen auch behandeln zu lassen, so dass sie ohne<br />
die Gefahr einer Infektion ins Krankenhaus kommen könnten. Bei durchschnittlich<br />
einem Sechstel der Patienten, die bei der Aufnahme ins Krankenhaus Träger multiresistenter<br />
Keime sind, wurden die Krankenhäuser nicht darüber informiert, so das<br />
Fazit einer Befragung des DKI.<br />
Träger solcher Keime kommen der Umfrage zufolge auch überproportional aus stationären<br />
Pflegeeinrichtungen. Die Rückmeldung eines Krankenhauses an den FABW:<br />
Die Notwendigkeit, Betten für zu isolierende Patienten (MRSA, Norwalk-Virus) vorzuhalten,<br />
habe deutlich zugenommen. Entsprechende Bettenkontingente seien aber<br />
nicht mehr vorhanden. Die Folge seien Wartezeiten, inadäquate Versorgungssituationen<br />
sowie finanzielle Einbußen aufgrund der nicht vorhandenen Möglichkeit zur<br />
Belegung von Betten in Mehrbettzimmern. Zu isolierende Patienten werden häufig,<br />
trotz gesicherter Diagnose und bekanntem elektivem Eingriff, nicht im Vorfeld von<br />
externen Stellen angemeldet, so dass das interne Krankenhausmanagement sich<br />
nicht auf diese Situation einstellen könne.<br />
<strong>VKD</strong>-<strong>Praxisberichte</strong> <strong>2015</strong> | Patientensicherheit und Entlassmanagement 53
Entlassmanagement<br />
Projektbezogene Partnerschaften<br />
Strategie als Grundlage eines integrierten Gesundheitsunternehmens<br />
Die St. Marien-Krankenhaus Siegen gem. GmbH ist ein modern geführtes und<br />
organisiertes integriertes Gesundheitsunternehmen mit schlanken und transparenten<br />
Strukturen. Das Unternehmen beschäftigt in seinen Einrichtungen und Filialen<br />
in den Bundesländern Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz circa 2.000 Menschen.<br />
Den Kern des Unternehmens bildet ein Akutkrankenhaus mit 441 Betten.<br />
Dort werden jährlich 20.000 Fälle stationär und über 50.000 Fälle ambulant versorgt.<br />
Komplementäre Aufgaben, wie der Betrieb von Wohn- und Pflegeeinrichtungen,<br />
Reha- und Präventionseinrichtungen sowie Filialpraxen eines Medizinischen<br />
Versorgungszentrums, übernehmen zwei Tochtergesellschaften.<br />
Dipl.-Kfm.<br />
Hans-Jürgen Winkelmann<br />
Geschäftsführer der<br />
St. Marien-Krankenhaus<br />
Siegen gem. GmbH<br />
Dipl.-Volksw. Dr. rer. pol.<br />
Christian Stoffers<br />
Leiter Referat Kommunikation<br />
& Marketing der St.<br />
Marien-Krankenhaus Siegen<br />
gem. GmbH, Vertr. Professur<br />
& Dozent im Fach Marketing<br />
Die Krankenhäuser in Deutschland stehen vor<br />
vielfältigen und komplexen strategischen<br />
Herausforderungen. Das Instrument »Kostenreduktion«<br />
als alleiniges Allheilmittel<br />
im Klinikmanagement hat dabei längst zu<br />
drastischen Konsequenzen geführt, die die<br />
Krankenhäuser regelmäßig in einem negativen<br />
Licht erscheinen lassen. Skandale um<br />
mangelnde Hygiene und überlastetes Personal<br />
sind da als die Image prägenden Ereignisse<br />
der letzten Jahre zu benennen. Um<br />
diese Konsequenzen zu vermeiden, müssen<br />
also andere Instrumente genutzt werden.<br />
Das Management hat hierzu die Kernprozesse<br />
zu analysieren und Ansätze zu entwickeln,<br />
mit deren Hilfe identifizierte Bruchstellen<br />
zu vor- und nachgelagerten Bereichen überwunden<br />
werden können. Hierin liegt nämlich<br />
der Schlüssel, den Herausforderungen<br />
des Wandels wirkungsvoll zu begegnen. Eine<br />
Grundvoraussetzung für ein Gelingen des Veränderungsprozesses<br />
ist dabei eine auf Langfristigkeit<br />
und Nachhaltigkeit ausgerichtete<br />
strategische Konzeption als integriertes Gesundheitsunternehmen.<br />
Diese beinhaltet unterschiedliche<br />
Facetten von Partnerschaften<br />
und erfüllt gleichzeitig gesetzliche Vorgaben,<br />
wie sie an das Entlassmanagement gestellt<br />
werden.<br />
Ausgangspunkt für die erfolgreiche Unternehmensentwicklung<br />
sind die klinikspezifische<br />
Standortbestimmung und die Erarbeitung einer<br />
individuellen Strategie. Dieser Prozess beginnt<br />
mit der Frage: Wo steht »unser« Unternehmen<br />
bezüglich der wesentlichen Umweltfaktoren<br />
»Kostendruck«, »Wettbewerb« und »Spezialisierung«?<br />
Hieraus leiten sich dann die Erfordernisse<br />
ab, mit deren Hilfe das Unternehmen<br />
zu einem integrierten Gesundheitsunternehmen<br />
weiterentwickelt werden kann; es ist erst<br />
als solches in seinem Umfeld nachhaltig erfolgreich.<br />
Die richtige Strategie<br />
ist der Schlüssel<br />
Den Unterschied zwischen erfolgreichen und<br />
weniger erfolgreichen Unternehmen macht<br />
eindeutig die Strategie aus. Hierbei sind unterschiedliche<br />
Ansätze notwendig. Innerhalb derer<br />
kommt dem systematischen und planvollen<br />
Aufbau von Partnerschaften eine besondere<br />
Rolle zu.<br />
Die Entwicklung eines Konzepts gestaffelter<br />
partnerschaftlicher Strukturen – von der<br />
projektbezogenen bis hin zur strategischen<br />
Partnerschaft – erscheint in diesem Zusammenhang<br />
unverzichtbar; es greift von der Gestaltung<br />
moderner Versorgungsstrukturen über<br />
den Bereich der Personalentwicklung bis hin<br />
zur technologischen Weiterentwicklung des<br />
Klinikums. Dabei wird das Einlassen auf dieses<br />
Konzept umso selbstverständlicher, je mehr<br />
man sich vergegenwärtigt, dass die Komplexität<br />
der Unternehmensführung gerade im Bereich<br />
von Partnerschaften einen strategischen<br />
Planungsansatz erfordert. Andernfalls würde<br />
das zeitaufwändige operative Geschäft eines<br />
Klinikums solche Fragestellungen in den Hintergrund<br />
drängen. Das Unternehmen wäre verleitet,<br />
sich in Abhängigkeiten zu begeben, die<br />
54<br />
<strong>VKD</strong>-<strong>Praxisberichte</strong> <strong>2015</strong> | Patientensicherheit und Entlassmanagement
Entlassmanagement<br />
Das St. Marien<br />
Krankenhaus Siegen<br />
eine Steuerung erheblich einschränkten. Bei<br />
der Entwicklung eines Konzepts muss also die<br />
Balance zwischen operativer Handlungsnotwendigkeit<br />
und strategischer Ausrichtung im<br />
Sinne eines vernünftigen Aufwand-Nutzen-<br />
Verhältnisses gefunden werden.<br />
Komplexität meistern<br />
Die St. Marien-Krankenhaus Siegen gem. GmbH<br />
hat diesen Prozess hin zu einem integrierten<br />
Gesundheitsunternehmen in den vergangenen<br />
Jahren erfolgreich vollzogen, obgleich die Voraussetzungen<br />
alles andere als günstig waren:<br />
Zwar hatte sich das Unternehmen sehr früh dazu<br />
entschlossen, den Veränderungsdruck in der<br />
Gesundheitswirtschaft als Herausforderung zu<br />
begreifen; als erstes katholisches Krankenhaus<br />
im Erzbistum Paderborn wechselte es bereits im<br />
Jahr 1988 in die Rechtsform einer GmbH. Auch<br />
vollzog es seither zahlreiche Schritte zum Ausbau<br />
der Akutversorgung, insbesondere in den<br />
Schwerpunktbereichen »Kardiologie«, »Orthopädie«<br />
und »Hämatologie/Onkologie«, und forcierte<br />
die Unternehmensentwicklung in vertikaler<br />
Richtung, doch mangelte es – in der Nachbetrachtung<br />
– an einer strategischen Konzeption<br />
für das zu beachtlicher Größe gewachsene<br />
Unternehmen. In getrennten Projekten waren<br />
lediglich in den einzelnen Bereichen, insbesondere<br />
in den Funktionen »Qualitätsmanagement«,<br />
»Controlling« und »Marketing«, erhebliche<br />
Fortschritte erzielt worden. Es fehlte bei<br />
den genannten Fortschritten vor allem aber der<br />
langfristig ausgerichtete, strukturierte und gesteuerte<br />
»Blick aufs Ganze« mit Instrumentarien<br />
der strategischen Unternehmensführung.<br />
Dieser war scheinbar auch nicht notwendig,<br />
konnte die Struktur doch damals mit tradierten<br />
Managementmethoden noch beherrscht werden.<br />
Zunehmende Komplexität des gesamten Unternehmensgeschehens<br />
im Hinblick auf Organisation,<br />
Wertschöpfungsprozesse und Kanalisierung<br />
nachhaltigen Wachstums machten also<br />
im St. Marien-Krankenhaus Siegen den Start<br />
eines groß angelegten strategischen Unternehmensplanungsprojektes<br />
erforderlich. Daher<br />
wurde von der Geschäftsführung dem Verwaltungsrat<br />
zu Beginn des Jahres 2008 die »Strategiekonzeption<br />
<strong>2015</strong>« vorgelegt und von diesem<br />
verabschiedet. Die Fragen nach dem »Wo<br />
steht unser Unternehmen?« und »Wohin soll<br />
unser Unternehmen sich entwickeln?« waren<br />
damit geklärt.<br />
Das Ziel: ein integriertes<br />
Gesundheitsunternehmen<br />
Zentraler Bestandteil der Konzeption war die<br />
Vision, die den Zustand des Unternehmens<br />
im Jahr <strong>2015</strong> beschreibt und die die Grundlage<br />
des Strategieprojektes sowie der strategischen<br />
Planung darstellt. Das Ziel, ein integriertes<br />
Gesundheitsunternehmen als Modell<br />
für andere Krankenhäuser zu entwickeln, war<br />
»geboren«. Mit der Konzeption konnte damit<br />
erstmals ein geschlossener, gesamtunternehmensbezogener<br />
Planungskreislauf vorgestellt<br />
und verabschiedet werden. Dieser hat fortan in<br />
allen Ebenen die Gesamtentwicklung des Unternehmens<br />
im Fokus; vorhandene Insellösungen<br />
und nicht aufeinander abgestimmte Konzepte<br />
galt es seitdem zu überwinden. Hierauf<br />
aufbauend wurden zum einen Steuerungsinstrumente,<br />
wie eine unternehmensspezifische<br />
Balanced-Scorecard entwickelt, zum anderen<br />
Handlungsansätze für organisatorische Herausforderungen,<br />
wie der Entwicklung von neuen<br />
Versorgungsansätzen und der Begegnung des<br />
technologischen Fortschritts, etabliert.<br />
Das System der Balanced-Scorecard verfolgt<br />
dabei als Führungsinstrument einen Ansatz<br />
zur Strategiesteuerung, der über die eher vergangenheitsorientierten<br />
Ansätze früherer Führungsinstrumente<br />
deutlich hinausgeht. Zentrale<br />
Inhalte sind hierin die vier Ebenen »Finanzen«,<br />
»Patienten/Bewohner«, »Mitarbeiter« und<br />
»Organisatorischen<br />
Herausforderungen auf<br />
vertikaler Ebene wird<br />
grundsätzlich durch ein<br />
gestaffeltes System an<br />
Partnerschaften begegnet.«<br />
Hans-Jürgen Winkelmann<br />
<strong>VKD</strong>-<strong>Praxisberichte</strong> <strong>2015</strong> | Patientensicherheit und Entlassmanagement 55
Entlassmanagement<br />
»Patienten erwarten,<br />
dass ihre medizinische<br />
Versorgung nicht isoliert<br />
betrachtet wird und sie die<br />
Versorgung nicht über viele<br />
Sektorengrenzen hinweg<br />
selbstständig organisieren<br />
müssen. Das Ziel, ein<br />
integriertes Gesundheitsunternehmen<br />
zu sein, ist damit<br />
längst kein Selbstzweck<br />
mehr, vielmehr erfüllt es die<br />
Anforderungen, die Patienten<br />
an das Krankenhaus<br />
heute stellen.«<br />
Hans-Jürgen Winkelmann<br />
»Prozesse«, die die Grundlage bilden für die<br />
Entwicklung von strategischen Zielen, Maßnahmen<br />
zur Zielerreichung und quantitativen sowie<br />
qualitativen Messgrößen. Die Besonderheiten<br />
bei diesem klinikindividuell zugeschnittenen<br />
Instrument bestehen in der Entwicklung einer<br />
spezifischen Softwarelösung und in der breit<br />
angelegten Umsetzung der Balanced-Scorecard<br />
in den strategischen Unternehmenseinheiten.<br />
Auf beiden Ebenen wurde auf das Know-how<br />
innerhalb des Unternehmens zurückgegriffen<br />
und lediglich bei der technischen Umsetzung<br />
der definierten Details des Führungsinstruments<br />
Unterstützung »eingekauft«.<br />
Daneben galt es, Handlungsansätze zu definieren,<br />
die das unternehmerische Handeln planbar<br />
gestalteten. Diese führten weg von der isolierten<br />
Betrachtung einzelner Partnerschaften hin<br />
zu einem systematischen Ansatz, diese strategisch<br />
zu erfassen. Die Umsetzung der Strategie<br />
konnte damit in diesem Bereich eingeleitet<br />
werden.<br />
Partnerschaften planbar gestalten<br />
Organisatorischen Herausforderungen auf<br />
vertikaler Ebene wird hiernach grundsätzlich<br />
durch ein gestaffeltes System an Partnerschaften<br />
begegnet, das – je nach unternehmerischer<br />
Notwendigkeit – bis zu einer vollständigen<br />
Integration innerhalb des Unternehmens,<br />
beispielsweise über das medizinische Versorgungszentrum,<br />
reicht. Das Krankenhaus entwickelt<br />
im genannten Fall an unterschiedlichen<br />
Standorten ein komplexes Versorgungsangebot<br />
um die Kernleistungen des Unternehmens herum.<br />
Gleichzeitig nimmt es bei diesem System<br />
regelmäßig eine dominante Stellung ein.<br />
Es wird hierin der Tatsache Rechnung getragen,<br />
dass die ambulante Versorgung einen immer<br />
wichtiger werdenden Baustein in der Versorgungskette<br />
eines Krankenhauses darstellt. Patienten<br />
erwarten, dass ihre medizinische Versorgung<br />
nicht isoliert betrachtet wird und sie die<br />
Versorgung nicht über viele Sektorengrenzen<br />
hinweg selbstständig organisieren müssen. Das<br />
Ziel, ein integriertes Gesundheitsunternehmen<br />
zu sein, ist damit längst kein Selbstzweck mehr,<br />
vielmehr erfüllt es die Anforderungen, die Patienten<br />
an das Krankenhaus heute stellen.<br />
Einen Zwitter stellen in diesem Zusammenhang<br />
als Joint-Venture betriebene Einrichtungen dar,<br />
die sowohl die medizinische Versorgung weiterentwickeln<br />
als auch andere Zukunftsbereiche<br />
des Krankenhauses berühren.<br />
Im Bereich der medizinischen Versorgung kann<br />
beispielhaft das Reflux-Zentrum Siegerland<br />
angeführt werden. Bei diesem Zentrum sind<br />
zwei Krankenhausträger gleichberechtig beteiligt.<br />
Eine überragende Stellung eines Partners<br />
würde das Kooperationsprojekt gefährden.<br />
Die Kliniken haben hierfür an einem zentral<br />
gelegenen Standort ein Portal errichtet. Dort<br />
werden die Patienten einem Versorgungspfad<br />
zugeordnet. Beginnend mit einem Beratungsangebot,<br />
dessen Inanspruchnahme durch den<br />
Patienten selbst bezahlt werden muss, ermöglicht<br />
dieser Pfad die zielgerichtete Versorgung<br />
der Patienten. So kann nach der Beratung eine<br />
Magenspiegelung zum Ausschluss von schwerwiegenden<br />
oder bösartigen Veränderungen in<br />
der Inneren Abteilung des einen Partners stehen.<br />
Bei gravierenden Befunden oder bei einer<br />
Unverträglichkeit der Medikamente kann<br />
schließlich eine operative Korrektur der Muskelschwäche<br />
im Übergang zur Speiseröhre<br />
durch die Chirurgische Abteilung des anderen<br />
Partners erfolgen. Die Leistungen nach der Eingangsberatung<br />
werden dabei von der jeweiligen<br />
Krankenversicherung des Patienten getragen.<br />
Die Technologie und das jeweils erforderliche<br />
Know-how verbleiben bei dieser Form der Kooperation<br />
jeweils im „Herrschaftsbereich“ des<br />
einzelnen Partners, was ein gewisses Maß an<br />
Kontrolle zulässt. Die Steuerung des Portals<br />
erfolgt durch eine niedergelassene Ärztin, was<br />
den nahtlosen Übergang in unterschiedliche<br />
Versorgungsbereiche sicherstellt.<br />
Das beschriebene Joint-Venture ließ sich zum<br />
Ende des Jahres 2014 relativ schnell etablieren.<br />
Um einen Affront gegenüber den ambulant tätigen<br />
Medizinern zu vermeiden, wurde zuvor über<br />
den lokalen Ärzteverein dessen Mitgliedern das<br />
neue Zentrum vermittelt. Die reibungslose Implementierung<br />
konnte nicht zuletzt deshalb<br />
gelingen, da in der Planung auch die Bedürfnisse<br />
externer Partner berücksichtigt wurden.<br />
Projekt »Albertus Magnus«<br />
Joint-Ventures mit anderen Krankenhausträgern<br />
sind also eine Lösung, um Versorgungsangebote<br />
weiterzuentwickeln. Dies kann vertikal<br />
entlang des Versorgungspfades, wie beim<br />
Reflux-Zentrum Siegerland, geschehen oder<br />
als horizontales Projekt; bei letzteren arbeiten<br />
Kliniken mit vergleichbarem Versorgungsauftrag<br />
zusammen, um ein spezialisiertes Versorgungsangebot<br />
zu schaffen. Ein Beispiel hierfür<br />
ist das vom St. Marien-Krankenhaus Siegen mit<br />
anderen Klinikträgern betriebene Brustzentrum<br />
Siegen-Olpe, an dem zuvorderst drei gynäkologische<br />
Kliniken zusammenarbeiten.<br />
Betrachtet man wiederum die vertikale Verknüpfung,<br />
so ist es ein besonderer Ansatz, unterschiedliche<br />
Modelle einer gestaffelten Partner-<br />
56<br />
<strong>VKD</strong>-<strong>Praxisberichte</strong> <strong>2015</strong> | Patientensicherheit und Entlassmanagement
Entlassmanagement<br />
schaft an einem Standort gleichzeitig zu realisieren.<br />
In diesem Kontext wurde das ambitionierte<br />
Projekt »Albertus Magnus« gestartet.<br />
Dieses fand ebenfalls im Jahr 2014 mit der Inbetriebnahme<br />
des Ambulanten Zentrums Albertus<br />
Magnus seinen Abschluss: In weniger als<br />
24 Monaten Planungs- und Bauzeit entstand<br />
dieses Zentrum an der Siegener Sandstraße; gut<br />
15 Millionen Euro kostete der Neubau, der zwischenzeitlich<br />
für über 1.000 Menschen täglich<br />
Anlaufpunkt ihrer medizinischen Behandlung<br />
ist.<br />
Im Ambulanten Zentrum Albertus Magnus wurden<br />
auf drei Etagen Arztpraxen und Einrichtungen<br />
unterschiedlicher medizinischer Fachrichtungen<br />
untergebracht. Zu den ambulanten<br />
Angeboten des St. Marien-Krankenhauses kamen<br />
weitere Angebote von dreizehn selbstständigen<br />
Praxis- und Einrichtungsbetreibern hinzu.<br />
Die Gesamtkombination orientiert sich dabei an<br />
den Schwerpunkten des St. Marien-Krankenhauses.<br />
Damit gelingt es dem Unternehmen, auf<br />
allen Stufen der Versorgung Angebote zu unterbreiten.<br />
Besonderen Wert legte man auf die<br />
medizinisch-technische Infrastruktur. So gibt<br />
es beispielsweise einen »offenen« Magnetresonanz-Tomographen,<br />
der als Hightech-Gerät den<br />
Menschen das beklemmende Gefühl nimmt, in<br />
eine Röhre geschoben zu werden. Es entstand<br />
ferner ein ambulanter Operationsbereich mit<br />
zwei Sälen und einem Eingriffsraum; dieser<br />
kann freilich auch von Partnern außerhalb des<br />
Zentrums genutzt werden.<br />
In Einklang mit der Strategie suchte man auch<br />
bei diesem Projekt den Schulterschluss mit<br />
externen Partnern, um die größte Einzelbaumaßnahme<br />
der Unternehmensgeschichte zu<br />
stemmen. Bei der Planung und Umsetzung in<br />
der Bauphase wurde ein Projektsteuerer bestellt,<br />
der mit den jeweiligen Fachressorts auf<br />
Seiten des Krankenhauses eng zusammenarbeitete.<br />
Daneben haben sich interne und externe<br />
Nutzer des ambulanten OP-Bereichs bereits ein<br />
Jahr vor dem eigentlichen Beginn des Operierens<br />
im neuen Zentrum in einer regelmäßigen<br />
Arbeitsgruppe partnerschaftlich über Abläufe,<br />
Ausstattungen und Nutzungstage verständigt.<br />
So konnten die Anforderungen sowohl der eigenen<br />
Praxen als auch jener der externen Partner<br />
früh in den Umsetzungsprozess integriert werden.<br />
Dies führte dazu, dass bereits ein halbes<br />
Jahr vor der Inbetriebnahme des Zentrums dessen<br />
Gesamtkomposition »spruchreif« war und<br />
sämtliche internen Prozesse hierauf abgestimmt<br />
werden konnten.<br />
Auch im Bereich »Technologie« wurde ein Weg<br />
gefunden, der es dem Unternehmen ermöglicht,<br />
die Steuerung zu behalten und damit<br />
eine zu große Abhängigkeit gegenüber den projektbegleitenden<br />
Firmen zu vermeiden. Bei der<br />
Einbindung der technischen Infrastruktur des<br />
Zentrums wurde dabei auf regionale Partner<br />
zurückgegriffen, zu denen teilweise langjährige<br />
Partnerschaften bestehen. Im Ergebnis führte<br />
dies alles dazu, dass die Differenz zwischen<br />
geplantem und tatsächlichem Investitionsvolumen<br />
unerheblich war.<br />
Durchlässigkeit im System<br />
Die Versorgungskette stellt jedoch keine Einbahnstraße<br />
dar. Patienten, die über den ambulanten<br />
Bereich in eine Klinik gelangt sind,<br />
wird über die Konzeption des St. Marien-Krankenhauses<br />
auch eine zeitige Rückkehr in den<br />
Alltag ermöglicht. Um hierbei die Kontinuität<br />
der Behandlung und Betreuung nahtlos sicherzustellen,<br />
wurde auch hier über gestaffelte<br />
Partnerschaften ein übergreifendes Angebot<br />
geschaffen. Die Konzeption reicht dabei eben-<br />
Im Jahr 2014 wurde das<br />
Ambulante Zentrum<br />
Albertus Magnus eröffnet.<br />
<strong>VKD</strong>-<strong>Praxisberichte</strong> <strong>2015</strong> | Patientensicherheit und Entlassmanagement 57
Entlassmanagement<br />
Das Reflux-Zentrum<br />
Siegerland am Standort<br />
Siegerlandflughafen<br />
falls von einer Partnerschaft auf Augenhöhe<br />
bis hin zur vollständigen Integration. Im Ambulanten<br />
Zentrum Albertus Magnus befindet<br />
sich beispielsweise die Praxis eines medizinischen<br />
Palliativ-Netzwerkes und eines Präventionszentrums.<br />
Gleichfalls befindet sich dort<br />
ein Standort der über die Tochtergesellschaft<br />
GSS Gesundheits-Service Siegen gem. GmbH<br />
betriebenen ambulanten kardiologischen Rehabilitation.<br />
Er gehört zu den ambulanten Rehabilitationseinrichtungen,<br />
die das integrierte<br />
Unternehmen an unterschiedlichen Orten im<br />
Versorgungsgebiet eingerichtet hat.<br />
Die Durchführung des Entlassmanagements als<br />
überleitende Tätigkeit innerhalb des integrierten<br />
Gesundheitsunternehmens erfolgt dann<br />
durch hierfür extra qualifizierte Mitarbeiter,<br />
die koordinierend mit den behandelnden Klinikärzten,<br />
den stationär und ambulant Pflegenden,<br />
dem sozialen Dienst, den Angehörigen<br />
und den niedergelassenen Ärzten oder den aufnehmenden<br />
Einrichtungen zusammenwirken;<br />
auch hier bietet das Unternehmen über seine<br />
Tochtergesellschaft GSS Gesundheits-Service<br />
Siegen im Bereich der Altenhilfe Lösungen an.<br />
Wird die Versorgungskette eines integrierten<br />
Gesundheitsunternehmens vollständig erfasst,<br />
so ist die Fragestellung, wie diese zukünftig<br />
erfolgreich gestaltet werden kann, bedeutsam.<br />
Daher sind auch Kooperationsprojekte, die zunächst<br />
nur mittelbar die medizinisch-pflegerische<br />
Leistungserbringung berühren, jedoch die<br />
Durchlässigkeit im System »kulturell« verankern,<br />
in dem strategischen Konzept zu erfassen.<br />
Ein Beispiel ist das Bildungsinstitut für Gesundheitsberufe<br />
in Südwestfalen. Das Institut wurde<br />
vom St. Marien-Krankenhaus Siegen zusammen<br />
mit zwei weiteren Krankenhausträgern im Jahr<br />
2014 gegründet. Rund 275 Auszubildende werden<br />
– nach abgeschlossener Zusammenlegung<br />
der bis dahin separat agierenden Krankenpflegeschulen<br />
und der Fertigstellung eines Neubaus<br />
– im Berufsfeld der Gesundheits- und<br />
Kranken- sowie Kinderkrankenpflege aus- und<br />
weitergebildet. Zusätzliche 75 neue Ausbildungsplätze<br />
entstehen durch die Etablierung<br />
einer Einrichtung zur Altenpflegeausbildung.<br />
Das gemeinsame Institut stellt damit eine Abkehr<br />
von kleinteiligen Insellösungen dar. Das<br />
Krankenhaus, das an der gegründeten GmbH<br />
ein Drittel der Kontrollrechte ausübt, kann über<br />
das Joint-Venture dem erwarteten Mangel an<br />
Fachkräften im Bereich Pflege entgegenwirken.<br />
Abschließend bleibt festzuhalten, dass neben<br />
der Methodik der Strategieentwicklung die Art<br />
und Weise ihrer Implementierung entscheidend<br />
ist. Eine Strategie muss von den Mitarbeitern<br />
getragen, akzeptiert und »gelebt« werden, nur<br />
dann ist sie erfolgreich und nachhaltig. Dazu ist<br />
es notwendig, dass die Strategie, nachdem sie<br />
vom Management entworfen wurde, von innen,<br />
also von den Mitarbeitern, weiterentwickelt<br />
wird. Dies ist zwischenzeitlich bei allen Projekten<br />
der Strategieimplementierung erfolgt.<br />
Die vorgestellten Projekte - gepaart mit einer<br />
überaus erfolgreichen Umsatz- und Mitarbeiterentwicklung<br />
- belegen, dass dies im integrierten<br />
Gesundheitsunternehmen gelungen ist.<br />
Schlussbemerkung<br />
Die St. Marien-Krankenhaus Siegen gem. GmbH<br />
zeigt, wie der Wandel hin zu einem integrierten<br />
Gesundheitsunternehmen verlaufen kann.<br />
Nach der Standortbestimmung wurde eine Vision<br />
entwickelt, auf der schließlich die Strategie<br />
fußt. Ihre Umsetzung erfolgt dann in den<br />
jeweiligen Projekten, für die beispielhaft die<br />
angeführten Joint-Venture und das Ambulante<br />
Zentrum Albertus Magnus stehen.<br />
Für ein integriertes Gesundheitsunternehmen<br />
ist es dabei unerlässlich, in Netzwerken zu<br />
denken und zu handeln, die ein gewisses Maß<br />
an Durchlässigkeit zu gewährleisten haben – in<br />
beide Richtungen. Eine Strategie greift dabei<br />
nur dann, wenn sie eine gestaffelte, projektbezogene<br />
Konzeption von Partnerschaften integriert<br />
und somit als Teil des Ganzen betrachtet.<br />
Strategie ist somit eine originäre Managementfunktion<br />
und deren Umsetzung wird durch Experten<br />
in den Referaten und Zentralen Diensten<br />
des Unternehmens begleitet und gesteuert.<br />
Elementar ist und bleibt bei allen Teilbereichen<br />
unternehmerischen Handelns deren Verankerung<br />
in die strategische Planung. Dies ist in<br />
Siegen mit der Strategie <strong>2015</strong> eingeleitet worden<br />
und wird mit der Nachfolgestrategie 2020<br />
weitergeführt und ausgebaut werden.<br />
58<br />
<strong>VKD</strong>-<strong>Praxisberichte</strong> <strong>2015</strong> | Patientensicherheit und Entlassmanagement
Gibt es Hoffnung<br />
beim Entlassmanagement?<br />
Ein gemeinschaftlicher neuer Versuch im Einbecker BürgerSpital<br />
Entlassmanagement<br />
Das Einbecker BürgerSpital ist ein besonderes, inzwischen bundesweit bekanntes<br />
Modell: bis 2005 Städtisches Krankenhaus, dann bis 2008 Kreiskrankenhaus mit<br />
Northeim und Bad Gandersheim, anschließend weitere Träger bis zur Planinsolvenz<br />
am 01.08.2012 (negatives Eigenkapital ca. 11 Mio. Euro, Verbindlichkeiten ca. 16 Mio.<br />
Euro). Seit Januar 2013 existiert das Einbecker BürgerSpital: eine gemeinnützige<br />
GmbH durch Bürgerbeteiligung mit privatem Kapital, einem verzinsten Darlehen der<br />
Stadt Einbeck und erheblichen Spenden. Im Ergebnis ist die finanzielle Gesundung<br />
durch Entschuldung, das Einbringen wirtschaftlichen Handelns aus dem Management<br />
örtlicher Unternehmen und die medizinische Neuausrichtung festzuhalten.<br />
Verbunden wird das Modell mit den Protagonisten, dem Treuhänder Jochen Beyes<br />
und dem medizinischen Geschäftsführer, gleichzeitig Gesellschafter und Chefarzt der<br />
Inneren Medizin, Dr. Olaf Städtler.<br />
Vorgehalten werden 103 Betten in den Bereichen Innere Medizin, Chirurgie,<br />
Schmerz-/Palliativmedizin, dazu Radiologie, Physiotherapie, Krankenpflegeschule<br />
und ambulanter Krankenpflegedienst mit spezialisierter ambulanter Palliativversorgung<br />
(SAPV). Durch die Insolvenz gab es 2012 einen Abbau von 350 auf 280 Mitarbeiter.<br />
Heute hat das Krankenhaus ca. 180 Vollkräfte/ 280 Mitarbeiter.<br />
Hans-Martin Kuhlmann<br />
Kaufmännischer Geschäftsführer,<br />
Einbecker BürgerSpital,<br />
Einbeck<br />
In einem Krankenhaus, das überleben will,<br />
muss auf die grundlegenden Strukturen eingewirkt<br />
werden. Hierbei spielt der »Patientenprozess«<br />
die zentrale Rolle, innerhalb desselben<br />
wieder das Entlassungsmanagement.<br />
Das Einbecker BügerSpital hat Anfang <strong>2015</strong><br />
mit der Reorganisation dieses komplexen<br />
Prozesses begonnen. Inzwischen sind wichtige<br />
Veränderungen geplant und auch bereits umgesetzt<br />
worden.<br />
Ein neues Modell, eine medizinische Neustrukturierung<br />
und die finanzielle Sanierung reichen<br />
nicht aus, um für ein Krankenhaus – gleich<br />
welcher Größe – eine dauerhafte Zukunft zu<br />
sichern. Die internen Prozesse, die neben medizinischen<br />
und pflegerischen Leistungen zunehmend<br />
von Bedeutung sind und gleichzeitig<br />
die Basis für eine wirtschaftliche Entwicklung<br />
darstellen, müssen reorganisiert werden. Die<br />
seit Jahren auseinander klaffende Entwicklung<br />
zwischen gedeckelten Einnahmen und größtenteils<br />
nicht zu beeinflussenden Kosten ist<br />
durch einfache Einsparungen nicht zu füllen.<br />
Im Krankenhaus, das überleben will, muss auf<br />
die grundlegenden Strukturen eingewirkt werden.<br />
Hierbei spielt der »Patientenprozess« die<br />
zentrale Rolle, innerhalb desselben wieder das<br />
Entlassmanagement.<br />
Aber wie sieht eine Reorganisation dieses komplexen<br />
Prozesses aus? Zum einen wurde die<br />
gesamte Abrechnung im Einbecker BürgerSpital<br />
mit externer Analyse- und Beratungshilfe<br />
durchleuchtet und neu strukturiert. Dieses<br />
Projekt läuft seit ca. sechs Monaten und befindet<br />
sich weiter in der Umsetzung. Zum anderen<br />
ergab sich die Möglichkeit, im Rahmen einer<br />
Bachelor-Arbeit einem Studenten der Hochschule<br />
Osnabrück die Plattform für seine Arbeit<br />
zu geben und dem Krankenhaus eine intensivere<br />
Beschäftigung mit Details zu ermöglichen.<br />
Vorgehensweise<br />
Um sich mit dem Thema »Entlassungsprozess«<br />
genauer zu beschäftigen und dessen Relevanz<br />
für das Krankenhaus herauszustellen, war eine<br />
bestimmte Vorgehensweise notwendig. Bauchgefühle<br />
und Eindrücke sind zwar wichtig, um<br />
erste Einschätzungen zu treffen, aber wenig<br />
valide.<br />
Mithilfe des §21-Datensatzes des Vorjahres<br />
wurden die Entlassungen ermittelt, die in der<br />
Markus Krahforst<br />
Hochschule Osnabrück<br />
<strong>VKD</strong>-<strong>Praxisberichte</strong> <strong>2015</strong> | Patientensicherheit und Entlassmanagement 59
Entlassmanagement<br />
»Die seit Jahren auseinander<br />
klaffende Entwicklung<br />
zwischen gedeckelten<br />
Einnahmen und größtenteils<br />
nicht zu beeinflussenden<br />
Kosten ist durch einfache<br />
Einsparungen nicht zu<br />
füllen. Im Krankenhaus, das<br />
überleben will, muss auf die<br />
grundlegenden Strukturen<br />
eingewirkt werden. Hierbei<br />
spielt der ‚Patientenprozess‘<br />
die zentrale Rolle, innerhalb<br />
desselben wieder das Entlassungsmanagement.«<br />
Hans-Martin Kuhlmann<br />
Zeit von 14 bis 19 Uhr stattfanden. Dieser Zeitraum<br />
wurde festgelegt, da eine gut geplante<br />
Entlassung bis 14 Uhr durchgeführt werden<br />
kann. Ab ca. 13:15 Uhr findet die Übergabe des<br />
Pflegedienstes zwischen Früh- und Spätdient<br />
statt. Sollte ein Patient im Laufe des Frühdienstes<br />
entlassen werden, dieses im KIS jedoch<br />
nicht entsprechend erfasst sein, wird dieses<br />
Versäumnis in der Übergabe festgestellt. Bei<br />
Entlassungen nach 19 Uhr wurde unterstellt,<br />
dass diese nicht geplant waren, beziehungsweise<br />
konkrete Gründe dafür vorlagen.<br />
Um ein möglichst genaues Bild dieses Zeitkorridors<br />
zu erhalten, wurden die Fälle mit dem<br />
Entlassungsgrund Tod (079) sowie Verlegungen<br />
(069, 089) nicht berücksichtigt. Das Ergebnis:<br />
Knapp 32 Prozent aller Entlassungen im Jahr<br />
2014 erfolgten im veranschlagten Zeitraum von<br />
14 bis 19 Uhr. Der Fragebogen des Deutschen<br />
Krankenhausinstituts (DKI) aus dem Jahre 2013<br />
zum Thema Entlassmanagement war hilfreich<br />
dabei, erste interne und externe Schwachstellen<br />
zu erkennen. So konnte festgestellt werden,<br />
dass die Kommunikation und Kooperation zu<br />
externen Einrichtungen und Institutionen nicht<br />
zu den Problemfeldern des Entlassungsprozesses<br />
zählten.<br />
Um die internen Schwachstellen und Problemfelder<br />
herauszufinden, wurden sowohl Interviews<br />
mit den Verantwortlichen geführt als<br />
auch eine Aufnahme des IST-Zustandes durch<br />
Beobachtung erhoben (Vgl. Zapp, W. (2010): S.<br />
95).<br />
Auf der Grundlage dieser Erkenntnisse entstand<br />
ein erstes Sollkonzept, das den Verantwortlichen<br />
vorgelegt wurde. Nach deren Rückmeldung<br />
erfolgte noch eine Anpassung und<br />
Ergänzung von Details. Bei der Erfassung des<br />
IST-Zustandes wurden nicht nur Schwachstellen<br />
herausgefunden, die explizit den Entlassungsprozess<br />
betreffen, sondern auch weitere<br />
Aspekte, die unter dem Punkt »Erfassung des<br />
IST-Zustandes« aufgeführt werden.<br />
Prozessgestaltung<br />
Für die Planung und Durchführung der Prozessgestaltung<br />
diente dem Haus die Arbeit<br />
von Prof. Dr. Winfried Zapp, der den Ablauf der<br />
Prozessgestaltung für die Institution Krankenhaus<br />
erarbeitet hat. Um nicht den gesamten<br />
Behandlungsprozess zu erfassen, musste<br />
der Prozess - in unserem Haus war das aufgrund<br />
der geschilderten Vorüberlegungen der<br />
Entlassungsprozess - abgegrenzt werden. Erst<br />
dann konnten gezielte Beobachtungen der IST-<br />
Situation stattfinden. Für eine Analyse muss<br />
die Komplexität und Dynamik eines Prozesses<br />
zudem reduziert werden. Dadurch wird dieser<br />
übersichtlicher und strukturierter.<br />
Der Prozess selbst wird dabei in seine Teilprozesse<br />
und diese wiederum in seine Teilschritte<br />
zerlegt. Die Zerlegung beziehungsweise Darstellung<br />
kann horizontal oder vertikal erfolgen.<br />
Wobei die vertikale Darstellung von einer bestehenden<br />
Organisationsstruktur ausgeht. Die<br />
Horizontale hingegen stellt den Prozess unabhängig<br />
von den Bereichen respektive Abteilungen<br />
in den Vordergrund. Nach der Schnittstellenanalyse<br />
und der Prozess-Würdigung erfolgt<br />
die Entwicklung einer Sollkonzeption.<br />
Abbildung 1 stellt die Vorgehensweise und den<br />
Ablauf der Prozessgestaltung zusammenfassend<br />
dar.<br />
Abbildung 1:<br />
Ablauf der Prozessgestaltung<br />
Quelle: Zapp, W. (2014): S.155 in Anlehnung an<br />
Zapp, W., Otten, S. (2010): S.117)<br />
60<br />
<strong>VKD</strong>-<strong>Praxisberichte</strong> <strong>2015</strong> | Patientensicherheit und Entlassmanagement
Erfassung des IST-Zustandes<br />
Der IST-Zustand wurde mittels Interviews, Beobachtungen<br />
und eines Fragebogens erfasst.<br />
Die Beobachtung fand über mehrere Tage auf<br />
den unterschiedlichen Stationen statt, um explizit<br />
die Abläufe kennenzulernen, die in den<br />
letzten Stunden vor der Entlassung eines Patienten<br />
erfolgen.<br />
Danach wurden die Prozesse und Teilschritte<br />
entsprechend abgebildet. Die Schnittstellenanalyse<br />
diente vor allem dazu, die Brüche im<br />
zeitlichen Ablauf sowie Kommunikationsdefizite<br />
zwischen den Bereichen aufzuzeigen. Am<br />
Ende der IST-Darstellung erfolgte die Prozesswürdigung.<br />
Dabei wurden Schwachstellen aufgedeckt<br />
und Erkenntnisse über Verbesserungspotenziale<br />
gewonnen. Probleme, Stärken und<br />
Schwächen wurden an dieser Stelle aber nicht<br />
nur aufgedeckt, sondern im Team mit den unterschiedlichen<br />
Berufsgruppen diskutiert. Für<br />
eine deutlichere Visualisierung wurde dafür<br />
das Ishikawa-Diagramm herangezogen. (Das<br />
Ishikawa-Diagramm ist ein Ursache-Wirkungs-<br />
Diagramm, mit dem kausale Beziehungen dargestellt<br />
werden können. Es wurde in den 1940er<br />
Jahren von Kaoru Ishikawa entwickelt und später<br />
vor allem im Qualitätsmanagement angewandt.)<br />
Bei der Erfassung und Würdigung des IST-Zustandes<br />
zeigten sich verschiedene Problemfelder,<br />
u.a.:<br />
• Diagnostik-Aufträge durch die Ärzte wurden<br />
teilweise mit Hilfe eines Notiz-Zettels<br />
im Dienstzimmer der Pflege gestellt. Die<br />
Pflege füllte das vorgefertigte Formular für<br />
Diagnostik-Aufträge aus und legte es dem<br />
Arzt zur Unterschrift ins Ablagefach. Dadurch<br />
besteht die Gefahr, dass einerseits<br />
unbeabsichtigt Notiz-Zettel »untergehen«<br />
und andererseits eine nicht unerhebliche<br />
Zeitverzögerung zwischen der Anforderung<br />
der Diagnostik durch den Arzt und deren<br />
Durchführung entsteht.<br />
• Mängel gab es auch bei der Information des<br />
Überleitungsmanagements. Der entsprechende<br />
Anamnesebogen wird regelhaft auf<br />
der Aufnahmestation ausgefüllt. Aufgrund<br />
von knappen Zeit- und Personalressourcen<br />
kam es aber vor, dass dieser Bogen nicht<br />
ausgefüllt wurden. Da auf einem Teil der<br />
Stationen keine Visite der Ärzte gemein-<br />
sam mit der Pflege stattfand, war die<br />
Kommunikation gefährdet. So wurde das<br />
Überleitungsmanagement mehrfach erst<br />
kurz vor der Entlassung des Patienten eingeschaltet.<br />
• Der Entlassungsbrief ist als weiterer bedeu-<br />
tender Punkt zu nennen. Üblich war, dass der<br />
Entlassungsbrief erst im Laufe des Tages<br />
fertiggestellt wurde, obwohl der Patient bereits<br />
seit den Morgenstunden auf die Entlassung<br />
wartete. Dieses hatte erheblichen<br />
Einfluss auf die darauffolgenden Prozesse.<br />
• Die poststationäre Versorgung mit neuverordneten<br />
Medikamenten erwies sich zum<br />
Teil ebenfalls als problematisch, besonders<br />
zum Wochenende und vor Feiertagen. Es gab<br />
keine festen Absprachen darüber, ob und wie<br />
viele Medikamente mitgegeben werden,<br />
oder stattdessen Rezepte über die kassenärztliche<br />
Notdienstambulanz ausgestellt<br />
werden sollten.<br />
Entwicklung einer Sollkonzeption<br />
Im Anschluss an die Prozesswürdigung erfolgt<br />
die Entwicklung einer Sollkonzeption. Wesentlich<br />
ist hier die Frage, welche Ziele man erreichen<br />
möchte. Generell gibt es im Prozessmanagement<br />
drei Säulen zur Erhöhung der<br />
Lebensqualität und Patientenzufriedenheit:<br />
• Die Qualität soll erhöht, gleichzeitig müssen<br />
Fehler eliminiert werden.<br />
• Der Prozess soll kostengünstig sein.<br />
• Eine Reduzierung der Durchlaufzeit soll ermöglicht<br />
werden.<br />
Idealer Weise werden alle drei Säulen gleichwertig<br />
berücksichtigt. (s. Abb. 2 »Elemente des<br />
Prozessmanagements«)<br />
Entlassmanagement<br />
Abbildung 2:<br />
Elemente des<br />
Prozessmanagements<br />
Quelle:<br />
Zapp, W. (2010): S. 35<br />
in Anlehnung an Gaitanides,<br />
M., Scholz, R., Vrohlings,<br />
A. (1994): S. 16<br />
<strong>VKD</strong>-<strong>Praxisberichte</strong> <strong>2015</strong> | Patientensicherheit und Entlassmanagement 61
Entlassmanagement<br />
Ausschlaggebend für die Entscheidung für eine<br />
bestimmte Prozessgestaltung war die Nutzung<br />
von Wirtschaftlichkeitsreserven. Die Anwendung<br />
der Prozesskostenrechnung stand<br />
anfangs auch zur Auswahl, wurde dann jedoch<br />
nicht weiter verfolgt. Der Grund war, dass die<br />
Prozesskostenrechnung ein sehr aufwändiges<br />
Instrument ist. Sie kann gegebenenfalls fallweise<br />
eingesetzt werden. Die reine Berechnung<br />
der Prozesskosten führt auch nicht zu einer<br />
Reduzierung der Kosten. Die Ergebnisse müssten<br />
mit anderen verglichen werden. Es war daher<br />
kritisch zu hinterfragen, ob nicht eher die<br />
bereits angewendeten Kostenrechnungssysteme<br />
(z.B. flexible Plankostenrechnung oder<br />
Deckungsbeitragsrechnung) als aussagefähige<br />
Instrumente ausgebaut werden sollten. Ergänzt<br />
um ein Prozesscontrolling können sie als<br />
Grundlage von Managemententscheidungen<br />
herangezogen werden.<br />
Im Rahmen des Optimierungsprozesses wurde<br />
der Zeitfaktor als eines der wichtigsten Optimierungskriterien<br />
verfolgt, da durch eine erhöhte<br />
Prozessdauer die Kosten in der Regel<br />
steigen, das Wohlbefinden sowie die Zufriedenheit<br />
des Patienten dagegen abnehmen. Das<br />
Messen bzw. die Reduzierung der Durchlaufzeiten<br />
ist daher ein entscheidendes Kriterium.<br />
Gute Ideen und Vorschläge für die Entlassung<br />
bietet der Expertenstandard »Entlassungsmanagement<br />
in der Pflege«. Besonders Patienten<br />
bestimmter Risikogruppen für poststationäre<br />
Probleme können durch die Empfehlungen<br />
optimaler übergeleitet werden. Insbesondere<br />
kann der so genannte »Drehtüreffekt« und damit<br />
auch die Fallzusammenführungen (nach §2<br />
FPV) mit einer gut organisierten Überleitung<br />
reduziert werden.<br />
Neben dem »Expertenstandard Entlassungsmanagement<br />
in der Pflege« wurde für die Sollkonzeption<br />
maßgeblich das Prinzip des »Lean<br />
Hospital Management« berücksichtigt. Dabei<br />
sollen die Prozesse und Teilschritte patientenorientierter<br />
gestaltet und Verschwendung<br />
(muda) reduziert werden. Dazu gehört beispielsweise<br />
die Vermeidung von Doppeluntersuchungen,<br />
aber auch die Reduzierung von<br />
Leerzeiten/Liegezeiten. Es geht also nicht um<br />
die Verkürzung der Verweildauer insgesamt,<br />
sondern um die Zeit, in der mit oder am Patienten<br />
nichts geschieht, d.h. keine Diagnostik,<br />
keine Behandlung, kein Transport.<br />
Case Management installiert<br />
Für die Entlassung des Patienten ist es wichtig,<br />
dass die Überleitung in die poststationäre<br />
Phase frühzeitig geplant wird. Gerade das war<br />
ein entscheidender Punkt dafür, im Einbecker<br />
BürgerHospital ein Case Management zu installieren,<br />
das den gesamten Fall von Anfang bis<br />
zum Ende begleitet.<br />
Interdisziplinäre Visite eingeführt<br />
Von großer Bedeutung war außerdem die Einführung<br />
einer interdisziplinären Visite, an der<br />
die Berufsgruppen Pflegedienst, Überleitungsbzw.<br />
Case-Mangement, Ärzte und das medizinische<br />
Controlling teilnehmen. Ziel ist eine<br />
verbesserte Kommunikation untereinander.<br />
Gleichzeitig sollen alle jederzeit einen gemeinsamen<br />
Kenntnisstand zum Zustand des jeweiligen<br />
Patienten, zu Statusveränderungen und<br />
zu den noch notwendigen Behandlungstagen<br />
haben – ein roter Faden, an dem sich die beteiligten<br />
Berufsgruppen orientieren können.<br />
Die nächsten Behandlungsschritte können so<br />
frühzeitig geplant und verbindlich vereinbart<br />
werden. Hiermit soll eine Verkürzung der Leerzeiten/Liegezeiten<br />
erreicht werden. Wenn ein<br />
Patient mehrere Tage ohne Diagnostik und Therapie<br />
im Krankenhaus verbringt, ist dies nicht<br />
nur unwirtschaftlich, sondern auch nicht im<br />
Interesse des Patienten.<br />
Bessere Absprache zur poststationären<br />
Medikamentenversorgung<br />
Eine verbesserte Absprache bezüglich der<br />
poststationären Medikamentenversorgung ist<br />
ebenfalls Teil des Sollkonzepts. Sowohl die Patienten<br />
als auch die Pflege müssen rechtzeitig<br />
wissen, wie die weitere Medikamentenversorgung<br />
verläuft. Sollen Medikamente mitgegeben<br />
werden, wenn ja, in welchem Ausmaß oder kann<br />
der Hausarzt für eine Rezeptierung konsultiert<br />
werden? Entlassungszeitpunkt und Öffnungszeiten<br />
des niedergelassenen Arztes müssen<br />
übereinstimmen. Eine Alternative zur Ausstellung<br />
von Rezepten kann auch die kassenärztliche<br />
Notdienstambulanz sein.<br />
Diagnostik-Aufträge<br />
künftig systembasiert<br />
Für eine schnellere Bearbeitung und geringeren<br />
Aufwand für Arzt und Pflege sollen die<br />
Diagnostik-Aufträge in Zukunft systembasiert<br />
über das ORBIS angefordert werden. Allerdings<br />
wurde die Umstellung der Diagnostik-Aufträge<br />
bereits vor der Prozessanalyse in Betracht gezogen.<br />
Eine Arbeitsgruppe dafür ist bereits gebildet<br />
worden.<br />
Aufenthaltslounge für<br />
zu entlassende Patienten<br />
Damit am Tag der Entlassung das Zimmer respektive<br />
das Bett des Patienten möglichst<br />
schnell für den nächsten Patienten zur Verfü-<br />
62<br />
<strong>VKD</strong>-<strong>Praxisberichte</strong> <strong>2015</strong> | Patientensicherheit und Entlassmanagement
Entlassmanagement<br />
gung stehen, soll in den kommenden Monaten<br />
eine Aufenthaltslounge entstehen. Hier können<br />
die zu entlassenden Patienten warten, bis<br />
der Entlassungsbrief oder andere Dokumente<br />
fertiggestellt sind. Mit modernem Flat-TV,<br />
aktueller Tageszeitung und einer Auswahl an<br />
Zeitschriften lässt sich die Wartezeit gut verbringen.<br />
Ein Kaffee- oder Getränkeautomat<br />
steht ebenfalls zur Verfügung. Es besteht zudem<br />
immer die Möglichkeit, auf fachliche Hilfe<br />
zurückzugreifen.<br />
Veränderung des Entlassbriefes<br />
Verändert wird auch der Entlassungsbrief. Bisher<br />
wurde er nur für den weiterbehandelnden<br />
Arzt formuliert. Für die poststationäre<br />
Behandlung ist das zwar sehr wichtig, für die<br />
Information des Patienten hat er allerdings<br />
keinen direkten Wert. Häufig sind die klassischen<br />
Entlassungsbriefe so formuliert, dass<br />
viele Patienten den Inhalt nicht verstehen. Zwar<br />
werden Diagnosen, Verlauf, neuverordnete Medikamente<br />
und das weitere Vorgehen nach dem<br />
Krankenhausaufenthalt oft im Arzt-Patienten-<br />
Gespräch behandelt, doch gerade ältere Patienten<br />
vergessen den Inhalt dieses Gesprächs<br />
oft. Ein für den Patienten verständlicher Entlassungsbrief<br />
mit kurzem und prägnantem Inhalt<br />
würde daher den Wert für ihn selbst steigern.<br />
Inhaltlich sollte der Brief die Diagnosen<br />
und den Verlauf beschreiben. Die neuverordnete<br />
oder geänderte Medikation sollte ebenfalls<br />
verständlich abgebildet werden. Weitere Empfehlungen<br />
wie Mobilisierung, sportliche Aktivitäten,<br />
Ernährung oder weitere Facharztbesuche<br />
könnten ebenfalls dazu gehören.<br />
Die Änderungen im Überblick<br />
• Einführung eines Case-Managements (Qualitätsverbesserung und Verkürzung der<br />
Verweildauer, insbesondere der Liegezeiten)<br />
• Einführung einer interdisziplinären Visite mit den Berufsgruppen Pflege, Case-<br />
Management, Ärzten und medizinischem Controlling (bessere Kommunikation,<br />
Transparenz und roter Faden für Patienten und Mitarbeiter, Reduzierung der<br />
Liegezeiten)<br />
• Bessere Absprache der poststationären Medikamentenversorgung (Patientenorientierung,<br />
Meidung von Versorgungsbrüchen)<br />
• Änderung der Diagnostik-Aufträge - statt Formulare in Zukunft systembasiert<br />
über ORBIS (Reduzierung von Liegezeiten, Beschleunigung der Transferzeit vom<br />
Antragsteller zum Durchführenden)<br />
• Errichtung einer Aufenthaltslounge für zu entlassende Patienten (Patientenorientierung,<br />
nachgelagerte Prozesse werden weniger beeinträchtigt)<br />
• Einführung eines zusätzlichen, für Patienten verständlichen Entlassungsbriefes<br />
(Patientenorientierung, Wertschöpfung für den Kunden (Patienten) erhöhen.)<br />
Das Einbecker BürgerSpital<br />
Foto: Franke/connectHC<br />
<strong>VKD</strong>-<strong>Praxisberichte</strong> <strong>2015</strong> | Patientensicherheit und Entlassmanagement 63
Entlassmanagement<br />
Abbildung 3:<br />
Der Entlassungsprozess.<br />
Eigene Darstellung in Anlehnung an GSG Consulting GmbH sowie Service Blueprinting<br />
Quelle: Zapp,W. Dorenkamp, A. (2002): S.127 sowie Schubert, E. (2013): S. 59)<br />
Abbildung 3 stellt den Entlassungsprozess in<br />
Form eines Prozessplans dar, wobei nicht alle<br />
Teilschritte und nicht alle genannten Verbesserungen<br />
abgebildet sind. Die Arbeitsteilung soll<br />
die Fragen »Wer macht was, wann, in welcher<br />
Reihenfolge?« beantworten.<br />
Fazit<br />
Gibt es also Hoffnung beim Entlassmanagement?<br />
Ein deutliches »Ja« ist die Antwort. In<br />
allen Bereichen des Krankenhauses hat sich die<br />
Erkenntnis durchgesetzt, dass die strukturierte<br />
Entlassung nicht nur ein erlös- und kostenrelevantes<br />
Thema darstellt, sondern dem Patienten<br />
und seinen Angehörigen ebenso wie den nachsorgenden<br />
Einrichtungen entgegenkommt. Zudem<br />
lassen sich viele Abläufe im Krankenhaus<br />
vernünftiger und schlanker gestalten. Auch<br />
wenn es auf dem praktischen Weg immer noch<br />
Fallstricken geben wird – es lohnt sich!<br />
Umfangreiche Literaturliste und Quellen<br />
bei den Verfassern<br />
Der Dank gilt Prof. Dr. Winfried Zapp von<br />
der Hochschule Osnabrück, dessen wichtige<br />
Arbeiten zum Prozessmanagement für die<br />
Vorbereitung und Umsetzung des Projektes<br />
„Entlassmanagement im Einbecker BürgerHospital“<br />
von großem Wert und großer<br />
Hilfe waren.<br />
64<br />
<strong>VKD</strong>-<strong>Praxisberichte</strong> <strong>2015</strong> | Patientensicherheit und Entlassmanagement
Verlegungsmanagement:<br />
Krankenhaus - Pflegeeinrichtung –<br />
Krankenhaus<br />
Strukturierte Überleitung sichert Weiterversorgung und Behandlungsergebnisse<br />
Entlassmanagement<br />
Das Klinikum Ingolstadt gehört mit rund 3.300 Mitarbeitern und 21 Kliniken und<br />
Instituten zu den größten Unternehmen in der Region. Der Gesundheitscampus<br />
rund um das Schwerpunktkrankenhaus umfasst ein Ärzte-Haus, ein Geriatrie- und<br />
Rehazentrum, ein Hollis-Facharztzentrum mit allen Disziplinen der Medizin sowie<br />
gewerblichen und sozialen Anbietern. Im Jahr 2012 wurde darüber hinaus ein neues<br />
Alten- und Pflegeheim mit 160 Betten, orientiert an einem modernen Pflegekonzept,<br />
in Betrieb genommen. In der im Ärztehaus ansässigen Gesundheits-Akademie des<br />
Klinikums werden für interne und externe Teilnehmer Seminare, Fort- und Weiterbildungen<br />
sowie Kurse aus verschiedenen aktuellen Themenbereichen angeboten.<br />
Nicht erst seitdem der Gesetzgeber den Krankenhäusern<br />
die Pflicht zum Entlassmanagement<br />
ins Gesetz geschrieben hat, bemüht<br />
sich das Klinikum Ingolstadt darum. Vielfach<br />
geht es dabei nicht nur um die Entlassung eines<br />
Patienten, sondern um die strukturierte<br />
Verlegung in eine andere Versorgungsform. In<br />
enger Zusammenarbeit mit ambulanten Pflegediensten<br />
und weiteren Pflegeheimen wurde<br />
ein Pflegeüberleitungsbogen erarbeitet, der<br />
eine reibungslose Entlassung in eine Weiterversorgung<br />
durch einen gesicherten und einheitlichen<br />
Informationsfluss unterstützen<br />
sollte. Die Anwendungserfahrungen sind gut,<br />
allerdings werden durch sich kontinuierlich<br />
verändernde Rahmenbedingungen immer Anpassungen<br />
und gemeinsame Weiterentwicklung<br />
notwendig bleiben, um den gemeinsamen<br />
Informationsbedarfen im Sinne des Patienten<br />
bzw. Bewohners jederzeit gerecht werden zu<br />
können.<br />
Für einen wirtschaftlichen Betrieb sind Krankenhäuser<br />
gezwungen, alle Prozesse von der<br />
Aufnahme bis zur Entlassung fallgruppenebenso<br />
wie einzelfallbezogen so exakt und früh<br />
wie möglich voraus zu planen, um Abweichrisiken<br />
rechtzeitig zu erkennen und entsprechend<br />
steuern zu können. Mit der Einführung von<br />
Versorgungspfaden und einem Fallmanagement<br />
werden im Klinikum Ingolstadt komplexe<br />
Versorgungsprozesse geplant, koordiniert und<br />
überwacht. Zur Vermeidung von Wiederaufnahmen,<br />
die hauptsächlich für die Patienten sehr<br />
belastend sein können, aber auch ein finanzielles<br />
Problem für das Krankenhaus darstellen,<br />
muss die Versorgung des Patienten nach seiner<br />
Entlassung sicher und nahtlos, seiner Situation<br />
entsprechend, gewährleistet sein. Dazu gehört<br />
neben der ärztlichen Nachsorge durch den niedergelassenen<br />
Haus- und/oder Facharzt insbesondere<br />
bei älteren Patienten auch eine die Situation<br />
stabilisierende, qualifizierte Pflege. All<br />
dies kann durch ein gut organisiertes Entlassoder<br />
Überleitungsmanagement zielgerichtet<br />
vorbereitet werden.<br />
Verbindliche Absprachen<br />
aller Beteiligten<br />
Durch das Entlassmanagement soll die bedarfsadäquate<br />
Versorgung nach der Übergabe<br />
an weitere Anbieter von Gesundheitsleistungen<br />
sichergestellt werden. Dafür ist eine patienten-<br />
und situationsorientierte Kommunikation<br />
zwischen den beteiligten ambulanten und stationären<br />
Leistungserbringern grundlegend und<br />
unabdingbar.<br />
Zu einer geplanten und sicheren Entlassung<br />
aus der akutstationären Behandlung im Krankenhaus<br />
gehört bei weitem mehr als die Übermittlung<br />
der medizinischen Diagnose an den<br />
nachbehandelnden und -betreuenden Bereich.<br />
Der Patient und seine Angehörigen müssen von<br />
Anfang an mit in die Planung einbezogen und<br />
über jeden Schritt in verständlicher Form informiert<br />
sein, um vermeidbare Unsicherheit auszuschließen.<br />
So kann bereits im Krankenhaus<br />
die erforderliche Pflege nach der Entlassung,<br />
Franz Hartinger<br />
Einrichtungsleiter Altenund<br />
Pflegeheim Klinikum<br />
Ingolstadt GmbH, Vorsitzender<br />
der Fachgruppe<br />
Pflegeeinrichtungen des<br />
Verbandes der Krankenhausdirektoren<br />
Deutschlands<br />
(<strong>VKD</strong>)<br />
<strong>VKD</strong>-<strong>Praxisberichte</strong> <strong>2015</strong> | Patientensicherheit und Entlassmanagement 65
Entlassmanagement<br />
»Gut beraten sind Krankenhäuser,<br />
die kooperative<br />
Fallmanagementkonzepte<br />
mit ambulanten Pflegediensten<br />
und Pflegeeinrichtungen<br />
pflegen, um das<br />
Zusammenspiel der Bereiche<br />
im Sinne einer positiven<br />
Weiterentwicklung bereits<br />
erfolgter Lösungsschritte zu<br />
intensivieren und durch die<br />
gemeinsame Verantwortung<br />
für ein reibungsarmes<br />
Verlegungsmanagement<br />
dem Anspruch der übergreifenden<br />
Prozessorientierung<br />
und –optimierung<br />
Rechnung tragen.«<br />
Franz Hartinger<br />
unter Berücksichtigung der familiären Umgebungssituation,<br />
gemeinsam organisiert werden.<br />
Dabei muss die Gefahr einer möglichen Überforderung<br />
pflegender Angehöriger durch die<br />
involvierten Experten immer mit im Blick behalten<br />
werden.<br />
Um eine zeitgerechte Entlassung aus dem<br />
Krankenhaus zu erreichen, sind nach Erstellung<br />
der Planung mit allen am weiteren Versorgungsprozess<br />
beteiligten Personen und Institutionen<br />
verbindliche Absprachen zu treffen.<br />
Für den Patienten ist die Abstimmung zwischen<br />
Hausarzt, ambulantem Pflegedienst, Apotheken<br />
sowie Sanitätshäusern, Therapeuten und<br />
nicht zuletzt den Angehörigen sehr wichtig,<br />
denn die Erwartungen der einzelnen Akteure<br />
sind oft völlig unterschiedlich und müssen auf<br />
einen Nenner gebracht werden. Bei fehlender<br />
oder ungenügender Abstimmung ist der Patient<br />
der Leidtragende, möglicherweise mit der Konsequenz<br />
der Rehospitalisierung, die, wie bereits<br />
erwähnt, auch für das Krankenhaus ein Problem<br />
darstellen kann.<br />
Gemeinsamer Überleitungsbogen<br />
Um die Überleitung der betreffenden Patienten<br />
strukturiert organisieren zu können, entstand<br />
vor einigen Jahren in enger Zusammenarbeit<br />
mit ambulanten Pflegediensten und weiteren<br />
Pflegeheimen ein sog. Pflegeüberleitungsbogen,<br />
der eine reibungslose Entlassung in eine<br />
Weiterversorgung durch einen gesicherten und<br />
einheitlichen Informationsfluss unterstützen<br />
sollte.<br />
Der Überleitungsbogen ist so strukturiert, dass<br />
er die für die Versorgung wesentlichsten Informationen<br />
enthält. Es werden Fragen beantwortet,<br />
die bei der Verlegung oder Entlassung eines<br />
Patienten an den behandelnden Haus- oder<br />
Facharzt, den ambulanten Pflegedienst oder<br />
auch in ein Pflegeheim gestellt werden müssen,<br />
um eine optimale Weiterbehandlung oder –betreuung<br />
zu sichern Das Formular ist als Pendelinstrument<br />
konzipiert. Es begleitet den Patienten<br />
bzw. Bewohner immer, wenn eine Verlegung<br />
zwischen den Bereichen erfolgt und enthält so<br />
immer die aktuellsten Informationen aus dem<br />
Krankenhaus für den nachbehandelnden/-versorgenden<br />
Bereich und umgekehrt.<br />
Dabei handelt es sich einerseits um Basisinformationen<br />
zur Betroffenensituation sowie den<br />
Einweisungsgrund bzw. die –diagnose, Zuständigkeiten,<br />
Kontakte und Erreichbarkeit der involvierten<br />
Institutionen und Personen.<br />
Darüber hinaus sind Informationen über die<br />
familiäre, soziale und Betreuungssituation mit<br />
entsprechenden Hinweisen auf einschlägige<br />
Dokumente, wie z.B. Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung<br />
etc., sowie den aktuellen Stand<br />
hinsichtlich der Weiterversorgungssituation<br />
enthalten.<br />
Wichtige behandlungs- und versorgungsrelevante<br />
Informationen zur Medikation, zu Diagnosen,<br />
Therapie, Risiken, Pflegebedarf, Mobilität,<br />
Ernährungs- und Allgemeinzustand,<br />
persönlichen Gewohnheiten etc. sowie zu den<br />
benötigten bzw. mitgeführten persönlichen<br />
Hilfsmitteln und Papieren werden im Einzelnen<br />
aufgeführt<br />
Diese umfangreichen, aber notwendigen Informationen<br />
sorgen dafür, dass der Übergang für<br />
die betreffenden Patienten/Bewohner möglichst<br />
wenige Schnittstellenprobleme mit sich<br />
bringt und alle, die sich mit seiner Behandlung,<br />
Pflege und Versorgung beschäftigen, auf dem<br />
gleichen Kenntnisstand sind. Das dient der<br />
Patientensicherheit, sorgt für Nachhaltigkeit,<br />
dient dem Erfolg der Behandlung, ermöglicht<br />
eine Verbesserung der Prozesse über Sektorengrenzen<br />
hinaus und ist daher auch wirtschaftlicher.<br />
Das neue Alten- und Pflegeheim Klinikum Ingolstadt<br />
Im Vordergrund steht bei einer gut geplanten<br />
und koordinierten Überleitung mit Blick auf<br />
die Vermeidung zu langer Krankenhausaufenthalte<br />
und häufiger, kurz aufeinanderfolgender<br />
Wiedereinweisungen in erster Linie immer das<br />
Patientenwohl, denn alle beteiligten Professionen<br />
und Institutionen sind den Grundsätzen<br />
der Qualität, Humanität und Wirtschaftlichkeit<br />
verpflichtet. Das bedeutet auch immer, den Patienten<br />
und seine Angehörigen in seiner/ihrer<br />
Würde und Autonomie zu respektieren sowie<br />
ihn/sie von Anfang an in den Versorgungsprozess<br />
mit einzubeziehen.<br />
66<br />
<strong>VKD</strong>-<strong>Praxisberichte</strong> <strong>2015</strong> | Patientensicherheit und Entlassmanagement
Entlassmanagement<br />
Strukturierte Verlegungen<br />
auch durch Konsiliarärzte<br />
Seit 2013 hat sich nun die Situation in Ingolstadt<br />
weiter verändert. Als der Überleitungsbogen<br />
entstand, gab es noch mehr ambulante<br />
Pflegedienste und das Klinikum konnte mehr<br />
stationäre Pflegeplätze anbieten, da es selbst<br />
über rund 100 stationäre eigene Pflegeplätze<br />
mehr verfügte. Mit der Eröffnung einer neuen<br />
Pflegeeinrichtung wurden diese um insgesamt<br />
80 somatische Plätze reduziert und an andere<br />
Heimbetreiber übergeben. Die klinikeigene<br />
Einrichtung ist nun ausschließlich psychiatrischen<br />
Pflegefällen vorbehalten und voll belegt.<br />
Die Verlegungen der noch vorhandenen psychiatrischen<br />
Bewohner in das Zentrum für psychische<br />
Gesundheit im Klinikum Ingolstadt und<br />
zurück, läuft sehr strukturiert ab. Hier spielt<br />
der Überleitungsbogen nicht dieselbe Rolle wie<br />
bei Verlegungen in externe Pflegeeinrichtungen<br />
oder zu ambulanten Diensten. Der Grund dafür<br />
ist, dass die Bewohner bei bestimmten Voraussetzungen<br />
durch dieselben Ärzte konsiliarisch<br />
sowohl im Heim als auch im Krankenhaus versorgt<br />
werden und eine Vielzahl von ihnen immer<br />
wieder im Klinikum in akutstationärer, psychiatrischer<br />
Behandlung ist und damit auch dem<br />
dortigen Pflegepersonal oft gut bekannt ist.<br />
Notwendigkeit strukturierter<br />
Verlegungen wächst<br />
Nicht jeder Patient des Krankenhauses benötigt<br />
eine umfangreich gesteuerte Entlassung.<br />
Der Bedarf für und der Anspruch an eine<br />
strukturierte Überleitung von Patienten in die<br />
Klinik hinein und von der Klinik in andere Betreuungsbereiche<br />
wird aus bekannten Gründen<br />
aber immer mehr zunehmen. Die Zahl der<br />
pflegebedürftigen Menschen wächst mit der<br />
demografischen Entwicklung. Die Zahl der Behandlungsfälle<br />
im Krankenhaus steigt damit<br />
ebenfalls. Gegenläufig entwickelt sich die Anzahl<br />
akutstationärer Betten.<br />
Für gemeinsame Mahlzeiten in der psychiatrischen Eingliederungshilfe<br />
Inzwischen stellen die Patienten ab 75 Jahre<br />
die bedeutendste Gruppe derjenigen, die aus<br />
dem Krankenhaus entlassen werden. Die über<br />
Achtzigjährigen leiden vielfach unter mehreren<br />
Krankheiten (Multimorbidität) und sind<br />
häufig hilfe- und pflegebedürftig. Diese Patientengruppe<br />
hat einen erhöhten poststationären<br />
Hilfebedarf und benötigt zwingend eine<br />
professionelle Überleitung. Allerdings bildet<br />
das Vergütungssystem der DRGs als Maßnahme<br />
zur Kostensenkung und Verweildauerverkürzung<br />
in Krankenhäusern diesen notwendigen<br />
Betreuungsaufwand nicht ab. Die Kliniken<br />
sind dennoch gefordert, in einer letztlich vorgegebenen<br />
Zeit ihre Leistungen zu erbringen.<br />
Gleichzeitig haben sie zu beachten, dass der<br />
erhöhte Zeit- und Kostendruck nicht zu einer<br />
Unterversorgung führt. Außerdem geht die<br />
Wiederaufnahme innerhalb kurzer Zeit nach einem<br />
akutstationären Aufenthalt mit derselben<br />
Diagnose zu deren finanziellen Lasten.<br />
Angesichts der in vielen Krankenhäusern zu<br />
konstatierenden notorischen Finanzprobleme<br />
müssten die Verweildauern als Möglichkeit der<br />
Kostensenkung weiter verkürzt werden. Das ist<br />
aber gerade angesichts der zunehmenden Zahl<br />
hochbetagter und alter Patienten mit ihren typischen<br />
Erkrankungen nicht mehr in dem Maße<br />
möglich, wie vielleicht in den 1990er Jahren.<br />
Zu bedenken ist außerdem, dass mit der Versorgungskomprimierung<br />
und der damit verbundenen<br />
Intensivierung des Behandlungsund<br />
Pflegeaufwandes nicht zwingend Kosten<br />
gespart werden, da die Leistungsdichte pro Patient<br />
und Tag steigt.<br />
Probleme<br />
Die meisten Patienten können nach der Krankenhausentlassung<br />
zurück in die eigene Häuslichkeit<br />
und werden sehr häufig durch Angehörige<br />
und ggf. mit Unterstützung eines<br />
ambulanten Pflegedienstes ausreichend versorgt.<br />
Gerade bei Patienten, die aufgrund eines<br />
akuten Ereignisses (Unfall, Schlaganfall,<br />
Herzinfarkt u. a.) bzw. einer entgleisten Grunderkrankung<br />
(z. B. Demenz, Herzinsuffizienz, u.<br />
a.) einen stationären Aufenthalt benötigen, ist<br />
die Nachversorgung jedoch trotz verschiedener<br />
Bemühungen der Krankenhäuser für die Patienten<br />
in ihrer Versorgungsrealität bisher nicht<br />
ausreichend geregelt, weil es vielfach an einem<br />
strukturierten Entlassmanagement fehlt.<br />
<strong>VKD</strong>-<strong>Praxisberichte</strong> <strong>2015</strong> | Patientensicherheit und Entlassmanagement 67
Entlassmanagement<br />
Eines der Zimmer<br />
im psychiatrischen<br />
Bereich<br />
Fotos: Klinikum Ingolstadt<br />
Ist die Rückkehr an den bisherigen Lebensort<br />
nicht ausreichend sichergestellt, ist zur Kontinuität<br />
der Versorgung eine stationäre Pflegeeinrichtung<br />
für einen Kurzzeitpflegeaufenthalt<br />
oder dauerhaft zu finden. Letzteres erfordert<br />
die Einstufung in eine Pflegestufe. Ein Problem<br />
ist es häufig auch, für den Patienten zügig eine<br />
notwendige Rehabilitation zu ermöglichen.<br />
Nicht alle am Entscheidungs- und Genehmigungsprozess<br />
Beteiligten können so zeitnah<br />
handeln, wie es für eine notwendige Verlegung<br />
erforderlich wäre. Erschwerend kommt hinzu,<br />
dass ein freier Platz in einer Rehabilitationseinrichtung<br />
nicht die Regel ist.<br />
Mit all diesen Problemen ist nicht nur das verlegende<br />
Krankenhaus konfrontiert. Auch die<br />
Anforderungsliste für Patient und Angehörige<br />
wird nicht kürzer. Insbesondere bei unvorhergesehenen<br />
Verlegungen in Pflegeeinrichtungen<br />
sind die Angehörigen stark belastet. Die wiederum<br />
meist älteren, teils hochbetagten Patienten<br />
und ihre oftmals gleichaltrigen Angehörigen<br />
benötigen dringend Hilfe durch weitere<br />
Personen.<br />
Während die Patienten eine Verlegung von einem<br />
Krankenhaus in eine stationäre Pflegeeinrichtung<br />
nicht selten als interne Verlegung im<br />
Krankenhaus erleben, ist für die Angehörigen<br />
ein enormer administrativer Aufwand zu bewältigen.<br />
Dabei erwarten Angehörige bei einer<br />
Verlegung in eine weitere stationäre Einrichtung,<br />
dass alle notwendigen Dinge durch die<br />
beteiligten Institutionen erledigt werden. Hier<br />
bedarf es großer Unterstützung, um es bei der<br />
Verlegung nicht zu einem Versorgungseinbruch<br />
kommen zu lassen.<br />
Das bedeutet auch, dass Patient und Angehörige<br />
ausreichend informiert werden und alle<br />
erforderlichen Heil- und Hilfsmittel sowie die<br />
dazu notwendigen Verordnungen zum Zeitpunkt<br />
der Verlegung bereitstehen bzw. vorliegen.<br />
Verschiedentlich kommt es bei unvorhergesehenen<br />
Verlegungen in Pflegeeinrichtungen<br />
auch dazu, dass der bislang vertraute Hausarzt<br />
aus Entfernungsgründen seinen Patienten nicht<br />
weiter versorgen kann und zeitnah ein neuer<br />
vom Patienten gewählt werden muss. Grundsätzlich<br />
halten weder Pflege- noch Rehabilitationseinrichtungen<br />
freie Plätze vor, die eine<br />
notfallmäßige Aufnahme ermöglichen. In vielen<br />
Regionen sind stationäre (Kurzzeit-) Pflegeplätze<br />
Mangelware und die Einrichtungen führen<br />
Wartelisten. Hier wird der Entlassungsaufwand<br />
aus dem Krankenhaus bzw. die Aufnahme<br />
in eine Folgeeinrichtung durch zusätzliche Anforderungen<br />
erhöht.<br />
Fazit<br />
Eine kontinuierliche poststationäre Versorgung<br />
der Patienten erfordert ein Pflegeassessment<br />
durch die verlegende Einrichtung als Basis für<br />
die bereichs- und sektorenübergreifende Behandlung<br />
und Betreuung. Ziel ist, Folgeschäden<br />
für den Patienten und Folgekosten für das<br />
Krankenhaus durch Versorgungseinschnitte<br />
zu vermeiden. Durch eine geplante und abgestimmte<br />
Überleitung können Patienten früher<br />
entlassen werden und niedergelassene Ärzte<br />
die Behandlung bei gleichzeitiger organisatorischer<br />
Entlastung fortführen. Ambulante Pflegedienste<br />
oder die nachfolgende Einrichtung<br />
profitieren dabei von der verbesserten Koordination.<br />
Je nach Notwendigkeit sind dafür unterschiedliche<br />
Maßnahmen erforderlich. Pflegeüberleitung<br />
ist ein Prozess, der sich eng auf den<br />
Zustand und die Bedürfnisse der betreffenden<br />
Patienten einstellen muss. Das beginnt bereits<br />
bei der Aufnahme ins Krankenhaus.<br />
Gut beraten sind Krankenhäuser, die kooperative<br />
Fallmanagementkonzepte mit ambulanten<br />
Pflegediensten und Pflegeeinrichtungen<br />
pflegen, um das Zusammenspiel der Bereiche<br />
im Sinne einer positiven Weiterentwicklung<br />
bereits erfolgter Lösungsschritte zu intensivieren<br />
und durch die gemeinsame Verantwortung<br />
für ein reibungsarmes Verlegungsmanagement<br />
dem Anspruch der übergreifenden Prozessorientierung<br />
und –optimierung Rechnung tragen.<br />
Der Gesundheitscampus des Klinikums der Maximalversorgung mit modernstem<br />
Pflegeheim und stationärem Hospiz sowie deren engen Verbindungen in die Kliniken<br />
hinein bietet beste Bedingungen für pflegebedürftige Patienten. Eine Servicestation<br />
als zentrale Anlaufstelle an der Verbindung zwischen Klinikum und Pflegeheim<br />
ermöglicht für Bewohner und Mitarbeiter kurze Wege – eine wichtige räumliche<br />
Voraussetzung für eine optimale Versorgung der Heimbewohner. Die unmittelbare<br />
Nähe vor allem zum Zentrum für Psychische Gesundheit ist ideal für die psychisch<br />
kranken Bewohner und auch für die Ärzte. Für alle Bewohner des Heims ergibt sich<br />
- bei Bedarf - neben der haus- und fachärztlichen Versorgung aus der unmittelbaren<br />
Anbindung an das Klinikum ein direkter Zugang zur medizinischen Kompetenz.<br />
68<br />
<strong>VKD</strong>-<strong>Praxisberichte</strong> <strong>2015</strong> | Patientensicherheit und Entlassmanagement
Entlassmanagement<br />
Familiale Pflege – der Übergang<br />
vom psychiatrischen Krankenhaus<br />
in die häusliche Pflege<br />
Unterstützung für pflegende Angehörige: Beraten – Begleiten – Schulen - Trainieren<br />
Die LVR Klinik Langenfeld ist ein modernes Fachkrankenhaus für Psychiatrie,<br />
Neurologie und Psychotherapie. Insgesamt werden mehr als 900 Mitarbeiterinnen<br />
und Mitarbeiter beschäftigt. Die Gesamtklinik umfasst 32 Stationen und vier<br />
Tageskliniken mit insgesamt 663 Behandlungsplätzen. Es gibt u.a. Fachabteilungen<br />
für: Allgemeine Psychiatrie, Gerontopsychiatrie und Neurologie, Abhängigkeitserkrankungen,<br />
Forensische Psychiatrie und Therapeutische Dienste.<br />
Um eine Wiedereingliederung in Beruf und Gesellschaft zu erleichtern, wurden<br />
vier Tageskliniken in den Gemeinden des Versorgungsgebietes (zwei allgemeinpsychiatrische<br />
in Leverkusen und Hilden sowie zwei gerontopsychiatrische in<br />
Langenfeld und Solingen) eröffnet. Die Patientinnen und Patienten werden hier<br />
tagsüber professionell und wohnortnah behandelt.<br />
Die Klinik verfügt zudem über spezialisierte Ambulanzen: die Ambulanz für<br />
Migrantinnen und Migranten, zwei Ambulanzen für Abhängigkeitserkrankungen,<br />
eine Ambulanz für geistig behinderte Erwachsene, eine Traumaambulanz, eine<br />
forensische Ambulanz und zwei gerontopsychiatrische Ambulanzen.<br />
Das Einzugsgebiet umfasst die kreisfreien Städte Leverkusen, Solingen, den<br />
mittleren und südlichen Teil des Kreises Mettmann sowie die Städte Leichlingen<br />
und Burscheid.<br />
Silke Ludowisy-Dehl<br />
Pflegedirektorin<br />
LVR-Klinik Langenfeld<br />
Mehr als zwei Drittel der pflegebedürftigen<br />
Menschen in Deutschland werden von ihren<br />
Familien in häuslicher Umgebung versorgt.<br />
Angehörige werden mit einer anstehenden<br />
Pflegesituation häufig erstmalig während<br />
einer Krankenhausbehandlung konfrontiert.<br />
Das Förderprogramm »Familiale Pflege« soll<br />
den Übergang vom Krankenhaus in die häusliche<br />
Pflege optimieren. Vor zwei Jahren wurde<br />
die Psychiatrie in das Förderprogramm aufgenommen.<br />
Die LVR-Klinik Langenfeld berät<br />
seitdem pflegende Familien, deren Angehörige<br />
an Demenz oder Altersdepression leiden.<br />
Seit 2006 besteht das Modellprojekt der Universität<br />
Bielefeld »Familiale Pflege unter den<br />
Bedingungen der G-DRGs«, das von der AOK<br />
Rheinland/Hamburg und der AOK NordWest<br />
gefördert wird. Schwerpunkte sind die Bildung,<br />
Beratung und Unterstützung von pflegenden<br />
Angehörigen im Sinne des SGB XI. Als Unterstützungsleistungen<br />
werden Beratungsgespräche,<br />
Pflegetrainings, Initialpflegekurse und<br />
Gesprächskreise gefördert. In diesem Rahmen<br />
werden Pflegetrainerinnen und Pflegetrainer<br />
ausgebildet, die in ihren Krankenhäusern pflegende<br />
Angehörige beraten und Initialpflegekurse<br />
sowie individuelle Pflegetrainings anbieten.<br />
Die Leistungen können bis sechs Wochen nach<br />
dem Krankenhausaufenthalt in Anspruch genommen<br />
werden. Die Teilnahme an den Initialpflegekursen<br />
hingegen setzt keinen Krankenhausaufenthalt<br />
voraus. Ende 2012 stimmten<br />
die Pflegekassen in Nordrhein-Westfalen einer<br />
Erweiterung des Personenkreises analog<br />
§45a SGB XI zu. Somit können seit 2013 auch in<br />
psychiatrischen Krankenhäusern die Beratung,<br />
Kurse und Pflegetrainings für Angehörige von<br />
Patienten mit Demenz und Altersdepression<br />
angeboten werden.<br />
Schwerpunkt der Beratung sind Familiengespräche<br />
zum Aufbau eines Pflegenetzwerkes<br />
im Rahmen der Entlassungsvorbereitung.<br />
»Die Erfahrung zeigt, dass<br />
unvorbereitete Angehörige<br />
schnell mit der Pflege überfordert<br />
sind. Eine frühzeitige<br />
kritische Auseinandersetzung<br />
mit der Pflegesituation kann<br />
dies abwenden. Die Familiengespräche<br />
sind im Krankenhaus<br />
oder nach der Entlassung<br />
möglich.«<br />
Silke Ludowisy-Dehl<br />
<strong>VKD</strong>-<strong>Praxisberichte</strong> <strong>2015</strong> | Patientensicherheit und Entlassmanagement 69
Entlassmanagement<br />
Die Pflegetrainings sind individuelle aufsuchende<br />
Maßnahmen, die das Lebensumfeld des<br />
Patienten einschließen. Im Gegensatz dazu vermitteln<br />
die Initialpflegekurse grundsätzliche<br />
Kenntnisse in der psychiatrischen Pflege. Die<br />
psychiatrischen Fachklinken des Landschaftsverbandes<br />
Rheinland beteiligen sich seit 2013<br />
an diesem Modellprojekt.<br />
In der LVR-Klinik Langenfeld haben zwei pflegerische<br />
Mitarbeitende der Abteilung für<br />
Gerontopsychiatrie und Neurologie an der<br />
wissenschaftlichen Weiterbildung zum Pflegetrainer<br />
an der Universität Bielefeld teilgenommen.<br />
Schwerpunkte waren die Erweiterung<br />
der Beratungskompetenz, Konzeptionierung<br />
der Initialpflegekurse sowie die Vertiefung der<br />
Kenntnisse zu Demenz und Altersdepression.<br />
Die Mitarbeitenden sind jeweils mit der Hälfte<br />
ihrer wöchentlichen Arbeitszeit in die Angebote<br />
für die Familiale Pflege eingebunden. Mit der<br />
anderen Hälfte übernehmen sie weiterhin ihre<br />
pflegerischen Aufgaben auf den Stationen. Ziel<br />
dieser Aufteilung ist die direkte Kontaktaufnahme<br />
mit den Angehörigen während des stationären<br />
Aufenthalts. So wird ein niederschwelliger<br />
Zugang zu den Angeboten gewährleistet.<br />
Bei Patienten mit Demenz oder Altersdepression<br />
werden regelhaft die Alltagskompetenzen<br />
eingeschätzt. Die Erkenntnisse werden in den<br />
multiprofessionellen Visiten beraten. Bei vorhandenen<br />
erheblichen Einschränkungen werden<br />
die Angehörigen über die Möglichkeiten<br />
der Beratungs- und Schulungsangebote der<br />
Pflegetrainer informiert. Neben der aktiven<br />
Ansprache gibt es einen Flyer, der die Angebote<br />
erläutert und Kontaktdaten der Pflegetrainer<br />
beinhaltet.<br />
Erstgespräch sondiert<br />
Unterstützungsbedarf<br />
Der Einstieg in die Hilfen erfolgt in aller Regel<br />
zu Beginn des stationären Aufenthalts. Wenn<br />
bekannt ist, dass der Patient in einer Pflegestufe<br />
eingestuft ist oder dieses zu erwarten ist,<br />
erfragen die Pflegenden oder die Mitarbeitenden<br />
des Sozialdienstes die weitere Versorgung.<br />
Soll die Pflege von den Angehörigen übernommen<br />
werden, wird ein Erstgespräch bei den<br />
Pflegetrainern angeboten. Die Pflegesituation<br />
wird exploriert und gemeinsam mit den Angehörigen<br />
der Beratungs- und Unterstützungsbedarf<br />
herausgearbeitet. Bereits hier wird darauf<br />
hingewiesen, dass die weiteren Leistungen für<br />
die Angehörigen kostenfrei erbracht werden, da<br />
die Kosten im Rahmen des Modellprogramms<br />
von den beteiligten Krankenkassen übernommen<br />
werden. Es ist auch unerheblich, wo der<br />
Patient versichert ist. Entscheidend ist, dass<br />
eine Pflegestufe (Stufe 0 ist eingeschlossen)<br />
vorliegt bzw. zu erwarten ist.<br />
Pflegetrainings je nach Einzelfall<br />
Aus den Erstgesprächen entwickeln sich die<br />
einzelfallbezogenen Pflegetrainings während<br />
des stationären Aufenthalts. Neben praktischen<br />
Übungen, z.B. Hilfestellung bei der Körperpflege,<br />
erhalten die Angehörigen auch Schulungen<br />
zu der psychiatrischen Erkrankung des betreffenden<br />
Patienten. Derzeit liegt der Schwerpunkt<br />
auf der Demenz und der Altersdepression.<br />
Diese Erkrankungen zeichnet aus, dass sie<br />
bei jedem Menschen andere Beeinträchtigungen<br />
in den Alltagskompetenzen verursachen.<br />
Die Pflegetrainings dienen dazu, bei den Angehörigen<br />
die erforderlichen Kompetenzen für die<br />
Übernahmen der Pflege im häuslichen Bereich<br />
zu entwickeln.<br />
Die enge Einbeziehung der Angehörigen optimiert den Übergang<br />
von der psychiatrischen Klinik in das häusliche Umfeld.<br />
70<br />
<strong>VKD</strong>-<strong>Praxisberichte</strong> <strong>2015</strong> | Patientensicherheit und Entlassmanagement
Entlassmanagement<br />
Durch die zunehmende Verweildauerverkürzung,<br />
nicht nur in der Somatik sondern auch in<br />
der Psychiatrie, reicht der zeitliche Rahmen oft<br />
nicht aus. Daher können bis zu sechs Wochen<br />
nach dem stationären Aufenthalt aufsuchende<br />
Pflegetrainings in der Wohnung des Patienten<br />
durchgeführt werden. Da die Bedingungen zuhause<br />
deutlich andere sind als im Krankenhaus,<br />
erfolgen die Pflegetrainings somit unter realen<br />
Bedingungen.<br />
Für demente Patienten werden neben der somatischen<br />
Pflege insbesondere Inhalte der<br />
Pflegetechnik der Validation vermittelt. Die<br />
Angehörigen lernen die Grundzüge einer bestätigenden<br />
und wertschätzenden Umgangsweise,<br />
um besser mit z.B. herausforderndem Verhalten<br />
der dementen Person umgehen zu können. Den<br />
Auswirkungen der Depression hingegen kann<br />
mit tagestrukturierenden Maßnahmen entgegen<br />
gewirkt werden. Die Pflegetrainer entwickeln<br />
mit den Angehörigen eine Beschäftigungsstrategie.<br />
Dazu werden zunächst frühere<br />
beliebte Aktivitäten ermittelt. Bei der Freude<br />
an Bewegung werden z.B. tägliche Spaziergänge<br />
geplant. Die Pflegetrainer ermuntern zur<br />
Inanspruchnahme von professioneller Pflege,<br />
wenn die Angehörigen an die Grenzen ihrer<br />
Leistungsfähigkeit kommen. Durch die Begleitung<br />
während der schwierigen Anfangssituation<br />
wird die familiale Pflege stabilisiert.<br />
Familienberatungsgespräch (im<br />
Krankenhaus oder in der Familie)<br />
Bei Übernahme der Pflege eines Angehörigen<br />
überblicken die Familien selten, wie sich ihr<br />
Alltag verändern wird. Es ist erforderlich, die<br />
häuslichen Bedingungen für die Versorgung<br />
und Pflege realistisch einzuschätzen und die<br />
Pflegeaufgaben gerecht auf die Familienmitglieder<br />
zu verteilen. Häufig wird der Aufwand<br />
falsch eingeschätzt und die Pflege wird von<br />
nur einem Familienmitglied (häufig Ehepartner<br />
oder Tochter bzw. Sohn) übernommen.<br />
Die Familiengespräche sollen den pflegenden<br />
Angehörigen helfen, ein Pflegenetzwerk aufzubauen,<br />
damit es gelingt, die Pflege in ihren<br />
Alltag einzufügen. Ziel ist es, alle Möglichkeiten<br />
und Ressourcen des sozialen Netzwerkes des<br />
Patienten auszuschöpfen. Die Erfahrung zeigt,<br />
dass unvorbereitete Angehörige schnell mit<br />
der Pflege überfordert sind. Eine frühzeitige<br />
kritische Auseinandersetzung mit der Pflegesituation<br />
kann dies abwenden. Die Familiengespräche<br />
sind im Krankenhaus oder nach der<br />
Entlassung möglich.<br />
Qualitätscheck (in der Familie)<br />
Pflegebedürftige Personen haben einen Anspruch<br />
auf die Versorgung mit Pflegehilfsmitteln<br />
gemäß § 40 SGB XI, wenn diese dazu<br />
geeignet sind, u.a. die Pflege zu erleichtern.<br />
Dazu gehören neben Verbrauchsmitteln auch<br />
technische Hilfsmittel, wie z.B. Pflegebett oder<br />
Rollstuhl. Der Anspruch auf Finanzierung der<br />
Hilfsmittel durch die Pflegekasse umfasst auch<br />
die Kosten der Schulung zur fachgerechten<br />
Nutzung. Die Anwenderschulungen werden regelhaft<br />
durch die Sanitätshäuser durchgeführt,<br />
über die die Pflegehilfsmittel bezogen werden.<br />
Der Anspruch ist den Pflegebedürftigen und ihren<br />
Angehörigen häufig nicht bewusst, notwendige<br />
Pflegehilfsmittel werden nicht beantragt.<br />
Zudem fühlen sich die pflegenden Personen<br />
trotz Produktschulung nicht immer sicher im<br />
Umgang mit dem technischen Pflegehilfsmittel.<br />
Die Pflegetrainer bieten daher zeitnah nach<br />
der Entlassung einen Qualitätscheck an. Neben<br />
der Einschätzung, ob ausreichend Pflegehilfsmittel<br />
vorhanden sind oder richtig eingesetzt<br />
werden, wird auch zu profanen Dingen, wie z.B.<br />
Stolperfallen, beraten.<br />
Im Rahmen der psychiatrischen Behandlung<br />
nimmt die Psychopharmakotherapie eine wichtige<br />
Rolle ein. So gehört zum Qualitätscheck<br />
auch die Einschätzung zur Einnahme und Verträglichkeit<br />
der Medikamente. Zudem wird auf<br />
weitere Beratungsmöglichkeiten, z.B. Wohnraumberatung,<br />
Gerontopsychiatrische Beratung,<br />
Pflegeberatungsstellen, hingewiesen.<br />
Initialpflegekurse<br />
In den Initialpflegekursen haben die pflegenden<br />
Angehörigen die Möglichkeit, mit anderen<br />
Betroffenen in Kontakt zu treten und Grundsätzliches<br />
zur Pflege zu erlernen. Die LVR-<br />
Klinik Langenfeld bietet jeweils einen Pflegekurs<br />
zu Demenz und Altersdepression an. Es<br />
werden Kenntnisse und Fertigkeiten zum Umgang<br />
mit diesen Erkrankungen, insbesondere<br />
mit krisenhaften Zuspitzungen, vermittelt.<br />
Schulungsschwerpunkte sind Kommunikation,<br />
biografische Arbeit, Grundzüge des Pflegeversicherungsrechts<br />
sowie ambulante und stationäre<br />
Hilfsangebote.<br />
Die Teilnehmenden erarbeiten zudem einen<br />
persönlichen Notfallplan, der z.B. das Vorgehen<br />
bei einer Verschlechterung der Pflegesituation<br />
festlegt. Die Kurse werden mit bis zu zehn<br />
Teilnehmenden durchgeführt. Sie laufen über<br />
zwölf Unterrichtsstunden verteilt auf drei Tage.<br />
Die anderthalbjährige praktische Erfahrung<br />
hat gezeigt, dass die psychiatrisch geprägten<br />
Initialpflegekurse deutlich weniger nachgefragt<br />
werden als die individuellen Pflegetrainings.<br />
Das kann zum einem mit der immer noch<br />
<strong>VKD</strong>-<strong>Praxisberichte</strong> <strong>2015</strong> | Patientensicherheit und Entlassmanagement 71
Entlassmanagement<br />
vorhandenen Stigmatisierung psychischer Erkrankungen<br />
zusammenhängen, zum anderen<br />
sind allgemeine Angebote zum Umgang mit<br />
Demenz oder Altersdepression im Einzugsgebiet<br />
der LVR-Klinik Langenfeld ausreichend<br />
vorhanden.<br />
Gesprächskreise für Angehörige<br />
Selbst wenn das Wissen und die Fertigkeiten<br />
erworben sind, stellt die tägliche Pflege für viele<br />
Angehörige eine Belastung dar. Um sich mit<br />
Menschen in ähnlichen Situationen auszutauschen<br />
und gemeinsam nach Lösungsstrategien<br />
zu suchen, werden Gesprächskreise angeboten.<br />
Die Inanspruchnahme ist noch zögerlich. Es<br />
scheint für Angehörige eine große Herausforderung<br />
zu sein, mit fremden Menschen über<br />
ihre Probleme und Ängste zu sprechen, auch<br />
wenn diese sich in der gleichen Situation befinden.<br />
Die Nachfrage der Angehörigen nach Beratung<br />
und individuellen Pflegetrainings hält unvermindert<br />
an. Eine Bewerbung der Angebote war<br />
nicht erforderlich, von Anfang an war das Interesse<br />
der Angehörigen groß. Viele Betroffene<br />
überzeugte die unkomplizierte Art und Weise<br />
der Hilfeleistung. Zudem erleben sie eine Wertschätzung<br />
für ihre Pflegearbeit und erhalten<br />
Beratung sowie Hilfe aus einer Hand.<br />
Hintergrund<br />
Der fortschreitende demografische Wandel wird den Anteil der pflegebedürftigen<br />
älteren Menschen von 2,6 Mio. in 2013 weiter erhöhen. Durch die zunehmende<br />
Lebenserwartung steigt auch das Risiko der Pflegebedürftigkeit im Alter. Pflegebedürftig<br />
sind demnach Menschen, für die wegen einer körperlichen, geistigen oder<br />
seelischen Krankheit oder Behinderung auf Dauer (mindestens sechs Monate) ein<br />
Hilfebedarf im Bereich der Grundpflege und hauswirtschaftlichen Versorgung<br />
besteht (§§ 14 und 15 SGB XI).<br />
Im vergangenem Jahr wurde das Gesetz dahingehend ergänzt, dass auch ein<br />
erheblicher Bedarf an allgemeiner Beaufsichtigung und Betreuung zu einem<br />
Leistungsanspruch führt (§ 45a SGB XI). Der Bedarf liegt vor, wenn aufgrund<br />
demenzbedingter Fähigkeitsstörungen, geistiger Behinderungen oder psychischer<br />
Erkrankungen Menschen in ihrer Alltagskompetenz auf Dauer erheblich eingeschränkt<br />
sind. Bei vielen älteren psychisch kranken Personen liegt zwar keine<br />
Pflegestufe vor, aber ihre Alltagskompetenzen sind als Folge ihrer Erkrankung<br />
dauerhaft und erheblich eingeschränkt.<br />
Mehr als zwei Drittel aller Pflegebedürftigen werden nach Aussage des statistischen<br />
Bundesamtes zu Hause versorgt. Der überwiegende Teil bezieht ausschließlich<br />
Pflegegeld. Das bedeutet, dass die Betreffenden allein durch Angehörige gepflegt<br />
werden. Personen ohne Pflegestufe mit erheblich eingeschränkter Alltagskompetenz<br />
wurden bisher nicht zu den Pflegebedürftigen gerechnet. Aus dem Alltag ist aber<br />
bekannt, dass die Entlassung aus der stationären psychiatrischen Behandlung in<br />
das häusliche Umfeld für viele Angehörige eine schwierige Situation darstellt. Die<br />
kompensatorische Funktion des stationären Aufenthalts ist aufgrund der verkürzten<br />
Verweildauer verschwunden. Angehörige sind gehalten, schnell eine Entscheidung<br />
über die Art und Weise der Pflege zu treffen und diese dann zu organisieren. Häufig<br />
wollen sie die häusliche Pflege selbst übernehmen.<br />
Um den Übergang besser zu begleiten und die Angehörigen auf ihre neuen Aufgaben<br />
vorzubereiten, sind Beratungs- und Schulungsangebote des psychiatrischen Krankenhauses<br />
erforderlich. Somit können Drehtüreffekte verhindert und die häusliche<br />
Pflege stabilisiert werden.<br />
72<br />
<strong>VKD</strong>-<strong>Praxisberichte</strong> <strong>2015</strong> | Patientensicherheit und Entlassmanagement
Impressum<br />
<strong>Praxisberichte</strong><br />
Zu aktuellen Fragen des<br />
Krankenhausmanagements <strong>2015</strong><br />
Kernthemen der Qualität:<br />
Patientensicherheit<br />
und Entlassmanagement<br />
Herausgeber:<br />
Verband der<br />
Krankenhausdirektoren<br />
Deutschlands e.V.<br />
Geschäftsstelle<br />
Oranienburger Straße 17<br />
D-10178 Berlin<br />
www.vkd-online.de<br />
Redaktion:<br />
Angelika Volk<br />
Redaktionsbüro Wirtschaft<br />
und Wissenschaft<br />
Bad Harzburg / Berlin<br />
kontakt@angelika-volk.de<br />
Satz / Layout:<br />
brainvibes.com<br />
D-47647 Kerken<br />
contact@brainvibes.com<br />
Druck und Verarbeitung:<br />
Vesterdruck GmbH<br />
D-47167 Duisburg<br />
www.vesterdruck.de<br />
Auflage:<br />
3.000<br />
Schutzgebühr:<br />
14,90 Euro<br />
ISBN 978-3-00-050612-3
112 Jahre<br />
... und kein bisschen leise !<br />
Gründungstag: 5. Juli 1903<br />
Gründungsort: Dresden<br />
Kernthemen der Qualität:<br />
Patientensicherheit<br />
und Entlassmanagement<br />
ISBN 978-3-00-050612-3