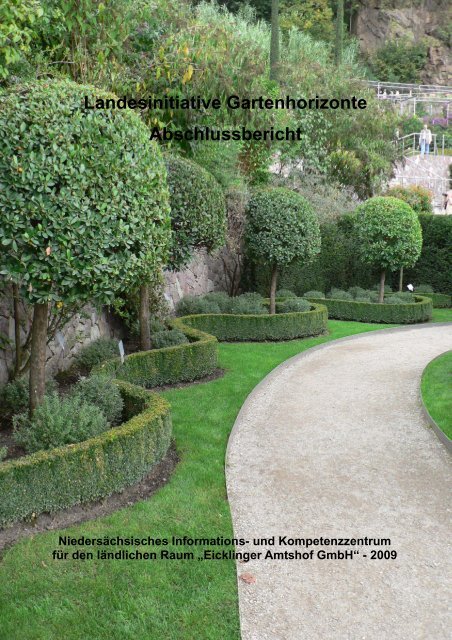Landesinitiative Gartenhorizonte Abschlussbericht
Landesinitiative Gartenhorizonte Abschlussbericht
Landesinitiative Gartenhorizonte Abschlussbericht
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Landesinitiative</strong> <strong>Gartenhorizonte</strong><br />
<strong>Abschlussbericht</strong><br />
Niedersächsisches Informations- und Kompetenzzentrum<br />
für den ländlichen Raum „Eicklinger Amtshof GmbH“ - 2009
<strong>Landesinitiative</strong> <strong>Gartenhorizonte</strong><br />
Studie zur Erarbeitung der Grundlagen für den Aufbau<br />
eines Gartennetzwerks in Niedersachsen<br />
Auftraggeber<br />
Niedersächsisches Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft,<br />
Verbraucherschutz und Landesentwicklung<br />
Referat 104<br />
Calenberger Straße 2<br />
30169 Hannover<br />
Auftragnehmer<br />
Niedersächsisches Informations- und Kompetenzzentrum<br />
für den ländlichen Raum „Eicklinger Amtshof GmbH“<br />
Mühlenweg 60<br />
29358 Eicklingen<br />
Bearbeiter<br />
Dipl.-Ing. Gudrun Viehweg, Landschaftsarchitektin
Inhaltsverzeichnis<br />
<strong>Landesinitiative</strong> GARTENHORIZONTE<br />
1 Zusammenfassung .............................................................................................................................. 5<br />
2 Einleitung ............................................................................................................................................. 6<br />
2.1 Anlass der Studie ........................................................................................................................... 6<br />
2.2 Rahmenbedingungen ..................................................................................................................... 7<br />
2.3 Zielstellung ..................................................................................................................................... 8<br />
2.4 Leitbild für die <strong>Landesinitiative</strong> <strong>Gartenhorizonte</strong> ............................................................................ 9<br />
3 Gremien .............................................................................................................................................. 10<br />
3.1 Steuerungsgruppe ....................................................................................................................... 10<br />
3.2 Arbeitsgruppen ............................................................................................................................. 10<br />
3.2.1 Gartenkultur .......................................................................................................................... 11<br />
3.2.2 Entwicklung und Weiterentwicklung bestehender Anlagen .................................................. 11<br />
3.2.3 Tourismus und Marketing ..................................................................................................... 11<br />
3.2.4 Organisation, Finanzierung und Wirtschaftlichkeit ............................................................... 12<br />
3.3 Zeitraum ....................................................................................................................................... 12<br />
4 Aufgabenstellung und Ergebnisse der Arbeitsgruppen ............................................................... 13<br />
4.1 Arbeitsgruppe Gartenkultur .......................................................................................................... 13<br />
4.2 Arbeitsgruppe Entwicklung und Weiterentwicklung bestehender Anlagen.................................. 14<br />
4.3 Arbeitsgruppe Tourismus und Marketing ..................................................................................... 16<br />
4.4 Arbeitsgruppe Organisation, Finanzierung und Wirtschaftlichkeit ............................................... 17<br />
5 Gesamtergebnis ................................................................................................................................ 18<br />
6 Projektmanagement Gartennetzwerk GARTENHORIZONTE ........................................................ 20<br />
6.1 Initiierungsphase .......................................................................................................................... 20<br />
6.2 Planungs- und Entwicklungsphase .............................................................................................. 20<br />
6.3 Umsetzungsphase ....................................................................................................................... 22<br />
6.3.1 Trägermodellvarianten Gartennetzwerk GARTENHORIZONTE .......................................... 24<br />
6.3.2 Organisationsmodelle ........................................................................................................... 25<br />
7 Ausblick ............................................................................................................................................. 26<br />
8 Anhang ............................................................................................................................................... 27<br />
8.1 Beiträge aus den Arbeitsgruppen ................................................................................................ 27<br />
Eicklinger Amtshof GmbH 3
<strong>Landesinitiative</strong> GARTENHORIZONTE<br />
8.1.1 Arbeitsgruppe Gartenkultur ................................................................................................... 27<br />
8.1.2 Arbeitsgruppe Entwicklung und Weiterentwicklung bestehender Anlagen .......................... 30<br />
8.1.3 Arbeitsgruppe Tourismus und Marketing .............................................................................. 36<br />
8.1.4 Arbeitsgruppe Organisation, Finanzierung und Wirtschaftlichkeit ........................................ 39<br />
8.2 Zeitplan ........................................................................................................................................ 44<br />
8.3 Kosten zur Erstellung einer Internetseite ..................................................................................... 45<br />
8.4 Grundlagenermittlung .................................................................................................................. 46<br />
8.4.1 Kategorisierung der Gärten und Parkanlagen ...................................................................... 46<br />
8.4.2 Literatur zu Gärten und Parks in Niedersachsen .................................................................. 49<br />
8.4.3 Weitere Literatur zu Gärten und Parks in Deutschland ........................................................ 52<br />
8.4.4 Fachforen .............................................................................................................................. 62<br />
8.4.5 Internetadressen zum Thema Gartenkultur .......................................................................... 63<br />
8.4.6 Garteninitiativen in Deutschland ........................................................................................... 64<br />
8.4.7 Offene Pforten....................................................................................................................... 66<br />
8.4.8 Gartenrouten ......................................................................................................................... 73<br />
8.4.9 Datenbanken und Datensammlungen .................................................................................. 74<br />
Eicklinger Amtshof GmbH 4
1 Zusammenfassung<br />
<strong>Landesinitiative</strong> GARTENHORIZONTE<br />
Gärten und Parkanlagen zählen zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten in einer Stadt oder auf dem<br />
Land. Welcher Hannover-Tourist besucht nicht gerne die Herrenhäuser-Gärten oder den Stadtpark? Welcher<br />
England-Besucher besichtigt nicht die Gärten des National Trust? Gerade das Beispiel England belegt,<br />
dass die Menschen Parkanlagen und Gärten besuchen, die unter einer Dachmarke vereint sind.<br />
Diese Dachmarken signalisieren dem Besucher, dass sich dahinter etwas Qualitätsvolles und Sehenswertes<br />
verbirgt.<br />
Im Zuge des Projektverbundes GARTENHORIZONTE im ehemaligen Regierungsbezirk Lüneburg wurde<br />
in einem Strategieworkshop Anfang 2008 zum Thema Gartenkultur eine Vision erarbeitet: In Niedersachsen<br />
soll ein Gartennetzwerk gegründet werden, in dem die bisherige Arbeit des Projektverbundes<br />
GARTENHORIZONTE landesweit weitergeführt wird. In diesem Netzwerk sollen die vorhandenen Initiativen<br />
rund um das Thema Garten in einer hochwertigen Dachmarke zusammengeführt werden. Das Gartennetzwerk<br />
dient als Serviceagentur für das Thema Gartenkultur und ist für ganz Niedersachsen zuständig.<br />
Um diese Vision zu verwirklichen, wurde im Oktober 2008 beim Niedersächsischen Ministerium für Ernährung,<br />
Landwirtschaft, Verbraucherschutz und Landesentwicklung ein Antrag auf Erarbeitung der vorliegenden<br />
Studie „<strong>Landesinitiative</strong> GARTENHORIZONTE“ eingereicht. Ziel der Studie war es zum einen<br />
herauszufinden, ob eine gemeinsame Initiative zum Thema Gartenkultur gewünscht ist. Zum anderen<br />
sollten die Grundlagen erarbeitet werden, um mit allen Beteiligten (Eigentümer, Politik, Denkmalpflege,<br />
Naturschutz, Tourismus...) gemeinsam die Zukunft dieser Garten- und Parkanlagen in die Hand zu nehmen,<br />
um langfristig ein stabiles Netzwerk aufbauen zu können. In diesem Netzwerk sollen die vorhandenen<br />
Initiativen gebündelt und das Thema Gartenkultur einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht<br />
werden. Mit der Einführung und Nutzung dieser qualitativ hochwertigen Dachmarke mit dem Titel<br />
GARTENHORIZONTE kann das große Potenzial Gartenkultur in Niedersachsen insgesamt besser vermarktet<br />
werden. Die vielfältigen Initiativen rund um das Thema Gartenkultur belegen, dass dieses Thema<br />
ein besonderes Zukunftspotenzial besitzt.<br />
Als Gesamtergebnis der Studie kann festgestellt werden, dass die Beteiligten an der Studie einstimmig<br />
den Aufbau eines landesweiten Gartennetzwerkes und einer Dachmarke befürworten. Die Ergebnisse der<br />
Studie bilden die Grundlage für die weitere Arbeit zum Aufbau eines Dachverbandes<br />
GARTENHORIZONTE. Die Bereitschaft der beteiligten Akteure, beim Aufbau eines Gartennetzwerkes<br />
mitzuarbeiten, ist vorhanden. Diese Chance gilt es für Niedersachsen zu nutzen, um das Land im Ländervergleich<br />
weiter zu positionieren: Niedersachsen, nicht nur Land der Pferde, sondern auch Land der<br />
Gärten!<br />
Eicklinger Amtshof GmbH 5
2 Einleitung<br />
2.1 Anlass der Studie<br />
<strong>Landesinitiative</strong> GARTENHORIZONTE<br />
Bereits heute besuchen viele Menschen im Zuge von Kultur- und Bildungsreisen die Parkanlagen Europas,<br />
Landesnetzwerke wie die „Gartenträume“ in Sachsen-Anhalt ziehen immer mehr Besucher an. Menschen<br />
besichtigen jedoch nicht nur die Gärten und Parkanlagen, sondern nutzen diese auch als Erholungs-<br />
und Freizeitort, um Ruhe und einen seelischen Ausgleich zu finden. Neben dem Gartenkunstwerk<br />
und der Erholungsfunktion als solche werden die Garten- und Parkanlagen aber vor allem auch aus ökonomischen<br />
Gründen immer stärker genutzt: Garten- und Parkfeste, Konzerte, Bootsfahrten, Festivals etc.<br />
werden angeboten. Daneben ziehen Bundes-, Landes- und Internationale Gartenschauen Millionen von<br />
Besuchern an. Hier haben vor allem die Sparten des Erwerbsgartenbaus die Möglichkeit, ihr Können unter<br />
Beweis zu stellen. Seit einigen Jahren werden auch immer häufiger touristische Angebote in Verbindung<br />
mit Privatgärten auf dem Markt platziert. Für viele Besitzer von kleinen Gartenanlagen bietet die<br />
Teilnahme an der so genannten „Offenen Pforte“ die Möglichkeit, ihre kleinen Kunstwerke interessierten<br />
Personen zu zeigen und sich mit Gleichgesinnten über den Freizeitgartenbau sowie Pflanzen zu unterhalten.<br />
In Zeiten künstlicher Erlebniswelten wie Disneyland und einer allgemeinen Hektik ist es schwer vorhersehbar,<br />
welche Rolle (historische) Gärten und Parks in Zukunft einnehmen werden. Entweder sie verfallen<br />
oder sie können durch neue Ideen und Projekte genutzt und vermarktet werden. Park- und Gartenanlagen<br />
lassen sich einzeln meist nur schwer touristisch vermarkten. Eine Kooperation und Vernetzung von<br />
kleineren und größeren Anlagen ermöglicht es, die gemeinsamen Belange besser zu organisieren und<br />
damit erfolgreicher am Markt aufzutreten. Eine Diskussion über die Zukunft von Gärten und Parkanlagen<br />
muss geführt werden, auch wenn die einzelnen Interessen oft weit auseinander liegen. Touristen wollen<br />
die Garten- und Parkanlage zu jeder Zeit besichtigen können, ohne Baustellen oder laufende Arbeiten am<br />
pflanzlichen Bestand; Denkmalpfleger versuchen die verschiedenen zeitlichen Schichten einer Anlage im<br />
Bestand darzustellen; der Eigentümer steht im Spannungsfeld zwischen ökonomisch gerechtfertigter Erhaltung<br />
und den Ansprüchen der Denkmalpflege und die Tourismuswirtschaft hat ein Interesse,<br />
vermarktbare Anlagen so vielen Kunden wie möglich als touristische Attraktion anbieten zu können.<br />
In allen Regionen Europas gibt es Parks und Gärten. Einige sind kulturhistorisch, international bedeutsam,<br />
andere eher von regionaler Bedeutung. Einige faszinieren mit herausragenden Pflanzensammlungen,<br />
andere durch ihren Gesamtentwurf oder durch die Menschen, die dort gewirkt oder gelebt haben.<br />
Aufzuzeigen, welche Bedeutung solche, aber auch unbekanntere Parks und Gärten für ihre Region besitzen<br />
und welche Chancen für die regionale Identität innerhalb Europas in der Gartenkunst ruhen, ist das<br />
Ziel des Europäischen Gartennetzwerkes (European Garden Heritage Network - EGHN). Es bringt Gartenfachleute,<br />
Behörden, Stiftungen und Tourismusagenturen zusammen, um durch die Vernetzung von<br />
Parks und Gärten deren Attraktivität zu steigern. Im internationalen Austausch werden Maßnahmen entwickelt<br />
und umgesetzt, die die Rahmenbedingungen für den Erhalt und den Ausbau von Parks und Gärten<br />
verbessern. Ziel ist es, Park- und Gartenlandschaften besser zu vermarkten und mehr Menschen für<br />
sie zu begeistern. So konnte in den letzten Jahren das Profil von Gärten gestärkt und ihre zentrale Be-<br />
Eicklinger Amtshof GmbH 6
<strong>Landesinitiative</strong> GARTENHORIZONTE<br />
deutung für Politik, Tourismus, Gesellschaft und Wirtschaftsentwicklung unterstrichen werden. Innerhalb<br />
des Projektes konnten länderübergreifend Ressourcen und Wissen ausgetauscht werden.<br />
Das Land Niedersachsen selbst zeichnet sich durch eine Vielzahl von Gärten aus: Historische Parkanlagen,<br />
denkmalgeschützte Gärten, moderne Gartenanlagen, Privatgärten und Erwerbsgartenbaubetriebe,<br />
die zur Wirtschaftskraft des Landes beitragen und ganze Regionen prägen. Jede Region in Niedersachsen<br />
hat ihre Besonderheiten, so zum Beispiel das Ammerland als Gartenland, wo Rhododendren besonders<br />
prächtig wachsen. Eine landesweite Kooperation wie das Europäische Gartennetzwerk gibt es bislang<br />
nicht. Im Auftrag des Niedersächsischen Ministeriums für Ernährung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz<br />
und Landesentwicklung wurde die vorliegende Studie unter dem Titel „<strong>Landesinitiative</strong><br />
GARTENHORIZONTE“ erarbeitet. Ziel ist es, die Grundlagen zu erarbeiten, um mit allen Beteiligten (Besitzer,<br />
Politik, Denkmalpfleger, Naturschutz, Touristiker,...) gemeinsam die Zukunft dieser Anlagen in die<br />
Hand zu nehmen.<br />
2.2 Rahmenbedingungen<br />
Die Grundlage für diese Studie bildet das Projekt GARTENHORIZONTE, das sich in den Jahren 2001 bis<br />
2004 als ein Teilprojekt von insgesamt 14 der Gesamtinitiative „Gärten, Parks und Gartenbau“ der damaligen<br />
Bezirksregierung Lüneburg entwickelt hat. Im Juli 2001 wurde das Projekt GARTENHORIZONTE im<br />
Regierungsbezirk Lüneburg mit elf Landkreisen gegründet, mit dem Ziel, die Gärten dieser Region zu erfassen<br />
und zu dokumentieren. Auftrag des Projektes war es, die Facetten der Gartenkultur aufzuzeigen,<br />
Aspekte ihrer Erhaltung und Pflege zu erarbeiten sowie ihre Bedeutung für Kultur und Geschichte der<br />
Region in ein öffentliches Bewusstsein zu rücken. Das Projekt ist eine Gemeinschaftsinitiative der Bezirksregierung<br />
Lüneburg (heute Regierungsvertretung Lüneburg), der Ämter für Agrarstruktur (heute GLL)<br />
Bremerhaven, Lüneburg und Verden sowie der Samtgemeinde Börde Lamstedt. Weitere Unterstützung<br />
erfolgte durch die Stiftung Niedersachsen sowie die regionale Arbeitsgemeinschaft Bremen / Niedersachsen.<br />
Ein weiteres Projekt der Gesamtinitiative war das Projekt „Crossing fences“. Dieses Projekt hatte zum<br />
Ziel, die Gärten unter touristischen Gesichtspunkten zu erfassen und inwertzusetzen. Unter der Leitung<br />
von Rambøll Management Consulting aus Hamburg wurde das Projekt inhaltlich von Touristikfachleuten<br />
unterstützt. Im Zuge des Projektverlaufs wurde das Projekt in „Gärten Europas“ umbenannt, da ein internationaler<br />
Austausch zu diesem Thema organisiert und durchgeführt wurde. Als Ergebnis dieses Projektes<br />
wurde eine Broschüre mit den für den Tourismus relevanten Gärten herausgegeben. Die Schnittstelle<br />
beider Projekte liegt im Thema Gartenkultur. Das Projekt GARTENHORIZONTE verfolgte dabei den wissenschaftlichen<br />
Ansatz, während das Projekt „Gärten Europas“ den touristischen Schwerpunkt betrachtete.<br />
Zum Projekt GARTENHORIZONTE wurden in einem ersten Projektabschnitt (2001 bis 2002) von Frau<br />
Dr. Hahn die vorhandenen Parks und Gärten im ehemaligen Regierungsbezirk Lüneburg flächendeckend<br />
erfasst und in einer Datenbank dokumentiert. In einem zweiten Schritt (2002 bis 2003) wurden die Gärten<br />
und Parks in Hinblick auf ihre kulturhistorische Bedeutung analysiert und bewertet. In einer dritten Phase<br />
(2003 bis 2004) wurde ein Maßnahmenkatalog zur Inwertsetzung der einzelnen Gärten und Parks erstellt.<br />
Die Ergebnisse wurden in einem Reiseführer „<strong>Gartenhorizonte</strong> – Historische Gärten zwischen Aller, Elbe<br />
Eicklinger Amtshof GmbH 7
<strong>Landesinitiative</strong> GARTENHORIZONTE<br />
und Weser“ veröffentlicht, herausgegeben vom Niedersächsischen Informations- und Kompetenzzentrum<br />
für den ländlichen Raum „Eicklinger Amtshof GmbH“. Ein weiteres Buch „Inwertsetzung des gartenkulturellen<br />
Potenzials in den Dörfern der Region zwischen Aller, Elbe und Weser“ wurde ebenfalls als Ergebnis<br />
dieses Projektes herausgegeben. Weitere Projekte wurden in dieser Zeit initiiert. Am 13. und 14. Mai<br />
2004 fand ein zweitägiges Symposium in der Stadthalle Verden statt. Im Rahmen dieses Symposiums<br />
wurden die Ergebnisse des Projektes präsentiert und in Arbeitsgruppen wurden Ideen für die Weiterentwicklung<br />
des Projektes GARTENHORIZONTE gesammelt. Daraus entstand 2005 der Projektverbund<br />
GARTENHORIZONTE, unter dem die einzelnen Projekte zusammengefasst sind.<br />
Aus diesem Projektverbund entstand die Idee für die vorliegende Studie. Am 4. April 2008 fand unter dem<br />
Titel „Gärten, Parks und Gartenbau in Niedersachsen“ ein Expertengespräch in der GLL Verden statt.<br />
Veranstalter war die Regierungsvertretung Lüneburg. Die Moderation übernahm das Niedersächsische<br />
Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz und Landesentwicklung. Neben Erfahrungsberichten<br />
wurden von vier Arbeitsgruppen erste inhaltliche Ergebnisse zum Aufbau eines landesweiten<br />
Gartennetzwerkes erarbeitet, die die Grundlage für die vorliegende Studie bilden. Im Oktober<br />
2008 wurde der Antrag für die Studie „<strong>Landesinitiative</strong> GARTENHORIZONTE“ beim Ministerium gestellt,<br />
worauf bereits im November 2008 die Auftaktveranstaltung im Niedersächsischen Ministerium für Ernährung,<br />
Landwirtschaft, Verbraucherschutz und Landesentwicklung in Hannover stattfand.<br />
Das Logo GARTENHORIZONTE wurde im Zuge des Prozesses entwickelt und als Wort- und Bildmarke<br />
beim Deutschen Patent- und Markenamt für das Land Niedersachsen gesichert.<br />
2.3 Zielstellung<br />
Um Voraussetzungen, Chancen und Grenzen des Aufbaus eines Gartennetzwerkes in Niedersachsen zu<br />
konkretisieren, sollen mit Hilfe von Expertenarbeitsgruppen Möglichkeiten für die Entwicklung und Umsetzung<br />
von Strategien zur Nutzung und nachhaltigen Wirkung des Qualitätssiegels GARTEN-<br />
HORIZONTE aufgezeigt werden. Ziel ist die Nutzung des Qualitätssiegels, um unter dieser Dachmarke<br />
die Entwicklung von Gartennetzen in Niedersachsen im Rahmen eines professionellen Marketings voranzutreiben.<br />
Durch die Studie sollen die tatsächlich vorhandenen Strukturen dokumentiert, Arbeitsstrukturen erhalten<br />
und gefördert werden. Es werden Fakten für die künftige Arbeit erwartet hinsichtlich:<br />
� Netzwerkgedanke<br />
� Informationsplattform<br />
� Innen- und Außenwahrnehmung<br />
� Förderfähigkeit verschiedener Bereiche insbesondere im Rahmen von PROFIL<br />
Ziele der <strong>Landesinitiative</strong> GARTENHORIZONTE sind:<br />
� Die Schaffung eines stabilen Netzwerkes, das die vorhandenen Initiativen bündelt und mittelfristig<br />
in der Lage ist, dauerhaft selbständig zu arbeiten.<br />
Eicklinger Amtshof GmbH 8
<strong>Landesinitiative</strong> GARTENHORIZONTE<br />
� Die Schaffung und Etablierung einer qualitativ hochwertigen Dachmarke mit einem eindeutigen<br />
und unverwechselbaren Label sowie die Positionierung und Profilierung der niedersächsischen<br />
Initiative innerhalb der Projektlandschaft der Länder.<br />
� Ein möglichst breiter Konsens unter Wahrung der wünschenswerten Individualität der einzelnen<br />
Initiativen und Akteure.<br />
� Eine kontinuierliche Weiterentwicklung der bestehenden Ansätze, um die Zukunftsfähigkeit des<br />
Netzwerkes sicherzustellen.<br />
� Das Interesse und die Akzeptanz einer breiten Öffentlichkeit zu wecken sowie Engagement und<br />
Mitwirkungsbereitschaft zu fördern.<br />
� Die bestehenden Einzelansätze sowie die Gesamtthematik in allen Bereichen privater und öffentlicher<br />
Bildung und Qualifikation zu integrieren und weiter zu entwickeln.<br />
2.4 Leitbild für die <strong>Landesinitiative</strong> <strong>Gartenhorizonte</strong><br />
Aus der Arbeit des Projektverbundes GARTENHORIZONTE wurde folgendes Leitbild für die <strong>Landesinitiative</strong><br />
heraus entwickelt:<br />
„Niedersachsen ist geprägt durch eine vielfältige, wertvolle und unverwechselbare Landschafts- und Gartenkultur.<br />
GARTENHORIZONTE ist das niedersächsische Netzwerk, das die Initiativen und Akteure rund<br />
um das Thema Garten in einer hochwertigen Dachmarke zusammenführt.“<br />
Eicklinger Amtshof GmbH 9
3 Gremien<br />
<strong>Landesinitiative</strong> GARTENHORIZONTE<br />
Die Studie baut auf den Strukturen aus dem Projektverbund GARTENHORIZONTE auf. Neben einer<br />
Steuerungsgruppe gibt es vier Arbeitsgruppen, die sich inhaltlich mit den unterschiedlichen Themen zum<br />
Aufbau eines Gartennetzwerkes befassen. Die Arbeitsgruppenmitglieder nahmen ehrenamtlich an der<br />
Studie teil. Mit der Koordination und Bearbeitung der Studie wurde das Niedersächsische Informationsund<br />
Kompetenzzentrum für den ländlichen Raum „Eicklinger Amtshof GmbH“ beauftragt.<br />
AG Organisation,<br />
Finanzierung und<br />
Wirtschaftlichkeit<br />
Koordinator<br />
Christian Wandscher<br />
3.1 Steuerungsgruppe<br />
Die Arbeiten wurden von der so genannten Steuerungsgruppe koordiniert und geleitet. Die Steuerungsgruppe<br />
setzt sich aus Vertretern des Niedersächsischen Ministeriums für Ernährung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz<br />
und Landesentwicklung, den Behörden für Geoinformation, Landentwicklung und Liegenschaften<br />
Bremerhaven, Lüneburg und Verden und der Regierungsvertretung Lüneburg zusammen. Die<br />
Leitung wurde der Regierungsvertretung Lüneburg übertragen.<br />
3.2 Arbeitsgruppen<br />
AG Gartenkultur<br />
Koordinator<br />
Prof. Dr.<br />
Hansjörg Küster<br />
Auftraggeber<br />
Nds. Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft,<br />
Verbraucherschutz und Landesentwicklung<br />
vertreten durch Alexander Burgath<br />
Steuerungsgruppe <strong>Landesinitiative</strong> GARTENHORIZONTE<br />
Leitung Regierungsvertretung Lüneburg, Frau Prochnow bzw. Herr Roßa<br />
Auftragnehmer: Eicklinger Amtshof GmbH, Eicklingen<br />
Gesamtkoordinator: Dr. Rainer Mühlnickel<br />
AG Entwicklung und<br />
Weiterentwicklung<br />
bestehender Anlagen<br />
Koordinator<br />
Dr. Jens Beck<br />
AG Marketing und<br />
Tourismus<br />
Koordinatorin<br />
Daniela Steinhoff<br />
Insgesamt wurden vier Arbeitsgruppen gebildet. Die Arbeitsgruppen hatten die Aufgabe, die inhaltlichen<br />
Vorgaben zu erarbeiten und zu dokumentieren. Die Arbeitsgruppen wurden mit namhaften Experten besetzt.<br />
Jede Arbeitsgruppe erhielt einen Koordinator. Der Gesamtkoordinator hatte die Aufgabe der Überwachung<br />
der organisatorischen Aufgaben der Arbeitsgruppen, Einhaltung des Zeitplans sowie die abschließende<br />
Dokumentation der Ergebnisse.<br />
Eicklinger Amtshof GmbH 10
Folgende Arbeitsgruppen wurden für die inhaltliche Bearbeitung der Studie gebildet:<br />
� Gartenkultur<br />
� Entwicklung und Weiterentwicklung bestehender Anlagen<br />
� Tourismus und Marketing<br />
� Organisation, Finanzierung und Wirtschaftlichkeit.<br />
3.2.1 Gartenkultur<br />
<strong>Landesinitiative</strong> GARTENHORIZONTE<br />
Die Koordination der Arbeitsgruppe Gartenkultur übernahm Prof. Dr. Hansjörg Küster vom Niedersächsischen<br />
Heimatbund e.V. Weitere Mitglieder waren:<br />
� Erika Brunken - Niedersächsische Gartenakademie, Bad Zwischenahn<br />
� Sigmund Graf Adelmann - Schaumburger Landschaft, Bückeburg<br />
� Klaus Hermann - Braunschweigische Landschaft e.V., Braunschweig<br />
� Elisa Hoferer - Behörde für Geoinformation, Landentwicklung und Liegenschaften, Verden<br />
� Roswitha Kirsch-Stracke - Institut für Umweltplanung der Leibniz Universität Hannover<br />
� Prof. Dr.-Ing. habil. Jürgen Milchert - Fachhochschule Osnabrück<br />
� Joachim Roemer - Landesverband Niedersächsischer Gartenfreunde<br />
� Imma Schmidt - schmidtKOMMUNIKATION, Hannover<br />
3.2.2 Entwicklung und Weiterentwicklung bestehender Anlagen<br />
Die Koordination dieser Arbeitsgruppe übernahm Dr. Jens Beck von der Niedersächsischen Gesellschaft<br />
zur Erhaltung historischer Gärten e.V. aus Hannover. Weitere Mitglieder waren:<br />
� Kai Uwe Grahmann - Braunschweigische Landschaft e.V., Braunschweig<br />
� Rainer Schomann - Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege, Hannover<br />
� Dr. Dankwart Seipp - Verein zur Förderung der Gartenkultur e.V., Bad Zwischenahn<br />
3.2.3 Tourismus und Marketing<br />
Die Koordination der Arbeitsgruppe übernahm Daniela Steinhoff von der Regierungsvertretung Lüneburg.<br />
Weitere Mitglieder waren:<br />
� Susanne Degener - Regierungsvertretung Hannover<br />
� Viktoria Freifrau von dem Bussche, Bad Essen<br />
� Melanie Ossenkop - Projekt European Garden Heritage Network, Westfeld<br />
� Claudia Schmidt - Regierungsvertretung Lüneburg<br />
� Petra Schoelkopf - Gartennetz Deutschland e.V., Hannover<br />
Eicklinger Amtshof GmbH 11
<strong>Landesinitiative</strong> GARTENHORIZONTE<br />
� Stefan Villena-Kirschner, BDLA / Landesgruppe Niedersachsen und Bremen, Bremen<br />
3.2.4 Organisation, Finanzierung und Wirtschaftlichkeit<br />
Die Koordination dieser Arbeitsgruppe übernahm Christian Wandscher vom Gartenkulturzentrum<br />
Niedersachsen - Park der Gärten gGmbH aus Bad Zwischenahn. Weitere Mitglieder waren:<br />
� Nikolaus Jansen - Regierungsvertretung Oldenburg<br />
� Olaf Klaukien - Regierungsvertretung Oldenburg<br />
� Dr. Rainer Mühlnickel - Eicklinger Amtshof GmbH<br />
� Günter Piegsa - Regierungsvertretung Braunschweig<br />
� Christa Ringkamp - Gartennetz Deutschland e.V., HORTEC Berlin<br />
� Silke Fennemann - Oldenburg Tourismus und Marketing GmbH<br />
� Mareen Römer - Oldenburg Tourismus und Marketing GmbH<br />
3.3 Zeitraum<br />
Die Studie begann mit der Auftaktveranstaltung am 6. November 2008 in Hannover. Die Arbeitsgruppen<br />
hatten bis Ende Februar Zeit zu tagen und die übertragenen Aufgaben zu erarbeiten. Geplant waren zwei<br />
Arbeitsgruppensitzungen pro Arbeitsgruppe. Der Bearbeitungszeitraum erstreckte sich insgesamt von<br />
November 2008 bis Juni 2009. Der vorliegende Bericht fasst die erarbeiteten Ergebnisse zusammen. Aus<br />
den Ergebnissen werden die Handlungsempfehlungen für den weiteren Prozess abgeleitet.<br />
Eicklinger Amtshof GmbH 12
4 Aufgabenstellung und Ergebnisse der Arbeitsgruppen<br />
<strong>Landesinitiative</strong> GARTENHORIZONTE<br />
Auf dem Expertenworkshop am 4. April 2008 in Verden sollten die Teilnehmer die Zielsetzungen der vorliegenden<br />
Studie erarbeiten. Aus diesen Ergebnissen erarbeitete die Steuerungsgruppe die Aufgabenstellungen<br />
für die einzelnen Arbeitsgruppen zur <strong>Landesinitiative</strong> GARTENHORIZONTE. Antworten und<br />
Lösungsvorschläge sollten für die folgende, übergeordnete Aufgabenstellungen gefunden werden:<br />
� Welche Dateien / Datensammlungen sind vorhanden, sind sie kompatibel, welche Daten müssen<br />
ggf. noch erhoben werden, wer könnte diese Arbeiten leisten und wer darf am Ende die Daten<br />
nutzen?<br />
� Unterscheidung historischer und denkmalgeschützter Gärten, Problematik der Pflege der Anlagen<br />
und Konzepte zur Lösung (Pflegelexikon)<br />
� Vermarktungsstrategien, regionale und überregionale Konzepte<br />
� Organisation des Netzwerkes, Verwendung der Dachmarke, Suche nach Einnahme- und Fördermöglichkeiten<br />
und Unterstützern, Ermittlung des Finanzbedarfs in den nächsten fünf Jahren<br />
� Welche Qualitätsmerkmale machen GARTENHORIZONTE aus und wie soll die Qualitätssicherung<br />
auch im Hinblick auf die Markennutzung betrieben werden? Welche Kriterien sind dabei für<br />
eine landesweite Bedeutung maßgeblich?<br />
Den Arbeitsgruppenmitgliedern war es freigestellt, die Themen entsprechend den Wünschen und Erfordernissen<br />
zu ergänzen. Im Folgenden werden die differenzierten Aufgabenstellungen der Arbeitsgruppen<br />
sowie die erarbeiteten Ergebnisse zusammengefasst dargestellt. Die einzelnen Beiträge der Arbeitsgruppen<br />
zur vorliegenden Studie sind als gesonderter, ungekürzter Beitrag im Anhang nachzulesen.<br />
4.1 Arbeitsgruppe Gartenkultur<br />
Die Arbeitsgruppe Gartenkultur erhielt die folgende, spezielle Aufgabenstellung:<br />
� Darstellung von Quellen zur Erfassung von Gärten – auch denkmalgeschützte und historische<br />
sowie Initiativen der Offenen Gärten und Gartenrouten: Welche Daten sind vorhanden? Was<br />
muss erhoben werden? Wer kann Daten sammeln und wie? Kalkulation des erforderlichen Kosten<br />
und Zeitaufwandes.<br />
� Erfassung von Fachforen<br />
� Möglichkeiten der Einbindung des Gartenbaus klären<br />
� Vorschläge für Foren zum Informationsaustausch<br />
Die Arbeitsgruppe Gartenkultur hat sich zunächst mit der Erfassung der Grundlagen für den Themenkomplex<br />
Gartenkultur in Niedersachsen, Deutschland und in Europa beschäftigt: Kategorisierung der<br />
Gärten und Parkanlagen als Grundlage für die Erstellung eines Gartenkatasters, Literaturliste zu Gärten<br />
und Parks in Niedersachsen und Deutschland als Informationsplattform, Auflistung der Fachforen zum Informationsaustausch<br />
sowie für Beteiligungsverfahren, Übersicht zu Garteninitiativen und Gartenrouten in<br />
Eicklinger Amtshof GmbH 13
<strong>Landesinitiative</strong> GARTENHORIZONTE<br />
Deutschland sowie Europa sowie Übersicht der vorhandenen Datenbanken und Datensammlungen. Die<br />
Listen stellen einen ersten Überblick dar und sind im Anhang nachzulesen. Die Recherche hat deutlich<br />
gezeigt, dass es eine Fülle von Informationen gibt, die aber losgelöst voneinander stehen und nicht miteinander<br />
verknüpft sind. Datensammlungen existieren zumeist in Papierform und warten darauf, erfasst zu<br />
werden.<br />
Erste Versuche der Zusammenarbeit und Koordination auf Bundes- und Europaebene wurden mit der<br />
Gründung des Europäischen Gartennetzwerkes (EHGN) bzw. des Gartennetzes Deutschland (GND) begonnen.<br />
Mit der Gründung des Projektverbundes GARTENHORIZONTE wurde in Niedersachsen auf<br />
Landesebene mit dieser Grundlagenarbeit begonnen. Insgesamt gibt es auf den einzelnen Ebenen (regional,<br />
Land, Bund, Europa) zahlreiche Initiativen, die sich dem Thema Gartenkultur widmen. Eine Kalkulation<br />
über die erforderlichen Kosten der Erfassung und Auswertung der vorhandenen Daten und damit für<br />
den Zeitaufwand müsste im weiteren Verfahren erarbeitet werden.<br />
Aus dieser ersten Bestandsaufnahme wurde deutlich, dass sich Niedersachsen durch eine große Vielfalt<br />
an Gärten und Parkanlagen auszeichnet. Aber wie unterscheidet sich der Bereich Gartenkultur in Niedersachsen<br />
von anderen Bundesländern? Unter welchem Alleinstellungsmerkmal können die Gärten und<br />
Parks vermarktet werden? Wie kann der Erwerbsgartenbau mit in das zukünftige Gartennetzwerk eingebunden<br />
werden?<br />
In Niedersachsen befinden sich im Vergleich zu anderen Bundesländern noch zahlreiche Landwirtschaftsbetriebe<br />
in der gleichen Hand wie Gutshöfe und Gartenanlagen. Die Kulturlandschaft als gewachsenes<br />
Geflecht aus landwirtschaftlichen Flächen, Gärten und Gütern lässt sich hier noch gut als Einheit<br />
erkennen. Diese bestehenden Strukturen lassen sich als Alleinstellungsmerkmal der niedersächsischen<br />
Gärten definieren.<br />
Insgesamt kann man davon ausgehen, dass es etwa 2.000 Gärten in Niedersachsen gibt, die besonders<br />
sehenswert sind, wirtschaftliche Bedeutung haben oder die kulturellen Leuchttürme ganzer Regionen<br />
sind.<br />
4.2 Arbeitsgruppe Entwicklung und Weiterentwicklung bestehender Anlagen<br />
Die Arbeitsgruppe erhielt die folgende, differenzierte Aufgabenstellung:<br />
� Darstellung bisheriger Pflegeprojekte, Vorstellung von Parkpflegewerken und Parkgesellschaften<br />
sowie Erstellen eines Pflegelexikons<br />
� gesetzliche Rahmenbedingungen<br />
� Definition des Begriffs historische Gärten<br />
� Vorschläge für Foren zum Informationsaustausch<br />
Die Arbeitsgruppe beschäftigte sich zunächst mit der grundlegenden Bedeutung der kontinuierlichen und<br />
fachgerechten Pflege für Gartenanlagen. Gärten sind künstliche und künstlerische Objekte, die gepflegt<br />
werden müssen, um das Erscheinungsbild und damit die planerische Intention zu erhalten. Dabei sind die<br />
Rahmenbedingungen zu beachten. In Zeiten knapper Haushaltskassen oder nicht mehr vorhandenen<br />
Eicklinger Amtshof GmbH 14
<strong>Landesinitiative</strong> GARTENHORIZONTE<br />
Grünflächenämtern in den Kommunen wird die Pflege von Gärten und Parkanlagen oft vernachlässigt.<br />
Fehlende fachliche Kenntnisse führen dazu, dass Anlagen oft falsch gepflegt und damit langfristig zerstört<br />
werden. Es müssen Strukturen gefunden werden, um diese Probleme zu lösen. Auch die Besitzer wertvoller<br />
Garten- und Parkanlagen dürfen dabei nicht außer acht gelassen werden. Sie benötigen nicht nur<br />
fachliche Unterstützung, sondern auch Hilfestellung bei der Bereitstellung bzw. Rekrutierung finanzieller<br />
Mittel. Letztlich gibt es kein Patentrezept für eine ideale Pflegestrategie. Jeder Garten benötigt eine eigene<br />
Lösung. Ein allgemeines Pflegelexikon ist deshalb aus Sicht der Arbeitsgruppe nicht notwendig. Neben<br />
der individuellen Pflege ist aber auch das Verständnis für die Notwendigkeit bestimmter Maßnahmen<br />
zu fördern. Das Verständnis für Pflegemaßnahmen setzt voraus, dass alle Beteiligten in einer Sprache<br />
miteinander sprechen. Differenzierungen zwischen historischen und denkmalgeschützten Anlagen oder<br />
der Unterschied zwischen Entwicklung und Weiterentwicklung bestehender Anlagen muss kommuniziert<br />
werden. Gleiches gilt für den Umgang mit den gesetzlichen Rahmenbedingungen. Gärten und Parkanlagen<br />
sind künstlich geschaffene Werke. Die Rechtslage betrachtet solche Anlagen meist aber nur sehr<br />
einseitig. So stehen oft die Interessen des Naturschutzes gegen die geforderten Pflegemaßnahmen bei<br />
der Wiederherstellung einer historischen oder denkmalgeschützten Parkanlage. Das gegenseitige Verständnis<br />
ist in diesem Bereich langfristig zu verbessern, behördliche Vorgänge sind zu vereinfachen.<br />
Gute Beispiele für Parkpflegegesellschaften existieren noch nicht. Es sollten positive Beispiele der Entwicklung<br />
und Weiterentwicklung gesammelt werden. Dabei können sowohl kleine als auch große Institutionen<br />
wie Stiftungen und Gartenverwaltungen in anderen Bundesländern berücksichtigt werden. Parkpflegewerke<br />
gibt es zahlreiche. In der Literatur finden sich zudem viele wissenschaftliche Veröffentlichungen,<br />
die sich mit diesem Thema beschäftigen. In Bezug auf eine vorbildliche Pflegeorganisation besteht<br />
noch Forschungsbedarf, so dass diese Frage im Rahmen der Arbeitsgruppenarbeit nicht abschließend<br />
beantwortet werden konnte.<br />
Um insgesamt die große Vielfalt an Gärten zu erhalten, müssen Strukturen entwickelt werden, die die Eigentümer<br />
bei der Pflege, der Erneuerung und der Weiterentwicklung der Anlagen unterstützen. Eine langfristige<br />
und damit nachhaltige Pflege ist als Ziel zu sichern. Denn nur gepflegte Anlagen werden von der<br />
Öffentlichkeit als positiv wahrgenommen. Es ist deshalb ungemein wichtig, dass alle Gärten, die der Öffentlichkeit<br />
präsentiert werden, die für Veranstaltungen offen stehen, die zu Reisezielen werden oder in<br />
Publikationen besprochen werden sollen, einen angemessenen Pflegezustand aufweisen und damit einen<br />
definierten Qualitätsstandard besitzen.<br />
Insgesamt fehlt ein allgemeines Medium, das über die Geschichte, die künstlerische Bedeutung oder botanische<br />
Besonderheiten eines Gartens informiert. Aktuelle Angaben zu Besichtigungsmöglichkeiten,<br />
Veranstaltungen, Terminen, Übernachtungsangeboten und Serviceeinrichtungen sind nur mühsam zu<br />
finden. Zwar verfügen mittlerweile sehr viele einzelne Objekte über eine eigene Homepage, auf der entsprechende<br />
Angaben vorhanden sind, aber sie lassen sich bisher nicht über ein zentrales Stichwort bzw.<br />
ein sinnvolles Suchsystem abrufen. Wichtig wäre beispielsweise die Möglichkeit, in einem gemeinsamen<br />
Verzeichnis gezielt nach Regionen, bestimmten Gartentypen, nach Gärten mit einem gastronomischen<br />
Angebot usw. suchen zu können.<br />
Eicklinger Amtshof GmbH 15
4.3 Arbeitsgruppe Tourismus und Marketing<br />
<strong>Landesinitiative</strong> GARTENHORIZONTE<br />
Innerhalb der Studie bestand die Aufgabe der Arbeitsgruppe darin, Vorschläge für das touristische Marketing<br />
und für das Netzwerk als solches zu erarbeiten. Um entsprechende Vorschläge zu entwickeln,<br />
müssen zunächst die Ziele für das touristische Marketing und die Ziele für das Netzwerk festgelegt werden.<br />
Marketingziele sind u.a. die Förderung der Identität des Bürgers und der Bürgerin mit der Region, die<br />
Stärkung des Image einer Region, die Entwicklung von zielgruppengerechten Angeboten von Gartenkultur<br />
und Gartenbau, die Festlegung von Mechanismen zur Qualitätssicherung u.v.m. Das Netzwerk hingegen<br />
sollte unter anderem das Ziel verfolgen, Öffentlichkeitsarbeit für öffentlich zugängliche Gärten zu leisten,<br />
Kooperationen mit Marketingorganisationen einzugehen, Qualitätsstandards für gartentouristische<br />
Angebote zu entwickeln und umzusetzen, Informations- und Beratungsstelle für gartenkulturelle Themen<br />
zu sein, Eigentümer und Kommunen bei der Erhaltung historischer Gärten zu unterstützen.<br />
Vor dem Hintergrund der vielfältigen Gartenkultur in Niedersachsen und dem Anspruch, diese in einem<br />
Netzwerk zu vereinen, kommt der Definition von Zielgruppen eine große Bedeutung zu. Zwei grundsätzlich<br />
unterschiedliche Zielgruppen sind zu berücksichtigen: die touristische Zielgruppe (Tages- und Übernachtungstouristen)<br />
und das Fachpublikum. Für beide Zielgruppen sind unterschiedliche Marketingstrategien<br />
zu entwickeln (in der Kürze des Bearbeitungszeitraumes war dies in der Arbeitsgruppe nicht<br />
leistbar). Hauptansprechpartner sind hierbei die Landesmarketingorganisation (TourismusMarketing Niedersachsen<br />
GmbH), die regionalen Marketingorganisationen und die örtlichen Touristinformationen.<br />
Die Arbeitsgruppe Tourismus und Marketing empfiehlt, nach einer umfassenden Bestandsanalyse niedersächsischer<br />
Gärten und Parks mit den Tourismusorganisationen über notwendige Qualitätsentwicklung,<br />
Möglichkeiten der touristischen Produktentwicklung und Organisation des gartentouristischen Marketings<br />
zu beraten. Die gartentouristische Produktentwicklung sollte anhand noch zu definierender Qualitätsstandards<br />
– die Arbeitsgruppe hat bereits aus ihrer Sicht drei wesentliche Qualitätskriterien entwickelt<br />
(Attraktivität, Pflegezustand und Besucherinfrastruktur eines Gartens oder Parkes) – entweder durch regionale<br />
oder örtliche Tourismusorganisationen erfolgen. Dabei sollen sie durch das Gartennetzwerk unterstützt<br />
werden. Die touristische Vermarktung muss dabei in Zuständigkeit und Verantwortung der regionalen<br />
Tourismusmarketingorganisationen liegen. Das geplante Netzwerk ist Dienstleister für alle Tourismusorganisationen<br />
und berät sie in gartenspezifischen Fragen. Darüber hinaus ist das Netzwerk Hauptansprechpartner<br />
und kompetente Beratungsstelle für alle Fragen rund um das Thema Gartenkultur in der<br />
Kommune.<br />
Geht es um die Frage der Vermarktung des Netzwerkes als solches, so ist es vor dem Hintergrund der<br />
Ziele eines landesweiten Gartennetzwerkes erforderlich, ein Kommunikationskonzept zu entwickeln, mit<br />
dem die relevante Öffentlichkeit erreicht werden kann. Von der Arbeitsgruppe empfohlene Kommunikationsmaßnahmen<br />
für das Innenmarketing können u.a. Foren zum Informationsaustausch und für das Außenmarketing<br />
u.a. die Erstellung eines Veranstaltungskalenders sein. Eine weitere Maßnahmenkonkretisierung<br />
ist erst nach einer Bestandsanalyse möglich, wenn feststeht, wer Netzwerkpartner und relevante<br />
Öffentlichkeit ist.<br />
Eicklinger Amtshof GmbH 16
4.4 Arbeitsgruppe Organisation, Finanzierung und Wirtschaftlichkeit<br />
Die Arbeitsgruppe erhielt die folgende, differenzierte Aufgabenstellung:<br />
� Finanzierungsmöglichkeiten für das Netzwerk<br />
� Kostenkalkulation für eine Internetplattform (Pflegeaufwand 5 Jahre)<br />
� Einsatz der Dachmarke<br />
<strong>Landesinitiative</strong> GARTENHORIZONTE<br />
� Mitgliedschaft im Europäischen Gartennetzwerk sowie im Gartennetzwerk Deutschland – Kosten<br />
und Nutzendarstellung<br />
Unabhängig von künftigen formellen Trägern ist die Frage nach der thematischen Ausrichtung eines Gartennetzwerkes<br />
zu klären. Die Organisationsform hängt dabei wesentlich von den thematischen Schwerpunkten<br />
ab. In Niedersachsen gibt es bereits eine Vielzahl an etablierten, gartenkulturellen Eigeninitiativen.<br />
Hierin besteht ein wesentlicher Unterschied zu anderen Bundesländern. Es gilt die niedersächsischen<br />
Initiativen zu bündeln und ein Projektziel zu entwickeln, das geeignet ist, einen breiten Konsens aller<br />
potenziellen Akteure herzustellen und Einzelinteressen zu integrieren. Für die weitere Arbeit ist es<br />
entscheidend, alle relevanten Akteure innerhalb der Initiative zu ermitteln. Am Beispiel der Gartenroute,<br />
die in Deutschland Vorbildcharakter besitzt, kann man exemplarisch feststellen, an welchen kritischen<br />
Punkten Projekte scheitern: an der langfristigen Finanzierung und an der intensiven Mitarbeit aller Partner.<br />
In der Kürze der Zeit konnte die konkrete Organisationsform bzw. die Wirtschaftlichkeit eines Gartennetzwerkes<br />
nicht ermittelt werden. Eine Eigenfinanzierung ist aber aufgrund des großen Arbeitsumfanges<br />
nicht denkbar. Vielmehr geht es darum, die Wichtigkeit eines solchen Netzwerkes herauszuarbeiten, um<br />
damit eine eindeutige Position in der Öffentlichkeit und gegenüber der Politik vertreten zu können. Es gilt,<br />
das Thema Gartenkultur als wesentliches, gesellschaftliches und kulturelles Gut in der Gesellschaft zu<br />
verankern. Als Vorbild für eine potenzielle Organisationsform könnte das Modell aus Brandenburg dienen,<br />
alternativ die ‚Regionalen’ aus Nordrhein-Westfalen.<br />
Das Logo GARTENHORIZONTE sollte nicht im klassischen Sinne der touristischen Vermarktung dienen,<br />
sondern vorerst nur für das Netzwerk selbst. Eine Verwendung als Schild an den Gärten oder in sonstiger<br />
Weise sollte nur nach eigenem Konzept und einem entsprechenden CI-Handbuch erfolgen, soweit es<br />
sich für eine Dachmarke eignet. Eine Verwendung durch Dritte darf vorerst nur auf Anfrage erfolgen.<br />
Es wird vorgeschlagen, beim Gartennetzwerk Deutschland Mitglied zu werden. Ein Beitritt hätte den Vorteil,<br />
Informationen zu bekommen und die angebotenen Dienstleistungen in Anspruch nehmen zu können.<br />
Über das Netzwerk können weiter Kontakte geknüpft werden. Eine Mitgliedschaft im Europäischen Gartennetzwerk<br />
wird vorerst nicht für notwendig erachtet.<br />
Eicklinger Amtshof GmbH 17
5 Gesamtergebnis<br />
<strong>Landesinitiative</strong> GARTENHORIZONTE<br />
Aus der Arbeit der Arbeitsgruppen wurden Handlungsempfehlungen für die zukünftige Weiterarbeit<br />
entwickelt. Dabei geht es zum einen um das Instrument, mit dem die Empfehlungen umgesetzt werden<br />
sollen, zum anderen geht es um die Inhalte. Einstimmiges Votum besteht in der Gründung eines<br />
landesweiten Gartennetzwerkes unter dem Titel GARTENHORIZONTE. Die thematische Arbeit in den<br />
Arbeitsgruppen war dabei der erste Schritt, um die Grundlagen für die Gründung eines landesweiten,<br />
gemeinsamen Gartennetzwerkes zu erarbeiten. Das für den Projektverbund entwickelte Logo soll<br />
weiterhin verwendet werden.<br />
Warum ein landesweites Gartennetzwerk? Der Vorteil eines gemeinsamen Netzwerkes liegt zum einen<br />
darin, dass man Projekte gemeinsam erarbeiten sowie Ergebnisse und Erfahrungen für andere nutzbar<br />
machen kann. Zum anderen können durch die gemeinsame Arbeit der Aufwand und das Risiko reduziert<br />
sowie gemeinsame Präsentationen von Themen und Schwerpunkten initiiert werden. Letztlich kann das<br />
Marketing durch gemeinsame Auftritte verbessert und insgesamt eine Steigerung des Images für Parks<br />
und Gärten sowie eine Steigerung von Besucherzahlen landesweit erreicht werden. Ein solches<br />
Gartennetzwerk soll die Interessen privater wie kommunaler und anderer öffentlicher Park- und<br />
Garteneigentümer, die Interessen des Erwerbsgartenbaus sowie der Verbände, die mit dem Thema<br />
Parks und Gärten der Region befasst sind, vertreten.<br />
Die Mehrheit der Besucher will einen Garten oder Park besichtigen, als Teil eines Tagesausflugs oder<br />
ihrer Ferien. Sie wollen auch die Kulturlandschaft kennenlernen, ein Museum oder eine Altstadt besuchen<br />
oder auch regionale Produkte kaufen. Die Vernetzung von Gärten und Kulturlandschaft bietet die<br />
Voraussetzung, verschiedene Besuchergruppen zu erreichen und sie mit entsprechenden Informationen<br />
zu anderen Orten zu führen. Gärten, Gartenbaubetriebe mit speziellem Sortiment oder Landschaften mit<br />
hoher Attraktivität können bereits bestehende touristische Angebote in einer Region ergänzen und erweitern.<br />
Dadurch können Potenziale und Entwicklungsmöglichkeiten für regionale Netzwerke und Synergien<br />
geschaffen werden. So kann es gelingen, durch verschiedene Veranstaltungen und Medien das<br />
öffentliche Interesse zu wecken und damit die Unterstützung zu steigern. Der Erwerbsgartenbau und<br />
andere Gewerbe wie Hotels und Restaurants können stärker in das Netzwerk eingebunden werden,<br />
indem sie Sponsor und Nutzer des Netzwerkes sind, indem sie zum Beispiel auf der Internetseite verlinkt<br />
werden oder dort Werbung schalten können. Denn insgesamt ist das Thema Gartenkultur positiv besetzt<br />
und deshalb attraktiv als Werbethema oder –plattform. Die Vielfalt und die regionale Verankerung der<br />
Gartenkultur in Niedersachsen bietet umfassende Möglichkeiten für Partner und Sponsoren, sich zu engagieren:<br />
von der Sanierung einer historischen Gartenanlage bis zur Pflanzung eines Baumes auf dem<br />
Dorfplatz in der eigenen Gemeinde. Das Netzwerk bietet darüber hinaus eine Plattform (Inhalte, Kontakte,<br />
Know-how bzw. Hilfestellung) für die Entwicklung touristischer Angebote. Insgesamt kann eine solche<br />
Initiative die lokale Wirtschaft stärken und damit zur Entwicklung einer Region, bezogen auf die<br />
Wirtschaftsbereiche Tourismus, Bildung, Kultur, Veranstaltungswesen sowie Garten- und Landschaftsbau<br />
beitragen.<br />
Eicklinger Amtshof GmbH 18
<strong>Landesinitiative</strong> GARTENHORIZONTE<br />
Die Marke GARTENHORIZONTE bietet die Chance, eine Dachmarke für alle in Niedersachsen angebotenen<br />
Gartenfestivals, Landpartien, Seminare, Führungen, Schulungen, Märkte zu sein. Ebenso können<br />
sich private und öffentliche Gärten darunter präsentieren. Es geht darum, eine Plattform für die Vielfalt<br />
der niedersächsischen Gartenkultur unter Berücksichtigung der regionalen Besonderheiten zu schaffen.<br />
Die Dachmarke würde eine in Niedersachsen vorhandene Lücke schließen. Mit einem niedersächsischen<br />
Gartennetzwerk kann sich das Land innerhalb der Aktivitäten anderer Länder entsprechend positionieren<br />
und die niedersächsischen, gartenkulturellen Belange auf Bundesebene kommunizieren.<br />
Insgesamt hat sich die gewählte Arbeitsstruktur – Steuerungsgruppe, thematische Arbeitsgruppen, Projektkoordinator<br />
– im Zuge der Studie bewährt, auch wenn die Mitarbeit in den einzelnen Arbeitsgruppen<br />
sehr unterschiedlich ausfiel. Ein Grund lag sicherlich im zeitlichen Aufwand dieser ehrenamtlichen Arbeit.<br />
Für die weitere Arbeit ist es entscheidend, alle wichtigen und etablierten Verbände im Grünen Bereich<br />
z.B. die DGGL, die Garten- und Landschaftsbauverbände oder Verbände des Produktionsgartenbaus zu<br />
berücksichtigen und zu beteiligen, um eine breite Basis zu schaffen und damit eine erfolgreiche Arbeit in<br />
einem potenziellen Gartennetzwerk gewährleisten zu können.<br />
Eicklinger Amtshof GmbH 19
6 Projektmanagement Gartennetzwerk GARTENHORIZONTE<br />
<strong>Landesinitiative</strong> GARTENHORIZONTE<br />
Der Aufbau eines Gartennetzwerkes ist als ein sehr komplexes Projekt zu betrachten und daher langfristig<br />
auszulegen. Neben der Grundlagenarbeit müssen Strukturen und Prozesse geschaffen werden, die<br />
das zu schaffende Netzwerk unterstützen und mit Inhalten füllen. Zur Gründung des Netzwerkes sind<br />
weitere Vorarbeiten erforderlich, um ein erfolgreiches System etablieren zu können.<br />
Zunächst steht am Anfang eines Projektes bzw. einer Projektidee der Initiierungsprozess. Er wird zum<br />
Projektstart und dann wieder zum Start jeder Projektphase durchlaufen. Gerade während der Initiierung<br />
werden durch Klärung und Festlegung der Projektziele die Weichen für den weiteren Projektverlauf und<br />
den Projekterfolg gestellt. Die Qualität der Projektziele / Phasenziele (Transparenz) und die Unterstützung<br />
der Stakeholder (Verbindlichkeit) entscheiden über den Projekterfolg.<br />
Daran schließt sich die Planungsphase an, in der die Ergebnisse der Initiierungsphase vertieft und ausgearbeitet<br />
werden. Alle Schritte orientieren sich am definierten Ziel des Projektes, ggf. werden Handlungsalternativen<br />
geprüft und ausgewählt. Anschließend folgt die Umsetzung der eigentlichen Projektidee<br />
auf Grundlage der bis dahin erarbeiteten Inhalten und der vorhandenen und neu geschaffenen Strukturen.<br />
6.1 Initiierungsphase<br />
Aufbauend auf den Ergebnissen und den Strukturen aus dem Projektverbund GARTENHORIZONTE<br />
wurde die vorliegende Studie konzipiert. Mit der Studie wurde eine erste Bestandsaufnahme vorgenommen,<br />
ein Meinungsbild abgefragt sowie das vorhandene gartenkulturelle Potenzial gesichtet und bewertet.<br />
Dabei konnten abschließend nicht alle Themen und Aufgabenbereiche in Gänze bearbeitet werden.<br />
So konnten noch keine Aussagen bzgl. der Förderfähigkeit verschiedener Bereiche im Rahmen von<br />
PROFIL getroffen werden. Gleiches gilt für die Suche nach Einnahme- und Fördermöglichkeiten und<br />
Unterstützern für ein Gartennetzwerk. Viele Themenbereiche, widergespiegelt in den verschiedenen Arbeitsgruppen,<br />
wurden angesprochen, bedürfen aber einer weiteren Vertiefung. Nicht nur eine inhaltliche<br />
Weiterarbeit ist erforderlich, sondern auch die Fragestellung, wie das Ziel tatsächlich umgesetzt werden<br />
kann.<br />
Aus der bisherigen Arbeit heraus besteht das eindeutige Votum der Arbeitsgruppenmitglieder sowie der<br />
Steuerungsgruppe, dass die vorhandenen Arbeitsstrukturen fortgeführt werden sollen, um das<br />
vorhandene und etablierte Potenzial nutzen zu können. Dabei könnte die Regierungvertretung Lüneburg<br />
bis zur institutionellen Gründung des Gartennetzwerkes das Projektmanagement für die <strong>Landesinitiative</strong><br />
übernehmen.<br />
6.2 Planungs- und Entwicklungsphase<br />
Nach der Initiierung erfolgt die Planungs- und Entwicklungsphase. Innerhalb dieser Phase geht es um die<br />
Weiterarbeit und Vertiefung der Themen, die innerhalb der vorliegenden Studie herausgearbeitet wurden.<br />
Für einen erfolgreichen Aufbau bzw. Gründung eines landesweiten Gartennetzwerkes sind folgende Aufgaben<br />
kurzfristig erforderlich. Sinnvoll ist es hierbei neben der Struktur der Arbeitsgruppen, die umfas-<br />
Eicklinger Amtshof GmbH 20
<strong>Landesinitiative</strong> GARTENHORIZONTE<br />
senden Studien bzw. Gutachten gesondert zu beauftragen, da dies im Zuge einer ehrenamtlichen Arbeit<br />
(der thematischen Arbeitsgruppen) nicht geleistet werden kann.<br />
Studien oder Gutachten<br />
� Erstellung einer Best-Practice-Datenbank mit den Gärten in Niedersachsen. In einem solchen<br />
Kataster sind die Gärten nach Naturraum, der Art der Gestaltung und des Zustandes zu erfassen<br />
und zu bewerten. Eine Kommission sollte die Auswahl und die Unterteilung der Gärten vornehmen.<br />
Für ein Gartennetzwerk ist insgesamt von Bedeutung, dass die erfassten Anlagen für Besucher<br />
zugänglich sind, auch wenn manche Anlagen nur ein oder zweimal für die Allgemeinheit geöffnet<br />
werden. Vorhandene Datensammlungen, wie die im Eicklinger Amtshof archivierte Arbeit<br />
von Frau Dr. Hahn, sind dabei zu nutzen.<br />
� Erfassung von vorbildlichen Pflegeorganisationen bzw. Parkpflegegesellschaften zur langfristigen<br />
Unterstützung von Eigentümern und Kommunen bei der Erhaltung von historischen Parkanlagen<br />
(z.B. die Parkpflegegesellschaft im Celler Raum). Was funktioniert bei der heutigen<br />
Pflegesituation, was funktioniert nicht? Wie ist die Position Niedersachsens im bundesweiten<br />
Vergleich? Welche Pflegemodelle sind in anderen Bundesländern bzw. in anderen europäischen<br />
Ländern erfolgreich? Bestehende Studien wie das Modellprojekt „Pflegemanagement für Parks<br />
und Gärten“ des Gartennetzes Deutschland sind dabei zu berücksichtigen.<br />
Arbeitsgruppenarbeit<br />
� Erarbeitung von Qualitätsmerkmalen für die zu vermarktenden Gärten in Kooperation mit den<br />
Verbänden (DGGL, BDLA,…). Die Gärten, die unter dem Logo GARTENHORIZONTE zukünftig<br />
präsentiert werden, müssen bestimmte Auswahlkriterien und Qualitätsstandards erfüllen. Ein<br />
wesentliches Kriterium ist zum Beispiel, dass die Gärten etwas Besonders bieten sollten, das die<br />
Besucher fasziniert, ihnen der Gartenbesuch in Erinnerung bleibt und sie wiederkommen lässt.<br />
Jeder Garten des Netzwerkes ist zugleich Botschafter oder Werbeträger für die anderen Gärten.<br />
Anschließend können in einem moderierten Prozess mit den Tourismusorganisationen die Gärten<br />
und Parks identifiziert werden, die in ein Tourismusmarketing integriert werden sollen.<br />
� Überprüfung des GARTENHORIZONTE Logos für die weitere Vermarktung. Mit der Landesmarketingorganisation<br />
ist zu klären, ob und unter welchen Voraussetzungen die Dachmarke<br />
GARTENHORIZONTE durch die Tourismusorganisationen vermarktet werden kann. Das Netzwerk<br />
soll zukünftig Dienstleister für alle Tourismusorganisationen sein und sie in gartenspezifischen<br />
Fragen beraten. In diesem Zusammenhang sind Kooperationsmöglichkeiten zu untersuchen.<br />
� Erfassung von erfolgreichen Finanzierungsmodellen für Parks und Gärten mit der Einbindung des<br />
Erwerbsgartenbaus. Dabei geht es vor allem um die generelle Finanzierbarkeit eines solchen<br />
Gartennetzwerkes.<br />
� Ausbau und Anpassung des Bildungsangebotes an die heutigen Bedürfnisse z.B. Pflege von<br />
historischen Gärten und Parkanlagen.<br />
Eicklinger Amtshof GmbH 21
<strong>Landesinitiative</strong> GARTENHORIZONTE<br />
� Erstellung eines Veranstaltungskalenders. Innerhalb der Arbeitsgruppen gab es unterschiedliche<br />
Meinungen. Die Notwendigkeit eines Veranstaltungskalenders gilt es nochmals zu diskutieren.<br />
� Öffentlichkeitsarbeit durch eine eigene Homepage, Printmedien, Präsentationen auf Messen und<br />
Gartenschauen durch die teilnehmenden Partner, Initiierung von Foren zum fachlichen Informationsaustausch<br />
(Seminare, Workshops, jährliche Netzwerktage mit Themenschwerpunkten). Innerhalb<br />
eines internen Netzwerkes könnte zum Nutzen aller Teilnehmer zu bestimmten Themen,<br />
darunter auch Pflege und Entwicklung der Anlagen, eine Plattform eingerichtet werden, die Berichte,<br />
Erfahrungen und Anregungen zu diesen Themen sammelt und allgemein zugänglich<br />
macht. Wichtig wäre hier eine professionelle, qualitätsvolle Aufarbeitung und Darstellung. Ein erster<br />
Vorschlag im Bereich Öffentlichkeitsarbeit ist die Herausgabe einer Broschüre unter dem Titel<br />
„Schlösser, Parks und Gärten in Niedersachsen“.<br />
� Suche nach Kooperationspartnern. Neben dem Erwerbsgartenbau können dies auch Unternehmen<br />
wie die Deutsche Bahn sein, die gezielt in ihren Medien Werbung für Gärten und Parkanlagen<br />
in Niedersachsen machen. Das Land Hessen hat bereits eine solche Kooperation mit der<br />
Bahn geschlossen und entsprechende Tourismusangebote geschaffen.<br />
� Suche nach einem geeigneten Trägermodell. Welche Unternehmensform soll das zukünftige<br />
Gartennetzwerk haben: Verein, Stiftung, gGmbH oder Genossenschaft? Ob der gemeinnützigen<br />
GmbH gegenüber den anderen Rechtsformen der Vorzug zu geben ist, ist bei Konkretisierung<br />
der Überlegungen zu prüfen.<br />
6.3 Umsetzungsphase<br />
Ziel der Umsetzungsphase sollte es sein, die Voraussetzungen zur Gründung eines Dachverbandes<br />
(vergleichbar mit der Akademie für den ländlichen Raum ALR) bzw. einer selbstständigen neutralen<br />
Organisation mit hauptamtlichen Arbeitsstrukturen zu schaffen, da nur so eine fachliche und<br />
kontinuierliche Arbeit des Gartennetzwerkes gewährleistet werden kann. Denn grundsätzlich hängt der<br />
Erfolg eines Projektes von der Kontinuität und dem Engagement einer zentralen Stelle ab, die sich persönlich<br />
mit dem Vorhaben identifiziert. Insgesamt ist eine landesweite Kontinuität anzustreben, Konkurrenzsituationen<br />
gilt es zu vermeiden, die Synergieeffekte sollten besonders herausgestellt werden. Die<br />
Erfahrungen aus anderen Bundesländern haben gezeigt, dass Gartentourismusprojekte häufig mit einer<br />
begrenzten (öffentlichen) Förderung ins Leben gerufen wurden, oft im Zusammenhang mit<br />
Gartenschauen, Regionalen oder auch touristischen Jahresthemen. Das langfristige Fortbestehen der<br />
Projekte ist jedoch oft nicht gesichert und nach dem Wegfall der Förderung entstehen erhebliche<br />
finanzielle Probleme, die eine Weiterentwicklung behindern oder sogar das Fortbestehen der Projekte<br />
bedrohen. Oft laufen dann die Programme nur noch auf Sparflamme durch den engagierten Einsatz von<br />
Vereinen und Einzelkämpfern weiter, haben aber für die Entwicklung des ländlichen Raumes, die<br />
Tourismusindustrie und Wirtschaft wenig Bedeutung. Werden Gartenzusammenschlüsse von Stiftungen<br />
betreut, wie den großen Schlösser- und Gärtenstiftungen der Länder, ist ein dauerhaftes Fortbestehen<br />
durch ein Stiftungsgrundkapital gegeben. Auch bei einer fortlaufenden Betreuung durch öffentliche<br />
Eicklinger Amtshof GmbH 22
<strong>Landesinitiative</strong> GARTENHORIZONTE<br />
Stellen oder durch Tourismusmarketingorganisationen scheint eine dauerhafte Grundfinanzierung und<br />
Vermarktung gegeben.<br />
Die Aufgaben eines solchen Dachverbandes liegen<br />
� in der Lobbyarbeit<br />
� in der Öffentlichkeits- und Pressearbeit zur dauerhaften Etablierung des Dachverbandes<br />
(Verteilung von Faltblättern, Aktualisierung einer Webseite)<br />
� im Marketing<br />
� in der Pflege einer Datenbank<br />
� in der Koordination der bestehenden Arbeitsgruppen<br />
� in der Routenentwicklung (Entwicklung weiterer Projektinhalte neben dem Aufbau neuer<br />
Gartenrouten, die Koordinierung bestehender Routen)<br />
� in der Bildungsarbeit in Zusammenarbeit mit anderen Bildungsträgern<br />
� im Austausch über Pflege und Entwicklung<br />
� in der Entwicklung von gartentouristischen Angeboten<br />
� in der Beratungsarbeit für das Thema Garten hinsichtlich Bildung, Qualität, Pflege, Vermarktung<br />
oder Finanzakquise<br />
� im Monitoring und der Evaluierung.<br />
In verschiedenen Garteninitiativen übernehmen die bestehenden Gartenakademien die wichtige Aufgabe<br />
der Schulung und Vermittlung von gartenbezogenen Themen. Eine finanzielle und institutionelle<br />
Förderung, bestensfalls durch das Land Niedersachsen, ist für die Umsetzung eines solchen<br />
Dachverbandes und Netzwerkes notwendig. Inwiefern sich die einzelnen Kommunen an einem solchen<br />
Netzwerk beteiligen, ist ebenfalls noch zu klären, es wäre sicherlich aber wünschenswert, um den<br />
Stellenwert eines solchen Netzwerkes nochmals zu verdeutlichen.<br />
Sobald das Gartennetzwerk GARTENHORIZONTE etabliert ist und funktioniert, kann die <strong>Landesinitiative</strong><br />
im Gartennetzwerk Deutschland (GND) sowie im Europäischen Gartennetzwerk Mitglied werden und so<br />
zur deutschlandweiten Vermarktung der niedersächsischen Gärten beitragen.<br />
Eicklinger Amtshof GmbH 23
6.3.1 Trägermodellvarianten Gartennetzwerk GARTENHORIZONTE<br />
<strong>Landesinitiative</strong> GARTENHORIZONTE<br />
Für ein Gartennetzwerk stehen verschiedene Trägermodelle zur Verfügung. Neben der klassischen Vereinsgründung<br />
kann noch die Gründung einer Stiftung, einer gemeinnützigen GmbH oder einer Genossenschaft<br />
in Erwägung gezogen werden.<br />
Verein<br />
Die Gründung eines Vereins zur Unterstützung des Projektes wäre denkbar. Jedoch sollte die<br />
Trägerschaft des Projektes nicht auf einem ehrenamtlich arbeitenden Verein übertragen werden, sondern<br />
beim Ministerium und/oder der Regierungsvertretung angesiedelt sein. Ein Verein ist auf das dauernde,<br />
ehrenamtliche Engagement seiner Mitglieder angewiesen. Bei geringer Mitgliederzahl oder einem<br />
möglichen Mitgliederschwund, auch einzelner besonders Engagierter, brechen Strukturen oft plötzlich<br />
zusammen, was die Fortsetzung der Tätigkeit und somit das Fortbestehen des Projektes gefährdet. Auch<br />
stehen einem Verein zunächst keine finanziellen Mittel zur Weiterentwicklung zur Verfügung. Gelder<br />
können für gewöhnlich nur in geringem Umfang aus Mitgliedsbeiträgen akquiriert werden. Diese Gelder<br />
reichen meist nur für die Sicherstellung der organisatorischen Vereinsarbeit (Mitgliederbetreuung,<br />
Mitgliederinformation, Vorträge, Führungen), nicht jedoch für darüber hinausgehende Projekte. Hierfür<br />
sind Vereine im Allgemeinen auf externe, meist projektbezogene Fördergelder und Sponsoren<br />
angewiesen.<br />
Stiftung<br />
Zur Gründung eines Gartennetzwerkes kann auch über die Einrichtung einer Stiftung zur Förderung der<br />
Gartenkultur in Niedersachsen nachgedacht werden. Eine derartige Stiftung könnte übergeordnete<br />
Tätigkeitsfelder wahrnehmen. Grundsätzlich gilt, dass die Verwirklichung des Stiftungszwecks durch eine<br />
ausreichende Vermögensausstattung beziehungsweise deren Erträge gesichert sein muss. Folgende<br />
Quellen zur Bereitstellung des Stiftungskapitals könnten dabei in Betracht gezogen werden:<br />
� Öffentliche Gelder (Ministerien, Kreise, Kommunen)<br />
� Stiftungen z.B. Deutsche Bundesstiftung Umwelt oder Deutsche Stiftung Denkmalschutz<br />
� private Förderer<br />
� Eine Anbindung an die Stiftung Niedersachsen wäre ein denkbarer Weg zur Einrichtung einer<br />
niedersächsischen Stiftung zur Förderung der Gartenkultur.<br />
Gemeinnützige GmbH<br />
Alternativ zu einem Verein oder einer Stiftung ist auch eine gGmbH denkbar. Bei der gGmbH handelt es<br />
sich um eine kapitalgesellschaftliche Struktur, die sich durch die Besonderheit der Gemeinnützigkeit<br />
auszeichnet. Im weiteren Unterschied zum Verein und zur Stiftung ist die beschränkte Haftung der<br />
Handelnden, der Gesellschafter hervorzuheben. Verein und Stiftung zeichnen sich demgegenüber durch<br />
die persönliche Haftung der Vorstandsmitglieder aus, die durch Satzung auf Fälle der groben<br />
Fahrlässigkeit und des Vorsatzes beschränkt werden können.<br />
Eicklinger Amtshof GmbH 24
Genossenschaft<br />
<strong>Landesinitiative</strong> GARTENHORIZONTE<br />
Eine Genossenschaft ist in mancher Hinsicht mit einem eingetragenen Verein (e.V.) vergleichbar. Zu beachten<br />
ist allerdings, dass das gesetzliche Leitbild eines Vereins der „nicht wirtschaftliche Verein“<br />
(§ 21 BGB) ist, also nicht auf wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb ausgelegt ist. Der wirtschaftliche Verein<br />
kann nur durch staatliche Verleihung seine Rechtsfähigkeit erlangen (§ 22 BGB). Da dies aber in der<br />
Praxis nahezu nie vorkommt, könnte man sagen, die Genossenschaft ist eine Sonderform oder Weiterentwicklung<br />
des wirtschaftlichen Vereins, die aufgrund der niedrigeren Hürden für jedermann zu gründen<br />
offen steht.<br />
Genossenschaften verfolgen vorrangig ökonomische Zwecke. Nach der am 18. August 2006 in Kraft getretenen<br />
Novellierung darf es sich auch um soziale oder kulturelle Zwecke handeln, was bedeutet, dass<br />
sich auch Sozial- und Kulturgenossenschaften der eG-Rechtsform bedienen können. Wesensmerkmale,<br />
die den Kern der Genossenschaftsidentität bilden, sind neben dem Förderungsprinzip die Grundsätze der<br />
Selbsthilfe, der Selbstverantwortung, der Selbstverwaltung und das Identitätsprinzip. Letzteres besagt,<br />
dass die Miteigentümer/Träger zugleich Geschäftspartner (Abnehmer, Lieferant) und Eigenkapitalgeber<br />
sind (Dreifachbeziehung).<br />
Der Zweck der Genossenschaft ist die Förderung des Erwerbs oder der Wirtschaft ihrer Mitglieder oder<br />
deren soziale oder kulturelle Belange durch den gemeinsamen Geschäftsbetrieb. Die eingetragene Genossenschaft<br />
ist eine juristische Person. Besonders interessant ist die eG aufgrund der Tatsache, dass<br />
eine Begrenzung der Haftung für getätigte Geschäfte der eG auf das Vermögen der eG möglich ist. Die<br />
Mitglieder der eG haften also dann nicht mit ihrem vollen Privatvermögen.<br />
Eine Empfehlung, welches Trägermodelle das geeignetste ist, kann an dieser Stelle nicht gegeben werden.<br />
Eine Entscheidung für ein Trägermodell hängt von einer Vielzahl von Rahmenbedingungen ab, die<br />
im Laufe des Prozesses noch geklärt werden müssen. Erst dann kann eine entsprechende Entscheidung<br />
für das eine oder andere Modell getroffen werden.<br />
6.3.2 Organisationsmodelle<br />
Für die weitere organisatorische wie konzeptionelle Arbeit ist es wichtig, Strukturen aufzubauen, die dem<br />
Ziel „Aufbau eines Gartennetzwerkes“ dienlich sind.<br />
Auf regionaler Ebene ist es denkbar, Unternehmensverbände zu schaffen, bestehend aus Vertretern der<br />
Grünen Branche (Erwerbsgartenbau, Gartenarchitektur, Handwerk, Marketing, Tourismus). Ziel ist dabei<br />
ein regionales Netzwerk aufzubauen, um die regionale Gartenkultur in ihrer Vielfalt zu fördern und gemeinsam<br />
dieses Ziel zu verfolgen. Diese Interessensgemeinschaften werden auf Landesebene von einer<br />
Koordinierungsstelle entsprechend begleitet. Um im Know-how-Transfer voneinander zu profitieren, sollten<br />
regelmäßig Konferenzen und Werkstattgespräche durchgeführt werden. Es bietet sich so die Möglichkeit<br />
des Informationsaustausches und der Kontaktpflege. In diesen Prozess sind Institutionen wie die<br />
Deutsche Gesellschaft für Gartenkunst und Landschaftskultur e.V. (DGGL), die TourismusMarketing Niedersachsen<br />
GmbH oder die Deutsche Gartenbau Gesellschaft von 1822 e.V. (DGG) einzubinden. Diese<br />
Institutionen bringen neue Impulse in den Prozess und können aus den Erfahrungen aus anderen Ländern<br />
berichten.<br />
Eicklinger Amtshof GmbH 25
<strong>Landesinitiative</strong> GARTENHORIZONTE<br />
Eine weitere Option in der Region besteht in der Gründung eines Vereins, der dann später in das jeweilige<br />
Trägermodell des Dachverbandes übergeht. Mit einem Verein schafft man ein Instrument, mit dem<br />
man Ziele in Form einer Satzung formulieren kann und zum anderen schafft man eine finanzielle Basis,<br />
mit der man Öffentlichkeitsarbeit betreiben oder Anträge auf Fördergelder stellen kann. Durch die Mitgliedsbeiträge<br />
und Sponsoren können darüber hinaus die Kosten für die Tagungen etc. finanziert werden.<br />
Ein Kuratorium begleitet dabei die Arbeit mit der fachlichen und gesellschaftspolitischen Kompetenz und<br />
Erfahrung seiner Mitglieder, in dem Vertreter der Vereine wie die DGGL oder DGG Mitglied des Kuratoriums<br />
werden. Auch die bereits bestehende Steuerungsgruppe könnte ihre bisherige Aufgabe der Entscheidungsvorbereitung<br />
oder Vorgabe von Themen weiter folgen.<br />
7 Ausblick<br />
Mit dem Projektverbund GARTENHORIZONTE wurde ein Prozess begonnen, den Wert der Niedersächsischen<br />
Gartenkultur zu erfassen und langfristig einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Mit<br />
der vorliegenden Studie wurde ein weiterer Schritt zur Etablierung dieser potenziellen markentouristischen<br />
als auch wirtschaftlichen Säule getan. Die breite Beteiligung durch die Arbeitsgruppenmitglieder<br />
sowie die Beteiligung der Behörden für Geoinformation, Landentwicklung und Liegenschaften und des<br />
Niedersächsischen Ministeriums für Ernährung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz und Landesentwicklung<br />
als Auftraggeber sowie der Regierungsvertretung Lüneburg spiegeln das landesweite Interesse an<br />
diesem Thema wider.<br />
Als Gesamtergebnis kann zunächst festgehalten werden, dass die Beteiligten einstimmig den Aufbau eines<br />
landesweiten Gartennetzwerkes befürworten. Entsprechend dem Vorbild des National Trust soll in<br />
Niedersachsen langfristig eine Dachmarke etabliert werden, die die Initiativen und Akteure rund um das<br />
Thema Garten in einer hochwertigen Dachmarke vereint. Bis zur Gründung eines Gartennetzwerkes<br />
GARTENHORIZONTE in Niedersachsen sind noch einige Schritte erforderlich. Die aufgebauten Strukturen<br />
können zur Erreichung dieses langfristigen Ziels genutzt werden. Neben dieser ehrenamtlichen Arbeit<br />
sind aber noch weitere Studien und Projekte erforderlich, um die Grundlagen für ein erfolgreich funktionierendes<br />
Gartennetzwerk aufzubauen.<br />
Die vorhandene Bereitschaft der beteiligten Akteure, beim Aufbau eines Gartennetzwerkes mitzuarbeiten,<br />
ist vorhanden. Diese Chance für Niedersachsen gilt es zu ergreifen, um Niedersachsen im Ländervergleich<br />
weiter zu positionieren: Niedersachsen ist nicht nur Land der Pferde, sondern auch Land der Gärten!<br />
Eicklinger Amtshof GmbH 26
8 Anhang<br />
8.1 Beiträge aus den Arbeitsgruppen<br />
8.1.1 Arbeitsgruppe Gartenkultur<br />
<strong>Landesinitiative</strong> GARTENHORIZONTE<br />
Den folgenden Beitrag hat Herr Prof. Dr. Küster als Zusammenfassung der Arbeitsgruppenarbeit verfasst.<br />
Gärten in Niedersachsen<br />
Niedersachsen ist das einzige Bundesland, das von der Küste bis zum Mittel-Gebirge reicht. Grundsätzlich<br />
lassen sich drei Typen von Landschaften unterscheiden. Die weithin bewaldeten Berge sind von sehr<br />
fruchtbaren Lössgebieten umgeben, in denen schon seit Jahrtausenden intensiver Ackerbau betrieben<br />
wird. Die lockeren Ablagerungen von Heide und Geest sind weniger fruchtbar, aber man kann dort sehr<br />
gut Flächen gestalten. Wenn man Mineraldünger verwendet, um den Boden zu düngen, lassen sich auch<br />
hier hohe landwirtschaftliche Erträge erzielen. In diesen Gegenden wurde Bahnbrechendes im Rahmen<br />
der Landreformen des 19. Jahrhunderts geleistet, bei der Verkoppelung und der Markenteilung.<br />
Der dritte Typ Landschaft ist die Marsch an der Küste und den Unterläufen der großen Flüsse. Wo es zu<br />
Salzwasserüberflutungen kommen kann, wachsen keine Bäume. Die Menschen, die sich in der Marsch<br />
ansiedelten, brauchten Kontakte mit urbanen Zentren. Sie mussten Überschüsse erzielen, vor allem an<br />
Vieh, später auch an anderen landwirtschaftlichen Erzeugnissen, z.B. Raps oder Obst. Diese Güter<br />
brachten sie auf städtische Märkte, um Holz und andere Güter erwerben zu können, an denen es in der<br />
Marsch fehlte. Auf ihre jeweilige Art waren die Menschen in Niedersachsen stets sehr erfolgreiche Landwirte,<br />
und das sind sie bis heute geblieben: Niedersachsen ist das Agrarland Nummer Eins in Deutschland.<br />
Dies gilt auch für viele Zweige des Gartenbaus. Für Gewächse, die andernorts nur in kleinen Gärten<br />
gezogen werden, gibt es in Niedersachsen umfangreiche Kulturanlagen: das Alte Land für Obstbau, das<br />
Oldenburger Münsterland für Obst, Beerenobst und Gemüse, das Gebiet Ammerland/Ostfriesland westlich<br />
von Oldenburg für Baumschulen, der Raum Papenburg für Unterglas-Gemüse- und Kräuteranbau,<br />
einige Flussmarschen für Kohl, die sandigen Dünen um Nienburg, Burgdorf, Gifhorn und im Emsland für<br />
Spargel. Diese Anbaugebiete haben europa- oder sogar weltweite Bedeutung.<br />
Alle vielfältigen Regionen Niedersachsens haben ihre besonderen Gärten, die in Beziehung zur Landschaft<br />
in ihrer Umgebung gestaltet wurden. Da sind die kleinen Guts- und Klostergärten im Bergland zu<br />
nennen, die möglichst nicht auf ackerfähigem Grund liegen sollten. In den Heide- und Geestgebieten<br />
nutzte man häufig feuchte Senken mit schönen Baumbeständen für die Anlage von Parks. Viele Gärten<br />
der Marschen sind urban geprägt. In ihnen wurden besondere Pflanzen, darunter viele Exoten, gezogen,<br />
denn ihre Besitzer standen mit Stadtbewohnern im Kontakt und zeigten sich daher besonders offen für<br />
städtische Einflüsse. Überall ging es den Menschen auf ihre besondere Art darum, die Idee vom beständigen<br />
Paradies in ihrer Nähe zu haben, zu sehen: eine Reminiszenz an den sonnigen Süden, das weit<br />
entwickelte England, das geordnete Frankreich – oder einfach den Traum von Arkadien. Dabei darf nicht<br />
übersehen werden, dass selbst ein Barockgarten auch ein Nutzgarten gewesen sein kann. Auch dort<br />
wurde beispielsweise Obst angebaut.<br />
Eicklinger Amtshof GmbH 27
<strong>Landesinitiative</strong> GARTENHORIZONTE<br />
Niedersachsen weist zahlreiche interessante Landschaften auf, die insgesamt touristisch interessant<br />
sind. Beispiele sind die Wildeshauser Geest mit ihren Sandböden und Flussniederungen, die Region Ostfriesland<br />
mit ihren zahlreichen kulturellen Besonderheiten, das Artland mit seiner Agrarlandschaft und<br />
prunkvollen Fachwerkhöfen, die Parklandschaft Ammerland mit ihrem harmonischen Grün, die Lüneburger<br />
Heide, das Alte Land, Kehdingen, Butjadingen, das Emsland, das Osnabrücker Land, der Harz und<br />
sein überaus fruchtbares Umfeld, das Eichsfeld. Alle diese Gegenden sind beliebte Landschaften mit typischen<br />
Formen des Pflanzenanbaus, auch und gerade in Gärten.<br />
In Niedersachsen besteht häufig noch eine intakte Einheit des Besitzes; Gutshof, Garten und Agrarland<br />
sind in vielen Fällen noch in einer Hand vereint. Diese Besitzstruktur kann eine besondere Attraktion<br />
ländlicher Räume sein, auf die hinzuweisen wichtig ist, um Menschen an entlegene Räume zu binden<br />
und Besucher dorthin zu locken. Vielfach sind die Gutshöfe mit ihren Gärten und Gutsbetrieben die einzigen<br />
Attraktionen weit und breit! Einmalig in Niedersachsen ist die große Zahl von Klöstern und Klostergärten,<br />
die sich gemeinsam mit großen Agrar- und Forstflächen im Besitz der Klosterkammer und ähnlicher<br />
Fonds befinden. Überreste einer überkommenen ständischen Struktur, die sich in Niedersachsen<br />
wie kaum in einem anderen Gebiet Deutschlands erhalten haben, müssen ebenso wie die Strukturen der<br />
Klosterkammer beachtet werden, um eine gute Zukunft für Niedersachsens Agrar- und Gartenlandschaften<br />
zu finden.<br />
Alleinstellungsmerkmale niedersächsischer Gärten<br />
Unter anderem die Überreste der ständischen Struktur des Landes führen zu einem Alleinstellungsmerkmal<br />
von Gärten in Niedersachsen. Wohl nirgends sonst in Mitteleuropa gibt es so viele erfolgreiche Agrarbetriebe,<br />
die sich in der gleichen Hand befinden wie bedeutende Gutshöfe und Gartenanlagen. Hier<br />
lässt sich die Einheit von Agrarland, Garten und Gut noch erleben, und zwar in allen oben genannten,<br />
grundsätzlich verschiedenen geographischen Räumen. In anderen Teilen Deutschlands gab es entweder<br />
nicht so zahlreiche Güter, oder sie wurden im Zuge der Landreformen in der DDR zerschlagen. In den<br />
östlichen Bundesländern wird heute vielfach versucht, an alte Traditionen des Besitzes und der Bildung<br />
von Einheiten aus Gütern, Gärten und Agrarland wieder anzuknüpfen. Dies ist in Niedersachsen nicht<br />
notwendig, weil die alten Strukturen noch bestehen. Sie müssen aber in moderne Formen überführt werden,<br />
wobei sowohl wirtschaftliche als auch kulturelle bzw. kulturgeschichtliche Gesichtspunkte zu beachten<br />
sind.<br />
Gartenbesitzer als Kunden<br />
Jeder Gartenbesitzer ist ein potenzieller Kunde der zahlreichen Gartenbaubetriebe in Niedersachsen. Der<br />
Trend zum eigenen Garten, zur Erhöhung der Lebensqualität durch das Leben im Grünen und im Garten<br />
steigt weiterhin. Die „Erdung“ der Menschen durch den direkten Kontakt zu Natur und Landschaft, zur<br />
Schöpfung, zum Werden und Vergehen, zu Kreativität, Erfrischung und Erholung ist ein wichtiger Lebensinhalt<br />
geworden. Das Bewusstsein für die Kreisläufe der Natur entwickelt sich weiter. In den Gärten und<br />
in den Gartenbaubetrieben wird Enormes für die Gesundheit, soziale Aufgaben und letztendlich für die<br />
Wirtschaft in Niedersachsen geleistet. Man könnte von einer schleichenden „gartenkulturellen Revolution“<br />
sprechen, die sich derzeit bemerkbar macht. Sie findet zunehmend Beachtung in den Medien.<br />
Eicklinger Amtshof GmbH 28
<strong>Landesinitiative</strong> GARTENHORIZONTE<br />
Es lohnt sich, in Gärten und in den Gartenbau zu investieren. Es gibt bereits zahlreiche Initiativen im grünen<br />
Bereich, sie zu erfassen, langfristig zu erhalten und zu fördern ist eine große Aufgabe.<br />
In einer immer unübersichtlicheren Welt wird der Garten zum vertrauten konkreten Heimatort, wird die<br />
Gartenkultur – ähnlich wie traditionell in England und später auch in den Niederlanden – ein Stück sinnvoller<br />
Beschäftigung, ein neues und friedliches Hobby der Nationen mit großer Breitenwirkung. Allerdings<br />
benötigt Gartenkultur (wie jegliche andere Form von Kultur) bestimmte Strukturen zu ihrem Schutz, für ihre<br />
Förderung und Entwicklung. Ähnlich wie in den beiden Ländern mit einer Tradition breiter Gartenkultur,<br />
in Großbritannien und den Niederlanden, ist auch in Niedersachsen eine Förderung der Gartenkultur<br />
notwendig. In Großbritannien und den Niederlanden sowie auch in einigen anderen Bundesländern<br />
(Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt) gibt es diese Förderung. Besonders erwähnenswert ist der britische<br />
National Trust, von dem auch deshalb ein hochgradig effizienter Schutz von Gartenanlagen ausgeht,<br />
weil er sowohl den Denkmalbestand als auch Landschaften, Gärten und Naturschönheiten im Visier<br />
hat.<br />
Frau Brunken von der Gartenakademie Niedersachsen in Bad Zwischenahn hat zur Einbindung des Erwerbsgartenbaus<br />
folgende Einschätzung abgegeben.<br />
Erwerbsgartenbau profitiert von Gartennetzwerk Niedersachsen<br />
Gartenbaubetriebe haben teilweise selbst Schaugärten, besondere Sortensammlungen und eine lange<br />
Gärtnertradition über mehrere Generationen hinweg und tragen damit zur Gartenkultur in Niedersachsen<br />
bei. Jeder Gartenliebhaber ist ein potenzieller Kunde für die Gartenbaubetriebe. Je mehr Gartenbesucher,<br />
um so größer der Nutzen. Förderung des ländlichen Raums durch eine mögliche Verlagerung des<br />
Konsums auf die nähere Umgebung als Folge von Verzicht auf Urlaubsreisen, um den eigenen Garten<br />
oder die offenen Gärten in der Umgebung zu genießen.<br />
Handlungsfelder im Bildungsbereich des Gartennetzwerkes<br />
Nur gut informierte Gartenbesitzer kümmern sich um die Restaurierung und den Erhalt von historischen<br />
und kulturell bedeutsamen Gärten. Nur gut informierte Gartenbesitzer öffnen ihre Gartenpforte. Nur gut<br />
informierte Gartenbesitzer können relevantes Gartenwissen und wichtige Aspekte der Gartenkultur an ihre<br />
Besucher weitergeben.<br />
Die Niedersächsische Gartenakademie könnte als Bildungspartner die Weiterbildung im Gartennetzwerk<br />
übernehmen und organisieren. Sie hat Kontakt zu allen Einrichtungen des Erwerbsgartenbaus (Wissenschaft,<br />
Beratung, Produktion, Verbände). Sie kooperiert mit den Niedersächsischen Gartenfreunden, hat<br />
Kontakt zu mehreren Offenen Gartenpforten, bildet im Jahr etwa 600 Gartenliebhaber bei Seminaren weiter,<br />
führt Exkursionen durch, hält Vorträge zu allen Gartenthemen, berät am Gartentelefon und im Park<br />
der Gärten.<br />
Kostbares Gartenwissen geht in unserer Zeit verloren. Viele Menschen bewirtschaften keine Garten<br />
mehr, haben keine Zeit, keine Lust oder kein Verhältnis zum Garten, leben mit Fernsehen und virtuellen<br />
Medien wie Computerspielen und Internet. Dabei resultieren Urvertrauen, Erfolgserlebnisse und Naturer-<br />
Eicklinger Amtshof GmbH 29
<strong>Landesinitiative</strong> GARTENHORIZONTE<br />
fahrung aus dem direkten Umgang mit Tieren, Pflanzen, Wasser, Luft und Boden. Die steigende Nachfrage<br />
nach Angeboten der Niedersächsischen Gartenakademie zeigt, dass die Beziehung zur Natur wieder<br />
wichtiger genommen wird, sogar von vielen Menschen wieder mehr gebraucht wird. Defizite in der<br />
Weiterbildung bestehen besonders in den Bereichen Bodenpflege, Düngung und Pflanzenpflege. Ebenso<br />
in den Bereichen regionale Gartengestaltung, Pflanzenkenntnisse (geeignete Arten und Sorten, Standortansprüche,<br />
Wuchsformen, Pflanzengesellschaften). Auch in der Denkmalpflege und im Bewusstsein<br />
für historische Gartenkultur sind Weiterbildung, Motivation und Betreuung dringend notwendig. Gutes<br />
Gartenwissen bringt Erfolg – auch in Gärten und Einrichtungen, die sich im Gartennetzwerk Niedersachsen<br />
wieder finden.<br />
8.1.2 Arbeitsgruppe Entwicklung und Weiterentwicklung bestehender Anlagen<br />
Für die Notwendigkeit von Pflege im Zuge der Erhaltung von historischen, aber auch neuzeitlichen Gartenanlagen<br />
verfasste Herr Beck zusammen mit Herrn Schomann folgende Einschätzung.<br />
Die Bedeutung kontinuierlicher, fachlicher Pflege für Gartenanlagen [Text: R. Schomann]<br />
Der Erhalt eines Gartens ist ohne geeignete Pflege nicht möglich. Wird ein Garten nach seiner Gestaltung<br />
sich selbst überlassen, so tritt im selben Augenblick die Wirkung der natürlichen Sukzession ein und<br />
es entwickelt sich mit eigener Dynamik etwas völlig anderes. Gärten sind künstliche Objekte. Je nach<br />
Qualität sogar Objekte künstlerischen Schaffens, die mit Mitteln der Gartenarchitektur aus unterschiedlichen<br />
Materialien an ausgewähltem Ort mit ganz spezifischer Absicht angelegt wurden. Das wesentliche<br />
Merkmal von Gärten, das sie gerade von anderen Objekten des Handwerks sowie der bildenden Kunst<br />
unterscheidet, ist die Verwendung der lebenden Pflanze als charakterisierender Bestandteil. Sie allein<br />
macht bereits Pflege notwendig, da sie sich durch Wachstum verändert und insofern die ihr zugedachte<br />
Form sowie Dimension nicht beständig sein kann. Garten unterscheidet sich deshalb von Natur, da er nur<br />
unter einem ständigen Regulieren der natürlichen Kräfte Bestand hat. Selbst der so genannte Naturgarten<br />
muss gepflegt werden, wenn sich an seiner Stelle nicht die für diesen Ort spezifische natürliche Vegetation<br />
durchsetzen soll. Da Gärten Ergebnis einer Gestaltung sind, bedarf es besonderer Kenntnisse, um<br />
durch entsprechende Pflegemaßnahmen diese Gestaltung unter jeweils anderen spezifischen Bedingungen<br />
zu bewahren. Es hat sich deshalb das Gärtnerhandwerk mit seinen ganz eigenen Spezialisierungen<br />
entwickelt, um diesen besonderen Anforderungen gerecht werden zu können.<br />
Spezifische Anforderungen historischer Gärten an die Pflege [Text: R. Schomann/J. Beck]<br />
Fachgerechte gärtnerische Pflege ist die Voraussetzung für einen dauerhaften Erhalt eines Gartens in<br />
der ihm eigenen Gestaltungsform. Fachgerechte Pflege bedeutet dabei eine vorausschauende Berücksichtigung<br />
aller notwendigen Maßnahmen, die zur Regulierung der objekt- und standorttypischen Bedingungen<br />
vorgenommen werden müssen. Im Falle der Pflege historischer Gärten sind weitere Kenntnisse<br />
als gärtnerische notwendig und bei denkmalgeschützten historischen Gärten müssen darüber hinaus<br />
ganz besondere Aspekte bei der Pflege beachtet werden, um deren Bedeutung für die Allgemeinheit bewahren<br />
zu können. Gilt es bei normalen Gärten im wesentlichen, deren Form und Gestalt sowie ihre Wirkung<br />
zu erhalten, so wird bei denkmalgeschützten Gärten versucht, mit geeigneten Mitteln die insbeson-<br />
Eicklinger Amtshof GmbH 30
<strong>Landesinitiative</strong> GARTENHORIZONTE<br />
dere in der Originalität begründeten ganz besonderen überkommenen Eigenschaften zu tradieren. Ein<br />
denkmalgeschützter historischer Garten bedarf deshalb einer denkmalgerechten Pflege. Für diese ist als<br />
Voraussetzung ein objektspezifisches Erhaltungsziel zu formulieren und mit geeigneten Mittel des Handwerks<br />
aber auch im besonderen Fall der wissenschaftlichen Forschung kontinuierlich umzusetzen. Selbst<br />
bei guter Absicht ist, wie sich bedauerlicherweise seit Jahren vielfach zeigt, ein denkmalgeschützter Garten<br />
nicht ohne besonderes fachliches Wissen zu erhalten. Ohne die Berücksichtigung solchen Wissens<br />
würde ein wesentlicher Teil dieses Kulturgutes verloren gehen.<br />
Dass gerade die Besitzer historischer Gärten heute vor schwerwiegenden Problemen bei der täglichen<br />
Pflege stehen, hat vielfältige Ursachen. Neben steigenden Personalkosten bei gleichzeitig sinkenden<br />
Einnahmen beispielsweise in der Landwirtschaft ist es vor allem der veränderte Kontext vieler Anlagen.<br />
Gutsgärten beispielsweise waren noch im 19. Jahrhundert Teil von personalintensiven Großbetrieben, bei<br />
denen immer eine oder mehrere Arbeitskräfte für Gartenarbeiten zur Verfügung standen. Oft gab es sogar<br />
fest angestellte Gärtner. Heute werden auch große Güter nur noch von einer Person mit entsprechendem<br />
Maschineneinsatz bewirtschaftet, so dass keine Möglichkeit mehr besteht, nebenbei noch einen<br />
Garten zu pflegen. Aber auch andere Grünanlagen sind von Veränderungen betroffen: Kurparks sind mit<br />
neuen Ansprüchen der Besucher konfrontiert, Residenzanlagen sind zu viel besuchten Stadtparks geworden,<br />
Wallanlagen durch zunehmenden Verkehr beeinträchtigt. Viele Städte haben ihre Grünflächenämter<br />
aufgelöst und sind mit teilweise erheblichen Haushaltsdefiziten belastet. All dies hat Folgen für die<br />
Pflege und Erhaltung der Park- und Gartenanlagen.<br />
Besondere Qualitäten der niedersächsischen Gartenkultur<br />
Die Gartenkultur Niedersachsens zeichnet sich durch eine große Vielfalt verschiedener Anlagen aus.<br />
Dementsprechend groß ist auch die Zahl der historischen Gärten. Sie sind häufig im privaten Kontext<br />
entstanden und noch heute in Privatbesitz. Obwohl viele Anlagen unter prinzipiell ähnlichen Voraussetzungen<br />
entstanden sind (beispielsweise die zahlreichen Gutsgärten), ist ihre konkrete Ausprägung und<br />
Gestaltung immer unterschiedlich, weil die Landschaft, die Lage, die finanziellen Möglichkeiten der Besitzer<br />
etc. bei jedem Objekt anders war. So hat sich eine faszinierende Reichhaltigkeit der Gartenkultur heraus<br />
gebildet, die in anderen Bundesländern so nicht vorhanden ist. Darüber hinaus sind viele Anlagen in<br />
eine noch intakte Kulturlandschaft eingebettet. Auch darin liegt eine Besonderheit der niedersächsischen<br />
Gärten.<br />
Historischer Garten und denkmalgeschützter Garten – rechtliche Grundlagen [Text: R. Schomann]<br />
Die Begriffspaare „historischer Garten“ und „denkmalgeschützter Garten“ sind im Allgemeinen gebräuchlich,<br />
wenn auf besondere alte Gärten hingewiesen wird. Beide Begriffspaare stehen jedoch nicht für den<br />
gleichen Inhalt, sondern unterscheiden sich in wesentlichen Aspekten. Mit der Bezeichnung „historischer<br />
Garten“ wird auf ein Objekt verwiesen, dass sich aufgrund einer herausragenden Bedeutung von anderen<br />
alten Gärten unterscheidet. Der Begriff „denkmalgeschützter Garten“, im Allgemeinen als „Gartendenkmal“<br />
bezeichnet, steht für Objekte, die einen Wert im Sinne eines Denkmalschutzgesetzes darstellen. Für<br />
Niedersachsen subsumiert das Niedersächsische Denkmalschutzgesetz die „Gartendenkmale“ in Paragraf<br />
3 unter dem Begriff Kulturdenkmal. Im Sinne dieses Gesetzes handelt es sich um Objekte, „an deren<br />
Erhaltung wegen ihrer geschichtlichen, künstlerischen, wissenschaftlichen oder städtebaulichen Bedeu-<br />
Eicklinger Amtshof GmbH 31
<strong>Landesinitiative</strong> GARTENHORIZONTE<br />
tung ein öffentliches Interesse besteht“. Insofern bilden „denkmalgeschützte Gärten“ eine besondere Kategorie,<br />
da sie eine Auswahl von Objekten darstellen und mit ihnen in besonderer Weise umzugehen ist,<br />
die in Paragraf 1 des Niedersächsischen Denkmalschutzgesetzes durch den Grundsatz formuliert ist,<br />
dass sie zu schützen, zu pflegen und wissenschaftlich zu erforschen sind.<br />
Bei der Pflege und Unterhaltung eines Gartens kann eine Vielzahl an gesetzlichen Regelungen von Bedeutung<br />
sein. Je nach Art der Pflege und Intensität von Maßnahmen müssen bestimmte Bundes- oder<br />
Landesgesetze aber möglicherweise auch kommunale Verordnungen berücksichtigt werden. So besitzt<br />
unter anderen das Naturschutzrecht, das Waldrecht, das Wasserrecht, das Abfallbeseitigungsrecht, das<br />
Bodenrecht, das Baurecht aber auch das Nachbarschaftsrecht eine mögliche Relevanz bei bestimmten<br />
Formen des Umgangs. Handelt es sich bei einem Objekt um einen denkmalgeschützten Garten, so ist<br />
vor allen das Niedersächsische Denkmalschutzgesetz zu berücksichtigen. Dieses regelt den Verfahrensablauf<br />
und den Rahmen des möglichen Umgangs.<br />
Auswahl der Objekte, die im Rahmen des Projektes von Interesse sind<br />
In Zusammenarbeit mit der Gruppe Gartenkultur sollte zunächst ein Überblick über die niedersächsische<br />
Gartenkultur gegeben und dabei herausgestellt werden, welche Anlagen im Zusammenhang mit dem<br />
Thema „Niedersächsische Gartenkultur“ interessant sein könnten. Einen Schwerpunkt sollten dabei historische<br />
Gärten bilden, aber auch neuere Anlagen, Arboreten, Pflanzensammlungen, Friedhöfe, Kuranlagen<br />
etc. müssen in die Betrachtung mit einbezogen werden. Ebenso gehören dazu diejenigen Anlagen,<br />
die vor allem als Teil einer Gesamtanlage (Ensemble) interessant sind und mit anderen baulichen Anlagen<br />
eine Einheit bilden. Ein Auswahlkriterium sollte eine gewisse öffentliche Zugänglichkeit der Anlagen<br />
sein, ein weiteres das übergeordnete Interesse an ihrer Erhaltung.<br />
Bei dieser Zusammenstellung sollte auf das bereits vorhandene Material zurückgegriffen und die Kooperation<br />
mit anderen Institutionen gesucht werden, die sich ebenfalls mit dem Thema beschäftigen, beispielsweise<br />
den Landschaften, dem Heimatbund etc.<br />
Betrachtung verschiedener Modelle der Entwicklung/Weiterentwicklung<br />
Der Begriff Entwicklung kann verschiedene Bedeutung haben. Im Fall der historischen Gärten sollte er im<br />
Sinne der Entwicklungspflege verstanden werden; bei neueren Anlagen sollte es eine zielgerichtete, dem<br />
Projektgedanken entsprechende Entwicklung sein. Diese kann von einer verbesserten Öffentlichkeitsarbeit<br />
bis hin zu baulichen Veränderungen reichen.<br />
Bisher wurde für jedes Objekt eine individuelle Lösung der Pflege, Erhaltung und Entwicklung gefunden.<br />
Die Besitzer vieler historischer Gärten haben die Art und Weise der Pflege und deren Umfang an ihre<br />
Möglichkeiten angepasst, oft bis hin zur weitgehenden Einstellung der Pflege aus finanziellen Gründen. In<br />
anderen Fällen sind erfolgreiche Strategien für die Lösung spezieller Probleme erarbeitet worden, sei es<br />
für die Gestaltung von Postkarten, Prospekten oder Parkplätzen. Ziel der <strong>Gartenhorizonte</strong> sollte es sein,<br />
übergreifende Ansätze zu finden und umsetzbare Modelle zu entwickeln, die für mehrere Anlagen eine<br />
Lösung bringen. Um die große Vielfalt der Gärten zu erhalten, müsste eine Struktur entwickelt werden,<br />
die die Eigentümer bei der Pflege, Erneuerung und Weiterentwicklung der Anlagen unterstützt.<br />
Eicklinger Amtshof GmbH 32
<strong>Landesinitiative</strong> GARTENHORIZONTE<br />
Im Hinblick auf das bestehende Pflegeproblem in vielen historischen Gärten sollten Beispiele für die vorbildliche<br />
Pflege bzw. Pflegeorganisation gesammelt und dargestellt werden. Dabei können sowohl kleine<br />
Initiativen berücksichtigt werden, die sich nur einer Anlage widmen, als auch große Institutionen wie die<br />
Stiftungen und Gartenverwaltungen in anderen Bundesländern. Trotz der teilweise positiven Beispiele<br />
wäre jedoch eine wissenschaftlich fundierte Studie zur Entwicklung eines Modellprojekts unbedingt notwendig.<br />
Bestandsaufnahme der gegenwärtig existierenden Lösungsansätze<br />
Es sollte der Versuch einer Bilanzierung unternommen werden: was funktioniert bei der gegenwärtigen<br />
Pflegesituation, was funktioniert nicht? Wie ist die Position Niedersachsens im bundesweiten Vergleich?<br />
Welche Modelle sind in anderen Bundesländern bzw. in anderen europäischen Ländern erfolgreich? Anhand<br />
verschiedener Beispiele sollte dargestellt werden, wie derzeit die Pflege durchgeführt wird. Das<br />
Bemühen der Besitzer um eine fachgerechte Pflege ist sichtbar, die Notwendigkeit wird bei den Besitzern<br />
gesehen. Fachliche und finanzielle Unterstützung ist erforderlich.<br />
Weiterhin wäre wichtig, in denkmalgeschützten Anlagen die Möglichkeiten aber auch die Grenzen der<br />
Entwicklungsfähigkeit aufzuzeigen und an einzelnen Beispielen das Potential der Anpassung an heutige<br />
Ansprüche aufzuzeigen. Die Chancen, die der Einsatz geförderter Arbeitskräfte in Gartenanlagen für deren<br />
Erhaltung bietet, sollten dabei besonders berücksichtigt werden.<br />
Das Schwerpunktthema Entwicklung/Erhaltung ist zwar besonders bei der Betrachtung der historischen<br />
Gärten von Bedeutung, aber auch bei neueren Anlagen sollten Aspekte der planerischen Entwicklung<br />
bedacht werden, beispielsweise wenn es zu Veränderungen aus Gründen der Tourismusförderung<br />
kommt.<br />
Langfristige Sicherung der Pflege<br />
Bedrohlich für alle Grünanlagen ist sowohl die unterlassene als auch die fachlich falsche Pflege. In vielen<br />
Fällen ist jedoch schon die alltägliche Pflege unzureichend, was besonders für die historischen Gärten<br />
bedrohlich ist. Denn für diese Objekte stellt eine über lange Jahre reduzierte Pflege eine existentielle Gefahr<br />
dar. Wertvolles Kulturgut in erheblichem Umfang ist vom Verfall bedroht.<br />
Die Besitzer, private wie öffentliche, müssen fachliche Unterstützung durch qualifizierte Beratung erhalten.<br />
Denn bei fachlich falscher Pflege droht ebenfalls der Verlust von Substanz und Schönheit.<br />
Die mit der Pflege betrauten Personen sollten in vorbildlichen Anlagen besonders geschult werden. Dies<br />
betrifft insbesondere die historischen Gärten. Für die Gartenakademie in Bad Zwischenahn könnte dies<br />
ein Betätigungsfeld sein.<br />
Die Pflege für die Eigentümer muss finanzierbar gemacht werden. Dazu ist zum einen die Information darüber<br />
wichtig, dass die richtige und ausreichende Pflege für einen Garten lebensnotwendig ist. Gartenkultur<br />
ist Teil des Sektors Kultur/Bildung und daher entsprechend zu behandeln. Eine finanzielle Effizienz<br />
darf nicht erwartet werden. Andererseits muss die finanzielle Situation der Eigentümer verbessert werden.<br />
Der Zugang zu Geldern muss erleichtert werden (EU-Gelder sind häufig zu kompliziert), andere Erleichterungen<br />
(Steuerrecht) müssen greifen.<br />
Eicklinger Amtshof GmbH 33
<strong>Landesinitiative</strong> GARTENHORIZONTE<br />
Das Projekt „<strong>Gartenhorizonte</strong>“ sollte sich aber nicht nur mit einzelnen Anlagen beschäftigen, sondern<br />
auch deren Umfeld in die Betrachtungen einbeziehen. Denn auch dort sind Fehlentwicklungen zu beobachten.<br />
Diese resultieren in der Regel aus Nutzungsänderungen, beispielsweise bei der Umwandlung<br />
von landwirtschaftlich genutzten Flächen in Bauland. Daher sollte „<strong>Gartenhorizonte</strong>“ sich für die stärkere<br />
Berücksichtigung von Grünanlagen auf anderen Planungsebenen einsetzen, etwa bei der Dorferneuerung<br />
und bei der Ausweisung neuer Bau- und Gewerbeflächen.<br />
Neue Informationsmöglichkeiten<br />
Ein allgemeines Medium, das über die Geschichte, die künstlerische Bedeutung oder botanische Besonderheiten<br />
eines Gartens informiert, fehlt bisher. Ebenfalls nur mühsam zu finden sind aktuelle Angaben<br />
zu Besichtigungsmöglichkeiten, Veranstaltungen, Terminen, Übernachtungsangeboten und Serviceeinrichtungen.<br />
Zwar verfügen mittlerweile sehr viele einzelne Objekte über eine eigene Homepage, auf der<br />
entsprechende Angaben vorhanden sind, aber sie lassen sich bisher nicht über ein zentrales Stichwort<br />
bzw. ein sinnvolles Suchsystem abrufen. Wichtig wäre beispielsweise die Möglichkeit, in einem gemeinsamen<br />
Verzeichnis gezielt nach Regionen, bestimmten Gartentypen, nach Gärten mit einem gastronomischen<br />
Angebot usw. suchen zu können. Für ein solches System wäre die Bildung von Kategorien wichtig,<br />
die im Hinblick auf notwendige Maßnahmen überprüft werden sollten. Beispielsweise könnten von der<br />
Arbeitsgruppe Möglichkeiten benannt werden, wie ein Garten durch entsprechende Maßnahmen in eine<br />
bestimmte Kategorie gelangen kann; dazu könnte die Überprüfung auf Rollstuhlgerechtigkeit gehören mit<br />
Maßnahmenvorschlägen zur Verbesserung der Situation, oder die Konzeption von Hinweis- und Erläuterungstafeln<br />
und der Auswahl der Aufstellungsorte.<br />
Ein Netzwerk, in dem über Anlagen, deren Pflege und die Lösung bestimmter Probleme informiert wird,<br />
sollte in erster Linie für historische Gärten eingerichtet werden. Entscheidend für die Auswahl der Objekte<br />
ist die kulturhistorische Bedeutung und nicht der Zustand einer Anlage. Das Objekt sollte für sich selbst<br />
stehen und an sich interessant sein.<br />
Der Informationsaustausch zwischen den Besitzern – öffentlicher wie privater – ist unzureichend. Die gegenseitige<br />
Information über Probleme bei der Pflege und deren Lösung, Finanzierungsmöglichkeiten von<br />
Maßnahmen, Terminabsprache und ähnliches finden nicht oder nur zufällig informell statt. Innerhalb eines<br />
internen Netzwerkes könnte zum Nutzen aller Teilnehmer zu bestimmten Themen, darunter auch<br />
Pflege und Entwicklung der Anlagen, eine Plattform eingerichtet werden, die Berichte, Erfahrungen und<br />
Anregungen zu diesen Themen sammelt und allgemein zugänglich macht. Wichtig wäre hier eine professionelle,<br />
qualitätvolle Aufarbeitung und Darstellung. Wenn beispielsweise aus einem Garten über die Entschlammung<br />
eines Teiches berichtet wird, sollten die Ausgangssituation, die Entscheidung für oder gegen<br />
eine bestimmte Methode, mögliche im Verfahren aufgetretene Schwierigkeiten und das Ergebnis umfassend<br />
dargestellt werden, damit sich andere Besitzer bei einer entsprechenden Maßnahme im eigenen<br />
Garten informieren können. Ebenso könnte über Erfahrungen mit Veranstaltungen und ähnliches berichtet<br />
und eine Pflanzenbörse eingerichtet werden. Gleichzeitig könnte dies Forum als eine Art Anbieterplattform<br />
gestaltet werden, auf der sich Firmen mit einem bestimmten qualifizierten Label präsentieren.<br />
Eicklinger Amtshof GmbH 34
Einflussnahme auf gesetzliche Vorgaben<br />
<strong>Landesinitiative</strong> GARTENHORIZONTE<br />
Bezüglich der Rechtslage wäre zu fordern, dass für bestimmte historisch wertvolle Anlagen oder andere<br />
interessante Objekte die Bedürfnisse des Gartens Vorrang vor den aus Gesetzen erwachsenden Forderungen<br />
und Auswirkungen haben. Das betrifft beispielsweise das Wasser-, Boden-, Forst- und Naturschutzrecht<br />
sowie einzelne Verordnungen wie das Lagern von Erdreich nach Entschlammungen etc.<br />
Auch die Reichweite des Naturschutzrechts sollte eingeschränkt werden können.<br />
Ebenso muss die Haftungsregelung im Fall der Zugänglichkeit historischer Anlagen anders gestaltet werden.<br />
Die Anpassung der Gärten an die Bedingungen des heutigen Haftungsrechts wäre mit sehr großen<br />
Verlusten gerade der Substanz verbunden, die den Wert und den besonderen Reiz dieser Anlagen ausmachen,<br />
beispielsweise alter Bäume oder alter, nicht der heutigen Bauordnung entsprechender Parkbauten.<br />
Dies wäre auch eine wichtige Forderung im Hinblick auf eine stärkere Öffnung gerade der privaten<br />
historischen Anlagen und eine Voraussetzung für ein besseres Marketing.<br />
Gärten als Hort botanischer Raritäten<br />
Die pflanzlichen Ressourcen besonders der historischen Gärten stellen ein großes Potenzial dar. Es sollte<br />
erhalten und genutzt werden. Durch ein Internetforum für historische Pflanzen kann eine (Wieder-)<br />
Verbreitung von seltenen Züchtungen unterstützt werden. Insgesamt stellen die Anlagen eine Art Genbank<br />
dar, deren Potenzial erschlossen werden sollte. Historisch relevante Park- und Gartengehölze (Zierund<br />
Nutzgehölze) sollten gezielt vermehrt und wieder in den Handel gebracht werden. Dazu wäre die Einrichtung<br />
einer speziellen Baumschule notwendig.<br />
Professionelles Marketing für <strong>Gartenhorizonte</strong><br />
Für die Anliegen der <strong>Gartenhorizonte</strong> muss auf Landesebene professionell geworben werden. Bei landesweiten<br />
Veranstaltungen muss <strong>Gartenhorizonte</strong> als ein zentrales Projekt herausgestellt werden.<br />
Nach den jüngst abgeschlossenen Forschungsprogrammen zum Thema „Pflege historischer Gärten“ und<br />
der allgemeinen Institutionalisierung des Schutzgedankens für wertvolle Garten- und Parkanlagen und<br />
andere Landschaftselemente (Denkmalschutz, Natur- und Landschaftsschutz etc.) könnte sich Niedersachsen<br />
als das Land profilieren, in dem die drängenden Probleme der Unterhaltung modellhaft gelöst<br />
werden.<br />
Forschungsprojekte zu den entsprechenden Themen sollten gebündelt und deren Durchführung erleichtert<br />
werden. Dazu wäre eine einfachere Antragstellung und die Unterstützung der Verwaltungsinstitutionen<br />
hilfreich. Für Niedersachsen wichtig könnte eine Bestandsaufnahme der bisherigen Pflegeprojekte<br />
sein und die Beantwortung der Frage, welche Strategien in verschiedenen Anlagen zur Bewältigung der<br />
Pflege möglich wären und wie sie umgesetzt werden könnten. Dies ist in dem sonst vorbildhaften Projekt<br />
der „Gartenträume“ in Sachsen-Anhalt nicht geschehen.<br />
Eicklinger Amtshof GmbH 35
8.1.3 Arbeitsgruppe Tourismus und Marketing<br />
<strong>Landesinitiative</strong> GARTENHORIZONTE<br />
Innerhalb der vorliegenden Studie hatte die AG Tourismus und Marketing die Aufgabe, Vorschläge für<br />
touristisches Marketing und für das Netzwerk als solches zu erarbeiten. Um Vorschläge für das Marketing<br />
des Netzwerkes und für touristisches Marketing entwickeln zu können, wurden zunächst die Ziele des<br />
Netzwerkes festgelegt. Über die bereits in der ersten Arbeitsgruppensitzung formulierten Ziele hinaus,<br />
sollte das Netzwerk weitere Ziele verfolgen:<br />
- Öffentlichkeitsarbeit für öffentlich zugängliche Gärten<br />
- Öffentlichkeitsarbeit an die Fachöffentlichkeit<br />
- Kooperation mit Marketingorganisationen<br />
- Entwicklung und Umsetzung von Qualitätsstandards für gartentouristische Angebote<br />
- Information und Beratung zu gartenkulturellen Themen<br />
- Informationen über Pflegemanagement<br />
- Unterstützung von Eigentümern und Kommunen bei der Erhaltung historischer Gärten<br />
- …<br />
Die Marke „<strong>Gartenhorizonte</strong>“ bietet die Chance, eine Dachmarke für alle in Niedersachsen angebotenen<br />
Gartenfestivals, Landpartien, Seminare, Führungen, Schulungen, Märkte, … zu sein. Ebenso können sich<br />
private und öffentliche Gärten darunter präsentieren. Die Dachmarke würde eine in Niedersachsen vorhandene<br />
Lücke schließen.<br />
Anforderungen an das Produkt Gärten und Parkanlagen (Qualitätskriterien)<br />
Weil Marken dem Kunden ein Qualitätsversprechen des Produktes und des dahinter stehenden Unternehmens<br />
bieten, müssen Qualitätsanforderungen an die unter „<strong>Gartenhorizonte</strong>“ zusammengefassten<br />
Angebote gestellt werden. Die Mitglieder der AG Tourismus/Marketing haben im Folgenden drei wesentliche<br />
Qualitätskriterien herausgearbeitet: Attraktivität, Pflegezustand und Infrastruktur. Unter dem Stichwort<br />
Attraktivität ist zu prüfen, ob eine gartenkulturelle Relevanz (historisch oder zeitgenössisch) vorliegt, ob<br />
Mehrwertangebote (z.B. Führungen, kulturelle Veranstaltungen) vorgehalten werden, ob es sich um einen<br />
Ort der Sicherheit handelt (physisch und emotional), ob sich der Garten oder Park sinnlich erfahren lässt,<br />
inwieweit eine regionale Identifikation stattfinden kann. Hoher Standard und Nachhaltigkeit sind bei der<br />
Überprüfung des Pflege- bzw. Erhaltungszustandes wichtige Indikatoren. Unter dem Qualitätskriterium<br />
Besucherinfrastruktur ist die Zugänglichkeit eines Gartens oder Parks zu verstehen im Hinblick auf Erreichbarkeit,<br />
Öffnungszeiten, Barrierefreiheit, Informationsangebot, Parkplatzangebot, Gastronomie- und<br />
Sanitäranlagen in der Nähe, Besucherlenkung.<br />
Touristische Vermarktung des Produktes Gärten und Parkanlagen<br />
Eines der Ziele des Netzwerkes ist es, der wachsenden Zahl an Gartenliebhabern, -interessierten und<br />
Gartentouristen einen leichten Informationszugang für Ausflugstipps und Reiseangebote in Niedersachsen<br />
zu verschaffen. Eine Internetrecherche durch die Projektgruppe nach gartentouristischen Angeboten<br />
Eicklinger Amtshof GmbH 36
<strong>Landesinitiative</strong> GARTENHORIZONTE<br />
bei den Marketingorganisationen hat ergeben, dass umfassende Informationen aus Kundensicht schwer<br />
auffindbar sind und gartentouristische Pauschalangebote gar nicht aufgefunden wurden. Mögliche Gründe<br />
dafür können neben einer mangelnden Themenbereitschaft, finanzielle Grenzen und fehlende Vernetzung<br />
zwischen Touristikern und Gartenfachleuten sein. Für das Tourismusmarketing in Niedersachsen<br />
sind unterschiedliche Tourismusorganisationen zuständig, die Hauptansprechpartner für die Entwicklung<br />
operativer touristischer Kommunikationskonzepte sein sollen: die Landesmarketingorganisation (TourismusMarketing<br />
Niedersachsen GmbH), regionale Marketingorganisationen (u.a. Die Nordsee GmbH, Lüneburger<br />
Heide GmbH, Harzer Verkehrsverband, …) und örtliche Touristinformationen.<br />
Die AG Tourismus/Marketing empfiehlt, nach einer umfassenden Bestandsanalyse niedersächsischer<br />
Gärten und Parks in einem moderierten Prozess mit den Tourismusorganisationen der Landes- und Regionalebene<br />
die in das Tourismusmarketing integrierbaren Gärten und Parks zu identifizieren. Mit der<br />
Landesmarketingorganisation ist zu klären, ob und unter welchen Voraussetzungen die Dachmarke „<strong>Gartenhorizonte</strong>“<br />
durch die TMN und ggf. regionale Tourismusorganisationen vermarktet wird. Das Netzwerk<br />
ist Dienstleister für alle Tourismusorganisationen und berät sie in gartenspezifischen Fragen. Die gartentouristische<br />
Produktentwicklung wird entweder durch regionale oder örtliche Tourismusorganisationen erfolgen.<br />
Bei dieser Aufgabe werden sie unterstützt durch das Gartennetzwerk. Die touristische Vermarktung<br />
muss in Zuständigkeit und Verantwortung der regionalen Tourismusmarketingorganisationen liegen.<br />
Netzwerk (Marketing für das Netzwerk: Innen-/Außenmarketing)<br />
Die AG Tourismus/Marketing unterscheidet im Netzwerk zwischen Partnern, Akteuren und Förderern.<br />
(Partner = offizielle Partner des Projektes, Förderer = finanzielle Förderer (Sponsoren) und ideelle Unterstützer,<br />
Akteure =Organisationen und Initiativen, die sich im Allgemeinen für die Gartenkultur in Niedersachsen<br />
einsetzen).<br />
Vor dem Hintergrund der Ziele eines Gartennetzwerkes für Niedersachsen und der Notwendigkeit einer<br />
stärkeren touristischen Vermarktung von Gärten und Parks, ist es erforderlich, ein Kommunikationskonzept<br />
zu entwickeln, um die relevanten Öffentlichkeiten (Außenmarketing: Kunden, Tourismusorganisationen,<br />
Gärtnereien, Staudenfreunde…Innenmarketing: private Eigentümer, Fachleute für Pflegemanagement,<br />
verschiedene Landesministerien, Städte und Gemeinden als öffentliche Eigentümer …) zu informieren<br />
und zu vernetzen. Folgende mögliche Kommunikationsmaßnahmen werden empfohlen.<br />
Für das Innenmarketing:<br />
- Foren zum Informationsaustausch<br />
(Seminare, Workshops, jährliche Netzwerktage mit Themenschwerpunkten, …)<br />
- Einrichtung einer Koordinierungsstelle (institutionalisiert)<br />
Für das Außenmarketing<br />
- Erstellung eines Veranstaltungskalenders (hiermit erreicht man Zielgruppen, die über die Gruppe der<br />
Garteninteressierten hinausgehen; ein effizientes und Ressourcen sparendes technisch und redaktionelles<br />
Datenmanagement sollte die Basis bilden);<br />
Eicklinger Amtshof GmbH 37
<strong>Landesinitiative</strong> GARTENHORIZONTE<br />
- weitere Instrumente: eine eigene Homepage, die alle Angebote bündelt, Printmedien, Präsentationen<br />
auf Messen und Gartenschauen durch die teilnehmenden Partner<br />
Netzwerk-Nutzen für Tourismusmarketing, Kommunen, Land<br />
Von einem landesweiten Gartennetzwerk profitieren unterschiedliche Organisationen und Institutionen:<br />
Touristische Marketingorganisationen<br />
Mit Garten(-kulturtourismus) kann ein Trendthema aufgenommen werden. Gärten können den kulturellen<br />
Aspekt mit sinnlicher Erfahrung angenehm verbinden, Geist und Seele werden gleichermaßen angesprochen.<br />
Qualitativ hochwertige Gärten können ein attraktives Ausflugsziel, insbesondere für Tages-/ Kurzreisen<br />
sein. In Kombination mit Veranstaltungen oder weiteren touristischen Zielen können Gärten eine<br />
breite Interessengruppe bedienen. Gärten, Gartenbaubetriebe mit speziellem Sortiment oder Landschaften<br />
mit hoher Attraktivität können bereits bestehende touristische Angebote in einer Region ergänzen und<br />
erweitern. Mit einem Netzwerk, das alle Akteure und Initiativen vereint, hätten Marketingorganisationen<br />
einen, im Idealfall, fachkundigen Ansprechpartner. Das Netzwerk bietet eine Plattform (Inhalte, Kontakte,<br />
Know-how bzw. Hilfestellung) für die Entwicklung touristischer Angebote.<br />
Zusammengefasst: Touristische Marketingorganisationen haben über das Netzwerk die Möglichkeit touristisch<br />
attraktive Gärten qualitativ weiter zu entwickeln, touristisch attraktive Gärten in touristische Produkte<br />
einzubauen und sie können aus einer bestehenden Datenbank Bausteine für Reiseangebote suchen.<br />
Kommunen und Landkreise<br />
Das Netzwerk ist Hauptansprechpartner für alle Fragen rund um das Thema Gartenkultur in der Gemeinde/Stadt<br />
und bietet eine kompetente Beratungsstelle im Land für Kommunen, die öffentliche Gärten bzw.<br />
Parks planen, pflegen und nutzen (z.B. Parks in Kur- und Erholungsorten). Darüber hinaus kann das<br />
Netzwerk das gartenkulturelle Potenzial einer Region aufzeigen und entwickeln helfen. Es kann unterstützen<br />
und stärken z.B. durch Initiierung von Projekten, Akquisition von Fördermitteln und Mitteln zur<br />
Kofinanzierung, Marketingkooperationen oder Vernetzung auf nationaler und internationaler Ebene. Das<br />
Netzwerk fungiert als Dienstleister für die Kommunen.<br />
Das Netzwerk trägt zur Stärkung der Wirtschaft in einer Region bei, z.B. durch den Ausbau des touristischen<br />
Potenzials der niedersächsischen Gartenkultur, durch die Schaffung von Arbeitsplätzen in Gärten<br />
und Gartenbaubetrieben. Nicht zuletzt ist dem Netzwerk ein sozialer Effekt zuzuschreiben: es stärkt die<br />
regionale Identität. Die Arbeit in der Pflege von Gärten und Parks bietet eine geeignete Plattform zur Anbindung<br />
von innovativen Projekten zur Qualifizierung und zur Integration von sozial benachteiligten Menschen.<br />
Land Niedersachsen<br />
Gartenkultur ist ein wesentlicher Erwerbszweig in Niedersachsen, das Netzwerk hilft, dieses Potenzial<br />
noch weiter auszuschöpfen. Darüber hinaus dient das Netzwerk der Profilierung/Imagepflege des Landes<br />
Niedersachsen. Zurzeit gibt es rund 26 gegründete bzw. in Gründung befindliche Gartennetzwerke in<br />
Deutschland. Mit einem niedersächsischen Netzwerk kann sich das Land innerhalb der Aktivitäten ande-<br />
Eicklinger Amtshof GmbH 38
<strong>Landesinitiative</strong> GARTENHORIZONTE<br />
rer Länder entsprechend positionieren. Schließlich kann das Netzwerk die niedersächsischen gartenkulturellen<br />
Belange bundesweit kommunizieren.<br />
Netzwerk-Nutzen für Netzwerkförderer, -partner, -akteure<br />
Förderer und Partner finden in dem Netzwerk einen fachkundigen Ansprechpartner zur gemeinsamen<br />
Entwicklung von ideellem und finanziellem Engagement. Als institutionalisierter Träger kann das Netzwerk<br />
auch der abwickelnde Partner (Sponsoringverträge, Spendenbescheinigungen) sein. Das Thema<br />
Gartenkultur ist positiv besetzt und insofern attraktiv als Werbethema oder -plattform für Sponsoren und<br />
Partner. Die Vielfalt und die regionale Verankerung der Gartenkultur in Niedersachsen bieten umfassende<br />
Möglichkeiten für Partner und Sponsoren, sich zu engagieren: von der Sanierung einer historischen<br />
Gartenanlage bis zur Pflanzung eines Baumes auf dem Dorfplatz in der eigenen Gemeinde.<br />
Eine Fachadresse für Gartenkultur in Niedersachsen stärkt das Image des Themas und erleichtert die<br />
Kontaktaufnahme von Interessierten. Über das Netzwerk können Ressourcen effizienter eingesetzt werden.<br />
Akteure können z.B. von Entwicklungen profitieren, die allen zur Verfügung gestellt werden. Außerdem<br />
ist ein Outsourcing bestimmter Marketingaktivitäten für weniger schlagkräftige Akteure möglich. Der<br />
gemeinsame Auftritt stärkt das Thema und der verbessert die Außenwahrnehmung des Themas und der<br />
beteiligten Akteure. Das Thema bekommt sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene mehr<br />
Gehör.<br />
8.1.4 Arbeitsgruppe Organisation, Finanzierung und Wirtschaftlichkeit<br />
Die Arbeitsgruppe erarbeitete zu ihrem Aufgabenfeld folgende Ergebnisse.<br />
Ermittlung des konkreten Finanzbedarfes für die nächsten 5 Jahre<br />
Herr Piegsa entnimmt dem Protokoll über die Vorstellung der Zwischenergebnisse am 08.12.08 die Aufgaben,<br />
für die der Finanzbedarf abgeschätzt werden müsste. In der Arbeitsgruppe Gartenkultur von Herrn<br />
Dr. Küster wird die Erfassung der Gärten und die Vernetzung vorhandener Foren benannt. Die Arbeitsgruppe<br />
Entwicklung bestehender Anlagen (Herr Beck) benennt die Erfassung der Pflegemodelle und deren<br />
Kosten, die Pflegeberatung, die Förderung der Pflege, den Aufbau eines Netzwerkes und eines Internetforums.<br />
In der Arbeitsgruppe Tourismus / Marketing (Frau Steinhoff) war vorgeschlagen worden, Daten<br />
für den Tourismus in einem Veranstaltungskalender zusammenzufassen. Während sich bei einigen<br />
Aufgaben Kosten zum gegenwärtigen Zeitpunkt grob eingrenzen lassen, ist bei der Mehrzahl der Aufgaben<br />
nicht nachzuvollziehen, wie diese Daten ohne weitere Abstimmungen über den Arbeitsumfang und<br />
ohne Bestandserhebungen in einem belastbaren Papier zusammengefasst werden können.<br />
Herr Klaukien stellt die Frage nach dem Benefit der Initiative, die sicherlich auch von übergeordneten<br />
Stellen zur Bereitstellung von Mitteln gestellt werden würde, und wie viele Touristen denn überhaupt die<br />
Einrichtungen und Institutionen der Gartenkultur nutzen würden. Außerdem betont er, dass der gesetzte<br />
Zeitplan sehr ambitioniert sei. Seiner Meinung nach sollte man der Initiative ein halbes Jahr mehr Zeit<br />
geben und dann die Grundlagen richtig erarbeiten. Für diese Gruppe sieht er die Beantwortung der kon-<br />
Eicklinger Amtshof GmbH 39
<strong>Landesinitiative</strong> GARTENHORIZONTE<br />
kreten Fragestellungen ebenfalls als problematisch an, da hierzu die Ergebnisse der anderen Arbeitsgruppen<br />
notwendig seien.<br />
Frau Fennemann betont, dass nach nun rund drei Sitzungen die klare Zielformulierung der <strong>Gartenhorizonte</strong><br />
unabdingbare Voraussetzung für jede weitere Maßnahme sei. Am Beispiel der Gartenroute, die in<br />
Deutschland Vorbildcharakter besitzt, kann man exemplarisch feststellen, an welchen kritischen Punkten<br />
Projekte scheitern: an der langfristigen Finanzierung und an der intensiven Mitarbeit aller Partner. Auch<br />
sehen sie einen Veranstaltungskalender sehr problematisch, da die Daten der einzelnen Einrichtungen<br />
nie aktuell seien, da es jährliche Änderungen gebe. Aus der Erfahrung können sie sagen, dass diese Anstrengungen<br />
immer nur fruchtbar seien, wenn die Finanzierung sichergestellt sei. Darüber hinaus sei aktive<br />
Mitarbeit der Macher vor Ort auch oftmals problematisch. Alle Beteiligten sind sich einig, dass für eine<br />
sinnhafte und Erfolg versprechende Initiative eine institutionelle Förderung unerlässlich sei. Dabei sind<br />
die folgenden Fragestellungen von Wichtigkeit, die hier nur stichpunktartig erfasst werden:<br />
- aktueller und interessanter sowie auffindbarer Internetauftritt<br />
- Finanzen und Inhalte sind immer das Problem<br />
- Erarbeiten, was es gibt und dann anhand vorhandener Modelle diese weiter ausarbeiten<br />
- Verbindlichkeit und Zuverlässigkeit der Aktion<br />
- Touristisch gesehen: Was kann man vermarkten? Was will der Kunde?<br />
- Konkreter Finanzbedarf kann nicht benannt, aber eine langfristige Förderung gefordert werden.<br />
Daher seien die in der Tagesordnung unter Punkt 2-4 genannten Fragen eher nachgeordnet. Gemeinsam<br />
wird in der Diskussion erarbeitet, dass als Zielsetzung für die Initiative elementar ist das Netzwerk zu<br />
gründen und durch den landesweiten Ansatz eine regionale Denkweise zu überwinden. Dabei sollte bedacht<br />
werden, dass eine finanzielle in die Pflichtnahme Dritter erfolgen müsse. Dabei könne überlegt<br />
werden, so der Vorschlag von Frau Fennemann, dass mit einer Geldgabe eine Verpflichtung der aktiven<br />
Teilnahme erreicht werden könne. Eine Eigenfinanzierung der <strong>Gartenhorizonte</strong> ist in jedem Falle nicht<br />
vorstellbar. Herr Piegsa ergänzt, dass es eine ähnlich umfangreiche Ideensammlung der Braunschweiger<br />
Landschaft gegeben habe. Um den zu umfangreichen Ansatz handhabbar zu machen, sei als erster<br />
Schritt eine Bestandsaufnahme der gartenkulturellen Anlagen und deren sukzessive Darstellung im Internet<br />
vorgesehen. Die Überlegung, zentral Gelder für Pflegemaßnahmen zur Verfügung zu stellen (in welcher<br />
Höhe und mit welchem Ansatz auch immer) sei für ganz Niedersachsen nicht vorstellbar, da dies an<br />
den verschiedensten Voraussetzungen, Gegebenheiten und Interessen scheitern dürfte. Grundsätzlich<br />
könnte eine landesweite Abfrage von Daten im Zuge des ersten praktischen Netzwerkgedankens für die<br />
Erstellung einer Internetplattform erfolgen. Somit wird folgende Zielsetzung definiert:<br />
Die landesweite Initiative sei notwendig, um auf Veranlassung des Landes die Finanzierung für entsprechende<br />
Lobby- und Netzwerkarbeit sicherzustellen. Dies solle zumindest anhand der bestehenden gartenkulturellen<br />
Leuchttürme und der denkmalgeschützten Anlagen (bei entsprechendem Pflegezustand)<br />
als Vorzeigeprojekte durch das Netzwerk unterstützt werden Ggf. sind diese Anlagen über das Garten-<br />
Eicklinger Amtshof GmbH 40
<strong>Landesinitiative</strong> GARTENHORIZONTE<br />
netzwerk Deutschland für Gartenreisen zu vermarkten. Der grundsätzliche Aufbau müsste sich wie folgt<br />
darstellen:<br />
- Deutschland: Gartennetzwerk Deutschland – besteht<br />
- Niedersachsen: ML 1 Mitarbeiter<br />
- Regierungsvertretungen: 4 x 1 Mitarbeiter<br />
- Gärten/Kommunen aktive Mitarbeit<br />
Die Frage der Organisationsform wird wie folgt besprochen: Es ist notwendig, eine Arbeitsgruppe zu<br />
gründen oder entsprechende Personen bei vorhandenen Institutionen anzusiedeln. Favorisiert wird aber<br />
die Einrichtung einer eigenen, selbstständigen neutralen Organisationsform (entweder eine zentrale Stelle<br />
oder bei den Regierungsvertretungen in der Fläche). Dies muss vom Land initiiert werden, da aus der<br />
Erfahrung gesagt werden kann, dass ein solches Vorhaben ansonsten kaum realisierbar ist. Aufgaben<br />
dieser selbstständigen, neutralen Organisationsform wären folgende.<br />
- Lobbyarbeit<br />
- Marketing mit Pressearbeit<br />
- Qualitätskriterien (DGGL) koordinieren<br />
- Ansprechpartner für Gärten in Bezug auf die Themen Bildung, Qualität, Pflege, Hilfestellungen für<br />
Vermarktung, Finanzakquise.<br />
- Pflege der Datenbank „Gärten in Niedersachsen“, Bundesweite Trends erkennen und weitergeben<br />
Newsletter<br />
- Routenentwicklung<br />
- Koordination der bestehenden Arbeitsgruppen der <strong>Gartenhorizonte</strong><br />
Die Frage des warum wird wie folgt beantwortet. Die Gartenkultur in Niedersachsen ist ganz besonders,<br />
da z.B.<br />
- größte Baumschulanbaugebiet Europas<br />
- Emsflower Emsbüren<br />
- Kräuter aus Papenburg<br />
- Obstbau Altes Land<br />
- Saatzucht Nördliches Harzvorland<br />
- vielfältige historische Anlagen<br />
- 1-000-jähringe Gartenkultur – Klostergärten<br />
- Hausgärten in einer breiten Vielfalt regional und inhaltlich<br />
- touristische Leuchttürme Herrenhausen etc.<br />
Eicklinger Amtshof GmbH 41
<strong>Landesinitiative</strong> GARTENHORIZONTE<br />
- Besondere Züchter aus Niedersachen (Ernst Pagels, Kurt Kramer, Wilhelm Bruns, ... )<br />
Das Thema ist generell in der Bevölkerung positiv besetzt und kann ein positives Image für Nds. prägen.<br />
Fazit: Image für das Land und Besetzung eines positiven Trendthemas mit einer Breite und Vielfalt.<br />
Zu einer ersten Kostenschätzung werden folgende Werte zusammengefasst, unabhängig davon, ob a)<br />
eine zentrale Arbeitsgruppe oder b) 4 Stellen in der Fläche der Regierungsvertretungen eingerichtet werden.<br />
Bei a) und b) ist in jedem Fall die Leitung in Hannover zu platzieren.<br />
Personal Kosten<br />
in Tausend Euro (T)<br />
1 Leiter 50<br />
1 Organisation 35<br />
1 Datentechnik 35<br />
1 Gärtner 35<br />
1 Denkmalschützer 35<br />
Sachkosten Büro 30<br />
Reisekosten 25<br />
Sonstiges /Marketing / VA / Internet / Betreuung<br />
Mitgliedschaft im GnD + EHGN 3<br />
Gesamt jährlich 278<br />
Gesamtkosten<br />
bezogen auf 5 Jahre<br />
einmalige Ausstattung für fünf Mitarbeiter 45<br />
Internetauftritt (einmalig) 30<br />
Eicklinger Amtshof GmbH 42<br />
30<br />
1.465<br />
Die Finanzierung dieser rund 1,5 Mio. Euro ist sicherlich das größte Problem. Die Arbeitsgruppe ist der<br />
einhelligen Auffassung, dass die Finanzierung (auch einer Teilsumme) durch externe Einrichtungen<br />
grundsätzlich als wenig realistisch gesehen wird und keine konkreten Einrichtungen genannt werden<br />
können. Grundsätzlich müssten hierzu die Modelle aus anderen Bundesländern näher untersucht werden.<br />
In der Diskussion wurden die Landschaften und die Kommunen/Landkreise als potenzielle (Mit-) Finanziers<br />
genannt. Die praktikabelste Lösung wäre, wenn das Land die vorstehenden Grundkosten wie
<strong>Landesinitiative</strong> GARTENHORIZONTE<br />
Personal, Büro und Internet finanziert. Weitergehende Projekte sollten dann nur umgesetzt werden, wenn<br />
diese mit einer Eigenfinanzierung von 50 % ausgestattet sind und die anderen 50 % von Dritten eingeworben<br />
werden.<br />
Eine Internetpräsentation sollte mindestens folgende Funktionen haben:<br />
- Grundlage für Verlinkung der vorhandenen Seiten der Einrichtungen<br />
- Niedersachsenkarte ggf. mit abgegrenzten Flächen der Regierungsvertretung<br />
- Links mit einer ersten Grobbeschreibung und max. 10 Grundabfragen<br />
- Hinweis immer auf Link, dass dann die Daten aus dem Link aktuell sind.<br />
Als Notvariante könnten für eine Startphase von zwei Jahren die vier Sachbearbeiterstellen der Arbeitsgruppe<br />
durch vorhandenes Fachpersonal aus den Landesbehörden (mit mind. 50 % der Arbeitzeit für<br />
dieses Projekt) gestellt werden. Die Leitung sollte in jedem Fall durch eine externe Person besetzt sein.<br />
Alle Beteiligten sind sich einig, dass diese Notvariante aufgrund der vorhandenen Wichtigkeit des Projektes<br />
nicht für inhaltlich förderlich gehalten wird. Aus diesem Grunde sollte diese Alternative nicht weiter<br />
verfolgt werden.<br />
Erfassung von Unterstützern für das Netzwerk<br />
Fraglich ist die Gründung eines Beirates. Die bisherigen Arbeitsgruppenmitglieder sollten bei einer weiteren<br />
Bearbeitung der Initiative aus Ihren Erfahrungen mögliche Unterstützer benennen, die dann von der<br />
neuen Stelle kontaktiert werden sollten.<br />
Verwendung und Einsatz der Dachmarke<br />
Das Logo „<strong>Gartenhorizonte</strong>“ sollte nicht im klassische Sinne der touristischen Vermarktung dienen, sondern<br />
vorerst nur für das Netzwerk - für alle Arbeiten des Teams (Briefkopf, Geschäftspapiere, Internet,<br />
Seminare, etc.) - verwandt werden. Eine Verwendung als Schild an den Gärten oder in sonstiger Weise<br />
sollte nur nach eigenem Konzept und einem entsprechenden CI-Handbuch erfolgen, soweit es sich für<br />
eine Dachmarke eignet. Verwendung durch Dritte sollte vorerst nur nach Anfrage erfolgen.<br />
Erarbeitung der Qualitätsmerkmale und Qualitätssicherung im Hinblick auf die Markennutzung<br />
In der Arbeitsgruppe ist es nicht abschließend möglich, allgemeine Kriterien festzulegen. Dazu sollte in<br />
jedem Fall die DGGL als kompetenter Ansprechpartner hinzugezogen werden.<br />
Untersuchung der Vorteile durch die Mitgliedschaft im Europäischen Gartennetzwerk und im Gartennetzwerk<br />
Deutschland (GnD).<br />
Es wird vorgeschlagen beim GnD Mitglied zu werden. Die Route der Gartenkultur (ab 2009 nicht mehr)<br />
und die Gartenregion Hannover sind dies bereits. Ein Beitritt hätte den Vorteil, dass man an Informationen<br />
herankommt und die Dienstleistungen in Anspruch nehmen kann. Dies wird für die Arbeit als wesentlich<br />
angesehen, auch um Kontakte zu knüpfen und aktuelle Entwicklungen gewahr zu werden. Eine gesonderte<br />
Mitgliedschaft im Europäischen Gartennetzwerk wird vorerst nicht für notwendig erachtet.<br />
Eicklinger Amtshof GmbH 43
8.2 Zeitplan<br />
Zeitraum Beteiligte Personen Arbeitsinhalte<br />
06.11.2008<br />
08.12.2008<br />
15.01.2009<br />
Steuerungsgruppe<br />
Arbeitsgruppenkoordinatoren<br />
Arbeitsgruppen<br />
Gesamtprojektkoordinator<br />
Arbeitsgruppenkoordinatoren<br />
Steuerungsgruppe<br />
Arbeitsgruppenkoordinatoren<br />
Gesamtprojektkoordinator<br />
Arbeitsgruppen<br />
19.02.2009 Arbeitsgruppenkoordinatoren<br />
26.02.2009<br />
Steuerungsgruppe<br />
Gesamtprojektkoordinator<br />
Arbeitsgruppenkoordinatoren<br />
Arbeitsgruppen<br />
<strong>Landesinitiative</strong> GARTENHORIZONTE<br />
Auftaktgespräch / Vorstellung<br />
1. Arbeitsgruppensitzung und<br />
Dokumentation der Ergebnisse<br />
Erstellung des Zwischenberichtes<br />
über alle Ergebnisse der<br />
Arbeitsgruppen<br />
2. Arbeitsgruppensitzung und<br />
Vorstellung der Ergebnisse<br />
Abstimmung der<br />
Arbeitsgruppenergebnisse<br />
Abschlussveranstaltung: Vorstellung<br />
der Ergebnisse der<br />
Arbeitsgruppen<br />
15.06.2009 Gesamtprojektkoordinator Abgabe des Projektberichtes<br />
Eicklinger Amtshof GmbH 44
8.3 Kosten zur Erstellung einer Internetseite<br />
<strong>Landesinitiative</strong> GARTENHORIZONTE<br />
Zur Erstellung einer Internetseite für das Gartennetzwerk GARTENHORIZONTE ist mit folgenden Kosten<br />
laut Kostenschätzung eines Anbieters zu rechnen:<br />
Kostenschätzung Kosten 5 Jahre<br />
Content Management<br />
(CMS) Grundpaket<br />
5.000,00 € einmalig 5.000,00 €<br />
Konzept, Layout, Planung 7.500,00 € einmalig 7.500,00 €<br />
Individuelle Anpassungen CMS 3.500,00 € einmalig 3.500,00 €<br />
Schulung / Einführung /<br />
Unterstützung<br />
1.000,00 € einmalig 1.000,00 €<br />
Wartung CMS 50,00 € monatlich 3.000,00 €<br />
WebHosting auf eigenem<br />
WebServer<br />
165,00 € monatlich 9.900,00 €<br />
Netto-Summe 29.900,00 €<br />
Eicklinger Amtshof GmbH 45
8.4 Grundlagenermittlung<br />
8.4.1 Kategorisierung der Gärten und Parkanlagen<br />
<strong>Landesinitiative</strong> GARTENHORIZONTE<br />
Die Arbeitsgruppe Gartenkultur hat die folgende Typenliste erarbeitet, nach der die einzelnen Gartentypen<br />
erfasst werden könnten. Überschneidungen zwischen den einzelnen Typen sind dabei möglich.<br />
Arboretum<br />
Barockgarten<br />
Bauerngarten, bäuerlicher Garten Gemeint ist damit der Typ „Ländlicher Privatgarten“ oder „Bäuerlicher<br />
/ Ländlicher Garten“, denn die Entwicklung zum Bauerngarten hin<br />
ging keineswegs allein von den Bauern aus.<br />
Baumgarten, Baumschule<br />
Blindengarten<br />
Botanischer Garten<br />
Containergarten<br />
Duftgarten<br />
Friedhof Spezialform Friedhof der Namenlosen, Kriegsgräberstätte, Friedwald,<br />
Mustergrabanlage<br />
Gemüsegarten<br />
Grabeland / Krautgarten<br />
Grünanlage<br />
Gutsgarten Spezialform im Küstengebiet (mehr urbane Kontakte)<br />
Hausgarten<br />
Herrschaftlicher Garten<br />
Historischer Garten / Park<br />
Inselgarten<br />
Irrgarten<br />
Kapitänsgarten<br />
Klostergarten<br />
Kleingarten<br />
Kräutergarten<br />
Eicklinger Amtshof GmbH 46
Künstlergarten Spezialform Garten in Künstlerkolonie<br />
Kurpark<br />
Landschaftsgarten, -park<br />
Landhausgarten<br />
Lehrgarten<br />
Lehrgarten<br />
Lehrgarten<br />
Naturerlebnispfad<br />
Naschgarten<br />
Nutzgarten<br />
Moorgarten<br />
Moorkolonie Gartenbau Wiesmoor<br />
Museumsgarten<br />
Obstgarten / Obstwiese<br />
Orangerie<br />
Palmengarten<br />
Park der Gärten Gartenschau<br />
Pfarrhausgarten/Pastorengarten<br />
Pflanzgarten in Forstbetrieben<br />
Pflanzen-; Sichtungsgarten<br />
Pottstück Gemüsegarten auf dem Acker<br />
Renaissance-Garten<br />
Rhododendrenpark, -schau<br />
Rosengarten<br />
Schaugarten z.B. am Gartenbaubetrieb<br />
Schmetterlingsgarten<br />
Schlosspark<br />
Schulgarten<br />
<strong>Landesinitiative</strong> GARTENHORIZONTE<br />
Eicklinger Amtshof GmbH 47
Skulpturengarten<br />
Sortengarten, Sorteninventar z.B. für Obstbaumsorten<br />
Stadtpark, Volkspark<br />
Steingarten<br />
Therapiegarten<br />
Weingarten evtl. auch historische Anlage<br />
Wildgehege, Tiergarten<br />
Villengarten<br />
Vogelpark<br />
Zengarten<br />
Zoologischer Garten<br />
<strong>Landesinitiative</strong> GARTENHORIZONTE<br />
Eicklinger Amtshof GmbH 48
8.4.2 Literatur zu Gärten und Parks in Niedersachsen<br />
<strong>Landesinitiative</strong> GARTENHORIZONTE<br />
Von der Arbeitsgruppe Gartenkultur wurde die folgende Literaturliste zu Gärten und Parks in Niedersachsen<br />
erfasst. Die Quellensammlung enthält überwiegend neuere Darstellungen (ca. seit 1990). Hinweise<br />
zu weiteren Publikationen finden sich in den Datenbanken und Literaturverzeichnissen, der hier angeführten<br />
Werke.<br />
Altwig, D.: Der Tiergarten, Hannover. Hannover 2005.<br />
Barlo, N., H. Komachi, Queren, H.: Herrenhäuser Gärten. Rostock 2006.<br />
Beck, J. und Lubrecht, R.: Historische Gutsgärten zwischen Elbe und Weser. Stade 2006.<br />
Beck, J.: Historische Gutsgärten im Elbe-Weser-Raum. Dissertation Hannover 2007.<br />
Beck, J.: Ein „Mustergut“ des 19. Jahrhunderts – Burgsittensen unter Caspar Detlev von Schulte. Zwischen<br />
Elbe und Weser 26(4), 2007, 13ff.<br />
Brandt, A., Bothmer, W. von, Rohde, M. (Hrsg.): Marketing für Gärten und Schlösser: Touristische Nutzungskonzepte<br />
für Gärten, Parks, Herrenhäuser und Schlösser. Rostock 2004.<br />
Brandt, A., Bothmer, W. von, Mangels, C. (Hrsg.): GartenNetze Deutschland: Entwicklung Vernetzung<br />
Vermarktung historischer Gärten. Rostock 2007.<br />
Bruch, R. vom: Die Rittersitze des Fürstentums Osnabrück. 4. Auflage, Osnabrück 2004.<br />
Bukies, K., Hoferer, E.: Zukunftsgärten. ASG-Schriftenreihe für ländliche Sozialfragen 146. Göttingen<br />
2008.<br />
Clark, R.: Gärten. Der Reiseführer zu privaten und öffentlichen Parks und Gärten in Deutschland. München<br />
2003.<br />
Curtius, J.: Gutspark Westerbrak. Gartendenkmalpflegerische Beiträge zur Erhaltung, Pflege und Entwicklung.<br />
Stadt und Grün 4/98, 273-277.<br />
Dannebeck, S.: Landschaftsprägend: Historische Kulturlandschaften im Nordwesten entdecken. Cloppenburg<br />
2008.<br />
Düring, A. von: Ehemalige und jetzige Adelssitze im Herzogtum Bremen. Stade 1938.<br />
Eichler, M.: Über Zäune schauen. Geöffnete Gärten im Herzen Niedersachsens. Nienburg 2008.<br />
Ellenberg, H.: Bauernhaus und Landschaft. In ökologischer und historischer Sicht. Stuttgart 1990.<br />
Emsländischer Heimatbund (Hrsg.): Gärten und Parks im Emsland. Jahrbuch des Emsländischen Heimatbundes<br />
42, 1996, 116-265.<br />
Falkenhausen, E. von, Klaffke-Lobsien, G. und Eulig, M.: Hannovers Natur entdecken, erleben, verstehen.<br />
Seelze-Velber 1998.<br />
Fok, O. und Schomann, R.: Künstlergärten und denkmalpflegerischer Umgang. Schriften der Kunststätte<br />
Bossard 4, Jesteburg 2005.<br />
Eicklinger Amtshof GmbH 49
<strong>Landesinitiative</strong> GARTENHORIZONTE<br />
Formann, I.: Gartenkultur hinter Klostermauern. Die Gärten des Stiftes Fischbeck – ein Beispiel für die<br />
Anlagen niedersächsischer Damenstifte. Stadt und Grün 9/2003, 26-31.<br />
Formann, I.: Vom Gartenland so den Conventualinnen gehört. Die Gartenkultur der evangelischen Frauenklöster<br />
und Damenstifte in Norddeutschland. CGL Studies 1. München 2006.<br />
Gartenregion Hannover: Gärten für das ganze Jahr. Hannover 2006.<br />
Garfs, J.: Ein heiterer Platz der Freude. Die ungewöhnliche Geschichte der Kurparkanlagen von Bad<br />
Pyrmont. Bad Pyrmont 1991.<br />
Gröll, W.: Rund um die Bauerngärten der Lüneburger Heide. Schriften des Freilichtmuseums am<br />
Kiekeberg 22. Ekestorf 1998.<br />
Gröning, G. und Wolschke-Bulmahn, J.: Von der Stadtgärtnerei zum Grünflächenamt. 100 Jahre kommunale<br />
Freiflächenverwaltung und Gartenkultur in Hannover. Berlin, Hannover 1990.<br />
Grünflächenamt der Landeshauptstadt Hannover und Wilhelm-Busch-Gesellschaft e.V. (Hrsg.): Zurück<br />
zur Natur. Ideen und Geschichte des Georgengartens in Hannover-Herrenhausen. Wallstein Verlag. Göttingen<br />
1997.<br />
Hahn, S.: Ergebnisbericht <strong>Gartenhorizonte</strong> 2001-2004.<br />
Hahn, S.: <strong>Gartenhorizonte</strong>. Klostergärten zwischen Aller, Elbe und Weser. Hrsg.: Informations- und Kompetenzzentrum<br />
für den ländlichen Raum Amtshof Eicklingen GmbH. Beckum 2006.<br />
Hahn, S., Hoffmann, A.: <strong>Gartenhorizonte</strong>. Historische Gärten zwischen Aller, Elbe und Weser. Hrsg. Informations-<br />
und Kompetenzzentrum für den ländlichen Raum Amtshof Eicklingen GmbH. Hamburg 2007.<br />
Heimatbund Niedersachsen e.V. und Niedersächsische Gesellschaft zur Erhaltung Historischer Gärten<br />
(Hrsg.): Historische Gärten in Niedersachsen. Langenhagen 2000.<br />
Hindersmann, U.: Der ritterschaftliche Adel im Königreich Hannover 1814-1866. Hannover 2001.<br />
Höing, H. (Hrsg.): Träume vom Paradies. Historische Parks und Gärten in Schaumburg. Melle 1999.<br />
In Nachbars Garten: Nord-West Niedersachsen und Provinz Groningen. Riepe 1998ff.<br />
Institut für Grünplanung und Gartenarchitektur der Universität Hannover (Hrsg.): Orangerien und Gewächshäuser<br />
in Niedersachsen. Ihre Entwicklung und gartenkünstlerische Bedeutung. Seminarbericht.<br />
Hannover 1995.<br />
Juranek, C. (Hrsg.): Fülle des Schönen. Gartenlandschaft Harz. Dößel 2000.<br />
Kaiser, H. (Hrsg.): Bauerngärten zwischen Weser und Ems. Materialien und Studien zur Alltagsgeschichte<br />
und Volkskultur Niedersachsens 30. Cloppenburg 1998.<br />
Kirsch, R.: Frühe Landschaftsgärten im niedersächsischen Raum. Göttingen 1993.<br />
Klaffke, K.: 50 Jahre Hermann-Löns-Park. Heimatland Heft 3, 1985, 91-93.<br />
Klaffke, K.: Der Hermann-Löns-Park. Stand August 2001. Hannover 2001.<br />
Eicklinger Amtshof GmbH 50
<strong>Landesinitiative</strong> GARTENHORIZONTE<br />
Köhler, M., Kellner, U.: Bibliographie zur Geschichte der Gartenkultur in Braunschweig. Materialien zur<br />
Geschichte der Gartenkultur. Braunschweig 2000.<br />
König, M. von (Hrsg.): Herrenhausen. Die königlichen Gärten in Hannover. Göttingen 2006.<br />
Krumm, C.: Der Hasefriedhof in Osnabrück: Der Friedhof als Garten; zur Entstehung, Konzeption und<br />
Entwicklung des Osnabrücker Friedhofes in der Hasetorvorstadt. Hannover 2000.<br />
Neubert-Preine, T.: Die Rittergüter der Hoya-Diepholz’schen Landschaft. Nienburg 2006.<br />
Niedersächsisches Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz<br />
(Hrsg.): Landkultur in Niedersachsen. Hannover 2008.<br />
Osten, V.J. von der: Die Rittergüter der Calenberg-Grubenhagenschen Landschaft. Hannover 1996.<br />
Ottenberg, M., Streibel, N.: Zwischen Trümmern und Träumen – Zur Gartenkultur an Notunterkünften der<br />
Nachkriegszeit. Stadt + Grün 57(1), 2008, 9-12.<br />
Prätsch, E.: Die offene Pforte: Gärten in und um Hannover 2007. Gartenregion Hannover. Hannover<br />
2007.<br />
Pühl, E.: Parks und Gärten zwischen Weser und Ems. Oldenburg 1994.<br />
Ritterschaft der Herzogtümer Bremen und Verden (Hrsg.): Die Güter der Ritterschaft im Herzogtum Bremen.<br />
Stade 2001.<br />
Rössing, R. und andere: Gärten und Parks in Niedersachsen. Würzburg 1993.<br />
Rohde, M.: Die Entwicklung der Gärten und Parks vom Mittelalter bis zum 20. Jahrhundert in Hannover.<br />
Berichte der Naturhistorischen Gesellschaft Hannover 141, 1999, 115-136.<br />
Rohde, M., Schomann, R. (Hrsg.): Historische Gärten heute. Leipzig 2003.<br />
Rohde, M.: Gutachten Französischer Garten Celle: Überplanung des Verbindungsweges zwischen Neuer<br />
Brücke, Magnusgraben (Wehlstraße, Maulbeerallee) und Südwall; Neuanlage der Schmuckbeete um das<br />
Caroline-Mathilde-Denkmal. Hannover 1999.<br />
Rohde, M.: Parkpflegewerk Hinüberscher Garten in Hannover-Marienwerder. Hannover 1997.<br />
Route der Gartenkultur im Nordwesten: 8 Tagesrouten durch eine Vielfalt von Parks und Gärten im<br />
Nordwesten Deutschlands. Varel 2004ff. (mehrere Landkarten mit Hinweisen auf Gärten und Parks)<br />
Samtgemeinde Flotwedel (Hrsg.): Über den Gartenzaun geschaut: Gartentraumgärten. Dorferneuerung<br />
im Regierungsbezirk Lüneburg. O.O. und o.J. (Broschüre).<br />
Schmidt, E.: Der Maschpark – ein Gartendenkmal in Hannover. Berichte zur Denkmalpflege in Niedersachsen<br />
5(3), 1985, 74-79.<br />
Schomann, R.: Gartendenkmalpflege in Niedersachsen. Berichte über die Tätigkeit der Bau- und Kunstdenkmalpflege<br />
in den Jahren 1991-1992. Niedersächsische Denkmalpflege 15, Hannover 1995.<br />
Schomann, R.: Jagdschloss Baum. Kulturdenkmal des Spätbarocks. Hannover 1994.<br />
Eicklinger Amtshof GmbH 51
Schrader, E.: Der Große Garten zu Herrenhausen, Hannover. Hannover 1989.<br />
Schulz, D.: Der Westfalenhof in Hannover. Hannover 1987.<br />
Schwarz, G.: Die Rittergüter des alten Landes Braunschweig. Braunschweig 2008.<br />
<strong>Landesinitiative</strong> GARTENHORIZONTE<br />
Schweinitz, A.-F. von: Die landesherrlichen Gärten in Schaumburg-Lippe von 1647-1918. Worms 1999.<br />
Segers-Glocke, C. (Hrsg.): Denkmaltopographie Bundesrepublik Deutschland: Baudenkmale in Niedersachsen.<br />
Diverse Bände.<br />
Segers-Glocke, C.: Gartendenkmalpflege in Niedersachsen. Dokumentation des Kolloquiums vom 29./30.<br />
Oktober 1993 in Hannover. Hameln 1994.<br />
Segers-Glocke, C.: Schlosspark Rastede: Kulturdenkmal landschaftlicher Gartenkunst. Dokumentation<br />
der Fachtagung am 24. März 2001. Hannover 2001.<br />
Sippel-Boland, M.: ...uns gesambten Gärtnern vor hiesiger Stadt... Geschichte(n) eines Wolfenbütteler<br />
Berufsstandes. Wolfenbüttel 1997.<br />
Sommer, E., Thiem, G.: Private Gartenparadiese in Niedersachsen. Schwülper 2007.<br />
Tute, H.-J. und Köhler, M. (Hrsg.): Gartenkunst in Braunschweig. Braunschweig 1989.<br />
Vogt, B.: Zehn Jahre Niedersächsische Gesellschaft zur Erhaltung Historischer Gärten. Emmerthal 2004.<br />
Widmer, P.: Gärten im Weserbergland. Eine Reise zu Parks und Gärten entlang der Weser. Holzminden<br />
2004.<br />
Widmer, P.: Gärten und Landsitze im Schaumburger Land. Kulturpfad Schaumburg 5. Bückeburg 2000.<br />
Winkel, G.: Der botanische Schulgarten Burg in Herrenhausen. Hannover 1965.<br />
8.4.3 Weitere Literatur zu Gärten und Parks in Deutschland<br />
Die folgende Literaturliste wurde von den Verfassern der Studie ergänzt.<br />
Albrecht, G., Albrecht, W.: Schlösser, Herrensitze und Gutshäuser in Vorpommerns Festlandskreisen:<br />
siedlungsstrukturelle Relikte und/oder touristische Ressourcen? In: Aktuelle Probleme der Regionalentwicklung<br />
in Mecklenburg-Vorpommern. Greifswalder Beiträge zur Regional-, Freizeit- und Tourismusforschung,<br />
Band 14. Forum für Regional-, Freizeit- und Tourismusforschung an der Universität Greifswald.<br />
Greifswald 2003. S. 70-102.<br />
Antz, C. (Hrsg.): Gartenträume. Historische Parks in Sachsen-Anhalt. Verlag Janos Stekovics. Halle an<br />
der Saale 2003.<br />
Antz, C.: Gartenträume. Ein Landesprojekt für Kultur und Natur, Tourismus und Image in Sachsen-Anhalt.<br />
In: Nachhaltiger Schutz des kulturellen Erbes – Umwelt und Kulturgüter. Brickwedde, Weinmann (Hrsg.).<br />
Erich Schmidt Verlag. Berlin 2004. S. 173-189.<br />
Antz, C., Hlavac, C. (Hrsg.): Vorwärts in´s Paradies. Gartentourismus in Europa. Profil Verlag. München<br />
2006.<br />
Eicklinger Amtshof GmbH 52
<strong>Landesinitiative</strong> GARTENHORIZONTE<br />
Arbeitskreis Historische Gärten der Deutschen Gesellschaft für Gartenkunst und Landschaftskultur<br />
(Hrsg.): Information in historischen Gärten. Arbeitsheft 1. Berlin 2002.<br />
Bay, P. de, Bolton, J.: Gartenkunst im Spiegel der Jahrhunderte. Heyne Verlag. München 2000.<br />
Bayerische Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen (Hrsg.): Nymphenburg. Schloss, Park<br />
und Burgen. Amtlicher Führer. München 1997.<br />
Benesch, A. R.: Gärten und Parks im Bezirk Melk. Stadtpark Melk. Melk 2006.<br />
Berry, S.: Gärten in der Stadt. Grüne Idylle zwischen Mauern. Callwey Verlag. München 1997.<br />
Beyse, R. Dr.: Bäume aus aller Welt in den Parks der Stadt Celle. Hrsg.: Stadt Celle. Baumkundlicher<br />
Verlag. Celle 2006.<br />
Bezirksvorstand Potsdam der Gesellschaft für Denkmalpflege im Kulturbund der DDR (Hrsg.): Peter Joseph<br />
Lenné 1789-1866. Gärten in und um Potsdam. Geschichte und Wiederherstellung. Potsdam 1989.<br />
Boes, A.: Der Celler Heilpflanzengarten. Düfte, Gifte Farbenspiele. Projekt KeimCelle Zukunft - Heilen im<br />
Dialog der Stadt Celle (Hrsg.). Celle 2000.<br />
Bosbach, F., Göning, G.: Landschaftsgärten des 18. und 19. Jahrhunderts. Beispiel deutsch-britischer<br />
Kulturtransfers. Band 26 der Prinz-Albert-Studien. München 2008.<br />
Brandenburgisches Ministerium für Landwirtschaft, Umweltschutz und Raumordnung (Hrsg.): Gartenkultur<br />
in Brandenburg und Berlin. Potsdam 2000.<br />
Brandt, A., Bothmer, W. von, Rohde, M. (Hrsg.): Diesseits von Eden. Europäische Marketing-Konzepte<br />
für Gärten und Schlösser. Hinstorff Verlag. Rostock 2006.<br />
Brilli, A.: Als Reisen eine Kunst war. Vom Beginn des modernen Tourismus: Die „Grand Tour“. Wagenbach<br />
Verlag. Berlin 1997.<br />
Bufe, T.: Gartenreise. Ein Führer durch Gärten und Parks in Ostwestfalen-Lippe. München 2000.<br />
Bund Heimat und Umwelt in Deutschland (Hrsg.): Weißbuch der historischen Gärten und Parks in den<br />
neuen Bundesländern. 2. Auflage. Bonn 2005.<br />
Bund Heimat und Umwelt in Deutschland (Hrsg.): Lebensraum Denkmal. Beiträge zur Tagung vom 2.-3.<br />
Mai 2006 in Osnabrück im Zentrum für Umweltkommunikation der Deutschen Bundesstiftung Umwelt.<br />
Bonn 2007.<br />
Bundesamt für Naturschutz (Hrsg.): Natursport und Kommunikation. Tagungsband zum Internationalen<br />
Fachseminar „Erlebnis-Konsumgut Natur: verehrt - verzehrt.“ 10.-11.11.2005 in Basel. Bonn - Bad Godesberg<br />
2006.<br />
Cooper, G., Taylor, G.: Gärten für morgen. Entwürfe für das 21. Jahrhundert. Ulmer Verlag. Stuttgart<br />
2000.<br />
Cowell, F. R.: Gartenkunst. Von der Antike bis zur Gegenwart. Besler Verlag. Stuttgart 1979.<br />
Eicklinger Amtshof GmbH 53
<strong>Landesinitiative</strong> GARTENHORIZONTE<br />
Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) und Deutsche Gesellschaft für Gartenkunst und Landschaftskultur<br />
(DGGL) e.V. (Hrsg.): Gärten und Kulturlandschaften. Engagement von Stiftungen und Eigentümern<br />
zur Bewahrung wertvoller Kultur und Natur. Schriftenreihe der DGGL. Band 11. Arbeitskreis Historische<br />
Gärten. Westerkappeln 2003.<br />
Deutsches Nationalkomitee für Denkmalschutz (Hrsg.): Historische Parks und Gärten. Ein Teil unserer<br />
Umwelt, Opfer unserer Umwelt. Schriftenreihe des Deutschen Nationalkomitees für Denkmalschutz. Band<br />
55. Bonn 1997.<br />
Deutsches Nationalkomitee für Denkmalschutz (Hrsg.): Rekonstruktion in der Denkmalpflege. Überlegungen<br />
- Definitionen - Erfahrungsbericht. Schriftenreihe des Deutschen Nationalkomitees für Denkmalschutz.<br />
Band 57. Bonn 1998.<br />
DGGL (Hrsg.): Historische Gärten in Deutschland. Denkmalgerechte Parkpflege. Aufgaben, Thesen und<br />
Instrumente zum Schutz, zur Erhaltung und zur Pflege des Gartenkulturerbes. Neustadt 2000.<br />
DGGL (Hrsg.): Historische Gärten in Deutschland – Denkmalgerechte Parkpflege. Neustadt 2000.<br />
DGGL (Hrsg.): Regionale Gartenkultur. Über die Identität von Landschaften. DGGL-Jahrbuch. Callwey<br />
Verlag. München 2006.<br />
Die Gärtner von Eden: 100 neue Traumgärten. Deutschland-Österreich-Schweiz. Callwey Verlag. München<br />
2007.<br />
Duttge, G. Tinnefeld, M. (Hrsg.): Gärten, Parkanlagen und Kommunikation. Lebensräume zwischen Privatsphäre<br />
und Öffentlichkeit. Berliner Wissenschafts-Verlag. Berlin 2006.<br />
Ehler, M. (Hrsg.): Fürstliche Garten(t)räume. Schlösser und Gärten in Mecklenburg und Vorpommern.<br />
Ausstellungskatalog. Lukas Verlag. Berlin 2003.<br />
Ehlers, H.: Gärten und Parks in Norddeutschland. Christians Verlag. Hamburg 1994.<br />
Emde, R. B., Herrmann, W.: Fürst Pückler und die Gartenbaukunst. Harenberg Edition. Dortmund 1995.<br />
Enge, T. O., Schröer, C.: Gartenkunst in Europa 1450-1800. Vom Villengarten der italienischen Renaissance<br />
bis zum englischen Landschaftsgarten. Taschen Verlag. Köln 1994.<br />
European Garden Heritage Network (Hrsg.) c/o Stiftung Schloss Dyck (Hrsg.): Ostwestfalen-Lippe. Düsseldorf.<br />
European Garden Heritage Network (Hrsg.): Bericht. Düsseldorf 2007.<br />
Facharbeitskreis Schlösser und Gärten in Deutschland (Hrsg.): gartenlust – lustgarten. Die schönsten historischen<br />
Gärten in Deutschland. Schnell + Steiner Verlag. Regensburg 2003.<br />
Fibig, P.: Leipzig – Ein Begleiter zu neuer Landschaftsarchitektur. Hrsg. Garten + Landschaft. München<br />
2008.<br />
Fischer, H., Wolschke-Bulmahn, J. (Hrsg.): Gärten und Parks im Leben der jüdischen Bevölkerung nach<br />
1933. CGL-Studies 5. München 2008.<br />
Eicklinger Amtshof GmbH 54
<strong>Landesinitiative</strong> GARTENHORIZONTE<br />
Forum Dessau-Wörlitzer Gartenreich (Hrsg.): Dessau-Wörlitzer Gartenreich. Neue Strategien für eine<br />
Landschaft. Dessau 1998.<br />
Förderverein Dessau-Wörlitzer Anlagen e.V. (Hrsg.): Verheißungen eines gefährdeten Gartenreichs:<br />
Wörlitz. Dokumentation des Symposiums am 10. Juni 1994. Alexander Antonow Verlag. Frankfurt am<br />
Main 1995.<br />
Ganser, K., Dettmar, J. (Hrsg.): Industrienatur, Ökologie und Gartenkunst im Emscher Park. Callwey Verlag.<br />
Stuttgart 1999.<br />
Die Gartenkunst des Barock. Tagungsband. Eine Tagung des Deutschen Nationalkomitees von ICOMOS<br />
in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege und dem Arbeitskreis Historische<br />
Gärten der DGGL in Schloss Seehof 1997. Arbeitshefte des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege,<br />
Band 103. Lipp. Verlag. München 1998.<br />
Gesellschaft der Freunde des Dessau-Wörlitzer Gartenreiches e.V. (Hrsg.): Wörlitzer Denkanstöße.<br />
Ideen und Erfahrungen aus den Niederlanden. Symposiumsdokumentation. Dessau 1998.<br />
Gesellschaft der Freunde des Dessau-Wörlitzer Gartenreiches e.V. (Hrsg.): Wörlitzer Denkanstöße.<br />
Ideen und Erfahrungen aus England. Symposiumsdokumentation. Dessau 1999.<br />
Glabau, L., Rimbach, D., Schumacher, H.: Gärten im Film. Führer zu Filmgärten in Deutschland, Europa<br />
und Übersee. Berlin 2008.<br />
Goecke, M.: Vorgeschichte und Entstehung des Stadtparkes in Hamburg-Winterhude und seine Bedeutung<br />
für das Stadtgrün. Dissertation an der TU Hannover. Hannover 1980.<br />
Goecke, M.: Stadtparkanlagen im Industriezeitalter. Das Beispiel Hamburg. In: Hennebo. D. (Hrsg.): Geschichte<br />
des Stadtgrüns. Band V. Hannover. Berlin 1981.<br />
Gothein, M.: Geschichte der Gartenkunst. 2 Bände. Nachdruck der 2. Auflage Jena 1926. Eugen Diederichs<br />
Verlag. München 1988.<br />
Grau, R.: Die Entwicklung und Bedeutung der Historischen Gärten im Grünflächensystem der Stadt<br />
Dresden. In: Die Gartenkunst 3/1991.<br />
Gruben, E. – M.: Die Gartenanlagen des Benrather Schlosses. In: Vernissage. Die Zeitschrift zur Ausstellung<br />
Nr. 18/03. Thema „Stiftung Schloss und Park Benrath“. S. 40-49. Heidelberg 2003.<br />
Hales, M.: Klostergärten. Collection Rolf Heyne. München 2000.<br />
Hannover Tourismus Center (Hrsg.): Hannover. Die Königlichen Gärten in Herrenhausen. Führer. Hannover<br />
1997.<br />
Hartmann, H.-G.: Moritzburg. Schloss und Umgebung in Geschichte und Gegenwart. Hermann Böhlaus<br />
Nachfolger. Weimar 1989.<br />
Hartmann, H.- G.: Barockgarten Großsedlitz. Edition Leipzig. Leipzig 2002.<br />
Hartz-Bentrup, B., Pusch, F. (Fotos): Private Gärten in Bremen. Ein Jahrhundert Gartenarchitektur.<br />
Schünemann Verlag. Bremen 2006.<br />
Eicklinger Amtshof GmbH 55
<strong>Landesinitiative</strong> GARTENHORIZONTE<br />
Havemann, A., Schild, M.: Hannover – Ein Begleiter zu neuer Landschaftsarchitektur. Hrsg. Garten +<br />
Landschaft. München 2006.<br />
Hennebo, D.: Gartendenkmalpflege. Eugen Ulmer Verlag. Stuttgart 1985.<br />
Henze, E.: Hamburg – Ein Begleiter zu neuer Landschaftsarchitektur. Hrsg. Garten + Landschaft. München<br />
2005.<br />
Herrenhäuser Gärten (Stadt Hannover) (Hrsg.): … prächtiger und reizvoller denn jemals … 70 Jahre Erneuerung<br />
des Großen Gartens. Ausstellungskatalog. Hannover 2007.<br />
Herzog, R.: Friedrich Ludwig von Sckell und Nymphenburg. Zur Geschichte, Gestaltung und Pflege des<br />
Schlossparks Nymphenburg. Begleitheft zur Ausstellung. Bayerische Schlösserverwaltung (Hrsg.). München<br />
2003.<br />
Hirsch E., Kaps, S.: Dessau im Gartenreich des Fürsten Franz von Anhalt- Dessau. Anhaltischer Verlag.<br />
Dessau 1994.<br />
Hirsch, E.: Von deutscher Frühklassik. Dessau-Wörlitz im Urteil der Aufklärung. Teil 1: 1741-1784. Schriftenreihe<br />
zur Geschichte der Stadt Dessau und Umgebung. Heft 55/I. Dessau 2003.<br />
Hirsch, E.: Dessau-Wörlitz. Aufklärung und Frühklassik. Kulturreisen in Sachsen-Anhalt Bd. 5. Verlag Janos<br />
Stekovics. Halle an der Saale 2006.<br />
Hlavac, C. (Hrsg.): Zurück in´s Paradies. Neue Wege im Gartentourismus. Profil Verlag. München 2002.<br />
Hlavac, C.: Garten-Spaziergänge. Historische Gärten und Parks – ein kulturtouristisches Angebot von<br />
Städten. In: Bachleitner, Reinhard, Kagelmann, H. Jürgen (Hrsg.): Kultur/Städte/Tourismus. S. 177-191.<br />
München 2003.<br />
Hlavac, C.: Landschaft als touristische Ressource – am Beispiel von Großgrünflächen, Gärten und Parks.<br />
In: TegernseerTourismusTage 2005. Tagungsband. Regensburg 2005.<br />
Hirsch, E.: Dessau-Wörlitz. Aufklärung und Frühklassik. Kulturreisen in Sachsen- Anhalt. Bd. 5. Verlag<br />
Janos Stekovics. Halle an der Saale 2006.<br />
Hoch, O.: Brandenburg Grün. Historische Gärten und Parks der Mark. Hrsg.: DGGL Berlin/Brandenburg<br />
e.V. Hamburg 2006.<br />
Hollender, S.: Der Neue Garten in Potsdam. Amtlicher Führer der Stiftung Schlösser und Gärten Potsdam-Sanssouci.<br />
Potsdam 1994.<br />
Hübner, G.: HORTUS POMERANIA – Ein Ansatz zur Inwertsetzung historischer Strukturelemente der<br />
Kulturlandschaft in Vorpommern. In: Aktuelle Probleme der Regionalentwicklung in Mecklenburg-<br />
Vorpommern. Greifswalder Beiträge zur Regional-, Freizeit- und Tourismusforschung, Band 14. Forum<br />
für Regional-, Freizeit und Tourismusforschung an der Universität Greifswald. Greifswald 2003. S. 103-<br />
105.<br />
Eicklinger Amtshof GmbH 56
<strong>Landesinitiative</strong> GARTENHORIZONTE<br />
Institut für Auslandsbeziehungen und Kulturstiftung Dessau-Wörlitz (Hrsg.): Den Freunden der Natur und<br />
Kunst. Das Gartenreich des Fürsten Franz von Anhalt-Dessau im Zeitalter der Aufklärung. Ausstellungskatalog.<br />
Stuttgart/Wörlitz 1997.<br />
Institut für Denkmalpflege der DDR, Arbeitsstelle Halle (Hrsg.): Denkmalpflege an Bauten und Gärten des<br />
Dessau-Wörlitzer Reformwerkes. Begleitheft zur Ausstellung in Wörlitz. Halle 1986.<br />
Jenzen, I. A.: Schloss und Park Pillnitz. Große Baudenkmäler Heft 523. 2. Auflage. Deutscher Kunstverlag.<br />
München 1998.<br />
Keller, H.: Kleine Geschichte der Gartenkunst. Blackwell Verlag. Berlin 1994.<br />
Kehn, W.: Christian Cay Lorenz Hirschfeld 1742-1792. Eine Biographie. Wernersche Verlagsgesellschaft.<br />
Worms1992.<br />
Kipp, O.: Die schönsten Schlossgärten und Parkanlagen in Deutschland. 100 Entdeckungsreisen.<br />
Callwey Verlag. München 2006.<br />
Kluckert, E.: Gartenkunst in Europa. Von der Antike bis zur Gegenwart. Könemann Verlag. Köln 2000.<br />
Kulturland Brandenburg e.V. (Hrsg.): Über Land. Landschaft und gärten in Brandenburg. L&H Verlag.<br />
Hamburg 2006.<br />
Kulturstiftung Dessau-Wörlitz (Hrsg.): Unendlich schön. Das Gartenreich Dessau-Wörlitz. Nicolai Verlag.<br />
Berlin 2005.<br />
L & H Verlag (Hrsg.): Potsdam Grün – Gartenkunst zwischen gestern und morgen. Aus der Reihe Green<br />
Guide. Hamburg 2001.<br />
L & H Verlag: Sachsen Grün. Historische Gärten und Parks. Hrsg.: Staatliche Schlösser, Gärten und Burgen<br />
Sachsen. Hamburg 2006.<br />
Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Thüringen (Hrsg.): Studie zur aktuellen touristischen Nutzung<br />
von Park- und Gartenanlagen in Thüringen. Erfurt 2006.<br />
Landesamt für Denkmalpflege: Denkmalpflege in Sachsen-Anhalt. Verlag für Bauwesen. Berlin 1998.<br />
Landesdenkmalamt Berlin (Hrsg.): Gartenkunst Berlin. 20 Jahre Gartendenkmalpflege in der Metropole.<br />
Berlin 1999.<br />
Landkreis Soltau-Fallingbostel (Hrsg.): Hinausspaziert! Natur und Umwelt im Landkreis Soltau-<br />
Fallingbostel. Mundschenk. Soltau 2006.<br />
Ludwig, K., Möhrle, H.: Stuttgart – Ein Begleiter zu neuer Landschaftsarchitektur. Hrsg. Garten + Landschaft.<br />
München 2005.<br />
Lux, J.: Schöne Gartenkunst. Paul Neff Verlag. Esslingen 1907.<br />
Maier-Solgk, F., Greuter, A.: Landschaftsgärten in Deutschland. Deutsche Verlagsanstalt. Stuttgart 1997.<br />
Magistrat der Stadt Homburg v.d. Höhe (Hrsg.): Die Landgräfliche Gartenlandschaft Bad Homburg. Wiederherstellung<br />
eines Gartendenkmals. Bad Homburg v.d. Höhe 2007.<br />
Eicklinger Amtshof GmbH 57
<strong>Landesinitiative</strong> GARTENHORIZONTE<br />
Ministerium für Landwirtschaft, Umweltschutz und Raumordnung des Landes Brandenburg (Hrsg.): Gartenkultur<br />
in Brandenburg und Berlin. Potsdam 2000.<br />
Ministerium für ländliche Entwicklung, Umwelt und Verbraucherschutz des Landes Brandenburg (Hrsg.):<br />
Grün im Dorf – Bauerngärten und Dorfplätze in Brandenburg. Potsdam 2006.<br />
Ministerium für Wirtschaft und Technologie, HORTEC GbR (Hrsg.): Gartenträume. Historische Parks in<br />
Sachsen-Anhalt. Denkmalpflegerisches und touristisches Gesamtkonzept sowie infrastrukturelle Rahmenplanung.<br />
Tourismus-Studien Sachsen- Anhalt Band 2. Magdeburg / Rehsen 2001.<br />
Moll, C.: Zürich – Ein Begleiter zu neuer Landschaftsarchitektur. Hrsg. Garten + Landschaft. München<br />
2006.<br />
Müller, A., Otten, H.: Historische Garten- und Parkanlagen. Kommunalverband Ruhrgebiet (Hrsg.) Essen.<br />
Müller, C.: Wurzeln schlagen in der Fremde. Die „Internationalen Gärten“ und ihre Bedeutung für Integrationsprozesse.<br />
Oekom Verlag. München 2002.<br />
Nickig, M. (Fotos), Wagner, F. (Text): Gartenkultur. Eine Auswahl schöner Gärten mit praktischen Hinweisen<br />
und Erklärungen. Ellert und Richter Verlag. Hamburg 1993.<br />
Niedersächsische Gesellschaft zur Erhaltung historischer Gärten e.V. (Hrsg.): Zehn Jahre Niedersächsische<br />
Gesellschaft zur Erhaltung historischer Gärten. Hannover 2004<br />
Niedersächsischer Heimatbund e.V. (Hrsg.): Kulturlandschaftserfasssung in Niedersachsen - -Bilanz und<br />
Ausblick. Vorträge der Tagung des NHB e.V. am 07. März 2003 in Hannover. Hannover 2003.<br />
Niedersächsischer Landfrauenverband Hannover e.V (Hrsg.).: Wir Frauen auf dem Lande. Das Jahrbuch<br />
2007. Deutscher Landwirtschaftsverlag GmbH. Hannover 2007.<br />
Niedersächsisches Informations- und Kompetenzzentrum für den ländlichen Raum „Eicklinger Amtshof<br />
GmbH“ (Hrsg.): Klostergärten zwischen Aller, Elbe und Weser. Beckum 2006.<br />
Niedersächsisches Informations- und Kompetenzzentrum für den ländlichen Raum „Eicklinger Amtshof<br />
GmbH“ (Hrsg.): Inwertsetzung des gartenkulturellen ländlichen Potenzials in den Dörfern der Region zwischen<br />
Aller, Elbe und Weser. L & H Verlag. Hamburg 2006.<br />
Niedersächsisches Landesverwaltungsamt, Institut für Denkmalpflege (Hrsg.): Gartendenkmalpflege in<br />
Niedersachsen. Dokumentation des Kolloquiums. Arbeitshefte zur Denkmalpflege in Niedersachsen Band<br />
13. Hameln 1994.<br />
NORD/LB Regionalwirtschaft (Hrsg.): Das Gartenreich Dessau-Wörlitz als Wirtschaftsfaktor. Grundlagen<br />
für eine Marketing-Konzeption. Tourismus-Studien Sachsen-Anhalt Band 6. Hannover / Magdeburg 2002.<br />
Nordrhein-Westfalen Tourismus e.V. (Hrsg.): Straße der Gartenkunst zwischen Rhein und Maas. Vorstudie.<br />
Nürnbrecht 2002.<br />
Orsenna, E.: Portrait eines glücklichen Menschen. Der Gärtner von Versailles André Le Notre. dtv. München<br />
2004.<br />
Eicklinger Amtshof GmbH 58
<strong>Landesinitiative</strong> GARTENHORIZONTE<br />
Paulus, H.-E. (Hrsg.): Paradiese der Gartenkunst in Thüringen. Historische Gartenanlagen der Stiftung<br />
Thüringer Schlösser und Gärten. Schnell und Steiner. Regensburg 2005.<br />
Pinter, Markus: Historische Heckentheater in der Gegenwart. Diplomarbeit an der Fachhochschule Weihenstephan.<br />
Freising 2005.<br />
Politische Ökologie: Landschaftskult. Natur als kulturelle Herausforderung. Politische Ökologie 96, 82<br />
Seiten. Ökonom Verlag. München 2005.<br />
Pressler, J., Wawrik, H., Weißer, P.: Parks und Gärten im Rhein-Neckar-Dreieck. K. F. Schimper-Verlag.<br />
Schwetzingen 1996.<br />
Pückler-Muskau, H. Fürst von: Andeutungen über Landschaftsgärtnerei. Reprint der Ausgabe von 1834.<br />
Deutsche Verlags-Anstalt. Stuttgart 1977.<br />
Reich, A.: Gärten, die wir lieben. Bruckmann Verlag. München 1966.<br />
Reisinger, C.: Der Schlossgarten zu Schwetzingen. Wernersche Verlagsgesellschaft. Worms 1987.<br />
Reitsam, C.: Das Konzept der „bodenständigen Gartenkunst“ Alwin Seiferts. Fachliche Hintergründe und<br />
Rezeption bis in die Nachkriegszeit. Europäische Hochschulschriften Reihe XLII Ökologie, Umwelt und<br />
Landespflege. Band 25. Frankfurt/Main 2001.<br />
Rogers, G., Kluth, S.: Traumhafte Privatgärten in Deutschland. BLV Verlag. München 2007.<br />
Rohde, M.: Pflege historischer Gärten. Theorie und Praxis. Muskauer Schriften Band 6. Leipzig 2008.<br />
Sarkowicz, H. (Hrsg.): Die Geschichte der Gärten und Parks. Buchausgabe nach einer Sendereihe des<br />
Hessischen Rundfunks. Insel Verlag. Frankfurt am Main 1998.<br />
Saudan, M., Saudan-Skira, S.: Zauber der Gartenwelt. Taschen Verlag. Köln 1997.<br />
Sächsische Schlösserverwaltung (Hrsg.): Der Große Garten zu Dresden. Gartenkunst in vier Jahrhunderten.<br />
Verlag Michel Sandstein. Dresden 2001.<br />
Schenck zu Schweinsberg, C. (Hrsg.): Schencks Schlösser & Gärten, Burgen, Klöster und Denkmäler.<br />
Ausgabe 2008. Schenck Verlag. Hamburg 2008.<br />
Scherer-Hall, R.: Kleines Lexikon der historischen Kulturlandschaft und ihrer Elemente. Eigenverlag des<br />
Autors. Köln 1996.<br />
Schomann, R.: Barocke Gärten. Gartendenkmalpflegerischer Umgang mit zerstörten Bereichen. Niedersächsisches<br />
Landesamt für Denkmalpflege (Hrsg.). Hannover 1998.<br />
Schriftenreihe Integrativer Tourismus & Entwicklung: Zurück ins Paradies, Neue Wege im Gartentourismus.<br />
Profil Verlag. München.<br />
Schuh, N.: Frankfurt – Ein Begleiter zu neuer Landschaftsarchitektur. Hrsg. Garten + Landschaft. München<br />
2008.<br />
Skerl, J., Grundner, T.: Schlösser und Gärten in Mecklenburg-Vorpommern. Hinstorff Verlag. Rostock<br />
2003.<br />
Eicklinger Amtshof GmbH 59
<strong>Landesinitiative</strong> GARTENHORIZONTE<br />
Staatliche Schlösser und Gärten Wörlitz-Oranienbaum-Luisium (Hrsg.): Historische Ansichten aus dem<br />
Gartenreich. Aquatintablätter der Chalkographischen Gesellschaft Dessau. Wörlitz 1992.<br />
Stadtgrün Bremen (Hrsg.): Wallanlagen Bremen. Bremen 1997.<br />
Stadt Wörlitz, Kulturstiftung Dessau-Wörlitz (Hrsg.): Das Dessau-Wörlitzer Gartenreich. Inventarisation<br />
und Entwicklungspotentiale der historischen Infrastruktur. Kataloge und Schriften der Kulturstiftung Dessau-Wörlitz;<br />
Bd. 7. Dessau 2000.<br />
Staatliche Schlösser und Gärten Potsdam-Sanssouci (Hrsg.): Potsdamer Schlösser in Geschichte und<br />
Kunst. VEB F.A. Brockhaus Verlag. Leipzig 1984.<br />
Stiftung Fürst-Pückler-Park Bad Muskau (Hrsg.): Englandsouvenirs. Fürst Pücklers Reise 1826-1829.<br />
Graphische Werkstätten Zittau. Zittau 2005.<br />
Stiftung Fürst-Pückler-Park Bad Muskau (Hrsg.): Fürst Pückler. Parkomanie in Muskau und Branitz. Ein<br />
Führer durch seine Anlagen in Sachsen, Brandenburg und Thüringen. L&H Verlag. Hamburg 2006.<br />
Stiftung Preußische Schlösser und Gärten (Hrsg.): Erlebnis Welterbe. Die Schlösser und Parks von Potsdam<br />
und Berlin. Potsdam 2006.<br />
Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg (Hrsg.): Zehn Jahre UNESCO-Welterbe<br />
der Potsdam-Berliner Kulturlandschaft. Berlin 2000.<br />
Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg (Hrsg.): Nichts gedeiht ohne Pflege. Die<br />
Potsdamer Parklandschaft und ihre Gärtner. Ausstellungskatalog. Potsdam 2001.<br />
Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg (Hrsg.): Preußisch Grün. Hofgärtner in<br />
Brandenburg-Preußen. Ausstellungskatalog. Potsdam 2004.<br />
Stiftung Preußische Schlösser (Hrsg.): Wege zum Garten. Michael Seiler zum 65. Geburtstag. Koehler &<br />
Amelang, Leipzig 2004.<br />
Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg (Hrsg.): Preußische Gärten in Europa. 300<br />
Jahre Gartengeschichte. Edition Leipzig. Potsdam/Leipzig 2007.<br />
Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen Schloss Gottorf (Hrsg.): Archäologische Erforschung<br />
des Gottorfer Barockgartens. Wachholtz Verlag. Neumünster 2006.<br />
Stiftung Schloss Dyck (Hrsg.): Historischer Park und Neue Gärten. Jüchen 2002.<br />
Stiftung Schloss und Park Benrath (Hrsg.): Museum für Europäische Gartenkunst. Begleittext durch die<br />
ständige Sammlung. Düsseldorf 2002.<br />
Stiftung Schloss und Park Benrath (Hrsg.): Schloss und Park Benrath. Steko-Kunstführer No. 25. Verlag<br />
Janos Stekovics. Dössel 2007.<br />
Stiftung Schlösser und Gärten Potsdam-Sanssouci (Hrsg.): Der Neue Garten in Potsdam. Amtlicher Führer.<br />
Berlin 1994.<br />
Stiftung Schlösser und Gärten Potsdam-Sanssouci (Hrsg.): Kleiner Führer durch den Park Sanssouci.<br />
Amtlicher Führer. Berlin 1995.<br />
Eicklinger Amtshof GmbH 60
<strong>Landesinitiative</strong> GARTENHORIZONTE<br />
Stiftung Schlösser und Gärten Potsdam-Sanssouci (Hrsg.): Park und Schloss Babelsberg. Amtlicher Führer.<br />
Berlin 1994.<br />
Stimmann, H., Ouwerkerk, E.-J. (Fotografien): Gärten, Plätze, Promenaden. Neueste Gartenkunst in Berlin.<br />
Nicolaische Verlagsbuchhandlung. Berlin 2008.<br />
Stratmann-Döhler, Siebenmorgen, H.: Das Karlsruher Schloss. G. Braun Buchverlag. Karlsruhe 1996.<br />
Tessin, W., Widmer, P., Wolschke-Bulmahn, J.: Nutzungsschäden in historischen Gärten. Eine sozialwissenschaftliche<br />
Untersuchung. Beiträge zur räumlichen Planung. Schriftenreihe des Fachbereichs Landschaftsarchitektur<br />
und Umweltentwicklung der Universität Hannover. Heft 59. Hannover 2001.<br />
Tessin, W., Wolschke-Bulmahn, J. (Hrsg.): Die aktuelle Nutzung historischer Parks als gartendenkmalpflegerisches<br />
Problem. Seminarbericht. WS 1998/1999. Institut für Grünplanung und Gartenarchitektur.<br />
Universität Hannover.<br />
Thimm, G.: Thüringen Grün. Vom fürstlichen Park zum modernen Stadtgrün. Hrsg.: Stiftung Weimarer<br />
Klassik und Kunstsammlungen, Thüringisches Landesamt für Denkmalpflege, Thüringer Tourismus<br />
GmbH. L&H Verlag. Berlin 2006<br />
Uerscheln, G., Kalusok, M.: Kleines Wörterbuch der europäischen Gartenkunst. Reclam Verlag. Stuttgart<br />
2001.<br />
Uerscheln, G.: Ein Museum für Europäische Gartenkunst. In: Vernissage. Die Zeitschrift zur Ausstellung<br />
Nr. 18/03. Thema „Stiftung Schloss und Park Benrath“. S. 6-27. Heidelberg 2003.<br />
Uhrig, N.: Berlin – Ein Begleiter zu neuer Landschaftsarchitektur. Hrsg. Garten + Landschaft. München<br />
2005.<br />
Vercelloni, V.: Historischer Gartenatlas. Eine europäische Ideengeschichte. Deutsche Verlags-Anstalt.<br />
Stuttgart 1994.<br />
Vereinigung der Landesdenkmalpfleger in der Bundesrepublik Deutschland, Landesdenkmalamt Berlin<br />
(Hrsg.): Alleen. Gegenstand der Denkmalpflege. Möglichkeiten ihres Schutzes, ihrer Erhaltung und Erneuerung.<br />
Berichte zu Forschung und Praxis der Denkmalpflege in Deutschland. Band 8. Berlin 2000.<br />
Vereinigung der Landesdenkmalpfleger in der Bundesrepublik Deutschland, Landesdenkmalamt Berlin<br />
(Hrsg.): Historische Gärten. Eine Standortbestimmung. Berichte zu Forschung und Praxis der Denkmalpflege<br />
in Deutschland. Band 11. Berlin 2003.<br />
Vereinigung der Landesdenkmalpfleger in der Bundesrepublik Deutschland, Regierungspräsidium Stuttgart<br />
– Landesamt für Denkmalpflege (Hrsg.): Rekonstruktion und Gartendenkmalpflege. Berichte zu Forschung<br />
und Praxis der Denkmalpflege in Deutschland. Band 15. Michael Imhof Verlag. Petersberg 2008.<br />
Verwaltung der Staatlichen Schlösser und Gärten in Hessen (Hrsg.): Park Wilhelmshöhe. Amtlicher Führer.<br />
Bad Homburg. o.Jg.<br />
Von Krosigk, K., Wiegand, H.: Glienicke. Reihe Berliner Sehenswürdigkeiten. Heft 6. Haude & Spener.<br />
Berlin 1992.<br />
Eicklinger Amtshof GmbH 61
Von Buttlar, F.: Peter Joseph Lenné. Volkspark und Arkadien. Nicolai Verlag. Berlin 1989.<br />
<strong>Landesinitiative</strong> GARTENHORIZONTE<br />
Wallner, V., Weber, G.: Der Kurpark in Baden. Stadtgemeinde Baden (Hrsg.). Baden 1994.<br />
Wähner, B.: Gärten und Parks in Sachsen. Ein Reiseführer. L&H Verlag. Hamburg 1997.<br />
Weddige, R.: Alte Hausgärten – neu gestalten. Callwey Verlag. München 1989.<br />
Weiss, T. (Hrsg.): Das Gartenreich Dessau-Wörlitz. Kulturlandschaft Dessau-Wörlitz. Ein Reiseführer.<br />
L&H Verlag. Hamburg 2001.<br />
Weiss, T. (Hrsg.): Das Gartenreich an Elbe und Mulde. Ausstellungskatalog. Wörlitz 1994.<br />
Wiedemann, G., Derksen, P.: Brandenburgs grüne Perlen. Entdeckungsreisen in unbekannte Gartenkultur.<br />
L&H Verlag. Hamburg 2006.<br />
Wiegand, H.: Entwicklung des Stadtgrüns in Deutschland zwischen 1890 und 1925 am Beispiel der Arbeiten<br />
Fritz Enckes. In: Hennebo, D. (Hrsg.): Geschichte des Stadtgrüns,. Band II. Patzer, Berlin. Hannover<br />
1977.<br />
Wieland, D.: Historische Parks und Gärten. Schriftenreihe des Deutschen Nationalkomitees für den<br />
Denkmalschutz. Band 45. Bonn 1993.<br />
Wimmer, C. A.: Parks und Gärten in Berlin und Potsdam. 4. überarb. Auflage. Nicolai Verlag. Berlin 1990.<br />
Wollweber, I.: Gartenkunst vom Kaiserreich bis zum Nationalsozialismus am Beispiel des Gartenarchitekten<br />
Harry Maasz. Schriftenreihe des Fachbereichs Landespflege der Fachhochschule Osnabrück. Heft 9.<br />
Osnabrück 1990.<br />
Wolschke-Bulmahn, J. (Hrsg.): Zur Theorie der Geschichte der Gartenkultur. Zur Praxis der Geschichtsforschung.<br />
Seminarbericht. WS 1999/2000. Institut für Grünplanung und Gartenarchitektur. Universität<br />
Hannover.<br />
Zentrum für Gartenkunst und Landschaftsarchitektur der Universität Hannover(Hrsg.): Bericht 2002-2004.<br />
Hannover 2004.<br />
Zepernick, B.; Hoffmann, I.: Der Heilpflanzengarten. Moderne Konzepte – Historische Beispiele. Leopold<br />
Stocker Verlag. Graz 2001.<br />
Zitat Hajos, G.. Gartenarchäologie und Gartendenkmalpflege. In: Die Gartenkunst 1. S. 96. Worms 1995.<br />
8.4.4 Fachforen<br />
� Bund Deutscher Landschaftsarchitekten BDLA<br />
www.bdla.de<br />
� Bundesverband Deutscher Gartenfreunde e.V.<br />
www.kleingarten-bund.de<br />
� CGL - Zentrum für Gartenkunst und Landschaftsarchitektur der Leibniz Universität Hannover<br />
(www.cgl.uni-hannover.de) Studien- und Diplomarbeiten, die am Institut für Grünplanung angefertigt<br />
wurden mit dem Thema Garten. Studentische Projektarbeiten und Diplomarbeiten der Univer-<br />
Eicklinger Amtshof GmbH 62
<strong>Landesinitiative</strong> GARTENHORIZONTE<br />
sität Hannover werden auch in der Präsenzbibliothek des Instituts für Umweltplanung, Leibniz<br />
Universität Hannover, Herrenhäuser 2, 30419 Hannover aufbewahrt<br />
(www.umwelt.uni.hannover.de/bib)<br />
� Deutsche Gartenbau Gesellschaft 1822 e.V. – DGG<br />
www.dgg1822.de<br />
� Deutsche Gesellschaft für Gartenkunst und Landschaftskultur - DGGL<br />
www.dggl.org<br />
� Förderverein Walshausen e.V.<br />
Walshausen, 31162 Bad Salzdetfurth<br />
� Gesellschaft der Staudenfreunde e.V. mit mehreren Regionalgruppen<br />
www.gds-staudenfreunde.de<br />
Regionalgruppe Braunschweig c/o Dr. Adelheidt Standt, Wittenacker 5, 38527 Meine, adelheid.standt@gmx.net<br />
Regionalgruppe Celle / Hannover c/o Adelheid Schmidt, Celle<br />
adelheid.schmidt@celle.de<br />
Regionalgruppe Stader Geest / Nordheide c/o Rika Kurz, Erlenweg 14, 21717 Deinste<br />
hjekurz@web.de<br />
Regionalgruppe Weser / Ems c/o Klaus Knospe, Osterfeldstraße 57, 26605 Aurich<br />
klaus.knospe@ewetel.de<br />
� Landesverband Niedersächsischer Gartenfreunde e.V. – LNG, Hannover<br />
� Landesverband Braunschweig der Gartenfreunde e.V. - Braunschweig<br />
� Landesverband der Gartenfreunde Ostfriesland e.V., Emden<br />
� Niedersächsische Gartenakademie Bad Zwischenahn<br />
www.nds-gartenakademie.de<br />
bietet den Gärtnern Seminare und Fachexkursionen zur beruflichen Weiterbildung an sowie Freizeitgärtnern<br />
Beratung, Seminare, Vorträge und Gartenexkursionen<br />
� Niedersächsische Gesellschaft zur Erhaltung Historischer Gärten e.V.<br />
www.historische-gaertenniedersachsen.net<br />
� Verein zur Förderung der Gartenkultur e.V. Bad Zwischenahn<br />
www.kultur-und-gaerten.de<br />
8.4.5 Internetadressen zum Thema Gartenkultur<br />
� <strong>Gartenhorizonte</strong> - www.mi.niedersachsen.de/master/C18392195_N17149389_L20_D0_I522<br />
� Offener Garten Hamburg – www.offenergarten.de/teilnehmer/hamburg<br />
� Gartenregion Hannover 2009 - www.hannover.de/gartenregion/index<br />
Eicklinger Amtshof GmbH 63
� Hannover, Naherholung, Parks, Gärten & Zoo -<br />
ww.hannover.de/de/kultur_freizeit/naherholung/index<br />
� Gartenlinksammlung - www.gartenlinksammlung.de/sitemap.htm<br />
� Gartentechnik - www.gartentechnik.de/vor_Ort/Deutschland/Niedersachsen/index<br />
<strong>Landesinitiative</strong> GARTENHORIZONTE<br />
� Historische Gärten in Niedersachsen - www.historische-gaerten-niedersachsen.net<br />
� Niedersächsische Landwirtschaftskammer<br />
www.lwk-niedersachsen.de/index.cfm/portal/3/nav/108/article/6952<br />
� Metropolregion Hamburg - www.metropolregion.hamburg.de/parks-gaerten<br />
� TourismusMarketingNiedersachsen<br />
www.reiseland-niedersachsen.de/lust-auf-natur/parks-gaerten/index.php<br />
� Schencks Schlösser und Gärten<br />
www.schencksreisefuehrer.de/schloesser_regional.php?regionID=9<br />
� Topsurftipps - www.topsurftips.de/tierparks_niedersachsen.php<br />
8.4.6 Garteninitiativen in Deutschland<br />
Bayern<br />
� Gartennetzwerk Bayern<br />
� Gartenroute in Mittelfranken<br />
Baden-Württemberg<br />
Berlin<br />
� Gartenakademie Baden-Württemberg e.V.<br />
� Gartennetzwerk grenzenloses Grün<br />
� Gartenkulturpfad Überlingen<br />
� Berlins Grüne Seite<br />
� Gartenkulturpfad Berlin<br />
� Gartenkulturpfad Neukölln<br />
Brandenburg<br />
� Gartenland Brandenburg e.V.<br />
� Gartenkulturpfad Neuruppin<br />
� Gartenkulturpfad Potsdam<br />
� Gartenkulturpfad Luckau<br />
Eicklinger Amtshof GmbH 64
Hamburg<br />
Hessen<br />
� Gartennetz Hamburg (Arbeitskreis)<br />
� Hamburg – Grüne Metropole am Wasser<br />
� Gartenkulturpfad Fulda (www.gartenkulturpfad-fulda.de)<br />
� Gartenkulturpfad Bad Nauheim<br />
<strong>Landesinitiative</strong> GARTENHORIZONTE<br />
� GartenRheinMain – Vom Klostergarten zum Regionalpark (www.gartenrheinmain.de)<br />
Mecklenburg-Vorpommern<br />
� Gartenroute Mecklenburg-Vorpommern<br />
Niedersachsen<br />
� Gartenakademie Münsterland<br />
� Gartenregion Hannover 2009<br />
� Route der Gartenkultur im Nordwesten (www.route-der-gartenkultur.de)<br />
Nordrhein-Westfalen<br />
� Landesarbeitsgemeinschaft Gartenrouten (erstmalige und landesweite Zusammenarbeit zu Thema<br />
Gartenkultur in NRW)<br />
� Das Münsterland - Die Parks und Gärten e.V.<br />
� Gärten in Westfalen (www.gaerten-in-westfalen.de)<br />
� Straße der Gartenkunst zwischen Rhein und Maas e.V. (www.strasse-der-gartenkunst.de)<br />
� Herrenhäuser und Parks im Mühlenkreis Minden-Lübbecke e.V.<br />
� Wege zur Gartenkunst (www.wege-zur-gartenkunst.de)<br />
� Garten_Landschaft OstWestfalenLippe (www.garten-landschaft-owl.de)<br />
Rheinland-Pfalz<br />
� Gartenlust – Rhein, Mosel, Saar (Arbeitskreis)<br />
� Interessengemeinschaft GartenRoute Hunsrück-Mittelrhein<br />
Saarland<br />
� Gärten ohne Grenzen (www.gaerten-ohne-grenzen.com)<br />
� Gartenlust – Rhein, Mosel, Saar (Arbeitskreis)<br />
Sachsen<br />
� Gartenkulturpfad: Parks und Gärten beiderseits der Neiße<br />
Eicklinger Amtshof GmbH 65
� Gartenkulturpfad Großenhain<br />
Sachsen-Anhalt<br />
<strong>Landesinitiative</strong> GARTENHORIZONTE<br />
� Gartenträume – Historische Parks in Sachsen-Anhalt e.V. (www.gartentraeume-sachsenanhalt.de)<br />
Schleswig-Holstein<br />
� Gartenrouten zwischen den Meeren (www.gartenrouten-sh.de)<br />
Thüringen<br />
� Netzwerk GartenKULTUR<br />
� Gärten und Parks der Klassik Stiftung Weimar<br />
Bundesebene<br />
� Gartenwelten Veranstaltungsreihe des BDLA (www.gartenwelten.net)<br />
� Gartennetz Deutschland – Bundesverband regionaler Garteninitiativen<br />
� Netzwerk „Frauen in der Geschichte der Gartenkultur“<br />
� Deutsche Zentrale für Tourismus e.V. (DZT) mit dem Themenjahr 2008 „Schlösser, Parks und<br />
Gärten“<br />
Europa<br />
� Deutsches Seminar für Tourismus (DSFT) Berlin e.V.<br />
� Europäisches Gartennetzwerk EGHN (www.eghn.org)<br />
� Crossing fences – Gärten Europas – Kultur, Natur, Erlebnis<br />
www.gaerten-europas.de<br />
www.crossing-fences.com<br />
� Open Tuinen Dagen - Tage der offenen Gärten, Amsterdam<br />
� National Trust (Stiftung)<br />
� Garten.netz.werk.NÖ (Österreich)<br />
8.4.7 Offene Pforten<br />
Zusammengestellt von Ronald Clark für den Gartenreiseführer 2009/10, Callwey-Verlag, Stand Juli 2008.<br />
Bundesweit<br />
Offene Gartenpforten<br />
Überblick über Aktionen mit Beteiligung der Deutschen Gesellschaft für Gartenkunst und Landschaftskultur<br />
(DGGL) - www.dggl.org<br />
Eicklinger Amtshof GmbH 66
Gartenwelten<br />
Überblick über die vom Bund Deutscher Landschaftsarchitekten veranstalteten Aktionen:<br />
www.gartenwelten.net<br />
Die offene Pforte<br />
Zirka 170 Gärten, Broschüre nur für Mitglieder der Gesellschaft der Staudenfreunde über<br />
GdS-Geschäftsstelle, Klaus Zimmermann, Tel. 06233 / 371837, Fax 06233 / 371937<br />
info@gds-staudenfreunde.de<br />
Bremen<br />
Bremerhaven, Cuxhaven, Wesermarsch<br />
Offene Gartenpforte - 40 Gärten<br />
Information über:<br />
BIS Bremerhaven Touristik & Tourist-Infos, H.-H.-Meier-Straße , 27568 Bremerhaven<br />
Tel. 0471 / 414141, Fax 0471 / 9464619<br />
touristik@bis-bremerhaven.de, www.bremerhaven-tourism.de<br />
Niedersachsen<br />
Nordostniedersachsen<br />
<strong>Landesinitiative</strong> GARTENHORIZONTE<br />
Gärten Europas - Der Weg ins Grüne - zirka 110 Gärten und Parks, davon 80 Privatgärten zwischen<br />
Nordsee und Heide<br />
Broschüre gegen frankierten Rückumschlag (DIN A5, 1,44 €)<br />
Stadt Celle, Projektbüro Crossing Fences, Helmuth-Hörstmann-Weg 1, 29221 Celle<br />
www.gaerten-europas.de<br />
Braunschweig<br />
Die Offene Pforte - zirka 30 Gärten<br />
Liste gegen frankierten Rückumschlag (0,55 €)<br />
Maria Warnat, An der Wasche 12b, 38122 Braunschweig, Tel. 05300 / 6336<br />
manfred.warnat@gmx.de, www.offenepforte.braunschweig.de<br />
Buchholz in der Nordheide<br />
Tag der offenen Gartenpforte - zirka 10 Gärten<br />
Stadt Buchholz i.d.N., Martina Bartusch, Tel. 04181 / 214787<br />
Martina.Bartusch@buchholz.de, www.buchholz.de<br />
Eicklinger Amtshof GmbH 67
Butjadingen und Stadland<br />
Gärten im Küstenwind - 5 Gärten<br />
Liste gegen frankierten Rückumschlag (0,55 €)<br />
Galerie am Wehlhamm, Sonnenstraße 1, 26969 Ruhwarden, Tel. 04736 / 598<br />
Celler Land<br />
Die offene Pforte im Celler Land - zirka 60 Gärten<br />
Broschüre gegen frankierten Rückumschlag (DIN lang, 0,95 €)<br />
<strong>Landesinitiative</strong> GARTENHORIZONTE<br />
AK Offene Pforte im Celler Land, Adelheit Schmidt, Heilpflanzengarten, Wittinger Straße 76, 29223 Celle,<br />
Tel. 05141 / 208173, Fax 05141 / 208174<br />
Adelheid.Schmidt@celle.de, www.die-offene-pforte.de.ms<br />
Dötlingen<br />
Offene Gartenpforten<br />
Zirka 10 Gärten, Informationen gegen frankierten Rückumschlag (0,55 €)<br />
Olaf Schachtschneider, Iserloyer Straße 2, 27801 Dötlingen-Aschenstedt, Tel. 04433 / 919100,<br />
Fax 04433 / 9191029, info@schachtschneider.com, www.doetlinger-gartenkultour.de<br />
Elsfleth<br />
Offene Gärten in Elsfleth - 5 Gärten<br />
Gabriele Caspari, Am Weserdeich 82, 26931 Elsfleth, www.offene-gaerten-elsfleth.de<br />
Landkreis Gifhorn<br />
Offene Gärten - 30 Gärten<br />
Kreisverband der Landfrauen Gifhorn e.V., Adelheid Standt, Tel. 05304 / 2932<br />
Anne-Gret Aselmeyer-Kohl, Tel. 05833 / 970409<br />
Gifhorn/Leiferde<br />
Tag der offenen Gartentür in Leiferde - zirka 17 Gärten, alle zwei Jahre, voraussichtlich Juni 2010<br />
Information über:<br />
Leiferder NABU-Artenschutzzentrum, 38542 Leiferde, www.nabuzentrum-leiferde.de<br />
oder Kulturring Leiferde, Dr. Jürgen Helmcke, Tel. 05373 / 6582, juergen.helmcke@ptb.de<br />
www.kulturring-leiferde.de<br />
Göttingen/Eichsfeld<br />
Tag des offenen Gartens - zirka 25 Gärten<br />
Liste gegen frankierten Rückumschlag (0,55 €)<br />
Eicklinger Amtshof GmbH 68
Interessengemeinschaft Bauernhaus e.V. – IGB, Postfach 1244, 28859 Lilienthal<br />
mail@igbauernhaus.de, www.igbauernhaus.de<br />
Goslar<br />
Die offene Pforte - 12 Gärten<br />
Informationen gegen frankierten Rückumschlag (0,55 €)<br />
Bernhard Klebe, FB 1.1.24, Charley-Jacob-Straße 3, 38640 Goslar, Tel. 05321 / 704527<br />
www.goslar.de<br />
Landkreis Hameln/Pyrmont<br />
Tag des Offenen Gartens - 12 Gärten<br />
Programm gegen frankierten Rückumschlag (0,55 €)<br />
Natur- und Umweltzentrum, Berliner Platz 4, 31785 Hameln, www.bund-hameln.de<br />
Hannover<br />
Die offene Pforte - zirka 125 Gärten<br />
Prospekt: gegen frankierten Rückumschlag (1,44 €)<br />
<strong>Landesinitiative</strong> GARTENHORIZONTE<br />
Landeshauptstadt Hannover, FB Umwelt und Stadtgrün, Langensalzastr. 17, 30169 Hannover<br />
Tel. 0511 / 16843801, Fax 0511 / 16842914, www.hannover.de<br />
Hildesheim<br />
„Die Offene Gartenpforte“ – Gärten in und um Hildesheim - zirka 50 Gärten<br />
Ursula Kreye-Wagner und Verena Leonhardt, Terrassenstieg 15, 31141 Hildesheim,<br />
Tel. 05064 / 960678, Fax 05064 / 960676, www.offenegartenpforte-hildesheim.de<br />
Langenhagen<br />
Offene Pforte Langenhagen - 12 Gärten<br />
Liste gegen frankierten Rückumschlag (0,55 €)<br />
Dr. Heinz Jansen, Auf dem Rußkampe 36, 30855 Langenhagen, Tel. 0511 / 732280<br />
www.langenhagen.de<br />
Region Mittelweser<br />
Gartentour - 16 Gärten<br />
Liste gegen frankierten Rückumschlag (0,55 €)<br />
Margret Jambroszyk, Am Sportplatz 99, 27305 Engeln OT Scholen,<br />
Tel. 04252 / 2040, Fax 04252 / 9090089<br />
Eicklinger Amtshof GmbH 69
info@elfenblume.de, www.gartentour-niedersachsen.de<br />
Nienburg/Weser<br />
Quer durch die Beete - zirka 25 Gärten<br />
<strong>Landesinitiative</strong> GARTENHORIZONTE<br />
Liste gegen frankierten Rückumschlag über: Anne Pagels, Kleine Rolle 8, 31582 Nienburg/Weser oder<br />
Sabine Cordts, Am Riedekamp 24, 31582 Nienburg/Weser<br />
Osnabrück und Umgebung<br />
Das offene Gartentor - zirka 35 Gärten<br />
Liste gegen frankierten Rückumschlag (0,55 €)<br />
Rüdiger Weddige, Stollenweg 22b, 49134 Wallenhorst, Tel. 0541 / 684238<br />
www.al.fh-osnabrueck.de<br />
Osnabrücker Land I<br />
Gärten im Hasetal – zirka 50 Gärten<br />
Bezug einer 72-seitigen Broschüre mit Karte für 1,50 € über<br />
Zweckverband Erholungsgebiet Hasetal, Langenstr. 33, 49624 Löningen<br />
Tel. 05432 / 599599, Fax 05432 / 599598, zeh@hasetal.de, www.hasetal.de<br />
Osnabrücker Land II<br />
Hinter’m Zaun das Paradies - Radwanderroute "GartenTraumTour" - 30 Gärten<br />
Informationen und Streckenkarte gegen frankierten Rückumschlag (A4, 1,44 Euro)<br />
Gemeinde Ostercappeln, Fachdienst Tourismus, Gildebrede 1, 49179 Ostercappeln, Tel. 05473 / 92020<br />
Osterholz-Scharmbeck<br />
Offene Gärten im Kulturland Teufelsmoor - zirka 30 Gärten<br />
Maike de Boer, Schumannring 3, 27711 Osterholz-Scharmbeck, Tel. 04791 / 898479<br />
info@gartenbegeisterung.de, www.gartenbegeisterung.de<br />
Landkreis Peine<br />
Die Offene Pforte - zirka 30 Gärten<br />
Liste gegen frankierten Rückumschlag (0,95 €) über<br />
Landkreis Peine, Agenda21-Büro, Elke Kentner, Burgstraße 1, 31225 Peine<br />
Tel. 05171 / 401527, www.landkreis-peine.de<br />
Landkreis Rotenburg/Wümme<br />
Private Gärten entdecken und erleben - 25 Gärten<br />
Eicklinger Amtshof GmbH 70
Liste gegen frankierten Rückumschlag (0,95 €)<br />
Karin und Christoph Gester, Orthof 18, 27374 Visselhövede OT Wittorf, Tel. 04260 / 620<br />
chrgester@aol.com, www.tourow.de<br />
Salzhausen<br />
Tag der offenen Gartenpforte - 10 Gärten<br />
Samtgemeinde Salzhausen, Rathausplatz 1, 21376 Salzhausen, Tel. 04172 / 90990<br />
www.salzhausen.de<br />
Schaumburger Land<br />
Offene Pforte - zirka 40 Gärten<br />
Liste gegen frankierten Rückumschlag (0,55 €) über<br />
Ulrike Schabel, Hauptstraße 70 ,31719 Wiedensahl, Tel. 05726 / 788<br />
www.schaumburgerland-tourismus.de<br />
Soltau-Fallingbostel<br />
Über Zäune schauen - zirka 50 Gärten<br />
Liste gegen frankierten Rückumschlag (0,55 €) über<br />
Marita Eichler, Marienburger Straße 1, 29683 Bad Fallingbostel, Tel. 05162 / 6282<br />
majoei@kabelmail.de, www.ueber-zaeune-schaeuen.de<br />
Tostedt<br />
Tag der offenen Gartenpforte - 17 Gärten<br />
Burkhard Allwardt, Tel. 04182 / 293850<br />
agenda21-tostedt@t-online.de, www.agenda21-tostedt.de<br />
Region Uelzen<br />
Offene Gärten in der Region Uelzen - 22 Gärten<br />
Liste gegen frankierten Rückumschlag (0,55 €) über<br />
<strong>Landesinitiative</strong> GARTENHORIZONTE<br />
HeideRegion Uelzen, Herzogenplatz 2, 29525 Uelzen, Tel. 0581 / 73040, Fax 0581 / 72384<br />
info@heideregion-uelzen.de, http://www.heideregion-uelzen.de<br />
Kreis Verden/Aller Armsen<br />
Tag der offenen Gärten - zirka 10 Gärten in ungeraden Jahren im Juni<br />
Liste gegen frankierten Rückumschlag (0,55 €) über<br />
Marela Seemann, Dorfstr. 45, 27308 Kirchlinteln/OT Armsen, Tel. 04238 / 230<br />
Eicklinger Amtshof GmbH 71
Wendland<br />
Gartenräume - zirka 20 Gärten<br />
Gruppe Gartenräume, Familie Mamerow, Tarmitzer Straße 11 a, 29439 Lüchow<br />
Tel 05841 / 974770, www.gartenraeume.info<br />
Weser Ems I<br />
<strong>Landesinitiative</strong> GARTENHORIZONTE<br />
Ems-Dollart - In Nachbars Garten/Het Tuinpad Op - 130 Gärten grenzübergreifend in der Provinz Groningen<br />
und in Nord-West Niedersachsen<br />
144-seitiger Gartenführer für 8,- Euro über<br />
Sekretariat "In Nachbars Garten" Tel. 04928 / 411 oder in Tourist Informationen und Geschäften im Einzugsgebiet<br />
Christiane Denecke, Alter Weg 10, 26632 Riepe, Tel. 04928 / 411, Fax: 0928 / 915693<br />
innachbarsgarten@yahoo.de, www.innachbarsgarten.de<br />
Weser Ems II<br />
Route der GartenKultur im Nordwesten - 120 Privatgärten in 14 Faltblättern<br />
Oldenburg Tourismus und Marketing GmbH, Kleine Kirchstraße 10, 26122 Oldenburg<br />
Tel. 0441 / 3616130, Tel. 01805 / 938 333, Fax 0441 / 36161350, www.nordwestgarten.de<br />
Weser-Ems III<br />
Bauerngärten im Nordwesten - zirka 25 Gärten<br />
Informationen gegen frankierten Rückumschlag (0,55€)<br />
Anke zu Jeddeloh, Wischenstraße 9, Jeddeloh I, 26188 Edewecht, Tel. 04405 / 7302<br />
ankezj@web.de, www.bauerngaerten-nordwest.de<br />
Weser-Ems III<br />
Der offene Garten - 15 Gärten im Ammerland<br />
Pro Natura e.V., Angelika Ernst, Diekweg 17, 26188 Friedrichsfehn, Tel. 04486 / 2481<br />
www.pronatura-ev.de<br />
Eicklinger Amtshof GmbH 72
8.4.8 Gartenrouten<br />
Bayern<br />
� Route der Gartenkultur - Auf den Spuren der Ansbacher Markgrafen<br />
Brandenburg<br />
Hessen<br />
� das Ruppiner Land / in der Oberhavel<br />
� das Havelland / den Fläming<br />
� das Dahme-Seengebiet<br />
� den Barnim / die Uckermark<br />
� das Elbe-Elster-Land<br />
� Gartenkulturpfad Fulda<br />
� Route durch die hessische Kulturlandschaft (Landschaftsroute)<br />
� Route der Industriekultur Rhein-Main (Landschaftsroute)<br />
Niedersachsen<br />
� Route der Gartenkultur im Nordwesten (www.route-der-gartenkultur.de)<br />
� GartenTraumTour im Osnabrücker Land<br />
� Bauerngärten laden ein! (www.bauerngaerten-nordwest.de)<br />
Nordrhein-Westfalen<br />
� Gärten + Parks links und rechts der Ems<br />
� Einblicke – Ausblicke: Gärten, Architektur, Landschaft – Rheinland<br />
� Parks und Gärten als Element der Stadtentwicklung – Ruhrgebiet<br />
� Gartenroute der kulturellen Ereignisse – Ostwestfalen-Lippe<br />
� Gärten in der Münsterländer Schloss- und Parklandschaft - Münsterland<br />
� Route der Industriekultur (Landschaftsroute) www.route-industriekultur.de<br />
Schleswig-Holstein<br />
Gartenrouten zwischen den Meeren*<br />
� Märchen und Mythen der Schleigärten – Region Schleswig / Schlei<br />
� Mit Picknickkorb ins Fördegrün – Region Kiel<br />
� Flanieren und Philosophieren lieblicher Seenlandschaften – Region Ostholstein<br />
� Von Baumschulbaronen und Pflanzenjägern – Region Pinneberg<br />
<strong>Landesinitiative</strong> GARTENHORIZONTE<br />
Eicklinger Amtshof GmbH 73
Europa<br />
� Von Wasserbäumen zu grünen Paradiesen – Lübeck<br />
� Zu grünem Werk und Ernteglück – Neumünster<br />
<strong>Landesinitiative</strong> GARTENHORIZONTE<br />
� Lebenskunst und kulinarische Genüsse entlang der Gärten im westlichen Loiretal (F)<br />
� Mythen und Legenden - Cheshire (GB)<br />
� Die Entwicklung der Parks und Gärten im Wandel der Zeiten – Surrey (GB)<br />
� Malerisches Cheshire - Cheshire (GB)<br />
� Wiederspiegelnde Landschaften – ein Land unendlicher Vielfalt - Somerset<br />
� Verborgene Paradiese entlang der Maas – Limburg (NL)<br />
� Wohnen im Grünen – Schloss-Gärten in Brügge und dem Brügger Umland (B)<br />
8.4.9 Datenbanken und Datensammlungen<br />
� ART-Guide (Datenbank für kunstgeschichtlich hochwertige Internetangebote, die von den Universitätsbibliotheken<br />
Heidelberg und Dresden aufgebaut wird)<br />
� Hardenbergsches Haus, Hannover. Gartenbibliothek (Bibliothek Ursula Gräfin Dohna)<br />
� Karten der Preußischen Landesaufnahme. Viele Gärten, die um 1900 bestanden, sind hier verzeichnet.<br />
� Niedersächsisches Informations- und Kompetenzzentrum für den ländlichen Raum „Eicklinger<br />
Amtshof GmbH“, Unterlagen von Dr. S. Hahn.<br />
� Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege - Rainer Schomann<br />
www.denkmalpflege.niedersachsen.de/master/C13121167_N13115694_L20_D0_I10768338.html<br />
(dort auch: so genannte Hinz-Kartei, im Keller des Landesamtes aufbewahrt; eine Kopie dieser<br />
Kartei besaß Professor Hennebo).<br />
� Datenbank über Parks und Gärten im ehemaligen Regierungsbezirk Lüneburg, 2004.<br />
Eicklinger Amtshof GmbH 74