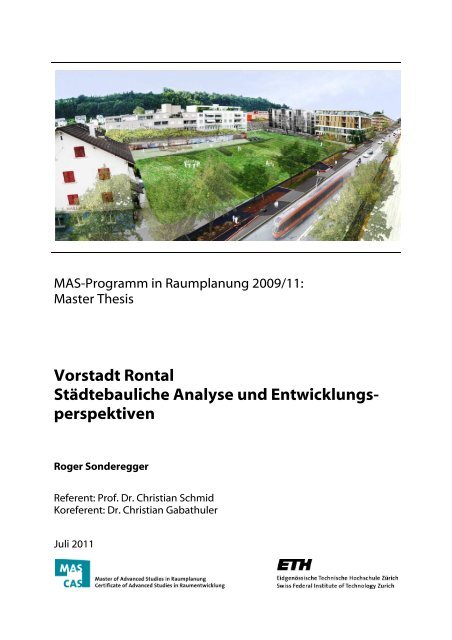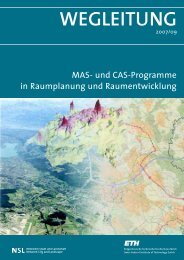Vorstadt Rontal Städtebauliche Analyse und Entwicklungs ...
Vorstadt Rontal Städtebauliche Analyse und Entwicklungs ...
Vorstadt Rontal Städtebauliche Analyse und Entwicklungs ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
MAS-Programm in Raumplanung 2009/11:<br />
Master Thesis<br />
<strong>Vorstadt</strong> <strong>Rontal</strong><br />
<strong>Städtebauliche</strong> <strong>Analyse</strong> <strong>und</strong> <strong>Entwicklungs</strong>perspektiven<br />
Roger Sonderegger<br />
Referent: Prof. Dr. Christian Schmid<br />
Koreferent: Dr. Christian Gabathuler<br />
Juli 2011
<strong>Vorstadt</strong> <strong>Rontal</strong> ____________________________________________________________________________________ Juli 2011<br />
Vorwort<br />
Die vorliegende Master Thesis bildet den Abschluss einer Ausbildung in Raumplanung an der<br />
ETH Zürich. Sie untersucht exemplarisch eine Luzerner <strong>Vorstadt</strong> <strong>und</strong> leistet damit einen Beitrag<br />
zur Diskussion über eine wünschenswerte Zukunft für unsere Vorstädte – dort wo ein grosser<br />
Anteil der Menschen heute <strong>und</strong> insbesondere in den kommenden 50 Jahren wohnt.<br />
Ein besonderer Dank geht an die Betreuung durch Prof. Dr. Christian Schmid. Ohne ihn hätte<br />
sich diese Arbeit nie vom alltäglichen Instrumentarium der Raumplanung Schweiz gelöst <strong>und</strong><br />
sich den gr<strong>und</strong>sätzlicheren Fragen zur Zukunft der Raumentwicklung gestellt. Nur wenige Per-<br />
sonen wagen es, sich den grossen Zusammenhängen in der Schweizer Raumplanung zuzu-<br />
wenden <strong>und</strong> diese auch öffentlich zu diskutieren – Christian Schmid gehört zu ihnen. Ebenso<br />
gebührt Dr. Christian Gabathuler ein herzlicher Dank. Er ist als Koreferent für den erkrankten<br />
Prof. Dr. Giovanni Danielli, meinen langjährigen Fre<strong>und</strong> <strong>und</strong> Arbeitskollegen, eingesprungen.<br />
Weiter möchte ich meinen langjährigen Fre<strong>und</strong>en Mariela Siegrist <strong>und</strong> Diego Comamala dan-<br />
ken, die mit unermüdlichem Einsatz die in dieser Arbeit enthaltenen Computeranimationen er-<br />
stellt haben. Wenn Bilder mehr als tausend Worte sagen, dann sollte man sie auch tatsächlich<br />
sprechen lassen. Ausserdem danke ich meinem Studienfre<strong>und</strong> Cornelius Wegelin, der fre<strong>und</strong>li-<br />
cherweise das Korrekturlesen dieser Arbeit übernommen hat. Er wird dieses Jahr selber das<br />
MAS Raumplanung an der ETH Zürich in Angriff nehmen, wozu ich ihm viel Erfolg wünsche.<br />
Diese Arbeit widme ich meinem Sohn Lukas, der während der Erarbeitung das Licht der Welt<br />
erblickte. Ich hoffe, in Zukunft relevante Beiträge zur Stärkung der Schweizer Raumplanung leis-<br />
ten zu können, um ihm dereinst eine lebenswerte Schweiz weiterzugeben.<br />
Luzern, im Juli 2011<br />
Roger Sonderegger<br />
I
<strong>Vorstadt</strong> <strong>Rontal</strong> ____________________________________________________________________________________ Juli 2011<br />
Inhaltsverzeichnis<br />
1 Das <strong>Rontal</strong> als Schweizer Agglomeration .................................................................................. 3<br />
1.1 Das Untersuchungsgebiet ................................................................................................................... 3<br />
1.2 Verkehrserschliessung ........................................................................................................................... 4<br />
1.3 Bevölkerung .............................................................................................................................................. 6<br />
1.4 Wirtschaft ................................................................................................................................................... 8<br />
1.5 Siedlungsästhetik <strong>und</strong> öffentlicher Raum ................................................................................... 11<br />
1.6 Baulandpotentiale ............................................................................................................................... 13<br />
1.7 Fazit: <strong>Städtebauliche</strong> Defizite im <strong>Rontal</strong> ...................................................................................... 14<br />
2 Die <strong>Vorstadt</strong> im wissenschaftlichen Diskurs ........................................................................... 19<br />
2.1 Lebhafte Diskussion in den 1990er-Jahren ................................................................................. 19<br />
2.2 Verschiebung in den deutschsprachigen Raum ....................................................................... 20<br />
2.3 Strategie zur städtebaulichen Aufwertung ................................................................................. 22<br />
3 Die Agglomeration Luzern im städtebaulichen Kontext .................................................... 25<br />
3.1 <strong>Städtebauliche</strong> Entwicklung ............................................................................................................ 25<br />
3.2 Städtenetz Zentralschweiz? .............................................................................................................. 27<br />
3.3 Fazit ........................................................................................................................................................... 30<br />
4 Szenarien der Raumentwicklung Schweiz .............................................................................. 32<br />
4.1 Gemeinsame Elemente ...................................................................................................................... 33<br />
4.2 Szenario 1: Eine Schweiz der Metropolen – Trendszenario ................................................... 33<br />
4.3 Szenario 2: Zersiedlung – Niedergang der Städte .................................................................... 36<br />
4.4 Szenario 3: Eine polyzentrische urbane Schweiz – vernetztes Städtesystem ................. 39<br />
4.5 Szenario 4: Eine Schweiz der Regionen – territoriale Solidarität ......................................... 42<br />
5 Vier Szenarien für das <strong>Rontal</strong> ....................................................................................................... 45<br />
5.1 Trendszenario: Zug entleert sich ins <strong>Rontal</strong> hinein .................................................................. 45<br />
5.2 Zersiedlung: Das <strong>Rontal</strong> wird zugebaut ....................................................................................... 47<br />
5.3 Polyurbanes Städtenetz: Das <strong>Rontal</strong> wird urbanisiert ............................................................. 49<br />
5.4 Territoriale Solidarität: Das <strong>Rontal</strong> bleibt <strong>Vorstadt</strong> ................................................................... 51<br />
5.5 Fazit: Lernen aus den Szenarien ...................................................................................................... 52<br />
II
<strong>Vorstadt</strong> <strong>Rontal</strong> ____________________________________________________________________________________ Juli 2011<br />
6 Eine räumliche <strong>Entwicklungs</strong>strategie für das <strong>Rontal</strong> ......................................................... 53<br />
6.1 Stärkung des öffentlichen Raums ................................................................................................... 53<br />
6.2 Schaffung von Kohärenz ................................................................................................................... 54<br />
6.3 Vernetzung ............................................................................................................................................. 54<br />
6.4 Verdeutlichung von Grenzen ........................................................................................................... 55<br />
6.5 Schaffung von Identifikationsorten ............................................................................................... 55<br />
6.6 Umstrukturierung der Regionalwirtschaft .................................................................................. 56<br />
7 Fazit für die Raumentwicklung Schweiz .................................................................................. 57<br />
8 Quellen ................................................................................................................................................ 60<br />
III
<strong>Vorstadt</strong> <strong>Rontal</strong> ____________________________________________________________________________________ Juli 2011<br />
Tabellenverzeichnis<br />
Tabelle 1 Bevölkerungsentwicklung 1999-2009 ............................................................................ 7<br />
Tabelle 2 Beschäftigte <strong>und</strong> Pendler im <strong>Rontal</strong> .............................................................................. 10<br />
Tabelle 3 Baulandpotentiale im <strong>Rontal</strong> (in ha) .............................................................................. 14<br />
Abbildungsverzeichnis<br />
Abbildung 1 Untersuchungsperimeter im Überblick .............................................................. 3<br />
Abbildung 2 Die K17 aus der Perspektive eines Velofahrers ................................................ 6<br />
Abbildung 3 Altersstruktur der Bevölkerung ............................................................................. 8<br />
Abbildung 4 Ausprägung der Wirtschaft nach Sektoren ....................................................... 9<br />
Abbildung 5 Hauptstrasse K17: Trennwirkung <strong>und</strong> Flächenverbrauch .......................... 11<br />
Abbildung 6 Kapelle in Ebikon ...................................................................................................... 12<br />
Abbildung 7 Fehlende raumplanerische <strong>und</strong> gestalterische Koordination................... 13<br />
Abbildung 8 Ausrichtung eines Lebensraumes auf das Auto ............................................ 15<br />
Abbildung 9 Amerikanische Verhältnisse in Verkehr <strong>und</strong> Gastronomienangebot ..... 16<br />
Abbildung 10 Zentraler Platz in Ebikon – zwischen Kirche, Hofmatt <strong>und</strong> Bahnhof ....... 17<br />
Abbildung 11 Urban geprägte Teilräume der Zentralschweiz ............................................. 28<br />
Abbildung 12 Die Schweiz der Metropolen – Trendszenario ................................................ 35<br />
Abbildung 13 Zersiedlung – Niedergang der Städte ............................................................... 38<br />
Abbildung 14 Eine polyzentrisch urbane Schweiz – vernetztes Städtesystem ............... 40<br />
Abbildung 15 Eine Schweiz der Regionen – territoriale Solidarität .................................... 43<br />
Abbildung 16 Trendszenario: Zug entleert sich ins <strong>Rontal</strong> hinein ...................................... 46<br />
IV
<strong>Vorstadt</strong> <strong>Rontal</strong> ____________________________________________________________________________________ Juli 2011<br />
Abbildung 17 Zersiedlung: Das <strong>Rontal</strong> wird zugebaut ........................................................... 48<br />
Abbildung 18 Polyurbanes Städtenetz: Das <strong>Rontal</strong> wird urbanisiert ................................. 50<br />
Abbildung 19 Territoriale Solidarität: Das <strong>Rontal</strong> bleibt <strong>Vorstadt</strong> ....................................... 51<br />
Abbildung 20 Vision für ein neues Dorfzentrum in Ebikon ................................................... 56<br />
Abbildung 21 Übersichtskarte morphologische Detailanalyse .............................................. 2<br />
Abbildung 22 Knoten ........................................................................................................................... 3<br />
Abbildung 23 Relikte ............................................................................................................................ 4<br />
Abbildung 24 Siedlungsinseln ........................................................................................................... 5<br />
Abbildung 25 Restflächen ................................................................................................................... 6<br />
Abbildung 26 Zerhäuselung .............................................................................................................. 7<br />
Abbildung 27 Transiträume................................................................................................................ 8<br />
Abbildung 28 Superkomplexe........................................................................................................... 9<br />
V
<strong>Vorstadt</strong> <strong>Rontal</strong> ____________________________________________________________________________________ Juli 2011<br />
Abschlussarbeit MAS-Programm in Raumplanung 2009/11<br />
<strong>Vorstadt</strong> <strong>Rontal</strong><br />
<strong>Städtebauliche</strong> <strong>Analyse</strong> <strong>und</strong> <strong>Entwicklungs</strong>perspektiven<br />
Roger Sonderegger<br />
Schönegg 3<br />
6014 Luzern<br />
Telefon: 041 534 39 30<br />
Mobil: 078 861 98 39<br />
E-Mail: roger.sonderegger@gmail.com<br />
Juli 2011<br />
Kurzfassung<br />
Das <strong>Rontal</strong> weist heute drei wesentliche städtebauliche Defizite auf: einen schwachen öffentlichen<br />
Verkehr, eine bauliche Entwicklung in die Fläche <strong>und</strong> wenig attraktive öffentliche Räume.<br />
Die Szenarioanalysen in dieser Arbeit zeigen ausserdem, dass sich das <strong>Rontal</strong> ohne Gegenmassnahmen<br />
weiter in eine nicht nachhaltige Richtung entwickeln wird. Die vorgeschlagene Aufwertungsstrategie<br />
umfasst eine Stadtbahn, eine Umgestaltung des Strassenraums <strong>und</strong> die Schaffung<br />
von Plätzen, die Stärkung des Langsamverkehrs, eine Verdichtung der Siedlung an zentralen Lagen<br />
<strong>und</strong> eine Begrenzung der Siedlung nach aussen. Die regionale Wirtschaft muss sich stärker in<br />
Richtung wertschöpfungsintensiver Betriebe entwickeln, z.B. mit der Gründung eines Cleantech-<br />
Zentrums anstelle des geplanten Ebisquare.<br />
In vielen Schweizer Vorstädten bestehen heute ähnliche Probleme. Gerade diese wenig beachteten<br />
Siedlungsteile ausserhalb der Kernstadt bieten jedoch riesige Potentiale, um das prognostizierte<br />
Bevölkerungswachstum in der Schweiz aufzunehmen. Damit diese Entwicklung gelingt,<br />
braucht es die Vorleistung der öffentlichen Hand <strong>und</strong> eine funktionierende Zusammenarbeit zwischen<br />
Gemeinden <strong>und</strong> Kantonen – am wirksamsten durch Gemeindefusionen. Die Agglomerationspolitik<br />
des B<strong>und</strong>es ist für die Lösung der diskutierten Probleme ein wichtiger Schritt in die<br />
richtige Richtung.<br />
Schlagworte<br />
<strong>Vorstadt</strong>; <strong>Rontal</strong>; Agglomeration Luzern; Stadtentwicklung; Agglomerationspolitik<br />
Zitierungsvorschlag<br />
Sonderegger, Roger (2011): <strong>Vorstadt</strong> <strong>Rontal</strong>: <strong>Städtebauliche</strong> <strong>Analyse</strong> <strong>und</strong> <strong>Entwicklungs</strong>perspektiven.<br />
Abschlussarbeit im MAS Raumplanung an der ETH Zürich.<br />
1
<strong>Vorstadt</strong> <strong>Rontal</strong> ____________________________________________________________________________________ Juli 2011<br />
1 Das <strong>Rontal</strong> als Schweizer Agglomeration<br />
1.1 Das Untersuchungsgebiet<br />
Das Untersuchungsgebiet <strong>Rontal</strong> liegt zwischen Luzern <strong>und</strong> Rotkreuz, also am Nordostrand der<br />
Agglomeration Luzern. Untersucht werden in dieser Arbeit die vier Gemeinden Ebikon, Buch-<br />
rain, Dierikon <strong>und</strong> Root (von Westen nach Osten). Funktionell <strong>und</strong> in der Agglomerationsdefini-<br />
tion des B<strong>und</strong>es liegen alle vier Untersuchungsgemeinden innerhalb der Agglomeration; bau-<br />
lich bestehen jedoch Lücken zwischen allen vier Dörfern. Den Namen <strong>Rontal</strong> verdankt die Regi-<br />
on einem kleinen Bach, der Ron, die vom Rotsee nach Nordosten bis Root fliesst <strong>und</strong> dort in die<br />
Reuss mündet.<br />
Abbildung 1 Untersuchungsperimeter im Überblick<br />
Quelle: B<strong>und</strong>esamt für Landestopographie (online)<br />
Die Fläche des Untersuchungsgebietes misst ca. 25,6km 2 . Ende 2009 wohnten r<strong>und</strong> 23‘500<br />
Menschen hier. Im Kantonalen Richtplan von 1998 wurde ein Teil des <strong>Rontal</strong>s (Gemeinden Ebi-<br />
kon <strong>und</strong> Dierikon) als Schwerpunkt für die kantonale Entwicklung von Wohnen <strong>und</strong> Arbeiten<br />
festgelegt (cf. Ecoptima 2003, p.8).<br />
3
<strong>Vorstadt</strong> <strong>Rontal</strong> ____________________________________________________________________________________ Juli 2011<br />
1.2 Verkehrserschliessung<br />
Die Verkehrserschliessung im <strong>Rontal</strong> wird nach Verkehrsträgern analysiert, also getrennt nach<br />
Motorisiertem Individualverkehr (MIV), öffentlichem Verkehr (öV) <strong>und</strong> Langsamverkehr (LV; d.h.<br />
Fuss- <strong>und</strong> Veloverkehr).<br />
1.2.1 Motorisierter Individualverkehr (MIV)<br />
Die Kantonsstrasse 17 (K17) erschliesst das gesamte <strong>Rontal</strong> von der Grenze zur Stadt Luzern bis<br />
zum Autobahnanschluss Root <strong>und</strong> weiter bis zur Kantonsgrenze zu Zug. Sie ist mit einem<br />
durchschnittlichen Tagesverkehr von bis zu 22‘000 Fahrzeugen (Ebikon Dorf) sehr stark be-<br />
lastet. Die K17 wurde in den 1960er-Jahren auf einer Länge von r<strong>und</strong> 3km (Dorfeingang Ebikon<br />
bis Einkaufszentrum MParc) als vierspurige Hauptachse mit zahlreichen Lichtsignalanlagen aus-<br />
gebaut. Bis heute wird die K17 auf der gesamten Länge mit Tempo 60 befahren, was hohe<br />
Lärmemissionen <strong>und</strong> eine sehr starke Trennwirkung innerhalb der Siedlung zur Folge hat.<br />
Im Juni 2011 wurde der Autobahnanschluss Buchrain eröffnet, der über einen unterirdischen<br />
Zubringer das <strong>Rontal</strong> direkt an die A4 Luzern-Zug anschliesst. Der Zubringer wird einen relevan-<br />
ten Anteil des heutigen Verkehrs auf der K65 übernehmen <strong>und</strong> damit die Durchfahrt von Buch-<br />
rain massgeblich entlasten können (Ecoptima 2003, p.51).<br />
Der neue Zubringer endet in der Mitte des <strong>Rontal</strong>s, was in Zukunft zum Verzicht auf viele lange<br />
Quell- <strong>und</strong> Zielfahrten führen wird. Laut Kanton Luzern (2011) <strong>und</strong> der Planung des Entwick-<br />
lungsschwerpunktes (Ecoptima 2003, p.52) ist aber aufgr<strong>und</strong> des besseren Verkehrsangebotes<br />
auch mit einem Mehrverkehr von bis zu 25% zu rechnen. Im Zentrum von Ebikon wird damit die<br />
K17 ihre Kapazitätsgrenze überschreiten, was vermehrte Staubildung zur Folge haben wird.<br />
Weitere Sammelstrassen sind im <strong>Rontal</strong> nur von untergeordneter Bedeutung.<br />
Aus Verkehrsperspektive ist mit dem neuen Autobahnzubringer die Situation für den MIV im<br />
<strong>Rontal</strong> – von langen Wartezeiten an den Lichtsignalanlage abgesehen – akzeptabel. Aus städte-<br />
baulicher Sicht stellt aber die Strassenraumgestaltung ein gewaltiges Hindernis für zukünftige<br />
Entwicklungen dar. Die starke Trennwirkung, die Priorisierung des motorisierten Verkehrs beim<br />
Fahren <strong>und</strong> Parkieren sowie die Dominanz von Lärm <strong>und</strong> Hektik an dieser Hauptachse behin-<br />
dern eine städtebauliche Aufwertung. Für zukünftige bauliche Entwicklungen bedeutet diese<br />
Voraussetzung zudem, dass der private Raum noch konsequenter vom öffentlichen getrennt<br />
werden wird als dies bereits heute der Fall ist (cf. Kategorien Siedlungsinseln in Anhang 2). Einer<br />
Neugestaltung der K17 kommt also höchste Priorität zu.<br />
4
<strong>Vorstadt</strong> <strong>Rontal</strong> ____________________________________________________________________________________ Juli 2011<br />
1.2.2 Öffentlicher Verkehr (ÖV)<br />
Die S-Bahn-Linie S1 führt von Luzern nach Zug <strong>und</strong> erschliesst das <strong>Rontal</strong> mit den Haltestellen<br />
Ebikon, Buchrain, Längenbold <strong>und</strong> Root. Die Haltestellen Buchrain <strong>und</strong> Längenbold wurden im<br />
Dezember 2004 eröffnet <strong>und</strong> haben die S-Bahn zusammen mit der Einführung eines 30‘-Taktes<br />
<strong>und</strong> modernen Zugskompositionen deutlich aufgewertet. Für eine weitere Steigerung der Att-<br />
raktivität <strong>und</strong> das notwendige Kapazitätswachstum zu Spitzenzeiten wäre die Einführung eines<br />
15’-Taktes zwingende Voraussetzung.<br />
Aufgr<strong>und</strong> von Kapazitätsengpässen am Rotsee (einspuriger Abschnitt) <strong>und</strong> bei der Zufahrt zum<br />
Bahnhof Luzern (zwei Gleise für alle wichtigen Zu- <strong>und</strong> Wegfahrten) brauchte es dafür jedoch<br />
einen weiteren Ausbau der Infrastruktur. Das Projekt Tiefbahnhof Luzern würde den Bahnhof<br />
Ebikon in einem ca. 7km langen Tunnel direkt mit dem Bahnhof Luzern verbinden <strong>und</strong> damit<br />
diese Probleme lösen. Allerdings ist aufgr<strong>und</strong> der aktuellen Prioritäten im B<strong>und</strong>esamt für Ver-<br />
kehr (Ausbau Ost-West-Achse) nicht vor 2025 mit einer Umsetzung zu rechnen.<br />
Das Rückgrat des öffentlichen Verkehrs im <strong>Rontal</strong> bleibt deshalb weiterhin der Bus. Die Diesel-<br />
buslinien 22 <strong>und</strong> 23 verbinden die Stadt Luzern mit Gisikon/Root bzw. Inwil <strong>und</strong> Perlen. Von Lu-<br />
zern bis Ebikon Hofmatt ergänzen sie sich in Spitzenzeit ca. zu einem 6‘-Takt. Beide Linien ver-<br />
fügen ab der Grenze zur Stadt Luzern bis zum Schlossberg über keine eigene Busspur, was in<br />
Stosszeiten zu regelmässigen <strong>und</strong> grossen Verspätungen führt.<br />
Die kapazitätsstarke Trolleybuslinie 1 hingegen endet heute im Maihof (Stadt Luzern) <strong>und</strong> da-<br />
mit für das <strong>Rontal</strong> an einer denkbar ungünstigen Stelle. Aus städtebaulicher <strong>und</strong> verkehrstech-<br />
nischer Sicht ist eine Verlängerung bis zum Kreisel beim MParc Ebikon dringend notwendig. Als<br />
erster Ausbauschritt kommt auch eine Verlängerung nur bis zum Bahnhof Ebikon in Frage. Für<br />
das <strong>Rontal</strong> deutlich besser geeignet wäre jedoch eine Trambahn; diese Idee wird in Kapitel 5.2<br />
detaillierter diskutiert.<br />
1.2.3 Fuss- <strong>und</strong> Veloverkehr (Langsamverkehr, LV)<br />
Das Wegnetz für den Langsamverkehr wurde in den vergangenen 10 Jahren schrittweise er-<br />
gänzt <strong>und</strong> aufgewertet, insbesondere entlang der Ron. Trotzdem präsentiert sich die Gesamtsi-<br />
tuation für den Fussverkehr heute unerfreulich. Eine Querung der Hauptstrasse ist für Fussgän-<br />
ger nur nach langem Warten an einem Lichtsignal oder bei Unter- <strong>und</strong> Überführungen möglich,<br />
die Beschriftung ist ungenügend. Möchte ein Ortsk<strong>und</strong>iger beispielsweise in Ebikon vom Bus<br />
auf die Bahn umsteigen, so wird er ohne Hilfe den Bahnhof kaum finden.<br />
5
<strong>Vorstadt</strong> <strong>Rontal</strong> ____________________________________________________________________________________ Juli 2011<br />
Abbildung 2 Die K17 aus der Perspektive eines Velofahrers<br />
Quelle: eigene Aufnahme<br />
Im Velowegnetz bestehen immer noch zahlreiche Lücken an wichtigen Orten. Besonders gra-<br />
vierend ist die Situation für Velofahrer entlang der K17: hier fehlen Velostreifen über weite Stre-<br />
cken. Die Signalisation ist vielerorts schwach, oder sie fehlt ganz. Veloabstellplätze – insbeson-<br />
dere gedeckte – sind im <strong>Rontal</strong> fast nirgends zu finden. Im Fuss- <strong>und</strong> Veloverkehr besteht also<br />
insgesamt grosser Handlungsbedarf.<br />
1.3 Bevölkerung<br />
Ende 2009 leben im <strong>Rontal</strong> r<strong>und</strong> 23‘500 Menschen, also r<strong>und</strong> ein Drittel der Bevölkerung der<br />
Stadt Luzern. Gegenüber 1999 entspricht dies einem Wachstum von 12,7%, was über dem<br />
Durchschnitt des Kantons Luzern <strong>und</strong> der Schweiz liegt. Der Blick in die Vergangenheit zeigt,<br />
dass das <strong>Rontal</strong> insbesondere seit den 1960er-Jahren stark an Bevölkerung gewonnen hat. Auch<br />
in den vergangenen 10 Jahren hat dieses Wachstum angehalten oder sich teilweise sogar noch<br />
beschleunigt: die Bevölkerung in den vier Untersuchungsgemeinden wuchs in dieser Zeit zwi-<br />
schen 7.4% <strong>und</strong> 23.5%.<br />
6
<strong>Vorstadt</strong> <strong>Rontal</strong> ____________________________________________________________________________________ Juli 2011<br />
Tabelle 1 Bevölkerungsentwicklung 1999-2009<br />
EW 2009 Seit 1999 Fläche (km 2 ) Einwohnerdichte<br />
Ebikon 11'850 +7.40% 9.7 1'224<br />
Dierikon 1'442 +9.20% 2.8 519<br />
Buchrain 5'710 +17.90% 4.8 1'190<br />
Root 4'363 +23.50% 8.7 504<br />
<strong>Rontal</strong> 23'365 +12.71% 25.9 902<br />
Stadt Luzern 76'702 +6.10% 37.4 2'051<br />
Kt Luzern 372'853 +8.20% 1493.0 250<br />
Quelle: Lustat, eigene Zusammenstellung aus den Gemeindeporträts 1<br />
Beim Vergleich der Bevölkerungsdichte zeigt sich, dass es sich im <strong>Rontal</strong> um einen Raum han-<br />
delt, der insgesamt zwischen städtischen <strong>und</strong> ländlichen Dichten liegt. Auch innerhalb der vier<br />
Untersuchungsgemeinden sind die Unterschiede gross: Dierikon <strong>und</strong> Root weisen nach wie vor<br />
eine ländliche Dichte auf, Ebikon <strong>und</strong> Buchrain sind mehr als doppelt so dicht besiedelt.<br />
Die Bevölkerung im <strong>Rontal</strong> ist im Vergleich mit der Stadt Luzern relativ jung, insbesondere in<br />
Dierikon <strong>und</strong> Root. Dies deutet darauf hin, dass die Zuwanderung in erster Linie aus Menschen<br />
im jungen <strong>und</strong> mittleren Alter besteht. Gleichzeitig deutet der Geburtenüberschuss (zum Ver-<br />
gleich Stadt Luzern: bedeutender negativer Geburtenüberschuss; Lustat 2010) darauf hin, dass<br />
auch zahlreiche junge Familien im <strong>Rontal</strong> leben. Mit r<strong>und</strong> 20% Ausländeranteil präsentiert sich<br />
das <strong>Rontal</strong> im Schweizer Durchschnitt. Nur Dierikon liegt mit 14,5% deutlich tiefer.<br />
1 Die Gemeindeporträts sind online verfügbar unter http://www.lustat.ch<br />
7
<strong>Vorstadt</strong> <strong>Rontal</strong> ____________________________________________________________________________________ Juli 2011<br />
Abbildung 3 Altersstruktur der Bevölkerung<br />
Kanton LU<br />
Quelle: Lustat, eigene Zusammenstellung aus den Gemeindeporträts<br />
Grob gefasst setzt sich heute die Bevölkerung im <strong>Rontal</strong> aus folgenden drei Gruppen zusam-<br />
men (eigene Einschätzung):<br />
1. Traditionelle, ortsansässige Bevölkerung (Familien, ältere Menschen)<br />
2. Zugezogene Arbeitskräfte der Industrie (Südeuropäische Familien, Männer)<br />
3. Neu zugezogene Pendler (DINKS; YUPPIES)<br />
Die dritte Gruppe hat dabei den Haupteinfluss auf das Wachstum <strong>und</strong> die Verjüngung der Be-<br />
völkerungsstruktur. Tatsächlich pendeln viele neu zugezogene Bewohner aus dem <strong>Rontal</strong> Rich-<br />
tung Zug-Zürich, oder aber in die Kernstadt Luzern (s. Punkt Wirtschaft, unten).<br />
1.4 Wirtschaft<br />
Das <strong>Rontal</strong> ist nicht nur Wohnort, sondern auch Standort vieler Unternehmen. Der 2. Sektor ist<br />
aufgr<strong>und</strong> der starken Position von Schindler <strong>und</strong> seiner Zulieferbetriebe heute vergleichsweise<br />
stark übervertreten, während nur r<strong>und</strong> 50% der Arbeitsplätze auf den 3. Sektor entfallen<br />
(Schweiz: 74,1%).<br />
Stadt LU<br />
<strong>Rontal</strong><br />
Root<br />
Buchrain<br />
Dierikon<br />
Ebikon<br />
0% 20% 40% 60% 80% 100%<br />
8<br />
< 20<br />
20-64<br />
65-79<br />
> 80
<strong>Vorstadt</strong> <strong>Rontal</strong> ____________________________________________________________________________________ Juli 2011<br />
Abbildung 4 Ausprägung der Wirtschaft nach Sektoren<br />
Kanton LU<br />
Stadt LU<br />
<strong>Rontal</strong><br />
Buchrain<br />
Dierikon<br />
Ebikon<br />
Quelle: Lustat, eigene Zusammenstellung aus den Gemeindeporträts<br />
Nur wenige Branchen dominieren den 2. Sektor: Maschinenindustrie, Metallverarbeitung, Fahr-<br />
zeugbau <strong>und</strong> Elektrotechnik. Mehr als die Hälfte der Beschäftigten im Sektor 2 ist in diesen<br />
Branchen tätig. Der Weltkonzern Schindler beschäftigt im <strong>Rontal</strong> r<strong>und</strong> 1'800 Mitarbeiter. Zu-<br />
sammen mit Zulieferern <strong>und</strong> den indirekten Drittleistungen ist Schindler Aufzüge AG damit der<br />
mit Abstand bedeutendste Wirtschaftsfaktor im <strong>Rontal</strong> (Ecoptima 2003, p. 12) 2 .<br />
Auch im 3. Sektor gibt es im <strong>Rontal</strong> ein dominantes Segment mit fast 50% aller Beschäftigten im<br />
Bereich Handel / Reparatur. Dazu gehören folgende Branchen:<br />
• Handel mit Autos <strong>und</strong> Reparatur<br />
• Handelsvermittlung <strong>und</strong> Grosshandel<br />
• Detailhandel <strong>und</strong> Reparatur von Gebrauchsgütern<br />
Diese Branchen sind gleichzeitig wertschöpfungsschwach, flächenintensiv <strong>und</strong> generieren viel<br />
Verkehr (mit hohem Schwerverkehrsanteil).<br />
2 „Laut Auskunft des BFS werden Konzerne sehr differenziert nach effektiven Tätigkeitsgebieten betrachtet, womit<br />
von den 1'800 Schindler-Beschäftigten im <strong>Rontal</strong> statistisch richtigerweise nur ein Teil dem Sektor 2 zugeordnet<br />
wird“ (Ecoptima 2003).<br />
Root<br />
0% 20% 40% 60% 80% 100%<br />
9<br />
1. Sektor<br />
2. Sektor<br />
3. Sektor
<strong>Vorstadt</strong> <strong>Rontal</strong> ____________________________________________________________________________________ Juli 2011<br />
Insgesamt arbeiten heute r<strong>und</strong> 11‘500 Menschen im <strong>Rontal</strong>. Nur sehr wenige wohnen dabei<br />
auch in der Gemeinde, in der sie arbeiten; r<strong>und</strong> 70% pendeln täglich. In der Pendlerstatistik hal-<br />
ten sich die Zu- <strong>und</strong> die Wegpendler ungefähr die Waage. Allerdings sind die Daten zum Pend-<br />
lerverhalten mit Vorsicht zu betrachten, da die aktuell verfügbaren Statistiken aus dem Jahr<br />
2000 stammen. Neuere Daten sind erst mit der Volkszählung 2010 zu erwarten.<br />
Tabelle 2 Beschäftigte <strong>und</strong> Pendler im <strong>Rontal</strong><br />
Beschäftigte Besch/EW Zupendler Wegpendler Zup/Wegp<br />
Ebikon 5'392 0.46 3'568 3'876 0.92<br />
Dierikon 1'607 1.11 1'291 485 2.66<br />
Buchrain 1'424 0.25 841 1'977 0.43<br />
Root 3'100 0.71 1'312 1'218 1.08<br />
<strong>Rontal</strong> 11'523 0.49 7'012 7'556 0.93<br />
Stadt 62'997 0.82 31'704 13'059 2.43<br />
Kanton 196'516 0.53 18'818 21'843 0.86<br />
Quelle: Lustat, eigene Zusammenstellung aus den Gemeindeporträts 3<br />
Die wichtigste Pendlerbewegung aus dem <strong>Rontal</strong> führte im Jahr 2000 in die Stadt Luzern. Aller-<br />
dings ist aufgr<strong>und</strong> von zahlreichen Beobachtungen damit zu rechnen, dass die Pendlerquote<br />
Richtung Zug <strong>und</strong> Zürich seither nochmals deutlich angestiegen ist. Mit dem im Juni 2011 neu<br />
eröffneten Autobahnanschluss Buchrain steigt zudem die Attraktivität des <strong>Rontal</strong>s als Wohnre-<br />
gion fürs Autopendeln nach Zürich nochmals zusätzlich.<br />
3 Die Daten stammen aus der VZ 2000 <strong>und</strong> sind somit mehr als 10 Jahre alt<br />
10
<strong>Vorstadt</strong> <strong>Rontal</strong> ____________________________________________________________________________________ Juli 2011<br />
1.5 Siedlungsästhetik <strong>und</strong> öffentlicher Raum<br />
Der öffentliche Raum präsentiert sich im <strong>Rontal</strong> in weiten Teilen in einem schlechten Zustand.<br />
Er wird durch den überdimensionierten Strassenraum entlang der K17 <strong>und</strong> der K65 dominiert.<br />
Auch die an die Hauptstrassen angrenzenden Gebiete werden zu einem grossen Teil durch den<br />
Verkehr belegt: als Parkier-, Rangier- oder Trennflächen für verschiedene Verkehrsteilnehmer.<br />
Plätze <strong>und</strong> Strassen mit Begegnungsqualitäten finden sich hingegen nur in Teilen der Wohn-<br />
quartiere, auf den Wegen entlang der Ron sowie in bestehenden Dorfkernen abseits der Kan-<br />
tonsstrasse.<br />
Abbildung 5 Hauptstrasse K17: Trennwirkung <strong>und</strong> Flächenverbrauch<br />
Quelle: eigene Aufnahme<br />
Ein weiterer Effekt der überdimensionierten Strasseninfrastruktur ist, dass die angrenzenden<br />
Liegenschaften an Attraktivität verlieren. Entsprechend fehlt mittel- bis langfristig auch die Be-<br />
reitschaft, in diese Immobilien zu investieren. Das Resultat sind Immobilien in einem schlechten<br />
bis sehr schlechten Zustand entlang der Hauptstrasse mit zunehmenden Leerständen. Es ist ei-<br />
ne eigentliche Verslumung festzustellen. Dadurch verlieren die Dorfzentren (insbesondere Ebi-<br />
kon) noch mehr an Attraktivität.<br />
Weiter fehlen im <strong>Rontal</strong> Elemente der Identifikation <strong>und</strong> der Orientierung. Die beiden stärksten<br />
Landmarks (cf. Lynch 2007) des <strong>Rontal</strong>s sind ein Testturm der Firma Schindler <strong>und</strong> die Werbe-<br />
säule eines amerikanischen Hamburgeranbieters in Längenbold bei Root. Auch ein neues<br />
Kunstwerk auf einem Strassenkreisel beim Business Center D4 („Tension-Energy“) kann an der<br />
fehlenden Identitätsstiftung nur wenig ändern. Die Dorfkirche Ebikon, die durchaus Qualitäten<br />
eines Landmarks entwickeln könnte, ist aufgr<strong>und</strong> von Bäumen <strong>und</strong> Gebäuden nur von wenigen<br />
Orten im <strong>Rontal</strong> aus sichtbar.<br />
11
<strong>Vorstadt</strong> <strong>Rontal</strong> ____________________________________________________________________________________ Juli 2011<br />
Neben der Kirche in Ebikon finden sich zahlreiche weitere Relikte mit Potential für Identitätsstif-<br />
tung: Speicher, Kapellen, Bauernhöfe <strong>und</strong> -häuser, sogar ein malerischer Weiler („Halte“). Die In-<br />
tegration in das städtebauliche Ensemble gelingt allerdings nicht (cf. Abbildung 6). Die Relikte<br />
wirken wie ein Gruss aus verstaubter Vergangenheit – eine Verbindung zwischen alt <strong>und</strong> neu<br />
existiert kaum.<br />
Abbildung 6 Kapelle in Ebikon<br />
Quelle: eigene Aufnahme<br />
Die im <strong>Rontal</strong> dominierenden Nutzungen tragen ausserdem wenig zu einer qualitativ hoch ste-<br />
henden Architektur bei. Industrie <strong>und</strong> Gewerbe setzen meist auf kostenbewusste Bauten, eben-<br />
so die Fachmärkte <strong>und</strong> Logistikbetriebe. Angesichts der Entwicklung der vergangenen zehn<br />
Jahre werden sich diese Nutzungen sogar noch verstärken, was die Ästhetik <strong>und</strong> die Mensch-<br />
lichkeit des Massstabs in der Siedlungsgestaltung weiter verschlechtern wird. Schliesslich ist<br />
auch die Heterogenität der Siedlungsstrukturen ein Problem für die Ästhetik. Verschiedene<br />
Massstäbe, Nutzungszwecke, Entstehungszeiträume <strong>und</strong> Architekturstile prallen hier ohne jede<br />
Koordination auf einander. Dies gilt sowohl für Wirtschafts- als auch für Wohngebäude.<br />
12
<strong>Vorstadt</strong> <strong>Rontal</strong> ____________________________________________________________________________________ Juli 2011<br />
Abbildung 7 Fehlende raumplanerische <strong>und</strong> gestalterische Koordination<br />
Quelle: eigene Aufnahme<br />
1.6 Baulandpotentiale<br />
Im <strong>Rontal</strong> waren 2007 r<strong>und</strong> 690ha Bauzonen ausgewiesen, was ungefähr der Hälfte der Stadt<br />
Luzern entspricht (inkl. Littau). Davon waren etwa 210ha bzw. 30% noch nicht überbaut. Hinzu<br />
kommen Potentiale für innere Verdichtungen, z.B. durch Nachverdichtung oder Nutzung von<br />
Brachen, die im <strong>Rontal</strong> zahlreich vorhanden sind. Insgesamt bestehen damit im <strong>Rontal</strong> Bau-<br />
landpotentiale von ungefähr 250ha bzw. 35-40% Wachstumspotential gegenüber heute. Teilt<br />
man die Mischzonen hälftig auf, so sind davon r<strong>und</strong> 60% sind für Arbeiten reserviert, <strong>und</strong> r<strong>und</strong><br />
40% für Wohnen.<br />
13
<strong>Vorstadt</strong> <strong>Rontal</strong> ____________________________________________________________________________________ Juli 2011<br />
Tabelle 3 Baulandpotentiale im <strong>Rontal</strong> (in ha)<br />
BZ (ha) Unüberbaut Inn. Reserven Potentiale total<br />
Ebikon 266.5 46.4 15.8 62.2<br />
Dierikon 50.2 15.3 4.6 19.9<br />
Buchrain 170.1 55.6 10.0 65.6<br />
Root 202.9 93.0 8.6 101.6<br />
<strong>Rontal</strong> 689.7 210.3 38.9 249.2<br />
Stadt Luzern 1297 138.5 63.2 201.7<br />
Quelle: ARE 2007<br />
Dieses gewaltige Wachstumspotential gilt es gezielt zu nutzen. Die Potentiale <strong>und</strong> Grenzen<br />
neuer Nutzungen messen sich nicht am Flächenangebot, sondern an der Verkehrserschliessung<br />
<strong>und</strong> der Umweltschutzgesetzgebung (Ecoptima 2003). Umso wichtiger ist es deshalb, dass auf<br />
den neuen bzw. wiederverwerteten Flächen die „richtigen Nutzungen“ realisiert werden.<br />
1.7 Fazit: <strong>Städtebauliche</strong> Defizite im <strong>Rontal</strong><br />
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass das <strong>Rontal</strong> im Jahr 2011 ein Raum ist, dem es weit-<br />
gehend an Identität <strong>und</strong> an städtebaulicher Qualität fehlt. Die Entwicklung der vergangenen 50<br />
Jahre muss mindestens kritisch beurteilt werden. Das <strong>Rontal</strong> hat Qualitäten verloren, die Dörfer<br />
haben sich zu identitätsarmen Vorstädten gewandelt. Die quantitativ ausgerichtete Wachs-<br />
tumspolitik des Kantons für den <strong>Entwicklungs</strong>schwerpunkt <strong>Rontal</strong> lässt für die Zukunft keine<br />
Trendwende erwarten.<br />
Die heute sichtbaren Resultate einer städtebaulichen Abwertung lassen sich auf drei haupt-<br />
sächliche Faktoren zurückführen: 1. Priorität für den motorisierten Individualverkehr, 2. Flächen-<br />
intensive Entwicklung, 3. Fehlende Qualitäten in der Siedlungsästhetik <strong>und</strong> im öffentlichen<br />
Raum. Diese drei Faktoren beeinflussen sich auch gegenseitig <strong>und</strong> ergeben so eine Entwick-<br />
lungsdynamik, die sich selber weiter antreibt.<br />
14
<strong>Vorstadt</strong> <strong>Rontal</strong> ____________________________________________________________________________________ Juli 2011<br />
1. Priorität für den motorisierten Individualverkehr<br />
Die einsetzende Massenmotorisierung bewog den Kanton Luzern Mitte der 1950er-Jahre – also<br />
vor Beginn der Nationalstrassenplanung – zu einem grosszügigen Ausbau der Hauptverbin-<br />
dungsachse Luzern-Zürich. Die Ausrichtung der Infrastruktur auf eine reibungslose Steuerung<br />
des Individualverkehrs verlangte nach getrennten Fahr- <strong>und</strong> Abbiegestreifen, überdimensio-<br />
nierten Kreuzungen mit zahlreichen Lichtsignalanlagen (die Ebikon im Volksm<strong>und</strong> den Namen<br />
„Amplikon“ eingetragen haben), grossen Schildern, hohen Tempi (Tempo 60!) sowie starker<br />
räumlicher Trennung zu ruhendem <strong>und</strong> langsamerem Verkehr. Das Resultat ist eine suburbane<br />
Landschaft, die weitgehend von der Ausrichtung auf das Automobil geprägt ist <strong>und</strong> in ihrem<br />
Zentrum einen tiefen Einschnitt in Raum <strong>und</strong> Identität trägt.<br />
Abbildung 8 Ausrichtung eines Lebensraumes auf das Auto<br />
Quelle: eigene Aufnahme<br />
Die Priorität für den motorisierten Individualverkehr hat aber nicht nur einen direkten Einfluss<br />
auf den Lebensraum <strong>und</strong> den Lebensstil der Bevölkerung. Eine grosszügig gestaltete Verkehrs-<br />
infrastruktur zieht zusammen mit der guten Erreichbarkeit auch neue Nutzungen an, die in ihrer<br />
Funktionslogik auf dem Strassenverkehr basieren. Im <strong>Rontal</strong> wird dies sichtbar anhand der zahl-<br />
reichen Fachmärkte, Freizeiteinrichtungen <strong>und</strong> Logistikbetriebe <strong>und</strong> Drive-In-Restaurants. Auch<br />
15
<strong>Vorstadt</strong> <strong>Rontal</strong> ____________________________________________________________________________________ Juli 2011<br />
Gewerbe- <strong>und</strong> Dienstleistungsbetriebe folgen in ihrer räumlichen Verteilung nicht der Logik der<br />
Dichte bzw. Erreichbarkeit mit dem ÖV, dem Velo oder zu Fuss, sondern der automobilen Er-<br />
reichbarkeit. Diese auf dem Auto basierende räumliche Planung <strong>und</strong> Entwicklung zeigt weit rei-<br />
chende Parallelen mit der Raumentwicklung in Nordamerika.<br />
2. Flächenintensive Entwicklung<br />
Die im <strong>Rontal</strong> ansässigen Gewerbe- <strong>und</strong> Industriebetriebe zeichnen sich insgesamt durch eine<br />
tiefe Wertschöpfung <strong>und</strong> einen hohen Flächenverbrauch aus. Dies gilt sowohl für Unternehmen<br />
mit einer langen Geschichte (z.B. Schindler AG) als auch für neu gegründete oder zugezogene<br />
Unternehmen (z.B. DHL). Diese Nutzungen werden einerseits durch die vorhandene Infrastruk-<br />
tur <strong>und</strong> die bestehenden Nutzungen angezogen; andererseits prägen sie selber wiederum den<br />
Raum <strong>und</strong> schaffen damit die Voraussetzung für weitere flächenintensive Nutzungen. Denn:<br />
inmitten von gut mit dem Auto erreichbaren Fachmärkten, Gewerbezentren <strong>und</strong> Industriebe-<br />
trieben werden sich keine Dienstleistungsbetriebe oder Wohnnutzungen ansiedeln, die andere<br />
Mobilitätsformen suchen oder schaffen würden.<br />
Abbildung 9 Amerikanische Verhältnisse in Verkehr <strong>und</strong> Gastronomienangebot<br />
Quelle: eigene Aufnahme<br />
16
<strong>Vorstadt</strong> <strong>Rontal</strong> ____________________________________________________________________________________ Juli 2011<br />
Aus raumplanerischer Perspektive fehlt es dem <strong>Rontal</strong> also an Dichte bzw. an Nutzungen, die<br />
Dichte produzieren. Die räumliche Entwicklung einer solchen Siedlungsstruktur muss also<br />
zwangsläufig nach aussen verlaufen – ein Trend, den auch die Raumplanung im <strong>Rontal</strong> nicht<br />
bremsen konnte. Ein grosser Teil der Hanglagen wurde in den letzten Jahrzehnten für Wohn-<br />
nutzungen bebaut, <strong>und</strong> freie Flächen im Talboden sowohl für Arbeiten als auch für Wohnen<br />
genutzt – trotz bestehender Brachen. Entsprechend präsentiert sich das <strong>Rontal</strong> heute stark zer-<br />
siedelt. Auch hier lässt sich eine Parallele zu Nordamerika ziehen: Zersiedlung als Resultat einer<br />
liberalen Raumentwicklungspolitik bzw. als Konzession an die wirtschaftliche Entwicklung <strong>und</strong><br />
das Leben im suburbanen Eigenheim.<br />
3. Qualität in der Siedlungsästhetik <strong>und</strong> im öffentlichen Raum, Identifikationspunkte<br />
Dierikon, Buchrain <strong>und</strong> Root verfügen zwar über relativ intakte Dorfkerne abseits der Hauptver-<br />
kehrsachsen, derjenige von Buchrain ist auch relativ stark belebt. Einige neuere Wohnsiedlun-<br />
gen dürfen als Inseln von höherer Qualität eingestuft werden. Die meisten weiteren Siedlungs-<br />
teile im <strong>Rontal</strong> weisen jedoch eine geringe städtebauliche Qualität aus <strong>und</strong> sind geprägt von<br />
einer pragmatischen bis billigen Architektur <strong>und</strong> einer fehlenden raumordnenden Struktur.<br />
Abbildung 10 Zentraler Platz in Ebikon – zwischen Kirche, Hofmatt <strong>und</strong> Bahnhof<br />
Quelle: eigene Aufnahme<br />
Die räumliche Organisation der Siedlung wirkt vielerorts zufällig. Schlüsselstellen wie zentrale<br />
Plätze oder der Zugang zu Bahnhöfen werden durch den Strassenverkehr besetzt. Es fehlen<br />
Sichtbeziehungen zu Identifikationspunkten wie Kirchen, Bahnhöfen, Denkmälern, oder weite-<br />
ren wichtigen Gebäuden. Der öffentliche Raum präsentiert sich weitgehend ohne Konzept <strong>und</strong><br />
ohne erkennbare Struktur. Orientierung <strong>und</strong> Identifikation sind in einer solchen Siedlung aus-<br />
serhalb des beschilderten Strassenraums schwierig.<br />
17
<strong>Vorstadt</strong> <strong>Rontal</strong> ____________________________________________________________________________________ Juli 2011<br />
Heute finden sich flächenintensive <strong>und</strong> gesichtslose städtebauliche Entwicklungen in allen<br />
westeuropäischen Ländern. In der Schweiz lässt sich eine Überprägung von suburbanen Dör-<br />
fern wie im <strong>Rontal</strong> an den Rändern der meisten grösseren Agglomerationen beobachten. Als<br />
Beispiele seien hier nur das Limmattal, das Glatttal, das Gebiet um Pratteln, die <strong>Vorstadt</strong> von<br />
Fribourg <strong>und</strong> der Westen Lausannes genannt.<br />
Die konsequente Ausrichtung einer Lebenswelt auf das Automobil ist allerdings nicht das Re-<br />
sultat einer Planung, sondern vielmehr einer fehlenden bzw. schwachen Planung bzw. einem li-<br />
beralen laissez-faire. Die Raumplanung war im <strong>Rontal</strong> unfähig, die Entwicklung von verkehrsin-<br />
tensiven Einrichtungen, flächenintensivem Wachstum <strong>und</strong> einer Abwertung des öffentlichen<br />
Raumes wirksam zu beeinflussen.<br />
Es gibt durchaus Vorstädte, in denen eine stark belastete Durchgangsstrasse umgestaltet <strong>und</strong><br />
damit die Dorfkerne stark aufgewertet wurden, so z.B. Horw (bei Luzern), Wabern <strong>und</strong> Köniz<br />
(beide bei Bern). Sie gehen alle auf erfolgreiche Initiativen der lokalen Behörden zurück <strong>und</strong> bil-<br />
den damit nur die Ausnahme zur Regel, dass auf der lokalen Ebene der politische Wille <strong>und</strong> die<br />
notwendigen Mittel für eine städtebauliche Aufwertung fehlen. Nur die übergeordnete Ebene,<br />
insbesondere die Agglomerationspolitik des B<strong>und</strong>es, können hier relevante Beiträge im grösse-<br />
ren Massstab leisten.<br />
18
<strong>Vorstadt</strong> <strong>Rontal</strong> ____________________________________________________________________________________ Juli 2011<br />
2 Die <strong>Vorstadt</strong> im wissenschaftlichen Diskurs<br />
Zunächst werden hier zwei Begriffe geklärt, um eine für diese Arbeit nicht relevante Diskussion<br />
um Benennungen der <strong>Vorstadt</strong> <strong>und</strong> deren Abgrenzung vorweg zu nehmen. Mit dem Begriff<br />
„<strong>Vorstadt</strong>“ ist in dieser Arbeit das suburbane Gebiet gemeint, das zwar ausserhalb der Kern-<br />
stadt, aber innerhalb der Agglomeration liegt. Für die Abgrenzung der Agglomeration wird auf<br />
die Definition des B<strong>und</strong>es zurück gegriffen, die im Rahmen der Volkszählung entstanden ist.<br />
Agglomerationen haben gemäss dieser Definition mindestens 20‘000 Einwohner, eine Kern-<br />
stadt, 2000 Arbeitsplätze <strong>und</strong> 85 Arbeitsplätze pro 100 Einwohner. Ausserdem sind sie baulich<br />
mit dem Zentrum verb<strong>und</strong>en oder sie entsenden mindestens 1/6 ihrer Personen zum Arbeiten<br />
in die Kernstadt. Hinzu kommen noch detailliertere Kriterien. Diese Definition der Agglomerati-<br />
onen wurde für Agglomerationsprogramme des B<strong>und</strong>es verwendet <strong>und</strong> ist damit auch politisch<br />
beeinflusst. Unter Experten ist sie nicht unumstritten.<br />
Dieses Kapitel zur wissenschaftlichen Diskussion der <strong>Vorstadt</strong> wurde weitgehend unverändert<br />
aus Sonderegger (2010) übernommen.<br />
2.1 Lebhafte Diskussion in den 1990er-Jahren<br />
Erste Publikationen zu den Vorstädten gehen zwar bis in die 1920er-Jahre zurück, <strong>und</strong> auch in<br />
den Folgejahrzehnten gibt es einzelne Überlegungen zur Entwicklung ausserhalb der Kernstäd-<br />
te. Die städtebauliche Diskussion bleibt jedoch auf die Kernstädte konzentriert. Erst mit dem<br />
Einsetzen der Globalisierung <strong>und</strong> ihrer Konsequenzen für die räumliche Organisation der Wirt-<br />
schaft gelangt die <strong>Vorstadt</strong> erstmals in den Fokus grösserer Untersuchungen. Thomas Sieverts<br />
identifiziert 1997 in seinem wegweisenden Buch „Zwischenstadt“ die folgenden drei Vorausset-<br />
zungen für die aktuellen Prozesse in der <strong>Vorstadt</strong>, wobei er sich primär auf metropolitan ge-<br />
prägte Räume bezieht (Sieverts 2007, p. 8).<br />
1. Die weltweite Arbeitsteilung der Wirtschaft <strong>und</strong> die damit veränderte Stellung der<br />
Stadt im weltwirtschaftlichen Gefüge.<br />
2. Die Auflösung der kulturellen Bindekräfte der Stadt <strong>und</strong> die damit verb<strong>und</strong>ene radikale<br />
kulturelle Pluralisierung der Stadtkultur.<br />
3. Die inzwischen fast vollständige Durchdringung der Natur durch Menschenwerk <strong>und</strong><br />
der sich damit auflösende Gegensatz zwischen Stadt <strong>und</strong> Natur.<br />
Diese Voraussetzungen sieht Sieverts als gegeben an, d.h. sie lassen sich durch die Planung<br />
nicht beeinflussen. Eine städtebauliche oder stadtsoziologische <strong>Analyse</strong> sollte demnach auf<br />
diesen Voraussetzungen aufbauen <strong>und</strong> sie nicht mit deren Konsequenzen vermischen.<br />
19
<strong>Vorstadt</strong> <strong>Rontal</strong> ____________________________________________________________________________________ Juli 2011<br />
Gleichzeitig oder noch vor Sieverts haben sich in den 1990er-Jahren auch zahlreiche amerikani-<br />
sche Wissenschaftler mit dem Phänomen der Suburbanisierung beschäftigt. Die Vielfalt an Beg-<br />
riffen, die in dieser Zeit geprägt wurden, spiegelt das breite Interesse am Thema wider. Edward<br />
Soja interpretiert in seinem Buch Postmetropolis beispielsweise die nach aussen gestülpte Stadt<br />
mit riesiger Ausbreitung als Exopolis (Soja 2000). Joël Garreau fokussiert seine Untersuchungen<br />
auf den Stadtrand (Edge City; Garreau 1991) <strong>und</strong> Allen J. Scott untersucht die räumlichen Struk-<br />
turen des Hightech-Clusters im Orange County <strong>und</strong> benennt die High-Tech-Region im Orange<br />
County (Kalifornien) Technopolis (Scott 1998).<br />
Interessanterweise haben sich diese amerikanischen Stadtsoziologen <strong>und</strong> Stadtgeographen<br />
(inklusive Michael Storper <strong>und</strong> Mike Davis) nach der Jahrtausendwende jedoch vermehrt The-<br />
men der globalisierten Wirtschaft in Städten gewidmet <strong>und</strong> zu suburbanen Räumen nur noch<br />
wenig publiziert – die Diskussion ist hier gewissermassen abgebrochen.<br />
2.2 Verschiebung in den deutschsprachigen Raum<br />
In der Schweiz hat sich die Raumentwicklungsdebatte im vergangenen Jahrzehnt ebenfalls<br />
vermehrt des Themas angenommen. Die Autoren um Angelus Eisinger stellten in „Stadtland<br />
Schweiz“ (2003) fest, dass die räumliche Entwicklung (<strong>und</strong> insbesondere die Zersiedlung) in der<br />
Schweiz entscheidend durch die föderalistischen Strukturen beeinflusst wurde. Diese kommen<br />
jedoch mit dem Wachstum <strong>und</strong> der zunehmenden Vernetzung der Städte zunehmend an ihre<br />
Grenzen. Einen möglichen Ansatz sehen Eisinger et al. in einem stärkeren Denken <strong>und</strong> Handeln<br />
in Regionen.<br />
Auch Herzog et al. (2005) kommen in ihren <strong>Analyse</strong>n zum Schluss, dass die Entwicklung in der<br />
Schweiz in den wachsenden urbanen Gebieten liegt, denen auch sie den Charakter von Regio-<br />
nen bzw. Netzwerken zusprechen. Auch der B<strong>und</strong> war in seinen <strong>Analyse</strong>n zu dieser Einschät-<br />
zung gelangt. Mit der Einführung der Agglomerationspolitik (2004) reagierte er auf diese Be-<br />
f<strong>und</strong>e <strong>und</strong> setzte erstmals ein Programm auf, das strikte auf den (funktionalen) Lebensraum der<br />
Menschen statt auf die politischen Körperschaften ausgerichtet ist.<br />
Während die genannten Publikationen sich vor allem auf die <strong>Analyse</strong> der Geschichte sowie der<br />
aktuellen Zustände <strong>und</strong> Prozesse konzentrieren, gibt es gerade im Städtebau auch den An-<br />
spruch, eine konkrete Vorstellung zur Aufwertung zu entwickeln. Allerdings bestehen hier keine<br />
gemeinsamen Vorstellungen zu einer wünschenswerten Stossrichtung; im Gegenteil. Zur De-<br />
batte der Architekten über die wünschenswerte Entwicklung der <strong>Vorstadt</strong> hält Lukas Küng in<br />
einem Essay (Küng 2009) fest, dass zum Thema <strong>Vorstadt</strong> zwei Positionen einander scheinbar<br />
unversöhnlich gegenüber stehen. Die einen Vertreter hängen an den historischen Kernstädten<br />
Europas <strong>und</strong> propagieren die Stadt der kurzen Wege bzw. der hohen Dichte.<br />
20
<strong>Vorstadt</strong> <strong>Rontal</strong> ____________________________________________________________________________________ Juli 2011<br />
Auf der anderen Seite stehen die Vertreter der Ansicht, dass die <strong>Vorstadt</strong> einfach die räumliche<br />
Abbildung des heutigen Lebensstils ist. Hochmobile Menschen, die nicht mehr auf die räumli-<br />
che Nähe zu Arbeitsplatz <strong>und</strong> Einkaufsmöglichkeiten angewiesen sind, würden sich auch nicht<br />
mehr in das historisch überholte Modell der dichten Stadt zwängen lassen. Küng bemängelt das<br />
Beharren auf diesen einander gegenüberstehenden Positionen <strong>und</strong> plädiert dafür, dass die Ar-<br />
chitekten wieder beginnen, städtebauliche Visionen zu entwickeln. (Küng 2009, p.14).<br />
Einen solchen Brückenschlag von der <strong>Analyse</strong> zum Städtebau leistet der Beitrag der Autoren<br />
um ETH-Professor Vittorio Magnano Lampugnani. In ihrem Handbuch zum Stadtrand werfen sie<br />
zunächst einen umfassenden Rückblick auf die Debatte seit dem Beginn des 20. Jahrh<strong>und</strong>erts<br />
<strong>und</strong> erarbeiten darauf basierend die Merkmale <strong>und</strong> Lücken der Debatte bis heute. Sie kommen<br />
dabei zum Schluss, dass es „für den suburbanen Raum bisher an einer spezifischen städtebauli-<br />
chen Terminologie, auf die für die Entwicklung von städtebaulichen Strategien zurückgegriffen<br />
werden kann“ (Lampugnani et al., p. 51) mangelt. Einen entsprechenden Vorschlag für die Ter-<br />
minologie präsentieren Lampugnani et al. anschliessend – dieser wird im Anhang der vorlie-<br />
genden Arbeit für die morphologische Detailanalyse verwendet.<br />
Die Arbeiten von Lampugnani et al. basieren auf einem mehrjährigen disziplinären For-<br />
schungsprojekt, das bis 2007 im Netzwerk Stadt <strong>und</strong> Landschaft an der ETH Zürich durchge-<br />
führt wurde. Zwar beschränkt sich ihr Wirkungsradius „auf die morphologischen <strong>und</strong> typologi-<br />
schen Eigenschaften des suburbanen Raums“ <strong>und</strong> vernachlässigt politische, ökonomische <strong>und</strong><br />
gesellschaftliche Rahmenbedingungen weitgehend (Lampugnani et al. 2007, p.15). Eine we-<br />
sentliche Stärke liegt jedoch in der Verbindung von Theorie <strong>und</strong> Empirie, die sorgfältig herge-<br />
stellt wird sowie in der solide begründeten Verwendung der Analogie als Methode (ebenda,<br />
p.55). Insbesondere zeichnet sich das Werk dadurch aus, dass es gleichzeitig <strong>Analyse</strong>methoden<br />
<strong>und</strong> Strategien zur Aufwertung des suburbanen Raumes unterbreitet. Diese Strategien werden<br />
in Kapitel 2.3 dieser Arbeit vorgestellt <strong>und</strong> in Kapitel 6.5 auch auf das <strong>Rontal</strong> angewendet.<br />
Damit lässt sich um die Jahrtausendwende eine Verschiebung der Diskussion in den deutsch-<br />
sprachigen Raum feststellen. Dies wurde auch durch die Ausrichtung einer neueren Ausgabe<br />
der DISP (NSL 2010) bestätigt. Sie widmet sich umfassend dem Thema Peripherie der Städte<br />
<strong>und</strong> Metropolen <strong>und</strong> umfasst in erster Linie Beiträge deutschsprachiger Autoren.<br />
Im Vergleich zur Fachdiskussion über Stadtgestaltung <strong>und</strong> Stadtentwicklung in der Kernstadt<br />
hat die <strong>Vorstadt</strong> bisher deutlich weniger Aufmerksamkeit enthalten. Dennoch lässt sich in den<br />
vergangenen 20 Jahren eine wieder erwachte Auseinandersetzung mit dem Thema feststellen.<br />
Die von Lampugnani et al. entworfene <strong>Analyse</strong>methode wurde in Sonderegger (2010) einge-<br />
setzt. Für die vorliegende MAS Thesis wurde nur wenig Bezug auf die vorhandene Literatur ge-<br />
nommen; mit der Übertragung der räumlichen Szenarien (ARE 2005) von der Gesamtschweiz<br />
auf das <strong>Rontal</strong> wurde vielmehr eine eigene Methodik gewählt. Die wiedererwachte Fachdiskus-<br />
sion lässt jedoch hoffen, dass in den kommenden Jahrzehnten die <strong>Vorstadt</strong> vermehrt zum Ge-<br />
genstand der Raumforschung <strong>und</strong> Raumplanung wird.<br />
21
<strong>Vorstadt</strong> <strong>Rontal</strong> ____________________________________________________________________________________ Juli 2011<br />
2.3 Strategie zur städtebaulichen Aufwertung<br />
In der wissenschaftlichen <strong>und</strong> planerischen Diskussion zur <strong>Vorstadt</strong> finden sich zahlreiche Ana-<br />
lysen; dezidierte Vorschläge zum Umgang mit diesem (städtebaulich) schwierigen Raum hinge-<br />
gen sind eher selten. Die Frage, wie eine gute <strong>Vorstadt</strong> zu bauen sei, bleibt in der Literatur also<br />
weitgehend unbeantwortet. Die Autoren um Lampugnani schlagen fünf Strategien vor (pp. 90-<br />
99; nachfolgend als „Teilstrategien“ bezeichnet), die basierend auf ihrer <strong>Analyse</strong>methode (vgl.<br />
Kapitel 2.2 oben) entwickelt wurden. Sie werden hier zunächst vorgestellt; in Kapitel 6 dieser<br />
Arbeit werden sie eingesetzt, um eine städtebauliche Strategie für das <strong>Rontal</strong> zu formulieren.<br />
Die folgenden Ausführungen orientieren sich eng am Originaltext von Lampugnani et al.<br />
2.3.1 Stärkung des öffentlichen Raums<br />
Zum öffentlichen Raum zählen neben Strassen, Plätzen <strong>und</strong> landschaftlichen Freiräumen auch<br />
öffentliche Gebäude. Hier sind Kommunikation, Aneignung <strong>und</strong> soziale Interaktion zwischen al-<br />
len Menschen möglich. Weitere wichtige Funktionen des öffentlichen Raums umfassen Er-<br />
schliessung, Orientierung, Aufenthalt <strong>und</strong> Generierung symbolischer Bedeutungen.<br />
Eine Stärkung des öffentlichen Raums braucht zunächst die Begrenzung einer unbebauten Flä-<br />
che. Die umgebenden Gebäude sollen in eine visuelle Beziehung zu einander treten. Ausser-<br />
dem gehört zu einem attraktiven öffentlichen Raum eine funktionale Bedeutung (Marktplatz,<br />
Festplatz etc.) oder eine Symbolkraft, die z.B. durch angrenzende Gebäude geschaffen wird<br />
(Kirchplatz, Rathausplatz). Ein öffentlicher Raum ist also dann attraktiv, wenn er die ihm zuge-<br />
dachten Funktionen gut erfüllt <strong>und</strong> die Menschen ihn intensiv nutzen.<br />
2.3.2 Schaffung von Kohärenz<br />
Zur Schaffung von Kohärenz können morphologische oder typologische Mittel eingesetzt wer-<br />
den. Morphologie bezieht sich auf die Form von städtebaulichen Elementen <strong>und</strong> ihre Bezie-<br />
hung zu einander. Morphologische Kohärenz kann erreicht werden durch „die Verwendung<br />
ähnlicher Formen, Stilmittel [oder] Materialien.“ Beispiele für morphologische Kohärenz sind<br />
das Kopfsteinpflaster einer Altstadt oder typische Fassadenelemente (beispielsweise schmied-<br />
eiserne Balkongeländer) in einem Jugendstilquartier.<br />
Typologische Kohärenz hingegen „entsteht durch die Variation eines Typus“, wobei ein Typus<br />
„eine elementare stadträumliche Gr<strong>und</strong>idee [beinhaltet], die nicht weiter reduziert werden<br />
kann. Der Typus bleibt trotz aller gestalterischer Vielfalt <strong>und</strong> Variation immer als konstantes<br />
Gr<strong>und</strong>prinzip erkennbar.“ Typologische Beispiele sind die Anordnung der Gebäude in einer<br />
Blockrandbebauung oder die Verwendung eines bestimmten Gebäudetyps innerhalb einer ge-<br />
schlossenen Siedlung, z.B. mit einer farblichen Variation der Fassade.<br />
22
<strong>Vorstadt</strong> <strong>Rontal</strong> ____________________________________________________________________________________ Juli 2011<br />
Ein weiteres Mittel zur Schaffung von Kohärenz ist Komplementarität, also „das Zusammentref-<br />
fen scheinbar widersprüchlicher Elemente bzw. Eigenschaften von Elementen im Stadtraum.“<br />
Zu einander komplementäre Räume sind z.B. öffentlicher <strong>und</strong> privater Raum, Innen- <strong>und</strong> Aus-<br />
senraum oder bebauter <strong>und</strong> unbebauter Raum. Eine Komplementarität kann dann Kohärenz<br />
schaffen, wenn „das Gegensatzpaar ein spannungsreiches Wechselspiel der Elemente erzeugt“.<br />
2.3.3 Vernetzung<br />
Das Ziel einer Vernetzungsstrategie ist es, „ein Zusammenwirken bislang isolierter Eigenschaf-<br />
ten <strong>und</strong> Potentiale von Objekten, Orten, Gebieten oder Akteuren“ zu erreichen. Damit können<br />
„die Zusammenhänge im Stadtraum erfahrbar gemacht <strong>und</strong> Sinnbezüge zwischen den einzel-<br />
nen Elementen hergestellt werden. Die Strategie der Vernetzung kann durch räumliche, funkti-<br />
onale <strong>und</strong> infrastrukturelle Gestaltungsmassnahmen umgesetzt werden.“ Objekte, Grenzen <strong>und</strong><br />
Gr<strong>und</strong>flächen werden dann als zusammengehörend wahrgenommen, wenn sie „optisch ähn-<br />
lich gestaltet sind“. Dies kann durch „Oberflächen, Bautypologien, Materialien, Formen, Nut-<br />
zungen, Farbe“ geschehen.<br />
Eine funktionale Vernetzung entsteht, wenn „Infrastruktur-, Versorgungs-, Freizeit- oder Dienst-<br />
leistungseinrichtungen“ so im Raum organisiert werden, dass sie sich gegenseitig ergänzen <strong>und</strong><br />
von überall ähnlich gut erreichbar sind. Infrastrukturell Vernetzung bedeutet, dass „Gebäude,<br />
Orte <strong>und</strong> Funktionen im Stadtraum durch Verkehrswege (Strassen, Fusswege, Gleis- <strong>und</strong> Was-<br />
serstrassen)“ mit einander verknüpft werden. Dadurch werden „Zugänglichkeit, Erreichbarkeit<br />
<strong>und</strong> Funktionsfähigkeit sowie die Voraussetzungen für soziale Interaktionen <strong>und</strong> eine zusam-<br />
menhängend wahrnehmbare Erlebbarkeit <strong>und</strong> Orientierung im Stadtraum geschaffen“.<br />
2.3.4 Verdeutlichung von Grenzen<br />
Die städtebauliche Bedeutung von Grenzen liegt darin, dass sie verschieden charakterisierte<br />
Teilräume voneinander trennen. Diese scheinbar triviale Aufgabe ist deshalb wichtig, weil da-<br />
durch „die Stadtstruktur in überschaubare Einheiten gegliedert [wird] <strong>und</strong> der Eindruck eines<br />
„Innen“ <strong>und</strong> „Aussen“ entsteht“. Grenzen können punktuell, linear oder als Rand verdeutlicht<br />
werden. „Eine punktuelle Verdeutlichung […] ist möglich, wenn ein Kreuzungspunkt aus Ver-<br />
kehrsweg <strong>und</strong> Trennlinie existiert“. Eine solche räumliche Situation wird als Eingang bezeichnet<br />
<strong>und</strong> findet sich beispielsweise an der Kreuzung von Ortsrand <strong>und</strong> Durchgangsstrasse. Dieser<br />
Schnittpunkt kann beispielsweise mit einem Tor oder einem Turm speziell markiert werden.<br />
Eine lineare Verdeutlichung einer Grenze wäre beispielsweise eine Allee oder ein Graben, der<br />
zwei Quartiere trennt. Eine solche Massnahme muss jedoch sorgfältig geprüft werden, weil ne-<br />
ben der linearen Verdeutlichung einer Grenze immer auch eine Zerschneidungswirkung geför-<br />
dert wird. Ein Rand hingegen entsteht, „wenn die Massnahmen flächig sind“. Er beinhaltet „Ei-<br />
genschaften beider Bereiche“. Dadurch kann ein Rand auch auf mehrere Arten gelesen werden.<br />
23
<strong>Vorstadt</strong> <strong>Rontal</strong> ____________________________________________________________________________________ Juli 2011<br />
2.3.5 Schaffung von Identifikationsorten<br />
Die Identifikationsorte ermöglichen die Orientierung im Raum <strong>und</strong> die Entwicklung eines Zu-<br />
sammengehörigkeitsgefühls. Für die Entwicklung solcher Orte bildet die Schaffung von Zei-<br />
chen eine mögliche Strategie. Zeichen sind dabei natürliche oder gebaute Objekte, die sich von<br />
ihrer stadträumlichen Umgebung deutlich abheben <strong>und</strong> sich durch ihre Einzigartigkeit aus-<br />
zeichnen. Wichtig ist für ein Zeichen, dass es eine Bedeutung enthält, die über die morphologi-<br />
sche <strong>und</strong> funktionelle Dimension hinausgeht. Erst indem einem Zeichen eine solche Bedeutung<br />
zugeordnet werden kann, entsteht eine Identifikation. Beispiele für Zeichen, die einen Identifi-<br />
kationsort konstituieren können, sind Kirchen, Krankenhäuser, Burgen oder moderne Türme.<br />
Zwei Bedingungen müssen immer erfüllt sein, damit ein Identifikationsort entstehen kann: Kon-<br />
trast <strong>und</strong> Sichtbarkeit. Der Kontrast kann „durch morphologische <strong>und</strong> typologische Unterschie-<br />
de sowie Massstabsbrüche in der Gestaltung erreicht“ <strong>und</strong> durch eine für die Umgebung atypi-<br />
sche Nutzung verstärkt werden. Die Sichtbarkeit ist dann gegeben, wenn Zeichen „einzeln ste-<br />
hen <strong>und</strong> räumlich vom Kontext isoliert sind. […] Weiterhin trägt eine besondere Lage an stadt-<br />
strukturellen Schnittstellen oder topografischen Erhebungen zur Erkennbarkeit bei.“<br />
24
<strong>Vorstadt</strong> <strong>Rontal</strong> ____________________________________________________________________________________ Juli 2011<br />
3 Die Agglomeration Luzern im städtebaulichen Kontext<br />
3.1 <strong>Städtebauliche</strong> Entwicklung<br />
Die Zentralschweiz präsentiert sich heute aus städtebaulicher Sicht sehr heterogen. Die Post-<br />
kartenbilder von Luzern, Pilatus <strong>und</strong> Rigi, die von Touristen begeistert nach Hause geschickt<br />
werden, haben mit dem Lebensraum der Zentralschweizer Bevölkerung nur wenig zu tun. Wäh-<br />
rend die Stadt Luzern insbesondere im Zentrum ihren attraktiven Charakter seit Jahrzehnten<br />
halten konnte, haben die meisten Vorstädte seit dem Zweiten Weltkrieg an Lebensqualität ver-<br />
loren. Die Zentralschweiz hat dabei eine ähnliche Entwicklung erfahren wie andere urbane Re-<br />
gionen in der Schweiz.<br />
Im Mittelalter bestand die Stadt Luzern einzig aus der Altstadt; das linke Seeufer wurde auf-<br />
gr<strong>und</strong> seines sumpfigen Charakters überhaupt nicht genutzt. Weitere Siedlungen bestanden als<br />
Dörfer (z.B. Littau, Kriens, Ebikon) oder als Städte (Zug, Schwyz, Sarnen, Stans).<br />
Ab 1850 brachte die Industrialisierung eine tiefgreifende Veränderung insbesondere der nördli-<br />
chen Vorstädte <strong>und</strong> von Kriens mit sich. Die meisten grossen Industrieanlagen in den Agglome-<br />
rationsgemeinden (Viscose, Giesserei, Stahlwerk (alle Emmenbrücke), Maschinenfabrik Bell in<br />
Kriens) wurden zwischen 1850 <strong>und</strong> 1910 errichtet. Ausserdem stammen alle Hauptachsen der<br />
Eisenbahn (Richtungen Bern, Basel, Zürich, Küssnacht, sowie die heutige Zentralbahn nach<br />
Stans/Sarnen) aus dieser Zeit. Das linke Seeufer der Stadt Luzern wurde für die Erstellung des<br />
ersten Bahnhofs inklusive Zufahrten genutzt.<br />
Zur Jahrh<strong>und</strong>ertwende wurde in der Stadt Luzern eine grosszügig angelegte Stadterweiterung,<br />
heute kurz Neustadt genannt, realisiert. Angelehnt an die Vorbilder europäischer Grossstädte<br />
(Paris, Barcelona, Valencia) erhielt Luzern damit sein urbanstes Quartier. Die übrigen Gebiete<br />
der Zentralschweiz <strong>und</strong> die meisten Schweizer Städte waren von dieser Entwicklung nicht be-<br />
troffen. In der Zwischen- <strong>und</strong> Nachkriegszeit entstand ein grosser Teil der heutigen Wohnquar-<br />
tiere in der Stadt Luzern. In den Agglomerationsgemeinden wurden zahlreiche Baugenossen-<br />
schaften gegründet, die ihre ersten Bauten alle in ähnlichem Stil errichteten, d.h. als Reihenhäu-<br />
ser oder oftmals als vierstöckige Wohnbauten.<br />
Ab den 1960er-Jahren begann in der Agglomeration Luzern <strong>und</strong> in der übrigen Zentralschweiz<br />
ein dynamisches bauliches Wachstum. Der Hauptanteil des Wachstums entfiel dabei auf Ge-<br />
werbe- <strong>und</strong> Wohnbauten; ab den 1970er-Jahren ergänzten Fachmärkte <strong>und</strong> grosse Einkaufs-<br />
zentren das Bild. Die grösseren Agglomerationsgemeinden Ebikon, Littau (inkl. Reussbühl),<br />
Kriens <strong>und</strong> Emmen wuchsen schnell mit der Kernstadt zusammen.<br />
25
<strong>Vorstadt</strong> <strong>Rontal</strong> ____________________________________________________________________________________ Juli 2011<br />
Die Strasseninfrastruktur (insbesondere Autobahnen <strong>und</strong> Hauptstrassen) wurde in dieser Zeit<br />
konsequent ausgebaut, was zusammen mit den schnell erstellten Gebäuden den ehemals dörf-<br />
lichen Charakter der <strong>Vorstadt</strong>gemeinden tiefgreifend veränderte. Die wachsenden Vorstädte<br />
profitierten dabei gleichzeitig von einer Zuwanderung aus ländlichen Regionen <strong>und</strong> einer star-<br />
ken Stadtflucht insbesondere durch junge Familien. In den Gebieten ausserhalb der Agglome-<br />
ration Luzern verlief diese Entwicklung bedeutend weniger dynamisch.<br />
In den 1990er-Jahren schliesslich setzte in den Kantonen Nidwalden (nur nördlicher Kan-<br />
tonsteil) <strong>und</strong> Zug (ganzer Kanton) eine rege Wohnbautätigkeit ein. Ausgelöst wurde diese Ent-<br />
wicklung in beiden Kantonen durch eine massive Steuersenkung. Im Kanton Zug wurden da-<br />
durch sehr viele finanzstarke Unternehmen angezogen, was zum Zuzug vieler neuer Arbeits-<br />
kräfte <strong>und</strong> schliesslich zu einer klassischen räumlichen Ausdifferenzierung führte. In der Kern-<br />
stadt fand ein starkes Wachstum der Arbeitsplätze statt (insbesondere im tertiären Sektor), wäh-<br />
rend die Vorstädte Baar, Cham <strong>und</strong> andere ein dynamisches Wachstum im Wohnbau erlebten.<br />
Anders ist die Entwicklung in Nidwalden zu verstehen: hierhin zogen viele mittelständische <strong>und</strong><br />
wohlhabende Privatpersonen mit Arbeitsplatz in Luzern oder Zug, die die Vorteile des ländli-<br />
chen Lebens in der Nähe von See <strong>und</strong> Alpen suchten. Gleiches gilt für die Schwyzer Gemeinden<br />
im näheren Einzugsbereich von Luzern, also beispielsweise Küssnacht <strong>und</strong> Merlischachen. Auch<br />
in weiten Teilen des periurbanen Raumes um Luzern setzte nach 1990 ein starkes Wachstum<br />
ein, so z.B. in den Gemeinden Dierikon, Gisikon, Rothenburg, Rain, Neuenkirch, Malters, Eschen-<br />
bach, Adligenswil <strong>und</strong> Meggen. Dieser dynamische Wachstumsprozess setzte sich nach der<br />
Jahrtausendwende in allen drei Räumen fort.<br />
In der Stadt Luzern setzte schliesslich um das Jahr 2000 eine Phase der Reurbanisierung <strong>und</strong> der<br />
Stadterneuerung ein. In Luzern wurden seit Jahrzehnten erstmals wieder grössere Wohnbau-<br />
projekte in Angriff genommen, z.B. Tribschenstadt <strong>und</strong> Citybay. Gleichzeitig setzte nach einer<br />
kantonalen Steuersenkung nun auch im Kanton Obwalden eine zunehmende Wohnbautätig-<br />
keit ein. Die beiden Halbkantone Ob- <strong>und</strong> Nidwalden durchlaufen damit eine für den gesamten<br />
internationalen Alpenraum typische Entwicklung. Sie wandeln sich von weitgehend selbständi-<br />
gen Wirtschafts- <strong>und</strong> Lebensräumen zu den nahen Städten zugewandten Wohnregionen mit<br />
hoher Pendlerrate <strong>und</strong> hoher Lebensqualität.<br />
Zusammenfassend lassen sich also für die vergangenen 50 Jahre folgende städtebauliche Ent-<br />
wicklungen festhalten.<br />
• Starke Sub-, Peri- <strong>und</strong> Reurbanisierungsprozesse in der Agglomeration Luzern<br />
• Zusammenwachsen zahlreicher Gemeinden in den Agglomerationen Luzern <strong>und</strong> Zug<br />
• Stärkung der Nachbarkantone (Obwalden, Nidwalden, Schwyz, Zug) als Wohnstandorte<br />
• Abwertung der Gemeinden im 1. Agglomerationsgürtel<br />
26
<strong>Vorstadt</strong> <strong>Rontal</strong> ____________________________________________________________________________________ Juli 2011<br />
3.2 Städtenetz Zentralschweiz?<br />
Der räumliche Fokus dieser Arbeit liegt auf dem <strong>Rontal</strong>. Dieses wurde als Fallbeispiel ausge-<br />
wählt, weil sich von hier diverse Aussagen auf andere Schweizer Vorstädte übertragen lassen.<br />
Vor den detaillierten <strong>Analyse</strong>n zum <strong>Rontal</strong> soll aber nun der räumliche Kontext hergestellt wer-<br />
den. Der Blick wird deshalb zunächst auf die gesamte Zentralschweiz <strong>und</strong> ihre besonderen Teil-<br />
räume geöffnet.<br />
Aus Sicht der Raumentwicklung ist die Zentralschweiz tatsächlich ein interessantes Gebiet, da<br />
sich hier sehr unterschiedliche <strong>Entwicklungs</strong>phänomene auf kleinem Raum beobachten lassen.<br />
Diese auffällige Heterogenität ist einerseits durch naturräumliche Voraussetzungen entstanden,<br />
z.B. See- <strong>und</strong> Alpensicht oder die Besonnung. Andererseits haben auch die Verkehrserschlies-<br />
sung, weitere Infrastrukturen sowie die Nähe zu Luzern bzw. Zürich eine zentrale Rolle gespielt.<br />
Zusätzlich kommen grosse Unterschiede in der kantonalen Steuerpolitik hinzu, die sich in der<br />
Zentralschweiz besonders deutlich an der Raumentwicklung ablesen lassen.<br />
In der Publikation „Die Schweiz – ein städtebauliches Porträt“ bezeichnen die Autoren die Zent-<br />
ralschweiz als Städtenetz (Herzog et al. 2005, p. 664). Neben Luzern gehören auch Stans,<br />
Schwyz, Altdorf, Zug <strong>und</strong> Sarnen zu diesem Netz. Den Netzwerkcharakter führen die Autoren in<br />
erster Linie auf funktionelle Zusammenhänge wie Pendlerbewegungen <strong>und</strong> Verkehrsverbin-<br />
dungen sowie auf den Vierwaldstättersee zurück (Herzog et al. p. 710ff). Die Argumentation für<br />
eine Bezeichnung als Städtenetz wirkt allerdings verkürzt <strong>und</strong> wendet den Blick ab von der He-<br />
terogenität der Zentralschweiz. Diese wird dann in Form der kantonalen Umrisse nachgereicht.<br />
Ein genauerer Blick auf die räumliche Realität zeigt nämlich, dass sich in der Zentralschweiz<br />
Zwischen- <strong>und</strong> Sonderräume gebildet haben, die sich nicht in ein solches Netzwerkschema<br />
pressen lassen, sondern längst ihre ganz eigene Dynamik entwickelt haben. Hier kommt die Be-<br />
zeichnung „Pockets“ in Herzog et al. (p. 714f) der Realität bedeutend näher als die Bezeichnung<br />
Städtenetz. An diesem Gedanken anschliessend soll hier nun mit einer adäquaten Abgrenzung<br />
<strong>und</strong> Benennung dieser Teilräume ein Schritt weiter gegangen werden. In der unten stehenden<br />
Abbildung werden die Räume zunächst im Überblick vorgestellt. Anschliessend werden die un-<br />
terschiedlichen Raumtypen charakterisiert <strong>und</strong> in einen Gesamtzusammenhang gestellt.<br />
27
<strong>Vorstadt</strong> <strong>Rontal</strong> _____________________ ____________________________________________________ ________________ Juli 2011<br />
Abbildung 11 Urban gepräg rägte Teilräume der Zentralschweiz<br />
Quelle: eigene Darstellung<br />
Luzern Süd: Sun Belt / Exoppolis<br />
Der Raum Luzern Süd lässt sich sic grob in zwei Teilräume unterteilen: Sun Belt Be <strong>und</strong> Exopolis. Die<br />
Richtung Süden exponierten n HHanglagen<br />
geniessen in der Zentralschweiz iz neben n dem Privileg<br />
der guten Besonnung meisten tens auch noch dasjenige der See- <strong>und</strong> Alpensi nsicht. Im Sun Belt ist<br />
beides der Fall. Entsprechend d finden sich auf der Horwer Halbinsel, am Son onnenberg in Luzern<br />
<strong>und</strong> Kriens sowie in weiteren n Stadtquartieren S<br />
am linken Ufer zahlreiche Woh ohnzonen von geho-<br />
benem Standard. Übrige Nutzu tzungen finden sich in diesen Hanglagen nur sel selten.<br />
28
<strong>Vorstadt</strong> <strong>Rontal</strong> ____________________________________________________________________________________ Juli 2011<br />
Diese Wohnnutzungen kontrastieren stark mit den flachen Gebieten zwischen Allmend, Kriens<br />
<strong>und</strong> Horw (Grossraum Luzern Süd bzw. Schl<strong>und</strong>). Hier finden sich Autogaragen <strong>und</strong> -händler,<br />
ein Schlachthof, Fachmärkte <strong>und</strong> kulturelle Nutzungen bunt gemischt mit neueren Büro- <strong>und</strong><br />
Wohngebäuden. Dieser Raum nimmt zusammengefasst alle diejenigen Nutzungen auf, die in<br />
der Stadt keinen Platz mehr gef<strong>und</strong>en haben. Nach Edward Soja (2000) wird ein solcher Ort<br />
Exopolis genannt – „die nach aussen gestülpte Stadt“.<br />
Kanton Nidwalden (nördlicher Kantonsteil): Wealthy Doughnut<br />
Seit r<strong>und</strong> zehn Jahren lässt sich im Kanton Nidwalden eine besonders starke räumliche Dynamik<br />
beobachten. Haupttreiber sind dabei die hohen Qualitäten des ländlichen Raums (Alpen, See,<br />
Bevölkerung, überschaubare Grösse), tiefe Steuern <strong>und</strong> die gute Erreichbarkeit per Bahn <strong>und</strong><br />
Autobahn. Die dadurch ausgelösten Migrationsbewegungen haben nicht nur zu einer starken<br />
Wohnbautätigkeit geführt, sondern auch grosse Folgeinvestitionen ausgelöst – insbesondere<br />
im Strassenbau.<br />
Die Siedlungsstruktur in der Region Stans hat sich dadurch von einzelnen Dörfern (Buochs, En-<br />
netbürgen, Ennetmoos, Oberdorf, Stans, Stansstad) zu einem fast durchgehenden Siedlungs-<br />
band gewandelt, das sich r<strong>und</strong> um den Flughafen Buochs legt. Die durch den Flughafen bean-<br />
spruchten Flächen wirken dadurch wie das Loch in einem Doughnut aus Siedlungsteig. Neben<br />
der baulichen Substanz hat sich durch die Immigration auch der Charakter der Bevölkerung<br />
stark verändert. Eine Verstädterung des Lebensstils, eine stark steigende Kaufkraft <strong>und</strong> dadurch<br />
schnell steigende Preise für Mieten <strong>und</strong> Immobilien sind dafür klare Zeichen.<br />
Luzern Nord (Emmenbrücke, Littau/Reussbühl): Rust Belt<br />
Der Norden Luzerns wurde um die vorletzte Jahrh<strong>und</strong>ertwende stark von der Industrie über-<br />
prägt (cf. Kapitel 3.1). Die meisten ansässigen Betriebe inklusive Stahlwerk <strong>und</strong> Giesserei haben<br />
bis heute überlebt, waren aber wiederholten <strong>und</strong> tiefgreifenden Restrukturierungen unterwor-<br />
fen. Stillgelegte Industriebrachen, marode Strassenbauten <strong>und</strong> grosser Investitionsbedarf bei<br />
einem relevanten Anteil der Immobilien an zentralen Lagen zeichnen heute das Bild einer Regi-<br />
on, die ihre besten Zeiten längst hinter sich hat. Weitere Betriebe wie der Militärflugplatz Em-<br />
men inkl. der hier ansässigen Firmen in der Verteidigungsindustrie haben ebenfalls eine unsi-<br />
chere Zukunft vor sich. See- <strong>und</strong> Alpensicht fehlen an vielen Lagen. Aufgr<strong>und</strong> dieser Faktoren<br />
wurde für die Region Luzern Nord die Bezeichnung Rust Belt gewählt.<br />
<strong>Rontal</strong>: Lucerne Strip<br />
Für eine detaillierte Untersuchung des <strong>Rontal</strong>s wird auf Kapitel 1 verwiesen. Der Name Lucerne<br />
Strip lehnt sich an den Las Vegas Strip an, der als Hauptachse durch die US-amerikanische Wüs-<br />
tenstadt führt. Im <strong>Rontal</strong> findet sich eine ähnliche urbane Struktur, die sich hauptsächlich an die<br />
überdimensionierte <strong>und</strong> aussergewöhnlich gerade geführte K17 fügt.<br />
29
<strong>Vorstadt</strong> <strong>Rontal</strong> ____________________________________________________________________________________ Juli 2011<br />
Meggen / Adligenswil / Merlischachen: Goldcoast<br />
Die Gemeinden am nördlichen Ufer des Vierwaldstättersees profitieren bezüglich See- <strong>und</strong> Al-<br />
pensicht sowie Besonnung <strong>und</strong> Erreichbarkeit von einer privilegierten Lage. Während das Sied-<br />
lungswachstum in den stadtnahen Gemeinden Meggen <strong>und</strong> Adligenswil schon vor mehreren<br />
Jahrzehnten eingesetzt hatte, wurden Merlischachen, Udligenswil <strong>und</strong> Küssnacht erst ungefähr<br />
bei der Jahrtausendwende von der Periurbanisierung erfasst. Exklusive Wohnbauten, die meist<br />
als Terrassen-, Reihen- oder Einfamilienhäuser realisiert werden, prägen diese zunehmend zer-<br />
siedelte Landschaft. Analog zur Zürcher Goldküste lassen sich auch an der Luzerner Goldcoast<br />
exorbitant hohe Immobilienpreise <strong>und</strong> eine zunehmende Gentrifizierung feststellen.<br />
Kanton Zug: High-Flyer<br />
Mit der Senkung der Unternehmenssteuern auf das tiefste Niveau in Europa ist der Kanton Zug<br />
als Pionier im Zentralschweizer Steuerwettbewerb vorausgegangen. Die davon erhofften Neu-<br />
zuzüge kapitalstarker Unternehmen übertreffen heute sogar die kühnsten Vorstellungen der<br />
damals verantwortlichen Politiker. Zwei der drei grössten Rohstoffhändler weltweit, zahllose Fi-<br />
nanzholdings <strong>und</strong> (europäische) Hauptsitze global tätiger Konzerne haben Zug fast über Nacht<br />
von einem verschlafenen Städtchen zu einer Drehscheibe des globalen Handels verwandelt.<br />
Heute präsentiert sich die Agglomeration Zug weitgehend als postmodernes Dienstleistungs-<br />
zentrum.<br />
Diese Entwicklung hat zu einer starken <strong>und</strong> schnellen Immigration geführt, was sich auf dem<br />
Wohnungsmarkt wiederum in einer sehr hohen Nachfrage ausdrückt. Da es sich dabei fast<br />
durchgehend um gut verdienende Nordeuropäer handelt, liegen die Wohnungspreise heute in<br />
Zug fast auf dem Niveau der Stadt Zürich. Diese Entwicklung greift ausserdem auf alle umlie-<br />
genden Gemeinden im Kanton Zug über, da hier die Einkommenssteuern ebenfalls tief <strong>und</strong> die<br />
Lebensqualität sehr hoch ist. Dadurch werden Einheimische zunehmend aus dem Kanton ge-<br />
drängt; im Freiamt <strong>und</strong> im <strong>Rontal</strong> haben entsprechende Entwicklungen auf dem Wohnungs-<br />
markt bereits spürbar eingesetzt.<br />
3.3 Fazit<br />
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Zentralschweiz durch eine äusserst heterogene<br />
Raumentwicklung geprägt ist. Die relevanten Unterschiede lassen sich dabei auf drei wichtige<br />
Faktoren in der Raumentwicklung zurück führen: naturräumliche Voraussetzungen, Erreichbar-<br />
keit <strong>und</strong> Steuern. Der Raum Zentralschweiz muss entsprechend nicht als Städtenetz, sondern<br />
vielmehr als mosaikartiger Teppich von zusammenhängenden Teilräumen verstanden werden.<br />
30
<strong>Vorstadt</strong> <strong>Rontal</strong> ____________________________________________________________________________________ Juli 2011<br />
Die Agglomeration Luzern nimmt in diesem Mosaik eine zentrale Stellung ein, indem sie einen<br />
grossen Teil von Bevölkerung <strong>und</strong> Arbeitsplätzen aufnimmt <strong>und</strong> gleichzeitig die funktionellen<br />
Verbindungen zur Metropole Zürich sicherstellt. In dieser Agglomeration wird für die weiteren<br />
<strong>Analyse</strong>n das <strong>Rontal</strong> herausgegriffen. Anhand dieses Beispiels lassen sich vergangene <strong>und</strong> zu-<br />
künftige Entwicklungen diskutieren, die nicht nur für die Zentralschweiz, sondern für die ge-<br />
samte Raumentwicklung in der Schweiz exemplarischen Charakter aufweisen.<br />
31
<strong>Vorstadt</strong> <strong>Rontal</strong> ____________________________________________________________________________________ Juli 2011<br />
4 Szenarien der Raumentwicklung Schweiz<br />
Ein wichtiges Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, neben einer möglichen auch die wahrschein-<br />
lichste zukünftige Raumentwicklung des <strong>Rontal</strong>s zu skizzieren. Dabei spielen ausser der Pla-<br />
nung auch die zu erwartenden Entwicklungen in Gesellschaft <strong>und</strong> Wirtschaft eine zentrale Rolle,<br />
denn die Planung kann immer nur einen begrenzten Einfluss auf die tatsächlichen Entwicklun-<br />
gen nehmen.<br />
Die Zukunft ist gr<strong>und</strong>sätzlich immer ungewiss. Die wichtigsten Trends der vergangenen 10 Jah-<br />
re einfach in die Zukunft zu interpolieren, wäre deshalb unbefriedigend. Die täglichen Auswir-<br />
kungen des Internets auf Wirtschaft <strong>und</strong> Gesellschaft hätten z.B. vor 20 Jahren noch nicht annä-<br />
hernd adäquat vorausgesagt werden können. Für die Untersuchung der Zukunft werden des-<br />
halb in der Regel verschiedene Szenarien gebildet bzw. betrachtet.<br />
Szenarien sind in sich kohärent formulierte Zukunftsbilder, also quasi mögliche Zukünfte. Diese<br />
mögen zwar teilweise etwas unrealistisch erscheinen; ihre Stärke liegt aber genau darin, sehr<br />
unterschiedliche Bilder darzustellen ohne sich an die grösste Wahrscheinlichkeit anzulehnen.<br />
Für die Skizzierung möglicher Zukünfte im <strong>Rontal</strong> sind die Szenarien 2030 des B<strong>und</strong>esamtes für<br />
Raumentwicklung (ARE) besonders geeignet, die im Raumentwicklungsbericht 2005 publiziert<br />
wurden (ARE 2005). Folgende vier Szenarien werden dann formuliert.<br />
• Szenario 1: Eine Schweiz der Metropolen – Trendszenario<br />
• Szenario 2: Zersiedlung – Niedergang der Städte<br />
• Szenario 3: Eine polyzentrische urbane Schweiz – vernetztes Städtesystem<br />
• Szenario 4: Eine Schweiz der Regionen – territoriale Solidarität<br />
In jedem Szenario wird ein kohärentes System von Hypothesen formuliert, das auf einer Be-<br />
schreibung der folgenden Faktoren basiert:<br />
• Internationaler Kontext<br />
• Innenpolitische Entwicklung<br />
• Wirtschaftliche Antriebskräfte<br />
• Auswirkungen auf Besiedlung, Verkehr <strong>und</strong> Tourismus<br />
Die wesentliche Rolle spielen dabei die sozioökonomischen Entwicklungen bis zum Jahr 2030.<br />
Sie ermöglichen eine konkrete <strong>und</strong> verständliche Formulierung der Szenarien. Daneben sind<br />
aber auch die Stellung <strong>und</strong> der Einfluss der Behörden von einer gewissen Bedeutung – sie sind<br />
neben den privaten die wichtigsten Akteure in der Gestaltung der Zukunft in der Schweiz. Die<br />
anschliessende Skizzierung der Szenarien orientiert sich weitgehend am Raumentwicklungsbe-<br />
richt Schweiz (ARE 2005).<br />
32
<strong>Vorstadt</strong> <strong>Rontal</strong> ____________________________________________________________________________________ Juli 2011<br />
4.1 Gemeinsame Elemente<br />
Die vier Szenarien der zukünftigen Raumentwicklung unterscheiden sich zwar gr<strong>und</strong>legend<br />
voneinander. Dennoch gibt es aber einige Elemente, die sich mit angemessener Wahrschein-<br />
lichkeit in allen vier Szenarien ähnlich entwickeln werden. Diese werden deshalb bereits hier<br />
vorgestellt <strong>und</strong> in der anschliessenden Formulierung der einzelnen Szenarien vorausgesetzt.<br />
1. Positives Konjunkturumfeld: Gr<strong>und</strong>sätzlich wird davon ausgegangen, dass sich die Weltwirtschaft<br />
langfristig positiv entwickelt, wobei in den verschiedenen Szenarien das Wachstum<br />
unterschiedlich gross angenommen wird. Auf ein Katastrophenszenario wird in Szenarioanalysen<br />
verzichtet, weil die Konsequenzen grosser Katastrophen nur schwer zu beschreiben<br />
wären <strong>und</strong> quasi ein eigenes Szenario darstellen würden.<br />
2. Verstärkte Integration der Schweiz in die Welt: es wird davon ausgegangen, dass die Globalisierung<br />
gr<strong>und</strong>sätzlich nicht umkehrbar ist; sie findet allerdings in den Szenarien 1, 3 <strong>und</strong> 4<br />
unterschiedlich schnell statt. In Szenario 2 wird hingegen von einem Rückzug der Schweiz<br />
auf sich selbst ausgegangen.<br />
3. Alterung der Gesellschaft: Bevölkerungsprognosen gehören zu den sichersten Prognosen<br />
überhaupt, da Transformationsprozesse hier sehr träge ablaufen. Alle vier Szenarien basieren<br />
auf der Annahme, dass die Bevölkerung in der Schweiz weiterhin leicht wächst <strong>und</strong><br />
gleichzeitig stark altert.<br />
4. Räumliche Stabilität: Neben den sich verändernden Elementen in Wirtschaft <strong>und</strong> Gesellschaft<br />
stellt der Raum ein gewisses Trägheitselement dar, das die möglichen Entwicklungen<br />
der kommenden 25 Jahren einschränkt. Von der Betrachtung einer f<strong>und</strong>amentalen Neugestaltung<br />
der räumlichen Strukturen in der Schweiz – beispielsweise ausgelöst durch Krieg<br />
oder Naturkatastrophen – wird deshalb abgesehen. Hingegen wird die fortschreitende Klimaerwärmung<br />
berücksichtigt.<br />
5. Landwirtschaft im Wandel: Es wird in allen vier Szenarien davon ausgegangen, dass sich die<br />
Landwirtschaft bis zum Jahr 2030 gr<strong>und</strong>legend verändern wird. Insbesondere werden zahlreiche<br />
Betriebe schliessen, <strong>und</strong> die weiterhin bestehenden Betriebe werden ihre Funktion<br />
von der Nahrungsproduktion weg <strong>und</strong> hin zu Landschaftspflege, Energieproduktion <strong>und</strong><br />
Dienstleistungen für die Freizeitgesellschaft anpassen.<br />
4.2 Szenario 1: Eine Schweiz der Metropolen – Trendszenario<br />
Die fortschreitende Globalisierung stärkt die Stellung der Metropolen weiter. In den Metropolen<br />
der Welt konzentrieren sich die Hauptquartiere der international tätigen Konzerne <strong>und</strong> damit<br />
die Entscheidungsmacht über die wesentlichen Vorgänge in der Weltwirtschaft. Die gleichzeiti-<br />
ge Konzentration der hoch spezialisierten Arbeitskräfte <strong>und</strong> der ärmeren Bevölkerungsschich-<br />
ten in einem hoch dynamischen Umfeld der Kernstädte führt aber zu grossen sozialen Span-<br />
nungen. Nach tief greifenden Deregulierungen sind die staatlichen Organe nicht mehr in der<br />
Lage, die daraus entstehenden Probleme gr<strong>und</strong>legend zu lösen; sie beschränken sich auf die<br />
Verwaltung <strong>und</strong> Lösung alltäglicher Aufgaben.<br />
33
<strong>Vorstadt</strong> <strong>Rontal</strong> ____________________________________________________________________________________ Juli 2011<br />
Die Schweiz bleibt im internationalen Wettbewerb dank hervorragender Hochschulen <strong>und</strong> ei-<br />
ner gestärkten Exportwirtschaft in einer komfortablen Position. Die Integration in die Weltwirt-<br />
schaft gelingt der Schweiz insbesondere dank der führenden drei Metropolitanräume Genf<br />
(Bassin Lémanique), Basel <strong>und</strong> Zürich. Im grenzüberschreitenden Metropolitanraum Bassin<br />
Lémanique leben r<strong>und</strong> 1,5 Mio., im trinationalen Wirtschaftsraum Basel r<strong>und</strong> 0,8 Mio. <strong>und</strong> in der<br />
Agglomeration Zürich gegen 2 Mio. Menschen.<br />
Obwohl diese drei Städte damit nach wie vor viel kleiner sind als die europäischen oder welt-<br />
weiten Metropolen, können sie sich durch hoch spezialisierte Dienstleistungen im Bankensek-<br />
tor, in der chemischen Industrie <strong>und</strong> durch die hohe Präsenz internationaler Organisationen auf<br />
dem internationalen Parkett behaupten. Einen wichtigen Beitrag leistet ausserdem die hervor-<br />
ragende Erreichbarkeit der drei Metropolen auf dem Land- <strong>und</strong> Luftweg.<br />
In diesem wirtschaftlich dynamischen Umfeld sind die Behörden in der Entwicklung zurück<br />
geblieben. Mangels politischem Willen sind Gemeindefusionen zum grossen Teil gescheitert,<br />
<strong>und</strong> die Resultate der föderalen Agglomerationspolitik sind hinter den Erwartungen zurück<br />
geblieben. Ausserdem bietet die Überwindung der zunehmenden Disparitäten – etwa zwischen<br />
Zentrum <strong>und</strong> Peripherie – zunehmende Schwierigkeiten. Angeführt wird die faktische Weiter-<br />
entwicklung der Metropolen denn auch nicht durch die Behörden, sondern durch private Ak-<br />
teure. Sie organisieren die Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft <strong>und</strong> Bildung <strong>und</strong> planen gros-<br />
se Infrastrukturinvestitionen, beispielsweise im Verkehr.<br />
In den drei Metropolitanräumen spielt die Konzentration eine entscheidende Rolle, denn ihre<br />
wirtschaftliche Dynamik basiert letztlich auf der Fähigkeit, Wohnraum <strong>und</strong> Beschäftigung für<br />
eine grosse Anzahl Menschen anzubieten, zwischen denen sich eine enges Netzwerk von pro-<br />
duktiven Interaktionen bildet. Ihre Grösse <strong>und</strong> die im internationalen Vergleich sehr hohe Le-<br />
bensqualität erlaubt es den Metropolen Genf, Basel <strong>und</strong> Zürich ausserdem, hoch spezialisierte<br />
Dienstleistungen <strong>und</strong> Entscheidungsmacht an sich zu binden. Zur hohen Lebensqualität gehö-<br />
ren insbesondere auch erstklassige Infrastrukturen für Messen, Kultur <strong>und</strong> Sport. Als Folge der<br />
wirtschaftlichen Dynamik <strong>und</strong> der hohen Konzentration von Funktionen <strong>und</strong> Entscheidungs-<br />
kompetenzen in den drei Metropolen sind diese die zentralen Treiber der Raumentwicklung in<br />
der Schweiz.<br />
Andererseits verursacht aber die hohe Konzentration auch beträchtliche Kosten im sozialen Be-<br />
reich. Insbesondere in den Kernstädten drohen Verarmung <strong>und</strong> eine Gettoisierung. Durch die<br />
hohe Konzentration kommt es unweigerlich auch zu Verkehrsproblemen in Stosszeiten, die sich<br />
im Individualverkehr in grossen Staus mit entsprechenden Zeitverlusten manifestieren. Der öf-<br />
fentliche Verkehr funktioniert insbesondere in dicht besiedelten Gebieten weiterhin gut, verur-<br />
sacht aber beträchtliche Defizite, die die öffentliche Hand abdecken muss. Ausserdem stellen<br />
die Infrastrukturen für Sport, Kultur <strong>und</strong> weitere öffentliche Aufgaben die zuständigen Behör-<br />
den vor grosse finanzielle Herausforderungen.<br />
34
<strong>Vorstadt</strong> <strong>Rontal</strong> _____________________ ____________________________________________________ ________________ Juli 2011<br />
Abbildung 12 Die Schweiz iz dder<br />
Metropolen – Trendszenario<br />
Quelle: Are (2005, p. 71)<br />
4.2.1 Konsequenzen für die räumliche Entwicklung<br />
Die drei dynamischen Metrop opolen sichern den Anschluss der Schweiz an die internationale<br />
Wirtschaft. Gleichzeitig sind sie aber von grossen sozialen <strong>und</strong> räumlichen Disparitäten D<br />
geprägt,<br />
<strong>und</strong> den Stadtzentren droht ein ei Niedergang (Verarmung), jedoch fast ohne e Verluste bei der Be-<br />
völkerung (-3%) <strong>und</strong> den Arbe beitsplätzen (-2%). Im periurbanen Raum hingeg egen wachsen insbe-<br />
sondere die wohlhabende Bev evölkerung (+16%) <strong>und</strong> die Beschäftigung in Unternehmen U<br />
mit ei-<br />
ner hohen Wertschöpfung (+22 22%) stark an.<br />
Die Mittelstädte im Einzugsber ereich der Metropolen profitieren besonders von vo deren wirtschaft-<br />
licher Dynamik, so beispielswe weise Winterthur oder Zug. Hier finden die Men enschen einerseits ei-<br />
ne hohe Lebensqualität abseit eits von Hektik <strong>und</strong> Verkehrsproblemen der grossen g Metropolen,<br />
können aber gleichzeitig die Vorteile V der Metropolen voll nutzen. In der Folgge<br />
wachsen hier so-<br />
wohl die Anzahl der Stellen (+6%) (+6 als auch die Bevölkerung (+9%) spürbar.<br />
Die weiteren Schweizer Städte dte <strong>und</strong> Agglomerationen können hingegen von vo der Dynamik der<br />
Metropolen nur sehr beschrän änkt profitieren, weil sie räumlich zu weit entfe tfernt liegen. Sie wer-<br />
den zu Bindegliedern zwische hen Metropolräumen <strong>und</strong> dem ländlichen Rau aum <strong>und</strong> entwickeln<br />
35
<strong>Vorstadt</strong> <strong>Rontal</strong> ____________________________________________________________________________________ Juli 2011<br />
sich zunehmend zu Standorten der föderalen <strong>und</strong> kantonalen Verwaltung. Dies trifft sowohl für<br />
Städte wie Chur <strong>und</strong> Neuenburg zu als auch für zahlreiche Städte im Espace Mittelland <strong>und</strong> für<br />
die Agglomeration Luzern.<br />
Die stadtnahen ländlichen Gebiete werden zunehmend als Siedlungs-, Erholungs- oder als Na-<br />
turschutzgebiet genutzt, die Bedeutung der Landwirtschaft hingegen geht stark zurück. Ent-<br />
sprechend wächst die Bevölkerung (+5%), die Zahl der Arbeitsplätze hingegen schrumpft leicht<br />
(-2%). Die peripher gelegenen ländlichen Gebiete erleben einen deutlichen Niedergang, der<br />
sich in einem starken Rückgang sowohl der Beschäftigung (-14%) als auch der Bevölkerung (-3%<br />
bis -16%) bemerkbar macht. Viele Gebäude stehen in der Folge leer. Die Lockerung der Gesetz-<br />
gebung, die eine sinnvolle Nachnutzung dieser Bauten anstrebte, hatte eine weitere starke Zer-<br />
siedlung zur Folge.<br />
Da insgesamt keine neue Zuwanderung stattfindet, altert die Schweizer Bevölkerung zuneh-<br />
mend. Der Trend zur Zersiedlung setzt sich ungebremst fort (Siedlungsfläche +11%): in guter<br />
Erreichbarkeit der Metropolen werden 100‘000 weitere Einfamilienhäuser gebaut.<br />
4.2.2 Fazit<br />
Die Schweiz wird durch die dynamische Entwicklung der drei Metropolitanräume Genf, Basel<br />
<strong>und</strong> Zürich geprägt. Sie stellen den Anschluss der Schweiz an die internationale Wirtschaft si-<br />
cher <strong>und</strong> konzentrieren gleichzeitig zentrale Funktionen <strong>und</strong> die Entscheidungsmacht in sich.<br />
Profitieren davon können neben den Metropolen auch die Mittelstädte im engeren Einzugsbe-<br />
reich der Metropolen – die Verlierer hingegen sind weiter entfernte Städte sowie der periphere<br />
ländliche Raum. Das Szenario „Eine Schweiz der Metropolen“ ist auch für die Umwelt <strong>und</strong> den<br />
Verkehr mit hohen Kosten verb<strong>und</strong>en <strong>und</strong> verfehlt insgesamt eine nachhaltige Entwicklung in<br />
der Schweiz.<br />
4.3 Szenario 2: Zersiedlung – Niedergang der Städte<br />
Die weltweite Wirtschaftskrise <strong>und</strong> die sozialen Ungleichheiten konnten seit dem Beginn des<br />
21. Jahrh<strong>und</strong>erts nicht überw<strong>und</strong>en werden, was den Wohlstand in den entwickelten Ländern<br />
insgesamt deutlich beeinträchtigt hat. Entsprechend stagniert die Globalisierung, <strong>und</strong> der in-<br />
ternationale Handel wurde spürbar gebremst. Die Schweizer Wirtschaft wird dadurch stark be-<br />
einträchtigt. Für den Export bewährter Schweizer Produkte – beispielsweise Vermögensverwal-<br />
tung oder Luxusgüter – hat dies gravierende Konsequenzen. Die Realisierung grosser Investiti-<br />
onen – insbesondere in Verkehrsinfrastrukturen – wurde zurückgestellt. Insgesamt verharren<br />
die entwickelten Länder in einer abwartenden Position: die Problembewältigung ist mangel-<br />
haft, die Behörden geschwächt <strong>und</strong> die Arbeitslosigkeit ist hoch.<br />
36
<strong>Vorstadt</strong> <strong>Rontal</strong> ____________________________________________________________________________________ Juli 2011<br />
Die Schweiz zieht sich in diesem Kontext in sich selbst zurück. Die Freihandelsabkommen sind<br />
gescheitert, weshalb die alten protektionistischen Massnahmen bestehen blieben. Davon profi-<br />
tieren jedoch nur wenige Branchen, insbesondere die Landwirtschaft. Eine weitreichende Dere-<br />
gulierung, die bis hin zu einer Governance nach angelsächsischem Muster geht, hat zu einer<br />
dramatischen Schwächung der öffentlichen Hand geführt. Die Aktivitäten der Behörden be-<br />
schränken sich auf die Bereitstellung zentraler Rahmenbedingungen <strong>und</strong> die Korrektur der<br />
schlimmsten Auswirkungen im Sozial- <strong>und</strong> Umweltbereich.<br />
Private Initiativen treten in allen Lebensbereichen in den Vordergr<strong>und</strong>, so z.B. freies Unterneh-<br />
mertum, Kulturmäzenat oder wohltätige Vereinigungen. Hingegen führte die Deregulierung<br />
auch zu einer Schwächung der weniger Privilegierten, was in den vergangenen Jahren ver-<br />
mehrt soziale Spannungen zur Konsequenz hatte. Aufgr<strong>und</strong> der Schwächung der öffentlichen<br />
Hand fehlen dieser jedoch die Mittel, um der schwachen Konjunktur <strong>und</strong> den zunehmenden<br />
Disparitäten im Land wirksame Massnahmen entgegen zu setzen.<br />
Während also die kantonalen <strong>und</strong> die föderalen Behörden stark geschwächt aus dieser Entwick-<br />
lung hervor gehen, gewinnen die Gemeinden hingegen an Bedeutung. Sie haben bewiesen,<br />
dass sie dank ihrer Nähe zu den Bürgern die anstehenden Aufgaben am besten lösen können.<br />
Sie delegieren dabei einen grossen Anteil ihrer Aufgaben an private Akteure. Aufgr<strong>und</strong> des<br />
stark wirkenden Protektionismus funktionieren die Gemeinden <strong>und</strong> Städte trotz ihrer be-<br />
schränkten Grösse gut.<br />
Als Teil der Deregulierungspolitik wurden die Vorschriften in der Landwirtschaftszone stark ge-<br />
lockert. Ungenutzte Landwirtschaftsgebäude können frei genutzt werden. Da trotz Protektio-<br />
nismus die Anzahl der Landwirtschaftsbetriebe rückläufig ist, kommen so zehntausende von<br />
landwirtschaftlichen Immobilien auf den freien Markt. Die Folge davon war eine starke Zersied-<br />
lung; die periurbanen Gebiete greifen tief in die Landwirtschaftszone hinein. Die Standorte von<br />
kleineren <strong>und</strong> mittleren Unternehmen liegen überall verteilt im Mittelland. Die Landschaft wird<br />
dadurch stark in Mitleidenschaft gezogen.<br />
Aufgr<strong>und</strong> der grossen Ausdehnung der Siedlungsfläche <strong>und</strong> der abnehmenden Bebauungs-<br />
dichte konnte das wachsende Verkehrsaufkommen nicht durch den öffentlichen Verkehr aufge-<br />
fangen werden, entsprechend nahm der Individualverkehr stark zu. Ausserdem mussten die<br />
anderen Infrastrukturnetze (Wasser, Abwasser, Energie, Telekommunikation) in der Fläche aus-<br />
gebaut werden, was zu einem starken Anstieg der Kosten geführt hat. Ausserdem sind die Infra-<br />
strukturen aufgr<strong>und</strong> der abnehmenden Siedlungsdichte immer schlechter ausgelastet. Die öf-<br />
fentliche Hand hat grosse Schwierigkeiten, für deren Bau <strong>und</strong> Unterhalt aufzukommen, was zu<br />
häufigen Pannen <strong>und</strong> Unterbrüchen führt.<br />
Für die Städte bedeutet diese Entwicklung einen Niedergang. Sowohl die Bevölkerung als auch<br />
die Arbeitsplätze erleben einen deutlichen Rückgang, was auch einen Abbau der öffentlichen<br />
Dienstleistungen zur Folge hat. Die hoch spezialisierten Dienstleistungen der Privatwirtschaft –<br />
37
<strong>Vorstadt</strong> <strong>Rontal</strong> _____________________ ____________________________________________________ ________________ Juli 2011<br />
beispielsweise im Bankensekto ktor oder im Rechtsbereich – finden in den Schw hweizer Städten keine<br />
genügend grosse Nachfrage mehr m <strong>und</strong> wandern in ausländische Metropolen len ab.<br />
Abbildung 13 Zersiedlung – Niedergang der Städte<br />
Quelle: ARE (2005, p. 76)<br />
Ausserdem hat die starke Der eregulierung dazu geführt, dass sich die Regio gionen sehr ungleich<br />
entwickeln. Es fehlt im Gegens ensatz zu früher eine ausgleichende Raumpoliti litik des B<strong>und</strong>es. Jede<br />
Gemeinde versuchte, eine eige igene Industrie anzusiedeln, was zu einem ineff effizienten Kampf der<br />
Gemeinden untereinander füh ührte. Zusammenfassend bringt das Szenario Zersiedlung Z<br />
also nur<br />
Verlierer: die Wirtschaft hat nur nu schwache <strong>Entwicklungs</strong>motoren, die Umwe weltprobleme werden<br />
nicht gelöst, die Landschaft wird wir stark zersiedelt <strong>und</strong> soziale Ungleichheiten n verstärken sich.<br />
4.3.1 Konsequenzen für die räumliche Entwicklung<br />
Die Schweizer Städte verlieren en sowohl Bevölkerung als auch an Arbeitsplätz ätze. Beide lassen sich<br />
im ländlichen Raum nieder. Die Di Stadtzentren entleeren sich <strong>und</strong> die daraus us entstehenden Bra-<br />
chen haben nur eine geringee<br />
Chance auf Wiederbelebung. Die grossen n Infrastrukturen der<br />
Städte wie Messehallen, Flugh ghäfen <strong>und</strong> Sportstätten kämpfen mit einer sink inkenden Auslastung.<br />
Alle Städte leiden unter massi ssiven Verkehrsproblemen. Die öffentliche Han and sieht sich ausser-<br />
stande, die sozialen Spannung ungen wirksam abzubauen. Auch die grösseren ren Schweizer Städte<br />
haben im internationalen Wett ettbewerb keine Chance.<br />
38
<strong>Vorstadt</strong> <strong>Rontal</strong> ____________________________________________________________________________________ Juli 2011<br />
Die gelockerten Bauvorschriften in der Landwirtschaftszone führten dazu, dass ausser in den<br />
ganz peripheren Regionen weite Teile des Landes mit Wohn-, Gewerbe- <strong>und</strong> Infrastrukturbau-<br />
ten überzogen sind. Die Siedlungsfläche in der Schweiz wächst um 50‘000ha. Das ökologische<br />
Gleichgewicht, die Vernetzung der Lebensräume <strong>und</strong> insbesondere das Landschaftsbild wer-<br />
den dadurch in Mitleidenschaft gezogen. Der Ruf der Schweiz leidet stark darunter, <strong>und</strong> der in-<br />
ternationale Tourismus geht in der Folge stark zurück (wobei bei letzterem die schwache Welt-<br />
konjunktur ebenfalls eine Rolle spielt).<br />
4.3.2 Fazit<br />
Im Szenario 2 „Zersiedlung“ wird von einem klaren Entscheid für die individuelle Initiative aus-<br />
gegangen. Diese Entscheidung hat für die Schweizer Raumentwicklung gravierende Konse-<br />
quenzen: die Städte verlieren Einwohner <strong>und</strong> Arbeitsplätze, das Mittelland leidet unter einer<br />
erdrückenden Zersiedlung <strong>und</strong> mangelhaften Infrastrukturnetzen <strong>und</strong> die peripheren Regionen<br />
werden von der wirtschaftlichen Entwicklung praktisch komplett abgehängt. Das Image der<br />
Schweiz wird international stark geschwächt, <strong>und</strong> der Tourismus geht in der Folge zurück. Die<br />
Schweiz ist insgesamt ärmer als vor 25 Jahren.<br />
4.4 Szenario 3: Eine polyzentrische urbane Schweiz – vernetztes<br />
Städtesystem<br />
Die Weltwirtschaft entwickelte sich nach der Jahrtausendwende positiv <strong>und</strong> es wurden wirksa-<br />
me internationale Abkommen zum Schutz der Umwelt ratifiziert. Dies führte in vielen Lebens-<br />
bereichen zu einer Wende hin zu einer nachhaltigen Entwicklung, von der weltweit vor allem<br />
die Städte profitieren konnten.<br />
Im internationalen Vergleich besticht die Schweiz mit einer vorbildlichen öffentlichen Verwal-<br />
tung, die durch drei Einflüsse gestärkt wurde. Erstens profitierte das Land von einer stabilen<br />
Konjunktur <strong>und</strong> einem wachsenden Aussenhandel, was sich insbesondere in der Vermögens-<br />
verwaltung <strong>und</strong> in einer Zunahme der Exporte äusserte. Zweitens ist es den Behörden dank ei-<br />
ner restriktiven Raumordnungspolitik gelungen, eine weitere Ausdehnung der Siedlungen zu<br />
stoppen <strong>und</strong> wertvolle Landschafts- <strong>und</strong> Naturräume zu schützen. Drittens gilt die bürgernahe<br />
direkte Demokratie international als vorbildlich.<br />
Durch die Einführung einer stärkeren Kontrolle der Bautätigkeit durch die B<strong>und</strong>esbehörden<br />
konnte die Zersiedlung in der Schweiz erfolgreich gestoppt werden. Dadurch hat sich eine klare<br />
Grenze zwischen den Städten <strong>und</strong> den umliegenden Landwirtschafts- <strong>und</strong> Naturräumen her-<br />
ausgebildet, die international als vorbildlich gilt. Gleichzeitig hat sich zwischen den Schweizer<br />
Städten ein enges Netzwerk gebildet, das auch die Klein- <strong>und</strong> Mittelstädte einschliesst.<br />
39
<strong>Vorstadt</strong> <strong>Rontal</strong> _____________________ ____________________________________________________ ________________ Juli 2011<br />
Die treibende Kraft dieser Entw twicklung waren die Agglomerationen, die durc urch eine erfolgreiche<br />
Förderpolitik des B<strong>und</strong>es zu neuer n Stärke gef<strong>und</strong>en haben. In vielen Agglo glomerationen wurde<br />
durch die Fusion verschiedene ner Gemeinden eine Verwaltungsstruktur gesch chaffen, die auch dem<br />
tatsächlichen Lebensraum der er Bevölkerung entspricht. Die grenzüberschreit reitenden Agglomera-<br />
tionen Genf, Basel, im Tessin <strong>und</strong> u in der Ostschweiz wurden durch Anpassu sungen im internatio-<br />
nalen Recht weiter gestärkt. . Die D Städte spezialisieren sich auf ihre jeweilig iligen wirtschaftlichen<br />
Kernkompetenzen <strong>und</strong> heben n sich damit von der internationalen Tendenz zur zu Angleichung ab.<br />
Abbildung 14 Eine polyzent entrisch urbane Schweiz – vernetztes Städtesyste tem<br />
Quelle: ARE (2005, p. 80)<br />
Dank dieser spezialisierten Entwicklung Ent <strong>und</strong> den hervorragenden Verkehrs hrsverbindungen zwi-<br />
schen den Städten erreicht das Städtenetz Schweiz insgesamt eine wirtscha haftlicheLeistungsfä- higkeit, die mit internationalen len Metropolen vergleichbar ist, ohne jedoch unter u den negativen<br />
Auswirkungen einer Grossstad tadt zu leiden. Dank dem erfolgreichen Kampf pf gegen die Zersied-<br />
lung sind die Schweizer Städte dte von einem Gürtel von Landwirtschafts- <strong>und</strong> nd Naturräumen um-<br />
geben. Die Bautätigkeit fand verstärkt v im bestehenden Siedlungsgebiet stat tatt, insbesondere auf<br />
Industrie- <strong>und</strong> Gewerbebrache hen. Im ersten <strong>Vorstadt</strong>gürtel entstehen vermeh ehrt städtische Mehr-<br />
familienhäuser, die das Modell ell des Einfamilienhauses zunehmend ablösen. en. Die Vorstädte sind<br />
durch den öffentlichen Verkeh ehr hervorragend erschlossen. Die peripheren n Regionen R hingegen<br />
können von der wirtschaftliche chen Dynamik der Städte nicht profitieren. Hier ier kann der hohe Le-<br />
bensstandard nur dank Unterst rstützung der öffentlichen Hand gehalten werde rden.<br />
40
<strong>Vorstadt</strong> <strong>Rontal</strong> ____________________________________________________________________________________ Juli 2011<br />
4.4.1 Konsequenzen für die räumliche Entwicklung<br />
Die Städte bilden ein robustes <strong>und</strong> leistungsfähiges Netzwerk, das insgesamt den Anschluss an<br />
die internationale Wirtschaft sicherstellt <strong>und</strong> die allgemeine Triebkraft für die Entwicklung in<br />
der Schweiz darstellt. Der daraus resultierende Wohlstand führt zu einem Aufschwung in den<br />
Agglomerationen (+8% Bevölkerung in grossen Agglomerationen, +6% in den kleineren). Der<br />
periurbane Raum im ersten Agglomerationsgürtel hingegen erfüllt sowohl städtische als auch<br />
ländliche Funktionen <strong>und</strong> bleibt bezüglich Bevölkerung <strong>und</strong> Arbeitsplätzen relativ stabil.<br />
Die weiter entfernten Regionen hingegen werden von der wirtschaftlichen Entwicklung abge-<br />
hängt <strong>und</strong> erleiden in der Folge einen starken Abschwung, der durch eine schrumpfende Be-<br />
völkerung, eine starke Überalterung sowie einen grossen Verlust an Arbeitsplätzen gekenn-<br />
zeichnet ist (-19%). Einige periphere Regionen haben als Regionale Naturpärke eine neue Iden-<br />
tität gef<strong>und</strong>en, die Schutz <strong>und</strong> Nutzen der vorhandenen Naturwerte in Einklang bringt.<br />
Als Konsequenz der starken Spezialisierung innerhalb des Städtenetzes findet eine Intensivie-<br />
rung des Austausches zwischen den Städten statt. In der Folge wächst der Verkehr zwischen<br />
<strong>und</strong> innerhalb der Agglomerationen stark an. Dank der hohen Dichte kann das Wachstum<br />
durch den gut ausgebauten öffentlichen Verkehr aufgefangen werden. Durch die hohe Auslas-<br />
tung des öffentlichen Verkehrs können gute Deckungsbeiträge erwirtschaftet werden. Die Au-<br />
tobahnen können dank der hohen Dichte vom regionalen Verkehr etwas entlastet <strong>und</strong> können<br />
wieder vermehrt ihre eigentlich Funktion übernehmen: die Verbindung der Schweizer Städte<br />
untereinander.<br />
Dank der vorbildlichen Bewahrung der landschaftlichen Stärken kann die Schweiz ausserdem<br />
eine steigende Anzahl internationaler Gäste willkommen heissen. Neben den Städten <strong>und</strong> den<br />
etablierten alpinen Destinationen können auch die Randregionen davon profitieren, seit sie au-<br />
thentische <strong>und</strong> strikte auf lokale Besonderheiten ausgerichtete Angebote erarbeitet haben.<br />
4.4.2 Fazit<br />
Eine gute Entwicklung der Konjunktur sowie eine gestärkte Kontrolle des B<strong>und</strong>es über die Bau-<br />
tätigkeit im Land hat zu einem dynamischen <strong>und</strong> wirtschaftlich leistungsfähigen Netz der<br />
Schweizer Städte geführt, in dem sich jede Stadt auf ihre ursprünglichen Kernkompetenzen<br />
konzentriert. Die Konzentration nach innen ermöglicht in Kombination mit der Vernetzung aus-<br />
serdem eine gesellschaftliche Solidarität <strong>und</strong> die Erhaltung des ökologischen Gleichgewichts.<br />
Die ländlichen Gebiete in der Nähe der Städte profitieren von deren Dynamik während die wei-<br />
ter entfernt gelegenen Gebiete nur eine geringe Vitalität aufweisen.<br />
41
<strong>Vorstadt</strong> <strong>Rontal</strong> ____________________________________________________________________________________ Juli 2011<br />
4.5 Szenario 4: Eine Schweiz der Regionen – territoriale Solidarität<br />
Eine markante Erhöhung der Rohstoffpreise nach der Jahrh<strong>und</strong>ertwende hat die Weltgemein-<br />
schaft vor neue Herausforderungen gestellt. Die Ratifizierung internationaler Umweltschutzab-<br />
kommen <strong>und</strong> eine pragmatische Umsetzung der Gr<strong>und</strong>sätze der nachhaltigen Entwicklung ha-<br />
ben dazu geführt, dass sich ein weltweites Gleichgewicht zwischen Ökonomie, Ökologie <strong>und</strong><br />
sozialen Anliegen einpendelt.<br />
Europa wächst kontinuierlich weiter. Neben den Grossmetropolen London, Paris, Madrid, Rhein-<br />
/Ruhrgebiet <strong>und</strong> der holländischen Randstad sind es im Wesentlichen Mittelstädte von der<br />
Grösse 200‘000 – 5Mio. Einwohner, die das europäische Städtesystem prägen. Diese Städte sind<br />
fest mit ihrem Umland verankert <strong>und</strong> vereinigen die beiden Funktionen Anschluss an die Welt-<br />
wirtschaft <strong>und</strong> Ausstrahlung auf die umliegenden Gemeinden.<br />
In der Schweiz konnten die Kantone die anstehenden Probleme nicht mehr zufriedenstellend<br />
lösen. Deshalb wurden 11 politische Regionen gegründet, die aufgr<strong>und</strong> ihres Gewichts zufrie-<br />
denstellend Politik (z.B. Wirtschaftsförderung) betreiben können <strong>und</strong> gleichzeitig nicht zu weit<br />
weg von den Bürgerinnen <strong>und</strong> Bürgern arbeiten. Jede Region weist ihre eigenen Stärken auf<br />
<strong>und</strong> verbindet die Städte mit dem ländlichen Raum innerhalb der Region. Dem sozialen Zu-<br />
sammenhalt – insbesondere auch zwischen Stadt <strong>und</strong> Land – kommt eine zentrale Funktion zu.<br />
So kann eine räumliche Entwicklung sicher gestellt werden, von der keine Landesteile ausge-<br />
schlossen werden.<br />
Die Regionen sind nicht klar begrenzt <strong>und</strong> überschneiden sich teilweise. Die Region Jura bei-<br />
spielsweise teilt gewisse Gebiete mit der Region Basel bzw. mit der Region Genf <strong>und</strong> unterhält<br />
gleichzeitig eine intensive partnerschaftliche Beziehung mit der französischen Region Franche-<br />
Comté. Es handelt sich also bei den Regionen nicht um eine territoriale Aufteilung der Schweiz,<br />
sondern vielmehr um Handlungsräume, die durchaus grenzüberschreitenden Charakter haben<br />
können.<br />
Basierend auf den sich ergänzenden Städten <strong>und</strong> ländlichen Räumen entwickelt jede Region ih-<br />
re eigenen wirtschaftlichen Kernkompetenzen. Gleichzeitig haben die Regionen auch genü-<br />
gend politische Kompetenzen, um direkte Partnerschaften mit anderen Regionen im In- <strong>und</strong><br />
Ausland zu schliessen. So konnten Fortschritte in der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit<br />
erreicht werden, namentlich im Verkehrsbereich, in der Beschäftigung <strong>und</strong> im Wohnungsbau.<br />
Der B<strong>und</strong> beschränkt sich in dieser Schweiz der Regionen auf die Bereitstellung geeigneter<br />
Rahmenbedingungen für eine positive Entwicklung. Dazu gehören insbesondere die Wäh-<br />
rungs- <strong>und</strong> die Aussenpolitik sowie die grossen Verkehrsinfrastrukturen. Die Kantone hingegen<br />
übernehmen die Regional- <strong>und</strong> die Sachpolitiken, <strong>und</strong> die Gemeinden behalten weiterhin ihre<br />
Rolle als bürgernächste Ebene der öffentlichen Verwaltung. Anfängliche Vorbehalte bezüglich<br />
einer ungleichen Entwicklung zwischen den Regionen <strong>und</strong> einer daraus folgenden Bedrohung<br />
42
<strong>Vorstadt</strong> <strong>Rontal</strong> _____________________ ____________________________________________________ ________________ Juli 2011<br />
des nationalen Zusammenhalt altes konnten ausgeräumt werden, indem der er B<strong>und</strong> B mit einem in-<br />
terregionalen Finanzausgleich ch eine Harmonisierung der Entwicklung sicherst rstellte.<br />
Abbildung 15 Eine Schweiz eiz der Regionen – territoriale Solidarität<br />
Quelle: ARE (2005, p. 82)<br />
4.5.1 Konsequenzen für die räumliche Entwicklung<br />
Die Regionen entwickeln sich h basierend b auf ihren jeweiligen Stärken <strong>und</strong> Besonderheiten Be<br />
weit-<br />
gehend selbständig. Für die Lösung Lö übergreifender Probleme wie beispielsw elsweise der Verkehrs-<br />
infrastruktur gehen sie flexible ble Partnerschaften ein. Die Bevölkerung identif ntifiziert sich nach an-<br />
fänglichen Vorbehalten stark k mmit<br />
den neuen Regionen. In jeder Region gibt t es e ein eigenes Städ-<br />
tesystem mit einer hierarchisch schen Struktur, das von den Metropolen bis zum m Dorf reicht <strong>und</strong> die<br />
jeweiligen Dienstleistungen bereit be stellt. So kann insgesamt eine räumliche e Entwicklung sicher-<br />
gestellt werden, von der alle Landesteile La profitieren können.<br />
Die Kosten für die Mobilität sind sin aufgr<strong>und</strong> der stark gestiegenen Energiepre preise so hoch wie nie<br />
zuvor. Als Folge davon fahren en die Menschen zwar nicht weniger oft im eig igenen Fahrzeug, die<br />
zurückgelegten Distanzen wer erden aber spürbar kürzer, weil die Menschen en sich zunehmende<br />
innerhalb ihrer eigenen Region ion bewegen. Gleichzeitig erlebt der öffentliche he Verkehr einen veri-<br />
tablen Aufschwung, <strong>und</strong> aufgr fgr<strong>und</strong> der kürzeren Distanzen erfolgt eine eige gentliche Renaissance<br />
des Fuss- <strong>und</strong> Veloverkehrs.<br />
43
<strong>Vorstadt</strong> <strong>Rontal</strong> ____________________________________________________________________________________ Juli 2011<br />
Der internationale Tourismus weist aufgr<strong>und</strong> der hohen Energiekosten rückläufige Ankunfts-<br />
zahlen aus, was die Schweiz auch betrifft. Die Schweiz konnte aber ihre intakten Landschaften,<br />
die attraktiven Städte <strong>und</strong> die Unterschiede zwischen den Regionen erhalten <strong>und</strong> profitiert von<br />
einem stark wachsenden Binnentourismus.<br />
4.5.2 Fazit<br />
Die Kantone waren den steigenden Herausforderungen der Weltwirtschaft nicht mehr gewach-<br />
sen, weshalb in der Schweiz die Ebene der Regionen eingeführt wurde. Diese haben es ge-<br />
schafft, gleichzeitig die Integration in die Weltwirtschaft <strong>und</strong> den inneren Zusammenhalt durch<br />
Identität sicher zu stellen. Die Bevölkerung ist insgesamt weniger mobil <strong>und</strong> richtet sich weit-<br />
gehend auf das Leben innerhalb der Regionen aus.<br />
44
<strong>Vorstadt</strong> <strong>Rontal</strong> ____________________________________________________________________________________ Juli 2011<br />
5 Vier Szenarien für das <strong>Rontal</strong><br />
Auf den oben stehenden <strong>Analyse</strong>n aufbauend soll nun die zukünftige Raumentwicklung im<br />
<strong>Rontal</strong> diskutiert werden. Dazu werden nochmals die vier Szenarien beigezogen, die in Kapitel 4<br />
vorgestellt wurden. Anhand jedes Szenarios wird eine mögliche räumliche Entwicklung des<br />
<strong>Rontal</strong>s bis ins Jahr 2030 diskutiert. Den Szenarien entsprechend ergeben sich daraus vier sehr<br />
unterschiedliche Zukunftsbilder, die nur wenige Elemente gemeinsam haben.<br />
Durch diese Diskussion in Szenarien wird vorerst ein Zwischenschritt geleistet, der anstelle der<br />
wünschbaren Zukunft die wahrscheinlichen Zukünfte beleuchtet. Aufbauend auf den ausfor-<br />
mulierten Szenarien werden erst anschliessend Elemente der einzelnen vier Diskussionen so<br />
kombiniert, dass sich eine Vision für die zukünftige Entwicklung des <strong>Rontal</strong>s ergibt.<br />
Im Interesse einer einfachen Verständlichkeit die vier Szenarien so formuliert, wie wenn wir uns<br />
bereits im Jahr 2030 befänden <strong>und</strong> aus der Zukunft auf die vergangene Entwicklung zurück<br />
schauen würden.<br />
5.1 Trendszenario: Zug entleert sich ins <strong>Rontal</strong> hinein<br />
Die Metropolisierung der Schweiz hat dazu geführt, dass der Einfluss von Zürich auf die Region<br />
Luzern stark zugenommen hat. Insbesondere pendeln sehr viele Zentralschweizer täglich nach<br />
Zürich, weshalb das Verkehrsaufkommen auf Strasse <strong>und</strong> Scheine fast unerträgliche Ausmasse<br />
angenommen hat. Viele Betriebe in Luzern sind als Zulieferer direkt von der Wirtschaft im<br />
Grossraum Zürich abhängig. Im <strong>Rontal</strong>, das über den direkten Anschluss der Autobahn A4 <strong>und</strong><br />
den Schnellzughalt in Ebikon besonders gut nach Zug <strong>und</strong> Zürich angeb<strong>und</strong>en ist, hat diese<br />
Entwicklung besonders stark akzentuiert stattgef<strong>und</strong>en.<br />
Hier hat entsprechend eine dynamische bauliche Entwicklung stattgef<strong>und</strong>en. Heute wohnen<br />
über 35‘000 Menschen im <strong>Rontal</strong>, was einem Wachstum von über 50% in 25 Jahren entspricht.<br />
Die Immobilienpreise in Zürich, Zug <strong>und</strong> an den zentralen Lagen in der Stadt Luzern sind inzwi-<br />
schen so stark angestiegen, dass eine grossflächige Gentrification stattgef<strong>und</strong>en hat. Mittel-<br />
ständische Familien ziehen zunehmend an peripherere Wohnorte. Im <strong>Rontal</strong> wohnen die Men-<br />
schen – je nach verfügbarem Einkommen – in verdichteten Wohnsiedlungen an zentraler Lage,<br />
oder im Reihen- bzw. Terrasseneinfamilienhaus am Hang.<br />
Verschiedene Steuersenkungen im Kanton Luzern seit dem Jahr 2012 haben dazu geführt, dass<br />
das <strong>Rontal</strong> für Firmen mit hohem Umsatz bedeutend attraktiver geworden ist. Zahlreiche An-<br />
bieter von Unternehmens- <strong>und</strong> von Finanzdienstleistungen haben aufgr<strong>und</strong> der exorbitanten<br />
Quadratmeterpreise in Zürich <strong>und</strong> Zug ihre Büros ins <strong>Rontal</strong> verlegt – <strong>und</strong> zwar sowohl Backof-<br />
45
<strong>Vorstadt</strong> <strong>Rontal</strong> ____________________________________________________________________________________ Juli 2011<br />
fices als auch Headquarters. Das riesige Gefälle in der Pro-Kopf-Produktivität, das früher die<br />
Kantonsgrenze zwischen Zug <strong>und</strong> Luzern markiert hat, wurde mit den Steuersenkungen weit-<br />
gehend ausgeglättet. Daraufhin hat sich der Kanton Zug quasi ins <strong>Rontal</strong> hinein „entleert“.<br />
Die Schindler-Gruppe ist in Umsatz <strong>und</strong> Gewinn zur Branchennummer 1 weltweit aufgerückt<br />
<strong>und</strong> bietet heute mehr als r<strong>und</strong> 2400 Mitarbeitenden einen Arbeitsplatz an, was einem Wachs-<br />
tum von 30% seit 2010 entspricht. Weitere Zulieferer von Schindler sind ins <strong>Rontal</strong> gezogen,<br />
nachdem die Just-in-time-Produktion noch straffer organisiert wurde.<br />
Abbildung 16 Trendszenario: Zug entleert sich ins <strong>Rontal</strong> hinein<br />
Quelle: Siegrist Comamala Architekten, Biel<br />
Die zentralen Lagen werden im <strong>Rontal</strong> zunehmend begehrter. Gleichzeitig werden hochwertige<br />
Grünräume knapp, obwohl einige Gebiete unter Naturschutz gestellt werden konnten. Entspre-<br />
chend hat das lokale Parlament eine konsequente bauliche Verdichtung nach innen beschlos-<br />
sen. An zentralen Lagen wurden sehr hohe Nutzungsziffern eingesetzt, <strong>und</strong> entlang der aufge-<br />
werteten K17 wurden mehrere grosse Hochhauszonen bewilligt. Daraus ist eine Verdichtung<br />
entstanden, die an amerikanische Verhältnisse im Kleinstmassstab erinnert. Um einen Quasi-<br />
Central Business District gruppieren sich die Unternehmensdienstleister sowie verdichtete<br />
Wohnbauten, nach aussen hin geht die Siedlung allmählich in einen ubiquitären Wohnsied-<br />
lungsbrei über. Aufgr<strong>und</strong> der hohen Kosten für neue Infrastrukturen musste auf die dringend<br />
notwendige Aufwertung des öffentlichen Raumes verzichtet werden.<br />
46
<strong>Vorstadt</strong> <strong>Rontal</strong> ____________________________________________________________________________________ Juli 2011<br />
Durch die intensive <strong>Entwicklungs</strong>dynamik haben sich auch die Disparitäten im <strong>Rontal</strong> ver-<br />
schärft. Das heimische Gewerbe wird von finanzkräftigeren Unternehmen von ihren ursprüngli-<br />
chen Firmengeländen verdrängt. Die einheimische Bevölkerung konnte das schnelle Wachstum<br />
durch zugezogene Mitbürger nicht wohlwollend annehmen <strong>und</strong> hat starke Abschottungsten-<br />
denzen entwickelt. Neid <strong>und</strong> Missgunst prägen das Lebensgefühl dieser Bevölkerungsgruppe.<br />
Sowohl in der Wirtschaft als auch in der Bevölkerung <strong>und</strong> im öffentlichen Leben ist damit eine<br />
Zweischichtengesellschaft entstanden. Auf der einen Seite findet sich eine Gruppe von Einhei-<br />
mischen, die weiterhin wichtige Bereiche von Wirtschaft <strong>und</strong> Politik bestimmt. Ergänzt wird die-<br />
se Gruppe durch Menschen, die sich ihr zugehörig fühlen, so z.B. alt eingesessene Familien <strong>und</strong><br />
Arbeiter mit Wurzeln im <strong>Rontal</strong>. Auf der anderen Seite steht eine gut verdienende Schicht von<br />
hypermobilen Arbeitsmigranten, die einen hedonistischen Lebensstil führen <strong>und</strong> kein Interesse<br />
an einer funktionierenden Gesellschaft zeigen. Aus dieser Situation ist eine soziale Spannung<br />
entstanden, die ein relevantes Potential für grössere Konflikte enthält.<br />
5.2 Zersiedlung: Das <strong>Rontal</strong> wird zugebaut<br />
Die Schwächung des Staates im Allgemeinen <strong>und</strong> der Raumplanung im Speziellen hat zu einem<br />
laissez-faire in der räumlichen Organisation von Arbeiten <strong>und</strong> Wohnen geführt. Für die wach-<br />
senden individuellen Ansprüche an Wohnraum wurden – trotz leicht rückgängiger Bevölke-<br />
rungsentwicklung – in kurzen Abständen neue Baulandreserven geschaffen. Entsprechend prä-<br />
sentierte sich das <strong>Rontal</strong> in den vergangenen 20 Jahren als permanente Baustelle, die mit dem<br />
Siedlungsrand jeweils weiter nach aussen wanderte.<br />
Heute sind alle Bauzonen inklusive der Hanglagen komplett überbaut, <strong>und</strong> ein endloser Tep-<br />
pich an Einfamilienhäusern überzieht das <strong>Rontal</strong>. Die Hanglagen wurden für grosse Terrassen-<br />
hauskomplexe genutzt, was sich auf das Landschaftsbild besonders negativ auswirkt. Die Sied-<br />
lung wirkt insgesamt zufällig organisiert. Aufgr<strong>und</strong> des wachsenden Angebotes an Bauland<br />
stiegen auch die Immobilienpreise nur schwach an. Die ständige Erweiterung der Siedlung hat<br />
hingegen die öffentliche Hand zu riesigen Investitionen in Verkehrs-, Telekommunikations- <strong>und</strong><br />
Energieinfrastrukturen gezwungen, die zusammen mit den steigenden Kosten für deren Unter-<br />
halt zu einer grossen Belastung geworden sind.<br />
Die tiefe Dichte <strong>und</strong> ein zunehmend individualisierter Lebensstil haben dazu geführt, dass auch<br />
kleine Haushalte meist über zwei oder mehr Autos verfügen. Das daraus entstehende Ver-<br />
kehrsaufkommen führt insbesondere in den morgendlichen <strong>und</strong> abendlichen Spitzenst<strong>und</strong>en<br />
zu einem regelmässigen Verkehrskollaps. Die öffentliche Hand kann den Forderungen für eine<br />
zusätzliche Strasseninfrastruktur aufgr<strong>und</strong> von Geld- <strong>und</strong> Platzmangel nicht mehr nachkom-<br />
men. Da auf einen Ausbau des öffentlichen Verkehrs verzichtet wurde, stehen die veralteten<br />
Dieselgelenkbusse ebenfalls sehr oft im Stau. Verspätungen <strong>und</strong> verpasste Anschlüsse in Luzern<br />
<strong>und</strong> Rotkreuz gehören zum Alltag.<br />
47
<strong>Vorstadt</strong> <strong>Rontal</strong> ____________________________________________________________________________________ Juli 2011<br />
Abbildung 17 Zersiedlung: Das <strong>Rontal</strong> wird zugebaut<br />
Quelle: Siegrist Comamala Architekten, Biel<br />
Die erhoffte Stärkung von wertschöpfungsintensiven Branchen im <strong>Rontal</strong> konnte nicht realisiert<br />
werden. Vielmehr haben sich zahlreiche neue Logistikunternehmen angesiedelt, die von der<br />
guten Erreichbarkeit des <strong>Rontal</strong>s profitieren. Die ständige Überlastung der Region Zürich <strong>und</strong><br />
des Autobahnkreuzes A1/A2 hat dazu einen wichtigen Beitrag geleistet. Die Firma Schindler<br />
musste nach einem langjährigen Niedergang vor einigen Jahren die Produktion <strong>und</strong> Entwick-<br />
lung komplett nach China verlegen, was zum Verlust von über 1500 Arbeitsplätzen <strong>und</strong> grossen<br />
Protesten aus der Bevölkerung führte. In Ebikon blieben nur die wichtigsten Headquarterfunk-<br />
tionen mit weniger als 300 Arbeitsplätzen erhalten. Grosse Brachen aus der ehemaligen Blüte-<br />
zeit konnten bis heute nicht nachgenutzt werden.<br />
Geradezu explodiert ist hingegen die Anzahl neuer Fachmärkte. Neben allen grossen Möbel-<br />
häusern haben sich Fachmärkte aller Branchen angesiedelt: Heim <strong>und</strong> Hobby, Garten, Babybe-<br />
darf, Sport, Unterhaltungselektronik, Erotik <strong>und</strong> weitere. Die gute Erreichbarkeit <strong>und</strong> die gros-<br />
sen Parkplatzkapazitäten werden von den K<strong>und</strong>en geschätzt. Abends sorgen drei grosse Mul-<br />
tiplexkinos sowie unzählige Sport- <strong>und</strong> Unterhaltungsmöglichkeiten für eine intensive Nutzung<br />
durch die Bevölkerung aus der Agglomeration sowie der Region Zug-Zürich, wo extensive<br />
Raumnutzungen vorausschauend eingedämmt wurden.<br />
48
<strong>Vorstadt</strong> <strong>Rontal</strong> ____________________________________________________________________________________ Juli 2011<br />
Die Zivilgesellschaft präsentiert sich fast vollständig zersplittert. Die Traditionsvereine (Musik,<br />
Turnen, Fussball, Handball <strong>und</strong> Tennis) wurden aufgelöst, die Menschen bevorzugen individuel-<br />
les Vergnügen zu Hause oder in dafür eingerichteten Clubs für Fitness oder Unterhaltung. Das<br />
Engagement für öffentliche Aufgaben ist fast komplett weggebrochen, was bei Gemeinderats-<br />
wahlen regelmässig zu einem Mangel an geeigneten Kandidaten <strong>und</strong> einer minimalen Wahlbe-<br />
teiligung führt. Die Menschen treffen sich vorwiegend innerhalb ihrer nach aussen abgeschot-<br />
teten Wohnsiedlungen.<br />
5.3 Polyurbanes Städtenetz: Das <strong>Rontal</strong> wird urbanisiert<br />
Die konsequente Ausrichtung der Schweizer Raumplanung auf die Entwicklung als Städtenetz<br />
hat dazu geführt, dass die Zersiedlung weitgehend eingedämmt werden konnte. Ein hervorra-<br />
gendes Netz des öffentlichen Verkehrs erschliesst die Städte untereinander <strong>und</strong> die Agglomera-<br />
tion fast flächendeckend im Viertelst<strong>und</strong>entakt. Das <strong>Rontal</strong> profitiert dank der Fertigstellung<br />
von Zimmerberg II <strong>und</strong> Tiefbahnhof Luzern von einem Viertelst<strong>und</strong>entakt auf den Fernver-<br />
kehrsverbindungen. Die ambitiösen Pläne für den Ausbau der S-Bahn mussten hingegen auf-<br />
gr<strong>und</strong> von Engpässen im Bahnhof Luzern verschoben werden – das <strong>Rontal</strong> wird deshalb wei-<br />
terhin im Halbst<strong>und</strong>entakt bedient.<br />
Aufgr<strong>und</strong> der positiven Erfahrungen im Glatttal sowie im Limmattal liessen sich Politik <strong>und</strong> Pla-<br />
nung jedoch davon überzeugen, dass sich diese Lücke mit einer Trambahn schliessen <strong>und</strong> da-<br />
mit eine städtebauliche Aufwertung besonders effektiv umsetzen lässt. Der Bau der Tramlinie<br />
<strong>Rontal</strong> gab den betreffenden Gemeinden grosse <strong>Entwicklungs</strong>impulse <strong>und</strong> eine neue Identität.<br />
Die Realisierung solch grosser Projekte im öffentlichen Verkehr wurde überhaupt erst möglich<br />
durch den Anschluss aller <strong>Rontal</strong>er Gemeinden bis <strong>und</strong> mit Gisikon an die Stadt Luzern <strong>und</strong> die<br />
vom B<strong>und</strong> dafür bereit gestellten Finanzmittel.<br />
Zusammen mit dem Tram wurde auch eine umfassende Aufwertung des öffentlichen Raumes<br />
geplant <strong>und</strong> konsequent umgesetzt. Entsprechend präsentierten sich heute insbesondere die<br />
gut frequentierten Lagen in einem erfreulichen Bild. Die komplett sanierte K17 (heute „Luzer-<br />
nerallee“) lädt dank der langen Baumalleen zum Flanieren ein. Auch das weitere Verkehrsnetz<br />
für Fussgänger <strong>und</strong> Velofahrer wurde konsequent ausgebaut, <strong>und</strong> es wird sowohl auf dem Ar-<br />
beitsweg als auch in der Freizeit rege benutzt.<br />
Dank der Stärkung des öffentlichen Verkehrs <strong>und</strong> des Langsamverkehrs beschränken sich Ver-<br />
kehrsprobleme im <strong>Rontal</strong> auf die Samstage, an denen nach wie vor in grösseren Fachmärkten<br />
mit dem Auto eingekauft wird. Der Schwerverkehr konnte nur teilweise aus dem <strong>Rontal</strong> ver-<br />
drängt werden, stellt aber aufgr<strong>und</strong> der gestiegenen Konzentration der verkehrsintensiven Ein-<br />
richtungen <strong>und</strong> des zentralen Autobahnanschlusses eine geringere Belastung dar als früher.<br />
49
<strong>Vorstadt</strong> <strong>Rontal</strong> ____________________________________________________________________________________ Juli 2011<br />
Die Aufwertung des Images des <strong>Rontal</strong>s hat zusammen mit einer starken Nachfrage nach Woh-<br />
nungen <strong>und</strong> attraktiven Flächen für Dienstleistungen zu einem Wachstum von Bevölkerung<br />
<strong>und</strong> Beschäftigten geführt. Um das Bevölkerungswachstum von über 20% – bei einem gleich-<br />
zeitig anhaltenden Flächenverbrauch pro Person – bewältigen zu können, wurden die zentral<br />
gelegenen Wohngebiete kontinuierlich verdichtet.<br />
Heute lebt ein Grossteil der Menschen im <strong>Rontal</strong> in sechs- bis achtstöckigen Wohngebäuden,<br />
welche dem <strong>Rontal</strong> zusammen mit dem öffentlichen Verkehr insgesamt einen sehr urbanen<br />
Charakter geben. Prägendes bauliches Element sind die neu geschaffenen Blockrandbebauun-<br />
gen, die an Paris, Barcelona oder die Luzerner Neustadt erinnern. Ältere Einfamilienhausquartie-<br />
re wurden laufend nachverdichtet, so dass sich heute im <strong>Rontal</strong> nur noch wenige freistehende<br />
Einfamilienhäuser finden.<br />
Abbildung 18 Polyurbanes Städtenetz: Das <strong>Rontal</strong> wird urbanisiert<br />
Quelle: Siegrist Comamala Architekten, Biel<br />
Die neu geschaffenen Arbeitsstellen entstanden vor allem im Dienstleistungsbereich. In der<br />
Nähe der Bahnhöfe sowie an mehreren Tramhaltestellen entstanden Dienstleistungszentren<br />
<strong>und</strong> grössere Bürogebäude, die auch grössere zusammenhängende Büroflächen bieten kön-<br />
nen. Durch die konsequente Nachnutzung von Brachen <strong>und</strong> Altbauten an zentralen Lagen<br />
musste dafür nur an wenigen Orten neues Bauland eingezont werden.<br />
50
<strong>Vorstadt</strong> <strong>Rontal</strong> ____________________________________________________________________________________ Juli 2011<br />
Im <strong>Rontal</strong> haben sich inzwischen Firmen aus der Pharma- <strong>und</strong> der IT-Branche sowie aus unter-<br />
nehmensorientierten Dienstleistungen niedergelassen. Daraus entstanden ist ein lebendiges<br />
<strong>und</strong> aktives Unternehmensnetzwerk, das sich einerseits aus Grossunternehmen <strong>und</strong> anderer-<br />
seits aus innovativen Kleinunternehmen <strong>und</strong> Neugründungen zusammensetzt. Dieser Unter-<br />
nehmergeist wirkt durchaus auch anziehend auf neue Firmen.<br />
5.4 Territoriale Solidarität: Das <strong>Rontal</strong> bleibt <strong>Vorstadt</strong><br />
Das Szenario „Regionen“ enthält nur wenige direkte Hinweise auf die räumliche Organisation<br />
<strong>und</strong> die bauliche Entwicklung in den Regionen der Schweiz, weshalb hier auf eine eingehende<br />
Diskussion verzichtet werden muss. Es lässt sich einzig sagen, dass beim beschriebenen Rück-<br />
zug auf die Region <strong>und</strong> stark steigenden Energiepreisen damit zu rechnen ist, dass das <strong>Rontal</strong> in<br />
seiner heutigen Ausprägung erstarrt. Das würde insbesondere bedeuten, dass sich der Lebens-<br />
raum der meisten Menschen im Alltag auf den Raum Luzern beschränken würde. Das <strong>Rontal</strong><br />
bleibt damit auf Jahrzehnte hinaus ein Vorort.<br />
Abbildung 19 Territoriale Solidarität: Das <strong>Rontal</strong> bleibt <strong>Vorstadt</strong><br />
Quelle: Siegrist Comamala Architekten, Biel<br />
51
<strong>Vorstadt</strong> <strong>Rontal</strong> ____________________________________________________________________________________ Juli 2011<br />
5.5 Fazit: Lernen aus den Szenarien<br />
Die Untersuchung verschiedener Szenarien für das <strong>Rontal</strong> hat vier Zukünfte gezeigt, die sehr<br />
unterschiedlich von einander sind. Es wurde festgehalten, dass das Trendszenario („Metropoli-<br />
sierung“) eine nicht nachhaltige Entwicklung mit sich bringt <strong>und</strong> deshalb keine Option für die<br />
Zukunftsgestaltung im <strong>Rontal</strong> sein kann. Das heisst also, dass auf politischer <strong>und</strong> planerischer<br />
Ebene gehandelt werden muss, wenn sich das <strong>Rontal</strong> nachhaltig entwickeln soll. Das Szenario<br />
Städtenetz kommt dieser Forderung einer nachhaltigen Entwicklung am nächsten <strong>und</strong> wird<br />
deshalb als Ausgangslage für eine räumliche <strong>Entwicklungs</strong>strategie genommen.<br />
In der Schweiz finden sich zahlreiche Analogien zur Raumentwicklung im <strong>Rontal</strong>, so z.B. der<br />
Westen von Lausanne (Ouest lausannois), das Glatttal <strong>und</strong> das Limmattal. Hier sind Aufwertun-<br />
gen bereits gelungen oder in Planung. Diesen drei <strong>und</strong> weiteren Beispielen ist gemeinsam, dass<br />
die Aufwertung des öffentlichen Verkehrs <strong>und</strong> des öffentlichen Raumes eine zentrale Rolle<br />
spielten. Im anschliessenden Kapitel wird nun eine städtebauliche Strategie für das <strong>Rontal</strong> skiz-<br />
ziert. Dabei wird auf fünf Teilstrategien zurück gegriffen, die von Lampugnani et al. vorgeschla-<br />
gen wurden (cf. Kapitel 2.3).<br />
52
<strong>Vorstadt</strong> <strong>Rontal</strong> ____________________________________________________________________________________ Juli 2011<br />
6 Eine räumliche <strong>Entwicklungs</strong>strategie für das <strong>Rontal</strong><br />
Die Ausgangslage für eine räumliche <strong>Entwicklungs</strong>strategie für das <strong>Rontal</strong> lässt sich aus der<br />
städtebaulichen <strong>Analyse</strong> <strong>und</strong> der Szenarioanalyse ableiten. Im <strong>Rontal</strong> bestehen bereits heute<br />
bedeutende städtebauliche Defizite. Ohne aktives Eingreifen von Seiten der Behörden wird sich<br />
die Raumentwicklung ausserdem in eine nicht nachhaltige Richtung bewegen. Um das <strong>Rontal</strong><br />
tiefgreifend <strong>und</strong> langfristig aufzuwerten, braucht es deshalb einen beherzten Einsatz der rele-<br />
vanten Akteure bei Kanton <strong>und</strong> den betroffenen Gemeinden. Die <strong>Entwicklungs</strong>strategie für die<br />
Raumentwicklung im <strong>Rontal</strong> setzt dabei auf die in Kapitel 2.3 vorgestellten fünf Teilstrategien,<br />
nämlich die…<br />
− Stärkung des öffentlichen Raums<br />
− Schaffung von Kohärenz<br />
− Vernetzung<br />
− Verdeutlichung von Grenzen <strong>und</strong><br />
− Schaffung von Identifikationsorten<br />
6.1 Stärkung des öffentlichen Raums<br />
Als dringendste Massnahme zur Aufwertung des öffentlichen Raums ist die komplette Neuges-<br />
taltung der K17 einzustufen. Die bestehenden Lichtsignalanlagen sind durch Kreisverkehre zu<br />
ersetzen, die bestehende Breite inklusive Zufahrten zu redimensionieren <strong>und</strong> die Begehungs-<br />
<strong>und</strong> Kreuzungsmöglichkeiten zu verbessern. Entsprechende Gestaltungsstudien bestehen be-<br />
reits. Die Geschwindigkeit ist innerorts auf 50, in den Dorfzentren auf 30 km/h zu begrenzen.<br />
Erste Priorität erhält dabei das Gebiet im Dorfkern von Ebikon; dies entspricht dem Abschnitt<br />
von der Abzweigung Richtung Löchli bis zur Abzweigung nach Buchrain. Hier wird die Ge-<br />
schwindigkeit auf 30 km/h herabgesetzt <strong>und</strong> die Strassenbreite auf zwei Spuren reduziert. Brei-<br />
te Trottoirs <strong>und</strong> eine Baumallee machen das Flanieren attraktiv. Die grosse Strassenkreuzung<br />
(inklusive Parkplatz) vor dem Restaurant Sonne wird in einen Dorfplatz umgewandelt; die Bra-<br />
che vor dem Gemeindehaus in einen urbanen Park mit Cafés <strong>und</strong> Läden.<br />
Dieser heute brach liegende Platz erhält ein komplett neues Gesicht. Hier treffen sich jung <strong>und</strong><br />
alt, um im Park zu spielen, den Tag zu geniessen, oder um zusammen zur Arbeit zu fahren. Die-<br />
ser hat aufgr<strong>und</strong> seiner zentralen Lage <strong>und</strong> in Hommage an das nie realisierte Einkaufszentrum<br />
den Namen „Ebisquare“ erhalten. Die Dorfzentren werden regelmässig für den motorisierten<br />
Verkehr gesperrt, um öffentliche Anlässe durchzuführen.<br />
53
<strong>Vorstadt</strong> <strong>Rontal</strong> ____________________________________________________________________________________ Juli 2011<br />
Der Bahnhofplatz wird zum attraktiven Treffpunkt, auf dem direkte Anschlüsse zwischen Bus<br />
<strong>und</strong> Bahn angeboten werden. Das gesamte Gebiet zwischen Bahntrassee, Sonne <strong>und</strong> Hofmatt<br />
soll in einer Gesamtbetrachtung geplant werden. Ein durchgängiger Bodenbelag <strong>und</strong> eine ein-<br />
heitliche Möblierung <strong>und</strong> neue Gebäude, die den Platz einfühlsam begrenzen, tragen zur Schaf-<br />
fung eines neuen Dorfzentrums bei.<br />
In zweiter Priorität sind schliesslich auch die Dorfdurchfahrten von Buchrain, Dierikon <strong>und</strong> Root<br />
in ähnlicher Vorgehensweise aufzuwerten – auch hier besteht beträchtliches Potential.<br />
6.2 Schaffung von Kohärenz<br />
Die Schaffung von Kohärenz stellt im <strong>Rontal</strong> eine besondere Herausforderung dar, da sich auf<br />
engem Raum Gebäude unterschiedlichster Funktion, Bauzeit <strong>und</strong> -qualität finden (cf. Anhang I).<br />
Dennoch ist Kohärenz für die Entwicklung in Richtung eines urbaneren <strong>Rontal</strong>s eine zentrale<br />
Teilstrategie, denn sie kann die heute bestehenden Brüche in der räumlichen Struktur überwin-<br />
den helfen. Als prägendes städtebauliches Element wird an zentralen Lagen eine Blockrandbe-<br />
bauung vorgeschlagen, die sich an den europäischen Stadterweiterungen des 19. Jahrh<strong>und</strong>erts<br />
orientiert. Die Nutzung wird stark durchmischt gestaltet, wobei Wohnen <strong>und</strong> Dienstleistungen<br />
dominieren. Die Erdgeschosse der Neubauten sind für öffentlich zugängliche Nutzungen wie<br />
Läden oder Gastronomie reserviert. Dadurch entsteht in den verdichteten Gebieten ein urbanes<br />
Flair. Cafés <strong>und</strong> Restaurants nutzen die grosszügigen neuen Trottoirs zur Bewirtung der Gäste<br />
an der frischen Luft.<br />
6.3 Vernetzung<br />
Der Ausbau <strong>und</strong> die Priorisierung des öffentlichen Verkehrs bilden das eigentliche Rückgrat ei-<br />
ner qualitativen Raumentwicklung im <strong>Rontal</strong>. Beispiele aus dem Inland (Zürich-Glatttal, Genf-<br />
Annemasse, Basel-Weil am Rhein, Bern West) <strong>und</strong> Ausland (Bordeaux, Valencia, Budapest) zei-<br />
gen insbesondere für suburbane Räume auf, dass dabei eine Tram- oder Stadtbahn die ent-<br />
scheidende Rolle übernehmen kann.<br />
Im <strong>Rontal</strong> wird diese Funktion von der neu zu erstellenden <strong>Rontal</strong>bahn übernommen. Diese<br />
Stadtbahn wird im <strong>Rontal</strong> den bestehenden 30‘-Takt auf der S-Bahn ergänzen. Die <strong>Rontal</strong>bahn<br />
führt vom Bahnhof Luzern bis zum Verkehrsknoten Rotkreuz. Innerhalb des <strong>Rontal</strong>s verläuft das<br />
Trassee auf der bestehenden K17, auf den heute vierspurigen Abschnitten als Eigentrassee.<br />
Vom Bahnhof Ebikon-<strong>Rontal</strong> führen Busverbindungen nach Perlen, Buchrain <strong>und</strong> Inwil. Diese<br />
drei Dörfer profitieren ausserdem von neuen Buslinien, die als Eilkurse via Autobahn direkt nach<br />
Luzern geführt werden. Der neue Schnellzughalt Ebikon-<strong>Rontal</strong> stellt halbstündlich direkte Ver-<br />
bindungen nach Zug <strong>und</strong> Zürich sicher.<br />
54
<strong>Vorstadt</strong> <strong>Rontal</strong> ____________________________________________________________________________________ Juli 2011<br />
Einen neuen Stellenwert erhält auch das Netz für den Langsamverkehr. Es wird entlang der re-<br />
naturierten Ron bis Perlen <strong>und</strong> von dort durchgehend bis Rotkreuz ausgebaut. Damit werden<br />
auch alle Bahnhöfe bzw. Stationen des <strong>Rontal</strong>s mit einander verb<strong>und</strong>en. Die Lücke im Netz nach<br />
Luzern wird behoben. Neben Velofahrern treffen sich darauf auch Spaziergänger <strong>und</strong> Inline<br />
Skater. Das Langsamverkehrsnetz im <strong>Rontal</strong> wird mit diesen Massnahmen so attraktiv, dass es<br />
auch regelmässig von Personen aus dem Kanton Zug genutzt wird. Ein öffentliches Verleihsys-<br />
tem mit Velos <strong>und</strong> E-Bikes steht an Bahnhöfen, bei Unternehmen <strong>und</strong> in Wohnquartieren zur<br />
Verfügung <strong>und</strong> hat das <strong>Rontal</strong> zu einem Mekka für Zweiradmobilität gemacht.<br />
6.4 Verdeutlichung von Grenzen<br />
Im <strong>Rontal</strong> existieren mit der Bahn- <strong>und</strong> Strasseninfrastruktur bereits heute starke Grenzen, die<br />
das Wohngebiet vom Industrie- <strong>und</strong> Gewerbegebiet räumlich trennt. Diese Grenze kann <strong>und</strong><br />
soll weiter gestärkt werden. Das unten porträtierte Schindler-Hochhaus kann als punktuelle<br />
Verstärkung der Grenze funktionieren – allerdings nur für Automobilisten, die vom Autobahn-<br />
zubringer her das <strong>Rontal</strong> erreichen. Eine bauliche Markierung des Ortsrandes von Dierikon bzw.<br />
Längenbold soll die Freihaltung eines letzen durchgehenden Grüngürtel sicher stellen <strong>und</strong> das<br />
bebaute Gebiet markant vom Nichtbaugebiet trennen.<br />
6.5 Schaffung von Identifikationsorten<br />
Die hohe Notwendigkeit von identitätsstiftenden Elementen wurde im <strong>Rontal</strong> bereits erkannt,<br />
denn das Kunstwerk Tension-Energy beim Business Center D4 wurde gemäss Initianten mit die-<br />
ser Absicht erstellt. Öffentliche Kunstwerke können im gesamten <strong>Rontal</strong> eine identitätsstiftende<br />
Funktion erfüllen. Alte Bauwerke, insbesondere ungenutzte Scheunen <strong>und</strong> leer stehende Ge-<br />
werbe- <strong>und</strong> Industriebauten, können für Kunstgalerien, als Veranstaltungszentrum oder für an-<br />
dere öffentlich zugängliche Zwecke umgenutzt werden.<br />
Ein grosses Potential als Identifikationsort haben in Ebikon die Dorfkirche <strong>und</strong> der Bahnhof. Die<br />
auf einem Hügel gelegene Kirche muss baulich freigehalten <strong>und</strong> von der umgebenden dichten<br />
Vegetation befreit werden. Beim Bahnhof stehen die Gestaltung eines eigentlichen Bahnhof-<br />
platzes sowie die Realisierung von kommerziellen Nutzungen im Vordergr<strong>und</strong>. Auch an weite-<br />
ren S-Bahnhaltestellen ist mit zunehmender Bebauung an eine Aufwertung zu denken.<br />
Einen weiteren Identifikationsort könnte der Schindler-Konzern realisieren. Seine zentrale öko-<br />
nomische Bedeutung dürfte Schindler mit einem mutigen Hochhaus zeigen <strong>und</strong> damit einen<br />
zentralen Landmark (cf. Lynch) ins <strong>Rontal</strong> setzen. In einem prominent gestalteten Turm – ange-<br />
lehnt an den bestehenden Turm für Experimente – könnte hier das Unternehmen eigene Ar-<br />
beitsplätze, ein Penthouse-Restaurant sowie weitere interessierte Mieter unterbringen.<br />
55
<strong>Vorstadt</strong> <strong>Rontal</strong> ____________________________________________________________________________________ Juli 2011<br />
6.6 Umstrukturierung der Regionalwirtschaft<br />
Ein weiteres wesentliches Element der neuen urbanen Qualitäten im <strong>Rontal</strong> ist nicht baulicher,<br />
sondern ökonomischer Natur. Als Ersatz für flächenintensive Nutzungen wie Fachmärkte oder<br />
Logistikzentren sind im <strong>Rontal</strong> sind in Zukunft vermehrt wertschöpfungsintensive Branchen zu<br />
fördern, insbesondere Dienstleistungen für Unternehmen (z.B. Informatik oder Beratung) oder<br />
Unternehmen aus der Ges<strong>und</strong>heitsbranche. Eine zentrale Rolle in der Neugestaltung der Wirt-<br />
schaft kann Cleantech spielen, also Unternehmen, die einen Beitrag zu einer nachhaltigen Aus-<br />
richtung der Wirtschaft leisten.<br />
Zentrales Element dieser Entwicklung kann ein regionales Wirtschaftszentrum für Cleantech<br />
werden. Realisieren lässt sich dies durch den Schindler-Konzern auf dem ursprünglich für Ebis-<br />
quare reservierten Gelände. Hier können von Start-Ups bis zu internationalen Konzernen meh-<br />
rere duzend Unternehmen ihre Forschung <strong>und</strong> die Headquarterfunktionen im Bereich Clean-<br />
tech ansiedeln. Ein solches Cleantech-Zentrum muss auf die Zusammenarbeit mit führenden<br />
Hochschulen <strong>und</strong> Investitionen führender Technologiekonzerne setzen.<br />
Die unten stehende Visualisierung zeigt eine städtebauliche Vision für das <strong>Rontal</strong>, die auf den<br />
oben diskutierten Teilstrategien aufbaut. Der Ausschnitt zeigt das neu gestaltete Dorfzentrum<br />
von Ebikon sowie einen Abschnitt der „Luzernerallee“, der neu gestalteten Hauptstrasse K17. Im<br />
Anhang dieser Arbeit findet sich eine Gegenüberstellung mit dem Platz im heutigen Zustand.<br />
Abbildung 20 Vision für ein neues Dorfzentrum in Ebikon<br />
Quelle: Siegrist Comamala Architekten<br />
56
<strong>Vorstadt</strong> <strong>Rontal</strong> ____________________________________________________________________________________ Juli 2011<br />
7 Fazit für die Raumentwicklung Schweiz<br />
Die <strong>Vorstadt</strong> hat in der Schweiz eine grosse Bedeutung als Lebensraum; fast 50% der gesamten<br />
Bevölkerung wohnen in Agglomerationen ausserhalb der Kernstädte. Insofern ist es bemer-<br />
kenswert, dass die Vorstädte trotz ihrer grossen Bedeutung <strong>und</strong> ihres grossen <strong>Entwicklungs</strong>po-<br />
tentials unter Raum- <strong>und</strong> Stadtplanern bisher eher wenig Beachtung fanden. Tom Sieverts (sei-<br />
ne Arbeiten beziehen sich jedoch eher auf Deutschland) <strong>und</strong> eine jüngere Publikation von Prof.<br />
Vittorio Lampugnani et al. an der ETH Zürich bilden hierzu die Ausnahmen.<br />
Die <strong>Analyse</strong> des <strong>Rontal</strong>s hat exemplarisch aufgezeigt, dass in den Schweizer Vorstädten bedeu-<br />
tende städtebauliche Defizite bestehen, <strong>und</strong> zwar insbesondere beim öffentlichen Verkehr, in<br />
der Entwicklung nach innen <strong>und</strong> bei der Qualität des öffentlichen Raumes. In leicht abgeänder-<br />
ter Form lassen sich diese Defizite heute auch in den meisten anderen Vorstädten beobachten.<br />
Vielerorts sind in den vergangenen 50 Jahren Qualität <strong>und</strong> Identität verloren gegangen. Nach<br />
einem rasanten Wachstum in den 1960er- <strong>und</strong> 1970er-Jahren ist das Wachstum meist abge-<br />
flacht. Bei einem grossen Anteil des heutigen Immobilienbestandes stehen entsprechend in<br />
den kommenden 15 Jahren bedeutende Investitionen an.<br />
Diese speziellen Herausforderungen in den Agglomerationsgemeinden fallen zusammen mit<br />
zwei allgemeinen Herausforderungen der Schweizer Raumplanung. Einerseits zeigt sich, dass<br />
die Zersiedlung in der Schweiz in den vergangenen Jahrzehnten trotz der gesetzlichen Gr<strong>und</strong>-<br />
lagen kaum gebremst werden konnte. Die meisten Experten sind sich einig, dass die Lebens-<br />
qualität in der Schweiz nur aufrechterhalten werden kann, wenn die Zersiedlung wirksam ge-<br />
stoppt wird.<br />
Andererseits wird für die kommenden Jahre ein weiteres starkes Bevölkerungswachstum vor-<br />
ausgesagt, insbesondere aufgr<strong>und</strong> der Immigration gut gebildeter Arbeitskräfte. Gleichzeitig<br />
zum Bevölkerungswachstum geht der Flächenverbrauch pro Person weiter. Es ist also mittelfris-<br />
tig mit einem grossen Wachstum der Wohnflächen in der Schweiz zu rechnen. Bereits heute<br />
machen sich auf dem Wohnungsmarkt – weit über die Agglomeration Zürich hinaus – Zeichen<br />
einer Wohnungsknappheit bemerkbar. Experten (cf. Tagesanzeiger 2011) gehen von bis zu<br />
100‘000 Wohnungen aus, die in der Schweiz jährlich fehlen.<br />
Wie lassen sich nun die besonderen Herausforderungen der <strong>Vorstadt</strong> (Verkehr, öffentlicher<br />
Raum, Dichte) <strong>und</strong> die allgemeinen Herausforderungen der Schweizer Raumplanung (Zersied-<br />
lung, Wohnungsknappheit) so kombinieren, dass daraus ein Beitrag zur nachhaltigen Raum-<br />
entwicklung entsteht?<br />
57
<strong>Vorstadt</strong> <strong>Rontal</strong> ____________________________________________________________________________________ Juli 2011<br />
In der <strong>Vorstadt</strong> besteht aufgr<strong>und</strong> der meist geringen Dichte das Potential für Wachstum nach<br />
innen bzw. für höhere Ausnützung der bestehenden Bauflächen. Immobilien von tiefer Bauqua-<br />
lität (beispielsweise aus der Hochkonjunktur) bieten beim Ablauf ihrer Lebenszeit die Chance<br />
für gelungene Ersatzneubauten. Eine urbanere Bauweise <strong>und</strong> eine höhere bauliche Dichte an<br />
zentralen Lagen sind also möglich. Sie passen ausserdem bestens zur Aufwertung des öffentli-<br />
chen Raumes <strong>und</strong> zur Stärkung des öffentlichen Verkehrs. Dies wurde in der vorliegenden Ar-<br />
beit exemplarisch für das <strong>Rontal</strong> aufgezeigt.<br />
Allerdings stehen einer solchen Entwicklung bedeutende institutionelle <strong>und</strong> kulturelle Hinder-<br />
nisse im Wege. Erstens besteht zwischen Agglomerationsgemeinden <strong>und</strong> Kernstadt eine Ge-<br />
meindegrenze, die für eine gemeinsame Planung (Verkehr, Städtebau) ein relevantes Hindernis<br />
darstellt. Zweitens sind die meisten Schweizer Vorstädte geprägt von einer bürgerlich-<br />
konservativen Bevölkerung, die Neuerungen gegenüber wenig aufgeschlossen reagiert. Ent-<br />
sprechend plant jede Gemeinde vorwiegend in ihrem eigenen Interesse. Drittens besteht in der<br />
Schweiz gegenüber einer hohen Dichte generell eine Zurückhaltung; die Rückkehr des Hoch-<br />
hauses in der Stadt könnte hier allenfalls ein Vorbote für eine Entwicklung sein, die in näherer<br />
Zukunft auch in den Vorstädten (wieder) salonfähig wird.<br />
Für eine Aufwertung <strong>und</strong> Stärkung der Schweizer Vorstädte liegt die Hauptverantwortung bei<br />
der öffentlichen Hand. Eine erfolgreiche Entwicklung kann nur von Gemeinden, Kanton <strong>und</strong><br />
B<strong>und</strong> gemeinsam initiiert <strong>und</strong> umgesetzt werden. Private Initiativen können nur unterstützend<br />
wirken. Besonders vielversprechend ist in diesem Zusammenhang die Agglomerationspolitik<br />
des B<strong>und</strong>es. Sie setzt den Fokus auf eine gemeindeübergreifende Zusammenarbeit innerhalb<br />
der Agglomeration <strong>und</strong> adressiert damit viele der in dieser Arbeit diskutierten Probleme auf<br />
adäquate Weise.<br />
Noch einen Schritt weiter geht eine Fusion der Agglomerationsgemeinden <strong>und</strong> der Kernstadt.<br />
Nur sie erlaubt ein konsequentes Denken in grösseren (funktionellen) Räumen <strong>und</strong> ergänzt ein<br />
Agglomerationsprogramm ideal. Lugano <strong>und</strong> Luzern sind diesen Weg in den vergangenen Jah-<br />
ren bereits erfolgreich gegangen, <strong>und</strong> in der Agglomeration Luzern laufen aktuell Gespräche<br />
für weitere Gemeindefusionen.<br />
Auch die Gründung <strong>und</strong> die Arbeit des Gemeindeverbandes Luzern plus ist positiv zu beurtei-<br />
len, da Luzern plus eine gemeindeübergreifende Planung anstrebt <strong>und</strong> gezielt in problemati-<br />
schen Räumen interveniert. Auf nationaler Ebene braucht es ausserdem eine Anpassung beim<br />
Fokus der Infrastrukturpolitik vom Fernverkehr auf den Agglomerationsverkehr, wenn die rele-<br />
vanten Probleme im öffentlichen Verkehr gelöst werden sollen. Für die Agglomeration Luzern<br />
sind in diesem Zusammenhang der Zimmerberg II <strong>und</strong> der Tiefbahnhof Luzern von entschei-<br />
dender Bedeutung.<br />
58
<strong>Vorstadt</strong> <strong>Rontal</strong> ____________________________________________________________________________________ Juli 2011<br />
In den Schweizer Vorstädten besteht also ein beträchtliches Potential für die Lösung der drin-<br />
genden Probleme der Schweizer Raumentwicklung. Dafür braucht es einerseits den Mut, eine<br />
Urbanisierung der <strong>Vorstadt</strong> zu fordern <strong>und</strong> zu realisieren. Andererseits lässt sich eine Vision nur<br />
dann umsetzen, wenn eine gemeindeübergreifende Zusammenarbeit stattfindet <strong>und</strong> der B<strong>und</strong><br />
grössere Infrastrukturprojekte unterstützt. Die Agglomerationspolitik des B<strong>und</strong>es könnte in Zu-<br />
kunft auch für Luzern <strong>und</strong> damit für das <strong>Rontal</strong> relevante Verbesserungen bringen – allerdings<br />
nur unter der Bedingung dass das Luzerner Agglomerationsprogramm noch deutlich an Quali-<br />
tät gewinnt.<br />
59
<strong>Vorstadt</strong> <strong>Rontal</strong> ____________________________________________________________________________________ Juli 2011<br />
8 Quellen<br />
ARE (2005): Raumentwicklungsbericht Schweiz. Bern: B<strong>und</strong>esamt für Raumentwicklung<br />
ARE (2007): Bauzonenstatistik Schweiz 2007. Bern: B<strong>und</strong>esamt für Raumentwicklung<br />
Ecoptima (2003): Erläuterungsbericht zum Richtplan <strong>Entwicklungs</strong>schwerpunkt <strong>Rontal</strong>. Bern,<br />
Luzern: Ecoptima <strong>und</strong> Albrecht & Partner.<br />
Eisinger, Angelus (2005): Stadtland Schweiz. : Untersuchungen <strong>und</strong> Fallstudien zur räumlichen<br />
Struktur <strong>und</strong> Entwicklung in der Schweiz. Avenir Suisse; Angelus Eisinger[et al.](Hg.).<br />
Basel: Birkhäuser.<br />
Garreau, Joël (1991): Edge City: Life on the New Frontier. New York: Doubleday.<br />
Tagesanzeiger (2011): Interview mit Dr. Ernst Hauri im Tagesanzeiger vom 9. Juli 2011, p.3.<br />
Herzog, Jacques, Roger Diener, Marcel Meili, Pierre de Meuron <strong>und</strong> Christian Schmid (2005): Die<br />
Schweiz: ein städtebauliches Porträt. Basel, Berlin, Boston: Birkhäuser.<br />
Kanton Luzern (2011): A14-Anschluss Buchrain Zubringer <strong>Rontal</strong>. Online (22.6.2011):<br />
http://www.a14-buchrain-rontal.lu.ch/index.htm<br />
Küng, Lukas (2009): Machen wir es uns nicht zu einfach! Positionen, Kontroversen <strong>und</strong><br />
Kompromisse in der städtebaulichen Entwicklung. In: Archithese 3/2009, pp.12-17.<br />
Lampugnani, Vittorio Magnano et al., Hsg. (2007): Handbuch zum Stadtrand: Gestaltungsstrategien<br />
für den suburbanen Raum. Herausgegeben von Vittorio Magnano Lampugnani<br />
<strong>und</strong> Matthias Noell, mit Gabriela Barman-Krämer, Anne Brandl <strong>und</strong> Patric Unruh. Basel,<br />
Boston, Berlin: Birkhäuser.<br />
LUSTAT Statistik Luzern (2010): Gemeindeporträts der Gemeinden Ebikon, Dierikon, Buchrain<br />
<strong>und</strong> Root sowie Kantonsporträt Kanton Luzern. Online unter www.lustat.ch<br />
Lynch, Kevin (2007): Das Bild der Stadt. Basel, Berlin, Boston: Birkhäuser <strong>und</strong> Gütersloh, Berlin:<br />
Bauverlag BV. Erstausgabe: 1960 unter dem Titel „The Image of the City“.<br />
NSL (2010): Disp – The Planning Review. Netzwerk Stadt <strong>und</strong> Landschaft, Eidgenössische<br />
Technische Hochschule Zürich (Hg.): Nr. 181, 2/2010.<br />
Scott, Allan J. (1998): Regions and the world economy: the coming shape of global production,<br />
competition, and political order. Oxford: Oxford University Press.<br />
Sieverts, Thomas (2005): Zwischenstadt: zwischen Ort <strong>und</strong> Welt, Raum <strong>und</strong> Zeit, Stadt <strong>und</strong> Land.<br />
Basel, Berlin, Boston: Birkhäuser <strong>und</strong> Gütersloh, Berlin: Bauverlag BV. Erstausgabe: 1997.<br />
Soja, Edward J. (2000): Postmetropolis: Critical Studies of Cities and Regions. London: Blackwell.<br />
Sonderegger, Roger (2010): Das <strong>Rontal</strong>. Luzerner <strong>Vorstadt</strong> im städtebaulichen Fokus.<br />
Unveröffentlichtes Exposé am MAS-Programm in Raumplanung 2009/2011. Zürich: ETH.<br />
Venturi, Robert, Denise Scott Brown <strong>und</strong> Steven Izenour (1972): Learning from Las Vegas.<br />
Cambridge, Massachusetts.<br />
60
<strong>Vorstadt</strong> <strong>Rontal</strong> ____________________________________________________________________________________ Juli 2011<br />
61
<strong>Vorstadt</strong> <strong>Rontal</strong> ____________________________________________________________________________________ Juli 2011<br />
Anhänge<br />
A-1
<strong>Vorstadt</strong> <strong>Rontal</strong> ____________________________________________________________________________________ Juli 2011<br />
A 1 Dorfzentrum Ebikon heute <strong>und</strong> Vision für ein neues Dorfzentrum<br />
Quelle: Eigene Aufnahme<br />
A-2
<strong>Vorstadt</strong> <strong>Rontal</strong> ____________________________________________________________________________________ Juli 2011<br />
Quelle: Siegrist Comamala Architekten, Biel<br />
A-3
<strong>Vorstadt</strong> <strong>Rontal</strong> ____________________________________________________________________________________ Juli 2011<br />
A 2 Morphologische Detailanalyse<br />
Im Exposé zur vorliegenden Masterarbeit wurde eine morphologische Detailanalyse durchge-<br />
führt. Diese suchte nach Formen von Urbanität, die den vorstädtischen Lebensraum prägen.<br />
Dazu wurden entlang der Arbeiten von Lampugnani et al. (2007) vorgegangen, das sich diese<br />
insbesondere auf die <strong>Vorstadt</strong> beziehen <strong>und</strong> sich damit hervorragend für die empirischen Ana-<br />
lysen eigneten. Lampugnani et al. unterscheiden folgende morphologischen Kategorien.<br />
- Knoten: Als Knoten werden strategische Punkte im Stadtgefüge bezeichnet. Es handelt sich<br />
dabei um Orte räumlicher Konzentration von Funktionen, Gütern <strong>und</strong> Aktivitäten, die durch<br />
die Überlagerung <strong>und</strong> Bündelung verschiedener städtischer Strukturen entsteht. Knoten<br />
liegen historisch oftmals im Zentrum, in den letzten Jahrzehnten jedoch zunehmend an<br />
Strassenkreuzungen.<br />
- Relikte: Unverwechselbare Orte, die jedoch an Bedeutung verloren haben. In ihnen sind<br />
Spuren vergangener Stadtentwicklungsphasen erkennbar. Bei Relikten handelt es sich oft-<br />
mals um Dorfkerne oder Bauten mit Symbolkraft wie beispielsweise Hallen <strong>und</strong> Kamine der<br />
Schwerindustrie. Relikte liegen oft an alten Verkehrswegen <strong>und</strong> sind heute schlecht er-<br />
schlossen, tragen aber entscheidend zu Orientierung <strong>und</strong> Identifikation in der <strong>Vorstadt</strong> bei.<br />
- Siedlungsinseln: Mit Siedlungsinseln sind Wohnanlagen gemeint, die in sich geschlossen<br />
<strong>und</strong> durch kompaktes <strong>und</strong> homogenes Bauen nach aussen isoliert funktionieren. Siedlungs-<br />
inseln bergen die Gefahr von sozial exklusiven Räumen in sich. Noch treffender wäre für<br />
diese Kategorie der Begriff Wohninseln.<br />
- Restflächen: Ungenutzte <strong>und</strong> unbebaute Bereiche innerhalb des bebauten Bereiches, von<br />
bebauten Gr<strong>und</strong>stücken umgeben. Sie gehören sowohl zum Naturraum als auch zum<br />
Stadtraum <strong>und</strong> geben Auskunft darüber, wie hoch der Nutzungsdruck an einem Ort ist.<br />
- Zerhäuselung: Die Zerhäuselung beschreibt den Prozess der Zersiedlung, der meist an der<br />
Peripherie <strong>und</strong> in Form von freistehenden Einfamilienhäusern stattfindet. Die zentralen<br />
Triebkräfte der Zerhäuselung sind die Massenmotorisierung einerseits <strong>und</strong> die individuelle<br />
Bebauung andererseits. Die Zerhäuselung ist damit das Resultat einer Vielzahl von Einzel-<br />
entscheidungen ohne städtebauliches Gesamtkonzept.<br />
- Transiträume: Dies sind grosse Verkehrsräume, die stark linear <strong>und</strong> monofunktional für den<br />
Verkehr organisiert sind. Transiträume bieten Orientierung in der <strong>Vorstadt</strong>struktur, zer-<br />
schneiden diese jedoch gleichzeitig. Kleinräumig haben Transiträume stark trennenden<br />
Charakter; grossräumig betrachtet stellen sie jedoch Vernetzung her.<br />
A-1
<strong>Vorstadt</strong> <strong>Rontal</strong> _____________________ ____________________________________________________ ________________ Juli 2011<br />
Superkomplexe: Damit sind Ansammlungen An<br />
grosser Gebäude für Konsum, , Freizeit F <strong>und</strong> Dienst-<br />
leistungen gemeint, die oft an Transiträumen gelegen sind. Sie missachte hten den räumlichen<br />
Kontext <strong>und</strong> stellen damit auto tonome <strong>und</strong> isolierte Komplexe dar.<br />
Abbildung 21 Übersichtska karte morphologische Detailanalyse<br />
A-2
<strong>Vorstadt</strong> <strong>Rontal</strong> ____________________________________________________________________________________ Juli 2011<br />
8.1.1 Knoten<br />
Knoten sind strategische Punkte im Stadtgefüge, an denen sich mehrere Funktionen konzent-<br />
rieren <strong>und</strong> überlagern. Im <strong>Rontal</strong> sind Knoten überraschenderweise eher selten. Die Verkehrs-<br />
kreuzungen werden nur selten von anderen Nutzungen überlagert.<br />
Abbildung 22 Knoten<br />
An diesem Knoten an der K17 überlagern sich die Funktionen Verkehr, Einkauf <strong>und</strong> Freizeit<br />
8.1.2 Relikte<br />
Relikte sind sichtbare Zeugen von früher, die im Lauf der Zeit an Bedeutung verloren haben. Sie<br />
sind im <strong>Rontal</strong> gut sichtbar <strong>und</strong> besonders auffällig. Gr<strong>und</strong>sätzlich lassen sich vier Typen von<br />
Relikten beobachten:<br />
• Landwirtschaftsgebäude (Scheunen <strong>und</strong> Speicher)<br />
• Geistliche Gebäude (Kirchen <strong>und</strong> Kapellen)<br />
• Wohngebäude (Bauernhäuser <strong>und</strong> Weiler, die heute zu reinen Wohnzwecken dienen)<br />
• Traditionelle Gasthöfe (insbesondere Hotel Löwen)<br />
A-3
<strong>Vorstadt</strong> <strong>Rontal</strong> ____________________________________________________________________________________ Juli 2011<br />
Abbildung 23 Relikte<br />
Oben links: Nicht genutzte Scheune. zu Abstellzwecken genutzt.<br />
Oben rechts: Schlechte Architektur nimmt keine Rücksicht auf die Qualitäten des Bestandes.<br />
Mitte links: Dorfkirche (eingerüstet); ein an die K17 versetzter Speicher <strong>und</strong> ein Wohnhaus.<br />
Mitte rechts: Kapelle an einer Wohnstrasse ohne jeglichen Bezug zur Umgebung.<br />
Unten links: Relikt <strong>und</strong> Weltwirtschaft: Bauernhaus <strong>und</strong> DHL bei Dierikon.<br />
Unten rechts: Der traditionelle Weiler „Halte“ ist erhalten geblieben<br />
A-4
<strong>Vorstadt</strong> <strong>Rontal</strong> ____________________________________________________________________________________ Juli 2011<br />
8.1.3 Siedlungsinseln<br />
Unter Siedlungsinseln (Wohninseln; W) werden Anlagen verstanden, die sich bewusst nach aus-<br />
sen abgrenzen. Architektonisch manifestiert sich dies nicht in einem grösseren Abstand zu<br />
Nachbargebäuden, sondern vielmehr in ihrer homogenen inneren Struktur <strong>und</strong> in baulichen<br />
Grenzen zum direkten Umfeld.<br />
Abbildung 24 Siedlungsinseln<br />
Oben links: Wohnpark Feldmatt: nach innen gewandte Architektur; die Einfahrt erfolgt aus dem<br />
Kreisverkehr durch das Gebäude hindurch<br />
Oben rechts: Homogene Wohnüberbauung in Buchrain aus den 1970er-Jahren. Typisches Ele-<br />
ment der Isolation ist die Böschung zur Strasse hin.<br />
Unten links: Terrassenhäuser schliessen sich baulich immer nach aussen hin ab. Dies passt zum<br />
exklusiven (=ausschliessenden!) Charakter der Bebauung.<br />
Unten rechts: Dieser Wohnpark grenzt sich durch die Architektur sowie das Gelände ab. Vor der<br />
Überbauung fliesst die Ron, dahinter liegt ein Hügelzug.<br />
A-5
<strong>Vorstadt</strong> <strong>Rontal</strong> ____________________________________________________________________________________ Juli 2011<br />
8.1.4 Restflächen<br />
Als Restflächen werden noch unbebaute Flächen innerhalb des bebauten Bereiches bezeich-<br />
net; ihre Zukunft ist noch unklar. Sie entwickeln in der Regel keine Qualitäten als Grünflächen,<br />
sondern weisen eher den Charakter einer Brache auf. Im <strong>Rontal</strong> bestehen grössere Restflächen<br />
zwischen der Kantonsstrasse K17 <strong>und</strong> der Bahntrassee. Die prominenteste Fläche ist wohl der<br />
Bauplatz des Ebisquare, eines Einkauf- <strong>und</strong> Freizeitparks mit ungewissen Realisierungschancen.<br />
Abbildung 25 Restflächen<br />
Oben links: Auf dieser Restfläche zwischen Bahn <strong>und</strong> K17 plant der Schindler-Konzern die Reali-<br />
sierung eines riesigen Einkaufs- <strong>und</strong> Freizeitcenters.<br />
Oben rechts: Restfläche mit ungewisser Zukunft in Längenbold. Im Hintergr<strong>und</strong> wiederum<br />
sichtbar: Zerhäuselung an den Hügelzügen.<br />
Unten: Diese Restfläche ist noch mit alten Birnbäumen bestückt, der <strong>Entwicklungs</strong>druck wird<br />
mit der Eröffnung des Zubringers <strong>Rontal</strong> jedoch steigen.<br />
A-6<br />
¨
<strong>Vorstadt</strong> <strong>Rontal</strong> ____________________________________________________________________________________ Juli 2011<br />
8.1.5 Zerhäuselung<br />
Die oft diskutierte Zersiedlung wird bei Lampugnani et al. als Zerhäuselung bezeichnet. Ge-<br />
meint sind hier ausschliesslich freistehende Einfamilienhäuser ohne Bebauungskonzept. Im<br />
<strong>Rontal</strong> liegen die entsprechenden Baugebiete ohne Ausnahme in Hanglage. Die unten stehen-<br />
den Bilder verdeutlichen, wie wenig hier eine Koordination gelungen ist. Baustile, Materialien<br />
<strong>und</strong> Kubaturen mischen sich hier zu einem bunten Durcheinander <strong>und</strong> stehen quasi stellvertre-<br />
tend für die städtebauliche Gesamtsituation im <strong>Rontal</strong>.<br />
Abbildung 26 Zerhäuselung<br />
Oben links: Diese Art der Bebauung hatte wohl keine gravierenden Einschränkungen der<br />
Raumplanung zu berücksichtigen.<br />
Oben rechts: Nur an sehr wenigen Stellen existiert auch im flachen Gebiet eine tiefe Geschos-<br />
sigkeit. „Unten“ dominieren ansonsten mehrstöckige Bauten.<br />
Unten links: Die Dimension der geplanten Überbauung im Vordergr<strong>und</strong> lässt auf eher auf eine<br />
neue Siedlungsinsel schliessen als auf Zerhäuselung<br />
Unten rechts: Links im Bild sichtbar: einige Bauten mit gleichem Charakter, was das Land-<br />
schaftsbild verändert.<br />
A-7
<strong>Vorstadt</strong> <strong>Rontal</strong> ____________________________________________________________________________________ Juli 2011<br />
8.1.6 Transiträume<br />
Mit Transiträumen sind Verkehrsräume gemeint, die linear gestaltet sind <strong>und</strong> monofunktional<br />
dem Verkehr dienen. Sie bieten einerseits Orientierung, andererseits zerschneiden sie aber<br />
auch den Lebensraum. Die bereits mehrfach erwähnte K17 <strong>und</strong> die Bahntrasse spielen dabei<br />
die Hauptrollen. Die Kantonsstrasse, die von Ebikon durch Buchrain <strong>und</strong> weiter nach Norden<br />
führt, wird einen grossen Teil ihrer heutigen Belastung an den neuen Zubringer von der A4 ins<br />
<strong>Rontal</strong> abgeben können. Dieser wiederum stellt einen städtebaulichen Sonderfall dar: er wird<br />
als vollständig gedeckte Brücke geführt (s. Bild Transitraum 2).<br />
Abbildung 27 Transiträume<br />
links: Die Kantonsstrasse K17 stammt aus der Zeit vor der Nationalstrassenplanung. Bis heute<br />
wird diese Hauptachse nach Zürich mit 60km/h befahren.<br />
rechts: Blick von der Haltestelle Buchrain Richtung Zug. Ein Bahntrassee zerschneidet durch sei-<br />
ne Höhe einen Lebensraum auf gravierende Weise.<br />
8.1.7 Superkomplexe<br />
Superkomplexe bezeichnen Gruppen von grossen Gebäuden, die ihm Dienst von Konsum,<br />
Freizeit <strong>und</strong> Dienstleistungen stehen. Sie liegen oftmals an Transitachsen. Im <strong>Rontal</strong> existieren<br />
Superkomplexe zu mehreren Themen; besonders auffällig ist die Ansammlung einer grossen<br />
Anzahl Garagen beim Eingang zum <strong>Rontal</strong> in Ebikon. Alle Superkomplexe im <strong>Rontal</strong> liegen ent-<br />
lang der Transitachse K17.<br />
A-8
<strong>Vorstadt</strong> <strong>Rontal</strong> ____________________________________________________________________________________ Juli 2011<br />
Abbildung 28 Superkomplexe<br />
Oben links: Vor 10 Jahren noch fast unbebaut, durch den Technopark gestärkt: Längenbold.<br />
Neben McDonalds gibt es hier Toys’r’us, einen Erotikmarkt <strong>und</strong> weitere Geschäfte.<br />
Oben rechts: Der M-Park ist ein Heim- <strong>und</strong> Hobbymarkt grosser Skala; daneben verfügt die<br />
Migros im <strong>Rontal</strong> auch noch über ein Sport- <strong>und</strong> Freizeitcenter.<br />
Unten links: Eine seltsame Ansammlung von Garagen <strong>und</strong> Tankstellen empfängt die Besucher<br />
des <strong>Rontal</strong>s bei der Einfahrt nach Ebikon – Teil 1.<br />
Unten rechts: Eine seltsame Ansammlung von Garagen <strong>und</strong> Tankstellen empfängt die Besucher<br />
des <strong>Rontal</strong>s bei der Einfahrt nach Ebikon – Teil 2.<br />
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass alle sieben <strong>Analyse</strong>kategorien im <strong>Rontal</strong> vorhanden<br />
sind. Einzig die Kategorie der Knoten ist schwach vertreten, was auf eine besonders kleine Dich-<br />
te an funktionellen Überlagerungen im <strong>Rontal</strong> hinweist. Die <strong>Analyse</strong>kategorien haben sich da-<br />
mit für eine deskriptive <strong>Analyse</strong> als geeignet erwiesen.<br />
A-9