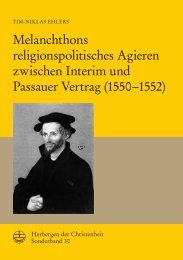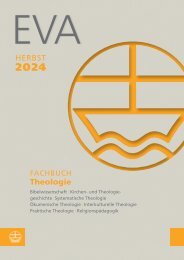Vera Vorneweg: Kein Wort zurück (Leseprobe)
Eine Frau möchte eine Geschichte über das Dorf ihrer Kindheit schreiben. Beim Verfassen des Textes stellt sie fest, dass ihr die Heimat fehlt. Nicht als Ort, sondern als Wort. Sie fängt an, nach dem Wort zu suchen und wird dabei in ein düsteres Kapitel der jüngeren deutschen Geschichte geführt. „Kein Wort zurück“ ist ein virtuoses Aufbegehren gegen die Sprachlosigkeit. Die Erzählung thematisiert den ideologischen Missbrauch von Sprache und sucht nach Verständigung und Auswegen in verfahrener Zeit. Der Text entstand im Rahmen Vera Vornewegs Stipendienaufenthalt in der Hohen Rhön im Südwesten Thüringens.
Eine Frau möchte eine Geschichte über das Dorf ihrer Kindheit schreiben. Beim Verfassen des Textes stellt sie fest, dass ihr die Heimat fehlt. Nicht als Ort, sondern als Wort. Sie fängt an, nach dem Wort zu suchen und wird dabei in ein düsteres Kapitel der jüngeren deutschen Geschichte geführt. „Kein Wort zurück“ ist ein virtuoses Aufbegehren gegen die Sprachlosigkeit. Die Erzählung thematisiert den ideologischen Missbrauch von Sprache und sucht nach Verständigung und Auswegen in verfahrener Zeit. Der Text entstand im Rahmen Vera Vornewegs Stipendienaufenthalt in der Hohen Rhön im Südwesten Thüringens.
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
VERA VORNEWEG<br />
KEIN WORT ZURÜCK<br />
Erzählung<br />
EDITION MUSCHELKALK
Prolog<br />
Pappeln, sich im Wind neigende Silberblätter, kleine Gehöfte aus Backstein, geputzte<br />
Fenster; Glanz an kunstvoll geschmiedeten Zäunen, große Grundstücksflächen,<br />
große Gerätschaften zum Pflügen und Düngen; Menschen mit Heugabeln<br />
an Kreuzungen, am Zaun lehnende Großmütterchen, bellende Hunde, in<br />
den Gassen spielende Kinder, Pflaumenbäume, Kopfsteinpflaster.<br />
Ich dachte an die schöne Erzählung, die ich gerade über mein Dorf schrieb,<br />
und glich das Geschriebene mit dem hier Gesehenen ab. Es waren mir bekannte<br />
Wörter, wie ich sie da auf den Wahlplakaten stehen sah – aber so, wie sie sich mir<br />
hier präsentierten, waren sie mir unlieb.<br />
Wie ein Blitz schlug der Gedanke in meinen Kopf ein, dass alles, was ich bereits<br />
über mein Dorf geschrieben hatte, nun nutzlos sein würde. Denn das, was<br />
ich mit Wörtern versucht hatte niederzuschreiben, unterschied sich nicht von<br />
den Wörtern, die hier auf den Plakaten standen. Nur ihr Hintergrund war ein<br />
anderer; sonst war alles gleich. Geschichte. Heimat. Natur. Familie – alles Wörter,<br />
die ich auch benutzte. Aber der Anblick und die Art und Weise, wie sich diese<br />
Wörter hier präsentierten, reichten aus, dass ich sie nicht mehr vor der Kulisse<br />
meiner Dorfgeschichte, an der ich gerade schrieb, sehen konnte.<br />
Der Vorort der Stadt war klein, nahezu dörflich, ich stieß direkt auf seinen<br />
Mittelpunkt zu; ich rannte. Vor mir baute sich das gleiche Bild wie zu meiner<br />
Kindheit auf: der große Platz in der Mitte des Dorfes, gesäumt von mächtigen<br />
alten Baumriesen, eine rote Bank, eine Schaukel, die wehende Kletterleiter im<br />
frischen Herbstwind. Aber irgendetwas war anders.<br />
Verfolgte mich jemand?<br />
Nein, dies war nicht mein Dorf.<br />
Mein Dorf.<br />
Mein Dorf.<br />
Oder war es nicht doch die Sprache an sich, die die Grenzen zog?<br />
7
I<br />
Dies soll eine Art Einführung in die Geschichte sein, die ich erzählen will, eine<br />
Art Hinführung, eine Art Wegführung von dem, was ich nicht sagen will. Es<br />
geht um eine Scharfstellung der Wörter, einer Untersuchung ihrer Form in Bezug<br />
zu ihrem Inhalt und umgekehrt. Denn je öfter ich die bereits geschriebene Geschichte,<br />
die fast fertige Geschichte lese, desto mehr drängt sich auf, dass noch<br />
etwas fehlt; etwas, das noch zuvor oder zum Ende oder in der Mitte geschrieben<br />
werden müsste.<br />
Zunächst vermutete ich, dass meine problematisch gewordene Beziehung zum<br />
Geschriebenen etwas mit einem Missverhältnis von Form und Inhalt zu tun<br />
haben könnte; mit den Proportionen, den Verteilungen, den Verhältnissen, die<br />
innerhalb oder außerhalb der Geschichte herrschten.<br />
Vielleicht war aber auch der Inhalt der bereits geschriebenen Geschichte zu<br />
gewichtig, in einem gewissen Sinne übergewichtig, dass es unzählig viele mühevolle<br />
Stunden des Zuschnitts, des Kürzens gekostet hätte, diesem umfangreichen<br />
Textkörper ein Kleid zu schneidern, in das sie, meine Geschichte, hineingepasst<br />
hätte. Vielleicht war es aber auch genau umgekehrt, und eigentlich war der Stoff<br />
meiner Geschichte zu dünn, zu mager und würde – egal in welchen Stoff ich sie<br />
hüllte – immer fahl und knochig aussehen.<br />
Auch wenn ich dem Geschriebenen unter Umständen Unrecht tat (aber ich<br />
möchte von Beginn an allen möglichen Fehlern auf den Grund gehen), hegte<br />
ich den Verdacht, dass irgendetwas falsch gelaufen sein musste – bei der Entwicklung<br />
des Erzählstrangs, beim Arrangement der Wörter, der Art und Weise<br />
ihrer Zusammenstellung zu Sätzen. Schließlich war ich diejenige, die die<br />
Wörter, so wie sie da in meiner Geschichte standen, zusammengestellt hatte. Ich<br />
war die Textmutter und meine Kinder die Wörter. Ich hatte mich der Wörter<br />
angenommen, sie adoptiert, sie studiert. Und als Schreibende ließ ich sie wachsen;<br />
ja, ich gestand ihnen all ihre kindlichen Freiheiten zu: Sie durften tun, was<br />
sie wollten, und ich schaute ihnen dabei zu. Nur hin und wieder griff ich in ihr<br />
wildes Spiel ein, stellte sie an einen bestimmten Platz, um ein bisschen Ruhe ins<br />
Haus zu bringen; fügte sie in einen bestimmten Satz, wo sie dann auch bleiben<br />
8
mussten. Aber ich war eine milde Mutter, fernab jeglichen Sinns für Autorität,<br />
und wenn ein <strong>Wort</strong> unzufrieden mit seinem von mir zugewiesenen Platz war,<br />
dann durfte es diesen auch wieder verlassen. Es kam auch nicht selten vor, dass<br />
ich besonders aufmüpfig-freche <strong>Wort</strong>kinder, die sich aus ihren Klagen ein Spiel<br />
machten, in meine Obhut nahm und – egal, welchen Platz ich ihnen zuwies –<br />
stets mit diesem unzufrieden waren. Aber auch auf dieses Spiel ließ ich mich<br />
ein; ja, heimlich genoss ich sogar ihre Rebellion, ihre Versuche, sich gegen mich<br />
aufzulehnen. So viel Text entstand dann doch immer auch aus dem Widerstand<br />
der Wörter gegen mich.<br />
Nichtsdestotrotz war ich verantwortlich für meine <strong>Wort</strong>kinder und ihre Position<br />
innerhalb meines Textes, deshalb musste ich sie auch hin und wieder ein<br />
wenig verrücken, drücken, ziehen oder vielmehr auch zu einem Ort hinlenken,<br />
an dem ich sie haben wollte und an dem sie dann auch bleiben wollten. Ja, für<br />
gute Texte war es essentiell, dass wir, die <strong>Wort</strong>kinder und ich, dass wir alle mit<br />
unseren jeweiligen Positionen innerhalb des Textes zufrieden waren.<br />
Aber vielleicht war meine Geschichte von Anfang an dem Untergang geweiht.<br />
Vielleicht war ich doch zu unbesorgt bei der Formierung der <strong>Wort</strong>kinder<br />
zu Sätzen gewesen, vielleicht fehlte es mir doch an der nötigen Strenge, an erzieherischem<br />
Durchsetzungsvermögen im Allgemeinen. Vielleicht war gar nicht<br />
mein Text gescheitert – vielleicht war ich als Mutter gescheitert.<br />
Doch auch Mütter machen Fehler, und ich wusste, dass ich für diese Fehler<br />
geradestehen musste, denn am Ende würde ich mich als die einzig <strong>Vera</strong>ntwortliche<br />
für diesen Text gegenüber der Öffentlichkeit rechtfertigen müssen. Am<br />
Ende würde ich vor Gericht geführt werden, wenn irgendetwas mit den Sätzen,<br />
der Aneinanderreihung meiner <strong>Wort</strong>kinder schiefgelaufen war. Ich würde vor<br />
dem Gericht der Öffentlichkeit stehen; einem Gericht, das gnadenlos und ohne<br />
mit der Wimper zu zucken noch die Todesstrafe praktiziert. Man denke nur an<br />
all die Zeitungen, die Feuilletons, diese <strong>Wort</strong>gerichte auf allerhöchster Stufe – sie<br />
sind die über mich Richtenden, die mich als Textmutter für alle Ewigkeit auf die<br />
Anklagebank setzen werden. Vor ihnen würde ich mich immer beweisen müssen.<br />
Aber liegt es wirklich in meiner Hand, wenn mir <strong>Wort</strong>kinder entlaufen? Wenn<br />
sie ausreißen und sich mit falschen <strong>Wort</strong>freunden und -freundinnen zusammentun?<br />
Und wenn diese dann gemeinsam eine ganz misslich grau-verschleierte<br />
Textwolke bilden?<br />
9
Bislang hatte es noch kein einziges meiner Wörter geschafft, gänzlich zu verschwinden.<br />
Immer wenn mir ein <strong>Wort</strong> kurzzeitig abhandengekommen war, hatte<br />
ich es irgendwann wiedergefunden und überzeugen können, zu mir nach Hause<br />
<strong>zurück</strong>zukommen. Aber bei dieser Geschichte war irgendetwas anders. Etwas<br />
fehlte, obwohl das zu gebrauchende <strong>Wort</strong> da war.<br />
Vorab möchte ich zu meiner Verteidigung allen <strong>Wort</strong>gerichten dieser Welt<br />
mitteilen, dass ich auch bei der Erzeugung dieser Geschichte nicht nachlässig<br />
war – im Gegenteil: Ich hatte konzentrierter und länger denn je gearbeitet und<br />
war stets um ein ansehnliches Arrangement meiner <strong>Wort</strong>kinder zu einer schönen<br />
Textpassage bemüht gewesen. Denn schließlich ging es bei der Geschichte um<br />
die Geschichte meines Ursprungs; meines Dorfes, in dem ich aufgewachsen war.<br />
Noch einmal <strong>zurück</strong> und aus einer anderen Perspektive betrachtet:<br />
Am Anfang war das <strong>Wort</strong>.<br />
Am Anfang war mein <strong>Wort</strong>.<br />
Es kann also auch sein, dass meine Geschichte gescheitert war, weil ich schon<br />
in einem frühen Entwicklungsstadium eines meiner <strong>Wort</strong>kinder einen Fehler gemacht<br />
hatte. Ich hatte mich möglicherweise in der Auswahl, der Vorauswahl des<br />
<strong>Wort</strong>es vertan. Denn ich pickte ein bestimmtes <strong>Wort</strong> und wählte dafür nicht ein<br />
anderes <strong>Wort</strong>.<br />
Vielleicht wäre alles anders geworden, wenn ich mir mehr Mühe bei der<br />
<strong>Wort</strong>auswahl gegeben hätte, vielleicht war es auch nur ein einziges <strong>Wort</strong>, das die<br />
Geschichte nun in eine bedenkliche Richtung zog.<br />
Aber was tun?<br />
Nach meiner jüngsten Reise quer durchs Land spürte ich, dass ich keinen Zugriff<br />
mehr auf bestimmte Wörter, die ich aber dringend benötigte, besaß. Auch wenn<br />
ich die Mutter meiner Texte war und mich deshalb für alles Geschriebene verantwortlich<br />
fühlte, so wuchs in mir der Gedanke, dass es jemand Dritten oder<br />
auch etwas Drittes geben musste, der, die oder das meine Geschichte, meine<br />
Sätze, meine Wörter in die falsche Richtung gezogen hatte. Mir kam es tatsächlich<br />
so vor, als ob einige der Wörter verschwunden waren – denn wollte ich sie<br />
niederschreiben, waren sie mir nicht mehr das, was sie einmal versprachen, gewesen<br />
zu sein.<br />
In jenen Tagen schien es, als spielten die Wörter ein böses Spiel mit mir, als<br />
hätten sie sich gemeinsam gegen mich, ihre Mutter, verbunden. Denn je näher<br />
10
ich die Wörter an mich heranholen wollte, desto weiter entfernten sie sich von<br />
mir. <strong>Kein</strong>er meiner sonstigen Lockrufe, meiner Aufforderungen, sich an einen<br />
bestimmten Platz im Satz zu stellen, funktionierte. Und auch wenn mir einige<br />
Wörter herausfordernd die Zunge entgegenstreckten und mir mit verschränkten<br />
Armen begegneten, so spürte ich, dass sie mir nicht als Wörter, als Kinder verloren<br />
gegangen waren, sondern dass mir vielmehr ein Teil von ihrer Bedeutung,<br />
von ihrem Herz, von ihrer Essenz abhandengekommen war.<br />
Denn in meinem Verständnis von einem <strong>Wort</strong> waren das <strong>Wort</strong> an sich und<br />
seine Bedeutung sehr eng miteinander verbunden: Ich benutzte ein <strong>Wort</strong>, weil<br />
ich etwas Bestimmtes ausdrücken wollte, was ich eben nur durch dieses eine bestimmte<br />
<strong>Wort</strong> tun konnte.<br />
Halten wir an dieser Stelle fest: Es war nicht unwahrscheinlich, dass die Wörter<br />
mit mir spielten; ich schrieb sie nieder, aber sie waren leer.<br />
Dabei hatte ich doch begonnen, eine Geschichte über den Ort meiner Kindheit<br />
zu schreiben. Ich war im Herbst vergangenen Jahres zum Schreiben in<br />
mein Dorf <strong>zurück</strong>gekehrt, um der Vergangenheit nachzuspüren und Menschen<br />
wiederzutreffen, mit denen ich meine Schulzeit verbracht hatte. Von meiner Familie<br />
lebte nur noch meine Tante im Dorf; sie war nach dem Tod meiner Großmutter<br />
in das leer stehende Haus ihrer Eltern gezogen.<br />
Die meisten meiner Schulfreunde und Schulfreundinnen aber hatten das<br />
Dorf verlassen. Aus meiner alten Klasse waren nur Kikki und Mandy geblieben,<br />
auch der Milchbauer, der schon damals als Kind immer nur „der Milchbauer“<br />
genannt wurde, weil seine Eltern einen Hof mit Kühen hatten. Auf diesem Hof<br />
arbeitete der Milchbauer jetzt immer noch; er hatte ihn sogar vergrößert und den<br />
Betrieb auf Bio-Produktion umgestellt.<br />
Während meiner Schreibzeit hatte ich einige Menschen wiedergesehen, die<br />
ich aus meiner Kindheit kannte; aber ich hatte auch einige neue kennengelernt,<br />
die erst seit kürzerer Zeit in meinem Dorf lebten. „Der Jäger“ kam ursprünglich<br />
aus einer großen Stadt im Westen, hatte sich aber seit zwei Jahren in dem<br />
geräumigen Holzhaus auf dem Berg nahe dem alten Steinbruch niedergelassen,<br />
wo er gemeinsam mit seiner Frau eine Pension mit einem kleinen Restaurant<br />
betrieb. Und als ich im Nachbardorf eine Pizzeria besuchte, lernte ich Abdul kennen,<br />
der eigentlich Abdullah hieß, aber von allen Abdul genannt wurde. Abdul<br />
war vor fünf Jahren nach Deutschland gekommen und hatte hier neben dem<br />
Schwimmbad eine Pizzeria eröffnet. Und immer, wenn ich bei Abdul Pizza aß,<br />
11
dann wusste ich, dass eigentlich er der Erzähler war; dass eigentlich er derjenige<br />
war, der schreiben sollte. Wie gebannt hatte ich seinen Geschichten aus dem fernen<br />
Marokko gelauscht, in denen es immer um Sonne und Wüste und Sehnsucht<br />
ging.<br />
Auch wenn mehr Menschen starben als geboren wurden, so zählte das Dorf<br />
noch immer vierhundert Seelen, und das waren beinahe genauso viele wie zu der<br />
Zeit, als ich dort als Kind gewohnt hatte.<br />
Meine Idee, eine Geschichte über das Dorf meiner Kindheit zu schreiben,<br />
war freudig von den im Dorf lebenden Menschen aufgenommen worden. Vor<br />
allem der Milchbauer hatte sich über meine Rückkehr gefreut: „Hätt’st schon mal<br />
häufiger vorbeischauen können.“ Bei unseren vielen Treffen, die immer mit viel<br />
Alkohol verbunden waren, hatte er sich oft über die viele Büroarbeit beschwert,<br />
die ihm der Hof bereiten würde. „Wenn es nur um die Tiere gehen würde“, hatte<br />
er immer wieder gesagt und dabei mit dem Kopf geschüttelt.<br />
Doch jetzt, <strong>zurück</strong> in der Stadt, als ich das Aufgeschriebene zu einer großen<br />
Geschichte zusammenbringen wollte, spürte ich, dass irgendetwas fehlte. Ich<br />
schrieb nieder, was ich schreiben wollte, aber es hatte eine andere Melodie, einen<br />
seltsamen Klang – alles, was ich schrieb, passte nicht mehr zu dem, was meine<br />
Sätze übermitteln sollten.<br />
Um mich abzulenken und das Problem mit meiner Geschichte noch einen kleinen<br />
Moment zu vergessen, begann ich, mich mit der Poesie zu beschäftigen. Ich<br />
versuchte, mich in die Wörter, in das Innenleben meiner <strong>Wort</strong>kinder hineinzuversetzen.<br />
So stellte ich mir vor, dass auch ich (wenn ich denn ein <strong>Wort</strong> sein würde<br />
und mich von meiner Bedeutung her verwandeln wollen würde) mich zuerst der<br />
Poesie zuwenden würde, der größten aller <strong>Wort</strong>künste; der Schmiede neuer Wörter,<br />
mit denen dann die neuen Gedanken und <strong>Wort</strong>fetzen wie Funken herausspringen<br />
würden.<br />
Ja, vielleicht hatten einige Wörter gar ein großes Interesse an Veränderung.<br />
Denn so wie der Mensch nach einem permanenten Wandel in seiner Bedeutung<br />
strebte, so wollten sich vielleicht auch die Wörter verändern, und sicherlich<br />
waren wir in einer Zeit angekommen, in der es sogar gut war, einige Wörter<br />
ziehen zu lassen. Es gab Wörter, die so sehr mit furchtbaren Geschehnissen in der<br />
Vergangenheit unserer Geschichte verbunden waren, dass diese Wörter jetzt, in<br />
12
die neue Zeit, nicht mehr hineinpassten – wie gut, dass einige von ihnen von allein<br />
gegangen waren. Dennoch ließ sich nicht ausschließen, dass sie sich nur versteckt<br />
hatten und irgendwo in einer Waldhöhle, getarnt unter Moos und Flechten, verharrten<br />
und nur darauf warteten, dass die Zeit ihrer Neu-Erscheinung wiederkommen<br />
würde.<br />
Um mich also auf die Wandelbarkeit der Wörter einzulassen, begann ich,<br />
Gedichte zu lesen und Poesieveranstaltungen zu besuchen. Ich wollte mich<br />
nicht damit zufriedengeben, dass die Wörter ein solches Spiel mit mir trieben –<br />
schließlich hatte ich jahrelang mit ihnen gearbeitet, und sie waren das Material all<br />
meiner Texte. In einem Gedichtband las ich etwas über alte Lieder und Tauben,<br />
die übers Meer geschickt wurden; ich notierte „da wellt es, wie es immer wellt“<br />
und „Nichts leichter als eine Sanduhr gebaut“.<br />
Auf einer Lyrik-Lesung hieß es in einem der Gedichte, dass man Fingerübungen<br />
mit Sonetten machen solle und man Blut in die Blüten einer Rose verwandeln<br />
könne, die sich dann um ein schlafendes Schloss schlingen würden.<br />
„Was entfacht sie in dir, die Rose?“, fragte die Poetin am Ende ihrer Darbietung.<br />
Ich verstand nicht ganz, wie das alles funktionieren sollte, mit der Poesie, den<br />
Wellen und den Rosen, aber ich wollte mich bemühen, und so kaufte ich immer<br />
wieder Rosen und stellte sie in Vasen, die ich in meiner Wohnung verteilte, und<br />
erklärte ihr Bild, die rote Rose, als Sinnbild für Veränderung.<br />
Und immer wieder gab es Momente, in denen sich meine Trauer um die verloren<br />
gegangenen Wörter in eine Erregung umschrieb; ein Gefühl, das im weitesten<br />
oder im engeren oder in welchem Sinne auch immer in einer Verwandtschaft<br />
zum Zorn stand.<br />
Ich spürte das Brodeln. Gleichsam der Fontäne eines Geysirs, die sich der<br />
Erdoberfläche nähert, fing ich innerlich an zu kochen. Ich schrieb und schrieb,<br />
und irgendwo in den Tiefen meines Körpers begannen <strong>Wort</strong>fetzen aufzusteigen,<br />
die ich versuchte, Stück für Stück zu dem richtigen <strong>Wort</strong> zusammenzubauen. Ich<br />
fischte nach den Wörtern, ich fing sie, ich schrieb sie nieder, mein Kopf wurde<br />
heißer und heißer; jetzt standen sie auf dem Papier, aber so, wie sie da standen,<br />
passten sie nicht; sie waren fehl an ihrem Platz, aber es gab keinen Ersatz für<br />
sie … es gab keinen Ersatz für sie. Und schon übertrug sich die Hitze auf meinen<br />
gesamten Körper, erst das Gesicht, dann den Hals, die Lunge, das Herz, den<br />
Bauch, zuletzt die Beine; und selbst in den Füßen, in den Fußzehenspitzen spürte<br />
ich den aufflammenden Zorn oder das, was ich Zorn nannte.<br />
13
Die Wörter schossen aus mir heraus, ich tobte, ich kochte, Blasen schlugen<br />
aus dem Rand des Topfes, des Kopfes, ich schrie – und schon während ich schrie,<br />
schämte ich mich für mein Schreien.<br />
14
Selbstzersetzung, die (weiblich): ein den Körper durchteilendes Gefühl, das<br />
die einzelnen Zellen in ihrer Außenstruktur aufweicht; kleine Nadeln werden in<br />
die Ränder der Zellaußenwände gestochen, aus denen dann die Zellflüssigkeit<br />
hinaustritt.<br />
Kommt es zu einer Durchmischung der im Herzmuskel angesiedelten Zellflüssigkeiten,<br />
wird der Prozess der Selbstzersetzung durch biodynamische Prozesse<br />
des eigenen Körpers beschleunigt. Die Gefahr der Ausbildung einer Autoimmunschwäche<br />
ist gegeben.<br />
15
Ich versuchte, mich in jenen Tagen des immer wieder aufflammenden Zorns auf<br />
die bereits geschriebene Dorfgeschichte zu besinnen und mich an all die Gespräche<br />
zu erinnern, die ich während meiner Dorfschreibzeit geführt hatte. Die<br />
Lebensgeschichten der Menschen hatten in mir eine längst verstummte Melodie<br />
erklingen lassen; es war das Lied der Kindheit gewesen, alles Dur-Töne, alles<br />
fröhlich an diesem Ort, der einst mein Zuhause gewesen war.<br />
Zuhause.<br />
Doch genau in Verbindung zu diesem <strong>Wort</strong> fehlte etwas.<br />
Und dieses Fehlen musste in Verbindung zu meiner Reise stehen, von der<br />
ich vor kurzem <strong>zurück</strong>gekehrt war. Seitdem hatte sich beim Schreiben etwas verändert.<br />
Denn schaute ich nun auf das eine <strong>Wort</strong> in meiner Dorfgeschichte, dann<br />
glich das <strong>Wort</strong> nur noch einer Floskel, einem gestorbenen <strong>Wort</strong>; da lag nur noch<br />
ein toter <strong>Wort</strong>körper auf meinem Blatt.<br />
Etwas war zwischen den Zeilen gestorben.<br />
Mehr und mehr beschlich mich das Gefühl, dass ich dem verloren gegangenen<br />
<strong>Wort</strong>, in den letzten Wochen, Monaten, Jahren, zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt<br />
hatte und es auch als <strong>Wort</strong> an sich wenig in meinen Texten oder Gedanken<br />
vorgekommen war. Und jetzt schien das <strong>Wort</strong> mich bestrafen zu wollen<br />
und verweigerte mir eisern den Zugriff auf seine Benutzung. Meine Verzweiflung<br />
wuchs von Tag zu Tag; wusste ich doch, dass ich alle Wörter benötigte, um als<br />
Schreibende zu existieren. Ohne sie war ich nichts, im Gegenteil zu meinem<br />
scheinbar verlorenen <strong>Wort</strong>: Ihm schien es nichts auszumachen, ohne mich zu<br />
sein.<br />
Immer wieder blitzten die Erinnerungen an meine Kinderzeit im Dorf auf. Der<br />
blaue wolkenlose Herbsthimmel, die gelb-braunen Stoppelfelder, das wilde<br />
Grün der Wiesen. Mein Kinderzimmer mit Blick zum Maisfeld, das Rascheln<br />
der vom Wind aneinandergeriebenen Blätter der Pappeln, die Kreisflüge der<br />
Rotmilane. Und immer wieder die Feste, das Ernten und Einkochen der Pflaumen,<br />
das Backen von Kuchen, der Überall-Duft im Haus nach Zimt, das Austauschen<br />
von Rezepten. Und irgendwann dann die Kürbisgesichter, die vor<br />
jeder Haustür standen, den Jahreszeitenwechsel einläuteten und den Herbst<br />
verabschiedeten.<br />
Doch wie damals der Waldrand am Horizont meines Kinderzimmerfensters<br />
sich immer wie ein dicker dunkelgrüner Strich durch die Landschaft gezogen<br />
16
und den Himmel von der Erde abgetrennt hatte, so war nun dieses vertraute,<br />
wohnlich-wohlige <strong>Wort</strong> von mir abgetrennt worden.<br />
Ich versuchte, mich auf meine letzten Begegnungen mit dem <strong>Wort</strong> zu besinnen<br />
und mich an die Momente zu erinnern, in denen ich das <strong>Wort</strong> in seinem ursprünglichen<br />
Sinn benutzt hatte. Immer wieder reiste ich gedanklich <strong>zurück</strong><br />
in mein Dorf. Sofort hörte ich das Glockengeläut unserer Dorfkirche, die das<br />
Verstreichen einer jeden Viertelstunde ankündigte. Und je mehr ich über das<br />
Verschwinden dieses ach-so-wichtigen <strong>Wort</strong>kindes nachdachte, desto mehr befürchtete<br />
ich, dass es nicht sein freiwilliger Entschluss gewesen war, von mir zu<br />
gehen, sondern dass es gewaltsam von mir weggeführt worden war.<br />
Hinzu kam, dass das <strong>Wort</strong>kind ein unheimlich hübsches Kind war, denn wo<br />
immer es auftauchte, löste es freudestrahlende Gesichter aus; es trug eine Art<br />
kindliche Geborgenheit in seinem Blick, in seinen glitzernden nussbraunen<br />
Augen; in der Art und Weise, wie es die Menschen anschaute. Ein jeder Mensch,<br />
der diesem <strong>Wort</strong> begegnete, sah für einen Moment sich selbst in seinen Augen,<br />
sah einen Ausschnitt von seiner eigenen Kindheit; sah einen Teil von dem, was<br />
einst vertraut gewesen war.<br />
17
II<br />
Meine Sorge um den Verlust des <strong>Wort</strong>es hatte sich in eine Angst umgewandelt,<br />
die mich rastlos machte und immer wieder vom Schreibtisch aufstehen ließ.<br />
Immer wieder ging ich zum Fenster und schaute auf die Straße und die Bäume<br />
und versuchte eine Verknüpfung zu finden zwischen dem Gesehenen und dem<br />
Imaginierten. Welche Verbindung bestand zwischen den Bildern meiner Kindheit<br />
und dem gerade Geschehenen? Inwieweit durchfärbte das kürzlich Erlebte<br />
meine Erinnerung? Und was war eigentlich auf meiner letzten Reise passiert?<br />
Jetzt peitschte der Regen in vom Himmel gekippten Kübeln auf die Straße,<br />
und die kahl gewordenen Bäume, die die Straße säumten, wirkten wie knorrige<br />
Riesen, deren blätterlose Äste wie nackte Finger in den grauen Himmel ragten.<br />
Zum ersten Mal erschienen mir die Bäume nutzlos und überflüssig, wie sie so<br />
hilflos auf ihre bloßen Körper <strong>zurück</strong>geworfen, in künstlich arrangierten Reihen<br />
dastanden.<br />
Der Bürgersteig war ungewöhnlich sauber, denn alles Wasser, das sich entlud,<br />
wurde direkt von den Gullys eingesogen, die zu einer künstlichen Reinheit der<br />
geteerten Straße beitrugen.<br />
Alles war glatt und glänzte.<br />
Ich begann, mich mit dem Tod zu beschäftigen. Es war ein Thema, das ich immer<br />
gemieden hatte, nun aber spürte ich, wie es mich mit einer besonderen Kraft<br />
durchdrang.<br />
Vielleicht würde ich das <strong>Wort</strong> nie wieder benutzen können, vielleicht musste<br />
ich es für immer aus meinem <strong>Wort</strong>schatz streichen, denn so, wie es sich mir<br />
beim Niederschreiben zeigte, war es unbrauchbar; nein, nicht nur unbrauchbar,<br />
sondern sogar zerstörerisch. Denn es verriet den ursprünglichen Sinn, den es<br />
einst für mich hatte und belegte das <strong>Wort</strong> an sich mit einer Bedeutung, die genau<br />
das Gegenteil von dem ausdrückte, was es dereinst für mich gewesen war. Benutzte<br />
ich jetzt dieses <strong>Wort</strong>, begab ich mich in eine Gefahrenzone, in dem hinter<br />
jedem Zaun der Verrat lauerte. Ich dachte an die grünen Wiesen, die Felder,<br />
mein Dorf, meine Kindheit, Gemeinschaft und Geborgenheit, und siehe da: Das<br />
<strong>Wort</strong> leuchtete kurz vor mir auf und verschmolz mit allen Erlebnissen und Erinnerungen.<br />
Aber schrieb ich das <strong>Wort</strong> jetzt nieder, so reiste ich nicht in das Dorf<br />
18
meiner Kindheit, sondern irrte durch einen dunklen Wald, in dem ein eisiger<br />
Wind wehte, der mir die Luft abschnitt. Dort gab es kein Rauschen, nur kahle<br />
Bäume standen in diesem Wald, in dem es ausschließlich parzellierte, mit Mauern<br />
abgegrenzte Flächen gab. Ich rief und rief nach dem <strong>Wort</strong>, aber es kam nicht<br />
mehr <strong>zurück</strong> zu mir.<br />
Ich wusste: Wörter sind keine in Beton gegossenen Buchstabenaneinanderreihungen<br />
mit dem immer gleichen Innenleben, der immer gleichen Seele hinter<br />
ihren mit Satzzeichen gezogenen Grenzen; dennoch war ich stets der Überzeugung<br />
gewesen, dass ich als Schreibende die Macht besitzen würde, sie so zu<br />
arrangieren, dass die Wörter in meinem (Bedeutungs-)Sinn funktionieren würden.<br />
Jetzt aber hatte offenbar etwas in diesen Prozess eingegriffen, und ich war<br />
nicht mehr Herrin meiner Wörter. Und wenn es passieren konnte, dass mir ein<br />
<strong>Wort</strong> entwendet wurde, so konnte dies auch ein zweites Mal geschehen … und<br />
irgendwann würde ich keine Wörter mehr haben.<br />
Ich bemerkte beim Schreiben, wie ich begann, dieses eine bestimmte wichtige<br />
<strong>Wort</strong> mehr und mehr zu meiden, aber dieses Meiden geschah in keinem Prozess<br />
des einfachen Auslassens, nein, es war schmerzlich, denn in einem jeden Vermeiden-Müssen<br />
des <strong>Wort</strong>es wurde ich mir der Unheimlichkeit seines Verlustes<br />
gewahr, seines Entschwindens aus meinem <strong>Wort</strong>schatz, aus meiner <strong>Wort</strong>familie;<br />
und immer wieder wurde ich von Verzweiflung gepackt. Ohne dieses <strong>Wort</strong> würde<br />
ich meine Geschichte nicht weiterschreiben können.<br />
Ja, vielleicht befand ich mich in einer Krise, vielleicht aber auch in einer falschen<br />
Zeit; vielleicht aber hatte ich auch irgendeine Entwicklung noch nicht verstanden,<br />
die ich aber hätte verstehen müssen … die schon alle verstanden hatten,<br />
außer mir.<br />
Ich wusste nicht, was zu tun war.<br />
Ich ging auf Friedhöfe, wandelte über ihre kieselig-grauen Wege, ließ mich leiten<br />
von den rot im Wind zuckenden Lichtern der Kerzen, las die Namen auf<br />
den Grabsteinen, die dazugehörigen Jahreszahlen und fand Beruhigung im<br />
Umrundet-Sein von Toten. Ich bildete mir ein, im Rauschen der Laubbäume,<br />
im Lied dieser hochgewachsenen Baumriesen Stimmen zu hören; Stimmen, die<br />
mir irgendetwas sagen wollten, was jetzt zu tun sei; Zeichen – ich sehnte mich<br />
19
nach nichts mehr als nach Zeichen, die mir irgendetwas zeigen sollten, etwas<br />
vorzeichnen, aufzeichnen, wie auch immer – am liebsten einen Weg, ein Muster,<br />
das ich nur noch mit meinen eigenen Farben ausmalen musste.<br />
Doch das Rauschen der Blätter, das Flackern der Kerzen oder das Vorbeifahren<br />
eines Autos ließen sich nicht in ein Zeichen umdeuten. Da gab es keinen<br />
Weg, keine Handlungsanweisung, noch nicht einmal einen Fingerzeig in<br />
irgendeine Richtung. Und auch wenn es vielleicht irgendwo immer einen Übertragungsfehler<br />
gab, so konnte ich noch nicht einmal diesen erkennen.<br />
Ich fing an, mich in die Dinge hineinzuträumen, die geschrieben werden wollten.<br />
Ich begann meine Träume aufzuschreiben und blätterte in den Traumlexika<br />
nach, um Erklärungen für das Verschwinden des <strong>Wort</strong>es aus meiner Wirklichkeit<br />
zu finden. Ich wollte mich nicht mit dem <strong>Wort</strong>verlust geschlagen geben und ließ,<br />
bevor ich mich schlafen legte, die grünen Wiesen, die Felder, die Gemeinschaft,<br />
die kindliche Geborgenheit noch einmal vor meinen Augen wie einen Garten<br />
wachsen, eine Aue mit alten Obstbäumen und einem kleinen Bächlein, das alles<br />
bewässerte, das gedeihen wollte.<br />
Ich versuchte, mir das verloren gegangene <strong>Wort</strong> so vorzustellen, als ob es mir<br />
in einem Traum erscheinen würde. Ich redete mir ein, dass ich erst dann das<br />
tatsächliche Wesen des <strong>Wort</strong>es erkennen würde. Nur im Traum konnte ich dem<br />
Vertrauten noch einmal neu begegnen und die Erinnerungen mit der Gegenwart<br />
verbinden. ‚Ich müsste noch einmal anfangen, mir meine Erinnerungen zu erzählen‘,<br />
dachte ich jedes Mal, als ich aus einem solchen Traum aufwachte.<br />
Irgendwann aber blieben die Träume einfach aus, und die Nächte wurden<br />
bilderlos. Der Wille war da, aber das Zusätzliche, das nicht in meiner Macht Stehende<br />
– das, was immer noch hinzukommen musste, damit sich ein Traumbild<br />
aufbauen konnte, entfaltete sich nicht.<br />
Immer wieder ging ich meine Notizen durch, die ich während meiner Dorfschreibzeit<br />
gemacht hatte, und dachte an meine ach-so-vielen Versuche, die Farben<br />
der Felder einzufangen. Ich stellte mir vor, dass ich eine Malerin war, die,<br />
versetzt in eine Herbststimmung, in die warme Abendsonne hinaus, in die Felder<br />
zog, aufbrechend zu ihrem Motiv, zur passenden Einstellung der Farben zum<br />
Licht. Doch ähnlich, wie es mir damals schwerfiel, Wörter für die verschiedenen<br />
Gelbtöne der Felder zu finden (eine immer neue Mischung aus Gelb, Rot, Braun,<br />
sich ständig neu abschattend), so fühlte ich mich jetzt bei der <strong>Wort</strong>suche wie eine<br />
20
Fischerin, die sich irgendwo auf den Weiten des Meeres in einem kleinen Boot<br />
befand und ein riesengroßes Treibnetz ausgehängt hatte. Und in diesem Fangnetz<br />
blieben so viele Wörter hängen, nur nicht das eine, gewünschte, das ich so sehnlichst<br />
vermisste – genau dieses <strong>Wort</strong> blieb einfach nicht hängen.<br />
Doch in jenen Tagen trat noch eine andere Frage auf mich zu, die mir schlaflose<br />
Nächte bereitete: War nicht vielleicht das <strong>Wort</strong> von mir gegangen, sondern<br />
war ich diejenige gewesen, die sich von dem <strong>Wort</strong> entfernt hatte? War nicht das<br />
Schreiben an sich eine Art und Weise der Grenzziehung zu anderen?<br />
So.<br />
Und nicht so.<br />
Wörter, die wie Steine übereinander- und aneinandergereiht wurden: Nur<br />
so konnte eine Mauer entstehen. Und vielleicht war ich diejenige gewesen, die<br />
die Grenze gezogen hatte. Und jetzt war vielleicht ich hinter meinem eigenen<br />
Gedankenstacheldraht hängen geblieben. Oder war es gar die Sprache im Allgemeinen,<br />
die ein böses Spiel mit mir trieb? War es nicht sie, die die Mauern<br />
erst aufbaute? Mein? Dein? Immer diese sich ständig aufdrängenden Possessivpronomen,<br />
diese besitzanzeigenden Fürwörter.<br />
Wurde mir nicht erst durch sie vorgegeben, wie ich zu denken hatte?<br />
Auch wenn ich es nicht wollte, musste ich plötzlich an den Tod des Haus- und<br />
Hofschweins meines Schulfreundes denken. Voller Freude hatte er mich während<br />
meiner Dorfschreibzeit zu einer Schlachtung auf seinen Hof eingeladen. „Dann<br />
kannst du mal sehen, wie das richtig gemacht wird.“ Mein Schulfreund hatte<br />
immer noch dieselben schönen blauen Augen wie zu unserer Jugendzeit; nur sein<br />
Körper war noch länger, seine Hände waren noch größer geworden.<br />
An dem Tag, an dem ich sehen sollte, „wie das richtig gemacht wird“, hatte<br />
die Sonne geschienen, und keine Wolke hatte am Himmel gestanden. Der<br />
Schlachter fuhr in einem kleinen schwarzen Auto auf den Hof und brachte eine<br />
Menge Messer mit; lange Messer, die alle nach Größe sortiert in einer weißen<br />
Plastikbox im Kofferraum lagen. Der Schlachter zog sich dann vor der Scheune,<br />
aus der gerade drei Katzenbabys heraushuschten, das blau-weiß gestreifte<br />
Hemd und die weiße Hose an. Auf seinem Oberkörper waren viele Tätowierungen<br />
gewesen. Er stieg dann in übergroße, weiße Gummistiefel, die schon an<br />
den Spitzen gelblich-braun waren, und schnürte sich eine weiße abwaschbare<br />
Plastikschürze um.<br />
21
Trotz des strahlenden Sonnenscheins und des blauen Himmels war es ein<br />
trüber, seltsamer Tag, denn auch die Kälber, die mit Flaschen gefüttert wurden,<br />
wirkten nicht niedlich, sondern eher gruselig. Sie hatten für ihre kleinen Köpfe<br />
viel zu große Augen, und eine Menge Fliegen schwirrten um sie herum.<br />
Mein Blick wanderte nun zum Schwein, das kurz darauf von meinem<br />
Schulfreund am Strick herausgeführt wurde. Der raue Strick war um das rechte<br />
Vorderbein geknotet. Ich merkte dem Schwein an, dass es mit Spaziergängen<br />
dieser Art keine Erfahrung hatte, denn es rümpfte ununterbrochen die Nase und<br />
schwenkte sein dickes Gesicht hin und her, was so aussah, als wollte es sich in<br />
seiner neuen Umgebung orientieren und die Möglichkeiten für seinen Ausbruch<br />
genauestens prüfen. Doch es wurde von meinem Schulfreund geradewegs in die<br />
Arme des Schlachters geführt, der das Bolzenschussgerät direkt zwischen den<br />
kleinen Schweineaugen ansetzte. Während der Schlachter den Schuss auslöste,<br />
schaute ich in die Augen meines Schulfreundes und hoffte, eine Gefühlsregung<br />
im Himmelblau seiner Augen zu erblicken – einen Moment der Reue oder der<br />
Trauer oder irgendeines anderen Zeichens, das mir zu verstehen gab, dass er diesen<br />
Akt der Tötung ebenso wie ich nicht gutheißen würde.<br />
Genau in diesem Augenblick erinnerte ich mich daran, wie er mich das erste<br />
Mal gefragt hatte, ob ich mit ihm bei dem Dorffest tanzen wollte. Da war ich vierzehn<br />
gewesen. „Kannst auch mit mir tanzen“, sagte er damals auf dem Geburtstag<br />
eines gemeinsamen Freunds ganz beiläufig, und noch während des Sprechens<br />
sank seine Stimme so kläglich zum Ende des Satzes hin ab, als ob er schon im<br />
Moment des Fragens die Frage bereute, als ob er schon im Voraus wüsste, dass<br />
ich mit dem Kopf schütteln würde, was ich dann natürlich auch tat. Doch irgendwann,<br />
zu einem späteren Zeitpunkt am Abend, stimmte ich dem gemeinsamen<br />
Tanz doch zu. Schließlich war ich vierzehn und er fünfzehn, und das passte doch<br />
eigentlich ganz gut zusammen. Und eigentlich war ich auch ein bisschen stolz,<br />
dass er mich ausgewählt hatte. Es waren schließlich noch eine Menge anderer<br />
Mädchen auf dem Geburtstag gewesen, die er auch hätte fragen können.<br />
Am Tag des Festes wartete er dann etwas unbeholfen, gleichsam in der Rolle<br />
eines großen, in einen Kommunionsanzug gezwungenen Kindes, vor dem Dorfgemeinschaftshaus<br />
auf mich. Seine schwarze Hose war leicht ausgebeult, sein<br />
weißes Hemd hatte er in die Hose gesteckt. An einer Seite schaute ein kleiner Zipfel<br />
heraus, den er schnell verschwinden ließ, als er sah, dass ich mich ihm näherte.<br />
Vielleicht hatte er sich sogar die Augenbrauen zurechtgezupft, denn sie schienen<br />
ungewöhnlich geordnet und in eine Richtung getrimmt zu sein. Als ich die<br />
22
Stufen des Dorfgemeinschaftshauses zu ihm hochstieg, zauberte sich ein Lächeln<br />
auf seine Lippen, das Grübchen und Gesichtsfältchen hervortreten ließ, die ich<br />
noch nie zuvor bemerkt hatte. Sonst sah ich ihn immer nur in Arbeitskleidung,<br />
in diesen stabilen grün-schwarzen Hosen, die aus einem dicken Stoff gewebt gewesen<br />
waren und nicht selten Zeichen geleisteter Arbeit auf sich trugen: Strohfetzen,<br />
kleine schwarz-klebrige Kleckse, manchmal auch ein paar verlorene, an<br />
den Außentaschen klebende Tierhaare. Schon als Jugendlicher hatte er viel auf<br />
dem Hof seiner Eltern mitgeholfen und kam nahezu immer in Arbeitskleidung<br />
zur Schule. Wir fanden das alle in der Klasse irgendwie cool, dass er schon richtig<br />
arbeitete und Sachen machte, die sonst nur Erwachsene machen durften. Selbst<br />
beim Kalben durfte er dabei sein, und weil man dafür die ganze Nacht wach bleiben<br />
musste, kam er morgens mit roten, aufgequollenen Augen zur Schule. Er<br />
hatte an dem Tag ganz dreckige Fingernägel gehabt, und ich war mir sicher gewesen,<br />
dass es Blut war, weil er bestimmt beim Herausziehen des Kalbes aus dem<br />
Bauch der Kuh geholfen hatte.<br />
Der Tanz mit ihm war dann überraschend leicht, wenngleich er sich komplett<br />
von dem Folkloretanz, den ich während meiner Kindheit lernte, unterschied.<br />
Aber ich hatte mit meiner Freundin ein paar Tage vor dem Dorffest in ihrem<br />
Zimmer ein paar dieser Tanzschritte geübt. Meine Freundin hatte den Mann gespielt<br />
und ihre Hand auf meinen Rücken gelegt. „Und eins und zwei und drei<br />
und vier“, zählte sie immer vor, und dann begannen wir, einen Walzertakt zu<br />
summen. Wir lachten viel und immer wieder trat ich ihr auf die Füße, manchmal<br />
aus Spaß und manchmal versehentlich, und als wir bei einer Drehung ihren CD-<br />
Player umschmissen und ebenso eine Kleiderstange, kam ihre Mutter ins Zimmer<br />
gestürmt, und wir setzten uns schnell aufs Sofa und taten so, als ob wir uns<br />
nicht bewegt hätten.<br />
Ich war überrascht, wie sicher mich der Milchbauer mit seinen Schritten über<br />
die Tanzfläche führte und wie sich unsere Schritte immer mehr aufeinander abstimmten.<br />
Alles fühlte sich erstaunlich angenehm an, auch dass er nach dem offiziellen<br />
Eröffnungstanz nicht von meiner Seite wich und später, sogar vor seinen<br />
Fußballfreunden, Versuche zeigte, hin und wieder meine Hand zu ergreifen. Von<br />
diesem Tag an tanzten wir alljährlich auf dem Dorffest zusammen – bis ich nach<br />
dem Schulabschluss das Dorf verließ.<br />
Das Schwein fing an, markerschütternd zu quieken. „Nein, noch nicht!“,<br />
schien es zu schreien. ‚Doch jetzt, und jetzt aber so richtig!‘, schien der Schlachter<br />
zu denken. Etwas an seinen Bewegungen war seltsam hart und ruppig; er packte<br />
23
das Schwein mit beiden Händen an seinem Hinterkopf, um das Bolzenschussgerät<br />
an der richtigen Stelle anzusetzen.<br />
Auch mein Schulfreund presste die Lippen zusammen und entschloss, den<br />
Strick des Schweins festzuhalten, das immer noch versuchte, sich von der Fußschlinge<br />
zu befreien. Ich fühlte, wie der Schlachter zornig mit dem Schwein ob<br />
seiner Widerspenstigkeit geworden war. „Jetzt aber!“, sagte der Schlachter und<br />
trat mit dem Metallschussgerät auf das Schwein zu.<br />
Der Knall, der nun die Luft durchschnitt, ließ den hellrosa Körper des Tieres<br />
umgehend niederfallen, seine Gliedmaßen zuckten, die Schweineaugen verdrehten<br />
sich, und als der Schlachter das Messer am Hals des Schweins ansetzte,<br />
trat dunkelrot zähflüssiges Blut aus dem Schweinehals. „Das ist der Blutkuchen“,<br />
sagte der Milchbauer, während ich wie gelähmt auf das immer noch zuckende<br />
Schwein schaute. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Mir fehlten die <strong>Wort</strong>e.<br />
Ich wusste nur, dass wir, der Milchbauer und ich, damals gemeinsam getanzt<br />
hatten.<br />
Die Suche nach dem verschwundenen <strong>Wort</strong> bestimmte jetzt meinen Alltag. Ich<br />
konnte nicht mehr schreiben, sondern nur noch suchen.<br />
Selbst beim Schminken dachte ich an das <strong>Wort</strong> und überlegte, wann ich begonnen<br />
hatte, dem <strong>Wort</strong> eine andere Kontur zu geben oder es anders für mich<br />
zu betonen: zuerst das Tuschen der Wimpern, das mühsame Trennen der einzelnen<br />
augenschützenden Kleinsthaare, das Fluchen über den verklebten Stab,<br />
bloß keine Klumpen, keine groben Satzaneinanderreihungen. Bloß den Blick<br />
aufhellen, glänzender soll er werden; strahlen soll das <strong>Wort</strong>. Und in allem, was<br />
ich tat, war der Versuch enthalten, der geschriebenen Geschichte Struktur zu<br />
verleihen, das eine vom anderen abzugrenzen; die ständige Suche nach Unterscheidungen,<br />
das Sezieren von Wörtern; Wörter, die wie Wimpern gefärbt und<br />
voneinander abgetrennt werden, „du nicht mit der und umgekehrt, bitte keine<br />
eigenen Paarbildungsversuche; nur ich bin die, die verlängert und anreichert; nur<br />
ich gebe euch, was ihr braucht; Länge, Geschwungenheit; das, was ihr nicht habt,<br />
wird euch hinzugefügt. Wörter wie Wimpern, Sätze, wie Augenaufschläge, damit<br />
ihr ihm standhaltet: dem schönen Blick.<br />
Dann das Nachzeichnen der Augenbrauen: ein Versuch des Verstärkens von<br />
schon Vorhandenem; da ist ein <strong>Wort</strong>, aber ich kann es schöner machen, ich kann<br />
ihm mehr Kraft und Farbe verleihen, ich kann ihm etwas hinzufügen, was es<br />
noch nicht hat.<br />
24
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek<br />
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in<br />
der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten<br />
sind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar.<br />
Gefördert durch die Sparkassen-Kulturstiftung Hessen-Thüringen, die Wartburg-Sparkasse<br />
und die Kulturstiftung des Freistaats Thüringen.<br />
© 2022 by Wartburg Verlag GmbH, Weimar<br />
Printed in Germany<br />
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt.<br />
Jede Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne<br />
Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für<br />
Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung<br />
und <strong>Vera</strong>rbeitung in elektronischen Systemen.<br />
Das Buch wurde auf alterungsbeständigem Papier gedruckt.<br />
Reihengestaltung: Felix Wilhelm, Dresden<br />
Satz und Layout: Dr. Jochen Ebert, Kassel<br />
Druck und Binden: BELTZ Grafische Betriebe GmbH, Bad Langensalza<br />
ISBN 978-3-86160-587-4<br />
www.wartburgverlag.net