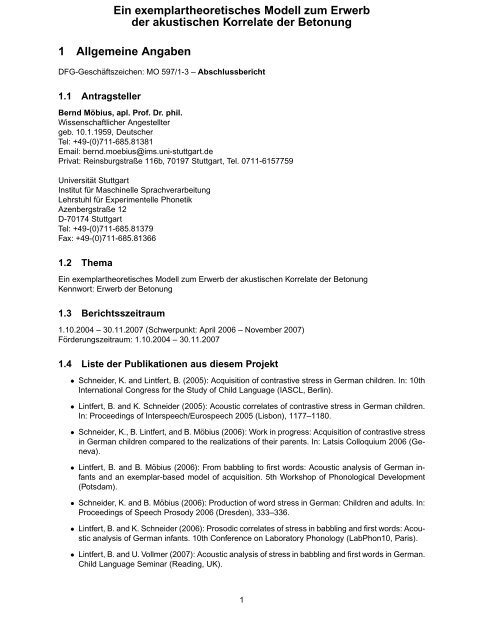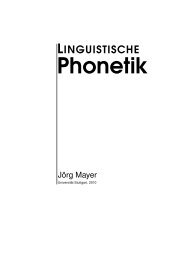Ein exemplartheoretisches Modell zum Erwerb der akustischen ...
Ein exemplartheoretisches Modell zum Erwerb der akustischen ...
Ein exemplartheoretisches Modell zum Erwerb der akustischen ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Ein</strong> <strong>exemplartheoretisches</strong> <strong>Modell</strong> <strong>zum</strong> <strong>Erwerb</strong><br />
<strong>der</strong> <strong>akustischen</strong> Korrelate <strong>der</strong> Betonung<br />
1 Allgemeine Angaben<br />
DFG-Geschäftszeichen: MO 597/1-3 – Abschlussbericht<br />
1.1 Antragsteller<br />
Bernd Möbius, apl. Prof. Dr. phil.<br />
Wissenschaftlicher Angestellter<br />
geb. 10.1.1959, Deutscher<br />
Tel: +49-(0)711-685.81381<br />
Email: bernd.moebius@ims.uni-stuttgart.de<br />
Privat: Reinsburgstraße 116b, 70197 Stuttgart, Tel. 0711-6157759<br />
Universität Stuttgart<br />
Institut für Maschinelle Sprachverarbeitung<br />
Lehrstuhl für Experimentelle Phonetik<br />
Azenbergstraße 12<br />
D-70174 Stuttgart<br />
Tel: +49-(0)711-685.81379<br />
Fax: +49-(0)711-685.81366<br />
1.2 Thema<br />
<strong>Ein</strong> <strong>exemplartheoretisches</strong> <strong>Modell</strong> <strong>zum</strong> <strong>Erwerb</strong> <strong>der</strong> <strong>akustischen</strong> Korrelate <strong>der</strong> Betonung<br />
Kennwort: <strong>Erwerb</strong> <strong>der</strong> Betonung<br />
1.3 Berichtsszeitraum<br />
1.10.2004 – 30.11.2007 (Schwerpunkt: April 2006 – November 2007)<br />
För<strong>der</strong>ungszeitraum: 1.10.2004 – 30.11.2007<br />
1.4 Liste <strong>der</strong> Publikationen aus diesem Projekt<br />
• Schnei<strong>der</strong>, K. and Lintfert, B. (2005): Acquisition of contrastive stress in German children. In: 10th<br />
International Congress for the Study of Child Language (IASCL, Berlin).<br />
• Lintfert, B. and K. Schnei<strong>der</strong> (2005): Acoustic correlates of contrastive stress in German children.<br />
In: Proceedings of Interspeech/Eurospeech 2005 (Lisbon), 1177–1180.<br />
• Schnei<strong>der</strong>, K., B. Lintfert, and B. Möbius (2006): Work in progress: Acquisition of contrastive stress<br />
in German children compared to the realizations of their parents. In: Latsis Colloquium 2006 (Geneva).<br />
• Lintfert, B. and B. Möbius (2006): From babbling to first words: Acoustic analysis of German infants<br />
and an exemplar-based model of acquisition. 5th Workshop of Phonological Development<br />
(Potsdam).<br />
• Schnei<strong>der</strong>, K. and B. Möbius (2006): Production of word stress in German: Children and adults. In:<br />
Proceedings of Speech Prosody 2006 (Dresden), 333–336.<br />
• Lintfert, B. and K. Schnei<strong>der</strong> (2006): Prosodic correlates of stress in babbling and first words: Acoustic<br />
analysis of German infants. 10th Conference on Laboratory Phonology (LabPhon10, Paris).<br />
• Lintfert, B. and U. Vollmer (2007): Acoustic analysis of stress in babbling and first words in German.<br />
Child Language Seminar (Reading, UK).<br />
1
• Schnei<strong>der</strong>, K. (2007): Acquisition of word stress in German: Vowel duration and incompleteness<br />
of closure. Proceedings of the 16th International Congress of Phonetic Sciences (Saarbrücken),<br />
1565–1568.<br />
• Schnei<strong>der</strong>, K. and B. Möbius (2007): Word stress correlates in spontaneous child-directed speech<br />
on German. Proceedings of Interspeech 2007 (Antwerpen), 1394–1397.<br />
• Lintfert, B. (in press): From babbling to first words: Acoustic analysis of German infants. In: Kern,<br />
S., F. Gayraud and E. Marsico (Hrsg.), Emergence of Linguistic Abilities, Cambridge Scholars<br />
Publishing.<br />
• Möbius, B., B. Lintfert, K. Schnei<strong>der</strong>, T. Wade (in prep.): Exemplar-based acquisition of word stress:<br />
A longitudinal study.<br />
2 Arbeits- und Ergebnisbericht<br />
2.1 Ausgangsfragen und Zielsetzung<br />
Ziel des Projekts war die Entwicklung eines exemplartheoretischen <strong>Modell</strong>s <strong>zum</strong> <strong>Erwerb</strong> <strong>der</strong> <strong>akustischen</strong><br />
Korrelate <strong>der</strong> Betonung im Deutschen. Hierzu wurde die Auswirkung <strong>der</strong> Betonung auf die Grundfrequenz,<br />
die Dauer und die Qualität <strong>der</strong> betonten Vokale in verschiedenen Altersgruppen (zwischen 4<br />
Monaten und ca. 15 Jahren) und über verschiedene Zeiträume hinweg untersucht. Es wurde analysiert,<br />
wann Kin<strong>der</strong> Unterschiede in <strong>der</strong> Betonung wahrnehmen, wann und wie sie Betonung realisieren und<br />
ob sie die <strong>akustischen</strong> Korrelate <strong>der</strong> Betonung ihrer Eltern übernehmen.<br />
2.2 Entwicklung <strong>der</strong> durchgeführten Arbeiten<br />
Zusätzlich zu den bereits vor Projektbeginn gesammelten Daten von 6 Kin<strong>der</strong>n wurden in <strong>der</strong> Projektlaufzeit<br />
weitere 9 Kin<strong>der</strong> in die regelmäßigen Aufnahmen mit einbezogen. So wurde ein Kin<strong>der</strong>sprachkorpus<br />
erstellt, das die sprachliche Entwicklung von 15 deutschsprachigen Kin<strong>der</strong>n im Alter zwischen 5<br />
Monaten und 8 Jahren dokumentiert. Die Daten <strong>der</strong> Kin<strong>der</strong> wurden, abhängig vom jeweiligen Alter und<br />
<strong>der</strong> damit verbundenen Phase des Spracherwerbs, den drei relevanten <strong>Erwerb</strong>sphasen zugeordnet. Zur<br />
Erstellung einer Vergleichsbasis mit älteren Altersgruppen wurden zusätzlich Evaluationsdaten im Kin<strong>der</strong>garten,<br />
in <strong>der</strong> Grundschule und im Gymnasium aufgenommen, in <strong>der</strong> Projektalufzeit allerdings erst<br />
partiell ausgewertet.<br />
Die Methoden <strong>der</strong> Sprachdatenerhebung, einschließlich <strong>der</strong> technischen Ausstattung für die Aufnahmen<br />
und <strong>der</strong> Aufnahmeszenarios, waren zu Projektbeginn bereits etabliert und wurden sukzessive<br />
optimiert, so dass die Projektdaten in einer technischen Qualität vorliegen, die eine Analyse mit allen<br />
gängigen akustisch-phonetischen Werkzeugen ermöglichte. In <strong>der</strong> ersten Projektphase war die Entwicklung<br />
altersgerechter Sprachtests ein wichtiger Schritt. Diese Tests dienten dazu, das für die Validierung<br />
<strong>der</strong> gestellten Hypothesen benötigte Sprachmaterial zu erheben, und dabei erwerbsphasengerechte<br />
Anfor<strong>der</strong>ungen an die Kin<strong>der</strong> zu stellen.<br />
Im Zuge <strong>der</strong> Projektarbeit stellte es sich als wertvoll heraus, auch Daten <strong>der</strong> Eltern in <strong>der</strong> Interaktion<br />
mit ihren Kin<strong>der</strong>n aufzuzeichnen. Als zusätzliche Evaluationsdaten wurden daher sowohl kind- als auch<br />
erwachsenengerichtete Äußerungen <strong>der</strong> Eltern erhoben, um überprüfen zu können, inwieweit einerseits<br />
die Kin<strong>der</strong> die gleichen Parameter verwenden wie ihre Eltern und ob an<strong>der</strong>erseits kindgerichtete Sprache<br />
sich durch eine spezielle Verwendung <strong>der</strong> Parameter auszeichnet. Die Auswertung dieser Daten<br />
erfolgt <strong>der</strong>zeit im Rahmen einer Studienarbeit.<br />
Am Ende des Projekts sollte ein exemplarbasiertes <strong>Modell</strong> vorliegen, das <strong>zum</strong>indest partiell –<br />
nämlich soweit im Rahmen unseres Projekts erreichbar – auf empirisch soli<strong>der</strong> Grundlage steht. Dieses<br />
Ziel wurde nur bedingt erreicht. Das bereits im Zwischenbericht (2006) entworfene Exemplarmodell<br />
berücksichtigt Ergebnisse <strong>der</strong> Analyse von Sprachdaten, die im Verlauf dieses Projekts erhoben und<br />
annotiert wurden. <strong>Ein</strong>e komputationelle <strong>Modell</strong>ierung, die die Variabilität <strong>der</strong> Sprachdaten als Funktion<br />
des zeitlichen Verlaufs <strong>der</strong> Entwicklung des Spracherwerbs über die im Projekt angenommenen Phasen<br />
interpretiert, konnte jedoch in <strong>der</strong> Projektlaufzeit nicht geleistet werden. Diese Arbeiten werden <strong>der</strong>zeit<br />
im Rahmen des Projekts A2 im Stuttgarter SFB 732 intensiv weiterverfolgt.<br />
Etwa zur Mitte <strong>der</strong> Projektlaufzeit wechselte eine <strong>der</strong> beiden Mitarbeiterinnen, Katrin Schnei<strong>der</strong>, in<br />
ein an<strong>der</strong>es DFG-Projekt am IMS (im Rahmen des Schwerpunktprogramms 1234). Sie führte jedoch<br />
2
die inhaltliche Betreuung <strong>der</strong> Untersuchungen <strong>der</strong> Sprachdaten aus <strong>der</strong> Takiphase (s.u.) fort, die ohnehin<br />
schon weit fortgeschritten war. In ihre Stelle im Projekt trat Ursula Vollmer ein, die vor allem die<br />
statistische Analyse und Auswertung übernahm.<br />
2.2.1 Korpus, Annotation, Analysetools<br />
Probanden. Insgesamt wurden in <strong>der</strong> Projektlaufzeit die Daten von 12 Kin<strong>der</strong>n erhoben. Die Daten<br />
von 10 Kin<strong>der</strong>n wurden im Detail analysiert, davon 6 Kin<strong>der</strong> zwischen dem 5. bis 36. Lebensmonat, und<br />
4 Kin<strong>der</strong> ab 36 Monate. <strong>Ein</strong> Kind (EL) wurde ab 24 Monaten von weiteren Analysen ausgeschlossen, da<br />
eine Spracherwerbsverzögerung ab diesem Alter festgestellt wurde.<br />
Als Evaluationsdaten wurden im Kin<strong>der</strong>garten 7 Kin<strong>der</strong> (Alter 3–6 Jahre), in <strong>der</strong> Grundschule 40<br />
Kin<strong>der</strong> (je Klassenstufe 10) und am Gymnasium 8 Kin<strong>der</strong> (Alter 13–14 Jahre) aufgenommen. Zieldaten:<br />
Benennen von Bildkarten (siehe Tabelle 2 im Anhang A), Nachsprechen von per CD eingespielten<br />
Zielwörtern, Lesen einer Wortliste (nur Gymnasium), Produktion von kontrastivem Wortakzent auf <strong>der</strong><br />
Basis graphisch vorliegen<strong>der</strong> Szenen (siehe Zwischenbericht). Von den aufgenommenen Evaluationsdaten<br />
(Kin<strong>der</strong>garten, Grundschule und Gymnasium) wurden für diesen Bericht nur die Daten <strong>der</strong> 1.<br />
Klasse ausgewertet.<br />
Die Tabellen im Anhang C geben einen Überblick über die gelabelten Aufnahmen, geglie<strong>der</strong>t nach<br />
Kind und Spracherwerbsphase. Die Aufteilung in die drei <strong>Erwerb</strong>sphasen Babbling, Mixing und Taki<br />
wurde im Zwischenbericht motiviert und erläutert.<br />
Babbling-Phase (Lallphase): 5–18 Monate. Sprachentwicklung vom Beginn <strong>der</strong> Kontrolle <strong>der</strong><br />
Phonation bis zu einer durchschnittlichen Produktion von etwa 250–300 Wörtern und <strong>der</strong> Produktion erster<br />
Zwei- bzw. Dreiwortsätze. Zwischen 5 und 18 Monaten wurden alle 6–8 Wochen Sprachaufnahmen<br />
des Lallens von insgesamt 6 Kin<strong>der</strong>n und ihren Eltern gemacht. Mit Beginn <strong>der</strong> Produktion erster Wörter<br />
wurde bei 3 Kin<strong>der</strong>n (NB, FZ und BW) Bildkarten mit unterschiedlichen Betonungsmustern eingeführt<br />
(siehe Tabelle 2 im Anhang A), um so den <strong>Erwerb</strong> <strong>der</strong> Silbe und des Betonungsmusters dokumentieren<br />
zu können.<br />
Mixing-Phase: 18–36 Monate. Starker Anstieg des Vokabulars, Neuorganisation <strong>der</strong> Wortbetonung,<br />
Vorbereitung <strong>der</strong> Entwicklung des phonologischen Lexikons (Boysson-Bardies de, 1999). Im Alter<br />
von 18 bis 36 Monaten wurden alle 6–8 Wochen Aufnahmen gemacht. Bei NB, FZ und BW wurden<br />
weiter die Bildkarten als Sprachanreiz verwendet. TS und ED wurden mit dem Taki-Szenario vertraut<br />
gemacht.<br />
Taki-Phase: ab 36 Monate. Die Kin<strong>der</strong> sind in <strong>der</strong> Lage, vollständige Sätze zu bilden. In dieser<br />
Phase wurde gezielt <strong>der</strong> <strong>Erwerb</strong> <strong>der</strong> kontrastiven Wortbetonung beobachtet. Dazu wurden alle 10–12<br />
Wochen Aufnahmen nach dem Taki-Szenario (siehe Abschnitt 2.3.2) gemacht. Ergebnisse liegen hier<br />
von insgesamt 4 Kin<strong>der</strong>n (LL, MS, TS, ED) über einen Zeitraum von etwa 4 Jahren vor.<br />
Bei allen teilnehmenden Kin<strong>der</strong>n war <strong>der</strong> Spracherwerb unauffällig, und es wurden keine vermehrten<br />
Mittelohrentzündungen festgestellt, die den Spracherwerbsprozess verzögern können. Dies wurde<br />
jeweils im Alter von 12 und 24 Monaten mittels ELFRA (Grimm und Doil, 2004) evaluiert.<br />
Aufnahmeszenarien und Technik. Alle Aufnahmen fanden in <strong>der</strong> häuslichen Umgebung <strong>der</strong> jeweiligen<br />
Kin<strong>der</strong> statt. Über ein an <strong>der</strong> Kleidung befestigtes Mikrofon wurden die sprachlichen Äußerungen<br />
<strong>der</strong> Kin<strong>der</strong> auf das entsprechende Medium aufgenommen. Die Eltern wurden in die Aufnahmetechnik<br />
eingewiesen.<br />
Die Aufnahmen erfolgten in <strong>der</strong> ersten Projektphase überwiegend mit einem Digitalen Audio Tape<br />
Recor<strong>der</strong> (DAT-Recor<strong>der</strong>) Sony TCD-D100 mit einer Abtastfrequenz von 48 kHz, 16 Bit linear. Das verwendete<br />
Mikrofon war ein kabelloses Klemmmikrofon NADY LT-4 (Lavalier) E-701 (600 Ohm). Das Mikrofon<br />
wird am Pullover/Nicki des Kindes nahe dem Hals befestigt und lässt qualitativ sehr hochwertige<br />
Aufnahmen zu.<br />
Ab 01/2005 wurden außerdem zweispurige Aufnahmen von Kind und Elternteil mit einem Marantz<br />
PMD670 Flash Recor<strong>der</strong> mit 2 GB CF-Karte und einer Abtastrate von 48 kHz gemacht. Die kabellosen<br />
Klemmmikrofone AKG CK 97-L wurden wie oben beschrieben angebracht. Die Daten wurden auf<br />
einen Rechner übertragen, auf 16 kHz downgesampelt und entsprechend <strong>der</strong> Annotationsschemata mit<br />
XWaves (Entropic, Inc.) bzw. WaveSurfer weiter bearbeitet.<br />
3
Annotation. Für die erhobenen Sprachdaten musste eine Konvention für die Annotation, die als<br />
<strong>Ein</strong>gabeinformation für die automatische Analyse dienen sollte, entwickelt werden. Für die Sprachdaten<br />
bis drei Jahren werden 8 Labelspuren verwendet. Alle störungsfreien Äußerungen von Kind und<br />
Elternteil wurden in die Analysen einbezogen und annotiert. Die 8 Labelspuren sind:<br />
cv: Vokalische und konsonantische Segmente.<br />
sylstr: Silbenstruktur und sprachliche Entwicklung (MBL nach Stoel-Gammon (1989)).<br />
phones-cover: weite Transkription: Konsonanten nach Artikulationsstelle und -art, Vokale nach Zungenhöhe<br />
und -lage.<br />
phones: enge Transkription nach XSAMPA.<br />
marks: Beginn und Ende des stabilen Bereichs eines Vokals (F2-Kriterium).<br />
stress: Silbenbetonung: unbetont (0), betont (1), nebenbetont (2).<br />
contour: perzeptuelle <strong>Ein</strong>schätzung <strong>der</strong> F0-Kontour (rise, fall, level).<br />
trans: grobe orthographische Transkription des Höreindrucks.<br />
Die annotierten Sprachdaten werden von einem zweiten erfahrenen Annotator kontrolliert. Weitere<br />
Details und ein Beispiel für die Annotation von Sprachdaten mit 8 Labelspuren finden sich im Zwischenbericht.<br />
Für die Sprachdaten <strong>der</strong> Kin<strong>der</strong> ab einem Alter von ca. drei Jahren werden nur noch 4 Labelspuren<br />
verwendet, da hier nur noch festgelegte Zielwörter untersucht wurden (siehe Abschnitt 2.3.2). Die 4<br />
Labelspuren sind:<br />
noise: Störgeräusche (Husten, Niesen, Lachen, auch Hineinsprechen des Elternteils in die Äußerung<br />
des Kindes).<br />
words: Tatsächliche Zielwortäußerungen.<br />
canwords: Intendiertes Zielwort.<br />
marks: Beginn und Ende <strong>der</strong> Zielvokale und <strong>der</strong>en stabiler Bereich.<br />
<strong>Ein</strong> Beispiel für die Annotation von Sprachdaten mit 4 Labelspuren findet sich im Zwischenbericht.<br />
Analysetools. Die Kin<strong>der</strong>sprachdaten wurden mit Hilfe eines am Institut für Maschinelle Sprachverarbeitung<br />
<strong>der</strong> Universität Stuttgart (IMS) entwickelten Programmpakets zur automatischen Extraktion<br />
und Berechnung <strong>der</strong> <strong>akustischen</strong> und Stimmqualitätsparameter analysiert. Dieses Tool wurde von<br />
Pützer und Wokurek (2006) entwickelt und zuvor nur für die Analysen männlicher, deutscher Sprecher<br />
getestet. Es verwendet Amplituden- und Frequenzmessungen an den spektralen Gipfeln <strong>der</strong> Harmonischen<br />
als Basis für die <strong>akustischen</strong> Analysen. Dies ermöglichte die Bearbeitung umfangreicher Sprachdaten<br />
in diesem Projekt.<br />
Das Analysetool misst automatisch zwischen den gesetzten Labels mit einer vorgegebenen Fensterlänge<br />
und Schrittweite verschiedene akustische Parameter wie die Grundfrequenz (F0), Intensität<br />
(RMS), Formanten, Harmonische und Amplituden. Über die so erhaltenen Messwerte werden dann<br />
mittels mathematischer Formeln verschiedene Stimmqualitätsparameter berechnet (Tabelle 1). Die Vokaldauer<br />
ergibt sich trivial aus den markierten Vokalintervallen.<br />
Die Messung <strong>der</strong> <strong>akustischen</strong> Parameter bzw. die Berechnung <strong>der</strong> daraus resultierenden Stimmqualitätsparameter<br />
wurde an 5 Zeitpunkten (bei 10%, 30%, 50%, 70% und 90% <strong>der</strong> Vokaldauer) innerhalb<br />
eines jeden Vokals in den Zielworten durchgeführt, um eventuell auftretende Parameterverän<strong>der</strong>ungen<br />
innerhalb eines jeden Vokals mit beobachten zu können. Die Verwendung dieser Methode <strong>der</strong> Profilanalyse<br />
(Möbius, 2004) wurde im Zwischenbericht motiviert und im Detail erläutert.<br />
CHILDES/Phon-Korpus. Das annotierte Korpus wurde <strong>der</strong> innerhalb von CHILDES (MacWhinney,<br />
1995) entwickelten und noch im Aufbau befindlichen phonologischen Datenbank PHON<br />
([http://childes.psy.cmu.edu/phon/]) zur Verfügung gestellt. Weitere Teile des Korpus werden kontinuierlich<br />
nach Abschluss noch anstehen<strong>der</strong> Transkriptionen nachgeliefert. Die bisher analysierten Sprachfiles<br />
werden im Laufe des ersten Halbjahres 2008, zusammen mit einer Beschreibung des Korpus, in<br />
die Sprachdatenbank PHON eingestellt.<br />
4
höchste Harmonische bei Stimmqualitätsparameter Formel<br />
2 ∗ F0 Open Quotient (OQ) OQ˜= (H1˜− H2˜)<br />
F1 Glottal Opening (GO) GO˜= (H1˜− A1˜)<br />
F2 Skewness (SK) SK˜= (H1˜− A2˜)<br />
F3 Rate of Closure (RC) RC˜= (H1˜− A3˜)<br />
F4 T4 T4˜= (H1˜− A4˜)<br />
− Completeness of Closure (CC) CC = B1<br />
− Incompleteness of Closure (IC) IC = B1/F1<br />
Tabelle 1: Formeln zur Berechnung <strong>der</strong> verschiedenen Stimmqualitätsparameter nach Pützer und Wokurek<br />
(2006).<br />
2.3 Ergebnisse<br />
2.3.1 Entwicklung von 5-36 Monaten<br />
Insgesamt wurden von 6 Kin<strong>der</strong>n (3 Mädchen und 3 Jungen) beginnend von einem Alter von 5 bis<br />
12 Monaten über einen Zeitraum von 2 Jahren regeläßig Aufnahmen gemacht. Von einem Jungen (OZ)<br />
liegen nur die Daten bis 18 Monate vor, von einem Mädchen (EL) bis 24 Monaten. <strong>Ein</strong> Mädchen (HH) und<br />
ein Junge (NB) wurden über den Zeitraum von fast 2 Jahren (5–36 bzw. 7–32 Monaten) analysiert und<br />
von einem Mädchen (FZ) und einem Jungen (BW) liegen Daten ab einen Alter von 12 bis 36 Monaten<br />
vor. <strong>Ein</strong>e genaue Übersicht <strong>der</strong> einzelnen Aufnahmen liefert die Tabellen im Anhang C.<br />
In diesem Abschlussbericht wird exemplarisch an einem Mädchen (HH) die Entwicklung des Vokalinventars<br />
sowie des Vokalraumes von betonten und untonten Vokalen gezeigt. Auch die Entwicklung<br />
betonter und unbetonter Silbenmuster sowie die akustische Realisierung wird beschrieben. Die Ergebnisse<br />
des an<strong>der</strong>en Kin<strong>der</strong> werden bei Lintfert (2008) präsentiert.<br />
Akustische Analysen. Von einem Gutachter wurde angemerkt, dass die automatische Formantmessung<br />
evaluiert werden sollte. Zu diesem Zweck wurden von einem Mädchen (Alter: 22 Monate) 80 Vokale<br />
manuell gemessen. Für F1 war <strong>der</strong> Unterschied <strong>der</strong> Mittelwerte <strong>der</strong> Formantfrequenzen zwischen<br />
automatisch und manuell gemessenen Werten 19,47 Hz bei einer Standardabweichung von 318,88 Hz<br />
(p = 0, 262). Für F2 war die Differenz <strong>der</strong> Mittelwerte zwischen automatischer und manueller Messung<br />
17,94 Hz bei einer Standardabweichung von 269,53 Hz (p = 0, 298). Tendenziell wurde F2 manuell höher<br />
gemessen als automatisch. F3 wurde in dieser Evaluation nicht gemessen.<br />
Diese Abweichungen zwischen automatisch gemessenen und manuell ermittelten Formantwerten<br />
sind für die Sprachaufnahmen des Mädchens im Alter von 22 Monaten also tatsächlich geringer als diejenigen,<br />
die z.B. für Männerstimmen bei Laborsprache berichtet werden (z.B. Möbius, 2001). Wir sind<br />
daher zuversichtlich, dass unsere auf Formantmessungen beruhenden Ergebnisse nicht durch systematische<br />
Messfehler entwertet werden.<br />
Bei <strong>der</strong> Auswertung aller Daten gingen wir so vor, dass Ausreißer und Extremwerte mittels explorativer<br />
Datenanalyse ermittelt und von den weiteren Analysen ausgeschlossen wurden. Als Schwellwert<br />
für die Klassifikation als Ausreißer wurde das 1,5fache des Interquartilabstands angesetzt (cf. Lee et al.,<br />
2006; Ménard et al., 2007). Nach diesem Kriterium mussten von den Daten des analysierten Mädchens<br />
bei 5708 Vokalemessungen für F0 2,9%, für F1 4,0%, für F2 4,44%, für F3 4,73%, für F4 3,71% und für<br />
die RMS-Intensität 4,08% <strong>der</strong> Messungen ausgeschlossen werden. Bei 1366 gemessenen Vokalendauern<br />
wurden 3,07% <strong>der</strong> Daten von <strong>der</strong> weiteren Analyse ausgeschlossen.<br />
Betonung. In <strong>der</strong> Lallphase wurde die Betonung über die auditiv beurteilte Prominenz <strong>der</strong> einzelnen<br />
Silbe innerhalb einer Äußerung markiert, wobei die prominenteste Silbe als die (haupt)betonte Silbe<br />
und die nicht prominenten Silben als unbetont markiert wurden. Bei Wortproduktionen wurde auf die<br />
korrekte lexikalische Betonung geachtet, ansonsten wurde mittels Prominenz <strong>der</strong> einzelnen Silben die<br />
Betonung markiert. Teile dieser Ergebnisse wurden auf <strong>der</strong> LabPhon10 (Paris) (Lintfert und Schnei<strong>der</strong>,<br />
2006) und beim Child Language Seminar (Reading, UK) (Lintfert und Vollmer, 2007) präsentiert.<br />
Produktion von Vokalen<br />
Um die Vokalentwicklung zu beschreiben, wurden die Vokale bezüglich <strong>der</strong> Zungenhöhe, <strong>der</strong> Zungenposition<br />
vorne/hinten und <strong>der</strong> Lippenrundung klassifiziert. Vier Gruppen, hohe�ÁÝ�ÙÍ, halbhohe<br />
5
��Ó, halbtiefe���Çund tiefe Vokale�beschreiben die Vokalhöhe. Die vor<strong>der</strong>en Vokale<br />
sind�ÁÝ������, wobei�Á���ungerundet undÝ���ihre gerundeten Entsprechungen<br />
sind. Die hinteren Vokale sindÙÍÓÇ.<br />
Die Tabellen 4 und 5 im Anhang B geben eine Übersicht über die produzierten Merkmale <strong>der</strong> betonten<br />
und unbetonten Vokale in Abhängigkeit vom Alter des Kindes.<br />
Mit Beginn <strong>der</strong> Lallphase produziert HH hauptsächlich tiefe und halbtiefe Vokale mit einer deutlichen<br />
Präferenz für vor<strong>der</strong>e, ungerundete Vokale. Dieses Produktionsmuster ist während <strong>der</strong> gesamten Lallphase<br />
zu beobachten. Mit Beginn <strong>der</strong> Produktion von ersten Wörten mit 18 Monaten wird es nötig, mehr<br />
erwachsenenähnliche Ziele zu produzieren, damit verbunden werden nun auch mehr hohe und halbhohe,<br />
sowie hintere Vokale produziert. Bis zu einem Alter von 15 Monaten sind mehr gerundete unbetonte<br />
Vokale als gerundete betonte Vokale von HH produziert worden. Mit Beginn <strong>der</strong> ersten Wortproduktionen<br />
mit 18 Monaten kehrt sich dies aber um, nun werden mehr betonte gerundete Vokale produziert.<br />
Es zeigt sich mit zunehmenden Alter ein deutlicher Anstieg im Vokalinventar. Die Produktion <strong>der</strong><br />
Vokale mit extremer artikulatorischer Position (�Ù�Ý) wird innerhalb <strong>der</strong> ersten 18 Monate gemeistert<br />
(cf. Ishizuka et al., 2007). Während zu Beginn <strong>der</strong> Lallphase deutlich die vor<strong>der</strong>en Vokale präferiert<br />
werden, werden mit zunehmenden Alter auch immer mehr Produktionen von hinteren Vokalen beobachtet.<br />
Unabhängig von diesem Anstieg des Vokalinventars wird auch eine graduelle Entwicklung <strong>der</strong><br />
Formantwerte hin zu typischeren Erwachsenenwerten beobachtet. Dieser Prozess beginnt innerhalb<br />
<strong>der</strong> Lallphase und ist mit 36 Monaten noch nicht abgeschlossen.<br />
Entwicklung des Vokalraums. Um die Entwicklung des Vokalraums zu veranschaulichen, wurde die<br />
Fläche <strong>der</strong> Dispersionsellipsen (mit Radius 1,5 Standardfehler <strong>der</strong> individuellen Formantwerte um den<br />
Mittelwert) im Raum F1 vs. F2 und F2 vs. F3 (in Bark) berechnet, jeweils getrennt für Betonung und<br />
Alter. ANOVA-Analysen mit <strong>der</strong> Ellipsenfläche als abhängiger Variable und Betonung, Vokalmerkmalen,<br />
und Alter als Faktoren wurden durchgeführt, um aufzuzeigen, ob und wie sich betonte und unbetonte<br />
Vokale in ihrer Ellipsenfläche unterscheiden und wie sich die untersuchten Vokalmerkmale im Untersuchungszeitraum<br />
bei HH entwickeln. Es zeigt sich, dass nur <strong>der</strong> Faktor Betonung signifikant ist (Höhe:<br />
F(6,368) = 37,858, p < 0, 05; vorne-hinten: F(8,463) = 46,904, p < 0, 05; Rundung: F(9,547) = 65,895,<br />
p < 0, 05). Es gibt keine signifikante Entwicklung des Effekts <strong>der</strong> untersuchten Faktoren. Die Entwicklung<br />
des Vokalraumes ist mit 36 Monaten noch nicht abgeschlossen.<br />
Phonologische Entwicklung<br />
Bis <strong>zum</strong> Alter von 36 Monaten ist CV, gefolgt von CVC, die am häufigsten produzierte Silbenstruktur.<br />
Die Ausprägung <strong>der</strong> Silbenstruktur ist signifikant von <strong>der</strong> Betonung abhängig (Pearsons Chi-Quadrat,<br />
p < 0, 05). In Abhängigkeit vom Alter des untersuchten Mädchens zeigt sich, dass sich mit <strong>der</strong> Produktion<br />
von Wörtern auch die Silbenstruktur än<strong>der</strong>t und diese ab einem Alter von 20 Monaten abhängig von <strong>der</strong><br />
Betonung wird. Dies bedeutet, dass sich die Silbenstruktur von betonten und unbetonten Silben in ihrer<br />
beobachteten und erwarteten Häufigkeit signifikant unterscheiden. Somit kann ein <strong>Ein</strong>fluss <strong>der</strong> Betonung<br />
auf die Silbenstruktur mit Beginn <strong>der</strong> Wortproduktion angenommen werden.<br />
Daher wurde jede kindliche Produktion dahingehend annotiert, ob sie als Lallen o<strong>der</strong> als bedeutungstragende<br />
Äußerung wahrgenommen wurde. Bedeutungstragend war die Äußerung dann, wenn<br />
aufgrund <strong>der</strong> Intention bzw. Antwort <strong>der</strong> Mutter ein Wort erkannt werden konnte und dieses Produktionsschema<br />
mehrmals dem gleichen Wort zugeordnet werden konnte. Mit <strong>Ein</strong>setzen <strong>der</strong> ersten Wörter<br />
im Alter von 18 Monaten zeigt auch <strong>der</strong> Faktor Produktionsphase (Lallphase vs. wortähnlich) einen signifikanten<br />
<strong>Ein</strong>fluss auf die Silbenstruktur (p < 0, 05), was nahelegt, dass in diesem Alter Lallproduktionen<br />
und Wörter unterschiedliche Silbenstrukturen aufweisen. Bezüglich des <strong>Erwerb</strong>s <strong>der</strong> Silbenstruktur und<br />
<strong>der</strong> Frage, inwieweit die Protosilben <strong>der</strong> Lallphase die Wortproduktion beeinflussen, werden in Lintfert<br />
(2008) weitere Analysen folgen.<br />
Akustische Entwicklung<br />
Alle untersuchten Parameter haben sich als abhängig vom Vokal herausgestellt. Daher wurden für die<br />
statistischen Analysen z-transformierte Normalisierungen durchgeführt, indem die Rohdaten durch ihre<br />
Unterschiede zu den vokalabhängigen Mittelwerten ersetzt wurden und diese Unterschiede durch die<br />
vokalspezifische Standardabweichung geteilt wurde. Um die akustische Entwicklung zu veranschaulichen,<br />
wurden ANOVA-Analysen mit Dauer und RMS-Intensität als abhängige Variable und Betonung<br />
und Alter als Faktoren, sowie MANOVA-Analysen <strong>der</strong> Stimmqualitätsparameter als abhängige Variable<br />
und Betonung, Alter und Phonemidentität als Faktoren durchgeführt.<br />
6
Dauer. Dauer zeigt zwar bei HH einen signifikanten Effekt von Betonung (F(12,799) = 16,462,<br />
p < 0, 05) und Alter (F(14,582) = 2,344, p < 0, 05), aber keinen signifikanten Interaktionseffekt von Betonung<br />
und Alter. Abbildung 1 im Anhang B zeigt, dass die Dauer abhängig vom Alter sehr unterschiedlich<br />
verwendet wird. HH verwendet bis <strong>zum</strong> Alter von 36 Monaten Dauer noch nicht konstant als Betonungsparameter,<br />
denn im Alter von 15, 18 und 34 Monaten sind ihre unbetonten Produktionen von Vokalen<br />
länger als die betonten Produktionen. Es zeigt sich aber auch ein signifikanter Haupteffekt <strong>der</strong> Position<br />
des Vokals im Wort (F(13,398) = 5,744, p < 0, 05). Ab einem Alter von 7 Monaten wird von HH bei<br />
mehrsilbigen Produktionen die letzte Silbe, unabhängig von <strong>der</strong> Betontung, gelängt. Das bedeutet, dass<br />
die durchschnittliche Vokallänge sowohl bei betonten wie auch bei unbetonten Vokalen in <strong>der</strong> letzten<br />
Silbe größer ist als am Anfang o<strong>der</strong> in <strong>der</strong> Mitte einer Äußerung.<br />
RMS-Intensität. Für die RMS-Intensität sind sowohl Betonung (F(15,125)= 16,824, p < 0, 05) als<br />
auch Alter (F(26,675) = 3,709, p < 0, 05) als Haupteffekt, als auch die Interaktion von Betonung und Alter<br />
signifikant (F(5,934)= 44,184, p < 0, 05). Betonte Vokale werden, bis auf das Alter von 27 Monaten, mit<br />
mehr Intensität produziert als unbetonte (Abbildung 1 im Anhang B). Bei Erwachsenen hingegen gilt<br />
Intensität nicht als Korrelat <strong>der</strong> deutschen Betonung, son<strong>der</strong>n es wird vorwiegend spectral tilt mit seinen<br />
Parametern Steilheit <strong>der</strong> glottalen Welle (skewness, SK) und Verschlussrate (rate of closure, RC) für die<br />
Markierung von Betonung verwendet.<br />
Stimmqualität. Es wurden die Parameter Öffnungsquotient (OQ), Steilheit <strong>der</strong> glottalen Welle<br />
(skewness, SK), Verschlussrate (rate of closure, RC), Vollständigkeit des Verschlusses (completeness<br />
of closure, CC), Unvollständigkeit des Verschlusses (incompleteness of closure, IC), sowie <strong>der</strong> Parameter<br />
T4 untersucht. T4 entspricht einer Extrapolation <strong>der</strong> Berechnungen <strong>der</strong> Parameter GO (glottale<br />
Öffnung), SK und RC, wobei <strong>der</strong> nächsthöhere Formant F4 und seine Amplituden mit berücksichtigt<br />
werden. Diese Stimmqualitätsparameter wurden ab einem Alter von 15 Monaten zusätzlich analysiert.<br />
Für die Parameter IC, SK, RC zeigte sich bei <strong>der</strong> Analyse mittels MANOVA kein Haupteffekt des Alters,<br />
und für Betonung ist <strong>der</strong> Parameter IC (F(3,409) = 4,162, p < 0, 05) signifikant. Es treten Interaktionseffekte<br />
von Betonung und Alter für den Parameter SK (F(14,583) = 2,780, p < 0, 05) auf (Abbildung 2<br />
im Anhang B). HH verwendet diese Parameter unterschiedlich, abhängig von <strong>der</strong> Betonung, aber oft nur<br />
tendenziell (vor allem RC) und bis zu einem Alter von 36 Monaten nicht konstant.<br />
Der Parameter IC zeigt, dass bis auf die Produktionen mit 18 Monaten, unbetonte Vokale mit einem<br />
unvollständigeren Verschluss als betonte Vokale produziert werden. Der Parameter SK wird unterschiedlich<br />
zur Betonung eingesetzt, zeigt aber keine klaren Tendenzen zwischen betonten und unbetonten<br />
Vokalen. Erwartet wird, dass unbetonte Vokale mit höheren SK-Werten produziert werden als betonte.<br />
Mit 18 und 27 Monaten werden dagegen betonte Vokale mit einem höheren SK-Wert produziert, nur mit<br />
20 Monaten werden unbetonte Vokale mit den erwarteten höheren SK-Werten produziert; im restlichen<br />
Untersuchungszeitraum gibt es keine klaren Unterschiede zwischen unbetonten und betonten Vokalen<br />
bezüglich ihrer SK-Werte. Der Parameter RC zeigt ein ähnliches Bild. Erwartet wurde, dass unbetonte<br />
Vokale höhere RC-Werte aufweisen als betonte Vokale. Dies triff bei HH aber nur im Alter von 20, 34 und<br />
36 Monaten zu. Mit 15, 18 und 27 Monaten werden unbetonte Vokale mit einem niedrigeren RC-Wert<br />
produziert als betonte, mit 30 Monaten kann keine Tendenz festgestellt werden.<br />
Zusammenfassung. In <strong>der</strong> Zusammenschau lässt sich zeigen, dass HH mit Beginn <strong>der</strong> Lallphase<br />
unterschiedlich prominente Vokale produzieren kann. Dafür verwendet sie bevorzugt RMS-Intensität,<br />
aber auch die Vokaldauer, welche bei erwachsenen Sprechern das bevorzugte Korrelat <strong>der</strong> Wortbetonung<br />
ist. Auch die untersuchten Stimmqualitätsparameter setzt sie ein. Doch es zeigt sich deutlich,<br />
dass die Verwendung <strong>der</strong> untersuchten Parameter bis <strong>zum</strong> Alter von 36 Monaten nicht konstant ist. Es<br />
liegt nahe anzunehmen, dass <strong>der</strong> <strong>Erwerb</strong> <strong>der</strong> Betonung bei diesem untersuchten Mädchen noch nicht<br />
abgeschlossen ist.<br />
Eltern HH. Die Mutter von HH zeigt sowohl bei <strong>der</strong> Untersuchung <strong>der</strong> Dauer als auch bei <strong>der</strong> RMS<br />
Intensität signifikante Unterschiede bei <strong>der</strong> Produktion von betonten und unbetonten Vokalen (Dauer:<br />
F(14,468)=16,031, p < 0, 05; RMS-Intensität: F(44,684)=52,678, p < 0, 05). Da sich auch die untersuchten<br />
Stimmqualitätsparameter als abhängig von den Vokalen herausgestellt haben, wurde auch hier<br />
mittels z-Transformation normalisiert und die normalisierten Daten mittels MANOVA analysiert.<br />
Für die Mutter waren die Parameter SK (F(11,166)= 11,654, p < 0, 05), CC (F(4,077)=4,548, p <<br />
0, 05) und IC (F(4,754) = 5,408, p < 0, 05) signifikant. Der Vater von HH produziert betonte Vokale<br />
7
signifikant länger als unbetonte Vokale (F(4,057)=4,741, p < 0, 05), RMS-Intensität verwendet er im<br />
Gegensatz zur Mutter aber nicht für die Betonung. Bei den Stimmqualitätsparametern sind OQ (F(3,302)<br />
= 5,929, p < 0, 05), CC (F(3,081)=4,918, p < 0, 05) und IC (F(3,131)=7,080, p < 0, 05) signifikant<br />
(Abbildung 5 im Anhang B).<br />
Beide Eltern produzieren betonte Vokale länger als unbetonte Vokale. Die Mutter verwendet daüber<br />
hinaus auch RMS als Parameter, um Betonung zu markieren. Dies könnte somit eine Erklärung dafür<br />
sein, dass auch das Mädchen bis <strong>zum</strong> Alter von 36 Monaten Intensität <strong>zum</strong> Markieren von Betonung verwendet.<br />
Bei den Stimmqualitätsparametern produzieren beide Eltern unbetonte Vokale mit den erwarteten<br />
höheren SK-Werten, allerdings waren nur die Daten <strong>der</strong> Mutter signifikant. Beide Eltern produzieren<br />
unbetonte Vokale mit höheren IC- und CC-Werten.<br />
<strong>Erwerb</strong> <strong>der</strong> Intonation. In einer Studienarbeit (Wagner) wurde die Entwicklung <strong>der</strong> Produktion von<br />
F0-Konturen im Alter von 5–18 Monaten anhand von 4 Kin<strong>der</strong>n untersucht. Wie in <strong>der</strong> Studie von Balog<br />
und Snow (2007) wurden hierzu F0-Konturen in monolyllabischen Äußerungen in den im Projekt<br />
erhobenen Daten sowohl automatisch analysiert als auch perzeptuell annotiert. Dabei zeigte sich, dass<br />
sich die in <strong>der</strong> Spracherwerbsforschung häufig verwendete Methode <strong>der</strong> Annotation <strong>der</strong> Intonation auf<br />
auditiver Basis <strong>zum</strong>indest in unserer Studie nicht bewährt hat, da 73% aller Konturen auditiv falsch klassifiziert<br />
wurden, wobei die Fehlerrate bei steigenden Konturen signifikant niedriger war als bei fallenden<br />
Konturen.<br />
Der Befund von Balog und Snow (2007), wonach die Variabilität von fallenden Konturen größer ist<br />
als die von steigenden, konnte hier nicht bestätigt werden. Bei allen vier Kin<strong>der</strong>n war die Variabilität von<br />
fallenden und steigenden Konturen etwa gleich groß. Hingegen wurde die von Snow (2006) beschriebene<br />
U-förmige Entwicklung des Umfangs <strong>der</strong> Tonhöhenverän<strong>der</strong>ung (zunächst ein Rückgang bis <strong>zum</strong><br />
Alter von ca. 11 Monaten, dann ein Plateau, dann ein Anstieg des Umfangs ab einem Alter von ca. 18<br />
Monaten) bestätigt.<br />
<strong>Ein</strong>e Entwicklung <strong>der</strong> Kontrolle über die F0-Produktion zeigt sich darin, dass insgesamt zunächst einfache<br />
Konturen ohne Richtungswechsel bevorzugt werden, bevor dynamischere Konturen mit größerem<br />
Umfang und Richtungswechseln entsprechend <strong>der</strong> zunehmend komplexeren Äußerungen in pragmatischen<br />
Kontexten produziert werden.<br />
In einer weiteren Studienarbeit (Nikolova) wurde die Entwicklung <strong>der</strong> Realisierung von intonatorischen<br />
Grenztönen im Spracherwerb des Deutschen anhand einer longitudinalen Studie eines Kindes<br />
im Alter von 27–52 Monaten untersucht. In <strong>der</strong> statistischen Analyse <strong>der</strong> <strong>akustischen</strong> Realisierung <strong>der</strong><br />
Grenztöne wurden Satzart, Grenztontyp, Struktur <strong>der</strong> Akzentsilbe sowie syntaktische und semantische<br />
Information als Faktoren und <strong>der</strong> F0-Verlauf auf <strong>der</strong> den Grenzton tragenden Silbe als abhängige Variable<br />
betrachtet. Es wurde festgestellt, dass die syntaktische und semantische Sprachentwicklung mit<br />
einer Reorganisation <strong>der</strong> Intonation im Alter von ca. 35–44 Monaten einhergeht. Auch die Äußerungen<br />
<strong>der</strong> Mutter und die mögliche Imitation ihrer Intonation durch die Tochter wurden berücksichtigt. Die Ergebnisse<br />
legen nahe, dass die Entwicklung <strong>der</strong> Intonationsproduktion auch mit 52 Monaten noch nicht<br />
abgeschlossen ist.<br />
2.3.2 Taki-Kin<strong>der</strong>: 3-8 Jahre<br />
Im Rahmen des Taki-Tests wurden in diesem Projekt die Daten von 4 Kin<strong>der</strong>n, und zwar von 2 Mädchen<br />
(ED und LL) und 2 Jungen (MS und TS) untersucht. Beim Taki-Szenario hatten die Kin<strong>der</strong> die Aufgabe,<br />
während des Spielens mit verschiedenen Spielzeugtierpaaren die entsprechenden vorgegebenen<br />
Namen dieser Tiere zu benutzen. Die Namen <strong>der</strong> Tiere (siehe Tabelle 3 im Anhang A), die jeweils ein<br />
Paar bildeten, waren segmentell identisch, unterschieden sich aber in <strong>der</strong> Position <strong>der</strong> Wortbetonung<br />
(kontrastive Betonung).<br />
Perzeption <strong>der</strong> Wortbetonung. Unsere Hypothese war, entsprechend <strong>der</strong> von Pierrehumbert (2003),<br />
dass Perzeption und Produktion durch den sogenannten perception-production-loop miteinan<strong>der</strong> verbunden<br />
sind. Demzufolge war es eine <strong>der</strong> ersten Aufgaben, zu kontrollieren, inwieweit die Kin<strong>der</strong> in <strong>der</strong><br />
Lage sind, die Namen den richtigen Tieren zuzuordnen. Es stellte sich heraus, dass dies, nach einer<br />
kurzen Lernphase, die sich nur über wenige Aufnahmesitzungen hinzieht, nahezu perfekt funktioniert.<br />
Die Kin<strong>der</strong> korrigierten sich jedes Mal sofort, wenn sie einen Fehler in <strong>der</strong> Benennung <strong>der</strong> Tiere gemacht<br />
hatten (Lintfert und Schnei<strong>der</strong>, 2005). Daraus schließen wir, dass die Perzeption <strong>der</strong> Wortbetonung bzw.<br />
die Wahrnehmung von im Deutschen existierenden Betonungsmustern bei diesen Kin<strong>der</strong>n bereits korrekt<br />
erfolgt.<br />
8
<strong>Ein</strong>schränkungen. Bei näherer Betrachtung <strong>der</strong> Zielworte stellte sich heraus, dass die meisten <strong>der</strong><br />
Vokale, die sich in wortmedialer Position in den dreisilbigen Worten befanden, zu�℄-ähnlichen Produktionen<br />
des korrespondierenden Vollvokals reduziert worden waren. Um eine Verfälschung <strong>der</strong> Analyseergebnisse<br />
für Vollvokale durch Hinzuziehen von reduzierten Vokalen zu verhin<strong>der</strong>n, entschieden wir<br />
uns, beschränkten wir die Analysen auf den ersten und den letzten Vokal jedes Zielwortes (Schnei<strong>der</strong>,<br />
2007; Schnei<strong>der</strong> und Möbius, 2007).<br />
Ergebnisse. Im Folgenden werden die Ergebnisse aus den Analysen <strong>der</strong> Aufnahmen <strong>der</strong> 4 Kin<strong>der</strong><br />
präsentiert.<br />
Vokaldauer. Es zeigte sich in unseren Untersuchungen durchgängig, dass die Vokaldauer dass<br />
auffälligste und zuverlässigste Korrelat <strong>der</strong> Wortbetonung bei deutschsprachigen Kin<strong>der</strong>n ist (Schnei<strong>der</strong><br />
und Lintfert, 2005; Lintfert und Schnei<strong>der</strong>, 2005; Schnei<strong>der</strong> et al., 2006; Schnei<strong>der</strong> und Möbius, 2006;<br />
Schnei<strong>der</strong>, 2007). Trotz leichter vokalspezifischer Dauerunterschiede werden betonte Vokale grundsätzlich<br />
mit einer signifikant längeren Dauer produziert als unbetonte Vokale (p < 0.001). Dieser Effekt<br />
konnte sowohl für alle Vokale insgesamt (Abbildung 3 im Anhang B), als auch für jedes untersuchte<br />
Vokalphonem separat (Abbildung 4 im Anhang B) nachgewiesen werden. Außerdem konnten wir Hinweise<br />
auf die Längung wortfinaler Silben finden, aber die Stärke bzw. Deutlichkeit dieses Effekts ist<br />
sprecherspezifisch.<br />
RMS-Intensität (RMS). In Bezug auf RMS-Intensität zeigen die Analysen <strong>der</strong> Kin<strong>der</strong>sprachdaten,<br />
dass dieser Parameter nicht zur Markierung betonter Vokale in den Zielwörtern benutzt wird. RMS ist<br />
vokalspezifisch, wobei /i/-Vokale die kleinsten Werte besitzen. Das zeigt sich für alle 4 untersuchten Kin<strong>der</strong>.<br />
Auch wenn in einzelnen Aufnahmesitzungen betonte Vokale mit tendenziell höheren RMS-Werten<br />
produziert wurden als unbetonte Vokale, ist eine Verallgemeinerung diesbezüglich nicht möglich, denn in<br />
<strong>der</strong> weitaus größeren Zahl <strong>der</strong> Fälle ist es vokal- und aufnahme- bzw. altersspezifisch, ob und wie sich<br />
betonte und unbetonte Vokale in Bezug auf den Parameter RMS unterscheiden. Wir folgern daraus,<br />
dass RMS im vorliegenden Szenario kein Korrelat <strong>der</strong> kontrastiven Wortbetonung bei den untersuchten<br />
Kin<strong>der</strong>n im Alter zwischen 2,5 und 8 Jahren ist.<br />
Open Quotient (OQ). Der Parameter OQ wird von allen 4 Kin<strong>der</strong>n vokalspezifisch verwendet, wobei<br />
<strong>der</strong> Vokal /i/ grundsätzlich signifikant niedrigere OQ-Werte hat als die beiden an<strong>der</strong>en Vokale /a/<br />
und /o/. Allerdings zeigt keines <strong>der</strong> Kin<strong>der</strong>, we<strong>der</strong> für eine <strong>der</strong> untersuchten Vokalqualitäten noch insgesamt,<br />
eine Verwendung dieses Parameters zur Markierung <strong>der</strong> Wortbetonung. Damit bestätigen unsere<br />
Ergebnisse die Resultate von Sluijter (1995, für Amerikanisches Englisch), dass OQ kein Korrelat <strong>der</strong><br />
Wortbetonung ist. Auch Sluijter (1995) beobachtete einen Werteunterschied für diesen Parameter bei<br />
verschiedenen Vokalen. Sie führte das darauf zurück, dass die OQ-Werte von <strong>der</strong> Muskelspannung im<br />
Larynx abhängen, die bei <strong>der</strong> Produktion von hinteren Vokalen größer ist als bei vor<strong>der</strong>en Vokalen.<br />
Grundfrequenz (F0). In verschiedenen Studien wurde festgestellt, dass im Deutschen die Grundfrequenz<br />
(F0) vokalspezifisch ist und nicht zur Markierung von Wortbetonung benutzt wird (Claßen et al.,<br />
1998; Dogil, 1999). In unseren Daten können wird diese Ergebnisse generell bestätigen. Allerdings zeigte<br />
sich für 3 <strong>der</strong> 4 Kin<strong>der</strong> (ED, MS und TS) eine zeitweilige, vokalspezifische Abhängigkeit <strong>der</strong> Grundfrequenz<br />
von <strong>der</strong> Betonung. Das Mädchen ED produzierte im Alter zwischen 3 und 4 Jahren alle betonten<br />
/a/-Vokale mit höherer F0 im Vergleich zu den unbetonten /a/-Vokalen. Die beiden Jungen produzierten<br />
für ca. 1 Jahr in ihrer sprachlichen Entwicklung (MS im Alter zwischen 4 und 5 Jahren, TS im Alter zwischen<br />
3 und 4 Jahren) die Vokale /i/ und /o/ mit höherer F0, wenn die Vokale betont waren. Dies zeigte<br />
sich auch in den z-transformierten Werten dieser Kin<strong>der</strong> (siehe Abbildungen 6 und 7 im Anhang B). Diese<br />
Abhängigkeiten verschwanden nach ca. 1 Jahr wie<strong>der</strong>. Es lässt sich mutmaßen, dass diese Kin<strong>der</strong><br />
den Parameter F0 in dieser Zeit als Betonungsparameter ausprobierten, um dann festzustellen, dass es<br />
kein optimaler Parameter für die Betonungsmarkierung im Deutschen ist.<br />
Für die beiden jüngeren Kin<strong>der</strong> in dieser Studie ließ sich erwartungsgemäß ein Absinken <strong>der</strong> Grundfrequenz<br />
über die Serie <strong>der</strong> Aufnahmesitzungen hinweg beobachten. Dies geht mit dem von an<strong>der</strong>en<br />
Studien berichteten Absinken <strong>der</strong> Stimmtonhöhe bei Kin<strong>der</strong>n im Verlauf ihrer sprachlichen Entwicklung<br />
einher.<br />
9
Spectral Tilt: Skewness (SK) und Rate of Closure (RC). In ihren Analysen deutscher Erwachsener<br />
fanden (Claßen et al., 1998) heraus, dass die spektrale Balance (spectral tilt) im Deutschen als<br />
Parameter zur Wortbetonungsunterscheidung benutzt wird. Nach dieser Studie haben unbetonte Vokale<br />
einen größeren spectral tilt als die betonten Vokale, was sich auch in den damit zusammenhängenden<br />
Parametern SK und RC zeigt. Beide Parameter sind vokalspezifisch. Der Vokal /a/ hat grundsätzlich<br />
signifikant höhere SK- bzw. RC-Werte als die beiden an<strong>der</strong>en Vokalqualitäten /i/ und /o/.<br />
In unseren Daten benutzte das älteste Kind (MS) den Parameter SK nicht zur Betonungsmarkierung.<br />
Die an<strong>der</strong>en 3 Kin<strong>der</strong> dagegen haben diesen Parameter in ihr Betonungsparameterinventar aufgenommen.<br />
ED produziert ab einem Alter von 3 Jahren und 9 Monaten durchgängig den Vokal /a/ (und den<br />
Vokal /o/ in Ansätzen) mit niedrigeren SK-Werten, wenn diese Vokale betont auftreten. LL produziert<br />
2 Vokalqualitäten, und zwar /a/ und /i/, ab einem Alter von knapp 6 Jahren mit höheren SK-Werten in<br />
unbetonten Positionen, und TS produziert ab einem Alter von knapp 4 Jahren die SK-Werte <strong>der</strong> Vokale<br />
/a/ und /o/ mit <strong>der</strong> Tendenz unbetont > betont. Dies sind allerdings nur Tendenzen und keine signifikanten<br />
Unterschiede in <strong>der</strong> Produktion von betonten und unbetonten Vokalen. Auch die z-transformierten<br />
SK-Werte für alle Vokalproduktionen <strong>der</strong> 3 Kin<strong>der</strong> zeigen ab dem angegebenen Alter die Tendenz, dass<br />
unbetonte Vokale höhere SK-Werte haben als betonte Vokale.<br />
Der Parameter RC wird von den Kin<strong>der</strong>n entsprechend dem Parameter SK verwendet, d.h., das älteste<br />
von uns untersuchte Kind (MS) benutzt auch diesen Parameter nicht zur Betonungsmarkierung. Für<br />
den Vokal /a/ findet sich sogar eine den Erwachsenendaten entgegengesetzte Verwendungstendenz bei<br />
MS. Die 3 an<strong>der</strong>en Kin<strong>der</strong> dagegen verwenden RC im gleichen Maß wie SK zur Betonungsmarkierung.<br />
Insgesamt läßt sich ableiten, dass in unseren Daten die spektralen Betonungsparameter von den<br />
Kin<strong>der</strong>n sprecherspezifisch und vokalspezifisch eingesetzt werden. Dieser unterschiedliche <strong>Ein</strong>satz<br />
könnte einerseits auf ein Ausprobieren <strong>der</strong> möglichen Hervorhebungsvarianten bei <strong>der</strong> Wortbetonung<br />
o<strong>der</strong> an<strong>der</strong>erseits durch familien- o<strong>der</strong> regionalspezifische Verwendungsweise von bestimmten Betonungsparametern<br />
erklärt werden.<br />
Completeness (CC) und Incompleteness of Closure (IC). Für den Parameter CC stellte Sluijter<br />
(1995) fest, dass betonte Vokale höhere CC-Werte besitzen als unbetonte Vokale. Die Daten für die<br />
von uns untersuchten Kin<strong>der</strong> zeigten keine klaren Ergebnisse für diesen Parameter. Bei allen Kin<strong>der</strong>n<br />
schwankte die Verwendung von CC stark von einer Aufnahmesitzung zur nächsten, und für die Jungen<br />
(MS und TS) zeigte sich mit steigendem Alter eine leicht entgegengesetzte Tendenz <strong>der</strong> CC-Werte für<br />
betonte vs. unbetonte Vokale im Vergleich zu den Erkenntnissen von Sluijter (1995).<br />
Um einen klareren <strong>Ein</strong>blick in diesen Parameter zu bekommen, verwendeten wir zusätzlich eine F1normalisierte<br />
Version von CC, und zwar IC (siehe Tabelle 1). Dieser Parameter verhält sich deutlich<br />
stabiler als CC. Dennoch sind die Ergebnisse sowohl vokal- als auch sprecherspezifisch. Die jüngste<br />
Probandin (ED) produziert die /a/-Vokale relativ konstant mit höheren IC-Werten in unbetonten Positionen.<br />
Die beiden an<strong>der</strong>en Vokalqualitäten zeigen noch keine Tendenz in Bezug auf IC. LL zeigt die gleiche<br />
vokalspezifische Verwendungsweise dieses Parameters. MS benutzt IC ebenfalls mit steigendem Alter<br />
mit höheren IC-Werten für die unbetonten Vokale, beson<strong>der</strong>s für /a/ und mit Tendenzen für die beiden<br />
an<strong>der</strong>en Vokalqualitäten. TS hat die gleiche Tendenz in <strong>der</strong> Verwendung von IC für alle 3 Vokale. Ob<br />
diese Tendenzen nur ein Ausprobieren eines Betonungsparameters sind o<strong>der</strong> ob die Verwendung von IC<br />
zur Betonungsmarkierung im Deutschen tatsächlich entgegengesetzt zu den Ergebnissen von Sluijter<br />
(1995) erfolgt, wurde an den Erwachsenendaten evaluiert (Abschnitt 2.3.4).<br />
2.3.3 Evaluationsdaten<br />
Die Erhebung <strong>der</strong> Evaluationsdaten erfolgte stichprobenartig mit etwa 10 Kin<strong>der</strong>n (5m/5f) pro Altersklasse<br />
im Kin<strong>der</strong>garten und in <strong>der</strong> Grundschule. Die Aufnahmen fanden Ende 2005 in <strong>der</strong> Grundschule<br />
Backnang-Maubach statt. Hier werden die Analysen <strong>der</strong> Daten von 3 Kin<strong>der</strong>n (2m/1f) <strong>zum</strong> Benennen<br />
von Bildkarten (siehe Tabelle 2 im Anhang A) präsentiert.<br />
Es zeigt sich, dass Vokaldauer in dieser Alterstufe ein zuverlässiges Korrelat <strong>der</strong> Wortbetonung ist.<br />
Betonte Vokale wurden von allen untersuchten Kin<strong>der</strong>n mit signifikant längerer Vokaldauer produziert<br />
als unbetonte Vokale (F(15,453) = 29,584, p < 0, 05). Es zeigt sich aber auch, dass die Vokaldauer von<br />
<strong>der</strong> Position im Wort abhängig ist (F(118,728) = 75,765; p < 0, 05): Unabhängig von <strong>der</strong> Betonung sind<br />
Vokale in <strong>der</strong> wortinitialen Silbe am kürzesten und Vokale in <strong>der</strong> wortfinalen Silbe am längsten.<br />
Bezüglich RMS-Intensität zeigt sich ebenfalls eine signifikante Abhängigkeit von <strong>der</strong> Betonung<br />
(F(6,911) = 7,167, p < 0, 05), aber auch von <strong>der</strong> Position <strong>der</strong> Silbe im Wort (F(27,160) = 9,388, p < 0, 05).<br />
Die letzte Silbe wird immer mit weniger Intensität produziert als die vorangegangenen. Zwischen den<br />
10
nicht-finalen Silben gibt es jedoch keinen Unterschied in RMS. Die betonte Silbe in einer Äußerung wird<br />
immer mit größerer Intensität produziert als unbetonte Silben.<br />
Bezüglich <strong>der</strong> Stimmqualitätsparameter zeigen SK und RC für die Vokale /a/ und /i/ die Tendenz,<br />
dass unbetonte Vokale mit größeren SK und RC-Werten produziert werden, während /o/ und /Ç/ die<br />
entgegengesetzte Tendenz aufweisen.<br />
Insgesamt zeigt sich im Alter von 6-7 Jahren, dass Dauer als Hauptkorrelat <strong>der</strong> Betonung stabil<br />
verwendet wird. Jedoch scheint auch die Intensität (gemessen als RMS) noch immer ein Korrelat <strong>der</strong><br />
Wortbetonung zu sein. Bezüglich <strong>der</strong> Stimmqualitätsparameter zeigt sich die Tendenz, dass unbetonte<br />
Vokale mit größeren spectral tilt, verbunden mit höheren Werten von SK und RC, produziert werden<br />
können.<br />
2.3.4 Elterndaten: kindgerichtet<br />
Neben den Aufnahmen mit den Kin<strong>der</strong>n wurden ab Beginn 2005 auch die Eltern während des gemeinsamen<br />
Spielens auf einer separaten Spur mit aufgenommen, um <strong>der</strong> Hypothese nachgehen zu können,<br />
dass Kin<strong>der</strong> die Betonungsparameter ihrer Eltern übernehmen. Hier wurden die Daten von 3 Müttern<br />
(AD, BL und KS) ausgewertet, die die Aufnahmen mit ihren Kin<strong>der</strong>n (ED, LL, MS und TS) regelmäßig<br />
absolvierten. Die Ergebnisse zu den einzelnen Parametern werden im Folgenden präsentiert.<br />
Vokaldauer. Die Vokaldauer ist auch bei den Erwachsenen das deutlichste Korrelat <strong>der</strong> Wortbetonung<br />
im Deutschen. Alle 3 Mütter nutzen die Vokaldauer, um Betonungsunterschiede zu markieren, d.h. betonte<br />
Vokale werden signifikant länger als ihre unbetonten Varianten produziert (p < 0.001). Dass sowohl<br />
Mütter als auch ihre Kin<strong>der</strong> die Vokaldauer als deutlichstes Korrelat <strong>der</strong> Wortbetonung benutzen, sehen<br />
wir als eine Bestätigung unserer Hypothese, dass die Kin<strong>der</strong> sich an den <strong>akustischen</strong> Wortbetonungsparametern,<br />
die ihnen ihre Eltern anbieten, orientieren.<br />
RMS-Intensität. RMS wird von den untersuchten Müttern nicht zur Betonungsmarkierung benutzt.<br />
Es sind zwar vokalspezifische und sprecherspezifische Tendenzen erkennbar, aber auch die ztransformierten<br />
RMS-Werte lassen bei allen Sprecherinnen we<strong>der</strong> eine Betonungsabhängigkeit noch<br />
eine Tendenz dieses Parameters erkennen. Wir folgern daraus, dass RMS im vorliegenden Szenario<br />
nicht zur kontrastiven Betonungsunterscheidung benutzt wird – we<strong>der</strong> von den Müttern noch von den<br />
Kin<strong>der</strong>n.<br />
Open Quotient (OQ). OQ wird von den Müttern vokalspezifisch verwendet. Im Vergleich zu den Kin<strong>der</strong>sprachdaten<br />
zeigt sich aber bei den Müttern ein deutlicher Wertebereichsunterschied zwischen allen<br />
3 untersuchten Vokalqualitäten mit /a/ > /o/ > /i/. Allerdings ist we<strong>der</strong> in den sprecherspezifischen Daten<br />
noch in den z-transformierten OQ-Werten eine Abhängigkeit dieses Parameters von <strong>der</strong> Betonung zu<br />
erkennen. Dieses Ergebnis untermauert damit die Ergebnisse von Sluijter (1995): OQ ist kein Korrelat<br />
<strong>der</strong> Wortbetonung.<br />
Grundfrequenz (F0). In den Daten <strong>der</strong> Mütter zeigte sich, dass die Grundfrequenz im Deutschen<br />
vokalspezifisch ist, aber nicht zur Unterscheidung von betonten und unbetonten Vokalen benutzt wird. In<br />
unseren Daten wurden nur die betonten /a/-Vokale immer mit einer leicht niedrigeren F0 im Vergleich zu<br />
unbetontem /a/ produziert. Dieses sprecherübergreifende Verhalten zeigte sich aber für keinen weiteren<br />
Vokal. Auch in den z-transformierten F0-Werten ließ sich keine Betonungsabhängigkeit erkennen. Damit<br />
werden die Erkenntnisse vorangehen<strong>der</strong> Studien für die Grundfrequenz bestätigt.<br />
Spectral Tilt: Skewness (SK) und Rate of Closure (RC). Nach Claßen et al. (1998) zeigen erwachsene<br />
deutsche Sprecher einen größeren spectral tilt für unbetonte im Vergleich zu betonten Vokalen,<br />
was sich auch in den glottalen Parametern SK und RC finden lässt. In den von uns untersuchten Sprachdaten<br />
<strong>der</strong> Mütter konnten wir für jede <strong>der</strong> 3 Sprecherinnen die beschriebene Tendenz für mindestens 2<br />
<strong>der</strong> 3 Vokale sowohl für SK als auch für RC nachweisen.<br />
In den z-transformierten SK-Werten zeigt sich für alle Sprecherinnen die Tendenz, dass unbetonte<br />
Vokale größere SK-Werte haben als betonte Vokale, und bei BL und KS waren diese Unterschiede<br />
sogar signifikant. Die z-transformierten RC-Werte sind bei allen Müttern signifikant kleiner bei betonten<br />
Vokalen.<br />
11
Diese Tendenzen bzw. Signifikanzen sind erst ansatzweise in den Sprachdaten <strong>der</strong> Kin<strong>der</strong> zu finden.<br />
Offensichtlich ist die Erkennung und Benutzung dieser Parameter vom Alter des Kindes abhängig<br />
(Schnei<strong>der</strong>, 2007; Schnei<strong>der</strong> und Möbius, 2007).<br />
Completeness (CC) und Incompleteness of Closure (IC). Laut Sluijter (1995) haben betonte Vokale<br />
höhere CC-Werte als unbetonte Vokale. Dies konnten wir in den Daten <strong>der</strong> Mütter nicht eindeutig<br />
bestätigen. Es zeigten sich sowohl sprecher- als auch vokalspezifische Unterschiede. AD benutzt<br />
den Parameter CC konstant für alle Vokale mit <strong>der</strong> Tendenz CC unbetont > CC betont, was sich auch<br />
in den z-transformierten CC-Werten als signifikante Betonungsabhängigkeit zeigt. KS produziert CC-<br />
Werte in Abhängigkeit davon, mit welchem Kind sie spricht: Beim jüngeren Kind (TS) produziert sie<br />
unbetonte Vokale mit tendenziell höheren CC-Werten als betonte Vokale, was sich auch signifikant in<br />
den z-transformierten CC-Werten zeigt, während sie, wenn sie mit dem älteren Kind (MS) spricht, CC<br />
vorwiegend so verwendet, wie Sluijter (1995) es in ihren Daten beschrieben hat. Auch BL benutzt den<br />
CC Parameter in <strong>der</strong> von Sluijter (1995) dokumentierten Richtung.<br />
Für den IC Parameter fanden wir ebenfalls eine Abhängigkeit vom Alter des Kindes, mit dem kommuniziert<br />
wurde, und zwar wurde von beiden Müttern (AD und KS boy2), die mit jüngeren Kin<strong>der</strong>n (bis<br />
ca. 4 Jahren) sprachen, IC konstant (wenn auch nicht signifikant) zur Betonungsmarkierung verwendet:<br />
IC unbetont > IC betont. Bei <strong>der</strong> Kommunikation mit älteren Kin<strong>der</strong>n (BL und KS boy1) zeigte sich keine<br />
klare Richtung für diesen Parameter.<br />
2.3.5 Elterndaten: erwachsenengerichtet<br />
<strong>Ein</strong>es unserer Ziele war es, zu untersuchen, inwieweit sich die Kin<strong>der</strong> an den <strong>akustischen</strong> Parametern<br />
ihrer Eltern orientieren, die diese benutzen, um Wortbetonung zu markieren. Dazu war es neben<br />
den Analysen <strong>der</strong> kindgerichtet Elternsprachdaten notwendig, Sprachdaten von den Eltern mit einzubeziehen,<br />
die im Gespräch mit Erwachsenen entstanden waren. Dazu wurden entsprechende Daten<br />
von 2 Vätern (TL und VS) und 3 Müttern (AD, AL und KS) im Rahmen einer Studienarbeit (Hezinger)<br />
aufgenommen und ausgewertet. Aufgrund <strong>der</strong> geringen Datenmenge können die hier präsentierten Ergebnisse<br />
jedoch nur als Tendenzen angegeben werden.<br />
Vokaldauer. Die untersuchten Daten zeigen erneut, dass die Vokaldauer eindeutig das stabilste und<br />
deutlichste Korrelat <strong>der</strong> Wortbetonung auch in <strong>der</strong> erwachsenengerichteten Sprache im Deutschen ist.<br />
Sowohl für jeden einzelnen Vokal als auch in den z-transformierten Werten zeigt sich diese Abhängigkeit<br />
<strong>der</strong> Vokaldauer von <strong>der</strong> Betonung. Dieses Ergebnis unterstreicht die Bedeutung des Ergebnisses in <strong>der</strong><br />
Kin<strong>der</strong>sprache, und zwar übernehmen offensichtlich alle von uns untersuchten Kin<strong>der</strong> dieses Korrelat<br />
<strong>der</strong> Wortbetonung von ihren Eltern, da es sehr klar die Wortbetonung wie<strong>der</strong>spiegelt.<br />
RMS-Intensität. Dieser Parameter wird, wie wir schon in <strong>der</strong> Analyse <strong>der</strong> kindgerichteten Erwachsenendaten<br />
vermutet hatten, nicht als Betonungsmarker im Deutschen eingesetzt. Grundsätzlich unterscheiden<br />
sich betonte und unbetonte Vokale kaum in ihren RMS-Werten, und es treten sowohl sprecherspezifische<br />
als auch vokalspezifische Verwendungstendenzen auf, die keine Verallgemeinerung zulassen.<br />
Dieser Parameter wird, laut unseren Erkenntnissen, demnach von den Erwachsenen im Deutschen<br />
nicht zur kontrastiven Betonungsmarkierung benutzt.<br />
Open Quotient (OQ). Auch in den erwachsenengerichteten Sprachdaten <strong>der</strong> Eltern konnte lediglich<br />
eine vokalspezifische Verwendungsweise dieses Parameters festgestellt werden. We<strong>der</strong> in den einzelnen<br />
OQ-Werten <strong>der</strong> untersuchten Vokale noch in den z-transformierten OQ-Werten fanden sich Hinweise<br />
auf eine betonungsabhängige Verwendung des OQ-Parameters im Deutschen. Wir können damit<br />
die Ergebnisse von Sluijter (1995) auch für die erwachsenengerichtete Sprache bestätigen: OQ ist kein<br />
Korrelat <strong>der</strong> Wortbetonung.<br />
Grundfrequenz (F0). Die Tendenz, die sich auch schon in den kindgerichteten Sprachdaten <strong>der</strong> Eltern<br />
fand, nämlich dass betonte /a/-Vokale mit niedrigeren F0-Werten produziert werden als unbetonte /a/-<br />
Vokale, liess sich auch hier nachweisen. Diese Tendenz zeigte sich aber für keinen <strong>der</strong> beiden an<strong>der</strong>en<br />
Vokale. Lediglich für eine Mutter (AL), für die aber keine Ergebnisse in den kindgerichteten Sprachdaten<br />
vorliegen, fand sich eine einheitliche Betonungsmarkierung mittels F0: sie produzierte alle betonten<br />
Vokale mit tendenziell niedrigeren F0-Werten im Vergleich zu den betonten Varianten. Um die Bedeutung<br />
12
dieses Unterschieds zu den an<strong>der</strong>en Eltern abzuklären, müssten weitere Untersuchungen an dieser<br />
Sprecherin stattfinden.<br />
Spectral Tilt: Skewness (SK) und Rate of Closure (RC). Beide Parameter werden von 4 <strong>der</strong> 5 Sprecher<br />
vokalspezifisch verwendet. Lediglich ein Vater (TL) produziert alle unbetonten Vokale mit höheren<br />
SK-Werten im Vergleich zu den betonten Vokalen. Für die an<strong>der</strong>en Sprecher gilt, dass sie nur einen<br />
o<strong>der</strong> zwei <strong>der</strong> untersuchten Vokale mit dieser Tendenz produzieren, und zwar sowohl für SK als auch<br />
für RC. Diese Tendenz schlägt sich in den z-transformierten Werten bei<strong>der</strong> Parameter nie<strong>der</strong>, die für<br />
3 <strong>der</strong> untersuchten Sprecher (TL, VS und KS) höhere SK- bzw. RC-Werte in den unbetonten Vokalen<br />
aufweisen. Die beiden an<strong>der</strong>en Sprecher produzierten keine interpretierbaren Tendenzen in diesen<br />
Parametern in Bezug auf die Betonungsunterscheidung <strong>der</strong> untersuchten Vokale. Deswegen lässt sich<br />
auch nur folgern, dass diese Parameter möglicherweise sprecherspezifisch zur Betonungsmarkierung<br />
eingesetzt werden.<br />
Completeness (CC) und Incompleteness of Closure (IC). Für CC zeigen sich, wie auch schon in <strong>der</strong><br />
kindgerichteten Sprache, sowohl sprecher- als auch vokalspezifische Unterschiede in <strong>der</strong> Verwendung<br />
dieses Parameters zur Betonungsmarkierung im Deutschen.<br />
In <strong>der</strong> F1-normalisierten Variante, d.h. im IC-Parameter, hatten wir in <strong>der</strong> kindgerichteten Sprache<br />
eine altersspezifische Verwendung dieses Parameters zur Betonungsmarkierung vermutet. In den erwachsenengerichteten<br />
Daten zeigte sich nun eine vokalspezifische Verwendung von IC. Für die Vokale<br />
/a/ und /o/ weisen 3 <strong>der</strong> 5 Sprecher höhere IC-Werte für die unbetonten Vokale auf, wogegen <strong>der</strong> Vokal<br />
/i/ von 3 <strong>der</strong> 5 Sprecher genau entgegengesetzt zur Betonungsmarkierung benutzt wird. Demzufolge<br />
konnten wir in den z-transformierten IC-Werten auch keine einheitliche Tendenz finden. Dies könnte<br />
auch als Bestätigung <strong>der</strong> Ergebnisse in den kindgerichteten Daten angesehen werden, d.h. IC (und evtl.<br />
auch CC) werden nur bei jüngeren Kin<strong>der</strong>n <strong>zum</strong> <strong>Ein</strong>satz gebracht, um gezielt auf die Unterscheidung<br />
zwischen betonten und unbetonten Vokalen hinzuweisen.<br />
2.3.6 <strong>Modell</strong>bildung<br />
Aufgrund <strong>der</strong> Empfehlungen <strong>der</strong> Gutachter wurde die ursprünglich für das dritte Projektjahr geplante<br />
Ausarbeitung eines exemplarbasierten <strong>Modell</strong>s des <strong>Erwerb</strong>s <strong>der</strong> Wortbetonung wesentlich früher in die<br />
Projektarbeit integriert. Das im ersten Projektantrag besprochene <strong>Modell</strong> von (Gut, 2000) hat sich für die<br />
laufenden Projektarbeiten als unzureichende Bezugsbasis herausgestellt, da es <strong>zum</strong> einen auf zu wenig<br />
Sprachdatenmaterial basiert und <strong>zum</strong> an<strong>der</strong>en zu unsichere Aussagen über zeitliche Entwicklungsphasen<br />
beim <strong>Erwerb</strong> <strong>der</strong> Prosodie macht.<br />
Im Zwischenbericht (2006) wurde ein neues <strong>Modell</strong> vorgeschlagen, das sich an eine exemplartheoretische<br />
Konzeption anlehnt, die im Rahmen des Stuttgarter DFG-Son<strong>der</strong>forschungsbereichs (SFB 732)<br />
komputationell modelliert und experimentell validiert wird.<br />
Im Lern- bzw. Spracherwerbsprozess werden phonetische und phonologische Kategorien über wahrgenommene<br />
Exemplare aufgebaut. <strong>Ein</strong>e kritische Anzahl wahrgenommener Exemplare einer sprachlichen<br />
Kategorie ist die grundlegende Voraussetzung für die Produktion dieser Kategorie. Das impliziert,<br />
dass Kin<strong>der</strong> beim <strong>Erwerb</strong> einer Kategorie zunächst die wahrgenommenen und intern synthetisierten<br />
Exemplare im Gedächtnis abspeichern, ohne sie zu produzieren. Sie produzieren also zunächst nicht<br />
alles, was sie perzipieren (Fisher et al., 2004). Dieses Phänomen wird als mismatch o<strong>der</strong> lag zwischen<br />
Perzeption und Produktion bei Kin<strong>der</strong>n bezeichnet.<br />
Der Mismatch zwischen Perzeption und Produktion im Spracherwerb lässt sich mit Hilfe eines exemplarbasierten<br />
<strong>Modell</strong>s erklären. Neugeborene haben bereits genügend Input von ihren Eltern bekommen,<br />
um bestimmte Erwartungen an die prosodische Struktur ihrer nativen Sprache zu stellen (siehe<br />
Überblick bei Mehler et al., 2000). Sie bilden aufgrund ihrer Erfahrung mit einer Anzahl wahrgenommener<br />
Exemplare sprachspezifische Verteilungen interner <strong>Modell</strong>e aus und generalisieren, um so mittels<br />
<strong>der</strong> abgelegten internen Lautmuster Bedeutungen o<strong>der</strong> syntaktische Anfor<strong>der</strong>ungen einzelner Wörter<br />
aus dem sie umgebenden Sprachstrom extrahieren zu können (cf. Saffran et al., 1996; ten Bosch und<br />
Cranen, 2007). Obwohl die Wörter nicht invariant und von <strong>der</strong> prosodischen Struktur <strong>der</strong> Äußerungen<br />
beeinflusst sind, werden sie in einer von Stimmen und Betonung abstrahierten Form wahrgenommen.<br />
Die traditionelle Sicht ist, dass es zu einer Normalisierung <strong>der</strong> wahrgenommenen sprachlichen Ereignisse<br />
mit dem Erstellen von kontextunabhängigen unterspezifizierten Sprachmustern für jedes Wort<br />
kommt.<br />
13
Untersuchungen sowohl zur Erwachsenensprache (Pierrehumbert, 2001a) als auch <strong>zum</strong> Spracherwerbsprozess<br />
(Curtin, 2002; Fisher et al., 2004; Zamuner et al., 2004; Beckman, 2003) legen jedoch<br />
die Annahme nahe, dass die im mentalen Lexikon zugrundeliegenden phonologischen Repräsentationen<br />
nicht völlig abstrakt sind, son<strong>der</strong>n dass feine phonetisch-akustische Details Teil <strong>der</strong> Repräsentation<br />
sind. In ihrer Untersuchung zur mentalen Repräsentationen <strong>der</strong> Betonung zeigen Curtin et al. (2005),<br />
dass Betonung in <strong>der</strong> Repräsentation einer analysierten Sequenz kodiert wird und betonte und unbetonte<br />
Silben somit unterschiedlich organisiert werden. Betonung ist bei 5–7 Monate alten Kin<strong>der</strong>n offenbar<br />
Teil ihrer proto-lexikalischen Repräsentation. Dies deckt sich mit unserem <strong>Modell</strong>, wonach Exemplare<br />
zusammen mit einer Merkmals- und Kontextbeschreibung abgelegt werden.<br />
Unser Exemplarmodell geht von maximal unterspezifizierten Lexikoneinträgen aus, die in die<br />
Analyse-durch-Synthese-Schleife eintreten, bei <strong>der</strong> Perzeption zwecks Verifikation <strong>der</strong> hypothetisierten<br />
Kategorien und bei <strong>der</strong> Produktion zwecks Generierung <strong>der</strong> Kategorien (siehe Zwischenbericht). Hier<br />
stehen in einer frühen Phase des Spracherwerbs nur die CV-Silbentypen aus dem Proto-Syllabary, die<br />
das Kind in <strong>der</strong> Lallphase eingeübt hat, als Basis für den internen Syntheseprozess zur Verfügung. Die<br />
kategoriespezifische Exemplarwolke enthält zu diesem Zeitpunkt Exemplare, die sich von Repräsentationen<br />
<strong>der</strong> Standardform (<strong>der</strong> Erwachsenensprache) signifikant unterscheiden. Nach einer bestimmten<br />
Anzahl von Durchläufen wird das Kind feststellen, dass <strong>der</strong> Unterschied zwischen intern synthetisierten<br />
und aktuell wahrgenommenen Exemplaren zu groß und die Repräsentation zu stark unterspezifiziert<br />
ist. Von nun an werden sich die intern synthetisierten (und später entsprechend produzierten) Formen<br />
zunehmend <strong>der</strong> Standardform annähern. Es werden sich Exemplarwolken herausbilden, die mehr und<br />
mehr Exemplare enthalten, <strong>der</strong>en Spezifikation <strong>der</strong> Standardform nahe kommt.<br />
Unter diesen <strong>Modell</strong>annahmen ist ein direkter Vergleich zwischen aktuell wahrgenommenen und abgespeicherten<br />
Exemplaren nicht notwendig; er ist tatsächlich nicht einmal nützlich in <strong>der</strong> <strong>Erwerb</strong>sphase.<br />
Im Gegenteil: Der interne Analyse-durch-Synthese-Prozess wird den kindlichen Hörer lehren, die festgestellten<br />
Unterschiede im Zusammenhang mit den zugrundeliegenden Gesten, die sie produzierten,<br />
zu interpretieren.<br />
Maximal unterspezifizierte Lexikoneinträge enthalten nur diejenigen Merkmale, die distinktiv sind.<br />
Bei strukturellen <strong>Ein</strong>heiten wie Silben, Morphemen o<strong>der</strong> Wörtern zählen hierzu auch suprasegmentale<br />
bzw. die metrische Struktur betreffende Merkmale. Diese <strong>Ein</strong>heiten enthalten demnach auch die Information<br />
über den Betonungsstatus. Zwei <strong>Ein</strong>heiten, <strong>der</strong>en segmentale Spezifikation gleich ist, die sich<br />
aber in ihrer metrischen Spezifikation unterscheiden, werden durch eigene, separate <strong>Ein</strong>träge im Lexikon<br />
repräsentiert. In unserem Projekt wurden die durch die Testwörter mit kontrastivem Betonungsmuster<br />
repräsentierten sprachlichen Kategorien grundsätzlich als <strong>Ein</strong>heit aus segmentaler und metrischer<br />
Spezifikation in Perzeption und Produktion dargestellt und analysiert.<br />
<strong>Ein</strong>e quantitative, komputationelle <strong>Modell</strong>ierung des <strong>Erwerb</strong>sverlaufs von Betonungsmerkmalen<br />
konnte in <strong>der</strong> Projektlaufzeit noch nicht abschließend geleistet werden. <strong>Ein</strong> solches <strong>Modell</strong> wird im<br />
Rahmen des Projekts A2 des Stuttgarter SFB 732 entwickelt. Das Exemplarmodell inkorporiert explizit<br />
lokalen <strong>akustischen</strong> Kontext bei <strong>der</strong> Exemplarspezifikation und -verarbeitung. Es wird ausdrücklich<br />
angenommen, dass akustische Detailinformation in <strong>der</strong> Reihenfolge, in <strong>der</strong> sie wahrgenommen wurde,<br />
erinnert, kodiert und selektiv verarbeite wird. Hierdurch werden spektrale und temporale Relationen<br />
bewahrt, so dass sprachliche <strong>Ein</strong>heiten nie isoliert, son<strong>der</strong>n immer in einem sprachlichen Kontext eingebettet<br />
verarbeitet werden. Die <strong>Modell</strong>ierung demonstriert, dass die Strategie, den Beitrag des lokalen<br />
Kontextes beim Abgleich von neu wahrgenommenen bzw. zu produzierenden sprachlichen Ereignissen<br />
mit abgespeicherten Exemplaren mit zu bewerten, eine Reihe von gut dokumentierten Kontexteffekten<br />
bei <strong>der</strong> Wahrnehmung von Sprachlauten und dem Gedächtnis für diese Sprachlaute erfolgreich nachbildet<br />
(Wade und Möbius, 2007). Das Exemplarmodell kommt dabei ohne explizite Normalisierung, z.B.<br />
für Sprechtempo o<strong>der</strong> Sprecheridentität, aus.<br />
Das Exemplarmodell kann zwar temporale Relationen zwischen sprachlichen Ereignissen im Kontext<br />
berücksichtigen, berücksichtigt jedoch <strong>der</strong>zeit die Variabilität von <strong>akustischen</strong> Parametern in einem<br />
Korpus nicht als mögliche Folge von größeren Zeitsprüngen bei <strong>der</strong> Korpusakquisition. Die Implementierung<br />
des Exemplarmodells wird <strong>der</strong>zeit dahingehend erweitert, dass die Variabilität <strong>der</strong> Sprachdaten<br />
als Funktion des zeitlichen Verlaufs <strong>der</strong> Entwicklung des Spracherwerbs über die im Projekt angenommenen<br />
Phasen interpretiert werden kann. Diese <strong>Modell</strong>erweiterung basiert auf den in diesem Projekt<br />
erhobenen, annotierten und analysierten Daten und ist <strong>zum</strong> Berichtszeitpunkt noch nicht abgeschlossen.<br />
14
2.4 Neuere relevante Arbeiten<br />
Das Wissen über die Prosodie einer Sprache erleichtert das Segmentieren des Wortstroms. Dieser<br />
Filtereffekt <strong>der</strong> Prosodie kann sowohl auf einer phonologischen wie auch <strong>akustischen</strong> Analyse des<br />
Sprachstroms beruhen. <strong>Ein</strong>e prosodische <strong>Ein</strong>teilung <strong>der</strong> Sprache ist sowohl bei <strong>der</strong> Wortsegmentation<br />
(Shukla et al., 2007) als auch beim Aufbau des Lexikons (Swingley, 2005) hilfreich. Es zeigt sich,<br />
dass Kin<strong>der</strong> mit <strong>der</strong> Produktion von Wörten mit unterschiedlichen <strong>akustischen</strong> Regularitäten vertraut<br />
werden, die durch die verschiedenen Wortbetonungen und Wortpositionen bedingt werden. Sie können<br />
somit entsprechend ihr mentales Lexikon abgleichen und neue rhythmische Segmentationsstrategien<br />
aufbauen. Sie lernen jedoch nicht nur, welche <strong>akustischen</strong> Muster in ihrer Sprache vorkommen (Maye<br />
et al., 2002), son<strong>der</strong>n sie entdecken auch den Zusammenhang zwischen <strong>der</strong> <strong>akustischen</strong> Struktur und<br />
an<strong>der</strong>en Aspekten <strong>der</strong> Sprache, wodurch akustische Regularien als Merkmal bestimmten sprachlichen<br />
Äußerungen zugeordnet werden können (Thiessen und Saffran, 2007). Durch die Entdeckung dieser<br />
Regularien können die Kin<strong>der</strong> nun besser und sicherer Wörter aus dem Sprachstrom segmentieren,<br />
denn eine Kombination von Merkmalen ist immer zuverlässiger für die Zwecke <strong>der</strong> Segmentation als ein<br />
einzelnes Merkmal (Christiansen et al., 1998).<br />
<strong>Ein</strong>e Störung in diesem phonologischen Prozess zeigt sich häufig durch Dyslexie. Kin<strong>der</strong> und Erwachsene<br />
mit Dyslexie zeigen Schwierigkeiten beim Aufbau phonologischer Repräsentationen. Für den<br />
Aufbau von Repräsentationen spielt auch die Wortbetonung eine Rolle.<br />
<strong>Ein</strong>e Untersuchung, die die Rolle <strong>der</strong> Wortbetonung beim Verständnis und bei <strong>der</strong> Produktion durch<br />
dreijährige Kin<strong>der</strong> mit einem familiären Risiko von Dyslexie und normal entwickelten Kin<strong>der</strong>n vergleicht,<br />
zeigt, dass eine reduzierte Fähigkeit, Wortbetonung für die Identifikation von Wortgrenzen zu verwenden,<br />
einhergeht mit den phonologischen Problemen, die dyslexische Kin<strong>der</strong> sowohl in <strong>der</strong> Perzeption<br />
wie auch bei <strong>der</strong> Produktion aufweisen (van Alphen et al., 2007). Daraus lässt sich schließen, dass das<br />
mentale Lexikon nur dann störungsfrei aufgebaut werden kann, wenn die noch plastischen unterspezifizierten<br />
lexikalischen Repräsentationen kontinuierlich mit wahrgenommenen Exemplare abgeglichen<br />
und modifiziert werden. Ist dies nicht <strong>der</strong> Fall, kommt es typischerweise zu Störungen im Spracherwerb.<br />
2.5 Beiträge zu den Projektergebnissen<br />
Projektmitarbeiterinnen<br />
• Britta Lintfert (10/2004–11/2007): Planung und Durchführung <strong>der</strong> Sprachaufnahmen; Konzeption<br />
einer konsistenten auditorischen und <strong>akustischen</strong> Annotation <strong>der</strong> Sprachaufnahmen; thematisch<br />
speziell die Bewertung <strong>der</strong> Rolle <strong>der</strong> Lallphase und <strong>der</strong> Übergang zu ersten Wörtern im Spracherwerb.<br />
• Katrin Schnei<strong>der</strong> (10/2004–6/2006): Statistische Analyse sowie Auswertung und Aufbereitung <strong>der</strong><br />
annotierten Sprachaufnahmen; thematisch speziell die Entwicklung <strong>der</strong> Betonung ab 3 Jahren und<br />
<strong>der</strong> Vergleich mit Erwachsenensprache.<br />
• Ursula Vollmer (11/2006–11/2007): Auswertung <strong>der</strong> experimentalphonetischen Untersuchungen,<br />
statistische Analyse und Auswertung <strong>der</strong> annotierten Sprachaufnahmen.<br />
• 13 studentische Hilfskräfte: Technische Aufbereitung und phonetische Annotation <strong>der</strong> Sprachaufnahmen,<br />
Unterstützung bei <strong>der</strong> Implementierung von Analysesoftware.<br />
Kooperationen<br />
• Projekt A2 im Stuttgarter SFB 732 (Bernd Möbius, Travis Wade): Exemplarbasierte <strong>Modell</strong>ierung<br />
<strong>der</strong> Entwicklung <strong>der</strong> Verwendung akustischer Korrelate <strong>der</strong> Wortbetonung (fortlaufend).<br />
• Projekt A3 im Stuttgarter SFB 732 (Wolfgang Wokurek): Automatische Analyse von Stimmqualitätsparametern<br />
in Kin<strong>der</strong>sprachdaten.<br />
• CHILDES/PHON-Projekt (Yvan Rose, Memorial University of Newfoundland, Kanada; Brian<br />
MacWhinney, Carnegie Mellon University, Pittsburgh, PA, USA): Integration <strong>der</strong> Projektdaten<br />
(Sprachaufnahmen und phonetische Annotationen) in das CHILDES/PHON-Korpus, eine Initiative<br />
zur Unterstützung korpusbasierter Forschung in <strong>der</strong> Phonologie und Phonetik <strong>der</strong> Kin<strong>der</strong>sprache.<br />
[http://childes.psy.cmu.edu/phon/]<br />
15
2.6 Qualifikationen<br />
• Britta Lintfert: Phonetic and phonological development of stress in German. Dissertation. Geplantes<br />
Datum <strong>der</strong> <strong>Ein</strong>reichung: Juli 2008.<br />
• Katrin Schnei<strong>der</strong>: Categorical perception of prosody. Dissertation. Geplantes Datum <strong>der</strong> <strong>Ein</strong>reichung:<br />
August 2008.<br />
• Tolga Ergin (2008, laufend): Produktion des kontrastiven Wortakzents bei Schülern <strong>der</strong> Altersgruppen<br />
10–18 Jahre. Diplomarbeit.<br />
• Ilyana Nikolova (2007): Realisierung von Grenztönen in deutschsprachigen Kin<strong>der</strong>sprachdaten.<br />
Studienarbeit.<br />
• Felix Wagner (2007): <strong>Erwerb</strong> <strong>der</strong> Intonation in <strong>der</strong> Lallphase. Studienarbeit.<br />
• Steven Nehls (2007): Funktionale Belastung des kontrastiven Wortakzents. Studienarbeit.<br />
• Nicolai Hezinger (2008): Kindgerichtete und erwachsenengerichtete Erwachsenensprache: Korrelate<br />
<strong>der</strong> Wortbetonung. Studienarbeit.<br />
• Hanns Maier (2008, laufend): Evaluierung <strong>der</strong> automatischen Formantmessung in Kin<strong>der</strong>sprachdaten.<br />
Studienarbeit.<br />
Literatur<br />
Balog, H. L. und D. Snow (2007): The adaption and application of relational and independent analyses<br />
for intonation production in young children. Journal of Phonetics 35, 118–133.<br />
Beckman, M. E. (2003): Input Representations (Inside the Mind and Out. In: Garding, G. und M. Tsujimura<br />
(Hrsg.), WCCFL 22 Proceedings, Somerville, MA: Cascadilla Press, 70–94.<br />
Boysson-Bardies de, B. (1999): How language comes to children: from birth to two years. Cambridge,<br />
MA: MIT Press.<br />
Christiansen, M., J. Allen, und M. Seidenberg (1998): Learning to segment speech using multiple cues:<br />
A connectionist model. Language and Cognitive Processess 13, 221–268.<br />
Claßen, K., G. Dogil, M. Jessen, K. Marasek, und W. Wokurek (1998): Stimmqualität und Wortbetonung<br />
im Deutschen. In: Linguistische Berichte, Westdeutscher Verlag, Band 174, 202–245.<br />
Curtin, S., T. H. Mintz, und M. H. Christiansen (2005): Stress changes the representational landscape:<br />
evidence from word segmentation. Cognition 96(3), 233–262.<br />
Curtin, S. L. (2002): Representational richness in phonological development. Dissertation, University of<br />
Southern California.<br />
Dogil, G. (1999): The phonetic manifestation of word stress. In: van <strong>der</strong> Hulst, H. (Hrsg.), Word Prosodic<br />
Systems in the Languages of Europe, Berlin: De Gruyter, 273–334.<br />
Fisher, C., B. A. Church, und K. E. Chambers (2004): Learning to identify spoken words. In: Hall, D. und<br />
S. Waxman (Hrsg.), Weaving a lexicon, Cambridge, MA: MIT Press, 3–40.<br />
Grimm, H. und H. Doil (2004): ELFRA, Elternfragebögen für die Früherkennung von Risikokin<strong>der</strong>n. Hogrefe,<br />
Verlag für Psychologie.<br />
Gut, U. (2000): Bilingual acquisition of intonation: a study of children speaking German and English. Nr.<br />
424 in Linguistische Arbeiten, Tübingen:Niemeyer.<br />
Ishizuka, K., R. Mugitani, und S. Amano (2007): Longitudinal developmental changes in spectral peaks<br />
of vowels produced by Japanese infants. Journal of the Acoustical Society of America 121(4), 2272–<br />
2282.<br />
Lee, S., D. Byrd, und J. Krivokapić (2006): Functional data analysis of prosodic effects on articulatory<br />
timing. Journal of the Acoustical Society of America 119(3), 1666–1671.<br />
16
Lintfert, B. (2008): Phonetic and phonological development of stress in German. Dissertation, Universität<br />
Stuttgart.<br />
Lintfert, B. und K. Schnei<strong>der</strong> (2005): Acoustic correlates of contrastive stress in German children. In:<br />
Proceeding of the Interspeech 2005, Lisbon, 1177–1180.<br />
Lintfert, B. und K. Schnei<strong>der</strong> (2006): Prosodic correlates of stress in babbling and first words: Acoustic<br />
analysis of German infants. LabPhon10, Paris.<br />
Lintfert, B. und U. Vollmer (2007): Acoustic analysis of stress in babbling and first words in German.<br />
Child Language Seminar, Reading.<br />
MacWhinney, B. (1995): The CHILDES Project: Tools for Analyzing Talk. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum,<br />
2 Ausg. [poppy.psy.cmu.edu/childes/].<br />
Maye, J., J. Werker, und L. Gerken (2002): Infant sensitivity to distributional information can affect phonetic<br />
discrimination. Cognition 82, B101–B111.<br />
Mehler, J., A. Christophe, und F. Ramus (2000): How infants acquire language: some preliminary observations.<br />
In: Marantz, A., Y. Miyashita, und W. O’Neil (Hrsg.), Image, Language, Brain: Papers from the<br />
first Mind-Brain Articulation Project symposium, Cambridge, MA: MIT Press, 51–75.<br />
Ménard, L., J.-L. Schwartz, L.-J. Boë, und J. Aubin (2007): Articulatory-acoustic relationships during<br />
vocal tract growth for French vowels: Analysis of real data and simulations with an articulatory model.<br />
Journal of Phonetics 35, 1–19.<br />
Möbius, B. (2001): German and Multilingual Speech Synthesis. Arbeitspapiere des Instituts für Maschinelle<br />
Sprachverarbeitung (Univ. Stuttgart), AIMS 7 (4), University of Stuttgart.<br />
Möbius, B. (2004): Corpus-based investigations on the phonetics of consonant voicing. Folia Linguistica<br />
38(1–2), 5–26.<br />
Pierrehumbert, J. (2001a): Exemplar dynamics: Word frequency, lenition, and contrast. In: Bybee, J.<br />
und P. Hopper (Hrsg.), Frequency effects and the emergence of linguistic structure, John Benjamins,<br />
Amsterdam, 137–157.<br />
Pierrehumbert, J. B. (2003): Probabilistic Phonology: Discrimation and Robustness. In: Bod, R., J. Hay,<br />
und S. Jannedy (Hrsg.), Probability Theory in Linguistics, MIT Press, 177–228.<br />
Pützer, M. und W. Wokurek (2006): Multiparametrische Stimmprofildifferenzierung zu männlichen und<br />
weiblichen Normalstimmen auf <strong>der</strong> Grundlage akustischer Analysen. Laryngo-Rhino-Otologie 85, 1–<br />
8.<br />
Saffran, J. R., R. N. Aslin, und E. L. Newport (1996): Statistical learning by 8-month-old infants. Science<br />
274, 1926–1928.<br />
Schnei<strong>der</strong>, K. (2007): Acquisition of word stress in German: Vowel duration and incompleteness of closure.<br />
In: Proceedings of the 16th ICPhS (Saarbrücken), 1565–1568.<br />
Schnei<strong>der</strong>, K. und B. Lintfert (2005): Acquisition of contrastive stress in German children. Posterpresentation<br />
at the 10th International Congress for the Study of Child Language (IASCL), Berlin.<br />
Schnei<strong>der</strong>, K., B. Lintfert, und B. Möbius (2006): Work in progress: Acquisition of contrastive stress<br />
in German children compared to the realizations of their parents. Poster Presentation at the Latsis<br />
Colloquium of the University of Geneva.<br />
Schnei<strong>der</strong>, K. und B. Möbius (2006): Production of word stress in German: Children and adults. In:<br />
Proceedings of Speech Prosody 2006 (Dresden), 333–336.<br />
Schnei<strong>der</strong>, K. und B. Möbius (2007): Word stress correlates in spontaneous child-directed speech in<br />
German. In: Proceedings of Interspeech 2007 (Antwerpen), 1394–1397.<br />
Shukla, M., M. Nespor, und J. Mehler (2007): An interaction between prosody and statistics in the segmentation<br />
of fluent speech. Cogitiv Psychology 54(1), 1–32.<br />
Sluijter, A. M. (1995): Phonetic correlates of stress and accent. Dissertation, University of Leiden.<br />
17
Snow, D. (2006): Regression and Reorganization of Intonation Between 6 and 23 Months. Child Development<br />
77(2), 281–296.<br />
Stoel-Gammon, C. (1989): Prespeech and early speech development of two late talkers. First Language<br />
9, 207–224.<br />
Swingley, D. (2005): Statistical clustering and the contents of the infant vocabulary. Cognitive Psychology<br />
50, 86–132.<br />
ten Bosch, L. und B. Cranen (2007): A computational model for unsupervised word discovery. In: Proceedings<br />
of Interspeech 2007 (Antwerpen), 1481–1484.<br />
Thiessen, E. D. und J. R. Saffran (2007): Learning to Learn: Infant’s Acquisition of Stress-Based Strategies<br />
for Word Segmentation. Language Learning and Development 3(1), 73–100.<br />
van Alphen, P., E. de Bree, P. Fikkert, und F. Wijnen (2007): The role of metrical stress in comprehension<br />
and production in Dutch children at-risk of dyslexia. In: Proceedings of Interspeech 2007 (Antwerpen),<br />
2313–2316.<br />
Wade, T. und B. Möbius (2007): Speaking rate effects in a landmark-based phonetic exemplar model.<br />
In: Proceedings of Interspeech 2007 (Antwerpen), 402–405.<br />
Zamuner, T. S., L. Gerken, und M. Hammond (2004): Phonotactic probalities in young children’s speech<br />
production. Journal of Child Language 31, 515–536.<br />
18
3 Zusammenfassung<br />
Wie Kin<strong>der</strong> sprechen lernen, insbeson<strong>der</strong>e wie sie das Lautinventar ihrer Muttersprache erwerben, ist<br />
bereits gründlich erforscht worden. Doch wie sie lernen, die Betonungsmuster ihrer Muttersprache zu<br />
verstehen und selbst anzuwenden, darüber ist bisher wenig bekannt. Ob ich etwas UmFAHRE o<strong>der</strong><br />
UMfahre, macht für Fahrzeug und Hin<strong>der</strong>nis einen gewaltigen Unterschied. Die betonte Silbe kann vom<br />
Sprecher auf verschiedene Weise hervor-gehoben werden, etwa durch Anheben <strong>der</strong> Stimme, größere<br />
Lautstärke, längere Dauer o<strong>der</strong> auch durch subtile Verän<strong>der</strong>ungen <strong>der</strong> Stimmqualität. Typischerweise<br />
erfolgt die Betonung durch eine Kombination mehrerer dieser Mittel, wobei es durchaus Unterschiede<br />
von Sprache zu Sprache gibt. Kin<strong>der</strong> müssen die richtige Kombination in ihrer Muttersprache lernen.<br />
Das abgeschlossene Projekt untersuchte, wie Kin<strong>der</strong> in den Altersstufen von fünf Monaten bis acht<br />
Jahren lernen, Wort- und Silbenbetonungen in <strong>der</strong> Lautsprache wahrzunehmen und zu produzieren. In<br />
das Projekt einbezogen wurden zehn Familien aus <strong>der</strong> Region Stuttgart, in denen weitestgehend dialektfrei<br />
gesprochen wird. Dabei wurden die Kin<strong>der</strong> in einer longitudinalen Studie zu Hause beim Spiel mit<br />
Tierfigur-Paaren wie Eisbär BImo und Braunbär biMO beobachtet. So lässt sich nachvollziehen, in welchen<br />
Schritten die Kin<strong>der</strong> die Ausspracheunterschiede erlernen und ob sie dabei die gleiche Strategie<br />
anwenden wie ihre Eltern. Alle Sprachäußerungen wurden mit drahtlosen Mikrofonen digital aufgenommen<br />
später akustisch analysiert. Die Aufnahmetechnik ermöglichte die Qualität von Laboraufnahmen<br />
im Feldversuch. Die Aufnahmen fanden über einen Zeitraum von mehreren Jahren in regelmäßigen<br />
Abständen statt, so dass sich <strong>der</strong> Fortschritt beim <strong>Erwerb</strong> <strong>der</strong> Betonung genau dokumentieren ließ.<br />
Theoretischer Rahmen für die Studie ist die Exemplartheorie, die postuliert, dass im Lern- bzw. Spracherwerbsprozess<br />
phonetische und phonologische Kategorien über wahrgenommene Exemplare aufgebaut<br />
werden. Untersuchungen sowohl zur Erwachsenensprache als auch <strong>zum</strong> Spracherwerbsprozess<br />
legen die Annahme nahe, dass die im mentalen Lexikon zugrundeliegenden phonologischen Repräsentationen<br />
nicht völlig abstrakt sind, son<strong>der</strong>n dass feine phonetische Details Teil <strong>der</strong> Repräsentation sind.<br />
<strong>Ein</strong>e kritische Anzahl wahrgenommener Exemplare einer sprachlichen Kategorie ist die grundlegende<br />
Voraussetzung für die Produktion dieser Kategorie. Das impliziert, dass Kin<strong>der</strong> beim <strong>Erwerb</strong> einer Kategorie<br />
zunächst die wahrgenommenen Exemplare im Gedächtnis abspeichern, ohne sie zu produzieren.<br />
Sie produzieren also zunächst nicht alles, was sie perzipieren. Dieses Phänomen wird als mismatch<br />
o<strong>der</strong> lag zwischen Perzeption und Produktion bei Kin<strong>der</strong>n bezeichnet.<br />
Der Mismatch zwischen Perzeption und Produktion im Spracherwerb lässt sich mit Hilfe eines exemplarbasierten<br />
<strong>Modell</strong>s erklären. Neugeborene haben bereits genügend Input von ihren Eltern bekommen,<br />
um bestimmte Erwartungen an die prosodische Struktur ihrer nativen Sprache zu stellen. Sie<br />
bilden aufgrund ihrer Erfahrung mit einer Anzahl wahrgenommener Exemplare sprachspezifische Verteilungen<br />
interner <strong>Modell</strong>e aus und generalisieren, um so mittels <strong>der</strong> abgelegten internen Lautmuster<br />
Bedeutungen o<strong>der</strong> syntaktische Anfor<strong>der</strong>ungen einzelner Wörter aus dem sie umgebenden Sprachstrom<br />
extrahieren zu können.<br />
Die Ergebnisse des Projekts deuten darauf hin, dass die Kin<strong>der</strong> über die verschiedenen Phasen<br />
des Spracherwerbs hinweg mit den verschiedenen Korrelaten <strong>der</strong> Wortbetonung experimentieren: mit<br />
spektralen Parametern, prosodischen Eigenschaften und <strong>der</strong> Stimmqualität. Im Alter von 3–5 Jahren<br />
stabilisiert sich die Verwendung <strong>der</strong> Parameter allmählich, ist jedoch selbst mit 8 Jahren noch nicht<br />
abgeschlossen. Die Ergebnisse legen auch die Annahme nahe, dass sich die Kin<strong>der</strong> daran orientieren,<br />
welche Merkmale ihre Eltern in kindgerichteter Sprache verwenden.<br />
Über das Projekt wurde im Unikurier <strong>der</strong> Universität Stuttgart Nr. 95 vom Mai 2005 ([http://www.unistuttgart.de/uni-kurier/uk95/forschung/fw62.html])<br />
und in einer Pressemitteilung Nr. 14/2005 <strong>der</strong> Universität<br />
Stuttgart vom 1.3.2005 ([http://www.uni-stuttgart.de/aktuelles/presse/2005/14.html]) berichtet.<br />
19
Appendix<br />
A Wortlisten<br />
gespanntes /a:/<br />
1.Silbe bet 2.Silbe bet. 3.Silbe bet. 1.Silbe unbet. 2.Silbe unbet. 3.Silbe unbet.<br />
Kamera Banane Akrobat Banane Buchstaben Gorilla<br />
Radfahrer Sandalen Fotograf Kamel Flughafen Kamera<br />
Lastwagen Tomate Elefant Paket Lastwagen Eisenbahn<br />
Trampolin Vulkan Papagei Müllwagen<br />
Malerin Saxophon Radfahrer<br />
Stadion Lawine Papagei<br />
Wohnwagen<br />
Skifahrer<br />
Rennfahrer<br />
gespanntes /i:/<br />
1.Silbe bet 2.Silbe bet. 3.Silbe bet. 1.Silbe unbet. 2.Silbe unbet. 3.Silbe unbet.<br />
Fliege Bikini Krokodil Bikini Eskimo Bikini<br />
Spiegel Lawine Giraffe Polizei Schmetterling<br />
Pinguin Gardine Gitarre Polizist Prinzessin<br />
Skifahrer Zitrone<br />
Prinzessin<br />
Teddybär Trampolin<br />
gespanntes /o:/<br />
1.Silbe bet 2.Silbe bet. 3.Silbe bet. 1.Silbe unbet. 2.Silbe unbet. 3.Silbe unbet.<br />
Kokosnuss Kanone Mikrofon Fotograf Anorak Postauto<br />
Kobolde Pistole Saxophon Gorilla Fotograf Eskimo<br />
Postauto Matrose Krokodil Mikrofon<br />
Wohnwagen Zitrone Polizei Postbote<br />
Pullover Polizist Trampolin<br />
Tomate Krokodil<br />
Bimo�����ÑÓ℄<br />
Trompete Saxophon<br />
Nami��Ò��Ñ�℄<br />
Tabelle 2:<br />
Doba���Ó���℄<br />
Wortlisten des Memory-Bildkarten-Szenarios.<br />
Badoni������ÓÒ�℄ Nami�Ò��Ñ��℄<br />
Badoni����Ó�Ò��℄<br />
Spielzeugtier 1 Name Spielzeugtier 2 Name<br />
Braunbär Eisbär<br />
großes Zebra kleines Zebra<br />
Otter Dachs<br />
großer Tiger Midano��Ñ����ÒÓ℄kleiner Tiger<br />
fliegen<strong>der</strong> Adler stehen<strong>der</strong> Adler<br />
Tabelle 3: Spielzeugtierpaare und die dazugehörigen Namen mit kontrastiver Betonung.<br />
20<br />
Midano�Ñ����ÒÓ�℄<br />
Doba��Ó����℄<br />
Bimo����ÑÓ�℄
B Ergebnisse<br />
Tabellen und Abbildungen <strong>zum</strong> Ergebnisteil des Arbeitsberichts (Abschnitt 2.3).<br />
5 7 15 18 20 27 30 34 36<br />
hoch 10,8 6,2 14,6 19,0 26,9 42,9 26,6 37,9 33,3<br />
halbhoch 2,7 12,4 12,2 18,0 26,9 21,4 23,4 5,2 22,5<br />
halbtief 51,4 41,2 19,5 19,0 7,7 14,3 15,6 17,2 14,7<br />
tief 35,1 39,2 53,7 44,0 38,5 21,4 34,4 39,7 29,4<br />
hinten 6,2 26,8 13,0 26,9 28,6 26,6 12,1 24,5<br />
vorne 64,9 53,6 19,5 43,0 34,6 50,0 39,1 48,3 46,1<br />
gerundet 8,1 9,3 2,4 5,0 3,8 21,4 1,6 1,7 3,9<br />
ungerundet 56,8 44,3 17,1 38,0 30,8 28,6 37,5 46,6 42,2<br />
Tabelle 4: Häufigkeit (in %) vokalischer Merkmale in <strong>der</strong> Produktion von betonten Vokalen: Zungenhöhe,<br />
Zungenposition vorne/hinten und Lippenrundung mit 5, 7, 15, 18, 20, 27, 30, 34 und 36 Monaten.<br />
5 7 15 18 20 27 30 34 36<br />
hoch 12,5 12,4 22,7 5,3 31,0 15,6 28,6<br />
halbhoch 10,0 17,1 5,6 13,6 9,7 26,3 30,1 25,6 29,1<br />
halbtief 42,5 33,3 33,3 29,5 3,5 3,3 4,6<br />
tief 32,5 29,5 61,1 29,5 22,6 26,3 4,4 18,9 13,1<br />
hinten 10,0 18,1 5,6 13,6 6,5 15,8 21,2 21,1 29,7<br />
vorne 55,0 44,8 33,3 52,3 3,2 15,8 43,4 23,3 32,6<br />
gerundet 17,5 11,4 11,1 4,5 0,9 1,1<br />
ungerundet 37,5 33,3 22,2 47,7 3,2 15,8 42,5 23,3 31,4<br />
Tabelle 5: Häufigkeit (in %) vokalischer Merkmale in <strong>der</strong> Produktion von unbetonten Vokalen: Zungenhöhe,<br />
Zungenposition vorne/hinten und Lippenrundung mit 5, 7, 15, 18, 20, 27, 30, 34 und 36 Monaten.<br />
Abbildung 1: Z-transformierte Dauer (links) und RMS-Intensität (rechts) von HH in Abhängigkeit vom<br />
Alter.<br />
21
Abbildung 2: IC (oben links), SK (oben rechts) und RC (unten links) für betonte und unbetonte znormalisierte<br />
Werte in Abhängigkeit vom Alter.<br />
Abbildung 3: Z-transformierte Werte <strong>der</strong><br />
Vokaldauern <strong>der</strong> Kin<strong>der</strong>.<br />
22<br />
Abbildung 4: Absolute Vokaldauern <strong>der</strong> Kin<strong>der</strong>.
Abbildung 5: Dauer (oben links), SK (oben rechts), CC (unten links) und IC (unten rechts) für betonte<br />
und unbetonte z-normalisierte Werte <strong>der</strong> Eltern von HH.<br />
Abbildung 6: Entwicklung von F0 für betonte<br />
und unbetonte Vokale bei ED.<br />
Abbildung 7: Entwicklung von F0 für betonte und unbetonte<br />
Vokale bei TS.<br />
23
C Annotierte, analysierte und ausgewertete Sprachdaten<br />
Die nachfolgenden Tabellen enthalten für jedes Kind die folgenden Informationen: projektinterne<br />
Aufnahme-Identifikation, Datum <strong>der</strong> Aufnahmesitzung, Alter des Kindes (Jahr;Monat:Tag), verwendetes<br />
Aufnahmeszenario, beteiligter Elternteil, ggf. Kommentare. In <strong>der</strong> Tabellenunterschrift: Name des<br />
Kindes (Kürzel) und Geburtsdatum.<br />
Aufnahme-ID Datum Alter Szenario Elternteil<br />
HH401-1 25.01.2004 0;5:23 Babbling Mutter<br />
HH401-2 27.01.2004 0;5:25 Babbling Mutter<br />
HH401-3 29.01.2004 0;5:27 Babbling Mutter<br />
HH4031 02.03.2004 0;7:0 Babbling Mutter<br />
HH4032 05.03.2004 0;7:3 Babbling Mutter<br />
HH4033 09.03.2004 0;7:7 Babbling Mutter<br />
HH4034 25.03.2004 0;7:23 Babbling Mutter<br />
HH4111 13.11.2004 1;3:11 Babbling Mutter<br />
HH4112 15.11.2004 1;3:12 Babbling Mutter<br />
HH5021 02.02.2005 1;6:0 Babbling Mutter<br />
HH5043 13.04.2005 1;8:11 Mixing Mutter<br />
HH5102 04.11.2005 2;3:2 Mixing Mutter<br />
HH6022 09.02.2006 2;6:7 Memory Vater<br />
HH6052 07.06.2006 2;10:8 Mixing Mutter<br />
HH6081 21.08.2006 3;0:19 Memory Mutter<br />
HH6082 24.08.2006 3;0:22 Memory Vater<br />
HH6083 24.08.2006 3;0:22 Memory Vater<br />
Tabelle 6: HH (02.08.2003)<br />
Aufnahme-ID Datum Alter Szenario Elternteil<br />
BW5032 23.03.2005 0;11:1 Babbling Mutter<br />
BW5033 24.03.2005 0;11:2 Babbling Mutter<br />
BW5034 25.03.2005 0;11:3 Babbling Mutter<br />
BW5071 09.07.2005 1;2:17 Babbling Vater<br />
BW5072 11.07.2005 1;2:19 Babbling Mutter<br />
BW5073 11.07.2005 1;2:19 Babbling Mutter<br />
BW5075 13.07.2005 1;2:21 Babbling Mutter<br />
BW5101 07.10.2005 1;5:15 Babbling Mutter<br />
BW5102 08.10.2005 1;5:16 Babbling Mutter<br />
BW5103 12.10.2005 1;5:20 Babbling Mutter<br />
BW5121 06.12.2005 1;7:14 Mixing Mutter<br />
BW6021 12.02.2006 1;9:20 Memory Mutter<br />
BW6022 13.02.2006 1;9:21 Memory Mutter<br />
BW6071 03.07.2006 2;2:11 Memory Mutter<br />
BW6072 04.07.2006 2;2:12 Memory Vater<br />
BW6091 18.09.2006 2;4:27 Memory Vater<br />
BW7041 03.04.2007 2;11:12 Memory Vater<br />
BW7042 05.04.2007 2;11:14 Memory Mutter<br />
Tabelle 7: BW (22.04.2004)<br />
24
Aufnahme-ID Datum Alter Szenario Elternteil<br />
FZ5091 30.09.2005 1;0:21 Babbling Mutter<br />
FZ5092 30.09.2005 1;0:21 Babbling Mutter<br />
FZ5093 03.10.2005 1;0:24 Babbling Mutter<br />
FZ5111 12.01.2006 1;4:3 Babbling Mutter<br />
FZ6031 06.03.2006 1;5:28 Babbling / Memory Mutter<br />
FZ6032 07.03.2006 1;5:29 Babbling Mutter<br />
FZ6035 16.03.2006 1;6:7 Babbling / Memory Mutter<br />
FZ6042 26.04.2006 1;7:17 Memory Mutter<br />
FZ6052 24.05.2006 1;8:15 Memory Mutter<br />
FZ6071 03.07.2006 1;9:24 Memory Mutter<br />
FZ6081 22.08.2006 1;11:13 Memory Mutter<br />
FZ6103 24.10.2006 2;1:15 Mixing Mutter<br />
FZ7031 15.03.2007 2;6:6 Memory Mutter<br />
FZ7032 16.03.2007 2;6:7 Memory Mutter<br />
Tabelle 8: FZ (06.09.2004)<br />
Aufnahme-ID Datum Alter Szenario Elternteil<br />
NB5041 06.04.2005 0;7:17 Babbling Mutter<br />
NB5043 07.04.2005 0;7:18 Babbling Mutter<br />
NB5045 08.04.2005 0;7:19 Babbling Mutter<br />
NB5046 08.04.2005 0;7:19 Babbling Mutter<br />
NB5051 12.05.2005 0;8:22 Babbling Mutter<br />
NB5052 13.05.2005 0;8:22 Babbling Mutter<br />
NB5053 14.05.2005 0;8:23 Babbling Mutter<br />
NB5054 05.05.2005 0;8:24 Babbling Mutter<br />
NB5055 17.05.2005 0;8:27 Babbling Mutter<br />
NB5056 17.05.2005 0;8:27 Babbling Mutter<br />
NB5057 17.05.2005 0;8:27 Babbling Mutter<br />
NB5058 18.05.2005 0;8:28 Babbling Mutter<br />
NB5071 12.07.2005 0;11:20 Babbling Mutter<br />
NB5072 13.07.2005 0;11:21 Babbling Mutter<br />
NB5073 14.07.2005 0;11:22 Babbling Mutter<br />
NB5074 15.07.2005 0;11:23 Babbling Mutter<br />
NB5091 17.10.2005 1;01:27 Babbling Mutter<br />
NB5092 18.10.2005 1;01:28 Babbling Mutter<br />
NB5093 19.10.2005 1;01:29 Babbling Mutter<br />
NB6021 17.02.2006 1;5:27 Babbling / Memory Mutter<br />
NB6022 10.02.2006 1;5:28 Babbling / Memory Mutter<br />
NB6023 22.02.2006 1;6:02 Babbling Mutter<br />
NB6041 24.02.2006 1;8:4 Mixing / Memory Mutter<br />
NB6042 25.02.2006 1;8:5 Mixing / Memory Mutter<br />
NB6061 15.06.2006 1;9:25 Mixing / Memory Mutter<br />
NB7041 17.04.2007 2;7:27 Memory Mutter<br />
NB7051 02.05.2007 2;8:12 Memory Vater<br />
Tabelle 9: NB (20.08.2004)<br />
25
Aufnahme-ID Datum Alter Szenario Elternteil<br />
EL2111 26.11.2002 0;5:4 Babbling Mutter<br />
EL2112 26.11.2002 0;5:4 Babbling Mutter<br />
EL302 03.03.2003 0;8:9 Babbling Mutter<br />
EL303 31.03.2003 0;9:7 Babbling Mutter<br />
EL3073 24.07.2003 1;1:2 Babbling Mutter<br />
EL3074 24.07.2003 1;1;2 Babbling Mutter<br />
EL3091 15.09.2003 1;2:22 Babbling Mutter<br />
EL3121 06.12.2003 1;5:14 Babbling Mutter<br />
EL4041 22.04.2004 1;10:0 Mixing Mutter<br />
EL4042 30.04.2004 1;10:8 Mixing Mutter<br />
EL4051 05.05.2004 1:10:13 Mixing Mutter<br />
EL4071 07.07.2004 2;0:15 Mixing Mutter<br />
EL4081 30.08.2004 2;2:8 Mixing Mutter<br />
Tabelle 10: EL (22.06.2002)<br />
Aufnahme-ID Datum Alter Szenario Elternteil<br />
OZ4101 21.10.2004 0;7:20 Babbling Mutter<br />
OZ4102 26.10.2004 0;7:26 Babbling Mutter<br />
OZ4121 02.12.2004 0;9:1 Babbling Mutter<br />
OZ4122 12.12.2004 0;9:11 Babbling Mutter<br />
OZ5031 13.03.2005 1;0:12 Babbling Mutter<br />
OZ5032 16.03.2005 1;0:15 Babbling Mutter<br />
OZ5051 08.05.2005 1;2:7 Babbling Mutter<br />
OZ5052 10.05.2005 1;2:9 Babbling Mutter<br />
OZ5053 11.05.2005 1;2;10 Babbling Mutter<br />
OZ5091 01.09.2005 1;6;0 Babbling Mutter<br />
Tabelle 11: OZ (01.03.2004)<br />
Aufnahme-ID Datum Alter Szenario Elternteil Kommentar<br />
TS206 2002/Jun 1;07 Taki Mutter<br />
TS210 2002/Okt 1;11 Taki Mutter<br />
TS211 2002/Nov 2;00 Taki Mutter<br />
TS301 2003/Jan 2;02 Taki Mutter<br />
TS303 2003/Mär 2;04 Taki Mutter<br />
TS3041 2003/April 2;05 Taki Vater<br />
TS3061 2003/Jun 2;07 Taki Mutter<br />
TS3071 2003/Juli 2;08 Taki Mutter<br />
TS3101 2003/Okt 2;11 Taki Mutter<br />
TS3111 2003/Nov 3;00 Taki Mutter<br />
TS4011 2004/Jan 3;02 Taki Mutter<br />
TS4031 2004/Mär 3;04 Taki Mutter<br />
TS4051 2004/Mai 3;06 Taki Mutter<br />
TS4071 2004/Juli 3;08 Taki Vater<br />
TS4101 2004/Okt 3;11 Taki Mutter<br />
TS5011 2005/Jan 4;02 Taki Mutter<br />
TS5061-1 2005/Jun 4;07 Taki Mutter<br />
TS5061-2 2005/Jun 4;07 Taki Mutter<br />
TS5061-3 2005/Jun 4;07 Taki Mutter<br />
TS5121 2005/Dez 5;01 Taki Mutter<br />
Tabelle 12: TS (19.11.2000)<br />
26
Aufnahme-ID Datum Alter Szenario Elternteil Kommentar<br />
ED4051 02.05.2004 2;03 Taki Mutter<br />
ED4052 14.05.2004 2;03 Taki Mutter<br />
ED4061 03.06.2004 2:04 Taki Mutter<br />
ED4111 22.11.2004 2:09 Taki Mutter<br />
ED4112 23.11.2004 2;09 Taki Mutter<br />
ED5011 23.01.2005 2;11 Taki Mutter<br />
ED5012 24.01.2005 2;11 Taki Mutter<br />
ED5041 21.04.2005 3;02 Taki Mutter<br />
ED5042 25.04.2005 3;02 Taki Mutter<br />
ED5043 26.04.2005 3;02 Taki Mutter<br />
ED5071 14.07.2005 3;05 Taki Mutter<br />
ED5072 14.07.2005 3;05 Taki Mutter<br />
ED5073-1 15.07.2005 3;05 Taki Mutter<br />
ED5073-2 15.07.2005 3;05 Taki Mutter<br />
ED5074-1 18.07.2005 3;05 Taki Mutter<br />
ED5074-2 18.07.2005 3;05 Taki Mutter<br />
ED5074-3 18.07.2005 3;05 Taki Mutter<br />
ED5101 27.10.2005 3;08 Taki Mutter<br />
ED5102-1 30.10.2005 3;08 Taki Mutter<br />
ED5102-2 30.10.2005 3;08 Taki Mutter<br />
ED5102-3 30.10.2005 3;08 Taki Mutter<br />
ED5103-1 31.10.2005 3;08 Taki Mutter<br />
ED5103-2 31.10.2005 3;08 Taki Mutter<br />
ED5103-3 31.10.2005 3;08 Taki Mutter<br />
ED5111-1 05.11.2005 3;09 Taki Mutter<br />
ED5111-2 05.11.2005 3;09 Taki Mutter<br />
ED6011-1 01.01.2006 3;11 Taki Mutter<br />
ED6011-2 01.01.2006 3;11 Taki Mutter<br />
ED6011-3 01.01.2006 3;11 Taki Mutter<br />
ED6011-4 01.01.2006 3;11 Taki Mutter<br />
ED6012-1 04.01.2006 3;11 Taki Mutter<br />
ED6012-2 04.01.2006 3;11 Taki Mutter<br />
ED6021-2 26.02.2006 4;0 Taki Mutter<br />
ED6021-3 26.02.2006 4;0 Taki Mutter<br />
ED6021-4 26.02.2006 4;0 Taki Mutter<br />
ED6022-2 28.02.2006 4;0 Taki Mutter<br />
ED6022-3 28.02.2006 4;0 Taki Mutter<br />
ED6022-4 28.02.2006 4;0 Taki Mutter<br />
ED6031-4 01.03.2006 4;01 Taki Mutter<br />
ED6031-5 01.03.2006 4;01 Taki Mutter<br />
ED6032-2 05.03.2006 4;01 Taki Mutter<br />
ED6032-3 05.03.2006 4;01 Taki Mutter<br />
ED6051-1 28.05.2006 4;03 Taki Mutter<br />
ED6051-2 28.05.2006 4;03 Taki Mutter<br />
ED6051-3 28.05.2006 4;03 Taki Mutter<br />
ED6052-3 30.05.2006 4;03 Taki Mutter<br />
ED6052-4 30.05.2006 4;03 Taki Mutter<br />
ED6052-5 30.05.2006 4;03 Taki Mutter<br />
ED6053-1 31.05.2006 4;03 Taki Mutter<br />
ED6053-2 31.05.2006 4;03 Taki Mutter<br />
ED6053-4 31.05.2006 4;03 Taki Mutter<br />
ED6061-1 04.06.2006 4;04 Taki Mutter<br />
ED6061-2 04.06.2006 4;04 Taki Mutter<br />
ED6061-3 04.06.2006 4;04 Taki Mutter<br />
Tabelle 13: ED (21.02.2002)<br />
27
Aufnahme-ID Datum Alter Szenario Elternteil Kommentar<br />
RL5041-1 02.04.2005 3;02 Taki Mutter<br />
RL5041-2 02.04.2005 3;02 Taki Mutter<br />
RL5042-1 02.04.2005 3;02 Taki Vater<br />
RL5042-2 02.04.2005 3;02 Taki Vater<br />
RL5043-1 05.04.2005 3;02 Taki Mutter<br />
RL5043-2 05.04.2005 3;02 Taki Mutter<br />
RL5043-3 05.04.2005 3;02 Taki Mutter<br />
RL5051-1 13.05.2005 3;03 Taki Mutter<br />
RL5051-2 13.05.2005 3;03 Taki Mutter<br />
RL5051-3 13.05.2005 3;03 Taki Mutter<br />
RL5051-4 13.05.2005 3;03 Taki Mutter<br />
RL5052-1 16.05.2005 3;03 Taki Mutter<br />
RL5052-2 16.05.2005 3;03 Taki Mutter<br />
RL5052-3 16.05.2005 3;03 Taki Mutter<br />
RL5053-1 17.05.2005 3;03 Taki Mutter<br />
RL5053-2 17.05.2005 3;03 Taki Mutter<br />
RL5053-3 17.05.2005 3;03 Taki Mutter<br />
RL5081-1 08.08.2005 3;06 Taki Mutter<br />
RL5081-2 08.08.2005 3;06 Taki Mutter<br />
RL5081-3 08.08.2005 3;06 Taki Mutter<br />
RL5082-1 09.08.2005 3;06 Taki Mutter<br />
RL5082-2 09.08.2005 3;06 Taki Mutter<br />
RL5101-1 23.10.2005 3;08 Taki Mutter<br />
RL5101-2 23.10.2005 3;08 Taki Mutter<br />
RL5101-3 23.10.2005 3;08 Taki Mutter<br />
RL5101-4 23.10.2005 3;08 Taki Mutter<br />
RL6011-1 11.01.2006 3;11 Taki Mutter reverberations<br />
RL6011-2 11.01.2006 3;11 Taki Mutter reverberations<br />
RL6012-1 16.01.2006 3;11 Taki Mutter reverberations<br />
RL6012-2 16.01.2006 3;11 Taki Mutter reverberations<br />
RL6013 16.01.2006 3;11 Taki Mutter reverberations<br />
RL6031 24.03.2006 4;01 Taki Mutter<br />
RL6032 28.03.2006 4;01 Taki Mutter<br />
RL6061-1 18.06.2006 4;04 Taki Mutter<br />
RL6061-2 18.06.2006 4;04 Taki Mutter<br />
RL6061-3 18.06.2006 4;04 Taki Mutter<br />
RL6062-1 20.06.2006 4;04 Taki Mutter<br />
RL6062-2 20.06.2006 4;04 Taki Mutter<br />
RL6063-1 23.06.2006 4;04 Taki Mutter<br />
RL6063-2 23.06.2006 4;04 Taki Mutter<br />
RL6091 03.09.2006 4;07 Taki Mutter<br />
RL6092 11.09.2006 4;07 Taki Mutter reverberations<br />
Tabelle 14: RL (21.02.2002)<br />
28
Aufnahme-ID Datum Alter Szenario Elternteil Kommentar<br />
LL211 06.12.2002 3;09 Taki Mutter<br />
LL212-1 06.12.2002 3;09 Taki Mutter<br />
LL212-2 06.12.2002 3;09 Taki Mutter<br />
LL302 21.02.2003 3;11 Taki Mutter<br />
LL304 10.04.2003 4;01 Taki Mutter<br />
LL307 26.07.2003 4;04 Taki Mutter<br />
LL4021 18.02.2004 4;11 Taki Mutter<br />
LL4051 13.05.2004 5;02 Taki Mutter<br />
LL5011 10.01.2005 5;10 Taki Mutter<br />
LL5021 17.02.2005 5;11 Taki Mutter<br />
LL5041-1 29.04.2005 6;01 Taki Mutter<br />
LL5041-2 29.04.2005 6;01 Taki Mutter<br />
LL5051 22.05.2005 6;02 Taki Mutter<br />
LL5052-1 23.05.2005 6;02 Taki Mutter<br />
LL5052-2 23.05.2005 6;02 Taki Mutter<br />
LL5111 12.11.2005 6;09 Taki Mutter<br />
LL6011-1 19.01.2006 6;10 Taki Mutter<br />
LL6011-2 19.01.2006 6;10 Taki Mutter<br />
LL6011-3 19.01.2006 6;10 Taki Mutter<br />
LL6061-1 28.06.2006 7;03 Taki Mutter<br />
LL6061-2 28.06.2006 7;03 Taki Mutter<br />
LL6061-3 28.06.2006 7;03 Taki Mutter<br />
Tabelle 15: LL (23.03.1999)<br />
Aufnahme-ID Datum Alter Szenario Elternteil Kommentar<br />
MS2051-1 2002/Mai 3;08 Taki Mutter<br />
MS2051-2 2002/Mai 3;08 Taki Mutter<br />
MS2051-3 2002/Mai 3;08 Taki Mutter<br />
MS2101 2002/Okt 4;01 Taki Mutter<br />
MS2111 2002/Nov 4;02 Taki Mutter<br />
MS3011 2003/Jan 4;04 Taki Vater<br />
MS3031 2003/Mär 4;06 Taki Mutter<br />
MS3041 2003/April 4;07 Taki Vater<br />
MS3061 2003/Jun 4;09 Taki Mutter<br />
MS3071 2003/Juli 4;10 Taki Mutter<br />
MS3111 2003/Nov 5;02 Taki Mutter<br />
MS4011 2004/Jan 5;04 Taki Mutter<br />
MS4031 2004/Mär 5;06 Taki Mutter<br />
MS4071 2004/Juli 5;10 Taki Mutter<br />
MS4101 2004/Okt 6;01 Taki Mutter<br />
MS5011-1 2005/Jan 6;04 Taki Mutter<br />
MS5011-2 2005/Jan 6;04 Taki Mutter<br />
MS5061 2005/Jun 6;09 Taki Mutter<br />
MS5121-1 2005/Dez 7;03 Taki Mutter<br />
MS5121-2 2005/Dez 7;03 Taki Mutter<br />
Tabelle 16: MS (08.09.1998)<br />
29