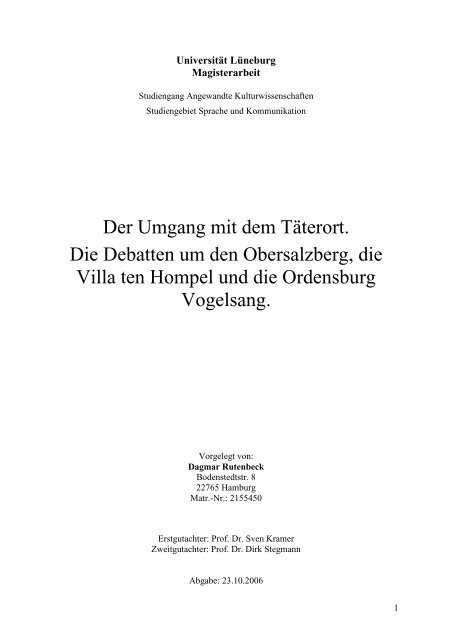Magisterarbeit Dagmar Rutenbeck - Obersalzberg Institut eV
Magisterarbeit Dagmar Rutenbeck - Obersalzberg Institut eV
Magisterarbeit Dagmar Rutenbeck - Obersalzberg Institut eV
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Universität Lüneburg<br />
<strong>Magisterarbeit</strong><br />
Studiengang Angewandte Kulturwissenschaften<br />
Studiengebiet Sprache und Kommunikation<br />
Der Umgang mit dem Täterort.<br />
Die Debatten um den <strong>Obersalzberg</strong>, die<br />
Villa ten Hompel und die Ordensburg<br />
Vogelsang.<br />
Vorgelegt von:<br />
<strong>Dagmar</strong> <strong>Rutenbeck</strong><br />
Bodenstedtstr. 8<br />
22765 Hamburg<br />
Matr.-Nr.: 2155450<br />
Erstgutachter: Prof. Dr. Sven Kramer<br />
Zweitgutachter: Prof. Dr. Dirk Stegmann<br />
Abgabe: 23.10.2006<br />
1
Inhaltsverzeichnis<br />
Inhaltsverzeichnis<br />
Inhaltsverzeichnis....................................................................................................................... 2<br />
Abbildungsverzeichnis ............................................................................................................... 4<br />
1. Einleitung ............................................................................................................................... 5<br />
2. Theoretische Grundlagen zu Vergangenheitsbewältigung und Erinnerungskultur................ 8<br />
2.1 Vergangenheitsbewältigung ............................................................................................. 8<br />
2.2 Erinnerungskultur........................................................................................................... 11<br />
3. Täterorte ............................................................................................................................... 16<br />
3.1 Begriffsbestimmung und Definition............................................................................... 16<br />
3.1.1 Exkurs zur Täterforschung ...................................................................................... 17<br />
3.1.2 Begrifflichkeiten in dieser Arbeit............................................................................ 20<br />
3.2 Kategorisierung der Täterorte ........................................................................................ 22<br />
3.2.1 Bauwerke des Nationalsozialismus......................................................................... 22<br />
3.2.2 Orte von hohem politischen Stellenwert ................................................................. 26<br />
3.3 Übersicht über die Täterorte........................................................................................... 26<br />
3.4 Umgang mit den Täterorten in der BRD........................................................................ 29<br />
4. Fallbeispiele ......................................................................................................................... 32<br />
4.1 <strong>Obersalzberg</strong>................................................................................................................... 32<br />
4.1.1 Geschichte des <strong>Obersalzberg</strong>s – Vom Tourismus zum Führersperrgebiet ............. 32<br />
4.1.1.1 Hitler auf dem <strong>Obersalzberg</strong> ............................................................................ 33<br />
4.1.1.2 Der Berghof im Führersperrgebiet ................................................................... 34<br />
4.1.2 Recreation Area und historische Sensationsgier ..................................................... 42<br />
4.1.3 Nutzungen in den 1990er Jahren............................................................................. 45<br />
4.1.3.1 Dokumentation <strong>Obersalzberg</strong>........................................................................... 47<br />
4.1.3.2 Intercontinental Berchtesgaden ........................................................................ 49<br />
4.1.3.3 Weitere touristische Nutzungen ....................................................................... 51<br />
4.2 Villa ten Hompel ............................................................................................................ 53<br />
4.2.1 Geschichte des Hauses – Von der Industriellen-Villa zur Polizeidienststelle......... 53<br />
4.2.1.1 Rolle der Ordnungspolizei im „Dritten Reich“ ................................................ 54<br />
4.2.1.2 Der Wehrkreis IV ............................................................................................. 55<br />
4.2.2 Sitz der Bezirksregierung und der Wiedergutmachungsbehörde............................ 57<br />
4.2.3 Debatte um den Geschichtsort................................................................................. 58<br />
4.2.3.1 Streit um die Einrichtung eines Geschichtsortes.............................................. 58<br />
2
Inhaltsverzeichnis<br />
4.2.3.2 Konzept und Umsetzung der Dokumentation .................................................. 61<br />
4.3 Ordensburg Vogelsang................................................................................................... 64<br />
4.3.1 Geschichte der Ordensburgen – Eliteschulen im NS-Erziehungssystem................ 65<br />
4.3.1.1 Anlage Vogelsang ............................................................................................ 66<br />
4.3.1.2 Die Ordensburgen im NS-Erziehungssystem................................................... 68<br />
4.3.1.3 Leben auf der Ordensburg................................................................................ 70<br />
4.3.2 Unter belgischer Besatzung im Naturschutzgebiet ................................................. 72<br />
4.3.3 Kontroverse um die verschiedenen Konzepte zur Nutzung der Burg..................... 75<br />
4.3.3.1 Nutzungskonzept des Fördervereins Nationalpark Eifel.................................. 75<br />
4.3.3.2 Machbarkeitsstudie im Auftrag des Kreises Euskirchen.................................. 79<br />
4.3.3.3 Standortentwicklungsgesellschaft Vogelsang .................................................. 82<br />
4.3.3.4 „Vogelsang ip“ des Büros Müller-Rieger ........................................................ 82<br />
5. Umgang mit dem Täterort .................................................................................................... 87<br />
5.1 Konzeption eines generellen Vorgehens ........................................................................ 87<br />
5.2 Einordnung des Vorgehens im Fall der Ordensburg Vogelsang.................................... 92<br />
6. Fazit...................................................................................................................................... 97<br />
7. Literaturverzeichnis.............................................................................................................. 99<br />
7.1 Bücher und Internetdokumente ...................................................................................... 99<br />
7.2 Zeitungsartikel und Presseinformationen..................................................................... 106<br />
8. Eidesstattliche Erklärung.................................................................................................... 112<br />
3
Abbildungsverzeichnis<br />
Abbildungsverzeichnis<br />
Abbildung 1: Der Berghof. Quelle: Hanisch 1998, S. 25. ...................................................... 35<br />
Abbildung 2: Der <strong>Obersalzberg</strong> bis 1933. Quelle: Hanisch 1995, S. 15. ................................ 37<br />
Abbildung 3: Der <strong>Obersalzberg</strong> von 1933-1945. Quelle: Hanisch 1995, S. 16. ..................... 37<br />
Abbildung 4: Villa ten Hompel. Quelle: Internetseite der Villa ten Hompel. ........................ 53<br />
Abbildung 5: Die Ordensburg Vogelsang im Jahre 1939. Quelle: Sammlung Heinen. .......... 66<br />
Abbildung 6: Karte der Anlage Vogelsang heute. Quelle: Sammlung Heinen. ...................... 77<br />
4
1. Einleitung<br />
Einleitung<br />
Erinnerungsarbeit ist in Deutschland so kompliziert wie in keinem anderen Land. Durch die<br />
ungeheuren Verbrechen im „Dritten Reich“ und die Unterstützung der nationalsozialistischen<br />
Politik durch einen Großteil der Bevölkerung ist die Erinnerung an die dreißiger und vierziger<br />
Jahre des letzten Jahrhunderts und die daraus folgenden Konsequenzen besonders schwierig.<br />
„Anders als die von öffentlicher Hand finanzierten Mahnmale, die auf staatlicher sowie<br />
privater Ebene in Polen und Israel zum Gedenken an die eigenen Opfer errichtet wurden, sind<br />
jene in Deutschland immer Mahnmale eines Täters, der seiner Opfer gedenkt.“ 1 Neben<br />
Gedenkstätten für die Opfer, wie sie zum Beispiel in ehemaligen Konzentrationslagern<br />
eingerichtet wurden, gibt es auch zahlreiche bauliche Hinterlassenschaften, die dazu gedacht<br />
waren, die angebliche Überlegenheit des nationalsozialistischen Systems für alle sichtbar zu<br />
machen. Deutschland ist das Land der Täter. Hier finden sich daher Orte, an denen die<br />
Verbrechen geplant und befohlen wurden. Die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts hat gezeigt,<br />
dass der Weg zu einer angemessenen Erinnerung besonders im offiziellen Raum umstritten<br />
ist. Inzwischen können nicht nur verschiedene Phasen des Umgangs mit der Vergangenheit<br />
unterschieden werden, es hat sich auch die Erkenntnis durchgesetzt, dass es nicht einen einzig<br />
richtigen Weg dafür gibt. Dabei werden heute auch die Debatten über die<br />
„Vergangenheitsbewältigung“ und die verschiedenen Vorschläge, die dabei aufkommen, mit<br />
berücksichtigt. James E. Young, ein amerikanischer Forscher, drückt es folgendermaßen aus:<br />
„Wie ich bereits erwähnt habe, ist das erfolgreichste deutsche Holocaust-<br />
Denkmal wahrscheinlich nicht ein einzelnes Monument, sondern die fortdauernde<br />
und unabgeschlossene Diskussion bezüglich der Art des Erinnerns, in wessen<br />
Namen erinnert werden soll und zu welchen Zwecken.“ 2<br />
Während über die angemessene Erinnerung an die Opfer schon zahlreiche Publikationen und<br />
Forschungsergebnisse zu finden sind, rückte der Bereich der Täter erst in den 1990er Jahren<br />
mit der so genannten „Täterforschung“ als neuem Gebiet in den Blickpunkt. Dabei gibt es in<br />
Deutschland zahlreiche Orte, die in erster Linie mit den Tätern in Verbindung gebracht<br />
werden. Dies sind zum Beispiel Bauten, die von den Nationalsozialisten errichtet wurden, wie<br />
das Reichsparteitagsgelände in Nürnberg oder der „Koloss von Rügen“, ein nie<br />
fertiggestelltes Hotel der Organisation „Kraft durch Freude“ (KdF). Orte der Täter sind aber<br />
auch noch bestehende Gebäude, in denen wichtige Entscheidungen im „Dritten Reich“<br />
1 Young 1997, S. 52. In dieser Arbeit wird in den Fußnoten die so genannte Kurzzitierweise verwendet. Neben<br />
Autor und Erscheinungsjahr sind alle weiteren Angaben im Literaturverzeichnis zu finden.<br />
2 Ebenda, S. 127.<br />
5
Einleitung<br />
getroffen wurden, wie das Haus der Wannsee-Konferenz. An einigen dieser Orte sind<br />
inzwischen Gedenkstätten entstanden, andere sind in Vergessenheit geraten.<br />
In dieser Arbeit sollen die Orte der Täter genauer beleuchtet werden. Dabei wird zunächst ein<br />
allgemeiner Hintergrund zur Vergangenheitspolitik und Erinnerungskultur gegeben.<br />
Anschließend werden die Begrifflichkeiten in den derzeitigen Debatten erörtert. Hierbei geht<br />
es insbesondere um die Unterscheidung zwischen Opfer- und Täterorten. Es wird hinterfragt,<br />
ob diese Einteilung sinnvoll ist und welche Alternativen es gibt. Dabei wird auch geklärt,<br />
welche Personen zur Gruppe der Täter zählen und wie nach 1945 mit den Tätern umgegangen<br />
wurde. Anschließend folgt eine Kategorisierung der Täterorte und ein Überblick über den<br />
derzeitigen Umgang mit solchen Orten von offizieller Seite.<br />
Im vierten Teil sollen die Debatten anhand dreier Beispiele vorgestellt werden. Die Orte<br />
<strong>Obersalzberg</strong>, Villa ten Hompel und Ordensburg Vogelsang wurden wegen ihrer<br />
Verschiedenartigkeit ausgewählt. Der <strong>Obersalzberg</strong> ist als Hitlers Wohnsitz einer der<br />
bekanntesten Täterorte. Die schon Ende der vierziger Jahre diskutierten Fragen zur Zukunft<br />
des Geländes weisen auf eine schwierige Entscheidungsfindung hin. Der Fokus wird bei<br />
diesem Beispiel auf die Diskussionen in den 1990er Jahren gelegt, wobei es insbesondere um<br />
die Errichtung einer historischen Dokumentation und eines Hotels ging. Das zweite Beispiel,<br />
die Villa ten Hompel in Münster, steht in dieser Arbeit für die Einrichtung einer Gedenkstätte<br />
an einem relativ unbekannten Ort mit deutlich weniger finanziellen Mitteln. In der Villa ten<br />
Hompel befand sich während der NS-Zeit der Sitz der Ordnungspolizei. Hierbei wird vor<br />
allem die Diskussion im Vorfeld der Einrichtung der Gedenkstätte beleuchtet. Mit der<br />
Ordensburg Vogelsang, einer von drei „Kaderschmieden“ für den NS-Führungsnachwuchs,<br />
wurde ein Beispiel gewählt, an dem die Debatte um die zukünftige Nutzung noch nicht<br />
abgeschlossen ist. Daher werden die einzelnen Parteien der Debatte vorgestellt und ihre<br />
jeweiligen Konzepte dargelegt. Die Diskussion wird bis zum Stand August 2006 geschildert.<br />
Die verschiedenen Debatten werden anhand der publizierten Zeitungsartikel verfolgt und<br />
dargelegt. Quellengrundlage sind sowohl die Online-Archive der jeweiligen Lokalzeitungen,<br />
in denen über eine Stichwortsuche die gewünschten Artikel zum Thema gefunden werden<br />
können, als auch überregionale Zeitungen und Zeitschriften. Weitere Quellen sind zudem die<br />
in einer Publikation zur Villa ten Hompel abgedruckten Zeitungsartikel, die Internetseiten der<br />
Orte und Einrichtungen selbst sowie eine ausführliche private Internetseite zur Ordensburg<br />
Vogelsang, die den aktuellen Verlauf verfolgt.<br />
Im letzten Teil der Arbeit werden die Ergebnisse der Debatten zusammengefasst, um daraus<br />
eine allgemeine Vorgehensweise für den Umgang mit dem Täterort zu konstruieren. Hierbei<br />
6
Einleitung<br />
geht es vor allem um die Frage, welcher Umgang mit Täterorten in der Bundesrepublik<br />
angemessen ist. Was ist an den verschiedenen Orten zu beachten? Welche Faktoren spielen<br />
bei der Einrichtung von Erinnerungsstätten eine Rolle? Was ist zur Alternative einer Neu-<br />
oder Umnutzung zu sagen? Diese Ergebnisse werden mit dem aktuellen Stand in Vogelsang<br />
abgeglichen, um einige Vorschläge zur weiteren Vorgehensweise dort zu machen.<br />
Wie Young in seinem Zitat beschreibt, sind die Debatten das eigentliche Zeugnis dafür, dass<br />
die Erinnerungskultur im Fluss ist und es keine eindeutigen, festgeschriebenen Regeln zum<br />
Umgang mit der Vergangenheit gibt. Engagierte Bürger, Journalisten, Wissenschaftler,<br />
Vereine und offizielle Stellen tragen mit ihren Vorschlägen und Wortmeldungen dazu bei,<br />
dass neue Ideen hervorgebracht, einige umgesetzt und viele auch wieder verworfen werden.<br />
Nur dieser Dialog kann in einer Demokratie zu einem angemessenen Umgang mit einer so<br />
problematischen Zeit wie dem „Dritten Reich“ führen. Daher ist es sinnvoll, solche Debatten<br />
näher zu betrachten.<br />
7
Vergangenheitsbewältigung und Erinnerungskultur<br />
2. Theoretische Grundlagen zu Vergangenheitsbewältigung und<br />
Erinnerungskultur<br />
Unter dem Punkt „Vergangenheitsbewältigung“ soll in dieser Arbeit beschrieben werden, wie<br />
in der Bundesrepublik bis zur Wiedervereinigung mit dem Erbe des Nationalsozialismus<br />
umgegangen wurde und zudem ein Ausblick auf die Zeit nach der Wende gegeben werden.<br />
Notwendig ist dies, um aufzuzeigen, warum Täterorte, obwohl sie im Land der Täter fast<br />
überall vorhanden sind, erst so spät ins Bewusstsein der Deutschen gerückt sind. Der Begriff<br />
„Vergangenheitsbewältigung“ wird hierbei beibehalten, trotz aller Kritik, er impliziere die<br />
Möglichkeit einer nachträglichen Veränderung der Vergangenheit. 3 Im zweiten Abschnitt<br />
dieses Kapitels wird unter dem Titel „Erinnerungskultur“ ein Überblick über die Theorien<br />
zum kollektiven Gedächtnis gegeben.<br />
2.1 Vergangenheitsbewältigung<br />
Die Vergangenheitsbewältigung der Bundesrepublik wird in der Fachliteratur in verschiedene<br />
Phasen eingeteilt, die je nach Werk und Autor variieren. Helmut König teilt die Zeit ab 1945<br />
in vier Abschnitte ein 4 : Die unmittelbare Nachkriegszeit bis zur Gründung der BRD war<br />
geprägt durch eine Schuld-Debatte, die jedoch nur in sehr abstrakter Form geführt wurde. Der<br />
Massenmord an den Juden kam nicht zur Sprache, persönliche Verstrickungen in die NS-<br />
Verbrechen blieben unerwähnt. Handlungssubjekte der Nachkriegsjahre waren die Alliierten;<br />
sie bestimmten, wie der Systemwechsel von der Diktatur zur Demokratie vonstatten gehen<br />
sollte und waren die Triebkraft hinter der Entnazifizierung. In den 1950er Jahren wurden die<br />
ehemaligen Täter in die neue Republik integriert, während sich der Staat nach außen und im<br />
Selbstverständnis klar von der NS-Vergangenheit abzusetzen versuchte. Durch diese<br />
Doppelstrategie konnten die alten Eliten wieder in ihre Positionen zurückkehren. Die Zeit<br />
zwischen 1960 und 1990 sieht König als Einheit, in der sich ein negativer Bezug auf die<br />
Vergangenheit und den Holocaust entwickelte. Diese kritische Auseinandersetzung mit dem<br />
„Dritten Reich“ lässt sich an verschiedenen Ereignissen festmachen. Helmut Dubiel, der in<br />
seinem Werk „Niemand ist frei von Geschichte“ 5 die Vergangenheitsbewältigung anhand der<br />
Bundestagsdebatten jahrzehnteweise nachzeichnet, nennt als herausragende Ereignisse<br />
zwischen 1960 und 1990 die großen Prozesse und die Verjährungsdebatten für Mord, die<br />
Auseinandersetzung der so genannten 68er-Generation mit ihren Eltern und in den achtziger<br />
Jahren die Frage nach dem richtigen Bezug auf die nationalsozialistische Vergangenheit. Die<br />
3 Vgl. hierzu und im Folgenden: König 2003, S. 7.<br />
4 Vgl.: Ebenda, S. 17ff.<br />
5 Dubiel 1999.<br />
8
Vergangenheitsbewältigung und Erinnerungskultur<br />
gleichen Debatten stehen auch bei König im Mittelpunkt der Zeit von 1960 bis 1990. Mit der<br />
Wiedervereinigung rückten dann allerdings andere Probleme in den Vordergrund: „Der<br />
Nationalsozialismus wird von einem Phänomen der Zeitgeschichte zu einem Ereignis der<br />
Geschichte.“ 6 Dies bedeutet, dass die Mehrheit der Bevölkerung den Nationalsozialismus<br />
nicht aus eigener Anschauung kennt. Aktuellere Ereignisse wurden wichtiger, der<br />
Nationalsozialismus war als unmittelbare Vergangenheit nicht mehr im Mittelpunkt<br />
politischer Auseinandersetzungen. Verschiedene Deutungsweisen und Lehren konnten aus der<br />
Vergangenheit herausgefiltert werden, wie die Auseinandersetzung um den Einsatz deutscher<br />
Soldaten im Kosovo zeigte. Einerseits wurde der Einsatz wegen der deutschen Vergangenheit<br />
abgelehnt, andererseits wurde gerade durch die NS-Zeit eine Verpflichtung gesehen, die den<br />
Einsatz berechtigte. Die Generation der Zeitzeugen verschwindet mit der Zeit. Trotzdem ist es<br />
nicht, wie kurz nach der Wende befürchtet, zu einer vollständigen Abnahme der<br />
Beschäftigung mit der NS-Zeit gekommen. Durch die Öffnung weiterer Quellenbestände in<br />
der ehemaligen Sowjetunion und neue Perspektiven von Forschern und Publikum wurden bis<br />
dahin noch kaum bearbeitete Felder wie die Täterforschung eröffnet.<br />
Eine ähnliche, wenn auch etwas gröbere Einteilung als König nimmt Aleida Assmann vor 7 :<br />
Die erste Phase von 1945-57 sieht sie vor allem unter dem Zeichen des kommunikativen<br />
Beschweigens der jüngsten Vergangenheit. Die Zeit des „Dritte Reiches“ wurde in der<br />
Öffentlichkeit soweit wie möglich verschwiegen. In der Folgezeit bis 1984 nahm die Kritik<br />
am Umgang mit dem Nationalsozialismus zu und auch die Strafverfolgung der Täter<br />
verschärfte sich. Ab dem Jahre 1985, im Zusammenhang mit dem Regierungswechsel zu<br />
Helmut Kohl, rückten verstärkt offizielle Erinnerungsriten und Symbole in den Vordergrund.<br />
Norbert Frei benennt seine vier Phasen des Umgangs mit der NS-Vergangenheit<br />
folgendermaßen 8 : Von 1945-49 gab es eine „Phase der politischen Säuberung“, die vor allem<br />
durch das Handeln der Alliierten bestimmt wurde. Obwohl viele ehemalige Nazis recht<br />
glimpflich davon kamen, stellt Frei doch heraus, dass es eine umfangreiche justizielle<br />
Säuberung gab. Es folgte die „Phase der Vergangenheitspolitik“ in den fünfziger Jahren, bei<br />
der versucht wurde, einen Schlussstrich zu ziehen. Die Leitbegriffe der Politik waren<br />
Amnestie und Integration. Wie auch König beschreibt Frei die fünfziger Jahre als den<br />
Versuch, NS-Verbrecher wieder in die Gesellschaft zu integrieren. In dieser Zeit wurden zwei<br />
Straffreiheitsgesetze verabschiedet, welche die ehemaligen NS-Täter begünstigten. Gerade in<br />
der nicht aufgearbeiteten Vergangenheit aus den fünfziger Jahren sieht Frei dann den<br />
6 König 2003, S. 17.<br />
7 Vgl.: Assmann; Frevert 1999, S. 143f.<br />
8 Vgl. zu den vier Phasen: Frei 2005, S. 26ff.<br />
9
Vergangenheitsbewältigung und Erinnerungskultur<br />
Unterschied zur folgenden „Phase der Vergangenheitsbewältigung“ bis in die siebziger<br />
Jahre. Verschiedene Intellektuelle und Teile der Bevölkerung wie die 68er-Generation fingen<br />
an, unbequeme Fragen zu stellen, die zu einer vermehrten Auseinandersetzung mit dem<br />
Nationalsozialismus führten. Mit der Ausstrahlung der Fernsehserie „Holocaust“ rückten dann<br />
auch die Verbrechen an den Juden ins allgemeine Bewusstsein. Anschließend nimmt Frei den<br />
Terminus von Assmann auf und spricht von einer „Phase der Vergangenheitsbewahrung“.<br />
Dies meint, dass nicht mehr die politisch überhöhten Auseinandersetzungen um die<br />
Vergangenheit im Vordergrund stehen, sondern verschiedene Zugangs- und Deutungsweisen<br />
nebeneinander existieren und darüber debattiert wird, wie Gedenken und Erinnerung in<br />
Zukunft aussehen sollen: „Zunehmend in den Mittelpunkt gerät [...] die Frage, welche<br />
Erinnerung an diese Vergangenheit künftig bewahrt werden soll.“ 9<br />
Egal welche der Periodisierungen man bevorzugt, die Einteilungen machen deutlich, dass sich<br />
der Umgang mit der NS-Vergangenheit seit dem Kriegsende gewandelt hat. Dabei ist es<br />
keineswegs mit zeitlichem Abstand , wie vielleicht zu erwarten wäre, zu einer Verringerung<br />
der Auseinandersetzung gekommen; im Gegenteil: „Soviel Hitler war nie.“ 10 Warnungen vor<br />
einem möglichen Überdruss angesichts der medialen Präsenz von NS-Themen sind immer<br />
wieder zu hören, genau wie Forderungen nach einem Schlussstrich. Solche Argumentationen<br />
werden unterschiedlich bewertet und sind Kern von Auseinandersetzungen, wie die Walser-<br />
Bubis-Debatte gezeigt hat. Die Forderung nach einem Schlussstrich ist jedoch unangebracht;<br />
sie würde beispielsweise auch nicht in Bezug auf das 18. oder 19. Jahrhundert an Historiker<br />
gestellt werden. Zudem zeigt sich, dass viele Themenbereiche noch nicht vollständig erforscht<br />
sind, die Forschung sogar oft erst am Anfang steht. Fragen nach der Lehre aus dem „Dritten<br />
Reich“ werden für jede Generation immer wieder neu beantwortet werden müssen, gerade um<br />
eine Wiederholung des Geschehens zu vermeiden. Dabei wird der Holocaust auch nicht nur<br />
als nationales Phänomen gesehen, wie die Stockholmer Übereinkunft zur „Erziehung über den<br />
Holocaust“ vom Januar 2000 zeigt. 11 Auch in nicht unmittelbar betroffenen Länder soll der<br />
Holocaust in der Erinnerung verankert werden. Die Gefahr der Entkontextualisierung durch<br />
eine solche Universalisierung des Gedenkens muss beachtet werden, damit es nicht zu einer<br />
völligen Instrumentalisierung kommt. In Deutschland, im Land des Geschehens, ist ein<br />
solches Herauslösen aus dem Kontext ein geringeres Problem. So gibt es hier genügend<br />
konkrete Orte, die man mit Tätern und Opfern des „Dritten Reiches“ verbinden kann, wie<br />
weiter unten noch ausgeführt wird.<br />
9 Frei 2005, S. 39.<br />
10 Ebenda, S. 7.<br />
11 Vgl.: Ebenda, S. 25.<br />
10
2.2 Erinnerungskultur<br />
Vergangenheitsbewältigung und Erinnerungskultur<br />
Begriffe wie kollektives Gedächtnis und Erinnerungskultur sind in den letzten Jahren immer<br />
wieder in den verschiedensten Zusammenhängen zu hören. Gedächtnis wird als ein<br />
interdisziplinäres Phänomen angesehen und kann damit zu einem Leitbegriff der<br />
Kulturwissenschaften erklärt werden. 12 Da auch diese Arbeit in den entsprechenden Rahmen<br />
fällt, soll zunächst ein kurzer Überblick über das Forschungsfeld Erinnerungskultur in<br />
Deutschland gegeben werden. Zur Orientierung wird eines der derzeit aktuellsten Werke auf<br />
diesem Gebiet herangezogen, Astrid Erlls „Kollektives Gedächtnis und Erinnerungskulturen“<br />
aus dem Jahr 2005. Dort wird das kollektive Gedächtnis als „[...] Oberbegriff für all jene<br />
Vorgänge organischer, medialer und institutioneller Art, denen Bedeutung bei der<br />
wechselseitigen Beeinflussung von Vergangenem und Gegenwärtigem in soziokulturellen<br />
Kontexten zukommt“ 13 beschrieben. Diese breite Definition umfasst somit alle Handlungen<br />
und Ereignisse, die Menschen beeinflussen, wenn es um die Beziehung zwischen der<br />
Vergangenheit und der Gegenwart geht. Ausgangspunkte für die heutige Forschung legten<br />
Maurice Halbwachs und Aby Warburg schon in den 1920er Jahren. 14 Halbwachs machte<br />
darauf aufmerksam, dass das kollektive Gedächtnis kein genaues Abbild der Vergangenheit<br />
ist, sondern durch Individuen und Gruppierungen beeinflusst wird. Sie bestimmen, an was<br />
und in welcher Form sich erinnert wird. 15 Das Thema geriet für die nächsten 60 Jahre<br />
allerdings in den Hintergrund und wurde erst in den 1980er Jahren wieder aufgenommen.<br />
International ist dabei der Franzose Pierre Nora besonders bedeutsam. Nora beschäftigt sich in<br />
seinem Werk mit so genannten „Gedächtnisorten“ (lieu de mémoire), meint dabei aber nicht<br />
nur geografische Orte, sondern bezieht sich auch auf Gedenkfeiern, Rituale, Texte oder<br />
Bücher. 16 Auf dem deutschsprachigen Gebiet konnten sich vor allem Aleida und Jan Assmann<br />
etablieren.<br />
Innerhalb des Feldes der Erinnerungskultur gibt es verschiedene Begrifflichkeiten und<br />
Konzepte. Da für diese Arbeit das Werk von Aleida Assmann „Erinnerungsräume“ 17 von<br />
besonderer Relevanz ist, wird im Folgenden die Theorie des „Kulturellen Gedächtnisses“ von<br />
Jan und Aleida Assmann vorgestellt. Sie unterscheiden zwei verschiedene „Gedächtnis-<br />
Rahmen“: das kommunikative und das kulturelle Gedächtnis. Das kommunikative Gedächtnis<br />
beruht dabei auf der Geschichtserfahrung der lebenden Generationen. Es ist daher auf ca. 80-<br />
12 Vgl.: Erll 2005, S. 1.<br />
13 Ebenda, S. 6.<br />
14 Vgl. hierzu und im Folgenden: Ebenda, S. 1-34.<br />
15 Vgl.: Burke 1991, S. 290.<br />
16 Vgl.: Nora 1990, S. 7.<br />
17 Assmann 1999.<br />
11
Vergangenheitsbewältigung und Erinnerungskultur<br />
100 Jahre beschränkt und entsteht durch Alltagsinteraktion. Das kulturelle Gedächtnis<br />
dagegen ist durch feste Inhalte und Sinnstiftungen geprägt. Es ist an bestimmte Objekte<br />
gebunden. Unter dem kulturellen Gedächtnis kann man zeremonialisierte, vergegenwärtigte<br />
Erinnerung an mystische Ereignisse der Vergangenheit verstehen. Der besondere Zeitpunkt,<br />
an dem wir uns zurzeit befinden und auf den vielleicht auch die intensive Beschäftigung mit<br />
dem Themenfeld Erinnerungskultur zurückzuführen ist, besteht darin, dass in Bezug auf den<br />
Nationalsozialismus gerade der Übergang vom kommunikativen zum kulturellen Gedächtnis<br />
stattfindet. Diese mitwandernde Phase zwischen kommunikativem und kulturellem<br />
Gedächtnis wird „Floating Gap“ genannt. Noch gibt es Überlebende und Zeitzeugen, die sich<br />
an das „Dritte Reich“ erinnern können. In einigen Jahren werden wir über den<br />
Nationalsozialismus nur noch etwas aus Büchern erfahren können.<br />
Aleida Assmann hat sich insbesondere mit „Erinnerungsräumen“ 18 auseinandergesetzt und<br />
sich dort in einem Kapitel speziell bestimmten Orten zugewandt. Da Täterorte geografische<br />
Orte sind, an denen die Vergangenheit in besonderer Weise auf die Gegenwart wirkt, scheint<br />
dies ein Aspekt zu sein, dem im Hinblick auf diese Arbeit besondere Aufmerksamkeit zu<br />
widmen ist. Orte helfen bei der Konstruktion kultureller Erinnerung, weil sie die Erinnerung<br />
festigen: Sie sind zum einen ein Beweis, dass die Vergangenheit sich wirklich abgespielt hat,<br />
zum anderen helfen sie, sich Vergangenheit zu vergegenwärtigen. Dabei überdauern sie<br />
Individuen und Generationen. 19<br />
Assmann unterscheidet verschiedene Orte, die für das kulturelle Gedächtnis von Relevanz<br />
sind: Generationenorte, heilige Orte, Ruinen, Gräber und traumatische Orte. 20<br />
Generationenorte sind in besonderer Weise mit der eigenen Familiengeschichte verbunden,<br />
wogegen heilige Orte mit der Anwesenheit der Götter assoziiert werden. Assmann<br />
veranschaulicht am Beispiel Jerusalem, dass bestimmte Gedächtnisorte sowohl historische als<br />
auch heilige Gedächtnisorte sein können und außerdem von verschiedenen<br />
Erinnerungsgemeinschaften umkämpft werden, wie es mit den Kreuzzügen der Fall war.<br />
Assmann nennt neben Generationen- oder Familienorten, die durch Kontinuität einer Familie<br />
geprägt sind, Gedenkorte, die durch Diskontinuität gekennzeichnet sind. Diskontinuität meint<br />
„[...] eine eklatante Differenz zwischen Vergangenheit und Gegenwart [...]“ 21 , wie sie vor<br />
allem durch Ruinen verdeutlicht wird. Ruinen sind Überreste einer Vergangenheit, die abrupt<br />
18 So der Titel des Buches Assmann 1999.<br />
19 Vgl.: Assmann 1999, S. 299.<br />
20 Vgl. hierzu und im Folgenden: Ebenda, Kapitel V „Orte“, S. 289-339.<br />
21 Ebenda, S. 309.<br />
12
Vergangenheitsbewältigung und Erinnerungskultur<br />
geendet hat und die man in den darauf folgenden Jahren unbeachtet gelassen hat. Mit den<br />
Bildungsreisen der Renaissance-Zeit wurden bestimmte Ruinen wiederbelebt, indem sie in der<br />
eigenen Anschauung erneut mit Leben gefüllt wurden. Im Gegensatz dazu wurden Ruinen im<br />
Mittelalter als etwas Selbstverständliches hingenommen, was nicht hinterfragt wurde. Es kann<br />
sogar soweit gehen, dass Ruinen ästhetisiert werden und ganz in der Natur aufgehen und als<br />
Teil der Landschaft betrachtet werden. Während Ruinen wie ein Fingerzeig auf etwas<br />
hinweisen, das sich an diesem Ort einmal abgespielt hat und jetzt nicht mehr dort ist, sind<br />
Gräber Gedenkorte göttlicher Präsenz. Allerdings wird es heutzutage immer schwieriger, das<br />
Gedenken an Tote auf einen bestimmten Ort festzulegen. Daher werden ortsunspezifische<br />
Monumente eingerichtet. „Das Gedächtnis des Ortes verbürgt die Präsenz des Toten; das<br />
Monument dagegen lenkt die Aufmerksamkeit vom Ort auf sich selbst als repräsentierendes<br />
Symbol.“ 22 An die Toten wird dann nicht am Ort ihres Begräbnisses, sondern an einem<br />
anderen Ort durch ein Zeichen erinnert. Im Hinblick auf den Nationalsozialismus und den<br />
Holocaust ist dieses Ersetzen des konkreten Ortes durch ein Symbol wieder aktuell geworden.<br />
Durch den Holocaust wurde jüdisches Leben ausradiert und es erfordert große Anstrengungen<br />
diese Leerstellen wieder zu finden und kenntlich zu machen. So kann auch die Debatte um<br />
das so genannte „Holocaust-Denkmal“ als ein Ringen um einen konkreten Erinnerungsort<br />
verstanden werden.<br />
Als letzten Kategorie von Orten beschreibt Assmann so genannte „traumatische Orte“. Diese<br />
stehen in einem großen Gegensatz zu den anderen Gedenkorten. Die vorher beschriebenen<br />
Gedenkorte sind normalerweise positiv besetzt. Selbst wenn dort blutige Ereignisse<br />
stattgefunden haben, tragen sie heute zur Sinnstiftung bei. Auch Niederlagen können dann in<br />
einem guten Licht gesehen werden und eine verpflichtende Botschaft beinhalten. Ein Beispiel<br />
wäre hierfür die Bastille: Obwohl dort während der französischen Revolution blutige<br />
Schlachten stattfanden, die viele Menschenleben kosteten, sind mit dem Ort positive<br />
Erinnerungen an die Revolution verbunden. Ein traumatischer Ort unterscheidet sich dagegen<br />
von solchen Orten, weil hier keine normative Sinnbildung möglich ist. Die Geschichte eines<br />
traumatischen Ortes ist mit Tabus besetzt und nicht erzählbar. Assmann benennt drei<br />
Merkmale von traumatischen Orten. 23 Sie besitzen eine antäische Magie, das heißt, man<br />
erwartet durch den Ort eine verstärkende Wirkung für die Erinnerung. Sie sind zudem<br />
semiauthentisch und schweben somit zwischen Authentizität und Inszenierung. Wenn<br />
Gedächtsnisorte zu Gedenkstätten umgestaltet werden, unterliegen sie einem Paradox: „Die<br />
Konservierung dieser Orte im Interesse der Authentizität bedeutet unweigerlich einen Verlust<br />
22 Assmann 1999, S. 325.<br />
23 Vgl. zu den drei Aspekten von historischen Orten: Assmann 2002, S. 203ff.<br />
13
Vergangenheitsbewältigung und Erinnerungskultur<br />
an Authentizität. Indem der Ort bewahrt wird, wird er bereits verdeckt und ersetzt.“ 24 Gerade<br />
an traumatischen Orten stellt sich die Frage, wie das Geschehene hier darstellbar ist. James E.<br />
Young geht davon aus, dass die nationalsozialistischen Verbrechen in unserer Sprache nicht<br />
darzustellen sind. Die Grenze zwischen Fakt und Fiktion verwischt vor allem, wenn<br />
Erinnerung inszeniert wird. So vergisst der Betrachter, dass er nicht unmittelbar Geschichte<br />
erlebt, sondern nur ein rekonstruiertes Bild des Geschehenen vor sich hat, was im<br />
schlechtesten Fall mit politischen Ambitionen aufgeladen oder durch unwahre Informationen<br />
verfälscht wurde. 25 Detlef Hoffmann weist auf die generelle Schwierigkeit des Begriffes<br />
„Authentizität“ hin. 26 In seiner Wortbedeutung meint authentisch glaubwürdig, echt oder<br />
ursprünglich. Gerade wenn man Orte oder Bauwerke betrachtet, muss man sich aber fragen,<br />
welcher Zustand als authentisch ausgewiesen bzw. welcher Zeitraum als erhaltungs- und<br />
repräsentationswürdig empfunden wird. Durch längere Bauzeiten und Nutzungen durchläuft<br />
jedes Gebäude verschiedene Phasen. Hoffmann ist sogar der Meinung, dass Orte oder<br />
Baudenkmäler überhaupt nicht authentisch sein können, da ein Historiker im Gegensatz zu<br />
einem Kriminalbeamten seine Vorstellungen des Ortes, die er sich anhand von Spuren<br />
gemacht hat, nie mit der Realität abgleichen kann, da diese bereits vergangen ist: „Hier<br />
wetteifern die Vorstellungen lediglich um die Interpretationsmacht der materiellen Spuren.“ 27<br />
Jeder Betrachter muss selbst überlegen, was genau er vor Augen hat und aus welcher Sicht (in<br />
wörtlicher und übertragener Bedeutung) er auf den Ort schaut. Dieses Verfahren ist ähnlich<br />
wie bei Fragen nach dem Ursprung und der Deutungsweise von beispielsweise<br />
Erinnerungstexten über Auschwitz. Auch hier ist zu fragen: „Welche Realität von Auschwitz<br />
repräsentieren sie? Wie prägend war der politische und gesellschaftliche Kontext, in dem sie<br />
entstanden?“ 28 Somit ist wichtig, dass bei Gedenkstätten deutlich gemacht wird, dass man<br />
nicht mit Betreten des Ortes vollends in die Vergangenheit eintaucht, sondern eine bereits<br />
„bearbeitete“ Darstellung der Vergangenheit am historischen Ort vor sich hat. Als dritten<br />
Aspekt von traumatischen Orten nennt Assmann die Überdeterminiertheit, was bedeutet, dass<br />
diese Orte besonders komplex sind. Auschwitz ist sicher als Symbol für die Vernichtung der<br />
Juden einer der wichtigsten traumatischen Orte. Seine Bedeutung als Ort ist ungeheuer<br />
vielschichtig und eng mit den Erinnerungen der Besucher verbunden. So ist Auschwitz<br />
Museum, Friedhof und Touristen-Ort in einem. Auschwitz ist auch in dem Bewusstsein zu<br />
einem Museum und Erinnerungsort geworden, dass die Leerstelle des Holocaust nicht aus<br />
24 Assmann 2002, S. 204.<br />
25 Vgl.: Reichel 1995, S. 28.<br />
26 Vgl.: Hoffmann 2002, S. 4.<br />
27 Hoffmann 1998, S. 6.<br />
28 Frei 2005, S. 178f.<br />
14
Vergangenheitsbewältigung und Erinnerungskultur<br />
unserem Gedächtnis verschwinden darf. Leerstelle meint in diesem Zusammenhang das<br />
Gefühl des Entsetzens und die Unerklärlichkeit, welche die millionenfache Auslöschung von<br />
Menschenleben hinterlassen hat sowie „[...] die Erinnerung an das jüdische Volk über das<br />
Motiv ihrer Abwesenheit [...]“ 29 . Als Ort, den man aufsuchen kann, trägt Auschwitz zu einer<br />
Intensivierung der Erinnerung bei, welche die meisten Menschen nur aus den<br />
Geschichtsbüchern kennen.<br />
29 Young 1997, S. 28.<br />
15
3. Täterorte<br />
Täterorte<br />
3.1 Begriffsbestimmung und Definition<br />
Täterorte, Geschichtsorte, böse Orte, Denkorte, Lernorte, Gedächtnisorte, Gedenkorte,<br />
historisch vorbelastete Orte oder Orte der Täter – all dies sind Begriffe, die geografische Orte<br />
in Deutschland bezeichnen, die das Thema dieser Arbeit sind. Teilweise sind es Begriffe, die<br />
von den Dokumentationsstätten gewählt wurden, um ihren Auftrag und ihre didaktische<br />
Absicht zu verdeutlichen. So trägt das Haus der Wannsee-Konferenz mit der dazugehörigen<br />
Dokumentation den Titel „Gedenk- und Bildungsstätte“, die Villa ten Hompel wird als<br />
„Geschichtsort“ bezeichnet. Stephan Porombka und Hilmar Schmundt wählten für ihr Buch,<br />
das sich mit unterschiedlichen „Stätten nationalsozialistischer Selbstdarstellung“ beschäftigt,<br />
den plakativen Titel „Böse Orte“ 30 . Andere Gedenkstätten werden als „Denkorte“, „Lernorte“<br />
oder „Gedächtnisorte“ bezeichnet. All diese Begriffe sind sehr vage und umschreiben noch<br />
nicht den Kern der Sache. Ohne Zusatzinformationen sind sie auf die unterschiedlichsten<br />
Sachverhalte anwendbar. Sie mögen zwar im jeweiligen Kontext adäquat sein, als Oberbegriff<br />
zur Klassifizierung bestimmter geografischer Orte sind sie jedoch nicht geeignet. Einen<br />
anerkannten Oberbegriff zu finden, ist bis heute nicht gelungen. Meist wird in der Forschung<br />
und auch in den Medien 31 von „Täterorten“ oder „Orten der Täter“ gesprochen, obwohl die<br />
Historiker mit dieser Bezeichnung alles andere als glücklich zu sein scheinen: Ulrich Haase<br />
spricht in der Rede zur Eröffnung des Symposiums „Historische Stätten aus der Zeit des<br />
Nationalsozialismus“ von einer „unscharfen Formulierung“ 32 .<br />
In dieser Arbeit soll es um Orte gehen, die entweder durch ihre herausragende<br />
Herrschaftsarchitektur oder ihre besondere politische Bedeutung während des „Dritten<br />
Reiches“ hervorstechen. Haase nutzt die Bezeichnung „Täterort“ als einen Begriff für Orte<br />
von „[...] zum Teil über die NS-Zeit hinaus [...] herausragender, aber durchaus<br />
unterschiedlicher Bedeutung“ 33 . Es sind „[...] Stätten, die für eine bestimmte Geisteshaltung,<br />
für Demagogie, Gigantonomie oder Monumentalität in der Kunst oder Architektur und<br />
Massengesellschaft stehen [...].“ 34 Als ein weiteres Merkmal eines Täterortes nennt Haase<br />
zudem einen ungeregelten historischen Tourismus. 35 Hiermit ist gemeint, dass der Ort eine<br />
große Faszination auf Menschen ausübt. Touristen kommen, um den Täterort selbst<br />
anzuschauen. Dies geschieht allerdings nicht in geregelten Bahnen, sondern meist ohne<br />
30<br />
Porombka; Schmundt 2005.<br />
31<br />
Vgl. beispielsweise: Wirsing 1998, S. 38.<br />
32<br />
Haase 1999, S. 7.<br />
33<br />
Ebenda.<br />
34<br />
Ebenda, S. 16.<br />
35<br />
Vgl.: Ebenda, S. 11.<br />
16
Täterorte<br />
offizielle Informationen, so dass sich schnell Legenden und Mythen um diesen Ort bilden. Die<br />
Definition des Täterortes nach Haase ist so weit schlüssig und grenzt auch für diese Arbeit ab,<br />
was unter dem Begriff zu verstehen ist. Um den Begriff näher zu beleuchten, soll hier<br />
zunächst ein kurzer Abschnitt zur Täterforschung folgen, dem sich dann noch einige<br />
Kritikpunkte zu den Begrifflichkeiten des Diskurses anschließen.<br />
3.1.1 Exkurs zur Täterforschung<br />
Während wie oben beschrieben der Umgang mit der Vergangenheit nach 1945 in<br />
verschiedene Phasen eingeteilt werden kann, so sind auch im Hinblick auf den Umgang mit<br />
den Tätern mehrere zeitliche Abschnitte zu unterscheiden. Nach Ulrich Herbert kann man<br />
hierbei fünf Phasen erkennen 36 : Nach dem Kriegsende bis 1957 wurden die Täter in der BRD<br />
kaum thematisiert. Die SS wurde als hauptverantwortliche Organisation für die Verbrechen<br />
im „Dritten Reich“ angesehen. Die Täter wurden kriminalisiert oder dämonisiert und hatten in<br />
der Vorstellung der Deutschen nichts mit der normalen Gesellschaft zu tun. Durch die Kölner<br />
Synagogenschändungen und die großen Prozesse, insbesondere der Eichmann-Prozess und<br />
der Frankfurter Auschwitz-Prozess, rückten die Täter in den Blickpunkt der Öffentlichkeit.<br />
Die Forschung blieb allerdings auf Distanz und beschränkte sich auf die wissenschaftliche<br />
Beschäftigung mit den politischen Abläufen und Entscheidungsprozessen, die teilweise sehr<br />
schwer zu rekonstruieren waren. Auch in der dritten Phase ab den siebziger Jahren gab es<br />
noch keine Annäherung an die Individualität der Täter. Die Diskussion wurde geprägt durch<br />
die Faschismusdebatte, die stark theoretisch blieb. Herbert nennt diesen Abschnitt sogar<br />
„Phase der zweiten Verdrängung“ 37 . In der vierten Phase der Täterforschung entbrannte –<br />
auch ausgelöst durch die Ausstrahlung der US-Fernsehserie „Holocaust“ 1979 – eine Debatte<br />
um den Entscheidungsprozess bei der Ingangsetzung der „Endlösung“: Die Strukturalisten<br />
unter den Forschern gingen von aufgesplitterten, improvisierten bürokratischen Eliten aus,<br />
während die Intentionalisten sich auf die Person Hitlers konzentrierten. Aus der Kritik am<br />
Strukturalismus und Intentionalismus erwuchsen auch neue Entwicklungen. So beschäftigte<br />
man sich in den 1980ern erstmals mit Opfergruppen, die vorher noch nicht in den Blickpunkt<br />
der Forschung gerückt waren. Eine wirkliche Täterforschung – als neue Disziplin innerhalb<br />
der NS-Forschung – etablierte sich erst in den 1990er Jahren und wurde vor allem durch die<br />
Goldhagen-Debatte und die Wehrmachtsausstellung ausgelöst. 38 Die Forscher wandten sich<br />
neuen Tätergruppen zu. So hatte Daniel Goldhagens Werk „Hitlers willige Vollstrecker“<br />
36 Vgl.: Herbert 1998, S. 12-31.<br />
37 Ebenda, S. 19.<br />
38 Vgl.: Paul; Mallmann 2004, S. 1.<br />
17
Täterorte<br />
seinen Ausgangspunkt in der bis dahin nicht ausreichenden Erforschung der Täter im „Dritten<br />
Reich“. 39 Nicht nur die Eliten wurden in den Blick genommen, auch die „kleinen Täter“<br />
wurden intensiv erforscht.<br />
Gerhard Paul geht gleichfalls von fünf Phasen der Täterforschung aus, die jedoch nicht mit<br />
denen von Herbert identisch sind 40 : Den Zeitraum bis Ende der 1980er Jahre teilt er grob in<br />
eine Phase der Distanzierung von den Tätern bis Anfang der sechziger und eine Phase der<br />
Entpersonalisierung bis Ende der achtziger Jahre ein. Durch Goldhagen und die<br />
Wehrmachtsausstellung folgten neue Impulse für den Täterdiskurs, der dann in einen<br />
Abschnitt der Konkretisierung mündete, in der man sich neuen Gruppen und den Direkttätern<br />
zuwandte. Gegenwärtig unterscheidet man verschiedene Tätertypen, nimmt jedoch von<br />
verallgemeinernden Erklärungsansätzen Abstand.<br />
Generell ist beim Begriff „Täter“ darauf hinzuweisen, dass eine eindeutige Unterscheidung<br />
zwischen den Tätern und Opfern selbst schwierig ist. Gerade in den siebziger und achtziger<br />
Jahren fiel diese Trennung zu eindeutig und kategorisch aus, so dass dabei nicht auf<br />
eventuelle Grauzonen geachtet wurde. 41 Insgesamt ist es nicht einfach, überhaupt eine<br />
gängige Definition zu finden, welche Personen als Täter bezeichnet werden. Armin Nolzen<br />
moniert in seinem Beitrag zum Streifendienst der Hitler-Jugend, dass der Täterbegriff sehr<br />
unpräzise verwendet wird. Seiner Meinung nach „[...] bedarf es einer Umwandlung der<br />
vagen Bezeichnung ‚Täter’ in ein brauchbares analytisches Instrument.“ 42 Goldhagen<br />
definiert alle als Täter, die in <strong>Institut</strong>ionen durch Wissen und Handlungen den Holocaust<br />
unterstützten:<br />
„Der hier vertretenen Definition zufolge ist jeder ein Täter, der in einer<br />
<strong>Institut</strong>ion arbeitete, die Teil des brutalen, mörderischen Herrschaftssystems war,<br />
eines Systems, an dessen Spitze die <strong>Institut</strong>ionen der direkten Massenvernichtung<br />
standen, denn er wußte, daß er durch sein Handeln die <strong>Institut</strong>ionen des<br />
Völkermords in Gang hielt.“ 43<br />
Dem schließt sich Thomas Sandkühler an und fügt hinzu, dass der Täterbegriff weit genug<br />
sein muss, um alle zu erfassen, die am arbeitsteiligen Prozess der Judenvernichtung beteiligt<br />
waren, aber auch differenziert genug, um Unterschiede zwischen den Positionen und<br />
Individuen nicht zu verwischen. 44 So ist sicher zu konstatieren, dass es grundsätzlich einen<br />
„Kernbestand“ an Tätern gibt, die – wie in der obigen Definition beschrieben – direkt am<br />
39 Vgl.: Pohl 2002, S. 95.<br />
40 Vgl.: Paul 2002, S. 16-67.<br />
41 Vgl.: Behrens; Haustein 2002, S. 3.<br />
42 Nolzen 2000, S. 39.<br />
43 Goldhagen 1996, S. 202.<br />
44 Vgl.: Sandkühler 1999, S. 40.<br />
18
Täterorte<br />
Völkermord beteiligt waren, die Befehle gaben und ausführten und den Holocaust durch ihre<br />
Handlungen unterstützten.<br />
Neben dieser Gruppe gibt es auch viele Menschen, die nicht eindeutig in eine der Kategorien<br />
Täter oder Opfer einzuteilen sind. Einige der wichtigsten Überlegungen in Hinblick auf die<br />
„Grauzone“ hat der italienische Schriftsteller Primo Levi in seinem Buch „Die<br />
Untergegangenen und die Geretteten“ niedergeschrieben. Levi, der selbst Insasse eines<br />
Konzentrationslager gewesen ist, beschreibt im zweiten Kapitel seines Buches, dass in der<br />
Geschichtsschreibung Zwischentöne – die „Grauzone“ – meist vernachlässigt werden, weil<br />
der Mensch lieber klare Verhältnisse – Schwarz und Weiß – vor sich habe. 45 Gerade in Bezug<br />
auf Konzentrationslager erwarten wir heute, und so war wohl auch Levis Erwartung damals,<br />
eindeutige Grenzen zwischen Guten und Bösen zu erkennen. Levi nennt die Erkenntnis, dass<br />
es keine eindeutigen Verbündeten unter den Insassen gab, als einen der größten Faktoren für<br />
den Zusammenbruch des Widerstandes. Levi beschreibt des Weiteren die verschiedenen<br />
Gruppen im Konzentrationslager, die für ihn nicht mehr einfach der guten oder bösen Seite<br />
zuzuordnen sind: so zum Beispiel die „Privilegierten“, die sich als Lagervollzugsangestellte<br />
gegen neu Ankommende richteten. „Sie [die hybride Klasse der Häftlinge als<br />
Vollzugspersonen; D.R.] ist eine Grauzone mit unscharfen Konturen, die die beiden Bereiche<br />
von Herren und Knechten voneinander trennt und zugleich miteinander verbindet.“ 46<br />
Natürlich sind die „Privilegierten“ nicht der gleichen Gruppe wie Lagerkommandanten<br />
zuzuordnen, dennoch verfügten sie über mehr Macht als neue Häftlinge und waren teilweise<br />
auch bereit, diese auszunutzen.<br />
Häftlinge, die mit kleinsten Privilegien ausgestattet waren, hatten bessere Chancen im Lager<br />
zu überleben. Besonders bei den so genannten „Kapos“, Insassen mit Kommando-Tätigkeiten,<br />
wird ein Urteil schwierig. Unter ihnen gab es wie in jeder Gesellschaft Menschen, die ihre<br />
Stellung missbrauchten und andere terrorisierten. Auch die „Sonderkommandos“ bestehend<br />
aus Juden, die unmittelbar mit der Vernichtung verbundene Aufgaben verrichten mussten,<br />
gehören zu der Gruppe, über die nur schwer ein Urteil zu fällen ist. Der Preis für die<br />
Zugehörigkeit zum Sonderkommando war der Tod, da die Sonderkommandos ebenfalls<br />
ermordet wurden. Die Beispiele zeigen, dass eine Unterscheidung in Täter und Opfer niemals<br />
einfach ist. Es darf keine grundsätzliche Verwischung der Grenze zwischen Tätern und<br />
Opfern im „Dritten Reich“ geben, dennoch ist immer zu bedenken, dass eine zu grobe<br />
Einteilung Feinheiten und Unterschiede vernachlässigt. Wie Levi verschiedene Opfergruppen<br />
beleuchtet hat, soll dies bei den für diese Arbeit relevanten Tätergruppen geschehen.<br />
45 Vgl.: Levi 1990, S. 33-68.<br />
46 Ebenda, S. 39.<br />
19
Täterorte<br />
Nach Goldhagens Definition würden die Mitarbeiter der Villa ten Hompel, die als Angestellte<br />
der Ordnungspolizei am Schreibtisch den Einsatz der „Judentransporte“ organisierten, unter<br />
den Begriff Täter fallen. Auch die Mitglieder der Führungsspitze der NSDAP, die sich am<br />
<strong>Obersalzberg</strong> niedergelassen hatten, allen voran Hitler, sind als Täter zu bezeichnen.<br />
Schwieriger wird eine Einteilung der so genannten Junker der Ordensburg Vogelsang. Diese<br />
Männer zwischen 23 und 29 Jahren meldeten sich freiwillig für die Ausbildung auf den<br />
Ordensburgen. Sie wurden auf ihre kommenden Führungsaufgaben in der Partei vorbereitet.<br />
Ihre gezielte Ausbildung lief in vielen Fällen darauf hinaus, dass sie zu einem späteren<br />
Zeitpunkt zu Tätern in Goldhagens Sinne geworden wären. Handlungen der Ordensjunker als<br />
Täter in Bezug auf den Holocaust sind jedoch nicht generell nachweisbar und daher ist eine<br />
pauschale Bezeichnung als Täter nicht angebracht. Hierzu wäre eine Unterscheidung in<br />
unterschiedliche Tätertypen vorzunehmen, wie sie Gerhard Paul und Klaus-Michael<br />
Mallmann vorstellen. Die Ordensjunker würden dann entweder zu den „band wagon Nazis“<br />
zählen, die ihre Gelegenheit nutzten, um Karriere zu machen. Andere waren sicher auch<br />
„Weltanschauungstäter“, welche ihr Handeln auf die rassische Neuordnung Europas<br />
ausrichteten. 47 Eine genauere Aufschlüsselung in verschiedene Tätertypen wird an dieser<br />
Stelle nicht vorgenommen, da sich diese Arbeit auf die Stätten der Täter und nicht die<br />
Personen konzentriert. Auch wenn eine Einordnung der Ordensjunker als Täter schwierig<br />
erscheint, ist die Ordensburg eindeutig kein Ort der Opfer und auch Frank Pütz spricht im<br />
Hinblick auf ein Konzept zur didaktischen Erschließung der Burg von einem „Ort der<br />
Täter“ 48 .<br />
In Bezug auf die in Kapitel 4 aufgeführten Täterorte ist darauf hinzuweisen, dass nicht alle<br />
Personen bzw. Täter an diesen Orten gleich schwer belastet sind. Letztendlich ist immer nur<br />
über eine Biografie der einzelnen Person herauszufinden, inwieweit sie schuldig geworden ist.<br />
3.1.2 Begrifflichkeiten in dieser Arbeit<br />
Der Begriff „Täterort“ wurde in der Literatur in Anlehnung an und zur Unterscheidung vom<br />
Begriff „Opferort“ gewählt, aber gerade diese Differenzierung ist problematisch. Es gibt Orte,<br />
die eindeutig der Täterseite zuzurechnen sind, wie beispielsweise das Haus der Wannsee-<br />
Konferenz, doch der Umkehrschluss bereitet umso mehr Schwierigkeiten. Jedes<br />
Konzentrationslager ist sowohl ein Ort der Opfer als auch der Täter. Zwar steht an diesen<br />
Orten die Perspektive der Opfer im Vordergrund, dennoch ist ein Bezug zu den Tätern<br />
vorhanden. Auch Volker Dahm weist auf diese Problematik hin: „Diese komplementären<br />
47 Vgl.: Paul; Mallmann 2004.<br />
48 Pütz 2003, S. 34.<br />
20
Täterorte<br />
Kategorien [Opferort und Täterort; D.R.] sind nicht unproblematisch, weil es zwar einen<br />
Täterort ohne Opfer, nicht aber Opferorte ohne Täter geben kann.“ 49 Komplizierter wird es<br />
zudem, wenn es sich um Orte mit doppelter Verfolgungsgeschichte in der ehemaligen DDR<br />
handelt. 50 So wurden beispielsweise aus ehemaligen Opfern des Nationalsozialismus neue<br />
Täter der DDR; aus einem KZ wie Buchenwald wurde das „Sowjetische Speziallager 2“.<br />
Wem soll man an solchen Orten gedenken? Dahm scheint es wichtig, dass an Täterorten nicht<br />
der Platz für eine Gedenkstätte ist. Diese sollen an Opferorten eingerichtet werden, denn diese<br />
Orte sind mit dem Leiden und Sterben von Menschen verbunden. Sie haben dadurch und<br />
durch ihre moralische Funktion eine gewisse Nähe zu Einrichtungen wie Kirchen, Moscheen,<br />
Synagogen oder Friedhöfen. Der konkrete Opferbezug fehlt an Täterorten und sie eignen sich<br />
damit auch nicht zum Trauern und Gedenken. „Der Täterort weckt durch die ihm eigene<br />
historische Authentizität die menschliche Neugier, den Wissensdrang und gibt der<br />
verstandesmäßigen Annäherung an das historische Geschehen weit mehr Freiheit als der<br />
Opferort.“ 51 Dieses Potenzial sollte genutzt werden, um mit angemessenen Methoden die<br />
Menschen heute über die Vergangenheit aufzuklären.<br />
Ein weiteres Problem bei der Vielfalt der Erinnerungsorte zeigt sich in der<br />
Auseinandersetzung zwischen Heidi Behrens und Petra Haustein mit Jörg Skriebeleit, die im<br />
GedenkstättenRundbrief ausgetragen wurde. So äußert Skriebeleit die Befürchtung, dass<br />
durch die in den 1990er Jahren entstandenen Gedenkstätten, die ihren Fokus auf die Täter<br />
legen, das Gedenken der Opfer generell zur Darstellung der Täter verlagert wird. 52 Behrens<br />
und Haustein sehen in der neuen Vielfalt eher eine Chance. 53 Auch Peter Reichel plädiert für<br />
die Täterorte. Für ihn ist es wichtig, dass sie in die Gedenkstättenlandschaft aufgenommen<br />
werden, da nur so die Faszination des NS-Regimes verdeutlicht werden kann. 54 Gerade wenn<br />
die Zeitzeugen nicht mehr da sind, wird es für die Nachkommen nicht verständlich sein,<br />
warum so viele Menschen das NS-Regime unterstützten. Das Doppelgesicht von Faszination<br />
und Gewalt – „der schöne Schein des Dritten Reiches“ 55 – kann an Täterorten gut dargestellt<br />
werden. Zudem zeigt sich an den Debatten über das Erbe des Nationalsozialismus und<br />
insbesondere über die Täterorte, dass die Diskussion um das kulturelle Gedächtnis der<br />
Deutschen nicht abgeschlossen ist. Noch immer sind wir auf der Suche nach der<br />
angemessenen Art des Gedenkens, müssen uns über Begrifflichkeiten und Inhalte von<br />
49 Dahm 1999a, S. 23.<br />
50 Vgl.: Behrens; Haustein 2002, S. 6.<br />
51 Dahm 1999a, S. 24.<br />
52 Vgl.: Skriebeleit 2001, S. 3.<br />
53 Vgl.: Behrens; Haustein 2002, S. 8.<br />
54 Vgl.: Reichel 1999, S. 34.<br />
55 So der Titel von Reichel 1991.<br />
21
Täterorte<br />
Erinnerungskultur einig werden. Reichel macht auch darauf aufmerksam, dass der Nutzen von<br />
Gedächtnisorten meist überschätzt wird. Im Zuge der Diskussion um die Errichtung des<br />
Holocaust-Mahnmals in Berlin wurde von Kritikern der Sinn dieser Gedenkstätte<br />
angezweifelt. Reichel sieht vor allem in Großveranstaltungen zur Erinnerung und in<br />
offiziellen Gedenktagen eine falsche Solidarisierung mit den Opfern und gibt Folgendes zu<br />
bedenken: „Unserem Land und unserer Geschichte wäre eine genaue Topographie der<br />
Tatorte und der Täter angemessener als eine Vereinnahmung der Opfer [...].“ 56<br />
Trotz all der aufgezeigten Probleme mit den Begriffen „Täter“ und „Täterort“ wird in dieser<br />
Arbeit der Terminus „Täterort“ weiter verwendet. Es wurde deutlich gemacht, dass der<br />
Begriff Defizite aufweist, aber zurzeit kein anderer weit verbreiteter Begriff zur Verfügung<br />
steht. Ein allgemeiner Ausdruck wie „durch den Nationalsozialismus historisch vorbelasteter<br />
Ort“ ist zu unpräzise, da nicht nur die Historizität eines Ortes oder der reine Bezug zum<br />
Nationalsozialismus ihn automatisch zum Erinnerungs- und Lernort erheben sollte –<br />
Tendenzen die durchaus zu beobachten sind. 57 Auch der Begriff „Tatort“ kann nicht<br />
verwendet werden, da nicht an allen Orten verbrecherische Taten geplant oder gar ausgeführt<br />
wurden. Wenn sich mit baulichen Hinterlassenschaften aus der NS-Zeit beschäftigt wird, ist<br />
Täterort die Begrifflichkeit, unter dem die Diskussion geführt wird. Daher wird auch im<br />
Folgenden in dieser Arbeit von Täterorten gesprochen.<br />
3.2 Kategorisierung der Täterorte<br />
Im Folgenden sollen nun Orte benannt werden, die unter den Begriff Täterort nach obiger<br />
Definition fallen. Dabei werden zwei Kategorien unterschieden: Bauwerke des<br />
Nationalsozialismus und Orte von hohem politischen Stellenwert. Viele Orte fallen in beide<br />
Kategorien, dennoch ist eine solche Unterscheidung für einen groben Überblick sinnvoll.<br />
3.2.1 Bauwerke des Nationalsozialismus<br />
Unter Täterorte können zunächst Orte und Bauwerke gefasst werden, die in der Zeit des<br />
Nationalsozialismus gebaut wurden und die im „Dritten Reich“ als bauliche Repräsentanten<br />
des NS-Regimes gedacht waren. Schon der Versuch von Helmut Weihsmann, eine lückenlose<br />
Bestandsaufnahme aller geplanten und durchgeführten NS-Baumaßnahmen, musste auf Grund<br />
des Umfangs scheitern. 58 Sein Werk „Bauen unterm Hakenkreuz“ zeigt aber auf, dass die<br />
Bautätigkeit der Nationalsozialisten nicht nur auf große Monumentalbauten beschränkt war.<br />
56 Reichel 1997, S. 75.<br />
57 Vgl.: Skriebeleit 2001, S. 7.<br />
58 Vgl.: Weihsmann 1998, S. 11.<br />
22
Täterorte<br />
So gibt es in fast jeder Stadt bauliche „Überreste“ – oft noch in Nutzung – aus der Zeit des<br />
Nationalsozialismus.<br />
In Bezug auf die Bauten aus der Zeit des Nationalsozialismus wird oftmals von „Nazi-<br />
Architektur“ oder „faschistischer Architektur“ gesprochen. Dies impliziert, dass es im<br />
„Dritten Reich“ einen einheitlichen Stil in der Architektursprache gegeben hätte. Dies ist aber<br />
nicht der Fall, im Gegenteil: Die Architekten im „Dritten Reich“ nutzten eine Vielzahl von<br />
Stilen. Weihsmann unterscheidet sechs verschiedene Tendenzen der NS-Architektur, die er<br />
verschiedenen Bauaufgaben zuordnet: „NS-Klassizismus“ für Propaganda-, Staats- und<br />
Parteibauten, „Heimatschutzstil“ für Siedlungsbauten und Ordensburgen, „moderate<br />
Moderne“ für Wohn- und Verwaltungsbau, „pathetischer Funktionalismus“ für Kasernen,<br />
Heeresbauten und Industrieverwaltungsbauten, „versachlichter Funktionalismus“ für<br />
Sportbauten und Stadien sowie „Neue Sachlichkeit“ für Technik-, Industrie- und<br />
Fabrikbauten. Die wenigsten dieser Stilrichtungen sind originär nationalsozialistisch; sie<br />
wurden jedoch für die NS-Ideologie vereinnahmt und entsprechend verwendet. 59 Auch<br />
Winfried Nerdinger, einer der Experten für die Architektur des „Dritten Reiches“, erklärt,<br />
dass die „[...] zusammengebündelten Elemente als einzelne nicht faschistisch sind,<br />
faschistisch ist die gesamte gesellschaftliche Anordnung.“ 60<br />
Wenn von „Nazi-Architektur“ oder „Nazi-Stil“ gesprochen wird, sind damit meistens die<br />
Monumentalbauten gemeint, die heute noch Anstoß erregen – eben solche Orte, die auch als<br />
Täterorte klassifiziert werden können. Der Großteil dieser Bauten waren Staats- und<br />
Parteibauten und sind daher in Orten wie Berlin, München oder Nürnberg ausgeführt worden.<br />
In der Ausstellung „Bauen im Nationalsozialismus. Bayern 1933-1945“ konnte jedoch<br />
nachgewiesen werden, dass auch in kleineren Gemeinden NS-Zentren geplant waren, selbst<br />
wenn diese meist nicht umgesetzt wurden. 61 Die Bauten sind erkennbar durch bestimmte<br />
Stilelemente:<br />
„Sie sollten wirken durch überdimensionale Größe, durch den Gestus ihrer<br />
Architektur, durch Symmetrien, durch schematische Reihung, geringe Gliederung,<br />
starke Betonung von Dach und Sockel, durch massiv wirkende Baumaterialien,<br />
insbesondere Naturstein, durch an den Bauten angebrachte große nazistische<br />
Symbole wie Hakenkreuze, Adler und Plastiken.“ 62<br />
59 Vgl.: Weihsmann 1998, S. 13.<br />
60 Nerdinger 1993, S. 12.<br />
61 Vgl.: Ebenda, S. 14.<br />
62 Rostock; Zadniček 1992, S. 31.<br />
23
Täterorte<br />
Sie wurden geplant, um für die Ewigkeit zu wirken. Dieser „Ruinenwert“ wurde von Hitler<br />
persönlich auf seiner Rede anlässlich der Grundsteinlegung der Nürnberger Kongresshalle mit<br />
folgenden Worten verkündet:<br />
„Wenn aber die Bewegung jemals schweigen sollte, dann wird noch nach<br />
Jahrtausenden dieser Zeuge hier reden. Inmitten eines heiligen Hains uralter<br />
Eichen werden dann die Menschen diese ersten Riesen unter den Bauten des<br />
Dritten Reiches in ehrfürchtigem Staunen bewundern.“ 63<br />
Laut Albert Speer hatte Hitler schon immer die Idee, dass Bauten ein Zeichen von einstiger<br />
Macht sein sollten. Speer entwickelte nach eigenen Angaben aus diesen Aussagen die<br />
„Theorie vom Ruinenwert“, die auch praktische Vorgaben zu Materialien und Statik<br />
enthielt. 64<br />
Bei Kenntnis der obigen Aussage Hitlers und der Ruinenwerttheorie stellt sich beim Anblick<br />
der baulichen Überreste die Frage: Hat sich Hitlers Ruinenwert erfüllt, wenn heute NS-Bauten<br />
wie das Kraft-durch-Freude-Bad in Prora auf Rügen unter Denkmalschutz gestellt werden?<br />
Hier ist jedoch einzuwenden, dass diese Ruinen heute nicht unter Denkmalschutz gestellt<br />
werden, um zur Bewunderung des NS-Systems anzuregen, sondern im Gegenteil als Mahnmal<br />
für ein totalitäres und verbrecherisches Regime stehen, dessen Großmachtsfantasien sich auch<br />
in der Architektur niedergeschlagen haben. Gerade diese repräsentativen Orte sind als<br />
potenzielle Gedenkorte interessant und vielleicht besser geeignet, als die Einrichtung von<br />
Erinnerungsstätten an beliebiger Stelle. Sie wurden zur Selbstdarstellung des<br />
Nationalsozialismus gebaut und demonstrieren heute durch ihre Größe auch den totalitären<br />
Anspruch des Regimes. Jürgen Rostock und Franz Zadniček weisen zudem darauf hin, dass<br />
„[...] die NS-Bauten nicht automatisch ewig weiterwirkende Sender dieser Botschaften [der<br />
NS-Ideologie; D.R.] [sind], denn das setzt eine gesellschaftliche Übereinkunft über die<br />
Bedeutung architektonischer Ausdrucksmittel voraus.“ 65 Von der gleichen These geht auch<br />
Hartmut Frank in der Einführung zum Sammelband „Faschistische Architekturen“ aus. Er<br />
nennt es eine Legende, dass es faschistische Architektur oder gar einen Nazi-Stil gäbe. Zu<br />
dieser Legendenbildung habe vor allem die heutige Sichtweise auf die zwölf Jahre Nazi-<br />
Diktatur beigetragen, die durch das Erschrecken über die Gräueltaten geprägt und damit<br />
notwendiger Weise antifaschistisch sei. 66<br />
Trotzdem ist eine gewisse Wirkung der NS-Bauten vorhanden. Hans-Ernst Mittig hat sich in<br />
seinem Aufsatz „NS-Architektur für uns“ die Frage nach der Wirkung der Bauten und dem<br />
heutigen Umgang mit dieser Architektur gestellt. Er glaubt, dass es unverantwortlich wäre,<br />
63 Zit. nach: Weihsmann 1993, S. 42.<br />
64 Vgl.: Speer 1969, S. 68f.<br />
65 Rostock; Zadniček 1992, S. 36.<br />
66 Vgl.: Frank 1985, S. 8.<br />
24
Täterorte<br />
wenn eine Fortwirkung der erstrebten Wirkung der NS-Architektur von vorneherein für<br />
nichtig erklärt würde. 67 Er unterscheidet verschiedene Wirkungen: Die Spontanwirkung der<br />
Architektur beschreibt die Eindrücke, die Bauten unmittelbar beim Rezipienten hervorrufen.<br />
Diese Wirkung wird bei NS-Bauten meist durch ihre Größe hervorgerufen, die bewusst<br />
eingesetzt wurde, um den einzelnen Betrachter einzuschüchtern. 68 Mittig beschreibt daneben<br />
auch die Werbewirkung von NS-Bauten. Dies meint, dass Anerkennung für die NS-Bauten<br />
sich nicht nur auf diese selbst erstrecken, sondern sich automatisch auf das ganze NS-System<br />
beziehen. Eine Wirkung, die noch heute durch Weiternutzung der Bauten und durch einen<br />
unvorsichtigen Umgang mit ihnen funktioniert. Dies ist für Mittig die eigentliche Gefahr:<br />
„Die Bauten allein, und wirkten sie noch so faszinierend, können Unvorbereiteten nicht<br />
faschistische Lehrsätze übermitteln, sondern allenfalls Neigungen dazu bestärken,<br />
Stimmungen schaffen, die für ausdrückliche Agitation heute empfänglich machen.“ 69 Daher<br />
sollte man nicht die Bauten bekämpfen, sondern die erneuerte Werbewirkung. Mittig stellt<br />
verschiedene Maßnahmen vor, wie dies geschehen kann. Eine eindeutige Lösung wird nicht<br />
vorgestellt, aber darauf eingegangen, wie die Nationalsozialisten ihre Architektur selbst gerne<br />
sahen. So sollten die Bauten an die Natur anknüpfen und die Ruinenwerttheorie wird<br />
ebenfalls erwähnt. Wichtig schien den Erbauern auch, Dauerhaftigkeit zu suggerieren, obwohl<br />
sich heute schon zeigt, dass viele Gebäude diesem Anspruch nicht standhalten. Mittig schlägt<br />
daher vor, auch bei zukünftigen Bauten darauf zu achten, dass diese als „Wegwerf-<br />
Architektur“ – also durch ihre kurze Lebensdauer – nicht die angestrebte Wirkung der NS-<br />
Bauten unterstreichen: „Eine Gegenstrategie darf sich deshalb heute nicht auf den Umgang<br />
mit erhaltender NS-Architektur begrenzen. Am wirksamsten wäre es, überall die Defizite zu<br />
bekämpfen, von denen die falschen Versprechungen der NS-Architektur lebten und leben.“ 70<br />
Heutzutage fällt der Umgang mit vielen Monumentalbauten des Nationalsozialismus nicht nur<br />
schwer, weil sie für die NS-Zeit stehen; es sind zudem Bauwerke, die Teil der Propaganda des<br />
„Dritten Reiches“ waren und ihren praktischen Nutzen verloren haben. Riesige<br />
Aufmarschplätze oder Kriegerdenkmäler sind heute nicht mehr in ihrem originären Zweck<br />
nutzbar. Daher gilt gerade bei den Bauwerken des Nationalsozialismus: „Die Bauten waren<br />
die Hülse. Die Vorgänge, die in ihnen stattfanden, gehörten mehr als bei jeder anderen<br />
Architektur zur ihrer Vervollständigung.“ 71<br />
67 Vgl.: Mittig 1992, S. 247.<br />
68 Vgl.: Ebenda, S. 248f.<br />
69 Ebenda, S. 250.<br />
70 Ebenda, S. 262.<br />
71 Pehnt 1979, S. 103.<br />
25
Täterorte<br />
3.2.2 Orte von hohem politischen Stellenwert<br />
Täterorte sind nicht nur Bauwerke, die während der NS-Zeit zu repräsentativen Zwecken<br />
gebaut wurden. Es können außerdem Orte sein, an denen während der NS-Zeit<br />
Entscheidungen von hohem politischen Stellenwert getroffen wurden. Dazu zählen die Orte,<br />
an denen Hitler und die politischen Eliten regiert haben und solche, an denen<br />
richtungsweisende Entscheidungen getroffen wurden. Dies sind vor allem Orte, an denen<br />
Regierungsorgane und wichtige Ämter ihren Sitz hatten. Dazu zählen beispielsweise das Haus<br />
der Wannsee-Konferenz, der Berghof am <strong>Obersalzberg</strong>, aber auch weniger bekannte Orte, wie<br />
die Villa ten Hompel in Münster, die von 1940 bis 1945 Sitz der regionalen Befehlshaber der<br />
Ordnungspolizei war. Gerade im Bereich der regionalen und lokalen Organe, die durch die<br />
vielschichtige Zusammenarbeit der einzelnen Organisationen am Holocaust beteiligt waren,<br />
ist die Fülle der Täterorte kaum überschaubar. Meist waren diese Stellen an den gleichen<br />
Orten untergebracht, wie schon in der Weimarer Republik und später wieder in der<br />
Bundesrepublik. In den wenigsten Fällen liegen dazu detaillierte Studien vor. Ein besonderer<br />
Fall ist das Wiener Rothschild-Palais. Hier ging die Enteignung der jüdischen Familie<br />
Rothschild im Zuge der „Arisierung“ einher mit der Etablierung der Zentralstelle für jüdische<br />
Auswanderung von Adolf Eichmann und des Sicherheitsdienstes im gleichen Gebäude. Das<br />
Palais wurde in den 1950er Jahren von der Arbeiterkammer Wien gekauft, die im Jahre 2005<br />
der Öffentlichkeit eine Studie über die Geschichte des Palais vorlegte. 72<br />
3.3 Übersicht über die Täterorte<br />
Wie zuvor dargelegt, gibt es sehr viele Täterorte, die sich in zwei Kategorien, Bauwerke des<br />
Nationalsozialismus und Orte von hohem politischen Stellenwert, unterscheiden lassen.<br />
Porombka und Schmundt haben in ihrem Essayband folgende Orte nationalsozialistischer<br />
Selbstdarstellung zusammen getragen: der Führerbunker in Berlin, der Berghof am<br />
<strong>Obersalzberg</strong>, das Kraft-durch-Freude-Bad in Prora, das Marine-Ehrenmal in Laboe,<br />
Carinhall in der Schorfheide, das Reichsparteitagsgelände in Nürnberg, das Olympiastadion in<br />
Berlin, das Musterdorf Alt-Rehse, die Heeresversuchsanstalt in Peenemünde und die<br />
Reichsautobahn. 73 Bis auf das Marine-Ehrenmal wurden alle Gebäude im „Dritten Reich“<br />
neu- oder umgebaut. Außer Führerbunker und Berghof sind alle Orte wenigstens teilweise<br />
erhalten, wenn auch nicht immer gekennzeichnet. Auf dem Symposium „Zum Umgang mit<br />
Gedenkorten von nationaler Bedeutung in der Bundesrepublik“ 1998 standen die gleichen<br />
Orte im Mittelpunkt (Nürnberg, <strong>Obersalzberg</strong>, Prora, Peenemünde). Zudem wurde noch auf<br />
72 Die Studie ist im Inhaltsverzeichnis dieser Arbeit unter Anderl 2005 zu finden.<br />
73 Vgl.: Porombka; Schmundt 2005.<br />
26
Täterorte<br />
den früheren Militärstandort Wünsdorf und das Haus der Wannsee-Konferenz mit einem<br />
Vortrag näher eingegangen. 74 Reichel nennt in seinem Werk „Politik mit der Erinnerung“<br />
noch die Wolfsschanze als weiteren prominenten Schauplatz der Geschichte. 75 Es ist auffällig,<br />
dass bei der Beschäftigung mit den Täterorten immer wieder dieselben Orte genannt werden.<br />
Daher soll im Folgenden für dieses Phänomen eine Erklärung gefunden werden.<br />
Auch bei bekannteren Bauwerken gerät die Vergangenheit erst in den Blick, wenn die<br />
Öffentlichkeit durch eine von engagierten Bürgern angestoßene Debatte Interesse für sie<br />
zeigt. Ein Beispiel dafür ist das Gestapo-Gelände oder auch der in den neunziger Jahren<br />
bevorstehende Verkauf und Abriss der Villa ten Hompel. Im Falle des Gestapo-Geländes, auf<br />
dem inzwischen die Ausstellung „Topographie des Terrors“ zu finden ist, wurden die<br />
Gebäudereste dieses Schreibtischtäterortes nach 1945 gesprengt. 76 Im „Dritten Reich“ befand<br />
sich auf dem ehemaligen Prinz-Albrecht-Gelände das geheime Staatspolizeiamt, der Sitz des<br />
Reichsführer-SS mit seinem persönlichen Stab und weitere SS-Führungsämter sowie der<br />
Sicherheitsdienst (SD) der SS. Die Fläche lag nach dem Krieg brach und war durch ihre<br />
geografische Lage direkt an der innerdeutschen Grenze für eine längerfristige Weiternutzung<br />
oder Bebauung nicht geeignet. Zeitweilig befand sich hier ein Autodrom, wo Jugendliche<br />
ohne Führerschein Autofahren konnten. Ende der siebziger Jahre wurde man auf das Gelände<br />
wieder aufmerksam und 1981 wurde ein erstes Hinweisschild errichtet. 1982 gründete sich<br />
dann aus einer Bürgerinitiative der Verein „Aktives Museum Faschismus und Widerstand in<br />
Berlin e.V.“, der sich vorrangig um den zukünftigen Umgang mit dem Gestapo-Gelände<br />
beschäftigte und dafür Vorschläge erarbeitete. Auch die Öffentlichkeit wurde auf das Gelände<br />
aufmerksam und eine Fachkommission wurde eingesetzt, die Vorschläge zum Umgang mit<br />
dem Gelände erarbeiten sollte. Ein Wettbewerb zur Errichtung eines Denkmals wurde<br />
ausgeschrieben, welches die historische Dimension des Platzes mit praktischen<br />
Anforderungen verbinden sollte. Doch die folgenden Diskussionen verhinderten die<br />
Umsetzung des Siegerentwurfes. In den Jahren 1986 und 1987 wurden Keller- und<br />
Fundamentreste freigelegt und eine kleinere Ausstellung erarbeitet. Obwohl man vorher schon<br />
übereingekommen war, dass das Gelände kein geeigneter Ort für ein Opfer-Mahnmal sei,<br />
wurde 1988 das Gestapo-Gelände als Ort für das Holocaust-Mahnmal ins Gespräch gebracht.<br />
Dies war ein Rückschritt in der Diskussion um das Gelände. Rund ein Jahr beherrschte dieses<br />
Thema die Debatte. 1990 legte die Fachkommission ihren Abschlussbericht vor und empfahl<br />
die Errichtung einer zentralen Ausstellungs-, Dokumentations- und Gedenkstätte. Die<br />
74 Vgl.: Asmuss; Hinz 1999.<br />
75 Vgl.: Reichel 1995, S. 9.<br />
76 Vgl. hierzu und im Folgenden: Endlich 1990, Lutz 1998 und Young 1997, S. 127-139.<br />
27
Täterorte<br />
Einrichtung der Gedenkstätte wurde jedoch zunächst wieder verzögert, da der Berliner Senat<br />
dem Projekt zwar zustimmte, es jedoch an die Bundesregierung weiterreichte. Erst im Jahre<br />
1995 wurde die selbständige öffentlich-rechtliche Stiftung „Topographie des Terrors –<br />
Internationales Dokumentations- und Begegnungszentrum Berlin“ gegründet. Zudem wurde<br />
1993 ein Architektenwettbewerb für das Gebäude der bis dahin im Freien befindlichen<br />
Ausstellung ausgeschrieben. Der Siegerentwurf wurde jedoch aus finanziellen Gründen nie<br />
realisiert und 2004 endgültig verworfen.<br />
Der kurze Abriss der Entwicklung eines Täterortes zu einer Gedenkstätte soll beispielhaft<br />
verdeutlichen, wie viel Zeit, Einsatz und Engagement von verschiedensten Seiten nötig ist,<br />
um aus einem historisch bedeutsamen Ort, der nur Wenigen bekannt ist, einen Ort zu machen,<br />
an dem Viele etwas über die Vergangenheit lernen können. Dass dieser Einsatz nicht an allen<br />
Täterorten zu leisten ist, geschweige denn die finanziellen Mittel aufzubringen sind, macht<br />
eine Beschränkung auf die bedeutsamen Orte nötig. Zudem gilt auch für die Täterorte, was<br />
Volker Dahm über die Einrichtungen von Gedenkstätten an Opferorten gesagt hat: „Nicht<br />
jeder Stein einer möglichen Haft- oder Mordstätte rechtfertigt eine Gedenkstätte.“ 77<br />
Übertreibungen führen zum Abstumpfen bis hin zur Abwehrhaltung, was sicher der Fall wäre,<br />
wenn jeder Opfer- als auch Täterort im Spiegel einer Gedenk- oder Dokumentationsstätte<br />
wieder auferstehen würde. Niemand kann und will sich unentwegt mit dem Leid der<br />
Vergangenheit auseinandersetzen. Trotzdem ist ein angemessenes Gedenken sinnvoll und das<br />
Verdrängen der Vergangenheit an vielen Orten schon so weit fortgeschritten, dass manche<br />
Tatsachen wohl für immer vergessen sein werden. Die Einrichtung einiger<br />
Dokumentationsstätten an Täterorten ist dabei schon ein Fortschritt. „Aber der Ausbau der<br />
Tatorte zu Gedächtnis- und Informationsstätten läßt sich auch als Alibi für mannigfache<br />
Unterlassungen nutzen“ 78 , bemerkte Mittig schon 1988, ein Jahr nachdem die erste<br />
Ausstellung „Topographie des Terrors“ eröffnet wurde. Daher gilt, dass nicht völlig in<br />
Vergessenheit geraten darf, was am jeweiligen Ort geschehen ist, auch wenn dieses Wissen<br />
nicht an alle vermittelt werden kann. In dieser Arbeit werden neben dem <strong>Obersalzberg</strong> zwei<br />
weniger bekannte Täterorte betrachtet, deren Geschichte allerdings inzwischen relativ gut<br />
dokumentiert ist. Um weitere unbekannte Täterorte nicht gänzlich in Vergessenheit geraten zu<br />
lassen, liefern zum einen Werke wie Weihsmanns „Bauen unterm Hakenkreuz“ oder<br />
Nerdingers „Bauen im Nationalsozialismus“ gute Überblicke über die Architektur de<br />
Nationalsozialismus. Auch hier sind viele Täterorte zu finden. Zum anderen gibt es<br />
inzwischen für große Städte wie Berlin Stadtführer, die sich auf Gedenkorte spezialisiert<br />
77 Dahm 1999a, S. 24.<br />
78 Mittig 1988, S. 26.<br />
28
Täterorte<br />
haben. Beispielhaft sei hier das Buch „Orte erinnern“ 79 von Johannes Heesch und Ulrike<br />
Braun genannt.<br />
3.4 Umgang mit den Täterorten in der BRD<br />
Der Umgang mit den Täterorten in der Bundesrepublik ist ähnlich wie die<br />
Vergangenheitsbewältigung besonders in den ersten Jahren nach dem Krieg durch<br />
Verdrängung geprägt. Nerdinger spricht von einem parallelen Vorgang: „Zur nahezu<br />
spurlosen Integration der Täter in die neue Gesellschaftsordnung [...] gehört als Gegenstück<br />
die Neutralisierung und stillschweigende Integration der ‚Tat-Orte’.“ 80 Obwohl teilweise<br />
angedacht war, zerstörte Bauten als Mahnmale stehen zu lassen, gibt es nur wenige Orte, an<br />
denen dies wirklich geschehen ist. Ruinen sind wichtige Erinnerungen an die Vergangenheit<br />
und damit können sie auch provozierend wirken. Dennoch sind sie in keinem Fall einfach<br />
durch etwas Neues zu ersetzen. 81 Ein Beispiel dafür ist die Nikolai-Kirche in Hamburg.<br />
Obwohl die Kirche nicht stärker zerstört war als andere Kirchen, sollte sie zunächst wieder<br />
aufgebaut werden. Aufgrund der Lage an der neu gebauten Ost-West-Straße (heute Willy-<br />
Brandt-Straße) und des fehlenden Geldes der Gemeinde, wurde der Wiederaufbau nicht<br />
verwirklicht. Verschiedene Pläne zur Neunutzung scheiterten, die Ruine steht jedoch bis heute<br />
als Symbol für Krieg und Zerstörung im 20. Jahrhundert. 82 Auch in der Alten Pinakothek in<br />
München wurde versucht, die Zeit des Krieges und die dadurch entstandenen Zerstörungen<br />
sinnvoll in die Renovierung zu integrieren. 83 Auch wenn einige Kritiker diese „offene<br />
Wunde“ in der Fassade nicht begrüßten, kann man hierin eine Alternative zu Abbruch oder<br />
Beseitigung aller Spuren sehen. Dass durch einen vollständigen Wiederaufbau in gewisser<br />
Weise auch die Zeit des Krieges und die damit verbundenen Leiden aller Seiten verdrängt<br />
werden, ist ein Argument, welches auch in den Kommentaren zum Wiederaufbau der<br />
Frauenkirche in Dresden fiel. In Bezug auf NS-Bauten ist jedoch darauf hinzuweisen, dass<br />
diese Bauten mit Hinblick auf die Ruinenwerttheorie nicht so erhalten bleiben sollten, dass sie<br />
in einem Atemzug mit Ruinen wie dem Colosseum in Rom oder ähnlichen Gebäuden genannt<br />
werden. 84 Das würde sie auf eine Ebene heben, welche die Nationalsozialisten angestrebt<br />
hätten und die ihnen auch in baulicher und architektonischer Hinsicht nicht gebührt.<br />
Nach dem Krieg wurden die meisten Gebäude abgerissen, gerade wenn sie sowieso schon<br />
zerstört waren. An anderen Orten wurden die Insignien des Nationalsozialismus wie<br />
79 Heesch; Braun 2003.<br />
80 Nerdinger 1992, S. 52.<br />
81 Vgl.: Pehnt 1991, S. 131.<br />
82 Vgl.: Reichel 1995, S. 77f.<br />
83 Vgl.: Ebenda, S. 70.<br />
84 Vgl.: Mittig 1992, S. 259.<br />
29
Täterorte<br />
Hakenkreuze entfernt und die Häuser in neuer Funktion weitergenutzt. Dies scheint in vielen<br />
Fällen auch legitim, schließlich war ein Großteil der Bautätigkeit im „Dritten Reich“ keine<br />
Monumentalarchitektur und der Wohnraum war in den zerstörten Städten knapp. Allerdings<br />
sollte auch bei den schnell umgenutzten Verkehrs-, Industrie- und Verwaltungsbauten nicht in<br />
Vergessenheit geraten, dass gerade diese einen ganz spezifischen Sinn in der NS-Geschichte<br />
hatten. 85 Doch nicht nur die Menschen der Nachkriegszeit waren in den ersten Jahren nach<br />
1945 zunächst einmal an einem Dach über dem Kopf interessiert. Auch bei den Alliierten<br />
standen praktische Gründe im Vordergrund; so nutzten die Briten Teile des Olympiastadions<br />
und die Amerikaner den Flughafen Tempelhof. 86 Nachdem die Alliierten die NS-Bauten<br />
wieder den Deutschen überließen, zogen dort meist politische und militärische Einrichtungen<br />
ein.<br />
Generell können drei Arten des Umgangs mit Gebäuden des Nationalsozialismus konstatiert<br />
werden: Abriss oder Sprengung als demonstrative Geste der Sieger oder spätere<br />
Verlegenheitslösung der Besiegten, die Weiternutzung nach einer Fassadensäuberung oder<br />
der vereinzelte Wiederaufbau des NS-Bauten. 87 Der Normalfall war eine Weiternutzung der<br />
Bauten ohne jeglichen Hinweis auf ihre Entstehungszeit und -umstände. 88<br />
„Daß diese Bauten wieder genutzt werden, auch mit zum Teil ähnlichen<br />
Funktionen, ist sicher verständlich, daß sich aber dieser Übergang ohne die<br />
geringste Diskussion um die in der Architektur überlieferte Geschichte vollzog,<br />
dokumentiert Haltung und Bewußtsein gegenüber jüngster Vergangenheit.“ 89<br />
Nerdinger moniert hier mit Recht, dass eine Chance verstrich, die nächste Generation für die<br />
Anfänge von Faschismus im ganz normalen Alltag zu sensibilisieren. Problematischer als bei<br />
Funktionsbauten war der Wiederaufbau von zerstörten Gebäudeteilen nach alten Plänen oder<br />
die Renovierung von reinen Repräsentationsbauten, die ohne Hinweise auf ihren historischen<br />
Zusammenhang weiter bestanden. Beispiele hierfür sind vor allem das<br />
Reichsparteitagsgelände, das eine jahrelange Diskussion um eine sinnvolle Nutzung auslöste.<br />
Erst als das Gelände 1973 unter Denkmalschutz gestellt wurde und damit die Stadt Nürnberg<br />
die Verpflichtung hatte, die Gelder für die Erhaltung aufzubringen, setzte ein Umdenken ein,<br />
dessen Resultat eine erste kleine Ausstellung in der Zeppelintribüne war. 90 Hier wurde<br />
versucht, die Öffentlichkeit zu informieren und dabei gleichzeitig den Täterort trivial zu<br />
nutzen. Auf dem Reichsparteitagsgelände fanden nach dem Krieg diverse<br />
85 Vgl.: Reichel 1995, S. 182.<br />
86 Vgl.: Ebenda, S. 181.<br />
87 Vgl.: Ebenda, S. 51.<br />
88 Vgl.: Nerdinger 1992, S. 52.<br />
89 Nerdinger 1988, S. 22-24.<br />
90 Vgl.: Museen der Stadt Nürnberg 1996, S. 50.<br />
30
Täterorte<br />
Freiluftveranstaltungen wie Rockkonzerte statt. Höhepunkte waren die Motorrad- und<br />
Autorennen um den Norisring, in dessen Mitte die Zeppelintribüne steht. 91 Jahrelang wurde<br />
die Vergangenheit des riesigen Geländes nicht beachtet und die Räumlichkeiten von der Stadt<br />
als Lager genutzt. „Die ‚Banalität des Bösen’ (Hanna Ahrendt) sollte durch triviale Nutzung<br />
wiedergespiegelt und die Gigantomanie der NS-Bauten somit durch Banalität historisch<br />
degradiert werden.“ 92 Aber dieses Konzept übersieht, dass die Monumentalität der Bauten<br />
auch heute noch wirkt. Eine triviale Nutzung und die Aufklärung über NS-Verbrechen<br />
widersprechen sich in ihrer Intention und damit wird die Aufklärung eventuell nicht wirksam.<br />
Auch im „Dritten Reich“ beeindruckten diese Bauten die Bevölkerung und schufen eine<br />
Fassade hinter der Verbrechen und Terror leicht vergessen werden konnten. Daher sollten die<br />
Bauten heute nicht ohne Informationen weiterbestehen, sondern als Orte gesehen werden, an<br />
denen die komplexen Zusammenhänge des „Dritten Reiches“ erläutert werden können.<br />
91 Vgl.: Museen der Stadt Nürnberg 1996, S. 36.<br />
92 Nerdinger 1992, S. 55.<br />
31
4. Fallbeispiele<br />
Fallbeispiele – <strong>Obersalzberg</strong><br />
Im folgenden Kapitel soll nun an drei verschiedenen Beispielen der Umgang mit Täterorten<br />
erläutert werden. Die drei Beispiele wurden ausgewählt, um unterschiedliche Umgangsweisen<br />
vorzustellen. Alle drei Orte definieren sich selbst als Täterorte. Der <strong>Obersalzberg</strong> ist der<br />
bekannteste der drei Orte. Die Villa ten Hompel hingegen ist den wenigsten ein Begriff und<br />
ist daher als Gegenbeispiel zum <strong>Obersalzberg</strong> für diese Untersuchung interessant. Die<br />
Ordensburg Vogelsang wurde ausgewählt, weil dort gerade intensiv über die zukünftige<br />
Nutzung debattiert wird. Durch den aktuellen Diskurs können Erkenntnisse zum Umgang mit<br />
Täterorten und den damit verbundenen Schwierigkeiten gewonnen werden, die für Kapitel 5<br />
von Nutzen sind. Zudem sind mit der militärischen Nutzung von nicht-deutscher Seite und<br />
einer lokal geprägten Diskussion sowohl Parallelen zum <strong>Obersalzberg</strong> als auch zur Villa ten<br />
Hompel vorhanden.<br />
4.1 <strong>Obersalzberg</strong><br />
Der <strong>Obersalzberg</strong> ist von den drei ausgewählten Fallbeispielen sicher der bekannteste<br />
Täterort. Zum einen, weil hier der Täter schlechthin, Adolf Hitler, nicht nur wohnte, sondern<br />
auch seinen zweiten Regierungssitz hatte; zum anderen wurde am <strong>Obersalzberg</strong> eine<br />
Verwendung für den Täterort gefunden, bei der sowohl eine Neunutzung in Form eines<br />
Wellnesshotels als auch die Einrichtung einer Dokumentationsstätte erfolgt ist. Die<br />
wechselvolle Geschichte des <strong>Obersalzberg</strong>s wird im Folgenden nachgezeichnet, um die<br />
Debatten über die heutige Nutzung besser nachvollziehen zu können und ein Bild von den<br />
Veränderungen vor Ort zwischen 1877 bis zur heutigen Zeit zu bekommen.<br />
4.1.1 Geschichte des <strong>Obersalzberg</strong>s – Vom Tourismus zum Führersperrgebiet<br />
Der <strong>Obersalzberg</strong> war ursprünglich ein bäuerliches Gebirgsdorf, in dem seit dem<br />
16. Jahrhundert Salz gefördert wurde. 93 Im 19. Jahrhundert kamen die ersten Touristen in den<br />
bayerischen Ort an der Grenze zu Österreich. Den Grundstein für den Tourismus legte<br />
Mauritia Mayer, Tochter eines Försters. Sie kaufte 1877 ein Haus auf dem <strong>Obersalzberg</strong> und<br />
eröffnete die Pension Moritz. Bald kamen viele Gäste zum <strong>Obersalzberg</strong>, darunter zahlreiche<br />
Prominente. Zu den Bekanntesten zählten Clara Schumann, Johannes Brahms, Prof. Carl von<br />
Linde sowie der Dichter Richard Voß, der Mauritia Mayer mit seinem Roman „Zwei<br />
Menschen“ ein Denkmal setzte. 94 Nach der Jahrhundertwende siedelten sich zudem immer<br />
93 Vgl.: Beierl 2004, S. 7.<br />
94 Vgl.: Schaffing; Baumann; Hoffmann 1985, S. 8.<br />
32
Fallbeispiele – <strong>Obersalzberg</strong><br />
mehr Vermögende auf dem <strong>Obersalzberg</strong> an, um in der warmen Jahreszeit die<br />
„Sommerfrische“ genießen zu können. So kamen der Flügelfabrikant Bechstein nach Bayern<br />
und ein norddeutscher Industrieller namens Winter ließ das Haus Wachenfeld bauen, welches<br />
später Hitlers Wohnsitz werden sollte. 95<br />
4.1.1.1 Hitler auf dem <strong>Obersalzberg</strong><br />
Hitler besuchte den <strong>Obersalzberg</strong> zum ersten Mal im Jahre 1920. Zu diesem Zeitpunkt hatte<br />
die Schwester von Mauritia Mayer die Pension an zwei Berliner Brüder verkauft und diese<br />
hatten an Bruno Büchner verpachtet, der die Pension in „Platterhof“ umtaufte, nach dem<br />
Roman von Richard Voß. 96 Hitler begleitete seinen damaligen Mentor Dietrich Eckart. Eckart<br />
war ein völkischer Schriftsteller und Antisemit. Er gab ein rechtsradikales, antisemitisches<br />
Blatt mit dem Titel „Auf gut deutsch“ heraus. Er hatte großen Einfluss auf den jungen Hitler<br />
und gab ihm seine „ideologische Grundlage“. 97 Eckart besuchte mehrmals den <strong>Obersalzberg</strong><br />
und fand dort auch Unterschlupf, als er wegen seiner antisemitischen Agitation in München<br />
und vor allem wegen Ausfällen gegen den damaligen Reichspräsidenten Friedrich Ebert vor<br />
Gericht geladen wurde. Meist logierte Eckart als Dr. Hofmann auf dem Platterhof, während<br />
Hitler sich den Tarnnamen Wolf zulegte – ein Name, der in der Bezeichnung für sein späteres<br />
Hauptquartier Wolfsschanze wiederkehrte. 98 Eckart hatte Verbindungen in völkisch-<br />
antisemitische Kreise und konnte sich in der jungen NSDAP großen Einfluss erwerben: „Als<br />
Schriftleiter des ‚Völkischen Beobachter’, der durch Eckarts finanzielle Garantie gekauft<br />
werden konnte, übte er die Funktion eines Chefideologen der frühen NSDAP aus.“ 99 Eckart<br />
starb 1923 und wurde in der Partei weiterhin in Ehren gehalten. In Berchtesgaden wurde<br />
später sogar ein Krankenhaus nach ihm benannt. 100<br />
Nach dem gescheiterten Putschversuch 1923 und seiner Haft in Landsberg, in der er den<br />
ersten Teil von „Mein Kampf“ verfasste, kam Hitler 1925 zum <strong>Obersalzberg</strong> zurück. Dort<br />
schrieb er den zweiten Teil von „Mein Kampf“ in einer Hütte, dem so genannten<br />
„Kampfhäusle“ oberhalb des Platterhofes, die ihm der Pächter Büchner, ein Anhänger Hitlers,<br />
zur Verfügung stellte. Hitler war inzwischen kein unbekannter Politiker mehr. Am<br />
<strong>Obersalzberg</strong> fand er immer mehr Anhänger und konnte auch schon vor dem Putschversuch<br />
Zuhörer für seine Reden finden. Darunter waren nicht nur Bergbauern, sondern auch die<br />
95<br />
Vgl.: Verlag A. Plenk KG 1983, S. 2. Das Werk wurde vom Verlag A. Plenk herausgegeben, ein Autor ist<br />
nicht genannt.<br />
96<br />
Vgl.: Chaussy; Püschner 1997, S. 34f.<br />
97<br />
Vgl.: Hanisch 1995, S. 10.<br />
98<br />
Vgl.: Schaffing; Baumann; Hoffmann 1985, S. 8.<br />
99<br />
Hanisch 1997, S. 11.<br />
100<br />
Vgl.: Chaussy; Püschner, S. 146.<br />
33
Fallbeispiele – <strong>Obersalzberg</strong><br />
Witwe Bechstein, die Hitler bewunderte und ihm später ihr Haus zur Verfügung stellte. Hitler<br />
fühlte sich am <strong>Obersalzberg</strong> heimisch und suchte nach einer dauerhaften Bleibe. Zwischen<br />
1925 und 1928 – die Angaben sind hier widersprüchlich 101 – mietete Hitler das Haus<br />
Wachenfeld, in dem seine Halbschwester Angela Raubal die Haushaltsführung übernahm.<br />
1932 ergab sich für Hitler die Gelegenheit, das Haus zu kaufen. Als der Kauf am 26. Juni<br />
1933 getätigt wurde, war er schon Reichskanzler.<br />
Der Berg und die Umgebung, in die es Hitler eigentlich eher zufällig im Gefolge von Eckart<br />
verschlagen hatte, war schon seit langer Zeit mit verschiedenen Mythen belegt, die Hitler in<br />
der Folgezeit geschickt für seine Propaganda ausnutzte. So heißt es in der Untersbergsage,<br />
dass im Berg Kaiser Barbarossa schliefe und nur alle hundert Jahre erwachen würde. Wenn<br />
dann die Raben nicht mehr um den Berg flögen, träte Barbarossa heraus und das<br />
tausendjährige Reich bräche an. Hitler kannte diese Sage und erklärte später, dass er sich ganz<br />
bewusst an diesem Ort niedergelassen hatte. 102 Auf jeden Fall trug auch der Russland-<br />
Feldzug, dessen Pläne am <strong>Obersalzberg</strong> entstanden, den Namen „Barbarossa“. Von der<br />
Untersbergsage gab es verschiedene Interpretationen, die im Kern jedoch immer wieder auf<br />
einen im Berg ruhenden Herrscher verweisen, mit dessen Auszug ein neues Reich beginnt.<br />
Den Inhalt bezog Hitler gerne auf seine eigene Person. 103<br />
4.1.1.2 Der Berghof im Führersperrgebiet<br />
Mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten begann auch am <strong>Obersalzberg</strong> eine andere<br />
Zeit. Der Reichskanzler Hitler gab sich nicht mehr mit dem eher bescheidenen Haus<br />
Wachenfeld zufrieden. Hitler, der sich gerne als Architekt sah, zeichnete selbst die Pläne zum<br />
Umbau. Ausgeführt wurde die Verwandlung des Haus Wachenfeld zum repräsentativen<br />
Berghof vom Münchner Architekten Alois Degano. Es wurde ein Neubau mit 17 Meter<br />
Giebelbreite und 37 Meter Länge direkt neben das Haus Wachenfeld gesetzt. 104 Der Berghof<br />
hatte eine Terrasse mit darunter liegenden Garagen. Die Gäste gelangten über eine Treppe mit<br />
Arkaden zum Eingang. Im Haus befanden sich Arbeits- und Schlafzimmer Hitlers, die Räume<br />
von Eva Braun, Bad und Ankleidezimmer, Speisezimmer, weitere Zimmer für Gäste und<br />
Personal, sowie ein Vorführraum für Kinofilme, eine so genannte große Halle mit<br />
versenkbarem Panoramafenster und eine Veranda. Die Außenansicht sowie zwei Innenräume<br />
und das Panoramafenster sind auf Abbildung 1 zu sehen.<br />
101 Vgl.: Hanisch 1997, S. 12.<br />
102 Vgl.: Schaffing; Baumann; Hoffmann 1985, S. 9.<br />
103 Vgl.: Hanisch 1997, S. 8.<br />
104 Vgl.: Chaussy; Püschner 1997, S. 102.<br />
34
Fallbeispiele – <strong>Obersalzberg</strong><br />
Abbildung 1: Der Berghof. Quelle: Hanisch 1998, S. 25.<br />
Doch nicht nur das Haus Wachenfeld wurde in den dreißiger Jahren zum Berghof umgebaut.<br />
Der gesamte <strong>Obersalzberg</strong> wandelte sich vom Erholungsgebiet unter für die meisten<br />
Bewohner skandalösen Umständen in das Führersperrgebiet. Das Führersperrgebiet war<br />
dreiteilig – Bezirk I umfasste den Berghof, Bezirk II die nähere Umgebung von Hitlers<br />
Wohnsitz und Bezirk III schloss ab Kriegsbeginn das umliegende Kehlsteinmassiv mit ein.<br />
Ab Mitte der dreißiger Jahre wurde der <strong>Obersalzberg</strong> zu einer ständigen Baustelle. 105<br />
Maßgebliche Triebkraft der Veränderungen war Martin Bormann, der auch der „Herrgott des<br />
<strong>Obersalzberg</strong>s“ genannt wurde. Seine Aktionen veränderten den <strong>Obersalzberg</strong> und hatten<br />
Folgen, die bis heute andauern:<br />
„Er wurde in kurzer Zeit Machthaber des Bergs, er hatte dem kleinen Fleck Erde<br />
seinen Nimbus verliehen, die Kultur des Orts verbannt, Heimat zerstört, die<br />
Landschaft mit grober Maschinengewalt verformt und eine ganze Armee von<br />
Bauarbeitern daran gesetzt, gewaltige Ideen in die Realität umzusetzen.“ 106<br />
Bormann war im Jahr 1900 geboren und trat nach der Teilnahme am Ersten Weltkrieg der SA<br />
bei. In der Partei machte er rasch Karriere, indem er unter anderem die Leitung der<br />
parteiinternen „Hilfskasse“-Versicherung inne hatte. Nach 1933 wurde er Stabsleiter des<br />
Stellvertreters des Führers Rudolf Heß und im Oktober 1933 wurde er zum Reichsleiter<br />
105 Vgl.: Lankheit 1999, S. 42.<br />
106 Beierl 2004, S. 15.<br />
35
Fallbeispiele – <strong>Obersalzberg</strong><br />
ernannt. Ab 1943 durfte er sich offiziell „Sekretär des Führers“ nennen und war einer der<br />
mächtigsten Männer in der Umgebung von Adolf Hitler, da er sämtliche Zugänge zu ihm<br />
kontrollierte. 107 Ab 1935 begann Bormann die Grundstücke der <strong>Obersalzberg</strong>er aufzukaufen.<br />
Einige Verkäufer konnten noch gute Gewinne erzielen, andere allerdings weigerten sich den<br />
Ort zu verlassen – teils aus Heimatverbundenheit, teils auch wegen der guten Geschäfte, die<br />
die vielen Bewunderer des Führers einbrachten. Dies radikalisierte die Methoden Bormanns<br />
und er machte auch vor Parteianhängern keinen Halt, wie die Beispiele des Wirtes Karl<br />
Schuster oder des Pächters Büchner zeigen. Schuster war der Wirt des Hotels „Zum Türken“<br />
(vgl. Abbildung 2: 27. Hotel zum Türken), welches zu den größten am Ort gehörte. Schuster<br />
war seit 1930 NSDAP-Mitglied. Während zuerst noch viele normale Touristen im „Türken“<br />
unterkamen, veränderte sich bald die Kundschaft: Zunehmend kamen Parteigenossen und<br />
politische Gefolgschaft Hitlers. Nach einer wahrscheinlich nicht allzu ernst gemeinten,<br />
abfälligen Bemerkung Schusters über die neue Kundschaft wurde im August 1933 eine<br />
Boykott-Aktion gegen ihn gestartet. Schuster kehrte nach einer Schutzhaft schließlich an den<br />
<strong>Obersalzberg</strong> zurück, doch sein Geschäft war ruiniert und er musste seinen Besitz für einen<br />
geringen Preis an Bormann verkaufen und mit seiner Familie den Landkreis innerhalb von<br />
acht Tagen verlassen. Aufkommende Gerüchte über die Vertreibung sollten durch ein<br />
Zeitungsinserat im „Berchtesgadener Anzeiger“ vom Januar 1934 unterbunden werden: „Wir<br />
warnen Verbreiter derartiger Gerüchte und müßten solche Personen als staatsfeindlich<br />
bezeichnen, sodaß diese Schädlinge ins Konzentrationslager nach Dachau verbracht werden<br />
müßten.“ 108 Im Hotel „Zum Türken“ wurde der Reichssicherheitsdienst (vgl. Abbildung 3:<br />
8. RSD) einquartiert. Auch die Unterstützung des Pächters des Platterhofes Büchner (vgl.<br />
Abbildung 3: 19. Platterhof), der Hitler in den 1920er Jahren gerne aufgenommen hatte und<br />
ihm sogar eine Hütte zum Schreiben zur Verfügung gestellt hatte, schützte ihn nicht vor<br />
Bormann. 1936 verkaufte Büchner, nachdem ihm vorher die Parteimitgliedschaft entzogen<br />
worden war. 109 Insgesamt wurden ca. 50 Häuser am <strong>Obersalzberg</strong> verkauft und meist danach<br />
abgerissen. „Rund 10 km 2 kaufte Bormann als Treuhänder an. Aus Privatbesitz stammten 278<br />
ha für 6 Millionen Mark, aus der öffentlichen Hand stammten 713 ha für 1,2 Millionen<br />
Mark.“ 110 Neben Hitler ließen sich auch weitere Nazi-Größen am <strong>Obersalzberg</strong> nieder.<br />
Göring, Bormann und Speer bauten sich Häuser in der Nähe des Berghofs. Außerdem<br />
entstanden SS-Kasernen, ein Gutshof (vgl. Abbildung 3: 7. SS-Kaserne, 12. Gutshof),<br />
107 Vgl.: Beierl 2004, S. 15ff.<br />
108 Berchtesgadener Anzeiger vom 27.01.1934. Zit. nach: Chaussy; Püschner 1997, S. 72.<br />
109 Vgl.: Chaussy; Püschner 1997, S. 89.<br />
110 Hanisch 1997, S. 14.<br />
36
Fallbeispiele – <strong>Obersalzberg</strong><br />
Garagengebäude, das Kehlsteinhaus mit zugehöriger Straße und der ehemalige Platterhof<br />
wurde zum Hotel umgebaut. Die Veränderungen am <strong>Obersalzberg</strong> sind durch die<br />
Gegenüberstellung von Abbildung 2 und Abbildung 3 ersichtlich.<br />
Abbildung 2: Der <strong>Obersalzberg</strong> bis 1933. Quelle: Hanisch 1995, S. 15.<br />
Abbildung 3: Der <strong>Obersalzberg</strong> von 1933-1945. Quelle: Hanisch 1995, S. 16.<br />
37
Fallbeispiele – <strong>Obersalzberg</strong><br />
Bis zum Kriegsende wurde permanent gebaut, vor allem an einem unterirdischen<br />
Bunkersystem, wobei im Durchschnitt 3.000 Arbeiter eingesetzt wurden. Nur ca. 30 Prozent<br />
kamen aus dem Deutschen Reich, der Rest waren Fremdarbeiter, die meist aus Italien und aus<br />
dem heutigen Tschechien stammten. 111 Die Mittel und Rohstoffe erhielt Bormann, da alle<br />
Baumaßnahmen als „kriegswichtige Sonderbauten des Führers“ geführt wurden. Ohne<br />
Genehmigung gelangte niemand mehr ins Führersperrgebiet. Albert Speer kommentiert in<br />
seinen „Erinnerungen“ die Veränderungen am <strong>Obersalzberg</strong> als auch die Pläne Hitlers zum<br />
Umbau des Haus Wachenfeld zum Berghof abfällig. Bormann beschreibt er als einen Mann<br />
„[...] ohne Empfinden für die unberührte Natur [...]“ 112 und die offensichtlichen praktischen<br />
Mängel am Berghof machten für Speer auch dessen besondere Note aus: „Es war noch immer<br />
der primitive Betrieb des ehemaligen Wochenendhauses, nur ins Überdimensionale<br />
gesteigert.“ 113<br />
Das Haus Wachenfeld war schon ab 1933 von einem Zaun umgeben und wurde von SS-<br />
Männern bewacht. Diese Absperrung war nötig, um die „Pilgerströme“ abzuhalten. Immer<br />
mehr Anhänger reisten zum <strong>Obersalzberg</strong>, um den Führer persönlich zu sehen. Die später nur<br />
noch in kontrollierten Bahnen am Berghof vorbeigeleiteten Scharen kamen, um einen Blick<br />
auf den „Volkskanzler“ Hitler zu erhaschen. Dieses Bild wurde gerade zur Anfangszeit<br />
bewusst in der Öffentlichkeit verbreitet. Einen großen Anteil an dieser Inszenierung hatte<br />
Hitlers Fotograf Heinrich Hoffmann. 1932 wurde der Band „Hitler, wie ihn keiner kennt“<br />
veröffentlicht, der Hitler als naturnahen, tierliebenden Kinderfreund zeigt. Dies war ein<br />
Novum, denn bis dahin waren Politiker nicht in ihrer angeblich privaten Umgebung gezeigt<br />
worden. Dabei darf nicht vergessen werden, dass alle diese Bilder Teil einer bewussten<br />
Inszenierung waren. Die wirklich private Seite Hitlers sowie unschöne Details wurden<br />
ausgeblendet: „alle sichtbaren Sicherheitsmaßnahmen [...], Absperrungen und die<br />
bewaffneten Männer des Begleitkommandos ebenso wie den durchaus tabuisierten wirklichen<br />
Privatbereich Hitlers [...]“ 114 bekam die Öffentlichkeit niemals zu Gesicht, ebenso wenig wie<br />
Hitlers Lebensgefährtin Eva Braun, obwohl diese ab 1933 seine Halbschwester Angela<br />
Raubal als erste Dame des Hauses ablöste.<br />
Der Berghof war nicht nur Hitlers Privathaus sondern auch der zweite Regierungssitz. Im<br />
Führersperrgebiet wurde modernste Technik installiert. In Berchtesgaden wurde eine<br />
Außenstelle der Reichskanzlei eröffnet, zudem gab es einen Regierungsflughafen in Ainring,<br />
111<br />
Vgl.: Chaussy; Püschner 1997, S. 149 und Beierl 2004, S. 88.<br />
112<br />
Speer 1969, S. 98.<br />
113<br />
Ebenda, S. 100.<br />
114<br />
Chaussy; Püschner 1997, S. 81.<br />
38
Fallbeispiele – <strong>Obersalzberg</strong><br />
der im Oktober 1934 eingeweiht wurde. Weitere Pläne zum Ausbau von Berchtesgaden<br />
konnten nicht mehr verwirklicht werden. 115 Am Berghof wurden Politiker und Repräsentanten<br />
aus verschiedenen Ländern empfangen. 116 Sie waren meist begeistert von der<br />
beeindruckenden Umgebung und Natur, wie zum Beispiel der ehemalige britische<br />
Premierminister Lloyd George, der sich während seines Besuches in Berchtesgaden begeistert<br />
über den Ort äußerte. 117 Bei den Besuchen nutzten Hitler und seine Anhänger alle Mittel, die<br />
ihnen zur Verfügung standen, um auf die Besucher Einfluss auszuüben. So war genau<br />
festgelegt, wer mit Hitler die Stufen zum Berghof hinaufgehen durfte oder wer oben in<br />
Empfang genommen wurde. Dies musste auch der österreichische Kanzler Kurt Schuschnigg<br />
erfahren, der bei seinem Besuch auf dem <strong>Obersalzberg</strong> im Februar 1938 durch eine<br />
Einschüchterungstaktik mürbe gemacht werden sollte, um dem „Anschluss“ Österreichs<br />
zuzustimmen. Während Schuschnigg lange Zeit im Vorraum warten musste, wurden ihm zwei<br />
furchteinflößende Generäle als demonstrative Geste der Drohung zur Seite gestellt. Hitler<br />
selbst drohte mit militärischer Gewalt, so dass Schuschnigg schließlich nachgab und das<br />
Verbot der Nationalsozialistischen Organisation in Österreich aufhob. 118 Einen Monat später<br />
folgte der „Anschluss“ Österreichs.<br />
Doch der <strong>Obersalzberg</strong> ist nicht nur ein Täterort, weil durch die Nazis der Ort zerstört und in<br />
neuer Funktion als Führersperrgebiet wieder aufgebaut wurde. Gerade hier, in der<br />
vermeintlichen Bergidylle, wurden viele weitreichende Entscheidungen des Regimes<br />
getroffen. Hitler selbst meinte, dass alle seine großen Pläne dort entstanden seien. 119 Im<br />
Berghof wurde nicht nur der Boykott gegen die Juden im Jahre 1933 geplant, sondern es<br />
wurden Entscheidungen für den Fall „Grün“, den militärischen Planungen zur Zerschlagung<br />
der Tschechoslowakei, oder im Fall „Weiß“, dem Decknamen für den Überfall auf Polen,<br />
getroffen. Vom <strong>Obersalzberg</strong> wurde an Stalin bezüglich des Nichtangriffspaktes telegrafiert<br />
und hier wurde auch der Russland-Feldzug „Unternehmen Barbarossa“ geplant. 120<br />
Der Glaube, dass ein Ort oder eine Landschaft politische Schuld haben kann, ist widersinnig,<br />
wie Ulrich Chaussy und Christoph Püschner in ihrem Werk „Nachbar Hitler“ anführen.<br />
Allerdings stellen sie die richtigen Fragen: „Welche spezielle Funktion kommt einem Ort wie<br />
<strong>Obersalzberg</strong> in Hitlers Herrschaft zu? Was geschah dort – und welches Bild wurde nach<br />
115<br />
Vgl.: Lankheit 1999, S. 74.<br />
116<br />
Eine Liste aller Besucher befindet sich bei Hanisch 1997, S. 32f.<br />
117<br />
Vgl.: Hanisch 1995, S. 26.<br />
118<br />
Vgl.: Chaussy; Püschner 1997, S. 135.<br />
119<br />
Vgl.: Beierl 2004, S. 20.<br />
120<br />
Vgl.: Chaussy; Püschner 1997, S. 136 und 141.<br />
39
Fallbeispiele – <strong>Obersalzberg</strong><br />
außen gespiegelt?“ 121 Niemand wird heute noch herausfinden können, was genau in Hitlers<br />
Kopf vorgegangen ist und welchen Einfluss die Umgebung mit der beeindruckenden<br />
Landschaft auf seine Gedankengänge hatte. Es wird jedoch an der Geschichte des<br />
<strong>Obersalzberg</strong> deutlich, dass sich hier in Miniaturform ähnliche Vorgänge wie im gesamten<br />
„Dritten Reich“ abgespielt haben. Der <strong>Obersalzberg</strong> enthüllt wie kein anderer Ort, die<br />
Verschränkung von „[...] biederer Normalität und monströser Abnormität [...]“ 122 im<br />
„Dritten Reich“. Die Normalität des Alltags war ein wesentlicher Faktor, der dem NS-Regime<br />
die Unterstützung der Mehrheit der Deutschen sicherte. Ernst Hanisch sieht diese<br />
Verschränkung auch in den Propagandabildern, die vom <strong>Obersalzberg</strong> publiziert wurden: Sie<br />
unterstreichen vor allem die Tendenz zur Idylle, wenn der private Hitler gezeigt wurde,<br />
während auf Parteitagen die Tendenz zur Monumentalisierung zum Zuge kam. 123 Wenn wir<br />
heute etwas über das „Dritte Reich“ lesen, dürfen wir nicht vergessen, dass es ein<br />
Doppelgesicht hatte: „Der <strong>Obersalzberg</strong> und Auschwitz gehören zusammen.“ 124 Wenn man<br />
genau hinsieht, ist der Terror auch am <strong>Obersalzberg</strong> zu finden, wie die rücksichtslose<br />
Zerstörung der Heimat und die Vertreibung der alten <strong>Obersalzberg</strong>er durch die<br />
Nationalsozialisten zeigt:<br />
„Der Bau einiger Häuser für die Elite des Dritten Reiches ist ein kleines Modell<br />
für die Errichtung der Herrschaft des Terrors, mit dem dann das ganze Land<br />
regiert wurde. Wie unter einer Lupe läßt sich im Planquadrat <strong>Obersalzberg</strong><br />
beobachten, wie der Nationalsozialismus entsteht, sich festigt, funktioniert.“ 125<br />
Eine der schwierigsten Baumaßnahmen, die am <strong>Obersalzberg</strong> vorgenommen wurden, war das<br />
Kehlsteinhaus. 126 Es war ein Geschenk der Partei zu Hitlers 50. Geburtstag und sollte die<br />
Macht der Nationalsozialisten veranschaulichen. Das Haus wurde vom Münchner Architekten<br />
Roderich Fick entworfen und sollte als Teehaus für Hitler sowie zum Empfang für Besucher<br />
dienen. Hitler selbst bevorzugte allerdings einen kleineren Pavillon auf dem Mooslahnerkopf,<br />
zu dem ihn seine Spaziergänge führten. Das Kehlsteinhaus enthielt mehrere Funktionsräume,<br />
ein nie benutztes Arbeitszimmer für Hitler, Speisesaal und Stube sowie eine achteckige<br />
Gesellschaftshalle. Die Bauarbeiten begannen 1937 und waren mit einem sehr großen<br />
Aufwand verbunden, da das Haus auf dem 1.800 Meter hohen Berg Kehlstein lag. Zum Haus<br />
führte eine 6,3 Kilometer lange Straße hinauf. Sie gilt noch heute als „Deutschlands schönste<br />
Alpenstraße“ 127 . Doch der Bau, der sicher eine technische Meisterleistung war, wurde von<br />
121 Chaussy; Püschner 1997, S. 79.<br />
122 Dahm 1999a, S. 26.<br />
123 Vgl.: Hanisch 1997, S. 44.<br />
124 Ebenda, S. 2.<br />
125 Chaussy; Püschner 1997, S. 10.<br />
126 Vgl. zum Bau des Kehlsteinhauses: Ebenda, S. 117ff.<br />
127 Dahm 1999a, S. 22.<br />
40
Fallbeispiele – <strong>Obersalzberg</strong><br />
Bormann ohne Rücksicht vorangetrieben. Die Arbeiter mussten selbst bei Schnee und Kälte<br />
weiterbauen. Um Unruhen zu vermeiden, wurde sogar eine Bordellbaracke für die Arbeiter<br />
mit französischen und italienischen Prostituierten eingerichtet. 128 Für die letzten 126 Meter<br />
zum Kehlsteinhaus wurde ein Aufzug in den Berg gebaut, der die Besucher bis zum Gipfel<br />
brachte. Der unheimlich große Aufwand und die Kosten von ca. 30 Millionen Reichsmark für<br />
ein Teehaus, das im Grunde nie benutzt wurde, waren auch für die Alliierten unvorstellbar.<br />
Daher glaubten sie der sorgsam gestreuten Propaganda der Nazis und vermuteten im „Eagle`s<br />
Nest“ (Adlerhorst), wie sie das Kehlsteinhaus nannten, einen wichtigen Teil der so genannten<br />
Alpenfestung. Diese angebliche Festung im Salzburger Land sollte der SS als letzter<br />
Rückzugsort vor den Alliierten dienen.<br />
Mit sich verschlechterndem Kriegsverlauf wurde die Sicherheit des <strong>Obersalzberg</strong>s zu einem<br />
wichtigen Thema. Daher plante Bormann 1943 die Einrichtung einer Flakabwehr, ein<br />
Luftlage-Kontrollzentrum, den Bau von umfassenden Bunkeranlagen und eines<br />
Stollensystems, in das sich die Bewohner des <strong>Obersalzberg</strong>s zurückziehen konnten. 129<br />
Ausführliche Forschungen zum Bau des Stollensystems finden sich in Florian Beierls Buch<br />
„Hitlers Berg“. Auf eine genauere Schilderung der Vorhaben und ihrer Ausführung wird an<br />
dieser Stelle aus Platzgründen verzichtet, dennoch ist festzuhalten, dass man es am<br />
<strong>Obersalzberg</strong> nicht mit einem einfachen Luftschutzraum zu tun hatte. „Die Bezeichnung<br />
‚Schutzstollen’ konnte im Fall der Planungen Bormanns von Anfang an als untertrieben<br />
bezeichnet werden. Was hier entstehen sollte, war ein unterirdisches Hauptquartier mit<br />
klimatisierten Wohnräumen größeren Ausmaßes.“ 130 Dabei hätte die Bunkeranlage trotz der<br />
Ausstattung nur einem kurzen Luftangriff standgehalten. Auf eine längere Belagerung vom<br />
Boden her hätte man nicht reagieren können. 131 Aber auch die Flakabwehr, die bei einem<br />
feindlichen Angriff das Tal durch eine Vernebelung für die Flieger unsichtbar machen sollte,<br />
konnte am Ende keinen Schutz vor Bombenangriffen bieten. Hitler war zum letzten Mal am<br />
15.7.1944 auf dem Berghof. 132 Das Kriegsende verbrachte er bis zu seinem Selbstmord in<br />
Berlin.<br />
Nach dem Bombenangriff am 25. April 1945 auf den <strong>Obersalzberg</strong> wurden die Häuser<br />
Görings und Bormanns völlig zerstört, andere Gebäude, darunter auch der Berghof, wurden<br />
nur teilweise getroffen. Unversehrt dagegen blieb das Kehlsteinhaus. Insgesamt gab es am<br />
<strong>Obersalzberg</strong> durch das Stollensystem nur wenige Opfer. Am 4. Mai 1945 wurde die<br />
128 Vgl.: Hanisch 1997, S. 19.<br />
129 Vgl.: Beierl 2004, S. 44.<br />
130 Ebenda, S. 47.<br />
131 Vgl.: Ebenda, S. 70.<br />
132 Vgl.: Schaffing; Baumann; Hoffmann 1985, S. 18.<br />
41
Fallbeispiele – <strong>Obersalzberg</strong><br />
kampflose Übergabe von Berchtesgaden von den verbliebenen Bewohnern angekündigt.<br />
Amerikanische und französische Soldaten erreichten kurz darauf den <strong>Obersalzberg</strong>.<br />
4.1.2 Recreation Area und historische Sensationsgier<br />
In den ersten Maitagen 1945 kam es zu Plünderungen der noch nicht zerstörten Häuser der<br />
ehemaligen Nazi-Größen. Die Bewohner des <strong>Obersalzberg</strong>s nahmen alles mit, was noch übrig<br />
geblieben war. Von Löffeln mit eingravierten Monogrammen über Bettwäsche und den<br />
Vorräten, die in den Bunkeranlagen lagerten. Ab dem 12. Mai nahm die amerikanische<br />
Militärverwaltung ihren Dienst auf und das ehemalige Sperrgebiet wurde erneut für Deutsche<br />
abgeriegelt. Zutritt hatten nur Ausländer, wenn sie einen bestimmten Ausweis vorweisen<br />
konnten. 133 Die Liegenschaften gingen 1949 in das Vermögen des Freistaates Bayern über,<br />
wobei sich die Amerikaner die Nutzung einiger Grundstücke vorbehielten. So entstand im<br />
ehemaligen Hotel Platterhof nach Auf- und Umbau das Hotel General Walker. Die<br />
Amerikaner richteten am <strong>Obersalzberg</strong> eine so genannte „Recreation Area“ ein, in der sich<br />
Soldaten mit ihren Familien von ihrem Einsatz erholen konnten. Auf dem ehemaligen Gutshof<br />
wurde ein Golfplatz und ein Skizentrum, die „Skytop Lounge“, eingerichtet. 134 Nach der<br />
teilweisen Öffnung des <strong>Obersalzberg</strong>s Ende der vierziger Jahre begannen immer mehr<br />
„Wallfahrer“, das ehemalige Führersperrgebiet zu besuchen. Die Bewohner stellten schnell<br />
fest, dass mit den Touristen ein gutes Geschäft zu machen war. „Die Frage des Umgangs mit<br />
nationalsozialistischen Repräsentationsbauten stellte sich auch andernorts, nirgends jedoch<br />
war die kommerzielle Ausbeutung dieser Zeit so sichtbar wie am <strong>Obersalzberg</strong>.“ 135 Bunte<br />
Broschüren, Postkarten, Wegweiser zu den einzelnen Häusern sowie Führungen waren ein<br />
Teil des Angebots, was den mit einer großen Portion Sensationsgier ausgestatten Gästen<br />
offeriert wurde. Dabei waren die zu kaufenden Andenken und Informationen meist unkritisch,<br />
oftmals falsch und historisch nicht korrekt. Bis heute sind solche Broschüren an den Kiosken<br />
zu erwerben. Statt seriöser Informationen bestand jahrelang ein Großteil der zu kaufenden<br />
Bücher aus marktschreierischen und verharmlosenden Publikationen. Nie hatte sich jemand<br />
für diese Geschäftemacherei zuständig gefühlt. Weder das Bayerische Finanzministerium, an<br />
welches das Vermögen der NSDAP und damit auch die Liegenschaften am <strong>Obersalzberg</strong><br />
gemäß der Kontrollratsdirektive Nr. 50 1949 gefallen war, noch die Kurdirektion des<br />
Berchtesgadener Landes machte Anstalten, etwas gegen die Flut der Broschüren zu<br />
unternehmen. 136 Zudem wurden in Bildbänden alte Propagandafotos von Heinrich Hoffmann<br />
133 Vgl.: Feiber 1999, S. 455.<br />
134 Vgl.: Weiß 1992, S. 275.<br />
135 Feiber 1999, S. 456.<br />
136 Vgl.: Weiß 1992, S. 279.<br />
42
Fallbeispiele – <strong>Obersalzberg</strong><br />
wiederverwendet – ohne erklärende Bildunterschriften oder Quellenangaben. Die Texte waren<br />
meist verharmlosend und aus dem Zusammenhang gerissen, wie das folgende Beispiel zeigt.<br />
In der 1983 vom Plenk-Verlag herausgegebenen Bilddokumentation – ein Verfasser der Texte<br />
ist nicht angegeben – findet man neben einem Bild vom Besuch des englischen Königs bei<br />
Hitler diese Textpassage: „Nachdem das Haus Wachenfeld in den ‚Berghof’ umgebaut war,<br />
erlebte es weltpolitisch bedeutende Besuche wie den von Schuschnigg vor der Eingliederung<br />
Österreichs oder, wie hier, vom König von England.“ 137 Es wird weder erläutert, welche<br />
weltpolitische Bedeutung diesen Besuchen inbegriffen war, noch dass die Entscheidungen,<br />
die auf dem Berghof getroffen wurden, den Zweiten Weltkrieg einleiteten. Gerade die<br />
Auslassung wichtiger Konsequenzen ist ein wesentliches Merkmal der Informationen, die<br />
lange Zeit vornehmlich an den Kiosken zu finden waren.<br />
Schon Anfang der fünfziger Jahre wurde die Presse auf die NS-Nostalgie am <strong>Obersalzberg</strong><br />
aufmerksam: Im Juli 1951 schrieb der Reporter Neven Du Mont einen Artikel mit dem Titel<br />
„Propagandazelle <strong>Obersalzberg</strong>“ für die Münchner Illustrierte. Er beleuchtete die Vorgänge<br />
am <strong>Obersalzberg</strong> und befürchtete das Aufkommen neonationalsozialistischer Strömungen.<br />
Auch der „Spiegel“ beschäftigte sich im Dezember 1951 mit den Vorgängen am<br />
<strong>Obersalzberg</strong>. Hier wurden vor allem die Streitigkeiten zwischen dem Land Bayern und der<br />
Gemeinde Berchtesgaden beschrieben. 138 Während von Seiten des Landes der Umgang mit<br />
den Ruinen von politischer Seite betrachtet wurde und man für eine Sprengung sämtlicher aus<br />
der NS-Zeit erhaltenen Gebäude und Ruinen war, plädierten die Berchtesgadener für eine<br />
Erhaltung des Areals und der Überreste und beriefen sich dabei auf wirtschaftliche Aspekte.<br />
Als Kompromiss wurde schließlich die Freigabe des Kehlsteinhauses für den Tourismus bei<br />
gleichzeitiger Sprengung der Ruinen sowie der Wiederaufforstung des Gebietes beschlossen.<br />
Doch schon damals hatte das Presseecho keine großen Konsequenzen auf den Profit, der aus<br />
der NS-Vergangenheit geschlagen wurde. Lediglich die Bunkerzugänge wurden zugemauert<br />
und einmalig alle Souvenirs beschlagnahmt, die auf den Nationalsozialismus Bezug nahmen.<br />
In der Region stellte man sich schon Ende der vierziger Jahre die Frage, was mit den NS-<br />
Bauten bzw. mit ihren Überresten und dem Gebiet geschehen solle. Der Bayerische Staat<br />
verweigerte die Rückgabe an die ehemaligen Besitzer. Es bildete sich eine „Gemeinschaft der<br />
ehemaligen <strong>Obersalzberg</strong>er“, deren Mitglieder versuchten, ihre alten Besitztümer wieder zu<br />
bekommen. Sie scheiterten jedoch. Nur die Witwe des „Türken“-Wirts Karl Schuster hatte<br />
vor der Wiedergutmachungskammer auf Rückerstattung geklagt und Recht bekommen. So<br />
137 Verlag A. Plenk KG 1983, Seitenzahlen sind im Bildteil nicht vorhanden.<br />
138 Vgl.: O.V.: <strong>Obersalzberg</strong>. Verzehr bedingt. In: Der Spiegel Nr. 49 (05.12.1951), S. 10-12.<br />
43
Fallbeispiele – <strong>Obersalzberg</strong><br />
kam es, dass 1950 das Hotel „Zum Türken“ wiedereröffnet wurde. 139 Aus seiner schon im<br />
„Dritten Reich“ prädestinierten Lage wurde auch in der Bundesrepublik wieder Kapital<br />
geschlagen: Ein Werbeschild mit der Aufschrift „Ganz nahe beim Berghof liegend“ wurde<br />
aufgestellt. 140<br />
1948 hatte die Kurdirektion auf die Frage nach der Zukunft des <strong>Obersalzberg</strong>s verschiedene<br />
Vorschläge gesammelt: So war beispielsweise von der Einrichtung einer Rodelbahn auf der<br />
Kehlsteinstraße die Rede oder von einem Kreuz aus Glühbirnen, das auf dem Gipfel<br />
aufgestellt werden sollte. Ernsthaftere Vorschläge waren die Verpachtung der Gebäude an<br />
politisch Verfolgte oder die Einrichtung einer Sühnekirche am Kehlstein. „Fast durchgängig<br />
aber war die Forderung nach einer pragmatisch-wirtschaftlichen Nutzung des Geländes.“ 141<br />
1951 gelang es den örtlichen Behörden die Zustimmung für eine touristische Nutzung des<br />
Kehlsteinhauses zu erlangen, was oben schon angesprochen wurde. Im Jahr darauf wurde das<br />
Haus an die Berchtesgadener Sektion des Deutschen Alpenvereins verpachtet, mit der<br />
Auflage, alle Aktivitäten zu verhindern, die an die Vergangenheit des Ortes erinnern könnten.<br />
1960 wurde die Berchtesgadener Landesstiftung gegründet, die das frühere NS-Vermögen bis<br />
heute verwaltet und es gemeinnützigen Zwecken zuführt. 142 Mit der Freigabe des<br />
Kehlsteinhauses wurde von alliierter Seite allerdings auch gefordert, die aus der Nazi-Zeit<br />
verbliebenen Ruinen zu sprengen, vor allem um den <strong>Obersalzberg</strong> nicht zu einem Treffpunkt<br />
für Ewiggestrige werden zu lassen. 143 1952 geschah dies, allerdings blieb vom Berghof eine<br />
Stützmauer bestehen, die andernfalls den Hang zum Rutschen gebracht hätte.<br />
Ein weiterer Skandal um das <strong>Obersalzberg</strong>er Gebiet kam 1964 ans Licht. Der „Spiegel“<br />
berichtete über die so genannte Steigenberger-Affäre. 144 Der Freistaat Bayern hatte im Jahre<br />
1957 sieben Hotels und Häuser am <strong>Obersalzberg</strong>, darunter das ehemalige Hotel Platterhof und<br />
den Gutshof, an den Hotelier Steigenberger verkauft. Der schnelle Verkauf war auf eine<br />
angeblich seriöse Information zurückzuführen, nach der sich die Amerikaner schon bald vom<br />
<strong>Obersalzberg</strong> zurückziehen würden. Da der Staat Bayern die Gebäude nicht aus eigener Regie<br />
betreiben konnte, verkaufte er die Hotels zu einem sehr günstigen Preis. Auch die weiteren<br />
Konditionen des Vertrages schienen nicht wohl überlegt gewesen zu sein. Der Hotelier durfte<br />
den Preis von drei Millionen DM in Jahresraten zahlen und bekam zudem noch eine<br />
Nutzungsentschädigung, da die Amerikaner auf dem <strong>Obersalzberg</strong> blieben. Schließlich wurde<br />
139 Vgl.: Chaussy; Püschner 1997, S. 168f.<br />
140 Vgl.: Feiber 1999, S. 456.<br />
141 Weiß 1992, S. 275.<br />
142 Vgl.: Feiber 1999, S. 457.<br />
143 Vgl.: Weiß 1992, S. 276.<br />
144 Vgl.: O.V.: Steigenberger. Hitlers Erbe. In: Der Spiegel, Nr. 27 (01.07.1964), S. 41-43.<br />
44
Fallbeispiele – <strong>Obersalzberg</strong><br />
der Vertrag durch den Bundesgerichtshof rückgängig gemacht. Über die historische Relevanz<br />
der Gebäude hatte sich die bayerische Regierung genauso wenig Gedanken gemacht, wie um<br />
die Vertragsklauseln.<br />
Bis 1995 wurde der <strong>Obersalzberg</strong> von über fünf Millionen amerikanischen Soldaten besucht,<br />
die im „Armed Forces Recreation Center“ die Landschaft genossen. Zudem haben jährlich ca.<br />
300.000 ausländische und deutsche Touristen ihren Urlaub am <strong>Obersalzberg</strong> verbracht und<br />
sich oft auf die Suche nach Spuren der Vergangenheit gemacht. 145 1995 kündigten die<br />
Amerikaner ihren Rückzug vom <strong>Obersalzberg</strong> an. Darüber war die Bayerische<br />
Landesregierung zunächst wenig glücklich 146 , konnte sie sich bis dahin doch darauf verlassen,<br />
dass sich die Amerikaner mit der unangenehmen Hinterlassenschaft beschäftigten und dafür<br />
Sorge trugen, dass keine Neonazis ihre Versammlungen abhielten. Der Versuch, die<br />
Amerikaner auf eine weitere Zeit von zehn Jahren am <strong>Obersalzberg</strong> zu halten, indem Bayern<br />
und der Bund die Kosten von 30 Millionen Mark für die Renovierung des Hotels General<br />
Walker getragen hätten, scheiterte. 147 Nun musste man sich selbst mit diesem Täterort<br />
auseinandersetzen. Die intensive Diskussion um die weitere Nutzung des Geländes wird im<br />
Folgenden nachgezeichnet.<br />
4.1.3 Nutzungen in den 1990er Jahren<br />
Die Diskussionen um die zukünftige Nutzung des <strong>Obersalzberg</strong>s riefen im Vergleich mit den<br />
anderen Beispielen in dieser Arbeit das größte Echo hervor. Nicht nur weil hier einer der<br />
Täterorte schlechthin betroffen war, sondern weil zum ersten Mal über die Zukunft eines jetzt<br />
erst wieder zugänglich gewordenen Täterortes gestritten wurde: „Es ist der erste Versuch,<br />
einen Nazi-Ort, an dem keine Gräuel stattfanden, in eine Stätte der Erinnerung zu<br />
verwandeln.“ 148 Erst danach kamen auch von offizieller Seite für größere Täterort wie das<br />
Reichsparteitagsgelände Überlegungen zur Einrichtung von Dokumentationsstätten auf.<br />
Daher war die Resonanz in den Medien sehr groß, so dass man in allen überregionalen<br />
Zeitungen Artikel zum Thema <strong>Obersalzberg</strong> finden konnte.<br />
Nach der Schlüsselübergabe der Amerikaner wurde der Bayerische Staat Eigentümer und voll<br />
verfügungsberechtigter Besitzer des Gebietes. Die „Kleine Reichskanzlei“ wurde ebenfalls<br />
145<br />
Vgl.: O.V.: Tarnname Wolf. In: Der Spiegel, Nr. 49 (05.12.1994), S. 92.<br />
146<br />
Vgl.: Ebenda, S. 94.<br />
147<br />
Vgl.: Finkenzeller 1995b, S. 16.<br />
148<br />
Ullmann 1999. Alle folgenden Zitate und Verweise ohne Seitenangabe beziehen sich auf Artikel aus Online-<br />
Archiven verschiedener Zeitungen oder Internetdokumente. Seitenangaben sind dort nicht vorhanden, aber der<br />
genaue Pfad zur jeweiligen Website ist im Literaturverzeichnis dieser Arbeit zu finden.<br />
45
Fallbeispiele – <strong>Obersalzberg</strong><br />
von den Amerikanern zurückgegeben. 149 Auch hier gab es erst Überlegungen, eine<br />
Geschichtsausstellung zu platzieren. Eine Ausschreibung des Landes sah jedoch keine<br />
historische Nutzung vor. Der Verkauf der Kanzlei an fünf Privatpersonen aus der Umgebung<br />
machte dann im Dezember 2001 der unklaren Zukunft ein Ende. Äußerlich steht das Gebäude<br />
unter Denkmalschutz, innen dürfen Veränderungen vorgenommen werden. Der Verkauf an<br />
die Privatleute setzte auch den Hoffnungen der Gemeinde Bischofswiesen ein Ende, das<br />
Gebäude einer touristischen Nutzung zuzuführen. Sie hatte geplant, in der ehemaligen<br />
Reichskanzlei ein Hotel unterzubringen. 150 Im November 1995 wurden endgültig die letzten<br />
Überreste des Berghofs abgetragen, 1997 folgten die Reste des Göring-Hauses. Der Platterhof<br />
bzw. das Hotel General Walker stellte sich als nicht sanierungsfähig heraus und wurde<br />
abgerissen. 151<br />
Zudem setzte sich in „[...] der Bayerischen Staatsregierung und [...] auch in der<br />
Marktgemeinde und dem Landkreis Berchtesgaden [...] die Einsicht durch, daß die<br />
Verdrängung der geschichtlichen Ereignisse des Nationalsozialismus nicht weiter<br />
durchgehalten werden kann.“ 152 Insgesamt waren die folgenden Entwicklungen jedoch mit<br />
viel Kritik verbunden: „Vom Salzburger Landtag bis zum Simon-Wiesenthal-Zentrum<br />
versuchten auch internationale Stellen Einfluss auf die Entwicklungen zu nehmen.“ 153 Schon<br />
im Jahr 1991 hatte sich eine Bürgerinitiative gegründet, die sich zum Ziel gesetzt hatte, die<br />
Einrichtung einer Dokumentationsstätte über die Ereignisse auf dem <strong>Obersalzberg</strong><br />
durchzusetzen. Die Mitglieder wurden jedoch als Nestbeschmutzer beschimpft. 154 Diese<br />
kritischen Bürger forderten von den zuständigen Stellen eine wirkliche Auseinandersetzung<br />
mit den zwölf Jahren des „Dritten Reiches“ am <strong>Obersalzberg</strong> und sahen die Chance,<br />
interessierten Touristen, seriöse und gut gemachte Informationen über Hitlers Berghof<br />
zukommen zu lassen. Dagegen war eine Mehrheit der <strong>Obersalzberg</strong>er und auch der Politiker<br />
mit der Verdrängung der Geschichte einverstanden. Die Geschäfte, die mit dem „Tourismus<br />
auf leisen Sohlen“ zu machen waren, liefen gut. Sven Felix Kellerhoff nennt es „Hitler-<br />
Romantik“, was Besuchern in Berchtesgaden entgegen schlug: Selbst ungefragt wurden<br />
Anekdoten um die Person des „Führers“ erzählt und an Kiosken sind neben seriösen Studien<br />
teilweise immer noch Propagandabücher rechtsextremer Verlage zu kaufen. 155 Letztendlich<br />
149 Vgl.: O.V.: „Soll` mer`n wegsprengen?“ Walter Mayr über den Umgang der Bayern mit dem Nazi-Erbe am<br />
<strong>Obersalzberg</strong>. In: Der Spiegel, Nr. 33 (12.08.1996), S. 110.<br />
150 Vgl.: Lotz 2001.<br />
151 Vgl.: Feiber 1999, S. 461.<br />
152 Chaussy; Püschner 1997, S. 199.<br />
153 Beierl 2004, S. 156.<br />
154 Vgl.: Müller 2001.<br />
155 Vgl.: Kellerhoff 2004.<br />
46
Fallbeispiele – <strong>Obersalzberg</strong><br />
wurde aber auch den zuständigen Politikern und anderen Bürgern klar, dass seriöse und gut<br />
gemachte Informationen der einzig richtige Weg sind. Dies ist vor allem auf den Druck von<br />
außen zurückzuführen, denn immer mehr Stimmen forderten eine wirkliche<br />
Auseinandersetzung mit den Geschehnissen am <strong>Obersalzberg</strong>. Vor allem sollte verhindert<br />
werden, dass der <strong>Obersalzberg</strong> zu einem „Wallfahrtsort“ der neuen rechten Szene wird. Im<br />
Sommer 1995 wurden in einem Kabinettsbeschluss daher Folgendes bekannt gegeben:<br />
„Am <strong>Obersalzberg</strong> soll in Zusammenarbeit mit dem <strong>Institut</strong> für Zeitgeschichte<br />
eine Dokumentationsstätte entstehen, deren Träger die Berchtesgadener<br />
Landesstiftung sein soll. Das Staatsministerium für Finanzen wurde beauftragt,<br />
das Nutzungskonzept in enger Abstimmung mit dem Markt Berchtesgaden und<br />
dem Landkreis Berchtesgaden umzusetzen.“ 156<br />
4.1.3.1 Dokumentation <strong>Obersalzberg</strong><br />
Für die Dokumentationsstätte wurde ein neues Gebäude auf dem Gelände des ehemaligen<br />
Parteigästehauses errichtet, welches auch einen Zugang zum unterirdischen Bunkersystem<br />
bietet. Der Fachbeirat zur Errichtung der Dokumentationsstätte bestand aus Vertretern der<br />
örtlichen Politik, Regierungsvertretern (je ein Vertreter des Innen-, des Kultus- und des<br />
Finanzministeriums) und Historikern. Geleitet wurde er von Prof. Möller, Leiter des <strong>Institut</strong>s<br />
für Zeitgeschichte in München. Das Konzept der Dokumentation, die nach der Eröffnung<br />
großes Lob erfuhr, war zunächst Opfer von Kritik. Als Verharmlosung wurde die Ausstellung<br />
noch vor ihrer Eröffnung 1999 vom Leiter des Simon-Wiesenthal-Zentrums, Shimon<br />
Samuels, verurteilt. 157 Doch nicht nur Angst um die Sommertouristen, vor der rechten Szene<br />
oder vor Verharmlosung schwang in den Bedenken gegen die Dokumentation mit. Es wurde<br />
auch Kritik geübt, weil in der Dokumentation der Holocaust gezeigt wird, der am<br />
<strong>Obersalzberg</strong> selbst nicht stattgefunden habe. Hier konnten die Historiker jedoch auf den<br />
Unterschied zwischen Opfer- und Täterort hinweisen:<br />
„[...] die Historiker sehen in der Dokumentation <strong>Obersalzberg</strong> auch keine reine<br />
Gedenkstätte für die Opfer des verbrecherischen Regimes. Sie zeigen die Stätte<br />
der Täter, die sich in der schönsten Berglandschaft Oberbayerns einnisteten, um<br />
von hier aus ihre menschenverachtende Politik zu betreiben.“ 158<br />
Die Dokumentation <strong>Obersalzberg</strong> wurde am 20. Oktober 1999 eröffnet. Auftraggeber war der<br />
Freistaat Bayern, Konzept und Realisation wurden vom <strong>Institut</strong> für Zeitgeschichte<br />
übernommen. Träger der Dokumentation ist die Berchtesgadener Landesstiftung. Das<br />
Konzept der Ausstellung richtet sich bewusst an historische Laien und verzichtet bis auf eine<br />
Gegenüberstellung von zwei Bildern im „Prolog“ auf emotionale Ansprachen und ist streng<br />
156<br />
Chaussy; Püschner 1997, S. 200.<br />
157<br />
Vgl.: Schostack 1997, S. 43.<br />
158<br />
Dultz 2000.<br />
47
Fallbeispiele – <strong>Obersalzberg</strong><br />
dokumentarisch angelegt. 159 Der Weg durch die Ausstellung ist in die Themenabschnitte<br />
„Prolog“, „<strong>Obersalzberg</strong>“, „Der Führer“, „Die Volksgemeinschaft“,<br />
„Rassenpolitik/Judenverfolgung/Völkermord“, „Widerstand und Emigration“, „Hitlers<br />
Außenpolitik“, „2. Weltkrieg“, „Bunkeranlage“ und „1945 bis heute“ eingeteilt. Die<br />
Dokumentation ist recht umfangreich angelegt, hat sich aber bewusst nicht nur auf die<br />
Vorgänge am <strong>Obersalzberg</strong> beschränkt, da diese Auswahl nur ein unvollständiges und nach<br />
dem Zufallsprinzip angelegtes Bild des Nationalsozialismus vermittelt hätte. Mit Bezug auf<br />
die Besonderheit des Ortes als zweitem Regierungssitz wird in der Dokumentation erstmals in<br />
Deutschland die Gesamtheit des nationalsozialistischen Systems in einer Ausstellung<br />
gezeigt. 160 Auch die faszinierenden Seiten des NS-Regimes werden beleuchtet und die<br />
angeblich heile Welt gezeigt. Ein Aspekt, der in Verknüpfung mit den anderen Themen,<br />
einem Täterort angemessen scheint. Als einen solchen definiert auch die Ausstellung den<br />
<strong>Obersalzberg</strong>:<br />
„Der <strong>Obersalzberg</strong> war in diesem doppelten Sinn ein Täterort: Hier wurden im<br />
kleinsten Kreis Verbrechen größten Ausmaßes ersonnen, besprochen und geplant,<br />
nicht aber begangen. Am <strong>Obersalzberg</strong> war der Blick demgemäß primär auf die<br />
Täter zu richten, aber eben nicht nur auf das, was sie am <strong>Obersalzberg</strong> sichtbar<br />
taten, sondern auch und vor allem auf das, was sie hier hinter der Fassade<br />
beschäftigte, auf ihr ganzes Denken und Tun, das in den Völkermord und die<br />
Katastrophe des Zweiten Weltkriegs führte.“ 161<br />
Der Besucher geht von oben über eine Galerie in die tieferliegenden Geschosse des Gebäudes,<br />
welches den Weg von der scheinbar heilen Welt in den Terror symbolisch verdeutlichen soll.<br />
Die Dokumentationsstätte bekam nach der Eröffnung durchgängig gute Kritiken von Presse<br />
und Öffentlichkeit, genau wie der Begleitband „Die tödliche Utopie“ 162 :<br />
„Was Hörst Möller bei der Eröffnung über den vorzüglichen, ein neuartiges<br />
Kompendium darstellenden Begleitband sagte, jeder Interessent könne damit<br />
‚eine sichere Kenntnis über diese Epoche der deutschen Geschichte gewinnen’,<br />
gilt auch für die Ausstellung. Gerade weil sie überschaubar ist, dazu mit dem<br />
Auto und zu Fuß leicht zu erreichen – nicht unwesentlich in diesem Hauptgebiet<br />
des Tourismus –, dürfte sie auch ein Publikum anziehen, das sonst kaum<br />
historische Ausstellungen besucht.“ 163<br />
Aus dem Jahresbericht 2005 geht hervor, dass die Erwartungen nach der Eröffnung bei<br />
Weitem übertroffen wurden. Bis Ende 2005 kamen 783.188 Besucher, bei der Eröffnung 1999<br />
159<br />
O.V.: Internetseite der Dokumentation <strong>Obersalzberg</strong>, Die Ausstellung, Info, Weg durch die Dokumentation.<br />
Online im Internet unter<br />
http://www.obersalzberg.de/cms_d/content/de_ausstellung_exponatverzeichnis/der_weg.html [06.08.2006].<br />
160<br />
Vgl.: Dahm 2002.<br />
161<br />
O.V.: Internetseite der Dokumentation <strong>Obersalzberg</strong>, Die Ausstellung, Info, Konzeption. Online im Internet<br />
unter http://www.obersalzberg.de/cms_d/content/de_ausstellung_exponatverzeichnis/konzeption.html<br />
[18.05.2006].<br />
162<br />
Möller 1999.<br />
163 Schostack 1999, S. 43.<br />
48
Fallbeispiele – <strong>Obersalzberg</strong><br />
hatte man auf jährlich 30.000 Besucher gehofft. Ca. 20 Prozent der Besucher sind Ausländer,<br />
für die ein Audioguide in Deutsch und Englisch zur Verfügung steht; Texthefte gibt es auf<br />
Französisch sowie weitere Informationen in 18 Sprachen. 164 Seit der Eröffnung der<br />
Ausstellung wurde außerdem ein neuer Erweiterungsbau in Betrieb genommen, in dem<br />
Schulklassen ihren Besuch vor- und nachbereiten können, und auch der Zugang zu den<br />
Bunkeranlagen wurde erweitert. Trotz der anfänglichen Kritik hat sich die Dokumentation zu<br />
einem viel besuchten Zentrum entwickelt, das die Geschichte des <strong>Obersalzberg</strong>s und des<br />
Nationalsozialismus angemessen darstellt. Damit ist nach jahrelanger Vernachlässigung der<br />
Vergangenheit endlich eine Dokumentation eingerichtet worden, die das Interesse der<br />
Besucher am historischen Täterort sowie die touristisch ansprechende Umgebung nutzt und<br />
der Neugierde mit seriösen Informationen begegnet.<br />
4.1.3.2 Intercontinental Berchtesgaden<br />
Schnell war man sich in der Region einig, dass auch die Liegenschaften des ehemaligen<br />
Sperrgebietes wieder touristisch genutzt werden sollten. Der Tourismus hat eine lange<br />
Tradition und ist auch heute noch die Haupteinnahmequelle der Region. Daher suchte der<br />
Freistaat Bayern nach einem privaten Investor für eine Hotelanlage auf dem <strong>Obersalzberg</strong>.<br />
Dabei war schon von Anfang an klar, dass dieses Gelände mit dem Erbbaurecht vergeben<br />
werden sollte. Durch dieses Verfahren wollte man sich gegen zukünftigen Extremismus<br />
schützen. 165 Zunächst wurde die „Gewerbegrund Projektentwicklungsgesellschaft“, eine<br />
Tochtergesellschaft der Bayerischen Landesbank, eingesetzt. 166 Diese sorgte für den Abriss<br />
des ehemaligen Hotels General Walker und der umliegenden Liegenschaften und baute für 70<br />
Millionen Mark ein Luxushotel auf dem ehemaligem Göring-Hügel. Betreiber des Hotels ist<br />
die US-Kette Intercontinental. 167 Die Entscheidung für die Errichtung eines Hotels auf dem<br />
<strong>Obersalzberg</strong> wurde verständlicherweise mit größerem Misstrauen betrachtet, als die<br />
Einrichtung der Dokumentation. Selbst die „New York Times“ wurde auf das Projekt<br />
aufmerksam. 168 Viele Reporter reisten an, um den Ort nach dem „braunen Gedankengut“<br />
verdächtigen Materialien zu durchkämmen. Dabei hatten selbst die ehemaligen Wortführer<br />
der Bürgerinitiative für eine Dokumentationsstätte nichts gegen das Hotel einzuwenden.<br />
Durch die Dokumentation sei sichergestellt, dass die Vergangenheit am <strong>Obersalzberg</strong> nicht<br />
einfach vergessen werde und ein Hotel sei eine große Chance für den Fremdenverkehr, waren<br />
164 Vgl.: Dokumentation <strong>Obersalzberg</strong> 2005, S. 4ff.<br />
165 Vgl.: Finkenzeller 1995a, S. 6.<br />
166 Vgl.: Knust 1999, S. 14.<br />
167 Vgl.: Schmalz 1999.<br />
168 Vgl.: Knöfel 2004, S. 145.<br />
49
Fallbeispiele – <strong>Obersalzberg</strong><br />
die Aussagen von Martin Rasp und Kurt Smetana von der Bürgerinitiative. 169 Der<br />
Fremdenverkehr hatte tatsächlich nach dem Abzug der Amerikaner zu leiden: Leer stehende<br />
Hotels und ein Rückgang der Übernachtungen um 33 Prozent waren die Folgen. 170 Das neue<br />
Hotel öffnete seine Pforten im Frühjahr 2005. Im Vorfeld wurde die Eröffnung an diesem<br />
Standort als „unsensibel“ verurteilt, u.a. von Florian Beierl, dem Verfasser von „Hitlers<br />
Berg“. 171 Allerdings gingen die Betreiber nicht völlig gedankenlos mit der Vergangenheit um.<br />
Bis ins kleinste Detail bemühte man sich, keine Assoziationen beim Interieur an die Häuser<br />
der Nationalsozialisten aufkommen zu lassen: Die Angestellten sollten beispielsweise keine<br />
Uniformen haben, die an Braunhemden erinnern. Auch sonst sorgte man dafür, dass Personal<br />
zu schulen und keine rechtsextremen Gruppen im Hotel übernachten zu lassen. 172 Dass an<br />
solch einem Ort zwar für alles gesorgt sein kann, sich aber trotzdem bestimmte Assoziationen<br />
einstellen, beschreibt Peter Roos mit einiger Süffisanz in seinem Artikel über den 20. April –<br />
Hitlers Geburtstag – im Hotel: „Was an dieser Stelle waltet, ist jenseits von Esoterik und<br />
Hysterie kulturelles Gedächtnis, das jede Assoziation zur Konnotation macht.“ 173 Auf der<br />
Homepage des Hotels gibt es einen Link „Geschichte“, der ausführlich über die Entwicklung<br />
des Tourismus am <strong>Obersalzberg</strong>, die Umwandlung zum Führersperrgebiet und die<br />
Geschehnisse nach 1945 berichtet. 174 Das Hotel profitierte auch von der gut laufenden<br />
Dokumentation. Insgesamt scheint eine gute Zusammenarbeit zwischen beiden Einrichtungen<br />
zu bestehen. Anfang 2006 spendete das Hotel 4.000 Euro an die Dokumentation. 175 Auch die<br />
Dokumentationsstelle unterstützte das Hotel, indem es Presseanfragen zur Hoteleröffnung<br />
beantwortete und neue Besuchergruppen für die Dokumentation erwartete. 176 Im Hotel selbst<br />
liegt das Buch zur Dokumentation aus und es gibt einen Shuttle-Service dorthin. Die<br />
Zusammenarbeit zwischen Hotel und Dokumentation beruht auf dem schon vorher<br />
beschlossenen Zwei-Säulen-Konzept am <strong>Obersalzberg</strong>. Dieses besagt konkret, dass die<br />
Nachnutzung auf zwei Säulen beruhen soll, nämlich die Errichtung einer Dokumentation und<br />
der zivilen Nachnutzung. 177 Ohne Dokumentation wäre also auch kein Hotel entstanden. Eine<br />
solche „Funktionsteilung“ in „Luxus, Kommerz und Zukunft“ gegenüber „professioneller<br />
169 Vgl.: Asmuth 2001.<br />
170 Vgl.: Rietzschel 2001, S. R1.<br />
171 Vgl.: Kellerhoff 2004.<br />
172 Vgl.: Ebenda.<br />
173 Roos 2005.<br />
174 Vgl.: O.V.: Internetseite des Intercontinental Berchtesgaden, Geschichte. Online im Internet unter<br />
http://www.berchtesgaden.intercontinental.com/Geschichte [06.08.2006].<br />
175 Vgl.: O.V.: Presseinformation des Intercontinental Berchtesgaden vom 27.01.2006. Online im Internet unter<br />
http://www.obersalzberg.de/cms_d/content/de_presse/index.html [18.05.2006].<br />
176 Vgl.: Dokumentation <strong>Obersalzberg</strong> 2005, S. 7f.<br />
177 Vgl.: O.V.: Presseinformation des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen vom 20.10.1999. Online im<br />
Internet unter http://www.obersalzberg.de/cms_d/content/de_presse/ [15.08.2006].<br />
50
Fallbeispiele – <strong>Obersalzberg</strong><br />
Vergangenheitsbewältigung“ mögen Kritikern verurteilen 178 , ist aber sicher noch die beste<br />
Variante, beide Nutzungen anzubieten. Daher kann für den <strong>Obersalzberg</strong> gesagt werden, dass<br />
eine touristische Nachnutzung des Täterortes durchaus angemessen ist, da sie zum einen an<br />
die Ursprünge des Ortes anknüpft und in Zusammenarbeit mit der historischen<br />
Dokumentation steht.<br />
Ein ganz normales Hotel wird es an einem Täterort sicher nicht geben, aber einen<br />
unangemessenen Umgang mit dem Standort und seiner Vergangenheit kann man den<br />
Betreibern nicht vorwerfen. Jeder Gast muss selbst entscheiden, ob er an diesem Ort Luxus<br />
genießen möchte. Daher ist das Fazit von Guido Heinen richtig: „Es herrscht nicht<br />
Belehrung, sondern ein faires Angebot zur historischen Einsicht. Es ist ein gutes Konzept.“ 179<br />
4.1.3.3 Weitere touristische Nutzungen<br />
Schmundt weist in seinem Essay zum <strong>Obersalzberg</strong> darauf hin, dass es sich eigentlich sogar<br />
um eine dreiteilige Quersubvention handelt: „Zwei-Säulen-Modell wurde das genannt, aber<br />
eigentlich steht es auf drei Säulen. Denn die Dokumentation wird wiederum durch das<br />
Kehlsteinhaus abgesichert, dessen Pachteinnahmen in die Landesstiftung fließen.“ 180 Das<br />
Kehlsteinhaus ist eine Attraktion, die Touristen anlockt, zumal es das einzig erhaltene<br />
Bauwerk aus dem „Dritten Reich“ am <strong>Obersalzberg</strong> ist. Auch die Stadt Berchtesgaden wirbt<br />
auf ihrer Website mit dem überwältigendem Panorama. Auf der Überblicksseite ist allerdings<br />
kein Hinweis auf die ursprüngliche Funktion des Hauses zu finden, aber ein Link zur<br />
Dokumentation. 181<br />
Einen weitaus weniger guten Ruf als die vorgestellten Nutzungen am <strong>Obersalzberg</strong> hat das<br />
Hotel „Zum Türken“. Dies ist vor allem darauf zurückzuführen, dass das Hotel aus der<br />
braunen Vergangenheit kräftig Kapital schlägt. Gegen Eintritt bekommt man Zutritt zu einem<br />
Teil der Bunkeranlagen – angeblich zu Gefängniszellen und Schießscharten des ehemaligen<br />
Führerbunkers –, in dessen Gängen aber keine Informationen sind und außer Schmierereien<br />
an den Wänden nichts zu sehen ist. Über den unseriösen Umgang mit der Geschichte sind die<br />
Macher der Dokumentation wenig begeistert. 182 Verbieten kann man diese Art des Umgangs<br />
mit der Vergangenheit nicht, nur hoffen, dass ein Großteil der Besucher auch die seriöse<br />
Dokumentation besuchen wird.<br />
178 Vgl.: Schmundt 1999, S. 42.<br />
179 Heinen, G. 2005.<br />
180 Schmundt 1999, S. 47.<br />
181 Vgl.: O.V.: Internetseite von Berchtesgaden, Kehlsteinhaus. Online im Internet unter<br />
http://www.berchtesgaden.de/de/1e6837ca-4fe4-1410-67ce-7e4df200811c.html [04.09.2006].<br />
182 Vgl.: Kellerhoff 2004.<br />
51
Fallbeispiele – <strong>Obersalzberg</strong><br />
Die verschiedenen Nutzungen am <strong>Obersalzberg</strong> zeigen, wie schwierig sich ein Umgang mit<br />
der Geschichte vor allem bei einem solch großen Areal gestaltet. Die Einrichtung der<br />
Dokumentationsstätte war auch von Seiten des Staates längst überfällig. Hier wurde jahrelang<br />
die Verantwortung beiseite geschoben. Erst auf Druck aus der Bevölkerung, vor allem der<br />
Bürgerinitiative für eine Dokumentationsstätte, und bei akutem Handlungsbedarf durch den<br />
Abzug der Amerikaner, wurde die Landesregierung aktiv. Die Verdrängung der Geschichte<br />
hatte bis dahin aber keinen Erfolg gehabt. Die Flut der unseriösen Broschüren zeigt, dass der<br />
Wohnort Hitlers und seiner engsten Vertrauten aus der Parteispitze weiterhin das Interesse der<br />
Touristen hervorriefen. Mit der Dokumentation <strong>Obersalzberg</strong> ist nun endlich ein Gegenpol<br />
zur Mystifizierung vorhanden. Der große Besucherandrang dort kann als Indiz für eine gut<br />
gemachte Ausstellung sowie das Bedürfnis der Touristen nach seriösen Informationen gelten.<br />
Mit der Errichtung eines Nobelhotels auf „Hitlers Berg“ wurde aber auch die Frage nach einer<br />
Neunutzung eines Täterortes gestellt. Einwende gegen das Hotel sind jedoch gerade in Bezug<br />
auf die lange Tradition des Tourismus am <strong>Obersalzberg</strong> und die Vorbedingung des Zwei-<br />
Säulen-Modells zurückzuweisen. Eine Nutzung des Täterortes in Verbindung mit historisch<br />
korrekten Informationen ist ein besserer Beitrag zur Entmystifizierung des Ortes als die<br />
Verdrängung. Die Aura des Ortes wird hierbei genutzt, aber zum ersten Mal wird der<br />
Anziehungskraft durch wirkliche Aufklärung über die Geschehnisse entgegengewirkt.<br />
„Noch ein Ziel wurde durch die Neugestaltung des <strong>Obersalzberg</strong>s erreicht: Der<br />
abenteuerliche Forschertourismus im Dickicht des Bergs ist reduziert worden, es<br />
gibt keine Öffnungen mehr im Waldboden, durch die man in moderige Keller und<br />
Gänge des ehemaligen <strong>Obersalzberg</strong>komplexes einsteigen kann.“ 183<br />
Nur der ehemalige Ort des Berghofes ist unmarkiert und zieht immer noch Menschen an.<br />
Szenen von diesem Ort beschreibt Schmundt sehr anschaulich in seinem Essay „Am<br />
Berghof“. 184 Auch wenn hier nichts zu sehen ist, außer an manchen Tagen Kerzen, welche<br />
einige Unverbesserliche aufgestellt haben, zeigt diese Leerstelle, dass man Geschichte nicht<br />
einfach verdrängen kann. Thomas Rietzschel monierte schon vor dem Hotelbau fehlende<br />
Informationen an der Stelle des Berghofes. Durch eine einfache Tafel wäre zu vermeiden,<br />
„[...] daß die hervorragend gestaltete Dokumentation den peinlichen Eindruck<br />
einer Alibiveranstaltung erweckt und es scheint, als habe man mit ihr den ganzen<br />
<strong>Obersalzberg</strong> entschulden wollen, um endlich wieder Baufreiheit für den<br />
geschichtsneutralen Tourismus schaffen zu können.“ 185<br />
Eine Hinweistafel wäre besser, als den Ort sich selbst und damit der Gefahr der<br />
fortwährenden Mystifizierung zu überlassen.<br />
183 Beierl 2004, S. 156.<br />
184 Vgl.: Schmundt 2005, S. 30ff.<br />
185 Rietzschel 2001, S. R3.<br />
52
4.2 Villa ten Hompel<br />
Fallbeispiele – Villa ten Hompel<br />
Die Villa ten Hompel wurde als Beispiel in diese Arbeit aufgenommen, um zu zeigen, dass<br />
auch an weniger bekannten Täterorten eine historische Nachnutzung entstehen kann, die zur<br />
Aufklärung über die Geschichte beiträgt. Die Geschichte und die Debatte der Villa ten<br />
Hompel sind gut dokumentiert, vor allem durch die heutigen Mitarbeiter des „Geschichtsort<br />
Villa ten Hompel“, welche nach „Entdeckung“ der Villa engagierte Vorkämpfer für eine<br />
Dokumentation an diesem Ort waren. In den folgenden Abschnitten werden zunächst die<br />
Geschichte des Hauses und die Entstehung des Täterortes vorgestellt. Dabei wird auch kurz<br />
auf die Funktion der Ordnungspolizei im „Dritten Reich“ eingegangen, um die Konzeption<br />
der Gedenkstätte verständlich zu machen. Anschließend wird die Nutzung der Villa nach<br />
1945 geschildert, wobei der Fokus auf die in den 1990er Jahren entstandene Debatte um die<br />
Einrichtung der Gedenkstätte gelegt wird. Abschließend werden Konzeption und Umsetzung<br />
des Lernortes vorgestellt und die aktuellen Probleme beleuchtet.<br />
4.2.1 Geschichte des Hauses – Von der Industriellen-Villa zur Polizeidienststelle<br />
Abbildung 4: Villa ten Hompel. Quelle: Internetseite der Villa ten Hompel. (Christoph Spieker, 2002).<br />
Online im Internet unter http://www.muenster.de/stadt/villa-ten-hompel/ [18.09.2006].<br />
Die Villa ten Hompel in der Stadt Münster wurde in den Jahren 1925 bis 1928 gebaut. Die<br />
Villa ist bis heute ein repräsentativer Bau (vgl. Abbildung 4) im klassizistisch-barocken Stil<br />
und „[...] Ausdruck für den konservativen Geist der Provinzialstadt in dieser Zeit.“ 186<br />
Bauherr des Gebäudes am Kaiser-Wilhelm-Ring 28 war der Zentrumsabgeordnete Rudolf ten<br />
Hompel. 187 Der Wicking-Konzern, dessen Inhaber ten Hompel war, war in den 1920er Jahren<br />
der größte Zementkonzern in Deutschland. Der Fabrikant machte neben seiner<br />
wirtschaftlichen auch eine steile politische Karriere und war von 1920 bis 1928<br />
186 Gorschenek 1983.<br />
187 Vgl. zu Rudolf ten Hompel: Kenkmann 2003, S. 19f.<br />
53
Fallbeispiele – Villa ten Hompel<br />
Reichstagsmitglied. 1931 geriet ten Hompel durch getätigte Investitionen in<br />
Zahlungsschwierigkeiten und musste seinen Konzern abgeben. Die Villa ging 1941 in den<br />
Besitz des Reichsfiskus über. Von 1941 bis 1944 residierte der Befehlshaber der<br />
Ordnungspolizei (BdO) des Wehrkreises IV in der Villa ten Hompel.<br />
Spätestens seit der so genannten Goldhagen-Debatte sind auch die Ordnungspolizei und ihre<br />
Polizeibataillone in den Blick der NS-Forschung geraten. Diese Gruppierung als Täter im NS-<br />
Staat war bis dahin ein relativ unerforschtes Gebiet. Eine der ersten ausführlichen Arbeiten zu<br />
diesem Thema wurde 1992 von Christopher R. Browning unter dem Titel „Ordinary Men“<br />
vorgelegt. Das Werk beschäftigt sich mit dem Reserve-Polizeibataillon 101 aus Hamburg und<br />
wurde 1993 auch in deutscher Übersetzung herausgegeben. 188<br />
4.2.1.1 Rolle der Ordnungspolizei im „Dritten Reich“<br />
Nach der Machtübernahme wurde die in der Weimarer Republik auf die Länder verteilte<br />
Polizeihoheit zentralisiert. 189 Der Reichsführer SS, Heinrich Himmler, wurde 1936 von Hitler<br />
zum Chef der Deutschen Polizei ernannt. Die Polizei wurde in zwei Hauptämter aufgeteilt, in<br />
die Sicherheitspolizei und die Ordnungspolizei. Zur Sicherheitspolizei gehörten die Geheime<br />
Staatspolizei (Gestapo) und die Kriminalpolizei. Chef der Sicherheitspolizei war Reinhard<br />
Heydrich. Die Ordnungspolizei unterstand Kurt Daluege und setzte sich aus den städtischen<br />
Schutzpolizeieinheiten, den Gendarmerieverbänden auf dem Lande und der Gemeindepolizei<br />
zusammen. Durch die zunehmende Zerstörung der deutschen Städte, das verschärfte<br />
Vorgehen der Nationalsozialisten auch gegen die eigene Bevölkerung sowie die Ausfälle<br />
durch den Einzug zur Wehrmacht herrschte seit Kriegsbeginn Personalmangel bei der<br />
Ordnungspolizei. Dieser wurde überwunden, indem auch ältere Jahrgänge, so genannte<br />
Reservisten, eingezogen wurden. Zudem gab es viele freiwillige Meldungen, weil man hoffte,<br />
so die Wehrpflicht umgehen zu können. Mit Kriegsbeginn wurden innerhalb der<br />
Ordnungspolizei Polizeibataillone gebildet, die jeweils fünfhundert Mann umfassten. Von den<br />
21 Bataillonen wurden 13 der Wehrmacht zugeteilt. Diese mussten in den Ostgebieten, vor<br />
allem in Polen und dem heutigen Tschechien, die Wehrmacht unterstützen. Bestanden die<br />
Bataillone hauptsächlich aus älteren Reservisten wurden sie Reserve-Polizeibataillone<br />
genannt. Die Ordnungspolizei war nicht nur zur Unterstützung der kämpfenden Truppen da<br />
und sorgte für Ordnung, sondern sie war auch massiv an der Vorbereitung und Durchführung<br />
des Holocaust beteiligt.<br />
188<br />
Der deutsche Titel des Werks lautet „Ganz normale Männer“ und wurde 1993 beim Rowohlt-Verlag<br />
veröffentlicht.<br />
189<br />
Vgl. zum Aufbau der Polizei im Nationalsozialismus: Browning 1993, S. 23-28 und Lichtenstein 1990,<br />
S. 18-28.<br />
54
Fallbeispiele – Villa ten Hompel<br />
„Das Spektrum reicht von der Zusammenarbeit mobiler Polizeibataillone mit<br />
Sicherheitspolizei, SD, Wehrmacht und einheimischen Helfern im Rahmen der<br />
‚Befriedung’ und ‚Entjudung’ über den täglichen Terror stationärer<br />
Dienststellen, etwa der Gendarmerie, gegen die Zivilbevölkerung bis hin zur<br />
Beteiligung an Deportationen, der Bewachung von Ghettos oder den<br />
Menschenjagden auf entflohene Juden.“ 190<br />
Dabei kam der Ordnungspolizei gerade beim Einsatz im Osten eine tragende Rolle zu: „Die<br />
Ordnungspolizei entwickelte sich rasch zu einem wichtigen Reservoir von Einsatzkräften, die<br />
zur Niederhaltung des von Deutschland besetzten Europas gebraucht wurden.“ 191<br />
Neben dem Einsatz im Osten gehörten die Deportation von jüdischen Bürgern, die<br />
Überwachung von Arbeitserziehungslagern und der Luftschutz in den Wehrkreisen vor Ort zu<br />
den Aufgaben der Ordnungspolizei. 192 Die Deportationen wurden zwar von der<br />
Sicherheitspolizei organisiert, doch die Bewachung der Transporte fiel der Ordnungspolizei<br />
zu. Der BdO in Münster war für die Transporte von Dortmund, Münster, Düsseldorf und Köln<br />
zuständig. Außerdem musste die Ordnungspolizei insbesondere in den ländlichen Gebieten<br />
„vorbereitende Maßnahmen“ der Deportation durchführen, worunter das Abholen und die<br />
Verbringung zur Sammelstelle zu verstehen sind. Als Bewacher der Arbeitserziehungslager<br />
war die Ordnungspolizei besonders bei den ausländischen Fremdarbeitern für die<br />
Verschlechterung der Lebensbedingungen verantwortlich.<br />
4.2.1.2 Der Wehrkreis IV<br />
Das Deutsche Reich war in verschiedene Wehrkreise eingeteilt. Der Wehrkreis IV entsprach<br />
ungefähr dem heutigen Nordrhein-Westfalen und war der größte und bevölkerungsreichste<br />
Wehrkreis im damaligen Reichsgebiet. 193 Erster Inspekteur der Ordnungspolizei (IdO) im<br />
Wehrkreis IV wurde 1936 der Oberst der Schutzpolizei Becker. 194 Die IdO sollten in ihrem<br />
jeweiligen Wehrkreis die Kriegsvorbereitungen der uniformierten Polizei beaufsichtigen. Der<br />
Titel IdO wurde 1940 durch BdO ersetzt. 1939 wurde Dr. Heinrich Lankenau 1939 zum IdO<br />
in Münster ernannt. Dieser verrichtete seine Arbeit in der Villa ten Hompel. Interessant ist<br />
Lankenau besonders, weil er im Jahre 1957 ein Buch mit dem Titel „Polizei im Einsatz<br />
während des Krieges 1939/45 in Nordrhein-Westfalen“ veröffentlichte. Darin schildert er die<br />
Arbeit der Ordnungspolizei, erwähnt aber mit keinem Wort ihre Beteiligung an der<br />
nationalsozialistischen Vernichtungspolitik. Als BdO müssen ihm jedoch die Taten seiner<br />
Untergebenen in den besetzten Gebieten bekannt gewesen sein. Zudem befand sich die<br />
190<br />
Matthäus 2002, S. 166f.<br />
191<br />
Browning 1993, S. 26.<br />
192<br />
Vgl. hierzu jeweils: Determann 1996, Lotfi 1996a und Lotfi 1996b.<br />
193<br />
Vgl.: Lotfi 1996b, S. 79.<br />
194<br />
Vgl. zu den einzelnen Befehlshabern Spieker 2001b und zu Lankenau Spieker 2001a.<br />
55
Fallbeispiele – Villa ten Hompel<br />
Sammelstelle für die Juden in Münster nur wenige hundert Meter von der Villa ten Hompel<br />
entfernt. Lankenau folgten noch drei weitere BdO für den Wehrkreis IV. Allerdings wurde die<br />
Hauptdienststelle 1944 von Münster nach Kaiserswerth verlegt.<br />
Die Vergehen der Ordnungspolizei sind in diversen Publikationen nachgewiesen worden.<br />
Auch verschiedene Polizeibataillone des Wehrkreises IV haben sich aktiv am Völkermord<br />
beteiligt. Stefan Klemp schildert in seiner Studie „Freispruch für das ‚Mord-Bataillon’“ den<br />
Weg und die Tätigkeiten des Bataillons 61. Dieses Bataillon stammte aus dem Ruhrgebiet.<br />
Neben Massenexekutionen und Partisanenjagd bewachte es das Warschauer Ghetto und<br />
verübte dort Exzesstaten. 195 Weitere Vergehen und die Beteiligung am Holocaust sind<br />
dokumentiert: So standen 1967 Angehörige eines Bataillons aus Köln vor Gericht, weil sie<br />
mindestens 250 Juden erschossen hatten und durch das Einsperren und Anzünden einer<br />
Synagoge noch einmal mindestens achthundert Menschen ums Leben kamen. Weitere<br />
Bataillone nahmen an Massenerschießungen teil. 196 Dennoch gelang es den ehemaligen<br />
Angehörigen ihre Taten weitgehend zu verschweigen und zu verdrängen, so dass die<br />
Beteiligung der Ordnungspolizei am Holocaust erst spät ein Thema der NS-Forschung wurde.<br />
„Die Arbeit verteilte sich auf eine weitverzweigte Bürokratie, und jeder konnte sich einreden,<br />
nur eine Rädchen im immensen Getriebe zu sein. Daher bezeichneten sich Beamte, Schreiber<br />
oder uniformierte Wachmänner im nachhinein nie als Täter“ 197 , beschreibt Raul Hilberg den<br />
arbeitsteiligen Völkermord und die daran beteiligten Personen. Zu den Tätern, die ihre Taten<br />
verdrängten, gehörte auch der ehemalige BdO Lankenau, wie er mit seinem Buch bewies.<br />
Die aufgeführten Tätigkeiten der Ordnungspolizei dürften genügen, um das Ausmaß der<br />
verbrecherischen Handlungen zu verdeutlichen.<br />
„Festzuhalten bleibt, daß die Ordnungspolizei, so sehr sie auch in die Verbrechen<br />
der Gestapo und Kriminalpolizei auf Anordnung der Sicherheitsbehörden<br />
eingebunden wurde, aufgrund der ihr verbliebenen Eigenständigkeit in bezug auf<br />
ihre Befehlshierarchie und die selbständige Ausführung der übertragenen<br />
‚Pflichten’ Mitverantwortung trug.“ 198<br />
Der BdO ist somit als ein so genannter Schreibtischtäter mittlerer Ebene anzusehen. Er war<br />
verantwortlich für die Aufstellung der Polizeibataillone sowie für deren Besoldung,<br />
Unterkunft, Ausrüstung, Ausbildung, Führung und Ersatzstellung. Der BdO erhielt nach dem<br />
Einsatz Abschriften der Kriegstagebücher und Tätigkeitsberichte von seinen Untergebenen. 199<br />
Damit war der BdO eindeutig im Bilde über die Vorgehensweise im Holocaust und somit<br />
195 Vgl.: Klemp 1998.<br />
196 Vgl.: Nachtwei 1996, S. 62ff.<br />
197 Hilberg 1992, S. 9.<br />
198 Lotfi 1996a, S. 27.<br />
199 Vgl.: Nachtwei 1996, S. 56.<br />
56
Fallbeispiele – Villa ten Hompel<br />
„[...] Mitorganisator des nationalsozialistischen Völkermordes.“ 200 Nach 1945 beriefen sich<br />
die Mitglieder der Ordnungspolizei, wenn sie wegen ihrer Taten im Polizeidienst angeklagt<br />
wurden, meist auf den angeblichen Befehlsnotstand. Allerdings sind keine Fälle bekannt, in<br />
denen die Verweigerung der Teilnahme an den verbrecherischen Handlungen eine wirkliche<br />
Gefahr nach sich gezogen hat. Lediglich eine Strafversetzung oder schlechtere<br />
Karrierechancen waren die Folge. 201<br />
4.2.2 Sitz der Bezirksregierung und der Wiedergutmachungsbehörde<br />
In der Schriftenreihe der Villa ten Hompel wurden verschiedene Aufsätze zur Weiternutzung<br />
des Gebäudes in der Bundesrepublik Deutschland veröffentlicht, so dass auch diese Periode<br />
gut dokumentiert ist. Von 1945 bis 1953 waren weiterhin die Polizeibehörden in der Villa ten<br />
Hompel untergebracht. 202 Mit dem Einmarsch der Alliierten wurde die Polizeiverwaltung<br />
dezentralisiert. Sie sollte den neu ernannten Regierungspräsidenten unterstellt werden und<br />
sich auf ausschließlich exekutive Funktionen beschränken. Um die polizeiliche Arbeit auch<br />
über die Kreis- und Bezirksgrenzen besser regulieren zu können, wurden überregionale<br />
Koordinierungsstellen eingerichtet, deren Chef der so genannte Landespolizeipräsident<br />
wurde. Sowohl der Landespolizeipräsident als auch der Polizeipräsident der Stadt Münster<br />
hatte seinen Sitz in der Villa ten Hompel. Die Kriminalpolizei wurde ebenfalls von den<br />
britischen Alliierten neu geordnet. „Das Zentrum der Kriminalpolizei für Westfalen,<br />
Schaumburg-Lippe und Lippe-Detmold wurde in der Villa ten Hompel in Münster<br />
angesiedelt, denn die Briten bestanden auf einer sichtbaren Trennung von der örtlichen<br />
Kriminalpolizei.“ 203 Das Kriminalpolizeiamt in Münster wurde jedoch schon 1946 wieder<br />
aufgelöst und mit dem Amt in Düsseldorf zusammengelegt. Als eine weitere Untergruppe der<br />
Polizei blieb die Wasserschutzpolizei bis 1953 in der Villa ten Hompel. Nachdem das Land<br />
Nordrhein-Westfalen seine volle Souveränität erhielt, wurde die Polizei reorganisiert und der<br />
Sitz der Wasserschutzpolizei nach Duisburg verlegt.<br />
Hatte bis ins Jahr 1953 noch eine Kontinuität von polizeilichen Dienststellen in der Villa ten<br />
Hompel bestanden, waren die neuen „Bewohner“ danach nicht mehr der Polizei zuzuordnen.<br />
Verschiedene Abteilungen der Bezirksregierungen kamen in den folgenden Jahren dort unter:<br />
das Dezernat für Veterinärangelegenheiten, das Gemeindeprüfungsamt, das Staatliche<br />
Gewerbeaufsichtsamt und das Enteignungsdezernat. Außerdem war die<br />
200 Nachtwei 1996, S. 77.<br />
201 Vgl.: Lichtenstein 1990, S. 7.<br />
202 Vgl. zu der Zeit von 1945 bis 1953: Lotfi 2001.<br />
203 Ebenda, S. 272.<br />
57
Fallbeispiele – Villa ten Hompel<br />
Wiedergutmachungsbehörde von 1953 bis 1968 in der Villa untergebracht. 204 Als es in den<br />
neunziger Jahren eine angeregte Debatte um die Nutzung des Täterortes gab, war noch nicht<br />
bekannt, dass hier auch einmal das Dezernat für Wiedergutmachung der Bezirksregierung<br />
Münster seinen Sitz gehabt hatte. Damit war eine Behörde in die Villa ten Hompel<br />
eingezogen, welche die Anträge von durch den NS-Staat geschädigten Personen bearbeitete.<br />
„Nachdem das Gebäude vorher ausschließlich ein Ort der Täter gewesen war, die an ihren<br />
Schreibtischen über das Schicksal von Verfolgten entschieden, wurde sie [die Villa; D.R.] mit<br />
dem Einzug des Dezernats für Wiedergutmachung auch ein Ort der Opfer.“ 205 Die Villa ten<br />
Hompel war die meiste Zeit ein Ort der Bürokratie gewesen, die im Falle der<br />
Wiedergutmachungsbehörde trotz aller guten Absichten wenig Einfluss auf die<br />
bundesdeutsche Politik und die Einstellung der Bevölkerung zu den Opfern des<br />
Nationalsozialismus hatte. Diese Situation sollte sich erst mit der Einrichtung des Lernortes<br />
ändern.<br />
Die Villa ten Hompel wurde zudem renoviert und zum Teil an Privatpersonen vermietet. Ab<br />
1971 bis 1995 wurden dann der Büchereistelle die Räume in der Villa zur Verfügung<br />
gestellt. 206 Nachdem das zuletzt in der Villa noch untergebrachte Gewerbeamt Mitte der<br />
neunziger Jahre ausgezogen war, wollte die Stadt Münster die Villa verkaufen. Allerdings<br />
gingen einige Mitarbeiter der Bezirksregierung Gerüchten nach, wonach in der Zeit des<br />
Nationalsozialismus Folterungen in den Kellerräumen stattgefunden hätten. 207 Dies konnte<br />
nicht bewiesen werden, aber die Beteiligung der Ordnungspolizei an den<br />
nationalsozialistischen Verbrechen kam ans Licht. Daraufhin setzte eine Debatte um die<br />
Nachnutzung der Villa ein, die im Anhang des Werkes „Villa ten Hompel“ von Alfons<br />
Kenkmann abgedruckt ist. Diese Debatte soll nun vorgestellt werden.<br />
4.2.3 Debatte um den Geschichtsort<br />
4.2.3.1 Streit um die Einrichtung eines Geschichtsortes<br />
Die Fronten zwischen den einzelnen politischen Parteien und beteiligten Personen verliefen<br />
zunächst recht deutlich: Nach dem Bekanntwerden der Vergangenheit der Villa ten Hompel<br />
als Sitz des BdO forderten die SPD und die GAL in Münster die Einrichtung einer<br />
Erinnerungsstätte. Dagegen lehnte das Dezernat der Stadt die Verantwortung für eine<br />
historische Einrichtung ab. Die Stadt Münster sei keine Nachfolgerin des Deutschen Reiches<br />
und damit auch nicht für die Aufarbeitung der Vergangenheit zuständig. Das Land Nordrhein-<br />
204 Vgl. zur Wiedergutmachungsbehörde in der Villa ten Hompel: Volmer 2001.<br />
205 Ebenda, S. 363.<br />
206 Vgl.: Ebenda, S. 343f.<br />
207 Vgl.: Kenkmann 1996a, S. 6.<br />
58
Fallbeispiele – Villa ten Hompel<br />
Westfalen ließ allerdings verlauten, dass es bereit sei, eine Gedenkstätte mit 70 Prozent der<br />
Kosten zu fördern, wenn eine kommunale Trägerschaft zur Verfügung stände. 208 Noch<br />
Anfang 1996 war der Tenor, dass die angespannte finanzielle Lage der Stadt und die Angst<br />
vor Folgekosten eine alleinige Trägerschaft der Stadt Münster verbieten würden. 209 Zudem<br />
war zu Beginn der Debatte noch nicht genau abzusehen, in welcher Form eine<br />
Dokumentations- oder Gedenkstätte in der Villa ten Hompel umgesetzt werden könnte.<br />
Obwohl klar war, dass die Villa ein Schreibtischtäterort ist, sollte hier eine Gedenkstätte für<br />
die Opfer entstehen: „In der Villa ten Hompel soll nach dem Willen der münsterschen SPD<br />
die Erinnerung an die Opfer des Nationalsozialismus ihren festen Platz haben.“ 210 Dies zeigt,<br />
dass vor allem der Verkauf der Villa verhindert werden sollte und die Überlegungen zur<br />
Nachnutzung noch unkonkret waren. So wurde beispielsweise auch die Einrichtung einer<br />
Tagungs- und Begegnungsstätte für verschiedene <strong>Institut</strong>ionen ins Visier genommen.<br />
Der anfangs von SPD und GAL vorgebrachte Vorschlag einer Dokumentationsstätte wurde<br />
im Februar 1996 mit Stimmen aller Fraktionen in einem Ratsantrag verabschiedet. 211<br />
Inzwischen lag auch schon das Konzept von Alfons Kenkmann für die zukünftige Nutzung<br />
vor, das im folgenden Kapitel vorgestellt wird. Trotz des oben genannten Schritts in Richtung<br />
Dokumentationsstätte suchte die Bezirksregierung in den folgenden Monaten unbeirrt weiter<br />
nach einem Käufer für die Villa und war fest entschlossen, an den Höchstbietenden zu<br />
verkaufen. 212 Im Juni 1996 saßen Stadt und Land dann an einem Tisch, um über die Zukunft<br />
der Villa zu verhandeln. Der Kaufpreis wurde auf 1,3 Million DM geschätzt. 213 Das<br />
vorliegende Konzept und konkrete Schritte schienen jedoch erst einmal in der Luft zu hängen.<br />
Daher stellte die Abgeordnete Brigitte Schumann eine „Kleine Anfrage“ bei der<br />
Landesregierung. Darin forderte sie konkrete Antworten auf die Frage nach einer Beteiligung<br />
der Landesregierung an der potenziellen Gedenkstätte und der wissenschaftlichen<br />
Erforschung der Polizeiarbeit im „Dritten Reich“, nach den Förderungsmaßnahmen und der<br />
Finanzierung. 214 Nachdem in der „Frankfurter Rundschau“ schon ein Artikel zur Geschichte<br />
208<br />
Vgl.: O.V.: „Villa ten Hompel“ als Stätte der Erinnerung? SPD/GAL fordern Kauf des Hauses durch die<br />
Stadt. In: Münstersche Zeitung (13.12.1995). Zit. nach: Kenkmann 1996a, S. 144.<br />
209<br />
Vgl.: O.V.: Nachdenken über die Villa. In: Westfälische Nachrichten (08.01.1996). Zit. nach: Kenkmann<br />
1996a, S. 145.<br />
210<br />
O.V.: Villa ten Hompel künftig Erinnerungsstätte? SPD begrüßt Nachtwei-Vorschlag: Für Gedenken an<br />
Opfer des Nazi-Regimes nutzen. In: In: Westfälische Nachrichten (26.01.1996). Zit. nach: Kenkmann 1996a,<br />
S. 146.<br />
211<br />
Vgl.: Völker 1996. Zit. nach: Kenkmann 1996a, S. 147.<br />
212<br />
Vgl.: Zeitungsartikel und Anzeige abgedruckt in Kenkmann 1996a, S. 148-151.<br />
213<br />
Vgl.: O.V.: Stadt und Land sitzen jetzt am Verhandlungstisch. Villa ten Hompel: Angebot liegt vor. Preis<br />
geringer als erwartet. In: Westfälische Nachrichten (08.06.1996). Zit. nach: Kenkmann 1996a, S. 155.<br />
214<br />
Vgl.: Schumann, Brigitte: Kleine Anfrage 426 (11.07.1996). Zit. nach: Kenkmann 1996a, S. 159f.<br />
59
Fallbeispiele – Villa ten Hompel<br />
der Villa ten Hompel und der regionalen Debatte erschienen war 215 , berichtete auch die „taz“<br />
über den Fortgang der Diskussionen. Darin wurden noch einmal die finanziellen Nöte von<br />
Land und Stadt erörtert: Der Verkauf des Landes sei vor allem aus Geldgründen voran<br />
getrieben worden. Die Stadt als Käufer wäre genehm, allerdings könne die sich den Kauf nur<br />
mit Unterstützung des Landes leisten – ein Teufelskreis. 216<br />
Dass die Bevölkerung sich an der Debatte beteiligte, zeigt der Leserbriefwechsel zwischen<br />
Udo Kreyenborg und dem Mitglied des Bundestages und Vorkämpfer für die<br />
Erinnerungsstätte Winni Nachtwei. Kreyenborg zweifelte die Bedeutung der Villa in der<br />
Nazi-Zeit an und nannte vor allem finanzielle Gründe, die gegen eine Gedenkstätte sprächen:<br />
„Reicht die zeitweilige Nutzung durch die Polizeibehörde, die die Terrormaßnahmen der<br />
Nazis durchführte aus, 1996 – über 50 Jahre später – in Zeiten knappster Kassen mit viel<br />
Aufwand hieraus eine Gedenk- und Mahnstätte zu machen?“ 217 Kreyenborg schlug<br />
stattdessen eine einfache Gedenktafel vor. Nachtwei hingegen plädierte eindeutig für eine<br />
Dokumentation und führte die Einmaligkeit einer solchen Gedenkstätte an. 218 Dass die<br />
Finanzierung der Dokumentation und auch die Folgekosten noch nicht ausführlich diskutiert<br />
worden waren, zeigte sich in den folgenden Monaten. Der anfängliche Konsens aller<br />
politischen Parteien zerbrach an der Finanzierungsfrage. 219 Die Vertreter der CDU-Fraktion<br />
lehnten es ab, einen Dringlichkeitsentscheid zum Kauf der Villa ten Hompel zu<br />
unterschreiben. Daraufhin brach ein öffentlich ausgetragener Streit zwischen den Fraktionen<br />
aus. Ein Mitglied der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung der CDU/CSU warf SPD und<br />
GAL vor, nur „[...] ihre Klientel [...] bedienen“ zu wollen 220 , wogegen ein Vertreter der SPD<br />
die Einwände der CDU gegen den Kauf der Villa als unglaubwürdig einstufte, da die Kosten<br />
schon bei der gemeinsam eingereichten Ratsinitiative absehbar gewesen wären. 221 Trotz der<br />
Gegenstimmen von der CDU wurde schließlich im August 1996 der Kauf der Villa ten<br />
Hompel durch die Stadt Münster beschlossen. Somit konnte mit der Umsetzung des Konzepts<br />
von Kenkmann zur Dokumentations- und Bildungsstätte begonnen werden. Das Konzept und<br />
die entstandene Dokumentation werden im Folgenden vorgestellt.<br />
215 Vgl.: Kenkmann 1996c, S. 8. Zit. nach: Kenkmann 1996a, S. 153f.<br />
216 Vgl.: Heitkamp 1996. Zit. nach: Kenkmann 1996a, S. 161.<br />
217 Kreyenborg 1996. Zit. nach: Kenkmann 1996a, S. 162.<br />
218 Vgl.: Nachtwei 1996a. Zit. nach: Kenkmann 1996a, S. 162.<br />
219 Vgl.: O.V.: Villa ten Hompel: Kein Konsens mehr. CDU: Gedenken an anderen Stellen. In: Westfälische<br />
Nachrichten (14.08.1996). Zit. nach: Kenkmann 1996a, S. 164.<br />
220 Vgl.: Sandhage 1996. Zit. nach: Kenkmann 1996a, S. 168.<br />
221 Vgl.: O.V.: Langela: Unverständlich, warum sich die CDU-Franktion ausklinkt. In: Münstersche Zeitung<br />
(21.08.1996). Zit. nach: Kenkmann 1996a, S. 169.<br />
60
Fallbeispiele – Villa ten Hompel<br />
4.2.3.2 Konzept und Umsetzung der Dokumentation<br />
Das inhaltliche Konzept zur Dokumentations- und Bildungsstätte Villa ten Hompel scheint im<br />
Gegensatz zu den anderen in dieser Arbeit vorgestellten Orten nicht Gegenstand einer<br />
intensiven Debatte gewesen zu sein. Das wird dadurch ersichtlich, dass der vorgelegte<br />
Entwurf, abgedruckt im Werk „Villa ten Hompel“ von 1996, augenscheinlich in den meisten<br />
Punkten mit dem heute bestehenden Geschichtsort übereinstimmt.<br />
Das Konzept sieht vier Grundfunktionen der Erinnerungsstätte vor: koordinieren, Service<br />
anbieten, fachwissenschaftliche Impulse bieten und in der historisch-politischen<br />
Bildungsarbeit Akzente setzen. 222 Dabei ist dem Verfasser Kenkmann wichtig, dass die<br />
Erinnerungsstätte nicht in direkte Konkurrenz zu bereits bestehenden Einrichtungen tritt,<br />
sondern stattdessen mit diesen konstruktiv zusammenarbeitet und die Vernetzung vorantreibt.<br />
Die Villa ten Hompel soll keine reine Dokumentation sein, sondern als Arbeits-, Studien- und<br />
Begegnungsstätte fungieren. Dies zeigt sich auch bei der Servicefunktion, indem<br />
beispielsweise Material für Studien zur Verfügung gestellt werden soll.<br />
Forschungsschwerpunkt ist das Themengebiet Ordnungspolizei. Aber nach Kenkmanns<br />
Konzept können auch andere Themen, die im Zusammenhang mit der nationalsozialistischen<br />
Herrschaft stehen, erforscht werden. Eine Zusammenarbeit in der Bildungsarbeit mit der<br />
Polizeiakademie in Hiltrup wird angestrebt. In der Villa ten Hompel soll eine ständige<br />
Ausstellung zur Beteiligung der deutschen Ordnungspolizei am Holocaust installiert werden<br />
und darüber hinaus eine Bibliothek und ein Archiv angelegt werden. Kenkmann schlägt vor,<br />
die Studienstätte zu einem „Lernort“ zu machen. Der Täterort soll Schülern dienen, um<br />
spezielle Kenntnisse über die Vergangenheit zu gewinnen. Im Konzept wird nicht auf die<br />
Ausrichtung am Täterort bzw. die Unterscheidung zu anderen Stätten an Opferorten Bezug<br />
genommen. Allerdings bezieht sich Kenkmann auf die Authentizität des Ortes, in der er eine<br />
besondere Chance sieht:<br />
„In den Räumen der Villa ten Hompel besteht die seltene Chance, eine<br />
Schnittstelle zwischen der historischen Forschung und der didaktischen<br />
Vermittlung zu installieren, die, und das macht ihre besondere Qualität aus,<br />
durch die Authentizität des Ortes zu einer besonderen Ernsthaftigkeit führt.“ 223<br />
Obwohl das Wort Täterort in dem Konzept nicht fällt – wohl aber im Titel des Buches, in dem<br />
das Konzept abgedruckt ist – , ist die Ausrichtung eindeutig nicht dem reinen Gedenken an<br />
die Opfer gewidmet. Im Gegenteil: Auch hier findet sich die Idee, die Neugier der Besucher<br />
auf einen authentischen Ort mit fachwissenschaftlich fundierter Wissensvermittlung zu<br />
verbinden. Die Nähe zu Schule und Universität ist unverkennbar.<br />
222 Vgl. hierzu und im Folgenden: Kenkmann 1996b, S. 127-137.<br />
223 Ebenda, S. 137.<br />
61
Fallbeispiele – Villa ten Hompel<br />
Der „Geschichtsort Villa ten Hompel“ eröffnete im Dezember 1999 mit einer<br />
Sonderausstellung seine Pforten, seit Mai 2001 ist die Dauerausstellung „Im Auftrag“ zu<br />
sehen. Diese bezieht sich auf das bürokratische und polizeiliche Handeln der Ordnungspolizei<br />
und ist im Begleitband 224 ausführlich beschrieben, so dass an dieser Stelle auf weitere<br />
Ausführungen verzichtet werden kann. Sie wurde im Jahre 2002 durch multimediale<br />
Präsentationen erweitert. Die Besucher können über Terminals weitergehende Informationen<br />
zu einzelnen Themengebieten abrufen. Der Geschichtsort Villa ten Hompel beruht auf drei<br />
Säulen (Erinnern, Forschen, Lernen) und entspricht somit dem Konzept von Kenkmann. 225<br />
Nach der Debatte um die künftige Nutzung der Villa wurde 1996 bekannt, dass auch die<br />
Wiedergutmachungsbehörde ihren Sitz im Haus hatte. Dieser Aspekt wurde in die Planungen<br />
mit aufgenommen und hatte eine Erweiterung der Perspektive zur Folge: „Durch die gezielte<br />
Aufnahme dieses Kontextes in die Dauerausstellung wird das Spektrum vom Täter zum Opfer<br />
und Zuschauer erweitert.“ 226 Die Internetseite des Geschichtsortes Villa ten Hompel<br />
informiert ausführlich über die wechselnden Sonderausstellungen, Veranstaltungen,<br />
Veröffentlichungen sowie die Bereiche Bildung und Forschung. 227 Wesentliche Bestandteile<br />
sind die „Mittwochsgespräche“, bei denen über zeitgeschichtliche Themen diskutiert wird,<br />
sowie ein Gedenkstättenfahrtenprogramm. 228<br />
Die Dauerausstellung wurde bei ihrer Eröffnung positiv aufgenommen und vor allem wegen<br />
ihrer nüchternen Darstellungsweise gelobt. 229 „Behutsam werden die Quellen präsentiert,<br />
sachlich erörtert, im Ton so kühl wie das Tun der Männer einst in der Villa. Laufende<br />
Propagandafilme des Dritten Reiches werden in ihrer Aussagekraft beschrieben und damit<br />
quellenkritisch eingeordnet“ 230 , schreibt Berthold Seewald von der „Welt“. Der regionale<br />
Bezug und die erstmalig in einer Ausstellung dokumentierten Handlungen der Polizei waren<br />
Teil der guten Bewertungen, die der damalige Präsident des Zentralrats der Juden, Paul<br />
Spiegel, aussprach. 231<br />
Auch internationale Aufmerksamkeit bekam die Villa ten Hompel, als die<br />
Ausstellungsmacher als eines von 57 nominierten Museen zur Preisverleihung für das<br />
224<br />
Vgl. Teil I „Ausstellung“ und Teil II „Bildteil“ in Kenkmann; Spieker 2001, S. 17-37 und 40-101.<br />
225<br />
Vgl.: Ebenda, S. 23.<br />
226<br />
Ebenda, S. 25.<br />
227<br />
Vgl.: O.V.: Internetseite der Villa ten Hompel. Online im Internet unter http://www.muenster.de/stadt/villaten-hompel/<br />
[29.08.2006].<br />
228<br />
Vgl.: Kenkmann 2003, S. 6f.<br />
229<br />
Vgl.: Robers 2001.<br />
230<br />
Seewald 2001.<br />
231<br />
Vgl.: O.V.: Stadt stellt sich der Geschichte. In: Münstersche Zeitung (06.05.2001).<br />
62
Fallbeispiele – Villa ten Hompel<br />
„Museum des Jahres 2003“ nach Athen eingeladen wurden und zu den 28 Endrunden-<br />
Kandidaten zählten. 232<br />
Die Mitarbeiter des Geschichtsortes Villa ten Hompel haben ihre Forschungsergebnisse in<br />
verschiedensten Publikationen veröffentlicht. 233 Es wurde mit verschiedenen Einrichtungen<br />
und Universitäten zusammengearbeitet sowie diverse Kooperationen eingeläutet. Daneben<br />
gab es die Konzeption von Ausstellungsprojekten und einer Wanderausstellung mit dem<br />
Thema „Verfolgung und Verwaltung“, die in verschiedenen deutschen Städten zu sehen<br />
war. 234 Die zahlreichen Tätigkeiten erwecken den Eindruck, dass mit der Villa ten Hompel ein<br />
Geschichtsort entstanden ist, der sich mit einem Schwerpunktthema in den unterschiedlichsten<br />
Kontexten der historischen Bildung engagiert. Damit konnte das angestrebte Konzept<br />
verwirklicht werden.<br />
Die Finanzierung, die schon bei der Debatte um die Einrichtung des Geschichtsortes Villa ten<br />
Hompel ein Thema war, wurde in den folgenden Jahren erneut zum Problem. Die Villa ten<br />
Hompel wurde sowohl von Landes- als auch von Bundesseite gefördert. Daneben konnte sie<br />
Spenden einwerben und erhielt private Fördermittel. Für die Dauerausstellung wurden fast<br />
150 Objekte von privater Seite zur Verfügung gestellt. Außerdem wurde ein Förderverein<br />
eingerichtet, der die Erinnerungs-, Forschungs- und Bildungsarbeit unterstützt. 235 Im Jahre<br />
2001 förderte der Bund die Villa ten Hompel mit 529.000 DM. 236 Dennoch war dies keine<br />
Garantie, dass das Bestehen der Erinnerungsstätte weiterhin gewährleistet war. Ende 2005<br />
mussten die Mitarbeiter erfahren, dass die Zukunft der Villa ten Hompel trotz der positiven<br />
Ergebnisse in Forschung und Öffentlichkeit keinesfalls gesichert sei. Stimmen aus der CDU<br />
erklärten, dass die Zuschüsse, die sich auf 280.000 Euro jährlich belaufen, für das kommende<br />
Jahr angesichts der angespannten Haushaltslage gestrichen werden sollten. Vertreter der<br />
Grünen reagierten mit Entsetzen. 237 Doch nicht nur die alten Fronten zwischen CDU und den<br />
Grünen in Bezug auf die Villa ten Hompel brachen wieder auf. Auch andere Parteien und<br />
Gruppierungen meldeten sich zu Wort, allen voran die SPD und die Gewerkschaft der Polizei,<br />
und forderten, den Bestand der Villa durch finanzielle Mittel zu sichern. 238 Die Proteste<br />
schienen ihre Wirkung nicht verfehlt zu haben, denn die Bezuschussung wurde letztendlich<br />
doch genehmigt:<br />
232<br />
Vgl.: O.V.: Aufstieg in die Europa-Liga. In: Westfälische Nachrichten (12.05.2004).<br />
233<br />
Eine Liste befindet sich in Kenkmann 2003, S. 152ff.<br />
234<br />
Vgl. zu den Tätigkeiten der Villa ten Hompel insbesondere: Kenkmann 2003, S. 132-165.<br />
235<br />
Vgl.: Kenkmann 203, S. 161f.<br />
236<br />
Vgl.: O.V.: Bund fördert Villa ten Hompel. In: Westfälische Nachrichten (19.06.2002).<br />
237<br />
Vgl.: Anger 2005.<br />
238<br />
Vgl.: O.V.: Villa ten Hompel erhält Unterstützung. In: Westfälische Nachrichten (05.01.2006).<br />
63
Fallbeispiele – Ordensburg Vogelsang<br />
„Aufatmen können die Städtischen Bühnen, deren Tanzsparte bzw. Kleines Haus<br />
nicht mehr auf dem Spiel steht, sowie die Villa ten Hompel. In beiden Fällen<br />
werden die städtischen Zuschüsse zwar leicht gekürzt, sie treffen aber nicht den<br />
Lebensnerv der genannten Einrichtungen.“ 239<br />
Ob es im kommenden Jahr wieder zu Einsparungen kommen wird, ist noch nicht geklärt. Die<br />
Einrichtung Villa ten Hompel ist in der Region beliebt und konnte 2005 einen Anstieg der<br />
Besucherzahlen auf 10.100 Besucher vermerken, darunter viele Schulklassen, die das<br />
Angebot zur Bildungsarbeit nutzten. Damit liegt sie im Trend der vielen kleineren<br />
Gedenkstätten in Nordrhein-Westfalen, die jedoch alle um ihre Förderung bangen müssen,<br />
ohne die ein Überleben nicht möglich ist. 240<br />
Dieses Fallbeispiel zeigt, dass ein wenig bekannter Täterort mit der Hilfe von engagierten<br />
Bürgern und der Unterstützung von politischer Seite zu einer historischen Attraktion<br />
umgewandelt werden kann, welche auf einem speziellen Gebiet neue Erkenntnisse für Laien<br />
und Fachwissenschaftler erarbeitet. Allerdings ist auch deutlich geworden, dass bei nicht so<br />
bekannten Täterorten die Frage der Finanzierung einer der wichtigsten zu klärenden Punkte<br />
ist. Dokumentationsstätten wie die Villa ten Hompel bedürfen langfristig finanzielle Hilfe von<br />
außen, um weiter bestehen zu können. Dabei treten sie auch in Konkurrenz zu anderen<br />
Kultur- und Bildungseinrichtungen und müssen in ihrer Arbeit erfolgreich sein. Daher ist es<br />
wichtig ein durchdachtes Konzept zu haben, welches auf die Spezifik des Täterortes<br />
zugeschnitten und regional verankert ist. Auch wenn die Einrichtung eines Lernortes an einem<br />
reinen Schreibtischtäterort wie der Villa ten Hompel zunächst wenig fruchtbar erscheint,<br />
konnte in Münster dank eines guten Konzepts ein vielseitiges Angebot aufgestellt werden.<br />
4.3 Ordensburg Vogelsang<br />
In der ehemaligen Ordensburg Vogelsang ist im Gegensatz zu den anderen vorgestellten<br />
Orten noch keine endgültige Nachnutzung eingetreten. Daher ist es hier besonders interessant<br />
zu sehen, wie von unterschiedlichsten Seiten auf die Nutzung einer Hinterlassenschaft aus der<br />
Zeit des Nationalsozialismus Einfluss genommen wird und wie kontrovers über einen solchen<br />
Ort diskutiert wird, bis es zu einer Entscheidung über die zukünftige Nutzung kommt.<br />
Im Folgenden werden zunächst die Entstehungsgeschichte und das Objekt selbst in<br />
Augenschein genommen und die Funktion der Ordensburgen im Erziehungssystem des<br />
„Dritten Reiches“ beschrieben. Anschließend folgen einige Anmerkungen zur Nutzung der<br />
Burg in der Zeit von 1945 bis 2006, bevor der aktuelle Diskussionsstand und die<br />
239 O.V.: Villa ten Hompel und Theater sind durch. In: Westfälische Nachrichten (07.01.2006).<br />
240 Vgl.: Joeres 2005, S. 2.<br />
64
Fallbeispiele – Ordensburg Vogelsang<br />
verschiedenen Konzepte für die Konversion des ehemaligen Militärstandortes in eine zivile<br />
Nachnutzung vorgestellt werden.<br />
4.3.1 Geschichte der Ordensburgen – Eliteschulen im NS-Erziehungssystem<br />
Die Ordensburgen stellten im NS-Erziehungssystem, wie weiter unten dargestellt wird, eine<br />
eigene Art der Ausbildungsstätten dar. Insgesamt wurden drei Ordensburgen gebaut. Diese<br />
befanden sich in der Eifel, in Sonthofen im Allgäu und in Crössinsee, heute Szczecinek, in<br />
Polen. 241 Eine weitere Ordensburg war in Marienburg geplant, wo man neben der schon<br />
bestehenden Burg aus dem Mittelalter, als repräsentatives Zeichen für die neue Ordnung des<br />
Nationalsozialismus eine Ordensburg bauen wollte. Alle drei Ordensburgen waren in ihrer<br />
Form und Ausführung unterschiedlich. Weihsmann behauptet, dass sich „[...] der Gebäudetyp<br />
der Schulungsburgen [...] an spätmittelalterliche[n], aus mehreren Gebäudekomplexen<br />
bestehenden Burganlagen [orientierte].“ 242 Dagegen sieht Ruth Schmitz-Ehmke in ihrer<br />
Beschreibung der Ordensburg Vogelsang die Assoziation zu einer Burg „[...] lediglich durch<br />
die Berglage des Baukomplexes und das an mittelalterliche Burgruinen erinnernde<br />
Bruchsteinmaterial [...]“ 243 zum Ausdruck gebracht. Der Name Ordensburg ist auf die<br />
Vorstellung einer elitären Gemeinschaft zurückzuführen, die auf den Schulen herangezogen<br />
werden sollte und die sich an den mittelalterlichen Ritterorden orientierte. Vogelsang nimmt<br />
in architektonischer Hinsicht eine Sonderstellung unter den Ordensburgen ein. Die<br />
Ordensburg Crössinsee wurde zwar vom gleichen Architekten wie Vogelsang errichtet,<br />
jedoch ohne genaue Kenntnis des Baugeländes, so dass der ursprüngliche Charakter eines<br />
Barackenlagers erhalten blieb, aus dem diese Ordensburg entstand. Die Anlage in Sonthofen<br />
dagegen ähnelte einer Klosterkirche und war weniger repräsentativ. Vogelsang ist heute<br />
neben dem Reichsparteitagsgelände und dem KdF-Hotel auf Rügen das größte noch erhaltene<br />
Bauensemble aus der Zeit des Nationalsozialismus.<br />
241 Die grundlegenden Informationen der folgenden Kapitel zu den Ordensburgen, insbesondere Vogelsang, sind<br />
zu finden in Weihsmann 1998, Schmitz-Ehmke 1988, Heinen 2002, Heinen 2006, Arntz 1986 und Scholtz 1967.<br />
242 Weihsmann 1998, S. 83.<br />
243 Schmitz-Ehmke 1988, S. 39.<br />
65
4.3.1.1 Anlage Vogelsang<br />
Fallbeispiele – Ordensburg Vogelsang<br />
Abbildung 5: Die Ordensburg Vogelsang im Jahre 1939. Quelle: Sammlung Heinen. Abgedruckt als<br />
Titelbild in Heinen 2002.<br />
Die Gesamtanlage der Ordensburg Vogelsang ist in die Natur der Eifel eingepasst. Das<br />
Gelände umfasst ca. 4.200 Hektar, von denen 50.000 Quadratmeter heutzutage<br />
denkmalgeschützte Gebäudefläche sind. Seit 1989 in die Denkmalliste eingetragen, wurde die<br />
Ordensburg Vogelsang dort wie viele andere NS-Hinterlassenschaften aufgenommen, um sie<br />
zunächst einmal als Quellenmaterial der NS-Epoche zu erhalten. 244 Vogelsang liegt über<br />
einem Stausee – dem Urftsee – an einem künstlich erschaffenen Hang. Ursprünglich sollte die<br />
Burg auf einer Rheininsel errichtet werden, doch der Architekt Clemens Klotz schlug<br />
stattdessen den Bau in der Eifel vor. Somit wurden auch die Vorstellung der abgeschiedenen<br />
Lage und des elitären Gedankens des Erziehungssystems der Ordensburgen erfüllt. Der<br />
ursprünglich vorgesehene Bergrücken namens Vogelsang stellte sich als zu klein für die Pläne<br />
heraus, daher wurde die Burg auf einem benachbarten Gelände gebaut; der Name Vogelsang<br />
wurde jedoch beibehalten. Baubeginn von Vogelsang war im Jahre 1934. Zu diesem<br />
Zeitpunkt waren schon alle wichtigen Details in den Plänen des Architekten Klotz<br />
verzeichnet, obwohl dieser immer wieder verschiedene Entwürfe vorlegte und auch im<br />
Nachhinein unterschiedliche Erweiterungen plante, von denen nur ein Bruchteil umgesetzt<br />
wurde. Clemens Klotz, der Architekt der Ordensburg Vogelsang, ist nicht so bekannt wie<br />
Albert Speer. Aber auch er erhielt einige große Bauaufträge von Seiten der Partei. Neben<br />
244 Vgl.: NUA 2002, S. 103.<br />
66
Fallbeispiele – Ordensburg Vogelsang<br />
Vogelsang ist Klotz auch für die Ordensburg Crössinsee und die Adolf-Hitler-Schulen in<br />
Waldbröl und Asterstein verantwortlich. Sein bekanntestes Gebäude ist jedoch das KdF-Hotel<br />
in Prora auf Rügen. Klotz erhielt diverse Titel der Partei, u.a. „Architekt der Reichsleitung der<br />
NSDAP“, und wurde 1936 von Hitler zum Professor ernannt. 245 Klotz war ein Freund von<br />
Robert Ley, der auch mitverantwortlich dafür war, dass Klotz drei Großbaustellen für die<br />
Deutsche Arbeitsfront (DAF) betreiben durfte.<br />
Die Bauarbeiten an der Burg schritten rasch voran. Bereits im Dezember 1934 konnte das<br />
Richtfest gefeiert werden. Die schon zur Zeit des „Dritten Reiches“ wirtschaftlich wenig<br />
ertragreiche Region erlebte durch den Bau einen großen Aufschwung. So konnten auch<br />
kritische Bevölkerungsteile besänftigt werden. Es gelang sogar durch die vielen benötigten<br />
Arbeitskräfte beim Bau und den Zulieferern die Arbeitslosigkeit auf null zu reduzieren. Im<br />
Jahr 1935 konnte der Kreis Schleiden zum ersten Kreis mit Vollbeschäftigung im<br />
Reichsgebiet erklärt werden. 246 Die eigentlich eher konservativ eingestellte Bevölkerung, die<br />
mehrheitlich aus Zentrumswählern bestand, war von den Leistungen und der Propaganda der<br />
Nationalsozialisten, aber auch von den persönlichen Vorteilen für sich und die Region<br />
beeindruckt.<br />
Vor der Errichtung der Anlage mussten zuerst große Landverschiebungen vorgenommen<br />
werden, so dass sechs Terrassen am Steilufer des Urftsees entstanden. Den Bau kann man in<br />
zwei Phasen einteilen. Bereits 1936 stand der erste Bauabschnitt vor der Vollendung. Bis<br />
dahin waren folgende Gebäude entstanden: Gemeinschaftshaus bestehend aus West- und<br />
Ostflügel mit Turm und Wandelhalle, Wirtschaftshaus, Appellplatz, Unterkunftshäuser, wenig<br />
später folgten Thingstätte 247 und Sportplatz. Im Innenhof des Gemeinschaftshauses wurden<br />
zwei Adlerplastiken aufgestellt, die dem Hof den Namen „Adlerhof“ gaben. Für die<br />
Gebäudeverkleidung wurde Bruchstein aus der Region genutzt. Auch die anderen Materialien<br />
sollten größtenteils als Arbeitsbeschaffungsmaßnahme aus der Eifel bezogen werden.<br />
Allerdings besteht die Burg unter der Verkleidung hauptsächlich aus Betonpfeilern und<br />
245 Vgl.: Schmitz-Ehmke 1988, S. 26f.<br />
246 Vgl.: Arntz 1986, S. 41.<br />
247 Thingstätten wurden für propagandistische Massenveranstaltungen errichtet. Mit dem Begriff „Thing“<br />
bezogen sich die Nationalsozialisten auf die germanischen Ahnen. Die Thing-Bewegung versuchte ein eigenes<br />
Repertoire zu schaffen, das durch Stücke und Inszenierungen die Thingstätte mit dem Geist des<br />
Nationalsozialismus erfüllen sollte. 1935 distanzierten sich die Nationalsozialisten vom Begriff „Thing“, da die<br />
Thing-Bewegung sich nicht zu einer eigenständigen Kunstform entwickeln konnte und<br />
Propagandaveranstaltungen mit moderneren Mitteln wie Film und Rundfunk erfolgreicher waren. Die bereits<br />
gebauten Thing-Stätten wurden in „Feierstätten“ umbenannt, auf denen auch weiterhin<br />
Propagandaveranstaltungen abgehalten wurden. Vgl.: Weihsmann 1998, S. 197ff.<br />
67
Fallbeispiele – Ordensburg Vogelsang<br />
Eisenkonstruktionen, so dass der vermeintliche Heimatstil aus finanziellen und zeitlichen<br />
Gründen nur vorgetäuscht wurde. 248<br />
Der zweite Bauabschnitt begann 1936 und monumentalisierte die Anlage. Zuerst wurde die<br />
Burgschänke gebaut. Es entstanden weitere Unterkunftshäuser, eine Turn- und<br />
Schwimmhalle, ein Sonnenwendplatz, ein Tor- und Wachgebäude, ein Kraftfahrzeughof und<br />
ein Haus für die weiblichen Angestellten. Geplant und nur teilweise zur Ausführung<br />
gekommen waren außerdem ein außerhalb der Burganlage gelegenes Dorf Vogelsang, in dem<br />
die Lehrer und Angestellten wohnen sollten, und als Höhepunkt der Anlage das „Haus des<br />
Wissens“. Kriegsbedingt wurden die Bauarbeiten 1941 eingestellt. Nur der Flugplatz am<br />
Walberhof wurde noch 1939 eingeweiht. Klotz erstellte trotz des Krieges und der damit<br />
verbundenen Unmöglichkeit des Weiterbaus diverse Pläne zum Ausbau von Vogelsang. Darin<br />
wurde das „Haus des Wissens“ vergrößert, so dass es einer riesigen Tempelhalle glich, in der<br />
neben der Ausbildung der Ordensjunker vor allem eine Ehrenhalle dominierte. Geplant waren<br />
weiterhin ein „Haus des Sports“ mit einer riesigen Arena und Sportplätzen, ein KdF-Hotel<br />
und ein repräsentativer Eingangshof. Gerade das KdF-Hotel mit 2.000 Betten entsprach nicht<br />
mehr der ursprünglichen Idee von der abgelegenen Ausbildung der Ordensjunker auf der<br />
Burg. Diese war aber innerhalb der Partei massiv in die Kritik geraten 249 , so dass man eine<br />
Verbindung zur „Volksgemeinschaft“ suchte.<br />
4.3.1.2 Die Ordensburgen im NS-Erziehungssystem<br />
Die Ordensburgen beruhten auf der Idee von Dr. Robert Ley, dem Reichsorganisationsleiter<br />
der NSDAP seit 1932. Seine Funktion war vor allem die innere Organisation der Partei und<br />
damit auch die fachliche und weltanschauliche Schulung des Parteipersonals. Seit Mai 1933<br />
bekleidete Ley zudem das Amt des Chefs der DAF. Sein Hauptkonkurrent in Bezug auf das<br />
Erziehungssystem war Alfred Rosenberg, der „Beauftragte des Führers zur Überwachung der<br />
weltanschaulichen Erziehung der Bewegung“. Auf den Ordensburgen sollten nach Leys<br />
Vorstellungen die zukünftigen Führer der Partei ausgebildet werden. Jede Burg sollte<br />
Kapazitäten von bis zu 1.000 Mann Belegung zur Verfügung stellen.<br />
Ley hatte neben den Ordensburgen und der Einrichtung der Adolf-Hitler-Schulen als<br />
Internats- und Vorschulen für die Ordensburgen, noch weitere Pläne für das NS-<br />
Erziehungssystem. So sollte durch eine permanente Auslese ein besonders zuverlässiger<br />
politischer Kader gewonnen werden. 250 Durchsetzen konnte er von seinen Plänen bis auf die<br />
248 Vgl.: Schmitz-Ehmke 1988, S. 41.<br />
249 Vgl.: Arntz 1986, S. 180ff.<br />
250 Vgl.: Scholtz 1967, S. 293.<br />
68
Fallbeispiele – Ordensburg Vogelsang<br />
Ordensburgen und Adolf-Hitler-Schulen jedoch kaum etwas, da sie zu theoretisch blieben.<br />
Zudem widersprach Leys Auslesesystem dem „[...] bis dahin praktizierten Grundsatz, Führer<br />
nur auf Grund politischer Bewährung einzusetzen.“ 251<br />
Die Grundvoraussetzungen für die Aufnahme auf die Ordensburgen waren nicht schulische<br />
Leistungen – jedem Nationalsozialisten sollte theoretisch diese „Weiterbildung“ offen stehen.<br />
Daher mussten die Ordenjunker zunächst nur folgende Auflagen erfüllen: Mitglied der<br />
NSDAP mit Dienstleistung in der HJ und Ableistung des Arbeitsdienstes und der<br />
Wehrpflicht, körperlich gesund ohne Behinderung und mit der „richtigen“ rassischen<br />
Abstammung, also einem Ariernachweis. Die Ausbildung auf den Burgen sollte drei Jahre<br />
dauern, bei dem die Junker jeweils ein Jahr auf jeder Burg verbrachten, um verschiedene<br />
Gegenden Deutschlands sowie unterschiedliche Landschaften und die damit verbundenen<br />
Sportarten kennen zu lernen. Anschließend sollte ein halbes Jahr auf der noch zu errichtenden<br />
Ordensburg Marienburg verbracht werden. Die Auslese war genauso willkürlich wie die<br />
Bewertung der Ordensjunker: Sie wurden persönlich von Ley und weiteren Parteiführern<br />
begutachtet und ausgewählt, wenn sie sich vor Leys Augen als „ganzer Kerl“ herausstellten.<br />
In einem Artikel von 1936 in der Zeitschrift „Wille und Macht“ wird dieses<br />
Auswahlverfahren beschrieben: „Nur ganze Kerle sollen auf den Burgen sein, sagte Dr. Ley,<br />
Kerle, die bereit sind, ihr Mannestum, ihren Mut, ihre Entschlossenheit und Kühnheit zu jeder<br />
Zeit unter Beweis zu stellen.“ 252 Auf den Burgen gab es keine Zeugnisse. Das Lehrpersonal<br />
bestand aus Haupt- und Gastlehrern. Auf den Ordensburgen war eine Teilung der zu<br />
vermittelnden Lehrinhalte vorgesehen: Crössinsee sollte vor allem der charakterlichen<br />
Ausbildung dienen, in Sonthofen Verwaltungs-, politische, diplomatische und Miltäraufgaben<br />
gelehrt werden und Vogelsang war für die Verbreitung der Rassenlehre vorgesehen. 253 Die<br />
Hauptaufgabe bestand allerdings weniger in der Vermittlung von Wissen, sondern in einer so<br />
genannten „Charakterbildung“, die auf Gehorsam und nationalsozialistischen Fanatismus<br />
hinauslief. 254 Die gelehrten Fächer waren der nationalsozialistischen Propaganda angepasst<br />
und ein besonders wichtiger Bestandteil war die sportliche und damit auch militärische<br />
Ausbildung. Dies spiegelte sich auch in der Ausstattung von Vogelsang wider, denn auf der<br />
Anlage waren neben Sportplätzen und Schwimmhalle später noch weitere Sportstätten mit<br />
olympischen Ausmaßen angedacht. Die Ordensjunker genossen trotz des großen Drucks, sich<br />
zu beweisen, einen recht hohen Lebensstandard auf der Burg und durch die vorangegangene<br />
251 Scholtz 1973, S. 165.<br />
252 Rüdiger, Karlheinz: Auslese der Bewegung. In: Wille und Macht. Führerorgan der nationalsozialistischen<br />
Jugend. 4. Jg., H. 12/1936. Zit. nach: Gamm 1984, S. 416.<br />
253 Vgl.: Arntz 1986, S. 93.<br />
254 Vgl.: Schmitz-Ehmke 1988, S. 15.<br />
69
Fallbeispiele – Ordensburg Vogelsang<br />
Auslese hatten sie auch in der Bevölkerung das Ansehen einer Eliteformation. Neben den<br />
unterschiedlichen Sportarten wurden auch gesellschaftliche Umgangsformen geübt, Feiern<br />
selbst organisiert und abgehalten und verschiedene Fahrten gemacht. 255 Die Feierlichkeiten<br />
spielten in der NS-Propaganda eine große Rolle und konnten somit für die Ordensjunker für<br />
ihre spätere Tätigkeit hilfreich sein.<br />
4.3.1.3 Leben auf der Ordensburg<br />
Bereits am 1. Mai 1936 konnten die ersten 500 Junker in Vogelsang einziehen, obwohl die<br />
Bauarbeiten teilweise noch nicht vollendet waren. Wie oben in Kapitel 4.3.1.2 schon<br />
beschrieben waren die Aufnahmekriterien relativ willkürlich und basierten nicht auf Wissen<br />
oder Kenntnis. So nutzten viele Parteimitglieder den Weg über die Ordensburg als<br />
Karriereleiter, die ihnen sonst verwehrt geblieben wäre. Dennoch kamen die Junker aus den<br />
verschiedensten familiären Verhältnissen und hatten unterschiedliche Bildungshintergründe.<br />
Dies und der ständige Druck sich zu beweisen, führten bald zu Spannungen. Nach einiger Zeit<br />
wurden nicht mehr genügend Freiwillige gefunden, die sich für die Ausbildung auf den<br />
Ordensburgen entschieden. Die Aufnahmebestimmungen wurden gelockert, was auch auf die<br />
nachlassende Attraktivität der über dreijährigen Ausbildung schließen lässt. Zudem waren<br />
Ziel und Ergebnis der Ausbildung nicht geklärt. Man einigte sich zwar darauf, dass die<br />
Ordensjunker als „Führeranwärter“ bezeichnet werden sollten, doch der Anspruch auf eine<br />
Führungsposition in der Partei war in keiner Weise geregelt. 256 Die erste Belegung von<br />
Vogelsang kann übrigens nicht als regulärer Jahrgang bezeichnet werden, da ihre Ausbildung<br />
schon nach einem Jahr frühzeitig endete und aus diesen Junkern Personal und Erzieher für die<br />
Ordensburgen und Adolf-Hilter-Schulen rekrutiert wurden. 257<br />
Das Leben auf der Ordensburg lief streng geregelt ab: Morgens gab es einen Fahnenappell,<br />
vormittags stand die schulische Ausbildung auf dem Programm, nachmittags widmete man<br />
sich dem Sport. In Vogelsang wurde durch die Lage am Wald und am See Reiten und Rudern<br />
gelehrt. Die wissenschaftliche Ausbildung stand zwar nicht im Vordergrund, doch es stellte<br />
sich schnell heraus, dass es den Junkern auch an intellektuellen Fähigkeiten mangelte, um die<br />
Vorträge der Gastredner zu verstehen. So heißt es 1939 im so genannten Kölker-Bericht:<br />
„Einen von Geist und Wissen getragenen Vortrag können viele Junker nicht verarbeiten. Sie<br />
geben sich alle Mühe, das Gehörte zu behalten, aber selbst dann steht das Erlernte vielfach<br />
einsam im Raum.“ 258 Der Kölker-Bericht war ein parteiinterner Bericht des<br />
255 Vgl.: Scholtz 1967, S. 289.<br />
256 Vgl.: Schmitz-Ehmke 1988, S. 17.<br />
257 Vgl.: Scholtz 1967, S. 275.<br />
258 Zit. nach: Arntz 1986, S. 183.<br />
70
Fallbeispiele – Ordensburg Vogelsang<br />
Gauschulungsleiters Julius Kölker des Gaus Köln-Aachen und wurde dem<br />
Reichsschulungsleiter Rosenberg 1939 vorgelegt. Der Bericht machte auch einige Vorschläge<br />
für die künftige Ausrichtung der Arbeit auf den Ordensburgen, diese wurden jedoch nicht<br />
mehr umgesetzt. Hieran zeigt sich, dass die Ideen Leys und ihre Umsetzung in den<br />
Ordensburgen auch innerhalb der Partei wenig Anhänger fanden.<br />
Der Unterricht in Vogelsang beschränkte sich auf wenige Schwerpunktfächer wie<br />
Rassenkunde, Geschichte und Geopolitik. Dabei stand besonders die Lehre in<br />
Rassenideologie im Vordergrund. Dieses war auch äußerlich in Vogelsang erkennbar. Das<br />
neue Menschenbild wurde in den beiden Plastiken „Der Fackelträger“ und „Deutscher<br />
Mensch“ verkörpert. Beide wurden vom Bildhauer Willy Meller aus Köln angefertigt. Er war<br />
ein Freund des Architekten Klotz und hatte für das Reichssportfeld in Berlin eine Siegesgöttin<br />
entworfen. 259 Der Fackelträger befindet sich auch heute noch auf dem Sonnenwendplatz. Die<br />
fünf Meter hohe Plastik zeigt einen nackten Mann mit Fackel. Daneben befindet sich folgende<br />
Inschrift: „Ihr seid die Fackelträger der Nation. Ihr tragt das Licht des Geistes voran im<br />
Kampfe. Adolf Hitler“. Der „Deutsche Mensch“ stand im Kultraum der Ehrenhalle. Der<br />
Raum befand sich im 48 Meter hohen Turm der Burg und wurde durch Lichtschlitze erhellt.<br />
Die Ehrenhalle war den 1923 beim Hitler-Putsch getöteten Anhängern Hitlers gewidmet. Die<br />
Statue des „Deutschen Menschen“ misst drei Meter und ist wie der „Fackelträger“<br />
unbekleidet. In der Ehrenhalle und dem Kultraum fanden auch diverse Feiern und<br />
nationalsozialistische „Kulthandlungen“ statt. So wurden hier beispielsweise die so genannten<br />
„Braunen Hochzeiten“ besiegelt. Die Ordensjunker sollten laut Ley möglichst verheiratet<br />
sein. Einige Ehezeremonien fanden auf der Burg selbst statt. Diese wurden jedoch nicht nach<br />
dem christlichen Zeremoniell durchgeführt, sondern waren ganz auf den<br />
nationalsozialistischen Staat ausgerichtet. Die Zeremonie wurde von einem SS-Mann<br />
abgehalten. Um die Ehe zu besiegeln, ging das Brautpaar in den Kultraum, in dem ein<br />
altarähnlicher Tisch stand. Vor der Plastik „Deutscher Mensch“ schworen die frisch<br />
Vermählten die Treue zur nationalsozialistischen Ideologie. 260 Der Burgkommandant Hans<br />
Dietel bemühte sich darum, dass die Burg mit dem noch in der Phase des Aufbaus<br />
befindlichen NS-Musterdorf Vogelsang als eigene Gemeinde anerkannt würde. Dies kam<br />
jedoch nicht zu Stande. 261 Allerdings hatte Vogelsang ab 1939 den Status eines Standesamts<br />
und so konnten im Burgsaal „Eheweihen“ abgehalten werden.<br />
259 Vgl.: Schmitz-Ehmke 1988, S. 29.<br />
260 Vgl.: Arntz 1986, S. 156f.<br />
261 Vgl.: Schmitz-Ehmke 1988, S. 12.<br />
71
Fallbeispiele – Ordensburg Vogelsang<br />
Ab 1939 wurden die meisten der Ordensjunker zur Wehrmacht eingezogen oder nach Hause<br />
geschickt. Die Ordensburgen wurden offiziell der Wehrmacht übergeben und kein einziger<br />
Ordensjunker hat jemals die eigentlich drei Jahre umfassende Ausbildung abschließen<br />
können. Viele der Junker meldeten sich auch freiwillig an die Front. In den folgenden Jahren<br />
wurde Vogelsang teilweise von der Wehrmacht genutzt, um Truppen unterzubringen. Von<br />
1942 bis 1944 wurden dort drei Adolf-Hitler-Schulen beherbergt. Das Krankenhaus wurde<br />
auch weiterhin von der umliegenden Bevölkerung genutzt. In den letzten Kriegsjahren<br />
wurden Familien, schwangere Frauen und Kinder aus den städtischen Gebieten nach<br />
Vogelsang evakuiert. Im Krankenhaus kamen viele Kinder zur Welt, so dass das Gerücht<br />
entstand, Vogelsang sei ein Standort des nationalsozialistischen „Zuchtprogramms“<br />
Lebensborn, was aber nicht der Fall gewesen ist. Am 4. Februar 1945 besetzten US-Truppen<br />
die Burg Vogelsang ohne Gegenwehr. Die Gebäude wurden im Krieg kaum zerstört, der<br />
Standort war für die Alliierten weniger wichtig als die städtischen Gebiete. Nur die östlichen<br />
Begrenzungen des Adlerhofes, einige Unterkunftshäuser und der Ostflügel wurden<br />
beschädigt.<br />
Das eigentliche Ziel – die Ausbildung von Führernachwuchs – ist auf der Ordensburg nie<br />
verwirklicht worden. Der große Aufwand der Errichtung des Gebäudes hatte von vorneherein<br />
vor allem Prestigezwecken gedient: „Die Burgen hatten der Selbstdarstellung der Partei vor<br />
ihr selber zu dienen, erst sekundär Ausbildungszwecken.“ 262 Das Erziehungssystem war wie<br />
viele Bereiche des NS-Staates durch interne Kompetenzkämpfe geprägt und ohne wirkliches<br />
Konzept. Es wurde auch innerhalb der Partei kritisiert. Vogelsang hatte unter den drei<br />
Ordensburgen den höchsten Stellenwert, obwohl die offizielle Übergabe und Einweihung aller<br />
drei Ordensburgen 1936 in Crössinsee stattgefunden hatte. Neben verschiedenen anderen<br />
Parteigrößen besuchte Hitler Vogelsang zweimal offiziell, einmal im November 1936 und<br />
einige Monate später im April 1937. 263 Zu diesen Zeitpunkten fanden auf der Burg Tagungen<br />
von Gauamts- und Kreisleitern statt. Hitlers dort gehaltenen Reden bezogen sich allerdings<br />
nicht auf die Ordensburgen.<br />
4.3.2 Unter belgischer Besatzung im Naturschutzgebiet<br />
Die Amerikaner hatten Vogelsang schon im Februar 1945 kampflos eingenommen. Die<br />
Anlage wurde im Krieg nur gering beschädigt. Nach der Kapitulation standen die Gebäude<br />
zunächst leer und wurden von der Bevölkerung geplündert. Erst im Winter 1945/46 belegten<br />
die Briten die Burganlage wieder. Die weitere Nutzung war zunächst unklar und es kamen<br />
262 Scholtz 1967, S. 274.<br />
263 Vgl.: Arntz 1986, S. 138.<br />
72
Fallbeispiele – Ordensburg Vogelsang<br />
Vorschläge auf, die Gebäude abzureißen: „It is agreed that this camp should be entirely<br />
destroyed since it was a focus of nazi sentiment“ 264 , wie es in einem Schreiben der „Control<br />
Comission“ an die Düsseldorfer Militärregierung heißt. Doch schon bald wurde festgestellt,<br />
dass sich das Gelände gut für einen Truppenübungsplatz eignen würde. Der Besetzungsbefehl<br />
für ein Sperr- und ein Aufmarschgebiet erfolgte 1947 und 1949, wurde jedoch auf 1946<br />
zurückdatiert. 265 Im abgeriegelten Sperrgebiet lagen die Anlage Vogelsang, der Urftsee und<br />
auch das Dorf Wollseifen. Für die Wollseifener Bevölkerung – ca. 550 Einwohner – bedeutete<br />
dies, dass sie im Sommer 1946 ihr Dorf innerhalb von drei Wochen vollständig räumen<br />
mussten. Dies führte zu Protesten in der Gegend und die 120 Familien hatten Schwierigkeiten,<br />
in der kurzen Zeit eine neue Bleibe und Arbeit zu finden. Ein weiteres Problem waren die<br />
Gräber, welche die Bewohner zurücklassen mussten. Erst 1955 konnten die Toten aus den bis<br />
dahin noch nicht durch Truppenübungen zerstörten Gräbern umgebettet werden. Die<br />
Wollseifener erhielten erst Jahre später Entschädigungszahlungen. Noch heute gibt es einen<br />
Traditionsverein Wollseifen, der sich zur Aufgabe gemacht hat, die Erinnerung an das Dorf zu<br />
erhalten. Im Dorf selbst wurden ab 1981 Rohbauten errichtet, um den Häuser- und<br />
Straßenkampf zu trainieren. 266<br />
Der Truppenübungsplatz der Briten wurde am 1. April 1950 an die Belgier übergeben und in<br />
„Camp Vogelsang“ umbenannt. Bis dahin hatten die Briten die Gebäude von Vogelsang<br />
weitgehend in ihrer ursprünglichen Nutzung übernommen. Die zerstörten<br />
Kameradschaftshäuser und der Ostflügel des Adlerhofes wurden nicht wieder aufgebaut. Die<br />
Belgier errichteten auf der schon unter den Nazis entstandenen Stufenkonstruktion des<br />
Audimax, das als Hörsaal des „Haus des Wissens“ dienen sollte, ein Kino. Auf den<br />
Grundmauern des „Haus des Wissens“ wurde die Kaserne „Van Dooren“ erbaut. Des<br />
Weiteren entstanden militärische Nutzbauten wie eine Tankstelle, Panzerhallen und Depots.<br />
Der Turm, in dem sich der Kultraum befunden hatte, wurde als Kletterraum genutzt.<br />
Insgesamt schienen die Belgier wenig Probleme mit der nationalsozialistischen Vergangenheit<br />
von Vogelsang zu haben. Die nationalsozialistischen Insignien wurden teilweise entfernt, aber<br />
Plastiken wie „Der Fackelträger“ oder das Innendekor in der Schwimmhalle und der<br />
Burgschänke blieben erhalten.<br />
Der Truppenübungsplatz mit Sperr- und Aufmarschgebiet sorgte in den umliegenden Dörfern<br />
der Eifel nicht unbedingt für Zustimmung. Franz Albert Heinen hat die Presseberichte aus den<br />
folgenden Jahren ausgewertet und zeichnet ein ausführliches Bild der Stimmung in der<br />
264 Zit. nach: Heinen 2002, S. 57.<br />
265 Vgl.: Ebenda, S. 58.<br />
266 Vgl..: Ebenda, S. 60ff.<br />
73
Fallbeispiele – Ordensburg Vogelsang<br />
Bevölkerung, die sich durch rollende Panzer und Schießübungen der Militärs belästigt<br />
fühlte. 267 Auch Vergrößerungsversuche des Truppenübungsplatzes waren von belgischer Seite<br />
vorgesehen, scheiterten jedoch letztendlich an den Protesten der Bevölkerung. 268 Während<br />
erst nur belgische Soldaten auf Vogelsang trainierten, kamen später noch Truppen aus nahezu<br />
allen NATO-Staaten hinzu. Bis zu 4.500 Soldaten konnten auf Vogelsang unterkommen. Mit<br />
Ende des Kalten Krieges änderte sich auch die Lage in Vogelsang. Statt großer<br />
Angriffsmanöver wurden jetzt Soldaten für ihren Einsatz beispielsweise auf dem Balkan<br />
vorbereitet. 269<br />
„Der Truppenübungsplatz beschäftigte in Spitzenzeiten bis zu 400 Personen, in den 90er<br />
Jahren immerhin noch mehr als 200.“ 270 Damit war das belgische Militär auch ein wichtiger<br />
Arbeitgeber in der Region. Besonders ab den 1980er Jahren hatten sich die Beziehungen zu<br />
den Einheimischen deutlich verbessert. Dennoch mehrten sich Stimmen in der Bevölkerung,<br />
die sich für eine Konversion des Geländes und der Anlage Vogelsang aussprachen. Die Eifel<br />
als Tourismusgebiet sollte nicht mehr durch Geschosslärm und Panzerspuren beeinträchtigt<br />
werden. Anfang der neunziger Jahre waren sich alle einig: „Vogelsang muss zivil werden,<br />
forderten unisono Politiker aller Parteien.“ 271 Es gründete sich 1992 eine<br />
Arbeitsgemeinschaft „Ziviles Vogelsang“, die für spätestens 2000 eine Öffnung und zivile<br />
Nutzung des Geländes forderte. Im März 2001 kündigte das belgische<br />
Verteidigungsministerium schließlich den Rückzug ihrer Streitkräfte aus Deutschland an.<br />
Ende 2005 sollte Vogelsang an die deutschen Behörden zurückgegeben werden. Damit war<br />
eine neue Situation geschaffen worden. Im folgenden Kapitel werden die unterschiedlichen<br />
Konzepte und der aktuelle Sachstand um die Nutzung von Vogelsang geschildert. Zunächst<br />
sollen jedoch noch einige Worte zum Nationalpark Eifel fallen, dessen Kern das Gelände von<br />
Vogelsang bildet.<br />
Der Nationalpark Eifel besteht seit 2004 und damit ist erst seit wenigen Jahren eine Fläche<br />
von 110 Quadratkilometern unter besonderen Schutz gestellt worden. Die Philosophie des<br />
Nationalparks lautet „Natur Natur sein lassen“. Ohne menschliche Eingriffe sollen sich in der<br />
Eifel Natur und Tierwelt frei entwickeln. An der Einrichtung des Parks hatte der Förderverein<br />
Nationalpark Eifel großen Anteil. 2002 mit über 400 Mitgliedern gegründet, zählt der<br />
gemeinnützige Verein heute über 800 Förderer. 272 Als Touristenattraktion und für den<br />
267 Vgl.: Heinen 2002, S. 87ff.<br />
268 Vgl.: Ebenda, S. 90ff.<br />
269 Vgl.: Heinen 2006, S. 25.<br />
270 Ebenda, S. 26.<br />
271 Heinen 2002, S. 169.<br />
272 Vgl.: NUA 2002, S. 6.<br />
74
Fallbeispiele – Ordensburg Vogelsang<br />
wirtschaftlichen Aufschwung der Region hatte der Nationalpark von Anfang an fast nur<br />
Befürworter: „Noch nie ist ein Nationalpark so schnell entstanden. Denn jeder wollte ihn.<br />
Politiker, Tourismusmanager, Kommunalverwaltungen und, anders als üblich, sogar die<br />
Bevölkerung, ein paar Jäger ausgenommen.“ 273 Im Herzen des Nationalparks liegt das<br />
ehemalige Gelände des Truppenübungsplatzes mit der Ordensburg Vogelsang. Seit dem Jahre<br />
2006 ist dieser Teil erstmals seit über 60 Jahren öffentlich zugänglich. Er gehört allerdings<br />
offiziell nicht zur Nationalparkfläche, dennoch war genau der Umstand, dass sich die Belgier<br />
zurückziehen würden, die Grundvoraussetzung für die Idee des Nationalparks. 274 Die<br />
Rundwege über das Gelände sind zurzeit noch genau markiert. Ein Abweichen vom Weg ist<br />
strengstens untersagt, da sich im umliegenden Boden immer noch Reste von Munition<br />
befinden können.<br />
4.3.3 Kontroverse um die verschiedenen Konzepte zur Nutzung der Burg<br />
Seit in der Region um Vogelsang klar war, dass das belgische Militär die ehemalige<br />
Ordensburg in absehbarer Zeit verlassen würde, machten sich verschiedene Gruppen der<br />
Bevölkerung und auch offizielle Stellen darüber Gedanken, was mit dem Gelände und<br />
insbesondere den Gebäuden in Zukunft geschehen sollte. Die Konzepte sind teilweise<br />
mehrfach überarbeitet worden, werden stetig fortgeschrieben und sind fast alle in der<br />
aktuellen Version auf der Internetseite www.lernort-vogelsang.de abrufbar. Zudem fand auch<br />
in den Zeitungen eine Debatte über die zukünftige Nutzung statt. Hauptsächlich wurde in den<br />
Lokalblättern „Kölner Stadt-Anzeiger“, „Kölnische Rundschau“ und „Aachener Zeitung“<br />
berichtet, aber es erschienen auch diverse Artikel in überregionalen Zeitungen und<br />
Zeitschriften wie in „Der Spiegel“, „Die Zeit“, „Die Süddeutsche“ oder in der „taz“. Im<br />
Folgenden werden nun die verschiedenen Konzepte vorgestellt und im Rahmen der Debatte<br />
näher beleuchtet.<br />
4.3.3.1 Nutzungskonzept des Fördervereins Nationalpark Eifel<br />
Der oben schon vorgestellte Förderverein Nationalpark Eifel hat verschiedene Arbeitskreise<br />
(AK), darunter auch einen AK Vogelsang, der sich intensiv Gedanken um eine Nutzung der<br />
Ordensburg gemacht hat. Dabei wollte der AK zeigen, dass grundsätzlich eine sinnvolle<br />
Nutzung aller Gebäude möglich wäre und die Bauwerke nicht abgerissen werden müssen.<br />
Ohne zunächst auf finanzielle Belange Rücksicht zu nehmen, wurden verschiedene Konzepte<br />
273 Putschögl 2005.<br />
274 Vgl.: NUA 2002, S. 19.<br />
75
Fallbeispiele – Ordensburg Vogelsang<br />
entwickelt und fortgeschrieben. 275 Durch personelle Überschneidungen konnte der AK<br />
Vogelsang unter anderem mit dem Verein „Gegen Vergessen Für Demokratie e.V.“<br />
zusammenarbeiten, der Vorschläge für ein Dokumentations-, Bildungs- und<br />
Begegnungszentrum auf Vogelsang vorlegte. 276 Der Verein „Gegen Vergessen Für<br />
Demokratie“ hat sich zum Ziel gesetzt, die Erinnerung an unterschiedliche Phasen der<br />
deutschen Geschichte im 20. Jahrhundert hochzuhalten – zum einen die<br />
nationalsozialistischen Verbrechen, zum anderen die Unrechts- und Verfolgungspolitik der<br />
SED. Zudem wollen sie sich aktiv für Demokratie einsetzen. 277 Mit ihrer Arbeit unterstützen<br />
und beraten sie Projekte und Initiativen, die sich mit der deutschen Geschichte<br />
auseinandersetzen und sich gegen demokratiefeindliche Aktivitäten wenden. In der<br />
Zusammenarbeit mit dem AK Vogelsang entwickelte man aus den unterschiedlichen<br />
Vorschlägen eine Projektskizze zum Dokumentationszentrum und zum Bildungs- und<br />
Begegnungszentrum Vogelsang, welches das Nutzungskonzept des AK Vogelsang ergänzt. 278<br />
Diese Projektskizze umfasst folgende Vorschläge: Das Bildungs- und Begegnungszentrum<br />
soll drei Lernfelder berücksichtigen: 1. Geschichte und Gesellschaft, 2. Geschichte der<br />
„Euregio Maas-Rhein“ und 3. Natur und Nachhaltigkeit. Auf Vogelsang soll nicht vorrangig<br />
an die Opfer des NS-Regimes erinnert werden, sondern durch eine Dokumentation sollen die<br />
NS-Macht- und Beeinflussungsstrukturen insbesondere in der Erziehung aufgezeigt werden.<br />
Dies entspricht der Vorgehensweise für die Errichtung einer Dokumentation am<br />
<strong>Obersalzberg</strong>. Auch hier wurde der Ort als Täterort definiert und damit für einen Lernort und<br />
gegen eine Gedenkstätte argumentiert. Für das Dokumentationszentrum mit den obigen<br />
Lernfeldern werden vier Ausstellungssegmente vorgeschlagen: die NS-Ordensburg im<br />
nationalsozialistischen Erziehungssystem, Bezüge zum Nationalsozialismus und aktuellem<br />
Rechtsextremismus, regionale Geschichte mit Schwerpunkt auf dem 19. und 20. Jahrhundert<br />
und die Geschichte der europäischen Staaten. In der Projektskizze werden im Weiteren die<br />
einzelnen Ausstellungsschwerpunkte genauer untergliedert und auch die vier Lernfelder<br />
begründet und vorgestellt. Grundsätzlich erscheint die Gliederung in die Lernfelder sinnvoll<br />
und dem Ort Vogelsang angemessen. Bezüge zum Nationalsozialismus, der<br />
Nachkriegssituation und dem umliegenden Nationalpark sind auf Vogelsang evident und in<br />
275 Vgl. hierzu und im Folgenden: Förderverein Nationalpark Eifel e.V. 2004. Das Konzept auf der Homepage<br />
Lernort Vogelsang ist die aktuellste veröffentlichte Version vom Oktober 2004. Auf der Homepage des<br />
Förderverein Nationalpark Eifel e.V. unter http://www.foerderverein-nationalpark-eifel.de/ befindet sich eine<br />
ältere und kürzere Version vom September 2003.<br />
276 Vgl.: Gegen Vergessen Für Demokratie e.V. 2004..<br />
277 Vgl.: O.V.: Internetseite des Vereins „Gegen Vergessen Für Demokratie e.V.“. Online im Internet unter<br />
http://www.gegen-vergessen.de/index.html [18.09.2006].<br />
278 Vgl.: Arbeitskreis Vogelsang im Förderverein Nationalpark Eifel e.V. 2004. Hier sind auch alle folgenden<br />
Informationen zum Inhalt der Projektskizze zu finden.<br />
76
Fallbeispiele – Ordensburg Vogelsang<br />
ihrer Ballung einmalig. Zudem bietet ein umfangreiches Angebot mehr<br />
Auslastungsmöglichkeiten für das Begegnungszentrum als eine Konzentration auf nur einen<br />
Schwerpunkt.<br />
ergänzende Beschriftung:<br />
1. Schwimmbad<br />
2. Sportanlagen<br />
3. Thing-Stätte<br />
4. Fackelträger<br />
5. Unterkunftshäuser<br />
6. Adlerhof mit West- und Ostflügel<br />
7. Burgschänke<br />
8. Redoute<br />
9. Kaserne „Van Dooren“<br />
10. Kino<br />
11. Panzerhallen mit Kraftfahrzeughof<br />
12. Eingangsgebäude „Malakoff“<br />
Abbildung 6: Karte der Anlage Vogelsang heute. Quelle (mit ergänzender Beschriftung): Sammlung<br />
Heinen. Abgedruckt als hintere Umschlagseite in Heinen 2006.<br />
Die Projektskizze ist nur ein Teil des Gesamtnutzungskonzeptes des AK Vogelsang, welches<br />
im Folgenden kurz umrissen wird. Das Nutzungskonzept des AK Vogelsang vom Oktober<br />
2004 macht zunächst einmal deutlich, dass die „[...] Nationalparkverträglichkeit jeglicher<br />
77
Fallbeispiele – Ordensburg Vogelsang<br />
Folgenutzung [...] gewährleistet sein [muss].“ 279 Zudem müsse die Geschichte des Ortes<br />
angemessen dargestellt werden und Vogelsang zu einem Lernort für Demokratie für alle<br />
Generationen werden. Nach den Vorstellungen des AK Vogelsang soll die Anlage möglichst<br />
autofrei bleiben. Die zentrale Empfangs- und Informationsstelle soll direkt am<br />
Eingangsgebäude Malakoff sein 280 . Hier sollen sich die Besucher über Vogelsang informieren<br />
können. Sanitäreinrichtungen sowie Einkaufs-, Gastronomie- und<br />
Unterhaltungsmöglichkeiten sollen dort zu finden sein. Zudem soll hier die<br />
Nationalparkverwaltung und Nationalparkwacht unterkommen. Für die 19.000 Quadratmeter<br />
Nutzfläche umfassende Kaserne „Van Dooren“ ist „[...] eine Nutzung als Unesco-Universität<br />
mit der Fachrichtung Ingenieur- und Technikerausbildung zur Nutzung regenerativer<br />
Energien [...]“ 281 angedacht. Im Ostflügel soll eine Ausstellung über den Nationalpark zu<br />
sehen sein, im Westflügel von Vogelsang die oben beschriebene Dokumentation zur NS-<br />
Geschichte. Im Untergeschoss des Hauptgebäudes könnten Seminarräume eingerichtet<br />
werden, so wie eine vom Deutschen Entwicklungsdienst geplante Ausstellung zum Thema<br />
„Rassismus heute“. In den Gebäuden des Adlerhofes soll die Ausstellung zur Euregio Maas-<br />
Rhein unterkommen. Die Burgschänke soll weiterhin als Gastronomie-Einrichtung fungieren.<br />
Besucher, die im Rahmen verschiedener Angebote längere Zeit auf Vogelsang bleiben, sollen<br />
in den bestehenden Unterkunftshäusern nach einigen baulichen Veränderungen untergebracht<br />
werden. Das ehemalige „Haus für die weiblichen Angestellten“, heute Redoute genannt, soll<br />
zu einem Hotel Garni umgebaut werden. Der Komplex rund um den Kraftfahrzeughof soll ein<br />
„Marktplatz der Regionen“ werden, in dem sich die Region Eifel beispielsweise über<br />
Geschäfte oder andere touristische Angebote präsentieren kann. Kino, Sportanlagen und<br />
Schwimmhalle sollen in ihrer ursprünglichen Funktion erhalten bleiben. Auch das Dorf<br />
Wollseifen soll als Ort der Erinnerung weiter bestehen und wenigstens einige der Rohbauten<br />
als Dokumente der Geschichte des Dorfes erhalten bleiben. Selbst wenn einige der<br />
Vorschläge nicht realisiert werden können:<br />
„Der Förderverein spricht sich ausdrücklich gegen eine Parzellierung des Areals<br />
mit separater Veräußerung von Einzelobjekten aus. Dabei bestünde die Gefahr,<br />
dass weniger interessante Objekte zu Investitionsruinen verkommen oder gar<br />
abgerissen werden. Dadurch würde das Gesamt-Ensemble verfälscht,<br />
denkmalgeschützte und zu erhaltende Bauwerke blieben eventuell ohne<br />
Nutzung.“ 282<br />
279 Förderverein Nationalpark Eifel e.V. 2004, S. 4.<br />
280 Zur besseren Übersicht über das Gelände und die einzelnen Gebäude vgl. Abbildung 6.<br />
281 Förderverein Nationalpark Eifel e.V. 2004, S. 5.<br />
282 Ebenda, S. 22.<br />
78
Fallbeispiele – Ordensburg Vogelsang<br />
Der AK Vogelsang macht in seinem Nutzungskonzept auf Grund fehlender Bestandsanalysen<br />
und Voruntersuchungen keine Kostenkalkulation. Er spricht sich für die Einrichtung einer<br />
Betreibergesellschaft in Form einer gemeinnützigen GmbH aus, die unter zwei<br />
Trägerstiftungen – vom Bund, Land, Kreis und Kommune und der schon bestehenden<br />
Bürgerstiftung Nationalpark Eifel – die Gesamtverantwortung tragen würde.<br />
Auch verschiedene Einzelpersonen engagierten sich im Konversionsprozess. So legte der<br />
Stadtplaner Andreas Glodowski ein Verkehrskonzept vor, welches im Anhang des<br />
Nutzungskonzepts AK Vogelsang zu finden ist. 283 Zudem schaltete sich auch der Rheinische<br />
Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz in die Diskussion ein und gab eine<br />
Stellungnahme zum denkmalpflegerischen Umgang mit der Burg ab. 284 Der Rheinische<br />
Verein stimmt in den meisten Punkten mit dem AK Vogelsang überein und spricht sich für<br />
eine Erhaltung der Gebäude und des Interieurs möglichst ohne Eingriffe aus. Zudem erwähnt<br />
der Verein auch die Sicherung des Geländes, welches durch gut ausgebildetes Personal vor<br />
Zerstörung und „Souvenir“-Jägern geschützt werden muss. Die Kontaminierung des Bodens<br />
durch Munition stellt besondere Herausforderungen an die zukünftige Nutzung und Freigabe<br />
von Flächen auf Vogelsang. Der Rheinische Verein regt an, „[...] inhaltlich angemessene<br />
Nutzungsformen zu finden, die der Historizität des Ortes und seiner durch die militärisch-<br />
schlichte Formensprache der Architektur vorgegebenen bedrückenden Aussagekraft gerecht<br />
werden.“ 285 Dies sind für den Verein vor allem didaktische Einrichtungen,<br />
Verwaltungseinrichtungen des Nationalparks und beispielsweise eine internationale<br />
Begegnungsstätte.<br />
4.3.3.2 Machbarkeitsstudie im Auftrag des Kreises Euskirchen<br />
Gleichzeitig mit den ersten Konzepten des AK Vogelsang wurde vom Landrat des Kreises<br />
Euskirchen eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben. Diese legte die Firma aixplan aus<br />
Aachen im November 2003 vor. 286 Grundsätzlich wird auch in der Machbarkeitsstudie eine<br />
Nutzung der Gebäude Vogelsangs als im Rahmen eines „Lernortes Geschichte“ sowie die<br />
Einrichtung des Nationalparkzentrums befürwortet. Gleichzeitig gibt es aber auch<br />
Überlegungen, wie der Standort für weiteres privates Engagement interessant gestaltet werden<br />
kann:<br />
283 Online im Internet unter http://www.lernortvogelsang.de/morgen/PDF_Dokument_Erschliessung_NP_Zentrum_Vogelsang/Konzept_Erschliessung_NP_Ze<br />
ntrum_Burg_Vogelsang.pdf [19.07.2006].<br />
284 Vgl. hierzu und im Folgenden: Rheinischer Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz 2005.<br />
285 Rheinischer Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz 2005.<br />
286 Vgl. hierzu und im Folgenden: Kreis Euskirchen 2003.<br />
79
Fallbeispiele – Ordensburg Vogelsang<br />
„Die Revitalisierung des Geländes und darauf aufbauende Marktöffnung von<br />
Vogelsang kann nur dann gelingen, wenn öffentliche Startinvestitionen zu einer<br />
frequenzwirksamen Kernnutzung führen und gleichzeitig in erheblichem Maße<br />
privates (Stiftungs-)Interesse aktiviert werden kann.“ 287<br />
Die Machbarkeitsstudie stimmt in vielen Punkten mit dem Konzept des AK Vogelsang<br />
überein, allerdings gibt es einige wichtige Unterschiede. Strategisches Ziel soll der Aufbau<br />
einer „Vogelsang-Akademie“ sein, deren wesentlicher Bestandteil ein NS-<br />
Dokumentationszentrum ist. Weitere Bausteine sind ein Europa-Zentrum für Jugend und<br />
Zukunft, ein ArtCentrum, ein „Kloster auf Zeit“, ein Schulungs- bzw. Technologiezentrum<br />
sowie ergänzende Gästehäuser. Die Nationalparkverwaltung soll nicht wie beim Konzept des<br />
AK Vogelsang im Eingangsbereich Malakoff unterkommen, sondern in der Redoute. Der<br />
zentrale Bereich der Information soll im Adlerhof zu finden sein. Es ist ein „Park im Park“<br />
angedacht, welcher sich auf der Zufahrt von der Bundesstraße bis zum Eingangsbereich<br />
Malakoff hinzieht. Hier soll der Nationalpark in einer eigenständigen Ausstellung erlebbar<br />
werden und der Bereich soll gleichzeitig als Wissenschaftspark und zur Ausstellung für<br />
Künstler dienen. Im Gegensatz zum Förderverein wird der Schwerpunkt in der<br />
Machbarkeitsstudie weniger auf den historischen Wert von Vogelsang gelegt, sondern die<br />
touristische Nutzung in den Vordergrund gestellt. 288<br />
Außerdem soll die in den fünfziger Jahren entstandene Kaserne „Van Dooren“ abgerissen und<br />
dort ein zentraler Platz installiert werden, da keine Nachnutzung möglich sei. Andere durch<br />
Abriss der nach der NS-Zeit entstandenen Gebäude freigewordenen Flächen sollen für eine<br />
künftige Bebauung freigehalten werden. Zudem sieht die Machbarkeitsstudie eine bauliche<br />
Veränderung der bestehenden Gebäude im Rahmen des Denkmalschutzes vor:<br />
„Diese Eingriffe bieten die Chance zur Aufarbeitung der Geschichte, ohne die<br />
eine Neuaneignung des Geländes nicht möglich wäre. Sie können - als Symbol<br />
einer Auseinandersetzung – zu einem besseren Verständnis der historischen<br />
Architektur führen. Der Dialog zwischen Alt und Neu im Äußeren wie im Inneren<br />
wird sichtbares Zeichen des Wandels.“ 289<br />
Einer der wesentlichen Unterschiede zum Nutzungskonzept des AK Vogelsang ist die<br />
Unterbringung des Dokumentationszentrums in der ehemaligen Burgschänke, während<br />
Gastronomie-Angebote im Westflügel zu finden sein sollen. Hier liegt also ein<br />
Nutzungstausch gegenüber dem anderen Konzept vor. Die Kosten für die Vorschläge der<br />
Machbarkeitsstudie belaufen sich wie folgt:<br />
„Die Gesamtherstellungskosten für die mittelfristig realistischen Nutzungen<br />
betragen 36 Mio. Euro. Die Herstellung der Übergabereife erfordert davon ca. 6<br />
287 Kreis Euskirchen 2003, S. 5.<br />
288 Vgl.: Kuhn 2003, S. 9.<br />
289 Kreis Euskirchen 2003, S. 25.<br />
80
Fallbeispiele – Ordensburg Vogelsang<br />
Mio., die Gestaltung der Freiräume und Verkehrsflächen ca. 7 Mio., die<br />
Gebäudemodernisierung ca. 19 Mio. und die Entwicklung des ‚Park im Park’<br />
insgesamt ca. 3 Mio. Hinzu kommt ca. 1 Mio. Euro an Entwicklungskosten.“ 290<br />
Finanziert werden soll diese Summe durch verschiedene Fonds des Bundes, des Landes<br />
Nordrhein-Westfalen sowie durch Stiftungen und Partnerschaften. Auf jeden Fall müsse eine<br />
„Stiftung Vogelsang“ eingerichtet werden, die als Grundeigentümer und förderbarer Investor<br />
auftritt. Schon im Vorfeld sollte eine Projektgruppe „Zukunft Vogelsang“ zusammenkommen.<br />
Zunächst seien aber Eigentumsfragen und Grundstücksbewertungen zu klären.<br />
Über die Differenzen zwischen Machbarkeitsstudie und Nutzungskonzept wurde in den<br />
folgenden Monaten intensiv diskutiert, ohne jedoch zu einem Ergebnis zu kommen. Zudem<br />
kam von anderer Seite massive Kritik an der Machbarkeitsstudie auf: Die<br />
Naturschutzverbände BUND (Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V.), LNU<br />
(Landesgemeinschaft Naturschutz und Umwelt e.V.) und NABU (Naturschutzbund<br />
Deutschland e.V.) wiesen in ihrer gemeinsamen Pressemitteilung vom 21.10.2003 darauf hin,<br />
dass verschiedene Aspekte der in der Machbarkeitsstudie enthaltenen Pläne nicht den<br />
Anforderungen des Nationalparks entsprächen. Dies galt vor allem für den „Park im Park“,<br />
die Zufahrt mit PKW auf das Gelände und die Ideen für den Ort Wollseifen. 291<br />
Um den Prozess nicht völlig ins Stocken geraten zu lassen, wurde im November 2004 eine so<br />
genannte „Herbstakademie Vogelsang 2004“ durchgeführt. Vertreter der verschiedenen<br />
Gruppen kamen mit weiteren Sachverständigen zusammen. Dabei waren auch Studenten<br />
verschiedener Fachrichtungen anwesend, die dem Prozess neue Impulse geben und konkrete<br />
bauliche Entwürfe für die Jugendbegegnungsstätte vorlegen sollten. 292 Fazit der Veranstaltung<br />
war zwar, dass sich die Akteure in vielen Punkten näher kamen, der Konsens jedoch nicht<br />
lange hielt. 293 Auch die Hamburger Consulting-Firma Wenzel Consulting stellte schon vorher<br />
fest, dass die Herbstakademie wenig professionell durchgeführt wurde, da die Firma aixplan<br />
als selbst involvierter Akteur, die Leitung und Koordination übernommen hatte. 294 Auch<br />
Professor Luc Merx von der Technischen Universität Kaiserslautern, der bei der<br />
Herbstakademie anwesend war, konnte nur feststellen, dass mit der verfahrenen Situation kein<br />
weiteres Vorgehen möglich sei: „Ich kann mir nicht vorstellen, dass auf diese Weise eine<br />
Lösung für Vogelsang gefunden wird.“ 295<br />
290 Kreis Euskirchen 2003, S. 6.<br />
291 Vgl.: BUND, LNU und NABU 2003.<br />
292 Vgl.: Kehren 2004a.<br />
293 So die Überschriften der Zeitungsartikel aus der Kölnischen Rundschau und dem Kölner Stadt-Anzeiger vom<br />
20.12.2004 und 14.01.2005.<br />
294 Vgl.: Kehren 2004b.<br />
295 Zit. nach: Lang 2004.<br />
81
Fallbeispiele – Ordensburg Vogelsang<br />
4.3.3.3 Standortentwicklungsgesellschaft Vogelsang<br />
Zum 1. Mai 2005 wurde schließlich die „Standortentwicklungsgesellschaft Vogelsang (SEV)“<br />
gegründet. Deren vorrangige Aufgabe ist es, Investoren für die zukünftige Nutzung zu finden<br />
und den derzeitigen Betrieb auf Vogelsang zu koordinieren. Sie soll planen, wie es mit<br />
Vogelsang weitergeht und einen Träger finden bzw. eine Trägergesellschaft gründen. 296<br />
Träger der SEV sind der Bund, das Land Nordrhein-Westfalen, die Kreise Euskirchen,<br />
Aachen und Düren, die Stadt Schleiden und der Förderverein. Zum Aufsichtsratschef wurde<br />
der Allgemeine Vertreter des Landrates Manfred Poth gewählt. Mit der Planung einer<br />
Besucheranlaufstelle ab 2006 wurde wiederum die Firma aixplan beauftragt, obwohl diese<br />
vorher wegen ihrer herausragenden Stellung im gesamten Konversionsprozess kritisiert<br />
worden war. 297 Dass Außenstehende den Eindruck bekamen, dass sich die SEV und aixplan<br />
gegenseitig die Aufträge zuschusterten, beweist auch die Kritik des Architekturbüros König.<br />
In der vom Kreis an aixplan vergebenen Machbarkeitsstudie war beispielsweise zum ersten<br />
Mal von der Einrichtung einer Standortentwicklungsgesellschaft gesprochen worden. Das<br />
Architekturbüro König protestierte gegen das Vergabeverfahren für die Besucheranlaufstelle,<br />
da es nicht öffentlich ausgeschrieben gewesen sei. 298 Trotzdem sei das Verfahren korrekt<br />
gewesen:<br />
„Manfred Poth, der Allgemeine Vertreter des Euskirchener Landrats [und<br />
gleichzeitig auch Aufsichtsratchef der SEV; D.R.], mochte gestern mit Hinweis<br />
aufs schwebende Verfahren nicht im Detail Stellung nehmen: ‚Die Vergabe war<br />
rechtlich korrekt und sowohl mit der Bewilligungsbehörde als auch mit der<br />
Standortentwicklungsgesellschaft abgestimmt.’“ 299<br />
Es zeigte sich, dass trotz der Vorlaufzeit die Realität die Diskussionen um die Nutzung<br />
überholte. Am 1. Januar 2006 wurde die Anlage Vogelsang für die Öffentlichkeit zugänglich.<br />
Es gibt inzwischen ein provisorisches Forum mit Informationen für die Besucher, sowie<br />
Broschüren mit Wegbeschreibungen über das Gelände. Es wurden zudem 20 Referenten<br />
ausgebildet, die täglich Gruppen über das Gelände führen und auch Zutritt zur Burgschänke<br />
und dem Kino gewähren. Ansonsten sind die Innenräume aus Sicherheitsgründen für die<br />
Touristen nicht zugänglich.<br />
4.3.3.4 „Vogelsang ip“ des Büros Müller-Rieger<br />
Als weitere Anregung und Grundlage für die kommende Gestaltung wurde im Dezember<br />
2005 ein Konzept des Münchner Büros Müller-Rieger vorgelegt. Dieses steht als solches nicht<br />
296 Vgl.: Lang 2005.<br />
297 Vgl.: Puderbach 2005.<br />
298 Vgl.: Heup 2005.<br />
299 Ebenda.<br />
82
Fallbeispiele – Ordensburg Vogelsang<br />
der Öffentlichkeit zur Verfügung, daher können die Inhalte des Konzepts nur durch<br />
Sekundärquellen wie Zeitungsberichte sowie eine Zusammenfassung auf der Internetseite des<br />
Kreises Euskirchen 300 erschlossen werden. Zudem sind im Infocenter von Vogelsang einige<br />
Aufsteller mit Informationen zur zukünftigen Nutzung zu finden, die auf dem Konzept von<br />
Monika Müller-Rieger basieren. Im Rahmen der Euroregionale 2008 hat das Büro für<br />
Ausstellungsplanung diverse Vorschläge gemacht. Neben einer Planung für drei<br />
Ausstellungen (die NS-Dokumentation, eine Darstellung der Regionalgeschichte und das<br />
Nationalparkzentrum) wurden die schon bestehenden Vorschläge einer<br />
Jugendbegegnungsstätte und die Unterbringung des Nationalparkforstamtes aufgegriffen. Es<br />
sind jedoch besonders die Konzepte zu einer so genannten „Brechung“ in die Kritik<br />
geraten. 301 Hierbei geht es um eine innere Brechung, das heißt, der Geist des<br />
nationalsozialistischen Gedankenguts soll durch die Hinwendung zur Demokratie gebrochen<br />
werden. Dies würde vor allem durch die Ausstellungen und ein mögliches<br />
Begegnungszentrum passieren und ist auch unumstritten. Die äußere Brechung dagegen sieht<br />
auch eine bewusste Veränderung der ursprünglichen Architektur vor. Dies soll zum Beispiel<br />
dadurch geschehen, dass in gelben Lettern das Wort „Eifelturm“ an die Wand des Turmes<br />
projiziert wird. 302 Gelb als durchgehende Farbe soll auch an anderen Stellen eingesetzt<br />
werden und ist zur Zeit schon auf den Broschüren zu sehen.<br />
Als Dachmarke wurde vom Büro Müller-Rieger der Name „Vogelsang ip“ vorgeschlagen,<br />
wobei „ip“ englisch ausgesprochen wird und wahlweise für „interesting people“ oder „in<br />
progress“ steht. 303 Auch die Homepage der SEV ist im Internet schon unter der Adresse<br />
www.vogelsang-ip.de zu finden. Dies führte jedoch zu großen Protesten: Vertreter von SPD<br />
und FDP sprachen sich gegen das Kürzel aus, wenngleich nicht gegen das Gesamtkonzept<br />
von Müller-Rieger. Ein CDU-Vertreter dagegen fand die Idee des Namenszusatzes durchaus<br />
passabel und einprägsam. 304 Auf jeden Fall kochten die Emotionen in der Region hoch. Da<br />
das Kürzel grundsätzlich auch zu eigenen Vorschlägen anregen sollte, wurden die Bürger<br />
kreativ und schlugen in Leserbriefen und Kommentaren vor, der Stadt Schleiden ein „ip“ für<br />
„ist pleite“ zu verleihen oder deuteten „ip“ als „invalid paraphe“. 305 Es zeigt sich an dieser<br />
hoch emotionalen Diskussion, dass die Bevölkerung sich durch schnell durchgesetzte<br />
300 Vgl.: O.V.: Internetseite des Kreises Euskirchen, Integriertes Ausstellungskonzept für Vogelsang. Online im<br />
Internet unter http://www.kreis-euskirchen.de/tourismus/vogelsang/Ausstellungskonzept.php [29.08.2006].<br />
301 Vgl.: Heinen 2005b.<br />
302 Vgl.: O.V.: Umstrittene Nazi-Burg. In: Der Spiegel, Nr. 51 (19.12.2005), S. 20.<br />
303 Vgl.: Hammes 2005.<br />
304 Vgl.: Reinartz 2006.<br />
305 Vgl.: Thalken 2006.<br />
83
Fallbeispiele – Ordensburg Vogelsang<br />
Entscheidungen übergangen fühlte, so dass derartige, meist eher kleinere Maßnahmen<br />
letztendlich sogar zu Widerstand gegen das gesamten Projekt führen können.<br />
Durch das Konzept von Müller-Rieger wurde noch einmal die Diskussion um die Verortung<br />
der einzelnen Nutzungen auf den Tisch gebracht. Immer wieder war besonders die<br />
Unterbringung der Gastronomie in der Burgschänke umstritten gewesen. Der AK Vogelsang<br />
wollte die Schänke weiternutzen und konnte sogar eine ortsansässige Brauerei als<br />
Interessenten vorweisen. Da die Einrichtung an rheinische Brauhäuser der zwanziger Jahre<br />
angelehnt ist und auch die Belgier keine Berührungsängste mit der schon unter den Nazis als<br />
Lokal genutzten Schänke hatten, könne die Gastronomie auch weiterhin in gleicher Funktion<br />
genutzt werden. 306 Bedenken gegen eine Gastronomie-Einrichtung in der Burgschänke<br />
wurden auf der Herbstakademie hingegen laut: Sollen Touristen genau dort Essen und<br />
Trinken, wo schon die Nazis gefeiert haben? Ein noch größeres Problem stellen Neonazis dar,<br />
die sich unter einem Decknamen in die Schänke einmieten und dort Versammlungen abhalten<br />
könnten. Müller-Rieger hat daher die Burgschänke als Ausstellungsraum vorgesehen, in dem<br />
die Fenster verdunkelt werden sollen. Gerade ausländische Besucher seien sehr sensibel und<br />
wollen nicht am Ort von Nazi-Festivitäten ihr Essen zu sich nehmen. Dafür möchte die<br />
Ausstellungsplanerin aus dem Schwimmbad eine „Hallen-Bar“ machen. Mit drastischen<br />
Worten kommentiert Volker Hoffmann vom Förderverein Nationalpark Eifel in der „taz“<br />
Müller-Riegers Ideen der Brechung:<br />
„Da halten es Brachialbrecher für unzumutbar, dass Kinder unterhalb eines<br />
Mosaiks mit germanischen Athleten unbekümmert schwimmen, während sie es<br />
sich gleichzeitig durchaus vorstellen können, an selber Stelle in einer Hallenbar<br />
Schampus zu trinken. Angeblich ist es Besuchern ebenso wenig zuzumuten, in der<br />
ehemaligen Schänke Kaffee zu trinken. Der Raum ist als Ausstellungsraum<br />
vorgesehen, der herrliche Blick auf den Stausee soll durch Schautafeln verdeckt<br />
werden. Nun, da breche ich so lange, bis das Genick von dem Ding gebrochen<br />
ist.“ 307<br />
Sowohl die Argumentationen für eine Unterbringung der Gastronomie in der ehemaligen<br />
Schänke als auch dagegen sind nachvollziehbar. Letztendlich ist die Verortung abhängig vom<br />
Gesamtkonzept und den finanziellen Mitteln.<br />
Diverse andere Nutzungsvorschläge für Vogelsang, die in den letzten Jahren aufgekommen<br />
waren, wurden inzwischen wieder verworfen. Der Vollständigkeit halber sollen sie jedoch an<br />
dieser Stelle erwähnt werden. Der damalige nordrhein-westfälische Kulturminister Michael<br />
Vesper von den Grünen hatte zum Jahresbeginn 2004 vorgeschlagen, dass Vogelsang zu<br />
306 Vgl.: Heup 2004.<br />
307 Zit. nach: Raijer 2006, S. 3.<br />
84
Fallbeispiele – Ordensburg Vogelsang<br />
einem dauerhaften Standort für die Wehrmachtsausstellung werden könne. 308 Damit solle<br />
verhindert werden, dass Neonazis Vogelsang als Wallfahrtsort missbrauchen würden. Die<br />
Idee verschwand jedoch schnell wieder aus den Medien, zumal sie nie in ein Gesamtkonzept<br />
für Vogelsang eingebunden wurde und die Wehrmachtsausstellung auch als<br />
Wanderausstellung konzipiert war. Auf der Herbstakademie wurden teilweise Vorschläge in<br />
baulicher Hinsicht entwickelt, die auf Grund der hohen Kosten von vorneherein utopisch<br />
anmuteten: Beispielsweise<br />
„[...] den zentralen Bereich zwischen Adlerhof und Malakoff-Bereich mit<br />
Liegestützen-Männern zu überbauen. Eine Riesenfläche, die in ihrer Dimension<br />
an das Holocaust-Denkmal von Berlin oder an die bizarren Betonpanzersperren<br />
des Westwalles erinnern könnte. Und die Idee einer Seilbahn von Heimbach bis<br />
nach Vogelsang.“ 309<br />
Auch wenn diese Vorschläge nicht in die Realität umgesetzt wurden, zeigen sie, dass auf der<br />
Herbstakademie mit viel Kreativität an die Sache herangegangen wurde. Leider ist das<br />
aufgezeigte Potenzial in der folgenden Zeit wenig genutzt worden. Die Idee, dass<br />
Schulschwimmen der Schleidener Schulen im Vogelsanger Hallenbad stattfinden zu lassen,<br />
wurde durch den Stadtrat abgelehnt. 310 Inzwischen hat sich aber eine „Initiativgruppe<br />
Schwimmbad“ gebildet, die aktiv für den Erhalt des Schwimmbads und seine Nutzung in<br />
ursprünglicher Form kämpft. 311 Zu Beginn der Diskussion wurde zudem immer wieder vom<br />
Abriss oder dem kontrollierten Verfall von Vogelsang gesprochen. So äußerte sich Frau<br />
Birgitta Ringbeck, die Referatsleiterin für Baudenkmalschutz im Städtebauministerium von<br />
Nordrhein-Westfalen, in einem Interview mit der „Zeit“ im August 2003 und plädierte auf<br />
Grund der Unmöglichkeit einer Gesamtnutzung von Vogelsang für den kontrollierten Verfall<br />
einiger Bereiche. 312 Eine ähnliche Argumentation vertrat auch Paul Spiegel, der damalige<br />
Vorsitzende des Zentralrats der Juden: „‚Reine Täterorte’, schrieb er, ‚sollten nicht um jeden<br />
Preis erhalten bleiben’; schon gar nicht eigneten sie sich ‚als Tourismusmagnet’.“ 313 Damit<br />
sprach sich Spiegel aber auch gegen die Chance aus, die Anziehungskraft von Täterorten zu<br />
nutzen, um an dieser Stelle wirkliche Aufklärung über den Nationalsozialismus zu bieten.<br />
Über die weitere Umsetzung einer zivilen Nutzung wurde bis jetzt noch nicht endgültig<br />
entschieden. Als erstes sind vor allem die Eigentumsverhältnisse zu klären, was bis zum<br />
jetzigen Zeitpunkt nicht geschehen ist. Auch engagierte Bürger wie die Betreiber der Seite<br />
„Lernort Vogelsang“ machten zur Jahreswende 2005/06 auf dieses Versäumnis aufmerksam:<br />
308 Vgl.: O.V. Wehrmachtsausstellung in Nazi-Burg? In: Der Spiegel, Nr. 2 (05.01.2004), S. 16.<br />
309 O.V.: Vogelsang: Turner, Orden und Haus der Jugend. In: Kölnische Rundschau (25.11.2004).<br />
310 Vgl.: Heinen 2005a.<br />
311 Vgl.: Klinkhammer 2006b.<br />
312 Vgl.: Ermlich 2003.<br />
313 Müllender 2004, S. 4.<br />
85
Fallbeispiele – Ordensburg Vogelsang<br />
„Allerdings scheint das Land es bis heute versäumt zu haben, mit dem Bund als<br />
Eigentümer der Immobilie die Modalitäten der Übergabe zu klären. Bislang war<br />
die Region davon ausgegangen, dass der Bund nicht nur die Immobilie zu einem<br />
symbolischen Preis überträgt, sondern darüber hinaus auch noch eine erhebliche<br />
finanzielle Mitgift zahlen würde.“ 314<br />
Im August dieses Jahres besuchte die ehemalige nordrhein-westfälische Umweltministerin<br />
und stellvertretende Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90 / Die Grünen Bärbel Höhn<br />
Vogelsang. Sie will sich für ein größeres Engagement des Bundes für Vogelsang einsetzen.<br />
Gespräche, die schon zu Jahresbeginn von verschiedenen Seiten gefordert wurden, verliefen<br />
bis jetzt allerdings auch aus Sicht der Politikerin nicht sonderlich befriedigend. 315<br />
Zudem ist Eile angebracht: Vogelsang hat seit der Öffnung Anfang des Jahres 2006 viele<br />
Besucher – 35.000 Personen in den ersten fünf Monaten –, doch dies bedeutet auch große<br />
Belastungen für die Gebäude. Sie verfallen langsam, aber „[i]rgendwelche<br />
Sanierungsbemühungen der Bundesimmobilienagentur als Verwalterin der bundeseigenen<br />
Immobilie sind bislang nicht erkennbar.“ 316 Immerhin sind alle beteiligten Gruppen<br />
inzwischen wieder zu einem Dialog bereit 317 , so dass zu hoffen bleibt, dass man sich in<br />
Zukunft auf eine gemeinsame Vorgehensweise einigen kann, zumal die Grundideen schon seit<br />
Beginn der Diskussion im Wesentlichen übereinstimmen. Dennoch scheinen die<br />
Eigentumsfrage sowie die vorwiegend durch Lokalpolitik und die verschiedenen Gruppen<br />
bestimmten Streitereien den Konversionsprozess zu behindern. Daher wird es Zeit, dass die<br />
schon seit Beginn der Diskussion bestehenden Fragen endgültig geklärt werden, damit aus<br />
Vogelsang ein interessanter Erinnerungsort werden kann. „Dazu aber muss die Debatte aus<br />
der Eifel raus und der Bund sich seiner Verantwortung stellen“ 318 , wie Jutta Göricke von der<br />
„Süddeutschen Zeitung“ im März 2006 forderte.<br />
314 Heinen 2005/2006.<br />
315 Vgl.: Klinkhammer 2006a.<br />
316 Heinen 2006a.<br />
317 Vgl.: Klinkhammer 2006c.<br />
318 Göricke 2006.<br />
86
5. Umgang mit dem Täterort<br />
Umgang mit dem Täterort<br />
Im Folgenden sollen Überlegungen zu einem generell geeigneten Umgang mit Täterorten<br />
vorgestellt werden. Nachdem in Kapitel 3 die Unterscheidung zwischen Opfer- und<br />
Täterorten deutlich gemacht und ein Überblick über die vorhandenen Täterorte gegeben<br />
wurde, stellt sich die Frage, ob mit Hilfe der Untersuchung der Täterorte <strong>Obersalzberg</strong>, Villa<br />
ten Hompel und Ordensburg Vogelsang ein generelles Vorgehen konzipierbar ist. Dabei<br />
können die in den Debatten aufgekommenen Argumentationen für und gegen die<br />
verschiedenen Verwendungen nützliche Hinweise auf Schwierigkeiten und Chancen im<br />
Prozess zur Umwandlung von ehemaligen Täterorten geben. Die zu beantwortenden Fragen<br />
sind unter anderem: Was ist angemessen an Täterorten? Welche Nutzungsweisen sind<br />
möglich und was muss dabei beachtet werden? Hierbei soll kein Konzept für einen weiteren<br />
speziellen Täterort erstellt werden, aber eine Zusammenfassung der obigen Untersuchungen<br />
kann eine Hilfe für zukünftige Überlegungen an verschiedenen Täterorten sein. In einem<br />
zweiten Schritt sollen die Ergebnisse auf die Ordensburg Vogelsang angewandt werden, da<br />
hier noch keine endgültige Folgenutzung eingetreten ist.<br />
5.1 Konzeption eines generellen Vorgehens<br />
Zunächst einmal ist festzustellen, dass die Aufstellung eines allgemeinen Schemas, das für<br />
alle Täterorte Gültigkeit hat, nicht sinnvoll ist. Dazu sind die Orte zu unterschiedlich, sowohl<br />
in ihrer Größe und Bekanntheit als auch von ihrem Umfeld sowie den finanziellen und<br />
touristischen Möglichkeiten. Dies war auch das Fazit einer Tagung über die „Darstellung der<br />
Täter in Gedenkstätten“, die 1996 in Hannover stattfand. Matthias Haß fasst in seinem<br />
Tagungsbericht die Ergebnisse zusammen und kritisiert, dass die Beiträge der Tagung zu<br />
spezifisch waren, um daraus eine allgemeine Handlungsanleitung zu erstellen:<br />
„Die spezifischen Bedingungen der einzelnen Gedenkstätten lassen es fraglich<br />
erscheinen, ob einzelne Fallbeispiele auf alle Gedenkstätten übertragen werden<br />
können. Es wäre im Gegenteil wünschenswert gewesen, wenn im letzten Beitrag<br />
allgemeinere Ansätze vorgestellt worden wären, die in den verschiedenen<br />
Gedenkstätten aufgegriffen werden können.“ 319<br />
Diese Überlegung macht im Umkehrschluss aber auch deutlich, dass es bestimmte Aspekte<br />
gibt, die an allen Orten auftauchen und daher der Umgang mit Täterorten erleichtert wird,<br />
wenn diese Schwierigkeiten von vorneherein beachtet werden. Diese Aspekte sollen nun<br />
herausgefiltert werden.<br />
319 Haß 1996, S. 385.<br />
87
Umgang mit dem Täterort<br />
Der Unterschied der Gruppe Täterorte zu der Gruppe der Opferorte ist in jedem Fall deutlich<br />
zu machen. Gerade weil Deutschland das Land der Täter ist, darf es nicht dazu kommen, dass<br />
sich die Deutschen selbst als vorrangige Opfer des NS-Regimes sehen. Im Gegensatz zu<br />
Opferorten fällt die Betroffenheit an Täterorten weniger stark aus, da hier in den meisten<br />
Fällen Menschen nicht gequält oder getötet wurden. Daher bietet sich die Gelegenheit rational<br />
und objektiv verschiedene Aspekte des Nationalsozialismus zu beleuchten. Jüngere<br />
Generationen erhalten durch die Unterscheidung in Opfer- und Täterorte die Möglichkeit, sich<br />
mit beiden Seiten der NS-Herrschaft vertraut zu machen und können so ein umfassendes<br />
Wissen über diese Jahre erhalten.<br />
Die Verschiedenartigkeit der einzelnen Orte ist kein Nachteil, sondern im Gegenteil eine<br />
große Chance. Gerade die Einzigartigkeit jedes Ortes bietet die Gelegenheit, einen<br />
bestimmten Aspekt zu betonen und zu vertiefen. Am Beispiel der Villa ten Hompel konnte<br />
gezeigt werden, dass sehr spezielle und bis dahin wenig erforschte Gebiete des<br />
Nationalsozialismus sich als neue Forschungsnischen etablieren können. Der regionale Bezug<br />
kann in der Bildungsarbeit von Vorteil sein, gerade wenn sie in Zusammenarbeit mit Schulen<br />
in der Umgebung geschieht.<br />
„Bei aller Unterschiedlichkeit der Gedenkstätten in Deutschland, die nicht nur<br />
vom Ort, an dem sie sich befinden, abhängt, sondern auch vom Zeitpunkt ihrer<br />
Gründung, von ihrer Stellung als kulturelle Einrichtung, von der Kapazität an<br />
Raum, Geld und Ausstattung und nicht zuletzt von der jeweiligen Interessenlage<br />
bzw. professionellen Herkunft der Leiterinnen und Leiter bzw. der<br />
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, hat sich für alle Gedenkstätten die Frage nach<br />
Vermittlung und Aneignung von Geschichte im Kontext gegenwärtiger politischer<br />
Kultur als zentral erwiesen.“ 320<br />
Bildungsarbeit ist heute ein wichtiger Bestandteil von Erinnerungsstätten. Durch Schulklassen<br />
und andere Gruppen wird eine regelmäßige Nutzung der vorhandenen Möglichkeiten<br />
gewährleistet. Dabei können die Aspekte der Bildungsarbeit sehr verschieden sein, sie sollten<br />
sich aber mit der ortsspezifischen Geschichte und den Voraussetzungen vereinbaren lassen.<br />
Meist werden Bezüge zwischen Nationalsozialismus und heutigem Rechtsextremismus<br />
aufgegriffen. Aber auch andere Themen, die einen Gegenwartsbezug aufweisen, wie<br />
beispielsweise Menschenrechte in Nürnberg 321 , können in der Bildungsarbeit an Täterorten<br />
eine Rolle spielen.<br />
Die Konzentration auf eine bestimmte Tätergruppe – in der Villa ten Hompel auf die Polizei –<br />
ist dem Ort meist angemessener, als der Versuch die gesamte NS-Geschichte einzubinden.<br />
Dies konnte am <strong>Obersalzberg</strong> gelingen, da mit einem renommierten Forschungsinstitut<br />
320 Genger 1997, S. 262.<br />
321 Vgl.: Huhle 2002.<br />
88
Umgang mit dem Täterort<br />
zusammengearbeitet wurde und der Ort mit der Ansiedlung der NS-Führungsspitze ein Abbild<br />
des ganzen nationalsozialistischen Staates im Kleinen darstellte. Als einer der bekanntesten<br />
und meist besuchten Täterorte ist zudem eine überblicksartige Darstellung dem Ort<br />
angemessen.<br />
Generell erscheint die Darstellung der Spezifik des Täterortes an Orten mit architektonischen<br />
Hinterlassenschaften des Nationalsozialismus einfacher, als an solchen, an denen politische<br />
Entscheidungen getroffen wurden. Dies gilt insbesondere, wenn diese Entscheidungen auf<br />
einer mittleren und unteren Ebene angesiedelt waren und es sich „nur“ um die arbeitsteilige,<br />
bürokratische Seite der Tat handelt. Auf dieses Problem der Darstellbarkeit macht Wulff<br />
Brebeck aufmerksam: „[...] die Tat des jeweilige Tatbeteiligten [erscheint] unspektakulär. Sie<br />
sieht – wir sprechen von der Visualisierung – nicht wie ein Teil eines Verbrechens aus.“ 322<br />
Meist beschränken sich Ausstellungen dann auf die Biografien der Hauptbeteiligten vor Ort.<br />
Dass jedoch auch das Handeln der Schreibtischtäter Gegenstand einer Ausstellung sein kann,<br />
zeigt der Lernort Villa ten Hompel.<br />
Täterorte sollten markiert werden. In vielen Gegenden ist das Wissen um einen solchen Ort<br />
schon verloren gegangen und nur durch intensive Nachforschungen wieder herstellbar. Wer<br />
weiß, wo die Befehlshaber ihren Dienst verrichteten oder an welcher Stelle der Sammelplatz<br />
für die Deportation der Juden war? Ist dieses Wissen aber vorhanden, sollte es publik gemacht<br />
werden. Dies kann auf verschiedene Weise geschehen. Ein gelungenes Beispiel ist die<br />
Broschüre des Wiener Rothschild-Palais, welche die Geschichte anschaulich und für jeden<br />
verständlich wiedergibt. Diese Informationen stehen Interessierten zur Verfügung. Ein<br />
weiteres klassisches Beispiel sind Erinnerungstafeln an Häusern. Auch diese geben<br />
Informationen über die Geschehnisse vor Ort. Hinzuweisen sei an dieser Stelle noch auf die<br />
so genannten Stolpersteine. 323 Dieses inzwischen sehr bekannte Projekt erinnert in ganz<br />
Deutschland durch eingelassene Metallplatten mit Namen an Opfer, die während der Nazi-<br />
Zeit deportiert wurden. Eine Idee wäre, etwas ähnliches für Täterorte einzuführen. Zwar sollte<br />
an Täterorten nicht auf das Einzelschicksal einer Person aufmerksam gemacht werden, aber es<br />
ist ein ansprechender Gedanke, dass die Menschen im Vorbeigehen über die Geschichte<br />
„stolpern“. Eine Idee, die auch der Siegerentwurf von 1984 für Umgestaltung des Gestapo-<br />
Geländes beinhaltete: die Originaldokumente der SS-Akten sollten auf Eisenplatten zu sehen<br />
sein, die einen Großteil des Geländebodens bedecken sollten. 324 Wie in Kapitel 3.2.3<br />
322 Brebeck 1993, S. 1.<br />
323 Vgl.: Demnig, Gunter: Internetseite der Aktion Stolpersteine. Online im Internet unter<br />
http://www.stolpersteine.com/ [04.09.2006].<br />
324 Vgl.: Young 1997, S. 135.<br />
89
Umgang mit dem Täterort<br />
geschildert wurde, ist es nicht zur Umsetzung dieses Entwurfes gekommen, wohl aber zur<br />
Einrichtung einer Dokumentation.<br />
An größeren und bekannteren Täterorten, besonders den baulichen Hinterlassenschaften des<br />
Nationalsozialismus, sollte die Einrichtung einer detaillierten Dokumentation ins Auge<br />
gefasst werden. Sie kann umfassend über die Geschichte vor Ort aufklären und<br />
Hintergrundinformationen liefern. An vielen Orten ist dies schon geschehen wie auf dem<br />
Reichsparteitagsgelände in Nürnberg, dem ehemaligen Gestapo-Gelände in Berlin oder dem<br />
Haus der Wannsee-Konferenz. Wenn an einem Täterort eine Dokumentation eingerichtet<br />
werden soll, muss diese auf jeden Fall den aktuellen wissenschaftlichen Stand widerspiegeln.<br />
Gerade ein sensibles Thema wie der Nationalsozialismus, muss historisch korrekt dargestellt<br />
werden. Bei einem falschem Umgang kann es sonst an Täterorten, die immer noch eine<br />
Faszination auf die Menschen ausüben, zu unerwünschten Eindrücken oder Erkenntnissen<br />
kommen. Zwar gibt es so gut wie keine Wirkungsforschung in Bezug auf NS-Bauwerke,<br />
welche die Auswirkungen der Bauten auf die Rezipienten belegen 325 , dennoch sind die von<br />
Hans-Ernst Mittig als Spontan- und Werbewirkung bezeichneten Wirkungen der NS-<br />
Architektur bis heute erfahrbar. Die Finanzierung einer Dokumentationsstätte ist nicht<br />
einfach. Damit ein solches Projekt tragfähig ist, ist eine finanzielle Unterstützung von Seiten<br />
der öffentlichen Hand nötig und es kann meist auf eine zusätzliche Nutzung des Täterortes<br />
nicht verzichtet werden, vor allem wenn es sich um Großbauten handelt. Bei der Einrichtung<br />
kultureller Nutzungen ist vorher die finanzielle Situation zu klären. In vielen Fällen hat sich<br />
gezeigt, dass die Koordination der einzelnen Behörden von Stadt, Land und Bund nicht<br />
funktioniert und dies zu erheblichen Verzögerungen in der Umsetzung der Projekte geführt<br />
hat, wie es bei der „Topographie des Terrors“ der Fall war. Wenn sich keine Behörde<br />
zuständig fühlt, werden die Verantwortlichkeiten nur hin und her geschoben, ohne zu einem<br />
Ergebnis zu kommen.<br />
Alle vorgestellten Beispiele haben gezeigt, dass die Öffentlichkeit auf jeden Fall in die<br />
Folgenutzung mit einzubeziehen ist. Oft sind es Personen vor Ort, welche den Täterort zuerst<br />
als solchen identifiziert und sich für einen angemessenen Umgang einsetzt haben. Am<br />
<strong>Obersalzberg</strong> wurde die Bürgerinitiative leider nicht in den Folgeprozess eingebunden. Dies<br />
ist besonders schade, da sich Stadt und Land jahrelang vor ihrer Verantwortung gedrückt<br />
haben. Die Bürger stellen zudem ein großes Potenzial dar, wie sich bei der Ideenfindung zur<br />
Nutzung der Ordensburg Vogelsang gezeigt hat. In der öffentlichen Diskussion kann genau<br />
ausgelotet werden, welche Ideen die Unterstützung der Bewohner finden. Wäre der Vorschlag<br />
325 Vgl.: Mittig 1992, S. 246.<br />
90
Umgang mit dem Täterort<br />
„Vogelsang ip“ vorher ausführlicher diskutiert worden, wären die Widerstände sicher<br />
moderater ausgefallen und Alternativen hätten eine Chance gehabt.<br />
Ob die Architektur des Täterortes erhalten, restauriert oder durch neue Elemente „gebrochen“<br />
werden sollte, hängt von den Gegebenheiten ab. Auf dem Reichsparteitagsgelände hat man<br />
sich mit dem modernen Museumsgebäude für eine Brechung entschieden. Ein pfeilartiger Bau<br />
aus Glas und Stahl, in dem die Dokumentation untergebracht ist, durchbohrt den Nordflügel<br />
der ehemaligen Kongresshalle. Wenn die Gebäude unter Denkmalschutz stehen, sind die<br />
Veränderungsmöglichkeiten beschränkt. Künstlerische Auseinandersetzungen mit dem<br />
Themengebiet in Form von Installationen und Monumenten können neue Denkanstöße geben.<br />
Auf der anderen Seite ist es gerade die Authentizität des Täterortes, die seine Attraktivität<br />
ausmacht. Daher sollte diese auch weiterhin für die Besucher sichtbar bleiben.<br />
In jedem Fall sollte versucht werden, ein Gesamtkonzept für die Nutzung des Täterortes zu<br />
erstellen. Auch hier ist bei Großbauten die Situation besonders schwierig und angesichts der<br />
Monumentalität einiger NS-Bauten überhaupt nicht möglich. Sowohl in Nürnberg als auch am<br />
<strong>Obersalzberg</strong> war die Dokumentationsstätte zunächst nur ein kleines Projekt, welches nicht in<br />
die Gesamtkonzeption eingebunden war. Hier hatten Historiker keinen Einfluss auf andere<br />
Nutzungen auf dem Gelände. 326 Inzwischen hat sich dies zumindest am <strong>Obersalzberg</strong><br />
geändert. Ein weiteres Beispiel für die Unmöglichkeit einer Gesamtnutzung ist das ehemalige<br />
KdF-Bad in Prora. Die in einem Abschnitt eingerichtete Museumsmeile steht nach<br />
Zeitungsberichten vor dem Aus. 327 Teile des Geländes wurden im Jahr 2005 verkauft, mit der<br />
Auflage des Haushaltsausschusses des Bundestages, die Museen zu erhalten. Diese Auflage<br />
konnte nicht eingehalten werden. Jetzt sollen 800 Ferienwohnungen entstehen und die<br />
verschiedenen kleinen Museen zu einem Großen zusammengefasst werden. Weitere Blöcke<br />
der riesigen Anlage konnten bis jetzt nicht einer sinnvollen Nutzung zugeführt werden und<br />
stehen vor dem Verfall. Eine rein historische oder kulturelle Nutzung ist aus finanziellen<br />
Gründen oft nicht möglich. Daher ist ein Nachdenken über ein Gesamtkonzept sinnvoll, das<br />
eine historische Dokumentation umfasst und diese mit weiteren Einrichtungen verbindet. Am<br />
<strong>Obersalzberg</strong> ist mit dem offiziellen Zwei-Säulen-Konzept eine Dualität gelungen, die eine<br />
erfolgreiche Dokumentation und eine angemessene Weiternutzung durch die Errichtung des<br />
Hotels beinhaltet. Grundsätzlich ist gegen eine Umnutzung auch nichts einzuwenden, so lange<br />
angemessen mit der Vergangenheit umgegangen wird. Das heißt konkret, dass diese nicht<br />
verschwiegen oder banalisiert wird und die neue Nutzung mit ausreichenden historischen<br />
Informationen untermauert wird. Ob diese Informationen letztendlich von den Bürgern<br />
326 Vgl.: Dahm 1999b, S. 76.<br />
327 Vgl.: O.V.: Museumsmeile in Prora steht vor dem Aus. In: Die Welt (02.06.2006).<br />
91
Umgang mit dem Täterort<br />
genutzt werden, bleibt diesen selbst überlassen. Niemand sollte gezwungen werden, sich zu<br />
erinnern, da dies sicher nicht die angestrebte Wirkung erzielen sondern im Gegenteil eine<br />
Abwehrhaltung heraufbeschwören würde. Zudem bedeutet eine Neunutzung auch die Chance<br />
auf ein erweitertes Publikum. In Verbindung mit dem Tourismus können so Menschen auf<br />
den Täterort aufmerksam werden, die sich ansonsten nicht für die Geschichte interessieren.<br />
Da der neuen Nutzung eines Täterortes in den meisten Fällen eine lange Zeit der Verdrängung<br />
sowie eine Debatte zur Umnutzung vorausgeht, sollte auch dieses „Ringen“ um den Täterort<br />
miteinbezogen werden. Für Täterorte gilt ähnlich wie für die Erinnerung an die Opfer durch<br />
bestimmte Monumente 328 , dass die Entstehungsgeschichte der heutigen Nutzung wichtig ist.<br />
Sie zeigt, wie schwierig der Weg des Erinnerns ist und dass dieser kein abgeschlossener<br />
Prozess ist. Die Debatten vor und nach der Errichtung von Monumenten und über die<br />
Behandlung von Täterorten sind die eigentlich wichtigen Auseinandersetzungen. Hier wird<br />
deutlich, dass Erinnerungskultur gelebt wird und es nicht eine richtige Art der Erinnerung<br />
gibt.<br />
Ein weiterer Vorschlag ist, die Vernetzung der Täterorte untereinander und mit anderen<br />
Gedenkstätten in Deutschland aber auch international voranzutreiben. Zum einen gehören<br />
Täter- und Opferorte zusammen, um ein ganzheitliches Bild vom Nationalsozialismus zu<br />
erhalten. Wenn beklagt wird, dass die Täterorte noch zu wenig in den Blick geraten sind und<br />
somit für die jüngere Generation die Faszination des Nationalsozialismus nicht verständlich<br />
ist, darf keine Umkehrung stattfinden, indem die Täterorte die Gedenkstätten für die Opfer<br />
verdrängen. Eine Vernetzung der Täterorte untereinander würde ein komplexeres Bild von der<br />
Architektur und den Plänen des nationalsozialistischen Staates geben. Architekturgeschichte<br />
könnte durch verschiedene Beispiele verdeutlicht werden und das Eindringen der Ideologie in<br />
sämtliche Bereiche wie Freizeit und Tourismus, Wissenschaft, Erziehung und Ausbildung<br />
durch die unterschiedlichen Orte wie Prora, Peenemünde oder Vogelsang beispielhaft<br />
erläutert werden.<br />
5.2 Einordnung des Vorgehens im Fall der Ordensburg Vogelsang<br />
Wie wurde im Fall der Ordensburg Vogelsang vorgegangen und in welchen Stadien der<br />
Konzeption zum Umgang mit diesem Täterort wurde besonders heftig diskutiert? Welche<br />
„Fehler“ wurden gemacht und wie sind diese in Zukunft zu vermeiden? Diese Fragen sollen<br />
zum Abschluss dieser Arbeit geklärt werden.<br />
328 Young 1997, S. 44f.<br />
92
Umgang mit dem Täterort<br />
Im Falle Vogelsangs ist der Titel Täter- oder Opferort, überhaupt die Unterscheidung in Täter<br />
und Opfer, schwieriger als bei den anderen vorgestellten Orten. Auf dieses Problem wurde<br />
schon in Kapitel 3.1.1 hingewiesen. Dennoch lassen sich die Ordensjunker, obgleich sie keine<br />
Befehlsgewalt in der nationalsozialistischen Hierarchie inne hatten und auch nicht während<br />
ihrer Zeit auf der Ordensburg am Holocaust beteiligt waren, bestimmten Tätertypen zuordnen.<br />
Sie waren begeisterte Anhänger des Nationalsozialismus und bereit, ihr Leben ganz in den<br />
Dienst dieser Ideologie zu stellen. In den verschiedenen Konzepten zum zukünftigen Umgang<br />
mit der Ordensburg findet sich kein ausdrücklicher Hinweis auf die Klassifizierung Täter-<br />
oder Opferort. Die Ideen zu den Inhalten der Dokumentation machen jedoch deutlich, dass<br />
hier nicht vorrangig an die Opfer das Nationalsozialismus gedacht wird, sondern das<br />
Entstehen der NS-Ideologie und die Manifestierung im Erziehungssystem beleuchtet werden<br />
sollen. Eine Zusammenarbeit mit anderen Täterorten ist angedacht, zum Beispiel dem EL-DE-<br />
Haus in Köln, in dem von Dezember 1935 bis März 1945 die Gestapo für den<br />
Regierungsbezirk Köln ihren Sitz hatte. 329 So könnte ein Bogen geschlagen werden von dem,<br />
was auf Vogelsang gelehrt und was an anderer Stelle ausgeführt wurde.<br />
Auch wenn Vogelsang kein reiner Täterort ist, kann die Ordensburg eher der Täterseite als der<br />
Opferseite zugerechnet werden. Eventuell sollte darüber nachgedacht werden, dass ein<br />
eindeutiges Profil mit einer einprägsamen Bezeichnung – wie „Schreibtischtäterort“ für die<br />
Villa ten Hompel – für Vogelsang erstellt wird. Auch wenn eine solche Bezeichnung<br />
vereinfachend ist, weiß der Besucher sofort, auf was er sich einlässt, zumal die Existenz und<br />
Funktion der Ordensburgen den Wenigsten bekannt ist.<br />
Bei der Ordensburg wurde bei der einzurichtenden Ausstellung darauf geachtet, dass ein<br />
eindeutiger Bezug zur Thematik vor Ort vorhanden ist. Sowohl die Projektskizze des Vereins<br />
„Gegen Vergessen Für Demokratie“ mit dem AK Vogelsang als auch das in der<br />
Machbarkeitsstudie und im Konzept von Müller-Rieger vorgesehene Dokumentationszentrum<br />
betonen die NS-Zeit und legen ihren Schwerpunkt auf das NS-Erziehungssystem. Allerdings<br />
sind die in der Projektskizze unter „Geschichte und Gesellschaft“ vorgesehenen Segmente<br />
sehr umfangreich. Neben der Ordensburg im NS-Erziehungssystem und Bezügen zum<br />
aktuellen Rechtsextremismus soll auch noch auf die regionale Geschichte des 19. und 20.<br />
Jahrhundert und die Geschichte der europäischen Nachbarn eingegangen werden. Das allein<br />
sind vier verschiedene Punkte, die wiederum um die übergeordneten Lernfelder „Geschichte<br />
329 Vgl.: O.V.: Internetseite des NS-Dokumentationszentrums der Stadt Köln (El-DE-Haus). Online im Internet<br />
unter http://museenkoeln.de/ns-dok_neu/homepage/fs_start.html [04.09.2006].<br />
93
Umgang mit dem Täterort<br />
der Euregio Maas-Rhein“ sowie „Natur und Nachhaltigkeit“ ergänzt werden. 330 Dieses<br />
Angebot umfasst zu unterschiedliche Themen und ist auch zu umfangreich, um von einzelnen<br />
Besuchern oder Gruppen innerhalb eines Besuches erfasst zu werden. Eine Reduzierung der<br />
Themenfelder oder die deutliche Unterscheidung der einzelnen Projekte wären hier<br />
angebracht, so dass Besucher sich jeweils nur einem Thema zuwenden können. Durch die<br />
Aufnahme der Themenfelder „Geschichte der Euregio Maas-Rhein“ und „Natur und<br />
Nachhaltigkeit“ ist allerdings auch ein regionaler Bezug vorhanden. Dieser sollte auf jeden<br />
Fall beibehalten werden, da gerade die Verbindung zum Nationalpark ein wichtiger<br />
Standortfaktor für Vogelsang ist. Eine Abgrenzung wie oben vorgeschlagen wäre aber von<br />
Vorteil, weil eine zu breite Streuung die Besucher überfordern würde. Inwieweit die<br />
Regionalgeschichte auch in die NS-Dokumentation aufgenommen wird, ist zurzeit noch nicht<br />
ersichtlich. Im Gegensatz zur Villa ten Hompel wird keine Ausrichtung auf eine Zielgruppe<br />
erfolgen. Dies ist vor allem auf das bis jetzt sehr breit geplante Angebot zurückzuführen.<br />
Zwar bietet sich im Zusammenhang mit dem Thema NS-Erziehungspolitik die Zielgruppe<br />
Lehrer an, doch diese Gruppe gehört zu den Gesellschaftsteilen, die sowieso vermehrt<br />
historische Bildungsangebote wahrnehmen.<br />
Die Ordensburg Vogelsang ist ein Täterort, der vor allem auf seine bauliche<br />
Hinterlassenschaft aus der NS-Zeit zurückzuführen ist. Das Ensemble wurde zu<br />
Repräsentationszwecken errichtet und ist Teil der NS-Propaganda. Die Besucher sollten nicht<br />
ohne Informationen auf das Gelände gelassen werden, sondern Sinn und Zweck der<br />
Anordnung der Gebäude müssen erläutert werden. Dabei sind auch die nicht mehr gebauten<br />
Erweiterungspläne mit einzubeziehen. Dies geschieht vor allem durch die Dokumentation,<br />
doch wenn Besucher aus anderen Gründen Vogelsang besuchen, beispielsweise im Rahmen<br />
eines Besuchs des Nationalparks Eifel, sollten sie über Broschüren und Informationstafeln die<br />
Möglichkeit haben, sich über die Vergangenheit zu informieren.<br />
Es hat sich gezeigt, dass ein großes Problem, die nicht geklärten Eigentumsverhältnisse sind.<br />
Dass dabei Vogelsang kein Einzelfall ist, geht aus der folgenden Bemerkung zum ehemaligen<br />
Raketenversuchsgelände in Peenemünde hervor: „Doch alle Pläne stießen auf das gleiche<br />
Problem – ungeklärte Eigentumsverhältnisse bei den Liegenschaften.“ 331 Des Weiteren muss<br />
natürlich auch die Finanzierung gesichert sein. Investoren und verbindliche Zusagen der<br />
künftigen Nutzer müssen eingeholt werden – auch hier fehlt es in Vogelsang noch an<br />
Vorarbeit, um die endgültige Nutzung umzusetzen.<br />
330 Vgl. zu den einzelnen Segmenten: Arbeitskreis Vogelsang im Förderverein Nationalpark Eifel e.V. 2004,<br />
S. 10-13.<br />
331 Bode; Kaiser 1995, S. 186.<br />
94
Umgang mit dem Täterort<br />
Leider scheint es auch in der Eifel in der Abstimmung der einzelnen Parteien und der<br />
öffentlichen Gruppierungen zu hapern. Zwar ist die Öffentlichkeit dem Projekt positiv<br />
gegenüber eingestellt und engagiert, was sich an Leserzuschriften in Zeitungen und vor allem<br />
der ehrenamtlichen Mitarbeit im Förderverein zeigt. Dennoch fühlen sich viele Bürger von<br />
den amtlichen Stellen nicht ernstgenommen und von einigen Entscheidungen überrollt. Eine<br />
bessere Absprache würde nicht nur dem Projekt im Endergebnis zu Gute kommen, sondern<br />
auch die kleinlich anmutenden Streitereien aus dem Weg räumen. „Wenn ‚Vogelsang’ eine<br />
Zukunft als Lernort und Nationalparkzentrum haben soll, dann müssen Förderverein und<br />
Projektplaner zusammenarbeiten, dann muss der Fachbeirat um einen Architekturhistoriker<br />
erweitert werden.“ 332 Diese Forderung ist auch weiterhin aktuell und muss erfüllt werden, um<br />
die Zukunft Vogelsangs erfolgreich zu gestalten.<br />
Besonders die „Brechung“ der Architektur war in der Debatte um Vogelsang ein viel<br />
diskutiertes Thema. Letztendlich ist es auch eine Geschmacksfrage, ob und in welcher Form<br />
eine solche Brechung nötig ist. Die Ordensburg ist in ihrer Größe und Monumentalität nicht<br />
mit dem Reichsparteitagsgelände oder dem KdF-Hotel auf Prora zu vergleichen, aber sie ist<br />
eine der wenigen vollständig erhaltenen Baudenkmäler aus der NS-Zeit. Wichtig ist vor<br />
allem, dass die bestehenden Gebäude und der Gesamteindruck, der in der Planung von Klotz<br />
angelegt war, nicht zerstört werden.<br />
Von Anfang an wurde Wert darauf gelegt, ein Gesamtkonzept für die Anlage Vogelsang zu<br />
erstellen. Dies ist sicher ein richtiger Ansatz, bereitet aber besondere Schwierigkeiten, da die<br />
Planungen umfangreicher sind und damit mehr Konfliktpotenzial bergen, als wenn nur<br />
einzelne Gebäude genutzt werden. Da Vogelsang insgesamt eine Fläche von 70.000<br />
Quadratmetern umfasst, die auch weiterhin gepflegt und in Stand gehalten werden muss, ist es<br />
richtig, dass auch Neunutzungen wie die Einrichtung von Hotels und Einkaufsmöglichkeiten<br />
ins Auge gefasst werden. Eine reine Veräußerung des Geländes war nie geplant und so ist zu<br />
hoffen, dass sich in Zukunft auf Vogelsang kulturelle, touristische und wirtschaftliche<br />
Nutzungen sinnvoll ergänzen. Ein Kritikpunkt an den vorliegenden Konzepten ist, dass der<br />
Nachkriegsgeschichte und den Konflikten um die heutige zivile Nutzung von Vogelsang zu<br />
wenig Beachtung geschenkt wird. Hier verbirgt sich noch viel Potenzial, gerade weil<br />
Vogelsang bis 2005 unter belgischer Besatzung stand. Die Chance, die konfliktreiche<br />
Situation zwischen Einheimischen und Alliierten darzustellen und den Umgang der Belgier<br />
mit der spezifischen Vergangenheit von Vogelsang zu zeigen, sollte genutzt werden.<br />
332 Mazzoni 2004, S. 13.<br />
95
Umgang mit dem Täterort<br />
Insgesamt zeigt sich, dass zur endgültigen Umsetzung eines Nutzungskonzepts auf Vogelsang<br />
schon wichtige Voraussetzungen erfüllt sind. Die bereits entstandenen Konflikte dürfen nicht<br />
dazu führen, dass der Vorgang zum Erliegen kommt. Stattdessen sollte die Chance genutzt<br />
werden, die angedachten Ideen wenigstens teilweise in die Realität umzusetzen. Vogelsang<br />
bietet in Kombination mit seiner landschaftlich schönen Lage und mit dem umliegenden<br />
neugeschaffenen Nationalpark gute Voraussetzungen, eine der Attraktionen der Eifel zu<br />
werden und damit den Besuchern die spezifische Geschichte des Ortes und so einen eher<br />
unbekannten Teil der NS-Geschichte näher zu bringen.<br />
96
6. Fazit<br />
Fazit<br />
Bei Täterorten schwingt immer die Befürchtung mit, dass sie zu einer Pilgerstätte für<br />
Ewiggestrige werden. Nicht das Erinnern und Lernen würde dann im Vordergrund stehen,<br />
sondern die Heraufbeschwörung der angeblich „guten Seiten“ des Nationalsozialismus. Daher<br />
wird oft versucht, buchstäblich Gras über diese Orte wachsen zu lassen. Aber wie die in dieser<br />
Arbeit vorgestellten Beispiele gezeigt haben, ist Verdrängung keine Lösung:<br />
„Die Auslöschung der Vergangenheit durch Spurenbeseitigung, Verschweigen<br />
oder Verdrängung gelang bei keiner architektonischen Hinterlassenschaft des<br />
Nationalsozialismus zufriedenstellend – in allen Fällen zeigte sich, daß nur eine<br />
offene und kritische Auseinandersetzung der [sic] Mythologisierung zu steuern<br />
vermag.“ 333<br />
Die Aura der Orte sollte sinnvoll genutzt werden, statt die oft jahrelang praktizierte<br />
Verdrängung und damit auch Mythologisierung zu fördern. Wenn Täterorte sich selbst<br />
überlassen werden, floriert dort schnell das „wilde Gedenken“ 334 und begünstigt die<br />
Verbreitung eines unwissenschaftlichen bis hin zu einem das „Dritte Reich“ verherrlichenden<br />
Geschichtsbild. Deutschland kann und darf sich nicht der Verantwortung entziehen, sich mit<br />
der Geschichte und den Folgen des „Dritten Reiches“ auseinander zu setzen. Täterorte als<br />
greifbare, materielle Spuren dieser Vergangenheit sind in Verbindung mit Opferorten eine<br />
Chance das Doppelgesicht des nationalsozialistischen Staates sichtbar und verständlich zu<br />
machen.<br />
Die Beschäftigung mit den Debatten um verschiedene Täterorte hat gezeigt, dass der Begriff<br />
„Täterort“ auch von den Wortführern wie Wissenschaftlern oder Journalisten als<br />
problematisch empfunden wird. Dennoch steht zurzeit noch keine Alternative zur Verfügung.<br />
Auch die Unterscheidung zwischen Täter- und Opferorten ist problematisch, doch sie hilft bei<br />
der Einordnung der Orte und damit auch ihrer vorrangigen Funktion: Opferorte zum<br />
Gedenken und Trauern, Täterorte zum Lernen und Aufklären. Das Zusammenspiel von Täter-<br />
und Opferorten sollte in Zukunft noch intensiver gefördert werden, um ein umfassendes Bild<br />
des Nationalsozialismus zu vermitteln und sowohl die verbrecherischen als auch die<br />
faszinierenden Seiten des NS-Regimes für die zukünftigen Generationen erfassbar zu machen<br />
und damit auch vor Wiederholung zu schützen. Mit der seit den 1990er Jahren einsetzenden<br />
Täterforschung sind Täterorte zunehmend ins Interesse der Öffentlichkeit gerückt. Sie sind<br />
die passenden Orte, um im Land der Täter beide Seiten des NS-Regimes zu vermitteln. Wenn<br />
333 Feiber 1999, S. 461.<br />
334 Der Begriff stammt aus der Einleitung von Porombka; Schmundt 1995, S. 11 und beschreibt, in Anlehnung an<br />
„wildes Denken“, Alternativen zur offiziellen Sinngebung jenseits von wissenschaftlichen <strong>Institut</strong>ionen bezogen<br />
auf die Vergangenheit. Konkret sind hierbei unwahre Geschichten und Mythen über Hitler und das „Dritte<br />
Reich“ gemeint.<br />
97
Fazit<br />
die finanziellen Mittel für die Einrichtung einer Dokumentation nicht ausreichen, kann auf<br />
andere Möglichkeiten zurückgegriffen werden, um die Öffentlichkeit über den Ort<br />
aufzuklären. Informationsbroschüren, Flyer oder Gedenktafeln sind kleine aber wirksame<br />
Mittel, um die Öffentlichkeit über den Täterort zu informieren. Wichtig ist vor allem, dass die<br />
Informationen wissenschaftlich korrekt sind und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht<br />
werden. Die Untersuchung der drei Beispiele <strong>Obersalzberg</strong>, Villa ten Hompel und Ordensburg<br />
Vogelsang hat gezeigt, dass viele Hindernisse bis zur Einrichtung einer angemessenen<br />
Nachnutzung an Täterorten zu überwinden sind. Ergebnisse sind nicht von heute auf morgen<br />
zu erzielen, der Prozess kann sich über Jahre hinziehen. Dennoch ist es mit viel Engagement<br />
von verschiedenen Seiten möglich, eine zufriedenstellende Lösung zu finden.<br />
Die Auswertung der drei Beispiele dieser Arbeit hat ergeben, dass es nicht sinnvoll ist, ein<br />
generelles Konzept zu entwickeln, welches auf alle Täterorte anwendbar ist, da die<br />
Voraussetzungen vor Ort zu unterschiedlich sind. Gewisse Aspekte sind allerdings an allen<br />
Täterorten zu beachten: Es ist wichtig, sich auf die lokalen Gegebenheiten einzustellen.<br />
Daneben sind wirtschaftliche Fragen und auch die zukünftige Finanzierung zu klären. Die<br />
Öffentlichkeit sollte mit einbezogen werden und alle Seiten müssen zu einem offenen und<br />
fairen Dialog bereit sein. Nicht nur historische Nutzungen oder Dokumentationsstätten sind<br />
angemessen. Am <strong>Obersalzberg</strong> ist deutlich geworden, dass auch andere Nutzungen wie Hotels<br />
oder Geschäfte möglich sind, so lange der historische Kontext nicht verdrängt wird und die<br />
neue Nutzung der ursprünglichen Funktion des Ortes nicht völlig zuwider läuft.<br />
Die Diskussionen um Täterorte zeigen, dass die Debatte um Erinnerungskultur noch lange<br />
nicht abgeschlossen ist. Im Gegenteil, diese Auseinandersetzung ist in Deutschland zu einem<br />
wichtigen Teil der Vergangenheitspolitik geworden und zeigt mehr als jedes fertige<br />
Monument, dass der Umgang mit der Vergangenheit weiterhin ein aktuelles Thema ist.<br />
Diskussionen um Täterorte sind dabei ein Teil der großen Debatte und bieten in ihrer Spezifik<br />
Hinweise auf die allgemeine Stimmung in der Öffentlichkeit.<br />
98
7. Literaturverzeichnis<br />
7.1 Bücher und Internetdokumente<br />
Literaturverzeichnis<br />
- Anderl, Gabriele (2005): Orte der Täter. Der NS-Terror in den „arisierten“ Wiener<br />
Rothschild-Palais. Wien 2005 (= Band 15 der Schriftenreihe des <strong>Institut</strong>s zur<br />
Erforschung der Geschichte).<br />
- Arbeitskreis Vogelsang im Förderverein Nationalpark Eifel e.V. (2004): Projektskizze<br />
zum Dokumentationszentrum und zum Bildungs- und Begegnungszentrum Vogelsang.<br />
O.O. 2004. In Zusammenarbeit mit dem Verein „Gegen Vergessen Für Demokratie“.<br />
Online im Internet unter http://www.lernort-vogelsang.de/morgen/PDF_Dokumente_<br />
Nutzungskonzept/Projektskizze_AK_Vogelsang.pdf [04.09.2006].<br />
- Arntz, Hans-Dieter (1986): Ordensburg Vogelsang 1934-1945. Erziehung zur politischen<br />
Führung im 3. Reich. Euskirchen 1986.<br />
- Asmuss, Burkhard; Hinz, Hans-Martin (Hg.) (1999): Historische Stätten aus der Zeit des<br />
Nationalsozialismus: Orte des Erinnerns, des Gedenkens und der kulturellen<br />
Weiterbildung? Zum Umgang mit Gedenkorten von nationaler Bedeutung in der<br />
Bundesrepublik Deutschland. Symposium am 23. und 24. November 1998 im<br />
Deutschen Historischen Museum. Frankfurt am Main u.a. 1999.<br />
- Assmann, Aleida (1999): Erinnerungsräume. Formen und Wandlungen des kulturellen<br />
Gedächtnisses. München 1999.<br />
- Assmann, Aleida (2002): Das Gedächtnis der Orte – Authentizität und Gedenken. In:<br />
Diesselb.: Firma Topf & Söhne – Hersteller der Öfen für Auschwitz. Ein<br />
Fabrikgelände als Erinnerungsort. Frankfurt am Main 2002, S. 197-212.<br />
- Assmann, Aleida; Frevert, Ute (1999): Geschichtsvergessenheit – Geschichtsversessenheit.<br />
Vom Umgang mit deutschen Vergangenheiten nach 1945. Stuttgart 1999.<br />
- Behrens, Heidi; Haustein, Petra (2002): Abschied von der Unübersichtlichkeit! Vom<br />
Verlust vermeintlicher Eindeutigkeiten im aktuellen erinnerungspolitischen Diskurs.<br />
Eine Replik auf Jörg Skriebeleit. In: GedenkstättenRundbrief, H. 106 (2002), S. 3-11.<br />
- Beierl, Florian M. (2004): Hitlers Berg. Licht ins Dunkel der Geschichte. Geschichte des<br />
<strong>Obersalzberg</strong>s und seiner geheimen Bunkeranlagen. Berchtesgaden 2004.<br />
- Bode, Volkhard; Kaiser, Gerhard (1995): Raketenspuren. Peenemünde 1936-1994. Eine<br />
historische Reportage mit aktuellen Fotos von Christian Thiel. Berlin 1995.<br />
- Brebeck, Wulff E. (1993): Zur Darstellung der Täter in den Ausstellungen der<br />
Gedenkstätten. In: GedenkstättenRundbrief 58 (1993), S. 1-2.<br />
- Browning, Christopher R. (1993): Ganz normale Männer. Das Reserve-Polizeibataillon<br />
101 und die „Endlösung“ in Polen. Reinbek 1993.<br />
- Burke, Peter (1991): Geschichte als soziales Gedächtnis. In: Assmann, Aleida; Harth,<br />
Dietrich (Hg.): Mnemosyne. Formen und Funktionen der kulturellen Erinnerung.<br />
Frankfurt am Main 1991, S. 289-304.<br />
- Chaussy, Ulrich; Püschner, Christoph (1997): Nachbar Hitler. Führerkult und<br />
Heimatzerstörung am <strong>Obersalzberg</strong>. Berlin, 2. aktualisierte Auflage 1997.<br />
99
Literaturverzeichnis<br />
- Dahm, Volker (1999a): Einführung: Der <strong>Obersalzberg</strong> als historischer Ort und als Stätte<br />
historisch-politischer Bildung. In: Möller, Horst u.a. (Hg.): Die tödliche Utopie.<br />
Bilder, Texte, Dokumente, Daten zum Dritten Reich. München 1999, S. 21-27.<br />
- Dahm, Volker (1999b): Der <strong>Obersalzberg</strong> bei Berchtesgaden. In: Asmuss, Burkhard;<br />
Hinz, Hans-Martin (Hg.): Historische Stätten aus der Zeit des Nationalsozialismus:<br />
Orte des Erinnerns, des Gedenkens und der kulturellen Weiterbildung? Zum Umgang<br />
mit Gedenkorten von nationaler Bedeutung in der Bundesrepublik Deutschland.<br />
Symposium am 23. und 24. November 1998 im Deutschen Historischen Museum.<br />
Frankfurt am Main u.a. 1999, S. 68-79.<br />
- Demnig, Gunter: Internetseite der Aktion Stolpersteine. Online im Internet unter<br />
http://www.stolpersteine.com/ [04.09.2006].<br />
- Determann, Andreas (1996): Wegbegleiter in den Tod. Zur Funktion der Ordnungspolizei<br />
bei den Deportationen jüdischer Bürger „in den Osten“. In: Villa ten Hompel. Sitz der<br />
Ordnungspolizei im Dritten Reich. Vom „Tatort Schreibtisch“ zur Erinnerungsstätte?<br />
Münster 1996, S. 28-53.<br />
- Dokumentation <strong>Obersalzberg</strong> (Hg.) (2005): Jahresbericht 2005. Online im Internet unter<br />
http://www.obersalzberg.de/cms_d/content/de_presse/ [06.08.2006].<br />
- Dubiel, Helmut (1999): Niemand ist frei von der Geschichte. Die nationalsozialistische<br />
Herrschaft in den Debatten des Deutschen Bundestages. München; Wien 1999.<br />
- Endlich, Stefanie (1990): Denkort Gestapogelände. Berlin 1990.<br />
- Erll, Astrid (2005): Kollektives Gedächtnis und Erinnerungskulturen. Eine Einführung.<br />
Stuttgart 2005.<br />
- Feiber, Albert A. (1999): Vergangenheit, die bleiben wird. Der <strong>Obersalzberg</strong> nach 1945.<br />
In: Möller, Horst u.a. (Hg.): Die tödliche Utopie. Bilder, Texte, Dokumente, Daten<br />
zum Dritten Reich. München 1999, S. 453-461 (ohne Bildteil).<br />
- Förderverein Nationalpark Eifel e.V. (Hg.) (2004): Vogelsang. Gestern – heute – morgen.<br />
Nutzungskonzept. Schleiden-Gemünd 2004. Online im Internet unter<br />
http://www.lernort-vogelsang.de/morgen/PDF_Dokumente_Nutzungskonzept/<br />
Nutzungskonzept_Foerderverein_NLP_Eifel_Stand_Okt_2004.pdf [19.07.2006].<br />
- Frank, Hartmut (1985): Welche Sprache sprechen Steine? Zur Einführung in den<br />
Sammelband ‚Faschistische Architekturen’. In: Ders. (Hg.): Faschistische<br />
Architekturen. Planen und Bauen in Europa 1930 bis 1945. Hamburg 1985 (= Stadt,<br />
Planung, Geschichte 3, herausgegeben von Gerhard Fehl, Juan Rodriguez Lores und<br />
Volker Roscher), S. 7-21.<br />
- Frei, Norbert (1995): 1945 und wir. Das Dritte Reich im Bewußtsein der Deutschen.<br />
München 1995.<br />
- Gamm, Hans-Jochen (1984): Führung und Verführung. Pädagogik des Nationalsozialismus.<br />
Frankfurt am Main; New York, 2. Auflage 1984.<br />
- Gegen Vergessen Für Demokratie e.V. (2004): Die ehemalige NS-„Ordensburg“<br />
Vogelsang. Aus der Geschichte lernen – Die Zukunft gestalten. Das Projekt eines<br />
Dokumentations-, Bildungs- und Begegnungszentrums. Kurzfassung. Köln 2004.<br />
Online im Internet unter http://www.lernort-vogelsang.de/morgen/PDF_Dokumente<br />
_Gegen_Vergessen_fuer_Demokratie/04_10_Konzept_Gegen_Vergessen_fuer_Demo<br />
kratie.pdf [19.06.2006].<br />
100
Literaturverzeichnis<br />
- Genger, Angela (1997): Gedenkstätten in Deutschland. Trauer – Dokumentation –<br />
Begegnung. In: Lichtenstein, Heiner; Romberg, Otto R. (Hg.): Täter – Opfer – Folgen.<br />
Der Holocaust in Geschichte und Gegenwart. Bonn, 2. erweiterte Auflage 1997,<br />
S. 255-264.<br />
- Goldhagen, Daniel Jonah (1996): Hitlers willige Vollstrecker. Ganz gewöhnliche<br />
Deutsche und der Holocaust. Berlin 1996.<br />
- Haase, Ulrich (1999): Rede zur Eröffnung des Symposiums. In: Asmuss, Burkhard; Hinz,<br />
Hans-Martin (Hg.): Historische Stätten aus der Zeit des Nationalsozialismus: Orte des<br />
Erinnerns, des Gedenkens und der kulturellen Weiterbildung? Zum Umgang mit<br />
Gedenkorten von nationaler Bedeutung in der Bundesrepublik Deutschland.<br />
Symposium am 23. und 24. November 1998 im Deutschen Historischen Museum.<br />
Frankfurt am Main u.a. 1999, S. 13-20.<br />
- Hanisch, Ernst (1995): Der <strong>Obersalzberg</strong>, das Kehlsteinhaus und Adolf Hitler.<br />
Berchtesgaden 1995 (herausgegeben von der Berchtesgadener Landesstiftung).<br />
- Haß, Matthias (1996): „Täter und Tatgehilfen im Nationalsozialismus. Zur Darstellung<br />
der Täter in den Gedenkstätten.“ Tagung der Niedersächsischen Landeszentrale für<br />
politische Bildung, der Stiftung Topographie des Terrors Berlin in Zusammenarbeit<br />
mit dem Wissenschaftlichen Beirat für Gedenkstättenarbeit des Landes Niedersachsen<br />
vom 20.-22.11.1996 im Historischen Museum Hannover. In: Internationale<br />
wissenschaftliche Korrespondenz zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung,<br />
H. 3 (1996), S. 375-385.<br />
- Heesch, Johannes; Braun, Ulrike (2003): Orte erinnern: Spuren des NS-Terrors in Berlin.<br />
Berlin 2003 (herausgegeben von Günter Braun).<br />
- Heinen, Franz Albert (2002): Vogelsang. Von der NS-Ordensburg zum<br />
Truppenübungsplatz. Eine Dokumentation. Aachen 2002.<br />
- Heinen, Franz Albert (2006): Vogelsang. Im Herzen des Nationalpark Eifel. Ein<br />
Begleitheft durch die ehemalige „NS-Ordensburg“. Düsseldorf 2006.<br />
- Herbert, Ulrich (1998): Vernichtungspolitik. Neue Antworten und Fragen zur Geschichte<br />
des „Holocaust“. In: Ders. (Hg.): Nationalsozialistische Vernichtungspolitik 1939-<br />
1945. Neue Forschungen und Kontroversen. Frankfurt am Main 1998, S. 9-66.<br />
- Hilberg, Raul (1992): Täter, Opfer, Zuschauer. Die Vernichtung der Juden 1933-1945.<br />
Frankfurt am Main 1992.<br />
- Hoffmann, Detlef (2002): „Authentische Orte“. Zur Konjunktur eines problematischen<br />
Begriffs in der Gedenkstättenarbeit. In: GedenkstättenRundbrief 110 (2002), S. 3-17.<br />
- Hoffmann, Detlef (Hg.) (1998): Das Gedächtnis der Dinge. KZ-Relikte und KZ-<br />
Denkmäler 1945-1955. Frankfurt am Main; New York 1998.<br />
- Huhle, Rainer (2002): Menschenrechtspädagogik an einem Erinnerungsort des<br />
Nationalsozialismus. Ein Beispiel aus Nürnberg. In: GedenkstättenRundbrief 109<br />
(2002), S. 3-10.<br />
- Kenkmann, Alfons (1996b): Vom Schreibtischtäterort zum Lernort. Überlegungen zur<br />
Nutzung der Ordnungspolizei-Residenz für die historisch-politische Bildungsarbeit.<br />
In: Ders. (Hg.): Villa ten Hompel. Sitz der Ordnungspolizei im Dritten Reich. Vom<br />
„Tatort Schreibtisch“ zur Erinnerungsstätte? Münster 1996, S. 115-137.<br />
- Kenkmann, Alfons (Hg.) (1996a): Villa ten Hompel. Sitz der Ordnungspolizei im Dritten<br />
Reich. Vom „Tatort Schreibtisch“ zur Erinnerungsstätte? Münster 1996.<br />
101
Literaturverzeichnis<br />
- Kenkmann, Alfons (Hg.) (2003): Geschichtsort Villa ten Hompel. Entwicklungen,<br />
Aktivitäten, Ergebnisse. Dokumentation über den Zeitraum vom 1. Oktober 2000 bis<br />
12. Dezember 2002. Münster 2003.<br />
- Kenkmann, Alfons; Spieker, Christoph (Hg.) (2001): Im Auftrag. Polizei, Verwaltung und<br />
Verantwortung. Begleitband zur gleichnamigen Dauerausstellung – Geschichtsort<br />
Villa ten Hompel. Essen 2001.<br />
- Klemp, Stefan (1998): Freispruch für das „Mord-Bataillon“. Die NS-Ordnungspolizei und<br />
die Nachkriegsjustiz. Münster 1998 (= Studien zum Nationalsozialismus 5).<br />
- König, Helmut (2003): Die Zukunft der Vergangenheit. Der Nationalsozialismus im<br />
politischen Bewußtsein der Bundesrepublik. Frankfurt am Main 2003.<br />
- Kreis Euskirchen (Hg.) (2003): Machbarkeitsstudie und Entwicklungskonzept für eine<br />
zivile Folgenutzung des Truppenübungsplatzes Vogelsang. Euskirchen 2003. Online<br />
im Internet in mehreren Teilen:<br />
� Titel/Impressum http://www.lernort-vogelsang.de/morgen/PDF-Dokumente_<br />
Machbarkeitsstudie_Ergebnisse/Machbarkeitsstudie_Titel_Impressum.pdf<br />
[29.08.2006].<br />
� Seite 3-13 http://www.lernort-vogelsang.de/morgen/PDF-Dokumente_<br />
Machbarkeitsstudie_Ergebnisse/Machbarkeitsstudie_Seiten_3_13.pdf<br />
[29.08.2006].<br />
� Seite 14-22 http://www.lernort-vogelsang.de/morgen/PDF-Dokumente_<br />
Machbarkeitsstudie_Ergebnisse/Machbarkeitstudie_Seiten_14_22.pdf<br />
[29.08.2006].<br />
� Seite 23-30 http://www.lernort-vogelsang.de/morgen/PDF-Dokumente_<br />
Machbarkeitsstudie_Ergebnisse/Machbarkeitsstudie_Seiten_23_30.pdf<br />
[29.08.2006].<br />
� Seite 31-39 http://www.lernort-vogelsang.de/morgen/PDF-Dokumente_<br />
Machbarkeitsstudie_Ergebnisse/Machbarkeitsstudie_Seiten_31_39.pdf<br />
[29.08.2006].<br />
- Lankheit, Klaus A. (1999): Der <strong>Obersalzberg</strong>. In: Möller, Horst u.a. (Hg.): Die tödliche<br />
Utopie. Bilder, Texte, Dokumente, Daten zum Dritten Reich. München 1999,<br />
S. 33-43.<br />
- Levi, Primo (1990): Die Untergegangenen und die Geretteten. München; Wien 1990.<br />
- Lichtenstein, Heiner (1990): Himmlers grüne Helfer. Die Schutz- und Ordnungspolizei im<br />
„Dritten Reich“. Köln 1990.<br />
- Lotfi, Gabriele (1996a): Der Einsatz der Ordnungspolizei in Arbeitserziehungslagern der<br />
rheinisch-westfälischen Gestapo. In: Kenkmann, Alfons (Hg.): Villa ten Hompel. Sitz<br />
der Ordnungspolizei im Dritten Reich. Vom „Tatort Schreibtisch“ zur<br />
Erinnerungsstätte? Münster 1996, S. 11-27.<br />
- Lotfi, Gabriele (1996b): Der Befehlshaber der Ordnungspolizei in Münster und der<br />
Luftschutz im Zweiten Weltkrieg. In: Kenkmann, Alfons (Hg.): Villa ten Hompel. Sitz<br />
der Ordnungspolizei im Dritten Reich. Vom „Tatort Schreibtisch“ zur<br />
Erinnerungsstätte? Münster 1996, S. 78-98.<br />
- Lotfi, Gabriele (2001): Die frühe Nachkriegszeit – Polizeibehörden in der Villa ten<br />
Hompel 1945 bis 1953. In: Kenkmann, Alfons; Spieker, Christoph (Hg.): Im Auftrag.<br />
102
Literaturverzeichnis<br />
Polizei, Verwaltung und Verantwortung. Begleitband zur gleichnamigen<br />
Dauerausstellung – Geschichtsort Villa ten Hompel. Essen 2001, S. 266-277.<br />
- Lutz, Thomas (1998): Von der Bürgerinitiative zur Stiftung. Der Bildungsgehalt der<br />
öffentlichen Debatte um den Umgang mit dem Prinz-Albrecht-Gelände in Berlin. In:<br />
Behrens-Cobet, Heidi (Hg.): Bilden und Gedenken. Erwachsenenbildung in<br />
Gedenkstätten und an Gedächtnisorten. Essen 1998, S. 75-90.<br />
- Matthäus, Jürgen (2002): Die Beteiligung der Ordnungspolizei am Holocaust. In: Kaiser,<br />
Wolf (Hg.): Täter im Vernichtungskrieg. Der Überfall auf die Sowjetunion und der<br />
Völkermord an den Juden. Berlin; München 2002, S. 166-185.<br />
- Mittig, Hans-Ernst (1988): Wie gehen wir mit NS-Bauten um? Beispiele in Berlin. In:<br />
Werk und Zeit 3 (1988), S. 26-30.<br />
- Mittig, Hans-Ernst (1992): NS-Architektur für uns. In: Ogan, Bernd; Weiß, Wolfgang W.:<br />
Faszination und Gewalt. Zur politischen Ästhetik des Nationalsozialismus. Nürnberg<br />
1992, S. 245-266.<br />
- Möller, Horst u.a. (Hg.) (1999): Die tödliche Utopie. Bilder, Texte, Dokumente, Daten<br />
zum Dritten Reich. München 1999.<br />
- Museen der Stadt Nürnberg (Hg.) (1996): Faszination und Gewalt. Das<br />
Reichsparteitagsgelände in Nürnberg. Mit Kurzführer durch die Ausstellung<br />
„Faszination und Gewalt“ in der Zeppelintribüne. Nürnberg 1996.<br />
- Nachtwei, Winfried (1996): „Ganz normale Männer“. Die Verwicklung von<br />
Polizeibataillonen aus dem Rheinland und Westfalen in den nationalsozialistischen<br />
Vernichtungskrieg. In: Kenkmann, Alfons (Hg.): Villa ten Hompel. Sitz der<br />
Ordnungspolizei im Dritten Reich. Vom „Tatort Schreibtisch“ zur Erinnerungsstätte?<br />
Münster 1996, S. 54-77.<br />
- Natur- und Umweltschutz-Akademie des Landes Nordrhein-Westfalen (NUA) (Hg.)<br />
(2002): Nationalpark Eifel. Eine Idee nimmt Gestalt an. Hamm 2002 (= NUA-<br />
Seminarbericht 8).<br />
- Nerdinger, Winfried (1988): Umgang mit der NS-Architektur. Das schlechte Beispiel<br />
München. In: Werk und Zeit 3 (1988), S. 22-24.<br />
- Nerdinger, Winfried (1992): Umgang mit den Spuren der NS-Vergangenheit – Indizien zu<br />
einer Geschichte der Verdrängung und zum Ende der Trauerarbeit. In: Ruppert,<br />
Wolfgang (Hg.): „Deutschland, bleiche Mutter“ oder eine neue Lust an der nationalen<br />
Identität. Berlin 1992, S. 51-60.<br />
- Nerdinger, Winfried (Hg.) (1993): Bauen im Nationalsozialismus. Bayern 1933-1945.<br />
Ausstellungskatalog des Architekturmuseums der TU. München 1993.<br />
- Nolzen, Armin (2000): Der Streifendienst der Hitler-Jugend und die „Überwachung der<br />
Jugend“, 1934-1945. Forschungsprobleme und Fragestellungen. In: Diekmann,<br />
Christoph; u.a. (Hg.): Durchschnittstäter. Handeln und Motivation. Berlin 2000 (=<br />
Beiträge zur Geschichte des Nationalsozialismus 16), S. 13-51.<br />
- Nora, Pierre (1999): Zwischen Geschichte und Gedächtnis. Berlin 1990.<br />
- O.V.: Internetseite der Dokumentation <strong>Obersalzberg</strong>, Die Ausstellung, Info, Weg durch<br />
die Dokumentation. Online im Internet unter http://www.obersalzberg.de/cms_d/<br />
content/de_ausstellung_exponatverzeichnis/der_weg.html [06.08.2006].<br />
103
Literaturverzeichnis<br />
- O.V.: Internetseite der Dokumentation <strong>Obersalzberg</strong>, Die Ausstellung, Info, Konzeption.<br />
Online im Internet unter http://www.obersalzberg.de /cms_d/content/de_ausstellung_<br />
exponatverzeichnis/konzeption.html [18.05.2006].<br />
- O.V.: Internetseite des Intercontinental Berchtesgaden, Geschichte. Online im Internet<br />
unter http://www.berchtesgaden.intercontinental.com/Geschichte [06.08.2006].<br />
- O.V.: Internetseite des Kreises Euskirchen, Integriertes Ausstellungskonzept für<br />
Vogelsang. Online im Internet unter http://www.kreis-euskirchen.de/tourismus<br />
/vogelsang/Ausstellungskonzept.php [29.08.2006].<br />
- O.V.: Internetseite des Lernortes Villa ten Hompel. Online im Internet unter<br />
http://www.muenster.de/stadt/villa-ten-hompel/ [29.08.2006].<br />
- O.V.: Internetseite des NS-Dokumentationszentrums der Stadt Köln (El-DE-Haus). Online<br />
im Internet unter http://museenkoeln.de/ns-dok_neu/homepage/fs_start.html<br />
[04.09.2006].<br />
- O.V.: Internetseite des Vereins „Gegen Vergessen Für Demokratie e.V.“. Online im<br />
Internet unter http://www.gegen-vergessen.de/index.html [18.09.2006].<br />
- O.V.: Internetseite von Berchtesgaden, Kehlsteinhaus. Online im Internet unter<br />
http://www.berchtesgaden.de/de/1e6837ca-4fe4-1410-67ce-7e4df200811c.html<br />
[04.09.2006].<br />
- Paul, Gerhard (2002): Von Psychopathen, Technokraten des Terrors und „ganz<br />
gewöhnlichen“ Deutschen. Die Täter der Shoah im Spiegel der Forschung. In: Ders.<br />
(Hg.): Die Täter der Shoah. Fanatische Nationalsozialisten oder ganz normale<br />
Deutsche? Göttingen 2002 (= Dachauer Symposien zur Zeitgeschichte 2), S. 13-90.<br />
- Paul, Gerhard; Mallmann, Klaus-Michael (2004): Sozialisation, Milieu und Gewalt.<br />
Fortschritte und Probleme der neueren Täterforschung. In: Mallmann, Klaus-Michael;<br />
Paul, Gerhard (Hg.): Karrieren der Gewalt. Nationalsozialistische Täterbiographien.<br />
Darmstadt 2004, S. 1-32.<br />
- Pehnt, Wolfgang (1979): Architektur. In: Steingräber, Erich (Hg.): Deutsche Kunst der<br />
20er und 30er Jahre. München 1979, S. 13-114.<br />
- Pehnt, Wolfgang (1991): Umgang mit Ruinen. Kulturbauten in der deutschen<br />
Nachkriegsarchitektur. In: Bracher, Karl-Dietrich; u.a. (Hg.): ´45 und die Folgen.<br />
Kunstgeschichte eines Wiederbeginns. Köln; Weimar 1991, S. 111-134.<br />
- Pohl, Rolf (2002): Gewalt und Grausamkeit. Sozialpsychologische Anmerkungen zur NS-<br />
Täterforschung. In: Perels, Joachim; Pohl, Rolf (Hg.): NS-Täter in der deutschen<br />
Gesellschaft. Hannover 2002 (= Diskussionsbeiträge des <strong>Institut</strong>s für Politische<br />
Wissenschaft der Universität Hannover 29, herausgegeben von Michael Buckmüller,<br />
Joachim Perels und Gert Schäfer), S. 69-117.<br />
- Porombka, Stephan; Schmundt, Hilmar (Hg.) (2005): Böse Orte. Stätten<br />
nationalsozialistischer Selbstdarstellung – heute. Berlin 2005.<br />
- Pütz, Frank (2003): Die NS-Ordensburg Vogelsang. In: Burgen und Schlösser 44, H. 1<br />
(2003), S. 24-35.<br />
- Reichel, Peter (1991): Der schöne Schein des Dritten Reiches. Faszination und Gewalt des<br />
Faschismus. München; Wien 1991.<br />
- Reichel, Peter (1995): Politik mit der Erinnerung. Gedächtnisorte im Streit um die<br />
nationalsozialistische Vergangenheit. München; Wien 1995.<br />
104
Literaturverzeichnis<br />
- Reichel, Peter (1997): Zwischen Ästhetisierung und Politisierung. Gedächtnisorte im<br />
Streit um die Vergangenheit. In: Kiesel, Doron; u.a. (Hg.): Pädagogik der Erinnerung.<br />
Didaktische Aspekte der Gedenkstättenarbeit. Frankfurt am Main 1997<br />
(= Arnoldshainer Texte 96), S. 57-78.<br />
- Reichel, Peter (1999): Die umstrittene Erinnerung. Über Ursachen der anhaltenden<br />
Auseinandersetzung um die öffentliche Darstellung der NS-Vergangenheit. In:<br />
Asmuss, Burkhard; Hinz, Hans-Martin (Hg.): Historische Stätten aus der Zeit des<br />
Nationalsozialismus: Orte des Erinnerns, des Gedenkens und der kulturellen<br />
Weiterbildung? Zum Umgang mit Gedenkorten von nationaler Bedeutung in der<br />
Bundesrepublik Deutschland. Symposium am 23. und 24. November 1998 im<br />
Deutschen Historischen Museum. Frankfurt am Main u.a. 1999, S. 21-37.<br />
- Rheinischer Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz (2005): Zukunft der<br />
Ordensburg Vogelsang. Stellungnahmen des Rheinischen Vereins für Denkmalpflege<br />
und Landschaftsschutz zum denkmalpflegerischen Umgang mit der Bundesimmobilie<br />
„Ordensburg Vogelsang“. Köln 2005. Online im Internet unter http://www.lernortvogelsang.de/webEdition/we_cmd.php?we_cmd[0]=show&we_cmd[1]=3055&we_cm<br />
d[4]=160 [19.07.2006].<br />
- Rostock, Jürgen; Zadniček, Franz (1992): Paradiesruinen. Das KdF-Seebad der<br />
Zwanzigtausend auf Rügen. Berlin 1992.<br />
- Sandkühler, Thomas (1999): Die Täter des Holocaust. Neuere Überlegungen und<br />
Kontroversen. In: Pohl, Karl Heinrich (Hg.): Wehrmacht und Vernichtungspolitik.<br />
Militär im nationalsozialistischen System. Göttingen 1999, S. 39-65.<br />
- Schaffing, Ferdinand; Baumann, Ernst; Hoffmann, Heinrich (1985): Der <strong>Obersalzberg</strong>.<br />
Brennpunkt der Zeitgeschichte. München; Wien 1985.<br />
- Schmitz-Emke, Ruth (1988): Die Ordensburg Vogelsang. Architektur, Bauplastik,<br />
Ausstattung. Köln 1988 (= Arbeitsheft 41 des Landschaftsverbandes Rheinland).<br />
- Schmundt, Hilmar (2005): Am Berghof. <strong>Obersalzberg</strong>. In: Porombka, Stephan; Schmundt,<br />
Hilmar (Hg.): Böse Orte. Stätten nationalsozialistischer Selbstdarstellung – heute.<br />
Berlin 2005.<br />
- Scholtz, Harald (1967): Die NS-Ordensburgen. In: Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte<br />
15 (1967), S. 269-298.<br />
- Scholtz, Harald (1973): Nationalsozialistische Ausleseschulen. Internatsschulen als<br />
Herrschaftsmittel des Führerstaates. Göttingen 1973.<br />
- Schumann, Brigitte: Kleine Anfrage 426 (11.07.1996). Zit. nach: Kenkmann 1996a,<br />
S. 159-160.<br />
- Skriebeleit, Jörg (2001): Neue Unübersichtlichkeit? Gedenkstätten und historische Orte<br />
im aktuellen erinnerungspolitischen Diskurs. In: GedenkstättenRundbrief 103 (2001),<br />
S. 3-10.<br />
- Speer, Albert (1969): Erinnerungen. Frankfurt am Main; Berlin 1969.<br />
- Spieker, Christoph (2001a): Export von Münster nach Den Haag: BdO Dr. Heinrich<br />
Lankenau (1891-1983). In: Kenkmann, Alfons; Spieker, Christopher (Hg.): Im<br />
Auftrag. Polizei, Verwaltung und Verantwortung. Begleitband zur gleichnamigen<br />
Dauerausstellung – Geschichtsort Villa ten Hompel. Essen 2001, S. 176-187.<br />
- Spieker, Christoph (2001b): Die Befehlshaber der Ordnungspolizei im Wehrkreis VI –<br />
biographische Skizzen. In: Kenkmann, Alfons; Spieker, Christopher (Hg.): Im<br />
105
Literaturverzeichnis<br />
Auftrag. Polizei, Verwaltung und Verantwortung. Begleitband zur gleichnamigen<br />
Dauerausstellung – Geschichtsort Villa ten Hompel. Essen 2001, S. 192-199.<br />
- Verlag A. Plenk KG (Hg.) (1983): <strong>Obersalzberg</strong>. Bis 1933. 1933-1945. 1945-heute.<br />
Bilddokumentation. Berchtesgaden 1983.<br />
- Volmer, Julia (2001): Zur Hausgeschichte nach 1945. Die Villa ten Hompel 1953 bis<br />
1968. ‚Wiedergutmachung’ an einem Täterort. In: Kenkmann, Alfons; Spieker,<br />
Christoph (Hg.): Im Auftrag. Polizei, Verwaltung und Verantwortung. Begleitband zur<br />
gleichnamigen Dauerausstellung – Geschichtsort Villa ten Hompel. Essen 2001,<br />
S. 342-364.<br />
- Weihsmann, Helmut (1998): Bauen unterm Hakenkreuz. Architektur des Untergangs.<br />
Wien 1998.<br />
- Weiß, Wolfgang W. (1992): Spurensuche am <strong>Obersalzberg</strong>. NS-Geschichte(n) zwischen<br />
Vermarktung und Verdrängung. In: Ogan, Bernd; Weiß; Wolfgang W.: Faszination<br />
und Gewalt. Zur politischen Ästhetik des Nationalsozialismus. Nürnberg 1992,<br />
S. 267-282.<br />
- Young, James E. (1997): Formen des Erinnerns. Gedenkstätten des Holocaust.<br />
Wien 1997.<br />
7.2 Zeitungsartikel und Presseinformationen<br />
- Anger, Dirk (2005): Keine langfristige Garantie für die Villa ten Hompel. In: Westfälische<br />
Nachrichten (31.12.2005). Online im Internet unter http://www.westline.de<br />
/nachrichten/archiv/index_mono.php?file_name=20051230230200_32b8118.nit&jahr<br />
gang=2005&stichwort=%2BVilla+%2BHompel&&start=0&order=datum&ort=%<br />
[29.08.2006].<br />
- Asmuth, Tobias (2001): „Ab und zu ein paar Spinner”. Wer hat Angst vor Wallfahrern:<br />
Auf dem <strong>Obersalzberg</strong> soll ein Hotel gebaut werden. In: Die Welt (24.07.2001).<br />
Online im Internet unter http://www.welt.de/data/2001/07/24/515457.html<br />
[29.08.2006].<br />
- BUND, LNU und NABU (Hg.) (2003): Konversionspläne für die Burg Vogelsang nicht<br />
nationalparkgerecht. Naturschützer kritisieren Missachtung der grundlegenden<br />
Nationalpark-Anforderungen. Pressemitteilung des BUND, LNU und NABU vom<br />
21.10.2003. Online im Internet http://www.nabu.de/modules/presseservice<br />
/index.php?show=23&db=presseservice_nrw [17.07.2006].<br />
- Dahm, Volker (2002): Historisch-politische Bildung an einem Täterort. Konzeptionelle<br />
Parameter der Dokumentation <strong>Obersalzberg</strong>. Presseinformation der Dokumentation<br />
<strong>Obersalzberg</strong> vom 01.12.2002. Online im Internet unter http://www.<br />
obersalzberg.de/cms_d/content/de_presse/ [15.08.2006].<br />
- Dultz, Michael (2000): Kritik am <strong>Obersalzberg</strong>-Museum ist weitgehend verebbt. Konzept<br />
„Stätte der Täter“ überzeugt auch die Skeptiker – Seit der Gründung vor einem Jahr<br />
kamen rund 120 000 Besucher. In: Die Welt (19.10.2000). Online im Internet unter<br />
http://www.welt.de/data/2000/10/19/587639.html [29.08.2006].<br />
- Ermlich, Günter (2003): Kontrollierter Verfall. In: Die Zeit, Nr. 33 (07.08.2003). Online<br />
im Internet unter http://zeus.zeit.de/text/2003/33/Nachgefragt__2fVogelsang<br />
[29.08.2006].<br />
106
Literaturverzeichnis<br />
- Finkenzeller, Roswin (1995a): Erbbaurecht gegen Extremismus. Pläne für die künftige<br />
Nutzung des <strong>Obersalzberg</strong>s. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung, Nr. 179<br />
(04.08.1995), S. 6.<br />
- Finkenzeller, Roswin (1995b): Auf historisch belastetem Gelände. Was es bei der<br />
künftigen Nutzung des <strong>Obersalzberg</strong>s zu bedenken gilt. In: Frankfurter Allgemeine<br />
Zeitung, Nr. 34 (09.02.1995), S. 16.<br />
- Göricke, Jutta (2006): Wo der Wille zum Herrschen trainiert wurde. In: Süddeutsche<br />
Zeitung (04.03.2006). Online im Internet unter http://www.lernortvogelsang.de/aktuelles/2006/06_03_04_SZ_Wo_der_Wille_zum_Herrschen_trainiert_<br />
wurde.php [29.08.2006].<br />
- Gorschenek, Eva-Maria (1983): Ausdruck für den Zeitgeist um 1920. Mit barocken<br />
Anklängen. In: Westfälische Nachrichten (13.08.1983). Zit. nach: Kenkmann 1996a,<br />
S. 143.<br />
- Hammes, Ramona (2005): Interessante „people“ am internationalen „place“. In: Kölnische<br />
Rundschau (21.12.2005). Online im Internet unter http://www.rundschauonline.de/html/artikel/1132676568320.shtml<br />
[19.07.2006].<br />
- Heinen, Franz Albert (2005/2006): Aktueller Sachstand „Konversion Vogelsang“. Zur<br />
Jahreswende 2005/06. Online im Internet unter http://www.lernort-vogelsang.de/ unter<br />
Heute, Aktueller Sachstand [29.08.2006].<br />
- Heinen, Franz Albert (2005a): „Entscheidung unverantwortlich“. In: Kölner Stadt-<br />
Anzeiger (31.12.2005). Online im Internet unter http://www.ksta.de/html/<br />
artikel/1135358135398.shtml [17.07.2006].<br />
- Heinen, Franz Albert (2005b): Der Eifelturm soll gelb zu Tale leuchten. In: Kölner Stadt-<br />
Anzeiger (22.12.2005). Online im Internet http://www.lernort-vogelsang.de<br />
/Dokumentation/presse/2005/12/05_12_22_KStA.php [29.08.2006].<br />
- Heinen, Franz Albert (2006a): Vogelsang: Die Steine fallen von der Wand. In: Kölner<br />
Stadt-Anzeiger (23.03.2006). Online im Internet http://www.ksta.de/html<br />
/artikel/1143027839849.shtml [19.07.2006].<br />
- Heinen, Guido (2005): Zimmer mit Einsicht. Wo Adolf Hitler seinen Berghof hatte,<br />
eröffnet jetzt ein Wellnesshotel. Eindrücke vom ersten Tag. In: Die Welt (03.03.2005).<br />
Online im Internet unter http://www.welt.de/data/2005/03/03/599481.html<br />
[29.08.2006].<br />
- Heitkamp, Volker (1996): Tatort Schreibtisch in der „Villa ten Hompel“. Im Haus der<br />
Nazipolizei wollen Geschichtsinitiativen Erinnerungsstätte. In: die tageszeitung<br />
(12.07.1996). Zit. nach: Kenkmann 1996a, S. 161.<br />
- Heup, Christoph (2004): Eifeler Brauhaus in der Burgschänke. In: Kölnische Rundschau<br />
(29.10.2004). Online im Internet http://www.rundschau-online.de/servlet<br />
/OriginalContentServer?pagename=ksta/page&atype=ksArtikel&aid=1096382506452<br />
[19.07.2006].<br />
- Heup, Christoph (2005): Beschwerde über den Auftrag an Aixplan. In: Kölnische<br />
Rundschau (02.09.2005). Online im Internet http://www.rundschauonline.de/servlet/OriginalContentServer?pagename=ksta/page&atype=ksArtikel&aid=<br />
1125483638562 [19.07.2006].<br />
- Joeres, Annika (2005): Vergesslich beim Erinnern. In: die tageszeitung NRW, Nr. 7592<br />
(16.02.2005), S. 2.<br />
107
Literaturverzeichnis<br />
- Kehren, Bernd (2004a): Studenten planen für Vogelsang. In: Kölnische Rundschau<br />
(09.11.2004). Online im Internet unter http://onlinearchiv.rundschauonline.de/paskr/articleShow.do?id=KR-11-09-2004-04530002890ARE<br />
[19.07.2006].<br />
- Kehren, Bernd (2004b): „Verhärtete Fronten schaden Projekt.“ In: Kölnische Rundschau<br />
(19.11.2004b). Online im Internet unter http://lernort-vogelsang.de/ unter Presseschau<br />
[15.08.2006].<br />
- Kellerhoff, Sven Felix (1996): Neue Dauerausstellung im Haus der Wannsee-Konferenz.<br />
In: Die Welt (18.01.2006). Online im Internet unter http://www.welt.de/<br />
data/2006/01/18/832751.html [29.08.2006].<br />
- Kellerhoff, Sven Felix (2004): Ferien in der Alpenresidenz. Im März eröffnet ein<br />
Interconti-Hotel auf dem <strong>Obersalzberg</strong> – Dort erholte sich einst Adolf Hitler. In: Die<br />
Welt (13.12.2004). Online im Internet unter http://www.welt.de/<br />
data/2004/12/13/373985.html [29.08.2006].<br />
- Kenkmann, Alfons (1996c): Hitlers willige Vollstrecker... bei der Ordnungspolizei in<br />
Münster. Eine regionale Debatte. In: Frankfurter Rundschau, Nr. 130/23 (07.06.1996),<br />
S. 8. Zit. nach: Kenkmann 1996a, S. 153f.<br />
- Klinkhammer, Gudrun (2006a): Bärbel Höhn sieht Handlungsbedarf. In: Kölnische<br />
Rundschau (06.08.2006). Online im Internet unter http://www.rundschauonline.de/html/<br />
artikel/1154442639415.shtml [29.08.2006].<br />
- Klinkhammer, Gudrun (2006b): Das Bad darf doch Bad bleiben. In: Kölnische Rundschau<br />
(19.08.2006). Online im Internet unter http://www.rundschau-online.de/html/artikel/<br />
1155913394796.shtml [29.08.2006].<br />
- Klinkhammer, Gudrun (2006c): Nur in einigen Details uneinig. In: Kölnische Rundschau<br />
(07.04.2006). Online im Internet unter http://www.rundschauonline.de/html/artikel/1143819565406.shtml<br />
[19.07.2006].<br />
- Knöfel, Ulrike (2004): Wellness auf heiklem Hügel. In: Der Spiegel, Nr. 51 (13.12.2004),<br />
S. 144-146.<br />
- Knust, Cornelia (1999): First-class-Hotel über Führerbunker. Der Berchtesgadener<br />
<strong>Obersalzberg</strong> wird zur Freizeitanlage. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung, Nr. 4<br />
(06.01.1999), S. 14.<br />
- Kreyenborg, Udo (1996): Eine Gedenktafel als Alternative? In: Westfälische Nachrichten<br />
(17.07.1996). Zit. nach: Kenkmann 1996a, S. 162.<br />
- Kuhn, Christine (2003): Schönheitsfleck im Paradies. Der Streit um eine ehemalige Nazi-<br />
Ordensburg überschattet die Errichtung des Nationalparks Eifel. In: Süddeutsche<br />
Zeitung, Nr. 278 (03.12.2003), S. 9.<br />
- Lang, Manfred (2004): Konversion Vogelsang: Herbe Experten-Kritik. In: Kölner Stadt-<br />
Anzeiger (20.11.2004). Online im Internet unter http://www.ksta.de<br />
servlet/OriginalContentServer?pagename=ksta/page&atype=ksArtikel&aid=10990642<br />
34425 [19.07.2006].<br />
- Lang, Manfred (2005): Vogelsang-Gesellschaft in trockenen Tüchern. In: Kölner Stadt-<br />
Anzeiger (30.04.2005). Online im Internet unter http://www.ksta.de<br />
/html/artikel/1114692992020.shtml [19.07.2006].<br />
- Lotz, Holger (2001): Erregung und Unverständnis über den Verkauf der ehemaligen<br />
Reichskanzlei. In: Berchtesgadener Anzeiger (31.10.2001). Online im Internet unter<br />
http://www.reichskanzlei-berchtesgaden.de/neuigkeiten.html [15.08.2006].<br />
108
Literaturverzeichnis<br />
- Mazzoni, Ira (2004): Sperrgebiet Geschichte. Die Diskussion um die zivile Nachnutzung<br />
der monströsen Nazi-Ordensburg Vogelsang in der Eifel hat begonnen. In:<br />
Süddeutsche Zeitung, Nr. 8 (12.01.2004), S. 13.<br />
- Müllender, Bernd (2004): Zur Wellnesskur in die Naziburg. In: die tageszeitung, Nr. 7273<br />
(02.02.2004), S. 4.<br />
- Müller, Volker (2001): Auf dem Göring-Hügel. Ein Luxushotel für den <strong>Obersalzberg</strong><br />
oder: Wie normal darf Berchtesgaden sein? In: Berliner Zeitung (30.07.2001). Online<br />
im Internet unter http://www.obersalzberg.de/cms_d/content/de_presse/<br />
ausderpresse.html [15.08.2006].<br />
- Nachtwei, Winni (1996a): Bundesweit einmaliges Projekt. In: Westfälische Nachrichten<br />
(20.07.1996). Zit. nach: Kenkmann 1996a, S. 162.<br />
- O.V.: „Soll` mer`n wegsprengen?“ Walter Mayr über den Umgang der Bayern mit dem<br />
Nazi-Erbe am <strong>Obersalzberg</strong>. In: Der Spiegel, Nr. 33 (12.08.1996), S. 101-111.<br />
- O.V.: „Villa ten Hompel“ als Stätte der Erinnerung? SPD/GAL fordern Kauf des Hauses<br />
durch die Stadt. In: Münstersche Zeitung (13.12.1995). Zit. nach: Kenkmann 1996a,<br />
S. 144.<br />
- O.V.: 4000 € Spende des Intercontinental <strong>Obersalzberg</strong> für die Dokumentation.<br />
Presseinformation des Intercontinental Resort Berchtesgaden vom 27.01.2006. Online<br />
im Internet unter http://www.obersalzberg.de/cms_d/content/de_presse/index.html<br />
[18.05.2006].<br />
- O.V.: Aufstieg in die Europa-Liga. In: Westfälische Nachrichten (12.05.2004). Online im<br />
Internet unter http://www.westline.de/nachrichten/archiv/index_mono.php<br />
?file_name=20040511230201_32ab3e1.nit&jahrgang=2004&stichwort=%2BVilla+%<br />
2BHompel&&start=15&order=datum&ort=% [29.08.2006].<br />
- O.V.: Bund fördert Villa ten Hompel. In: Westfälische Nachrichten (19.06.2002). Online<br />
im Internet unter http://www.westline.de/nachrichten/archiv/index_mono.php?<br />
file_name=20020618233000_32d9aa3.nit&jahrgang=2002&stichwort=%2BVilla+%2<br />
BHompel&&start=10&order=datum&ort=% [29.08.2006].<br />
- O.V.: Der Konsens hielt nicht sehr lange. In: Kölner Stadtanzeiger (14.01.2005). Online<br />
im Internet unter http://www.ksta.de/servlet/OriginalContentServer?pagename<br />
=ksta/page&atype=ksArtikel&aid=1105553521597 [19.07.2006].<br />
- O.V.: Faltlhauser: Dokumentation am <strong>Obersalzberg</strong> ist Stätte historisch-politischer<br />
Bildung. Presseinformation des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen vom<br />
20.10.1999. Online im Internet unter http://www.obersalzberg.de/cms_d/<br />
content/de_presse/ [15.08.2006].<br />
- O.V.: In vielen Punkten kamen Akteure sich näher. In: Kölnische Rundschau<br />
(20.12.2004). Online im Internet unter http://www.rundschauonline.de/servlet/OriginalContentServer?pagename=ksta/page&atype=ksArtikel&aid=<br />
1103214653801 [17.07.2006].<br />
- O.V.: Langela: Unverständlich, warum sich die CDU-Franktion ausklinkt. In:<br />
Münstersche Zeitung (21.08.1996). Zit. nach: Kenkmann 1996a, S. 169.<br />
- O.V.: Museumsmeile in Prora steht vor dem Aus. In: Die Welt (02.06.2006). Online im<br />
Internet unter http://www.welt.de/data/2006/06/02/899413.html [04.09.2006].<br />
- O.V.: Nachdenken über die Villa. In: Westfälische Nachrichten (08.01.1996). Zit. nach:<br />
Kenkmann 1996a, S. 145.<br />
109
Literaturverzeichnis<br />
- O.V.: <strong>Obersalzberg</strong>. Verzehr bedingt. In: Der Spiegel Nr. 49 (05.12.1951), S. 10-12.<br />
- O.V.: Stadt stellt sich der Geschichte. In: Münstersche Zeitung (08.05.2001). Online im<br />
Internet unter http://www.westline.de/nachrichten/archiv/index_mono.php?<br />
file_name=20010507_msln0026.htm&jahrgang=2001&stichwort=%2BVilla+%2BHo<br />
mpel&&start=25&order=datum&ort=% [29.08.2006].<br />
- O.V.: Stadt und Land sitzen jetzt am Verhandlungstisch. Villa ten Hompel: Angebot liegt<br />
vor. Preis geringer als erwartet. In: Westfälische Nachrichten (08.06.1996). Zit. nach:<br />
Kenkmann 1996a, S. 155.<br />
- O.V.: Steigenberger. Hitlers Erbe. In: Der Spiegel, Nr. 27 (01.07.1964), S. 40-43.<br />
- O.V.: Tarnname Wolf. In: Der Spiegel, Nr. 49 (05.12.1994), S. 89-94.<br />
- O.V.: Umstrittene Nazi-Burg. In: Der Spiegel, Nr. 51 (19.12.2005), S. 20.<br />
- O.V.: Villa ten Hompel erhält Unterstützung. In: Westfälische Nachrichten (05.01.2006).<br />
Online im Internet unter http://www.westline.de/nachrichten/archiv/index_mono.php?<br />
file_name=20060104230200_32db61e.nit&jahrgang=2006&stichwort=%2BVilla+%2<br />
BHompel&&start=15&order=datum&ort=% [29.08.2006].<br />
- O.V.: Villa ten Hompel künftig Erinnerungsstätte? SPD begrüßt Nachtwei-Vorschlag: Für<br />
Gedenken an Opfer des Nazi-Regimes nutzen. In: Westfälische Nachrichten<br />
(26.01.1996). Zit. nach: Kenkmann 1996a, S. 146.<br />
- O.V.: Villa ten Hompel und Theater sind durch. In: Münstersche Zeitung (07.01.2006).<br />
Online im Internet unter http://www.westline.de/nachrichten/archiv/index_mono.php?<br />
file_name=20060106232900_630_001_2412275&jahrgang=2006&stichwort=%2BVil<br />
la+%2BHompel&&start=15&order=datum&ort=% [29.08.2006].<br />
- O.V.: Villa ten Hompel: Kein Konsens mehr. CDU: Gedenken an anderen Stellen. In:<br />
Westfälische Nachrichten (14.08.1996). Zit. nach: Kenkmann 1996a, S. 164.<br />
- O.V.: Vogelsang: Turner, Orden und Haus der Jugend. In: Kölnische Rundschau<br />
(25.11.2004). Online im Internet http://www.rundschau-online.de/servlet/<br />
OriginalContentServer?pagename=ksta/page&atype=ksArtikel&aid=1099064837920<br />
[17.07.2006].<br />
- O.V.: Wehrmachtsausstellung in Nazi-Burg? In: Der Spiegel, Nr. 2 (05.01.2004), S. 16.<br />
- Puderbach, Johannes (2005): Die ersten Aufträge wurden vergeben. In: Kölner Stadt-<br />
Anzeiger (08.07.2005). Online im Internet unter http://www.ksta.de/html/<br />
artikel/1120567062750.shtml [19.07.2006].<br />
- Putschögl, Monika (2005): Weg vom Schuss. In: Die Zeit, Nr. 48 (24.11.2005). Online im<br />
Internet unter http://www.zeit.de/2005/48/Vogelsang [29.08.2006].<br />
- Raijer, Henk (2006): Die Hypothek der Geschichte lastet auf Vogelsang. In: die<br />
tageszeitung NRW, Nr. 7871 (14.01.2006), S. 3.<br />
- Reinartz, Patrik (2006): Nicht alle begreifen „Vogelsang ip“. In: Kölnischer Stadt-<br />
Anzeiger (05.01.2006). Online im Internet unter http://www.ksta.de/html/<br />
artikel/1135358156240.shtml [19.07.2006].<br />
- Rietzschel, Thomas (2001): Der Geschichte kann man nicht entrinnen. Zum Hotelbau auf<br />
dem <strong>Obersalzberg</strong>. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung, Reiseblatt, Nr. 171<br />
(26.07.2001), S. R3.<br />
- Robers, Norbert (2001): Gelungene Aufarbeitung. In: Westfälische Nachrichten<br />
(06.05.2001). Online im Internet unter http://www.westline.de/nachrichten/<br />
110
Literaturverzeichnis<br />
archiv/index_mono.php?file_name=20010505_324138d.nit&jahrgang=2001&stichwo<br />
rt=%2BVilla+%2BHompel&&start=25&order=datum&ort=% [29.08.2006].<br />
- Roos, Peter (2005): Hitlerconti. Im Luxushotel auf dem <strong>Obersalzberg</strong> am 20. April: Was<br />
geschieht hier an „Führers“ Geburtstag? In: Die Zeit, Nr. 18 (28.04.2005). Online im<br />
Internet unter http://www.zeit.de/2005/18/Hotel_Hitler [29.08.2006].<br />
- Sandhage, Franz-Josef (1996): Ankauf zum Nachteil der Stadt und der Bürger. In:<br />
Münstersche Zeitung (20.08.1996). Zit. nach: Kenkmann 1996a, S. 168.<br />
- Schmalz, Peter (1999): Dokumentationszentrum auf dem <strong>Obersalzberg</strong> eröffnet. Besucher<br />
können sich über die frühere Residenz von Adolf Hitler informieren – Schwieriger<br />
Umgang mit der Vergangenheit. In: Die Welt (21.10.1999). Online im Internet unter<br />
http://www.welt.de/data/1999/10/21/652668.html [29.08.2006].<br />
- Schostack, Renate (1997): Mißtrauen, das nicht vergehen will. Von Hitlers<br />
„Alpenfestung“ zur Erblast: Streit um den <strong>Obersalzberg</strong>. In: Frankfurter Allgemeine<br />
Zeitung, Nr. 257 (05.11.1997), S. 43.<br />
- Schostack, Renate (1999): Den Berg entzaubern. Geschichtsschau auf dem <strong>Obersalzberg</strong>.<br />
In: Frankfurter Allgemeine Zeitung, Nr. 247 (23.10.1999), S. 43.<br />
- Seewald, Berthold (2001): Des Staates dritte Säule. Eine Ausstellung in Münster zeigt die<br />
Verstrickung der Polizei in die NS-Diktatur. In: Die Welt (23.11.2001). Online im<br />
Internet unter http://www.welt.de/data/2001/11/23/535500.html [29.08.2006].<br />
- Thalken, Michael (2006): Viele Vorschläge, aber auch viel Kritik. In: Kölner Stadt-<br />
Anzeiger (17.01.2006). Online im Internet unter http://www.ksta.de<br />
/html/artikel/1137402815901.shtml [19.07.2006].<br />
- Ullmann, Gaby: Aufklärung am vergessenen Ort der Täter. Nach Berchtesgaden: Auch<br />
Nürnberg arbeitet mit einem Dokumentationszentrum seine Vergangenheit auf. In: Die<br />
Welt (25.10.1999). Online im Internet unter http://www.welt.de/data<br />
/1999/10/25/653051.html [29.08.2006].<br />
- Völker, Karin (1996): Ja zum Gedenken – Jein zum Zahlen. NS-Polizeikommando „Villa<br />
ten Hompel“: Stadt und RP verhandeln über Verkauf. In: Westfälische Nachrichten<br />
(21.02.1996). Zit. nach: Kenkmann 1996a, S. 147.<br />
- Wirsing, Sibylle (1998): Tatort, Täterort, Geschäftsstelle. Diese diffuse historische<br />
Neugier: Ein Berliner Symposion zu Stätten der NS-Zeit. In: Frankfurter Allgemeine<br />
Zeitung, Nr. 277 (28.11.1998), S. 38.<br />
111
8. Eidesstattliche Erklärung<br />
Eidesstattliche Erklärung<br />
Name: <strong>Dagmar</strong> <strong>Rutenbeck</strong> Matrikelnummer: 2155450<br />
Ich erkläre:<br />
1. Die Arbeit wurde selbstständig und ohne Benutzung anderer als der angegebenen<br />
Hilfsmittel angefertigt.<br />
2. Alle Stellen, die wortwörtlich oder nur geringfügig verändert aus Veröffentlichungen<br />
oder anderen Quellen entnommen sind, enthalten die notwendige Kennzeichnung; d.h.<br />
sie sind einzurücken und in Anführungszeichen zu setzen. Die Belegstelle ist in<br />
unmittelbarem Zusammenhang mit dem Zitat anzugeben.<br />
3. Die vorliegende Arbeit wurde bisher noch keiner Prüfungsbehörde in gleicher oder<br />
ähnlicher Form vorgelegt.<br />
___________________ ____________________________<br />
Datum Unterschrift<br />
112