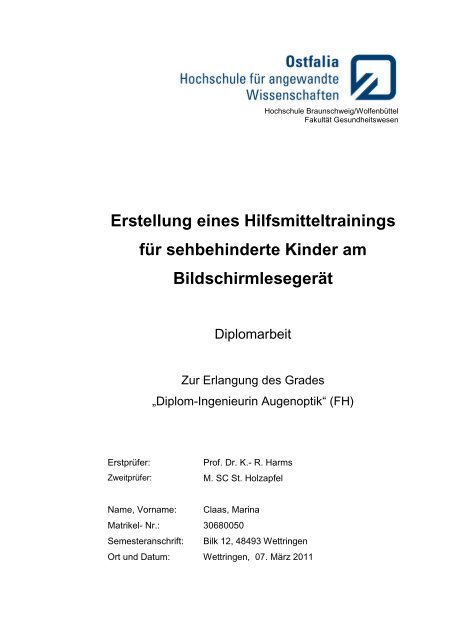Diplomarbeit: Hilfsmitteltraining für sehbehinderte Kinder - Optelec
Diplomarbeit: Hilfsmitteltraining für sehbehinderte Kinder - Optelec
Diplomarbeit: Hilfsmitteltraining für sehbehinderte Kinder - Optelec
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Hochschule Braunschweig/Wolfenbüttel<br />
Fakultät Gesundheitswesen<br />
Erstellung eines <strong>Hilfsmitteltraining</strong>s<br />
<strong>für</strong> <strong>sehbehinderte</strong> <strong>Kinder</strong> am<br />
Bildschirmlesegerät<br />
<strong>Diplomarbeit</strong><br />
Zur Erlangung des Grades<br />
„Diplom-Ingenieurin Augenoptik“ (FH)<br />
Erstprüfer: Prof. Dr. K.- R. Harms<br />
Zweitprüfer: M. SC St. Holzapfel<br />
Name, Vorname: Claas, Marina<br />
Matrikel- Nr.: 30680050<br />
Semesteranschrift: Bilk 12, 48493 Wettringen<br />
Ort und Datum: Wettringen, 07. März 2011
Danksagung<br />
An erster Stelle ein herzliches Dankeschön an meine beiden<br />
Probandinnen, mit denen ich das erarbeitete <strong>Hilfsmitteltraining</strong><br />
ausprobieren konnte. Beide haben mir sehr bei der Ideenfindung<br />
geholfen und mir gezeigt, worauf ich bei der Erstellung einer Schulung<br />
achten muss, auch wenn ich nur die Resultate von einer von ihnen<br />
tatsächlich in die Arbeit aufnehmen konnte. Ein Dank geht außerdem<br />
an alle <strong>Kinder</strong> der Klasse E der Irisschule, denen ich im Schulunterricht<br />
zuschauen durfte und die es durch ihren Frohsinn immer wieder<br />
geschafft haben, mich aufzumuntern und zu motivieren. Natürlich<br />
bedanke ich mich auch bei dem Kollegium der Irisschule <strong>für</strong> die<br />
erstklassige Unterstützung, besonders bei Frau De Byl, die mir immer<br />
mit guten Ratschlägen und Hilfestellungen zur Seite stand.<br />
Selbstverständlich danke ich Frau Holzapfel, die den Kontakt zur<br />
Irisschule erst ermöglicht hat und die immer wieder wertvolle<br />
Anregungen geben konnte. Außerdem bedanke ich mich bei Herrn<br />
Harms, der immer erreichbar war und mir bei jeglichen Fragen und<br />
Problemstellungen zur Seite stand.<br />
Vielen Dank an Augenoptik Viehoff <strong>für</strong> angepasste Arbeitszeiten<br />
während der <strong>Diplomarbeit</strong>sphase und auch an die Arbeitskollegen,<br />
sowohl <strong>für</strong> das gezeigte Interesse am <strong>Diplomarbeit</strong>sthema als auch <strong>für</strong><br />
das Verständnis <strong>für</strong> gestresste Momente aufgrund der <strong>Diplomarbeit</strong>.<br />
Ein ganz großes Dankeschön an meine Familie und meine Freunde <strong>für</strong><br />
Unterstützung und Motivation, außerdem an alle Plauder- und<br />
Chatpartner, die immer wenn nötig <strong>für</strong> Ablenkung gesorgt haben. Ein<br />
besonderes Dankeschön auch an alle Mitglieder von SAO06 <strong>für</strong> den<br />
ständigen Gedankenaustausch über die verschiedensten mehr oder<br />
weniger ernst zu nehmenden Problemstellungen in Bezug auf<br />
<strong>Diplomarbeit</strong>en.<br />
Zuletzt vielen Dank an meine Probeleserinnen Anja und Crossi, die der<br />
Arbeit den letzten Schliff verpasst haben!<br />
II
Inhaltsverzeichnis<br />
Abbildungs- und Tabellenverzeichnis ................................................... VI<br />
Verzeichnis der Formelzeichen .......................................................... VIII<br />
1 Einleitung........................................................................................ 1<br />
2 Grundlagen..................................................................................... 4<br />
2.1 Begriffserklärungen .................................................................. 4<br />
2.2 Relevanz von Bildschirmlesegeräten als Hilfsmittel <strong>für</strong> <strong>Kinder</strong> . 9<br />
2.3 Voraussetzungen <strong>für</strong> das Lesen ............................................. 14<br />
2.3.1 Sehschärfe, Kontrastempfindlichkeit, Gesichtsfeld .......... 14<br />
2.3.2 Voraussetzungen und Einschränkungen des Lesens<br />
aufgrund der Verwendung eines Bildschirmlesegerätes .............. 19<br />
2.4 Das Bildschirmlesegerät ......................................................... 20<br />
2.4.1 Grundlagen, Bestandteile, Möglichkeiten, Funktionen ..... 20<br />
2.4.2 Der richtige Umgang mit dem BLG- vom schlechten zum<br />
guten Bild ..................................................................................... 23<br />
3 Herausforderungen im Umgang mit dem Bildschirmlesegerät und<br />
deren Schulung ................................................................................... 27<br />
3.1 Allgemeines ............................................................................ 27<br />
3.2 Richtige Platzierung/ Aufstellung des Gerätes ....................... 28<br />
3.3 Richtige Platzierung des Lesegutes, Bewegung des<br />
Kreuztisches und Linieneinblendung ............................................... 30<br />
3.3.1 Zu beachtende Faktoren .................................................. 30<br />
3.3.2 Übungen .......................................................................... 34<br />
3.4 Einstellung des Abbildungsmaßstabes ................................... 38<br />
3.4.1 Zu beachtende Einflussfaktoren ...................................... 38<br />
3.4.2 Übungen .......................................................................... 40<br />
3.5 Orientierung auf dem Arbeitsblatt ........................................... 44<br />
3.5.1 Anzuwendende Suchmethoden ....................................... 44<br />
3.5.2 Übungen .......................................................................... 45<br />
3.6 Einstellung von Lesefarbe, Helligkeit und Kontrast ................ 48<br />
III
3.6.1 Zu beachtende Einflussfaktoren ...................................... 48<br />
3.6.2 Übungen .......................................................................... 49<br />
3.7 Hand- Auge- Koordination bzw. Schreiben/Malen unter dem<br />
BLG 53<br />
3.7.1 Zu beachtende Faktoren .................................................. 53<br />
3.7.2 Übungen .......................................................................... 56<br />
3.8 Nutzung der Fernkamera........................................................ 59<br />
3.8.1 Zu beachtende Faktoren .................................................. 59<br />
3.8.2 Übungen .......................................................................... 60<br />
3.9 Übungen zur kombinierten Nutzung der Funktionen .............. 61<br />
4 Zusammenstellung eines individuellen Trainings ......................... 65<br />
4.1 Individualität der Schüler ........................................................ 65<br />
4.2 Ermittlung des Trainingsbedarfs ............................................. 66<br />
4.2.1 Allgemeines ..................................................................... 66<br />
4.2.2 Fragebögen ..................................................................... 66<br />
4.2.3 Eingangstest .................................................................... 67<br />
4.2.3.1 Allgemeines ............................................................... 67<br />
4.2.3.2 Aufbau des Eingangstestes ....................................... 69<br />
4.2.3.3 Kritik am Eingangstest ............................................... 71<br />
4.3 Zusammenstellung der Übungsbausteine .............................. 72<br />
4.4 Ausgangstest .......................................................................... 73<br />
5 Erprobung des <strong>Hilfsmitteltraining</strong>s ................................................ 74<br />
5.1 Ablauf ..................................................................................... 74<br />
5.2 Vorstellung der Probandin ...................................................... 74<br />
5.3 Ergebnisse des Eingangstestes ............................................. 76<br />
5.4 Auswertung des Eingangstestes ............................................ 79<br />
5.5 Zusammenstellung der Übungsbausteine .............................. 80<br />
5.6 Ergebnisse des Ausgangstests .............................................. 83<br />
5.7 Vergleich von Ein- und Ausgangstest ..................................... 84<br />
5.8 Ausgangsfragebogen <strong>für</strong> die <strong>Kinder</strong> ....................................... 88<br />
5.8.1 Aufbau des Fragebogens ................................................. 88<br />
IV
5.8.2 Ergebnisse des Fragebogens .......................................... 88<br />
5.8.3 Auswertung des Fragebogens ......................................... 89<br />
5.9 Diskussion der Ergebnisse und Ausblick ................................ 89<br />
6 Fazit ............................................................................................. 93<br />
Literaturverzeichnis ............................................................................. 95<br />
I. Fragebögen und Informationsmaterial ........................................ 100<br />
II. Ein- und Ausgangstest ............................................................... 119<br />
III. Übungsmaterial ....................................................................... 149<br />
Ehrenwörtliche Erklärung .................................................................. 184<br />
V
Abbildungs- und Tabellenverzeichnis<br />
Abbildungs- und Tabellenverzeichnis<br />
Sehbehinderung: ................................................................................. 4<br />
Tabelle 1 : Klassifikation der Sehbeeinträchtigungen ............................ 4<br />
Abbildung 1: Anzahl der 2007 in Deutschland lebenden Menschen mit<br />
Sehbehinderung unter 65 nach Altersgruppen .................................... 11<br />
Abbildung 3: Anteil der Sehbehinderten an der Gesamtbevölkerung<br />
nach Altersgruppen ............................................................................. 13<br />
Abbildung 4 : Zeilensprung, Variante A ............................................... 32<br />
Abbildung 5 : Zeilensprung, Variante B ............................................... 32<br />
Abbildung 6 : Bewegung Kreuztisch [E] ............................................... 34<br />
Abbildung 7 : Bewegung von Kreuztisch bzw. Arbeitsblatt [G] ............ 35<br />
Abbildung 8: Bewegung von Kreuztisch bzw. Arbeitsblatt [F] ............. 36<br />
Abbildung 9 : Bewegung von Kreuztisch bzw. Arbeitsblatt [F] – ohne<br />
Buchstaben ......................................................................................... 37<br />
Abbildung 10: Bewegung von Kreuztisch oder Arbeitsblatt [F] - 2 ....... 38<br />
Abbildung 11 : Einstellung des Abbildungsmaßstabs [E] ..................... 40<br />
Abbildung 12 : Einstellung des Abbildungsmaßstabs [G] .................... 41<br />
Abbildung 13 : Einstellung des Abbildungsmaßstabes [F] .................. 43<br />
Abbildung 14: Scanning eines Arbeitsblattes ...................................... 45<br />
Abbildung 15 : Orientierung auf dem Arbeitsblatt [E] ........................... 46<br />
Abbildung 16: Orientierung auf dem Arbeitsblatt [G} ........................... 47<br />
Abbildung 17: Orientierung auf dem Arbeitsblatt [F] ............................ 48<br />
Abbildung 18 : Einstellung der Farbe [E] ............................................. 50<br />
Abbildung 19: Einstellung von Farbe und Kontrast [E] ........................ 50<br />
Abbildung 20: Einstellung von Farbe und Kontrast [E] – ohne Zahlen . 51<br />
Abbildung 22: Einstellung von Helligkeit, Farbe und Kontrast [F] ........ 52<br />
Abbildung 23: Einstellung von Helligkeit, Farbe und Kontrast [F] - ohne<br />
Buchstaben ......................................................................................... 53<br />
Abbildung 24 : Hand – Auge - Koordination [E] ................................... 56<br />
Abbildung 25 : Hand – Auge - Koordination [G] – ohne Buchstaben ... 57<br />
Abbildung 26 : Hand-Auge-Koordination [G] ....................................... 58<br />
Abbildung 27 : Hand – Auge – Koordination [F] .................................. 59<br />
Abbildung 28 : Übung zur Kombination der Funktionen - 3 ................. 61<br />
VI
Abbildung 29 :Übung zur Kombination der Funktionen - 4 .................. 62<br />
Abbildung 31 : Position des BLG‘s zum Fenster ................................. 76<br />
Abbildung 32: Die Sitzhaltung der Probandin vor ihrem BLG .............. 77<br />
Abbildung 33 : Positionierung des Bildschirmlesegerätes im<br />
Klassenraum ....................................................................................... 77<br />
Abbildung 34 : Benötitigte Zeit <strong>für</strong> die Einstellung des<br />
Bildschirmlesegerätes ......................................................................... 84<br />
Abbildung 35: Planmäßigkeit und Sinnhaftigkeit der Einstellungen ..... 85<br />
Abbildung 36 : Für die einzelnen Aufgaben benötigte Zeit in Minuten . 85<br />
Abbildung 37 : Bewertung der Kreuztischbewegung nach Schulnoten 86<br />
Abbildung 38: Bewertung von Hand-Auge-Koordination und Stifthaltung<br />
nach Schulnoten .................................................................................. 86<br />
Abbildung 39 : Bewertung der Suchsystematik nach Schulnoten ........ 87<br />
Abbildung 40: Bewertung des Schriftbildes nach Schulnoten .............. 87<br />
VII
Verzeichnis der Formelzeichen<br />
Verzeichnis der Formelzeichen<br />
aE<br />
Sehentfernung<br />
β’ Abbildungsmaßstab<br />
CMichelson<br />
Michelsonkontrast<br />
Γ‘ Vergrößerung<br />
Γ’Ann<br />
Vergrößerung durch Annäherung<br />
Γ’Bedarf<br />
Vergrößerungsbedarf<br />
Γ’ges Gesamtvergrößerung<br />
Γ’Obj<br />
Objektvergrößerung<br />
Lmax<br />
Maximale Leuchtdichte<br />
Lmin<br />
Minimale Leuchtdichte<br />
VisusCC<br />
Sehschärfe eines Auges mit<br />
Korrektion<br />
y Objektgröße<br />
y’ Bildgröße<br />
VIII
Kapitel 1: Einleitung<br />
1 Einleitung<br />
Insgesamt werden ca. zwei Drittel aller Informationen aus der Umwelt<br />
über das visuelle System aufgenommen, 1 unter anderem durch das<br />
Lesen von Zeitungen oder Büchern, hiermit verbringt im Durchschnitt<br />
jeder Mensch in Deutschland etwa eine dreiviertel Stunde pro Tag. 2<br />
Sowohl im Berufsleben als auch in der Schule ist das Lesen eine<br />
wichtige und häufig genutzte Möglichkeit, um sich Wissen anzueignen. 3<br />
In der Schule werden zur visuellen Vermittlung von Informationen unter<br />
anderem Schulbücher, Tafelbilder oder Arbeitsblätter verwendet. Diese<br />
werden von <strong>Kinder</strong>n ohne Sehbehinderung mit durchschnittlich 123<br />
Wörtern pro Minute gelesen. Ein Erwachsener mit Sehbehinderung<br />
dagegen liest mit Hilfe eines Bildschirmlesegerätes deutlich langsamer,<br />
durchschnittlich zwischen 15 und 60 Wörter pro Minute (WpM). 4<br />
Denninghaus vergleicht die Lesegeschwindigkeit von Schülern mit<br />
Sehbehinderung, die auf die Verwendung eines Hilfsmittels angewiesen<br />
sind, mit der Lesegeschwindigkeit von ebenfalls <strong>sehbehinderte</strong>n<br />
Schülern, die jedoch kein Hilfsmittel benötigen. Er stellt fest, dass<br />
Schüler mit hochgradiger Sehbehinderung, die zum Lesen ein<br />
Hilfsmittel verwenden und hiermit noch unerfahren sind, ca. um zwei<br />
Drittel langsamer lesen als diejenigen, die kein Hilfsmittel verwenden,<br />
und um 1/3 langsamer lesen, wenn sie bereits Erfahrungen im Umgang<br />
mit dem Hilfsmittel gesammelt haben. 5 Dies lässt erwarten, dass auch<br />
die Lernleistung <strong>sehbehinderte</strong>r <strong>Kinder</strong>, die auf ein Hilfsmittel<br />
angewiesen sind, deutlich herabgesetzt ist. Es besteht das Risiko, dass<br />
keine Lesefertigkeit erreicht wird, da sich der Lernprozess wesentlich<br />
1 Vgl. Krug, F. –K., Didaktik <strong>für</strong> den Unterricht mit <strong>sehbehinderte</strong>n Schülern, 2001 S.<br />
105.<br />
2 Vgl. Bundesamt <strong>für</strong> Statistik, Zahl der Woche Nr. 16 (Internet).<br />
3 Vgl. Krug, F.–K., Didaktik <strong>für</strong> den Unterricht mit <strong>sehbehinderte</strong>n Schülern, 2001, S.<br />
215<br />
4 Vgl. Krug, F.-G., Didaktik <strong>für</strong> den Unterricht mit <strong>sehbehinderte</strong>n Schülern, 2001, S.<br />
126.<br />
5 Vgl. Denninghaus, Erwin (1997): Die Förderung der Lesegeschwindigkeit bei blinden<br />
und <strong>sehbehinderte</strong>n Jugendlichen und jungen Erwachsenen. In: horus, H. 1. Online<br />
verfügbar unter http://www.dvbs-online.de/horus/1997-1-2126.htm, zuletzt geprüft am<br />
30.12.2008<br />
1
Kapitel 1: Einleitung<br />
schwieriger gestaltet. 6 Aus Denninghaus‘ Angaben geht allerdings auch<br />
hervor, dass mit dem Hilfsmittel gesammelte Erfahrungen die<br />
Lesegeschwindigkeit verdoppeln können.<br />
Falcon-Piva und Koob zeigen in ihrer Studie, dass speziell auf<br />
Bildschirmlesegeräte bezogen ein <strong>Hilfsmitteltraining</strong> bei Erwachsenen<br />
zwar nicht die Lesegeschwindigkeit an sich steigert, den Umgang mit<br />
dem Lesegerät in den Bereichen Kreuztischbewegung, Hand- Auge-<br />
Koordination und Schreiben jedoch deutlich verbessert. 7 Außerdem<br />
wurde in einer Studie von Cox, Reimer et al. erfolgreich ein<br />
<strong>Hilfsmitteltraining</strong> <strong>für</strong> <strong>Kinder</strong> mit Aufsetzlupen erprobt. Hier wurde<br />
gezeigt, dass ein <strong>Hilfsmitteltraining</strong> die Handhabung der Lupe<br />
verbessert und Aufgabenstellungen, die mit Lupe gelöst werden sollten,<br />
nach dem Training besser bearbeitet werden konnten. 8<br />
Zusammengefasst zeigen diese drei Studien, dass ein Training am BLG<br />
bei Erwachsenen zu einem besseren Umgang mit diesem führt,<br />
außerdem eine Schulung mit Aufsetzlupen bei <strong>Kinder</strong>n eine bessere<br />
Handhabung und Aufgabenerfüllung zur Folge hat, und weiterhin<br />
Erfahrungswerte bei der Nutzung von Hilfsmitteln bei Schülern zu einer<br />
erhöhten Lesegeschwindigkeit führen. Diese Ergebnisse lassen<br />
erwarten, dass ein <strong>Hilfsmitteltraining</strong> <strong>für</strong> <strong>Kinder</strong> am BLG ebenfalls<br />
positive Ergebnisse wie einen sichereren Umgang mit dem BLG und<br />
somit erfolgreicheres Lösen von Aufgaben auch in der Schule, und<br />
möglicherweise eine erhöhte Lesegeschwindigkeit zur Folge haben<br />
wird. Deswegen soll in der vorliegenden <strong>Diplomarbeit</strong> ein<br />
<strong>Hilfsmitteltraining</strong> <strong>für</strong> <strong>sehbehinderte</strong> <strong>Kinder</strong> am Bildschirmlesegerät<br />
erarbeitet werden. Die Arbeit soll in einfachen Schritten erklären, wie<br />
ein Bildschirmlesegerät <strong>Kinder</strong>n mit Sehbehinderung in der Schule<br />
helfen kann und mit welchen Aufgaben den Schülern die Arbeit am BLG<br />
erleichtert werden kann. Sie soll somit auch als Leitfaden <strong>für</strong><br />
Lehrer/innen dienen, die Schüler/innen unterrichten welche ein BLG<br />
6<br />
Vgl. Krug, F.-K., Didaktik <strong>für</strong> den Unterricht mit <strong>sehbehinderte</strong>n Schülern, 2001, S.<br />
126.<br />
7<br />
Vgl. Falcón-Piva, A., Koob, A., Handhabungstraining am Bildschirmlesegerät, 2009,<br />
S. 124 f.<br />
8<br />
Vgl. Cox, R. F., Reimer, A. M. et al., Young children´s use of a visual aid, 2009, S. 7<br />
f.<br />
2
Kapitel 1: Einleitung<br />
benutzen. Um die Arbeit auch <strong>für</strong> fachfremde Leser wie z. B. Lehrer<br />
leicht nachvollziehbar zu gestalten, werden Fachbegriffe zu Beginn<br />
erklärt.<br />
Daraufhin wird erläutert, welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen<br />
um Lesefähigkeit erreichen zu können und wie diese durch die<br />
Sehbehinderung und die Nutzung des Bildschirmlesegerätes<br />
eingeschränkt werden. Außerdem werden die verschiedenen<br />
Funktionen von Bildschirmlesegeräten erklärt, sodass deutlich wird zu<br />
welchen Themen Übungseinheiten in einem Training enthalten sein<br />
sollten. Zu den jeweiligen Funktionen wird erläutert, welche<br />
Besonderheiten bei der Nutzung zu beachten sind, und mit welchen<br />
Übungen diese einem Kind mit Sehbehinderung näher gebracht werden<br />
können.<br />
Im Anschluss wird gezeigt, wie aus den vorgestellten Übungen ein<br />
individuelles Training <strong>für</strong> einen Schüler zusammengestellt werden kann.<br />
Hier<strong>für</strong> wird zunächst erläutert, wie der Trainingsbedarf eines Schülers<br />
mithilfe von Fragebögen an Eltern, <strong>Kinder</strong> und Lehrer sowie durch<br />
Verwendung eines Eingangstestes ermittelt werden kann, um die<br />
notwendigen auf den Bedarf des Kindes abgestimmten Übungen<br />
auswählen zu können.<br />
Die Erstellung der verschiedenen Aufgaben wird durch Beobachtungen,<br />
die während mehrerer Hospitationsstunden in der Irisschule in Münster<br />
gemacht wurden, gestützt.<br />
Die beschriebene Vorgehensweise <strong>für</strong> die Erstellung eines<br />
<strong>Hilfsmitteltraining</strong>s wird darauf hin mit einer Schülerin, die ein<br />
Bildschirmlesegerät verwendet, erprobt, um den Nutzen des<br />
<strong>Hilfsmitteltraining</strong>s bewerten zu können und<br />
Verbesserungsmöglichkeiten aufzuzeigen.<br />
3
Kapitel 2: Grundlagen<br />
2 Grundlagen<br />
2.1 Begriff Begriffserklärungen<br />
Visus:<br />
Der Begriff Visus ist gleichbedeutend mit Sehschärfe, und gibt das<br />
Auflösungsvermögen des visuellen Systems an, also die Fähigkeit,<br />
feine Details eines Objektes wahrzunehmen. Die Sehschärfe bei hohem<br />
Kontrast liegt bei Menschen ohne Sehbehinderung im Regelfall bei<br />
mindestens 1,0 und nimmt mit dem Alter ab. 9 Oft wird die Sehschärfe<br />
auch als Prozentzahl angegeben, wobei 100% einem Visus von 1,0<br />
entsprechen.<br />
Sehbehinderung<br />
Sehbehinderung:<br />
Tabelle 1 : Klassifikation der Sehbeeinträchtigungen 10<br />
9<br />
Vgl. Goersch, H.; Wörterbuch der Optometrie; 200 2004; S.259.<br />
10<br />
Eigene Darstellung nach ICD ICD-10-GM; GM; Internationale statistische Klassifikation der<br />
Krankheiten, 2010, S. 280.<br />
4
Kapitel 2: Grundlagen<br />
Eine mittelschwere oder schwere Sehbeeinträchtigung liegt vor, wenn<br />
der Visuscum correctione(Visuscc), also die Sehschärfe bei bester optischer<br />
Korrektur, zwischen 0,05 und 0,3 liegt. Bei einem Visuscc zwischen 0,02<br />
und 0,05 auf beiden Augen besteht eine hochgradige Sehbehinderung.<br />
Diese liegt ebenfalls vor, wenn „das Gesichtsfeld des gesünderen<br />
Auges bei zentraler Fixation nicht größer als 10 Grad ist.“ 11<br />
Akkommodation<br />
Durch Akkommodation wird der Brechwert des Auges durch das<br />
Akkommodationssystem, bestehend aus Augenlinse und<br />
verschiedenen Muskeln und Nerven, auf ein Objekt in einer bestimmten<br />
Entfernung eingestellt. 12 Die Akkommodationsfähigkeit nimmt mit<br />
zunehmendem Alter ab, der dem Auge am nächsten liegende Punkt,<br />
auf den sich das Auge einstellen kann, rückt immer weiter vom Auge<br />
weg.<br />
Gesichtsfeld/Lesegesichtsfeld<br />
Als Gesichtsfeld bezeichnet man die „Gesamtheit aller Punkte im<br />
Außenraum, die bei unbewegtem Kopf und Primärstellung der Augen<br />
gleichzeitig wahrgenommen werden können.“. 13 Für das<br />
Lesegesichtsfeld gilt dasselbe, speziell auf das Lesen bezogen. Nur<br />
Buchstaben, die sich innerhalb des Lesegesichtsfeldes befinden,<br />
können wahrgenommen und ausgewertet werden.<br />
Abbildungsmaßstab<br />
Der Abbildungsmaßstab gibt mit<br />
� ′ = �′<br />
�<br />
das Verhältnis von orientierter Bildgröße zu orientierter Objektgröße<br />
an. 14 Bei Bildschirmlesegeräten wird das betrachtete Objekt mit dem<br />
Abbildungsmaßstab β‘ auf dem Bildschirm abgebildet.<br />
11 ICD-10-GM; Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten, 2010, S. 280.<br />
12 Vgl. Goersch, H.; Wörterbuch der Optometrie; 2004 S. 10ff.<br />
13 Goersch, H., Wörterbuch der Optometrie, 2004, S.<br />
14 Vgl. Goersch, H. Wörterbuch der Optometrie, 2004, S. 3.<br />
5
Kapitel 2: Grundlagen<br />
Vergrößerungsbedarf<br />
Nach Definition bezeichnet der Vergrößerungsbedarf „die<br />
Vergrößerung, die ein Sehbehinderter bei ausreichender Beleuchtung<br />
zum Lesen normaler Druckschrift mit ca. 2mm hohen Buchstaben<br />
braucht.“ 15 Dies bezieht sich auf eine Entfernung von 25 cm.<br />
Der Vergrößerungsbedarf eines Sehbehinderten variiert nach Art und<br />
Ausprägung der Sehschädigung und hängt außerdem auch von<br />
anderen Faktoren wie dem Kontrast und der Beleuchtung ab.<br />
Vergrößerung:<br />
„Die Vergrößerung Γ‘ ist der Quotient aus der Größe des mit einer<br />
Sehhilfe vergrößerten Netzhautbildes und der Größe des<br />
Netzhautbildes bei Betrachtung des Objektes ohne Sehhilfe aus 25 cm<br />
Entfernung“ 16 , also:<br />
Γ‘=<br />
��öß� ��� �����öß����� �������������<br />
��öß� ��� �������������� ���� �������� ��� ���� ����������<br />
Diese Angabe der Vergrößerung bezieht sich auf die Betrachtung naher<br />
Objekte.<br />
Eine Vergrößerung kann sich nicht nur durch die Verwendung eines<br />
Hilfsmittels ergeben, sondern auch durch die Annäherung an ein<br />
Objekt. Die dabei entstehende Netzhautbildgröße ergibt sich wie folgt:<br />
Netzhautbildgröße (in Grad) = 57,3 x Objektgröße (in cm) / Sehentfernung (in cm) 17<br />
Je kleiner die Sehentfernung wird, desto größer ist das Netzhautbild.<br />
Die Vergleichsentfernung <strong>für</strong> die Angabe der Vergrößerung ist 25 cm.<br />
Die Vergrößerung durch Annäherung berechnet sich dann als<br />
15<br />
Prof. Dr.-Ing. Schreck, K., Vergrößerung und Vergrößerungsangaben bei<br />
Vergrößernden Sehhilfen, 2003, S. 1.<br />
16<br />
Schreck, K., Vergrößerung und Vergrößerungsangaben bei Vergrößernden<br />
Sehhilfen, 2003, S. 1.<br />
17<br />
Vgl. Legge, G. E., Psychophyics of Reading in Normal and Low Vision, 2007, S.47.<br />
6
Kapitel 2: Grundlagen<br />
Γ’Ann =<br />
Und somit gekürzt<br />
also<br />
��,� � ��������öß�(�� ��)/�������������(�� ��)<br />
��,� � ��������öß�/����<br />
Γ’Ann =<br />
�/�������������(�� ��)<br />
�/����<br />
Γ’Ann = 25cm/aE(in cm).<br />
Dabei ist aE der Abstand zwischen Auge und Objekt. Ist die<br />
Sehentfernung kleiner als 25cm, ergibt sich folglich eine Vergrößerung<br />
durch Annäherung, bei einer Sehentfernung größer als 25cm ergibt sich<br />
eine Verkleinerung.<br />
Eingeschränkt wird die Vergrößerung durch Annäherung durch die<br />
Akkommodationsfähigkeit des Menschen, die mit dem Alter immer<br />
weiter abnimmt. Aus diesem Grund kann ein Mensch bei<br />
gleichbleibender Fehlsichtigkeit im Normalfall als Kind eine höhere<br />
Vergrößerung durch Annäherung erreichen als im Erwachsenenalter.<br />
Die dritte Möglichkeit, um eine Vergrößerung zu erreichen und somit<br />
einen Vergrößerungsbedarf zu decken, ist die Objektvergrößerung z. B.<br />
durch vergrößerte Fotokopien eines Textes. Diese berechnet sich als<br />
Γ’Objekt= �<br />
� =β‘<br />
Und entspricht somit dem Abbildungsmaßstab. Dabei ist y die Größe<br />
der Originals und y‘ die Größe des Objektes auf der vergrößerten<br />
Kopie.<br />
Die Vergrößerung, die bei der Verwendung eines Hilfsmittels, z. B.<br />
eines BLG´s, entsteht, berechnet sich als Produkt aus<br />
Abbildungsmaßstab des Hilfsmittels und der Vergrößerung durch<br />
Annäherung:<br />
Γ‘ges = β’Hilfsmittel x Γ’Annäherung 18<br />
18 Schreck, K., Vergrößerung und Vergrößerungsangaben bei Vergrößernden<br />
Sehhilfen, 2003, S. 4.<br />
7
Kapitel 2: Grundlagen<br />
Liegt zusätzlich eine Objektvergrößerung vor, wird auch dieser Faktor<br />
mit einberechnet und es ergibt sich:<br />
Γ‘ges = β’Hilfsmittel x Γ’Annäherung x Γ’Obj<br />
Diese Gesamtvergrößerung sollte dem Vergrößerungsbedarf des<br />
Sehbehinderten entsprechen.<br />
Negativkontrast<br />
Als Negativkontrast wird die Textdarstellung von weißem Text auf<br />
schwarzem Hintergrund bezeichnet. Für einige Menschen mit<br />
Sehbehinderung, meist Klienten mit getrübten Augenmedien, macht<br />
dies ein schnelleres und anstrengungsfreieres Lesen möglich, da der<br />
Anteil heller Flächen verringert wird und so weniger Blendung auftritt. 19<br />
Viele Bildschirmlesegeräte ermöglichen eine Einstellung des<br />
Negativkontrastes.<br />
Fehlfarbenmodus<br />
Durch die Verwendung des Fehlfarbmodus weicht die Darstellung des<br />
betrachteten Materials durch das Bildschirmlesegerät vom natürlichen<br />
Farbeindruck ab. Hierdurch werden Bildunterschiede, die im<br />
Echtfarbmodus kaum auffallen, sichtbar gemacht. Für Sehbehinderte<br />
wirkt diese Darstellung oft angenehmer, zusätzlich macht sie<br />
kontrastarme Darstellungen leichter sichtbar. Möglich sind hier z. B. die<br />
Farbvarianten blau auf gelb oder rot auf schwarz. 20<br />
Echtfarbmodus<br />
Als Echtfarbmodus wird die Einstellung am Bildschirmlesegerät<br />
bezeichnet, in der alle Farben der Vorlage auf dem Monitor in ihrer<br />
natürlichen Farbe erscheinen.<br />
19<br />
Vgl. Legge, G. E.; Psychophysics of Reading in Normal and Low Vision, 2007, S.<br />
46.<br />
20<br />
Vgl. Informationspool Computerhilfsmittel <strong>für</strong> Blinde und Sehbehinderte,<br />
Bildschirmlesegeräte, Wörterbuch, zuletzt geprüft am 23.11.2009, (Internet).<br />
8
Kapitel 2: Grundlagen<br />
2.2 Relevanz von Bildschirmlesegeräten als Hilfsmittel<br />
<strong>für</strong> <strong>Kinder</strong><br />
Die Sehschärfe, die benötigt wird, um einen Text zu lesen, hängt ab<br />
vom Abstand zwischen Auge und Text, dem Kontrast zwischen Text<br />
und Hintergrund, der Qualität der Beleuchtung und der Versalhöhe des<br />
Textes. Als Versalhöhe bezeichnet man die Höhe der Großbuchstaben<br />
eines Textes, diese beträgt bei standardisiertem Zeitungsdruck zwei<br />
mm. Um einen solchen Text bei guter Beleuchtung aus einer<br />
Entfernung von 25 cm fließend und mit wenig Anstrengung lesen zu<br />
können, ist mindestens ein Visus von 0,4 erforderlich, bzw. das Produkt<br />
aus dem vorhandenen Visus des Sehbehinderten und der<br />
Vergrößerung muss mindestens 0,4 ergeben. 21 Die Vergrößerung kann<br />
entweder durch Vergrößerung durch Annäherung, Objektvergrößerung<br />
oder aber durch ein Hilfsmittel bzw. durch eine Kombination dieser<br />
Faktoren erreicht werden. Als Hilfsmittel sind hier einerseits optische<br />
Hilfsmittel wie zum Beispiel Lupen, oder aber elektronische Hilfsmittel,<br />
z. B. Bildschirmlesegeräte, zu nennen. Die Nutzung eines<br />
Bildschirmlesegerätes als Hilfsmittel ist häufig dann sinnvoll, wenn eine<br />
Vergrößerung von 8x oder mehr benötigt wird. 22 Ein<br />
Vergrößerungsbedarf Γ‘ von mindestens 8x liegt vor, wenn der Visuscc<br />
0,05 oder weniger beträgt, denn dann ergibt sich<br />
Vcc x Γ‘ = 0,4<br />
und ein fließendes Lesen von Texten mit einer Versalhöhe von zwei<br />
mm ist möglich.<br />
Somit erscheint der Einsatz eines BLGs vornehmlich bei hochgradig<br />
Sehbehinderten sinnvoll. Dies ist allerdings eine rein mathematische<br />
Schlussfolgerung, der tatsächliche Vergrößerungsbedarf kann von dem<br />
berechneten Wert abweichen, darüber hinaus ist der Nutzen eines<br />
21 Vgl. Trauzettel- Klosinski, S. et al.; Lesefähigkeit von Sehbehinderten; in: Zeitschrift<br />
<strong>für</strong> praktische Augenheilkunde und augenärztliche Fortbildung, 21/2000; S. 531.<br />
22 Vgl. Informationspool Computerhilfsmittel <strong>für</strong> Blinde und Sehbehinderte,<br />
Bildschirmlesegeräte, Stand: 31. 08. 2010 (Internet).<br />
9
Kapitel 2: Grundlagen<br />
BLG´s <strong>für</strong> <strong>Kinder</strong> abhängig von der Schriftgröße des Arbeitsmaterials<br />
sowie von Kontrastempfindlichkeit und Gesichtsfeld des Schülers und<br />
seiner Fertigkeit und Motivation, ein Bildschirmlesegerät zu verwenden.<br />
Eine Finanzierung des Bildschirmlesegerätes über die Krankenkasse ist<br />
bei einer Sehschärfe von 0,1 oder weniger möglich 23 , die in Schulen<br />
verwendeten Bildschirmlesegeräte werden über den jeweiligen<br />
Landschaftsverband getragen. Das Verfahren zur Beantragung und<br />
Genehmigung eines Bildschirmlesegerätes wird hier nicht weiter<br />
beschrieben, da dies den Rahmen der vorliegenden Arbeit übersteigt.<br />
Geht man von der Verwendung eines Bildschirmlesegerätes durch<br />
<strong>Kinder</strong> mit einer hochgradigen Sehbehinderung aus, stellt sich die<br />
Größe der Bevölkerungsgruppe im schulpflichtigen Alter, <strong>für</strong> die eine<br />
Verwendung eines BLG´s in Frage kommt, statistisch gesehen wie folgt<br />
dar:<br />
Im Jahr 2007 lebten in Deutschland 348.442 <strong>sehbehinderte</strong> oder blinde<br />
Einwohner, das sind ca. 0,42% der Bevölkerung. Hiervon galten 51.168<br />
Menschen als hochgradig sehbehindert. 24 Die Zahl der <strong>Kinder</strong> mit<br />
Sehbehinderung im Alter zwischen vier und sechs Jahren in<br />
Deutschland lag 2007 bei 424, die der <strong>Kinder</strong> mit hochgradiger<br />
Sehbehinderung bei 60. Im Alter zwischen sechs und fünfzehn Jahren<br />
gab es 3155 Sehbehinderte, davon 445 mit einer hochgradigen<br />
Sehbehinderung. Im Alter zwischen 15 und 18 wurden statistisch 1018<br />
<strong>sehbehinderte</strong> Jugendliche erfasst, davon 196 mit einer hochgradigen<br />
Sehbehinderung. 25 In der folgenden Abbildung werden diese Strukturen<br />
detailliert dargestellt:<br />
23<br />
Informationspool Computerhilfsmittel <strong>für</strong> Blinde und Sehbehinderte;<br />
Bildschirmlesegeräte- Worauf zu achten ist; Stand 20007; (Internet).<br />
24<br />
Vgl. statistisches Bundesamt, Statistik der schwerbehinderten Menschen 2007;<br />
Stand 2009; S. 23 (Internet).<br />
25<br />
Vgl. statistisches Bundesamt, Statistik der schwerbehinderten Menschen 2007,<br />
Stand 2009; S. 8f (Internet).<br />
10
Kapitel 2: Grundlagen<br />
82,00<br />
165,00<br />
247,00<br />
60,00<br />
210,00<br />
270,00<br />
445,00<br />
1607,00<br />
2052,00<br />
Menschen mit Sehbehinderung nach<br />
Altersgruppen<br />
hochgradig Sehbehinderte sonstige Sehbehinderte Sehbehinderte gesamt<br />
196,00<br />
822,00<br />
1018,00<br />
524,00<br />
2433,00<br />
2957,00<br />
962,00<br />
4346,00<br />
5308,00<br />
9504,00<br />
11283,00<br />
Abbildung 1: Anzahl der 2007 in Deutschland lebenden Menschen mit<br />
Sehbehinderung unter 65 nach Altersgruppen 26<br />
Nimmt man diese Gruppen zusammen, gab es im Jahr 2007 in<br />
Deutschland 701 Sehbehinderte im Alter zwischen vier und achtzehn<br />
Jahren, <strong>für</strong> die wahrscheinlich der Einsatz eines Bildschirmlesegerätes<br />
in Schule oder Freizeit sinnvoll wäre und die gegebenenfalls von einem<br />
Training am Bildschirmlesegerät profitieren würden. Im Alter zwischen<br />
vier und sechs Jahren besteht noch keine Schulpflicht, diese<br />
Altersgruppe wird hier dennoch berücksichtigt, da hier bereits <strong>für</strong> die<br />
Schulzeit nützliche Erfahrungen mit dem BLG gesammelt werden<br />
können. Abbildung 1 zeigt deutlich, dass die Anzahl der<br />
Sehbehinderten mit dem Alter ansteigt und in der Altersgruppe der<br />
Schulanfänger sehr gering ausfällt. Abbildung 2 verdeutlicht, dass der<br />
Anteil der hochgradig Sehbehinderten unter der Gesamtzahl der<br />
Sehbehinderten bei der Altersgruppe zwischen null und vier Jahren mit<br />
33,2% am höchsten ist, dann stark abfällt auf 22,2 % bei den vier- bis<br />
sechsjährigen und dann stetig weiter sinkt bis auf unter 10% bei den 60<br />
26 Eigene Darstellung, erstellt nach Bundesamt <strong>für</strong> Statistik, Statistik der<br />
schwerbehinderten Menschen 2007; Stand 2009; S. 8f (Internet).<br />
1779,00<br />
18613,00<br />
21338,00<br />
2725,00<br />
15303,00<br />
17105,00<br />
1802,00<br />
18162,00<br />
20207,00<br />
unter 4 4 - 6 6 - 15 15 - 18 18 -25 25 - 35 35 - 45 45 - 55 55 - 60 60 - 65<br />
2045,00<br />
11
Kapitel 2: Grundlagen<br />
bis 62jährigen. Das bedeutet, dass laut Statistik jeder fünfte<br />
<strong>sehbehinderte</strong> Schulanfänger an einer hochgradigen Sehbehinderung<br />
leidet. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass auch verstärkt <strong>Kinder</strong> mit<br />
Mehrfachbehinderung eingeschult werden, die aufgrund der weiteren<br />
Behinderungen in dieser Statistik nicht berücksichtigt werden.<br />
Anteil in %<br />
40,00%<br />
35,00%<br />
30,00%<br />
25,00%<br />
20,00%<br />
15,00%<br />
10,00%<br />
5,00%<br />
0,00%<br />
Anteil hochgradig Sehbehinderter<br />
unter 4 4 - 6 6 - 1515 - 1818 -2525 - 3535 - 4545 - 5 55 - 60 60 - 62<br />
Altersgruppe nach Jahren<br />
Abbildung 2: Anteil der hochgradig Sehbehinderten an der Gesamtheit<br />
der Sehbehinderten in Deutschland 2007 nach Altersgruppen 27<br />
Abbildung 3 zeigt, dass der Anteil der <strong>sehbehinderte</strong>n Schulanfänger im<br />
Verhältnis zu der Gesamtzahl der deutschen Bevölkerung in dieser<br />
Altersgruppe mit 0,01% bis 0,03% sehr gering ausfällt. Dies erklärt,<br />
warum wenig Literatur und auch wenig verbreitetes Wissen in der<br />
Allgemeinheit über das Thema „<strong>sehbehinderte</strong> <strong>Kinder</strong>“ bzw.<br />
„<strong>sehbehinderte</strong> Schulanfänger“ existiert.<br />
27 Eigene Darstellung, erstellt nach Bundesamt <strong>für</strong> Statistik, Statistik der<br />
schwerbehinderten Menschen 2007; Stand 2009; S. 8f; (Internet).<br />
12
Kapitel 2: Grundlagen<br />
Anteil der Sehbehinderten<br />
1,60%<br />
1,40%<br />
1,20%<br />
1,00%<br />
0,80%<br />
0,60%<br />
0,40%<br />
0,20%<br />
0,00%<br />
Abbildung 3: Anteil der Sehbehinderten an der Gesamtbevölkerung<br />
nach Altersgruppen 28<br />
Andere Quellen weichen stark von den Zahlen des Bundesamtes <strong>für</strong><br />
Statistik ab: So vermutet Beyer <strong>für</strong> das Jahr 2007 eine Anzahl von<br />
knapp 15000 Schülern mit Sehbehinderung im deutschen<br />
Schulsystem. 29<br />
Dies ist ein Vielfaches der vom statistischen Bundesamt angegebenen<br />
Zahl von 3587 Sehbehinderten im Alter zwischen sechs und achtzehn<br />
Jahren, also im schulpflichtigen Alter.<br />
Hier wurden allerdings auch die Schüler mit einer Sehauffälligkeit, also<br />
einem Visuscc von 0,4 bis 0,5, berücksichtigt, dies erklärt die hohen<br />
Abweichungen.<br />
Anteil der Sehbehinderten an der<br />
Gesamtbevölkerung<br />
0,01% 0,03% 0,04% 0,07%<br />
unter 6 6 bis 15 15 bis<br />
25<br />
25 bis<br />
45<br />
Altersgruppen<br />
0,27%<br />
45 bis<br />
65<br />
1,52%<br />
0,40%<br />
über 65 Gesamt<br />
Beyer betont aber auch, dass die statistischen Zahlen hier<br />
wahrscheinlich zu niedrig liegen, da Sehbehinderungen nicht immer<br />
erkannt werden oder <strong>Kinder</strong> mit Sehbehinderung nicht erfasst werden,<br />
da die Eltern keine sonderpädagogische Unterstützung in Anspruch<br />
nehmen oder aber die Sehbehinderung aufgrund einer<br />
28 Eigene Darstellung, erstellt nach Bundesamt <strong>für</strong> Statistik, Statistik der<br />
schwerbehinderten Menschen 2007; Stand 2009; S. 8f; (Internet).<br />
29 Vgl. Beyer, F.; Sehbehinderung und Blindheit, in: Opp, G; Theunissen, G.,<br />
Handbuch schulische Sonderpädagogik, 2009, S. 196.<br />
13
Kapitel 2: Grundlagen<br />
Mehrfachbehinderung nicht als sonderpädagogischer Schwerpunkt<br />
benannt wird. 30<br />
2.3 Voraussetzungen <strong>für</strong> das Lesen<br />
2.3.1 Sehschärfe, Kontrastempfindlichkeit, Gesichtsfeld<br />
Im Folgenden sollen lediglich augenoptische, nicht aber z. B.<br />
neurologische Voraussetzungen <strong>für</strong> das Lesen und Schreiben erläutert<br />
werden.<br />
„Voraussetzungen <strong>für</strong> die Lesefähigkeit ist ein ausreichendes<br />
Auflösungsvermögen (Visus), sowie eine Mindestausdehnung<br />
(Lesegesichtsfeld) des zum Lesen benutzten Netzhautareals.“ 31 Um<br />
lesen zu können, sind also aus augenoptischer Sicht betrachtet zwei<br />
Voraussetzungen zu erfüllen: Zum einen ist eine ausreichende<br />
Sehschärfe notwendig, des Weiteren ein ausreichend großes<br />
Netzhautareal, in dem diese Sehschärfe vorliegt. Je nachdem, in<br />
welcher Schriftgröße das Lesegut abgefasst ist, wie gut der Kontrast ist<br />
und welche Schriftart verwendet wird, können die Zahlenwerte <strong>für</strong> diese<br />
optischen Voraussetzungen variieren:<br />
Während <strong>für</strong> das fließende Lesen einer Zeitung ein Visus von 0,4<br />
benötigt wird, sind <strong>Kinder</strong>bücher meist so groß geschrieben, dass ein<br />
Visus von 0,25 ausreicht. 32 Ist die benötigte Sehschärfe aufgrund einer<br />
Sehbehinderung nicht gegeben, hilft eine vergrößerte Darstellung des<br />
Objektes zum Beispiel durch ein Bildschirmlesegerät. Dabei verringert<br />
sich der benötigte Visus um den Faktor der Vergrößerung, trotzdem<br />
wird oft nicht die gleiche Lesefähigkeit erreicht:<br />
Legge schreibt, dass auch mit einer ausreichenden Vergrößerung des<br />
Textes nur 30% der Menschen mit Sehbehinderung eine<br />
Lesegeschwindigkeit erreichen, die der durchschnittlichen<br />
Lesegeschwindigkeit von Menschen ohne Sehbehinderung entspricht,<br />
30 Vgl. Beyer, F.; Sehbehinderung und Blindheit, in: Opp, G; Theunissen, G.,<br />
Handbuch schulische Sonderpädagogik, 2009, S. 196.<br />
31 Vgl. Trauzettel- Klosinski, S. et al.; Lesefähigkeit von Sehbehinderten; in: Zeitschrift<br />
<strong>für</strong> praktische Augenheilkunde und augenärztliche Fortbildung, 21/2000; S. 529.<br />
32 Vgl. D’Andrea, F. M., Farrenkopf, C.; Looking to Learn; 2000, S. 20.<br />
14
Kapitel 2: Grundlagen<br />
der Großteil erreicht eine deutlich geringere Lesegeschwindigkeit. 33<br />
Legge betont aber auch, dass die Fähigkeit, überhaupt Lesen zu<br />
können, erst durch die Vergrößerung entsteht, und dass die<br />
Lesefähigkeit an sich eine Verbesserung der Lebensqualität bedeutet,<br />
selbst wenn nur langsames Lesen möglich ist.<br />
Der zum Lesen eines Textes benötigte Visus hängt nicht nur von der<br />
Schriftgröße, sondern auch vom Kontrast ab. Um diesen Kontrast zu<br />
berechnen, wird üblicherweise der Michelson-Kontrast verwendet, mit<br />
CMichelson=(Lmax – Lmin)/(Lmax + Lmin). 34<br />
Hierbei gibt Lmax die maximale Leuchtdichte an, also die des hellen<br />
Grundes bei schwarz auf weiß geschriebenem Text, und Lmin gibt die<br />
minimale Leuchtdichte an, also die der schwarzen Buchstaben. Bei<br />
einem Text im Negativkontrast verhält es sich umgekehrt. Die Werte <strong>für</strong><br />
den Michelson – Kontrast liegen zwischen 0 und 1 bzw. zwischen 0%<br />
und 100%. 35<br />
Der zum Lesen benötigte Kontrast liegt bei Menschen mit<br />
Sehbehinderung oft wesentlich höher als bei Menschen ohne<br />
Sehbehinderung. Aus diesem Grund ist eine herabgesetzte<br />
Kontrastempfindlichkeit häufig ein wesentlicher Faktor, der die<br />
Lesefähigkeit Sehbehinderter einschränkt. 36<br />
Ein schwarz auf weiß gedrucktes Buch ist wegen des guten Kontrastes<br />
einfacher zu lesen als eine auf Recyclingpapier bedruckte Zeitung. So<br />
liegt beispielsweise der Kontrast einer Nahsehprobentafel bei K=0,88,<br />
eine gewöhnliche Tageszeitung dagegen bietet nur einen Kontrast von<br />
K=0,66. 37<br />
33 Vgl. Legge, G. E.; Psychophyisics of Reading in Normal and Low Vision, 2007, S.<br />
30.<br />
34 Vgl. Sutter, M. Kontrast und Kontrastempfindlichkeit in der Low Vision<br />
Rehabilitation; in: Blickpunkt Focus; 19/2006; S. 1.<br />
35 Vgl. Legge, G. E.; Psychophyisics of Reading in Normal and Low Vision, 2007, S.<br />
45.<br />
36 Vgl. Legge, G. E.; Psychophysics of Reading in Normal and Low Vision, 2007, S.<br />
56.<br />
37 Vgl. Handorff, C.; Messung und Bedeutung des Kontrastsehvermögens bei<br />
Sehbehinderten, 2004.<br />
15
Kapitel 2: Grundlagen<br />
Am Bildschirmlesegerät kann der Kontrast abhängig von der am BLG<br />
gewählten Darbietungsart und möglichen Reflexen auf dem Monitor<br />
sowohl höher als auch niedriger sein als der des abgebildeten<br />
Objektes.<br />
Während die Kontrastschwelle, als der geringste wahrnehmbare<br />
Kontrast eines Normalsichtigen bei K=0,01 liegt, erhöht sich dieser Wert<br />
bei <strong>sehbehinderte</strong>n Menschen auf K = 0,28 - 0,45 bei hellen Objekten<br />
auf dunklem Grund bzw. K = 0,45 – 0,7 bei dunklen Objekten auf<br />
hellem Grund. 38 Die bei Menschen mit Sehbehinderung schlechte<br />
Sehschärfe wird bei ungünstigen Kontrastverhältnissen oft noch<br />
wesentlich herabgesetzt, deswegen erhöht sich bei schlechtem<br />
Kontrast der Vergrößerungsbedarf. 39 Ist der erforderliche Kontrast<br />
durch das Lesegut, z. B. bei Zeitungen, nicht gegeben, lassen sich am<br />
Bildschirmlesegerät durch die Einstellung verschiedener Farbmodi die<br />
Vorrausetzungen <strong>für</strong> den Sehbehinderten optimieren.<br />
Die richtige Einstellung des Kontrastes am BLG führt möglicherweise zu<br />
einem geringeren Vergrößerungsbedarf, sodass ein geringerer<br />
Abbildungsmaßstab nötig ist und ein besserer Überblick über das<br />
Arbeitsmaterial gewährleistet wird.<br />
Die <strong>für</strong> das Lesen erforderliche Größe des verwendeten<br />
Netzhautareals, also des Lesegesichtsfeldes, beträgt vom<br />
Fixationspunkt, also vom angeblickten Objektpunkt aus gesehen<br />
mindestens 2° jeweils nach links und rechts sowie 1 ° nach oben und<br />
unten. So kann bei einem Leseabstand von 25 cm eine<br />
Buchstabengruppe von bis zu 12 Buchstaben wahrgenommen<br />
werden. 40 Dies ist notwendig, denn<br />
38<br />
Vgl. Krug, F.- K.; Didaktik <strong>für</strong> den Unterricht mit <strong>sehbehinderte</strong>n Schülern; 2001, S.<br />
122.<br />
39<br />
Vgl. Sutter, M. Kontrast und Kontrastempfindlichkeit in der Low Vision<br />
Rehabilitation; in: Blickpunkt Focus 19/2006; S. 3.<br />
40<br />
Vgl. Trauzettel- Klosinski, S. et al.; Lesefähigkeit von Sehbehinderten; in: Zeitschrift<br />
<strong>für</strong> praktische Augenheilkunde und augenärztliche Fortbildung, 21/2000; S. 530.<br />
16
Kapitel 2: Grundlagen<br />
„Lesen ist weder Buchstabieren noch das ganzheitliche Erfassen eines<br />
Textes. Beim Lesen wird während einer Fixation stets eine ganze<br />
Buchstabengruppe wahrgenommen.“ 41<br />
Bei einem kleineren Lesegesichtsfeld ist zwar das Erkennen einzelner<br />
Buchstaben möglich, z. B. bei der Bestimmung der Sehschärfe mit<br />
einzelnen Sehzeichen, zum Lesen müssen aber mehrere Buchstaben<br />
und Buchstabengruppen gleichzeitig wahrgenommen werden.<br />
Deswegen weicht auch der tatsächliche Vergrößerungsbedarf<br />
möglicherweise von dem aufgrund des erreichten Optotypenvisus, also<br />
der an einzelnen Sehzeichen erreichten Sehschärfe, zu erwartenden<br />
Vergrößerungsbedarf ab. Dies ist aufgrund des folgenden<br />
Zusammenhangs möglich:<br />
Im Normalfall liegt der Fixationspunkt auf der Foveola, also der<br />
Netzhautstelle, an der der höchste Visus erreicht werden kann. Es ist<br />
möglich, dass dieser Bereich zwar <strong>für</strong> das Lesen von einzelnen<br />
Optotypen genutzt wird, jedoch nicht <strong>für</strong> das Lesen von Texten. Dies<br />
kommt zum Beispiel vor, wenn ein Ringskotom vorhanden ist, also ein<br />
ringförmig um die Foveola verlaufender Ausfall der Netzhautfunktionen.<br />
Der funktionierende, innerhalb des Ringes liegende Netzhautteil wir<br />
dann zwar <strong>für</strong> das Lesen einzelner Optotypen genutzt, ist <strong>für</strong> die<br />
Wahrnehmung ganzer Buchstabengruppen allerdings zu klein.<br />
Deshalb fixiert der Klient dann möglicherweise mit einer Netzhautstelle<br />
außerhalb des Skotoms, es liegt eine exzentrische Fixation vor. Der<br />
neue Fixationsort weist dann einen geringeren Visus auf. Dieser kann,<br />
aufgrund des reziproken Verhältnisses zwischen Visus und<br />
Vergrößerungsbedarf, beispielsweise durch einen höheren<br />
Abbildungsmaßstab am BLG kompensiert werden. 42 Der<br />
Vergrößerungsbedarf liegt dann höher, als aufgrund des<br />
Optotypenvisus zu erwarten gewesen wäre.<br />
Es muss beachtet werden, dass auch die Vergrößerung und der<br />
Gesichtsfeldausschnitt im reziproken Verhältnis zueinander stehen. Es<br />
41 Trauzettel- Klosinski, S. et al.; Lesefähigkeit von Sehbehinderten; in: Zeitschrift <strong>für</strong><br />
praktische Augenheilkunde und augenärztliche Fortbildung, 21/2000; S. 530.<br />
42 Trauzettel-Klosinski et al. 2000, Lesefähigkeit von Sehbehinderten; in: Zeitschrift <strong>für</strong><br />
praktische Augenheilkunde und augenärztliche Fortbildung, 21/2000; S. 530f.<br />
17
Kapitel 2: Grundlagen<br />
ist also möglich, dass infolge einer zu hohen Vergrößerung der<br />
Buchstaben auch das außerhalb des Skotoms liegende Netzhautareal<br />
nicht groß genug ist, als dass ganze Buchstabengruppen dort<br />
abgebildet werden könnten. Lesefähigkeit wird dann weder durch das<br />
kleine Netzhautareal mit hohem Visus, noch durch das größere<br />
Netzhautareal mit geringerem Visus ermöglicht. Auch Krug beschreibt<br />
den Zusammenhang zwischen ausreichender Vergrößerung und<br />
Einschränkung des Gesichtsfeldes als problematisch:<br />
„Bis zu einem gewissen Grad ist eine Vergrößerung der Buchstaben <strong>für</strong><br />
die Lesefähigkeit unproblematisch. Erst wenn die Vergrößerung einen<br />
kritischen Wert überschreitet, der Blickwinkel immer kleiner wird bzw.<br />
die Wortübersicht verloren geht, wird die Leseleistung herabgesetzt.<br />
Dies macht deutlich, dass der Visus eines Menschen nur indirekt<br />
dessen Leseleistung bestimmt, vielmehr sind die durch einen<br />
herabgesetzten Visus notwendigen Vergrößerungen und die damit<br />
verbundenen Gesichtsfeldeinschränkungen da<strong>für</strong> verantwortlich.“ 43<br />
Es kann also möglicherweise nur entweder eine ausreichende<br />
Vergrößerung eingestellt oder ein ausreichendes Lesegesichtsfeld<br />
erhalten werden, sodass trotzt Hilfsmittel kein fließendes Lesen möglich<br />
ist.<br />
Um dies zu vermeiden ist es von großer Wichtigkeit bei der Nutzung<br />
von Bildschirmlesegeräten darauf zu achten, dass die Vergrößerung<br />
zwar so hoch wie zum Erkennen der Buchstaben nötig, aber trotzdem<br />
so klein wie möglich eingestellt wird, um das Lesegesichtsfeld nicht<br />
unnötig einzuschränken.<br />
Legge beschreibt die optimale Textgröße zur Deckung des<br />
Vergrößerungsbedarfs als Critical Prinz Size (CPS):<br />
Dies ist die kleinste Textgröße, in der ein Text mit <strong>für</strong> den Leser<br />
höchstmöglicher Geschwindigkeit gelesen werden kann. 44 Diese Größe<br />
variiert von Mensch zu Mensch. Die CPS ist gewöhnlich mindestens<br />
doppelt so groß wie die Textgröße, in der einzelne Buchstaben gelesen<br />
43<br />
Vgl. Krug, F. – K., Didaktik <strong>für</strong> den Unterricht mit <strong>sehbehinderte</strong>n Schülern, 2001, S.<br />
219.<br />
44<br />
Legge, G. E., Psychophysics of Reading in Normal and Low Vision; 2007; S. 51f.<br />
18
Kapitel 2: Grundlagen<br />
werden können, bei Sehbehinderten ist dieser Unterschied oft noch<br />
größer. Aus diesem Grund ist es bei der Verwendung von<br />
vergrößernden Sehhilfen wichtig die CPS zu berücksichtigen und nicht<br />
von kleinstgelesenen Optotypen auszugehen, da sonst trotz Sehhilfe<br />
nur ein anstrengendes und langsames Lesen möglich ist.<br />
Entspricht der vergrößerte Text in seiner Größe der CPS, können auch<br />
Menschen mit Sehbehinderung hohe Lesegeschwindigkeiten erreichen.<br />
Dabei hängt die erreichbare Lesegeschwindigkeit nur begrenzt von der<br />
Sehschärfe des Klienten ab, es spielen andere Faktoren wie<br />
beispielsweise die Größe und Position des nutzbaren Netzhautareals<br />
eine bedeutende Rolle. 45<br />
2.3.2 Voraussetzungen und Einschränkungen des Lesens<br />
aufgrund der Verwendung eines<br />
Bildschirmlesegerätes<br />
Ungeübte Sehbehinderte, die zum Lesen ein Bildschirmlesegerät<br />
verwenden, lesen mit einer um 2/3 verringerten Geschwindigkeit im<br />
Vergleich zu Sehbehinderten, die nicht auf die Benutzung eines BLG´s<br />
angewiesen sind. Erfahrene Nutzer von BLG´s dagegen weisen eine<br />
nur um 1/3 verringerte Lesegeschwindigkeit auf. 46 Dies weist darauf hin,<br />
dass das Lesen mit einem BLG mit Problemen verbunden ist, die aber<br />
zumindest teilweise durch Übung behoben werden können.<br />
Ein ausschlaggebender Punkt hierbei ist die Verkleinerung des<br />
Bildausschnittes bei zunehmendem Vergrößerungsmaßstab. Bei sehr<br />
hoher Vergrößerung umfasst dieser nur noch wenige Wörter oder sogar<br />
nur einzelne Buchstaben. Hierdurch wird es möglicherweise schwierig,<br />
einen Überblick über einen gesamten Text zu behalten, außerdem ist<br />
ein Verrutschen zwischen den Zeilen beim Übergang vom Ende einer<br />
gelesenen Zeile zum Anfang der nächsten Zeile leicht möglich.<br />
45<br />
Vgl. Legge, G. E.; Psychophysics for Reading in Normal and Low Vision, 2007, S.<br />
52.<br />
46<br />
Vgl. Krug, F. – K., Didaktik <strong>für</strong> den Unterricht mit <strong>sehbehinderte</strong>n Schülern, 2001, S.<br />
219.<br />
19
Kapitel 2: Grundlagen<br />
Mit einem kleiner werdenden abgebildeten Ausschnitt des Bildes auf<br />
dem Monitor wird eine vermehrte Bewegung des Kreuztisches bzw. der<br />
Handkamera oder des Arbeitsmaterials nötig. Diese Bewegung wird<br />
allerdings mit zunehmendem Abbildungsmaßstab erschwert, da die<br />
Bewegungsgeschwindigkeit der Abbildung um den Faktor des<br />
Abbildungsmaßstabes größer ist als die tatsächliche<br />
Bewegungsgeschwindigkeit des Objektes. 47<br />
Im Sinne einer einfachen und sinnvollen Anwendung des BLG sollte in<br />
diesem Zusammenhang stets darauf geachtet werden, dass der<br />
Abbildungsmaßstab nicht größer als benötigt eingestellt wird.<br />
2.4 Das Bildschirmlesegerät<br />
2.4.1 Grundlagen, Bestandteile, Möglichkeiten, Funktionen<br />
Die Ansprüche, die die Nutzer an ihre Bildschirmlesegeräte stellen und<br />
die Tätigkeiten, denen sie mit Hilfe des Gerätes nachgehen wollen, sind<br />
sehr verschieden. Deswegen und aufgrund ständiger<br />
Neuentwicklungen auf dem Markt gibt es viele unterschiedliche Geräte.<br />
Die Grundausstattung eines Bildschirmlesegerätes umfasst jedoch im<br />
Allgemeinen die drei Bestandteile Kamera, Monitor und Kreuztisch.<br />
Das Arbeitsmaterial wird auf den Kreuztisch gelegt, von der Kamera<br />
aufgenommen und über den Monitor mit dem erforderlichen<br />
Abbildungsmaßstab wiedergegeben.<br />
Der Kreuztisch ist eine auf einer horizontalen und einer vertikalen<br />
Schiene angebrachte Platte, auf die das zu vergrößernde<br />
Arbeitsmaterial gelegt wird. Die Platte lässt sich waagerecht als auch<br />
senkrecht und diagonal bewegen und macht so ein Verfolgen von<br />
Zeilen bzw. ein Wechsel zwischen verschiedenen Stellen des<br />
Arbeitsblattes möglich. Der Kreuztisch lässt sich arretieren, so dass z.<br />
B. beim Schreiben keine ungewollten Kreuztischbewegungen<br />
entstehen. Oft ist auch ein Arretieren der vertikalen Schiene einzeln<br />
47 Schreck, K.; Holzapfel, S.; Abbildungseigenschaften und Gebrauchseigenschaften<br />
optisch und elektronisch vergrößernder Sehhilfen, in: 2. Interdisziplinärer Low Vision<br />
Congress; 2004, S. 15f.<br />
20
Kapitel 2: Grundlagen<br />
möglich so dass nur noch Bewegungen nach rechts und links gemacht<br />
werden können und ungewollte Bewegungen nach vorne und hinten<br />
vermieden werden. 48 Bei einigen Geräten wird das System aus<br />
Kreuztisch und Kamera ersetzt durch ein Handkamerasystem, dass<br />
beim Lesen direkt über den Text geführt wird und zum Schreiben über<br />
dem Schreibgut befestigt werden kann. Dies hat den Vorteil, dass<br />
größere Vorlagen wie z. B. Zeitungen problemlos abgefahren werden<br />
können, was mit dem Kreuztisch aus Platzgründen mühsam ist. 49<br />
Allerdings ergibt sich als Nachteil, dass es <strong>für</strong> Nutzer mit motorischen<br />
Einschränkungen schwierig ist die Kamera ruhig zu halten, das Bild<br />
verwackelt also möglicherweise schneller. 50 Ist weder ein Kreuztisch<br />
noch eine Handkamera vorhanden, muss stattdessen das<br />
Arbeitsmaterial selbst unter der Kamera bewegt werden. In diesem Fall<br />
wird die Durchführung einer gleichmäßigen und fließenden Bewegung<br />
zusätzlich erschwert, außerdem wird das Arbeitsmaterial dabei oft<br />
schräg angehoben, sodass während der Bewegung immer nur<br />
Ausschnitte und nie das gesamte Arbeitsblatt fokussiert werden<br />
können. 51<br />
Als Monitore werden sowohl Flachbildschirme als auch Röhrenmonitore<br />
angeboten. Der Vorteil der Flachbildschirme liegt in der Platzersparnis<br />
einerseits und in der Flimmerfreiheit der Bilder andererseits. Allerdings<br />
entsteht hier bei der Bewegung des Lesegutes unter der Kamera bei<br />
manchen Monitoren ein Nachzieheffekt, das bedeutet, dass das<br />
wiedergegebene Bild während der Bewegung verschwimmt. Bei neuen<br />
Geräten tritt dieser Effekt jedoch bereits deutlich verringert auf. Ein<br />
großer Vorteil von Flachbildmonitoren ist außerdem, dass diese auf<br />
einem Schwenkarm sehr nah vor den Augen des Nutzers positioniert<br />
48 D’Andrea F; Farrenkopf C.; Looking to Learn; 2000; S. 204.<br />
49 Vgl. Informationspool Computerhilfsmittel <strong>für</strong> Blinde und Sehbehinderte,<br />
Bildschirmlesegeräte, Stand: 31. 08. 2010 (Internet).<br />
50 D’Andrea, F; Farrenkopf, C.; Looking to Learn; 2000, S. 195.<br />
51 Beobachtungen während der Unterrichtshospitation an der Irisschule in Münster.<br />
21
Kapitel 2: Grundlagen<br />
werden können, dies ermöglicht dem Nutzer zusätzlich eine höhere<br />
Vergrößerung durch Annäherung. 52<br />
Die Abbildung des Arbeitsmaterials am Monitor erfolgt bei einfachen<br />
Geräten in schwarz-weiß, es gibt jedoch ebenfalls Geräte mit<br />
Farbwiedergabe, um beispielsweise Fotos, Landkarten oder aber auch<br />
Bilder in Schulbüchern betrachten zu können. Außerdem ermöglichen<br />
viele BLG´s die Einstellung von Fehlfarben wie z. B. gelb auf blau.<br />
Diese Einstellung dient genau wie die bei allen Geräten vorhandene<br />
Farbumkehr der Erhöhung des Kontrastes ohne Verstärkung der<br />
Blendung.<br />
BLG‘s arbeiten je nach Gerät mit einem möglichen Abbildungsmaßstab<br />
von bis zu 60fach, der sich bei den meisten Geräten stufenlos<br />
verstellen lässt.<br />
Einige Geräte ermöglichen eine Speicherung der Einstellungen von<br />
Abbildungsmaßstab, Farb- und Kontrasteinstellung <strong>für</strong> verschiedene<br />
Vorlagentypen, z. B <strong>für</strong> das Betrachten von Landkarten eine farbige<br />
Einstellung mit höhere Abbildungsmaßstab oder <strong>für</strong> das Lesen von Text<br />
die Abbildung im Negativkontrast im bevorzugten Abbildungsmaßstab.<br />
Diese Einstellungen müssen dann nicht jedesmal neu justiert werden.<br />
Um die Abbildung des Lesegutes scharf zu stellen, arbeiten viele<br />
Geräte mit Autofocus, das heißt die Kamera stellt sich automatisch so<br />
ein, dass die Vorlage scharf auf dem Bildschirm abgebildet wird. Dieser<br />
sollte aber auf manuellen Focus umzustellen sein, um z. B. beim<br />
Schreiben unter dem Gerät auf das Schreibgut anstatt auf die<br />
schreibende Hand fokussieren zu können.<br />
Zur einfacheren Orientierung auf dem Lesegut lässt sich oft eine<br />
horizontale Linie, das sogenannte Zeilenlineal, einblenden, um beim<br />
Lesen nicht zwischen den Zeilen zu verrutschen. Hierzu lässt sich auch<br />
die Zeilenabdeckung verwenden, eine Einstellung, in der immer nur<br />
eine Zeile lesbar und der Rest des Bildschirms schwarz ist. Die<br />
Zeilenabdeckung hat im Vergleich zum Zeilenlineal den Vorteil, dass sie<br />
52 Vlg. Schreck, K.; Holzapfel, S.; Abbildungseigenschaften und<br />
Gebrauchseigenschaften optisch und elektronisch vergrößernder Sehhilfen; in: 2.<br />
Interdisziplinärer LowVision-Congress; 2004; S. 23ff.<br />
22
Kapitel 2: Grundlagen<br />
den Bildschirm insgesamt abdunkelt und somit weniger Blendung<br />
auftritt. Allerdings leidet hierdurch die Orientierung auf dem Arbeitsblatt,<br />
da immer nur eine Zeile sichtbar ist. 53<br />
Um die direkte Blendung des Nutzers durch die Beleuchtung des<br />
Arbeitsblattes zu reduzieren, gibt es bei einigen Geräten die<br />
Möglichkeit, am Monitor eine Blende anzubringen, andere Geräte<br />
arbeiten mit Infrarotlicht um die Blendung gering zu halten.<br />
Sollen nicht nur nahe, sondern auch ferngelegene Objekte, z. B. die<br />
Tafel im Klassenraum, vergrößert werden, können hier<strong>für</strong> BLG´s mit<br />
Fernkamera genutzt werden. Es gibt hier<strong>für</strong> Geräte mit zwei Kameras,<br />
bei denen sich der Bildschirm in zwei Hälften aufteilen lässt. Dabei wird<br />
dann auf der einen Hälfte das über die Fernkamera aufgenommene<br />
Tafelbild abgebildet und auf der anderen Hälfte die über die Nahkamera<br />
aufgenommenen eigenen Aufzeichnungen. Verstärkt werden jedoch<br />
Geräte mit einer schwenkbaren Kamera <strong>für</strong> Ferne und Nähe eingesetzt,<br />
sodass auf dem Bildschirm jeweils nur Objekte in einer Entfernung<br />
dargestellt werden können. 54<br />
2.4.2 Der richtige Umgang mit dem BLG- vom schlechten<br />
zum guten Bild<br />
Der richtige Umgang mit dem BLG hängt zunächst von dem Gerät an<br />
sich ab: Die Funktionen sollten möglichst einfach und übersichtlich<br />
angeordnet sein, denn je mehr Knöpfe und Funktionen das Gerät bietet,<br />
desto schwieriger ist es, die richtige Einstellung zu finden. Die<br />
Bedienelemente am Gerät sollten <strong>für</strong> den Sehbehinderten z. B. durch<br />
farbige Kennzeichnung oder unterschiedliche Größe und Form gut<br />
erkennbar sein. 55 Welche Reihenfolge bei der Einstellung der<br />
Funktionen am BLG Sinn macht, mag von jedem Nutzer anders<br />
empfunden werden. Beobachtungen während der Hospitation in der<br />
53 Vgl. D’Andrea, F; Farrenkopf, C.; Looking to Learn; 2000; S. 205 f.<br />
54 Vgl: D’Andrea, F; Farrenkopf, C.; Looking to Learn; 2000; S. 198.<br />
55 Vgl. Informationspool Computerhilfsmittel <strong>für</strong> Blinde und Sehbehinderte,<br />
Bildschirmlesegeräte, Stand: 31. 08. 2010 (Internet).<br />
23
Kapitel 2: Grundlagen<br />
Irisschule in Münster lassen jedoch folgendes Vorgehen sinnvoll<br />
erscheinen:<br />
Schritt 1: Farbe I<br />
Zunächst sollte sich der Nutzer des BLG´s die Frage stellen, ob das,<br />
was er betrachten möchte, farbig ist.<br />
Ist dies der Fall, sollte der Echtfarbmodus eingestellt sein, ist dies nicht<br />
der Fall, sollte auf schwarz/weiß oder den <strong>für</strong> den Benutzer am<br />
angenehmsten erscheinenden Negativkontrast umgestellt werden, um<br />
möglichst gute Kontraste zwischen Text und Hintergrund zu erzielen<br />
und so den Vergrößerungsbedarf gering zu halten.<br />
Ist im Vorhinein nicht bekannt, ob das Bild oder der Text farbige Anteile<br />
hat, sollte zunächst der Echtfarbmodus eingeschaltet bleiben, da<br />
Farben sonst später übersehen werden.<br />
Wird von Lehrern Arbeitsmaterial an Schüler verteilt, ist ein Hinweis, ob<br />
die Einstellung des Echtfarbmodus nötig ist, an dieser Stelle hilfreich.<br />
Schritt 2: Abbildungsmaßstab I<br />
Zu Beginn sollte ein kleiner Abbildungsmaßstab eingestellt werden,<br />
sodass ein guter Überblick über das gesamte Bild bzw. den gesamten<br />
Text möglich ist, dies dient der ersten Orientierung.<br />
Schritt 3: Helligkeit<br />
Im Überblick ist nun auch erkennbar, ob das gesamte Bild eher dunkel<br />
oder aber überbelichtet erscheint. Dies kann zum Beispiel von der<br />
verwendeten Papierart abhängen: Bei einer Vorlage aus<br />
Recyclingpapier wirkt das gesamte Bild dunkler, und eine Einstellung<br />
mit mehr Helligkeit ist sinnvoll. Einige Bücher dagegen sind auf<br />
weißem, leicht glänzenden Papier gedruckt, das stark reflektiert und<br />
somit überbelichtet wirkt, wenn die Helligkeit am BLG nicht<br />
herabgesetzt wird.<br />
24
Kapitel 2: Grundlagen<br />
Schritt 4: Kontrast<br />
Auch der Kontrast muss passend eingestellt werden: Ist der Kontrast zu<br />
hoch eingestellt, wirkt das Bild überbelichtet, Konturen sind schlecht<br />
erkennbar. Bei zu geringem Kontrast dagegen werden Konturen nicht<br />
sichtbar, da sie sich nicht vom Hintergrund abheben. Hier muss der<br />
Nutzer des BLG´s durch probieren herausfinden, welche Einstellung <strong>für</strong><br />
das vorliegende Arbeitsmaterial sinnvoll ist.<br />
Schritt 5: Farbe II<br />
War unter Punkt „Farbe I“ noch nicht klar, ob es sich überhaupt um eine<br />
farbige Abbildung handelt, sollte dies spätestens jetzt erkennbar sein.<br />
Durch den geringen Abbildungsmaßstab ist ein guter Überblick<br />
gewährleistet, es würden also auch farbige Bereiche am Rande des<br />
Arbeitsmaterials sichtbar, die richtige Einstellung der Helligkeit<br />
verhindert, dass die Färbung durch Über- oder Unterbelichtung nicht<br />
erkannt wird.<br />
Wird jetzt sichtbar, dass es sich um eine farbige Abbildung handelt,<br />
sollte der Echtfarbmodus beibehalten werden. Ansonsten kann in den<br />
Schwarzweißmodus oder den vom Benutzer am angenehmsten<br />
empfundenen Fehlfarbenmodus, gegebenenfalls im Negativkontrast,<br />
umgeschaltet werden.<br />
Schritt 6: Abbildungsmaßstab II<br />
Farbe, Helligkeit und Kontrast sind jetzt passend eingestellt. Dies<br />
garantiert, dass der Abbildungsmaßstab nur so hoch gewählt wird, wie<br />
es auch nötig ist. Bei einer anderen Vorgehensweise bestünde die<br />
Gefahr, dass zum Beispiel ein Text aufgrund von schlecht eingestellter<br />
Farbe und Helligkeit in einem sehr schlechten Kontrast abgebildet wird<br />
und so eine viel höhere Vergrößerung benötigt werden würde. Dies<br />
hätte einen verkleinerten Bildausschnitt und die unter 2.3.2<br />
beschriebenen damit zusammenhängenden Schwierigkeiten zur Folge.<br />
Zur richtigen Einstellung des Abbildungsmaßstabes soll an dieser Stelle<br />
der zu betrachtende Ausschnitt, z. B. der Zeilenanfang eines Textes<br />
oder eine Abbildung, mithilfe des Kreuztisches so verschoben werden,<br />
25
Kapitel 2: Grundlagen<br />
dass er mittig auf dem Monitor abgebildet wird. Dann kann der<br />
Vergrößerungsmaßstab soweit erhöht werden, bis die gewünschten<br />
Details gut erkennbar sind.<br />
Die vorgenommenen Einstellungen können natürlich im Nachhinein<br />
wieder geändert werden falls sie nicht als angenehm empfunden<br />
werden oder sich andere Anforderungen ergeben.<br />
26
Kapitel 3: Herausforderungen im Umgang mit dem Bildschirmlesegerät<br />
und deren Schulung<br />
3 Herausforderungen im Umgang mit dem<br />
Bildschirmlesegerät und deren Schulung<br />
3.1 Allgemeines<br />
Der Übungsschwerpunkt und der Schwierigkeitsgrad der Übungen am<br />
BLG sollen <strong>für</strong> jeden Schüler individuell gestaltet werden, je nachdem<br />
wie weit seine bisherigen Fähigkeiten entwickelt sind. Hier<strong>für</strong> werden<br />
verschiedene Trainingsbausteine erstellt, die dann <strong>für</strong> jeden Schüler je<br />
nach Bedarf zu einer Schulung zusammengesetzt werden.<br />
Dabei muss die allgemeine schulische Entwicklung des Kindes<br />
berücksichtigt werden: Je nach Lese- und Schreibfähigkeit können <strong>für</strong><br />
das Training entweder ganze Texte, einzelne Wörter und Buchstaben<br />
oder aber Bilder und Symbole verwendet werden.<br />
Werden <strong>für</strong> die Schulungsaufgaben Texte verwendet, sollen diese<br />
einfach und gut überschaubar sein. Es können auch Materialien<br />
verwendet werden, die dem Schüler bereits aus dem Schulunterricht<br />
vertraut sind. So kann sich der Schüler auf die Übungen mit dem BLG<br />
und dessen Funktionen konzentrieren und muss sich nicht erst mit dem<br />
Arbeitsmaterial an sich vertraut machen. 56<br />
Zu den verschiedenen Funktionen des Bildschirmlesegerätes werden<br />
jeweils Übungen in drei Schwierigkeitsstufen erstellt: Einführung [E],<br />
Grundkenntnisse [G], und Fortgeschritten [F]. Die Schulung richtet sich<br />
an <strong>Kinder</strong>, die sich ungefähr im Einschulungsalter befinden. Manche<br />
<strong>Kinder</strong> haben vielleicht das erste Mal bereits im Vorschulalter Kontakt<br />
mit einem BLG, andere beginnen vielleicht erst ein oder zwei Jahre<br />
nach Schuleintritt mit der Arbeit am BLG, weil zuvor keine<br />
Notwendigkeit hier<strong>für</strong> vorhanden oder bekannt war. Deswegen ist der<br />
Großteil der Übungen sowohl in einer Ausführung mit Schrift oder<br />
Zahlen, als auch in einer Ausführung <strong>für</strong> Vorschulkinder mit Symbolen<br />
statt Buchstaben vorhanden.<br />
Einige der Übungen sind nur von farbtüchtigen Schülern lösbar.<br />
Deswegen ist es wichtig, vor der Erstellung einer Schulung mit dem<br />
56 Vgl. D’Andrea, F. M.; Farrenkopf, C.; Looking to Learn; 2000; S. 206.<br />
27
Kapitel 3: Herausforderungen im Umgang mit dem Bildschirmlesegerät<br />
und deren Schulung<br />
jeweiligen Schüler einen Farbtest durchzuführen und wenn nötig die<br />
Übungen mit Farbanteilen durch andere zu ersetzten.<br />
Da auf dem Markt viele verschiedene Geräte mit den<br />
unterschiedlichsten Funktionen angeboten werden, lässt der Umfang<br />
dieser Arbeit es nicht zu, auf alle möglichen Funktionen näher<br />
einzugehen. Stattdessen werden nur die gebräuchlichsten Funktionen<br />
näher betrachtet.<br />
Anmerkung: Vorlagen <strong>für</strong> alle hier erklärten Aufgaben und Übungen<br />
finden sich in Originalgröße im Anhang. Die im Text verwendeten<br />
Abbildungen sind meist stark verkleinert und hier nur zum Verständnis<br />
eingefügt.<br />
3.2 Richtige Platzierung/ Aufstellung des Gerätes<br />
Um Beschwerden wie schnelles Ermüden, Rückenschmerzen oder<br />
Verspannungen zu vermeiden, sollte bei der Aufstellung des BLG´s auf<br />
ergonomische Anforderungen geachtet werden. 57<br />
Das Kind sollte eine möglichst bequeme und entspannte Haltung vor<br />
dem BLG einnehmen können.<br />
Die Höhe von Tisch und Monitor sollte so eingestellt sein, dass der<br />
Nutzer auf das obere Drittel des Bildschirms schaut, unter dem Tisch<br />
sollte hierbei auf genügend Beinfreiheit geachtet werden. Die richtige<br />
Höhe <strong>für</strong> den Lesetisch befindet sich auf Höhe der Ellenbogen, so dass<br />
dieser bequem erreichbar ist.<br />
Oft bilden Kreuztisch, Kamera und Bildschirmlesegerät ein<br />
geschlossenes System, das heißt die einzelnen Komponenten lassen<br />
sich nicht gegeneinander verschieben. Es gibt jedoch ebenfalls<br />
Systeme, bei denen sich der Bildschirm unabhängig von Kreuztisch und<br />
Kamera positionieren lässt. In den meisten Fällen ist es trotzdem<br />
sinnvoll den Kreuztisch direkt vor dem Bildschirm zu platzieren, da<br />
sonst eine ständige, auf Dauer unbequeme Körperdrehung erforderlich<br />
ist, um gleichzeitig auf den Bildschirm zu schauen und den Kreuztisch<br />
zu bedienen. 58 Bei sehr kleinen Schülern kann es sinnvoll sein, den<br />
57 Vgl. D’Andrea, F. M.; Farrenkopf, C.; Looking to Learn; 2000; S. 202.<br />
58 Merk, S., Bildschirmlesegeräte, Stand 2004 (Internet).<br />
28
Kapitel 3: Herausforderungen im Umgang mit dem Bildschirmlesegerät<br />
und deren Schulung<br />
Monitor neben den Kreuztisch zu stellen, da die Position des<br />
Bildschirms über Kreuztisch und Kamera möglicherweise so hoch wäre,<br />
dass der Schüler kaum oder nur in einer sehr unbequemen Haltung auf<br />
den Monitor schauen kann und dabei die Abbildung auch nicht gut<br />
erkennt. 59<br />
Bestenfalls sollte die Höhe des Monitors so eingestellt werden, dass die<br />
oberste Zeile des Bildschirms nicht höher liegt als die Augen des<br />
Nutzers. 60<br />
Da dies speziell bei <strong>Kinder</strong>n schwer zu erreichen ist, sollte durch<br />
Ausprobieren getestet werden, welche Positionierung von Kreuztisch,<br />
Kamera und Monitor <strong>für</strong> den Schüler die Angenehmste ist. Dabei ist es<br />
wichtig sowohl die Meinung des Schülers selbst als auch die<br />
Beobachtungen von Lehrern und Eltern zu berücksichtigen.<br />
Eine zu hohe Positionierung des Monitors lässt sich oft entweder durch<br />
eine gute Platzierung des Lesegutes ausgleichen, so dass die zu<br />
lesende Zeile stets im Unteren Drittel des Bildschirms erscheint, oder<br />
aber bei einigen Geräten durch eine Neigung des Monitors, sodass<br />
dieser aus der Position des Schülers besser zu erkennen ist. 61<br />
Um einen sicheren Sitz zu gewährleisten sollte der Schüler mit den<br />
Füßen bequem auf den Boden kommen. Um diese Anforderungen<br />
erfüllen zu können, sollten sowohl der Tisch als auch der Stuhl<br />
höhenverstellbar sein.<br />
Des Weiteren wird eine Positionierung des BLG’s seitlich zum Fenster<br />
angestrebt. Steht das BLG so im Raum, dass der Schüler mit dem<br />
Rücken zum Fenster sitzt, wird das einfallende Licht auf dem Bildschirm<br />
reflektiert und macht so den abgebildeten Text schwer lesbar. Sitzt der<br />
Schüler frontal zum Fenster, kann er direkt geblendet werden. Ein Platz<br />
nahe am Fenster ist trotzdem vorteilhaft, da so das natürliche Licht als<br />
Beleuchtung genutzt werden kann, idealerweise sollte dieses durch<br />
59 Vgl. D’Andrea, F. M., Farrenkopf, C., Looking to learn, 2000, S. 202.<br />
60 Vgl. Rabe, G., Einsatz des Bildschirmlesegerätes in Schulen <strong>für</strong> Schülerinnen und<br />
Schüler mit Sehbehinderung, 2004, S. 38.<br />
61 Vgl. Rabe, G., Einsatz des Bildschirmlesegerätes in Schulen <strong>für</strong> Schülerinnen und<br />
Schüler mit Sehbehinderung, 2004, S. 40.<br />
29
Kapitel 3: Herausforderungen im Umgang mit dem Bildschirmlesegerät<br />
und deren Schulung<br />
Vorhänge regulierbar sein. 62 Außerdem ist es sinnvoll, das BLG so<br />
aufzustellen, dass der Schüler weiterhin problemlos mit Lehrern und<br />
Mitschülern kommunizieren kann.<br />
Der Tisch des Bildschirmlesegerätes sollte so groß sein, dass der<br />
Schüler dort auch weitere Unterlagen wie Bücher und Stifte<br />
aufbewahren kann. 63 Um <strong>für</strong> den Schüler ein angenehmes und<br />
unkompliziertes Arbeiten mit verschiedenen Unterlagen zu ermöglichen,<br />
kann alternativ neben das Bildschirmlesegerät und den Kreuztisch ein<br />
weiterer Tisch in bequem erreichbarer Entfernung aufgestellt werden,<br />
um hier Bücher und Schreibmaterialien abzulegen oder Arbeiten<br />
auszuführen, <strong>für</strong> die das BLG nicht benötigt wird. 64<br />
Die richtige Aufstellung des Bildschirmlesegerätes wird in den<br />
Schulungseinheiten nicht mit dem Kind geübt. Allerdings wird nach dem<br />
Eingangstest die Platzierung des Gerätes so gut wie möglich optimiert,<br />
dies wird dann während der Schulungen im Rahmen dieser Arbeit auch<br />
während des Ausgangstestes beibehalten. Dies hat möglicherweise<br />
Einfluss auf die Ergebnisse des Ausgangstests. Natürlich soll der<br />
Schüler selber wissen, wie sein BLG bestenfalls zu platzieren ist.<br />
Zusätzlich werden <strong>für</strong> die Eltern und Lehrer Notizen gemacht, sodass<br />
die richtige Platzierung, sollte während der Benutzung etwas<br />
verschoben worden sein, immer wieder hergestellt werden kann. Diese<br />
Vorgehensweise ist auch <strong>für</strong> von dieser Arbeit unabhängige<br />
Schulungen sinnvoll.<br />
3.3 Richtige Platzierung des Lesegutes, Bewegung des<br />
Kreuztisches und Linieneinblendung<br />
3.3.1 Zu beachtende Faktoren<br />
Der richtige Umgang mit dem Kreuztisch ist <strong>für</strong> Schüler besonders<br />
wichtig beim Lesen von Texten, da durch die entsprechenden<br />
62 Vgl. Rabe, G., Einsatz des Bildschirmlesegerätes in Schulen, 2004, S. 41, zitiert<br />
nach Huber-Spitzy, V., Bildschirmarbeit und Augen.<br />
63 Vgl. D‘Andrea, F.M., Farrenkopf, C., Looking to Learn, 2000, S. 202.<br />
64 Vgl. Rabe, G., Einsatz des Bildschirmlesegerätes in Schulen <strong>für</strong> Schülerinnen und<br />
Schüler mit Sehbehinderung, 2004, S. 40.<br />
30
Kapitel 3: Herausforderungen im Umgang mit dem Bildschirmlesegerät<br />
und deren Schulung<br />
Bewegungen ein schneller Übergang zwischen dem letzten Wort der<br />
aktuellen Zeile des zu lesenden Textes und dem ersten Wort der<br />
nächsten Zeile möglich ist. Nur wenn ein problemloser Zeilensprung<br />
beherrscht wird, kann fließend und mit gutem Textverständnis gelesen<br />
werden. Wird diese Fähigkeit nicht besessen, ist es schwierig, die<br />
richtige Zeile eines Textes zu finden, <strong>für</strong> das Lesen wird insgesamt<br />
mehr Zeit benötigt und das Textverständnis leidet möglicherweise<br />
darunter, dass der Schüler zunächst in falsche Zeilen abrutscht und<br />
dieses nicht direkt bemerkt. 65<br />
Allerdings ist das Erlernen des Umgangs mit dem Kreuztisch aus den<br />
bereits in 2.4.1 erwähnten Umständen sehr mühsam und sollte<br />
zunächst an Aufgaben geübt werden, die nur eine Kreuztischbewegung<br />
in eine Richtung erfordern, zum Beispiel das Verfolgen gerader Linien<br />
auf einem Arbeitsblatt, <strong>für</strong> die Bewegung nach oben und unten muss<br />
dann das Arbeitsmaterial verschoben werden.<br />
Werden diese Übungen gut beherrscht, kann als nächstes die<br />
kombinierte Bewegung des Kreuztisches in beide Richtungen geübt<br />
werden. Dies kann zunächst durch spielerische Aufgaben wie das<br />
Verfolgen einer geschlängelten Linie von Bild zu Bild, erfolgen. 66 Dabei<br />
kann die Geschwindigkeit der Bewegung durch teilweises Arretieren<br />
des Kreuztisches reguliert werden, um dem Schüler die Aufgaben zu<br />
vereinfachen. 67<br />
Wichtiger ist allerdings, den Übergang von Zeile zu Zeile an Texten zu<br />
üben, da diese Fähigkeit beim Lesen oft benötigt wird. Dies ist jedoch<br />
wesentlich schwieriger, da jeder Zeilenanfang ähnlich aussieht.<br />
Für den Übergang von Zeile zu Zeile gibt es zwei verschiedene<br />
Techniken:<br />
Entweder wird die gerade gelesene Zeile zu ihrem Anfang<br />
zurückverfolgt um dann in die darunterliegende Zeile zu wechseln<br />
(Variante A), sodass der Kreuztisch nur horizontal und vertikal bewegt<br />
wird, oder es wird in einer schrägen Bewegung direkt der Anfang der<br />
65 D’Andrea, F. M.; Farrenkopf, C.; Looking to learn; 2000; S. 205.<br />
66 D’Andrea, F. M.; Farrenkopf, C.; Looking to learn; 2000; S. 204.<br />
67 D’Andrea, F. M.; Farrenkopf, C.; Looking to learn; 2000; Appendix 7.A.<br />
31
Kapitel 3: Herausforderungen im Umgang mit dem Bildschirmlesegerät<br />
und deren Schulung<br />
nächsten Zeile gesucht (Variante B). Diese zwei Techniken werden in<br />
den folgenden Abbildungen dargestellt:<br />
Abbildung 4 : Zeilensprung, Variante A 68<br />
Abbildung 5 : Zeilensprung, Variante B 69<br />
Um dem Schüler das Auffinden der richtigen Zeile zu erleichtern, gibt es<br />
verschiedene Möglichkeiten: Ein Mittel ist, die einzelnen Zeilen<br />
durchzunummerieren sodass am Ende der aktuellen Zeile die gleiche<br />
Nummer steht wie am Anfang der nächsten Zeile. Sind dem Schüler<br />
noch nicht alle Zahlen bekannt, können stattdessen Symbole genutzt<br />
werden. So kann sich der Schüler sicher sein, welche Zeile er als<br />
nächstes betrachten muss.<br />
Eine andere Möglichkeit, die jedoch nur bei Variante B einsetzbar ist, ist<br />
es, eine gepunktete Linie vom Ende der aktuellen Zeile bis zum Anfang<br />
der nächsten Zeile zu ziehen. Dieser Linie muss der Schüler dann mit<br />
68 Eigene Darstellung.<br />
69 Eigene Darstellung.<br />
32
Kapitel 3: Herausforderungen im Umgang mit dem Bildschirmlesegerät<br />
und deren Schulung<br />
dem Bildschirmlesegerät folgen, so kommt er automatisch an den<br />
Anfang der richtigen Zeile. 70<br />
Der Schüler kann außerdem die Zeilen, die er bereits gelesen hat,<br />
selbst mit einem Stift markieren.<br />
Diese Hilfestellungen können, wenn der Schüler die Bewegungen<br />
ausreichend beherrscht, zurückgestellt werden.<br />
Hilfsmittel, die ebenfalls ein Verrutschen in die falsche Zeile beim Lesen<br />
verhindern, ohne dabei das Arbeitsmaterial bekleben oder bemalen zu<br />
müssen sind die Verwendung des Zeilenlineals oder der<br />
Zeilenabdeckung am Bildschirmlesegerät. Hierdurch wird die aktuelle<br />
Zeile wie bereits in 2.4.1 beschrieben markiert.<br />
Die Funktionen Zeilenabdeckung und Linieneinblendung sind nur<br />
effektiv, wenn das Lesegut auf dem Kreuztisch richtig platziert ist. Die<br />
eingeblendete Linie erscheint auf dem Bildschirm immer horizontal, und<br />
das Schriftstück muss so ausgerichtet sein, dass die Abbildung der<br />
Zeilen auf dem Bildschirm parallel zu der eingeblendeten Linie verläuft.<br />
Dies lässt sich am einfachsten erreichen, in dem man das Schriftstück<br />
bündig an die hintere Kante des Kreuztisches legt, bei manchen<br />
Geräten gibt es hier eine Kante, so dass das Lesegut in dieser Position<br />
bleibt ohne zu verrutschen, außerdem hilft oft eine fühlbare Markierung<br />
dabei, das Arbeitsmaterial auch mittig zu positionieren. Die gerade<br />
Positionierung des Leseguts ist auch dann zu beachten, wenn weder<br />
Zeilenlineal noch Zeilenabdeckung verwendet werden, da die<br />
Orientierung auf dem Arbeitsblatt und der Zeilensprung leichter fallen,<br />
wenn das Arbeitsmaterial gerade ausgerichtet ist. 71<br />
Durch die richtige Positionierung des Arbeitsmaterials kann in manchen<br />
Fällen auch eine unvorteilhafte Aufstellung des Monitors ausgeglichen<br />
werden: Ist dieser nicht optimal auf die Größe des Schülers eingestellt,<br />
und der Bildschirm steht wie in 4.1.2 beschrieben zu hoch, kann dies<br />
durch eine günstige Platzierung des Lesegutes kompensiert werden. In<br />
diesem Fall sollte dem Schüler gezeigt werden das Lesegut so zu<br />
70 D’Andrea, F. M.; Farrenkopf, C.; Looking to learn; 2000; S. 205.<br />
71 D’Andrea, F; Farrenkopf,C.; Looking to learn;2000; S. 205f.<br />
33
Kapitel 3: Herausforderungen im Umgang mit dem Bildschirmlesegerät<br />
und deren Schulung<br />
platzieren, dass die zu lesende Zeile auf dem Monitor ganz unten, und<br />
somit auf Augenhöhe des Kindes, erscheint. 72<br />
Ist kein Kreuztisch vorhanden, wird stattdessen das Lesegut oder aber<br />
die Handkamera bewegt. Die Anforderungen <strong>für</strong> das Lesen und den<br />
Zeilensprung bleiben jedoch die Gleichen.<br />
3.3.2 Übungen<br />
Als Einstiegsübung <strong>für</strong> die Bewegung des Kreuztisches kann man<br />
waagerechte oder senkrechte Reihen mit Bildern oder Buchstaben<br />
verfolgen lassen, so dass die Bewegung des Tisches an sich und<br />
außerdem die Einschätzung der Bewegungsgeschwindigkeit geübt<br />
wird. Zunächst sollen wie in 3.3.1 beschrieben nur waagerechte Linien<br />
verfolgt werden:<br />
Abbildung 6 : Bewegung Kreuztisch [E] 73<br />
Es ist wichtig darauf zu achten, dass die Übung <strong>für</strong> den Schüler eine<br />
interessante Aufgabe ist und nicht zu einem gelangweilten Hin- und<br />
Herschieben des Kreuztisches wird. Sind die Aufgaben zu einfach,<br />
72 Vgl. Rabe, G., Einsatz des Bildschirmlesegerätes in Schulen <strong>für</strong> Schülerinnen und<br />
Schüler mit Sehbehinderung, 2004, S. 38.<br />
73 Eigene Darstellung.<br />
34
Kapitel 3: Herausforderungen im Umgang mit dem Bildschirmlesegerät<br />
und deren Schulung<br />
können sie mit Übungen zu verschiedenen Abbildungsmaßstäben<br />
kombiniert werden.<br />
Die folgende Übung ist etwas anspruchsvoller, da sie Bewegung der<br />
Kreuztisches in beide Richtungen erfordert:<br />
Abbildung 7 : Bewegung von Kreuztisch bzw. Arbeitsblatt [G] 74<br />
Um die Übungen interessanter zu gestalten, können sie außerdem mit<br />
Rätselaufgaben verbunden werden.<br />
Abbildung 8 zeigt eine Übung <strong>für</strong> Fortgeschrittene <strong>für</strong> das Lernfeld<br />
Kreuztischbewegung. Der Proband soll hier aus dem vorhandenen<br />
Buchstabengitter die Buchstabenkombination „ABC“ heraussuchen und<br />
kennzeichnen.<br />
7474 Eigene Darstellung.<br />
35
Kapitel 3: Herausforderungen im Umgang mit dem Bildschirmlesegerät<br />
und deren Schulung<br />
Abbildung 8: Bewegung von Kreuztisch bzw. Arbeitsblatt [F] 75<br />
Der Schüler soll das Gitter Zeile <strong>für</strong> Zeile nach der richtigen<br />
Kombination absuchen. Diese Übung ist <strong>für</strong> das Finden der richtigen<br />
Zeile recht schwierig, da zusammenhangslose Buchstaben aufgereiht<br />
sind. Im Gegensatz zu einem fließenden Text kann hier nicht durch<br />
Textverständnis herausgefunden werden, ob man sich in der richtigen<br />
Zeile befindet. Sollte sich die Aufgabe als zu schwierig erweisen,<br />
können die Zeilenenden und –Anfänge als Hilfestellung durch Symbole<br />
oder farbige Klebepunkte gekennzeichnet werden. Die Übung festigt<br />
außerdem die Fertigkeiten im Bereich „Orientierung auf dem<br />
Arbeitsblatt“, da der Zeilensprung dem im Kapitel 3.5.1 beschriebenem<br />
Absuchen verschiedener Zeilen beim Scanning ähnelt.<br />
Außerdem kann hier durch Linieneinblendung oder Zeilenabdeckung<br />
auch die momentan betrachtete Zeile gekennzeichnet werden, um nicht<br />
zu verrutschen.<br />
Durch das Kennzeichnen der gefundenen Buchstabenkombinationen<br />
wird zusätzlich die Hand-Auge-Koordination geübt. Da nur einzelne<br />
Buchstabenkombinationen gefunden werden müssen, kann diese<br />
Aufgabe auch gut <strong>für</strong> Schüler verwendet werden, die noch nicht alle<br />
Buchstaben beherrschen.<br />
75 Eigene Darstellung.<br />
36
Kapitel 3: Herausforderungen im Umgang mit dem Bildschirmlesegerät<br />
und deren Schulung<br />
Sollte der Schüler noch gar nicht lesen können, kann die gleiche<br />
Aufgabe auch wie in Abbildung 8 demonstriert mit Bildern durchgeführt<br />
werden:<br />
Abbildung 9 : Bewegung von Kreuztisch bzw. Arbeitsblatt [F] – ohne<br />
Buchstaben 76<br />
Der Rätselcharakter der Übung soll die Motivation des Schülers<br />
steigern.<br />
Folgende Übung ist <strong>für</strong> die Bewegung des Kreuztisches noch<br />
anspruchsvoller, da immer wieder zum oberen Bereich des<br />
Arbeitsblattes gewechselt werden muss, um die Bilder zu betrachten.<br />
Außerdem ist hier das Lesen eines zusammenhängenden Textes<br />
erforderlich.<br />
76 Eigene Darstellung.<br />
37
Kapitel 3: Herausforderungen im Umgang mit dem Bildschirmlesegerät<br />
und deren Schulung<br />
Abbildung 10: Bewegung von Kreuztisch oder Arbeitsblatt [F] - 2 77<br />
Als Hilfestellung sind die einzelnen Worte zunächst miteinander<br />
verbunden, später fällt diese Hilfestellung weg, kann aber durch<br />
Linieneinblendung oder Zeilenabdeckung ersetzt werden.<br />
3.4 Einstellung des Abbildungsmaßstabes<br />
3.4.1 Zu beachtende Einflussfaktoren<br />
Die passende Einstellung des Abbildungsmaßstabes ist besonders<br />
wichtig <strong>für</strong> eine gute Handhabung des Bildschirmlesegerätes. Dabei gilt,<br />
dass die Vergrößerung immer so klein wie möglich, aber so groß wie<br />
nötig eingestellt werden sollte. Wird eine zu kleine Vergrößerung<br />
gewählt, ist der Vergrößerungsbedarf des Schülers nicht gedeckt und<br />
das Bildschirmlesegerät erfüllt keinen Zweck, selbst wenn alle anderen<br />
Einstellungen wie Kontrast und Farbe optimal ausgewählt wurden.<br />
Durch die Vergrößerung durch Annäherung kann allerdings erreicht<br />
werden, dass ein geringerer Abbildungsmaßstab nötig wird. Dies kann<br />
sinnvoll sein, um den Abbildungsmaßstab gering und somit den<br />
77 Verändert nach: Wachendorf, P.; Debbrecht, J.; Lies mal! Das Heft mit der Ente,<br />
2010, S. 24.<br />
38
Kapitel 3: Herausforderungen im Umgang mit dem Bildschirmlesegerät<br />
und deren Schulung<br />
Bildausschnitt groß zu halten. Allerdings sollte auch beachtet werden,<br />
dass es möglicherweise auf Dauer unbequem und ergonomisch<br />
gesehen unvorteilhaft ist, so nah am Bildschirm zu sitzen. Zusätzlich<br />
können aufgrund der geringen Entfernung zum Bildschirm<br />
Anstrengungsbeschwerden infolge der ständigen Akkommodation<br />
auftreten. Weiterhin erhöht der kleine Abstand zum Monitor auftretende<br />
Blendungseffekte. Dies sollte ausgetestet werden, gegebenenfalls<br />
muss die Vergrößerung durch Annäherung verringert und der<br />
Abbildungsmaßstab erhöht werden.<br />
Eine zu hoher Abbildungsmaßstab bringt allerdings auch Nachteile mit<br />
sich: Je höher dieser eingestellt wird, desto kleiner wird der Ausschnitt<br />
des Objektes, der auf dem Bildschirm dargestellt werden kann.<br />
Hierdurch wird ein vermehrter Einsatz des Kreuztisches notwendig, um<br />
z. B. einen Text von links nach rechts und Zeile <strong>für</strong> Zeile abzufahren. 78<br />
Zusätzlich wird der Umgang mit dem Kreuztisch erschwert, da sich die<br />
Abbildungsgeschwindigkeit auf dem Bildschirm um den Faktor des<br />
Abbildungsmaßstabs erhöht. 79 Diese Zusammenhänge sollten dem<br />
Schüler erklärt werden, bevor unter Berücksichtigung dieser Einflüsse<br />
die Einstellung des Abbildungsmaßstabes geübt wird.<br />
Der notwendige Abbildungsmaßstab ist nicht bei allen mit dem BLG<br />
ausgeführten Tätigkeiten gleich. Er variiert je nach Schriftgröße des<br />
Leseguts einerseits, aber auch je nach dem was der Schüler genau<br />
sehen will. Ein kleinerer Vergrößerungsmaßstab ist aufgrund des<br />
größeren Bildausschnittes dann sinnvoll, wenn ein Überblick über das<br />
Material geschafft werden soll, z. B. um zu sehen, ob sich auf einer<br />
Buchseite ein Bild befindet oder nicht. Ein höherer Abbildungsmaßstab<br />
sollte eingestellt werden um Details zu betrachten oder einen klein<br />
gedruckten Text zu lesen.<br />
78 D’Andrea, F. M.; Farrenkopf, C.; Looking to learn, 2000; S. 203.<br />
79 Schreck, K.; Holzapfel, S.; Abbildungseigenschaften und Gebrauchseigenschaften<br />
optisch und elektronisch vergrößernder Sehhilfen, in: 2. Interdisziplinärer Low Vision<br />
Congress; 2004, S. 15f.<br />
39
Kapitel 3: Herausforderungen im Umgang mit dem Bildschirmlesegerät<br />
und deren Schulung<br />
3.4.2 Übungen<br />
Um die Einstellung des richtigen Abbildungsmaßstabes zu üben, ist es<br />
wichtig, dass der Schüler zunächst die Sinnhaftigkeit und den Nutzen<br />
dieser Einstellung versteht. Dabei kann die folgende Übung helfen:<br />
Abbildung 11 : Einstellung des Abbildungsmaßstabs [E] 80<br />
Durch den Wechsel von sehr großer zu sehr kleiner Schrift wird<br />
deutlich, dass der <strong>für</strong> die kleine Schrift verwendete Abbildungsmaßstab<br />
<strong>für</strong> das Lesen der groß geschriebenen Sätze unnötig hoch ist. Der<br />
Schüler soll hier auf die Nachteile wie den kleinen Bildausschnitt und<br />
die daraus folgende Notwendigkeit, das Lesegut mehr zu bewegen,<br />
aufmerksam gemacht werden. Dem Schüler wird dann gezeigt, dass<br />
sich diese durch ein Verringern des Abbildungsmaßstabs vermeiden<br />
lassen. Vor der Durchführung der Übung sollen dem Schüler die<br />
verschiedenen Farbmodi gezeigt werden, die er an seinem Lesegerät<br />
einstellen kann. Die dem Schüler angenehmste Einstellung wird dann<br />
<strong>für</strong> die Übungen verwendet. Zwar vermischen sich so die Übungen aus<br />
den Bereichen ‚Farbe‘ und ‚Abbildungsmaßstab‘, dies ist jedoch<br />
sinnvoll, um nicht durch ungünstige Farbeinstellungen einen übermäßig<br />
großen Abbildungsmaßstab zu benötigen.<br />
80 Verändert nach: Debbrecht, J.; Wachendorf, P.; Lies mal! Das Heft mit dem Frosch,<br />
2010, S. 15.<br />
40
Kapitel 3: Herausforderungen im Umgang mit dem Bildschirmlesegerät<br />
und deren Schulung<br />
Dem Schüler wird auch demonstriert, dass sich der benötigte<br />
Abbildungsmaßstab durch unterschiedliche Entfernungen vom Monitor<br />
verändert.<br />
Bei der folgenden Übung ändert sich die Schriftgröße nur schleichend,<br />
deswegen ist <strong>für</strong> den Schüler nicht sofort erkennbar, dass der<br />
Abbildungsmaßstab geändert werden muss. Der Schüler soll hier selbst<br />
erkennen, ab wann das Lesen mit dem zunächst gewählten<br />
Abbildungsmaßstab zu anstrengend wird, und soll diesen dann neu<br />
einstellen. Um dem Schüler den Nutzen dieser Änderungen zu<br />
verdeutlichen, kann er auch zuerst versuchen, den kompletten Text<br />
ohne Änderung der Einstellungen zu lesen, und dann nochmal mit<br />
ständiger Anpassung des Abbildungsmaßstabes. Als Variation der<br />
Übung kann diese auch umgekehrt werden, sodass zunächst sehr<br />
kleine und dann immer größer werdende Buchstaben verwendet<br />
werden, so werden wiederholt die Nachteile von zu hoher Vergrößerung<br />
verdeutlicht.<br />
Abbildung 12 : Einstellung des Abbildungsmaßstabs [G] 81<br />
Diese Übungen sind recht einfach zu lösen, da die Schriftgröße von<br />
Zeile zu Zeile stetig kleiner wird und der Abbildungsmaßstab so auch<br />
nur in eine Richtung geändert werden muss. Abgesehen von der<br />
81 Verändert nach: Wachendorf, P.; Debbrecht, J.; Lies mal! Das Heft mit dem Frosch;<br />
2010; S. 8.<br />
41
Kapitel 3: Herausforderungen im Umgang mit dem Bildschirmlesegerät<br />
und deren Schulung<br />
Änderung des Vergrößerungsmaßstabes wird hier zusätzlich der<br />
Zeilensprung geübt.<br />
Kann der Schüler noch nicht lesen, können die Worte durch Symbole<br />
ersetzt werden.<br />
Die nachstehende Übung zur Einstellung des Abbildungsmaßstabes ist<br />
schwieriger, da hier abwechselnd Wörter in verschiedenen<br />
Schriftgrößen gelesen werden sollen. Der Abbildungsmaßstab muss<br />
dem entsprechend öfter und in verschiedene Richtungen geändert<br />
werden. Außerdem muss der Abbildungsmaßstab immer wieder so<br />
eingestellt werden, dass ein Überblick über das gesamte AB möglich<br />
wird, um die zugehörigen Bausteine verbinden zu können. Zusätzlich<br />
wird hier die Orientierung auf dem Arbeitsblatt und durch das Verbinden<br />
der Bausteine die Hand-Auge-Koordination geübt.<br />
Dem Schüler kann zum Verbinden der Bausteine der Ratschlag<br />
gegeben werden, einen Finger zunächst an den entsprechenden<br />
Baustein auf der linken Hälfte zu legen, dann den Kreuztisch so zu<br />
bewegen, dass der passende Baustein auf der rechten Hälfte sichtbar<br />
wird und eine Linie von hier zum Finger zu führen. Dieser Weg wird im<br />
Allgemeinen gefunden, auch wenn er nicht auf dem Monitor abgebildet<br />
wird.<br />
Auch hier kann man statt Satzteilen auch Symbole verbinden lassen,<br />
wenn der Schüler noch nicht lesen kann.<br />
42
Kapitel 3: Herausforderungen im Umgang mit dem Bildschirmlesegerät<br />
und deren Schulung<br />
Abbildung 13 : Einstellung des Abbildungsmaßstabes [F] 82<br />
Bei den Übungen zur Einstellung des Abbildungsmaßstabes muss<br />
speziell darauf geachtet werden, dass der Schüler den<br />
Abbildungsmaßstab so groß wie nötig einstellt, um die Schrift ohne<br />
Anstrengung lesen zu können, jedoch auch so klein wie möglich, um<br />
den Überblick über den Gesamttext nicht zu verlieren. Deswegen sollte<br />
der Schüler z. B. bei der Aufgabe ‚Sätze verbinden‘ darauf hingewiesen<br />
werden, dass er den Abbildungsmaßstab zum Lesen der groß<br />
geschriebenen Worte verringert.<br />
Als Gedankenstütze <strong>für</strong> das Einstellen des Abbildungsmaßstabs könnte<br />
man z. B. die Felder, <strong>für</strong> die ein größerer Abbildungsmaßstab<br />
eingestellt werden muss, grün hinterlegen, und die Felder, die<br />
vermutlich mit kleinem Abbildungsmaßstab gut erkannt werden, rot<br />
hinterlegen. Sollte zum Lesen nicht der Echtfarbmodus verwandt<br />
werden, können stattdessen runde und eckige Umrandungen der<br />
Satzteile als Hilfestellung dienen.<br />
82 Verändert nach: Wachendorf, P.; Debbrecht, J.; Lies mal! Das Heft mit der Ente;<br />
2010; S. 44.<br />
43
Kapitel 3: Herausforderungen im Umgang mit dem Bildschirmlesegerät<br />
und deren Schulung<br />
3.5 Orientierung auf dem Arbeitsblatt<br />
3.5.1 Anzuwendende Suchmethoden<br />
Bei vielen Tätigkeiten, die mithilfe des BLG´s ausgeführt werden, ist es<br />
wichtig, sich auf dem Arbeitsmaterial gut orientieren zu können.<br />
Der Schüler muss in der Lage sein, z. B. bestimmte Textabschnitte oder<br />
Grafiken zu finden oder zwischen verschiedenen Textpassagen hin und<br />
her zu springen. 83<br />
Ist das zu suchende Detail sehr groß oder markant, lässt es sich am<br />
leichtesten auffinden indem am BLG ein sehr kleiner<br />
Abbildungsmaßstab eingestellt wird, sodass ein umfassender Überblick<br />
über das Material ermöglicht wird. So kann das Detail direkt erkannt,<br />
mittig zur Kamera positioniert und mit einem höheren<br />
Abbildungsmaßstab genauer betrachtet werden. Ist das Detail jedoch<br />
klein oder schwer auffindbar oder müssen mehrere verschiedene<br />
Ausschnitte auf einem Arbeitsblatt gefunden werden, sollte der Schüler<br />
einen systematischen Ablauf <strong>für</strong> das Absuchen des Arbeitsmaterials<br />
entwickeln.<br />
Zeun beschreibt in seiner Monokularschulung das Scanning als<br />
Methode zum Auffinden spezieller Objekte innerhalb eines<br />
Blickbereiches. Hierbei wird ein begrenzter Bereich, in dem sich das<br />
Objekt befindet, systematisch abgesucht. Es wird jeweils eine Zeile des<br />
Blickfeldes abgesucht, am Ende des Bereiches springt der Blick<br />
diagonal zum Anfang der nächsten Zeile. So ist ein lückenloses<br />
Absuchen bzw. Scannen des Blickfeldes möglich. 84<br />
83 Vgl. D’Andrea, F.; Farrenkopf, C.; Looking to Learn; 2000; S. 206.<br />
84 Vgl. Zeun, Ulrich; Monokularschulung; 2003; S.19.<br />
44
Kapitel 3: Herausforderungen im Um Umgang gang mit dem Bildschirmlesegerät<br />
und deren Schulung<br />
Abbildung 14: : Scanning eines Arbeitsblattes 85<br />
Dies lässt sich von der Nutzung eines Monokulars auf die Nutzung des<br />
BLG´s übertragen: Um ein Arbeitsblatt lückenlos nach einem<br />
bestimmten Ausschnitt abzusuchen, wird zunächst der o ooberste,<br />
ganz<br />
links liegende Abschnitt de des s Arbeitsmaterials betrachtet. DDie<br />
obere Zeile<br />
wird dann durch Kreuztischbewegung von links nach rechts<br />
abgescannt, es folgt der Übergang zur nächsten Zeile. Die Bewegung<br />
des s Kreuztisches ist hierbei die GGleiche<br />
wie die in Kapitel 3.3.1<br />
beschriebene <strong>für</strong> den Zeilensprung beim Lesen nach ‚Variante B‘<br />
erforderliche Bewegung.<br />
Als weitere Suchmethode nennt Zeun das Verfolgen von Linien,<br />
genannt ‚Tracking Tracking‘. ‘. Hier sollen mit dem Monokular Leitlinien verfolgt<br />
werden, um ein be bestimmtes Objekt zu finden. 86 Dies findet auch bei der<br />
Arbeit mit dem BLG Anwendung, wenn z. B. Flussdiagramme<br />
betrachtet werden sollen.<br />
3.5.2 Übungen<br />
Die Orientierung auf dem Arbeitsblatt kann als Einführung durch das<br />
Betrachten von Wimmelbildern trainiert werden werden. . Bei dem folgenden<br />
Beispiel iel soll der Schüler die Frage „ „Da Da sind 3 Mäuse. Wie viele Nüsse<br />
haben sie gesammelt?“ beantworten.<br />
85<br />
Eigene Darstellung.<br />
86<br />
Vgl. Zeun, U.; Monokularschulung, 2003, S. 18.<br />
45
Kapitel 3: Herausforderungen im Umgang mit dem Bildschirmlesegerät<br />
und deren Schulung<br />
Abbildung 15 : Orientierung auf dem Arbeitsblatt [E] 87<br />
Um dies herauszufinden, soll zunächst durch Scanning entdeckt<br />
werden, wo sich die Mäuse befinden. Wenn nötig, kann dann durch<br />
Erhöhung des Abbildungsmaßstabes der Ausschnitt vergrößert werden,<br />
um die Nüsse zu zählen. Das Einblenden einer der Scanning-<br />
Bewegung entsprechenden Zickzacklinie erleichtert dabei das<br />
Absuchen des Bildes. Bei weiteren Übungen kann diese Linie dann<br />
weggelassen werden, sodass der Schüler dann ohne Hilfe die<br />
Suchsystematik befolgen muss.<br />
Die folgende Abbildung zeigt eine Übung, die sowohl das Scanning als<br />
auch das Tracking trainieren kann:<br />
87 Büsch, S., et al., Sachen suchen bei den Tieren, 2006, S. 5<br />
46
Kapitel 3: Herausforderungen im Umgang mit dem Bildschirmlesegerät<br />
und deren Schulung<br />
Abbildung 16: : Orientierung auf dem Arbeitsblatt [G} 88<br />
Dem Schüler wird hier jeweils eine Figur gegeben, die er zunächst<br />
erkennen muss. Dann muss der Schüler das Arbeitsblatt nach dem<br />
Feld mit dem richtigen Begriff absuchen und zuletzt die jeweilige Linie<br />
zum dazu gehörigen Feld verfolgen, in dem die Figur abgelegt werden<br />
soll. Die gleiche Übung lässt sich auch <strong>für</strong> <strong>Kinder</strong> durchführen, die noch<br />
nicht lesen können, hierzu werden die Begriffe durch Abbildungen<br />
ersetzt.<br />
Eine Übung <strong>für</strong> Fortgeschrittene zur Orientierung auf dem Arbeitsblatt<br />
ist das Lösen von Labyrinthen. Hier soll mit einem Stift der richtige Weg<br />
aus dem La Labyrinth nachgezeichnet werden. Die ie Verfolgung der<br />
Labyrinthwege entspricht dem Tracking, zusätzlich ka kann die Lage von<br />
Labyrinth- Ein Ein- und Ausgang zuvor r durch Scanning bestimmt werden werden.<br />
88<br />
Eigene Darstellung<br />
Darstellung.<br />
47
Kapitel 3: Herausforderungen im Umgang mit dem Bildschirmlesegerät<br />
und deren Schulung<br />
Abbildung 17: Orientierung auf dem Arbeitsblatt [F] 89<br />
Für diese Übung können je nach Fertigkeiten des Schülers Labyrinthe<br />
in verschiedenen Schwierigkeitsstufen gewählt werden. Außer der<br />
Orientierung auf dem Arbeitsblatt werden die Bewegung des<br />
Kreuztisches sowie das Zeichnen mit Hilfe des BLG´s geübt.<br />
3.6 Einstellung von Lesefarbe, Helligkeit und Kontrast<br />
3.6.1 Zu beachtende Einflussfaktoren<br />
Während der Hospitation an der Irisschule konnte beobachtet werden,<br />
dass die richtige Einstellung von Kontrast, Helligkeit und Farbe<br />
besonders beim Betrachten von Bildern sowie beim Malen eine große<br />
Rolle spielt. Bei kontrastarmen Vorlagen ist es möglich, dass Bilder<br />
oder Buchstabengruppen auf dem BLG nicht sichtbar werden, wenn<br />
dieses nicht richtig eingestellt ist.<br />
Um hier die richtige Einstellung zu finden, muss dem Schüler zunächst<br />
bewusst sein, was er überhaupt sehen will, ob zum Beispiel farbige<br />
Bilder oder kontrastarme Texte betrachtet werden sollen. Dies ist <strong>für</strong><br />
den Schüler nicht immer von vorneherein klar, deswegen sollte durch<br />
Lehrer darauf hingewiesen werden, wenn Arbeitsmaterial mit diesen<br />
Anforderungen verteilt wird.<br />
89 Zufällig erstellt http://www.blinde-kuh.de/spiele/maze/generator.cgi.<br />
48
Kapitel 3: Herausforderungen im Umgang mit dem Bildschirmlesegerät<br />
und deren Schulung<br />
Die richtige Einstellung von Farbe, Helligkeit und Kontrast kann auch<br />
beim Lesen von Texten von großer Bedeutung sein: Wie bereits in<br />
Kapitel 2.2.1 beschrieben, hängt der Vergrößerungsbedarf des Nutzers<br />
nicht nur von der Buchstabengröße des Lesegutes und dem<br />
vorhandenen Visus ab, sondern variiert auch je nach Farbe der Schrift<br />
und Qualität der Kontraste. Sinnvoll <strong>für</strong> das Lesen von Texten ist je<br />
nach Vorliebe des Schülers die Nutzung des Schwarz- Weiß- Modus,<br />
möglicherweise im Negativkontrast, oder aber eines Fehlfarbenmodus.<br />
So entsteht oft ein höherer Kontrast im Vergleich zum Echtfarbmodus.<br />
Ist das Bildschirmlesegerät optimal eingestellt, benötigt der Schüler also<br />
möglicherweise eine geringere Vergrößerung, als wenn die Vorlage im<br />
Echtfarbmodus auf dem Monitor abgebildet wird.<br />
Hierdurch vergrößert sich der auf dem Bildschirm abgebildete<br />
Ausschnitt des Textes, und der Schüler bekommt einen besseren<br />
Überblick über den Gesamttext. Er kann mehr Buchstaben auf einmal<br />
sehen, hat also ein größeres Lesegesichtsfeld und somit ist ein<br />
flüssigeres Lesen mit weniger Kreuztischarbeit möglich.<br />
3.6.2 Übungen<br />
Mit der folgenden Übung kann die Einstellung des richtigen Farbmodus<br />
geübt werden. Der Schüler soll hier erkennen, dass er den<br />
Echtfarbmodus einstellen muss um die Aufgabe zu lösen.<br />
Außerdem werden der Zeilensprung sowie die Hand-Auge-Koordination<br />
geübt. Dabei ist der Anspruch <strong>für</strong> das Erkennen der Farben eher gering.<br />
Das Verbinden der richtigen Kästchen ist jedoch sehr anspruchsvoll, da<br />
dies nur mit viel Kreuztischbewegung möglich ist.<br />
49
Kapitel 3: Herausforderungen im Umgang mit dem Bildschirmlesegerät<br />
und deren Schulung<br />
Abbildung 18 : Einstellung der Farbe [E] 90<br />
Die gleiche Übung lässt sich auch verwenden, wenn der Schüler noch<br />
nicht lesen kann, hierzu werden die ausgeschriebenen Farben ebenfalls<br />
durch Kästchen mit Farbfüllung ers ersetzt etzt und es müssen die richtigen<br />
Farben verbunden werden.<br />
Die Übung ‚Einstellung von Farbe und Kontrast [E]‘ erfordert ebenfalls<br />
die e Einstellung des Echtfarbmodus. Der Schüler soll hier erkennen,<br />
dass er den Echtfarbmodus einstellen muss um die Aufgabe zu lösen.<br />
Abbildung 19: : Einstellung von Farbe und Kontrast [E] 91<br />
90<br />
Eigene Darstellung<br />
Darstellung.<br />
91<br />
Eigene Darstellung.<br />
50
Kapitel 3: Herausforderungen im Umgang mit dem Bildschirmlesegerät<br />
und deren Schulung<br />
Hier nimmt der Kontrast der verschiedenen Kugeln immer weiter ab,<br />
deswegen müssen möglicherweise zusätzlich Helligkeit und Kontrast<br />
am BLG neu eingestellt werden.<br />
Außerdem wird durch das Lösen der Rechenaufgaben das Schreiben<br />
unter dem BLG geübt, auch die Bewegung und Koordination des<br />
Kreuztisches sowie der Zeilensprung können hierbei trainiert werden.<br />
Für <strong>Kinder</strong>, die noch nicht rechnen können, kann man die Übung<br />
folgendermaßen umstellen:<br />
Abbildung 20: Einstellung von Farbe und Kontrast [E] – ohne Zahlen 92<br />
Um die Einstellung von Farbe, Helligkeit und Kontrast zu vertiefen,<br />
wurde die Aufgabe im Folgenden erschwert:<br />
Abbildung 21 : Einstellung von Helligkeit, Farbe und Kontrast [G] 93<br />
Hier wechseln sich farbige Kugelreihen mit Reihen in verschiedenen<br />
Graustufen ab. Die Kugelreihen in Graustufen sind im Echtfarbmodus<br />
92 Eigene Darstellung.<br />
93 Eigene Darstellung.<br />
51
Kapitel 3: Herausforderungen im Umgang mit dem Bildschirmlesegerät<br />
und deren Schulung<br />
kaum zu erkennen, aus diesem Grund müssen die Einstellungen am<br />
Bildschirmlesegerät <strong>für</strong> jede Zeile erneuert werden.<br />
Auch diese Übung kann man <strong>für</strong> <strong>Kinder</strong> ohne Rechenkenntnisse in die<br />
oben gezeigte Ankreuzaufgabe umändern.<br />
Abbildung 21 zeigt eine fortgeschrittene Übung <strong>für</strong> die Einstellung von<br />
Farbe, Helligkeit und Kontrast: Hier muss der Schüler mehrmals<br />
zwischen dem Echtfarbmodus und dem Schwarz/Weiß- bzw.<br />
Fehlfarbenmodus wechseln, da die kontrastarme Schrift im<br />
Echtfarbmodus nicht erkannt werden kann. Auch hier werden zusätzlich<br />
der Zeilensprung sowie die Orientierung auf dem Arbeitsblatt und die<br />
Hand-Auge-Koordination geübt.<br />
Abbildung 22: Einstellung von Helligkeit, Farbe und Kontrast [F] 94<br />
Der Schüler soll während der Durchführung der Aufgabe darauf<br />
hingewiesen werden, dass die kontrastarmen Wörter bei ungünstiger<br />
Einstellung des BLG’s gar nicht zu sehen sind und erst bei richtiger<br />
Einstellung von Helligkeit, Farbe und Kontrast wahrgenommen werden<br />
können. Um die Erklärungen interessant zu gestalten kann man die<br />
kontrastarme Schrift mit einer Geheimschrift vergleichen.<br />
94 Eigene Darstellung.<br />
52
Kapitel 3: Herausforderungen im Umgang mit dem Bildschirmlesegerät<br />
und deren Schulung<br />
Für Schüler, die noch nicht schreiben können, lässt sich stattdessen die<br />
unten stehende Aufgabe einsetzen. Hier soll der Schüler zunächst das<br />
farbige Bild betrachten und dann jeweils die richtige, kontrastarm<br />
dargestellte Form sowie die richtige Farbe einkreisen. Auch zur<br />
Bewältigung dieser Aufgabe ist ein ständiges Neueinstellen von Farbe<br />
und Kontrast notwendig.<br />
Abbildung 23: Einstellung von Helligkeit, Farbe und Kontrast [F] - ohne<br />
Buchstaben 95<br />
3.7 Hand- Auge- Koordination bzw. Schreiben/Malen<br />
unter dem BLG<br />
3.7.1 Zu beachtende Faktoren<br />
Das Schreiben unter dem BLG stellt aus verschiedenen Gründen eine<br />
besondere Herausforderung dar.<br />
Es ergibt sich <strong>für</strong> den Schüler eine ungewohnte Hand- Augen-<br />
Koordination. Während die Schreibhand auf der Unterlage unter der<br />
95 Eigene Darstellung.<br />
53
Kapitel 3: Herausforderungen im Umgang mit dem Bildschirmlesegerät<br />
und deren Schulung<br />
Kamera zeichnet oder schreibt, entsteht das Bild, welches der Schüler<br />
betrachten soll, an einer anderen Stelle, nämlich auf dem Monitor. 96<br />
Dies erschwert die richtige Einschätzung der zum Schreiben nötigen<br />
Bewegungen; Größe und Form der Buchstaben werden möglicherweise<br />
falsch beurteilt. Außerdem entsteht auf dem Bildschirm, im Gegensatz<br />
zum natürlichen, dreidimensionalen Sehen, nur ein zweidimensionales<br />
Bild. Hierdurch wird das Aufsetzten des Stiftes am gewünschten Ort<br />
und somit z. B. das Schreiben in Kästchen oder auf Linien zusätzlich<br />
erschwert. Außerdem ergibt sich durch die Positionierung von Kamera,<br />
Beleuchtung und Schreibgut eine ungünstige Schattenposition. Der<br />
Schatten der Schreibhand fällt oft direkt auf das in dem Moment zu<br />
beschreibende Schriftstück. Im Gegensatz zum Schreiben ohne BLG<br />
lässt sich durch Änderung der Kopfhaltung und Blickrichtung diese<br />
Situation nicht verbessern, da sich die Abbildung auf dem Monitor<br />
hierdurch nicht ändert. Stattdessen muss die Schreibhand<br />
dementsprechend anders positioniert werden. 97<br />
Des Weiteren gestaltet sich das Schreiben unter dem<br />
Bildschirmlesegerät auch aufgrund von Platzmangel problematisch.<br />
Möglicherweise ist der Stift in der Hand zu lang und stößt an die<br />
Kamera, oder aber die Hände selbst kommen an das Gerät. Um trotz<br />
des Platzmangels schreiben zu können, wird der Stift oft sehr schräg<br />
gehalten. Deswegen sind klassische Füllfederhalter hier<strong>für</strong> weniger<br />
geeignet, besser ist die Verwendung von Roller Pens, Filzstiften oder<br />
weichen Blei- und Buntstiften. 98 Entscheidend hierbei ist auch die<br />
richtige Haltung des Stiftes in der Hand: Am sinnvollsten ist es, den Stift<br />
im sogenannten „Dreifingergriff“ zu halten, das heißt der Stift sollte<br />
zwischen Daumen und Zeigefinger gehalten werden und dabei auf dem<br />
Mittelfinger ruhen. 99 So kann der Stift ohne verkrampfte Handhaltung<br />
auch bei detailreichen Schreib- oder Malaufgaben sicher geführt<br />
werden. Um das Schreiben mit der dominanten Hand möglichst gut<br />
96<br />
Vgl. D’Andrea, F. M.; Farrenkopf, C.; Looking to learn; 2000; S. 207.<br />
97<br />
Beobachtung während Unterrichtshospitation in der Irisschule.<br />
98<br />
Vgl. Hofer, U., Integration von Schülerinnen und Schülern mit einer Sehschädigung<br />
an Regelschulen, 2004, S. 2.<br />
99<br />
Vgl. Koch, C., Funktionaloptometrie, 2004, S. 63.<br />
54
Kapitel 3: Herausforderungen im Umgang mit dem Bildschirmlesegerät<br />
und deren Schulung<br />
bewältigen zu können, sollte nach dem ‚Lead-Support-System‘<br />
vorgegangen werden. Das bedeutet, dass alle anderen Aufgaben, wie<br />
das Hin- und Herschieben der Schreibunterlage auf dem Kreuztisch<br />
oder auch das Festhalten der Schreibunterlage während des<br />
Schreibens an sich, von der Nicht-dominanten Hand erfüllt werden. 100<br />
Der Kreuztisch sollte zum Schreiben arretiert sein, da sich dieser sonst<br />
durch die Schreibbewegungen verstellen kann und somit ein<br />
unsauberes Schriftbild entsteht. Gerade bei großen Mal- oder<br />
Schreibunterlagen kann es auch schwierig sein, diese auf dem<br />
Kreuztisch gut zu platzieren. Deswegen ist es bei Verwendung eines<br />
Bildschirmlesegerätes von Objektvergrößerung durch vergrößerte<br />
Kopien abzusehen. An dieser Stelle wäre es <strong>für</strong> den Schüler einfacher,<br />
sich einen größeren Abbildungsmaßstab einzustellen und auf die<br />
Objektvergrößerung zu verzichten.<br />
Eine weitere Schwierigkeit besteh darin, dass der <strong>sehbehinderte</strong><br />
Schüler beim Schreiben unter dem BLG viele Tätigkeiten gleichzeitig<br />
ausführen muss: Der Stift muss festgehalten und geführt werden, die<br />
Schreibunterlage muss während des Schreibens auf dem Kreuztisch<br />
festgehalten und zwischen den einzelnen Schreibintervallen so bewegt<br />
werden, dass immer der richtige Ausschnitt des Arbeitsmaterials über<br />
das BLG abgebildet wird. Weiterhin müssen möglicherweise<br />
Einstellungen am BLG an sich geändert werden. Der Kreuztisch bleibt<br />
hierbei arretiert. Um die Ausführung der unterschiedlichen Aufgaben<br />
zumindest zunächst einfacher zu gestalten, kann die Schreibunterlage<br />
beim Üben auf dem Kreuztisch festgeklebt werden, so muss vom<br />
Schüler eine Anforderung weniger bewältigt werden 101 . Allerdings sollte<br />
hier darauf geachtet werden, dass weder der Kreuztisch noch die<br />
Vorlage durch Klebereste beschädigt werden, alternativ kann auch eine<br />
rutschfeste Schreibunterlage verwendet werden.<br />
Der benötigte Abbildungsmaßstab ist beim Schreiben aufgrund der<br />
größeren Versalhöhe im Allgemeinen geringer als beim Lesen. Bei den<br />
folgenden Übungen soll deswegen verstärkt darauf geachtet werden,<br />
100 Vgl. Koch, C., Funktionaloptometrie, 2004, S. 63 f.<br />
101 Vgl. D’Andrea, F. M.; Farrenkopf, C.; Looking to learn; 2000; S. 207.<br />
55
Kapitel 3: Herausforderungen im Umgang mit dem Bildschirmlesegerät<br />
und deren Schulung<br />
dass der Schüler den Abbildungsmaßstab den neuen Voraussetzungen<br />
anpasst, um das Schreiben mit dem BLG nicht durch einen unnötig<br />
hohen Abbildungsmaßstab zusätzlich zu erschweren.<br />
3.7.2 Übungen<br />
Bevor mit Übungen zum Schreiben oder Malen unter dem BLG<br />
begonnen wird, sollte die Hand-Auge-Koordination an sich trainiert<br />
werden. Bei der folgenden Aufgabe sollen hierzu Figuren - in diesem<br />
Fall wurden Monopolyfiguren gewählt - unter dem BLG betrachtet und<br />
auf einen vorgegebenen Platz auf dem Arbeitsblatt gelegt werden.<br />
Hier<strong>für</strong> muss der Schüler zunächst erkennen, um was <strong>für</strong> eine Figur es<br />
sich handelt, dann muss der richtige Platz auf dem AB gefunden<br />
werden, und zuletzt muss auch die Hand mit dem Gegenstand diese<br />
Position finden, um den Gegenstand dort abzulegen. Dabei muss der<br />
Schüler darauf achten, dass keine der bereits abgelegten Figuren durch<br />
die Hand verschoben wird. Der Blick des Schülers soll dabei<br />
ununterbrochen auf den Bildschirm und nicht auf die Vorlage selbst<br />
gerichtet sein.<br />
Abbildung 24 : Hand – Auge - Koordination [E] 102<br />
Um den Umgang mit dem Stift unter dem BLG zu üben, sollte mit sehr<br />
einfachen Übungen begonnen werden. Der Schüler kann zunächst<br />
102 Eigene Darstellung.<br />
56
Kapitel 3: Herausforderungen im Umgang mit dem Bildschirmlesegerät<br />
und deren Schulung<br />
einfache Formen und Linien auf einem Arbeitsblatt nachzeichnen. Bei<br />
der Aufgabe ‚Hand- Auge- Koordination [F]‘ sollen sowohl<br />
geschwungene als auch eckige Formen nachgezeichnet werden und<br />
eignet sich somit auch gut <strong>für</strong> Schüler im Vorschulalter. Hierdurch wird<br />
die Stiftführung in verschiedene Richtungen geschult. Außerdem soll<br />
der Schüler durch diese Übung lernen, den Stift an der richtigen<br />
Position aufzusetzen, beim Schreiben in der richtigen Zeile zu bleiben<br />
und die vorgegebene Zeichengröße einzuhalten.<br />
Abbildung 25 : Hand – Auge - Koordination [G] – ohne Buchstaben 103<br />
Bei dieser Übung muss unbedingt darauf geachtet werden, dass der<br />
Schüler die ganze Zeit auf den Bildschirm und nicht auf seine Hand<br />
unter der Kamera schaut. 104 Außerdem soll auf die in Kapitel 2.3.2<br />
beschriebene Stift- und Handhaltung aufmerksam gemacht werden,<br />
auch die Problemlösung bei ungünstigem Schattenfall wird erklärt.<br />
Um den Schwierigkeitsgrad der Übung zu erhöhen, können Reihen mit<br />
Buchstaben oder Wörtern vervollständigt werden, hierzu können die<br />
von dem jeweiligen Schüler aktuell in der Schule verwendeten<br />
Lineaturen verwendet werden.<br />
Abbildung 26 zeigt eine Vorlage mit Lineatur <strong>für</strong> die 1. Klasse. Hier<br />
können je nach Leistungsstand der Schüler einzelne Buchstaben oder<br />
ganze Worte durch den Lehrer vorgegeben werden, die vom Schüler<br />
103 Eigene Darstellung.<br />
104 Vgl. D’Andrea, F. M.; Farrenkopf, C.; Looking to learn; 2000; S. 207 f.<br />
57
Kapitel 3: Herausforderungen im Umgang mit dem Bildschirmlesegerät<br />
und deren Schulung<br />
wiederholt werden müssen. Die Übung entspricht im Schwierigkeitsgrad<br />
auf die Auge- Hand-Koordination bezogen der Abbildung 24, ist aber in<br />
Bezug auf die Schreibfähigkeit des Schülers anspruchsvoller und somit<br />
<strong>für</strong> Schüler die bereits schreiben können gut geeignet.<br />
Abbildung 26 : Hand-Auge-Koordination [G] 105<br />
Als fortgeschrittene Übung zur Hand-Auge-Koordination können<br />
Zahlenbilder in verschiedenen Schwierigkeitsstufen verwendet werden.<br />
Der Stift muss hier immer wieder in verschiedene Richtungen geführt<br />
werden, dabei ist es <strong>für</strong> den Schüler wichtig darauf zu achten, dass die<br />
Schreibhand die nächsten Zahlen nicht verdeckt.<br />
Zusätzlich wird durch das Suchen der Zahlen die Orientierung auf dem<br />
Arbeitsblatt geübt, außerdem ist ein häufiger Wechsel des<br />
Abbildungsmaßstabs nötig, um einerseits einen Überblick über das<br />
bereits gezeichnete zu erhalten und andererseits die kleinen Zahlen<br />
lesen zu können.<br />
105 Eigene Darstellung.<br />
58
Kapitel 3: Herausforderungen im Umgang mit dem Bildschirmlesegerät<br />
und deren Schulung<br />
Abbildung 27 : Hand – Auge – Koordination [F] 106<br />
3.8 Nutzung der Fernkamera<br />
3.8.1 Zu beachtende Faktoren<br />
Soll ein Bildschirmlesegerät auch zur Vergrößerung entfernter Objekte<br />
verwendet werden, kann hierbei wie bereits in 2.4.1 beschrieben<br />
entweder ein Zweikamerasystem oder aber eine schwenkbare Kamera<br />
zur Abbildung von Nahen und Fernen Objekten eingesetzt werden.<br />
Bei beiden Systemen ist es wichtig, mit der Kamer das gesuchte Objekt<br />
im Raum auffinden zu können.<br />
Hier<strong>für</strong> gelten die gleichen Ansätze wie bei der Orientierung auf dem<br />
Arbeitsblatt: Es ist sinnvoll, zunächst einen kleinen Abbildungsmaßstab<br />
zu wählen, um einen Überblick über den Raum zu bekommen. Dann<br />
kann die Kamera auf das gewünschte Detail gelenkt werden. Sollte dies<br />
nicht gleich auffindbar sein, kann es durch die Suchmethoden Scanning<br />
und Tracking gefunden werden. Um das Detail genau zu betrachten,<br />
wird daraufhin der Abbildungsmaßstab erhöht.<br />
Wird eine schwenkbare Kamera <strong>für</strong> Ferne und Nähe verwandt, muss<br />
diese beim Abschreiben von der Tafel ständig neu positioniert und<br />
106 Maisel, K.; Kigotipps (Internet).<br />
59
Kapitel 3: Herausforderungen im Umgang mit dem Bildschirmlesegerät<br />
und deren Schulung<br />
eingestellt werden. Hierbei helfen ein Einrasten der Kamera sowie der<br />
Autofocus. Außerdem gibt es Geräte mit Memory-Funktion, die die<br />
Einstellungen <strong>für</strong> bestimmte Situationen abspeichern.<br />
Soll ein Text an der Tafel gelesen werden, ergeben sich hier die<br />
gleichen Anforderungen wie bei dem Lesen in der Nähe:<br />
Möglicherweise muss der Abbildungsmaßstab während des Lesens<br />
geändert werden, auch Helligkeit und Kontrast müssen richtig<br />
eingestellt werden, um den Text oder auch Abbildungen gut zu<br />
erkennen.<br />
Außerdem muss auch hier der Zeilensprung beherrscht werden, dazu<br />
wird statt des Kreuztisches oder des Leseguts die Kamera bewegt.<br />
Bei der Nutzung eines Zweikamerasystems sollte darauf geachtet<br />
werden, dass der Schüler den Bildschirm nur dann in Fern- und<br />
Nahbereich aufteilt, wenn dies auch wirklich wegen eines ständig<br />
nötigen Blickwechsels erforderlich ist. Ansonsten würde diese<br />
Einstellung den Bildausschnitt unnötig verkleinern. 107<br />
3.8.2 Übungen<br />
Das Auffinden eines Objektes im Raum kann geübt werden, indem<br />
Zettel mit Bildern an verschiedenen Stellen an der Tafel aufgehängt<br />
werden und durch den Schüler gesucht und erkannt werden müssen.<br />
Als Einstieg finden hierbei Zettel mit nur einem zu benennenden Bild<br />
Verwendung.<br />
Um die Aufgabe zu erschweren, können dann Texte benutzt werden,<br />
bei denen der Schüler nicht nur das Auffinden und Scharfstellen,<br />
sondern auch das Verfolgen der Zeile und den Zeilensprung trainiert.<br />
Die Übungen können jeweils in verschiedenen Bild- oder Schriftgrößen<br />
benutzen werden, um die Einstellung des richtigen<br />
Abbildungsmaßstabes zu üben.<br />
Als fortgeschrittene Übung <strong>für</strong> das Auffinden im Raum können auch<br />
mehrere Zettel gleichzeitig angebracht werden, die dann innerhalb<br />
eines bestimmten Zeitfensters gesucht werden müssen. Hier<strong>für</strong> kann<br />
107 Eigenes Gedankengut.<br />
60
Kapitel 3: Herausforderungen im Umgang mit dem Bildschirmlesegerät<br />
und deren Schulung<br />
der Schüler die Methode des Scanning anwenden und kann auf diese<br />
Weise alle Zettel finden und das jeweilige Objekt benennen.<br />
Werden hierbei statt Bildern Buchstaben verwendet, kann gleichzeitig<br />
das Abschreiben von der Tafel geübt werden: Auf jedem Blatt steht ein<br />
Buchstabe, werden die Blätter durch Scanning in der richtigen<br />
Reihenfolge gefunden und jeder Buchstabe abgeschrieben, ergibt sich<br />
daraus ein Wort. Werden die Bilder an einer Tafel befestigt, können<br />
diese auch durch Linien verbunden werden, sodass ebenfalls das<br />
Aufsuchen von Objekten durch Tracking geübt wird.<br />
Als weiterführende Übung <strong>für</strong> das Abschreiben von der Tafel können<br />
ganze Worte ooder<br />
Sätze abgeschrieben werden, , oder aber, sollte der<br />
Schüler noch h nicht lesen und schreiben können, Symbole abgemalt<br />
werden.<br />
Es können hier<strong>für</strong> Worte, Sätze oder Bilder in Anlehnung an den<br />
Schulunterricht frei gewählt und einfach auf DIN A4 Zettel gedruckt<br />
werden, deswegen werden hier keine Beispielübungen aufgeführt.<br />
3.9 Übungen gen zur kombinierten Nutzung der Funktionen<br />
Einige der zuvor vorgestellten Übungen fordern die Einstellung<br />
verschiedener Funktionen am BLG; sie haben dabei aber einen<br />
Konzentrationsschwerpunkt der primär im Vordergrund steht steht. Die<br />
folgenden Aufgaben sollen möglichst viele verschiedene Fertigkeiten<br />
gleichzeitig fordern. Sie entsprechen original Übungen aus dem<br />
Schulunterricht der Sehbehindertenschule und sind somit praxisnah.<br />
Abbildung 28 : Übung zur Kombination der Funktionen - 3 108<br />
108<br />
Wachendorf, P.; Debbrecht, J.; Druckschrift; 2010, S.53.<br />
61
Kapitel 3: Herausforderungen im Umgang mit dem Bildschirmlesegerät<br />
und deren Schulung<br />
Mit dieser Übung wird außer dem Schreiben mithilfe des BLG´s auch<br />
die richtige Einstellung von Farbe und Kontrast geübt, da die sehr<br />
kontrastarm dargestellten vorgegebenen Worte durch den Schüler<br />
erkannt werden müssen. Des Weiteren wird der Zeilensprung trainiert;<br />
dieser gestaltet sich hier als besonders anspruchsvoll<br />
anspruchsvoll, da der Abstand<br />
zwischen den einzelnen Lineaturen schwer von der Lineat Lineatur an sich zu<br />
unterscheiden ist, zumindest wenn nicht der Echtfarbmodus verwendet<br />
wird. Dies ist wiederum nicht sinnvo sinnvoll, da die Schrift dann nur schwer<br />
gesehen werden kann. Für den Schüler ist es deswegen problematisch<br />
zu erkennen, ob er in der richtigen Zeile schreibt. 109<br />
Darüber hinaus<br />
wird die richtige Platzierung des Schreibguts auf dem Kreuzti Kreuztisch sowie<br />
die Stifthaltun Stifthaltung und die Hand- Auge- Koordination beim Schreiben<br />
trainiert.<br />
Auch bei der nachstehenden Aufgabe wird der Umgang mit<br />
verschiedenen Funktionen gleichzeitig gefestigt:<br />
Abbildung 29 :Übung zur Kombination der Funktionen - 4 110<br />
Durch das Aufsuchen der Felder mit dem Buchstaben ‚Pf‘ wird die<br />
Orientierung auf dem Arbeitsblatt und das Scanning trainiert, das<br />
Ausmalen der Felder festigt zusätzlich die Hand-Auge Auge-Koordination.<br />
109<br />
Beobachtungen während der Besuche in der Irisschule.<br />
110<br />
Debbrecht, J.; Wachendorf, P.; Dr Druckschrift; 2010, S. 64.<br />
62
Kapitel 3: Herausforderungen im Umgang mit dem Bildschirmlesegerät<br />
und deren Schulung<br />
Um das Gemalte erkennen zu können, müssen Farbe und Kontrast<br />
richtig eingestellt werden. Außerdem wird die Einstellung des<br />
Abbildungsmaßstabs geübt, da mehrmals zwischen Detail- und<br />
Übersicht gewechselt werden muss. Eine auch <strong>für</strong> die Schüler sehr<br />
motivierende Übung zur kombinierten Nutzung des BLG´s ist das Malen<br />
nach Zahlen:<br />
Abbildung 30 : Übung zur Kombination der Funktionen - 5 111<br />
Auch hier muss der Schüler viele der gelernten Dinge gleichzeitig<br />
anwenden: Durch scanning muss er das Arbeitsblatt nach Feldern mit<br />
einer bestimmten Zahl absuchen, Der Abbildungsmaßstab muss oft<br />
geändert werden, um sowohl die Zahlen zu lesen als auch einen<br />
Überblick über das Bild zu erhalten. Durch das Ausmalen wird die<br />
Hand-Auge-Koordination geübt, außerdem muss viel mit dem<br />
Kreuztisch gearbeitet werden. Zusätzlich wird die Aufgabe erschwert,<br />
da immer wieder auf die unten stehende Auflistung von Zahlen und<br />
Farben geschaut und außerdem der richtige Buntstift ausgewählt<br />
werden muss. Der Blick wird oft vom Bildschirmlesegerät abgewandt<br />
111 Kostenlose Malvorlagen und gratis Ausmalbilder, Stand 2008 (Internet).<br />
63
Kapitel 3: Herausforderungen im Umgang mit dem Bildschirmlesegerät<br />
und deren Schulung<br />
und die Stelle, an der gerade gemalt wird, muss immer wieder neu<br />
aufgesucht werden.<br />
64
Kapitel 4: Zusammenstellung eines individuellen Trainings<br />
4 Zusammenstellung eines individuellen<br />
Trainings<br />
4.1 Individualität der Schüler<br />
Aus verschiedenen Gründen erscheint es sinnvoll, ein <strong>Hilfsmitteltraining</strong><br />
am Bildschirmlesegerät auf jeden Probanden bzw. Schüler individuell<br />
abzustimmen. Hier<strong>für</strong> spricht, dass die <strong>Kinder</strong> unterschiedliche<br />
Sehfunktionen besitzen: So kann sich z. B. der Vergrößerungsbedarf<br />
stark unterscheiden, auch andere Faktoren wie die Fähigkeit zur<br />
Farberkennung oder die Blendempfindlichkeit können variieren. Dies<br />
hat zur Folge, dass der Übungsbedarf beim Umgang mit dem BLG<br />
ebenfalls sehr unterschiedlich sein kann, so macht z. B. ein hoher<br />
Vergrößerungsbedarf eine vermehrte Verwendung des Kreuztisches<br />
notwendig, eine Farbblindheit macht die Einstellung des Echtfarbmodus<br />
überflüssig. Ein Training sollte so ausgelegt sein, dass überflüssige<br />
Einheiten wegfallen, um sich auf das <strong>für</strong> den jeweiligen Schüler<br />
Wesentliche konzentrieren zu können.<br />
Für ein individuelles Training sprechen desweiteren folgende Gründe:<br />
Die Schüler benutzen unterschiedliche Geräte, deswegen sollte das<br />
Training Besonderheiten des verwendeten BLG´s, wie z. B. den<br />
Gebrauch einer Fernkamera, berücksichtigen. Weiterhin sind die<br />
Anforderungen und Wünsche, die die <strong>Kinder</strong> an ihr Gerät stellen, so wie<br />
die Aufgaben, die sie mit Hilfe des Gerätes erledigen wollen, ebenfalls<br />
unterschiedlich. Außerdem ist davon auszugehen, dass sich die<br />
Schüler auf verschiedenen Kenntnisstufen befinden, was die bisherige<br />
Qualität ihres Umgangs mit dem BLG betrifft. Je nach dem, wie lange<br />
das Gerät bereits genutzt wird, wie oft und mit welcher Motivation das<br />
BLG verwendet wird und wie schnell das jeweilige Kind lernt, zeigt sich<br />
vermutlich ein unterschiedliches Können, somit resultieren<br />
Abweichungen im Trainingsbedarf. 112<br />
112 D’Andrea, F; Farrenkopf, C.; Looking to Learn; 2000; S. 202.<br />
65
Kapitel 4: Zusammenstellung eines individuellen Trainings<br />
4.2 Ermittlung des Trainingsbedarfs<br />
4.2.1 Allgemeines<br />
Die im Folgenden erläuterte Ermittlung des Trainingsbedarfs sollte<br />
aufgrund der in 4.1 aufgeführten Gründe vor der Zusammenstellung<br />
einer Schulung immer durchgeführt werden. Die Ermittlung des<br />
Trainingsbedarfs erfolgt einerseits durch Fragebögen an Schüler, Eltern<br />
und Lehrer, andererseits durch die Durchführung eines Eingangstests,<br />
der die Ergebnisse der Fragebögen verfeinert. Die erstellten<br />
Fragebögen sowie die Übungen <strong>für</strong> den Eingangstest und der<br />
dazugehörige Bewertungsbogen befinden sich im Anhang der Arbeit<br />
und können <strong>für</strong> die Ermittlung des Trainingsbedarfs übernommen<br />
werden.<br />
Bei der Erprobung des Eingangstests mit einer Probandin wurden den<br />
Bewertungsbogen betreffend noch Verbesserungsmöglichkeiten<br />
sichtbar, aus diesem Anlass findet sich auch die verbesserte Version<br />
des Bewertungsbogens im Anhang wieder.<br />
Der dem Eingangstest ähnelnde Ausgangstest wurde lediglich erstellt,<br />
um im Rahmen dieser Arbeit den Umgang mit dem BLG vor und nach<br />
den Trainingseinheiten vergleichen zu können, <strong>für</strong> die Erstellung eines<br />
<strong>Hilfsmitteltraining</strong>s außerhalb dieser Arbeit ist eine Durchführung des<br />
Ausgangstestes nicht notwendig.<br />
4.2.2 Fragebögen<br />
Es werden sowohl die Schüler selbst, als auch Lehrer und Eltern<br />
befragt, um einen möglichst lückenlosen Überblick über den Umgang<br />
des Schülers mit dem BLG, sowohl in der Schule als auch zu Hause, zu<br />
erlangen.<br />
Die Fragebögen selbst lassen sich jeweils grob in drei Teile<br />
aufschlüsseln:<br />
Zunächst sollen die Voraussetzungen geprüft werden, unter denen das<br />
Training stattfinden soll, z. B. die Art und der Standort des BLG´s, aber<br />
auch der Entwicklungsstand des Schülers was das Lesen und<br />
Schreiben betrifft.<br />
66
Kapitel 4: Zusammenstellung eines individuellen Trainings<br />
Weiterhin soll herausgefunden werden, welche Erfahrungen der<br />
Schüler am BLG bereits gesammelt hat und wie gut er mit dem<br />
Bildschirmlesegerät umgehen kann. Außerdem wird ermittelt, ob es<br />
Situationen gibt, in denen die Verwendung des BLG´s sinnvoll wäre, in<br />
denen aber wegen Handhabungsunsicherheit trotzdem ohne Hilfsmittel<br />
gearbeitet wird.<br />
Um das Ausfüllen der Fragebögen zu erleichtern und die Antworten<br />
möglichst einfach auswerten zu können, bestehen die Fragebögen<br />
hauptsächlich aus geschlossenen Fragen und Ankreuzfragen. Die<br />
Leistung des Schülers im Umgang mit dem BLG wird dabei von Lehrern<br />
und Eltern nach dem Schulnotensystem bewertet. Die Bedeutung der<br />
einzelnen Noten wird, um Missverständnissen vorzubeugen, erklärt. Die<br />
Schüler können in dem <strong>für</strong> sie bestimmten Fragebogen über ein System<br />
aus lachenden, weinenden oder neutralen Smileys beurteilen, wie<br />
Ihnen die Arbeit mit dem BLG gefällt.<br />
Alle drei Fragebögen bieten auch Platz <strong>für</strong> individuelle Angaben und<br />
Wünsche.<br />
4.2.3 Eingangstest<br />
4.2.3.1 Allgemeines<br />
Bevor mit dem Handhabungstraining <strong>für</strong> die Schüler begonnen wird,<br />
wird ein Eingangstest mit ihnen durchgeführt. Dieser soll gleichzeitig<br />
zwei Aufgaben erfüllen: Zum einen sollen hier die Ergebnisse des<br />
Fragebogens überprüft werden, um genauer einschätzen zu können,<br />
wie gut der jeweilige Schüler bereits mit dem BLG umzugehen weiß,<br />
sodass ein <strong>für</strong> ihn sinnvolles Training erstellt werden kann.<br />
Zum anderen werden die Ergebnisse des Eingangstestes mit den<br />
Ergebnissen des nach den Trainingseinheiten durchzuführenden<br />
Ausgangstestes verglichen, um die Effektivität des Trainings beurteilen<br />
zu können.<br />
Der Eingangstest soll also Aufgaben enthalten, die die Fertigkeiten des<br />
Schülers am BLG gut darstellen und außerdem leicht zu bewerten und<br />
zu vergleichen sind. Um die Bewältigung der verschiedenen Aufgaben<br />
67
Kapitel 4: Zusammenstellung eines individuellen Trainings<br />
schnell und einfach bewerten zu können, wird außerdem ein<br />
Bewertungsbogen erstellt. Dieser wird in Anlehnung an den<br />
Fragebogen von Falcon-Piva und Koob erstellt. 113<br />
Die einzelnen Kriterien des erstellten Bewertungsbogens wiederholen<br />
sich teilweise bei jeder Aufgabe. Dies ist sinnvoll, da es möglich ist,<br />
dass zum Beispiel die Bewegung des Kreuztisches beim Lesen sehr<br />
gut bewältigt wird, bei Aufgabe 2, „Auffinden von Figuren“ jedoch viel<br />
schwerer fällt, da die Grundaufgabe eine andere und ungewohntere ist.<br />
Im Anhang der Arbeit befinden sich jeweils ein Eingangstest <strong>für</strong> <strong>Kinder</strong><br />
mit Lese- und Schreibkenntnissen und ein Eingangstest <strong>für</strong> <strong>Kinder</strong>, die<br />
noch nicht lesen und schreiben können. Das Einstellen des BLG ist ein<br />
elementares Bewertungskriterium. Aus diesem Grund werden die<br />
Grundeinstellungen des BLG vor den Übungen so verändert, dass der<br />
Schüler diese in jedem Fall verbessern muss. Insgesamt soll der<br />
Eingangstest ungefähr 15 - 20 Minuten dauern. Dies sollte reichen, um<br />
genügend Beobachtungen <strong>für</strong> die Bewertung zu sammeln, ohne die<br />
Schüler zu überfordern.<br />
Die Durchführung des Eingangstests findet an einem gesonderten<br />
Termin statt, dieser sollte nicht mit dem ersten Training<br />
zusammengelegt werden, da sich die Zusammensetzung des<br />
Trainingsaufbaus an den Ergebnissen des Eingangstests orientiert.<br />
Neben der Durchführung des Eingangstests werden außerdem<br />
Vergrößerungsbedarf, Kontrastsehen und Farbensehen des Schülers<br />
überprüft. Nur wenn Vergrößerungsbedarf und Kontrastempfindlichkeit<br />
bekannt sind, kann die Sinnhaftigkeit der Einstellungen am<br />
Bildschirmlesegerät beurteilt werden; die Qualität des Farbensehens ist<br />
wichtig <strong>für</strong> die richtige Auswahl der Übungen.<br />
Im Rahmen dieser Arbeit wir der Vergrößerungsbedarf mithilfe der ‚SZB<br />
Chart‘ <strong>für</strong> <strong>Kinder</strong> mit Sehbehinderung ermittelt. Für die Sehschärfe bei<br />
geringem Kontrast wird die ‚SZB Bailey-Lovie-Chart‘ mit geringem<br />
Kontrast (10%) verwendet und das Farbensehen wird mit dem ‚D 15<br />
Farnsworth Test‘ überprüft.<br />
113 Vgl. Falcón-Piva, A.; Koob, A.; Handhabungstraining am Bildschirmlesegerät,<br />
2009, S.32 ff.<br />
68
Kapitel 4: Zusammenstellung eines individuellen Trainings<br />
Außerdem wird während des Eingangstests die Positionierung des<br />
BLG´s dokumentiert. Diese werden mit den in 3.2 erläuterten<br />
Anforderungen verglichen und gegebenenfalls <strong>für</strong> die folgenden<br />
Übungseinheiten und den Ausgangstest optimiert.<br />
4.2.3.2 Aufbau des Eingangstestes<br />
Aufgabe 1:<br />
Der Schüler bekommt die Aufgabe, einen Text zu lesen. Die<br />
verwendeten Texte werden den Deutschbüchern der jeweiligen<br />
Unterrichtsklasse entnommen, um die Schüler damit weder zu über-<br />
noch zu unterfordern.<br />
Der jeweilige Schüler stellt sich zunächst das BLG so ein, dass er in der<br />
Lage ist, den Text zu lesen. Es wird zum einen bewertet, wie lange der<br />
Schüler benötigt, um alle Einstellungen vorzunehmen, außerdem wird<br />
die Sinnhaftigkeit und Planmäßigkeit der Einstellungen bewertet. Die<br />
‚Planmäßigkeit‘ meint dabei, wie systematisch der Proband vorgeht und<br />
wie sicher er sich bei der Bedienung der einzelnen Elemente ist. Unter<br />
dem Punkt ‚Sinnhaftigkeit‘ wird bewertet, inwiefern die Einstellungen<br />
des Schülers seinen Bedürfnissen entsprechen. Um dies bewerten zu<br />
können, wird der Schüler nach der Aufgabe nach den Gründen <strong>für</strong> sein<br />
Vorgehen befragt. Außerdem wird geprüft, ob der gewählte<br />
Abbildungsmaßstab notwendig ist, oder ob vielleicht ein geringerer<br />
Maßstab sinnvoller wäre.<br />
Weiterhin wird die Lesegeschwindigkeit in Wörtern pro Minute<br />
gemessen und im Anschluss durch 3 Fragen das Textverständnis<br />
kontrolliert. Ein besonderes Augenmerk wird darauf gelegt, wie der<br />
Schüler den Zeilensprung vom Ende der ersten Zeile zum Anfang der<br />
nächsten Zeile bewältigt. Sollten hier Unsicherheiten auftreten, sodass<br />
der Schüler z. B. zwischen den Zeilen verrutscht, wird dies vermerkt.<br />
Des Weiteren wird auch die Platzierung des Lesegutes auf dem<br />
Kreuztisch beobachtet und die Bewegung des Kreuztisches beurteilt.<br />
69
Kapitel 4: Zusammenstellung eines individuellen Trainings<br />
Aufgabe 2:<br />
Der Schüler soll in Aufgabe 2 alle auf dem Zettel abgebildeten Kreise<br />
und Sterne einkreisen. Das Auffinden der einzelnen Figuren ist<br />
unterschiedlich schwer. Während große, kontrastreiche Figuren, die<br />
mittig auf dem Arbeitsblatt abgebildet sind, auf den ersten Blick zu<br />
erkennen sind, sind kleine und kontrastarme Figuren oder auch<br />
besonders diejenigen ohne Farbfüllung nur mit der richtigen Einstellung<br />
am BLG auffindbar. Am Rand des Arbeitsblattes liegende Figuren<br />
werden möglicherweise nur gefunden, wenn dieses systematisch<br />
abgesucht wird. Auch das Einkreisen der Figuren ist je nach Größe des<br />
Kreises bzw. des Sterns unterschiedlich schwer.<br />
Die Bewertungskriterien der Aufgabe 2 lauten wie folgt:<br />
Zunächst werden auch hier die Schnelligkeit, Sinnhaftigkeit und<br />
Planmäßigkeit der Einstellungen am BLG beurteilt. Weiterhin wird<br />
beobachtet, mit welcher Systematik das Blatt abgesucht wird. Das<br />
Umkreisen der einzelnen Figuren gibt außerdem erste Anhaltspunkte<br />
<strong>für</strong> die Fertigkeiten des Schülers, was das Schreiben unter dem BLG<br />
betrifft. Der Umgang mit dem Schreibgerät sowie die Hand-Auge-<br />
Koordination werden hier bewertet. Zusätzliches Bewertungskriterium<br />
ist die Anzahl der gefundenen Figuren.<br />
Aufgabe 3:<br />
Hier soll der Schüler einen Gegenstand auf einem Wimmelbild finden,<br />
diesen dann genau betrachten und ein Detail benennen.<br />
Bewertet werden auch hier wieder die Schnelligkeit, Sinnhaftigkeit und<br />
Planmäßigkeit der Einstellungen am BLG. Besonders wird dabei auf<br />
den Übergang von der Überblick- auf die Detaileinstellungen geachtet.<br />
Des Weiteren wird beurteilt, mit welcher Systematik der Schüler das AB<br />
nach dem entsprechenden Gegenstand absucht und inwiefern hier<strong>für</strong><br />
die Bewegung des Kreuztisches eingesetzt wird.<br />
Aufgabe 4:<br />
Der Schüler bekommt die Aufgabe, einen Text zu schreiben. Auch hier<br />
sollen wieder Texte oder Übungen aus dem jeweiligen Unterricht<br />
70
Kapitel 4: Zusammenstellung eines individuellen Trainings<br />
verwendet werden, sodass die Aufgabe dem Lernentwicklungsstand<br />
des Schülers entspricht.<br />
Die Erfüllung der Aufgabe wird anhand der folgenden Kriterien<br />
bewertet:<br />
Zunächst wird wieder beurteilt, wie schnell, zweck- und planmäßig der<br />
Schüler sich das BLG einstellt. Außerdem wird überprüft, wie der<br />
Schüler den Stift unter dem BLG handhabt. Es wird gemessen, wie<br />
viele Wörter bzw. Buchstaben der Schüler in der vorgegebenen Zeit<br />
schreibt und welche Qualität das Schriftbild vorweist. Des Weiteren wird<br />
beobachtet, wie die Hand-Auge-Koordination ausfällt und ob das<br />
Arbeitsblatt auf dem Kreuztisch richtig platziert und bewegt wird.<br />
Aufgabe 5<br />
Diese Aufgabe ist optional und wird nur durchgeführt, wenn das BLG<br />
auch als Tafelgerät genutzt wird.<br />
Der Schüler soll hier einen an der Tafel befestigten Zettel im Din A4<br />
Format auffinden und den darauf abgebildeten Text vorlesen.<br />
Bewertet wird bei Aufgabe 5 wiederum die Plan- und Sinnhaftigkeit der<br />
Einstellungen am BLG, außerdem wird die Zeit gemessen, die benötigt<br />
wird, um das Arbeitsblatt zu finden. Desweiteren wird der Zeilensprung<br />
und das Verfolgen der einzelnen Textzeilen mithilfe der Kamera<br />
beurteilt.<br />
4.2.3.3 Kritik am Eingangstest<br />
Während der Durchführung des Eingangstestes sind verschiedene<br />
Punkte deutlich geworden, die bei einer erneuten Durchführung<br />
geändert werden sollten.<br />
Für die Ausführung der einzelnen Aufgaben wurde zunächst geplant,<br />
dem Schüler jeweils zwei Minuten Zeit zu geben, die Aufgabe dann<br />
abzubrechen und das Ergebnis z. B. nach Anzahl der geschriebenen<br />
Worte zu bewerten. Grund hier<strong>für</strong> war unter anderem, dass der<br />
Eingangstest inklusive der Zeiten <strong>für</strong> Einstellungen am BLG nur ca. 20<br />
Minuten dauern sollte, um ein Absinken der Konzentration des Schülers<br />
zu verhindern.<br />
71
Kapitel 4: Zusammenstellung eines individuellen Trainings<br />
Dies hat sich in der Praxis nicht als sinnvoll erwiesen, da ein Abbrechen<br />
der jeweiligen Aufgabe <strong>für</strong> den Schüler demotivierend wirkt. Besser ist<br />
es, die Aufgaben vollständig ausführen zu lassen und die <strong>für</strong> die<br />
Aufgabe benötigte Zeit zu bewerten. Dies hat sich direkt bei der<br />
Durchführung der ersten Aufgabe gezeigt, weswegen das Vorgehen<br />
sofort geändert wurde.<br />
Des Weiteren ist das Vorgehen, die Einstellungen des BLG vor jeder<br />
Aufgabe so zu verändern, dass es <strong>für</strong> den Schüler ungünstig ist, kritisch<br />
zu betrachten. Zwar lässt sich durch dieses Vorgehen gut beobachten,<br />
wie der Proband beim Ändern der Einstellungen vorgeht. Allerdings<br />
kann der Proband, sollte er die Einstellungen nicht zu seinen Gunsten<br />
ändern können, die komplette Aufgabe nicht lösen. Hierdurch könnt<br />
sich Frustration auf Seiten des Schülers einstellen, außerdem könnten<br />
dann die restlichen aus der Aufgabe folgenden Bewertungspunkte<br />
möglicherweise nicht beurteilt werden.<br />
Bei der Erprobung des Eingangstests wurde dies so gelöst, dass dem<br />
Probanden bei der Einstellung von Vergrößerung, Farbe und Kontrast<br />
geholfen wurde; die Bewertung der Einstellungen erfolgte dann mit der<br />
Schulnote 5.<br />
Für den Bewertungsbogen hat es sich außerdem als sinnvoll erwiesen,<br />
die Bewertung der Planmäßigkeit der Einstellungen <strong>für</strong> die Funktionen<br />
Abbildung, Kontrast, Farbe und Helligkeit einzeln vorzunehmen.<br />
Außerdem soll, falls kein Kreuztisch vorhanden ist, der entsprechende<br />
Teil des Bewertungsbogens nicht wegfallen, sondern durch eine<br />
Bewertung der Bewegung von Handkamera oder Arbeitsmaterial<br />
ersetzt werden.<br />
4.3 Zusammenstellung der Übungsbausteine<br />
Auf Grundlage der Ergebnisse der verschiedenen Fragebögen sowie<br />
des Eingangstestes wird das individuelle Training <strong>für</strong> den Schüler<br />
erstellt. Aus den in Kapitel 3 vorgestellten Übungsbausteinen werden<br />
Aufgaben ausgewählt, die besonders auf die Bereiche eingehen, in<br />
denen der jeweilige Schüler Übungsbedarf hat und deren<br />
Schwierigkeitsgrad dem Können des Schülers entspricht.<br />
72
Kapitel 4: Zusammenstellung eines individuellen Trainings<br />
Die Beobachtungen während der Durchführung der ersten<br />
Übungseinheit können in die Auswahl der Übungen <strong>für</strong> weitere<br />
Einheiten mit einfließen.<br />
Im Rahmen dieser Arbeit werden drei Trainingseinheiten durchgeführt,<br />
die jeweils ungefähr eine Stunde dauern. Die Übungseinheiten erfolgen<br />
an drei aufeinanderfolgenden Tagen. Am darauf folgenden Tag wird der<br />
Ausgangstest durchgeführt.<br />
Außerhalb der Untersuchungen dieser Arbeit macht es möglicherweise<br />
Sinn, mehr Trainingseinheiten durchzuführen. Um dies zu beurteilen,<br />
sollte der Fortschritt des Schülers beobachtet werden.<br />
4.4 Ausgangstest<br />
Der Ausgangstest soll als Abschluss nach Ablauf des Trainings mit dem<br />
Probanden durchgeführt werden. Die Ergebnisse des Ausgangstestes<br />
werden dann mit den Ergebnissen des Eingangstestes verglichen, um<br />
die Effektivität der Schulung zu bewerten.<br />
Um einen sinnvollen Vergleich zwischen Ein- und Ausganstest<br />
durchführen zu können, werden der Aufbau und die Art der Aufgaben<br />
<strong>für</strong> den Ausgangstest genau vom Eingangstest übernommen.<br />
Es werden zwar andere Texte und Bilder <strong>für</strong> die Aufgaben gewählt, um<br />
zu vermeiden, dass die Ergebnisse durch einen Übungseffekt verfälscht<br />
werden, im Schwierigkeitsgrad entsprechen sie aber denen des<br />
Eingangstestes.<br />
Auch die Bewältigung des Ausgangstests wird mithilfe eines<br />
Bewertungsbogens beurteilt. Dieser ist der Gleiche, der auch <strong>für</strong> den<br />
Eingangstest verwendet wird.<br />
Der Ausgangstest soll an einem gesonderten Termin, nicht direkt nach<br />
der letzten Trainingsstunde ausgeführt werden, damit die<br />
Rahmenbedingungen denen des Eingangstestes entsprechen. Die<br />
Durchführung direkt nach der letzten Trainingsstunde könnte die<br />
Ergebnisse verfälschen, da die Schüler einerseits durch das Training<br />
erschöpft sein könnten, andererseits aber auch in dem Moment durch<br />
das Training so an die Arbeit mit dem BLG gewöhnt sind, dass die<br />
Ergebnisse besser ausfallen als z. B. ein paar Tage später.<br />
73
Kapitel 5: Erprobung des <strong>Hilfsmitteltraining</strong>s<br />
5 Erprobung des <strong>Hilfsmitteltraining</strong>s<br />
5.1 Ablauf<br />
Das <strong>Hilfsmitteltraining</strong> wird zur Demonstration des Vorgehens und zur<br />
Kontrolle der Effektivität mit einer Probandin durchgeführt, diese ist<br />
Schülerin der Irisschule in Münster.<br />
Zunächst wird durch Fragebögen und Eingangstest der Trainingsbedarf<br />
der Schülerin geklärt. Außerdem werden Vergrößerungsbedarf,<br />
Kontrastempfindlichkeit und Farbwahrnehmung getestet. So kann bei<br />
den Übungen berücksichtigt werden, wenn z. B. gar keine<br />
Farbwahrnehmung vorliegen sollte.<br />
Aufbauend auf die Testergebnisse wird aus den in Kapitel 4<br />
vorgestellten Trainingsbausteinen eine Schulung zusammengestellt, die<br />
auf drei Schulungstermine á je einer Stunde Dauer ausgelegt ist. Die<br />
Ergebnisse des vorangegangenen Übungstermins werden bei der<br />
Zusammenstellung der Übungen <strong>für</strong> den jeweils nächsten Termin<br />
berücksichtigt.<br />
Im Anschluss wird durch den Ausgangstest der erzielte Fortschritt im<br />
Umgang mit dem BLG ermittelt.<br />
5.2 Vorstellung der Probandin<br />
Die Probandin ist sechs Jahre alt und besucht die Klasse E, also das<br />
erste Schulbesuchsjahr der Irisschule in Münster, welches allerdings<br />
nicht einer ersten Grundschulklasse entspricht, sondern ein<br />
Einführungsjahr darstellt.<br />
Bei der Probandin besteht eine Netzhautdystrophie und Verdacht auf<br />
eine Farbsinnstörung. Der Vergrößerungsbedarf Γ‘Bedarf der Probandin<br />
wurde während des Einganstestes ermittelt und liegt bei 8x. Der D 15<br />
Farnsworth Farblegetest ergab keine wesentlichen Irrtümer, es liegt<br />
also keine offensichtliche Farbfehlsichtigkeit vor. Der Low- Contrast-<br />
Visus der Probandin liegt bei 0,025.<br />
Sie kann bereits lesen und auch alle Buchstaben schreiben, die Form<br />
einiger Buchstaben weicht jedoch von der gelehrten Druckschrift ab, da<br />
74
Kapitel 5: Erprobung des <strong>Hilfsmitteltraining</strong>s<br />
diese noch nicht in der Schule behandelt wurden, sondern die<br />
Probandin sie sich selbst beigebracht hat.<br />
Die Probandin ist sehr motiviert und ehrgeizig, sie sieht <strong>für</strong> sich selbst<br />
einen Sinn in der Schulung und hofft, durch die Schulung bestimmte<br />
Aufgaben besser lösen zu können.<br />
Sie gibt an, gerne mit dem BLG zu arbeiten, dabei macht ihr das Lesen<br />
mithilfe des Gerätes mehr Spaß als ohne, beim Schreiben und Malen<br />
verhält es sich umgekehrt.<br />
Die Einstellung des Abbildungsmaßstabes wird von der Probandin nach<br />
eigenen Angaben oft und gerne genutzt, Farbe und Kontraste werden<br />
weniger gerne umgestellt, das Zeilenlineal und die Zeilenabdeckung<br />
sind nicht bekannt.<br />
In der Schule verwendet sie das BLG „Videomatik Lux“ von Reinecker.<br />
Dies ist ein geschlossenes System aus Kreuztisch, Kamera und<br />
Flachbildschirm. Das Gerät bietet einen Abbildungsmaßstab zwischen<br />
3,5x und 100x, als Farbeinstellungen lassen sich Echtfarbmodus,<br />
schwarz auf weiß, weiß auf schwarz und drei verschiedene<br />
Fehlfarbenmodi einstellen. Das Gerät besitzt einen abstellbaren<br />
Autofocus, eine Einblendung von Zeilenlineal sowie Zeilenabdeckung<br />
ist möglich. Der Flachbildschirm hat eine Bilddiagonale von 43 cm bzw.<br />
17 Zoll und ist schwenkbar.<br />
Das BLG wird von der Schülerin seit ca. 5 Monaten zum Lesen,<br />
Schreiben, Malen und gelegentlich zum Basteln verwendet.<br />
Die Bewertung des Umgangs mit dem BLG durch die Lehrerin zeigt,<br />
dass speziell bei der Verwendung verschiedener Farb- und<br />
Kontrasteinstellungen sowie bei der Bedienung des Kreuztisches und<br />
beim Schreiben mithilfe des BLG‘s Übungsbedarf besteht. Besonders<br />
der Wechsel zwischen verschiedenen Einstellungen, z. B. beim<br />
Wechsel von Überblick zu Details, wird als schwierig bewertet.<br />
Die Probandin verwendet zuhause ebenfalls seit zwei Monaten ein<br />
BLG, und zwar das „CCTV II Duo Kameralesesystem“ von Steller. Hier<br />
wurde von der Firma Steller bereits eine Schulung durchgeführt, in der<br />
das Lesen mit dem BLG geübt wurde und die Einstellungen von<br />
Vergrößerung, Farbe und Kontrast gezeigt wurden. Das Gerät von<br />
75
Kapitel 5: Erprobung des <strong>Hilfsmitteltraining</strong>s<br />
Steller unterscheidet sich von dem in der Schule verwendeten Gerät<br />
von Reinecker unter anderem dadurch, dass hier eine Handkamera<br />
verwendet wird und so die Kreuztischnutzung wegfällt.<br />
Die Befragung der Eltern und der Probandin selbst zeigt, dass das<br />
Schreiben mithilfe des BLG noch schwer fällt und dies deswegen noch<br />
lieber ohne Lesegerät gemacht wird, außerdem beschreibt die<br />
Probandin selber, dass sie Schwierigkeiten bei der Einstellung von<br />
Farbe und Kontrast hat.<br />
Da die zu erstellende Schulung am Gerät in der Schule durchgeführt<br />
werden soll, wird das Training auf die Bedürfnisse am Reinecker-Gerät<br />
angepasst.<br />
Die Probandin selber wünscht sich, Aufgaben wie „Malen nach Zahlen“<br />
oder auch Zahlenbilder mit dem BLG ausführen zu können. Hierauf soll<br />
während des Trainings Rücksicht genommen werden.<br />
5.3 Ergebnisse des Eingangstestes<br />
Das Bildschirmlesegerät steht seitlich zum Fenster, und ist im<br />
Klassenraum aufgrund eines rollbarem Untergestells frei beweglich.<br />
Abbildung 31 : Position des BLG‘s zum Fenster<br />
Der Monitor ist so eingestellt, dass die untere Hälfte des Bildschirmes<br />
auf Augenhöhe der Probandin steht.<br />
76
Kapitel 5: Erprobung des <strong>Hilfsmitteltraining</strong>s<br />
Abbildung 32: Die Sitzhaltung der Probandin vor ihrem BLG<br />
Der Kreuztisch befindet sich ungefähr auf Ellbogenhöhe, der Tisch auf<br />
dem das BLG steht, besitzt eine Fußablage. Neben dem BLG steht ein<br />
weiterer Tisch, auf dem Unterlagen abgelegt werden und Arbeiten<br />
erledigt werden können, <strong>für</strong> die das BLG nicht benötigt wird.<br />
Abbildung 33 : Positionierung des Bildschirmlesegerätes im<br />
Klassenraum<br />
Der Eingangstest zeigt, dass die einzelnen Funktionen des BLG´s der<br />
Probandin bekannt sind und schnell und planmäßig eingestellt werden.<br />
Die Probandin verwendet die meiste Zeit nur einen Abbildungsmaßstab,<br />
und zwar 5,8x. Bei einer Entfernung vom Monitor von 20 cm entspricht<br />
dies aufgrund der Vergrößerung durch Annäherung und den Formeln<br />
Γ‘ges = β’Hilfsmittel x Γ’Annäherung<br />
77
Kapitel 5: Erprobung des <strong>Hilfsmitteltraining</strong>s<br />
und<br />
Γ’Ann = 25cm/aE(in cm).<br />
einer Vergrößerung von 7,25. Wird die <strong>für</strong> die Ermittlung des<br />
Vergrößerungsbedarfs zugrundegelegte Versalhöhe von 2 mm<br />
berücksichtigt, ergibt sich durch die im Eingangstest verwendeten<br />
Schriftgrößen mit Versalhöhen zwischen 3,1 und 9,0 mm mit<br />
Γ’Objekt= �<br />
� =β‘<br />
eine zusätzliche Objektvergrößerung von 1,55x bis 4,5x. Daraus<br />
resultieren aufgrund von<br />
Γ‘ges = β’Hilfsmittel x Γ’Annäherung x Γ’Obj<br />
Gesamtvergrößerungen zwischen 11,24 und 32,62. Dies wird auch bei<br />
verschiedenen Schriftgrößen der Vorlage nicht geändert. Der dadurch<br />
entstehende unterschiedliche Vergrößerungsbedarf wird durch<br />
Vergrößerung durch Annäherung kompensiert. Dies stützt die von der<br />
Lehrerin beschriebene Beobachtung, dass selten zwischen<br />
verschiedenen Einstellungen gewechselt wird.<br />
Die Probandin bewegt sowohl beim Lesen als auch beim Absuchen von<br />
Bildern das Arbeitsmaterial auf dem Kreuztisch hin und her, bewegt<br />
allerdings nicht oder nur wenig den Kreuztisch an sich. Das<br />
Arbeitsmaterial liegt hierdurch nicht gerade und mittig an der hier<strong>für</strong><br />
vorgesehenen Kante des Kreuztisches.<br />
Beim Schreiben führt die Probandin den Kreuztisch hin und her und hält<br />
das Arbeitsblatt auf dem Kreuztisch fest.<br />
Die Probandin schreibt bei einem Abbildungsmaßstab von 4,8x und<br />
einem Abstand von 10cm vom Bildschirm, dies entspricht einer<br />
Vergrößerung von 12x. Bei einer Versalhöhe der geschriebenen<br />
Buchstaben von 9 mm ergibt sich, unter Berücksichtigung der <strong>für</strong> die<br />
Leseprobe zugrunde gelegten Versalhöhe von 2 mm, eine zusätzliche<br />
78
Kapitel 5: Erprobung des <strong>Hilfsmitteltraining</strong>s<br />
Vergrößerung von 4x, sodass die Schülerin bei einer<br />
Gesamtvergrößerung von 48x schreibt. Die Probandin setzt beim<br />
Schreiben sehr viel Kreuztischbewegung ein, um die Zeilen ganz<br />
bearbeiten zu können.<br />
Sowohl <strong>für</strong> die Lese- als auch <strong>für</strong> die Schreibaufgaben stellt sich die<br />
Probandin sehr sicher die ihr angenehmste Fehlfarbe ein.<br />
Bei Bildern, die die Einstellung des Echtfarbmodus erforderlich machen,<br />
hat die Probandin Schwierigkeiten, Helligkeit und Farbe kombiniert so<br />
einzustellen, dass ein <strong>für</strong> sie angenehmes Bild entsteht, bei Aufgabe 2<br />
werden manche Figuren nicht sichtbar, da Kontrast und Helligkeit dies<br />
nicht zulassen.<br />
Das Absuchen des Arbeitsmaterials geschieht ohne Suchsystematik, so<br />
dass Lücken entstehen. Auch hier wird statt des Kreuztisches das<br />
Arbeitsmaterial bewegt.<br />
5.4 Auswertung des Eingangstestes<br />
Die Positionierung des Bildschirmlesegerätes ist insgesamt gut. Der<br />
Monitor steht <strong>für</strong> die Probandin zwar etwas zu hoch, dies lässt sich<br />
jedoch nicht ändern, da die vorhandenen Möbel dies nicht zulassen,<br />
allerdings ist durch richtige Positionierung des Leseguts trotzdem ein<br />
komfortables Lesen möglich. (Siehe Kapitel 3.2) Die Probandin kann<br />
bequem sehr nahe an den Monitor rangehen, hat genügend Beinfreiheit<br />
und ausreichend Platz <strong>für</strong> Unterlagen, auch außerhalb des<br />
Kreuztisches. Dieser hat die richtige Höhe, so dass er leicht bewegt<br />
werden kann. Durch die seitliche Positionierung zum Fenster tritt keine<br />
Blendung durch Sonnenlicht auf. Eine Änderung der Positionierung des<br />
Bildschirmlesegerätes ist also nicht notwendig.<br />
Probandin 1 hat bei der Lösung der Aufgaben des Eingangstestes<br />
gezeigt, dass sie bereits sehr sicher mit dem Bildschirmlesegerät<br />
umgehen kann.<br />
Die einzelnen Funktionen des BLG´s sind ihr bekannt, sie weiß genau,<br />
<strong>für</strong> welche Einstellungen die einzelnen Knöpfe verwendet werden.<br />
Trotzdem gibt es einige Aspekte, in denen der Umgang mit dem BLG<br />
verbessert werden kann:<br />
79
Kapitel 5: Erprobung des <strong>Hilfsmitteltraining</strong>s<br />
Die <strong>für</strong> das Lesen verwendete Gesamtvergrößerung zwischen 11,24<br />
und 32,62 ist wesentlich höher als die durch den Vergrößerungsbedarf<br />
zu erwartende. Es ist zu klären ob diese <strong>für</strong> die Probandin wirklich nötig<br />
ist, oder ob ein kleinerer Abbildungsmaßstab, verbunden mit einem<br />
größeren Bildausschnitt, sinnvoller wäre.<br />
Dies gilt ebenfalls <strong>für</strong> die <strong>für</strong> das Schreiben verwendete Vergrößerung<br />
von 48x. Hier wird bereits während des Eingangstestes deutlich, dass<br />
das Schreiben durch den kleinen Bildausschnitt und die dadurch nötige<br />
Kreuztischbewegung eingeschränkt wird.<br />
Die Probandin bewegt allerdings meist das Arbeitsmaterial anstatt des<br />
Kreuztisches, dies erschwert den Zeilensprung sowie das Absuchen<br />
von Bildern, da der Bewegungsspielraum auf dem Kreuztisch begrenzt<br />
ist. Hierdurch und durch die fehlende Suchsystematik entstehen Lücken<br />
beim Absuchen von Arbeitsmaterial nach bestimmten Details.<br />
Außerdem positioniert die Probandin das Arbeitsmaterial nicht optimal<br />
auf dem Kreuztisch, hierdurch werden das Verfolgen von Zeilen beim<br />
Lesen und der Zeilensprung eingeschränkt.<br />
Während des Schreibens wird der Kreuztisch nicht arretiert, dies führt<br />
zu unkontrollierten Bewegungen, die das Schreiben erschweren und<br />
den Überblick über die Zeilen verloren gehen lassen.<br />
Insgesamt wird selten zwischen verschiedenen Abbildungsmaßstäben<br />
gewechselt, die Einstellung von Helligkeit und Kontrast ist unsicher und<br />
wird ebenfalls selten geändert.<br />
5.5 Zusammenstellung der Übungsbausteine<br />
Das Training <strong>für</strong> die Probandin soll besonders folgende Aspekte<br />
beinhalten:<br />
Der Wechsel zwischen verschiedenen Einstellungen, sowohl den<br />
Abbildungsmaßstab als auch die Kontrast- und Farbeinstellungen<br />
betreffend, soll geübt werden. Hierzu können Übungen der<br />
Schwierigkeitsstufe ‚Grundkenntnisse‘ verwendet werden, da der<br />
Umgang mit den Funktionen an sich der Schülerin bereits bekannt sind.<br />
80
Kapitel 5: Erprobung des <strong>Hilfsmitteltraining</strong>s<br />
Außerdem soll der Umgang mit dem Kreuztisch und die richtige Auflage<br />
des Arbeitsmaterials beim Lesen und Schreiben trainiert werden. Des<br />
Weiteren werden der Probandin die verschiedenen Methoden zur<br />
Orientierung auf dem Arbeitsblatt und Auffinden von Details an<br />
dazugehörigen Aufgaben erläutert. Dazu werden zunächst<br />
Einführungsübungen verwendet.<br />
Die Trainingseinheiten werden nicht im Klassenzimmer sondern in<br />
einem gesonderten Raum durchgeführt, um den normalen Verlauf des<br />
Schulunterrichts zu stören und im Gegenzug auch nicht von Mitschülern<br />
oder Lehrern unterbrochen zu werden.<br />
Trainingseinheit 1<br />
In der ersten Trainingseinheit werden der Probandin Aufgaben gestellt,<br />
die ihr den Nutzen der verschiedenen Funktionen und dem häufigen<br />
Ändern der Einstellungen bewusst machen sollen.<br />
Da die Einstellung des Abbildungsmaßstabes der Probandin keine<br />
Schwierigkeiten bereitet, wird hierzu die [G]- Übung gewählt, und zwar<br />
mit größer werdenden Buchstaben. So soll der Probandin gezeigt<br />
werden, weshalb der Abbildungsmaßstab bei größeren Buchstaben<br />
verringert werden soll. Dabei wird auf den schlechteren<br />
Gesamtüberblick sowie die vermehrte und durch die höhere<br />
Geschwindigkeit erschwerte Kreuztischbedienung hingewiesen.<br />
Die Bewegung des Kreuztisches wird anhand der Übung<br />
Kreuztischbewegung [G] trainiert. Der Probandin wird hierbei erklärt,<br />
dass das Arbeitsblatt möglichst an der da<strong>für</strong> vorgesehenen Kante<br />
platziert werden soll. Außerdem werden die Systematik beim<br />
Zeilensprung und der Nutzen des Zeilenlineals erläutert.<br />
Des Weiteren wird der Probandin am ersten Trainingstag die<br />
Suchtechnik Scanning erläutert. Diese wird an den Übungen<br />
‚Orientierung auf dem Arbeitsblatt‘ [E1] und [E2] geübt, da bisher noch<br />
keine Systematik beim Absuchen genutzt wird.<br />
Die Hand- Auge- Koordination bereitet der Probandin kaum Probleme,<br />
deswegen wird der erste Übungstag mit der Übung Hand-Auge-<br />
Koordination [F] abgeschlossen<br />
81
Kapitel 5: Erprobung des <strong>Hilfsmitteltraining</strong>s<br />
Trainingseinheit 2<br />
Am zweiten Übungstag werden zunächst Wiederholungsaufgaben<br />
gestellt, um die Erkenntnisse des Vortages zu festigen.<br />
Hierzu werden die Übungen ‚Orientierung auf dem Arbeitsblatt‘ [E1]<br />
sowie [E2] unter Verwendung anderer Bilder wiederholt, außerdem wird<br />
die Übung ‚Abbildungsmaßstab [E]‘ als einfache Wiederholung <strong>für</strong> die<br />
Einstellung des Abbildungsmaßstabes gewählt. Auf Wunsch der<br />
Probandin wird diese Übung außerdem in Verbindung mit<br />
Matheaufgaben wiederholt.<br />
Um auch die Suchmethodik ‚Tracking‘ zu trainieren, wird am zweiten<br />
Übungstag außerdem die Aufgabe ‚Orientierung auf dem Arbeitsblatt<br />
[G] gestellt, diese wiederholt zudem dass Scanning und die richtige<br />
Bewegung des Kreuztisches.<br />
Die Bewegung des Kreuztisches wird zusätzlich durch die [F]-Übung zu<br />
dieser Funktion trainiert.<br />
Um die richtige Handhabung bei der Einstellung des<br />
Abbildungsmaßstabes zu vertiefen, wird die Aufgabe<br />
Abbildungsmaßstab [F] gestellt.<br />
Als Abschlussübung wird die Aufgabe ‚Farbe und Kontrast‘ [F] gewählt,<br />
um den Umgang mit diesen Funktionen zu festigen.<br />
Trainingseinheit 3<br />
Am dritten und letzten Übungstag sollen die im Voraus vermittelten<br />
Kenntnisse vertieft und gefestigt werden.<br />
Als Einstieg wird wiederum die Aufgabe ‚Orientierung auf dem<br />
Arbeitsblatt‘[E] mit geändertem Bild verwendet.<br />
Die Einstellung von Farbe und Kontrast wird mit der [F] Übung geschult.<br />
Außerdem wird wie am Vortag auf Wunsch der Probandin der<br />
Abbildungsmaßstab im Schwierigkeitsgrad [F] an Matheaufgaben<br />
geübt. Des Weiteren werden zwei Aufgaben zur kombinierten Nutzung<br />
der Funktionen gestellt.<br />
82
Kapitel 5: Erprobung des <strong>Hilfsmitteltraining</strong>s<br />
5.6 Ergebnisse des Ausgangstests<br />
Der Ausgangstest hat zu folgenden Ergebnissen geführt:<br />
Für das Lesen verwendet die Probandin den Abbildungsmaßstab 5,3.<br />
Bei einem Abstand zum Monitor zwischen fünf cm <strong>für</strong> das Lesen der<br />
kleinsten Schrift und zehn cm <strong>für</strong> das Lesen der größten Schrift. Dies<br />
entspricht einer Vergrößerung von 25x bis 12,5x, unter<br />
Berücksichtigung der verschiedenen Schriftgrößen und der daraus<br />
resultierenden Objektvergrößerung von 1,55x bzw. 4,5x entstehen<br />
Gesamtvergrößerungen von 38,75 <strong>für</strong> die kleine und 56,25 <strong>für</strong> die<br />
große Schrift. Die Formeln <strong>für</strong> die Berechnung der<br />
Gesamtvergrößerungen entsprechen den unter 5.3 genannten.<br />
Das Arbeitsmaterial wird von der Probandin gerade und mittig an die<br />
hintere Kante des Kreuztisches gelegt, zum Lesen und Absuchen des<br />
Arbeitsmaterials wird der Kreuztisch bewegt.<br />
Die Probandin schreibt bei dem kleinstmöglichen Abbildungsmaßstab<br />
von 3,5x und einer Entfernung vom Bildschirm von sechs cm, dies<br />
entspricht einer Vergrößerung von 14,5x, bzw. unter der<br />
Berücksichtigung der Versalhöhe eine Gesamtvergrößerung von<br />
58,33x.<br />
Die Probandin arretiert während des Schreibens an sich den<br />
Kreuztisch, bewegt aber diesen und nicht das Arbeitsblatt, wenn ein<br />
anderer Ausschnitt betrachtet werden soll.<br />
Sowohl <strong>für</strong> das Lesen als auch <strong>für</strong> das Schreiben stellt sich die<br />
Probandin sehr sicher die ihr angenehmste Fehlfarbe ein. Auch beim<br />
Betrachten von Bildern werden Helligkeit, Farbe und Kontrast zielsicher<br />
und planmäßig eingestellt, sodass bei Aufgabe zwei alle Sterne und<br />
Kreise gefunden werden.<br />
Bei Aufgabe 2 und 3 wird das Arbeitsmaterial systematisch durch<br />
Scanning abgesucht, der Kreuztisch wird dabei sicher hin- und her<br />
bewegt.<br />
83
Kapitel 5: Erprobung des <strong>Hilfsmitteltraining</strong>s<br />
5.7 Vergleich von Ein- und Ausgangstest<br />
Für die vorzunehmenden Einstellungen am Bildschirmlesegerät hat die<br />
Probandin im Ausganstest bei drei von vier Aufgaben mehr Zeit<br />
benötigt als beim Eingangstest.<br />
Zeit in Sekunden<br />
Abbildung 34 : Benötitigte Zeit <strong>für</strong> die Einstellung des<br />
Bildschirmlesegerätes<br />
Dieses Ergebnis ist möglicherweise zurückzuführen auf eine höhere<br />
Genauigkeit und intensivere Beschäftigung mit der Frage nach der<br />
sinnvollsten Einstellung <strong>für</strong> die betreffende Aufgabe. Diese Vermutung<br />
wird gestützt durch die Tatsache, dass die Einstellungen bei allen<br />
Aufgaben sinnhafter zu sein scheinen, als dies im Eingangstest der Fall<br />
war.<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
Dauer der Einstellung<br />
Zu bearbeitende Aufgabe<br />
Eingagnstest<br />
Ausgangstest<br />
84
Kapitel 5: Erprobung des <strong>Hilfsmitteltraining</strong>s<br />
Abbildung 35: Planmäßigkeit und Sinnhaftigkeit der Einstellungen<br />
Die <strong>für</strong> die einzelnen Aufgaben benötigte Zeit hat sich bei Aufgabe 1<br />
erhöht, bei allen anderen Aufgaben verringert. Dies lässt die<br />
Schlussfolgerung zu, dass die im Ausgangstest gewählten<br />
Einstellungen <strong>für</strong> die Bearbeitung der Aufgaben sinnvoller waren.<br />
Dauer in Minuten<br />
Bewertung nach Schulnoten<br />
10<br />
8<br />
6<br />
4<br />
2<br />
0<br />
Ausführung der Einstellungen<br />
4<br />
3<br />
2<br />
1<br />
0<br />
Aufgabe<br />
1<br />
Aufgabe<br />
2<br />
Aufgabe<br />
3<br />
Zu bearbeitende Aufgabe<br />
Aufgabe<br />
4<br />
Dauer der Aufgabenbearbeitung<br />
Aufgabe 1 Aufgabe 2 Aufgabe 3 Aufgabe 4<br />
zu bearbeitende Aufgabe<br />
Planmäßigkeit/ET<br />
Planmäßigkei/AT<br />
Sinnhaftigkeit/ET<br />
Sinnhaftigkeit/AT<br />
Abbildung 36 : Für die einzelnen Aufgaben benötigte Zeit in Minuten<br />
Ein weiterer Grund <strong>für</strong> die schnellere Erledigung der Aufgaben ist<br />
möglicherweise die bessere Bedienung des Kreuztisches:<br />
Eingangstest<br />
Augangstest<br />
85
Kapitel 5: Erprobung des <strong>Hilfsmitteltraining</strong>s<br />
Bewertung nach<br />
Schulnoten<br />
Abbildung 37 : Bewertung der Kreuztischbewegung nach Schulnoten<br />
Diese hat sich bei jeder Aufgabe deutlich verbessert, da im<br />
Ausgangstest der Kreuztisch an sich und nicht wie im Eingangstest das<br />
Arbeitsmaterial bewegt wurde.<br />
Die Hand-Auge-Koordination der Probandin war bereits während des<br />
Eingangstestes beim Schreiben sehr gut. Beim Aufsuchen der Figuren<br />
bei Aufgabe zwei hat sie jedoch sehr oft auf das Blatt anstatt auf den<br />
Bildschirm geschaut. Dies wurde beim Ausgangstest unterlassen.<br />
Bewertung nach Schulnoten<br />
6<br />
4<br />
2<br />
0<br />
4<br />
3<br />
2<br />
1<br />
0<br />
Abbildung 38: Bewertung von Hand-Auge-Koordination und Stifthaltung<br />
nach Schulnoten<br />
Kreuztischbewegung<br />
Aufgabe 1 Aufgabe 2 Aufgabe 3 Aufgabe 4<br />
zu bearbeitende Aufgabe<br />
Eingangstest<br />
Ausgangstest<br />
Hand- Auge- Koordination und<br />
Stifthaltung<br />
Hand-Auge-<br />
Koordination/ET<br />
Aufgabe 2 Aufgabe 4<br />
zu bearbeitende Aufgabe<br />
Hand- Auge-<br />
Koordination AT<br />
Stifthaltung/ET<br />
Stifthaltung/AT<br />
Sowohl im Ein- als auch im Ausgangstest wurde die Stifthaltung der<br />
Probandin mit „sehr gut“ bewertet, der Stift wurde jeweils im<br />
86
Kapitel 5: Erprobung des <strong>Hilfsmitteltraining</strong>s<br />
Dreifingergriff gehalten und konnte immer direkt an die gewünschte<br />
Stelle geführt werden.<br />
Die Suchsystematik der Probandin hat sich durch das <strong>Hilfsmitteltraining</strong><br />
verbessert: Während des Eingangstestes wurde das Arbeitsmaterial<br />
ohne System abgesucht. Im Ausgangstest wurde die eingeübte<br />
Suchsystematik angewandt, sodass der Probandin ein beinahe<br />
lückenloses Absuchen der Bilder möglich war.<br />
Bewertung nach<br />
Schulnoten<br />
Abbildung 39 : Bewertung der Suchsystematik nach Schulnoten<br />
Zwar war die Lesbarkeit der Schrift der Probandin bereits während des<br />
Eingangstestes gut, allerdings variierten die Buchstabengrößen bei<br />
Aufgabe 4 und das Einhalten der vorgegebenen Lineatur war schwierig.<br />
Dies konnte im Ausgangstest verbessert werden:<br />
Bewertung nach<br />
Schulnoten<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
1<br />
0<br />
4<br />
3<br />
2<br />
1<br />
0<br />
Suchsystematik<br />
Aufgabe 2 Aufgabe 3<br />
zu bearbeitende Aufgabe<br />
Schriftbild<br />
Aufgabe 2 Aufgabe 4<br />
zu bearbeitende Aufgabe<br />
Suchsystematik<br />
Eingangstest<br />
Suchsystematik<br />
Ausgangstest<br />
Schriftbild<br />
Eingangstest<br />
Schriftbild<br />
Ausgangstest<br />
Abbildung 40: Bewertung des Schriftbildes nach Schulnoten<br />
Das bessere Schriftbild ist möglicherweise auf den kleiner gewählten<br />
Abbildungsmaßstab zurückzuführen. Hierdurch wird ein größerer<br />
87
Kapitel 5: Erprobung des <strong>Hilfsmitteltraining</strong>s<br />
Bildausschnitt auf dem Monitor abgebildet und die Probandin erhält<br />
einen besseren Überblick über die vorgegebene Lineatur und das am<br />
Anfang der Zeile vorgeschriebene Wort.<br />
Als weiterer Grund <strong>für</strong> das verbesserte Schriftbild ist das Arretieren des<br />
Kreuztisches denkbar.<br />
5.8 Ausgangsfragebogen <strong>für</strong> die <strong>Kinder</strong><br />
5.8.1 Aufbau des Fragebogens<br />
Nach Beendigung des Trainings wird mit der Probandin ein<br />
Ausgangsfragebogen ausgefüllt.<br />
Dieser fragt zunächst die gleichen Fragen ab, die bereits im<br />
Eingangsfragebogen beantwortet wurden. So werden Unterschiede<br />
festgestellt, was die Grundeinstellung des Schülers zum BLG betrifft.<br />
Weiterhin werden Fragen gestellt, die sich direkt auf das durchgeführte<br />
Training am BLG beziehen, um herauszufinden, ob die Testperson<br />
selbst einen Lernerfolg sieht. Außerdem sollen geklärt werden, an<br />
welchen Stellen des Trainings Verbesserungspotential besteht<br />
5.8.2 Ergebnisse des Fragebogens<br />
Die Probandin gibt im Ausgangsfragebogen an, dass sie sehr gerne mit<br />
dem Bildschirmlesegerät arbeitet, besonders das Lesen mit dem BLG<br />
macht ihr Spaß. Sie stellt fest, dass ihr das Malen mithilfe des<br />
Lesegerätes gar keinen Spaß macht, das Schreiben aber schon.<br />
Weiterhin ergibt der Ausgangsfragebogen, dass die Probandin ab und<br />
zu mit verschiedenen Abbildungsmaßstäben arbeitet, jedoch am<br />
liebsten immer die gleiche Einstellung bei ca. 4x Vergrößerung<br />
beibehält. Die Einstellungen von Helligkeit, Farbe und Kontrast<br />
verwendet sie gerne und oft, das Zeilenlienal ab und zu.<br />
Die Probandin meint, dass ihr das Training am BLG Spaß gemacht hat<br />
und dass sie dabei viel gelernt hat. Als Lerninhalte nennt sie hierbei die<br />
Suchsystematiken, das Umstellen von Farbe und Kontrast sowie die<br />
richtige Platzierung des Leseguts.<br />
88
Kapitel 5: Erprobung des <strong>Hilfsmitteltraining</strong>s<br />
Am besten haben der Probandin die Übungen gefallen, bei denen<br />
mithilfe des BLG´s gelesen werden sollte.<br />
5.8.3 Auswertung des Fragebogens<br />
Während der durchgeführten Schulung wurden der Probandin Lese-<br />
Schreib- und Malaufgaben gestellt. Alle Aufgaben konnten gut erledigt<br />
werden, deswegen lässt sich nicht erschließen, weshalb unter dem<br />
Bildschirmlesegerät so ungerne gemalt wird.<br />
Die Angabe der Probandin, am liebsten immer den Abbildungsmaßstab<br />
4x einzustellen, passt nur teilweise zu den Beobachtungen während der<br />
Übungsstunden und zur der Auswertung von Ein- und Ausgangstest:<br />
Die Probandin ändert tatsächlich sehr selten den Abbildungsmaßstab,<br />
sie variiert lieber die Vergrößerung durch Annäherung. Der verwendete<br />
Abbildungsmaßstab beträgt aber meistens 5,3x.<br />
Die Funktionen Farbe, Helligkeit und Kontrast werden nach der<br />
Schulung lieber eingesetzt als zuvor. In der Schulung wurde der Sinn<br />
dieser Einstellungen eingehend demonstriert, die Schülerin setzte diese<br />
Funktionen beim Ausgangstest bereits verstärkt ein, dieser Lerneffekt<br />
wird durch die Angaben der Schülerin im Ausgangsfragebogen<br />
bestätigt.<br />
Auch der Anwendungsbereich <strong>für</strong> das Zeilenlineal wurde während der<br />
Schulung erklärt, während dieses vor der Schulung unbekannt war, wird<br />
es jetzt von der Schülerin verwendet.<br />
Die Angaben der Schülerin, während des Trainings viel gelernt zu<br />
haben, als auch die Nennung der verschiedenen Lernbereiche<br />
unterstützen die Ergebnisse des Ein- und Ausgangstestes und die<br />
Schlussfolgerung, dass das <strong>Hilfsmitteltraining</strong> besonders in den<br />
Bereichen Suchsystematik, Umgang mit dem Kreuztisch sowie<br />
Einstellung von Farbe, Helligkeit und Kontrast Fortschritte erzielt hat.<br />
5.9 Diskussion der Ergebnisse und Ausblick<br />
In Kapitel 5.5 wurde als Ziel des Trainings eine Verbesserung speziell<br />
in folgenden Bereichen festgelegt: Es sollte häufiger ein Wechsel<br />
zwischen verschiedenen Einstellungen, sowohl den<br />
89
Kapitel 5: Erprobung des <strong>Hilfsmitteltraining</strong>s<br />
Abbildungsmaßstab als auch die Kontrast- und Farbeinstellungen<br />
betreffend stattfinden. Außerdem wurde eine Optimierung des<br />
Umgangs mit dem Kreuztisch und der Platzierung des Arbeitsmaterials<br />
beim Lesen und Schreiben angestrebt. Des Weiteren sollten durch das<br />
Erlernen der Methoden Scanning und Tracking die Orientierung auf<br />
dem Arbeitsblatt verbessert und das Auffinden von Details erleichtert<br />
werden. Sowohl der Vergleich von Ein- und Ausgangstest als auch die<br />
Auswertung des Ausgangsfragebogens zeigen, dass dies größtenteils<br />
erreicht wurde: Die Handhabung des Kreuztisches sowie die<br />
Suchsystematik und die Sinnhaftigkeit der Einstellungen haben sich im<br />
Ausgangstest im Vergleich zum Eingangstest verbessert. Auch im<br />
Ausgangstest gibt die Probandin wörtlich folgende Lerninhalte an:<br />
„Wenn ich etwas suche, dann muss ich den Tisch im Zick-Zack<br />
bewegen, die Farben müssen öfter umgestellt werden, die Blätter<br />
müssen beim Lesen hinten an die Kante“, und bestätigt damit<br />
zumindest teilweise einen Lernerfolg in den gewünschten Bereichen.<br />
Die Sinnhaftigkeit der Einstellungen betreffend ist der Erfolg allerdings<br />
nur teilweise gegeben: Der Bewertungsbogen macht hier keinen<br />
Unterschied zwischen der Einstellung von Farbe und Kontrast und der<br />
Einstellung des Abbildungsmaßstabes. Eine Verbesserung konnte<br />
allerdings lediglich bei der Einstellung von Farbe und Kontrast<br />
festgestellt werden. Der Abbildungsmaßstab wurde auch beim<br />
Ausgangstest höher als erwartet gewählt und ist damit nicht als sinnvoll<br />
zu bewerten. Allerdings ist dies auch nur eine objektive und auf<br />
Rechnungen zurückzuführende Annahme; <strong>für</strong> das subjektive Empfinden<br />
der Probandin ist die gewählte Vergrößerung möglicherweise die<br />
angenehmste. In den Trainingseinheiten wurde verstärkt auf einen<br />
häufigen Wechsel zwischen den Abbildungsmaßstäben hingewiesen<br />
und die Vorteile wurden der Probandin erklärt. Trotzdem wurde<br />
weiterhin bevorzugt, die Unterschiede im Vergrößerungsbedarf durch<br />
Vergrößerung durch Annäherung zu kompensieren.<br />
Als Anleitung <strong>für</strong> das Schreiben mithilfe des BLG wurde in 3.7.1<br />
angegeben, dass der Kreuztisch arretiert werden und das<br />
Arbeitsmaterial auf diesem bewegt werden soll, wenn unterschiedliche<br />
90
Kapitel 5: Erprobung des <strong>Hilfsmitteltraining</strong>s<br />
Bildausschnitte gesehen werden müssen. Falcón-Piva und Koob<br />
erklärten den Probanden in ihrer Studie ebenfalls dieses Vorgehen und<br />
erzielten hiermit einen Lernerfolg. 114 Dieses Vorgehen ist im<br />
Bewertungsbogen <strong>für</strong> Aufgabe 4 deswegen das Kriterium <strong>für</strong> eine sehr<br />
gute Kreuztischbewegung. Sowohl beim Ein- als auch beim<br />
Ausgangstest bewegte die Probandin stattdessen den Kreuztisch und<br />
arretierte diesen beim Eingangstest gar nicht und beim Ausgangstest<br />
nur während des Schreibens an sich. Während der entsprechenden<br />
Übungen in den Trainingseinheiten wurde der Probandin die in 3.7.1<br />
beschriebene Vorgehensweise zwar gezeigt, diese wurde allerdings als<br />
unangenehm empfunden. Da mit der beim Ausgangstest verwendeten<br />
Methodik bereits ein besseres Schriftbild erzielt wurde als im<br />
Eingangstest, ist zu bedenken, dass das von der Probandin<br />
angewandte System möglicherweise genau so sinnvoll ist wie das<br />
vorgegebene.<br />
Hier ist festzustellen, dass die Individualität der Schüler also nicht nur<br />
den Trainingsbedarf betrifft, sondern auch die anzuwendenden<br />
Techniken im Umgang mit dem Bildschirmlesegerät nicht pauschalisiert<br />
werden können. Möglicherweise sind <strong>für</strong> unterschiedliche Schüler auch<br />
unterschiedliche Vorgehensweisen optimal. Solange der jeweilige<br />
Schüler mit der von ihm gewählten Technik gute Ergebnisse erzielt,<br />
scheint es deswegen sinnvoll, ihn in dieser Technik zu unterstützen. Ein<br />
Aufzwängen der im Allgemeinen als optimal angesehene Technik ist<br />
dagegen weniger effektiv, da der Schüler mit dieser Technik<br />
möglicherweise nicht zurecht kommt.<br />
Interessant wäre eine Erprobung des <strong>Hilfsmitteltraining</strong>s an weiteren<br />
Testpersonen. Einerseits könnte so überprüft werden, ob durch ein<br />
Training immer eine Verbesserung der Handhabung mit dem<br />
Bildschirmlesegerät erzielt wird oder ob dies bei der durchgeführten<br />
Probe eher dem Ehrgeiz und der guten Auffassungsgabe der Probandin<br />
zu verdanken war.<br />
114 Vgl. Falcón-Piva, A., Koob, A., Handhabungstraining am Bildschirmlesegerät,<br />
2009, S. 90 f.<br />
.<br />
91
Kapitel 5: Erprobung des <strong>Hilfsmitteltraining</strong>s<br />
Außerdem könnte beobachtet werden, ob die oben beschriebene<br />
Technik beim Schreiben mithilfe des BLG’s nur von einer einzelnen<br />
Probandin oder aber grundsätzlich als angenehmer empfunden wird.<br />
Gegebenenfalls wäre eine Abänderung der Anleitung <strong>für</strong> das Schreiben<br />
und eine Änderung der Kriterien im Bewertungsbogen angebracht.<br />
Außerdem wäre bei einer weiterführenden Studie interessant zu<br />
beobachten, ob der beim Ausgangstest beobachtete Lernerfolg<br />
langfristig ist oder sich alte Gewohnheiten im Umgang mit dem BLG<br />
schnell wieder durchsetzten. Hierzu könnte nach einigen Wochen<br />
sowohl ein erneuter Ausgangstest als auch eine weitere Befragung der<br />
Lehrer informativ sein.<br />
Informativ wäre möglicherweise auch ein Vergleich zwischen dem<br />
Umgang der Probanden mit dem Gerät in der Schule und dem zu<br />
Hause verwendeten BLG. Ein entsprechender Test sowohl vor als auch<br />
nach den Trainingseinheiten würde zeigen, ob die Testperson das<br />
gelernte auch an dem zu Hause verwendeten BLG umsetzen kann.<br />
Dies ist fraglich, da meist unterschiedliche Geräte verwendet werden<br />
und außerdem ein anderes Umfeld gegeben ist.<br />
92
Kapitel 6: Fazit<br />
6 Fazit<br />
In der vorliegenden Arbeit wurde ein Verfahren entwickelt, mit dem ein<br />
individuelles <strong>Hilfsmitteltraining</strong> <strong>für</strong> <strong>Kinder</strong> mit Sehbehinderung am<br />
Bildschirmlesegerät erstellt werden kann. Dieses Verfahren soll als<br />
Leitfaden <strong>für</strong> Lehrer/innen von Schülern, die ein Bildschirmlesegerät<br />
verwenden, dienen. Um ein sinnvolles Training zu erstellen, ist es<br />
notwendig die Zusammenhänge zwischen dem Grad der<br />
Sehbehinderung, dem Vergrößerungsbedarf und den verschiedenen<br />
am BLG möglichen Einstellungen zu verstehen. Deswegen wurden zu<br />
Beginn die optischen Voraussetzungen <strong>für</strong> das Lesen und die durch die<br />
Arbeit mit dem Bildschirmlesegerät entstehenden Einschränkungen<br />
erläutert. Auch die Grundbestandteile und –funktionen von<br />
Bildschirmlesegeräten wurden im Vorhinein geklärt. Da es eine große<br />
Vielfalt an unterschiedlichen Geräten auf dem Markt gibt, sollten vor der<br />
Erstellung eines Trainings bekannt sein, welches Gerät der Schüler<br />
genau benutzt und ob dieses spezielle, in dieser Arbeit nicht erörterte,<br />
Funktionen bietet. Nur so kann die Schulung individuell auf die<br />
Bedürfnisse des Schülers und das verwendete Gerät zugeschnitten<br />
werden.<br />
In der Arbeit wurde erläutert, wie der individuelle Trainingsbedarf von<br />
<strong>Kinder</strong>n im Vor- oder Grundschulalter ermittelt werden kann um hierauf<br />
eine auf den jeweiligen Schüler zugeschnittene Schulung aufzubauen.<br />
Es wurde ein System von Übungsbausteinen zusammengestellt,<br />
welches Übungen <strong>für</strong> die unterschiedlichen Funktionen eines BLG´s in<br />
verschiedenen Schwierigkeitsstufen sowohl <strong>für</strong> lese- und schreibfähige<br />
<strong>Kinder</strong> als auch <strong>für</strong> Vorschulkinder beinhaltet. Abhängig vom<br />
Trainingsbedarf werden diese Bausteine zu einem <strong>Hilfsmitteltraining</strong><br />
kombiniert. Die Vorgehensweise wurde an einer Probandin<br />
demonstriert, hierdurch wurde außerdem die Effektivität des Trainings<br />
geprüft. Die mit der Probandin durchgeführte Schulung hat Erfolge<br />
gezeigt, ein Training am Bildschirmlesegerät scheint also positive<br />
Ergebnisse zu erzielen. Um das Training signifikant zu bewerten, wäre<br />
allerdings eine Studie mit mehreren Probanden nötig. Die Durchführung<br />
93
Kapitel 6: Fazit<br />
der Schulung hat außerdem gezeigt, dass im Umgang mit dem BLG<br />
auch von den in der Arbeit vorgestellten Techniken abweichende<br />
Vorgehensweisen gute Ergebnisse erzielen können und eine<br />
individuelle Beschäftigung mit den Vorlieben des Schülers bei einer<br />
Schulung deswegen besonders wichtig ist.<br />
94
Literaturverzeichnis<br />
Blaha, Friedrich, Der Mensch am Bildschirmarbeitsplatz, Wien-New<br />
York: Springer Verlag 1995<br />
Büsch, Sigrid et al., Sachen suchen bei den Tieren, Ravensburg:<br />
Ravensburger Buchverlag Otto Maier GmbH, 2006<br />
D’Andrea, Frances Mary; Farrenkopf, Carrol; Looking to Learn –<br />
Promoting literacy for students with low vision; New York: AFB; 2000<br />
Denninghaus, Erwin; Die Förderung der Lesegeschwindigkeit bei<br />
blinden und <strong>sehbehinderte</strong>n Jugendlichen und jungen Erwachsenen. In:<br />
horus, H. 1/1997. http://www.dvbs-online.de/horus/1997-1-2126.htm;<br />
zuletzt geprüft 2008<br />
Deutsches Institut <strong>für</strong> Medizinische Dokumentation und Information;<br />
Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und<br />
verwandter Gesundheitsprobleme, 2010<br />
Hofer, Ursula; Integration von Schülerinnen und Schülern mit einer<br />
Sehbehinderung in Regelschulen, 2004<br />
Goersch, Helmut; Wörterbuch der Optometrie; 3. Auflage; Heidelberg:<br />
DOZ-Verlag 2004<br />
Handorff, Christoph von; Messung und Bedeutung des<br />
Kontrastsehvermögens bei Sehbehinderten; Vortrag gehalten in der<br />
WVAO Landesgruppe Mecklenburg-Vorpommern; 22. Mai 2004.<br />
95
Literaturverzeichnis<br />
Huber-Spitzy, Veronika; Bildschirmarbeit und Augen, in: Blaha,<br />
Friedrich, Der Mensch am Bildschirmarbeitsplatz, Wien-New York:<br />
Springer Verlag 1995<br />
Informationspool Computerhilfsmittel <strong>für</strong> Blinde und Sehbehinderte,<br />
Bildschirmlesegeräte – Was ist ein Bildschirmlesegerät?<br />
http://www.incobs.de/produktinfos/bildschirmlesegeraete/beschreibung.<br />
php,<br />
Stand 30.11.2009<br />
Informationspool Computerhilfsmittel <strong>für</strong> Blinde und Sehbehinderte,<br />
Bildschirmlesegeräte – Worauf zu achten ist,<br />
http://www.incobs.de/produktinfos/bildschirmlesegeraete/worauf_achten<br />
.php,<br />
Stand 12.04.2007<br />
Informationspool Computerhilfsmittel <strong>für</strong> Blinde und Sehbehinderte,<br />
Bildschirmlesegeräte- Informationen zur Arbeitsplatzausstattung,<br />
http://www.incobs.de/downloads/broschueren/pdf_bildschirmlesegeraet<br />
e.pdf,<br />
Stand Juni 2007<br />
Informationspool Computerhilfsmittel <strong>für</strong> Blinde und Sehbehinderte,<br />
Wörterbuch,<br />
http://www.incobs.de/glossar.php,<br />
Stand 23.11. 2009<br />
Koch, Carmen; Funktional-Optometrie; Mainz: WVAO 2004<br />
Krug, Franz- K.; Didaktik <strong>für</strong> den Unterricht mit <strong>sehbehinderte</strong>n<br />
Schülern; München: Ernst Reinhardt Verlag 2001<br />
Legge, Gordon; Psychophysics of Reading in Normal and Low Vision;<br />
Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates 2007<br />
96
Literaturverzeichnis<br />
Merk, Stephan; Bildschirmlesegeräte;<br />
http://www.merkst.de/reha/bildschirmlesegeraete.htm,<br />
Stand 04. Mai 2009.<br />
Opp, Günther; Theunissen, Georg; Handbuch schulische<br />
Sonderpädagogik; Bad Heilbrunn: Julius Kinkhardt Verlag 2009<br />
Rabe, Giovana; Einsatz des Bildschirmlesegerätes in Schulen <strong>für</strong><br />
Schülerinnen und Schüler mit Sehbehinderung; Dortmund:<br />
Staatsexamen 2004<br />
Schreck, Klaus; Vergrößerung und Vergrößerungsangaben bei<br />
Vergrößernden Sehhilfen; Berlin: Technische Fachhochschule; 2010<br />
Schreck, Klaus; Holzapfel, Sefanie; Abbildungseigenschaften und<br />
Gebrauchseigenschaften optisch und elektronisch vergrößernder<br />
Sehhilfen; in: Low Vision Stiftung; 2. Interdisziplinärer LowVision<br />
Congress- Diagnostikk, Therapie, S. 23 – 44 Rehabilitation;<br />
Spurbuchverlag: Würzburg 2004<br />
Sutter, Markus; Kontrast und Kontrastempfindlichkeit in der Low Vision<br />
Rehabilitation; in: Blickpunkt Focus; Fachzeitschrift des<br />
Schweizerischen Verbandes der Orthoptistinnen und Orthoptisten,<br />
19/2006.<br />
Statistisches Bundesamt; Bevölkerung nach Altersgruppen,<br />
Familienstand und Religionszugehörigkeit;<br />
http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/Sites/destatis/Internet/DE/Co<br />
ntent/Statistiken/Bevoelkerung/Bevoelkerungsstand/Tabellen/Content75<br />
/AltersgruppenFamilienstand.psml,<br />
Stand: 09. 11. 2009<br />
97
Literaturverzeichnis<br />
Statistisches Bundesamt; Statistik der schwerbehinderten Menschen<br />
2007;<br />
http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/Sites/destatis/Internet/DE/Co<br />
ntent/Publikationen/Qualitaetsberichte/Sozialleistungen/Schwerbehinde<br />
rte,property=file.pdf,<br />
Wiesbaden 2009<br />
Statistisches Bundesamt Deutschland; Zahl der Woche Nr. 16;<br />
http://www.stabu.de/jetspeed/portal/cms/Sites/destatis/Internet/DE/Pres<br />
se/pm/Uebersicht/WirtschaftsrechnungenZeitbudgets,gtp=273794_253<br />
D4,templateId=renderPrint.psml,<br />
Bonn; Stand 20.04.2004<br />
Trauzettel-Klosinski, S. Laubengaier, C. Sadowski, B. Pietsch-Breitfeld,<br />
B.; Lesefähigkeiten von Sehbehinderten; in: Zeitschrift <strong>für</strong> praktische<br />
Augenheilkunde und augenärztliche Fortbildung (ZPA), Band 21; S. 529<br />
– 533; Kaden: Tübingen 2000<br />
Wachendorf, Peter; Debbrecht, Jan; Druckschrift; 6. Auflage; Brühl:<br />
Jandorf Verlag 2010<br />
Wachendorf, Peter; Debbrecht, Jan; Lies mal! Das Heft mit der Ente; 9.<br />
Auflage; Brühl: Jandorf Verlag 2010<br />
Wachendorf, Peter; Debbrecht, Jan; Lies mal! Das Heft mit dem Frosch;<br />
9. Auflage; Brühl: Jandorf Verlag 2010<br />
Zeun, Ulrich; Monokular-Schulung; Münster: Monsenstein und<br />
Vannerdat 2003<br />
98
Anhang<br />
Anmerkung:<br />
Soweit nicht anders vermerkt, wurden alle im Anhang beigefügten<br />
Dokumente und Bilder selbst erstellt.<br />
Aus Gründen der Formatierung weicht die Größe einiger der<br />
Dokumente von der Originalgröße ab. Deswegen sind alle Dokumente<br />
zusätzlich der beiliegenden Daten-CD beigefügt.<br />
Diese enthält zusätzlich folgendes Datenmaterial, welches nicht im<br />
Anhang enthalten ist:<br />
- Die Probandin betreffende, ausgefüllte Fragebögen:<br />
o Fragebogen an die Eltern<br />
o Fragebogen an die Probandin<br />
o Fragebogen an die Lehrerin<br />
o Ausgangsfragebogen an die Probandin<br />
- Texte und Bilder des Ausgangstests<br />
- Von der Probandin bearbeitete Unterlagen des Eingangstestes<br />
- Von der Probandin bearbeitete Übungsmaterialien<br />
- Von der Probandin bearbeitete Unterlagen des Ausgangstestes<br />
99
Anhang<br />
I. Fragebögen und Informationsmaterial<br />
- Informationsblatt <strong>für</strong> die Eltern<br />
- Formular: Eiverständniserklärung der Eltern<br />
- Anleitung zum Ausfüllen der Fragebögen <strong>für</strong> die Eltern<br />
- Fragebogen <strong>für</strong> die Eltern<br />
- Fragebogen <strong>für</strong> die <strong>Kinder</strong><br />
- Anleitung zum Ausfüllen der Fragebögen <strong>für</strong> die Lehrer<br />
- Fragebogen <strong>für</strong> die Lehrer<br />
- Ausgangsfragebogen <strong>für</strong> die <strong>Kinder</strong><br />
100
Anhang<br />
Informationsblatt<br />
101
Anhang<br />
Einverständniserklärung<br />
102
Anhang<br />
Anleitung zum Ausfüllen der Fragebögen<br />
103
Anhang<br />
Fragebögen <strong>für</strong> die Eltern<br />
104
Anhang<br />
105
Anhang<br />
106
Anhang<br />
Fragebögen <strong>für</strong> die <strong>Kinder</strong><br />
107
Anhang<br />
108
Anhang<br />
109
Anhang<br />
110
Anhang<br />
Anleitung zum Ausfüllen der Fragebögen/Lehrer<br />
111
Anhang<br />
Fragebogen <strong>für</strong> die Lehrer<br />
112
Anhang<br />
113
Anhang<br />
114
Anhang<br />
Ausgangsfragebogen <strong>für</strong> die <strong>Kinder</strong><br />
115
Anhang<br />
116
Anhang<br />
117
Anhang<br />
118
Anhang<br />
II. Ein- und Ausgangstest<br />
- Eingangstest<br />
- Bewertungsbogen Eingangstest<br />
- Bewertungsbogen Eingangstest- verbesserte Version<br />
- Anmerkung zum Ausgangstest<br />
119
Anhang<br />
Eingangstest<br />
Aufgabe 1: Lese den Text<br />
Da steht eine Burg!<br />
Eine Burg aus rotem Stein.<br />
Sie steht auf einem Berg.<br />
Ein Weg führt zum Tor.<br />
Die Burg gehört Lea.<br />
Lea ist eine Königin.<br />
Sie steht auf dem linken Turm.<br />
Was fliegt denn da?<br />
Drei bunte Luftballons.<br />
Und eine blaue Wolke.<br />
120
Anhang<br />
Beantworte die Fragen:<br />
1. Wo steht die Burg:<br />
O Auf einem Berg O Neben einem Fluss<br />
2. Wem gehört die Burg?<br />
O Einem Prinzen O Einer Königin<br />
3. Was fliegt über der Burg?<br />
O Vögel O Luftballons<br />
121
Anhang<br />
Aufgabe 2: Finde alle Kreise und Sterne und<br />
kreise sie mit einem Bleistift ein!<br />
122
Anhang<br />
Aufgabe 3: Beantworte die Fragen<br />
Da ist ein Eisstand! Wie viele Kugeln Eis<br />
kauft das Mädchen?___<br />
115<br />
115 Büsch, S., et al., Sachen suchen bei den Tieren, 2006, S. 5<br />
123
Anhang<br />
Der Hund kann Handstand! Welche Farbe<br />
hat seine Schleife?________<br />
116<br />
116 Büsch, S., et al., Sachen suchen bei den Tieren, 2006, S. 10<br />
124
Anhang<br />
Bei den Affen steht ein Schild mit einer<br />
roten Zahl. Kannst du sie lesen? ___<br />
117<br />
117 Büsch, S., et al., Sachen suchen bei den Tieren, 2006, S. 6<br />
125
Anhang<br />
Aufgabe 4: Vervollständige die Reihen<br />
126
Anhang<br />
Aufgabe 5: Schreibe den Text von der<br />
Tafel ab.<br />
127
Anhang<br />
Viele <strong>Kinder</strong> mögen Eis.<br />
Fische leben im<br />
Wasser.<br />
128
Bewertungsbogen Eingangstest<br />
129
Anhang<br />
130
Anhang<br />
131
Anhang<br />
132
Anhang<br />
133
Anhang<br />
134
Anhang<br />
135
Anhang<br />
136
Anhang<br />
137
Anhang<br />
Bewertungsbogen Eingangstest, verbesserte Version<br />
138
Anhang<br />
139
Anhang<br />
140
Anhang<br />
141
Anhang<br />
142
Anhang<br />
143
Anhang<br />
144
Anhang<br />
145
Anhang<br />
146
Anhang<br />
147
Anhang<br />
Ausgangstest<br />
Der Ausgangstest entspricht dem Eingangstest, es wurden lediglich<br />
andere Texte gewählt. Diese sind auf der beigefügten Daten-CD<br />
hinzugefügt. Auch der Bewertungsbogen <strong>für</strong> den Ausgangstest<br />
entspricht dem <strong>für</strong> den Eingangstest.<br />
148
Anhang<br />
III. Übungsmaterial<br />
- Übungen zur Bewegung von Kreuztisch bzw. Handkamera<br />
oder Arbeitsmaterial<br />
- Übungen zur Einstellung des Abbildungsmaßstabes<br />
- Übungen zur Orientierung auf dem Arbeitsblatt<br />
- Übungen zur Einstellung von Farbe, Helligkeit und Kontrast<br />
- Übungen <strong>für</strong> die Hand- Auge- Koordination<br />
149
Anhang<br />
Übungsmaterial zur Bewegung von Kreuztisch bzw. Arbeitsblatt<br />
Bewegung von Kreuztisch bzw. Arbeitsblatt [E]<br />
150
Anhang<br />
Bewegung von Kreuztisch bzw. Arbeitsmaterial [G]<br />
151
Anhang<br />
Bewegung von Kreuztisch bzw. Arbeitsmaterial [G] – ohne Buchstaben<br />
152
Anhang<br />
Bewegung von Kreuztisch bzw. Arbeitblatt [F]<br />
153
Anhang<br />
Bewegung von Kreuztisch bzw. Arbeitblatt [F] – ohne Buchstaben<br />
154
Anhang<br />
Bewegung von Kreuztisch bzw. Arbeitsblatt [F] - 2<br />
Da --------------------- sind ------------------------ drei ------------------------ Fotos.<br />
O Ja O Nein<br />
Da ----------------------------- liegt --------- ein ----------------------------------- Hut.<br />
O Ja O Nein<br />
Da ----- ist ---------------------------------------------------- ein-----------------Lama.<br />
O Ja O Nein<br />
Da ----------------------------------- ist ----------- eine -------------------------Hose.<br />
O Ja O Nein<br />
Da --------------- liegen ------------------------------------ drei ---------Legosteine.<br />
O Ja O Nein<br />
Da ----- ist --------------------------------------------------------------------- eine Lok.<br />
O Ja O Nein<br />
Da ist eine Limo.<br />
O Ja O Nein<br />
Da ist eine Hupe.<br />
O Ja O Nein<br />
Da liegt eine Feder.<br />
O Ja O Nein<br />
118<br />
118 Verändert nach: Wachendorf, P.; Debbrecht, J.; Lies mal! Das Heft mit der Ente,<br />
2010, S. 24.<br />
155
Anhang<br />
Übungsmaterial zum Abbildungsmaßstab<br />
Abbildungsmaßstab[E]<br />
119<br />
Das ist Pia.<br />
Pia ist eine Eskimofrau.<br />
Sie lebt am Nordpol.<br />
Pias Kleider sind grau.<br />
Die Handschuhe sind rot.<br />
Ihre Haut ist hellbraun.<br />
Neben Pia steht ein Eimer.<br />
In dem Eimer sind Fische.<br />
Überall liegt Schnee.<br />
Hinten siehst du zwei Iglus.<br />
119 Verändert nach: Debbrecht, J.; Wachendorf, P.; Lies mal! Das Heft mit dem<br />
Frosch, 2010, S. 15.<br />
156
Anhang<br />
157
Anhang<br />
Abbildungsmaßstab[G]<br />
120<br />
120 120 Verändert nach: Wachendorf, P.; Debbrecht, J.; Lies mal! Das Heft mit dem<br />
Frosch; 2010; S. 8.<br />
158
Anhang<br />
Abbildungsmaßstab [G] – ohne Buchstaben<br />
159
Anhang<br />
Abbildungsmaßstab[G] - umgekehrt<br />
Lese den Text laut vor!<br />
Da steht ein Reh!<br />
Es ist hellbraun.<br />
Es steht auf einer Wiese<br />
Viele Blumen blühen.<br />
Bunte Vögel fliegen herum.<br />
Ein Schmetterling!<br />
Die Sonne scheint.<br />
Der Himmel ist blau.<br />
121<br />
121 121 Verändert nach: Wachendorf, P.; Debbrecht, J.; Lies mal! Das Heft mit dem<br />
Frosch; 2010; S. 13.<br />
160
Anhang<br />
Abbildungsmaßstab [F]<br />
122<br />
122 Verändert nach: Wachendorf, P.; Debbrecht, J.; Lies mal! Das Heft mit der Ente;<br />
2010; S. 44.<br />
161
Anhang<br />
Abbildungsmaßstab [F] – ohne Buchstaben<br />
162
Anhang<br />
Übungen zur Orientierung auf dem Arbeitsblatt<br />
Orientierung auf dem Arbeitsblatt [E1]<br />
163
Anhang<br />
Orientierung auf dem Arbeitsblatt [E2]<br />
123<br />
Da sind 3 Mäuse! Wie viele Nüsse haben sie gesammelt?<br />
123 Büsch, S., et al., Sachen suchen bei den Tieren, 2006, S 5<br />
164
Anhang<br />
Orientierung auf dem Arbeitsblatt [G]<br />
165
Anhang<br />
Orientierung auf dem Arbeitsblatt [G] – ohne Buchstaben<br />
166
Anhang<br />
Orientierung auf dem Arbeitsblatt [F] 124<br />
124 Zufällig erstellt http://www.blinde-kuh.de/spiele/maze/generator.cgi.<br />
167
Anhang<br />
Übungen zur Einstellung von Farbe, Helligkeit und Kontrast<br />
Farbe [E]<br />
168
Anhang<br />
Farbe [E] – ohne Buchstaben<br />
169
Anhang<br />
Farbe und Kontrast [E]<br />
Farbe und Kontrast [E] – ohne Zahlen<br />
170
Anhang<br />
Farbe und Kontrast [G]<br />
Farbe und Kontrast [G] – ohne Zahlen<br />
171
Anhang<br />
Farbe und Kontrast [F]<br />
172
Anhang<br />
Farbe und Kontrast [F] – ohne Buchstaben<br />
173
Anhang<br />
Übungen zur Hand- Auge- Koordination<br />
Übung zur Hand- Auge- Koordination [E]<br />
174
Anhang<br />
Hand- Auge- Koordination [E] – ohne Buchstaben<br />
175
Anhang<br />
Hand- Auge- Koordination [G]<br />
176
Anhang<br />
Hand – Auge – Koordination [F]<br />
125<br />
125 Maisel, K.; Kigotipps (Internet).<br />
177
Anhang<br />
Hand- Auge- Koordination [F] – ohne Zahlen 126<br />
126 Zufällig erstellt http://www.blinde-kuh.de/spiele/maze/generator.cgi.<br />
178
Anhang<br />
Übungen zur kombinierten Nutzung der Funktionen<br />
Übung zur kombinierten Nutzung der Funktionen 1<br />
Male alle Felder mit einem b oder B<br />
aus!<br />
127<br />
127<br />
Wachndorf, P.; Debbrecht, J.; Druckschrift; 2010,<br />
179
Anhang<br />
Übung zur kombinierten Nutzung der Funktionen 2<br />
180
Anhang<br />
Übung zur kombinierten Nutzung der Funktionen - 3<br />
128<br />
Übung zur kombinierten Nutzung der Funktionen - 4<br />
129<br />
128<br />
Wachendorf, P.; Debbrecht, J.; Druckschrift; 2010, S.53<br />
129<br />
Debbrecht, J.; Wachendorf, P.; Dr Druckschrift; 2010, S. 64<br />
181
Anhang<br />
Übung zur kombinierten Nutzung der Funktionen - 5<br />
130<br />
130 Kostenlose Malvorlagen und gratis Ausmalbilder, Stand 2008 (Internet)<br />
182
Anhang<br />
183
Anhang<br />
Ehrenwörtliche Erklärung<br />
Hiermit erkläre ich an Eides statt, dass ich die vorliegende Arbeit<br />
selbstständig und ohne unerlaubte fremde Hilfe angefertigt habe,<br />
andere als die angegebenen Quellen nicht benutzt und die den<br />
benutzten Quellen wörtlich oder inhaltlich entnommenen Stellen als<br />
solche kenntlich gemacht habe.<br />
Ort, Datum Unterschrift<br />
184
185