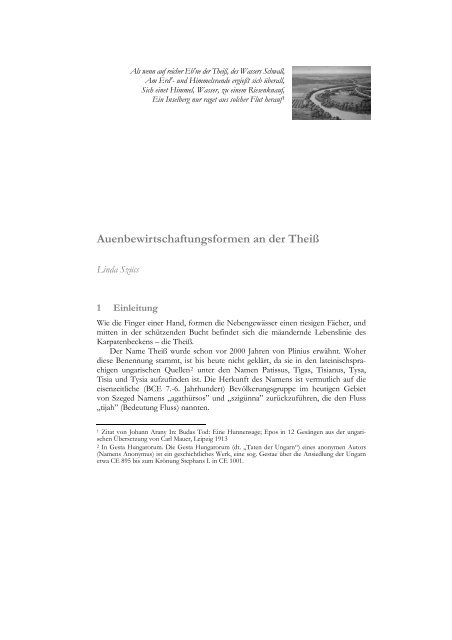Auenbewirtschaftungsformen an der Theiß
Auenbewirtschaftungsformen an der Theiß
Auenbewirtschaftungsformen an der Theiß
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Als wenn auf reicher Eb'ne <strong>der</strong> <strong>Theiß</strong>, des Wassers Schwall,<br />
Am Erd'- und Himmelsr<strong>an</strong>de ergießt sich überall,<br />
Sich einet Himmel, Wasser, zu einem Riesenknauf,<br />
Ein Inselberg nur raget aus solcher Flut herauf 1<br />
<strong>Auenbewirtschaftungsformen</strong> <strong>an</strong> <strong>der</strong> <strong>Theiß</strong><br />
Linda Szücs<br />
1 Einleitung<br />
Wie die Finger einer H<strong>an</strong>d, formen die Nebengewässer einen riesigen Fächer, und<br />
mitten in <strong>der</strong> schützenden Bucht befindet sich die mä<strong>an</strong><strong>der</strong>nde Lebenslinie des<br />
Karpatenbeckens – die <strong>Theiß</strong>.<br />
Der Name <strong>Theiß</strong> wurde schon vor 2000 Jahren von Plinius erwähnt. Woher<br />
diese Benennung stammt, ist bis heute nicht geklärt, da sie in den lateinischsprachigen<br />
ungarischen Quellen 2 unter den Namen Patissus, Tigas, Tisi<strong>an</strong>us, Tysa,<br />
Tisia und Tysia aufzufinden ist. Die Herkunft des Namens ist vermutlich auf die<br />
eisenzeitliche (BCE 7.-6. Jahrhun<strong>der</strong>t) Bevölkerungsgruppe im heutigen Gebiet<br />
von Szeged Namens „agathürsos” und „szigünna” zurückzuführen, die den Fluss<br />
„tijah” (Bedeutung Fluss) n<strong>an</strong>nten.<br />
1 Zitat von Joh<strong>an</strong>n Ar<strong>an</strong>y In: Budas Tod: Eine Hunnensage; Epos in 12 Gesängen aus <strong>der</strong> ungarischen<br />
Übersetzung von Carl Mauer, Leipzig 1913<br />
2 In Gesta Hungarorum. Die Gesta Hungarorum (dt. „Taten <strong>der</strong> Ungarn“) eines <strong>an</strong>onymen Autors<br />
(Namens Anonymus) ist ein geschichtliches Werk, eine sog. Gestae über die Ansiedlung <strong>der</strong> Ungarn<br />
etwa CE 895 bis zum Krönung Steph<strong>an</strong>s I. in CE 1001.
2<br />
Linda Szücs<br />
Dieser Fluss spielt in <strong>der</strong> ungarischen Geschichte eine entscheidende Rolle. Seine<br />
Bedeutung spiegelt sich in <strong>der</strong> Sprache <strong>der</strong> Anwohner <strong>der</strong> <strong>Theiß</strong> wie<strong>der</strong>, wo das<br />
Wort „Getreide”, das neben dem Fluss geerntet wurde, auch für „Leben” (ungarisch<br />
„élet”) verwendet wird, die Dörfer neben dem Fluss als „Lebenskammer”<br />
(ungarisch „életkamrák“) und „Getreideernte” als „Lebensdeckung” (ungarisch<br />
„élet-takarás“) bezeichnet werden. Nicht zuletzt zeigen die ungarischen Volkslie<strong>der</strong><br />
die tiefe Verbindung zur <strong>Theiß</strong>:<br />
„Fischer bin ich in <strong>der</strong> Eb’ne weitem Kreis,<br />
Wohn’ in einer kleinen Hütte <strong>an</strong> <strong>der</strong> <strong>Theiß</strong>;<br />
Braunes Mädchen, komm herzu und werde mein!<br />
Stets wird meine Mutter deine Pfleg’rin sein.<br />
Edelsteine, Gold und Silber hab’ ich nicht,<br />
Nur ein Hüttchen, das ein stilles Glück verspricht;<br />
Doch ein feurig schlagend Herz hebt meine Brust,<br />
Lechzend nach <strong>der</strong> Gegenliebe Himmelslust.“ 3<br />
2 Naturräumliche Beschreibung<br />
In den Bergen von Máramaros (Maramuresch, Ukraine) in den Waldkarpaten, in<br />
einer Höhe von 1680 Metern, umgegeben von 1800-2000 Meter hohen Bergen<br />
verbirgt sich jene Quelle, die als kleines Rinnsal die Schwarze <strong>Theiß</strong> in die Welt<br />
setzt. Nach knapp 50 Kilometern vereint sie sich bei Rahó (Ukraine) mit <strong>der</strong> Weißen<br />
<strong>Theiß</strong>. Von diesem Punkt aus wird sie <strong>Theiß</strong> gen<strong>an</strong>nt, die Länge des Flusses<br />
(946 km) bemisst sich aber von <strong>der</strong> Quelle <strong>der</strong> Schwarzen <strong>Theiß</strong> (Gyukics 2007).<br />
Bei <strong>der</strong> extremen Wasserführung <strong>der</strong> <strong>Theiß</strong> spielt die Morphologie des Einzugsgebietes<br />
eine wichtige Rolle. Aus den geologisch-morphologischen Eigenschaften<br />
ergibt sich, dass die Wasserreserve <strong>der</strong> umgebenden R<strong>an</strong>dgebirge schnell<br />
abfließt, so dass Hochwasserwellen verstärkt auftreten.<br />
Mit dem <strong>an</strong>gesammelten Wasser vom Bogen <strong>der</strong> östlichen Karpaten tritt die<br />
<strong>Theiß</strong> in die Ebene von Szatmár (Sathmar), wo <strong>der</strong> Schwung ihres noch schnellen<br />
Wassers aus den höher gelegenen, steileren Tälern allmählich verloren geht und<br />
sich ihr Strom – unter Tiszabecs – im Flachl<strong>an</strong>d <strong>der</strong> Ungarischen Tiefebene maßgeblich<br />
verringert. Die regelmäßig kommenden großen Wassermassen im Frühjahr<br />
brechen oft aus dem Flussbett aus und bahnen sich neue Wege im tiefen Flachl<strong>an</strong>d,<br />
wodurch die charakteristischen Mä<strong>an</strong><strong>der</strong> entst<strong>an</strong>den sind (Gyukics 2007).<br />
Dies könnte ein wichtiger Siedlungsfaktor gewesen sein, weil dadurch in dem<br />
Überschwemmungsgebiet eine dreischichtige Tiefenglie<strong>der</strong>ung entst<strong>an</strong>den ist: ers-<br />
3 Volkslied „Fischer bin ich <strong>an</strong> <strong>der</strong> <strong>Theiß</strong>“. Übersetzt von Mihály Agost Greguss (1825-1882) Aus:<br />
Ungarische Volkslie<strong>der</strong> übersetzt und eingeleitet von M. A. Greguss, Leipzig 1846
<strong>Auenbewirtschaftungsformen</strong> <strong>an</strong> <strong>der</strong> <strong>Theiß</strong><br />
tens das immer von Wasser bedeckte niedrige Überschwemmungsgebiet, zweitens<br />
das periodisch überschwemmte Hochgebiet und drittens <strong>der</strong> überschwemmungsfreie<br />
Flussrücken (Tóth 2000), wo sich die o. g. Lebenskammern (kleinere Siedlungen)<br />
konzentrierten.<br />
Abb. 1: Orographie und Flusssysteme des Theiss-Einzugsgebietes (Shmu et al. 2003)<br />
Vor <strong>der</strong> <strong>Theiß</strong>regulierung im 19. Jahrhun<strong>der</strong>t wurden in den geographischen und<br />
kartographischen Beschreibungen die niedrigen Überflutungsgebiete als „perpetua<br />
stagna arundicta“, und die hohen als „plagas inundationibus aquarum obnoxias“<br />
bezeichnet (Orosz 1992).<br />
3 <strong>Auenbewirtschaftungsformen</strong> in <strong>der</strong> Geschichte Ungarns<br />
Die Auengebietsnutzung <strong>an</strong> <strong>der</strong> <strong>Theiß</strong> wird von Bellon (2003) in drei Phasen unterteilt.<br />
Der erste und auch längste Abschnitt dauerte von <strong>der</strong> L<strong>an</strong>dnahme <strong>der</strong><br />
3
4<br />
Linda Szücs<br />
Ungarn in CE 895 bis zu den ersten Flussregulierungsmaßnahmen 1754 und wird<br />
„feuchte Auenwirtschaft“ gen<strong>an</strong>nt. Die zweite Periode beg<strong>an</strong>n in <strong>der</strong> Mitte des 18.<br />
Jahrhun<strong>der</strong>ts und endete 1960, als die Wasserverhältnisse und die L<strong>an</strong>dnutzungsformen<br />
sich deutlich geän<strong>der</strong>t hatten. Zur dritten Ära gehört die Kollektivierung<br />
<strong>der</strong> L<strong>an</strong>dwirtschaft mit größtenteils monokulturellen Ackerl<strong>an</strong>dschaften, seit 2000<br />
aber mit dem Einbau von Flutgebietsspeichern.<br />
3.1 Die feuchte Auenwirtschaft<br />
Die nomadisierenden Ungarn („Magyaren”) ließen sich erst ab CE 895 im heutigen<br />
Ungarn nie<strong>der</strong>. Sie dr<strong>an</strong>gen zunächst in das mittlere und obere <strong>Theiß</strong>gebiet nach<br />
Großmähren vor. Das ebene Gebiet des <strong>Theiß</strong>-Tales – die Ungarische Tiefebene –<br />
war zur Zeit <strong>der</strong> L<strong>an</strong>dnahme ein Gebiet mit Auenwäl<strong>der</strong>n und Steppen. Es war<br />
sowohl mit Gewässern durchsetzt als auch mit einem dichten Siedlungsnetz überzogen<br />
(Gyukics 2007).<br />
Nicht zufällig wurde dieses Gebiet von den Siedlern gewählt. In ihrer vorherigen<br />
Heimat – kurz vor und vermutlich auch noch nach ihrer Einw<strong>an</strong><strong>der</strong>ung in das<br />
Karpatenbecken – Etelköz (auch Atelkuzu, ungarisch für „L<strong>an</strong>d zwischen den<br />
Flüssen“) hatten sie schon viel Erfahrung mit <strong>der</strong> Auenbewirtschaftung gesammelt.<br />
Die Gräberuntersuchungen von Bálint (1980) zeigen, dass sich die Wohlhabenden<br />
<strong>der</strong> führenden und mittleren Schichten, vor allem die Kriegerkaste und die Viehzüchter,<br />
hauptsächlich auf s<strong>an</strong>digem Steppengebiet <strong>an</strong>siedelten. Die einfache Bevölkerung<br />
konzentrierte sich hingegen auf die fischreichen Flüsse.<br />
Bedeutsam ist, dass in den Auengebieten die Malaria endemisch war (Wernsdorfer<br />
2002), wovon – wegen <strong>der</strong> oben gen<strong>an</strong>nten Differenzierung des Siedlungssystems<br />
– eher die einfache Bevölkerung betroffen war. Die Kr<strong>an</strong>kheit hat sich im<br />
Südwesten und Südosten des L<strong>an</strong>des, entl<strong>an</strong>g dem Lauf <strong>der</strong> <strong>Theiß</strong> und <strong>der</strong> Donau,<br />
extrem verbreitet. Die auch als Kr<strong>an</strong>kheit <strong>der</strong> Rin<strong>der</strong> auftretende Malaria hat bis<br />
zum Beginn des 20. Jahrhun<strong>der</strong>t – bis zu den ersten effektiven Gesundheitsmaßnahmen<br />
bzw. den Flussregulierungsmaßnahmen – ihre Opfer gefor<strong>der</strong>t. 4<br />
Die Auenwirtschaft in Ungarn hatte ihre Blütezeit im 14.-15. Jahrhun<strong>der</strong>t erreicht,<br />
zu <strong>der</strong>en Erfolg größtenteils <strong>der</strong> Rin<strong>der</strong>export geführt hat. Im europäischen<br />
Wirtschaftsleben im 14. und 15. Jahrhun<strong>der</strong>t traten bedeutende Verän<strong>der</strong>ungen<br />
ein. Die zu seiner neuen Entwicklung gel<strong>an</strong>gte europäische Region brauchte einen<br />
erheblichen Fleischimport um die Bevölkerung in den Städten zu versorgen. Diese<br />
Ansprüche wurden durch Rin<strong>der</strong> befriedigt, die größtenteils auf den Puszten <strong>der</strong><br />
tiefländischen Marktflecken gezüchtet und gemästet wurden. Jährlich trieb m<strong>an</strong> sie<br />
zu Zehntausenden auf die Märkte <strong>der</strong> norditalienischen, süddeutschen und böhmisch-mährischen<br />
Gebiete (Bellon 1996). In dieser Zeit hat allein <strong>der</strong> Viehexport<br />
60-90 % <strong>der</strong> Gesamtausfuhr des L<strong>an</strong>des gebildet.<br />
4 Unter den Habsburgern sind bereits im 19. Jh. <strong>Theiß</strong>regulierungen vorgenommen worden, die einen<br />
ersten Rückg<strong>an</strong>g <strong>der</strong> Malaria, dem „Sumpffieber“, erbrachte.
<strong>Auenbewirtschaftungsformen</strong> <strong>an</strong> <strong>der</strong> <strong>Theiß</strong><br />
Die Zeit bis zum 16. Jahrhun<strong>der</strong>t k<strong>an</strong>n als Blütezeit <strong>der</strong> sogen<strong>an</strong>nten Fok-<br />
Wirtschaft (siehe unten: Die Entstehung <strong>der</strong> Fok-Systeme) mit reichen Fischereien<br />
und Viehhaltung bezeichnet werden (Bálint 1980).<br />
Die Hauptstadt Buda sowie die große Tiefebene wurden 1541 von den Türken<br />
besetzt, <strong>der</strong>en rund <strong>an</strong><strong>der</strong>thalb Jahrhun<strong>der</strong>te <strong>an</strong>dauernde Herrschaft einen tiefen<br />
Einschnitt in die Geschichte des L<strong>an</strong>des bedeutete. In dieser Zeit wurden im Zuge<br />
<strong>der</strong> Abholzungen, <strong>der</strong> Entvölkerung und <strong>der</strong> Eingriffe in den Wasserhaushalt aus<br />
militärischen Gründen 5 stufenweise immer größere Gebiete vom Wasser erobert<br />
(Gyukics 2007).<br />
Da die Fok nicht mehr regelmäßig gepflegt und bewirtschaftet wurden, brachen<br />
sie größtenteils zusammen und sind heute nur noch in Resten auszumachen. 6<br />
Nach <strong>der</strong> Türkenzeit herrschte in <strong>der</strong> Tiefebene eine differenzierte Auenbewirtschaftung,<br />
<strong>der</strong> führende Zweig wurde die Viehhaltung.<br />
3.2 Die Entstehung <strong>der</strong> Fok-Systeme<br />
Die Ablagerungen <strong>der</strong> <strong>Theiß</strong> und <strong>der</strong>en Nebenflüsse haben <strong>an</strong> beiden Seiten des<br />
Flussbetts einen bis zu vier Meter hohen und mehrere hun<strong>der</strong>t Meter breiten<br />
„Flussrücken“ (Hochufer) gebildet (Tiszarücken, Szamosrücken, Krasznarücken).<br />
Als „Fok“ (Sg.: <strong>der</strong> Fok, Pl.: die Fok) bezeichnet m<strong>an</strong> Durchbrüche durch das<br />
Flussufer, durch die das Hochwasser vom Mutterbett in einen Pol<strong>der</strong> bzw. Koog<br />
strömt und beim Senken des Wasserst<strong>an</strong>des über dieselben Öffnungen zurückfließt.<br />
Die Lage und die Größe <strong>der</strong> Fok waren unterschiedlich, sie lagen z. B. bei<br />
<strong>der</strong> Mittleren <strong>Theiß</strong> vier bis fünf Meter über dem mittleren Wasserspiegel. 7<br />
Das Wasser wurde von den Fok durch Abflussgräben, sog. „A<strong>der</strong>n“ in höher<br />
gelegene Senken geführt. Das Ensemble aus Fok und <strong>der</strong>en A<strong>der</strong>n nennt m<strong>an</strong> Fok-<br />
System (siehe Abb. 2 und 3). Der tiefste Punkt des Fok-Systems war also <strong>der</strong> Fok<br />
selbst, <strong>der</strong> unmittelbar mit dem Flussbett verbunden war. So wurde beim Hochwasser<br />
das <strong>an</strong>grenzende Auengebiet bzw. das <strong>an</strong>thropogen entst<strong>an</strong>dene Wasserbecken<br />
(Abb. 3., „Stachelnuss-See“) stufenweise „von unten“, d. h. von diesem tiefsten<br />
Punkt, ohne zerstörende Erosion aufgefüllt. Durch die A<strong>der</strong>n füllten sich Flächen<br />
mit Wasser, von denen aus wie<strong>der</strong>um <strong>an</strong>grenzende Ackerfluren bewässert<br />
werden konnten. Bei größeren Wassermengen konnten Fischereiseen entstehen,<br />
<strong>der</strong>en Wasser über die A<strong>der</strong>n in das Flussbett zurückgeleitet werden konnte. Die<br />
gemeinsame Bewirtschaftung <strong>der</strong> Fok, <strong>der</strong> A<strong>der</strong>n, und <strong>der</strong> verbundenen Seen, die<br />
flexibel in <strong>der</strong> L<strong>an</strong>dwirtschaft eingesetzt wurden, nennt m<strong>an</strong> Fok-Wirtschaft.<br />
5 Große Gebiete wurden zum Schutz von Burgen vernässt, wie z. B. mit dem Sumpf von Ecsed zum<br />
Schutz <strong>der</strong> gleichnamigen Burg.<br />
6 Die Untersuchungen von Fodor (2001) belegen, dass die Fok-Wirtschaft <strong>an</strong> <strong>der</strong> <strong>Theiß</strong> seit dem 19.<br />
Jahrhun<strong>der</strong>t nur noch in Spuren zu entdecken ist.<br />
7 Quelle: http://www.terra.hu/ci<strong>an</strong>/fok.html<br />
5
6<br />
Linda Szücs<br />
Abb. 2 (l.): Ein typischer Fok am <strong>Theiß</strong>-Ufer in <strong>der</strong> Nähe von Alpár (1786) 8<br />
Abb. 3 (r.): Das Auengebiet von Alpár nach <strong>der</strong> zweiten Militäraufnahme (1861)<br />
(beide Abbildungen aus Fodor 2001)<br />
Wichtige Eigenschaft dieser Fok-Systeme ist erstens, dass sie bei Flut die Erosion<br />
durch das Wassers vermin<strong>der</strong>n, und zweitens das Sinken des Wasserst<strong>an</strong>des in den<br />
Binnengewässer zu regulieren erlaubten. Diese Art <strong>der</strong> Auenbewirtschaftung verl<strong>an</strong>gsamt<br />
den Takt und das Maß <strong>der</strong> Flussbettän<strong>der</strong>ungen. Das Auffüllen mit Wasser<br />
„von unten“ ermöglicht die Rückleitung in den Fluss und somit die Regulierungen<br />
<strong>der</strong> Überschwemmungen effektiver gestaltet. Es reguliert den Abfluss, so<br />
dass <strong>der</strong> Hochwasserspiegel sinken k<strong>an</strong>n, <strong>der</strong> Wasservorrat in den Überflutungsgebieten<br />
selbst aber zunimmt.<br />
Die bedeutendste Funktion <strong>der</strong> Fok war aber die Sicherung des Fischzuwachses<br />
und damit die Sicherung einer Fischwirtschaft. Mit dem Frühjahrshochwasser<br />
erreichte eine Menge von Fischen das Seebecken. Das flache und sich schnell aufwärmende<br />
Wasser begünstigte das Wachstum des Phyto- und Zoopl<strong>an</strong>ktons und<br />
bot einen günstigen Fortpfl<strong>an</strong>zungsort für Fische. Nach dem Hochwasser hat m<strong>an</strong><br />
<strong>an</strong> den Fok aus Ästen und Zweigen Reusen aufgestellt. Jüngeren Fische konnten<br />
ungehin<strong>der</strong>t in das Flusssystem zurückkehren, ältere und größere Fischarten konnten<br />
entnommen werden (Molnár 2001).<br />
Es existieren drei Theorien zur Entstehung <strong>der</strong> Fok: Andrásfalvy (1975) 9 vermutet,<br />
dass die Fok <strong>an</strong>thropogen entst<strong>an</strong>den sind. Seiner Meinung nach stellen sie Durchstiche<br />
des Ufers dar, die m<strong>an</strong> entgegen <strong>der</strong> Fließrichtung <strong>an</strong>legte und mit <strong>der</strong>en<br />
Hilfe m<strong>an</strong> die nahe gelegenen Senken (Abb. 2) „von unten“ aufgefüllte. So konnte<br />
8 Auf <strong>der</strong> historischen Karte von 1786 sind die typischen Strukturelemente <strong>der</strong> Fokwirtschaft zu<br />
erkennen. Der Stachelnuss-See ist mit <strong>der</strong> <strong>Theiß</strong> von unten – gegen die Fließrichtung <strong>der</strong> <strong>Theiß</strong> -<br />
verbunden. Der obere Teil <strong>der</strong> See ist nicht mit <strong>der</strong> <strong>Theiß</strong> verbunden.<br />
9 Andrásfalvy hat die Fok-wirtschaft (1975) <strong>an</strong> <strong>der</strong> Donau in Sárköz untersucht, welche mehrere<br />
Übereinstimmungen mit <strong>der</strong> Fok-wirtschaft <strong>an</strong> <strong>der</strong> <strong>Theiß</strong> aufweist.
<strong>Auenbewirtschaftungsformen</strong> <strong>an</strong> <strong>der</strong> <strong>Theiß</strong><br />
das Wasser bei Hochwasser abgezweigt und bei Rückg<strong>an</strong>g des Hochwassers in das<br />
Flussbett zurückgeführt werden. Frisnyák (1992) und Károlyi (1975) halten die Fok<br />
für natürlich entst<strong>an</strong>dene Auskolkungen, die von <strong>der</strong> Bevölkerung modifiziert und<br />
unterhalten wurden. Die dritte Gruppe um Deák (2001) und Lászlóffy (1982) ist<br />
<strong>der</strong> Meinung, dass die Fok ausschließlich natürlichen Ursprungs sind und ohne<br />
menschlichen Einfluss funktionierten. Nach ihrer Meinung ergibt sich die Entstehung<br />
<strong>der</strong> Fok aus <strong>der</strong> natürlichen Wasserbewegung.<br />
3.3 Die zweite L<strong>an</strong>dnahme – die <strong>Theiß</strong>regulierung<br />
Im 17. und 18. Jahrhun<strong>der</strong>t wurden in Mittel- und Westeuropa Flussregulierungen<br />
und <strong>der</strong> Bau von K<strong>an</strong>älen vor<strong>an</strong>getrieben (z. B. Nie<strong>der</strong>l<strong>an</strong>de, Rhone-Gebiet, O<strong>der</strong>-<br />
Gebiet usw.). Ungarn weist im Vergleich mit Westeuropa einen wichtigen Unterschied<br />
auf. Wegen <strong>der</strong> regelmäßigen großflächigen Überschwemmungen in den<br />
Auengebieten konnte eine Kapitalakkumulation in <strong>der</strong> Agrarwirtschaft nicht vor<br />
Einsetzen von Hochwasser-Regulierungsmaßnahmen erfolgen. In Westeuropa<br />
hingegen hatte die bereits früh gut entwickelte Agrarwirtschaft die Entwicklung<br />
des Wasserbaus geför<strong>der</strong>t, weshalb diese Län<strong>der</strong> auch früh ihr Produktionsniveau<br />
steigern konnten. 10<br />
Die Bevölkerung <strong>an</strong> <strong>der</strong> <strong>Theiß</strong> beg<strong>an</strong>n nach dem Vertreiben <strong>der</strong> Türken (1717)<br />
wie<strong>der</strong> Fuß zu fassen, zu wachsen und die entvölkerten Gebiete wie<strong>der</strong> zu besiedeln.<br />
Mit <strong>der</strong> steigenden Bevölkerungszahl und dem Fortschritt in Europa wuchs<br />
auch die Nachfrage nach immer mehr Getreide und Rin<strong>der</strong>n, so dass es von größtem<br />
Interesse war, das Wasser wie<strong>der</strong> aus den früheren Wirtschaftsflächen zurückzudrängen<br />
(Gyukics 2007).<br />
Eine Reihe von Militäringenieuren und wissenschaftlichen Feldmessern, wie<br />
Mátyás Bél und Sámuel Mikoviny, beteiligten sich <strong>an</strong> <strong>der</strong> kartographischen L<strong>an</strong>desaufnahme.<br />
Sie vermaßen Flüsse und legten die Grundsteine für die <strong>an</strong>gehenden<br />
Wasserregulierungsarbeiten Ende des 18. Jahrhun<strong>der</strong>ts, die die Geschichtsschreibung<br />
als „zweite L<strong>an</strong>dnahme“ bezeichnet (Gyukics 2007).<br />
Diese Regulierungsmaßnahmen haben deutliche Än<strong>der</strong>ungen in <strong>der</strong> L<strong>an</strong>dwirtschaft<br />
mit sich gebracht (Abbildung 4). In 100 Jahren hat die Ackerfläche um 50 %<br />
zugenommen, <strong>der</strong> Anteil <strong>der</strong> Wiesen und Weiden aber um 50 % abgenommen<br />
(Szalai 1992). Die Entwässerungsarbeiten haben die ungarische Tiefebene bis Mitte<br />
des 19. Jahrhun<strong>der</strong>ts zum trockensten Gebiet des Karpatenbeckens werden lassen.<br />
Im Zusammenh<strong>an</strong>g damit wurde die extensive Viehzucht eingestellt, es vermin<strong>der</strong>te<br />
sich die Anzahl <strong>der</strong> Tiere, und allmählich wurden diese Gebiete zu Ackerl<strong>an</strong>d<br />
(Bellon 1996).<br />
10 Die Wassermaßnahmen des Habsburger Reichs hatten im 18. Jahrhun<strong>der</strong>t für West-Europa wegen<br />
<strong>der</strong> Kr<strong>an</strong>kheitsmin<strong>der</strong>ung eine große Bedeutung. Der im 20. Jahrhun<strong>der</strong>t aufgestellte Cordon S<strong>an</strong>itair<br />
– das Isolationsgebiet zur Eindämmung von Seuchen – hat dazu beigetragen, die Kr<strong>an</strong>kheiten, wie<br />
Malaria, Rin<strong>der</strong>seuche, o<strong>der</strong> die Heuschreckenschäden zu vermin<strong>der</strong>n.<br />
7
8<br />
Anteil (%)<br />
100<br />
90<br />
80<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
Die Verteilung <strong>der</strong> L<strong>an</strong>dnutzungstypen im heutigen Gebiet<br />
von Ungarn<br />
1853 1867 1883 1895 1913 1925 1935 1949 1956<br />
Jahr<br />
Linda Szücs<br />
Steuerfreies Gebiet<br />
Streuobst<br />
Ried<br />
Wald<br />
Weingebiet<br />
Weide<br />
Wiese<br />
Acker<br />
Abb. 4 Die Verteilung <strong>der</strong> L<strong>an</strong>dnutzungstypen im heutigen Gebiet von Ungarn von 1853<br />
bis 1956 (Sz cs nach Daten von Szalai, 1992)<br />
Das Absperren des sogen<strong>an</strong>nten Mirhó-Foks <strong>an</strong> <strong>der</strong> Oberen <strong>Theiß</strong> 1754 war die<br />
erste Flutentlastungsarbeit, die ein Gebiet von bedeutendem Umf<strong>an</strong>g einschloss. 11<br />
Der wirtschaftspolitische Rahmen <strong>der</strong> Wasserarbeiten wurde später von István<br />
Széchényi ausgearbeitet. Er schrieb in seinem Flugblatt „Ged<strong>an</strong>kenfragmente im<br />
Bezug auf die Org<strong>an</strong>isierung des <strong>Theiß</strong>-Tales“ im Jahre 1846: „Das <strong>Theiß</strong>-Tal und<br />
dessen Regulierung ist meines Erachtens nicht als regionaler, o<strong>der</strong> für einige Bereiche<br />
als vorteilhaft <strong>an</strong>zusehen<strong>der</strong> Umst<strong>an</strong>d zu betrachten, son<strong>der</strong>n vielmehr unter<br />
dem Aspekt, <strong>der</strong> sich für die nationalen Interessen und für die enormen Wasser<strong>an</strong>lagen<br />
durch die größtmögliche Ausgeglichenheit ergibt.“<br />
Er rief die „Gesellschaft des <strong>Theiß</strong>-Tales“ ins Leben, die zum Motor <strong>der</strong> praktischen<br />
<strong>Theiß</strong>-Regulierung wurde. Der Wasserbau-Ingenieur Vásárhelyi fasste die<br />
Arbeiten zusammen und skizzierte den technischen Pl<strong>an</strong> zur <strong>Theiß</strong>-Regulierung.<br />
Etwa zur Jahrhun<strong>der</strong>twende entst<strong>an</strong>den Staudämme von insgesamt 4200 km<br />
Länge, die – nach den Nie<strong>der</strong>l<strong>an</strong>den – das zweitgrößte Hochwasserschutzsystem<br />
Europas bildeten. Durch die pl<strong>an</strong>mäßigen Einschneidungen verkürzte sich <strong>der</strong><br />
Flusslauf <strong>der</strong> <strong>Theiß</strong> um mehr als 400 km. Die Gefahr des aufstauenden Wassers<br />
wurde allerdings nur verringert, nicht aufgehoben. Nicht umsonst lautet <strong>der</strong> be-<br />
11 Die Maßnahme wurde ein Jahr nach <strong>der</strong> großen preußischen O<strong>der</strong>melioration (Trockenlegung <strong>der</strong><br />
Flussaue, Teil-K<strong>an</strong>alisierung <strong>der</strong> O<strong>der</strong>) unterhalb Fr<strong>an</strong>kfurt/O<strong>der</strong> begonnen. Es darf vermutet werden,<br />
dass die Erfahrungen <strong>der</strong> Wasserbauer im 18.Jh. nicht wirklich von L<strong>an</strong>desgrenzen behin<strong>der</strong>t<br />
wurden.
<strong>Auenbewirtschaftungsformen</strong> <strong>an</strong> <strong>der</strong> <strong>Theiß</strong><br />
rühmte Spruch <strong>der</strong> Bauern in <strong>der</strong> Tiefebene: „Zwei Götter brauchen wir, einen,<br />
<strong>der</strong> das Wasser gibt, und einen <strong>an</strong><strong>der</strong>en, <strong>der</strong> es wie<strong>der</strong> nimmt!“ (Gyukics 2007).<br />
3.4 Die <strong>Theiß</strong> heute<br />
In <strong>der</strong> Mitte des 20. Jahrhun<strong>der</strong>t beg<strong>an</strong>n eine neue Ära in <strong>der</strong> Entwicklung <strong>der</strong><br />
Wasserwirtschaft des <strong>Theiß</strong>-Tales. Mitte <strong>der</strong> 1960er Jahre wurden die Pläne für das<br />
Bewässerungssystem <strong>der</strong> Tiefebene durch die Errichtung des Stausees von Kisköre<br />
einschließlich <strong>der</strong> damit verbundenen Deiche, K<strong>an</strong>äle und <strong>der</strong> <strong>an</strong><strong>der</strong>en Strombauobjekte<br />
erstellt. Die Bauarbeiten und die Errichtung des Stausees waren in drei<br />
Bauetappen gepl<strong>an</strong>t, es wurden aber nur zwei dieser Bauetappen verwirklicht. 1973<br />
wurde <strong>der</strong> Wasserst<strong>an</strong>d des zum ersten Mal Flusses erhöht, 1978 erhöhte m<strong>an</strong> den<br />
Wasserst<strong>an</strong>d um weitere <strong>an</strong><strong>der</strong>thalb Meter. Für die dritte Phase wäre eine weitere<br />
Anhebung des Wasserst<strong>an</strong>des um <strong>an</strong><strong>der</strong>thalb bis zwei Meter gepl<strong>an</strong>t gewesen, mit<br />
dem Ergebnis, dass die einzelnen Inseln, die heutzutage dem See seinen beson<strong>der</strong>en<br />
Reiz geben und vielen Lebewesen Lebensraum bieten, überflutet worden wären.<br />
Die Bestimmung des Staudamms und Stausees von Kisköre wurde bald neu<br />
bewertet und so entst<strong>an</strong>d <strong>der</strong> „<strong>Theiß</strong>-See“ mit einer Fläche von 127 km 2 als natürliche<br />
Filter<strong>an</strong>lage für die <strong>Theiß</strong>.<br />
L<strong>an</strong>dschaftlich verkörpert <strong>der</strong> See die Überschwemmungsbereiche aus den<br />
Zeiten vor <strong>der</strong> Flussregulierung. Demzufolge spielt er eine bedeutende Rolle, sowohl<br />
im Leben als auch im Nist- und Brutverhalten <strong>der</strong> Zugvögel (siehe unten:<br />
„Ausflugsziel <strong>Theiß</strong>-See“). Neben <strong>der</strong> Sicherung <strong>der</strong> Wasservorräte haben heute<br />
Naturschutz und Tourismus Vorr<strong>an</strong>g.<br />
In den letzten Jahren gab es mehrere Hochwasser im Gebiet <strong>der</strong> <strong>Theiß</strong>. Im<br />
Jahr 1998 überstieg <strong>der</strong> Wasserst<strong>an</strong>d <strong>der</strong> Oberen <strong>Theiß</strong> den jemals gemessenen<br />
höchsten Wasserst<strong>an</strong>d um 93 cm. Darauf folgte 1999 die Mittlere <strong>Theiß</strong>, die den<br />
bei Szolnok gemessenen Rekord aus dem Jahre um 65 cm übertraf. Die jüngste<br />
Katastrophe geschah im Jahr 2010, als große Regenmengen die zweitgrößte Überflutung<br />
<strong>der</strong> Geschichte verursachten.<br />
4 Schlussfolgerung<br />
Die jüngsten Hochwasser haben bewiesen, dass die Sicherheitsphilosophie von<br />
Széchényi und Vásárhelyi weiterer Entwicklung bedarf. Das Wirtschaften mit dem<br />
Fluss – nicht mehr gegen ihn –, die Verwirklichung <strong>der</strong> Weiterentwicklung des<br />
Vásárhelyi-Pl<strong>an</strong>s und <strong>der</strong> Einbau von Flutgebietsspeichern als Sicherheitsventil ins<br />
System sind dringend notwendig. M<strong>an</strong> k<strong>an</strong>n die Dämme nicht bis zum Himmel<br />
bauen. Die Flüsse müssen zurückbekommen, was ihnen gehört, und dies k<strong>an</strong>n nur<br />
geschehen, wenn <strong>der</strong> Mensch am Ufer <strong>der</strong> <strong>Theiß</strong> den ausgeglichenen Weg zum<br />
friedlichen Nebenein<strong>an</strong><strong>der</strong>leben neu entdeckt. Vielleicht ist die Wie<strong>der</strong>belebung<br />
<strong>der</strong> Fok-Wirtschaft eine Antwort darauf?<br />
9
10<br />
5 Ausflugsziel <strong>Theiß</strong>-See<br />
Linda Szücs<br />
Der <strong>Theiß</strong>-See befindet sich 150 km östlich von Budapest im Komitat Heves. Mit<br />
dem Auto gel<strong>an</strong>gt m<strong>an</strong> über die Autobahn M3 zum <strong>Theiß</strong>-See, bei Füzesabony<br />
muss in Richtung Tiszafüred abgefahren werden.<br />
Der <strong>Theiß</strong>-See wird von <strong>der</strong> Eisenbahnstrecke Füzesabony-Debrecen überquert.<br />
Auf dieser Strecke verkehren Regionalzüge im Zweistunden-Takt, die <strong>an</strong><br />
beiden Ufern des Sees in den Orten Poroszló und Tiszafüred halten. Der Fahrradweg<br />
um den See ermöglicht einen schönen Ausflug. Außerdem besteht die Möglichkeit,<br />
mit K<strong>an</strong>ubooten den See auf Augenhöhe zu entdecken.<br />
In Tiszafüred entst<strong>an</strong>d im Jahre 1949 das erste Dorfmuseum des L<strong>an</strong>des, in<br />
dem typisches Sattelzeug <strong>der</strong> Hirten, Keramik und historische Angelgeräte gezeigt<br />
werden.<br />
Abb. 5: Blick über den <strong>Theiß</strong>-See<br />
Das im nördlichen Gebiet des Sees, in <strong>der</strong> Bucht von Tiszavalk gelegene Vogelreservat<br />
ist streng geschützt. Es wurde in die Reihe <strong>der</strong> international <strong>an</strong>erk<strong>an</strong>nten<br />
Lebensräume für Wasservögel aufgenommen und gehört zum Nationalpark Hortobágy,<br />
<strong>der</strong> den von <strong>der</strong> UNESCO verliehenen Titel „Teil des Weltnaturerbes“<br />
erl<strong>an</strong>gt hat. Die Zugvögel, die hier zwischenl<strong>an</strong>den, wie z. B. <strong>der</strong> Kr<strong>an</strong>ich, <strong>der</strong><br />
Schwarzstorch, das Blässhuhn o<strong>der</strong> <strong>der</strong> Silberreiher aus Finnl<strong>an</strong>d, Russl<strong>an</strong>d, dem<br />
Baltikum, Weißrussl<strong>an</strong>d und <strong>der</strong> Ukraine, fliegen auf <strong>der</strong> Ostroute – dem sog. „Eastern<br />
Flyway“. Für sie ist <strong>der</strong> <strong>Theiß</strong>-See als Rastplatz von außerordentlicher Bedeutung.<br />
Von diesem „Trittsteinbiotop“ fliegen die Zugvögel in Richtung Bosporus<br />
und weiter in den Nahen Osten.
<strong>Auenbewirtschaftungsformen</strong> <strong>an</strong> <strong>der</strong> <strong>Theiß</strong><br />
Am <strong>Theiß</strong>-See liegen mehrere kleine Urlaubsorte, wie Abádszalók, Karczak<br />
o<strong>der</strong> Kisköre, die am besten auf dem Fahrradweg um den <strong>Theiß</strong>-See zu erreichen<br />
sind. In unmittelbarer Nähe befinden sich auch Str<strong>an</strong>d- und Freibä<strong>der</strong>, die ihr<br />
Wasser aus Thermalquellen beziehen. Beson<strong>der</strong>s Tiszacsege, wo das Heilwasser<br />
eine Temperatur von 81°C hat, ist bei Rheumatikern in g<strong>an</strong>z Ungarn beliebt.<br />
Literatur<br />
Andrásfalvy B. (1975) Duna mente népének ösi ártéri gazdálkodása Tolna és<br />
Bar<strong>an</strong>ya megyében az ármentesítés befejezéséig. (<strong>Auenbewirtschaftungsformen</strong><br />
<strong>der</strong> frühen Bevölkerung <strong>an</strong> <strong>der</strong> Donau in Komitat Tolna und Bar<strong>an</strong>ya),<br />
Szekszárd<br />
Bálint Cs. (1980) Természeti földrajzi tényezök a honfoglaló magyarok<br />
megtelepedésében. (Naturgeographische Faktoren in <strong>der</strong> Ansiedlung <strong>der</strong><br />
ungarischen L<strong>an</strong>dnehmer) In: Ethnographia: A Magyar Néprajzi Társaság<br />
folyóirata, 91. Jahrg<strong>an</strong>g, Akadémiai Kiadó, Budapest. S. 35-49<br />
Bellon T. (1996) A nagykunsági mezövárosok állattartó gazdálkodása a 18 - 19.<br />
századb<strong>an</strong> - történeti-néprajzi t<strong>an</strong>ulmány. (Die Viehzuchtwirtschaft <strong>der</strong><br />
Marktflecken in Großkum<strong>an</strong>ien in den 18-19. Jahrhun<strong>der</strong>ten – Eine historischethnographische<br />
Studie) Karcag Város Önkormányzata, Karcag<br />
Bellon T. (2003) A Tisza néprajza – Ártéri gazdálkodás a tiszai Alföldön. (Die<br />
Ethologie <strong>der</strong> <strong>Theiß</strong> – Auenwirtschaft <strong>an</strong> <strong>der</strong> ungarischen Tiefebene) Timp<br />
Kiadó, Budapest<br />
Deák Antal András (2001): Fokok és délibábok. (Fok und Kimmungen) In:<br />
Hidrológiai Közlöny, 89./1. S. 39-41.<br />
Fodor Z. (2001) Az ártéri gazdálkodás fokai a Tisza mentén. (Die Fok <strong>der</strong><br />
Auenwirtschaft <strong>an</strong> <strong>der</strong> <strong>Theiß</strong>) In: Földrajzi Konferencia (Konferenzb<strong>an</strong>d),<br />
Szeged<br />
Frisnyák S. Dr. (1992) Az Alföld kultúrgeográfiai korszakai. (Die<br />
kulturgeographischen Epochen <strong>der</strong> ungarischen Tiefebene) In: Mérlegen a<br />
Tisza szabályozás. Magyar Hidrológiai Társaság és az Országos Vízügyi<br />
F igazgatóság, Budapest. S. 3-18.<br />
Gyukics P. (2007) Entl<strong>an</strong>g <strong>der</strong> Brücken auf <strong>der</strong> <strong>Theiß</strong>: Vom Ursprung bis zum<br />
Einmündung. Yuki Stúdió, Budapest<br />
Glassl H. (1970) Der Ausbau <strong>der</strong> ungarischen Wasserstraßen in den letzten<br />
Regierungsjahren Maria Theresias In: Ungarn-Jahrbuch. Zeitschrift für die<br />
Kunde Ungarns und verw<strong>an</strong>dte Gebiete. B<strong>an</strong>d 2, Jahrg<strong>an</strong>g 1970, von Hase &<br />
Koehler Verlag, Mainz<br />
11
12<br />
Linda Szücs<br />
Károlyi, Zs. – Nemes, G. (1975) Szolnok és a Közép-Tiszavidék vízügyi múltja.<br />
(Die Verg<strong>an</strong>genheit von Szolnok und <strong>der</strong> Mittlere-<strong>Theiß</strong>gebiet) – In: Vízügyi<br />
Történeti Füzetek, 8. Vízdok, Budapest<br />
Lászlóffy Woldemár (1982): A Tisza. (Die <strong>Theiß</strong>) Vízi munkálatok és<br />
vízgazdálkodás a Tisza vízrendszerében. Akadémiai Kiadó, Budapest<br />
Molnár S. (2001) A középkori fokgazdálkodás nyomainak kutatása az Ecseg-tó<br />
területén. (Untersuchung <strong>der</strong> Spuren <strong>der</strong> Fok-wirtschaft am Ecseg-See).<br />
Zusammenfassung einer Dissertation, SZTE TTK Földt<strong>an</strong>i és Öslényt<strong>an</strong>i<br />
T<strong>an</strong>szék, Szeged<br />
Orosz I. (1992) Az Alföld mezögazdasága és a Tisza szabályozás. (Die<br />
L<strong>an</strong>dwirtschaft <strong>der</strong> ungarischen Tiefebene und die Regulierung <strong>der</strong> <strong>Theiß</strong>). In:<br />
Mérlegen a Tisza szabályozás. Magyar Hidrológiai Társaság és az Országos<br />
Vízügyi Föigazgatóság, Budapest. S. 25-32<br />
Szalai Gy. (1992) A vízrendezési es öntözési feladatok megjelenése és fejlödése az<br />
Alföldön. (Die Erscheinung und Entwicklung <strong>der</strong> Wassermaßnahmen und<br />
Bewässerungsmaßnahmen auf <strong>der</strong> ungarischen Tiefebene). In: Mérlegen a<br />
Tisza szabályozás. Magyar Hidrológiai Társaság és az Országos Vízügyi<br />
Föigazgatóság, Budapest. S. 95-110<br />
Tóth A. (2000) A Tisza-völgy vízrajzi állapotának változása a történelem folyamán<br />
(Die Verän<strong>der</strong>ungen des hydrographischen Zust<strong>an</strong>ds <strong>der</strong> <strong>Theiß</strong> in <strong>der</strong><br />
Geschichte). In: Ezer év a Tisza mentén (A millenium in the Tisza region).<br />
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatósága, Szolnok. S. 15-30<br />
Walther H. Wernsdorfer (2002) Malaria in Mitteleuropa. In: Denisia 6, Kataloge<br />
des OÖ. L<strong>an</strong>desmuseums, Neue Folge Nr. 184 (2002), Biologiezentrum Linz.<br />
S. 201-212<br />
Bildquellen:<br />
Abbildung auf <strong>der</strong> ersten Seite: Gemälde von Márton Zsoldos („<strong>Theiß</strong>gebiet aus<br />
<strong>der</strong> Vogelperspektive”) (2008)<br />
Abb. 1: Orographie und Flusssysteme des Theiss-Einzugsgebietes (Shmu et al.<br />
2003, zitiert nach Tisza-River-Project, Friedrich Schiller-Universität Jena,<br />
Institut für Geographie. http://www.geoinf.uni-jena.de/4482.0.html . zuletzt<br />
besucht am 2.8.2010<br />
Abb. 2: Historische Karte aus dem Jahre 1786 OL. S.80. Tisza 1./1. In: Fodor Z.<br />
(2001) Az ártéri gazdálkodás fokai a Tisza mentén. (Die Grade <strong>der</strong><br />
Auenwirtschaft <strong>an</strong> <strong>der</strong> <strong>Theiß</strong>) In: Földrajzi Konferencia (Konferenzb<strong>an</strong>d),<br />
Szeged
<strong>Auenbewirtschaftungsformen</strong> <strong>an</strong> <strong>der</strong> <strong>Theiß</strong><br />
Abb. 3: Das Auengebiet von Alpár nach <strong>der</strong> zweiten Militäraufnahme (1861)<br />
36./56. In: Fodor Z. (2001) Az ártéri gazdálkodás fokai a Tisza mentén. (Die<br />
Grade <strong>der</strong> Auenwirtschaft <strong>an</strong> <strong>der</strong> <strong>Theiß</strong>) In: Földrajzi Konferencia<br />
(Konferenzb<strong>an</strong>d), Szeged<br />
Abb. 4: Diagramm aus den Daten von Szalai (1992), erstellt von Linda Szücs<br />
Abb. 5: <strong>Theiß</strong>-See (Foto: Linda Szücs, 2006)<br />
13