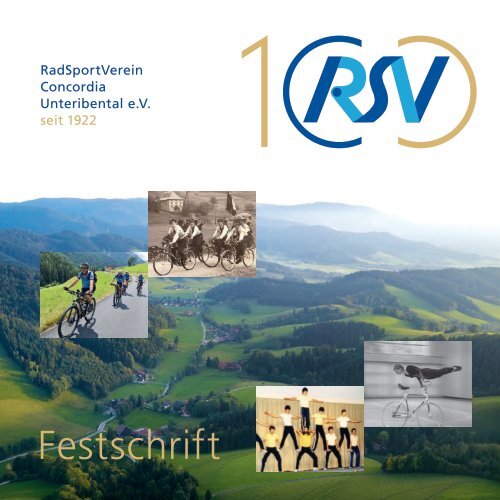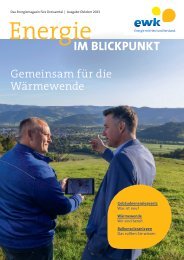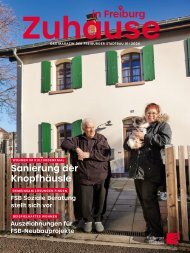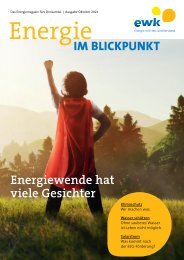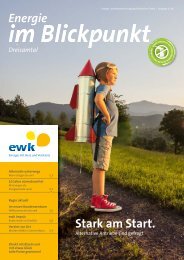RSV-Festschrift
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
RadSportVerein<br />
Concordia<br />
Unteribental e.V.<br />
seit 1922<br />
<strong>Festschrift</strong>
DOLD HOLZWERKE<br />
DER NACHHALTIGE<br />
ARBEITGEBER IN DER REGIO
Was Sie in der <strong>Festschrift</strong> erwartet<br />
Festprogramm 4<br />
Grußwort der Vorstandschaft 5<br />
Grußwort des Bürgermeisters 6<br />
Die Ortschaft Unteribental gratuliert 7<br />
In Gedenken an unsere Verstorbenen 10<br />
Chronik RadSportVerein Concordia Unteribental e.V. 11<br />
Die erste Ausfahrt des Radfahrvereins nach dem 2. Weltkrieg 28<br />
Korso-Sport vom Anfang bis zum Ende 30<br />
Die Erfolgsgeschichte der Kunstradsportgruppe 34<br />
Chronik der Turnabteilung 42<br />
Unsere Turn-Trainingsgruppen 44<br />
Chronik der MTB-Abteilung 48<br />
Unsere MTB-Trainingsgruppen 51<br />
Aus der Chronik von Unteribental 62<br />
Die Schule in Unteribental 88<br />
Es war einmal … 96<br />
Herzlichen Dank 97<br />
Impressum 97<br />
3
Festprogramm<br />
der Feierlichkeiten<br />
zum 100-jährigen Bestehen<br />
des <strong>RSV</strong> Unteribental<br />
Samstag, 16. September 2023<br />
in der Sommerberghalle<br />
Großer Jubiläumsabend<br />
Einlass 18:00 Uhr _ Sektempfang<br />
Beginn 19:00 Uhr _ Drei-Gänge-Menü<br />
Programm<br />
• Kunstradfahr-Vorführungen<br />
• Trail-Akrobatik Patrick Schechinger mit Partner<br />
• Sketche der Theatergruppe Unteribental<br />
• Brass Makers<br />
• Fuß & Friends<br />
Sonntag, 17. September 2023<br />
Beginn 14:00 Uhr<br />
Festumzug Korso<br />
mit Korsofreunden von Vereinen des Badischen<br />
und Württembergischen Radsport-Verbandes;<br />
es werden über 200 Mitwirkende erwartet<br />
Moderation<br />
Otto Huber (Hauptstraße Ehrentribüne)<br />
Umzugsstrecke<br />
Sommerberg/ Hauptstraße/ Schulstraße<br />
13:45 Uhr _ Aufstellung am Sommerberg<br />
14:00 Uhr _ Festumzug<br />
17:00 Uhr _ Preisverleihung<br />
Ab 12:00 Uhr<br />
Bewirtung in der Sommerberghalle und an Ständen<br />
vor dem Rathaus und vor der Halle<br />
Reichhaltige Speisen- und Getränkeauswahl, Kaffeestube<br />
mit selbstgebackenen Kuchen und Torten<br />
17:30 Uhr<br />
Ziehung der Gewinner der Jubiläums-Tombola<br />
4
Grußwort der Vorstandschaft<br />
Es war mit Sicherheit mutig, dass vor 100 Jahren sich einige<br />
wenige Männer zusammengefunden hatten, um unseren<br />
<strong>RSV</strong> Unteribental zu gründen. Diese Tatsache und die daraus<br />
erwachsene Tradition sind uns Auftrag und Verpflichtung, die<br />
Geschicke des Vereins auch in unserer Zeit zu lenken und einen<br />
immateriellen, weil nicht in Geld aufzuwiegenden Nutzen für<br />
unsere Mitglieder, für die Gemeinde und auch für uns selbst zu<br />
erzeugen.<br />
Die Güter, mit denen wir den Wert des Vereins bemessen<br />
wollen, sind Freude und Spaß, Zusammenhalt und Geselligkeit,<br />
Gemeinschaft und Verantwortung für sich und andere. Dabei<br />
soll das Erlernen der sportlichen Fähigkeiten und das fortwährende<br />
Trainieren die körperliche Fitness schaffen und dauerhaft<br />
erhalten. Dies zum Wohl dessen, der sich dank seiner persönlichen<br />
Fitness wohl fühlen kann. Es soll auch ausstrahlen auf<br />
die Gesellschaft, denn Menschen, die sich wohl fühlen, die fit<br />
sind, können andere im Positiven anstecken und mitziehen.<br />
Zur Korso-und Rennsportgruppe, die von Anfang an sportliche<br />
Disziplinen waren, kamen 1972 die Saalsportgruppe (Kunstradfahren)<br />
und 1973 die Gymnastikgruppen und ab 2007 die<br />
Abteilung Mountainbike hinzu.<br />
Mit den regelmäßigen Veranstaltungen schaffen wir die Räume<br />
für Austausch, für Genuss und für gesundes Lachen, kurz dafür,<br />
dass wir es uns alle gut gehen lassen dürfen. Davon können wir<br />
alle gewinnen, das ist auch die Mühe wert, die es zweifelsohne<br />
erfordert.<br />
Wie damals, als die Unterstützung „maßgeblicher Personen in<br />
der Gemeinde“ schon für die Vereinsgründung erforderlich<br />
war, so sind auch wir im Vorstand auf die Unterstützung angewiesen.<br />
Wir bekommen diese von der Gemeinde, von unseren<br />
zahlreichen Mitgliedern, von befreundeten Vereinen aus der<br />
Nachbarschaft, von vielen Firmen und Gewerbetreibenden als<br />
unsere Sponsoren.<br />
Wir bedanken uns bei allen, die uns geholfen haben, dieses<br />
Vereinsjubiläum auszurichten. Wir wünschen allen Gästen<br />
viel Freude bei den bevorstehenden Veranstaltungen – einfach<br />
eine gute Zeit!<br />
Die Vorstandschaft des <strong>RSV</strong> Unteribental e.V.<br />
5
Liebe Mitglieder, Freunde<br />
und Gönner<br />
des <strong>RSV</strong> Unteribental!<br />
Vor hundert Jahren gab es noch kein Handy, kein Computer,<br />
kein Dosenbier, man schrieb von Hand oder auf der mechanischen<br />
Schreibmaschine. In den 100 Jahren <strong>RSV</strong> Unteribental<br />
sind viele Dinge und Moden entwickelt worden, die alle wieder<br />
verschwunden sind oder überholt wurden, geblieben ist der<br />
<strong>RSV</strong>.<br />
Aber jetzt im Jahr 2023 so hundert Jahre nach Ihrer Gründung,<br />
ist es wieder erklärtes Ziel und auch als Antwort auf den<br />
fortschreitenden Klimawandel notwendig, das Fahrrad als Teil<br />
der Mobilität und Verkehrswende zu verstehen. Baden-<br />
Württemberg (the LÄND) fördert aktuell mit Programmen wie<br />
MOVERS; BIKE IT! und anderem mehr, das Radfahren und den<br />
Bau von Radwegen.<br />
Vor 100 Jahren: Wer hätte sich das träumen lassen.<br />
Liebe Radler und Radlerinnen des <strong>RSV</strong>, Ihr Hobby, Ihr Sport<br />
ist unverbrüchlich. Sie tragen den Namen unserer Gemeinde<br />
Buchenbach in nationale und internationale Meisterschaften<br />
Ihrer Disziplinen.<br />
Buchenbach ist stolz auf seinen <strong>RSV</strong> im Unteribental, es ist<br />
mir eine Ehre Schirmherr der Jubiläumsfeierlichkeiten zu sein.<br />
Ihnen Allen ein Dankeschön für Ihr ehrenamtliches Wirken<br />
im <strong>RSV</strong>.<br />
Herzlichst<br />
Ihr Ralf Kaiser,<br />
Bürgermeister<br />
6
Die Ortschaft Unteribental<br />
gratuliert voller Stolz „ihrem“<br />
Jubilar.<br />
Es verdient höchste Anerkennung, wie der <strong>RSV</strong> Concordia<br />
Unteribental e.V. über nunmehr 101 Jahre die in § 1 seiner<br />
Gründungssatzung vom 28.5.1921 niedergelegten Vereinszwecke,<br />
„der Pflege des Radsports und der Pflege der<br />
Kameradschaft und der geselligen Unterhaltung“ mit Leben<br />
erfüllt hat.<br />
Vorausschauende und kreative Verantwortliche haben mit<br />
großem Erfolg bei den Mitgliedern und getragen von der ganzen<br />
Bürgerschaft, über sportliche Angebote ein Vereinsleben<br />
geschaffen, das die gesamte Ortschaft jederzeit geprägt hat.<br />
Jung und Alt kann sich bei sportlicher Betätigung aus einem<br />
überaus vielfältigen Angebot bedienen und zugleich über<br />
die sprichwörtlich gute Kameradschaftspflege das Leben in<br />
der örtlichen Gemeinschaft mit Einsatz und Freude erfolgreich<br />
mitgestalten.<br />
Der Verein hat eine unverwechselbare Identität, weil er sich<br />
neuen Entwicklungen im Spitzen- und Breitensport mit Erfolg<br />
geöffnet hat, zugleich aber den verbindenden Wert der<br />
Traditionspflege erkannt und gepflegt hat. So gilt ein besonderer<br />
Dank allen, die mit dieser gelungenen <strong>Festschrift</strong> für die<br />
heutige Generation der Bürgerinnen und Bürger in Unteribental<br />
ein Dokument von bleibendem historischem Wert geschaffen<br />
haben.<br />
Der <strong>RSV</strong> Concordia ist mehr als nur ein Sportverein.<br />
Die Ortschaft mit ihrem vielfältigen Gemeinschaftsleben kann<br />
man sich ohne das Wirken des Vereins mit seinen engagierten<br />
Mitgliedern nicht vorstellen.<br />
Der Ortschaftsrat dankt allen, die durch ihre Mitgliedschaft<br />
über mehr als ein Jahrhundert das örtliche Leben mitgestaltet<br />
und geprägt haben. Wir wünschen dem überaus lebendigen<br />
Jubilar eine weiter erfolgreiche Zukunft. Unserer Unterstützung<br />
kann er sicher sein.<br />
Christoph Frank,<br />
Ortsvorsteher<br />
7
Griesdobelstr. 2<br />
79256 Buchenbach<br />
Tel. 0 76 61 / 90 31 90<br />
Thomas Maier<br />
info@maier-buchenbach.de<br />
Thomas Maier<br />
info@maier-buchenbach.de<br />
www.maier-buchenbach.de<br />
Möbel nach Maß<br />
Möbel 90 31 90 / 61 76 0 Tel. nach Maß<br />
79256 Buchenbach<br />
Griesdobelstr. 2<br />
Griesdobelstr. 2<br />
79256 Buchenbach<br />
Griesdobelstr. 2<br />
Tel.<br />
79256 0 76<br />
Buchenbach<br />
61 / 90 31 90<br />
info@maier-buchenbach.de<br />
Tel. 0 76 61 / 90 31 90<br />
Möbel nach Maß<br />
Thomas Maier<br />
www.maier-buchenbach.de<br />
info@maier-buchenbach.de<br />
Thomas Maier<br />
www.maier-buchenbach.de<br />
Möbel nach Maß<br />
Tel.: 01703254072
Jobs & Karriere<br />
bei Dreisamtals größtem Arbeitgeber!<br />
Du bist ein Teamplayer und möchtest dich am Erfolgskurs von Testo Industrial Services beteiligen?<br />
Dann bist du bei uns genau richtig!<br />
Vom Azubi, Berufs- oder Quereinsteiger bis zum Fachspezialisten,<br />
wir freuen uns auf neue Kolleg:innen!<br />
Informiere dich jetzt auf unserer Website<br />
über unsere offenen Stellen.<br />
www.testotis.de/jobs<br />
Testo Industrial Services GmbH · Gewerbestraße 3 · 79199 Kirchzarten
In Dankbarkeit gedenken wir unserer<br />
Ehrenmitglieder und Mitglieder,<br />
sowie allen Freunden und Förderern<br />
unseres Vereins,<br />
die der Tod aus unserer Mitte<br />
genommen hat.<br />
Wir werden sie in guter<br />
Erinnerung behalten.
Chronik<br />
11
1920 waren junge radsportbegeisterte Männer in den vorhandenen<br />
Nachbarvereinen tätig. Daraus entstand der Wunsch, in<br />
der eigenen Gemeinde auch einen Radfahrverein zu gründen,<br />
zumal das Fahrrad in jener Zeit die Straßenszene beherrschte<br />
und das häufigste Fortbewegungsmittel war.<br />
Um überhaupt einen Verein zu gründen und zu unterhalten,<br />
bedurfte es in der damaligen Zeit der Zustimmung und Unterstützung<br />
maßgeblicher Personen in der Gemeinde. Nun, diese<br />
wurden gefunden in der Person des damaligen Bürgermeisters<br />
Josef Heizler und Schlossermeisters Theodor Eckmann.<br />
Mit dieser Zustimmung und Unterstützung wurde am 28. Mai<br />
1921 ins Gasthaus Hirschen zur Gründungsversammlung<br />
eingeladen. Folgende Personen hatten sich eingefunden und<br />
hoben den Verein aus der Taufe, sie gaben ihm den Namen<br />
Radfahrverein „Concordia“ Unteribental.<br />
Anwesende bei der Gründungsversammlung:<br />
Peter Bartberger Wickehüsli (Wickenhäuschen)<br />
Leo Dold<br />
Kleiburehofbur (Kleinbauernhof)<br />
Josef Dold<br />
Kleiburehof (Kleinbauernhof)<br />
Theodor Eckmann Schmi:dewäber (Schmiede-Weber)<br />
Josef Heizler<br />
August Heizler Brüder vum Jägerhof<br />
Friedrich Heizler<br />
Engelbert Ketterer alte Stroßewart (alter Straßenwart)<br />
Wilhelm Löffler Wirt vum Wirtshisli (Wirt v. Hirschen)<br />
Pius Molz<br />
Waldhiäter (Waldhüter)<br />
Max Saier<br />
Maxehofbur<br />
Leo Saier<br />
Melcherhofbur<br />
Karl Saier<br />
Haurihofbur<br />
August Steinhart Peterhofbur<br />
Albert Willmann Schni:derhofbur (Schneiderhofbauer)<br />
Emil Willmann Schlegelhofbur<br />
Josef Willmann<br />
Wilhelm Willmann I Weberdobelhisli<br />
Wilhelm Willmann II Schni:derhof<br />
In den Vorstand wurden gewählt:<br />
1. Vorsitzender: Max Saier<br />
2. Vorsitzender: Josef Willmann<br />
Schriftführer<br />
und Rechner: Emil Willmann<br />
Fahrwart:<br />
Albert Willmann<br />
Beisitzer:<br />
Friedrich Heizler, Leo Saier<br />
Für die damaligen Verhältnisse sehr beachtlich, gab sich der<br />
junge Verein sofort eine Vereinssatzung. In § 1 dieser Satzung<br />
Stand: Der Zweck unseres Vereins ist die Pflege des Radsports,<br />
ferner Pflege der treuen Kameradschaft und der geselligen<br />
Unterhaltung.<br />
Im ersten Jahr konnte der junge Verein immerhin 60 neue<br />
Mitlieder aufnehmen. Bei jeder sich bietenden Gelegenheit<br />
beteiligte sich der Verein an radsportlichen Veranstaltungen in<br />
der näheren und weiteren Umgebung.<br />
Neben dem Korso-Sport wurde aktiver Rennsport betrieben.<br />
Die erste Generalversammlung nach der Gründung im Jahre<br />
1923 brachte eine Änderung im Vorstand.<br />
In dieser Generalversammlung wurde folgender<br />
Vorstand gewählt:<br />
1. Vorsitzender: Friedrich Heizler<br />
2. Vorsitzender: Theodor Eckmann<br />
Schriftführer: Karl Willmann<br />
Rechner:<br />
Karl Saier<br />
Beisitzer:<br />
Dominikus Saier, Bürgermeister<br />
Hugo Volk, Hauptlehrer<br />
Wilhelm Willmann, Ratschreiber<br />
Diesem neuen Vorstand oblag nun die Aufgabe, ein Banner zu<br />
beschaffen und die Vorbereitungen zu treffen für die Fahnenweihe.<br />
Am 24. Mai 1925 konnte der Verein die Fahnenweihe<br />
abhalten, wozu sich 25 Gastvereine eingefunden hatten. Der<br />
Radfahrverein Ebringen übernahm die Patenschaft, da man zu<br />
diesem Verein besonders enge Beziehungen hatte. Durch die<br />
gute Unterstützung aller Mitglieder und der ganzen Gemeinde<br />
wurde das Fest der Fahnenweihe für den jungen Verein ein<br />
großer stolzer Erfolg.<br />
12
Radrennfahrer Sportfest 1925<br />
Hintere Reihe: Max Löffler (*1906, †1969), Leo Dold (*1903, †1990), August Steinhart (*1902, †1993)<br />
Vordere Reihe: Wilhelm Löffler (*1903, †1942), Karl Willmann (*1897, †….), Albert Willmann (*1902, †1981)<br />
13
24. Mai 1925 – Fahnenweihe<br />
4. Reihe:<br />
??, Johann Ketterer, ??, ??<br />
3. Reihe:<br />
??, Josef o. August Heizler,<br />
Wilhelm Löffler, August Steinhart, ??,<br />
??, Wilhelm Willmann<br />
2. Reihe:<br />
Josef Willmann, Leo Dold, Friedrich<br />
Heizler, Albert Willmann, ??,<br />
Ewald Willmann, Josef Willmann<br />
1. Reihe:<br />
??, Frieda Ketterer später Warth,<br />
Maria Willmann später Schlegel,<br />
Augusta Steinhart, Karl Willmann,<br />
Sophie Steinhart später Löffler, ??,<br />
Berta Heizler, ??<br />
Fest-Tribüne beim 30-jährigen<br />
Jubiläum auf der Wiese unterhalb<br />
vom Wirtshisli (Gasthaus Hirschen)<br />
14
Festjungfrauen beim 30-jährigen<br />
Jubiläum, im Hintergrund<br />
das alte Schulhaus und Leo Dold<br />
mit Pritschenwagen<br />
Im Jahre 1926 beteiligte sich der Verein mit überaus großer<br />
Beteiligung an der Fahnenweihe des Nachbarvereins „Waldheil“<br />
Stegen und übernahm die angebotene Patenschaft. In der nun<br />
folgenden Zeit beteiligte sich der Verein an allen radsportlichen<br />
Veranstaltungen und errang viele I A Preise im Korso Klasse A,<br />
aber auch einige junge Rennsportler vertraten die Farben des<br />
Vereins und der Gemeinde ganz ausgezeichnet.<br />
Viel zu den Erfolgen in jener Zeit im Korso steuerten die jungen<br />
hübschen Ibentäler Trachtenmädchen bei. Sie gaben dem Verein<br />
neue Impulse und wurden im Verein voll anerkannt, was<br />
für damalige Verhältnisse immerhin sehr beachtlich war. Es gab<br />
zwischenzeitlich keine Familie mehr in der Gemeinde, die nicht<br />
Mitglied des Radfahrvereins war, sodass sich dieses neben dem<br />
Vereinsleben auch positiv im Gemeindeleben auswirkte.<br />
Besonders aber auch die geselligen Veranstaltungen, wie<br />
Theateraufführungen, Hammelverlosungen, Preiskegeln,<br />
Vereinsmeisterschaften im Straßenrennen, Langsamfahren,<br />
Schüler-Dauerlauf, Weihnachtsfeiern, Kameradschaftsabende<br />
und Tanzveranstaltungen (z.B. Kappenabende am Rosenmontag)<br />
fanden im Verein und in der Gemeinde großen Anklang<br />
und trugen wesentlich zur finanziellen Unterstützung des<br />
Vereins bei.<br />
Einen großen Verlust hatte der Verein am 23. März 1924<br />
durch den plötzlichen Tod von Bürgermeister Josef Heizler<br />
und am 10. März 1931 durch den ebenfalls plötzlichen Tod<br />
des 2. Vorsitzenden Theodor Eckmann zu beklagen.<br />
In den Jahren 1933 bis 1939 musste das Vereinsleben den damaligen<br />
politischen Verhältnissen angepasst werden, was nicht<br />
immer die Zustimmung aller Mitglieder fand. Die Aufzählung<br />
aller sportlichen Erfolge in dieser Zeit bis zu Kriegsbeginn 1939<br />
würde einfach den Rahmen dieser Vereinschronik sprengen.<br />
In den Kriegsjahren 1939 bis 1945 kam das Vereinsleben ganz<br />
zum Erliegen. Die Besatzungsmacht ließ nach Kriegsende auch<br />
in der Nachkriegszeit vorläufig kein Vereinsleben zu.<br />
Am 19. Mai 1951 hat Albert Willmann den Versuch unternommen,<br />
den Verein wieder zum Leben zu erwecken.<br />
Seiner Einladung sind 18 Mann gefolgt, die eine vorläufige<br />
Vorstandschaft wählten: Albert Willmann, Josef Eckmann,<br />
Karl Bartberger, Oskar Weber, Richard Saier.<br />
Am 10. Mai 1951 fand in Haagen-Turmringen wieder eines<br />
der ersten Radfahrfeste statt. Obwohl sich der Verein noch<br />
nicht neu gebildet hatte, beteiligte sich der Verein an diesem<br />
Fest und übernahm die angebotene Patenschaft zur dortigen<br />
Fahnenweihe.<br />
15
So war es ganz selbstverständlich, dass am 24. Juni 1951 zur<br />
ersten Generalversammlung nach dem Kriege eingeladen wurde.<br />
Hierzu hatten sich neben den alten Mitgliedern auch junge<br />
eingefunden, dem auch in der Zusammensetzung des Gesamtvorstandes<br />
Rechnung getragen wurde.<br />
Es wurde folgender Vorstand gewählt:<br />
1. Vorsitzender: Albert Willmann<br />
2. Vorsitzender: Erich Löffler<br />
Schriftführer: Theodor Mäder<br />
Rechner:<br />
Hermann Helmle<br />
Fahrwart:<br />
Karl Bartberger<br />
Beisitzer:<br />
August Steinhart, Max Schlegel,<br />
Josef Eckmann<br />
Der bisherige 1. Vorsitzende Friedrich Heizler, der den Verein<br />
ununterbrochen von 1923 bis 1951, also nahezu 30 Jahre<br />
geführt hatte, wurde für seine besonderen Verdienste zum<br />
Ehrenvorstand ernannt.<br />
Besondere Anerkennung und Dank zollte man bei dieser Generalversammlung<br />
der Hirschenwirtin Sophie Löffler. Sie hatte<br />
Banner und über 30 Pokale dem Zugriff der Besatzungsmacht<br />
durch ihr energisches und kluges Auftreten verwehrt. Sie war<br />
dem Verein immer besonders eng verbunden als Wirtin des<br />
Vereinslokals und des aktiven Mitwirkens in jungen Jahren.<br />
Wenn einmal kleine Zwistigkeiten im Verein auftraten, war sie<br />
zur Stelle und hat immer für den Vereinsfrieden gesorgt. Leider<br />
verstarb Sie schon mit 64 Jahren am 8. März 1964 und wurde<br />
unter großer Beteiligung des Vereins zur letzten Ruhe begleitet.<br />
Der Vorstandschaft von 1951 oblag nun die Aufgabe, das<br />
Vereinsleben wieder neu zu aktivieren.<br />
Der Fahrwart führte Probe-Fahrten durch und wies jeden in die<br />
Gepflogenheiten des Korso-Fahrens ein. Schon am 28.07.1951<br />
fuhr man wieder als offizieller Verein zum Radfahrfest nach<br />
Langenbach bei Vöhrenbach. 28 Fahrer, davon 6 Trachtenmädchen,<br />
fuhren früh am Morgen über St. Peter nach St. Märgen<br />
zum Gottesdienst. Nach einer kleinen Stärkung ging es weiter<br />
zum Neuhäusle, Kalte Herberge, Urach, Vöhrenbach, bis man<br />
um 12 Uhr in Langenbach ankam. Dort nahm man erfolgreich<br />
am Korso-Umzug teil und fuhr mit einem schönen Pokal am<br />
späten Nachmittag wieder zurück ins Ibental. Glücklich und<br />
zufrieden kam man um 22 Uhr im Hirschen an, „wo man noch<br />
in vergnügter Stimmung bei gestiftetem Ehrentrunk beinander<br />
blieb“ (Zitat Protokoll). Diese Fahrt wurde mit alten Rädern<br />
ohne Gangschaltung und Federung bestritten. Einfache Streckenlänge<br />
war 38 km, 830 hm und wird heute im Routenplaner<br />
mit Fahrzeit 2h 48 min angegeben.<br />
Ab 1952, ca. 10 Jahre lang, fand die Generalversammlung<br />
jedes Jahr am 19. März, dem Josefstag statt.<br />
Neben der Teilnahme von weiteren Korso-Festen wurden die<br />
Vorbereitungen für das anstehende 30-jährige Bestehen getroffen.<br />
Am 7. September 1952, ein Jahr verspätet, feierte man<br />
das 30-jährige Jubiläum, verbunden mit Preiskorso und Wanderfahrten.<br />
Es wurde ein Festausschuss gegründet und einem Ausschuss-Mitglied<br />
(Pius Schlegel) wurde die Aufgabe übertragen,<br />
12 Fest-Jungfrauen zu besorgen, zu einer Besprechung zwecks<br />
Zierung einzuladen, um ihnen bekannt zu geben, welche Arbeiten<br />
ihnen am Fest zugewiesen werden (Zitat Protokoll). Er hatte<br />
keine Probleme, diese zu finden, denn damals war das eine Ehre<br />
und man freute sich, wenn man auserwählt wurde.<br />
25 Brudervereine beteiligten sich und noch mancher Radsportfreund<br />
erinnerte sich gerne an dieses Fest. Die ganze Gemeinde<br />
hatte mit großem Einsatz sämtliche Häuser geschmückt und ein<br />
4 Kilometer langer Straßenschmuck hinterließ bei allen beteiligten<br />
Vereinen und Festbesuchern einen nachhaltigen guten<br />
Eindruck. Angespornt durch das gute Gelingen des 30-jährigen<br />
Stiftungsfestes und durch den guten Besuch der Brudervereine,<br />
beteiligte sich nun der Verein in den nächsten Jahren an allen<br />
Festen im Bezirk Freiburg und darüber hinaus an vielen Bundesfesten.<br />
16
Ausschnitt aus dem Protokollbuch<br />
über die Ausfahrt nach Langenbach<br />
Besonders hatte man sich inzwischen wieder ganz dem Korso-<br />
Sport verschrieben. Der schöne Räderschmuck mit natürlichen<br />
Zweigen (Lärche-Ries) aus heimatlichen Wäldern und die<br />
große Beteiligung von Jung und Alt fand immer wieder große<br />
Beachtung in der näheren und weiteren Umgebung. Wo sich<br />
der Radfahrverein Unteribental an einem Korso-Wettbewerb<br />
beteiligte, wussten die Brudervereine der Klasse A, dass die<br />
Ibentäler nur sehr schwer zu schlagen waren. Hierbei wurden<br />
auch viele Meist- und Weitpreise errungen.<br />
17
An der Generalversammlung am 17. Mai 1967 bat der bisherige<br />
1. Vorsitzende Albert Willmann, ihn von seinem Amt zu<br />
entbinden. Es solle ein junger Vorstand die Geschicke des<br />
Vereins leiten, da er ohnehin durch seine vielseitigen Verbandstätigkeiten<br />
sehr beansprucht wäre. Es war nicht leicht diesem<br />
Wunsch zu entsprechen, da vorher keine Vorgespräche stattgefunden<br />
hatten. Nach längeren Diskussionen und Wahlvorgängen<br />
konnte dann doch Philipp Heizler dazu bewegt werden,<br />
das Amt des 1. Vorsitzenden zu übernehmen, da eine große<br />
Mehrheit sich für Ihn ausgesprochen hatte.<br />
Es wurde folgender Vorstand gewählt:<br />
1. Vorsitzender: Philipp Heizler<br />
2. Vorsitzender: Franz Josef Willmann<br />
Schriftführer: Karl Willmann<br />
Rechner:<br />
Erwin Löffler<br />
Fahrwart:<br />
Josef Willmann<br />
Fähnrich:<br />
Franz Maier<br />
Jugendleiter: Bernhard Ketterer<br />
Beisitzer:<br />
Josef Eckmann, Max Schlegel,<br />
Erich Löffler, Albert Schlegel<br />
Der bisherige 1. Vorsitzende Albert Willmann wurde für seine<br />
besonderen Verdienste um den Verein zum Ehrenvorstand<br />
ernannt.<br />
Die Hoffnung aller Mitglieder, mit dieser Vorstandschaft neuen<br />
Auftrieb zu erhalten, wurde erfüllt. Es wurden 3 Bundesmeisterschaften<br />
und 3 Bezirksmeisterschaften im Korso Klasse A<br />
errungen. Eine besondere Aufgabe fiel aber auch in diese Zeit,<br />
da es galt, das 50-jährige Vereinsjubiläum vorzubereiten.<br />
In der Zeit vom 16. bis 19.07.1971 feierte man dieses große<br />
Fest verbunden mit dem Bezirksfest des Bezirkes 3 Freiburg. Ein<br />
großes Festzelt wurde am Gummenwald aufgestellt und somit<br />
gute Voraussetzungen geschaffen für einen reibungslosen<br />
Ablauf des Festes. Beim Festbankett konnte der Verein neben<br />
den Gründungsmitgliedern eine große Zahl an Ehrengästen und<br />
Freunde des Radsports aus nah und fern begrüßen.<br />
Festdamen am 50-jährigen Jubiläum:<br />
vorne links: Luzia Kürner; vorne rechts: Irmgard Fuß<br />
geb. Molz; hintere Reihe: Theresia Bensel geb. Molz,<br />
Maria Weber geb. Andris, Roswitha Schlegel geb. Eckmann,<br />
Roswitha Steiert geb. Bartberger<br />
Eine besondere Ehrung erhielten die Gründungsmitglieder:<br />
Ehrenvorstände Friedrich Heizler und Albert Willmann, sowie<br />
die Ehrenmitglieder August Steinhart, Leo Dold, Karl Saier,<br />
Emil Willmann und Wilhelm Willmann. Des Weiteren wurden<br />
13 Mitglieder besonders geehrt für 40-jährige Mitgliedschaft.<br />
Am Samstag wurde der Startschuss für die Bezirksmeisterschaft<br />
der Rennfahrer gegeben. Die Strecke führte über St. Peter,<br />
St. Märgen, Wagensteig, Buchenbach, Unteribental und betrug<br />
insgesamt 70 km und musste 3mal durchfahren werden.<br />
Der Festtag wurde eingeleitet mit einem großen Wecken des<br />
Musikvereins Buchenbach. Es schloss sich ein gut besuchter<br />
Festgottesdienst im Festzelt an. 44 Gastvereine hatten sich<br />
eingefunden und beteiligten sich am Korso-Wettbewerb.<br />
Trotz strömenden Regens säumten viele Festgäste den langen<br />
Festzug. Beeindruckt war man vom überaus großen Blumenschmuck<br />
an Häusern, Straßen und im Festzelt. Hier galt ein<br />
besonderer Dank August Steinhart. Ein großer bunter Abend<br />
mit den fidelen Egerländer beschloss diesen außergewöhnli-<br />
18
chen Tag. Zum Festausklang am Montag war es eine Selbstverständlichkeit,<br />
dass man sich am Morgen in unserer Wallfahrtskirche<br />
„Maria Lindenberg“ zu einem Gedenkgottesdienst für<br />
alle Gefallenen und verstorbenen Mitglieder des Vereins traf.<br />
Mit einem gelungenen Kinderfest und einer Tanzveranstaltung<br />
klang dieses große Fest aus. Dieses gut gelungene 50-jährige<br />
Vereinsjubiläum gab dem Verein ganz natürlich neue Impulse.<br />
So war es eine logische Folge, dass bei der Generalversammlung<br />
1973 sich zwei neue Abteilungen, eine Saalsportgruppe<br />
(Kunstradfahren) und eine Gymnastikgruppe vorstellte und in<br />
den Hauptverein aufgenommen wurden.<br />
Entscheidend für das Zustandekommen dieser beiden neuen<br />
Abteilungen war der Bau der Ibentalhalle, wobei die Verantwortlichen<br />
der Gemeinde Weitblick und großen Mut bewiesen<br />
haben.<br />
Durch die Bildung dieser 2 Abteilungen und durch den Bevölkerungszuwachs<br />
stieg die Mitgliederzahl des Vereins stark an und<br />
erreichte im Jubiläumsjahr 325 Mitglieder. Dies erforderte vom<br />
Gesamtvorstand einen immer größer werdenden Einsatz und<br />
führte auch dazu, dass eine Erweiterung des Gesamtvorstandes<br />
vorgenommen wurde.<br />
Dieser Aufgabe stellte sich der in der Generalversammlung<br />
1978 neu gebildete Gesamtvorstand.<br />
1. Vorsitzender Philipp Heizler<br />
2. Vorsitzender Richard Saier<br />
Schriftführer Karl Willmann<br />
1. Rechner Gerhard Kohler<br />
2. Rechner Richard Ketterer<br />
1. Fahrwart Reinhard Ketterer<br />
2. Fahrwart Berthold Ketterer<br />
Fähnrich<br />
Josef Weber<br />
Jugendleiter Bernhard Ketterer<br />
Saalsportwart Franz Josef Willmann<br />
Abt. Leiter<br />
Gymnastikgruppe Hannelore Löffler<br />
Beisitzer<br />
Josef Eckmann, Erich Löffler,<br />
Erich Schlegel, Josef Willmann<br />
Dieser Gesamtvorstand bildete mit den noch hinzubestellten<br />
Mitgliedern den Festausschuss zum 60-jährigen Vereinsjubiläum<br />
vom 30.07. bis 02.08.1982. Bürgermeister Hans Matthis<br />
als Schirmherr, Ortsvorsteher Josef Eckmann als Festpräsident,<br />
sowie die Ortschafts- und Gemeinderäte Walter Danzeisen,<br />
Oskar Willmann und Adolf Kürner, letzterer gleichzeitig als Abteilungskommandant<br />
der Freiwilligen Feuerwehr Unteribental.<br />
Zum Festbankett begrüßte Vorstand Philipp Heizler die Festgesellschaft<br />
zum 18. Bundesfest des BRMB, verbunden mit<br />
dem 60-jährigen Stiftungsfest des Radfahrvereins Concordia<br />
Unteribental. Er begrüßte besonders die noch lebenden Gründungsmitglieder<br />
Leo Dold, August Steinhart, Karl Saier, Emil<br />
Willmann, Josef Willmann, Wilhelm Willmann. Weitere Ehrenmitglieder<br />
waren Ferdinand Herbstritt, Johann Ketterer, Josef<br />
Molz, Albert Schlegel, Josef Schlegel, Ludwig Thoma, Ewald<br />
Willmann, Josef Willmann, Karl Willmann<br />
Das gelungene Festbankett wurde vom Musikverein Buchenbach<br />
musikalisch umrahmt. Am Samstagnachmittag tagte die<br />
Bundesvorstandschaft in der Ibentalhalle. Abends fand der<br />
große Bunte Abend mit den „Harzwald Musikanten“ statt. Am<br />
Sonntagnachmittag, nach viel Regen, konnten unter Sonnenschein<br />
40 Vereine mit 1.500 Radfahrern einen einstündigen<br />
Korso veranstalten. Abends spielte die Gruppe „Mirage“ zum<br />
Tanz.<br />
Am Montagmorgen fand auf dem Lindenberg eine heilige<br />
Messe für alle verstorbenen Mitglieder des Vereins statt. Den<br />
Ausklang dieses großen, schönen Festes bildete am Montagnachmittag<br />
das Kinderfest, mitgestaltet von einer Abordnung<br />
des Musikvereins Buchenbach.<br />
Die ganze Gemeinde hatte mit übergroßem Einsatz sämtliche<br />
Häuser geschmückt und der lange Festzug hinterließ bei allen<br />
Beteiligten einen nachhaltig guten Eindruck.<br />
Verbunden mit dem Bundesfest 1982 wurde am 22. Mai die<br />
Gesamt-Badische Meisterschaft im Straßenrennsport ausgerichtet.<br />
Der Rundkurs führte über eine Strecke von 30 km die von<br />
den Junioren 2 Mal und den Amateuren 4 Mal zu fahren war.<br />
19
19. bis 22. Juni 1998 wurde das 75-jährige Vereinsjubiläum<br />
zusammen mit der FFW Unterital (50 Jahre) gefeiert.<br />
Höhepunkt der Jahreshauptversammlung am 20.04.1985 war<br />
die Ehrung von Vorstand Philipp Heizler. In Anwesenheit des<br />
BRMB-Präsidenten Max Schneider, überreichte Ortsvorsteher<br />
Josef Eckmann Herrn Heizler die Verdienst-Ehrennadel des<br />
Landes Baden-Württemberg.<br />
Bei der Generalversammlung 1987 legte Vorstand Philipp<br />
Heizler nach 20 erfolgreichen Jahren sein Amt in jüngere<br />
Hände. Zu seinem Nachfolger wurde Berthold Ketterer gewählt.<br />
Philipp Heizler wurde aufgrund seiner herausragenden Dienste<br />
für den Verein zum Ehrenvorstand ernannt.<br />
Bei der Jahreshauptversammlung 1989 erklärte Karl Willmann<br />
nach 24 Jahren Schriftführertätigkeit seinen Rücktritt.<br />
1990 kommt es durch den Rücktritt des 1. Vorstandes Berthold<br />
Ketterer zur Neuwahl. Zum neuen Vorstand wählte die Versammlung<br />
Franz-Josef Heizler.<br />
Das 70-jährige Vereinsjubiläum vom 21. bis 23.06.1991 wurde<br />
intern gefeiert. Vorstand F.J. Heizler begrüßte die Festversammlung,<br />
insbesondere die zwei noch lebenden Gründungsmitglieder<br />
August Steinhart und Emil Willmann. Festprolog, Chronik<br />
und Ehrungen bildeten wichtige Punkte im Programm, das von<br />
Beiträgen des Musikvereins Buchenbach musikalisch begleitet<br />
wurde. Beim Fußball-Turnier der Radfahrvereine des Bezirks III<br />
belegte die heimische Mannschaft den 3. Platz. Der Festgottesdienst<br />
und ein Tanzabend mit der Kapelle „Amorada“ rundeten<br />
die Veranstaltung ab.<br />
1992 wurde als Erweiterung des Gesamtvorstandes das Amt<br />
des Pressewarts geschaffen, gewählt wurde Gabriele Zähringer.<br />
Aufgrund seiner aufopfernden Tätigkeit als Jugendleiter<br />
von 1967 bis 1992 wurde Bernhard Ketterer 1996 zu seinem<br />
60. Geburtstag zum Ehrenmitglied ernannt.<br />
Der Fest-Vorstand setzte sich wie folgt zusammen:<br />
1. Vorstand Franz-Josef Heizler<br />
2. Vorstand Karl Maier<br />
1. Rechner Albert Willmann<br />
2. Rechner Richard Ketterer<br />
Schriftführerin Aurelia Willmann<br />
Pressewart Gabriele Zähringer<br />
Jugendleiter Alfred Aegerter<br />
1. Fahrwart Reinhard Ketterer<br />
2. Fahrwart Berthold Ketterer<br />
1. Fähnrich Konrad Zahn<br />
2. Fähnrich Martin Klingele<br />
Saalsport<br />
Franz-Josef Willmann<br />
Turnen (Frauen) Elisabeth Heizler<br />
Turnen (Herren) Günter Stucky<br />
Beisitzer<br />
Erich Schlegel, Erhard Heizler,<br />
Peter Schlegel, Karl Willmann<br />
Am Freitag wurde das Fest mit einem feierlichen Festbankett<br />
in einem großen, festlich geschmückten Festzelt eröffnet.<br />
Von 23 – 2 Uhr wurde bei einer „Oldie-Night“ kräftig getanzt.<br />
Am Samstag begann um 10 Uhr ein Duathlon, an dem acht<br />
Mannschaften teilnahmen. Pokalsieger wurde der TuS Obermünstertal<br />
e.V. Um 14 Uhr begann der Kinder- und Seniorennachmittag<br />
mit Auftritten der Kunstradfahrer, Trachtengruppe<br />
und Trachtensinggruppe. Um 15 Uhr stand für die Kinder ein<br />
Spiele-Parkour mit zwölf Stationen bereit, an dessen Ende jedes<br />
Kind eine Wurst mit Wecken erhielt. Das DRK richtete einen<br />
Ballonwettbewerb aus, bei dem Freikarten für den Europapark<br />
gewonnen werden konnten. Der Gewinn des Wettbewerbs war<br />
zu Gunsten des Ibentäler Kindergartens. Zusätzlich wurden<br />
Fahrten mit dem Feuerwehrauto angeboten.<br />
20
1. Reihe sitzend von links nach rechts:<br />
August Steinhart, Josef Eckmann, Wendelin Drescher, Franz-Josef Heizler, Walter Danzeisen<br />
2. Reihe stehend von links nach rechts:<br />
Johann Ketterer, Emil Willmann, Herbert Witt, Albert Schlegel, Josef Molz, Pius Schlegel,<br />
Josef Willmann, Konrad Zahn, Max Schlegel, Philipp Heizler, Augusta Zahn, Frieda Molz<br />
21
Am Abend gastierten „Die Bayrische 7“ im Festzelt, eine Band<br />
mit sieben Musikerinnen, die volkstümliche Schlager vortrugen.<br />
Am Sonntag wurde das Tal schon um 6 Uhr mit Böllerschüssen<br />
geweckt. Um 9.30 Uhr war Festgottesdienst und anschließend<br />
das Frühschoppenkonzert des MV Buchenbach. Um 13.30 Uhr<br />
kündigten dann erneute Böllerschüsse den Festzug an. Über<br />
2400 Festzugsteilnehmer sorgten bei über 32° Grad für einen<br />
festlichen Umzug durchs Ibental, vorbei an einer Ehrentribüne<br />
beim Stroßewart. Es nahmen 6 Festkutschen, 27 Feuerwehren,<br />
46 Radfahrvereine, 12 Musikvereine und 6 historische Feuerwehrspritzen<br />
teil. Am Abend war die Party-Band „Die Blaumeisen“<br />
zu Gast.<br />
Der Montag begann um 9 Uhr mit einem Gottesdienst für die<br />
Verstorbenen der beiden Vereine auf dem Lindenberg. Am<br />
Abend folgte zum Ausklang der musikalische Höhepunkt des<br />
Festes mit der Kapelle „Die Klostertaler“. Die Gewinne bei<br />
der Festverlosung um 22 Uhr waren: 1. Preis: 1 Woche Finnland<br />
für 2 Pers., 2. Preis: 1 Woche Mallorca für 2 Pers., 3. Preis:<br />
1 Woche Mercedes A-Klasse<br />
Bei der JHV am 10. November 2001 gab es<br />
größere Veränderungen im Vorstand.<br />
1. Vorstand Erhard Heizler neu<br />
2. Vorstand Markus Molz neu<br />
Schriftführerin Aurelia Zähringer<br />
Kassiererin Christine Saier neu<br />
Stellv. Kassiererin Uschi Seifert neu<br />
Jugendleiter Herbert Saier neu<br />
1. Fahrwart F.J. Willmann neu<br />
2. Fahrwart Meinrad Saier neu<br />
1. Fähnrich Konrad Zahn<br />
2. Fähnrich Martin Klingele<br />
1.Beisitzer F.J. Heizler neu<br />
2. Beisitzer Peter Schlegel<br />
3. Beisitzer Albert Willmann neu<br />
4. Beisitzer Alfred Schlegel neu ab 20.04.2002<br />
Saalsport Gabriele Zähringer neu<br />
Turnabteilung<br />
Frauen u. Männer Elli Heizler<br />
Bei der JHV am 3. April 2004 wurde Aurelia Zähringer von<br />
Meinrad Saier im Posten des Schriftführers abgelöst. Rudi<br />
Müller und Thomas Fuß wurden neue Beisitzer.<br />
Am 24. September 2006 war ein großer Vereins-Ausflug an<br />
den Bodensee mit dem Hummel-Bus, Stationen: Schaffhausen,<br />
Kaffee-Pause in Stein am Rhein, von Konstanz mit der Fähre<br />
nach Lippertsreute bei Überlingen, auf einem Hof Bauernvesper<br />
mit Most, Apfelzügle-Fahrt durch verschiedene Apfelplantagen,<br />
fröhliche Heimfahrt …<br />
Bei der JHV am 16. März 2007 kamen 2 neue Beisitzer in den<br />
Vorstand (Dietmar Klausmann und Annette Bügner), Svenja<br />
Saier wurde Jugendsprecherin, 2. Fahrwart und 2. Fähnrich<br />
blieben vakant und wurden in der neuen Satzung abgeschafft.<br />
Im Laufe des Jahres 2008 wurde die Vereins-Satzung aktualisiert<br />
in deren Folge eine Umbenennung stattfand. Aus Radfahrverein<br />
wurde Radsportverein „Concordia“ Unteribental e.V.<br />
Bei der JHV am 26. März 2010 gab es einige Änderungen im<br />
Vorstand: Jugendleiter: Thomas Fuß, Fähnrich: Herbert Saier,<br />
Beisitzer: Rudi Müller, Michaela Ketterer, Hans-Peter Zipfel,<br />
Suzana vor der Horst, Jugendsprecher: Sebastian Zähringer,<br />
MTB-Leiter: Eric Bügner<br />
Im Jahre 2011 richtete Eric Bügner für den Verein eine sehenswerte<br />
Homepage ein und pflegte sie hervorragend, bis 2013<br />
unser neuer Schriftführer Roland Hässler diese anspruchsvolle<br />
Aufgabe übernahm. Er bestückt seitdem regelmäßig die Plattform<br />
mit aktuellen Terminen, Berichten, Fotos und sorgt somit<br />
für einen interessanten Auftritt unseres Vereins im Internet.<br />
2012 wurde das 90-jährige Jubiläum mit einem Festabend in<br />
der Sommerberghalle in Buchenbach gefeiert. Die Halle war<br />
festlich geschmückt und dekoriert, die Gäste wurden mit Sekt<br />
empfangen. Die Küche der Friedrich-Husemann-Klinik verwöhnte<br />
die Besucher mit einem Fest-Menü und der Kabarettist<br />
Martin Wangler alias „Fidelius Waldvogel“ sorgte für einen<br />
sehr unterhaltsamen Abend. Er wurde umrahmt von einer Hip-<br />
Hop-Gruppe des <strong>RSV</strong>, der Folkgruppe Liederlich, Andi Kromer<br />
(2-facher Bike-Trial-Weltmeister) und den <strong>RSV</strong>-Kunstradfahrern.<br />
22
2013 brachte mehrere Wechsel in der Vorstandschaft. Erhard<br />
Heizler wollte zurücktreten, fand aber keinen Nachfolger<br />
und somit stellte er sich nach langen Diskussionen nochmal<br />
zur Wahl.<br />
Es wurde folgender Vorstand gewählt:<br />
1. Vorstand: Erhard Heizler<br />
2. Vorstand: Thomas Bürkle neu<br />
Schriftführer: Roland Hässler neu<br />
Kassiererin: Christine Saier<br />
2. Kassierer: Rudi Müller neu<br />
Jugendleiter: Thomas Fuß<br />
Fahrwart: Frank Reichmann neu<br />
Fähnrich:<br />
Herbert Saier<br />
1. Beisitzerin: Michaela Ketterer<br />
2. Beisitzer: Hans-Peter Zipfel<br />
3. Beisitzerin: Suzana vor der Horst<br />
4. Beisitzer: Wolfgang Steiert neu<br />
Ltg. Hallenradsport: Gaby Zähringer<br />
Ltg. Turnabteilung: Ursula Seifert neu<br />
Ltg. MTB-Abteilung: Hansi Matthis neu<br />
Im Juni fand der Radlerhock statt und bei den Buchenbacher<br />
Kulturtagen übernahm der <strong>RSV</strong> zusammen mit der FFW Unteribental<br />
die Bewirtung am Gummenwald.<br />
Bei der Leistungsschau im Oktober präsentierte sich der <strong>RSV</strong><br />
mit MTB-Vorführungen und einem Stand in der Sommerberghalle,<br />
in dem das Leistungsspektrum mit Banner und PC-Präsentation<br />
dargestellt wurde.<br />
Beim Radlerhock 2014 nahmen sehr viele Biker an den geführten<br />
Touren teil, da kein Ultra-Bike in Kirchzarten stattfand.<br />
Erstmals wurde eine Tour „Junge Wilde“ für den Nachwuchs<br />
angeboten.<br />
Im Jahr 2015 war der <strong>RSV</strong> erstmals beim Buchenbacher Fastnachtsumzug<br />
mit einem Wurst- und Getränkestand vertreten.<br />
Im Jahr 2016 gab es bei der JHV folgende Veränderungen<br />
in der Vorstandschaft:<br />
Michaela Ketterer stellte ihr Amt als Beisitzer zur Verfügung,<br />
Hans-Peter Zipfel übernahm das Amt des Jugendleiters und gab<br />
dafür den Beisitz ab.<br />
Detlef König und Michael Riedinger wurden als neue Beisitzer<br />
gewählt.<br />
Alle anderen Personen wurden in ihren Ämtern wiedergewählt<br />
bzw. bestätigt.<br />
Die MTB-Abteilung bietet erstmals regelmäßig Jugendtouren<br />
immer freitags unter Leitung von Guide „Hansi“ an und in den<br />
Gruppen-Touren werden die ersten E-bikes „gesichtet“.<br />
Außerdem findet im Mai erstmalig eine gemeinsame Wegepflege<br />
mit dem Schwarzwaldverein Buchenbach statt.<br />
2017: Das Highlight dieses Jahres ist sicherlich die erstmalige<br />
Veranstaltung „kleinKunst im Tal“ am 21. Oktober. Nachdem<br />
die Theatergruppe schon längere Zeit wegen Nachwuchsmangel<br />
und Zeitnot keine Stücke mehr einstudieren konnte, hat<br />
der Verein mit Unterstützung von Thomas Fuß dieses Format<br />
erdacht und umgesetzt. Es war ein sehr großer Erfolg – die<br />
Ibentalhalle zum Bersten voll und alle Besucher und auch die<br />
Mitwirkenden waren voll des Lobes. Mitwirkende waren:<br />
Mimy Woods Band, Lucy und Tobi, Uli Führe, Christoph Fuß,<br />
Folk Gruppe Liederlich.<br />
2018 nahm der <strong>RSV</strong> am Kinder- und Jugend-Aktionstag in der<br />
Sommerbergschule Buchenbach teil,<br />
Im Jahr 2019 gab es bei der JHV folgende Veränderungen im<br />
Vorstand:<br />
Suzana vor der Horst trat von ihrem Amt als Beisitzer zurück,<br />
Herbert Saier trat vom Amt des Fähnrichs zurück – beide hatten<br />
diese Ämter neun Jahre lang inne.<br />
Hans-Peter Zipfel gab das Amt des Jugendleiters ab, übernahm<br />
aber die freiwerdende Beisitzer-Position von Suzana.<br />
Die Position des Jugendleiters blieb bedauerlicherweise vakant.<br />
Ebenso war die Position des Fähnrichs nicht wieder zu besetzen.<br />
Neu gewählt wurde Fabienne Zähringer als stellvertretende<br />
Kassiererin.<br />
23
Da Versammlungen nun wieder unter Einschränkungen möglich<br />
sind, bieten wir am Samstag. 04.09. einen Mitgliederhock im<br />
Gummenwald an und freuen uns über 75 Gäste.<br />
Im Jahre 2020 entschieden wir uns für einen neuen Trikot-<br />
Lieferanten.<br />
Im März sollten wie immer die Einladungen zur JHV verschickt<br />
werden – doch dann: CORONA!<br />
Zuerst: Absage der JHV, kurz darauf die Absage aller offiziellen<br />
Vereinstermine.<br />
Plötzlich ist „online“ auch für uns im <strong>RSV</strong> die rettende Alternative<br />
– wir halten Vorstandsitzungen via Microsoft Teams ab.<br />
Ab sofort hieß es: kein Turnen, kein Kunstrad und MTB nur<br />
allein oder allenfalls zu zweit oder in kleinen Gruppen (im Wald,<br />
wo es keiner sieht) – und eher ohne Vereinstrikot (wo doch<br />
jetzt alle die neuen Stücke im Schrank haben). Natürlich darf<br />
es auch keinen Radlerhock und keine „kleinKunst im Tal“-Veranstaltung<br />
geben.<br />
Unter dem Eindruck des anhaltenden Einschränkens beschließt<br />
der Vorstand, die 100-Jahr-Feier nicht für das Jahr 2022 zu<br />
planen.<br />
In 2022 bessern sich die Anzeichen dafür, dass die Pandemie<br />
nun überwunden scheint – wir können normal zur JHV am<br />
2. Mai einladen. Auch ist zwischenzeitlich beschlossen, dass<br />
wir das große Jubiläum im Jahr 2023 feiern wollen.<br />
Vor diesem Hintergrund sind alle Vorstandsmitglieder bereit,<br />
ihre jeweiligen Ämter für eine weitere Periode von drei Jahren<br />
auszuüben. Dies wird von den Anwesenden mit großem Beifall<br />
gewürdigt.<br />
Am 26.Juni kann auch wieder unser beliebte Radlerhock<br />
stattfinden.<br />
Eine Vorstandsitzung wird in Präsenz im Freien vor der Ibentalhalle<br />
in einem großen Stuhlkreis abgehalten.<br />
Die Lockerungen im Sommer erlauben wieder etliche Aktivitäten<br />
– aber der 2. Lockdown im Herbst & Winter lässt das<br />
Vereinsleben erneut fast vollständig erstarren.<br />
2021 Die ganze Gesellschaft stöhnt unter „Lockdown und kein<br />
Ende“ – die Frage „gibt es überhaupt noch ein aktives Vereinsleben<br />
wird online via Homepage gestellt. Immerhin: unsere<br />
Mitglieder sind unerschrocken sportlich aktiv – der herrliche<br />
Winter ermöglicht Langlauf im Dreisamtal und schöne Schneeschuh-Touren<br />
(die Lifte sind ja im Schwarzwald geschlossen).<br />
Die JHV wird im Frühjahr auf unbestimmte Zeit verschoben –<br />
und dann am 10. September nachgeholt. Sie umfasst somit<br />
nun zwei Vereinsjahre! Es folgen nur 39 Gäste der Einladung<br />
– vielleicht lag es auch daran, dass wir auf die bisher übliche<br />
Bewirtung mit Speisen verzichteten.<br />
Radlerhock in der Gummenwaldhütte<br />
24
2023 ist unser Jubiläumsjahr!<br />
Der Verein nahm bzw. nimmt auch heute noch an Veranstaltungen<br />
anderer Vereine im Dreisamtal teil, wie z.B. in den 90-er<br />
und 2000-er-Jahren beim „Spiel ohne Grenzen“ bei der FFW in<br />
Wagensteig, beim Vereinsschießen der Vereine von Buchenbach<br />
oder beim Pfingst-Fußball-Turnier in Stegen.<br />
Seit über 40 Jahren findet jeden Sommer am Gummenwald der<br />
Radlerhock statt. All die Jahre ist er eine gelungene Mischung<br />
aus gemütlichem Beisammensein, sportlichen Herausforderungen<br />
und über viele Jahre war auch Tanz dabei. In den 80-er<br />
und 90-er Jahren gab es sogar Duathlon (Fußballturnier kombiniert<br />
mit Mountainbikerennen bzw. Querfeldeinrennen).<br />
Grandios, sensationell organisiert und präsentiert von Hubert<br />
Andris (Poschtler). Dessen großer persönlicher Einsatz war ein<br />
Garant für den Erfolg des Radlerhocks. Seit vielen Jahren hat<br />
das Mountainbiken den Fußball komplett abgelöst. Beim Hock<br />
werden vier geführte Rad-Touren unterschiedlicher Leistungsstufen<br />
angeboten, von 40 – 65 km und 900 – 1600 hm. Sonntags<br />
um 9 Uhr beginnt der Hock mit einem Radlerfrühstück<br />
und ab 10 Uhr fahren die Rad-Gruppen mit ihren Guides durch<br />
die herrliche Landschaft rund ums Ibental. Das Besondere<br />
an diesen Touren ist, dass sie jedes Jahr neu ausgetüftelt und<br />
die Biker somit immer wieder aufs Neue überrascht werden,<br />
was unsere Umgebung Schönes zu bieten hat. Die Strecken<br />
sind gespickt mit Panoramawegen, herrlichen Ausblicken, tollen<br />
Abfahrten und natürlich beste Verpflegung an der Strecke.<br />
Währenddessen „hocken“ zahlreiche Besucher bei musikalischer<br />
Unterhaltung, leckerem Essen, Kaffee und Kuchen<br />
beisammen. Nach und nach kommen die Bike-Gruppen zurück<br />
und erzählen von ihren wunderschönen Eindrücken ihrer<br />
Touren, während auch sie sich stärken. Zum Abschluss gibt es<br />
eine Verlosung mit vielen attraktiven Preisen. Dieses Jahr wurden<br />
die Rad-Touren bereits am Samstag durchgeführt, damit<br />
auch die Radler am Sonntag den Hock von Anfang an genießen<br />
konnten.<br />
Auf einer Tour vom Radlerhock<br />
Nun freuen wir uns gemeinsam auf die Feier unseres<br />
100-jährigen Jubiläums. Mit dem Jubiläumsabend und Festumzug<br />
haben wir wunderbare Möglichkeiten, gemeinsam<br />
zu feiern und die Errungenschaften des Vereins zu würdigen.<br />
An dieser Stelle danken wir allen Mitgliedern und Unterstützern<br />
für ihr Engagement. Ohne sie hätte der Verein nicht das<br />
erreichen können, was er heute ist. Das Engagement jedes Einzelnen<br />
trägt dazu bei, den Verein stark und lebendig zu halten.<br />
Möge das Fest eine Zeit der Freude, des Zusammenhalts und<br />
der Feier sein, die noch lange in Erinnerung bleiben wird.<br />
25
Dr. Uwe Miedtke, Markenhofstraße 7b<br />
Kirchzarten-Burg am Wald<br />
Verkauf im Hofladen und<br />
auf dem Markt: FR in Kirchzarten,<br />
SA in Freiburg-Littenweiler<br />
Wir gratulieren zum Jubiläum!
www.saier.com<br />
Seit 30Jahren für<br />
Sie auf dem Dach!<br />
Dachtechnik aus Meisterhand<br />
. Dächer aller Art<br />
. Dachreparaturen<br />
. Balkonsanierung<br />
. Solaranlagen<br />
. Dachfenster<br />
. Fassadengestaltung<br />
Saier Dachtechnik GmbH<br />
Ibenbachstraße 8 . 79256 Buchenbach<br />
Tel.: +49 7661 99711 . info@saier.com<br />
Freie Fahrt für saubere Oberflächen<br />
Wir entwickeln und produzieren Reinigungsmaschinen für<br />
die industrielle Produktion und bieten vielseitige Arbeits- und<br />
Ausbildungsplätze in einem motivierten Team.<br />
Dem <strong>RSV</strong> Unteribental e.V. wünschen wir ein schönes Jubiläumsfest<br />
und viel Glück und Erfolg für die nächsten 100 Jahre!<br />
Surface Cleaning Technology<br />
www.wandres.com
Die erste Ausfahrt des<br />
Radfahrvereins „Concordia“<br />
Unteribental nach dem<br />
2. Weltkrieg an Pfingsten<br />
13. oder 14. Mai 1951<br />
nach Haagen-Tumringen<br />
Im Dritten Reich wurden nach der Machtergreifung der<br />
Nationalsozialisten ab 1933 nach und nach alle Vereine<br />
und Organisationen gleichgeschaltet und damit faktisch<br />
als selbständige Einheiten aufgelöst. Nach Kriegsende 1945<br />
wurden von den Besatzungsmächten, in unserem Fall von<br />
den Franzosen, zunächst alle Vereine verboten.<br />
1947 erfolgte dann der Befehl der Franzosen, dass in allen<br />
Gemeinden, in denen bisher noch keine Feuerwehr existierte,<br />
eine solche zu gründen war. Infolgedessen wurde dann auch<br />
das Vereinsrecht wieder gelockert. Und so entstand unter den<br />
früheren Mitgliedern des Radsportvereins der Wunsch auch<br />
diesen wieder neu zu gründen. Man erfuhr irgendwie, dass<br />
in Haagen-Tumringen (heute ein Stadtteil von Lörrach) ein Radsportfest<br />
stattfinden sollte.<br />
Die alten, eingefleischten Mitglieder, die den Verein gegründet<br />
und bis zu seiner Auflösung vorangebracht hatten, motivierten<br />
die Jugend dorthin zu fahren und am Korso-Festzug teilzunehmen.<br />
Wir jungen Burschen – Buebe und Maidli – fühlten<br />
uns verpflichtet, den Wünschen der Alten Folge zu leisten. In<br />
Erinnerung sind mir da besonders Friedrich Heizler (Jägerbur),<br />
Albert Willmann (Schni:derbur), Josef Willmann (Zähringersepp)<br />
und Peter Bartberger (Wickepeter).<br />
Sie ließen keine Ruhe, bis sich eine Gruppe von ungefähr<br />
15 Personen zusammenfand, die das Wagnis auf sich nehmen<br />
wollten. Es waren sicher dabei: Karl Bartberger als Fahrwart,<br />
Willi Willmann (de klei Willi vum Kleiburehisli im Weberdobel)<br />
als Fähnrich, seine Schwester Erika Willmann, Klara Saier<br />
(später verh. Molz), Karl Molz (Schwärzle-Karle), Karl Willmann<br />
(Schlegelhof), Richard Saier (Haurihof) und als 15-jähriger<br />
Lehrling ich, Bernhard Ketterer (Raiweberhisli). Eventuell waren<br />
auch dabei Berta Kürner (später verh. Helmle, Leistmacherhof),<br />
Rita Saier (Haurihof). Ich bin mir nicht sicher, ob auch der<br />
Zähringersepp mitgefahren ist.<br />
Da aufgrund der Notzeit bedingt durch Krieg und Nachkriegszeit,<br />
niemand ein funktionierendes Fahrrad hatte, mussten aus<br />
vielen unbrauchbaren und alten Rädern erst einmal eine entsprechende<br />
Anzahl halbwegs funktionierender Räder zusammengeflickt<br />
werden. Einer, ich glaube es war der Schwärzle-Karle, hatte<br />
in einem 28er Rahmen ein 24er Hinterrad, weil halt kein anderes<br />
aufzutreiben war. Schutzbleche und so weiter wurden zum Teil<br />
mit Schnüren festgebunden. Eine Gangschaltung hatte niemand,<br />
die war uns völlig unbekannt. Und so machten wir uns an einem<br />
Sonntagmorgen zwischen 7.00 und 8.00 Uhr auf den Weg ins<br />
Wiesental nach Haagen-Tumringen, dort sollte am Nachmittag<br />
um 14.00 Uhr der Festzug stattfinden.<br />
Niemand der Teilnehmer konnte sich vorstellen, was das für<br />
eine abenteuerliche Fahrt werden sollte. Nicht nur das Material<br />
lies sehr zu wünschen übrig, auch die Straßen waren zum<br />
großen Teil in einem heute unvorstellbaren Zustand. Das ging<br />
ja bei uns im Ibental schon los, das Ibentalsträßle war damals<br />
noch ein besserer Feldweg und noch lange nicht asphaltiert.<br />
Die erste Etappe ging bis zum Gasthaus Steinwasen, dort wurde<br />
die erste Rast gemacht, um Wasser zu trinken. Kurz vor dem<br />
Notschrei, an der Hofsgrunder Säge, am steilsten Stück unseres<br />
Weges, blühten am Straßenrand sehr viele Maiglöckchen, damit<br />
schmückten unsere mitfahrenden Mädchen den Banner.<br />
Wilhelm Willmann hatte das Fahnentuch mithilfe einer Vorrichtung<br />
seitlich an seinem Fahrrad befestigt, die Fahnenstange<br />
hatte ein anderer an sein Fahrrad angebunden.<br />
28
Weiter ging die Fahrt! Wir freuten uns darauf, dass wir es ja<br />
dann laufen lassen können, wenn wir erst einmal die Höhe<br />
des Notschreis erreicht hätten.<br />
Welch ein Trugschluss! Da ging das Abenteuer erst recht los.<br />
Die Straße wurde immer schlechter! Und wir hatten natürlich<br />
nur unzulängliche Bremsen.<br />
Die Rücktrittbremsen wurden bald heiss und mussten immer<br />
wieder gekühlt werden. Felgenbremsen gab es nur bei neuen<br />
Fahrrädern, die damals dann aufkamen, aber so einen Luxus<br />
hatten wir nicht. Und die alten Stempelbremsen, bei denen<br />
über ein Hebelgestänge von oben ein Gummiklotz auf den<br />
Vorderreifen gedrückt wurde, erwiesen sich für eine längere<br />
Bergabfahrt als völlig unbrauchbar. Die Bremsklötze flogen bald<br />
auf Nimmerwiedersehen davon! Somit kamen wir natürlich<br />
auch bergab nur recht langsam voran!<br />
Die nächste Pause machten wir dann in Aftersteg in der Kurve,<br />
wo es zum Todtnauer Wasserfall geht. Dort stand damals<br />
schon, wie auch heute noch ein Kiosk. Geld, um etwas zu<br />
kaufen, hatten wir aber natürlich auch keines.<br />
Wer etwas dabei hatte, packte dort sein Vesper aus, das wurde<br />
dann untereinander kameradschaftlich geteilt. Hauptsächlich<br />
kann ich mich an Brot und alte, verschrumpelte Äpfel vom Vorjahr<br />
erinnern, die wir genussvoll verzehrten.<br />
Dann ging es weiter hinunter ins Wiesental. Ab Todtnau war<br />
es ja dann Gottseidank nicht mehr so steil, so dass die Schwierigkeiten<br />
mit den Bremsen weniger wurden. Aber die Straße<br />
war unglaublich schlecht: mal Schotterpiste, mal Pflastersteine,<br />
dann wieder Schlaglöcher, die nur die geübten Radler<br />
schwungvoll umfahren konnten. Außerdem gab es im Wiesental<br />
auch noch nicht die Talstraße, die heute im Wesentlichen an<br />
der Wiese entlang schnurgerade talabwärts führt. Die Straße<br />
schwenkte damals ständig von der einen zur anderen Talseite,<br />
damit alle Ortschaften Straßenanbindung hatten.<br />
Somit war der Weg nach Haagen sicher noch um einiges<br />
weiter, als er es heute ist. (Heutzutage wird in Google Maps<br />
der Weg mit ca. 66 km und 4 Std. Fahrzeit für einen Radfahrer<br />
angegeben.)<br />
Als wir endlich im Festort ankamen ging auch schon der Festzug<br />
los, beinahe wären wir noch zu spät gekommen. Der Umzug<br />
dauerte wohl bis gegen 16.00 Uhr. Viel gastronomisches<br />
Angebot gab es sowieso nicht, höchstens ein Paar Wienerle<br />
und ein Bier. Deshalb machten wir uns unmittelbar nach der<br />
Preisverteilung auf den Heimweg. Welchen Preis wir erringen<br />
konnten, weiß ich heute nicht mehr. Heimwärts fuhren wir<br />
durchs Oberland und Markgräflerland über Müllheim und Bad<br />
Krozingen nach Freiburg. Dort gingen wir alle miteinander<br />
noch auf die Mess, die ja damals noch auf dem heutigen Alten<br />
Messplatz in der Wiehre stattgefunden hat. Das kann eigentlich<br />
nur die Frühjahrsmess gewesen sein. Also wird diese Fahrt wohl<br />
an Pfingsten 1951 (13. oder 14. Mai) stattgefunden haben.<br />
Um Mitternacht, oder gar noch später, sind wir dann alle<br />
wohlbehalten wieder im Ibental angekommen, und es war beschlossene<br />
Sache, dass wir unseren Radfahrverein „Concordia“<br />
Unteribental wieder aufleben lassen wollten.<br />
Wenn ich heute im Fernsehen das Radrennen Paris – Roubaix,<br />
die sogenannte „Hölle des Nordens“ sehe, fühle ich mich<br />
immer wieder an unsere damalige Ausfahrt nach Haagen-<br />
Tumringen erinnert.<br />
Niedergeschrieben aus der Erinnerung im September 2021<br />
von Bernhard Ketterer, Raiwäberhiisli (Rainweberhäusle)<br />
29
Korso-Sport vom Anfang<br />
bis zum Ende<br />
von links: Karl Willmann, Arnold Schwär, Oskar Weber,<br />
Fritz Heizler, Gottfried Zipfel<br />
Als vor 100 Jahren der <strong>RSV</strong> Concordia Unteribental gegründet<br />
wurde, lag auf dem Korso-Sport das Hauptaugenmerk<br />
unseres Vereins. Korso-Veranstaltungen waren ein gesellschaftliches<br />
Ereignis und oft auch ein „Highlight“ im Alltag auf<br />
welches hingefiebert wurde.<br />
Aber was ist Korso?<br />
Ein Korso ist ein festlicher Umzug, bei dem Fahrräder, Schmuck<br />
an den Rädern, Kleidung, Fahren und Haltung, Anzahl der Teilnehmer<br />
pro Gruppe und die Länge des Anfahrtsweges jeder<br />
Gruppe bewertet werden. Korso-Wettbewerbe werden anlässlich<br />
besonderer Ereignisse, z.B. Jubiläumsfeste durchgeführt.<br />
Damit verbunden ist in der Regel das Kreis-/ und/oder Bezirksfest.<br />
Da beim Korso ein eindrucksvolles Bild entsteht, wenn die<br />
Radfahrer/-innen in einheitlicher Kleidung mit geschmückten<br />
Rädern fahren, ist er immer ein glanzvoller Höhepunkt dieser<br />
Festtage.<br />
Es werden folgende Korso-Arten unterschieden:<br />
• Gewöhnliches Korso, in einheitlicher oder uneinheitlicher<br />
Kleidung und ohne Schmuck oder Blumen an den Rädern<br />
• Blumenkorso, i. d. R. in einheitlicher Kleidung, mit lebenden<br />
Blumen als Dekoration<br />
• Schmuckkorso, i. d. R. in einheitlicher Kleidung, mit künstlichem<br />
Schmuck als Dekoration. Zweifarbige Radbänder im<br />
Vorder- und Hinterrad und Schärpen der Radfahrer spiegeln<br />
die Vereinsfarben wieder. Der geschmackvollen Herrichtung<br />
und Ausstattung sind keine Grenzen gesetzt. Motivwagen<br />
und historische Fahrräder werden oft eingebunden.<br />
Die Wertung erfolgt durch Preisrichter, die eine Standwertung<br />
und eine Bewertung der Fahrt (Streckenwertung) vornehmen.<br />
Es werden außerdem Ehrenpreise (Weitpreis, Meistpreis,<br />
Jugendpreis) ausgesetzt.<br />
Unser Verein nahm in der Regel am Blumenkorso Gruppe A<br />
teil. Hierbei werden die Räder und der Rahmen der Fahrräder<br />
mit Lärchenreisig und Blumen geschmückt. Auch wird ein<br />
Blumenkorb am Lenker angebracht. Stolz sind wir auf unsere<br />
beeindruckende Oldtimersammlung. Über die Jahre haben wir<br />
besondere Raritäten an Oldtimerfahrrädern zusammengetragen.<br />
30
Zuletzt sind wir beim Verbands- und Bezirksfest des RMSV<br />
Concordia Erzingen (59. Winzerfest) in 2017 angetreten<br />
und belegten dort den 2. Platz. Außerdem wurden wir in den<br />
letzten aktiven Jahren immer Bezirksmeister des Bezirks 3.<br />
Bedauerlicherweise hat der Badische Radsportverband im Jahr<br />
2022 die Sparte Korso fallen gelassen, sodass die übrig gebliebenen<br />
Vereine in einer Versammlung am 5. Dezember 2022 in<br />
Neudingen entschlossen, sich nun selbständig zu organisieren.<br />
Unter dem neuen Namen „Korsofreunde“ bekannten sich<br />
insgesamt 13 Vereine weiterhin zu der traditionellen Sportart.<br />
Eine Wertung mit Preisrichtern soll es in Zukunft nicht mehr<br />
geben, es werden aber weiterhin Jugend-, Meist-, und Weitpreise<br />
vergeben. Otto Huber vom <strong>RSV</strong> Germania Neudingen<br />
unser ehemaliger Korso-Referent im BRV erklärte sich weiterhin<br />
bereit Ansprechperson und Obmann der Korso-Vereine zu sein.<br />
Sehr stolz sind wir vom <strong>RSV</strong> Concordia Unteribental darauf,<br />
dass anlässlich unseres 100-jährigen Jubiläums ein Korso-<br />
Umzug stattfinden wird, bei dem zwölf Radsportvereine ihre<br />
Teilnahme erklärt haben.<br />
Unteribental, im Juni 2023<br />
Frank Reichmann, Fahrwart Korso<br />
Korso Erzingen 2017<br />
31
BS ANZ220018<br />
BODENBELÄGE VOM PROFI<br />
Entdecken Sie die neuesten Trends<br />
in unseren Ausstellungen<br />
Kirchzarten · Jakob-Saur-Str. 1 · Tel. 07661 3968-0<br />
www.zg-raiffeisen-baustoffe.de<br />
hr_anzeige_180x90.qxp_Layout<br />
WEIL ES<br />
1<br />
IHR<br />
04.05.23<br />
ZUHAUSE<br />
16:08<br />
WIRD<br />
Seite 1<br />
Ihr starker Partner für Tore und Torantriebe<br />
– von Beratung über Montage bis Service.<br />
Heim & Ruf GbR<br />
TBS-Werksvertretung . 79274 St. Märgen . Tel. 07669/921084 . www.heim-ruf.de
Besuchen Sie uns<br />
und lassen Sie sich<br />
von traditioneller<br />
Schwarzwälder<br />
Gastlichkeit<br />
verwöhnen.<br />
Wir freuen uns auf Sie.<br />
Familie Schlötzer · Hauptstr. 22 · 79256 Buchenbach<br />
Tel. 07661/4185 · Fax 90 31 14 · Montag Ruhetag
Ein halbes Jahrhundert<br />
Akrobatik auf dem Rad:<br />
Die Erfolgsgeschichte<br />
der Kunstradsportgruppe<br />
Seit 50 Jahren zeigt die Kunstradsportgruppe unseres<br />
Vereins sportliche Höchstleistungen und beeindruckt<br />
mit athletischen Darbietungen. Von den einfachen Anfängen<br />
in Unteribental bis hin zu nationalen Erfolgen hat sich der<br />
Kunstradsport in unserem Verein im Laufe der Jahre stetig<br />
gewandelt und die Sportler*innen zu großen Erfolgen geführt.<br />
In diesem Artikel werfen wir einen Blick auf die historische<br />
Entwicklung der Gruppe und wie sich die Trainingsbedingungen<br />
im Laufe der Zeit verändert haben.<br />
Die Anfänge in Unteribental:<br />
Im Jahr 1973 wurde unsere Kunstradsportgruppe gegründet.<br />
Gründungsväter waren Franz Josef Willmann und Bernhard<br />
Ketterer, der erste Trainer war Peter Ruh. Damals fand das<br />
Training noch auf einer einzigen Fahrfläche für alle Sportler*innen<br />
statt. Trotz beengter Verhältnisse wagten sich die<br />
Athlet*innen schon damals an Höchstschwierigkeiten, die auch<br />
heute noch bei internationalen Wettkämpfen gezeigt werden.<br />
Die bescheidenen Trainingsbedingungen waren kein Hindernis<br />
für baldige Erfolge auf Landes- und Bundesebene. Zu den<br />
erfolgreichsten Sportler*innen dieser Gründungszeit gehörten<br />
Jürgen Ketterer, Kim Lessmann, Meinrad Saier und die<br />
Geschwister Aurelia, Gabriele und Georg Willmann.<br />
Der Umzug nach Buchenbach:<br />
Mit der Zeit wuchs die Kunstradsportgruppe und erforderte<br />
bessere Trainingsmöglichkeiten. So entschied man sich, nach<br />
Buchenbach umzuziehen, wo mit drei Fahrflächen deutlich<br />
mehr Platz zur Verfügung stand. Dies ermöglichte den Sportler*innen,<br />
ihr Können weiter auszubauen und neue Übungen<br />
zu erlernen.<br />
Von Erfolgen und Förderungen zur Professionalisierung:<br />
Durch Erfolge und die Förderung talentierter Sportler*innen<br />
wurden die Trainingsmethoden der Kunstradsportgruppe im<br />
Laufe der Jahre immer weiter verbessert. Die Landes- und<br />
Bundestrainer*innen forderten eine erhöhte Trainingsfrequenz<br />
und -dauer, um das Potenzial der Athleten voll auszuschöpfen.<br />
Von anfänglich 4 Stunden pro Woche wuchs der Trainingsumfang<br />
auf bis zu 10 Stunden pro Woche an. Diese erhöhte<br />
Intensität erforderte nicht nur den Einsatz und das Engagement<br />
der Athlet*innen und Trainer*innen, sondern auch die Unterstützung<br />
und den Rückhalt der Gemeinde. Zusätzlich professionalisierten<br />
neue Gerätschaften wie Handstandklötze, Wippen,<br />
Standräder und Longen das Training.<br />
Die sportlichen Erfolge der Gruppe sind zahlreich und beeindruckend.<br />
Von nationalen Meisterschaften bis hin zu internationalen<br />
Wettbewerben haben die Athlet*innen der Kunstradsportgruppe<br />
ihre Fähigkeiten und ihr Talent unter Beweis<br />
gestellt. Diese Erfolge haben sogar dazu geführt, dass zwei<br />
unserer Fahrer*innen, Svenja Weiß, geb. Saier und Sebastian<br />
Zähringer, in den Nationalkader berufen wurden – eine<br />
große Ehre und Anerkennung für unseren Verein. Es ist keine<br />
Übertreibung zu sagen, der <strong>RSV</strong> Unteribental habe sich zur<br />
nationalen Bekanntheit im Kunstradsport entwickelt.<br />
Maßgeblich für die Betreuung der Sportler waren in den vergangenen<br />
Jahrzehnten die Trainer: Hans Junker, Jürgen Ketterer<br />
und Aurelia Zähringer, Gabriele Zähringer und Herbert Saier.<br />
Die Entwicklung der Kunstradsportgruppe ist ein Zeugnis für<br />
den Einsatz, die Leidenschaft und den Teamgeist unserer<br />
Mitglieder. Von bescheidenen Anfängen in Unteribental bis hin<br />
zu nationaler Anerkennung haben wir gemeinsam eine bemerkenswerte<br />
Reise unternommen.<br />
Wir sind stolz darauf, unsere Athlet*innen auf ihrem Weg<br />
zu begleiten und sind gespannt auf das, was die Zukunft für<br />
unsere Kunstradsportgruppe bereithält.<br />
von Gabriele Zähringer<br />
34
von links nach rechts:<br />
Sandra Löffler, Konrad Zahn, Stephanie<br />
Schwab, Gabriele Zähringer,<br />
Manuela Wangler, Ramona Schuler,<br />
Elisabeth Chatzipavlidis, Silvia Tobler,<br />
Aurelia Zähringer, Franz-Josef Heizler<br />
auf den Rädern: Valeska Engesser,<br />
Svenja Weiss<br />
Sitzend v. links:<br />
Johanna Ruttloff, Tabea Blüse,<br />
1. Reihe stehend v. links:<br />
Sebastian Zähringer, Eva Reichmann,<br />
Julia Dürrmeier, Nora Kern,<br />
Svenja Weiß<br />
2. Reihe stehend v. links:<br />
Anne Dürrmeier, Gabriele Zähringer,<br />
Nele Metz<br />
35
Die häufigsten Fragen<br />
im Rand-Leistungssport<br />
Falls Sie als Leser dieses Artikels gerade noch zu der Gruppe<br />
gehören, die die Stirn runzeln und versuchen das kryptische<br />
Wort: „Kunstrad?“ zu entschlüsseln, dann keine Bange. Aber<br />
auch wenn Sie schon „Insider“ sind, die folgenden Absätze<br />
beantworten häufige Fragen, die einer/m Athletin/en im Kunstradsport<br />
begegnen. Und ganz gleich ob in einem Interview für<br />
einen Zeitungsartikel oder wenn Sie als Kunstradfahrer/in von<br />
einem verdutzten Taxifahrer gefragt werden, warum Sie nicht<br />
einfach mit dem Fahrrad nach Hause fahren anstatt es auseinandergeschraubt<br />
in den Kofferraum zu legen – selten ist Zeit<br />
unseren Sport wirklich ausführlich zu erklären. Diese <strong>Festschrift</strong><br />
bietet hierfür Gelegenheit.<br />
Also dann,<br />
Was ist das eigentlich?<br />
Da Sie vermutlich immer noch das Bild des Taxikofferaums im<br />
Kopf haben, fangen wir am Besten damit an zu erklären, was<br />
denn ein Kunstrad so besonders macht. Warum denn nun nicht<br />
auf der Straße zu ihrem auserkorenen Ziel rollen?<br />
Die Räder sind in der Tat anders als gewöhnliche Fahrräder.<br />
Und in erster Linie sind sie im öffentlichen Straßenverkehr illegal:<br />
keine Bremsen, kein Licht. Erschwerend hinzu kommt<br />
außerdem noch ein extremes Maß an Unpraktikabilität. Es gibt<br />
weder Gangschaltung noch Freilauf und die Reifen sind auf<br />
steinharte 14 Bar Luftdruck aufgepumpt. Für alle unter Ihnen,<br />
die ein Rennrad unbequem finden, hier sprechen wir über<br />
ganz andere Maßstäbe. Die speziell konstruierten Zweiräder<br />
mit dem steilen Lenkwinkel fahren sich zusätzlich auch noch<br />
instabil und wackelig. Insgesamt also keine Kurzbeschreibung,<br />
durch die der Drang entsteht, zum Telefon zu greifen und ein<br />
eigenes Exemplar bei einer der wenigen Fahrradmanufakturen<br />
zu ordern. Zumindest sofern man den einzigen Vorteil dieses<br />
Sportgeräts außer Acht lässt – die maximale Kontrolle über jede<br />
noch so kleine Bewegung.<br />
Und genau diese Kontrolle ist für das Kunstradfahren unerlässlich.<br />
Stellen Sie sich vor Sie stehen freihändig auf dem Sattel<br />
eines fahrenden Fahrrads. Ich weiß, das mag komisch klingen,<br />
aber ich bitte Sie dennoch zumindest um den Versuch. Sie<br />
fokussieren Ihren Lenker und sehen, dass eine kleine Veränderung<br />
des Drucks auf Ihren Zehenspitzen umgehend in einem<br />
Pendeln des Steuerkopfes resultiert. Ihre Oberschenkel und der<br />
Po sind maximal angespannt und die Knie gestreckt, während<br />
sie flach atmen. Langsam und gleichmäßig gehen Sie in die<br />
Knie und drücken sich dann mit einem kleinen Sprung nach<br />
vorne oben ab – Freiflug also über einem Fahrrad. Spätestens<br />
jetzt ist es absurd, aber hey. Parabelförmig kommt der Lenker<br />
näher. Fünf Zentimeter zu weit links oder rechts würde bedeuten<br />
(im besten Fall), dass sie ihren Flug unfreiwillig bis zum Boden<br />
fortsetzen. Plus minus drei Zentimeter und ihr Fuß rutscht<br />
bei Kontakt mit dem Lenker ins Leere ab. Oder Sie knicken um.<br />
Oder beides … aber lassen wir das hier.<br />
Plus minus ein Zentimeter und alles ist gut. Sie haben die Chance,<br />
mit einem Abfedern der Beine Ihre Fahrt auf dem Lenker<br />
fortzusetzen und werden mit einem Adrenalinschub belohnt.<br />
Falls Sie beobachtet wurden, vernehmen Sie eventuell noch<br />
ein Klatschen der Zuschauer. Die maximale Kontrolle über das<br />
Fahrrad hat sich ausgezahlt.<br />
Oftmals liest man über den Kunstradsport zusammenfassende<br />
Erklärungen wie: es handelt sich um eine Mischung aus Sport,<br />
Kunst und akrobatischen Elementen. Und während auf einer<br />
objektiven Ebene absolut nichts an dieser Beschreibung auszusetzen<br />
ist, wird sie der Sportlerperspektive nicht gerecht. Wenn<br />
Sie also in Zukunft in einem Interview eines/r Kunstradfahrers/<br />
so etwas lesen, wie, man benötige Kraft und Flexibilität, ästhetisches<br />
Gefühl und Mut, dann denken Sie an das eben durchgeführte<br />
Gedankenexperiment. Derartige Abläufe in Substantive<br />
zu verpacken, ist annähernd unmöglich.<br />
36
Chancen, durch die Glasfront der Sporthalle einige Blicke zu<br />
erhaschen. Und mehr ist zumeist nicht notwendig. Zugegeben,<br />
ab einem gewissen Alter ist die typische Reaktion nicht: das<br />
sollte ich auch mal ausprobieren. Wenn Sie sich bereits auch<br />
ohne waghalsige Experimente auf einem Fahrrad Mühe geben<br />
müssen, dass alle Bandscheiben da bleiben, wo sie sind, ist das<br />
eine sehr vernünftige Einstellung. Doch wenn Sie noch mit dem<br />
kindlichen Optimismus vertraut sind, dann ist sofort klar – das<br />
will ich auch können. Ab diesem ersten Funkeln in den Augen<br />
und der Neugier, es selbst auszuprobieren, ist es nur noch eine<br />
Frage eines Anrufs oder einer E-Mail an den <strong>RSV</strong> Unteribental.<br />
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie mit Ihrem Kind mal bei<br />
uns vorbeischauen. Das Einstiegsalter liegt bei ca. 6 Jahren. Das<br />
hängt mit den Rädern zusammen, die erst ab einer gewissen<br />
Größe hergestellt werden. Meistens merken die Kinder relativ<br />
schnell, ob sie ein/e Kunstradfahrer/in sind. Denn falls ja, dann<br />
bleiben sie einfach in der Halle und wollen den Trick, den sie<br />
gerade üben, „nur noch einmal” und danach „nur noch einmal“<br />
versuchen – dann klappt es bestimmt …<br />
Aber warum Kunstradfahren?<br />
Wie kommt man dazu?<br />
Diese Frage lässt sich glücklicherweise<br />
recht einfach beantworten.<br />
Sebastian Zähringer<br />
Das Einzige, was es benötigt, ist ein kurzer Augenblick, in<br />
dem man den Sport live beobachten kann. Und hierbei ist es<br />
vollkommen egal, ob bei einem Showauftritt, einem Wettkampf<br />
oder einfach während eines Trainings. Es gibt nicht viele<br />
Radsport- Vereine, die eine Abteilung Kunstradfahren haben,<br />
umso schöner, dass es beim <strong>RSV</strong> Unteribental möglich ist. Die<br />
Sporthalle in Buchenbach bietet hier ziemlich optimale Voraussetzungen.<br />
Wer von Ihnen in den Abendstunden schon einmal<br />
am Waldrand des Sommerbergs entlanggelaufen ist, hatte gute<br />
Sobald Kinder Laufrad- oder Fahrradfahren können, wächst<br />
bei vielen das Interesse das Sportgerät weiter auszuprobieren.<br />
Sie werden kreativ und artistisch, üben freihändig fahren,<br />
stellen Füße auf Sattel oder Stange, machen „Gepäckträgersitz“,<br />
lernen vielleicht auch Einradfahren und einige Tricks.<br />
Das Kunstrad eröffnet nochmal ganz neue vielfältige Möglichkeiten.<br />
Es gibt im Einer-Kunstradfahren über 100 verschiedene<br />
Übungen mit unterschiedlicher Schwierigkeit (fahrend auf zwei<br />
Rädern/Niederrad, fahrend auf dem Hinterrad/Steiger, Übergänge,<br />
vorwärts, rückwärts, im Halb-/Kreis, in der Wechselrunde<br />
(8), in Drehungen/Pirouetten). In der Halle, mit Hilfestellung<br />
der/s Trainers/in kann man diese Vielfalt Stück für Stück<br />
kennenlernen und einüben. Es gibt immer wieder was Neues.<br />
Aber es wird nicht nur auf dem Kunstrad trainiert, sondern<br />
Koordinations-, Kraft- und Dehnübungen gehören fest zur Trainingseinheit<br />
dazu. Auf und im Einklang mit dem Fahrrad turnen<br />
macht sehr viel Spaß :)<br />
37
Svenja Weiß<br />
Zeitmanagement?<br />
Der Bundestrainer der deutschen Kunstrad Nationalmannschaft<br />
hat über die Jahre mitverfolgt, wie viele Versuche ein/e<br />
Sportler/-in in etwa braucht, um die anfangs beschriebene<br />
Übung zu meistern (den Sprung vom Sattel auf den Lenker).<br />
Die Schätzung: ungefähr 3000. Geht man davon aus, dass<br />
ein/e fortgeschrittene/r Kunstradfahrer/in 30 Sekunden je Versuch<br />
braucht, so ergibt sich eine Trainingszeit von 25 Stunden,<br />
nur um diesen einen Trick zu beherrschen. Und dabei haben<br />
wir noch nicht einmal berücksichtigt, dass man als Grundvoraussetzung<br />
perfekt auf dem Sattel und Lenker eines Fahrrads<br />
38
(stehend) fahren können muss. Sie wollen an einem Wettkampf<br />
teilnehmen? Eine typische Kür besteht aus 30 Übungen. 30x 25<br />
Stunden – da kommt einiges zusammen. Zugegeben nicht alle<br />
Übungen sind derart komplex und hin und wieder kommt es<br />
vor, dass Sportler ein ungeahntes Talent für einige Tricks entdecken.<br />
Wo andere mehrere Monate konsequent trainieren<br />
müssen und sich annähernd die Zähne ausbeißen, reicht bei<br />
ihnen eine einzige Trainingseinheit. Das verleiht natürlich einen<br />
enormen Motivationsschub. Doch auch in diesen seltenen<br />
Fällen ist die Arbeit noch nicht vorbei. Für einen Wettkampf<br />
will man schließlich, dass die Übung leichtfüßig und ohne zu<br />
wackeln funktioniert. Wenn man dann einen Sportler beobachtet,<br />
der die Übung in Perfektion beherrscht, so entsteht fast der<br />
Eindruck, die Übung wäre einfach.<br />
Doch was genau haben diese Tatsachen mit Zeitmanagement<br />
zu tun? Um es möglichst einfach zu halten, eine ambitionierte<br />
Wettkampf-Karriere erfordert Zeit. Wie in jedem Leistungssport<br />
muss man mehrfach die Woche ins Vereinstraining, macht Kraft<br />
und Ausdauersport zu Hause und ist an den Wochenenden<br />
auf Trainingslagern oder Wettkämpfen unterwegs. Und all das,<br />
während man zur Schule geht, in Ausbildung ist oder arbeitet.<br />
Sehr schnell lernt man also zu priorisieren und Kompromisse zu<br />
finden. Und oft ist es gar nicht der ausgeklügelte Terminkalender<br />
der gutes Zeitmanagement ermöglicht, sondern vielmehr<br />
das Vermögen ehrlich zu sich selbst zu sein und auf den eigenen<br />
Körper zu hören. Wenn er eine Pause braucht, dann am<br />
besten flexibel sein und nicht erst dann machen, wenn sie im<br />
Kalender vorgesehen ist. Und auch hier kommen die Autoren<br />
nicht umhin zu betonen, wie einzigartig die Möglichkeiten sind,<br />
die der <strong>RSV</strong> bietet. Ein Trainerteam, der Zugang zu zwei Hallen<br />
und das Entgegenkommen der Gemeinde ermöglichen beste<br />
Trainingsbedingungen – auch im Hinblick auf Zeitmanagement.<br />
Konzentration<br />
Das „Feeling“ auf dem Kunstrad ist schwer zu beschreiben.<br />
Es ist eine Mischung aus höchster Konzentration, körperlicher<br />
Anspannung, Anstrengung, Achtsamkeit und mentaler<br />
Fokussierung. Am besten klappte es bei mir (Svenja), wenn ich<br />
es trotz körperlicher Höchstanstrengung schaffte in eine Art<br />
hochkonzentrierte Trance zu finden und die automatisierten<br />
und im Kleinhirn abgespeicherten Bewegungsabläufe sich wie<br />
von selbst abspielten, ich jedoch immer in Bereitschaft war<br />
mögliche kleine Unsicherheiten frühzeitig zu spüren und auszugleichen.<br />
Heute glaube ich, dass es mir „quirligem Wirbelwind“ gut tat<br />
fernab der Schule dieses Übungsfeld zu haben. Ich lernte beim<br />
Sport mich zu konzentrieren, fokussieren und meine Nervosität<br />
bei Wettkämpfen als positive Energiequelle zu nutzen. Ich<br />
lernte mit Fehlern, Enttäuschungen und mit Erfolg, Konkurrenz<br />
und allem was dazugehört umzugehen. Und all das in einem<br />
geschützten Rahmen mit viel Unterstützung durch Trainer und<br />
Verein.<br />
Wo ist Unteribental?<br />
Von Ihnen weiß das jeder. Diese Frage wurde mir aber bei<br />
Wettkämpfen sehr oft gestellt. Mittlerweile hat sich das aber<br />
auch geändert- weil der <strong>RSV</strong> Unteribental im Kunstradsport<br />
national bekannt ist. „Unteribental liegt in der Nähe von Freiburg<br />
im Dreisamtal am Rande des Schwarzwaldes“. Dort leben<br />
ganz viele wunderbare Menschen und es gibt einen einzigartigen<br />
Radsportverein- dessen 100-jähriges Jubiläum wir feiern<br />
dürfen. Ich hoffe, dass der Verein mit seinem ehrenamtlichen<br />
und gemeinschaftlichen Charakter noch sehr lange bestehen<br />
bleibt.<br />
von den beiden früheren Nationalkaderathleten<br />
Svenja Weiß, geb. Saier und Sebastian Zähringer<br />
39
Herzlichen Glückwunsch<br />
zum 100-Jährigen Jubiläum!<br />
Sportliche Grüße aus der March,<br />
von Team Willtec!<br />
Messtechnik<br />
www.willtec.de<br />
Schnell. Einfach. Messen.<br />
Herzlich<br />
Willkommen<br />
frische Hofprodukte<br />
direkt vom Erzeuger<br />
und Produkte aus der Region<br />
Dienstags vormittag<br />
finden Sie uns auf dem<br />
Wochenmarkt<br />
in Kirchzarten<br />
in der Fußgängerzone<br />
Öffnungszeiten: Mittwoch von 14.00 – 18.30 Uhr, Freitag von 6.30 – 18.30 Uhr<br />
Familie Stiegeler · Talstraße 21 · 79256 Buchenbach · saierhof@t-online.de · www.saierhof.de
JUBILÄUMSANGEBOTE<br />
seit1933... alles, was Sie bewegt!<br />
Radbekleidung / Radschuhe<br />
50%<br />
Cross Tourer CT3<br />
UVP<br />
€ 4699,-<br />
- € 900,-<br />
€ 3799,-<br />
bei Barkauf<br />
oder EC-Karte<br />
Motor<br />
Shimano EP8, DU-EP800,<br />
250 W, 85 Nm<br />
Akku<br />
Core S1, 630 Wh, 36 V,<br />
17,5 Ah<br />
Schaltung<br />
Shimano Deore XT,<br />
RD- M8000, Shadow Plus,<br />
11-S<br />
Öffnungszeiten Bike<br />
Mo.- Fr. 09.00-18.00 Uhr<br />
Sa. 09.00-13.00 Uhr<br />
Freiburger Strasse 17, 79199 Kirchzarten<br />
A U T O F A H R R A D T A N K S T E L L E<br />
Women<br />
a m Kirchplatz<br />
Kirchplatz 1 . 79199 Kirchzarten<br />
Tel. 07661-98 99752
50 Jahre Chronik<br />
der Turnabteilung<br />
• Die Gründungsversammlung der Turnabteilung fand am<br />
12. Februar 1973 im Gasthaus Hirschen in Unteribental statt.<br />
• Hannelore Löffler war die erste Abteilungsleiterin der<br />
Turnabteilung.<br />
• Die Gemeinde unterstützte die Anschaffung von Sportgeräten,<br />
da die Schule die Geräte mitbenutzte.<br />
• Rita Kohler leitete die Frauen- und Mädchengymnastik,<br />
während Friedel Leßmann für das Männer- und „Knabenturnen“<br />
verantwortlich war.<br />
• Das Sportangebot wurde sehr gut angenommen.<br />
• Alle zwei Jahre fand eine Adventsfeier in der Ibentalhalle<br />
statt, mit Vorführungen, Tombola und anfangs Tanz zum<br />
Ausklang.<br />
• Es gab auch andere Aktivitäten, wie z.B. ein Fußballspiel<br />
der Turnfrauen Ibental gegen Fußball-Frauen Stegen<br />
am 21. Mai 1978, das mit einem 0:0 „für Ibental“ endete ;)<br />
• Die Männer beteiligten sich von 1984 – 1986 beim Handball-<br />
Grümpelturnier in Kappel und belegten gute Platzierungen.<br />
• Die Turnkinder haben verschiedene Ausflüge unternommen,<br />
zum Beispiel in den Europapark nach Rust im Juli 1976,<br />
in den Vogelpark im Wiesental, 1986 erneut nach Rust und<br />
später in den Steinwasenpark.<br />
Turnfrauen von 1983<br />
1. Reihe sitzend v. links: Rita Kohler, Irmgard Maier,<br />
Rita Klingele, Veronika Batt, Theresia Bensel<br />
2. Reihe v. links: Luise Heizler, Klara Molz,<br />
Elisabeth Ketterer, Waltraud Schlegel, Birgit Schlegel,<br />
Veronika Schlegel, Gertrud Herden, Christine Saier,<br />
Hanni Willmann, Elli Heizler<br />
3. Reihe v. links: Gisela Fild-Keßler, Paula Vogt,<br />
Hedwig Schlegel, Hannelore Löffler, Monika Schlegel,<br />
Klara Willmann, Irma Ketterer<br />
• Die Männer unternahmen Ausflüge ins Elsass, machten<br />
einen Tagesausflug mit dem Rad um den halben Bodensee,<br />
eine Radwanderung an den Kaiserstuhl zur geschlossenen<br />
Riegeler-Brauerei (101 km, 9,5 h Fahrzeit) und eine Tageswanderung<br />
ins Dahner Felsenland.<br />
• Die Frauen waren die größten „Fegbesen“, sie fuhren nach<br />
Paris, in die Schweiz, ins Elsass, nach Heidelberg, wanderten<br />
vom Feldberg zum Titisee, fuhren nach Michelstadt im<br />
Odenwald zum Weihnachtsmarkt, an den Bodensee, ins<br />
Kleinwalsertal, nach Taubergießen, machten eine Stadtführung<br />
in Freiburg, fuhren nach Ischgl, zum Sonnenhof<br />
Kleinaspach, nach Köln und zum Kaiserstuhl.<br />
• Zum 50-jährigen Jubiläum der Turnabteilung ist es wieder<br />
an der Zeit einen Ausflug zu unternehmen.<br />
42
Es ist beeindruckend, wie viele engagierte Übungsleiter<br />
im Laufe der 50-jährigen Geschichte der Turnabteilung tätig<br />
waren. Hier ist eine Zusammenfassung der verschiedenen<br />
Übungsleiter:<br />
• Rita Kohler und Friedel Leßmann waren die ersten Übungsleiter<br />
und betreuten die Turner (Frauen, Männer, Mädchen<br />
und Jungen) über viele Jahre hinweg. Rita Kohler war sogar<br />
18 Jahre lang tätig.<br />
• Das Ehepaar Enßle folgte auf Friedel Leßmann als Übungsleiter.<br />
• Danach übernahmen Günter Stucky und Gerhard Klingele<br />
die Betreuung der Männer und Jungen.<br />
• Helga Münzer übernahm nach Rita Kohler die Leitung der<br />
Vital-Gymnastik-Gruppe der Frauen und hatte diese Position<br />
für 29 Jahre inne.<br />
• Im Herbst 2021 wurde aus der Vital-Gymnastik-Gruppe eine<br />
Yoga-Gruppe unter der Leitung von Simone Steinhart.<br />
Vorführung der Männersportgruppe Adventsfeier 1985<br />
Untere Reihe (von links nach rechts):<br />
Günter Stucky, Helmut Enßle, Wolfgang Willmann,<br />
Hans-Peter Fuß, Hans-Peter Zähringer<br />
Obere Reihe (von links nach rechts):<br />
Manfred Ketterer, Gerhard Klingele, Konrad Molz,<br />
Bernhard Ketterer, Michael Klingele<br />
• Seit 2017 gibt es zusätzlich eine bodyArt-Gruppe unter der<br />
Leitung von Antje Schober.<br />
• Lorita Häussler leitet seit 2004 die Tai-Chi/Qigong-Gruppe.<br />
• Annette Reichmann bietet seit dem Jahre 2000 den Kurs<br />
„Fit durch den Winter“ an.<br />
• Für die Kinderbetreuung gab es im Laufe der 50 Jahre fast<br />
20 verschiedene Übungsleiter, die sich um die Kinder kümmerten:<br />
Rita Kohler (Mädchen), Friedel Leßmann (Jungen),<br />
später gemischte Gruppen mit Käthe Friemel, Ingeborg<br />
Enßle, Christel Koop, Susanne Paul, Julia Müller, Sabrina<br />
Saum, Annika Saum (Turnen und Hip Hop), Evelyn Schweiz,<br />
Carolin Brauchle, Sabine Winterhalter, Philipp und Antje<br />
Rießle, Theresa Drubba, Elisabeth Chatzipavlidis, Carolin<br />
Simon, Sandra Möbius<br />
• Es ist großartig zu sehen, wie viele Menschen ihre Zeit<br />
und Energie investiert haben, um den Mitgliedern der<br />
Turnabteilung ein breites Spektrum an sportlichen Aktivitäten<br />
anzubieten.<br />
Die Leiterinnen der Turnabteilung waren/sind wie folgt:<br />
• Hannelore Löffler 1973 – 1995<br />
• Elli Heizler 1995 – 2013<br />
• Uschi Seifert seit 2013<br />
Diese Damen haben einen bedeutenden Beitrag zur Entwicklung<br />
und Leitung der Turnabteilung geleistet und haben<br />
über viele Jahre hinweg Verantwortung übernommen. Ihr<br />
Engagement und ihre Führung haben zweifellos dazu beigetragen,<br />
dass die Turnabteilung erfolgreich und aktiv geblieben ist.<br />
43
Unsere Trainingsgruppen<br />
Lorita Häußler, Physiotherapeutin<br />
Tai-Chi, Qigong<br />
Antje Schober, liz.bodyART-Trainerin<br />
body Art ®<br />
Simone Steinhart, Yoga-Trainerin<br />
Hatha-Yoga<br />
Ziel dieser Übungsgruppe ist sanftes funktionelles<br />
Bewegen des ganzen Körpers.<br />
Wir bedienen uns dafür der fernöstlichen<br />
heilgymnastischen Methoden des Taijiquan<br />
und Qigong, um die Ausgeglichenheit<br />
aller Muskeln, Sehnen und Gelenke<br />
anzustreben. Lockern, aber auch kräftigen,<br />
strecken und dehnen, ebenso das Gleichgewicht<br />
trainieren und die Körperhaltung<br />
aufrichten. Die Übungen und Bewegungen<br />
sind fließend und harmonisch.<br />
Montag 8:30 Uhr – 9:30 Uhr<br />
bodyART® ist ein ganzheitliches Körpertraining<br />
und basiert auf den 5 Elementen<br />
der Chinesischen Medizin. Es trainiert den<br />
Mensch als Einheit von Körper, Geist und<br />
Seele. Durch die Übungen werden Kraft,<br />
Flexibilität und Balance miteinander verbunden.<br />
Stabilität, Koordination, Wohlbefinden,<br />
Verbesserung der Körperhaltung,<br />
Vorbeugung und Entgegenwirkung von<br />
Rückenschmerzen sowie Stressabbau sind<br />
positive Effekte des einzigartigen Trainings.<br />
Der Körper wird durch das regelmäßige<br />
Training athletisch geformt und fühlt sich<br />
im Alltag wieder gestärkt und vital!<br />
Montag 18:30 Uhr – 19:30 Uhr<br />
Mein Yoga ist zu verstehen als Rückzugsmöglichkeit<br />
in mitten des hektischen<br />
Alltagstrubel. Es ist eine Einladung an all<br />
jene, die bereits etwas Yogaerfahrung<br />
mitbringen aber auch an alle die einfach<br />
nur neugierig und offen für Neues sind.<br />
Wir werden Asanas (Körperübungen),<br />
Pranayama (Atemübungen) und Meditation<br />
vereinigen. Wir werden nachspüren,<br />
um unseren Körper wieder feiner wahrnehmen<br />
zu können. Wir werden Hatha-<br />
Yoga praktizieren. Durch Yoga kann Glück,<br />
Zufriedenheit und Selbstbewusstsein<br />
gesteigert werden. Yoga kann uns lehren,<br />
dass der Ort der inneren Ruhe und der<br />
Gelassenheit, wo wir immer wieder neuen<br />
Mut und neue Kraft schöpfen können,<br />
letztendlich in uns selbst liegt.<br />
Montag 19.45 – 21.15 Uhr<br />
44
Carolin und Sandra<br />
Kinderturnen<br />
Bei unserem Kinderturnen von 3 bis 7<br />
Jahren wird gelaufen, gerannt, gesprungen,<br />
getanzt und geklettert. Bei dem<br />
vielseitigen Angebot erlernen die Kinder<br />
spielerisch motorische Grundlagen<br />
aber auch emotionale und psychosoziale<br />
Kompetenzen werden gestärkt.<br />
Gerne darf mit Mama oder Papa geschnuppert<br />
werden.<br />
Annette Reichmann, Übungsleiterin<br />
Fit durch den Winter<br />
Als Ausgleich zum Mountainbiken trifft<br />
sich die gemischte Gruppe in der<br />
„kalten Jahreszeit“ zum Training in der<br />
Halle. Ein Schwerpunkt liegt bei der<br />
Koordination/Aerobic – sehr zur Freude<br />
der männlichen Teilnehmer …<br />
Donnerstag 19:15 Uhr – 21:00 Uhr,<br />
von Oktober bis April<br />
Donnerstag 15:30 Uhr – 16:30 Uhr<br />
Sämtliche Trainingseinheiten finden<br />
in der Ibentalhalle statt.<br />
45
LASST DIE<br />
WADEN BRENNEN!<br />
www.steinhauser-bau.de
Bei uns ist die Luft klarer und die Aussicht einmalig!<br />
Wir glauben, es wird Ihnen hier gefallen…<br />
Genießen Sie bei uns hausgemachte Kuchen und<br />
Knödelgerichte, zünftige Vesper, leckeres<br />
Bauernhofeis uvm.<br />
Öffnungszeiten saisonabhängig, siehe Homepage.<br />
79256 Buchenbach<br />
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!<br />
Ihr Hüttenwirt Markus Schroth & Team<br />
Tel. 07661/3324 oder 0173/9068945<br />
www.hoefener-huette.de info@hoefener-huette.de
Chronik der MTB-Abteilung<br />
1998<br />
Erste MTB-Touren von und für Ibentäler,<br />
Initiator Alfred Schlegel<br />
2002<br />
Erste MTB-Touren beim Radlerhock auf privater Basis<br />
2004<br />
Mehrtägige Alpentour mit Jürgen Ketterer auf privater Basis,<br />
ab da verschiedene Leistungs-Gruppen mit Jürgen Ketterer,<br />
Arthur Saier, Gottfried Saier und später Dieter Faller<br />
2007 im April<br />
Gründung MTB-Abteilung, Leitung kommissarisch Eric Bügner<br />
2007/2008<br />
Produktion der ersten <strong>RSV</strong>-Rad-Trikots (65 Stück), Erstellung<br />
einer Homepage mit Tourenarchiv v. Arthur und Jürgen<br />
Kids-Gruppe MTB<br />
25.10.2008<br />
Eric Bügner wurde offiziell zum Abteilungsleiter MTB gewählt<br />
2008<br />
Gründung einer Kids-Gruppe MTB; erster Guide: Oliver Aniol,<br />
der Jahre später durch Florian Jesse und Hansi Matthis „beerbt“<br />
wurde.<br />
Anschaffung neuer Rad-Trikots.<br />
Neue Rad-Trikots<br />
48
2015<br />
Versuch, mit Gemeinde und Förster im Gummenwald eine<br />
legale Bike-Strecke für die Kinder (wie in Freiburg) auf<br />
Pachtbasis zu bauen. Wurde aufgrund von Haftungsproblemen<br />
abgelehnt.<br />
Seit 2016<br />
Jährliche Teilnahme der MTB-Abteilung an der Arbeitswanderung<br />
des Schwarzwaldvereins Buchenbach zur gemeinsamen<br />
Wegepflege.<br />
Revitalisierung des Pump Tracks<br />
30.11.2019<br />
Pumptrack – Revitalisierung<br />
25.05.2011<br />
Bau eines Pump Track des <strong>RSV</strong>-Unteribental am Gummenwald<br />
neben dem Sportplatz<br />
2011<br />
Erstmals Verpflegung am Rinken beim Ultra Bike Kirchzarten,<br />
ab da jedes Jahr<br />
2013<br />
Hansi Matthis wird neuer MTB Abteilungsleiter<br />
2013<br />
Alfred Schlegel beendet sein Guiding nach 13 Jahren in der<br />
MTB Gruppe, Nachfolger: Gottfried Saier und Wolfgang Steiert<br />
Gemeinsame Wegepflege<br />
2014<br />
Entstehung neuer Bike-Gruppe für Jugendliche ab 15 Jahren,<br />
Guides: Kevin Steiert und Joscha Ketterer<br />
Technik-Training, Bike-Reparaturkurse, Projekttage in der<br />
Sommerbergschule Buchenbach (ab da jährlich bis 2018)<br />
49
Gruppe Arthur am Reschensee
Unsere MTB-Trainingsgruppen<br />
Guide Dieter<br />
Diese Gruppe ist unsere sogenannte<br />
Genuss-Gruppe für Einsteiger, E-Biker und<br />
gelegentlich trainierende Biker, die durch<br />
regelmäßige Teilnahme über die Zeit ihre<br />
Fitness und Ausdauer steigern möchten.<br />
Guide Gottfried<br />
Für sportliche, gut trainierte Biker,<br />
die in der Lage sind längere Anstiege zu<br />
bewältigen. Gelegentliche technisch<br />
anspruchsvolle Abschnitte sind möglich.<br />
Guide Arthur<br />
Für ambitionierte Biker mit einer guten<br />
Grundkondition und Fahrtechnik.<br />
In sportlichem Tempo werden abwechslungsreiche<br />
Touren auf Forstwegen und<br />
Trails gefahren.<br />
Tourenstart:<br />
von Mitte April bis Mitte September,<br />
donnerstags um 17 Uhr<br />
Tourenstart:<br />
von Mitte April bis Mitte September,<br />
dienstags um 18 Uhr<br />
Tourenstart:<br />
von Mitte April bis Mitte September,<br />
dienstags um 18 Uhr<br />
Für alle Gruppen gilt:<br />
• wir starten mit unseren Abendtouren ca. Mitte April und fahren<br />
bis ca. Mitte September.<br />
• wir fangen im Frühjahr moderat an, um „Sitzpolster“ und Kondition wieder<br />
aufzubauen. Bis zur Sommer-Sonnwende haben wir dann so viel Kraft<br />
und Motivation, dass wir die langen Abende gut nutzen können und auch<br />
dreistündige Touren ein Genuss sind.<br />
Treffpunkt für alle Gruppen zum Beginn<br />
der Touren ist die Vater-Unser-Kapelle in<br />
Unteribental. Nach den anstrengenden<br />
Touren gönnen sich die Biker eine Einkehr<br />
um Durst und Hunger zu stillen. Man<br />
lässt die Tour nochmal Revue passieren<br />
und denkt schon wieder an die nächste<br />
Ausfahrt …<br />
51
Erlebnisse 16 Jahre<br />
Donnerstaggruppe Dieter<br />
Seit Mitte 2007 führe ich die Donnerstagabend-MTB-Gruppe.<br />
Weil aus beruflichem Grund der damalige Gruppenleiter<br />
(Wolfgang Reichmann; leider schon verstorben) an einem<br />
Abend verhindert war, habe ich kurzfristig die Tour an diesem<br />
Abend geleitet. Aus dieser Aushilfe wurden jetzt 16 Jahre<br />
MTB-Guide der Donnerstagabendgruppe („Die Genussbiker“).<br />
Erfahrungen bei der Erkundung von Radwegen konnte ich bei<br />
Arthur Saier sammeln, mit dem ich Anfang der 2000er-<br />
Jahre manche Tour gefahren bin.<br />
Schanzenhof<br />
Zu Anfang meiner Gruppenleitung waren wir durchschnittlich<br />
mit 8 bis 10 Personen unterwegs, das steigerte sich dann<br />
auf bis zu 18 Personen, aktuell sind wir im Schnitt mit 16 Personen<br />
unterwegs.<br />
Schwarzwaldhotel<br />
Bonndorf<br />
52
Pause am Kirnbergsee 2020<br />
In 2008 hatten wir leider einen schweren Unfall, bei dem<br />
die verunfallte Teilnehmerin mit dem Krankenwagen in die<br />
Klinik gebracht werden musste (schwere Gehirnerschütterung).<br />
Etwas ähnliches passierte auch 2018, auch hier musste<br />
eine Teilnehmerin die Nacht im Krankenhaus verbringen.<br />
Abgesehen von solchen persönlichen Pannen gab es auch<br />
eine Unmenge an technischen Defekten, wobei platte Reifen<br />
zu den harmlosesten zählten; auch Kettenrisse und Reifenplatzer<br />
gehörten dazu.<br />
Zu den Highlights der Touren zählten die Schwarzwaldtouren.<br />
Sorgfältig so geplant, dass allein vom Termin her eigentlich<br />
gutes Wetter sein sollte (meistens immer im Juli durchgeführt).<br />
Leider erwies sich der Wettergott als Gegner der Mountainbiker<br />
und so hatten wir oftmals Pech mit dem Wetter; und<br />
das mitten im Sommer. Ich musste mir dann oft sehr hämische<br />
Kommentare anhören. Zumindest hat es die Landwirte<br />
gefreut: Sobald diese erfahren haben, dass ich eine Wochenendtour<br />
plane, konnte der Güllewagen angespannt werden!<br />
Dem Klimawandel sei Dank, wurde es aber (gefühlt seit 2016)<br />
Wettermäßig deutlich besser. Wir konnten Wochenendtouren<br />
ohne Regen fahren!!!!!! (nicht immer, aber immer öfters).<br />
Seit 2015 kamen die ersten E-Bikes auf. Vielen verhalf dieses<br />
Motor-unterstütztes Treten, bei meiner Gruppe weiterhin<br />
dabeizubleiben. Mittlerweile (Stand 2022) sind die Anzahl an<br />
„Muskelbiker“ aber an einer Hand abzuzählen (ich gehöre<br />
auch noch dazu und bin Stolz darauf).<br />
Ich hoffe, dass wir auch weiterhin noch einige schöne Touren<br />
bei bester Gesundheit fahren können.<br />
Dieter Faller<br />
53
Gruppe Gottfried<br />
Die aktuelle Gruppe<br />
54
Ausflug in die Alpen
Gruppe Arthur<br />
57
100<br />
stolze<br />
Jahre!<br />
Herzlichen Glückwunsch.<br />
Wir wünschen dem Radsportverein<br />
„Concordia“ Unteribental alles Gute zum<br />
Jubiläum.<br />
Miteinander und füreinander – gerne<br />
unterstützen wir das Ehrenamt in der Region!<br />
spk-hsw.de/vereinssupport
Jahre<br />
<strong>RSV</strong> Unteribental<br />
Herzlichen Glückwunsch<br />
zum Jubiläum!<br />
Mit uns sind Sie<br />
goldrichtig beraten.<br />
Agentur<br />
Holger Götz<br />
Dorfstr. 11<br />
79256 Buchenbach<br />
goetz.holger@dvag.de
Du meine Heimat „Ibental“<br />
Der Sommerberg mit Matten und Feldern,<br />
der Winterberg mit rauschenden Wäldern<br />
umfrieden dich schützend, du liebes Tal,<br />
Du meine Heimat, Ibental.<br />
Am Eingang grüßt uns die Vaterunser – Kapelle,<br />
mit dem Gebet unseres Herrn und gegen die Helle,<br />
des Lindenberghimmels steht vieler Wallfahrten Ziel und Lohn<br />
das Haus Mariens mit ihrem Sohn.<br />
Durchs Ibental eilt der Ibenbach mit lebendiger Kraft,<br />
macht‘s heimatlich, sagt uns, dass das Segen schafft,<br />
wer so wie er zwischen oben und unten<br />
die guten Stationen des Lebens gefunden.<br />
So bleib uns erhalten, geboren im Frieden<br />
als Schmuck der Natur, als Heimat hinieden<br />
geliebt von uns allen, du schönes Tal,<br />
du unsere Heimat Ibental.<br />
von Friedrich Heizler
Unteribental<br />
61
Aus der Chronik<br />
von Unteribental<br />
Die Gemarkung von Unteribental (das Tal der Eiben) reicht<br />
bis auf die Höhen des Hochgerichtes (oberhalb des Lindenbergs)<br />
und schließt den Lindenberg mit Wallfahrtskirche,<br />
Gäste-, Tagungs- und Exerzitienhaus Maria Lindenberg<br />
einschließlich Pilgergaststätte mit ein. Das schmale Band der<br />
Talstraße, die steil von St. Peter herabführt und sich nach<br />
Buchenbach, Burg und Stegen verzweigt, umsäumen stattliche,<br />
jahrhundertealte Bauernhöfe, die seit altersher dem Bild<br />
des Dorfes und seiner politischen und wirtschaftlichen Struktur<br />
das Gepräge geben. Aus der Geschichte des Tales und seiner<br />
Geschlechter erzählen die markanten Namen seiner Höfe.<br />
Erste urkundliche Hinweise<br />
Erstes Licht in die Geschichte Unteribentals bringen die Gründung<br />
des Klosters St. Peter und die Schenkungen an das Gotteshaus.<br />
Es unterliegt aber keinem Zweifel, dass Unteribental<br />
bereits vor der im Jahre 1093 erfolgten Gründung St. Peters<br />
erschlossen und besiedelt war. Herzog Bertold III. von Zähringen<br />
schenkte nämlich um das Jahr 1113 an das Kloster einen<br />
Mansus (etwa 30 Morgen Feld) bei Ebnet und sechs Lehen<br />
(Grundstücke mit Gebäuden) im Ibental. Die lateinische Stelle<br />
lautet „iuxgta villam I w a“. Somit ist „Iwa“ die erste urkundliche<br />
Schreibweise für das Ibental.<br />
Die mächtigsten Fürsten in unserem Gebiet waren damals die<br />
Herzöge von Zähringen, die, von dem schwäbischen Herrschergeschlecht<br />
der Staufen vom Herzogtum Schwaben verdrängt,<br />
im deutschen Südwesten zielstrebig einen eigenen Staat aufbauten.<br />
Schwerpunkt ihrer Herrschaft war die von ihnen 1120<br />
gegründete Stadt Freiburg i. Br. Einen Zähringer Vorposten im<br />
Dreisamtal bildete Weiler (Stegen), denn Hitto von Weiler und<br />
seine Söhne Giselbert und Hiltebert gehörten zu jenen fünf<br />
Dienstmannen, die Herzog Bertold II. um das Jahr 1090 ausgesandt<br />
hatte, um für das Kloster St. Peter ein geeignetes Baugelände<br />
zu suchen. Sie werden später zusammen mit Reginhard<br />
und Reinhard von Weiler als besondere Vertrauensleute der<br />
Herzöge bei Verträgen und Grenzbeschreibungen als Zeugen<br />
aufgeführt.<br />
Gegenspieler der Zähringer im Dreisamtal waren die Grafen<br />
von Haigerloch, die auf der Burg Wiesneck saßen und 1118<br />
St. Märgen gegründet hatten. Im Zuge der Machtkämpfe ließen<br />
die Zähringer um 1120 die Burg Wiesneck für Jahrzehnte<br />
zerstören. Wenn die Ibentäler Bauern dabei nicht mithalfen, so<br />
waren sie doch staunende Zeugen dieses Kriegswerkes.<br />
Am Abhang der Kürnburg zwischen Breisgau und der Ortenau<br />
hatte das Kloster St. Peter ein bedeutendes Gut. Bei einer<br />
Klärung der Eigentumsverhältnisse am 6. Juli 1203 an Ort und<br />
Stelle in Anwesenheit des Abtes werden unter den neun<br />
Zeugen auch Konrad und Kuno von Ibental genannt, deren<br />
hervorragende Stellung somit hervorgehoben wird.<br />
Knapp zwei Jahrzehnte nach der Gründung St. Peters war in<br />
einer Grenzbeschreibung (Rotulus Sanpetrinus, eine 6,3m<br />
lange Pergamentrolle im Generallandesarchiv Karlsruhe) aus<br />
der Zeit um 1111, Unteribental eindeutig im Herrschaftsgebiet<br />
des Klosters eingeschlossen. Die westliche Grenze verlief von<br />
Wisenegge (Burg Wiesneck) zum Sconeberg und von dort nach<br />
Staffilegga über dem Steurental. Etwas ausführlicher ist die<br />
zweite Grenzliste aus der Zeit um 1200: Über den Zwerisberg<br />
zur Wiesneck, von dort mit einem weiten Sprung zur Staphelegge<br />
oder Wasenegge (Waseck) in Eschbach und hinauf auf<br />
den Flansen (Flaunser).<br />
Dass Unteribental vor der Gründung St. Peters besiedelt war,<br />
geht aus einem zusätzlichen Beweis hervor: Der oberste Hof in<br />
Oberibental, der Wolfsteigehof, gehörte bis ins 18. Jahrhundert<br />
zur Pfarrei Kirchzarten. Diese Tatsache kann nur so gedeutet<br />
werden, dass der Wolfsteigehof schon vor der Gründung von<br />
St. Peter bestand und deswegen zur älteren Pfarrei Kirchzarten<br />
gehörte.<br />
62
Mit dem Aussterben der Herzöge von Zähringen im Jahre<br />
1218 zerfiel ihr Staat, der sich vom Schwarzwald bis tief in die<br />
Schweiz und Burgund (Ostfrankreich) erstreckte. Ihre Erben<br />
waren in unserem Gebiet die Grafen von Urach, die nun Freiburg<br />
und die Vogtei über St. Peter erwarben. Seit jener Zeit<br />
ist Unteribental für immer der Herrschaft St. Peter entglitten.<br />
Die Gemeinde bleibt nun für sechs Jahrhunderte mit der Herrschaft<br />
Weiler in Stegen verbunden.<br />
Die weltliche Herrschaft<br />
Nach dem Aussterben der Zähringer Herzöge 1218 gehörte<br />
Unteribental Freiburger Ministerialien, die zum Stand des<br />
niederen Adels aufgestiegen waren und auf dem Schloss Weiler<br />
in Stegen saßen. Wie das Beispiel Weiler zeigt, wurde mit der<br />
Zeit der Begriff „Maieramt“ gleichbedeutend mit „Herrschaft“.<br />
Ursprünglich bezeichnet der Name „Maier“ einen herrschaftlichen<br />
Verwaltungsbeamten. Die „Maier von Weiler“ begegnen<br />
uns schon im 13. Jahrhundert unter den führenden Familien,<br />
1280 im Rat der Stadt Freiburg. Sie sind identisch mit den reichen<br />
Meierniesse. So tritt 1321 „Heinrich Meiger Niessen von<br />
Willer“ zusammen mit Graf Konrad von Freiburg als Schiedsrichter<br />
über verschiedene Adelige auf. 1442 wird Hans Ulrich<br />
Meier von Kaiser Friedrich IV. mit der Herrschaft Weiler belehnt.<br />
Als 1480 Hans Ulrich Meyer von Wyler als letzter seines<br />
Namens stirbt, heiratete die Witwe Junker Hans von Reischach,<br />
die 1486 vom Kaiser mit der Herrschaft belehnt wird.<br />
Als im Bauernkrieg der Schwarzwälder Haufen („Bauernheer“<br />
des Hans Müller von Bulgenbach) im Mai 1525 von Furtwangen<br />
über St. Peter ins Dreisamtal zog, schlossen sich ihm die Bauern<br />
des Dreisamtales an. Sie erstürmten die Burg Wiesneck, brannten<br />
sie nieder und eroberten die Stadt Freiburg. Doch wenige<br />
Wochen später mussten die Bauern kapitulieren. Ihre Forderungen<br />
nach einer sozialen und religiösen Neuordnung blieben<br />
unerfüllt. In der Brandschatzung für die Bauern heißt es:<br />
Under Yben und Stegen hat 28 Hüser von gmeynen Lütten.<br />
Die Reischach blieben Inhaber der Herrschaft Weiler, bis Kaiser<br />
Rudolf II. den bisherigen erzherzoglichen Sekretär Dr. Justinian<br />
Moser 1759 damit belehnte. Das Kloster St. Peter gab seine<br />
Ansprüche auf Unteribental nicht auf. Nachdem ein Rechtsstreit<br />
von 1560 bis 1591 zu ungunsten des Klosters entschieden wurde,<br />
sandte 1696 der Abt eine Bittschrift an den Kaiser Leopold,<br />
damit Weiler und Unteribental dem Kloster verliehen werden<br />
als Ersatz dafür, dass kaiserliche Soldaten 1678 das Kloster in<br />
Brand gesteckt hatten. Die Bittschrift hatte keinen Erfolg.<br />
Als Zeichen der weltlichen Gerichtsbarkeit stand einst auf der<br />
höchsten Anhöhe des Ibentals, auf dem Hochgericht (815m)<br />
über dem Lindenberg ein Galgen, hart an der Grenze nach<br />
St. Peter. Auch zwischen dem unteren Ibental und dem unteren<br />
Rechtenbach heißt der Bergrücken zum Nadelhof der Galgenbühl.<br />
Schließlich soll auch auf dem Sommerberg des Schneiderhofes<br />
ein Galgen gestanden haben. Trotz diesem Überangebot<br />
lässt sich urkundlich keine Hinrichtung nachweisen.<br />
Viel Elend und Not brachten Kriege und Seuchen. 1611/12<br />
wütete die Pest. Im Dreißigjährigen Krieg plünderten und<br />
mordeten schwedische, kaiserliche und französische Soldaten<br />
und zündeten Häuser an. Die Leute flüchteten in die Wälder.<br />
Von 1677 bis 1697 war Freiburg von den Franzosen besetzt.<br />
Um 1713 soll ein französischer Soldat auf dem Zähringerhof<br />
erstochen worden sein, weil er raubend ins Haus eingedrungen<br />
war und die Bäuerin bedroht habe. Im Jahre 1735 wird in der<br />
Hofübergabe des Thomashansenhofs auf die „gegenwärtig<br />
schlimmen Zeiten“ hingewiesen.<br />
Im Jahre 1700 wurden die aus dem Elsass stammenden Freiherren<br />
von Kageneck mit der Herrschaft Weiler belehnt. Seit 1771<br />
in den Grafenstand erhoben, spielte die Familie von Kageneck<br />
in Freiburg und im vorderösterreichischen Breisgau eine führende<br />
Rolle. Der Preßburger Friede 1805 setzte den überkommenen<br />
Verhältnissen ein jähes Ende, denn der Breisgau kam an<br />
das neugebildete Großherzogtum Baden.<br />
Zur Herrschaft Weiler gehörte außer Unteribental und Stegen<br />
auch Ober- und Unterbirken, der Nadelhof und der Wehrlehof<br />
mit dem unteren Rechtenbach. Das ganze Gebiet war nach<br />
Kirchzarten eingepfarrt; 1796 kam Unteribental zur neu errichteten<br />
Pfarrei Buchenbach<br />
63
eine Beschwerde der Ibentäler blieb ohne Erfolg. 1810 kam<br />
Ibental zum Bezirksamt St. Peter und 1820 zum Landamt<br />
Freiburg. Erst 1827 sind Unteribental und Stegen durch<br />
Ministerialerlass in zwei voneinander unabhängige Gemeinden<br />
getrennt worden.<br />
Die Geschichte der Vogteien<br />
Ibental und Stegen, beide zur Herrschaft Weiler gehörig, waren<br />
ursprünglich selbständige Vogteien (Gemeinden). Im Jahre<br />
1557 verordnete der Grundherr in Weiler, dass „der Vogt aus<br />
denen, die Gueter haben“, ernannt werden solle. Lange Zeit<br />
vertrat ein Vogt beide Gemeinden. Melchior Dilger (Melcherhof),<br />
seit 1702 als Bauer genannt, war von 1725 bis 1741 Vogt<br />
von Unteribental und Stegen. Bei der Amtsübernahme 1725<br />
war er in Gegenwart des Pfarrers und der sechs anderen Vögte<br />
in der Pfarrkirche zu Kirchzarten in den Vogtsstuhl im Chor der<br />
Kirche geführt worden. Andere Bauern versahen das Ehrenamt<br />
als „Richter“ (etwa Gemeinderat). Der Vogt hatte für die Einhaltung<br />
von Recht und Ordnung auf den 19 Höfen zu sorgen,<br />
zu welchen in der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts viele kleine<br />
Berghäuschen dazu kamen, Zeichen einer stark angewachsenen<br />
Bewohnerschaft. 7 der 9 Berghäuschen besaßen gar kein Land,<br />
höchstens einen Küchengarten, hatte man doch nur den Platz<br />
für das Haus aus dem Land der großen Höfe herausgeschnitten.<br />
Um die Wende zum 19. Jahrhundert war ein neuer Hof aus<br />
dem Berghäuschen des Pretschenhofs entstanden: der Eckpeterhof<br />
auf dem Lindenberg (Hof im Eck des Oberibentals). Zu<br />
den großen Höfen gehörte eine Scheuer, ein Schweinehaus, ein<br />
Waschhaus, oft noch mit einem Backofen ausgestattet, manchmal<br />
auch eine Mühle. Eine Kapelle rundete häufig diese quasi<br />
autarken Hofbezirke ab.<br />
Für Kriegs- und andere Lasten wurden Ibental und Stegen als<br />
eine gemeinsame Gemeinde veranlagt. Auch bei einer<br />
Neuregelung 1764 wurden beide Vogteien als eine Gemeinde<br />
behandelt, aber in einem Zeugnis von 1787 heißt es: „ehevor<br />
mit Stegen vereinbarte, nunmehr aber …für sich bestehende<br />
Gemeinde Ibental. Wohl wegen der Kriegslasten forderte<br />
Ibental 1804 die Trennung beider Gemeinden. Diesem Antrag<br />
hat die Regierung im folgenden Jahr entsprochen. Aber schon<br />
1806 wurde die Wiedervereinigung beider Gemeinden verfügt,<br />
Nach einer Statistik vom Jahre 1790, einer Art Bodenbenutzungserhebung,<br />
umfasste Unteribental 27 Eigentümer mit<br />
zusammen 2372 Juchert (1 Juchert = ca. 36 Ar), sind 85392 Ar<br />
oder 853,9 Hektar. Davon waren 449 Juchert Äcker und 1128<br />
Juchert Brand- und Weidfeld. Größter Hof war der Thomashansenhof<br />
mit 245 Juchert, gefolgt vom Mathislehof mit<br />
182 Juchert, beide Höfe haben eigene Jagd. Heute enthält die<br />
Gemarkung 834,18 Hektar mit 272 Flurstücken.<br />
(Quelle WebGIS Geodaten)<br />
Bäuerliche Rechtsverhältnisse<br />
Das Weistum (eine alte Aufzeichnung von Rechtsgewohnheiten)<br />
der Bauernschaft von Unteribental gibt die Nachricht, dass<br />
ihre Altvorderen ihre Lehen (Höfe) empfingen von der Herrschaft<br />
von Freiburg und dass die Herrschaftsrechte alsdann als<br />
rechtes Mannlehen an den Hof zu Weiler geliehen wurden. Die<br />
Unteribentäler waren nicht wenig stolz auf ihre unmittelbare<br />
Belehnung. Sie ließen sich von ihrer Obrigkeit mit „ir Herren“<br />
anreden und dieser Anrede entsprach die freie Stellung, die<br />
sie einnahmen. Vor allem waren sie darauf bedacht, dass dem<br />
benachbarten Kloster keinerlei Gerichtsbarkeit, sondern nur<br />
die gebührenden Abgaben zustanden. An den alten Zusammenhang<br />
mit dem oberen Tal erinnerte nur der gemeinsame<br />
wechselseitige Weidegang und die geringe Steuer, die sie für<br />
die Nutzung des Allmendwaldes nach St. Peter zahlten.<br />
Politischer Mittelpunkt für jedes Tal war der Dinghof, auf dem<br />
die Bauern zur Rechtssprechung zusammenkamen. Jeder musste<br />
bei Gefahr einer Geldbuße erscheinen. Mitte Februar war der<br />
wichtigste Dingtag. Dann wurde der Dingrodel (Weistum) verlesen,<br />
die Übertragung von Gütern vorgenommen und Streitigkeiten<br />
geschlichtet.<br />
Nach dem Weistum gab es ein Recht des straflosen Totschlags.<br />
Jeder Bauer konnte den Gemeindehirten erschlagen, wenn er<br />
ihn bei der Herde schlafend auf seinem Acker traf.<br />
64
Die Altersversorgung auf den Höfen<br />
Für die Längenausdehnung eines Lehens, das nur durch Berg<br />
und Wald eingeschränkt war, bestanden keine bestimmten Vorschriften.<br />
Es galt das Recht: „Wer zu Ywa bauen will, der soll<br />
zu seinem Hof ausfahren an die Straße, und wo er dann Gut in<br />
dem Tal hat, da soll er fahren auf das Lehen, darauf er bauen<br />
will …“ Danach gab es also ursprünglich einen festen Besitz<br />
nur an dem Talboden, im Übrigen galt ein ziemlich weites Besetzungsrecht.<br />
In engem Zusammenhang mit dem Erbrecht steht die Altersversorgung,<br />
die in Zeiten ohne ‚soziales Netz‘ die Bauern stark<br />
beschäftigte. Waren die wirtschaftlichen Verhältnisse des Hofes<br />
in Ordnung und der Hoferbe ein tüchtiger Mann, war auch das<br />
Leibgeding der Eltern gesichert.<br />
Musste der Hof an Fremde übergeben werden, tat man gut<br />
daran, einen Vertrag aufzusetzen. Einen solchen ließen 1786<br />
Bauern aus dem oberen Ibental aufsetzen, bevor sie in das<br />
halbe Berghäuschen auf dem Winterberg zogen. Genauestens<br />
wurde vertraglich festgehalten, was „er, Leibgedingmann mit<br />
Weib und mehreren Kindern“, zu beanspruchen hatte.<br />
Auch im Erbrecht wird die alte Rechts- und Wirtschaftsgemeinschaft<br />
mit St. Peter sichtbar: Stirbt ein Ehegatte, so ist jedem<br />
lebenden Kind sein Anteil zugefallen, wenn es will, und<br />
dem überlebenden Teil auch das seine. Die Erben haben volle<br />
Verfügungsfreiheit über ihre Erbportion, nur das Haus solle<br />
dem überlebenden Gatten bleiben, nach dessen Ableben aber<br />
ebenso wie anderes Gut, geteilt werden.<br />
„Jeglichem Kind ist sein Teil gefallen, wenn es will“ sagt das<br />
Weistum des Ibentals. Mit dieser Berechtigung war der Güterzersplitterung<br />
Tür und Tor geöffnet. „Wenn einem Lehenmann<br />
Not angeht, so mag er um seine Schulden zu bezahlen, sein<br />
liegend Gut angreifen, so weit, dass er selber nach dem Urteil<br />
seiner Nachbarn noch auf seinem Hof bleiben kann. Wird er<br />
aber von Alter und Siechtum schwach, so mag er alles verkaufen<br />
bis an das Haus; wenn er an dies kommt, so mag er die<br />
Wände um und um verkaufen und erst wenn er an die sechste<br />
Säule kommt, so soll er zu dem Herrn sprechen: ‚Geht her und<br />
nehmt den Dritteil und lasst mir die zwei Teile, denn ich vermag<br />
nicht mehr zu bleiben.‘ Und das soll ihm niemand wehren.“<br />
Trotz diesem offensichtlichen Zerschlagen der Güter enthält das<br />
Weistum von Unteribental auch erste Ansätze für das bis in die<br />
jüngste Zeit geltende Minorat (Erbrecht des jüngsten Sohnes)<br />
und für die noch heute geltende Unteilbarkeit der geschlossenen<br />
Hofgüter.<br />
66<br />
Wovon lebte nun eine solche kinderreiche Familie? Zwei Kühe<br />
standen im Stall, dazu ein Schwein und zwei Hühner. Mit<br />
einem Schlachtfest vor Weihnachten war also nicht zu rechnen.<br />
Ganz ohne Wurst und Speck wollte man aber nicht sein: Jährlich<br />
waren 40 Pfund geräucherter Speck, ein „Hammerstrumpf“<br />
(ein Schinken) und von jeder Wurstsorte eine für die Leibgedinger<br />
fällig. Sollte eine Kuh eingehen, musste der Hofbauer<br />
täglich ein Maß Milch, ca. 1,5 Liter liefern. Die Matten für das<br />
Viehfutter waren vom Bauern unentgeltlich zu mähen, einen<br />
Kuhstall, ein Milchhaus und einen Schweinestall hatte ebenfalls<br />
der Bauer einzurichten. Zum Kochen und Heizen wurden<br />
vier Klafter Tannenholz und drei Buchenholz benötigt, für die<br />
ebenfalls der jetzt auf dem Hof sitzende Bauer zu sorgen hatte.<br />
Ein Krautgarten und ein Stück Rübenfeld ergänzten den Speisezettel<br />
mit Gemüse. Das notwendige Getreide hatte wiederum<br />
der Bauer zu liefern: 10 Sester Winter- und 24 Sommerfrucht,<br />
34 Sester Mischlete (meist Hafer und Hülsenfrüchte gemischt)<br />
sowie 22 Sester Hafer und 1 Sester Hafermehl, insgesamt 90<br />
Sester. Die benötigten zehn Sester Erdäpfel (Kartoffeln) wollten<br />
die Leibgedinger selbst setzen, natürlich in das vom Bauern<br />
„gebesserte“ (gedüngte) Feld. Drei Kirschbäume und ein Apfelbaum<br />
würden ihnen ebenfalls zustehen, dazu „alljährlich das<br />
nöthige Kornstroh in die Better und die Helmen in die Säck“,<br />
vier Pfund Schafwolle zum Verspinnen usw. Was für einen Wert<br />
musste ein großer Hof haben, welchen Status ein Hofbauer,<br />
wenn die ihn notgedrungen Abgebenden so viele Forderungen<br />
stellen konnten!
Dieser Vertrag verschafft uns nebenbei einen Einblick in die<br />
Essgewohnheiten der Ibentäler: Morgens ein Hafermus oder<br />
eine Brotsuppe, zum Vesper Brot, selten Speck dazu, denn<br />
bei 40 Pfund pro Jahr blieben nur 50 g pro Tag, mittags süßes<br />
Kraut (frisches Weißkraut), Sauerkraut oder ein anderes Gemüse<br />
mit Kartoffeln, häufig mit Butter „abgeschmälzte* Mehlspeisen<br />
wie Mehlnocken, Nudeln oder Knöpfli dazu Dörrobst<br />
oder „Epfelbabbe“ (Apfelmus). Um vier Uhr Brot und Milch<br />
oder Apfelmost, abends wieder Suppe mit grobem Brot. Nur an<br />
hohen Festtagen kamen Schinken und Würste auf den Tisch.<br />
Steuern und Abgaben<br />
Der sagenumwobene Birkjörglehof in der Talmitte war der<br />
frühere Fronhof, auf dem die Naturalabgaben (Hafer, Korn und<br />
anderes) der übrigen Höfe angeliefert und gesammelt wurden.<br />
Zuvor scheint der Gallihof als Ding- oder Maierhof der politische<br />
und wirtschaftliche Mittelpunkt gewesen zu sein, dessen<br />
Inhaber eine leitende Stellung einnahm. Auf dem Ding- oder<br />
Maierhof mussten die Bauern ihre Abgaben abliefern und auf<br />
ihm kamen sie jährlich mindestens zwei Mal zu Gerichtsversammlungen<br />
zusammen.<br />
Vom untersten bis zum obersten Hof umfasste Unteribental<br />
früher 19 Bauernhöfe mit insgesamt 44 ½ Lehen. Die gewichtigsten<br />
Abgaben bezog naturgemäß die Herrschaft Weiler.<br />
Sie bestanden in der Bezahlung des jährlichen Boden- oder<br />
Lehenzinses, eine Art Grundsteuer, in Naturalleistungen, in<br />
Frondiensten, auch in Bußen und Geldstrafen und in der<br />
Entrichtung des Besthauptes im Stall bei Tod des Bauern. Da<br />
dem Grundherrn nach dem Tod des Bauern eine Arbeitskraft<br />
verloren ging, wurde den Hinterbliebenen das beste Stück<br />
Vieh aus dem Stall geholt. Eine unregelmäßige, aber auf den<br />
bäuerlichen Besitz besonders hart drückende Verpflichtung war<br />
die sogenannte Dritt-Teiligkeit, das heißt bei Tod des Bauern<br />
oder bei Veräußerung des Hofes musste eine Abgabe im Werte<br />
eines Drittels vom Grundeigentum an die Grundherrschaft entrichtet<br />
werden. Diese oft umstrittene Belastung bestand sogar<br />
bis ins 19. Jahrhundert. Erst im Jahre 1867 wurde der „Lehensverband“<br />
der Ibentäler Höfe mit der Grundherrschaft durch<br />
einen großherzoglichen Erlass aufgelöst. Der Zehnten, eine<br />
Art Kirchensteuer, musste an die Pfarrei Kirchzarten geleistet<br />
werden. Geringer waren die Abgaben nach St. Peter, mit dem<br />
Unteribental durch den Allmendwald verbunden blieb. Die<br />
Bauern zahlten zum Beispiel auf Martini 1571 10 Pfund Steuer<br />
und 6 Schilling Holzgeld, auf Martini 1702 an Steuer zusammen<br />
19 Gulden und 10 Batzen. Zudem lieferten sie um 1600 – 1702<br />
jährlich zu Weihnachten und Fasnacht je ein Huhn, also jährlich<br />
36 Hühner und zusammen 51 Eier. Der Vogt zog die Abgaben<br />
ein und brachte sie gegen eine kleine Vergütung ins Kloster.<br />
Obwohl Unteribental stets 19 Höfe umfasste, hieß der Allmendwald<br />
im Obertal auf der Gemarkung St. Peter der 18-Bauernwald,<br />
denn der Leistmacherhof hatte keinen Anteil an der<br />
Allmend („was allen gemein ist“). Nach der Klosteraufhebung<br />
1806 mussten sich die Unteribentäler arg wehren, bis ihnen<br />
der Staat den Allmendwald als Eigentum abtrat. Im Jahre 1838<br />
erfolgte die Aufteilung des 50 Juchert großen Waldes, wobei<br />
jeder der 18 Teilhaber etwa 2 ½ Juchert Waldgelände erhielt.<br />
Heute sind von den einstigen Teilhabern nur noch sechs Ausmärker<br />
übriggeblieben.<br />
Der drittunterste Hof, der Leistmacherhof, hatte wie schon<br />
erwähnt, keinen Anteil an der Allmend und war deswegen<br />
steuerfrei. Ein Zinsrodel (Lagerbuch, Dokument über Rechtsverhältnisse)<br />
aus der Zeit um 1550 berichtet von diesem Hof: „Gibt<br />
keine Stür, gibt aber der Herrschaft von Freiburg einen Krom<br />
dafür“. Dazu bemerkt um 1600 der Klostersekretär Strobel:<br />
„Dieser Krom ist ein ledern Tesch mit gewüssen Thaten und<br />
Spangen darob, darin gehört, wenn man sie jährlich liefert, ein<br />
abgebrochen messerlin und ain roter nestel. Und empfangen<br />
sollichen Krom die Grafen von Fürstenberg“. Und eine spätere<br />
Hand fügt hinzu: „Obiger Krom wird annoch jährlich einem<br />
Obervogt zu Neustadt als Fürstenbergischen Beamten geliefert“.<br />
Offensichtlich ging es um die symbolhafte Anerkennung<br />
einer Schuldhaftigkeit, deren Hintergründe nicht mehr sichtbar<br />
sind.<br />
67
Übersicht der Höfe (von oben nach unten)<br />
Bevölkerungsstatistik von 1815<br />
Von den ca. 300 Einwohnern waren 65 Steuerzahler (im<br />
20. Jahrhundert „Haushaltungsvorstände“ genannt). Diese Zahl<br />
hat sich bis 1968, als die ersten neuen Bürger an den Hofacker<br />
zogen, kaum verändert. Unter den Steuerzahlern gab es<br />
17 wohlhabende Bauern, 3 ebenfalls betuchte Bauern-Witwen,<br />
6 Liebdinger (Leibgedinger), 19 Tagelöhner, davon 6 „notorisch<br />
arm“, 11 Spinnerinnen, der Hirschenwirt Pfister, 1 Schmied<br />
und 1 Weber, der Vogt Andreas Heizler und Lehrer Joseph<br />
Heizler (er füllte die Bürgerlisten aus), 4 wurden unter „Sonstige“<br />
aufgeführt. Die vielen Söhne, Töchter, Besitzlosen ohne<br />
Hof zählten nicht zu den regulären Bürgern, sie bezahlten<br />
der Herrschaft in Weiler auch keine Grund- und Haussteuer.<br />
Von alten Geschlechtern<br />
Alte Bauernhöfe sind naturgemäß auch Heimstätten alter<br />
Bauerngeschlechter. Seit mindestens dem Jahre 1502 sitzt die<br />
Familie Maier (früher: Mayer) in ununterbrochener Generationenfolge<br />
auf dem Gallihof. Im gleichen ältesten Höfe- und Bauernverzeichnis,<br />
vom Kloster St. Peter um 1502 angelegt, finden<br />
wir neben zwei Bauern Mayer, auch die Familiennamen Heizler<br />
(früher: Heitzler, Heintzler) und Steinhart, die heute noch im<br />
Ibental beheimatet sind. Die Schlegel sind seit 1557 im Ibental<br />
nachweisbar und von etwa 1600 an bis heute auf dem Schlegelhansenhof<br />
ansässig. Seit 1604 besaß die Familie Eckmann<br />
den Jägerhof, bis sie 1751 von der Familie Heizler abgelöst<br />
wurde. Seit über 300 Jahren ist der Mathislehof im Eigentum<br />
der Familie Andris. Die früheren Familien Wick, Hauri, Zähringer,<br />
Schwarz (Schwärzle) und Pretsch leben in Hofnamen weiter.<br />
Zu den im Ibental ausgestorbenen Geschlechtern zählen auch<br />
die Kienzler, denen von 1750 bis 1902 der Dreherhof gehörte.<br />
Aus der Zeit vor 1800 ist ferner zu erwähnen, dass die Familie<br />
Saum seit 1756 auf dem Eckhof, die Familie Molz seit 1792<br />
auf dem Schwärzlehof und die Familie Willmann seit 1793 auf<br />
dem Zähringerhof sitzt.<br />
• Eckpeterhof (Saum)<br />
• Wolfsteigehof (beide gehören inzwischen zu St. Peter)<br />
• Pretschenhof (verfallen)<br />
• Mathislehof (Andris)<br />
• Thomashansenhof (Blattmann)<br />
• Gallihof (Maier)<br />
• Schlegelhansenhof (Schlegel)<br />
• Schwärzlehof (Molz)<br />
• Melcherhof (v. Marschall, Pächter Herr)<br />
• Jägerhof (Heizler)<br />
• Schneiderhof (Willmann)<br />
• Birkjörglehof (Dold)<br />
• Maxenhof oder Saiergut (Schlegel)<br />
• Schlegelhof (Benz)<br />
• Kleinbauernhof (Dold, bis 1964)<br />
• Weberdobelhof (Danzeisen, jetzt Frank nicht OV)<br />
• Dreherhof (Schlegel)<br />
• Zähringerhof (Willmann)<br />
• Peterhof, 1635 – 1670 eine Talwirtschaft mit einer Matte,<br />
die „Tanzplatz“ heißt (Steinhart)<br />
• Hansjörgenhof 1856 – 1862 eine Wirtschaft (Ketterer)<br />
• Leistmacherhof (Helmle, 1911 auf der Winterseite abgebrannt<br />
und dann auf der Sommerseite neu aufgebaut worden)<br />
• Haurihof (Saier)<br />
• Schmiedeweberhof (Willmann)<br />
• Wickenhof (Eckmann, bis 1970)<br />
68
Blick um 1966 vom Untertal Richtung Lindenberg mit<br />
dem damals noch existierenden Kleinbauernhof von Leo Dold.<br />
Später entstand dort das Baugebiet „Hofacker“,<br />
69
Viele Kinder, hohe Sterblichkeit, Heirat mit Genehmigung<br />
Je größer der Landbesitz eines Bauern war, je mehr Kinder hatte<br />
er. 8 – 12 oder sogar 18 Kinder (aus 2 Ehen) waren durchaus<br />
normal. In das Kopfkissen von Schwangeren wurden geweihte<br />
Kräuter eingenäht um vielleicht die Geburt zu erleichtern.<br />
Das Kind wurde dann entweder vom Storch gebracht, von der<br />
Hebamme „vom Wi:b mit seim Korb“ oder „vom Bach/Wasser<br />
daher g’flößt“. Als Mittel gegen die gefürchteten Gichter<br />
(Krampfanfälle, hohes Fieber), die häufig zum Tod des Neugeborenen<br />
führten, wurden geweihte Gegenstände, wie kleine<br />
Muttgergottesstatuen in das Bettchen eingenäht. Ins erste<br />
Kindsbad kam Weihwasser und geweihtes Salz, manchmal ein<br />
Rosenkranz, geweihtes Wachs oder ein Geldstück. Den Kindern<br />
drückte man gerne eine Schreibfeder oder einen Griffel ins<br />
Händchen, damit sie später in der Schule erfolgreich waren.<br />
Da die Bäuerinnen während der Schwangerschaft bis zur letzten<br />
Minute vor der Geburt schwere Arbeit verrichten mussten,<br />
gab es viele Fehlgeburten. Das wiederum bedeutet, dass eine<br />
Bäuerin fast durchgehend schwanger war und das ohne einen<br />
Tag Mutterschutz oder Erziehungsurlaub. Lediglich nach der<br />
Geburt wurde eine Mutter ca. 6 Wochen lang geschont und<br />
galt als „Kindbetterin“. Daher kommt der Begriff „Kindbettwecken“,<br />
den man beim Besuch einer Wöchnerin zur Stärkung<br />
vorbeibrachte. Der erste Ausgang führte die Mutter in die Kirche,<br />
wo sie vom Pfarrer ausgesegnet wurde. Nach der Schonfrist<br />
dauerte die Stillzeit nicht allzu lange, weil die Milch durch<br />
die harte Arbeit der Bäuerin bald ausblieb. Die Kindersterblichkeit<br />
war dementsprechend hoch. Ein Drittel der Säuglinge starb<br />
im 1. Lebensjahr, die Hälfte der Kinder erlebten oft nicht den<br />
10. Geburtstag. Deshalb wurden die Kinder entweder am Tag<br />
der Geburt oder 1 Tag danach getauft. Noch Ende des 19. Jahrhunderts<br />
läutete die Glocke bei der Taufe nur für eheliche Kinder.<br />
Die Sterblichkeitsrate bei unehelichen Kindern war deutlich<br />
höher, hatten sie doch meist einen schlechten Start, weil sie in<br />
ärmliche Verhältnisse geboren wurden. Sie waren oft Kinder<br />
von Tagelöhnern, die ohne Haus, Hof und Vermögen nicht<br />
heiraten konnten. Es waren Bauernsöhne, die nicht Hoferben<br />
waren und kein Land besaßen. Oft arbeiteten sie auf dem Hof<br />
von Verwandten oder waren als Handwerker tätig. Man konnte<br />
aber zum Hofbauern aufsteigen, wenn sich eine Witwe wieder<br />
verheiraten wollte, weil sie einen Vater für ihre Kinder und<br />
eine Arbeitskraft für ihren Hof brauchte. Oft verheiratete man<br />
sich innerhalb eines Tales, was aber zu verwandtschaftlichen<br />
Ehen führte. Man musste deshalb bei der Kirchenbehörde um<br />
Heiratserlaubnis (Dispens) nachsuchen.<br />
Ein Beispiel aus jener Zeit um 1760:<br />
Lorenz Schwarz vom Schwerzlelenzenhof (heute Schwärzlehof)<br />
stellte einen solchen Antrag, als er Agatha Schlegel ehelichen<br />
wollte, die die Großnichte seiner verstorbenen Ehefrau Maria<br />
Zipfel war. Am Tag der Hochzeit, das heiratswillige Paar war<br />
bereits 3 Mal von der Kanzel verkündet worden, stellte sich<br />
heraus, dass die beiden miteinander verwandt waren. Trauung<br />
und Hochzeitsessen mussten abgesagt werden, im ganzen<br />
Tal wurde gemunkelt, es entstand „ein großes Ärgernis“.<br />
Lorenz Schwarz, als langjähriger Vogt sicher eine Persönlichkeit,<br />
wehrte sich: „Seine Braut sei schon 40 Jahre alt, es bestehe<br />
also keine Aussicht, dass sie Kinder bekomme. Allein mit seinen<br />
Kindern könne er das große Bauerngut und die Wirtschaft nicht<br />
umtreiben und aufgeben wolle er seinen Besitz im Wert von<br />
6000 Gulden auch nicht. Außerdem wolle er mit seinen 70<br />
Jahren auch keine junge Person mehr heiraten, sondern eine<br />
bestandene“. Im ganzen Tal sei aber keine mehr wie die Schlegelin,<br />
höchstens eine, mit der er aber noch näher verwandt sei.<br />
Der Oberkirchenrat verweigerte dennoch die Zustimmung und<br />
die Ehe kam nicht zustande. Lorenz Schwarz grämte sich aber<br />
nicht lange, denn 1 Monat später heiratete er Katherina Walter<br />
aus Stegen. Vernunftgründe waren oft maßgebend für eine<br />
Eheschließung , die wirtschaftliche Notwendigkeit diktierte die<br />
Partnerwahl, weniger Liebe und Zuneigung.<br />
70
Hochzeitsbräuche<br />
Bis in die 50er-Jahre war beim Abholen der Braut am Hochzeitsmorgen<br />
ein alter Brauch, dass der Hochzeiter alle mit<br />
Handschlag begrüßte und den Brautstrauß überreichte. Er<br />
bedankte sich bei den Schwiegereltern mit viel Respekt und<br />
in aller Förmlichkeit für seine zukünftige Frau, danach wurde<br />
ein gemeinsames Gebet gesprochen, an dessen Ende der Vater<br />
seinen Segen gab und die Mutter das junge Paar mit Weihwasser<br />
besprengte.<br />
Der Bursche schenkte seinem Schatz als erstes Geschenk einen<br />
Rosenkranz und einen Wachsstock (dünne, aufgerollte Kerze,<br />
die beim Beten abgebrannt wird), wofür sie sich mit Zigarren<br />
und einem passenden Etui revanchierte. Wollte ein Mädchen<br />
nach auswärts heiraten - natürlich mit Genehmigung seiner Eltern<br />
- so fand zunächst eine „Beschau“ statt, d.h. das Mädchen<br />
stattete auf dem Hof, auf den es heiraten will, einen Besuch<br />
ab. Ist dieser gut ausgefallen, so fand bald die Hochzeit statt.<br />
Dazu wird ein „Ho:sdigla:der“ (Hochzeitslader) bestellt, der fein<br />
herausgeputzt von Haus zu Haus geht und alle Verwandten<br />
und Bekannten zur Hochzeitsfeier einlädt. Als Dankeschön wird<br />
er bei der Feier dann freigehalten, die Eingeladenen jedoch<br />
nicht. Diese haben alles, was sie essen und trinken, selbst zu<br />
bezahlen!<br />
Am Hochzeitsmorgen (früher nur Dienstag oder Donnerstag),<br />
begann man mit der sogenannten „Morgesuppe“ (Bratwurst,<br />
Wein, Brot, Hefezopf, Kaffee) im Wirtshaus und begab sich<br />
dann um halb 10 Uhr in die Kirche. Nach der Messe ging das<br />
Tafeln im Gasthaus weiter. Noch nach dem Zweiten Weltkrieg<br />
wurde die Hochzeiterin ermahnt, nur bei zunehmendem Mond<br />
zu heiraten und während der Traumesse möglichst nah neben<br />
ihrem Hochzeiter zu knien. Es soll auch ja kein Spalt zwischen<br />
den beiden entstehen, damit sie möglichst lang miteinander<br />
leben dürfen. Brennen beim Traugottesdienst während der<br />
Wandlung die Kerzen auf dem Altar nur matt, so bedeutet das<br />
Unglück in der Ehe. Flackert eine Flamme, so muss der auf der<br />
entsprechenden Seite befindliche Partner bald sterben. Nach<br />
der Messe überreichten die Brautleute dem Pfarrer außer einem<br />
weißen Taschentuch noch ein Kränzchen und luden ihn zum<br />
Hochzeitsessen ein.<br />
Von ein oder zwei jungen Frauen – oft auch von der Hochzeitsnäherin<br />
– bekommen alle Gäste „de‘ Ho:sdigmaie“ ans Festtagsgewand<br />
geheftet, und zwar diejenigen, die „recht“ (den<br />
ganzen Tag) bei der Hochzeit sind, ein weißes Sträußchen und<br />
der „Zuëlauf* ein farbiges (blau, rosarot).<br />
Für das Sträußchen gab man vor 100 Jahren zwischen 10 und<br />
50 Pfennig, später ein oder zwei Mark. Sobald alle im Gasthaus<br />
waren, erhielten Hochzeiter, Ehrengesell und Brautführer Ehrentänze<br />
mit der Braut. Um 12 Uhr wurde dann das Brautpaar<br />
von der Musikkapelle „nach Hause gespielt“, d.h. sie wurden<br />
musikalisch aus dem Gasthaus begleitet und von der Hochzeitskutsche<br />
oder Auto nach Hause gefahren. Im Gasthaus feierte<br />
die Hochzeitsgesellschaft noch oft bis zum frühen Morgen.<br />
Beim Heimgehen sollte die Hochzeiterin darauf achten, als erste<br />
den Fuß ins Haus zu setzen, weil sie dann im Haus das Sagen<br />
haben wird. Bis lange Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg wurde<br />
oft am Sonntag nach der Hochzeit ein „Nu:ho:sdig“ (Nachhochzeit)<br />
mit Musik und Tanz gefeiert. Pfarrer Schellhammer<br />
aus Buchenbach verurteilte 1881 diese Sitte: „Tanzlustbarkeiten<br />
kommen bei Hochzeiten vor und wird gewöhnlich am Sonntag<br />
nach der Hochzeit nochmals getanzt, welches ein schreiendes<br />
Unheil ist und mir schon vielen Kummer bereitet hat.“ Dieser<br />
Tag wird auch „Zahltag“ genannt, wohl auch deshalb,<br />
weil alle „rechten“ Gäste freigehalten wurden. Noch in den<br />
Sechzigerjahren notierte der „Ho:sdigschri:ber“ während der<br />
Hochzeitsfeier feinsäuberlich, wer wieviel zu bezahlen hatte.<br />
1957 machte die Rechnung für alles, was eine Person von der<br />
Morgensuppe bis in die späte Nacht hinein verzehrte, ganze<br />
zwölf Mark! Die Musikanten wurden übrigens immer vom<br />
Wirt freigehalten. Sie hatten auch kleine Einnahmen durch die<br />
„Tanzbändel*, die alle Gäste auf dem Tanzboden für 50 Pfennig<br />
kaufen und anstecken mussten.<br />
Manches Hochzeitspaar zog es vor, „kei‘ recht Ho:sdig* zu<br />
feiern. In solchen Fällen begab man sich, nur von den allernächsten<br />
Bekannten oder Verwandten begleitet, oft ins Kloster<br />
Birnau oder nach Einsiedeln, um sich dort in aller Stille trauen<br />
zu lassen.<br />
71
Gleichgültig, ob man ein kleines oder ein großes Hochzeitsfest<br />
beging, es wurde fast immer „vorg‘spanne“. Dieser Brauch ist<br />
leider nach der Jahrtausendwende eingeschlafen. Heiratete ein<br />
Einheimischer eine Auswärtige oder umgekehrt, so versperrten<br />
die ledigen Burschen (wenn eine Frau heiratet) oder Mädchen<br />
(wenn ein Mann heiratet) am Hochzeitsmorgen mit einem<br />
gebundenen Kranz die Straße, um die „Entführung* aus dem<br />
Heimatort zu verhindern. Man ließ das junge Paar erst dann<br />
passieren, wenn es einen angemessenen Betrag bezahlt hatte.<br />
Als Dankeschön wurde der Hauseingang zur neuen Wohnung<br />
oder bei Wegzug derjenige zur elterlichen Wohnung festlich<br />
mit einem Tannenreisig-Kranz und Papier-Blumen geziert.<br />
Heirateten zwei Einheimische, wurde die Haustür ohne Bedingung,<br />
rein aus Sympathie geschmückt. Interessanterweise<br />
hat sich auch der Wortlaut der Rede der Vorspanner über 100<br />
Jahre kaum verändert, während der beidseitig mit Schinken<br />
und Speckseiten behangene Hochzeitswagen des vorletzten<br />
Jahrhunderts schon lange dem geschmückten Hochzeitsauto<br />
gewichen war.<br />
Bräuche bei Krankheit und Tod<br />
1857 beschreibt Pfarrer Franz von Buchenbach, wie er von<br />
Pfarrangehörigen zu Schwerkranken abgeholt wurde, um sie<br />
mit den heiligen Sakramenten zu versehen. Dies geschah immer<br />
„im schwarzen Überrock mit umhängender Stola zu Pferd, das<br />
die Parochiane (Pfarrangehörigen) selbst bringen“. Jedermann<br />
wusste, was dieser Zug, dem ein Mann mit Laterne und Glocke<br />
vorausging, zu bedeuten hatte. Später wurden die Pfarrer in<br />
der „Chaise“ (Pferdekutsche) abgeholt oder gingen auch zu<br />
Fuß. Wenn so „de Herr ins Dal kumme isch“, riefen die Bäuerinnen<br />
alle Anwesenden zusammen und nahmen kniend vor<br />
dem Haus Platz, um vom Pfarrer den Segen zu erhalten. Noch<br />
in den 60er-Jahren konnte man vereinzelt beobachten, wie der<br />
auf dem Fahrrad vorbeifahrende Pfarrer am Straßenrand oder<br />
auf dem nahen Feld niederkniende Gläubige segnete. Mit dem<br />
Einzug des Autos verschwand diese Gepflogenheit endgültig. In<br />
der Zufahrt zum Haus, in dem ein Kranker mit den hl. Sterbesakramenten<br />
versehen werden sollte, bildeten die Hausangehörigen<br />
kniend ein Spalier für den das Allerheiligste tragenden<br />
Priester. Die Kinder wurden „hinter’s Hu:s oder hinter d’Schi:re<br />
(Scheune) g’schickt“ um nicht zu stören. In jedem Haushalt<br />
war eine Versehgarnitur vorhanden: Kreuz, Kerzen und Weihwasserschale<br />
wurden auf einem Versehtisch bereitgestellt. Der<br />
Sterbende wurde mit Gebeten begleitet, bis er starb. Der Sarg<br />
wurde mit einer brennenden Kräuterpalme ausgeräuchert bevor<br />
man den Verstorbenen im Sonntagsgewand darin aufbahrte.<br />
Während der Totenwache wurde der Rosenkranz gebetet und<br />
Verwandte, Nachbarn und Freunde kamen vorbei, um Abschied<br />
zu nehmen. Die Angehörigen bedankten sich im Namen des<br />
Toten und luden zu einem Vesper ein. Meist, spätestens nach<br />
drei Tagen, fand die Beerdigung statt, weil vor allem im Sommer<br />
die notwendige Kühlung fehlte. Mit dem Bau der Friedhofskapelle<br />
in Buchenbach in den 70-er Jahren verschwanden<br />
diese Hausbesuche fast vollständig, denn die Verstorbenen<br />
wurden dort aufgebahrt und mittlerweile bieten auch die Bestatter<br />
schöne Räumlichkeiten zum Abschied nehmen. Während<br />
es früher ausnahmslos nur Erdbestattungen gab, erleben<br />
wir einen Trend zu Urnenbeisetzungen in Erdgräbern, Stelen,<br />
anonym und sehr beliebt sind Friedwälder, wie z.B. am Stollenbach<br />
bei Oberried.<br />
72
Der Brauch vom Scheibenschlagen<br />
Nicht aus christlicher Überlieferung, sondern aus heidnischen<br />
Wurzeln ist das Scheibenschlagen um die Zeit der Tagundnachtgleiche,<br />
am Sonntag nach Fastnacht, hervorgegangen.<br />
Es wurde später quasi christianisiert, denn es wird bis heute<br />
vor dem Entzünden des großen Scheibenhaufens (Reisighaufen)<br />
von den „Schi:bebuäbe“ das Glaubensbekenntnis und<br />
der „Engel des Herrn“ gebetet. Dann läutet im Tal die Glocke<br />
der Peterhof-Kapelle, während der Scheibenhaufen „un d’Hex“<br />
(Strohpuppe) mit Fackeln entzündet werden. Mit dem Spruch<br />
vom „Schi:bevadder“: „Schi:b, Schi:b i:ber d‘Rhi:, wem soll diä<br />
Schi:be si? Diä Schi:be soll d‘heilige Dreifaltigkeit si:“ beginnt<br />
dann das eigentliche Scheibenschlagen, bei dem für alle Bürger<br />
des Ibentals glühende Holzscheiben ins Tal geschlagen werden.<br />
Neben guten Wünschen für die Familien werden die geschlagenen<br />
Scheiben auch von lustigen Begebenheiten begleitet. So<br />
mancher wird dabei aufs Korn genommen, was früher manchmal<br />
zu Ärgernis führte, heute steht man drüber. Anschließend<br />
ziehen die Scheibenbuben bis tief in die Nacht singend von<br />
Haus zu Haus, tragen den „Schi:bespruch“ vor und bitten um<br />
eine Spende (Geld oder Naturalien). Was sie am Samstag nicht<br />
schaffen, wird am Sonntag nachgeholt.<br />
73
1. und 2. Weltkrieg bis heute<br />
1915 wurde die gesamte landwirtschaftliche Produktion unter<br />
staatliche Kontrolle gestellt und 1916 steuerte das neue Kriegsernährungsamt<br />
die Versorgung mit Lebensmitteln. Es wurde alles<br />
zugeteilt, reglementiert und Bezugsscheine eingeführt. Die<br />
Höfe mussten mehr abliefern, als ihnen zugeteilt wurde. 1918<br />
wurde Fleisch so knapp, dass im Hirschen und bei den Privatleuten<br />
„fleischlose Wochen“ eingelegt wurden. Für Fleischkarten<br />
wurde als Ersatz Mehl und Grieß ausgegeben. Angesichts<br />
dieser ständigen Lebensmittelknappheit wurde der Markt mit<br />
minderwertigen Ersatzstoffen überschwemmt. Für die Finanzierung<br />
des Krieges wurden Haushaltsmittel aufgewendet und<br />
Privathaushalte wurden zur Abgabe von Metallgegenständen<br />
verpflichtet. 1915 begann die Einziehung aller Fünfundzwanzig-<br />
Pfennig-Münzen, 2 Wochen später Koch- und Backgeschirr aus<br />
Kupfer, Messing und Nickel, aber auch Stanniolpapier, Blechspielzeug,<br />
Milchkannen, Brenngeschirr und Glocken. Zur Unterstützung<br />
in der Landwirtschaft wurden Unteribental 15, später<br />
20 Kriegsgefangene (meist Russen) zugeteilt. Für sie wurde im<br />
abgebrannten Speichergebäude vom Leistmacherhof ein Lager<br />
eingerichtet, welches von 4 Zivilisten der Gemeinde bewacht<br />
wurde. Sie erhielten 30 Pfennig je Arbeitstag, in der Erntezeit<br />
tgl. 20 Pfennig Zulage in Form von Scheckmarken, einzulösen<br />
in bestimmten Geschäften.<br />
Die Heeresleitung wollte verhindern, dass die Gefangenen<br />
mittels Bargeld einen Fluchtversuch unternehmen könnten. Die<br />
Vorschriften sahen für die Gefangenen 3 warme Mahlzeiten<br />
tgl. vor, überwiegend aus Kartoffeln, 3 x in der Woche Fleisch,<br />
1 x Fisch, außerdem viel Gemüse und Hülsenfrüchte. Sie durften<br />
keine Zivilkleidung tragen, das Rauchen in Scheunen und<br />
Ställen, sowie das Betreten von Wirtschaften war verboten. Sie<br />
hatten grundsätzlich Alkoholverbot, doch betraf dies nicht den<br />
Hausmost der Bauern. Eine Bekanntmachung des Bürgermeisters<br />
lautete wie folgt: „Es wird darauf aufmerksam gemacht,<br />
dass jeder, nicht durch die Arbeit bedingte, Verkehr, besonders<br />
an Sonn- und Feiertagen, d.h. wenn nicht gearbeitet wird, von<br />
Seiten der Bevölkerung mit den z.Zt. hier beschäftigten Kriegsgefangenen<br />
strengstens verboten ist. Ebenfalls ist ein herandrängen<br />
an die Gefangenen, namentlich der Kinder, sowie ein<br />
beschenken derselben durch Zigarren u.a. andere Gegenstände<br />
unzulässig. Ferner ist verboten das verabreichen von alkoholischen<br />
Getränken. Denjenigen Landwirten, die gegen diese<br />
Vorschriften zuwiderhandeln, werden die ihnen zugewiesenen<br />
Gefangenen sofort entzogen.“<br />
Die Behörden beanstandeten immer wieder eine zu geringe<br />
Distanz gegenüber den Ausländern, wie z.B. Fluchthelfer,<br />
Töchter von Arbeitgebern unterhielten „Liebeleien“, Gefangene<br />
übernachteten auf den Höfen. Landkarten durften nicht<br />
in deren Hände gelangen und brauchbare Männerkleidung<br />
durfte nicht für Vogelscheuchen verwendet werden. Nach dem<br />
Waffenstillstand blieben die Russen noch ca. 2 Jahre, bis wieder<br />
deutsche Arbeitskräfte verfügbar waren und bekamen den gleichen<br />
Lohn wie freie Arbeiter.<br />
Nach Kriegsende begann die Inflation zu galoppieren. Im Dezember<br />
1922 bestritt eine 5-köpfige Familie ihren mtl. Lebensunterhalt<br />
mit 62.287 Mark, im Oktober 1923 musste sie bereits<br />
312 Mrd. und im Folgemonat unvorstellbare 50 Billionen Mark<br />
aufwenden. 1 Kilo Kartoffeln kostete am 10. Juli 1923 4.600<br />
Mark, am 22. September 1,04 Mio. und am 25. Oktober 1923<br />
schließlich 390 Mio. Papiermark. Die Inflation fraß zwar alle<br />
Schulden auf und ließ die Gläubiger leer ausgehen, aber auch<br />
die Ersparnisse lösten sich buchstäblich in Nichts auf. Die großen<br />
Verlierer waren die Arbeiter, bürgerliche Schicht und Rentner.<br />
Ein durchaus ansehnliches Vorkriegsvermögen von 50.000<br />
Mark war Ende 1923 gerade noch 0,0005 Goldpfennig wert.<br />
Da die Notenpresse der Regierung nicht mehr hinterherkam,<br />
druckte die Gemeinde eigenes Notgeld. Erst nach der Abwertung<br />
der Papiermark 1:1 Billion ging es 1924 mit der Währung<br />
wieder aufwärts.<br />
1921 schloss die Gemeinde Unteribental mit Karl Andris v.<br />
Mathislehof einen Vertrag zur Errichtung eines Kleinkraftwerks.<br />
Dies erwies sich als völlig unzureichend, vor allem während der<br />
„Drusch“ (Dreschen). Mit ständigen Stromausfällen mussten die<br />
74
Bewohner noch jahrzehntelang leben. Unteribental wurde erst<br />
nach dem 2. Weltkrieg an die Fernversorgung mit Elektrizität<br />
angeschlossen.<br />
Bei den Reichstagswahlen 1933 feierte die NSDAP auch in<br />
Unteribental einen deutlichen Sieg. Deshalb wurde auch hier<br />
die Rassenpolitik unterstützt, wie am Beispiel von Leo M.<br />
beschrieben. Im 1. Weltkrieg durch einen Kopfschuss schwer<br />
verletzt, durfte er zunächst als Kriegsversehrter auf dem elterlichen<br />
Hof leben und musste 1924 in die Heil- und Pflegeanstalt<br />
Emmendingen aufgenommen werden. Von dort kam er mit<br />
zahlreichen anderen Patienten nach Grafeneck, wo er am<br />
10. Juni 1940 starb. Die Eltern erhielten seine Asche mit der<br />
Mitteilung, er habe an einer ansteckenden Krankheit gelitten<br />
und seine Leiche deshalb verbrannt werden müssen. In Wirklichkeit<br />
wurde er mit größter Wahrscheinlichkeit im Rahmen der<br />
Aktion T4 ermordet.<br />
Langsam wurde klar, dass die Regierung Kriegsvorbereitungen<br />
traf, denn Faserstoffe, Fett, Schweinefleisch, Eier und Landbutter<br />
war ständig Mangelware. Um die Bevölkerung ruhig<br />
zu stellen, wurde gelegentlich tiefgefrorenes Schweinefleisch<br />
importiert. Der Schwarzmarkt florierte, billige Ersatzprodukte<br />
kamen auf den Markt und man fühlte sich an Kriegszeiten<br />
erinnert. Durch Propaganda und Luftschutzübungen wurde<br />
das Volk auf Luftangriffe vorbereitet. 1936 wurden in Kirchzarten<br />
Luftschutzschulen eingerichtet, die der Bevölkerung im<br />
Dreisamtal das richtige Verhalten bei Bombenangriffen beibrachten.<br />
Die Signale wurden immer unverkennbarer auf Krieg<br />
gestellt. Der Feldberg hatte sich in eine Festung verwandelt,<br />
überall lagen Wehrmachtseinheiten, große Gebiete waren für<br />
Zivilisten gesperrt. Am Westwall an der französischen Grenze<br />
wurde die militärische Befestigung ausgebaut und lief im März<br />
1939 auf Hochtouren. Die 33-jährigen wurden zu einer 8 bis 15<br />
wöchigen Ausbildung eingezogen. Die Jahrgänge 1906 – 1919<br />
wurden erfasst. Im Juli fanden Truppenbewegungen statt und<br />
am 25./26. August wurden die Gemeinden entlang der Grenze<br />
zu Frankreich evakuiert. Ab Ende August wurden Lebensmittel<br />
rationiert und die Bauern mussten alles außer den Selbstverbrauch<br />
an das Ernährungsamt abliefern. Verboten war auch<br />
Schlachten ohne Genehmigung oder der Aufkauf von Eiern<br />
ohne Berechtigungsschein, wie ein Mann und eine Frau aus<br />
Unteribental erfahren mussten: Er wurde im Oktober 1941 zu<br />
einer Geldstrafe von 5 Mark verurteilt, sie kam im Februar<br />
1945 sogar vor das Sondergericht Freiburg, das sie zu einem<br />
Monat Gefängnis verurteilte.<br />
Die Einberufungsaktion verlangte der hiesigen Landwirtschaft<br />
einiges ab, denn nahezu jeder Hof war davon betroffen. Diese<br />
fehlenden Arbeitskräfte versuchte man durch Zwangsarbeiter<br />
aus dem Polenfeldzug zu kompensieren. Im Archivalienverzeichnis<br />
von Unteribental wird auf eine Akte mit Namensverzeichnissen<br />
von Ausländern hingewiesen, aber sie ist trotz intensiver<br />
Suche nicht auffindbar. Fest steht, dass für die Arbeiter strenge<br />
Regeln galten: von 21 bis 6 Uhr bestand Ausgehverbot, sie<br />
durften keine öffentlichen Verkehrsmittel und keine Fahrräder<br />
benutzen. Sie durften sich nicht versammeln, Kirchen, Theater,<br />
Kinos und andere kulturelle Veranstaltungen nicht besuchen.<br />
Die Wohnung des Arbeitgebers war tabu und schlafen sollten<br />
sie in Stall und Scheune. Der Bauer hatte das Recht auf körperliche<br />
Züchtigung und Regelverstöße musste er der Gestapo<br />
anzeigen. Dies galt auch für die inzwischen eingetroffenen<br />
russischen Zwangsarbeiter. Sexuelle Beziehungen zu deutschen<br />
Frauen war für Polen und Russen ein Tatbestand, auf dem die<br />
Todesstrafe stand. Ein Verhältnis mit Franzosen oder Italiener<br />
wurde milder bestraft, mit einem Holländer sogar geduldet.<br />
Auch hier galt die Hierarchie des Rassismus. Ledige Frauen<br />
kamen in der Regel mit Gefängnisstrafen bis zu zehn Monaten<br />
davon. Verheiratete mussten ein bis zwei Jahre ins Zuchthaus.<br />
Strafverschärfend fiel ins Gewicht, wenn eine Frau Kinder hatte,<br />
ihr Mann an der Front stand, oder sie aus der Beziehung mit<br />
dem Ausländer ein Kind erwartete.<br />
75
Nach der Bombardierung Freiburgs am 27. November 1944<br />
kamen viele Flüchtlinge ins Dreisamtal. Der Freiburger<br />
Verleger Theophil Herder-Dorneich hat in seinem Haus 35<br />
Personen aufgenommen, darunter sämtliche Mitarbeiter seiner<br />
Buchhandlung. Am 22. April 1945 wurde die Außenstelle des<br />
Armeeverpflegungslagers in Wagensteig ausgeräumt und die<br />
Lebensmittel an die Bevölkerung verteilt. Am 23. April 1945<br />
rollten französische Panzer durch die Ortsteile, der Krieg war<br />
vorbei und die Bevölkerung wurde dazu aufgerufen, keinen<br />
Widerstand zu leisten. Die Franzosen verhängten ab 12. Mai<br />
1945 eine scharfe Ausgangssperre zwischen 20.30 und 6 Uhr.<br />
Der Ort durfte nicht verlassen werden und das Fahrradfahren<br />
war verboten. Sämtliche Waffen, Rundfunk- und Lichtbildgeräte<br />
mussten abgeliefert werden. Geplünderte Gegenstände<br />
mussten der Militärregierung zurückgebracht werden. Alle<br />
Wehrmachtsangehörigen hatten sich bei der Besatzungsverwaltung<br />
zu melden, damit die „Säuberung“ beginnen konnte.<br />
Im Ibental wurden die 17 betroffenen ehemaligen NSDAP-<br />
Mitglieder zu Bewährungsstrafen, 15% Gehaltskürzungen (Bedienstete<br />
der Gemeinde) und Geldbußen verurteilt. Die meisten<br />
wurden als „Mitläufer“ ohne besondere Sühnemaßnahmen<br />
schuldig gesprochen.<br />
Abgaben an die Franzosen<br />
Während der französischen Besatzung wurde die bäuerliche<br />
Bevölkerung im Dreisamtal zu Lebensmittel- und Holzabgaben<br />
herangezogen. Sie musste die hungernde deutsche Bevölkerung,<br />
als auch die französischen Truppen und die Angehörigen<br />
der Militärregierung versorgen. Außerdem mussten sie zu<br />
den umfangreichen Lebensmittelexporten nach Frankreich<br />
beitragen. Zu Beginn der Besatzung war nicht an Versorgen<br />
zu denken, weil die Franzosen Lebensmittel, Tiere, Kleidung,<br />
Radios, Uhren, Fahrräder und sogar Autos mitnahmen. Im<br />
Laufe der Zeit wurden für die entnommenen Güter Requisitionsscheine<br />
ausgestellt, damit konnten die Geschädigten<br />
Anträge auf Wiedergutmachung stellen. Es gab Ablieferungskontingente,<br />
Anbauvorschriften und Zwangsmaßnahmen.<br />
76
Gleichzeitig mangelte es an männlichen Arbeitskräften, Saatgut,<br />
Düngemittel, Maschinen und Zugtieren. Verschärft wurde<br />
die Situation durch die hungernde Stadtbevölkerung, die aufs<br />
Land strömte und durch Tauschhandel versuchte, an Lebensmittel<br />
zu kommen. Es blühte der Schwarzhandel und Hamstern.<br />
Wer aber keine Geld- oder Tauschwaren hatte, war auf<br />
Felddiebstähle angewiesen, die wiederum durch eine Feldhut<br />
hart bestraft wurden. Außerdem wurde Wohnraum für die<br />
Besatzung beschlagnahmt, wie z.B. das Haus Lindenberg als<br />
Ferienheim für französische Kinder. Allmählich fanden in den<br />
Ortsteilen auch wieder traditionelle Feste statt, Vereine gründeten<br />
sich wieder neu. Am 30. Mai 1948 vergnügten sich die<br />
Ibentäler beim Tanz im Hirschen. Am 10. Januar 1950 fand im<br />
Hirschen ein Kriegsheimkehrerfest statt.<br />
1946 fanden die ersten Kreistagswahlen statt, bei der die<br />
Badische Christlich-Soziale Volkspartei (BCSV) spätere CDU in<br />
Unteribental bei einer Wahlbeteiligung von 68% auf 76,5% der<br />
Stimmen kam. Bei der Landtagswahl am 18. Mai 1947 lag die<br />
Wahlbeteiligung über 70% und die BCSV bekam 80,4% der<br />
Stimmen. Schließlich beendete die erste freie Bundestagswahl<br />
am 14. August 1949 die Besatzungszeit. Die Wahlbeteiligung<br />
erreichte einen neuen Rekord von 86% mit einem Stimmenanteil<br />
der CDU von 86,5%.<br />
Hilfe des damaligen Landrats Schill durchzusetzen. Aus heutiger<br />
Sicht war es eine mutige und richtige Entscheidung, denn die<br />
Halle und der Kindergarten werden von der Gesamtgemeinde<br />
Buchenbach täglich genutzt. Die Kosten für das Gemeindezentrum<br />
mit 1,4 Mio. Mark wurden fast ohne fremde Hilfe<br />
verwirklicht, lediglich für den Kindergarten gab es den landesüblichen<br />
Zuschuss. Dies war für die damalige kleine Gemeinde<br />
eine große finanzielle Herausforderung. Am 13.01.1973 fand<br />
die feierliche Einweihung mit Schlüsselübergabe statt. Die Halle<br />
wird seither von zahlreichen Vereinen aus der Gesamtgemeinde<br />
genutzt. Sie dient unter anderem unserem Verein und dem<br />
Kindergarten als Turnhalle, dem Akkordeon-Club Höllental als<br />
Probelokal, sowie der VHS für ihre Kurse. Über viele Jahrzehnte<br />
wurden regelmäßig an Weihnachten Theaterveranstaltungen<br />
aufgeführt. Die Ibentäler Theatergruppe war weithin bekannt<br />
und spielte sehr erfolgreich abwechselnd für den <strong>RSV</strong> und<br />
die FFW Unteribental. Traditionell wurde jedes Jahr der Ring<br />
der Körperbehinderten zu einer Aufführung eingeladen und<br />
kostenlos mit Kaffee und Kuchen bewirtet. Diese Veranstaltung<br />
war immer etwas Besonderes, denn die Theatergruppe und<br />
der ausrichtende Verein wurden stets mit sehr viel Dankbarkeit<br />
belohnt.<br />
Am 8. Dezember 1951 musste über folgende Frage abgestimmt<br />
werden: „Wiederherstellung des Landes Baden“ oder „Gründung<br />
eines Südweststaates“. Unteribental sprach sich mit 84%<br />
für Baden aus.<br />
Die jahrhundertealte, rein landwirtschaftliche Struktur wandelte<br />
sich ab 1965 durch eine gezielt angestrebte Aufwärtsentwicklung<br />
im Wohnbereich, durch Ansiedlung von Gewerbebetrieben<br />
und Förderung des Fremdenverkehrs. Mit dem Ankauf<br />
des 32 ha großen land- und forstwirtschaftlichen Kleinbauernhofs<br />
der Familie Dold in der Mitte des Tales konnten Teile<br />
der Grundstücke als Baugrundstücke ausgewiesen werden.<br />
Daneben entstand ein Gemeindezentrum mit Rathaus, Schule,<br />
Kindergarten, Mehrzweckhalle und 5 Wohnungen, sodass ein<br />
Mittelpunkt in der Gemeinde geschaffen wurde, der sogenannte<br />
Hofacker. Trotz behördlicher Widerstände ist es dem<br />
damaligen Bürgermeister Eckmann gelungen, dieses Projekt mit<br />
Ibentalhalle<br />
77
Die bauliche Entwicklung im Hofacker ermöglichte Straßenbaumaßnahmen,<br />
sowie den Bau einer Wasser- und Abwasserversorgungsanlage,<br />
wie z.B. Quellfassung und Hochbehälter im<br />
Weberdobel.<br />
Neben dem Baugebiet am Kleinbauernhof entstand um 1970<br />
auf dem ebenfalls gemeindeeigenen Grundstück “Wickenhof“<br />
ein weiteres Baugebiet für Wohnhäuser und Gewerbebetriebe,<br />
wie z.B. für die Firma Siko und Team Grün Furtner. Es wurde<br />
ständig erweitert und ab 1990 kam angrenzend das Baugebiet<br />
Haurihof dazu.<br />
Bereits in den 60-er Jahren hat die Gemeinde für die Vereine<br />
eine Festbaracke errichtet und 1973 mit einem „Sportzentrum“<br />
(Rasensportplatz mit Dusch-, Geräte- und Schiedsrichterräumen)<br />
ergänzt. Es wurde ohne staatliche Zuschüsse mit einem<br />
Aufwand von 200 000 Mark finanziert. Zusätzlich haben Förster<br />
und Vereine einen wunderschönen Waldspielplatz mit Sandkasten,<br />
Wippe, Kletterbaum und Seilbahn angelegt. Von 2004-<br />
2005 wurde die Festbaracke umgebaut und saniert. Unter der<br />
Leitung von Markus Molz und F.J. Willmann, unterstützt von<br />
vielen freiwilligen Helfern unseres Vereins, der FFW Unteribental,<br />
der Zainemacherzunft Buchenbach und der Wandergruppe<br />
Himmelreich-Höllental, erfuhr das Gebäude eine erhebliche<br />
optische Aufwertung. 5000 ehrenamtliche Arbeitsstunden wurden<br />
investiert, um aus einer Baracke ein sehenswertes Festgebäude<br />
zu gestalten. Zum Dank lud die Gemeinde zu einem<br />
Helferfest am Gummenwald ein.<br />
Solche Gemeinschaftsprojekte und das Engagement der freiwilligen<br />
Helfer tragen dazu bei, die Gemeinde und ihre Einrichtungen<br />
aufzuwerten und ein Gefühl von Zusammengehörigkeit<br />
und Stolz zu fördern.<br />
Sogar der SC-Trainer Christian Streich hat sich in unseren Sportplatz<br />
verliebt: „Im Ibetal, schöne Platz, hinte so ä Raseplätzle,<br />
isch aber kei Originalgröße, isch traumhaft, s’geht d’Hang<br />
hoch, kannsch hinsitze, kannsch kicke unte, s’gibt nix Schöners,<br />
häsch nuch Ussicht. Ich fahr do ab un zue mit dem Fahrrad<br />
vorbei wenn ich nach St. Peter fahr“.<br />
Vom Milchhäusle Unteribental …<br />
Im Jahre 1965 wurde eine Milchgenossenschaft in Unteribental<br />
gegründet die darauf abzielte, eine Milchsammelstelle für die<br />
Bauern des Ibentals zu errichten. Der Bau der Sammelstelle<br />
fand von 1967 bis 1969 auf dem Gelände des Dreherhofs statt<br />
und schuf eine zentrale Anlaufstelle für die Milchablieferung.<br />
Die Sammelstelle war nicht nur als Treffpunkt beliebt, sondern<br />
bot auch eine Einkaufsmöglichkeit für Milchprodukte. Sie wurde<br />
im Jahr 1977 leider wieder geschlossen, und die Genossenschaft<br />
in Folge ein Jahr später aufgelöst. Ab diesem Zeitpunkt<br />
waren die Landwirte gezwungen, eigene Kühlkammern zur<br />
Lagerung der Milch einzurichten. Die Abholung erfolgte entweder<br />
direkt vom Hof durch einen Milchwagen oder durch die<br />
Bereitstellung eines Milchtanks an der Straße.<br />
Von 1919 bis zur Errichtung der Sammelstelle 1969, also 50<br />
Jahre lang, war es üblich, dass Leo Dold (d’Kleibure-Leo) mit<br />
seinem motorisierten Pritschenwagen die Milch der Landwirte<br />
einsammelte und zu einer Sammelstelle nach Kirchzarten, später<br />
zum Milchhof nach Freiburg brachte. Jeder Hof hatte entlang<br />
des Weges ein Milchbänkle, auf dem die gefüllten Milchkannen<br />
abgestellt wurden. Leo Dold füllte diese Milch in seine<br />
40-Liter-Kannen um und hievte sie auf seine Pritsche. Nebenbei<br />
nahm er gelegentlich auch Landwirte mit ihren kleinen<br />
Schweinchen mit, die er auf dem „Saumärkt“ ablud. Auf dem<br />
Rückweg von Freiburg kehrten Leo Dold und die Landwirte oft<br />
beim Metzger in Ebnet ein. Dort nutzten sie den Erlös aus dem<br />
Schweineverkauf, um sich eine leckere Fleischwurst zu gönnen.<br />
Das war vermutlich eine willkommene Belohnung für ihre harte<br />
Arbeit. Außerdem besaß damals lange Zeit keiner der Ibentäler<br />
ein Auto und so waren Leo’s tägliche Fahrten und seine Besorgungen<br />
enorm wichtig.<br />
Diese Entwicklung zeigt, wie sich die Strukturen und Prozesse<br />
in der Milchwirtschaft über die Jahre verändert haben und wie<br />
die Landwirte neue Wege finden mussten, um ihre Milchproduktion<br />
effizient zu organisieren und zu vermarkten.<br />
78
… zum Feuerwehr-Gerätehaus Unteribental<br />
Nachdem die Gemeinde das Gebäude der Milchsammelstelle<br />
mit dem Grundstück erworben hatte, wurde es von der FFW<br />
Unteribental, die 1947 gegründet wurde, in unzähligen Arbeitsstunden<br />
mit einem Minimum an finanziellen Mitteln zum<br />
neuen Feuerwehrgerätehaus umgebaut. Im Jahr 1983 konnte<br />
die Feuerwehr von ihrem alten Gerätehaus beim Jägerhof, das<br />
1960 erbaut worden war, in das neue Gebäude umziehen. Im<br />
Rahmen des Umbaus wurde die Garage für das Feuerwehrfahrzeug<br />
vergrößert, um den Anforderungen des modernen Fuhrparks<br />
gerecht zu werden. Zudem wurde eine Küche eingebaut,<br />
um den Feuerwehrleuten die Möglichkeit zu bieten, sich vor<br />
Ort zu verpflegen. Ein Mannschaftsraum wurde ebenfalls geschaffen,<br />
um die Kameradschaftspflege innerhalb der Feuerwehr<br />
zu unterstützen.<br />
Der Umbau des ehemaligen Milchsammelstellengebäudes in<br />
ein Feuerwehrgerätehaus war eine bedeutende Entwicklung<br />
für die FFW Unteribental und ermöglichte es der Feuerwehr,<br />
ihre Ausrüstung angemessen unterzubringen und effektiver auf<br />
Notfälle in der Gemeinde zu reagieren.<br />
Die Bevölkerungsentwicklung zeigt deutlich, dass sich das abgelegene<br />
Ibental den Erfordernissen des Zeitwandels angepasst<br />
hatte. Für das Jahr 1836 wird die Einwohnerzahl mit 338 angegeben.<br />
Nachdem sie 1939 auf 282 gesunken war und 1962 nur<br />
292 betrug, ist sie bis zum Jahre 1973 durch die rege Neubautätigkeit<br />
auf 495 Personen angestiegen und heute sind es 675.<br />
Das Wappen<br />
von Unteribental:<br />
In Blau ein pfahlweise<br />
gestellter silberner<br />
(weißer) Schlüssel<br />
Die Bürgermeister von Unteribental<br />
1848 – 1901 Johann Gremmelsbacher,<br />
Joseph Kienzler,<br />
Johann Gremmelsbacher,<br />
Landolin Schwarz,<br />
Severin Künzler<br />
1901 – 1919 Wilhelm Willmann<br />
1919 – 1924 Josef Heizler (Jägerhof)<br />
1924 – 1933 Dominikus Saier (Melcherhof)<br />
1933 – 1939 Karl Friedrich Saier<br />
(v. Saiergut bzw. Maxenhof,<br />
„Ins Maxe“, Tochter Elise verh. Schlegel)<br />
1939 – 1945 Friedrich Heizler (Jägerhof)<br />
1945 – 1946 Karl Friedrich Saier<br />
1946 – 1957 Karl Saier (Haurihof)<br />
1957 – 1965 Friedrich Heizler<br />
1965 – 1974 Josef Eckmann (Wickenhof)<br />
Im Zuge der Gemeindereform musste zum 1. Januar 1975<br />
die Selbstständigkeit der politischen Gemeinde aufgegeben<br />
werden. Bürgermeister Eckmann sperrte sich bis zuletzt gegen<br />
diese Reform und willigte erst auf Druck der Landesregierung<br />
ein. In Form eines Eingliederungsvertrages mit der Gemeinde<br />
Buchenbach, mit welcher schon bisher enge Beziehungen zur<br />
gemeinsamen Kirchengemeinde bestanden, wurde durch eine<br />
Ortschaftsverfassung erreicht, dass die Interessen des Ibentals<br />
künftig durch einen Ortschaftsrat mit Ortsvorsteher in<br />
der Gesamtgemeinde vertreten werden. Letzter Bürgermeister<br />
und erster Ortsvorsteher von Unteribental war Josef Eckmann.<br />
Nachfolger waren Walter Danzeisen, Dr. Wolfgang Freiherr<br />
Marschall von Bieberstein und Christoph Frank bis heute.<br />
Trotz der sprunghaften Entwicklung hinsichtlich der Bevölkerungsstruktur<br />
konnte doch weitgehendst der landwirtschaftliche<br />
Charakter des Tals erhalten werden, sodass das Ibental<br />
auch heute noch zu den schönsten Tälern des Dreisamtals<br />
gehört.<br />
79
Der letzte Ortsdiener von Unteribental<br />
Als Josef Molz am 8. Mai 1948 aus der Kriegsgefangenschaft<br />
zurückkam, wurde er Ortsdiener und Feldhüter. Seine Tätigkeiten<br />
umfassten Arbeiten in Wald und Feld, die Mithilfe beim<br />
Öffnen des Krebsgrabens und das jährliche Spalten von 30 Ster<br />
Holz für das Schulhaus, das der ehemalige Gemeinderechner<br />
Johann Ketterer vorher zersägen musste. Als Feldhüter hatte<br />
er sogar Polizeigewalt, aber während seiner Amtszeit blieb ihm<br />
eine Arretierung erspart. 1983 wurde er in seinen wohlverdienten<br />
Ruhestand verabschiedet. Da er der Sohn von Waldhüter<br />
Pius Molz war, wurde er auch „s’Waldhiäter’s Sepp“ genannt.<br />
„Seppe-Lädele“ und das erste Telefon<br />
1928 verkaufte Josef Helmle (Leistmacherhof) dem Straßenwart<br />
Engelbert Ketterer aus St. Peter einen Bauplatz an der Talstraße.<br />
Nach der Fertigstellung ca. 1934 richtete seine Frau Josefa<br />
Ketterer, genannt „Seppe“, dort einen kleinen Laden ein. Bei<br />
ihr gab es „Luxusartikel“ wie z.B. Zucker, Salz, Pfeffer, Mehl,<br />
Öl, Essig, Grieß, Nudeln, Erbswurst, Linde-Kaffee genannt<br />
Zigori-Kaffee oder Muckefuck (Zichorienkaffee ist ein kaffeeähnliches<br />
Getränk, das aus den Wurzeln der Gemeinen Wegwarte<br />
(Zichorie) hergestellt wird), Pfannenputzer, Stumpe<br />
(Zigarren) Marke: Weißer Rabe, Bier (Löwenbräu), Gutzele<br />
(Bonbons), Kernseife, Waschmittel, Schuhfett, Schuhbändel,<br />
Zwick für Geißle (geflochtene Schnur für Holzstab um die Kühe<br />
zu treiben). Zum größten Luxus im Laden gehörte das Telefon,<br />
denn es war das Einzigste im Untertal. Auf dem Jägerhof im<br />
Obertal war ein zweites installiert, ebenso waren beide Anwesen<br />
mit einer Sirene ausgestattet. Somit konnte man vom<br />
Untertal ins Obertal relativ schnell einen Brand melden und<br />
sofort mit beiden Sirenen die Feuerwehr alarmieren. Dem Straßenwart<br />
und Jägerhof oblag die ehrenvolle Aufgabe der Verbreitung<br />
wichtiger Nachrichten im Dorf, bis in den 60-er Jahren<br />
nach und nach das Telefon in jedem Haus Einzug nahm. Da<br />
„Stroßewarts“ keine Nachfolger hatten, verkauften sie das Haus<br />
1960 an Theodor Mäder, ebenfalls Straßenwart, welcher mit<br />
seiner Familie bis dahin auf dem Leistmacherhof lebte. D’Seppe<br />
führte ihr Lädele bis zu ihrer Erkrankung, bis dann Berta Mäder<br />
1966/67 übernahm und Josefa bis zu ihrem Tod am 1. Juni<br />
1968 pflegte. Danach wurde auch das Lädele aufgelöst. Schon<br />
zu „Seppe’s“ Zeiten gab es vor dem Haus an der Straße eine<br />
lange Holzbank. Sie war ein beliebter Treffpunkt am Sonntagmorgen<br />
zum Frühschoppen oder unter der Woche nach Feierabend.<br />
So hatten die Untertäler ihren eigenen „Stammtisch“<br />
zum Diskutieren und Neuigkeiten austauschen. Diese Tradition<br />
pflegte Berta Mäder noch lange weiter, bis 1995 das Ibental<br />
eine neue Straße bekam. Die letzte Bank war eine Spende von<br />
Eugen Molz vom Schwärzlehof.<br />
Fleischbeschauer<br />
Die Gemeinde Unteribental leistete sich ab 1959 einen eigenen<br />
Fleischbeschauer. Richard Ketterer absolvierte einen Lehrgang<br />
und wurde danach zu allen Schweine-Hausschlachtungen gerufen,<br />
um die Trichinenschau vorzunehmen. Er war für Buchenbach,<br />
Wagensteig, Falkensteig, Burg und Unteribental zuständig<br />
und kam z.B. im Jahre 1964 auf eine stattliche Zahl von 426<br />
Untersuchungen und dies hauptsächlich in den Wintermonaten.<br />
Die Gebühr betrug damals 2 D-Mark je Fleischbeschau. Sie<br />
dauerte mindestens ½ Stunde, die Anfahrt nicht mitgerechnet.<br />
Bei den damaligen Schneeverhältnissen konnte das mitunter<br />
eine lange und anstrengende Angelegenheit werden. Einmal<br />
musste er im tiefen Schnee zur Hinterwaldkopfhütte laufen,<br />
was zur Folge hatte, dass er dafür einen ganzen Samstag<br />
opfern musste. Im Laufe der Jahre dehnte sich das Aufgabengebiet<br />
auf Stegen mit seinen Ortsteilen und die Spirzen in<br />
Buchenbach aus, was durch die Unterstützung von Eugen Furtwängler<br />
und bei rückläufigen Hausschlachtungen einigermaßen<br />
zu bewältigen war. Nach 40 Jahren übergab er diese Aufgabe<br />
komplett an seinen Kollegen, der diese Tätigkeit noch ein paar<br />
Jahre, bis zur Einstellung der Hausschlachtungen, ausübte.<br />
80
Plan einer Autobahn über den Schwarzwald<br />
In den 60-er Jahren wurde eine Autobahn über den Schwarzwald<br />
geplant. Es gab verschiedene Trassenvorschläge, die alle<br />
Ortsteile (außer Falkensteig) betroffen hätten. Es entstand eine<br />
Bürgerinitiative, die das Ehepaar Heinemann (Neubürger aus<br />
Unteribental) später in eine „Aktionsgemeinschaft für demokratische<br />
Verkehrsplanung“ umwandelte. Mit sehr viel Engagement<br />
formierten sie einen Widerstand gegen den Bau der<br />
Schwarzwaldautobahn, dass sich dieser Bewegung immer mehr<br />
Gegner anschlossen. Zusammen mit Bürgermeister Eckmann<br />
und vielen betroffenen Landwirten aus der Region reisten sie<br />
sogar bis zum Staatssekretär des Verkehrsministeriums nach<br />
Bonn. Sie erreichten auch mehrere Begehungen namhafter<br />
Politiker vor Ort, u.a. vom damaligen Bundesminister Gerhard<br />
Eppler. Er äußerte sich nach einer Schwarzwaldwanderung<br />
im August 1973 wie folgt: „Jede Autobahntrasse von Freiburg<br />
nach Donaueschingen sei eine kleinere oder größere Barbarei.“<br />
Die Planung der Strecke von Ebnet bis Jostalende umfasste<br />
60 Hofgüter, die ruiniert gewesen wären. Der Beharrlichkeit der<br />
Eheleute Heinemann und vieler Mitstreiter ist es zu verdanken,<br />
dass der Bau der Schwarzwaldautobahn A86 erfolgreich verhindert<br />
wurde. Im Oktober 1979 verkündete Ministerpräsident<br />
Späth das „Aus“!<br />
81
Verbindung mit dem Lindenberg<br />
Die Bauern von Unteribental sind mit dem auf ihrer Gemarkung<br />
gelegenen Lindenberg seit Jahrhunderten eng verbunden. Wie<br />
eine alte „Urkundschrift“ berichtet, errichtete der Bauer Pantaleon<br />
Mayer, nachdem in seinem Stall eine Viehseuche erloschen<br />
war, in Erfüllung eines Gelübdes auf dem Gallihof einen<br />
Bildstock. Nach einer Muttergotteserscheinung beim heutigen<br />
„Frauenbrunnen“ ließ er auf der höchsten Erhebung des<br />
Gallihofes, auf dem Lindenberg, eine hölzerne Kapelle bauen.<br />
Sie wurde später nach der wunderbaren Heilung des Ibentäler<br />
Altbauern Hans Zähringer „mit Freuden“ wesentlich erweitert.<br />
Aus diesen legendären Anfängen entwickelte sich um 1500 die<br />
bekannte Wallfahrt auf dem Lindenberg.<br />
Im Bauernkrieg wurde die Kapelle geschändet und die Pilger<br />
„übel verschmäht und verspottet“. Nachdem 1584 ein neuer<br />
Hochaltar aufgestellt worden war, wurde die Wallfahrtskapelle<br />
1601 durch den Weihbischof von Konstanz feierlich eingeweiht.<br />
Den Gottesdienst besorgten die Benediktinermönche aus St.<br />
Peter. Da die alte Kapelle „den Pilgerstrom nicht mehr fassen“<br />
konnte, wurde 1761/62 ein Neubau ausgeführt. Noch heute ist<br />
im Kapelleneingang das Wappen des Abtes Steyrer zu sehen,<br />
der sich um den Neubau und die Ausgestaltung große Verdienste<br />
erwarb. Neben der Kapelle stand damals ein kleines<br />
Häusle für den Sigrist (Messdiener) und eine Wirtschaft samt<br />
Scheuer und Stallung.<br />
Dem schmucken Wallfahrtskirchlein war keine lange Lebensdauer<br />
beschieden. Der österreichische Kaiser Josef II., der Wallfahrten<br />
für religiösen Aberglauben hielt, verfügte 1786 den<br />
Abbruch der Kapelle. Mit den Baumaterialien sollte die Eschbacher<br />
Pfarrkirche gebaut werden. Nach dem letzten feierlichen<br />
Gottesdienst vor dem Abbruch 1787 gab es ein „überlautes<br />
Geschrey und Lärmen von den Weybern“. Aber das Zutrauen<br />
des Volkes an den Lindenberg blieb ungebrochen, es wurde<br />
behauptet, der Ort wäre ein Gnadenort. „In Menge fahrten sie<br />
dahin und verrichteten ihr Gebet bei den Ruinen“. Die Bauern<br />
von Unteribental begannen 1800 mit dem Wiederaufbau und<br />
führten ihn gegen den Widerstand kirchlicher und weltlicher<br />
Behörden weiter. 1805 stellte man in der halbausgebauten<br />
Kapelle einen Altar auf. Der Freiburger Stadtpfarrer Dr. Häberlin<br />
schrieb nach Konstanz: „Die neue Wallfahrtskirche sollte<br />
man eher anzünden als einweihen. Es gibt bekannter Dinge im<br />
Lande Breisgau kein im Christentum unwissenderes und darum<br />
liederlicheres Volk als gerade im Kirchzartener Tal“. Daraufhin<br />
erging an alle Priester das kanonische Interdikt (Verbot), in<br />
der Kapelle Gottesdienst, eine Predigt oder Andacht zu halten.<br />
Um die halbfertige Kapelle zu retten, verpflichteten sich die<br />
19 Bauern zu ihrem Ausbau und ihrer Unterhaltung. Nach Genehmigung<br />
durch den Erzbischof konnten 1849 erstmals nach<br />
63 Jahren wieder Gottesdienste auf dem Lindenberg gehalten<br />
werden. Ein schweres Unwetter gab den Anlass, dass die Bewohner<br />
von Unteribental und Eschbach am Pfingstmittwoch<br />
1850 eine gemeinsame Flurprozession auf den Lindenberg<br />
machten. In Erfüllung eines Gelübdes wird diese gemeinsame<br />
Prozession (beginnend im jeweiligen Tal, Treffpunkt auf der<br />
Höh) noch heute jeden Mittwoch nach Pfingsten (seit über 170<br />
Jahren) mit einem Abschlussgottesdienst auf dem Lindenberg<br />
durchgeführt. In seiner Zeit als Bürgermeister und Ortvorsteher<br />
hat Josef Eckmann den Kindern als Belohnung für’s Mitlaufen<br />
und Beten oben auf dem Lindenberg, einen mit Schinken belegten<br />
Spitzwecken und Bluna spendiert. Das zog damals noch<br />
als Motivation zum Mitlaufen.<br />
Die Bauern vom Ibental traten 1860 die Kapelle dem Stiftungsvorstand<br />
als Eigentum ab. Inzwischen hatten sich nach 1854<br />
über 40 Mädchen, die zumeist aus der Umgebung stammten,<br />
auf dem Lindenberg angesiedelt. Sie trugen gleiche Kleidung<br />
und bildeten einen religiösen Verein nach der dritten Ordensregel<br />
des hl. Franziskus. Sie „führten ein raues, lediglich der<br />
Arbeit und der Andacht gewidmetes Leben“. Gründerin war<br />
Veronika Benitz aus Breitnau, die seit 1858 den benachbarten<br />
Renzenhof in Eschbach besaß.<br />
82
Wallfahrtskirche Maria Lindenberg<br />
Nach einer Parteirevolte der damals allmächtigen Nationalliberalen<br />
in Offenburg schritt Staatsminister Jolly zu einem<br />
Gewaltakt, der im badischen Kulturkampf große Wellen schlug.<br />
Mit Hilfe von einem Dutzend Gendarmen wurden am Aschermittwoch<br />
1869 41 Schwestern vom Lindenberg vertrieben,<br />
weil ihr Zusammenleben gesetzwidrig sei. Selbst als 8 Schwestern<br />
durch Kaufvertrag grundbuchmäßige Eigentümerinnen am<br />
Lindenberg geworden waren, wurden sie von acht Polizisten<br />
„im Namen des Gesetzes“ verjagt. Die vertriebenen Schwestern<br />
mussten ins Ausland gehen, in die Schweiz, nach Hohenzollern<br />
und ins Elsass.<br />
Erbe der 1878 verstorbenen Veronika Benitz auf dem Lindenberg<br />
wurde durch Testament der Freiburger Rechtsanwalt und<br />
Reichstagsabgeordnete Dr. Ludwig Marbe, der 1881 die Kapelle<br />
renovieren ließ und 1906 die drei Güterkomplexe an die<br />
Gemeinde Unteribental für 80 000 Mark verkaufte. Mit dem<br />
Erlös wurde eine Lokalkaplanei (Wohn- und Diensthaus eines<br />
Kaplans) gegründet. Nachdem seit 1915 Exerzitien abgehalten<br />
wurden, veräußerte die Gemeinde 1923 ihre Liegenschaften<br />
auf dem Lindenberg samt dem Renzenhof an das Erzbischöffliche<br />
Missionsinstitut, das 1927 ein Kur- und Exerzitienhaus<br />
bauen ließ. Die Besinnungstage wurden im 2. Weltkrieg unterbrochen<br />
durch die Einquartierung von Volksdeutschen aus dem<br />
Osten und Müttern mit Kleinkindern.<br />
Nach Kriegswende wurden die Exerzitien wieder aufgenommen<br />
und ab 1948 kamen die Brautleutewochen hinzu und im<br />
Jahre 1955 heirateten 118 Paare auf dem Lindenberg. Während<br />
eines Umbaus 1977 wurde das Kur- und Exerzitienhaus<br />
durch einen Schwelbrand zerstört. Bereits 1975 entstand eine<br />
Pilgergaststätte und 1980 wurde das neue Exerzitienhaus und<br />
ein Personalhaus fertiggestellt. Von 1983 bis 1984 wurde vom<br />
Frauenbrunnen bis zum Wallfahrtsplatz ein Kreuzweg errichtet.<br />
Jedes Steinkreuz wurde gespendet, die Spender sind auf<br />
der Rückseite der Steine eingraviert. 1995 kam am südl. Hang<br />
der Pilgersaal St. Josef (150 Pers.) hinzu. 1997 wurden 500<br />
Jahre Wallfahrtsstätte „Maria Lindenberg“ gefeiert. Seit 1908<br />
leben Franziskanerinnen aus dem Mutterhaus in Gengenbach<br />
auf dem Lindenberg. 1955 eröffnete das Männerwerk der<br />
Erzdiözese Freiburg die Ewige Anbetung. Ursprung war der<br />
erste Besuch nach dem 2. Weltkrieg von Kanzler Adenauer in<br />
Moskau. 30 Männer pilgerten nach Sachseln/Flüeli zum Schweizer<br />
Friedensheiligen Nikolaus von Flüe, um dort Tag und Nacht<br />
für den Frieden zu beten. Von da an versprachen sie, dies jedes<br />
Jahr auf dem Lindenberg zu tun. Seitdem wird inzwischen das<br />
ganze Jahr (außer Dezember) rund um die Uhr gebetet, Wechsel<br />
immer samstags. Jede Gruppe, die aus 20 bis 28 Männern<br />
besteht, hat einen Obmann, der die Männer in dreier- oder<br />
vierer-Gruppen einteilt. Tagsüber dauert eine Schicht eine<br />
Stunde, nachts zwei Stunden. Alljährlich beteiligen sich etwa<br />
1000 Männer aus allen Teilen des Erzbistums. 1982 wurden die<br />
Fatima-Tage eingeführt. An jedem 13. der Monate Mai bis<br />
Oktober finden abends Gottesdienste mit einer Lichterprozession<br />
statt, welche sehr feierlich und sehr gut besucht sind.<br />
83
84
Über dem Altar und Kreuz hängt im Turm die Glocke, gegossen<br />
von der Firma Schillinger in Heidelberg.<br />
Die Vaterunser-Kapelle<br />
Am Eingang des Tales oberhalb des Wagensteigbachs, steht die<br />
am 25. März 1968 eingeweihte Vaterunser-Kapelle.<br />
Ihre Grundstruktur ist das Vaterunser. Sie versucht auf eigenartige,<br />
ja einzigartige Weise, die Vielfalt und die Einheit dieses<br />
Gebets darzustellen: „Die Einheit durch die Geschlossenheit der<br />
Form, die Vielfalt durch die darin versammelten Symbole der<br />
Schöpfung, des Weltalls und des menschlichen Schicksals“.<br />
Der Kapellengrundriss bildet ein gleichseitiges Sechseck. Über<br />
den Umfassungswänden steigt das Dach bei gleicher Traufhöhe<br />
zum Mittelpunkt an, über dem der Turmhelm mit einer<br />
Glockenstube errichtet ist. Altarzentrum und die sechs Nischen<br />
sind nach dem Willen des Bauherrn architektonischer Ausdruck<br />
für die Darstellung symbolischer Zeichen der sieben Bitten des<br />
Vaterunsers und der Schöpfung.<br />
Der Altarstein stammt aus der Zeit des alten Kirchenstaates.<br />
In einen weißen Stein, in der Mitte des Altars eingelassen, ist<br />
Asche von Märtyrern aus römischen Gräbern der christlichen<br />
Frühzeit versenkt. Über dem Altar schwebt das Kreuz, ein altes<br />
Wegkreuz aus dem Glottertal. Um das Kreuz, das die Mitte bildet,<br />
ordnen sich die Nischen, die von der Welt der Schöpfung<br />
und ihrer Geschichte erzählen. In den Nischen sind die sieben<br />
Bitten des Vaterunsers auf den Beton aufgemalt und wirken als<br />
dekoratives Band innerhalb des Raumes.<br />
Im Leben der Pfarrei Buchenbach erfüllt die Vaterunser-Kapelle<br />
eine wichtige Aufgabe für das Ibental. Sie ist eine Stiftung<br />
des Ehrenbürgers Dr. Theophil Herder-Dorneich und seiner<br />
Ehefrau Elisabeth Herder-Dorneich, die eingebracht wurde in<br />
die Stiftung ORATIO DOMINICA.<br />
Die Sonnenuhr bei der Kapelle trägt, in den Runen eingemeißelt,<br />
die Tierkreiszeichen, die Zeichen der vier Evangelisten sind<br />
figürlich behandelt. Auf dem Sockel der Uhr steht der Spruch:<br />
DU MENSCH, SPRACHE GOTTES<br />
GLEICHE DER SONNE<br />
RUH‘ IN DER MITTE DEINER BEWEGUNG<br />
Zusammengetragen von Klaus Weber<br />
Schrifttum + Quellen<br />
AMADEUS Johannes (Hrsg), Ein Zeichen, die Vaterunser-Kapelle, 1976<br />
FLEIG Edgar, Studien zur Geschichte des Klosters St. Peter, 1908<br />
FREIBURG IM BREISGAU, Stadt und Landkreis, Band II (Die Gemeinden), 1974<br />
GOTHEN E., Die Hofverfassung auf dem Schwarzwald,<br />
dargestellt an der Geschichte des Gebietes von St. Peter in ZGO 40, 1886<br />
HOG Joseph, Die Schwesternschaft von der ewigen Anbetung<br />
auf dem Lindenberg 1854 – 1869, FDA 1977<br />
HOG Joseph, Wallfahrt Maria Lindenberg (Kirchenführer) 1980<br />
KIRCHZARTEN, Geografie, Geschichte, Gegenwart, 1966<br />
KÜNZLER Leo, Geschichte der Höfe in Unteribental, Handschrift<br />
MAYER Fridolin, Maria Lindenberg, 1950<br />
MAYER Julius, Geschichte der Benediktinerabtei St. Peter, 1893<br />
SCHOFER Josef, Das Unrecht am Lindenberg, 1928<br />
STÖRK Wilhelm, Die Gottesmutter vom Lindenberg,<br />
ein Geschichts- und Gebetbuch, 1892<br />
WALTER Maximilian, Geschichte der Gemeinde Stegen, 1920 Handschrift<br />
WEECH Friedrich, Der Rotulus Sanpetrinus, in FDA Bd. XV 1882<br />
Akten und Beraine des Badischen Generallandesarchives in Karlsruhe<br />
85
Wir machen,<br />
dass es fährt.<br />
Nur wo 1a autoservice draufsteht,<br />
ist auch 1a autoservice drin.<br />
*Hauptuntersuchung nach §29 StVZO, durchgeführt von externen Prüfingenieuren der amtlich anerkannten Überwachungsorganisationen.<br />
• Inspektion<br />
• HU*/ AU<br />
• Ölwechsel<br />
• Reifenservice<br />
• Karosseriearbeiten<br />
• Unfallinstandsetzung<br />
Hauptstraße 72<br />
79254 Oberried<br />
Tel. 07661 / 40 46<br />
Fax 07661 / 28 78<br />
RiederKFZ@freenet.de<br />
www.rieder.go1a.de<br />
• Bremsenservice<br />
• Klimaservice<br />
• Sicherheits-Checks<br />
• Autoglas<br />
• Gasprüfung für Wohn-<br />
wagen und Wohnmobile<br />
Wir planen Ihr Draußen-Wohnzimmer<br />
www.team-gruen-furtner.de<br />
07661 905050 0
SIKO<br />
INNOVATIVER ARBEITGEBER<br />
Arbeitsinhalt<br />
– Eigenverantwortung<br />
– Ergebnisorientiert<br />
– Ideenumsetzung & Verwirklichung<br />
– Zukunftsorientierte Weiterbildung<br />
SIKO – Wir stellen Sensoren und Positioniersysteme<br />
für Industrie und Maschinenbauher. Langfristige Ausrichtung<br />
und agile Arbeitsmethoden sorgen dafür,<br />
dass wir erfolgreich sind und stetig wachsen. Wachsen<br />
Sie mit uns! Wir heißen innovative Ideen willkommen<br />
und schreiben TEAMGEIST groß – dieser Spirit sorgt<br />
seit über 60 Jahren dafür, dass wir als Unternehmen<br />
in Familienbesitz gemeinsam erfolgreich sind.<br />
Sie haben Lust sich einzubringen? Es erwarten Sie interessante<br />
Aufgaben, herausfordernde Projekte und<br />
eine wertschätzende Unternehmenskultur mit über<br />
200 Mitarbeitern an zwei Standorten.<br />
Arbeitsumfeld<br />
– Mobiles Arbeiten<br />
– Moderne Arbeitsplatzausstattung<br />
Benefits<br />
– Hansefit / JobRad<br />
– Betriebsevents<br />
Work-Life-Balance<br />
– Gleitzeit<br />
– Keine Schichtarbeit<br />
– Flexible Arbeitszeitmodelle<br />
Follow „SIKO-global“<br />
SIKO GmbH<br />
Weihermattenweg 2, 79256 Buchenbach,<br />
www.siko-global.com
Die Schule in Unteribental<br />
(von ihren Anfängen bis 1981)<br />
Das Schulwesen um 1770<br />
Vor 1770 gab es keine allgemeine Schulpflicht und keine öffentlichen<br />
Schulen. Die Menschen damals konnten, abgesehen<br />
von wenigen Ausnahmen, weder Lesen noch Schreiben. Schulen<br />
gab es nur in Klöstern und Städten. Das gesamte Bildungswesen<br />
im Mittelalter und in den folgenden Jahrhunderten<br />
lag in den Händen der Kirche. Verstärkt durch die Reformation<br />
richteten auch die Städte Schulen ein. Das Land blieb aber<br />
so gut wie ausgeschlossen von den Bildungsmöglichkeiten.<br />
Um 1770 gab es in unserer Gegend nur je eine Schule in Freiburg<br />
und in St. Peter. Abt Speyrer ließ 1754 in St. Peter ein<br />
zweigeschossiges Schulhaus erbauen. Dem Kloster St. Peter war<br />
die Bildung und Erziehung der Kinder und Jugendlichen immer<br />
ein besonderes Anliegen.<br />
In Kirchzarten und anderen Gemeinden des Dreisamtals entstanden<br />
bis im Jahre 1800 Schulen, die mit unseren heutigen<br />
Einrichtungen jedoch nicht zu vergleichen waren. Schulmeister<br />
oder Schullehrer war damals ein Handwerker oder Bauer, der<br />
auf irgendeine Weise Lesen und Schreiben gelernt hatte und<br />
nun anbot, Kinder zu unterrichten. Er handelte mit den Eltern<br />
ein Schulgeld aus. Die Tätigkeit als Lehrer übte er neben seinem<br />
eigentlichen Beruf aus, denn allein vom Unterricht konnte<br />
er nicht leben. Zunächst betreute er die Kinder im Einzelunterricht.<br />
Erst später wurde Klassenunterricht erteilt.<br />
Dieser Schullehrer hatte keine besondere Vorbildung. Jeder,<br />
der sich berufen und im Stande fühlte, konnte Lehrer sein.<br />
Die Schule war ein Privatunternehmen, der Unterricht fand in<br />
der Wohnung des Lehrers statt. Da es keine Schulpflicht gab,<br />
konnte jeder seine Kinder in die Schule schicken oder auch<br />
nicht. Der finanzielle Beitrag der Eltern, das Schulgeld, war die<br />
einzige Vergütung für den Lehrer.<br />
In der Regel wurde nur im Winterhalbjahr unterrichtet. Diese<br />
Winterschule dauerte von Allerheiligen bis Fastnacht oder<br />
Ostern. In der übrigen Zeit wurden die Kinder zur Arbeit gebraucht.<br />
Das änderte sich 1774, als das Schulwesen im vorderösterreichischen<br />
Breisgau durch Dekrete der Kaiserin Maria<br />
Theresia entscheidend reformiert wurde. In Freiburg wurde die<br />
Normalschule eingerichtet, die jeder besucht haben musste,<br />
wenn er als Lehrer eingestellt werden wollte.<br />
Der Ortsgeistliche hatte die Aufsicht über die Schulen seiner<br />
Pfarrei.<br />
Joseph Heizler vom Jägerhof, der erste Lehrer im Ibental<br />
Bis 1786 geben die Akten keine Auskunft über die Tätigkeit<br />
eines Lehrers im Ibental. Die kaiserlichen Reformen der 1770er<br />
Jahre waren sicherlich ein entscheidender Impuls, dass Unteribental<br />
einen Lehrer bekam. Es ist ebenso anzunehmen, dass<br />
die Entstehung von Schulen in den Nachbargemeinden, wie<br />
z.B. Buchenbach und Eschbach, zur Errichtung einer Schule in<br />
Unteribental beigetragen hat.<br />
Im Jahre 1786 wird zum ersten Mal ein Lehrer in Unteribental<br />
urkundlich erwähnt. Joseph Heizler, so sein Name, wurde 1764<br />
auf dem Jägerhof geboren und war der älteste Bruder des<br />
späteren Hofbauern Andreas Heizler. Er wurde als 22-jähriger<br />
der erste Lehrer in Unteribental. Man darf annehmen, dass er<br />
seine Schulbildung in der Normalschule in Freiburg erhalten<br />
hatte. Mit ihm beginnt die eigentliche Schulchronik Unteribentals.<br />
Der Unterricht fand im sogenannten „Schuhmacherhäusle“<br />
statt. Dieses Häusle war ursprünglich wohl ein Leibgeding. Aus<br />
dem Hofplan geht hervor, dass dieses kleine Gebäude an der<br />
Stelle des heutigen Jägerhofs stand und zu dieser Zeit wohl<br />
Eigentum des Lehrers Heizler war. Joseph Heizler heiratete<br />
1796 Katharina Gohr von Höfen, nach deren Tod 1803, Maria<br />
Pfister, Tochter des Rainwebers Pfister. Sie hatten zusammen<br />
vier Kinder.<br />
88
Der Bau des ersten Schulhauses 1806<br />
Der Platz für das neue Schulhaus wurde mit Bedacht ausgewählt.<br />
Etwa in der Mitte zwischen Ober- und Untertal wurde<br />
das Schulhaus auf einem Grundstück errichtet, das vom<br />
Birkjörglehof erworben wurde. Das Haus war einstöckig, rechts<br />
neben dem Eingang befand sich die Lehrerwohnung, links der<br />
Schulraum. Neben dem Schulgebäude, zum Hang hin, wurde<br />
ein Ökonomiegebäude für den Lehrer gebaut, in dem auch der<br />
Schulabort (Toilette) war. Die Kosten waren in folgender Weise<br />
aufgeteilt: das Großpriorat von Heitersheim übernahm als<br />
Patron und Zehntherr die Löhne für die Handwerker, die Grundherrschaft<br />
v. Kageneck musste die Baumaterialien stellen und<br />
die Gemeinde die Spann- und Frondienste leisten.<br />
Durch den Bau des Schulhauses wurden die schulischen Verhältnisse<br />
im Ibental wesentlich verbessert. Joseph Heizler zog<br />
mit seiner Familie aus dem Schuhmacherhäusle aus und bezog<br />
die neue Lehrerwohnung.<br />
Das Schulwesen um 1810<br />
Nach der Bildung des badischen Staates 1803 übernahm der<br />
Staat die Oberaufsicht über das gesamte Schulwesen. Die<br />
kirchlichen und städtischen Schulen wurden dem Staat unterstellt,<br />
die Besetzung von Schulstellen durch Gemeinden war<br />
nicht mehr möglich. In einem Gesetz über die gemeinen<br />
und wissenschaftlichen Schulen wurde die Schulpflicht erneut<br />
festgelegt. Die Knaben vom 7. bis 14. und die Mädchen vom<br />
7. bis 13. Lebensjahr wurden zum Besuch der gemeinen oder<br />
Trivialschule verpflichtet.<br />
„Die Trivialschulen sollten den Stadtbürger und den Landmann<br />
in Kenntnis all desjenigen setzen, was ihm für den Lebensberuf<br />
als Christ und Staatsbürger zu wissen notwendig ist“.<br />
Für die Schulentlassenen gab es die Fortbildungsschule, die<br />
drei Jahre dauerte und am Sonntag gehalten wurde. Daher<br />
wurde sie auch Sonntagsschule genannt. Die Christenlehre<br />
war ebenfalls Pflicht. Wer fehlte, musste ein Bußgeld bezahlen.<br />
In der Pfarrei Buchenbach war die Christenlehre im Winter<br />
im Anschluss an den Vormittagsgottesdienst, im Sommer von<br />
13 bis 14 Uhr, da, wie Pfarrer Franz schreibt, „im Sommer der<br />
größte Teil der Christenlehrjugend zum Hüten gebraucht wird“.<br />
Er versicherte auch, dass zum Besuch der Christenlehre und<br />
der Sonntagsschule die Jugend beiderlei Geschlechts, auch<br />
fremde Lehrlinge und Dienstboten ohne Ausnahme, bis nach<br />
zurückgelegtem 18. Lebensjahr angehalten wurden.<br />
Unterrichtsgegenstände<br />
Das Ziel des Schulunterrichtes war es, im Wesentlichen in<br />
den Volksschulen den Kindern Lesen, Rechnen und Schreiben<br />
beizubringen. Während im 18. Jahrhundert der Religionsunterricht<br />
im Vordergrund stand, wurde er jetzt ein Unterrichtsfach<br />
neben den drei anderen.<br />
Der Pfarrer erteilte den Religionsunterricht in den Schulen.<br />
Da die Pfarrei Buchenbach eine heimische Pfarrschule und drei<br />
Filialschulen umfasste, musste der Pfarrer jede Woche einmal<br />
zu Fuß nach Ibental, Wagensteig und Falkensteig, um an den<br />
dortigen Filialschulen Religionsunterricht zu geben.<br />
Ein besonderes Fach für die Mädchen war über den Winter die<br />
„Industrieschule“. Hier sollten die 11 bis 14-jährigen Mädchen<br />
Nähen, Stricken und Flechten lernen.<br />
1838 wurde in einem Vertrag zwischen der Gemeinde Unteribental<br />
und dem Schullehrer Lienert vereinbart, dass die<br />
Gemeinde der „Industrie-Lehrerin“, vermutlich die Frau des<br />
Lehrers Lienert, für die Abhaltung dieser Schule und Erteilung<br />
des dabei gesetzlich vorgeschriebenen Unterrichts mit Einschluss<br />
des Flechtens von Allerheiligen bis Ostern, also jeweils<br />
für den Winterkurs, 20 fl. bzw. Gulden zu bezahlen hatte.<br />
Die „notorisch armen Kinder, die die Schreibmaterialien aus<br />
dem Schulfond beziehen“, sollten den Stoff unentgeltlich vom<br />
Schullehrer bekommen. Dafür jedoch blieben die gefertigten<br />
Arbeiten Eigentum des Schullehrers. „Nur was die Kinder<br />
selbst zur Arbeit von zu Haus mitbringen, nehmen sie wieder<br />
als eigentümlich zurück“.<br />
89
Die Stellung des Lehrers um 1820<br />
Der Lehrer erhielt ein jährliches Gehalt von 118 fl. bzw. Gulden,<br />
welches von der Gemeinde quartalsweise ausbezahlt wurde.<br />
Dieser Betrag war für damalige Verhältnisse sehr gering, womit<br />
das Wort vom armen Dorfschulmeister seine Berechtigung<br />
hatte. Ob Joseph Heizler bei der geringen Besoldung als Lehrer<br />
noch einen anderen Beruf, vielleicht den des Schuhmachers,<br />
ausgeübt hat, lässt sich nicht nachweisen. Es ist jedoch anzunehmen,<br />
dass er im Sommerhalbjahr auf andere Weise gearbeitet<br />
hat. Damals waren die Lehrer auch darauf angewiesen,<br />
andere Nebenverdienste zu haben. In der Regel war der Lehrer<br />
Organist, oft auch Meßner und Lektor.<br />
In Buchenbach z.B. war der Meßnerdienst mit dem Schuldienst<br />
verbunden. Da das Ibental keine eigene Kirche hatte, waren<br />
alle diese Nebentätigkeiten für den hiesigen Lehrer nicht möglich.<br />
Eine Nebeneinnahme hatte Joseph Heizler durch sein Amt<br />
als Gerichtsschreiber, heute Ratsschreiber. In einer Aufstellung<br />
zur Volkszählung 1815, die wohl von seiner Hand geschrieben<br />
wurde, wird er als Lehrer und Gemeindeschreiber erwähnt.<br />
Ebenso bekleidete er das Amt des Akzisors bis zu seinem Tode.<br />
Der Akzisor hatte bestimmte Steuern einzutreiben.<br />
Wie schon erwähnt, hatte der Lehrer auch ein Anrecht auf eine<br />
Wohnung und ein Ökonomiegebäude, für die er keine Miete<br />
bezahlen musste.<br />
Vom Schulholz<br />
Schon die ältesten Urkunden belegen, dass die Gemeinde mit<br />
dem Holz für den Schulofen auch dem Lehrer das Holz für dessen<br />
Wohnung unentgeltlich anlieferte. Mit der Lieferung dieses<br />
Lehrerholzes war für den Lehrer die Verpflichtung verbunden,<br />
die tägliche Feuerung des Schulofens zu übernehmen.<br />
1829 wurde vom Badischen Direktorium des Dreisam-Kreises<br />
festgelegt:<br />
„Das Holzquantum für den Schuldienst zu Unteribental sowohl<br />
für die Heizung der Schulstube als zum eigenen Gebrauche für<br />
den Lehrer wird auf jährlich 5 Klafter (15 Ster), und zwar auf<br />
3 Klafter buchenes und 2 Klafter tannenes hiermit festgesetzt,<br />
welche auf Kosten der Gemeinde aufgemacht und in der Fron<br />
vor das Schulhaus zu führen sind. Das Holz für die Schulstube<br />
ist auf Kosten der Gemeinde sägen und spalten zu lassen, das<br />
Sägen und Spalten der weiteren 2 Klafter aber hat der Lehrer<br />
selbst als Bedürfnis für sich auf seine Kosten zu besorgen“.<br />
Gelegentlich gab es wegen der Holzlieferung Anstände. 1836<br />
beklagte sich Lehrer Lienert, dass das Holz „nicht in gehörigem<br />
Maß, nass und grün geliefert war“.<br />
Diese Regelung des Schulholzes hat die Zeiten überdauert. Sie<br />
galt noch bis 1974, als die bis dahin selbständige Ibentäler<br />
Grundschule aufgelöst wurde.<br />
Schulinspektion<br />
Verantwortlich für die Schulen einer Gemeinde war in der<br />
ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts der Pfarrer. Er war der Vorgesetzte<br />
des Lehrers und hatte die Schulaufsicht. Er schrieb<br />
Zeugnisse über Leistungen und sittliches Verhalten des Lehrers,<br />
er leitete dessen Bitten und Beschwerden weiter. Da Unteribental<br />
eine Filialschule war, war der Pfarrer von Buchenbach Schulinspektor.<br />
Ihm unterstanden auch die Schulen in Buchenbach,<br />
Wagensteig und Falkensteig.<br />
Beim Schulhaus-Erweiterungsbau von 1833 bis 1836 gab es für<br />
Pfarrer Franz von Buchenbach viele Anlässe, als Schulinspektor<br />
von Unteribental die Behörden in Freiburg zu bitten, zu mahnen,<br />
zu drängen. Eine Fülle von Eingaben im Gemeindearchiv<br />
von Unteribental beweist, wie ernst Pfarrer Franz seine Aufgabe<br />
nahm und mit welcher Tatkraft er sich für Lehrer Lienert und<br />
die Schule im Ibental einsetzte.<br />
Schulversäumnisse<br />
Nach der Errichtung öffentlicher Schulen und der Einführung<br />
der Schulpflicht war der Schulbesuch ein ständiges Problem<br />
für Lehrer und Behörden. Gerade im ländlichen Bereich wurden<br />
die Kinder zur Arbeit gebraucht, besonders der Weidebetrieb<br />
vom späten Frühjahr bis in den Herbst war ihnen anvertraut.<br />
Für die Eltern war die Arbeitskraft der Kinder oft wichtiger als<br />
das Lernen in der Schule.<br />
90
Um 1800 besuchten nur etwa 60% aller Schulpflichtigen den<br />
Unterricht. Jeden Tag fehlten einige Kinder. Um diesem Übel<br />
abzuhelfen, wurden Geldstrafen ausgesprochen. Lehrer und<br />
Pfarrer mussten Listen über die fehlenden Schüler führen.<br />
Das Bürgermeisteramt hatte dann die Schulstrafen für einmaliges,<br />
unentschuldigtes und unbegründetes Fehlen 3 – 6 kr bzw.<br />
Kreuzer einzuziehen.<br />
Pfarrer Franz berichtete im Jahre 1837:<br />
„Die Christenlehr-Versäumnisse wurden auf gleichem Wege und<br />
gleiche Weise wie die Schulversäumnisse nach dem Schulgesetz<br />
betätigt und ohne Nachsicht bestraft, da man die Erfahrung<br />
hinlänglich gemacht, dass alle liebreichen Ermahnungen sich<br />
meist als furchtlos erwiesen. Von 1834 bis 1837 wurden in<br />
der gesamten Pfarrei Christenlehr- und Schulstrafen von 74 fl<br />
bzw. Gulden und 32 kr bzw. Kreuzer beigetrieben und in den<br />
Stiftungsfond der betr. Gemeinde einnehmlich verrechnet. Das<br />
war ein beachtlicher Betrag!“<br />
Johann Lienert wurde Nachfolger von Joseph Heizler<br />
Am 24. Februar 1828 starb Joseph Heizler, der erste Lehrer vom<br />
Ibental. Schon während seiner Krankheit wurde der Unterricht<br />
abwechselnd von den beiden Söhnen des Lehrers Eckmann aus<br />
Buchenbach notdürftig gehalten. Im August 1828 wurde dann<br />
Johann Lienert ins Ibental versetzt. Er war 25 Jahre alt.<br />
Im Sommer 1829 beantragte Lienert die endgültige Anstellung<br />
als Lehrer und die staatliche Genehmigung zur Heirat.<br />
Damals durfte ein Lehrer nur heiraten, wenn die Behörde geprüft<br />
hatte, ob die materiellen und charakterlichen Voraussetzungen<br />
zur Gründung eines Hausstandes und einer Familie gegeben<br />
waren. Pfarrer Weltin von Buchenbach, seines Zeichens<br />
Schulinspektor, schrieb ein Zeugnis über den jungen Lehrer.<br />
Er durfte heiraten.<br />
Das Schulhaus wurde 1833 erweitert<br />
Das 1806 erbaute Schulhaus war reparaturbedürftig geworden.<br />
Die Reparaturarbeiten in Höhe von 189 fl 30 kr, wurden<br />
vom Großherzoglichen Direktorium genehmigt und bis 1828<br />
abgeschlossen. Um die Bezahlung dieser Summe entstand nun<br />
ein Rechtsstreit, der sich bis ins Jahr 1832 hinzog. Die für den<br />
Bau des ersten Schulhauses bestandenen Baupflichtigkeiten<br />
waren nicht mehr bekannt. Die Auseinandersetzungen um die<br />
Baupflicht und damit um die Übernahme der Bau- und Reparaturkosten<br />
ging bis vor das Provincialgericht in Karlsruhe, das<br />
1832 entschied:<br />
„Die Baupflicht ist geteilt:<br />
a. Die Grundherrschaft (v. Kageneck) hat alle Baumaterialien<br />
anzuschaffen.<br />
b. Die Zehntherrschaft (der Badische Staat als Rechtsnachfolger<br />
des Heitersheimer Priorats) hat die Taglöhner und Handwerker<br />
zu bezahlen.<br />
c. Die Schulgemeinde hat alle Hand- und Spannfronen zu<br />
leisten und Grund und Boden anzuschaffen.“<br />
Damit war eine wichtige Klärung erfolgt. Jetzt konnte die Gemeinde<br />
auch beginnen, das zu klein gewordene Schulhaus zu<br />
erweitern:<br />
Das Schulhaus sollte zweistöckig werden, die Lehrerwohnung<br />
sollte in den zweiten Stock kommen.<br />
Im Mai 1832 wurden die Bauarbeiten versteigert. Der Baubeginn<br />
verzögerte sich, sodass das Landamt Freyburg am<br />
31. August 1833 zum „ungesäumten Beginn der Reparation“<br />
auffordern musste. Schule und Lehrersfamilie mussten während<br />
der Bauarbeiten, die sich lange hinzogen, ausquartiert werden.<br />
Beide fanden beim Hirschenwirt Mathias Pfister Unterkunft.<br />
Man darf wohl annehmen, dass während dieser Zeit der Unterricht<br />
in der Wirtsstube abgehalten wurde.<br />
91
Frondienste für die Schule<br />
Der Bau des Schulhauses bedeutete für die Bürger der Gemeinde<br />
eine zusätzliche Arbeitsbelastung. Sie mussten die im<br />
Gerichtsurteil geforderten Hand- und Spannfronen leisten. In<br />
den Gemeindeakten von Unteribental sind genaue Listen über<br />
die Fronarbeiten der einzelnen Bürger vorhanden. Die Angaben<br />
betreffen „Mann, Pferd und Wagen“. Das Baumaterial musste<br />
z.T. von weit hergebracht werden. Es wurden Fuhren aufgezeichnet<br />
nach Heimbach, Rechtenbach, Waldau u.a. In diesem<br />
Schulhaus steckte so nicht nur der finanzielle Beitrag der Bürger<br />
durch Umlagen, sondern auch ein beträchtliches Maß an Arbeit<br />
und persönlichen Opfern.<br />
Das Ökonomiegebäude der Schule<br />
Sowohl der Pfarrer als auch der Lehrer waren in der damaligen<br />
Zeit nicht in der Lage, allein von ihrem Gehalt zu leben. Der<br />
damalige Pfarrer von Buchenbach hatte ein Ökonomiegebäude<br />
mit Stallungen, Scheune, Holzschopf usw., ebenso auch<br />
der Lehrer Lienert in Unteribental. Dieses Ökonomiegebäude<br />
neben der Schule wurde während der Bauarbeiten abgerissen.<br />
Nach der Fertigstellung des Schulhauses begann ein langer<br />
Streit um das Ökonomiegebäude. Man wurde sich nicht einig,<br />
an welchem Platz das neue Gebäude errichtet werden sollte,<br />
welche Größe es haben sollte und wer die Kosten trägt. Nach<br />
drei Jahren war immer noch nichts geschehen, sodass Pfarrer<br />
Franz nach Freiburg schreiben musste: „Da nun das Schulhaus<br />
ohne alle Ökonomiegebäude ist, und nicht einmal einen<br />
Schweinestall darbietet, so fand sich der dermalige Lehrer Lienert<br />
genötigt, seine Gaiße, die er wegen seiner starken Familie<br />
und vielen Kindern auf keinen Fall entbehren kann, in eine der<br />
unteren Kammern des Schulhauses zu stellen… Dies macht den<br />
Besitz eines Ökonomiegebäudes zum wahren Bedürfnis. Denn<br />
wer einmal kürzere oder längere Zeit gelebt hat, der wird es<br />
wohl wissen, mit welch großen Kosten der Ankauf von Milch,<br />
als eines so wichtigen Bedürfnisses für eine zahlreiche Familie<br />
mit vielen Kindern verbunden ist, und dass man dieselbe auf<br />
dem Land, wo namentlich in Heu- und Erntezeit mit allen guten<br />
Worten und Geld in der Hand, nicht erhalten kann. Oder wie<br />
will man dem Lehrer zumuten, dass er bei seiner so geringen<br />
Besoldung gerade den größten Aufwand für die unumgängliche<br />
Befriedung dieses Nahrungsmittels mache. Oder aller<br />
Bauern Knecht werde und zum größten Nachteil der Schule<br />
und des Unterrichts treulos seinem Berufe nur dem Eigennutz<br />
fröne und dem Eigensinn schlechter Eltern diene, die mit einem<br />
Hafen Milch wochenlang für ihre Kinder Ferien zu erkaufen<br />
suchen.“<br />
Der Streit zog sich hin, das Badische Hofgericht in Freiburg<br />
musste 1842 endgültig entscheiden. Ein kleines, dem früheren<br />
ähnliches Ökonomiegebäude, wurde erstellt. Damit konnte<br />
„der für die Solidität des Gebäudes offenbar sehr schädliche<br />
Unfug, dass der Lehrer ein Zimmer des Schulhauses als Stall für<br />
seine Ziege benutzte“, aufhören.<br />
Ablösung der auf dem Zehnten zu Unteribental<br />
haftenden Schulhausbaulasten<br />
Das überkommene Zehntrecht sah vor, dass die Zehntberechtigten<br />
die Kirch-, Pfarr- und Schulhäuser an den Orten zu erbauen<br />
haben, wo sie den Zehnten beziehen. Die Gemeinde Unteribental<br />
war zehntpflichtig gegenüber dem badischen Staat, der die<br />
Rechtsnachfolge des Priorats von Heitersheim angetreten hatte.<br />
Daher musste die badische Hofdomänenkammer auch die<br />
Löhne der Handwerker und Taglöhner beim Schulhauserweiterungsbau<br />
übernehmen.<br />
1833 gab der Badische Staat die Möglichkeit, den Zehnten<br />
abzulösen. Er gründete eine Zehnschuldentilgungskasse, die<br />
den Zehntpflichtigen durch Kapitalleihe helfen sollte. 1843<br />
begannen die Verhandlungen über die Ablösung der auf dem<br />
Zehnten von Unteribental haftenden Schulhausbaulasten. 1848<br />
wurde sie mit einem Ablösungsvertrag abgeschlossen, welcher<br />
festlegte, dass die Baulasten vom 20. Dezember 1847 an auf<br />
die Lastenberechtigten, die Gemeinde Unteribental, übergingen.<br />
Das Ablösungskapital wurde mit 799 fl 46 kr festgesetzt.<br />
Damit war Unteribental Eigentümer des Schulgebäudes.<br />
Die ersten 70 Jahre Schule in Unteribental<br />
Nachdem beim kath. Oberschulrat in Karlsruhe über Johann<br />
Lienert Beschwerden wegen Trinkens eingegangen sind, wurde<br />
er 1858 nach Wagensteig versetzt. Ob er sich dort gebessert<br />
92
hat, ist nicht überliefert. Joseph Heizler und Johann Lienert<br />
haben 70 Jahre lang die Geschicke der Schule in Unteribental<br />
bestimmt. Viele Schülergenerationen sind durch ihre Hände gegangen.<br />
Aus den Akten wird die Dankbarkeit der Gemeinde für<br />
die Arbeit Joseph Heizlers besonders deutlich. In einem Schreiben<br />
an die Behörde in Freiburg heißt es über den ersten Lehrer:<br />
„… Wir haben einen Mann verloren, der uns 40 Jahre seine<br />
Dienste als Lehrer widmete, derselbe war er auch zugleich<br />
Akzisor, allein es waren die Einkünfte der Lehrer besonders in<br />
unserer Gegend äußerst gering, sodass ein ordentlicher Mann<br />
ledigen Standes kaum etwas ersparen konnte, viel weniger als<br />
Familienvater, welches Joseph Heizler war. Derselbe hinterließ<br />
eine Frau mit vier noch lebenden Kindern. Gerne hätten wir<br />
seiner Familie zum Danke unserer Anerkennung für die 40-jährigen<br />
mühseligen Dienste des seeligen Heizler eine jährliche Belohnung<br />
bestimmt, allein unsere Gemeinde ist zu kraftlos, und<br />
kann mit dem besten Willen die gebührende Unterstützung<br />
nicht gewähren … Ja, 40 Jahre Dienst leisten in einer armseligen<br />
und durch den Krieg geprüften Gegend findet gewiss eine<br />
gütige Berücksichtigung, und ist ein Fall, der nicht alltäglich<br />
vorkömmt …„<br />
Unteribental, den 22sten August 1836<br />
Franz, Pfarrer<br />
gehorsamster Gemeinderat<br />
Bürgermeister Mayer<br />
GemeinteRath Vogt<br />
GemeinteRath Steinhart<br />
GemeindeRath Schlegel<br />
Zusammengetragen von Lothar Heitz<br />
Literaturverzeichnis und Quellen<br />
Akten des Gemeindearchivs Unteribental<br />
Akten des Pfarrarchivs Buchenbach<br />
Akten des Generalbundesarchivs in Karlsruhe<br />
BRAUN, St.: (Hrsg.): Memoiren des letzten Abtes von St. Peter (Ignaz Speckle) 1870<br />
GRAF, N.: Ortschronik der Gemeinde Eschbach (unveröffentlicht)<br />
HASELIER, G.: Kirchzarten 1966<br />
KÜNZLER L.: Geschichte der Höfe Unteribental (unveröffentlicht)<br />
MOSER, M.: Der Lehrerstand des 18. Jahrhunderts<br />
im vorderösterreichischen Breisgau 1908<br />
STIEFEL, K.: Baden 1648-1952, Bd. I und II 1977<br />
Die Schule von 1858 bis 1981<br />
Leitende Lehrer: 1859 – 1866 Herr ???<br />
1866 – 1876 Albert Schüle<br />
1876 – 1878 Otto Lorenz<br />
1878 – 1887 Hugo Berger<br />
1887 – 1890 Josef Spitzmüller<br />
1891 – 1909 Urban Rüttenauer<br />
1909 – 1910 Karl Winter<br />
1910 – 1911 Anton Mayer<br />
1911 – 1949 Hugo Volk<br />
1949 – 1974 Eugen Göppert<br />
Bis 1974 war die Schule immer noch eine „Einlehrerschule“<br />
in der 8 Jahrgänge in einem Klassenraum unterrichtet wurden,<br />
oft 50 bis 60 Schulkinder. Es gehörte viel Idealismus des Lehrers<br />
dazu, unter solchen Umständen zu unterrichten. Mit dem<br />
nötigen Maß an Strenge, Disziplin und Humor hat Herr Göppert<br />
diese Herkulesaufgabe sehr gut bewältigt. Neben der Vermittlung<br />
von Wissen aus dem Lehrplan, hat er den Schülern auch<br />
Unkraut jäten und Holz stapeln beigebracht. Herr Göppert<br />
persönlich heizte jede Nacht um zwei Uhr den Schulkachelofen<br />
an, damit es die Schüler im Winter schön warm hatten.<br />
Im Schuljahr 1972/73 konnten die Schüler endlich in ein neues<br />
Klassenzimmer umziehen. Dies wurde durch den Bau einer<br />
Mehrzweckhalle inkl. Kindergarten möglich gemacht. Im Zuge<br />
der Gemeindereform wurde diese Art von Schule im Sommer<br />
1974 geschlossen und Herr Göppert in den wohlverdienten<br />
Ruhestand verabschiedet.<br />
Bis der Neubau der Schule in Buchenbach fertig war, wurde<br />
Berthold Faller von 1974 – 1981 mit einer Schulklasse nach<br />
Unteribental „ausgelagert“. Danach wurde die Schule aufgelöst<br />
und der Raum dem Kindergarten Unteribental überlassen.<br />
Das alte Schulhaus befindet sich seit 1973 in Privatbesitz.<br />
93
Stübeweg 53 | 79108 Freiburg<br />
T + 49 761 559 37 - 0 | mail@frischebrueder.de<br />
www.frischebrueder.de<br />
Ihr Obst- & Gemüsespezialist<br />
REGIONAL | NATIONAL | INTERNATIONAL<br />
... verbinden Heimat & Genuss<br />
365 TAGE<br />
FRISCHE & QUALITÄT
Unsere Sportbowl<br />
Wir gratulieren dem<br />
<strong>RSV</strong> zum Jubiläum!<br />
Sportplatz Buchenbach<br />
Burger Straße 8<br />
Reservierung unter:<br />
07661 / 62 76 46<br />
wiesneck-buchenbach.de<br />
wiesneck.buchenbach<br />
Do. & Fr. ab 17.30 Uhr<br />
Sa. & So. ab 12.00 Uhr<br />
Küche:<br />
Do & Fr. 18 - 21 Uhr<br />
Sa. 14 - 21 Uhr<br />
So. 12 - 20 Uhr<br />
Fam. Helmut Löffler<br />
Ibentalstraße 38<br />
79252 Buchenbach-Unteribental<br />
Tel: 07661- 98 11 90 & 42 04<br />
Email: info@wirtshisli-hirschen.de<br />
www.wirtshisli-hirschen.de<br />
Öffnungszeiten<br />
Mittwoch bis Sonntag 11 – 24 Uhr<br />
Montag und Dienstag Ruhetag
Es war einmal…<br />
… ein Altbauer der sich von seinem 90. bis zu seinem<br />
95. Lebensjahr täglich mit einem Ochsenkarren auf die Höhe<br />
des Sommerbergs bringen ließ, um von dort zu Fuß den<br />
Gottesdienst auf dem Lindenberg zu besuchen. Zuvor hatte er<br />
jahrelang den beschwerlichen Weg vom Tal auf die Höhe zu<br />
Fuß zurückgelegt. In seinem ganzen Leben soll dieser fromme<br />
Mann nur dreimal in einem Gasthaus gewesen sein: bei seiner<br />
Hochzeit, der Hochzeit seiner Schwester und derjenigen seines<br />
Hofnachfolgers.<br />
… Tanz zur Ziehharmonika im Wirtshäusle 1888<br />
Pfarrer Weiß notierte 1889: „Voriges Jahr entdeckte ich, dass<br />
dort (beim Tanz zur Ziehharmonika im Ibentäler Wirtshäusle)<br />
sämtliche Schulkinder außer zwei, rauchen. Die männliche<br />
Jugend, selbst Kinder, sind rauflustig. Ein Mädchen von dort<br />
konnte dieses Jahr nicht zur ersten hl. Communion zugelassen<br />
werden, wegen zu großer Verkommenheit in sittlicher Hinsicht.“<br />
… der Hexentanz:<br />
In früheren Jahren hat in der Walpurgisnacht auf der Anhöhe<br />
zwischen Wagensteig und dem Ibental, beim „Schwarzwaldwägli“<br />
südwestlich vom „Rombache‘ hi:sli“, immer der Hexentanz<br />
stattgefunden. Jedermann wusste von diesem Geschehen<br />
und hat sich daher auch immer entsprechend verhalten und<br />
diesen Ort gemieden. Einer der letzten Knechte vom Falkenhof<br />
hat dieses Wissen jedoch nicht ernst genommen und musste<br />
deshalb eine böse Erfahrung machen.<br />
Zu später Stunde befand er sich auf dem Heimweg von einer<br />
Hochzeitsfeier in St. Märgen und hat der Tatsache, dass gerade<br />
Walpurgisnacht war, keine besondere Aufmerksamkeit geschenkt.<br />
Er war daher nicht wenig erstaunt, kurz vor seinem<br />
Abstieg ins Wagensteigtal plötzlich auf dem Bergkamm ein<br />
wildes Treiben zu beobachten. Aus einiger Entfernung konnte<br />
er sehr anmutig aussehende, junge Frauengestalten ganz deutlich<br />
erkennen. Bald war er von der Grazie und dem Liebreiz<br />
der Tänzerinnen derart fasziniert und hingerissen, dass er sich<br />
ihnen langsam zu nähern wagte. Was dann geschah, muss<br />
jedoch sehr schlimm gewesen sein.<br />
Denn erst bei Sonnenaufgang zu Hause angekommen, verweigerte<br />
er fortan jede nähere Auskunft über die Geschehnisse<br />
jener Nacht und machte von diesem Tage an zeitlebens immer<br />
einen großen Bogen um besagte Stelle auf der Berghöhe.<br />
96
Ibental-Lied<br />
Wo meiner Kindheit Wiege stand<br />
wo mich bewacht die Mutterhand<br />
nur dort leb ich in Glück und Ruh<br />
Oh Ibental, wie schön bist du<br />
Am steilen Hang ich träumend geh<br />
und über meine Heimat seh<br />
Da weht mir Gottes Odem zu<br />
Oh Ibental, wie schön bist du<br />
Ein Kirchlein hoch am Berge steht<br />
bewacht von Linden rank und schön<br />
von dort kommt Trost und Hilf uns zu<br />
Oh Ibental, wie schön bist du<br />
Ein Rehlein still am Waldrand äst<br />
der Jäger in sein Jagdhorn bläst<br />
Das Echo hallt ins Tal uns zu<br />
Oh Ibental, wie schön bist du<br />
Und wenn ich einmal scheiden muss<br />
sei dies mein letzter Abschiedsgruss<br />
deckt mich mit Heimaterde zu<br />
Oh Ibental, wie schön bist du<br />
Herzlichen Dank<br />
Der <strong>RSV</strong> Concordia Unteribental e.V. bedankt sich ganz<br />
herzlich bei allen, durch deren Unterstützung diese <strong>Festschrift</strong><br />
ermöglicht wurde.<br />
Unteribental, im September 2023<br />
Erhard Heizler, 1. Vorsitzender<br />
Impressum<br />
Herausgeber<br />
RadSportVerein Concordia Unteribental e.V.<br />
Redaktion<br />
Uschi Seifert<br />
Fotos<br />
Jörg Volkmann, Dieter Faller, Arthur Saier,<br />
Michael Riedinger, Gottfried Saier, Gerhard Kohler,<br />
Archiv <strong>RSV</strong>, Archiv der Gemeinde Buchenbach,<br />
Foto Bank, Thomas Eckerle, Roland Hässler, Adrian Ketterer<br />
Gestaltung<br />
Stefan Saumer, dots-da.com<br />
Druck<br />
Dreisam Druck Kirchzarten<br />
97
ER HAT VERKAUFT!<br />
SIE AUCH?<br />
Ralf Vögt<br />
www.steinhauser-bau.de<br />
Tel +49 (0) 7661 93 50-24 79199 Kirchzarten<br />
BUCHENBACH<br />
Umbau/Sanierung,<br />
Renovierung und<br />
Malerarbeiten<br />
Innenputz • Außenputz<br />
Dekorative Oberflächen<br />
Trockenbau • Wärmedämmung<br />
Gerüstbau • Fließ-Estriche<br />
PETER FISCHER- STUKKATEURMEISTER<br />
TELEFON 0 76 61-16 69 FAX 20 73<br />
info@fischer-der-stukkateur.de
GLÜCKWUNSCH ZU<br />
JAHREN<br />
RADSPORTVEREIN!<br />
TRAGWERKSPLANUNG<br />
• IM STAHLBETONFERTIGTEILBAU<br />
ZUSAMMEN MIT SPANNBETONBAU IM DIREKTEN VERBUND<br />
• INDUSTRIE- UND GEWERBEBAU<br />
• WOHNUNGSBAU UND BRÜCKENBAU<br />
WMW GMBH INGENIEURBÜRO FÜR BAUWESEN<br />
KONRAD-GOLDMANN-STRASSE 7 | 79100 FREIBURG<br />
T +49 761 7059990 | INFO@WMW-GMBH.DE | WWW.WMW-GMBH.DE