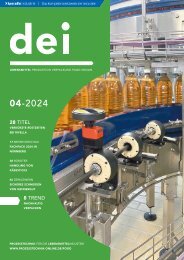KEM Konstruktion 12.2023
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Ausgabe 12 | 2023<br />
www.kem.de<br />
<strong>Konstruktion</strong><br />
Automation<br />
WIS-<br />
Konferenz<br />
Engineering 2036<br />
Nachhaltigkeit im Fokus<br />
» Seite 8<br />
Kennzahl<br />
der Nachhaltigkeit<br />
CO 2 -Footprint<br />
» Seite 14<br />
„Verantwortung für die<br />
Lieferkette übernehmen“<br />
Dr. Gunter Beitinger,<br />
Siemens Digital<br />
Industries<br />
» Seite 18<br />
Engineering-Tipps für Produkt- und Produktionsentwicklung<br />
» Im Fokus<br />
Beeinflusst Software<br />
den Energieverbrauch?<br />
» Seite 30<br />
TITELSTORY<br />
DST-Verbinder<br />
ermöglicht<br />
nachhaltigere<br />
Montage<br />
» Seite 50
Innovativ Bewegen<br />
Drahtwälzlager:<br />
Nachhaltigkeit durch Erneuerung<br />
Mit der Runderneuerung von Drahtwälzlagern Kosten & Ressourcen sparen<br />
Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung<br />
sind auch im Maschinenbau wichtige Themen.<br />
Maschinen und Komponenten instand<br />
zu setzen anstatt sie zu verschrotten ist in<br />
vielen Fällen der bessere Ansatz, um Effizienz<br />
und Rentabilität einer Produktionsanlage<br />
zu erhalten oder gar zu steigern. Franke<br />
Drahtwälzlager unterstützen Sie dabei.<br />
Oftmals genügt ein Austausch einzelner<br />
Komponenten wie Laufringe, Wälzkörper<br />
und Käfig, um das Lager wieder vollständig<br />
funktionsfähig zu machen. Das spart Zeit<br />
und Kosten und ist ein wertvoller Beitrag zur<br />
Erhaltung von Ressourcen und zur Schonung<br />
der Umwelt. Lassen Sie sich beraten!<br />
„Bei einer Drehverbindung aus dem Standardprogramm<br />
kann Refurbishing bis zu 60% günstiger sein als eine<br />
Neuanschaffung. Bei Speziallösungen ist der Effekt<br />
noch weitaus größer.“<br />
Franke GmbH, Aalen<br />
info@franke-gmbh.de
» EDITORIAL<br />
Make it right<br />
„Make it run, make it right, make it fast“ lautet in der Softwareentwicklung<br />
die Devise, wobei die Zeit häufig nur für das „Make it run“ reicht, berichtet<br />
Dr. Hans Egermeier, ein Experte für das Thema Software im Maschinenbau in<br />
unseren <strong>KEM</strong> Perspektiven (ab S. 30). Das Trendinterview verdeutlicht, welches<br />
Potential im „Make it right“ steckt – hier sinngemäß dem sauberen<br />
Coden. Nicht nur unscheinbare Kleinstprogramme, vielleicht gerade deswegen<br />
X-mal ausgeführt, können den Energieverbrauch und damit den<br />
CO 2 -Ausstoß deutlich nach oben treiben. Ein Grund mehr, sich mit den Möglichkeiten<br />
des „Green Coding“ zu beschäftigen – denn der CO 2 -Fußabdruck<br />
taucht in immer mehr Lastenheften auf.<br />
„Make it right“ ist somit auch ein Schlüssel zu mehr Nachhaltigkeit – und<br />
gerade ein Land wie Deutschland bekommt mit „mehr Energieeffizienz“ einen<br />
großen Hebel, Energie zu sparen und auch damit die Energiewende weg von<br />
fossilen Energieträgern voranzubringen. Deswegen hat sich die Redaktion der<br />
<strong>KEM</strong> <strong>Konstruktion</strong>|Automation einmal umgeschaut, welche Potentiale nicht<br />
nur der Maschinen- und Anlagenbau nutzen kann. Dazu haben wir unter anderem<br />
einen Blick auf den Begriff des CO 2 -Fußabdrucks geworfen (S. 14)<br />
und sind im <strong>KEM</strong> Porträt (S. 18) der Frage nachgegangen, was das CO 2 -<br />
Managementtool Sigreen von Siemens kann.<br />
Nachhaltigkeit ist aber weit mehr als nur die Reduzierung des Energieverbrauchs<br />
und damit des CO 2 -Footprints. So ist grüne Mobilität (S. 42) gefragt<br />
und das Beispiel der Elektrofähre Medstraum (S. 44) zeigt, dass die Verknüpfung<br />
verschiedener Verkehrsträger wichtig ist. Im Maschinenbau steckt<br />
zudem Potential, die Ressourceneffizienz zu steigern, wie unsere Titelgeschichte<br />
zeigt (S. 50). Sie steht exemplarisch dafür, dass es auch die eher<br />
unscheinbaren „Kleinteile“ sein können, mit denen sich die Bilanz nicht nur<br />
mit Blick auf die Nachhaltigkeit verbessern lässt. Vielversprechend ist auch<br />
ein Ansatz, Kunststoffabfälle wieder in Öl rückzuverwandeln, um so eine<br />
nachhaltigere Herstellung von Kunststoffen zu ermöglichen (S. 6).<br />
Mit anderen Worten: Gehen wir es an, machen wir es – Make it right.<br />
In diesem Sinne wünscht das Team der <strong>KEM</strong> <strong>Konstruktion</strong>|Automation<br />
allen Leser:innen und Geschäftspartner:innen viele Anregungen und alles<br />
Gute zum Jahreswechsel.<br />
Mehr Präzision.<br />
Hochgenaue Wegund<br />
Abstandsmessung<br />
capaNCDT<br />
• Kapazitive Sensoren für Weg, Abstand<br />
und Position<br />
• Höchste Messgenauigkeit und Stabilität<br />
• Temperaturbereich -270°C bis +200°C<br />
• Hohe Störsicherheit bei Magnetfeldern<br />
• Kundenspezifische Ausführungen für<br />
OEM und Serienintegration<br />
• Ideal für industrielle Messaufgaben:<br />
F&E, Maschinenbau und Automation<br />
Dipl.-Ing. Michael Corban<br />
Chefredakteur <strong>KEM</strong> <strong>Konstruktion</strong><br />
michael.corban@konradin.de<br />
Dickenmessung<br />
Walzenspalt-Überwachung<br />
Folgen Sie uns auch über Social Media:<br />
LinkedIn:<br />
hier.pro/WPkdG<br />
Positionierung der Waferstage<br />
Kontaktieren Sie unsere<br />
Applikationsingenieure:<br />
Tel. +49 8542 1680<br />
micro-epsilon.de/capa
» INHALT 12 | 2023 59. JAHRGANG<br />
TITELSTORY<br />
Chancen für mehr<br />
Mit den DST-Verbindern<br />
von Böllhoff der Verbindungs-<br />
Nachhaltigkeit in<br />
konnte Boge Kompressoren<br />
bei der Montage » Seite 50<br />
technik<br />
von Schalldämmhauben<br />
eine nachhaltigere Alternative<br />
zu Nietmuttern finden.<br />
Bild: Böllhoff/Konradin Mediengruppe<br />
MAGAZIN<br />
Branchennews<br />
Pre-Opening der ersten HydroPRS-Anlage 6<br />
CO 2-Fußabdruck: Ein Überblick zu Definition,<br />
Berechnung und Kritik am CO 2-Footprint, der den<br />
Einfluss eines Produktes auf das Klima beschreibt.<br />
» Seite 14<br />
IM FOKUS<br />
Green Coding: Der Energiehunger von Software<br />
wächst durch KI und Big Data. In der Programmierung<br />
schlummert aber Einsparpotential.<br />
» Seite 30<br />
Bild: Pcess609/stock.adobe.com<br />
Bild: peopleimages.com/stock.adobe.com<br />
VERANSTALTUNGSTIPP<br />
Konferenz Engineering 2036 beleuchtet Potentiale zu<br />
mehr Nachhaltigkeit in der Produktentwicklung 8<br />
Dassault Systèmes tritt dem ZVEI bei 10<br />
Joint Venture für Energie- und Ressourceneffizienz 11<br />
» TRENDS<br />
Schwerpunkt Nachhaltigkeit<br />
Die Grundlagen legen – im Engineering fallen<br />
80 % der Entscheidungen zur Nachhaltigkeit 12<br />
Hintergrund: Die Rolle des CO 2 -Fußabdrucks und<br />
seine Bedeutung als Vergleichswert 14<br />
<strong>KEM</strong> PORTRÄT<br />
Dr. Gunter Beitinger von Siemens:<br />
„Nur, was man transparent macht, kann man<br />
aktiv beeinflussen“ 18<br />
Messtechnik für die Energiewende und die<br />
Dekarbonisierung der Industrie 24<br />
Silke Bucher von Schneider Electric zur Rolle der<br />
Digitalisierung mit Blick auf die Nachhaltigkeit 27<br />
<strong>KEM</strong> PERSPEKTIVEN<br />
Green Coding in der Automatisierung 30<br />
Dr. Stefan Jörres von Phoenix Contact zu den Schritten<br />
auf dem Weg zur All Electric Society 36<br />
Energy-Harvesting versorgt IoT-Sensoren nachhaltig 40<br />
4 <strong>KEM</strong> <strong>Konstruktion</strong>|Automation » 12 | 2023
Jetzt kostenloses<br />
Whitepaper<br />
downloaden!<br />
Bild: L&T Technology Services<br />
Green Mobility: Die Dekarbonisierung des Verkehrssektors<br />
ist von großer Bedeutung, um die Auswirkungen<br />
des Klimawandels abzuschwächen.<br />
» Seite 42<br />
» TRENDS<br />
Nachhaltige Mobilität<br />
Green Mobility für eine nachhaltige Zukunft 42<br />
In Hochgeschwindigkeit emissionsfrei über den Fjord 44<br />
» WERKSTOFFE & VERFAHREN<br />
Verbindungstechnik<br />
Blindnietmuttern effizient setzen 46<br />
Der CO 2 -Footprint von Schrauben zählt 48<br />
TITELSTORY<br />
Ecotech-Service findet mit DST-Schnellbefestigern<br />
eine Alternative zu Nietmuttern 50<br />
Mit der richtigen Verbindungstechnik<br />
einfacher reparieren 54<br />
RUBRIKEN<br />
Editorial 3<br />
Wir berichten über 10<br />
Inserentenverzeichnis 58<br />
Vorschau 58<br />
Impressum 58<br />
Präzise, individuell<br />
und nachhaltig<br />
Keramik kommt zum Einsatz, wenn andere Materialien<br />
versagen. maxon entwickelt und produziert keramische<br />
Präzisionskomponenten für Ihre spezielle Anwendung.<br />
Jetzt informieren und kostenloses Whitepaper<br />
downloaden: de.maxongroup.com/ceramics/de<br />
<strong>Konstruktion</strong><br />
Automation<br />
Precision<br />
Ceramic<br />
Components<br />
FOLGEN SIE UNS AUCH ÜBER SOCIAL MEDIA:<br />
LinkedIn:<br />
hier.pro/WPkdG<br />
<strong>KEM</strong> <strong>Konstruktion</strong>|Automation » 12 | 2023 5
MAGAZIN » Branchen-News<br />
Mura Technology feiert Pre-Opening der ersten HydroPRS-Anlage<br />
Ein Schritt in Richtung Kreislaufwirtschaft<br />
Kunststoffabfälle werden nicht verbrannt, sondern in 30 min wieder zu Öl – nur mit Druck, Hitze und Wasser:<br />
Das HydroPRS-Recycling wird jetzt im kommerziellen Maßstab an den Start gehen. Mura Technology macht damit<br />
– mit Unterstützung des Investors igus – einen Schritt hin zur Kreislaufwirtschaft für Kunststoffe.<br />
Die erste HydroPRS-Kunststoff-Recyclinganlage<br />
von Mura Technology öffnete<br />
im Oktober am Industriestandort Wilton<br />
International in Teesside, Großbritannien,<br />
ihre Tore für Investoren, Partner und<br />
Befürworter, bevor die Anlage 2024 in Betrieb<br />
gehen wird. Die Anlage nutzt überkritisches<br />
Wasser (Wasser bei hoher Temperatur<br />
und hohem Druck), um Produkte wie<br />
Folien, Töpfe oder Becher aus mehrschichtigen<br />
Mischkunststoffen, die bisher als untrennbar<br />
galten, in neuwertige, recycelte<br />
Kohlenwasserstoff-Rohstoffe umzuwandeln.<br />
Diese können dann für die Herstellung<br />
neuer Kunststoffe und anderer Produkte<br />
verwendet werden. Die Kapazität der Anlage<br />
beträgt 20.000 t pro Jahr und soll pers -<br />
pektivisch auf mehr als das Dreifache erhöht<br />
werden. Bisher konnten Mischkunststoffe<br />
im mechanischen Recycling nur mit<br />
großem Aufwand sortenrein getrennt werden<br />
und landeten daher meist in der Verbrennung.<br />
Die Vorteile des neuen Recyclingverfahrens<br />
liegen auf der Hand: Durch die<br />
Rückverwandlung von Kunststoffabfällen<br />
in neue Ersatzrohstoffe geht kein<br />
Rohöl als wertvoller fossiler Rohstoff<br />
verloren. Gleichzeitig zeigen unabhängige<br />
Lebenszyklusanalysen der WMG an<br />
der University of Warwick, dass die<br />
»Durch die Rück verwandlung von<br />
Kunststoffabfällen geht kein<br />
Rohöl als wertvoller fossiler<br />
Rohstoff verloren – das ist<br />
ein echter Wendepunkt im<br />
Kunststoffrecycling, gerade<br />
für technische Kunststoffe.«<br />
Bild: igus<br />
igus-Geschäftsführer Frank Blase<br />
CO 2 -Emissionen um 80 % geringer sind<br />
als bei der Verbrennung. Im Vergleich zu<br />
fossilen Rohstoffen auf Erdölbasis erzeugt<br />
HydroPRS Produkte mit gleichem<br />
oder geringerem Treibhauspotential und<br />
spart pro Tonne verarbeiteter Kunststoffabfälle<br />
bis zu 5 Barrel Öl ein.<br />
Dank dieser Technologie kann ein und<br />
dasselbe Material unbegrenzt oft recycelt<br />
werden. Das bedeutet, dass HydroPRS<br />
das Potential hat, Einwegkunststoffe<br />
erheblich zu reduzieren und die<br />
Recyclingfähigkeit von Materialien in der<br />
Kunststoffindustrie dauerhaft zu erhö-<br />
hen. „Diese Technologie ist ein echter<br />
Wendepunkt im Kunststoffrecycling. Wir<br />
sind stolz darauf, Mura als erster Partner<br />
auf diesem Weg zu begleiten“, sagt igus-<br />
Geschäftsführer Frank Blase. Er hatte im<br />
Jahr 2019 von HydroPRS gelesen und<br />
war von der Zukunftsfähigkeit der Technologie<br />
überzeugt. igus hat mittlerweile<br />
5 Mio. Euro investiert, um Mura von der<br />
Start-up-Phase bis zur Kommerzialisierung<br />
der Technologie zu unterstützen.<br />
Als kunststoffproduzierendes Unternehmen<br />
fühlt sich igus auch dafür verantwortlich,<br />
die Umweltbilanz seiner Werkstoffe<br />
kontinuierlich zu optimieren. Die<br />
Unterstützung der HydroPRS-Technologie<br />
ist dabei nur einer von vielen Bausteinen.<br />
igus nutzt 99 % der Kunststoffabfälle<br />
aus der eigenen Produktion für<br />
neues Granulat für die Spritzgießmaschinen.<br />
2019 starteten die Kölner zudem<br />
„chainge“ – eine digitale Recycling-<br />
Plattform für ausrangierte Energieketten<br />
und andere Bauteile aus technischen<br />
Kunststoffen. Im Jahr 2022 ist die erste<br />
Energiekette aus 100 % Rezyklat entstanden.<br />
(bt)<br />
Bild: igus<br />
Die erste HydroPRS-<br />
Anlage des britischen<br />
Unternehmens Mura<br />
Technology wird in<br />
Teesside, Großbri -<br />
tannien, 2024 in<br />
Betrieb gehen.<br />
6 <strong>KEM</strong> <strong>Konstruktion</strong>|Automation » 12 | 2023
IDEEN<br />
FABRIK<br />
Aus Ideen die Lösungen entwickeln<br />
für die Elektrotechnik von morgen.<br />
woehner.com<br />
<strong>KEM</strong> <strong>Konstruktion</strong>|Automation » 12 | 2023 7
MAGAZIN » Branchen-News » Veranstaltungstipp<br />
Wie <strong>Konstruktion</strong> und Produktion im Team die Zukunft meistern können<br />
Ideen für mehr Nachhaltigkeit<br />
Fragestellungen der Nachhaltigkeit verlangen eine unternehmensweite<br />
Zusammenarbeit vom Design über die Fertigung bis zur Beschaffung. Und<br />
neben dem CO 2 -Fußabdruck gilt es weit mehr zu bedenken – etwa beim<br />
Betrieb von Produkten, Maschinen und Anlagen. Die Konferenz<br />
Engineering 2036 will Ideen für mehr Nachhaltigkeit liefern.<br />
Bild: Walter<br />
»Wie können wir auf Mond<br />
und Mars leben und dort<br />
Ressourcen nutzen, ohne auf<br />
Nachschub von der Erde<br />
angewiesen zu sein?<br />
Extreme Herausforderungen<br />
führen zu disruptiven<br />
Innovationen.«<br />
Bild: Ilya/stock.adobe.com<br />
Wissenschafts-Astronaut Prof. Ulrich Walter<br />
beleuchtet diese Fragen im Rahmen seines<br />
Impulsvortrags auf der Engineering 2036.<br />
Teamarbeit ist insbesondere über die<br />
Grenzen von <strong>Konstruktion</strong> und Fertigung<br />
hinweg gefragt – nicht zuletzt bietet<br />
hier die Digitalisierung vielfältige<br />
Chancen (genannt sei etwa der digitale<br />
Zwilling). Die Konferenz Engineering 2036<br />
greift diese Herausforderungen auf und<br />
stellt sowohl methodische Ansätze als<br />
auch praktisch verfügbare Systemlösungen<br />
und Komponenten vor.<br />
Mit Blick auf die Methodik kann das Systems<br />
Engineering eine wichtige Rolle<br />
spielen, da es hilft, die hohe Komplexität<br />
rund um die Nachhaltigkeit in den Griff<br />
zu bekommen. Denn hinter dem Begriff<br />
Revolutionäre Montagefreundlichkeit:<br />
Der VX25 im 25 mm-Maßraster<br />
Entdecken Sie die durchgängige Anreihtechnik von Rittal<br />
Entdecken Sie den VX25: Mit seinem symmetrischen Rahmenprofi l im 25 mm-Maßraster, das von allen Seiten<br />
zugänglich ist, erleben Sie mehr Montagefreundlichkeit. Unsere durchgängige Anreihtechnik für alle Anwendungsfälle<br />
sorgt für Komplexitätsreduzierung.<br />
8 <strong>KEM</strong> <strong>Konstruktion</strong>|Automation » 12 | 2023
Das vorläufige Programm der Konferenz Engineering 2036<br />
(Änderungen vorbehalten)<br />
TERMININFO<br />
Engineering 2036<br />
Konferenz für Nachhaltigkeit<br />
27./28. November 2024<br />
Arena2036, Stuttgart<br />
Mittwoch, 27. November 2024<br />
Donnerstag, 28. November 2024<br />
13:00<br />
13:15<br />
13:45<br />
14:15<br />
14:45<br />
16:15<br />
16:45<br />
17:30<br />
18:00<br />
19:00<br />
20:00<br />
bis etwa<br />
21:00<br />
22:30<br />
Begrüßung und Ausblick<br />
Nachhaltiger werden – mehr als ein Buzzword?<br />
Keynote – Die Hebel für eine nachhaltigere Produktgestaltung und<br />
-nutzung: Chancen und Möglichkeiten zu mehr Nachhaltigkeit in<br />
Engineering und Fertigung<br />
N.N., Fraunhofer IPA<br />
Impulsvortrag – Schulterschluss von <strong>Konstruktion</strong> und Produktion:<br />
Raus aus den Silos – nur die frühzeitige Teamarbeit bringt uns weiter<br />
Dr.-Ing. Walter Koch, Vorsitzender der Gesellschaft für<br />
Systems Engineering – GfSE e.V.<br />
Pause<br />
Parallele Sessions<br />
Podium A: Circular Economy<br />
Podium B: Auf Kundenwünsche eingehen<br />
Pause<br />
Pitches zu 10 Produkt- und Lösungsansätzen für mehr<br />
Nachhaltigkeit in der Produktentwicklung und Fertigung<br />
Individuelle Gespräche mit den beteiligten Unternehmen und<br />
Besuch der Fachausstellung<br />
Führung durch die Arena2036<br />
(nach Anmeldung)<br />
Beginn der Abendveranstaltung mit Abendessen in der Arena2036<br />
Impulsvortrag<br />
Leben im Weltraum – Treiber innovativer Kreislaufwirtschaft<br />
Extreme Herausforderungen treiben disruptive Innovationen<br />
Univ.-Prof. Ulrich Walter, Diplom-Physiker und Wissenschafts-Astronaut<br />
Ende der Abendveranstaltung<br />
09:30<br />
09:45<br />
10:15<br />
10:45<br />
11:15<br />
12:45<br />
14:00<br />
14:30<br />
15:00<br />
ab 15:30<br />
Begrüßung und Ausblick<br />
Tipps für die Realisierung von mehr Nachhaltigkeit und<br />
neue Tools in der Praxis<br />
Keynote – Komplexität managen:<br />
Advanced Systems Engineering und Künstliche Intelligenz (KI)<br />
Prof. Dr.-Ing. Roman Dumitrescu,<br />
Direktor am Fraunhofer IEM und Geschäftsführer it‘s OWL<br />
Impulsvortrag – Produktentwicklung im Maschinen- und Anlagenbau:<br />
Lastenheft vs. Scrum – zielorientiert agil entwickeln, aber wie?<br />
Dr.-Ing. Hans Egermeier, lean·digital·transformation<br />
Pause<br />
Parallele Sessions<br />
Podium A: Nachhaltigkeit in der Praxis<br />
Podium B: Energie im Griff<br />
Mittagspause<br />
Impulsvortrag – Software als Schlüsseldisziplin:<br />
Alles im Blick und im Griff mit dem Composable Enterprise<br />
Prof. Dr. August-Wilhelm Scheer, Scheer PAS<br />
Abschlussvortrag – Alles eine Frage der Energie:<br />
Energie ist mehr als nur Strom – aber nur regenerative Quellen<br />
bringen uns weiter<br />
(N.N., Fraunhofer IPA)<br />
Pause<br />
Möglichkeit zur Teilnahme an Institutsführungen am Fraunhofer IPA<br />
(nach Möglichkeit und Anmeldung)<br />
steht weit mehr als nur der CO 2 -Fußabdruck.<br />
Die Wahl der zum Einsatz kommenden<br />
Technik und Materialien sowie<br />
der Betrieb von Produkten, Maschinen<br />
und Anlagen wollen betrachtet werden.<br />
Die Engineering 2036 liefert dazu Knowhow<br />
und Ideen für mehr Nachhaltigkeit –<br />
trotz des Veranstaltungsortes Stuttgart<br />
nicht nur aus dem Land der Tüftler und<br />
Denker.<br />
INFO<br />
Weitere Infos zur Konferenz<br />
Engineering 2026:<br />
hier.pro/4YH45<br />
Erfahren Sie mehr:<br />
www.rittal.de/VX25<br />
<strong>KEM</strong> <strong>Konstruktion</strong>|Automation » 12 | 2023 9
MAGAZIN » Branchen-News<br />
Netzwerk will Innovationen fördern<br />
Dassault Systèmes tritt dem ZVEI bei<br />
Dassault Systèmes ist dem Verband der<br />
Elektro- und Digitalindustrie (ZVEI) beigetreten.<br />
Dominic Kurtaz, Managing Director<br />
EuroCentral bei Dassault Systèmes, und Dr.<br />
Gunther Kegel, Präsident des ZVEI, verkündeten<br />
die Mitgliedschaft in Darmstadt auf<br />
der 3DExperience Conference von Dassault<br />
Systèmes. Ziel des Beitritts ist es, gemeinsam<br />
mit dem Netzwerk Innovationen in<br />
der Branche voranzutreiben.<br />
Dassault Systèmes trägt zur Entwicklung<br />
mit Lösungen auf der 3DExperience Plattform<br />
bei, teilt branchenübergreifende Expertise<br />
und gestaltet Fortschritte in der<br />
Fertigung sowie innovative Geschäftsmodelle<br />
mit. Im Rahmen der Mitgliedschaft<br />
wird sich Dassault Systèmes auch in die<br />
Gremienarbeit des Verbands mit Fokus<br />
auf Automatisierung und Manufacturing-X<br />
einbringen.<br />
(bt)<br />
Dominic Kurtaz, Dassault Systèmes (li.), und<br />
Dr. Gunther Kegel, ZVEI (re.), verkünden auf<br />
der 3DExperience Conference den Beitritt von<br />
Dassault Systèmes in den ZVEI.<br />
Bild: Dassault Système<br />
Hannover Messe veranstaltet erstmals KI-Konferenz für die Industrie<br />
KI in der Industrie stellt besondere Anforderungen<br />
Die Konferenz „KI in der Industrie“ findet am<br />
24. Januar 2024 in Frankfurt am Main statt.<br />
Bild: lassedesignen/stock.adobe.com<br />
Die Konferenz „KI in der Industrie“ findet<br />
am 24. Januar 2024 in der Maindock<br />
Eventlocation in Frankfurt am Main statt.<br />
Dort erklären Experten in drei Sessions<br />
anhand von Use Cases, wie KI die Industrie<br />
verändern wird und welche Schritte<br />
erforderlich sind, um wettbewerbsfähig<br />
zu bleiben. Bereits jedes dritte Industrieunternehmen<br />
setzt Künstliche Intelligenz<br />
ein oder plant den Einsatz. Das<br />
wurde auf der Hannover Messe 2023<br />
deutlich, wo das Thema KI, angefacht<br />
durch den Hype um ChatGPT, diskutiert<br />
wurde.<br />
Aber KI in der Industrie ist mehr als ein<br />
riesiges Sprachmodell und stellt besondere<br />
Anforderungen. Die Industrie fragt sich,<br />
wie Geschäftsideen aussehen, wie trainierte<br />
Modelle deployt werden oder wer<br />
die MLOps verantwortet. „Dort setzen wir<br />
mit unserer KI-Konferenz an und bieten<br />
den Teilnehmenden die Möglichkeit, in<br />
kleinen Gruppen mit Experten zu diskutieren,<br />
Fragen zu stellen und die eigenen<br />
Netzwerke zu erweitern“, sagt Hubertus<br />
von Monschaw, Global Director Trade Fair<br />
and Product Management Hannover Messe<br />
bei der Deutschen Messe AG. (bec)<br />
Wir berichten über<br />
AMPower .................................................................................. 14<br />
Arnold Umformtechnik ...................................................... 48<br />
BDI .............................................................................................. 54<br />
Beckhoff ................................................................................... 30<br />
BMW .......................................................................................... 54<br />
Boge ........................................................................................... 50<br />
Böllhoff .............................................................................. 46, 50<br />
Bundesumweltministerium .............................................. 14<br />
ConPlusUltra ........................................................................... 14<br />
Dassault Systèmes ................................................................ 10<br />
Effizienz-Agentur NRW ...................................................... 14<br />
Endress+Hauser .............................................................. 11, 24<br />
Faber Castell ............................................................................ 14<br />
Fraba .......................................................................................... 40<br />
Fraunhofer IPK ....................................................................... 12<br />
Fraunhofer IAO ...................................................................... 44<br />
Fraunhofer IEM ...................................................................... 44<br />
Greenhouse Gas Protocol .................................................. 14<br />
Hannover Messe .................................................................... 10<br />
HSVA .......................................................................................... 44<br />
igus ................................................................................................ 6<br />
IINAS .......................................................................................... 14<br />
Kolumbus ................................................................................. 44<br />
L&T Technology Services .................................................... 42<br />
Massachusetts Institute of Technology (MIT)...........<br />
14<br />
Max-Planck-Gesellschaft .................................................. 14<br />
Merck ......................................................................................... 14<br />
Mura Technology ..................................................................... 6<br />
Nationale Klimaschutzinitiative ...................................... 12<br />
Phoenix Contact .................................................................... 36<br />
Posital ........................................................................................ 40<br />
SAP .............................................................................................. 14<br />
Schneider Electric ................................................................. 27<br />
Sick .............................................................................................. 11<br />
Siemens ...................................................................... 14, 18, 30<br />
SimaPro ..................................................................................... 14<br />
Systain Consulting ............................................................... 14<br />
Talsen Team ............................................................................. 30<br />
Thinktank Industrielle Ressourcenstrategien ............ 14<br />
TU München ............................................................................ 14<br />
TÜV Süd .................................................................................... 14<br />
Ubito .......................................................................................... 40<br />
Universität Wien ................................................................... 54<br />
World Resources Institute ................................................. 14<br />
ZUG ............................................................................................. 12<br />
ZVEI ..................................................................................... 10, 14<br />
10 <strong>KEM</strong> <strong>Konstruktion</strong>|Automation » 12 | 2023
Sick und Endress+Hauser stärken das Geschäftsfeld Prozessautomation<br />
Joint Venture für Energie- und Ressourceneffizienz<br />
Um ihre Kunden bei wichtigen Themen wie Energie- und Ressourceneffizienz<br />
sowie Klima- und Umweltschutz noch besser zu unterstützen, bündeln die beiden<br />
Unternehmen Sick und Endress+Hauser ihre Kräfte. Das deutsche Sensorunternehmen<br />
und der Schweizer Mess- und Automatisierungstechnik-Spezialist<br />
streben eine strategische Partnerschaft für das Geschäftsfeld Prozessautomation<br />
von Sick an und haben dafür eine gemeinsame Absichtserklärung unterzeichnet.<br />
Ziel der Partnerschaft ist, das Angebot von Endress+Hauser um<br />
die Prozessanalyse- und Gas-Durchflussmesstechnik von Sick zu erweitern.<br />
Geplant sind zudem folgende Maßnahmen:<br />
• Für die Produktion und<br />
Weiterentwicklung der<br />
Sick-Prozesstechnik wollen<br />
die beiden Unternehmen<br />
ein Joint Venture<br />
gründen.<br />
• Die Verkaufs- und Serviceteams<br />
des Sick-Geschäftsbereichs<br />
Prozessautomation<br />
sollen Teil des globalen<br />
Endress+Hauser Vertriebsnetzwerks<br />
werden.<br />
Schon bisher haben die Firmen<br />
immer wieder auftrags-,<br />
projekt- und kundenbezogen<br />
zusammengearbeitet. Beide<br />
Gesellschafterfamilien sowie<br />
die jeweiligen Aufsichtsgremien<br />
von Sick und Endress+Hauser<br />
stehen hinter<br />
dem Vorhaben einer strategischen<br />
Partnerschaft. Auf Basis<br />
der Absichtserklärung<br />
(Memorandum of Understanding)<br />
prüfen nun die<br />
Fachleute beider Seiten im<br />
Rahmen einer Due Diligence,<br />
wie die Zusammenarbeit verwirklicht<br />
und zum Erfolg geführt<br />
werden kann. Zu einer<br />
Vertragsunterzeichnung soll<br />
es noch im ersten Quartal<br />
2024 kommen; der Vollzug<br />
ist für Mitte nächsten Jahres<br />
geplant. Das Kerngeschäft<br />
der Fabrik- und Logistikautomation,<br />
in dem Sick über 80<br />
Prozent des Umsatzes generiert,<br />
bleibt von der strategischen<br />
Partnerschaft unberührt.<br />
(eve)<br />
INDUSTRIAL<br />
POWERISE ®<br />
Prozessmesstechnik spielt eine zentrale Rolle bei Energieund<br />
Ressourceneffizienz sowie Klima- und Umweltschutz.<br />
POWER MEETS CONTROL<br />
INDUSTRIAL POWERISE ® – DIE NEUE KLASSE<br />
ELEKTROMECHANISCHER ANTRIEBE<br />
• Schlankes Design und wartungsfreier Betrieb<br />
• Einzigartige Kombination mit Gasfeder möglich<br />
• Application Engineering für individuelle<br />
Anpassung<br />
• Millionenfache Erfahrung aus der<br />
Automobilindustrie<br />
SCAN HERE<br />
FOR MORE<br />
INFORMATION:<br />
Bild: Endress+Hauser<br />
YOUR MOTION. OUR SOLUTION.<br />
Stabilus GmbH · industrial.powerise@stabilus.com <strong>KEM</strong> <strong>Konstruktion</strong>|Automation · www.stabilus.com » 12 | 2023 11
TRENDS » Interview » Nachhaltigkeit<br />
Den Grundstein für eine ganzheitliche Nachhaltigkeitsbetrachtung legen<br />
„Frühzeitig beginnen – im Engineering<br />
fallen 80 % der Entscheidungen“<br />
Welchen Einfluss hat die Produktentwicklung auf die Nachhaltigkeit? Dieser Fragestellung ist Thomas<br />
Kruschke als wissenschaftlicher Mitarbeiter der Abteilung ‚Nachhaltige Produkt-Ökosysteme‘ des Fraun -<br />
hofer-Instituts für Produktionsanlagen und <strong>Konstruktion</strong>stechnik IPK in Berlin bis Juli 2023 nachgegangen.<br />
Seine Antwort ist klar: Engineering und <strong>Konstruktion</strong> haben es in der Hand, für mehr Nachhaltigkeit<br />
zu sorgen. Dabei gilt: Je früher, desto besser – Informationen sind entscheidend. Kruschke arbeitet heute<br />
als fachlicher Projektmanager bei der gemeinnützigen Zukunft – Umwelt – Gesellschaft (ZUG) gGmbH<br />
in Berlin im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative (NKI).<br />
Interview: Michael Corban, Chefredakteur <strong>KEM</strong> <strong>Konstruktion</strong>|Automation<br />
<strong>KEM</strong> <strong>Konstruktion</strong>|Automation:<br />
Kann die Produktentwicklung dazu<br />
beitragen, nachhaltigere Produkte<br />
zu entwerfen? Und gelingt<br />
es dabei, den Blick über<br />
den CO 2 -Fußabdruck der eigenen<br />
Fertigung auf den Einsatz<br />
der Produkte zu legen?<br />
Thomas Kruschke: Einer der wesentlichen<br />
Gestaltungshebel liegt darin, Produkte<br />
zu modularisieren und für eine bessere<br />
Demontage- und Recycling-Fähigkeit<br />
zu sorgen. Im Fokus muss immer ein möglichst<br />
ressourcenschonender Umgang entlang<br />
des gesamten Produktlebenszyklus<br />
stehen. Das bedeutet, dass in jeder Lebenszyklusphase<br />
die Potenziale zur Operationalisierung<br />
der 9R-Strategien (Refuse, Re -<br />
think, Reduce, Reuse, Repair, Refurbish,<br />
Remanufacture, Repurpose, Recycle – Potting<br />
et al. 17) ausgeschöpft werden.<br />
Entscheidend ist aber auch, dass wir als<br />
Produktentwickler die Chance haben, die<br />
ökologische Dimension unserer Entscheidungen<br />
nachvollziehen zu können. Über eine<br />
Lebenszyklusanalyse (Life Cycle Assesment<br />
– LCA) kann ich mir diese Informationen<br />
beschaffen. Dabei gilt: Je früher, desto<br />
besser. Je früher ich diese Analyse durchführe,<br />
desto mehr kann ich Emissionen reduzieren<br />
und damit nachhaltigere Produkte<br />
entwickeln. Digitale Zwillinge können<br />
dann produktindividuell und nachvollziehbar<br />
Erkenntnisse liefern, wie nachhaltig<br />
Bild: Kruschke<br />
das jeweilige Produkt ist – auch über den<br />
CO 2 -Footprint hinaus. Sie unterstützen bei<br />
Entscheidungen während der Auslegung<br />
des Produkts und der Gestaltung der Produktionsprozesse<br />
genauso wie im Bereich<br />
After Sales oder bei der Wartung der Systeme,<br />
indem mögliche Optimierungsmaßnahmen<br />
aufgezeigt werden. Und: Am Ende<br />
des Produktlebens stellen sie produktspezifische<br />
Informationen zu dessen Demontage<br />
und Verwertungspotentialen zur Verfügung<br />
– das erleichtert die Wiederverwendung<br />
sowie Remanufacturing oder Recycling.<br />
<strong>KEM</strong> <strong>Konstruktion</strong>|Automation: Können<br />
Sie kurz den Ablauf eines Life Cycle Assessments<br />
erläutern?<br />
Kruschke: Zu Beginn werden zunächst die<br />
Systemgrenzen festgelegt, wobei im Sinne<br />
einer Kreislaufwirtschaft bevorzugt eine<br />
Betrachtung ‚von der Wiege bis zur Wiege‘<br />
»Digitale Zwillinge unterstützen bei<br />
Entscheidungen über den Lebenszyklus<br />
hinweg – und stellen am Ende<br />
produktspezifische Informationen<br />
zu Wiederverwendung sowie Remanufacturing<br />
oder Recycling bereit.«<br />
Thomas Kruschke, heute fachlicher Projektmanager bei der<br />
ZUG gGmbH in Berlin/Nationale Klimaschutzinitiative (NKI)<br />
– Cradle to Cradle – gewählt werden sollte.<br />
Cradle to Gate würde nur die Herstellung<br />
des Produktes umfassen, nicht den Betrieb;<br />
Cradle to Grave würde die Entsorgung beinhalten.<br />
Im zweiten Schritt geht es dann<br />
darum, sämtliche Umweltwirkungen innerhalb<br />
dieser Grenzen zu erfassen – neben<br />
der Produktion dann eben auch über die<br />
Nutzungsphase hinweg bis zur Entsorgung,<br />
idealerweise dem Recycling.<br />
Das ist eine große Aufgabe – aber im Engineering<br />
werden 80 % aller Entscheidungen<br />
getroffen, die das Produkt und damit auch<br />
seine Nachhaltigkeit definieren. Deswegen<br />
ist es aus der ökonomischen Perspektive<br />
sinnvoll, sich frühzeitig auch mit den Umweltwirkungen<br />
zu beschäftigen – viele<br />
Entscheidungen lassen sich später nicht<br />
mehr rückgängig machen und spätere Änderungen<br />
verursachen hohe Kosten. Das<br />
gilt nicht nur für die Produktentwicklung<br />
im Allgemeinen, sondern insbesondere<br />
12 <strong>KEM</strong> <strong>Konstruktion</strong>|Automation » 12 | 2023
auch mit Blick auf die ansteigenden Nachhaltigkeitsanforderungen.<br />
<strong>KEM</strong> <strong>Konstruktion</strong>|Automation: Lassen<br />
sich denn die Systemgrenzen immer sinnvoll<br />
legen und wie kommt man an all die<br />
Daten, um ein LCA durchzuführen?<br />
Veranstaltungstipp:<br />
Engineering 2036<br />
Engineering 2036: Konferenz für<br />
nachhaltige Produktentwicklung<br />
Aufzuzeigen, welche Rolle die<br />
Produktentwicklung mit Blick auf<br />
nachhaltigere Produkte spielen kann,<br />
ist Ziel der Engineering 2036. Die<br />
Konferenz findet am 27./28. November<br />
2024 in der Arena2036 in<br />
Stuttgart statt. Veranstalter ist die<br />
<strong>KEM</strong> <strong>Konstruktion</strong>|Automation, unterstützt<br />
von der Schwesterzeitschrift<br />
Industrieanzeiger und dem Fraunhofer<br />
IPA. Mehr dazu finden Sie in<br />
dieser Ausgabe in der Vorschau auf<br />
S. 8 und online hier:<br />
hier.pro/4YH45<br />
Bild: Ilya/stock.adobe.com<br />
Kruschke: Die Grenzen müssen passend<br />
gewählt sein! Ist zum Betrieb eines Produktes<br />
eine Server-Infrastruktur erforderlich,<br />
muss diese selbstredend mit betrachtet<br />
werden. Nur wenn ich alle Stoff- und<br />
Energieströme im Produktlebenszyklus erfasse,<br />
komme ich zu den gewünschten<br />
Aussagen etwa mit Blick auf den<br />
CO 2 -Footprint. Die DIN EN ISO 14044 (Umweltmanagement<br />
– Ökobilanz – Anforderungen<br />
und Anleitungen) liefert hier eine<br />
standardisierte und genormte Vorgehensweise<br />
zur Bewertung der Nachhaltigkeit<br />
von Produkten anhand verschiedener Wirkkategorien.<br />
Daten liefern zudem eine Reihe<br />
von Life-Cycle-Inventory-Datenbanken –<br />
auch wenn es hier noch die ein oder andere<br />
Informationslücke gibt. Bezüglich der Materialien<br />
ist die Datenlage gut, bei den<br />
Produk tionsprozessen weniger und bezüglich<br />
der End-of-Life-Phase und der Betrachtung<br />
von multiplen Produktlebenszyklen<br />
gibt es noch Nachholbedarf. Des Weiteren<br />
stellen fehlende Informationen bei<br />
Buy-Entscheidungen eine große Herausforderung<br />
dar.<br />
<strong>KEM</strong> <strong>Konstruktion</strong>|Automation: Und mit<br />
diesen Daten kommen die eingangs erwähnten<br />
digitalen Zwillinge zum Einsatz?<br />
Kruschke: Genau – aber nur, wenn das jeweilige<br />
Produkt sich für den Einsatz eines<br />
digitalen Zwillings eignet. Da der Aufwand,<br />
der mit der Einführung eines digitalen<br />
Zwillings zusammenhängt, gegenüber dem<br />
Nutzen – also dem Unterstützen zur Operationalisierung<br />
der 9R-Strategien –, nicht<br />
zwangsläufig zu einer Reduktion der Umweltauswirkungen<br />
führt. Generell gilt es,<br />
zwischen einem konventionellen und einem<br />
digitalen Weg abzuwägen. Der Nutzen<br />
des digitalen Zwillings ist vor allem, Informationen<br />
über den Produktlebenszyklus<br />
hinweg zur Verfügung zu stellen – und das<br />
erleichtert am Ende dann den Einstieg in<br />
die Kreislaufwirtschaft. Gerade in der Produktentwicklung<br />
könnten digitale Zwillinge<br />
aber auch helfen, die Transparenz über<br />
die Umweltauswirkungen zu erhöhen.<br />
<strong>KEM</strong> <strong>Konstruktion</strong>|Automation: Wollen<br />
Sie das kurz erläutern?<br />
Kruschke: Das Ziel ist ja, frühzeitig zu erkennen,<br />
welche Entscheidungen welche<br />
Auswirkungen haben – denn die Entscheidungen<br />
in der Produktentwicklung wirken<br />
ja über den gesamten Produkt lebenszyklus<br />
hinweg. Wenn wir künftig also Cradle to<br />
Cradle denken, kommt der Qualität der zugrundeliegenden<br />
Datenbanken eine hohe<br />
Bedeutung zu. Begleiten digitale Zwillinge<br />
ein Produkt lebenslang, kann man Daten<br />
im Feld erfassen und mit ihnen die Qualität<br />
der Datenbanken für eine fundierte Lebenszyklusanalyse<br />
nach und nach steigern.<br />
www.ipk.fraunhofer.de; www.klimaschutz.de<br />
Innovation im<br />
optimalen<br />
Rahmen<br />
Da stecken maximale<br />
Flexibilität, Zeitersparnis<br />
sowie höchster<br />
Montagekomfort drin.<br />
Unsere KDSI-SR Schraubrahmen<br />
im Baukasten-System (Inlay &<br />
Dichtelement) für Schaltschrank,<br />
Gehäuse oder Maschine. Kabelmanagement<br />
auf innovative Art:<br />
sicher, schnell und<br />
kinderleicht.<br />
Hier kostenloses<br />
<strong>KEM</strong> <strong>Konstruktion</strong>|Automation » 12 | 2023<br />
Muster anfordern:<br />
13
Produkte möglichst grün zu machen, wird künftig immer stärker gefordert sein. Daher müssen Unternehmen wissen, wo welche Emissionen entstehen –<br />
insbesondere mit Blick auf den CO 2-Fußabdruck.<br />
Was kann der CO 2 -Fußabdruck – und was nicht?<br />
Kennzahl und Stellschraube<br />
der Nachhaltigkeit<br />
Der CO 2 -Fußabdruck wurde ursprünglich von der Ölindustrie eingeführt, um den<br />
Fokus weg von der Industrie auf die Verbraucher zu lenken. Gleichwohl liefert die<br />
Angabe einen Vergleichswert, welchen Einfluss ein Produkt auf das Klima hat.<br />
Ein Überblick zu Definition, Berechnung und Kritik am CO 2 -Footprint.<br />
IM ÜBERBLICK<br />
Was steckt hinter dem<br />
CO 2 -Fußabdruck und warum<br />
wurde er etabliert? Eine<br />
Übersicht zu Hintergründen,<br />
der Berechnung und<br />
Kritik.<br />
Tobias Meyer, freier Mitarbeiter der <strong>KEM</strong> <strong>Konstruktion</strong>|Automation<br />
14 <strong>KEM</strong> <strong>Konstruktion</strong>|Automation » 12 | 2023
Nachhaltigkeit « TRENDS<br />
Bild: Pcess609/stock.adobe.com<br />
Laut Sandra Gottschall, Projektleiterin<br />
Klimaneutralität beim Beratungsunternehmen<br />
ConPlusUltra, zeigt der Carbon<br />
Footprint Emissions-Hotspots und<br />
Optimierungspotentiale auf: „Mit ihm<br />
geht man auf Entdeckungsreise im eigenen<br />
Unternehmen, bei den Lieferantenbetrieben<br />
sowie bei Kundinnen und Kunden.<br />
Es werden keine nutzlosen Datenfriedhöfe<br />
geschaffen, sondern nützliche Informationen<br />
für die Produktentwicklung,<br />
den Einkauf, die Produktion, Marketing<br />
und für den Verkauf generiert. Umweltfreundlichkeit<br />
und Nachhaltigkeit sind die<br />
Standards der Zukunft und werden massive<br />
Wettbewerbsvorteile generieren.“<br />
Woher stammt der Begriff<br />
CO 2 -Fußabdruck?<br />
Der Ölindustrie startete vor etwa 20 Jahren<br />
eine Werbekampagne, die den Begriff<br />
CO 2 -Fußabdruck beziehungsweise -Footprint<br />
erstmals einführte. 2004 wurde<br />
auch ein entsprechender Rechner online<br />
gestellt, mit dem jeder seinen persönlichen<br />
Einfluss auf den Klimawandel ermitteln<br />
konnte. Damit gelang eine Wahrnehmungsverschiebung:<br />
Statt der bis dato<br />
vor allem für den Klimawandel getadelten<br />
Fossilenergiekonzerne fühlte sich nun der<br />
Bürger selbst verantwortlich. Der<br />
CO 2 -Footprint gilt aber inzwischen als eine<br />
der wichtigsten Größen, wenn es darum<br />
geht, den Einfluss eines Produktes<br />
auf den Klimawandel zu beziffern.<br />
Wie berechnet man den<br />
CO 2 -Fußabdruck?<br />
Das Greenhouse Gas Protocol (GHG) ist<br />
eine der am häufigsten angewandten<br />
Methoden zur Bestimmung des CO 2 -Fußabdrucks.<br />
Die Entwicklung wird vom<br />
World Resources Institute (WRI) und dem<br />
World Business Council for Sustainable<br />
Development (WBCSD) koordiniert. Zahlreiche<br />
weitere Standards bauen darauf<br />
auf, unter anderem auch die Norm ISO<br />
14067 zur Bilanzierung des CO 2 -Fußabdrucks<br />
von Produkten. Außerdem relevant<br />
sind die ISO 14040 (komplette Lebenszyklusanalyse)<br />
sowie produktgruppenspezifische<br />
Normen: Die IEC 63372 etwa zielt<br />
speziell auf elektrische und elektronische<br />
Produkte. Laut ZVEI wird bei der Analyse<br />
der existierenden Normen und Standards<br />
schnell deutlich, dass aktuell ein einheitlicher<br />
Rahmen fehlt. Letzterer sei erforderlich,<br />
um eine Validität der Vergleichbarkeit<br />
der ermittelten Werte für den<br />
CO 2 -Fußabdruck sicherzustellen.<br />
Die Formel für den CO 2 -Fußabdruck ist<br />
einfach zu überblicken und lautet:<br />
Verbrauchswert (etwa Gas in kWh,<br />
Lkw-Transportvolumen in tkm oder<br />
Bürofläche in m 2 ) × Emissionsfaktor<br />
(t CO 2 e pro kWh / tkm / m 2 )<br />
= Emissionslast (in t CO 2 e).<br />
Die Verbrauchswerte bekommen Unternehmen<br />
aus ihren Unterlagen – abhängig<br />
davon, wie viel Gas, Öl oder andere rele-<br />
vante Stoffe verbraucht wurden. Der<br />
Emissionsfaktor wird von Organisationen<br />
wie dem Internationalen Institut für<br />
Nachhaltigkeitsanalysen und -strategien<br />
IINAS heraus gegeben und kann etwa in<br />
der Datenbank ProBas (Prozessorientierte<br />
Basisdaten für Umweltmanagement-Instrumente)<br />
des Bundesumweltministeriums<br />
(BMUV) abgerufen werden.<br />
Häufig werden Durchschnittswerte für<br />
Industriezweige herangezogen, was auch<br />
Kalkulationen erlaubt, wenn man selbst<br />
keine individuellen Werte für seine Anlagen<br />
kennt. Das GHG empfiehlt jedoch wo<br />
immer möglich die Verwendung der eigenen<br />
Werte. Neben Kohlendioxid befeuern<br />
auch noch andere Stoffe den Klimawandel<br />
beziehungsweise den Treibhauseffekt,<br />
weshalb auch diese in die entsprechende<br />
Berechnung einfließen – auch wenn der<br />
Name des Fußabdrucks nur auf CO 2 anspielt.<br />
Daher können die Einflüsse der<br />
ebenfalls relevanten Stoffe in sogenannte<br />
CO 2 -Äquivalente (CO 2 e) umgerechnet<br />
werden. Man spricht dann vom Treibhauspotential<br />
des jeweiligen Stoffes.<br />
Was sind Scope-1-, -2- und -3-<br />
Emissionen?<br />
Das Greenhouse Gas Protocol (GHG) unterscheidet<br />
drei Klassen der Emissionen:<br />
• Scope 1: Direkte CO 2 -Emissionen an<br />
eigenen Standorten, sprich wenn direkt<br />
selbst Kohlendioxid freigesetzt wird.<br />
Dazu gehören etwa Gas-betriebene<br />
Anlagen als Teil der Produktion oder<br />
auch Heizung und Dieselgeneratoren.<br />
• Scope 2: Indirekte CO 2 -Emissionen,<br />
die bei Energieversorgern etwa durch<br />
deren Stromerzeugung entstehen.<br />
• Scope 3: Alle anderen CO 2 -Emissionen,<br />
die entlang der Wertschöpfungskette<br />
verursacht werden (zum Beispiel bei<br />
Lieferanten, für den Transport, während<br />
der Nutzungsphase des Produkts<br />
und für die Entsorgung).<br />
Scope 3 ist derzeit eine optionale Kategorie,<br />
die in den von Unternehmen bereitgestellten<br />
Berichten nicht verpflichtend angegeben<br />
werden muss. Der überwiegende<br />
Teil der produktbedingten Emissionen<br />
entsteht jedoch in der Lieferkette. Um<br />
diese messbar zu machen, ist eine Zusammenarbeit<br />
entlang oftmals komplexer und<br />
<strong>KEM</strong> <strong>Konstruktion</strong>|Automation » 12 | 2023 15
TRENDS » Nachhaltigkeit<br />
Bild: Siddharth/stock.adobe.com<br />
Das Greenhouse Gas Protocol (GHG) teilt Emissionen in drei Gruppen (Scopes): eigener Ausstoß, zugekaufte<br />
Energie sowie Lieferkette, Nutzung und Entsorgung.<br />
branchenübergreifender Lieferketten erforderlich.<br />
Bisher wird daher – wie oben<br />
schon erwähnt – häufig mit industrieweiten<br />
Durchschnittswerten für Prozesse kalkuliert.<br />
Nutzt ein Zulieferer aber beispielsweise<br />
selbsterzeugten Solarstrom<br />
oder regeneriert seine Abwärme geschickt,<br />
hat sein Produkt eventuell einen<br />
niedrigeren CO 2 -Fußabdruck als die Ware<br />
der Konkurrenz. Damit das auch der Kunde<br />
in seine CO 2 -Bilanz einfließen lassen<br />
kann, muss man ihm solche Daten mitteilen<br />
– was bisher kaum gemacht wird.<br />
Die derzeitige Praxis ist vielmehr die, dass<br />
Hersteller beispielsweise Computer-Chips<br />
in Asien zukaufen und den Scope 3 dann<br />
mit den Durchschnittswerten für die<br />
Chipproduktion aus einer Datenbank angeben.<br />
Daher initiierte Siemens 2021 das<br />
offene Estainium-Netzwerk, mit dem<br />
Hersteller, Lieferanten, Kunden und Partner<br />
Daten zum CO 2 -Fußabdruck vertraulich<br />
austauschen können. Dadurch werden<br />
die bereitgestellten Daten verifiziert<br />
und somit die vertrauenswürdige Aggregation<br />
eines CO 2 -Fußabdrucks über die<br />
gesamte Lieferkette ermöglicht – ohne<br />
dass die beteiligten Unternehmen strategisch<br />
relevante Informationen, beispielsweise<br />
über ihre Lieferketten, offenlegen<br />
müssen. Weitere Gründungsmitglieder<br />
sind Weidmüller, Merck, Faber Castell<br />
sowie der TÜV Süd und mehrere Forschungsinstitute.<br />
Welche Tools gibt es zur<br />
Berechnung des CO 2 -Footprints?<br />
Generell kann der CO 2 -Fußabdruck im<br />
Unternehmen komplett selbst kalkuliert<br />
werden, was entsprechende personelle<br />
Kapazitäten und Kompetenzen voraussetzt.<br />
Das dadurch entstandene Wissen<br />
ist dann eventuell erkenntnisreicher, als<br />
die reine Auswertung durch externe Stellen.<br />
Dennoch kann der Footprint auch<br />
einfach durch Tools berechnet werden.<br />
Generell sollte dabei beachtet werden, ob<br />
die gewünschten Standards (GHG, ISO<br />
etc.) erfüllt werden und welche Daten die<br />
Tools zugrunde legen.<br />
Die Beratungsfirma Effizienz-Agentur<br />
NRW bietet mit dem EcoCockpit einen<br />
kostenlosen Rechner für Unternehmen,<br />
der auch GHG-konform ist. Die CO 2 -<br />
Bilanz eines Unternehmens oder eines<br />
Produkts kann damit nach Registrierung<br />
erfolgen.<br />
Wer einen größeren Funktionsumfang benötigt,<br />
bekommt das beispielsweise mit<br />
SimaPro, einem der Pioniere in Sachen<br />
Software für Life Cycle Assesment: Die<br />
erste Version wurde bereits 1990 entwickelt.<br />
Die Abkürzung des Namens steht<br />
für ‚Systematische Milieu Analyse van<br />
Producten‘, das Niederländische ist hier<br />
wohl auch im Deutschen verständlich.<br />
Mit den Daten aus der Software ergeben<br />
sich die Treibhausgas-Bilanzen und die<br />
Produktdesigner können bereits sehen,<br />
wie groß der CO 2 -Fußabdruck verschiedener<br />
Designvarianten sein wird.<br />
Auch mit dem SAP Product Footprint<br />
Management können Unternehmen den<br />
CO 2 -Fußabdruck ihrer Produkte über die<br />
gesamte Wertschöpfungskette sowie den<br />
den kompletten Produktlebenszyklus hinweg<br />
berechnen. Die Software integriert<br />
Daten aus sämtlichen Lösungen, die die<br />
Fertigungsprozesse steuern, Stammdaten<br />
aus Geschäftsanwendungen wie SAP<br />
S/4HANA Cloud sowie von Lieferanten<br />
und Energieflüssen für Anlagen, um den<br />
Umwelteinfluss unterschiedlicher Produktionsszenarien<br />
zu ermitteln.<br />
Der Scope3Analyzer ist ein kostenfreies,<br />
webbasiertes Tool, mit dem sich die Emissionen<br />
der vorgelagerten Lieferkette ermitteln<br />
lassen. Das Tool kann die Emissionen<br />
auf Basis bereits vorliegender Verbrauchs-<br />
und Einkaufsdaten berechnen.<br />
Außerdem ist es berichtskonform nach<br />
gängigen Standards: GHG, CDP sowie die<br />
Science Based Targets Initiative akzeptieren<br />
die angewandte Methodik. Es entstand<br />
durch die Zusammenarbeit der Systain<br />
Consulting GmbH, dem Thinktank Industrielle<br />
Ressourcenstrategien und dem<br />
Institut für Industrial Ecology der Hochschule<br />
Pforzheim mithilfe der Förderung<br />
des Umweltministeriums von Baden-<br />
Württemberg.<br />
Mit SiGreen (siehe dazu auch <strong>KEM</strong> Porträt<br />
ab S. 18) hat Siemens eine Anwendung<br />
zur Erfassung von tatsächlichen Daten<br />
16 <strong>KEM</strong> <strong>Konstruktion</strong>|Automation » 12 | 2023
entwickelt, die dort erhoben werden, wo<br />
die Emissionen entstehen: In den jeweiligen<br />
Schritten entlang der Lieferkette. Bei<br />
der Berechnung des CO 2 -Fußabdrucks<br />
nutzt SiGreen Realdaten anstelle von industriellen<br />
Durchschnittswerten. Damit<br />
soll sich der CO 2 -Fußabdruck zu einem<br />
Mess- und Steuerungsinstrument wandeln<br />
und so aktiv mit Verbesserungsmaßnahmen<br />
gezielt gesenkt werden können.<br />
Die auf industriellen 3D-Druck fokussierte<br />
Beratung AMPower aus Hamburg bietet<br />
mit dem Additive Manufacturing Sustainability<br />
Calculator Metal ein Tool zur<br />
Berechnung des CO 2 -Fußabdrucks<br />
von einzelnen gedruckten<br />
Teilen. Dies soll auch eine<br />
Vergleichbarkeit zu konventionellen<br />
Verfahren ermöglichen.<br />
Auf der Website des Greenhouse<br />
Gas Protocol werden<br />
ebenfalls Tools angeboten, die<br />
nach verschiedenen Kriterien<br />
klassifiziert sind, etwa für bestimmte<br />
Industrien, Länder<br />
oder auch prozessübergreifende Kalkulationen.<br />
Berechnen lassen sich auch die<br />
Unsicherheiten im Scope 3.<br />
Welche Dienstleistungen gibt<br />
es in diesem Umfeld?<br />
Diverse Beratungsfirmen unterstützen bei<br />
der Berechnung des CO 2 -Fußabdruckes<br />
beziehungsweise dem Life Cycle Assesment<br />
für Produkte und das gesamte Unternehmen,<br />
ebenso bei der Erstellung der<br />
entsprechenden Nachhaltigkeitsberichte.<br />
Diese sind ab 2024 beziehungsweise 2025<br />
für viele Unternehmen verpflichtend. Das<br />
DFGE Institut für Energie, Ökologie und<br />
Ökonomie etwa wurde 1999 als Spin-Off<br />
der TU München gegründet und liefert<br />
Antworten auf Fragen zur ökologischen<br />
Nachhaltigkeit, Energieeffizienz, internationalen<br />
Normen und Klimaschutz. Kerngeschäft<br />
sei die Auseinandersetzung mit der<br />
Fragestellung, ob und vor allem wie eine<br />
sinnvolle Kombination von Ökologie und<br />
Wirtschaftlichkeit erreicht werden kann.<br />
Kritik am CO 2 -Fußabdruck<br />
»Mit dem CO 2 -Fußabdruck geht man<br />
auf Entdeckungsreise im eigenen Unter -<br />
nehmen, bei den Lieferantenbetrieben<br />
sowie bei Kundinnen und Kunden.«<br />
Sandra Gottschall, Projektleiterin Klimaneutralität beim<br />
Beratungsunternehmen ConPlusUltra<br />
Anfangs sollte der CO 2 -Fußabdruck die<br />
Aufmerksamkeit ablenken von den Konzernen,<br />
die ihr Geld mit Fossilenergieträgern<br />
verdienen, hin zu den einzelnen<br />
Menschen, die diese nutzen. Die Corona-<br />
Pandemie hat gezeigt, dass der direkte<br />
Einfluss des einzelnen mit seinen Möglichkeiten<br />
zur Einschränkung kaum Relevanz<br />
hat: Trotz großflächig reduziertem<br />
Pendelverkehr durch Homeoffice und<br />
massenhaft gestrichenen Flügen ging der<br />
CO 2 -Ausstoß weltweit nur um 7 % zurück,<br />
wie die Max-Planck-Gesellschaft Ende<br />
2020 bekannt gab: Besonders deutlich<br />
war der Rückgang der Emissionen in den<br />
USA (-12 %) und in den EU-Mitgliedsstaaten<br />
(-11 %). Experten weisen zudem<br />
darauf hin, dass eine Entscheidung des<br />
einzelnen zu Produkten mit besserem<br />
CO 2 -Fußabdruck auch praktisch umgesetzt<br />
werden können muss: Fahrrad und<br />
E-Auto benötigen beispielsweise entsprechende<br />
Infrastruktur, die vielerorts noch<br />
ausbaubedürftig ist. Der Nutzer denkt daher,<br />
er müsse das (Verbrenner)-Auto generell<br />
stehen lassen, um seine persönlichen<br />
Emissionen zu senken – eine andere, bessere<br />
Wahl sieht er nicht, da E-Auto oder<br />
Fahrrad für ihn nicht praktikabel sind. Daher<br />
können die ökologisch besseren Produkte<br />
allein nicht für den nötigen<br />
breiten Impact sorgen. Der<br />
Fokus auf den CO 2 -Fußabdruck<br />
eines Produktes gilt deswegen<br />
als teilweise zu verkürzt. Wie<br />
wenig Einfluss der einzelne auf<br />
seinen Footprint nehmen kann,<br />
verdeutlicht auch eine Berechnung<br />
des Massachusetts Institute<br />
of Technology (MIT): Ein<br />
obdachloser Amerikaner, der in<br />
Sammelunterkünften wohnt und in Suppenküchen<br />
isst, stieß 2008 noch immer<br />
8,5 t CO 2 pro Jahr aus – zwar weniger als<br />
halb so viel wie der normale US-Bürger<br />
(zirka 20 t), aber doppelt so viel wie der<br />
damalige weltweite Durchschnitt.<br />
Der CO 2 -Fußabdruck für Produkte gilt<br />
inzwischen ebenfalls als überholter<br />
Begriff – immer öfter wird die sogenannte<br />
Lebenszyklusanalyse (Life Cycle Assessment)<br />
herangezogen: Dabei werden<br />
neben den Klimagasemissionen auch<br />
weitere Faktoren wie Land- und Wasserverbrauch<br />
mit einkalkuliert.<br />
SPANNTECHNIK | NORMELEMENTE | BEDIENTEILE<br />
100 % PRODUKTKOMPETENZ<br />
Mehr als 65.000 Produkte<br />
Ergonomie und Stabilität<br />
• •<br />
Entwicklung und Produktion<br />
Über 100 Jahre SICHER MIT KIPP<br />
am Standort Deutschland<br />
kipp.com<br />
<strong>KEM</strong> <strong>Konstruktion</strong>|Automation » 12 | 2023 17
TRENDS » Porträt » Nachhaltigkeit<br />
CO 2 -Emissionswerte eines Produktes entlang der Lieferkette managen<br />
„Nur, was man transparent macht,<br />
kann man aktiv beeinflussen“<br />
Um die CO 2 -Emissionen eines Produktes aktiv beeinflussen zu können, müssen diese im ersten Schritt transparent<br />
gemacht werden. Mit der Software Sigreen stellt Siemens ein CO 2 -Management-Tool bereit, mit dem Emissionswerte<br />
entlang der Lieferkette managebar werden – einschließlich vertrauenswürdiger Abfrage, Berechnung und<br />
Weitergabe realer CO 2 -Fußabdrucksdaten eines Produktes. Dr. Gunter Beitinger, quasi der Erfinder von Sigreen,<br />
erläutert im Interview mit <strong>KEM</strong> <strong>Konstruktion</strong>|Automation, was das Softwaretool aktuell so „einzigartig“ macht.<br />
Interview: Nico Schröder, Korrespondent <strong>KEM</strong> <strong>Konstruktion</strong>|Automation, Augsburg<br />
Mit Sigreen können<br />
Informationen zum<br />
Product Carbon Footprint<br />
(PCF) entlang<br />
bereits bestehender<br />
Geschäftsbeziehungen<br />
ausgetauscht werden.<br />
<strong>KEM</strong> <strong>Konstruktion</strong>|Automa -<br />
tion: Herr Dr. Beitinger, Sie<br />
sagen: „Bis zu 90 % aller<br />
CO 2 -Emissionen der Industrie<br />
entstehen nicht bei der Produktion,<br />
sondern entlang der<br />
Lieferketten.“ Ist das der Impuls<br />
und die Ausgangslage gewesen,<br />
Sigreen zu entwickeln?<br />
Dr. Gunter Beitinger: Je nach<br />
Wertschöpfungstiefe und Position<br />
des Unternehmens in der<br />
Lieferkette können mehr als<br />
90 % der CO 2 -Emissionen<br />
außerhalb des eigenen Betriebes entstehen. Das<br />
sehen wir beispielsweise hier bei Siemens an unserem<br />
Simatic-Portfolio. Natürlich kann der Prozentsatz<br />
auch bei 70 % oder 60 % liegen. Wir wollen<br />
jedenfalls auf ein entscheidendes Thema hinweisen –<br />
und zwar: Verantwortung für die eigene Lieferkette<br />
zu übernehmen.<br />
Bild: Siemens<br />
<strong>KEM</strong> <strong>Konstruktion</strong>|Automation: Woran<br />
liegt es, dass bis zu 90 % aller<br />
industrieller CO 2 -Emissionen in der<br />
Wertschöpfungskette liegen? Und was<br />
folgt daraus?<br />
Beitinger: Das liegt an den Zukaufteilen,<br />
also an den Modulen und Komponenten,<br />
die außerhalb des eigenen Einflussbereiches gefertigt<br />
werden. Durch die Kaufentscheidung ist man<br />
aber durchaus für diese Emissionen verantwortlich.<br />
Insofern werden vom Gesetzgeber und der Gesellschaft<br />
immer mehr Forderungen laut, dieser Verantwortung<br />
bei den Produkten gerecht zu werden.<br />
<strong>KEM</strong> <strong>Konstruktion</strong>|Automation: Wie sieht das<br />
produktseitig am Beispiel des Werkes in Amberg<br />
aus, wo Siemens speicherprogrammierbare Steuerungen<br />
(SPS) fertigt?<br />
Beitinger: Unsere speicherprogrammierbaren Steuerungen<br />
werden modular – ergänzt und je nach Leistungsspektrum<br />
mit Input-, Output- und Analogmodulen<br />
– ausgestattet und können die jeweiligen<br />
Automatisierungsaufgaben übernehmen. Bei Produkten<br />
wie unseren SPS liegen tatsächlich über 90% der<br />
Emissionen, die entstehen, in der Lieferkette. Wenn<br />
wir unser Produkt also umweltfreundlich am Markt<br />
positionieren wollen, müssen wir diese Emissionen<br />
transparent machen, damit wir sie beeinflussen können.<br />
Die restlichen 10 % betreffen den Anteil an<br />
Emissionen, die im eigenen Betrieb entstehen, also<br />
durch den Bezug von Elektrizität und durch die Veredelung<br />
am eigenen Standort. Die 10 % sind im Verhältnis<br />
zum Gesamten recht wenig und verhältnismäßig<br />
leicht ermittelbar. Man kann beispielsweise<br />
auf die Stromrechnung schauen<br />
und kennt damit die Emissionen, die<br />
IM INTERVIEW<br />
Dr. Gunter Beitinger ist<br />
der „Erfinder“ des<br />
CO 2 - Management-Tools<br />
Sigreen von Siemens.<br />
auf Elektrizität zurückgehen. Seine<br />
Prozesse muss man natürlich<br />
kennen.<br />
<strong>KEM</strong> <strong>Konstruktion</strong>|Automation:<br />
Auf welche Hürden stoßen<br />
Unternehmen bei der Ermittlung<br />
des Gros an Emissionswerten?<br />
Beitinger: Zum einen müssen die Informationen<br />
vom Lieferanten bereitgestellt werden. Der steht<br />
dann meistens vor der gleichen Herausforderung wie<br />
man selbst. Die erste Hürde besteht also darin, ob er<br />
überhaupt entsprechende Informationen zu den<br />
18 <strong>KEM</strong> <strong>Konstruktion</strong>|Automation » 12 | 2023
»Wir wollen auf ein<br />
entscheidendes Thema<br />
hinweisen – und zwar:<br />
Verantwortung für die<br />
eigene Lieferkette zu<br />
übernehmen.«<br />
Bild: Siemens<br />
Emissionen liefern kann. Sollte der Lieferant dies<br />
lösen können, eventuell durch auf sogenannten Life-<br />
Cycle-Assessment (LCA)-Daten basierende Berechnungen,<br />
kann er eine Abschätzung liefern. Diesen<br />
Werten muss man am Ende allerdings vertrauen können.<br />
Das wäre gegeben, wenn der Lieferant ergänzend<br />
zu den berechneten Werten auch Hintergrundinformationen<br />
zu Prozessen, Datenquellen oder<br />
Ermittlungsverfahren, also zu seiner Lieferantenstruktur,<br />
preisgeben würde oder preisgibt. In der<br />
Regel wird er das allerdings nicht tun, da dies seine<br />
eigene Wettbewerbsfähigkeit einschränken könnte.<br />
Somit steckt man schon im zweiten Dilemma. Sollte<br />
das trotzdem gelöst werden – möglicherweise aufgrund<br />
von Machtverhältnissen oder Abhängigkeiten<br />
– muss man immer noch sicherstellen, dass die<br />
Daten, die der Zulieferer dann bereithält, aggregierbar<br />
sind. Dahinter steht folgende Frage: Hat der Lieferant<br />
wirklich die gleichen Regeln und Methoden<br />
angewandt, sodass man die Daten entlang der Lieferkette<br />
aufsummieren kann? Das wäre die dritte Hürde,<br />
die man nehmen muss.<br />
<strong>KEM</strong> <strong>Konstruktion</strong>|Automation: Sehen Sie wei -<br />
tere Herausforderungen?<br />
Beitinger: Es ist sehr aufwendig und die Verfügbarkeit<br />
von Expertenwissen spielt eine Rolle. Das ist aber<br />
lösbar. Nur diese drei Aufgaben, die mit den erwähnten<br />
Hürden verbunden sind, sind essenziell.<br />
<strong>KEM</strong> <strong>Konstruktion</strong>|Automation: Aus dieser Einsicht<br />
heraus haben Sie eine Lösung erarbeitet, die<br />
nun unter dem Namen Sigreen am Markt verfügbar<br />
ist – eben aus dem eigenen Wunsch heraus, die<br />
Produkte, die Sie in den Werken fertigen,<br />
CO 2 -neutral anbieten zu können. Wie also schaffen<br />
Sie die notwendige Transparenz?<br />
Beitinger: Hier gilt die Regel: Nur, was man misst,<br />
was man transparent macht, kann man aktiv beeinflussen.<br />
Und nur so lassen sich gezielt Maßnahmen<br />
ableiten. Ansonsten ist man im Blindflug. In der<br />
Regel werden heute produktbezogene Emissionswerte<br />
mithilfe der erwähnten Life-Cycle-Assessment-<br />
Daten ermittelt. Es handelt sich dabei um in Datenbanken<br />
verfügbare Durchschnittswerte. Über einen<br />
Dreisatz kann man damit bereits den eigenen<br />
CO 2 -Wert abschätzen. Das ist ein guter Startpunkt –<br />
vor allem, wenn das Produkt physisch noch gar nicht<br />
existiert und man dies in der Design- beziehungs -<br />
weise in der <strong>Konstruktion</strong>sphase machen will, aber<br />
keine realen Daten hat. Wenn mein Lieferant noch<br />
nicht in der Lage ist, mir Werte zu nennen, kann das<br />
ein sehr guter Start sein, weil man damit einen Anker<br />
gesetzt hat.<br />
Um produktbezogene<br />
Emissionen entlang der<br />
Lieferkette managen<br />
und letztlich reduzieren<br />
zu können, hat<br />
Dr. Gunter Beitinger<br />
das CO 2 -Management-<br />
Tool namens Sigreen<br />
entwickelt.<br />
<strong>KEM</strong> <strong>Konstruktion</strong>|Automation » 12 | 2023 19
TRENDS » Porträt » Nachhaltigkeit<br />
Die Siemens-Software<br />
Sigreen bietet Mechanismen,<br />
um vertrauenswürdige<br />
CO 2 -Emissionswerte<br />
entlang der<br />
gesamten Lieferkette zu<br />
managen.<br />
<strong>KEM</strong> <strong>Konstruktion</strong>|Automation: Inwieweit lassen<br />
sich mit Sigreen wirklich Emissionen reduzieren?<br />
Beitinger: Von Durchschnittswerten müssen wir zu<br />
realen Daten kommen, um Maßnahmen ergreifen zu<br />
können, die nachhaltig wirken. Der CO 2 -Fußabdruck<br />
soll nachhaltig gesenkt werden. Entgegnen könnte<br />
man, dass in einem Produkt nun so viele Module und<br />
Komponenten existieren würden, dass man nicht alle<br />
berücksichtigen könne. Hier verweise ich auf das<br />
Pareto-Prinzip: 80–20 oder 70–30. Wenn man<br />
anfängt, kann man bei 20 bis 30 % der Komponenten<br />
70 bis 80 % der Emissionswerte erfassen und abdecken,<br />
wenn man diese Werte beim Lieferanten<br />
anfragt. Über die Zeit kann man überlegen, wie weit<br />
man das vorantreibt. Man kann zumindest schnell<br />
für über 20 bis 30 % seiner Komponenten 70 bis<br />
80 % des CO 2 -Fußabdrucks entlang der Lieferkette<br />
mit Realdaten abdecken und sich durch die gewonnene<br />
Transparenz Ziele setzen. Aus den Zielen heraus<br />
können Maßnahmen eingeleitet werden, deren Wirksamkeit<br />
überprüfbar wird. Diese Wirksamkeit kann<br />
durch Sigreen verifiziert werden, da Realdaten verifiziert<br />
von Lieferanten übermittelt werden können.<br />
<strong>KEM</strong> <strong>Konstruktion</strong>|Automation: Liegt die Besonderheit<br />
von Sigreen gerade in den gelösten Fragen<br />
zur Verifizierbarkeit?<br />
Beitinger: Das ist es, was Sigreen an sich so einzigartig<br />
macht. Also um vertrauenswürdige CO 2 -Emissionswerte<br />
entlang der gesamten Lieferkette zu verfolgen,<br />
brauche ich bestimmte Mechanismen. Dabei<br />
Bild: Siemens<br />
geht es um Folgendes: Lieferanten wollen die Datenfreiheit<br />
nicht aufgeben und aus Wettbewerbsgründen<br />
keine vertraulichen Informationen austauschen.<br />
Gleichzeitig man muss diesen Informationen aber<br />
vertrauen können, also müssen sie verifiziert sein.<br />
Zusätzlich bedarf es der Möglichkeit, anzugeben,<br />
nach welchen Methoden diese Informationen zur<br />
Verfügung gestellt werden sollen, da Unternehmen<br />
beispielsweise nicht allein die Chemieindustrie, sondern<br />
auch die Automobilindustrie beliefern. Noch<br />
gibt es hier keine universellen Standards, weswegen<br />
Informationen entsprechend industriespezifisch weitergeben<br />
werden, um aggregierbar zu sein.<br />
<strong>KEM</strong> <strong>Konstruktion</strong>|Automation: Welche Rolle<br />
spielen Zertifikate und Zertifizierungen?<br />
Beitinger: Zertifikate sind für uns so wichtig, weil<br />
sie zum einen ermöglichen, dass Informationen weitergegeben<br />
werden, die vertrauenswürdig sind, ohne<br />
dass Details bekannt werden, ohne dass vertrauliche<br />
Informationen weitergegeben werden. Zum anderen<br />
können die verifizierbaren Zertifikate, die Verifiable<br />
Credentials, wieder zurückgezogen werden, sollte<br />
sich im Prozess etwas geändert haben. Die verifizierbaren<br />
Zertifikate werden von einer unabhängigen<br />
dritten Partei, von Akkreditierern, ausgestellt. Und<br />
das passiert über ein sogenanntes dezentrales Netzwerk.<br />
Hat ein Zertifikat seine Gültigkeit verloren,<br />
kann es mit neuem und verlässlichem Wert ausgestellt<br />
und versendet werden. Dem kann man wieder<br />
vertrauen – und hat eben die Sicherheit, seinen<br />
CO 2 -Fußabdruck immer aktuell halten zu können. Die<br />
Information des CO 2 -Wertes wird entlang bereits<br />
bestehender Geschäftsbeziehungen ausgetauscht,<br />
das Zertifikat aber über eine dezentrale Infrastruktur,<br />
wo man die Informationen mit Private Keys verschlüsselt<br />
und mit Public Keys verifizieren kann, die<br />
eben in dieser dezentralen Infrastruktur liegen. Wir<br />
nutzen das IDunion-Netzwerk beziehungsweise nennen<br />
wir es auch das Estainium-Netzwerk, weil wir<br />
dort eben einen sogenannten TSX, also einen Connector,<br />
eine Anbindung entwickelt und zum Patent<br />
gebracht haben, die die Verbindung zwischen Sigreen<br />
und dem dezentralen Netzwerk ermöglicht, sodass<br />
die Verifizierungszertifikate ausgestellt werden können.<br />
Der TSX – wir nennen ihn Trustworthy Supply<br />
Chain Exchange Connector – bildet ein wesentliches<br />
Differenzierungsmerkmal zu Lösungen, die wir bisher<br />
gesehen haben.<br />
<strong>KEM</strong> <strong>Konstruktion</strong>|Automation: Was ist datenund<br />
workflowmäßig erforderlich, um den CO 2 -Produktfußabdruck<br />
beeinflussen zu können?<br />
20 <strong>KEM</strong> <strong>Konstruktion</strong>|Automation » 12 | 2023
Beitinger: Eingangs nutzen<br />
Sie eine Materialliste, in der<br />
die entsprechenden Detailinformationen<br />
zu Gewicht,<br />
Dimensionen und weiteren<br />
Details vermerkt sind. Auch<br />
die Lieferanten sind hinterlegt.<br />
Diese Materialliste, die aus<br />
unserer Teamcenteranwendung<br />
– unserem Backbone für<br />
das Engineering – bereitgestellt<br />
wird, wird über Sigreen<br />
abgegriffen. Anschließend<br />
kann man seine Anfrage direkt<br />
an die Lieferanten rausschicken,<br />
eben mit der Bitte, den<br />
CO 2 -Fußabdruck zu einem<br />
bestimmten Produkt, zu einer gelieferten Komponente<br />
zu bekommen. Was man im Vorfeld tun kann, sind<br />
erste Lebenszyklus-, kurz: LCA-Berechnungen des<br />
CO 2 -Fußabdrucks, um eine Vorabschätzung und klare<br />
Indikation zu haben, auf welche Baugruppen man<br />
sich fokussieren sollte, weil sie „CO 2 -auffällig“ sind.<br />
So kann die Reise gezielt beginnen, um ein Produkt<br />
umweltfreundlicher zu bekommen. Deswegen sagen<br />
wir, es handelt sich um ein Product-Carbon-Footprint-Management-Tool,<br />
weil es eben diese Transparenz<br />
sowie Fokussierung und letztlich die Beeinflussung<br />
des CO 2 -Fußabdrucks ermöglicht.<br />
<strong>KEM</strong> <strong>Konstruktion</strong>|Automation: Es wird nicht<br />
gang und gäbe sein, dass Lieferanten diese Daten<br />
bereithalten.<br />
Bild: Siemens<br />
Beitinger: So ist es. Was wir allerdings sehen, ist ein<br />
wachsender Druck seitens Regulierungsbehörden,<br />
Interessensgruppen und unserer Gesellschaft allgemein,<br />
sodass die Awareness, die Bereitschaft bei den<br />
Industrieunternehmen da ist und viele vorbereitet<br />
sind. Es hängt aber auch von der Größe eines Unternehmens<br />
und davon ab, welche Produkte mit welchen<br />
Materialien ausgeliefert werden. Und zusammenfassend:<br />
Die Emissionen, die unter der direkten<br />
Kontrolle der Unternehmen stehen, also die Scope-<br />
1-Emissionen sowie die Emissionen aus der außerhalb<br />
des Unternehmens erzeugten gekauften Energie,<br />
also Scope 2, sind bekannt. Sie sind erfasst und<br />
können offengelegt werden. Damit werden die<br />
gesamten Fehler über die Kette bereits geringer und<br />
der Anteil an Realdaten erhöht sich. Das ist schon ein<br />
Mehrwert, wenn man in die Reise einsteigt. Darüber<br />
hinaus werden zunehmend die sogenannten Scope-3-Emissionen<br />
erfasst – die Emissionen entlang<br />
der Wertschöpfungskette. Vielleicht hat ein Unternehmen<br />
auch schon ein Umweltziel kommuniziert.<br />
Falls ja, findet man in den Unternehmen bereits<br />
Strukturen vor, die eine systematische Ermittlung<br />
und Bereitstellung der Daten eben ermöglichen.<br />
<strong>KEM</strong> <strong>Konstruktion</strong>|Automation: Und wenn dem<br />
nicht so ist?<br />
Beitinger: Dann sollten die Unternehmen den<br />
Einsatz von Tools wie Sigreen zur Unterstützung in<br />
jedem Fall in Erwägung ziehen, da die Erfassung und<br />
Analysen dieser Daten und des Energieverbrauchs<br />
einschließlich der Endanwendung den Rahmen der<br />
manuellen Techniken immer sprengen. Durch den<br />
Einsatz geeigneter Softwarewerkzeuge kann sich ein<br />
Unternehmen viel Wiederholungsarbeit ersparen,<br />
weil die Daten systematisch erfasst werden.<br />
<strong>KEM</strong> <strong>Konstruktion</strong>|Automation: In welche Richtung<br />
entwickeln sich Regularien und Reporting-<br />
Pflichten mit Blick auf die komplexe Thematik<br />
Product Carbon Footprint aktuell?<br />
Beitinger: Es existieren verschiedene Normen und<br />
Leitfäden, die definieren, wie ein Product Carbon<br />
Nach Werksleitungen in<br />
den USA und Mexiko ist<br />
Dr. Gunter Beitinger seit<br />
2015 für die Werke der<br />
Geschäftseinheit Factory<br />
Automation bei Siemens<br />
Digital Industries verantwortlich<br />
– unter anderem<br />
auch für das Siemens-Werk<br />
in Amberg.<br />
»Die Entnahme von Emissionen aus der<br />
Atmosphäre ist ein weiterer wichtiger Aspekt.<br />
Die reine Vermeidung und Reduzierung wird<br />
nicht ausreichen, um die Erderwärmung in dem<br />
Umfang zu reduzieren, sodass wir von weiteren<br />
Umweltkatastrophen verschont werden.«<br />
<strong>KEM</strong> <strong>Konstruktion</strong>|Automation » 12 | 2023 21
TRENDS » Porträt » Nachhaltigkeit<br />
Für den hohen Automatisierungs-<br />
und Digitalisierungsgrad<br />
sind Siemenswerke<br />
als Leuchtturmwerke<br />
etabliert. Sie<br />
zeigen gut, wie Technologien<br />
aus der vierten<br />
industriellen Revolution<br />
effizient genutzt werden<br />
können. Dies wiederum<br />
ist ein Ausgangspunkt<br />
für mehr<br />
Nachhaltigkeit.<br />
Footprint (PCF) zu berechnen und zu berichten ist –<br />
unter anderem ISO 14067. Dann gibt es die übergreifende<br />
Umweltbewertung in Form von Ökobilanzen<br />
und Berichtsnormen. Insgesamt ist das für Unternehmen<br />
herausfordernd und teils belastend. Trotzdem<br />
haben die Unternehmen die Verpflichtung, regelkonform<br />
zu berichten. Somit ist die Awareness und die<br />
Suche nach softwaregestützten Lösungen sehr groß.<br />
Und Erlasse wie CBAM (Carbon Border Adjustment<br />
Mechanism) durch die EU in 2023 erhöhen grundsätzlich<br />
den Druck. CBAM ist ein Meilenstein gewesen,<br />
weil dadurch ganz klar bestimmte Produkte oder<br />
vielmehr kohlenstoffintensive Güter mit entsprechenden<br />
Auflagen und Abgaben beim Import in die<br />
europäische Gemeinschaft belegt werden. Zement,<br />
Aluminium, Düngemittel und Wasserstoff sind<br />
darunter. Jeder weiß, dies ist nur der erste Schritt,<br />
auf diese Industriegüter zu gehen, die bekanntlich<br />
den größten Anteil der industriellen Emissionen<br />
adressieren. Man kann jetzt schon sagen, dass die<br />
Berichterstattung zu CO 2 -Emissionen Ausmaße wie<br />
das Finanzreporting bekommen wird und dem vom<br />
Aufwand her in nichts nachstehen dürfte.<br />
<strong>KEM</strong> <strong>Konstruktion</strong>|Automation: Welche Rolle<br />
spielt die Estainium Association im Zusammenhang<br />
mit Sigreen?<br />
Beitinger: Die Estainium-Vereinigung wurde von<br />
mir 2022 gemeinsam mit Unternehmen, Start-ups<br />
und Hochschulen auf internationaler Ebene gegründet.<br />
Ich stehe der Organisation aktuell auch als erster<br />
Vorstand zur Verfügung. Grundsätzlich wollen wir<br />
einen Beitrag zur Dekarbonisierung der industriellen<br />
Bild: Siemens<br />
Lieferkette leisten. Hier gibt es noch wesentlich mehr<br />
Themen, die man außerhalb der Anwendung von<br />
Sigreen adressieren muss. Die industrielle Dekarbonisierung<br />
ist einfach ein interdisziplinäres Feld. Wir<br />
sind im Verein davon überzeugt, dass man ganzheitlich<br />
in einem vorwettbewerblichen branchen- und<br />
funktionsübergreifendem Ökosystem arbeiten sollte.<br />
Wir bieten den Unternehmen einmal an, bei der<br />
Infrastruktur für den Datenaustausch mitzuarbeiten<br />
und zu entwickeln. Den TSX-Connector beispielsweise<br />
haben wir in diesen Verein gegeben. Somit steht er<br />
erstmal allen Vereinsmitgliedern zur Verfügung. Und<br />
andere Lösungen können darauf aufgesetzt werden.<br />
Wir glauben, es kann nur gemeinsam gehen, also<br />
eine Firma oder eine Lösung alleine wird nicht die<br />
Dekarbonisierung der gesamten industriellen Lieferkette<br />
erreichen. Des Weiteren adressieren wir Unterstützung<br />
und Hilfe für Unternehmen, um deren<br />
Methodenunsicherheit aufzulösen. Uns geht es um<br />
Transparenz bei den Methoden zur Ermittlung von<br />
Product Carbon Footprints: Wie unterscheiden sie<br />
sich oder wie können sie ineinander übergeführt werden?<br />
Das sind damit verbundene Fragen. Wir wollen<br />
aber nicht normativ oder standardisierend unterwegs<br />
sein. Wir möchten Unternehmen befähigen, Regelwerke<br />
richtig und regelkonform anzuwenden.<br />
Die Entnahme von Emissionen aus der Atmosphäre<br />
ist ein weiterer wichtiger Aspekt. Die reine Vermeidung<br />
und Reduzierung wird nicht ausreichen, um die<br />
Erderwärmung in dem Umfang zu reduzieren, sodass<br />
wir von weiteren Umweltkatastrophen verschont<br />
werden. Wir müssen also in Klimaschutzprojekte<br />
investieren, die aktiv zur Entnahme von Kohlenstoff<br />
beitragen. Diesem Thema stellen wir uns aktiv.<br />
<strong>KEM</strong> <strong>Konstruktion</strong>|Automation: Sigreen wird über<br />
die digitale Business Plattform Xcelerator von<br />
Siemens angeboten. Welche Vorteile hat das?<br />
Beitinger: Das Tool wird über Xcelerator angeboten,<br />
weil wir offene API-Schnittstellen haben. Dies<br />
ermöglicht es, Teamcenter oder andere Datenbanken<br />
und Datenquellen anzubinden, um die Informationen<br />
leicht und automatisiert zu importieren. Sigreen fügt<br />
sich nahtlos ins Siemens-Produkt-Portfolio ein, ist<br />
aber offen für andere Anbindungen. Übrigens ist<br />
Sigreen frei verfügbar, kostet in der Nutzung also<br />
nichts. Wir wollen, dass die Software genutzt wird<br />
und dass auch das Einladen und das Onboarden der<br />
Lieferanten hürdenlos ist. Die Grundfunktionen sind<br />
alle frei verfügbar. Unabhängig von der Größe des<br />
Unternehmens, wollen wir sicherstellen, dass das<br />
Tool nutzbar ist und den Austausch der Informationen<br />
als Beitrag zur Dekarbonisierung leisten kann.<br />
22 <strong>KEM</strong> <strong>Konstruktion</strong>|Automation » 12 | 2023
<strong>KEM</strong> <strong>Konstruktion</strong>|Automation: Wie integrationsfähig<br />
ist die Software?<br />
Beitinger: Wir bieten offene API-Schnittstellen an<br />
die man frei belegen kann. Darüber hinaus existieren<br />
Integrationsmöglichkeiten zum Siemens-Software-<br />
Portfolio sowie mit weiteren Partnern. Und diese<br />
werden weiter ausgebaut. Somit können Unternehmen<br />
Sigreen auch mit branchenspezifischen Lösungen<br />
sehr gut kombinieren und sich damit in die Systemlandschaft<br />
einbinden.<br />
<strong>KEM</strong> <strong>Konstruktion</strong>|Automation: Welche Unternehmen<br />
können Sigreen einsetzen?<br />
uns sehr stark auf die Prozessindustrie, die Chemieindustrie,<br />
die Automobilindustrie und die Lebensmittelindustrie.<br />
Vor allem deren Regelwerke bilden wir<br />
heute bereits in Sigreen ab.<br />
<strong>KEM</strong> <strong>Konstruktion</strong>|Automation: Wer sind die<br />
Anwender der Sigreen-Software in Unternehmen?<br />
Beitinger: Produktmanager, Einkäufer, Werkleiter,<br />
das General Management sowie das Sustainability<br />
Management. Wir stellen diesen Anwendern mit<br />
ihren unterschiedlichen Anforderungen bei der Informationsaufbereitung<br />
und Darstellung spezifische<br />
Bedienermasken zur Verfügung.<br />
Beitinger: Die industriellen Lieferketten kreuzen<br />
sich, teilen sich, drehen Schleifen. Daher ist Sigreen<br />
an sich ist erstmal industrieagnostisch. Auf der anderen<br />
Seite können wir als Start-up innerhalb von<br />
Siemens, das seit etwa zwei Jahren auf dem Markt<br />
ist, nicht alle Industrien gleichzeitig und gleich<br />
intensiv bedienen und deren spezifische Anforderungen<br />
sofort im Detail erfüllen. Aktuell fokussieren wir<br />
www.siemens.com<br />
INFO<br />
Das komplette Interview lesen<br />
Sie online, unter:<br />
hier.pro/sbHzY<br />
Go sustainability.<br />
Die IIoT-Lösungen und die Analysesoftware von Emerson<br />
erkennen Druckluftlecks und ermöglichen Herstellern so<br />
Energiekosteneinsparungen von über 20 %.<br />
Erfahren Sie mehr unter Emerson.com/Sustainable-Automation<br />
<strong>KEM</strong> <strong>Konstruktion</strong>|Automation » 12 | 2023 23
In Elektrolyseur-Anlagen wird bei Endress+Hauser Wasserstoff dezentral aus regenerativer Energie hergestellt.<br />
Bild: Endress+Hauser<br />
Messtechnik für die Energiewende<br />
Dekarbonisierung der Industrie<br />
Die Energiewende in der Industrie hat ein klares Ziel: die Umstellung der Energieversorgung auf eine nachhaltige<br />
Basis mit regenerativen Energien. Hierdurch soll der anthropogene CO 2 -Ausstoß verringert beziehungsweise<br />
vermieden werden, der heute durch fossile Energieträger verursacht wird. Viele Technologien zur Dekarbonisierung<br />
der Industrie haben hohe und sehr spezielle Anforderungen an die Prozessmesstechnik. Endress+Hauser<br />
trägt als Partner der Prozessindustrie zur Umstellung bei.<br />
Florian Kraftschik, Sales Marketing Manager Communication, Frederik Effenberger, Industry Manager Decarbonization, beide<br />
Endress+Hauser Deutschland<br />
INFO<br />
Mehr zu den Lösungen<br />
von Endress+Hauser für<br />
Wasserstoff-Anwendungen:<br />
hier.pro/xwlZo<br />
Die Energiewende ist für die chemische Prozessindustrie<br />
eine bedeutende Herausforderung, die sie<br />
möglichst rasch bewältigen muss. Die Komplexität dieser<br />
Aufgabe rührt daher, dass fossile Rohstoffe einerseits<br />
ersetzt werden müssen, da sie die Quelle des klimaschädlichen<br />
Kohlendioxids sind. Andererseits ist CO 2<br />
in der chemischen Industrie jedoch auch ein Rohstoff,<br />
der für diverse Prozesse benötigt wird.<br />
Die Umstellung auf erneuerbare Rohstoffe und Energieträger<br />
erfordert daher häufig umfangreiche Anpassungen<br />
der bestehenden Prozesse.<br />
Um die verschiedenen Strategien und Ansätze zur Erreichung<br />
der Klimaziele besser beschreibbar<br />
zu machen, werden sie in<br />
drei Themen untergliedert:<br />
• Der erste Punkt ist die Elektrifizierung<br />
von Prozessen zur Emissionsvermeidung<br />
sowie die Effizienzsteigerung<br />
bestehender Anlagen<br />
mit dem Ziel, Emissionen zu reduzieren,<br />
wo sie sich nicht vermeiden<br />
lassen.<br />
Ein engmaschiges Netz an Messinstrumenten und Energierechnern<br />
erfasst die Wärmemengen, die durch die Endress+Hauser-<br />
Dampfleitungen fließen.<br />
• Der zweite Punkt behandelt die Umstellung auf<br />
alternative Energieträger, allen voran auf grünen<br />
Wasserstoff. Neben der Herstellung, dem Transport,<br />
der Nutzung und Speicherung von H 2 fallen auch<br />
Power-to-Chemicals-Ansätze (P2C) oder das Thema<br />
Green Steel unter diesen Punkt.<br />
Bild: Endress+Hauser<br />
24 <strong>KEM</strong> <strong>Konstruktion</strong>|Automation » 12 | 2023
Nachhaltigkeit « TRENDS<br />
• Das dritte Thema behandelt CO 2 als Rohstoff, den es<br />
als Emission oder als abgeschiedenes Produkt zu erfassen<br />
gilt. Hierunter fallen Schlagworte wie Carbon<br />
Capture (CC) oder Direct Air Capture (DAC), auch die<br />
Speicherung sowie der Transport von CO 2 fallen<br />
unter diesen Themencluster.<br />
Per Direct Air Capture<br />
von Endress+Hauser<br />
wird CO 2 direkt aus der<br />
Luft filtriert und für<br />
die Weiterverwendung<br />
gespeichert.<br />
Elektrifizierung von Prozessen und<br />
Effizienzsteigerung<br />
Als erste und vielversprechende Maßnahme kann die<br />
chemische Industrie Prozesse, wo dies möglich ist, direkt<br />
auf regenerativen – emissionsfreien – Strom aus<br />
Wind, Wasser und Sonne umstellen. Dies ist sicherlich<br />
eine der größten und vermutlich auch einfachsten<br />
Stellschrauben in der Prozessindustrie.<br />
Für Prozesse, die zwar nicht sofort emissionsfrei gestellt<br />
werden können, existieren jedoch oft größere<br />
Einsparpotenziale für Emissionen, die sich durch Effizienzsteigerungen<br />
und Optimierungen der Anlagen<br />
realisieren lassen. Als Grundlage für Optimierungsmaßnahmen<br />
müssen Energieverbräuche engmaschig<br />
gemessen und bilanziert werden. Dies gelingt mit dem<br />
Feldgeräteportfolio von Endress+Hauser, mit dem<br />
sämtliche Parameter sowohl in den Kernprozessen als<br />
auch in Utilities wie Dampf-, Heiz-, Kühl- oder CIP/SIP-<br />
Kreisläufen bis hin zu eichfähigen Messstellen erfasst<br />
werden können. Das Geräteportfolio umfasst die Messparameter<br />
Druck, Durchfluss, Materialfeuchte, Flüssigkeitsanalyse,<br />
Füllstand, optische Analyse, Systemkomponenten<br />
und Temperatur. Der Messtechnikspezialist<br />
bietet neben Dienstleistungen zur Erfassung von<br />
CO 2 -Emissionen außerdem Digitalisierungsservices<br />
rund um das IIoT-Ökosystem Netilion.<br />
Wasserstoff als Speichermedium<br />
Der zweite Punkt dieses Beitrags zur Dekarbonisierung<br />
der Industrie betrifft die Umstellung von Anlagen auf<br />
alternative Energieträger. Entscheidend für die Emissi-<br />
onssenkungen durch Elektrifizierung ist die ausreichende<br />
Verfügbarkeit der regenerativen Energie. Die<br />
Sonne scheint nicht überall und zu jeder Zeit in gleichem<br />
Maße, auch die Erzeugung von Windenergie ist<br />
großen Schwankungen unterworfen. Die regenerative<br />
Energie ist somit zwar die Grundlage für die Elektrifizierung,<br />
ein Schlüsselfaktor für das Gelingen der Energiewende<br />
sind jedoch Speichertechnologien, die diese<br />
Schwankungen ausgleichen können. Ein Medium, in<br />
dem die überschüssige Sonnen- und Windenergie gespeichert<br />
werden kann, ist Wasserstoff. Die Umwandlung<br />
von Elektrizität in Wasserstoff ist zwar verlustbehaftet,<br />
jedoch kann dieser gut gespeichert und nach<br />
Bedarf relativ einfach wieder in Elektrizität zurückverwandelt<br />
werden. Die Speicherung von Energie in Wasserstoff<br />
ist unter dem Begriff Power-to-Chemicals<br />
(P2C) bekannt.<br />
Den Messgeräten und -lösungen kommt bei der gesamten<br />
Energiewende ein sehr wichtiger Stellenwert<br />
zu. Bereits heute sind sowohl Kernprozesse als auch<br />
Bild: Endress+Hauser<br />
Wenn’s heiß hergeht<br />
Hochtemperaturbeständige Festkeramik-Halbzeuge<br />
Aluminium-Silikate: Bis 1150°C temperaturbeständig<br />
Aluminum-Oxide: Bis 1360°C temperaturbeständig<br />
Macor ® , Shapal und Zirkonoxidkeramiken<br />
Als Rund- und Vierkantstab, Platte oder Scheibe<br />
Leichte Bearbeitung mit HSS-Werkzeugen<br />
Preiswerte Werkstofflösung<br />
Zertifiziert nach<br />
DIN EN ISO 9001:2015<br />
<strong>KEM</strong> <strong>Konstruktion</strong>|Automation » 12 www.kager.de<br />
| 2023 25<br />
Hochtemperaturprodukte | Kälteerzeugung | Dichten und Kleben | Messtechnik | Beschichtungen | Problemlöser
TRENDS » Nachhaltigkeit<br />
Per Carbon Capture von Endress+Hauser ist es möglich, CO 2 -Emissionen<br />
einzufangen, zu speichern und für die Industrie nutzbar zu machen.<br />
Bild: Endress+Hauser<br />
Für präzise Messdaten für die Prozesssteuerung, -überwachung und<br />
-dokumentation hält Endress+Hauser verschiedenste Geräte, Lösungen<br />
und Dienstleistungen bereit.<br />
Bild: Endress+Hauser<br />
Utilities wie zum Beispiel Wärme-, Kühlkreisläufe oder<br />
CIP/SIP-Anlagen mit einem engmaschigen Netz an<br />
Messinstrumenten ausgestattet, um Messwerte und<br />
weitere Daten für die Prozessüberwachung und -steuerung<br />
zu erheben und an die Steuerung zu kommunizieren.<br />
Im Rahmen der Energiewende benötigen Anlagenbetreiber<br />
darüber hinaus auch präzise Messwerte über<br />
Energieeinspeisung, -verbräuche und die genaue Energiedistribution<br />
bis hin zur anlagenweiten Energiebilanzierung.<br />
Auch die CO 2 -Emissionen in die Umwelt müssen<br />
genauestens erfasst werden. Weil die Energiemengen<br />
exakt und zuverlässig erfasst werden müssen, sind<br />
die Anforderungen an die Messinstrumente hoch, was<br />
die Messgenauigkeiten oder die Anforderungen an die<br />
Langzeitstabilität betrifft.<br />
Sehr speziell werden die Anforderungen an die Messtechnik<br />
jedoch besonders dann, wenn die Geräte im<br />
direkten Kontakt mit Wasserstoff stehen. Beispielsweise<br />
bietet Endress+Hauser für die Druckmessung<br />
im Elektrolyseur eine Druckmesszelle mit goldbeschichteter<br />
Membran an, die einen effektiven Schutz<br />
gegen die Diffundierung der sehr kleinen H 2 -Moleküle<br />
durch die Membran darstellt. Diffundiert das Gas<br />
durch herkömmliche Membran-Materialien, so kann<br />
dies zu Geräteausfällen führen. Teils müssen Anlagen<br />
und Geräte im Kontakt mit Wasserstoff außerordentlich<br />
hohen Drücken und geringen Temperaturen<br />
standhalten und entsprechende Messbereiche abdecken.<br />
Besondere Anforderungen stellt auch die qualitative<br />
Messung des H 2 als Produkt der Elektrolyse.<br />
Hier bietet der Schweizer Spezialist mit dem Sauerstoffanalysegerät<br />
OXY5500 ein Gerät, mit dem sich in<br />
Echtzeit der Gehalt an Restsauerstoff im Wasserstoff<br />
ermitteln lässt.<br />
Für Prozesse, die bisher noch nicht auf regenerative<br />
Energien umgestellt wurden oder für solche, bei denen<br />
dies gar nicht möglich ist, bieten sich – als dritter<br />
Punkt dieses Beitrags – aktiv abscheidende Emissionstechnologien<br />
an. Das sogenannte Carbon Capture (CC)<br />
fängt CO 2 ein, bevor es in die Luft abgegeben wird und<br />
dort einen schädlichen Einfluss auf unser Klima nimmt.<br />
Direct Air Capture (DAC) fängt CO 2 direkt aus der Umgebungsluft<br />
ein. Hierzu bieten sich verschiedene Verfahren<br />
wie zum Beispiel die Aminwäsche an, die heute<br />
schon vielfach angewendet wird, um CO 2 aus Prozessgasen,<br />
Abgasen oder auch aus der natürlichen Umluft<br />
zu gewinnen. Zur exakten Messung der CO 2 -Konzentration<br />
der Ausgangsgase setzt der Hersteller hier auf<br />
die bewährte Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy<br />
(TDLAS), damit der Prozess sicher und effizient<br />
gesteuert werden kann.<br />
Das Hauptaugenmerk der CO 2 -Wende liegt derweil<br />
zwar auf der Vermeidung und Abscheidung des Gases,<br />
jedoch spielt Kohlendioxid in der Industrie ebenso als<br />
Rohstoff eine für die Produktion wichtige Rolle.<br />
Dort wird es fehlen, wenn Prozesse auf emissionsfreie<br />
Energieträger umgestellt werden und kein Ersatz geschaffen<br />
wird. Dies betrifft zum Beispiel die Produktion<br />
von Methanol. An dieser Stelle wird es – so absurd es<br />
zunächst klingen mag – gegebenenfalls sogar nötig sein,<br />
eine neue Versorgungsinfrastruktur für die CO 2 -Versorgung<br />
aufzubauen, etwa in Form eines Pipeline-Netzes.<br />
Für jeden dieser Speicher-, Transport- und Einspeise-<br />
Prozesse benötigen Anlagenbetreiber wiederum präzise<br />
Messdaten für die Prozesssteuerung, -überwachung und<br />
-dokumentation, für die Endress+Hauser verschiedenste<br />
Geräte, Lösungen und Dienstleistungen bereithält. (jg)<br />
www.endress.com/de<br />
26 <strong>KEM</strong> <strong>Konstruktion</strong>|Automation » 12 | 2023
Nachhaltigkeit « TRENDS<br />
IIoT-Consulting<br />
„Sehr viele Kundendiskussionen zum<br />
Thema CO 2 -Fußabdruck pro Produkt“<br />
Mit neuem Consulting begleitet Schneider Electric Industrieunternehmen auf dem herausfordernden Weg<br />
ihrer digitalen Transformation. Im Interview erläutert Silke Bucher, Director Industrial Digital Transformation<br />
DACH Europe Operations, woran viele Digitalisierungsprojekte in Unternehmen scheitern, wie digitale<br />
Transformation „besser“ gelingen kann und warum dieser Transformationsprozess aktuellen Kunden- und<br />
Marktanforderungen den Weg ebnet – beispielsweise Richtung Energiemanagement sowie Nachhaltigkeit oder<br />
CO 2 -Fußabdruck pro Produkt.<br />
Interview: Nico Schröder, Korrespondent <strong>KEM</strong> <strong>Konstruktion</strong>|Automation, Augsburg<br />
<strong>KEM</strong> <strong>Konstruktion</strong>|Automation: Frau<br />
Bucher, welche Anforderungen haben<br />
Ihre Kunden aktuell?<br />
Bucher: Es herrscht eine starke Nachfrage<br />
zum Thema Energiemanagement und<br />
Nachhaltigkeit in Kombination mit<br />
Produktionsdaten aus dem Herstellprozess.<br />
Denn es geht nicht mehr nur darum,<br />
Energiemanagement beziehungsweise<br />
Energiemonitoring zu betreiben. Gerade<br />
haben wir zum Beispiel sehr viele Kundendiskussionen<br />
zum Thema CO 2 -Fußabdruck<br />
pro Produkt. Und hierbei wird vor<br />
allem das Zusammenspiel von Daten<br />
wichtig. Einerseits werden plötzlich Energiedaten<br />
aus einer Maschine relevant:<br />
Wie viel verbraucht eine Maschine zu<br />
welchem Zeitpunkt? Und auf der anderen<br />
Seite geht es um die Prozessdaten: Wie<br />
lange läuft meine Maschine, welche Auslastung<br />
ist gegeben und mit welchem<br />
Silke Bucher ist Director Industrial Digital<br />
Transformation DACH Europe Operations<br />
bei Schneider Electric.<br />
»Das komplexe Thema<br />
Rückverfolgbarkeit<br />
beziehungsweise<br />
Traceability nimmt zu.«<br />
Bild: Schneider Electric<br />
Energieverbrauch? Diese Aspekte sind am<br />
Ende des Tages zusammen zu betrachten,<br />
um wirklich zu wissen, wie viel CO 2 ein<br />
Produkt in der Produktion verbraucht hat.<br />
<strong>KEM</strong> <strong>Konstruktion</strong>|Automation: Das ist<br />
sicherlich ein erster Baustein, um das<br />
Produkt letztlich globaler im<br />
Lebenszyklus betrachten zu können...<br />
Bucher: Es ist ein Baustein, ja. Wir müssen<br />
tatsächlich die gesamte Lieferkette<br />
betrachten – von den Rohstoffen bis hin<br />
zum Produkt, das im Betrieb läuft, und<br />
darüber hinaus. Unerlässlich hierfür ist es,<br />
Informationsquellen zu schaffen. Mit dem<br />
Wunsch vieler Hersteller, dem Kunden am<br />
Ende des Tages sozusagen auf das Produkt<br />
drucken zu können, wie viel CO 2 bisher<br />
verbraucht worden ist, nimmt das<br />
komplexe Thema Rückverfolgbarkeit<br />
beziehungsweise Traceability zu.<br />
Alles rund um<br />
die Verbindung<br />
Anlagentechnik<br />
Wenn man alles aus einer Hand bekommt,<br />
passt auch alles perfekt zusammen!<br />
Deshalb bietet Ihnen ARNOLD lückenlose Komplettsysteme:<br />
Engineering, Verbindungselemente, Zuführtechnik,<br />
Verarbeitungssysteme, Remote Services – präzise<br />
abgestimmt auf Ihr individuelles Produktkonzept.<br />
Mehr Infos unter www.arnold-fastening.com<br />
Remote Services<br />
Elemente<br />
Baugruppen<br />
<strong>KEM</strong> <strong>Konstruktion</strong>|Automation » 12 | 2023 27
TRENDS » Nachhaltigkeit<br />
Ergebnisse wirklich ableitbar zu machen,<br />
predictive/vorausschauend zu arbeiten<br />
und Ausfallsicherheit hinzubekommen.<br />
<strong>KEM</strong> <strong>Konstruktion</strong>|Automation: Was<br />
hindert Unternehmen Ihrer Erfahrung<br />
nach daran, Mehrwerte mittels digitaler<br />
Transformation zu generieren und gerade<br />
auch ein Return on Investment (ROI)<br />
zu erzielen?<br />
Bild: Schneider Electric<br />
Erfolgreiche digitale Transformation: Die Smart Factory im französischen Le Vaudreuil dient<br />
Schneider Electric heute als Showcase.<br />
<strong>KEM</strong> <strong>Konstruktion</strong>|Automation: Werden<br />
gerade auch für OEMs Energiemanagement-Services<br />
wichtiger, um den<br />
verschiedenen Maschinennutzern geeignete<br />
Angebote machen zu können?<br />
Bucher: Wenn OEMs ihre Maschinen<br />
schon so ausstatten würden, dass das<br />
Energiemonitoring direkt Teil der Maschine<br />
ist und sie Energiemessgeräte direkt<br />
mitverbauen würden, wäre es für Endverbraucher<br />
viel einfacher. Diese müssten in<br />
der Hinsicht nichts nachrüsten und hätten<br />
die Daten direkt dabei. Das ist gerade<br />
noch so ein Push-Pull, den wir beobachten.<br />
<strong>KEM</strong> <strong>Konstruktion</strong>|Automation: Worum<br />
genau geht es Ihnen bei der sogenannten<br />
„industriellen digitalen Transformation“?<br />
Silke Bucher: Es geht uns darum, eine<br />
erfolgreiche und schnelle digitale<br />
Transformation in Industrieunternehmen<br />
umzusetzen – und zwar mit einem Endto-end-Ansatz<br />
vom Consulting über die<br />
Designs der Lösungen bis hin zur Durchführung<br />
der Projekte. Bislang hat Schneider<br />
Electric stark aufs Thema Software<br />
per se gesetzt. Der neue Consulting-<br />
Ansatz ist nun sinnvoll, weil zwar viele<br />
Unternehmen das Thema digitale Transformation<br />
als wichtig eingestuft haben,<br />
aber oftmals an der Umsetzung gescheitert<br />
sind – aus recht unterschiedlichen<br />
Gründen: Es hat vielleicht doch zu viel<br />
gekostet, zu viel Zeit geraubt oder das<br />
Personal ist mitunter nicht richtig<br />
geschult gewesen. Zwar haben mehr Unternehmen<br />
begonnen, Daten zu sammeln,<br />
aber sie richtig zu verwerten, nutzbringend<br />
zu verarbeiten und damit eine<br />
erfolgreiche digitale Transformation zu<br />
erreichen, ist für viele immer noch ein<br />
Problem.<br />
<strong>KEM</strong> <strong>Konstruktion</strong>|Automation: Was<br />
beinhaltet ein solches Kontextualisieren<br />
von Daten im Grunde?<br />
Bucher: Das beinhaltet Fragen wie: Wo<br />
werden die Daten eigentlich gesammelt,<br />
wie sind die Daten auszuwerten und was<br />
mache ich mit den Ergebnissen? Dabei<br />
geht es auch darum, dem Kunden die<br />
Optionen zu geben, On-Premises – also<br />
lokal – zu arbeiten, in der Cloud oder<br />
hybrid. Wir arbeiten hier inzwischen stark<br />
mit unserem industriellen Aveva-Softwareportfolio.<br />
Hierbei geht es darum,<br />
Daten aus verschiedenen Quellen zu<br />
sammeln, darzustellen und mit Analytik-<br />
Funktionen zu bewerten – also smarte<br />
Bucher: Häufig verrennen sich die Beteiligten<br />
und verlieren das Ziel aus den<br />
Augen. Allzu oft ist der Fokus auf nur<br />
einem Use Case im ersten Schritt im<br />
Unternehmen. Sie entwickeln dann beispielsweise<br />
aus Standardsoftware kundenspezifische<br />
Varianten, die zum einen<br />
sehr kostenintensiv und zum anderen<br />
schnell komplex und unübersichtlich werden.<br />
Auf einen abgegrenzten Bereich im<br />
Unternehmen bezogen funktioniert das<br />
vielleicht noch, aber wenn man den<br />
gesamten Betrieb und dessen Entwicklung<br />
im Blick hat, wird es schwierig. Denn spezifische<br />
Insellösungen machen ein skaliertes,<br />
langfristiges Vorgehen problematisch<br />
– insbesondere, wenn sich Prioritäten<br />
oder Zielsetzungen über die Zeit verändern.<br />
Ein anderes Hindernis sind fehlende<br />
Zeithorizonte bei der Umsetzung. Das<br />
Proof of Concept führt nicht zu einem<br />
ersichtlichen ROI, von dem man als Unternehmen<br />
eine vernünftige Ausrollvariante<br />
erreicht. Auch daran scheitern viele Digitalisierungsprojekte.<br />
<strong>KEM</strong> <strong>Konstruktion</strong>|Automation: Was<br />
passiert, wenn es kein klassisches<br />
Enablement derer gibt, die letztlich mit<br />
digitalen Tools umgehen sollen?<br />
Bucher: Ganz einfach: Das Potenzial digitaler<br />
Technologien bleibt ohne Enablement<br />
ungenutzt. Nur wenn ich eine Technologie<br />
auch wirklich angemessen kenne<br />
und den Umgang mit ihr vernünftig<br />
gelernt habe, erschließen sich mir die<br />
damit verbundenen Mehrwerte. Tools<br />
werden einfach nicht genutzt, wenn der<br />
Mehrwert nicht vermittelt ist. Mangelndes<br />
Enablement führt letztlich nur zu<br />
Frust und zur Ablehnung der Technologien.<br />
28 <strong>KEM</strong> <strong>Konstruktion</strong>|Automation » 12 | 2023
<strong>KEM</strong> <strong>Konstruktion</strong>|Automation: Wie wird sich die<br />
digitale Transformation in den kommenden Jahren<br />
entwickeln?<br />
Bucher: Gerade in den nächsten zwei bis drei Jahren<br />
wird das Thema digitale Transformation nochmal ein<br />
ganz anderes Tempo aufnehmen. Denn nicht zuletzt die<br />
Krisen rund um Corona, Lieferketten oder Energie haben<br />
einmal mehr bestätigt, dass Digitalisierung als zentrale<br />
unternehmerische Kernkompetenz verstanden werden<br />
muss. Wenn ich mir unsere Kunden, auch aus dem Mittelstand,<br />
anschaue und bewerte, wie gut die durch diese<br />
Krisen gekommen sind, dann kristallisiert sich ein eindeutiges<br />
Bild heraus: Wer rechtzeitig in die digitale<br />
Transformation investiert hat, steht jetzt deutlich resilienter<br />
und besser da als der Branchendurchschnitt –<br />
gerade, wenn es um Energiethemen geht.<br />
<strong>KEM</strong> <strong>Konstruktion</strong>|Automation: Können Sie Ansätze<br />
nennen, die dazu beitragen, dass digitale Transformation<br />
„besser“ gelingt?<br />
Bucher: Für mich sind Systemoffenheit und eine ganzheitliche<br />
Denkweise zentral. Denn einen langfristigen<br />
Return-on-Investment habe ich nur, wenn sich meine<br />
Lösung skalieren lässt, wenn sie offen für die Anbindung<br />
von Drittanbieter-Komponenten bleibt und jederzeit<br />
eine durchgängige Kommunikation von Daten zulässt.<br />
Silo-Denken oder Insellösungen versprechen dagegen<br />
höchstens einen sehr kurzfristigen Effekt. Was aber<br />
übrigens nicht heißt, dass man immer sofort den ganz<br />
großen Wurf wagen muss. Beim Umbau unseres Werks<br />
im französischen Le Vaudreuil zur Smart Factory haben<br />
wir uns zum Beispiel erstmal nur auf einen bestimmten<br />
Produktionsbereich fokussiert. Da wir aber von Anfang<br />
an mit unserer offenen IoT-Architektur namens Eco<br />
Struxure gearbeitet haben, konnten wir die für gut<br />
befundenen Lösungen sukzessive auf die gesamte Fabrik<br />
übertragen. Heute dient uns dieser Standort auch als<br />
Showcase für eine sehr erfolgreiche digitale Transformation.<br />
SERVICE IM FOKUS<br />
SERIENTÄTER<br />
www.se.com<br />
INFO<br />
Broschüre (PDF, Englisch) zu den aktuellen<br />
Digital Transformation Services<br />
hier.pro/F7uZO<br />
Wir gestehen,<br />
COG trägt die Verantwortung für viele serienmäßige Erfolge<br />
unserer Kunden. Von der Idee über die Mischungsentwicklung<br />
bis zur Produktion kundenspezifischer Elastomerlösungen<br />
und Assembling.<br />
• Einzelne O-Ringe oder komplett montiert<br />
• Full Service: Entwicklung, <strong>Konstruktion</strong> und Prototyping<br />
• Logistik, Produktion, Montage und Konfektionierung<br />
Fordern Sie jetzt Akteneinsicht in die Erfolge<br />
unserer Kunden an: info@cog.de<br />
<strong>KEM</strong> <strong>Konstruktion</strong>|Automation » 12 | 2023 29<br />
COG.de
TRENDS » Perspektiven » Nachhaltigkeit<br />
Software-Programmierung beeinflusst den Energieverbrauch<br />
Energie sparen durch<br />
„grünes Programmieren“<br />
Software-Applikationen werden durch moderne Fähigkeiten wie Echtzeit-Datenanalyse und KI immer energiehungriger.<br />
Daher schlummert gerade in der Automatisierung mit ihren häufig 24/7 laufenden Anlagen<br />
großes Einsparpotential. Gehoben werden kann es durch „grünere Programmierung“ (Green Coding).<br />
Tobias Meyer, freier Mitarbeiter der <strong>KEM</strong> <strong>Konstruktion</strong>|Automation<br />
<strong>KEM</strong> <strong>Konstruktion</strong>|Automation: Wie<br />
bekannt ist das Thema „Green Coding“<br />
bei Ihnen im Unternehmen?<br />
Henning Mersch (Beckhoff): Der Begriff<br />
ist bekannt – und viele unserer Bemühungen<br />
im Unternehmen zur CO 2 -Reduktion,<br />
Steigerung der Energieeffizienz<br />
usw. lassen sich auch im Bereich Green<br />
Coding einordnen.<br />
Carolin Rubner (Siemens): Bei Siemens<br />
strukturieren wir unsere Forschungsthemen<br />
in Company Core Technologies (CCT),<br />
unter Software, System and Processes leite<br />
ich das Modul Sustainable Software<br />
Engineering and industrial-grade DevOps.<br />
Insofern haben wir das Green Coding als<br />
Forschungsthema schon länger identifiziert<br />
und im Sustainable Software Engineering<br />
gebündelt.<br />
Dr. Hans Egermeier (Talsen Team): Wir<br />
sind aktiv dabei, das wichtige Thema<br />
Nachhaltigkeit durch die Digitalisierung<br />
voranzutreiben. Es gibt einen hemds -<br />
ärmeligen Spruch, der in der praktischen<br />
Softwareumsetzung häufig die Führungsgröße<br />
ist: Make it run, make it right, make<br />
it fast. Für viele Teams, in die ich als Berater<br />
Einblick habe, ist schon der erste<br />
Schritt ein riesengroßes Thema, also eine<br />
Software überhaupt einmal fehlerfrei und<br />
robust zum Laufen zu bringen. Make it<br />
right – also sauber zu coden – ist dann<br />
schon die nächste große Hürde, für die<br />
dann aber in den Projekten häufig keine<br />
Zeit mehr ist. Die Firmen sind dann froh,<br />
dass es läuft. Never touch a running sys-<br />
tem – und auf geht‘s zum nächsten Projekt.<br />
Make it fast und neuerdings dann<br />
noch make it green sind dann beinahe auf<br />
demselben, schwer noch zusätzlich zu<br />
realisierenden Level.<br />
<strong>KEM</strong> <strong>Konstruktion</strong>|Automation: Die<br />
Forschung zeigt, dass etwa eine Zufallszahlen-Funktion<br />
in Python viel Strom<br />
braucht, ein anderes Modul mit dem<br />
gleichen Zweck kommt mit 2 % der<br />
Energie aus. Textverarbeitungsprogramme<br />
unterscheiden sich im Energiebedarf<br />
für die gleiche Tätigkeit um das Vier -<br />
fache. Sehen Sie ein ähnliches Spar -<br />
potential in der Software für Industrieautomatisierungssysteme?<br />
Mersch: Für die Industrieautomatisierung,<br />
insbesondere die PC-basierte Steuerungstechnik<br />
wie sie Beckhoff seit Anbeginn<br />
nach vorne treibt, gibt es eine wesentliche<br />
Stellschraube: das Betriebssystem.<br />
Deswegen passt Beckhoff ein generisches<br />
Betriebssystem wie Windows auch<br />
hochgradig an die Industrieanforderungen<br />
an. So werden beispielsweise zur<br />
Ressourceneinsparung Windows-Dienste<br />
abgestellt oder für ein Desktop-System<br />
übliche, hier aber verzichtbare Komponenten<br />
nicht installiert. Zudem bietet<br />
Beckhoff Betriebssysteme an, die mit kleinerem<br />
Footprint auskommen. Klassisch<br />
war das Windows CE, nun ist es Twincat/<br />
BSD. Auch in unseren eigenen Testzentren<br />
für die Überprüfung der Produktqualität<br />
werden bevorzugt ressourcenschonende<br />
Betriebssysteme eingesetzt. Natürlich<br />
funktioniert dies besonders gut für die<br />
Bild: Beckhoff<br />
Henning Mersch,<br />
Produktmanager Twincat bei der<br />
Beckhoff Automation GmbH & Co. KG, Verl<br />
»Ressourceneffizienz<br />
bedeutet auch, kleinere<br />
und damit im Normalfall<br />
günstigere CPUs<br />
verwenden zu können.<br />
Wichtig sind aber zudem<br />
konstante Laufzeiten,<br />
damit das Gesamtsystem<br />
echtzeitfähig ist.<br />
Hier muss man<br />
in manchen Fällen<br />
durchaus gegeneinander<br />
abwägen.«<br />
arithmetischen, vom Betriebssystem unabhängigen<br />
Teile. Letztendlich laufen Integrationstests<br />
auf allen Betriebssystemen,<br />
die wir anbieten.<br />
30 <strong>KEM</strong> <strong>Konstruktion</strong>|Automation » 12 | 2023
Bild: peopleimages.com/stock.adobe.com<br />
Kann die Art der Programmierung den Energieverbrauch beeinflussen? Ja – und die Differenz zwischen bester und schlechtester Lösung kann beachtlich sein.<br />
Rubner: Der allererste Schritt muss wirklich<br />
sein, das Bewusstsein zu schaffen,<br />
dass auch die Digitalisierung Emissionen<br />
erzeugt. Wir erreichen viele Nachhaltigkeitsziele<br />
durch Digitalisierung, müssen<br />
aber auch schauen, dass die Digitalisierung<br />
selbst die Nachhaltigkeit mit betrachtet.<br />
Wir müssen betrachten, was die<br />
CO 2 -Emission und den Ressourcenverbrauch<br />
beeinflusst: Welche Architekturen<br />
wähle ich, arbeite ich an einem Monolith<br />
oder ist die Software modular sowie viele<br />
andere Thematiken wie Implementierung<br />
oder auch die DevOps-Infrastruktur.<br />
Schlussendlich müssen wir in der Anlage<br />
messen und konkrete Zahlen zur Verfügung<br />
stellen, durch die dann via Feedbackschleife<br />
wieder das Software- und<br />
Solutiondesign verbessert werden kann.<br />
Egermeier: Dafür ist es wichtig, das<br />
praktische Produktionsumfeld zu kennen.<br />
Denn einige Anlagen werden dort nach<br />
wie vor nie abgeschaltet, und zwar nicht,<br />
weil 24/7 produziert wird, sondern weil<br />
sich die Betreiber nicht trauen, sie abzuschalten<br />
– aus Angst, das Ganze wird nie<br />
wieder hochfahren. Sprich, allein im<br />
„make it right“ liegt schon ein riesengroßes<br />
Optimierungspotential: Anlagen so zu<br />
programmieren, dass ich sie tatsächlich<br />
fallbezogen einfach ausschalten und<br />
dann wieder anschalten kann. Schon so<br />
kann man Energie sparen, denn allein die<br />
Implementierung eines Schlafmodus wäre<br />
je nach Verständnis schon ein großer<br />
Beitrag zum Green Coding.<br />
<strong>KEM</strong> <strong>Konstruktion</strong>|Automation: Werden<br />
bereits Versuche angestellt, mit<br />
welchen Programmiermethoden oder<br />
Modulen bzw. Bibliotheken die besten<br />
Ergebnisse hinsichtlich Ressourceneffizienz<br />
erzielt werden können?<br />
Mersch: Ja, und das schon immer. Ressourceneffizienz<br />
bedeutet dabei schließlich<br />
auch, kleinere und damit im Normalfall<br />
günstigere CPUs verwenden zu können.<br />
Wichtig sind aber zudem konstante<br />
Laufzeiten, damit das Gesamtsystem<br />
echtzeitfähig ist. Hier muss in manchen<br />
Fällen durchaus gegeneinander abgewogen<br />
werden.<br />
IM FOKUS<br />
Softwarecode, besser die Art<br />
der Programmierung, kann<br />
den Energieverbrauch<br />
deutlich beeinflussen – nicht<br />
nur bei 24/7-Anlagen ein<br />
wichtiges Thema.<br />
Rubner: Wir arbeiten mit Partnern wie der<br />
Gesellschaft für Informatik und dem Öko-<br />
Institut im Förderprojekt Eco-Digit quasi<br />
an einem Prüfstand für Software: Ziel ist<br />
die Entwicklung einer automatisierten Bewertungsumgebung,<br />
die für beliebige<br />
Software die Daten zu Ressourcenverbräuchen,<br />
CO 2 -Emissionen etc. transparent offenlegt.<br />
Zudem schauen wir auch immer,<br />
was außerhalb unseres Kosmos passiert,<br />
denn wir müssen ja nicht das Rad neu erfinden.<br />
Siemens ist zudem als seit Kurzem<br />
auch Steering Member Teil der 2021 unter<br />
anderem von Microsoft, GitHub, Thoughtworks<br />
und Accenture ins Leben gerufenen<br />
Green Software Foundation. Dort haben<br />
wir bereits begonnen, Tools und Methoden<br />
zu sammeln und wollen das Thema gemeinsam<br />
mit weiteren Industriegrößen<br />
auch Richtung Standardisierung vorantreiben.<br />
Zusätzlich stehen wir mit verschiedenen<br />
Einrichtungen wie dem Umweltcampus<br />
Trier oder dem Hasso-Plattner-Institut<br />
(Clean-IT Konferenz) im Austausch.<br />
<strong>KEM</strong> <strong>Konstruktion</strong>|Automation » 12 | 2023 31
TRENDS » Perspektiven » Nachhaltigkeit<br />
In der grünen Programmierung steckt ein enormes Potential – besonders dann, wenn sie von Anfang an berücksichtigt wird.<br />
Bild: ArtemisDiana/stock.adobe.com<br />
Egermeier: Dafür wird wahrscheinlich<br />
das Tooling sehr wichtig werden. Denn zu<br />
erkennen, welches Modul was macht ist<br />
in schon in kleinsten Softwareprojekten<br />
sehr schwer. Um überhaupt die fehlerfreie<br />
Funktionsfähigkeit einer Software – das<br />
make it right – zu überwachen, lassen gute<br />
Programmierer kontinuierlich entsprechende<br />
Tests mitlaufen. Denkbar wäre,<br />
dass wir so etwas auch für den Energieverbrauch<br />
etablieren können. Denn für einen<br />
Programmierer ist so etwas sehr<br />
schwer oder gar nicht ersichtlich, wir kennen<br />
das aus der Diskussion um zu langsame<br />
Software: Die Spekulationen um die<br />
Gründe dafür sind oft falsch. Schon bei<br />
relativ gering-komplexen Software-Programmen<br />
ist man als Programmierer nicht<br />
mehr oder nur mit unverhältnismäßig viel<br />
Aufwand in der Lage zu erkennen, warum<br />
das System zu langsam ist. Erst mit Performance-Analysetools<br />
sieht man wirklich,<br />
wo die Schwachstelle im Code ist. Oft<br />
sind das dann kleine Programmteile, die<br />
total unscheinbar wirken, an einer anderen<br />
Stelle aber vielleicht tausende Male<br />
ausgeführt werden – und alle aber denken,<br />
diese kleine Funktion sei ja so superschnell,<br />
das mache nichts aus. Ich kann<br />
mir sehr gut vorstellen, dass es sich beim<br />
Green Coding in ähnlicher Weise verhält.<br />
<strong>KEM</strong> <strong>Konstruktion</strong>|Automation: Labels<br />
wie der Blaue Engel zertifizieren inzwischen<br />
auch Software. Dabei sieht man<br />
Programme, deren neue Versionen auch<br />
neue Hardware benötigt, als wenig<br />
nachhaltig an. Legt man in der Automatisierungstechnik<br />
mehr Wert auf Abwärtskompatibilität<br />
als etwa bei Office-<br />
Software?<br />
Mersch: Das ist tatsächlich ein klassischer<br />
Unterschied. Auch wenn die Einsatzbereiche<br />
schwer zu vergleichen sind,<br />
werden unsere Steuerungen typischerweise<br />
um mehrere Faktoren länger eingesetzt<br />
als Computer in Rechenzentren oder<br />
im Desktop-Bereich. Das heißt aber auch,<br />
dass Energieeffizienzmaßnahmen der<br />
CPU-Lieferanten sich bei unseren Kunden<br />
erst später auswirken, da hier die Langzeitverfügbarkeit<br />
eine wichtige Rolle<br />
spielt. Wenn in Rechenzentren Computer<br />
ausgetauscht werden, weil es sich aus<br />
Gründen der Energieeffizienz rechnet, ist<br />
das in der Industrieautomatisierung noch<br />
lange nicht der Fall – allein schon, weil<br />
die Industrieautomatisierung selbst in der<br />
Regel nicht den größten Anteil am Energiebedarf<br />
einer Anlage oder Maschine<br />
ausmacht.<br />
Rubner: Hierbei ist eine gute API-Strategie<br />
definitiv ein wichtiger Punkt, ebenso<br />
gut definierte Funktionalitäten, die dann<br />
leicht wieder gefunden und auch wiederverwendet<br />
werden können. Containerisierung<br />
erleichtert zudem die Wiederverwendbarkeit<br />
auf verschiedener Hardware<br />
oder neuen Plattformen. Natürlich müssen<br />
wir dabei messen, wie viel zusätzliches<br />
CO 2 wir dadurch einkaufen und was<br />
wir durch Wiederverwenden sparen.<br />
Egermeier: Der Brownfield-Bereich in<br />
der Automatisierungsbranche ist riesig<br />
und in aller Regel können es sich Hersteller<br />
kaum leisten, harte Kompatibilitätsbrüche<br />
zu riskieren. Wenn Softwareoptimierungen<br />
der Steuerungen auf Bestandsanlagen<br />
gemacht werden, achten<br />
die meisten Hersteller peinlich genau<br />
drauf, dass diese ohne Hardwareänderung<br />
weiterbetrieben werden können. Wenn<br />
plötzlich ein kleines Softwareupdate dazu<br />
führt, dass nichts mehr geht, überlegen<br />
sich Kunden sehr schnell, ob nicht ein<br />
Wechsel des Steuerungsherstellers in Betracht<br />
zu ziehen wäre.<br />
<strong>KEM</strong> <strong>Konstruktion</strong>|Automation: Aktuell<br />
versuchen Softwareanbieter, sich unter<br />
anderem über den Funktionsumfang abzugrenzen.<br />
Könnten die eventuell von<br />
vielen Kunden ungenutzten Softwareelemente<br />
künftig ein Kritikpunkt werden?<br />
Mersch: Gegensteuern könnte man mit<br />
einer hohen Fähigkeit zur Modularisierung.<br />
Und hier sprechen Sie eine der<br />
Hauptvorteile der PC-basierten Steuerun-<br />
32 <strong>KEM</strong> <strong>Konstruktion</strong>|Automation » 12 | 2023
gen von Beckhoff an: Auf eine gegebenenfalls<br />
kleine Basis können, müssen aber<br />
nicht zusätzliche Funktionen installiert<br />
werden. Die Option einer zusätzlichen Installation<br />
zu haben, wird aber nie ein Kritikpunkt<br />
werden. Modularisierung von<br />
Software in Form von paketierten Updates<br />
bietet Beckhoff schon lange – und<br />
wir forcieren hier gerade mit einem Twincat<br />
Paket Manager zusätzlich die Einfachheit.<br />
Denn die Optionen müssen vom<br />
Kunden ja auch genutzt werden, und<br />
zwar auf möglichst einfache Art und Weise.<br />
Modularisierung spielt gerade auf der<br />
Anlagen-Ebene eine entscheidende Rolle:<br />
Das Konzept Module Type Package (MTP)<br />
sorgt für einheitliche Schnittstellen von<br />
Teilanlagen – und diese Ansätze sehe ich<br />
als äußerst vielversprechend im Bereich<br />
Green Coding: Fertige Module für unterschiedliche<br />
Produktionen schnell arrangieren<br />
zu können, bedeutet weniger Teilanlagen<br />
bauen zu müssen!<br />
Rubner: Um hier gut aufgestellt zu sein<br />
arbeiten wir mit Experten aus verschiedenen<br />
Bereichen zusammen. Siemens-intern<br />
haben wir eine Software, die uns<br />
hierbei unterstützt: Green Digital Twin.<br />
Dieser hilft uns, die Gesamtlösung zu bewerten,<br />
möglichst nachhaltig zusammenzustellen<br />
und dann leicht daraus auch<br />
den entsprechenden CO 2 -Fußabdruck zu<br />
bestimmen. Hier schauen wir, was wir dafür<br />
von der Softwareseite und der Service-<br />
und Solutionsseite machen müssen.<br />
Egermeier: Ich würde sagen, die Größe<br />
von Software und der Energiebedarf korrelieren<br />
nicht. Die ausgeführten Anweisungen<br />
pro Zeit sind entscheidend. Ein<br />
kleines sehr uneffizientes Programm kann<br />
damit mehr Energie verbrauchen als eine<br />
große, funktional vielfältige aber effizient<br />
umgesetzte Applikation.<br />
<strong>KEM</strong> <strong>Konstruktion</strong>|Automation: Welche<br />
Möglichkeiten sehen Sie, die Software<br />
von morgen möglichst ressourceneffizient<br />
zu gestalten?<br />
Mersch: Einfachheit für den Anlagenund<br />
Maschinenbauer ist das Wichtigste.<br />
Das Thema sollte möglichst keine (aktive)<br />
Rolle spielen, sondern automatisiert erledigt<br />
werden – wie eingangs bezüglich<br />
Compiler angesprochen: effiziente Hardware<br />
weise auswählen und klug mit den<br />
richtigen Softwarekomponenten kombinieren<br />
– und das hochindividuell, wie es<br />
nur die PC-basierte Steuerungstechnik<br />
ermöglicht.<br />
Rubner: Ein Life Cycle Assessment von<br />
Software ist nicht einfach. Wir nutzen die<br />
Methode, die wir auch für unsere Hardwarekomponenten<br />
anwenden, seit dem<br />
Bild: Siemens<br />
Carolin Rubner, Head of Sustainable<br />
Software Engineering and industrial-grade<br />
DevOps, Siemens Technology, Erlangen<br />
»Wir erreichen viele<br />
Nachhaltigkeitsziele durch<br />
Digitalisierung – müssen<br />
aber auch schauen, dass<br />
die Digitalisierung selbst<br />
die Nachhaltigkeit<br />
mit betrachtet.«<br />
letzten Geschäftsjahr bereits für Software<br />
und jetzt auch für Services. Dabei teilt<br />
sich das Ganze auf Energie und Material,<br />
denn man muss auch vom Laptop bis zum<br />
Data Center die Infrastruktur der Entwickler<br />
mit einbeziehen. Zur Energie<br />
gehört, was für Entwicklung, Speicherung<br />
und Betrieb notwendig ist. Einige Punkte<br />
des verwendeten Ansatzes zur Lebens -<br />
zyklusanalyse haben wir hier schon genauer<br />
betrachtet – Produktion, Vertrieb<br />
und Speicherung – bei Materialbeschaf-<br />
<strong>KEM</strong> <strong>Konstruktion</strong>|Automation » 12 | 2023 33
TRENDS » Perspektiven » Nachhaltigkeit<br />
Bild: Siemens<br />
Siemens setzt wie andere auf Automatisierung via PC-Technik, die flexibel und leistungsfähig genug ist, um Machine Learning und Datenanalyse fertigungsnah<br />
ausführen zu können. Gerade bei Anlagen, die rund um die Uhr laufen, kommt deswegen der Art der Programmierung eine hohe Bedeutung zu.<br />
Dr. Hans Egermeier, Geschäftsführer der<br />
Talsen Team GmbH, Freilassing<br />
Bild: Talsen Team<br />
»Der wichtigste Hebel<br />
wird sein, bereits in der<br />
Programmiererausbildung<br />
das Bewusstsein für Green<br />
Coding zu schaffen.«<br />
fung und End of Life stehen noch einige<br />
Definitionen aus. Hier können wir auf<br />
Regularien des Greenhouse Gas Protokoll<br />
ICT Sector Guidance zurückgreifen.<br />
Zudem gibt es jetzt auch von der Green<br />
Software Foundation die Software Carbon<br />
Intensity Specification, die dann<br />
etwas leichter in Software-Entwicklungszyklen<br />
anwendbar ist.<br />
Egermeier: Es gibt natürlich klassische<br />
Handgriffe wie etwa den trivialen Fall, einen<br />
Prozess warten zu lassen. Dazu kann<br />
man eine Schleife zig mal durchlaufen<br />
lassen, was bedeutet, dass der Rechner in<br />
dem Sinne gar nicht wirklich wartet. Dabei<br />
wird dann wirklich Energie verbrannt.<br />
Ändern lässt sich das mit einem speziellen<br />
Event, das tatsächlich die Prozesse auch<br />
anhält und erst startet, wenn ich sage<br />
‚Hey, jetzt lauf!‘. Das heißt, allein dieses<br />
Warten kann ich bestimmt sehr energieaufwändig<br />
implementieren oder es sehr<br />
energieeffizient gestalten. Der wichtigste<br />
Hebel dabei wird sein, bereits in der Programmiererausbildung<br />
das Bewusstsein<br />
für Green Coding zu schaffen. Stünden<br />
dann beispielsweise drei vergleichbare<br />
Module parat, kann ich mir das ‚grünste‘<br />
aussuchen. Dann wäre ich noch ganz am<br />
Anfang, bevor ich überhaupt was zum<br />
Laufen bekomme, hinsichtlich Energie -<br />
effizienz schon mal einen Schritt weiter.<br />
Zudem birgt auch die schlaue Programmierung<br />
von Robotern und anderen Physiken<br />
großes Optimierungspotential in<br />
Bezug auf den Energieverbrauch: Wege<br />
kurz halten, Temperaturgefälle gut ausgleichen,<br />
scharfe Beschleunigungsprofile<br />
vermeiden. Dafür braucht es entsprechende<br />
Simulationen und digitale Zwillinge.<br />
Wahrscheinlich würde also Green<br />
Coding in der Automatisierung mit der<br />
Messtechnik beginnen. So können wir bestimmen,<br />
wie viel Energie in welcher Betriebsphase<br />
oder in welchem Betriebszustand<br />
verbraucht wird. Aus den Erkenntnissen<br />
könnte man dann die Maßnahmen<br />
für ein Green Coding im übertragenen<br />
Sinne ableiten.<br />
INFO<br />
Die Green Software Foundation<br />
treibt als gemeinnützige<br />
Stiftung die Nachhaltigkeit<br />
von Software voran:<br />
hier.pro/eEJ9l<br />
34 <strong>KEM</strong> <strong>Konstruktion</strong>|Automation » 12 | 2023
Industrie<br />
fachjobs24.de – hier finden Arbeitgeber<br />
qualifizierte Fach- und<br />
Führungskräfte<br />
Sprechen Sie Nutzer von Branchen-Fachmedien an:<br />
die Interessierten und Engagierten ihres Fachs<br />
Erreichen Sie die Wechselwilligen, schon bevor<br />
sie zu aktiven Suchern werden<br />
Für optimales Personalmarketing: Präsentieren Sie<br />
sich als attraktiver Arbeitgeber der Branche<br />
EINFACH,<br />
SCHNELL UND<br />
FÜR NUR<br />
249€<br />
Preis zzgl. MwSt<br />
Einzigartiges Netzwerk zielgruppenspezifischer Branchen-Channels<br />
Augenoptik Handwerk Architektur<br />
Arbeitswelt<br />
Wissen<br />
34 Online-Partner<br />
28 Print-Partner<br />
<strong>KEM</strong> <strong>Konstruktion</strong>|Automation Das Stellenportal für » 12 Ihren | 2023 Erfolg! 35
TRENDS » Interview » Nachhaltigkeit<br />
Herausforderungen auf dem Weg zur All Electric Society (AES)<br />
„Nachhaltigkeit beginnt bereits mit dem<br />
richtigen Einsatz der DC-Technologie“<br />
IM INTERVIEW<br />
Dr. Stefan Jörres,<br />
Director Platform<br />
Innovation BA ICE,<br />
Phoenix Contact,<br />
Blomberg<br />
Das Konzept der All Electric Society (AES) verspricht eine nachhaltige Nutzung der Ressourcen<br />
der Erde. Es setzt die Verfügbarkeit von ausreichend ‚grünem‘ Strom voraus, verbunden<br />
mit einem sehr effizienten Umfang mit Energie. Deswegen spielt auch die direkte Nutzung<br />
von Gleichstrom (DC-Industrie) eine wichtige Rolle, genauso wie die Kopplung der Sektoren<br />
Energie, Industrie, Infrastruktur und Mobilität. Das führt zu einer Reihe von Herausforderungen<br />
und der Entwicklung angepasster Komponenten.<br />
Michael Corban, Chefredakteur <strong>KEM</strong> <strong>Konstruktion</strong>|Automation<br />
<strong>KEM</strong> <strong>Konstruktion</strong>|Automation: Die<br />
Idee der All Electric Society (AES), die<br />
Phoenix Contact unterstützt, setzt über<br />
die Sektorenkopplung die ganzheitliche<br />
Betrachtung von Energieerzeugung, -verteilung,<br />
-speicherung und -verbrauch voraus.<br />
Welche Herausforderungen ergeben<br />
sich hieraus?<br />
Dr. Stefan Jörres (Phoenix Contact):<br />
Mit Blick auf das Energiesystem hat<br />
Deutschland einen kompletten Systemwandel<br />
eingeleitet. Zuvor lief die Energie<br />
unidirektional von großen Kraftwerken<br />
über Verteil- und Übertragungssysteme<br />
zum Verbraucher. Zukünftig wird es eine<br />
Vielzahl dezentraler Einheiten geben – sowohl<br />
Erzeuger- als auch Speichereinheiten<br />
zur Stabilisierung der Netze –, die intelligent<br />
miteinander gekoppelt werden müssen.<br />
Zudem werden einzelne Sektoren<br />
Energie untereinander austauschen müssen,<br />
so dass diese in der richtigen Form<br />
dort zur Verfügung steht, wo sie benötigt<br />
wird. Diese Kopplung in einem Netz zu ermöglichen,<br />
das ursprünglich für eine unidirektionale<br />
Energieverteilung konzipiert<br />
war, ist eine Herausforderung.<br />
Um es greifbarer zu machen: Erreicht etwa<br />
eine Photovoltaik-Anlage zur Mittagszeit<br />
einen Peak, gilt es eine Möglichkeit zu finden,<br />
die erzeugte Energie zu speichern. Ist<br />
umgekehrt der Verbrauch sehr hoch, muss<br />
dieser Speicher die Energie wieder zur Verfügung<br />
stellen. Gelingt uns dies auch per<br />
Sektorenkopplung, können wir unser Netz<br />
Bild: Phoenix Contact<br />
Dr. Stefan Jörres, Director Platform<br />
Innovation BA ICE, Phoenix Contact, Blomberg<br />
»Einzelne Sektoren werden<br />
Energie untereinander<br />
austauschen müssen–<br />
diese Kopplung in einem<br />
Netz zu ermöglichen, das<br />
ursprünglich für eine<br />
unidirektionale<br />
Energieverteilung<br />
konzipiert war, ist eine<br />
Herausforderung.«<br />
so weit entlasten, dass wir es nicht komplett<br />
erneuern müssen. Dafür bieten wir<br />
bereits Produkte, Lösungen und Dienstleistungen<br />
– und entwickeln diese stetig<br />
weiter.<br />
<strong>KEM</strong> <strong>Konstruktion</strong>|Automation: Wie<br />
lässt sich denn ein solches, doch komplexes<br />
System steuern?<br />
Jörres: Das ist in der Tat ein echte Herausforderung.<br />
In dem früheren unidirektionalen<br />
Netz konnten wir das sehr einfach über<br />
die Netzfrequenz steuern. Auf diese Weise<br />
ist das europäische Verbundnetz entstanden.<br />
Sinkt die Frequenz, muss mehr Energie<br />
erzeugt werden, steigt sie, muss weniger<br />
zugeführt werden. Das ist alles gut<br />
machbar bei Wechselspannung. Durch die<br />
Sektorenkopplung kommen nun aber auch<br />
Gleichstrom-Anteile dazu, etwa von Photovoltaik-Anlagen<br />
oder DC-Speichern. Bei<br />
der Kopplung derart verschiedener Systeme<br />
den Lastfluss zu steuern und damit<br />
Energie zu managen, ist die künftige Herausforderung.<br />
Deshalb geht es darum, die<br />
einzelnen Sektoren nicht nur leistungstechnisch,<br />
sondern auch kommunikativ<br />
miteinander zu vernetzen. Das setzt standardisierte<br />
Kommunikationsprotokolle innerhalb<br />
von verschiedenen Netzwerken<br />
voraus, um nicht an Systemgrenzen zu<br />
scheitern. Leider kommen wir mit der Sektorenkopplung<br />
in Bereiche, in denen nichts<br />
mehr standardisiert ist.<br />
Man findet deswegen bislang nur wenige<br />
Planer, die beispielsweise solch eine Sektorenkopplung<br />
übergreifend planen und realisieren<br />
können – etwa über eine Fabrik<br />
oder Produktionsstätte beziehungsweise<br />
ein smartes Gebäude hinweg. Auch hier ist<br />
die ganz normale AC-Verteilung kein Pro-<br />
36 <strong>KEM</strong> <strong>Konstruktion</strong>|Automation » 12 | 2023
Bild: Phoenix Contact<br />
Solarenergie ermöglicht den Einsatz grüner Energie und die Nutzung von Gleichstrom (DC-Industrie). Phoenix Contact nutzt und testet dieses Konzept selbst<br />
mit dem neuen Gebäude 60 in Blomberg.<br />
blem – ganz im Gegensatz zum DC-Netz.<br />
Hier entwickeln wir derzeit technisch erst<br />
die entsprechenden Lösungen, um auch<br />
den DC-Anteil mit einbinden zu können.<br />
Dabei lernen wir, sowohl mit den Vorteilen<br />
umzugehen als auch die Nachteile in den<br />
Griff zu bekommen. Das betrifft zum Beispiel<br />
die Schutzorgane, um ein sicheres<br />
Netz aufzubauen.<br />
<strong>KEM</strong> <strong>Konstruktion</strong>|Automation: Wollen<br />
Sie das etwas näher erläutern?<br />
Jörres: Schaltvorgänge beherrschen wir<br />
gut bei Wechselstrom. Wir können etwa<br />
gerade bei hohen Lasten sehr präzise beim<br />
Nulldurchgang schalten. Bei einem Gleichstromnetz<br />
gibt es keinen Nulldurchgang<br />
und die Frage ist, wie ich gerade bei hohen<br />
Lasten dann sicher schalten kann – unter<br />
anderem geht es auch darum, die Lichtbogen-Problematik<br />
in den Griff zu bekommen.<br />
Die Realisierung passender Schutzorgane<br />
ist also ebenfalls eine der wesentlichen<br />
Herausforderungen beim bevorstehenden<br />
Umbau der Energieversorgung. Zumal<br />
unsere Entwicklungseinheiten parallel<br />
noch vor der Herausforderung stehen, diese<br />
Schutzorgane zu einem marktfähigen<br />
Preis anzubieten.<br />
Die noch fehlende Standardisierung erschwert<br />
das zusätzlich. Im europäischen<br />
Verbundnetz mit Wechselstrom erfolgt<br />
beispielsweise der Transport mit Höchstspannung<br />
von 220 oder 380 kV oder Hochspannung<br />
von 110 kV, die Mittelspannung<br />
arbeitet mit 10 bis 30 kV und die Niederspannung<br />
dann mit 230 und 400 V. So<br />
weit, so gut und standardisiert. Verschiedene<br />
Spannungslevel gibt es natürlich aber<br />
auch bei Gleichstrom – 100, 110, 200, 400,<br />
690, 1000 oder 1500 V. Die verschiedenen<br />
Spannungsebenen müssen natürlich bei<br />
der Entwicklung der Schutzorgane berücksichtigt<br />
werden. Im Bereich der Schaltund<br />
Schutzorgane wäre deswegen mehr<br />
Standardisierung ein Vorteil.<br />
<strong>KEM</strong> <strong>Konstruktion</strong>|Automation: Welche<br />
Rolle wird denn künftig die Gleichstromversorgung<br />
spielen?<br />
Jörres: Eine große – unserer Ansicht nach<br />
beginnt Nachhaltigkeit bereits mit dem<br />
richtigen Einsatz der DC-Technologie. Regenerative<br />
Energiequellen wie die Photovoltaik<br />
lassen sich damit wandlungsfrei<br />
nutzen und dank Energierückgewinnung<br />
steigt die Energieeffizienz weiter. Zusätzlich<br />
gehen wir von einem bis zu 55 % ge-<br />
Foto: Panduit GmbH<br />
Innovative Lösungen für anspruchsvollste Industrieumgebungen<br />
Zuverlässige und sichere Infrastruktur<br />
Panduit bietet innovative Lösungen<br />
für anspruchsvollste Industrieumgebungen<br />
– von Leitständen<br />
und Fertigungsbereichen bis hin zur<br />
Stromerzeugung. Im Angebot befinden<br />
sich zuverlässige, langlebige<br />
und sichere Verbindungslösungen<br />
für Netzwerke und die Stromvers -<br />
orgung. Moderne Industrieunternehmen<br />
streben nach höherer Produktionsgeschwindigkeit<br />
und Kostenkontrolle<br />
– bei gleichbleibender<br />
Qualität, mehr Sicherheit und Zu -<br />
verlässigkeit der Systeme. Seit über<br />
60 Jahren ist Panduit weltweit führender<br />
Anbieter von innovativen<br />
Lösungen im Bereich physikalische<br />
und elektrische Infrastruktur für Rechenzentren,<br />
Industrie und Gebäudeautomatisierung<br />
und die damit<br />
verbundenen Dienstleistungen. Wir<br />
machen Verbindungen möglich.<br />
KONTAKT<br />
ANZEIGE<br />
Am Kronberger Hang 8<br />
65824 Schwalbach am Taunus<br />
Telefon +49 (0) 69 950 961 29<br />
Mail CX-DACH@panduit.com<br />
<strong>KEM</strong> <strong>Konstruktion</strong>|Automation » 12 | 2023 37
TRENDS » Interview » Nachhaltigkeit<br />
ringeren Kupferverbrauch aus und reduzierten<br />
Gerätekosten bei gleichzeitig geringerem<br />
Platzbedarf. Warum? Weil bereits<br />
heute die meisten Endgeräte mit Gleichstrom<br />
versorgt werden. Betreibe ich also<br />
Maschinen, Motoren oder Förderbänder<br />
direkt in einem Gleichstromnetz, entfallen<br />
die Wandlungsverluste der Erzeugung von<br />
Gleichstrom aus Wechselstrom, wie das<br />
bislang der Fall ist. Und die Bremsenergie<br />
einer Anlage lässt sich als elektrischer<br />
Strom wieder dem DC-Netz zuführen.<br />
Mit unserem neuen Gebäude 60 am<br />
Hauptsitz Blomberg verfügen wir gerade<br />
mit Blick auf die Gleichstromversorgung<br />
über eine sehr reale Testanlage. Hier stehen<br />
alle energieerzeugenden und energieverbrauchenden<br />
Teilnehmer in einem elektrischen,<br />
thermischen und kommunikativen<br />
Verbund wie zuvor beschrieben – es<br />
handelt sich um eine Blaupause für die All<br />
Electric Society. Genutzt wird unter anderem<br />
ein Eisspeicher für den Bedarf an Wärme<br />
und Kälte. Und die Photovoltaik-Anlage<br />
mit 2,5 MW p sowie passende Speicherlösungen<br />
liefern die elektrische Energie.<br />
Bei den Speichern setzen wir sowohl auf<br />
Batteriespeicher als auch Wasserstoff.<br />
<strong>KEM</strong> <strong>Konstruktion</strong>|Automation: Durch<br />
die erwähnte Einspeisung von Bremsenergie<br />
entsteht also ein Verbund aus<br />
Verbrauchern, die gleichzeitig auch Erzeuger<br />
elektrischer Energie sind?<br />
Jörres: Genau so ist es. In dem Gebäude<br />
ist zum Beispiel ein Gleichstromnetz in<br />
Verbindung mit bidirektionaler Ladetechnik<br />
installiert. Damit sind E-Autos nicht<br />
nur Verbraucher – sie können auch temporär<br />
zu Energiespeichern werden und das<br />
Gebäude versorgen. Gerade durch diese Integrationsfähigkeit<br />
bringt ein Gleichstromnetz<br />
die Sektorenkopplung voran.<br />
Und in der industriellen Nutzung lassen<br />
sich wie erwähnt Verlustleistungen wirksam<br />
reduzieren – etwa durch die Nutzung<br />
der Rekuperationsenergie beim Bremsen<br />
von Elektromotoren. Ganz im Sinne der Erkenntnisse<br />
der Forschungsprojekte DC-Industrie<br />
und DC-Industrie2, die von der<br />
ZVEI-Arbeitsgemeinschaft Open DC<br />
Alliance (ODCA) weiterentwickelt werden.<br />
Oder um es auf den Punkt zu bringen:<br />
Gleichstrom aus erneuerbaren Energien<br />
kann leicht in die Produktion eingebunden<br />
werden und zugleich einen wichtigen Beitrag<br />
für mehr Energie- und Ressourcen -<br />
effizienz leisten.<br />
<strong>KEM</strong> <strong>Konstruktion</strong>|Automation: Um<br />
weltweit das für die AES erforderliche<br />
Stromnetz bis 2030 zu installieren, geht<br />
Phoenix Contact von einem Bedarf von<br />
16 Millionen km neuen Leitungen und<br />
rund 5,5 Millionen Schaltschränken aus<br />
– wie lässt sich diese Aufgabe stemmen,<br />
insbesondere auch mit dem Blick auf den<br />
Fachkräftemangel?<br />
Jörres: Diese Zahlen ergeben sich, wenn<br />
man alle verfügbaren Studien und Paper<br />
zusammenführt und davon ausgeht, dass<br />
unser Ziel die Schaffung eines neuen digitalen<br />
Netzes für die Stromversorgung ist.<br />
Und in der Tat: Ausschließlich in der Energieverteilung<br />
und -übertragung werden<br />
dann 5,5 Millionen Schaltschränke gebraucht.<br />
Nun ist die Zahl der Schaltschrankbauer<br />
begrenzt und sie lässt sich<br />
aufgrund des Fachkräftemangels auch<br />
nicht beliebig steigern. Umso wichtiger ist<br />
es deshalb, herauszufinden, wie wir einen<br />
Schaltschrank sowohl unter zeitlichen als<br />
auch Kostenaspekten effizienter aufbauen<br />
können. Damit rückt die gesamte Prozesskette<br />
des Schaltschrankbaus in den Fokus<br />
– von der Planung bis zur Produktion. Ein<br />
Lösungsansatz sind digital vollständig abbildbare<br />
Prozesse.<br />
Um ein Beispiel zu nennen: Bei der Verdrahtung<br />
haben wir erkannt, dass rund die<br />
Hälfte der erforderlichen Zeit auf die Vorbereitung<br />
der Leiter und ihre Markierung<br />
entfällt. Genau hier setzen wir mit unseren<br />
Lösungen an und automatisieren diese Tätigkeiten<br />
auf Basis digital abgebildeter<br />
Prozesse – das Stichwort lautet digitaler<br />
Zwilling. Baue ich den gesamten Schaltschrank<br />
von vorne herein komplett digitalisiert<br />
als Zwilling auf, ergibt sich eine<br />
Vielzahl von Möglichkeiten, schneller und<br />
effizienter zu produzieren.<br />
www.phoenixcontact.com<br />
Bild: Phoenix Contact<br />
Je mehr kommunikative<br />
Systeme zum Einsatz kommen,<br />
desto mehr Schaltschränke<br />
werden benötigt.<br />
Umso wichtiger ist es, die<br />
Prozesse im Schaltschrankbau<br />
zu optimieren und zu<br />
automatisieren.<br />
INFO<br />
Mehr zum Hintergrund der<br />
All Electric Society (AES):<br />
hier.pro/UlRRQ<br />
38 <strong>KEM</strong> <strong>Konstruktion</strong>|Automation » 12 | 2023
Phoenix Contact eröffnet Park der All Electric Society in Blomberg<br />
Auf rund 7600 m² hat das Unternehmen entlang der Zufahrt<br />
in Blomberg einen frei zugänglichen Park errichtet, der das<br />
Zukunftsbild der All Electric Society (AES) für alle erlebbar<br />
macht und verständlich erklärt. Anhand des Energieflusses<br />
von der Gewinnung über die Wandlung, Speicherung und Verteilung<br />
bis hin zum optimierten Energieeinsatz wird gezeigt,<br />
wie die All Electric Society Wirklichkeit werden kann. Dabei<br />
veranschaulichen reale Applikationen, wie Sektorenkopplung<br />
funktioniert und welche Technologien diese ermöglichen.<br />
Der Park stellt in verkleinerter Form ein Abbild der<br />
realen Welt dar.<br />
Energie- und Datenfluss sind roter Faden des Parks<br />
Entlang des Energie- und Datenflusses werden Applikationen<br />
in einen sinnhaften Zusammenhang gesetzt und deren gegenseitige<br />
Beeinflussung aufgezeigt. Ausgangsbasis ist die Erzeugung<br />
von regenerativer Energie mit Solar und Wind.<br />
Solarmodule befinden sich auf den Dächern der Cubes und der<br />
Ladestationen, sind in die Fassade des Pavillons integriert<br />
und als Bodenplatten eingesetzt. Rund 550 Module sind verbaut<br />
und liefern 155.000 kWh Strom pro Jahr.<br />
Das Thema Windenergie wird exemplarisch durch eine begehbare<br />
Windgondel sowie durch einen Windtree vermittelt.<br />
Schon bei kleinen Windbewegungen drehen sich seine grünen<br />
Blätter aus Kunststoff, die wie Turbinen funktionieren, und<br />
erzeugen so Energie. Mit 36 Blättern, sogenannten Aeroleafs,<br />
liefert der Windtree bis zu 10,8 kW p Leistung.<br />
• Energie speichern und abrufen<br />
Da die Ressourcen Sonne und Wind nicht immer im gleichen<br />
Maße zur Verfügung stehen, muss überschüssige Energie<br />
gespeichert und bei Bedarf wieder abgegeben werden<br />
können. Hierfür werden Batteriespeicher eingesetzt. Die<br />
Energieverbraucher im Park sind die Gebäude, Elektroladesäulen<br />
und die Applikationen im Park selbst. An diesen Verbrauchern<br />
werden auch verschiedene Optimierungsmaßnahmen<br />
aufgezeigt, die dazu dienen, den Energiebedarf und<br />
Ressourceneinsatz zu senken.<br />
• Energiemanagementsystem<br />
Die elektrische Verbindung von Energieerzeugern, -speichern,<br />
-verbrauchern und dem Mittelspannungsnetz erfolgt<br />
über eine Ortsnetzstation. Dabei sorgt ein Energiemanagementsystem<br />
für eine Balance zwischen Erzeugern, Speichern<br />
und Verbrauchern. Energie wird so in den benötigten<br />
Strom- und Spannungsbereichen bereitgestellt. Dieses System<br />
erfasst alle relevanten Kenndaten und steuert die<br />
entsprechenden Energieflüsse.<br />
Im Kreisverkehr direkt am Park ist ein Solar-Tracker mit einem<br />
Durchmesser von 12 m das Erkennungsmerkmal des Parks der<br />
All Elec tric Society. Er ist um die Zentralachse drehbar, um<br />
stets im richtigen Winkel zur Sonne zu stehen.<br />
• Wärme und Kälte:<br />
Im Park wird nicht nur elektrische Energie benötigt. Die Kuben<br />
und der Pavillon im Park müssen mit Wärme oder Kälte<br />
versorgt werden. Dieser Energiefluss wird durch ein eigenständiges<br />
Wärme- und Kälte-Energiemanagementsystem gesteuert.<br />
Hierbei werden auch Wärmeverluste, die beim Wandeln<br />
von Energie entstehen, berücksichtigt und genutzt.<br />
Zum Einsatz kommt ein Eisspeicher mit zwei Wärmepumpen.<br />
• Zentrale Steuerung:<br />
Die beiden eigenständigen Energiemanagementsysteme<br />
‚elektrische Energie‘ und ‚Wärme/Kälte‘ werden zentral in<br />
einem überlagerten System zusammengeführt und verwaltet.<br />
Ebenso wichtig wie das Erfassen und Auswerten der<br />
Energieverbrauchs- und Energieerzeugungsdaten, um den<br />
Energiefluss steuern zu können, sind Effizienzmaßnahmen,<br />
die den Energieverbrauch senken. Dies ist ein wesentlicher<br />
Punkt, um die AES Wirklichkeit werden zu lassen. Nur mit<br />
einer zusätzlichen Senkung des primären Energiebedarfs<br />
durch Effizienzmaßnahmen kann eine Energieversorgung,<br />
die auf erneuerbaren Ressourcen fußt, funktionieren.<br />
Ansatzpunkte hierfür zeigt der Park mit dem energie -<br />
optimierten Gebäudebetrieb.<br />
Das Thema Effizienz hat übrigens ebenfalls einen engen Bezug<br />
zu Nachhaltigkeit. Auch dieser Aspekt wird im Park berücksichtigt:<br />
Der Pavillon ist nach dem Cradle-to-Cradle-Prinzip<br />
gebaut – es wurden nur Materialien eingesetzt, die kreislauffähig<br />
sind. Dieser Ansatz für eine durchgängige und konsequente<br />
Kreislaufwirtschaft stellt das nachhaltige<br />
Produzieren in den Vordergrund.<br />
(eve)<br />
Bild: Phoenix Contact<br />
<strong>KEM</strong> <strong>Konstruktion</strong>|Automation » 12 | 2023 39
Energy-Harvesting mit Wiegand-Draht ermöglicht nachhaltige Datenübertragung<br />
Batterie adé – neue Chancen<br />
für die Energieversorgung im IoT<br />
Das Energy-Harvesting per Wiegand-Technologie hat sich bei Absolut-Drehgebern bereits bewährt,<br />
um bei einem Stromausfall die letzte Position zu sichern. Fraba baut sein Know-how<br />
rund um den Wiegand-Draht und seine Anwendung weiter aus und hat 2021 Ubito als Startup<br />
für neue Produktideen gegründet, um die Nutzung der Wiegand-Technik als Energiequelle für<br />
smarte Sensoren voranzubringen. Das zahlt sich aus, denn die zur Verfügung stehende Energie<br />
nimmt stetig zu – und öffnet so neue Anwendungsmöglichkeiten.<br />
Das Internet of Things<br />
(IoT) ermöglicht auch<br />
die weiträumige<br />
Sammlung von Daten.<br />
Allerdings benötigen<br />
die Sensoren Energie.<br />
Als Alternative zu Batterien<br />
bietet sich unter<br />
bestimmten Bedingungen<br />
das Energy-Harvesting<br />
mittels Wiegand-Technologie<br />
an.<br />
Energie ist häufig der ‚Treibstoff‘ – doch in vielen<br />
Fällen wird Energie nur in kleinen und kleinsten<br />
Mengen benötigt. Je nach Anwendung sind dann Batterien<br />
das Mittel der Wahl, die allerdings eine Reihe<br />
von Nachteilen mit sich bringen wie Batteriewechsel.<br />
Müssen hin und wieder nur Sensorwerte übertragen<br />
werden – ist die erforderliche Energiemenge also eher<br />
gering –, könnte künftig auch die Wiegand-Technologie<br />
eine Lösung anbieten.<br />
Überall da, wo Bewegung und ein externes Magnetfeld<br />
vorhanden sind, lässt sich das Energy-Harvesting<br />
per Wiegand-Draht nutzen. Veränderungen im Magnetfeld<br />
genügen, um elektrische Impulse beziehungsweise<br />
Energie zu erzeugen. Bewährt hat sich die Technik<br />
schon in Absolut-Drehgebern: Bleibt eine Maschine<br />
oder Anlage wegen Stromausfall stehen, kann die<br />
Position der jeweiligen Antriebe die entscheidende Information<br />
sein, um einen schnellen Wiederanlauf zu<br />
ermöglichen. Der Wiegand-Draht, Bestandteil der Encoder-Kits,<br />
die etwa der Bereich Posital der Kölner<br />
Fraba GmbH anbietet, stellt in diesen Fällen die Energie<br />
bereit, um die letzte Position sicher zu speichern.<br />
Bild: jahidsuniverse/stock.adobe.com (generiert mit KI)<br />
Der Wiegand-Effekt<br />
Kernstück der Wiegand-Technologie ist der Wiegand-Draht. Er<br />
besteht aus einer speziell konditionierten ferromagnetischen<br />
Eisen-Cobalt-Vanadium-Legierung mit sehr spezifischen physikalischen<br />
Eigenschaften. Wird dieser Draht einem sich verändernden<br />
externen Magnetfeld ausgesetzt, behält er zunächst<br />
seine magnetische Polarität bei. Erreicht das externe<br />
Magnetfeld jedoch einen bestimmten Schwellenwert, kehrt<br />
sich die Polarität des haarfeinen Wiegand-Drahtes abrupt um.<br />
Dieser Polaritäts-Switch erfolgt innerhalb weniger Mikrosekunden<br />
(10 - 20 µs) und erzeugt über eine Kupferspule, die um<br />
den Spezialdraht gewickelt ist, einen deutlichen Stromimpuls.<br />
Dieser Impuls ist stark genug, um Logikschaltungen zu aktivieren<br />
und elektronische Chips mit geringer Leistung zu versorgen.<br />
Nutzen lässt sich das als<br />
• (eigen-versorgte) magnetische Sensorik oder für das<br />
• Energy-Harvesting.<br />
Wiegand-Element, Hysteresekurve mit Puls sowie Blick in den Aufbau<br />
mit Wiegand-Draht und Spule zur Nutzung der Pulsenergie.<br />
Vorteile der Wiegand-Technologie sind, dass sie ohne mechanischen<br />
Verschleiß arbeitet und die Lebenszeit damit nahezu<br />
keinen Restriktionen unterliegt. Zudem liefert der Wiegand-<br />
Draht konsistente Energieimpulse über den gesamten Frequenzbereich<br />
– und arbeitet damit auch bei sehr geringen<br />
Geschwindigkeiten.<br />
Bild: Fraba<br />
40 <strong>KEM</strong> <strong>Konstruktion</strong>|Automation » 12 | 2023
Nachhaltigkeit « TRENDS<br />
Bild: Fraba<br />
Entwicklung der Pulsenergie im Laufe<br />
der Zeit: Lag diese in den 90er Jahren noch<br />
bei 20 - 50 nJ, erreichten die Wiegand-<br />
Sensoren von Fraba schon 2015 mit 100 -<br />
220 nJ bereits mehr als das Vierfache.<br />
Verfügbare Pulsenergie steigt stetig<br />
Bereits 2021 gründete Fraba deswegen Ubito als<br />
Start-Up für neue Produktideen rund um die Wiegand-Technik<br />
als Energiequelle smarter Sensoren. Im<br />
Aachener F&E-Zentrum wurde seit dem die Entwicklung<br />
eines Wiegand-Harvesters vorangetrieben, der in<br />
der Lage ist, genügend Energie für die Stromversorgung<br />
der kompletten Sensorelektronik zu gewinnen,<br />
einschließlich eines hocheffizienten Ultrabreitband/<br />
UWB-Funksenders.<br />
„Die verfügbare Energie pro Puls konnte in der Vergangenheit<br />
von zunächst 50 auf 150 nJ gesteigert werden“,<br />
berichtet Tobias Best, General Manager von Ubito.<br />
„Wir gehen davon aus, dass künftig bis zu 10.000 nJ<br />
möglich werden – genug Energie also für die drahtlose<br />
Kommunikation.“ Das würde es erlauben, insbesondere<br />
im IoT-Umfeld (Internet of Things) Signale zu sammeln<br />
und zu übermitteln, ohne dafür auf eine Stromversorgung<br />
oder Batterien zurückzugreifen. Die Wiegand-<br />
Technologie stände damit – ein sich änderndes externes<br />
Magnetfeld vorausgesetzt – auch als Alternative<br />
zu Energy-Harvesting-Techniken wie Solar-, Piezooder<br />
Thermoelektrik als verlässliche Energiequelle für<br />
autonome Sensorknoten zur Verfügung.<br />
Zahlreiche Anwendungen denkbar<br />
„Eine Vielzahl von Anwendungen kann von Wiegand-<br />
Harvestern profitieren“, fährt Best fort. Ein Beispiel sei<br />
etwa die einfache Erfassung der Anzahl von Toröffnungen<br />
manueller Tore – um so ohne zusätzliche<br />
Energieversorgung eine Kontrolle der Federn zu ermöglichen<br />
– ganz im Sinne der Predictive Maintenance.<br />
„Entscheidend ist dabei: Die Wiegand-Technologie<br />
eignet sich auch für langsam laufende Anwendungen<br />
(siehe dazu auch Kasten zur Wiegand-Technologie).<br />
Dass sich das Energy-Harvesting per Wiegand-Draht<br />
auch an anderer Stelle nutzen lässt, hat Fraba bereits<br />
mit seinen Wiegand-Sensoren gezeigt, die sich als eigensichere<br />
Näherungsschalter einsetzen lassen. Sie<br />
passen auf eine Fingerkuppe und gewinnen ausreichend<br />
Energie, um zuverlässig und sicher Signale für<br />
Alarmsysteme liefern zu können. Eine externe Stromversorgung<br />
oder Back-up- beziehungsweise Puffer-<br />
Batterien sind dazu nicht erforderlich.<br />
Die Sensoren können dabei auf unterschiedliche<br />
Weise als Näherungsschalter genutzt werden:<br />
• Ist etwa das zu erfassende Objekt von sich aus<br />
magnetisiert beziehungsweise mit einem oder<br />
mehreren kleinen Permanentmagneten bestückt,<br />
reagiert der Wiegand-Sensor, sobald das Objekt<br />
ihm so nah kommt, dass eine Polaritätsumkehr erfolgt<br />
und der Impuls erzeugt wird. Nutzen lässt<br />
sich dieser Effekt, um etwa Linear- oder Drehbewegungen<br />
exakt zu erfassen und zu messen.<br />
• Alternativ kann der Wiegand-Sensor als Näherungsschalter<br />
auch zwischen einem Satz Permanentmagneten<br />
installiert werden. Kommt ihm hier<br />
ein Objekt aus Eisen oder Stahl<br />
zu nahe, wird das Magnetfeld<br />
unmittelbar um den Wiegand-<br />
Sensor so weit verzerrt, dass<br />
ein Polaritätswechsel erfolgt,<br />
was wiederum den Stromimpuls<br />
– und damit das Alarm -<br />
signal – auslöst. (co)<br />
www.ubito.com<br />
INFO<br />
Mehr zum Energy-Harvesting<br />
bei Ubito:<br />
hier.pro/u2V5l<br />
<strong>KEM</strong> <strong>Konstruktion</strong>|Automation » 12 | 2023 41
Green Mobility für eine nachhaltige Zukunft<br />
Saubere Mobilität<br />
Traditionelle Automobilhersteller und neue<br />
Marken arbeiten intensiv an Innovationen,<br />
neuen Modellen und Produkt-Features.<br />
Die Dekarbonisierung des Verkehrssektors ist von entscheidender<br />
Bedeutung, um die schädlichen Auswirkungen des Klimawandels<br />
abzuschwächen. Der Beitrag zeigt auf, wie wir die Dekarbonisierung<br />
beschleunigen, urbane Ökosysteme umgestalten und<br />
die globale Automobilindustrie revolutionieren können.<br />
Amit Chadha, CEO & Geschäftsführer, L&T Technology Services, Karnataka, Indien<br />
Bild: L&T Technology Services<br />
Die Welt verändert sich. Um die Bedrohung durch<br />
den Klimawandel abzuwenden, ist eine umfassende<br />
Transformation hin zu einer nachhaltigen Lebensweise<br />
erforderlich.<br />
Im Hinblick auf dieses Ziel steht die Automobilindustrie<br />
als allgegenwärtige Emissionsquelle, aber auch als Innovationstreiber<br />
für die Zukunft der Mobilität im Fokus.<br />
Angesichts des starken Anstiegs der weltweiten<br />
Treibhausgasemissionen erhöht sich der öffentliche<br />
Druck auf die Branche zunehmend. Durch eine beschleunigte<br />
Dekarbonisierung, die Weiterentwicklung<br />
und Umgestaltung städtischer Ökosysteme und eine<br />
Neuausrichtung der Automobilindustrie können wir jedoch<br />
eine Perspektive für eine Zukunft abseits des derzeitigen<br />
Trends schaffen. Grüne Mobilität hat sich dahingehend<br />
als ein wichtiger Wegbereiter erwiesen. Unterschiedlichste<br />
Interessengruppen sind bemüht, ein<br />
tieferes Verständnis für das vielschichtige Potenzial<br />
grüner Mobilität zu entwickeln, um dieses in der Gestaltung<br />
einer nachhaltigen Zukunft optimal ausschöpfen<br />
zu können.<br />
Globaler Auftrag ist die schnelle<br />
Dekarbonisierung<br />
Die Dekarbonisierung des Verkehrssektors ist von entscheidender<br />
Bedeutung, um die schädlichen Auswirkungen<br />
des Klimawandels abzuschwächen. Fahrzeuge,<br />
die mit fossilen Brennstoffen betrieben werden, sind<br />
für einen erheblichen Teil der Kohlendioxidemissionen<br />
verantwortlich und verschärfen den Treibhauseffekt.<br />
Um die Dekarbonisierung zu beschleunigen, müssen<br />
Regierungen und Unternehmen heute der Einführung<br />
sauberer, erneuerbarer Energiequellen wie Strom und<br />
Wasserstoff für den Antrieb von Fahrzeugen und öffentlichen<br />
Verkehrsmitteln Vorrang einräumen.<br />
Elektrofahrzeuge spielen durch den Wegfall der mit<br />
fossilen Brennstoffen betriebenen Motoren eine wichtige<br />
Rolle bei der Verbesserung der allgemeinen Luftqualität<br />
und haben sich als vielversprechende Lösung<br />
zur Reduzierung von Kohlenstoffemissionen etabliert.<br />
Sie überzeugen zudem durch flexible Nutzungsmöglichkeiten<br />
und erschwingliche Mobilitäts- und Wartungsoptionen.<br />
Die jüngsten Fortschritte in der Batterietechnologie,<br />
der Ausbau der Ladeinfrastruktur und<br />
öffentliche Anreize für den Kauf und die Nutzung machen<br />
Elektrofahrzeuge immer beliebter. Um eine breite<br />
Akzeptanz von Elektrofahrzeugen zu erreichen, müssen<br />
wir uns jedoch mit zentralen Fragen wie der Batterieentsorgung,<br />
der Nachhaltigkeit der Lieferkette und einem<br />
sozial gerechten Zugang zur E-Fahrzeugtechnologie<br />
befassen.<br />
Urbane Gebiete sind von zentraler Bedeutung für die<br />
Dynamik des Wandels hin zu einer grünen Mobilität.<br />
Die wachsende Weltbevölkerung zieht es in die Städte<br />
– Verkehrsstaus, Umweltverschmutzung und die begrenzte<br />
Verfügbarkeit von Grünflächen werden zunehmend<br />
zu großen Herausforderungen. Infolgedessen<br />
müssen sich Städte neu erfinden, um nachhaltige Mobilität<br />
zu fördern und die Lebensqualität ihrer Einwohner<br />
zu erhalten.<br />
Effiziente Verkehrssysteme, wie zum Beispiel von Bussen<br />
und Zügen, die mit sauberer Energie betrieben werden,<br />
können die individuelle Fahrzeugnutzung, Verkehrsstaus<br />
und Emissionen weiter reduzieren. Fußgängerfreundliche<br />
Infrastrukturen, Radwege und Mikromobilitätslösungen<br />
wie E-Scooter und Bike-Sharing-<br />
Programme fördern ebenfalls die Offenheit für umweltfreundliche<br />
Verkehrsmittel. Auf der Makroebene<br />
helfen intelligente Verkehrsüberwachungssysteme und<br />
die datengesteuerte Städteplanung, den Verkehrsfluss<br />
42 <strong>KEM</strong> <strong>Konstruktion</strong>|Automation » 12 | 2023
Nachhaltige Mobilität « TRENDS<br />
Bild: L&T Technology Services<br />
Bild: L&T Technology Services<br />
Da Software-Defined-Vehicles in den Fokus der großen Automobilhersteller<br />
weltweit rücken, wird es in Zukunft eine größere Nachfrage nach digitalen<br />
Ingenieurdienstleistungen geben.<br />
Die software-basierte Fahrzeugentwicklung spielt eine Schlüsselrolle, da sie ein<br />
optimiertes Fahrgast- und Fahrererlebnis bietet und gleichzeitig die Konformität<br />
mit den sich entwickelnden gesetzlichen Standards sicherstellen muss.<br />
zu optimieren, Leerlaufzeiten zu reduzieren und den<br />
Kraftstoffverbrauch zu minimieren. Insgesamt ist die<br />
Integration grüner Mobilität in städtische Ökosysteme<br />
eine Win-Win-Situation.<br />
Revolution der Autoindustrie als<br />
Vorreiter des Wandels<br />
Im Zentrum der grünen Mobilität steht die globale Automobilindustrie.<br />
Traditionelle Automobilhersteller und<br />
neue Marken arbeiten intensiv an Innovationen, neuen<br />
Modellen und Produkt-Features und gestalten im<br />
Kampf um Marktanteile im Vertrieb umweltfreundlicher<br />
Fahrzeuge die Branchenlandschaft neu.<br />
Investitionen in die Forschung und Entwicklung alternativer<br />
Materialien und Fertigungsverfahren ermöglichen<br />
den Bau leichterer, energieeffizienterer Fahrzeuge.<br />
Autonome Fahrzeuge sollen künftig aktiv mit dem<br />
Verkehrsnetz kommunizieren und so den Verkehrsfluss<br />
verbessern und Unfälle reduzieren. Technologische<br />
Fortschritte wie diese, in Kombination mit Elektrofahrzeugen<br />
und Shared-Mobility-Lösungen, sind wichtige<br />
Bestandteile auf dem Weg zu einer nachhaltigeren und<br />
effizienteren Zukunft des Verkehrssektors. Die software-basierte<br />
Fahrzeugentwicklung spielt dabei eine<br />
Schlüsselrolle, da sie ein optimiertes Fahrgast- und<br />
Fahrererlebnis bietet und gleichzeitig die Konformität<br />
mit den sich entwickelnden gesetzlichen Standards sicherstellen<br />
muss. Da Software-Defined-Vehicles (SDVs)<br />
in den Fokus der großen Automobilhersteller weltweit<br />
rücken, wird es in Zukunft eine größere Nachfrage<br />
nach digitalen Ingenieurdienstleistungen geben.<br />
Partnerschaften innerhalb des<br />
Ökosystems wichtig<br />
Um die gesamte Wertschöpfungskette abzudecken und<br />
alle wichtigen Parameter im EV/SDV-Ökosystem zu verstehen,<br />
arbeiten einige Hersteller bereits mit Engineering<br />
Research&Development-Partnern zusammen.<br />
Durch die Zusammenarbeit mit einem ER&D-Partner,<br />
der über branchenübergreifendes Fachwissen, digitale<br />
Engineering-Fähigkeiten und ein breites Netzwerk für<br />
Co-Innovationen verfügt, werden Transformationsinitiativen<br />
unterstützt und technologische Beschränkungen<br />
durch branchenübergreifende Expertise kosteneffizient<br />
überwunden.<br />
Oftmals werden ER&D-Unternehmen auch angefragt,<br />
um Schwerpunkte in der Softwareentwicklung zu definieren,<br />
welche in Zusammenarbeit mit Drittanbietern<br />
zum Beispiel CloudOps und schnelle Over-the-Air-Updates<br />
ermöglichen. Die zunehmende Komplexität der<br />
EV-Technologien erfordert die Einführung von softwaredefinierten<br />
Designs, die in der Lage sind, vielfältige<br />
Herausforderungen zu bewältigen – von der Entwicklung<br />
bis zur anschließenden Bereitstellung, Wartung<br />
und Aktualisierung.<br />
Die Verwirklichung einer umweltfreundlichen Mobilität<br />
erfordert die Zusammenarbeit unterschiedlicher Interessengruppen.<br />
Regierungen spielen eine wichtige Rolle<br />
beim Erlass von Richtlinien und Vorschriften, die Anreize<br />
für die Einführung nachhaltiger Prozesse und<br />
Technologien schaffen.<br />
Ebenso wichtig ist die Beteiligung des privaten Sektors.<br />
Nachhaltigkeitsinitiativen von Unternehmen, Investitionen<br />
in F&E und Partnerschaften für innovative Mobilitätslösungen<br />
können den<br />
Wandel beschleunigen. Zudem<br />
sind das Bewusstsein der Verbraucher<br />
und eine klimafreundliche<br />
Lebensweise von<br />
Bedeutung für die Gestaltung<br />
der Marktnachfrage und die<br />
Beeinflussung von Unternehmensentscheidungen.<br />
(jg)<br />
www.ltts.com/de/<br />
INFO<br />
Mehr zum Thema E-Mobilität von<br />
L&T Technology Services (engl.):<br />
hier.pro/cvVtm<br />
<strong>KEM</strong> <strong>Konstruktion</strong>|Automation » 12 | 2023 43
TRENDS » Nachhaltige Mobilität<br />
Grüne Schifffahrt: Baukastenprinzip reduziert Entwicklungszeit um 70 %<br />
In Hochgeschwindigkeit emissionsfrei<br />
über den Fjord<br />
Seit Sommer 2022 verkehrt die E-Fähre Medstraum rund um das norwegische Stavanger. Interessant<br />
ist neben dem emissionsfreien Antrieb auch die im EU-Projekt TrAM entstandene Entwicklungsmethodik.<br />
Wiederverwendbare Bausteine sollen den Bau von Fähren – normalerweise aufwendige und<br />
langwierige Einzelfertigungen – deutlich schneller, effizienter und wettbewerbsfähiger machen.<br />
Bild: Marius Knutsen/TrAM-Konsortium<br />
23 Knoten für insgesamt<br />
150 Fahrgäste:<br />
Die Medstraum ist in<br />
Dienst im Linienbetrieb<br />
zwischen der Stadt<br />
Stavanger und den<br />
umliegenden Gemeinden<br />
und Inseln.<br />
Die norwegische Elektro-Passagierfähre Medstraum<br />
ist die weltweit erste emissionsfreie,<br />
elektrisch betriebene Hochgeschwindigkeitsfähre im<br />
Linienbetrieb. 4 Jahre arbeitete ein europäisches<br />
Konsortium im Forschungsprojekt TrAM an neuen<br />
Methoden, um E-Passagierfähren künftig schneller<br />
und kostengünstiger zu entwickeln – und damit die<br />
Mobilität nachhaltiger zu machen. Erreicht wurde<br />
dies mit modularen Bausteinen, die sich wiederverwenden<br />
lassen. Bei künftigen Fährprojekten sollen<br />
sich auf diese Weise die Entwicklungszeit um 70 %<br />
und die Herstellkosten um 25 % senken lassen. Beteiligt<br />
waren das Fraunhofer-Institut für Entwurfstechnik<br />
Mechatronik IEM sowie das Fraunhofer-Institut<br />
für Arbeitswirtschaft und Organisation IAO.<br />
Systemmodell verdeutlicht<br />
Zusammenhänge<br />
Das Fraunhofer IEM verantwortete die Entwicklung einer<br />
ganzheitlichen Methodik, welche die maritime Industrie<br />
künftig bei Entwurf und Bau modularer Fähren<br />
unterstützt. Per Model-Based Systems Engineering<br />
(MBSE) konnten die Forschenden dabei ein gemeinsames<br />
Verständnis unter allen Entwicklungspartnern erreichen.<br />
Dreh- und Angelpunkt ist das Systemmodell,<br />
das Komplexitäten und Abhängigkeiten in der Entwicklung<br />
transparent und handhabbar macht. Der Clou: Das<br />
Systemmodell ist lösungsneutral und flexibel im<br />
Schiffbau einsetzbar. Die Analyse der Anforderungen<br />
verschiedener Fährtypen lieferte Standardelemente für<br />
die Entwicklung, ähnlich einem Baukastenprinzip.<br />
Das Fraunhofer IEM brachte seine in der Automobilbranche<br />
und dem Maschinenbau gewonnene Engineering-Expertise<br />
ein, wie sich individuelle Produkte<br />
in kurzer Entwicklungszeit realisieren lassen. Diese<br />
Ansätze konnten erfolgreich auch in der maritimen<br />
Industrie eingesetzt werden und auf diese Weise<br />
zwei Ziele verbinden:<br />
• Die Wettbewerbsfähigkeit vollelektrischer Hochgeschwindigkeitsfähren<br />
wird durch modulares Design<br />
und modulare Herstellung deutlich erhöht.<br />
• Gleichzeitig ist dies ein wichtiger Baustein für<br />
das Erreichen der europäischen Klimaziele im<br />
Mobilitätssektor.<br />
Begleitend untersuchte deswegen das Fraunhofer<br />
IAO, wie Städte ihre Mobilitätskonzepte an neue<br />
Technologien anpassen können und wie die Schnittstellen<br />
zwischen Wasser- und Landmobilität zukünftig<br />
gestaltet sein müssen. Hierbei stand die Frage im<br />
Fokus, wie durch das gezielte Zusammenspiel von<br />
Wasser- und Landmobilität ein Beitrag für eine klimaneutrale<br />
und bedarfsgerechte urbane Mobilität<br />
geleistet werden kann. Konkret ging es dabei unter<br />
anderem auch um die Integration der Informations-,<br />
Buchungs- und Ticketsysteme.<br />
1500 t weniger CO 2 pro Jahr<br />
Die Demonstrator-Fähre Medstraum (Norwegisch<br />
‚mit Strom‘) wurde in der Fjellstrand-Werft in Norwegen<br />
gebaut. Sie ist seit Sommer 2022 zwischen<br />
der Stadt Stavanger und den umliegenden Gemeinden<br />
und Inseln im Linienbetrieb. „Die Medstraum<br />
44 <strong>KEM</strong> <strong>Konstruktion</strong>|Automation » 12 | 2023
KISSED BY NATURE<br />
WORLD LEADING COMPACT AC MOTORS<br />
Bild: Marius Knutsen/TrAM-Konsortium<br />
Das Team des TrAM-Konsortiums bei der Entgegennahme der Auszeichnung<br />
‚Ship of the Year‘ auf der Messe SMM in Hamburg im September 2022.<br />
verringert unsere Emissionen um 1500 t CO 2 pro Jahr,<br />
obwohl wir auf unserer Strecke mit dem geringsten<br />
Energiebedarf fahren“, berichtete Mikal Dahle, Projektleiter<br />
bei der ÖPNV-Verwaltung Kolumbus in der<br />
norwegischen Provinz Rogaland anlässlich der Vorstellung<br />
der Fähre. „Das entspricht der Menge von<br />
60 Bussen.“<br />
Das EU-Projekt TrAM<br />
Im Rahmen des EU-Projektes TrAM (Transport:<br />
Advanced and Modular) arbeiteten insgesamt 15<br />
Partner aus 7 EU-Staaten zusammen. Die Projektleitung<br />
übernahm Kolumbus, Mobilitätsdienstleister<br />
der norwegischen Provinz Rogaland. Deutsche Partner<br />
waren neben dem Fraunhofer IEM und Fraunhofer<br />
IAO die HSVA Hamburgische Schiffbau-Versuchsanstalt.<br />
Die HSVA übernahm als Schiffbau-Expertin<br />
die Wassertanktests und hydrodynamische Optimierung<br />
für die modulare Schiffsklasse.<br />
(co)<br />
www.iem.fraunhofer.de<br />
tramproject.eu<br />
WWW.ROTEK-MOTOREN.DE<br />
FEIERN<br />
Sie mit der ganzen Welt!<br />
Bitten Sie Ihre Gäste statt<br />
Geschenke um Spenden<br />
für die SOS-Kinderdörfer.<br />
Danke!<br />
90%<br />
UP TO<br />
EFFICIENCY<br />
Die Medstraum im Überblick<br />
• Kapazität: 150 Personen<br />
• Länge: 31 m<br />
• Breite: 9 m<br />
• Betriebsgeschwindigkeit: 23 Knoten<br />
• Einsparung von derzeit 1500 t CO 2 pro Jahr<br />
(je nach Einsatzgebiet)<br />
• 2 Elektromotoren<br />
• Batteriekapazität: 1,5 MWh<br />
• Ladeleistung: mehr als 2 MW<br />
• Klassifizierung nach dem International Code<br />
of Safety for High-Speed Crafts (HSC-Code)<br />
sos-kinderdoerfer.de<br />
2020/1<br />
<strong>KEM</strong> <strong>Konstruktion</strong>|Automation » 12 | 2023 45
WERKSTOFFE & VERFAHREN » Verbindungstechnik<br />
IM FOKUS<br />
Mit Blindnietmuttern und<br />
-schrauben lassen sich viele<br />
Verbindungsaufgaben lösen.<br />
Das Setzen kann mit der<br />
neuen Werkzeuggeneration<br />
effizient erfolgen.<br />
Bild: Böllhoff/Konradin Mediengruppe<br />
Mit dem Rivkle Neo<br />
P107 stellt Böllhoff eine<br />
neue Generation pneumatisch-hydraulischer<br />
Setzwerkzeuge vor.<br />
Neue Generation pneumatisch-hydraulischer Setzwerkzeuge vorgestellt<br />
Blindnietmuttern<br />
effizient setzen<br />
Das Rivkle Neo P107 ergänzt das Werkzeugprogramm von Böllhoff und ist im Rivkle-<br />
Sortiment das schnellste Setzwerkzeug für die zugehörigen Blindnietmuttern und Blindnietschrauben.<br />
Es eignet sich für anspruchsvolle Aufgaben in der Produktion bei mittelgroßen<br />
und großen Serien, für die es entwickelt und validiert wurde. Mit dem Werkzeug<br />
lassen sich Rivkle-Elemente aus Stahl in den Abmessungen M3 bis M8 verarbeiten.<br />
Annette Löwen, Leitung FAT Marketing Deutschland, Böllhoff Verbindungstechnik GmbH, Bielefeld<br />
46 <strong>KEM</strong> <strong>Konstruktion</strong>|Automation » 12 | 2023
Beim Setzen von Blindnietmuttern oder Blindnietschrauben<br />
liefert die pneumatisch-hydraulische<br />
Technologie des neuen Setzwerkzeugs Rivkle Neo<br />
P107 eine hohe Leistung bei geringem Gewicht. Ohne<br />
die Auswechseleinheiten wiegt das Werkzeug nur<br />
2 kg. Zudem sorgt der pneumatisch unterstützte Kolbenrückhub<br />
für optimierte Zykluszeiten. So können<br />
etwa bis zu 36 Rivkle-Blindnietmuttern pro Minute<br />
vernietet werden. Das Werkzeug ist darüber hinaus<br />
kompatibel mit den bestehenden Rivkle-Auswechseleinheiten<br />
(Gewindedornen und Mundstücken).<br />
Die von der Böllhoff Verbindungstechnik GmbH in<br />
Bielefeld entwickelte kraftgesteuerte Funktionsweise<br />
ermöglicht den Anwendern ein sehr effizientes Arbeiten<br />
– für jede Abmessung der Rivkle-Elemente ist nur<br />
eine Setzkraft einzustellen. Das Aufspindeln erfolgt<br />
durch einfachen axialen Druck auf den Gewindedorn<br />
und der Ausspindelvorgang wird automatisch beim<br />
Erreichen der Setzkraft ausgelöst. Manuelles Ausspindeln<br />
ist im Bedarfsfall – etwa bei einem blockierten<br />
Gewindedorn – über eine Knopfbetätigung möglich.<br />
Ergonomie im Blick<br />
Die Arbeit mit dem Neo P107 ist nicht nur effizient –<br />
die Entwickler hatten auch die Ergonomie im Blick.<br />
So liegt das Werkzeug durch den ergonomischen<br />
Griff angenehm in der Hand. Die Bedienung ist komfortabel,<br />
da sie nur über einen Knopf erfolgt – für<br />
den gesamten Nietzyklus.<br />
Entwickelt wurde das Setzwerkzeug in enger Zusammenarbeit<br />
mit Kunden, um eine möglichst benutzerfreundliche<br />
Handhabung in anspruchsvoller Industrieumgebung<br />
sicherzustellen.<br />
Geliefert wird das Neo P107 in einem Transportkoffer<br />
mit Bedienungsanleitung, einer Quick-Start-Anleitung,<br />
einem Hydrauliköl-Nachfüll- und Entlüftungsset<br />
sowie einem Schrauben- und Sechskantschlüssel.<br />
Die jeweiligen Auswechseleinheiten (Gewindedorne<br />
und Mundstücke) und weiteres Zubehör sind separat<br />
bestellbar.<br />
(co)<br />
www.boellhoff.com<br />
Die Vorteile im Überblick<br />
• Einsatzbereich 3 bis 18 kN<br />
(Rivkle-Elemente M3 – M8 aus Stahl)<br />
• Hohe Leistung – Vernietung von bis zu<br />
36 Rivkle-Blindnietmuttern/min<br />
• Effizient und kraftgesteuert:<br />
Für jede Rivkle-Abmessung ist nur eine Setzkraft einzustellen.<br />
• Optimierte Wartung<br />
• Kompatibel mit bestehenden Rivkle-Auswechseleinheiten (Gewindedornen<br />
und Mundstücken), schnelle Wechsel sind möglich.<br />
Blindnietmuttern<br />
Die Rivkle-Blindnietmuttern und -schrauben bieten eine Reihe von Vorteilen:<br />
• Tragfähige Gewinde an dünnwandigen Bauteilen<br />
• Montage bei einseitiger Zugänglichkeit (blinde Montage)<br />
• Flexibel einsetzbar in jedem Fertigungsschritt<br />
• Keine Temperaturbelastung des Werkstücks – dadurch kein Verzug<br />
• Verschiedene Ausführungen<br />
INFO<br />
Mehr zum Neo P107 im<br />
Technischen Forum:<br />
hier.pro/SENkv<br />
Rivkle-Blindnietmuttern und<br />
-schrauben eignen sich für<br />
die Befestigung belastbarer<br />
Muttern- beziehungsweise<br />
Bolzengewinde an Bauteilen<br />
mit geringer Wandstärke.<br />
Bild: Böllhoff<br />
<strong>KEM</strong> <strong>Konstruktion</strong>|Automation » 12 | 2023 47
WERKSTOFFE & VERFAHREN » Verbindungstechnik<br />
Nachhaltigkeit in der Verbindungstechnik<br />
Der CO 2 -Footprint von Schrauben zählt<br />
Immer drängender rückt das Thema Klimaschutz und eine damit verbundene CO 2 -Reduktion auf die<br />
Agenda. Hier ist auch die Zulieferindustrie gefragt. Dass sie mit neuen Konzepten, Verfahren und Produkten<br />
ihren Anteil leisten kann, zeigt Arnold Umformtechnik mit der Initiative ACO 2 -Save Sie unterstützt bei<br />
der Reduktion von CO 2 -Emissionen, indem Verbindungselemente nachhaltig ausgelegt werden.<br />
Um den Carbon Footprint so gering wie möglich<br />
zu halten, müssen alle Beteiligten an einem<br />
Strang ziehen sowie Strategien entwickeln und umsetzen,<br />
die konsequent auf Klimaschutz zielen. Davon<br />
ist man bei der Arnold Umformtechnik GmbH &<br />
Co. KG in Forchtenberg-Ernsbach überzeugt und legt<br />
Wert darauf, dass die Thematik Nachhaltigkeit und<br />
CO 2 -Neutralität in der kompletten Supply Chain betrachtet<br />
werden muss.<br />
Vor diesem Hintergrund hat Arnold die Initiative<br />
ACO 2 -Save ins Leben gerufen (das A steht hier für<br />
Arnold). Dabei werden Kunden beziehungsweise Anwender<br />
aktiv bei der<br />
Reduktion von CO 2 -<br />
»Mit der Initiative ACO 2 -Save<br />
lassen sich die CO 2 -Emissionen<br />
reduzieren – der größte Einspareffekt<br />
ergibt sich durch die<br />
Nutzung von innovativer Verbindungs-<br />
und Kaltumformtechnik.«<br />
Emissionen unterstützt,<br />
indem Verbindungselemente<br />
und<br />
Kaltumformteile<br />
nachhaltig ausgelegt<br />
und angewendet<br />
werden. So erfolgt eine<br />
begleitende CO 2 -<br />
Kalkulation bereits<br />
Mit der Initiative „ACO 2 -Save“ will Arnold Umformtechnik<br />
als Systemanbieter für Verbindungselemente<br />
den CO 2 -Fußabdruck seiner Kunden gezielt reduzieren.<br />
im Entwicklungsprozess. Mit einem eigens entwickelten<br />
CO 2 -Kalkulator kann der sogenannte Product<br />
Carbon Footprint (CO 2 -Fußabdruck) für das bei Arnold<br />
angefragte Teil ermittelt und dann gemeinsam<br />
mit dem Kunden eine Optimierung durchgeführt<br />
werden. Ziel dabei ist am Ende des Entwicklungsprozesses<br />
ein technisch hochwertiges Produkt, das sowohl<br />
kosten- als auch CO 2 -optimiert ist.<br />
Möglichkeiten für CO 2 -Einsparungen<br />
Digitalisierung: Um bereits im Entwicklungsprozess<br />
CO 2 -Emissionen zu vermeiden – beispielsweise durch<br />
eine unnötige Muster- und Prototypenvielfalt –, setzen<br />
die Arnold-Entwickler digitale Prognosetools wie<br />
FEM-Analysen und eigenentwickelte Prognoseprogramme<br />
ein. Damit wird die Vielzahl an Varianten<br />
deutlich reduziert, was Zeit, Geld und CO 2 spart.<br />
Produktionstechnologie: Der größte Einspareffekt<br />
ergibt sich jedoch durch die Nutzung von innovativer<br />
Verbindungs- und Kaltumformtechnik. Gemeinsam<br />
mit dem Kunden analysiert das Unternehmen beispielsweise<br />
Möglichkeiten zum Wechsel der Produktionstechnologie<br />
von Teilen – also unter anderem, ob<br />
Teile, die derzeit noch spanabhebend hergestellt<br />
werden, als Kaltumformteile kosteneffizienter gefertigt<br />
werden können. Ebenso kann geprüft werden, ob<br />
vorhandene Gewindeschrauben durch gewindeformende<br />
Schrauben ersetzt werden können und dabei<br />
auf Gewindeschneidautomaten und ihre Emissionen<br />
komplett verzichtet werden kann.<br />
Downsizing: Eine weitere Option ist es, durch den<br />
Einsatz innovativer Verbindungselemente ein<br />
Downsizing durchzuführen und somit beispielsweise<br />
eine M5-Schraube durch eine M4 zu ersetzen. Und<br />
nicht zuletzt tragen innovative Verbindungssysteme<br />
zur Gewichtsreduzierung bei – vor allem beim Fügen<br />
im Multimaterial-Mix – was letztendlich zu einer<br />
Reduzierung der Gesamtemission führt.<br />
48 <strong>KEM</strong> <strong>Konstruktion</strong>|Automation » 12 | 2023<br />
Bild: Arnold Umformtechnik<br />
Praxisbeispiel zeigt Potential<br />
Dass der ACO 2 -Save-Ansatz funktioniert, belegt ein<br />
konkretes Beispiel: Eine in einem Kundenbauteil eingesetzte<br />
Sonderschraube aus Aluminium sollte so-
Bild: Arnold Umformtechnik<br />
Bild: Arnold Umformtechnik<br />
Durch ACO 2 -Save und den damit einhergehenden Wechsel der Produktionstechnologie<br />
konnten Einsparpotentiale erreicht und die CO 2 -Emissionen, die durch diese<br />
Schraube bei der Produktion entstehen, um 45 % reduziert werden.<br />
Anwendungsbeispiel: Durch Battery Packs in E-Fahrzeugen<br />
steigt das durchschnittliche Fahrzeuggewicht weiter an. Innovative<br />
Fügekonzepte können helfen, CO 2 -Emissionen über<br />
die gesamte Supply-Chain hinweg zu reduzieren.<br />
wohl kostentechnisch als auch hinsichtlich ihrer<br />
CO 2 -Emissionen überarbeitet werden. Als Alternative<br />
wurde von Arnold eine Conform-Next-Schraube entwickelt,<br />
die sich aufgrund der konstruktiven Auslegung<br />
für den Einsatz bei größeren Durchmessern,<br />
längeren Bauteilen, komplexeren Geometrien und<br />
höheren Gewichten beziehungsweise schwereren<br />
Bauteilen eignet.<br />
Das bisher eingesetzte Teil hat ein Volumen von<br />
8.733 mm 3 , ein Gewicht von 23,58 g pro Stück und<br />
wurde traditionell spanabhebend hergestellt. Zur<br />
Produktion wurde dazu ein Drehteilrohling verwendet,<br />
der ein Ausgangsvolumen von 25.630 mm 3 und<br />
69,2 g pro Stück hatte. Durch die ACO 2 -Save-Analyse<br />
konnten die Arnold-Entwickler dieses Teil auf ein<br />
Umformteil der Produktreihe Conform Next umstellen.<br />
Nach der Optimierung hat der Umformrohling<br />
gerade noch ein Volumen von 9.195 mm 3 und<br />
24,82 g pro Stück. Das heißt: Durch den Umformprozess<br />
ist ein erheblich geringerer Material-Input notwendig,<br />
da kaum Abfall beim Produktionsprozess<br />
entsteht.<br />
45 % weniger Emissionen<br />
Neben einer erheblichen Kostenoptimierung, die<br />
durch den geringeren Materialeinsatz bei Kaltumformverfahren<br />
entsteht, hat dies natürlich auch einen<br />
erheblichen Einfluss auf den Product Carbon<br />
Footprint der Sonderschraube. Durch die Reduzierung<br />
des Einsatzgewichts, den geringeren Ausschuss<br />
und die somit effizientere Fertigung konnten alle<br />
CO 2 -Emissionen, die durch diese Schraube bei der<br />
Produktion entstehen, um 45 % reduziert werden.<br />
Dieses eine Beispiel verdeutlicht bereits, dass durch<br />
die ACO 2 -Save-Initiative erhebliche Potentiale im<br />
Bereich des Product Carbon Footprint gehoben werden<br />
können.<br />
(co)<br />
www.arnold-fastening.com<br />
Thomapren®-EPDM/PP-<br />
Schläuche – FDA konform<br />
www.rct-online.de<br />
Elastischer Pumpen-, Pharma- und<br />
Förderschlauch für höchste Ansprüche<br />
• High-Tech-Elastomer EPDM/PP: Temperaturbeständig<br />
bis +135 °C, UV-beständig, chemikalienresistent,<br />
niedrige Gaspermeabilität<br />
• Für Schlauchquetschventile und Peristaltikpumpen: Bis zu<br />
30 mal höhere Standzeiten gegenüber anderen Schläuchen<br />
• Biokompatibel und sterilisierbar: Zulassungen nach FDA,<br />
USP Class VI, ISO 10993, EU 2003/11/EG<br />
Reichelt<br />
Chemietechnik<br />
GmbH + Co.<br />
Englerstraße 18<br />
D-69126 Heidelberg<br />
Tel. 0 62 21 31 25-0<br />
Fax 0 62 21 31 25-10<br />
rct@rct-online.de<br />
<strong>KEM</strong> <strong>Konstruktion</strong>|Automation » 12 | 2023 49
TITEL » Verbindungstechnik<br />
Der DST-Schnellbefestiger ermöglicht<br />
nicht nur eine schnellere Montage und<br />
höhere Prozesssicherheit, er bietet<br />
auch ökologische Vorteile. Er reduziert<br />
sowohl die Anzahl der eingesetzten<br />
Verbindungselemente als auch den<br />
Materialeinsatz.<br />
Bild: Böllhoff/Konradin Mediengruppe<br />
Ecotech-Service findet mit DST-Schnellbefestigern eine Alternative zu Nietmuttern<br />
Nachhaltigere<br />
Verbindungstechnik<br />
Mit dem DST-Verbinder von Böllhoff konnte Boge Kompressoren bei der Montage<br />
von Schalldämmhauben eine nachhaltigere Alternative zu Nietmuttern finden. Dazu<br />
nahmen Spezialisten des Engineering-Consulting-Services Ecotech von Böllhoff die<br />
Situation unter die Lupe und schlugen nach der Analyse die Schnellbefestiger vor.<br />
Diese verkürzen nicht nur die Montagezeiten und erhöhen die Prozesssicherheit,<br />
sondern die verwendete Snap-Technologie kommt auch mit weniger Material aus<br />
– ein ökologisch wertvoller Vorteil.<br />
50 <strong>KEM</strong> <strong>Konstruktion</strong>|Automation » 12 | 2023
Kurze Entscheidungswege können die Zusammenarbeit<br />
beschleunigen, wie ein Beispiel<br />
zweier Bielefelder Unternehmen zeigt:<br />
Die Boge Kompressoren Otto Boge GmbH<br />
& Co. KG wandte sich als Spezialistin für<br />
Kompressoren und Drucklufttechnik an<br />
die Böllhoff GmbH, um eine Alternative<br />
zu Nietmuttern zu finden – und um auch<br />
bei der Verbindungstechnik effizientere<br />
und nachhaltigere Technologien einzusetzen.<br />
„Wir hinterfragen stets unsere <strong>Konstruktion</strong>en,<br />
um die Anforderungen unserer Kunden<br />
bestmöglich zu erfüllen und eine hohe Kundenzufriedenheit<br />
sicherzustellen“, erläutert Boge-Geschäftsführer<br />
Olaf Hoppe den Hintergrund. „Dazu werden<br />
auch die Montageprozesse kontinuierlich überprüft<br />
und Verbindungselemente intensiv getestet.“<br />
Böllhoff unterstützt den Nachbarn speziell bei Fragen<br />
der Verbindungstechnik mit seinem Engineering-<br />
Consulting-Service Ecotech. „Wir nahmen dazu die<br />
gesamte Verbindungstechnik der Kompressoren unter<br />
die Lupe, um sie gemeinsam mit Boge weiterzuentwickeln<br />
und zu optimieren“, ergänzt Marcel Rupprecht,<br />
Geschäftsführer von Böllhoff. „Dabei übernehmen<br />
wir das komplette Projektmanagement und<br />
Bandbegehungen sowie Services wie Tear-Down-<br />
Analysen gehören ebenfalls zu unserem Portfolio –<br />
immer mit dem Ziel vor Augen, die perfekte Verbindung<br />
zu finden.“ Die Ecotech-Beratung konnte auf<br />
diese Weise nicht nur Optimierungspotentiale in den<br />
Kompressoren aufzeigen, sondern auch den Montageaufwand<br />
reduzieren – und damit die Kosten für<br />
den Kunden.<br />
Praxisbeispiel Schalldämmhauben<br />
Mit Blick auf die konkrete Fragestellung, eine Alternative<br />
zu den Nietmuttern zu finden, die in Schalldämmhauben<br />
eingesetzt werden, fand zunächst im<br />
Juli 2022 eine Bandbegehung statt. Der Anwendungsfall<br />
wurde dann von den Ecotech-Spezialisten<br />
detailliert untersucht und analysiert. Als Ergebnis<br />
unterbreitete Böllhoff einen technischen Lösungsvorschlag<br />
basierend auf seiner DST-Verbindungstechnik.<br />
IM ÜBERBLICK<br />
Kürzere Montagezeiten und<br />
mehr Prozesssicherheit bei<br />
niedrigeren Prozesskosten – in<br />
der Verbindungstechnik steckt<br />
Potential; auch für die<br />
Nachhaltigkeit.<br />
Olaf Hoppe, Geschäftsführer der Boge<br />
Kompressoren Otto Boge GmbH & Co. KG,<br />
Bielefeld<br />
»Um eine hohe Kundenzufriedenheit<br />
und Nachhaltigkeit<br />
sicherzustellen, werden<br />
auch Montageprozesse<br />
kontinuierlich überprüft und<br />
Verbindungselemente intensiv<br />
getestet.«<br />
Bild: Boge<br />
Der Engineering-Consulting-Service Ecotech von Böllhoff nahm zusammen mit Boge die gesamte Verbindungstechnik der<br />
Kompressoren unter die Lupe, um sie gemeinsam weiterzuentwickeln und zu optimieren.<br />
Bild: Böllhoff<br />
<strong>KEM</strong> <strong>Konstruktion</strong>|Automation » 12 | 2023 51
TITEL » Verbindungstechnik<br />
Die DST-Schnellbefestiger nutzen eine innovative<br />
Snap-Technologie und können mit einem Federblech<br />
versehen werden, um Schwingungen zu kompensieren<br />
und Toleranzen auszugleichen. Durch den Austausch<br />
von drei Blindnietmuttern gegen einen DST-<br />
Verbinder mit Vierkantbohrung können damit sowohl<br />
Monteure als auch Kunden von Boge den Kompressor<br />
leichter und ohne Werkzeug öffnen und schließen.<br />
So ergeben sich eine Reihe von Vorteilen:<br />
• Der DST-Verbinder verkürzt die Montagezeiten<br />
und senkt damit die Prozesskosten.<br />
• Zudem eliminiert er Fehlerpotentiale und erhöht<br />
so die Prozesssicherheit.<br />
• Die Snap-Technologie bietet eine nachhaltige Lösung,<br />
die sowohl die Montageeffizienz steigert als<br />
auch ökologische Vorteile bietet. Denn durch die<br />
DST-Verbinder wird nicht nur die Anzahl der eingesetzten<br />
Verbindungselemente reduziert, sondern<br />
auch der Materialeinsatz als solcher.<br />
Vorteile wie diese zeigen, dass Kunden wie Boge zusammen<br />
mit dem Ecotech-Service Produkte und Prozesse<br />
nachhaltiger gestalten können. Dies lässt sich<br />
auf weitere Anwendungen übertragen, auch in anderen<br />
Branchen – ganz im Sinne des Böllhoff-Leitspruchs<br />
‚Passion for successful Joining‘.<br />
Die Schnellverschlusstechnik<br />
Mit den DST-Verbindern lassen sich Verbindungen<br />
per Snap-Technologie einfach herstellen und bei<br />
Bedarf leicht wieder lösen.<br />
Mit den DST-Schnellbefestigern lassen sich einfach<br />
und sicher hochfeste und kraftschlüssige<br />
Verbindungen ohne Werkzeug herstellen. Ermöglicht<br />
wird dies durch die Snap-Technologie, die<br />
nach dem Prinzip eines Fallschlosses arbeitet –<br />
das etwa von Haustüren bekannt ist. Zwei Einzelteile<br />
bilden dabei die Grundlage: die sogenannte<br />
Führung mit abgeschrägten Spannbacken und eine<br />
Feder, die innerhalb der Führung sitzt. Wird<br />
ein DST-Befestiger durch eine geeignete Öffnung<br />
geführt, schiebt die Einlaufschräge der Spann -<br />
backen das Snap-Element wie eine Falle im Führungskanal<br />
zurück. Dabei wird die Feder gespannt.<br />
Sobald die Höhe der Spannbacken beim<br />
Einstecken überwunden ist, federn die Snap-Elemente<br />
wieder zurück nach außen. Dabei entsteht<br />
das typische ‚Snap-Geräusch‘.<br />
Die DST-Schnellbefestiger verbinden gleichermaßen<br />
Blech, Kunststoff oder Holz, verfügbar sind<br />
verschiedene Varianten. Die Verbinder bieten<br />
eine Reihe von Vorteilen:<br />
Bild: Böllhoff<br />
• Aufgrund der Snap-Technologie lassen sich die<br />
Verbinder schnell und ohne zusätzliches Werkzeug<br />
montieren.<br />
• Die einfache Technologie sorgt für einwandfreie<br />
Verbindungen – selbst an schwer zugänglichen<br />
Stellen.<br />
• Die DST-Schnellbefestiger ermöglichen hohe<br />
Festigkeiten – vergleichbar mit einer<br />
geschraubten Lösung.<br />
• Auch unter starker Belastung erfüllt der<br />
Schnellverschluss seine Funktion: Er bleibt<br />
passgenau, sicher und fest und ist rüttel-,<br />
vibrations- und erdbebensicher.<br />
Ein weiteres Plus je nach Variante: Viele der DST-<br />
Schnellbefestiger lassen sich so einfach demontieren<br />
wie montieren. Je nach Ausführung sind<br />
die Verbindungen einfach per Hand, mit handelsüblichen<br />
Werkzeugen oder durch spezifische Spezialwerkzeuge<br />
wieder lösbar. Die Demontagemöglichkeit<br />
mittels Spezialwerkzeug wird speziell in<br />
Fällen empfohlen, in denen Vandalismus oder unbefugte<br />
Demontage zu befürchten sind. Alle Befestigungen<br />
sind sind zudem jederzeit wieder -<br />
verwendbar.<br />
Mehr zu den DST-Schnellbefestigern:<br />
hier.pro/Q0wQE<br />
52 <strong>KEM</strong> <strong>Konstruktion</strong>|Automation » 12 | 2023
Bild: Böllhoff<br />
»Unser Ecotech-Service nimmt die<br />
gesamte Verbindungstechnik unter<br />
die Lupe, um Optimierungspotentiale<br />
aufzuzeigen und die Nachhaltigkeit<br />
zu steigern.«<br />
Marcel Rupprecht, Geschäftsführer der Böllhoff GmbH, Bielefeld<br />
Das<br />
Upgrade<br />
für dein<br />
Engineering<br />
Know-how!<br />
Langjährige Kooperation<br />
Die Partnerschaft zwischen Böllhoff und Boge begann<br />
bereits 2006 mit der Einführung des Kanban-<br />
Belieferungssystems Ecosit für Verbindungselemente.<br />
Dadurch konnten die Warendisposition optimiert und<br />
die logistische Versorgung sowie Lagerung der Produkte<br />
direkt am Montageort effizient gestaltet werden.<br />
„Die Kooperation führte zu reibungslosen administrativen<br />
Prozessen und gesteigerter Effizienz“,<br />
fährt Boge-Chef Olaf Hoppe fort. „Sowohl Boge als<br />
auch Böllhoff haben sich der Nachhaltigkeit verschrieben<br />
– und setzen sich für umweltfreundliche<br />
Lösungen ein.“ Das Kanban-System habe die Nachhaltigkeit<br />
entlang der Wertschöpfungskette verbessert<br />
und Synergien geschaffen. Im Verlauf der Partnerschaft<br />
wurden in den letzten 10 Jahren über 27<br />
Millionen Verbindungselemente von Böllhoff geliefert,<br />
davon 1,5 Millionen aus eigener Produktion.<br />
(co)<br />
www.boellhoff.com<br />
Ob kompaktes Seminar oder<br />
umfangreicher Zertifikatslehrgang,<br />
ob vor Ort oder<br />
online, bei uns findest du<br />
VDI-Weiterbildungen in<br />
allen Bereichen des<br />
Maschinenbaus.<br />
INFO<br />
Mehr zum Thema Nachhaltigkeit<br />
und dem Ecotech-<br />
Service von Böllhoff:<br />
hier.pro/7ceQX<br />
Starte jetzt die Weiterbildung,<br />
die zu dir passt!<br />
www.vdi-wissensforum.de/<br />
maschinenbau-zukunft-gestalten<br />
<strong>KEM</strong> <strong>Konstruktion</strong>|Automation » 12 | 2023 53
WERKSTOFFE & VERFAHREN » Verbindungstechnik<br />
Bild: Natalia/stock.adobe.com<br />
Die WEEE legt Anforderungen für die Entsorgung und das Recycling von elektronischen Geräten fest. Dazu zählt, dass bestimmte Materialien in den Geräten<br />
getrennt und recycelt (können) werden müssen, was letztlich nur erfüllt werden kann, wenn sich diese Produkte leichter demontieren lassen.<br />
Reparaturen werden mit der richtigen Verbindungstechnik einfacher<br />
Schraubverbindungen retten die Welt<br />
Schraubverbindungen sind lösbar – und genau das ist ihr Vorteil, wenn Reparaturen anstehen. Das Kleben<br />
mag Vorteile im Montageprozess bieten – aber wer je versucht hat, ein verklebtes Gehäuse zu öffnen, weiß:<br />
Nach offen kommt kaputt. Konstrukteur:innen sollten also mehr denn je lösbare Verbindungen mit Schrauben<br />
bevorzugen. Sie ermöglichen eine nachhaltigere Wirtschaft und Lebens weise – mit länger haltbaren,<br />
reparier- und recycelbaren Produkten.<br />
Thomas Preuß, Fachjournalist in Königswinter (turmpresse.de)<br />
Der größte Nachteil von Schraubverbindungen im<br />
Vergleich zu anderen Verbindungstechniken, wie<br />
Schweißen, Kleben, Nieten oder Löten, ist: Schraubverbindungen<br />
sind – leicht und zerstörungsfrei – lösbar.<br />
Leider lösen sich Schrauben oder Muttern im Betrieb<br />
manchmal von allein. Oder sagen wir richtiger: „lockern“.<br />
Insbesondere, wenn Vibrationen oder dynamische Belastungen<br />
auftreten, können Schrauben im Laufe der Zeit<br />
locker werden. Daher müssen geschraubte Verbindungen<br />
regelmäßig inspiziert und die Fügeelemente gegebenenfalls<br />
nachgezogen werden, ehe sich die Schrauben<br />
tatsächlich lösen. Das Wartungspersonal muss übrigens<br />
geschult sein, um beim Wiederanzug ebenfalls alles<br />
richtig zu machen!<br />
Aufwendig also. Abgesehen davon: Für Schraubverbindungen<br />
müssen Löcher in die zu verbindenden Bauteile<br />
gebohrt werden. Dies verursacht Kosten, braucht Zeit,<br />
und die Bohrungen können die strukturelle Integrität<br />
der Materialien beeinträchtigen. Im Vergleich zu geschweißten,<br />
genieteten oder geklebten Verbindungen<br />
weisen Schraubenverbindungen oft eine geringere Festigkeit<br />
auf. Die Schraube selbst kann ein Schwachpunkt<br />
sein und unter hohen Belastungen brechen. Schraubverbindungen<br />
sind außerdem anfällig für Korrosion, insbesondere<br />
wenn die <strong>Konstruktion</strong>en im Freien oder in<br />
feuchten Umgebungen betrieben werden. Auch Korro -<br />
sion kann die Festigkeit der Verbindung beeinträchtigen<br />
und zum Versagen führen.<br />
Pro und Contra<br />
Der größte Vorteil einer Schraubverbindung ist: Sie<br />
lässt sich wieder lösen – und es gibt weitere Pluspunkte.<br />
Damit ermöglichen Schraubenverbindungen<br />
eine einfache Montage und Demontage von Bauteilen,<br />
was wiederum die Wartung, Reparatur und den Austausch<br />
von Komponenten erleichtert. Insbesondere bei<br />
Produkten, die einem planmäßigen oder nicht auszuschließenden<br />
Verschleiß unterliegen, sollten sich Kon-<br />
54 <strong>KEM</strong> <strong>Konstruktion</strong>|Automation » 12 | 2023
strukteure bemühen, die Demontage „lösbar“ zu gestalten.<br />
Man denke nur an die Bremsbacken und Beläge am<br />
Fahrrad oder Auto, an eine verbogene Felge oder auch<br />
ein defektes Haushaltsgerät. Man möchte ja nicht gleich<br />
das ganze Fahrzeug oder die ganze Maschine entsorgen,<br />
nur weil ein Teil abgenutzt ist.<br />
Da fällt mir gerade unser Wäschetrockner ein: Bei dem<br />
war ich kürzlich sehr froh, den Deckel, alle Seitenbleche,<br />
das Bedienfeld und einige Innereien mit einem Akkuschrauber<br />
– und zugegeben: einigen Spezialbits, aber<br />
immerhin – öffnen und das Gerät reparieren zu können.<br />
Das lief nicht mehr, weil angeblich der Wasserbehälter<br />
voll war. Stimmte aber nicht. (Wer das gleiche Problem<br />
hat: Der kleine Kondensatsammelbehälter war von Flusen<br />
zugesetzt, so dass der Füllstandssensor eine Fehlermeldung<br />
ausgab. Die Maschine lief nicht mehr an, weil<br />
sie vermutete, dass der große Sammelbehälter auch voll<br />
sei. Falscher „Fehler“! Schrauben gelöst, Flusensumpf<br />
abgesaugt, Sensor geputzt, Maschine wieder zugeschraubt,<br />
läuft!)<br />
Moderne Gesellschaften<br />
fordern nachhaltige <strong>Konstruktion</strong><br />
Die Anforderungen an eine einfache Montage und Demontage<br />
werden übrigens höher und glücklicherweise<br />
seit Jahren schon aus verschiedenen Richtungen befeuert.<br />
In einigen Bereichen erfahren Schraubverbindungen<br />
dadurch eine Art Revival. Allerdings sind in der Industrie,<br />
was die Verbindungstechniken angeht, durchaus auch<br />
sich widersprechende Trends zu notieren. So führen die<br />
Trends zum Leichtbau und zur Automatisierung der Fertigung<br />
zum Teil zu gegenläufigen Entwicklungen als die<br />
zunehmenden Forderungen moderner Gesellschaften<br />
nach einer nachhaltigen Produktion, nach Ressourcenschonung<br />
und Recycling.<br />
Der Leichtbau hat unter anderem in der Automobil- und<br />
Luftfahrtindustrie den Einsatz leichter Materialien, wie<br />
Aluminiumlegierungen, Kunststoffen und Verbundwerkstoffen,<br />
jahrelang befördert. Dadurch wurden und werden<br />
die Fahr- und Flugzeuge leichter, die Kraftstoffeffizienz<br />
verbessert. (Nicht zwingend verbrauchen die Fahrzeuge<br />
weniger Kraftstoff, da sie über die Jahrzehnte<br />
auch schwerer wurden, aber das ist ein anderes Thema.)<br />
Bei diesen Werkstoffen und Materialkombinationen<br />
werden aus verschiedenen Gründen verstärkt Verbindungsmethoden<br />
wie Kleben oder Nieten eingesetzt, die<br />
die Schraubmontage oder auch das Schweißen anteilig<br />
zurückdrängen. Auch der Einsatz des 3D-Drucks, der<br />
Konstrukteur:innen neue Möglichkeiten eröffnet, hat<br />
das Potential, Schraubverbindungen zu ersetzen.<br />
Parallel dazu steigt weltweit, zumindest in vielen Ländern<br />
der „Alten Welt“, das Bewusstsein für Nachhaltigkeit<br />
und Recycling. Menschen, Regierungen und Unternehmen<br />
achten verstärkt darauf, Produkte ganz oder<br />
teilweise am Ende ihrer Lebensdauer recyceln zu können,<br />
stofflich zu verwerten oder den Kreislauf gar zu<br />
100 % zu schließen. Dieser Trend spricht eher für die<br />
Verwendung von mehr Schraubverbindungen, da diese<br />
eine einfachere Demontage und Wiederverwendung<br />
einzelner Komponenten ermöglichen. Zumal diese Fügetechnik<br />
in der Regel sehr kostengünstig ist: Sie erfordert<br />
weniger spezialisierte Ausrüstung und Fachkenntnisse<br />
als andere Verbindungsmethoden, etwa das Schweißen.<br />
EU will Recycling noch stärker fördern<br />
Auch wenn die „Letzte Generation“ in jüngerer Zeit eine<br />
mediale Wucht entfaltet, so ändert sich im Großen doch<br />
zumeist erst etwas, wenn es die Gesetze fordern. In<br />
Europa gelten schon länger verschiedene Richtlinien, die<br />
eine nachhaltigere Wirtschaft zum Ziel haben. So hat<br />
die Europäische Union bereits 2012 die „Richtlinie über<br />
Elektro- und Elektronikabfälle“ erlassen (Waste Electrical<br />
and Electronic Equipment Directive, WEEE), die<br />
bis 2014 in nationales Recht umzusetzen war. Die WEEE<br />
legt Anforderungen für die Entsorgung und das Recycling<br />
von elektronischen Geräten fest. Dazu zählt, dass<br />
bestimmte Materialien in den Geräten getrennt und recycelt<br />
(können) werden müssen, was letztlich nur erfüllt<br />
werden kann, wenn sich diese Produkte leichter demontieren<br />
lassen.<br />
Außerdem hat die EU 2020 eine Agenda für die Förderung<br />
einer Kreislaufwirtschaft verabschiedet („Circular<br />
Economy Action Plan“), die darauf zielt, den Ressourcenverbrauch<br />
und die Abfallproduktion insgesamt zu reduzieren.<br />
Im Rahmen dieser Agenda werden aktuell und<br />
in näherer Zukunft verschiedene Maßnahmen ergriffen,<br />
mit denen das Recycling von Produkten gefördert werden<br />
soll, einschließlich der Förderung von wiederverwendbaren<br />
<strong>Konstruktion</strong>slösungen.<br />
Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) unterstützt<br />
nach eigenen Angaben den „Action<br />
Plan“, warnt aber auch, der Plan schlage<br />
„zahlreiche Maßnahmen vor, die<br />
erheblich in die Gestaltung von<br />
Produkten, den Ablauf von<br />
Produktionsprozessen sowie<br />
die Ausgestaltung von<br />
Wertschöpfungsketten<br />
eingreifen werden“. Dies<br />
gelte etwa für den Ende<br />
März 2022 veröffentlichten<br />
Entwurf für eine neue<br />
Ökodesign-Verordnung, die<br />
unter anderem Fragen der<br />
Haltbarkeit, Wiederverwendbarkeit,<br />
Reparierbarkeit oder des<br />
Recyclinganteils in Produkten regeln<br />
soll.<br />
Insbesondere wenn<br />
Vibrationen oder dynamische<br />
Belastungen auftreten,<br />
können Schrauben im<br />
Laufe der Zeit locker werden.<br />
Daher müssen geschraubte<br />
Verbindungen<br />
regelmäßig inspiziert und<br />
die Fügeelemente gegebenenfalls<br />
nachgezogen werden,<br />
ehe sich die Schrauben<br />
tatsächlich lösen.<br />
Bild: industrieblick/stock.adobe.com<br />
<strong>KEM</strong> <strong>Konstruktion</strong>|Automation » 12 | 2023 55
WERKSTOFFE & VERFAHREN » Verbindungstechnik<br />
Zu einer Recycling-optimierten Fahrzeugkonstruktion gehört, Teile einfach<br />
auszutauschen. Die Schraubverbindung macht es möglich.<br />
Ebenso relevant seien verbraucherbezogene Initiativen,<br />
wie das geplante „Recht auf Reparatur“, das Auswirkungen<br />
auf das allgemeine Gewährleistungsrecht und langfristige<br />
Ersatzteil-Verfügbarkeiten haben werde. Das Ziel<br />
schadstofffreier Kreisläufe lasse „noch viele Fragen offen“<br />
und werde „erhebliche Umstellungen in der Produktgestaltung<br />
und in Produktionsprozessen nach sich<br />
ziehen“, so der BDI. Man sehe wohl die Chancen für Unternehmen,<br />
mit innovativen und nachhaltigeren Produkten<br />
Wettbewerbsvorteile zu sichern. „Allerdings werden<br />
viele Unternehmen auf dem Weg dahin große Herausforderungen<br />
zu bewältigen haben.“<br />
Mögliche Folgen der WEEE-Richtlinie<br />
für die <strong>Konstruktion</strong><br />
Zurück zu den möglichen Folgen der WEEE-Richtlinie<br />
für die Konstrukteur:innen der westlichen Welt. Die EU<br />
wollte mit der Richtlinie die Vermeidung, Verwertung<br />
und sichere Entsorgung von Abfällen fördern. Insbesondere<br />
bei der Vermeidung kommt das Design ins Spiel. In<br />
diesem Zusammenhang spricht die Forschungsgruppe<br />
Ecodesign der Universität Wien von „ökointelligenter<br />
Produktentwicklung“. Seit 1996 befasst sich die Gruppe<br />
mit den Prinzipien des „Ecodesigns“ und der Kreislaufwirtschaft;<br />
sie ist am Institut für <strong>Konstruktion</strong>swissenschaften<br />
und Produktentwicklung tätig, forscht im internationalen<br />
Umfeld.<br />
Die Forscher:innen haben einige Tools entwickelt, mit<br />
denen sich Produkte verbessern und ökointelligenter gestalten<br />
lassen. Zu den Strategien zählen unter anderem<br />
die verwertungsgerechte sowie die demontagegerechte<br />
Produktentwicklung, wobei es bei der letzteren auch um<br />
die Wahl der geeigneten Verbindungstechnik geht. So<br />
sollen sich Konstrukteur:innen die Frage stellen, wie einfach<br />
die Demontage abläuft, welche Werkzeuge erforderlich<br />
und ob diese gebräuchlich sind oder wie gut die<br />
Verbindungsstellen erreicht werden können. Aber auch,<br />
wie häufig die Verbindungen im späteren Gebrauch gelöst<br />
werden müssen und ob das Verhältnis von Einfach-<br />
Bild: Dusko/stock.adobe.com<br />
heit und dauerhaft möglicher Lösbarkeit vertretbar ist.<br />
Die Forschungsgruppe gibt Konstrukteur:innen zahlreiche<br />
weitere Tipps, zum Beispiel sollen sie:<br />
• Recyclingfähige Werkstoffe wählen: Schon in der<br />
Planungsphase sollen Werkstoffe bevorzugt werden,<br />
die in Zukunft wiederverwendet oder verwertet werden<br />
können. Konstrukteur:innen benötigen daher<br />
spezielles Fachwissen über die Recyclingprozesse.<br />
• Werkstofftrennung ermöglichen: Wenn Werkstoffe,<br />
die sich im Prinzip leicht recyceln lassen, aus konstruktiven<br />
Gründen (Festigkeit, Steifigkeit) mit anderen<br />
Materialien verklebt oder anderweitig untrennbar<br />
verbunden werden, können sie zu einem Problem<br />
werden. Denn das mache die Wiederverwertung unter<br />
Umständen unmöglich. Die konstruktive Gestaltung<br />
sollte vielmehr grundsätzlich eine einfache<br />
Trennung ermöglichen – was wiederum bei Schraubverbindungen<br />
gegeben ist.<br />
Recyclingoptimierte Fahrzeugkonstruktion<br />
Dass die Industrie hier zum Teil auf einem guten Weg ist,<br />
mögen Beispiele aus der Automobilindustrie belegen. So<br />
stellte BMW nach eigenen Angaben bereits 1992 die<br />
weltweit erste herstellereigene Werknorm „Recyclingoptimierte<br />
Fahrzeugkonstruktion“ vor, 1993 folgten die<br />
ersten Handbücher für Verwertungsbetriebe zur ökologischen<br />
Demontage.<br />
Das Elektroauto i3 wurde von dem bayrischen Automobilhersteller<br />
rundherum mit einer robusten geschraubten/geklippten<br />
Kunststoffbeplankung versehen: „Kleine<br />
Rempler werden absorbiert, Beschädigungen des Lacks<br />
führen nicht zu Korrosion. Einzelne Bauteile der Außenhaut<br />
können schnell und kostengünstig (…) ausgewechselt<br />
werden“, schrieb BMW in einer Pressemitteilung zur<br />
Markteinführung des i3. Die Reparaturkosten lägen dadurch<br />
um rund 40 % niedriger als bei konventioneller<br />
Bauweise. Auch der Hochvolt-Speicher sei „so konstruiert,<br />
dass einzelne Batteriemodule zur Reparatur einfach<br />
ausgetauscht werden können“, was wiederum nur via<br />
Schraubtechnik möglich ist.<br />
Künftig dürfte so manches Karosserieteil oder manche<br />
Innenraumkomponente wieder eher verschraubt statt<br />
verschweißt oder verklebt werden, um die Trennung der<br />
Materialien für den Recyclingprozess zu erleichtern und<br />
den Materialkreislauf zu schließen. Hierzu noch einmal<br />
BMW: 100 % seien das Ziel, formulierte der Premiumhersteller<br />
Ende 2021 seinen Anspruch an ein nachhaltiges<br />
Produkt, und stellte in dem Zusammenhang den<br />
BMW i Vision Circular vor, ein nach dem Gedanken der<br />
Kreislaufwirtschaft konzipiertes Auto. Die Studie bestehe<br />
zu 100 % aus recycelten Materialien und sei ebenfalls<br />
zu 100 % recycelbar. Man darf also davon ausgehen,<br />
dass die Schraubmontage noch lange ihre Berechtigung<br />
als Verbindungstechnik behalten wird. (co)<br />
56 <strong>KEM</strong> <strong>Konstruktion</strong>|Automation » 12 | 2023
Wir<br />
präsentieren<br />
Ihnen<br />
PARTNER der<br />
Industrie<br />
DAS<br />
FIRMENVERZEICHNIS<br />
industrie.de/firmenverzeichnis<br />
Visitenkarten helfen schnell,<br />
passende Produkte/Lösungen oder<br />
Informationen zu Unternehmen<br />
in der jeweiligen Branche zu finden.<br />
FLUIDTECH<br />
MASCHINENELEMENTE<br />
SENSORIK<br />
RCT® Reichelt Chemietechnik GmbH + Co.<br />
www.rct-online.de<br />
Reichelt Chemietechnik steht für das Prinzip<br />
„Angebot und Vertrieb der kleinen Quantität“ gepaart<br />
mit einer viele Bereiche umfassenden Produktvielfalt<br />
und einem hohen technischen Beratungsservice.<br />
Das Angebot von Reichelt Chemietechnik umfasst<br />
ca. 80 000 Artikel, die aus den Bereichen Schlauchtechnik,<br />
Verbindungselemente, Durchflusstechnik,<br />
Labor technik, Halbzeuge, Befestigungselemente,<br />
Filtration und Antriebstechnik stammen.<br />
Reichelt Chemietechnik GmbH + Co.<br />
Englerstraße 18, 69126 Heidelberg<br />
Tel. 0 62 21/3 12 50, info@rct-online.de<br />
Smalley Europa<br />
www. smalley.com/de<br />
Das vor mehr als 50 Jahren gegründete Unternehmen<br />
Smalley Steel Ring Company ist zum Weltmarktführer<br />
bei der Fertigung und Entwicklung von Spirolox<br />
Sicherungsringen, Schnappringen mit einheitlichem<br />
Querschnitt und Wellenfedern geworden. Smalley hat<br />
mit der Einführung modernster Produkte die Messlatte<br />
vorgegeben und wird alles dafür tun, dass seine<br />
Innovationen den Weg in die Zukunft auch weiterhin<br />
aufzeigen.<br />
Schönbuch Sensor GmbH & Co. KG<br />
www.schoenbuch-sensor.de<br />
Schönbuch Sensor bietet ein breites Standardprogramm<br />
an industrieller Sensorik im Bereich von induktiven<br />
und optischen Schaltersystemen, Lichtschranken,<br />
Lichtgittern mit entsprechendem Zubehör sowie<br />
Kabeldosen und Netzteilen.<br />
Der Schwerpunkt liegt auf applikationsspezifischen<br />
Lösungen, die in Zusammenarbeit mit den Kunden<br />
realisiert werden.<br />
Sonderapplikationen realisieren wir nach individuellen<br />
Kundenwünschen. Anfertigungen auch in Kleinserien<br />
möglich! Das Unternehmen ist nach DIN ISO<br />
9001:2015 zertifiziert.<br />
STECKVERBINDER<br />
VERBINDUNGSTECHNIK<br />
www.industrie.de<br />
Stäubli Electrical Connectors GmbH<br />
www.staubli.com<br />
Stäubli entwickelt elektrische Verbindungslösungen<br />
für industrielle Anwendungen in Branchen wie erneuerbare<br />
Energien, Automatisierungstechnik, Energieübertragung,<br />
Bahnindustrie, Schweißautomatisierung,<br />
Prüf- und Messtechnik, Medizintechnik und E-Mobility.<br />
Das umfangreiche Angebot an standardisierten und<br />
kundenspezifischen Steckverbindern zeichnet sich<br />
durch Langlebigkeit, Effizienz und hohe Leistung aus.<br />
Komplettlösungen inklusive Kabelkonfektionierung<br />
reduzieren die Montagekosten und vereinfachen die<br />
Logistik.<br />
Stäubli – Steckverbinderlösungen, die Unternehmen<br />
voranbringen.<br />
Ferdinand Gross GmbH & Co. KG<br />
www.schrauben-gross.de<br />
Ferdinand Gross ist Spezialist für Verbindungstechnik<br />
und C-Teile-Management und bietet Kunden und<br />
Partnern aus der Industrie maßgeschneiderte Dienstleistungen.<br />
Unser Sortiment reicht von Verbindungselementen<br />
über Werkzeuge bis zu Sonder anfertigungen.<br />
Wir sorgen für schnellste Verfügbarkeit von über<br />
107 000 Artikeln. Im Bereich C-Teile-Management<br />
bietet Ferdinand Gross kunden spezifische Lösungen<br />
zur Senkung Ihrer Beschaffungs kosten um bis zu 70 %.<br />
<strong>KEM</strong> <strong>Konstruktion</strong>|Automation » 12 | 2023 57
INSERENTENVERZEICHNIS<br />
IMPRESSUM<br />
Arnold Umformtechnik GmbH & Co.KG,<br />
Forchtenberg 27<br />
C. Otto Gehrckens GmbH & Co. KG,<br />
Pinneberg 29<br />
Conta-Clip Verbindungstechnik GmbH,<br />
Hövelhof 13<br />
Deutsche Hochschulwerbung<br />
und -vertriebs GmbH, Düsseldorf 60<br />
EMERSON Automation Solutions, Augsburg 23<br />
Franke GmbH, Aalen 2<br />
Ferdinand Gross GmbH & Co KG,<br />
Leinfelden-Echterdingen 57<br />
KAGER Industrieprodukte GmbH,<br />
Dietzenbach 25<br />
HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG, Sulz 17<br />
LEANTECHNIK AG, Oberhausen 33<br />
Maxon Motor GmbH, Sexau 5<br />
VORSCHAU<br />
Metrofunkkabel-Union GmbH, Berlin 59<br />
MICRO-EPSILON-MESS- TECHNIK<br />
GmbH & Co. KG, Ortenburg 3<br />
Panduit GmbH, Schwalbach 37<br />
RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co.,<br />
Heidelberg 49,57<br />
Rittal GmbH & Co. KG, Herborn 8-9<br />
Rotek GmbH & Co.KG, Bremerhaven 45<br />
J.Schmalz GmbH, Glatten 29<br />
Schönbuch Sensor GmbH & Co. KG,<br />
Bad Teinach-Zavelstein 57<br />
Smalley Steel Ring Company,<br />
US-Lake Zurich, IL 57<br />
Stabilus GmbH, Koblenz 11<br />
Stäubli Electrical Connectors GmbH,<br />
Weil am Rhein 57<br />
VDI Wissensforum GmbH, Düsseldorf 53<br />
Wöhner GmbH & Co. KG, Rödental 7<br />
VERBINDUNGSTECHNIK<br />
Kleben beim Leichtbau mit Metallen? Das Thema ist<br />
vielfältiger und umfangreicher und damit auch über Automobil-<br />
und Luftfahrtindustrie<br />
hinaus interessant.<br />
Auch die Beständigkeit von<br />
geschweißten, gestanzten<br />
oder genieteten Bauteilen<br />
lässt sich durch zusätzliches<br />
Kleben erhöhen.<br />
Bild: Ruderer Klebetechnik<br />
MASCHINENELEMENTE<br />
Die RotoClamp-Klemmsysteme von Hema<br />
eignen sich für rotatorische Positionsklemmungen<br />
in Achsen, Tischen und Schwenk -<br />
köpfen von Maschinen. Da das Klemmsystem<br />
nach dem Fail-Safe-Prinzip arbeitet, klemmt<br />
es Achsen auch bei einem Energieausfall<br />
schnell und mit großer Kraft. Anforderungen<br />
hinsichtlich enger Bauräume begegnen die<br />
Konstrukteure bei Bedarf durch individuelle<br />
Anpassungen an der Bauteilgeometrie.<br />
FAHRZEUGBAU<br />
Der Trend zum softwaredefinierten Fahrzeug<br />
(Software-Defined Vehicle) ist nicht mehr<br />
aufzuhalten. Das bedeutet, dass Funktionen,<br />
die bisher etwa in der Firmware fest kodiert<br />
sind, in einen Software-Layer überführt werden,<br />
der auf standardisierter Hardware läuft.<br />
Die Entkopplung der Software von der Hardware<br />
ermöglicht Hardware-Unabhängigkeit<br />
und unterstützt zudem die schnelle Bereitstellung<br />
neuer Funktionen.<br />
ISSN 1612–7226<br />
Herausgeberin: Katja Kohlhammer<br />
Verlag:<br />
Konradin-Verlag Robert Kohlhammer GmbH,<br />
Ernst-Mey-Straße 8,<br />
70771 Leinfelden-Echterdingen, Germany<br />
Geschäftsführer: Peter Dilger<br />
Verlagsleiter: Peter Dilger<br />
Redaktion:<br />
Chefredakteur:<br />
Dipl.-Ing. Michael Corban (co), Phone + 49 711 7594–417<br />
Stellvertretender Chefredakteur:<br />
Johannes Gillar (jg), Phone + 49 711 7594–431<br />
Korrespondent:<br />
Nico Schröder M.A. (sc), Phone +49 170 6401879<br />
Newsdesk:<br />
Frederick Rindle (Leitung, fr), Bettina Tomppert (bt),<br />
Evelin Eitelmann (eve), Dr. Ralf Beck (bec)<br />
Redaktionsassistenz:<br />
Carmelina Weber<br />
Phone +49 711 7594–257, Fax: –1257<br />
carmelina.weber@konradin.de<br />
Layout:<br />
Helga Nass, Phone +49 711 7594–278<br />
Anja Carolin Graf, Phone +49 711 7594–297<br />
Gestaltungskonzept:<br />
Katrin Apel<br />
Gesamtanzeigenleiter:<br />
Andreas Hugel, Phone +49 711 7594–472<br />
Auftragsmanagement:<br />
Andrea Haab, Phone +49 711 7594–320<br />
Leserservice:<br />
<strong>KEM</strong> <strong>Konstruktion</strong>|Automation,<br />
Phone +49 711 7252–209<br />
E-Mail: konradinversand@zenit-presse.de<br />
<strong>KEM</strong> <strong>Konstruktion</strong>|Automation erscheint monatlich und wird<br />
kostenlos nur an qualifizierte Empfänger geliefert.<br />
Bezugspreise: Inland 84,90 € inkl. Versandkosten und MwSt.;<br />
Ausland: 84,90 € / 92,70 CHF inkl. Versandkosten.<br />
Einzelverkaufspreis: 8,60 € / 16,00 CHF inkl. MwSt., zzgl.<br />
Versandkosten. Bezugszeit: Das Abonnement kann erstmals<br />
vier Wochen zum Ende des ersten Bezugsjahres gekündigt<br />
werden. Nach Ablauf des ersten Jahres gilt eine<br />
Kündigungsfrist von jeweils vier Wochen zum Quartalsende.<br />
Auslandsvertretungen:<br />
Großbritannien: Jens Smith Partner ship, The Court, Long<br />
Sutton, GB-Hook, Hampshire RG29 1TA, Phone 01256<br />
862589, Fax 01256 862182, E-Mail: jsp@trademedia.info<br />
USA: TD.A. Fox Advertising Sales, Inc., Detlef Fox, 5 Penn<br />
Plaza, 19th Floor, New York, NY 10001,<br />
Phone +1 212 8963881, Fax +1 212 6293988,<br />
detleffox@comcast.net<br />
Gekennzeichnete Artikel stellen die Meinung des Autors,<br />
nicht unbedingt die der Redaktion dar. Für unverlangt<br />
eingesandte Manuskripte keine Gewähr. Alle in <strong>KEM</strong><br />
<strong>Konstruktion</strong>|Automation erscheinenden Beiträge sind<br />
urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, auch Übersetzungen,<br />
vorbehalten. Reproduktionen gleich welcher Art, nur<br />
mit schriftlicher Genehmigung des Verlages.<br />
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Stuttgart.<br />
Druck: Konradin Druck GmbH, Leinfelden-Echterdingen.<br />
Printed in Germany.<br />
<strong>Konstruktion</strong><br />
Automation<br />
© 2023 by Konradin-Verlag Robert Kohlhammer GmbH,<br />
Leinfelden-Echterdingen.<br />
<strong>KEM</strong> <strong>Konstruktion</strong>|Automation 01-02/2024 erscheint am 15.02.2024<br />
EDA<br />
58 <strong>KEM</strong> <strong>Konstruktion</strong>|Automation » 12 | 2023
Die DNA von Metrofunk<br />
sichert bei Hitze<br />
und Geschwindigkeit<br />
Metrofunk Kabel-Union GmbH<br />
Lepsiusstraße 89, D-12165 Berlin, Tel. 030 79 01 86 0<br />
info@metrofunk.de – www.metrofunk.de<br />
<strong>KEM</strong> <strong>Konstruktion</strong>|Automation » 12 | 2023 59
Sie suchen Personal?<br />
Bei uns finden Sie talentierte Mitarbeitende für<br />
Praktikum, Aushilfsjob und Berufseinstieg!<br />
Gutschein-Code:<br />
Jetzt<br />
kostenlos testen!<br />
4-wöchige Premium-Anzeige*<br />
im Wert von über 142 EUR<br />
Promo2023<br />
unistellenmarkt.de<br />
*Der Gutschein ist innerhalb von drei Monaten nach Erscheinen dieser Magazin-Ausgabe nur online einlösbar unter www.unistellenmarkt.de. Der Gutschein gilt nur für eine kostenlose vierwöchige<br />
Premiumanzeige an einem Standort; nicht für andere Produkte des UNIstellenmarktes bzw. Maßnahmen auf dem Campus sowie Zusatzleistungen oder für mehrere Standorte. Der Gutschein kann nur<br />
vor Abschluss des Bestellvorgangs eingelöst werden. Die Barauszahlung des Gutscheins sowie die nachträgliche Anrechnung sind nicht möglich. Der Gutschein ist pro Nutzer nur einmalig einzulösen<br />
und nicht übertragbar. Eine Kombination mit anderen Gutscheinen ist nicht möglich. Jeder gewerbliche und kommerzielle Weiterverkauf des Gutscheins ist untersagt. Der Gutschein wird nicht erstattet,<br />
wenn der Kunde die mit dem Gutschein bezahlte vierwöchige Premium-Anzeige im Rahmen seiner Mängelrechte rügt.<br />
60 <strong>KEM</strong> <strong>Konstruktion</strong>|Automation » 12 | 2023