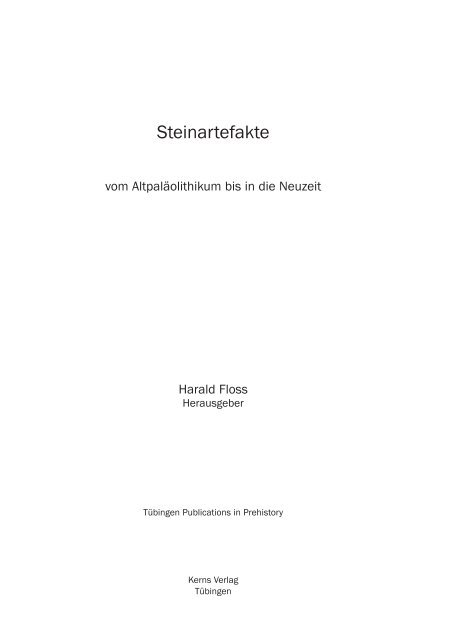PDF download - Institut für Ur- und Frühgeschichte der Universität ...
PDF download - Institut für Ur- und Frühgeschichte der Universität ...
PDF download - Institut für Ur- und Frühgeschichte der Universität ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Steinartefakte<br />
vom Altpaläolithikum bis in die Neuzeit<br />
Harald Floss<br />
Herausgeber<br />
Tübingen Publications in Prehistory<br />
Kerns Verlag<br />
Tübingen
Tübingen Publications in Prehistory<br />
Nicholas J. Conard, editor<br />
Tübingen Publications in Prehistory reflect the<br />
work of a cooperative project between the<br />
Department of Early Prehistory and Quaternary<br />
Ecology of the University of Tübingen’s <strong>Institut</strong>e<br />
for Pre- and Protohistory and Medieval<br />
Archaeology and Kerns Verlag to provide the<br />
results of current research in prehistoric archaeology<br />
and all its allied fields to a broad international<br />
audience. Inquiries about publications or or<strong>der</strong>s<br />
can be directed to:<br />
Kerns Verlag<br />
Postfach 210516, 72028 Tübingen, Germany<br />
Fax: 49-7071-367641 Tel: 49-7071-367768<br />
email: info@kernsverlag.com<br />
www.kernsverlag.com<br />
Umschlagabbildungen:<br />
Zwei Blattspitzen aus <strong>der</strong> Haldensteinhöhle,<br />
Gemeinde <strong>Ur</strong>spring, Lonetal, Baden-<br />
Württemberg. Die F<strong>und</strong>e gehören zu den spätmittelpaläolithischen<br />
Blattspitzengruppen.<br />
Foto: Hilde Jensen, <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Ur</strong>- <strong>und</strong><br />
<strong>Frühgeschichte</strong> <strong>und</strong> Archäologie des Mittelalters,<br />
<strong>Universität</strong> Tübingen.<br />
Zeichnung: nach Bosinski 1967.<br />
Satz <strong>und</strong> Gestaltung:<br />
Susanne Jüttner, burkert gestaltung, Ulm<br />
& Kerns Verlag, Tübingen.<br />
Schutzumschlag:<br />
Christiane Hemmerich Konzeption <strong>und</strong><br />
Gestaltung, Tübingen.<br />
© 2012 Kerns Verlag.<br />
Alle rechte vorbehalten.<br />
ISBN: 978-3-935751-12-4.<br />
Printed in Germany.
Inhaltsverzeichnis<br />
Vorwort 9<br />
Nicholas J. Conard, Tübingen Publications in Prehistory<br />
1. Einleitung: Steinartefakte – aus unserer Sicht 11<br />
Harald Floss, Herausgeber<br />
2.<br />
Die RohmateRialien unD ihRe VeRänDeRungen<br />
Bedeutende Silices in Europa – Historie, Bestimmungsmethodik<br />
<strong>und</strong> archäologische Bedeutung<br />
Harald Floss & Markus Siegeris<br />
15<br />
3. Das Rohmaterial <strong>der</strong> Steinwerkzeuge aus urgeschichtlicher<br />
Zeit in Nie<strong>der</strong>sachsen – Lagerstätten <strong>und</strong> Import<br />
Stephan Veil<br />
31<br />
4. Artefakt-Rohstoffe in Ostdeutschland<br />
Thomas Weber<br />
45<br />
5. Lithische Rohmaterialien im Rheinland<br />
Harald Floss<br />
55<br />
6. Silex-Rohmaterialien in Baden-Württemberg<br />
Wolfgang Burkert<br />
63<br />
7. Silex-Rohmaterialien in Bayern<br />
Utz Böhner<br />
79<br />
8. Entstehung <strong>und</strong> Verwitterung von Silices<br />
Rolf C. A. Rottlän<strong>der</strong><br />
93<br />
9. Verän<strong>der</strong>ungen an Steinartefakten<br />
durch Wind, Hitze <strong>und</strong> Frost<br />
Werner Schön<br />
101<br />
10. Hitzebehandlung (Tempern)<br />
Jürgen Weiner<br />
gRunDbegRiffe, techniken unD SchlaginStRumente<br />
105<br />
11. Gr<strong>und</strong>begriffe <strong>der</strong> Artefaktmorphologie <strong>und</strong> <strong>der</strong> Bruchmechanik<br />
Harald Floss<br />
117<br />
12. Schlagtechniken<br />
Harald Floss & Mara-Julia Weber<br />
133<br />
13. Der Habitus – Eine Vermittlung zwischen Technologie <strong>und</strong> Typologie<br />
Harald Floss<br />
137<br />
14. Schlaggeräte aus Stein<br />
Jürgen Weiner<br />
141<br />
15. Retuscheure aus Stein<br />
Jürgen Weiner<br />
147<br />
16. Die Suche nach Eolithen <strong>und</strong> das Problem<br />
<strong>der</strong> Unterscheid barkeit zwischen Artefakten <strong>und</strong> Geofakten<br />
Lutz Fiedler<br />
SteinaRtefakte DeS altpaläolithikumS<br />
153<br />
17. Oldowan <strong>und</strong> an<strong>der</strong>e frühe Geröllgeräte- bzw. Abschlagindustrien<br />
Miriam Noël Haidle<br />
159<br />
18. Gr<strong>und</strong>formerzeugung im Altpaläolithikum<br />
Thomas Weber<br />
167<br />
19. Kugelige Kerne, Polye<strong>der</strong> <strong>und</strong> Sphäroide<br />
Lutz Fiedler<br />
187
20. Altpaläolithische Abschlaggeräte in Mitteldeutschland 191<br />
Thomas Laurat, Armin Rudolph & Wolfgang Bernhardt<br />
21. Cleaver 201<br />
Lutz Fiedler<br />
22. Faustkeile 209<br />
Jean-Marie Le Tensorer<br />
23. Pics 219<br />
Lutz Fiedler<br />
SteinaRtefakte DeS mittelpaläolithikumS<br />
24. Das Levallois-Konzept 227<br />
Jürgen Richter<br />
25. Diskoide Kerne 237<br />
Lutz Fiedler<br />
26. Klingentechnologie vor dem Jungpaläolithikum 245<br />
Nicholas J. Conard<br />
27. Moustérien <strong>und</strong> Micoquien 267<br />
Jürgen Richter<br />
28. Mittelpaläolithische Spitzen 273<br />
Michael Bolus<br />
29. Schaber 281<br />
Jürgen Richter<br />
30. Messer mit Rücken 287<br />
Michael Bolus<br />
31. Gekerbte <strong>und</strong> gezähnte Stücke 293<br />
Jürgen Richter<br />
32. Keilmesser 297<br />
Olaf Jöris<br />
33. Blattförmige Schaber, Limaces, Blattspitzen 309<br />
Michael Bolus<br />
SteinaRtefakte DeS Jung- unD enDpaläolithikumS<br />
34. Frühjungpaläolithische Gr<strong>und</strong>formerzeugung in Europa 327<br />
Thorsten Uthmeier<br />
35. Kielkratzer <strong>und</strong> Kielstichel: Werkzeug vs. Lamellenkern 341<br />
Foni Le Brun-Ricalens & Laurent Brou<br />
36. Retuschierte Lamellen im Aurignacien: Dufour et alii 357<br />
Foni Le Brun-Ricalens<br />
37. Gr<strong>und</strong>formerzeugung im mittleren Jungpaläolithikum 367<br />
Clemens Pasda<br />
38. Gr<strong>und</strong>formerzeugung im Magdalénien 379<br />
Harald Floss<br />
39. Gr<strong>und</strong>formerzeugung im Nordischen Endpaläolithikum 389<br />
Sönke Hartz<br />
40. Lithische Spitzen des Jungpaläolithikums 399<br />
Harald Floss<br />
41. Kratzer 415<br />
Claus-Joachim Kind<br />
42. Stichel 421<br />
Clemens Pasda
43. Rückenmesser<br />
Michael Bolus<br />
429<br />
44. Endretuschen<br />
Clemens Pasda<br />
435<br />
45. Ausgesplitterte Stücke. Kenntnisstand nach einem<br />
Jahrh<strong>und</strong>ert Forschung<br />
Foni Le Brun-Ricalens<br />
439<br />
46. Spitzklingen<br />
Clemens Pasda<br />
457<br />
47. Kostenki-Enden (Dorsalabbau an Abschlägen)<br />
Jens A. Frick<br />
459<br />
48. Lateralretuschen<br />
Clemens Pasda<br />
467<br />
49. Bohrer<br />
Harald Floss<br />
477<br />
50. Signifikante Gerättypen des Jungpaläolithikums<br />
im östlichen Mitteleuropa<br />
Jiří Svoboda<br />
481<br />
51. Lithische Spitzen des mittleren Jungpaläolithikums<br />
Clemens Pasda<br />
489<br />
52 Dreiecke des Magdalénien<br />
Christiane Höck<br />
497<br />
53. Lithische Projektilspitzen im Spätglazial<br />
Harald Floss & Mara-Julia Weber<br />
509<br />
54. Jungpaläolithische Gerölle mit Gebrauchsspuren<br />
Gisela Schulte-Dornberg<br />
517<br />
55. Schleifsteine mit Rille (Pfeilschaftglätter)<br />
Michael Bolus<br />
SteinaRtefakte DeS meSolithikumS<br />
525<br />
56. Gr<strong>und</strong>formproduktion <strong>und</strong> -verwendung im frühen<br />
Mesolithikum Mitteleuropas<br />
Martin Heinen<br />
535<br />
57. Gr<strong>und</strong>formproduktion <strong>und</strong> -verwendung im späten<br />
Mesolithikum Mitteleuropas<br />
Birgit Gehlen<br />
549<br />
58. Mesolithische Silexwerkzeuge in Mitteleuropa<br />
Birgit Gehlen<br />
581<br />
59. Mikrolithen<br />
Martin Heinen<br />
599<br />
60. Flächenretuschierte Projektile des Mesolithikums<br />
Martin Heinen<br />
621<br />
61. Kern- <strong>und</strong> Scheibenbeile<br />
Stefan Wenzel<br />
631<br />
62. Gr<strong>und</strong>formerzeugung im Nordischen Endmesolithikum<br />
(Ertebøllekultur) <strong>und</strong> im Nordischen Frühneolithikum<br />
(Ältere Trichterbecherkultur)<br />
Sönke Hartz & Harald Lübke<br />
639
63. Geräteformen im Nordischen Endmesolithikum (Ertebøllekultur)<br />
<strong>und</strong> im Nordischen Frühneolithikum (Ältere Trichterbecherkultur) 647<br />
Sönke Hartz & Harald Lübke<br />
64.<br />
SteinaRtefakte DeS neolithikumS unD DeR metallzeiten<br />
Rohmaterial <strong>und</strong> Gr<strong>und</strong>formspektren als historische Quellen:<br />
Beispiele aus dem Frühneolithikum Mitteleuropas<br />
Birgit Gehlen & Andreas Zimmermann<br />
659<br />
65. Abbaugeräte des neolithischen Bergbaus<br />
Jürgen Weiner<br />
679<br />
66. Klingenerzeugung im Neolithikum<br />
Jürgen Weiner<br />
689<br />
67. Die Silexgeräte <strong>der</strong> Linienbandkeramik, des frühen<br />
Mittel neolithikums <strong>und</strong> <strong>der</strong> Rössener Kultur<br />
Birgit Gehlen<br />
717<br />
68. Quantitative Analyse – Werkzeugspektren<br />
bandkeramischer Siedlungen im Vergleich<br />
Carsten Mischka<br />
765<br />
69. Mahl- <strong>und</strong> Schleifsteine<br />
Nicole Kegler-Graiewski<br />
779<br />
70. Erntemesser <strong>und</strong> Sicheln<br />
Philipp Drechsler<br />
791<br />
71. Neolithische Pfeilköpfe<br />
Werner Schön<br />
807<br />
72. Neolithische Beilklingen aus Feuerstein<br />
Jürgen Weiner<br />
827<br />
73. Felsgesteingeräte des Alt- <strong>und</strong> Mittelneolithikums<br />
Birgit Gehlen<br />
837<br />
74. Beile <strong>und</strong> Äxte aus Felsgestein<br />
Christoph Willms<br />
857<br />
75. Felsgesteine als Rohmaterial neolithischer Steinbeile<br />
<strong>und</strong> -äxte in Mitteleuropa<br />
Gesine Schwarz-Mackensen & Werner Schnei<strong>der</strong><br />
875<br />
76. Dickenbännlibohrer<br />
Jutta Hoffstadt<br />
893<br />
77. Gerätebestand des Jung- bis Endneolithikums<br />
Petra Kieselbach<br />
901<br />
78. Spätneolithische Flinttechnologie im Norden<br />
Volker Arnold<br />
923<br />
79. Metallzeitliche Silexartefakte<br />
Heiko Hesse<br />
SteinaRtefakte DeR neuzeit<br />
931<br />
80. Feuerschlagsteine <strong>und</strong> Feuererzeugung<br />
Jürgen Weiner<br />
943<br />
81. Flintensteine<br />
Jürgen Weiner<br />
961<br />
82. Dreschschlitten<br />
Jürgen Weiner<br />
973
Das Levallois-Konzept<br />
Jürgen Richter<br />
Der Terminus “Levallois” geht auf die im 19. Jahrh<strong>und</strong>ert entdeckte F<strong>und</strong>stelle im<br />
Pariser Vorort Levallois-Perret an <strong>der</strong> Seine zurück <strong>und</strong> bezeichnet ein im Mittel -<br />
paläolithikum bedeutsames Konzept zur Herstellung von Silexabschlägen.<br />
Das Verbreitungsgebiet des Phänomen “Levallois” umfasst Europa, den Vor<strong>der</strong>en<br />
Orient <strong>und</strong> Afrika. Sein bevorzugter Nutzungszeitraum beginnt in Afrika um<br />
400.000 B.P. <strong>und</strong> in Europa um 300.000 B.P. (Korolevo, Ukraine), erstreckt sich über<br />
das gesamte Mittelpaläolithikum <strong>und</strong> endet mit diesem um 35.000 B.P. (z.B. Molodova,<br />
Ukraine). Vereinzelt tritt das Levallois-Konzept auch in späterer Zeit auf, zum<br />
Beispiel im “Khormusan” in Nubien (12.000 v. Chr.) <strong>und</strong> sogar im 20. Jh. in Australien.<br />
Das Levallois-Konzept ist demzufolge zu verschiedenen Zeiten <strong>und</strong> in verschiedenen<br />
Räumen mehrmals erf<strong>und</strong>en <strong>und</strong> angewandt worden.<br />
Die sogenannte “Levalloistechnik” wurde in <strong>der</strong> älteren Literatur als eine Weise<br />
beschrieben, einen Abschlag vorbestimmter Form (“Levalloisabschlag”, “Levalloisspitze”,<br />
“Levalloisklinge”) von <strong>der</strong> gewölbten Oberseite eines zuvor r<strong>und</strong>um präparierten,<br />
oval-schildförmigen Kerns zu gewinnen. Die Steinbearbeitungstechnologie<br />
mittelpaläolithischer Inventare wurde als große Dichotomie aufgefasst. Inventare<br />
waren entwe<strong>der</strong> “Levallois” o<strong>der</strong> “Nicht-Levallois”.<br />
Die intensive, durch neue Materialstudien <strong>und</strong> durch Experimente unterstützte<br />
Beschäftigung mit dem Phänomen “Levallois” führte in den letzten zwanzig Jahren<br />
zum Verschwinden <strong>der</strong> “großen Dichotomie” zugunsten einer Vielzahl unterschied -<br />
licher Steinbearbeitungs-Konzepte des Mittelpaläolithikums. Darüber hinaus wurden<br />
das Phänomen “Levallois” <strong>und</strong> die mit ihm verknüpften Klassifikationen völlig neu<br />
überdacht. Gr<strong>und</strong>legend hierzu waren die Arbeiten von Jean-Michel Geneste, Eric<br />
Boëda, Philip van Peer <strong>und</strong> zwei Kongresse in Rom <strong>und</strong> Philadelphia. Beson<strong>der</strong>s die<br />
Arbeiten von E.Boeda führten zu einer neuen Systematik, in <strong>der</strong>en Zentrum die<br />
Begriffe “Konzept”, “Methode”, “Technik” <strong>und</strong> “Schema” stehen.<br />
Systematik des Levallois-Konzeptes<br />
Unter einem Konzept <strong>der</strong> Steinartefaktherstellung ist das Prinzip zu verstehen, mit<br />
dessen Hilfe ein Werkstück (das <strong>für</strong> die Steinbearbeitung vorgesehene Gesteinsrohstück)<br />
als Raum-Objekt aufgefasst <strong>und</strong> geglie<strong>der</strong>t wird. Das Phänomen “Levallois”<br />
ist ein solches Konzept. Dieses räumliche Konzept kann durch eine Methode o<strong>der</strong><br />
auch mehrere, unterschiedliche Methoden umgesetzt werden. Die verschiedenen<br />
Methoden, denen das Levallois-Konzept zugr<strong>und</strong>e liegt, können insofern zur Gruppe<br />
24<br />
227
228<br />
Das Levallois-Konzept<br />
<strong>der</strong> “Levallois-Methoden” gerechnet werden. Heute kennen wir eine ganze Reihe<br />
verschiedener Levallois-Methoden. Beispielsweise wird eine solche spezifische<br />
Methode des Levallois-Konzeptes als “zentripetale, wie<strong>der</strong>holte Levallois-Methode”<br />
(Boëda 1994, Fig. 175) bezeichnet, eine an<strong>der</strong>e als “Safaha-Methode”, eine wei tere<br />
als “Nubische Methode vom Typ II” (Van Peer 1992, 40, 41).<br />
Eine Methode bezeichnet demnach den beson<strong>der</strong>en Weg, <strong>der</strong> verfolgt wird, um das<br />
Konzept zu erfüllen. Zu diesem Weg gehören verschiedene Techniken, also die Art<br />
<strong>und</strong> die Anwendungsweise des Schlaginstrumentes, ebenso wie verschiedene Schemata,<br />
nach denen die Gestaltung <strong>der</strong> Oberflächen des Werkstückes in den einzelnen<br />
Abbaustadien erfolgt, <strong>und</strong> schließlich die Regeln, nach denen Techniken <strong>und</strong> Schemata<br />
verknüpft sind <strong>und</strong> einan<strong>der</strong> ablösen.<br />
Die Dorsalfläche eines einzelnen Levallois-Abschlages <strong>und</strong> die Anordnung <strong>der</strong> Negative<br />
auf einem einzelnen Levallois-Kern geben daher bestenfalls ein solches Schema<br />
wie<strong>der</strong>, nämlich gerade dasjenige Jeweils-Schema, das die Abbaufläche besaß, als <strong>der</strong><br />
Abschlag gewonnen o<strong>der</strong> <strong>der</strong> Kern aufgegeben wurde. Wenige Momente zuvor o<strong>der</strong><br />
danach hätte die Abbaufläche ein an<strong>der</strong>es Schema (o<strong>der</strong> auch wie<strong>der</strong> ein ähnliches)<br />
zeigen können. Um auf die Technik zu schließen, mit <strong>der</strong> ein Schema verwirklicht<br />
wurde, wird selten ein einzelnes Objekt ausreichen. Vielmehr wird man technische<br />
Merkmale hierzu an einer statistisch relevanten Anzahl ähnlicher Objekte erheben<br />
müssen. Die Methode schließlich kann nur aus <strong>der</strong> gemeinsamen Betrachtung aller<br />
Kerne, Zielabschläge, Formungs- <strong>und</strong> Präparationsabschläge <strong>und</strong> <strong>der</strong> mit ihnen verknüpften<br />
Schemata <strong>und</strong> Techniken abgeleitet werden.<br />
Dem prähistorischen Steinbearbeiter war die Methode als Rezeptur greifbar, die<br />
erlernt werden konnte. Ob den prähistorischen Menschen das hinter <strong>der</strong> Rezeptur stehende<br />
Konzept jeweils bewusst war, ist nicht leicht zu beurteilen. Bei <strong>der</strong> Auswahl<br />
<strong>der</strong> Rohstücke <strong>und</strong> bei <strong>der</strong> Vorbereitung des Abbauvorganges wäre die Kenntnis des<br />
Konzeptes jedenfalls vorteilhaft gewesen.<br />
Gr<strong>und</strong>prinzip des Levallois-Konzeptes<br />
Ein Gr<strong>und</strong>prinzip des Levallois-Konzeptes ist es, zunächst ein sehr genau definiertes<br />
Zwischenprodukt zu schaffen, das dann den Ausgangspunkt <strong>für</strong> den Gr<strong>und</strong>formen -<br />
abbau bildet. Der Gr<strong>und</strong>formenabbau nach dem Levallois-Konzept geht von einem<br />
präparierten Kernstein aus, <strong>der</strong> in einer ersten Arbeitsphase aus dem Rohstück<br />
geschaffen wird.<br />
Das Levallois-Konzept (Abb. 1) besteht in folgen<strong>der</strong> räumlicher Aufteilung des Kernsteines<br />
(vgl. Boeda 1994, 13): Der Kern besteht aus zwei gegenüberliegenden kon -<br />
vexen Flächen (Abb. 1, A & D), die sich r<strong>und</strong>um überschneiden. Wo die beiden<br />
Flächen sich überschneiden, entsteht eine Konturlinie. Diese bezeichnet die Schnittebene<br />
zwischen Ober- <strong>und</strong> Unterseite des Kerns (Abb. 1, C). Ober- <strong>und</strong> Unterseite<br />
haben streng getrennte Funktionen.<br />
Auf <strong>der</strong> Oberseite, <strong>der</strong> Levallois-Abbaufläche, werden die Zielabschläge gewonnen;<br />
die Trennfläche <strong>der</strong> Zielabschläge ist parallel zur Schnittebene <strong>der</strong> Ober- <strong>und</strong> Unterseite<br />
(Abb. 1, C). Die Oberseite besitzt distale <strong>und</strong> laterale Konvexität, wodurch die<br />
Zielabschläge distal <strong>und</strong> lateral begrenzt werden. Hierdurch erhalten die Zielabschläge<br />
ihre vorherbestimmte Form. Die Unterseite dient <strong>der</strong> Präparation <strong>der</strong> Schlagflächen<br />
<strong>für</strong> die Abschläge <strong>und</strong> Zielabschläge <strong>der</strong> Oberseite. Das abbaufähige Volumen
Abb. 1: Raumkonzept <strong>der</strong> Levalloismethode.<br />
Kernstein in perspektivischer<br />
Darstellung. A Oberseite des<br />
Kernsteines, B Volumen zwischen<br />
Kernoberseite A <strong>und</strong> Schnittebene C<br />
(nur dieses Volumen steht <strong>für</strong> den<br />
Abbau von Zielabschlägen zur Verfügung.<br />
Wenn das Volumen B abgebaut<br />
ist, dann ist <strong>der</strong> Kern technisch<br />
erschöpft), C Schnittebene zwischen<br />
Oberseite A <strong>und</strong> Unterseite D<br />
des Kernsteines, D Unterseite des<br />
Kernsteines, E Schlagrichtung <strong>und</strong><br />
Schlagachse (gepunktete Linie) des<br />
vorgesehenen Zielabschlages.<br />
eines Levallois-Kerns beschränkt sich daher auf das Volumen (Abb. 1, B) zwischen<br />
<strong>der</strong> Levallois-Abbaufläche <strong>und</strong> <strong>der</strong> Schnittebene zwischen Ober- <strong>und</strong> Unterseite.<br />
Definition des Levallois-Konzeptes<br />
Fünf Kriterien definieren damit (nach Boëda 1994) das Levallois-Konzept<br />
(Abb. 2; Abb. 3):<br />
1. Der Kern hat eine schwach konvexe Oberseite <strong>und</strong> eine konvexe Unterseite<br />
2. Ober- <strong>und</strong> Unterseite haben strikt getrennte Funktionen<br />
3. Die Oberseite dient ausschließlich <strong>der</strong> Formungsabschlag- <strong>und</strong> Zielabschlag -<br />
gewinnung<br />
4. Die Unterseite dient ausschließlich <strong>der</strong> Präparation <strong>der</strong> Schlagflächen<br />
5. Die Trennflächen <strong>der</strong> Zielabschläge liegen zur Schnittebene zwischen Ober<strong>und</strong><br />
Unterseite parallel<br />
Soll das Levallois-Konzept in einem mittelpaläolithischen Inventar nachgewiesen<br />
werden, so müssen die genannten fünf Kriterien erfüllt sein. Um dies zu prüfen,<br />
müssen die vorhandenen Kernsteine, Präparations- <strong>und</strong> Formungsabschläge <strong>und</strong> Zielabschläge<br />
gemeinsam betrachtet werden. Der Nachweis des Levallois-Konzeptes<br />
erfolgt also über die gesamthafte Betrachtung technischer Eigenschaften <strong>und</strong> Schemata<br />
des Gr<strong>und</strong>formenabbaus in einem Inventar. Einzelne Produkte des Levallois-<br />
Konzeptes ähneln oft solchen des “Diskoiden Konzeptes”. Anhand <strong>der</strong> oben genannten<br />
Kriterien ist jedoch eine klare Unterscheidung <strong>der</strong> beiden Konzepte möglich<br />
geworden (Abb. 4).<br />
Es ist notwendig, sehr klar zwischen dem Nachweis einer Methode des Levallois-<br />
Konzeptes (zum Beispiel “wie<strong>der</strong>holter, bipolarer Levallois-Klingenabbau”) <strong>und</strong><br />
dem Beschreiben von Einzelformen über Typbegriffe (zum Beispiel “Diskuskern”,<br />
“Levallois-Spitze”) zu unterscheiden. Eine Levallois-Spitze (flache, symmetrische<br />
Spitze mit präparierter Schlagfläche <strong>und</strong> Ypsilon-Gratmuster auf <strong>der</strong> Dorsalfläche)<br />
kann das Ergebnis sehr verschiedener Methoden des Gr<strong>und</strong>formenabbaus sein<br />
(Abb. 5).<br />
Jürgen Richter 229
230<br />
Das Levallois-Konzept<br />
Abb. 2: Aufsicht auf die Oberseite eines Levallois-<br />
Kernes. C Schnittebene zwischen Ober- <strong>und</strong> Unterseite.<br />
F Terminale Konvexität <strong>der</strong> Oberseite zur terminalen<br />
Begrenzung des Zielabschlages, G1 <strong>und</strong><br />
G2 Laterale Konvexitäten <strong>der</strong> Oberseite zur lateralen<br />
Begrenzung des Zielabschlages, H Umriss <strong>und</strong><br />
Trennfläche (gerastert) des beabsichtigten Zielabschlages,<br />
E Schlagrichtung des Zielabschlages.<br />
Der Levallois-Abbauprozess<br />
Ein Levallois-Abbauprozess glie<strong>der</strong>t sich in folgende Schritte:<br />
Abb. 3: Längsschnitt eines Levallois-Kernes.<br />
A Oberseite des Kernsteines, C Schnittebene<br />
zwischen Ober- <strong>und</strong> Unterseite, D Unterseite,<br />
E Schlagrichtung des Zielabschlages, H<br />
Trennfläche des Zielabschlages, J Spezielle<br />
Schlagflächenpräparation des Zielabschlages.<br />
Die Flächen H <strong>und</strong> D sind parallel.<br />
Vorbereitung<br />
• Auswahl des Rohstückes. Dicke platten- o<strong>der</strong> fladenförmige Rohstücke sind<br />
besser geeignet als kugelige, weil bei <strong>der</strong> Schlagflächenpräparation <strong>und</strong> bei <strong>der</strong><br />
Abbauflächenpräparation <strong>der</strong> Umfang stark reduziert wird.<br />
• Initialisierung. Am Rohstück werden Partien mit günstigen Winkeln gesucht, an<br />
denen die ersten Abschläge angelegt werden. Die Ventralflächennegative dieser<br />
Abschläge bilden die Schlagflächen <strong>für</strong> die nächsten Schritte<br />
• Festlegung <strong>der</strong> Ober- <strong>und</strong> Unterseite. Das Rohstück wird eingehend betrachtet.<br />
Dabei muss <strong>der</strong> Steinschläger die spätere Unter- <strong>und</strong> Oberseite in das Rohstück<br />
“hineinsehen”.<br />
Herstellung eines Vollkernes<br />
• Schlagflächenpräparation. Von <strong>der</strong> Unterseite werden abschnittsweise o<strong>der</strong> umlaufend<br />
Abschläge gelöst. Ihre Ventralflächennegative dienen als Schlagflächen <strong>für</strong>
Abb. 4: Definierende Kriterien <strong>der</strong> Levallois-Methode (rechte Spalte). Kriterien <strong>der</strong> Diskoiden Methode<br />
zum Vergleich (linke Spalte). 1 Der Levallois-Kern <strong>und</strong> <strong>der</strong> Diskoide Kern haben eine Ober- <strong>und</strong> eine<br />
Unterseite, die durch eine Schnittebene getrennt sind. 2 Beim Levallois-Kern dient nur die Oberseite<br />
<strong>der</strong> Gewinnung von Zielabschlägen, die Unterseite dient zur Präparation <strong>der</strong> Schlagflächen <strong>der</strong> oberseitigen<br />
Formungs- <strong>und</strong> Zielabschläge. Beim Diskoiden Kern sind beide Seiten gleichwertig. 3 Die<br />
Oberseite des Levallois-Kerns besitzt laterale <strong>und</strong> terminale Konvexität, die beiden Seiten des Diskoiden<br />
Kerns besitzen periphere Konvexität. 4 Die Trennfläche des Levallois-Zielabschlages ist parallel<br />
zur Schnittebene zwischen Ober- <strong>und</strong> Unterseite. Beim Diskoiden Kern konvergieren die Trennflächen<br />
<strong>der</strong> Abschläge mit <strong>der</strong> Schnittebene zwischen den beiden Seiten (nach Boëda 1995, 85).<br />
Jürgen Richter 231
232<br />
Das Levallois-Konzept<br />
Abb. 5: Verschiedene Möglichkeiten <strong>der</strong> Entstehung einer Levalloisspitze aus Gr<strong>und</strong>formenabbau-<br />
Methoden des diskoiden Konzeptes (oben), des Levallois-Konzeptes (rechts), des pyramidalen Konzeptes<br />
(unten) <strong>und</strong> des jungpaläolithischen Klingenkonzeptes (links) (nach Boëda 1994, Fig. 177).<br />
die Formungsabschläge auf <strong>der</strong> Oberseite. In <strong>der</strong> Praxis geht dieser Schritt dem<br />
nächsten nicht vollständig voraus, son<strong>der</strong>n die beiden Schritte wechseln sich<br />
abschnittsweise ab.<br />
• Abbauflächenformung. Die Schlagflächen <strong>der</strong> Unterseite werden genutzt, um<br />
Formungsabschläge von <strong>der</strong> Oberseite abzubauen. Die Formungsabschläge werden<br />
so angelegt, dass die Oberseite eine leicht konvexe Form erhält <strong>und</strong> damit zur<br />
Levallois-Abbaufläche wird. Bei <strong>der</strong> Anordnung <strong>der</strong> Formungsabschläge können<br />
sehr unterschiedliche Schemata angewandt werden. An dieser Stelle des Abbauprozesses<br />
entsteht durch die vielen möglichen Schemata eine technologische<br />
Wahlfreiheit (technological choice). Diese Schemata bilden deshalb die Gr<strong>und</strong> lage<br />
<strong>für</strong> die Rekonstruktion <strong>der</strong> verschiedenen Methoden des Levallois-Konzeptes.<br />
Am Ende dieses Arbeitsschrittes ist ein Zwischenprodukt entstanden, <strong>der</strong><br />
Levallois-Vollkern.
Zielabschlaggewinnung<br />
• Spezielle Schlagflächenpräparation. An einem kurzen Abschnitt <strong>der</strong> Unterseite des<br />
Kerns werden kleine Abschläge <strong>und</strong> Absplisse in <strong>der</strong> Weise abgebaut, dass eine<br />
exakt begrenzte, leicht konvexe Schlagfläche <strong>für</strong> den geplanten Zielabschlag entsteht.<br />
Damit ist ein präziser Auftreffpunkt <strong>für</strong> den Schlagstein gegeben.<br />
• Abheben des Zielabschlages. Unter Nutzung <strong>der</strong> speziell präparierten Schlagfläche<br />
wird von <strong>der</strong> Oberseite ein großer Abschlag abgehoben, <strong>der</strong> Zielabschlag o<strong>der</strong><br />
Levallois-Abschlag (o<strong>der</strong>: Levallois-Spitze). Der Levallois-Abschlag greift dabei<br />
über das Zentrum <strong>der</strong> Abbaufläche hinaus.<br />
• Abheben weiterer Zielabschläge. Gegebenenfalls können von <strong>der</strong>selben Abbau -<br />
fläche weitere Zielabschläge abgehoben werden. Hierzu werden weitere spezielle<br />
Schlagflächen präpariert.<br />
Am Ende dieses Arbeitsschrittes ist <strong>der</strong> Kern technisch erschöpft, weil die Abbaufläche<br />
nun ganz eben ist. Sie bietet nicht mehr die laterale <strong>und</strong> terminale Konvexität,<br />
die zur lateralen <strong>und</strong> terminalen Begrenzung <strong>der</strong> Zielabschläge notwendig ist.<br />
Ein Levallois-Restkern ist entstanden. Er besitzt eine völlig flache Oberseite <strong>und</strong><br />
eine konvexe Unterseite.<br />
Wie<strong>der</strong>holte Einrichtung zum Vollkern<br />
Wenn <strong>der</strong> Kern nach <strong>der</strong> Zielabschlaggewinnung zwar technisch erschöpft ist, aber<br />
noch groß genug ist (über 4-6 cm Durchmesser), um ihn weiter abzubauen, kann die<br />
Arbeitsschrittfolge “Herstellung des Vollkerns” wie<strong>der</strong>holt werden. Es folgt also eine<br />
erneute Schlagflächenpräparation <strong>der</strong> Unterseite <strong>und</strong> eine Abbauflächenformung <strong>der</strong><br />
Oberseite. Oft wird hierbei nicht <strong>der</strong> ganze Kern überarbeitet, son<strong>der</strong>n nur die notwendigen<br />
Partien, bis wie<strong>der</strong> eine laterale <strong>und</strong> distale Konvexität <strong>der</strong> Levallois-<br />
Abbaufläche vorliegt. Hierbei entsteht wie<strong>der</strong> ein Zeitpunkt technologischer Wahlfreiheit,<br />
<strong>und</strong> ist es möglich, die Anordnung <strong>der</strong> Formungsabschläge zu verän<strong>der</strong>n,<br />
also nach einem an<strong>der</strong>en Abbauschema zu verfahren, als bei <strong>der</strong> ersten Ausbeutung<br />
<strong>der</strong> Levallois-Abbau fläche.<br />
Wie<strong>der</strong>holte Zielabschlaggewinnung<br />
Erneut erfolgt die spezielle Schlagflächenpräparation <strong>für</strong> den Zielabschlag, das Ab -<br />
heben des Zielabschlages <strong>und</strong> eventuell das Abheben weiterer Zielabschläge.<br />
Die Arbeitsschrittfolge endet wie<strong>der</strong>, wenn <strong>der</strong> Kern technisch erschöpft, die<br />
Levallois-Abbaufläche also ganz flach ist. Die “wie<strong>der</strong>holte Einrichtung zum Vollkern”<br />
<strong>und</strong> die “wie<strong>der</strong>holte Zielabschlaggewinnung” kann solange fortgesetzt werden,<br />
bis <strong>der</strong> Kern dimensional erschöpft ist. Erfahrungsgemäß ist das bei Levallois-<br />
Kernen bei 4-6 cm Durchmesser <strong>der</strong> Fall.<br />
Weitere Nutzung des Kerns<br />
Ein erschöpfter Levallois-Kern kann verworfen werden <strong>und</strong> überliefert damit das<br />
innerhalb <strong>der</strong> letzten Arbeitsschrittfolge angewandte Schema <strong>der</strong> Zielabschlag -<br />
gewinnung.<br />
Er kann aber auch weiter abgebaut werden, ohne dass die Levallois-Kriterien beachtet<br />
werden. In diesem Fall würde er nach seiner Hauptnutzung regelwidrig, o<strong>der</strong> besser:<br />
regeldifferent, abgebaut. Häufig geschieht das in Form einer zentripetalen<br />
Jürgen Richter 233
234<br />
Das Levallois-Konzept<br />
Abschlagserie, wobei “diskomorphe Restkerne” entstehen. Solche Restkerne sind<br />
von kleinen Restkernen des “Diskoiden Konzeptes” nicht zu unterscheiden.<br />
Für die Restkerne gilt, dass eindeutige Schema-Zuordnungen nicht immer möglich<br />
sind. Ebenso ist die Trennung zwischen parallelen <strong>und</strong> konvergenten <strong>und</strong> zwischen<br />
orthogonalen <strong>und</strong> zentripetalen Abbauflächen nicht strikt auszählbar. Dazu kommt<br />
<strong>der</strong> irreguläre Abbau im letzten Stadium <strong>und</strong> schließlich die Umarbeitung zum Werkzeug.<br />
Um die Schemata in Rohmaterialgruppen <strong>und</strong> Inventaren aufzuspüren, müssen<br />
also stets mehrere Kernformen <strong>und</strong> mehrere Abschlagformen gemeinsam betrachtet<br />
werden.<br />
Schemata zur Abschlagherstellung<br />
Wie erwähnt, kann die Vorbereitung <strong>der</strong> Levallois-Abbaufläche nach verschiedenen<br />
Schemata geschehen, die <strong>der</strong> Steinschläger vor Augen hat. Ein solches Schema<br />
beschreibt die Strukturierung <strong>der</strong> Abbaufläche durch die beson<strong>der</strong>e Anordnung <strong>der</strong><br />
Formungs- <strong>und</strong> Zielabschläge zueinan<strong>der</strong>. Diese Strukturierung wird durch die<br />
Betrachtung des Gratmusters <strong>und</strong> <strong>der</strong> Ventralflächennegative auf den Abbauflächen<br />
<strong>der</strong> Restkerne <strong>und</strong> ebenso auf <strong>der</strong> Dorsalfläche <strong>der</strong> Zielprodukte erkennbar. Während<br />
eines Abbauprozesses kann sich mehrfach die Gelegenheit ergeben, das zuvor<br />
gewählte Schema zu än<strong>der</strong>n. Die Schemata sind daher nicht Ausdruck strikt zugehöriger<br />
Herstellungsprozesse, son<strong>der</strong>n treten häufig als Stadien desselben Abbauprozesses,<br />
innerhalb einer einzigen Methode, auf.<br />
Die Identifikation des Schemas anhand <strong>der</strong> Levallois-Produkte <strong>und</strong> <strong>der</strong> Kernsteine<br />
tritt an die Stelle <strong>der</strong> früheren Typklassifikation <strong>der</strong> Kernsteine (Abb. 6).<br />
L1: Einzel-Zielabschlag-Schema. Zielprodukte sind Levallois-Zielabschläge, <strong>der</strong>en<br />
Dorsalfläche ausschließlich zentripetale Negative von <strong>der</strong> Präparation <strong>der</strong> Abbau -<br />
fläche zeigt. Nach dem Abheben des ersten Zielabschlages besteht die Möglichkeit,<br />
seitlich rechts o<strong>der</strong> links einen Kernkantenabschlag zu gewinnen. Wird <strong>der</strong> Kernkantenabschlag<br />
möglichst schräg zur Abbaufläche gestellt, kann ein Übergang zur Weiterarbeit<br />
in Schema L2 geschaffen werden. Kennzeichnend ist <strong>für</strong> Schema L1 <strong>und</strong> L2,<br />
dass keine um die Kernunterseite umlaufende Schlagflächenpräparation erfolgt, son<strong>der</strong>n<br />
alle Zielabschläge <strong>und</strong> Kernkantenabschläge von nur einer Abbaukante aus (unipolar)<br />
gewonnen werden. Das Schema L1 wird in <strong>der</strong> sogenannten “klassischen<br />
Levallois-Methode” angewandt (Van Peer 1992, 40). Die Victoria-West o<strong>der</strong> “Para -<br />
levallois”-Methode ist eine Variante, bei <strong>der</strong> das Schema L1 in einen zur Zielabschlag-Achse<br />
querovalen Umriss gelegt wird.<br />
L2: Unipolares, paralleles Schema <strong>für</strong> wie<strong>der</strong>holte Zielabschläge. Zielprodukte sind<br />
Levallois-Abschläge mit teilweise parallelem Gratmuster. Schema L2 folgt Schema<br />
L1 häufig innerhalb einer Abbaufolge. Entscheidend ist hierbei die Verbesserung <strong>der</strong><br />
lateralen Konvexität <strong>der</strong> Abbaufläche durch möglichst schräggestellte Kernkantenabschläge<br />
(extrem: Kernkantenklinge). Dies kann auch durch mehrere unmittelbar aufeinan<strong>der</strong><br />
folgende Kernkantenabschläge erfolgen. Es fallen somit viele, häufig<br />
schlanke Kernkantenabschläge o<strong>der</strong> Abschläge mit Kortexkante an (Couteau à dos).<br />
Die nunmehr stark aufgewölbte Abbaufläche erlaubt das Abheben mehrerer Zielabschläge<br />
mit parallelen Graten. Manchmal sind die Leitgrate leicht konvergent<br />
<strong>und</strong>/o<strong>der</strong> schräg zur Schlagrichtung.
L3: Bipolares, paralleles Schema <strong>für</strong><br />
wie<strong>der</strong>holte Zielabschläge. Zielprodukte<br />
sind schlanke Abschläge mit<br />
parallelem Gratmuster, <strong>der</strong>en Dorsalfläche<br />
Ventralflächen-Negative vorhergehen<strong>der</strong><br />
Zielabschläge aus zwei<br />
gegenüberliegenden Schlagrichtungen<br />
zeigen.<br />
L4: Unipolares, konvergentes Schema<br />
<strong>für</strong> wie<strong>der</strong>holte Zielabschläge.<br />
Zielprodukte sind spitze Abschläge,<br />
die Negative vorhergehen<strong>der</strong> Zielabschläge<br />
zeigen. Wie bei Schema L1<br />
<strong>und</strong> L2 stammen die Zielabschläge<br />
von einer Schlagfläche. Am Ende <strong>der</strong><br />
Sequenz sind jedoch auch bipolar<br />
geschlagene Kernkantenabschläge<br />
<strong>und</strong> zentripe tale Präparationsabschläge<br />
zugelassen. Zielabschläge scheinen<br />
aber nach solchen Maßnahmen<br />
nicht mehr gewonnen zu sein. Die<br />
Zielabschläge ähneln weniger Levallois-Spitzen<br />
als den Abschlägen des<br />
Schemas L2. Schema L3 kann durchaus<br />
ein Spät stadium des Schemas L2<br />
sein.<br />
Abb. 6: Einige Schemata, die innerhalb <strong>der</strong> verschiedenen<br />
Methoden des Levallois- Konzeptes häufig auftreten.<br />
L5: Unipolares, konvergentes Schema <strong>für</strong> Levalloisspitzen. Zielprodukte sind<br />
Levallois spitzen. Diese haben die Form eines spitzen, gleichschenkligen Dreiecks.<br />
Das Gratmuster auf <strong>der</strong> Dorsalfläche bildet ein umgekehrtes Ypsilon. Dieses Gratmuster<br />
wird erzeugt, indem unmittelbar vor dem Zielabschlag von dessen Schlag -<br />
fläche aus ein kurzer Abschlag gewonnen wird.<br />
L6: Bipolares Schema <strong>für</strong> Levalloisspitzen. Zielprodukte sind Levalloisspitzen.<br />
Ihr Gratmuster in Form eines umgekehrten Ypsilon zeigt in <strong>der</strong> Mitte ein Negativ in<br />
<strong>der</strong> gleichen Richtung, rechts <strong>und</strong> links daneben aber zwei Negative in Gegenrichtung<br />
<strong>der</strong> Schlagrichtung des Zielabschlags.<br />
L7: Orthogonales Schema <strong>für</strong> wie<strong>der</strong>holte Zielabschläge. Zielprodukte sind Abschläge,<br />
<strong>der</strong>en Dorsalfläche die Negative vorhergehen<strong>der</strong>, rechtwinklig aufeinan<strong>der</strong> -<br />
treffen<strong>der</strong> Zielabschläge zeigt. Die Kerne besitzen jeweils zwei winklig (manchmal<br />
auch konvex) angeordnete Kanten, die zu Schlagflächen präpariert sind. Es fällt allerdings<br />
auf, dass fast alle abgebildeten Kerne eine Bruchkante o<strong>der</strong> Kortexkante besitzen,<br />
die nicht als Schlagfläche taugt <strong>und</strong> auch nur unter großem Materialverlust<br />
umzuarbeiten wäre. Wäre diese Kante nicht vorhanden, hätte eine umlaufende<br />
Schlagflächenpräparation erfolgen können, wie sie <strong>für</strong> Schema B2 notwendig ist.<br />
Jürgen Richter 235
236<br />
Das Levallois-Konzept<br />
L8: Zentripetales Schema <strong>für</strong> wie<strong>der</strong>holte Zielabschläge. Levallois-Abschläge dieses<br />
Schemas besitzen auf ihrer Dorsalfläche zentripetal angeordnete Negative vorher -<br />
gehen<strong>der</strong> Zielabschläge. Oft haben sie einen winkligen Umriß. Negative von Formungsabschlägen<br />
bedecken die Dorsalfläche – wenn überhaupt – nur partiell. Um<br />
mehrere Zielabschläge umlaufend von <strong>der</strong>selben Abbaufläche zu gewinnen, ist es<br />
notwendig, <strong>der</strong>en Konvexität immer wie<strong>der</strong> herzustellen. Dies geschieht entwe<strong>der</strong><br />
mit erneuten, kleinen Abbauflächen-Präparationen von <strong>der</strong> Kernkante aus, o<strong>der</strong> durch<br />
Zurückverlegung <strong>der</strong> Kernkantenabschnitte, die den neuen Zielabschlag lateral <strong>und</strong><br />
distal begrenzen sollen. Hierbei entstehen gedrungene Abschläge mit Kernkantenrest<br />
(vgl. zur Unterscheidung die schlanken Kernkantenabschläge des Schemas L2).<br />
Diese eclats à debordement partiel sind in einigen Inventaren sehr häufig.<br />
Wenn oben Formungsabschläge <strong>und</strong> Zielabschläge unterschieden werden, so ge -<br />
schieht das, um ihre unterschiedliche technische Funktion darzustellen. Es ist aber<br />
nicht so, dass die Zielabschläge beabsichtigte Produkte darstellen, die Formungsabschläge<br />
hingegen nur technische Abfälle. Vielmehr bilden Zielabschläge <strong>und</strong> Formungsabschläge<br />
gemeinsam ein beabsichtigtes Sortiment an Gr<strong>und</strong>formen. Nicht<br />
einzelne Zielabschlagformen, son<strong>der</strong>n das gesamte Sortiment an Gr<strong>und</strong>formen bildet<br />
die Gr<strong>und</strong>lage des mittelpaläolithischen Werkzeugspektrums. Das ist ein entscheiden<strong>der</strong><br />
Unterschied zur Situation im mittleren <strong>und</strong> späten Jungpaläolithikum, wo fast alle<br />
Werkzeugformen aus einer einzigen Zielabschlagform, die serienweise hergestellt<br />
wurde, gewonnen werden konnten: aus <strong>der</strong> Klinge.<br />
LITERATUR<br />
Bietti, A. 1996: Reduction processes of the<br />
European Mousterian. Kongress Rom 1995.<br />
Quaterneria Nova, VI.<br />
Boëda, E. 1994: Le concept Levallois: variabilité‚<br />
des méthodes. Monographie du CRA 9.<br />
Paris: CNRS.<br />
1995: Steinartefakt-Produktionssequenzen im<br />
Micoquien <strong>der</strong> Kulna-Höhle. Quartär 45/46,<br />
75-98.<br />
Dibble, H. L. & Bar-Yosef, O. (Hrsg.) 1995: The<br />
Definition and Interpretation of Levallois<br />
Technology. Monographs in World Archaeology,<br />
vol. 23, Madison.<br />
Geneste, J.-M. 1989: Les industries de la Grotte<br />
Vaufrey: Technologie du Débitage, Économie<br />
et Circulation de la matière première<br />
lithique. In: Rigaud J. P. (Hrsg.), La Grotte<br />
Vaufrey. Paléoenvironnement, Chronologie,<br />
Activités humaines. Mémoires Société Préhistorique<br />
Française XIX, Chalon-sur-Marne,<br />
441-517.<br />
Van Peer, Ph. 1992: The Levallois Reduction<br />
Strategy. Monographs in World Archaeology<br />
13. Madison: Prehistory Press.