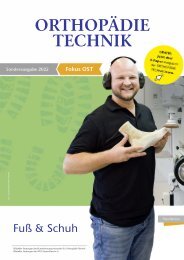05 / 2024
Die Fachzeitschrift ORTHOPÄDIE TECHNIK ist die maßgebliche Publikation für das OT-Handwerk und ein wichtiger Kompass für die gesamte Hilfsmittelbranche.
Die Fachzeitschrift ORTHOPÄDIE TECHNIK ist die maßgebliche Publikation für das OT-Handwerk und ein wichtiger Kompass für die gesamte Hilfsmittelbranche.
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
75. Jahrgang<br />
ORTHOPÄDIE<br />
Exklusiver Medienpartner der<br />
TECHNIK<br />
Sanitätshaus • Reha-Technik<br />
Live auf der OTWorld<br />
Mobilität neu<br />
definiert.<br />
Peer-Review<br />
#WeEmpowerPeople<br />
www.ottobock.com<br />
10778=de_DE-01-2404_C.indd 1 <strong>05</strong>.04.24 15:11<br />
Prothetik<br />
Mai <strong>2024</strong><br />
Kompression<br />
OTWorld-Vorschau<br />
Offizielles Fachorgan des Bundesinnungsverbandes für Orthopädie-Technik<br />
Offizielles Fachorgan der ISPO Deutschland e. V.
Handwerk<br />
Innovationen & Verlässlichkeit<br />
Wir freuen uns auf Sie!<br />
Prothetik <strong>2024</strong>/25<br />
Seminare <strong>2024</strong><br />
Gegründet 1862<br />
Aktivitätsbandbreite<br />
Zubehör<br />
Robustheit ISO Qualität<br />
Liner Kniegelenke<br />
Wasserfeste Komponenten<br />
Unikat<br />
Meine Prothese<br />
Individualität<br />
Füße<br />
SmartTemp<br />
Verlässlichkeit<br />
Sortimentsvielfalt<br />
Prothetik<br />
Aktives Leben<br />
Akzeptanz<br />
Designliner<br />
Stumpfstrümpfe<br />
Handwerk Modularadapter<br />
Emotionalität Intuy Knee<br />
Unterschenkel Bandbreite<br />
Orthopädietechnische Kompetenz<br />
Außendienstteam<br />
Unterdrucksysteme<br />
Oberschenkel<br />
META Familie<br />
Gegründet 1862<br />
Oberschenkelschaft-Technologie<br />
Orthopädietechnik<br />
Tipps und Tricks<br />
Fachlicher Austausch<br />
Alltagstauglich<br />
Versorgung<br />
Unterdruckversorgung<br />
Prepreg-Verarbeitung<br />
Schlüssige Konzepte<br />
Intuy Knee Auf Augenhöhe<br />
Seminare<br />
Vom Techniker für den Techniker<br />
Anwendbare Techniken<br />
Praxisorientiert Theorie und Praxis<br />
Eigene Werkstücke Kompetenz<br />
Versorgung am Patienten<br />
Motivierend<br />
Digitales Modellieren<br />
Made in<br />
Baden-Württemberg<br />
Orthetik <strong>2024</strong>/25<br />
Orthetik <strong>2024</strong>/25<br />
Gegründet 1862<br />
Knieorthesen<br />
Aktivitätsunterstützer<br />
Cervicalorthesen<br />
Drei-Punkt-Korsett EFO<br />
Hüftorthesen Wirbelsäulenorthesen<br />
Sportverletzung Postoperative Versorgung<br />
Individuell anpassbar Quantum-A ® PRO<br />
MLO Dynamic Qualität Von Kopf bis Fuß<br />
Konservative Versorgung<br />
DynaCox ® evo<br />
Hilfsmittelnummer<br />
Peronäusorthesen<br />
Schlaganfallversorgung<br />
Bewegung<br />
Orthetik<br />
Hochwertige Materialien<br />
Return-to-Walk<br />
Made in Germany<br />
Verlässlichkeit<br />
Maßanfertigung<br />
Vielfalt<br />
Besuchen Sie uns<br />
an unserem Stand in<br />
14. - 17. Mai <strong>2024</strong><br />
Leipziger Messe<br />
HALLE 1 / D10/E11<br />
... aus Göppingen<br />
direkt zu Ihnen<br />
Material <strong>2024</strong>/25<br />
Gegründet 1862<br />
Material <strong>2024</strong>/25<br />
Klebstoffe<br />
Arbeitsersparnis<br />
Qualität Handwerk<br />
Kontaktfärbepapier<br />
Schleifmittel<br />
Carbongewebematte<br />
Problemlöse-Materialien<br />
Sprühkleber<br />
Eurolen ®<br />
Armierungsmaterialien<br />
Werkzeuge<br />
Biokompatibilität Laminierharz 80:20<br />
Ortholen<br />
Haftband<br />
Material<br />
® Carbonfaser Verbindungstechnik<br />
Sortimentsvielfalt<br />
Polstermaterialien<br />
Subortholen Gipstechnik Tiefzieh-Zubehör<br />
Plattenmaterialien Prepregmaterialien<br />
Laminiertechnik Tepefom ® Schränkeisen<br />
Orthotherm ® Clear Spachtelmassen<br />
Trikotschläuche Gießharze Schäume<br />
Lieferschnelligkeit<br />
Scaleo ®<br />
Servicefertigung <strong>2024</strong>/25<br />
Gegründet 1862<br />
Oberschenkelschaft-Technologie<br />
Orthopädietechnik<br />
Arbeitsersparnis<br />
Fachlicher Austausch<br />
Alltagstauglich<br />
Prozessorientiert<br />
Eigene Werkstücke<br />
Versorgung am Patienten<br />
Skoliose<br />
Anwendbare Techniken<br />
Verlässlichkeit<br />
Laminiertechnik<br />
Vom Techniker für den Techniker<br />
Testschäfte in XXL Schlüssige Konzepte<br />
Lieferschnelligkeit<br />
Fräsmodelle<br />
Servicefertigung<br />
Qualität<br />
Digitales Modellieren<br />
Kompetenz<br />
DESIGN Liner<br />
... auch in<br />
bewegten Zeiten!<br />
Rev. <strong>2024</strong>/<strong>05</strong> © Wilhelm Julius Teufel GmbH<br />
www.wjt-ortho.com
Editorial<br />
Ausfahrt in Richtung Zukunft<br />
Anfang April nutzten wir alle im Verlag die Ostertage,<br />
um die eigenen Batterien ein wenig aufzuladen und<br />
Zeit mit Freunden und der Familie zu verbringen. Wer<br />
mit dem Auto unterwegs war und den Weg nicht kannte,<br />
der hat vermutlich sein Navigationsgerät eingeschaltet<br />
und sich bis zum Ziel lotsen lassen. Das ist komfortabel<br />
und sorgt dafür, dass selbst Reisemuffeln ein Gegenargument<br />
genommen wird. Auch in der Orthopädie-Technik<br />
wird sich in diesem Jahr zeigen, welche Richtung Politik,<br />
Justiz und das Fach selbst einschlagen.<br />
Die erste Ausfahrt, die viele von Ihnen in diesem Jahr<br />
nehmen werden, wird Sie mit Sicherheit nach Leipzig<br />
führen. Dort steht vom 14. bis zum 17. Mai die OTWorld<br />
an – mit Weltleitmesse und Weltkongress der Pflichttermin<br />
für jeden und jede aus dem Fach. Egal ob aus<br />
den ehrenamtlichen Verbänden und Fachgesellschaften<br />
oder der Industrie: Die Vorfreude, in Leipzig die Branche<br />
zusammenzubringen, ist ungebrochen. Lesen Sie<br />
ab Seite 36, was die Persönlichkeiten des Fachs über die<br />
OTWorld zu sagen und welche Tipps sie parat haben.<br />
Mit René Schaar ist nun auch der letzte Keynote-Speaker<br />
des Kongresses bekannt gegeben worden. Der stellvertretende<br />
Gleichstellungsbeauftragte des Norddeutschen<br />
Rundfunks (NDR) wird über Inklusion in den Medien<br />
sprechen. Er selbst hat zu mehr Sichtbarkeit von Menschen<br />
mit Behinderungen beigetragen, indem er sich für<br />
den Einzug der rollstuhlfahrenden Elin in die Fernsehserie<br />
„Sesamstraße“ stark machte. Lesen Sie das komplette<br />
Interview ab Seite 26.<br />
Während in Leipzig vor allem die orthopädietechnische<br />
Versorgung im Vordergrund steht, müssen die<br />
Richter:innen in Karlsruhe klären, ob die einseitige Entlassung<br />
von Apotheken aus der Präqualifizierung (PQ)<br />
für verhandelte Hilfsmittel rechtens ist oder nicht. Die<br />
Sanitätshaus Stolle GmbH hat wie angekündigt ihre Verfassungsklage<br />
am 2. April eingereicht. Aus Sicht der Branche<br />
muss die Justiz nun ein deutliches Stopp-Schild für<br />
die Ungleichbehandlung von Apotheken und Sanitätshäusern<br />
aufstellen und damit die Versäumnisse der Politik<br />
korrigieren. Lesen Sie mehr dazu auf Seite 8.<br />
Seit mehr als zwei Jahren tobt nun schon wieder ein<br />
Krieg in Europa. In der Ukraine sterben Tausende Menschen<br />
und noch viele mehr werden verwundet. Einige<br />
davon benötigen eine Hilfsmittelversorgung für<br />
zum Beispiel verlorene Gliedmaßen. Im Rahmen der<br />
OTWorld wird es deshalb eine Sonderfläche zum Thema<br />
Kriegsversorgungen geben und auch im Kongress<br />
werden sich Beiträge inhaltlich mit den Versorgungen<br />
dieser Art beschäftigen. Der Verein Human Study<br />
ist bereits 2017 mit der Ausbildung von ukrainischen<br />
Orthopädietechniker:innen gestartet, seit Kriegsbeginn<br />
ist der Bedarf noch einmal drastisch gestiegen. Christian<br />
Schlierf gibt ab Seite 30 ein Zwischenfazit zu dem Projekt.<br />
Auch das Aurora-Projekt beschäftigt sich mit der Qualifikation<br />
von Fachkräften für die Ukraine. Dr. Sebastian<br />
Benner stellt das Projekt auf der OTWorld und ab Seite<br />
32 vor.<br />
Die Orthopädie-Technik wird in diesem Jahr auf dem<br />
Weg in Richtung Zukunft mit Sicherheit die Ausfahrten<br />
Leipzig und Karlsruhe nehmen. Vielleicht wird es den<br />
einen oder anderen Umweg auf der Fahrt geben. Solange<br />
die angestrebten Ziele zum Wohle des Fachs erreicht<br />
werden und man nicht in einer Sackgasse stecken bleibt,<br />
sind diese Schlenker erlaubt.<br />
Gleich zwei Hinweise in eigener Sache darf ich Ihnen<br />
an dieser Stelle geben. Für unsere internationale Leserschaft<br />
haben wir erneut in Zusammenarbeit mit der International<br />
Society for Prosthetics and Orthotics (ISPO)<br />
pünktlich zur OTWorld unser englischsprachiges Magazin<br />
HowToTreat veröffentlicht.<br />
Eine neue – digitale – Richtung wird der Verlag OT einschlagen.<br />
Lassen Sie sich auf der OTWorld überraschen,<br />
welche Neuigkeiten wir für Sie bereithalten. Ich kann<br />
Ihnen versprechen, dass es sich lohnen wird. Bis dahin<br />
bleibt mir nur zu sagen: Bis bald in Leipzig! Wir freuen<br />
uns, Sie bei uns am Stand in Halle 3 zu begrüßen und<br />
über Themen der Branche zu sprechen.<br />
Heiko Cordes,<br />
Chef vom Dienst<br />
Foto: BIV-OT/Carolin Ebbert<br />
Offizielles Fachorgan des Bundesinnungs -<br />
verbandes für Orthopädie-Technik<br />
Offizielles Fachorgan der ISPO<br />
Deutschland e. V.
Inhalt<br />
62<br />
Editorial<br />
3 Ausfahrt in Richtung Zukunft<br />
42<br />
Politik und Verbände<br />
6 BIV-OT: Wir machen den Unterschied!<br />
Pierre Koppetsch ist neuer Obermeister<br />
8 Verfassungsbeschwerde eingereicht<br />
Überarbeitung der MDR gefordert<br />
Info<br />
10 Armprothese aus dem 3D-Drucker: Hero Arm besticht<br />
durch Leichtigkeit<br />
Interview mit Sebastian Hannen<br />
14 Mobiles Sanitätshaus holt Versorgung nach Hause<br />
Interview mit Torben Naumann<br />
16 Rehabilitation nach Kreuzbandriss: Kniebandage<br />
zeigt positive Effekte<br />
Interview mit Prof. Gisela Sole<br />
20 Die Kinder stehen im Mittelpunkt<br />
Interview mit Lars Kieroth<br />
10<br />
26<br />
24 Passformkontrolle, 3D-Druck, Registerforschung:<br />
DGIHV präsentiert Programm zur OTWorld<br />
26 Monster oder Superheld – Wie Stereotype in Film und<br />
Fernsehen unser Denken formen<br />
Interview mit René Schaar<br />
30 Hilfsmittelversorgung im Krisengebiet: Human Study<br />
qualifiziert vor Ort und auf Distanz<br />
32 Ukrainische Fachkräfte schätzen „German Gründlichkeit“<br />
Interview mit Dr. Sebastian Benner<br />
36 Was sagt das Fach zur OTWorld?<br />
42 Mit Prothese ins Weltall<br />
43 OTWorld-Daily: Tägliche Updates zu Messe und Kongress<br />
44 OTWorld bietet „Tag des E-Rezeptes“<br />
46 Stimmen aus der Branche<br />
55 Das „Savoir-vivre“ kommt nach Leipzig<br />
Interview mit Nathalie Balducci-Michelin und Jacques Fecherolle<br />
56 Starpower für die OTWorld<br />
58 Unikate für gesunden Druck<br />
BEILAGEN:<br />
∙ Verlag Orthopädie-Technik<br />
∙ Confairmed
Digitalisierung<br />
61 Sicherheitsrisiko bei Microsoft-Exchange-Server<br />
62 DMEA <strong>2024</strong>: Orthopädie-Technik im „Digi-Tal“?<br />
64 Cybersicherheit ist eine Pflichtaufgabe<br />
68 AOK-Krankenkassen unterstützen Pilotprojekt<br />
E-Verordnung<br />
Sicherer Messengerdienst fürs Gesundheitswesen<br />
Fachartikel<br />
Kompression<br />
70 Medizinische adaptive Kompressionssysteme<br />
in der Praxis<br />
S. Klör<br />
Prothetik<br />
74 Schulung im Umgang mit Exoprothesenpassteilen<br />
an der oberen Extremität (Armprothesen)<br />
A. Fürst, H.-P. Baumgärtler<br />
82 Agonisten-Antagonisten-Myo neural-Interface<br />
(AMI) – eine neue Versorgungsdimension für den<br />
transtibialen Stumpf?<br />
V. Hoursch et al.<br />
90 FIRST – eine neuartige Konzeptprothese für<br />
die frühe Versorgung von Kindern mit<br />
angeborenen Fehlbildungen an den oberen<br />
Extremitäten<br />
M. Schäfer et al.<br />
100 Ergebnisse einer Anwenderbefragung zum<br />
subischialen VPS-Schaftsystem<br />
T. Vogel<br />
Berufsbildung<br />
104 Auszubildende sammeln Ski-Erfahrungen<br />
Markt<br />
106 Weiteres Wachstum für Ottobock<br />
107 Mark Jalaß neuer BVMed-Vorstandsvorsitzender<br />
108 Neues aus der Industrie<br />
109 Kleinanzeigen<br />
114 Vorschau/Impressum<br />
Für tägliche Branchen-News<br />
folgen Sie uns auf
Politik und Verbände<br />
BIV-OT: Wir machen<br />
den Unterschied!<br />
„Wir machen den Unterschied!“ – unter diesem Motto<br />
steht der Jahresbericht März 2023 bis März <strong>2024</strong> des Bundesinnungsverbandes<br />
für Orthopädie-Technik (BIV-OT).<br />
„Unsere Häuser machen mit ihrer individuellen und bedarfsgerechten<br />
Versorgung mit Hilfsmitteln einen entscheidenden<br />
Unterschied für die Teilhabe, Selbstbestimmung<br />
und Lebensqualität ebenso wie die Lebensfreude der<br />
Menschen, die auf Hilfsmittel angewiesen sind“, erklärt<br />
BIV-OT-Präsident Alf Reuter mit Blick auf das vergangene<br />
Geschäftsjahr. „Wir als Verband arbeiten gemeinsam mit<br />
Hunderten von engagierten Orthopädietechnikerinnen<br />
und Orthopädietechnikern daran, dass die Betriebe weiterhin<br />
den Unterschied für ihre Patienten machen können.“<br />
Der Bundesinnungsverband setzte im vergangenen<br />
Geschäftsjahr zahlreiche Projekte auf und um, damit die<br />
orthopädietechnischen Betriebe und Sanitätshäuser in<br />
Deutschland weiterhin ihr Hauptaugenmerk auf die Versorgung<br />
der Menschen mit Hilfsmitteln legen können.<br />
Das bereits im März 2023 vom Bündnis „Wir versorgen<br />
Deutschland“ (WvD) vorgelegte Reformkonzept „Versorgung<br />
sichern. Vorschläge für eine nachhaltige Hilfsmittelreform“<br />
gestaltete der BIV-OT wesentlich mit. Damit<br />
gelang erstmals die Einbeziehung orthopädietechnischer<br />
Betriebe, Sanitätshäuser und Homecare-Dienstleister als<br />
handelnde Akteure in ein Reformvorhaben im Bereich<br />
Hilfsmittel. Ebenso konnten BIV-OT-Positionen in den<br />
bundesweiten Diskussionsprozess zur Hilfsmittelreform,<br />
zum Bürokratieabbau und zur Digitalisierung eingebracht<br />
werden. Ob solitär als BIV-OT oder als Mitglied des WvD-<br />
Bündnisses – die politische Stimme des BIV-OT wird in Berlin<br />
deutlich wahrgenommen. Dies zeigte sich auch anlässlich<br />
der Feier zu „100 Jahre Verbandsgeschichte“ am 13. November<br />
2023 in Berlin mit rund 200 Gästen aus Politik, Gesellschaft,<br />
Ärzteschaft, Medien und dem Handwerk.<br />
Die Befreiung der Apotheken von der Präqualifizierung<br />
durch das im Juli 2023 beschlossene Arzneimittel-Lieferengpassbekämpfungs-<br />
und Versorgungsverbesserungsgesetz<br />
(ALBVVG) stellte eine besondere Herausforderung für<br />
den BIV-OT, die 14 (Landes-)Innungen, sechs Fachverbände<br />
sowie deren 4.500 Mitgliedsbetriebe mit rund 48.000<br />
Mitarbeitenden dar. „Die Befreiung der Apotheken von<br />
der Präqualifizierung wird uns noch länger beschäftigen.<br />
Diese Ungleichbehandlung von Apotheken und unseren<br />
Betrieben muss geändert werden. Ebenso wird es Zeit, dass<br />
unser Handwerk die überfällige Anerkennung und Gleichstellung<br />
mit den akademischen Berufen im Gesundheitswesen<br />
erhält. Daran arbeiten wir ebenso intensiv wie an<br />
der Reform der Hilfsmittelversorgung“, betont Alf Reuter.<br />
Mehr Digitalisierung<br />
Ob eine neue Kalkulationsdatenbank im Mitgliederportal<br />
„Mein Sanitätshaus“ oder das Pilotprojekt E-Verordnung<br />
für orthopädische Hilfsmittel: Der BIV-OT treibt die digitale<br />
Zukunft der Branche maßgeblich voran. Die neue Kalkulationsdatenbank,<br />
die weitgehend im Jahr 2023 erarbeitet<br />
wurde und <strong>2024</strong> an den Start gehen soll, bringt mehr<br />
Transparenz, mehr Freiraum, mehr Service für die Betriebe<br />
und damit mehr Zeit für Patient:innen. Das bereits in<br />
der Testphase befindliche Pilotprojekt E-Verordnung für<br />
orthopädische Hilfsmittel unter der Leitung des BIV-OT<br />
sichert den Betrieben auch nach der Umstellung von Rezepten<br />
in Papierform auf elektronische Verordnungen am<br />
1. Juli 2027 den Zugang zum Markt.<br />
Know-how sichert Qualität<br />
Petra Menkel, Alf Reuter<br />
und weitere Gäste<br />
feierten 2023 in Berlin<br />
die 100-jährige<br />
Verbandsgeschichte.<br />
Für die Tochtergesellschaften Confairmed GmbH und Verlag<br />
Orthopädie-Technik stand das Geschäftsjahr ganz im<br />
Zeichen der OTWorld. Die Confairmed GmbH organisiert<br />
den Weltkongress der OTWorld, der gemeinsam mit der internationalen<br />
Fachmesse vom 14. bis 17. Mai <strong>2024</strong> in Leipzig<br />
stattfindet. Mehr Vorsprung durch Information – dafür<br />
steht die Arbeit des Verlags OT. Dies galt im vergangenen<br />
Geschäftsjahr nicht nur für die zahlreichen Fachartikel,<br />
sondern ebenso für die im Januar 2023 begonnene neue<br />
Serie „Fachkräfteoffensive“ und das internationale Fachmagazin<br />
„HowToTreat“. Der Bericht steht ab sofort, wie seine<br />
Vorgänger, auf der Webseite des Bundesinnungsverbandes,<br />
zum Download bereit.<br />
Foto: Tanzyna<br />
Pierre Koppetsch ist neuer Obermeister<br />
Anfang April wählten die Mitglieder der Innung für Orthopädie-Technik<br />
für den Regierungsbezirk Düsseldorf<br />
einen neuen Obermeister. Pierre Koppetsch erhielt von den<br />
versammelten Stimmberechtigten in der nordrhein-westfälischen<br />
Landeshauptstadt das Vertrauen und wird nun als<br />
Obermeister die Innung anführen. Vorgänger Thomas<br />
Münch wird dem Vorstand allerdings erhalten bleiben. Im<br />
Amt des stellvertretenden Obermeisters wird das Mitglied<br />
des Vorstandes im Bundesinnungsverband für Orthopädie-<br />
Technik (BIV-OT) Koppetsch mit Rat und Tat unterstützen.<br />
6<br />
ORTHOPÄDIE TECHNIK <strong>05</strong>/24
Entlastende Orthesen bei<br />
Kniearthrose<br />
ROAM OA und OA GO®<br />
NEU!<br />
Besuchen Sie uns<br />
Halle 5, Platz A04/B03<br />
MKT-OT-GO-ROAM-FK-OT-<strong>2024</strong>-02 Copyright © <strong>2024</strong> DJO, LLC, a subsidiary of Enovis Corporation<br />
Überzeugend durch Komfort und Leichtigkeit:<br />
• Entlastung des medialen oder lateralen Kompartiments bei mittlerer Gonarthrose<br />
• Einstellbare BOA® * Drehverschlüsse sorgen für eine individuelle Entlastung<br />
• Schlankes Design, passt unter die Kleidung<br />
Erfahren Sie mehr zu unseren Neuprodukten unter enovis-medtech.de<br />
*<br />
Die Marke BOA® ist das Eigentum der Boa Technology, Inc.<br />
enovis-medtech.de
Politik und Verbände<br />
Verfassungsbeschwerde eingereicht<br />
Wie angekündigt hat die Stolle Sanitätshaus GmbH<br />
eine Verfassungsbeschwerde gegen die einseitige<br />
Befreiung von Apotheken aus der Präqualifizierung für<br />
bestimmte Produktgruppen eingereicht. Konkret geht<br />
es um die Benachteiligung des Sanitätsfachhandels und<br />
die Gefährdung der GKV-Versicherten durch den Wegfall<br />
einheitlicher Versorgungs- und Qualitätsstandards. „Wir<br />
sind zuversichtlich, auf diesem Weg die einseitige Befreiung<br />
der Apotheken von der Präqualifizierung zu Fall zu<br />
bringen und damit den fairen Wettbewerb sowie einheitliche<br />
Qualitätsstandards in der Hilfsmittelversorgung<br />
wieder herzustellen“, erklärt Stolle-Geschäftsführer Detlef<br />
Möller.<br />
„Die unterschiedlichen Regeln für Apotheken und Sanitätshäuser<br />
verstoßen gegen den Grundsatz der Gleichbehandlung.<br />
Der Zugang zum Markt wird für Apotheken<br />
und Sanitätshäuser von völlig unterschiedlichen Voraussetzungen<br />
abhängig gemacht“, kommentieren die Generalsekretäre<br />
des Bündnisses „Wir versorgen Deutschland“<br />
(WvD), Kirsten Abel und Patrick Grunau die aktuelle Situation.<br />
„Patienten, insbesondere aus vulnerablen Gruppen,<br />
sollten sich darauf verlassen können, eine gleichermaßen<br />
hochwertige Versorgung zu erhalten, unabhängig vom Ort<br />
der Leistung.“ Während das Arzneimittel-Lieferengpass-<br />
bekämpfungs- und Versorgungsverbesserungsgesetz (ALB-<br />
VVG) ursprünglich darauf abzielte, Bürokratie zu reduzieren<br />
und Mehrfachprüfungen zu eliminieren, wurde aus<br />
Sicht des Bündnisses ein Gesetz beschlossen, das neue bürokratische<br />
Doppelstrukturen im System etabliere, Patientensicherheit<br />
gefährde und einheitliche Mindeststandards<br />
der Versorgung untergrabe. Daher sieht WvD nach wie vor<br />
deutlichen Korrekturbedarf: „Wir haben konstruktive Vorschläge<br />
für eine bürokratiearme und gerechte Qualitätssicherung<br />
im Rahmen der sogenannten Präqualifizierung<br />
gemacht und stehen bereit, um mit politischen Entscheidungsträgern<br />
und Gesundheitsakteuren eine Lösung zu<br />
finden, die allen gerecht wird“, so Abel und Grunau.<br />
Detlef Möller betont, dass die Beschwerde der Politik ein<br />
Zeichen sein sollte, die fortgesetzte Ignoranz gegenüber<br />
den Sanitätshäusern und der mittelständisch geprägten<br />
Struktur in der Hilfsmittelversorgung zu beenden und<br />
stattdessen eine einheitliche und qualitätssichernde bürokratische<br />
Entschlackung bei der Präqualifizierung für alle<br />
Leistungserbringer in Angriff zu nehmen. Die Verfassungsbeschwerde<br />
wurde am 2. April von der Kanzlei Zuck, Vaihingen,<br />
eingereicht. Im Folgenden wird nun das Bundesverfassungsgericht<br />
zunächst über die Annahme der Verfassungsbeschwerde<br />
entscheiden.<br />
Überarbeitung der MDR gefordert<br />
Am 26. Mai feiert die europäische Medizinprodukteverordnung<br />
(MDR) ihren dritten „Geburtstag“, sie gilt in<br />
der Medizintechnikbranche weiterhin als ein viel diskutiertes<br />
Thema. Jüngst meldete sich auch die Politik in Person<br />
von Bayerns Gesundheitsministerin Judith Gerlach zur<br />
MDR zu Wort. Sie fordert eine Überarbeitung. Gerlach betont:<br />
„Bayern, Deutschland und Europa müssen auch künftig<br />
für medizintechnische Unternehmen attraktiv bleiben.<br />
Deshalb ist es wichtig, dass die europäische Verordnung zu<br />
Medizinprodukten besser wird. Derzeit ist vieles überbürokratisch<br />
– das führt zu Innovationshemmnissen.“<br />
Ähnlich lautet auch das Fazit der<br />
EU-Abgeordneten Peter Liese, Angelika<br />
Niebler und Andreas Glück,<br />
die bereits Ende Februar im Europäischen<br />
Parlament (EP) darauf<br />
hingewiesen haben, dass die MDR<br />
„über das Ziel hinausgeschossen“<br />
sei und grundlegend überarbeitet<br />
werden müsse. Peter Liese forderte<br />
dabei unter anderem eine Regelung<br />
Foto: Susie Knollon/Stimmkreisbüro Judith Gerlach<br />
Bayerns Gesundheitsministerin<br />
Judith Gerlach fordert eine MDR-<br />
Anpassung.<br />
zu Nischenprodukten sowie die Abschaffung der Rezertifizierungs-Regelung.<br />
Auch die EU-Kommission zeigte sich in<br />
der Diskussion aufgeschlossen. „Die EP-Debatte zeigt überdeutlich<br />
die Erkenntnis der Parlamentarier:innen, dass<br />
die MDR über das Ziel hinausgeschossen ist und dringend<br />
nachgebessert werden muss. Auch die Unterstützung des<br />
Vorschlags, die Rezertifizierung von Bestandsprodukten<br />
abzuschaffen, ist ein gutes Signal. Nach den EP-Wahlen im<br />
Juni müssen die Lösungen so schnell wie möglich vorangetrieben<br />
werden“, kommentiert BVMed-Geschäftsführer<br />
und Vorstandsmitglied Dr. Marc-Pierre Möll die Entwicklung,<br />
die eine neuerliche Anpassung der MDR wahrscheinlich<br />
macht.<br />
Welche Folgen eine Beibehaltung des Status-Quo haben<br />
wird, das skizzierte Judith Gerlach: „Die EU-Medizinprodukte-Verordnung<br />
hat als Ziel, Patienten besser zu schützen.<br />
Das unterstützen wir selbstverständlich. Dieses Ziel<br />
kann jedoch nicht erreicht werden, wenn die Versorgungssicherheit<br />
mit lebenswichtigen Medizinprodukten nicht<br />
mehr gewährleistet ist. Im schlimmsten Fall werden wegen<br />
Überregulierungen Produkte nur noch außerhalb der Europäischen<br />
Union entwickelt und produziert. Hier besteht<br />
dringender Handlungsbedarf. Über die Hälfte der gesamten<br />
europäischen MedTech-Entwicklung und -Produktion<br />
findet in Süddeutschland statt – und wir in Bayern wollen,<br />
dass das so bleibt!“<br />
8<br />
ORTHOPÄDIE TECHNIK <strong>05</strong>/24
Gemeinsam<br />
im medialog<br />
Wir freunen uns auf<br />
Ihren Besuch!<br />
OTWorld,<br />
14. – 17. Mai <strong>2024</strong><br />
Halle 1, Stand D20/E21<br />
www.medi.de<br />
medi. ich fühl mich besser.
Info<br />
Mit dem Hero Arm hat Sebastian Hannen,<br />
Bereichsleitung Produktion bei<br />
Fuchs & Möller, die passende Versorgung<br />
für Niklas gefunden.<br />
Fotos [2]: Fuchs & Möller<br />
Armprothese aus dem 3D-Drucker:<br />
Hero Arm besticht durch Leichtigkeit<br />
Ihre Gliedmaßen befinden sich noch im Wachstum. Die<br />
Kraft ist noch gering. Für Kinder wie den achtjährigen<br />
Niklas, der mit einer Fehlbildung des rechten Unterarms<br />
auf die Welt kam, gestaltet sich die Suche nach einer<br />
passenden Armprothese oft schwierig. Im Herbst 2023<br />
zeigte sie Erfolg. Der „Hero Arm“ des Hilfsmittelherstellers<br />
Open Bionics, eine 3D-gedruckte myoelektrische<br />
Prothese mit einer multiartikulierenden bionischen<br />
Hand, hat genau das, was Niklas braucht: ein geringes<br />
Gewicht, ein auffälliges Design und eher wenige, aber<br />
für ihn elementare Funktionen. Im Gespräch mit der OT-<br />
Redaktion erzählt Orthopädietechnik-Meister Sebastian<br />
Hannen, Sanitätshaus Fuchs & Möller, wie er auf das System<br />
aufmerksam wurde, welche Vorteile es bietet und<br />
warum eine Versorgung mit weniger Funktionen manchmal<br />
mehr ist.<br />
OT: Im Februar 2022 sagten Sie im Interview mit meiner<br />
Kollegin, dass es häufig individueller Lösungen bedarf, da die<br />
Passteilvarianten, die der Markt bietet, für Kinderversorgungen<br />
häufig zu groß, zu schwer oder funktionell ungeeignet sind.<br />
Wie hat sich der Markt im Bereich Armprothetik seitdem entwickelt?<br />
Sebastian Hannen: Bereits nach meiner Ausbildung an der<br />
Orthopädischen Universitätsklinik Heidelberg 2001 bin<br />
ich in den Bereich Armprothetik eingestiegen und führe<br />
das bis heute fort. Als Produktionsleitung bei Fuchs & Möller<br />
weiß ich, worauf es bei Kinderversorgungen ankommt.<br />
Bis heute hat sich mit Blick auf die Kinderhände der Firma<br />
Ottobock – abgesehen von kleinen Modifikationen – wenig<br />
verändert. Diese Systemhände haben eine kleine Grifföffnung,<br />
das heißt, selbst wenn das Kind die Hand öffnen und<br />
schließen kann, kann es einen Becher nicht halten. Auch<br />
die Geschwindigkeit, in der sich die Hand öffnet, ist für<br />
viele zu gering. Nach solchen Enttäuschungen besteht die<br />
Gefahr, dass die Kinder die Lust verlieren, die Prothese zu<br />
tragen. Später kam dann die Prothesenhand der Firma Vincent<br />
Systems, die Vincent Young, auf den Markt – vermutlich<br />
das beste System, das es mit Blick auf die Funktionen<br />
aktuell gibt. Die Hand ist meiner Meinung nach aber erst<br />
für Kinder ab neun Jahren geeignet. Sie ist etwas schwerer<br />
und es kann manchmal schwierig sein, die passende Größe<br />
für unsere kleineren Anwender zu finden. Darüber hinaus<br />
gibt es Passivhände, mittlerweile auch mit beweglichen<br />
Lösungen. Letztendlich bleiben es aber Habitusprothesen.<br />
Die Anwender können die Finger zwar bewegen, aber nicht<br />
10<br />
ORTHOPÄDIE TECHNIK <strong>05</strong>/24
Info<br />
aktiv steuern. Wir standen deswegen immer vor der Frage:<br />
Wie können wir den Übergang gestalten, also die Zeit bis<br />
zum Jugendalter überbrücken?<br />
OT: Kann der Hero Arm diese Lücke schließen?<br />
Hannen: Ja. Er hat viele Vorteile. Man muss bedenken:<br />
Bei Prothesen sitzt das Hauptgewicht am Ende. Das bringt<br />
schlechte Hebelverhältnisse mit sich. Für die Kinder ist<br />
es deswegen sehr anstrengend, eine Prothese den ganzen<br />
Tag über zu tragen und zu benutzen. Auch die Stumpflänge<br />
und die Hautverhältnisse können eine Versorgung erschweren.<br />
Statt Titan, schwerem Stahl oder Aluminium<br />
kommt beim Hero Arm Kunststoff zum Einsatz. Daher ist<br />
er deutlich leichter. Wir können damit Kinder bereits ab<br />
sieben Jahren versorgen. Trotzdem ist das System nicht<br />
besonders komplex. Den Kindern stehen „nur“ sechs verschiedene<br />
Griffe zur Verfügung, aber aus meiner Sicht<br />
reicht das völlig aus. Kinder brauchen keine Hightech-<br />
Hand. Sie brauchen eine Hand, mit der sie zwei oder drei<br />
Griffe machen können, eine Hand, die schnell reagiert,<br />
robust ist und vor allem leicht. All das bildet das System<br />
von Open Bionics ab. Ich würde mir wünschen, dass auch<br />
andere Hersteller von der Hightech-Variante zurückgehen<br />
und stattdessen auf das setzen, was wirklich gebraucht<br />
wird. Der Hero Arm ist zudem nicht nur für Kinder geeignet,<br />
auch Jugendliche und Erwachsene können von der<br />
Prothese profitieren, je nachdem, wo der Fokus in der Versorgung<br />
liegt.<br />
OT: Wie steht es um die Versorgung der Kleinsten, also um<br />
Kinder, die jünger als sieben Jahre alt sind?<br />
Hannen: Aktuell gibt es nur die Kinderhände von Ottobock<br />
und Habitusprothesen.<br />
OT: Woran liegt es, dass es so wenig Auswahl gibt?<br />
Hannen: Ich glaube, es liegt nicht daran, dass die Hersteller<br />
nicht wollen, sondern dass sie es – noch – nicht können.<br />
Es braucht kleine Sensoren, kleine Motoren und kleine Verkabelungen:<br />
Es ist unheimlich schwierig, all das im Miniformat<br />
herzustellen. Ich bin mir aber sicher, dass der 3D-<br />
Druck neue Möglichkeiten eröffnen wird.<br />
OT: Auch der Hero Arm wird per 3D-Druck hergestellt. Ist das<br />
Verfahren die Zukunft?<br />
Hannen: Ich denke, die additiven Herstellungsverfahren<br />
bieten uns neue Möglichkeiten und ergänzen unsere bisherigen<br />
Tätigkeiten. Beim Hero Arm sind wir für den Schaft<br />
zuständig, wir ermitteln die Elektrodenpunkte, sorgen für<br />
eine optimale Passform und Zuschnitt und übertragen die<br />
digitalen Daten an den Hersteller. Den restlichen Aufbau<br />
des Unterarms sowie die Installation der Elektrik übernimmt<br />
die Firma Open Bionics. Der 3D-Druck ermöglicht<br />
uns hierbei Konstruktionen, die wir händisch nicht hätten<br />
fertigen können. Dazu gehört auch der Schaft, der sich wie<br />
eine Ziehharmonika öffnen und schließen lässt, und sich<br />
somit im Umfang anpassen lässt.<br />
OT: Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit der<br />
Hero Arm zum Einsatz kommen kann?<br />
Hannen: Der Stumpf muss – vom Ellenbogen bis Stumpfende<br />
– mindestens acht Zentimeter lang sein. Zudem müssen<br />
ausreichend myoelektrische Signale vorhanden sein.<br />
Ein Signal reicht aber tatsächlich schon aus, um die Pro these<br />
zu steuern. Die Hautverhältnisse und ebenso die kognitiven<br />
Fähigkeiten müssen auch eine Versorgung zulassen.<br />
Prothese für den Alltag<br />
Greifen, heben,<br />
halten: Die Prothese<br />
unterstützt Niklas<br />
im Alltag bei zahlreichen<br />
Tätigkeiten.<br />
OT: Wie wurde Niklas versorgt, bevor er den Hero Arm erhalten<br />
hat?<br />
Hannen: Mit einem Kinderhandsystem von Ottobock.<br />
Hätten wir den Hero Arm nicht als Alternative gefunden,<br />
hätte er sich wahrscheinlich gegen eine erneute Versorgung<br />
aufgrund der technischen Defizite und des hohen<br />
Gewichtes entschieden.<br />
OT: Wie sind Sie auf die Prothese aufmerksam geworden?<br />
Hannen: Die Firma Open Bionics hatte mich noch vor<br />
Markteinführung angesprochen und gefragt, was ich von<br />
dem Produkt halte und was ich verändern würde. Ich dachte<br />
dabei gleich an Niklas und daran, ob der Hero Arm vielleicht<br />
die Lösung sein könnte. Er ist deutlich leichter, hat<br />
eine größere Griffkraft und Griffgeschwindigkeit. Damit<br />
können wir alles abbilden, was Niklas wollte. Normalerweise<br />
richten wir uns nach dem Qualitätsstandard des Vereins<br />
zur Qualitätssicherung in der Armprothetik (VQSA).<br />
Dieser schreibt einen Schaft mit HTV-Silikon vor. Das bietet<br />
einen guten Komfort und eine gute Compliance bei den<br />
Patienten. Ich habe mich dann aber entschieden, das System<br />
so auszuprobieren, wie es der Hersteller anbietet, also<br />
ohne Silikon. Der Schaft ist wie eine Art Ziehharmonika gestaltet.<br />
Er kann durch einen Bohrverschluss etwas größer<br />
und kleiner gemacht werden. Wir haben festgestellt, dass<br />
die Luftzirkulation dadurch deutlich besser ist.<br />
ORTHOPÄDIE TECHNIK <strong>05</strong>/24<br />
11
Info<br />
Fotos [2]: Fuchs & Möller<br />
Bevor Niklas den Hero Arm bekam,<br />
wurde er mit einer Habitusprothese<br />
versorgt, später dann mit einem Kinderhandsystem<br />
von Ottobock.<br />
OT: Wie zufrieden ist Niklas mit dem<br />
Ergebnis?<br />
Hannen: Niklas ist das erste Kind, das in<br />
Deutsch land mit dem Hero Arm versorgt wurde. Er trägt<br />
ihn jetzt bereits seit ein paar Monaten und ist sehr zufrieden.<br />
Er benutzt die Prothese für sämtliche Tätigkeiten in<br />
der Schule und um im Haushalt und Garten mitzuhelfen.<br />
Auch beim Fahrradfahren trägt er sie, weil er beide Hände<br />
braucht, um sicher steuern zu können. Er schwitzt jetzt<br />
deutlich weniger und das Gewicht macht ihm – trotz seines<br />
kurzen Unterarmstumpfes – keine Probleme. Auch das Design<br />
kommt sehr gut an.<br />
OT: Wie genau sieht seine Prothese aus?<br />
Hannen: Mir persönlich gefällt die Prothese durch die Gitterstruktur<br />
auch ohne Cover optisch sehr gut. Außerdem<br />
wirkt sie dadurch nicht so klobig. Gerade für Kinder ist es<br />
aber toll, dass es andere Möglichkeiten gibt. Niklas hat sich<br />
für eine Variante entschieden, die an den Marvel-Superhelden<br />
„Black Panther“ angelehnt ist. Tatsächlich wünschen<br />
sich die meisten unserer jungen Patienten bunte und auffällige<br />
Designs. Und das machen wir gerne möglich. Denn<br />
klar ist: Je mehr sich der Patient mit der Prothese identifiziert,<br />
desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass er sie<br />
auch trägt. Niklas tut das mit Stolz. Wenn man bedenkt,<br />
dass er zuvor in der Schule gehänselt wurde, ist die Optik<br />
umso wichtiger. Seine Mutter hat mir zurückgemeldet,<br />
dass die Mitschüler den Arm toll finden. Zum ersten Mal<br />
steht Niklas jetzt im Mittelpunkt – und zwar positiv.<br />
OT: Funktion oder Optik: Was steht für Ihre Patient:innen im<br />
Fokus?<br />
Hannen: In erster Linie ist eine Armprothese ein Werkzeug.<br />
Ich habe Patienten, die ihre Prothese nur für bestimmte<br />
Tätigkeiten anziehen. Das kann täglich auch nur eine Stunde<br />
sein. Aber für diese eine Stunde brauchen sie die Prothese,<br />
weil es eben keine andere Möglichkeit gibt, diese Tätigkeiten<br />
auszuführen. Und dann gibt es Patienten, die ihre<br />
Prothese den ganzen Tag von morgens bis abends tragen.<br />
Vielen Kunden ist es wichtig, dass sie durch die Prothese<br />
optisch an die Gesellschaft angeglichen sind. Für jeden<br />
steht etwas anderes im Fokus.<br />
Knallbunt statt hautfarben<br />
OT: Braucht in erster Linie tatsächlich Niklas die Prothese oder<br />
braucht sie vielmehr die Gesellschaft?<br />
Hannen: Niklas ist ohne Unterarm auf die Welt gekommen.<br />
Er kennt es nicht anders und ist sehr geschickt. Kinder<br />
können viel ausgleichen. Aber sie haben eben auch weniger<br />
Tätigkeiten auszuführen als Erwachsene. Ist die Selbstständigkeit<br />
als Kind noch deutlich reduziert, wird sie im Jugend-<br />
und Erwachsenenalter immer mehr gefordert. Man<br />
muss vorsichtig sein: Durch die Kompensationsbewegungen<br />
kommt es zu einem vermehrten Übergreifen mit der<br />
gesunden Hand, die Kinder müssen sich mehr verdrehen.<br />
Das wirkt sich auf den gesamten Bewegungsapparat aus und<br />
kann auch zu einer Überlastung der gesunden Hand führen.<br />
Ich sehe häufig – wie auch bei Niklas –, dass Menschen<br />
mit Behinderungen ausgegrenzt werden. Es muss sich etwas<br />
in der Gesellschaft ändern. Sie muss offener und hilfsbereiter<br />
werden. Zu mir kam mal eine ältere Dame, die zur<br />
12<br />
ORTHOPÄDIE TECHNIK <strong>05</strong>/24
Info<br />
Sicherheit einen Rollator bekommen sollte und ihre größte<br />
Sorge war: Was sollen die Nachbarn denken?<br />
Es gibt aber auch andere Beispiele, die zeigen, dass sich<br />
sehr wohl etwas tut. Früher sollten Prothesen immer hautfarben<br />
sein und möglichst wenig auffallen. Heute wollen<br />
viele Patienten keine Kosmetik haben und wenn, dann<br />
eine knallbunte. Sie sagen: Ich stehe dazu. Und jeder soll<br />
das sehen.<br />
Was man außerdem nicht aus den Augen verlieren sollte:<br />
Manchmal ist es für die Eltern wichtiger, dass ihr Kind<br />
eine Prothese bekommt, als für das Kind selbst. Oft fließen<br />
die Tränen, wenn sie ihr Kind mit Prothese sehen. Zum<br />
ersten Mal ist ihr Kind „komplett“. Das berührt, zeigt aber<br />
auch, dass man von Anfang an aufklären und deutlich machen<br />
muss, dass es darum geht, was das Kind möchte.<br />
OT: Wie gehen Sie dabei vor? Wie gelingt es Ihnen, die Eltern<br />
zu erreichen?<br />
Hannen: Ich bin ein Freund von offener und ehrlicher<br />
Kommunikation und versuche, die Gespräche mit Ruhe zu<br />
führen. Ich sage in jedem Beratungsgespräch, dass es nicht<br />
darum geht, dass das Kind die Prothese jeden Tag stundenlang<br />
trägt. Es reicht, wenn es sie für bestimmte Tätigkeiten<br />
nutzt. Eltern sollten keinen Druck machen, sondern unterstützen.<br />
Die Kinder müssen den Mehrwert selbst erkennen<br />
und das gelingt am besten spielerisch. Manche Eltern stecken<br />
die Ziele viel zu hoch, gehen davon aus, dass die Prothese<br />
eine gesunde Hand mit all ihren Funktionen ersetzen<br />
kann. Deswegen finde ich es wichtig, von Anfang an aufzuzeigen,<br />
was möglich ist und was nicht. Wir können viel,<br />
die Technik kann viel, aber nicht alles.<br />
Ergo- und physiotherapeutische<br />
Begleitung<br />
OT: Mit einer Prothese gut umgehen zu können, erfordert auch<br />
Übung. Wie kam Niklas bei der ersten Anprobe zurecht?<br />
Hannen: Das ging schnell. Niklas hat nicht mal eine Stunde<br />
gebraucht, um die Prothese komplett bedienen zu können.<br />
Ich finde es wichtig – und zwar bei allen armprothetischen<br />
Versorgungen –, dass insbesondere Kinder ergo- und<br />
physiotherapeutisch begleitet werden. Physiotherapeuten<br />
sollten von Anfang an darauf achten, dass die Kinder die<br />
richtige Haltung einnehmen. Ansonsten entstehen Fehler,<br />
wie bei einem schlechten Gangbild auch, die man nur<br />
schwer wieder beheben kann. Ergotherapeuten haben die<br />
Aufgabe, die Übungen mit der Prothese spielerisch zu gestalten.<br />
Wir Orthopädietechniker sind während dieses Prozesses<br />
auch gefordert, da die Prothese immer wieder passend<br />
eingestellt werden muss. Am Anfang stellt man die<br />
Elektroden relativ großzügig ein, damit die Bewegungen<br />
recht schnell verstanden und ausgeführt werden können.<br />
Der Nachteil ist aber, dass es dadurch ungewollt zu Fehlsteuerungen<br />
kommen kann. Der Muskel gibt bereits bei<br />
kleiner Anspannung ein Signal und die Prothese führt eine<br />
ungewollte Bewegung aus. Unsere Aufgabe ist es, die Elektroden<br />
immer wieder zu justieren und somit ein gezieltes<br />
Greifen bzw. Ansteuern zu ermöglichen. Bei Open Bionics<br />
lassen sich solche Einstellungen über eine App vornehmen,<br />
bei anderen Handsystemen funktioniert das über die Steuerungsprogramme<br />
am Laptop sowie an der Elektrode.<br />
OT: Hat die Krankenkasse die Kosten problemlos übernommen?<br />
Hannen: Ich hatte als erstes die Vincent-Young-Hand eingereicht,<br />
weil ich zu diesem Zeitpunkt den Hero Arm noch<br />
nicht kannte. Weil sie Niklas besser gefiel, habe ich dann einen<br />
zweiten Vorschlag gemacht, die Versorgung aber nicht<br />
direkt eingereicht. Ich habe erst mit den Mitarbeitern der<br />
Krankenkasse gesprochen, weil ich wusste, dass ihnen das<br />
Produkt nicht bekannt ist. Ich habe die Funktionen und<br />
Vorteile erläutert und auch den Hersteller darum gebeten,<br />
in Kontakt mit der Krankenkasse zu treten. Probleme gab es<br />
bei der Übernahme dadurch nicht. Die Versorgung wurde<br />
direkt genehmigt.<br />
Back to basics<br />
OT: Die Frage ist ja immer: Was wünscht sich der Patient<br />
bzw. die Patientin? Viele Funktionen oder doch eher ein geringes<br />
Gewicht und eine schnelle Reaktionsgeschwindigkeit?<br />
Ist es denkbar, dass all die Vorteile der aktuell auf dem Markt<br />
erhältlichen Systeme künftig kombiniert werden?<br />
Hannen: Mit Sicherheit. Eine meiner ersten Fragen an Open<br />
Bionics war, ob ich die Komponenten des Systems einzeln<br />
bekommen kann. Denn dann würde genau das passieren,<br />
was Sie ansprechen. Ich könnte die Einzelteile mit anderen<br />
kombinieren. Anscheinend bin ich nicht der einzige Orthopädietechniker,<br />
der danach gefragt hat. Open Bionics<br />
arbeitet daran, diese Option möglich zu machen. Und bestimmt<br />
wird auch der eine oder andere Hersteller auf die<br />
Idee aufmerksam und setzt statt schwerem Titan, Stahl<br />
oder Aluminium auf 3D-druckbaren leichten Kunststoff.<br />
OT: Zwei Jahre sind seit dem letzten Interview vergangen.<br />
Wenn wir uns in zwei Jahren wieder treffen, was hoffen Sie<br />
dann berichten zu können?<br />
Hannen: Ich hoffe, dass es dann deutlich mehr Optionen<br />
für unsere Kleinsten gibt. Und ich hoffe, dass sich viele Hersteller<br />
wieder mehr auf die Basics konzentrieren anstatt auf<br />
Hightech-Prothesen. Ich würde mir außerdem wünschen,<br />
dass die Bürokratie abnimmt und dass die Krankenkassen<br />
uns die Möglichkeit bieten, nicht nur das, was im Hilfsmittelverzeichnis<br />
steht, abzubilden. Unser Beruf ist so vielseitig.<br />
Warum sollten wir uns durch einen Hilfsmittelkatalog einschränken<br />
lassen? Jeder Patient ist anders, es fällt mir schwer<br />
einem Kunden zu erklären, dass er keine Hobbys haben darf,<br />
nur weil eine Sportprothese nicht im Hilfsmittelverzeichnis<br />
aufgeführt ist. Wenn wir den Behinderungsausgleich tatsächlich<br />
schaffen wollen, müssen wir es richtig angehen.<br />
Die Fragen stellte Pia Engelbrecht.<br />
ORTHOPÄDIE TECHNIK <strong>05</strong>/24<br />
13
Info<br />
Das Team von Mocca health: (hinten v. l.)<br />
Anne Schmidt, Ivonne Diesing und Maren Diekmann<br />
sowie (vorne v. l.) Martina Kroll, Torben<br />
Naumann, Anna Hirsch und Anneke Wegner.<br />
Foto: Linda Meiers<br />
Mobiles Sanitätshaus holt Versorgung nach Hause<br />
Hausbesuche von Ärzt:innen, Fußpfleger:innen und<br />
Friseur:innen, Lieferdienste von Restaurants und Supermärkten<br />
– mittlerweile sind Services wie diese gang<br />
und gäbe. Da liegt der Gedanke nahe, auch die Versorgung<br />
mit Hilfsmitteln ins Haus zu holen. Als rein mobiles<br />
Sanitätshaus macht Mocca health genau das möglich:<br />
Das Team hat sich auf die Versorgung von flachgestrickten<br />
Kompressionsstrümpfen zur Ödemtherapie<br />
spezialisiert und versorgt die Kund:innen in ihren eigenen<br />
vier Wänden. Welche Vorteile das hat und wie die<br />
Mitarbeiter:innen die Arbeitsweise erleben, das erläutert<br />
Geschäftsführer Torben Naumann im Gespräch mit<br />
der OT-Redaktion.<br />
OT: Was hat Sie dazu inspiriert, Ihre Kund:innen zu Hause zu<br />
versorgen?<br />
Torben Naumann: Die Idee kam in der Tat von meiner<br />
Mutter. Sie hat sich schon vor mehr als zehn Jahren damit<br />
befasst, Kund:innen eine mobile Flachstrickversorgung<br />
in den eigenen vier Wänden anzubieten. Der Grundgedanke<br />
ist heute noch der gleiche. Wir fahren zu unseren<br />
Kund:innen nach Hause und ersparen ihnen dadurch lästige<br />
Wege und lange Wartezeiten. Als ich vor zwei Jahren<br />
zu meiner Mutter und meiner Schwester ins Team gestoßen<br />
bin, habe ich mich primär darauf fokussiert, eine neue Positionierung<br />
auszuarbeiten, Prozesse neu aufzusetzen beziehungsweise<br />
zu automatisieren und das Unternehmen digital<br />
auszurichten.<br />
OT: Wie läuft der Versorgungsprozess im Einzelnen ab?<br />
Naumann: Unsere Kund:innen melden sich bei uns entweder<br />
direkt per Telefon oder über unsere Website. Eine Expertin<br />
aus der entsprechenden Region setzt sich dann mit<br />
ihnen in Verbindung und vereinbart einen Termin zur Beratung<br />
und Vermessung. Im Anschluss kümmern wir uns<br />
um die Genehmigung der Krankenkassen sowie gemeinsam<br />
mit unseren Kund:innen um etwaige Widersprüche.<br />
Sobald wir die Kompressionsware erhalten haben, vereinbaren<br />
wir eine finale Anprobe, um sicherzustellen, dass die<br />
Versorgung optimal sitzt.<br />
OT: Welche Vorteile bietet die mobile Versorgung gegenüber<br />
einem stationären Sanitätshaus?<br />
Naumann: Durch unser mobiles Angebot können wir<br />
sehr flexibel auf die Bedürfnisse unserer Kund:innen eingehen.<br />
Das betrifft zum einen den zeitlichen Faktor, weil<br />
wir uns nach den Terminen und Verfügbarkeiten unserer<br />
Kund:innen richten und keine fixen Ladenöffnungszeiten<br />
haben. Das ist insbesondere für Berufstätige sehr<br />
praktisch. Zum anderen sind wir örtlich eben komplett<br />
flexibel; wir beraten und vermessen unsere Kund:innen<br />
zu Hause in ihrem privaten „safe space“, in der Mittagspause<br />
bei der Arbeit oder in der Physio-Praxis nach der<br />
Lymphdrainage. Die Krankheitsbilder Lip- und Lymphödem<br />
sind nach wie vor stigmatisiert, das führt bei Betroffenen<br />
oft nicht nur zu Scham, sondern macht die Behandlung<br />
auch zu einem sehr sensiblen und persönlichen Thema.<br />
Darauf gehen wir mit unserem mobilen Service ein<br />
und schaffen ein vertrautes und sicheres Umfeld für unsere<br />
Kund:innen.<br />
OT: Ein stationäres Sanitätshaus können Patient:innen auch<br />
spontan zu den Öffnungszeiten aufsuchen. Wie flexibel sind<br />
Sie im Hinblick auf die Terminvereinbarung?<br />
Naumann: In der Regel sind Spontanbesuche bei Flachstrickversorgungen<br />
eher selten, daher lassen sich Versor-<br />
14<br />
ORTHOPÄDIE TECHNIK <strong>05</strong>/24
Info<br />
gungstermine sehr gut im Voraus planen. Dabei sind wir<br />
sehr flexibel und richten uns in erster Linie nach den Bedürfnissen<br />
unserer Kund:innen. Das heißt, wir arbeiten<br />
morgens, mittags, abends und auch mal am Wochenende,<br />
wenn es nicht anders passt.<br />
OT: Welche Ansprüche stellt der Service an die<br />
Mitarbeiter:innen?<br />
Naumann: Unsere Mitarbeiter:innen müssen sehr eigenständig<br />
arbeiten können und in der Lage sein, sich selbst<br />
gut zu organisieren. Unser Konzept bringt viele Freiräume<br />
mit sich, aber im Umkehrschluss verlangt es von uns allen<br />
viel (Eigen-)Verantwortung. Aus fachlicher Sicht sind<br />
un sere Expert:innen bestens geschult und werden laufend<br />
weitergebildet, um sicherzustellen, dass wir alle Versorgungsarten<br />
und Herstellermodelle mit unserem hohen<br />
Qualitätsanspruch anbieten können.<br />
OT: Was schätzen die Mitarbeiter:innen an dem Konzept?<br />
Welche Versorgung soll es sein? Geschäftsführer<br />
Torben Naumann und seine Schwester Maren Diekmann,<br />
fachliche Leitung, diskutieren die Optionen.<br />
Foto: Siegbert Dierke<br />
Naumann: Unsere Mitarbeiter:innen schätzen es sehr, dass<br />
wir so frei arbeiten können. Neben dem, was wir machen,<br />
ist es uns ganz wichtig, wie wir es machen. Unser Arbeitsumfeld<br />
ist sehr zeitgemäß und geht dabei auf die Bedürfnisse<br />
unserer Mitarbeiter:innen ein. Darüber hinaus schätzen<br />
sie die Nähe zu unseren Kund:innen. Unsere Expert:innen<br />
fungieren als direkte Ansprechpersonen und begleiten unsere<br />
Kund:innen in allen Belangen von A bis Z aus einer<br />
Hand. Das schafft eine sehr enge Bindung.<br />
OT: Gibt es etwas, was Ihre Mitarbeiter:innen vermissen?<br />
Naumann: Durch unsere Aufstellung ist es natürlich<br />
so, dass man nicht mal eben einen Kaffee mit seinen<br />
Kolleg:innen in der Küche trinken kann – dafür muss man<br />
sich dann schon abstimmen und „irgendwo in der Mitte“<br />
treffen. Ab und zu fehlt das, aber die Vorteile unserer Arbeitsweise<br />
wiegen das auf jeden Fall auf.<br />
OT: Mocca health versteht sich als rein mobiles Sanitätshaus.<br />
Gibt es dennoch einen zentralen Ort, an dem die<br />
Mitarbeiter:innen zusammenkommen? Hat das Auswirkungen<br />
auf das soziale Miteinander?<br />
Naumann: Es gibt in der Tat eine zentrale Geschäftsadresse,<br />
allerdings kommen unsere Mitarbeiter:innen hier nicht<br />
zusammen. Wir sind über den Außendienst bewusst dezentral<br />
organisiert, um unseren Service flächendeckend anbieten<br />
zu können. Das soziale Miteinander ist sicherlich eine<br />
Herausforderung, die unsere Arbeitsweise mit sich bringt,<br />
der wir uns aber alle von Anfang an bewusst sind. Wir<br />
haben jede Woche ein virtuelles Team-Meeting und individuelle<br />
Check-In-Gespräche mit allen Mitarbeiter:innen.<br />
Alle zwei bis drei Monate kommen wir aber auch als Team<br />
für Fortbildungen und (interne) Schulungen zusammen.<br />
Aus unserer Sicht funktioniert das sehr gut und es kommt<br />
uns nicht so vor, dass wir uns de facto nicht so häufig in<br />
Person sehen.<br />
OT: Welche Anforderungen stellt der Service an den Betrieb und<br />
an Sie als Geschäftsführer?<br />
Naumann: Meine Aufgabe ist es in erster Linie, die Rahmenbedingungen<br />
für unser Team sicherzustellen. Das<br />
heißt, ich muss dafür sorgen, dass alle Mitarbeiter:innen<br />
die Werkzeuge an die Hand bekommen, die sie benötigen,<br />
um unsere Kund:innen optimal zu versorgen – das umfasst<br />
natürlich die notwendige Grundausstattung wie Pkw und<br />
Hardware. Darüber hinaus gehören zu den Werkzeugen<br />
aber auch Fortbildungen und Schulungen, die sowohl auf<br />
das Fachliche als auch auf die Soft-Skills ausgerichtet sind.<br />
Abgesehen von diesen „direkten“ Anforderungen sehe<br />
ich es als meine Aufgabe, das Unternehmen zukunftsorientiert<br />
auszurichten und unsere Prozesse stetig zu optimieren.<br />
Wir wollen die Digitalisierung im Gesundheitswesen<br />
aktiv mitgestalten und sind dementsprechend aufgestellt.<br />
OT: Wie kommt das Konzept bei den Kund:innen an?<br />
Naumann: Das Feedback ist bisher durchweg positiv. Sie<br />
schätzen unseren flexiblen Service und die Nähe zu unseren<br />
Expert:innen sehr. Rund zwei Drittel von uns sind<br />
selbst von einem Lip- oder Lymphödem betroffen, daher<br />
wissen wir genau, wovon wir sprechen und kommunizieren<br />
auf Augenhöhe. Das ist nicht nur authentisch, sondern<br />
kommt auch sehr gut bei unseren Kund:innen an.<br />
OT: Abgesehen von der Option mobiles oder stationäres Sanitätshaus<br />
– wo sehen Sie Schwachstellen in der Versorgung von<br />
Patient:innen mit Lip- und Lymphödemen?<br />
Naumann: Aus unserer Erfahrung ist die Ödemversorgung<br />
oftmals eine Odyssee für die Betroffenen. Das fängt häufig<br />
schon bei fehlenden oder falschen Diagnosen an – insbesondere<br />
bei Lipödemen. Dadurch werden Betroffene<br />
letztlich auch häufig falsch oder gar nicht versorgt. Wenn<br />
sie dann eine Diagnose bekommen haben, geht die Suche<br />
nach einem geeigneten Versorger in ihrer Nähe los. Hier<br />
gibt es ebenfalls oft Schwachstellen in der Qualität und in<br />
der Abwicklungsgeschwindigkeit der Versorger.<br />
Die Fragen stellte Pia Engelbrecht.<br />
ORTHOPÄDIE TECHNIK <strong>05</strong>/24<br />
15
Info<br />
Rehabilitation nach Kreuzbandriss:<br />
Kniebandage zeigt positive Effekte<br />
Grafik: Bauerfeind<br />
Jung, aktiv und dann ein Kreuzbandriss. Sportler:innen<br />
wollen nach einer Rekonstruktion des vorderen Kreuzbandes<br />
(VKB) wieder schnell ihr Training aufnehmen.<br />
Während der Rehabilitation können Hilfsmittel den Prozess<br />
erleichtern. Welchen Einfluss haben Kniebandagen<br />
bei verbliebenen funktionellen Defiziten? Das hat Physiotherapeutin<br />
Prof. Gisela Sole, tätig an der Universität<br />
von Otago (Neuseeland), anhand der „Genutrain“ von<br />
Bauerfeind untersucht. Im Gespräch mit der OT-Redaktion<br />
stellt sie die zentralen Ergebnisse der Studie vor.<br />
OT: Eine Operation ist nach einem Kreuzbandriss erst der<br />
Anfang. Welche Rolle spielt die Rehabilitation für das langfristige<br />
Ergebnis einer Kreuzbandrekonstruktion?<br />
Gisela Sole: Das Ziel der Rekonstruktion des vorderen<br />
Kreuzbandes ist die Wiederherstellung der anatomischen<br />
Stabilität des Kniegelenks. Die Operation allein vermindert<br />
weder die Hemmung und Schwäche der Oberschenkelmuskulatur<br />
nach der Ruptur noch das Risiko einer langfristigen<br />
posttraumatischen Kniearthrose. Nach einer VKB-Ruptur<br />
und -Rekonstruktion haben die Betroffenen oft lange Zeit<br />
Angst vor einer erneuten Verletzung, was angesichts der hohen<br />
Rate sowohl am ipsilateralen als auch am kontralateralen<br />
Knie realistisch ist. Eine Studie von Noyes und Barber-<br />
Westin zeigte, dass statistisch gesehen bis zu einer von fünf<br />
Sportlern, die nach einer VKB-Rekonstruktion wieder Sport<br />
treiben, sich erneut am Knie verletzt. Vermeidung aufgrund<br />
von Angst kann zu verminderter körperlicher Aktivität und<br />
damit zu erhöhtem Körpergewicht und Adipositas führen,<br />
was das Risiko einer Arthrose erhöht. Rehabilitation ist notwendig,<br />
um die neuromuskuläre Kontrolle und Kraft der<br />
Oberschenkelmuskulatur des Knies und der gesamten kinetischen<br />
Kette zu verbessern und das Selbstvertrauen zu stärken<br />
und schafft die Voraussetzung für die Wiederaufnahme<br />
Einbeiniger Distanzsprung (Horizontal Jump), Akuteffekt<br />
Können Patient:innen<br />
nach einer Kreuzband<br />
Rekonstruktion vom<br />
Tragen einer Bandage<br />
profitieren? Dieser Frage<br />
ging Prof. Gisela Sole<br />
auf den Grund.<br />
von Sport und Arbeit. Eine langfristige Förderung der körperlichen<br />
Aktivität ist notwendig, um die Gesundheit des<br />
Kniegelenks und des gesamten Körpers zu optimieren.<br />
OT: Welche Komponenten sind für eine erfolgreiche Rehabilitation<br />
entscheidend? An welchem Punkt kommen Hilfsmittel<br />
wie Bandagen ins Spiel?<br />
Sole: Die Definition von Erfolg im Zusammenhang mit der<br />
Rehabilitation ist schwierig, da sich die Ziele oder Erfolgsindikatoren<br />
des Einzelnen im Laufe der Zeit ändern können.<br />
Solche Veränderungen können auf Veränderungen der Lebensumstände<br />
zurückzuführen sein, etwa Veränderungen<br />
der beruflichen oder familiären Rolle, aber auch darauf, ob<br />
die betroffene Person wieder Sport treiben oder ihre sportlichen<br />
Aktivitäten auf dem Niveau von vor der Verletzung<br />
fortsetzen möchte oder nicht. Unabhängig von solchen<br />
Veränderungen erfordert die Rehabilitation einen multimodalen,<br />
individuellen Ansatz. Ein kürzlich veröffentlichter<br />
Expertenbericht von Kotsifaki et al. enthält evidenzbasierte<br />
Leit linien, die eine Stärkung der Oberschenkelmuskulatur<br />
durch Übungen in offener und geschlossener kinetischer<br />
Kette, plyometrisches Training und Beweglichkeitstraining<br />
beinhalten, die für den individuellen Kontext der<br />
Person relevant sind. Während in der Akutphase nach einer<br />
VKB-Rekonstruktion eine Orthese eingesetzt wird, ist über<br />
den Einsatz von Kniebandagen weniger bekannt. In unserer<br />
früheren qualitativen Studie mit zehn Teilnehmern, die bis<br />
zu zehn Jahre nach der Rekonstruktion teilnahmen, berichteten<br />
einige, dass sie eine Orthese oder Bandage während<br />
des Trainings oder bei Aktivitäten, bei denen sie Angst vor<br />
einer Verletzung hatten, verwendeten. Es wurde über Erfahrungen<br />
berichtet, nach denen eine solche Bandage in jeder<br />
Phase der Rehabilitation und auch längerfristig verwendet<br />
wurde, wenn sie dem Patienten half, körperlich aktiv zu<br />
bleiben.<br />
OT: Um die Wirksamkeit von Bandagen zu untersuchen, haben<br />
Sie eine Studie im postoperativen Setting mit der Genutrain<br />
durchgeführt. Welche Fragestellungen lagen der Studie zugrunde?<br />
Sole: Das Hauptziel der Studie war die Bestimmung der<br />
Akuteffekte der Genutrain-Kniebandage unmittelbar nach<br />
dem Anlegen sowie der Auswirkungen nach sechs Wochen<br />
Tragedauer auf die von den Teilnehmern berichteten Ergebnisse,<br />
die Funktion sowie die Kinematik und Kinetik<br />
des Kniegelenks während des Step-Down-Springens. Die<br />
Teilnehmer waren Patienten, deren VKB-Rekonstruktion<br />
Foto: University of Otago<br />
16<br />
ORTHOPÄDIE TECHNIK <strong>05</strong>/24
Info<br />
zwischen sechs Monaten und fünf Jahren zurücklag und<br />
die noch nicht wieder zu ihrem normalen Niveau körperlicher<br />
Aktivitäten zurückgekehrt waren.<br />
Die primäre Fragestellung war, ob das Tragen der Bandage<br />
die maximale einbeinige Sprungweite beeinflusst,<br />
alle anderen Variablen waren sekundäre Fragestellungen.<br />
Eine weitere sekundäre Analyse wurde hinzugefügt, um<br />
festzustellen, ob das Tragen der Bandage die Bodenreaktionskräfte<br />
und die Kraft des Knies während des Step-<br />
Down-Sprungs beeinflusst.<br />
Die Studie bestand aus zwei Teilen, wobei erstens die Akuteffekte<br />
in einem laborbasierten Crossover-Design und zweitens<br />
die Sechs-Wochen-Effekte in einem randomisierten klinischen<br />
Design untersucht wurden. Da während der Covid-<br />
19-Phase die Teilnehmerzahl im zweiten Teil reduziert war,<br />
sind diese Ergebnisse mit Vorsicht zu interpretieren.<br />
OT: Zu welchen zentralen Ergebnissen hat die Studie geführt?<br />
Sole: Zu den unmittelbaren Effekten zählen folgende:<br />
Beim maximalen einbeinigen Distanzsprung (Horizontal<br />
Jump) mit der Genutrain um das verletzte Knie erhöhte<br />
sich die Sprungweite signifikant um 3,6 Prozent im Vergleich<br />
zum Sprung ohne Bandage. Beim Step-Down-Hop-<br />
Test verbesserte sich die Kniebeugung mit Kniebandage<br />
um durchschnittlich 3 Grad, was eine Verbesserung darstellt.<br />
Auch die Kniekraft verbesserte sich, insbesondere in<br />
den ersten 5 Prozent der Standphase nach Bodenkontakt,<br />
der Phase, in der Kreuzbandrisse am häufigsten wieder auf-<br />
treten. Nach sechs Wochen waren die Teilnehmer, die eine<br />
Bandage trugen, nach eigenen Angaben aktiver als die Teilnehmer<br />
ohne Bandage. Sie hatten auch eine kürzere Dauer<br />
der Standphase beim Step-Down-Hop-Test, was auf eine<br />
schnellere Leistung hindeutet.<br />
OT: Wie erklären Sie sich die Effekte?<br />
Sole: Wie wir in unseren Veröffentlichungen dargelegt haben,<br />
ist es möglich, dass nach einer VKB-Verletzung beim<br />
Bodenkontakt ohne Bandage weniger Kontrolle über das<br />
Knie vorhanden ist und eine geringere Fähigkeit besteht,<br />
das erste Aufkommen zu absorbieren. Das Tragen einer<br />
Kniebandage könnte die neuromuskuläre Kontrolle oder<br />
das Bewusstsein für die Position und Bewegung des Knies<br />
verbessern. Wir spekulieren, dass das Tragen der Bandage<br />
die unterschwellige Angst vor einer erneuten Verletzung<br />
oder vor einer Bewegung verringern könnte, wodurch die<br />
muskuläre Sicherung durch den Quadrizeps abnehmen<br />
könnte. Das verbesserte Bewusstsein könnte zu einer besseren<br />
Absorption und Kontrolle bei Bodenkontakt führen,<br />
was sich in einer leicht erhöhten Kraft während der ersten<br />
fünf Prozent der Standphase äußert, während die Bandage<br />
getragen wird. Basierend auf unseren Ergebnissen spekulieren<br />
wir vorsichtig, dass die Bandage die sensomotorischen<br />
Mechanismen während der frühen exzentrischen<br />
(Absorptions-)Phase des Bodenkontakts verbessern könnte,<br />
was wiederum das Risiko einer VKB-Verletzung oder einer<br />
erneuten Verletzung verringern könnte.<br />
... Energie Effizienz zum Anfassen<br />
Schnelle Erwärmung aller Thermoplaste<br />
Maximale Energieeffizienz ohne Vorheizen<br />
Exakte Kontrolle der Materialtemperatur<br />
Halle 1-F22<br />
www.vacupress.de
Info<br />
OT: An der Studie haben Patient:innen teilgenommen, deren<br />
Operation zwischen sechs Monaten und fünf Jahren zurücklag.<br />
Hat die Länge des Zeitraums einen Einfluss auf die Wirkung<br />
der Genutrain-Bandage?<br />
Sole: In unserer Studie wurde nicht untersucht, ob es einen<br />
Zusammenhang zwischen der Zeit seit der Rekonstruk tion<br />
des vorderen Kreuzbandes und einer der Variablen gibt.<br />
Wir bräuchten eine viel größere Stichprobe, um einen solchen<br />
möglichen Zusammenhang zu untersuchen. Grobe<br />
Beobachtungen unserer Rohdaten deuten jedoch darauf<br />
hin, dass die Zeit seit der Operation keinen Einfluss auf die<br />
Ergebnisse hatte. Dies würde bedeuten, dass Personen mit<br />
einer VKB-Rekonstruktion eine Bandage als nützlich empfinden<br />
könnten, unabhängig davon, ob die Operation weniger<br />
als ein Jahr oder viel länger zurückliegt.<br />
OT: Gab es Dinge, die Sie überrascht haben?<br />
Sole: Ja, wir waren überrascht, dass sich der Kniebeugewinkel<br />
allein durch das Anlegen einer Bandage so schnell verändern<br />
kann. Beim Training von Personen mit VKB-Ruptur/-<br />
Rekonstruktion werden häufig Übungen zur Verbesserung<br />
der Kniebeugung durchgeführt, zum Beispiel die Anleitung,<br />
mit „weicheren Knien“ zu landen. Welling et al. fanden<br />
bei einer gemischten Gruppe von kniegesunden Männern<br />
und Frauen Unterschiede von durchschnittlich circa<br />
2 Grad bei einem beidbeinigen Sprung, wenn verschiedene<br />
Formen von verbalem Feedback gegeben wurden. Wir<br />
gaben unseren Probanden kein Feedback, sondern forderten<br />
sie auf, nach dem Aufsetzen auf der Kraftmessplatte „so<br />
schnell wie möglich“ nach vorne zu springen.<br />
OT: Welche Schlüsse ziehen Sie aus den Ergebnissen der Studie?<br />
Sole: Eine Kniebandage kann als Ergänzung zur Rehabilitation<br />
nützlich sein, um die Bewegungsmuster der Kniebeugung<br />
bei bestimmten Personen zu verbessern.<br />
Aktiver nach Kreuzbandriss:<br />
Dabei soll die Genutrain von<br />
Bauerfeind unterstützen.<br />
OT: Würden Sie mit Blick auf die Studienergebnisse empfehlen,<br />
dass die Versorgung mit einer Bandage zur Standardtherapie<br />
nach einer Kreuzbandrekonstruktion gehören sollte?<br />
Sole: Nein, wir haben keine Belege dafür, dass eine Kniebandage<br />
Teil der Standardrehabilitation nach einer vorderen<br />
Kreuzbandrekonstruktion sein sollte. Kliniker können<br />
jedoch mit ihren jeweiligen Patienten erörtern, ob eine<br />
solche Bandage für sie von Nutzen sein könnte, und ihre<br />
Entscheidung auf das Feedback der Patienten nach der Anwendung<br />
stützen.<br />
Foto: Bauerfeind<br />
OT: Sind Fragen offengeblieben?<br />
Sole: Die Corona-Pandemie beeinträchtigte den randomisierten<br />
klinischen Part, sodass dieser Teil der Studie statistisch<br />
nicht ausreichend aussagekräftig war. Weitere Untersuchungen<br />
sind erforderlich, um die Wirksamkeit der Bandage<br />
in der Rehabilitation zur Verbesserung der körperlichen<br />
Aktivität und zur Stärkung des Vertrauens in das Knie<br />
zu ermitteln.<br />
Die Fragen stellte Pia Engelbrecht.<br />
Grafik: Bauerfeind<br />
Literatur:<br />
Sole, G., Lamb, P., Pataky, T. et al. Immediate and 6-week effects of wearing<br />
a knee sleeve following anterior cruciate ligament reconstruction: a<br />
cross-over laboratory and randomised clinical trial. BMC Musculoskelet<br />
Disord 22, 655 (2021) and Immediate and six-week effects of wearing a<br />
knee sleeve following anterior cruciate ligament reconstruction on knee<br />
kinematics and kinetics: a cross-over laboratory and randomised clinical<br />
trial. BMC Musculoskelet Disord 23, 560 (2022)<br />
Einbeiniger Distanzsprung (Step-Down-Hop-Test),<br />
Langzeiteffekt<br />
Sole G., Pataky T., Hammer N., Lamb P. Can a knee sleeve influence<br />
ground reaction forces and knee joint power during a step-down hop in<br />
participants following anterior cruciate ligament reconstruction? A secondary<br />
analysis. PLOS ONE 17(12) (2022): e0272677<br />
18<br />
ORTHOPÄDIE TECHNIK <strong>05</strong>/24
Unsere Produkte und weitere Informationen finden Sie auf der neuen Website.<br />
www.vet-al.de<br />
HIER<br />
SCANNEN<br />
WWW.VET-AL.DE
Info<br />
Die Kinder stehen im Mittelpunkt<br />
Sie dürfen nicht wählen, während der Corona-Pandemie<br />
erhielten sie bescheuerte Tipps – Stichwort: Kniebeugen<br />
bei Kälte – und auch ansonsten bekommen sie häufig<br />
das Wort „Nein“ zu hören. Die Rede ist natürlich von<br />
Kindern. Rund 14 Millionen Kinder und Jugendliche unter<br />
18 Jahren leben, laut Deutschlandatlas im Jahr 2021,<br />
in Deutschland. Mehr als 415.000 von ihnen haben eine<br />
körperliche oder geistige Beeinträchtigung. Ein Teil von<br />
diesen Kindern und Jugendlichen benötigt eine Hilfsmittelversorgung.<br />
Und so, wie in der Medizin vom Bild des<br />
Mannes als „Standard-Erwachsener“ langsam aber sicher<br />
abgewichen wird, so ist auch die Erkenntnis bei vielen<br />
Menschen mittlerweile etabliert, dass Kinder keine Miniatur-Erwachsenen<br />
sind, sondern spezielle Bedürfnisse und<br />
Ansprüche haben an ihre Versorgungen, Versorger:innen<br />
und auch an das Umfeld der Versorgungen.<br />
Das hat auch das Vitalcentrum Hodey erkannt. Der<br />
Vollsortimenter vom Niederrhein hat deshalb unter<br />
dem Eigennamen „Hodey Kids“ nicht nur eine Marke,<br />
sondern ein Dach geschaffen für einen Versorgungsbereich,<br />
in dem die Kinder und Jugendlichen und deren<br />
Angehörige im Mittelpunkt stehen. An den Standorten<br />
Kamp-Lintfort und Aachen hat Hodey Kids seine berufliche<br />
Heimat. Was hinter dem Konzept steckt, erklärt Lars<br />
Kieroth, Geschäftsführer des Hodey Vitalcentrums und<br />
Hodey Kids, im Gespräch mit der OT-Redaktion.<br />
OT: Warum haben Sie sich dazu entschieden den Bereich der<br />
Kinderversorgung von den anderen Versorgungsbereichen abzutrennen?<br />
Lars Kieroth: Hodey ist ein traditionelles Familienunternehmen,<br />
deshalb hat die Versorgung der Allerkleinsten<br />
für und bei uns seit jeher einen besonderen Stellenwert.<br />
Wir bieten das volle Sortiment orthopädischer sowie<br />
Reha- und Pflegehilfsmittel für Kinder an – mit viel Leidenschaft<br />
für die neuesten Technologien und dem obersten<br />
Ziel, jedem Kind das Leben ein Stück leichter zu machen.<br />
Deshalb war es uns sehr wichtig, unter dem Dach<br />
Hodey Kids eine eigene kleine Welt zu erschaffen, die sich<br />
gezielt an den Bedürfnissen und Vorlieben betroffener Familien<br />
orientiert.<br />
OT: Wie wichtig war es Ihnen, mit Hodey Kids auch eine eigene<br />
Marke zu schaffen – und was sind die Vorteile für die kleinen<br />
Patient:innen?<br />
Kieroth: Wir haben die Marke Hodey Kids primär ins Leben<br />
gerufen, um betroffenen Familien eine konkrete Anlaufstelle<br />
zu geben, wenn es um die Versorgung ihrer Kinder<br />
geht. Mit der Implementierung der Marke Hodey Kids<br />
und dem ganzheitlichen pädiatrischen Ansatz, den Hodey<br />
Kids verfolgt, können wir bei der Versorgung gezielt auf die<br />
speziellen Bedürfnisse und Anforderungen von Kindern<br />
eingehen, sei es in Bezug auf Design, Größe oder Funktionalität<br />
ihrer Hilfsmittel. Zudem schnüren unsere Hodey-<br />
Kids-Lots:innen, selbst pflegende Eltern, und unsere Re-<br />
Lars Kieroth (links) und<br />
Frank Hodey bilden die<br />
neue Geschäftsführung<br />
des Hodey Vitalcentrums.<br />
hakind-zertifizierten Fachberater:innen für jede Familie<br />
ein intensives, langfristiges und besonders einfühlsames<br />
Rundum-sorglos-Paket, das weit über die übliche Versorgung<br />
hinausgeht. Ein großer Mehrwert für die Kinder –<br />
und für ihre Eltern, da wir ihnen auf Augenhöhe emotional<br />
begegnen können.<br />
OT: Wie lange haben Sie gebraucht, um Ihr Konzept zu entwickeln,<br />
und welche Meilensteine setzten Sie in dieser Zeit?<br />
Kieroth: Die Entwicklung des ganzheitlichen Markenkonzepts<br />
hat einige Zeit in Anspruch genommen. Wir wollten<br />
unbedingt sicherstellen, dass wir alle Aspekte der Versorgung<br />
von Kindern und Jugendlichen berücksichtigen und<br />
bestmöglich bedienen. So etwas bricht man auch mit jahrelanger<br />
Erfahrung in der Versorgung von Kindern nicht<br />
einfach übers Knie.<br />
Meilensteine bei der Entwicklung der Marke waren unter<br />
anderem die Vorstellung unserer Lotsin für Pädiatrie,<br />
die Entwicklung des Hodey-Kids-Hilfsmittelpasses, die<br />
Einführung von KI bei der Erstellung von Begründungen<br />
sowie die Implementierung von Maßnahmen zur Elternintegration,<br />
darunter regelmäßig stattfindende Elternseminare<br />
rund ums Thema Pflege und Versorgung sowie<br />
Events für die ganze Familie, die im entspannten Rahmen<br />
Raum für gegenseitigen Austausch und Hilfestellung<br />
bieten. Ein besonderes Highlight war unser Hodey-Kids-<br />
Launch-Event Anfang März, bei dem wir „unseren“ Familien<br />
erstmals das fertige Markenkonzept von Hodey Kids<br />
vorstellen durften.<br />
OT: Kinder- und Jugendliche haben andere Bedürfnisse als ihre<br />
Eltern. Können Sie ein paar Beispiele nennen, wie Sie auf die<br />
Anforderungen für die Kinder eingegangen sind?<br />
Kieroth: Um auf die Bedürfnisse der Kinder einzugehen,<br />
haben wir für die Marke Hodey Kids im ersten Schritt an<br />
Fotos [2]: Vitalcentrum Hodey<br />
20<br />
ORTHOPÄDIE TECHNIK <strong>05</strong>/24
Info<br />
den beiden Hodey-Kids-Standorten Kamp-Lintfort und<br />
Aachen kinderfreundliche Räumlichkeiten gestaltet. Natürlich<br />
haben wir auch unser Personal entsprechend geschult,<br />
um eine einfühlsame, kindgerechte Betreuung und<br />
eine exzellente Versorgung der Kleinsten zu gewährleisten.<br />
Mit unserem Knautschball-Maskottchen „Hey“ haben<br />
wir der Marke Hodey Kids zudem im wahrsten Sinne<br />
des Wortes noch ein kindgerechtes Gesicht gegeben. Hey<br />
ist Freund, Begleiter und Trostspender in einem. Er turnt,<br />
kullert und hüpft zur Erheiterung der Kinder als wiederkehrendes<br />
Gestaltungselement durch die Markenwelt von<br />
Hodey Kids – als Animation auf der Website, als farbenfrohes<br />
Motiv auf T-Shirts und Turnbeuteln oder als knalliger<br />
Sticker auf den liebevoll designten Hodey-Kids-Mappen,<br />
die mit lustigen Hey-Geschichten und Malbüchern die Zeit<br />
im Wartezimmer überbrücken sollen. Das freut nicht nur<br />
die Kinder, sondern auch die Eltern.<br />
OT: Apropos Eltern: Die Kinder und Jugendlichen kommen in<br />
den seltensten Fällen allein ins Sanitätshaus. Welche Maßnahmen<br />
haben Sie sich überlegt, um die Eltern und Angehörigen<br />
mitzunehmen auf die Versorgungsreise?<br />
OT: Wie bereits gesagt, haben Sie die Elternlotsin angestellt.<br />
Waren weitere Personalbewegungen nötig, um das Hodey-Kids-<br />
Team aufzubauen und können Sie einmal Ihr Personalkonzept<br />
beschreiben?<br />
Kieroth: Unser Ziel bei Hodey Kids ist es, eine optimale und<br />
vor allem langfristige Versorgung der Kleinsten sicherzustellen.<br />
Dafür braucht es fachliche Kompetenz, Empathie<br />
und Beständigkeit. Um das Team aufzubauen, waren und<br />
sind deshalb zusätzliche Personalbewegungen erforderlich<br />
– eine große Herausforderung in Zeiten des Fachkräftemangels.<br />
Gerade in der Versorgung von Kindern ist ein<br />
vertrauensvoller, sensibler Umgang mit der ganzen Familie<br />
und vor allem mit dem Kind wichtig. Deshalb sind unsere<br />
Fachberater:innen allesamt Rehakind-zertifiziert. So<br />
stellen wir sicher, dass betroffene Familien in ganzheitlicher<br />
Hinsicht gut versorgt werden. Unser Personalkonzept<br />
umfasst außerdem Schulungen im Umgang mit Kindern,<br />
regelmäßige Teammeetings zur Verbesserung der Abläufe<br />
Kieroth: Neben den klassischen Flyern, Broschüren sowie<br />
der Website mit FAQs und umfangreichem Diagnose-Register<br />
dient den pflegenden Eltern die Hodey-Kids-Mappe<br />
als hilfreiches Tool, um wichtige Infos zu Hilfsmitteln,<br />
Terminen und mehr einzutragen. Auch Rezepte und Arztbriefe<br />
finden darin Platz, gemeinsam entwickelt mit betroffenen<br />
Eltern, die wissen, worauf es ankommt. Zudem<br />
bieten wir pflegenden Eltern langfristige Betreuung und<br />
Begleitung durch unsere Fachberater:innen sowie unsere<br />
Lots:innen, die den Familien während des gesamten Versorgungsprozesses<br />
– und auch darüber hinaus – unterstützend<br />
und informierend zur Seite stehen. Dieses Angebot<br />
wird äußerst positiv angenommen und hilft den Eltern,<br />
sich sicher und verstanden zu fühlen. Im Fokus bei der<br />
Entwicklung stand immer eine gewisse Niederschwelligkeit<br />
im Kontakt und Einfachheit in der Sprachwahl, ohne<br />
dabei die Professionalität zu kompromittieren. Wir wollen<br />
unseren Eltern und Kindern soweit es geht immer auf Augenhöhe<br />
begegnen können.<br />
OT: Stichwort Augenhöhe: Sie haben eine Elternlotsin eingestellt,<br />
die sich um die Eltern der betroffenen Kinder kümmert.<br />
Was macht diese Lotsin und wie gut wird dieses Angebot angenommen?<br />
Kieroth: Unsere Lotsin Yvonne Straus, selbst pflegende<br />
Mutter, ist Ansprechpartnerin, Tippgeberin, Helferin, Bezugsperson<br />
und mentale Stütze für betroffene Familien. Sie<br />
begleitet pflegende Eltern auf ihrer Odyssee durch den Pflegedschungel,<br />
von Anfang an und solange die Hilfsmittel<br />
mitwachsen. Fragen klären, Tipps geben, Kontakte knüpfen:<br />
Unsere Lotsin zeigt den Familien Schritt für Schritt,<br />
was zu tun ist – und hilft ihnen dabei, schnell die Hilfe zu<br />
bekommen, die sie brauchen. Dieses Zusatzangebot wird<br />
von den betroffenen Familien dankend angenommen, die<br />
Resonanz ist durchweg positiv. Das zeigt uns, dass wir mit<br />
dem Konzept „Lots:in“ auf dem richtigen Weg sind.<br />
Der „Hilfsmittelpass“ konnte von den Kindern bei der Präsentation<br />
von Hodey Kids Anfang März erstmals in Augenschein genommen<br />
werden.<br />
ORTHOPÄDIE TECHNIK <strong>05</strong>/24<br />
21
Info<br />
Die Kinder stehen im Mittelpunkt<br />
der Aufmerksamkeit, doch auch die<br />
Eltern müssen im Zuge der Versorgung<br />
„abgeholt“ werden, um für das Kind<br />
ein gutes Ergebnis zu erzielen.<br />
Foto: Vitalcentrum Hodey<br />
und eine offene Kommunikation. Wir haben ein sehr offenes<br />
und positives Team und stellen beim Recruiting sicher,<br />
dass der persönliche Fit gegeben ist. Leichter leben und<br />
leichter arbeiten geht nur, wenn die Harmonie und Hegemonie<br />
im Team stimmen.<br />
OT: Kinder sind nicht immer in Begleitung ihrer Eltern oder anderer<br />
Erwachsener, die sich gut mit der Versorgung auskennen,<br />
beispielsweise in der Schule. Haben Sie eine Idee, wie Kinder<br />
Informationen für ihr Umfeld zur Verfügung stellen können?<br />
Kieroth: Um unseren kleinen Kund:innen wichtige Informationen<br />
für ihr Umfeld an die Hand geben zu können,<br />
haben wir den Hodey-Kids-Hilfsmittelpass entwickelt –<br />
eine Art „Scheckheft“ für Hilfsmittel. Der Hilfsmittelpass<br />
kann mit allen relevanten Informationen zu den jeweiligen<br />
Hilfsmitteln gefüttert werden und ist so handlich,<br />
dass er ohne Probleme überall mitgeführt werden kann.<br />
Er dient sowohl Therapeut:innen und Ärzt:innen als auch<br />
Erzieher:innen als wichtige Informationsquelle: Wie funktioniert<br />
das Hilfsmittel? Worauf muss ich achten? Wer ist<br />
der zuständige Versorger? Wann war die letzte Anpassung?<br />
Dadurch ermöglicht der Hilfsmittelpass eine bessere Koordination<br />
der Versorgung, eine verbesserte Kommunikation<br />
zwischen den Beteiligten und eine umfassende Dokumentation<br />
der Versorgungsschritte.<br />
OT: Der Hilfsmittelpass klingt nach einer guten Idee. Wie weit<br />
sind Sie mit der Umsetzung und welche weiteren Benefits haben<br />
Eltern und Kinder, wenn sie das Heft bei sich führen?<br />
Kieroth: Der Hilfsmittelpass wurde bereits im März im Rahmen<br />
unseres Hodey-Kids-Launch-Events vorgestellt und<br />
befindet sich derzeit in der Erprobungsphase. Die Erstauflage<br />
wird kontinuierlich bei den Kinderversorgungen ausgegeben.<br />
Aktuell erreichen uns zum Hilfsmittelpass viele<br />
positive Resonanzen, aber auch Optimierungsvorschläge<br />
und Anregungen, die wir natürlich dankend entgegennehmen.<br />
Der Hilfsmittelpass ist im Übrigen Bestandteil einer<br />
liebevoll gestalteten Mappe, die neben dem eigentlichen<br />
Hilfsmittelpass im handlichen A6-Format außerdem praktische<br />
Organizer-Funktionen sowie zahlreiche spielerische<br />
Elemente mit kindgerechter Gestaltung bietet, darunter<br />
Steckbriefe, Malbücher, Sticker und Geschichten, die den<br />
betroffenen Familien das Leben ein Stück leichter machen<br />
sollen.<br />
OT: Nicht jedes Sanitätshaus hat die Kapazitäten, um all<br />
die Maßnahmen umzusetzen, die Sie jetzt umgesetzt haben.<br />
Können Sie den Kolleg:innen einen Tipp geben, was sich vielleicht<br />
mit wenig Mitteln, aber großem Benefit für die Kinder<br />
und Jugendlichen oder deren Angehörigen umsetzen lässt?<br />
Kieroth: Kolleg:innen, die nicht über die gleichen Kapazitäten<br />
verfügen, empfehlen wir, mit einfachen Mitteln die<br />
Familien „abzuholen“. Darunter fallen beispielsweise Mitarbeiterschulungen<br />
im Umgang mit Kindern und Eltern<br />
sowie auch die Implementierung von kleinen Maßnahmen<br />
wie Whatsapp-Kontakt, Spielecken oder Informationsmaterialien<br />
– so kann man zumindest einen Vorteil für die betroffenen<br />
Familien erzielen.<br />
OT: Wie sehen Ihre langfristigen Planungen mit Hodey Kids<br />
aus? Was sind aus Ihrer Sicht die nächsten Schritte in der pädiatrischen<br />
Versorgung?<br />
Kieroth: Aus unserer Sicht geht es darum, ganzheitliche<br />
Ansätze und Lösungen für die Versorgung unserer Kleinsten<br />
zu schaffen. Der Bereich der Hilfsmittel ist für unsere<br />
Eltern schon kompliziert genug, da liegt es unter anderem<br />
an uns als Marktteilnehmer, Lösungen zu schaffen, um<br />
Wartezeiten, die in unserem Ermessen liegen, auf ein Minimum<br />
zu reduzieren. Die Technologie, die dabei zum Einsatz<br />
kommt, versuchen wir in diesem Jahr weiter auszubauen<br />
und robuster zu gestalten. Als konsequenter nächster<br />
Schritt schwebt uns eine ständige Ausstellung für unsere<br />
Kleinsten vor, in welcher jederzeit die aktuellen Hilfsmittel<br />
ausprobiert werden können. Die Pläne dafür liegen schon<br />
in der Schublade und warten auf Umsetzung. Es bleibt also<br />
spannend bei Hodey Kids!<br />
Die Fragen stellte Heiko Cordes.<br />
22<br />
ORTHOPÄDIE TECHNIK <strong>05</strong>/24
ORTHOPÄDIE<br />
TECHNIK<br />
Sonderseiten zu Messe und Kongress<br />
Jetzt auf unserem Messestand in Halle 1, C22/D21<br />
Die neue BORT CoxaPro Hüftorthese<br />
NICHT VERPASSEN!<br />
BORT Ausstellerworkshop<br />
14.<strong>05</strong>.<strong>2024</strong> - 11:00-11:45 Uhr<br />
Raum M26, 1. Ebene/Messehaus<br />
Innovative Unterstützung nach<br />
Schlaganfall: BORT OmoControl<br />
Schultergelenkorthese<br />
www.bort.com<br />
Keynote diskutiert<br />
Inklusion in den Medien<br />
Hilfsmittelversorgung<br />
in Kriegsgebieten<br />
Was sagt das Fach<br />
zur OTWorld?<br />
Der offizielle, tägliche<br />
Newsletter zur<br />
OTWorld<br />
Jetzt<br />
kostenlos<br />
anmelden<br />
Exklusiver Medienpartner der OT World
Passformkontrolle, 3D-Druck, Registerforschung:<br />
DGIHV präsentiert Programm zur OTWorld<br />
Foto: Pohlig<br />
Als langjähriger Partner und Teil der Community<br />
„OTWorld.friends“ unterstützt die Deutsche Gesellschaft<br />
für interprofessionelle Hilfsmittelversorgung e. V.<br />
(DGIHV) auch <strong>2024</strong> wieder den Wissenstransfer bei der<br />
OTWorld. Die Fachgesellschaft ist Kooperationspartner<br />
von zwei Symposien und zwei Workshops.<br />
Am Donnerstag, 16. Mai, findet ab 9:15 Uhr ein einstündiger<br />
Workshop unter dem Titel „Unter-/Oberschenkelprothetik<br />
– Wie kontrolliere ich die Passform des Schaftes?<br />
Wie sehen die Abnahmekriterien aus?“ statt. Den Vorsitz<br />
übernimmt Olaf Gawron, Orthopädietechnik-Meister<br />
und stellvertretender Vorsitzender des geschäftsführenden<br />
Vorstands der DGIHV. Die Teilnehmenden lernen in dem<br />
Workshop die Konstruktionsmerkmale und Funktionsweisen<br />
von Unter- und Oberschenkelprothesenschäften einschließlich<br />
der praktischen Vorgehensweise bei der Passformkontrolle<br />
kennen. Darüber hinaus erfahren sie, was<br />
die Gesamtfunktion einer Unter- oder Oberschenkelprothese<br />
ausmacht. Die Beschreibung der Abnahmekriterien<br />
und deren Durchführung rundet das Lernangebot ab.<br />
Weiter geht es von 15:15 bis 16:30 Uhr mit dem Symposium<br />
„Kinderorthopädie: 3D-Printing – neue Möglichkeiten<br />
in der Hilfsmittelversorgung“ unter der Leitung von<br />
Dr. med. Jennifer Ernst, Klinik für Unfallchirurgie, Orthopädie<br />
und Plastische Chirurgie der Universitätsmedizin<br />
Göttingen, und Univ.-Prof. Dr. med. habil. Wolfram Mittelmeier,<br />
Klinikdirektor der Orthopädischen Klinik und<br />
Poliklinik in Rostock. Design-Freiheiten, Nachhaltigkeit<br />
und ein hoher Grad an Individualisierung sind Schlagwörter,<br />
die den 3D-Druck kennzeichnen. Die Teilnehmenden<br />
erfahren, wie die Vorteile des additiven Herstellungsverfahrens<br />
in der Kinderorthopädie-Technik am besten eingesetzt<br />
werden.<br />
Welchen Mehrwert<br />
Patienten erhebungen<br />
bieten, zeigt der Workshop<br />
um OTM Olaf Gawron auf.<br />
Dr. Jennifer Ernst,<br />
Universitätsmedizin<br />
Göttingen, steht dem<br />
Symposium „Kinderorthopädie:<br />
3D Printing<br />
– neue Möglichkeiten<br />
in der Hilfsmittelversorgung“<br />
vor.<br />
Was bringen Patientenerhebungen<br />
in der Orthopädie-Technik?<br />
Am Freitag, 17. Mai, stehen die Themen Registerforschung<br />
und Patientenerhebungen im Fokus des DGIHV-Programms.<br />
„Patientenversorgung sicherstellen und wie uns<br />
Registerforschung dabei hilft: Eine internationale Perspektive“<br />
heißt das Symposium, das von 10:30 bis 11:45<br />
Uhr stattfindet. Die Teilnehmenden lernen internationale<br />
Initiativen kennen, die machbare Erhebungsstrukturen<br />
aufbauen. Ansätze und Synergien stehen dabei zur Diskussion<br />
– doch auch Überraschungen, die bei der Einführung<br />
unvermeidlich sind. Geleitet wird das Symposium<br />
von Dipl.-Ing. (FH) Merkur Alimusaj, Leiter der Technischen<br />
Orthopädie am Universitätsklinikum Heidelberg,<br />
und Dr. Urs Schneider, Bereichsleiter und Abteilungsleiter<br />
bei Fraunhofer IPA.<br />
Klinische Untersuchungen, Profilerhebungen und Assessments<br />
– was bringen Patientenerhebungen in der<br />
Orthopädie-Technik? Wie können sie im Alltag eines Betriebes<br />
ein- und umgesetzt werden? Das erläutern<br />
Olaf Gawron und Merkur Alimusaj zwischen 12 und 13<br />
Uhr. Der Workshop soll den Teilnehmenden Hintergründe<br />
und inhaltliche Erläuterungen bieten, wie eine Zustandserhebung<br />
erfolgt und sich in den Alltag integrieren<br />
lässt.<br />
Foto: privat<br />
24<br />
ORTHOPÄDIE TECHNIK <strong>05</strong>/24
Besuchen Sie unseren Workshop<br />
Indikations-Fortbildung Knie<br />
Die Orthopädietechnik als kompetenter Arztpartner<br />
Prof. Dr. med. Dr. h. c. mult.<br />
Joachim Grifka<br />
em. Lehrstuhlinhaber für Orthopädie<br />
der Universität Regensburg<br />
Donnerstag, 16. Mai, 12:00-12:45 Uhr<br />
Messehaus, Ebene 0, Raum M21<br />
• kein zusätzlicher Eintritt<br />
• Rucksack mit kostenloser<br />
Mittagsbewirtung+Getränk<br />
Indikationen und biomechanische<br />
Wirkweise eines Knieorthesensystems<br />
mit Mobilisierungsfunktion<br />
MEMO-Abschnitt<br />
Workshop: Indikations-Fortbildung Knie<br />
Messehaus<br />
Ebene 0<br />
Raum M21<br />
• kein zusätzlicher Eintritt<br />
• Rucksack mit kostenloser<br />
Mittagsbewirtung+Getränk<br />
Donnerstag<br />
16. Mai <strong>2024</strong><br />
12:00-12:45 Uhr<br />
Indikationen und biomechanische<br />
Wirkweise eines Knieorthesensystems<br />
mit Mobilisierungsfunktion
Wünscht sich mehr Diversität<br />
in der Medienlandschaft:<br />
René Schaar, stellvertretender<br />
Gleichstellungsbeauftragter<br />
des NDR.<br />
Foto: Norbert Scheffler<br />
Monster oder Superheld – Wie Stereotype in Film<br />
und Fernsehen unser Denken formen<br />
In jungen Jahren hat sich René Schaar sehnlichst gewünscht,<br />
Kinder mit Behinderungen im Fernsehen zu sehen.<br />
Heute macht er sich als stellvertretender Gleichstellungsbeauftragter<br />
des Norddeutschen Rundfunks (NDR)<br />
für Inklusion in den Medien stark. Durch ihn zog im vergangenen<br />
Jahr Elin, die erste Bewohnerin im Rollstuhl, in<br />
die „Sesamstraße“ ein. Am Freitag, 17. Mai, steht er nun<br />
als Keynote-Speaker auf der Bühne der OTWorld. In seinem<br />
Vortrag „Who cares about representation? Behinderte<br />
Menschen in den Medien“ wird Schaar beleuchten,<br />
wie Behinderungen in Film und Fernsehen dargestellt<br />
werden. Zudem hinterfragt er Stereotype und zeigt auf,<br />
welchen Einfluss sie auf unser Denken haben und welche<br />
Chancen er in Bewegtbildern für Vielfalt und Inklusion<br />
sieht. Im Gespräch mit der OT-Redaktion schaut er auf<br />
die deutschen und internationalen Bildschirme.<br />
OT: Laut Statistischem Bundesamt lag die Zahl der schwerbehinderten<br />
Menschen in Deutschland 2021 bei 9,4 Prozent.<br />
Eine Studie des Instituts für Medienforschung an der Universität<br />
Rostock zeigt, dass jedoch lediglich 0,4 Prozent in der<br />
deutschen TV-Landschaft eine sichtbar schwere Behinderung<br />
haben. Woher rührt diese Diskrepanz?<br />
René Schaar: Das hat verschiedene Gründe. Hinter der Kamera<br />
liegt das sicherlich an den Bildungschancen und da-<br />
mit verbunden dem Weg in den Journalismus. Wer kann<br />
es sich leisten, nicht bezahlte Praktika anzunehmen? Wer<br />
wird eigentlich Autor:in oder Redakteur:in, wer wird CvD<br />
oder Planer:in? Wer kommt in diese machtvolleren Positionen<br />
und kann darüber entscheiden, was wir im Programm<br />
sehen? Wir müssen uns anschauen, wie das Recruiting stattfindet,<br />
wie der Bildungsweg und das Schulsystem aussehen.<br />
Dasselbe gilt auch vor der Kamera. Denn Schauspielschulen<br />
haben einen sehr harten Auswahlprozess. Dieses System<br />
und die dahinter liegenden Normen zu hinterfragen ist eine<br />
Aufgabe für jede einzelne Schnittstelle, für jede einzelne<br />
Person. Wenn jede und jeder an ihrer beziehungsweise seiner<br />
Stellschraube dreht, dann kommen wir deutlich weiter.<br />
Für viele Schauspieler:innen stellt sich zudem die Frage:<br />
Traue ich mir den Job überhaupt zu? Wenn Vorbilder fehlen,<br />
kommen sie vielleicht gar nicht auf die Idee, dass das<br />
ein Weg für sie sein könnte. Das hat viel mit sogenanntem<br />
internalisierten Ableismus zu tun, also mit verinnerlichten<br />
Stereotypen und Denkmustern. Eine behinderte Person<br />
sieht so und so aus, kann nur dieses oder jenes und nichts<br />
anderes und ist hilfsbedürftig. Wenn man das oft genug<br />
hört und im direkten Umfeld niemanden hat, der oder die<br />
einen unterstützt oder einem Selbstbewusstsein gibt, dann<br />
bleiben nur die Medien, dann bleiben nur die Geschichten,<br />
die wir uns als Gesellschaft erzählen. Genau da knüpft<br />
mein Vortrag auf der OTWorld an.<br />
26<br />
ORTHOPÄDIE TECHNIK <strong>05</strong>/24
OT: Sie haben das Merkmal „hilfsbedürftig“ angesprochen.<br />
Welche weiteren Stereotype herrschen in Film und Fernsehen<br />
vor?<br />
Schaar: Egal ob die Figuren in den Märchen der Brüder<br />
Grimm oder die Star-Wars- und James-Bond-Bösewichte –<br />
das sind Menschen, die angsteinflößend sein sollen und die<br />
– ganz bewusst als Gestaltungsmittel – eine Behinderung<br />
haben. Sie sind entstellt, fehlgebildet, sprechen komisch,<br />
haben vielleicht einen Akzent, Wortfindungsstörungen,<br />
ein Metallgebiss oder sie lispeln. Es sind immer dieselben<br />
Geschichten, die wir uns erzählen, mit Stereotypen, die<br />
wir immer wieder reproduzieren. Entweder sind behinderte<br />
Menschen angsteinflößende Monster, bemitleidenswerte<br />
Wesen oder – wenn sie es dann trotz aller Widrigkeiten<br />
geschafft haben und stark genug waren, sich dem System<br />
anzupassen – werden sie überhöht und zu Superhelden stilisiert.<br />
Es gibt wenig Graustufen, nur das eine oder das andere<br />
Extrem. Die Frage ist: Was hat das eigentlich mit unserer<br />
Lebensrealität zu tun und in unserem Alltag für Konsequenzen?<br />
OT: Welche Geschichten sollten wir uns stattdessen erzählen?<br />
Schaar: Um ein Beispiel zu nennen: Ich war gerade in London<br />
im Urlaub und habe mir meine erste Barbie gekauft.<br />
Und die Geschichte, die sie erzählt, finde ich super. Sie ist<br />
eine schwarze Frau und sitzt im Rollstuhl. Und das ist kein<br />
medizinischer Krankenhausrollstuhl mit Griffen hinten<br />
dran, sondern einer, der an sie angepasst ist. Damit ist sie<br />
eigenständig unterwegs. Ich war so im Flow, dass ich mir<br />
direkt die zweite Barbie gekauft habe, und zwar aus dem<br />
neuesten Disney-Film „Wish“: eine etwas dickere Barbie,<br />
die eine Gehhilfe benutzt. Das finde ich supercool. Auch<br />
im Bereich Kinderliteratur bewegt sich etwas, wenn man<br />
sich beispielsweise das Buch „Als Ela das Weltall eroberte“<br />
von Raúl Krauthausen anschaut. Aus Mangel an realistischen<br />
Geschichten sind wir gezwungen, selber tätig zu<br />
werden. Neue Publikationen setzen auf Beiläufigkeit und<br />
Leichtigkeit. Sie zeigen, dass Behinderung nur ein Merkmal<br />
von ganz vielen ist, das den jeweiligen Charakter auszeichnet.<br />
Bei der OTWorld werde ich ein Tool vorstellen,<br />
mit dem überprüft werden kann, ob und wie Geschichten<br />
Stereotype reproduzieren.<br />
Bewegung in der Branche<br />
OT: Es heißt: Sprache formt das Denken, beeinflusst, wie wir<br />
die Welt wahrnehmen. Haben Bewegtbilder Ihrer Meinung<br />
nach den gleichen Einfluss?<br />
Schaar: Video-Content – also Mediatheken, Streaming und<br />
Social Media – ist das am stärksten wachsende Medium.<br />
Wenn sie gut gemacht sind, können Videoformate ein sehr<br />
niedrigschwelliger Zugang für Menschen sein und – aus öffentlich-rechtlicher<br />
Perspektive – den Bildungsauftrag erfüllen,<br />
zum Zusammengehörigkeitsgefühl der Gesellschaft<br />
beitragen, zur Solidarität und letztendlich auch zur Demokratie.<br />
Sie können aber eben auch schlecht gemacht sein<br />
und Stereotype fördern. Und das gar nicht unbedingt mit<br />
bösem Willen, sondern weil die Macher:innen einen blinden<br />
Fleck haben. Insofern kommt den Medien eine große<br />
ORTHOPÄDIE TECHNIK <strong>05</strong>/24<br />
Verantwortung zu. Ich nehme in Bezug auf Inklusion und<br />
Vielfalt aber deutlich mehr Bewegung in der Branche wahr.<br />
OT: Woran liegt das?<br />
Schaar: Zum einen an gesetzlich veränderten Rahmenbedingungen.<br />
Im Medienstaatsvertrag wird das Thema Barrierefreiheit<br />
explizit erwähnt und wir als Medienschaffende<br />
sind dazu verpflichtet, es umzusetzen. Für Websites und<br />
Apps gilt das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz. Dann gibt es<br />
natürlich noch die UN-Behindertenrechtskonvention, auf<br />
die immer wieder geprüft wird. Aus unternehmerischer<br />
Perspektive haben wir auch den Fachkräftemangel im<br />
Blick. Wir können es uns einfach nicht leisten, behinderte<br />
Menschen aus dem Bewerberpool auszuklammern und<br />
dieses Potenzial nicht zu schöpfen.<br />
„Ich habe mich selten so gesehen<br />
gefühlt“<br />
OT: Haben Sie Film- und Serientipps, in denen Vielfalt gut umgesetzt<br />
wird?<br />
Schaar: Viele Disney- und Pixar-Filme sind echt gut. Es gibt<br />
eine Arielle, die schwarz ist, Nemo, der eine kurze Flosse<br />
hat, Lucas Vater, der einen kurzen Arm hat. Im Film „Red“<br />
trägt Stacy ein Glukosemessgerät, das ganz beiläufig in einer<br />
Szene gezeigt wird. Das ist in der Community total ge-<br />
Anzeige<br />
Schneller.<br />
Stärker.<br />
Besser<br />
vernetzt.<br />
Die TASKA CX ist die Hand,<br />
die eine große Rolle im täglichen<br />
Leben der Nutzer spielen wird.<br />
Um mehr zu erfahren, besuchen<br />
Sie taskaprosthetics.com<br />
27
Dank René Schaar zog im vergangenen Jahr<br />
mit Elin die erste Bewohnerin im Rollstuhl<br />
in die ARD-Serie „Sesamstraße“ ein.<br />
feiert worden. Menschen aus Lateinamerika haben sich<br />
über die Figuren mit krausen Haaren und dunkler Hautfarbe<br />
in „Encanto“ gefreut, weil sie sich hier endlich repräsentiert<br />
sehen. Oft wird Behinderung nur beiläufig erwähnt<br />
beziehungsweise gezeigt, oder aber es wird – wie bei Nemo<br />
– ein wichtiges Thema angesprochen. Das, was Nemo im<br />
Meer erlebt, findet oft in der Gesellschaft statt. Eltern wollen<br />
ihre behinderten Kinder am liebsten in Watte packen<br />
und beschützen. Die Kinder müssen sich im wahrsten<br />
Sinne des Wortes freischwimmen und emanzipieren. Für<br />
mich persönlich ist das wirklich ein sehr schöner und gelungener<br />
Film. Welche Rolle ich am coolsten finde, ist die<br />
von Maya Lopez in „Hawkeye“, gespielt von Alaqua Cox.<br />
Auf Disney-Plus hat sie mit „Echo“ jetzt eine eigene Spinoff-Serie<br />
bekommen. Sie ist eine Frau, indigen, gehörlos<br />
und trägt eine Beinprothese. Was mir auch gefällt: Sie ist<br />
erst eine Bösewichtin, die dann aber zu einer Vertrauten<br />
wird, also ein sehr komplexer Charakter, der eine Entwicklung<br />
durchmacht. In der Netflix-Serie „Sex Education“ sind<br />
neben zwei behinderten Hauptcharakteren – eine Figur ist<br />
taub, eine andere im Rollstuhl unterwegs – auch eine Reihe<br />
von behinderten Statist:innen im Hintergrund zu sehen.<br />
Das ist normal an immer mehr Regelschulen und normal<br />
in Serien. Doch leider ist es noch immer eine Seltenheit,<br />
dass behinderte Rollen auch von behinderten Menschen<br />
gespielt werden.<br />
OT: Damit sprechen Sie ein großes Diskussionsthema an. Dürfen<br />
nicht behinderte Menschen behinderte Menschen spielen?<br />
Schaar: Ich mache gerne den Vergleich zu Blackfacing. Früher<br />
haben sich weiße Menschen schwarz angemalt und so<br />
getan, als wären sie schwarze Personen. Kann man machen,<br />
ist halt trotzdem scheiße. Ich traue Schauspieler:innen viel<br />
zu. Aber gelebte Diskriminierungserfahrungen haben einen<br />
sehr hohen und nicht zu unterschätzenden Wert. Die<br />
können Menschen aus eigener Betroffenheit in die Rolle<br />
einfließen lassen. Ich habe in London kürzlich das Musical<br />
„The Little Big Things“ gesehen, das die Geschichte des<br />
Autors Henry Fraser erzählt. Infolge eines Badeunfalls ist er<br />
seit seinem 17. Lebensjahr querschnittgelähmt. Das Musical<br />
behandelt, was der Unfall für die Familie bedeutet, welchen<br />
Einfluss er auf Freundschaften hat und den eigenen<br />
Selbstwert. Das war ein toller Abend mit grandioser Musik.<br />
Foto: NDR / Thorsten Jander<br />
Und gleichzeitig habe ich mich selten so gesehen gefühlt.<br />
Die behinderten Rollen wurden von behinderten Menschen<br />
gespielt und teilweise wurden die nicht behinderten<br />
Rollen von Menschen mit Behinderung gespielt. Die Behinderung<br />
hat in dem Fall gar keine Bedeutung gehabt. Es<br />
war eine Mischung aus authentischer Repräsentation und<br />
gleichzeitiger Beiläufigkeit. Da waren verzweifelte, tieftraurige,<br />
auch teilweise suizidale Momente dabei, die aber<br />
von Humor und Leichtigkeit unterbrochen wurden. Und<br />
diese Gratwanderung schafft man nur, wenn Menschen<br />
aus eigener Betroffenheit heraus an dem Drehbuch mitschreiben<br />
und mitspielen.<br />
Betroffene ins Boot holen<br />
OT: Kann es auch ein „zu viel“ an Diversität geben?<br />
Schaar: Eine Sorge, die ich von Redaktionen kenne, ist,<br />
dass wir unsere Zuschauer:innen nicht überfordern dürfen.<br />
Diese Sorge teile ich gar nicht, denn Vielfalt spiegelt<br />
doch die Lebensrealität wider. Also warum sollte ich mich<br />
daran nicht orientieren und diese Realität darstellen? Und<br />
gleichzeitig verstehe ich, woher der Widerstand kommt.<br />
Über Jahrzehnte haben wir Programm für einen bestimmten<br />
Typ Mensch gemacht. Jetzt befinden wir uns in einem<br />
Umgewöhnungsprozess. Die erste Reaktion ist Ablehnung<br />
und Kritik. Man muss aber verstehen, dass es nicht darum<br />
geht, etwas wegzunehmen, sondern darum, etwas zu ergänzen,<br />
was bisher fehlte.<br />
Eine Sache kann helfen, um nicht „übers Ziel hinauszuschießen“:<br />
Wenn das Know-how in der bestehenden<br />
Belegschaft nicht vorhanden ist, holt die Leute, die es<br />
betrifft, mit ins Boot, und zwar zum frühestmöglichen<br />
Zeitpunkt, also beim Schreiben des Drehbuchs, beim<br />
Entwickeln eines neuen Produkts oder beim Programmieren<br />
einer neuen Internetseite. Egal ob in Form von<br />
Beratungsunternehmen, Selbstvertretungsvereinen oder<br />
Influencer:innen.<br />
OT: Wie divers ist die internationale Medienlandschaft?<br />
Gibt es Vorreiter?<br />
Schaar: Ich stelle immer wieder fest, dass wichtige Impulse<br />
aus dem englischsprachigen Raum kommen.<br />
OT: Können Sie sich erklären, warum?<br />
Schaar: Ich habe eine Theorie. Ich glaube, das Zusammenleben<br />
ist dort selbstverständlicher. In Deutschland hingegen<br />
herrschen nach wie vor bestimmte Stereotype über<br />
Menschen mit Behinderungen vor. Wir leben in einer Leistungsgesellschaft,<br />
machen den Selbstwert von der individuellen<br />
Produktivität abhängig, und wer angeblich nichts<br />
beitragen kann, der hat es nicht oder weniger verdient, ein<br />
Teil dieser Gesellschaft zu sein. Dieses Denken hat sich in<br />
28<br />
ORTHOPÄDIE TECHNIK <strong>05</strong>/24
der Nazi-Zeit manifestiert. Es wurde damals ganz offensiv<br />
kommuniziert, dass behinderte Menschen das Erbgut<br />
verunreinigen würden und den Staat viel kosten. Deswegen<br />
müsse man diese Menschen loswerden, sie wären „lebensunwert“.<br />
Ich glaube, über diese Propaganda wurde uns<br />
eine Haltung nahegebracht, die wir nie wirklich aufgearbeitet<br />
haben. Das ist zumindest ein Erklärungsansatz.<br />
Diversität messbar machen<br />
OT: 2021 hat Netflix begonnen, eine Studie bezüglich Diversität<br />
aufzusetzen. Gemeinsam mit der Inklusionsinitiative der<br />
University of Southern California (USC) Annenberg untersucht<br />
der Streaminganbieter die in den USA in Auftrag gegebenen<br />
Filme und Serien im Hinblick auf mehrere Inklusionsmaßstäbe<br />
– darunter Geschlecht, ethnische Herkunft, LGBTQI+ und<br />
Behinderung. Netflix hat sich dazu verpflichtet, die Ergebnisse<br />
bis 2026 alle zwei Jahre zu veröffentlichen. Wie wichtig sind<br />
solche Erhebungen?<br />
Schaar: In diesem Bereich passiert gerade ganz viel und<br />
ich bin ein großer Fan davon, weil wir in der Vergangenheit<br />
oft aus dem Bauchgefühl heraus agiert haben. Dabei<br />
ist ein datenbasierter Ansatz wichtig. Wir sollten Diversität<br />
und Inklusion messbar machen. Das ist auch unternehmerisch<br />
sinnvoll, weil wir so eine Wirksamkeitsmessung unserer<br />
bestehenden Maßnahmen etablieren und gleichzeitig<br />
Bedarfe für neue Maßnahmen erkennen. Zudem gibt es<br />
neue regulatorische Anforderungen wie die EU-Richtlinie<br />
Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), die<br />
Unternehmen dazu verpflichtet, auch über nicht-finanzielle,<br />
ökologische und soziale Nachhaltigkeitsdaten zu berichten.<br />
Das begrüße ich sehr, weil durch die einheit lichen<br />
KPIs (Key Performance Indicators, dt. Schlüsselkennzahlen,<br />
Anm. d. Red.), die dort abgefragt werden, ein branchenübergreifender<br />
Vergleich möglich wird. Damit macht die<br />
EU einen sehr großen Schritt in die richtige Richtung, die<br />
Wirtschaft als Ganzes nachhaltiger zu gestalten, und zwar<br />
auch sozial.<br />
Anzeige<br />
Zur Person<br />
René Schaar wurde 1992 geboren, lebt in Hamburg<br />
und ist gelernter Mediengestalter Bild/Ton<br />
sowie zertifizierter Diversity Manager. Aktuell<br />
leitet er stellvertretend den Bereich Gleichstellung<br />
und Diversity beim Norddeutschen Rundfunk<br />
(NDR). 2023 wurde er mit dem Senator-Neumann-Preis<br />
für Inklusion ausgezeichnet. Außerdem<br />
erhielt er den Grimme-Online-Award im Jahr<br />
2020 für die Umsetzung des Youtube-Formats<br />
„STRG_F“. Er engagiert sich ehrenamtlich als Wertebotschafter<br />
bei der überparteilichen Bildungsinitiative<br />
German-Dream und bei Ahoi e. V., einem<br />
Selbstvertretungsverein behinderter Menschen.<br />
wir immer wieder: Man kann so viele Regeln und Gesetze<br />
aufstellen, wie man möchte. Darüber wird keine Veränderung<br />
stattfinden. Veränderung entsteht, weil es einzelne<br />
Personen gibt, die Bock darauf haben, die eine positive<br />
Grundhaltung haben, neugierig sind und sagen: Lasst es<br />
uns mal ausprobieren, was soll schon passieren?<br />
ÜBERDENKEN SIE HANDPROTHESEN<br />
Mechanisch<br />
Angenehm<br />
leicht<br />
Die Fragen stellte Pia Engelbrecht.<br />
Bionische Eigenschaften<br />
Unabhängige 5-<br />
Fingerbewegung<br />
OT: Sie selbst haben eine Behinderung. Finden Sie sich in der<br />
deutschen Medienlandschaft wieder? Fühlen Sie sich repräsentiert?<br />
Sofortige<br />
Steuerung<br />
Variable<br />
Griffmuster und<br />
Handgelenkstellungen<br />
Schaar: Ja. Weil ich ein weißer, blonder und blauäugiger Cishetero-Dude<br />
bin (lacht). Und davon gibt es verdammt viele<br />
im Fernsehen. Was das Thema Behinderung angeht, finde<br />
ich mich und meine Community zu wenig repräsentiert.<br />
Das gilt grundsätzlich für unsichtbare Merkmale, also auch<br />
für psychische und chronische Erkrankungen.<br />
OT: Schon Kleines kann Großes bewirken. Was kann jede:r<br />
noch heute direkt umsetzen, um die Welt ein bisschen inklusiver<br />
zu machen?<br />
Schaar: Sich umschauen, Menschen, die behindert oder<br />
chronisch krank sind, mit ins Team holen. Einfach die Tür<br />
und das Herz aufmachen. Das kann bedeuten, einer alten<br />
Frau über die Straße zu helfen, aber eben auch, sich am Arbeitsplatz<br />
zu fragen, ob behinderte Menschen repräsentiert<br />
werden und ob die Prozesse inklusiv sind. Es hilft, wacher<br />
und sensibler zu sein. Das, was es braucht, und das merken<br />
Robuste<br />
Konstruktion<br />
und einfache<br />
Reparatur<br />
„Ich habe fast alle<br />
Handprothesen<br />
probiert, aber diese<br />
ist allerdings die<br />
effizienteste und<br />
praktischste nach<br />
meiner Erfahrung.“<br />
Anwender M<br />
Weitere Informationen auf unserer<br />
Website: www.metacarpal.co.uk<br />
ORTHOPÄDIE TECHNIK <strong>05</strong>/24<br />
29
Foto: Christian Schlierf<br />
Regelmäßig reist Christian Schlierf<br />
(2. v. l.) ins ukrainische Lwiw,<br />
unterstützt bei der Versorgung und<br />
schult die Techniker:innen.<br />
Hilfsmittelversorgung im Krisengebiet:<br />
Human Study qualifiziert vor Ort und auf Distanz<br />
Als Human Study 2017 mit dem Ausbildungsprogramm<br />
in der Ukraine startete, gab es keine nach internationalen<br />
Standards ausgebildeten Orthopädietechniker:innen<br />
im Land. Heute sind es 21, Tendenz steigend. Denn der gemeinnützige<br />
Verein, der weltweit Fachkräfte für die Hilfsmittelversorgung<br />
schult, arbeitet an einer flächendeckenden<br />
Ausbildung und Versorgung. Und das – aber nicht nur<br />
– vor dem Hintergrund des Angriffskriegs Russlands im Februar<br />
2022. Auch unabhängig von der Invasion ist der Bedarf<br />
in der Ukraine groß. Bei der OTWorld wird Christian<br />
Schlierf, Geschäftsführer von Human Study, ein Zwischenfazit<br />
des Projekts ziehen.<br />
Bereits vor Ausbruch des Krieges benötigten laut Schlierf<br />
von den 40 Millionen Einwohner:innen der Ukraine rund<br />
300.000 Menschen orthopädietechnische Hilfsmittel, circa<br />
drei Viertel davon eine orthetische Versorgung. „Durch die<br />
Invasion seit 2014 und vor allem seit 2022 sind dazu noch<br />
Kriegsversehrte hinzugekommen, hauptsächlich Amputierte,<br />
sehr viele davon mit sogenanntem Poly-Trauma,<br />
also multiple Amputierte“, so Schlierf. Die Gesamtzahl der<br />
kriegsversehrten Zivilist:innen und Soldat:innen sei nicht<br />
öffentlich, vom ukrainischen Gesundheitsministerium<br />
würden Angaben zwischen 40.000 und 90.000 kommuniziert.<br />
Vor Kriegsausbruch gab es 46 orthopädietechnische<br />
Werkstätten mit rund 300 Techniker:innen ohne formelle<br />
Qualifikation im Land. Innerhalb der vergangenen zwei<br />
Jahre kam es zu einem Boom. Die Zahl ist auf 84 Werkstätten<br />
mit rund 500 Techniker:innen gewachsen. Eine positive<br />
Entwicklung, findet Schlierf, doch die reiche nicht aus.<br />
Denn nicht nur die Quantität, sondern auch die Qualität<br />
der Techniker:innen sei entscheidend. „Unser Ziel ist es,<br />
die Techniker nach und nach zu qualifizieren und gemeinsam<br />
mit lokalen Partnern langfristig eine nationale Ausbildung<br />
auf die Beine zu stellen.“ Nicht nur Kriegsversehrte<br />
seien darauf angewiesen, sagt Schlierf und warnt davor,<br />
das Gesamtbild aus den Augen zu verlieren. Denn entgegen<br />
des „Hypes“ rund um die prothetische Versorgung von<br />
Menschen mit Amputationen benötige der Großteil nach<br />
wie vor Orthesen. „Es gibt in der Ukraine – genauso wie<br />
in allen anderen Ländern auch – viele Menschen mit Skoliose,<br />
Cerebralparese, Diabetes und allen anderen Pathologien.“<br />
Wer langfristig Versorgung gewährleisten möchte,<br />
müsse auch langfristig denken. Deswegen strebt der Verein<br />
eine umfassende Ausbildung in allen Versorgungsbereichen<br />
und auf drei Niveaus an. Dazu gehören Gesell:innen,<br />
Techniker:innen, die für die Koordinierung zuständig sind<br />
und den Gesell:innen zuarbeiten, sowie Meister:innen.<br />
Die Ausbildung umfasst je nach Stufe zwischen 1.800 und<br />
3.900 Stunden und ist von der International Society for<br />
Prosthetics and Orthotics (ISPO) zertifiziert.<br />
Human Study setzt bei all seinen Programmen weltweit<br />
auf das gleiche Prinzip: Blended Learning. Das bedeutet,<br />
es wird berufsbegleitend sowohl online als auch vor Ort<br />
gelehrt. Das theoretische Wissen wird multimedial über<br />
eine Lernplattform vermittelt, die fachpraktische Ausbildung<br />
findet im ukrainischen Lwiw statt. Zurück in der eigenen<br />
Werkstatt können die Techniker:innen ihr Wissen<br />
dann anwenden und weitergeben. Nicht nur aus der Distanz,<br />
sondern zusätzlich vor Ort zu lehren, hält Schlierf<br />
für notwendig, um den Techniker:innen das mitzugeben,<br />
was sie unter den jeweiligen Gegebenheiten auch tatsächlich<br />
umsetzen können. „Wir arbeiten dort in ihrer Realität<br />
mit ihren Patienten und mit ihren Materialien“, be<br />
30<br />
ORTHOPÄDIE TECHNIK <strong>05</strong>/24
tont er. Statt hochmoderner, kostspieliger Versorgungen<br />
wird eher auf konventionelle Techniken gesetzt. „Das ist<br />
vielleicht nicht ganz so funktionell, aber es erfüllt seinen<br />
Zweck und ist nachhaltiger. Nicht nur aus finanzieller<br />
Sicht, sondern auch vom Handling her. Denn wer repariert<br />
ein C-Leg, wenn es kaputt geht?“ Ziel ist es, die bislang<br />
21 Absolvent:innen als Lehrkräfte weiterzubilden, um<br />
die Ukra ine so zu befähigen, langfristig ihre eigenen Fachkräfte<br />
auszubilden. Dafür arbeitet Human Study mit den<br />
medizinischen Universitäten in Kiew, Lwiw und Charkiw<br />
zusammen, die ein einheitliches, standardisiertes Curriculum<br />
erarbeiten. Der Startschuss soll im Herbst <strong>2024</strong> fallen,<br />
die Weiterbildung über einen Zeitraum von zwei Jahren<br />
laufen. „Bis dahin bleiben wir die Lehrer“, erklärt Schlierf.<br />
Zudem soll von einer der Universitäten das Blended-Learning-Programm<br />
übernommen, weitergeführt und parallel<br />
zum Vollzeitstudium angeboten werden. Und zwar so lange,<br />
bis der bestehende Markt befriedigt ist, also alle aktuell<br />
500 Techniker:innen die Ausbildung durchlaufen haben.<br />
„Wenn alles nach Plan läuft, haben wir in fünf Jahren die<br />
Fachkompetenz im ganzen Land verankert“, hofft Schlierf.<br />
Bislang scheint dieser Plan tatsächlich aufzugehen.<br />
„Aber es ist Krieg. Wir wissen nicht, was morgen sein wird.<br />
Das ist ein Risikofaktor, der über allem schwebt, was wir<br />
tun.“ Über den notwendigen strategischen und politischen<br />
Willen sowie über ausreichend Fundraising macht sich der<br />
Orthopädietechnik-Meister wenig Sorgen. Eine Herausforderung<br />
stellt für ihn der Fachkräftemangel dar – und zwar<br />
auf deutscher Seite. „Wir haben begrenzte Kapazitäten, was<br />
die Ausbildung der Techniker betrifft. Wir brauchen dringend<br />
Unterstützung – sowohl bei der inhaltlichen Gestaltung<br />
als auch vor Ort.“ Schlierf selbst unterstützt regelmäßig<br />
in Lwiw, fühlt sich dort – weil weit weg von der Front –<br />
sicher. „Man bewegt sich im Kriegsgebiet. Eine Garantie dafür,<br />
dass es keine Treffer gibt, gibt es aber natürlich nicht.“<br />
Wer sich bei Christian Schlierf über die Unterstützungsmöglichkeiten<br />
informieren und mit ihm austauschen<br />
möchte, hat dazu bei der OTWorld auch abseits<br />
seines Kongressvortrags die Gelegenheit. Am Stand von<br />
Human Study innerhalb des Sonderausstellungsbereichs<br />
OTWorld.campus stehen er und sein Team Rede und Antwort.<br />
Und die Chancen stehen gut, ihn hier auch tatsächlich<br />
anzutreffen, denn: „Ich habe gelernt, dass es besser ist,<br />
statisch an einem Punkt zu bleiben. Irgendwann kommen<br />
sie alle bei dir vorbei“, sagt er und lacht.<br />
ORTHOPÄDIE TECHNIK <strong>05</strong>/24<br />
Pia Engelbrecht<br />
Christian Schlierf stellt das Ausbildungsprogramm<br />
von Human Study innerhalb des<br />
OTWorld-Symposiums „Hilfsmittelversorgung<br />
im Krisengebiet: Was sind die Herausforderungen?“<br />
am Donnerstag, 16. Mai, vor. Dieses findet<br />
von 10:30 bis 11:45 Uhr statt.<br />
vkb-werbung.de<br />
Mehr Flexibilität<br />
auf engstem Raum<br />
findet man nur<br />
hier . . .<br />
PROFI-KLEBSTOFFE<br />
VON RENIA<br />
RENIA GMBH | D-51109 Köln<br />
Tel.+49-221-630799-0<br />
info@renia.com | www.renia.com<br />
31
Aurora-Projekt: Ukrainische Fachkräfte<br />
schätzen „German Gründlichkeit“<br />
Seit November 2023 werden an fünf BG-Kliniken sowie<br />
an der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH)<br />
Ärzt:innen und Therapeut:innen aus der Ukraine fortgebildet.<br />
Im Gespräch mit der OT-Redaktion berichtet<br />
Dr. med. Sebastian Benner, Sektionsleiter Technische<br />
Orthopädie, Leitender Oberarzt BG Service- und Rehabilitationszentrum<br />
sowie Facharzt für Orthopädie und<br />
Unfallchirurgie an der BG Unfallklinik Frankfurt am<br />
Main, inwiefern die ukrainischen Fachkräfte von der<br />
Hospitation profitieren und welchen Nutzen die deutschen<br />
Kolleg:innen im Gegenzug haben. Über das Aurora-Projekt<br />
informiert Benner im OTWorld-Kongress<br />
innerhalb des Symposiums „Hilfsmittelversorgung im<br />
Krisengebiet: Was sind die Herausforderungen?“ am<br />
Donnerstag, 16. Mai.<br />
OT: Zehntausende Soldat:innen und Zivilist:innen wurden<br />
seit Beginn des Angriffskriegs Russlands auf die Ukraine<br />
verletzt. Es liegt auf der Hand, dass der Bedarf an Versorgungen<br />
seitdem enorm steigt. Inwiefern soll das Aurora-Projekt hier<br />
unterstützen?<br />
Sebastian Benner: Der Bedarf akutchirurgischer Versorgungen<br />
ist immens, wobei vor allem die langwierigen Verläufe<br />
nach Schusswunden oder Explosionen mit ausgedehnten<br />
Verletzungen der Extremitäten sowie Weichteilund<br />
Knocheninfekten eine Herausforderung darstellen.<br />
Oftmals ist ein Erhalten der Extremitäten nicht möglich<br />
und eine Amputation mit entsprechender Prothesenversorgung<br />
unumgänglich.<br />
Das Aurora-Projekt zielt auf die Schulung und den Austausch<br />
zwischen dem ukrainischen und deutschen medizinischen<br />
Personal ab. Dabei hospitieren seit November 2023<br />
insgesamt 72 Ärzte und Therapeuten in Kleingruppen für<br />
den Zeitraum eines Monats in insgesamt fünf BG-Kliniken<br />
und der Medizinischen Hochschule Hannover. Durch die<br />
hohe Expertise und die Multidisziplinarität der Berufsgenossenschaftlichen<br />
Unfallkliniken gelingt es, einen guten<br />
Überblick in den Bereichen Traumachirurgie, Septischeund<br />
Hand-/Plastische Chirurgie, aber auch der Fuß-, Sportund<br />
Wirbelsäulenchirurgie zu vermitteln. Einen großen<br />
Stellenwert nimmt aber vor allem die Rehabilitation und<br />
Prothesenversorgung von Amputierten ein. Dabei rotieren<br />
die Hospitanten durch die stationäre und ambulante Rehabilitationsabteilung<br />
der BG-Kliniken sowie die Sektion für<br />
Technische Orthopädie und die an die Klinik angegliederte<br />
Orthopädiewerkstatt.<br />
OT: In welchen Bereichen bestehen Wissenslücken bei den<br />
Fachkräften?<br />
Benner: Wir sehen uns als gleichgestellt und auf einer Ebene,<br />
weshalb ich nicht von Wissenslücken sprechen würde.<br />
Dennoch profitieren gerade die „jüngeren“ Chirurgen<br />
davon, komplexe Operationen mitzubegleiten, ohne<br />
den Druck einer Kriegssituation zu verspüren. Ich erinnere<br />
mich aber auch an die Rückmeldung eines älteren und<br />
erfahrenen Unfallchirurgen aus der Ukraine, welcher die<br />
„German Gründlichkeit“ hervorhob und für sich den Vorteil<br />
darin sah, kleinere, aber hilfreiche Unterschiede in<br />
einzelnen Operationsschritten aus Deutschland kennengelernt<br />
zu haben. Auch strukturelle Abläufe unseres Krankenhauses<br />
sind von großem Interesse.<br />
OT: Wie versucht „Aurora“ diese Lücken zu schließen?<br />
Benner: Wir geben unseren Gästen die Möglichkeit, ihre<br />
vierwöchige Hospitation so individuell zu gestalten, wie<br />
sie es wünschen. Aus diesem Grund wird meist tagesaktuell<br />
entschieden, in welcher Fachabteilung sie hospitieren<br />
möchten, um der für sie interessantesten Operation oder<br />
Therapie beizuwohnen. Genauso wichtig ist aber auch,<br />
dass Zeit zum „Durchatmen“ bleibt und zum Beispiel das<br />
Wochenende für einen Kurztrip innerhalb Deutschlands<br />
genutzt wird.<br />
OT: Essenziell sind nach einer Amputation und<br />
anderen kriegsbedingten operativen Eingriffen die<br />
orthopädietechnische Versorgung und Rehabilitation.<br />
Inwiefern unterscheiden sich die Strukturen bezüglich<br />
der Versorgung und die Begleitung der Patient:innen<br />
in der Ukraine von der in Deutschland?<br />
Benner: Ein sicher großer Unterschied liegt darin, dass der<br />
Beruf des ukrainischen „Prothesisten“ in seiner Wertigkeit<br />
nicht mit dem Ausbildungsberuf des deutschen Orthopädietechnikers<br />
zu vergleichen ist. Hinzu kommt die<br />
Problematik, dass bei rasant gestiegenem Bedarf nicht genügend<br />
Fachpersonal zur Prothesenversorgung zur Verfügung<br />
steht. Auch ein flächendeckendes Netzwerk an Orthopädietechnikern,<br />
wie wir es in Deutschland kennen,<br />
gab und gibt es in der Ukraine bisher nicht. Die Rehabilitation<br />
nach Amputation mit täglicher Prothesengehschule,<br />
wie wir dies vor allem aus der Welt der Arbeitsunfälle in<br />
BG-Kliniken kennen, war bisher in der Ukraine ebenfalls<br />
nicht existent.<br />
OT: Das beste Wissen nützt wenig, wenn die notwendigen<br />
Gegebenheiten und Ressourcen nicht zur Verfügung stehen.<br />
Kann das, was in Deutschland gelernt wird, dennoch auf die<br />
Arbeitsabläufe in der Ukraine übertragen werden?<br />
32<br />
ORTHOPÄDIE TECHNIK <strong>05</strong>/24
Benner: Gerade was die Akutversorgung mit speziellen<br />
Operationstechniken und Behandlungsalgorithmen angeht,<br />
findet trotz Ressourcenknappheit ein guter Lernprozess<br />
statt, der sich sicher positiv auf die Abläufe in der<br />
Ukra ine auswirkt. Hierbei fällt immer wieder auf, dass ein<br />
großes Interesse auch an organisatorischen Abläufen in einer<br />
großen Klinik wie der BGU besteht. Da zum Beispiel die<br />
Rehabilitation erst in jüngster Vergangenheit einen größeren<br />
Stellenwert in der Ukraine erlangt hat und der Berufszweig<br />
des Rehabilitationsarztes bisher noch nicht existierte,<br />
ist das diesbezügliche Know-how aus einer BG-Klinik<br />
essenziell für den Wissenstransfer in die Ukraine.<br />
OT: Am Abreisetag haben die Fachkräfte nicht nur ihren Koffer<br />
im Gepäck. Was hoffen Sie, können die Teilnehmer:innen mit<br />
zurück in die Ukraine nehmen?<br />
Benner: Wichtig ist mir vor allem, dass unsere Gäste eine<br />
lehrreiche und möglichst unbeschwerte Zeit bei uns in<br />
Deutschland hatten. Mit vielen besteht auch noch Kontakt<br />
über die Hospitationszeit hinaus. Dieses wertvolle Netzwerk<br />
wird immer dann aktiviert, wenn über komplexe Fälle<br />
entschieden werden muss.<br />
OT: Profitiert umgekehrt auch das Personal den BG Kliniken<br />
und dem MHH von dem Projekt und dem Austausch mit den<br />
Teilnehmer:innen?<br />
Der offizielle, tägliche Newsletter<br />
des Verlags Orthopädie-Technik<br />
zur OTWorld<br />
Jetzt<br />
kostenlos<br />
anmelden<br />
Benner: Ja absolut! Je länger der Krieg andauert, desto erfahrener<br />
sind selbst die jüngeren Kollegen aus der Ukraine.<br />
So tragisch es klingt, die hohe Anzahl an Verletzten<br />
führt zu einer steilen Lernkurve. In Bezug auf die Versorgung<br />
von Amputierten können wir mittlerweile gemeinsam<br />
an Fällen lernen, die wir glücklicherweise in der Form<br />
in Deutschland nur ganz selten sehen. Es stellt sich immer<br />
häufiger die Frage, wie drei- oder sogar vierfach amputierte<br />
Patienten versorgt werden sollten. Sollte man in derart speziellen<br />
Fällen erst mit der Prothetisierung der oberen oder<br />
erst der unteren Extremität beginnen? Diese Fragen können<br />
nicht selten nur im interdisziplinären Team aus deutschen<br />
und ukrainischen Ärzten, Therapeuten und Orthopädietechnikern<br />
beantwortet werden. Da durch die hohe<br />
Anzahl an Amputierten auch die Expertise auf diesem Gebiet<br />
rasant steigt, wird es mutmaßlich nicht mehr lange<br />
dauern, bis wir uns mit komplexen Fällen an die großen<br />
Einrichtungen in der Ukraine wenden, um uns in Einzelfällen<br />
deren Expertise als Hilfe zu holen.<br />
33
Benner: Meines Erachtens sind sowohl die Schulung in<br />
Deutschland als auch die Weiterbildung in der Ukraine<br />
wichtig. Die Vorteile des Aurora-Hospitationsprogramms<br />
bei uns in Deutschland liegen darin, dass wir uns außerhalb<br />
des Kriegsgeschehens Zeit nehmen können, um im<br />
geschützten Raum Wissen zu vermitteln und Fälle zu diskutieren.<br />
Neben Aurora sind wir jedoch auch in anderen<br />
Projekten tätig, um direkt mit Ärzten und Therapeuten vor<br />
Ort in der Ukraine in Kontakt zu treten. Zum Beispiel findet<br />
jede Woche Telemedizin mit Ärzten unserer Klinik und<br />
verschiedenen ukrainischen Krankenhäusern statt. Auch<br />
kommt es zu einem Wissenstransfer im Rahmen einer<br />
zweiwöchentlich stattfindenden Onlineschulung, bei der<br />
Kollegen aus den BG-Kliniken und andere zu relevanten<br />
Themen aus der Unfallchirurgie, Amputations- und Verbrennungschirurgie,<br />
der Technischen Orthopädie und der<br />
Rehabilitation referieren. Eine Vor-Ort-Weiterbildung gestaltet<br />
sich vor allem aus Sicherheitsgründen für uns noch<br />
schwierig und wird aktuell eher durch NGOs (Nichtregierungsorganisationen,<br />
Anm. der Red.) angeboten.<br />
OT: Auf der OTWorld halten Sie einen Vortrag über das<br />
Aurora -Projekt. Innerhalb des Symposiums „Hilfsmittelversorgung<br />
im Krisengebiet“ kommen neben Ihnen weitere<br />
Expert:innen zu Wort. Was bedeutet Ihnen dieser Austausch?<br />
Foto: BGU<br />
Benner: Der Austausch mit anderen Experten, die in ähnliche<br />
Projekte eingebunden sind, ist sehr wertvoll. Dies<br />
zeigt sich immer wieder bei größeren Zusammentreffen<br />
von in der Ukraine tätigen Ärzten oder Therapeuten, aber<br />
auch bei der Kooperation mit der Industrie und Hilfsorganisationen.<br />
Es ist wichtig, auch die Standpunkte der anderen<br />
zu verstehen und die Bedürfnisse besser kennenzulernen.<br />
Nicht jeder gutgemeinte Aktionismus in und für die<br />
Ukraine hat Erfolg und führt zum gewünschten Ziel. Zum<br />
Beispiel ist es im Interesse der Ukraine, deren Kriegsverletzte<br />
im eigenen Land zu versorgen und nur in selteneren Fällen<br />
in andere Länder wie Deutschland zu verteilen. Auch<br />
müssen zum Beispiel beim Aufbau eines Orthopädietechniker-Netzwerkes<br />
die lokalen Gegebenheiten und die bisher<br />
in dieser Branche arbeitenden Personen berücksichtigt<br />
und einbezogen werden.<br />
OT: Die OTWorld ist nicht nur ein Ort für den Austausch,<br />
s ondern auch für die Fort- und Weiterbildung. Welche Kongressveranstaltungen<br />
werden Sie dafür nutzen?<br />
Dr. Sebastian Benner (rechts) gibt sein Wissen an die<br />
Hospitant:innen aus der Ukraine weiter.<br />
OT: Sie und Ihr Team schulen die ukrainischen Fachkräfte<br />
in Deutschland. Andere Hilfsprojekte setzen auf die Weiterbildung<br />
vor Ort in der Ukraine. Wo liegen die Vor- und<br />
Nach teile der beiden Ansätze?<br />
Benner: Der Kongress bietet eine exzellente Möglichkeit,<br />
mit Experten auf dem Gebiet der Technischen Orthopädie<br />
in Kontakt zu treten. Ich bin gespannt auf Neuigkeiten<br />
der Industrie, freue mich aber vor allem auf Gespräche und<br />
Kontakte außerhalb der einzelnen Vorträge. Besonders am<br />
Herzen liegen mir die Sichtbarkeit und Wertschätzung des<br />
Berufs des Orthopädietechnikers. Ich hoffe sehr, dass der<br />
Kongress hierbei helfen kann und jeder einzelne Referent<br />
mit einem spannenden Vortrag dazu beiträgt.<br />
Die Fragen stellte Pia Engelbrecht.<br />
Die OTWorld präsentiert auf der Messe eine<br />
Sonderschau rund um das Thema Hilfsmittelversorgung<br />
in Krisengebieten. Zentrales Element<br />
ist die Ausstellung „Barriere:Zonen“ der<br />
Organisation Handicap International. Auf 20<br />
Roll-ups werden Schicksale von Menschen mit<br />
Behinderung in Konflikt-, Kriegs- und Krisengebieten<br />
dokumentiert.<br />
34<br />
ORTHOPÄDIE TECHNIK <strong>05</strong>/24
VenoTrain ® hero<br />
GESUNDHEIT<br />
KOMMT LÄSSIG.<br />
Medizinische Kompression<br />
für mehr Aktivität in Freizeit<br />
und im Beruf<br />
Entdecken Sie mehr auf der OTWorld <strong>2024</strong>. Besuchen Sie uns in Halle 5, Stand D06 / E<strong>05</strong>.<br />
Mehr zu unserem Messeprogramm: experts.bauerfeind.com/b2b/otworld24
Was sagt das Fach zur OTWorld?<br />
Alle zwei Jahre ist Leipzig für vier Tage das Epizentrum der weltweiten Orthopädie-Technik. Die OTWorld vereint<br />
Neuheiten aus Industrie und Handwerk im Rahmen der Weltleitmesse und Wissen für heute und morgen aus der<br />
Versorgung im Weltkongress. Doch wie sehen es die Fachleute aus der Branche eigentlich? Die OT-Redaktion ist auf<br />
Stimmenfang gegangen und hat Expert:innen aus dem Fach gefragt, wie sie zur OTWorld stehen und warum sich<br />
ein Besuch lohnt.<br />
Foto: Daniel Heinrich<br />
Daniel Heinrich ist seit 2019<br />
Obermeister der Orthopädietechniker-Innung<br />
Südwest.<br />
Er ist Inhaber von Heinrich &<br />
Klassmann Orthopädietechnik-Team<br />
in Koblenz und<br />
kümmert sich an der Meisterschule<br />
in Heidelberg um<br />
die Fort- und Weiterbildung<br />
des Berufsnachwuchses.<br />
OT: Wie wichtig ist die OTWorld trotz<br />
Krisen, Katastrophen und Krieg als Raum zum Austausch?<br />
Daniel Heinrich: Die OTWorld ist für mich der fachliche<br />
Austausch in unserem Arbeitskosmos. Es gibt kein anderes<br />
OT-Ereignis, welchem ich persönlich mit solch einer Vorfreude<br />
und Spannung entgegenfiebere. Der internationale<br />
und interdisziplinäre Austausch, das Treffen mit tollen<br />
Kolleginnen und Kollegen und die Aussicht auf viele interessante<br />
und innovative Produktlösungen lassen mein<br />
OT-Herz im Vorfeld schon etwas höherschlagen. Besonders<br />
liegt mir am Herzen, einen Teil dieser Begeisterung für<br />
Messe und Kongress an unsere Angestellten und an Interessierte<br />
weiterzugeben.<br />
OT: Wenn Sie an Ihre erste OTWorld-Teilnahme zurückdenken,<br />
was ist Ihnen besonders in Erinnerung geblieben?<br />
Heinrich: Ich glaube, bei meiner ersten Teilnahme war ich<br />
von der Vielfältigkeit und dem gesamten Angebot an Ausstellern<br />
und Produkten sowie von der doch für mich damals<br />
noch unbekannt großen Menge an interessierten<br />
Menschen für diesen „kleinen“ Markt Orthopädie-Technik<br />
sehr überrascht und positiv inspiriert.<br />
OT: Die OTWorld feiert – unter diesem Namen – ihren<br />
10. Geburtstag in diesem Jahr. Wie wichtig ist es, dass Weltkongress<br />
und Leitmesse die internationale OT-Gemeinschaft<br />
nach Leipzig holen und was kann das Fach von den internationalen<br />
Kolleg:innen lernen?<br />
Heinrich: Der internationale Dialog ist zwingend notwendig<br />
und essenziell, um sich gegenseitig auszutauschen,<br />
voneinander zu lernen und auch um gemeinsame Projekte<br />
und Ideen anzustoßen. Ich denke, dass wir hier in<br />
Deutschland in der Orthopädie-Technik schon ganz gut<br />
im internationalen Vergleich aufgestellt sind. Allerdings<br />
hilft der bekannte Blick über den Tellerrand definitiv,<br />
um sich mit neuen Ideen und anderen Herangehensweisen<br />
und Erkenntnissen auseinanderzusetzen oder diese<br />
überhaupt mit einzubeziehen und sich dementsprechend<br />
weiterzuentwickeln. Ich freue mich sehr auf Ideen, die irgendwo<br />
auf der Welt entstanden sind und die man dann<br />
als Fachmann auf der OTWorld entdeckt, um am Ende dadurch<br />
eine Verbesserung in der Versorgung unserer Anwender<br />
erreichen zu können. Das ist toll!<br />
Im November 2022 wurde Armin Zepf zum Obermeister<br />
der Landesinnung für Orthopädie-Technik Baden-<br />
Württemberg gewählt. Die Themen Aus-, Fort- und<br />
Weiterbildung rund um die Orthopädie-Technik sowie<br />
Digitalisierung gehören zu den Kompetenzthemen des<br />
Geschäftsführers der Häussler Technische Orthopädie<br />
GmbH in Ulm.<br />
OT: Herr Zepf, Sie beschäftigen sich in Ihrem Betrieb mit<br />
Lösungen zum Beispiel beim Positionieren im digitalen Versorgungsprozess.<br />
Haben Sie sich schon angeschaut, welche<br />
Vorträge oder Aussteller Sie in Leipzig besuchen werden, die<br />
Ihnen in diesem Bereich weiterhelfen können?<br />
Armin Zepf: Ja, wir haben bereits eine Auswahl an Vorträgen<br />
und Ausstellern ausgemacht, die sich auf digitale Lösungen<br />
im Versorgungsprozess spezialisieren, sowohl auf<br />
Produkt- als auch auf Prozessseite. Wir freuen uns auf neue<br />
Perspektiven und innovative<br />
Ansätze, um unsere<br />
Dienstleistungen im Versorgungsprozess<br />
weiter<br />
zu optimieren.<br />
OT: Die OTWorld ist ein Ort,<br />
an dem die Branche zusammenkommt,<br />
auch um in die Zukunft<br />
zu schauen. Was erwarten Sie<br />
für Trends im Jahr <strong>2024</strong>?<br />
Zepf: Ich erwarte, dass die Trends in <strong>2024</strong> stark von digitaler<br />
Integration und personalisierten Versorgungslösungen<br />
geprägt sein werden. Technologien wie künstliche Intelligenz<br />
und 3D-Druck werden eine zunehmend wichtige<br />
Rolle in der Entwicklung und Herstellung von orthopädietechnischen<br />
Hilfsmitteln spielen und ermöglichen<br />
Foto: Marc Hoerger<br />
36<br />
ORTHOPÄDIE TECHNIK <strong>05</strong>/24
ORGANIC TECHNOLOGY<br />
INSPIRED BY NATURE<br />
Entdecken Sie die Handgelenkorthesen<br />
der MANU-CAST® ORGANIC-Reihe<br />
GUTE GRÜNDE FÜR<br />
DIE ORGANIC-REIHE<br />
Leicht<br />
Atmungsaktiv<br />
Optimale Passform<br />
Hohe Atmungsaktivität<br />
und optimale<br />
Luftzirkulation<br />
durch das spezielle<br />
Abstandsgestrick<br />
Recycelte Materialien<br />
Röntgenstrahlen<br />
durchlässig<br />
Optimierter Materialeinsatz<br />
für mehr<br />
Leichtigkeit – bei hoher<br />
Stabilität aufgrund der<br />
organischen Struktur<br />
www.sporlastic.de/organic-kontakt<br />
EXKLUSIVES ORGANIC<br />
INFOPAKET SICHERN!<br />
Scannen Sie den QR-Code und fordern<br />
Sie unser exklusives Infopaket zur<br />
MANU-CAST® ORGANIC-Reihe an.<br />
Granulat aus<br />
recycelten Materialien
effizientere Patientenversorgung bei gleichbleibender Versorgungsqualität.<br />
OT: Katastrophen, Krieg und Krisen machen auch vor der OT-<br />
Branche nicht Halt. Was für eine Stimmung erwarten Sie in<br />
Leipzig – jetzt erst recht oder Ernüchterung?<br />
Zepf: Trotz der Herausforderungen, mit denen die Welt<br />
konfrontiert ist, erwarte ich eine Stimmung der Zuversicht<br />
in Leipzig. Die Branche zeigt sich resilient und bereit, gemeinsam<br />
Lösungen zu entwickeln, die nicht nur den aktuellen,<br />
sondern auch zukünftigen Anforderungen gerecht<br />
werden.<br />
Neu im Amt, aber mit Sicherheit kein Unbekannter:<br />
Michael Schäfer wurde im März zum Landesinnungsmeister<br />
in Bayern gewählt. Der Traunsteiner hat in den<br />
vergangenen Jahren in verschiedenen Ehrenämtern an<br />
der Gegenwart und Zukunft der Orthopädie-Technik<br />
mitgearbeitet. 2020 war er zudem Kongresspräsident<br />
der OTWorld.<br />
OT: Herr Schäfer, Sie waren 2020 bei der OTWorld.connect<br />
Kongresspräsident und haben dadurch einen guten Einblick in<br />
die Arbeit im Vorfeld einer OTWorld erhalten. Was macht den<br />
Kongress der OTWorld aus und wie bewerten Sie dessen<br />
Entwicklung in den vergangenen Jahren?<br />
Michael Schäfer: Die OTWorld greift die aktuellen nationalen<br />
wie internationalen Themen unseres Faches in einer<br />
gelungenen Melange aus Medizin, Wissenschaft und Technik<br />
auf und stellt diese in den unterschiedlichen Formaten<br />
der OTWorld ansprechend dar. Besonders wichtig empfinde<br />
ich in diesem Zusammenhang auch die Einbindung der<br />
verschiedenen Fachgesellschaften in das Programm. Das<br />
hat sich absolut bewährt und über die vergangenen Jahre<br />
gefestigt. Besonders wertvoll sind aus meiner Sicht jene<br />
Veranstaltungen, in denen sich die wissenschaftliche Betrachtung<br />
und das praktische Versorgungswissen die Hand<br />
geben. Beide Teile sind für die Nachhaltigkeit unserer Arbeit<br />
enorm wichtig. Dies wird einerseits durch hochkarätige<br />
Symposien und Vortragsblöcke, andererseits durch<br />
ein vielfältiges Workshopangebot mit hohem Praxisbezug<br />
untermauert. Besonders schön finde ich dabei, dass die<br />
Programminhalte auch Auszubildende und junge Nachwuchskräfte<br />
mit Themen abholen. Dass man in diesem<br />
Jahr ein spezifisches Fortbildungsprogramm für Mitarbeiter<br />
des Sanitätshauses aufgesetzt hat, erachte ich vor dem<br />
Hintergrund der aktuellen politischen Bestrebungen einer<br />
unfairen Markterweiterung auf andere Anbieter für essenziell<br />
und wichtig. Hier muss mehr denn je das Bewusstsein<br />
hin zur qualitätsorientierten Versorgung und Fachlichkeit<br />
gelenkt werden und vor allem einer ungleichen Behandlung<br />
der unterschiedlichen Akteure im Rahmen der Leistungserbringung<br />
Einhalt geboten werden.<br />
OT: Sie haben es bereits erwähnt, es wird <strong>2024</strong> einen<br />
größeren Anteil an praktischen Inhalten im Kongress geben.<br />
Wie gefällt Ihnen dieser Ansatz, dass Mitarbeitende im<br />
Sanitätshaus die Möglichkeit haben für ihren Berufsalltag<br />
etwas mitzunehmen?<br />
Schäfer: In Zeiten der Digitalisierung müssen wir sehr darauf<br />
achten, dass das Versorgungswissen, die Erfahrung und<br />
das nach wie vor benötigte<br />
handwerkliche Geschick<br />
nicht unter die Räder<br />
kommen, denn letztendlich<br />
steht für unsere<br />
Patienten ein adäquates<br />
und für ihren Körper gut<br />
angepasstes Versorgungsergebnis<br />
im Vordergrund. Daher<br />
erachte ich den Fokus auf die praktischen<br />
Inhalte und die Weitergabe von Versorgungserfahrung<br />
und Versorgungswissen als ungemein wichtig. Die<br />
Patienten interessiert in der Anwendung ihres Hilfsmittels<br />
nicht vordergründig, in welchem Workflow und dazugehörigen<br />
Versorgungsprozess sie zu ihrem Hilfsmittel gelangen,<br />
sondern vielmehr wie professionell sie betreut werden<br />
und wie gut sich die Versorger auf ihre Probleme und<br />
Gegebenheiten einstellen. Für diese Anforderungen benötigen<br />
wir auch in Zukunft sehr gut ausgebildete Fachkräfte,<br />
die dieses Versorgungswissen aufnehmen, verarbeiten<br />
und in die heutige Versorgungslandschaft transportieren<br />
und übersetzen. Dass ein Fokus in diesem Jahr darin liegt,<br />
die OTWorld zunehmend auch für die Inhalte der Mitarbeiter<br />
im Sanitätshaus zu erschließen, erachte ich für äußerst<br />
wichtig und wertvoll. Wir müssen den aktuellen Bestrebungen<br />
der Politik unsere geballte Beratungs- und Versorgungskompetenz<br />
entgegensetzen, denn das ist der Wert<br />
unserer Arbeit, der auch bei den Patienten ankommt und<br />
geschätzt wird. Gerade zum jetzigen Zeitpunkt ist es enorm<br />
wichtig, dass die unterschiedlichen Disziplinen unseres Faches<br />
einen engen Schulterschluss und Geschlossenheit demonstrieren.<br />
OT: Erstmals können <strong>2024</strong> Besucher:innen bereits im<br />
Kongress programm die sogenannten Take-Home-Messages sehen.<br />
Hilft diese Maßnahme aus Ihrer Sicht, den eigenen Besuch<br />
noch besser planen zu können?<br />
Schäfer: Die Take-Home-Messages veranschaulichen die<br />
Inhalte des Kongressprogramms verständlich und helfen<br />
den Besuchern durch nützliche Erklärungen und Zieldefinitionen<br />
bei der Programmauswahl. Das Programm<br />
und die Vorankündigung profitieren auf jeden Fall von<br />
den zusätzlichen Take-Home-Messages, weil diese nicht<br />
nur Lust auf das Thema machen, sondern auch die Transparenz<br />
zu den Inhalten erhöhen. Vor allem den vielseits interessierten<br />
Kongressbesuchern erleichtern diese Messages<br />
die Auswahl bei parallelen Programminteressen. Aus meiner<br />
Sicht sollte das unbedingt beibehalten werden.<br />
Foto: BIV-OT/Chris Rausch<br />
38<br />
ORTHOPÄDIE TECHNIK <strong>05</strong>/24
Foto: BIV-OT/Chris Rausch<br />
Thomas Münch war langjähriger<br />
Obermeister der<br />
Innung für Orthopädie-<br />
Technik Düsseldorf und<br />
gehört dem Vorstand<br />
des BIV-OT an.<br />
OT: Herr Münch, Sie sind im<br />
Pilotprojekt „E-Verordnung“ des<br />
Bundesinnungsverbandes für Orthopädie-Technik<br />
der Ansprechpartner aus dem Vorstand. Was<br />
für ein Interesse erhoffen Sie sich bei der kommenden OTWorld<br />
von Betrieben bei diesem Thema?<br />
Thomas Münch: Ich kann mir gut vorstellen, dass die<br />
Besucher sich sehr intensiv an den Ständen des BIV-OT<br />
und der Softwareanbieter über den Stand des Piloten informieren<br />
werden. Insbesondere über die Vorteile der Digitalisierung.<br />
Aber auch über das Wie. Wie kann es funktionieren,<br />
wie wird es funktionieren und wie kann ich mitmachen?<br />
OT: Digitalisierung ist ein Thema, das insgesamt die Branche<br />
berührt. Ist es aus Ihrer Sicht im Kongress und auf der Messe<br />
entsprechend vertreten?<br />
Münch: Ich finde, dass die Digitalisierung auf der OTWorld<br />
einen festen Platz hat. Digitalisierung ist ja nicht nur die E-<br />
Verordnung, sondern im Besonderen auch die Maßnahme<br />
und das Modellieren. Ich selbst bin sehr gespannt, welche<br />
neuen Scanner zur Körperformerfassung angeboten werden<br />
und wie sich die Preissituation darstellt.<br />
OT: Ihre Söhne sind ebenfalls im Fach und dem Familienbetrieb<br />
aktiv. Wie unterscheiden sich die Interessen in Bezug auf den<br />
OTWorld-Besuch?<br />
Thomas Münch: Diese Frage kann ich nicht beantworten,<br />
aber ich kann ja meine Söhne fragen!<br />
Martin Münch: Meine Interessen bezüglich der OTWorld<br />
sind der Austausch mit den Kollegen sowie das Kennenlernen<br />
der neuen Produkte der Hersteller, um hier die Möglichkeit<br />
aufgezeigt zu bekommen, wie wir unsere Anwender<br />
noch besser versorgen können. Im Bereich der Digitalisierung<br />
ist für mich sehr interessant zu sehen, was es für neue<br />
Möglichkeiten der Scantechnik gibt.<br />
Ralf Münch: Für mich ist die OTWorld der Ort, an dem alle<br />
zusammenkommen, um sich gemeinsam auszutauschen,<br />
und zwar mit dem Hauptaugenmerk auf unsere Anwender.<br />
Wie versorge ich meine Patienten womit am besten?<br />
Und die beste Lösung muss hier immer individuell sein.<br />
Ich kann nicht alles scannen, aber ich kann auch vielleicht<br />
nicht alles per Gipsabdruck lösen. Die Digitalisierung ist<br />
für mich einfach nur eine ergänzende Möglichkeit der Versorgung.<br />
Sie wird uns Techniker nie verdrängen können.<br />
Wir freuen uns auf<br />
Ihren Besuch:<br />
OTWorld Leipzig <strong>2024</strong><br />
Halle 3, Stand H17<br />
Mehr Selbstbestimmung für Ihre Patient:innen –<br />
dank ReadyWrap ® .<br />
Die Alternative in der initialen Entstauungsphase<br />
bei Lymphödem, bei einem<br />
ausgeprägten venösen Ödem und bei UCV.<br />
Besuchen Sie unsere Workshops im Messehaus:<br />
Medizinische Adaptive Kompressionssysteme –<br />
neue Behandlungsmöglichkeit in der Kompression:<br />
leitliniengerecht und vorteilhaft<br />
14.<strong>05</strong>. 11:00–11:45 Uhr Raum M22, Ebene 0<br />
Versorgung von Schwangeren mit Hilfsmitteln:<br />
Wie binde ich eine attraktive Zielgruppe<br />
an mein Sanitätshaus?<br />
16.<strong>05</strong>. 12:00–12:45 Uhr Raum M24, Ebene -1<br />
www.Lohmann-Rauscher.com<br />
39
Christiana Hennemann ist Geschäftsführerin des Vereins<br />
Rehakind. Die Fördergemeinschaft wurde im Jahr 2000<br />
gegründet und setzt sich für die speziellen Bedürfnisse<br />
von Kindern und Jugendlichen mit Handicap und Hilfsmittelbedarf<br />
ein.<br />
OT: Rehakind ist langjähriger Partner der OTWorld und in<br />
diesem Jahr auf der Messe als Teil der „OTWorld.friends“<br />
vertreten. Sie haben diesmal aber keinen eigenen Stand.<br />
Werden Sie auf andere Weise die Fahnen für die Versorgung<br />
von Kindern mit Behinderungen hochhalten?<br />
Christiana Hennemann: Sicherlich, ich werde mit meiner<br />
Kollegin die Chance nutzen, uns dort mit vielen Fachinformationen<br />
aus dem spannenden Kongress zu versorgen<br />
und natürlich zu „netzwerken“ – das geht in Leipzig<br />
immer besonders gut. Der Verein muss seine Ressourcen<br />
bewusst einteilen, und in diesem Jahr steht vor allem die<br />
politische Arbeit für die Sicherung und Optimierung zeitnaher<br />
und bedarfsgerechter Hilfsmittelversorgung auf<br />
dem Programm von Rehakind e. V. Als einzigartiges neutrales<br />
Netzwerk arbeiten wir eng mit verschiedenen medizinischen,<br />
therapeutischen und pflegerischen Fachgesellschaften<br />
und vor allem der Selbsthilfe zusammen und<br />
müssen miteinander eine starke Stimme für die kleine<br />
Gruppe junger Menschen bilden. Die Chancen der Inklusion<br />
– selbst in den ersten Arbeitsmarkt – sind durch neue<br />
digitale Hilfsmittel größer denn je, das muss auch in die<br />
Köpfe der Entscheider! Außerdem werden die Familien<br />
insgesamt durch gute Hilfsmittelversorgung der Kinder<br />
entlastet, sodass die zum Teil gut ausgebildeten Mütter in<br />
ihre Berufe zurückkehren können, das ist angesichts des<br />
Fachkräftemangels eine wichtige Entwicklung und sichert<br />
auch gegen Altersarmut ab.<br />
OT: Sie haben den Vorsitz des Workshops „Die Aufrichtung<br />
im Sitzen bei neuroorthopädischen Erkrankungen“ inne.<br />
Was erwartet die Teilnehmenden hier?<br />
Hennemann: Julia Heil, schon lange Rehakind-Mitglied<br />
und auch Rehakind-Referentin, ist eine echte Praktikerin:<br />
Über 25 Jahre als Therapeutin und Hilfsmittelversorgerin<br />
tätig, wird sie ihre Erfahrungen in Sachen „Sitzen und Positionieren“<br />
einbringen, denn schließlich ist das unsere<br />
„Hauptbeschäftigung<br />
den Tag über“. Dazu<br />
die in ihrem Neuroorthopädie-Studium<br />
an der Donau-<br />
Universität Krems<br />
gewonnenen Erkenntnisse,<br />
die langfristig<br />
zu mehr Evidenzbasierung<br />
der<br />
Christiana Hennemann,<br />
Geschäftsführerin Rehakind e. V.<br />
Versorgung führen.<br />
Dies ist zunehmend<br />
wichtig, denn Kostenträger<br />
werden in<br />
Zeiten knapper Budgets<br />
danach schauen, welche Versorgungen auch größtmögliche<br />
Evidenz aufweisen. Wissenschaft bei solch kleinen<br />
„Fallzahlen“ ist nicht einfach, vor allem gerade bei<br />
Kindern, deren Entwicklung sehr individuell ist. Aber: Es<br />
gibt Ansätze, und diese stellen wir hier praxisnah vor und<br />
zur Diskussion.<br />
OT: „Kinder-, Jugend- und Neuroorthopädie“ ist in diesem Jahr<br />
ein Schwerpunktthema des Kongresses. Was erhoffen Sie sich –<br />
vor dem Hintergrund Ihrer eigenen Vereinsarbeit – davon?<br />
Hennemann: Viele der in Leipzig vortragenden Referent:innen<br />
sind seit Jahren auch im Beirat von Rehakind<br />
oder beim Focus-CP-Rehakind-Kongress aktiv. Es zeigt<br />
sich, dass nur interdisziplinäre und interprofessionelle<br />
Zusammenarbeit auf Augenhöhe zum Erfolg bei den jungen<br />
Patient:innen führt, und sich so auch volkswirtschaftlich<br />
rechnet. Neurologisch-orthopädische Behinderungen<br />
bleiben „ein Leben lang“, und nur gut versorgte Kinder<br />
und Jugendliche werden später möglichst selbstständige<br />
Erwachsene – unter Umständen mit weniger Pflegebedarf<br />
–, die mit einer zunehmend längeren Lebenserwartung<br />
auch aktiv am gesellschaftlichen Leben in allen Bereichen<br />
teilhaben können. Die Benennung von Chancen und Problemen<br />
in diesem Arbeitsfeld bringt öffentliche Aufmerksamkeit<br />
und damit auch mehr Einsatzmöglichkeiten von<br />
innovativen Therapien und Hilfsmitteln zum Wohle der<br />
jungen Menschen.<br />
Foto: Rehakind e. V.<br />
Foto: Simone Borchardt<br />
Simone Borchardt sitzt seit 2021 im<br />
Deutschen Bundestag. Die CDU-<br />
Politikerin aus Mecklenburg-<br />
Vorpommern ist Mitglied im<br />
Gesundheits ausschuss.<br />
Die Hilfsmittelbranche ist<br />
ein wichtiger Bestandteil<br />
der Gesundheitsversorgung<br />
unseres Landes und als solche<br />
nicht wegzudenken. Dabei ist<br />
die Bandbreite der Produktpalette<br />
sehr hoch – egal ob es sich um niedrigschwellige Hilfsmittel<br />
wie Kompressionsstrümpfe oder um komplexe Hilfsmittel<br />
wie Rollstühle handelt: Die Patientenprofile sind divers,<br />
dementsprechend ist der Einsatz von Hilfsmitteln vielfältig.<br />
Oftmals kommen diese kurativ nach Operationen zum<br />
Einsatz, um Patientinnen und Patienten auf dem Weg der<br />
Genesung zu helfen. Auch für den Ausgleich von Nachteilen,<br />
die durch eine Behinderung entstehen, ist eine adäquate<br />
Versorgung mit Hilfsmitteln unabdingbar, um eine<br />
vollwertige gesellschaftliche Teilhabe für die Betroffenen<br />
zu gewährleisten.<br />
Gerade in der Prävention ist die Bedeutung der Hilfsmittel<br />
in den letzten Jahren angestiegen. Viele repräsen-<br />
40<br />
ORTHOPÄDIE TECHNIK <strong>05</strong>/24
tative Studien haben gezeigt, dass der Einsatz von passenden<br />
Hilfsmitteln Krankheiten effektiv vorbeugen kann.<br />
So können Kosten eingespart und Ressourcen effektiv<br />
gehoben werden, indem etwa komplexe, kostspielige Operationen<br />
oder die stationäre Pflege vermieden oder hinausgezögert<br />
werden.<br />
Insgesamt zeigt sich also, dass wir den Hilfsmittelmarkt<br />
besser verstehen und ihn ganzheitlich betrachten müssen.<br />
Die bedarfsgerechte Versorgung der Patientinnen und Patienten<br />
mit innovativen Hilfsmitteln, die dem aktuellen<br />
Stand der medizinischen Erkenntnis und des technischen<br />
Fortschrittes entsprechen, ist uns als CDU/CSU-Bundestagsfraktion<br />
ein besonders wichtiges Anliegen. Bezogen auf bereits<br />
CE-gekennzeichnete Hilfsmittel heißt das: Wir brauchen<br />
keine zusätzliche Zertifizierung der Zertifizierung. Ist<br />
der Nutzen nachgewiesen, müssen Neuerungen – und sei es<br />
als Pilot – schneller ins Hilfsmittelverzeichnis und damit in<br />
den Markt kommen. Dafür müssen wir Regularien schaffen,<br />
der Abbau einschränkender bürokratischer Regelungen<br />
muss unbedingt angegangen werden. Ferner bedarf es einer<br />
Digitalisierung, die Entlastung schafft und Innovationen<br />
fördert. Die beiden Digitalgesetze tun dies nicht, sie sind in<br />
dieser Form eher ein zusätzlicher Ballast als eine Erleichterung<br />
für Leistungserbringer und Betroffene.<br />
Es liegt auf der Hand: Der Hilfsmittelmarkt muss gestärkt<br />
werden. Denn nur durch einen voll funktionsfähigen<br />
Hilfsmittelmarkt, der die notwendige Flexibilität besitzt,<br />
kann das deutlich angeschlagene Gesundheitssystem<br />
spürbar entlastet werden. Dies ist auch für die dauerhafte<br />
internationale Anschlussfähigkeit des deutschen Hilfsmittelmarkts<br />
unerlässlich!<br />
Deswegen freut es mich sehr, dass sich Vertreterinnen<br />
und Vertreter der Hilfsmittelbranche zur OTWorld <strong>2024</strong> in<br />
Leipzig zusammenfinden werden, um sich über zukunftsfähige<br />
Lösungen in der Hilfsmittelversorgung auszutauschen.<br />
Ich wünsche allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern<br />
viele bereichernde Erkenntnisse, spannende Diskussionen<br />
und neue Inspirationen!<br />
Foto: Kristine Lütke<br />
Kristine Lütke ist seit 2021 Bundestagsabgeordnete<br />
für die FDP und<br />
Sucht- und drogenpolitische<br />
Sprecherin und Vorsitzende<br />
der AG Gesundheit der Fraktion<br />
der Freien Demokraten<br />
im Bundestag.<br />
Etwa ein Viertel der Versicherten<br />
in der gesetzlichen<br />
Krankenversicherung benötigt<br />
eine Versorgung mit medizinischen<br />
Hilfsmitteln. Diese können<br />
unerlässlich sein, um Gesundheit zu erhalten oder um<br />
körperliche Defizite auszugleichen. Hier geht es beispielsweise<br />
um Brillen, Einlagen, Gehstützen oder Windeln<br />
als Inkontinenzhilfen. 2020 hatte die gesetzliche Krankenversicherung<br />
28 Millionen Hilfsmittel-Anträge zu bescheiden.<br />
Für mich bedeutet das: Eine qualitativ hochwertige<br />
Hilfsmittelversorgung ist ein wichtiger Baustein für<br />
die Sicherung der Teilhabe und der Lebensqualität der Patientinnen<br />
und Patienten. Denn selbstverständlich wollen<br />
die betroffenen Antragstellenden schnell und vor allem<br />
gut versorgt werden.<br />
Die OTWorld in Leipzig ist daher ein Schaufenster sowie<br />
die größte und international führende Branchenplattform<br />
für Hersteller, Händler und Leistungserbringer in der<br />
modernen Hilfsmittelversorgung. In ihrer einzigartigen<br />
Kombination aus Weltkongress und Weltleitmesse bringt<br />
die OTWorld alle zwei Jahre Expertinnen und Experten aus<br />
allen fünf Kontinenten zusammen. Sie alle haben das Ziel,<br />
die OTWorld als gemeinsames zentrales Innovations- und<br />
Dialogforum für eine individuelle und vor allem patientengerechte<br />
Versorgung zu präsentieren.<br />
Dabei sind eine patientenzentrierte Versorgung und gute<br />
Arbeitsbedingungen für Leistungserbringer zwei Seiten einer<br />
Medaille. Als Freidemokratin ist mir wichtig, dass auch<br />
weiterhin die freien Berufe im Gesundheitswesen gestärkt<br />
werden. Niedergelassene Ärztinnen und Ärzte, Zahnärztinnen<br />
und Zahnärzte und selbstverständlich die Heilmittelerbringerinnen<br />
und -erbringer müssen in medizinischen Fragen<br />
autonom und frei von Weisungen Dritter entscheiden<br />
können. Denn die Therapiefreiheit der Behandlung kommt<br />
am Ende den Patientinnen und Patienten zugute. Freiheit<br />
und Verantwortung sind die Basis der Vertrauensbeziehung<br />
zwischen Leistungserbringern und Patienten.<br />
Indem wir den Menschen in den Gesundheitsberufen<br />
vertrauen, schaffen wir den Raum für Innovationen. Für<br />
mich ist klar, dass diese dann auch die Patientinnen und<br />
Patienten schneller erreichen müssen. Im Hilfsmittelverzeichnis<br />
müssen die Produktgruppen schnell und kontinuierlich<br />
weitergeschrieben werden. Die bedarfsgerechte Versorgung<br />
der Patientinnen und Patienten mit innovativen<br />
Hilfsmitteln, die dem aktuellen Stand der medizinischen<br />
Erkenntnis und des technischen Fortschritts entsprechen,<br />
ist mir ein wichtiges Anliegen. Die Versicherten müssen<br />
sich auf eine Hilfsmittelversorgung verlassen können, die<br />
der individuellen Therapiesituation entspricht.<br />
Gerade der präventive Charakter von Hilfsmitteln darf<br />
nicht unterschätzt werden. Das zeigt auch eine Umfrage<br />
des Instituts für Demoskopie Allensbach aus dem vergangenen<br />
Jahr. Menschen, die medizinische Hilfsmittel nutzten,<br />
benötigten nach eigenen Angaben weniger Medikamente,<br />
konnten operative Eingriffe oft vermeiden, sind mobiler<br />
und gewinnen dadurch schlussendlich an Lebensqualität.<br />
Es zeigt sich: Hilfsmittel haben eine hohe Relevanz – für<br />
den einzelnen Betroffenen, aber auch für das Gesundheitssystem<br />
im Ganzen.<br />
ORTHOPÄDIE TECHNIK <strong>05</strong>/24<br />
41
Mit Prothese ins Weltall<br />
Der Wendepunkt im Leben von John McFall ist auf das<br />
Jahr 2000 datiert. Der damals 19-Jährige verunfallte<br />
mit seinem Motorrad und sein rechtes Bein oberhalb des<br />
Knies wurde infolgedessen amputiert. Doch statt Selbstmitleid<br />
oder Jammern schöpfte der Brite Kraft aus der Situation<br />
– auch dank moderner Hilfsmittelversorgung. Nur<br />
drei Jahre nach seinem Unfall stieg er ins Lauftraining ein.<br />
Bei seinem ersten internationalen Wettkampf, den Europameisterschaften<br />
des Internationalen Paralympischen Komitees<br />
(IPC) in Finnland, holte er 20<strong>05</strong> Bronze im 200-Meter-Lauf.<br />
Dem folgten zahlreiche Medaillengewinne, darunter<br />
Silber für seine persönliche Bestzeit über 100 Meter<br />
von 12,70 Sekunden beim Internationalen Bayer-Leichtathletik-Wettbewerb<br />
in Leverkusen 2006. Zwei Weltmeistertitel<br />
holte er 2007 bei der World-Wheelchair-and-Amputee-Sports-Federation<br />
über 100 Meter und 200 Meter. 2008<br />
trat er zudem für Großbritannien bei den Paralympics in<br />
Peking in der Klasse der Läufer mit Amputationen oberhalb<br />
des Knies an und brachte für seine Leistungen über 100 Meter<br />
Bronze mit nach Hause.<br />
John McFall während des Astronautentrainings im Astronautenzentrum<br />
der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) in Köln.<br />
Foto: ESA<br />
Auf Sport- folgt Medizinstudium<br />
Auch beruflich ist John McFall durchgestartet: Seinem<br />
Sportstudium schloss er noch ein Medizinstudium an. Von<br />
2014 bis 2016 arbeitete er als Foundation Doctor im britischen<br />
National Health Service in verschiedenen medizinischen<br />
und chirurgischen Fachbereichen in Südost-Wales.<br />
Danach absolvierte er bis 2018 eine chirurgische Grundausbildung<br />
in Allgemeinchirurgie, Urologie sowie Traumatologie<br />
und Orthopädie. Im Jahr 2018 sicherte er sich einen<br />
Platz im nationalen Trauma- und Orthopädie-Facharztausbildungsprogramm<br />
des Vereinigten Königreichs und ist<br />
heute Facharzt für Traumatologie und Orthopädie.<br />
Nächstes Ziel:<br />
Die Eroberung des Weltraums<br />
Dass er gerne außergewöhnliche Reisen unternimmt und<br />
dass es kaum Grenzen gibt, was er mit seiner Prothese erreichen<br />
kann, bewies McFall 2008: Nach den Paralympischen<br />
Spielen in Peking machte er sich zu Fuß auf den Heimweg<br />
ins Vereinigte Königreich. Nach den nächsten Zielen gefragt,<br />
sagte er damals, er wolle irgendwann die Sahara<br />
durchqueren, den Atlantik mit dem Ruderboot überqueren<br />
und eine Lizenz für den freien Fall erwerben.<br />
Seit Kurzem steht die Raumfahrt auf McFalls To-do-Liste:<br />
Im November 2022 wurde er als Mitglied der Astronautenreserve<br />
der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) ausgewählt,<br />
um an der Machbarkeitsstudie „Fly!“ teilzunehmen.<br />
Damit will die ESA Hindernisse für Astronaut:innen<br />
mit körperlichen Einschränkungen in der Raumfahrt verstehen<br />
und überwinden. Das Ziel dieser Studie ist es, sich<br />
auf McFalls vielfältiges Fachwissen zu stützen, um Möglichkeiten<br />
zu erforschen, wie Menschen mit körperlichen<br />
Behinderungen – insbesondere mit einer Amputation der<br />
unteren Gliedmaßen – als voll integrierte Mitglieder einer<br />
Astronautencrew während einer Langzeitmission zur<br />
Internationalen Raumstation (ISS) aufgenommen werden<br />
können.<br />
Mit der Ausschreibung hat die ESA anerkannt, dass es<br />
Menschen geben könnte, die geistig und mental für den<br />
Job qualifiziert sind, aber bisher aus medizinischen Gründen<br />
nicht ausgewählt worden wären. Für die Erforschung<br />
des Weltraums durch den Menschen bringt der mittlerweile<br />
43-Jährige nicht nur den wissenschaftlichen und medizinischen<br />
Hintergrund sowie körperliche Fitness mit. Er eröffnet<br />
der ESA ganz neue Perspektiven und konnte gerade<br />
als Mensch mit einer körperlichen Beeinträchtigung schon<br />
sehr viele Hindernisse überwinden.<br />
Außergewöhnliche Belastungen<br />
für Mensch und Prothese<br />
Damit stellt sich John McFall nun gänzlich neuen Herausforderungen:<br />
ein Überlebenstraining auf der Ostsee, die<br />
Anprobe eines Raumanzugs, der Ein- und Ausstieg in eine<br />
Raumkapsel, Zentrifugen-Training. Gemeinsam mit dem<br />
Hersteller Ottobock unterzieht die ESA aktuell die Prothesentechnik<br />
intensiven Tests. Und in einem Interview der<br />
Wochenzeitung „Die Zeit“ danach gefragt, ob sein Handicap<br />
im All nicht sogar ein Vorteil wäre, antwortet McFall:<br />
„Im Weltraum ist jeder behindert. Jeder Mensch muss mit<br />
dieser Umgebung erst mal klarkommen.“<br />
Auf seinen Motorradunfall angesprochen, sagte er zudem,<br />
es sei „in gewisser Weise das Beste gewesen, was mir je<br />
passiert ist. Er hat mir einen Fokus gegeben, einen Antrieb,<br />
jeder Tag ist eine neue Herausforderung. (…) Ich hatte immer<br />
eine Liste von Zielen und Wünschen, die sich nach meinem<br />
Unfall nicht geändert haben – sie haben nur die Richtung<br />
gewechselt. Der Verlust meines Beins hat mein Leben<br />
verändert, aber er hat nicht verändert, wer ich bin.“<br />
Zur Eröffnung der OTWorld <strong>2024</strong> spricht John McFall<br />
am Dienstag, 14. Mai <strong>2024</strong>, über seine „Mission Possible“.<br />
Start der Veranstaltung ist um 16:45 Uhr.<br />
42<br />
ORTHOPÄDIE TECHNIK <strong>05</strong>/24
OTWorld-Daily<br />
Tägliche Updates zu Messe und Kongress<br />
Im Aufzug, im (Hotel-)Bett, auf dem Weg zur Leipziger<br />
Messe oder auch daheim: Der OTWorld-Daily ist der tägliche<br />
Newsletter, der alle wichtigen Informationen rund um<br />
Weltleitmesse und Weltkongress bereithält. Jeden Morgen<br />
kommt er pünktlich um 7 Uhr in das eigene E-Mail-Postfach<br />
und hält Tipps für die Tagesplanung parat sowie Neuigkeiten<br />
aus Industrie und auch eine Rückschau auf interessante<br />
Highlights des Vortags.<br />
Bereits vor zwei Jahren hat der Verlag Orthopädie-Technik<br />
als exklusiver Medienpartner der OTWorld dieses Format<br />
ins Leben gerufen – mit Erfolg. In dem täglichen Newsletter<br />
gibt es für Besucher:innen der OTWorld wertvolle<br />
Hinweise aus der Redaktion zu den Highlights des jeweiligen<br />
Tages im Kongressprogramm.<br />
In den „Tipps des Tages“ findet jede Besucherin bzw. jeder<br />
Besucher eine Inspiration für einen tollen Vortrag oder<br />
einen hilfreichen Workshop. Natürlich handelt es sich<br />
dabei um eine Vorauswahl, die ein möglichst breites Themenspektrum<br />
erfasst, es empfiehlt sich selbstverständlich,<br />
das Kongressprogramm noch einmal selbst in die Hand zu<br />
nehmen.<br />
Einen Vorgeschmack auf die Neuheiten aus der Industrie<br />
liefert die „Innovation des Tages“. Dort verraten die<br />
Hersteller, was Besucher:innen auf der OTWorld an dem jeweiligen<br />
Messestand kennenlernen und auch einmal selbst<br />
in die Hand oder in Augenschein nehmen können, um die<br />
neuesten Versorgungsmöglichkeiten zu entdecken. Wo<br />
sonst kann man die Zukunft in den Händen halten, wenn<br />
nicht auf der OTWorld?<br />
Darüber hinaus wird die Redaktion auf exklusiven Stimmenfang<br />
gehen und mit Personen rund um Messe- und<br />
Kongressgeschehen sprechen, um Eindrücke von den vier<br />
Tagen in Leipzig zu sammeln und auch für die Daheimgebliebenen<br />
das OTWorld-Feeling einzufangen.<br />
Der OTWorld-Daily erscheint bereits ab dem Vortag<br />
der Messe, 13. Mai, um bei der Anreise gen Leipzig<br />
den geeig neten Lesestoff parat zu halten. Und natürlich<br />
dürfen die Höhepunkte des Freitag nicht fehlen, deswegen<br />
geht der Daily am Dienstag, 21. Mai, noch einmal<br />
in die Verlängerung und liefert das<br />
Wichtigste rund um die OTWorld ins<br />
E-Mail-Postfach.<br />
Anmeldungen für den OTWorld-<br />
Daily sind ab sofort über den nebenstehenden<br />
QR-Code möglich oder auf<br />
dem Fachportal 360-ot.de.<br />
Die COVVI Hand<br />
Bald bei ORTHO-REHA Neuhof erhältlich<br />
• Robust & vielseitig einsetzbar<br />
• Kompatibel mit COAPT Gen2<br />
• In drei Größen & vier Farben erhältlich<br />
Live erleben auf der OTWorld<br />
vom 14. - 17. Mai <strong>2024</strong><br />
Halle 5 | Stand D20/E21<br />
www.ortho-reha-neuhof.de
OTWorld bietet „Tag des E-Rezeptes“<br />
Am Donnerstag, 16. Mai <strong>2024</strong>, wird es auf der OTWorld<br />
in Leipzig einen „Tag des E-Rezeptes“ mit einem speziellen<br />
Rahmenprogramm geben. Besucher:innen können<br />
sich über den gesamten Prozess von der elektronischen Verordnung<br />
(E-Verordnung) des Arztes bzw. der Ärztin bis hin<br />
zur Abrechnung informieren. Ein Highlight: Erstmals können<br />
alle Besucher:innen die Ausstellung und Einlösung einer<br />
E-Verordnung selbst durchspielen und die Verarbeitung<br />
in der Branchensoftware selbst testen.<br />
Zudem wird es die Möglichkeit geben, an einem geführten<br />
Messe rundgang zum gesamten Themenspektrum teilzunehmen:<br />
Neben der elektronischen Verordnung geht es<br />
auch um die Telematikinfrastruktur (TI) und die Kartenausgabe<br />
durch die Handwerkskammern. Ein Vortragsprogramm<br />
und die Möglichkeit, persönlich mit den Projektverantwortlichen<br />
ins Gespräch zu kommen, runden das<br />
Programm ab.<br />
Die E-Verordnung für Hilfsmittel soll zum 1. Juli 2027<br />
in Deutschland analog zum E-Rezept für Arzneimittel für<br />
Leistungserbringer im Bereich Hilfsmittel eingeführt werden.<br />
Bereits im Sommer diesen Jahres beginnt die Ausgabe<br />
des für die TI-Nutzung nötigen elektronischen Berufsausweises<br />
(eBA) durch erste Handwerkskammern. Ab Anfang<br />
2025 soll dann flächendeckend die Beantragung der Ausweise<br />
in Kartenform möglich sein. Das Thema darf daher<br />
auf der OTWorld nicht fehlen. Weitere Projekte, die sich<br />
mit der Umsetzung der Digitalisierung befassen, werden<br />
deshalb zum ersten „Tag des E-Rezeptes“ vorgestellt. An<br />
diesem Tag bekommen Interessierte die Chance, schon vor<br />
dem Stichtag 1. Juli 2027 die nötigen Informationen zur<br />
Einführung der E-Verordnung für Hilfsmittel einzuholen<br />
und erste Kontakte zu knüpfen. So soll ein reibungsloser<br />
Übergang von der analogen zur digitalen Verordnung sichergestellt<br />
werden.<br />
E-Verordnung für orthopädische<br />
Hilfsmittel im Fokus<br />
Der Bundesinnungsverband für Orthopädie-Technik (BIV-<br />
OT) bietet auf seiner Standpräsenz in Halle 3 – direkt gegenüber<br />
des Kongresseingangs – für Interessierte sogenannte<br />
„Faktensnacks“ zum Pilotprojekt E-Verordnung<br />
für orthopädische Hilfsmittel an. In entspannter Café-<br />
Atmosphäre können die Besucher:innen in den Dialog mit<br />
den Vertreter:innen aus Haupt- und Ehrenamt kommen<br />
und dort ihre Fragen platzieren und mitdiskutieren. Darüber<br />
hinaus wird es in Zusammenarbeit mit den beteiligten<br />
Projektpartnern ein besonderes Programm zum Thema<br />
E-Rezept geben. Am Stand des BIV-OT wird sich erstmals<br />
Der offizielle, tägliche Newsletter<br />
des Verlags Orthopädie-Technik<br />
zur OTWorld<br />
Jetzt<br />
kostenlos<br />
anmelden<br />
Ist beim Bundesinnungsverband<br />
für Orthopädie-<br />
Technik der Ansprechpartner<br />
zum Thema Pilotprojekt<br />
E-Verordnung: Vorstandsmitglied<br />
Thomas Münch.<br />
für alle Besucher:innen die Gelegenheit bieten, eine E-Verordnung<br />
für Hilfsmittel auszustellen, mit der dann bei den<br />
Softwareanbietern der Opta-Data-Gruppe sowie Carelogic<br />
und Top-M der Gesamtprozess live getestet werden kann.<br />
Außerdem wird es vormittags und nachmittags vom BIV-<br />
OT begleitete Messerundgänge geben, bei denen der Fokus<br />
auf der Software und der TI liegen wird. Hier können alle<br />
Fragen rund um die technischen Komponenten und Voraussetzungen<br />
gestellt werden. Auch ein Vortragsprogramm<br />
wird es geben.<br />
Expert:innen beantworten Fragen<br />
Neben den festen Programmpunkten des Tages wird es für<br />
Besucher:innen ebenso möglich sein, sich eigenständig<br />
über die Einführung der E-Verordnung für orthopädische<br />
Hilfsmittel zu informieren. Die Projektpartner beantworten<br />
den Besucher:innen ihre Fragen an ihren Ständen. So<br />
können sich Interessierte gezielt Informationen einholen<br />
und sich für eine reibungslose Einführung vernetzen.<br />
Thomas Münch ist im Vorstand des Bundesinnungsverbandes<br />
für Orthopädie-Technik mit der Leitung des Pilotprojekts<br />
E-Verordnung betraut. Auf der OTWorld können<br />
Betriebe erstmals sehen, wie die Theorie der E-Verordnung<br />
in der Praxis aussieht.<br />
Foto: BIV-OT/Chris Rausch<br />
44<br />
ORTHOPÄDIE TECHNIK <strong>05</strong>/24
@bebeltyson<br />
ERLEBEN SIE INNOVATION IN AKTION<br />
SYNSYS<br />
@sophie_loubet<br />
It’s Your Choice!<br />
KINTERRA<br />
Karbon und Hydraulik<br />
Einfach digital mit Orten<br />
Karbonfeder-Füße<br />
RUSH Glasfaser-Füße<br />
Wir sind dabei!<br />
Wir sind Aussteller auf der OTWorld.<br />
Treffen Sie unsere wunderbaren Ambassadors<br />
und das Team von PROTEOR zum inspirierenden<br />
Austausch auf Augenhöhe.<br />
Wir freuen uns über Ihren Besuch auf unserem<br />
Messestand B20/C21 in Halle 1.<br />
Internationale Fachmesse und Weltkongress<br />
14. – 17. Mai <strong>2024</strong><br />
Leipziger Messe<br />
www.ot-world.com<br />
Partnerland<br />
Frankreich
Stimmen aus der Branche<br />
An keinem anderen Ort kommen so viele Produkte und Neuheiten zusammen wie auf der OTWorld. Viele haben<br />
sich bereits etabliert, andere müssen den Weg in die Versorgung noch finden. Während sich die Besucher:innen auf<br />
der Messe über die Innovationen der Branche informieren können, springt auch die OT auf den folgenden Seiten<br />
von Stand zu Stand. Industriepartner verraten, was die Besucher:innen in Leipzig erwartet und welchen Highlights<br />
sie entgegenfiebern.<br />
Foto: Ottobock<br />
Oliver Jakobi,<br />
CEO Ottobock<br />
Die internationale O&P-Branche<br />
kommt in Leipzig zusammen<br />
– ein optimaler Anlass,<br />
um eine Weltpremiere zu feiern:<br />
Mit unserem neuen Prothesenkniegelenk<br />
setzen wir<br />
Maßstäbe. Anwenderinnen<br />
und Anwender, die die Prothese<br />
schon testen konnten, sind<br />
begeistert und sprechen von einem<br />
enormen Entwicklungssprung – hin<br />
zu noch mehr Bewegungsfreiheit, einem<br />
natürlicheren Gangbild und deutlich<br />
weniger Anstrengung beim Gehen. Wir<br />
freuen uns darauf, das neue Prothesenkniegelenk auf der<br />
OTWorld offiziell vorstellen zu können.<br />
Begeisterung ist das, was uns antreibt. Wir wollen Menschen<br />
mit Mobilitätseinschränkungen damit begeistern,<br />
dass sie dank optimaler Versorgung ihr Leben so gestalten<br />
können, wie sie es möchten. Ob das bedeutet, möglichst<br />
eigenständig das Leben zu bestreiten, den Mount Everest<br />
zu besteigen oder sogar ins All zu fliegen, entscheidet jeder<br />
für sich selbst. Jeder hat seine individuellen Gipfel zu<br />
erklimmen. Es sind die persönlichen und authentischen<br />
Geschichten, die begeistern. Deshalb freuen wir uns, dass<br />
mehr als 30 Anwenderinnen und Anwender bei uns am<br />
Stand unterstützen. Sie erzählen Ihnen und uns von ihren<br />
Erfolgen, ihren Herausforderungen und ihren persönlichen<br />
Gipfelstürmen. Dabei helfen ihnen innovative Produkte<br />
und eine optimale Versorgung.<br />
„Welten verbinden“ ist nicht nur das Motto der<br />
OTWorld, sondern auch das unbedingte Zielbild der Branche.<br />
Nur wenn wir alle am Versorgungsprozess Beteiligten<br />
miteinander verbinden, können Menschen mit Mobilitätseinschränkungen<br />
die für sie bestmögliche Versorgung<br />
erhalten. Auch digitale Welten gehören längst dazu. Digitaler<br />
Fortschritt und der Einsatz von Künstlicher Intelligenz<br />
spielen im Versorgungsprozess längst eine entscheidende<br />
Rolle. Den digitalen ebenso wie den technologischen Fortschritt<br />
treiben wir innerhalb der Branche weiter voran. So<br />
werden wir auch in unserer Werkstatt bei den diesjährigen<br />
Paralympischen Spielen in Paris erstmalig digitale Prozesse<br />
– vom Scan bis zum 3D-Druck – anwenden und damit noch<br />
schneller auf die Bedürfnisse der Athletinnen und Athleten<br />
eingehen.<br />
Mit Prothese surfen oder bergsteigen, auf Carbonfedern<br />
zur Medaille in Paris, mit dem „Exopulse Mollii Suit“ den<br />
Alltag bewältigen: Unsere Highlights aus den Bereichen<br />
Prothetik, „NeuroMobility“ sowie Business Solutions präsentieren<br />
wir Ihnen an unserem Messestand. Im Mittelpunkt<br />
steht dabei die Event-Fläche mit ihren stündlichen<br />
Shows. Wir freuen uns, Sie dort zu treffen und zu begeistern!<br />
In Kürze ist es so weit, die OTWorld <strong>2024</strong> öffnet wieder ihre<br />
Tore. Lohnt sich der Besuch? Aus meiner Sicht auf jeden Fall!<br />
Nirgendwo sonst wird diese Bandbreite des Fachs geboten.<br />
Ein Kongress mit hochkarätigen Vorträgen und vielfältigen<br />
Themen. Eine Messe mit Ausstellern aus aller Welt, die den<br />
„State of the Art“ der Branche erlebbar machen. Beeindruckende<br />
neue Produkte mit echtem Innovationsgrad und realem<br />
Anwendernutzen, zum Anfassen, Fachsimpeln und<br />
in Aktion zu sehen. Bei uns am Stand in Halle 1, D10/E11,<br />
in stündlich stattfindenden Produkt-Shows bieten wir Ihnen<br />
spannende Produkteinblicke. Lernen Sie beispielsweise<br />
das aktive, motorunterstützte Kniegelenk „Intuy Knee“<br />
kennen, das die Unterstützung der Mobilität für Prothesenträger<br />
in einer Vielzahl von wesentlichen Alltagssituationen<br />
auf ein neues Level hebt. Und da das Aufstehen der<br />
Ralf Link, Geschäftsführer<br />
Wilhelm Julius Teufel GmbH<br />
erste Schritt zum Gehen ist, unterstützt<br />
das Gelenk bereits dieses.<br />
Last but not least ist es die Atmosphäre der vier intensiven<br />
Tage, die die OTWorld im besten Sinne zu einem Familientreffen<br />
der Orthopädie-Technik werden lässt. Kollegen,<br />
Wegbegleiter und Freunde wiedersehen und gleichzeitig<br />
neue Kontakte in alle Welt zu knüpfen, das bietet in diesem<br />
Umfang nur die OTWorld.<br />
Sehen wir uns in Leipzig? Wir freuen uns auf Sie!<br />
Foto: Wilhelm Julius Teufel GmbH<br />
46<br />
ORTHOPÄDIE TECHNIK <strong>05</strong>/24
Foto: Össur<br />
In einer Welt, die zunehmend von Unwägbarkeiten und<br />
Herausforderungen geprägt ist, steht die OTWorld <strong>2024</strong><br />
in Leipzig wieder einmal als ein gutes Beispiel dafür, wie<br />
Widerstandsfähigkeit, Innovation und Gemeinschaft uns<br />
nicht nur durch schwierige Zeiten tragen, sondern auch<br />
dazu beitragen können, eine bessere Zukunft zu gestalten.<br />
Inmitten von Krisen, Konflikten und Naturkatastrophen<br />
bleibt die Bedeutung der Orthopädie- und Rehatechnik-Branche<br />
unerschütterlich – ein Sektor, der im Kern immer<br />
das menschliche Wohlbefinden und die Verbesserung<br />
der Lebensqualität fokussiert.<br />
Die OTWorld ist weit mehr als<br />
eine Fachmesse; sie ist ein Treffen<br />
des Handwerks und des Fortschritts.<br />
Hier versammeln<br />
sich Fachleute aus aller Welt,<br />
um Wissen auszutauschen,<br />
Innovationen zu präsentieren<br />
und zukunftsweisende<br />
Lösungen für die Herausforderungen<br />
unserer Zeit<br />
Fabian Jung, Marcom Management<br />
Lead EMEA Marketing, Össur<br />
Ob in der Weltpolitik, der Gesellschaft oder in der Wirtschaft:<br />
Die dynamischen, krisenreichen Zeiten der letzten<br />
Jahre fordern uns alle ganz besonders heraus. Das spürt<br />
auch die Branche: Interdisziplinäre Veranstaltungen wie<br />
die OTWorld sind wichtiger denn je, um den schnelllebigen<br />
Anforderungen geschlossen zu begegnen und die Versorgung<br />
von Patient:innen auf das nächste Level zu heben.<br />
Das Zusammenkommen von Expert:innen weltweit, die<br />
alle an der Schnittstelle von Mensch und Technik versorgen,<br />
ist der Schlüssel, um unterschiedlichen Perspektiven<br />
Gehör zu verschaffen und über Therapieansätze zu diskutieren.<br />
Deshalb steht der Messeauftritt von Medi dieses Jahr<br />
unter dem Motto „medialog“: Wir fokussieren uns auf den<br />
persönlichen Austausch mit Fachkräften aus den Bereichen<br />
Handwerk, Medizin und Therapie. Es ist essenziell, Erfahrungen<br />
und Best Practices auszutauschen. Denn eine optimale<br />
Versorgung mit Hilfsmitteln bringt Patient:innen<br />
größtmögliche Selbstständigkeit, Mobilität und Teilhabe<br />
im Alltag. Deshalb freuen wir uns darauf, an unserem<br />
Messestand in Halle 1 viele konstruktive und inspirierende<br />
Fachgespräche zu führen, vorhandene Partnerschaften zu<br />
verstärken und neue Kontakte zu knüpfen. Denn für nachzu<br />
diskutieren. Gerade in Zeiten globaler Unsicherheiten<br />
zeigt sich die wahre Stärke unserer Branche: die Fähigkeit,<br />
sich anzupassen, zu innovieren und über Grenzen hinweg<br />
zusammenzuarbeiten, um die Lebensqualität von Menschen<br />
zu verbessern. Die Partnerschaft auf Augenhöhe,<br />
die Sie als Kunden mit Össur pflegen, ist aus unserer Sicht<br />
beispielhaft dafür, wie durch gemeinsames Engagement<br />
und den Austausch von Fachwissen und Erfahrungen sehr<br />
gute Ergebnisse für Patienten und Anwender erzielt werden<br />
können.<br />
Die OTWorld <strong>2024</strong> bietet eine einzigartige Plattform<br />
für diese Partnerschaft auf Augenhöhe. Lassen Sie uns diese<br />
weiter ausbauen und uns über Lösungen und Versorgungsmöglichkeiten<br />
und Best Practices austauschen. Die<br />
Teilnahme an der OTWorld bedeutet für uns, gemeinsam<br />
mit unseren Kunden an der Spitze eines sich ständig weiterentwickelnden<br />
Marktes zu stehen, der unmittelbar zur<br />
Verbesserung der Lebensqualität von Patienten und Anwendern<br />
beiträgt für ein „Life without Limitations“. Wir<br />
freuen uns auf unser Treffen bei der OTWorld <strong>2024</strong> in<br />
Leipzig mit Ihnen.<br />
haltigen Erfolg braucht es starke Partner und ein einzigartiges<br />
Netzwerk.<br />
Als besonderes Highlight haben wir die bekannten Influencerinnen<br />
und Lipödem-Patientinnen Jana Crämer<br />
und Caroline Sprott exklusiv zu Gast am Medi-Stand: am<br />
Mittwoch, dem 15. Mai <strong>2024</strong>, um 15 Uhr und 17 Uhr sowie<br />
am Donnerstag, dem 16. Mai <strong>2024</strong>, um 11 Uhr. Beide<br />
Testimonials der aktuellen Mediven-Kampagne werden<br />
offen über ihre Krankheitsgeschichte und ihr Leben mit<br />
medizinischer Kompression berichten. Ihr Ziel: anderen<br />
Betroffenen Mut zu machen und<br />
die Öffentlichkeit zur Erkrankung<br />
Lip- und Lymphödem<br />
aufzuklären.<br />
Robert Unfried, Geschäftsleitung<br />
Medi Deutschland<br />
Foto: Medi<br />
ORTHOPÄDIE TECHNIK <strong>05</strong>/24<br />
47
Foto: Bauerfeind<br />
Rainer Berthan, Vorstandsvorsitzender<br />
der Bauerfeind AG<br />
zinische Hilfsmittel produzieren? Gerade in Zeiten des<br />
Wandels und angesichts globaler Herausforderungen ist<br />
es wichtig, dass unsere Branche partnerschaftlich zusammenarbeitet<br />
und wir gemeinschaftlich nach Lösungen suchen.<br />
Die OTWorld bietet uns Gelegenheit dazu.<br />
Bei aller Sympathie für digitale Kommunikation schätze<br />
ich das persönliche Gespräch – ganz besonders auf der<br />
OTWorld. Hier treffen wir uns abseits vom Tagesgeschäft,<br />
meist verabredet, oft spontan. Produktmanager, Trainer<br />
oder Vertriebskollegen stehen für Fragen und Anregungen<br />
bereit. Der persönliche Austausch ermöglicht tiefere Einblicke,<br />
wenn es um Produkterfahrungen geht.<br />
Das Gespräch am Messestand bietet Raum für Diskussion<br />
und Interaktion. Neuheiten erhalten erste Blicke und<br />
Resonanz. Ich freue mich darauf zu sehen, wie Besucher<br />
unsere Knieorthese „SecuTec Genu Flex“ betrachten, sie<br />
in die Hand nehmen und mit dem Entwickler über Details<br />
sprechen. Ich freue mich auf spannende Diskussionen<br />
während unseres Bühnenprogramms und auf neue Ideen<br />
aus unseren Workshops.<br />
Im Namen von Ofa Bamberg möchte ich unsere Vorfreude<br />
und Zuversicht für die bevorstehende OTWorld <strong>2024</strong> in<br />
Leipzig zum Ausdruck bringen. In einer Zeit, die von Unsicherheiten<br />
und Herausforderungen geprägt ist, könnte<br />
man sich fragen, warum solch ein Ereignis von Bedeutung<br />
sein soll. Doch gerade in diesen Zeiten zeigt sich die wahre<br />
Stärke und Innovationskraft unserer Branche.<br />
Die OTWorld <strong>2024</strong> ist nicht nur eine Messe, sie ist ein<br />
Symbol des stetigen Fortschritts und der Zusammenarbeit,<br />
die unsere Industrie auch in herausfordernden Zeiten auszeichnen.<br />
Sie bietet eine Plattform für Fachleute aus aller<br />
Welt, um sich zu vernetzen, Wissen auszutauschen und die<br />
neuesten technologischen Fortschritte rund um das Thema<br />
optimale Patientenversorgung zu präsentieren.<br />
In Anbetracht der globalen Herausforderungen ist die<br />
Nachfrage nach Lösungen im Gesundheitssektor, einschließlich<br />
Orthopädie, Phlebologie und Lymphologie<br />
nicht nur stabil, sondern zeigt sogar Wachstumstendenzen.<br />
Diese medizinischen Fachgebiete tragen maßgeblich<br />
zur Verbesserung der Lebensqualität bei und sind somit<br />
von unschätzbarem Wert. Die OTWorld <strong>2024</strong> bietet eine<br />
Plattform, auf der wir innovative Produkte und Dienstleistungen<br />
vorstellen können, die genau auf die aktuellen und<br />
zukünftigen Bedürfnisse unserer Kunden und deren Patienten<br />
zugeschnitten sind. Ofa Bamberg ist stolz darauf, ein<br />
aktiver Teil dieser dynamischen Branche zu sein und zur<br />
Gesundheitsversorgung beizutragen.<br />
Gemeinsam wollen wir die OTWorld <strong>2024</strong> als Fest des<br />
menschlichen Potenzials und der technologischen Meis-<br />
Heiko Denk, Leitung Vertrieb<br />
Ofa national / international<br />
Die OTWorld verbindet.<br />
Wir bei Bauerfeind<br />
freuen uns, Akteure<br />
der Branche<br />
vom 14. bis 17. Mai<br />
<strong>2024</strong> in Leipzig zu<br />
treffen. Die Fachmesse<br />
bietet auch in schwierigen<br />
Zeiten eine verlässliche<br />
Plattform zum Netzwerken,<br />
zum Weiterbilden und zum Austausch von Ideen.<br />
Wir nutzen die Möglichkeit, unsere Produkte zu präsentieren<br />
und darüber hinaus mit den Gästen ins Gespräch<br />
über die Zukunft zu kommen. Was brauchen Patienten,<br />
was Leistungserbringer? Welche technischen Neuerungen<br />
unterstützen das Handwerk? Wie kann die Industrie auch<br />
weiterhin am Standort Deutschland hochwertige mediterleistungen<br />
feiern, die<br />
uns allen zugutekommen.<br />
Wir laden Sie herzlich ein,<br />
sich uns anzuschließen, um<br />
die Zukunft der medizinischen<br />
Versorgungstechnik mitzugestalten<br />
und die Grenzen des Machbaren neu zu definieren.<br />
Die OTWorld <strong>2024</strong> ist aber nicht nur die perfekte Gelegenheit,<br />
um Ihnen unsere neuesten Produkte und Dienstleistungen<br />
vorzustellen – sie ist das Ereignis, um nachhaltige<br />
Beziehungen innerhalb der Branche zu fördern und zu<br />
stärken und um unsere Vision und unser Engagement für<br />
ein besseres Jetzt und ein besseres Morgen zu teilen.<br />
Wir sehen der OTWorld <strong>2024</strong> mit großer Erwartung<br />
entgegen und hoffen, dass sie ein Ort des Austauschs, der<br />
Inspiration und der Fortschritte sein wird. Wir freuen uns<br />
auf ein inspirierendes Zusammentreffen in Leipzig, wo<br />
wir gemeinsam die neuesten Entwicklungen und Errungenschaften<br />
in der Welt der medizinischen Hilfsmittel<br />
entdecken und diskutieren können. Gemeinsam gestalten<br />
wir die Zukunft!<br />
Foto: Heiko Denk<br />
48<br />
ORTHOPÄDIE TECHNIK <strong>05</strong>/24
Vormerken<br />
16. Mai <strong>2024</strong><br />
im Rahmen der OTWorld <strong>2024</strong><br />
TAG DES<br />
E-REZEPTES<br />
Sie wollen nichts<br />
verpassen oder haben Fragen?<br />
Wir antworten!<br />
Die Mitglieder des Pilotprojektes<br />
„eVerordnung für<br />
orthopädische Hilfsmittel in<br />
Deutschland“ stehen Ihnen<br />
mit Rat und Tat zur Seite.<br />
Internationale Fachmesse<br />
und Weltkongress<br />
www.ot-world.com
Foto: Schein Orthopädie Service KG<br />
Volker Bister, Mitglied der<br />
Geschäftsführung und Leiter<br />
Marketing/Vertrieb bei Schein<br />
Orthopädie Service KG<br />
In den letzten Jahren haben wir<br />
eine äußerst positive Entwicklung<br />
der OTWorld-Messe verzeichnet,<br />
die sowohl durch eine höhere<br />
Besucherzahl als auch durch eine größere<br />
Ausstellungsfläche belegt wird. Diese Erfolge unterstreichen<br />
die zunehmende Bedeutung und Relevanz der Messe für die<br />
Branche. Die OTWorld bietet eine exzellente Plattform, um<br />
sich auf nationaler und internationaler Ebene umfassend<br />
über alle Facetten der Branche zu informieren und einen Einblick<br />
in die neuesten Entwicklungen zu erhalten.<br />
Auf der Messe werden wir eine Vielzahl von Neuheiten<br />
präsentieren, wobei das Thema „my generation“ einen besonderen<br />
Fokus einnimmt. Unser neuer „my generation“-<br />
Schuhkatalog reflektiert deutlich die Antwort auf die Bedürfnisse<br />
und Anforderungen unserer Kunden. Wir sind<br />
uns bewusst, dass Funktionalität und Komfort ebenso<br />
wichtig sind wie Stil und Ästhetik. Aus diesem Grund legen<br />
wir bei der Gestaltung unserer Schuhe nicht nur Wert auf<br />
modische Aspekte, sondern auch auf die Bedürfnisse und<br />
Gesundheit der Füße unserer Kunden.<br />
Unser Ziel ist es, innovative Produkte und Lösungen anzubieten,<br />
die nicht nur ästhetisch ansprechend sind, sondern<br />
auch einen spürbaren Mehrwert für unsere Kunden<br />
bieten. Wir setzen dabei auf eine Kombination aus Tradition<br />
und Innovation, um hochwertige Produkte zu entwickeln,<br />
die den Anforderungen des modernen Marktes<br />
gerecht werden. Wir freuen uns darauf, auf der OTWorld-<br />
Messe unsere neuen Produkte und Lösungen zu präsentieren<br />
und mit unseren Kunden und Partnern in einen konstruktiven<br />
Austausch zu treten. Wir sind überzeugt davon,<br />
dass die OTWorld-Messe auch in Zukunft eine bedeutende<br />
Rolle für die Branche spielen wird, und freuen uns darauf,<br />
Teil dieses spannenden Events zu sein.<br />
Die OTWorld ist für uns nach wie vor die Leitmesse<br />
schlechthin in der Orthopädie-Technik – und eine exzellente<br />
Gelegenheit, neue Kontakte zu knüpfen und alte wieder<br />
aufzufrischen. Gerade in der heutigen von Krisen und<br />
Konflikten gekennzeichneten Zeit ist es umso wichtiger,<br />
miteinander in Verbindung zu bleiben. Auch wenn es an<br />
der Globalisierung sicherlich genug zu kritisieren gibt, so<br />
ist und bleibt internationaler Austausch auf medizinischer,<br />
wissenschaftlicher und wirtschaftlicher Ebene essenziell.<br />
Nichtsdestoweniger leben wir in einer Zeit des Wandels –<br />
alte Gewissheiten zerfallen, Selbstverständlichkeiten sind<br />
es plötzlich nicht mehr, aber auch neue Wege tun sich auf.<br />
Doch all das ist nicht neu – und sicherlich keine „Zeitenwende“,<br />
dieses Wort zeugt lediglich von Hybris. Unruhige<br />
Zeiten sind dabei nicht zwangsläufig nur negativ, sie bieten<br />
vielmehr oft genug vorher ungeahnte Möglichkeiten.<br />
Vielleicht kann auch unsere Branche hier Impulse generieren<br />
und neue Wege gehen – scheinbar Altbewährtes infrage<br />
stellen, nur das Gute behalten und Denkverbote aufbrechen.<br />
Gerade der Gesundheitssektor steht vor massiven<br />
Umbrüchen, wenn er sich nicht schon mittendrin befin-<br />
Dr. Rainer M. Buchholz,<br />
Geschäftsführer Renia<br />
det: neue Technologien als Chancen und Risiken, aber vor<br />
allem der demografische Wandel mit den damit einhergehenden<br />
Problemfeldern wie Fachkräftemangel und der<br />
Schwierigkeit einer dauerhaft stabilen Finanzierung des<br />
Gesundheitswesens. Was kann der Einzelne tun, um diese<br />
positiv mitzugestalten? Wenig. Was können viele zusammen<br />
bewegen? Eine ganze Menge! Auch das spricht für die<br />
Vernetzung und mithin für die OTWorld. Immer noch gilt:<br />
Jeder Krieg und jede Krise enden irgendwann, und es gibt<br />
immer ein „danach“. Kontaktabbrüche und Brandmauern<br />
zahlen sich dann selten aus, ganz im Gegenteil: Nur gemeinsam<br />
lässt sich danach etwas Neues schaffen. In diesem<br />
Sinne freuen wir uns auf eine erfolgreiche OTWorld<br />
mit vielen guten Gesprächen.<br />
Foto: Rainer M. Buchholz<br />
50<br />
ORTHOPÄDIE TECHNIK <strong>05</strong>/24
Das Dreve-Vertriebsteam freut sich sehr auf die bevorstehende<br />
OTWorld in Leipzig. In unserer heutigen Zeit werden<br />
persönliche Begegnungen und direkter Austausch oft<br />
vernachlässigt. Die OTWorld mit Fachmesse und Weltkongress<br />
ist daher eine besonders wertvolle Gelegenheit, um<br />
persönliche Kontakte zu knüpfen und Beziehungen zu<br />
pflegen.<br />
Die OTWorld bietet uns als Newcomer in der Branche<br />
die Chance, unsere innovativen Produkte und Dienstleistungen<br />
einem breiten Fachpublikum zu präsentieren und<br />
potenzielle Kunden direkt anzusprechen. Der persönliche<br />
Kontakt auf der Messe hilft uns, die Bedürfnisse unserer<br />
Kunden besser zu verstehen, auch in Zukunft individuelle<br />
Lösungen anzubieten und damit die Partnerschaft weiter<br />
zu stärken.<br />
Messen sind für uns die ideale Plattform, um sich über<br />
die neuesten Branchentrends und Innovationen auf dem<br />
Laufenden zu halten. Durch unsere Workshop-Teilnahme<br />
im Bereich 3D-Druck werden wir wertvolle Einblicke gewinnen,<br />
unser Know-how erweitern und neue Strategien<br />
David Bockhorn,<br />
Vertriebsleiter Dreve<br />
Firmengruppe<br />
Wir bei L&R freuen uns sehr auf die OTWorld <strong>2024</strong>! Denn<br />
trotz der allgegenwärtigen Krisen und der mannigfaltigen<br />
Herausforderungen, mit denen wir alle konfrontiert<br />
sind, bleibt eines gleich: unser Auftrag – die Versorgung<br />
der Menschen. Egal ob Leistungserbringer, Ärzt:innen,<br />
Therapeut:innen oder wir als Industrie: Wir alle möchten<br />
diesen Auftrag erfüllen. Nur durch unsere enge Zusammenarbeit<br />
gelingt es, die bestmöglichen Lösungen für<br />
Patient:innen zu finden und anbieten zu können.<br />
Die OTWorld bietet immer<br />
eine ideale Plattform für<br />
den dafür so wichtigen<br />
Austausch zu zielführenden,<br />
partnerschaftlichen<br />
und gewinnentwickeln,<br />
um auch für künftige Herausforderungen<br />
gerüstet zu sein.<br />
Fachmessen wie die OTWorld<br />
bieten uns die Möglichkeit<br />
zum Networking und die Gelegenheit,<br />
neue Geschäftspartnerinnen<br />
und -partner<br />
zu finden. Durch Gespräche<br />
auf unserem Messestand<br />
entstehen langfristige Beziehungen<br />
und neue Geschäftschancen,<br />
die weit über den eigentlichen<br />
Messezeitraum hinausweisen.<br />
Insgesamt sehen wir die OTWorld<br />
also als eine lohnende Investition für<br />
unsere Firma an. Sie bietet uns den idealen<br />
Raum, uns zu präsentieren, Kontakte zu knüpfen und<br />
Branchentrends zu verfolgen. Dies alles ist unter anderem die<br />
Basis, auf der wir letztlich unser Business fortentwickeln.<br />
Foto: Dreve Firmengruppe<br />
Der offizielle, tägliche Newsletter<br />
des Verlags Orthopädie-Technik<br />
zur OTWorld<br />
Jetzt<br />
kostenlos<br />
anmelden<br />
Foto: Lohmann und Rauscher GmbH<br />
Anja Wichmann, L&R<br />
Key Account Management<br />
für den Sanitätsfachhandel<br />
bringenden Konzepten der Zusammenarbeit. Für L&R ist<br />
der kunden- und bedürfnisorientierte Lösungsanbieter-<br />
Gedanke dabei eines der wichtigsten Prinzipien und prägt<br />
unsere Angebote für den Sanitätsfachhandel.<br />
Egal, ob es um Produktlösungen wie die „Cellacare“-<br />
Bandagen und -Orthesen, das Medizinische Adaptive<br />
Kompressionssystem „Readywrap“ oder die Medizinischen<br />
Kompressionsstrümpfe „Venosan“, unser umfangreiches<br />
Service-Angebot oder um unser wertvolles Netzwerk<br />
an Verordnern, Empfehlern und Anwendern geht – in<br />
L&R finden Sie immer den richtigen Partner. Besprechen<br />
Sie gerne Ihr Anliegen direkt mit meinen Kolleg:innen und<br />
mir am L&R-Stand. Und profitieren Sie von unseren zwei<br />
Workshops zum Thema der erfolgreichen Erschließung<br />
neuer Marktpotenziale.<br />
Im ersten Workshop zeigen wir mit dem Produkt „Readywrap“<br />
neue Optionen zur Versorgung und Kundenbindung<br />
für den Sanitätsfachhandel auf. Im zweiten Workshop<br />
thematisieren wir die Versorgung von Schwangeren<br />
und bieten praxisnahe Tipps zur Gewinnung und Bindung<br />
neuer Kund:innen.<br />
ORTHOPÄDIE TECHNIK <strong>05</strong>/24<br />
51
Foto: Beil<br />
Tom Mewes,<br />
Geschäftsführer von Beil<br />
Als Geschäftsführer<br />
von Beil in Peine<br />
freue ich mich, auch<br />
in diesem Jahr Teil<br />
der OTWorld <strong>2024</strong> in<br />
Leipzig sein zu können.<br />
Die OTWorld ist<br />
der führende Weltkongress<br />
für zeitgemäße Versorgungen<br />
mit innovativen und<br />
zukunftsträchtigen Hilfsmitteln und als Weltleitmesse ist<br />
sie meiner Meinung nach unabdingbar für den brancheninternen<br />
Austausch. Ich schätze die OTWorld als internationale<br />
Plattform, die es Ausstellern und Besucher:innen<br />
ermöglicht, sich über neueste Entwicklungen in der Technologie<br />
und der Materialienbeschaffung sowie über Trends<br />
und Erkenntnisse auszutauschen. Der Fortschritt bei technischen<br />
Hilfsmitteln sowie bei traditionellen Versorgungsmethoden<br />
wird hier nicht nur sichtbar, sondern kann direkt<br />
geteilt und besprochen werden.<br />
Besonders in Zeiten, in denen die Suche nach alternativen<br />
Materialien und umweltfreundlichen Lösungen dringlicher<br />
denn je ist, spielt der Dialog auf Branchenmessen<br />
eine entscheidende Rolle. Sowohl bei technischen Hilfsmitteln<br />
als auch bei Produkten für traditionelle Versorgungsmethoden<br />
gibt es kontinuierliche Innovationen und<br />
Verbesserungen. Und gerade in Kriegs- und Katastrophengebieten<br />
ist die Herstellung von wirtschaftlich interessanten<br />
Hilfsmitteln mit einfachen und bewährten Methoden<br />
besonders wichtig. Ein intelligenter Wissensaustausch und<br />
das Teilen von Informationen sind unerlässlich, um diese<br />
Herausforderungen gemeinsam zu bewältigen und innovative<br />
Lösungen zu entwickeln.<br />
Als Geschäftsführer von Beil habe ich die Möglichkeit,<br />
einen gemeinnützigen Beitrag zu leisten. Unsere Produkte<br />
bilden die Grundlage für die Orthopädie- und Schuhtechnik<br />
und ermöglichen es Werkstätten und Rehabilitationszentren,<br />
Menschen mit lebensverändernden Hilfsmitteln<br />
zu versorgen. Wir sind stolz darauf, Teil der OTWorld zu<br />
sein und freuen uns darauf, unsere Produkte vorzustellen.<br />
Gerade in Zeiten globaler Herausforderungen ist der konstruktive<br />
Austausch zwischen Produzenten, Ärzten und<br />
Versorgern wichtiger denn je.<br />
In einer Welt, in der Herausforderungen, Probleme und<br />
Kriege zur alltäglichen Realität geworden sind, setzt sich<br />
Alps dafür ein, durch Innovationen in der Prothetik das<br />
Leben von Menschen zu verbessern. Die OTWorld <strong>2024</strong> in<br />
Leipzig ist zweifellos eine wichtige Veranstaltung, die man<br />
nicht verpassen sollte. Die Teilnahme an dieser Veranstaltung<br />
hat viele Vorteile für Alps und die gesamte globale<br />
Prothesengemeinschaft: Wir sind stolz auf unsere neuesten<br />
Erfolge in der Entwicklung von Linern, Kniegelenken,<br />
Füßen, Kniemechanismen und anderen Komponenten.<br />
Die Messe gibt uns die Möglichkeit, unsere neuen Entwicklungen<br />
vorzustellen und Feedback von Experten und Kunden<br />
zu erhalten. Wir glauben an die Kraft der Zusammenarbeit<br />
und des Wissensaustausches, und diese Messe bietet<br />
uns eine ausgezeichnete Gelegenheit, uns mit den weltweit<br />
führenden Unternehmen auf diesem Gebiet zu treffen und<br />
Möglichkeiten der Kooperation auszuloten. Alps ist stets<br />
bestrebt, das Leben von Menschen, die auf Prothesen angewiesen<br />
sind, zu verbessern. Die Teilnahme an der OTWorld<br />
<strong>2024</strong> unterstreicht unser Engagement für diese Mission.<br />
Unser Ziel ist es, uns mit anderen Akteuren der Branche zu<br />
vernetzen, um neue innovative Lösungen zu erforschen<br />
und unseren Kunden einen besseren Zugang zu diesen Lösungen<br />
zu ermöglichen. Alps fühlt sich der weltweiten Prothesengemeinschaft<br />
gegenüber verantwortlich. Die Teilnahme<br />
an der OTWorld <strong>2024</strong> wird uns helfen, uns aktiv<br />
in diese Gemeinschaft einzubringen und mit anderen Teil-<br />
Yevheniia Skorokhod, General<br />
Manager Alps South Europe<br />
nehmern zusammenzuarbeiten,<br />
um Herausforderungen<br />
zu meistern und<br />
Innovationen voranzutreiben.<br />
Die OTWorld <strong>2024</strong> in Leipzig<br />
ist ein Leuchtturm der Hoffnung<br />
und des Fortschritts in der Prothetik. Für Alps ist dies nicht<br />
nur eine Veranstaltung, sondern eine entscheidende Basis,<br />
um unser Engagement für die Verbesserung des Lebens von<br />
Menschen, die eine prothetische Versorgung benötigen, zu<br />
bekräftigen. Wir freuen uns auf die Teilnahme an dieser<br />
Messe und sind voller Optimismus und Entschlossenheit,<br />
mit anderen Branchenführern zusammenzukommen, unsere<br />
Innovationen zu präsentieren und neue Partnerschaften<br />
zu schmieden, die letztlich zu einer besseren und inklusiveren<br />
Zukunft für alle beitragen werden. Lassen Sie<br />
uns gemeinsam diese Gelegenheit nutzen, um einen nachhaltigen<br />
Einfluss auszuüben und die Grenzen der Prothesentechnologie<br />
und Rehabilitation zu erweitern.<br />
Foto: Alps<br />
52<br />
ORTHOPÄDIE TECHNIK <strong>05</strong>/24
Für meine Kolleg:innen und mich ist die OTWorld eines<br />
der diesjährigen Messehighlights. Auf kaum einem Event<br />
gibt es die Möglichkeit, in so kurzer Zeit derart viele interessante<br />
Menschen aus der Hilfsmittelbranche zu treffen,<br />
mit ganz unterschiedlichen persönlichen und beruflichen<br />
Hintergründen. Deshalb wird Optica mit einem großen<br />
Stand vertreten sein, um das breite Spektrum unserer Services<br />
und Produkte für Hilfsmittelerbringer:innen zu präsentieren.<br />
<strong>2024</strong> steht ganz im Zeichen der Digitalisierung, denn<br />
in diesem Jahr startet die Anbindung der Hilfsmittelbranche<br />
an die Telematikinfrastruktur. Wir bei Optica haben<br />
uns zum Ziel gesetzt, die Hilfsmittelerbringer:innen umfassend<br />
auf ihrem Weg in die TI zu begleiten. Denn der Erfolg<br />
eines Betriebs wird maßgeblich davon abhängen, ob er<br />
gut für die digitale Zukunft aufgestellt ist. Voraussetzung<br />
für die Nutzung der TI ist eine zukunftsfähige Software –<br />
wie „Optica Omnia“: Unsere Branchensoftware mit vielen<br />
neuen Features, etwa für die Dauerversorgung, werden wir<br />
auf der OTWorld ausführlich vorstellen. Wir unterstützen<br />
Leistungserbringer:innen nicht nur ganz konkret bei der<br />
TI-Anbindung, sondern sind auch gefragter Experte und<br />
Partner, etwa beim Pilotprojekt zur E-Verordnung, das der<br />
BIV-OT kürzlich gestartet hat. Auch unsere zwei Workshops,<br />
die wir in Leipzig veranstalten, nehmen das Thema<br />
Digitalisierung in den Fokus.<br />
Die OTWorld wird wieder viele inspirierende Begegnungen<br />
und spannende Gespräche bereithalten – wir freuen<br />
uns darauf!<br />
Astrid Biedermann,<br />
Teamleiterin Vertrieb Hilfsmittel<br />
bei Optica Abrechnungszentrum<br />
Dr. Güldener<br />
GmbH<br />
Foto: Optica<br />
Werden Sie Abonnent der<br />
ORTHOPÄDIE TECHNIK<br />
13,30 €<br />
pro Monat<br />
PREISVORTEIL<br />
Laufzeit 12 Monate;<br />
danach monatlich kündbar<br />
Inklusive aller Sonderausgaben<br />
Lieferung frei Haus innerhalb<br />
Deutschlands<br />
Monatliche Erscheinungsweise<br />
Weitere Informationen<br />
unter www.360-ot.de<br />
Bestellungen an:<br />
bestellung@biv-ot.org<br />
53
Foto: OTN Implants<br />
Die OTWorld <strong>2024</strong> steht vor der Tür und dieses Jahr ist es<br />
sehr wichtig, diese Messe nicht zu verpassen. Aufgrund<br />
der besonderen Situationen weltweit, mit deren Auswirkungen<br />
Freunde und Geschäftspartner täglich konfrontiert<br />
sind, ist der fachliche und persönliche<br />
Austausch in Leipzig<br />
heute umso wichtiger. Der<br />
Orthopädie-Technik, insbesondere<br />
im Bereich<br />
traumatischer Amputationen,<br />
kommt daher eine<br />
große Bedeutung zu. Auf<br />
der OTWorld <strong>2024</strong> fin<br />
den alle engagierten Partner und Freunde die Lösungen<br />
bei problematischen und schwierigen Versorgungsituationen<br />
am Ende der Therapiekaskade.<br />
Das Team von OTN Implants zeigt auf der OTWorld<br />
<strong>2024</strong> die neuesten Entwicklungen im Bereich der knochenverankerten<br />
Prothesen für Menschen nach Amputationen<br />
der oberen und unteren Extremitäten. Unsere<br />
Press-Fit-Implantate sorgen bei allen Anwendern<br />
für hohe Zufriedenheit bei den täglichen Aufgaben und<br />
Aktivitäten. OTN Implants freut sich, die gelebten und<br />
erfolgreichen Partnerschaften zu intensivieren, neue<br />
Partner zu gewinnen und den fachlichen Austausch voranzubringen.<br />
Henk van de Meent MD, PhD,<br />
CEO OTN Implants<br />
Alexandra Houiste,<br />
Marketing Activation<br />
and Communication<br />
Manager bei Proteor<br />
Die OTWorld in Leipzig ist auch in diesem Jahr für uns<br />
ein besonders wichtiger internationaler Marktplatz, um<br />
mit unseren Kunden und Entscheidern und auch den Anwendern<br />
unserer Produktlösungen auf Augenhöhe als ein<br />
führendes Unternehmen in den Bereichen Prothetik und<br />
Orthetik persönlich zu kommunizieren. Dieses Jahr ist es<br />
für uns ein besonderer Anlass, als Aussteller vor Ort als<br />
ein französisches Unternehmen präsent zu sein, da die<br />
OTWorld Frankreich als Partnerland begrüßt und auch<br />
die Paralympischen Spiele im Sommer in Paris im Fokus<br />
stehen. Diese sportlichen Aktivitäten unterstützen wir<br />
seit vielen Jahren und würdigen alle Teilnehmer, die so<br />
viel Ehrgeiz, Mut, Leistung und Herzblut an den Tag legen<br />
– wie auch die täglichen Leistungen aller Anwender unserer<br />
Produkte. Wir freuen uns auf viele Besucher bei uns<br />
am Messestand zum inspirierenden Austausch mit unseren<br />
wunderbaren Markenbotschaftern und dem Team<br />
von Proteor.<br />
Interessenten können in die Welt mikroprozessorgesteuerter<br />
Produkte eintauchen. Dazu gehört unser einzigartiges<br />
Synsys-Komplettsystem, das Bewegungsabläufe<br />
ermöglicht, die vorher für Oberschenkelamputierte<br />
nur schwer oder gar nicht möglich waren, und unsere<br />
Produkthighlights Quattro, Kinnex, Kinterra und Rush.<br />
Auch unser Karbonfuß-Portfolio präsentieren wir in Aktion.<br />
Unser Entwicklungsprozess basiert seit über 100<br />
Jahren auf einem kollaborativen Ansatz mit Orthopädietechnikern<br />
und den Menschen, die sie versorgen. Wenn<br />
wir alle zusammenarbeiten, ist es erstaunlich zu sehen,<br />
was Anwender erreichen können. Zudem spielen digitale<br />
Lösungen auch bei uns eine immer größere Rolle, die<br />
seit über 25 Jahren im Angebot sind. Unsere leistungsstarke<br />
CAD/CAM-Lösung Orten wurde dafür entwickelt, um<br />
Arbeitsabläufe zur Erstellung individueller Hilfsmittel zu<br />
optimieren. Wir bieten damit Orthopädietechnikern eine<br />
einfache und effiziente Plattform, um von Anfang an einfach<br />
und unkompliziert digital arbeiten zu können. Wir<br />
freuen uns auf viele Besucher bei uns am Messestand mit<br />
Wohlfühlambiente und vielen Überraschungen für die<br />
tägliche Praxis.<br />
Foto: Proteor<br />
54<br />
ORTHOPÄDIE TECHNIK <strong>05</strong>/24
Das „Savoir-vivre“ kommt nach Leipzig<br />
<strong>2024</strong> fungiert Frankreich als offizielles Partnerland der<br />
OTWorld. Mehr als 25 französische Aussteller präsentieren<br />
sich an Einzelständen sowie am französischen Gemeinschaftsstand.<br />
Seit Jahren gehört auch der Verband<br />
„Syndicat National de l’Orthopédie Française“ (SNOF) zu<br />
den Partnern der OTWorld. Im Gespräch mit der OT-Redaktion<br />
blicken Generaldelegierte Nathalie Balducci-Michelin<br />
und Präsident Jacques Fecherolle auf ihren Besuch<br />
im Jahr 2022 zurück und auf die Highlights <strong>2024</strong> voraus.<br />
OT: Der SNOF ist seit Jahren Partner der OTWorld – und<br />
nun offizielles Partnerland. Was bedeutet Ihnen die deutschfranzösische<br />
Freundschaft?<br />
Jacques Fecherolle / Nathalie Balducci-Michelin: Die<br />
deutsch französische Freundschaft ist vor allem eine dauerhafte<br />
Verbindung, die für uns durch ein gemeinsames<br />
Thema, die Orthopädie-Technik, geprägt ist. Sie treibt aber<br />
auch den Willen der Branche, Innovationen in Frankreich<br />
und in Deutschland vorzustellen und die Sichtbarkeit auf<br />
beiden Märkten zu erreichen.<br />
OT: 2022 haben Sie die OTWorld in Leipzig besucht.<br />
Was waren Ihre Highlights?<br />
Fecherolle/Balducci-Michelin: Wir waren begeistert von der<br />
Qualität der Organisation der Veranstaltung und sehr erfreut<br />
über den Empfang unserer Delegation. Besonders beeindruckt<br />
hat uns das Entdecken von Neuheiten, wie zum<br />
Beispiel die technologische Verbesserung einiger Hilfsmittel.<br />
OT: Was können die Besucher:innen in diesem Jahr von den<br />
französischen Ausstellern erwarten?<br />
Fecherolle/Balducci-Michelin: Auf der OTWorld erwartet<br />
die Besucher eine Fülle an Produkten der französischen<br />
Aussteller. Eine besondere Gelegenheit bietet sich für zweisprachige<br />
Besucher außerdem durch die Teilnahme an den<br />
hochwertigen Kongressbeiträgen, die besonders auch von<br />
französischen Besuchern sehr geschätzt werden.<br />
OT: Wie viel Frankreich wird auf der<br />
OTWorld spürbar sein? Reist das<br />
„Savoir-vivre“ mit nach Leipzig?<br />
Fecherolle/Balducci-Michelin:<br />
Wir sind sicher, dass die anwesenden<br />
Aussteller und Kongressteilnehmer<br />
die für Frankreich typische<br />
Geselligkeit mitbringen und<br />
den Austausch nutzen werden.<br />
OT: Die Welt der Orthopädie-<br />
Technik ist in Leipzig zu Gast.<br />
Welche Erkenntnisse erhoffen sich<br />
die französischen Besucher:innen<br />
vom Austausch mit den internationalen Kolleg:innen,<br />
um ihre Arbeit in Frankreich zu bereichern?<br />
Fecherolle/Balducci-Michelin: Orthopädietechniker werden<br />
unter anderem daran interessiert sein zu verstehen,<br />
wie sich Materialien oder neue Technologien einsetzen lassen.<br />
Insbesondere erhoffen sie sich sicherlich Erkenntnisse,<br />
wie sie diese ideal für ihre Patienten anpassen können.<br />
Ziel ist es, sich zu informieren, Neuigkeiten direkt vor Ort<br />
zu erleben und sich durch den angebotenen Kongress weiterzubilden.<br />
OT: Was sind aktuell die größten Herausforderungen im<br />
französischen Gesundheitssystem und in der Hilfsmittelversorgung<br />
in Frankreich?<br />
Fecherolle/Balducci-Michelin: Der Zugang zu medizinischer<br />
Versorgung für alle und die gute Versorgung der Patienten<br />
bleibt unserer Meinung nach die größte Herausforderung<br />
für das französische Gesundheitssystem. Dass dem<br />
Patienten geeignete Hilfsmittel für seine Therapie zur Verfügung<br />
stehen, bleibt wiederum ein Anliegen des Pflegepersonals<br />
und der Gesundheitsfachkräfte.<br />
Foto: SNOF<br />
Generaldelegierte<br />
Nathalie Balducci-<br />
Michelin und Präsident<br />
Jacques Fecherolle.<br />
Die Fragen stellte Pia Engelbrecht.<br />
neue Kollektion<br />
ORTHESEN<br />
STABIL<br />
ANTIVARUS<br />
by<br />
www.mygeneration-schein.de<br />
14.-17. Mai <strong>2024</strong> Leipziger Messe<br />
Halle 1 | Stand E26/F25
Starpower für die OTWorld<br />
Es gibt weltweit viele Millionen Menschen, die ein Hilfsmittel<br />
benötigen, damit beispielsweise Inklusion gelingt<br />
oder Sport getrieben werden kann. Bei einigen Menschen<br />
wird jedoch ein bisschen genauer hingeschaut: Prominente<br />
stehen aufgrund außergewöhnlicher Leistungen und besonderem<br />
Interesse an ihrer Person verstärkt im Fokus der<br />
Öffentlichkeit. Unter ihnen sind natürlich auch Menschen<br />
mit Bedarf an Hilfsmitteln – und einige davon werden auf<br />
der OTWorld <strong>2024</strong> in Leipzig zu Gast sein.<br />
Dazu gehört u. a. Handball-Weltmeister Dominik Klein.<br />
Der ehemalige Handball-Profi, der während seiner aktiven<br />
Karriere viele Jahre für Deutschlands Top-Verein THW<br />
Kiel und die deutsche Nationalmannschaft auf der Platte<br />
stand, wird erzählen, wie Hilfsmittelversorgung ihm half,<br />
nach einer Verletzung wieder in den Profisport zurückzukehren.<br />
2015 hatte sich der Außenspieler quasi auf dem Höhepunkt<br />
seiner Karriere eine Kreuzbandruptur zugezogen<br />
und fiel damit monatelang aus. Klein kämpfte sich zurück<br />
in das Kieler Team des jetzigen Nationaltrainers Alfred Gislason<br />
und wagte kurz darauf sogar noch einmal den Schritt<br />
zu einem neuen sportlichen Abenteuer und heuerte beim<br />
französischen Erstligisten HBC Nantes an. Insgesamt gewann<br />
Klein neben der Weltmeisterschaft 2007 noch drei<br />
Champions-League-Titel, acht Deutsche Meisterschaften<br />
und sechsmal den DHB-Pokal. Auf der OTWorld wird er am<br />
Dienstag, 14. Mai, ab 11 Uhr auf dem Stand von Bauerfeind<br />
in Halle 5 über sein Comeback und die Rolle von Hilfsmitteln<br />
sprechen.<br />
Nach einem Motorradunfall wurde John McFall mit 19<br />
Jahren sein rechtes Bein oberhalb des Knies amputiert. Seitdem<br />
hat der Brite eindrucksvoll gezeigt, was mit moderner<br />
Hilfsmittelversorgung alles möglich ist. Er gilt als einer der<br />
schnellsten Männer der Welt über 100 Meter und 200 Meter<br />
in der Klasse der Oberschenkelamputierten. Er ist Facharzt<br />
für Traumatologie und Orthopädie. Und mit seiner Auf-<br />
Foto: Abel Aber<br />
Der Boxsport hat<br />
Abel Aber geholfen,<br />
das Tragen seiner Beinprothese<br />
zu akzeptieren.<br />
Will anderen Betroffenen Mut machen:<br />
Influencerin Caroline Sprott.<br />
nahme als Projekt-Astronaut bei der Europäischen Weltraumorganisation<br />
(European Space Agency – ESA) könnte<br />
er vielleicht der erste Mensch mit einer körperlichen Einschränkung<br />
sein, der in den Weltraum fliegt. John McFall<br />
trägt die neueste Beinprothese von Ottobock, die das Unternehmen<br />
zum Start der OTWorld erstmalig vorstellt.<br />
Frankreich ist nicht nur Partnerland der OTWorld in<br />
diesem Jahr, es ist auch Gastgeber der Olympischen und<br />
Paralympischen Spiele. Mit Sophie Loubet und Abel Aber<br />
werden zwei französische Para-Athlet:innen in Leipzig<br />
zu Gast sein. Ein Osteosarkom hat Sophie Loubets Leben<br />
grundlegend verändert: Aufgrund des bösartigen Knochentumors<br />
wurde der französischen Sportlerin 2019 das<br />
rechte Bein amputiert. Dass sie heute auf fast jedem Bild<br />
ihrer Social-Media-Kanäle neue sportliche Herausforderungen<br />
meistert und lächelnd ihre Prothese von Proteor in<br />
Szene setzt, konnte sie sich damals nicht vorstellen. Moderne<br />
Hilfsmittel haben für sie alles verändert und begleiten<br />
die erfolgreiche Para-Sportlerin auf dem erhofften Weg zu<br />
den Paralympics.<br />
Über das Boxtraining lernte Abel Aber seine Prothese<br />
nach einen Motorroller-Unfall 2003 zu akzeptieren. Doch<br />
beim Boxen blieb es nicht. Ausgerüstet mit einer Oberschenkelprothese<br />
von Proteor gehört der 38-Jährige zu den<br />
erfolgreichsten Para-Sportlern Frankreichs in der Kanu-<br />
Disziplin. Sein großes Ziel: die Goldmedaille bei den Paralympics<br />
zu gewinnen.<br />
Nach einem schweren Verkehrsunfall im Jahr 2004<br />
hat sich Sebastian Dietz ins Leben zurückgekämpft. Der<br />
damals 19-Jährige wollte nicht akzeptieren, aufgrund<br />
der schweren Verletzungen entlang der Wirbelsäule nie<br />
wieder laufen zu können. Dank engagierter Ärzt:innen,<br />
Physiotherapeut:innen und moderner Hilfsmittelversorgung<br />
mit einer Fußheberorthese von Sporlastic, aber auch<br />
Foto: Medi<br />
56<br />
ORTHOPÄDIE TECHNIK <strong>05</strong>/24
mit unerschütterlichem Ehrgeiz kam er wieder auf die Beine<br />
und fand seinen Weg in den Profisport. Durch die Orthese<br />
kann Dietz im linken Bein mehr Kraft aufbauen, was<br />
es ihm ermöglicht, seinen Fokus voll und ganz auf das Kugelstoßen<br />
zu legen. Zu den größten Erfolgen des 39-Jährigen<br />
gehören Paralympics-Gold im Diskus und im Kugelstoßen<br />
sowie Europa- und Weltmeister-Titel in beiden Disziplinen.<br />
Sebastian Dietz gehört zum Paralympicskader des<br />
Teams Deutschland Paralympics.<br />
Der paralympische Leichtathletik-Goldmedaillengewinner<br />
Heinrich Popow war als Ottobock-Markenbotschafter<br />
schon viele Male auf der OTWorld. In diesem Jahr<br />
moderiert er das Netzwerktreffen „Startschuss für Paralympics-Sportler<br />
und -Techniker auf dem Weg nach Paris“ sowie<br />
den Workshop „Paralympics – unsere Erfahrungen und<br />
ein Gewinn für Versorgungen im Alltag“. Als ehemaliger<br />
Para-Leichtathlet und gelernter Orthopädietechniker gibt<br />
Popow seine Erfahrungen weiter: Er motiviert Kinder und<br />
Erwachsene mit Amputationen, wieder Sport zu treiben, er<br />
unterstützt Para-Sprinter:innen und Weitspringer:innen<br />
als Mentor und arbeitet als Sportmoderator im TV.<br />
„Ich lasse mich nicht behindern!“ – So lautet das Lebensmotto<br />
von Paralympics-Sportler und Orthopädietechnik-<br />
Meister Markus Rehm. Im Jahr 2003 musste ihm nach einem<br />
Unfall beim Wakeboarden das rechte Bein unterhalb<br />
des Knies amputiert werden. Seit Jahren zählt der Weitspringer<br />
zu den erfolgreichsten Sportler:innen Deutschlands.<br />
Bei den Paralympischen Spielen in Rio de Janeiro<br />
(Brasilien) holte er gleich zwei Goldmedaillen im Weitsprung<br />
und mit der deutschen 4x100-Meter Staffel, mit<br />
8,72 Meter ist er zudem der aktuelle Weltrekordhalter im<br />
Weitsprung. Markus Rehm gehört zum Paralympicskader<br />
des Teams Deutschland Paralympics. Er ist am Dienstag<br />
und Mittwoch (14./15. Mai) am Stand von Össur zu erleben.<br />
Für Arne Uplegger, Abwehrspieler der Dresdner Eislöwen,<br />
begann das Jahr <strong>2024</strong> turbulent: Beim Auswärtsspiel<br />
erlitt der 26-Jährige einen Kreuzbandriss. Oberstes<br />
Ziel des dienstältesten Eishockeyspielers im Dresdner<br />
Team: Er will zurück in seinen Sport. Wie ihn auf diesem<br />
Weg eine teilflexible Hartrahmenorthese von Bauerfeind<br />
zur Stabilisierung seines Kniegelenks unterstützt, erzählt<br />
er zur OTWorld.<br />
Die Influencerinnen und Testimonials Jana Crämer und<br />
Caroline Sprott berichten offen über ihre Krankheitsgeschichte<br />
und ihr Leben mit medizinischer Kompression.<br />
Ihr Ziel ist es, anderen Betroffenen Mut zu machen und zu<br />
inspirieren, zu sich selbst zu stehen – aber auch die Öffentlichkeit<br />
zu sensibilisieren und zur Erkrankung Lip- und<br />
Lymphödem aufzuklären. Bei Jana Crämer wurde ein kombiniertes<br />
Lip- und Lymphödem diagnostiziert, bei Caroline<br />
Sprott ein Lipödem an beiden Armen und Beinen.<br />
Im Alter von neun Jahren entdeckte Simon Liedtke seine<br />
Liebe zum Baseball, mittlerweile ist er als Infielder und<br />
Pitcher bei den Heidenheim Heideköpfen in der 1. Bundesliga<br />
aktiv. Im Sommer 2023 erlitt der Stuttgarter seine<br />
erste schwere Verletzung: In einem Spiel überstreckte er<br />
das Bein und riss sich dabei das hintere Kreuzband im<br />
linken Kniegelenk. Die Ärzt:innen sagten ihm zunächst<br />
das Saisonaus voraus, doch dann sollte alles anders kommen.<br />
Wie Simon Liedtke – dank einer Orthese von Bauerfeind<br />
– in kürzester Zeit zurück ins Spiel fand, erzählt er<br />
auf der OTWorld.<br />
BOTA ist ein in Europa aktives Familienunternehmen.<br />
Seit über 80 Jahren befinden sich die Entwicklung,<br />
die Produktion und der Vertrieb in Belgien.<br />
Bota ist ISO 13485 und OEKO-TEX ® 100 Standard zertifiziert.<br />
Meterware<br />
• Massgefertigt 3D-Flachstricken<br />
• Breite von 90 bis 180 cm<br />
• Verschiedene Farben und Strukturen<br />
Orthopädie<br />
• Bota Bandagen 3D-Qualität<br />
• Reise-, Stütz- und Kompressionsstrümpfe<br />
• Podologie<br />
OT-WORLD, LEIPZIG<br />
14. – 17. Mai <strong>2024</strong><br />
Halle 5. Stand B 60<br />
ORTHOPÄDIE TECHNIK <strong>05</strong>/24<br />
Mehr Info: Tel. +32 9 386 11 78 • info@bota.be • www.bota.be<br />
57<br />
Since 1940<br />
AD 2022/04 D
Orthopädietechnik-<br />
Meister Stephan Klör<br />
misst den Beinumfang<br />
für die fachgerechte<br />
Versorgung von<br />
Kathrin Rammin<br />
mit Kompressionsstrümpfen.<br />
Foto: Schritt für Schritt/Barwich-Foto-Film<br />
´<br />
Unikate für gesunden Druck<br />
Nachdem Kathrin Rammin im Jahr 20<strong>05</strong> die Diagnose<br />
Gebärmutterhalskrebs erhalten hatte, wurde sie innerhalb<br />
kurzer Zeit operiert, durchlief Chemotherapie und<br />
Bestrahlung. Bei dem Eingriff im Unterbauch wurden mit<br />
Gebärmutter und Gebärmutterhals auch Lymphknoten<br />
entfernt. Nach Abschluss der Behandlungen bemerkte die<br />
damals 34-Jährige eine zunehmende Schwellung im rechten<br />
Bein, von der Leiste bis in die Zehen, und schnell wurde<br />
klar: Infolge der Operation entwickelte sich ein Lymphödem.<br />
Bereits seit 2006 geht Rammin regelmäßig zur Lymphtherapie<br />
und trägt konsequent jeden Tag Kompressionsstrümpfe.<br />
Einzige Ausnahme: Wenn das Bein für eine Behandlung<br />
nackt sein muss. Ansonsten gehört die Routine<br />
dazu „wie das Zähneputzen. Auch wenn es anstrengend<br />
ist, da morgens reinzukommen. Ich schaffe das mittlerweile<br />
in etwa zwei Minuten“, erklärt Kathrin Rammin.<br />
Was sie schätzt: Das Gefühl von Sicherheit und die positiven<br />
Auswirkungen des Kompressionsstrumpfs, der Druck<br />
auf das Gewebe ausübt, den Lymphabfluss fördert und die<br />
Schwellung reduziert. Sie weiß allerdings auch, wie es ist,<br />
wenn der Kompressionsstrumpf nicht richtig sitzt: „Dann<br />
rutscht der genauso wie eine schlechtsitzende Strumpfhose,<br />
schnürt die Kniekehle ab, liegt beispielsweise zu eng<br />
am Knöchel, wirft Falten, scheuert und führt im schlimmsten<br />
Fall zu offenen Stellen.“ Da bei einem Lymphödem das<br />
lymphatische System gestört ist, sind Verletzungen und<br />
Entzündungen besonders riskant. „Für die optimale Anpassung<br />
braucht es Fachwissen und vor allem die Geduld,<br />
so lange nachzujustieren bis es passt“, sagt sie.<br />
Die für sie optimale Betreuung findet Rammin seit<br />
2015 bei der „Schritt für Schritt“ GmbH und Orthopädietechnik-Meister<br />
Stephan Klör, den sie lachend ihren „Bestrumpfungsmann“<br />
nennt. Klör wird auf der OTWorld<br />
zum Thema Kompression mehrfach referieren und beispielsweise<br />
im Workshop „Wirkungsvolle und qualifizierte<br />
orthopädietechnische Kompressionsversorgung – Beratung<br />
und Behandlungsempfehlung, Ausmessen, Kompressionsdruck<br />
und -materialien, Zusatzprodukte, Tipps und<br />
Tricks“ (Dienstag ab 10:30 Uhr) praxisnah sein Wissen und<br />
seine Erfahrung mit den Teilnehmenden teilen. Zweimal<br />
im Jahr misst er beide Beine von Rammin komplett aus, jeden<br />
Zeh und jede Falte, damit anhand der Daten ein neuer<br />
Kompressionsstrumpf gefertigt werden kann – ein Unikat,<br />
das perfekt zu den individuellen Anforderungen der Patientin<br />
passt. Derzeit trägt sie am rechten Bein einen Leistenstrumpf<br />
mit Zehenkappen und darüber eine komplette<br />
Kompressionsstrumpfhose über beide Beine, sodass das<br />
rechte Bein zwar stärker komprimiert wird, sie im Zusammenspiel<br />
beider Beine aber ein ausgewogenes Gefühl hat.<br />
Die Zehenkappen helfen zudem gegen den Lymphstau in<br />
einzelnen Zehen. Worauf der Orthopädietechnik-Meister<br />
besonderen Wert legt: das Probetragen. „Nach eingehender<br />
Erstberatung, Anamnese und dem Vermessen spielt die<br />
Anprobe eine entscheidende Rolle – erst wenn der Strumpf<br />
unter Spannung auf dem Körper aufliegt und sich allen<br />
Rundungen anpasst, merkt die jeweilige Patientin, ob jeder<br />
Druckverstärker und jede Pelotte an der richtigen Stelle ist,<br />
ob alles sitzt“, erklärt Klör. Entsprechend wichtig ist es ihm,<br />
dass seine Kundin auch jeden neuen Kompressionsstrumpf<br />
intensiv probeträgt und mehrmals wäscht. Sollte etwas<br />
nicht passen, wird beim Hersteller neu gestrickt – immerhin<br />
begleitet die Maßanfertigung sie durch ihren gesamten<br />
Alltag, zur Arbeit genauso wie zum Fahrradfahren, zu den<br />
Hunderunden oder langen Spaziergängen, zum Skifahren,<br />
Schwimmen und seit Kurzem auch zum Yoga.<br />
Kathrin Rammin sieht sich noch lange nicht am Ende<br />
ihrer Reise und war dieses Jahr bereits zur Voruntersuchung<br />
für einen weiteren Eingriff, der die Gesundheit ihres Beines<br />
weiter verbessern soll. Darüber hinaus will sie ihre Erfahrungen<br />
teilen, mit ihrem angeeigneten Wissen aufklären.<br />
Dafür ist sie zusammen mit Stephan Klör regelmäßig bei<br />
Kongressen unterwegs. Ihr gemeinsames Ziel: Sie wollen<br />
dem Thema Gehör verschaffen, langfristig Verbesserungen<br />
in der Behandlung der Erkrankung anstoßen und auf<br />
diese Weise möglichst vielen Betroffenen helfen.<br />
58<br />
ORTHOPÄDIE TECHNIK <strong>05</strong>/24
Richtungsweisend<br />
Mit digitalen Lösungen<br />
gemeinsam<br />
Perspektiven schaffen<br />
Lösungen wie für uns gemacht!<br />
Wir profitieren mit den Lösungen der opta data von den Stärken einer Gruppe, die uns als Hilfsmittelanbieter<br />
dort unterstützt, wo es wirklich zählt. Mit jahrzehntelanger Erfahrung ebnen die Expert:innen<br />
der opta data uns den Weg für alle Herausforderungen und sind an unserer Seite bei der Digitalisierung<br />
von Prozessen. So bietet uns beispielsweise die digitale Abrechnung mit connect schon heute echte<br />
Mehrwerte.<br />
Als Partner und Vorreiter für die Telematikinfrastruktur ist opta data auch unsere Anlaufstelle für alle<br />
Fragen zu diesem Thema. Hier bekommen wir direkt unseren TI-Anschluss.<br />
Live für Sie vor Ort<br />
OTWorld Leipzig<br />
14. - 17. Mai <strong>2024</strong><br />
Halle 5, Stand E30/G31<br />
go.optadata.de/otworld<strong>2024</strong>
Grill den<br />
Präsidenten<br />
Exklusiv und gratis für alle<br />
Mitglieder der Innungen<br />
Alf Reuter, Präsident des<br />
Bundesinnungsverbandes<br />
für Orthopädie-Technik,<br />
stellt sich den Fragen der<br />
Mitgliedsunternehmen<br />
und geht in die<br />
Diskussion.<br />
Motto: Nicht meckern,<br />
sondern mitgestalten!<br />
Mittwoch<br />
15.<strong>05</strong>.<strong>2024</strong><br />
13:00 - 13:45 Uhr<br />
im BIV Café<br />
Halle 3, Stand<br />
D10/E11<br />
Imbiss<br />
inklusive<br />
Per E-Mail vorab<br />
Fragen einreichen<br />
an: info@biv-ot.org.
Digitalisierung<br />
Sicherheitsrisiko bei Microsoft-Exchange-Server<br />
Im Geschäftsumfeld gehört der Microsoft-Exchange-Server<br />
zu den beliebtesten Anwendungen, da damit die Verwaltung<br />
von E-Mail-Nachrichten, Kalendern, Kontakten und<br />
Aufgaben erledigt wird. Das Bundesamt für Sicherheit in<br />
der Informationstechnik (BSI) hat jetzt mindestens 17.000<br />
Instanzen von Microsoft-Exchange-Servern in Deutschland<br />
identifiziert, die durch eine oder mehrere kritische Schwachstellen<br />
verwundbar sind. Cyberkriminelle sowie Akteure im<br />
Dienst von Nationalstaaten nutzen diese Schwachstellen<br />
bereits aktiv zur Verbreitung von Schadsoftware, zu Cyberspionage<br />
oder für Ransomware-Angriffe aus. Betroffen sind<br />
insbesondere Schulen und Hochschulen, Kliniken, Arztpraxen,<br />
Pflegedienste und andere medizinische Einrichtungen,<br />
Büros von Rechtsanwält:innen und Steuerberater:innen,<br />
Kommunalverwaltungen sowie viele mittelständische Unternehmen.<br />
BSI-Präsidentin Claudia Plattner ruft daher auf,<br />
dass sich Unternehmen ihrer Verantwortung bewusst werden<br />
und entsprechend reagieren: „Dass es in Deutschland<br />
von einer derart relevanten Software zigtausende angreifbare<br />
Installationen gibt, darf nicht passieren. Unternehmen,<br />
Organisationen und Behörden gefährden ohne Not ihre IT-<br />
Systeme und damit ihre Wertschöpfung, ihre Dienstleistungen<br />
oder eigene und fremde Daten, die womöglich hochsensibel<br />
sind. Cybersicherheit muss endlich hoch oben auf die<br />
Agenda. Es besteht dringender Handlungsbedarf!“<br />
Rund 45.000 Microsoft-Exchange-Server in Deutschland<br />
sind derzeit ohne Beschränkungen aus dem Internet<br />
erreichbar. Nach aktuellen Erkenntnissen des BSI sind etwa<br />
zwölf Prozent davon so veraltet, dass für sie keine Sicherheitsupdates<br />
mehr angeboten werden. Rund 25 Prozent aller<br />
Server werden zwar mit aktuellen Versionen Exchange<br />
2016 und 2019 betrieben, verfügen aber über einen veralteten<br />
Patch-Stand. In beiden Fällen sind die Server für mehrere<br />
kritische Schwachstellen anfällig. Damit sind mindestens<br />
37 Prozent aller offen aus dem Internet erreichbaren<br />
Microsoft-Exchange-Server verwundbar.<br />
Bereits 2021 warnte das BSI mehrfach vor der aktiven<br />
Ausnutzung kritischer Schwachstellen in Microsoft Exchange<br />
und rief zeitweise die IT-Bedrohungslage „Rot“<br />
aus. Trotzdem hat sich die Lage seitdem<br />
nicht verbessert, da viele Betreiber von<br />
Exchange-Servern weiterhin sehr nachlässig<br />
handeln und zur Verfügung stehende<br />
Sicherheitsupdates nicht zeitnah einspielen.<br />
Aktuell bewertet das BSI die IT-Bedrohungslage<br />
als geschäftskritisch („Orange“).<br />
Eine massive Beeinträchtigung des Regelbetriebs<br />
ist zu erwarten. Das BSI empfiehlt,<br />
webbasierte Dienste des Exchange-Servers<br />
Foto: BSI<br />
wie Outlook Web Access grundsätzlich nicht offen aus<br />
dem Internet erreichbar zu machen, sondern den Zugriff<br />
auf vertrauenswürdige Quell-IP-Adressen zu beschränken<br />
oder über ein VPN abzusichern.<br />
Cybersicherheit – bin ich gefährdet?<br />
Wie hoch die eigene Bedrohungslage durch Cyberangriffe<br />
ist, können viele kleine und mittelständische Unternehmen<br />
gar nicht einschätzen. Deswegen hat das BSI in Zusammenarbeit<br />
mit dem Bundesverband mittelständische<br />
Wirtschaft (BVMW) ein Konsortium zur Erarbeitung einer<br />
DIN SPEC gegründet. Ergebnis ist die DIN SPEC 27076, die<br />
als Grundlage für den Cyberrisikocheck dient. Beim Cyberrisikocheck<br />
befragt ein IT-Dienstleister ein Unternehmen<br />
in einem ein- bis zweistündigen Interview zur IT-Sicherheit<br />
im Unternehmen. Darin werden 27 Anforderungen<br />
aus sechs Themenbereichen daraufhin überprüft, ob<br />
das Unternehmen sie erfüllt. Für die Antworten werden<br />
nach den Vorgaben der DIN SPEC Punkte vergeben. Als Ergebnis<br />
erhält das Unternehmen einen Bericht, der u. a. die<br />
Punktzahl und für jede nicht erfüllte Anforderung eine<br />
Handlungsempfehlung enthält. Die Empfehlungen sind<br />
nach Dringlichkeit gegliedert. Der Cyberrisikocheck ist allerdings<br />
keine IT-Sicherheitszertifizierung.<br />
Die Kosten entsprechen denen eines Beratertages. Auf<br />
Bundesebene werden der Check und sich daran anschließende<br />
Handlungsempfehlungen bereits jetzt über das<br />
Programm „go-digital“ mit 50 Prozent bezuschusst. Mehrere<br />
Bundesländer haben ebenfalls eine Förderbereitschaft<br />
signalisiert. Plattner erklärt: „Der Cyberrisikocheck<br />
ist ein echtes Win-win-win-Produkt: für die kleinen Unternehmen,<br />
für die IT-Dienstleister und für das BSI. Damit<br />
haben wir den Grundstein für ein KMU-Cybersicherheitslagebild<br />
gelegt, und das ist ein wichtiger Schritt auf<br />
dem Weg zur Cybernation Deutschland. Wir freuen uns,<br />
dass schon jetzt mehr als 120 weitere IT-Dienstleister ihr<br />
Interesse an einer Durchführung des Cyberrisiko checks<br />
bekundet haben.“<br />
Premiere: Mehr als 60 IT-Dienstleister<br />
haben an der Schulung für die Durchführung<br />
des Cyberrisikochecks teilgenommen.<br />
ORTHOPÄDIE TECHNIK <strong>05</strong>/24<br />
61
Digitalisierung<br />
Die DMEA, Europas führender Kongress für digitale Gesundheitslösungen,<br />
fand vom 16. bis 18. April in Berlin<br />
statt. Rund 18.500 Expert:innen und Interessierte aus den<br />
unterschiedlichsten Professionen kamen zusammen, um<br />
die neuesten Entwicklungen in der Digitalisierung des Gesundheitswesens<br />
zu diskutieren und sich bei den rund 800<br />
Ausstellern zu informieren.<br />
Für die Orthopädie-Technik im Speziellen und das<br />
Gesundheitshandwerk im Allgemeinen standen Themen<br />
wie digitale Transformation, E-Rezept und Telematikinfrastruktur<br />
(TI) im Mittelpunkt. Doch es ging um weit mehr<br />
als technische Umsetzungen, es ging um einen Kulturwandel.<br />
Entscheidungsträger sind gefordert, neue Denkweisen<br />
zu fördern und Ressourcen für die Neugestaltung von Prozessen<br />
bereitzustellen.<br />
Können große IT-Unternehmen wie Google oder Amazon<br />
Web Services (AWS) potenzielle Partner für kleinere<br />
Handwerksbetriebe sein? Die Einschätzung von Antonia<br />
Schmidt (AWS) auf der DMEA unterstreicht, dass es an der<br />
Zeit ist, aktiv zu werden und nicht auf weitere gesetzliche<br />
Regelungen zu warten, um den digitalen Raum mitzugestalten.<br />
Der Blick über den Tellerrand der Orthopädie-Technik<br />
zeigte auf der DMEA einmal mehr, dass es längst zahlreiche<br />
Lösungen für eine effektive Kommunikation und<br />
Arbeitsweise zwischen B2C, B2B und auch für Unternehmen<br />
mit einer komplexen Filialstruktur und untereinander<br />
im Unternehmen gibt.<br />
Thomas Süptitz, Leiter des Referats „Cybersicherheit<br />
und Interoperabilität“ im Bundesministerium für Gesundheit,<br />
betonte die Wichtigkeit einheitlicher Sicherheitsstandards,<br />
die sowohl für Krankenhäuser als auch für kleinere<br />
Praxen gelten sollten, um den Schutz von Patienten- und<br />
Gesundheitsdaten zu gewährleisten. Denn hier dürfe es<br />
keine Unterschiede zwischen den verschiedenen Versorgungsbereichen<br />
geben.<br />
Im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) zeigt sich,<br />
dass der Krankenhaussektor bereits deutlich weiter ist als<br />
das Gesundheitshandwerk. Die Herausforderung besteht<br />
darin, Ideen zu entwickeln und umzusetzen, die den All-<br />
Bundesgesundheitsminister<br />
Prof. Karl<br />
Lauterbach gehört zu<br />
den Stammgästen auf<br />
der DMEA.<br />
Foto: Messe Berlin GmbH<br />
DMEA <strong>2024</strong>: Orthopädie-Technik im „Digi-Tal“?<br />
tag erleichtern, ohne die Arbeitsbelastung unnötig zu erhöhen.<br />
Die Vorstellung, dass neue Technologien nur mehr Arbeit<br />
bedeuten, müsse – so der Tenor vieler Besucher:innen<br />
– überwunden werden. Zukunftsfähige Lösungen zeigen<br />
bereits heute auf, dass digitale Unterschriften und entsprechende<br />
Archivierung zusammen mit einer echten Neugestaltung<br />
der Prozesse zu mehr Effizienz im Unternehmen<br />
und Zeit für die Patient:innen führen.<br />
Die DMEA <strong>2024</strong> hat deutlich gemacht, dass sich die<br />
Orthopädie-Technik noch im „Digi-Tal“ befindet. Die Vorstellung,<br />
Daten lokal sicherer zu speichern, ist eine Illusion.<br />
Sicherheitsstandards im Cloud-Computing mit dem C5-<br />
Zertifikat des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik<br />
(BSI) können nur von entsprechenden Marktteilnehmern<br />
bereitgestellt werden. Eine Überwachung und<br />
Sicherung rund um die Uhr kann von kleineren Betrieben<br />
kaum geleistet werden, was eine ehrliche Auseinandersetzung<br />
mit den Möglichkeiten und Grenzen digitaler Technologien<br />
erfordert.<br />
Die Digitalisierung in der Orthopädie-Technik und im<br />
Gesundheitshandwerk steht an einem Punkt, an dem alte<br />
Prozesse hinterfragt und neue Wege beschritten werden<br />
müssen. Die DMEA hat einmal mehr gezeigt, dass der Weg<br />
der digitalen Transformation nicht nur Herausforderungen,<br />
sondern auch große Chancen für die Branche bereithält.<br />
Terminplanungstools, Korrespondenz mit Mediziner:innen<br />
und Praxen sowie die automatisierte Benachrichtigung<br />
der Patient:innen über den Status ihrer Hilfsmittelversorgung<br />
können bereits heute unabhängig von TI und Co. in<br />
den Unternehmen eingeführt und umgesetzt werden. Die<br />
personellen Ressourcen muss jedes Unternehmen im Rahmen<br />
seiner Verantwortung bereitstellen – und damit sind<br />
explizit keine Orthopädietechniker:innen gemeint, sondern<br />
„Hidden Champions“, die als Chancenagenten im<br />
Unternehmen mit einer digitalen Mission unterwegs sind.<br />
Die nächste DMEA wird Anfang April 2025 wieder in<br />
Berlin stattfinden.<br />
<br />
Daniel Behm<br />
62<br />
ORTHOPÄDIE TECHNIK <strong>05</strong>/24
Digitalisierung<br />
KI-generiertes Bild. Tool: DALLE<br />
Cybersicherheit ist eine Pflichtaufgabe<br />
206 Milliarden Euro – so viel kosteten Cyberangriffe die<br />
deutsche Wirtschaft im Jahr 2022 laut Angaben des Digitalverbands<br />
Bitkom. Eine gewaltige Summe, doch finanzieller<br />
Schaden ist nur eine Komponente, wie Cyberkriminelle<br />
Profit aus ihren Angriffen ziehen. Zum Beispiel können die<br />
Kriminellen auch das Netzwerk des Angegriffenen kapern<br />
und für illegale Aktivitäten nutzen – etwa zum Senden von<br />
Phishing-Mails oder zur Verbreitung von Kinderpornografie.<br />
Deshalb ist es so wichtig, dass die Unternehmen, egal<br />
welcher Größe, Wert auf die eigene Cybersicherheit legen.<br />
Dabei muss es nicht immer das teure All-in-Service-Paket<br />
sein, das sich kleinere Unternehmen scheuen zu finanzieren,<br />
sondern es reicht manchmal eine externe Festplatte,<br />
um seine Daten zu sichern.<br />
Wo fängt Cybersicherheit an? Wenn es nach Björn<br />
Schemberger, Abteilungsleiter Detektion und Reaktion der<br />
Cybersicherheitsagentur Baden-Württemberg (CSBW),<br />
geht, dann spätestens bei den Login-Daten für Accounts<br />
im Internet. „Ich gehöre ja zu der Generation, die lange<br />
Zeit ein Passwort – manchmal auch in verschiedenen Variationen<br />
– und oftmals auch einen Bezug zu dem Passwort<br />
hatte. Das ist natürlich ein Relikt der Vergangenheit. Heutzutage<br />
ist es aus meiner Sicht unumgänglich, einen Passwortmanager<br />
einzusetzen.“<br />
Was ist ein Passwortmanager? Wie der Name schon<br />
sagt, ist dies ein digitales Werkzeug, das dazu entwickelt<br />
wurde, Nutzer:innen bei der Verwaltung ihrer Passwörter<br />
zu unterstützen. Dieses Tool speichert und organisiert<br />
Passwörter in einer verschlüsselten Datenbank, die durch<br />
ein Hauptpasswort gesichert ist. Das Hauptpasswort ist<br />
das einzige Passwort, das sich der Anwender merken muss.<br />
Die Kernfunktion eines Passwortmanagers besteht darin,<br />
unterschiedliche, komplexe Passwörter für jede genutzte<br />
Website oder Anwendung zu erstellen und sicher zu speichern.<br />
Zusätzlich bietet ein Passwortmanager oft weitere<br />
Funktionen wie die automatische Eingabe von Passwör-<br />
Mit einem Passwortmanager lassen sich die privaten und<br />
beruflichen Accounts schützen.<br />
Unternehmen jeder<br />
Größe können<br />
Opfer von Cyberangriffen<br />
werden.<br />
Experte Björn<br />
Schemberger rät daher,<br />
Cybersicherheit zur<br />
Chefsache zu machen.<br />
tern in Formularfelder im Internetbrowser sowie die Möglichkeit,<br />
sichere Notizen und andere sensible Informationen<br />
zu speichern. Moderne Passwortmanager sind in der<br />
Regel plattformübergreifend verfügbar, was bedeutet, dass<br />
sie auf verschiedenen Geräten wie Computern, Smartphones<br />
und Tablets genutzt werden können, um einen nahtlosen<br />
Zugriff zu ermöglichen. „Oft nutzen die Leute dienstlich<br />
wie privat die gleichen Kennwörter und das ist natürlich<br />
Gift für die Cybersicherheit“, erklärt Schemberger einen<br />
weiteren Grund, warum Passwortmanager ein absolutes<br />
Muss im betrieblichen Cybersicherheitskonzept sein<br />
müssen. „Ich empfehle einmal auf der Website des Hasso-<br />
Plattner-Instituts zu überprüfen, ob eigene Accounts in der<br />
Vergangenheit geleakt wurden“, rät Schemberger. Bei dem<br />
„HPI Identity Leak Checker“ kann man – als Privatperson<br />
oder auch Unternehmen – den Check einmal am Tag kostenlos<br />
durchführen. Die Ergebnisse – rund 1,5 Millionen<br />
geleakte Accounts täglich – sprechen eine deutliche Sprache,<br />
sodass auch die letzten Zweifler von der Sinnhaftigkeit<br />
einer aktiven Cybersicherheit überzeugt sein sollten.<br />
Cybersicherheit ist Chefsache<br />
Entscheidend ist, dass vor allem die Führungskräfte davon<br />
überzeugt sind, wie wichtig es ist, in die eigene Cybersicherheit<br />
zu investieren. „Cybersicherheit muss ein zentrales<br />
Thema der Leitungsebene sein“, erklärt Schemberger.<br />
Wer selbst nicht glaubt, dass sich der Aufwand lohnt, wird<br />
auch die Belegschaft schwer davon überzeugen können, Sicherheitsmaßnahmen<br />
einzuhalten. „Das Geld, dass ich in<br />
meine digitale Sicherheit stecke, kann ich natürlich nicht<br />
in mein Produkt investieren. Das ist für manche schon eine<br />
Frage von ‚entweder oder‘. Allerdings muss man sich fragen,<br />
wie hoch mein Schaden werden könnte, wenn ich untätig<br />
bleibe“, gibt Schemberger einen Gedankenanstoß. Ob deutsche<br />
Unternehmen sich der Gefahren von Cyberangriffen<br />
bewusst sind, beantwortet der Experte mit einem pauschalen<br />
„Ja.“ Wie informiert die einzelnen Betriebe sind, das<br />
steht auf einem anderen Blatt. „Als Unternehmen ist man<br />
immer limitiert. Die Kernfragen sind also: ‚Wieviel Mittel<br />
habe ich zur Verfügung?‘ und ‚Auf welche Technologien<br />
setze ich?‘. Und das ist bei wahrscheinlich jedem Betrieb<br />
individuell. Nicht nur die Frage, wieviel Geld setze ich an,<br />
das ist grundlegend erforderlich, aber setze ich es auch da<br />
an, wo wirklich der Schuh drückt?“, fragt Schemberger. Als<br />
Beispiel nennt er Betriebe, die viel Geld in Sicherheit investieren,<br />
aber zum Beispiel keine Passwortstrategie haben und<br />
somit an einer vergleichbar einfachen und kostengünstigen<br />
Stelle sparen und ein Einfallstor für Kriminelle öffnen.<br />
Foto: Cybersicherheitsagentur Baden-Württemberg<br />
64<br />
ORTHOPÄDIE TECHNIK <strong>05</strong>/24
Digitalisierung<br />
Von Profis beraten lassen<br />
Der Rat des Experten ist daher, sich professionell und regelmäßig<br />
beraten zu lassen. Zum einem, weil Sicherheitsexpert:innen<br />
das Unternehmen analysieren und dann<br />
Empfehlungen aussprechen können, welche Maßnahmen<br />
passend zu den jeweiligen Anforderungen sind, und zum<br />
anderen, weil externe Expert:innen stets aktuelle Bedrohungslagen<br />
im Blick haben. Damit wird gewährleistet, dass<br />
der Schutz an die neusten Bedrohungen aus dem Netz angepasst<br />
wird. Um sich einen ersten Überblick zu verschaffen,<br />
hat die Cybersicherheitsagentur Baden-Württemberg<br />
ein Prüfdokument für Unternehmen erstellt. Unter dem<br />
Titel „Häufig ausgenutzte konzeptionelle Schwächen bei<br />
IT-Sicherheitsarchitekturen“ wurde zusammengefasst, an<br />
welcher Stelle Unternehmer:innen nachsteuern müssen<br />
bei ihrem eigenen Konzept. „Als Cybersicherheitsagentur<br />
des Landes Baden-Württemberg liegt unser primärer Fokus<br />
auf dem öffentlichen Sektor. Hier beraten wir intensiv und<br />
geben Hilfestellungen. Daraus ergeben sich aber Erkenntnisse,<br />
die auch für Unternehmen interessant sind. Diese<br />
können wir als neutrale Stelle zur Verfügung stellen“, erklärt<br />
Schemberger dazu, warum es sich lohnt, in das Dokument<br />
einmal reinzuschauen, ohne Bedenken zu haben,<br />
dass dort ein Produkt bevorzugt angepriesen wird.<br />
Zudem rät Schemberger, sich zur Krisenvorsorge auch<br />
wirklich an Sicherheitsexpert:innen zu wenden, die Erfahrung<br />
im Bereich Incident Response haben und nicht ausschließlich<br />
an den IT-Dienstleister des Vertrauens. Letztgenannte<br />
haben ihr Know-how und ihre Expertise üblicherweise<br />
im Bereich des IT-Betriebs, oftmals fehlt ausgewiesene<br />
Kompetenz im Bereich IT-Sicherheitsarchitekturen<br />
und es wird zu Standardlösungen gegriffen anstatt<br />
maßgeschneiderte Lösungsarchitekturen zu entwickeln.<br />
Von den krisenerfahrenen Expert:innen können wertvolle<br />
Hinweise kommen, welche zentralen Maßnahmen wie<br />
z. B. Ransomware-resistentes Back-up, zentrales und Ransomware-resistentes<br />
Logging etc. umgesetzt werden sollten,<br />
um im Krisenfall besser aufgestellt zu sein. Ein ge-<br />
meinsamer Workshop kann hier wertvolle Erkenntnisse<br />
schaffen, welche Bausteine in der IT-Sicherheitsarchitektur<br />
noch dringend umgesetzt werden sollten. Dabei muss<br />
Sicherheit nicht teuer sein. „Wenn ich mich beispielsweise<br />
gegen einen Ransomware-Angriff schützen will, dann<br />
reicht mir im besten Fall eine USB-Festplatte zum Wechseln.<br />
Kostenpunkt für diesen Speicher: vielleicht 100 Euro.<br />
Nehmen wir einmal den Friseurbetrieb um die Ecke mit<br />
drei Mitarbeitenden. Wenn die keinen Remotezugang aus<br />
dem Internet brauchen, dann kann man sich die hohen Investitionen<br />
sparen und wirklich sein Back-Up auf einer externen<br />
Festplatte speichern. Schon hat man für wenig Geld<br />
die Daten geschützt und kann im Falle eines Falles direkt<br />
weiterarbeiten“, erklärt Schemberger. Natürlich lässt sich<br />
das nicht pauschalisieren. Je nach Größe und Gewerk sowie<br />
Datenzugang brauchen Unternehmen unterschiedliche<br />
Sicherheitsmaßnahmen. Ein Beispiel ist die Netzwerksegmentierung.<br />
„Ich muss vielleicht nicht meine Daten der<br />
vergangenen zehn Jahre so abspeichern, dass sie vom Internet<br />
aus verfügbar sind“, meint der Experte. Vielmehr lässt<br />
sich durch eine Teilung in aktuelle und archivierte Dateien<br />
mit einer zwischengeschalteten Firewall eine sinnvolle<br />
Trennung zwischen den Informationen erreichen. Denn<br />
so gehen im Falle eines Angriffs nicht sofort alle Dateien<br />
auf einmal verloren. Oder man nimmt das Thema Web site.<br />
„Ich muss nicht zwangsläufig die Website auf meinem eigenen<br />
Server hosten, sondern kann auch einen Webserver<br />
dafür nutzen“, meint Schemberger. Der Vorteil: Wenn die<br />
Website gehackt wird, kann nicht in das System an sich eingedrungen<br />
werden.<br />
Spielt die Größe eine Rolle?<br />
Gerade kleinere Betriebe werden sich fragen, wie attraktiv<br />
sie für Cyberkriminelle sind. Die Antwort des Experten<br />
ist eindeutig: „Die Kriminellen wissen in den meisten Fällen<br />
gar nicht um die Größe des Unternehmens, das sie da<br />
angreifen.“ In erster Linie geht es den Angreifern darum,<br />
Zugang zu einem System zu bekommen. Wenn dieser ge-<br />
14. – 17. Mai <strong>2024</strong><br />
OTWorld Leipzig<br />
Besuchen Sie uns<br />
in Halle 1, Stand A10 / B11<br />
www.ofa.de<br />
Neugierig?<br />
Freuen Sie sich auf unsere<br />
Highlights in Leipzig
Digitalisierung<br />
Angreifer haben leichtes Spiel<br />
KI-generiertes Bild, Tool: DALLE<br />
Wenn ein Ransomwareangriff erfolgreich war, zählen häufig<br />
Minuten, um den Schaden gering zu halten.<br />
Für Schemberger ist es wichtig zu betonen, dass sich die<br />
Entscheider nicht vor dem Thema Cybersicherheit drücken,<br />
weil das Feld so immens groß ist. Vielmehr solle man<br />
an einem Punkt gezielt starten und sich dann sukzessive<br />
vorarbeiten. Ein erfolgreicher Cyberangriff kann schließlungen<br />
ist, wird dieser Zugang auf dem Schwarzmarkt verkauft.<br />
Dabei gibt es drei große „Geschäftsmodelle“. Das<br />
erste Modell ist die Verschlüsselung der Daten. Dies ist die<br />
Folge eines Ransomwareangriffs. Das betroffene Unternehmen<br />
bekommt erst wieder Zugriff auf seine Daten und<br />
technische Infrastruktur, wenn es eine Geldsumme an<br />
die Kriminellen bezahlt. Der Angriff auf Medi im August<br />
2022 ist vielen aus der Branche noch bestens im Gedächtnis,<br />
legten die Angreifer doch die gesamte Produktion des<br />
Bayreuther Herstellers lahm. Das zweite Modell ist, dass der<br />
Angreifer die vorhandene Infrastruktur für illegale Aktivitäten<br />
nutzt. Das bedeutet, dass die eigenen Rechner beispielsweise<br />
Teil eines Bot-Netzwerks werden. Ein Botnetz,<br />
kurz für „Roboternetzwerk“, ist eine Sammlung von internetverbundenen<br />
Geräten, die ohne das Wissen ihrer Besitzer<br />
mit Malware infiziert und ferngesteuert werden. Diese<br />
Geräte können PCs, Server, mobile Geräte und sogar vernetzte<br />
Haushaltsgeräte umfassen. Cyberkriminelle nutzen<br />
diese Netzwerke oft für verschiedene bösartige Aktivitäten,<br />
darunter das Versenden von Spam-E-Mails, das Durchführen<br />
von DDoS-Attacken (Distributed Denial of Service),<br />
bei denen Websiten durch Überlastung zum Stillstand gebracht<br />
werden, und das Mining von Kryptowährungen.<br />
Das Heimtückische an Botnetzen ist ihre Fähigkeit, sich<br />
unbemerkt auszubreiten. Sie nutzen Sicherheitslücken in<br />
Software und Betriebssystemen, um sich zu vermehren.<br />
Einmal eingerichtet, kann der Betreiber des Botnetzes diese<br />
„Bots“ gleichzeitig nutzen, um automatisierte Aufgaben<br />
über das Internet auszuführen, was die Angriffskraft potenziell<br />
vervielfacht.<br />
Industriespionage ist das dritte Geschäftsmodell der Cyberkriminellen.<br />
Im Gegensatz zu den beiden anderen Modellen<br />
handelt es sich bei dem Auskundschaften von Betriebsgeheimnissen<br />
meistens um einen gezielt gegen ein<br />
Unternehmen oder eine Behörde gerichteten Angriff, um<br />
an bestimmte Informationen zu gelangen.<br />
Deshalb können auch kleine Betriebe durchaus das Ziel<br />
von Cyberangriffen sein – die Wahrscheinlichkeit ist für<br />
den Experten sogar sehr hoch, da sich die Frequenz der Angriffe<br />
ständig erhöht. „Seit fünf Jahren merke ich einen Anstieg.<br />
Hatte man damals hin und wieder einmal eine große<br />
Meldung, dass es einen Hack oder eine Kompromittierung<br />
gab, so sind es heute mehrere Fälle täglich“, erklärt Schemberger.<br />
Die Arbeitsweise der Kriminellen hat sich professionalisiert<br />
und die Methoden haben sich verfeinert. Ein<br />
Beispiel: Wenn ein Softwareanbieter einen Patch zur Verfügung<br />
stellt, um eine Schwachstelle im eigenen Produkt zu<br />
beheben, dann scannen die Kriminellen direkt die Nutzer<br />
dieser Software ab, ob diese den Patch bereits aufgespielt<br />
haben – oder noch nicht. Entwickler und Firmen liefern<br />
den Kriminellen damit eine Steilvorlage für ihr illegales<br />
Treiben, die Angreifer bekommen die Schwachstelle quasi<br />
umsonst geliefert und müssen nur noch die Opfer identifizieren.<br />
In puncto Sicherheitsupdates rät der Experte daher<br />
dringend dazu, tagesaktuell alles auf den neuesten Stand<br />
zu bringen. Gegebenenfalls geht es für Unternehmen um<br />
Minuten, bevor das eigene System beispielsweise vollständig<br />
verschlüsselt wird.<br />
Apropos Verschlüsselung. So digital alle werden wollen,<br />
manchmal muss es analog sein. Björn Schemberger rät<br />
den Unternehmen, sich im Vorfeld darüber Gedanken zu<br />
machen, wie sie im Notfall reagieren wollen und sich diese<br />
Handlungsanweisung auszudrucken. „Ich empfehle, die<br />
Szenarien einmal mit Experten durchzuspielen. Da kann<br />
man die wichtigen Entscheidungen ohne großen Stress<br />
treffen und ist so im Falle eines Falles gerüstet und muss<br />
nicht spontan entscheiden. Unter Umständen kann das<br />
den Fortbestand des Unternehmens sichern.“<br />
Denn trotz eines Angriffs bleibt die Welt ja nicht stehen.<br />
Bestellte Ware wird weiterhin von den Partnern angeliefert,<br />
da müssen die Mitarbeitenden dann mit Bleistift<br />
und Papier ran – eine mühselige Arbeit, die es zu verhindern<br />
gilt. Entscheidend dafür ist auch der Faktor „Mensch“.<br />
Egal, wie gut das Sicherheitsnetz ist, wenn ein Mitarbeitender<br />
eine Phishing-Mail öffnet, dann droht dem gesamten<br />
Unternehmen eine große Gefahr. Damit die Mitarbeitenden<br />
gewarnt sind, wird empfohlen, regelmäßige Schulungen<br />
anzubieten, um auf generelle und aktuelle Bedrohungen<br />
hinzuweisen. Auch hier liegt die Verantwortung in<br />
der Chefetage, die ihren Angestellten vorleben muss, wie<br />
wichtig Cybersicherheit ist. „Außerdem müssen Zuständigkeiten<br />
geklärt werden“, rät Schemberger aufgrund seiner<br />
Erfahrungen. Wenn nicht klar ist, wer welche Aufgabe<br />
in dem System hat, dann kann es im schlimmsten Fall zu<br />
einem erfolgreichen Angriff führen und vermeintliche Sicherheitsmaßnahmen<br />
haben nicht gegriffen, weil die entscheidende<br />
Person vielleicht gar nicht wusste, dass sie zuständig<br />
ist.<br />
Keine Herkulesaufgabe<br />
66<br />
ORTHOPÄDIE TECHNIK <strong>05</strong>/24
Digitalisierung<br />
lich die unternehmerische – oder sogar die private – Existenz<br />
gefährden. „Wenn ich ein kleiner Betrieb bin, dann<br />
können mir zwei externe Festplatten, eine rot angemalt,<br />
eine grün angemalt, für wenig Geld meine Existenz sichern.<br />
Die eine Festplatte ist mit dem System verbunden,<br />
die andere liegt daheim und sichert vielleicht dadurch meinen<br />
Kundenstamm“, erklärt Schemberger und hat noch einen<br />
weiteren Rat: „Wenn man solche externen Festplatten<br />
von einem Ort zum anderen bewegt, dann sollte man darauf<br />
achten, dass die Festplatten verschlüsselt sind. Wenn<br />
die Festplatten dann einmal in fremde Hände fallen, können<br />
diese nicht so einfach Zugang zu den Daten haben.“<br />
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Unternehmen<br />
egal welcher Größe wahrscheinlich täglich einer<br />
Vielzahl globaler Angriffe ausgesetzt sind. In die digitale<br />
Sicherheit seines Unternehmens zu investieren, ist daher<br />
keine Option, sondern eine Pflichtaufgabe. Externe<br />
Sicherheitsberater:innen können helfen, den konkreten<br />
Bedarf an Sicherheitsmaßnahmen festzulegen. Bereits mit<br />
einem überschaubaren Budget gibt es Maßnahmen, die essenziell<br />
die eigene Cybersecurity erhöhen können. Und<br />
eine gute Nachricht für Entscheider:innen: Nicht alles<br />
muss auf einen Schlag erledigt werden. Wer sich mit dem<br />
Thema beschäftigt und konsequent damit beginnt, erste,<br />
vielleicht auch kleinere, Maßnahmen umzusetzen, und<br />
das eigene Team auf diesem Weg mitnimmt, der hat schon<br />
den entscheidenden Schritt getan.<br />
grow<br />
Let yourself<br />
Trend Colours <strong>2024</strong> / 25<br />
Lebensfreude in Bewegung<br />
Heiko Cordes<br />
Betriebe in Baden-<br />
Württemberg aufgepasst!<br />
Am 14. Mai <strong>2024</strong> wird Björn Schemberger, Leiter der<br />
Abteilung Detektion und Reaktion bei der Cybersicherheitsagentur<br />
Baden-Württemberg (CSBW), einer<br />
der Vortragenden bei der Veranstaltung „Cybersicherheit<br />
duldet keinen Aufschub – Was bedeutet<br />
NIS 2 für Ihr Unternehmen?“ des Ministeriums<br />
für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Baden-Württemberg<br />
sein. Die Veranstaltung findet digital von<br />
16 bis 18 Uhr statt. Anmeldungen sind unter ssl.<br />
vdivde-it.de/registration/3078 möglich.<br />
Sollten baden-württembergische Unternehmen<br />
von einem Cyberangriff betroffen sein, unterstützt<br />
sie die CSBW bei der ersten Einordnung und hilft<br />
mit zielgruppenspezifischen Anlaufstellen weiter.<br />
Die Cyber- Ersthilfe ist rund um die Uhr telefonisch<br />
unter 0711 / 137 99999 erreichbar, zu den Geschäftszeiten<br />
per E-Mail an cyberersthilfe@cybersicherheit.bwl.de<br />
und über das Meldeformular auf<br />
der Website der CSBW: cybersicherheit-bw.de/meldeformular-cyber-ersthilfe-bw.<br />
endless<br />
green<br />
wild<br />
red<br />
sunnyny<br />
yellow<br />
beautiful<br />
blue<br />
lovely<br />
rose<br />
powerful<br />
pink<br />
Juzo Kompressionsprodukte sind im<br />
medizinischen Fachhandel erhältlich.<br />
ORTHOPÄDIE TECHNIK <strong>05</strong>/24<br />
juzo.de/trend-colours
Digitalisierung<br />
AOK-Krankenkassen unterstützen<br />
Pilotprojekt E-Verordnung<br />
Zum 15. April <strong>2024</strong> haben sich der AOK-Bundesverband<br />
sowie die AOKs Baden-Württemberg, Niedersachsen,<br />
Nordost, NordWest, PLUS für Sachsen und Thüringen sowie<br />
Sachsen-Anhalt dem Pilotprojekt E-Verordnung für<br />
orthopädische Hilfsmittel unter der Leitung des Bundesinnungsverbandes<br />
für Orthopädie-Technik (BIV-OT) angeschlossen.<br />
Gemeinsam mit den anderen Partnern des<br />
Pilotprojektes testen sie ab sofort die elektronische Verordnung<br />
für orthopädische Hilfsmittel – ehemals Muster 16 –<br />
vom Kostenvoranschlag bis zur Abrechnung. Darüber hinaus<br />
arbeiten die AOKs an der Umsetzung mit.<br />
„Wir wollen gemeinsam mit den bisherigen Partnern des<br />
Pilotprojektes den Weg der E-Verordnung für orthopädische<br />
Hilfsmittel gematikkonform und mit Wahlfreiheit für die<br />
Versicherten gestalten und erproben“, erklärt Frank Rudolf,<br />
Hilfsmittel-Experte des AOK-Bundesverbands. „Gemeinsam<br />
können wir die komplexe Digitalisierung der Hilfsmittelverordnung<br />
erfolgreich umsetzen und damit die Versorgung<br />
unserer 27 Millionen Versicherten langfristig sichern.“<br />
Thomas Münch, Vorstandsmitglied des BIV-OT, begrüßt<br />
die AOKs im Pilotprojekt E-Verordnung für orthopädische<br />
Hilfsmittel: „Die Mitarbeit von Kostenträgern, die insgesamt<br />
37 Prozent der gesetzlich Versicherten in Deutschland vertreten,<br />
ist ein wichtiger Schritt für die Prozessoptimierung.<br />
Ziel unseres Projektes war es von Anfang an, den gesamten<br />
Prozess von der elektronischen Verordnung des Arztes, über<br />
den Versicherten und den<br />
Kostenvoranschlag des<br />
Leistungserbringers bis<br />
hin zur Abrechnung mit<br />
dem Kostenträger abzubilden.<br />
Dabei setzen wir auf Thomas Münch, Mitglied des<br />
wettbewerbsneu trale, offene<br />
und etablierte Stan-<br />
dass die AOK-Krankenkassen<br />
BIV-OT-Vorstands, freut sich,<br />
dards und schließen keinen<br />
aus.“ Schon heute unterstützen.<br />
das Pilotprojekt E-Verordnung<br />
setzen die AOKs auf innovative<br />
und digitale Wege. „Gemeinsam werden wir Schnittstellen<br />
definieren, bestehende technische Lösungen fit für<br />
die digitale Welt von morgen machen und damit einen reibungslosen<br />
Übergang von der Papierform zur elektronischen<br />
Verordnung ermöglichen“, so Münch.<br />
Nach dem Willen des Gesetzgebers müssen voraussichtlich<br />
zum 1. Juli 2027 alle Sanitätshäuser, orthopädie(schuh)<br />
technischen Werkstätten, Hörakustiker und Augenoptiker<br />
elektronische Verordnungen von Hilfsmitteln verarbeiten<br />
können, um die 73 Millionen gesetzlich Versicherten weiterhin<br />
zu versorgen.<br />
Daher wurde auf Initiative der Gesundheitshandwerke<br />
unter zentraler Mitwirkung des BIV-OT das größte deutsche<br />
Pilotprojekt für die Einführung der E-Verordnung für<br />
Hilfsmittel aufgesetzt.<br />
Foto: BIV-OT/Chris Rausch<br />
Sicherer Messengerdienst fürs Gesundheitswesen<br />
Whatsapp oder Facebook-Messenger sind Programme,<br />
mit denen weltweit viele Millionen Menschen sich<br />
täglich Nachrichten schreiben. Doch diese Messengerdienste<br />
haben vor allem beim Thema Datenschutz Nachholbedarf<br />
und eignen sich deshalb nicht, um medizinische Daten auszutauschen.<br />
Der Bedarf an einem Kurznachrichtendienst als<br />
Ergänzung zur E-Mail wurde aber bei den Verantwort lichen<br />
der Gematik, bei Politik und im Gesundheitswesen allgemein<br />
erkannt und mit dem TI-Messenger präsentierte die<br />
Gematik die entsprechende Lösung. Doch die Gematik, als<br />
nationale Agentur für digitale Gesundheit,<br />
legte nur die Rahmenbedingungen fest, die<br />
konkrete Ausarbeitung des Programms liegt<br />
in der Verantwortung der Anbieter.<br />
Mit Famedly, einem Berliner Unternehmen,<br />
erhielt der erste Anbieter Anfang April<br />
eine Zulassung durch die Gematik. Darauf<br />
aufbauend wird der TI-Messenger in der Modellregion<br />
für digitale Gesundheit in Hamburg<br />
und Umgebung getestet und ausgewer-<br />
Foto: Gematik<br />
Laut Dr. Florian Hartge, Geschäftsführer<br />
der Gematik, erleichtern TI-Messenger<br />
die Direktkommunikation im medizinischen<br />
Versorgungsalltag.<br />
tet. Dr. Florian Hartge, Geschäftsführer der Gematik: „Mit<br />
den TI-Messengern können Praxisteams, Krankenhäuser<br />
und andere medizinische Einrichtungen Kurznachrichten<br />
verschicken. Dabei tauschen sie sich in Echtzeit aus und<br />
sind räumlich flexibel. Ein übergreifender Messagingstandard<br />
hat bis jetzt gefehlt. Nun schließt sich eine Lücke, und<br />
die Direktkommunikation im medizinischen Versorgungsalltag<br />
wird noch einfacher.“<br />
Die Gematik prüft die Interoperabilität aller Messenger-<br />
Lösungen der jeweiligen Hersteller – eine zentrale Voraussetzung,<br />
um einander kontaktieren zu können.<br />
Die Gründer von Famedly, Dr. Niklas Zender und Dr.<br />
Phillipp Kurtz: „Mit der Zulassung unseres TI-Messengers<br />
gehen wir einen entscheidenden Schritt in die Digitalisierung<br />
des Gesundheitswesens. Es war uns wichtig, eine Lösung<br />
auf den Markt zu bringen, die mehr als nur die tägliche<br />
Kommunikation erleichtert. Unser TI-Messenger erfüllt<br />
nicht nur die hohen Datenschutzanforderungen, sondern<br />
ist benutzerfreundlich und integrierbar in bestehende<br />
IT-Systeme, um Arbeitsprozesse effizienter zu gestalten.“<br />
Geplant ist, dass die TI-Messenger zukünftig auch Versorgungsprozesse<br />
unterstützen können, zum Beispiel das<br />
Terminmanagement. Darüber hinaus kann ein Messenger<br />
auch perspektivisch bei der Überweisung oder beim Aufnahme-<br />
und Entlassmanagement zum Einsatz kommen.<br />
68<br />
ORTHOPÄDIE TECHNIK <strong>05</strong>/24
Besuchen Sie uns!<br />
Halle 3<br />
Stand F32<br />
Wieder Greifen und Bewegen mit der MyoPro® Armorthese<br />
Besonders<br />
geeignet bei<br />
Lähmung und<br />
Spastik nach<br />
Schlaganfall<br />
Die MyoPro® Orthese ist das erste myoelektrisch betriebene Orthesensystem<br />
für Arm und Hand und ermöglicht Menschen mit einem Funktionsverlust des<br />
Armes und der Hand durch z.B. Schlaganfall, Querschnitt oder Verletzung des<br />
Plexus brachialis eine Wiederherstellung der verloren gegangenen Funktionen<br />
in der betroffenen Hand (Greifen, Halten und Öffnen) sowie im Arm (Heben,<br />
Halten und Strecken).<br />
kontakt@myomo.de<br />
www.myomo.de<br />
Myomo Europe GmbH | Merkelstrasse 15 | 37085 Göttingen
Kompression<br />
S. Klör<br />
Medizinische adaptive Kompressionssysteme<br />
in der Praxis<br />
Medical Adaptive Compression Systems in Practice<br />
Die Kompressionsbehandlung bei<br />
Ödemen an den Extremitäten ist seit<br />
Jahrzehnten etabliert, die Wirksamkeit<br />
wissenschaftlich fundiert belegt.<br />
Bestanden die Therapieoptionen<br />
bislang hauptsächlich aus medizinischen<br />
Kompressionsstrümpfen<br />
oder phlebologischen Kompressionsverbänden,<br />
drängen inzwischen<br />
medizinische adaptive Kompressionssysteme<br />
auf den Markt. Der<br />
große Vorteil dieser Systeme ist die<br />
Anpassbarkeit des Drucks auch bei<br />
wechselnden Schwellungszuständen.<br />
Der Artikel beleuchtet die Hintergründe<br />
der medizinischen adaptiven<br />
Kompressionssysteme und<br />
veranschaulicht die Anwendungsmöglichkeiten<br />
anhand von Fallbeispielen.<br />
Schlüsselwörter: medizinisch adaptive<br />
Kompressionssysteme (MAK), venöse<br />
Ödeme, Kompressionstherapie,<br />
Bandagen, Verbände<br />
Compression treatment for oedema<br />
of the extremities has been established<br />
for decades, and its effectiveness<br />
has been scientifically proven.<br />
While therapy options have so far<br />
mainly consisted of medical compression<br />
stockings or phlebological compression<br />
bandages, medical adaptive<br />
compression systems are now entering<br />
the market. The great advantage<br />
of these systems is the adaptability<br />
of the pressure even with changing<br />
swelling conditions. The article sheds<br />
light on the background of medical<br />
adaptive compression systems and<br />
illustrates the possible applications<br />
using case studies.<br />
Key words: Medical Adaptive Compression<br />
Systems (MAC), Venous<br />
Oedema, Compression Treatment,<br />
Bandages, Dressings<br />
Einleitung<br />
Seit einiger Zeit stehen die medizinischen<br />
adaptiven Kompressionssysteme<br />
(MAK) als Alternative zu herkömmlichen<br />
Kompressionsverbänden<br />
und Kompressionsstrümpfen in<br />
der Entstauung von lymphatischen<br />
und ausgeprägten venösen Ödemen<br />
sowie in der Therapie des Ulcus cruris<br />
venosum zur Verfügung.<br />
Die grundsätzlichen Vorteile einer<br />
Kompressionsbehandlung sind vielfältig.<br />
Durch die Unterstützung des<br />
venösen und lymphatischen Rückflusses<br />
kann sie helfen, die Ödementstehung<br />
zu verhindern und vorhandene<br />
Ödeme zu minimieren, Schadstoffe<br />
abzutransportieren und Entzündungen<br />
zu reduzieren. Dies ist<br />
Voraussetzung für eine verbesserte<br />
Wundheilung, fördert die Mobilität,<br />
kann Schmerzen reduzieren und die<br />
Lebensqualität der Patienten (deutlich)<br />
verbessern.<br />
Problematisch ist bei klassischen<br />
Kompressionsmitteln häufig das Anlegen<br />
der Verbände bzw. das Anziehen<br />
der Bestrumpfung. Dies wird durch<br />
die Verwendung von MAK deutlich<br />
vereinfacht. Gerade in der Entstauungsphase<br />
erweist sich die Anpassbarkeit<br />
an variierende Umfänge bei<br />
gleichzeitigem einfachem Handling<br />
als vorteilhaft. Die Anwendung von<br />
medizinisch-adaptiver Kompression<br />
sollte jedoch stets unter Aufsicht medizinischer<br />
Fachkräfte erfolgen, um<br />
eine sichere und wirksame Behandlung<br />
zu gewährleisten.<br />
Vorgeschichte<br />
Die Idee zu MAK wird dem Amerikaner<br />
Frank Shaw zugeschrieben, der<br />
auf der Suche nach Linderung für die<br />
Lymphödeme seiner Frau die Beobachtung<br />
machte, dass Giraffen trotz<br />
der stattlichen Beinlänge und nur<br />
kurzen Liegephasen keine Ödeme in<br />
den Beinen entwickeln. Ursächlich<br />
dafür ist die Beschaffenheit der Giraffenhaut,<br />
die an den Beinen deutlich<br />
straffer ist als beim Menschen und damit<br />
keine Ausdehnung zulässt. Diese<br />
Erkenntnis führte dazu, eine unelastische,<br />
über Klettverschlüsse einstellbare<br />
Kompressionsversorgung zu entwickeln.<br />
Medizinische adaptive<br />
Kompressionssysteme<br />
Die am Markt verfügbaren Produkte<br />
bestehen in der Regel aus einer<br />
unelastischen Manschette, die über<br />
einem Unterziehstrumpf angelegt<br />
wird. Allen gemeinsam ist ein Klettverschluss-System,<br />
das entweder gegenläufig<br />
oder in gleicher Richtung<br />
verschlossen wird. Der Kompressionsdruck<br />
ist jederzeit nachjustierbar.<br />
Bei einem der verfügbaren Produkte<br />
kann mithilfe einer Schablone<br />
der verordnete Kompressionsdruck<br />
reproduzierbar eingestellt werden,<br />
bei den anderen erfolgt die Einstellung<br />
nach dem Gefühl des Patienten.<br />
MAK erzeugen, ähnlich wie Kurzzugbinden,<br />
einen hohen Arbeitsund<br />
einen niedrigen Ruhedruck und<br />
weisen eine höhere Stiffness auf. Im<br />
Gegensatz zu diesen sind sie bei Volumenänderungen<br />
aber leichter und<br />
schneller nachpassbar und können<br />
somit auch den erforderlich Kompressionsdruck<br />
besser aufrechterhalten.<br />
Die meisten Produkte sind in der<br />
Maschine waschbar und genügen so<br />
den hygienischen Standards. MAK-<br />
Produkte sind sowohl für die untere<br />
als auch für die obere Extremität verfügbar<br />
und sind im Hilfsmittelverzeichnis<br />
unter 17.06.23. (Bein) bzw.<br />
17.10.10. (Arm) gelistet.<br />
70<br />
ORTHOPÄDIE TECHNIK <strong>05</strong>/24
Kompression<br />
Studienlage<br />
a. b. c.<br />
Abb. 1 a–d Patientin 1 mit ReadyWrap®-Unterschenkel<br />
segment (Lohmann & Rauscher [a]), mit Compression-Wrap-Unterschenkelsegment<br />
(Juzo [b]), mit<br />
Circaid®-juxtafit®-essentials-Unterschenkelsegment<br />
(Medi [c]), mit Circaid®-Juxtafit®-Fuß-, -Unterschenkelund<br />
-Oberschenkelsegment mit Knie (Medi [d]).<br />
Ein erster Nachweis zur Überlegenheit<br />
der medizinisch adaptiven Kompressionssysteme<br />
konnte von Blecken<br />
et al. bereits 20<strong>05</strong> geführt werden [1].<br />
In einer randomisiert kontrollierten<br />
Studie wurde bei 12 Probanden mit<br />
beidseitigen venösen Unterschenkelulcera,<br />
die eine Seite konventionell<br />
mit 4-lagigen elastischen Wickeln<br />
versorgt, während die Gegenseite mit<br />
einem MAK-System (Circaid) versehen<br />
wurde. Untersucht wurde neben<br />
der Reduktion der Ulcusgröße über<br />
einen Beobachtungszeitraum von<br />
12 Wochen auch die Umfangsreduktion<br />
und die Patientenzufriedenheit.<br />
Signifikante Unterschiede zugunsten<br />
der MAK zeigten sich in der Reduktion<br />
der Ulcusgröße. In der Umfangreduktion<br />
und Patientenzufriedenheit<br />
konnten keine signifikanten Unterschiede<br />
festgestellt werden.<br />
Einen signifikanten Unterschied in<br />
der Volumenreduktion konnten 2013<br />
Damstra und Partsch beim Vergleich<br />
von MAK zu einem Mehrkomponentenverband<br />
zur Volumenreduktion<br />
bei lymphatischem Beinödem nachweisen<br />
[2]. Untersucht wurde die Volumenreduktion<br />
bei je 15 Patienten jeweils<br />
2 Stunden und 24 Stunden nach<br />
Anlage des Kompressionsmittels. Bereits<br />
nach 2 Stunden konnte eine stärkere<br />
Volumenreduktion bei Verwendung<br />
der MAK beobachtet werden,<br />
eine signifikante Überlegenheit stellte<br />
sich nach 24 Stunden dar.<br />
Für venöse Ödeme führten Mosti et<br />
al. 2015 den Nachweis der Überlegenheit<br />
der MAK. In der initialen Entstauungsphase<br />
wurden 20 Beine mit venösem<br />
Ödem mit MAK und 20 Beine mit<br />
unelastischen Bandagen therapiert.<br />
Die Volumenreduktion wurde nach<br />
einem Tag und nach 7 Tagen gemessen.<br />
Auch hier zeigte sich nach einem<br />
Tag die Tendenz einer größeren Volumenreduktion<br />
und nach 7 Tagen eine<br />
signifikant größere Reduktion. Ebenfalls<br />
bemerkenswert war das Ergebnis,<br />
dass der Druck der unelastischen<br />
Bandagierung über die Tragezeit stark<br />
abnahm, während er bei den MAK<br />
durch die Nachstellmöglichkeit konstant<br />
gehalten werden konnte.<br />
Diese Nachstellmöglichkeit bietet<br />
aber nicht nur Chancen, sondern auch<br />
die Gefahr, dass die Patienten den erwünschten<br />
Druck nicht eigenständig<br />
reproduzieren können. Mit dieser Fragestellung<br />
haben sich auch Mosti und<br />
Partsch 2017 befasst [4]. Allen 31 Patienten<br />
gelang es nach einer entsprechenden<br />
Einweisung in das Hilfsmittel,<br />
den Druck über die Tragedauer im<br />
vorgegebenen Zielbereich zu halten.<br />
Zu diesem Ergebnis kommt auch<br />
eine Untersuchung von Protz et al.<br />
aus dem Jahre 2017 [5]. Verglichen<br />
wurde hier die Reproduzierbarkeit der<br />
gewünschten Drücke bei unterschiedlichen<br />
Kompressionsverfahren. Im<br />
Rahmen von Fortbildungsmaßnahmen<br />
wurden von 137 Teilnehmenden<br />
insgesamt 302 Bandagierungen<br />
vorgenommen und anschließend die<br />
Einhaltung des vorgegebenen Druckwertes<br />
überprüft. Die Quote der Einhaltung<br />
des geforderten Druckbereichs<br />
lag bei Bandagierungen mit<br />
Kurzzugbinden bei 11,2 %, bei der<br />
Verwendung von Mehrkomponentensystemen<br />
bei 35,2 % und bei MAK<br />
bei 85,0 %. Auch der Tragekomfort<br />
wurde von den Probanden mit MAK<br />
am höchsten bewertet.<br />
Die Studienlage zu MAK erscheint<br />
also auf den ersten Blick ermutigend.<br />
Ein Review von Williams aus 2016 zeigt<br />
jedoch, dass bislang aber vor allem<br />
Langzeitbeobachtungen fehlen [6].<br />
Einbindung in Leitlinien<br />
Medizinische adaptive Kompressionssysteme<br />
wurden in die aktuellen S2k-<br />
Leitlinien zur medizinischen Kompressionstherapie<br />
aufgenommen [7].<br />
Ebenso werden sie in der S2k-Leitlinie<br />
Diagnostik und Therapie der Varikose<br />
berücksichtigt [8]. Im Folgenden werden<br />
die wichtigsten Empfehlungen<br />
und Aussagen der beiden medizinischen<br />
Leitlinien zur Anwendung von<br />
MAK als Originalzitate zusammengefasst.<br />
„Die medizinische Kompressionstherapie<br />
soll integraler Bestandteil der<br />
Therapie phlebologischer Krankheitsbilder<br />
sein. Sie kann mit MKS (Medizinischer<br />
Kompressionsstrumpf),<br />
PKV (Phlebologischer Kompressionsverband)<br />
oder MAK erfolgen. Voraussetzung<br />
sind spezielle Kenntnisse und<br />
Erfahrungen sowohl hinsichtlich Diagnose,<br />
Differentialdiagnose, Risiken<br />
und Kontraindikationen als auch in<br />
der Verordnung zeitgemäßer Kompressionsmaterialien<br />
und der Technik<br />
des Anlegens.“ (S2k-Leitlinie zur medizinischen<br />
Kompressionstherapie,<br />
Empfehlung 1)<br />
„In der initialen Entstauungsphase<br />
beim Lymphödem und beim ausgeprägten<br />
venösen Ödem sowie beim<br />
Ulcus cruris venosum können MAK<br />
als Alternative zur Bandagierung mit<br />
Binden eingesetzt werden.“ (S2k-Leitlinie<br />
zur medizinischen Kompressionstherapie,<br />
Empfehlung 27 bzw. S2k-<br />
Leitlinie zur Diagnostik und Therapie<br />
der Varikose, Empfehlung 40)<br />
Versorgungsbeispiel 1<br />
d.<br />
Frau R. ist 20<strong>05</strong> im Alter von 34 Jahren<br />
nach einer Unterleibsoperation<br />
an einem einseitigen Lymphödem des<br />
rechten Beines erkrankt. Trotz regelmäßiger<br />
wöchentlicher Lymphdrainage<br />
über mehrere Jahre verschlechterte<br />
sich die Situation kontinuierlich. Erst<br />
ORTHOPÄDIE TECHNIK <strong>05</strong>/24<br />
71
Kompression<br />
2011 erfolgte die Erstversorgung mit<br />
flachgestrickter Kompression. Zu diesem<br />
Zeitpunkt betrug die maximale<br />
Maßdifferenz zur Gegenseite 12 cm.<br />
Aktuell trägt sie 23 Stunden täglich<br />
auf der betroffenen Seite einen flachgestrickten<br />
medizinischen Kompressionsstrumpf<br />
A-G in der Kompressionsklasse<br />
III mit Zehenkappen und darüber<br />
eine flachgestrickte Kompressionsstrumpfhose<br />
A-T in der Kompressionsklasse<br />
II. Mit dieser Versorgung konnten<br />
sowohl die Maßdifferenz als auch<br />
die Festigkeit des Ödems reduziert werden.<br />
Trotzdem bleibt ein Unterschied<br />
zur Gegenseite bestehen. Zusätzlich<br />
zur Bestrumpfung nutzt sie MAK,<br />
um bei Bedarf temporär zusätzlichen<br />
Kompressionsdruck auszuüben.<br />
Auf den Fotos trägt sie zu Demonstrationszwecken<br />
3 unterschiedliche<br />
MAK-Produkte für den Unterschenkel<br />
(Abb. 1 a–c) sowie eine Ganzbeinversorgung<br />
(Abb. 1d). Auf eigenen<br />
Wunsch trägt Frau R. ihre MKS auch<br />
unter den MAK, um keinen Druckverlust<br />
während des Wechsels der Produkte<br />
für die Fotoaufnahmen zu riskieren.<br />
Ein Leben ohne Kompression<br />
ist für Frau R. nicht denkbar.<br />
Versorgungsbeispiel 2<br />
Abb. 2 Patientin 2 mit MAK am Unterschenkel.<br />
Die 39-jährige Frau leidet unter einem<br />
beidseitigen Lipödem bei gleichzeitiger<br />
Adipositas permagna (Körpergewicht<br />
230 kg). Es bilden sich<br />
Hautfalten und Überhänge im Fuß<br />
und Kniebereich. Das Anziehen der<br />
flachgestrickten MKS konnte sie alleine<br />
nicht bewerkstelligen, so dass<br />
nach der Trennung von ihrem Partner<br />
die Kompressionstherapie nicht<br />
fortgesetzt wurde. Dies führte zu einer<br />
zunehmenden Verschlechterung<br />
des Allgemeinzustandes, so dass sie<br />
die Füße nicht mehr erreichen konnte<br />
und sich die Umfangsmaße an den<br />
Beinen verdoppelten. Die Haut war<br />
dementsprechend stark gespannt und<br />
zeitweise trat Lymphe aus. Die Überhänge<br />
erschwerten zusätzlich eine<br />
MKS-Versorgung. Wegen des Handlings<br />
wurde daher eine MAK-Versorgung<br />
durchgeführt (Abb. 2). Nach intensiver<br />
Einweisung und Übung war<br />
es der Patientin möglich, die Versorgung<br />
allein anzulegen. Von Beginn<br />
an hatte die Patientin ein gutes entlastendes<br />
Gefühl. Nach 3 Monaten<br />
MAK-Therapie konnte sie ihre Stiefel<br />
wieder tragen, was vorher unmöglich<br />
erschien und das subjektive Empfinden<br />
der Lebensqualität deutlich steigerte<br />
(Abb. 3).<br />
Versorgungsbeispiel 3<br />
Im Vorfeld der Versorgung einer<br />
24-jährigen Patientin erhielt der Autor<br />
vom Vater der Patientin folgende<br />
Beschreibung der Situation:<br />
„Sie hat ME/CFS (Myalgische Enzephalomyelitis/Chronisches<br />
Fatigue<br />
Syndrom) infolge von Post Covid.<br />
Das Chronische Fatigue Syndrom ist<br />
eine Multisystemerkrankung, bei der<br />
Belastungsintoleranz aufgrund von<br />
Energiemangel ein Kardinalsymptom<br />
ist. Bei meiner Tochter gab es<br />
einen Zusammenbruch des Systems<br />
vor 3 Monaten, der sie in die komplette<br />
Bettlägerigkeit geführt hat.<br />
Sie kommt noch auf 2 Toilettengänge<br />
am Tag, sonst liegen, auch das Essen<br />
geht nur noch im Liegen. Es gibt<br />
durch die Bettlägerigkeit eine Dekonditionierung<br />
und zudem auch POTS,<br />
das ist das Posturale Tachykardie Syndrom.<br />
Auch hier eine Vielfalt an Symptomen,<br />
alles ausgelöst durch Dysautonomien.<br />
Wenn sie in den Stand<br />
kommt, geht ihr Puls auf 140, der<br />
vorher bei 80 bis 90 war. Es wird gesagt,<br />
dass das Blut im unteren Körper<br />
versackt. Deshalb auch der Ruf nach<br />
Kompressionsstrümpfen/Kompressionsstrumpfhosen,<br />
um dem Körper<br />
Halt zu geben. […] Meine Fragen gehen<br />
auch in Richtung Anwendung<br />
in der Praxis. Sie ist tageweise so geschwächt,<br />
dass sie den Akt, etwas Zusätzliches<br />
anzuziehen, gar nicht bewerkstelligen<br />
kann, auch mit Hilfe<br />
nicht, da sie das körperlich und auch<br />
mental überfordert. […] Vielleicht<br />
haben Sie Ideen, wie wir vorgehen<br />
Abb. 3 Patientin 2 mit Stiefeln.<br />
könnten, so dass wir das Passende auf<br />
das Rezept schreiben können.“<br />
Beim Hausbesuch stellte sich sehr<br />
schnell heraus, dass die Patientin extrem<br />
schmerz- und druckempfindlich<br />
war. Schon das Palpieren sowie<br />
das Ausmessen mit dem Maßband<br />
waren beschwerlich. Die Beine waren<br />
extrem dünn – ein b-Maß von 18,5 cm<br />
sowie 45 cm im g-Maß. Im Versorgungsgespräch<br />
mit der Mutter und<br />
der Patientin waren wir uns einig,<br />
dass aufgrund der Gesamtsituation<br />
keine herkömmlichen Strümpfe genutzt<br />
werden können. So kam der Gedanke,<br />
MAK als 2-teilige Versorgung<br />
für Unterschenkel und Oberschenkel<br />
einzusetzen. Konkret wurde hier<br />
das Circaid®-System von medi ausgewählt,<br />
weil mithilfe des integrierten<br />
Built-In-Pressure-Systems (BPS) der<br />
individuelle Kompressionsdruck exakt<br />
eingestellt, kontrolliert und gerade<br />
in diesem speziellen Fall einfach<br />
nachjustiert werden konnte. Das Anlegen<br />
der MAK als solches ist für die<br />
Mutter einfach umzusetzen. Im Ergebnis<br />
lässt sich feststellen, dass nach<br />
einer langsamen Gewöhnung an die<br />
MAK die Patientin nun die Versorgung<br />
nutzt und trotz aller o. g. Umstände<br />
gut zurechtkommt. Die gewünschte<br />
Kreislaufstabilisierung<br />
konnte erfolgreich umgesetzt werden.<br />
Versorgungsbeispiel 4<br />
Der männliche Patient, Ende 50, stellt<br />
sich mit diversen Diagnosen vor. Neben<br />
der allgemeinen Adipositas findet<br />
man im Beinbereich eine Varikosis,<br />
ein Lymphödem, abgeheilte Erysipele<br />
sowie linksseitig ein Ulcus cruris<br />
venosum, welches schon seit Jahren<br />
besteht (Abb. 4). Es sind außerdem<br />
deutliche manifeste Abschnürungen<br />
durch falsch angelegte Kurzzug-<br />
72<br />
ORTHOPÄDIE TECHNIK <strong>05</strong>/24
Kompression<br />
Abb. 4 Patient 4 ohne Versorgung.<br />
Abb. 5 Patient 4 mit Versorgung.<br />
binden vorhanden. Die Beinform in<br />
Verbindung mit der offenen Wunde<br />
lässt eine MKS-Versorgung nicht<br />
zu. Die MAK ermöglichen die Anpassung<br />
auch an unterschiedlich starke<br />
Wundauflagen und kann vom Patienten<br />
nach Bedarf reguliert werden<br />
(Abb. 5). Der Patient fühlt sich mit der<br />
Versorgung deutlich mobiler. Aktuell<br />
ist das Ulkus noch nicht abgeheilt, befindet<br />
sich aber auf dem Weg der Besserung.<br />
Fazit<br />
Die medizinischen adaptiven Kompressionssysteme<br />
stellen eine deutliche<br />
Bereicherung der Therapieoptionen<br />
in der Kompressionsbehandlung<br />
dar. Vor allem in der initialen<br />
Entstauungstherapie, wenn es um die<br />
Anpassung an sich rasch ändernde<br />
Volumina geht, sind diese Kompressionssysteme<br />
dem phlebologischen<br />
Kompressionsverband überlegen, da<br />
sie jederzeit vom Anwender selbst adaptiert<br />
werden können. Ein weiterer<br />
Anwendungsschwerpunkt liegt bei<br />
Patienten, die das Anziehen eines medizinischen<br />
Kompressionsstrumpfs<br />
nicht selbstständig ausführen können.<br />
Hier ist das Handling der MAK<br />
im Vergleich deutlich einfacher. Die<br />
Studienlage zur Verwendung der MAK<br />
ist bei den gängigen Indikationen wie<br />
Lymphödemen, venösen Ödemen<br />
und Ulcus cruris venosum vielversprechend,<br />
obwohl Langzeitergebnisse<br />
bislang fehlen.<br />
Der Autor:<br />
Stephan Klör<br />
Schritt für Schritt GmbH<br />
Schützenstraße 1<br />
21244 Buchholz<br />
Begutachteter Beitrag/reviewed paper<br />
Zitation: Klör S. Medizinische adaptive Kompressionssysteme in der Praxis. Orthopädie Technik, <strong>2024</strong>; 75 (5): 70–73<br />
Literatur:<br />
[1] Blecken SR, Villavicencio JL, Kao TC. Comparison of<br />
elastic versus nonelastic compression in bilateral venous<br />
ulcers: a randomized trial. Journal of Vascular Surgery,<br />
20<strong>05</strong>; 42 (6): 1150–1155. doi: 10.1016/j.jvs.20<strong>05</strong>.08.015<br />
[2] Damstra RJ, Partsch H. Prospective, randomized,<br />
controlled trial comparing the effectiveness of adjust able<br />
compression Velcro wraps versus inelastic multicomponent<br />
compression bandages in the initial treatment of leg<br />
lymphedema. Journal of Vascular Surgery: Venous and<br />
Lymphatic Disorders, 2013; 1 (1): 13–19. doi: 10.1016/ j.<br />
jvsv.2012.<strong>05</strong>.001<br />
[3] Mosti et al. Adjustable Velcro Compression Devices are<br />
More Effective than Inelastic Bandages in Reducing Venous<br />
Edema in the Initial Treatment Phase: A Randomized<br />
Controlled Trial. European Journal of Vascular and Endovascular<br />
Surgery, 2015; 50 (3): 368–374. doi: 10.1016/j.<br />
ejvs.2015.<strong>05</strong>.014<br />
[4] Mosti G, Partsch H. Self-management by firm, non-elastic<br />
adjustable compression wrap device. Veins and Lymphatics,<br />
2017; 6: 7003<br />
[5] Protz K et al. Kompressionsmittel für die Entstauungstherapie.<br />
Hautarzt, 2018; 69, 232–241. doi: 10.1007/<br />
s001<strong>05</strong>-017-4084-3<br />
[6] Williams A. A review of the evidence for adjustable compression<br />
wrap devices. Journal of Wound Care, 2016; 25<br />
(5): 242–247. doi: 10.12968/jowc.2016.25.5.242<br />
[7] Rabe E et al. S2k Leitlinie: Medizinische Kompressionstherapie<br />
der Extremitäten mit Medizinischem Kompressionsstrumpf<br />
(MKS), Phlebologischem Kompressionsverband<br />
(PKV) und Medizinischen adaptiven<br />
Kompressionssystemen (MAK). 2018. https://register.<br />
awmf.org/assets/guidelines/037-0<strong>05</strong>l_S3k_Medizinische-<br />
Kompressionstherapie-MKS-PKV_2019-<strong>05</strong>.pdf (Zugriff am<br />
15.02.<strong>2024</strong>)<br />
[8] Pannier F et al. S2k Leitlinie Diagnostik und Therapie<br />
der Varikose. 2019. https://register.awmf.org/assets/<br />
guidelines/037-018l_S2k_Varikose_Diagnostik-Thera<br />
pie_2019-07.pdf (Zugriff am 15.02.<strong>2024</strong>)<br />
ORTHOPÄDIE TECHNIK <strong>05</strong>/24<br />
73
Prothetik<br />
A. Fürst, H.-P. Baumgärtler<br />
Schulung im Umgang mit<br />
Exoprothesenpassteilen<br />
an der oberen Extremität<br />
(Armprothesen)<br />
Training in the Use of Exoprosthesis Fittings on the<br />
Upper Extremity (Arm Prostheses)<br />
Nach einer Amputation ist vor allem<br />
die Selbstständigkeit von Betroffenen<br />
sehr eingeschränkt. In allen Bereichen<br />
gibt es erhebliche Einschränkungen,<br />
seien es die Aktivitäten des<br />
täglichen Lebens, Hobbys oder berufliche<br />
Tätigkeiten.<br />
Trotz des hohen technischen Fortschritts<br />
gibt es keine Prothese, welche<br />
die menschliche Hand in allen<br />
Belangen ersetzen kann. Im Gegenteil:<br />
Aufgrund der fehlenden sensorischen<br />
Rückmeldung bleibt eine<br />
Prothese bis auf Weiteres nur eine<br />
Hilfshand. Somit gibt es auch nicht<br />
die eine Prothese, die für jeden Betroffenen<br />
geeignet ist.<br />
Es ist ein umfangreiches, standardisiertes,<br />
aber individuell anpassbares<br />
Prothesentraining notwendig,<br />
um das Maximum aus der für den<br />
Klienten geeigneten Prothesenversorgung<br />
herauszuholen. Bei der Entscheidung,<br />
welche die geeignete<br />
Prothese für den Betroffenen ist, bedarf<br />
es einer genauen Betrachtung<br />
seiner Voraussetzungen, Anforderungen<br />
und Wünsche.<br />
Dabei müssen die Bereiche des<br />
ICF (Funktion, Aktivität und Teilhabe)<br />
vollständig abgedeckt und berücksichtigt<br />
werden. Ein besagtes<br />
Prothesentraining wird nicht nur<br />
zu einer besseren Funktionalität,<br />
sprich einem besseren Verständnis<br />
der Technik und deren Handhabung<br />
führen. Auch die Selbstständigkeit<br />
in den Aktivitäten des täglichen Lebens<br />
sowie die Teilhabe im sozialen<br />
und beruflichen Umfeld werden erheblich<br />
verbessert.<br />
Schlüsselwörter: Prothesengebrauchsschulung,<br />
Prothesentraining, Ergotherapie,<br />
Amputation obere Extremität<br />
After an amputation, the independence<br />
of those affected is very limited.<br />
There are considerable restrictions in<br />
all areas, be it activities of daily living,<br />
hobbies or professional activities.<br />
Despite the high level of technical<br />
progress, there is no prosthesis that<br />
can replace the human hand in all<br />
respects. On the contrary, due to the<br />
lack of sensory feedback, a prosthesis<br />
remains only an auxiliary hand for<br />
the time being. This means that there<br />
is no one prosthesis that is suitable<br />
for every person affected.<br />
Comprehensive, standardized but<br />
individually adaptable prosthesis<br />
training is necessary in order to get<br />
the most out of the prosthetic fitting<br />
that is suitable for the client. When<br />
deciding which prosthesis is suitable<br />
for the person concerned, it is necessary<br />
to take a close look at their prerequisites,<br />
requirements and wishes.<br />
The areas of the ICF (function, activity<br />
and participation) must be fully<br />
covered and taken into account. This<br />
prosthesis training will not only lead<br />
to improved functionality, i.e. a better<br />
understanding of the technology<br />
and its handling. It will also significantly<br />
improve independence in daily<br />
activities and participation in the<br />
social and professional environment.<br />
Key words: Prosthesis Use Training,<br />
Prosthesis Training, Occupational<br />
Therapy, Upper Limb Amputation<br />
Einleitung<br />
Der unwiderrufliche Verlust der körperlichen<br />
Unversehrtheit, wie sie<br />
durch eine Hand- oder Armamputation<br />
geschieht, stellt Betroffene lebenslang<br />
vor große Herausforderungen.<br />
Die Einschränkungen, die sich aus einer<br />
Amputation ergeben, zeigen sich<br />
den Klienten in allen Lebensbereichen.<br />
Ungeachtet des Ausmaßes einer<br />
Amputation sind das Körpererleben<br />
und die Funktion der betroffenen Extremität<br />
verändert. Was zur Folge hat,<br />
dass die Selbstständigkeit und auch<br />
der Selbstwert gefährdet sind.<br />
Bei Klienten mit fehlenden Gliedmaßen,<br />
insbesondere an der oberen<br />
Extremität, lässt sich das im Grundgesetz<br />
(Art. 3 GG) verankerte Recht<br />
auf Teilhabe häufig nicht ungehindert<br />
umsetzen. Das Sozialgesetz sieht hier<br />
einen bestmöglichen Ausgleich der<br />
Behinderung vor. Bei der Versorgung<br />
mit Exoprothesen an der oberen Extremität<br />
ist es Stand der Technik, Klienten<br />
möglichst mit myoelektrischen<br />
Prothesenpassteilen zu versorgen. Mit<br />
dem Bauprinzip der Myoelektrik in<br />
Kombination mit 5 beweglich konstruierten<br />
Fingern können moderne Handund<br />
Armprothesen für eine Vielzahl<br />
einzelner Bewegungen angesteuert<br />
werden. Aus dieser Vielzahl von Möglichkeiten<br />
ist es nun möglich, eine individuelle<br />
Auswahl an nutzbaren Griffen<br />
für die Klienten einzustellen, damit<br />
sie durch diese ihren Alltag besser<br />
bewältigen können. Die Komplexität<br />
der Ansteuerungsmöglichkeiten fordert<br />
von den Nutzern technisches Ver-<br />
74<br />
ORTHOPÄDIE TECHNIK <strong>05</strong>/24
Prothetik<br />
ständnis und die Fertigkeit, mit der<br />
verbliebenen Muskulatur unterschiedliche<br />
Signale zur Ansteuerung der Prothese<br />
zu produzieren. Zum Erlernen<br />
der Ansteuerungen und damit zur Umsetzung<br />
einer sicheren Nutzung der<br />
Prothese sind die Klienten auf ein interdisziplinäres<br />
Versorgungsteam, vor<br />
allem Orthopädietechniker und Therapeuten,<br />
angewiesen.<br />
Wie tiefgreifend die Beeinträchtigung<br />
der Lebenssituation durch eine<br />
Amputation ist, wird in Äußerungen<br />
von Klienten sichtbar: „… das war ein<br />
ziemlicher Schock – ist das wirklich<br />
passiert oder ist das nur ein Traum?<br />
Ich kann meine Arbeit nicht mehr<br />
machen, ich brauch im Alltag bei allem<br />
Möglichen Hilfe. Ich will zumindest<br />
meinen Alltag wieder normal machen<br />
können und kein drittes Kind<br />
für meine Frau sein.“ Dies berichtete<br />
ein Betroffener beim ersten Kontakt<br />
im Anamnesegespräch.<br />
Der Wunsch, ein verloren gegangenes<br />
Körperteil zu ersetzen, scheint<br />
so alt zu sein wie die Entwicklung des<br />
technischen Fortschritts. So wurde<br />
in einem ägyptischen Grab der hölzerne<br />
Ersatz eines Großzehs gefunden<br />
[1]. Die Mumie wurde auf die Zeit<br />
etwa 950 bis 700 vor Christus datiert.<br />
Die erste Eigenkraftprothese für eine<br />
Hand entwickelte der Berliner Zahnarzt<br />
Peter Baliff um 1812 und könnte<br />
damit als Vorreiter der modernen<br />
Armprothesen bezeichnet werden.<br />
Die Anforderungen an eine künstliche<br />
Extremität waren wohl damals<br />
ebenso anspruchsvoll wie heute: Die<br />
Prothese sollte die verloren gegangene<br />
Funktion wiederherstellen. Mit modernster<br />
Technik kann eine Prothese<br />
mittlerweile so konstruiert werden,<br />
dass sie, dass sie spezielle Griffe ausführt,<br />
dass z. B. eine Computermaus<br />
bedienet werden kann. Die technischen<br />
Möglichkeiten und die Anbindung<br />
an unseren Körper reichen jedoch<br />
noch nicht aus, um einen gesunden,<br />
funktionierenden Arm oder eine<br />
Hand zu ersetzen.<br />
Ein großes Problem stellt dabei die<br />
direkte Rückmeldung aus der Prothese<br />
an den Benutzer dar. Das heißt, die<br />
gesamte Sensibilität und Propriozeption<br />
(zu den aktuellen Positionen in<br />
den Gelenken, zum Krafteinsatz, zur<br />
Oberflächenberührung) kann aus der<br />
Prothese noch nicht an den Körper zurückgemeldet<br />
werden. Jakubowitz [2]<br />
berichtet davon, dass die aktuellen<br />
Feedbacksysteme auf einer sensorischen<br />
Substitution basieren und somit<br />
von einer wirklichkeitsnahen<br />
Rückkopplungskontrolle noch weit<br />
entfernt sind. Diese Defizite müssen<br />
die Betroffenen beim Gebrauch einer<br />
Prothese kompensieren. So ist es notwendig,<br />
dass gezielte Bewegungen immer<br />
mit Blickkontakt ausgeführt werden.<br />
Jede Bewegung benötigt eine aufwändige<br />
Bewegungsplanung für den<br />
Einsatz der Prothese im Alltag.<br />
Wie auch Meinecke-Allekotte [3]<br />
berichtet, ist es für ein bestmögliches<br />
Outcome unumgänglich, die Klienten<br />
frühzeitig auf die Nutzung einer<br />
Prothese vorzubereiten und neu zu<br />
erlernende Fähigkeiten zu trainieren.<br />
Hier spielt unter anderem die enge Zusammenarbeit<br />
mit einem erfahrenen<br />
Orthopädietechniker eine ausschlaggebende<br />
Rolle. In enger Abstimmung<br />
zwischen Orthopädietechnik und<br />
Therapie können die Feinabstimmungen<br />
der Komponenten an der Prothese<br />
und deren Ansteuerungen entsprechend<br />
dem Muskelpotenzial des<br />
Stumpfes vorgenommen werden.<br />
Mittlerweile sind auf dem Hilfsmittelmarkt<br />
eine Vielzahl unterschiedlicher<br />
myoelektrischer Prothesen<br />
erhältlich. Jede Prothese verfolgt<br />
ein eigenes Konstruktionskonzept.<br />
Die Berücksichtigung der individuellen<br />
Bedürfnisse und Wünsche zum<br />
Prothesengebrauch [4] ist notwendig,<br />
damit die geeignete Prothese für den<br />
jeweiligen Betroffenen ausgewählt<br />
werden kann. Um mit der eigenen<br />
Prothese bestmöglich umgehen zu<br />
können, ist es unumgänglich, dass<br />
Patienten in der Bedienung und Anwendung<br />
intensiv geschult werden.<br />
Je komplexer eine Prothese konstruiert<br />
ist, umso anspruchsvoller gestalten<br />
sich die Bedienung und das Training.<br />
Ein fehlendes Prothesentraining<br />
kann auch zur Ablehnung des Klienten<br />
gegenüber der Prothese führen.<br />
Laut Biddiss et al. [5] ist diese Ablehnung<br />
ein komplexes Thema und abhängig<br />
von persönlichen, kontextuellen<br />
und technischen Faktoren. Roeschlein<br />
und Domholdt [6] zeigen, dass<br />
einer der Ablehnungsfaktoren ein fehlendes<br />
Training nach einer Prothesenanpassung<br />
ist. Dromerick et al. [7] ergänzen<br />
zudem, dass intensives Training<br />
zur Prothesenbenutzung die<br />
Leistungen der oberen Extremität<br />
verbessert. Dies bedeutet, dass man<br />
dieser Ablehnung durch gezielte Therapie<br />
und interprofessionelle Zusammenarbeit<br />
entgegenwirken kann und<br />
sollte. Auch Weeks, Anderson und<br />
Wallace [8] empfehlen, so bald wie<br />
möglich nach der Amputation eine<br />
Prothese anzupassen und mit dem<br />
Training zu beginnen.<br />
Ein möglichst gutes Outcome für<br />
den Betroffenen ist mit bestimmten<br />
Voraussetzungen verbunden. Neben<br />
einer abgeschlossenen Narbenheilung,<br />
einer guten Stumpfstabilität<br />
und Stumpfform sind auch das soziale<br />
Umfeld, eine notwendige Medikation<br />
sowie psychische oder physische<br />
Begleiterkrankungen zu beachten.<br />
Die Einbindung von anderen betroffenen<br />
Personen, sogenannten Peers,<br />
kann einen sehr positiven Effekt auf<br />
die Verarbeitung und Akzeptanz der<br />
Situation haben.<br />
Dem allgemein hohen Kostendruck<br />
folgend verkürzen sich die Zeiten<br />
des stationären Aufenthalts, wohingegen<br />
die Verletzungen komplexer<br />
und die Prothesenbedienung komplizierter<br />
werden. Grifka und Kuster [9]<br />
haben bereits 2011 darauf hingewiesen,<br />
dass die Entscheidungen, welche<br />
Prothese für den Betroffenen am besten<br />
ist, vom individuellen Nutzen für<br />
den Amputierten abhängig gemacht<br />
werden. Diesem individuellen Nutzen<br />
ist auch ein individuell abgestimmtes<br />
Prothesentraining gegenüberzusetzen.<br />
Aus diesem Grund war es uns ein<br />
Anliegen, ein effizientes Training zu<br />
konzipieren, das den ICF-Ansprüchen<br />
genauso entspricht wie den modernen<br />
medizinisch-rehabilitativen Anforderungen.<br />
Prothesentraining<br />
Die Behandlung nach Amputation<br />
kann in 2 Phasen unterteilt werden.<br />
Phase 1 ist das präprothetische<br />
Training. Phase 2, die Prothesengebrauchsschulung,<br />
beinhaltet das Erlernen<br />
der Grundfunktionen der Prothese,<br />
das Anwenden der Prothese bei<br />
einzelnen Aktivitäten und ein Teilhabetraining.<br />
Das präprothetische Training beinhaltet:<br />
– Narbenbehandlung<br />
– Auseinandersetzung mit dem veränderten<br />
Körperbild bzw. dem bestehendem<br />
Phantomgefühl<br />
ORTHOPÄDIE TECHNIK <strong>05</strong>/24<br />
75
Prothetik<br />
a. b.<br />
Abb. 1a u. b Beispiel für eine Myotestung für eine 2-EMG-Elektrodensteuerung (a) und<br />
eine Steuerung von komplexeren Steuerungssystemen mittels Elektrodenmanschette (b).<br />
– Behandlung von Phantomschmerzen<br />
– Behandlung des Stumpfes<br />
– Einhändertraining<br />
– Training der Aktivitäten des täglichen<br />
Lebens (AdLs) – ohne Prothese<br />
– Myotestung/Myotraining<br />
Um festzustellen, welche Prothesenart<br />
individuell anwendbar ist und<br />
welches Steuerungssystem eine betroffene<br />
Person umsetzen kann, wird<br />
bereits sehr früh eine Myotestung<br />
durchgeführt (Abb. 1). Unter Myotestung<br />
versteht man die graphische<br />
Abbildung der vorhandenen Muskelpotenziale,<br />
die zur Steuerung einer<br />
Prothese verwendet werden könnten.<br />
Mit dieser softwareunterstützten<br />
Darstellung kann den Patienten<br />
die Muskelkontraktion visualisiert<br />
werden. Mit der visuellen Rückmeldung<br />
ist es den Klienten möglich,<br />
Muskeln selektiv anzusteuern und<br />
so zu trainieren, dass diese dauerhaft<br />
reproduziert werden können. Dies<br />
kann zum einen mit 2 EMG-Elektroden<br />
zur Muskelsignalsuche durchgeführt<br />
werden. Sind die Muskelsignale<br />
so schwach, dass eine 2-Elektrodensteuerung<br />
nicht möglich ist, kann<br />
zum anderen mithilfe von „Elektrodenmanschetten“<br />
eine Evaluation<br />
für komplexere Steuerungssysteme<br />
durchgeführt werden.<br />
Die Myotestung wird in enger Zusammenarbeit<br />
von Ergotherapie und<br />
Orthopädietechnik durchgeführt.<br />
Die Ergebnisse aus Myotestung, den<br />
Fähigkeiten des Patienten und dem<br />
Anforderungsprofil (ICF-basiert: Körperfunktion,<br />
Teilhabe, Umweltfaktoren<br />
sowie personenbezogene Faktoren)<br />
(siehe Kasten und Abb. 2) zur gewünschten<br />
Prothesennutzung, stellen<br />
die Grundlage (Weichenstellung)<br />
für eine prothetische Versorgung dar.<br />
Sobald feststeht, welche Prothesenausführung<br />
mit welchem Steuerungssystem<br />
ausgeführt werden kann, wird<br />
mit dem Myotraining begonnen. Dabei<br />
sollen die in der Testung gefundenen<br />
Signale verinnerlicht und weiter<br />
verbessert werden. Bei manchen<br />
Systemen ist es notwendig, zwischen<br />
mehreren Komponenten (Hand öffnen/schließen,<br />
Hand drehen, Ellenbogen)<br />
umzuschalten. Hierzu müssen<br />
verschiedene Varianten einstudiert<br />
werden. Möglichkeiten hierbei sind<br />
z. B. 2 oder 3 schnelle Muskelkontraktionen,<br />
ein langer Muskelimpuls oder<br />
eine Kokontraktion (die möglichst<br />
gleichzeitige Anspannung eines Muskels<br />
[Agonist] mit seinem Gegenspieler<br />
[Antagonist], z. B. M. biceps- und<br />
M. triceps brachii).<br />
Die Elektroden können in ihrer<br />
Empfindlichkeit, bzw. Sensitivität<br />
verändert werden. Je besser und zuverlässiger<br />
das Muskelsignal reproduzierbar<br />
ist, umso geringer kann später<br />
die Sensitivität der Elektroden eingestellt<br />
werden. Wenn die Elektrode<br />
sehr empfindlich eingestellt ist, reicht<br />
bereits ein sehr geringer Muskelimpuls<br />
zur Ansteuerung der Prothese.<br />
Dies kann jedoch auch zu ungewollten<br />
Bewegungen führen. Dadurch<br />
sollen ungewollte Bewegungen der<br />
Prothese minimiert werden.<br />
Prothesengebrauchsschulung<br />
Hier wird zuerst mit dem Erlernen der<br />
Grundfunktionen begonnen. Die Betroffenen<br />
sollen den Umgang mit der<br />
Prothese erlernen. Zu Beginn werden<br />
sämtliche Bedienfunktionen erklärt.<br />
Dazu zählen neben allen technischen<br />
Gegebenheiten, wie z. B. das<br />
Ein- und Ausschalten der Prothese,<br />
das Akku-Management oder die Maximallasten<br />
der Komponenten, auch<br />
hygienische Vorgaben bzw. Reinigungshinweise.<br />
Anschließend wird<br />
das selbstständige An- und Ausziehen<br />
der Prothese erlernt. Vor allem<br />
ICF: Klassifikation von Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit<br />
Die ICF (International Classification of Functioning,<br />
Disability and Health der WHO) klassifiziert im Unterschied<br />
zur ICD (International Statistical Classification<br />
of Diseases and Related Health Problems) die Auswirkungen<br />
einer Verletzung oder Erkrankung in Bezug auf<br />
die Körperfunktionen, die Aktivitäten und die Teilhabe<br />
einer Person.<br />
Sowohl der Begriff der Funktionsfähigkeit als auch der<br />
der Behinderung beschreiben die Folgen, die sich für einen<br />
Menschen mit einem Gesundheitsproblem in Bezug<br />
zu seinen Umwelt- und seinen personenbezogenen Faktoren<br />
(Kontextfaktoren) ergeben. Die Grundlage für diese<br />
Sichtweise stellt das biopsychosoziale Modell dar [10].<br />
In Anlehnung an diese Systematik gehen wir davon<br />
aus, dass Klienten mit einer Armprothese in ihrer Teilhabefähigkeit<br />
profitieren, je besser sie die Funktionen<br />
einer Prothese in einzelnen Aktivitäten einsetzen können.<br />
Aus diesem Gedanken heraus ergibt sich für uns die<br />
Aufteilung der Prothesengebrauchsschulung in Funktions-,<br />
Aktivitäts- und Teilhabetraining.<br />
76<br />
ORTHOPÄDIE TECHNIK <strong>05</strong>/24
Prothetik<br />
Abb. 2a u. b Anamnese bogen<br />
zur Erfassung der Daten von<br />
Pro thesenpatienten (a) und<br />
Frage bogen zur Nutzung der<br />
Prothese (b).<br />
a.<br />
b.<br />
bei Mehrfachamputationen können<br />
verschiedene Hilfsmittel zum Einsatz<br />
kommen. Die Prothesengebrauchsschulung<br />
umfasst aufeinander aufbauend:<br />
– Funktionstraining<br />
• Öffnen/Schließen der Hand<br />
• Umschalten zwischen den Komponenten<br />
(Ellbogen/Hand/Unterarmrotation)<br />
– Aktivitätstraining:<br />
• Greifen von Gegenständen, Holzwürfel/Schaumstoffwürfel<br />
– Teilhabetraining:<br />
• Beidhändiges Essen<br />
• Bilaterale Haushaltstätigkeiten<br />
• Hobbys<br />
• Berufliche Tätigkeiten<br />
Funktionstraining<br />
Je nach Prothesenart und -komponenten<br />
sind verschiedene Funktionen<br />
möglich (Hand öffnen/schließen,<br />
Handrotation, Ellenbogen beugen/strecken).<br />
Ziel ist es, die Prothese<br />
gezielt und willkürlich ohne Störsignale<br />
und Fehlimpulse bedienen<br />
zu können. Wie oben (Myotestung/<br />
Myotraining) beschrieben, müssen<br />
die Umschaltvarianten zwischen den<br />
jeweiligen Komponenten bei einer<br />
Prothesensteuerung mittels 2 Elektroden<br />
erlernt werden. Diese gilt es ebenso<br />
willkürlich und ohne Störsignale<br />
dauerhaft reproduzieren zu können.<br />
Aktivitätstraining<br />
Die erlernten Funktionen werden in<br />
einfache Tätigkeiten integriert. Hier<br />
ORTHOPÄDIE TECHNIK <strong>05</strong>/24<br />
77
Prothetik<br />
Abb. 3 „Box and<br />
Block Test“.<br />
geeigneten Griffvarianten gefunden<br />
werden müssen. Ziel ist es, dass der<br />
Klient Erfahrungen sammelt, mit welchen<br />
Griffvariationen er die für ihn<br />
notwendigen Tätigkeiten am besten<br />
durchführen kann. Im Laufe der Zeit<br />
sammelt man als Therapeut Erfahrungen,<br />
welche Griffe für die jeweiligen<br />
Tätigkeiten geeignet sind, dies kann<br />
allerdings nicht verallgemeinert werden.<br />
So nutzen manche Betroffene<br />
zum Greifen von kleinen Gegenständen<br />
eher einen Spitzgriff, andere hingegen<br />
präferieren den Dreipunktgriff.<br />
gilt zu beachten, dass die Belastung<br />
von einfachen zu schweren Tätigkeiten<br />
langsam gesteigert werden soll. So<br />
beginnen wir beispielsweise mit großen,<br />
festen Gegenständen und tasten<br />
uns langsam an kleine, weiche oder<br />
teils auch zerbrechliche Gegenstände<br />
heran. Um für die Betroffenen eigene<br />
Vergleichswerte zu generieren,<br />
nutzen wir unter anderem den „Box<br />
and Block Test“ (Abb. 3). Diese Werte<br />
werden in einer Verlaufsdokumentation<br />
festgehalten und können zur Beurteilung<br />
der Lernfortschritte der Klienten<br />
genutzt werden. Hierbei soll der<br />
Betroffene innerhalb einer Minute so<br />
viele Holzblöcke wie möglich von der<br />
einen Seite der Box auf die andere Seite<br />
legen. Dabei können verschiedene<br />
Griffvarianten genutzt werden. Dies ist<br />
von Klient zu Klient unterschiedlich.<br />
Des Weiteren bietet der „Clothespin<br />
Relocation Test“ eine Möglichkeit,<br />
die Nutzung der Prothese in allen<br />
Ebenen und mit Einschluss aller Komponenten<br />
zu überprüfen (Abb. 4). Dabei<br />
muss mit Wäscheklammern, die<br />
einen unterschiedlich starken Widerstand<br />
haben, in verschiedenen Positionen<br />
hantiert werden. Somit muss<br />
der Ellbogen teilweise gestreckt oder<br />
gebeugt, die Hand gedreht sowie aufund<br />
zugemacht werden.<br />
Teilhabetraining<br />
In dem zu Beginn ausgefüllten Anforderungsprofil<br />
stehen die Tätigkeiten,<br />
die der Betroffene mit der Prothese im<br />
Alltag ausführen möchte, und somit<br />
auch die nächsten Therapieschritte<br />
(Abb. 5). Hierfür wird oft eine längere<br />
Trainingsphase benötigt, da hier die<br />
a.<br />
a.<br />
Fazit<br />
Durch die Versorgung mit einer Exoprothese<br />
haben Klienten die Möglichkeit,<br />
ihre Selbstständigkeit zu verbessern.<br />
Nach unserer Überzeugung<br />
kann die Integration dieses technischen<br />
Hilfsmittels nur in enger Zusammenarbeit<br />
spezialisierter Orthopädietechniker<br />
und Therapeuten<br />
stattfinden.<br />
Mit einer früh einsetzenden Prothesengebrauchsschulung<br />
schafft<br />
man für Klienten die Voraussetzun-<br />
Abb. 4a u. b „Clothespin Relocation<br />
Test“ zur Evaluation der Prothesennutzung<br />
in allen Ebenen.<br />
Abb. 5a u. b Training der Aktivitäten des täglichen Lebens sowie der beruflichen<br />
Tätigkeiten/Hobbys.<br />
b.<br />
b.<br />
Zitation: Fürst A, Baumgärtler HP. Schulung im Umgang mit Exoprothesenpassteilen an der oberen Extremität (Armprothesen).<br />
Orthopädie Technik. <strong>2024</strong>; 75 (5): 74–79<br />
78<br />
ORTHOPÄDIE TECHNIK <strong>05</strong>/24
Prothetik<br />
gen, ihre verbliebenen Fähigkeiten<br />
maximal zu nutzen, die Akzeptanz<br />
für eine Prothese zu fördern und frühzeitig<br />
Lebensperspektiven zu schaffen.<br />
Unsere Erfahrung hat gezeigt,<br />
dass ein abgestuftes Training, angelehnt<br />
an die ICF, die Therapieplanung<br />
erleichtern und eine Gewöhnung an<br />
die Prothese fördern kann.<br />
Unsere Empfehlung ist, sämtliche<br />
Ergebnisse aus durchgeführten Assessments<br />
zusammen mit einer ausführlichen<br />
Videodokumentation dem<br />
Kostenträger als Entscheidungshilfe<br />
vorzulegen.<br />
Hinweis:<br />
In dem Artikel wird die männliche<br />
Schreibweise der schnelleren Lesbarkeit<br />
wegen verwendet, wir würden sie<br />
aber gerne als geschlechtsneutral verstanden<br />
wissen.<br />
Die Autoren:<br />
Alexander Fürst<br />
Ergotherapeut<br />
Berufsgenossenschaftliche Unfallklinik<br />
Murnau<br />
Prof.-Küntscher-Straße 8<br />
82418 Murnau am Staffelsee<br />
alexander.fuerst@bgu.murnau.de<br />
0151/18313399<br />
Hans-Peter Baumgärtler<br />
Leitung Ergotherapie<br />
Berufsgenossenschaftliche Unfallklinik<br />
Murnau<br />
Prof.-Küntscher-Straße 8<br />
82418 Murnau am Staffelsee<br />
hans.baumgaertler@bgu-murnau.de<br />
Begutachteter Beitrag/reviewed paper<br />
Literatur:<br />
[1] SRF 2 Kultur. Schritt für Schritt: Die Geschichte der Prothese.<br />
https://www.srf.ch/kultur/gesellschaft-religion/pro<br />
thesen-im-wandel-schritt-fuer-schritt-die-geschichte-derprothese<br />
(Zugriff am 18.01.<strong>2024</strong>)<br />
[2] Jakubowitz E, Kettenbach A, Fleischer-Lück B. Aktuelle<br />
Entwicklungen in der Handprothetik – wie nah sind wir<br />
wirklich an Sensibilität und Intelligenz? Orthopädie Technik,<br />
2018; 69 (7): 30–38<br />
[3] Meinecke-Allekotte B. Mit einer myoelektrischen Handprothese<br />
zurück ins Leben – Prothesengebrauchsschulung<br />
als Teil des interdisziplinären Rehabilitationspfads. Orthopädie<br />
Technik, 2021; 72 (2): 38–43<br />
[4] Kretz D. Teilhandamputation und Hilfsmittelversorgung<br />
– welche Versorgungen sind sinnvoll? Orthopädie<br />
Technik, 2018; 69 (7): 40–44<br />
[5] Biddiss EA, Chau TT. Upper limb prosthesis use and<br />
abandonment: A survey of the last 25 years. Prosthetics<br />
and Orthotics International, 2007; 31 (3): 236–257<br />
[6] Roeschlein RA, Domholdt E. Factors related to successful<br />
upper extremity prosthetic use. Prosthetics and Orthotics<br />
International, 1989; 13 (1): 14–18<br />
[7] Dromerick AW et al. Effect of Training on Upper-Extremity<br />
Prosthetic Performance and Motor Learning: A Single-Case<br />
Study. American Academy of Physical Medicine<br />
and Rehabilitation, 2008; 89 (6): 1199–1204<br />
[8] Weeks DL, Wallace SA, Anderson DI. Training with an<br />
upper-limb prosthetic simulator to enhance transfer of<br />
skill across limbs. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation,<br />
2003; 84 (3): 437–443 https://doi.org/10.1<strong>05</strong>3/<br />
apmr.2003.50014<br />
[9] Grifka J, Kuster M. Orthopädie und Unfallchirurgie: Für<br />
Praxis, Klinik und Facharztprüfung. Heidelberg: Springer,<br />
2011<br />
[10] Engel GL. The need for a new model: a challenge for<br />
biomedicine. Science, 1977; 196 (8): 129–136. https://doi.<br />
org/10.1126/science.847460<br />
Weiterführende Literatur:<br />
Baumgartner R, Botta P. Amputation und Stumpfversorgung.<br />
Stuttgart, Thieme: 2007<br />
Benner S et al. Exoprothesenversorgung der oberen<br />
Extremität. Trauma und Berufskrankheit, 2019; 21: 55–60.<br />
https://doi.org/10.1007/s10039-019-0414-2<br />
Breier S. Verbessern nach Amputation Alltagsfunktionalität<br />
und Lebensqualität: Myoelektrische Teilhandprothesen.<br />
Ergotherapie und Rehabilitation, 2020; 59 (4): 20–24<br />
Glapa K et al. Rehabilitation bei Patienten nach Amputationen<br />
an den Extremitäten. Orthopäde, 2021; 50: 900–909.<br />
https://doi.org/10.1007/s00132-021-04173-x<br />
Greitemann B, Brückner L, Schäfer M, Baumgartner R<br />
(Hrsg.). Amputation und Prothesenversorgung. Indikationsstellung<br />
– operative Technik – Nachbehandlung –<br />
Funktionstraining. 4. Auflage. Stuttgart: Thieme, 2016<br />
Karst B, Winkler C. Spezielle Bewegungstherapie – obere<br />
Extremität. In: Greitemann B, Brückner L, Schäfer M,<br />
Baumgartner R (Hrsg). Amputation und Prothesenversorgung.<br />
4. Auflage. Stuttgart: Thieme, 2016<br />
Kulmer T, Kogelbauer B, Sommer M. Assessments bei<br />
myoelektrischen Prothesen der oberen Extremität – ein<br />
modifizierter Scoping Review. ergoscience 2016, 11 (3):<br />
102–112<br />
Salminger S et al. Prothetischer Ersatz an der oberen<br />
Extremität bei Amputation oder Funktionsverlust. Manuelle<br />
Medizin, 2019; 57: 16–20. https://doi.org/10.1007/<br />
s00337-018-0490-6<br />
Simmel S, Baumgärtler H-P. Indikationsprüfung neuer<br />
Armprothesen. Trauma Berufskrankheiten, 2018; 20 (1):<br />
26–30. https://doi.org/10.1007/s10039-017-0280-8<br />
Verein zur Qualitätssicherung in der Armprothetik e.V.<br />
(Hrsg.). Kompendium Qualitätsstandard im Bereich der<br />
Prothetik der oberen Extremität. Dortmund: Orthopädie-<br />
Technik, 2014<br />
ORTHOPÄDIE TECHNIK <strong>05</strong>/24<br />
79
Menschen bewegen.<br />
Foto: iStock<br />
OTWorld-Rabatt!<br />
Bis zum 30.06.<strong>2024</strong> buchen<br />
und 20 % sparen.<br />
SEMINARPROGRAMM <strong>2024</strong><br />
Souveräne Kommunikation mit Kunden<br />
im Sanitätshaus<br />
Einsteigerkurs: Leicht gesagt – erfolgreiche<br />
Kommunikation im Sanitätshaus<br />
• Grundlagen der Kommunikation<br />
• Kommunikationswerkzeuge in der verbalen und nonverbalen<br />
Kommunikation kennenlernen<br />
• Lernen, wie sich Absicht und Wirkung des gesprochenen Wortes<br />
unterscheiden und Sie gezielt besser kommunizieren<br />
Ziel: Gesprächskompetenzen verbessern und souverän mit Kunden<br />
und Kollegen kommunizieren<br />
Für wen: Mitarbeitende und Quereinsteiger im Sanitätshaus,<br />
insbesondere in der Beratung, im Verkauf und Kundenempfang<br />
Termin: 25. und 26. Juni <strong>2024</strong><br />
Preis: ab 549 EUR<br />
Vertiefungskurs: Verkaufs- und Beratungsgespräche<br />
im Sanitätshaus souverän führen<br />
• Die Wichtigkeit der eigenen inneren Haltung verstehen<br />
• Tipps für den Umgang mit emotionalen Situationen<br />
• No-Gos der Kommunikation<br />
Ziel: Deeskalierende und wertschätzende Kommunikation auch in<br />
schwierigen Gesprächssituationen<br />
Für wen: Mitarbeitende und Quereinsteiger im Sanitätshaus,<br />
insbesondere in der Beratung, im Verkauf und Kundenempfang<br />
Termin: 27. Juni <strong>2024</strong><br />
Preis: ab 299 EUR<br />
NEU<br />
NEU<br />
Basiskurs Qualitätsstandards<br />
Armprothetik<br />
• Vorstellung des Qualitätsstandards im Bereich Prothetik der<br />
oberen Extremität<br />
• Aufbau, Struktur und Dokumentationsanforderungen des<br />
Qualitätsstandards<br />
• Umsetzung des Qualitätsstandards im Versorgungsalltag<br />
• Vorstellung des Versorgungsablaufs der Habitusprothetik<br />
Ziel: Armprothetik sicher beraten<br />
Für wen: Orthopädietechniker, alle an der Versorgung Beteiligten<br />
Termine: 23. Mai <strong>2024</strong>, 12. Dezember <strong>2024</strong><br />
Preis: 509 EUR<br />
MDR leicht gemacht – So gelingt die<br />
erfolgreiche Umsetzung im Unternehmen<br />
• die wesentlichen Anforderungen der MDR für Sonderanfertigungen<br />
in der Orthopädie-Technik und Orthopädie-Schuhtechnik<br />
• MDR-konforme Dokumentation<br />
• Integration der Anforderungen in ein bestehendes<br />
QM-System nach ISO 9001 oder ISO 13485<br />
Ziel: sichere Einbindung der Anforderungen der MDR<br />
in das eigene QM-System<br />
Für wen: Geschäftsführung, QM-Beauftragte, Verantwortliche nach<br />
Art. 15 MDR, fachliche Leitungen aus herstellenden Bereichen und Handel<br />
Termin: 15. Oktober <strong>2024</strong><br />
Preis: ab 329 EUR<br />
Knackpunkte in der MDR im Sanitätshaus –<br />
Wichtige regulatorische Anforderungen verstehen<br />
und umsetzen<br />
• Produktprüfung gem. Art. 14 und Label-Prüfung von Import-Produkten<br />
• Vereinzelung gemäß Art. 16<br />
• Aufrechterhalten der Hersteller-Vorgaben hinsichtlich<br />
Lagerung und Transport<br />
• Materialrückverfolgung im Bereich OT und OST<br />
Ziel: Produkte gemäß den regulatorischen Anforderungen richtig<br />
prüfen, kennzeichnen und lagern<br />
Für wen: Geschäftsführer, QM-Beauftragte, fachliche Leitungen<br />
aus herstellenden Bereichen OT, OST und Sitzschalen-Herstellung und<br />
fachliche Leitungen aus dem Sanitätsfachhandel<br />
Termin: 24. September <strong>2024</strong><br />
Preis: ab 329 EUR<br />
NEU<br />
Die „Verantwortliche Person nach Art. 15 MDR“<br />
• Grundlagen zur Rolle Sonderanfertiger / Hersteller nach MDR<br />
• Pflichten und Zuständigkeiten der Verantwortlichen Person<br />
• Praxisbeispiele zur Umsetzung im betrieblichen Alltag<br />
Ziel: Kenntnis über Aufgaben und Pflichten der Verantwortlichen<br />
Person, Erlernen von Umsetzungsstrategien<br />
Für wen: (Technische) Geschäftsführung und fachliche Leitung<br />
sowie Personen, die als für die Einhaltung der Regulierungsvorschriften<br />
verantwortliche Person tätig sind oder zukünftig tätig werden sollen.<br />
Termin: 24. September <strong>2024</strong><br />
Preis: ab 329 EUR<br />
NEU
MDR – spezielle Anforderungen für<br />
Hersteller und Sonderanfertiger<br />
• allgemeine Pflichten der Hersteller<br />
• spezielle Pflichten der Sonderanfertiger<br />
• System zur Überwachung nach dem Inverkehrbringen (PMS)<br />
Ziel: sichere Einbindung der Anforderungen der MDR als Hersteller und<br />
Sonderanfertiger<br />
Für wen: Geschäftsführung, leitende Mitarbeiter, QM- und Sicherheitsbeauftragte<br />
aus Unternehmen der Leistungserbringer, des Gesundheitshandwerks<br />
und Dienstleistungserbringer im Medizinproduktebereich und<br />
Medizinproduktehandel<br />
Termin: 09. September <strong>2024</strong><br />
Preis: ab 329 EUR<br />
MDR – spezielle Anforderungen für<br />
Händler, Importeure und Bevollmächtigte<br />
• Pflichten der Händler<br />
• Pflichten von Importeuren und Bevollmächtigten<br />
• System zur Überwachung nach dem Inverkehrbringen (PMS)<br />
Ziel: sichere Einbindung der Anforderungen der MDR als Händler,<br />
Importeur und Bevollmächtigter<br />
Für wen: Geschäftsführung, leitende Mitarbeiter, QM- und Sicherheitsbeauftragte<br />
aus Unternehmen der Leistungserbringer, des Gesundheitshandwerks<br />
und Dienstleistungserbringer im Medizinproduktebereich und<br />
Medizinproduktehandel<br />
Termin: 09. September <strong>2024</strong><br />
Preis: ab 329 EUR<br />
Interne Audits – Sinnhafte Umsetzung<br />
in die Praxis<br />
• Grundlagenwissen zu Audits und Auditierung<br />
• Anwendung und Umsetzung im eigenen Betrieb<br />
• Problembehandlung konkreter Fälle<br />
Ziel: Audits sicher und effektiv planen und nutzbringend im eigenen<br />
Unternehmen umsetzen<br />
Für wen: QM-Beauftragte, interne Auditoren und Geschäftsführung<br />
des Gesundheitswesens bzw. der Gesundheitshandwerke<br />
Termin: <strong>05</strong>. September <strong>2024</strong><br />
Preis: ab 329 EUR<br />
Vertragsschulung: Sichere Anwendung<br />
der Verträge<br />
• Überblick über die komplexe Vertragslandschaft<br />
verschiedener Leistungsträger<br />
• Verträge verstehen und anwenden<br />
• Fehlabrechnungen, Kürzungen und Absetzungen vermeiden<br />
Ziel: Sicheres, wirtschaftliches Anwenden von Verträgen, Erstellen von<br />
Kostenvoranschlägen und vertragskonformen Abrechnungen<br />
Für wen: Mitgliedsbetriebe des Bundesinnungsverbandes für<br />
Orthopädie-Technik (BIV-OT) und Fachverbände sowie deren Inhaber<br />
und Mitarbeiter<br />
Termine: 13. Juni <strong>2024</strong>, 14. November <strong>2024</strong><br />
Preis: ab 469 EUR<br />
DIN EN ISO 13485:2021<br />
Werkzeug und Wegweiser<br />
• Umsetzung der Norm im eigenen Betrieb<br />
• Kenntnis von möglichen Fallstricken<br />
• Änderungen, die sich aus der MDR ergeben<br />
Ziel: QM-System sicher anwenden<br />
Für wen: Geschäftsführung, leitende Mitarbeiter, QM- und Sicherheitsbeauftragte<br />
aus Unternehmen der Leistungserbringer, des Gesundheitshandwerks<br />
und Dienstleistungserbringer im Medizinproduktebereich und<br />
Medizinproduktehandel<br />
Termin: 04. September <strong>2024</strong><br />
Preis: ab 499 EUR<br />
Train the Trainer – Fit für<br />
MDR-Mitarbeiterschulungen<br />
• Grundlagenwissen MDR und MPDG<br />
• Entwicklung eines Leitfadens zur Wissensvermittlung<br />
im eigenen Unternehmen<br />
• unternehmerischen Alltag und regulative Anforderungen<br />
unter einen Hut bringen<br />
Ziel: Schulungen für Medizinprodukteberater sicher und<br />
effektiv durchführen<br />
Für wen: QM-Beauftragte, interne Auditoren und Geschäftsführung<br />
des Gesundheitswesens bzw. der Gesundheitshandwerke<br />
Termin: <strong>05</strong>. September <strong>2024</strong><br />
Preis: ab 329 EUR<br />
Alle angegebenen Preise verstehen sich zzgl. MwSt.<br />
Der OTWorld-Rabatt gilt ab 14. Mai <strong>2024</strong>. Der Rabatt gilt nicht für den<br />
Basiskurs Qualitätsstandards Armprothetik.<br />
Alle Seminare ausgenommen Basiskurs Qualitätsstandards Armprothetik<br />
finden digital statt. Der Basiskurs Qualitätsstandards Armprothetik findet<br />
in Präsenz in Dortmund statt.<br />
Die Confairmed GmbH veranstaltet nationale<br />
und internationale Seminare und Messen<br />
rund um die Technische Orthopädie; u.a. den<br />
Weltkongress auf der Weltleitmesse OTWorld.<br />
Wir sind ein 100%-iges Tochterunternehmen<br />
des Bundesinnungsverbandes für Orthopädie-<br />
Technik. Durch die direkte Verwandtschaft sind wir<br />
un mittelbar über aktuelle Vertragsabschlüsse und neue<br />
gesetzliche Vorgaben informiert.<br />
Mit diesem Wissen richten wir unsere Seminare<br />
optimal auf die Bedürfnisse der Betriebe aus.<br />
Details zu den Veranstaltungen<br />
und Buchungsmöglichkeiten unter:<br />
www.confairmed.de/seminare<br />
SEMINARPROGRAMM <strong>2024</strong>
Prothetik<br />
V. Hoursch 1 , M. Egger 1 , L. Pardo 2 , V. Witowski 1 , L. Jopp 1 , M. Kalff 1,2 ,<br />
L. Lorbeer 1 , L. Niehage 3 , O. Breitenstein 4 , S. Sehmisch 1 , J. Ernst 1,2<br />
Agonisten-Antagonisten Myoneural-Interface<br />
(AMI) – eine<br />
neue Versorgungsdimension für<br />
den transtibialen Stumpf?<br />
Agonist-antagonist Myoneural Interface (AMI) – a New Treatment<br />
Dimension for the Transtibial Limb?<br />
1<br />
Medizinische Hochschule Hannover, Klinik<br />
für Unfallchirurgie, Carl-Neuberg-Straße 1,<br />
30625 Hannover, Deutschland<br />
2<br />
Klinik für Unfallchirurgie, Orthopädie<br />
und Plastische Chirurgie, Universitätsmedizin<br />
Göttingen, Deutschland<br />
3<br />
OTM, John + Bamberg GmbH & Co. KG,<br />
Hannover<br />
4<br />
OTM, Brandes & Diesing OHG, Hannover<br />
Myodese, Myoplastik und Myopexien<br />
sind operative Techniken, die<br />
eine Refixierung der Muskulatur im<br />
Stumpf zur Polsterung des distalen<br />
Knochenendes und der muskulären<br />
Führung des Stumpfes beschreiben.<br />
Eine Ruptur oder Dislokation<br />
der Muskeltransposition am transtibialen<br />
Amputationsstumpf kann<br />
zu einer insuffizienten Weichteildeckung,<br />
immobilisierenden Ulzerationen,<br />
Stumpfschmerzen und bei sehr<br />
aktiven Unterschenkelamputierten<br />
zu biomechanischen Einschränkungen<br />
beim Gehen führen. Das Agonisten-Antagonisten-Myoneural-Interface<br />
(AMI) beschreibt eine neue<br />
Operationsmethode, bei der Muskel-Agonisten<br />
und -Antagonisten<br />
gezielt miteinander gekoppelt werden.<br />
Durch die Wiederherstellung<br />
des Agonisten-Antagonisten-Gefüges<br />
konnten die Erstbeschreiber den<br />
Lagesinn der amputierten Extremität<br />
(Pro priozeption) rekonstruieren<br />
und eine verbesserte motorische<br />
Kon trolle des Stumpfes, der Prothese<br />
und des Gehvermögens aufzeigen.<br />
In dieser Arbeit stellen wir unsere<br />
ersten Ergebnisse mit dieser Operationstechnik<br />
im Rahmen transtibialer<br />
Amputationen, die Komplikationen<br />
und den Einfluss dieser Operationstechnik<br />
auf den Stumpf vor.<br />
Schlüsselwörter: Unterschenkelamputation,<br />
Myodese, Myoplastik,<br />
Agonist-Antagonist-Myoneurale<br />
Schnittstelle (AMI), Propriozeption<br />
Myodesis, myoplasty and myopexy<br />
are surgical techniques describing<br />
the refixation of the muscles in the<br />
residual limb to cushion the distal<br />
end of the bone and to improve<br />
motor control of the residual limb.<br />
At transtibial amputees a rupture or<br />
dislocation of this cushion can lead<br />
to insufficient soft tissue coverage<br />
on the ventral, distal tibia. This leads<br />
often to ulcerations, residual limb<br />
pain and, in very active transtibial<br />
amputees, restrictions in walking.<br />
The Agonist-Antagonist-Myoneural-Interface<br />
(AMI) describes a new<br />
surgical method in which muscle agonists<br />
and antagonists are selectively<br />
coupled. By restoring the agonist-antagonist<br />
muscle strain the inventors<br />
could demonstrate restored proprioception,<br />
improved motor control of<br />
the residual limb and the prosthesis<br />
and improved gait. In this paper<br />
we present the first results with this<br />
surgical technique for transtibial amputations,<br />
its complications, and the<br />
influence of this surgical technique<br />
on residual limb circumference.<br />
Key words: Transtibial Amputation,<br />
Myodesis, Myoplasty, Agonist-Antagonist<br />
Myoneural Interface (AMI),<br />
Proprioception<br />
Allgemeines und<br />
Prävalenzen<br />
In Deutschland werden jährlich ca.<br />
56.000 Amputationen durchgeführt.<br />
Die Amputationszahlen steigen gegenwärtig<br />
jährlich um 6,7 %. Gleichzeitig<br />
sinken dabei die Zahlen an Majoramputationen<br />
[1].<br />
11,5 % dieser Amputationen sind<br />
transtibiale Amputationen [1]. Aus<br />
biomechanischer Perspektive ist eine<br />
transtibiale Amputation mit Erhalt<br />
der Kniegelenkfunktion einer Oberschenkelamputation<br />
und Knieexartikulation<br />
überlegen. Kurze transtibiale<br />
Stümpfe können bis zu einer Länge<br />
von 5–6 cm und Erhalt des Ansatzes<br />
der Patellarsehne funktionell sein [2].<br />
Chirurgische Grundprinzipien<br />
der transtibialen Amputation<br />
und ihre Modifikationen<br />
Chirurgische Zielgrößen für eine erfolgreiche<br />
prothetische Versorgung sind<br />
ein funktioneller, sensibler und suffizient<br />
weichteilgedeckter Stumpf [3].<br />
Stumpflänge<br />
Bei der Planung der Osteotomiehöhe<br />
bleibt eine Tibialänge von 5 cm funktionell<br />
prothetisch versorgbar. Ab einer<br />
Tibialänge von 8 cm wird empfohlen,<br />
die Fibula zu entfernen, da<br />
auf dieser Höhe die Membrana interossea<br />
fehlt und es so zu Druckstellen<br />
aufgrund der häufigeren Dislokation<br />
der Fibula kommen kann [3]. Brückner<br />
beschrieb für vaskulär kompromittierte<br />
Patienten, dass eine Tibialänge<br />
von 9 cm mit weniger Kompli<br />
82<br />
ORTHOPÄDIE TECHNIK <strong>05</strong>/24
Prothetik<br />
kationen einhergeht [5]. Tibia längen<br />
von bis zu 16–18 cm haben in der Regel<br />
eine gute Weichteildeckung durch<br />
die kräftigen Muskelbäuche auf dieser<br />
Amputationshöhe. Bei Stumpflängen<br />
darüber hinaus kann eine suffiziente<br />
Weichteildeckung aufgrund des<br />
sehnigen, distalen Anteils der Unterschenkelmuskeln<br />
erschwert sein. Die<br />
Fibula sollte 1–2 cm kürzer als die Tibia<br />
sein und die Tibia sollte im ventralen<br />
Drittel abgerundet werden [3].<br />
Weichteilmanagement<br />
Die Planung des Hautlappens wird<br />
durch die verfügbare intakte Haut und<br />
Weichteile determiniert. Es hat sich<br />
nach Burgess ein langer dorsaler Lappen<br />
(Haut der Wade bis zur Achillessehne)<br />
und ein kurzer ventraler Hautlappen<br />
durchgesetzt, die in einer ventralen,<br />
horizontalen Narbe abheilen<br />
[3, 4]. Diese Technik wurde später von<br />
Brückner modifiziert [5]. Eine Alternative<br />
sind zwei symmetrische mediale<br />
und laterale Hautlappen mit einer vertikalen<br />
Narbe (sagittaler Zugang) [6–8].<br />
Die tiefen und oberflächlichen Flexoren<br />
inklusive des M. soleus, die Unterschenkelextensoren<br />
und die lateralen<br />
Muskeln der Peronealloge werden<br />
so weit proximal wie möglich reseziert<br />
und entfernt. Der mediale und/oder<br />
laterale Gastrocnemiusbauch wird<br />
von dorsal nach ventral um die Tibia<br />
und Fibula geschlagen. Die oberflächlichen<br />
Faszien der Mm. gastrocnemii<br />
werden an die der Stümpfe der Mm.<br />
peronaei bzw. an das mediale Periost<br />
der Tibia mit resorbierbarem Nahtmaterial<br />
fixiert (Myoplastik, Myopexie).<br />
Eine Modifikation der Fixierung<br />
von Muskelstümpfen ist die transossäre<br />
Fixation des Muskellappens durch<br />
Bohrlöcher durch die Tibia (Myodese<br />
nach Bowker) [2, 9, 10], s. Abb. 1a, b .<br />
Durch die Refixierung der Muskulatur<br />
um den Knochen verbessert sich<br />
ebenso die Durchblutung des Stumpfendes.<br />
Eine zu enge, strangulierende<br />
Muskelnaht hingegen kann zu Muskelnekrosen<br />
führen. Mechanisch widerstandsfähiger<br />
sind die Muskelfaszien,<br />
die in den drei oben genannten<br />
Techniken von dem Nahtmaterial satt<br />
und muskelsparend gegriffen werden<br />
sollten, um eine stabile Naht zu ermöglichen<br />
[2, 11, 12].<br />
Die Transposition und Refixation<br />
der Stumpfmuskulatur ist wichtig,<br />
um eine komfortable, sichere und robuste<br />
Schaftanpassung erzielen zu<br />
können. Aus orthopädietechnischer<br />
Perspektive sollte dies so erfolgen,<br />
dass insgesamt eine konische Form<br />
des Unterschenkelstumpfes erzielt<br />
wird. Demnach lässt sich ein Stumpf<br />
mit dreieckigem, konischem Querschnitt<br />
drehstabil in den Prothesenschaft<br />
einbetten. Eine Birnenform<br />
erschwert die Prothesenversorgung<br />
und eine schnelle Atrophie der Unterschenkelmuskeln<br />
ermöglicht die<br />
definitive Prothesenversorgung und<br />
damit die Mobilisation und Rehabilitation<br />
[2, 13]. In der klinischen Versorgung<br />
sind wir jedoch häufiger mit<br />
den Komplikationen distal und am<br />
Fibulaköpfchen insuffizient weichteilgedeckter<br />
Unterschenkelstümpfe<br />
konfrontiert als Folge der Atrophie der<br />
konischen Stumpfformung.<br />
Grenzen der gegenwärtigen<br />
Prinzipien der Unterschenkelamputation<br />
Das stabile Vernähen von Muskulatur<br />
miteinander grenzt am Stumpf wie auch<br />
in anderen Bereichen der Chirurgie an<br />
biomechanische Grenzen [14]. Unabhängig<br />
vom Nahtmaterial können<br />
Nähte aus der weichen, bei Muskelkontraktur<br />
stets bewegenden Muskulatur<br />
ausreißen, insbesondere wenn<br />
das Knie vor abgeschlossener Vernarbung<br />
bewegt wird. Dies kann auch bei<br />
einer transossären Fixation der Muskelstümpfe<br />
auftreten [15].<br />
Die Dislokation der Muskelstümpfe<br />
nach proximal führt zu einer insuffizienten<br />
Weichteildeckung der Tibia-<br />
und Fibulaenden, bis das Stumpfende<br />
nur noch mit Vollhaut bedeckt<br />
ist. Dies kann zu Druckstellen, Ulzerationen<br />
und Stumpfschmerzen führen.<br />
Um die Muskelnaht stabil in einer<br />
Vernarbung abheilen zu lassen,<br />
hat Brückner eine Immobilisation der<br />
Kniebeugung bis zur stabilen Ausheilung<br />
empfohlen [13].<br />
Der Anteil oben beschriebenen<br />
Abgleitens der Muskeln vom Stumpfende<br />
mit notwendiger chirurgischer<br />
Revision tritt in ca. 6 % der Fälle auf,<br />
insbesondere, wenn der Stumpf in<br />
eine Prothese mit zu engem Schafteingang<br />
angepasst wird. Durch den<br />
Zug an den Muskeln beim Einsteigen<br />
in den Schaft kann das Ausreißen begünstigt<br />
werden [13, 16, 17].<br />
Ein weiteres wichtiges Ziel der chirurgischen<br />
Refixierung der Muskeln<br />
um den Knochenstumpf ist neben der<br />
Weichteildeckung der Erhalt der physiologischen<br />
Vorspannung der Muskeln<br />
[18]. Durch die Amputation verlieren<br />
die Muskeln ihren distalen Ansatz.<br />
Durch die fehlende distale Insertion<br />
ziehen sie sich zurück und können<br />
sich trotz intakter Innerva tion<br />
nicht mehr kontrahieren [13].<br />
Um die Polsterung des knöchernen<br />
Stumpfes und den distalen Reinsertionspunkt<br />
der Muskeln zu erreichen,<br />
werden die Muskelstümpfe bisher wie<br />
oben beschrieben über dem knöchernen<br />
Stumpfende miteinander vereinigt<br />
(wahlweise die Agonisten und<br />
Anta gonisten, Myoplastik) oder transossär<br />
am Knochen fixiert (Myopexie,<br />
Myodese) [19]. In seinen Reiseberichten<br />
nach der Rückkehr von seinem<br />
Kollegen Marian Weiss aus Wierzejewskiego<br />
beschrieb der Amputationschirurg<br />
Ernest Martin Burgess die gute<br />
Stumpfpolsterung und erhaltene Propriozeption,<br />
nachdem er diese Stumpfmuskel-adressierende<br />
Vorgehensweise<br />
erstmals gesehen hatte [20]. Diese<br />
klinische Beobachtung konnte 1967<br />
und bis heute weder für die Myoplastik<br />
noch für die Myodese objektiviert werden<br />
[19].<br />
Agonisten-Antagonisten<br />
Myoneural-Interface (AMI)<br />
Die Propriozeption beschreibt unseren<br />
Lagesinn. Also die Fähigkeit, bei<br />
geschlossenen Augen genau zu wissen,<br />
in welcher Position sich Körperteile<br />
befinden [21]. Propriozeption<br />
wird zentral im Großhirn durch neurale<br />
Informationen aus dem Kleinhirn,<br />
den Gehörgängen, aus spinaler<br />
Ebene und Informationen aus peripheren<br />
Sinnesorganen in Muskeln,<br />
Sehnen, Gelenkkapseln und Haut verrechnet<br />
[22, 23]. Bei diesen peripheren<br />
Sinnesorganen wird die Propriozeption<br />
in erster Linie durch Mechanorezeptoren<br />
vermittelt, die als Muskelspindeln<br />
und Golgi-Sehnenorgane<br />
bezeichnet werden und Muskellänge,<br />
-geschwindigkeit und -spannung<br />
wahrnehmen. Diese Rezeptoren sind<br />
in den Muskeln und am Muskel-Sehnen-Übergang<br />
lokalisiert [24].<br />
In den Extremitäten überspannen<br />
Muskelpaare ein Gelenk und sind als<br />
Agonist und Antagonist miteinander<br />
gekoppelt. Eine afferente Signalübertragung<br />
der Information von den<br />
Mechanorezeptoren bei Bewegungen<br />
der Gliedmaßen wird durch die Mus<br />
ORTHOPÄDIE TECHNIK <strong>05</strong>/24<br />
83
Prothetik<br />
b.<br />
c.<br />
Fibula<br />
Tibia<br />
Die Osteotomie wird bei einer Länge<br />
von 14–16 cm und die Hautlappen<br />
mit einem langen dorsalen Lappen<br />
geplant. Während der transtibialen<br />
Amputation werden bei der AMI-Methode<br />
der M. tibialis anterior und ein<br />
Bauch des M. gastrocnemius unter<br />
Vorspannung an den intramuskulären<br />
Anteil der Sehnen ventral der Tibia<br />
miteinander durch eine Sehnennaht<br />
verknüpft, um die muskuläre<br />
Kopplung der Fußhebung und -senkung<br />
(oberes Sprunggelenk) zu rekona.<br />
Gastrocnemius-Muskel<br />
Soleus-<br />
Muskel<br />
Achillessehne<br />
kelanspannung und -entspannung<br />
der Agonisten und Antagonisten codiert.<br />
Bei der Fußhebung führt eine<br />
Kontraktion der Fußheber (Extensoren<br />
und M. tibialis anterior) zu einer<br />
Dehnung der entspannten Fußsenker<br />
(Flexoren, Mm. gastrocnemius medialis<br />
und lateralis sowie M. soleus).<br />
Das bisherige Vorgehen bei einer<br />
transtibialen Amputation berücksichtigt<br />
nicht oder nur unvollständig die<br />
anatomische und neuromechanische<br />
Kopplung von Agonisten und Antagonisten<br />
(Abb. 1a, b).<br />
Abb. 1a–c Möglichkeiten der<br />
Refixation der Stumpfmuskulatur.<br />
Myoplastik/-pexie (a). Die Faszie des<br />
dorsalen Gastrocnemiusbauchs wird<br />
an der ventralen derben Faszie über<br />
eine Naht fixiert, um die Tibia und Fibula<br />
abzupolstern (b). Myodese. Die<br />
Stumpfmuskulatur wird über Bohrlöcher<br />
an der Tibia fixiert (c). AMI: Agonist<br />
und Antagonist werden miteinander<br />
verbunden (oben). Kontrahiert<br />
der Agonist (links unten), wird der Antagonist<br />
(rechts oben) gedehnt. AMI<br />
transtibial bedeutet, dass der M. tibialis<br />
anterior und ein Bauch des M. gastrocnemius<br />
unter Vorspannung ventral<br />
der Tibia miteinander durch eine<br />
Sehnennaht verknüpft werden. Wenige<br />
Zentimeter distal vom ersten AMI<br />
folgt der zweite AMI, dazu werden<br />
der M. proneus longus und der M. tibialis<br />
posterior miteinander verbunden.<br />
Ziel ist, die muskuläre Kopplung<br />
der Fußhebung und -senkung (oberes<br />
Sprunggelenk) zu rekonstruieren (vgl.<br />
Abb. 2c).<br />
Copyright A Innovative Amputations medizin, Klinik für<br />
Unfallchirurgie Medizinische Hochschule Hannover<br />
Schnelle Reaktionen zur Korrektur<br />
der Haltung und zum Ausgleich des<br />
Gleichgewichts beim Gehen sind für<br />
Beinamputierte durch die gestörte motorische<br />
Kontrolle und propriozeptive<br />
Wahrnehmung stark beeinträchtigt<br />
[25–28].<br />
In Untersuchungen der Arbeitsgruppe<br />
der Erstbeschreiber der AMI-<br />
Technik und ihren Nachuntersuchungen<br />
konnten nach Wiederherstellung<br />
der Kopplung von Agonisten und Antagonisten<br />
im Rahmen der Amputation<br />
eine verbesserte motorische Kontrolle<br />
und propriozeptive Wahrnehmung<br />
gezeigt werden [28–32].<br />
Diese Ergebnisse als auch die Prävalenz<br />
der Vorstellung von insuffizient<br />
weichteilgedeckten transtibialen<br />
Stümpfen mit exponierter Tibiakante<br />
und Fibulaköpfchen in unserer Amputationssprechstunde<br />
motivierten uns<br />
zur Einführung dieser Operationsmethode<br />
im Januar 2022. Im Folgenden<br />
berichten wir über die ersten perioperativen<br />
Ergebnisse dieser innovativen<br />
Interpretation der Muskeltransposition<br />
für transtibial Amputierte.<br />
Methoden<br />
Patientenkollektiv<br />
Transtibial Amputierte, die im Zeitraum<br />
von Januar 2022 bis Dezember<br />
2023 AMIs erhielten, wurden eingeschlossen.<br />
Kontraindikationen waren<br />
ein massives Muskeltrauma, mangelnde<br />
Compliance und ein reduzierter<br />
Allgemeinzustand, der eine Operationszeit<br />
von mehr als drei Stunden<br />
verbietet.<br />
Operative Schritte des transtibialen<br />
Agonisten-Antagonisten<br />
Myoneural-Interface<br />
Anzahl der<br />
Patienten<br />
Gesamt<br />
Trauma<br />
Diabetes mellitus<br />
und/oder Durchblutungsstörungen<br />
Sepsis<br />
Infektion<br />
ohne Sepsis<br />
Spätversagen<br />
von Extremitätenrekonstruktionen<br />
Kongenital<br />
20 7 1 4 1 5 1 1<br />
Geschlecht M/F 16/4 7/0 1/0 3/1 1/0 4/1 0/1 0/1<br />
Alter bei AMI-<br />
Amputation<br />
(ø, Jahre)<br />
52, 35 50, 42 85 57, 25 53 54, 17 2 53<br />
Komplikationen 3 2 – – – 1 – –<br />
Tumor<br />
Tab. 1 Demographie und Amputationsursache der transtibialen Agonisten-Antagonisten-Myoneural-Interfaces (AMI)<br />
im Beobachtungszeitraum.<br />
84<br />
ORTHOPÄDIE TECHNIK <strong>05</strong>/24
Prothetik<br />
ORTHOPÄDIE TECHNIK <strong>05</strong>/24<br />
struieren. Diese Verbindung wird von<br />
einer gleitenden Struktur umschlossen.<br />
Dazu kann eine glatte faszienartige<br />
Struktur, der Tarsaltunnel oder<br />
das Retinakulum (extensorum) verwendet<br />
werden. Sollte dies aufgrund<br />
von Infektionen oder Nekrosen nicht<br />
möglich sein, kann alternativ eine<br />
azelluläre dermale Matrix verwendet<br />
werden. Das Gleitlager wird an der lateralen<br />
Tibiakante im distalen Drittel<br />
des Knochens mit transossären Ankernähten<br />
fixiert und das Gleitlager<br />
sodann verschlossen.<br />
Zur Rekonstruktion der Inversion<br />
und Eversion des unteren Sprunggelenks<br />
wird in gleicher Vorgehensweise<br />
wenige Zentimeter distal vom ersten<br />
AMI der M. peroneus longus mit<br />
dem M. tibialis posterior verbunden<br />
(Abb. 1c). Der verbleibende M. soleus<br />
wird bei sicherer Durchblutung von<br />
dorsal nach ventral über AMI I und<br />
II geschlagen und der Muskel mit seiner<br />
Faszie an der ventralen oberflächlichen<br />
Körperfaszie fixiert, bevor der<br />
lange dorsale Hautlappen umgeschlagen<br />
und die Haut verschlossen wird<br />
[33, Abb. 1c]. Die durchtrennten Nerven<br />
werden anschließend zur Prävention<br />
von schmerzhaften Stumpfneuromen<br />
mithilfe eines selektiven<br />
Nerventransfers auf sensible Hautnerven<br />
(Targeted Sensory Reinnervaion,<br />
TSR), motorische Empfängernerven<br />
von Nicht-AMI-Muskeln (Targeted<br />
Muscle Reinnervation, TMR) oder in<br />
ein kleines avaskuläres Muskeltransplantat<br />
(Regenerative Peripheral Nerve<br />
Interface, RPNI) koaptiert. Diese<br />
Methoden reduzieren nachweislich<br />
die Prävalenz von Neurom- und Phantomschmerzen<br />
[34–39].<br />
Alle weiteren, nicht-prozessierten<br />
Muskeln im transtibialen Amputationsstumpf<br />
werden weit proximal abgesetzt<br />
und reseziert. Vor dem Umschlagen<br />
des langen dorsalen Hautlappens<br />
sollte eine Drainage eingelegt werden.<br />
Es folgt der zweischichtige Wundverschluss.<br />
Sollten keine Kontraindikationen<br />
vorliegen, wird zur anti-ödematösen<br />
Therapie ein weißer Schwamm auf<br />
der Hautnaht aufgelegt und mit einem<br />
epikutanen Vakuumsystem versorgt.<br />
Im Operationssaal wird der Stumpf<br />
bis Mitte des Oberschenkels über das<br />
anliegende Vakuumsystem mit Watte<br />
und elastischer Wicklung moderat gewickelt<br />
und in einer Schiene in Kniestreckung<br />
unter Aufhebung der Knieflexion<br />
(Knie-Immobilisations-Schiene)<br />
für vier bis sechs Wochen Tag und<br />
Nacht ruhiggestellt.<br />
Nachbehandlung<br />
Das epikutane Vakuumsystem wird<br />
auf Station nach fünf bis sieben Tagen<br />
abgenommen. Dann wird der<br />
Stumpf mit einem Pflaster und einem<br />
rundgestrickten Stumpfkompressionsstrumpf<br />
der Kompressionsklasse II<br />
über dem Pflaster versorgt. Postoperativ<br />
wird der Stumpf inklusive des<br />
Knies in zwei Ebenen geröntgt. Die Fäden<br />
oder Hautklammern werden erst<br />
nach sicherer Wundheilung 21 bis<br />
28 Tage nach Amputation entfernt.<br />
Die Knie flexion und Belastung werden<br />
nach sechs Wochen vollständig<br />
freigegeben. Ab diesem Zeitpunkt<br />
sollen Fußhebung und -senkung sowie<br />
In- und Eversion dreimal täglich<br />
20-mal durch eine aktive Kontraktion<br />
der AMI-Muskeln beübt werden. Zum<br />
Training wird dem Patienten ein visualisiertes<br />
Bewegungsprotokoll mit<br />
den oben beschriebenen Bewegungen<br />
ausgehändigt.<br />
Outcome-Parameter<br />
Anzahl, Geschlecht, Alter und Ursache<br />
der transtibialen Amputation,<br />
Anzahl der AMIs, Komplikationen<br />
und klinische Schmerzerhebung wurden<br />
dokumentiert und analysiert.<br />
Umfänge des Amputationsstumpfes<br />
in Sechs-Zentimeter-(cm)-Schritten<br />
bis 18 cm proximal der Kniebeugefalte<br />
wurden in den klinischen Verlaufskontrollen<br />
erhoben und longitudinal<br />
im Beobachtungszeitraum illustriert.<br />
Ergebnisse<br />
Im 24-monatigen Beobachtungszeitraum<br />
wurden 20 transtibiale Amputationen<br />
mit einem AMI versorgt. Bei allen<br />
transtibialen Amputationen wurden<br />
zwei AMIs rekonstruiert (AMI I,<br />
AMI II), s. Abb. 1c, Tab. 1.<br />
Die Ursachen für eine transtibiale<br />
Amputation waren dabei akutes Trauma<br />
(n = 7), Diabetes mellitus und/<br />
oder Durchblutungsstörungen (n = 1),<br />
Sepsis (n = 4), Spätversagen von Extremitätenrekonstruktionen<br />
(n = 5),<br />
Infektion ohne Sepsis (n = 1), Tumor<br />
(n = 1) und eine Amputation im Rahmen<br />
einer angeborenen Fehlbildung<br />
(s. Tab. 1). 14 Patienten waren unilateral<br />
betroffen, drei weitere bilateral.<br />
Im Beobachtungszeitraum traten drei<br />
Komplikationen auf: zwei Frühinfek<br />
BESCHREITEN SIE MIT UNS<br />
NEUE WEGE UND OPTIMIEREN<br />
SIE IHRE PROZESSE.<br />
Mit unseren branchengerechten und<br />
stets aktuellen Softwarelösungen für<br />
Sanitätshäuser sowie Orthopädieund<br />
Rehatechnik machen Sie sich das<br />
Potenzial der digitalen Welt für Ihren<br />
Alltag zu Nutze.<br />
IHRE VORTEILE:<br />
• Modernste Softwarelösungen<br />
• Mobile Lösung für iOS und Android<br />
• Faires Preismodell<br />
• Artikel- und Vertragsdatenpflege<br />
durch unsere Spezialisten<br />
• Qualifizierter Support<br />
Steigern Sie mit unsereren<br />
Lösungen OTWin und<br />
OTWin Mobile die Qualität und<br />
Produktivität Ihrer Arbeit.<br />
Profitieren Sie von über 30 Jahren<br />
Branchen-Know-how durch die<br />
ein malige Firmenkonstellation<br />
Sanitätshaus und EDV-Entwicklung<br />
in einem Hause.<br />
ORTHOPÄDIE +<br />
REHA-TECHNIK<br />
MESSE LEIPZIG<br />
14.-17. MAI <strong>2024</strong><br />
HALLE 3<br />
STAND B06<br />
www.otedv.de<br />
OT > EDV | Bgm.-Smidt-Straße 36<br />
28195 Bremen | Fon: 04 21 / 79 262 40<br />
Fax: 04 21 / 79 262 50 | info@otedv.de
Prothetik<br />
tionen (n = 2) und ein Spätinfekt (n =<br />
1), die zur Resektion von mindestens<br />
einem AMI (n = 2) führten, und eine<br />
(n = 1) Nachamputation mit Konversion<br />
zu einer Knieexartikulation unter<br />
Erhalt und Transposition der AMIs I<br />
und II (s. Tab. 1).<br />
Umfänge<br />
Die im Rahmen der klinischen Untersuchung<br />
erhobenen Umfänge (in<br />
cm, hier exemplarisch für n = 1, transtibial<br />
rechts) zeigen bis zur Mobilisation<br />
einen zunehmenden Trend<br />
an allen Messpunkten in jewils 6 cm<br />
Abständen nach proximal und distal<br />
ab Kniebeugefalte. Nach Ausgabe<br />
der Interims prothese an Tag 166 nach<br />
Amputation (Anmerkung: Dies war<br />
eine sepsisassoziierte Amputation mit<br />
einer retrahierten Mobilisation aufgrund<br />
des initialen sepsisgeschwächten<br />
Allgemeinzustandes) reduziert<br />
sich der Umfang an drei von sieben<br />
Messpunkten. Gefolgt wird dies von<br />
einem Umfangs-Peak an sechs von<br />
sieben Messpunkten, der 70 Tage nach<br />
Mobilisation auf der Interimsprothese<br />
auf Umfangswert nahe direkt nach<br />
Amputation sistiert (Abb. 2a, b).<br />
Diskussion<br />
Die Konstruktion von AMIs konnte bei<br />
einer Vielzahl der Indikationen – von<br />
Trauma bis Diabetes-mellitus-assoziierten<br />
Amputationen – im Rahmen der<br />
primären Amputation im Beobachtungszeitraum<br />
durchgeführt werden.<br />
In 16 % (n = 3) der Fälle kam es zu einer<br />
Komplikation, die eine chirurgische<br />
Revision erforderte. In 5 % der Fälle<br />
(n = 1) war eine Nachamputation unter<br />
Verlust des Knies notwendig. Diese<br />
Komplikationen traten im Rahmen<br />
einer traumatischen Amputation aufgrund<br />
einer komplexen Extremitätenverletzung<br />
mit hohem Grad an Kontamination<br />
im Rahmen einer (sub-)totalen<br />
Amputation (n = 2) oder einer Amputation<br />
nach Spätversagen einer Extremitätenrekonstruktion<br />
mit chronischem<br />
Infekt auf. Beide Indikationen<br />
implizieren allein bereits ein hohes<br />
Risikoprofil für postoperative Revisionen.<br />
Überraschenderweise erlitt keine<br />
Amputation im Rahmen von Diabetes<br />
mellitus und seinen Folgen mit einer<br />
AMI-Versorgung eine Komplikation.<br />
Es konnte in der klinischen Untersuchung<br />
im Beobachtungszeitraum<br />
a.<br />
b.<br />
Copyright 2a Innovative Amputationsmedizin, Klinik<br />
für Unfallchirurgie Medizinische Hochschule Hannover<br />
c. d.<br />
Abb. 2a–d Messpunkte in Sechs-Zentimeter-Abständen ab der Kniebeugefalte<br />
nach jeweils distal und proximal (a). Umfänge eines exemplarischen transtibialen<br />
rechten Stumpfes an den Messpunkten im longitudinalen Verlauf nach der Amputation<br />
(b). Der Patient hat ein Mobilitätslevel (MOBIS) 3 erreicht. Die gepunktete Linie<br />
zeigt den Trend der Umfänge. Markiert ist ebenfalls der Zeitpunkt der Ausgabe der<br />
Interimsprothese an Tag 166 nach Amputation. Klinisches Foto eines transtibialen<br />
Amputationsstumpfes mit AMI I, II und harmonischer Weichteildeckung (c).<br />
Mit angelegten Elektroden zur Illustration der Lokalisation der Muskelbäuche nach<br />
Transposition und Ableitungsoption von EMG-Signalen der AMI-Muskeln zur zukünftigen<br />
Ansteuerung eines mechatronischen Sprunggelenks, oberes Elektrodenpaar AMI I,<br />
unteres Elektrodenpaar AMI II (d).<br />
keine Dislokation der AMIs objektiviert<br />
werden. Die AMI-Muskeln konnten<br />
reliabel von allen Patienten entsprechend<br />
ihrer Funktion angesteuert<br />
werden und führten zu einer palpablen<br />
und sichtbaren Kontraktion des<br />
entsprechenden Muskels am Amputationsstumpf,<br />
ohne dass der transponierte<br />
Muskel zu einer unkontrollierbaren<br />
Weichteilmasse („padding“)<br />
führte [3].<br />
Die im Rahmen der klinischen Untersuchung<br />
erhobenen Umfänge zeigen<br />
eine Zunahme mit einer Hypertrophie<br />
nach täglicher Mobilisation in<br />
der Interimsprothese, die dann leicht<br />
abnimmt und sich auf einem stabilen<br />
Niveau einpendelt. Insgesamt reduziert<br />
sich der Umfang in keinem<br />
Mess punkt im Beobachtungszeitraum<br />
von bis zu einem Jahr um mehr<br />
als 10 %. Dies ist deutlich weniger als<br />
Vergleichsmessungen von Stumpfvolumina<br />
und -umfängen nach Standardamputationen.<br />
In einem Review<br />
von Sanders und Fatone wird eine Volumenreduktionen<br />
von 17–35 % und<br />
eine Volumenstabilisierung 100 Tage<br />
nach Standardamputation dokumentiert<br />
[40].<br />
Dies wird in Abbildung 2 exemplarisch<br />
an einem rechten transtibialen<br />
Amputationsstumpf dargestellt. Trotz<br />
erwartet abnehmender postoperativer<br />
86<br />
ORTHOPÄDIE TECHNIK <strong>05</strong>/24
Prothetik<br />
Schwellung bis zur Mobilisation in der<br />
Prothese wurde keine Umfangsreduktion,<br />
sondern eine Zunahme gemessen.<br />
Dies kann auf die im ausgehändigten<br />
Bewegungsprotokoll instruierte<br />
gezielte Anspannung der AMI-Muskeln<br />
ab der sechsten postoperativen<br />
Woche zurückgeführt werden. Nach<br />
regelmäßigem Gehen in der Prothese,<br />
hier gekennzeichnet als Ausgabe<br />
der Interimsprothese an Tag 166 nach<br />
Amputation (Anmerkung: Dies war<br />
eine sepsisassoziierte Amputation mit<br />
einer retrahierten Mobilisation aufgrund<br />
des initial sepsisreduzierten Allgemeinzustandes),<br />
verringert sich der<br />
Umfang in den überwiegenden Messpunkten.<br />
Dies kann auf die effektive<br />
Kompression des Schaftes unter täglicher<br />
Mobilisation in Zusammenhang<br />
mit einem residuellem Ödem zurückzuführen<br />
sein. Gefolgt wird dies von<br />
einem Umfangs-Peak an sechs von<br />
sieben Messpunkten. 100 Tage nach<br />
Mobilisation stabilisieren sich die Umfänge<br />
auf einem Wert direkt nach Amputation.<br />
Der Peak nach Mobilisation<br />
könnte eine reaktive Hypertrophie der<br />
Muskulatur als Antwort auf die Mehrbelastung<br />
in der Prothese sein.<br />
Die longitudinale Analyse der gemittelten<br />
Umfänge zeigte einen Trend<br />
zur Umfangszunahme als unmittelbar<br />
messbaren Effekt in der Nachbeobachtung<br />
dieser neuen Amputationsmethode<br />
mit relevanten Auswirkungen<br />
für einen robusteren Stumpf<br />
(Abb. 2 a–d). Es bleibt abzuwarten, wie<br />
nachhaltig in Stabilität und Funktionalität<br />
die gleitenden AMI-Konstrukte<br />
an der ventralen Tibia sind.<br />
Neben einer im ausgehändigten<br />
Bewegungsprotokoll deutlich geringen<br />
Prävalenz von Phantom- und<br />
Neuromschmerzen (n = 1/13) in dieser<br />
analysierten Subgruppe im Vergleich<br />
zu Prävalenzen nach Standard-Amputation<br />
gaben alle Patienten ein ungestörtes<br />
Phantomgefühl der amputierten<br />
Ex tremität an. Eine detaillierte<br />
Analyse der Schmerzen war hier nicht<br />
Gegenstand des vorliegenden Artikels.<br />
In Zukunft könnte es interessant sein<br />
zu untersuchen, welchen Einfluss diese<br />
neue Operationsmethode auf das<br />
Embodiment hat. Weiterhin sollte<br />
systematisch untersucht werden, wie<br />
hoch die propriozeptive Fähigkeit ist,<br />
und ob dies möglicherweise klinisch<br />
relevante Auswirkungen auf Balance<br />
und Gehvermögen hat. Die insgesamt<br />
niedrige Prävalenz amputationsassoziierter<br />
Schmerzen könnte auch Folge<br />
des selektiven Nerventransfers (TMR,<br />
TSR, RPNI) sein.<br />
Die Kopplung der Agonisten und<br />
Antagonisten wurde bereits im letzten<br />
Jahrhundert zur direkten Kraftübertragung<br />
und verbesserten Armprothesensteuerung<br />
unter dem Begriff<br />
„Kine plastik“ beschrieben [41, 42].<br />
Wir haben wie unser Kollege in Boston<br />
(M. Carty, Brigham and Women’s<br />
Hospital, Harvard Medical School Boston)<br />
in Analogie zur transtibialen Amputation<br />
das AMI-Verfahren für transradiale<br />
Amputationen durchgeführt.<br />
Anders als bei der Kine plastik wird hier<br />
die Kopplung der Agonisten und Antagonisten<br />
nun nicht zur direkten Kraftübertragung<br />
wie bei der originären<br />
Kineplastik, wohl aber zur indirekten<br />
Kraftübertragung genutzt. Es konnten<br />
nach Ausheilung der Sehnennaht unmittelbar<br />
sechs bis zu acht Myo signale<br />
zur myoelektrischen Steuerung der<br />
Handprothese genutzt werden.<br />
Die transponierten und gekoppelten<br />
Muskeln der transtibialen AMIs<br />
sind unter Laborbedingungen bereits<br />
zur myoelektrischen Steuerung<br />
von mechatronischen Sprunggelenken<br />
eingesetzt worden. Die gezielte<br />
Transposition erlaubt eine reliable<br />
Ansteuerung unter Verwendung von<br />
Oberflächenelektroden [43]. Weitere<br />
sekundäre und tertiäre Einflüsse dieses<br />
sogenannten Closed-loop-Mechanismus<br />
von rekonstruierter Propriozeption<br />
(Sensorik) und Myosignalen<br />
(motorischer Kontrolle) könnten neue<br />
Versorgungsdimensionen für Unterschenkelamputierte<br />
bedeuten.<br />
Für die Autoren:<br />
Victor Hoursch<br />
Assistenzarzt in Weiterbildung<br />
Klinik für Unfallchirurgie<br />
Medizinische Hochschule Hannover<br />
Carl-Neuberg-Straße 1<br />
30625 Hannover<br />
Hoursch.Victor@mh-hannover.de<br />
Begutachteter Beitrag/reviewed paper<br />
Zitation: Hoursch V et al. Agonisten-Antagonisten-Myoneural-Interface (AMI) – eine neue<br />
Versorgungs dimension für den transtibialen Stumpf? Orthopädie Technik, <strong>2024</strong>; 75 (5): 82–88<br />
Seit 75 Jahren<br />
Partner der<br />
Betriebe<br />
Feiern Sie<br />
mit uns!<br />
Halle 3<br />
D20/E21<br />
Sie sind eingeladen.<br />
Holen Sie sich an unserem<br />
Messestand Ihre Geburtstagsüberraschung<br />
ab<br />
und profitieren Sie von<br />
unseren Geburtstagsangeboten.<br />
Wir freuen<br />
uns auf Sie.<br />
ORTHOPÄDIE TECHNIK <strong>05</strong>/24
Prothetik<br />
Literatur:<br />
[1] Spoden M, Nimptsch U, Mansky T. Amputation rates of the<br />
lower limb by amputation level – observational study using<br />
German national hospital discharge data from 20<strong>05</strong> to 2015.<br />
BMC Health Services Research, 2019; 19 (1): 8<br />
[2] Baumgartner R. Unterschenkelamputation. Operative<br />
Orthopädie und Traumatologie, 2011; 23 (4): 280–288<br />
[3] Souza JM, Wade SM, Harrington CJ, Potter BK. Functional<br />
Limb Restoration Through Amputation: Minimizing Pain and<br />
Optimizing Function With the Use of Advanced Amputation<br />
Techniques. Annals of Surgery, 2021; 273 (3): e108–e113<br />
[4] Burgess EM, Zettl JH. Amputations below the knee. Artificial<br />
Limbs, 1969; 13 (1): 1–12<br />
[5] Stahel PF, Oberholzer A, Morgan SJ, Heyde CE. Concepts<br />
of transtibial amputation: Burgess technique versus modified<br />
Brückner procedure. ANZ Journal of Surgery, 2006; 76 (10):<br />
942–946<br />
[6] Persson BM. Sagittal incision for below-knee amputation in<br />
ischaemic gangrene. Journal of Bone & Joint Surgery, 1974; 56<br />
(1): 110–114<br />
[7] Alter AH, Moshein J, Elconin KB, Cohen MJ. Below-knee<br />
amputation using the sagittal technique: a comparison with the<br />
coronal amputation. Clinical Orthopaedics, 1978; 131: 195–201<br />
[8] Tisi PV, Than MM. Type of incision for below knee amputation.<br />
Cochrane Database of Systematic Reviews, 2014; 4:<br />
CD003749<br />
[9] Bowker J. Minor and Major Lower-Limb Amputations and<br />
Disarticulations in Patients with Diabetes Mellitus. Levin and<br />
O‘Neal‘s The Diabetic Foot, 2008; 403–428<br />
[10] Morris CD, Potter BK, Athanasian EA, Lewis VO. Extremity<br />
amputations: principles, techniques, and recent advances. Instructional<br />
course lectures, 2015; 64: 1<strong>05</strong>–117<br />
[11] Schrock Jr RD, Zettl JH, Burgess EM, Romano RL. A preliminary<br />
report of basic studies from Prosthetics Research Study.<br />
Bulletin of prosthetics research, 1968; 10: 90–1<strong>05</strong><br />
[12] Pino AE, Taghva S, Chapman C, Bowker JH. Lower-limb<br />
amputations in patients with diabetes mellitus, Orthopedics,<br />
2011; 34 (12): e885–e892<br />
[13] Greitemann B, Brückner L, Schäfer M, Baumgartner R. Amputation<br />
und Prothesenversorgung, Indikationsstellung – operative<br />
Technik – Nachbehandlung – Funktionstraining. Stuttgart:<br />
Thieme, 2016<br />
[14] Kragh JF et al. Suturing of lacerations of skeletal muscle.<br />
Journal of Bone & Joint Surgery, 20<strong>05</strong>; 87 (9): 1303–13<strong>05</strong><br />
[15] Ponce BA et al. A biomechanical analysis of controllable<br />
intraoperative variables affecting the strength of rotator cuff repairs<br />
at the suture-tendon interface. American Journal of Sports<br />
Medicine, 2013; 41 (10): 2256–2261<br />
[16] Pascale B, Potter B. Residual Limb Complications and Management<br />
Strategies. Current Physical Medicine and Rehabilitation<br />
Reports, 2014; 2: 241–249<br />
[17] Tintle SM et al. Reoperation after combat-related major<br />
lower extremity amputations. Journal of Orthopaedic Trauma,<br />
2014; 28 (4): 232–237<br />
[18] Gottschalk F. Transfemoral amputation. Biomechanics and<br />
surgery. Clinical Orthopaedics and Related Research, 1999; 361:<br />
15–22<br />
[19] Geertzen JHB et al. Myodesis or myoplasty in trans-femoral<br />
amputations. What is the best option? An explorative study.<br />
Medical Hypotheses, 2019; 124: 7–12<br />
[20] Warren R. Early Rehabilitation of the Elderly Lower Extremity<br />
Amputee. Surgical Clinics of North America, 1968; 48 (4):<br />
807–816<br />
[21] Tuthill JC, Azim E. Proprioception. Current Biology, 2018;<br />
28 (5): R194–R203<br />
[22] Proske U, Gandevia SC. The proprioceptive senses: their roles<br />
in signaling body shape, body position and movement, and<br />
muscle force. Physiological Reviews, 2012; 92 (4): 1651–1697<br />
[23] Edin BB, Johansson N. Skin strain patterns provide kinaesthetic<br />
information to the human central nervous system.<br />
Journal of Physiology, 1995; 487 (1): 243–251<br />
[24] Day J et al. Muscle spindles in human tibialis anterior encode<br />
muscle fascicle length changes. Journal of Neurophysiology,<br />
2017; 117 (4): 1489–1498<br />
[25] Vanicek N, Strike S, McNaughton L, Polman R. Postural<br />
responses to dynamic perturbations in amputee fallers versus<br />
nonfallers: a comparative study with able-bodied subjects. Archives<br />
of Physical Medicine and Rehabilitation, 2009; 90 (6):<br />
1018–1025<br />
[26] Beurskens R, Wilken JM, Dingwell JB. Dynamic Stability of<br />
Individuals with Transtibial Amputation Walking in Destabilizing<br />
Environments. Journal of Biomechanics, 2014; 47 (7):<br />
1675–1681<br />
[27] Metzger AJ et al. Feedforward control strategies of subjects<br />
with transradial amputation in planar reaching. Journal of Rehabilitation<br />
Research and Development, 2010; 47 (3): 201–211<br />
[28] Shell CE et al. Lower-Limb Amputees Adjust Quiet Stance<br />
in Response to Manipulations of Plantar Sensation. Frontiers in<br />
Neuroscience, 2021; 15: 611926<br />
[29] Petrini FM et al. Enhancing functional abilities and cognitive<br />
integration of the lower limb prosthesis. Science Translational<br />
Medicine, 2019; 512 (11): eaav8939<br />
[30] Clites TR et al. The Ewing Amputation: The First Human<br />
Implementation of the Agonist-Antagonist Myoneural Interface.<br />
Plastic and Reconstructive Surgery—Global Open, 2018; 6<br />
(11): e1997<br />
[31] Sullivan C et al. Clinical, Functional, and Sensorial Outcomes<br />
of the Agonist-Antagonist Myoneural Interface (AMI)<br />
Ewing Amputation. Plastic and Reconstructive Surgery—Global<br />
Open, 2023; 11 (10S): 124<br />
[32] Chiao RB et al. Patient Reported Outcome Measures<br />
(PROMs) Amongst Lower Extremity Agonist–Antagonist Myoneural<br />
Interface (AMI) Amputees. Applied Sciences, 2023; 13<br />
(18): 1<strong>05</strong>08<br />
[33] Berger L et al. The Ewing Amputation: Operative technique<br />
and perioperative care. Orthoplastic Surgery, 2023; 13: 1–9<br />
[34] Gardetto A et al. Reduction of Phantom Limb Pain and<br />
Improved Proprioception through a TSR-Based Surgical Technique:<br />
A Case Series of Four Patients with Lower Limb Amputation.<br />
Journal of Clinical Medicine, 2021; 10 (17): 4029<br />
[35] Dumanian GA et al. Targeted Muscle Reinnervation Treats<br />
Neuroma and Phantom Pain in Major Limb Amputees: A Randomized<br />
Clinical Trial. Annals of Surgery, 2019; 270 (2): 238–<br />
246<br />
[36] Valerio IL et al. Preemptive Treatment of Phantom and Residual<br />
Limb Pain with Targeted Muscle Reinnervation at the<br />
Time of Major Limb Amputation. Journal of the American College<br />
of Surgeons, 2019; 228 (3): 217–226<br />
[37] Woo SL et al. Regenerative Peripheral Nerve Interfaces for<br />
the Treatment of Postamputation Neuroma Pain: A Pilot Study.<br />
Plastic and Reconstructive Surgery—Global Open, 2016; 4 (12):<br />
e1038<br />
[38] Mauch JT, Kao DS, Friedly JL, Liu Y. Targeted muscle reinnervation<br />
and regenerative peripheral nerve interfaces for pain<br />
prophylaxis and treatment: A systematic review. Journal of Plastic,<br />
Reconstructive & Aesthetic Surgery, 2023; 75 (3): 948–959<br />
[39] de Lange JWD et al. Prevention is better than cure: Surgical<br />
methods for neuropathic pain prevention following amputation<br />
– A systematic review. Journal of Plastic, Reconstructive &<br />
Aesthetic Surgery, 2022; 75 (3): 948–959<br />
[40] Sanders JE, Fatone S. Residual limb volume change: systematic<br />
review of measurement and management. Journal of Rehabilitation<br />
Research and Development, 2011; 48 (8): 949–986<br />
[41] G. Vanghetti, Vitalizzazione delle membra artificiali: teoria<br />
e casistica dei motori plastici (chirurgia cinematica per protesi<br />
cinematica); con 137 illustrazioni. U. Hoepli, 1916<br />
[42] Sauerbruch F. Chirurgische Vorarbeit für „Die willkürlich<br />
bewegbare künstliche Hand“. Medizinische Klinik, 1915; 11:<br />
1125–1126<br />
[43] Srinivasan SS et al. Neural interfacing architecture enables<br />
enhanced motor control and residual limb functionality postamputation.<br />
Proceedings of the National Academy of Sciences of the<br />
United States of America, 2021; 118 (9) : e2019555118<br />
88<br />
ORTHOPÄDIE TECHNIK <strong>05</strong>/24
Photo: AdobeStock: dimdimich<br />
LEIPZIG<br />
WENN NICHT JETZT,<br />
WANN DANN?<br />
SCHNELL NOCH<br />
TICKETS SICHERN!<br />
Die Weltleitmesse mit täglichen<br />
praxisorientierten Workshops,<br />
Austausch auf Augenhöhe und<br />
Ausstellern mit Neuheiten und Trends.<br />
Nicht verpassen:<br />
Workshops zur<br />
Lymph-Versorgung<br />
Internationale Fachmesse und Weltkongress<br />
14. – 17. Mai <strong>2024</strong><br />
Leipziger Messe<br />
www.ot-world.com<br />
Partnerland<br />
Frankreich
Prothetik<br />
M. Schäfer, T. Wetzelsperger, S. Kunz, E. Laassidi, M. Hehmann,<br />
K. Laassidi<br />
FIRST – eine neuartige<br />
Konzeptprothese für die frühe<br />
Versorgung von Kindern mit<br />
angeborenen Fehlbildungen an<br />
den oberen Extremitäten<br />
FIRST – a Novel Concept Prosthesis for the Early Care of Children<br />
with Congenital Malformations of the Upper Extremities<br />
Die prothetische Versorgung der<br />
kindlichen oberen Extremität ist in<br />
den seltensten Fällen auf einen klassischen<br />
Amputationshintergrund<br />
zurückzuführen. Zwar treten auch<br />
hier traumatisch bedingte Amputationen<br />
wie z. B. in Folge landwirtschaftlicher<br />
oder verkehrsbedingter<br />
Unfälle oder Amputationen nach<br />
Tumorerkrankungen auf, den dominanten<br />
Anteil der Versorgungsindikationen<br />
an der kindlichen oberen<br />
Extremität nehmen jedoch jene Fälle<br />
ein, in denen Kindern aufgrund angeborener<br />
Fehlbildungen Finger, die<br />
Hand, der Unterarm oder sogar der<br />
ganze Arm fehlt. Nicht selten kommt<br />
es im Zuge von ersten prothetischen<br />
Versorgungen zu einem ablehnenden<br />
Verhalten der Kinder. Dieses ist<br />
einerseits auf den Umstand zurückzuführen,<br />
dass bei diesem Krankheitsbild<br />
der Körper von Geburt an<br />
kortikal so angelegt ist, wie er ist,<br />
und die Kinder eine fehlende Hand<br />
nicht vermissen, zum anderen wurde<br />
der erstprothetischen Versorgung<br />
von Kindern mit angeborenen<br />
Fehlbildungen keine ausreichende<br />
Aufmerksamkeit im Hinblick auf die<br />
regelhafte motorische Entwicklung<br />
eines Kindes zuteil. Die bis dato zumeist<br />
zum Einsatz kommenden passiven<br />
Erstprothesenversorgungen –<br />
früher Patschhände genannt – bieten<br />
keine wirklich spürbare und effiziente<br />
Unterstützung und somit<br />
auch keinen tatsächlichen Mehrwert<br />
in dieser frühen Versorgungsphase<br />
des kindlichen Alltages. Basierend<br />
auf dieser Erkenntnis wurde ein neuartiges<br />
System zur erstprothetischen<br />
Versorgung von Kindern mit angeborenen<br />
Fehlbildungen entwickelt.<br />
Das hier vorgestellte neuartige<br />
Prothesenkonzept FIRST setzt genau<br />
an den geschilderten Problemen und<br />
den daraus gewonnenen Erfahrungen<br />
und Erkenntnissen an. Über eine<br />
spielerische Gestaltung dieser Konzeptprothese,<br />
orientiert an der motorischen<br />
Entwicklung in der frühkindlichen<br />
Phase, ausgeführt im bunten<br />
3D-Druck-Design und angereichert<br />
mit verschiedenen Werkzeugen für<br />
den Einsatz im frühkindlichen Alltag,<br />
versucht die FIRST-Prothese die Aufmerksamkeit<br />
des Kindes zu wecken<br />
und den Charakter eines Alltagbegleiters<br />
im Leben abzubilden.<br />
Schlüsselwörter: Dysmelie, Kinder,<br />
FIRST, Armprothese, 3D-Druck, Entwicklungsmotorik<br />
The prosthetic treatment of the<br />
child‘s upper extremity is rarely due<br />
to a classic amputation background.<br />
Although traumatically-related amputations<br />
also occur here, such as a<br />
result of agricultural or traffic- related<br />
accidents or amputations after tumor<br />
diseases, the main indications for<br />
care of children‘s upper extremities<br />
are those cases in which children<br />
have malformated fingers, hands,<br />
etc. due to congenital malformations<br />
in the Forearm or even the entire<br />
arm. It is not uncommon for children<br />
to behave negatively during the first<br />
prosthetic fittings. On the one hand,<br />
this is due to the fact that in this<br />
clinical picture the body is cortically<br />
designed the way it is from birth and<br />
the children do not miss a missing<br />
hand, and on the other hand, the<br />
initial prosthetic care of children<br />
with congenital malformations has<br />
not received sufficient attention<br />
the regular motor development of a<br />
child. The passive initial prosthetics<br />
that have mostly been used to date<br />
– previously called patty hands – do<br />
not offer any really noticeable and<br />
efficient support and therefore no<br />
actual added value in this early care<br />
phase of the child‘s everyday life.<br />
Based on this knowledge, a novel<br />
system was developed for the initial<br />
prosthetic care of children with congenital<br />
malformations.<br />
The novel FIRST prosthetic concept<br />
presented here addresses exactly<br />
the problems described and<br />
the experiences and insights gained<br />
from it. Through a playful design<br />
of this concept prosthesis, oriented<br />
towards motor development in the<br />
early childhood phase, executed in<br />
a colorful 3D printed design and enriched<br />
with various tools for use in<br />
everyday life in early childhood, the<br />
FIRST prosthesis attempts to arouse<br />
the child‘s attention and character of<br />
an everyday companion in life.<br />
Key words: Congenital Malformations,<br />
Children, FIRST, Upper Extremity<br />
Prosthetics, 3D-Print, Developmental<br />
Motor Skills<br />
90<br />
ORTHOPÄDIE TECHNIK <strong>05</strong>/24
Prothetik<br />
Einleitung<br />
Die Inzidenz von angeborenen Fehlbildungen<br />
an den oberen Extremitäten<br />
kann leider nicht in einem internationalen<br />
Zusammenhang angegeben<br />
werden, weil diese nur in vereinzelten<br />
Ländern und nicht durchgängig<br />
erhoben wird. Insofern stützt man<br />
sich in der Aussage auf die konkreten<br />
Zahlen dieser Erhebungen. Demnach<br />
kommen angeborene Fehlbildungen<br />
an den oberen Extremitäten bei ca. 1<br />
von 2800 Geburten vor [1, 2]. Je nach<br />
Ausprägungsform können individuelle<br />
Hilfsmittel wie Prothesen oder individuell<br />
angepasste Alltagshilfen funktionelle<br />
Defizite ausgleichen und die<br />
Optik und/oder Funktion der versorgten<br />
Extremität an das physiologische<br />
Vorbild annähern.<br />
Schon früh versuchte man, die Kinder<br />
mit passiven Prothesen ab einem<br />
Alter von ca. 6 Monaten an die Verwendung<br />
von externen Hilfsmitteln<br />
zu gewöhnen, um die motorische und<br />
neuronale Entwicklung im Kindesalter<br />
hin zu einer bimanuellen Interaktion<br />
im Alltag zu fördern [3]. Die<br />
erfolgreiche Anwendung eines solchen<br />
Körperersatzes verlangt jedoch<br />
vom Kind eine gezielte Koordination<br />
der eingeschränkten Freiheitsgrade<br />
mit oft notwendigen Ausgleichsbewegungen<br />
erschwerend zum fehlenden<br />
taktilen Feedback der Prothese. Zusätzlich<br />
empfinden Kinder mit kongenitalen<br />
Fehlbildungen an der oberen<br />
Extremität ihre gesundheitliche Lebensqualität<br />
in vielen Fällen als kaum<br />
herabgesetzt im Vergleich zu gesunden<br />
Kindern [4].<br />
Dabei spielen auch klinische Faktoren,<br />
wie z. B. die noch vorhandene<br />
Länge des fehlgebildeten Ärmchens,<br />
eine nicht zu unterschätzende Rolle,<br />
da vor allem die längeren distalen<br />
Stumpfvarianten gute bimanuelle<br />
Kompensationen erfüllen können<br />
und von den Kindern auch entsprechend<br />
erfolgreich eingesetzt werden<br />
[5]. Auch existierende Handgelenke<br />
oder Pseudo-Handgelenke, deren distaler<br />
Part nur weichteilig-muskulär<br />
dargestellt ist, können den funktionalen<br />
Einsatz des fehlgebildeten Ärmchens<br />
funktionell bereichern [6]. Zu<br />
respektieren ist auch, dass sich Eltern<br />
von Kindern mit angeborenen Fehlbildungen<br />
gegen eine prothetische<br />
Versorgung für ihr Kind entscheiden<br />
können.<br />
Die Summe der situativen und klinischen<br />
Erkenntnisse vereinfacht die<br />
Empfehlung zum Start einer möglichen<br />
Hilfsmittelversorgung nicht<br />
maßgeblich. In der Literatur existieren<br />
viele unterschiedliche Erkenntnisse,<br />
die auf einen Versorgungsstart<br />
zwischen dem 2. Lebensmonat und<br />
dem 2. Lebensjahr als möglichen<br />
Startzeitpunkt für eine prothetische<br />
Versorgung hinweisen [7]. Studien<br />
mit kindlichen Patientenkollektiven<br />
zeigen auch länderspezifische Unterschiede<br />
zum Versorgungsstart sowie<br />
der Art der ersten Prothesenversorgung<br />
[8, 9].<br />
Letztendlich kann man konstatieren,<br />
dass in eine Entscheidung zum<br />
Zeitpunkt der ersten prothetischen<br />
Versorgung mehrere Kriterien einfließen.<br />
Neben dem persönlichen Umfeld<br />
des Kindes sowie der kognitiven<br />
Entwicklung fließen auch die klinischen<br />
Voraussetzungen der Extremität<br />
mit ein. Die Art des angebotenen<br />
Hilfsmittels, die Auswahl der zur Verfügung<br />
stehenden Technologien sowie<br />
die Unterstützung beim Erlernen<br />
des Anwendens nehmen einen nicht<br />
zu unterschätzenden Einfluss auf den<br />
Versorgungserfolg.<br />
In Nordamerika wurde zu Beginn<br />
des Jahrtausends im Rahmen einer<br />
Umfrage von 56 % der befragten Kliniken<br />
rückgemeldet, dass sie den Start<br />
der prothetischen Versorgung im Alter<br />
von 6 Monaten – zunächst mit passiven<br />
und Eigenkraft-gesteuerten Prothesenvarianten<br />
– präferieren, die Versorgung<br />
mit einer myoelek trischen<br />
Prothese aber schon oft vor einer Beendigung<br />
des 1. Lebensjahres zum<br />
Einsatz kommt. Das selbstständige<br />
Sitzen des Kindes, das normalerweise<br />
zwischen dem 6. und 10. Lebensmonat<br />
erlernt wird, wurde im Kontext<br />
zur Prothesenversorgung von einigen<br />
Kliniken als Voraussetzung zum Versorgungsstart<br />
benannt. Einen konkreten<br />
entwicklungsneurologischen<br />
Bezug kann man aus dieser Forderung<br />
jedoch nicht ableiten [7].<br />
Erkenntnisse aus der prothetischen<br />
Versorgung<br />
der oberen Extremität im<br />
Kindesalter<br />
Prothesenversorgungen im Bereich<br />
der oberen Extremitäten können eine<br />
wichtige Rolle im Leben von Kindern<br />
einnehmen. Dabei sind jene Kinder<br />
mit tatsächlich durchgeführten Amputationen<br />
deutlich in der Minderheit<br />
und werden in den meisten Fällen<br />
eher in den distal gelegenen Amputationsniveaus<br />
der Hand und des Unterarmes<br />
prothetisch versorgt [1, 2, 8].<br />
In der Nachversorgung amputierter<br />
Kinder steht die prothetische Versorgung<br />
nicht zur Diskussion, da sie in<br />
diesen Fällen die wichtige Herausforderung<br />
einer bestmöglichen körperlichen<br />
und funktionalen Wiederherstellung<br />
der zuvor vorhandenen und<br />
kortikal angelegten Hand einnimmt.<br />
Studien hierzu belegen neben positiven<br />
psychologischen Effekten auch<br />
den wertvollen Beitrag von Prothesen<br />
sowohl zur Minderung der kortikalen<br />
Reorganisation wie auch des Phantomschmerzes<br />
[9, 10].<br />
Leider sind die höheren Gelenkniveaus<br />
wie das Ellenbogen- und<br />
Schultergelenk in der prothetischen<br />
Abb. 1 Individuell angepasste Alltagshilfen für Kinder mit angeborenen Fehlbildungen.<br />
Fotos: Pohlig GmbH<br />
ORTHOPÄDIE TECHNIK <strong>05</strong>/24<br />
91
Prothetik<br />
Fotos: Pohlig GmbH<br />
Passteilauswahl nur sehr gering und<br />
funktionell ungenügend repräsentiert.<br />
Dagegen fordert die indikative<br />
Weichenstellung zur prothetischen<br />
Versorgung bei Kindern mit angeborenen<br />
Fehlbildungen ein deutlich differenzierteres<br />
Vorgehen. Die Kinder<br />
vermissen die fehlenden Anteile der<br />
oberen Extremität nicht, weil diese<br />
bereits seit der Geburt körperlich so<br />
angelegt sind. Geringgradige Ausprägungen<br />
mit Fehlbildungen an den<br />
Fingern und der Hand können oftmals<br />
gut und ohne größere Einbußen<br />
im Lebensalltag kompensiert werden.<br />
Sobald jedoch die Greif- und Haltefunktion<br />
der Hand eingeschränkt ist,<br />
hat dies auch Auswirkungen auf den<br />
Lebensalltag. Oftmals können spezifische<br />
Funktionalitäten für gewisse<br />
Tätigkeiten wie z. B. Essen, Schreiben,<br />
Greifen, Halten, Lenken und Bedienen<br />
von Alltagsgegenständen durch<br />
individuell angepasste Alltagshilfen<br />
kompensiert werden (Abb. 1). Ist das<br />
Defektvolumen jedoch größeren Ausmaßes,<br />
hierzu zählt bereits das Fehlen<br />
der Hand, dann sollte auf jeden Fall<br />
der unmittelbare Behinderungsausgleich<br />
durch eine Prothese in die indikative<br />
Auswahl einbezogen werden<br />
(Abb. 2).<br />
Kinder mit transversalen Reduktionsdefekten<br />
im Bereich des Unterarmes<br />
stellen in der oberen Extremität<br />
das größte Kollektiv dar, das für eine<br />
Prothesenversorgung in Frage kommt<br />
[11]. Mit zunehmendem Längendefizit<br />
fällt es den Kindern mit angeborenen<br />
Fehlbildungen an den oberen Extremitäten<br />
schwer, die fehlende Armlänge<br />
zu kompensieren und Alltagsaktivitäten<br />
vollumfänglich ausführen zu<br />
können, wobei diese Defizite mit zunehmendem<br />
Alter auch verstärkt negative<br />
Auswirkungen auf die motorische<br />
Entwicklung haben können [12].<br />
Die Art der zum Einsatz kommenden<br />
Prothesenversorgung hängt sowohl<br />
vom Alter und der kognitiven<br />
Entwicklung des Kindes als auch von<br />
den Erstattungsrichtlinien des jeweiligen<br />
Gesundheitssystems eines Landes<br />
ab. So werden z. B. in den USA passive<br />
und Eigenkraft-gesteuerte Prothesensysteme<br />
im Rahmen der erstprothetischen<br />
Versorgung eingesetzt,<br />
gefolgt von myoelektrischen Prothesen,<br />
wohingegen im europäischen<br />
Raum die passiven Prothesensysteme<br />
zur Erstversorgung, gefolgt von den<br />
myoelektrischen Systemen dominieren<br />
[13].<br />
Für die Prothesenversorgung stehen<br />
demnach unterschiedliche technische<br />
Möglichkeiten zur Verfügung,<br />
die je nach Anwendung sowohl eine<br />
funktionelle Unterstützung als auch<br />
einen optischen Ausgleich leisten<br />
können (Abb. 3). James beschreibt<br />
2010, dass die meisten Kinder mit einer<br />
Fehlbildung im Unterarm eine nahezu<br />
normale Funktionalität und Lebensqualität<br />
erreichen können [14].<br />
Passive Prothesen bieten dabei eine<br />
Unterstützung in der sozialen Akzeptanz<br />
der Gesellschaft und der körperlichen<br />
Wiederherstellung. Prothesen<br />
mit funktionalen Werkzeugen können<br />
den Kindern im besten Fall eine<br />
Funktionserweiterung ermöglichen.<br />
Sie stellt jedoch auch fest, dass viele<br />
Kinder mit einer einseitigen angeborenen<br />
Fehlbildung im Unterarm das<br />
Abb. 2 Angeborene Reduktionsdefekte an der kindlichen oberen Extremität.<br />
Abb. 3 Wiederherstellung der Körperform<br />
mit Silikon-Handprothese.<br />
Tragen einer Prothese ablehnen, weil<br />
ihnen die zur Verfügung stehenden<br />
Prothesen zu wenig funktionale Zugewinne<br />
im Alltag bieten.<br />
Gestützt wird diese Aussage von<br />
einer Metaanalyse zur Ablehnungsquote<br />
von Prothesen für die obere<br />
Extremität. Diese zeigt, dass ca. 45 %<br />
der Kinder Eigenkraft-gesteuerte und<br />
35 % der Kinder myoelektrische Versorgungen<br />
ablehnen, bei erwachsenen<br />
Anwendern konnte im Vergleich<br />
eine niedrigere Ablehnung mit jeweils<br />
26 % und 23 % festgestellt werden [15].<br />
Dennoch verfügen Kinder mit kongenitalen<br />
Fehlbildungen an den oberen<br />
Extremitäten über motorische<br />
Einschränkungen, die sich tendenziell<br />
mit zunehmendem Alter weiter<br />
verstärken und im schlimmsten Fall<br />
zu Überlastungsschäden führen können<br />
[16–18]. Das unterstreicht die<br />
Komplexität und Vielfältigkeit der<br />
zu beachtenden Faktoren, die in ein<br />
adäquates Prothesenkonzept für die<br />
obere Extremität bei Kindern einfließen<br />
sollten, damit die notwendigen<br />
Vorteile erreicht werden und das<br />
Hilfsmittel im Alltag auch zur erfolgreichen<br />
Anwendung kommt und getragen<br />
wird.<br />
Mit dieser Erkenntnis wird jedoch<br />
auch der Aufruf an Prothetiker und<br />
Entwickler adressiert, zukünftig Prothesen<br />
zu entwickeln, die eine verbesserte<br />
Teilhabe ermöglichen.<br />
Die Niederländer Postema et al.<br />
konnte in einer crosssektionalen Studie<br />
mit 32 Kindern unter Befragung<br />
Fotos: Pohlig GmbH<br />
92<br />
ORTHOPÄDIE TECHNIK <strong>05</strong>/24
der Kinder sowie deren Eltern ermitteln,<br />
dass die Ablehnungsquote bei etwas<br />
mehr als einem Drittel aller Kinder<br />
(34 %) lag [19]. Dabei wurde festgestellt,<br />
dass ein Erstversorgungszeitpunkt<br />
nach dem 2. Lebensjahr, ein<br />
mangelnder funktionaler Nutzen in<br />
der Anwendung der Prothese sowie<br />
die Phase der Pubertät zu einer erhöhten<br />
Ablehnungsquote führt.<br />
Gestützt werden diese Erkenntnisse<br />
durch eine umfangreiche Multicenter-Studie<br />
von Mitarbeitern der<br />
Shriner-Kinderkliniken in Kalifornien<br />
von 2007 [20]. 489 Patienten im Alter<br />
zwischen 2 und 20 Jahren, die eine<br />
einseitige transversale Fehlbildung<br />
am Unterarm hatten, wurden darin<br />
zur Zufriedenheit mit ihrer prothetischen<br />
Versorgung, der Lebensqualität<br />
sowie zur funktionsgebenden Bereicherung<br />
ihres Alltages durch Prothesen<br />
befragt. Auch hier haben 34 % der<br />
Befragten die Versorgung mit einer<br />
Prothese abgelehnt und gaben dafür<br />
im Wesentlichen die fehlende Funktion,<br />
den fehlenden Tragekomfort,<br />
ein mangelhaftes Aussehen oder eine<br />
schlechte Passform an.<br />
Egermann et al. kommen in einer<br />
Studie mit 41 Kindern mit Fehlbildungen<br />
im Unterarm, alle zwischen dem<br />
2. und 5. Lebensjahr und versorgt mit<br />
myoelektrischen Kinderprothesen, zu<br />
der Erkenntnis, dass die Kinder unterschiedliche<br />
Prothesenfunktionen für<br />
ihren Alltag wünschen und aufgrund<br />
dessen auch ein Bezug zwischen der<br />
Variabilität und der Akzeptanz der<br />
Prothesenversorgung besteht [21].<br />
Dies geht mit den Untersuchungsergebnissen<br />
von Bagley et. al. einher,<br />
dass die Lebensqualität bei Kindern<br />
mit angeborenen Fehlbildungen an<br />
den oberen Extremitäten nahezu normal<br />
ist, sie jedoch für spezifische Alltagssituationen<br />
und Aktivitäten Unterstützung<br />
benötigen [20].<br />
In Schweden wurde ebenfalls eine<br />
Umfrage (DISABKIDS-Questionnaire)<br />
zur gesundheitsbezogenen Lebensqualität<br />
von 140 Kindern und Jugendlichen<br />
mit angeborener Reduktions-<br />
Fehlbildung im Alter von 8–16 Jahren<br />
durchgeführt [22]. Die Ergebnisse zeigen,<br />
dass Kinder und Jugendliche mit<br />
angeborenen Extremitäten-Fehlbildungen<br />
eine deutlich höhere Lebensqualität<br />
erzielen als Kinder mit anderen<br />
chronischen Erkrankungen. Dies<br />
bestätigen auch Ergebnisse früherer<br />
Studien [4].<br />
Prothetik<br />
Während Fischer und Könz [23] im<br />
Rahmen ihrer ergotherapeutischen<br />
Bachelor-Arbeit zu der Schlussfolgerung<br />
gelangen, dass multifunktionelle<br />
Prothesen, welche darauf abzielen,<br />
jegliche Fähigkeiten einer Hand zu<br />
ersetzen, nicht realisierbar sind, stellten<br />
Peterson und Prigge in ihren Ausführungen<br />
ein Protokoll für eine erfolgreiche<br />
frühe Prothesenanpassung<br />
mit myoelektrischer Armprothese<br />
vor [24]. Unter Berücksichtigung der<br />
neurologischen Entwicklung werden<br />
hier die motorischen Fähigkeiten der<br />
Greifentwicklung und die bimanuellen<br />
Fähigkeiten des heranwachsenden<br />
Kindes in Kontext zur kognitiven<br />
Entwicklung gesetzt. Basierend auf<br />
Erkenntnissen in der Hirnforschung,<br />
die in Untersuchungen von einer positiven<br />
Rückkopplung des funktionsunterstützenden<br />
Tragens einer Armprothese<br />
auf die Hirnaktivität [25]<br />
berichten, wird in dieser Auseinandersetzung<br />
auch der frühzeitige Einsatz<br />
eines aktiv greifenden myoelektrischen<br />
Prothesensystems als wichtig<br />
erachtet. Nach Erfahrung der Autoren<br />
sind Kinder im Alter von 12 Monaten<br />
bereits in der Lage, ein myoelektrisches<br />
System zu kontrollieren, während<br />
das Bedienen Eigenkraft-gesteuerter<br />
Prothesen erst zu einem deutlich<br />
späteren Zeitpunkt realisiert werden<br />
kann. Die auf diese Aussage hin kritische<br />
Auseinandersetzung mit dem<br />
Sachverhalt [26], inwieweit die Versorgung<br />
mit einer Prothese, insbesondere<br />
mit einer Prothese mit einer aktiven<br />
Greiffunktion positive Auswirkungen<br />
auf die Entwicklung des Gehirns hat,<br />
ist spannend und muss sicherlich in<br />
einem weiterführenden interdisziplinären<br />
Dialog mit Entwicklungsneurologen<br />
fortgesetzt werden.<br />
Die jüngsten Arbeiten von Battraw<br />
et al. [27] stellen die grundsätzliche<br />
These auf, dass die psychosoziale und<br />
funktionelle Verbesserung, die das<br />
Kind durch eine entsprechend gestaltete<br />
Prothese erfährt, entscheidend<br />
für die Akzeptanz und das Tragen der<br />
Prothese sind. Dabei sollten die Prothesen<br />
stets so gestaltet werden, dass<br />
die Fehlbildung Peergroup-verträglich<br />
ist und das Kind unter Gleichaltrigen<br />
keinem zusätzlichen Stigma<br />
ausgesetzt ist.<br />
Herausforderungen, die an ein modernes<br />
und erfolgreiches Kinderprothesensystem<br />
zu stellen sind, werden<br />
in dieser Arbeit begründet, hergeleitet<br />
So wird ein<br />
Schuh draus!<br />
Der 3D-gedruckte Leisten<br />
Der schnellste Weg zu Ihrem<br />
Maßleisten führt über Dreve!<br />
Die digitale Fertigung auf unseren<br />
Hochleistungs-Druckanlagen<br />
ermöglicht durchgehend Industriestandard<br />
in Bezug auf Präzision,<br />
Bauvolumen, Material und Prozessflexibilität.<br />
Highlights<br />
• Extra kurze Lieferzeit<br />
• Jederzeit reproduzierbar<br />
• Absolut präzise und<br />
passgenau<br />
• Energie- und<br />
ressourcenschonend<br />
• Sehr stabil und in alle<br />
Richtungen belastbar<br />
OTWORLD – Wir sind dabei<br />
Halle 1, Stand G34<br />
ortho.dreve.de<br />
ORTHOPÄDIE TECHNIK <strong>05</strong>/24
Prothetik<br />
Foto: Pohlig GmbH<br />
und zusammenfassend wie folgt formuliert:<br />
– Die Prothese soll die altersgerechten<br />
Alltagsaktivitäten unterstützen<br />
und ein kindgerechtes Aussehen<br />
haben.<br />
– Der Einstieg in die Prothesenversorgung<br />
soll für das Kind leicht gemacht<br />
werden, schnelle Erfolge in<br />
der Umsetzung sind wichtig.<br />
– Die Prothese sollte möglichst<br />
leichtgewichtig sein.<br />
– Die Prothese soll gerade für Kinder<br />
robust sowie wasser- und schmutzresistent<br />
sein.<br />
Entwicklung des konzeptionellen<br />
Ansatzes<br />
„Die FIRST-Prothese“<br />
Die zuvor aus der Literatur geschilderten<br />
Erkenntnisse und Erfahrungen<br />
können durch viele Versorgungen<br />
bestätigt werden. Die Tatsache, dass<br />
passive Erstprothesen, früher auch<br />
aufgrund der zum Fäustling geschlossenen<br />
Kinderhandvariante „Patschhand“<br />
genannt, von vielen Kinder mit<br />
angeborenen Fehlbildungen nicht<br />
angenommen wurden, hat mehrere<br />
Gründe. Ergänzend zu den Erkenntnissen<br />
von Battraw et al. [27] bieten<br />
sie neben der mangelnden Sensibilität<br />
und Feinmotorik [28] im Alltag eines<br />
heranwachsenden Kindes zu wenig<br />
funktionelle Unterstützungsmöglichkeiten,<br />
erzielen wenig Aufmerksamkeit<br />
und Akzeptanz beim Kind [29]<br />
und der Umwelt und werden oftmals<br />
eher als lästig empfunden.<br />
Diese Herausforderung aufgreifend,<br />
hat man sich 2017 in einem<br />
Qualitätszirkel im Hause der Autoren<br />
gemeinsam mit den Therapeuten an<br />
einen prothetisch-konzeptionellen<br />
Neuanfang gewagt. Grundsätzlich<br />
war klar, dass die Prothese sowohl<br />
funktionell als auch im Aussehen für<br />
das Kind einen spielerischen Charakter<br />
bekommen soll und aus Gründen<br />
der verbesserten Aufmerksamkeit<br />
bunt zu konzipieren ist.<br />
Klar war auch von Beginn an, dass<br />
die neue frühkindliche Erstversorgungsprothese<br />
FIRST heißen soll. Die<br />
Bedeutung der Namensgebung setzt<br />
sich sowohl aus dem Zeitpunkt der<br />
Versorgung, der Erwartung an das<br />
System, den verschiedenen Einsatzgebieten<br />
sowie dem Charakter der Versorgung<br />
wie folgt zusammen:<br />
F rühkindliche<br />
I ntegrative<br />
R ehabilitative<br />
S ituationsorientierte<br />
T rainingsprothese<br />
Abb. 4 Die verfügbaren Wechseladapter zur FIRST-Prothese.<br />
Abb. 5 Selbstständiger Tausch des<br />
Wechseladapters durch das Kind.<br />
Abb. 6 Ball-Fang- und Wurfhilfe zur<br />
FIRST-Prothese.<br />
Basierend auf den Grenzsteinen zur<br />
frühkindlichen körper- und handmotorischen<br />
Entwicklung [30] der ersten<br />
Lebensmonate und Jahre wurden verschiedene<br />
Wechselaufsätze der FIRST-<br />
Prothese mit unterschiedlichen Funktionalitäten<br />
konzipiert, die zum einen<br />
an die jeweilige motorische Entwicklung<br />
des Kindes adaptieren, zum anderen<br />
aber auch in der Therapie zur<br />
Weiterentwicklung und zur Förderung<br />
der Fähigkeiten des Kindes genutzt<br />
werden können (Abb. 4).<br />
Eine Grundvoraussetzung für die<br />
Konzeption dieser Erstversorgungsprothese<br />
lag darin, dass die Kinder bereits<br />
im Kleinstkindesalter in der Lage<br />
sein sollten, die Wechseladapter selbstständig<br />
in ihrem Lebensalltag wechseln<br />
zu können, so dass diese jederzeit<br />
und in einem selbstbestimmten Kontext<br />
gewählt und ausgetauscht werden<br />
können (Abb. 5). Letzteres geht auch<br />
einher mit einer reduzierten Belastbarkeit<br />
dieser Komponenten. In Anlehnung<br />
an die motorische Entwicklung<br />
wurden die ersten Wechseladapter<br />
als „Starter-Kit“ mit der Funktion einer<br />
Schaufel, einer Rolle eines Kinderhändchens<br />
mit federndem Daumen<br />
und eines Greifers gewählt. Sobald die<br />
Kinder diese Wechseladapter sicher<br />
und selbstbestimmt im Alltag einsetzen<br />
können, kann man in einem weiteren<br />
Versorgungsschritt die nächste<br />
Entwicklungsstufe mit dem weiterführenden<br />
„Follow-up-Kit“, bestehend<br />
aus einem Hammer, einer Fang- und<br />
Wurfhilfe (Abb. 6) sowie einer Ess- und<br />
Funktionshilfe, ergänzen. Seit kurzer<br />
Zeit steht auch ein Lenkhilfe-Adapter<br />
zur Verfügung, der am Fahrrad<br />
befestigt werden kann und in den das<br />
Kind seine Prothese adaptieren kann.<br />
Foto: Pohlig GmbH<br />
Foto: Pohlig GmbH<br />
94<br />
ORTHOPÄDIE TECHNIK <strong>05</strong>/24
Prothetik<br />
Fotos: Pohlig GmbH<br />
Abb. 7 Individuelle Größenbestimmung für die Wechseladapter der FIRST-Prothese.<br />
Mit diesen bunten und kindgerechten<br />
Wechseladaptern kann die FIRST-Prothese<br />
wie ein Multifunktions-Werkzeugkasten<br />
genutzt werden.<br />
Konstruktion der<br />
FIRST-Prothese<br />
Das Layout der FIRST-Prothese wurde<br />
zunächst auf die Versorgung von Kindern<br />
mit transversalem Reduktionsdefekt<br />
abgestimmt, da dies das größte<br />
Versorgungskollektiv darstellt. Alle<br />
Adapter sowie der Außenschaft der<br />
FIRST-Prothese werden digital konzipiert<br />
und im additiven 3D-Druck<br />
unter Anwendung des selektiven Lasersinter-Verfahrens<br />
nach einem dokumentierten<br />
Ablauf aus PA11/PA12<br />
hergestellt, anschließend oberflächenbehandelt,<br />
gefärbt und montiert.<br />
Produkte in dieser Fertigungstechnik<br />
haben sich vor allem für die<br />
Versorgung der oberen Extremitäten<br />
bewährt, weil sie eine Bauraum- und<br />
querschnittsoptimierte Gestaltung<br />
ermöglichen [31]. Dies hat zur Folge,<br />
dass die Prothese deutlich leichter<br />
als Kinderprothesen in traditionellen<br />
Fertigungstechniken ausgeführt werden<br />
kann, was sowohl die Akzeptanz<br />
als auch den Tragekomfort für das<br />
Kind spürbar erhöht.<br />
Die Größe der Wechseladapter<br />
wird bei jeder Versorgung individuell<br />
an die Größe der Kinderhand angepasst,<br />
so dass entsprechende Funktionalitäten<br />
wie z. B. die Griffweite mit<br />
zunehmendem Wachstum auch größer<br />
werden (Abb. 7).<br />
Der Außenschaft verfügt über ein<br />
Handgelenk mit dem Universaladapter,<br />
das sich bereits in der 3. weiterentwickelten<br />
Bauweise befindet. Es ist<br />
über eine Edelstahlachse mit dem Unterarm-Außenschaft<br />
verbunden und<br />
kann wahlweise mithilfe eines halbrunden<br />
Arretierungsclips festgestellt<br />
werden (Abb. 8). Der Innenschaft der<br />
FIRST-Prothese wird aufgrund des zumeist<br />
noch sehr jungen Alters der Kinder<br />
in einer thermoplastischen Technik<br />
(Abb. 9b) angefertigt, so dass im<br />
a.<br />
Zuge von Wachstumsschüben mehrmals<br />
im Volumen nachgepasst werden<br />
kann.<br />
Bei längeren Unterarm-Fehlbildungen<br />
kann die Bauweise aufgrund<br />
der ausreichend guten Führungseigenschaften<br />
deutlich flexibler gestaltet<br />
werden, indem man die Fläche des<br />
Außenschaftes reduziert (Abb. 9a).<br />
Wahlweise und bei besonderen Anforderungen,<br />
wie z. B. anatomischen<br />
Hinterschneidungen, Hypersensibilitäten<br />
der Haut oder einem erhöhten<br />
Anspruch an die Haftung der Prothese,<br />
kann der Innenschaft auch in einer<br />
HTV-Silikon-Vollkontakt-Schafttechnik<br />
gefertigt werden (Abb. 9c).<br />
In Abhängigkeit zur Stumpflänge<br />
und dem Armniveau können weitere<br />
Konstruktionsvarianten zum Einsatz<br />
kommen. So kann es beispielsweise<br />
Abb. 8a u. b Handgelenk der FIRST-Prothese; alte Varianten (a), neue Variante 3 mit<br />
Sperrclip (b).<br />
a.<br />
Abb. 9a–c Unterarm-Schaftgestaltungsvarianten bei der FIRST-Prothese.<br />
b.<br />
b.<br />
c.<br />
Fotos: Pohlig GmbH Fotos: Pohlig GmbH<br />
ORTHOPÄDIE TECHNIK <strong>05</strong>/24<br />
95
Prothetik<br />
vorkommen, dass bei sehr langen Unterarmstümpfchen<br />
auf den Einsatz<br />
des Handgelenkes verzichtet wird und<br />
damit etwaige Überlängen vermieden<br />
werden. Bei ultrakurzen Unterarmstümpfen<br />
hat sich hingegen die<br />
Versorgung mit einer „Open-end-Variante“<br />
[6] mit gelenkgeführter Oberhülse<br />
und flexiblem Innenschaft mit<br />
Lasche bewährt (Abb. 10b). Dabei ist<br />
darauf zu achten, dass die suprakondyläre<br />
Bettung der humeralen Epikondylen<br />
anatomisch konturiert in<br />
die Oberhülse eingearbeitet wird, da<br />
dieser Schaftbereich der Prothese Rotationsstabilität<br />
gewährleistet.<br />
Die Versorgung der deutlich seltener<br />
vorkommenden Oberarmfehlbildungen<br />
wurde nach den ersten Erfahrungskurven<br />
mit der Unterarm-<br />
FIRST-Prothese (Abb. 10c) konzipiert.<br />
Auch hier bestehen 2 Versorgungsvarianten,<br />
zum einen die bereits vom<br />
ultrakurzen Unterarm bekannte Variante<br />
mit der Oberhülse, dem flexiblen<br />
Innenschaft mit Lasche und den bilateralen<br />
Ellenbogen-Gelenkschienen.<br />
Diese kommen bei angeborenen Ellenbogen-Exartikulationen<br />
und langen<br />
Oberarmstümpfchen zum Einsatz.<br />
Zum anderen besteht bei mittellangen<br />
und kürzeren Stumpfvarianten<br />
die Möglichkeit der endoskelettalen<br />
Versorgung mit einem Rohrskelettsystem<br />
(Abb. 10a). Hier empfiehlt<br />
sich der Einsatz eines sperrbaren Ellenbogensystems,<br />
welches über einen<br />
Druckknopf am Handgelenk entriegelt<br />
und justiert werden kann.<br />
Abb. 11 FIRST-<br />
Probeprothese mit<br />
Probeadapter.<br />
Versorgungsablauf mit<br />
der FIRST-Prothese<br />
Die erstprothetische Versorgung von<br />
Kleinkindern erfordert viel Aufmerksamkeit<br />
und Einfühlungsvermögen.<br />
Bereits die Formabdrucknahme des<br />
Unterarmstümpfchens kann in der<br />
frühkindlichen Phase herausfordernd<br />
sein, da die Kinder in diesem Alter selten<br />
Verständnis für diese Maßnahme<br />
aufbringen können. Nach Erstellung<br />
eines Formmodelles wird in Anlehnung<br />
an die Abläufe des Qualitätsstandards<br />
im Bereich Prothetik der<br />
oberen Extremitäten [32, 33] auch bei<br />
der FIRST-Prothese zunächst eine Probeprothese<br />
erstellt. In der Regel wird<br />
der Innenschaft aus einem flexiblen<br />
wiederverschweißbaren Thermoplast<br />
erstellt, das im Zuge der Anprobe gute<br />
Änderungs- und Nachbesserungsmöglichkeiten<br />
bietet. Über den Innenschaft<br />
wird eine Carbon-Probespange<br />
angefertigt, die zur Verbindung mit<br />
den FIRST-Komponenten dient. Hier<br />
für gibt es einen FIRST-Probeadapter,<br />
der sowohl das Handgelenk als auch<br />
die Aufnahme für die verschiedenen<br />
Handkomponenten beinhaltet und<br />
auf thermoplastischem Wege an die<br />
Carbonspange angeformt und mit<br />
ihr verbunden wird (Abb. 11). Neben<br />
Passformoptimierungen müssen bei<br />
der Probeprothese auch die Endlänge<br />
sowie die Stellung der Prothese ermittelt<br />
werden. Die FIRST-Probeprothese<br />
wird dann beübt und beschult und<br />
zur externen Erprobung mit nach<br />
Hause gegeben.<br />
Der Zeitraum der externen Erprobung<br />
wird zur digitalen Konstruktion<br />
der definitiven FIRST-Prothese auf<br />
den gescannten Grundmodellen genutzt.<br />
Nach positivem Abschluss der<br />
externen Probephase wird sowohl der<br />
Prothesenschaft wie auch die ganze<br />
Probeprothese inkl. Stellung eingescannt<br />
und zur weiteren Bearbeitung<br />
vorbereitet. Zu diesem Zeitpunkt werden<br />
auch das Design und die Farbe<br />
der Prothese ausgewählt (Abb. 12).<br />
Fotos: Pohlig GmbH<br />
a. b. c.<br />
Abb. 10a–c Konstruktionsvarianten bei der FIRST-Prothese.<br />
Fotos: Pohlig GmbH<br />
96<br />
ORTHOPÄDIE TECHNIK <strong>05</strong>/24
Außerdem werden die Wechselkomponenten<br />
auf die individuellen Maße<br />
der kindlichen Hand gefittet, endbearbeitet<br />
und zur Endanprobe montiert.<br />
Die Erstabgabe erfolgt in der Regel<br />
mit 4 Wechseladaptern (Starter-<br />
Kit) (Abb. 13).<br />
Fotos: Pohlig GmbH<br />
Prothetik<br />
Abb. 13 Definitive<br />
FIRST-Prothese mit<br />
Starter-Kit.<br />
Fachkräfte<br />
finden<br />
Prothesengebrauchsschulung<br />
Die Prothesengebrauchsschulung<br />
[32–34] stellt eine essentielle Maßnahme<br />
im Rahmen der erstprothetischen<br />
Versorgung – und ganz besonders<br />
im Rahmen der frühkindlichen<br />
Versorgung – dar. Die Kinder benötigen<br />
die gezielte Förderung und Unterstützung,<br />
um so die verschiedenen<br />
Funktionsadapter bestmöglich zum<br />
Einsatz zu bringen (Abb. 14).<br />
Bei der FIRST-Prothese folgt die<br />
Gebrauchsschulung einem 5-stufigen<br />
Programm, das sich aus den folgenden<br />
Schritten zusammensetzt:<br />
1. Gewöhnen: Das Begleiten der ersten<br />
Gewöhnungsphase beinhaltet<br />
das Adaptieren an die neue Situation,<br />
das Gewicht der Prothese, die<br />
neue Armlänge und vor allem das<br />
tägliche Tragen und Nutzen der<br />
Prothese.<br />
2. Entdecken: Sobald die Eingewöhnung<br />
vollzogen wurde, beginnt die<br />
Entdeckungsphase. Unter Berücksichtigung<br />
einer beidhändigen<br />
Interaktion werden die Funktionsadapter<br />
spielerisch auf neue Nutzungsgebiete<br />
ausgeweitet.<br />
3. Spielen: Das Spielen nimmt in der<br />
frühkindlichen Phase eine wichtige<br />
Rolle ein. Die Prothese sollte<br />
dabei, wenn möglich, die grobmotorischen<br />
Halte- und Führungsaufgaben<br />
einnehmen, so dass die<br />
nicht beeinträchtigte Hand die<br />
feinmotorischen Aufgaben erfüllen<br />
kann. Die Spiele sind vor allem<br />
im Kleinstkindesalter noch sehr<br />
elementar und beinhalten die Tätigkeiten<br />
Halten, Stecken, Stapeln,<br />
Auspacken, Blättern, Walzen, Greifen<br />
etc.<br />
4. Automatisieren: Durch einen zunehmenden<br />
Einsatz der Prothese<br />
werden auch die Abläufe automatisiert<br />
wiederholt und auf verschiedenen<br />
Bewegungsebenen zum<br />
Einsatz gebracht. Ziel ist die Integration<br />
und Akzeptanz der Prothese<br />
in das Körperschema. Auch dabei<br />
spielt die beidhändige Interaktion<br />
eine wichtige Rolle.<br />
5. Vorbereiten auf die Erweiterung/<br />
Folgeversorgung: Werden die ersten<br />
Funktionsadapter beherrscht,<br />
kann die Ausweitung auf neue<br />
Komponenten und Funktionen<br />
erfolgen. Auch nächste Stufen der<br />
Abb. 12 Themenmuster- und Farbauswahl für die FIRST-Prothese.<br />
STELLENANZEIGEN<br />
Buchen Sie Ihre<br />
Stellenanzeige<br />
in der OT<br />
Erreichen Sie mit Ihrer Stellenanzeige<br />
im Fachmagazin<br />
ORTHOPÄDIE TECHNIK die<br />
Branchen-Fachkräfte aller<br />
Ebenen des gesamten deutschsprachigen<br />
Raums, egal ob für<br />
den Handel, die Werkstatt<br />
oder für die Industrie.<br />
Jocelyn Blome berät Sie zu<br />
Ihrer Anzeigenschaltung<br />
unter +49 151 10841489.<br />
Unsere Mediadaten<br />
Fotos: Pohlig GmbH<br />
Weitere Informationen<br />
unter: www.360-ot.de/<br />
mediadaten/<br />
ORTHOPÄDIE TECHNIK <strong>05</strong>/24
Prothetik<br />
Fotos: Pohlig GmbH<br />
Abb. 14 Definitive FIRST-Prothese in kindlichen Alltags situationen.<br />
Fortbewegung, wie z. B. das Dreirad-/Roller/-Laufradfahren<br />
können<br />
durch die FIRST-Prothese unterstützt<br />
werden.<br />
Die Begleitung durch eine zielgerichtete<br />
Gebrauchsschulung ist für<br />
die Kinder enorm wichtig. Sie erhöht<br />
nicht nur die Akzeptanz der Prothese,<br />
sondern vermittelt den Kindern auch<br />
Anreize, die Prothese zielgerichteter<br />
und v. a. beidhändig einzusetzen.<br />
Im Übergang zur aktiven myoelektrischen<br />
Prothese werden die in der<br />
Prothese enthaltenen Hohlräume genutzt,<br />
um das Prothesengewicht der<br />
FIRST-Prothese sukzessive zu erhöhen<br />
und sich dem höheren Gewicht der<br />
Myoprothese anzunähern. Dadurch<br />
wird das Kind sowohl im Aufbau der<br />
benötigten Muskulatur wie auch im<br />
Handling des höheren Prothesengewichtes<br />
auf die Folgeversorgung bestmöglich<br />
vorbereitet.<br />
Diskussion, Ergebnisse<br />
Subsumiert man die in der Literatur<br />
aufgeführten Erkenntnisse sowie die<br />
daraus resultierenden Anforderungen<br />
für eine kindgerechte frühfunktionale<br />
Prothesenversorgung, so konnten<br />
viele dieser Anforderungen erfolgreich<br />
in dem FIRST-Konzept umgesetzt<br />
werden.<br />
Das Beste vorweg: Die Resonanz<br />
und Akzeptanz der FIRST-Prothese<br />
seitens der Kinder ist gut. Durch den<br />
spielerischen Charakter, das wählbare<br />
Design und die bunten Farben erfährt<br />
die FIRST-Prothese eine sehr gute Akzeptanz.<br />
Vor allem Kinder, die zuvor<br />
traditionelle passive Versorgungen<br />
getragen haben, schätzen das gerin<br />
ge Gewicht der Prothese, das farbliche<br />
Layout und die deutlich erhöhte<br />
Funktionalität durch die Wechseladapter<br />
der prothetischen Erstversorgung.<br />
Durch die Möglichkeit, den Komponentenwechsel<br />
selbst vorzunehmen,<br />
wird bei vielen Kindern anfänglich<br />
auch das Gefühl des Stolzes<br />
verzeichnet, was wiederum auch die<br />
Trageintensität steigert. Vereinzelt beobachten<br />
wir eine temporäre Nutzung<br />
der FIRST-Prothese, die an die Funktionalitäten<br />
gekoppelt sind. Auch das<br />
ist als Erfolg zu werten.<br />
Die Prothese ist wasser- und<br />
schmutzresistent und kann nach etwaigen<br />
Verunreinigungen auch wieder<br />
gut gesäubert werden. Das deutlich<br />
reduzierte Gewicht und die erhöhte<br />
Funktionalität durch die verschiedenen<br />
Funktionskomponenten<br />
erwecken bei den Kindern sichtlich<br />
Aufmerksamkeit und Akzeptanz. Vereinzelt<br />
berichten die Eltern der etwas<br />
älteren Kinder, dass z. B. andere Kinder<br />
in der Kita neidisch sind und auch<br />
so eine Prothese wollen. Auch diese<br />
Attraktivität trägt zu einer Steigerung<br />
der Akzeptanz des Hilfsmittels bei.<br />
Die Therapieziele sind klar formuliert<br />
und liegen in der Förderung der<br />
gesunden motorischen und geistigen<br />
Entwicklung, in einer Verbesserung<br />
der Kraft, Beweglichkeit und Körpersymmetrie.<br />
Die beidhändige Interaktion<br />
nimmt bei allen Bestrebungen<br />
einen wichtigen Part ein und vervollständigt<br />
das Körperschema des Kindes.<br />
Nach den ersten Jahren der Erfahrung<br />
mit der FIRST-Prothese fällt<br />
auf, dass die Kinder durch Umgang<br />
und Bedienen des Hilfsmittels auch<br />
deutlich routinierter in die Folgeversorgung<br />
mit einer aktiven myoelektrischen<br />
Prothese einsteigen. Im Vergleich<br />
zu Kindern ohne prothetische<br />
Vorversorgung fällt auf, dass sich die<br />
Signalgebung zur Ansteuerung der<br />
aktiven Prothese spürbar stärker und<br />
differenzierter darstellt. Sowohl der<br />
muskuläre Aufbau wie auch die gewonnenen<br />
koordinativen Fähigkeiten<br />
leisten einen spürbaren Vorschub<br />
in der entscheidenden Phase der Eingewöhnung.<br />
Aufgrund der Tatsache, dass digitale<br />
Arbeitsschritte und Abläufe in<br />
den Workflow dieser Versorgung integriert<br />
werden konnten, stellt sich<br />
die FIRST-Prothese auch im Hinblick<br />
auf den Kosten-Nutzen-Effekt im Vergleich<br />
zu sonst üblichen Habitusprothesen<br />
in einem wirtschaftlichen<br />
Rahmen dar und wird von den Kostenträgern<br />
bis dato gut angenommen.<br />
Entscheidend sind am Ende jedoch<br />
die positive Resonanz und der Einsatz<br />
des Hilfsmittels, denn nur wenn es im<br />
Alltag eine entsprechende Nutzung<br />
erfährt, hat es sich auch gelohnt.<br />
Danksagung:<br />
Die Entwicklung des FIRST-Konzeptes<br />
wurde 2018 gestartet. Erste<br />
Versorgungsvarianten standen der<br />
Pohlig GmbH 2020 zur Verfügung.<br />
Seit diesem Zeitpunkt wurde das Konzept<br />
in einer Teamleistung kontinuierlich<br />
weiterentwickelt und verbessert.<br />
Der große Dank und die Wertschätzung<br />
gilt all jenen Mitarbeitern<br />
aus der Orthopädie-Technik, Therapie<br />
und Entwicklung der Pohlig GmbH,<br />
die an diesem Projekt wertvollen Input<br />
geleistet und mit viel Engagement<br />
an der Weiterentwicklung und Umsetzung<br />
des FIRST-Konzeptes mitgearbeitet<br />
haben.<br />
Interessenkonflikt:<br />
Die Autoren sind Angestellte der<br />
Pohlig GmbH.<br />
Für die Autoren:<br />
Michael Schäfer<br />
c/o Pohlig GmbH<br />
Grabenstätter Str. 1<br />
83278 Traunstein<br />
m.schaefer@pohlig.net<br />
Begutachteter Beitrag/reviewed paper<br />
98<br />
ORTHOPÄDIE TECHNIK <strong>05</strong>/24
Prothetik<br />
Zitation: Schäfer M et al. FIRST – eine neuartige Konzeptprothese für die frühe Versorgung von Kindern mit angeborenen Fehlbildungen an den oberen<br />
Extremitäten. Orthopädie Technik, <strong>2024</strong>; 75 (5): 90–99<br />
Literatur:<br />
[1] Parker SE et al. Updated national birth prevalence estimates<br />
for selected birth defects in the United States, 2004–<br />
2006. Birth Defects Research Part A: Clinical and Molecular<br />
Teratology, 2010; 88 (12): 1008–1016<br />
[2] Koskimies E et al. Congenital upper limb deficiencies and<br />
associated malformations in Finland: a population-based<br />
study. The Journal of hand surgery, 2011; 36 (6): 1<strong>05</strong>8–1065<br />
[3] Meurs M et al. Prescription of the first prosthesis and later<br />
use in children with congenital unilateral upper limb<br />
deficiency: A systematic review. Prosthetics and orthotics<br />
international, 2006; 30 (2): 165–173<br />
[4] James MA et al. Impact of prostheses on function and<br />
quality of life for children with unilateral congenital<br />
below-the-elbow deficiency. Journal of Bone & Joint Surgery,<br />
2006; 88 (11): 2356–2365<br />
[5] Kuyper MA et al. Prosthetic management of children<br />
in the Netherlands with upper limb deficiencies. Prosthetics<br />
and Orthotics International, 2001; 25: 228–234. doi:<br />
10.1080/03093640108726606<br />
[6] Schäfer M, Multerer C. Angeborene Fehlbildungen der<br />
oberen Extremitäten. In: Greitemann B, Brückner L, Schäfer<br />
M, Baumgartner R. (Hrsg.). Amputation und Prothesenversorgung.<br />
Stuttgart, New York: Thieme, 2016: 532–545<br />
[7] Shaperman J, Landsberger S, Setoguchi Y. Early upper<br />
limb prosthesis fitting: when and what do we fit. Journal<br />
of Prosthetics and Orthotics, 2003; 15 (1): 11–17. doi:<br />
10.1097/00008526-200301000-00004<br />
[8] Vakhshori V et al. Trends in pediatric traumatic upper<br />
extremity amputations. Hand, 2019; 14 (6), 782–790<br />
[9] Flor H. Phantom-limb pain: characteristics, causes, and<br />
treatment. The Lancet Neurology, 2002; 1 (3): 182–189<br />
[10] Diers M, Flor H. Phantomschmerz. Psychologische Behandlungsstrategien.<br />
Der Schmerz, 2013; 27 (2): 2<strong>05</strong>–213<br />
[11] Al-Worikat AF, Dameh W. Children with limb deficiencies:<br />
demographic characteristics. Prosthetics and orthotics<br />
international, 2008; 32 (1): 23–28<br />
[12] Mano H, Fujiwara S, Haga N. Adaptive behaviour and<br />
motor skills in children with upper limb deficiency. Prosthetics<br />
and Orthotics International, 2018; 42 (2): 236–240.<br />
doi: 10.1177/0309364617718411<br />
[13] Farr S et al. Peromelia–congenital transverse deficiency<br />
of the upper limb: a literature review and current prosthetic<br />
treatment. Journal of children‘s orthopaedics, 2018; 12<br />
(6): 558–565<br />
[14] James MA. Unilateral Upper Extremity Transverse Deficiencies:<br />
Prosthetic Use and Function. Journal of Pediatric<br />
Orthopaedics, 2010; 30: 40–44<br />
[15] Biddiss E, Chau T. Upper limb prosthesis use and abandonment:<br />
A survey of the last 25 years. Prosthetics and orthotics<br />
international, 2007; 31 (3): 236–257<br />
[16] Sims T, Donovan-Hall M, Metcalf C. Children’s and<br />
adolescents’ views on upper limb prostheses in relation to<br />
their daily occupations. British Journal of Occupational<br />
Therapy, 2020; 83 (4): 237–245<br />
[17] Shida-Tokeshi J et al. Predictors of continued prosthetic<br />
wear in children with upper extremity prostheses. Journal<br />
of Prosthetics and Orthotics, 20<strong>05</strong>; 17 (4): 119–124<br />
[18] Burger H, Vidmar G. A survey of overuse problems in<br />
patients with acquired or congenital upper limb deficiency.<br />
Prosthetics and orthotics international, 2016; 40 (4):<br />
497–502<br />
[19] Postema K et al. Prosthesis rejection in children with<br />
a unilateral congenital arm defect. Clinical Rehabilitation,<br />
1999; 13 (3): 243–249<br />
[20] Wagner LV, Bagley A, James MA. Reasons for prosthetic<br />
rejection by children with unilateral congenital transverse<br />
forearm total deficiency. American Academy of Orthotists<br />
and Prosthetists, 2007; 19 (2): 51–54<br />
[21] Egermann M, Kasten P, Thomsen M. Myoelectric hand<br />
prostheses in very young children. International Orthopaedics,<br />
2009; 33 (4): 1101–11<strong>05</strong><br />
[22] Ylimäinen K et al. Health-related quality of life in Swedish<br />
children and adolescents with limb reduction deficiency.<br />
Acta Paediatrica, 2010; 99 (10): 1550–1555<br />
[23] Fischer M, Könz J. Prothesen, es gibt allerhand zu<br />
tun: wie Prothesen die Health-related Quality of Life von<br />
Kindern mit einer Dysmelie an der oberen Extremität beeinflussen.<br />
ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte<br />
Wissenschaften. Bachelor-Thesis, 2021. doi: 10.21256/<br />
zhaw-24690<br />
[24] Peterson JK., Prigge P. Early upper-limb prosthetic fitting<br />
and brain development: Considerations for success.<br />
Journal of Prosthetics and Orthotics, 2020; 32 (4): 229–235<br />
[25] Van den Heiligenberg FMZ et al. Artificial limb representation<br />
in amputees. Brain, 2018; 141 (5): 1422–1433<br />
[26] Rose VL, Parikh PJ. Getting a Child a Myoelectric Prosthesis:<br />
Did We Miss the Bus? Journal of Prosthetics and Orthotics,<br />
2022; 34 (3): 132–133<br />
[27] Battraw MA et al. A review of upper limb pediatric<br />
prostheses and perspectives on future advancements. Prosthetics<br />
and orthotics international, 2022; 46 (3): 267–273<br />
[28] Döderlein L, Schäfer M. Rehabilitation von Kindern<br />
und Jugendlichen mit angeborenen Gliedmaßendefekten.<br />
Kinder- und Jugendmedizin, 2010; 10 (7): 395–402<br />
[29] Koller A, Wetz HH. Management of upper limb deformities:<br />
Treatment concepts through the years. Orthopäde,<br />
2006; 35 (11): 1137–1145<br />
[30] Michaelis R, Niemann G. Entwicklungsneurologie<br />
und Neuropädiatrie. Stuttgart: Thieme, 2004: 62 ff. doi:<br />
10.1<strong>05</strong>5/b-001-3200<br />
[31] Kienzle C, Schäfer M. Integration additiver Fertigungsverfahren<br />
(3D-Druck) in den orthopädietechnischen Versorgungsalltag.<br />
Orthopädie Technik, 2018; 69 (5): 48–55<br />
[32] Schäfer M. Behandlungspfade in der exoskelettalen<br />
prothetischen Versorgung der oberen Extremitäten. Orthopäde,<br />
2021; 50 (1): 32–43<br />
[33] Alimusaj M et al. Kompendium Qualitätsstandard im<br />
Bereich Prothetik der oberen Extremitäten. Dortmund:<br />
Verlag Orthopädie-Technik, 2014<br />
[34] Kelly BM et al. Comprehensive care for the child with<br />
upper extremity limb deficiency. Journal of Pediatric Rehabilitation<br />
Medicine, 2009; 2 (3): 195–208<br />
ORTHOPÄDIE TECHNIK <strong>05</strong>/24<br />
99
Prothetik<br />
T. Vogel<br />
Ergebnisse einer Anwenderbefragung<br />
zum subischialen<br />
VPS-Schaftsystem<br />
Results of a User Survey on the Subischial VPS Socket System<br />
Das VPS-System (Vacuum-Pressure-<br />
Socket-System) von Vogel Orthopädie<br />
Technik ist seit 2022 auf dem<br />
Markt. Die Auswertung von 30 Fragebögen<br />
soll helfen, das Schaftsystem<br />
einzuordnen und zu bewerten.<br />
Zur Konzeption und Auswertung des<br />
verwendeten Fragebogens wurde<br />
Prof. Dr. Jürgen Rütt (orthopädische<br />
Privatpraxis Dr. Theben, Köln) eingebunden,<br />
um die Qualität der ermittelten<br />
Daten zu bestätigen.<br />
Schlüsselwörter: subischialer Prothesenschaft,<br />
Vakuumhaftung, Femurlänge,<br />
Gefäßerkrankungen<br />
The VPS (vacuum pressure socket)<br />
system by Vogel Orthopädie Technik<br />
has been on the market since 2022.<br />
The evaluation of 30 questionnaires<br />
is intended to assist with the classification<br />
and assessment of the socket<br />
system. Prof. Dr Jürgen Rütt (private<br />
orthopaedic practice Dr Theben, Cologne)<br />
was involved in preparing and<br />
evaluating the questionnaire in order<br />
to confirm the quality of the data obtained.<br />
Key words: subischial prosthesis<br />
socket, vacuum adhesion, femoral<br />
length, vascular diseases<br />
Einleitung<br />
Bei Schaftsystemen, die den Sitzbeinast<br />
miteinbeziehen, kommt es häufig<br />
zu Problemen im Bereich der Kontaktpunkte.<br />
Auch die Nähe zum Hygienebereich<br />
sowie eventuelle Einschränkungen<br />
in der Bewegungsfreiheit sind<br />
nachteilig. Die Schaftformen können<br />
sich zudem negativ auf den Sitzkomfort<br />
auswirken [1, 2].<br />
Beim Fahrradfahren bereiten oft<br />
die konstruktiv notwendigen Anoder<br />
Abstützungspunkte am Sitzbeinast<br />
Probleme, da diese mit dem Sattel<br />
in Kontakt kommen. So beschreiben<br />
Anwender:innen immer wieder, dass<br />
sie am Sattel hängenbleiben oder in<br />
ihrer Sattelwahl eingeschränkt sind.<br />
Sportler:innen verzichten daher entweder<br />
ganz auf einen Prothesenschaft<br />
oder tragen Sonderkonstruktionen,<br />
die nicht mit dem Sattel kollidieren.<br />
Klassische und bisherige subischiale<br />
Schaftsysteme haben ihren<br />
höchsten Reduzierungswert in der<br />
Schafteintrittsebene (Ø 2,5–3,5 %),<br />
der nach distal abnimmt. Sie wirken<br />
so dem Kompressionsstrumpfprinzip<br />
entgegen, was gerade bei<br />
Patient:innen, die zum Zeitpunkt ihrer<br />
Amputation unter einer Gefäßerkrankung<br />
leiden (ca. 73 %), kritisch<br />
zu betrachten ist [3].<br />
Diese Vorgehensweise ist jedoch<br />
notwendig, damit sich bisherige subischiale<br />
Schaftsysteme entweder<br />
durch eine muskuläre Verblockung<br />
und/oder hohe Reduzierwerte von bis<br />
zu 6 % stabilisieren können und es<br />
nicht zu einer ungewollten Rotation<br />
des Schaftes um den Stumpf oder zu<br />
einem Shifting kommt [4, 5].<br />
Das subischiale VPS-System verfolgt<br />
hier einen neuen Ansatz, denn<br />
durch die Konstruktion eines Kräftedreiecks<br />
in den Ruhezonen zwischen<br />
den Hauptmuskelgruppen ist<br />
der Schaft bereits in Ruhe stabil (Abb.<br />
1). Dies geschieht schon beim Abdruck<br />
unter Zuhilfenahme eines speziellen<br />
Abdruckgerätes, dem „Dimplematen“<br />
(Abb. 2). So wird gewährleistet, dass es<br />
nur zu einer Volumenverschiebung<br />
und nicht zu einer Volumenreduktion<br />
kommt. Da in der Schafteintrittsebene<br />
also nicht über Volumenreduktion<br />
und/oder Muskelverblockung der<br />
Prothesenschaft in Position gehalten<br />
werden muss, ist hierzu keine gesonderte<br />
Reduktion des Volumens in diesem<br />
Bereich notwendig, mit Ausnahme<br />
jener, die zur Einhaltung des Kompressionsstrumpfprinzips<br />
nach einer<br />
eigens hierfür entwickelten Reduktionstabelle<br />
ermittelt wird. Diese orientiert<br />
sich an der RAL-GZ 387/1 [6]<br />
und gewährleistet so Kraftschlüssigkeit<br />
und Haftung des Prothesenschaftes<br />
im Steuerungs- und Endbereich.<br />
Bei diesem „Kompressionstrumpfprinzip“<br />
liegt der geringste Reduzierwert<br />
in der Schafteintrittsebene<br />
(Ø 0,8–1,1 %) und nimmt nach distal<br />
zu. Diese revolutionäre Herangehensweise<br />
wurde bisher in keiner anderen<br />
mir bekannten Schafttechnik<br />
beschrieben. Hierbei wird die Annäherung<br />
an das hydrostatische Prinzip<br />
umgesetzt, wodurch sich die Gewebsübergänge<br />
fließend darstellen und<br />
dem Punkt Rechnung getragen wird,<br />
dass ca. 73 % aller Amputierten zum<br />
Zeitpunkt ihrer Amputation an einer<br />
Gefäßerkrankung leiden (Abb. 3).<br />
Das Ziel der Befragung ist, diese völlig<br />
neue Herangehensweise durch den/<br />
die Anwender:in bewerten zu lassen.<br />
Methode<br />
Um das VPS-System besser einordnen<br />
zu können und das Wirkprinzip<br />
zu überprüfen, wurde ein anonymisierter<br />
Fragebogen [7] entwickelt,<br />
der die Einschätzung der VPS-<br />
Anwender:innen zu diesem System<br />
im Vergleich zu deren bisherigen<br />
Schaft versorgungen widergibt. Die<br />
von Vogel Orthopädie Technik zerti-<br />
100<br />
ORTHOPÄDIE TECHNIK <strong>05</strong>/24
Prothetik<br />
fizierten Orthopädietechniker:innen<br />
werden gebeten, den Fragebogen nach<br />
mindestens einmonatiger Tragezeit<br />
gemeinsam mit dem/r Anwender:in<br />
auszufüllen. Alle Anwender:innen kamen<br />
mit den bisherigen Versorgungen<br />
zurecht. Der Wunsch, das VPS-System<br />
zu testen, barg vor allem die Hoffnung,<br />
den Schaftkomfort verbessern zu können.<br />
Ein grundlegendes Bedürfnis, das<br />
sich in mehreren Befragungen bereits<br />
widergespiegelt hat [8, 9].<br />
In einer Querschnittuntersuchung<br />
wurden so die ersten 30 Versorgungen<br />
von insgesamt neun zertifizierten Unternehmen<br />
bis Mitte Februar <strong>2024</strong><br />
ausgewertet. Sie geben Hinweise auf:<br />
a) Anwender (Alter, Mobilitätsgrad<br />
etc.)<br />
b) Allgemeine Zufriedenheit<br />
c) Vergleich mit dem bisherigen<br />
Schaftsystem<br />
d) Gangmechanik Stabilität<br />
e) Fazit des Anwenders<br />
Abb. 1 Konstruktion<br />
eines Kräftedreiecks<br />
in den Ruhezonen<br />
zwischen den Hauptmuskelgruppen.<br />
Grafik: Tobias Vogel<br />
Ergebnisse<br />
Zu a): Ausgewertet wurden 30 Fragebögen.<br />
Die Anwender:innen waren<br />
im Durschnitt 53 Jahre alt, wogen<br />
94,2 kg und waren 175 cm groß. Der<br />
Mobilitätsgrad lag im Mittel bei 2,7<br />
und die angegebene Stumpflänge war<br />
< 2/3 und > 1/3 im Verhältnis zur kontralateralen<br />
Seite. 15 Befragte waren<br />
mit einem ramus-, 12 mit einem sitzbeinumgreifenden<br />
Prothesenschaft<br />
und drei Teilnehmer mit einem subischialen<br />
System (MWK-Schaft) versorgt.<br />
Neun Anwender:innen hatten<br />
ein Locking System und 21 waren bereits<br />
mit einem Vakuumhaftschaftsystem<br />
versorgt, davon 16 mit Liner<br />
und fünf ohne. Die mediane Nutzung<br />
des VPS-Systems zum Zeitpunkt der<br />
Befragung betrug 13 Wochen (IQR5-<br />
47). Eine Sensitivitätsanalyse zwischen<br />
den beiden Gruppen mit einer<br />
Nutzungsdauer < 13 Wochen versus<br />
> 13 Wochen ergab keine signifikanten<br />
Unterschiede.<br />
Zu b): Unter „Allgemeine Zufriedenheit“<br />
(Abb. 4) wurde abgefragt,<br />
wie die Anwender:innen den VPS-<br />
Prothesen schaft im Alltag empfinden.<br />
Neben der allgemeinen Einschätzung<br />
wurden hier die Punkte „Passung am<br />
Stumpf“, „Gewicht der Prothese“,<br />
„Stehen“, „Gehen/Laufen“, „Sitzen“,<br />
„Gleichgewicht Stehen/Gehen“, „Erschöpfung“,<br />
„Anlegen“, „Schaftgröße“<br />
und „Toilettengang“ abgefragt.<br />
Abb. 2 Der Dimplemat ermöglicht es, die Ruhepunkte an Oberschenkelstümpfen<br />
reproduzierbar einzustellen.<br />
Abb. 3 Harmonischer Übergang zwischen Stumpf und Schaftrand.<br />
Foto: Maria Schulz<br />
Fotos: Tobias Vogel<br />
ORTHOPÄDIE TECHNIK <strong>05</strong>/24<br />
101
Prothetik<br />
Grafik: Tobias Vogel<br />
Im Mittel gaben 61 % der An wender:innen<br />
die Beurteilung „deutlich<br />
besser“ (20 %) oder „besser“ (41 %)<br />
an. Dabei stechen mit einer klaren<br />
Gewichtung von 20 oder mehr<br />
Anwender:innen die Bereiche „Passform<br />
am Stumpf“, „Sitzen“, „Schaftgröße“<br />
und „Toilettengang“ heraus.<br />
Leicht überdurchschnittlich mit > 15<br />
bis < 20 Anwender:innen heben sich<br />
„Zufriedenheit im Alltag“, „Gehen“,<br />
„Gleichgewicht beim Gehen“, metabolische<br />
„Erschöpfung (deutlich weniger<br />
bzw. weniger)“ und „Anlegen<br />
der Prothese“ hervor.<br />
Zu c): Beim „Vergleich mit dem bisherigen<br />
Schaftsystem“ (Abb. 5) empfanden<br />
68 % aller Anwender:innen die<br />
Punkte „Komfort/Bewegungsfrei heit“<br />
als „besser“ (20 %) oder „gut“ (48 %).<br />
25 % gaben „gleich“ an und lediglich<br />
3 % „weniger“ bzw. „schlecht“. Dabei<br />
hoben sich insbesondere die Bereiche<br />
„Platz zum Hygienebereich“ und „Bewegungsfreiheit<br />
der einzelnen Bewegungsrichtungen“<br />
positiv ab.<br />
d): Unter dem Punkt „Gangmechanik<br />
Stabilität“ (Abb. 6) wurden die<br />
Punkte „Stabilität in der Stand- und<br />
Schwungphase“, „natürliches Gangbild“,<br />
„Schwungbewegung“, „Bücken<br />
und Heben“ von den Anwender:innen<br />
beurteilt. Im Mittel empfanden 45 %<br />
die Punkte als „besser“ (8 %) oder gut<br />
(37 %). 44 % bewerten diesen Bereich<br />
mit „gleich“. 7 % gaben „weniger“<br />
und 5 % „schlechter“ an. Insbesondere<br />
wurden hier die Aspekte die „Stabilität<br />
Schwungphase“ und „Schwungbewegung“<br />
mehrheitlich als „deutlich<br />
besser“ oder „besser“ in Vergleich<br />
zur Standardversorgung empfunden.<br />
Als Fazit (Abb. 7) empfehlen 28 von<br />
30 Anwender:innen das VPS-System<br />
weiter und nennen „Schaftkomfort“<br />
(80 %), „Fahrrad-/Autofahren“ (53 %),<br />
und „Hygiene“ (47 %) als wesentliche<br />
Innovationspunkte und Gründe für<br />
ihre Entscheidung.<br />
Schlussfolgerung<br />
Abb. 4 Die allge<br />
meine Zufriedenheit<br />
der Anwender:innen<br />
mit<br />
dem VPS-System<br />
im Vergleich zum<br />
Vorgängersystem.<br />
Vier der 30 Anwender:innen haben<br />
sich gegen eine Versorgung mit dem<br />
VPS-System entschieden. Gründe<br />
hierfür waren bei zwei Anwendern<br />
ein zu kurzer Stumpf (Femurlänge)<br />
einhergehend mit einer Instabilität<br />
im System und den daraus resultierenden<br />
Druckstellen. Bei den andern<br />
beiden Anwender:innen standen<br />
Schmerzen im Vordergrund sowie<br />
eine Ablehnung eines Vakuumhaftschaftsystems.<br />
Dennoch würden 28<br />
Anwender:innen das Schaftsystem<br />
weiterempfehlen.<br />
Die Auswertung der Ergebnisse<br />
zeigt: Die Versorgung mit einem VPS-<br />
System bringt den Anwender:innen<br />
folgende Vorteile: 1. Schaftkomfort,<br />
2. Einfaches Fahrrad-/Autofahren,<br />
3. Freiheit im Hygienebereich, 4. Stabilität<br />
des Schaftes und 5. Frei Laufen.<br />
Diese Bewertungen spiegeln sich in<br />
den einzelnen Bereichen wider. Die<br />
drei Anwender:innen, die bereits mit<br />
einem subischialen System versorgt<br />
waren, haben sich aufgrund der Eigenstabilität<br />
für das VPS-System entschieden.<br />
Wegen der niedrigschwelligen Voraussetzungen<br />
(Vakuumhaftschaftsystem<br />
als Vollkontaktschaft ab geringer<br />
Endbelastungsfähigkeit, Mobilitätsklassen<br />
1–4, ab mittellangem<br />
Stumpf) eignet sich das VPS-System<br />
für ein breites Patientenspektrum.<br />
Seine konstruktiven Elemente halten<br />
den Prothesenschaft – wie unter<br />
Punkt d), „Gangmechanik/Stabilität“,<br />
festgestellt – sowohl in der Ruheposition<br />
als auch beim Laufen sehr<br />
stabil. Ein „Shifting“, also die mediolaterale<br />
Verschiebung des Prothesenschaftes<br />
einhergehend mit dem<br />
Abhebeln der lateralen Anlage, ist in<br />
der Praxis kaum feststellbar. Die Anwendung<br />
des „Kompressionsstrumpfprinzips“<br />
(Reduzierung des Stumpfvolumens<br />
auf Grundlage der RAL-GZ<br />
387/1, also prozentual ansteigend von<br />
proximal nach distal) trägt der Tat-<br />
Grafik: Tobias Vogel<br />
Grafik: Tobias Vogel<br />
Abb. 5 Das VPS-System im alltäglichen Anwendungsvergleich<br />
mit bisherigen Schaftsystemen.<br />
Abb. 6 Die empfundene Stabilität im Vergleich zum vorherigen<br />
Schaftsystem.<br />
102<br />
ORTHOPÄDIE TECHNIK <strong>05</strong>/24
Prothetik<br />
distal zunehmen, lässt sich das VPS-<br />
System leicht an- und ablegen. Ebenso<br />
kommt besonders dieser Anwendergruppe<br />
die beschriebene Eigenstabilität<br />
des Systems zugute. Hier sollte<br />
man zukünftig untersuchen, ob der<br />
Schaftkomfort und die festgestellte<br />
Stabilität des VPS-Systems auch die<br />
Tragezeit sowie die Mobilität/Aktivität<br />
der Anwender:innen erhöhen.<br />
Grafik: Tobias Vogel<br />
Abb. 7 Die von den Anwender:innen festgestellten Vorteile.<br />
sache Rechnung, dass rund 76 % der<br />
Anwender:innen zum Zeitpunkt der<br />
Amputation an einer Gefäßerkrankung<br />
litten.<br />
Diskussion<br />
Die Anzahl der multimorbiden und<br />
geriatrischen Patient:innen mit<br />
Ober schenkelamputationen nimmt<br />
stetig zu [10]. Die Mobilitätsklasse<br />
liegt hier in der Regel bei 1 bis 2.<br />
13 Anwender:innen der vorgestellten<br />
Befragung fielen in diesen Mobilitätsbereich.<br />
Diese Anwendergruppe<br />
sitzt überwiegend und kann zum<br />
Toi lettengang die Prothese häufig<br />
nicht selbstständig an- und ablegen.<br />
Durch die geringen Reduzierwerte<br />
in der Schafteintrittsebene, die nach<br />
Interessenkonflikt:<br />
Der Autor ist für Vogel Orthopädie<br />
Technik, Hersteller des VPS-Systems,<br />
tätig.<br />
Der Autor:<br />
Tobias Vogel<br />
Geschäftsführer Vogel Orthopädie<br />
Technik<br />
Beethovenstr. 9<br />
50226 Frechen<br />
www.ot-vogel.de<br />
Tel. +49 2234 6882673<br />
Mobil +49 163 5511986<br />
Begutachteter Beitrag/reviewed paper<br />
Zitation: Vogel T. Ergebnisse einer Anwender befragung zum subischialen VPS-Schaftsystem. Orthopädie Technik, <strong>2024</strong>; 75 (5): 100–103<br />
Literatur:<br />
[1] Das Pohlig-Bionic-Socket-System (PBSS) – Neue Perspektiven bei der Prothesenversorgung nach Oberschenkelamputation.<br />
Orthopädie Technik, 2014; 65 (5): 62–68<br />
[2] Bethmann R. Biomechanische Einflussfaktoren auf funktionales Schaftdesign. Orthopädie Technik, 2020; 71 (8): 24–29<br />
[3] Ernst J, Stinus H, Greitemann B, Lehmann W. Amputationen im Oberschenkelbereich. e.Medpedia, 2022. https://www.<br />
springermedizin.de/emedpedia/detail/orthopaedie-und-unfallchirurgie/amputationen-im-oberschenkelbereich?epediaDoi<br />
=10.1007%2F978-3-642-54673-0_244 (Zugriff am 15.02.<strong>2024</strong>)<br />
[4] Bethmann R. Biomechanische Einflussfaktoren auf funktionales Schaftdesign. Orthopädie Technik, 2020; 71 (8): 24–29<br />
[5] Fatone S, Caldwell R. Northwestern University Flexible Subischial Vacuum Socket for persons with transfemoral<br />
amputation – Part 1: Description of technique. Prosthetics and Orthotics International, 2017; 41 (3): 237–245. doi:<br />
10.1177/0309364616685229<br />
[6] RAL Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e. V. Medizinische Kompressionsstrümpfe. Gütesicherung<br />
RAL-GZ 387/1, Bonn : RAL Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e. V., 2008. https://www.gzg-kompressionsstruempfe.de/uploads/media/RAL-GZ_387-1_Medizinische_Kompressionsstruempfe.pdf<br />
(Zugriff am 15.02.<strong>2024</strong>)<br />
[7] Vogel Orthopädie Technik. Fragebogen zur Erhebung der Unterschiede zwischen bisherigen Schaftsystemen und<br />
dem VPS-System. https://om5106.n3cdn1.secureserver.net/wp-content/uploads/<strong>2024</strong>/02/Fragebogen.pdf (Zugriff am<br />
15.02.<strong>2024</strong>)<br />
[8] Turner S, McGregor A. Perceived effect of socket fit on major lower limb prosthetic rehabilitation: A clinician and<br />
amputee perspective. Archives of Rehabilitation Research and Clinical Translation, 2020; 2 (3): S100<strong>05</strong>9<br />
[9] Wetz HH. Bericht zum Prüfauftrag Klassifikation von Schaftsystemen und Stumpfbettungen. Münster: Klinische Prüfstelle<br />
für orthopädische Hilfsmittel, 2008<br />
[10] Bemmer L. Behandlungsverlauf nach Amputationen an der unteren Extremität. Inaugural-Dissertation. Göttingen:<br />
Georg-August-Universität, 2020<br />
ORTHOPÄDIE TECHNIK <strong>05</strong>/24<br />
103
Berufsbildung<br />
Auszubildende sammeln Ski-Erfahrungen<br />
Rund 60 Schüler:innen des Max-Born-Berufskollegs nahmen<br />
Mitte Februar an einer Ski-Fortbildung teil. Diese<br />
fand in der Gemeinde Ahrntal in Südtirol statt – über 900 Kilometer<br />
entfernt von Recklinghausen. Zunächst stand für die<br />
Schüler:innen und ihre begleitenden Lehrer:innen das Skifahren<br />
im Vordergrund. Knapp die Hälfte aller Schüler:innen<br />
stand zuvor noch nie auf Skiern und wurde daher in die Basics<br />
des Skifahrens eingeführt, während die Fortgeschrittenen<br />
ihre Fähigkeiten im Schnee verbessern konnten.<br />
Nachdem die Schüler:innen ihre sportlichen Fähigkeiten<br />
trainiert hatten, widmeten sie sich der fachspezifischen<br />
Annährung an das Thema Skifahren. Im Rahmen der<br />
Maßnahme wurde ein theoretisches und praktisches Fachseminar<br />
zum Prothesensystem „ProCarve“ aus dem Hause<br />
Otto bock angeboten. Elisabeth Kecht, Orthopädietechnik-<br />
Meisterin bei der Firma Pohlig in Traunstein, führte gemeinsam<br />
mit Anwender Klaus Rother die Auszubildenden und<br />
Lehrer:innen der Orthopädie-Technik zunächst in einem<br />
Theorieseminar in die Produktlinie ein. Mit diesem System<br />
ist es möglich, sowohl als unter- als auch oberschenkelamputierter<br />
Anwender mit einer Prothese Ski zu fahren.<br />
Wie Kecht berichtet, ging sie mit ungewisser Erwartung<br />
in dieses Seminar, da es ihre erste Veranstaltung war, die sich<br />
um das „ProCarve“-System drehte. „Somit wusste ich nicht,<br />
wie hoch das Interesse der Azubis sein würde. Ich wurde jedoch<br />
sehr positiv überrascht“, erzählt sie. „Die Azubis waren<br />
sehr aufgeschlossen. Mit so vielen Fragen und einem so<br />
hohen Interesse habe ich gar nicht gerechnet. Das hat mich<br />
sehr gefreut!“ Auch für den Anwender Klaus Rother war es<br />
eine Premiere.<br />
Grau ist bekanntlich alle Theorie, daher folgte als zweiter<br />
Teil des Seminars der Feldversuch auf der Piste. Hier<br />
waren die Auszubildenden erstaunt, welchen sehenswerten<br />
Fahrstil Rother mit diesem Prothesensystem präsentieren<br />
konnte. Vor Kleingruppen berichtete er direkt auf<br />
der Piste von den praktischen Details, die durch Angaben<br />
für die orthopädie-technischen Umsetzungen von Kecht<br />
ergänzt wurden. Hier fasst Kecht zusammen: „Die Fragen<br />
der Teilnehmer:innen waren sehr gut bedacht und<br />
die Neugier der Auszubildenden war groß. Ich denke, es<br />
war gut, den Schüler:innen die Antworten aus orthopädietechnischer<br />
und von der Anwenderansicht zu geben,<br />
um die Vor- und Nachteile der Passteile im Alltag aufzuzeigen.“<br />
Auf die Frage, ob beide Referenten im nächsten Jahr<br />
noch einmal ein solches Seminar durchführen würden,<br />
antworteten sie einstimmig: „Auf jeden Fall! Wir würden<br />
uns beide sehr über eine erneute Anfrage freuen und wären<br />
nächstes Jahr gerne wieder mit dabei!“ Matthias Quante,<br />
Organisator der Fahrt und Lehrer am Max-Born-Berufskolleg,<br />
bedankte sich im Namen aller Auszubildenden<br />
und Lehrer:innen sehr herzlich. Er hob hervor, dass viele<br />
Ausbildungsbetriebe ihre Auszubildenden für diese Fahrt<br />
finanziell unterstützt haben, und dankte auch der Firma<br />
Ottobock für die Unterstützung. Noch direkt auf der Piste<br />
stellte Quante bereits die Anfrage für ein weiteres Seminar<br />
im nächsten Schuljahr.<br />
Daniel Schulze Frenking<br />
Max-Born-Berufskolleg, Recklinghausen<br />
Fotos [3]: Daniel Schulze Frenking<br />
Anwender Klaus Rother zeigte den<br />
Auszubildenden auf der Piste, wie das<br />
vorgestellte Prothesensystem in der<br />
Praxis funktioniert.<br />
Premiere: Elisabeth Kecht kam aus Traunstein nach Ahrntal, um den Schüler:innen<br />
das Prothesensystem vorzustellen.<br />
104<br />
ORTHOPÄDIE TECHNIK <strong>05</strong>/24
BIV Café<br />
Kaffee und Faktensnacks<br />
im BIV Café auf der<br />
OTWorld<br />
Genießen<br />
und informieren<br />
in Halle 3<br />
Stand D10/E11<br />
Wir laden ein zu Kaffeegenuss<br />
und Informationshäppchen,<br />
präsentiert von den Experten<br />
des deutschen Spitzenverbandes<br />
der Orthopädie-Technik,<br />
die über die heißen<br />
Themen der<br />
Branche<br />
berichten.<br />
Telematik<br />
Kalkulationsdatenbank<br />
E-Verordnung<br />
Hilfsmittelreform<br />
Zulassung<br />
Online-Versorgung<br />
Präqualifizierung Hilfsmittelverzeichnis<br />
Absetzung vermeiden<br />
Digitalisierung<br />
Herzlich willkommen im BIV Café<br />
auf der OTWorld <strong>2024</strong>.
Markt<br />
Weiteres Wachstum<br />
für Ottobock<br />
Wachstum steht für<br />
Hans Georg Näder, Gründerenkel<br />
und Chef des<br />
Verwaltungsrats von<br />
Ottobock, ganz oben auf<br />
der Prioritätenliste.<br />
Foto: Ottobock<br />
Vor rund sieben Jahren stieg die Private-Equity-Gesellschaft<br />
EQT bei Ottobock ein und übernahm ein Fünftel<br />
des Unternehmens. In der darauffolgenden Phase<br />
folgten ein starkes Umsatzwachstum sowie eine nochmalige<br />
Steigerung der Professionalisierung bei dem Duderstädter<br />
Unternehmen. Nun entschied sich die Familie<br />
um Gründerenkel Prof. Hans Georg Näder dazu, den<br />
zuvor veräußerten 20-Prozent-Anteil zurückzukaufen.<br />
Im Gespräch mit der OT-Redaktion erklärt Näder diesen<br />
Schritt.<br />
OT: Herr Prof. Näder, 2017 stieg EQT mit einem 20-Prozent-<br />
Anteil bei Ottobock ein, nach sechs Jahren kaufte Ihre Familie<br />
den Anteil wieder zurück. Wie bewerten Sie die gemeinsame<br />
Zeit mit EQT?<br />
Hans Georg Näder: Die Zusammenarbeit mit EQT war von<br />
hohem gegenseitigem Respekt und Vertrauen geprägt. Und<br />
sie war sehr erfolgreich: 2023 haben wir den höchsten Umsatz<br />
und das beste Ergebnis in der Unternehmensgeschichte<br />
erzielt. Über den gesamten Zeitraum haben wir den Umsatz<br />
von rund 880 Millionen Euro um rund 8 Prozent pro<br />
Jahr auf rund 1,5 Milliarden Euro im Jahr 2023 gesteigert.<br />
Das bereinigte EBITDA hat sich auf rund 280 Millionen<br />
Euro verdoppelt. Mindestens genauso wichtig ist, dass wir<br />
Ottobock mit dem Support von EQT weiter professionalisiert<br />
und bis zur IPO-Readiness entwickelt haben. Damit<br />
haben wir eine starke Basis für die nächste Wachstumsphase<br />
unseres Unternehmens gelegt. Es war jedoch von Anfang<br />
an klar, dass EQT für uns ein Partner auf Zeit sein wird. Jetzt<br />
werden wir die erfolgreiche Strategie als reines Familienunternehmen<br />
in der Rechtsform der SE & Co. KGaA fortsetzen,<br />
im Besitz meiner Familie und unter der Führung von<br />
CEO Oliver Jakobi und seinem starken Managementteam.<br />
OT: Ist der Rückkauf die logische Konsequenz aus der aktuellen<br />
Firmenstrategie, auf Wachstum zu setzen?<br />
Näder: Als EQT nach einem Käufer für die 20 Prozent suchte,<br />
gab es eine Reihe Interessenten. Im Laufe des Auswahlprozesses<br />
haben wir als Familie dann entschieden, Ottobock<br />
wieder zu einem 100-prozentigen Familienunternehmen<br />
zu machen. Der Wachstumskurs, auf dem wir uns befinden,<br />
steht in unserer Strategie im Fokus.<br />
OT: Der Einstieg von EQT war von außen auch mit einem potenziellen<br />
Börsengang Ottobocks verbunden. In der jüngeren<br />
Vergangenheit haben Sie dieses Vorhaben bereits von der Liste<br />
mit der höchsten Priorität gestrichen. Wie ist der Stand bei Ottobock<br />
und der Börse?<br />
Näder: Auf unserer Prioritätenliste ganz oben steht stetiges<br />
Wachstum. Nur so können wir weiterhin in Forschung<br />
und Entwicklung investieren und alles daransetzen, für<br />
unsere Anwenderinnen und Anwender weltweit die besten<br />
Produkte, Services und eine exzellente Rundumversorgung<br />
zur Verfügung zu stellen. Ein Börsengang bleibt jedoch<br />
weiterhin das Ziel. Die Grundlagen dafür haben wir<br />
geschaffen. Wann es so weit sein wird, werden wir sehen.<br />
OT: In anderen Medien wurde über den Kaufpreis spekuliert.<br />
Fakt ist: Durch die Wertsteigerung des Unternehmens in den<br />
vergangenen Jahren dürfte der Kaufpreis gegenüber dem Verkaufspreis<br />
gestiegen sein. Was kostet es Sie, Ottobock wieder<br />
komplett in die Familienhände zurückzuholen?<br />
Näder: Wir haben über die Näder Holding GmbH mit einem<br />
Investorenkonsortium ein Finanzierungspaket in<br />
Höhe von 1,1 Milliarden Euro vereinbart, um das zukünftige<br />
Wachstum von Ottobock zu unterstützen. Zu weiteren<br />
Finanzierungsdetails äußern wir uns jedoch nicht.<br />
OT: Finanzielle und wirtschaftliche Interessen auf der einen,<br />
emotionale Beweggründe auf der anderen Seite: Was bedeutet<br />
es Ihnen persönlich zu wissen, dass Ottobock wieder<br />
ein reiner Familienbetrieb ist, und was bedeutet es für Ihre<br />
Mitarbeiter:innen?<br />
Näder: Für meine Familie und mich ist es ein schöner Moment<br />
der Firmengeschichte, im 1<strong>05</strong>. Jahr von Ottobock<br />
wieder als 100-prozentiges Familienunternehmen zu agieren.<br />
Ich danke allen involvierten Teams, die daran mitgewirkt<br />
haben, das zu ermöglichen. Und auch die Mitarbeiterinnen<br />
und Mitarbeiter freuen sich über diesen Schritt. Gemeinsam<br />
werden wir den erfolgreichen Weg weitergehen<br />
und uns dabei an unseren Unternehmenswerten „menschlich“,<br />
„verlässlich“, „erfinderisch“ und „smart“ orientieren.<br />
OT: Sie sind die dritte Generation Ihrer Familie in der Unternehmensführung,<br />
Ihre Töchter sind in unterschiedlichen Rollen<br />
ebenfalls im Unternehmen tätig. Haben Sie sich im Vorfeld des<br />
Rückkaufs abgestimmt und hatten Ihre Töchter ein Mitspracherecht?<br />
Näder: Über die Zukunft des Unternehmens tauschen wir<br />
uns in der Familie eng aus. Über den Rückkauf der Anteile<br />
waren wir uns einig.<br />
OT: Mit Blick auf die Zukunft von Ottobock – welche Auswirkungen<br />
hat der Rückkauf auf Unternehmen und Branche?<br />
Näder: Wir haben in den vergangenen Jahren und mit der<br />
Unterstützung von EQT große Schritte gemacht. Auf diesem<br />
Wachstumspfad werden wir uns konsequent fortbewegen<br />
und dabei auch die Digitalisierung und den Einsatz<br />
von Künstlicher Intelligenz in der Branche als Vorreiter<br />
106<br />
ORTHOPÄDIE TECHNIK <strong>05</strong>/24
Markt<br />
weiter vorantreiben. Auf der diesjährigen OTWorld werden<br />
– neben unseren Produktlaunches – digitale Versorgungsprozesse<br />
deshalb wieder eine Rolle spielen. Unser Hauptaugenmerk<br />
legen wir weiterhin auf die Anwenderinnen<br />
und Anwender, um sie dabei zu unterstützen, möglichst<br />
das Leben zu leben, das sie sich vorstellen. Unser Purpose<br />
– Mobilität für Menschen mit Handicap – ist aktueller und<br />
wichtiger denn je. Jetzt, nach dem erfolgreichen Closing,<br />
heißt es deshalb: mit Volldampf voraus!<br />
Die Fragen stellte Heiko Cordes.<br />
Mark Jalaß neuer BVMed-<br />
Vorstandsvorsitzender<br />
Nach 17 Jahren an der Spitze des Bundesverbandes<br />
Medizintechnologie (BVMed) ist für Dr. Meinrad<br />
Lugan Schluss. Der Vorstandsvorsitzende stellte<br />
sich bei der Mitgliederversammlung Mitte April<br />
nicht mehr zur Wiederwahl. Lugan und der ebenfalls<br />
ausgeschiedene Dr. Manfred Elff wurden von<br />
den BVMed-Mitgliedern aufgrund ihrer langjährigen<br />
Verdienste zu Ehrenmitgliedern des Vorstands<br />
gewählt. Neuer starker Mann auf der Kommandobrücke<br />
des Medizintechnikverbandes ist Mark Jalaß.<br />
Der 58-Jährige ist Direktor Marketing und Vertrieb<br />
ambulanter Bereich und Industrie bei Lohmann &<br />
Rauscher. Jalaß ist seit 2018 im BVMed-Vorstand und<br />
bereits seit 2008 als Sprecher verschiedener BVMed-<br />
Arbeitskreise aktiv. Zu seinen stellvertretenden Vorsitzenden<br />
wurden Dorothee Stamm von Medtronic<br />
und Marc Michel von Peter Brehm gewählt.<br />
Als weitere Vorstandsmitglieder treten Dr. Chima<br />
Abuba von GHD, Alexia Anapliotis von Merete, Stefan<br />
Geiselbrechtinger von Oped, Manuela Hoffmann-Lücke<br />
von Paul Hartmann, Frank Kirchner<br />
von B. Braun und Dr. med Hans-Christian Wirtz von<br />
Johnson & Johnson an. Außerdem ist BVMed-Geschäftsführer<br />
Dr. Marc-Pierre Möll Mitglied des Vorstands.<br />
Ausgeschieden aus dem BVMed-Vorstand<br />
sind zudem Manfred Hinz (3M) und Kristof Boogaerts<br />
(Johnson & Johnson Medical).<br />
FUSSKONGRESS<br />
ÖGF MEETS D.A.F.<br />
29. JAHRESTAGUNG DER D.A.F.<br />
Foto: BVMed/Manfred Beeres<br />
© https://www.erfolgsliebe.com<br />
Mark Jalaß, Dorothee Stamm und Marc Michel (v. l.)<br />
führen künftig den BVMed als Vorstand an.<br />
ORTHOPÄDIE TECHNIK <strong>05</strong>/24<br />
www.fusskongress.de
Neues aus der Industrie<br />
Knieprothesen bequem anpassen<br />
mit der connectgo.pro App<br />
Anzeige<br />
Die individuelle Anpassung<br />
mechatronischer Knieprothesen<br />
ist ein komplexer<br />
Prozess, der hohe Präzision erfordert. Ziel ist es, ein optimales<br />
Nutzungserlebnis und eine hohe Passgenauigkeit zu gewährleisten,<br />
indem die Prothese perfekt auf den Anwender<br />
abgestimmt wird. Schritt für Schritt analysiert der Orthopädietechniker<br />
das Bewegungsverhalten des Nutzers und<br />
stellt darauf basierend die Prothese ein. Für die Anpassung<br />
nutzt er abhängig vom Prothesentyp unterschiedliche Anwendungen.<br />
Foto: © Ottobock<br />
Die Einstellung der<br />
Knieprothese mit Laptop<br />
und Desktop-Applikation<br />
gehört bald der Vergangenheit<br />
an. Zukünftig<br />
können Orthopädietechniker<br />
für diesen Prozess<br />
das Smartphone mit<br />
der connectgo.pro App<br />
nutzen.<br />
Nutzerfreundlich, effizient und<br />
nur ein einziges System<br />
Um diesen oft zeitintensiven Prozess zu optimieren, hat<br />
Ottobock gemeinsam mit dem Unternehmen BAYOOMED<br />
die connectgo.pro App entwickelt. Mit dieser App können<br />
bald alle Knieprothesen von Ottobock mit nur einer App<br />
eingestellt werden – ganz bequem vom Smartphone oder<br />
Tablet aus. „Mit der neuen<br />
App ist der Orthopädietechniker<br />
bei der Einstellung<br />
der Knieprothesen deutlich<br />
flexibler als mit den<br />
bisherigen Anwendungen<br />
für Laptops und kann im<br />
engen Austausch mit dem<br />
Prothesenträger schnell<br />
Foto: © BAYOOMED<br />
Ausschnitt aus dem<br />
User Interface der neuen<br />
connectgo.pro App.<br />
und unkompliziert die Anpassungen<br />
in der App vornehmen“,<br />
erläutert Florian<br />
Mayer, Projektleiter von<br />
BAYOOMED. „Wir haben<br />
viele Erfahrungswerte aus<br />
der Praxis in die Entwicklung<br />
der App einfließen lassen und besonderen Wert auf<br />
eine gute Nutzerfreundlichkeit gelegt.“<br />
Die connectgo.pro App bietet noch weitere Vorteile: Da<br />
die App zukünftig alle Ottobock-Knieprothesen unterstützt,<br />
müssen Orthopädietechniker bei der Zertifizierung<br />
für die jeweilige Prothese nur ein einziges System beherrschen.<br />
Gleichzeitig fallen Wartung und die Durchführung<br />
von Updates ebenfalls nur noch für ein einziges System<br />
an, sodass Aktualisierungen schneller angeboten werden<br />
können. Wie bei den bisherigen Systemen hat der Orthopädietechniker<br />
über die connectgo.pro App einfachen Zugang<br />
zu Online-Inhalten und kann weiterhin Anwendern<br />
„MyModes“ für spezielle Aktivitäten einstellen, die diese<br />
mit der Cockpit App anpassen können.<br />
„Das Team von BAYOOMED hat unsere Anforderungen<br />
an die neue App sofort verstanden und sehr gut umgesetzt“,<br />
freut sich Bernhard Prochaska, Product Owner von<br />
Ottobock. „Wir sind froh, unseren Kunden mit der neuen<br />
App ein Tool an die Hand geben zu können, das ihnen Arbeitsprozesse<br />
erleichtert und Zeit spart.“<br />
Ab Mai wird die connectgo.pro App für die ersten<br />
Knieprothesen von Ottobock verfügbar sein. Weitere<br />
Knieprothesentypen werden über das Jahr hinweg von<br />
der App unterstützt.<br />
BAYOOMED – Das Unternehmen<br />
hinter der App<br />
Hinter der Entwicklung der connectgo.pro App steht<br />
BAYOOMED mit Hauptsitz in Darmstadt. Das Unternehmen<br />
ist spezialisiert auf die Entwicklung von Medical Apps und<br />
medizinischer Software.<br />
Mit über 250 Personenjahren<br />
Projekterfahrung<br />
in der Softwareentwicklung<br />
im regulierten Medizin-<br />
und Pharma umfeld<br />
und mehr als 400 Medizintechnikkunden<br />
zählt das<br />
Unternehmen zu den erfahrensten<br />
medizinischen<br />
Softwareentwicklern in<br />
Europa. „Wir freuen uns<br />
über das Vertrauen, das<br />
Ottobock uns als Dienstleister<br />
entgegengebracht<br />
hat“, betont Miriam Schulze,<br />
Geschäftsführerin von<br />
BAYOOMED. „Durch die<br />
intensive Zusammenarbeit<br />
der jeweiligen Projektteams,<br />
konnten wir<br />
wertvolle Erfahrungswerte<br />
aus Orthopädietechnik<br />
mit unseren Kenntnissen<br />
im Bereich medizinischer<br />
Apps zu einem tollen Ergebnis<br />
zusammenführen.“<br />
Das BAYOOMED-Team, das<br />
die neue connectgo.pro App<br />
entwickelt hat.<br />
Besuchen Sie den<br />
BAYOOMED-Stand in Halle 3,<br />
F23 auf der OT World<br />
(14. – 17. Mai <strong>2024</strong>) und informieren<br />
Sie sich über die<br />
neue connectgo.pro App<br />
oder individuelle medizinische<br />
Softwarelösungen für<br />
Ihr Unternehmen.<br />
Weitere Informationen unter: www.bayoomed.com<br />
Foto: © BAYOOMED<br />
108<br />
ORTHOPÄDIE TECHNIK <strong>05</strong>/24
STELLENANGEBOTE<br />
Ralf Münch<br />
Großenbaumer Allee 250<br />
47249 Duisburg<br />
Tel.: 0203-764011<br />
www.muench-hahn.de<br />
www.muench-ot.de<br />
Orthopädietechniker Meister<br />
(m/w/d)<br />
// Vollzeit ab sofort<br />
Ihre Aufgaben:<br />
• Fertigen von individuellen<br />
Hilfsmitteln der Groß orthopädie<br />
• Beratung und Anpassung der<br />
Hilfsmittel am Kunden<br />
• Ansprechpartner für<br />
Kostenträger<br />
• Mitarbeiterführung<br />
• Mitbetreuung der BG-Klinik<br />
• Administrative Aufgaben<br />
Ihr Profil:<br />
• Abgeschlossene Ausbildung zum<br />
Orthopädietechnikermeister<br />
• Erfahrung im Bereich der<br />
individuellen Orthetik und<br />
Prothetik<br />
• Sie sind bereit, Verantwortung<br />
zu übernehmen?<br />
Wir bieten:<br />
• Einen verantwortungsvollen<br />
Job in einem starken TEAM<br />
• Arbeiten mit den neusten<br />
Innovationen der OT<br />
• Langfristige Perspektive in<br />
einem zukunftsorientierten<br />
Familienbetrieb<br />
• Leistungsgerechte Bezahlung<br />
• Urlaubs- und Weihnachtsgeld<br />
• Firmenwagen<br />
Über Ihre Bewerbung an<br />
rtm@muench-ot.de würde ich mich sehr freuen!<br />
<strong>2024</strong>-04_Münch.indd 1 19.04.<strong>2024</strong> 10:22:20<br />
360-ot.de/jobs<br />
109
STELLENANGEBOTE<br />
Besuchen Sie<br />
uns im Internet!<br />
www.360-ot.de<br />
am Wörthersee -<br />
wo andere Urlaub<br />
machen :)<br />
Modernes Sanitätshaus mit Groß-/Kleinorthopädie<br />
sowie Reha-Technik in zentraler Lage Berlins aus<br />
Altersgründen zu verkaufen.<br />
Wir suchen Verstärkung für unser Team am<br />
„maierhofer campus“ in Klagenfurt:<br />
Orthopädie-Techniker (m/w/d)<br />
Ihre Aufgaben bei uns:<br />
• Fachgerechte Fertigung von Prothesen & Orthesen,<br />
inkl. Anpassungsarbeiten & Servicierung<br />
• Kundenversorgung mit weiteren orthopädischen<br />
Heilbehelfen & Hilfsmitteln in unseren Filialen und im<br />
regionalen Außendienst (Kliniken, Pflegeheime, etc.)<br />
• Kontaktpflege & Zusammenarbeit im Bereich med.<br />
Einrichtungen, Kliniken, Fachärzte, Therapeuten, etc.<br />
Wir bieten Ihnen:<br />
• Ein spannendes und verantwortungsvolles Aufgabengebiet<br />
in einem modernen Arbeitsumfeld<br />
• Div. Benefits wie: Rabatte für Mitarbeiter*innen, Kinderbetreuungszuschuss,<br />
Fortbildungen, Parkplatz, etc.<br />
• Unterstützung bei der Wohnungssuche<br />
• Einen Arbeitsplatz in einer Region, in der andere Urlaub<br />
machen :)<br />
Anforderungen:<br />
• Sie haben eine abgeschlossene Orthopädietechnik-Ausbildung<br />
und sind mit Versorgungen im Bereich Prothetik<br />
& Orthetik vertraut<br />
• Sie haben Freude an der Arbeit mit Menschen und zeichnen<br />
sich durch Einfühlungsvermögen und Teamgeist aus<br />
• Sie haben einen Führerschein Klasse B<br />
Wir bieten eine attraktive und leistungsgerechte Bezahlung,<br />
mit der Bereitschaft zur Überzahlung je nach Qualifikation und<br />
Erfahrung. Das Mindestgehalt für diese Position lt. Kollektivvertrag<br />
beträgt 2.780,00 Euro brutto (38,5h Vollzeit, 14x jährlich).<br />
Sie fühlen sich angesprochen?<br />
Dann senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen, bitte<br />
zu Handen unseres OT-Meisters Christopher Pirker, an:<br />
bewerbung@maierhofer.co.at<br />
maierhofer GmbH<br />
Eiskellerstraße 3-5<br />
9020 Klagenfurt am Wörthersee<br />
maierhofer.co.at/karriere<br />
www.maierhofer.co.at<br />
T: +43 (0)463 56 5960<br />
Wir sind zertifiziert für C-Leg, Kinevo und Myoarm -<br />
prothetik. Unser Haus verfügt über langjährige Erfahrung<br />
und wir haben einen stets wachsenden Kundenstamm.<br />
Durch unsere engen Kontakte zu niedergelassenen Ärzten,<br />
Kliniken und Behörden des Landes Berlin sind wir<br />
bestens vernetzt.<br />
Die zentrale Lage unseres Sanitätshauses bietet eine<br />
exzellente Verkehrsanbindung und gute Erreichbarkeit<br />
für unsere Kunden. Zudem verfügen wir über einen<br />
großen Kundenparkplatz.<br />
Langfristiger Mietvertrag kann zugesichert werden.<br />
Wir freuen uns über Ihre Zuschriften unter<br />
berlinprosthetics@gmail.com<br />
Zuerst wissen,<br />
wer sucht!<br />
Abonnieren Sie unseren<br />
kostenlosen JOBLETTER und<br />
erhalten Sie jeden Monatsanfang<br />
die aktuellsten Stellenangebote,<br />
-gesuche und Kleinanzeigen<br />
aus der Branche.<br />
Anmeldung unter:<br />
360-ot.de/newsletteranmeldung<br />
www.360-ot.de<br />
110 360-ot.de/jobs
Schulleitung (m/w/d) der<br />
Bundesfachschule für Orthopädie-Technik<br />
Ziel der Stelle<br />
Mit 70 Jahren Erfahrung in der Fort- und Weiterbildung im Bereich Orthopädie- und Rehabilitationstechnik zählt<br />
die Bundesfachschule für Orthopädietechnik zu den führenden branchenbezogenen Bildungseinrichtungen.<br />
Meistervorbereitungslehrgänge, Fortbildungsseminare und ein Bachelor- sowie Masterstudiengang als Franchise-<br />
Studienangebot der Fachhochschule Dortmund bilden die Kernkompetenz der Bildungseinrichtung und ihrer<br />
angeschlossenen Institute, IMB und IQZ. Träger der Einrichtung ist der als gemeinnützig anerkannte eingetragene<br />
Verein Bundesfachschule für Orthopädietechnik e. V.<br />
Für ein engagiertes Team mit 30 Mitarbeitenden, suchen wir ab sofort eine Schulleitung (m/w/d) in Vollzeit (40 Stunden/<br />
Woche). Wir freuen uns über Bewerbungen von Menschen, die kreativ auf dem vorhandenen aufbauen, konstruktiv<br />
Projekte verwirklichen, eine Leidenschaft für das Thema Orthopädie- und Rehabilitationstechnik mitbringen und<br />
wertschätzend Mitarbeitende führen.<br />
Aufgaben<br />
• Sie übernehmen die fachliche Leitung der Bundesfachschule für Orthopädie-Technik mit ihren Einrichtungen<br />
• Sie repräsentieren die Bundesfachschule in Gremien, Ausschüssen und Fachkreisen<br />
• Sie sind verantwortlich für die Koordination der Arbeit des Trägervereins gemeinsam mit dem Vorstand und<br />
der Geschäftsführung des Vereins<br />
• Sie verantworten die strategische Planung, Koordination und operative Umsetzung der Lehrangebote<br />
• Sie übernehmen die Leitung der operativen Abläufe der Bundesfachschule in fachlichen, personellen,<br />
organisatorischen, administrativen und kommunikativen Belangen<br />
• Sie sind verantwortlich für die Weiterentwicklung der Einrichtung sowie für die Beantragung, Umsetzung<br />
und Verwaltung von öffentlichen Fördermitteln<br />
Profil<br />
• Sie (m/w/d) bringen eine Master- oder Meister- Qualifikation oder einen Facharztabschluss mit Nähe zur<br />
Orthopädie- und Rehabilitationstechnik oder einen vergleichbaren Abschluss mit<br />
• Sie verfügen über die pädagogische Qualifikation (Ausbildereignungsprüfung o. Ä.) und haben eine Affinität zu<br />
den an der dualen beruflichen Bildung beteiligten Akteuren<br />
• Sie konnten bereits Führungserfahrung sammeln und Ihr Führungsstil ist sehr integrativ und wertschätzend geprägt<br />
• Sie sind offen für die kontinuierliche Einarbeitung in neue Themengebiete<br />
• Sie bringen ein hohes Maß an Kommunikations- und Kooperationskompetenz auf allen Ebenen der<br />
Leitungsaufgaben mit<br />
• Sie haben Freude an kreativen Lösungswegen und kooperativer Entscheidungsfindung und binden Ihr Team aktiv ein<br />
• Die Zusammenarbeit mit Menschen mit Handicap liegt Ihnen am Herzen<br />
Benefits<br />
• Vielfältiges und interessantes Aufgabengebiet mit großen Gestaltungsspielräumen und hoher Eigenverantwortung<br />
• Eine für eine gemeinnützige Bildungseinrichtung attraktive Vergütung<br />
• Flache Hierarchien und direkte Kommunikationsstrukturen<br />
• Systematische Einarbeitung sowie eine angenehme Arbeitsatmosphäre in einem kompetenten, offenen und<br />
motivierten Team<br />
• Einen sicheren Arbeitsplatz mit der Möglichkeit, sich persönlich sowie fachlich weiterzuentwickeln<br />
Dann senden Sie uns Ihre Bewerbung bitte bis zum 30.06.<strong>2024</strong> ausschließlich per Mail an Bewerbung@ot-bufa.de<br />
und geben Sie neben Ihrem frühestmöglichen Eintrittstermin auch Ihre Gehaltsvorstellung an. Bitte verwenden Sie<br />
bei Anhängen ausschließlich das PDF-Format oder gezippte Dateien.<br />
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!<br />
Bundesfachschule für Orthopädie-Technik e. V.<br />
Schliepstraße 6-8 • 44135 Dortmund<br />
Lars Grun, Alf Reuter, Vorsitzende des Trägervereins<br />
Ass. Norbert Stein, Geschäftsführer des Bundesfachschule für Orthopädie-Technik e. V.<br />
111
STELLENANGEBOTE<br />
WERDEN SIE TEIL DES TEAMS<br />
Wir suchen für die PLZ-Gebiete 30-34, 37-39 und 49 zum 1. November <strong>2024</strong> einen<br />
Außendienstmitarbeiter (M/W/D)<br />
Aufgabengebiete eines Außendienstmitarbeiters bei FIOR & GENTZ sind vielseitig!<br />
Die Vermittlung von theoretischen sowie praktischen Kenntnissen im modernen<br />
Orthesenbau ist grundlegender Bestandteil Ihrer Aufgaben. Sie unterstützen<br />
unsere Kunden von der Patientenbefundung über die Herstellung der Orthese<br />
bis zur Übergabe der Orthese. Zu Ihren Aufgaben gehört außerdem die<br />
qualifizierte Beratung zu Orthesengelenken, Orthesenschuhen und<br />
Therapieschuhen sowie deren Verkauf.<br />
Ihr Profil:<br />
Sie sind ausgebildeter Orthopädietechnik-Mechaniker/-Meister mit<br />
Erfahrung im Bereich des Orthesenbaus – dann freuen wir uns auf<br />
Ihre Bewerbung!<br />
Unser Angebot:<br />
Firmenwagen (auch zur privaten Nutzung)<br />
leistungsgerechte Vergütung<br />
umfassende Einarbeitung in Lüneburg<br />
sicherer Arbeitsplatz in einem erfolgreichen, krisenfesten Unternehmen<br />
Tätigkeit in einem interessanten und abwechslungsreichen Aufgabengebiet<br />
vermögenswirksame Leistungen, betriebliche Altersvorsorge<br />
30 Tage Urlaubsanspruch bei einer 5-Tage-Woche<br />
Wir freuen uns auf Ihre schriftliche und aussagekräftige Bewerbung,<br />
gern auch per E-Mail an: bewerbungen@fior-gentz.de.<br />
PLZ-<br />
Gebiete<br />
30-34,<br />
37-39,<br />
49<br />
Gesellschaft für Entwicklung und Vertrieb<br />
von orthopädietechnischen Systemen mbH<br />
Dorette-von-Stern-Straße 5<br />
21337 Lüneburg (Deutschland)<br />
+49 4131 24445-0<br />
+49 4131 24445-57<br />
bewerbungen@fior-gentz.de<br />
www.fior-gentz.de<br />
Jetzt ist<br />
Buchen Sie Ihre<br />
Anzeige bis:<br />
Schluss!<br />
13.<strong>05</strong>.<strong>2024</strong><br />
stellenmarkt@360-ot.de<br />
Besuchen Sie<br />
uns im Internet!<br />
www.360-ot.de<br />
112 360-ot.de/jobs
„Mit KI bewegt sich was“<br />
Illustration: Karlheinz Baumann
Vorschau Juni<br />
Schwerpunktthema 1:<br />
Brustversorgung<br />
Versorgungsmöglichkeiten des Lymphödems<br />
Trotz der weltweiten Zunahme von Brustkrebsfällen bleibt<br />
das sekundäre Lymphödem nach Mammakarzinom eine oft<br />
vernachlässigte Folgeerkrankung in der öffentlichen Diskussion.<br />
Im Zuge der konservativen Therapie ist die Versorgung<br />
mit medizinischen Hilfsmitteln ein wichtiger Grundpfeiler<br />
der Behandlung. Die Aufklärung über das Lymphödem inklusive<br />
entsprechender Therapiemöglichkeiten soll nicht<br />
nur das Bewusstsein schärfen, sondern auch die Grundlage<br />
für verbesserte Präventions-, Behandlungs- und Versorgungsstrategien<br />
schaffen. Konkret wird die Notwendigkeit<br />
einer verstärkten Sensibilisierung und besseren Versorgung<br />
mit Hilfsmitteln innerhalb der Mammakarzinom-Therapie<br />
auf gezeigt. Medizinische Kompressionsstrümpfe und<br />
-handschuhe, Kompressions-BHs, Brustprothesen und weitere<br />
Hilfs mittel zur Versorgung von Lymphödemen nach<br />
Mamma karzinom-Therapie werden besprochen.<br />
Schwerpunktthema 2:<br />
Kommunikation im Sanitätshaus<br />
Verkaufs- und Beratungsgespräche<br />
souverän meistern<br />
Die nächste<br />
Ausgabe<br />
erscheint am<br />
<strong>05</strong>.06.<strong>2024</strong>.<br />
Seine Kund:innen sieht man am liebsten mit einem<br />
Lächeln aus der Tür gehen. Doch was, wenn das<br />
Beratungsgespräch nicht wie geplant verläuft? Wie<br />
in der Werkstatt braucht es auch hinter dem Verkaufstresen<br />
das richtige Werkzeug. Wann welches<br />
gezückt werden sollte, erklärt ein Online- Seminar der<br />
Confairmed. Unter dem Titel „Souveräne Kommunikation<br />
mit Kunden im Sanitätshaus“ bietet Beraterin<br />
Julia Kamleiter ab Juni <strong>2024</strong> einen Einsteiger- und einen<br />
Aufbaukurs an. Für sie ist eine gelungene Kommunikation<br />
in Beratung und Verkauf sowie in Reklamations-<br />
und Konfliktsituationen die Grundlage für<br />
eine langfristige Kundenbeziehung. In der OT verrät<br />
Kamleiter, was die Teilnehmer:innen erwartet.<br />
Impressum<br />
ORTHOPÄDIE TECHNIK: Offizielles Fachorgan<br />
des Bundesinnungsverbandes für Orthopädie-<br />
Technik. Erscheint 12-mal im Jahr. Bezugspreis<br />
inkl. Versand jährlich Inland 159,90 Euro<br />
(inkl. MwSt.), Ausland 189,90 Euro (ggf. zzgl.<br />
MwSt.). Auch mit Ermäßigung für Studierende/<br />
Auszubildende erhältlich (nur gültig mit Nachweis).<br />
Kündigungsfrist: Das Abo gilt zunächst<br />
für ein Jahr. Danach monatlich kündbar.<br />
ISSN 0340-5591<br />
Herausgeber:<br />
Bundesinnungsverband für Orthopädie-Technik<br />
Postfach 10 06 51, 44006 Dortmund<br />
Reinoldistraße 7-9, 44135 Dortmund<br />
Tel. +49 231 55 70 50-0, Fax -40<br />
www.biv-ot.org<br />
Geschäftsführung: Georg Blome<br />
Verleger:<br />
Verlag Orthopädie-Technik<br />
Postfach 10 06 51, 44006 Dortmund<br />
Reinoldistraße 7-9, 44135 Dortmund<br />
Tel. +49 231 55 70 50-50, Fax -70<br />
info@biv-ot.org, www.360-ot.de<br />
Verlagsleitung:<br />
Susanne Böttcher<br />
Programmleitung:<br />
Michael Blatt (V.i.S.d.P.)<br />
Ständige Redaktion:<br />
Heiko Cordes (CvD), Pia Engelbrecht,<br />
Anja Knies, Brigitte Siegmund<br />
Lektorat:<br />
7Silben/Tanja Jentsch<br />
Wissenschaftlicher Beirat:<br />
Dipl.-Ing. Merkur Alimusaj, Heidelberg<br />
Silke Auler, Dortmund<br />
Jan Becker, Dortmund<br />
Ralph Bethmann, Duderstadt<br />
Dr. Harald Böhm, Aschau i. Chiemgau<br />
Prof. em. Dr.-Ing. Ulrich Boenick, Berlin<br />
Dr. med. Hartmut Bork, Sendenhorst<br />
Prof. Dr. med. Frank Braatz, Göttingen<br />
PD Dr. med. habil. Lutz Brückner,<br />
Bad Klosterlausnitz<br />
Dr. med. Tymoteusz Budny, Münster<br />
Prof. Dr. med. Martin Engelhardt, Osnabrück<br />
Dr. med. Jennifer Ernst, Hannover<br />
Olaf Gawron, Heidelberg<br />
Prof. Dr. med. Goetz A. Giessler, Zug<br />
Dr. med. Jürgen Götz, Regensburg<br />
Prof. Dr. med. Bernhard Greitemann,<br />
Bad Rothenfelde<br />
Dipl. Ing. Daniel Heitzmann, Heidelberg<br />
Rainer Hilker, Bad Schwartau<br />
Prof. Ann-Kathrin Hömme, Dortmund<br />
Lars Jäger, Markkleeberg<br />
Dr. Annette Kerkhoff, Münster<br />
Detlef Kokegei, Dortmund<br />
Dr. med. Armin Koller, Rheine<br />
Prof. Dr.-Ing. Marc Kraft, Berlin<br />
Ludger Lambrecht, Dortmund<br />
Dr. med. Franz Landauer, Salzburg<br />
Daniel Merbold, Kössen<br />
Dr. med. Stefan Middeldorf, Bad Staffelstein<br />
Ingo Pfefferkorn, Rostock<br />
Prof. Dr. med. Stefanie Reich-Schupke, Bochum<br />
Dr.-Ing. Rüdiger Rupp, Heidelberg<br />
Michael Schäfer, Traunstein<br />
Dr. med. Franz-Josef Schingale, Pommelsbrunn<br />
Dr. med. Urs Schneider, Stuttgart<br />
Dr. med. Johannes Schröter, Wiesbaden<br />
Frank Schulz, Münster<br />
Bernd Sibbel, Dortmund<br />
Thomas Stief, Osnabrück<br />
Dr. med. Hartmut Stinus, Bovenden<br />
Norbert Stockmann, Dortmund<br />
Jürgen Stumpf, Fulda<br />
Heinz Trebbin, Durach<br />
Bernd Urban, Weiden<br />
Dr. Sebastian Wolf, Heidelberg<br />
Anzeigen/Sonderwerbeformen &<br />
Stellen-/Kleinanzeigen:<br />
Jocelyn Blome, jocelyn.blome@biv-ot.org,<br />
Tel. +49 231 557<strong>05</strong>0-54/-61<br />
Mobil +49 151 108 414 89<br />
Vertrieb: Iris Elbe, iris.elbe@biv-ot.org<br />
Bei Nichterscheinen infolge höherer Ge walt<br />
be steht kein Anspruch auf Nach lieferung bzw.<br />
Schadenersatz. Ver antwortlich in ihrer Gesamtheit<br />
für den Anzeigenteil ist die Geschäftsführung<br />
des Bundesinnungsverbandes für Orthopädie-Technik,<br />
44135 Dortmund; für den Inhalt<br />
der verantwortliche Redakteur. Mit Namen gekennzeichnete<br />
Artikel stellen nicht in jedem Fall<br />
die Ansicht der Redaktion dar, sondern nur die<br />
des Verfassers.<br />
Autorenhinweise:<br />
Manuskripte für Fachbeiträge zu Versorgungsbereichen<br />
der Orthopädie-Technik und ihrer<br />
Nachbardisziplinen sind an den Verlag zu richten,<br />
der sie anonymisiert an den Wissenschaftlichen<br />
Beirat zur Begutachtung und Entscheidung<br />
über eine Veröffentlichung weiterleitet.<br />
In der Regel werden nur Beiträge angenommen,<br />
die nicht bereits anderweitig, insbesondere<br />
in deutschsprachigen Medien, publiziert<br />
worden sind. Weiterführende Informationen zu<br />
den Formalia eines Fachbeitrags können über<br />
360-ot.de/autorenhinweise eingesehen oder<br />
per E-Mail an fachredaktion@biv-ot.org abgefragt<br />
werden.<br />
Erfüllungsort und Gerichtsstand: Dortmund.<br />
Gestaltung:<br />
Miriam Klobes,<br />
Marcus Linnartz<br />
Druckvorstufe/Druck:<br />
Silber Druck oHG<br />
Otto-Hahn-Straße 25<br />
D - 34253 Lohfelden<br />
www.silberdruck.de<br />
114<br />
ORTHOPÄDIE TECHNIK <strong>05</strong>/24
MAKING<br />
LIVES<br />
BETTER<br />
Die Leidenschaft für Innovation<br />
gepaart mit dem Bestreben,<br />
auf die Bedürfnisse von<br />
Prothesenträgern und<br />
Prothesentechnikern einzugehen<br />
und sie sogar vorwegzunehmen,<br />
hat uns dazu geführt, qualitativ<br />
hochwertige Prothesenlösungen<br />
zu entwickeln. Entdecken<br />
Sie unsere neuesten<br />
Spitzenprodukte wie Pro-Fit und<br />
SoftSil Liner und das ProStride<br />
Kniegelenk.<br />
www.easyliner.eu<br />
OT-WORLD, LEIPZIG 14.-17. MAI <strong>2024</strong><br />
Halle 1, Stand A26/B27
Bereit für den<br />
nächsten Schritt.<br />
Die Weltpremiere auf der OTWorld.<br />
Live vom 14. bis 17. Mai <strong>2024</strong> in Leipzig,<br />
Halle 5 I Stand D30.<br />
#WeEmpowerPeople<br />
www.ottobock.com