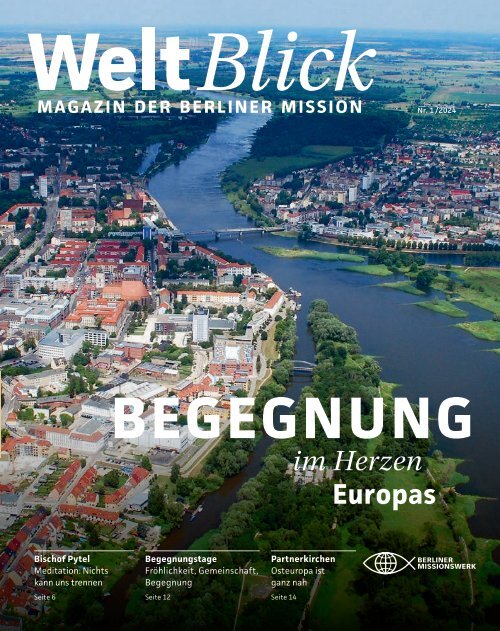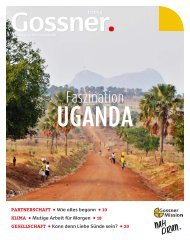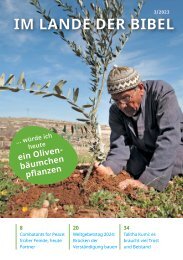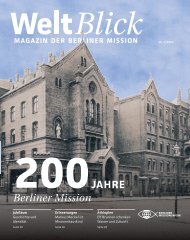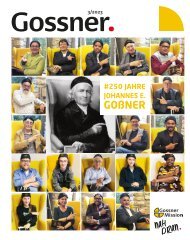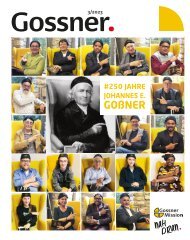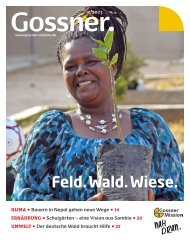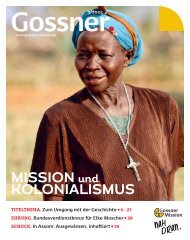WeltBlick 1/2024
Begegnung im Herzen Europas
Begegnung im Herzen Europas
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Nr. 1 /<strong>2024</strong><br />
BEGEGNUNG<br />
im Herzen<br />
Europas<br />
Bischof Pytel<br />
Meditation: Nichts<br />
kann uns trennen<br />
Seite 6<br />
Begegnungstage<br />
Fröhlichkeit, Gemeinschaft,<br />
Begegnung<br />
Seite 12<br />
Partnerkirchen<br />
Osteuropa ist<br />
ganz nah<br />
Seite 14
Impressum<br />
Nr. 1 /<strong>2024</strong><br />
Die Zeitschrift <strong>WeltBlick</strong> erscheint<br />
dreimal jährlich.<br />
ISSN 2513-1524<br />
Auflage<br />
9.000 Exemplare<br />
Redaktion<br />
Jutta Klimmt, Gerd Herzog<br />
Editorial Design<br />
NORDSONNE IDENTITY, Berlin<br />
Layout<br />
Katrin Alt, hellowork.de<br />
Druck<br />
Bonifatius-Druckerei, Paderborn<br />
Papier<br />
Das Magazin des Berliner Missionswerkes<br />
wurde auf 100 % recyceltem Altpapier<br />
gedruckt. Sowohl das Umschlagpapier als<br />
auch das Papier der Innenseiten sind mit<br />
dem Blauen Engel ausgezeichnet.<br />
Umschlagpapier<br />
Circle Offset white, 170 g/m 2<br />
Blauer Engel, FSC-zertifiziert, EU Ecolabel<br />
Innenseitenpapier<br />
Charisma Silk, 80 g/m 2<br />
Blauer Engel, EU-Umweltzeichen<br />
Herausgeber<br />
Direktor Dr. Christof Theilemann für das <br />
Berliner Missionswerk der Evangelischen<br />
Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische<br />
Oberlausitz und der Evangelischen Landeskirche<br />
Anhalts.<br />
Kontakt<br />
Berliner Missionswerk<br />
Georgenkirchstraße 69 / 70<br />
10249 Berlin<br />
E-Mail: redaktion@berliner-missionswerk.de<br />
Telefon: 030/24344-168<br />
Spendenkonto<br />
Berliner Missionswerk<br />
Evangelische Bank<br />
BIC GENODEF1EK1<br />
IBAN DE86 5206 0410 0003 9000 88<br />
Transparenz und Kontrolle<br />
Informationen zur Finanzierung des Berliner<br />
Missionswerkes, sowie zum Umgang mit<br />
Spenden und zur Kontrolle der Projektmittel<br />
finden Sie online unter → berliner-missionswerk.de/ueber-uns/transparenz<br />
Titel<br />
Im Herzen Europas:<br />
Blick auf die Oder<br />
mit der Doppelstadt<br />
Frankfurt/<br />
Słubice. Hier finden<br />
von 7. bis 9. Juni die Christlichen Begegnungstage<br />
<strong>2024</strong> statt: »Nichts kann uns trennen«.<br />
(Foto: pixabay)<br />
HABEN SIE ANREGUNGEN,<br />
KRITIK ODER THEMEN<br />
WÜNSCHE?<br />
Schreiben Sie uns per E-Mail oder<br />
Brief an<br />
redaktion@berliner-missionswerk.de<br />
Berliner Missionswerk<br />
Redaktion <strong>WeltBlick</strong><br />
Georgenkirchstraße 69/70<br />
10249 Berlin<br />
WIR FREUEN UNS AUF IHRE<br />
ZUSCHRIFT!<br />
Für Sie immer aktuell!<br />
Gerne informieren wir Sie jederzeit aktuell. Besuchen Sie unsere Webseiten<br />
→ www.berliner-missionswerk.de<br />
→ www.talitha-kumi.de<br />
Oder bestellen Sie unseren E-Mail-Newsletter.<br />
Schreiben Sie einfach eine E-Mail mit dem Betreff »Newsletter« an<br />
redaktion@berliner-missionswerk.de<br />
Bildnachweis<br />
S. 6 mofles/iStock; S. 8/9 CBT; S. 16 Gerd Herzog; S. 17 iStock/Adrian Catalin Lazar/iStock; S. 18<br />
Lijudmila Melnitschenko; S. 19 bbsferrari/iStock; S. 30 Konstatin Börner; S. 31 EKBO (Stäblein),<br />
Uwe Kloessing (Woidke), EKD (Schürer-Behrmann); S. 22 li. und unten Gerd Herzog, re. iThemba<br />
Labantu; S. 23 oben Diocese of London, unten li. Gerd Herzog, unten re. Privat; S. 24–28 Barbara<br />
Neubert; S. 31–33 Gerd Herzog; S. 36 Evangelische Kirche A.B. in Rumänien.<br />
Dieses Druckerzeugnis ist mit dem<br />
Blauen Engel ausgezeichnet.
Editorial<br />
Liebe Leserinnen,<br />
liebe Leser,<br />
»Nichts kann uns trennen!« Ein starker Slogan für die Christlichen Begegnungstage,<br />
die im Juni in Frankfurt (Oder) und Słubice stattfinden werden. Und die<br />
gerade in diesen schwierigen Zeiten ein wichtiges Zeichen setzen wollen: Nichts<br />
kann uns trennen im Herzen Europas! Kein Krieg, keine militärische Bedrohung.<br />
Und auch nicht der Blick zurück auf die gemeinsame Geschichte, die über lange<br />
Phasen hinweg von Gewalt und Misstrauen geprägt war.<br />
»Die schwierige Vergangenheit hatte Barrieren errichtet«, sagt Waldemar Pytel,<br />
Bischof der Diözese Breslau/Wrocław der Evangelisch-Augsburgischen Kirche in<br />
Polen. Aber Ressentiments auf beiden Seiten seien abgebaut, Unrecht aufgearbeitet<br />
worden. »Heute machen wir uns gemeinsam stark für gegenseitiges Verständnis,<br />
für Toleranz, Respekt und Harmonie.«<br />
Auch Generalsuperintendentin Theresa Rinecker blickt in ihrem Beitrag zurück<br />
auf Jahrzehnte, »in die vielfältige Konflikte, Krieg, Vertreibung und Flucht eingeschrieben«<br />
waren. Doch: »Längst verbindet uns eine gelebte und gestaltete Versöhnungsgeschichte,<br />
die Verantwortung für die Nachbarschaft und das gemeinsame<br />
europäische Haus wahrnimmt.«<br />
Ob Tschechien, Rumänien, Polen oder Wolga – unsere Partnerkirchen in Ostmitteleuropa<br />
engagieren sich vielfältig – und betätigen sich bewusst als Brückenbauerinnen:<br />
durch soziale Projekte, kulturellen Austausch und lebendigen Dialog.<br />
Bei den Christlichen Begegnungstagen wollen sie ihr Engagement vorstellen.<br />
Kreativ, fröhlich, bunt.<br />
So soll die Veranstaltung ein Fest der Hoffnung und des Glaubens werden. Theresa<br />
Rinecker: »Ein Zeichen für Toleranz und Weltoffenheit in Europa, für Gemeinsinn<br />
und ganz besonders natürlich für den Frieden – heute mehr denn je.«<br />
Jutta Klimmt<br />
leitet das Öffentlichkeitsreferat<br />
des Berliner Missionswerkes.<br />
Herzliche Einladung also nach Frankfurt (Oder) und Słubice!<br />
Ihre<br />
Editorial<br />
3
Inhalt<br />
6<br />
Bischof Pytel<br />
Nichts kann uns trennen<br />
2 Impressum<br />
3 Editorial<br />
4 Inhalt<br />
6 Meditation: Nichts kann uns trennen<br />
Von Bischof Waldemar Pytel<br />
BEGEGNUNGEN IM HERZEN EUROPAS<br />
24<br />
10 Grundsätzliches<br />
Brücken der Verständigung<br />
Begegnung in der Grenzregion<br />
12 CBT24<br />
Strahlkraft<br />
Fröhlichkeit, Gemeinschaft, Begegnung<br />
14 Partnerkirchen<br />
Osteuropa ist ganz nah<br />
Gemeinsam für Frieden und Solidarität<br />
Kuba<br />
Hoffnung säen, der Wut Raum geben<br />
20 BibelSeite<br />
Wer anderen nicht begegnet,<br />
kann nichts von ihnen lernen<br />
Mit dem Direktor in der Bibel geblättert<br />
21 CBT24<br />
Warum wir uns auf die<br />
Begegnungstage freuen<br />
Frank Schürer-Behrmann, Christian<br />
Stäblein, Dietmar Woidke<br />
22 KurzForm<br />
24 WeltReise<br />
Hoffnung säen und der Wut Raum geben<br />
4 <strong>WeltBlick</strong> 1/<strong>2024</strong>
12<br />
Strahlkraft<br />
Christliche Begegnungstage <strong>2024</strong><br />
17<br />
Partnerkirchen<br />
Osteuropa ist ganz nah<br />
30<br />
Jubiläum<br />
Bénédicte Savoy fordert Transparenz<br />
30 Jubiläum<br />
Radikale Transparenz<br />
32 Menschen mit Mission<br />
34 Leserbriefe<br />
36 Spenden und Helfen<br />
Inhaltsverzeichnis<br />
5
Meditation<br />
NICHTS<br />
»Und Jesus ging aus dem Tempel fort und seine Jünger traten<br />
zu ihm und zeigten ihm die Gebäude des Tempels. Er aber<br />
antwortete und sprach zu ihnen: Seht ihr nicht das alles?<br />
Wahrlich, ich sage euch: Es wird hier nicht ein Stein auf dem<br />
andern bleiben, der nicht zerbrochen werde.«<br />
Matthäus 24,1–2<br />
scheidung näher brachte – diesen Mann muss man beseitigen.<br />
Einige Zeit vergeht ... und der Tempel wird zerstört.<br />
Lassen Sie uns das Datum ändern. Lassen Sie uns nur siebenunddreißig<br />
Jahre zurückgehen. Während seines Besuchs in<br />
West-Berlin appelliert Präsident Ronald Reagan an den sowjetikann<br />
uns trennen<br />
VON BISCHOF WALDEMAR PYTEL<br />
Lassen Sie uns in der Zeit zweitausend Jahre zurückgehen.<br />
Natürlich wurde eine Welle der Kritik ausgelöst. Viele Menschen<br />
schüttelten ungläubig den Kopf: »Das wird niemals<br />
passieren.« Die Emotionen kochten hoch, und den Gegnern des<br />
Heilands wurde ein weiterer Vorwand geliefert, der sie einer Ent-<br />
6 <strong>WeltBlick</strong> 1/<strong>2024</strong>
schen Führer Michail Gorbatschow: »Wenn Sie Frieden wollen<br />
... kommen Sie zu diesem Tor und reißen Sie diese Mauer<br />
nieder«. Einige schütteln wahrscheinlich wieder ungläubig den<br />
Kopf. »Das wird niemals geschehen. Es ist unmöglich.« In Polen<br />
springt Lech Walesa über die Mauer der Werft, es finden die<br />
ersten halbwegs freien Wahlen statt und der Zerfall des kommunistischen<br />
Systems in Europa beginnt. Schließlich fällt vor<br />
genau fünfunddreißig Jahren die Berliner Mauer.<br />
Lassen Sie uns noch einmal in der Zeit zurückspringen. Es<br />
ist 1945 – der Zweite Weltkrieg ist zu Ende. Worte des Hasses<br />
kommen aus vielen Mündern. Wieder das Kopfschütteln. »Wir<br />
werden uns nie mit Deutschen versöhnen. Es gibt zu viele Ressentiments<br />
in uns. Es ist nicht möglich.« Jahre sind vergangen.<br />
Die beiden geteilten Länder und Völker nähern sich allmählich<br />
an. Es gibt Entschuldigungen und Worte der Vergebung. Es<br />
kommt zum Nachdenken über das Böse einer vergangenen Zeit<br />
und zu aufrichtigen Erklärungen beider Seiten: »Nie wieder«.<br />
Vor fünfunddreißig Jahren wurde ein Symbol für die Versöhnung<br />
errichtet – Deutsche und Polen stehen bei der Versöhnungsmesse<br />
in Kreisau/Krzyżowa Seite an Seite. Acht Jahre<br />
später unterzeichnen die damalige Evangelische Kirche schlesische<br />
Oberlausitz und die Diözese Breslau/Wrocław der Evangelisch-Augsburgischen<br />
Kirche in Polen einen Partnerschaftsvertrag.<br />
Diese Zeitreise durch wichtige Jahrestage für unsere Völker<br />
zeigt uns eindringlich, dass bestimmte Dinge fallen müssen,<br />
damit etwas Neues entstehen kann. Der Tempel fällt und Christus<br />
verspricht, ihn in drei Tagen wieder aufzubauen. Die Berliner<br />
Mauer wird niedergerissen, und so beginnt sich eine zuvor<br />
in zwei Hälften geteilte Nation langsam zu vereinen. Mit der<br />
Zeit werden weitere Barrieren zerstört, die durch unsere<br />
gemeinsame schwierige Vergangenheit errichtet wurden, und<br />
auf ihren Trümmern sprießen gegenseitiges Verständnis, Toleranz,<br />
Respekt und Harmonie. Manche Dinge müssen fallen,<br />
damit etwas Neues entstehen kann.<br />
Heute können wir sehen, wie viel Gutes unsere Partnerschaft<br />
bewirkt hat. Der Blick ist fast symbolisch. Aus den bröckelnden<br />
Ziegeln gegenseitiger Ressentiments und der Aufarbeitung<br />
von Unrecht, die uns vorher in einer Mauer trennten,<br />
haben wir einen Tempel gegenseitiger Herzlichkeit, Zusammenarbeit<br />
und Respekt gebaut. Durch den Zusammenschluss<br />
ist eine starke Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische<br />
Oberlausitz entstanden, die die Partnerschaft nicht nur<br />
übernommen, sondern weiterentwickelt hat, sodass wir eine<br />
grenzüberschreitende Verbindung aufgebaut haben, die es uns<br />
ermöglicht, unsere Beziehungen weiter zu stärken und neue,<br />
inspirierende Initiativen zu starten. Eine davon sind die zweifellos<br />
die Christlichen Begegnungstage (CBT) in Frankfurt<br />
(Oder) und Słubice. Wir sind dankbar, dass wir als kleine Kirche<br />
dieses Ereignis gemeinsam gestalten können. Inmitten einer<br />
schwierigen Realität – Unruhen – wollen wir ein starkes Zeichen<br />
setzen, dass uns im Herzen Europas nichts trennen wird. Nichts<br />
wird uns von Gott und voneinander trennen! Wollen wir zu<br />
Friedensstiftern werden in einer Welt, die derzeit an so vielen<br />
Orten von Gewalt, Konflikten und Krieg zerrissen ist?<br />
Nichts kann uns trennen, wir können Pilger des Friedens<br />
werden auf einem Pilgerweg des Vertrauens durch die Länder,<br />
aus denen wir zu den CBT kommen werden. Ich glaube, dass<br />
dieses Treffen Menschen zusammenbringen wird, die sehr<br />
unterschiedlich sind, junge und alte Menschen. Versöhnung<br />
erfordert Dialog und mutige, kreative Gesten. So können wir<br />
denselben Weg einschlagen und den tiefen Wunsch zum Ausdruck<br />
bringen, so verständnisvoll miteinander zu leben, wie<br />
Christus es sich für seine Freunde gewünscht hat. Wir sollten<br />
nicht nur aufeinander schauen, sondern auch auf Osteuropa,<br />
das unsere geistige und materielle Unterstützung braucht.<br />
Ein afrikanisches Sprichwort besagt: »Eine lange Reise<br />
erscheint kurz, wenn wir sie gemeinsam gehen«. Während der<br />
großen Wildtierwanderung zwischen der Serengeti und der<br />
Masai Mara sind die Kälber auf die Kraft der Erwachsenen<br />
angewiesen, um den Fluss zu überqueren und ans Ufer zu<br />
gelangen. Auch wir brauchen manchmal jemanden, der uns<br />
trägt. Und wenn wir uns gemeinsam den Herausforderungen<br />
stellen, können wir die Schönheit erkennen, die uns hilft, den<br />
Funken zu sehen, der den CBT-Leitgedanken »Nichts kann uns<br />
trennen« nicht zu einer leeren Plattitüde werden lässt, sondern<br />
es uns ermöglicht, die Gegenwart Christi zu entdecken und<br />
wieder zu verstehen, dass er immer bei uns ist und wir beieinander.<br />
Genau deshalb sind die bevorstehende Christlichen Begegnungstage<br />
in Frankfurt (Oder) und Słubice eine Gelegenheit für<br />
uns, Zeugnis zu geben – nichts kann uns trennen von der Liebe<br />
Gottes, von der Kirche und dem Glauben an Jesus als Erlöser oder<br />
von unseren Völkern Mittel- und Osteuropas, die miteinander versöhnt<br />
sind und ein freudiges Zeugnis als Kinder Gottes ablegen.<br />
Jesus hat sein Leben hingegeben, gerade damit wir den<br />
Geschmack des Lebens genießen können. Damit wir das Leben<br />
feiern können. Das ist es, was wir in Frankfurt (Oder) und<br />
Słubice tun wollen. /<br />
Waldemar Pytel<br />
ist seit 2014 Bischof der Diözese Breslau/Wrocław der Evangelisch-<br />
Augsburgischen Kirche in Polen.<br />
Meditation<br />
7
TitelThema<br />
8 <strong>WeltBlick</strong> 1/<strong>2024</strong>
Inspiration und Glaube, Gemeinschaft<br />
und Spiritualität:<br />
Vom 7. bis 9. Juni <strong>2024</strong> laden<br />
die EKBO und die Evangelisch-<br />
Augsburgische Kirche in Polen<br />
gemeinsam zum großen ostmitteleuropäischen<br />
Kirchentag:<br />
»Nichts kann uns trennen«<br />
CBT24:<br />
Begegnungen an<br />
der Oderbrücke<br />
BEGEGNUNG im Herzen Europas<br />
9
BRÜCKEN<br />
der Verständigung<br />
Christliche Begegnungstage in der Grenzregion<br />
zwischen Polen und Deutschland<br />
Wir leben an Oder und Neiße davon, dass die Flüsse nicht als<br />
trennende Grenze gesehen werden, sondern als lebendige<br />
Ströme unserer Verbundenheit. Gerade in dieser herausfordernden<br />
Zeit!<br />
TEXT: THERESA RINECKER<br />
Das Berliner Missionswerk stärkt und begleitet Begegnungen<br />
und Partnerschaften weltweit, damit Menschen aus<br />
verschiedenen Kirchen, Kulturen und Kontinenten einander<br />
wahrnehmen, voneinander lernen und miteinander ihre<br />
Erfahrungen und Gestaltungsideen teilen.<br />
Gemeinsam mit seinen Partnerkirchen steht das Berliner<br />
Missionswerk für ein lebendiges Zeugnis des Glaubens in der<br />
Welt. Diese oft langjährigen Partnerschaften sind geprägt von<br />
gegenseitigem Respekt, Vertrauen und dem gemeinsamen Ziel,<br />
auch vor Ort und ganz konkret die Lebensqualität von Menschen<br />
zu verbessern. Sie spiegeln das Interesse an geografischer<br />
und kultureller Vielfalt wider. Und zeigen so das gemeinsame<br />
Engagement der Trägerkirchen des Berliner<br />
Missionswerkes und der Partnerkirchen für Frieden, Gerechtigkeit<br />
und sozialen Wandel in der Welt.<br />
Dabei spielen die Beziehungen zu unseren östlichen Partnern<br />
in Europa, insbesondere zur Diözese Breslau/Wrocław der<br />
Evangelisch-Augsburgischen Kirche in Polen (EAKiP), eine<br />
besondere Rolle. Sie gehen zurück auf die aktive Partnerschaftsarbeit<br />
zwischen der vormaligen Kirche der schlesischen Oberlausitz<br />
und den brandenburgischen Kirchenkreisen an der<br />
Oder mit den polnischen Nachbarn.<br />
Die lange bewegende Geschichte, in die vielfältige Konflikte,<br />
Krieg, Vertreibung und Flucht eingeschrieben sind, ist<br />
nicht länger trennend. Längst verbindet uns eine seit Jahrzehnten<br />
gelebte und gestaltete Versöhnungsgeschichte, die Verantwortung<br />
für die Nachbarschaft und das gemeinsame europäische<br />
Haus wahrnimmt.<br />
Wir leben an Oder und Neiße davon, dass die Flüsse nicht<br />
als trennende Grenze gesehen werden, sondern als der lebendige<br />
Strom unserer Verbundenheit. Gerade in dieser Zeit, in der<br />
wir vor vielfältigen Herausforderungen stehen, ist es für uns in<br />
der Mitte Europas lebensnotwendig, uns miteinander verbunden<br />
zu wissen. Dem verheerenden Angriffskrieg in der Ukraine<br />
wollen wir mit der uns anvertrauten Friedensbotschaft unser<br />
klares Glaubenszeugnis entgegensetzen.<br />
So bin ich überaus dankbar, dass viele Menschen diese Partnerschaft<br />
aktiv und freundschaftlich gestalten und in engem<br />
Austausch stehen. Wir treffen uns regelmäßig zu Gesprächen<br />
und zur Konsultation und besuchen einander zu festlichen<br />
Anlässen. Zuletzt zum 500. Jubiläum der Reformation in Wroclaw/Breslau.<br />
So feiern wir miteinander und lernen voneinander<br />
in den verschiedensten Bereichen – vom Ehrenamt bis zu<br />
Finanzierungsmodellen. Als Kirche im strukturellen und gesellschaftlichen<br />
Umbruch sehen wir als EKBO staunend, wie die<br />
Minderheitskirche in Polen kraftvoll und attraktiv evangelische<br />
Stimme und Botschaft ist.<br />
Zum grenzüberschreitenden Austausch gehören auch vielfältige<br />
ökumenische Kontakte und Veranstaltungen. So verbindet<br />
uns der mittlerweile 8. Ökumenische Pilgerweg für Klimagerechtigkeit,<br />
der im August <strong>2024</strong> in Gniezno/Gnesen beginnen<br />
und nach 21 Stationen Mitte Oktober in Berlin eintreffen wird.<br />
Betend und pilgernd setzen sich katholische und evangelische<br />
Geschwister gemeinsam für die Bewahrung der Schöpfung und<br />
für den Frieden ein. Dieses gemeinsame Handeln leuchtet wie<br />
ein Hoffnungsschimmer inmitten der Spaltungsideen und fins-<br />
10 <strong>WeltBlick</strong> 1/<strong>2024</strong>
teren Bestrebungen nationaler Abgrenzung, die auch in Europa<br />
zunehmen.<br />
Unmittelbar bevor stehen die Christlichen Begegnungstage<br />
vom 7. bis 9. Juni in Frankfurt (Oder)/Słubice. Sie werden von<br />
der EKBO gemeinsam mit der EAKiP vorbereitet und zeigen die<br />
tiefe Verbundenheit und das lebendige Interesse zwischen<br />
unseren beiden Kirchen.<br />
Diese Begegnungstage, die seit vielen Jahren Menschen<br />
unterschiedlicher protestantischer Glaubensrichtungen und<br />
Hintergründe aus Mittel- und Osteuropa zusammenbringen,<br />
haben sich zu einem Symbol der Einheit und des gegenseitigen<br />
Respekts entwickelt. In einer Welt, die von politischen Spannungen<br />
und kulturellen Unterschieden geprägt ist, bieten sie<br />
einen Raum für Dialog, Austausch und gemeinsames Gebet. Sie<br />
stellen sich Ausgrenzung und Abschottung entgegen und erinnern<br />
daran, dass trotz unserer Unterschiede und historischen<br />
Konflikte die gemeinsamen Werte des Glaubens und der<br />
Menschlichkeit das Potenzial für eine gute Zukunft sind. Inmitten<br />
der aktuellen geopolitischen Spannungen in Osteuropa sind<br />
die Christlichen Begegnungstage aber nicht nur als Plattform<br />
des Dialogs und der Vielsprachigkeit zu sehen, sondern werden<br />
selber zu einer Brücke des Verstehens für gute Wege in die<br />
Zukunft.<br />
Bei den Begegnungstagen wird Raum sein zur vergewissernden<br />
und kritischen Reflexion über gemeinsame Herausforderungen,<br />
vor denen wir in unseren Kirchen und Gesellschaften<br />
stehen. Gemeinsam suchen wir nach Ideen und Lösungen<br />
für die vielfältigen sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen<br />
Probleme. Gegenseitig wollen wir uns ermutigen, über nationale<br />
Interessen hinaus zu denken und gemeinsame Antworten<br />
auf gemeinsame Herausforderungen zu finden.<br />
So sollen die Christlichen Begegnungstage ein Symbol der<br />
Hoffnung und des Glaubens werden. Sie setzen ein Zeichen der<br />
Liebe, des Mitgefühls und der Solidarität. Diese Werte haben<br />
Zukunft, wenn wir uns von ihnen leiten lassen. Wir werden<br />
erleben, wie uns Gespräch und Gebet, Fragen und Hören, Diskutieren<br />
und zusammen Streiten beleben und stärken. Wir sind<br />
auch mit diesem mittel- und osteuropäischen Kirchentag Teil<br />
einer großen europäischen und weltweiten Familie. Und bleiben<br />
dabei: Nichts kann uns trennen. Nichts kann uns trennen<br />
voneinander und von Gott. Brücken der Verständigung sind<br />
Wege in die Zukunft. /<br />
Theresa Rinecker<br />
ist Generalsuperintendentin des Sprengels Görlitz der EKBO. Dialog,<br />
Austausch und Versöhnung über Grenzen hinweg sind ihr ein<br />
besonderes Anliegen.<br />
BEGEGNUNG im Herzen Europas<br />
11
Strahl<br />
KRAFT<br />
Christliche Begegnungstage <strong>2024</strong>:<br />
Fröhlichkeit, Gemeinschaft, Begegnung<br />
Die Christlichen Begegnungstage (CBT) sind ein internationaler Kirchentag<br />
der evangelischen Kirchen Mittel- und Osteuropas, die alle<br />
drei bis vier Jahre stattfinden. Die CBT gehen auf eine Initiative der<br />
damaligen Evangelischen Kirche der schlesischen Oberlausitz zurück,<br />
die 1991 zum ersten Treffen der evangelischen Kirchen Polens und<br />
der damaligen Tschechoslowakei nach Görlitz einlud.<br />
I<br />
m Laufe der Jahre haben sich die Begegnungstage<br />
zu einem Kirchentag evangelischer Kirchen<br />
aus den Ländern Mittel- und Osteuropas<br />
entwickelt. Bisherige Veranstaltungsorte waren Görlitz,<br />
Niesky, Wisła, Český Těšín, Prag, Bratislava,<br />
Dresden, Wrocław und Budapest. Die für 2020<br />
geplanten CBT in Graz mussten wegen der Covid-<br />
Pandemie abgesagt werden. Nun feiern wir die CBT<br />
an der deutsch-polnischen Grenze in der Doppelstadt<br />
Frankfurt (Oder)/Słubice. Zum CBT24 laden<br />
die EKBO und die Evangelisch-Augsburgische Kirche<br />
in Polen gemeinsam ein.<br />
Das bisherige Logo der CBT mit den vier Händen,<br />
die sich zu einem Kreuz falten, wurde durch<br />
ein neues, dynamisches und zeitgemäßes Logo<br />
ersetzt. Diesmal sind es einander zugewandte,<br />
betende Hände, die an Fische erinnern, das Symbol<br />
des Christentums. Die Fische sind einander zugewandt,<br />
die Hände im Gebet vereint. In der Mitte<br />
befindet sich das Kreuz. Im Hintergrund ist das<br />
Symbol der Sonne zu sehen: Wo Gemeinschaft und<br />
Begegnung zusammenkommen, entsteht strahlende<br />
Kraft. Die verschiedenen Farben stehen für die<br />
unterschiedlichen Kulturen und Traditionen der<br />
Kirchen in Mittel- und Osteuropa, die trotz aller<br />
Unterschiede zusammenhalten, gemeinsam beten<br />
und sich begegnen. Sie zeigen auch konkrete Merkmale<br />
der Gemeinschaft der Kirchen: Gelb/Gold<br />
steht für Fröhlichkeit und Religiosität, Braun für<br />
Tradition und Beständigkeit, Grün/Cyan für Offenheit,<br />
Latschenkiefer-Grün für Schwere und Mystik.<br />
»Nichts kann uns trennen«: Das Motto der<br />
CBT24 aus Römer 8 bringt die Botschaft zum Ausdruck,<br />
dass evangelische Christinnen und Christen<br />
in Mittel- und Osteuropa angesichts von Konflikten<br />
zusammenstehen, Solidarität zeigen und sich Spaltungen<br />
und Machtansprüchen widersetzen. Als<br />
gewachsene Gemeinschaft stehen wir mutig zusammen.<br />
Dabei trägt uns die Liebe Gottes, die uns in<br />
Jesus Christus geschenkt ist. Die deutsch-polnische<br />
Freundschaft spiegelt sich in der gemeinsamen Einladung<br />
der EKBO und der lutherischen Kirche in<br />
Polen sowie darin, dass die Begegnungstage an<br />
einem grenzüberschreitenden Ort stattfinden.<br />
An den CBT nehmen Menschen aus den evangelischen<br />
Kirchen Polens, Tschechiens, der Slowakei,<br />
Ungarns, Österreichs, Rumäniens, Sloweniens und<br />
der Ukraine sowie aus Deutschland teil. Aus<br />
12 <strong>WeltBlick</strong> 1/<strong>2024</strong>
POLEN<br />
Evangelisch-Augsburgische Kirche<br />
ca. 61.700 Mitglieder<br />
Evangelisch-Reformierte Kirche in Polen<br />
3.500 Mitglieder<br />
TSCHECHIEN<br />
Deutschland beteiligen sich sechs Landeskirchen:<br />
Neben der gastgebenden EKBO sind die Nordkirche,<br />
die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland<br />
(EKM), die Evangelisch-Lutherische Kirche in Sachsen<br />
(EVKLS) und Bayern (ELKB) sowie die Evangelische<br />
Landeskirche in Württemberg (elk-wue) an der<br />
Programmgestaltung beteiligt. Regionale ökumenische<br />
Partner sind ebenfalls beteiligt. Das Programm<br />
wird von Vertreter:innen der Kirchen gemeinsam<br />
vorbereitet und verantwortet. /<br />
Dr. Dr. Vladimir Kmec<br />
hat gemeinsam mit einer kleinen Gruppe die Neugestaltung<br />
des CBT-Logos begleitet. Nach viel Vorbereitungsarbeit<br />
als CBT-Geschäftsführer freut er sich nun auf die<br />
vielen Begegnungen und Events vor Ort.<br />
Evangelische Kirche der Böhmischen Brüder<br />
67.000 Mitglieder<br />
Tschechoslowakische Hussitische Kirche<br />
23.600 Mitglieder<br />
Schlesische Evangelische Kirche A.B.<br />
15.000 Mitglieder<br />
SLOWAKEI<br />
Evangelische Kirche A.B. in der Slowakei<br />
280.000 Mitglieder<br />
Reformierte Christliche Kirche in der Slowakei<br />
90.000 Mitglieder<br />
ÖSTERREICH<br />
Evangelische Kirche A.B.<br />
252.000 Mitglieder<br />
Evangelische Kirche H.B.<br />
12.000 Mitglieder<br />
UNGARN<br />
Reformierte Kirche in Ungarn<br />
2,5 Mil. Mitglieder<br />
Evangelisch-Lutherische Kirche in Ungarn<br />
180.000 Mitglieder<br />
UKRAINE<br />
Reformierte Kirche in Transkarpatien<br />
135.000 Mitglieder<br />
Deutsche Evang.-Luth. Kirche in der Ukraine<br />
1.000 Mitglieder<br />
RUMÄNIEN<br />
Evangelische Kirche A.B. in Rumänien<br />
10.000 Mitglieder<br />
Reformierte Kirche in Rumänien<br />
690.000 Mitglieder<br />
Evangelisch-Lutherische Kirche in Rumänien<br />
30.000 Mitglieder<br />
SLOWENIEN<br />
Reformierte Kirche in Slowenien<br />
200 Mitglieder<br />
Evangelische Kirche A.B. in Slowenien<br />
20.000 Mitglieder<br />
BEGEGNUNG im Herzen Europas<br />
13
Osteuropa ist<br />
ganz NAH<br />
Partnerkirchen: Gemeinsam für Frieden und Solidarität<br />
In einer globalisierten Welt, in der kulturelle und<br />
religiöse Vielfalt als Grundlage für Verständnis<br />
und Zusammenarbeit gilt, spielen Partnerschaften<br />
zwischen religiösen Gemeinschaften eine wichtige<br />
Rolle. Das Berliner Missionswerk hat sich als<br />
engagierter Akteur in der Förderung solcher Partnerschaften<br />
etabliert, insbesondere in Richtung<br />
Osteuropa.<br />
TEXT: VLADIMIR KMEC<br />
Partnerschaften sind ein wichtiges Instrument<br />
für den grenzüberschreitenden Dialog, für die<br />
Förderung von Frieden und Solidarität. Sie<br />
tragen zu einem friedlichen Miteinander in einer<br />
gemeinsamen Region bei.<br />
Partnerschaftsarbeit ist Beziehungsarbeit. Kirchengemeinden<br />
und Kirchenkreise der EKBO pflegen<br />
aktive partnerschaftliche Beziehungen zu Kirchengemeinden<br />
in fast allen Ländern Mittel- und<br />
Osteuropas. Einige Partnerschaften sind offiziell<br />
und seit langem etabliert und leben von regelmäßigem<br />
Austausch. Andere bestehen aus guten Kontakten,<br />
die einzelne Personen initiierten, oder von sporadischen<br />
Besuchen.<br />
Auf der landeskirchlichen Ebene haben sich vier<br />
offizielle Partnerschaften entwickelt, die das Berliner<br />
Missionswerk pflegt: zur Diözese Breslau der<br />
Evangelisch-Augsburgischen Kirche in Polen, zur<br />
Evangelischen Kirche der Böhmischen Brüder, zur<br />
Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien und zu<br />
Propsteien der Evangelisch-Lutherischen Kirche<br />
Europäisches Russland an der Unteren Wolga.<br />
Zusätzlich pflegt die EKBO gute Beziehungen zu<br />
katholischen Bistümern auf der polnischen Seite der<br />
Grenze, die durch die ökumenischen Konsultationen<br />
der Bischöfe und Bischöfinnen an der Oder und<br />
Neiße entstanden sind.<br />
Die Partnerschaften sind zwar relativ jung; die<br />
Partnerkirchen blicken ihrerseits jedoch auf eine<br />
lange Geschichte zurück. Auch wenn wir unsere östlichen<br />
Nachbarländer oft als religiös und kulturell<br />
homogen ansehen, ist das religiöse Leben in Mittelund<br />
Osteuropa schon seit Jahrhunderten von Pluralismus<br />
geprägt. Durch ihre religiöse, pädagogische,<br />
kulturelle und diakonische Arbeit nehmen diese<br />
protestantischen Kirchen in Mittel- und Osteuropa<br />
aktiv am gesellschaftlichen Leben teil. Die Beteiligungsgemeinschaft,<br />
das Ehrenamt und die Gastfreundschaft<br />
sind wichtige Grundsteine dieser enormen<br />
Leistung der kleinen Minderheitskirchen.<br />
14 <strong>WeltBlick</strong> 1/<strong>2024</strong>
Hier erfahren Sie mehr:<br />
→ christlichebegegnungstage.de<br />
Von den Diasporakirchen und ihrer Minderheitserfahrung<br />
können wir viel lernen; denn die Kirchen<br />
stehen vor ähnlichen Herausforderungen wie<br />
wir in Deutschland. Osteuropa ist uns näher, als es<br />
manchmal scheint.<br />
Die letzten Jahre waren für die Menschen in Mittel-<br />
und Osteuropa eine Zeit vieler Herausforderungen<br />
– politische Umbrüche, Auswanderung, Pandemie<br />
und Finanzkrisen. Es war aber der Krieg in der<br />
Ukraine, der das Leben und den Alltag gravierend<br />
verändert hat.<br />
Die russische Invasion hat weitreichende humanitäre,<br />
ökonomische, politische und soziale Folgen<br />
für ganz Osteuropa. Die Menschen in Osteuropa zeigen<br />
sehr starke Solidarität mit den Menschen in der<br />
Ukraine. Die Kirchen leisten Katastrophenhilfe, sie<br />
bieten Schutz und Unterstützung. Sie haben Aufnahmezentren<br />
an den Grenzübergängen gebaut und<br />
humanitäre Transporte in die Ukraine organisiert.<br />
Bis heute verteilen sie Lebensmittel, Wasser, Medikamente,<br />
Decken, Schlafsäcke und Hygiene-Artikel.<br />
Geflüchtete werden medizinisch und seelsorgerisch<br />
betreut. Gemeinderäume wurden zu Aufnahmezentren<br />
und Unterkünften umgebaut; Gemeindemitglieder<br />
haben Geflüchtete in ihren Häusern untergebracht.<br />
Diese Herausforderungen werden noch lange<br />
bestehen bleiben. Gut, dass wir jetzt bei den Christlichen<br />
Begegnungstagen (CBT) die Chance haben,<br />
uns darüber auszutauschen und gegenseitig zu stärken.<br />
Die Partnerschaften, vor allem die Beziehungen<br />
zu unseren polnischen Partnern, wurden durch die<br />
gemeinsame Vorbereitung der CBT vertieft. Einen<br />
besseren und symbolträchtigeren Ort als den an der<br />
deutsch-polnischen Grenze, in der Doppelstadt<br />
Frankfurt (Oder)/Słubice, konnte man für die CBT<br />
<strong>2024</strong> nicht wählen. In einer Zeit, in der nationalistische<br />
Tendenzen und politische Spannungen auf<br />
dem Vormarsch sind und in der Ukraine ein zerstörerischer<br />
Krieg herrscht, sind Partnerschaften und<br />
ein grenzüberschreitender Kirchentag wie die CBT<br />
ein leuchtendes Beispiel für die Kraft der Zusammenarbeit<br />
über Grenzen hinweg.<br />
Die Kirchen in Mittel- und Osteuropa tragen<br />
eine gemeinsame Verantwortung für den Frieden in<br />
Europa. Indem sie Brücken zwischen verschiedenen<br />
Kulturen und Weltanschauungen bauen, tragen<br />
diese Partnerschaften dazu bei, eine Welt zu schaffen,<br />
die von Respekt, Verständnis, Solidarität und<br />
Frieden geprägt ist. /<br />
Dr. Dr. Vladimir Kmec<br />
ist Osteuropareferent im Berliner Missionswerk. Er betreut die<br />
Partnerschaftsarbeit nach Polen, Tschechien, Rumänien und in die<br />
Wolgaregion. Zugleich ist er Geschäftsführer der Christlichen Begegnungstage<br />
(CBT) <strong>2024</strong>.<br />
BEGEGNUNG im Herzen Europas<br />
15
Unsere Partnerkirchen<br />
in Ostmitteleuropa<br />
In Tschechien, Rumänien, Polen und an der Wolga – die protestantischen<br />
Partnerkirchen in Ostmitteleuropa bewirken Veränderungen.<br />
Durch soziale Projekte, kulturellen Austausch und lebendigen Dialog<br />
bauen sie Brücken, die nachhaltige Verbindungen schaffen.<br />
TEXT: VLADIMIR KMEC<br />
Mit großem Engagement<br />
TSCHECHIEN<br />
Die Evangelische Kirche der Böhmischen Brüder<br />
steht vor enormen Herausforderungen. In einem der<br />
säkularsten Länder der Welt versucht die kleine Kirche,<br />
strukturelle Änderungen voranzutreiben; sie setzt<br />
sich für Minderheiten und für die Demokratie ein und<br />
bietet suchenden Menschen eine religiöse Heimat an.<br />
Hier das Jan Hus-Haus, Sitz der Kirche in Prag.<br />
Die Geschwister aus Tschechien blicken trotz<br />
der Herausforderungen engagiert und positiv in die<br />
Zukunft. Die kleine Kirche, die rund 60.000 Mitglieder<br />
in 240 Gemeinden zählt, pflegt insgesamt 50<br />
Partnerschaften, was ihr Wirken weit über die Grenzen<br />
Tschechiens hinaus bekannt macht.<br />
Beeindruckend sind die Spontanität und das<br />
große ehrenamtliche Engagement der Menschen in<br />
der Kirche. Obwohl Tschechien keine Grenze mit<br />
der Ukraine hat, sind die Auswirkungen des Krieges<br />
in der tschechischen Gesellschaft überall spürbar.<br />
Unsere Partnerkirche bietet geflüchteten Menschen<br />
ganz konkrete Hilfe und Unterstützung an: Sie<br />
kümmert sich um etwa 2000 ukrainische Geflüchtete,<br />
die in Tschechien Schutz gefunden haben. Darüber<br />
hinaus organisiert die Kirche Hilfstransporte in<br />
die Ukraine und unterstützt zwei tschechische<br />
Gemeinden innerhalb der Ukraine.<br />
Die Evangelische Kirche der Böhmischen Brüder<br />
steht exemplarisch für den Geist der Solidarität und<br />
der praktischen Nächstenliebe, der den christlichen<br />
Glauben prägt. In Zeiten globaler Herausforderungen<br />
erweist sich das Wirken der Kirche als Quelle<br />
der Inspiration und der Hoffnung auf eine bessere<br />
Welt.<br />
16 <strong>WeltBlick</strong> 1/<strong>2024</strong>
Diaspora<br />
RUMÄNIEN<br />
Die Evangelische Kirche Augsburgischen Bekenntnisses<br />
in Rumänien ist mit ihrer 500-jährigen lutherischen,<br />
siebenbürgischen, sächsischen und deutschsprachigen<br />
Geschichte und Tradition ein Beispiel<br />
dafür, dass eine kleine Kirche Großes leisten kann.<br />
Mit ihren nur circa 11.000 Mitgliedern zeigt diese<br />
kleine Minderheitskirche, die nach den Abwanderungen<br />
nach der Wende 95 Prozent ihrer Mitglieder<br />
verloren hat, außerordentliches Engagement in allen<br />
Bereichen der Gemeinde- und Kirchenarbeit. Die<br />
Kirche betreibt diakonische Einrichtungen, Schulen,<br />
Ausbildungszentren und sogar ein landeskirchliches<br />
Museum.<br />
Das Zentrum für Evangelische Theologie Ost bietet<br />
unterschiedliche Ausbildungsangebote und<br />
Seminare an. Die Kirche kümmert sich zudem um<br />
rund 160 Kirchenburgen und entwickelt für diese<br />
neue Nutzungsmodelle. Eine wichtige Aufgabe für<br />
die Kirche! Seit 2022 kümmert sich die Kirche auch<br />
um geflüchtete Menschen aus der Ukraine.<br />
Die Geschichte der »Kirche der Siebenbürger<br />
Sachsen« reicht mehr als 850 Jahre zurück. Bereits<br />
im zwölften Jahrhundert ließen sich Siedler aus der<br />
Rhein- und Moselgegend in Siebenbürgen nieder.<br />
Gerufen zur Verteidigung der Grenzen und zur<br />
Erschließung des Landes, gründeten sie Dörfer und<br />
bauten Städte. Die Gotteshäuser waren zugleich<br />
Zufluchtsorte und wurden deshalb immer mehr zu<br />
jenen Kirchenburgen ausgebaut, die heute ein charakteristisches<br />
Merkmal der siebenbürgischen<br />
Landschaft sind. Hier die Kirchenburg von Birthälm.<br />
In ihrem Kernsiedlungsgebiet, dem »Königsboden«,<br />
konnten die Siebenbürger Sachsen wertvolle<br />
Privilegien genießen und sich in weitgehender<br />
Autonomie selbst verwalten. 1550 wurde die lutherische<br />
Kirche offiziell anerkannt. Die Verkündigungssprache<br />
ist seit der Reformation Deutsch (bzw.<br />
Mundart).<br />
Bis zum Ersten Weltkrieg unterstanden alle<br />
deutschsprachigen evangelischen Gemeinden im<br />
heutigen Rumänien, darunter auch in der Hauptstadt<br />
Bukarest, der preußischen kirchlichen Administration.<br />
Erst in den 1920er Jahren hat sich diese<br />
lutherische Diaspora in den Verband der Evangelischen<br />
Kirche Augsburgischen Bekenntnisses in<br />
Rumänien (EKR) integriert.<br />
Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs wanderten<br />
im Jahr 1990 zwei Drittel der evangelischen Gemeindeglieder<br />
nach Deutschland aus. In den darauffolgenden<br />
Jahren dauerte dieser Prozess an.<br />
Die EKR ist heute eine evangelisch-lutherische<br />
konfessionelle und sprachliche Minderheitskirche.<br />
Sie umfasst vornehmlich deutschsprachige evangelische<br />
Christen in Siebenbürgen und in Bukarest.<br />
Bischofssitz ist Sibiu/Hermannstadt; Verkündigungssprache<br />
ist Deutsch.<br />
Das Berliner Missionswerk unterstützt Projekte<br />
in Rumänien, die sich auf Bildung, Gesundheit und<br />
soziale Entwicklung konzentrieren. Durch die<br />
Begegnung von Fachkräften, den Austausch zwischen<br />
Partnergemeinden, die Bereitstellung von<br />
finanziellen Mitteln und den Freiwilligendienst<br />
konnte eine nachhaltige Zusammenarbeit aufgebaut<br />
werden, die bereits zahlreiche positive Veränderungen<br />
in den Gemeinden vor Ort bewirkt hat.<br />
BEGEGNUNG im Herzen Europas<br />
17
In großer Sorge<br />
WOLGA<br />
Die Geschichte der Wolgadeutschen ist auch<br />
eine Geschichte der deutsch-russischen Beziehungen.<br />
Ein Wunder, dass manches die Zeitläufte überstanden<br />
hat – so wie Kirche von Gnadentau/Werchnij<br />
Jeruslan. Seit 2014 besteht eine Partnerschaft<br />
zwischen den Propsteien Saratow und Wolga der<br />
Evangelisch-Lutherischen Kirche im Europäischen<br />
Russland (ELKER) und der EKBO.<br />
Die beiden Propsteien Saratow und Wolgograd<br />
erstrecken sich auf etwa tausend Kilometern entlang<br />
des westlichen Ufers der mittleren und unteren<br />
Wolga. Die meisten Gemeinden liegen westlich des<br />
Stroms. Die Entfernung von Gemeinde zu Gemeinde<br />
beträgt bis zu 300 Kilometern.<br />
Seit vielen Jahren stehen die Gemeinden an der<br />
Wolga vor der Herausforderung, den christlichen<br />
Glauben und ihre lutherische Tradition Mitmenschen<br />
zu vermitteln, die nicht durch ethnisch-familiäre<br />
Beziehungen damit vertraut sind. In den zahlenmäßig<br />
kleinen Gemeinden – viele ihrer<br />
Mitglieder sind nach Deutschland umgesiedelt –<br />
schließt der Gemeindeaufbau auch die Suche nach<br />
diakonischen Initiativen ein.<br />
Der Krieg gegen die Ukraine hat gravierende Auswirkungen<br />
auf die Partnerkirche in Russland. Als eine<br />
kleine Kirche hat die Evangelisch-Lutherische Kirche<br />
Europäisches Russland keinen leichten Stand. Trotzdem<br />
hat sich Erzbischof Dietrich Brauer mutig gegen<br />
den Krieg positioniert – und musste anschließend mit<br />
seiner Familie aus Russland fliehen.<br />
Die Kommunikation zu den Christinnen und<br />
Christen an der Wolga riss damals weitgehend ab –<br />
aus Angst, dass Gespräche abgehört oder Post abgefangen<br />
werden könnte. Trotz dieser schwierigen<br />
Situation versucht das Berliner Missionswerk, Kontakt<br />
zu halten.<br />
18 <strong>WeltBlick</strong> 1/<strong>2024</strong>
Klein, aber mutig<br />
POLEN<br />
Die Evangelisch-Augsburgische Kirche in Polen<br />
ist mit ihren rund 61.000 Mitgliedern eine Minderheitskirche,<br />
die aber sehr aktiv in diakonischen,<br />
sozialen und kulturellen Bereichen ist. Sie ist klein,<br />
aber mutig – auch dank der engagierten Arbeit vieler<br />
Ehrenamtlicher. Davon profitiert auch die Friedenskirche<br />
in Schweidnitz/Świdnica, Weltkulturerbe der<br />
UNESCO (Foto).<br />
Und heute traut sie sich auch, Neues zu wagen!<br />
Im Mai 2022 wurden in Warschau zum ersten Mal<br />
neun Frauen zu Pfarrerinnen ordiniert. Vorausgegangen<br />
war eine Diskussion, die »mit Unterbrechungen<br />
seit 70 Jahren geführt wurde«, wie es in der Einladung<br />
zum Gottesdienst hieß. Zuvor konnten<br />
Frauen in der Kirche seit 1999 als Diakoninnen<br />
arbeiten.<br />
Neben diesem wichtigen Schritt wurde die<br />
Arbeit der Kirche seit Herbst 2021 von der Flüchtlingskrise<br />
geprägt. Zunächst harrten Hunderte<br />
Geflüchtete verzweifelt in den Wäldern an der belarussisch-polnischen<br />
Grenze aus. »Die Situation im<br />
Grenzgebiet zwischen Polen und Belarus wird von<br />
Tag zu Tag schlimmer, je länger der Winter andauert«,<br />
schrieb im Januar 2022 Bischof Ryszard Bogusz,<br />
zugleich Präsident der Diakonie in Polen.<br />
Zahlreiche Menschen in den polnischen Dörfern<br />
in der Grenzregion stellten Kerzen und Leuchter in<br />
ihre Fenster und zeigten damit den Geflüchteten an:<br />
»Hier gibt es Wasser oder etwas Warmes zu essen,<br />
vielleicht sogar eine Waschgelegenheit oder ein sauberes<br />
Bett für ein oder zwei Nächte.« Unterstützt<br />
wurden die Menschen in ihrem Engagement von der<br />
evangelischen Kirche in Polen und von der polnischen<br />
Diakonie.<br />
Verschärft wurde die Situation in Polen im März<br />
2022, als nach dem russischen Angriffskrieg auf die<br />
Ukraine Millionen Geflüchtete aus der Ukraine ins<br />
Land strömten. Diakonie und Gemeinden in Polen<br />
initiierten Hilfezentren und Feldküchen, in denen<br />
die neu Ankommenden eine erste Unterkunft,<br />
Lebensmittel, Matratzen, Decken und Schlafsäcke<br />
erhielten. Seit dem Ausbruch des Krieges steht die<br />
kleine Kirche somit vor einer überwältigenden Aufgabe.<br />
Unterstützt werden die Gemeinden bei ihrer<br />
Flüchtlingshilfe u. a. vom Berliner Missionswerk.<br />
Zu den lebendigen Beziehungen zwischen den Kirchen<br />
in Polen und in Berlin-Brandenburg trägt ein<br />
»Gemeindebegegnungstag« bei, der abwechselnd in<br />
Polen und in Deutschland gefeiert wird. In Frankfurt<br />
(Oder) fand im Oktober 2019 die erste der nunmehr<br />
regelmäßigen ökumenischen Konsultationen der<br />
Bischöfe an Oder und Neiße statt, zu denen seitdem<br />
im zweijährlichen Rhythmus eingeladen wird.<br />
Zudem beweisen zahlreiche Besuche, Austausch-<br />
und Studienreisen in beide Richtungen, wie<br />
aktiv und lebendig die Partnerschaft ist. Die Entscheidung<br />
der polnischen Partnerkirche, die Christlichen<br />
Begegnungstage <strong>2024</strong> gemeinsam mit der<br />
EKBO zu organisieren, hat die Zusammenarbeit zwischen<br />
den beiden Kirchen vertieft. Die Partnerschaft<br />
fußt auf dem Vertrag, der am 16. März 1997 zwischen<br />
der Diözese Breslau/Wroclaw der Evangelisch-Augsburgischen<br />
Kirche in Polen und der Evangelischen<br />
Kirche der schlesischen Oberlausitz unterzeichnet<br />
wurde. Im Zuge der Kirchenfusion übernahm auf<br />
deutscher Seite die EKBO die Partnerschaft. Die<br />
Wurzeln der Evangelisch-Augsburgischen Kirche<br />
reichen bis in die Reformationszeit zurück.<br />
BEGEGNUNG im Herzen Europas<br />
19
BibelSeite<br />
»Wer anderen nicht begegnet,<br />
kann nichts von ihnen lernen«<br />
Mit dem Direktor in der Bibel geblättert<br />
Worauf freuen sie sich am meisten,<br />
wenn Sie an die Christlichen<br />
Begegnungstage denken?<br />
CHRISTOF THEILEMANN: Ich verstehe<br />
unser Ökumenisches Zentrum,<br />
das Berliner Missionswerk, vor<br />
allem als ein Haus, das Begegnung<br />
ermöglicht. Wer anderen nicht<br />
begegnet, kann nichts von ihnen<br />
lernen. Sein/ihr Horizont verengt<br />
sich dann. Das Tolle an den Christlichen Begegnungstagen<br />
ist, dass Sie eine Flut von Begegnungen schaffen werden,<br />
vom Bischof bis zum Gemeindeglied, vom Kirchenmusiker<br />
zur jugendlichen Ehrenamtlichen – und das aus vielen, vielen<br />
Ländern. Die Menschen, die aus den kleineren evangelischen<br />
Kirchen in Osteuropa kommen, brauchen diese<br />
Begegnung so dringend wie wir. Wir können von ihnen viel<br />
lernen. Sie stehen für die Sache Gottes in ganz anderen, oft<br />
schwierigeren Zusammenhängen ein. Sicher können auch<br />
sie uns etwas abschauen. Aber diese Ökumene der Vielfalt,<br />
diese große Familie aus Christinnen und Christen ist das,<br />
was uns aufbaut. Das ist ganz im Sinne dessen, was für Paulus<br />
das entscheidende Kriterium des Lebens in der<br />
Gemeinde oder der Kirche war (vgl. 1. Korinther 10,23f.)<br />
Gelingende Ökumene motiviert!<br />
»Nichts kann uns trennen«: Was sagt die Bibel zu diesem<br />
hohen Anspruch?<br />
CHRISTOF THEILEMANN: In Römer 8,38 betont Paulus, dass<br />
uns nichts von der Liebe Gottes trennen kann. Das Leitmotiv<br />
der Christlichen Begegnungstage stammt selbst aus der<br />
Bibel. Dass uns nichts trennen kann, ist freilich ein hoher<br />
Anspruch. Doch wir müssen uns dabei klar machen, dass<br />
Gott selbst dafür einsteht, dass uns a) nichts von IHM trennen<br />
kann und dass deshalb b) uns als Mitglieder der großen<br />
christlichen Familie nichts voneinander trennen kann. Ja, es<br />
ist wahr: Wir Menschen, eben auch wir Christen, tun anderen<br />
Menschen weh, laden Schuld auf uns. Aber Gott in<br />
20 Christus <strong>WeltBlick</strong> hat sich 1/<strong>2024</strong> siegreich dafür eingesetzt, dass uns nichts<br />
mehr auf das Böse festlegen kann. Es muss so nicht mit der<br />
Menschheit weitergehen. Es muss so nicht bleiben. Deutlich<br />
ist: Wenn man nur auf uns schaut, dann kann man leicht<br />
mutlos werden. Aber wenn wir im Glauben auf Christus blicken,<br />
dann geht es weiter! Eine meiner prägendsten Erfahrungen<br />
als Jugendlicher war im August 1981 die Zentralausschusstagung<br />
des Ökumenischen Rates der Kirchen in<br />
Dresden. Da war ich als Steward dabei. Es war ein befreiendes<br />
Erlebnis, mit Jugendlichen aus den verschiedensten<br />
Ländern zusammen zu arbeiten und zu feiern – inmitten<br />
eines weithin ummauerten Landes. Manche der Kontakte<br />
von damals halten bis heute. Nichts konnte uns trennen.<br />
Die Mauer fiel.<br />
Sie sind selbst in der Grenzregion aufgewachsen, nächst<br />
dem Eisernen Vorhang. Wie war es für Sie, als Deutschland<br />
wiedervereinigt wurde?<br />
CHRISTOF THEILEMANN: Manche Menschen diskutieren<br />
immer noch, ob man es ein Wunder Gottes nennen kann,<br />
dass die Mauer damals fiel. Natürlich ist es immer eine persönliche<br />
Entscheidung, ob man das so sehen will. Ich kann<br />
das. Die Mauer hatte meine Familie über viele Jahre hinweg<br />
getrennt. Im heimatlichen Vogtland wuchs ich elf Kilometer<br />
entfernt von Oberfranken auf. Beim Studium und später<br />
in Berlin war die Mauer an der Gartenstraße 250 Meter entfernt.<br />
Nun könnte ich viel erzählen, wie es damals war. Aber<br />
ich sage es kurz: Es war eine Befreiung! Was ich in Dresden<br />
ansatzweise 1981 erlebt hatte, wurde nun ganz Wirklichkeit.<br />
Und es hat ja im Vogtland, genauer gesagt mit der<br />
Demonstration in Plauen angefangen, bevor in Leipzig und<br />
dann in Berlin der Durchbruch kam. Wir wurden noch einmal<br />
ganz anders freie Menschen. Der Gott, an den wir glauben,<br />
will nicht, dass Menschen getrennt sind: nicht von Ihm,<br />
nicht untereinander. Nicht zuletzt deshalb ist das wichtige<br />
Wort in der Bibel dafür der »Bund«, der Bund Gottes mit<br />
Israel, zu dem wir hinzukommen. Nicht von ungefähr sind<br />
Jesu Gleichnisse für das Reich Gottes oft Hochzeiten oder<br />
gemeinsame Essen… Das Ende der Wege Gottes ist die<br />
Barmherzigkeit, die Menschen zusammenbringt (vgl.<br />
Römer 11). So kennen wir den Gott, der Liebe ist..
STOLZ UND DANKBAR<br />
Die Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische<br />
Oberlausitz ist froh und auch ein wenig stolz,<br />
gemeinsam mit der Evangelisch-Augsburgischen Kirche<br />
in Polen Gastgeberin dieses internationalen Kirchentages<br />
im Herzen Europas zu sein. Wir sind dankbar für<br />
unsere starke grenzüberschreitende Verbundenheit.<br />
Ich freue mich auf gemeinsame Veranstaltungen, auf<br />
Gottesdienste, auf buntes, vielfältiges Treiben in Frankfurt<br />
und Słubice. Begegnen. Beten. Debattieren. Tafeln.<br />
Willkommen dazu.<br />
Christsein ist bunt, Glaube ist vielfältig. Das spiegelt<br />
das beeindruckende Programm für die Christlichen<br />
Begegnungstage. Allen, die dieses Programm vorbereitet<br />
haben und allen, die mitwirken, danke ich von Herzen<br />
Wir sprechen unterschiedliche Sprachen – und doch<br />
sind wir eins – in der Sprache des Glaubens und des Herzens.<br />
Eins vor Gott. Nutzen Sie, nutzen wir die Tage, um<br />
uns inspirieren zu lassen, um zu diskutieren und zu feiern.<br />
Ich freue mich auf die Begegnung mit Ihnen!<br />
Bischof Dr. Christian Stäblein<br />
GUTES ZEICHEN<br />
Das Herz des Glaubens liegt in der Begegnung: Wenn<br />
Christinnen und Christen aus vielen verschiedenen Kirchen<br />
und Ländern Europas zusammenkommen, wenn sie<br />
gemeinsam nach Antworten auf die großen Fragen<br />
unserer Zeit suchen, dann ist das ein gutes Zeichen<br />
dafür, wie lebendig die Kirche und der christliche Glauben<br />
sind. Ich freue mich sehr darüber, dass diese besonderen<br />
Begegnungen <strong>2024</strong> in der deutsch-polnischen<br />
Doppelstadt Frankfurt (Oder)/Słubice stattfinden und<br />
bin davon überzeugt, dass es kaum einen besseren Ort<br />
für Begegnung gibt.<br />
Genau hier, in diesen beiden Städten, sehen wir, wie<br />
wichtig der Austausch über Grenzen hinweg ist, wie<br />
wichtig es ist, die Dinge zu überwinden, die uns trennen.<br />
Nirgendwo sonst sind sich Polen und Deutschland so<br />
nahe. Und im Land Brandenburg haben die freundschaftlichen<br />
Beziehungen zu unseren polnischen Nachbarinnen<br />
und Nachbarn sogar Verfassungsrang. Ich bin<br />
sehr dankbar, wenn so von den Christlichen Begegnungstagen<br />
ein Zeichen ausgeht für Toleranz und Weltoffenheit<br />
in Europa, für Gemeinsinn und ganz besonders<br />
natürlich für den Frieden – heute mehr denn je.<br />
Ich freue mich sehr über alle Gäste, die die Begegnungstage<br />
besuchen und wünsche allen Teilnehmerinnen<br />
und Teilnehmern viel Freude, viele gute Gespräche<br />
und vor allem spannende Begegnungen!«<br />
Ministerpräsident Dr. Dietmar Woidke,<br />
Schirmherr der CBT <strong>2024</strong><br />
ZEIGEN, WIE SCHÖN ES IST<br />
Die europäische Doppelstadt Frankfurt (Oder)/Słubice ist<br />
viel schöner als ihr Ruf. Bei den Christlichen Begegnungstagen<br />
wollen wir das zeigen! Im Kleistforum von 2001 gibt es<br />
Kinder- und Jugendveranstaltungen, inhaltliche Podien und<br />
Ausstellungen. In der fünfschiffigen Marienkirche singen verschiedenste<br />
Chöre. Ihre Schwester, die Friedenskirche von<br />
1230, lädt zum Technogottesdienst ein. Im Audimax der<br />
Europa-Universität Viadrina diskutieren Bischöfe und Politiker:innen.<br />
Im Collegium Polonicum an der Stadtbrücke wird<br />
die deutsch-polnische Freundschaft gefeiert. Und im Lennépark,<br />
auf den Plätzen, in der Uni-Mensa, an der Oderpromenade<br />
und auf der Oderinsel Ziegenwerder gibt es Essen und<br />
Begegnung. Bestimmt scheint die Sonne. Ich wünschte, die<br />
Tage dauerten mindestens eine Woche – dann könnten alle<br />
noch besser sehen, wie schön es in der Mitte Europas ist, und<br />
welche Kraft in den protestantischen Kirchen steckt!<br />
Superintendent Frank Schürer-Behrmann,<br />
Kirchenkreis Oderland-Spree<br />
BEGEGNUNG im Herzen Europas<br />
21
KurzForm<br />
ITHEMBA LABANTU<br />
EPIPHANIAS<br />
Ein großes Dankeschön<br />
Aus Kapstadt, via Facebook: »Wir senden<br />
ein großes Dankeschön an das Berliner<br />
Missionswerk für eine neue Tiefkühltruhe<br />
für unsere Suppenküche, einen neuen<br />
5000l Wassertank und 50 Bäume für unseren<br />
Sportplatz. Wir sind sehr dankbar für Eure kontinuierliche<br />
Unterstützung!« Diesen Dank geben wir gerne an alle<br />
weiter, die uns dabei helfen, iThemba Labantu zu helfen!<br />
Start ins<br />
Jubiläumsjahr <strong>2024</strong><br />
Mit Gottesdienst und Empfang zu Epiphanias<br />
sind Berliner Missionswerk und Gossner<br />
Mission am 6. Januar ins neue Jahr gestartet. Im<br />
Großen Saal des Berliner Rathauses würdigte<br />
Bischof Dr. Christian Stäblein – als Vorsitzender<br />
des Missionsrates – zunächst die Arbeit<br />
des Werkes im vergangenen Jahr. Und lenkte<br />
anschließend den Blick auf <strong>2024</strong>: »Ein ganz besonderes<br />
Jubiläumsjahr ist gestartet: 200 Jahre<br />
Berliner Mission!«.<br />
Mehr Information:<br />
→ berliner-missionswerk.de/aktuelles/meldung/<br />
epiphanias-start-ins-jubilaeumsjahr-<strong>2024</strong><br />
→ berliner-missionswerk.de/ueber-uns/<br />
200-jahre-berliner-mission<br />
Mehr Information:<br />
→ berliner-missionswerk.de/projekte-spenden/afrika/suedafrika-<br />
ithemba-labantu<br />
TALITHA KUMI<br />
Matthias Wolf blickt zurück<br />
Im Mai wird Matthias Wolf Talitha Kumi nach<br />
sechs Jahren als Schulleiter verlassen. Jetzt<br />
hat er zurückgeblickt – auf die Arbeit in einem<br />
schwierigen Spannungsfeld, auf langwierige<br />
Baumaßnahmen – und auf große Erfolge.<br />
»Der Blick von der auf einem Hügel gelegenen<br />
Schule ins weite Land hat mir immer gut<br />
getan«.<br />
Mehr Information:<br />
→ berliner-missionswerk.de/aktuelles/meldung/schulleiter-matthiaswolf-blickt-zurueck<br />
22 <strong>WeltBlick</strong> 1/<strong>2024</strong>
LONDON<br />
Hochgeschätzt<br />
Bischof Dr. Christian Stäblein wurde am 21. Januar <strong>2024</strong> in<br />
einem feierlichen Gottesdienst als Ehrenprediger (»Honorary<br />
Canon«) der Diözese London eingeführt – und hat von nun<br />
an das Recht, in der Kathedrale St Paul‘s zu predigen. »Der<br />
Empfang war außerordentlich herzlich«, so Direktor Dr. Christof<br />
Theilemann, der Bischof Stäblein nach London begleitete, »die<br />
Gastgeber in London haben hohen Respekt vor unserer Kirche«.<br />
Das Berliner Missionswerk betreut die – seit 1999 vertraglich<br />
vereinbarte – Partnerschaft der beiden Kirchen.<br />
Mehr Information:<br />
→ berliner-missionswerk.de/aktuelles/meldung/<br />
london-partnerkirche-ehrt-bischof-staeblein<br />
TEAMGEIST<br />
SÜDAFRIKA<br />
Sechs Kolleg:innen beim<br />
Firmenlauf<br />
Strahlende Gesichter vor dem Start, freudige<br />
Momente nach der Ziellinie. Sechs Kolleg:innen<br />
haben in diesem Jahr am 22. Berliner<br />
Firmenlauf teilgenommen – 5,5 Kilometer<br />
Teamleistung rund um den Berliner Tiergarten!<br />
Mehr Fotos:<br />
→ facebook.com/BerlinerMissionswerk<br />
Außenministerinnen regten Austausch an<br />
Die Initiative für die Tagung ging von den Außenministerinnen Naledi<br />
Pandor und Annalena Baerbock aus, während die Organisation in den<br />
Händen von Afrikareferent Dr. Martin Frank und dem deutschen Kulturattaché<br />
von Jesko von Samson lag. Im Mittelpunkt standen der Einfluss<br />
deutscher Missionare in Südafrika und die Erleichterung des digitalen<br />
Zugriffs auf relevante Quellen und Archive. Zu diesem Anlass kamen<br />
Kirchenführer:innen, Historiker:innen sowie Regierungsvertreter:innen<br />
aus Deutschland und Südafrika am 12. März in Pretoria zusammen.<br />
Mehr Information:<br />
→ berliner-missionswerk.de/aktuelles/meldung/suedafrikaaussenministerinnen-regen-austausch-an<br />
KurzForm<br />
23
WeltReise<br />
KUBA.<br />
Sie wollen gehen<br />
– und sie wollen bleib<br />
24 <strong>WeltBlick</strong> 1/<strong>2024</strong>
Auf der Suche nach dem Sehnsuchtsort?<br />
Junge Kubanerinnen<br />
auf der Plaza Vieja in der Altstadt<br />
Havannas.<br />
en<br />
Im März hat Barbara Neubert Kuba<br />
besucht, zum ersten Mal als Referentin<br />
des Berliner Missionswerkes. Sie kennt<br />
Kuba, kennt die Situation, die schon<br />
lange nicht gut ist. Aber jetzt ist alles<br />
viel schwieriger geworden. Ein Land in<br />
der Dauerkrise. Barbara Neubert hat<br />
mit Menschen gesprochen, die sich fortwährend<br />
von Freunden und Verwandten<br />
verabschieden müssen. Sie hat Menschen<br />
erlebt, die nicht wissen, wie es weitergeht.<br />
Und sie hat Menschen erlebt, die<br />
trotz allem die Hoffnung nicht aufgeben.<br />
TEXT UND FOTOS: BARBARA NEUBERT<br />
Am Sonntag flossen Tränen. Einer der Teamer<br />
feierte seinen letzten Gottesdienst in seiner<br />
Heimat. Da standen sie nun: seine Freundin,<br />
die Freunde aus der Gemeinde, die Pfarrerin. Sie<br />
sangen für ihn, beteten für ihn. Er hatte endlich ein<br />
Visum bekommen, um zu seiner Mutter zu ziehen,<br />
die seit Jahren in den USA lebt. Er wollte gehen, und<br />
er wollte bleiben, das spürten alle in diesem Gottesdienst.<br />
Denn er liebt sein Land, seine Stadt, seine<br />
Gemeinde, seine Freundin. Gleichwohl – er wollte<br />
gehen. Wie so viele, die das Leben auf der Insel<br />
nicht mehr aushalten. Ohne die Unterstützung der<br />
Exilkubaner und -kubanerinnen würde es vielen<br />
Familien auf der Insel noch schlechter gehen, wäre<br />
ihnen ein Leben in Würde kaum möglich. Das weiß<br />
jeder, und das ist bitter. Manche schätzen, dass im<br />
vergangenen Jahr eine halbe Million Menschen das<br />
Land verlassen haben. Das sind sehr viele, in Kuba<br />
leben nur etwa elf Millionen Menschen. »Willst Du<br />
auch gehen?« In jedem Gespräch wird es irgendwann<br />
zum Thema. Ich habe keinen kennengelernt,<br />
der nicht einen nahen Verwandten im Ausland hat.<br />
Dies betrifft auch die Gemeinden. Denn es sind<br />
auch Gemeindemitglieder, die gehen und eine<br />
Lücke hinterlassen. Zugleich werden Gemeinden<br />
immer wichtiger, sie ersetzen Familie, hier begegnen<br />
sich Freunde, hier findet man einen Zufluchts-<br />
WeltReise<br />
25
26 <strong>WeltBlick</strong> 1/<strong>2024</strong>
Linke Seite: Tanzkurs in Placetas,<br />
im Haus der Kultur.<br />
Camajuaní: Der Schein trügt,<br />
die Kirche ist offen.<br />
Die Geschichte der Frau, die<br />
Jesus vor seinem Tod salbt,<br />
dargestellt in der Gemeinde<br />
in Cárdenas: »Was für ein zärtlicher<br />
Moment«, sagt Barbara<br />
Neubert.<br />
Keine Idylle für Touristen, sondern<br />
öffentlicher Nahverkehr:<br />
Taxistand in Placetas.<br />
Rechte Seite: Osterfreude in<br />
Camajuaní nach dem Gottesdienst<br />
bei Sonnenaufgang.<br />
Beeindruckend, wie viele<br />
Sorten Bohnen hier wachsen:<br />
Gemeindegarten in Placetas.<br />
Essen auf Rädern in Cárdenas,<br />
im Regenschauer.<br />
Das Kreuz wird zum Baum des<br />
Lebens: Ostervorbereitungen<br />
in Placetas.<br />
Die Tür zum Gemeindehaus<br />
steht offen – dahinter wird gekocht<br />
und gelacht.<br />
WeltReise<br />
27
WeltReise<br />
ort. In den Kirchengemeinden<br />
treffen sich Menschen, die<br />
gemeinsam Hoffnung suchen,<br />
Hoffnung stärken, Hoffnung<br />
feiern. In der Gemeinde in<br />
Caibarién gibt es Frauen, die<br />
gemeinsam gegen den Brustkrebs<br />
kämpften. Überall ein<br />
schweres Schicksal – in Kuba,<br />
wo gerade die medizinische<br />
Versorgung zusammenbricht,<br />
umso schwerer. Der Pfarrer<br />
findet eine Psychologin, die<br />
die Frauen und ihre Selbsthilfegruppe<br />
begleitet.<br />
Viele Gemeinden und<br />
ökumenischen Zentren geben Essen aus. Manche<br />
Menschen können sich ein warmes Essen nicht<br />
mehr leisten, von ihrer Grundrente oder von ihrem<br />
Gehalt. Die Inflation frisst alles auf. Je nachdem, wie<br />
viele Spenden da sind, wird zwei oder vier Mal in<br />
der Woche gekocht und dann ausgefahren. »Essen<br />
auf Rädern«, auch bei uns in Deutschland weit verbreitet.<br />
Mit dem Unterschied, dass es in Kuba sehr<br />
kompliziert ist, an die Lebensmittel zu kommen. Die<br />
privaten Händler verlangen horrende Preise. In den<br />
Links: Barbara Neubert und<br />
Generalsuperintendent Kristóf<br />
Bálint besuchen eine der vom<br />
Berliner Missionswerk geförderten<br />
Biogas-Anlagen. Die<br />
Kubanerin betreut die Anlage –<br />
und kümmert sich um ihre<br />
Enkelin, deren Eltern ausgewandert<br />
sind.<br />
Rechts: Programmplanung in<br />
Cárdenas: Barbara Neubert mit<br />
dem Pfarrehepaar Sarahí García<br />
Gómez und Alison Infante<br />
sowie dem Kuba-Freiwilligen<br />
des Berliner Missionswerkes,<br />
Georg.<br />
staatlichen Geschäften, in denen man mit Lebensmittelkarte<br />
einkaufen kann, kommen Reis oder Kartoffeln<br />
nur alle paar Wochen an. Und in der Zwischenzeit?<br />
Wenn geliefert wurde, stellt sich mein<br />
Kollege im Ruhestand gleich in die Schlange und<br />
wartet mit den anderen zwei Stunden lang. Er ist<br />
weit über 80 Jahre alt. Was kann da man tun? Wie sät<br />
man Hoffnung?<br />
Was Hoffnung macht, sind die Gemeinden. Egal<br />
wie klein sie sind, immer haben sie die Menschen in<br />
der Nachbarschaft im Blick. Die Türen sind offen,<br />
jeder und jede ist willkommen. Diese Gemeinden<br />
leben Solidarität. Mit ihren Gebeten, ihrem Gesang<br />
und ihrer Herzlichkeit stärken sie die Hoffnung. Und<br />
sie packen an, so wie die Gemeinden in Camjuaní<br />
und Placetas. Sie nutzen ihre Gemeindegärten und<br />
lassen alles wachsen, was die tropische Erde hergibt:<br />
Bananen und Mango, Yukka und Süßkartoffel,<br />
Tomaten und Rote Beete. Die Gemeinden nutzen<br />
jede Gelegenheit, die sich bietet, sie wissen, was die<br />
Menschen brauchen. In Cárdenas wird Seife und<br />
Shampoo hergestellt und verkauft. Shampoo speziell<br />
für krauses schwarzes Haar, »Black Lives Matter«,<br />
auch in der Gemeinde. Eine Gemeinde hat<br />
dafür einen kleinen Laden eröffnet; hier können die<br />
28 <strong>WeltBlick</strong> 1/<strong>2024</strong>
Havanna<br />
Menschen ihr Kunsthandwerk verkaufen, etwas<br />
dazuverdienen.<br />
In einer anderen Gemeinde wird ein Kindergarten<br />
aufgemacht. Er darf nicht Kindergarten heißen,<br />
denn der Staat wacht über sein Bildungsmonopol.<br />
Es gab eine Zeit, da war das wichtig: Nicht der<br />
Reichtum der Eltern sollte über Bildung, Chancen<br />
und Lebensweg der Kinder entscheiden. Jeder nach<br />
seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen.<br />
Heute schafft es der Staat nicht mehr, alle Kinder<br />
von klein auf zu fördern, deshalb hat die<br />
Gemeinde in Guanabacoa eine Kinderbetreuung<br />
organisiert, von montags bis freitags. Die Eltern können<br />
zur Arbeit gehen, die Kinder spielen und lernen<br />
zusammen. »Lasset die Kinder zu mir kommen!« –<br />
die Kirche hat einen Weg dafür gefunden.<br />
Hoffnung säen – und der Wut Raum geben. Der<br />
Wut, dass sich so wenig ändert; der Sorge, wie es in<br />
Zukunft weitergeht. Wenn die Kubanerinnen und<br />
Kubaner über‘s Meer blicken, sehen sie im Westen<br />
das Land Haiti. Es gehört inzwischen zu den »Failed<br />
States«, zu den gescheiterten Staaten, die nicht<br />
mehr in der Lage sind, grundlegende staatliche Aufgaben<br />
zu erfüllen. In Haiti hat die Regierung die<br />
Kontrolle über das Staatsgebiet an kriminellen Banden<br />
verloren. Es gibt weder Rechtssicherheit noch<br />
Sozialleistungen, die Menschen kämpfen ums Überleben.<br />
Blicken die Kubanerinnen und Kubaner nach<br />
Norden, sehen sie Florida und die USA. Wo ein Teil<br />
der Menschen, im Überfluss lebt, zugleich ein anderer<br />
Teil unterhalb der Armutsgrenze; eine kapitalistische<br />
Wirtschaftsweise keine Rücksicht nimmt.<br />
Wohin wird sich Kuba entwickeln? Welche sozialen<br />
Errungenschaften wird das Land erhalten können? /<br />
KUBA<br />
Der karibische Inselstaat Kuba gehört zu den letzten verbliebenen<br />
sozialistischen Ländern. Nach dem Tod des langjährigen<br />
Staatschefs Fidel Castro 2016 und dem Rückzug seines<br />
Bruders Raúl Castro vom Amt des Präsidenten zugunsten von<br />
Miguel Díaz-Canel 2018 schien sich in Kuba eine vorsichtige<br />
Öffnung durchzusetzen. Diese Hoffnungen haben sich bisher<br />
nicht erfüllt; die wirtschaftliche Lage gilt als äußerst angespannt.<br />
In den Kirchengemeinden des Landes wurden derweil<br />
Projekte fortgeführt, die bereits in der Vergangenheit zur<br />
Erleichterung des Alltags beigetragen haben.<br />
Nach der Unabhängigkeit Kubas von Spanien Ende des<br />
19. Jahrhunderts entwickelten sich enge Kontakte zu den<br />
USA. Dort lernten Kubaner protestantische Kirchen kennen<br />
und luden Missionare nach Kuba ein, die zunächst in bürgerlichen<br />
intellektuellen Kreisen Gehör fanden, die dann auch<br />
Gemeinden gründeten. Die Partnerkirche des Berliner Missionswerkes,<br />
die Presbyterianisch-Reformierte Kirche in Kuba<br />
(IPRC), hat hier ihre Wurzeln.<br />
Nach der massiven Verschlechterung der Beziehungen<br />
zwischen den USA und Kuba ab 1960 wurde die IPRC als erste<br />
protestantische Kirche 1967 selbständig. Heute hat sie etwa<br />
15.000 Gemeindeglieder in 53 Gemeinden. Mit diakonischen<br />
Projekten, z. B. einem Waschsalon, Gemüsegärten und »Essen<br />
auf Rädern« unterstützen die Gemeinden ihre Mitglieder und<br />
Nachbarn in dem von Mangel geprägten Alltag. 1999 haben<br />
die IPRC, das Berliner Missionswerk und die Evangelische<br />
Kirche in Berlin-Brandenburg (heute EKBO) einen Partnerschaftsvertrag<br />
unterzeichnet.<br />
Einwohner<br />
10,9 Millionen<br />
(<strong>2024</strong>, geschätzt)<br />
Fläche<br />
110.860 km2<br />
(etwas weniger als ein Drittel der Größe Deutschlands. Die<br />
Hauptinsel Kubas ist über 1.200 km lang und zwischen 30<br />
und 190 km breit)<br />
Barbara Neubert<br />
hat die Insel zum ersten Mal 1993 besucht und ist<br />
seit September 2023 Kuba-Referentin des Berliner<br />
Missionswerkes.<br />
Religionen<br />
Offiziell bekennt sich die Mehrheit der Bevölkerung<br />
zu keiner Religion. Die größte Religionsgruppe bilden<br />
katholische und evangelische Christen.<br />
Quelle: World Factbook<br />
WeltReise<br />
29
HeimSpiel<br />
RADIKALE<br />
Transparenz<br />
»Es gibt viel zu diskutieren«, meint Bénédicte Savoy<br />
Das Berliner Missionswerk hat Bénédicte Savoy eingeladen, zur<br />
200. Wiederkehr des Gründungstages am 29. Februar <strong>2024</strong> zu sprechen.<br />
Mit ihrem Vortrag »Trophäen des Glaubens« und ihren Forderungen<br />
nach Transparenz und Zugänglichkeit ermunterte sie die<br />
Zuhörer:innen, die historische Verantwortung ernst zu nehmen und<br />
miteinander zu sprechen.<br />
TEXT UND FOTO: GERD HERZOG<br />
»Man wird größer, wenn man schwierige Themen<br />
anpackt«: Savoy gilt seit langem als kritische<br />
Stimme im Gespräch über die Aufarbeitung<br />
der kolonialen Vergangenheit, vor einigen<br />
Jahren hatte ihr Expertenbericht zur kolonialen<br />
Raubkunst in Frankreich für Aufsehen gesorgt. Jubiläen<br />
neigen dazu, Momente der unkritischen Selbstfeier<br />
zu sein, »umso bemerkenswerter finde ich es,<br />
zu diesem Anlass sprechen zu dürfen«. Den Abend<br />
eröffnet hatte Direktor Dr. Christof Theilemann mit<br />
einer kurzen Andacht.<br />
Hundert Gäste waren der Einladung ins Evangelische<br />
Zentrum gefolgt, um Savoys Ausführungen<br />
zu lauschen und den Gründungstag der Berliner<br />
Mission zu begehen. Am 29. Februar 1824, auf<br />
den Tag genau vor 200 Jahren, kamen einige<br />
wenige Männer in einer Wohnung am Berliner<br />
Holzmarkt zusammen, um die Berliner Mission ins<br />
Leben zu rufen. Sie folgten dem Zeitgeist, der auf<br />
ein weltweites Verbreiten des Evangeliums<br />
drängte. Und das lange bevor das Deutsche Kaiserreich<br />
selbst Kolonialmacht wurde und der Siegeszug<br />
des Imperialismus im späten 19. Jahrhundert<br />
die Missionare vor gänzlich neue Herausforderungen<br />
stellte.<br />
Bénédicte Savoy hat sich über Jahre als eine<br />
maßgebliche Stimme in den Debatten um die Aufarbeitung<br />
der kolonialen Vergangenheit, die Rückführung<br />
kulturellen Erbes Afrikas und die Restitution<br />
etabliert. Ein bedrückender Fakt sei, so Savoy,<br />
dass der überwiegende Teil der Kulturschätze der<br />
56 afrikanischen Staaten in europäischen Museen<br />
beherbergt werde, »und dabei spielten auch Missionare<br />
eine Rolle«. Durch ihre Nähe zu den Menschen<br />
erwiesen sie sich oft als die aufmerksameren<br />
Ethnografen, Historiker und Wissenschaftler. »Sie<br />
brachten, gemäß ihrem Selbstverständnis, das<br />
Licht und das Kreuz nach Afrika und nahmen<br />
Objekte mit«, erläuterte Savoy. Die Objekte, die von<br />
den Missionaren in ihre Heimatländer gesandt<br />
wurden, sollten ursprünglich den Erfolg ihrer<br />
Arbeit unter Beweis stellen. Während die Motivation<br />
anfangs vorrangig religiös-theologisch war,<br />
dienten die Objekte später auch der Spenden-<br />
30 <strong>WeltBlick</strong> 1/<strong>2024</strong>
Bénédicte Savoy<br />
Andachtsraum des<br />
Evangelischen Zentrums:<br />
»Man hat<br />
den Menschen<br />
ihre kulturellen<br />
Grundlagen entzogen«<br />
sammlung. Schließlich wurden sie verkauft, als<br />
auf dem Kunstmarkt hohe Preise für »exotische«<br />
Objekte erzielt wurden. Savoy zeichnete nach, wie<br />
sich die Motive verbanden und in welchem<br />
Umfang sakrale Gegenstände und Herrschaftsinsignien<br />
nach Europa gelangten: »Man hat den Menschen<br />
ihre kulturellen Grundlagen entzogen.«<br />
Savoy gelang es, das Publikum in ihren Bann<br />
zu ziehen, was auch in der Diskussion ihres Vortrags<br />
deutlich wurde, zu der Dr. Theilemann die<br />
Gäste einlud. Auf die Frage, was sie sich von den<br />
heutigen Missionswerken wünsche, antwortete<br />
Savoy: »Radikale Transparenz«, Transkriptionen<br />
von Handschriften und digitale Foto-Archive,<br />
kurz: »Erreichbarkeit sicherstellen«. Denn die kostbaren<br />
Archive der Missionswerke seien eine wichtige<br />
Ergänzung zu den politischen Archiven,<br />
betonte sie und forderte, diese für Menschen in<br />
den ehemaligen Kolonien zugänglich zu machen.<br />
Auch dem Hinweis, dass Christen in afrikanischen<br />
Partnerkirchen, den ehemaligen Missionskirchen,<br />
den Kampf gegen den Glauben an Magie und<br />
Hexerei unterstützen, wich sie nicht aus. »Das ist<br />
das Gespräch der Menschen vor Ort; dafür fehlt<br />
häufig der Raum. Die Kirche könnte solche Räume<br />
schaffen!« Es gebe viele verschiedene Meinungen,<br />
sowohl hier im Raum als auch in den afrikanischen<br />
Staaten: »Es gibt viel zu diskutieren!« /<br />
Gerd Herzog<br />
ist als Historiker besonders an der Geschichte des Berliner Missionswerkes<br />
interessiert und war erfreut, wie viele Gäste dieses<br />
Interesse teilten.<br />
HeimSpiel<br />
31
Menschen mit Mission<br />
Theresa Rinecker<br />
gebürtig aus Merseburg, leitet gemeinsam<br />
mit Bischof Waldemar Pytel die<br />
Christlichen Begegnungstage CBT24.<br />
Studiert hat sie in Jena, Pastorin war sie<br />
in Thüringen, seit 2018 ist sie Generalsuperintendentin<br />
des Sprengels Görlitz<br />
der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische<br />
Oberlausitz (EKBO).<br />
Die CBT sind ihr ein Herzensanliegen,<br />
»Unter dem Motto ›Nichts kann uns<br />
trennen!‹ gehen wir weiter in der<br />
gemeinsamen Verantwortung für unser<br />
europäisches Zuhause«, sagt sie.<br />
»Besonders dankbar sind wir<br />
für die gemeinsame Einladung<br />
der EKBO und<br />
der Evangelisch-<br />
Augsburgischen Kirche<br />
in Polen zu den<br />
CBT24«.<br />
Anna-Sophia Köhn<br />
sucht eine neue Herausforderung und<br />
verlässt nach fast sechs Jahren das Freiwilligenprogramm.<br />
Während ihrer Zeit<br />
im Berliner Missionswerk hatte sie dort<br />
nicht nur das Fördermittel-Management<br />
in der Hand und Verträge koordiniert,<br />
sondern war auch das musikalische<br />
Gesicht des Werkes. Mit ihrer Trompete<br />
setzte sie Zeichen – auch bei Wind und<br />
Wetter und Minusgraden, wie hier auf<br />
dem Foto vor der Französischen Friedrichstadtkirche.<br />
Anna-Sophia hat versprochen,<br />
sich hin und wieder sehen –<br />
und ihre Trompete hören – zu lassen.<br />
Doch zunächst wünschen wir ihr alles<br />
Gute und Gottes Segen für die Zukunft!<br />
Dorothea Gauland<br />
wurde in Frankfurt am Main geboren,<br />
war in den vergangenen Jahren Pfarrerin<br />
für Ökumene und Interreligiösen Dialog<br />
der Evangelischen Kirche in Hessen und<br />
Nassau. Theologie studiert hat sie in<br />
Heidelberg, Rom und Berlin. Im Dezember<br />
2023 wurde sie auf die Stelle für den<br />
Interreligiösen Dialog beim Berliner Missionswerk<br />
berufen, die zuvor zehn Jahre<br />
lang von Dr. Andreas Goetze betreut<br />
wurde. Zu Gaulands Aufgaben gehört<br />
auch die Bearbeitung theologischer<br />
Grundsatzfragen, darunter das christliche<br />
Selbstverständnis in einer multireligiösen<br />
Situation sowie Fragen zu den<br />
theologischen Grundlagen des Judentums<br />
und des Islams im Verhältnis zum<br />
christlichen Glauben. Darüber hinaus<br />
wird sie Gemeinden, kirchliche Gremien<br />
sowie Einrichtungen wie Kitas, Schulen<br />
und Familienbildungsstätten beraten,<br />
begleiten und fortbilden.<br />
Otto Kohlstock<br />
leitet das Diakoniezentrum iThemba Labantu in Kapstadt. Und hält in der Hand eine Schale,<br />
die es ohne ihn nicht gäbe. Er hat nicht nur die Keramikwerkstatt aufgebaut, sondern<br />
iThemba Labantu zu dem gemacht, was es heute ist: Hoffnung für die Menschen in der<br />
Township Philippi. Die farbenfrohen Stücke passen gut zu Otto Kohlstock: zu seinem<br />
Optimismus, seiner zupackenden Art, seiner Freude an der Arbeit. Und nicht zuletzt<br />
zu seinem Gottvertrauen – das er braucht. An diesem Ort, wo direkt hinter der Mauer<br />
Armut, Verzweiflung und Gewalt beginnen. Und denen er mit Liebe, Vertrauen und<br />
tatkräftiger Hilfe begegnet, seit mehr als zwanzig Jahren. Otto Kohlstock ist kein<br />
Auslandspfarrer, darauf legt er Wert, sondern der letzte Missionar des Berliner Missionswerkes.<br />
Jetzt wurde er 70 Jahre alt und wir gratulieren von Herzen.<br />
32 <strong>WeltBlick</strong> 1/<strong>2024</strong>
Barbara Hustedt<br />
stammt aus Niedersachsen, hat in<br />
Bethel, Marburg und in Brasilien studiert.<br />
Hier, in São Leopoldo und am<br />
Priesterseminar in Recife begann ihr<br />
Interesse an der Ökumene. Zuletzt ging<br />
sie nach Heidelberg und als Pfarrerin<br />
später in die niedersächsischen Gemeinden<br />
Hardegsen und Oesede/Georgsmarienhütte<br />
und zuletzt nach Lüneburg.<br />
Dann als Krankenhausseelsorgerin nach<br />
Berlin-Buch, bevor sie Referentin von<br />
Bischof Dröge und danach von Bischof<br />
Stäblein wurde. »Ich reise gerne, bin<br />
neugierig auf andere Menschen, andere<br />
Landschaften und Gewohnheiten, spreche<br />
gerne andere Sprachen«, hat sie einmal<br />
im Interview gesagt. Das passt, denn<br />
seit April ist sie stellvertretende Direktorin<br />
und Ökumenereferentin im Berliner<br />
Missionswerk, zuständig auch für die<br />
Partnerkirchen in Westeuropa, Nordamerika<br />
und Ostasien. Herzlich willkommen!<br />
Pavel Pokorný<br />
ist ein tschechischer Pfarrer, Krankenhausseelsorger<br />
und seit 2021 Synodenältester<br />
der Evangelischen Kirche der<br />
Böhmischen Brüder (EKBB). Geboren<br />
wurde er in Kutná Hora, Mittelböhmen.<br />
Im Mittealter war Kuttenberg, so der<br />
deutsche Name, nach Prag die zweitgrößte<br />
Stadt Böhmens, bis sie im Zuge<br />
der Hussitenkriege an Bedeutung verlor.<br />
Konfessionskriege, Intoleranz, Verbote<br />
prägten die kirchliche Landschaft Mitteleuropas<br />
lange Zeit, bis zum Toleranzpatent<br />
Kaiser Joseph II. Während der<br />
deutschen Okkupation 1938/39 bis<br />
1945 war die EKBB genauso wie die Bevölkerung<br />
schwerer Verfolgung ausgesetzt;<br />
unter der Herrschaft der<br />
Kommunisten wurden die Kirchen<br />
streng kontrolliert. Heute ist die Tschechische<br />
Republik ein weitgehend säkularisiertes<br />
Land und die Böhmischen<br />
Brüder eine Minderheitenkirche mit<br />
großem Engagement.<br />
Waldemar Pytel<br />
begann 1978 sein Theologiestudium in<br />
Warschau. Nach dem Abschluss wurde er<br />
1986 in der Friedenskirche in Schweidnitz/Świdnica<br />
zum Pfarrer ordiniert;<br />
unmittelbar danach trat er dort seine<br />
Vikariatszeit an. Seine Anstrengungen<br />
trugen wesentlich dazu bei, dass die<br />
Schweidnitzer Friedenskirche 2001 in<br />
die UNESCO-Liste des Welterbes aufgenommen<br />
wurde. Auch im Rat der<br />
Stiftung »Kreisau für europäische<br />
Verständigung« engagiert sich Pytel.<br />
Gemeinsam mit Generalsuperintendentin<br />
Theresa Rinecker leitet er <strong>2024</strong><br />
die Christlichen<br />
Begegnungstage.<br />
Bénédicte Savoy<br />
sagt von sich selbst: »Ich bin auf der Seite der Enteigneten«. Die französische<br />
Kunsthistorikerin erlangte internationale Bekanntheit, als sie 2018 vom französischen<br />
Präsidenten Emmanuel Macron beauftragt wurde, einen Bericht über<br />
die Restitution afrikanischer Kulturgüter zu verfassen – und damit zugleich einen<br />
Teil der französischen Kolonialgeschichte beleuchtete. 2023 präsentierte sie ihre<br />
neueste Arbeit, den »Atlas der Abwesenheit – Kameruns Kulturerbe in Deutschland«.<br />
In diesem Werk dokumentiert sie mehr als 40.000 Objekte aus Kamerun, die zwischen<br />
1886 und 1916 in das Deutsche Reich gebracht wurden und heute noch in deutschen<br />
öffentlichen Museen zu finden sind – die größte Sammlung ihrer Art weltweit.<br />
Menschen mit Mission<br />
33
Zu: <strong>WeltBlick</strong> 3/2023 (»200 Jahre Berliner Mission«)<br />
Wertvolle Verbindung<br />
Als ehemalige Mitarbeiterin der Schulstiftung und Unterstützerin<br />
des Freiwilligenprogramms freue ich mich jedes Mal,<br />
wenn ich die <strong>WeltBlick</strong> in meinem Briefkasten finde. Mittlerweile<br />
lebe ich in Hamburg, und da ist die <strong>WeltBlick</strong> eine wertvolle<br />
Verbindung zum Berliner Missionswerk und seiner<br />
Arbeit; neue Ausgaben sind immer ein kleines Highlight in<br />
meinem Alltag. In der letzten Ausgabe hat mich vor allem der<br />
Artikel zur Nutzung des Hauses Georgenkirchstraße während<br />
der DDR-Zeit und des Kalten Krieges beeindruckt. Und auch<br />
der Artikel zur Geschichte der Berliner Mission sowie des Missionswerks<br />
war äußerst spannend. Vielen Dank! Es ist immer<br />
wieder spannend und eine Freude, von den ehemaligen Kolleginnen<br />
und Kollegen zu hören und über ihre Arbeit auf dem<br />
Laufenden zu bleiben.<br />
Svenja Salzmann<br />
Abteilungsleiterin Zentrum für Studium generale und Persönlichkeitsentwicklung<br />
an der Bucerius Law School (aktuell in Elternzeit),<br />
Hamburg<br />
Zu: <strong>WeltBlick</strong> 3/2023 (»200 Jahre Berliner Mission«)<br />
Viele Erinnerungen<br />
Das neue Heft löst bei mir viele Erinnerungen aus. Doch<br />
zuvor eine technische Anmerkung. In unserer badischen Landeskirche<br />
gab es die Anweisung von Konfirmandinnen und<br />
Konfirmanden zu sprechen und zu schreiben, in dieser Doppelform<br />
Frauen und Männer zu benennen. Ich finde das sehr<br />
gut und habe mir diese Form zu Eigen gemacht. Es würde<br />
auch dem Magazin der Berliner Mission gut tun!!<br />
1967 war ich Gast im Missionshaus am Mittagstisch von<br />
Familie Althaus und wurde danach in den anderen Familien<br />
herumgereicht, bei Meckels und Wekels. 1968 bis 1974<br />
folgte mein Dienst als Missionar der Berliner Mission in Südafrika,<br />
gemeinsam mit Bernhard Schiele und seiner Frau<br />
Magdalena (eine Ärztin), Bischof Paul Gerhard Pakendorf,<br />
Walter Kramer, Gotthilf Wahl (dessen Frau war auch Ärztin),<br />
Herbert Meißner und vielen andere. Wir waren damals etwa<br />
gut 20 Missionsfamilien, die der damalige Bischof Kurt<br />
Scharf einmal bei einer Missionskonferenz besuchte.<br />
Die Zeit in Südafrika hat mein Leben entscheidend<br />
geprägt: Den Dienst in der badischen Landeskirche, als Landeskirchlicher<br />
Beauftragter für Mission und Ökumene der<br />
Prälatur Südbaden und nun den Ruhestand. Als Pfarrer i. R.<br />
übernahm ich neun Vertretungsdienste in deutsch-englischen<br />
Gemeinden in Südafrika, Simbabwe und Namibia, nach<br />
dem Ende der Apartheid. Eine besondere Zeit, reich an<br />
Erfahrungen!<br />
Den Grundstein dafür legte mein Dienst bei der Berliner<br />
Mission. Der Bericht von Markus Meckel löst diese Afrika-<br />
Erinnerungen aus, die ich an dieser Stelle nur andeuten kann.<br />
Karlfrieder Walz<br />
Pfarrer i. R., Maulburg<br />
Zu »Kampf gegen Apartheid, Kolonialismus und Rassismus.<br />
Nachruf auf den Berliner Missionar Markus Braun«<br />
(<strong>WeltBlick</strong> 2/2023)<br />
Missgeschick<br />
Leider ist bei meinem Nachruf auf Markus Braun ein<br />
Missgeschick passiert. Der inhaltlich entscheidende Satz<br />
wurde weggelassen, in dem der Hinweis auf den inhaltlichen<br />
Grund des Schuldbekenntnisses, der Völkermord an<br />
den Herero und den Nama genannt wird. Der wieder eingefügte<br />
Satz (fettgedruckt) macht erst klar, worum es in<br />
dem Schuldbekenntnis eigentlich ging:<br />
»Ein Schuldbekenntnis der EKD zur Vollversammlung<br />
des Lutherischen Weltbunds, die im Mai 2017 in Windhoek<br />
stattfand, ist auch auf Grund unserer Zusammenarbeit<br />
und des Drängens des Mainzer Arbeitskreises Südliches<br />
Afrika und der Solidarischen Kirche Rheinland entstanden.<br />
Das Schuldbekenntnis wurde vor der Vollversammlung<br />
des LWB im April 2017 von der EKD unter dem Titel<br />
»Vergib uns unsere Schuld (Matthäus 6,12) – EKD-Erklärung<br />
zum Völkermord im früheren Deutsch-Südwestafrika«<br />
veröffentlicht. Ein überfälliger Schritt und ein wichtiger<br />
Erfolg für die Aufarbeitung der kolonialen<br />
Vergangenheit, zu dem Markus Braun durch seinen unermüdlichen<br />
Einsatz beigetragen hat.«<br />
Ich hoffe auf Ihr Verständnis und freue mich auf die<br />
Veröffentlichung!<br />
Gerd Decke<br />
Pfarrer i. R., Berlin<br />
(Gerd Decke war von 1993–2005 im Berliner Missionswerk<br />
Referent für das Südliche Afrika und das Horn von Afrika)<br />
Antwort auf den Hinweis von Gerd Decke<br />
Wichtige Ergänzung<br />
Sie haben Recht, das ist eine wichtige Ergänzung, die wir<br />
hiermit gerne nachreichen.<br />
Die Redaktion<br />
HIER IST PLATZ AUCH FÜR<br />
IHREN LESERBRIEF!<br />
Schreiben Sie uns per E-Mail oder<br />
Post an<br />
leserbrief@berliner-missionswerk.de<br />
<strong>WeltBlick</strong>-Redaktion<br />
Leserbriefe<br />
c/o Berliner Missionswerk<br />
Georgenkirchstr. 70<br />
10249 Berlin<br />
WIR FREUEN UNS AUF IHRE<br />
ZUSCHRIFT!<br />
34 <strong>WeltBlick</strong> 1/<strong>2024</strong>
Das Berliner Missionswerk auf YouTube:<br />
Geschichte und Gegenwart in 8 Minuten<br />
Hier finden Sie das Video:<br />
berliner-missionswerk.de/ueber-uns/200-jahre-berliner-mission<br />
Die Gegenwart auf 80 Seiten:<br />
Jahresbericht 2023<br />
Unsere Partnerkirchen unterstützen Flüchtlinge aus der Ukraine und<br />
sorgen sich um das Klima: »Wir haben einen Garten geerbt, dürfen<br />
keine Wüste hinterlassen«. Der Jahresbericht 2023 zeigt, wie tief unser<br />
gemeinsamer christlicher Glaube und die Hoffnung auf eine friedliche<br />
Welt uns verbinden. »Wir sind stolz darauf, unseren Jahresbericht zu<br />
präsentieren, der die Arbeit und das Engagement unseres Teams sowie<br />
die Unterstützung unserer Partner und Spender widerspiegelt«, so<br />
Direktor Dr. Christof Theilemann.<br />
Der Jahresbericht 2023 online:<br />
berliner-missionswerk.de/aktuelles/meldung/neu-jahresbericht-2023
Spendenkonto<br />
Für die<br />
besonders Schutzbedürftigen<br />
Berliner Missionswerk<br />
Evangelische Bank<br />
BIC GENODEF1EK1<br />
IBAN DE86 5206 0410 0003 9000 88<br />
Kennwort<br />
»<strong>WeltBlick</strong> – Hilfe für Geflüchtete«<br />
Noch immer sind mehr als 6,3 Millionen Ukrainerinnen<br />
und Ukrainer auf der Flucht vor dem blutigen Krieg<br />
in Ihrer Heimat. Besonders unsere kleine rumänische<br />
Partnerkirche leistet seit über zwei Jahren Große und<br />
hält Heime und Gemeindehäuser für Geflüchtete<br />
offen. Viele von ihnen haben sich schnell ein selbstständiges<br />
Leben in Rumänien aufgebaut. Doch gibt es<br />
Geflüchtete, zumeist Pflegebedürftige, ältere Menschen<br />
oder Mütter mit kleinen Kindern, die langfristig<br />
auf Unterstützung angewiesen bleiben.<br />
Für diese besonders Schutzbedürftigen soll ein leerstehendes<br />
Gebäude im landeskirchlichen Erholungsheim<br />
in Michelsberg saniert und als neues Zuhause<br />
zur Verfügung gestellt werden.<br />
Bitte helfen Sie dabei, akute Not zu lindern<br />
und langfristige Perspektiven zu<br />
schaffen. Bitte helfen Sie uns, die Partnerkirchen<br />
in Osteuropa bei der Hilfe<br />
für Geflüchtete zu unterstützen!