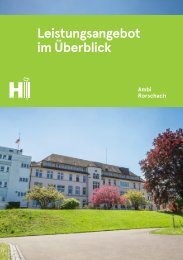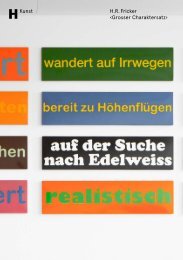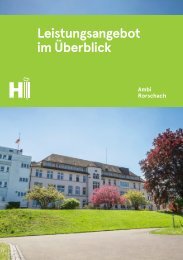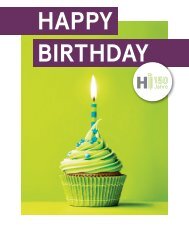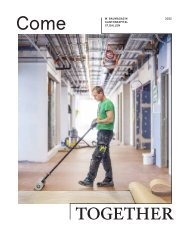Taetigkeitsbericht_MFZ
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Tätigkeitsbericht 2022 – 2023<br />
Medizinisches<br />
Forschungszentrum
«Eine gute Wissenschaftskultur ist die Basis für qualitativ hochstehende<br />
Forschung und mitentscheidend, dass Nachwuchskräfte<br />
eine Karriere in der akademischen Medizin anstreben.<br />
Die Forschungskultur muss durch Respekt, Offenheit und Transparenz<br />
geprägt sein und ein teamorientiertes Arbeiten ermöglichen.<br />
Nachwuchsforschende dürfen nicht einem zu ehrgeizigen<br />
Publikationsdruck ausgesetzt und nicht von einer einzigen Person<br />
abhängig sein. Sie brauchen eine verständnisvolle und fördernde<br />
Arbeitsumgebung, angemessene Forschungszeit, transparente<br />
institutionelle Rahmenbedingungen, Unterstützung im Einwerben<br />
von Drittmitteln und kalkulierbare Karrierewege.»<br />
Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissenschaften<br />
(2016) Wissenschaftskultur und Nachwuchsförderung in der<br />
Medizin.<br />
Titelbild: Herzfibroblasten in Nahaufnahme.<br />
Nadine Cadosch, natur wissenschaftliche Doktorandin im Institut<br />
für Immunbiologie, zeigt anhand der mikroskopischen Darstellung<br />
von Fibroblasten aus dem Herzen die Funktion dieser Bindegewebszellen:<br />
Aufbau und Erhalt der Gewebestruktur, Koordination<br />
des Zusammenspiels der Zellen im Herzmuskel und Versorgung<br />
mit wichtigen Wachstumsfaktoren.
Inhalt<br />
Vorwort des CEO und Vorsitzenden der Geschäftsleitung 4<br />
Vorwort der Präsidentin der Forschungskommission 5<br />
Management Summary 6<br />
Organisation des Medizinischen Forschungszentrums 7<br />
Highlights 8<br />
Forschungsförderung und Forschungskommunikation 12<br />
Forschungskommission14<br />
Projekt- und Personenförderung 16<br />
Projekte Forschungsförderung 18<br />
Kooperationsprojekte Empa-Kantonsspital St.Gallen 20<br />
Medizinische Dissertationsprojekte 20<br />
Besondere Erfolge aus der Projektförderung 21<br />
Forschungskommunikation23<br />
Medizinisches Forschungszentrum 24<br />
Stabsstellen26<br />
Forschungsförderung und -kommunikation 27<br />
Betriebs- und Forschungsmanagement 27<br />
Technologietransfer 27<br />
Zentraleinheiten Labor 28<br />
Clinical Trials Unit 30<br />
Dienstleistungsangebote 32<br />
CTU-Netzwerk 34<br />
Zusammenfassung und Ausblick 34<br />
Institut für Immunbiologie 38<br />
Immunbiologie 40<br />
Neuroimmunologie 44<br />
Experimentelle Neurochirurgie 50<br />
Experimentelle Dermatologie 56<br />
Assoziierte Forschungsgruppen 62<br />
Experimentelle Onkologie und Hämatologie 64<br />
Experimentelle Infektiologie 74<br />
Experimentelle Urologie 84<br />
Weiterbildung und universitäre Ausbildung 88<br />
Seminarreihen des Medizinischen Forschungszentrums 90<br />
Weiterbildungen der Clinical Trials Unit 91<br />
Universitäre Kurse und Seminare 92<br />
Ausblick: Forschungshaus 09 94<br />
Interviews<br />
Als Allrounderinnen mittendrin 36<br />
Jedes Experiment ein Abenteuer 48<br />
Neuland in der Heimat 72<br />
Endlich Zeit für das Warum 82
Die Forschenden des Kantonsspitals St.Gallen<br />
sind vor allem in der translationalen und klinischen<br />
Forschung tätig. Dabei werden sie vom<br />
Medizinischen Forschungszentrum umfassend<br />
unterstützt. Gemäss Leistungsvereinbarung<br />
des Kantonsspitals St.Gallen mit dem Kanton<br />
unterstützt das Medizinische Forschungszentrum<br />
die Forschenden durch den Betrieb einer<br />
Clinical Trials Unit, der Koordinationsstelle für<br />
Forschungsförderung, des Instituts für Immunbiologie<br />
und den Betrieb von Laborinfrastruktur<br />
für translationale Forschungsprojekte. Der<br />
vorliegende Tätigkeitsbericht ist ein eindrücklicher<br />
Beleg für die hohe Fachkompetenz der<br />
Mitarbeitenden des Medizinischen Forschungszentrums,<br />
die exzellente Qualität der<br />
wissenschaftlichen Arbeit der Forschungsgruppen<br />
und die kostenbewusste Umsetzung<br />
des Leistungsportfolios.<br />
Stefan Lichtensteiger<br />
CEO und Vorsitzender der Geschäftsleitung<br />
Forschung fördert die<br />
Unternehmensentwicklung<br />
Die universitäre Ausbildung von Ärztinnen und Ärzten, die fachärztliche<br />
Weiterbildung sowie die medizinische Forschung sind<br />
die Grundpfeiler für die Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit<br />
und die Sicherstellung der hohen medizinischen Behandlungsqualität<br />
in der Schweiz. Das Kantonsspital St.Gallen<br />
leistet als grosses Zentrums- und Ausbildungsspital dazu einen<br />
wesentlichen Beitrag. Mit einem Einzugsgebiet, das sich über<br />
alle Ostschweizer Kantone erstreckt und rund 700’000 Personen<br />
umfasst, ist das Kantonsspital St.Gallen eines der grössten<br />
Spitäler der Schweiz. Die hohe Qualität der medizinischen Versorgung<br />
am Kantonsspital St.Gallen zeigt sich in den zahlreichen<br />
Leistungsaufträgen im Bereich der hochspezialisierten<br />
Medizin. Um den Status als Endversorgerspital zu erhalten und<br />
die dafür notwendigen Fachkräfte rekrutieren zu können, engagieren<br />
sich die akademischen Mitarbeitenden des Kantonsspitals<br />
St.Gallen aktiv in der universitären Lehre und Forschung.<br />
«Das Kantonsspital St.Gallen entwickelt<br />
sich zu einem universitären Lehr- und<br />
Forschungsspital.»<br />
Die weitere Entwicklung des Medizinischen<br />
Forschungszentrums wird in den kommenden<br />
Jahren durch die Anpassung der baulichen<br />
Forschungsinfrastrukturen ermöglicht. Der<br />
Verwaltungsrat hat die Modernisierung der Labor-<br />
und Büroflächen im Haus 09 im April 2023<br />
genehmigt, so dass der Ausbau zu einem vollwertigen<br />
Forschungsgebäude in den Jahren<br />
2025 und 2026 erfolgen kann.<br />
Ein besonderes Anliegen der Geschäftsleitung<br />
ist die Unterstützung einer attraktiven Karriereentwicklung<br />
des ärztlichen Kaders. Die Karriereförderung<br />
von fortgeschrittenen Forschenden<br />
aus dem medizinischen Bereich zum Aufbau<br />
einer eigenen Forschungsgruppe und die Finanzierung<br />
von medizinischen Doktorarbeiten<br />
durch die Forschungskommission sind für den<br />
Forschungsstandort besonders attraktiv.<br />
Durch die Aktivitäten des Medizinischen Forschungszentrums<br />
werden weitere akademische<br />
Karrierewege geschaffen, um hoch qualifiziertes<br />
Personal frühzeitig rekrutieren und<br />
am Kantonsspital St.Gallen halten zu können.<br />
Die Geschäftsleitung gratuliert den Mitarbeitenden<br />
des Medizinischen Forschungszentrums<br />
zu ihren hervorragenden Leistungen in<br />
den Jahren 2022 und 2023. Die breit gefächerten<br />
Aktivitäten des Medizinischen Forschungszentrums<br />
sind ein wichtiger Beitrag zur Weiterentwicklung<br />
des Unternehmens zu einem<br />
universitären Lehr- und Forschungsspital.<br />
4 Vorwort des CEO und Vorsitzenden der Geschäftsleitung
Forschung für unsere Patienten<br />
Forschung ist neben Klinik und Lehre eine der<br />
drei tragenden Säulen der Medizin. Sie steht<br />
im Dienste der Optimierung der Behandlungsqualität<br />
für unsere Patientinnen und Patienten.<br />
Als Ausbildungsspital unterstützt das Kantonsspital<br />
St.Gallen, dass Mitarbeitende Forschung<br />
betreiben und sich wissenschaftlich qualifizieren<br />
können. Modernste Ausstattung und<br />
hochqualifizierte interdisziplinäre Teams<br />
bilden die Grundlage für die bestehende,<br />
hohe nationale und internationale Anerkennung.<br />
Dabei werden die Forschenden durch<br />
das Medizinische Forschungszentrum – einschliesslich<br />
der Clinical Trials Unit – sowie<br />
durch die Forschungsförderung unterstützt.<br />
Die Forschungskommission des Kantonsspitals<br />
St.Gallen dient der Forschungsförderung. Sie<br />
berät die Geschäftsleitung, fördert die Sichtbarkeit<br />
der Forschungsaktivitäten nach innen<br />
und aussen und entscheidet über die Vergabe<br />
von Forschungsmitteln. Die Mitglieder der<br />
Forschungskommission sind hochqualifizierte<br />
Vertreter aller medizinischen Departemente.<br />
Sie werden durch externe Expertinnen und<br />
Experten der Empa, der Universität St.Gallen,<br />
des Ostschweizer Kinderspitals und des Zentrums<br />
für Labormedizin ergänzt. Dabei ist die<br />
Forschungskommission wissenschaftlich unabhängig<br />
und stützt sich bei der Beurteilung<br />
von Forschungsprojekten auf national und international<br />
geltende Vorgaben. Gefördert<br />
werden Projekte aus den Bereichen der klinischen<br />
Forschung, der translationalen Forschung<br />
und der Grundlagenforschung.<br />
«Modernste Ausstattung und<br />
hochqualifizierte interdisziplinäre<br />
Teams bilden die Grundlage<br />
für die bestehende, hohe<br />
nationale und internationale<br />
Anerkennung.»<br />
Dr. Katja Hämmerli-Keller<br />
Präsidentin der Forschungskommission, Leitende Psychologin<br />
Rückblickend auf die Jahre 2022 und 2023<br />
wurden eine Vielzahl von Forschungsprojekten<br />
auf höchstem nationalen und internationalen<br />
Qualitätsniveau gefördert. Zusätzlich<br />
konnten Forschungstalente im Rahmen der<br />
Nachwuchsgruppenstelle gefördert, sowie die<br />
Projektzusammenarbeit mit der Universität<br />
St.Gallen mit einem Projektwettbewerb unterstützt<br />
werden. Die regelmässige Förderung von<br />
Kooperationsprojekten mit der Empa unterstreicht<br />
die Wichtigkeit der Zusammenarbeit mit externen<br />
Partnern. Ein grosser Dank gebührt den Mitgliedern der Forschungskommission,<br />
welche durch ihre Kompetenz und interdisziplinäre<br />
Zusammenarbeit die Forschungsförderung am<br />
Kantonsspital St.Gallen unterstützen. Zusätzlich möchte ich<br />
mich im Namen der Forschungskommission bei Prof. Dr.<br />
Miodrag Filipovic, welcher mit höchstem Engagement von 2019<br />
bis 2023 die Forschungskommission präsidiert hat, bedanken.<br />
Ein weiterer Dank gilt an dieser Stelle dem Team des Medizinischen<br />
Forschungszentrums, insbesondere Frau Dr. Miluse<br />
Trtikova, Administration Forschungskommission, für die hervorragende<br />
Arbeit.<br />
Der Ausblick in die Zukunft des Kantonsspitals St.Gallen als universitäres<br />
Lehr- und Forschungsspital ist vielversprechend. Die<br />
Zusammenarbeit mit internen und externen Partnern sowie die<br />
Sichtbarkeit der exzellenten Forschungstätigkeit stehen weiter<br />
im Zentrum. Das Kantonsspital St.Gallen hat sich den Ruf eines<br />
attraktiven Forschungsspitals geschaffen und ist ein attraktiver<br />
Partner in diesem Bereich. Mit der neu gegründeten KSSG-<br />
Stiftung werden sich neue Forschungsförderungsmöglichkeiten<br />
ergeben. Des Weiteren steht der Aufbau der IT-Infrastruktur im<br />
Bereich der klinischen Forschung und damit die Beteiligung am<br />
Swiss Personalized Health Network an. Schliesslich wird die exzellente<br />
Forschungsleistung des Kantonsspitals St.Gallen im<br />
Rahmen des Forschungstages am 28. November 2024 präsentiert.<br />
Dabei wird ganz im Sinne «Forschung für unsere Patienten»<br />
die Bedeutung der Forschung in Anwesenheit von Vertretern des<br />
Gesundheitsdepartements des Kanton St.Gallen, des Verwaltungsrates<br />
der St.Galler Spitalverbunde, der Geschäftsleitung des<br />
Kantonsspitals St.Gallen sowie externer Partner hervorgehoben.<br />
Vorwort der Präsidentin der Forschungskommission 5
Neue Forschungsgruppen in den Bereichen Experimentelle<br />
Neurochirurgie und Experimentelle Onkologie/Hämatologie<br />
erweitern das breite Spektrum der Forschung am Medizinischen<br />
Forschungszentrum. In einer zweiten Forschungsgruppe<br />
der Experimentellen Neurochirurgie untersucht PD Dr. Dr.<br />
Isabel Hostettler die Ursachen und mögliche therapeutische<br />
Interventionen bei Gefässerweiterungen im Gehirn. Eine dritte<br />
Forschungsgruppe in der Experimentellen Onkologie/Hämatologie,<br />
die von Dr. Nageswara Rao Tata geleitet wird, erforscht<br />
die genetischen und immunologischen Mechanismen bei Leukämien.<br />
Besonders erwähnenswert ist die Ernennung<br />
von Dr. Natalia Pikor im April 2023<br />
zur Assistenzprofessorin im Fach Neuroimmunologie<br />
an der ETH Zürich. Die erstmalige<br />
Vergabe einer Professur an eine Forschungsinstitution<br />
der Ostschweiz honoriert die ausserordentlichen<br />
Leistungen von Prof. Pikor, die<br />
sich u. a. in der Vergabe von CHF 1,8 Millionen<br />
im Rahmen eines «Starting Grants» des<br />
Schweizerischen Nationalfonds zeigt.<br />
Prof. Dr. Burkhard Ludewig<br />
Leiter Medizinisches Forschungszentrum<br />
Starke Nachwuchskräfte in der universitären<br />
Forschung<br />
Das Medizinische Forschungszentrum schafft eine attraktive<br />
Forschungsumgebung, um die akademische Ausbildung in der<br />
biomedizinischen, translationalen und klinischen Forschung<br />
am Kantonsspital St.Gallen zu stärken. Die Ausstrahlung des<br />
Kantonsspitals St.Gallen als Forschungsstandort zeigt sich in<br />
der steigenden Zahl von Doktorierenden in den Forschungsgruppen<br />
des Medizinischen Forschungszentrums. Besonders<br />
erfreulich für die akademische Ausbildung des zukünftigen<br />
ärztlichen Kaders ist die Möglichkeit der Promotion im PhD-<br />
Ausbildungsgang «Klinische Wissenschaften» der medizinischen<br />
Fakultät der Universität Zürich. Die Interviews auf den<br />
Seiten 36, 48, 72 und 82 dieses Tätigkeitsberichts zeigen die<br />
Begeisterung der Doktorierenden für die biomedizinische und<br />
klinische Forschung und belegen die Attraktivität des Kantonsspitals<br />
St.Gallen als universitäres Forschungsspital.<br />
«Die Begeisterung der Doktorierenden<br />
für die biomedizinische und klinische<br />
Forschung ist ein Beleg für die Attrak -<br />
tivität des Kantonsspitals St.Gallen<br />
als universitäres Forschungsspital.»<br />
Die Ausbildung der akademischen Nachwuchskräfte<br />
am Medizinischen Forschungszentrum<br />
wird ausschliesslich über Drittmittel<br />
und Beiträge der Forschungskommission<br />
des Kantonsspitals St.Gallens finanziert. Die<br />
Förderung von einjährigen medizinischen<br />
Dissertationen durch die Forschungskommission<br />
ist ein wichtiges Instrument, um den<br />
Assistenzärztinnen und -ärzten am Kantonsspital<br />
St.Gallen attraktive Forschungsmöglichkeiten<br />
zu bieten.<br />
Exzellente Forschung misst sich an der Einwerbung<br />
von kompetitiven Drittmitteln und<br />
Publikationen in hochrangigen Fachzeitschriften.<br />
Zu den herausragenden Publikationen der<br />
Forschenden des Medizinischen Forschungszentrums<br />
in den Jahren 2022 und 2023 zäh -<br />
len Veröffentlichungen in den Zeitschriften<br />
Nature, Nature Immunology, Science Immunology<br />
und Science Translational Medicine.<br />
Die hohe Qualität der Forschung am Medizinischen<br />
Forschungszentrum und die breite Unterstützung<br />
der klinisch Forschenden in den<br />
Kliniken, Zentren und Instituten des Kantonsspitals<br />
St.Gallen wird durch die administrative<br />
und organisatorische Expertise der Mitarbeitenden<br />
der Clinical Trials Unit ermöglicht. Die<br />
Unterstützung klinischer und translationaler<br />
Forschungsprojekte im Sinne einer Anschubfinanzierung<br />
erfolgt durch direkte Beiträge<br />
der Forschungskommission aus dem Budget<br />
des Medizinischen Forschungszentrums.<br />
Um die vielfältigen Aufgaben in der Unterstützung<br />
der Forschenden am Kantonsspital<br />
St.Gallen auch in Zukunft gewährleisten zu<br />
können, hat der Verwaltungsrat der St.Galler<br />
Spitalverbunde im April 2023 das Bauprojekt<br />
«Forschungshaus 09» genehmigt. Mit der<br />
Anpassung der Labor- und Büroinfrastruktur<br />
im Haus 09 wird das moderne Forschungsumfeld<br />
am Kantonsspital St.Gallen erhalten<br />
und die Attraktivität des Forschungsstandorts<br />
weiter gesteigert.<br />
6 Management Summary
Organisation des Medizinischen<br />
Forschungszentrums<br />
Das Medizinische Forschungszentrum stellt<br />
den Forschenden des Kantonsspitals St.Gallen<br />
Dienstleistungen und Infrastrukturen zur Verfügung,<br />
die sämtliche Forschungsaktivitäten<br />
von der Grundlagenforschung bis zu klinischen<br />
Studien fördern und unterstützen. Die Forschungsgruppen<br />
des Instituts für Immunbiologie<br />
arbeiten an Projekten der translationalen<br />
Forschung, die sowohl auf nationaler als auch<br />
auf internationaler Ebene höchste Anerkennung<br />
finden.<br />
«Neuste medizinische Erkenntnisse<br />
aus der Forschung<br />
sichern die bestmögliche<br />
Behandlung der Patientinnen<br />
und Patienten auf univer -<br />
si tärem Niveau.»<br />
Geschäftsbericht Kantonsspital St.Gallen 2022<br />
Im April 2023 wurde das Medizinische Forschungszentrum<br />
dem Direktionsdepartement angegliedert. Die Clinical Trials<br />
Unit und das Institut für Immunbiologie bilden gemeinsam mit<br />
den Zentraleinheiten Labor und den Stabstellen die permanenten<br />
Forschungseinrichtungen.<br />
Die Stabsstellen sind für verschiedene organisatorische und<br />
administrative Aufgaben zuständig. Dazu gehören die Organisation<br />
der Aktivitäten der Forschungskommission und die<br />
Förderung von Innovationsaktivitäten im Rahmen des Technologietransfers.<br />
Die Zentraleinheiten Labor unterstützen die experimentell<br />
oder klinisch Forschenden aktiv bei ihren Projekten und stellen<br />
die notwendige technologische Infrastruktur zur Verfügung.<br />
Die Kliniken, Institute und Zentren des Kantonsspitals St.Gallen<br />
haben die Möglichkeit, Forschungsgruppen am Medizinischen<br />
Forschungszentrum zu etablieren. Zurzeit arbeiten elf Forschungsgruppen<br />
in den Laboren des Medizinischen Forschungszentrum.<br />
Geschäftsleitung Kantonsspital St.Gallen<br />
Departement Direktion<br />
Medizinisches Forschungszentrum<br />
Forschungskommission<br />
Kliniken, Institute,<br />
Zentren<br />
Stab<br />
Forschungsförderung- und<br />
kommunikation<br />
Betriebs- und<br />
Forschungsmanagement<br />
Technologietransfer<br />
Clinical Trials Unit<br />
Dienstleistungen/Services<br />
Zentraleinheiten Labor<br />
Institut für Immunbiologie<br />
Immunbiologie<br />
Neuroimmunologie<br />
Experimentelle<br />
Neurochirurgie I, II<br />
Experimentelle<br />
Dermatologie<br />
betrieblichorganisatorisch<br />
personell &<br />
fachlich<br />
Kliniken, Institute, Zentren<br />
Experimentelle Onkologie<br />
I–III<br />
Experimentelle Urologie<br />
Experimentelle Infektiologie<br />
I, II<br />
Organigramm 7
Highlights<br />
ERC gewährt Millionenförderung für<br />
Erforschung der Herzmuskelentzündung<br />
Der Europäische Forschungsrat (ERC) fördert Projekte mit<br />
Pioniercharakter aus allen wissenschaftlichen Disziplinen. Der<br />
Forschungsgruppe um Prof. Dr. Burkhard Ludewig wurde in<br />
diesem hochkompetitiven Wettbewerb ein Förderbeitrag von<br />
knapp CHF 2,5 Millionen zugesprochen. Ziel des im Jahr 2022<br />
gestarteten Projekts ist die Erforschung der molekularen und<br />
immunologischen Prozesse bei Herzmuskelentzündungen.<br />
SWISS BRIDGE AWARD für<br />
wegweisende Krebsforschung<br />
Prof. Dr. Lukas Flatz und sein Team der<br />
Experimentellen Dermatologie erhielten im<br />
Jahr 2023 namhafte Unterstützung für ein<br />
Projekt im Bereich der Krebsmedizin. Die<br />
Unterstützung von Swiss Bridge in der Höhe<br />
von CHF 250’000 ermöglicht translationale<br />
Arbeiten zur Entstehung von Therapieresistenzen<br />
bei Tumorerkrankungen und zur Entwicklung<br />
neuer Behandlungswege.<br />
8 Highlights
Mögliche Beteiligung von<br />
Darmbakterien bei Hirntumoren<br />
und Aneurysmen<br />
PD Dr. Marian Neidert, stellvertretender Chefarzt<br />
der Neurochirurgie, war einer der Hauptautoren<br />
einer Studie über die mögliche Rolle<br />
von Darmbakterien bei Hirntumoren. Die in<br />
der Fachzeitschrift Nature (2023) veröffentlichte<br />
Studie zeigt, dass Bestandteile von Darmbakterien<br />
Immunreaktionen in Hirntumoren<br />
auslösen können. PD Dr. Dr. Isabel Hostettler,<br />
seit 2021 Oberärztin in der Neurochirurgie<br />
und Forschungsleiterin am Medizinischen<br />
Forschungszentrum, untersucht den Zusammenhang<br />
zwischen Darmbakterien und Hirnaneurysmen.<br />
Double Impact: Zwei Studien in der<br />
Fachzeitschrift Nature Immunology publiziert<br />
Den Forschungsteams um Prof. Dr. Natalia Pikor und Prof.<br />
Dr. Burkhard Ludewig ist es gelungen, zwei Studien in der Mai-<br />
Ausgabe 2023 der Fachzeitschrift Nature Immunology zu publizieren.<br />
Die Nachwuchswissenschaftlerinnen Dr. Angelina De<br />
Martin und Dr. Mechthild Lütge sind die Erstautorinnen dieser<br />
bedeutenden Studien. Die Arbeiten befassen sich mit der<br />
Funktion von Bindegewebszellen in menschlichen Gaumenmandeln<br />
und dem Zusammenspiel von Bindegewebszellen und<br />
Immunzellen in Mensch und Maus.<br />
Highlights 9
Highlights<br />
SNF fördert Forschung zur<br />
Resistenzentwicklung von Darmbakterien<br />
bei Antibiotikabehandlungen<br />
Der Schweizerische Nationalfonds (SNF) unterstützt das Projekt<br />
«mBiomR» unter der Leitung von PD Dr. Baharak Babouee Flury,<br />
Oberärztin mbF an der Klinik für Infektiologie, Infektionsprävention<br />
und Reisemedizin und Forschungsgruppenleiterin Experimentelle<br />
Infektiologie am Medizinischen Forschungszentrum,<br />
mit einem Forschungs beitrag von CHF 815’000. In dem vierjährigen<br />
Projekt wird die Resistenzentwicklung gefährlicher Darmbakterien<br />
durch Antibiotikabehandlungen untersucht.<br />
Erste ETH Professur der<br />
Ostschweiz<br />
Prof. Dr. Natalia Pikor erforscht die Regulation<br />
von Immunantworten im Zentralnervensystem.<br />
Sie erhielt 2022 einen «SNF Starting Grant»<br />
des Schweizerischen Nationalfonds in Höhe<br />
von CHF 1,8 Millionen und wurde im April 2023<br />
zur Professorin für Neuroimmunologie an der<br />
ETH Zürich ernannt. Mit ihrer Berufung verstärkt<br />
das Departement Biologie der ETH Zürich<br />
die Grundlagenforschung in den Be reichen<br />
Neuro- und Tumorimmunologie sowie Virologie.<br />
Prof. Pikor und ihr Team der Neuroimmunologie<br />
führen ihre erfolgreichen Arbeiten am Medizinischen<br />
Forschungszentrum des Kantonsspitals<br />
St.Gallen fort und stärken die Zusammenarbeit<br />
der beiden Institutionen.<br />
10 Highlights
SNF fördert wegweisende<br />
Forschung zu Tonsillenkrebs<br />
Der Schweizerische Nationalfonds unterstützt<br />
ein Projekt unter der Leitung von Prof. Dr.<br />
Burkhard Ludewig, das in enger Zusammenarbeit<br />
mit der Hals-Nasen-Ohrenklinik des<br />
Kantonsspitals St.Gallen durchgeführt wird.<br />
Ziel des Projektes ist die Erforschung der molekularen<br />
Grundlagen des Tonsillenkrebses,<br />
der hauptsächlich durch humane Papillomaviren<br />
verursacht wird. Der bewilligte Beitrag<br />
beläuft sich auf insgesamt CHF 950’000 über<br />
einen Zeitraum von vier Jahren.<br />
Strategische Investition<br />
in die Zukunft<br />
Der Verwaltungsrat der St.Galler Spitalverbunde hat den Kredit<br />
für den Umbau des Hauses 09 in ein Forschungshaus genehmigt.<br />
Die strategische Investition in modernste Forschungsinfrastruktur<br />
stärkt die translationale Forschung am Kantonsspital<br />
St.Gallen. Die kliniknahe Forschung ist für eine qualitativ hochstehende<br />
medizinische Versorgung von zentraler Bedeutung,<br />
da Leistungsaufträge im Bereich der hochspezialisierten Medizin<br />
nur an forschungsaktive Standorte vergeben werden können.<br />
Highlights 11
Forschungsförderung und<br />
Forschungskommunikation<br />
• Forschungskommission<br />
• Projekt - und Personenförderung<br />
• Besondere Erfolge aus der Projektförderung<br />
• Forschungskommunikation<br />
12 Xxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxx 13
Forschungsförderung und<br />
Forschungs kommunikation<br />
Das Kantonsspital St.Gallen ist ein aktives Forschungsspital.<br />
Die exzellenten Leistungen der<br />
Forschenden am Kantonsspital St.Gallen werden<br />
national und international wahrgenommen,<br />
was die Sichtbarkeit des Unternehmens<br />
erhöht. Wissenschaftliche Aktivität und Erfolge<br />
in der Forschung werden unter anderem von<br />
Kennzahlen wie der Anzahl von Publikationen<br />
und Zitationsindizes gemessen. Das Scimago<br />
Institutions Ranking nutzt in drei Gruppen unterteilte<br />
Indikatoren, die den wissenschaftlichen,<br />
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen<br />
Einfluss von Einrichtungen widerspiegeln sollen<br />
und umfasst sowohl grössenabhängige als<br />
auch grössenunabhängige Indikatoren (scimagoir.com).<br />
Im Jahr 2022 wurde das Kantonsspital<br />
St.Gallen im Scimago Institutions Ranking<br />
an 8. Stelle aller im Bereich Medizin forschenden<br />
Gesundheitsorganisationen der Schweiz<br />
aufgeführt. Im Jahr 2023 verbesserte sich das<br />
Kantonsspital St.Gallen auf Rang 7. Die Forschungsleistung<br />
anderer Kantons- oder Zentrumsspitäler<br />
reicht nicht aus, um in diesem<br />
Ranking geführt zu werden.<br />
Das Medizinische Forschungszentrum wurde<br />
von der Geschäftsleitung beauftragt, die Forschungskommission<br />
in der Koordination und<br />
Kommunikation der Forschungsaktivitäten<br />
zu unterstützen und die Forschenden des<br />
Kantonsspitals St.Gallen bei der Einwerbung<br />
von kompetitiven Forschungsgeldern zu beraten.<br />
Diesen Aufgaben kommt die Stabsstelle<br />
Forschungsförderung und –kommunikation,<br />
unter der Leitung von Dr. Miluse Trtikova,<br />
nach.<br />
Forschungsförderung<br />
Gemäss den Vorgaben des CEO des Kantonsspitals<br />
St.Gallen wurde in den Jahren 2022 und<br />
2023 jährlich CHF 600’000 aus dem Budget<br />
des Medizinischen Forschungszentrums für<br />
die Förderung von Forschungsprojekten zur<br />
Verfügung gestellt. Die Vergabe dieser Gelder<br />
erfolgt mittels eines Evaluierungsprozesses<br />
durch die Mitglieder der Forschungskommission.<br />
Zusätzlich werden Mittel aus den Gemeinkostenanteilen<br />
(Overhead) zur Unterstützung<br />
weiterer Forschungsaktivitäten zur Verfügung<br />
gestellt. Auch über die Vergabe dieser Mittel<br />
verfügt die Forschungskommission.<br />
Forschungskommunikation<br />
Die Forscherinnen und Forscher des Kantonsspitals St.Gallen<br />
haben in den Jahren 2022 und 2023 an ungefähr 350 wissenschaftlichen<br />
Projekten gearbeitet und rund 1’000 wissenschaftliche<br />
Arbeiten veröffentlicht. Diese erfolgreiche wissenschaftliche<br />
Tätigkeit des Kantonsspitals St.Gallen wird dem<br />
Fachpublikum und der breiten Öffentlichkeit über eine eigene<br />
Forschungsdatenbank zugänglich gemacht. Dieser zentrale<br />
Kommunikationskanal wird zudem von den Forschenden des<br />
Kantonsspitals St.Gallen genutzt, um neue Forschungsergebnisse<br />
und -aktivitäten zu kommunizieren. Die Administration<br />
der Forschungsdatenbank liegt in der Verantwortung des<br />
Medizinischen Forschungszentrums.<br />
Forschungskommission<br />
Die Forschungskommission setzt sich aus Repräsentanten der<br />
klinischen Departemente und der Leitung des Medizinischen<br />
Forschungszentrums zusammen. Die nicht ständigen Mitglieder<br />
aus den Reihen des ärztlichen Kaders werden durch die<br />
Konferenz der Klinik-, Instituts- und Zentrumsleiter gewählt.<br />
Darüber hinaus haben jeweils eine Vertreterin oder ein Vertreter<br />
der Universität St.Gallen, der Empa, des Ostschweizer<br />
Kinderspitals und des Zentrums für Labormedizin als externe<br />
Mit glieder Einsitz in der Kommission. Die Präsidentschaft wird<br />
durch die Forschungskommission vorgeschlagen und von der<br />
Geschäftsleitung gewählt.<br />
Die Forschungskommission hat neben der Organisation der<br />
Forschungsförderung und der Begutachtung der Projektanträge<br />
die Aufgabe, die Geschäftsleitung des Kantonsspitals<br />
St.Gallen bei Forschungsangelegenheiten zu unterstützen<br />
und zu beraten. Weitere Aufgaben der Forschungskommission<br />
sind die Qualitätssicherung in der Forschung, unter anderem<br />
durch Regelungen zur guten wissenschaftlichen Praxis<br />
und bei wissenschaftlichem Fehlverhalten. Zudem wird der<br />
Austausch zwischen den Forschenden des Kantonsspitals<br />
St.Gallen und der Öffentlichkeit gefördert, beispielsweise<br />
durch den jährlich stattfindenden Forschungstag.<br />
14 Forschungsförderung und Forschungskommunikation
Mitglieder Forschungskommission<br />
Dr. Katja Hämmerli Keller Präsidentin seit 12/2023,<br />
Leitende Psychologin<br />
Prof. Dr. Christoph<br />
Driessen<br />
PD Dr. Baharak Babouee<br />
Flury<br />
Prof. Dr. Oliver Bozinov<br />
Prof. Dr. Dr. Antonio<br />
Cozzio<br />
Prof. Dr. Florian Dick<br />
Dr. Susanne Diener<br />
PD Dr. Daniel Engeler<br />
Prof. Dr. Miodrag Filipovic<br />
Prof. Dr. Roland<br />
Hausmann<br />
Prof. Dr. Thomas<br />
Hundsberger<br />
Prof. Dr. Burkhard<br />
Ludewig<br />
Prof. Dr. Micha Maeder<br />
Dr. Reinhard Maier<br />
PD Dr. Marian Neidert<br />
Prof. Dr. Paul Martin<br />
Putora<br />
Dr. Marc Schlaeppi<br />
Prof. Dr. Alex Dommann<br />
Prof. Dr. René Rossi<br />
Prof. Dr. Alexander<br />
Geissler<br />
Prof. Dr. Janna Hastings<br />
Prof. Dr. Wolfgang Korte<br />
Prof. Dr. Roger Lauener<br />
Vizepräsident,<br />
Chefarzt Onkologie/<br />
Hämatologie<br />
Ärztlich-wissenschaftliche<br />
Leiterin Clinical Trials Unit,<br />
Oberärztin, mbF Infektiologie/<br />
Infektionsprävention/Reisemedizin<br />
Chefarzt Neurochirurgie,<br />
Mitglied bis 05/2023<br />
Chefarzt Dermatologie/<br />
Venerologie/Allergologie<br />
Chefarzt Gefässchirurgie<br />
Leiterin Departement<br />
Interdisziplinäre<br />
Medizinische Dienste,<br />
Mitglied bis 03/2023<br />
Chefarzt Urologie<br />
Chefarzt Operative<br />
Intensivmedizin,<br />
Präsident bis 11/2023<br />
Chefarzt Rechtsmedizin<br />
Leitender Arzt Neurologie<br />
Leiter Medizinisches<br />
Forschungszentrum<br />
Stv. Chefarzt Kardiologie<br />
Operativer Leiter<br />
Clinical Trials Unit<br />
Stv. Chefarzt Neurochirurgie,<br />
Mitglied seit 06/2023<br />
Stv. Chefarzt<br />
Radio-Onkologie<br />
Zentrumsleiter Integrative<br />
Medizin<br />
Leiter Departement<br />
«Materials meet Life», Empa,<br />
externes Mitglied bis 12/2022<br />
Co-Leiter Departement<br />
«Materials meet Life»,<br />
Empa, externes Mitglied seit<br />
01/2023<br />
School of Medicine,<br />
Universität St.Gallen,<br />
externes Mitglied bis 12/2022<br />
School of Medicine,<br />
Universität St.Gallen,<br />
externes Mitglied seit<br />
01/2023<br />
Vorsitzender der Geschäftsleitung,<br />
Zentrum für Labormedizin<br />
St.Gallen, externes<br />
Mitglied<br />
Chefarzt Kinder- und<br />
Jugendmedizin,<br />
Ostschweizer Kinderspital,<br />
externes Mitglied
Projekt- und Personen förderung<br />
Projektförderung: Verwendete Mittel pro Klinik, Institut und Zentrum in TCHF<br />
0 50 100 150 200 250 300 350<br />
Urologie<br />
Zentrum für Integrative Medizin<br />
Medizinisches Forschungszentrum<br />
Psychosomatik und Konsilliarpsychiatrie<br />
Infektiologie/Infektionsprävention/Reisemedizin<br />
Neurochirurgie<br />
Neurologie<br />
Hals-Nasen-Ohrenklinik<br />
Muskelzentrum/ALS Clinic<br />
Radio-Onkologie<br />
Gastroenterologie/Hepatologie<br />
Augenklinik<br />
Orthopädische Chirurgie und Traumatologie des Bewegungsapparates<br />
Endokrinologie/Diabeto logie/Osteologie/Stoffwechselerkrankungen<br />
Allgemein-, Viszeral-, Endokrin- und Transplantationschirurgie<br />
Rheumatologie<br />
Anästhesiologie<br />
Kardiologie<br />
Dermatologie/Venerologie/Allergologie<br />
Mittelverwendung<br />
Fachbereich/Dritte<br />
Onkologie/Hämatologie<br />
Dienstleistungen Clinical Trials Unit<br />
Die Forschungskommission finanziert und unterstützt<br />
die Forschenden des Kantonsspitals<br />
St.Gallen über verschiedene Fördergefässe.<br />
Grundsätzlich wird zwischen Projekt- und Personenförderung<br />
unterschieden.<br />
1. Projektförderung<br />
• Forschungsprojekte am<br />
Kantonsspital St.Gallen<br />
• Kooperationsprojekte mit der Empa<br />
2. Personenförderung<br />
• Medizinische Dissertationen<br />
• Nachwuchsgruppenleitung<br />
Vorranging werden Projekte gefördert, die eine<br />
klare Strategie zur Einwerbung von kompetitiven<br />
Drittmitteln vorweisen. Die Förderung soll<br />
die Erhebung von Datensätzen ermöglichen,<br />
um vollständig ausgearbeitete Forschungsgesuche<br />
bei kompetitiven Ausschreibungen<br />
des Schweizerischen Nationalfonds, der<br />
Schweizerischen Agentur für Innovationsförderung<br />
(Innosuisse) oder anderen Förderinstitutionen<br />
einreichen zu können. Im Fördergefäss<br />
Projektförderung haben die Mitglieder<br />
der Forschungskommission in den Jahren 2022<br />
und 2023 insgesamt 70 Projektanträge begutachtet. Die Finanzierung<br />
von Forschungsprojekten am Kantonsspital St.Gallen<br />
machte den grössten Teil dieser Gesuche aus. Die Bewilligungsrate<br />
lag bei 54 %. Eine Zusammenstellung der geförderten Projekte<br />
ist auf den Seiten 18 – 19 zu finden.<br />
Für Kooperationsprojekte mit Forschenden der Empa St.Gallen<br />
wird ein maximaler Gesamtbetrag von CHF 50’000 zugesprochen,<br />
wobei der Anteil des Kantonsspitals St.Gallen CHF 25’000<br />
nicht überschreiten darf. Diese Kooperationsprojekte mit der<br />
Empa dienen der Anschubfinanzierung für ein- oder mehrjährige<br />
Projekte. Neben der Stärkung der Zusammenarbeit zwischen<br />
den beiden Institutionen, ist die Einwerbung kompetitiver<br />
Drittmittel ein wesentliches Ziel dieses Förderinstruments. In<br />
den Jahren 2022 und 2023 wurden von der Forschungskommission<br />
7 der 10 ein gereichten Anträge für Kooperationsprojekte<br />
bewilligt (Seite 20).<br />
Ein Grossteil der Mittel aus der Projektförderung wurden in den<br />
Jahren 2022 und 2023 an Forschende der Kliniken, Institute und<br />
Zentren des Kantonsspitals St.Gallen mit hoher Forschungsaktivität<br />
darunter die Klinik für Onkologie und Hämatologie, die<br />
Klinik für Dermatologie, Venerologie und Allergologie und das<br />
Medizinische Forschungszentrum vergeben (siehe obenstehende<br />
Grafik). Die Empfänger der Beiträge haben ca. 17 % der<br />
zugesprochenen Mittel eingesetzt, um Dienstleistungen der<br />
Clinical Trials Unit zu finanzieren.<br />
16 Forschungsförderung und Forschungskommunikation
Hoch motivierte Ärztinnen und Ärzte arbeiten im Rahmen ihrer<br />
medizinischen Dissertation in etablierten Forschungsgruppen<br />
am Kantonsspital St.Gallen. Um die Karrieren der Nachwuchsforschenden<br />
zu unterstützen und an das Kantonsspital St.Gallen<br />
zu rekrutieren, werden medizinische Dissertationen über die<br />
Mittel des Forschungsförderungsfonds gefördert. Dafür müssen<br />
die Kandidatinnen und Kandidaten in einem medizinischen<br />
Doktoratsprogramm eingeschrieben sein und von einem promotionsberechtigten<br />
Mitglied einer medizinischen Fakultät an<br />
einer Schweizer Universität offiziell betreut werden. Auf Seite 20<br />
sind die in der Berichtsperiode 2022 und 2023 geförderten<br />
Dissertationssprojekte aufgeführt.<br />
Ein weiterer wichtiger Ansatz der Karriereförderung über die<br />
Mittel des Forschungsförderungsfonds ist die Finanzierung von<br />
Stellen für Nachwuchsgruppenleitende. In diesem Fördergefäss<br />
wird für klinisch Forschende mit entsprechendem Leistungsausweis<br />
50 % geschützte Zeit für Forschung finanziert.<br />
Zudem werden CHF 100’000 pro Jahr projektspezifische Forschungsgelder<br />
zur Verfügung gestellt. Die Förderung der Nachwuchsgruppe<br />
von Dr. Nikolaus Wagner wurde im Jahr 2022 für<br />
ein zweites Jahr verlängert. Im Jahr 2023 wurde die Förderung<br />
der von Dr. Tolga Dittrich geleiteten Nachwuchsforschungsgruppe<br />
in der Klinik für Neurologie bewilligt.<br />
Xxxxxxxxxxxxx 17
Projekte Forschungsförderung<br />
Bewilligte Projekte 2022<br />
Projekt Hauptantragsteller/-in Klinik/Zentrum CHF<br />
Analysis of the effect of biological therapy on SARS-CoV-2-<br />
specific antibody levels following booster vaccination in<br />
patients with inflammatory bowel disease<br />
Joel Dütschler<br />
Gastroenterologie/<br />
Hepatologie<br />
26’700<br />
Symptoms compatible with long-COVID in SARS-CoV-2<br />
positive and negative healthcare workers – analysis of<br />
prospective cohort<br />
Philipp Kohler<br />
Infektiologie/Infektionsprävention/Reisemedizin<br />
65’788<br />
The impact of subthalamic deep brain stimulation on interlimb<br />
coordination in patients with Parkinson’s disease<br />
Florian Brugger Neurologie 30’000<br />
Treatment and outcomes of surgical site infections after<br />
spinal instrumentation – a retrospective cohort study<br />
Tudor Cosma<br />
Infektiologie/Infektionsprävention/Reisemedizin<br />
7’600<br />
Untersuchung der kardialen Pumpfunktion und kardialer<br />
Biomarker in Abhängigkeit der Pharmakodynamik der<br />
Proteasominhibition bei mit Proteasominhibitoren behandelten<br />
Patienten<br />
Genetic contributors of multiple myeloma cells involved in<br />
their homing and escape from T-cell recognition<br />
Determining postoperative recovery and the impact of adverse<br />
events in neurosurgery based on self-reported, app-based<br />
longitudinal assessment – a collaborative observational research<br />
project<br />
Frequency and Clinical Significance of PR3- and<br />
MPO-Antineutrophil Cytoplasmic Antibodies (ANCA) in<br />
Ulcerative Colitis and Crohn’s Disease (IBD-ANCA Study)<br />
Evaluation of Polycyclic Polyprenylated Acylphloroglucinols<br />
(PPAPs) as a potential new class of cancer therapeutics in<br />
glioblastoma<br />
Shunt-dependency after aneurysmal subarachnoid<br />
haemorrhage – the role of early hyperglycaemia in cerebrospinal<br />
fluid and blood<br />
Kira-Lee Koster Onkologie/Hämatologie 26’200<br />
Lenka Besse Onkologie/Hämatologie 75’500<br />
Alexis Terrapon Neurochirurgie 46’840<br />
Alfred Mahr Rheumatologie 32’000<br />
Kerstin Kampa-Schittenhelm Onkologie/Hämatologie 95’000<br />
Isabel Hostettler Neurochirurgie 37’300<br />
Deciphering Antimicrobial Resistance Mechanisms of<br />
Escherichia coli and Pseudomonas aeruginosa isolated<br />
from Patients with Urinary Tract- and Surgical Site Infections<br />
at St.Francis Referral Hospital, Ifakara-Tanzania<br />
Magreth Macha<br />
Infektiologie/Infektionsprävention/Reisemedizin<br />
22’040<br />
Elucidate and Exploit Functional Basis of Mutual Exclusivity of<br />
Major Driver Mutations in Myeloid Neoplasms for Therapeutic<br />
Targeting<br />
Tata Nageswara Rao Onkologie/Hämatologie 88’000<br />
Point Prevalence of Antibiotic Resistance in Helicobacter pylori<br />
in St.Gallen: An Observational Pilot Trial<br />
Alexander Kueres-Wiese<br />
Gastroenterologie/<br />
Hepatologie<br />
12’400<br />
The role of keratinocyte-differentiation antigens in head and<br />
neck squamous cell cancer<br />
Lukas Flatz<br />
Dermatologie/Venerologie/<br />
Allergologie<br />
79’000<br />
18 Forschungsförderung und Forschungskommunikation
Projekte Forschungsförderung<br />
Bewilligte Projekte 2023<br />
Projekt Hauptantragsteller/-in Klinik/Zentrum CHF<br />
Application of an IT knowledge base to improve<br />
decision-making for breast cancer in radiation oncology<br />
The motor side of neglect: Improving the diagnosis and understanding<br />
of premotor- and motor neglect following stroke<br />
Colchicine in Patients at Cardiac Risk undergoing Major<br />
Non-Cardiac Surgery: prospective, randomized, triple-blinded,<br />
placebo-controlled, multi-centre study<br />
Fabio Dennstädt Radio-Onkologie 14’380<br />
Georg Kägi Neurologie 9’340<br />
Timur Yurttas Anästhesiologie 98’090<br />
Analysis of the effect of biological therapy on booster<br />
vaccine-elicited systemic responses against SARS-CoV-2 variants<br />
of concern in patients with inflammatory bowel diseases<br />
Joel Dütschler<br />
Gastroenterologie/<br />
Hepatologie<br />
16’650<br />
Trispecific antibodies to target melanoma Lukas Villiger Dermatologie/Venerologie/<br />
Allergologie<br />
67’753<br />
Novel screening assay for synthetic cannabinoids Björn Moosmann Rechtsmedizin 30’000<br />
Targeting the immunoproteasome in vivo Christoph Driessen Onkologie/Hämatologie 45’560<br />
Impact of Tenofovir disoproxil fumarate/Emtricitabine<br />
(TDF/FTC) on the gut microbiome and microbiomemediated<br />
toxicity of TDF/FTC in men using event-based<br />
HIV Pre-Exposure prophylaxis<br />
Julia Notter<br />
Infektiologie/Infektionsprävention/Reisemedizin<br />
30’140<br />
Early protected full weight-bearing vs. partial weight-bearing<br />
after surgical fixation of unstable ankle fractures, monitored<br />
with bio-feedback insoles. A randomized controlled study.<br />
Andreas Toepfer<br />
Orthopädische Chirurgie<br />
und Traumatologie<br />
des Bewegungsapparates<br />
28’150<br />
T cell responses in myocarditis, inflammatory cardiomyopathy<br />
and heart failure<br />
Burkhard Ludewig<br />
Medizinisches<br />
Forschungszentrum<br />
48’600<br />
Systematic sequence-walk to identify isoform-specific, fully<br />
modified, small interfering RNAs (siRNAs) to target ASPP2kappa<br />
for in vivo application<br />
Kerstin Kampa-Schittenhelm Onkologie/Hämatologie 93’000<br />
Entwicklung einer interprofessionell abgestimmten<br />
Intervention zur Optimierung des Antibiotikagebrauchs<br />
im stationären Setting: eine mixed-methods Studie<br />
Patrizia Künzler-Heule<br />
Entwicklung und Qualitätsmanagement<br />
Pflege<br />
22’650<br />
Effectiveness of XBB.1.5-adapted booster vaccines against<br />
novel SARS-CoV-2 variants in patients with inflammatory bowel<br />
diseases<br />
Joel Dütschler<br />
Gastroenterologie/<br />
Hepatologie<br />
15’150<br />
Outcomes of patients with Oligometastatic Non-Small<br />
Cell Lung Cancer (NSCLC) treated with first line Immuno-/<br />
or Chemoimmunotherapy<br />
Susanne Weindler Onkologie/Hämatologie 6’500<br />
Forschungsförderung und Forschungskommunikation 19
Kooperationsprojekte Empa-Kantonsspital St.Gallen<br />
Bewilligte Projekte 2022 und 2023<br />
Projekt Hauptantragsteller/-in Klinik/Zentrum CHF<br />
Fluorescence-based rapid diagnostic tool for sensitive and<br />
selective DetectiOn Of uReaSe-producing bacTEria causing<br />
ventilator-associated Pneumonia - DOORSTEP<br />
Werner Albrich<br />
Infektiologie/Infektionsprävention/Reisemedizin<br />
10’750<br />
Integrative analysis for the delineation of cellular crosstalk<br />
in glioblastoma<br />
Marian Neidert Neurochirurgie 25’000<br />
Exploring the impact of hexagonal boron nitride (nanomedicines)<br />
on bacterial quorum sensing communication and its<br />
consequences on bacterial lung invasion and pathogenesis<br />
Werner Albrich<br />
Infektiologie/Infektionsprävention/Reisemedizin<br />
25’000<br />
Personalized transdermal fentanyl dosing in vulnerable patients<br />
using Empa’s digital twin tool<br />
Katelijne De Nys Palliativzentrum 23’900<br />
The influence of anchor coating on primary stability of<br />
stemless humeral shoulder prosthesis component. Proof of<br />
concept study.<br />
Bernhard Jost<br />
Orthopädische Chirurgie<br />
und Traumatologie<br />
des Bewegungsapparates<br />
5’000<br />
ScintiPOFs: development of plastic scintillation materials<br />
based on perovskite-polymer optical fiber composites for<br />
high-precision radiation dosimetry<br />
Discovery of novel biomarkers for the early stages of chronic<br />
wound formation<br />
Konrad Buchauer Radio-Onkologie 25’000<br />
Ulf Benecke Angiologie 5’000<br />
Medizinische Dissertationsprojekte<br />
Bewilligte Projekte 2022 und 2023<br />
Projekt Doktorand/-in Klinik/Zentrum CHF<br />
T-Zell Antigen Detektion bei Patienten mit kutanen immunassoziierten<br />
Nebenwirkungen in der IMIT Kohorte und mit<br />
Lichen ruber planus<br />
Tamara Etterlin<br />
Dermatologie/Venerologie/<br />
Allergologie<br />
67’045<br />
Fibroblastendifferenzierung und -funktion im Tonsillenkarzinom<br />
Samuel Meili<br />
Medizinisches<br />
Forschungszentrum<br />
64’096<br />
Tumor immune milieu heterogeneity in postmortem autopsies<br />
from the ImmunoMonitoring of ImmunoTherapy (IMIT, CTU<br />
16/015) St.Gallen clinical study in patients with advanced non<br />
small-cell lung cancer or melanoma<br />
Nicolas Davaz Onkologie/Hämatologie 63’626<br />
Evaluation des Einflusses von HLA-Genpolymorphismen auf<br />
das T-Zell-Rezeptor-Repertoire und T-Zell-Spezifitäten<br />
bei Patientinnen und Patienten mit nicht-kleinzelligem Lungenkarzinom<br />
unter Immun-Checkpoint-Inhibitor-Therapie<br />
Pablo Sieber<br />
Dermatologie/Venerologie/<br />
Allergologie<br />
65’385<br />
T cell responses in myocarditis, inflammatory cardiomyopathy<br />
and heart failure<br />
Emily Payne<br />
Medizinisches<br />
Forschungszentrum<br />
24’336<br />
20 Forschungsförderung und Forschungskommunikation
Besondere Erfolge aus der Projektförderung<br />
Der Erfolg der Forschungsförderung am Kantonsspital St.Gallen wird unter<br />
anderem durch hochrangige Publikationen sichtbar, die aus der Projektförderung<br />
finanziert oder teilfinanziert wurden. Im Folgenden sollen drei besonders<br />
erfolgreiche Projekte aus der Forschungsförderung vorgestellt werden.<br />
01<br />
Die Studie zu Long Covid der Klinik für Infektiologie,<br />
Infektionsprävention und Reisemedizin zeigt, dass das<br />
Risiko für Long-Covid-Symptome nach einer Ansteckung<br />
mit Omikron kleiner ist als nach einer Infektion mit dem<br />
ursprünglichen Coronavirus. Die Studienergebnisse gelten<br />
zumindest für die Population von jungen, gesunden und<br />
geimpften Frauen. Diese waren in der Studie überrepräsentiert.<br />
Die Ergebnisse der Studie «Post-Acute Sequelae<br />
After Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2<br />
Infection by Viral Variant and Vaccination Status: A Multicenter<br />
Cross-Sectional Study» wurden im Juli 2023 im<br />
Journal Clinical Infectious Diseases veröffentlicht.<br />
02<br />
03<br />
Forschende der Empa haben gemeinsam<br />
mit der Klinik für Neurologie des Kantonsspitals<br />
St.Gallen Eiweissbausteine und<br />
-fasern im Liquor von Patienten sichtbar<br />
gemacht. Ihr Fazit: Ultralange feine Eiweissfasern<br />
sind ein eindeutiges Kennzeichen<br />
für eine Alzheimer- Demenz. Die<br />
Studie «Protein fibril length in cerebrospinal<br />
fluid is increased in Alzheimer’s<br />
disease» wurde im März 2023 im Journal<br />
Communications Biology publiziert und<br />
liefert neue Erkenntnisse zur Rolle von<br />
Eiweissanhäufungen bei der Entstehung<br />
von Demenzerkrankungen und soll deren<br />
Früherkennung verbessern.<br />
Zusammen mit einem internationalen Forschungsteam<br />
haben Mitarbeiter der Experimentellen Dermatologie<br />
eine Methode entwickelt, um Antigene zu identifizieren,<br />
die sowohl auf Krebszellen als auch auf gesunden Zellen<br />
vorkommen. So können die Neben wirkungen der Immuntherapie<br />
entschlüsselt und damit die Therapie verbessert<br />
werden. Die Ergebnisse der Studie «Autoreactive<br />
napsin A–specific T cells are enriched in lung tumors and<br />
inflammatory lung lesions during immune checkpoint<br />
blockade» wurden im September 2022 im Fachjournal<br />
Science Immunology veröffentlicht.<br />
Forschungsförderung und Forschungskommunikation 21
22 Xxxxxxxxxxxxx
Forschungs kommunikation<br />
Ein wichtiges Instrument zur Kommunikation<br />
der Forschungsergebnisse am Kantonsspital<br />
St.Gallen ist die Forschungsdatenbank (forschung.kssg.ch/de).<br />
Die neu gestaltete Datenbank<br />
wurde im September 2022 live geschaltet.<br />
Neben einem neuen Design bietet die Datenbank<br />
eine komfortable Nutzung und ermöglicht<br />
es, jederzeit auf die hinterlegten Forschungsdaten<br />
zuzugreifen. Abonnenten des Newsletters<br />
haben die Möglichkeit, monatlich über die Forschungsaktivitäten<br />
am Kantonsspital St.Gallen<br />
informiert zu werden. Die Daten der Forschungsdatenbank<br />
bilden die Grundlage der bibliometrischen<br />
Auswertung aller Publikationen<br />
der Forschenden am Kantonsspital St.Gallen.<br />
Diese Auswertung und alle Publikationen pro<br />
Klinik, Institut oder Zentrum werden im Geschäftsbericht<br />
des Kantonsspitals St.Gallen veröffentlicht.<br />
Die Analyse der Publikationsdaten in der Forschungsdatenbank<br />
für die Jahre 2022 und 2023<br />
ergab, dass insgesamt 952 Veröffentlichungen<br />
unter Beteiligung von Forschenden des Kantonsspitals<br />
St.Gallen erschienen sind. Von diesen<br />
wurden 848 in Journalen mit Einflussfaktor<br />
publiziert. Zur Berechnung des mittleren Einflussfaktors<br />
wurden die Daten des Citation Reports<br />
von Clarivate Analytics verwendet. Im Jahr<br />
2022 wurde mit 393 wissenschaftlichen Arbeiten<br />
in Zeitschriften mit Einflussfaktor der bisher<br />
höchste durchschnittliche Wert von 10,2 pro<br />
Publikation erreicht.<br />
Publikationen mit Einflussfaktor 2022 und 2023<br />
Anzahl Publikationen mit Einflussfaktor<br />
500<br />
450<br />
400<br />
350<br />
300<br />
250<br />
200<br />
150<br />
100<br />
50<br />
0<br />
10.2<br />
= Mittlerer Einflussfaktor pro Publikation<br />
9.8<br />
2022 2023<br />
In der Forschungsdatenbank werden die Projekte und Studien,<br />
die am Kantonsspital St.Gallen durchgeführt werden, ausführlich<br />
beschrieben. Die Dokumentation klinischer Studien in dieser<br />
Datenbank ermöglicht es Patientinnen und Patienten den Zugang<br />
zu Informationen zu neuen Behandlungsmöglichkeiten am<br />
Kantonsspital St.Gallen zu erhalten.<br />
Die Auswertung für das Jahr 2023 zeigt, dass 34 Projekte im<br />
Bereich der Grundlagenforschung und 251 klinische Studien<br />
durchgeführt wurden oder aktuell noch aktiv sind. In 173 Studien<br />
agiert das Kantonsspital St.Gallen als Kooperationspartner<br />
(teilnehmendes Zentrum), 78 Studien wurden vom Kantonsspital<br />
St.Gallen als Hauptzentrum bzw. alleiniges Zentrum durchgeführt<br />
(siehe untenstehende Abbildung).<br />
Anzahl Forschungsprojekte am Kantonsspital St.Gallen im<br />
Jahr 2023<br />
3<br />
4<br />
1 Projekte aus der Grundlagenforschung 34<br />
2 Multizentrische Studien, Kantonsspital St.Gallen als<br />
teilnehmendes Zentrum 173<br />
3 Monozentrische Studien 30<br />
4 Multizentrische Studien, Kantonsspital St.Gallen als Hauptzentrum 48<br />
1<br />
2<br />
Forschungsförderung und Forschungskommunikation 23
Medizinisches Forschungszentrum<br />
• Stabstellen und Zentraleinheiten Labor<br />
• Clinical Trials Unit<br />
• Institut für Immunbiologie<br />
24 Xxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxx 25
Medizinisches Forschungszentrum<br />
Die zunehmenden Forschungsaktivitäten am<br />
Kantonsspital St.Gallen widerspiegeln sich auch<br />
in der Personalentwicklung des Medizinischen<br />
Forschungszentrums. Ende 2023 waren insgesamt<br />
58 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verteilt<br />
auf 43,5 Vollzeitstellen am Medizinischen<br />
Forschungszentrum beschäftigt. Der Grossteil<br />
des Personals wird über Drittmittel finanziert<br />
(65 %). Bei den Drittmittelstellen ist zwischen<br />
2021 und 2023 ein Anstieg um 11 % zu verzeichnen.<br />
Darüber hinaus wird die Infrastruktur<br />
des Medizinischen Forschungszentrums<br />
von rund 30 Mitarbeitenden der angeschlossenen<br />
Kliniken genutzt.<br />
Finanzierung der Personaleinheiten<br />
am Medizinischen Forschungszentrum<br />
43.5<br />
2023<br />
2021<br />
15.1<br />
15.2 25.5<br />
Kanton/Kantonsspital St.Gallen<br />
28.4 43.5<br />
Dritte<br />
40.7<br />
Im Rahmen ihres Engagements an verschiedenen<br />
Universitäten, betreuen die Forschungsgruppenleitenden<br />
des Medizinischen Forschungszentrums<br />
eine zunehmende Anzahl<br />
von Doktorierenden. In den Jahren 2022 und<br />
2023 waren insgesamt 26 Studierende in<br />
unterschiedlichen Doktoratsprogrammen an<br />
der Universität Zürich oder der ETH Zürich<br />
eingeschrieben. Zudem werden am Medizinischen<br />
Forschungszentrum medizinische Doktorarbeiten<br />
der Universität Tübingen und naturwissenschaftliche<br />
Doktorarbeiten der<br />
Universität Bern betreut. Das Medizinische<br />
Forschungszentrum leistet so einen wichtigen<br />
Beitrag in der Ausbildung von hochqualifiziertem<br />
Personal am Kantonsspital St.Gallen.<br />
Doktoratsprogramme Universität Zürich<br />
und ETH Zürich<br />
Medizinisches Doktorat (Dr. med.)<br />
Die medizinische Dissertation umfasst in der Regel einjährige<br />
Forschungsarbeiten zu medizinischen Themen, die<br />
entweder experimentell oder klinisch ausgerichtet sein<br />
können. Das medizinische Doktorat kann von Ärztinnen<br />
und Ärzten erworben werden.<br />
Doktorat Klinische Forschung (Dr. sc. med.)<br />
Das dreijährige Doktoratsprogramm Klinische Forschung<br />
der medizinischen Fakultät der Universität Zürich steht<br />
Akademikerinnen und Akademikern aus verschiedenen<br />
Ausbildungsgängen offen. Absolventen erhalten nach erfolgreichem<br />
Abschluss den Titel Doctor scientiarum medicarum<br />
(Dr. sc. med.).<br />
Wissenschaftliches Doktorat (Dr. sc. nat.)<br />
Das wissenschaftliche Doktorat wird von naturwissenschaftlichten<br />
Fakultäten der ETH und der Universität Zürich verliehen<br />
und erfordert eine mindestens vierjährige Ausbildung<br />
in der Grundlagenforschung. Nach erfolgreicher<br />
Verteidigung der Dissertation erhalten Absolventen den<br />
Titel Doctor scientiarum naturalium (Dr. sc. nat.).<br />
Stabsstellen<br />
Die Mitarbeitenden des Stabs unterstützen die Leitung des<br />
Medizinischen Forschungszentrums in den Aufgabenbe reichen<br />
der Administration und der strategischen Steuerung. Von besonderer<br />
Bedeutung sind Beiträge des Stabs zur Forschungsförderung,<br />
zur Qualitätssicherung in der Forschung, der Kommunikation<br />
von Forschungsergebnissen am Kantonsspital<br />
St.Gallen und dem Transfer von For schungsergebnissen durch<br />
das Innovationsmanagement.<br />
Forschungsförderung und -kommunikation<br />
Dr. Miluse Trtikova<br />
Koordinatorin Forschungsförderung und<br />
-kommunikation<br />
Betriebs- und Forschungsmanagement<br />
Dr. Sonja Caviezel-Firner Leiterin Betriebs- und Forschungsmanagement<br />
Céline Engetschwiler, MSc<br />
Simone Galler<br />
Harindra Wewelwala Hewage<br />
Marina Mancic<br />
Maja Cvetkovic<br />
Anna Elisabeth<br />
Bucheli-Burkhart<br />
Indire Elshani<br />
Stv. Leiterin Betriebs- und Forschungsmanagement,<br />
Leiterin Technologietransfer<br />
Assistentin Administration<br />
Tierpfleger<br />
Tierpflegerin<br />
Mitarbeiterin Labor<br />
Mitarbeiterin Labor<br />
Mitarbeiterin Labor<br />
26 Medizinisches Forschungszentrum
Forschungsförderung und<br />
-kommunikation<br />
Die Aufgaben der Stabstelle Forschungsförderung<br />
und -kommunikation werden von Dr.<br />
Miluse Trtikova wahrgenommen. In dieser<br />
Funktion unterstützt sie die Forschungskommission<br />
in der Koordination der Forschungsaktivitäten<br />
am Kantonsspital St.Gallen. Sie<br />
kümmert sich um die administrativen Belange,<br />
unterstützt die Tätigkeiten der Forschungskommission,<br />
insbesondere die Verwaltung der<br />
spitalinternen Beiträge zur Forschungsförderung.<br />
Zudem unterstützt sie die Forschenden<br />
des Kantonsspitals St.Gallen bei der Akquisition<br />
von Drittmitteln sowie bei der Kommunikation<br />
von Forschungsthemen. Die Forschungs- und<br />
Studiendatenbank wird ebenfalls von Dr. Miluse<br />
Trtikova betreut.<br />
Betriebs- und Forschungsmanagement<br />
Unter der Leitung von Dr. Sonja Caviezel-<br />
Firner und ihrer Stellvertreterin, MSc Céline<br />
Engetschwiler, unterstützt das Team für<br />
Betriebs- und Forschungsmanagement die<br />
klinische und translationale Forschung. Neben<br />
der Verwaltung und Koordination aller drittmittelrelevanten<br />
Aspekte ist das Team für die<br />
Laborinfrastruktur und die Versuchstierhaltung<br />
zuständig. Darüber hinaus werden wissenschaftliche<br />
Seminare, Fortbildungen und universitäre Lehrveranstaltungen<br />
organisiert. Dr. Caviezel- Firner ist Bio -<br />
sicherheitsbeauftragte und zuständig für die Überwachung<br />
und Umsetzung der Biosicherheitsstandards, die Schulung der<br />
Mitarbeitenden und die Zusammenarbeit mit den Behörden in<br />
allen Fragen der Biosicherheit.<br />
Dr. Sonja Caviezel-Firner und MSc Céline Engetschwiler engagieren<br />
sich aktiv in der Ausbildung von Biomedizinischen Analytikerinnen<br />
und Analytikern (HF/FH). Neben der persönlichen<br />
Betreuung der Studierenden während der Praktika halten sie<br />
auch Vorlesungen an der Höheren Fachschule des Berufs- und<br />
Weiterbildungszentrums für Gesundheits- und Sozialberufe<br />
St.Gallen. Darüber hinaus sind sie massgeblich an der Planung<br />
und Umsetzung des Projekts «Forschungshaus 09» beteiligt. In<br />
enger Zusammenarbeit mit dem Portfoliomanagement des<br />
Kantonsspitals St.Gallen und externen Planern wurde die Machbarkeitsstudie<br />
erfolgreich abgeschlossen. Die Realisierung<br />
dieses Projekts ist für den Zeitraum 2024 bis 2026 geplant<br />
(Ausblick Forschungshaus 09 Seite 94).<br />
Technologietransfer<br />
Die Stabstelle Technologietransfer unter der Leitung von MSc<br />
Céline Engetschwiler verwaltet das Patentportfolio des<br />
Kantonsspitals St.Gallen und verhandelt in enger Koordination<br />
mit dem Rechtsdienst Lizenz- und Forschungsverträge mit<br />
kommerziellen Forschungspartnern. Die Mitarbeitenden der<br />
Stabsstelle Technologietransfer prüfen Ideen und Vorschläge<br />
der Forschenden des Kantonsspitals St.Gallen bezüglich Patentierung<br />
und unterstützen die ersten Schritte im Patentierungsprozess.<br />
v.l.n.r.: Céline Engetschwiler, Maja Cvetkovic, Indire Elshani, Sonja Caviezel-Firner, Simone Galler, Marina Mancic<br />
Medizinisches Forschungszentrum 27
28 Medizinisches Forschungszentrum
Zentraleinheiten Labor<br />
Die Mitarbeitenden der Zentraleinheiten Labor bieten fachliche<br />
Expertise und praktische Unterstützung bei der Durchführung<br />
anspruchsvoller Techniken und komplexer administrativer<br />
Abläufe. Dr. Elke Scandella-Grabher ist als Tierschutzbeauftragte<br />
verantwortlich für die Einhaltung der Tierschutzstandards,<br />
die Durchführung von Inspektionen, die Unterstützung<br />
bei der Umsetzung von Tierschutzrichtlinien und -verfahren<br />
sowie die Schulung der Mitarbeitenden. Zudem ist sie für die<br />
Kommunikation mit dem kantonalen Veterinäramt und den<br />
Bundesämtern zuständig.<br />
Dr. Cristina Gil Cruz unterstützt die Forschenden des Instituts<br />
für Immunbiologie bei der Planung und Durchführung von klinischen<br />
Studien und leitet klinisch-translationale Forschungsprojekte<br />
auf dem Gebiet der Herzmedizin.<br />
Dr. Lucas Onder und Dr. Christian Pérez Shibayama sind für die<br />
technische Leitung der Durchflusszytometrie, der Zellsortierung<br />
und der konfokalen Laser-Scanning-Mikros kopie verantwortlich.<br />
Zu ihren Aufgaben gehören die Wartung und Kalibrierung<br />
der Geräte und die Schulung des Personals in den entsprechenden<br />
Verfahren. Darüber hinaus bieten sie technische Unterstützung<br />
und Beratung für Forschende und Studierende am Medizinischen<br />
Forschungszentrum im Studiendesign und in der<br />
technischen Umsetzung von komplexen Experimenten an.<br />
Mit dem Aufbau einer weiteren Zentraleinheit im Bereich Genomik<br />
und Bioinformatik wurde begonnen. Die Hauptaufgabe<br />
dieser zentralen Einheit besteht darin, die Forschenden bei<br />
der Analyse der Genomdaten und der Interpretation der bioinformatischen<br />
Ergebnisse zu unterstützen. Die Mitarbeitenden<br />
mit der entsprechenden Expertise werden derzeit noch<br />
über Drittmittel von Prof. Ludewig finanziert.<br />
Zentraleinheiten Labor<br />
Dr. Elke Scandella-Grabher<br />
Dr. Christian Ivan Pérez Shibayama<br />
Dr. Lucas Onder<br />
Dr. Cristina del Carmen Gil Cruz<br />
Fachverantwortliche Tierversuche<br />
Fachverantwortlicher Zytometrie<br />
Fachverantwortlicher Mikroskopie<br />
Fachverantwortliche klinische Studien<br />
Medizinisches Forschungszentrum 29
v.l.n.r.: Nicole Graf, Elke Hiendlmeyer, Anela Karic, Reinhard Maier, Uwe Ramsperger, Martina Kurz, Peter Schönenberger,<br />
Mareen Reiter, Raphaela Monassi, Erin West, Jacqueline Bossart, Baharak Babouee Flury, André Höpli, Lynn Radamaker<br />
Clinical Trials Unit<br />
Die Clinical Trials Unit (CTU) ist zentrale Ansprechpartnerin für<br />
klinische Studien am Kantonsspital St.Gallen. Mit ihrem breiten<br />
Dienstleistungsangebot steht sie den Forschenden bei der<br />
Organisation und Durchführung von Studien zur Verfügung. Auf<br />
nationaler Ebene ist die CTU des Kantonsspitals St.Gallen Teil<br />
des Netzwerks der Swiss Clinical Trial Organisation (SCTO). Die<br />
SCTO ist eine Forschungsinfrastruktur von nationaler Bedeutung,<br />
die seit 2009 Dienstleistungen für die Durchführung von<br />
klinischen Projekten anbietet. Jede CTU im SCTO-Netzwerk<br />
übernimmt die Koordination einer der Schlüsselbereiche der<br />
klinischen Forschung (CTU-Netzwerk Seite 34). Die SCTO wird<br />
in der Budgetperiode 2021 – 2024 gemäss Art. 15 des Bundesgesetzes<br />
über die Förderung der Forschung und Innovation<br />
vom Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation<br />
unterstützt. Die CTU des Kantonsspitals St.Gallen erhält aus diesen<br />
Bundesmitteln einen jährlichen Beitrag von CHF 400’000.<br />
Der Entscheid über eine Fortsetzung der Unterstützung der<br />
SCTO und des CTU-Netzwerks für die Budgetperiode 2025 – 2028<br />
wird im Dezember 2024 bekannt gegeben.<br />
Die erfolgreiche Arbeit der SCTO und des CTU-Netzwerks wird<br />
von nationalen und internationalen Forschungspartnern und<br />
nationalen Entscheidungsträgern geschätzt. Die Vernetzung<br />
innerhalb der SCTO fördert den Erfahrungsaustausch zwischen<br />
den Mitarbeitenden der verschiedenen CTU-Standorte und<br />
stärkt damit die klinische Forschung in der Schweiz.<br />
«Das CTU-Netzwerk setzt sich<br />
für eine schweizweite Harmonisierung<br />
der Prozesse in der<br />
klinischen Forschung ein.»<br />
Um die Prozesse in der klinischen Forschung<br />
schweizweit zu harmonisieren, werden den<br />
klinisch Forschenden aller Schweizer Spitäler<br />
unter anderem webbasierte Protokolle und<br />
Werkzeuge zur Verfügung gestellt. Die von den<br />
Expertenteams des CTU-Netzwerks entwickelten<br />
Werkzeuge sind auf der Website der<br />
SCTO (www.sctoplatforms.ch) verfügbar. Im<br />
Rahmen dieses Netzwerkes leitet die CTU<br />
St.Gallen ein Expertenteam, das einen Online-<br />
Leitfaden entwickelt. Dieser soll es klinisch<br />
Forschenden und anderen Interessierten ermöglichen,<br />
sich im Bereich der klinischen<br />
Forschung zu orientieren, ein Grundverständnis<br />
zu erlangen und klare Anweisungen für die<br />
Planung und Durchführung klinischer Studien<br />
zu erhalten. Der Leitfaden ist auf der Website<br />
www.easy-gcs.ch verfügbar.<br />
30 Clinical Trials Unit
In den Jahren 2022 und 2023 war die CTU des<br />
Kantonsspitals St.Gallen an 169 klinischen<br />
Studien bzw. Forschungsprojekten beteiligt.<br />
Die Mehrzahl dieser Studien sind Prüfarzt-initiierte<br />
Studien, in denen medizinisch-wissenschaftliche<br />
Fragestellungen von Forschenden<br />
des Kantonsspitals St.Gallen oder anderer<br />
Spitäler untersucht werden. Insgesamt waren<br />
92 % der klinischen Studien in den Jahren 2022<br />
und 2023 multizentrisch organisiert (siehe<br />
nachstehende Grafik).<br />
Klinische Studien am Kantonsspital St.Gallen<br />
in den Jahren 2022 und 2023<br />
2<br />
3<br />
1 Multizentrisch international 58 %<br />
2 Multizentrisch national 34 %<br />
3 Monozentrisch 8 %<br />
Zentrale Einrichtung für spitalübergreifende<br />
Aufgaben in der klinischen Forschung<br />
Die CTU übernimmt nicht nur Aufgaben in der<br />
direkten Projektunterstützung, sondern dient<br />
auch als zentrale Anlauf- und Koordinationsstelle<br />
für klinische Studien und Forschungsprojekte<br />
am Kantonsspital St.Gallen. Dazu gehören<br />
die Umsetzung des Generalkonsents<br />
und die Optimierung des neuen Klinikinformationssystems<br />
für die Forschung. Letzteres<br />
wird in den nächsten Jahren am Kantonsspital<br />
St.Gallen und in den Spitälern der heutigen<br />
Spitalregionen eingeführt.<br />
Generalkonsent<br />
Am Kantonsspital St.Gallen konnten im Jahr<br />
2019 die Prozesse zur Einholung der generellen<br />
Einwilligung zur Daten- und Probenforschung,<br />
auch Generalkonsent genannt, erfolgreich etabliert<br />
werden. Mit dem Generalkonsent können<br />
Personen, die im Spital behandelt werden, in<br />
die zukünftige Weiterverwendung ihrer Gesundheitsdaten<br />
und ihrer Bioproben für Forschungsprojekte<br />
einwilligen. Bis Juli 2023 wurden<br />
knapp 130’000 Entscheide erfasst, 85 %<br />
der angefragten Patientinnen und Patienten<br />
haben der Weiterverwendung zugestimmt.<br />
1<br />
IT-Projekt IDEAL<br />
Ein weiteres spitalübergreifendes Projekt der CTU ist das nationale<br />
IT-Projekt IDEAL zum verschlüsselten Datenaustausch<br />
zwischen Schweizer Spitälern. In der klinischen Forschung<br />
werden Patientendaten pseudonymisiert erfasst, d. h. mit<br />
einem studienspezifischen Code verschlüsselt. Mit Hilfe von<br />
IDEAL können Gesundheitsdaten von Studienteilnehmenden<br />
lokal pseudonymisiert werden, bevor diese in interne oder externe<br />
Studiendatenbanken eingespeist werden. IDEAL ist damit<br />
ein zentraler Baustein für die automatisierte Übertragung dieser<br />
Daten aus dem Spitalinformationssystem in eine Studiendatenbank,<br />
wobei alle regulatorischen Anforderungen eingehalten<br />
werden.<br />
Darüber hinaus wird das Kantonsspital St.Gallen mit diesem<br />
Projekt an die nationale Swiss Personalized Health Networkund<br />
BioMedIT-Infrastrukturen angeschlossen, die bereits zwischen<br />
den Universitätsspitälern der Schweiz bestehen. Diese<br />
IT-Infrastrukturen sollen den Datenaustausch zwischen den<br />
Forschungsinstitutionen erleichtern und fördern. IDEAL wurde<br />
im Dezember 2023 in der Klinik für Transplantationsmedizin<br />
und Nephrologie für die Swiss Transplant Cohort Study in enger<br />
Zusammenarbeit mit dem Departement Informatik und dem<br />
Universitätsspital Basel erfolgreich implementiert.<br />
Darauf aufbauend beteiligt sich das Kantonsspital St.Gallen am<br />
Folgeprojekt Cohort Demonstrator, das vom Swiss Personalized<br />
Health Network gefördert wird. Konkret geht es dabei um<br />
den automatisierten Transfer von pseudonymisierten Labordaten<br />
in die Swiss Transplant Cohort Study-Studiendatenbank<br />
über das BioMedIT-Netzwerk. Bei erfolgreicher Umsetzung<br />
könnte dieses Infrastruktursystem auch für andere Forschungsprojekte<br />
und Register genutzt werden, die an die Swiss<br />
Personalized Health Network- und BioMedIT-Infrastrukturen<br />
angeschlossen sind, wie beispielsweise die HIV-Kohortenstudie.<br />
Mitarbeitende<br />
Die CTU St.Gallen ist gemäss Stellenplan des Kantonsspitals mit<br />
4,7 Vollzeitstellen ausgestattet. Im Jahr 2023 konnten zusätzlich<br />
9 Vollzeitstellen über Einnahmen aus Dienstleistungen und<br />
Fördergelder finanziert werden.<br />
Clinical Trials Unit<br />
PD Dr. Baharak Babouee Flury<br />
Dr. Reinhard Maier<br />
Anela Karic<br />
Dr. Synove Otterbech<br />
Peter Schönenberger<br />
André Höpli<br />
Dr. Lynn Radamaker<br />
Dr. Elke Hiendlmeyer<br />
Dr. Simone Kälin<br />
Mareen Reiter<br />
Dr. Uwe Ramsperger<br />
Andrea Stadler<br />
Dr. Erin West<br />
Dr. Nicole Graf<br />
Martina Kurz<br />
Jacqueline Bossart<br />
Patricia Caminada<br />
Raphaela Monassi<br />
Joelle Küng<br />
Ärztlich-wissenschaftliche Leitung<br />
Operative Leitung<br />
Administration<br />
Qualitätsmanagement<br />
Datenmanagement<br />
Datenmanagement<br />
Datenmanagement<br />
Projektmanagement, Monitoring<br />
Projektmanagement, Monitoring<br />
Projektmanagement, Monitoring<br />
Projektmanagement, Monitoring<br />
Projekt- und Qualitätsmanagement, Monitoring<br />
Biostatistik<br />
Biostatistik<br />
Leitende Studienkoordination<br />
Studienkoordination<br />
Studienkoordination<br />
Studienkoordination<br />
Studienkoordination<br />
Clinical Trials Unit 31
Dienstleistungsangebote<br />
Die CTU bietet eine Reihe von Dienstleistungen für die Organisation<br />
und Durchführung von Studien an, darunter Projektmanagement,<br />
Monitoring, Datenmanagement, Biostatistik, Studienkoordination<br />
und Qualitätsmanagement. Der Grad der<br />
Beteiligung der CTU an einzelnen Projekten ist sehr unterschiedlich<br />
und hängt von der Komplexität der jeweiligen Studie<br />
ab. Die Rolle und das Aufgabenspektrum der CTU richten sich<br />
danach, ob es sich um mono- oder multizentrische, nationale<br />
oder internationale Studien handelt. Bei kleineren Aufträgen<br />
können Kunden gezielt einzelne Dienstleistungen der CTU nutzen,<br />
wie z.B. die Fallzahlberechnung durch die Mitarbeiter der<br />
Biostatistik. Bei grossen Studienaufträgen werden alle verfügbaren<br />
Dienstleistungen der CTU genutzt.<br />
Die Dienstleistungen der CTU werden sowohl von den verschiedenen<br />
Kliniken des Kantonsspitals St.Gallen als auch von<br />
externen Kunden in Anspruch genommen. Die nachstehende<br />
Grafik zeigt die Anzahl der Stunden, die die Mitarbeitenden<br />
der CTU in den Jahren 2022 und 2023 für interne und externe<br />
Kundinnen und Kunden geleistet haben und verdeutlicht die<br />
Vielfalt und den Umfang der Unterstützung. Die nachfolgenden<br />
Abschnitte geben einen Überblick über die Aktivitäten der CTU<br />
in den Jahren 2022 und 2023 in den wichtigsten Dienstleistungssektoren.<br />
Projektmanagement und Monitoring<br />
In den Jahren 2022 und 2023 beteiligte<br />
sich die CTU an 52 Studien mit dem Service<br />
Monitoring und/oder dem Service Projektmanagement.<br />
Für 27 dieser Projekte wurde in<br />
Zusammenarbeit mit der ärztlichen und wissenschaftlichen<br />
Leitung der CTU ein regulatorisches<br />
und wissenschaftliches Protokoll-<br />
Review durchgeführt. Umfragen bei den<br />
Kunden der CTU haben gezeigt, dass das Protokoll-Review<br />
von den klinisch Forschenden<br />
im Allgemeinen als sehr hilfreich empfunden<br />
wird.<br />
Datenmanagement<br />
Die Haupttätigkeit des Datenmanagements ist<br />
die Erstellung von gesetzeskonformen Datenbanken<br />
für klinisch Forschende. Bisher bot<br />
die CTU ausschliesslich das klinische Datenmanagementsystem<br />
secuTrial ® an. Um das Angebot<br />
zu erweitern, wurde zusätzlich REDCap ®<br />
eingeführt. REDCap ® ist eine webbasierte<br />
Software zur elektronischen Datenerhebung<br />
Aufwand der CTU für Kunden 2022 und 2023 in Stunden<br />
0 500 1000 1500 2000<br />
2500<br />
3000<br />
Gastroenterologie/Hepatologie<br />
Urologie<br />
Neurochirurgie<br />
Muskelzentrum/ALS Clinic<br />
Kantonsspital Winterthur<br />
Ostschweizer Kinderspital<br />
Dermatologie/Venerologie/Allergologie<br />
Externe Organisationen<br />
Radiologie und Nuklearmedizin<br />
Kardiologie<br />
Zentrale Notaufnahme (ZNA)<br />
Infektiologie/Infektionsprävention/Reisemedizin<br />
Frauenklinik<br />
Neurologie<br />
Anästhesiologie<br />
Rheumatologie<br />
Zentrum für Integrative Medizin<br />
Pneumologie und Schlafmedizin<br />
Augenklinik<br />
Brustzentrum St.Gallen<br />
Orthopädische Chirurgie und Traumatologie des Bewegungsapparates<br />
Endokrinologie/Diabetologie/Osteologie/Stoffwechselerkrankungen<br />
Kantonsspital Frauenfeld<br />
Hals-Nasen-Ohrenklinik<br />
Allgemeine Innere Medizin/Hausarztmedizin/Notfallmedizin<br />
Allgemein-, Viszeral-, Endokrin-, und Transplantationschirurgie<br />
Institut für Immunbiologie<br />
Onkologie/Hämatologie<br />
32 Clinical Trials Unit
mittels Fragebögen und Formularen, die insbesondere für die<br />
klinische Forschung geeignet ist. An solche Programme werden<br />
strenge regulatorische Anforderungen gestellt. Um diesen gerecht<br />
zu werden, wurde die Software installation einer intensiven<br />
Validierung durch die CTU unterzogen. Im Gegensatz zu<br />
secuTrial ® steht REDCap ® nur für Forschungsprojekte zur<br />
Verfügung, bei denen die Projekt leitung bei Forschenden des<br />
Kantonsspitals St.Gallen liegt. Es eignet sich insbesondere für<br />
Studien/Register, die der Humanforschungsverordnung unterliegen.<br />
Die CTU bietet zwei Servicemodelle für die Nutzung von<br />
REDCap ® an. Im «Full Model» wird ein CTU-Datenmanager mit<br />
der Entwicklung der Datenbank beauftragt, ähnlich wie bei<br />
secu Trial ® Studien. Im «Light Model» können Studienteams<br />
die Datenbank selbst entwickeln und pflegen, wobei sie auch<br />
für die korrekte Umsetzung verantwortlich sind, inklusive dem<br />
Studienprotokoll, regulatorischen Richtlinien, Validierung<br />
und der Dokumentation. In diesem Modell ist die CTU nur für<br />
das Hosting der Software und die Datensicherung verantwortlich.<br />
Als Unterstützung führen die Datenmanager der CTU eine<br />
Überprüfung der Datenbank durch, bevor diese in den produktiven<br />
Betrieb geht. Dieses wertvolle Feedback sichert den<br />
hohen Qualitätsstandard.<br />
Bis Ende 2023 hat das CTU Team 63 secuTrial ® Projekte begleitet.<br />
Zusätzlich wurde bereits ein REDCap ® Full Model Projekt<br />
erstellt und 13 REDCap ® Light Model Projekte unterstützt.<br />
Studienkoordination und Biobankverwaltung<br />
In den Jahren 2022 und 2023 waren die Studienkoordinatorinnen<br />
an 47 klinischen Studien und Projekten beteiligt. Darunter<br />
waren 6 Studien, bei denen neben der Koordination auch der<br />
Betrieb einer Biobank übernommen wurde. Weitere 6 Studien<br />
werden von der CTU als reine Biobankprojekte betreut. Für die<br />
Verwaltung der Proben in der Biobank verwendet die CTU die<br />
Datenbank «OpenSpecimen», die auch von externen Kunden<br />
für ihre lokale Probenverwaltung genutzt wird.<br />
«In den Ultratiefkühlschränken der CTU werden<br />
ca. 48’000 Proben gelagert. Insgesamt sind in der<br />
Datenbank über 170’000 Proben aus mono- und<br />
multizentrischen Studien erfasst.»<br />
Biostatistik<br />
In den Jahren 2022 und 2023 waren die Biostatistikerinnen der<br />
CTU an 80 Projekten im Rahmen der Studienplanung und/oder<br />
Datenauswertung beteiligt. Die kostenlose statistische Erstberatung<br />
wurde von Forschenden in 40 Beratungen in Anspruch<br />
genommen. In diesen Beratungsgesprächen wurden Forschungsideen<br />
eingehend diskutiert, präzisiert und so konzipiert,<br />
dass die zu erhebenden Daten verlässliche Aussagen ermöglichen.<br />
Eine fundierte Fallzahlberechnung und gegebenenfalls die<br />
Erstellung eines statistischen Analyseplans sind<br />
wichtige Qualitätskriterien bei der Antragstellung<br />
und Veröffentlichung von Forschungsergebnissen.<br />
Die Auswertung der erhobenen Studiendaten<br />
bildete die Grundlage für zahlreiche Konferenzbeiträge<br />
und Publikationen in renommierten<br />
wissenschaftlichen Zeitschriften. Neben<br />
den klassischen statistischen Auswertungen<br />
wurde in den Publikationen besonderer Wert<br />
auf die Entwicklung anschaulicher Darstellungen<br />
und Entscheidungshilfen für den klinischen<br />
Alltag gelegt. Im Berichtszeitraum wurden 21<br />
Publikationen veröffentlicht, an denen Biostatistikerinnen<br />
der CTU als Co-Autorinnen beteiligt<br />
waren.<br />
Qualitätsmanagement<br />
Das Qualitätsmanagement hat eine zentrale<br />
Funktion innerhalb der CTU. Der Sponsor einer<br />
Studie ist verpflichtet, ein Qualitätsmanagementsystem<br />
einzurichten, um die Einhaltung<br />
der gesetzlichen Verpflichtungen und die hohe<br />
Qualität der Ergebnisse zu gewährleisten. Die<br />
klinischen Studien müssen nach Standardarbeitsanweisungen<br />
durchgeführt werden, die<br />
entsprechend den regulatorischen Anforderungen<br />
erstellt, aktualisiert und den Forschenden<br />
von der CTU zur Verfügung gestellt<br />
werden.<br />
Im Jahr 2022 wurde die CTU einer Inspektion<br />
durch die Swissmedic unterzogen, welche<br />
keine wesentlichen Beanstandungen ergab.<br />
Generell sind solche Inspektionen wichtige<br />
Gradmesser für den Betrieb einer CTU. Die<br />
Qualitätssicherung und die Einhaltung der<br />
Standards in der klinischen Forschung werden<br />
durch regelmässige externe Inspektionen gefestigt,<br />
was von der CTU an die Forschenden<br />
am Kantonsspital St.Gallen weitergegeben wird.<br />
Dr. Synove Otterbech ist im CTU-Netzwerk für<br />
die Qualitätssicherung und der Sicherstellung<br />
des Wissenstransfers zuständig und hat während<br />
der Berichtsperiode in diesem Rahmen<br />
zwei Audits geleistet. Ein Audit wurde am CTC<br />
in Zürich (Auditfokus: risikobasiertes Qualitätsmanagement)<br />
und ein Audit am CTU-EOC in<br />
Lugano (Audit fokus: HFV-Projekte und Biobank-Management)<br />
durchgeführt. Zudem<br />
wurde eine Forschungsgruppe der Klinik für<br />
Neurologie am Kantonsspital St.Gallen mit<br />
einem Pre-Audit als Vorbereitung für eine<br />
Swissmedic Inspektion unterstützt.<br />
Clinical Trials Unit 33
Fortbildung<br />
Die CTU bietet Grund- und Auffrischungsmodule<br />
zum Good Clinical Practice (GCP) Kurs<br />
an, die von Swissethics anerkannt sind. Für<br />
Studienleitende ist die Teilnahme am Grundkurs<br />
obligatorisch, um die entsprechende<br />
Ausbildung nach internationalen Richtlinien zu<br />
erlangen. Für das weitere Studien personal wird<br />
die Absolvierung dringend empfohlen. In den<br />
Jahren 2022 und 2023 haben insgesamt 111<br />
Teilnehmende, davon rund 36 % aus externen<br />
Institutionen, erfolgreich ein GCP-Zertifikat<br />
erworben. Zusätzlich absolvierten 69 Studierende<br />
des Medizinstudiums der Universitäten<br />
St.Gallen und Zürich (Joint Medical Master)<br />
den GCP Grundkurs. Der Auffrischungskurs<br />
wurde in den Berichtsjahren von 101 Personen<br />
besucht.<br />
Die CTU organisiert vierteljährlich eine Veranstaltung<br />
zu Themen der klinischen Forschung.<br />
«Die zunehmende Komplexität<br />
klinischer Studien und die<br />
damit verbundenen erhöhten<br />
Anforderungen an die Studienteams<br />
machen einen regelmässigen<br />
Austausch und eine<br />
kontinuierliche Weiterbildung<br />
notwendig.»<br />
Die Weiterbildungen im Rahmen des «Netzwerks<br />
Klinische Studien» erfreuen sich grosser<br />
Beliebtheit und fanden im Berichtszeitraum<br />
sieben Mal statt. Insgesamt wurden 181<br />
Teilnehmende registriert. Die Themen der<br />
Veranstaltungen für die Jahre 2022 und 2023<br />
sind im Abschnitt «Aus- und Weiterbildung»<br />
aufgeführt.<br />
CTU-Netzwerk<br />
Nach einer erfolgreichen ersten Förderperiode<br />
(2017 bis 2020), werden die SCTO und<br />
das CTU-Netzwerk sowie das damit verbundene<br />
SwissPed-Net (Schweizer Netzwerk der<br />
Pädiatrischen Forschungszentren) auch in<br />
den Jahren 2021 bis 2024 vom Staatssekretariat<br />
für Bildung, Forschung und Innovation gefördert.<br />
Plattformkonzept der SCTO<br />
Um den klinisch Forschenden eine schweizweit harmonisierte<br />
Unterstützung bieten zu können, wurden Plattformen zu studienspezifischen<br />
Themen geschaffen. Die Plattformen des<br />
CTU-Netzwerks fungieren als Kompetenzgruppen und bieten<br />
den klinisch Forschenden Unterstützung in Bereichen wie<br />
Auditing, Aus- und Weiterbildung, Daten management, Monitoring,<br />
Projektmanagement, Regulatory Affairs, Sicherheit sowie<br />
Statistik und Methodik. Die Geschäftsstelle der SCTO koordiniert<br />
den Austausch zwischen den Plattformen. Über die Fortschritte<br />
der einzelnen Projekte der Plattformen wird regelmässig<br />
in den Gremien des CTU-Netzwerks und im Vorstand der<br />
SCTO berichtet.<br />
Plattform Projektmanagement<br />
Unter der Leitung von Dr. Otterbech koordiniert die CTU des<br />
Kantonsspitals St.Gallen die Plattform Projektmanagement. Im<br />
Rahmen dieser Plattform wird zusammen mit weiteren Experten<br />
aus dem CTU-Netzwerk ein Online-Tool (Easy Guide Clinical<br />
Studies) entwickelt, das Interessierten den Einstieg in die Welt<br />
der klinischen Studien erleichtern soll. Dieser Leitfaden ist seit<br />
März 2023 als Beta Version online verfügbar (www.easy-gcs.ch)<br />
und kann auch für Schulungen und zum Selbsttraining genutzt<br />
werden. Darüber hinaus entwickeln die Mitglieder der Plattform<br />
einen Qualitätsleitfaden für nicht-klinische Studien bzw.<br />
Forschungsprojekte. Im Rahmen von nicht-klinischen Studien<br />
besteht ein grosser Bedarf an administrativer Unterstützung,<br />
da die Anzahl solcher Projekte in den letzten Jahren stark<br />
angestiegen ist. Der Easy Guide Clinical Studies wurde von<br />
Dr. Otterbech im Mai 2022 am DACH Symposium für Klinische<br />
Studien in Salzburg und im November 2023 am SPCRC Kongress<br />
in Basel vorgestellt.<br />
SCTO Symposium 2023 in St.Gallen<br />
Das SCTO Symposium wurde von der CTU des Kantonsspitals<br />
St.Gallen organisiert und hat am 7. Juni 2023 in St.Gallen stattgefunden.<br />
Über 170 Teilnehmende konnten sich über das Thema<br />
«Clinical research in the age of digital health» informieren.<br />
34 Clinical Trials Unit
Zusammenfassung und Ausblick<br />
Die Einführung eines nationalen Ansprechpartners für klinische<br />
Studien in der Schweiz, sowohl durch die Schaffung der<br />
SCTO, als auch durch die Einrichtung lokaler Kompetenzzentren<br />
an den grossen Spitälern, ist bei den klinisch Forschenden<br />
auf ein sehr positives Echo gestossen. Die damit verbundene<br />
Stärkung der klinischen Forschung trägt wesentlich zur Attraktivität<br />
der Schweiz als Standort für medizinische und biomedizinische<br />
Forschung bei. Die Etablierung der CTUs an den Universitäts-<br />
und Forschungsspitälern verlief äusserst erfolgreich.<br />
Im Jahr 2023 waren die CTUs des SCTO-Netzwerks an über<br />
2’400 Projekten beteiligt, wovon ein Grossteil (88 %) akademische<br />
Initiativen unter der Leitung von Prüfärzten waren.<br />
Im Rahmen der nationalen Zusammenarbeit zwischen der SCTO<br />
und dem CTU Netzwerk wurden wichtige Instrumente für klinisch<br />
Forschende zur Planung und Durchführung von Studien<br />
entwickelt, wie z.B. Vorlagen für einen Monitoringplan oder ein<br />
Risikobewertungsformular für klinische Forschungsprojekte.<br />
Weitere Informationen zu diesen Hilfsmitteln sind auf der eigens<br />
dafür eingerichteten Internetseite www.sctoplatforms.ch<br />
zu finden. Ein aktueller Schwerpunkt der SCTO und des CTU-<br />
Netzwerks ist die Implementierung und Förderung der Patienten-<br />
und Öffentlichkeitsbeteiligung in der akademischen und<br />
klinischen Forschung.<br />
«Gut ausgebildete und forschungsinteressierte<br />
Mitarbeitende sowie eine<br />
Institution, die der Forschung einen<br />
hohen Stellenwert einräumt, sind grundlegend<br />
für den Erfolg eines Forschungsspitals.»<br />
Die Zusammenarbeit der CTU mit dem Ostschweizer<br />
Kinderspital hat sich in den letzten<br />
Jahren deutlich verstärkt und soll weiter ausgebaut<br />
werden. Eine Studienkoordinatorin<br />
und ein Projektleiter mit einer Anstellung bei<br />
der CTU und dem Ostschweizer Kinderspital<br />
sind dabei wichtige Bindeglieder. Die Zusammenarbeit<br />
der beiden Organisationen ist<br />
durch eine entsprechende Leistungsvereinbarung<br />
geregelt.<br />
Um den steigenden Anforderungen und der<br />
zunehmenden Komplexität in den Prozessen<br />
der klinischen Forschung gerecht zu werden,<br />
ist eine kontinuierliche Weiterbildung der<br />
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der CTUs<br />
unerlässlich. Dies beinhaltet einen regen Austausch<br />
mit anderen CTUs und der SCTO. Gut<br />
ausgebildete und forschungsinteressierte<br />
Mitarbeitende sowie eine Institution, die der<br />
Forschung einen hohen Stellenwert einräumt,<br />
sind grundlegend für den Erfolg eines Forschungsspitals.<br />
Zu den wichtigsten Herausforderungen für die CTU in den<br />
kommenden Jahren zählen die weiter zunehmende regulatorische<br />
Komplexität klinischer Studien sowie die Digitalisierung.<br />
Sowohl die gestiegenen regulatorischen Anforderungen im administrativen<br />
Bereich als auch die Zunahme von Vorschriften<br />
im Rahmen der Digitalisierung von Studien erhöhen die Grundkosten<br />
klinischer Studien. Kostentreiber sind u. a. die IT-<br />
Sicherheit, die Systemvalidierung von Computern bzw. Software<br />
und das Qualitätsmanagement. Um diesen Herausforderungen<br />
zu begegnen, wurde die Zusammenarbeit der CTU mit dem<br />
Departement IT und dem Rechtsdienst des Kantonsspitals<br />
St.Gallen intensiviert. Die Einführung eines neuen Klinikinformationssystems<br />
am Kantonsspital St.Gallen bietet vielfältige<br />
Möglichkeiten für Verbesserungen und Erleichterungen in der<br />
klinischen Forschung, insbesondere bei der Weiterverwendung<br />
bestehender Patienten daten. Die Leitung der CTU und Mitarbeitende<br />
des Daten- und Projektmanagements der CTU engagieren<br />
sich in einer Arbeitsgruppe mit weiteren Vertretern der klinischen<br />
Forschung, um die Studien abläufe im neuen Klinikinformationssystem<br />
abzubilden und zu optimieren.<br />
Clinical Trials Unit 35
Simone Kälin und Erin West<br />
Projektmanagerin der Clinical Trials Unit<br />
Biostatistikerin der Clinical Trials Unit<br />
«Die klaren Strukturen<br />
in der CTU sind mir sofort<br />
aufgefallen.» Erin West<br />
«Eine klinische Studie<br />
ist mehr Marathon<br />
denn Sprint.» Simone Kälin<br />
36 Xxxxxxxxxxxxx
Als Allrounderinnen mittendrin<br />
Was ist reizvoll daran, klinische Studien zu managen –<br />
statt selber zu forschen? Darauf haben Molekularbiologin<br />
Dr. Simone Kälin und Biostatistikerin Dr. Erin West mehr<br />
als eine Antwort.<br />
Beide haben zuvor aktiv geforscht, beide betreuen<br />
heute in der Clinical Trials Unit (CTU)<br />
mehrere Forschungsstudien parallel: Simone<br />
Kälin als Projektmanagerin seit 2015, Postdoktorandin<br />
Erin West ist im August 2023 zum<br />
Team gestossen. Und beide können sich nichts<br />
Besseres vorstellen. Ein Dialog über Meilensteine,<br />
strapazierte Geduld und mit Fingerspitzengefühl<br />
gewählte Worte.<br />
Simone Kälin: Müsste ich meine Tätigkeit in<br />
ein Wort fassen, wäre es Vielfalt. Als Projektmanagerin<br />
bin ich immer wieder konfrontiert<br />
mit anderen Situationen, anderen Teams, anderen<br />
Bedürfnissen. Von der Offerte bis zum<br />
Studienabschluss halte ich das Heft in der<br />
Hand, bin mitten im Geschehen. Dazu kommt:<br />
Forschung ist niemals statisch. Ich bin als Allrounderin<br />
gefordert, mit meinem Wissensstand<br />
à jour zu bleiben. So stellt sich selbst<br />
nach acht Jahren keine Routine ein. Dass es<br />
mir je langweilig werden könnte, ist schlicht<br />
unvorstellbar (lacht).<br />
Erin West: Während der Pandemiejahre vertiefte<br />
ich mich in ein einziges Forschungsthema:<br />
Spezialisierung war gefragt. Interessant,<br />
aber eindimensional. Jetzt geniesse ich<br />
die Breite. Parallel mehrere klinische Studien<br />
zu betreuen, ist unglaublich abwechslungsreich.<br />
Das Wort, das mir zu meiner Aufgabe<br />
zuerst in den Sinn kommt, hat aber damit<br />
nichts zu tun. Es ist: Struktur.<br />
Die klare Struktur in der CTU ist mir sofort<br />
aufgefallen. Hier hat jede und jeder eine definierte<br />
Rolle. Das macht vieles einfacher und<br />
übersichtlicher.<br />
Simone Kälin: Ich erinnere mich, wie ich zu Beginn überrascht<br />
war von der Grösse des Medizinischen Forschungszentrums,<br />
vom Umfang der Forschung und der internationalen Vernetzung<br />
– durchaus vergleichbar mit einem Universitätsspital.<br />
Und trotzdem ist die Stimmung familiär.<br />
Erin West: Oh ja, hier ist es wirklich familiär. Vor meinem Start<br />
hatte ich Bedenken wegen der Sprache. Doch das ist überhaupt<br />
kein Problem. Kommunikation ist in meinen Augen der<br />
Schlüssel zum Gelingen, intern und extern. Es kommt vor, dass<br />
ich schlechte Nachrichten überbringen muss. Der Klassiker:<br />
Die Forschungsstudie wird länger dauern als erhofft. Aber<br />
nicht wir bestimmen den Fahrplan, er ist von vielen Faktoren<br />
und Stellen abhängig, wir müssen immer wieder auf grünes<br />
Licht warten. Dieser Prozess lässt sich nicht beschleunigen, es<br />
gibt keine Abkürzung. Dann komme ich mir vor wie eine Bremse<br />
und wähle meine Worte mit Fingerspitzengefühl. Das gehört zu<br />
den Dingen, die ich hier gelernt habe.<br />
Simone Kälin: Eine klinische Studie ist mehr Marathon denn<br />
Sprint, sie kann Jahre dauern. Dazu kommen die zum Teil konträren<br />
Interessen der Anspruchsgruppen: Die Ethikkommission<br />
hat andere Schwerpunkte als das Studienteam, die geldgebenden<br />
Firmen setzen andere Prioritäten als Ärztinnen<br />
oder Juristen – und so weiter. Für alle aber gilt: Geduld ist ein<br />
zentraler Faktor. Leider gehört sie nicht zu meinen grössten<br />
Stärken, aber ich mache Fortschritte (lacht). Umso schöner ist<br />
der Moment, wenn das Ziel erreicht ist. Kürzlich konnten wir<br />
eine mehrjährige Studie abschliessen, die schon vor meiner<br />
Anstellung begonnen hatte. Das war ein Meilenstein.<br />
Erin West: Meine Meilensteine waren bisher die drei Studienstarts.<br />
Wenn alles sauber abgeklärt und aufgegleist ist und es<br />
losgehen kann – diese Aufbruchsstimmung mag ich.<br />
Simone Kälin: Die Frage, ob ich nicht lieber selber forschen<br />
würde, als die Fäden bei klinischen Studien in den Händen zu<br />
halten, wird mir immer wieder gestellt. Meine Antwort lautet:<br />
Nein. Es ist ein gutes Gefühl, Forscherinnen und Forschern den<br />
Rücken frei zu halten und Forschungsarbeit zu ermöglichen.<br />
Erin West: Forschung ist immer Teamarbeit. Ich trage meinen<br />
Teil bei, auch wenn ich selber nicht im Labor sitze.<br />
Interview 37
Institut für Immunbiologie<br />
Am Institut für Immunbiologie arbeiten fünf Forschungsgruppen<br />
an verschiedenen klinisch-translationalen und grundlagenwissenschaftlichen<br />
Projekten. Die Forschungsgruppen von Prof.<br />
Dr. Burkhard Ludewig (Immunbiologie), Prof. Dr. Natalia Pikor<br />
(Neuroimmunologie), Prof. Dr. Lukas Flatz (Experimentelle Dermatologie)<br />
und PD Dr. Marian Neidert sowie PD Dr. Dr. Isabel<br />
Hostettler (Experimentelle Neurochirurgie I und II) haben in den<br />
Jahren 2022 und 2023 beachtliche wissenschaftliche Erfolge<br />
erzielt und namhafte Drittmittelbeiträge eingeworben.<br />
Die Forschungsgruppenleiterinnen und -leiter konnten für die<br />
Jahre 2022 und 2023 insgesamt CHF 4,5 Mio. an Fördermitteln<br />
akquirieren. Der grösste Teil dieser Mittel wurde im Rahmen<br />
von kompetitiven Verfahren eingeworben. Hervorzuheben ist<br />
der «Starting Grant» des Schweizerischen Nationalfonds in der<br />
Höhe von CHF 1,8 Mio., der an Prof. Pikor vergeben wurde.<br />
Damit wurde gleichzeitig ihre Anstellung als Assistenzprofessorin<br />
an der ETH Zürich ermöglicht. Prof. Ludewig erhielt einen<br />
Beitrag vom Schweizerischen Nationalfonds von CHF 950’000<br />
und Prof. Flatz wurde mit dem «Swiss Bridge Award», dotiert<br />
mit CHF 250’000, ausgezeichnet. In den entsprechenden Abschnitten<br />
der einzelnen Arbeitsgruppen findet sich eine vollständige<br />
Auflistung der eingeworbenen Drittmittel während<br />
der Berichtsperiode.<br />
Drittmittelzusprachen in Mio. CHF<br />
4.5<br />
2022/23 4.5<br />
2020/21<br />
2018/19<br />
4.2<br />
3.9<br />
Das Institut für Immunbiologie ist akademisch eng mit der<br />
Universität Zürich und der ETH Zürich verbunden. Prof. Ludewig<br />
ist Titularprofessor an der mathematisch-naturwissenschaftlichen<br />
Fakultät der Universität Zürich. Seit Oktober 2021<br />
ist Prof. Ludewig in Teilzeit (20 %) an der Klinik für Kardiologie<br />
des Universitätsspitals Zürich tätig und leitet dort die Arbeitsgruppe<br />
Translationale Kardioimmunologie. Prof. Pikor ist seit<br />
2023 Assistenzprofessorin am Institut für Mikrobiologie der<br />
ETH Zürich. Beide Forschungsgruppenleiter besitzen das Promotionsrecht,<br />
sind «Principal Investigator» an der «Life Science<br />
Zürich Graduate School Zurich» und engagieren sich in den<br />
naturwissenschaftlichen Doktoratsprogrammen «Microbiology<br />
and Immunology» und «Cancer Biology» wie auch am Doktoratsprogramm<br />
«Klinische Wissenschaften». Prof. Lukas Flatz<br />
wurde Anfang 2021 an die Universität Tübingen berufen und<br />
führt als ärztlicher Leiter die Sektion für Dermatoonkologie der<br />
Universitäts-Hautklinik. Prof. Flatz führt seine Arbeitsgruppe am<br />
Institut für Immunbiologie mit hohem Engagement weiter.<br />
Während des Berichtszeitraums haben mehrere<br />
Doktoranden und Masteranden erfolgreich ihr<br />
Studium an den Universitäten abgeschlossen.<br />
Dr. Angelia De Martin hat am 21. August 2023<br />
ihre Doktorarbeit an der Universität Zürich<br />
verteidigt und die entsprechende Prüfung bestanden.<br />
Dr. De Martin hat während ihrer Dissertation<br />
die Fibroblasten in Tonsillen und im<br />
Darm untersucht. Am 6. Dezember 2023 hat<br />
Dr. Sarah Grabherr ihre Doktoratsprüfung an<br />
der Universität Zürich abgelegt. Dr. Grabherr<br />
hat über vier Jahre an der Immun reaktion<br />
gegen murine Coronaviren geforscht. Dr. Yves<br />
Stanossek hat seine medizinische Doktorarbeit<br />
mit dem Titel «PI16+ reticular cells in<br />
human palatine tonsils govern T cell activity in<br />
distinct subepithelial niches» an der Universität<br />
Zürich abgeschlossen. Ausserdem haben in<br />
den Jahren 2022 und 2023 Ann-Kristin Jochum<br />
und Bianka Broske ihre Masterarbeiten abgeschlossen.<br />
Die hohe wissenschaftliche Produktivität der<br />
Mitarbeitenden des Instituts für Immunbiologie<br />
zeigte sich auch in den Jahren 2022 und 2023<br />
durch die Veröffentlichung von 83 Originalarbeiten<br />
und 9 Übersichtsartikeln. Hervorzuheben<br />
sind die exzellenten Originalarbeiten der<br />
Gruppen Ludewig und Pikor, die in der Mai-<br />
Ausgabe des Journals Nature Immunology<br />
gleich zwei Arbeiten veröffentlichen konnten.<br />
Des Weiteren konnte PD Dr. Neidert zusammen<br />
mit einem internationalen Forscherteam<br />
einen Artikel im renommierten Journal Nature<br />
veröffentlichen.<br />
Standespolitisch engagiert sich Prof. Ludewig<br />
weiterhin im Vorstand der Swiss Clinical Trial<br />
Organization. Zudem ist Prof. Ludewig Mitglied<br />
des Editorial Boards des Journal of Experimental<br />
Medicine und im Jahr 2023 war er als Fachgutachter<br />
bei der Evaluation des Max Delbrück<br />
Zentrums, Berlin sowie von P01 Förderprogrammen<br />
des National Institutes of Health, USA<br />
tätig. Prof. Flatz, Prof. Pikor und Prof. Ludewig<br />
engagieren sich regelmässig als ad hoc Gutachter<br />
für weitere nationale und internationale<br />
Förderinstitutionen (u. a. Europäischer Forschungsrat,<br />
Schweizerischer Nationalfonds,<br />
Krebsliga Schweiz, Deutsche Forschungsgemeinschaft)<br />
sowie für interna tionale Fachzeitschriften<br />
wie Nature, Nature Reviews Immunology,<br />
Nature Immunology, Immunity, und Science<br />
Immunology.<br />
38 Institut für Immunbiologie
Xxxxxxxxxxxxx 39
v.l.n.r.: Anna Joachimbauer, Nadine Cadosch, Elina Bugar, Mechthild Lütge, Emily Payne, Lucas Onder, Burkhard Ludewig,<br />
Hung-Wei Cheng, Lisa Kurz, Cristina Gil Cruz, Christian Pérez Shibayama, Elke Scandella<br />
Immunbiologie<br />
In der Forschungsgruppe von Prof. Dr. Burkhard<br />
Ludewig wird sowohl immunologische<br />
Grundlagen forschung als auch translationale<br />
Forschung auf den Gebieten der Immunabwehr<br />
von Infektionserregern, der Tumor- und<br />
der Kardioimmunologie durchgeführt. Besonderes<br />
Augenmerk gilt der Interaktion zwischen<br />
Fibroblasten und Immunzellen bei der Organentwicklung<br />
und in verschiedenen Krankheitssituationen.<br />
Die Forschungsprojekte werden<br />
in Teams mit unterschiedlichen fachlichen<br />
und technischen Expertisen bearbeitet.<br />
Erfahrene Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler<br />
unterstützen Prof. Ludewig in der<br />
Betreuung von naturwissenschaftlichen und<br />
medizinischen Doktoratsstudentinnen und<br />
-studenten. Dies ermöglicht die Sicherung der<br />
qualitativ hochwertigen Forschungsergebnisse<br />
und gewährleistet eine optimale Planung<br />
und Durchführung der Projekte. Als besondere<br />
Schwerpunkte in der Doktorandenausbildung<br />
haben sich die Anwendung bioinformatischer<br />
Ansätze und die Analyse komplexer<br />
Datensätze erwiesen. Im Jahr 2023 hat Dr.<br />
Angelina De Martin erfolgreich ihre Dissertation<br />
an der mathematisch-naturwissenschaftlichen<br />
Fakultät der Universität Zürich abgeschlossen.<br />
Dr. Yves Stanossek hat im gleichen Jahr seine<br />
Doktorarbeit an der medizinischen Fakultät der Universität<br />
Zürich verteidigt.<br />
In den Jahren 2022 und 2023 wurden Fachartikel in hochrangigen<br />
wissenschaftlichen Zeitschriften veröffentlicht. In<br />
der Mai Ausgabe 2023 von Nature Immunology erschienen zwei<br />
Arbeiten der Gruppen von Prof. Ludewig und Prof. Pikor «backto-back».<br />
Darin werden neue Klassifikationen von Fibroblasten<br />
und bisher unbekannte Funktionen von Fibroblasten in lymphoiden<br />
Organen beschrieben. Die Bedeutung dieser neuen<br />
Erkenntnisse wurde in einem begleitenden «News&Views»-<br />
Artikel in derselben Ausgabe von Nature Immunology gewürdigt.<br />
Die wissenschaftliche Arbeit der Forschungsgruppe von Prof.<br />
Ludewig wird durch hoch kompetitive Drittmittel unterstützt.<br />
Im Jahr 2022 startete das Projekt «CardiacStroma», das vom<br />
Europäischen Forschungsrat mit rund CHF 2,5 Mio. gefördert<br />
wird. Ziel des auf fünf Jahre angelegten Projekts ist es, die<br />
Wechselwirkungen zwischen kardialen Stromazellen und<br />
Immunzellen zu erforschen, um neue immuntherapeutische<br />
Ansätze zur Behandlung von Herzmuskelentzündungen und der<br />
daraus resultierenden Herzinsuffizienz zu etablieren. Ausserdem<br />
unterstützt der Schweizerische Nationalfonds ein Forschungsprojekt<br />
zum Thema «Tonsillenkrebs», das in enger Zusammenarbeit<br />
mit der Hals-Nasen-Ohrenklinik durchgeführt<br />
wird, mit einem Beitrag von 950’000 CHF.<br />
40 Immunbiologie
Immunbiologie<br />
Prof. Dr. Burkhard<br />
Ludewig<br />
Dr. Elke<br />
Scandella-Grabher<br />
Dr. Lucas Onder<br />
Dr. Cristina del Carmen<br />
Gil Cruz<br />
Dr. Christian Ivan Pérez<br />
Shibayama<br />
Dr. Hung-Wei Cheng<br />
Dr. Angelina Marisa De<br />
Martin<br />
Dr. Mechthild Lütge<br />
Lisa Kurz<br />
Nadine Alessia Cadosch<br />
Dr. Anna Joachimbauer<br />
Iliana Papadopoulou<br />
Chrysa Papadopoulou<br />
Dr. Emily Payne<br />
Samuel Meili<br />
Dr. Yves Marcel Stanossek<br />
Leiter Medizinisches<br />
Forschungszentrum,<br />
Gruppenleiter Immunbiologie<br />
Wissenschaftlerin,<br />
Fachverantwortliche<br />
Tierversuche<br />
Wissenschaftler,<br />
Fachverantwortlicher<br />
Mikroskopie<br />
Wissenschaftlerin,<br />
Projektkoordinatorin<br />
klinische Studien<br />
Wissenschaftler,<br />
Fachverantwortlicher<br />
Durchflusszytometrie<br />
Wissenschaftler<br />
Wissenschaftlerin<br />
Wissenschaftlerin<br />
Doktorandin (sc. nat.)<br />
Doktorandin (sc. nat.)<br />
Doktorandin (sc. nat.)<br />
Doktorandin (sc. nat.)<br />
Doktorandin (sc. nat.)<br />
Doktorandin (sc. med.)<br />
Doktorand (med.),<br />
Assistenzarzt, Hals-Nasen-<br />
Ohrenklinik<br />
Assistenzarzt, Hals-Nasen-<br />
Ohrenklinik, Wissenschaftler<br />
Forschungsprojekte und klinische<br />
Studien<br />
Die folgenden Forschungsprojekte waren in<br />
den Jahren 2022 bis 2023 aktiv. Weitere Details<br />
zu den Projekten sind in der Forschungsund<br />
Studiendatenbank des Kantonsspitals<br />
St.Gallen und auf der Homepage des Instituts<br />
für Immunbiologie zu finden.<br />
Tissue Cytokines at the Nexus of Immune Cell-<br />
Cardiac Stromal Cell Interaction – Cardiac<br />
Stroma<br />
ERC Horizon 2020 – Advanced Grant<br />
01.01.2022 – 31.12.2026, EUR 2’424’000<br />
Hauptantragsteller: Burkhard Ludewig<br />
Myokarditis ist eine akute Entzündung des<br />
Herzmuskels, die durch eine Reaktion des Immunsystems<br />
ausgelöst wird. Neuere Forschungsergebnisse<br />
haben gezeigt, dass kreuzreaktive<br />
T-Zellen eine wichtige Rolle bei der<br />
Entstehung von Myokarditis spielen. Ziel dieses<br />
Projektes ist die Aufklärung der molekularen<br />
Signalwege, die die Interaktion zwischen Immun-<br />
und Stromazellen im Herzgewebe während<br />
der Entzündungsreaktion regulieren. Darüber<br />
hinaus sollen neue Ansätze für die<br />
Behandlung von Myokarditis identifiziert und<br />
eine umfassende Analyse der zellulären und<br />
molekularen Veränderungen während einer<br />
Herzmuskelentzündung durchgeführt werden.<br />
Regulation of lymphoid organ fibroblast differentiation and<br />
function by bone morphogenic proteins<br />
Schweizerischer Nationalfonds<br />
01.01.2023 – 31.12.2026, CHF 950’000<br />
Hauptantragsteller: Burkhard Ludewig<br />
Um eine gezielte Aktivierung von Immunzellen in den Lymphknoten<br />
zu gewährleisten, kontrollieren Fibroblasten in diesen Organen<br />
spezielle Milieus. Beim Tumorwachstum in Lymphknoten<br />
sind die Funktionen der Fibroblasten und ihre Interaktion mit<br />
Immunzellen stark beeinträchtigt. Ziel dieses Projektes ist es, die<br />
Ursachen für die gestörte Interaktion zwischen Fibroblasten und<br />
Immunzellen während des Krebswachstums in Lymphknoten<br />
aufzuklären. Durch die Fokussierung auf Fibroblasten als zentrale<br />
Koordinatoren der Zell-Zell-Kommunikation sollen grundlegende<br />
Erkenntnisse gewonnen werden, um das Verständnis<br />
der Tumorimmunität zu vertiefen und verbesserte Behandlungsmöglichkeiten<br />
zu entwickeln.<br />
Defining the identity and differentiation pathways of the immunestimulating<br />
fibroblastic tumor stroma<br />
Schweizerischer Nationalfonds, Sinergia<br />
01.01.2018 – 30.06.2022, CHF 3’177’365 (total), CHF 877’530<br />
(Immunbiologie)<br />
Hauptantragsteller: Burkhard Ludewig<br />
Projektpartner: Mark Robinson, Maries van den Broek, Bernd<br />
Bodenmiller (Universität Zürich)<br />
Die Zusammensetzung des Tumormikromilieus beim nicht-kleinzelligen<br />
Lungenkarzinom ist durch einen sehr hohen Anteil fibroblastischer<br />
Stromazellen gekennzeichnet. In diesem Kollaborationsprojekt<br />
sollen neue Erkenntnisse über die verschiedenen<br />
fibroblastischen Tumorstromazellen gewonnen werden. Insbesondere<br />
sollen Fibroblasten identifiziert werden, die schützende<br />
Immunantworten gegen Tumorzellen fördern. Dazu werden am<br />
Institut für Immunbiologie des Kantonsspitals St.Gallen präklinische<br />
Modellsysteme entwickelt, um immunstimulierende Fibroblasten<br />
im Tumorstroma zu charakterisieren und zu testen, ob<br />
genetische oder medikamentöse Veränderung dieser Zellen einen<br />
therapeutischen Vorteil bringt. Es wird erwartet, dass die Definition<br />
einzigartiger Wirkmechanismen in der Mikroumgebung des<br />
Tumors die Entwicklung neuer Therapien fördern wird.<br />
Stromal cell niches at the nexus of the innate lymphoid cell<br />
interactome<br />
Schweizerischer Nationalfonds<br />
01.01.2019 – 31.12.2022, CHF 904’000<br />
Hauptantragsteller: Burkhard Ludewig<br />
Angeborene lymphoide Zellen (ILCs) spielen eine bedeutende<br />
Rolle bei verschiedenen Krankheiten. Während die Signalwege<br />
für die Entwicklung und Funktion von ILCs mittlerweile gut erforscht<br />
sind, besteht weiterhin Unklarheit über die äusseren Faktoren,<br />
die bestimmen, wo, wann und wie ILCs aufrechterhalten<br />
und kontrolliert werden. Dieses Forschungsprojekt konzentriert<br />
sich auf die Untersuchung der fibroblastischen Retikulumzellen<br />
in sekundären lymphoiden Organen, die eine entscheidende<br />
Umgebung für die ILCs schaffen. Diese Umgebung beeinflusst<br />
massgeblich die Wirkung von Immunreaktionen. Die Erkenntnisse<br />
dieser Studie werden dazu beitragen, gezielte Therapieansätze<br />
zu entwickeln, die sich auf ILCs und Stromazellen richten.<br />
Immunbiologie 41
Spatial transcriptomics for the dissection of<br />
cardiac inflammation and structural remodeling<br />
in myocarditis patients<br />
Forschungsförderung Kantonsspital St.Gallen<br />
01.01.2021 – 31.12.2022, CHF 76’149<br />
Hauptantragsteller: Burkhard Ludewig<br />
Myokarditis ist eine plötzlich auftretende Entzündung<br />
des Herzens, die zu Kardiomyopathie<br />
und Herzinsuffizienz führen kann. Dieses Projekt<br />
zielt darauf ab, die molekularen Prozesse<br />
zu untersuchen, die die Interaktion zwischen<br />
Immunzellen und Stromazellen im Herzgewebe<br />
steuern. Dazu werden Herzbiopsien von<br />
Patientinnen und Patienten mit einer neuen<br />
Technik analysiert.<br />
Fibroblastendifferenzierung und –funktion<br />
im Tonsillenkarzinom<br />
Forschungsförderung Kantonsspital St.Gallen<br />
01.08.2022 – 31.07.2023, CHF 64’096<br />
Medizinische Dissertation<br />
Hauptantragsteller: Burkhard Ludewig, Samuel<br />
Meili<br />
Die steigende Inzidenz von Infektionen mit<br />
humanen Papillomaviren geht mit einer Zunahme<br />
von Tonsillenkarzinomen einher. Ziel<br />
dieses Projekts ist es, die tumorinduzierten<br />
Veränderungen in fibroblastischen Retikulumzellen<br />
der Tonsillen zu charakterisieren<br />
und neue Erkenntnisse über die Ursprungsund<br />
Differenzierungswege von Tumorfibroblasten<br />
im Lymphknoten und Gaumenmandeln<br />
zu gewinnen. Darüber hinaus könnte das<br />
Zusammenspiel der Kommunikation zwischen<br />
Immun- und Stromazellen bisher unbekannte<br />
molekulare Mechanismen aufdecken, die kritische<br />
zelluläre Interaktionen während der Tumorentwicklung<br />
und Metastasierung steuern.<br />
T cell responses in myocarditis, inflammatory<br />
cardiomyopathy and heart failure<br />
Forschungsförderung Kantonsspital St.Gallen<br />
2023, CHF 48’600<br />
Hauptantragsteller: Burkhard Ludewig<br />
Das Forschungsprojekt basiert auf der Hypothese,<br />
dass bakterielle Bestandteile, die Herzmuskelantigene<br />
imitieren, die Reaktionen der<br />
selbstreaktiven T- und B-Zellen bei Patientinnen<br />
und Patienten mit Herzinsuffizienz beeinflussen.<br />
Um dies zu untersuchen, wird eine<br />
bioinformatische Analyse potenzieller Herzmuskelantigen-Mimikry-Peptide<br />
im menschlichen<br />
Mikrobiom durchgeführt. Zusätzlich wird<br />
die Bildung von Antikörpern gegen bestimmte<br />
Bestandteile des Mikrobioms bei Patienten<br />
mit Herzinsuffizienz bewertet und die Aktivierung<br />
von auto- und mikrobiomreaktiven CD4+<br />
T-Zellen überwacht.<br />
42 Immunbiologie
Xxxxxxxxxxxxx 43
v.l.n.r.: Sara Kraker, Sarah Grabherr, Vanessa Skipness, Georgios Perdikaris, Natalia Pikor, Margaux Verdon<br />
Neuroimmunologie<br />
Die Forschungsgruppe um Prof. Dr. Natalia<br />
Pikor untersucht, wie das Immunsystem auf<br />
Entzündungsreaktionen im Gehirn reagiert –<br />
dies im Zusammenhang mit viralen Entzündungen,<br />
der Auto immunerkrankung Multiple<br />
Sklerose und bösartigen Erkrankungen des<br />
zentralen Nervensystems. Die molekularen<br />
und mechanistischen Grundlagen, die das immunologische<br />
Programm der Zellen in Gehirn<br />
und Rückenmark steuern, sind noch weitgehend<br />
un bekannt. Durch die enge Kooperation<br />
mit der Klinik für Neurochirurgie und anderen<br />
Arbeitsgruppen des Medizinischen Forschungszentrums<br />
können Untersuchungen<br />
sowohl an präklinischen Modellen als auch an<br />
klar definierten Patientengruppen durchgeführt<br />
werden.<br />
Die Forschungsgruppe Neuroimmunologie bildet<br />
in Zusammenarbeit mit der ETH Zürich und<br />
der Universität Zürich akademischen Nachwuchs<br />
aus. Im Dezember 2023 verteidigte Sarah<br />
Grabherr erfolgreich ihre Dissertation an<br />
der mathematisch-naturwissenschaftlichen<br />
Fakultät der Universität Zürich. Sara Kraker und<br />
Margaux Verdon wurden über das Doktoratsprogramm<br />
«Mikrobiologie und Immunologie»<br />
der «Life Science Zurich Graduate School» rekrutiert.<br />
Die exzellente wissenschaftliche Qualität der Forschungsgruppe<br />
um Prof. Pikor spiegelt sich in hoch kompetitiven Drittmitteleinwerbungen<br />
wider. Neben dem Ambizione-Beitrag des<br />
Schweizerischen Nationalfonds (2019 – 2022) ist Prof. Pikor<br />
Preisträgerin der Peter Hans Hofschneider Stiftungsprofessur<br />
der Stiftung Experimentelle Biomedizin für die Jahre<br />
2022 – 2024. Zudem wurde sie 2022 mit einem «Starting<br />
Grant» des Schweizerischen Nationalfonds ausgezeichnet, der<br />
an talentierte Nachwuchsforschende mit vielversprechenden<br />
Karriereaussichten vergeben wird. Mit dieser Auszeichnung<br />
konnte Prof. Pikor ihre Assistenzprofessur an der ETH Zürich<br />
antreten und ist damit die erste Inhaberin einer ETH-Professur<br />
in der Ostschweiz. Prof. Pikor führt ihre herausragenden<br />
Forschungsaktivitäten am Kantonsspital St.Gallen fort, was die<br />
Partnerschaft der beiden Institutionen stärken wird. Das auf<br />
fünf Jahre angelegte Forschungsprojekt des «Starting Grants»<br />
hat zum Ziel, die Mechanismen zu untersuchen, welche die<br />
Interaktionen zwischen Immun zellen und Stromazellen während<br />
einer Viruserkrankung im zentralen Nervensystem initiieren und<br />
aufrechterhalten.<br />
Neuroimmunologie<br />
Prof. Dr. Natalia Barbara Pikor<br />
Dr. Sarah Anna Grabherr<br />
Sara Kraker<br />
Margaux Verdon<br />
Vanessa Skipness<br />
Georgios Perdikaris<br />
Gruppenleiterin Neuroimmunologie<br />
Wissenschaftlerin<br />
Doktorandin (sc. nat.)<br />
Doktorandin (sc. nat.)<br />
Masterandin (M.Sc.)<br />
Masterand (M.Sc.)<br />
44 Immunbiologie/Neuroimmunologie
Forschungsprojekte und klinische<br />
Studien<br />
Folgende Forschungsprojekte wurden in den<br />
Jahren 2022 und 2023 durchgeführt. Weitere<br />
Details zu den Projekten finden sich in der<br />
Forschungs- und Studiendatenbank des<br />
Kantonsspitals St.Gallen.<br />
Dissecting mechanisms of antiviral immunity<br />
to coronaviruses in the gastrointestinal tract<br />
Peter Hans Hofschneider Stiftungsprofessur<br />
01.01.2022 – 31.12.2024, CHF 813’772<br />
Hauptantragstellerin: Natalia Pikor<br />
Die Mechanismen und Krankheitsfolgen von<br />
Coronavirus-Infektionen im Darm, in der Leber<br />
und im zentralen Nervensystem, sind noch nicht<br />
ausreichend untersucht. Ziel dieses Projektes<br />
ist die Aufklärung der Infektionsmechanismen<br />
und Pathologien von Leber- und Magen-Darm-<br />
Infektionen. Die Aufklärung der Abwehrmechanismen<br />
gegen Coronaviren in Organen ausserhalb<br />
der Lunge wird dazu beitragen, die Risiko -<br />
faktoren für Patientinnen und Patienten mit<br />
Neigung zu Multiorganerkrankungen besser zu<br />
verstehen sowie die pathologischen Konsequenzen<br />
einer Infektion mit enterischen Coronaviren<br />
aufzuzeigen und damit die Entwicklung<br />
neuer Therapieansätze zu unterstützen.<br />
Mechanisms governing the priming and sustenance<br />
of encephalitogenic lymphocyte –<br />
stromal cell interactions during neurotropic<br />
viral infection<br />
Schweizerischer Nationalfonds, Starting Grant<br />
01.04.2023 – 31.03.2028, CHF 1’800’000<br />
Hauptantragstellerin: Natalia Pikor<br />
Verschiedene Viren, darunter auch Coronaviren,<br />
können im Zentralnervensystem ein<br />
Reservoir bilden. Obwohl das Virus während<br />
dieser Zeit inaktiv ist, kann es reaktiviert werden,<br />
wenn das Immunsystem geschwächt ist.<br />
In diesem Projekt werden die Interaktionen<br />
zwischen Immunzellen und Fibroblasten<br />
untersucht, die die antivirale Immunantwort<br />
unterstützen und das Wiederauftreten einer<br />
latenten neurotropen Coronavirus-Infektion<br />
verhindern.<br />
Identification and manipulation of immunestimulating<br />
fibroblastic stromal cell niches in<br />
the inflamed CNS<br />
Schweizerischer Nationalfonds, Ambizione<br />
01.01.2019 – 30.06.2023, CHF 851’259<br />
Hauptantragstellerin: Natalia Pikor<br />
Neuere Studien weisen darauf hin, dass lokale<br />
Entzündungen des zentralen Nervensystems<br />
häufiger sind als bisher angenommen. Interessanterweise<br />
induzieren bestimmte Virus infektionen die Ansammlung<br />
von Gedächtnis-Lymphozyten, die eine Rolle bei der<br />
lokalen Immunüberwachung spielen könnten. In diesem Projekt<br />
werden wir die Funktion von immunstimulierenden Fibroblasten<br />
im Kontext neurotropher Virusinfektionen untersuchen und<br />
die Mechanismen der Kreuzaktivierung von myelinspezifischen<br />
T-Zellen analysieren. Diese Untersuchungen können zu einem<br />
besseren Verständnis der Mechanismen führen, die Virusinfektionen<br />
und Autoimmunität im zentralen Nervensystem<br />
steuern.<br />
Elucidating mechanisms of disease pathogenesis in a coronavirus-induced<br />
model of Multiple Sclerosis<br />
Schweizerische Multiple Sklerose Gesellschaft<br />
01.11.2021 – 31.10.2023, CHF 140’000<br />
Hauptantragstellerin: Natalia Pikor<br />
Neurotrope Viren erhöhen das Risiko, eine Autoimmunerkrankung<br />
des zentralen Nervensystems zu entwickeln. In diesem<br />
Projekt wird ein präklinisches Modell für neurotrope Virusinfektionen<br />
genutzt, um zu untersuchen, wo, wann und wie<br />
antivirale Immunantworten das Risiko von Autoimmunreaktionen<br />
im zentralen Nervensystem erhöhen.<br />
Entschlüsselung der krebsassoziierten Fibroblastenlandschaft<br />
bei malignen Erkrankungen des ZNS<br />
Stiftung OPOS<br />
01.01.2023 – 31.12.2023, CHF 85’000<br />
Hauptantragstellerin: Natalia Pikor<br />
Immun-Checkpoint-Therapien sind bei Hirntumoren nur<br />
begrenzt wirksam. Zudem ist die zelluläre Zusammensetzung<br />
dieser Tumore noch nicht genau bekannt. Unser Forschungsansatz<br />
konzentriert sich darauf, wie krebsassoziierte Fibroblasten<br />
die Rekrutierung und Retention von Immunzellen im<br />
zentralen Nervensystem steuern und eine antitumorale Immunantwort<br />
induzieren können. Ziel dieses Projektes ist es,<br />
molekulare Muster und Immuninteraktionen von krebsassoziierten<br />
Fibroblasten in verschiedenen Tumoren des zentralen<br />
Nervensystems zu identifizieren, um potenzielle Therapieansätze<br />
aufzudecken.<br />
Veröffentlichungen<br />
Die folgenden Arbeiten sind in den Jahren 2022 bis 2023 von den<br />
Forschungsgruppen Ludewig und Pikor veröffentlicht worden:<br />
Originalarbeiten<br />
1. Alexandre YO, Schienstock D, Lee HJ, Gandolfo LC, Williams CG, Devi S, Pal B,<br />
Groom JR, Cao W, Christo SN, Gordon CL, Starkey G, D’costa R, Mackay LK,<br />
Haque A, Ludewig B, Belz GT, Mueller SN. A diverse fibroblastic stromal<br />
cell landscape in the spleen directs tissue homeostasis and immunity. Sci<br />
Immunol. 2022, 7: eabj0641.<br />
2. Assen FP, Abe J, Hons M, Hauschild R, Shamipour S, Kaufmann WA, Costanzo<br />
T, Krens G, Brown M, Ludewig B, Hippenmeyer S, Heisenberg CP, Weninger W,<br />
Hannezo E, Luther SA, Stein JV, Sixt M. Multitier mechanics control stromal<br />
adaptations in the swelling lymph node. Nat Immunol. 2022, 23: 1246 – 1255.<br />
3. Cheng HW, Mörbe U, Lütge M, Engetschwiler C, Onder L, Novkovic M, Gil-Cruz<br />
C, Perez-Shibayama C, Hehlgans T, Scandella E, Ludewig B. Intestinal fibroblastic<br />
reticular cell niches control innate lymphoid cell homeostasis and<br />
function. Nat Commun. 2022, 13: 2027.<br />
Immunbiologie/Neuroimmunologie 45
4. Gómez Atria D, Gaudette BT, Londregan J, Kelly S, Perkey<br />
E, Allman A, Srivastava B, Koch U, Radtke F, Ludewig B,<br />
Siebel CW, Ryan RJ, Robertson TF, Burkhardt JK, Pear<br />
WS, Allman D, Maillard I. Stromal Notch ligands foster<br />
lymphopenia-driven functional plasticity and homeostatic<br />
proliferation of naive B cells. J Clin Invest. 2022,<br />
132.<br />
5. Li C, Ward LA, Nguyen A, Lam E, Dasoveanu D, Ahmed M,<br />
Haniuda K, Buechler MB, He HH, Ludewig B, Mcnagny<br />
KM, Gommerman JL. Neonatal LTβR signaling is required<br />
for the accumulation of eosinophils in the inflamed<br />
adult mesenteric lymph node. Mucosal Immunol. 2022,<br />
15: 418 – 427.<br />
6. Schmiedeberg K, Abela IA, Pikor NB, Vuilleumier N,<br />
Schwarzmueller M, Epp S, Pagano S, Grabherr S,<br />
Patterson AB, Nussberger M, Trkola A, Ludewig B, Von<br />
Kempis J, Rubbert-Roth A. Postvaccination anti-S IgG<br />
levels predict anti-SARS-CoV-2 neutralising activity<br />
over 24 weeks in patients with RA. RMD Open. 2022, 8.<br />
7. Schmiedeberg K, Vuilleumier N, Pagano S, Albrich WC,<br />
Ludewig B, Kempis JV, Rubbert-Roth A. Efficacy and<br />
tolerability of a third dose of an mRNA anti-SARS-<br />
CoV-2 vaccine in patients with rheumatoid arthritis<br />
with absent or minimal serological response to two<br />
previous doses. Lancet Rheumatol. 2022, 4: e11 – e13.<br />
8. Shaikh H, Pezoldt J, Mokhtari Z, Gamboa Vargas J, Le DD,<br />
Peña Mosca J, Arellano Viera E, Kern MA, Graf C, Beyersdorf<br />
N, Lutz MB, Riedel A, Büttner-Herold M, Zernecke<br />
A, Einsele H, Saliba AE, Ludewig B, Huehn J, Beilhack A.<br />
Fibroblastic reticular cells mitigate acute GvHD via<br />
MHCII-dependent maintenance of regulatory T cells.<br />
JCI Insight. 2022, 7.<br />
9. Vuilleumier N, Pagano S, Ludewig B, Schmiedeberg K,<br />
Haller C, Von Kempis J, Rubbert-Roth A. Anti-SARS-<br />
CoV-2 mRNA vaccines as inducers of humoral response<br />
against apolipoprotein A-1? Eur J Clin Invest.<br />
2022, 52: e13713.<br />
10. Brandstadter JD, De Martin A, Lütge M, Ferreira A, Gaudette<br />
BT, Stanossek Y, Wang S, Gonzalez MV, Camiolo E,<br />
Wertheim G, Austin B, Allman D, Lim MS, Fajgenbaum DC,<br />
Aster JC, Ludewig B, Maillard I. A novel cryopreservation<br />
and biobanking strategy to study lymphoid tissue stromal<br />
cells in human disease. bioRxiv. 2023.<br />
11. Brandstadter JD, De Martin A, Lütge M, Ferreira A, Gaudette<br />
BT, Stanossek Y, Wang S, Gonzalez MV, Camiolo E,<br />
Wertheim G, Austin B, Allman D, Bagg A, Lim MS, Fajgenbaum<br />
DC, Aster JC, Ludewig B, Maillard I. A novel cryopreservation<br />
and biobanking strategy to study lymphoid<br />
tissue stromal cells in human disease. Eur J<br />
Immunol. 2023, 53: e2250362.<br />
12. D’rozario J, Knoblich K, Lütge M, Shibayama CP, Cheng<br />
HW, Alexandre YO, Roberts D, Campos J, Dutton EE, Suliman<br />
M, Denton AE, Turley SJ, Boyd RL, Mueller SN, Ludewig<br />
B, Heng TSP, Fletcher AL. Fibroblastic reticular<br />
cells provide a supportive niche for lymph node-resident<br />
macrophages. Eur J Immunol. 2023, 53: e2250355.<br />
13. De Martin A, Stanossek Y, Lütge M, Cadosch N, Onder L,<br />
Cheng HW, Brandstadter JD, Maillard I, Stoeckli SJ, Pikor<br />
NB, Ludewig B. PI16(+) reticular cells in human palatine<br />
tonsils govern T cell activity in distinct subepithelial<br />
niches. Nat Immunol. 2023, 24: 1138 – 1148.<br />
14. Delgobo M, Weiss E, Ashour D, Richter L, Popiolkowski L,<br />
Arampatzi P, Stangl V, Arias-Loza P, Mariotti-Ferrandiz<br />
E, Rainer PP, Saliba AE, Ludewig B, Hofmann U, Frantz S,<br />
Campos Ramos G. Myocardial Milieu Favors Local Differentiation<br />
of Regulatory T Cells. Circ Res. 2023, 132:<br />
565 – 582.<br />
15. Grabherr S, Waltenspühl A, Büchler L, Lütge M, Cheng HW, Caviezel-Firner S,<br />
Ludewig B, Krebs P, Pikor NB. An Innate Checkpoint Determines Immune<br />
Dysregulation and Immunopathology during Pulmonary Murine Coronavirus<br />
Infection. J Immunol. 2023, 210: 774 – 785.<br />
16. Lütge M, De Martin A, Gil-Cruz C, Perez-Shibayama C, Stanossek Y, Onder L,<br />
Cheng HW, Kurz L, Cadosch N, Soneson C, Robinson MD, Stoeckli SJ, Ludewig<br />
B, Pikor NB. Conserved stromalimmune cell circuits secure B cell homeostasis<br />
and function. Nat Immunol. 2023, 24: 1149 – 1160.<br />
17. Martínez-Riaño A, Wang S, Boeing S, Minoughan S, Casal A, Spillane KM, Ludewig<br />
B, Tolar P. Long-term retention of antigens in germinal centers is controlled<br />
by the spatial organization of the follicular dendritic cell network. Nat Immunol.<br />
2023, 24: 1281 – 1294.<br />
18. Martínez-Riaño A, Wang S, Boeing S, Minoughan S, Casal A, Spillane KM, Ludewig<br />
B, Tolar P. Author Correction: Long-term retention of antigens in germinal<br />
centers is controlled by the spatial organization of the follicular dendritic cell<br />
network. Nat Immunol. 2023, 24: 2164.<br />
19. Tkachev V, Vanderbeck A, Perkey E, Furlan SN, Mcguckin C, Gómez Atria D,<br />
Gerdemann U, Rui X, Lane J, Hunt DJ, Zheng H, Colonna L, Hoffman M, Yu A,<br />
Outen R, Kelly S, Allman A, Koch U, Radtke F, Ludewig B, Burbach B, Shimizu Y,<br />
Panoskaltsis-Mortari A, Chen G, Carpenter SM, Harari O, Kuhnert F, Thurston<br />
G, Blazar BR, Kean LS, Maillard I. Notch signaling drives intestinal graftversus-host<br />
disease in mice and nonhuman primates. Sci Transl Med. 2023,<br />
15: eadd1175.<br />
20. Purde MT, Cupovic J, Palmowski YA, Makky A, Schmidt S, Rochwarger A,<br />
Hartmann F, Stemeseder F, Lercher A, Abdou MT, Bomze D, Besse L, Berner<br />
F, Tüting T, Hölzel M, Bergthaler A, Kochanek S, Ludewig B, Lauterbach H,<br />
Orlinger KK, Bald T, Schietinger A, Schürch C, Ring SS, Flatz L. A replicating<br />
LCMV-based vaccine for the treatment of solid tumors. Mol Ther. 2024, 32:<br />
426 – 439.<br />
Übersichtsarbeiten<br />
1. Onder L, Cheng HW, Ludewig B. Visualization and functional characterization<br />
of lymphoid organ fibroblasts. Immunol Rev. 2022, 306: 108 – 122.<br />
2. Sattler S, Campos Ramos G, Ludewig B, Rainer PP. Cardioimmunology: the<br />
new frontier! Eur Heart J. 2023, 44: 2355 – 2357.<br />
3. Sikking MA, Stroeks S, Marelli-Berg F, Heymans SRB, Ludewig B, Verdonschot<br />
JaJ. Immunomodulation of Myocardial Fibrosis. JACC Basic Transl Sci. 2023,<br />
8: 1477 – 1488.<br />
4. De Martin A, Stanossek Y, Pikor NB, Ludewig B. Protective fibroblastic niches<br />
in secondary lymphoid organs. J Exp Med. 2024, 221.<br />
Kongressbeiträge (Auswahl)<br />
Burkhard Ludewig<br />
Remodeling of tonsillar stromal cells during inflammation. Cambridge Healthtech<br />
Institute 2nd Meeting on «Targeting Stromal Cells in Cancer and Inflammatory<br />
Diseases», 3-day Virtual Event, 5. – 8.4. 2022.<br />
Dermal fibroblasts steer vaccine-induced immune response in melanoma. 2nd<br />
international symposium «Frontiers in Skin Immunity», Heidelberg, Deutschland,<br />
27. – 28. Mai 2022<br />
Lymphoid organ fibroblasts. International Aegean Conference on «Mesenchymal<br />
Cells in Health & Disease», Chania, Griechenland, 3. – 8. Juni 2022<br />
Cardiac fibroblasts control myocardial autoimmune disease. International Symposium<br />
– From Paradigms to Paradoxes in Immunity and Immunopathology (PPII),<br />
Freiburg/Breisgau, Deutschland, 6. – 8. Oktober 2022<br />
Human lymphoid organ fibroblasts. Stromal Immunology Workshop StromOZ<br />
2023, Melbourne, Australien, 17. März 2023<br />
Stromalimmune cell interaction in human lymphoid organs. ThymOz Conference<br />
2023, Heron Island, Australien, 22. – 27. März 2023<br />
Stromalimmune cell interaction in lymphoid organs. Geneva Centre for Inflammation<br />
Research (GCIR) Symposium, Genf, 5. Oktober 2023<br />
46 Immunbiologie/Neuroimmunologie
Lymphoid organ fibroblasts. The 32nd Hot Spring Harbor<br />
International Symposium, Recent Advances in Cell Biology<br />
and Immunology 2023, Kyushu, Japan (online), 25. – 26.<br />
Oktober 2023<br />
Cardiac Antigen Recognition in Autoimmune Myocarditis.<br />
American Heart Association Scientific Sessions, Philadelphia,<br />
USA, 10. – 13. November 2023.<br />
Natalia Pikor<br />
1. An innate checkpoint determines immune dysregulation<br />
and immunopathology during pulmonary murine<br />
coronavirus infection. Plenary Speaker, World Immune<br />
Regulation Meeting, Davos, 7. Juli, 2022.<br />
2. Spatialtemporal control of inhaled murine coronavirus<br />
infection. Stiftung Experimentelle Biomedizin,<br />
Essen, Deutschland, 5. – 6. Juli, 2023.<br />
3. Lymphoid organ fibroblasts – novel findings. 25th Allergology<br />
and Immunology Update 2023, Grindelwald,<br />
27. – 29. Januar 2023.<br />
4. Immune-interacting fibroblasts – lymphoid organs and<br />
beyond. UZH Cutting Edge Immunology Seminar, Zürich,<br />
April 2023.<br />
Die Forschungsergebnisse der Mitarbeitenden wurden auf<br />
verschiedenen nationalen und internationalen Kongressen<br />
vorgestellt:<br />
Abstracts mit Posterpräsentationen: 18<br />
Für Vorträge ausgewählte Abstracts: 16<br />
Abschlussarbeiten und Auszeichnungen<br />
Doktorarbeiten<br />
1. Angelina Marisa De Martin (2023). Coordination of Mucosal Immune Responses<br />
by Fibroblastic Stromal Cells. Universität Zürich; betreut durch Ludewig B.<br />
2. Yves Marcel Stanossek (2023). PI16+ reticular cells in human palatine tonsils<br />
govern T activity in distinct subepithelial niches. Universität Zürich; betreut<br />
durch Stöckli S. und Ludewig B.<br />
3. Sarah Anna Grabherr (2023). Spatial – Temporal Control of Inhaled Murine<br />
Coronavirus Infection. Universität Zürich; betreut durch Pikor N.<br />
Preise und Auszeichnungen<br />
Angelina De Martin, Aegean Conference Travel Award in recognition of an excellent<br />
research talk contribution (2022): PI16+ reticular cells in human palatine<br />
tonsils activate T and B cells in distinct subepithelial niches. First International<br />
Conference on Mesenchymal Cells in Health & Disease, Chania, Griechenland.<br />
Mechthild Lütge, Aegean Conference Travel Award in recognition of an excellent<br />
research talk contribution (2022). Conserved stromal-immune cell circuits secure<br />
B cell homeostasis and function. First International Conference on Mesenchymal<br />
Cells in Health & Disease, Chania, Griechenland.<br />
Nadine Cadosch, Poster Presentation Award (2022): CCL19+ FRC like CAFs generate<br />
distinct niches in the pancreatic cancer microenvironment. First International<br />
Conference on Mesenchymal Cells in Health & Disease. Chania, Griechenland.<br />
Angelina De Martin, Best Talk prize (2023). 12th European Mucosal Immunology<br />
Group Meeting (EMIG), Bern.<br />
Nadine Cadosch, Posterprize (2023). Pericardial lymphoid clusters control T cell<br />
activation and differentiation during autoimmune myocarditis. WIRM XVII, Davos.<br />
Neuroimmunologie 47
Elina Bugar und<br />
Niranjan Ireddy<br />
Doktoranden der Immunbiologie und der Experimentellen Infektiologie<br />
48 Xxxxxxxxxxxxx
Jedes Experiment ein Abenteuer<br />
Elina Bugar stammt aus Kanada, Niranjan Ireddy aus Indien.<br />
Beide sind für ihr Doktoratsstudium mit wenig Erwartungen<br />
in die Ostschweiz gekommen. Die Überraschung folgte auf<br />
dem Fuss.<br />
Niranjan Ireddy hatte die Ostschweiz nicht<br />
auf dem Radar, damals. Er arbeitete nach seinem<br />
Masterstudium in Bern in der Diagnostik,<br />
als seine Supervisorin anrief und das Medizinische<br />
Forschungszentrum am Kantonsspital<br />
St.Gallen ins Spiel brachte. «Ich musste erst<br />
nachschauen, wo das liegt», erinnert sich der<br />
Doktorand und lacht.<br />
Seit Mai 2023 forscht der Mikrobiologe und<br />
Immunologe im Labor der Experimentellen<br />
Infektiologie zu Infektionen, die aufgrund von<br />
Komplikationen entstehen. Das Erstaunen von<br />
damals ist heute noch seiner Stimme anzuhören,<br />
wenn er sagt: «Ich habe nicht gewusst,<br />
dass es hier so viele Forschungsgruppen gibt<br />
und die Forschung so vielfältig ist.» In den<br />
ersten Tagen habe es einige Zeit gebraucht,<br />
bis er sich zurechtfinden konnte.<br />
Stunden wie im Flug<br />
Auch Elina Bugar wird ihren ersten Tag im<br />
Labor für Immunbiologie nicht so schnell vergessen:<br />
«Ich landete sofort mitten im Projekt»,<br />
erzählt sie vergnügt. «Kaum angekommen,<br />
hiess es: Komm mit in die Klinik, es gibt klinische<br />
Proben. Die Stunden flogen nur so vorbei,<br />
ich fand es super interessant.»<br />
Ein erster Tag ganz nach dem Geschmack der<br />
Kanadierin, die Abenteuer liebt und zuvor in<br />
Zürich geforscht und ihren Master in Biochemie<br />
in München erworben hatte. Nach dem<br />
aufregenden ersten Tag sei es zwar ein wenig<br />
ruhiger geworden, räumt die Doktorandin ein.<br />
Doch bis heute gelte: «Jedes Experiment, das<br />
wir durchführen, gleicht einem Abenteuer.»<br />
Und sollte es dann noch immer nicht funktionieren, können<br />
sie auf Unterstützung zählen. «Der Austausch untereinander<br />
ist phantastisch», findet Niranjan. Er nutzt jede Gelegenheit,<br />
Kontakte zu knüpfen und zu pflegen. Als Vorbereitung auf den<br />
Skitag mit seinen Kollegen aus der Klinik hat er extra einen Skilehrer<br />
angestellt und Stemmbogen geübt.<br />
Elina Bugar betont die ungewohnte Hilfsbereitschaft – für sie<br />
ein Novum: «Anderswo spielt der Wettbewerb unter Forschenden<br />
eine stärkere Rolle, es gibt einen ’Publizier-Hype’.<br />
Hier hingegen ist es selbstverständlich, dass man sich gegenseitig<br />
unterstützt, was viel zur familiären Atmosphäre beiträgt.»<br />
Und noch einen Pluspunkt erwähnen beide: die Nähe<br />
zur Klinik. «Ich habe oft in der Klinik zu tun und geniesse die<br />
Zusammenarbeit mit dem Team dort», sagt Elina.<br />
Verliebt in die Natur<br />
Es sind neben ihrem Forschungsprojekt vor allem die Menschen<br />
und das internationale Umfeld, die den Reiz des Standorts<br />
St.Gallen ausmachen – aber nicht nur. Beide haben sich in die<br />
Natur rund um die Stadt im grünen Ring verliebt, geraten beim<br />
Stichwort «Seealpsee» ins Schwärmen.<br />
Noch stecken sie tief in ihrer Doktorarbeit, trotzdem taucht ab<br />
und an der Gedanke an das «Danach» auf. Für Niranjan ist klar:<br />
Er wird sich in seinem Heimatland Indien mit dem Wissen aus<br />
der Schweiz auf die Diagnostik fokussieren. Bei Elina Bugar<br />
gleicht die Zukunft noch einem weissen Papier. «Ich bin nicht<br />
sicher, ob ich nach Kanada zurückkehren werde.»<br />
Sicher ist sie hingegen, was sie dereinst mitnehmen wird: «Ein<br />
riesiges Netzwerk und einen grossen Freundeskreis.» Und, so<br />
hofft sie, einen ansehnlichen deutschen Wortschatz. Denn die<br />
deutsche Sprache ist für die Biochemikerin mindestens so<br />
eine herausfordernde «Challenge» wie das Entschlüsseln der<br />
Entwicklung von Stromazellen in der Milz.<br />
Nicht das Ende der Welt<br />
Nicht immer verlaufe das Abenteuer so, wie<br />
sie sich das vorgestellt habe. Inzwischen kann<br />
sie Misserfolge gelassener nehmen: «In der<br />
Forschungsarbeit braucht es Resilienz. Wenn<br />
etwas nicht auf Anhieb funktioniert, bedeutet<br />
das noch nicht das Ende der Welt. Dann probiert<br />
man es halt wieder.» Try and try again,<br />
heisse die Devise.
v.l.n.r.: Anna Maria Zeitlberger, Jonathan Sutter, Marian Neidert, Isabel Hostettler, Vincens Kälin, Angelica Patterson<br />
Experimentelle Neurochirurgie<br />
Experimentelle Neurochirurgie I<br />
Die Forschungsgruppe von PD Dr. Marian<br />
Neidert führt Forschungsprojekte auf dem<br />
Gebiet der Immunologie von Tumoren des<br />
Gehirns durch. Die aggressivste Form des<br />
Gehirntumors, das Glioblastom, ist trotz aller<br />
Fortschritte in der Operation und Nachsorge<br />
bis heute nicht heilbar. Im Forschungslabor<br />
Experimentelle Neurochirurgie wird deshalb<br />
nach neuen Therapieansätzen gegen aggressive<br />
Tumorvarianten gesucht. Gewebeproben<br />
von Hirntumoren werden untersucht und<br />
analysiert, um in naher Zukunft T-Lymphozyten<br />
so zu stimulieren, dass bösartige Zellen<br />
erkannt und eliminiert werden können.<br />
Im Jahr 2023 konnte PD Dr. Neidert zusammen<br />
mit einem internationalen Forscherteam in der<br />
Fachzeitschrift Nature neue Mechanismen zur<br />
Kontrolle von Hirntumoren beschreiben. Die<br />
Forscherinnen und Forscher konnten Bruchstücke<br />
von bakteriellen Proteinen nachweisen,<br />
die dem Immunsystem auf der Oberfläche von<br />
Tumorzellen präsentiert werden. Diese so genannten<br />
Peptide können das Immunsystem<br />
gegen den Tumor aktivieren. Diese Erkenntnisse<br />
könnten helfen, neue Immuntherapien<br />
gegen Glioblastome zu entwickeln.<br />
Experimentelle Neurochirurgie II<br />
Seit 2023 verstärkt PD Dr. Dr. Isabel Hostettler die Experimentelle<br />
Neurochirurgie. Sie arbeitet auf dem Gebiet der vaskulären<br />
Neurochirurgie und erforscht die Ursachen einer Form des<br />
Schlaganfalls, der aneurysmatischen Subarachnoidalblutung.<br />
Trotz Fortschritten bei der Diagnose und Behandlung dieser<br />
Krankheit ist die Sterblichkeitsrate nach wie vor hoch und viele<br />
Überlebende leiden unter bleibenden Behinderungen. Es wird<br />
vermutet, dass aneurysmatische Subarachnoidalblutungen<br />
unter anderem dadurch entstehen, dass Bindegewebsbestandteile,<br />
die für die Festigkeit der Blutgefässwände eine<br />
wichtige Rolle spielen, nicht in ausreichendem Masse produziert<br />
werden. Zudem beeinträchtigen chronische Entzündungen,<br />
verursacht durch ein gestörtes Mikrobiom, die Funktion<br />
der Gefässwand. Die gezielte Modulation des Mikrobioms<br />
könnte zu einem neuen therapeutischen Ansatz führen, um die<br />
aneurysmatische Subarachnoidalblutung zu behandeln.<br />
Die Forschungsgruppe von PD Dr. Dr. Hostettler wird mit Hilfe<br />
von Einzelkern-RNA-Sequenzierungen und der Analyse des<br />
Mikrobioms in verschiedenen Geweben wie Stuhl, Speichel<br />
und Aneurysmagewebe weitere Einblicke in die Mechanismen<br />
der Entstehung und Ruptur von Aneurysmen innerhalb des<br />
Hirns gewinnen.<br />
50 Experimentelle Neurochirurgie
Experimentelle Neurochirurgie I<br />
PD Dr. Marian Christoph<br />
Neidert<br />
Angelica Brooke Patterson<br />
Vincens Kälin<br />
Jonathan Sutter<br />
Dr. Anna Maria Zeitlberger<br />
Stv. Chefarzt, Klinik für Neurochirurgie,<br />
Gruppenleiter, Experimentelle Neurochirurgie<br />
Doktorandin (sc. nat.)<br />
Experimentelle Neurochirurgie II<br />
PD Dr. Dr. Isabel Charlotte<br />
Hostettler<br />
Oberarzt, Klinik für Neurochirurgie,<br />
Wissenschaftler, Experimentelle Neurochirurgie<br />
Assistenzarzt, Klinik für Neurochirurgie,<br />
Wissenschaftler, Experimentelle Neurochirurgie<br />
Oberärztin, Klinik für Neurochirurgie, Wissenschaftlerin,<br />
Experimentelle Neurochirurgie<br />
Oberärztin, Klinik für Neurochirurgie, Wissenschaftlerin,<br />
Experimentelle Neurochirurgie<br />
Forschungsprojekte und klinische Studien<br />
Folgende Forschungsprojekte wurden in den Jahren 2022 bis<br />
2023 durchgeführt. Weitere Details zu den Projekten finden<br />
sich in der Forschungs- und Studiendatenbank des Kantonsspitals<br />
St.Gallen.<br />
Dissecting the heterogeneity of T-cell antigens in glioblastoma<br />
– mapping natural HLA ligands and Characterizing tumor<br />
– infiltrating lymphocytes<br />
Krebsforschung Schweiz<br />
2019 – 2023, CHF 325’000<br />
Hauptantragsteller: Marian Neidert<br />
Dieses Projekt wurde am Labor für Molekulare Neuroonkologie<br />
des Universitätsspitals Zürich initiiert und wird dort weitgehend<br />
weitergeführt. In diesem Projekt werden Proben aus<br />
verschiedenen Tumorregionen des Glioblastoms untersucht,<br />
um Erkenntnisse über immunologische Zielstrukturen und im<br />
Gewebe vorhandene Immunzellen zu gewinnen.<br />
Validating a Tumor Tissue Cutting Device for the Production<br />
of Patient-Derived Glio-blastoma Organoids<br />
Unus Pro Multis, Martin Hilti Stiftung (Liechtenstein)<br />
2023, CHF 9’200<br />
Tumor Tissue Cutting Device for the Production of Patient-<br />
Derived Glioblastoma Organoids<br />
Padella Stiftung (Liechtenstein)<br />
2023, CHF 5’000<br />
Loco-Regional Immunotherapy of Glioblastoma Using Ex Vivo<br />
Expanded Antigen-Specific T cells<br />
Dr. Hans Altschüler Stiftung<br />
2022, CHF 28’000<br />
Forschungsförderung Kantonsspital St.Gallen<br />
2021 – 2022, CHF 46’500<br />
Blumenau-Léonie Hartmann-Stiftung<br />
2021 – 2023, CHF 269’130<br />
Hauptantragsteller: Marian Neidert<br />
In diesem Projekt sollen die wissenschaftlichen Vorarbeiten für<br />
eine T-Zell-Therapie für das Glioblastom geleistet werden.<br />
Dazu werden Methoden zur Selektion relevanter immunologischer<br />
Zielstrukturen (Antigene) sowie zur Aufreinigung antigenspezifischer<br />
T-Zellen und deren Expansion<br />
in vitro entwickelt. Das übergeordnete Ziel ist<br />
die Entwicklung einer lokalen Therapie mit T-<br />
Zellen, die über einen Katheter in die Tumorhöhle<br />
des Patienten eingebracht werden.<br />
In Vitro Effects of Tumor-Treating Fields on<br />
the Immune Landscape of Glioblastoma<br />
Forschungskollaboration: Novocure<br />
2021 – 2025, CHF 136’800<br />
Hauptantragsteller: Marian Neidert<br />
In der Schweiz wurde die Behandlung von Hirntumorpatienten<br />
mit elektrischen Wechselfeldern<br />
(sog. Tumor Therapy Fields, TTF) zugelassen.<br />
Diese nicht-invasive Therapie wird<br />
von der Firma Novocure unter dem Namen<br />
«Optune» angeboten. Neben anderen therapeutischen<br />
Effekten zeigen bisherige Daten,<br />
dass TTF-Behandlungen einen immunogenen<br />
Zelltod von Tumorzellen auslösen und so die<br />
Immunantwort gegen Tumore stimulieren<br />
können. In diesem gemeinsamen Projekt mit<br />
der Firma Novocure wird der Einfluss von TTF<br />
auf die Erkennung von Tumoren durch Immunzellen<br />
untersucht.<br />
Integrative analysis for the delineation of<br />
cellular crosstalk in glioblastoma<br />
Forschungsförderung Kantonsspital St.Gallen<br />
2022 – 2023, CHF 50’000<br />
Hauptantragsteller: Marian Neidert, Marija<br />
Buljan (Empa)<br />
Im Glioblastom machen Immunzellen, insbesondere<br />
Makrophagen, einen grossen Teil der<br />
Gesamtzellmasse aus. Die Interaktion zwischen<br />
Tumorzellen und dem Tumormikromilieu soll in<br />
diesem Kollaborationsprojekt vor allem mit<br />
Hilfe von Proteomanlysen aufgedeckt werden.<br />
KSSG Collaborative Brain Tumour Registry<br />
Forschungsförderung Kantonsspital St.Gallen<br />
2022 – 2023, CHF 4600<br />
Hauptantragsteller: Anna Maria Zeitlberger,<br />
Thomas Hundsberger<br />
Trotz Fortschritten in den operativen Therapiemöglichkeiten,<br />
Bestrahlungstechniken und<br />
Systemtherapie ist die Prognose von bösartigen<br />
Hirntumoren weiterhin sehr schlecht. Dieses<br />
Projekt hat das Ziel, ein multidisziplinäres, prospektives<br />
Register aufzubauen, welches zur<br />
Qualitätssicherung und Vergleichbarkeit der<br />
Therapien im nationalen und internationalen<br />
Vergleich dienen soll. Zusätzlich wird es eine<br />
wertvolle Ressource für die weitere die klinische<br />
Forschung darstellen, indem es eng mit<br />
der Biodatenbank verknüpft ist.<br />
Experimentelle Neurochirurgie 51
Shunt-dependency after aneurysmal subarachnoid haemorrhage<br />
– the role of early hyperglycaemia in cerebro-spinal fluid<br />
and blood<br />
Forschungsförderung Kantonsspital, St.Gallen<br />
2024 – 2026, CHF 37’300<br />
Hauptantragstellerin: Isabel Hostettler<br />
Mehrere Faktoren beeinflussen die Beeinträchtigung nach einer<br />
aneurysmatischen Subarachnoidalblutung und damit die Fähigkeit,<br />
ein normales Leben zu führen. Das Ziel ist es, herauszufinden,<br />
ob erhöhte Glukosewerte in der Rückenmarksflüssigkeit<br />
darauf hindeuten, dass ein künstlicher Abfluss des Hirnwassers<br />
erforderlich ist (ventrikulo-peritoneale Shunt). Das würde die<br />
Behandlungsperspektive klar beeinflussen, da es ermöglichen<br />
würde, frühzeitig einen Shunt einzusetzen, anstatt wiederholt<br />
Drainagen auszutauschen.<br />
Microbiome-driven cellular interactions in intracranial aneurysms<br />
– a translational pilot study using metagenomic shotgun,<br />
single-nucleus RNA sequencing and microbiome analysis<br />
Julia Bangerter-Rhyner-Stiftung<br />
2024 – 2025, CHF 50’000<br />
Forschungsförderung Kantonsspital, St.Gallen<br />
2024 – 2025, CHF 54’080<br />
Hauptantragstellerin: Isabel Hostettler<br />
Um die aneurysmatische Subarachnoidalblutung besser zu<br />
verstehen und bessere Behandlungsentscheidungen treffen zu<br />
können, ist es wichtig, die Faktoren zu beschreiben, die mit<br />
der Entstehung, dem Wachstum und der Ruptur von Hirnaneurysmen<br />
zusammenhängen. Es ist bekannt, dass chronische<br />
Entzündungen eine Rolle spielen. Die Hypothese ist, dass das<br />
Mikrobiom die Entzündung bei Hirnaneurysmen beeinflussen<br />
kann. Es ist geplant, das Mikrobiom in Stuhl und Speichel zu<br />
untersuchen und Einzelkern-RNA- Sequenzierung einzusetzen,<br />
um die zellulären Mechanismen bei Hirnaneurysmen zu entschlüsseln.<br />
Veröffentlichungen<br />
Folgend sind die Arbeiten aufgeführt, welche von den Mitarbeitenden<br />
der Experimentellen Neurochirurgie am Kantonsspital<br />
St.Gallen in den Jahren 2022 und 2023 erstellt wurden.<br />
Originalarbeiten<br />
Experimentelle Neurochirurgie I<br />
1. Comfort LD, Neidert MC, Bozinov O, Regli L, Stienen MN. Determining the impact<br />
of postoperative complications in neurosurgery based on simulated longitudinal<br />
smartphone app-based assessment. Acta Neurochir (Wien). 2022,<br />
164: 207 – 217.<br />
2. Neidert MC, Zeitlberger AM, Leske H, Tschopp O, Sze L, Zwimpfer C, Wiesli P,<br />
Bellut D, Bernays RL, Rushing EJ, Schmid C. Association of pre- and postoperative<br />
αKlotho levels with long-term remission after pituitary surgery for<br />
acromegaly. Sci Rep. 2022, 12: 14765.<br />
3. Stienen MN, Germans MR, Zindel-Geisseler O, Dannecker N, Rothacher Y,<br />
Schlosser L, Velz J, Sebök M, Eggenberger N, May A, Haemmerli J, Bijlenga P,<br />
Schaller K, Guerra- Lopez U, Maduri R, Beaud V, Al-Taha K, Daniel RT, Chiappini<br />
A, Rossi S, Robert T, Bonasia S, Goldberg J, Fung C, Bervini D, Maradan-Gachet<br />
ME, Gutbrod K, Maldaner N, Neidert MC, Früh S, Schwind M, Bozinov O, Brugger<br />
P, Keller E, Marr A, Roux S, Regli L. Longitudinal neuropsychological assessment<br />
after aneurysmal subarachnoid hemorrhage and its relationship with<br />
delayed cerebral ischemia: a prospective Swiss multicenter study. J Neurosurg.<br />
2022, 137: 1742 – 1750.<br />
4. Voglis S, Schaller V, Müller T, Gönel M, Winklhofer S,<br />
Mangana J, Dummer R, Serra C, Weller M, Regli L, Le<br />
Rhun E, Neidert MC. Maximal surgical tumour load reduction<br />
in immune-checkpoint inhibitor naïve patients<br />
with melanoma brain metastases correlates with prolonged<br />
survival. Eur J Cancer. 2022, 175: 158 – 168.<br />
5. Wang J, Weiss T, Neidert MC, Toussaint NC, Naghavian<br />
R, Sellés Moreno C, Foege M, Tomas Ojer P, Medici G,<br />
Jelcic I, Schulz D, Rushing E, Dettwiler S, Schrörs B, Shin<br />
JH, Mckay R, Wu CJ, Lutterotti A, Sospedra M, Moch H,<br />
Greiner EF, Bodenmiller B, Regli L, Weller M, Roth P,<br />
Martin R. Vaccination with Designed Neopeptides Induces<br />
Intratumoral, Cross-reactive CD4+ T-cell Responses<br />
in Glioblastoma. Clin Cancer Res. 2022, 28:<br />
5368 – 5382.<br />
6. Weber L, Padevit L, Müller T, Velz J, Vasella F, Voglis S,<br />
Gramatzki D, Weller M, Regli L, Sarnthein J, Neidert MC.<br />
Association of perioperative adverse events with subsequent<br />
therapy and overall survival in patients with<br />
WHO grade III and IV gliomas. Front Oncol. 2022, 12:<br />
959072.<br />
7. Yang Y, Neidert MC, Velz J, Kälin V, Sarnthein J, Regli L,<br />
Bozinov O. Mapping and Monitoring of the Corticospinal<br />
Tract by Direct Brainstem Stimulation. Neurosurgery.<br />
2022, 91: 496 – 504.<br />
8. Yang Y, Velz J, Neidert MC, Stienen MN, Regli L, Bozinov O.<br />
Natural History of Brainstem Cavernous Malformations:<br />
On the Variation in Hemorrhage Rates. World Neurosurg.<br />
2022, 157: e342 – e350.<br />
9. Zeitlberger AM, Putora PM, Hofer S, Schucht P, Migliorini<br />
D, Hottinger AF, Roelcke U, Läubli H, Spina P, Bozinov O,<br />
Weller M, Neidert MC, Hundsberger T. Next generation<br />
sequencing in adult patients with glioblastoma in Switzerland:<br />
a multi-centre decision analysis. J Neurooncol.<br />
2022, 158: 359 – 367.<br />
10. El-Garci A, Zindel-Geisseler O, Dannecker N, Rothacher<br />
Y, Schlosser L, Zeitlberger A, Velz J, Sebök M, Eggenberger<br />
N, May A, Bijlenga P, Guerra-Lopez U, Maduri R, Beaud V,<br />
Starnoni D, Chiappini A, Rossi S, Robert T, Bonasia S,<br />
Goldberg J, Fung C, Bervini D, Gutbrod K, Maldaner N,<br />
Früh S, Schwind M, Bozinov O, Neidert MC, Brugger P,<br />
Keller E, Germans MR, Regli L, Hostettler IC, Stienen MN.<br />
Successful weaning versus permanent cerebrospinal<br />
fluid diversion after aneurysmal subarachnoid hemorrhage:<br />
post hoc analysis of a Swiss multicenter study.<br />
Neurosurg Focus. 2023, 54: E3.<br />
11. Goldberg J, Z’graggen WJ, Hlavica M, Branca M, Marbacher<br />
S, D’alonzo D, Fan-dino J, Stienen MN, Neidert MC,<br />
Burkhardt JK, Regli L, Seule M, Roethlisberger M, Guzman<br />
R, Zumofen DW, Maduri R, Daniel RT, El Rahal A, Corniola<br />
MV, Bijlenga P, Schaller K, Rölz R, Scheiwe C, Shah M, Heiland<br />
DH, Schnell O, Beck J, Raabe A, Fung C. Quality of<br />
Life After Poor-Grade Aneurysmal Subarachnoid Hemorrhage.<br />
Neurosurgery. 2023, 92: 1052 – 1057.<br />
12. Hoenisch Gravel N, Nelde A, Bauer J, Mühlenbruch L,<br />
Schroeder SM, Neidert MC, Scheid J, Lemke S, Dubbelaar<br />
ML, Wacker M, Dengler A, Klein R, Mauz PS, Löwenheim H,<br />
Hauri-Hohl M, Martin R, Hennenlotter J, Stenzl A, Heitmann<br />
JS, Salih HR, Rammensee HG, Walz JS. TOF(IMS)<br />
mass spectrometry-based immunopeptidomics refines<br />
tumor antigen identification. Nat Commun. 2023, 14:<br />
7472.<br />
13. Leske H, Camenisch Gross U, Hofer S, Neidert MC, Leske<br />
S, Weller M, Lehnick D, Rushing EJ. MGMT methylation<br />
pattern of long-term and short-term survivors of glioblastoma<br />
reveals CpGs of the enhancer region to be of<br />
high prognostic value. Acta Neuropathol Commun.<br />
2023, 11: 139.<br />
52 Experimentelle Neurochirurgie
14. Medici G, Freudenmann LK, Velz J, Wang SS, Kapolou K, Paramasivam N,<br />
Mühlenbruch L, Kowalewski DJ, Vasella F, Bilich T, Frey BM, Dubbelaar ML,<br />
Patterson AB, Zeitlberger AM, Silginer M, Roth P, Weiss T, Wirsching HG,<br />
Krayenbühl N, Bozinov O, Regli L, Rammensee HG, Rushing EJ, Sahm F, Walz<br />
JS, Weller M, Neidert MC. A T-cell antigen atlas for meningioma: novel<br />
options for immunotherapy. Acta Neuropathol. 2023, 146: 173 – 190.<br />
15. Naghavian R, Faigle W, Oldrati P, Wang J, Toussaint NC, Qiu Y, Medici G, Wacker<br />
M, Freudenmann LK, Bonté PE, Weller M, Regli L, Amigorena S, Rammensee HG,<br />
Walz JS, Brugger SD, Mohme M, Zhao Y, Sospedra M, Neidert MC, Martin R.<br />
Microbial peptides activate tumour-infiltrating lymphocytes in glioblastoma.<br />
Nature. 2023, 617: 807 – 817.<br />
16. Padevit L, Vasella F, Friedman J, Mutschler V, Jenkins F, Held U, Rushing EJ,<br />
Wirsching HG, Weller M, Regli L, Neidert MC. A prognostic model for tumor<br />
recurrence and progression after meningioma surgery: preselection for<br />
further molecular work-up. Front Oncol. 2023, 13: 1279933.<br />
17. Terrapon APR, Krüger M, Hundsberger T, Neidert MC, Bozinov O. Laser Interstitial<br />
Thermal Therapy for Radionecrosis. Neurosurg Clin N Am. 2023, 34:<br />
209 – 225.<br />
18. Hoyningen A, Koster KL, Neidert MC, Bozinov O, Lauber A, Kim OC, Hundsberger<br />
T, Krüger MT. Laser Interstitial Thermal Therapy in a Large Thalamic<br />
Glioma with Long-Term Remission: A Case Report. Oncol Res Treat. 2024,<br />
47: 42 – 48.<br />
19. Yildiz Y, Lauber A, Char NV, Bozinov O, Neidert MC, Hostettler IC. Subarachnoid<br />
hemorrhage due to pituitary adenoma apoplexy-case report and review of<br />
the literature. Neurol Sci. 2024, 45: 997 – 1005.<br />
Originalarbeiten<br />
Experimentelle Neurochirurgie II<br />
1. Butenschoen VM, Glossner T, Hostettler IC, Meyer B, Wostrack M. Quality of<br />
life and return to work and sports after spinal ependymoma resection. Sci<br />
Rep. 2022, 12: 4926.<br />
2. Hostettler IC, Kreiser K, Lange N, Schwendinger N, Trost D, Frangoulis S, Hirle<br />
T, Gempt J, Wostrack M, Meyer B. Treatment during cerebral vasospasm<br />
phase-complication association and outcome in aneurysmal subarachnoid<br />
haemorrhage. J Neurol. 2022, 269: 5553 – 5560.<br />
3. Hostettler IC, Seiffge D, Wong A, Ambler G, Wilson D, Shakeshaft C, Banerjee<br />
G, Sharma N, Jäger HR, Cohen H, Yousry TA, Al-Shahi Salman R, Lip GYH,<br />
Brown MM, Muir K, Houlden H, Werring DJ. AP-OE and Cerebral Small Vessel<br />
Disease Markers in Patients With Intracerebral Hemorrhage. Neurology.<br />
2022, 99: e1290 – e1298.<br />
4. Hostettler IC, Wilson D, Fiebelkorn CA, Aum D, Ameriso SF, Eberbach F,<br />
Beitzke M, Kleinig T, Phan T, Marchina S, Schneckenburger R, Carmona-Iragui<br />
M, Charidimou A, Mourand I, Parreira S, Ambler G, Jäger HR, Singhal S, Ly J, Ma<br />
H, Touzé E, Geraldes R, Fonseca AC, Melo T, Labauge P, Lefèvre PH, Viswanathan<br />
A, Greenberg SM, Fortea J, Apoil M, Boulanger M, Viader F, Kumar S, Srikanth<br />
V, Khurram A, Fazekas F, Bruno V, Zipfel GJ, Refai D, Rabinstein A,<br />
Graff-Radford J, Werring DJ. Risk of intracranial haemorrhage and ischaemic<br />
stroke after convexity subarachnoid haemorrhage in cerebral amyloid<br />
angiopathy: international individual patient data pooled analysis. J Neurol.<br />
2022, 269: 1427 – 1438.<br />
5. Koller H, Ansorge A, Hostettler IC, Koller J, Hitzl W, Hempfing A, Jeszenszky D.<br />
Center of rotation analysis for thoracic and lumbar 3-column osteotomies<br />
in patients with sagittal plane spinal deformity: insights in geometrical changes<br />
can improve understanding of correction mechanics. J Neurosurg Spine.<br />
2022, 36: 440 – 451.<br />
6. Koller H, Hostettler IC, Stengel FC, Koller J, Ferraris L, Hitzl W, Hempfing A.<br />
Surgical Realignment After Anterior Multi-level Decompression Using Cages<br />
and Plate for 3-level to 5-level Degenerative Fusions: Lessons Learned From<br />
the Analysis of Geometric Changes, Reciprocal Coupling, and Prediction of<br />
Sagittal Cervical Balance. Clin Spine Surg. 2022, 35: E649 – e659.<br />
7. Maldaner N, Visser V, Hostettler IC, Bijlenga P, Haemmerli J, Roethlisberger M,<br />
Guzman R, Daniel RT, Giammattei L, Stienen MN, Regli L, Verbaan D, Post R,<br />
Germans MR. External Validation of the HATCH (Hemorrhage, Age, Treatment,<br />
Clinical State, Hydrocephalus) Score for Prediction of Functional Outcome<br />
After Subarachnoid Hemorrhage. Neurosurgery. 2022, 91: 906 – 912.<br />
8. Mingardo E, Beaman G, Grote P, Nordenskjöld A, Newman<br />
W, Woolf AS, Eckstein M, Hilger AC, Dworschak GC,<br />
Rösch W, Ebert AK, Stein R, Brusco A, Di Grazia M, Tamer<br />
A, Torres FM, Hernandez JL, Erben P, Maj C, Olmos JM,<br />
Riancho JA, Valero C, Hostettler IC, Houlden H, Werring<br />
DJ, Schumacher J, Gehlen J, Giel AS, Buerfent BC,<br />
Arkani S, Åkesson E, Rotstein E, Ludwig M, Holmdahl G,<br />
Giorgio E, Berettini A, Keene D, Cervellione RM, Younsi<br />
N, Ortlieb M, Oswald J, Haid B, Promm M, Neissner C,<br />
Hirsch K, Stehr M, Schäfer FM, Schmiedeke E, Boemers<br />
TM, Van Rooij I, Feitz WFJ, Marcelis CLM, Lacher M,<br />
Nelson J, Ure B, Fortmann C, Gale DP, Chan MMY, Ludwig<br />
KU, Nöthen MM, Heilmann S, Zwink N, Jenetzky E,<br />
Odermatt B, Knapp M, Reutter H. A genome-wide association<br />
study with tissue transcriptomics identifies genetic<br />
drivers for classic bladder exstrophy. Commun<br />
Biol. 2022, 5: 1203.<br />
9. Morel S, Hostettler IC, Spinner GR, Bourcier R, Pera J,<br />
Meling TR, Alg VS, Houlden H, Bakker MK, Van’t Hof F,<br />
Rinkel GJE, Foroud T, Lai D, Moomaw CJ, Worrall BB,<br />
Caroff J, Constant-Dits-Beaufils P, Karakachoff M, Rimbert<br />
A, Rouchaud A, Gaal-Paavola EI, Kaukovalta H, Kivisaari<br />
R, Laakso A, Jahromi BR, Tulamo R, Friedrich CM,<br />
Dauvillier J, Hirsch S, Isidor N, Kulcsàr Z, Lövblad KO,<br />
Martin O, Machi P, Mendes Pereira V, Rüfenacht D,<br />
Schaller K, Schilling S, Slowik A, Jaaskelainen JE, Von Und<br />
Zu Fraunberg M, Jiménez-Conde J, Cuadrado-Godia E,<br />
Soriano-Tárraga C, Millwood IY, Walters RG, The Neur<br />
ISTP, The Ican Study G, Genetics, Observational Subarachnoid<br />
Haemorrhage Gosh Study I, International<br />
Stroke Genetics Consortium I, Kim H, Redon R, Ko NU,<br />
Rouleau GA, Lindgren A, Niemelä M, Desal H, Woo D,<br />
Broderick JP, Werring DJ, Ruigrok YM, Bijlenga P. Intracranial<br />
Aneurysm Classifier Using Phenotypic Factors:<br />
An International Pooled Analysis. J Pers Med. 2022, 12.<br />
10. Schwarz G, Banerjee G, Hostettler IC, Ambler G, Seiffge<br />
DJ, Brookes TS, Wilson D, Cohen H, Yousry T, Salman RA,<br />
Lip GYH, Brown MM, Muir KW, Houlden H, Jäger R, Werring<br />
DJ, Staals J. Magnetic resonance imaging-based<br />
scores of small vessel diseases: Associations with intracerebral<br />
haemorrhage location. J Neurol Sci. 2022, 434:<br />
120165.<br />
11. Sebök M, Hostettler IC, Keller E, Rautalin IM, Coert BA,<br />
Vandertop WP, Post R, Sardeha A, Tjerkstra MA, Regli L,<br />
Verbaan D, Germans MR. Prehemorrhage antiplatelet<br />
use in aneurysmal subarachnoid hemorrhage and impact<br />
on clinical outcome. Int J Stroke. 2022, 17: 545 – 552.<br />
12. Bakker MK, Kanning JP, Abraham G, Martinsen AE,<br />
Winsvold BS, Zwart JA, Bourcier R, Sawada T, Koido M,<br />
Kamatani Y, Morel S, Amouyel P, Debette S, Bijlenga P,<br />
Berrandou T, Ganesh SK, Bouatia-Naji N, Jones G,<br />
Bown M, Rinkel GJE, Veldink JH, Ruigrok YM. Genetic<br />
Risk Score for Intracranial Aneurysms: Prediction of<br />
Subarachnoid Hemorrhage and Role in Clinical Heterogeneity.<br />
Stroke. 2023, 54: 810 – 818.<br />
13. El-Garci A, Zindel-Geisseler O, Dannecker N, Rothacher<br />
Y, Schlosser L, Zeitlberger A, Velz J, Sebök M, Eggenberger<br />
N, May A, Bijlenga P, Guerra-Lopez U, Maduri R, Beaud V,<br />
Starnoni D, Chiappini A, Rossi S, Robert T, Bonasia S,<br />
Goldberg J, Fung C, Bervini D, Gutbrod K, Maldaner N,<br />
Früh S, Schwind M, Bozinov O, Neidert MC, Brugger P,<br />
Keller E, Germans MR, Regli L, Hostettler IC, Stienen MN.<br />
Successful weaning versus permanent cerebrospinal<br />
fluid diversion after aneurysmal subarachnoid hemorrhage:<br />
post hoc analysis of a Swiss multicenter study.<br />
Neurosurg Focus. 2023, 54: E3.<br />
14. Gaastra B, Duncan P, Bakker MK, Hostettler IC, Alg VS,<br />
Houlden H, Ruigrok YM, Galea I, Tapper W, Werring D,<br />
Bulters D. Genetic variation in NFE2L2 is associated<br />
with outcome following aneurysmal subarachnoid<br />
haemorrhage. Eur J Neurol. 2023, 30: 116 – 124.<br />
Experimentelle Neurochirurgie 53
15. Hostettler IC, Lange N, Schwendinger N, Ambler G, Hirle T, Frangoulis S, Trost<br />
D, Gempt J, Kreiser K, Meyer B, Winter C, Wostrack M. VPS dependency after<br />
aneurysmal subarachnoid haemorrhage and influence of admission hyperglycaemia.<br />
Eur Stroke J. 2023, 8: 301 – 308.<br />
16. Hostettler IC, Lange N, Schwendinger N, Frangoulis S, Hirle T, Trost D, Gempt<br />
J, Kreiser K, Wostrack M, Meyer B. Duration between aneurysm rupture and<br />
treatment and its association with outcome in aneurysmal subarachnoid<br />
haemorrhage. Sci Rep. 2023, 13: 1527.<br />
17. Koller H, Stengel FC, Hostettler IC, Koller J, Fekete T, Ferraris L, Hitzl W,<br />
Hempfing A. Clinical and surgical results related to anterior-only multilevel<br />
cervical decompression and instrumented fusion for degenerative disease.<br />
Brain Spine. 2023, 3: 101716.<br />
18. Nash PS, Best JG, Ambler G, Wilson D, Banerjee G, Hostettler IC, Seiffge D,<br />
Cohen H, Yousry TA, Salman RA, Lip GYH, Brown MM, Muir KW, Houlden H, Jäger<br />
HR, Werring DJ. Associations of renal function with cerebral small vessel<br />
disease and functional outcome in acute intracerebral haemorrhage: A<br />
hospital-based prospective cohort study. J Neurol Sci. 2023, 452: 120743.<br />
19. Schwarz G, Banerjee G, Hostettler IC, Ambler G, Seiffge DJ, Ozkan H, Browning<br />
S, Simister R, Wilson D, Cohen H, Yousry T, Al-Shahi Salman R, Lip GYH, Brown<br />
MM, Muir KW, Houlden H, Jäger R, Werring DJ. MRI and CT imaging biomarkers<br />
of cerebral amyloid angiopathy in lobar intracerebral hemorrhage. Int J<br />
Stroke. 2023, 18: 85 – 94.<br />
Übersichtsarbeiten<br />
1. Yang Y, Velz J, Neidert MC, Lang W, Regli L, Bozinov O. The BSCM score: a guideline<br />
for surgical decision-making for brainstem cavernous malformations.<br />
Neurosurg Rev. 2022, 45: 1579 – 1587.<br />
2. Carretta A, Epskamp M, Ledermann L, Staartjes VE, Neidert MC, Regli L, Stienen<br />
MN. Collagen-bound fibrin sealant (TachoSil®) for dural closure in cranial<br />
surgery: single-centre comparative cohort study and systematic review of the<br />
literature. Neurosurg Rev. 2022, 45: 3779 – 3788.<br />
3. Hoyningen A, Koster KL, Neidert MC, Bozinov O, Lauber A, Kim OC, Hundsberger<br />
T, Krüger MT. Laser Interstitial Thermal Therapy in a Large Thalamic<br />
Glioma with Long-Term Remission: A Case Report. Oncol Res Treat. 2024,<br />
47: 42 – 48.<br />
4. Yildiz Y, Lauber A, Char NV, Bozinov O, Neidert MC, Hostettler IC. Subarachnoid<br />
hemorrhage due to pituitary adenoma apoplexy-case report and review of<br />
the literature. Neurol Sci. 2024, 45: 997 – 1005.<br />
Kongressbeiträge (Auswahl)<br />
Marian Neidert<br />
1. Immuntherapie. Post-SNO Symposium, München, Deutschland, Dezember<br />
2022.<br />
2. A digital data-warehouse for T cell antigens in neurooncology. SFCNC, Basel,<br />
September 2022<br />
3. Neurotrauma. Radio.log. Zürich, November 2022.<br />
4. T cell antigen discovery in brain tumors. Translational Immunology Research<br />
Program (TRIMM) Keynote Lecture, Helsinki, Finnland, Mai 2023.<br />
5. 3D printed PCL scaffold implant for burr hole reconstruction improves<br />
patient cosmesis and quality of life. The 20th ASEAS Congress of Neurological<br />
Surgery (CANS), Bangkok, Thailand, September 2023.<br />
9. Interdisciplinary therapy of brain metastases: surgery.<br />
Congress of the Swiss Society of Senology, Zürich, September<br />
2023<br />
10. Neurochirurgischer Ansatz bei Hirnmetastasen. Brustkrebs-Hirnmetastasen<br />
– ein Update, Universitätsspital<br />
Zürich, Zürich, Oktober 2023<br />
Isabel Hostettler<br />
1. Shunt dependency after aneurysmal sub-arachnoid<br />
haemorrhage and influence of admission hyperglycaemia.<br />
Annual EANS Vascular Section Meeting, Nizza,<br />
Frankreich, September 2022.<br />
2. Baseline perihematomal edema in intracerebral hemorrhage<br />
is associated with lower case fatality and<br />
higher CRP. Annual EANS Vascular Section Meeting,<br />
Nizza, Frankreich, September 2022<br />
3. Non-aneurysmal subarachnoid haemorrhage – an update.<br />
European Stroke Organisation Conference. Mai<br />
2022<br />
4. Influenceable factors in aneurysmal sub-arachnoid<br />
haemorrhage – is there a light at the end of the tunel?<br />
16th International Conference on Subarachnoid Hemorrhage.<br />
Juni 2023<br />
5. Other causes of subarachnoid haemorrhage. ESO<br />
workshop on intracranial aneurysms. Oktober 2023<br />
6. AVM – unruptured AVM follow-up and prevention. ESO<br />
master workshop on intra-cranial aneurysms. November<br />
2023<br />
Abschlussarbeiten und<br />
Auszeichnungen<br />
Doktorarbeiten<br />
1. Samira Frangoulis (2023). Duration between aneurysm<br />
rupture and treatment and its association with outcome<br />
in aneurysmal subarachnoid haemorrhage. Technische<br />
Universität München; betreut durch Hostettler I.C.<br />
2. Gioele Medici (2023). The intratumoral spatial heterogeneity<br />
of T cell antigens in glioblastoma: an integrated<br />
multi-omics approach. Universität Zürich; betreut<br />
durch Neidert M.C.<br />
Masterarbeiten<br />
1. Sarah Khanna (2023). Extent of Resection and Residual<br />
Tumor Volume in Melanoma Brain Metastases. Universität<br />
Zürich; betreut durch Neidert M.C<br />
Preise<br />
1. Isabel Hostettler. Swiss Stroke Society (SSS) Award<br />
06/2022.<br />
6. Microbial peptides activate tumor-infiltrating lymphocytes in glioblastoma.<br />
The 20th ASEAS Congress of Neurological Surgery (CANS), Bangkok,<br />
Thailand, September 2023.<br />
7. Lokale Immuntherapie bei Glioblastomen – mehr als nur eine Hoffnung?<br />
St.Gallen Oncology Conferences (SONK), St.Gallen, September 2023.<br />
8. Immunotherapy for brain tumors – The peptide at the center of the immunological<br />
synapse. Jahreskongress SWISS-STRANSFUSION, Rorschach, September<br />
2023.<br />
54 Experimentelle Neurochirurgie
Xxxxxxxxxxxxx 55
v.l.n.r.: Ann-Kristin Jochum, Pablo Sieber, Lukas Flatz, Cheyenne Collins, Nicola Davaz, Oltin Pop<br />
Experimentelle Dermatologie<br />
Die Klinik für Dermatologie, Venerologie und<br />
Allergologie hat sich zum Ziel gesetzt, die<br />
medizinische Versorgung durch Forschung zu<br />
unterstützen und zu ergänzen, um Patientinnen<br />
und Patienten gemäss den neuesten<br />
medizinischen Erkenntnissen zu behandeln.<br />
Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf<br />
translationaler Forschung und klinischen Studien,<br />
um den Patientinnen und Patienten<br />
frühzeitig Zugang zu innovativen Therapieansätzen<br />
zu ermöglichen.<br />
Als Teil der Klinik widmet sich das Labor für<br />
Experimentelle Dermatologie vorrangig der<br />
Entwicklung von Impfstoffen gegen den<br />
schwarzen Hautkrebs und der Untersuchung<br />
von neuartigen Immuntherapien. In enger Zusammenarbeit<br />
mit der Klinik für Onkologie<br />
wurde eine prospektive Melanom- und Lungenkrebskohorte<br />
aufgebaut, um die immunologischen<br />
Nebenwirkungen der Immuntherapie<br />
zu untersuchen und besser vorhersagen zu<br />
können, welche Patientinnen und Patienten am<br />
besten von dieser Therapie profitieren.<br />
Die Experimentelle Dermatologie ermöglicht<br />
talentierten jungen Ärztinnen und Ärzten eine<br />
fundierte wissenschaftliche Ausbildung. In<br />
den Jahren 2022 und 2023 ergriffen sechs<br />
ambitionierte Medizinerinnen oder Mediziner<br />
die Chance, eine medizinische Dissertation oder eine Masterarbeit<br />
in der Experimentellen Dermatologie zu erarbeiten.<br />
Zudem konnte Michal Wojciech Krolik seine naturwissenschaftliche<br />
Dissertation an der Universität Zürich abschliessen.<br />
Prof. Dr. Lukas Flatz ist Leiter des Labors für Experimentelle<br />
Dermatologie am Kantonsspital St.Gallen und Sektionsleiter der<br />
Dermato-Onkologie am Universitätsklinikum Tübingen. Im Jahr<br />
2023 wurden er und sein Team mit dem «Swiss Bridge Award»<br />
ausgezeichnet. Das Preisgeld von CHF 250’000 soll dazu beitragen,<br />
die Entstehung von Therapieresistenzen bei Krebs besser<br />
zu verstehen und neue Behandlungswege zu finden.<br />
Experimentelle Dermatologie<br />
Prof. Dr. Dr. Antonio Cozzio<br />
Prof. Dr. Lukas Flatz<br />
Dr. Dr. Lukas Villiger<br />
Dr. Omar Hasan Ali<br />
Dr. Oltin Tiberiu Pop<br />
Dr. Fiamma Berner<br />
Marie-Therese Abdou<br />
Ann-Kristin Jochum<br />
Mette-Triin Purde<br />
Nina Wyss<br />
Tamara Etterlin<br />
Nicola Davaz<br />
Cheyenne Collins<br />
Pablo Sieber<br />
Bianca Broske<br />
Chefarzt/Klinikleiter, Klinik für Dermatologie,<br />
Venerologie und Allergologie<br />
Konsiliararzt, Klinik für Dermatologie,<br />
Venerologie und Allergologie<br />
Gruppenleiter, Experimentelle Dermatologie<br />
Klinik für Dermatologie, Venerologie<br />
und Allergologie, Assistenzarzt<br />
Wissenschaftler, Experimentelle Dermatologie<br />
Wissenschaftler<br />
Wissenschaftler<br />
Wissenschaftlerin<br />
Wissenschaftlerin<br />
Assistenzärztin, Institut für Pathologie<br />
Wissenschaftlerin, Experimentelle Dermatologie<br />
Doktorandin (sc. nat)<br />
Doktorandin (med.)<br />
Doktorandin (med.)<br />
Doktorand (med.)<br />
Doktorandin (med.)<br />
Doktorand (med.)<br />
Masterandin (M.Sc.)<br />
56 Experimentelle Dermatologie
Forschungsprojekte und klinische Studien<br />
Folgende Forschungsprojekte wurden in den Jahren 2022 bis<br />
2023 durchgeführt. Weitere Details zu den Projekten finden<br />
sich in der Forschungs- und Studiendatenbank des Kantonsspitals<br />
St.Gallen.<br />
Intratumoral injection of IP-001 following thermal ablation in<br />
patients with advanced solid tumors.<br />
Forschungskollaboration Immunophotonics<br />
2022 – 2023: CHF 62’580<br />
Partner: Lukas Flatz<br />
Im Jahr 2020 wurden weltweit etwa 2,2 Millionen Lungenkrebsfälle<br />
diagnostiziert. Der Grossteil der Fälle betrifft das<br />
nicht-kleinzellige Lungenkarzinom. Bis 2026 werden über<br />
210’000 Ablations- und SBRT-Bestrahlungsbehandlungen in<br />
den USA und Europa erwartet. IP-001, eine intratumorale Injektion<br />
nach thermischer Ablation, könnte die Wirksamkeit<br />
dieser Behandlungen verbessern. Eine multizentrische Phase<br />
1b/2a Studie wird bei Patientinnen und Patienten mit kolorektalem<br />
Krebs, nicht-kleinzelligem Lungenkrebs und Weichteilsarkomen<br />
durchgeführt.<br />
The role of autoreactive napsin A-specific T cells during<br />
checkpoint blockade in patients with renal cell carcinoma<br />
Novartis Foundation for medical-biological Research<br />
2023: CHF 80’000<br />
Hauptantragsteller: Lukas Flatz<br />
In dieser Studie wurde eine Methode untersucht, um Selbstantigene<br />
zu identifizieren, die eine wirksame Immunantwort<br />
gegen Nierenkarzinome auslösen könnten.<br />
Analyse immun-assoziierter Toxizitäten bei Ostschweizer<br />
Krebspatienten unter Immun-Checkpoint-Inhibitor Therapie<br />
Krebsliga Ostschweiz<br />
2022: CHF 25’000<br />
Principal investigator: Lukas Flatz<br />
Die Einführung von Checkpoint-Inhibitoren hat die Aussichten<br />
für Patientinnen und Patienten mit Melanom und nicht-kleinzelligem<br />
Lungenkrebs verbessert. Dieses Projekt konzentriert<br />
sich auf die Rolle von Auto-T-Zell-Reaktionen bei Patientinnen<br />
und Patienten mit nicht-kleinzelligem Lungenkrebs, die mit<br />
Checkpoint-Inhibitoren behandelt werden. Es soll untersucht<br />
werden, ob Autoimmuntoxizitäten mit einem besseren Behandlungsergebnis<br />
für die Patienten einhergeht.<br />
Characterization of safety, tolerability and recommended<br />
dose of Tinostamustine (EDO-S101) in combination with Nivolumab<br />
in patients with refractory, locally advanced or metastatic<br />
melanoma<br />
Forschungskollaboration: Mundipharma<br />
Studienleiter: Lukas Flatz<br />
2023/2024: CHF 200’150<br />
Diese Studie untersucht einen Behandlungsansatz, der therapeutischen<br />
Nutzen verspricht, wenn Immun- und Chemotherapie<br />
versagen: die thermische Entfernung eines Tumorknotens<br />
und die anschliessende Injektion der Substanz IP-001<br />
in den Tumor. Das Ziel ist die Aktivierung des Immunsystems<br />
und damit die Verkleinerung des behandelten<br />
Tumors. Darüber hinaus soll eine breitere<br />
Immunreaktion ausgelöst werden, die sich<br />
auch gegen Krebszellen ausserhalb des behandelten<br />
Tumor richtet.<br />
Discover markers of resistance in skin cancer<br />
SwissBridge<br />
2023: CHF 250’000<br />
Hauptantragsteller: Lukas Flatz<br />
Die meisten Krebspatientinnen und -patienten<br />
sprechen zunächst gut auf ihre Therapie<br />
an. Im Laufe der Zeit können sich jedoch Resistenzen<br />
entwickeln, die die Wirksamkeit der<br />
Behandlung beeinträchtigen. Die Folge ist,<br />
dass der Krebs ausser Kontrolle gerät und sich<br />
weiter im Körper ausbreiten kann. Immun-<br />
Checkpoint-Inhibitoren haben bei einigen<br />
Krebsarten Fortschritte gebracht. Die Resistenzentwicklung<br />
bleibt jedoch eine grosse<br />
Herausforderung. Ziel des Vorhabens ist es,<br />
Differenzierungsmarker für Melanome und<br />
Plattenepithelkarzinome zu identifizieren.<br />
Dieser Ansatz könnte zu einer Verbesserung<br />
der Prognose bei diesen Krebsarten und zur<br />
Entwicklung neuer Therapie ansätze führen.<br />
T cell receptor and single-cell RNA sequencing<br />
to determine the specificity and phenotype<br />
of tumor-infiltrating lymphocytes in melanoma<br />
during immune checkpoint blockade<br />
Stiftung für Naturwissenschaftliche und<br />
Technische Forschung (Liechtenstein)<br />
2022/2023: CHF 100’000<br />
Hauptantragsteller: Lukas Flatz<br />
Immun-Checkpoint-Inhibitoren sind eine<br />
wirksame Behandlungsmöglichkeit für Menschen<br />
mit Melanom. Allerdings profitieren<br />
nicht alle Patienten gleichermassen davon und<br />
Aussagen über das mutmassliche Ansprechen<br />
der Therapie sind schwierig zu treffen. Es ist<br />
bekannt, dass es T-Zellen gibt, welche gegen<br />
den Tumor gerichtet sind. Diese können sowohl<br />
im Blut als auch im Melanomgewebe<br />
nachgewiesen werden. Wir möchten herausfinden,<br />
wie die Behandlung mit Immun-<br />
Checkpoint-Inhibitoren diese T-Zellen und<br />
ihre Eigenschaften beeinflussen, um daraus<br />
Rückschlüsse auf den Therapieerfolg ziehen<br />
zu können.<br />
Forschungskollaboration<br />
Hookipa Biotech<br />
01.01.2022 – 31.12.2023, CHF 256’000<br />
Hauptantragsteller: Lukas Flatz<br />
Die Therapie des metastasierten Melanoms<br />
stellt insbesondere bei BRAF-Wildtyp-Tumoren,<br />
die durch das Fehlen tumorinfiltrierender<br />
Experimentelle Dermatologie 57
Lymphozyten gekennzeichnet sind, eine besondere Herausforderung<br />
dar. In unserem aktuellen Projekt untersuchen wir<br />
innovative Impfstoff-Vektoren. Durch diese Experimente wollen<br />
wir die Wirksamkeit von Impfstoffen beurteilen, die verschiedene<br />
klassische Melanom-Antigene exprimieren.<br />
Immuntherapiebedingte Pneumonitis in Lungenkrebspatienten<br />
– Entschlüsselung der Mechanismen<br />
Lungenliga St.Gallen-Appenzell<br />
2023, CHF 80’000<br />
Hauptantragsteller: Lukas Flatz<br />
Nebenwirkungen bei der Behandlung von Krebs mit Immun-<br />
Checkpoint-Inhibitoren sind häufig. Besonders bei Lungenkrebspatienten<br />
kann es zu Lungenentzündungen kommen, die<br />
oft die Therapien einschränken. Dieses Projekt soll helfen, die<br />
Gründe für diese Nebenwirkungen besser zu verstehen und<br />
Möglichkeiten zur Vorbeugung zu finden.<br />
Evaluation des Einflusses von HLA-Genpolymorphismen auf<br />
das T-Zell-Rezeptor-Repertoire und T-Zell-Spezifitäten bei<br />
Patientinnen und Patienten mit nicht-kleinzelligem Lungenkarzinom<br />
unter Immun-Checkpoint-Inhibitor-Therapie<br />
Forschungsförderung Kantonsspital St.Gallen<br />
2023 – 2024, CHF 65’358<br />
Hauptantragsteller: Lukas Flatz<br />
Doktorand: Pablo Sieber<br />
HLA-Genotypen bestimmen in hohem Masse die individuelle<br />
Ausprägung des Immunsystems. Dennoch zeigen Patienten mit<br />
ähnlichen oder sogar identischen HLA-Genotypen zum Teil sehr<br />
unterschiedliche Immunantworten auf bestimmte Stimuli und<br />
letztlich auch ein unterschiedliches Ansprechen auf eine Immuntherapie.<br />
Dieses Phänomen soll anhand von Lungenkarzinom-Patienten<br />
unter Immun-Checkpoint-Inhibitor-Therapie<br />
untersucht werden.<br />
Trispecific antibodies to target melanoma<br />
Forschungsförderung Kantonsspital St.Gallen<br />
2023 – 2024, CHF 67’753<br />
Hauptantragsteller: Lukas Villinger, Lukas Flatz<br />
Trispezifische Antikörper sind darauf ausgelegt, drei bestimmte<br />
Epitope zu binden und haben sich in präklinischen Studien als<br />
vielversprechend erwiesen. In dieser Studie sollte ein trispezifischer<br />
Antikörper entwickelt werden, um tumorspezifische<br />
Immunzellen für die Behandlung von Melanomen zu aktivieren.<br />
The role of keratinocyte-differentiation antigens in head and<br />
neck squamous cell cancer<br />
Forschungsförderung Kantonsspital St.Gallen<br />
2023 – 2024, CHF 72’640<br />
Hauptantragsteller: Lukas Flatz<br />
In dieser Studie werden die neu identifizierten Keratinozyten-<br />
Differenzierungsantigene bei Kopf-Hals-Tumoren untersucht.<br />
Dies könnte dazu beitragen, neue Therapien zu entwickeln und<br />
das Verständnis der Anti-Tumor-T-Zell-Reaktionen bei diesen<br />
Tumoren zu verbessern.<br />
Tumor immune milieu heterogeneity in postmortem<br />
autopsies from the Immuno-Monitoring<br />
of ImmunoTherapy (IMIT, CTU 16/015)<br />
St.Gallen clinical study in patients with advanced<br />
non small-cell lung cancer or melanoma<br />
Forschungsförderung Kantonsspital St.Gallen<br />
2023 – 2024, CHF 64’107<br />
Hauptantragsteller: Markus Jörger<br />
Doktorand: Nicola Davaz<br />
Im Verlauf der Tumorentstehung und der anschliessenden<br />
Metastasierung diversifizieren<br />
sich die bösartigen Zellen durch zunehmende<br />
Mutationen und werden heterogener. Die<br />
Hetero genität des Tumors steht in engem<br />
Zusammenhang mit dem Fortschreiten der<br />
Erkrankung und dem Ansprechen auf die<br />
Behandlung, insbesondere im Bereich der Immuntherapie.<br />
Daher ist ein genaues Verständnis<br />
der immunologischen Heterogenität von<br />
Tumoren für die Entwicklung wirksamer Therapien<br />
unerlässlich. In dieser Studie sollen die<br />
Wechselwirkungen zwischen Tumor- und Immunzellen<br />
in der Mikroumgebung an Autopsieproben<br />
untersucht werden.<br />
T-Zell-Antigen-Detektion bei Patienten mit<br />
kutanen immun-assoziierten Nebenwirkungen<br />
in der IMIT Kohorte und mit Lichen ruber<br />
planus<br />
Forschungsförderung Kantonsspital St.Gallen<br />
2021 – 2022, CHF 67’045<br />
Hauptantragsteller: Antonio Cozzio<br />
Doktorandin: Tamara Etterlin<br />
Bei Patientinnen und Patienten mit einem Melanom<br />
treten unter der Behandlung mit Immun-<br />
Checkpoint-Inhibitoren häufig Nebenwirkungen<br />
an der Haut auf. Die Mechanismen, die zu<br />
diesen Nebenwirkungen führen, sind jedoch<br />
noch wenig verstanden. In dieser Arbeit soll die<br />
spezifische Immunantwort gegen Hautantigene<br />
untersucht und charakterisiert werden.<br />
Detektion von T- und B-Zell-Immunantworten<br />
gegen Pneumozyten Typ II Antigene bei Patienten<br />
mit nicht-kleinzelligem Plattenepithelkarzinom<br />
und Pneumonitis unter Immun-<br />
Checkpoint-Inhibitor Therapie<br />
Forschungsförderung Kantonsspital St.Gallen<br />
2022, CHF 67’045<br />
Hauptantragsteller: Lukas Flatz<br />
Doktorandin: Nina Wyss<br />
Patientinnen und Patienten mit Lungenkrebs<br />
entwickeln während der Behandlung mit Immun-Checkpoint-Inhibitoren<br />
häufig Lungenentzündungen.<br />
In dieser Arbeit werden die<br />
durch Checkpoint-Inhibitoren aus gelösten Immunbmechanismen<br />
der Lungenetzündungen<br />
zu untersucht.<br />
58 Experimentelle Dermatologie
Deciphering the mechanisms of Th2 skewing in cutaneous<br />
T-cell lymphoma and identifying potential targets for novel<br />
therapeutic options<br />
Hauptantragsteller: Antonio Cozzio<br />
Doktorandin: Cheyenne Collins<br />
Bei vielen Patientinnen und Patienten mit kutanen T-Zell-Lymphomen<br />
kommt es im Verlauf der Erkrankung zu einer Schwächung<br />
des Immunsystems. Die Ursache hierfür wird in einer<br />
Th2-Dominanz der T-Helferzellen vermutet. Im Rahmen dieses<br />
Projektes sollen die Mechanismen dieses sogenannten «Th2-<br />
Skewing» näher untersucht und damit mögliche Zielstrukturen<br />
zur Aufrechterhaltung der Funktion des Immunsystems identifiziert<br />
werden. Eine Verlang samung oder ein Stopp der Immunschwäche<br />
könnte die Gesamtprognose von Lymphompatientinnen<br />
und -patienten verbessern, da schwere Infektionen in<br />
fortgeschrittenen Stadien eine der Haupttodesursachen darstellen.<br />
Veröffentlichungen<br />
Folgend sind die Arbeiten aufgeführt, welche von den Mitarbeitenden<br />
der Experimentellen Dermatologie am Kantonsspital<br />
St.Gallen in den Jahren 2022 und 2023 erstellt wurden.<br />
Originalarbeiten<br />
1. Berner F, Bomze D, Lichtensteiger C, Walter V, Niederer R, Hasan Ali O, Wyss<br />
N, Bauer J, Freudenmann LK, Marcu A, Wolfschmitt EM, Haen S, Gross T,<br />
Abdou MT, Diem S, Knöpfli S, Sinnberg T, Hofmeister K, Cheng HW, Toma M,<br />
Klümper N, Purde MT, Pop OT, Jochum AK, Pascolo S, Joerger M, Früh M,<br />
Jochum W, Rammensee HG, Läubli H, Hölzel M, Neefjes J, Walz J, Flatz L.<br />
Autoreactive napsin A-specific T cells are enriched in lung tumors and inflammatory<br />
lung lesions during immune checkpoint blockade. Sci Immunol.<br />
2022, 7: eabn9644.<br />
2. Blanchard G, Yurchenko AA, Pop OT, Weibel L, Theiler M, Hauser V, Fraitag S,<br />
Guenova E, Flatz L, Nikolaev SI, Hohl D. PTCH1 inactivation is sufficient to cause<br />
basaloid follicular hamartoma in paediatric Nevoid basal cell carcinoma<br />
syndrome. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2022, 36: e954 – e956.<br />
3. Bomze D, Meirson T, Hasan Ali O, Goldman A, Flatz L, Habot-Wilner Z. Ocular<br />
Adverse Events Induced by Immune Checkpoint Inhibitors: A Comprehensive<br />
Pharmacovigilance Analysis. Ocul Immunol Inflamm. 2022, 30: 191 – 197.<br />
4. Klümper N, Saal J, Berner F, Lichtensteiger C, Wyss N, Heine A, Bauernfeind<br />
FG, Ellinger J, Brossart P, Diem S, Schmid S, Joerger M, Frueh M, Ritter M,<br />
Hölzel M, Flatz L, Bald T. Creactive protein flare predicts response to checkpoint<br />
inhibitor treatment in non-small cell lung cancer. J Immunother Cancer.<br />
2022, 10.<br />
5. Kostner L, Cerminara SE, Pamplona GSP, Maul JT, Dummer R, Ramelyte E,<br />
Mangana J, Wagner NB, Cozzio A, Kreiter S, Kogler A, Streit M, Wysocki A,<br />
Zippelius A, Läubli H, Navarini AA, Maul LV. Effects of COVID-19 Lockdown on<br />
Melanoma Diagnosis in Switzerland: Increased Tumor Thickness in Elderly<br />
Females and Shift towards Stage IV Melanoma during Lockdown. Cancers<br />
(Basel). 2022, 14.<br />
6. Purde MT, Niederer R, Wagner NB, Diem S, Berner F, Hasan Ali O, Hillmann D,<br />
Bergamin I, Joerger M, Risch M, Niederhauser C, Lenz TL, Früh M, Risch L,<br />
Semela D, Flatz L. Presence of autoantibodies in serum does not impact the<br />
occurrence of immune checkpoint inhibitor-induced hepatitis in a prospective<br />
cohort of cancer patients. J Cancer Res Clin Oncol. 2022, 148:<br />
647 – 656.<br />
8. Yurchenko AA, Pop OT, Ighilahriz M, Padioleau I, Rajabi F,<br />
Sharpe HJ, Poulalhon N, Dreno B, Khammari A, Delord M,<br />
Alberti A, Soufir N, Battistella M, Mourah S, Bouquet F,<br />
Savina A, Besse A, Mendez-Lopez M, Grange F, Monestier<br />
S, Mortier L, Meyer N, Dutriaux C, Robert C, Saiag P,<br />
Herms F, Lambert J, De Sauvage FJ, Dumaz N, Flatz L,<br />
Basset-Seguin N, Nikolaev SI. Frequency and Genomic<br />
Aspects of Intrinsic Resistance to Vismodegib in Locally<br />
Advanced Basal Cell Carcinoma. Clin Cancer Res. 2022,<br />
28: 1422 – 1432.<br />
9. Zehnder M, Amarov B, Abrunhosa-Branquinho AN, Maiwald-Urosevic<br />
M, Mühleisen B, Saulite I, Anzengruber F,<br />
Imhof L, Navarini AA, Cozzio A, Dummer R, Dimitriou F,<br />
Guenova E. Radiotherapy as a Treatment Option for<br />
Local Disease Control in Primary Cutaneous Diffuse<br />
Large B-Cell Lymphoma, Leg Type. Dermatology. 2022,<br />
238: 967 – 976.<br />
10. Amaral T, Pop OT, Chatziioannou E, Sinnberg T, Niessner<br />
H, Zhao J, Ring SS, Joerger M, Schroeder C, Armeanu-<br />
Ebinger S, Cozzio A, Leiter U, Thomas I, Jochum W,<br />
Garbe C, Forchhammer S, Levesque M, Mangana J,<br />
Hölzel M, Dummer R, Schürch CM, Forschner A, Flatz L.<br />
EGFR expression is associated with relapse in a melanoma<br />
cohort receiving adjuvant PD-1-based immunotherapy.<br />
J Am Acad Dermatol. 2023, 89: 1072-1074.<br />
11. Chatziioannou E, Leiter U, Thomas I, Keim U, Seeber O,<br />
Meiwes A, Boessenecker I, Gonzalez SS, Torres FM,<br />
Niessner H, Sinnberg T, Forschner A, Flatz L, Amaral T.<br />
Features and Long-Term Outcomes of Stage IV Melanoma<br />
Patients Achieving Complete Response Under<br />
Anti-PD-1-Based Immunotherapy. Am J Clin Dermatol.<br />
2023, 24: 453 – 467.<br />
12. Chatziioannou E, Rossner J, Aung TN, Rimm DL, Niessner<br />
H, Keim U, Serna-Higuita LM, Bonzheim I, Kuhn Cuellar L,<br />
Westphal D, Steininger J, Meier F, Pop OT, Forchhammer<br />
S, Flatz L, Eigentler T, Garbe C, Röcken M, Amaral T, Sinnberg<br />
T. Deep learning-based scoring of tumour-infiltrating<br />
lymphocytes is prognostic in primary melanoma and<br />
predictive to PD-1 checkpoint inhibition in melanoma<br />
metastases. EBioMedicine. 2023, 93: 104644.<br />
13. Latzka J, Assaf C, Bagot M, Cozzio A, Dummer R, Guenova<br />
E, Gniadecki R, Hodak E, Jonak C, Klemke CD, Knobler R,<br />
Morrris S, Nicolay JP, Ortiz-Romero PL, Papadavid E,<br />
Pimpinelli N, Quaglino P, Ranki A, Scarisbrick J, Stadler R,<br />
Väkevä L, Vermeer MH, Wehkamp U, Whittaker S, Willemze<br />
R, Trautinger F. EORTC con-sensus recommendations<br />
for the treatment of mycosis fungoides/Sézary syndrome<br />
– Update 2023. Eur J Cancer. 2023, 195: 113343.<br />
14. Lichtensteiger C, Koblischke M, Berner F, Jochum AK,<br />
Sinnberg T, Balciunaite B, Purde MT, Walter V, Abdou<br />
MT, Hofmeister K, Kohler P, Vernazza P, Albrich WC,<br />
Kahlert CR, Zoufaly A, Traugott MT, Kern L, Pietsch U,<br />
Kleger GR, Filipovic M, Kneilling M, Cozzio A, Pop O,<br />
Bomze D, Bergthaler A, Hasan Ali O, Aberle J, Flatz L.<br />
Autoreactive T cells targeting type II pneumocyte antigens<br />
in COVID-19 convalescent patients. J Autoimmun.<br />
2023, 140: 103118.<br />
15. Loo L, Waller MA, Moreno CL, Cole AJ, Stella AO, Pop OT,<br />
Jochum AK, Ali OH, Denes CE, Hamoudi Z, Chung F,<br />
Aggarwal A, Low JKK, Patel K, Siddiquee R, Kang T, Mathivanan<br />
S, Mackay JP, Jochum W, Flatz L, Hesselson D,<br />
Turville S, Neely GG. Fibroblast-expressed LRRC15 is a<br />
receptor for SARS-CoV-2 spike and controls antiviral<br />
and antifibrotic transcriptional programs. PLoS Biol.<br />
2023, 21: e3001967.<br />
7. Sinnberg T, Lichtensteiger C, Hill-Mündel K, Leischner C, Niessner H, Busch C,<br />
Renner O, Wyss N, Flatz L, Lauer UM, Hoelzle LE, Nohr D, Burkard M, Marongiu<br />
L, Venturelli S. Vitamin C Deficiency in Blood Samples of COVID-19 Patients.<br />
Antioxidants (Basel). 2022, 11.<br />
Experimentelle Dermatologie 59
16. Nuñez NG, Berner F, Friebel E, Unger S, Wyss N, Gomez JM, Purde MT,<br />
Niederer R, Porsch M, Lichtensteiger C, Kramer R, Erdmann M, Schmitt C,<br />
Heinzerling L, Abdou MT, Karbach J, Schadendorf D, Zimmer L, Ugurel S,<br />
Klümper N, Hölzel M, Power L, Kreutmair S, Capone M, Madonna G, Cevhertas<br />
L, Heider A, Amaral T, Hasan Ali O, Bomze D, Dimitriou F, Diem S, Ascierto<br />
PA, Dummer R, Jäger E, Driessen C, Levesque MP, Van De Veen W, Joerger<br />
M, Früh M, Becher B, Flatz L. Immune signatures predict development of<br />
auto immune toxicity in patients with cancer treated with immune checkpoint<br />
inhibitors. Med. 2023, 4: 113 – 129.e117.<br />
17. Ramelyte E, Nägeli MC, Hunger R, Merat R, Gaide O, Navarini AA, Cozzio A,<br />
Wagner NB, Maul LV, Dummer R. Swiss Recommendations for Cutaneous<br />
Basal Cell Carcinoma. Dermatology. 2023, 239: 122 – 131.<br />
18. Sinnberg T, Lichtensteiger C, Ali OH, Pop OT, Jochum AK, Risch L, Brugger SD,<br />
Velic A, Bomze D, Kohler P, Vernazza P, Albrich WC, Kahlert CR, Abdou MT,<br />
Wyss N, Hofmeister K, Niessner H, Zinner C, Gilardi M, Tzankov A, Röcken M,<br />
Dulovic A, Shambat SM, Ruetalo N, Buehler PK, Scheier TC, Jochum W, Kern L,<br />
Henz S, Schneider T, Kuster GM, Lampart M, Siegemund M, Bingisser R,<br />
Schindler M, Schneiderhan-Marra N, Kalbacher H, Mccoy KD, Spengler W,<br />
Brutsche MH, Macek B, Twerenbold R, Penninger JM, Matter MS, Flatz L. Pulmonary<br />
Surfactant Proteins Are Inhibited by Immunoglobulin A Autoantibodies in<br />
Severe COVID-19. Am J Respir Crit Care Med. 2023, 207: 38 – 49.<br />
19. Váraljai R, Zimmer L, Al-Matary Y, Kaptein P, Albrecht LJ, Shannan B, Brase JC,<br />
Gusenleitner D, Amaral T, Wyss N, Utikal J, Flatz L, Rambow F, Reinhardt HC,<br />
Dick J, Engel DR, Horn S, Ugurel S, Sondermann W, Livingstone E, Sucker A,<br />
Paschen A, Zhao F, Placke JM, Klose JM, Fendler WP, Thommen DS, Helfrich I,<br />
Schadendorf D, Roesch A. Interleukin 17 signaling supports clinical benefit of<br />
dual CTLA-4 and PD-1 checkpoint inhibition in melanoma. Nat Cancer. 2023,<br />
4: 1292 – 1308.<br />
20. Verardi F, Maul LV, Borsky K, Steinmann S, Rosset N, Pons HO, Sorbe C, Yawalkar<br />
N, Micheroli R, Egeberg A, Thyssen JP, Heidemeyer K, Boehncke WH, Conrad C,<br />
Cozzio A, Pinter A, Kündig T, Navarini AA, Maul JT. Sex differences in adverse<br />
events from systemic treatments for psoriasis: A decade of insights from the<br />
Swiss Psoriasis Registry (SDNTT). J Eur Acad Dermatol Venereol. 2023.<br />
21. Wagner NB, Knierim SM, Luttermann F, Metzler G, Yazdi AS, Bauer J, Gassenmaier<br />
M, Forschner A, Leiter U, Amaral T, Garbe C, Eigentler TK, Forchhammer<br />
S, Flatz L. Histopathologic regression in patients with primary cutaneous<br />
melanoma undergoing sentinel lymph node biopsy is associated with favorable<br />
survival and, after metastasis, with improved progression-free survival<br />
on immune checkpoint inhibitor therapy: A single-institutional cohort<br />
study. J Am Acad Dermatol. 2023.<br />
22. Purde MT, Cupovic J, Palmowski YA, Makky A, Schmidt S, Rochwarger A,<br />
Hartmann F, Stemeseder F, Lercher A, Abdou MT, Bomze D, Besse L, Berner<br />
F, Tüting T, Hölzel M, Bergthaler A, Kochanek S, Ludewig B, Lauterbach H,<br />
Orlinger KK, Bald T, Schietinger A, Schürch C, Ring SS, Flatz L. A replicating<br />
LCMV-based vaccine for the treatment of solid tumors. Mol Ther. 2024, 32:<br />
426 – 439.<br />
23. Wagner NB, Lenders MM, Kühl K, Reinhardt L, Fuchss M, Ring N, Stäger R, Zellweger<br />
C, Ebel C, Kimeswenger S, Oellinger A, Amaral T, Forschner A, Leiter U,<br />
Klumpp B, Hoetzenecker W, Terheyden P, Mangana J, Loquai C, Cozzio A,<br />
Garbe C, Meier F, Eigentler TK, Flatz L. Baseline metastatic growth rate is an<br />
independent prognostic marker in patients with advanced BRAF V600 mutated<br />
melanoma receiving targeted therapy. Eur J Cancer. 2024, 196: 113425.<br />
Kongressbeiträge<br />
Vorträge (Auswahl)<br />
Deciphering immune checkpoint inhibitor-mediated toxicity.<br />
Lukas Flatz. Interdisciplinary Immunology – Bridging<br />
the gaps between disciplines, Bonn, Deutschland, Mai 2022<br />
The T cell repertoire in melanoma patients receiving<br />
immune checkpoint inhibitors. Ann-Kristin Jochum. Interdisciplinary<br />
Immunology – Bridging the gaps between<br />
disciplines Bonn, Deutschland, Mai 2022<br />
Propagation competence of a self-antigen-targeting<br />
vector-based cancer vaccine determines antitumor efficacy<br />
in mouse melanoma. Mette-Triin Purde. MIM retreat<br />
2022, Zürich<br />
Gegenwart und Zukunft von Immuntherapien in der Dermatologie.<br />
Lukas Flatz. Ostschweizer Sommersymposium,<br />
Rorschach, Mai 2023<br />
Abschlussarbeiten und<br />
Auszeichnungen<br />
Doktorarbeiten<br />
1. Michal Wojciech Krolik (2023). Recombinant lymphocytic<br />
choriomeningitis virus-based vaccine vector protects<br />
type I interferon receptor deficient mice from viral<br />
challenge. Universität Zürich; betreut durch Flatz L.<br />
Masterarbeiten<br />
1. Ann-Kristin Jochum (2022). Clonality and specificity<br />
of the T-cell repertoire in melanoma patients receiving<br />
immune check-point inhibitors. Universität Zürich;<br />
betreut durch Flatz L.<br />
2. Bianca Broske (2023). Assessing the role of the ErbB<br />
receptor family in cutaneous squamous cell carcinoma<br />
in relation to tumor differentiation and disease progression.<br />
Universität Bonn; betreut durch Flatz L.<br />
Preis<br />
Flatz Lukas, Swiss Bridge Award 2023<br />
Übersichtsarbeiten/Empfehlungen<br />
1. Dippel E, Assaf C, Becker JC, Von Bergwelt-Baildon M, Bernreiter S, Cozzio<br />
A, Eich HT, Elsayad K, Follmann M, Grabbe S, Hillen U, Klapper W, Klemke CD,<br />
Loquai C, Meiss F, Mitteldorf C, Wehkamp U, Nashan D, Nicolay JP, Oschlies<br />
I, Schlaak M, Stranzenbach R, Moritz R, Stoll C, Vag T, Weichenthal M, Wobser<br />
M, Stadler R. S2k-Guidelines – Cutaneous lymphomas (ICD10 C82 – C86):<br />
Update 2021. J Dtsch Dermatol Ges. 2022, 20: 537 – 554.<br />
2. Berner F, Flatz L. Autoimmunity in immune checkpoint inhibitor-induced<br />
immune-related adverse events: A focus on autoimmune skin toxicity and<br />
pneumonitis. Immunol Rev. 2023, 318: 37 – 50.<br />
3. Ramelyte E, Nägeli MC, Hunger R, Merat R, Gaide O, Navarini AA, Cozzio A,<br />
Wagner NB, Maul LV, Dummer R. Swiss Recommendations for Cutaneous<br />
Basal Cell Carcinoma. Dermatology. 2023, 239: 122 – 131.<br />
60 Experimentelle Dermatologie
Xxxxxxxxxxxxx 61
Assoziierte Forschungsgruppen<br />
• Experimentelle Onkologie<br />
• Experimentelle Infektiologie<br />
• Experimentelle Urologie<br />
62 Xxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxx 63
v.l.n.r.: Andrej Besse, Lenka Besse, Marianne Kraus, Christoph Driessen, Max Mendez-Lopez, Jonas Schwestermann<br />
Experimentelle Onkologie<br />
und Hämatologie<br />
Der Bereich Experimentelle Onkologie und<br />
Hämatologie der Klinik für Medizinische Onkologie<br />
und Hämatologie am Medizinischen<br />
Forschungszentrum verbindet exzellente Patientenversorgung<br />
mit innovativer experimenteller<br />
Forschung. Unser Hauptaugenmerk liegt<br />
auf der Erforschung biologischer Grundlagen<br />
von Krebserkrankungen mit dem Ziel, diese<br />
Erkenntnisse in klinisch wirksame Therapien<br />
umzusetzen. Mit Methoden der Zell- und Molekularbiologie,<br />
Bio- und Synthesechemie bearbeiten<br />
wir Fragestellungen aus der klinischen<br />
Medizin, immer mit Blick auf die Relevanz und<br />
potenzielle Anwendbarkeit für unsere Patientinnen<br />
und Patienten.<br />
Unsere Forschungsgruppen konzentrieren sich<br />
darauf, resistente Krebserkrankungen besser<br />
zu verstehen und die Prognose sowie Therapieansätze<br />
für hämatologische und solide<br />
Tumoren zu verbessern. Wir nutzen ein breites<br />
Spektrum zell- und systembiologischer<br />
Analysen sowie innovative Ansätze der Genmodifikation.<br />
Darüber hinaus entwickeln wir<br />
niedermolekulare Wirkstoffe gegen resistente<br />
Krebsarten und arbeiten eng mit der pharmazeutischen<br />
Industrie zusammen.<br />
Ein weiterer wichtiger Aspekt unserer Arbeit besteht darin,<br />
bereits bekannte Medikamente aus anderen medizinischen<br />
Bereichen auf ihre Wirksamkeit gegen Krebsarten zu untersuchen,<br />
die gegen herkömmliche Therapien resistent sind.<br />
Wir konzentrieren uns auch darauf, neue Ansätze zu entwickeln,<br />
um spezifische Zielstrukturen im Krebs zu hemmen und<br />
so neue Behandlungsmöglichkeiten zu schaffen.<br />
Experimentelle Onkologie I<br />
Die von Prof. Dr. Christoph Driessen und Dr. Lenka Besse gemeinsam<br />
geleitete Forschungsgruppe beschäftigt sich mit der<br />
Proteasen- und Proteasombiologie des Multiplen Myeloms, der<br />
häufigsten Krebserkrankung des Blut- und Lymphsystems.<br />
Trotz anfänglich guter Wirksamkeit entwickelt das Myelom häufig<br />
Resistenzen gegen diese Medikamente. Das derzeitige Wissen<br />
über diese Myelomform ist begrenzt, weshalb die meisten<br />
Patientinnen und Patienten mit Multiplem Myelom an dieser<br />
therapie resistenten Erkrankung versterben. Die Identifizierung<br />
neuer Therapieoptionen für das resistente Myelom ist daher<br />
von grosser Bedeutung. Der Gruppe ist es gelungen, solche<br />
neuen Therapieoptionen erfolgreich in die klinische Behandlung<br />
einzuführen.<br />
Im Jahr 2023 wurde Dr. Lenka Besse als Leiterin der Arbeitsgruppe<br />
«Cancer Immunotherapy» an die Masaryk Universität<br />
in Brünn, Tschechien, berufen. Trotz dieser neuen Position<br />
besteht weiter hin eine enge Zusammenarbeit mit der Forschungsgruppe<br />
in St.Gallen.<br />
64 Experimentelle Onkologie und Hämatologie
Experimentelle Onkologie II<br />
Die Forschungsgruppe unter der Leitung von PD Dr. Kerstin<br />
Kampa-Schittenhelm beschäftigt sich mit der Untersuchung<br />
von ASPP-Proteinen, die in gesunden Zellen essentielle Antitumorfunktionen<br />
steuern. Kürzlich wurde mit ASPP2kappa<br />
eine neue, defekte Proteinvariante speziell in Leukämiezellen<br />
identifiziert. Diese Variante ist mit einem schlechteren Therapieansprechen,<br />
aggressiverem Tumorwachstum und dem<br />
Potenzial zur Entartung gesunder Zellen verbunden.<br />
Die laufenden Arbeiten zielen darauf ab, die ASPP-Proteine als<br />
prognostische Parameter zu validieren und als potentielle Angriffspunkte<br />
für personalisierte Therapien zu nutzen. Dabei<br />
werden aktuell spezifische, für die in vivo Applikation modifizierte<br />
siRNAs getestet, die die ASPP2kappa Aktivität hemmen.<br />
Ein weiterer Forschungsschwerpunkt der Arbeitsgruppe von<br />
PD Dr. Kampa-Schittenhelm ist die Charakterisierung neuer<br />
Substanzen, die das Wachstum von Tumorzellen hemmen.<br />
Diese neuen Therapeutika werden in Tumorzellmodellen in<br />
Zusammenarbeit mit pharmazeutischen Unternehmen und<br />
akademischen Kooperationspartnern untersucht. Die Erkenntnisse<br />
aus diesen präklinischen Untersuchungen bilden<br />
die Grundlage für spätere klinische Studien.<br />
Experimentelle Onkologie<br />
und Hämatologie<br />
Prof. Dr. Christoph<br />
Driessen<br />
Nicole El Kharrazi<br />
Experimentelle Onkologie I<br />
Dr. Lenka Besse<br />
Dr. Andrej Besse<br />
Dr. Max Mendez Lopez<br />
Jonas Schwestermann<br />
Chefarzt Klinik für Medizinische<br />
Onkologie und Hämatologie,<br />
Leiter Experimentelle Onkologie<br />
Biomedizinische Analytikerin,<br />
Labormanagerin<br />
Gruppenleiterin<br />
Experimentelle Onkologie I<br />
Wissenschaftler<br />
Wissenschaftler<br />
Doktorand (sc. nat.)<br />
Experimentelle Onkologie II<br />
PD Dr. Kerstin<br />
Kampa- Schittenhelm<br />
Prof. Dr. Marcus<br />
Schittenhelm<br />
Anna Lena Ahrens<br />
Vanessa Aellig<br />
Alessia Ruiba<br />
Lea Stiehl<br />
Lara Aldinger<br />
Gruppenleiterin Experimentelle<br />
Onkologie II<br />
Leitender Arzt, Klinik für<br />
Medizinische Onkologie und<br />
Hämatologie, Wissenschaftler<br />
Wissenschaftlerin<br />
Biomedizinische Analytikerin<br />
Doktorandin (sc. nat.)<br />
Doktorandin (med.)<br />
Doktorandin (med.)<br />
Experimentelle Onkologie III<br />
PD Dr. Nageswara Rao<br />
Tata<br />
Dr. Narasimha Rao Uda<br />
Amanda Müggler<br />
Sarantis Tsetsakos<br />
Aileen Holzwarth<br />
Gruppenleiter Experimentelle<br />
Onkologie III<br />
Wissenschaftler<br />
Wissenschaftlerin<br />
Doktorand (sc. nat.)<br />
Praktikantin<br />
v.l.n.r.: Lara Aldinger, Lea Stiehl, Marcus Schittenhelm, Kerstin Kampa-Schittenhelm, Vanessa Aellig, Alessia Ruiba, Nicole El Kharrazi<br />
Experimentelle Onkologie / Hämatologie 65
Experimentelle Onkologie III<br />
Im Jahr 2022 wurde die Experimentelle Onkologie und Hämatologie<br />
um eine weitere Forschungsgruppe unter der Leitung von<br />
Dr. Nageswara Rao Tata erweitert. Der wissenschaftliche Schwerpunkt<br />
dieser Forschungsgruppe liegt auf Blutstammzellen im<br />
Alter und ihrer Rolle bei der Entwicklung von Leukämien.<br />
Obwohl Fortschritte bei der Erforschung der Mechanismen, die<br />
das Überleben und die Vermehrung leukämischer Stammzellen<br />
steuern, gemacht wurden, bleiben viele Aspekte dieses Bereichs<br />
noch unerforscht. Trotz des Wissens über die Mutationen, die<br />
Leukämien verursachen, können die darauf abzielenden Therapien<br />
die Krankheit oft nicht heilen. Die Arbeitsgruppe konzentriert<br />
sich darauf, wie sich der Stoffwechsel von leukämischen<br />
Stammzellen unterscheidet, sowohl in Mausmodellen als auch in<br />
Zellen von Patientinnen und Patienten. Es besteht die Möglichkeit,<br />
dass das bösartige Verhalten nicht ausschliesslich von den<br />
zugrundeliegenden Mutationen abhängt. Darüber hinaus wird<br />
der mögliche Einsatz von Stoffwechselprodukten als neue Biomarker<br />
für Leukämien untersucht. Das übergeordnete Ziel ist es,<br />
metabolische Therapieansätze und funktionelle Biomarker zu<br />
identifizieren und damit die Behandlungsmöglichkeiten von<br />
Leukämien zu erweitern.<br />
Forschungsprojekte und<br />
klinische Studien<br />
Folgende Forschungsprojekte wurden in den<br />
Jahren 2022 bis 2023 durchgeführt. Weitere<br />
Details zu den Projekten finden sich in der Forschungs-<br />
und Studiendatenbank des Kantonsspitals<br />
St.Gallen.<br />
Experimentelle Onkologie I<br />
Revealing the molecular landscape of bone<br />
marrow-mediated proteasome inhibitor resistance<br />
in multiple myeloma<br />
Krebsliga Schweiz<br />
01.07.2020 – 31.12.2023, CHF 357’150<br />
Hauptantragsteller: Christoph Driessen<br />
Durch das Verständnis der molekularen Heterogenität<br />
und Plastizität des resistenten Myeloms<br />
wollen wir neue Therapien identifizieren, die<br />
die Wirksamkeit der derzeitigen Proteasominhibitoren<br />
erhöhen und die Myelomkontrolle bei<br />
den Patientinnen und Patienten verbessern.<br />
v.l.n.r.: Narasimha Rao Uda, Amanda Müggler, Nageswara Rao Tata, Nicole El Kharrazi, Sarantis Tsetsakos<br />
66 Experimentelle Onkologie / Hämatologie
ALK-Inhibitoren als potentielle Therapie bei Proteasom-<br />
Inhibitor-resistentem Multiplen Myelom<br />
Wilhelm-Sander Stiftung<br />
01.10.2021 – 31.10.2023, EUR 180’224<br />
Hauptantragsteller: Christoph Driessen<br />
Das Projekt zielt darauf ab, den Wirkmechanismus und die<br />
Faktoren, die die Wirksamkeit von ALK-Inhibitoren gegen multiple<br />
Myelomzellen beeinflussen, mit Hilfe eines genomweiten<br />
CRISPR/Cas9-Bibliothek-Screenings zu identifizieren. Anschliessend<br />
sollen vielversprechende Kombinationen aus ALK-<br />
Inhibitoren und anderen Medikamenten für die klinische Entwicklung<br />
neuer Therapieoptionen für das therapieresistente<br />
multiple Myelom identifiziert werden.<br />
Cardiotoxicity of proteasome inhibitors: Molecular basis and<br />
potential mitigation strategies<br />
Swiss Cancer Foundation<br />
01.01.2022 – 31.12.2022, CHF 50’000<br />
Hauptantragsteller: Christoph Driessen<br />
In diesem Projekt soll die Wirkung von Carfilzomib auf Modellsysteme<br />
in vitro und in vivo analysiert werden und im Speziellen<br />
die Kardiotoxizität von Carfilzomib bei Patientinnen und Patienten<br />
mit multiplem Myelom untersucht werden.<br />
Genetic contributors of multiple myeloma involved in protection<br />
against T-cell mediated cell death<br />
Forschungsförderung Kantonsspital St.Gallen<br />
01.07.2022 – 30.06.2023, CHF 75’500<br />
Hauptantragstellerin: Lenka Besse<br />
Dieses Projekt zielt darauf ab, ein genomweites CRISPR-Cas9-<br />
Screening anzuwenden, um Schlüsselelemente zu identifizieren,<br />
die dazu führen, dass Myelomzellen der Erkennung durch Immunzellen<br />
entgehen. Ausserdem sollen Faktoren im Zusammenhang<br />
mit der Tumor-Mikroumgebung identifizieren werden, die<br />
die Therapieresistenz fördern.<br />
Targeting the immunoproteasome in vivo<br />
Forschungsförderung Kantonsspital St.Gallen<br />
01.08.2023 – 31.12.2023, CHF 45’560<br />
Hauptantragsteller: Christoph Driessen<br />
Immunproteasom-Inhibitoren hemmen selektiv die einzelnen<br />
Untereinheiten des Immunproteasoms in Zellen. In diesem<br />
Projekt soll die Wirkung des Immunproteasom-Inhibitors in<br />
vivo untersucht werden, mit besonderem Fokus auf das<br />
Immunproteasom-Inhibitionsprofil, die Verträglichkeit, die<br />
Herztoxizität und die Gewebeverteilung.<br />
Experimentelle Onkologie II<br />
Oncogenic, dominant-negative splicing of<br />
the Apoptosis Stimulating Protein of TP53-2<br />
(ASPP2) – a key regulator in tumorigenesis<br />
and therapy resistance<br />
Schweizerischer Nationalfonds<br />
2021 – 2025, CHF 430’000<br />
Hauptantragstellerin: Kerstin Kampa-Schittenhelm<br />
Das Ziel dieses Forschungsvorhabens ist es, die<br />
Rolle der neu identifizierten Isoform ASPP2 in<br />
der Tumorentstehung und bei der Resistenz<br />
gegenüber Krebstherapien zu untersuchen.<br />
Evaluation of potential antitumor efficacy of<br />
Type B Polycyclic Polyprenylated Acylphloroglucinol<br />
(PPAP) antibiotics in acute myeloid<br />
leukemia (AML) cell models<br />
Ministry of Science, Research and the Arts<br />
(MWK) Baden-Württemberg<br />
2021 – 2023, EUR 60’000<br />
Hauptantragstellerin: Kerstin Kampa-Schittenhelm<br />
In diesem Projekt wird die antileukämische<br />
Wirksamkeit der mit unseren Kooperationspartnern<br />
neu synthetisierten und kontinuierlich<br />
weiter entwickelten PPAP Derivate untersucht.<br />
Role of ASPP2k for treatment response<br />
towards BCL-inhibitors in acute leukemia<br />
models<br />
Apis Assay Technologies, Biotech research<br />
funding<br />
2022 – 2024, CHF 380’000<br />
Hauptantragstellerin: Kerstin Kampa-Schittenhelm<br />
In diesem Projekt wird untersucht, ob in Modellen<br />
der akuten Leukämie ein Zusammenhang<br />
zwischen der Expression von ASPP2k und<br />
dem Ansprechen auf BCL-Inhibitoren besteht.<br />
Evaluation of Polycyclic Polyprenylated Acylphloroglucinols<br />
(PPAPs) as a potential new<br />
class of cancer therapeutics in glioblastoma<br />
Forschungsförderung Kantonsspital St.Gallen<br />
01.06.2023-30.05.24, CHF 95’000<br />
Hauptantragstellerin: Kerstin Kampa-Schittenhelm<br />
Ziel dieses Projektes ist die Charakterisierung<br />
von PPAPs des Typs B im Hinblick auf ihre<br />
tumorinhibierende Wirkung in Glioblastomen.<br />
Die antiproliferative und proapoptotische<br />
Wirksamkeit von PPAPs konnte bereits in<br />
akuten Leukämien gezeigt werden. Zusammen<br />
mit bestehenden Kooperationspartnern<br />
werden diese PPAPs der ersten und zweiten<br />
Experimentelle Onkologie und Hämatologie 67
Generation weiter entwickelt, um die Wirksamkeit auf Glioblastomzellen<br />
zu verbessern. Ziel ist es, eine Verbindung zu<br />
identifizieren, die sich für die weitere (prä-)klinische Entwicklung<br />
eignet.<br />
Systematic sequence-walk to identify isoform-specific, fully<br />
chemically modified small interfering RNAs (siRNAs) to target<br />
ASPP2k for in vivo application<br />
Forschungsförderung Kantonsspital St.Gallen<br />
01.06.2024 – 30.05.25, CHF 93’000<br />
Hauptantragstellerin: Kerstin Kampa-Schittenhelm<br />
Projektpartner: Marcus Schittenhelm<br />
Gemeinsam mit bestehenden Kooperationspartnern werden<br />
vollständig chemisch modifizierte, GMP-konforme ASPP2ksiRNAs<br />
entwickelt, die für die in vivo-Anwendung geeignet<br />
sind, um die Expression von ASPP2k spezifisch zu hemmen. Ziel<br />
dieses Projekts ist es, die vielversprechendste siRNA in Bezug<br />
auf Sequenz und chemisches Modifikationsmuster zu identifizieren,<br />
um ASPP2k in vivo spezifisch und wirksam zu hemmen.<br />
Dies soll die Grundlage für die klinische Entwicklung von auf<br />
ASPP2k zielgerichtete Therapeutika bilden.<br />
The role of ASPP2kappa in breast cancer: a potential prognostic<br />
marker and novel therapeutic target<br />
Stiftup Foundation<br />
01.12.2023-30.11.2024, CHF 30’000<br />
Hauptantragstellerin: Kerstin Kampa-Schittenhelm<br />
Dieses Projekt zielt darauf ab, die Rolle von ASPP2k bei Brustkrebs<br />
zu charakterisieren. Insbesondere soll untersucht werden,<br />
in welcher Weise ASPP2k zur Therapieresistenz und Metastasierung<br />
beiträgt. Darüber hinaus wird der Stellenwert der Expression<br />
von ASPP2k als früher prognostischer Marker für das<br />
Therapieansprechen und das Gesamtüberleben bei Brustkrebs<br />
untersucht.<br />
Experimentelle Onkologie III<br />
Exploiting metabolic liabilities in leukemic<br />
stem cells for targeted therapy of myeloid<br />
malignancies<br />
Schweizerischer Nationalfonds<br />
2020 – 2024, CHF 632’000<br />
Hauptantragsteller: Nageswara Rao Tata<br />
Dieses Projekt untersucht die molekularen und<br />
metabolischen Mediatoren, die mit malignen<br />
myeloischen Erkrankungen assoziiert sind. Bestimmte<br />
genetische Mutationen in den Tumorzellen,<br />
so genannte Treibermutationen, führen<br />
zu metabolischen Veränderungen der Leukämiezellen<br />
und sind daher mögliche neue therapeutische<br />
Ziele bei Myeloidleukämien.<br />
Age-induced cellular and molecular alterations<br />
driving myeloid leukemia initiation and<br />
progression<br />
Krebsliga Schweiz<br />
2021 – 2024, CHF 374’585<br />
Hauptantragsteller: Nageswara Rao Tata<br />
Ziel dieser Studie ist es, das Zusammenspiel<br />
von altersbedingten zellintrinsischen und<br />
-extrinsischen Veränderungen der hämatopoetischen<br />
Stammzellen und ihrer zellulären<br />
Nischen im Knochenmark im Verlauf von myeloischen<br />
Leukämien aufzuklären.<br />
Leveraging systemic metabolic alterations to<br />
identify functional biomarkers and therapeutic<br />
targets in myeloid leukemias<br />
Fond’Action contre le cancer’s, Lausanne<br />
2022 – 2024, CHF 125’000<br />
Hauptantragsteller: Nageswara Rao Tata<br />
Ziel dieser Studie ist es, systemische metabolische<br />
Biomarker zu identifizieren und zu<br />
charakterisieren. Bestimmte Kombinationen<br />
von Biomarkern könnten die Vorhersage des<br />
Krankheitsverlaufs bei myeloproliferativen<br />
Neoplasien verbessern.<br />
Elucidate and Exploit Functional Basis of Mutual<br />
Exclusivity of Major Driver Mutations in<br />
Myeloid Neoplasms for Therapeutic Targeting<br />
Forschungsförderung Kantonsspital St.Gallen<br />
2023 – 2024, CHF 88’000<br />
Hauptantragsteller: Nageswara Rao Tata<br />
In diesem Projekt sollen die wichtigsten Treibermutationen<br />
bei myeloproliferativen Neoplasien<br />
untersucht werden. Die wechselseitige<br />
Exklusivität unterschiedlicher Mutationen<br />
könnte eine zielgerichtete Therapie gegen<br />
bestimmte Tumorklone ermöglichen.<br />
68 Experimentelle Onkologie und Hämatologie
Veröffentlichungen<br />
Folgend sind die Arbeiten aufgeführt, welche von den Mitarbeitenden<br />
der Experimentellen Onkologie am Kantonsspital<br />
St.Gallen in den Jahren 2022 und 2023 erstellt wurden.<br />
Originalarbeiten<br />
Experimentelle Onkologie I<br />
1. Besse A, Kraus M, Mendez-Lopez M, Maurits E, Overkleeft HS, Driessen C,<br />
Besse L. Immunoproteasome Activity in Chronic Lymphocytic Leukemia as<br />
a Target of the Immunoproteasome-Selective Inhibitors. Cells. 2022, 11:<br />
838.<br />
2. Ferguson ID, Lin YT, Lam C, Shao H, Tharp KM, Hale M, Kasap C, Mariano MC,<br />
Kishishita A, Patiño Escobar B, Mandal K, Steri V, Wang D, Phojanakong P,<br />
Tuomivaara ST, Hann B, Driessen C, Van Ness B, Gestwicki JE, Wiita AP. Allosteric<br />
HSP70 inhibitors perturb mitochondrial proteostasis and overcome<br />
proteasome inhibitor resistance in multiple myeloma. Cell Chem<br />
Biol. 2022, 29: 1288 – 1302.e1287.<br />
3. Ferguson ID, Patiño-Escobar B, Tuomivaara ST, Lin YT, Nix MA, Leung KK, Kasap<br />
C, Ramos E, Nieves Vasquez W, Talbot A, Hale M, Naik A, Kishishita A, Choudhry<br />
P, Lopez-Girona A, Miao W, Wong SW, Wolf JL, Martin TG, 3rd, Shah N, Vandenberg<br />
S, Prakash S, Besse L, Driessen C, Posey AD, Jr., Mullins RD, Eyquem<br />
J, Wells JA, Wiita AP. The surfaceome of multiple myeloma cells suggests<br />
potential immunotherapeutic strategies and protein markers of drug resistance.<br />
Nat Commun. 2022, 13: 4121.<br />
4. Kliebhan J, Besse A, Kampa-Schittenhelm K, Schittenhelm M, Driessen C.<br />
Mutant TP53 driving the Warburg Effect in Mantle Cell lymphoma. Clin<br />
Case Rep. 2022, 10: e6296.<br />
5. Besse L, Kraus M, Besse A, Driessen C, Tarantino I. The cytotoxic activity of<br />
carfilzomib together with nelfinavir is superior to the bortezomib/nelfinavir<br />
combination in non-small cell lung carcinoma. Sci Rep. 2023, 13: 4411.<br />
6. Zhou X, Besse A, Peter J, Steinhardt MJ, Vogt C, Nerreter S, Teufel E, Stanojkovska<br />
E, Xiao X, Hornburger H, Haertle L, Lopez MM, Munawar U, Riedel A, Han<br />
S, Maurits E, Overkleeft HS, Florea B, Einsele H, Kortüm KM, Driessen C, Besse<br />
L, Rasche L. High-dose carfilzomib achieves superior anti-tumor activity over<br />
low-dose and recaptures response in relapsed/refractory multiple myeloma<br />
resistant to lowdose carfilzomib by co-inhibiting the b2 and b1 subunits of the<br />
proteasome complex. Haematologica. 2023, 108: 1628 – 1639.<br />
7. Bandini C, Mereu E, Paradzik T, Labrador M, Maccagno M, Cumerlato M, Oreglia<br />
F, Prever L, Manicardi V, Taiana E, Ronchetti D, D’Agostino M, Gay F, Larocca A,<br />
Besse L, Merlo GR, Hirsch E, Ciarrocchi A, Inghirami G, Neri A, Piva R. Lysin (K)-<br />
specific demethylase 1 inhibition enhances proteasome inhibitor response<br />
and overcomes drug resistance in multiple myeloma. Exp Hematol Oncol.<br />
2023,12: 71.<br />
Experimentelle Onkologie II<br />
1. Kliebhan J, Besse A, Kampa-Schittenhelm K, Schittenhelm M, Driessen C.<br />
Mutant TP53 driving the Warburg Effect in Mantle Cell lymphoma. Clin<br />
Case Rep. 2022, 10: e6296.<br />
2. Tsintari V, Walter B, Fend F, Overkamp M, Rothermundt C, Lopez CD, Schittenhelm<br />
MM, Kampa-Schittenhelm KM. Alternative splicing of Apoptosis Stimulating<br />
Protein of TP53-2 (ASPP2) results in an oncogenic isoform promoting<br />
migration and therapy resistance in soft tissue sarcoma (STS). BMC Cancer.<br />
2022, 22: 725.<br />
3. Sutter T, Schittenhelm M, Volken T, Lehmann T. Treatment regimens in patients<br />
over 64 years with acute myeloid leukaemia: a retrospective single-institution,<br />
multi-site analysis. Hematology. 2023, 28: 2206694<br />
4. Schittenhelm MM, Kaiser M, Györffy B, Kampa-Schittenhelm KM. Evaluation of<br />
apoptosis stimulating protein of TP53-1 (ASPP1/PPP1R13B) to predict therapy<br />
resistance and overall survival in acute myeloid leukemia (AML). Cell Death Dis.<br />
Accepted Dec. 3rd, 2023<br />
Experimentelle Onkologie III<br />
1. Koster KL, Messerich NM, Volken T, Cogliatti S, Lehmann<br />
T, Graf L, Holbro A, Benz R, Demmer I, Jochum W, Rao TN,<br />
Silzle T. Prognostic Significance of the Myelodysplastic<br />
Syndrome-Specific Comorbidity Index (MDS-CI) in<br />
Patients with Myelofibrosis: A Retrospective Study.<br />
Cancers (Basel). 2023, 15.<br />
2. Messerich NM, Uda NR, Volken T, Cogliatti S, Lehmann T,<br />
Holbro A, Benz R, Graf L, Gupta V, Jochum W, Demmer I,<br />
Rao TN, Silzle T. CRP/Albumin Ratio and Glasgow Prognostic<br />
Score Provide Prognostic Information in Myelofibrosis<br />
Independently of MIPSS70-A Retrospective<br />
Study. Cancers (Basel). 2023, 15.<br />
Übersichtsarbeiten<br />
Experimentelle Onkologie I<br />
1. Schwestermann J, Besse A, Driessen C, Besse L. Contribution<br />
of the Tumor Microenvironment to Metabolic<br />
Changes Triggering Resistance of Multiple Myeloma to<br />
Proteasome Inhibitors. Front Oncol. 2022, 12: 899272.<br />
Kongressbeiträge<br />
Die Forschungsergebnisse der Mitarbeitenden<br />
wurden auf verschiedenen nationalen und internationalen<br />
Kongressen vorgestellt:<br />
Experimentelle Onkologie I<br />
Vorträge<br />
1. Andrej Besse. Bortezomib resistant multiple myeloma<br />
shows a specific dependency on Ecpas in vitro and in<br />
vivo. EMBO Workshop: the 20S Proteasome Degradation<br />
Pathway. Weizmann Institute of Science, Rehovot,<br />
Israel, 2023.<br />
2. Jonas Schwestermann. Interaction with pathologic tumor<br />
microenvironment in multiple myeloma cells induces<br />
transcriptional changes on a single-cell level<br />
that are relevant for resistance to Carfilzomib in vivo.<br />
SOHC Basel, Schweiz, 2023.<br />
Experimentelle Onkologie II<br />
Ausgezeichnete Beiträge<br />
Alessia Ruiba, Posterpreis (2022). Specific inhibition of<br />
oncogenic ASPP2kappa(k) using antibody-conjugated nanoparticles<br />
results in improved response to chemotherapy in<br />
HER2-positive breast cancer models. DGHO/OeGHO/<br />
SGMO and SGH+SSH annual meeting.<br />
Leonie Kampa, Posterpreis (2022). First in-class evaluation<br />
of type B Polycyclic Polyprenylated Acylphloroglucinols<br />
(PPAP) in acute myeloid leukemia (AML) reveals potent antileukemic<br />
efficacy. DGHO/OeGHO/SGMO and SGH+SSH annual<br />
meeting.<br />
Marlon Hafner, Posterpreis (2023). Oncogenic ASPP2kappa(k)<br />
promotes all classical hallmarks of cancer in glioblastoma.<br />
DGHO/OeGHO/SGMO and SGH+SSH annual meeting.<br />
Experimentelle Onkologie und Hämatologie 69
Vorträge<br />
1. Marlon Hafner. Inhibierung von onkogenem ASPP2kappa(k), einer dominantnegativen<br />
Isoform des Tumorsuppressors ASPP2, führt zur Reaktivierung von<br />
p53 im Glioblastom. DGHO/OeGHO/SGMO and SGH+SSH annual meeting<br />
Wien, Österreich 2022.<br />
2. Kerstin Kampa-Schittenhelm. Oncogenic Splicing of the p53-associated<br />
tumorsupressor ASPP2: a key regulator of therapy resistance and tumor<br />
progression. SOHC Basel, Schweiz 2022.<br />
3. Kerstin Kampa-Schittenhelm. Expression of ASPP2k, a dominant-negative, oncogenic<br />
isoform of the Apoptosis-Stimulating Protein of p53-2 (ASPP2), accounts<br />
for a more aggressive tumorbiology in HER2+ breast cancer. DGHO/<br />
OeGHO/SGMO and SGH+SSH annual meeting Hamburg, Deutschland, 2023.<br />
6. Leonie Kampa. Novel synthetic type-B Polyprenylated Acylphloroglucinol<br />
peptides (PPAP) display potent antileukemic efficacy, especially in Venetoclax-resistant<br />
acute myeloid leukemia (AML) models. DGHO/OeGHO/SGMO<br />
and SGH+SSH annual meeting Hamburg, Deutschland, 2023.<br />
7. Gesine Hellwig. Double knock-down of both oncogenic ASPP proteins, iASPP<br />
and ASPP2k results in strong, additive inhibition of proliferation in HER2+ breast<br />
cancer models DGHO/OeGHO/SGMO and SGH+SSH annual meeting Hamburg,<br />
Deutschland, 2023.<br />
8. Kerstin Kampa-Schittenhelm. ASPP2kappa(k) – a central hub of tumorigenesis<br />
and drug resistance. SOHC Basel, Schweiz, 2023.<br />
Experimentelle Onkologie III<br />
Vorträge<br />
1. Nageswara Rao Tata. Targeting Metabolic Dependencies in Myeloproliferative<br />
Neoplasms. MPN-MPNr EuroNet 16th meeting, Belgrade, Serbien, Mai 2023.<br />
2. Nageswara Rao Tata. Targeting Metabolic Dependencies in Myeloproliferative<br />
Neoplasms. Wilsede Meeting Modern trends in human leukemia and cancer,<br />
Wilsede, Deutschland, Juni 2023.<br />
3. Narasimha Rao Uda. Growth Differentiation Factor 15 – a Potential Biomarker<br />
and a Therapeutic Target in Myeloproliferative Neoplasms. 6th Annual Swiss<br />
Society of Oncology and Hematology Conference, Basel, Schweiz.<br />
Abstracts mit Posterpräsentationen<br />
Experimentelle Onkologie I: 4<br />
Experimentelle Onkologie II: 8<br />
Experimentelle Onkologie III: 2<br />
Abschlussarbeiten<br />
Masterarbeiten<br />
1. Franziska Esslinger (2023). Evaluation of Polycyclic Polyprenylated Acylphloroglucinols<br />
(PPAPs) as a potential new class of cancer therapeutics in GB. Universität<br />
Tübingen, betreut von Kampa-Schittenhelm K.<br />
Doktorarbeiten<br />
1. Mihada Bajrami Saipi (2022). Inhibitor of Apoptosis Stimulating Protein of<br />
p53 (iASPP) in akuten myeloischen Leukämien – Expression und Funktion<br />
des antiapoptotischen Familienmitglieds der ASPP-Proteinfamilie. Universität<br />
Tübingen, betreut von Kampa-Schittenhelm K.<br />
2. Vasileia Tsintari (2022). Characterization of a novel oncogenic alternative<br />
splice variant of ASPP2 in solid tumor models. Universität Tübingen, betreut<br />
von Kampa-Schittenhelm K.<br />
3. Sara Orlich (2023). Die Rolle von LIN9 in akuten Leukämien. Universität Tübingen,<br />
betreut von Kampa-Schittenhelm K.<br />
4. Ingmar Rieger (2023). Charakterisierung der Rolle von ASPP2kappa beim Kolorektalen<br />
Karzinom. Universität Tübingen, betreut von Kampa-Schittenhelm<br />
K und Schittenhelm M.<br />
70
Xxxxxxxxxxxxx 71
Angelina De Martin und Samuel Meili<br />
Wissenschaftlerin Immunbiologie<br />
Doktorand Immunbiologie und Assistenzarzt Hals-Nasen-Ohrenklinik<br />
«Die Zeit hier<br />
hat meine<br />
Leidenschaft<br />
für die<br />
Forschung<br />
geweckt.»<br />
Angelina De Martin<br />
«Die Forschungsarbeit<br />
hat meinen<br />
Horizont erweitert.»<br />
72 Xxxxxxxxxxxxx<br />
Samuel Meili
Neuland in der Heimat<br />
Angelina De Martin und Samuel Meili sind in der Ostschweiz<br />
gross geworden und für ihr Doktorat in die Heimat<br />
zurückgekehrt – ohne zu ahnen, was ihre Zeit am Institut<br />
für Immunbiologie auslösen würde.<br />
Angelina De Martin, Sie sind im Kantonsspital<br />
St.Gallen geboren und haben kürzlich hier promoviert.<br />
Einmal St.Gallen, immer St.Gallen?<br />
Angelina de Martin: (Lacht.) Tatsächlich bin<br />
ich im Haus 06 am Kantonsspital zur Welt gekommen.<br />
Doch zwischendurch habe ich an<br />
der ETH in Zürich Gesundheitswissenschaften<br />
und Technologie studiert und kehrte 2016 für<br />
die Masterarbeit zurück nach St.Gallen.<br />
Weshalb haben Sie St.Gallen den Vorzug gegeben,<br />
statt dem Ruf der grossen weiten Welt<br />
zu folgen?<br />
Angelina De Martin: Mein Forschungsgebiet<br />
ist die Immunantwort in lymphoiden Organen<br />
wie den Lymphknoten oder Mandeln. Am Institut<br />
für Immunbiologie fand ich ideale Bedingungen<br />
dafür – vor allem durch die Verbindung<br />
zur Hals-Nasen-Ohren-Klinik am Kantonsspital<br />
St.Gallen. Mir hat schon meine Masterarbeit<br />
hier so gut gefallen, dass ich keinen Grund sah,<br />
für mein Doktorat in die Ferne zu schweifen.<br />
Dabei gilt das Medizinische Forschungszentrum<br />
St.Gallen im internationalen Vergleich<br />
eher als «klein» …<br />
Angelina de Martin: … doch dafür ist es überraschend<br />
gut ausgestattet. Alle wichtigen<br />
Methoden sind hier möglich, es kann richtig<br />
gute Forschung betrieben werden. St.Gallen<br />
ist gross genug, um sämtliche Disziplinen abzudecken,<br />
und klein genug, dass man sich<br />
kennt und persönlich austauschen kann. Ich<br />
würde jederzeit wieder hierherkommen.<br />
Samuel Meili, Sie stammen aus Teufen, haben<br />
an der Universität Basel Medizin studiert und<br />
sind nun als Assistenzarzt an der Hals-Nasen-<br />
Ohren-Klinik und Doktorand am Institut für<br />
Immunbiologie zurück in der Ostschweiz.<br />
Was hat bei Ihnen den Ausschlag gegeben?<br />
Samuel Meili: Das breite Spektrum, das St.Gallen<br />
bietet. Hier wird sehr gute, evidenzbasierte<br />
Medizin gemacht, und trotzdem ist das Umfeld<br />
familiär und freundlich. Ehrlich gesagt, konnte<br />
ich mir zu Beginn unter Grundlagenforschung<br />
nicht viel vorstellen. Aber jetzt hat es mir den Ärmel reingezogen,<br />
und ich freue mich auf meine weitere zweijährige Forschungszeit<br />
neben der klinischen Tätigkeit.<br />
Ihr gemeinsames Thema ist die Immunantwort bei bösartiger<br />
Erkrankung der Gaumenmandeln. Was erforschen Sie konkret?<br />
Angelina De Martin: Wir versuchen zu verstehen, wie Fibroblasten,<br />
also Zellen im Bindegewebe, die Immunzellen aktivieren<br />
und steuern.<br />
Samuel Meili: Aktuell werten wir Daten aus über die Immunantwort<br />
im Blut, wenn es zu Mandelkrebs durch Viren kommt.<br />
Wir wollen herausfinden, ob und inwiefern sich die Immunzellen<br />
bei Patienten und Gesunden unterscheiden.<br />
Welchen Einfluss hat Ihre Forschungsarbeit auf Ihre Arbeit als<br />
Assistenzarzt in der Hals-Nasen-Ohren-Klinik?<br />
Samuel Meili: Sie hat mein wissenschaftliches Verständnis geschärft.<br />
Dank meiner Arbeit in der Grundlagenforschung kann<br />
ich den Patientinnen und Patienten noch präziser und fundierter<br />
erklären, was bei ihrer Erkrankung genau passiert.<br />
Wie gelingt Ihnen der Spagat zwischen Wissenschaft und Klinik?<br />
Samuel Meili: Gerade in St.Gallen ist dieser Spagat einfacher zu<br />
bewältigen als anderswo, da die Wege kurz sind und man sich<br />
kennt. Meine Kollegen an anderen Standorten beneiden uns<br />
zum Beispiel darum, dass wir direkt mit klinischen Proben aus<br />
dem Spital arbeiten können. Das Wechselspiel zwischen Wissenschaft<br />
und Praxis erlebe ich nur positiv: Ich trage das Forschungswissen<br />
in die Klinik und die praktischen Erfahrungen in<br />
die Forschung.<br />
Angelina De Martin, Sie haben Ihre Promotion abgeschlossen<br />
und ziehen bald weiter. Was nehmen Sie mit?<br />
Angelina De Martin: Ein enormes Wissen – und ein Feuer für<br />
die Wissenschaft. Als ich 2016 nach St.Gallen kam, wusste ich<br />
nicht wirklich, was Forschung überhaupt ist. Die Zeit hier hat<br />
meine Leidenschaft für die Forschungsarbeit entfacht. Gleichzeitig<br />
realisiere ich erst jetzt die Mankos. Je mehr man geforscht<br />
hat und weiss, desto deutlicher zeigt sich, wie viel wir noch nicht<br />
wissen.<br />
Samuel Meili, Sie waren vorher nie im Labor tätig. Was hat Ihnen<br />
die Forschung am Institut für Immunbiologie gebracht?<br />
Samuel Meili: Sie hat in mir die Freude für das wissenschaftliche<br />
und experimentelle Arbeiten geweckt und meinen Horizont<br />
markant erweitert. Ich durfte wichtige Labormethoden und Fertigkeiten<br />
erlernen, die es für das Planen und Durchführen einer<br />
wissenschaftlichen Studie benötigt.<br />
Interview 73
v.l.n.r.: Werner Albrich, Christian Kahlert, Susanne Nigg<br />
Experimentelle Infektiologie<br />
Das Forschungslabor für Experimentelle Infektiologie<br />
ist Teil der Klinik für Infektiologie,<br />
Infektionsprävention und Reisemedizin. Der<br />
Forschungsschwerpunkt liegt auf klinischen<br />
Studien mit experimentellem Ansatz, einschliesslich<br />
Prüfarzt-initiierter Studien im<br />
Bereich der immunologisch-infektiologischen<br />
Forschung.<br />
Durch die Zusammenarbeit des Konsiliardienstes<br />
der Klinik für Infektiologie, Infektionsprävention<br />
und Reisemedizin mit anderen<br />
Fachabteilungen des Kantonsspitals St.Gallen<br />
und des Ostschweizer Kinderspitals ergeben<br />
sich wichtige lokale Kooperationen, die eine<br />
ganzheitliche Herangehensweise an komplexe<br />
klinische Fragestellungen ermöglichen. Unsere<br />
vielfältigen Forschungsprojekte tragen<br />
zur Klärung klinischer Fragestellungen im<br />
Bereich der Immunantwort gegen Infektionserreger,<br />
der Erkennung von Immunpathologien<br />
bei Infektionskrankheiten und des Einflusses<br />
des Mikrobioms auf die Abwehr<br />
pathogener Mikroorganismen bei.<br />
Experimentelle Infektiologie I<br />
Prof. Dr. Werner Albrich leitet Projekte zur Epidemiologie, Diagnostik,<br />
Therapie und Prävention von Atemwegsinfektionen,<br />
insbesondere von Pneumokokken. Parallel dazu erforscht PD<br />
Dr. Christian Kahlert die vertikale Übertragung von Pathogenen<br />
wie HIV, Atemwegsinfektionen, einschliesslich COVID-19, sowie<br />
die damit verbundenen Immunreaktionen.<br />
Die Forschungsarbeiten in den Jahren 2022 und 2023 umfassen<br />
verschiedene Projekte, darunter solche, die im Rahmen<br />
der SURPRISE+ Studie (https://surprise.infekt-kssg.ch/) entstanden<br />
sind oder in Zusammenarbeit mit Dr. Tobias Silzle und<br />
Dr. Stefanie Fischer von der Klinik für Onkologie und Hämatologie<br />
durchgeführt wurden. Diese Projekte konzentrieren sich<br />
einerseits auf die Immunität nach Impfung oder Infektion mit<br />
COVID-19 bei Patientinnen und Patienten mit Immunsuppression<br />
und andererseits auf postinfektiöse Erkrankungen bei<br />
Spitalmitarbeitenden. Zudem wurden die Arbeiten mit einem<br />
Atemwegsepithelmodell wiederaufgenommen.<br />
Experimentelle Infektiologie I<br />
Prof. Dr. Werner Albrich<br />
PD Dr. Christian Kahlert<br />
Susanne Nigg<br />
Leitender Arzt, Klinik für Infektiologie,<br />
Infektionsprävention und Reisemedizin,<br />
Gruppenleiter<br />
Oberarzt mbF, Klinik für Infektiologie,<br />
Infektionsprävention und Reisemedizin,<br />
Gruppenleiter<br />
Biomedizinische Analytikerin<br />
Experimentelle Infektiologie II<br />
PD Dr. Baharak Babouee Flury Oberärztin mbF, Klinik für Infektiologie, Infektionsprävention<br />
und Reisemedizin, Gruppenleiterin,<br />
ärztliche Leitung Clinical Trials Unit<br />
Anja Bösch<br />
Magreth Erick Macha<br />
Niranjan Ireddy<br />
Wissenschaftlerin<br />
Doktorandin (sc. nat)<br />
Doktorand (sc. nat)<br />
74 Experimentelle Infektiologie
v.l.n.r.: Anja Bösch, Baharak Babouee Flury, Magreth Erick Macha, Niranjan Ireddy<br />
Experimentelle Infektiologie II<br />
PD Dr. Baharak Babouee Flury und ihre Forschungsgruppe untersuchen<br />
die Mechanismen der Antibiotikaresistenz von<br />
schwer behandelbaren Spitalkeimen. Dafür haben sie vom<br />
Schweizerischen Nationalfonds einen Forschungsbeitrag von<br />
CHF 815’000 erhalten. Ziel des Projekts ist es, die Ausbreitung<br />
gefährlicher Darmbakterien und ihre Anpassung an die Behandlung<br />
mit Antibiotika zu untersuchen.<br />
Forschungsprojekte und klinische Studien<br />
Die folgenden Forschungsprojekte waren in den Jahren 2022<br />
und 2023 aktiv. Weitere Details zu den Projekten sind in der Forschungs-<br />
und Studiendatenbank zu finden und auf der Internetseite<br />
der Infektiologie, Infektionsprävention und Reisemedizin.<br />
Analysis of the effect of biological therapy on SARS-CoV-2-<br />
specific antibody levels following booster vaccination in<br />
patients with inflammatory bowel disease<br />
Forschungskollaboration: Inselspital Bern und Kantonsspital<br />
St.Gallen<br />
Forschungsförderung Kantonsspital St.Gallen<br />
2022, 26’700<br />
Hauptantragsteller: Joel Dütschler<br />
Partner: Werner Albrich<br />
Bei dieser Studie handelt es sich um eine nationale, multizentrische<br />
Kohortenbestätigungsstudie, die als kombinierte prospektive<br />
Beobachtungs- und retrospektive Datenerhebungsstudie<br />
konzipiert ist. Die Daten werden anhand eines Patientenfragebogens,<br />
der Auswertung von Blutproben und aus den Patientenakten<br />
erhoben.<br />
Procalcitonin and Lung ultrasonography based<br />
antibiotherapy in patients with lower<br />
respiratory tract infection in Swiss emergency<br />
departments: stepped-wedge cluster-randomized<br />
trial.<br />
Forschungskollaboration: Universität Lausanne,<br />
Kantonsspital St.Gallen<br />
Schweizerischer Nationalfonds<br />
2022 – 2026, CHF 2’882’314<br />
Hauptantragsteller: Noémie Boillat-Blanco<br />
Partner: Werner Albrich<br />
Akute Atemwegsinfektionen sind einer der<br />
häufigsten Gründe für eine Konsultation in der<br />
Notaufnahme und auch die Hauptursache<br />
für die unangemessene Verschreibung von<br />
Antibiotika. In diesem Projekt wird untersucht,<br />
ob die übermässige Verabreichung von<br />
Antibiotika in Notaufnahmen durch eine neue<br />
Diagnosestrategie für bakterielle Lungenentzündung<br />
reduziert werden kann. Dabei sollen<br />
in Kombination verschiedener Tests, einschliesslich<br />
Lungenultraschall und Biomarkerlevel,<br />
die bakterielle Lungenentzündung eindeutig<br />
diagnostiziert werden können.<br />
Effects of OM-85 on pneumococcal (Streptococcus<br />
pneumoniae, SP) colonization, invasion<br />
and epithelial response in a pseudostratified<br />
human airway epithelial (HAE) tissue<br />
model with an air-liquid interface (ALI)<br />
OM Pharma<br />
2022 – 2023, CHF 77’000<br />
Hauptantragsteller: Werner Albrich, Christian<br />
Kahlert<br />
Experimentelle Infektiologie 75
In diesem Projekt wird der Einfluss von OM-85 (Bronchovaxom)<br />
auf die Integrität und Funktion des Bronchialepithels in einem<br />
Modell mit Luft-Flüssigkeits-Grenzfläche untersucht, sowie der<br />
protektiven Einfluss auf Pneumokokken-Infektionen ermittelt.<br />
Fluorescence-based rapid diagnostic tool for sensitive and<br />
selective Detection Of uReaSe-producing bacTEria causing<br />
ventilator-associated Pneumonia – DOORSTEP<br />
Forschungsförderung Kantonsspital St.Gallen<br />
2022 – 2023, CHF 35’750<br />
Hauptantragsteller (KSSG): Werner Albrich, Giorgia Giovannini<br />
(Empa)<br />
Bei dieser Zusammenarbeit mit der Empa handelt es sich um<br />
ein Proof-of-Concept-Projekt, in dem die mikrobiologische<br />
Diagnostik von bakteriellen nosokomialen Infektionen, insbesondere<br />
Ventilator-assoziierte Pneumonien (VAP) beschleunigt<br />
und verbessert werden soll. Grundlage ist der Nachweis der<br />
Urease-Produktion von häufigen VAP-Erregern wie Klebsiella<br />
pneumoniae mittels Polymeren, die nach Abbau von Fluorophoren<br />
durch Urease quantitativ gemessen werden können.<br />
Exploring the impact of hexagonal boron nitride (nanomedicines)<br />
on bacterial quorum sensing communication and its<br />
consequences on bacterial lung invasion and pathogenesis<br />
Forschungsförderung Kantonsspital St.Gallen<br />
2022 – 2023, CHF 50’000<br />
Hauptantragsteller (KSSG): Werner Albrich, Govind Gupta<br />
(Empa), Tina Bürki (Empa)<br />
In dieser Zusammenarbeit mit der Empa wird untersucht, ob<br />
Bor- basierte Nanopartikel oder zweidimensionale Materialien<br />
das luxS-vermittelte Quorum Sensing von Pneumokokken und<br />
damit deren Virulenz und Gewebeinvasivität modulieren können.<br />
mBiomR; Unravelling the mechanisms and dynamics underlying<br />
the response of intestinal bacteria from the ESKAPE<br />
group to antimicrobial treatment<br />
Schweizerischer Nationalfonds<br />
2023 – 2027, CHF 815’658<br />
Hauptantragstellerin: Baharak Babouee Flury<br />
Obwohl allgemein bekannt ist, dass Antibiotika zur Selektion<br />
resistenter Darmbakterien führen, die zugrunde liegenden Mechanismen<br />
noch wenig verstanden. In diesem Projekt sollen die<br />
Auswirkungen einer Antibiotikabehandlung auf die Darmbakterien<br />
sowie die Erholung des Darmmikrobioms nach Beendigung<br />
der Behandlung untersucht werden. Ziel ist es, die Verteilungsdynamik<br />
sowie die Anpassungs- und Resistenzmechanismen von<br />
Bakterien der ESKAPE-Gruppe zu entschlüsseln. Dies wird die<br />
Identifizierung von Antibiotika ermöglichen, die für die Selektion<br />
spezifischer Resistenzen in Bakterien verantwortlich sind.<br />
A Multiomic Approach to unravel the Resistance Mechanisms<br />
to Ceftazidime-Avibactam in Pseudomonas aeruginosa<br />
Forschungsförderung Kantonsspital St.Gallen<br />
2019 – 2023<br />
Hauptantragstellerin: Baharak Babouee Flury<br />
In Zusammenarbeit mit dem EMBL Heidelberg und der Empa<br />
St.Gallen werden die Resistenzmechanismen von P. aeruginosa<br />
gegenüber dem neuen Antibiotikum Ceftazidim-Avibactam<br />
unter sucht. Mit Hilfe eines Multi-Omics-Ansatzes<br />
(Genomik, Transkriptomik, Proteomik) werden<br />
resistente P. aeruginosa Stämme durch<br />
eine mehrstufige Selektion auf Ceftazidim-Avibactam<br />
und Meropenem erzeugt und die<br />
Kreuzresistenz evaluiert.<br />
Resistance Development in Escherichia coli<br />
at different pH following Delafloxacin and<br />
Ciprofloxacin Challenge<br />
Forschungskollaboration<br />
2021 – 2023, CHF 100’000<br />
Hauptantragstellerin: Baharak Babouee Flury<br />
Delafloxacin ist ein neues nicht-zwitterionisches<br />
Fluorchinolon, das von der FDA und der<br />
EMA für die Behandlung von Hautinfektionen<br />
und Pneumonien zugelassen wurde. Delafloxacin<br />
wirkt gegen grampositive Organismen und<br />
Anaerobier, ähnlich wie Ciprofloxacin gegen<br />
gramnegative Bakterien. Im Gegensatz zu anderen<br />
Fluorchinolonen zeigt Delafloxacin eine<br />
verbesserte Wirksamkeit im sauren Milieu. Da<br />
herkömmliche Testbedingungen nicht immer<br />
den Infektionsort widerspiegeln, wird hier die<br />
Resistenzentwicklung von E. coli gegenüber<br />
Delafloxacin und Ciprofloxacin in saurem und<br />
neutralem Milieu untersucht.<br />
Deciphering antimicrobial resistance mechanisms<br />
of E. coli and P. aeruginosa isolated<br />
from patients with urinary tract and surgical<br />
site infections at St. Francis Referral Hospital<br />
Ifakara-Tanzania<br />
Vontobel Stiftung: Swiss Government Excellence<br />
Award<br />
2021 – 2024, CHF 122’000<br />
Hauptantragstellerin: Baharak Babouee Flury<br />
In Zusammenarbeit mit dem Schweizerischen<br />
Tropeninstitut werden die Mechanismen<br />
der Antibiotikaresistenz bei den Bakterienstämmen<br />
E. coli und P. aeruginosa untersucht.<br />
Diese werden von Patientinnen und Patienten<br />
mit Harnwegs- oder chirurgischen Infektionen<br />
im St.Francis Referral Hospital in Tansania<br />
isoliert. Gleichzeitig werden klinische Daten<br />
einschliesslich des Antibiotikaverbrauchs erhoben,<br />
um Risikofaktoren für die Resistenzentwicklung<br />
zu untersuchen.<br />
Deciphering Antimicrobial Resistance Mechanisms<br />
of Escherichia coli and Pseudomonas<br />
aeruginosa isolated from Patients with Urinary<br />
Tract- and Surgical Site Infections at St.Francis<br />
Referral Hospital, Ifakara-Tanzania<br />
Forschungsförderung Kantonsspital St.Gallen<br />
2022, CHF 22´040<br />
Hauptantragstellerin: Magreth Macha<br />
76 Experimentelle Infektiologie
Veröffentlichungen<br />
Die folgenden Arbeiten sind in den Jahren 2022 und 2023 veröffentlicht<br />
worden:<br />
Originalarbeiten<br />
1. Aebi-Popp K, Kahlert CR, Crisinel PA, Decosterd L, Saldanha SA, Hoesli I,<br />
Martinez De Tejada B, Duppen thaler A, Rauch A, Marzolini C. Transfer of<br />
antiretroviral drugs into breastmilk: a prospective study from the Swiss<br />
Mother and Child HIV Cohort Study. J Antimicrob Chemother. 2022, 77:<br />
3436 – 3442.<br />
2. Albrich WC, Ghosh TS, Ahearn-Ford S, Mikaeloff F, Lunjani N, Forde B, Suh<br />
N, Kleger GR, Pietsch U, Frischknecht M, Garzoni C, Forlenza R, Horgan M,<br />
Sadlier C, Negro TR, Pugin J, Wozniak H, Cerny A, Neogi U, O’toole PW,<br />
O’mahony L. A high-risk gut microbiota configuration associates with fatal<br />
hyperinflammatory immune and metabolic responses to SARS-CoV-2. Gut<br />
Microbes. 2022, 14: 2073131.<br />
3. Babouee Flury B, Güsewell S, Egger T, Leal O, Brucher A, Lemmenmeier E,<br />
Meier Kleeb D, Möller JC, Rieder P, Rütti M, Schmid HR, Stocker R, Vuichard-<br />
Gysin D, Wiggli B, Besold U, Mcgeer A, Risch L, Friedl A, Schlegel M,<br />
Kuster SP, Kahlert CR, Kohler P. Risk and symptoms of COVID-19 in health<br />
professionals according to baseline immune status and booster vaccination<br />
during the Delta and Omicron waves in Switzerland-A multicentre cohort<br />
study. PLoS Med. 2022, 19: e1004125.<br />
4. Blankenberger J, Kaufmann M, Al-banese E, Amati R, Anker D, Camerini AL,<br />
Chocano-Bedoya P, Cullati S, Cusini A, Fehr J, Harju E, Kohler P, Kriemler S,<br />
Michel G, Rodondi N, Rodondi PY, Speierer A, Tancredi S, Puhan MA, Kahlert<br />
CR. Is living in a household with children associated with SARS-CoV-2 seropositivity<br />
in adults? Results from the Swiss national seroprevalence study<br />
Corona Immunitas. BMC Med. 2022, 20: 233.<br />
5. Chappell E, Kohns Vasconcelos M, Goodall RL, Galli L, Goetghebuer T, Noguera-Julian<br />
A, Rodrigues LC, Scherpbier H, Smit C, Bamford A, Crichton S,<br />
Navarro ML, Ramos JT, Warszawski J, Spolou V, Chiappini E,<br />
Venturini E, Prata F, Kahlert C, Marczynska M, Marques L, Naver L, Thorne C,<br />
Gibb DM, Giaquinto C, Judd A, Collins IJ. Children living with HIV in Europe:<br />
do migrants have worse treatment outcomes? HIV Med. 2022, 23: 186 – 196.<br />
6. Darie AM, Khanna N, Jahn K, Osthoff M, Bassetti S, Osthoff M, Schumann DM,<br />
Albrich WC, Hirsch H, Brutsche M, Grize L, Tamm M, Stolz D. Fast multiplex<br />
bacterial PCR of bronchoalveolar lavage for antibiotic stewardship in hospitalised<br />
patients with pneumonia at risk of Gram-negative bacterial infection<br />
(Flagship II): a multicentre, randomised controlled trial. Lancet Respir Med.<br />
2022, 10: 877 – 887.<br />
7. Dörr T, Haller S, Müller MF, Friedl A, Vuichard D, Kahlert CR, Kohler P. Risk of<br />
SARS-CoV-2 Acquisition in Health Care Workers According to Cumulative<br />
Patient Exposure and Preferred Mask Type. JAMA Netw Open. 2022, 5:<br />
e2226816.<br />
8. European P, Paediatric Infections Co-hort Collaboration E, Lyons A, Thompson<br />
L, Chappell E, Ene L, Galli L, Goetghebuer T, Jourdain G, Noguera-Julian A,<br />
Kahlert CR, Königs C, Kosalaraksa P, Lumbiganon P, Marczyńska M, Marques L,<br />
Navarro M, Naver L, Okhonskaia L, Prata F, Puthanakit T, Ramos JT, Samarina A,<br />
Thorne C, Voronin E, Turkova A, Giaquinto C, Judd A, Collins IJ. Outcomes of<br />
etravirine-based antiretroviral treatment in treatment-experienced children<br />
and adolescents living with HIV in Europe and Thailand. Antivir Ther. 2022, 27:<br />
13596535221092182.<br />
9. Fischer T, El Baz Y, Graf N, Wilder-muth S, Leschka S, Kleger GR, Pietsch U,<br />
Frischknecht M, Scanferla G, Strahm C, Wälti S, Dietrich TJ, Albrich WC. Clinical<br />
and Imaging Features of COVID-19-Associated Pulmonary Aspergillosis. Diagnostics<br />
(Basel). 2022, 12.<br />
10. Fischer T, El Baz Y, Scanferla G, Graf N, Waldeck F, Kleger GR, Frauenfelder T,<br />
Bremerich J, Kobbe SS, Pagani JL, Schindera S, Conen A, Wildermuth S,<br />
Leschka S, Strahm C, Waelti S, Dietrich TJ, Albrich WC. Comparison of temporal<br />
evolution of computed tomography imaging features in COVID-19 and<br />
influenza infections in a multicenter cohort study. Eur J Radiol Open. 2022,<br />
9: 100431.<br />
11. Hachfeld A, Atkinson A, Calmy A, De Tejada BM, Hasse B, Paioni P, Kahlert CR,<br />
Boillat-Blanco N, Stoeckle M, Aebi-Popp K. Decrease of condom use in heterosexual<br />
couples and its impact on pregnancy rates: the Swiss HIV Cohort<br />
Study (SHCS). HIV Med. 2022, 23: 60 – 69.<br />
12. Hachfeld A, Atkinson A, Stute P, Calmy A, Tarr PE, Darling<br />
K, Babouee Flury B, Polli C, Sultan-Beyer L, Abela IA,<br />
Aebi-Popp K. Women with HIV transitioning through<br />
menopause: Insights from the Swiss HIV Cohort Study<br />
(SHCS). HIV Med. 2022, 23: 417 – 425.<br />
13. Haller S, Güsewell S, Egger T, Scanferla G, Thoma R,<br />
Leal-Neto OB, Flury D, Brucher A, Lemmenmeier E,<br />
Möller JC, Rieder P, Rütti M, Stocker R, Vuichard-Gysin<br />
D, Wiggli B, Besold U, Kuster SP, Mcgeer A, Risch L,<br />
Schlegel M, Friedl A, Vernazza P, Kahlert CR, Kohler P.<br />
Impact of respirator versus surgical masks on SARS-<br />
CoV-2 acquisition in healthcare workers: a prospective<br />
multi-centre cohort. Antimicrob Resist Infect<br />
Control. 2022, 11: 27.<br />
14. Kohler P, Seiffert SN, Kessler S, Ret-tenmund G, Lemmenmeier<br />
E, Qalla Widmer L, Nolte O, Seth-Smith HMB,<br />
Albrich WC, Babouee Flury B, Gardiol C, Harbarth S,<br />
Münzer T, Schlegel M, Petignat C, Egli A, Héquet D. Molecular<br />
Epidemiology and Risk Factors for Extended-<br />
Spectrum β-Lactamase-Producing Enterobacterales<br />
in Long-Term Care Residents. J Am Med Dir Assoc.<br />
2022, 23: 475 – 481.e475.<br />
15. Lunjani N, Albrich WC, Suh N, Barda B, Finnegan LA, Dam<br />
SA, Walter J, Sadlier C, Horgan M, O’toole PW, O’mahony<br />
L. Higher levels of bacterial DNA in serum associate<br />
with severe and fatal COVID-19. Allergy. 2022, 77:<br />
1312 – 1314.<br />
16. Menges D, Zens KD, Ballouz T, Caduff N, Llanas-Cornejo<br />
D, Aschmann HE, Domenghino A, Pellaton C, Perreau M,<br />
Fenwick C, Pantaleo G, Kahlert CR, Münz C, Puhan MA,<br />
Fehr JS. Heterogenous humoral and cellular immune<br />
responses with distinct trajectories post-SARS-CoV-2<br />
infection in a population- based cohort. Nat Commun.<br />
2022, 13: 4855.<br />
17. Paioni P, Aebi C, Bielicki J, Buettcher M, Crisinel PA,<br />
Kahlert CR, Wagner N, Berger C. Swiss recommendations<br />
on perioperative antimicrobial prophylaxis in children.<br />
Swiss Med Wkly. 2022, 152: w30230.<br />
18. Patel K, Huo Y, Jao J, Powis KM, Wil-liams PL, Kacanek D,<br />
Yee LM, Chad-wick EG, Shiau S, Jacobson DL, Brummel<br />
SS, Sultan-Beyer L, Kahlert CR, Zash R, Seage GR, 3rd.<br />
Dolutegravir in Pregnancy as Compared with Current<br />
HIV Regimens in the United States. N Engl J Med. 2022,<br />
387: 799 – 809.<br />
19. Peralta GP, Camerini AL, Haile SR, Kahlert CR, Lorthe E,<br />
Marciano L, Nussbaumer A, Radtke T, Ulyte A, Puhan MA,<br />
Kriemler S. Lifestyle Behaviours of Children and Adolescents<br />
During the First Two Waves of the COVID-19<br />
Pandemic in Switzerland and Their Relation to Well-<br />
Being: An Observational Study. Int J Public Health.<br />
2022, 67: 1604978.<br />
20. Rossel A, Zandberg KPM, Albrich WC, Huttner A. How<br />
representative is a point-of-care randomized trial?<br />
Clinical outcomes of patients excluded from a pointof-care<br />
randomized controlled trial evaluating antibiotic<br />
duration for Gram-negative bacteraemia: a multicentre<br />
prospective observational cohort study. Clin<br />
Microbiol Infect. 2022, 28: 297.e291 – 297.e296.<br />
21. Rüfenacht S, Gantenbein P, Boggian K, Flury D, Kern L,<br />
Dollenmaier G, Kohler P, Albrich WC. Remdesivir in<br />
Coronavirus Disease 2019 patients treated with anti-<br />
CD20 monoclonal antibodies: a case series. Infection.<br />
2022, 50: 783 – 790.<br />
22. Sadlier C, Albrich WC, Neogi U, Lun-jani N, Horgan M,<br />
O’toole PW, O’mahony L. Metabolic rewiring and serotonin<br />
depletion in patients with postacute sequelae of<br />
COVID-19. Allergy. 2022, 77: 1623 – 1625.<br />
Experimentelle Infektiologie 77
23. Schmiedeberg K, Vuilleumier N, Pagano S, Albrich WC, Ludewig B, Kempis JV,<br />
Rubbert-Roth A. Efficacy and tolerability of a third dose of an mRNA anti-<br />
SARS-CoV-2 vaccine in patients with rheumatoid arthritis with absent or<br />
minimal serological response to two previous doses. Lancet Rheumatol.<br />
2022, 4: e11 – 13.<br />
24. Simonet S, Marschall J, Kuhn R, Schlegel M, Kahlert CR. Implementation of an<br />
electronic, secure, web-based application to support routine hand hygiene<br />
observation with immediate direct feedback and anonymized benchmarking.<br />
Am J In-fect Control. 2022, 50: 1263 – 1265.<br />
25. Strahm C, Seneghini M, Güsewell S, Egger T, Leal-Neto O, Brucher A, Lemmenmeier<br />
E, Meier Kleeb D, Möller JC, Rieder P, Ruetti M, Rutz R, Schmid HR,<br />
Stocker R, Vuichard-Gysin D, Wiggli B, Besold U, Kuster SP, Mcgeer A, Risch L,<br />
Friedl A, Schlegel M, Schmid D, Vernazza P, Kahlert CR, Kohler P. Symptoms<br />
Compatible With Long Coronavirus Disease (COVID) in Healthcare Workers<br />
With and Without Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-<br />
CoV-2) Infection-Results of a Prospective Multicenter Cohort. Clin Infect<br />
Dis. 2022, 75: e1011 – e1019.<br />
26. Studer S, Rassouli F, Waldeck F, Brutsche MH, Baty F, Albrich WC. No evidence<br />
of harmful effects of steroids in severe exacerbations of COPD associated<br />
with influenza. Infection. 2022, 50: 699 – 707.<br />
27. Su E, Fischer S, Demmer-Steingruber R, Nigg S, Güsewell S, Albrich WC, Rothermundt<br />
C, Silzle T, Kahlert CR. Humoral and cellular responses to mRNA-based<br />
COVID-19 booster vaccinations in patients with solid neoplasms under active<br />
treatment. ESMO Open. 2022, 7: 100587.<br />
28. Sumer J, Flury D, Kahlert CR, Mueller NJ, Risch L, Nigg S, Seneghini M, Vernazza<br />
P, Schlegel M, Kohler P. Safety Evaluation of a Medical Congress Held During<br />
the COVID-19 Pandemic-A Prospective Cohort. Int J Public Health. 2022, 67:<br />
1604147.<br />
29. Waldeck F, Seiffert SN, Manser S, Zemp D, Walt A, Berger C, Albrich WC,<br />
Schlegel M, Roloff T, Egli A, Nolte O, Kahlert CR. Outbreak investigation including<br />
molecular characterization of community associated methicillin-resistant<br />
Staphylococcus aureus in a primary and secondary school in Eastern<br />
Switzerland. Sci Rep. 2022, 12: 19826.<br />
30. Babouee Flury B, Bösch A, Gisler V, Egli A, Seiffert SN, Nolte O, Findlay J. Multifactorial<br />
resistance mechanisms associated with resistance to ceftazidimeavibactam<br />
in clinical Pseudomonas aeruginosa isolates from Switzerland.<br />
Front Cell Infect Microbiol. 2023, 13: 1098944.<br />
31. Bessat C, Boillat-Blanco N, Albrich WC. The potential clinical value of pairing<br />
procalcitonin and lung ultrasonography to guide antibiotic therapy in patients<br />
with community-acquired pneumonia: a narrative review. Expert Rev Respir<br />
Med. 2023, 17: 919 – 927.<br />
32. Bielicki I, Schmid H, Atkinson A, Kah-lert CR, Berger C, Troillet N, Marschall J,<br />
Bielicki JA. Association between perioperative prophylaxis with cefuroxime<br />
plus metronidazole or amoxicillin/clavulanic acid and surgical site infections<br />
in paediatric uncomplicated appendectomy: a Swiss retrospective cohort<br />
study. Antimicrob Resist Infect Control. 2023, 12: 106.<br />
33. Bilal M, Zoller M, Fuhr U, Jaehde U, Ullah S, Liebchen U, Büsker S, Zander J,<br />
Babouee Flury B, Taubert M. Cefepime Population Pharmacokinetics, Antibacterial<br />
Target Attainment, and Estimated Probability of Neurotoxicity in<br />
Critically Ill Patients. Antimicrob Agents Chemother. 2023, 67: e0030923.<br />
34. Bloch N, Rüfenacht S, Ludwinek M, Frick W, Kleger GR, Schneider F, Albrich WC,<br />
Flury D, Kuster SP, Schlegel M, Kohler P. Healthcare‐associated infections in<br />
intensive care unit patients with and without COVID-19: a single center prospective<br />
surveillance study. Antimicrob Resist Infect Control. 2023, 12: 147.<br />
35. Bögli J, Güsewell S, Strässle R, Kahlert CR, Albrich WC. Pediatric hospital admissions,<br />
case severity, and length of hospital stay during the first 18 months<br />
of the COVID-19 pandemic in a tertiary children’s hospital in Switzerland.<br />
Infection. 2023, 51: 439 – 446.<br />
36. Bösch A, Macha ME, Ren Q, Kohler P, Qi W, Babouee Flury B. Resistance development<br />
in Escherichia coli to delafloxacin at pHs 6.0 and 7.3 compared<br />
to ciprofloxacin. Antimicrob Agents Chemother. 2023, 67: e0162522.<br />
37. Crisinel PA, Kusejko K, Kahlert CR, Wagner N, Beyer LS, De Tejada BM, Hösli I,<br />
Vasconcelos MK, Baumann M, Darling K, Duppenthaler A, Rauch A, Paioni P,<br />
Aebi-Popp K. Successful implementation of new Swiss recommendations on<br />
breastfeeding of infants born to women living with HIV. Eur J Obstet Gynecol<br />
Reprod Biol. 2023, 283: 86 – 89.<br />
38. Daniore P, Moser A, Höglinger M, Probst Hensch N, Imboden<br />
M, Vermes T, Keidel D, Bochud M, Ortega Herrero<br />
N, Baggio S, Chocano-Bedoya P, Rodondi N, Tancredi S,<br />
Wagner C, Cullati S, Stringhini S, Gonseth Nusslé S, Veys-<br />
Takeuchi C, Zuppinger C, Harju E, Michel G, Frank I,<br />
Kahlert CR, Albanese E, Crivelli L, Levati S, Amati R, Kaufmann<br />
M, Geigges M, Ballouz T, Frei A, Fehr J, Von Wyl V.<br />
Interplay of Digital Proximity App Use and SARS-CoV-2<br />
Vaccine Uptake in Switzerland: Analysis of Two Population-Based<br />
Cohort Studies. Int J Public Health. 2023,<br />
68: 1605812.<br />
39. Endrich O, Triep K, Schlapbach LJ, Posfay-Barbe KM,<br />
Heininger U, Giannoni E, Stocker M, Niederer-Loher A,<br />
Kahlert CR, Natalucci G, Relly C, Riedel T, Aebi C, Berger<br />
C, Agyeman PKA. Sensitivity of ICD coding for sepsis in<br />
children-a population-based study. Intensive Care<br />
Med Paediatr Neonatal. 2023, 1: 5.<br />
40. Favre G, Maisonneuve E, Pomar L, Daire C, Poncelet C,<br />
Quibel T, Monod C, Martinez De Tejada B, Schäffer L,<br />
Papadia A, Radan AP, Todesco-Bernasconi M, Ville Y,<br />
Voekt CA, Eggel-Hort B, Capoccia-Brugger R, Johann S,<br />
Grawe C, Defert S, Mottet N, Kahlert CR, Garabedian C,<br />
Sentilhes L, Weber B, Leu S, Bassler D, Lepigeon K, Winterfeld<br />
U, Panchaud A, Baud D. Maternal and perinatal<br />
outcomes following pre-Delta, Delta, and Omicron<br />
SARS-CoV-2 variants infection among unvaccinated<br />
pregnant women in France and Switzerland: a prospective<br />
cohort study using the COVI-PREG registry.<br />
Lancet Reg Health Eur. 2023, 26: 100569.<br />
41. Hachfeld A, Atkinson A, Stute P, Calmy A, Tarr PE, Darling<br />
KEA, Babouee Flury B, Polli C, Sultan-Beyer L, Abela IA,<br />
Aebi-Popp K. Brief Report: Does Menopause Transition<br />
Influence Viral Suppression and Adherence in Women<br />
Living With HIV? J Acquir Immune Defic Syndr. 2023, 92:<br />
399 – 404.<br />
42. Haller S, Babouee Flury B. Zoonotic poxvirus lesions vs<br />
mosquito bite lesions: differential diagnosis of the uncommon<br />
vs the common. J Travel Med. 2023, 30.<br />
43. Harju E, Speierer A, Jungo KT, Levati S, Baggio S,<br />
Tancredi S, Noor N, Rodondi PY, Cullati S, Imboden M,<br />
Keidel D, Witzig M, Frank I, Kohler P, Kahlert C, Crivelli L,<br />
Amati R, Albanese E, Kaufmann M, Frei A, Von Wyl V,<br />
Puhan MA, Probst-Hensch N, Michel G, Rodondi N,<br />
Chocano-Bedoya P. Changes in Healthcare Utilization<br />
During the COVID-19 Pandemic and Potential Causes- A<br />
Cohort Study From Switzerland. Int J Public Health.<br />
2023, 68: 1606010.<br />
44. Hensen T, Fässler D, O’mahony L, Al-brich WC, Barda B,<br />
Garzoni C, Kleger GR, Pietsch U, Suh N, Hertel J, Thiele<br />
I. The Effects of Hospitalisation on the Serum Metabolome<br />
in COVID-19 Patients. Metabolites. 2023, 13.<br />
45. Kahlert CR, Nigg S, Onder L, Dijkman R, Diener L, Vidal<br />
AGJ, Rodriguez R, Vernazza P, Thiel V, Vidal JE, Albrich<br />
WC. The quorum sensing com system regulates pneumococcal<br />
colonisation and invasive disease in a<br />
pseudo-stratified airway tissue model. Microbiol Res.<br />
2023, 268: 127297.<br />
46. Kahlert CR, Strahm C, Güsewell S, Cusini A, Brucher A,<br />
Goppel S, Möller E, Möller JC, Ortner M, Ruetti M,<br />
Stocker R, Vuichard-Gysin D, Besold U, Mcgeer A, Risch<br />
L, Friedl A, Schlegel M, Vernazza P, Kuster SP, Kohler P.<br />
Post-Acute Sequelae After Severe Acute Respiratory<br />
Syndrome Coronavirus 2 Infection by Viral Variant and<br />
Vaccination Status: A Multicenter Cross-Sectional<br />
Study. Clin Infect Dis. 2023, 77: 194-202.<br />
47. Kohler P, Babouee Flury B, Güsewell S, Egger T, Leal O,<br />
Brucher A, Lemmenmeier E, Meier Kleeb D, Möller JC,<br />
Ortner M, Rieder P, Ruetti M, Schmid HR, Stocker R,<br />
Vuichard-Gysin D, Speer O, Wiggli B, Besold U, Mcgeer<br />
A, Risch L, Friedl A, Schlegel M, Vernazza P, Kahlert CR,<br />
78 Experimentelle Infektiologie
Kuster SP. Clinical symptoms of SARS-CoV-2 break-through infection during<br />
the Omicron period in relation to baseline immune status and booster<br />
vaccination-A prospective multi-centre cohort of health professionals<br />
(SURPRISE study). Influenza Other Re-spir Viruses. 2023, 17: e13167.<br />
48. Kohler P, Dörr T, Friedl A, Stocker R, Vuichard D, Kuster SP, Kahlert CR. SARS-<br />
CoV-2 risk in household contacts of healthcare workers: a prospective cohort<br />
study. Antimicrob Resist Infect Control. 2023, 12: 98.<br />
49. Kohns Vasconcelos M, Meyer Sauteur PM, Keitel K, Santoro R, Egli A, Coslovsky<br />
M, Seiler M, Lurà M, Köhler H, Loevy N, Kahlert CR, Heininger U, Van Den Anker<br />
J, Bielicki JA. Detection of mostly viral pathogens and high proportion of<br />
antibiotic treatment initiation in hospitalised children with communityacquired<br />
pneumonia in Switzerland – baseline findings from the first two<br />
years of the KIDS-STEP trial. Swiss Med Wkly. 2023, 153: 40040.<br />
50. Kusejko K, Smith D, Scherrer A, Paioni P, Kohns Vasconcelos M, Aebi-Popp K,<br />
Kouyos RD, Günthard HF, Kahlert CR. Migrating a Well-Established Longitudinal<br />
Cohort Database From Oracle SQL to Research Electronic Data Entry<br />
(REDCap): Data Management Research and Design Study. JMIR Form Res.<br />
2023, 7: e44567.<br />
51. Lichtensteiger C, Koblischke M, Berner F, Jochum AK, Sinnberg T, Balciunaite B,<br />
Purde MT, Walter V, Abdou MT, Hofmeister K, Kohler P, Vernazza P, Albrich WC,<br />
Kahlert CR, Zoufaly A, Traugott MT, Kern L, Pietsch U, Kleger GR, Filipovic M,<br />
Kneilling M, Cozzio A, Pop O, Bomze D, Bergthaler A, Hasan Ali O, Aberle J, Flatz<br />
L. Autoreactive T cells targeting type II pneumocyte antigens in COVID-19<br />
convalescent patients. J Autoimmun. 2023, 140: 103118.<br />
52. Paioni P, Aebi-Popp K, Martinez De Tejada B, Rudin C, Bernasconi E, Braun DL,<br />
Kouyos R, Wagner N, Crisinel PA, Güsewell S, Darling KEA, Duppenthaler A,<br />
Baumann M, Polli C, Fischer T, Kahlert CR. Viral suppression and retention in<br />
HIV care during the post-partum period among women living with HIV: a longitudinal<br />
multicenter cohort study. Lancet Reg Health Eur. 2023, 31: 100656.<br />
53. Sabatini S, Kaufmann M, Fadda M, Tancredi S, Noor N, Van Der Linden BWA,<br />
Cullati S, Frank I, Michel G, Harju E, Luedi C, Frei A, Ballouz T, Menges D, Fehr<br />
J, Kohler P, Kahlert CR, Scheu V, Ortega N, Chocano-Bedoya P,<br />
Rodondi N, Stringhini S, Baysson H, Lorthe E, Zufferey MC, Suggs LS, Albanese<br />
E, Vincentini J, Bochud M, D’acremont V, Nusslé SG, Imboden M, Keidel D,<br />
Witzig M, Probst-Hensch N, Von Wyl V. Factors Associated With COVID-19<br />
Non-Vaccination in Switzerland: A Nationwide Study. Int J Public Health.<br />
2023, 68: 1605852.<br />
54. Schaub C, Barnsteiner S, Schönenberg L, Bloch N, Dräger S, Albrich WC, Conen<br />
A, Osthoff M. Antibiotic treatment durations for common infectious diseases<br />
in Switzerland: comparison between real-life and local and international<br />
guideline recommendations. J Glob Antimicrob Resist. 2023, 32: 11 – 17.<br />
55. Schlapbach LJ, Goertz S, Hagenbuch N, Aubert B, Papis S, Giannoni E, Posfay-<br />
Barbe KM, Stocker M, Heininger U, Bernhard-Stirnemann S, Niederer-Loher A,<br />
Kahlert CR, Natalucci G, Relly C, Riedel T, Aebi C, Berger C, Agyeman PKA.<br />
Organ Dysfunction in Children With Blood Culture-Proven Sepsis: Comparative<br />
Performance of Four Scores in a National Cohort Study. Pediatr Crit<br />
Care Med. 2023.<br />
56. Schwenke JM, Thorball CW, Schoepf IC, Ryom L, Hasse B, Lamy O, Calmy A,<br />
Wandeler G, Marzolini C, Kahlert CR, Bernasconi E, Kouyos RD, Günthard HF,<br />
Ledergerber B, Fellay J, Burkhalter F, Tarr PE. Association of a Polygenic Risk<br />
Score With Osteoporosis in People Living With HIV: The Swiss HIV Cohort<br />
Study. J Infect Dis. 2023, 228: 742-750.<br />
57. Silzle T, Kahlert CR, Albrich WC, Nigg S, Demmer Steingruber R, Driessen C,<br />
Fischer S. Humoral and cellular BNT162b2 mRNA-based booster vaccine-induced<br />
immunity in patients with multiple myeloma and persistence of neutralising<br />
antibodies: results of a prospective single-centre cohort study.<br />
Swiss Med Wkly. 2023, 153: 40090.<br />
58. Sinnberg T, Lichtensteiger C, Ali OH, Pop OT, Jochum AK, Risch L, Brugger SD,<br />
Velic A, Bomze D, Kohler P, Vernazza P, Albrich WC, Kahlert CR, Abdou MT,<br />
Wyss N, Hofmeister K, Niessner H, Zinner C, Gilardi M, Tzankov A, Röcken M,<br />
Dulovic A, Shambat SM, Ruetalo N, Buehler PK, Scheier TC, Jochum W, Kern L,<br />
Henz S, Schneider T, Kuster GM, Lampart M, Siegemund M, Bingisser R,<br />
Schindler M, Schneiderhan-Marra N, Kalbacher H, Mccoy KD, Spengler W,<br />
Brutsche MH, Maček B, Twerenbold R, Penninger JM, Matter MS, Flatz L.<br />
Pulmonary Surfactant Proteins Are Inhibited by Immunoglobulin A Autoantibodies<br />
in Severe COVID-19. Am J Respir Crit Care Med. 2023, 207: 38 – 49.<br />
59. Strahm C, Kahlert CR, Güsewell S, Vuichard-Gysin D, Stocker R, Kuster SP,<br />
Kohler P. Evolution of symptoms compatible with post-acute sequelae of<br />
SARS-CoV-2 (PASC) after Wild-type and/or Omicron BA.1 infection: A prospective<br />
healthcare worker cohort. J Infect. 2023.<br />
60. Studer S, Rassouli F, Waldeck F, Brutsche M. Baty F,<br />
Albrich WC. No evidence of harmful effects of steroids<br />
in severe exacerbations of COPD associated with influenza.<br />
Infection 2022 Jan 29:1 –9.<br />
61. Sumer J, Keckeis K, Scanferla G, Frischknecht M, Notter<br />
J, Steffen A, Kohler P, Schmid P, Roth B, Wissel K, Vernazza<br />
P, Klein P, Schoop R, Albrich WC. Novel Echinacea<br />
formulations for the treatment of acute respiratory<br />
tract infec-tions in adults-A randomized blinded controlled<br />
trial. Front Med (Lausanne). 2023, 10: 948787.<br />
62. Tancredi S, Chiolero A, Wagner C, Haller ML, Chocano-<br />
Bedoya P, Ortega N, Rodondi N, Kaufmann L, Lorthe E,<br />
Baysson H, Stringhini S, Michel G, Lü-di C, Harju E, Frank<br />
I, Imboden M, Witzig M, Keidel D, Probst-Hensch N,<br />
Amati R, Albanese E, Corna L, Crivelli L, Vincentini J,<br />
Gonseth Nusslé S, Bochud M, D’acremont V, Kohler P,<br />
Kahlert CR, Cusini A, Frei A, Puhan MA, Geigges M, Kaufmann<br />
M, Fehr J, Cullati S. Seroprevalence trends of<br />
anti-SARS-CoV-2 antibodies and associated risk factors:<br />
a population-based study. Infection. 2023, 51:<br />
1453 – 1465.<br />
63. Tancredi S, Ulytė A, Wagner C, Keidel D, Witzig M, Imboden<br />
M, Probst-Hensch N, Amati R, Albanese E, Levati<br />
S, Crivelli L, Kohler P, Cusini A, Kahlert C, Harju E, Michel<br />
G, Lüdi C, Ortega N, Baggio S, Chocano-Bedoya P,<br />
Rodondi N, Ballouz T, Frei A, Kaufmann M, Von Wyl V,<br />
Lorthe E, Baysson H, Stringhini S, Schneider V, Kaufmann<br />
L, Wieber F, Volken T, Zysset A, Dratva J, Cullati S.<br />
Changes in socioeconomic resources and mental<br />
health after the second COVID-19 wave (2020 – 2021):<br />
a longitudinal study in Switzerland. Int J Equity Health.<br />
2023, 22: 51.<br />
64. Urwyler P, Leimbacher M, Charitos P, Moser S, Heijnen I,<br />
Trendelenburg M, Thoma R, Sumer J, Camacho-Ortiz A,<br />
Bacci MR, Huber LC, Stüssi-Helbling M, Albrich WC,<br />
Sendi P, Osthoff M. Recombinant C1 inhibitor in the<br />
prevention of severe COVID-19: a randomized, openlabel,<br />
multicenter phase IIa trial. Front Immunol. 2023,<br />
14: 1255292.<br />
65. Van Singer M, Brahier T, Koch J, Hugli PO, Weckman AM,<br />
Zhong K, Kain TJ, Leligdowicz A, Bernasconi E, Ceschi A,<br />
Parolari S, Vuichard-Gysin D, Kain KC, Albrich WC,<br />
Boillat-Blanco N. Validation of sTREM-1 and IL-6 based<br />
algorithms for outcome prediction of COVID-19. BMC<br />
Infect Dis. 2023, 23: 630.<br />
66. Waldeck F, Boroli F, Zingg S, Walti LN, Wendel-Garcia<br />
PD, Conen A, Pa-gani JL, Boggian K, Schnorf M, Siegemund<br />
M, Abed-Maillard S, Michot M, Que YA, Bättig V,<br />
Suh N, Kleger GR, Albrich WC. Higher risk for influenzaassociated<br />
pulmonary aspergillosis (IAPA) in asthmatic<br />
patients: A Swiss multicenter cohort study on IAPA in<br />
critically ill influenza patients. Influenza Other Respir<br />
Viruses. 2023, 17: e13059.<br />
67. Woelfel S, Dütschler J, König M, Dulovic A, Graf N,<br />
Junker D, Oikonomou V, Krieger C, Truniger S, Franke A,<br />
Eckhold A, Forsch K, Koller S, Wyss J, Krupka N, Oberholzer<br />
M, Frei N, Geissler N, Schaub P, Albrich WC,<br />
Friedrich M, Schneiderhan-Marra N, Misselwitz B, Korte<br />
W, Bürgi JJ, Brand S. STAR SIGN study: Evaluation of<br />
COVID-19 vaccine efficacy against the SARS-CoV-2<br />
variants BQ.1.1 and XBB.1.5 in patients with inflammatory<br />
bowel disease. Aliment Pharmacol Ther. 2023, 58:<br />
678 – 691.<br />
68. Woelfel S, Dütschler J, König M, Graf N, Oikonomou V,<br />
Krieger C, Truniger S, Franke A, Eckhold A, Forsch K,<br />
Wyss J, Krupka N, Albrich W, Frei N, Geissler N, Schaub<br />
P, Friedrich M, Misselwitz B, Korte W, Bürgi JJ, Brand S.<br />
Systemic and T cell-associated responses to SARS-<br />
CoV-2 immunisation in gut inflammation (STAR SIGN<br />
study): effects of biologics on vaccination efficacy of<br />
the third dose of mRNA vaccines against SARS-CoV-2.<br />
Aliment Pharmacol Ther. 2023, 57: 103-116.<br />
Experimentelle Infektiologie 79
Übersichtsarbeiten<br />
1. Seneghini M, Rüfenacht S, Babouee-Flury B, Flury D, Schlegel M, Kuster SP,<br />
Kohler PP. It is complicated: Potential short- and longterm impact of coronavirus<br />
disease 2019 (COVID-19) on antimicrobial resistance-An expert review.<br />
Anti-microb Steward Healthc Epidemiol. 2022, 2: e27.<br />
2. Bessat C, Boillat-Blanco N, Albrich WC. The potential clinical value of pairing<br />
procalcitonin and lung ultra sonography to guide antibiotic therapy in patients<br />
with community-acquired pneumonia: a narrative review. Expert Rev<br />
Respir Med. 2023, 17: 919-927.<br />
Abschlussarbeiten und Auszeichnungen<br />
Betreute Doktorarbeiten<br />
1. Simon Andreas Simonet. Implementation of an electronic, secure, web-based<br />
application to support routine hand hygiene observation with immediate<br />
direct feedback and anonymized benchmarking. Universität Bern, betreut<br />
durch Kahlert C. <br />
Betreute Masterarbeiten<br />
1. Jasmin Bögli betreut durch Albrich W. und Kahlert C.<br />
Kongressbeiträge (Auswahl)<br />
Werner Albrich. Management in the current era of nosocomial infections caused<br />
by gram negative bacilli Presentation 2. Swiss Society for Infectious Diseases SSI,<br />
Joint Annual Meeting, Interlaken, September 2022.<br />
Baharak Babouee Flury. Multiresistente Keime – Heute und Zukunft. Pflegekongress<br />
für Intensivmedizin, Suhr, Mai 2022<br />
Posterpräsentationen (Auswahl)<br />
Anja Bösch. Resistance Development in Escherichia coli at different pH following<br />
Delafloxacin and Ciprofloxacin Challenge. Swiss Society for Infectious Diseases<br />
SSI, Joint Annual Meeting, September 2022.<br />
Christian Kahlert. Effect of SARS-CoV-2 mRNA vaccine booster on humoral and<br />
cellular immunity in patients with multiple myeloma and poor response to<br />
two-dose primary immunisation. Swiss Society for Infectious Diseases SSI, Joint<br />
Annual Meeting, Interlaken, September 2022.<br />
Werner Albrich. Effect of COVID-19 on hospitalizations for lower respiratory tract<br />
infections in Switzerland: comparison of national data between 2020 and<br />
2015 – 2019. Swiss Society for Infectious Diseases SSI, Joint Annual Meeting, Interlaken,<br />
September 2022.<br />
Werner Albrich. Clinical and imaging features of COVID-19 associated pulmonary<br />
aspergillosis. Swiss Society for Infectious Diseases SSI, Joint Annual Meeting,<br />
Interlaken, September 2022.<br />
Magreth Macha. Prevalence of Antibiotic Resistance among Urinary Tract Infections<br />
caused by Escherichia coli in Patients from rural Tanzania – Implications for<br />
Empirical Antibiotic Treatment Guidelines. Swiss Society for Infectious Diseases<br />
SSI, Joint Annual Meeting, September 2023.<br />
80 Xxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxx 81
Anna Joachimbauer und Emily Payne<br />
Doktorandinnen Immunbiologie<br />
Endlich Zeit für das Warum<br />
Klinik oder Forschung? «Beides!», sagen die Medizinerinnen<br />
Emily Payne und Anna Joachimbauer und konzentrieren sich<br />
nun ganz auf ihre wissenschaftliche Arbeit. Sie tun es mit Blick<br />
auf den Klinikalltag.<br />
Emily Payne:<br />
Mehr Spielraum zum Gestalten<br />
«Warum gehe ich als Ärztin in die Wissenschaft?<br />
Genau deswegen. Wegen des Warums.<br />
Im klinischen Alltag bleibt für das Warum viel zu<br />
wenig Zeit. Ich liebte meine Aufgabe als Assistenzärztin<br />
in der Klinik für Allgemeine Innere<br />
Medizin/Hausarztmedizin und Notfallmedizin.<br />
Aber ich habe rasch gemerkt, dass ich von beiden<br />
Welten etwas möchte: von der Forschung<br />
und von der Klinik.<br />
«Forschung und Klinik<br />
gehören zusammen.»<br />
Forschung lässt sich nicht nebenbei betreiben.<br />
Man muss sich tief in die Materie hineinversetzen,<br />
Methoden kennenlernen, sie richtig anwenden<br />
können. Wenn man das mal beherrscht<br />
und eine gewisse Routine entwickelt hat, ist es<br />
wohl eher möglich, die Forschung in den Klinikalltag<br />
zu integrieren.<br />
Als Ärztin möchte ich beidem gerecht werden: den wissenschaftlichen<br />
Fragen und der Sicherheit der Patientinnen und<br />
Patienten. Forschung und Klinik gehören in der Medizin zusammen,<br />
und St.Gallen bietet da viele Möglichkeiten – bereits jetzt,<br />
nach nur zwei Monaten, betreue ich spannende Fälle mit Bezug<br />
zur Klinik. Aktuell entwickle ich einen Suchtest, der Antikörper<br />
im Blut erfassen kann. Auf das Auswerten der Daten mit statistischen<br />
Methoden freue ich mich heute schon.<br />
Ich geniesse es, im Labor Experimente strukturiert anzugehen.<br />
Trotz dieser Struktur bleibt viel Spielraum zum Selbergestalten.<br />
Anders als in der Klinik kann ich in der Forschungsarbeit mehr<br />
eigene Ideen vorantreiben. Es ist ein gutes Gefühl zu sagen: Das<br />
hier ist mein eigenes Projekt, das ich zusammen mit dem Team<br />
entwickelt habe.<br />
Unser Team ist toll, wir stehen zusammen, für uns alle hat Qualität<br />
Priorität, und jede und jeder unterstützt auch die Projekte der<br />
anderen, wir wollen vorankommen, die Medizin weiterentwickeln.<br />
In der Klinik sieht man schneller einen Erfolg, die Forschungsarbeit<br />
braucht Geduld. Das Warum lässt sich nicht an einem Tag<br />
beantworten.»<br />
82 Interview
Anna Joachimbauer:<br />
Zwei Welten zusammenbringen<br />
«Forschung hat mich schon im Studium begeistert.<br />
Trotzdem entschied ich mich zunächst<br />
für die Klinik. Meine Aufgaben in der Klinik waren<br />
durchaus interessant, nur: Ich wandte an,<br />
was bereits bekannt war, aber mein Beitrag zur<br />
Weiterentwicklung der Medizin fehlte. Mir<br />
wurde bewusst, wie wichtig es für mich ist,<br />
selber etwas beizutragen.<br />
Ich sehe mich in der Translation: Ich finde die<br />
Klinikarbeit spannend, ich finde Forschung<br />
spannend, und ich erlebte in den drei Jahren<br />
am Medizinischen Forschungszentrum immer<br />
wieder, wie wichtig der Austausch zwischen<br />
Wissenschaft und Klinik ist.<br />
«Forschung hat mich schon<br />
im Studium begeistert.»<br />
Im Moment konzentriere ich mich in meiner Forschungsarbeit<br />
auf die Verbesserung der Diagnostik bei Herzmuskelentzündungen.<br />
Davon sind vor allem junge Menschen betroffen. Bei 20 bis<br />
30 Prozent entwickelt sich in der Folge eine chronische Entzündung<br />
– was oft erst bemerkt wird, wenn die Erkrankung bereits<br />
zu einer dauerhaften Schädigung des Herzens geführt hat. Das<br />
Ziel ist es, gefährdete Personen früh herauszufiltern, um dem<br />
Krankheitsverlauf rechtzeitig entgegenwirken zu können. In zwei<br />
Projekten parallel forsche ich an einem Diagnoseverfahren zur<br />
verbesserten Diagnose der Herzmuskelentzündung.<br />
«In der Klinik fehlte mir etwas.»<br />
Am meisten mag ich die Datenanalyse nach einem Experiment:<br />
Das ist wie ein Integrationsprozess, ich kann alles Revue passieren<br />
lassen und nochmals in Ruhe durchgehen. Zeit und<br />
Ruhe – diese zwei Privilegien der Forschung schätze ich nach<br />
der Klinikzeit besonders.»<br />
In St.Gallen funktioniert dieser Transfer recht<br />
gut, weil es hier überschaubar und persönlich<br />
ist. Doch oft fehlt die Zeit dafür, die Kliniktage<br />
sind durchgetaktet, man funktioniert. Deshalb<br />
baue ich mir jetzt meine Forschungsgrundlage<br />
auf. Das sehe ich als Investition für die Basis<br />
meiner künftigen Arbeit in der Klinik. Denn mit<br />
dieser Grundlage im Gepäck kann die Balance<br />
zwischen Forschung und Klinik eher gelingen.<br />
Interview 83
v.l.n.r.: Orlando Burkhardt, Manolis Pratsinis, Daniel Engeler<br />
Experimentelle Urologie<br />
Die Experimentelle Urologie, integriert in die<br />
Klink für Urologie, widmet sich den wissenschaftlichen<br />
Untersuchungen im Bereich der<br />
Erkrankungen der Harn- und männlichen<br />
Geschlechtsorgane. Unsere Forschungsaktivitäten<br />
konzentrieren sich sowohl auf translationale<br />
Studien als auch auf die Grundlagenforschung,<br />
mit dem Ziel, ein tieferes Ver ständnis<br />
der physiologischen Prozesse, Patho logien und<br />
Behandlungsmöglichkeiten zu erlangen. In enger<br />
Zusammenarbeit mit dem Medizinischen<br />
Forschungszentrums, insbesondere den Mitarbeitenden<br />
der Clinical Trials Unit, sowie in<br />
Kooperation mit nationalen und internationalen<br />
Partnern wie der Empa, der Universität<br />
Zürich, der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft<br />
für Klinische Krebsforschung und der<br />
Europäischen Gesellschaft für Urologie wird an<br />
verschiedenen Projekten gearbeitet. Diese zum<br />
Teil langfristig angelegten Studien versprechen<br />
in den nächsten Jahren bedeutende Ergebnisse<br />
und neue Erkenntnisse. Ein Beispiel hierfür<br />
ist eine Studie, in der verschiedene Behandlungen<br />
und ihre Wirksamkeit bei gut -<br />
artiger Prostatavergrösserung untersucht wurden. Dafür wurde<br />
vor mehr als zehn Jahren mit der Rekrutierung von Patienten<br />
für die randomisierte kontrollierte Studie begonnen. Inzwischen<br />
konnten die Kurz-, Mittel- und Langzeitergebnisse in renommierten<br />
Fachzeitschriften publiziert werden. In diesem<br />
langfristig an gelegten Forschungsprogramm können weitere<br />
Unterprojekte angegangen werden, z. B. zu neuen Therapieoptionen<br />
bei der gutartigen Prostatavergrösserung sowie zum<br />
Stellenwert der Prostataembolisation beim Prostatakarzinom.<br />
Experimentelle Urologie<br />
PD Dr. Daniel Engeler<br />
Dr. Manolis Pratsinis, M.Sc.<br />
Dr. Orlando Burkhardt<br />
Sigrid Patzl<br />
Chefarzt, Klinik für Urologie,<br />
Gruppenleiter, Experimentelle Urologie<br />
Leitender Arzt, Klinik für Urologie<br />
Wissenschaftler, Experimentelle Urologie<br />
Oberarzt, Klinik für Urologie<br />
Wissenschaftler, Experimentelle Urologie<br />
Studienkoordinatorin<br />
Forschungsprojekte und klinische Studien<br />
Die folgenden Forschungsprojekte waren in den Jahren 2022<br />
und 2023 aktiv. Weitere Details zu den Projekten sind in der<br />
Forschungs- und Studiendatenbank des Kantonspitals St.Gallen<br />
zu finden.<br />
84 Experimentelle Urologie
Das BPH-Register: Prospektiv geführte Kohortenstudie bei<br />
Männern mit benigner Prostatahyperplasie.<br />
Hauptantragsteller: Manolis Pratsinis<br />
Seit 2017 werden alle Patienten, die im Kantonsspital St.Gallen<br />
wegen einer BPH operiert werden, prospektiv im BPH-Register<br />
erfasst. Bisher wurden 900 Patienten eingeschlossen, unabhängig<br />
von der Operationsmethode. Mit Hilfe dieses Registers<br />
können die verschiedenen Behandlungen im Kurz- und<br />
Langzeit verlauf verglichen werden. Diese Daten sind unerlässlich<br />
für die Planung und Entwicklung weiterer Studien (siehe<br />
«ATHLETE-Studie»). Darüber hinaus ermöglicht die umfassende<br />
Datenerhebung mit dem Schwerpunkt auf «patientreported<br />
outcome measures» den Vergleich der erfassten<br />
Endpunkte.<br />
ATHLETE-Studie<br />
Blumenau-Léonie-Hartmann Stiftung<br />
CHF 177’282<br />
Hauptantragsteller: Daniel Engeler<br />
Die Aquablation wird bei der chirurgischen Behandlung der<br />
gutartigen Prostatavergrösserung eingesetzt, um Prostatagewebe<br />
unter Echtzeit-Ultraschallbildgebung in Kombination mit<br />
einem robotergestützten Hochdruckwasserstrahl zu resezieren.<br />
Die ATHLETE-Studie vergleicht die Aquablation mit dem etablierten<br />
HoLEP-Verfahren. In dieser randomisierten kontrollierten<br />
Studie wird untersucht, ob die Aquablation bei Patienten mit<br />
vergrösserter Prostata der HoLEP hinsichtlich Wirksamkeit und<br />
Sicherheit gleichwertig ist.<br />
Prospektive Kohortenstudie für das Prostatakarzinom –<br />
Aufbau einer Biobank<br />
Forschungsförderung Kantonsspital St.Gallen, Schweizerische<br />
Arbeitsgemeinschaft für Klinische Krebsforschung<br />
Multicenter Studie; SAKK-Projekt 63/12<br />
Hauptantragsteller: Daniel Engeler<br />
Das Ziel dieses Projektes ist der Aufbau einer umfassenden<br />
longitudinalen Biobank zur Erforschung verschiedener diagnostischer,<br />
prognostischer und prädiktiver Biomarker des<br />
Prostatakarzinoms. Derzeit liegen Proben und klinische Daten<br />
von über 1’200 Patienten vor, die multizentrisch gesammelt<br />
wurden. Basierend auf diesen Proben sind derzeit mehrere<br />
Teilprojekte zu Biomarkern in den verschiedenen Stadien des<br />
Prostatakarzinoms geplant oder bereits angelaufen.<br />
Prostatic Artery Embolization in Patients with Prostate Cancer<br />
Hauptantragsteller: Orlando Burkhardt<br />
Die Prostataembolisation ist eine weltweit angewandte Methode<br />
zur Behandlung der gutartigen Prostatavergrösserung.<br />
Trotz der sicheren Durchführbarkeit der Prostataembolisation<br />
bei fortgeschrittenem oder lokalisiertem Prostatakarzinom ist<br />
der onkologische Nutzen aufgrund des nicht reproduzierbaren<br />
Tumoransprechens und des Fehlens prospektiv randomisierter<br />
Studien umstritten. An der Klinik für Urologie des Kantonsspitals<br />
St.Gallen wird eine prospektive Pilotstudie zur Prostataembolisation<br />
bei Patienten mit fortgeschrittenem Prostatakarzinom<br />
durchgeführt.<br />
bTUNED-Studie<br />
Multizentrische Studie (Zentren in Belgien,<br />
Brasilien, und der Schweiz)<br />
Hauptantragsteller: Daniel Engeler<br />
Für Patienten mit neurologischen Erkrankungen<br />
stellt die häufig vorhandene Nervenfunktionsstörung<br />
des unteren Harntraktes eine<br />
erhebliche Einschränkung der Lebensqualität<br />
dar. Die Nervenstimulation durch die Haut ist<br />
eine nicht-invasive Behandlungsmethode,<br />
deren Wirksamkeit und Sicherheit durch randomisierte<br />
kontrollierte Studien belegt ist.<br />
Eine aktuelle multizentrische Studie (bTU-<br />
NED) untersucht die Wirksamkeit dieser Nervenstimulation<br />
bei unkontrollierter Blasenaktivität.<br />
Personalisierung der Blasenkrebstherapie<br />
anhand von Unterschieden im Mikrobiom der<br />
Blase und von Stuhlproben. SILENT-EMPIRE-<br />
Studie<br />
Multizentrisch (Universitätsspital Zürich,<br />
Universität Zürich, Kantonsspital St.Gallen)<br />
2023 – 2024<br />
Hauptantragsteller: Daniel Engeler<br />
Bei nicht-muskelinvasivem Blasenkrebs mit<br />
Risiko für ein Fortschreiten der Erkrankung<br />
wird nach der Operation in der Regel eine<br />
Erhaltungstherapie mit einem Immunmedikament<br />
durchgeführt. In dieser multizentrischen<br />
Studie wird das Mikrobiom im Stuhl und in der<br />
Blase vor Beginn der Therapie untersucht, um<br />
den Therapieerfolg abzuschätzen. Um die Unterschiede<br />
und den Einfluss des Mikrobioms<br />
auf das Ansprechen auf diese Therapie zu verstehen,<br />
werden klinische Daten, Blut-, Urinund<br />
Stuhlproben sowie Proben aus Operationspräparaten<br />
von Patienten analysiert.<br />
Prospektive Kohortenstudie Studie zur universellen<br />
Früherkennung von Krebs<br />
Forschungskollaboration: Kantonsspital St.<br />
Gallen und Industriepartner 4D Lifetec AG<br />
Hauptantragsteller: Daniel Engeler<br />
Eine wachsende Zahl von Studien hat gezeigt,<br />
dass die Anhäufung von DNA-Schäden und<br />
DNA-Reparaturdefizite in Blutzellen zwei gemeinsame<br />
Befunde bei Krebspatienten sind,<br />
und zwar unabhängig von der Krebsart. Mit<br />
einem neu entwickelten, hoch standardisierten<br />
Single-Cell-Gel-Elektrophorese-Assay<br />
wird die DNA-Schädigung von Blutzellen auf<br />
Einzelzellebene bei Krebspatienten und gesunden<br />
Probanden gemessen und die Aussagekraft<br />
für die Krebsfrüherkennung im Rahmen<br />
einer Phase-2-Studie evaluiert.<br />
Experimentelle Urologie 85
Veröffentlichungen<br />
Die folgenden Originalarbeiten wurden in den Jahren 2022 und<br />
2023 veröffentlicht:<br />
Originalarbeiten<br />
1. Aeppli S, Engeler DS, Fischer S, Omlin A, Pratsinis M, Hermann C, Rothermundt<br />
C. Incidence and outcome of patients with renal cell carcinoma treated with<br />
partial or radical nephrectomy in the Cantons St Gallen and Appenzell<br />
2009 – 2018. Swiss Med Wkly. 2022, 152: w30175.<br />
2. Parsons BA, Baranowski AP, Berghmans B, Borovicka J, Cottrell AM, Dinis-Oliveira<br />
P, Elneil S, Hughes J, Messelink BEJ, De CWaC, Abreu-Mendes P, Zumstein<br />
V, Engeler DS. Management of chronic primary pelvic pain syndromes. BJU Int.<br />
2022, 129: 572 – 581.<br />
3. Pratsinis M, Fankhauser C, Pratsinis K, Beyer J, Bührer E, Cathomas R, Fischer<br />
N, Hermanns T, Hirschi-Blickenstorfer A, Kamradt J, Alex Kluth L, Zihler D, Mingrone<br />
W, Müller B, Nestler T, Rothschild SI, Seifert B, Templeton AJ, Terbuch A,<br />
Ufen MP, Woelky R, Gillessen S, Rothermundt C. Metastatic Potential of Small<br />
Testicular Germ Cell Tumors: Implications for Surveillance of Small Testicular<br />
Masses. Eur Urol Open Sci. 2022, 40: 16 – 18.<br />
4. Rentsch CA, Thalmann GN, Lucca I, Kwiatkowski M, Wirth GJ, Strebel RT, Engeler<br />
D, Pedrazzini A, Hüttenbrink C, Schultze-Seemann W, Torpai R, Bubendorf<br />
L, Wicki A, Roth B, Bosshard P, Püschel H, Boll DT, Hefermehl L,<br />
Roghmann F, Gierth M, Ribi K, Schäfer S, Hayoz S. A Phase 1/2 Single-arm<br />
Clinical Trial of Recombinant Bacillus Calmette-Guérin (BCG) VPM1002BC<br />
Immunotherapy in Non-muscle-invasive Bladder Cancer Recurrence After<br />
Conventional BCG Therapy: SAKK 06/14. Eur Urol Oncol. 2022, 5: 195 – 202.<br />
5. Abreu-Mendes P, Baranowski AP, Berghmans B, Borovicka J, Cottrell AM,<br />
Dinis-Oliveira P, Elneil S, Hughes J, Messelink BEJ, Tidman V, Pinto R, Tornic<br />
J, Flink I, Parsons BA, Zumstein V, Engeler DS. Myofascial Pelvic Pain: Best<br />
Orientation and Clinical Practice. Position of the European Association of<br />
Urology Guidelines Panel on Chronic Pelvic Pain. Eur Urol Focus. 2023, 9:<br />
172 – 177.<br />
6. Burkhardt O, Abt D, Engeler D, Schmid HP, Müllhaupt G, Zumstein V. Prostatic<br />
Artery Embolization in Patients with Prostate Cancer: A Systematic Review.<br />
Eur Urol Focus. 2023.<br />
7. Burkhardt O, Schmid HP, Engeler D, Zumstein V. Ventral-inlay buccal mucosal<br />
graft urethroplasty in a 44-year old female patient with recurrent urethral<br />
stricture. J Surg Case Rep. 2023, 2023: rjad025.<br />
8. Lyatoshinsky P, Pratsinis M, Markert E, Schmid HP, Müllhaupt G. Spindle<br />
cell/pleomorphic lipoma of the seminal vesicle: First description of a rare<br />
benign mesenchymal tumor. Urol Case Rep. 2023, 47: 102337.<br />
9. Monda S, Pratsinis M, Lui H, Noel O, Chandrasekar T, Evans CP, Dall’era MA.<br />
Secondary Bladder Cancer After Prostate Cancer Treatment: An Age-matched<br />
Comparison Between Radiation and Surgery. Eur Urol Focus. 2023.<br />
10. Monda SM, Lui HT, Pratsinis MA, Chandrasekar T, Evans CP, Dall’era MA. The<br />
Metastatic Risk of Renal Cell Carcinoma by Primary Tumor Size and Subtype.<br />
Eur Urol Open Sci. 2023, 52: 137 – 144.<br />
11. Pratsinis M, Müllhaupt G, Güsewell S, Betschart P, Zumstein V, Engeler D, Schmid<br />
HP, Lamb AD, Abt D. Comparison of traditional outcome measures and self-assessed<br />
goal achievement in patients treated surgically for benign prostatic hyperplasia.<br />
World J Urol. 2023, 41: 1125 – 1131.<br />
12. Stalder SA, Gross O, Anderson CE, Bachmann LM, Baumann S, Birkhäuser V,<br />
Bywater M, Del Popolo G, Engeler DS, Agrò EF, Friedl S, Grilo N, Kiss S, Koschorke<br />
M, Leitner L, Liechti MD, Mehnert U, Musco S, Sadri H, Stächele L, Tornic J, Van<br />
Der Lely S, Wyler S, Kessler TM. bTUNED: transcutaneous tibial nerve stimulation<br />
for neurogenic lower urinary tract dysfunction. BJU Int. 2023, 132:<br />
343 – 352.<br />
Übersichtsarbeiten<br />
1. Omlin A, Pratsinis M, Stoll S, Riniker S, Hess Soom J, Förbs D, Padberg Sgier B,<br />
Azzarello-Burri S, Rothermundt C. Molekulargenetik und Molekularpathologie<br />
beim Prostatakarzinom. Swiss Medical Forum, 2022, doi: 10.4414/<br />
smf.2022.08858<br />
2. Liechti MD, Van Der Lely S, Knüpfer SC, Abt D, Kiss B,<br />
Leitner L, Mordasini L, Tornic J, Wöllner J, Mehnert U,<br />
Bachmann LM, Burkhard FC, Engeler DS, Pannek J,<br />
Kessler TM. Sacral Neuromodulation for Neurogenic<br />
Lower Urinary Tract Dysfunction. NEJM Evid. 2022, 1:<br />
EVIDoa2200071.<br />
3. Parsons BA, Goonewardene S, Dabestani S, Pacheco-<br />
Figueiredo L, Yuan Y, Zumstein V, Cottrell AM, Borovicka<br />
J, Dinis-Oliveira P, Berghmans B, Elneil S, Hughes J,<br />
Messelink BEJ, De CWaC, Baranowski AP, Engeler DS.<br />
The Benefits and Harms of Botulinum Toxin-A in the<br />
Treatment of Chronic Pelvic Pain Syndromes: A Systematic<br />
Review by the European Association of Urology<br />
Chronic Pelvic Pain Panel. Eur Urol Focus. 2022, 8:<br />
320 – 338.<br />
4. Pratsinis M, Rothermundt C, Fankhauser C. Reply to<br />
Julian Chavarriaga and Robert Hamilton’s Letter to<br />
the Editor re: Manolis Pratsinis, Christian Fankhauser,<br />
Katerina Pratsinis, et al. Metastatic Potential of Small<br />
Testicular Germ Cell Tumors: Implications for Surveillance<br />
of Small Testicular Masses. Eur Urol Open<br />
Sci 2022;40:16-8. Should We Be Afraid of Surveillance?<br />
Clinically Meaningful Reasons Why Offering<br />
Surveillance for Incidentally Detected Small Testicular<br />
Masses Remains a Safe Approach. Eur Urol Open Sci.<br />
2022, 45: 52.<br />
5. Templeton AJ, Omlin A, Berthold D, Beyer J, Burger IA,<br />
Eberli D, Engeler D, Fankhauser C, Fischer S, Gillessen S,<br />
Nicolas G, Kroeze S, Lorch A, Müntener M, Papachristofilou<br />
A, Schaefer N, Seiler D, Stenner F, Tsantoulis P,<br />
Vlajnic T, Zilli T, Zwahlen D, Cathomas R. Interdisciplinary<br />
Swiss consensus recommendations on staging and<br />
treatment of advanced prostate cancer. Swiss Med<br />
Wkly. 2023, 153: 40108.<br />
6. Zumstein V, Parsons BA, Dabestani S, Baranowski AP,<br />
Tidman V, Berghmans B, Borovicka J, Cottrell AM, Dinis-<br />
Oliveira P, Elneil S, Hughes J, Messelink BEJ, Abreu-<br />
Mendes P, Sacks B, Yuan Y, Engeler DS. The Benefits and<br />
Harms of Pharmacological Treatment for Postradiation<br />
Pelvic Pain: A Systematic Review by the European Association<br />
of Urology Chronic Pelvic Pain Panel with<br />
Recommendations for Clinical Practice. Eur Urol Open<br />
Sci. 2023, 56: 29 – 38.<br />
7. Tornic J, Engeler D. Latest insights into the pathophysiology<br />
of bladder pain syndrome/interstitial cystitis.<br />
Curr Opin Urol. 2024, 34: 84 – 88.<br />
Abschlussarbeiten<br />
Doktorarbeiten<br />
1. Rüedi G. Predicting Functional Urinary Outcomes following<br />
Low-Dose Rate Brachytherapy for Prostate Cancer.<br />
Betreut durch Engeler D.<br />
2. Hecker M. Long-term correlation of traditional outcome<br />
measures and self-assessed goal achievement in<br />
patients treated surgically for benign prostatic hyperplasia.<br />
Betreut durch Pratsinis M.<br />
Masterarbeiten<br />
1. Schubiger F. Classification of residual fragments after<br />
intrarenal surgery (CORFIS). Betreut durch Burkhard O.<br />
2. Geisser V. Behandlung der benignen Prostatahyperplasie<br />
mittels Prostata arterienembolisation: Auswertung eines<br />
prospektiven BPH-Registers. Betreut durch Engeler D.<br />
86 Experimentelle Urologie
Experimentelle Urologie 87
Weiterbildung und universitäre Ausbildung<br />
• Seminarreihen des Medizinischen Forschungszentrums<br />
• Weiterbildungen der Clinical Trials Unit<br />
• Universitäre Kurse und Seminare<br />
88 Xxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxx 89
Seminarreihen des Medizinischen<br />
Forschungszentrums<br />
Experimentelle Medizin<br />
2022<br />
21.02. Prof. Ivan Maillard, University of Pennsylvania<br />
Perelman School of Medicine<br />
Therapeutic Targeting of Notch Signaling: From<br />
Cancer to Inflammatory Disorders.<br />
14.04. Prof. Dr. Nicole Joller, Institut für Experimentelle<br />
Immunologie, Universität Zürich<br />
Regulation and control of antiviral immunity.<br />
29.04. Dr. Jovana Cupovic, Max-Planck-Institut für<br />
Immunbiologie und Epigenetik, Freiburg<br />
Metabolic reprogramming of fibroblastic reticular<br />
cells<br />
13.05. Prof. Dr. Mark Robinson, Department of Molecular<br />
Life Sciences, Universität Zürich<br />
20.05. Dr. Leslie Cooper, Mayo Clinic, Jacksonville,<br />
USA<br />
Diagnosis and treatment of myocarditis.<br />
25.05. Prof. Alexander Poltorak, Tufts University<br />
School of Medicine, Boston<br />
Basic mechanisms underlying innate immunity.<br />
25.11. Prof. Dr. Christoph Schneider, Peter Hans<br />
Hofschneider Stiftungsprofessur, Institut of<br />
Physiology, University of Zurich<br />
Tuft cell – immune cell interaction.<br />
2023<br />
31.01. Prof. Dr. Annette Oxenius, Institute of Microbiology,<br />
ETH Zürich<br />
Pathology and Persistence of Cytomegalovirus<br />
Infection<br />
10.03. Prof. Dr. Marco Prinz, Institut für Neuropathologie,<br />
Universität Freiburg<br />
Myeloid cell activity in the diseased central nervous<br />
system<br />
09.06. PD Dr. med. Héctor Rodriguez Cetina Biefer,<br />
Forschung Herzchirurgie USZ<br />
NAD+ in cardiac metabolism<br />
29.06. Prof. Stephane Heymans, Department of Cariology,<br />
Maastricht University<br />
Precision Phenotyping of Dilated Cardiomyopathy<br />
08.09. Dr. Johannes Soeding, Quantitative and Computational<br />
Biology, Max Planck Institute, Göttingen<br />
Software tools for protein structure and sequence<br />
searching<br />
27.10. Dr. Amelieke Cremers, Department of Fundamental<br />
Microbiology, University of Lausanne<br />
Pneumococcal behavior in human sepsis<br />
Work in Progress<br />
Das «Work in Progress» Seminar wurde 2021<br />
ins Leben gerufen, um den wissenschaftlichen<br />
und technologischen Austausch der einzelnen<br />
Arbeitsgruppen zu fördern. In den Jahren<br />
2022 und 2023 wurden 16 Seminare durchgeführt<br />
bei denen jeweils zwei Forschende aus<br />
unterschiedlichen Forschungsgruppen ihre<br />
Ergebnisse präsentierten.<br />
Klinisches Forschungsseminar<br />
Von und für klinisch Forschende. Aktuelle<br />
Forschungsprojekte werden von Forschenden<br />
des Kantonsspitals St.Gallen und externen<br />
Gästen vorgestellt.<br />
2023<br />
15.02. Nina Wyss, Experimentelle Dermatologie,<br />
Kantonsspital St.Gallen<br />
Autoimmunity against surfactant protein B (SP-<br />
B) drives immune checkpoint inhibitor-related<br />
pneumonitis.<br />
15.03. Dr. Nicole Graf, Clinical Trials Unit, Kantonsspital<br />
St.Gallen<br />
Analysing composite endpoints: Introduction to<br />
the win statistics approach.<br />
26.04. PD Dr. Marian Neidert, Klinik für Neurochirurgie,Kantonsspital<br />
St.Gallen<br />
Microbial Peptides Activate Tumor-Infiltrating<br />
Lymphocytes in Glioblastoma.<br />
10.05. Dr. Tim Fischer, Radiologie und Nuklearmedizin,<br />
Kantonsspital St.Gallen<br />
MRI in musculoskeletal Radiology.<br />
14.06. Dr. Joel Dütschler, Klinik für Gastroenterologie<br />
und Hepatologie, Kantonsspital St.Gallen<br />
Responses to SARS-CoV-2 immunisation in patients<br />
with inflammatory bowel diseases.<br />
16.08. Dr. Hans Ebinger, Innovationspark Ost, Dr.<br />
Marcia Nissen, HSG School of Medicine<br />
Digital Therapeutics for Healthy Longevity –<br />
Program for the collaboration between HSG,<br />
Empa, KSSG and Innovationspark Ost.<br />
13.09. PD Dr med. Dr. rer. nat. Philip Broser, Neurophysiologie,<br />
Ostschweizer Kinderspital<br />
Insights from quantum technology based paediatric<br />
neurophysiology investigations – paving<br />
the way for new treatments.<br />
18.10. Dr. Timur Yurttas, Anästhesiologie/Intensivmedizin,<br />
Kantonsspital St.Gallen<br />
Studies in perioperative medicine: results of the<br />
COALAS trial (systemic lidocaine as an adjunctive<br />
analgesic in bariatric surgery) and preview of the<br />
COLCAT trial (colchicine in patients at cardiac<br />
risk undergoing major noncardiac surgery).<br />
15.11. Dr. Manolis Pratsinis, Urologie, Kantonsspital<br />
St.Gallen<br />
Goal attainment scaling in men treated surgically<br />
for benign prostatic hyperplasia: what<br />
really matters.<br />
90 Weiterbildung und universitäre Ausbildung
Weiterbildungen der<br />
Clinical Trials Unit<br />
Netzwerk Klinische Studien<br />
Die Clinical Trials Unit möchte die Vernetzung<br />
und Kommunikation aller Mitarbeiterinnen<br />
und Mitarbeiter im Bereich der klinischen<br />
Forschung fördern. Zu diesem Zweck wurde<br />
eine Veranstaltungsreihe ins Leben gerufen,<br />
die allen Interessierten offensteht. In den Berichtsjahren<br />
wurden folgende Seminare<br />
durchgeführt.<br />
2022<br />
30.03. Das IRONMAN-Register: Eine inernationale<br />
Kohorten-Studie und ihre Herausforderungen<br />
PD Dr. Aurelius Omlin, Onkologie/Hämatologie,<br />
Dr. Simone Kälin, Clinical Trials Unit<br />
Neue Forschungsdatenbank des KSSG: alles<br />
über die Forschungsaktivitäten an einem Ort –<br />
benutzerfreundlich und aktuell<br />
Dr. Reinhard Maier, Clinicla Trials Unit, Dr. sc.<br />
Mila Trtikova, Medizinisches Forschungszentrum<br />
Newsletter Clinical Trails Unit<br />
Im halbjährlich verschickten Newsletter liefert<br />
die CTU wichtige Informationen zur Planung<br />
und Durchführung von klinischen Studien. Anund<br />
Abmeldung kann über das Sekretariat der<br />
CTU erfolgen.<br />
Kurse<br />
Um den Schutz der Studienteilnehmenden<br />
und eine hohe Qualität in klinischen Studien<br />
zu gewährleisten, sind fachgerechte Kenntnisse<br />
und die durchgehende Einhaltung der<br />
nationalen Gesetzgebung sowie internationaler<br />
Standards, wie Good Clinical Practice,<br />
(GCP), erforderlich.<br />
Die CTU führt mehrere Kurse pro Jahr in<br />
«Good Clinical Practice» sowie « Good Clinical<br />
Practice Refresher» durch.<br />
22.06 Neue Technologien bei älteren Menschen. Wie<br />
ist der aktuelle Stand?<br />
PD Dr. Thomas Münzer, Geriatrische Klinik<br />
St.Gallen<br />
Der einfache Guide für klinische Studien (Easy-<br />
GCS)<br />
Dr. Synove Otterbech, Clinical Trials Unit<br />
07.09 Digitale Gesundheitsversorgung – von der Therapie<br />
zur Prävention<br />
Prof. Dr. med. Christiane Brockes, CEO alcare<br />
AG, Professorin UZH<br />
Untersuchung von Biomarker der Alzheimer<br />
Demenz: Die A3BAD-Studie<br />
Thomas Schneider, Neurologie KSSG<br />
30.11. REDcap: Neue Möglichkeiten der Datenerfassung<br />
am KSSG<br />
André Höpli, Clinical Trials Unit<br />
Das Medizinische Forschungszentrum am KSSG<br />
Prof. Dr. Ludewig Burkhard, Leiter <strong>MFZ</strong><br />
2023<br />
29.03. SCTO Aufgaben, Plattform und Ressourcen<br />
Pascale Wenger, SCTO<br />
Patient and Public Involvement (PPI)<br />
Tamara Kohler, SCTO<br />
21.06. Spitalpharmazie inklusive Rundgang<br />
Dr. Daniel Fetz, Leiter Spitalpharmazie, Michael<br />
Hilty, Projektleiter, Katharina Enghofer, Apothekerin<br />
Herstellung<br />
20.09. Das Schweizer Trauma-Register am KSSG<br />
Dr. Christian Maschmann, Notfallzentrum<br />
Einführung von digitalen PROMs am KSSG<br />
Khaula Rajab, Projektleitung Medizin Informatik,<br />
Dr. Karlmeinrad Giesinger, Orthopädie und Traumatologie<br />
Weiterbildung und universitäre Ausbildung 91
Universitäre Kurse und Seminare<br />
2022<br />
FS<br />
Universität Zürich<br />
HS<br />
Universität Zürich<br />
Klinischer Kurs Innere Medizin – St.Galler Track<br />
INNST201, 2022-02-01 2022-07-31, Werner<br />
Albrich<br />
Mantelstudium: Grundlagen des wissenschaftlichen<br />
Arbeitens («St.Galler Track») 19MAS400,<br />
2022-02-01 2022-07-31, Antonio Cozzio<br />
Poliklinische Visite DER0M040, 2022-09-19<br />
2022-12-08, Antonio Cozzio<br />
Dermatologie und Venerologie – klinische Aspek -<br />
te für Studierende der Medizin und Assistenzärzte<br />
DER0M080, 2022-09-22 2022-11-17,<br />
Antonio Cozzio<br />
Themenblock Infekt, Abwehr & Systemerkrankungen<br />
TBL3016, 2022-02-01 2022-07-31,<br />
Antonio Cozzio<br />
Klinische-pathologische Gegenüberstellung in<br />
der Dermatopathologie DER17007, 2022-08-01<br />
2023-01-31, Antonio Cozzio<br />
Themenblock Haut TBL4140, 2022-02-01 2022-<br />
07-31, Antonio Cozzio<br />
Poliklinische Visite DER0M040, 2022-02-21<br />
2022-05-20, Antonio Cozzio<br />
Dermatologie und Venerologie – klinische Aspek<br />
te für Studierende der Medizin und Assistenzärzte<br />
DER0M080, 2022-02-24 2022-05-05,<br />
Antonio Cozzio<br />
Klinische-pathologische Gegenüberstellung in<br />
der Dermatopathologie DER17007, 2022-02-01<br />
2022-07-31, Antonio Cozzio<br />
Klinische-pathologische Gegenüberstellung in<br />
der Dermatopathologie DER17007, 2022-02-01<br />
2022-07-31, Antonio Cozzio<br />
Prostate cancer: from bench to bedside BME328,<br />
2022-04-08 2022-05-11 Blockkurs (8.4. – 11.5.),<br />
Daniel Engeler<br />
Klinisch-dermatopathologische Fallbesprechungen<br />
DER21003, 2022-08-01 2023-01-31, Antonio<br />
Cozzio<br />
Translationelle Dermatologie und Forschungskolloquium<br />
DER21004, 2022-08-01 2023-01-31,<br />
nach Ankündigung Antonio Cozzio<br />
Assistenten/Studierenden Kolloquium II Dermatologie,<br />
Venerologie, Allergologie DER21005,<br />
2022-08-01 2023-01-31, Antonio Cozzio<br />
Assistenten/StudierendenKolloquium I Dermatologie,<br />
Venerologie DER21006, 2022-08-01<br />
2023-01-31, Antonio Cozzio<br />
Klinische Aspekte Dermatologie/Allergologie<br />
für Studierende der Medizin DER21007, 2022-<br />
08-01 2023-01-31, Antonio Cozzio<br />
Klinisches Seminar Urologie CHI18002, 2022-<br />
08-01 2023-01-31, Daniel Engeler<br />
Themenblock Niere, Elektrolyte und Wasserhaushalt<br />
TBL4130, 2022-02-01 2022-07-31,<br />
Daniel Engeler<br />
Chirurgische Visite im Kantonsspital St.Gallen<br />
CHI601f, 2022-02-01 2022-07-31, Daniel Engeler<br />
Klinisches Seminar Urologie CHI18002, 2022-<br />
02-01 2022-07-31, Daniel Engeler<br />
Chirurgische Visite im Kantonsspital St.Gallen<br />
CHI601f, 2022-08-01 2023-01-31, Daniel Engeler<br />
Cancer and the immune system BIO251, 2022-<br />
09-20 2022-12-20 Di 10:15-12:00, Lukas Flatz<br />
Klinischer Kurs Ophthalmologie, im Universitätsspital<br />
Zürich KUR416S, 2022-08-01 2023-01-31,<br />
Christian Kahlert<br />
Klinischer Kurs Chirurgie – St.Galler Track<br />
CHIST201, 2022-02-01 2022-07-31, Daniel<br />
Engeler<br />
Klinischer Kurs Neurologie und Neurochirurgie,<br />
im Kantonsspital St.Gallen KUR416DH, 2022-08-<br />
01 2023-01-31, Marian Neidert<br />
Ophthalmologischer Kurs (Gruppenunterricht),<br />
im Universitätsspital Zürich OPH6010a, 2022-<br />
02-01 2022-07-31, Christian Kahlert<br />
Prostate cancer: from bench to bedside BME328,<br />
2022-04-08 2022-05-11 Blockkurs (8.4. – 11.5.),<br />
Burkhard Ludewig<br />
Research Internship Immunology BIO381, 2022-<br />
02-01 2022-07-31, Burkhard Ludewig<br />
Research Internship Immunology BIO381, 2022-<br />
08-01 2023-01-31, Burkhard Ludewig<br />
ETH<br />
551-1171-00L, Immunology: From Milestones to<br />
Current Topics, B. Ludewig, N. Pikor, L. Tortola,<br />
J. Kisielow, A. Oxenius, Uni-Dozierende<br />
Prostate cancer: from bench to bedside BME328,<br />
2022-04-08 2022-05-11 Blockkurs (8.4. – 11.5.),<br />
Elke Scandella-Grabher<br />
ETH<br />
551-0396-01L, Immunology I, A. Oxenius, B.<br />
Becher, M. Groettrup, M. Kopf, B. Ludewig, C.<br />
Münz, R. Spörri, M. van den Broek<br />
92 Weiterbildung und universitäre Ausbildung
2023<br />
FS<br />
Universität Zürich<br />
HS<br />
Universität Zürich<br />
Mantelstudium: Grundlagen des wissenschaftlichen<br />
Arbeitens («St.Galler Track») 19MAS400,<br />
2023-02-01 2023-07-31, Antonio Cozzio<br />
Themenblock Infekt, Abwehr & Systemerkrankungen<br />
TBL3016 2023-02-01, 2023-07-31,<br />
Antonio Cozzio<br />
Poliklinische Visite DER0M040, 2023-09-18<br />
2023-12-07 bis 7.12., Antonio Cozzio<br />
Dermatologie und Venerologie – klinische Aspek -<br />
te für Studierende der Medizin und Assistenzärzte<br />
DER0M080 2023-09-21 2023-11-16,<br />
Antonio Cozzio<br />
Themenblock Haut TBL4140, 2023-02-01<br />
2023-07-31, Antonio Cozzio<br />
Poliklinische Visite DER0M040, 2023-02-20<br />
2023-05-17, Antonio Cozzio<br />
Dermatologie und Venerologie – klinische Aspek -<br />
te für Studierende der Medizin und Assistenzärzte<br />
DER0M080, 2023-02-23 2023-04-27,<br />
Antonio Cozzio<br />
Klinische-pathologische Gegenüberstellung in<br />
der Dermatopathologie DER17007, 2023-02-01<br />
2023-07-31, Antonio Cozzio<br />
Klinische-pathologische Gegenüberstellung in<br />
der Dermatopathologie DER17007, 2023-02-01<br />
2023-07-31, Antonio Cozzio<br />
Prostate cancer: from bench to bedside BME328,<br />
2023-04-18 2023-05-10 Blockkurs (18.4. – 10.5.),<br />
Daniel Engeler<br />
Klinischer Kurs Chirurgie – St. Galler Track<br />
CHIST201, 2023-02-01 2023-07-31, Daniel<br />
Engeler<br />
Klinische-pathologische Gegenüberstellung in<br />
der Dermatopathologie DER17007, 2023-08-01<br />
2024-01-31, Antonio Cozzio<br />
Klinisch-dermatopathologische Fallbesprechungen<br />
DER21003, 2023-08-01 2024-01-31, Antonio<br />
Cozzio<br />
Translationelle Dermatologie und Forschungskolloquium<br />
DER21004, 2023-08-01 2024-01-31,<br />
Antonio Cozzio<br />
Assistenten/StudierendenKolloquium II Dermatologie,<br />
Venerologie, Allergologie DER21005,<br />
2023-08-01 2024-01-31, Antonio Cozzio<br />
Assistenten/Studierenden Kolloquium I Dermatologie,<br />
Venerologie DER21006, 2023-08-01<br />
2024-01-31, Antonio Cozzio<br />
Klinische Aspekte Dermatologie/Allergologie<br />
für Studierende der Medizin DER21007, 2023-<br />
08-01 2024-01-31, Antonio Cozzio<br />
Klinisches Seminar Urologie CHI18002, 2023-<br />
08-01 2024-01-31, Daniel Engeler<br />
Klinisches Seminar Urologie CHI18002, 2023-02-<br />
01 2023-07-31, Daniel Engeler<br />
Ophthalmologischer Kurs (Gruppenunterricht),<br />
im Universitätsspital Zürich OPH6010a, 2023-<br />
02-01 2023-07-31, Christian Kahlert<br />
Klinischer Kurs Ophthalmologie, im Universitätsspital<br />
Zürich KUR416S, 2023-08-01 2024-01-31,<br />
Christian Kahlert<br />
Research Internship Immunology BIO381, 2023-<br />
08-01 2024-01-31, Burkhard Ludewig<br />
Prostate cancer: from bench to bedside BME328,<br />
2023-04-18 2023-05-10 Blockkurs (18.4. – 10.5.),<br />
Burkhard Ludewig<br />
Research Internship Immunology BIO381, 2023-<br />
02-01 2023-07-31, Burkhard Ludewig<br />
ETH<br />
551-1171-00L, Immunology: From Milestones to<br />
Current Topics, B. Ludewig, N. Pikor, L. Tortola,<br />
J. Kisielow, A. Oxenius, Uni-Dozierende<br />
Prostate cancer: from bench to bedside BME328,<br />
2023-04-18 2023-05-10 Blockkurs (18.4. – 10.5.),<br />
Elke Scandella-Grabher<br />
ETH<br />
551-0396-01L, Immunology I, A. Oxenius, B.<br />
Becher, M. Kopf, B. Ludewig, C. Münz, R. Spörri,<br />
M. van den Broek<br />
Weiterbildung und universitäre Ausbildung 93
Ausblick:<br />
Forschungshaus 09<br />
Die Labore des Medizinischen Forschungszentrums<br />
befinden sich im Haus 09 des Kantonsspitals<br />
St.Gallen. Das Haus 09 wurde ursprünglich<br />
1960 als Schule für Pleoptik und Orthoptik<br />
erbaut. Mit dem Einzug der ehemaligen Laborforschungsabteilung<br />
im Jahre 1996 wurden<br />
einige Räume im dritten Obergeschoss als<br />
Forschungslabore eingerichtet. Mit der Eingliederung<br />
der Laborforschungsabteilung in<br />
das 2009 neu gegründete Medizinische Forschungszentrum<br />
wurde die Laborinfrastruktur<br />
im Haus 09 kontinuierlich erweitert und den<br />
Bedürfnissen einer modernen Forschungseinrichtung<br />
angepasst. Bestehende kleine Räume<br />
und ehemalige Patientenzimmer wurden zu<br />
funktionalen Laboren umgestaltet und adäquate<br />
Räumlichkeiten und Einrichtungen für<br />
Tierhaltung und Biobanking geschaffen. Dennoch<br />
stossen die derzeitigen Räumlichkeiten<br />
für den hochtechnisierten Laborbetrieb an<br />
ihre Grenzen, da sich sowohl die Laborinfrastruktur<br />
als auch die Anforderungen an die biologische<br />
Sicherheit im Laufe der Zeit weiterentwickelt<br />
haben.<br />
«Die Weiterentwicklung der zentrumsmedizinischen<br />
Leistungen wird durch die anwendungsorientierte<br />
Forschung ergänzt und unterstützt. Zudem ist das<br />
Kantonsspital St.Gallen an zukunftsweisenden<br />
Forschungsprojekten aktiv beteiligt. Dies ermöglicht<br />
den Patientinnen und Patienten den Zugang zu<br />
Behandlungsmethoden auf höchstem Niveau und<br />
zeichnet das Kantonsspital St.Gallen über die<br />
Landesgrenzen hinaus als innovatives, zukunftsorientiertes<br />
Spital aus.»<br />
Geschäftsbericht Kantonsspital St.Gallen, 2023<br />
Im Rahmen des Projektes «Come together» werden zwei Etagen<br />
des Hauses 09 umgenutzt und baulich neu gestaltet. Mit<br />
dem Umzug verschiedener Kliniken, Institute und Zentren in<br />
den Neubau 07A werden auch die bisher im Haus 09 untergebrachten<br />
Kliniken verlagert. Dadurch entstehen im Haus 09<br />
Freiflächen von rund 900 m 2 . Gemäss Masterplan 2019 ist das<br />
Haus 09 als innovatives Forschungszentrum konzipiert. Die<br />
freiwerdenden Flächen und die bisher genutzten Räumlichkeiten<br />
im Haus 09 werden daher umfassend saniert und für<br />
modernste Forschungsaktivitäten angepasst.<br />
In einer sorgfältigen Machbarkeitsstudie hat das Kantonsspital<br />
St.Gallen ein nachhaltiges Bauprojekt entwickelt, das ohne aufwändige<br />
An- und Umbauten auskommt. Bei laufendem Betrieb<br />
werden in den Jahren 2025 und 2026 flexible Büroarbeitsplätze<br />
und moderne Laborräume geschaffen. Das Haus 09 wird so zu<br />
einem zeitgemässen Forschungszentrum umgestaltet.<br />
94 Aus- und Rückblick
Impressum<br />
Herausgeber<br />
Medizinisches Forschungszentrum<br />
Kantonsspital St.Gallen<br />
Gestaltung<br />
Die Gestalter AG, St.Gallen<br />
Unternehmenskommunikation<br />
Felicitas Stirnimann Rauwolf<br />
Projektleitung<br />
Sonja Caviezel-Firner, Céline Engetschwiler<br />
Redaktion<br />
Céline Engetschwiler, Reinhard Maier, Burkhard Ludewig, Sonja<br />
Caviezel-Firner, Lukas Flatz, Marian Christoph Neidert, Isabel<br />
Hostettler, Natalia Pikor, Kerstin Kampa-Schittenhelm, Lenka<br />
Besse, Christoph Driessen, Baharak Babouee Flury, Werner<br />
Albrich, Christian Kahlert, Daniel Engeler, Lucas Onder, Simone<br />
Galler<br />
Interviews<br />
Franziska Hidber, Silberfeder Textagentur<br />
Fotographie<br />
Bodo Rüedi<br />
Bezug<br />
immunbiologie@kssg.ch
gemeinsam<br />
innovativ<br />
kompetent<br />
Kontakt<br />
Kantonsspital St.Gallen<br />
Medizinisches Forschungszentrum<br />
Haus 09<br />
Rorschacher Strasse 95<br />
CH-9007 St.Gallen<br />
immunbiologie@kssg.ch<br />
www.kssg.ch/mfz