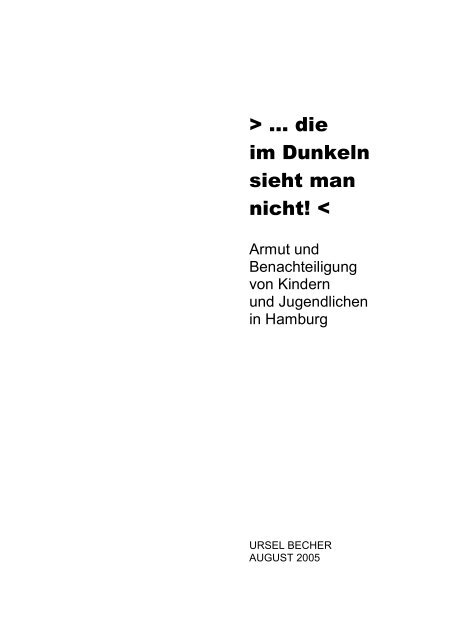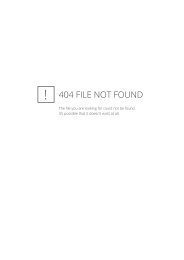Die ganze Studie herunterladen - Stiftung Mittagskinder
Die ganze Studie herunterladen - Stiftung Mittagskinder
Die ganze Studie herunterladen - Stiftung Mittagskinder
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
... die<br />
im Dunkeln<br />
sieht man<br />
nicht! <<br />
Armut und<br />
Benachteiligung<br />
von Kindern<br />
und Jugendlichen<br />
in Hamburg<br />
URSEL BECHER<br />
AUGUST 2005
Meinen herzlichen Dank<br />
allen – Personen und Gremien –, die das Zustandekommen und den Prozess<br />
der Erarbeitung dieser <strong>Studie</strong> ermöglicht haben. Besonders nennen möchte<br />
ich die Mitglieder der Lenkungsgruppe des o. g. Projekts (siehe Anlage 7), die<br />
durch ihre ideelle, aber – bezogen auf die technische Abwicklung – auch<br />
materielle Unterstützung die Voraussetzungen dafür geschaffen haben.<br />
Michael König, Regionalleiter im Jugendamt der Region III im Bezirk<br />
Eimsbüttel war darüber hinaus bei der Konzeptionierung ein hilfreicher und bei<br />
der Realisierung der <strong>Studie</strong> kritisch begleitender Gesprächspartner. Er hat,<br />
ebenso wie Rüdiger Kühn, Leiter von SME im Schanzenviertel, die Planung<br />
und Durchführung der Gruppendiskussionen in den jeweiligen Gebieten, aber<br />
auch die Erstellung einer "begleitenden Bildreportage" unterstützt.<br />
Krimhild Strenger, Steg, und die Mitglieder des Kooperationsverbundes<br />
Schanzenviertel waren bei Fragen der Einbeziehung des Schanzenviertels als<br />
spezifisches Untersuchungsgebiet und bei der Durchführung der dortigen<br />
Gruppendiskussionen hilfreich.<br />
Meinen besonderen Dank an alle Gesprächspartner in den Einzelinterviews<br />
und die Mitglieder der Gruppendiskussionen (s. Anlage 3, 3a und 4), die durch<br />
ihr Mitwirken den Erkenntnisgewinn ermöglicht und so wesentlich zu den<br />
Aussagen der <strong>Studie</strong> beigetragen haben.<br />
Im Zusammenhang mit der von der Fotografin Petra Wollny erstellten<br />
Bildreportage herzlichen Dank an die Mitglieder des Sanierungsbeirats<br />
Schulterblatt sowie der Stadtteilkonferenzen in Eidelstedt und Stellingen und<br />
die Mitglieder des Ausschusses für Schule, Kultur, Integration und Sport, die<br />
gemeinsam deren Finanzierung ermöglicht haben.<br />
Heidi Kranz hat die Schreibarbeiten, das Erstellen von Tabellen und<br />
Diagrammen – in bewährter Form – übernommen und durch begleitende<br />
Gespräche Anregungen für die Arbeit gegeben. Ihr ebenso vielen Dank wie<br />
Ela Cramer, Ingrid Nümann-Seidewinkel und Barbara Lange, die durch ihre<br />
Bereitschaft, kritisch Korrektur zu lesen, mir sehr geholfen haben.<br />
Herrn Landmann herzlichen Dank für die graphische Gestaltung des<br />
Titelblattes und des "Ausschnitts" aus der Bildreportage im Bericht.<br />
Darüber hinaus meinen Dank an all diejenigen, die mich durch Gespräche bei<br />
der Realisierung der <strong>Studie</strong> unterstützt haben.<br />
<strong>Die</strong> Erstellung der Bildreportage sowie die technische Bearbeitung und<br />
Gestaltung des Berichts wurden finanziell gefördert durch<br />
��den Ausschuss für Schule, Kultur, Integration und Sport Eimsbüttel,<br />
��die Stadtteilkonferenzen in Eidelstedt und Stellingen,<br />
��das Projekt "Sozialraum- und lebensweltorientierte Hilfen zur Erziehung"<br />
in der Region III in Eimsbüttel,<br />
��den Sanierungsbeirat Schulterblatt.
Vorwort ......................................................................................................................................... 3<br />
Zusammenfassung .......................................................................................................................... 5<br />
1 Einleitung .......................................................................................................................13<br />
2 Hintergrund der Projektentwicklung.............................................................................15<br />
2.1 Hintergrund für die Erarbeitung der <strong>Studie</strong> .......................................................................15<br />
2.2 Armut und Benachteiligung von Kindern und Jugendlichen<br />
– ein Thema des 11. Kinder- und Jugendberichts.............................................................17<br />
2.3 Armut – ein multidimensionales Phänomen......................................................................20<br />
2.4 Das Lebenslagenkonzept als handlungsleitender Erklärungsansatz .................................23<br />
2.5 Forschungsdesign............................................................................................................29<br />
3 Armut und Benachteiligung von Kindern und Jugendlichen in Hamburg ..................32<br />
3.1 Armut in einer reichen Gesellschaft – ein Phänomen in Hamburg?...................................32<br />
3.2 Bürger dieser Stadt<br />
– wie erlangt man den Status Mitglied einer Risikogruppe zu sein? ..................................39<br />
3.3 "Arme" und "reiche" Stadtteile (und Bezirke) in Hamburg<br />
Verteilung von Risikogruppen auf räumliche Gebiete........................................................48<br />
Exkurs: Wohn- und Wohnumfeldproblematik als sichtbare Form der Ausgrenzung...............66<br />
3.4 Armut und Benachteiligung junger Menschen – ihre Lebenslage und Lebenswelt.............76<br />
3.4.1 Dimensionen der Lebenslage................................................................................77<br />
3.4.2 Armut und Benachteiligung – gestaltende Elemente der Lebenswelt .....................91<br />
3.4.3 Kreislauf der Armut ...............................................................................................95<br />
3.5 Resümee – das Lebenslagenkonzept als geeigneter Ansatz<br />
zur Analyse von Armut und Benachteiligung junger Menschen .........................................98<br />
4 Konsequenzen .............................................................................................................104<br />
4.1 Konsequenzen auf der gesellschaftlichen Ebene............................................................105<br />
4.2 Konsequenzen für eine Sozial- und Wohnungspolitik .....................................................107<br />
4.3 Konsequenzen auf der Ebene der Jugendhilfe<br />
unter Berücksichtigung der Zielsetzung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes................112<br />
Exkurs: Bildung als primäre Ressource,<br />
den Kreislauf von Armut und Benachteiligung zu durchbrechen .............................121<br />
Literaturliste..................................................................................................................................139<br />
Anlagen ......................................................................................................................................141
Vorwort<br />
"<strong>Die</strong> im Dunkeln sieht man nicht!" Mit diesem Satz wird hier nicht Brecht zitiert, sondern der<br />
Titel eines Dokumentarfilmes der siebziger Jahre des vorigen Jahrhunderts, der die<br />
Problematik armer Familien und damit auch die Armut und Benachteiligung von Kindern und<br />
Jugendlichen sichtbar machte.<br />
Sieht man heute in Hamburg Armut und Benachteiligung? Und falls ja, wo werden sie<br />
sichtbar? Und unter welchem Label?<br />
Jedes fünfte Kind (19,8%) unter sechs Jahren lebte 2003 in dieser Stadt von Sozialhilfe.<br />
Durch Hartz IV hat sich die Zahl armer und benachteiligter Kinder und Jugendlicher noch<br />
erhöht. Sie "verirren" sich nur selten/ eher nie auf die Flaniermeilen rund um die Alster, auf<br />
den Rathausplatz oder ähnlich exponierte Orte. Dafür begegnen wir ihnen in Quartieren des<br />
Sozialen Wohnungsbaus – oft Großsiedlungen – z. B. in den Kitas dort, in Hauptschulen, die<br />
häufig als "Restschulen" bezeichnet werden, in Förderschulen und in Einrichtungen der<br />
Jugendhilfe.<br />
Erkenntnisse aus der Begleitung des Projekts "Sozialraum- und lebensweltorientierte Hilfen<br />
zur Erziehung unter Einbeziehung der Implementierung eines Sozialraumbudgets" in der<br />
Region III (Eidelstedt/ Stellingen) in Eimsbüttel sind in erster Linie Anlass zur Erarbeitung<br />
dieser <strong>Studie</strong>. In einer Analyse der Zielgruppen wurde festgestellt: ca. 60% der<br />
Hilfeempfänger lebten zum Zeitpunkt der Untersuchung 2002 von Sozialhilfe – Hilfe zum<br />
Lebensunterhalt – und gut 90% lagen mit ihrem Einkommen unter der von der EU definierten<br />
Armutsgrenze.<br />
<strong>Die</strong>se Familien sind meistens nicht nur in ihrer materiellen Situation benachteiligt, sie sind in<br />
der Regel in vielen Dimensionen ihrer Lebenslage – z. B. Bildung, Arbeit, Wohnen, Zugang<br />
zu <strong>Die</strong>nsten und Einrichtungen – in ihren Teilhabechancen beeinträchtigt. <strong>Die</strong> Entwicklungs-<br />
und Bildungschancen der Kinder sind sehr gering. <strong>Die</strong> Auseinandersetzung mit Fragen von<br />
Armut und Benachteiligung junger Menschen und ihrer Eltern war sehr bedeutsam für das<br />
Projekt; sie war u. a. handlungsleitend bei der Konzeptionierung alternativer und<br />
ergänzender Arbeitsansätze.<br />
Eine weitere Schlussfolgerung aus den Ergebnissen der verschiedenen – während der<br />
Projektlaufzeit durchgeführten – Untersuchungen und den dazu geführten Diskussionen, war<br />
die Entscheidung zu dieser <strong>Studie</strong> als "Soziale Arbeit auf der Makroebene". Damit soll ein<br />
Beitrag geleistet werden zur – in erster Linie – erfahrungswissenschaftlichen Erfassung der<br />
Lebenslage, der Probleme und Nöte junger Menschen mit wenig oder keinen Ressourcen<br />
zur Bewältigung ihrer Beeinträchtigungen und Benachteiligungen sowie mit behinderten<br />
Lernprozessen. <strong>Die</strong> Erkenntnisse werden als bedeutsam angesehen für die<br />
Weiterentwicklung von Handlungsstrategien in der Jugendhilfe sowie im bildungs- und<br />
sozialpolitischen Bereich, aber auch für einen jugendpolitischen Diskurs in Hamburg.<br />
Mit der <strong>Studie</strong> ist neben der Gewinnung von Erkenntnissen und der Sichtbarmachung der<br />
Armutsproblematik und von Benachteiligungsprozessen die Intention verbunden, im Sinne<br />
einer "Sozialarbeiterischen Öffentlichkeitsarbeit" zur Sensibilisierung und Meinungsbildung<br />
zu Problemen und Mängellagen der betroffen jungen Menschen beizutragen. Ziel ist die<br />
Aktivierung verschiedener gesellschaftlicher Gruppen, zur Verbesserung der Lebenslage und<br />
der Teilhabechancen armer und benachteiligter Kinder und Jugendlicher..<br />
Hamburg im August 2005<br />
Ursel Becher<br />
3
Zusammenfassung<br />
Armut und Benachteiligung von Kindern und Jugendlichen sind zur Zeit in Hamburg offensichtlich keine<br />
wirklich relevanten gesellschaftlichen und politischen Themen. Diskutiert werden gelegentlich – auch in den<br />
Medien – Einzelfälle: ein misshandeltes oder unterversorgtes Kind, auffällige Jugendliche. Das Thema wird<br />
stark individualisiert, versehen mit Schuldzuschreibungen an die Eltern, gelegentlich auch an "die<br />
Jugendhilfe" oder "die Schule".<br />
Mit struktureller Armut als Ursache entsprechender Situationen und Erscheinungsformen findet kaum eine<br />
Auseinandersetzung statt. So wird nur von sehr wenigen Menschen in dieser Stadt registriert, dass jedes<br />
fünfte Kind unter 6 Jahre (19,8%) 2003 von Sozialhilfe lebte und ca. jedes dritte Kind in der Altersstufe von<br />
einem Einkommen unter der von der EU-Kommission definierten Armutsgrenze lebt. "<strong>Die</strong> im Dunkeln sieht<br />
man nicht!"<br />
Hintergrund für diese <strong>Studie</strong> sind Erkenntnisse aus der Begleitung eines Projekts der Hilfen zur<br />
Erziehung in der Region III (Eidelstedt und Stellingen) in Eimsbüttel (siehe Punkt 2.1) und dort die<br />
Feststellung, dass es sich bei den Betreuten fast ausschließlich um von Armut und Benachteiligte<br />
betroffene junge Menschen handelt. Das führte in dem Projekt u. a. zu der Entscheidung zu dieser <strong>Studie</strong><br />
als "Soziale Arbeit auf der Makroebene".<br />
<strong>Die</strong> <strong>Studie</strong> bezieht sich grundsätzlich auf die Situation armer und benachteiligter junger Menschen in<br />
Hamburg (siehe Punkt 2.5). Vertiefende Untersuchungen beziehen sich auf die spezifische Situation in der<br />
o. g. Region III und auf das Schanzen- und Karolinenviertel als innerstädtische Vergleichsregionen. Neben<br />
quantitativen Daten – ermittelt aus vorhandenen statistischen Materialien – werden qualitative Daten, die im<br />
Rahmen von Einzelinterviews und Gruppendiskussionen mit Experten verschiedener Arbeitsfelder und<br />
Funktionen (vgl. Anlage 3 und 3a) gewonnen werden, erhoben.<br />
Armut – ein multidimensionales Problem, das Lebenslagenkonzept<br />
Das Beziehen von Sozialhilfe/ Hilfe zum Lebensunterhalt und heute Hartz IV gilt bei vielen Politikern und<br />
Vertretern der Wirtschaft als bekämpfte Armut. Betroffene, aber auch Experten der Praxis, z. B.<br />
Sozialarbeiter, Lehrer und Armutsforscher, bestreiten die Relevanz dieser Aussage. Benachteiligung in<br />
reichen Industrienationen – und so reichen Städten wie Hamburg – ist immer ein relativer und historischer<br />
Begriff und nicht mehr die Frage der Subsistenzsicherung. Benachteiligung ist demzufolge im Verhältnis zur<br />
Lebenssituation anderer Bevölkerungsgruppen zu sehen und ist für jede geschichtliche Periode neu zu<br />
beschreiben (vgl. Punkt 2.3).<br />
<strong>Die</strong> Europäische Union sprach schon 1984 von der Multidimensionalität von Armut. Sie führt dazu aus:<br />
"<strong>Die</strong>ses Prinzip geht von der Feststellung des multidimensionalen Charakters der Armut und der sozialen<br />
Ausgrenzung aus, die nicht nur auf unzureichende finanzielle Mittel hinweist, sondern auch im<br />
Wohnungswesen, in der Berufsbildung, in der Beschäftigung, im Bildungswesen, im Gesundheitswesen, im<br />
Zugang zu <strong>Die</strong>nstleistungen usw. spürbar wird." Häufig besteht bei diesen Menschen Unsicherheit über ihre<br />
Rechte und Ansprüche, Abhängigkeit gegenüber Institutionen, die u. a. im Zusammenhang mit den<br />
bestehenden Ermessensspielräumen stehen und – noch immer – ihr Ausgeliefertsein gegenüber<br />
gesellschaftlichen Diskriminierungen.<br />
Armut – und insbesondere die Armut junger Menschen – ist eindeutig ein multidimensionales Problem,<br />
wobei die materielle Mängellage das relevante Problem darstellt, dessen Vorhandensein bedeutsam für<br />
andere Lebensbereiche ist.<br />
Das dieser <strong>Studie</strong> zugrunde gelegte Lebenslagenkonzept (vgl. Punkt 2.4) nach Staub-Bernasconi impliziert,<br />
dass die klassische Struktur sozialer Ungleichheit bestimmt wird durch Einkommen, Bildung und Berufs-/<br />
Erwerbsstatus, sowie den daraus abgeleiteten Dimensionen, z. B. Kompetenzen, Lebensstile,<br />
gesellschaftliche Positionen. <strong>Die</strong> Lebenslage begünstigt die Herausbildung schichtspezifischer sozialer<br />
Milieus.<br />
<strong>Die</strong> ungleiche Verteilung von gesellschaftlichen Gütern und Positionen führt zu Problemen der<br />
Bedürfnisbefriedigung. Folgende Problembereiche werden definiert:<br />
• Ausstattungsprobleme – darunter werden Beeinträchtigungen von Teilhabechancen an Ressourcen<br />
und Errungenschaften der Gesellschaft verstanden.<br />
• Austauschprobleme – sie entstehen dort, wo es zu asymmetrischen Beziehungen kommt, d. h. wo die<br />
Gegenseitigkeit und Gleichwertigkeit nicht in der Balance sind.<br />
5
• Machtprobleme – die Verteilungsmuster einer Gesellschaft sind nicht primär von menschlichen<br />
Bedürfnissen und Fähigkeiten, sondern von der Verfügung über Machtquellen abhängig. Unterschieden<br />
wird in:<br />
o Behinderungsmacht – sie ist darauf angelegt, die Möglichkeiten von Menschen und<br />
Menschengruppen zu beschneiden, z. B. durch Diskriminierungen, Stigmatisierungen und<br />
Segregation.<br />
o Begrenzungsmacht – sie soll z. B. im Rahmen der Bildungs-, Jugend- und Sozialpolitik die Teilhabe<br />
und Teilnahme an Gütern und am sozialen Austausch für Alle ermöglichen und entspricht damit<br />
dem Sozialstaatsprinzip.<br />
Armut – ein Phänomen in Hamburg<br />
Armut und Benachteiligung von Kindern und Jugendlichen in dieser Stadt werden von den befragten<br />
Experten als sehr reale Probleme bezeichnet. <strong>Die</strong> Problematik beruht nicht nur auf einer sehr schlechten<br />
materiellen Situation der Familien, sondern auch auf der Situation, wo und wie man wohnt, auf welche<br />
Schule man geht, welche Angebote und Einrichtungen zur Verfügung stehen.<br />
<strong>Die</strong> spezifische Benachteiligung von Kindern, die speziell in den Bereichen Schule und Bildung sichtbar<br />
wird, werden mit großer Sorge gesehen. Besonders bedeutsam sind die durch ihre Lebenslage<br />
verhinderten Lernprozesse, aber auch Stigmatisierungs- und Ausgrenzungsprozesse. Den Kindern fehlt ein<br />
großer Erfahrungsreichtum und die damit verbundenen Verhaltenskompetenzen. Benachteiligten jungen<br />
Menschen ist es oft peinlich, nicht mitreden und mithalten zu können.<br />
Der an vielen Stellen sichtbare Reichtum in dieser Stadt wird für arme Kinder und Jugendliche als<br />
problemverstärkend ansehen. "Ein generelles Problem ist das, was man politisch als Auseinanderklaffen<br />
von Armut und Reichtum bezeichnet." Für Familien, die arm sind, wird in Hamburg deutlich sichtbar, was es<br />
bedeutet, wenn man nicht arm ist. Ihnen wird vorgeführt, was sie sich nicht leisten können, woran sie nicht<br />
teilnehmen können.<br />
Auf die Problematik der Infantilisierung von Armut und Benachteiligung wird von den Gesprächsteilnehmern<br />
fast übereinstimmend hingewiesen. Wiederholt wird auf die Problematik eingegangen, dass zunehmend<br />
Kinder auffallen, die hungern. <strong>Die</strong>s wird insbesondere in Kitas und Schulen offensichtlich.<br />
"Brüche" in der Biografie von Menschen – Krankheit, Arbeitslosigkeit, Trennung und Scheidung – sind,<br />
obwohl Massenerscheinungen, sozial-, jugend- und bildungspolitisch nicht ausreichend abgesichert, um ein<br />
"Abrutschen" in Armut und Benachteiligung zu verhindern. Kinder in entsprechenden Familien sind in<br />
Gefahr, diese "Lücke" in ihrer eigenen Biografie zu perpetuieren.<br />
<strong>Die</strong> Darstellung der Armutsproblematik von jungen Menschen in Politik und Medien wird als sehr marginal<br />
bezeichnet. Sie ist offensichtlich kein relevantes und interessantes Thema. Medial wird es "in erster Linie<br />
unter ordnungspolitischen Gesichtpunkten abgehandelt" und "wird häufig mit einem Verwahrlosungsaspekt<br />
versehen". Relativ groß wird das Interesse der Medien eingeschätzt, wenn man Probleme an individuellen<br />
Fällen festmachen kann; strukturelle Probleme anzusprechen, wird immer schwieriger. Es besteht relative<br />
Übereinstimmung bei den Gesprächsteilnehmern, dass nur sehr selten ein "gründlich recherchierter Artikel<br />
über Zusammenhänge von Armut" veröffentlicht würde.<br />
Im Zusammenhang mit Armut und Benachteiligung wird schon sehr lange die Frage nach Risikogruppen<br />
diskutiert (vgl. Punkt 3.2). "Es sind Familien, die durch Risikofaktoren, die eine Armutsentwicklung und<br />
Abwärtsmobilität begünstigen können, betroffen sind." Als besondere Risikofaktoren werden u. a. genannt:<br />
niedriges Einkommen, Krankheit, Unfall, (fremde) ethnische Herkunft, Arbeitslosigkeit, diskontinuierlicher<br />
Erwerbsverlauf sowie Trennung und Scheidung. Arbeitslosigkeit muss heute als "Schlüsselrisiko"<br />
angesehen werden.<br />
Als weitere "verstärkende Faktoren", Mitglied einer Risikogruppe zu werden, gelten:<br />
• <strong>Die</strong> "Überspezialisierung" in Schulen, die als Ursache für Stigmatisierungen und Ausgrenzungen<br />
angesehen wird. Durch den aktuellen bildungspolitischen Trend – in Hamburg setzt man auf eine<br />
intensive schulische Selektion – werden die Bildungschancen für benachteiligte Schüler reduziert und<br />
damit ihre Bildungsbenachteiligung maßgeblich verstärkt.<br />
• <strong>Die</strong> "Gettoisierung von Armut", d. h. die sozialräumliche Ausgrenzung von Armutsbevölkerung in<br />
spezifische Quartiere und Stadtteile.<br />
<strong>Die</strong> Frage nach Risikogruppen impliziert aber auch die Frage nach Strukturen und Bedingungen, die die<br />
Möglichkeit, Mitglied einer Risikogruppe zu werden, begünstigen. <strong>Die</strong> Ausführung der Experten weisen sehr<br />
deutlich auf entsprechende Faktoren hin:<br />
6
• Erosion der Familien – 72 Scheidungen auf 100 Eheschließungen in Hamburg 2003<br />
• (fehlende) "pädagogische Infrastruktur", die der Vereinbarkeit von "Erziehungsarbeit" und<br />
Berufstätigkeit von Frauen, insbesondere auch alleinerziehenden Frauen, gerecht wird<br />
• ein Schulsystem, dass dem Bedarf an Förderung und Unterstützung von Kindern "bildungsferner"<br />
Eltern nicht entspricht<br />
• eine "<strong>Die</strong>nstleistungsgesellschaft", die keine/ kaum Arbeitsplätze für gering qualifizierte Schulabgänger<br />
bereit hält<br />
• Massenarbeitslosigkeit und die dadurch verursachten Benachteiligungen, die die genannten Risiken<br />
potenzieren<br />
• ein (offensichtlich) stark ausgeprägtes gesellschaftliches Bedürfnis, einer primär strukturell<br />
begründeten Problematik durch Individualisierung und Ausgrenzung zu begegnen.<br />
Es fragt sich, wie lange unsere Gesellschaft es sich noch leisten kann – nicht nur bei Berücksichtigung der<br />
demografischen Entwicklung – das vorhandene Bildungspotential von benachteiligten Kindern "brach liegen<br />
zu lassen", stellt Bildung doch laut Aussagen führender Politiker und Wirtschaftsexperten die zukünftige<br />
Ressource unserer Gesellschaft dar.<br />
Wenn von einem "Kreislauf der Armut" gesprochen wird, so wird dieser Kreislauf von der<br />
Bildungssituation benachteiligter Kinder aus aufgezeigt. Benachteiligten Schülern wird meistens eine höher<br />
qualifizierende Schulbildung nicht zugetraut. Aufgrund mangelnder Förderung und Unterstützung durch ihre<br />
Eltern und die Institution Schule bleiben ihnen vielfach qualifizierte Schulabschlüsse versagt. Viele von<br />
ihnen haben eine Förderschule besucht oder die Hauptschule ohne Abschluss verlassen. Verbunden mit<br />
der ungenügenden Schulausbildung ist in der Regel ein sehr anregungsarmes Milieu, das latent<br />
vorhandene Fähigkeiten nicht fördert und aktiviert, sondern die schon benannten Informations-,<br />
Interessens- und Konfliktlösungsdefizite hervorruft.<br />
Räumliche Verteilung von Risikogruppen – "arme" und "reiche" Stadtteile in Hamburg<br />
Arme und benachteiligte Familien leben überproportional häufig in benachteiligten Gebieten. <strong>Die</strong> Höhe des<br />
Anteils an Sozialhilfeempfängern wird hier als Kriterium zur Benennung "armer" und "reicher" Stadtteile<br />
gewählt.<br />
Eine These zum Verständnis:<br />
<strong>Die</strong> Verteilung von Armut und Reichtum in Stadtgebieten ist sehr ungleichmäßig.<br />
Aufgrund von Segregationsprozessen bilden sich Regionen mit positiv bewerteten<br />
Faktoren und steigendem Wohlstand und andererseits Regionen mit negativ<br />
bewerteten, benachteiligend wirkenden Faktoren und zunehmender Armut.<br />
Mit anderen Worten:<br />
Arme Menschen leben in der Regel in kleinen Wohnungen, in verdichteten, häufig<br />
durch Umweltbeeinträchtigungen belasteten Regionen mit unzureichender bzw.<br />
schlechter Infrastruktur.<br />
Wohlhabende und reiche Menschen leben dagegen in großen Wohnungen, in der<br />
Regel in aufgelockerten, attraktiven Wohngebieten; ihnen steht ein umfassendes<br />
Angebot an <strong>Die</strong>nstleistungen und eine ihren Bedarfen entsprechende Infrastruktur<br />
zur Verfügung.<br />
<strong>Die</strong>se These kann durch die dargestellten Strukturdaten als erwiesen angesehen werden (vgl. Punkt 3.3).<br />
<strong>Die</strong> Analyse weist – gemessen an den Sozialhilfeempfängern und Arbeitslosen, dem Ausländeranteil, dem<br />
Anteil an Einelternfamilien, der Einwohnerdichte, der Wohn- und Bildungssituation – auf relativ homogene<br />
Strukturen in den jeweiligen "armen" und "reichen" Stadtteilen hin. Es findet eine Kumulation sogenannter<br />
Risikogruppen, aber auch von privilegierten Gruppen in segregierten Stadtteilen statt. <strong>Die</strong> Wohn- und<br />
Wohnumfeldsituation korrespondiert mit der Bewohnerstruktur.<br />
<strong>Die</strong> Erkenntnisse im Rahmen der Lebenslagen- und Lebensweltanalyse armer und benachteiligter junger<br />
Menschen (vgl. Punkt 3.5) lassen sich in folgendem Resümee darstellen:<br />
Eine deprivierte Einkommenslage an der definierten Armutsgrenze beeinflusst fast alle anderen<br />
Dimensionen der Lebenslage der betroffenen Familien und löst in der Regel Beeinträchtigungen und<br />
Benachteiligungen in der Entwicklung von Kindern aus.<br />
7
<strong>Die</strong> Teilhabe materiell benachteiligter Familien und insbesondere ihrer Kinder an der modernen "Markt- und<br />
Konsumgesellschaft" ist kaum möglich. <strong>Die</strong> Wohnsituation dieser Familien ist häufig gekennzeichnet durch<br />
ein Leben in gettoisierten und stigmatisierten Wohngebieten. Oft wohnen sie in sehr engen, z. T. schlecht<br />
und unzureichend ausgestatteten Wohnungen. <strong>Die</strong> Zimmer sind in der Regel sehr klein und die<br />
Wohnungen verfügen häufig über zu wenig Räume – gemessen an der Personenzahl –, so dass kaum<br />
Rückzugsmöglichkeiten bestehen. Aufgrund erlebter Stigmatisierungen und Ausgrenzungen im<br />
Zusammenhang mit ihrer Wohnsituation grenzen viele benachteiligte Kinder und Jugendliche ihren<br />
Lebensradius stark ein, d. h. sie beschränken sich relativ stark auf ihr Wohngebiet.<br />
Kinder, die in materieller Armut oder materieller Mängellage leben, sind in ihrer Bildungssituation stark<br />
benachteiligt. Sie erreichen signifikant niedrigere Bildungsabschlüsse. Sozioökonomisch benachteiligte<br />
Kinder, die durch ihre Familien, aber auch durch ihr soziales Umfeld nicht ausreichend unterstützt und<br />
gefördert werden (können), bekommen häufig Schwierigkeiten in der Schule. Sie werden oft – u. a. wegen<br />
ihrer Unterversorgtheit, z. B. in den Bereichen Wohnung, materielle Ausstattung, kulturelles Verständnis<br />
und Verhalten – stigmatisiert und ausgegrenzt. An solchen Ausgrenzungsprozessen sind sowohl Mitschüler<br />
als auch Lehrer beteiligt. Begünstigt werden entsprechende Prozesse durch ein stark selektierendes<br />
Schulsystem. Schüler reagieren auf erlebte Diskriminierungen häufig mit Lernschwierigkeiten, aber auch<br />
mit Schulverweigerung.<br />
"Schüler, ganz gleich ob sie nun eine Förderschule besuchen oder ohne Hauptschulabschluss ausgeschult<br />
werden, haben praktisch keine Chance, in normale Arbeitsverhältnisse integriert zu werden." Ihre<br />
schlechten Bildungsabschlüsse erschweren bzw. verhindern eine Berufsausbildung. Wenn sie Arbeit<br />
finden, ist diese in der Regel wenig qualifiziert, nicht attraktiv und niedrig bezahlt. Auch bei Erwerbsarbeit<br />
können sie meistens die gesellschaftlich als normal anerkannten Konsumgüter nicht erwerben. Durch die<br />
ihnen im Einzelfall angebotenen Arbeitsplätze erhalten sie in der Regel weder ein besseres Prestige noch<br />
einen Statusgewinn.<br />
Von Armut und Benachteiligung betroffene junge Menschen und ihre Eltern fühlen sich durch ihre oft<br />
deprivierende Lebenslage psychisch belastet, was häufig zu Perspektivlosigkeit und resignativem Verhalten<br />
führt. Wenn keine Möglichkeiten der Verbesserung ihrer Situation real oder subjektiv vorhanden sind, kann<br />
das auch Depressionen auslösen. Gekoppelt daran ist oft die Entwicklung eines Zugehörigkeitsgefühles zu<br />
einem als "unten" empfundenen Milieu – das Selbstverständnis als Außenseiter wirkt dann meistens auch<br />
"identitätsstiftend". Auf Ablehnungen, z. B. durch Bildungseinrichtungen oder Arbeitgeber, reagieren sie mit<br />
Ohnmachtsgefühlen, Enttäuschung, Hilflosigkeit, Ängsten. Auch Wut bestimmt dann vielfach ihr Verhalten.<br />
Fluchttendenzen, Rückzug, Resignation, Krankheit, aber auch Aggressivität, Gewalt, Kriminalität, sind<br />
Formen der Kompensation ihrer Lebenslage, mit denen sie versuchen, für sich ein Stück weit<br />
"Gleichgewicht" zu erlangen und Dinge erträglicher zu machen.<br />
Erkenntnisse aus der Lebenslagen-/ Lebensweltanalyse weisen auf ein "Aushebeln des<br />
Sozialstaatsprinzips" hin. Begrenzungsmacht durch Bildungs-, Jugend- und Sozialpolitik wird reduziert<br />
und damit werden Entwicklungs- und Teilhabechancen armer und benachteiligter junger Menschen<br />
eingeschränkt.<br />
Armut und Benachteiligung stehen in engem Zusammenhang mit der Verteilung von Ressourcen in einer<br />
Gesellschaft. Durch das in der deutschen Verfassung festgeschriebene Sozialstaatsprinzip wird das Ziel<br />
der Chancengleichheit verfolgt. Daraus ergibt sich der Auftrag an den Gesetzgeber, "für einen Ausgleich<br />
der sozialen Gegensätze und damit für eine gerechte Sozialordnung zu sorgen". Es geht um die<br />
"Angleichung der tatsächlichen Voraussetzungen zum Erwerb materieller und immaterieller Güter". 1<br />
<strong>Die</strong>se im Grundgesetz definierte Aufgabe wird sowohl auf Bundesebene als auch auf der Ebene des<br />
Stadtstaates Hamburg offensichtlich zur Disposition gestellt – und zwar sowohl auf der finanziellen Ebene<br />
als auch auf der Ebene spezifischer Formen der Förderung. Dazu einige Aussagen der Experten:<br />
• Es ist "wahnsinnig viel gekürzt worden in den letzten Jahren. Das spiegelt sich im Haushaltsplan<br />
wider." Hingewiesen wird auf den Kita-Bereich und auf Schließungen, z. B. von Schulen, Bücherhallen,<br />
Schwimmhallen sowie auf mangelnden Neubau von Sozialwohnungen. <strong>Die</strong> Einsparungen sind "von der<br />
Masse her nicht etwas, was den Haushalt sanieren würde. ... Wenn man volkswirtschaftlich denkt, wird<br />
es mehr Kosten verursachen, wenn Kinder nicht frühzeitig erreicht werden."<br />
• Sparmaßnahmen wirken sich sehr problematisch aus, z. B. in Kitas. Sie sind "die zentralen<br />
Bildungseinrichtungen 2 im frühen Kindesalter. ... Wenn da was wegbricht, ist das eine Katastrophe."<br />
1 Jarass in: Jarass, H., Pieroth, B., Kommentar zum Grundgesetz, München, 2004, S. 574, RZ 108<br />
2 vgl. § 22, Abs. 2 Kinder- und Jugendhilfegesetz: "<strong>Die</strong> Aufgabe umfasst die Betreuung, Bildung und Erziehung<br />
des Kindes. ..... soll sich an den Bedürfnissen der Kinder und ihrer Familien orientieren."<br />
8
• Probleme werden auch bezogen auf Formen und Inhalte von Angeboten gesehen: "Mit den bisher<br />
bestehenden Lernmethoden genügen schulpädagogische Regeleinrichtungen den Bedürfnissen von<br />
Schülern, die unter den Bedingungen von Armut leben, nicht." Um der Situation der Schüler gerecht zu<br />
werden, "bedarf es pädagogischer Professionalität bei Lehrern, um bei Leistungs-, Lern- und<br />
Verhaltensproblemen die zugrundeliegende Armutsproblematik zu erkennen. ... Das ist<br />
bedauerlicherweise kein Bestandteil der regulären Lehrerausbildung."<br />
Sofern sozialer Frieden – und das bedeutet speziell auch Entwicklungs- und Bildungschancen für arme und<br />
benachteiligte Kinder und Jugendliche – gesichert werden soll, ist es erforderlich, für die verschiedenen<br />
Aufgabenbereiche der "Begrenzungsmacht" die Ressourcen – Finanzen, Personal, Kompetenzen – zur<br />
Verfügung zu stellen, der sie zur Erfüllung ihrer Aufgaben bedürfen. Das impliziert eine stärkere<br />
Wahrnehmung gestaltender Funktionen durch Politik und Verwaltung.<br />
<strong>Die</strong> Verbesserung der Lebenssituation armer und benachteiligter junger Menschen erfordert<br />
Konsequenzen in verschiedenen gesellschaftlichen und politischen Bereichen (vgl. Punkt 4).<br />
Bedenkt man, dass die Verfestigung und Aufrechterhaltung von Armut und Benachteiligung von Kindern<br />
und Jugendlichen durch gesellschaftliche Stigmatisierungs- und Diskriminierungsprozesse sowie<br />
Segregation begünstigt wird, so muss es auf der gesellschaftlichen und gesellschaftspolitischen Ebene<br />
zu einer Veränderung von Einstellungen und Verhaltensweisen kommen. Wenn arme und benachteiligte<br />
Menschen sich in eine Gesellschaft integrieren sollen, muss diese Gesellschaft eine Bereitschaft zur<br />
Integration haben.<br />
Berücksichtigt man die Auswirkungen, die – neben finanzieller Armut – Stigmatisierungs-, Diskriminierungs-<br />
und Segregationsprozesse auf benachteiligte Familien haben, so wird deutlich, dass eine Veränderung des<br />
"sozialen Klimas" in der Gesellschaft erforderlich ist, um dieser Problematik zu begegnen. Das bedeutet<br />
Setzung von Werten wie Solidarität und Integrationskraft. Jeder Mensch hat den Anspruch, in seiner Eigen-<br />
und Besonderheit geachtet zu werden; das impliziert eine akzeptierende Einstellung und Haltung ihnen<br />
gegenüber. Dazu bedarf es eines Beitrages aller zu einer offenen, sozialen, gerechten – d. h. durch<br />
Chancengleichheit gekennzeichneten – Gesellschaft. "Gemeinschaft und Solidarität sind Dinge, die man<br />
lernt."<br />
Sozialpolitik und Wohnungspolitik sind Instrumente, mit denen der Staat seiner gestaltenden Funktion<br />
gerecht werden soll. "Sozialstaat und Demokratie gehören zusammen, sie bilden eine Einheit.<br />
...[Sozialpolitik] sorgt für annähernd vergleichbare Lebenschancen." 1 Es wird inzwischen deutlich, dass der<br />
Staat dem Postulat der Sozialstaatlichkeit durch gestaltende Einwirkungen – z. B. im Rahmen der<br />
Gesetzgebung –, Verteilung und Lenkung nicht mehr gerecht wird (vgl. Punkt 4.2).<br />
<strong>Die</strong> Notwendigkeit, Lücken im System der sozialen Sicherung zu schließen, wurde wiederholt betont.<br />
Besonders Leistungen für Familien sind unzureichend. Da Arbeitslosigkeit die Situation ist, durch die Armut<br />
und Benachteiligung verfestigt werden, ist der Arbeitsmarkt, der Zugang zu Arbeit und ggf. auch die<br />
Umverteilung von Arbeit ein wichtiges Kriterium zur Verbesserung der Lebenssituation.<br />
<strong>Die</strong> Ballung benachteiligter Bevölkerungsgruppen in benachteiligten Stadtgebieten verschärft die aus Armut<br />
und Benachteiligung resultierenden Probleme. <strong>Die</strong> Stabilisierung der Bewohnerstruktur, insbesondere in<br />
Großsiedlungen des sozialen Wohnungsbaus, stand im Mittelpunkt vieler Gespräche. <strong>Die</strong>s ist ein Ziel, das<br />
dann besonderer Anstrengungen und Konzepte bedarf, wenn es um die Unterbringung von Personen und<br />
Familien geht, die sogenannte "Problemfälle" des Wohnungsmarktes darstellen.<br />
Durch "Flexibilisierung dürfen Sozialwohnungen frei belegt werden, damit sich keine einseitige<br />
Belegungsstruktur verfestigt. ... Dafür müssen sie aber die Leute woanders unterbringen – in<br />
entsprechender Zahl." [Bisher ist offensichtlich nicht sichtbar geworden, wo "diese Leute" untergebracht<br />
werden.]<br />
Es muss verhindert werden, dass Familien mit Kindern unsanierte Wohnungen in Großsiedlungen am<br />
Stadtrand erhalten. Für die Familien, insbesondere die Kinder, bedeutet ein entsprechender Umzug<br />
meistens eine Entwurzelung, Verlust von Freunden und Peer-Groups und Desintegration in die neuen<br />
Wohngebiete.<br />
Um die beiden Zielsetzungen des Gesetzes<br />
• Wohnraumversorgung benachteiligter Gruppen<br />
• Schaffung und Erhaltung sozial stabiler Bewohnerstrukturen<br />
1 Prantl, H., a.a.O., S. 32 f.<br />
9
in Einklang zu bringen, ist eine "problembezogene" Kooperation relevanter Einrichtungen in den Stadtteilen<br />
und Quartieren erforderlich, um eine Integration Aller zu gewährleisten.<br />
Der Sachverhalt, dass gut ein Viertel aller Sozialwohnungen im Zeitraum zwischen 2003 und 2009 aus der<br />
Bindung fallen, wird bisher nicht als ein besonderes Problem registriert. Auf einem engen "bezahlbaren"<br />
Wohnungsmarkt sind immer arme und benachteiligte Bevölkerungsgruppen die Verlierer.<br />
Zielgruppen der Jugendhilfe sind häufig von Armut und Benachteiligung betroffen. Viele Schwierigkeiten<br />
armer und benachteiligter Kinder und Jugendlicher entstehen dadurch, dass sie und ihre Eltern häufig<br />
chronisch belastenden, sie überfordernden Situationen ausgesetzt sind (vgl. Punkt 4.3).<br />
Notwendig sind sozialraum- und lebensweltorientierte Ansätze in der Jugendhilfe, deren Ziel die<br />
Veränderung von sich nachteilig auswirkenden gesellschaftlichen Entwicklungen und Tatbeständen sowie<br />
die Schaffung einer familienfreundlichen Umwelt ist. Das bedeutet auch, Beiträge zu leisten zur Beseitigung<br />
von Disparitäten im lokalen und sozialen Bereich. Sozialräume sind so zu gestalten, dass sie "tragfähig und<br />
belastbar“ sind, d.h., dass dort auch anfallende Schwierigkeiten und Konflikte aufgefangen werden können.<br />
Das erfordert, dass in Krisen und Konfliktsituationen Unterstützungssysteme (Ressourcen) und<br />
Kompetenzen verfügbar sind. Dazu notwendig ist eine regionale, kleinräumig erreichbare – formale und<br />
informelle – Infrastruktur, die sich entlastend und integrierend auf die Lebenssituation der Bewohner<br />
auswirkt bzw. deren Entlastung und Integration begünstigt, fördert, ermöglicht. Gefordert sind präventive,<br />
niedrigschwellige Angebote im Viertel.<br />
<strong>Die</strong> Möglichkeiten der Jugendhilfe, Armut und Benachteiligungen junger Menschen und ihrer Familien "zu<br />
vermeiden oder abzubauen" 1 sind sicherlich gering. Im Rahmen sozialraum- und lebensweltorientierter<br />
Handlungsstrategien obliegt es den Vertretern der Jugendhilfe aber, Ursachen, Strukturen und<br />
Bedingungen von Armut und Benachteiligung zu analysieren, die Betroffenen zu aktivieren, sich offensiv mit<br />
ihrer Lebenslage und Lebenswelt auseinanderzusetzen, Vernetzungen aufzubauen und die u. a. im<br />
Rahmen von Evaluation deutlich gewordenen Einschränkungen, Belastungen und Benachteiligungen in der<br />
(jugend- und sozialpolitischen) Öffentlichkeit zu demonstrieren. Verbunden damit ist eine Lobbyfunktion.<br />
Der Bildung kommt bei der Verbesserung der Lebenssituation benachteiligter junger Menschen eine<br />
wichtige Funktion zu. Sie stellt die primäre Ressource dar, den Kreislauf von Armut und Benachteiligung zu<br />
durchbrechen.<br />
<strong>Die</strong> Bildungssituation armer und benachteiligter junger Menschen wurde in allen Interviews und<br />
Gruppendiskussionen erörtert. Der "Kreislauf der Armut" (vgl. Punkt 3.4.3) wird in engem Zusammenhang<br />
mit einer ungenügenden Schulbildung gesehen: Benachteiligten Schülern wird meistens eine höher<br />
qualifizierende Schulbildung nicht zugetraut. Aufgrund mangelnder Förderung und Unterstützung durch ihre<br />
Eltern und die Institution Schule, bleiben ihnen häufig qualifizierte Schulabschlüsse versagt. Viele von ihnen<br />
haben eine Förderschule besucht oder die Hauptschule ohne Hauptschulabschluss verlassen.<br />
Von einem Teil der Betroffenen kann Benachteiligung in verschiedenen Lebensbereichen kompensiert<br />
werden. Eine gute Einbindung in soziale Netzwerke, ein (relativ) hohes Bildungsniveau und die<br />
Integration ins Erwerbsleben sind geeignete Ressourcen, Krisen und Konfliktsituationen konstruktiv zu<br />
bewältigen und eine positive Identität und Personalität zu entwickeln. <strong>Die</strong> Frage, ob es Kindern und<br />
Jugendlichen gelingt, den Kreislauf der Armut zu durchbrechen, hängt maßgeblich von ihren<br />
Partizipationschancen am Bildungssystem ab.<br />
Für den Bereich Schule werden in erster Linie folgende Aspekte zur Verbesserung der Bildungschancen<br />
genannt:<br />
• Wegen der starken institutionellen Selektion im Rahmen des Schulsystems in Hamburg wird gefordert,<br />
zu verhindern, dass Kinder "selektiert" und in Sonderschulen und Spezialeinrichtungen "delegiert"<br />
werden. Es sollte den Kindern vermittelt werden, dass sie ins "Regelsystem Schule gehören und dort<br />
auch erwünscht sind." ... "Es ist wichtig, dass am Ende der Grundschule alle Schüler und ihre Eltern<br />
integriert sind – später wird es unheimlich schwer."<br />
• Es wird darauf hingewiesen, dass "Kinder vor Ort – dort wo sie ausgegrenzt werden, sei es in der Kita<br />
oder in der Schule – Akzeptanz ihrer Lebensverhältnisse erfahren (müssen)". Kinder, auch solche mit<br />
abweichendem Verhalten, dürfen nicht in Spezialeinrichtungen untergebracht werden: "Sonst ist ihr<br />
Lebenslauf schon vorprogrammiert, wenn sie immer weitergeschickt werden".<br />
• Das Bildungsangebot in der Schule sollte zentrale Aspekte der Lebenswirklichkeit benachteiligter<br />
Schüler stärker berücksichtigen.<br />
1 vgl. §1 Abs. 1 Kinder- und Jugendhilfegesetz<br />
10
• In die letzten Klassen sollten mehr Praxisanteile integriert werden – dadurch wird bei vielen<br />
benachteiligten Schülern ein größeres Interesse an "Schule" geweckt, gleichzeitig aber auch ein<br />
besserer Einstieg in die Erwerbsarbeit vorbereitet.<br />
• <strong>Die</strong> Gliederung des Schulsystems bis zur 9. Klasse sollte aufgehoben werden. <strong>Die</strong> Hauptschule sollte<br />
abgeschafft werden, weil sie in diesem gegliederten System zur "Restschule" wird und es "für die<br />
Lehrer, die dort arbeiten, kaum möglich ist, ... noch irgendeine motivierende Situation<br />
hinzubekommen". Gleichzeitig sollte das "Sitzenbleiben" abgeschafft werden. Es wird als<br />
"Ressourcenverschwendung" angesehen.<br />
• Zur Förderung der Bildungssituation werden Ganztagsschulen "für absolut erforderlich" gehalten. "<strong>Die</strong><br />
Bedingungen, die zur Zeit dafür geboten werden, sind aber aus personellen und inhaltlichen Gründen<br />
nicht akzeptabel."<br />
<strong>Die</strong> zur Zeit (auch) in Hamburg angedachten "Modelle von Ganztagsschulen" entsprechen nicht den<br />
Anforderungen, die in der heutigen Gesellschaft an Schule gestellt werden. "... wenn dann einfach nur ein<br />
'Pädagogischer Mittagstisch' sowie einige musische, sportliche und technische Kurse im Sinne einer<br />
verlängerten Aufbewahranstalt an die alte Halbtagsschule angehängt werden, dann wertet man erstens die<br />
nachmittags liegenden Fächer ab, und zweitens werden die Schüler damit nicht leistungsfähiger, sondern<br />
bloß erschöpft. ..."<br />
"Eine Ganztagsschule braucht jedenfalls deutlich mehr Personal, Ausstattung und Erziehungskompetenz –<br />
über Bildungskompetenz hinaus – als eine lediglich verlängerte Halbtagsschule, denn eine Ganztagsschule<br />
ist stets auch Lebensmittelpunkt junger Menschen, was eine Halbtagsschule nie sein kann."<br />
Wenn Erkenntnisse die Voraussetzung für Veränderungen sind, dann mögen Erkenntnisse und<br />
Erfahrungen, die im Rahmen dieser <strong>Studie</strong> sichtbar werden, zu Veränderungsprozessen führen. <strong>Die</strong><br />
aufgezeigten Problemstellungen bieten eine Grundlage dafür. <strong>Die</strong> Hinweise zu Verbesserungen der<br />
Lebenslage und die damit verbundenen Ansätze für Vernetzungen und Kooperationen im Rahmen einer<br />
sozialraum- und lebensweltorientierten (Schul-) Bildung und Jugendhilfe bieten eine Basis, um bestehende<br />
Strukturen und Systeme zu hinterfragen und ggf. Alternativen zu entwickeln.<br />
Wie würde die Arbeit in Schulen, aber auch in Kitas und Jugendhilfeeinrichtungen bewertet, wenn folgende<br />
Erfolgskriterien zugrunde gelegt würden:<br />
• Das soziale Klima in der Institution.<br />
• <strong>Die</strong> Anerkennung und Wertschätzung, die ihren jeweiligen Zielgruppen entgegengebracht werden.<br />
• <strong>Die</strong> Kreativität und die Freude am Lernen, die im Rahmen der Aktivitäten zwischen Experten und den<br />
jungen Menschen sichtbar werden.<br />
Dafür sind neben einem Paradigmenwechsel bei den betroffenen Experten auch eine Veränderung der<br />
Rahmenbedingungen einschließlich veränderter Arbeitsbedingungen notwendig.<br />
Erforderlich sind eine Gesellschaft und eine Politik, für die die Vermeidung und der Abbau von<br />
Benachteiligung und die Schaffung positiver Lebensbedingungen für junge Menschen und einer kinder- und<br />
familienfreundlichen Umwelt 1 handlungsleitende Prinzipien sind.<br />
1 §1 Abs. 3 Kinder- und Jugendhilfegesetz<br />
11
1 Einleitung<br />
"Arm ist man – benachteiligt wird man" – diese lakonische und erklärende Bemerkung weist<br />
(auch) auf gesellschaftliche und politische Aspekte bei der Entstehung und Aufrechterhaltung<br />
von Armut hin. <strong>Die</strong>se Aussage impliziert vielfach Hilflosigkeit, ruft aber auch Hilflosigkeit<br />
hervor.<br />
Obwohl Kinderarmut im Bereich der Wissenschaft, aber gelegentlich auch im Rahmen<br />
sozialarbeiterischer Praxis thematisiert wird und auch auf die gesellschaftlichen und<br />
Sozialarbeiterischen Folgen hingewiesen wird, besteht der Eindruck, dass Armut ein<br />
tabuisiertes Thema ist. Das mag mit der vermeintlichen und häufig auch tatsächlichen<br />
Ohnmacht der handelnden Experten ebenso wie mit dem eingetretenen gesellschaftlichen<br />
Klima zusammenhängen. Daher wird es als notwendig angesehen, eine möglichst<br />
praxisnahe <strong>Studie</strong> zu dieser Problematik zu erstellen, da Kinderarmut auch in Hamburg, der<br />
"wachsenden Stadt", ein wachsendes Problem ist.<br />
<strong>Die</strong> Frage, ob das "Festhalten in Armut" und das Zulassen von Exklusion an<br />
gesellschaftlicher Teilhabe und Teilnahme mit dem Sozialstaatsprinzip vereinbar ist – "<strong>Die</strong><br />
Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat" 1 – kann und<br />
soll an dieser Stelle nicht beantwortet werden. Im Rahmen dieser <strong>Studie</strong> werden u. a. die<br />
Auswirkungen von Armut und Benachteiligung auf die davon betroffenen Kinder,<br />
Jugendlichen und ihre Familien aufgezeigt und die gesellschaftliche Relevanz dieser<br />
Thematik dargestellt.<br />
Neben der Sichtbarmachung der Armutsproblematik und von Benachteiligungsprozessen<br />
geht es hier um einen Beitrag "Sozialarbeiterischer Öffentlichkeitsarbeit" im Sinne der<br />
Sensibilisierung und Meinungsbildung zu Problem- und Mängellagen der Betroffenen und<br />
der Aktivierung verschiedener gesellschaftlicher Gruppen zu ihrer Bearbeitung.<br />
Ausgangspunkt für diese <strong>Studie</strong> waren in erster Linie Erkenntnisse aus dem Projekt<br />
"Sozialraum- und lebensweltorientierte Hilfen zur Erziehung unter Einbeziehung der<br />
Implementierung eines Sozialraumbudgets", die im Rahmen der Analyse der Zielgruppen<br />
von Hilfen zur Erziehung (HzE) und der Phänomene, die Hintergrund und Ausgangspunkt<br />
der Hilfen sind, sowie bei einer Sozialraum- und Lebenslagen-/ Lebensweltanalyse<br />
gewonnen wurden: ca. 60 % der Hilfeempfänger lebten von Sozialhilfe – Hilfe zum<br />
Lebensunterhalt – und gut 90 % lagen mit ihrem Einkommen unter der von der EU<br />
definierten Armutslinie. 2<br />
Im Rahmen des o. g. Projekts wurde in erster Linie auf der individuellen Ebene (Mikro-<br />
Ebene) mit den Betroffenen zusammengearbeitet. Das entspricht der Vorstellung sowohl von<br />
vielen Professionellen der Sozialen Arbeit selbst als auch der Gesellschaft allgemein. Nimmt<br />
aber Soziale Arbeit – und hier besonders die Jugendhilfe – ihren Auftrag: "Jugendhilfe soll<br />
zur Verwirklichung des Rechts ... junge Menschen in ihrer individuellen Entwicklung fördern<br />
und dazu beitragen, Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen" 3 ernst, so kann sie<br />
sich nicht auf diese Ebene reduzieren. "Soziale Arbeit [ist] als eine Profession, die ... auf<br />
verschiedenen sozialen Ebenen – nämlich Individuum, Familie, Kleingruppe, territoriales<br />
Gemeinwesen, Organisation ... – präsent zu sein hat," 4 zu verstehen. In vielen –<br />
insbesondere europäischen – Ländern war und ist es selbstverständlich, dass Soziale Arbeit<br />
zwar immer beim Individuum und seinem unmittelbaren Kontext ansetzt, "um aber im<br />
Folgenden die Frage zu stellen, was auf der Ebene soziokultureller Systeme problematisch<br />
1 Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, Artikel 20, Abs. 1<br />
2 Erkenntnisse aus einem Schnittstellenprojekt in Farmsen/ Berne entsprechen diesen Daten.<br />
3 § 1 Abs. 3 Satz 1 Kinder- und Jugendhilfegesetz / SGB VIII<br />
4 Staub Bernasconi, S., Soziale Arbeit als "Menschenrechtsprofession",<br />
in: Hochstrasser, F. u.a., <strong>Die</strong> Fachhochschule für Soziale Arbeit, Bern, Stuttgart, Wien, 1997, S. 315 f.<br />
13
ist und deswegen verändert werden müsste ... aufgrund sachgemäßer Analyse der<br />
Probleme, Ressourcen und Zugänge zu den verschiedenen Systemen". 1<br />
In Deutschland haben dagegen Vorbehalte gegen die Ausweitung Sozialer Arbeit auf die<br />
Makro-Ebene Tradition. <strong>Die</strong> Umsetzung von Erfahrungen und Erkenntnissen, die auf der<br />
individuellen (Mikro-) Handlungsebene gewonnen werden, in handlungsleitende<br />
Erklärungsansätze, die gesellschaftliche und politische Aspekte ins Blickfeld rücken, ist nicht<br />
üblich.<br />
<strong>Die</strong>se Tradition wurde u. a. in dem o. g. Projekt durch die Entwicklung Fallunabhängiger<br />
Arbeit (FuA) unterbrochen. Durch diese <strong>Studie</strong> soll eine Erweiterung zu diesem Ansatz<br />
erfolgen. Als entscheidend für das Theorie- und Praxisverständnis Sozialer Arbeit wird die<br />
erfahrungswissenschaftliche Erfassung der Lebenslage, Probleme und Nöte junger<br />
Menschen mit wenig oder keinen Ressourcen zur Lebensbewältigung und mit behinderten<br />
Lernprozessen angesehen.<br />
Eine solche "erfahrungswissenschaftliche Erfassung" von Armut und Benachteiligung von<br />
Kindern und Jugendlichen in Hamburg wird durch diese <strong>Studie</strong> als Soziale Arbeit auf der<br />
Makro-Ebene geleistet. Ihr liegt ein multidimensionaler Ansatz zur Erfassung und Erklärung<br />
von Armut und Benachteiligung zugrunde. Im Rahmen eines (Handlungs-)<br />
Forschungsprozesses werden quantitative und qualitative Daten erhoben, die die Situation in<br />
Hamburg insgesamt erfassen. Vertiefende Untersuchungen beziehen sich auf die<br />
spezifische Situation in der Region III (Eidelstedt, Stellingen) in Eimsbüttel und auf das<br />
Schanzen- und Karolinenviertel. Durch solche kleinräumlichen Untersuchungen werden z. T.<br />
gravierende Abweichungen zu den eher nivellierenden Hamburger Durchschnittswerten<br />
deutlich.<br />
Bei den quantitativen Daten wird auf verfügbares statistisches Material zurückgegriffen. <strong>Die</strong><br />
qualitativen Daten werden im Rahmen von Gruppendiskussionen mit Professionellen in zwei<br />
Untersuchungsgebieten und durch Einzelinterviews/ Expertengespräche mit sogenannten<br />
Opinionleadern erhoben.<br />
Eine Auseinandersetzung mit dem Verständnis von Armut und Benachteiligung und dem<br />
Lebenslagenkonzept als handlungsleitendem Erklärungsansatz stellt den Hintergrund für die<br />
<strong>Studie</strong> dar. Anschließend werden die Untersuchungsergebnisse zu den definierten Fragen<br />
zu Armut und Benachteiligung von Kindern und Jugendlichen in Hamburg aufgezeigt. Ein<br />
Exkurs zu "Wohn- und Wohnumfeldproblematik als sichtbarste Form der Ausgrenzung"<br />
ergänzt diese Einschätzungen.<br />
Abschließend werden definierte Konsequenzen<br />
• auf der gesellschaftlichen Ebene<br />
• auf der Ebene der Jugendhilfe und<br />
• für eine Sozial- und Wohnungspolitik,<br />
ergänzt durch einen Exkurs "Bildung als primäre Ressource, den Kreislauf von Armut und<br />
Benachteiligung zu durchbrechen", benannt.<br />
1 ebenda, S. 316<br />
14
2 Hintergrund der Projektentwicklung<br />
Das dieser <strong>Studie</strong> zugrunde gelegte Forschungskonzept resultiert aus Erfahrungen und<br />
Erkenntnissen, die im Rahmen der wissenschaftlichen Begleitung des o. g. Projektes<br />
"Sozialraum- und lebensweltorientierte HzE" und der in diesem Zusammenhang<br />
realisierten Praxisforschung gewonnen wurden.<br />
Eine Auseinandersetzung mit den Ausführungen zu der Situation armer und benachteiligter<br />
Kinder und Jugendlicher im 10. und 11. Kinder- und Jugendbericht der Bundesregierung und<br />
mit Definitionen zu Armut und Benachteiligung sowie mit dem Lebenslagenansatz als<br />
theoretischem Erklärungsmodell ermöglichen es, die in der <strong>Studie</strong> aufgezeigten<br />
Untersuchungsergebnisse in Beziehung zu gesamtgesellschaftlichen Erkenntnissen zu<br />
reflektieren.<br />
Abschließend wird in diesem Kapitel das Forschungsdesign dargestellt, das auf Prämissen<br />
und methodischen Forschungsansätzen der Handlungsforschung basiert. Quantitative und<br />
qualitative Forschungsmethoden dienen dem Erkenntnisgewinn. 1<br />
2.1 Hintergrund für die Erarbeitung der <strong>Studie</strong><br />
Analysiert man die Lebenslage von Familien, die im Rahmen von Hilfen zur Erziehung<br />
unterstützt und gefördert werden, so wird schnell deutlich, dass sich die Angebote in erster<br />
Linie an arme und benachteiligte Familien richten (vgl. Punkt 1).<br />
Der Anspruch auf HzE wird generell daran geknüpft, dass "eine dem Wohl der Kinder oder<br />
der Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine<br />
Entwicklung geeignet und notwendig ist" (§ 27 Abs. 1 KJHG).<br />
"Eine Gefährdung des Kindeswohles liegt vor, wenn durch die soziale, psychosoziale oder<br />
individuelle Sozialisationssituation, in der sich der Minderjährige befindet, konkret<br />
benennbare Schädigungsfolgen wahrscheinlich eintreten werden, so dass die<br />
Nichtveränderung der Situation eine Gefahr für das Wohl des Kindes bedeutet. ... Das Wohl<br />
des Kindes ist ... dann nicht gewährleistet, wenn die Sozialisationslage des betreffenden<br />
Minderjährigen sich im Vergleich als benachteiligend darstellt. ....wenn die konkrete<br />
Lebenssituation durch Mangel oder soziale Benachteiligung gekennzeichnet ist." 2<br />
<strong>Die</strong>se Ausführungen von Münder weisen darauf hin, dass die Realisierung von HzE in<br />
hohem Maße mit Benachteiligungen von Kindern und Jugendlichen korreliert.<br />
Schon zu Beginn des Projektes (2001) wurde die räumliche Ansiedlung der Familien, die<br />
eine HzE erhalten, untersucht. Es kristallisierte sich sehr schnell heraus, dass ca. 60% aller<br />
"Empfängerfamilien" in sieben Quartieren lebten; deren Bevölkerung machte aber nur ca.<br />
30% der Bevölkerung in der Region III in Eimsbüttel aus.<br />
<strong>Die</strong>se Quartiere stellen innerhalb der schon als benachteiligt anzusehenden Stadtteile<br />
nochmals besonders belastete und belastende Regionen dar. Betrachtet man den Anteil der<br />
Kinder, die in den Quartieren zu dem Zeitpunkt von Sozialhilfe/ Hilfe zum Lebensunterhalt<br />
(HLU) lebten, so wird die Infantilisierung von Armut deutlich. <strong>Die</strong>s betrifft insbesondere<br />
Paarhaushalte mit mehreren Kindern sowie Einelternfamilien.<br />
1<br />
Der Bericht ist so geschrieben, dass einzelne Kapitel in sich geschlossen sind, so dass es gelegentlich<br />
zu Wiederholungen kommt.<br />
2<br />
Münder u. a.. (Hrsg.), Frankfurter Kommentar zum SGB VIII: Kinder- und Jugendhilfe,<br />
Weinheim, 4. Auflage, 2003, S. 279 f<br />
15
Bezogen sich diese Erkenntnisse zur Einkommenssituation auf die Bevölkerung in den<br />
Quartieren und der Region III insgesamt, so wurde im Rahmen einer Analyse der<br />
Lebenssituation der 176 Familien, für die im Laufe des Jahres 2001 eine HzE bewilligt<br />
wurde, deutlich, dass 60% der Familien Sozialhilfe oder Arbeitslosenhilfe erhielten. Auch bei<br />
den übrigen Familien lag das Einkommen in der Regel unter der von der EG 1984 definierten<br />
Armutsgrenze von 50% des bereinigten Durchschnittseinkommens je steuerpflichtigem<br />
Haushalt in dem jeweiligen Mitgliedsstaat.<br />
<strong>Die</strong> meisten dieser Familien sind in ihren ökonomischen, immateriellen und sozialen<br />
Dimensionen beeinträchtigt und in ihren Chancen zur gesellschaftlichen Teilhabe<br />
eingeschränkt. Der multidimensionale Charakter ihrer Deprivation weist nicht nur auf<br />
unzureichende finanzielle Mittel hin, sondern auch auf Deprivationen in den Bereichen<br />
Familie, Schule/ Bildung, berufliche Qualifizierung/ Beschäftigung, Freizeit, Wohnen,<br />
physische/ psychische Gesundheit, Zugang zu <strong>Die</strong>nstleistungen, Lebensperspektiven und<br />
Entwicklungschancen. Häufig besteht bei den Familien Unsicherheit über ihre Rechte und<br />
Ansprüche, Abhängigkeit gegenüber Institutionen und – noch immer – ein Ausgeliefertsein<br />
gegenüber gesellschaftlicher Diskriminierung. In der Regel ist ihre Lebenslage<br />
gekennzeichnet durch eine Vielzahl von Belastungsfaktoren und einem Mangel an<br />
Bewältigungsstrategien. Oft führt die genannte Lebenslage zu Überbelastungen und<br />
Überforderungen, aber auch zu Perspektivlosigkeit und Zukunftsangst, die sich z. T. in<br />
Apathie und Resignation niederschlagen, z. B.<br />
• bezogen auf das Managen des Alltags,<br />
• die Erziehung und Förderung der Kinder,<br />
• ihre soziale Integration und gesellschaftliche Teilhabe.<br />
Folgeerscheinungen von Armut und Benachteiligung bei Kindern und Jugendlichen sind in<br />
erster Linie<br />
• Leistungsschwäche,<br />
• depressives Verhalten,<br />
• Unausgeglichensein, Jähzorn und Depressivität,<br />
• Armut als Delinquenzrisiko und<br />
• der Versuch wegen fehlender Anerkennung und Zuwendung Aufmerksamkeit zu<br />
erreichen, auch durch negative Verhaltensweisen. 1<br />
Viele der Kinder sind psychisch sehr belastet und entwickeln ein Zugehörigkeitsgefühl zu<br />
einem als "unten" empfundenen Milieu. Da ihnen häufig Modelle für eine kompetente<br />
Lebensweise, Lebensplanung und Aufgabenwahrnehmung fehlen, nehmen sie ihre Situation<br />
als chancenlos wahr.<br />
<strong>Die</strong>se Ergebnisse bestätigen die These aus dem 10. Kinder- und Jugendbericht, dass<br />
insbesondere Jugendliche aus benachteiligten Familien – und hier besonders aus<br />
Einelternfamilien – Zielgruppe der HzE sind 2 . Armut beeinträchtigt Kinder in ihren<br />
Entwicklungs- und Teilhabechancen erheblich. Auch wenn die Eltern meistens zuerst ihre<br />
eigenen Bedürfnisse zurückstellen, entsteht bei länger anhaltendem Sozialhilfebezug oder<br />
einer vergleichbaren Einkommenssituation eine von ihnen nicht mehr zu bewältigende<br />
Unterversorgungslage. Möglichkeiten und Fähigkeiten der Familienhaushalte, bei<br />
Einkommensarmut den täglichen Lebensunterhalt zu bestreiten, nehmen mit der Dauer und<br />
Tiefe der Armutslage ab. 3<br />
1 Andrä, H., Begleiterscheinungen und psychosoziale Folgen von Kinderarmut, in: Butterwegge, Ch. (Hrsg.),<br />
Kinderarmut in Deutschland, Frankfurt am Main, 2000, S. 280 f.<br />
2 BMSFSJ (Hrsg.),10. Kinder- und Jugendbericht, Drucksache 13/11368, S. 264<br />
3 vgl. Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung (Hrsg.), Lebenslagen in Deutschland, Bonn 2001, S. 113<br />
16
2.2 Armut und Benachteiligung von Kindern und Jugendlichen<br />
– ein Thema des 11. Kinder- und Jugendberichts<br />
Schon im 10. Kinder- und Jugendbericht wurde darauf hingewiesen, dass es einen engen<br />
Zusammenhang zwischen Armut und einem Bedarf an HzE gäbe, "insbesondere mit<br />
stationären Hilfen. ... <strong>Die</strong>se Tatsache ... zeigt deutlich die Grenzen sozialpädagogischer<br />
Maßnahmen und bedarf einer Politik, deren zentraler Punkt der Abbau sozialer<br />
Benachteiligung ist. Notwendig sind regelmäßige Armutsberichterstattungen auf Bundes-,<br />
Landes und kommunaler Ebene unter besonderer Berücksichtigung von Familien mit<br />
Kindern. Dringend geboten ist eine Armutspolitik, die das gesamte Lebensumfeld von<br />
Kindern und Familien berücksichtigt (wirtschaftliche Sicherung, Arbeit und Wohnen,<br />
Gesundheit, soziale Beziehungen, Bildung, kulturelle Teilhabe)." 1<br />
Der 11. Kinder- und Jugendbericht "reagiert" auf die o. g. Aussage im 10. Kinder- und<br />
Jugendbericht und befasst sich in erster Linie mit den Lebenslagen von Kindern und<br />
Jugendlichen und den sich entwickelnden Lebenswelten.<br />
Klocke und Hurrelmann weisen darauf hin, dass sich Kinderarmut als ein gravierendes<br />
gesellschaftliches Problem gestaltet: "so lebten nach dem 50%-Einkommens-Ansatz [EG-<br />
Armutsgrenze] etwa 2,8 Millionen Kinder Ende der 90er Jahre in Armut". 2<br />
Im Zusammenhang mit sozioökonomischer Benachteiligung wird auf vielfältige Formen der<br />
Unterversorgung aufmerksam gemacht: "Zweifelsohne sind Mangelerfahrung,<br />
problematische Gesundheitszustände, schlechte Versorgung mit Wohnraum, Aufwachsen in<br />
sogenannten 'belasteten Stadtteilen' oder unzureichende Kleidung nach wie vor wichtige<br />
Indikatoren für Problemlagen, Unterstützungs- und Förderbedarf."<br />
Von Armut und Benachteiligung betroffene Kinder und Jugendliche nehmen die massiven<br />
Einschränkungen ihrer Handlungs- und Entwicklungsperspektiven im Vergleich zu<br />
wohlhabenden Kindern bewusst wahr. In einer Konsumgesellschaft aufzuwachsen ohne oder<br />
mit nur sehr geringen Teilnahmechancen an der altersspezifischen "Warenwelt" und an<br />
Freizeitaktivitäten beeinflusst ihre "personale und soziale Identitätsentwicklung sowie ihre<br />
Positionierung innerhalb von Peer-Groups. <strong>Die</strong> [Nicht-] Realisierung von<br />
Konsumbedürfnissen hat Einfluss auf ihr Selbstwertgefühl, ihr psychosoziales Wohlbefinden<br />
und ihre Lebensfreude. Kinder und Jugendliche, die keine Kleidung ausgewählter Marken<br />
tragen, nicht über gerade "angesagte" Accessoires verfügen, sich keine kommerziellen<br />
Freizeitaktivitäten leisten können und/ oder in weniger angesehenen Wohnverhältnissen<br />
leben, fallen negativ auf, gehören nicht dazu. Sie laufen Gefahr, von Gleichaltrigen<br />
stigmatisiert und ausgegrenzt zu werden und nehmen sehr sensibel wahr, dass die<br />
Verfügbarkeit von materiellen Ressourcen ihre Chancen im immateriellen Bereich<br />
entscheidend mitbestimmen (vgl. Neuberger 1997, Kock/ Holz 1999)". 3<br />
Zur Bewältigung ihrer sozioökonomischen Benachteiligung werden von den betroffenen<br />
Kindern und Jugendlichen, aber auch von ihren Eltern, verschiedene Bewältigungsstrategien<br />
entwickelt. "Viele von Armut Betroffene schämen sich für ihre Lage, versuchen diese zu<br />
leugnen und kommen Prozessen der Ausgrenzung durch einen Rückzug aus sozialen<br />
Kontakten zuvor. ...In Verbindung mit diesen Reaktionen sind psychosoziale Störungen,<br />
Selbstwertkrisen, Lernschwierigkeiten und soziale Auffälligkeiten von Kindern und<br />
Jugendlichen zu verzeichnen. Bei einem Teil der jungen Menschen tritt die Versorgung mit<br />
Statussymbolen an die Stelle der erforderlichen Grundversorgung oder der äußere Schein<br />
wird durch Verschuldung aufrechterhalten". 4<br />
1<br />
10. Kinder- und Jugendbericht, a.a.O., S. 268<br />
2<br />
aus: BMFSFJ (Hrsg.), 11. Kinder- und Jugendbericht, Berlin, 2/2002, S. 141<br />
3<br />
ebenda, S. 146<br />
4<br />
ebenda, S. 146<br />
17
<strong>Die</strong> Zahl überschuldeter Haushalte nimmt in Deutschland kontinuierlich zu. Waren 1999<br />
bundesweit "erst" ca. 2,8 Millionen Haushalte überschuldet 1 , so waren es 2005 laut 2.<br />
Armutsbericht der Bundesregierung bereits 3,13 Millionen private Überschuldungen. "Ein<br />
Privathaushalt ist dann überschuldet, wenn Einkommen und Vermögen über einen längeren<br />
Zeitraum trotz Reduzierung des Lebensstandards nicht ausreichen, um fällige Forderungen<br />
zu begleichen." 2<br />
Erschreckend ist der hohe Anteil ver- und überschuldeter Jugendlicher: "Jugendliche sind<br />
sich häufig über Kreditzinsraten und andere Risiken des schnellen Geldes nicht im Klaren." 3<br />
Mit der Vereinfachung des Zugangs zu Kreditkarten und Privatkrediten steigt ihre<br />
Verschuldung.<br />
"Welche Auswirkungen ökonomische Ungleichheit und soziale Ausgrenzung in einer<br />
hochgradig an materiellen Werten orientierten Gesellschaft haben, ist noch nicht<br />
erschöpfend belegt und bedarf einer eingehenden multidimensionalen Betrachtung.<br />
Nachgewiesen sind Zusammenhänge zwischen sozioökonomischen Mängellagen und<br />
Schulverweigerung bzw. Schulversagen, Bildungserfolg, Arbeitslosigkeit, physischen und<br />
psychosozialen Beeinträchtigungen, erfasster Delinquenz, Freizeitverhalten etc." 4<br />
Mit Hinweis auf verschiedene Untersuchungsergebnisse wird weiter ausgeführt:<br />
• "dass Kinder, die in materieller Armut oder zumindest materiellen Mängellagen leben,<br />
signifikant niedrigere Bildungsabschlüsse erreichen ...<br />
• dass Jugendliche aus Familien mit niedrigerem Sozialprestige deutlich häufiger<br />
Ausbildungseinrichtungen besuchen, die einen weniger erfolgreichen Berufsstart<br />
erkennen lassen und dort auch Prozessen der Statuszuschreibung unterliegen....<br />
• Auch in Bezug auf die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen deuten <strong>Studie</strong>n<br />
negative Effekte durch sozioökonomisch prekäre Lebenslagen an.<br />
• Als psychosoziale Auswirkungen von Langzeitarbeitslosigkeit und damit verbundener<br />
Armut in Familien werden zudem genannt: Zerstörung des Rollengefüges in den<br />
Familien, verstärkt Depressionen und Resignation auch bei Kindern, Zukunftsängste der<br />
Kinder, Rückgang der Schulleistungen und zunehmende soziale Isolation. ...." 5<br />
<strong>Die</strong> hier aufgezeigten Phänomene und ihre Bedeutung für Teilhabechancen in unserer<br />
Gesellschaft werden in die Untersuchungen – besonders bei der Realisierung der<br />
Expertengespräche – einbezogen.<br />
<strong>Die</strong> Lebenslage und in dem Zusammenhang die Institutionen des sozialen Nahraums sind<br />
von besonderer Bedeutung für die Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen.<br />
Lebenswelt bezieht sich darauf, wie Menschen sich - in Wechselbeziehung mit ihrer Umwelt<br />
- erfahren, z. B. in ihren räumlichen, sozialen und zeitlichen Strukturen und in ihren<br />
kulturellen Möglichkeiten. Menschen leben in ihrer Familie, in ihrer (Um-)Welt, mit der sie<br />
sich identifizieren, aus der sie ihre Identität beziehen. Ihre Lebenswelt ist gekennzeichnet<br />
durch Aufgaben, die bewältigt und mit den Mitteln (Kompetenzen, Ressourcen), die ihnen zur<br />
Verfügung stehen, angegangen werden müssen.<br />
Soziale Nahräume werden im 11. Kinder- und Jugendbericht definiert "als ein Gefüge mehr<br />
oder minder dauerhafter sozialer Beziehungen. ... Geht man vom Bild der konzentrischen<br />
Kreise aus, so ist der innere Kreis die familiale Lebensform, den nächsten Kreis bilden die<br />
informellen Netzwerke und den wiederum nächsten Kreis die organisierten Netzwerke, die in<br />
1<br />
ebenda, S. 146<br />
2<br />
Deutscher Bundestag, Drs. 15/5015, Lebenslagen in Deutschland, 2. Armuts- und Reichtumsbericht,<br />
Berlin, 3/2005, S. 63<br />
3<br />
11. Kinder- und Jugendbericht, a.a.O., S.196<br />
4<br />
ebenda, S. 146<br />
5<br />
ebenda, S. 146<br />
18
der Regel einen formalen bzw. institutionalisierten Charakter haben (Schule, Angebote der<br />
Kinder- und Jugendhilfe u. a.). Typischerweise bewegen sich Kinder und Jugendliche in<br />
mehreren dieser Kreise." 1 An dieser Stelle werde ich nur auf den "Nahraum Familie"<br />
eingehen:<br />
Familien, verstanden als Lebensform von Personen – Sorgeberechtigten mit einem Kind<br />
bzw. mit mehreren Kindern – haben inzwischen sehr unterschiedliche Gesichter: "Eltern mit<br />
ein, zwei oder mehreren Kindern, Alleinerziehende, Mehrgenerationenhaushalte,<br />
homosexuelle Paare mit Kindern, sogenannte Patchworkfamilien, .. Familien, die Migrations-<br />
oder auch Fluchterfahrungen haben... ." 2<br />
Obwohl diese unterschiedlichen Formen familialen Zusammenlebens lange bekannt sind,<br />
werden die Auswirkungen veränderter Familienformen generell und für das Aufwachsen von<br />
Kindern speziell weitgehend ausgeblendet.<br />
<strong>Die</strong> inzwischen sehr hohe Scheidungsquote hat bei der Veränderung familialer<br />
Lebensformen besondere Relevanz. In Deutschland werden z. B. ein Drittel der Ehen<br />
geschieden. In Hamburg kommen schon seit Beginn der 80er Jahre auf 100<br />
Eheschließungen jährlich mehr als 50 Ehescheidungen: 1980 –100:50 (8930:4494), 2000 –<br />
100:59 (7865:4637), 2003 – 100:72 (6595:4986). 3 "Gleichzeitig bringen immer mehr<br />
unverheiratete Frauen – mit oder ohne einen festen Partner – Kinder zur Welt. Anlog dazu<br />
hat deshalb in den 90er Jahren die Zahl der Alleinerziehenden weiter zugenommen." 4 Der<br />
Anteil der Kinder in Einelternfamilien stieg bis zum Jahr 1998 auf 21%, davon lebten<br />
wiederum 18% mit ihren alleinerziehenden Vätern zusammen. Insbesondere in städtischen<br />
und großstädtischen Regionen zeigt der Normaltypus der Familie – Ehepaare mit Kind/<br />
Kindern – Erosionserscheinungen. 5<br />
Materielle Benachteiligungen sind in Einelternfamilien besonders häufig. Alleinerziehende<br />
sind überwiegend in den unteren Einkommensgruppen vertreten. "Ein Drittel der allein<br />
Erziehenden hat monatlich weniger als 1300 Euro [Haushaltsnettoeinkommen] zur<br />
Verfügung, fast drei Viertel weniger als 2000 Euro." 6<br />
Der Rückgang der Kinderhäufigkeit – inzwischen wachsen ca. ein Fünftel aller Kinder als<br />
Einzelkinder auf – beeinträchtigt Kinder ebenfalls in ihrer Entwicklung; ihnen fehlt<br />
"Gleichaltrigengeselligkeit". "Das heißt, die Familie bietet aufgrund des Fehlens von<br />
Geschwistern immer weniger die Möglichkeit, als soziales Lernfeld zu fungieren, in dem<br />
Geschwisterrivalitäten ausgelebt werden können, gleichzeitig aber auch Fähigkeiten<br />
erworben werden können, wie konkurrierende Interessen zu respektieren, Zuwendung der<br />
Eltern zu teilen und Kompromisse zu schließen sind. Einzelkinder sind deshalb ... auf<br />
Gleichaltrigenkontakte außerhalb der Familie [z. B. in Kitas] angewiesen." 7<br />
Eine Kompensation eingeschränkter bzw. fehlender sozialer Lernmöglichkeiten im<br />
Verwandtschaftssystem besteht inzwischen für viele Kinder nicht mehr. Fehlende materielle,<br />
aber auch soziale und kulturelle Ressourcen haben Einfluss auf die familiale Sozialisation.<br />
Wachsende Komplexität der Lebenslagen junger Menschen stellen erhebliche und<br />
gravierende Anforderungen an ihre Familien. "Wie selbstverständlich wird davon<br />
ausgegangen, dass Familien aus sich heraus in der Lage sind, die vielschichtigen<br />
Erziehungs- und Sozialisationsaufgaben angemessen bewältigen zu können. Darüber aber,<br />
wie die hierzu erforderlichen Kompetenzen und Fähigkeiten erworben werden können,<br />
herrscht weitgehend Unklarheit. Vermittlung eines tragfähigen Werte- und Normensystems<br />
angesichts einer Pluralisierung von Wertvorstellungen, Vorbereitung auf einen kompetenten<br />
1<br />
ebenda, S. 122<br />
2<br />
ebenda, S. 122<br />
3<br />
Statistisches Jahrbuch Hamburg, 2004/2005, Statistikamt Nord (Hrsg.), Hamburg, 10/2004, S. 28<br />
4<br />
11. Kinder- und Jugendbericht, a.a.O., S. 123<br />
5<br />
ebenda, S. 123<br />
6<br />
Lebenslagen in Deutschland, 2005, a.a.O., S. 78<br />
7<br />
11. Kinder- und Jugendbericht, a.a.O., S. 124<br />
19
Umgang mit den Angeboten der Konsum- und Medienwelt im Kontext einer immer stärker<br />
medial geprägten und in Marktzusammenhängen eingebundenen Jugendphase, Schul- und<br />
Berufswahl vor dem Hintergrund eines Bedeutungszuwachses von Bildung bei gleichzeitig<br />
abnehmender Integrationskraft von Bildungsabschlüssen – alles dies sind<br />
Herausforderungen, mit denen sich Familien zunehmend konfrontiert sehen." 1<br />
<strong>Die</strong> Bedeutung nachbarschaftlicher, arbeiterkultureller oder religiös geprägter Milieus als<br />
unterstützende Systeme ist inzwischen ebenso verloren gegangen wie die von Verwandten.<br />
"Konnten beispielsweise familiale 'Sozialisationsdefizite', die innerhalb des familialen<br />
Kernverbandes entstanden waren, durch solche quasi selbstverständlichen Einbindungen<br />
kompensiert oder zumindest verdeckt werden", so führt die zunehmende Erosion dieser<br />
Milieus dazu, dass Eltern "zu der entscheidenden Institution der Reproduktion des Sozialen" 2<br />
werden.<br />
<strong>Die</strong> hier dargestellten Situationen mit ihren Benachteiligungs- und Erosionsprozessen in<br />
Familie und z. B. Nachbarschaft sind von großer Relevanz für die sich entwickelnden<br />
Lebenswelten junger Menschen.<br />
<strong>Die</strong> Lebenswelt armer und benachteiligter junger Menschen wird in der Regel durch die<br />
folgenden Sachverhalte beeinflusst:<br />
• permanente Unsicherheit bezogen auf die gesamte Lebenssituation<br />
• Erfahrung der elterlichen Unsicherheit � Schwierigkeit ein eigenes, stabiles<br />
Selbstbewusstsein zu entwickeln<br />
• Verlust des Selbstwertgefühls und Unsicherheit bezogen auf ihr Selbstbild<br />
• Verlust der Kindheit durch zu frühe Übernahme von Verantwortung für die Familie<br />
• Schulangst, die sowohl Lernschwierigkeiten als auch Schulverweigerung hervorrufen<br />
kann<br />
• kaum Möglichkeit eigener Interessensentfaltung wegen fehlender Anregungen und<br />
Wahlmöglichkeiten<br />
• begrenzte Zukunftsperspektiven – die daraus resultierende Frustration kann sich in<br />
Gewaltanwendung und Suchtverhalten niederschlagen<br />
• bewusste Wahrnehmung persönlicher Chancenlosigkeit<br />
• fehlende Modelle für eine kompetente Lebensweise, Lebensplanung und<br />
Aufgabenwahrnehmung. 3<br />
2.3 Armut – ein multidimensionales Phänomen<br />
In dieser <strong>Studie</strong> werden wiederholt die Begriffe Armut und Benachteiligung verwandt, ohne<br />
dass bisher benannt wurde, was unter diesen Begriffen verstanden werden soll. Im<br />
Folgenden sollen verschiedene Definitionen zu Armut von Armutsexperten aus Politik und<br />
Wissenschaft aufgeführt und das der <strong>Studie</strong> zugrunde liegende Verständnis von Armut und<br />
Benachteiligung aufgezeigt werden.<br />
In dem zweiten Armutsbericht weist die Bundesregierung darauf hin: "Armut und Reichtum<br />
sind als gesellschaftliche Phänomene untrennbar mit Werturteilen verbunden. ... In<br />
Gesellschaften wie der unseren liegt das durchschnittliche Wohlstandsniveau wesentlich<br />
über dem physischen Existenzminimum. ... Eine weitere Form der Armutsdefinition, auf die in<br />
1<br />
11. Kinder- und Jugendbericht, a.a.O., S. 125<br />
2<br />
ebenda, S. 126 f.<br />
3<br />
vgl. Palloks, K., Konzeption zum Forschungsvorhaben "Indikatoren zur Messung der Armutssituation von<br />
Kindern und Jugendlichen", Unveröffentlichtes Manuskript, Potsdam 2000, S. 10 f.<br />
20
Gesellschaften mit höherem durchschnittlichen Wohlstandsniveau zurückgegriffen wird, ist<br />
das soziokulturelle Existenzminimum. Es nimmt nicht nur die physische Existenz zum<br />
Bezugspunkt, sondern auch den Ausschluss von Teilhabe am gesellschaftlich üblichen<br />
Leben, die soziale Ausgrenzung. Das soziokulturelle Existenzminimum wird im<br />
Sozialhilferecht definiert und abgesichert." 1<br />
Leistungen nach dem Bundessozialhilfegesetz sollen "die Führung eines Lebens<br />
ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht". 2 Dass dieses durch Sozialhilfe / Hilfe<br />
zum Lebensunterhalt (HLU) heute möglich ist, wird vielfach von Betroffenen – insbesondere<br />
von Familien mit Kindern – sowie Experten der Praxis und besonders der Armutsforschung<br />
bestritten, von Vertretern der Wirtschaft und vielfach auch der Politik aber bestätigt. Hier wird<br />
deutlich, dass die Betrachtung von Armut untrennbar mit Werturteilen verbunden ist.<br />
In den 70er Jahren begann eine sehr intensive Diskussion zur Armutsproblematik. Heiner<br />
Geißler hat mit seinem Buch "<strong>Die</strong> neue soziale Frage" erheblich zu dieser Diskussion<br />
beigetragen. Es fand u. a. eine Auseinandersetzung darüber statt, dass Armut nicht mehr mit<br />
einer Gefahr der Subsistenzsicherung gleichzusetzen, sondern neben einer materiellen<br />
Benachteiligung auch durch Ausgrenzungsprozesse und Mangel an Teilhabechancen<br />
gekennzeichnet sei: Armut in reichen Industrienationen ist nicht in erster Linie ein Problem<br />
der Sicherung des physischen Existenzminimums, sondern der Tatbestand der<br />
Schlechterstellung eines Teils der Bevölkerung am untersten Ende der Einkommens- und<br />
Wohlstandspyramide. Sie stellt für die betroffenen Menschen ein sie in ihrer individuellen und<br />
gesellschaftlichen Situation beeinträchtigendes, benachteiligendes Phänomen dar. "In Armut<br />
leben heißt, sich in einer Position relativer Benachteiligung im Vergleich zur übrigen<br />
Gesellschaft im Hinblick auf ökonomische Güter und daraus folgend, im Hinblick auf Macht,<br />
Prestige und Ausbildungschancen zu befinden." 3<br />
Benachteiligung in reichen Industrienationen – und so reichen Städten wie Hamburg – ist<br />
immer ein relativer und auch historischer Begriff. Benachteiligung ist demzufolge zu sehen<br />
im Verhältnis zur Lebenssituation anderer Bevölkerungsgruppen und ist für jede<br />
geschichtliche Periode neu zu beschreiben.<br />
1984 – einige Jahre nach Beendigung des 1. EG-Armutsprogramms (1976 bis Ende 1980)<br />
definierte die damalige EG-Kommission Arme als "Einzelpersonen und Personengruppen,<br />
die über so geringe (materielle, kulturelle und soziale) Mittel verfügen, dass sie von<br />
der Lebensweise ausgeschlossen sind, die in dem Mitgliedsstaat, in dem sie leben, als<br />
Minimum annehmbar ist." <strong>Die</strong>ses Minimum wird definiert als "weniger als die Hälfte des<br />
durchschnittlichen Pro-Kopf-Einkommens ihres Landes". In der Bundesrepublik wird die<br />
Höhe der Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Bundessozialhilfegesetz als Armutsgrenze<br />
bezeichnet; sie liegt ca. 10% unter der von der EG benannten Armutsgrenze.<br />
Armut bedeutet für die davon Betroffenen nicht nur eine schlechte materielle Situation: <strong>Die</strong><br />
Europäische Union sprach schon 1984 von der Multidimensionalität von Armut. Sie führt<br />
dazu aus: "<strong>Die</strong>ses Prinzip geht von der Feststellung des multidimensionalen Charakters der<br />
Armut und der sozialen Ausgrenzung aus, die nicht nur auf unzureichende finanzielle Mittel<br />
hinweist, sondern auch im Wohnungswesen, in der Berufsbildung, in der Beschäftigung, im<br />
Bildungswesen, im Gesundheitswesen, im Zugang zu <strong>Die</strong>nstleistungen usw. spürbar wird."<br />
Häufig besteht bei diesen Menschen Unsicherheit über ihre Rechte und Ansprüche,<br />
Abhängigkeit gegenüber Institutionen, die u. a. im Zusammenhang mit den bestehenden<br />
Ermessensspielräumen stehen und – noch immer – ihr Ausgeliefertsein gegenüber<br />
gesellschaftlichen Diskriminierungen.<br />
Beisenherz weist auf die Notwendigkeit hin, dass Kinderarmut nicht unter dem generellen<br />
Armutsbegriff zu subsumieren, sondern unter der Perspektive der Bedingungen des<br />
1 Lebenslagen in Deutschland, 2005, a.a.O., S. 11<br />
2 Bundessozialhilfegesetz (BSHG), § 1 Abs. 2<br />
3 Christiansen, U., Obdachlos weil arm, Gießen, 1973, S. 9<br />
21
Heranwachsens zu betrachten sei: "Hier zeigt sich dann, dass es ... sinnvoller ist, von<br />
Mütterarmut denn von Kinderarmut zu reden. ... <strong>Die</strong> fehlende Anerkennung der<br />
Erziehungsleistung und die Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt sind – mit jeweils<br />
unterschiedlichem Gewicht – die eigentlichen Ursachen der Kinderarmut. ... Ökonomische<br />
Produktion und humane Reproduktion geraten anscheinend im Zeitalter der Globalisierung in<br />
einen kaum noch versöhnbaren Gegensatz. ...wenn die Verträglichkeit der Produktion mit<br />
fundamentalen Erfordernissen humanen Aufwachsens nicht herstellbar ist." 1<br />
Es entsteht der Eindruck "als ob sich entscheidende Weichenstellungen in Richtung von<br />
sozialer Exklusion biografisch in die Kindheit vorverlegen. ... Der Widerspruch zwischen dem<br />
universellen Teilhaberecht einerseits und der ungleichen Verteilung von faktischen Teilhabe-<br />
und Entwicklungsmöglichkeiten bricht schon in der Kindheit und dort besonders sichtbar<br />
auf". 2<br />
Olk weist darauf hin, dass es darum geht "bei sozialwissenschaftlichen Analysen der<br />
Lebenssituation und Befindlichkeiten von Kindern strikt die Perspektive von Kindern<br />
einzunehmen". 3<br />
Auf die Bedeutung der Lebenslagen und Bewältigungsformen von Kindern, die unter<br />
Armutsbedingungen aufwachsen, wird zunehmend hingewiesen. Es reicht nicht aus,<br />
ausschließlich die materielle Lage zu berücksichtigen, "um die Bedeutung von Armut und<br />
Unterversorgung für die Lebenssituation von Kindern in allen ihren relevanten Dimensionen<br />
auszuleuchten". 4 "Es ist notwendig neben der ökonomischen Situation des<br />
Familienhaushaltes ... vor allem auch weitere relevante Bereiche der Lebenssituation und<br />
Lebenslage der betroffenen Kinder in den Blick zu nehmen." 5<br />
Olk verweist in dem Zusammenhang auf Dimensionen der Lebenslage von Kindern die<br />
2000 in einer <strong>Studie</strong> des Bundesverbandes der AWO benannt wurden:<br />
• Materielle Situation des Haushalts (familiäre Armut)<br />
• Materielle Versorgung des Kindes<br />
o Grundversorgung, d. h. Wohnen, Nahrung, Kleidung, materielle<br />
Partizipationsmöglichkeiten<br />
• "Versorgung" im kulturellen Bereich<br />
o z. B. kognitive Entwicklung, sprachliche und kulturelle Kompetenz, Bildung<br />
• Situation im sozialen Bereich<br />
o soziale Kontakte, soziale Kompetenzen<br />
• Psychische und physische Lage<br />
o Gesundheitszustand, körperliche Entwicklung. 6<br />
Ähnliche Aspekte werden von weiteren Experten der Jugendhilfe im Zusammenhang mit<br />
Armut und Benachteiligung von Kindern und Jugendlichen genannt:<br />
• materielle Unterversorgung bei Wohnung, Kleidung und Freizeitaktivitäten<br />
• die gesundheitliche Versorgung ist beeinträchtigt und zum Teil durch mangelhafte<br />
Ernährung gekennzeichnet<br />
• Bedürfnisse, z. B. nach Teilhabe an Bildung, kulturellen Angeboten und Freizeit/Urlaub<br />
können nicht befriedigt werden<br />
1<br />
Beisenherz, H.G., Kinderarmut in der Wohlstandsgesellschaft, Opladen, 2002, S. 10 f.<br />
2<br />
ebenda, S. 12<br />
3<br />
Olk, Th., Kinder in der Armut, in: Kinderreport Deutschland 2004, Deutsches Kinderhilfswerk,<br />
München 2004, S. 23<br />
4<br />
ebenda, S. 27<br />
5<br />
ebenda, S. 27<br />
6<br />
vgl. ebenda, S. 28<br />
22
• fehlende bzw. eingeschränkte Chancen, z. B. der Kinder und Jugendlichen im Bildungs-<br />
und Ausbildungsbereich, werden auch durch jugend- und sozialpolitische Maßnahmen<br />
nicht ausgeglichen. 1<br />
Auf die durch Kinderarmut hervorgerufenen Benachteiligungen wird auch im ersten<br />
Armutsbericht besonders hingewiesen: "Armut von Kindern bedeutet eine Einschränkung<br />
ihrer Erfahrungs-, Entwicklungs- und Lernmöglichkeiten, insbesondere dann, wenn<br />
belastende Faktoren kumulieren. Kinder werden insbesondere als arm bezeichnet, wenn<br />
folgende Kriterien zutreffen:<br />
• wenn die für ein einfaches tägliches Leben erforderlichen Mittel unterschritten werden<br />
• wenn es an unterstützenden Netzwerken für ihre soziale Integration mangelt<br />
• wenn sie von den für die Entwicklung von Sozialkompetenzen wichtigen<br />
Sozialbeziehungen abgeschnitten bleiben<br />
• wenn Bildungsmöglichkeiten für ihre intellektuelle und kulturelle Entwicklung fehlen<br />
• wenn sie in ihrem Umfeld gesundheitlichen Beeinträchtigungen ausgesetzt sind<br />
• wenn Kinder in Familien vernachlässigt werden<br />
• wenn Kinder in Familien Gewalt ausgesetzt sind". 2<br />
Bei einer Analyse der Armut und Benachteiligung von Kindern und Jugendlichen stellt sich u.<br />
a. die Frage "welche Handlungsspielräume Kinder [und Jugendliche] in Armutslagen<br />
überhaupt noch vorfinden, um ihre Lebenswelt selbst zu gestalten und welche Deutung der<br />
Situation und welche Bewältigungsstrategien sie vor dem Hintergrund ihrer spezifischen<br />
Ressourcenausstattung und ihrer persönlichen Kompetenzen entwickeln [können], um mit<br />
einer Lebenssituation in Armut mehr oder weniger produktiv umzugehen." 3<br />
Armut – und insbesondere Kinderarmut – ist eindeutig als multidimensionales Problem<br />
definiert, wobei die materielle Mängellage das relevante Phänomen darstellt, dessen<br />
Vorhandensein bedeutsam für die anderen Lebensbereiche ist.<br />
Können Folgeerscheinungen und Bewältigungsformen von Armut auch generalisiert werden,<br />
so ist gleichzeitig eine Reaktions- und Verhaltensvarianz festzustellen. Insofern ist es<br />
notwendig, Aufmerksamkeit auf Ressourcen und Kompetenzen zu richten, die dazu<br />
beitragen können, Teilhabechancen in den unterschiedlichen Bereichen zu erhalten oder zu<br />
entwickeln.<br />
2.4 Das Lebenslagenkonzept als handlungsleitender Erklärungsansatz<br />
<strong>Die</strong> bisherigen Ausführungen haben gezeigt, dass die Benennung von Armutsgrenzen und<br />
-kriterien korrespondiert mit der technischen und wirtschaftlichen Entwicklung eines Landes<br />
und den jeweils geltenden kulturellen und ethisch-normativen Werten. Gemeinsam ist heute<br />
allen Definitionen, dass sie die Multidimensionalität der Armut und die Relevanz der<br />
Lebenslage für die Armen einbeziehen.<br />
Schon in den 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts fand eine Auseinandersetzung mit dem<br />
Lebenslagenkonzept statt. Neurath, der Begründer dieses Ansatzes, verstand darunter den<br />
Spielraum, der Menschen in den verschiedenen Dimensionen, die ihr Leben ausmachen, zur<br />
Befriedigung ihrer Bedürfnisse und Interessen zur Verfügung steht.<br />
1<br />
vgl. Becher, U., Kruse, I. Armutsrisiken für Einelternfamilien – Einelternfamilien – ein Armutsrisiko?<br />
Potsdam 2001, S.6<br />
2<br />
Lebenslagen in Deutschland, 2001, a.a.O., S. 116<br />
3<br />
Olk, a.a.O., S. 24<br />
23
Hurrelmann definierte die Lebenslage als den Handlungsspielraum, der den Menschen<br />
aufgrund ihrer Lebensumstände zur Befriedigung ihrer Interessen zur Verfügung steht.<br />
Geringe Handlungsspielräume führen zur Beeinträchtigung und Benachteiligung von<br />
Menschen.<br />
<strong>Die</strong> Lebenslage ist in erster Linie durch folgende Charakteristika gekennzeichnet:<br />
• Multidimensionalität – die Lebenslage bezieht sich auf verschiedene Bereiche. <strong>Die</strong><br />
sozioökonomische Lage beeinflusst entscheidend die Handlungsspielräume, aber auch<br />
die Handlungsmotivation eines Menschen.<br />
• <strong>Die</strong> klassische Struktur sozialer Ungleichheit, die bestimmt wird durch Einkommen,<br />
Bildung und Berufs-/ Erwerbsstatus sowie den daraus abgeleiteten Dimensionen (z. B.<br />
Kompetenzen, Lebensstile, gesellschaftliche Positionen) begünstigen die Herausbildung<br />
schichtspezifischer sozialer Milieus.<br />
Zur Verdeutlichung, welche Aspekte – z. B. Strukturen und Prozesse – die Menschen in ihrer<br />
Lebenslage benachteiligen – oder privilegieren – wird hier das von Staub-Bernasconi<br />
entwickelte Lebenslagenkonzept dargestellt. Es dient als handlungsleitender Ansatz zur<br />
Erklärung von Armut und Benachteiligung und setzt sich mit Fragen der "unterschiedlichen<br />
Ressourcen oder sozialen Positionen [auseinander], kurz:[es] fragt nach Gleichheit oder<br />
Ungleichheit zwischen Menschen und Menschengruppen und den sie stützenden Regeln<br />
und kulturellen Deutungs- und Sanktionsmustern." 1<br />
Staub-Bernasconi zeigt auf, dass Menschen zur Befriedigung ihrer Bedürfnisse auf<br />
Kompetenzen und "Ressourcen angewiesen sind, die in den sozialen Systemen, deren<br />
Mitglieder sie sind, unterschiedlich knapp sein können." 2 <strong>Die</strong>se ungleiche Verteilung ist die<br />
Basis für Probleme der individuellen Bedürfniserfüllung, aber auch für die Bedürfniserfüllung<br />
spezifischer benachteiligter Gruppen. Folgende Problembereiche werden u. a. benannt:<br />
• Ausstattungsprobleme<br />
• Austauschprobleme<br />
• Machtprobleme.<br />
Unter Ausstattungsproblemen werden Beeinträchtigungen von Teilhabechancen an<br />
Ressourcen und Errungenschaften einer Gesellschaft verstanden. Sie werden differenziert<br />
in:<br />
• die körperliche Ausstattung<br />
Hierunter werden u. a. Gesundheit, Geschlecht, Alter, aber auch Gehirnstrukturen als<br />
Grundlage für Prozesse der Informationsverarbeitung subsumiert.<br />
• die sozioökonomische und sozioökologische Ausstattung<br />
Hierzu werden u. a. Bildung, Arbeit, Einkommen und Vermögen, und davon abgeleitet die<br />
gesellschaftliche Position, das Konsum- und Komfortgüterniveau, ein soziales<br />
Sicherheitsniveau und die Wohn- und Wohnumfeldsituation gerechnet. Zu<br />
berücksichtigen sind u. a. auch die Bevölkerungsstruktur und die Infrastruktur in dem<br />
bewohnten Stadtteil.<br />
• die Ausstattung mit Erkenntniskompetenzen<br />
Von Erkenntniskompetenz spricht Staub-Bernasconi, "wenn ... Grundorientierungen oder<br />
Erlebensweisen über Sozialisationsprozesse weiterentwickelt und gefördert worden<br />
sind". <strong>Die</strong> Erkenntniskompetenz impliziert "Prozesse des Empfindens, Fühlens, der<br />
Aufmerksamkeit, des Gedächtnisses, der Wahrnehmung, des Lernens, Denkens, der<br />
Begriffsbildung und -verknüpfung einschließlich des Bewertens von Sachverhalten, der<br />
Bildung von Zielen und Plänen – und schließlich als übergeordnete Funktion: die<br />
Ermöglichung von (Selbst) Bewusstsein...". 3<br />
1<br />
Staub-Bernasconi, Sylvia, Soziale Probleme – Soziale Berufe – Soziale Praxis, in: Heiner, M. u.a.,<br />
Methodisches Handeln in der Sozialen Arbeit, Freiburg 1994, S. 13<br />
2<br />
ebenda, S. 14<br />
3<br />
ebenda, S. 15<br />
24
• die symbolische Ausstattung<br />
Gemeint ist das Verfügen über Begriffe, Aussagen und Aussagensysteme. Hier werden<br />
verschiedene Wissensformen unterschieden: Bilder als Beschreibungswissen, Codes<br />
(Grundlage für Kommunikation und Informationsverarbeitung) als Erklärungswissen und<br />
Werte/ Ziele als Wertewissen.<br />
• die Ausstattung mit Handlungskompetenzen<br />
Hierbei geht es um Handlungsweisen wie routiniertes, rollenbezogenes und kognitiv<br />
gesteuertes Verhalten, das über Sozialisationsprozesse gefördert und weiterentwickelt<br />
worden ist.<br />
• die Ausstattung mit informellen und formellen Beziehungen und Mitgliedschaften,<br />
die sowohl zugeschrieben als auch frei gewählt bzw. erworben sein können. 1<br />
Ausstattungsprobleme sind Probleme beeinträchtigter Bedürfniserfüllung. "Aufgrund von<br />
zahllosen Forschungsergebnissen kann nachgewiesen werden, dass psychische Einbrüche,<br />
geistige Desorientierung, selbstzerstörerisches abweichendes Verhalten, soziale Isolation<br />
und Apathie dann entstehen, wenn menschliche Grundbedürfnisse nicht erfüllt werden<br />
können.... ." 2<br />
Soziale Probleme im Ausstattungsbereich sind qualitative und quantitative<br />
Ausstattungsdefizite von Individuen, aber auch von sozialen Systemen wie Familien,<br />
Gruppen, Organisationen. "Der Defizitbegriff bezieht sich hier nicht auf persönliche oder gar<br />
moralische Mängel, wie dies oft unterstellt wird, sondern auf das Problem beeinträchtigter<br />
Bedürfniserfüllung ... und das damit zusammenhängende Problem ungleich verteilter<br />
Ressourcen... . Wenn man den Begriff weit fasst, so wäre von Armut in bezug auf den<br />
sozioökologischen Kontext, die Teilhabe an sozioökonomischen Gütern, ferner von Armut<br />
des Erlebens, Erkennens, der Symbolwelt sowie des befriedigenden, erfolgreichen Handelns<br />
und schließlich von Beziehungsarmut zu sprechen." 3<br />
Austauschprobleme<br />
Menschen sind in bezug auf ihre psychischen, sozialen und kulturellen Bedürfnisse auf<br />
Austauschbeziehungen angewiesen. Ausstattungsmerkmale (s. o.) und die damit<br />
verbundenen Ressourcen werden zu Tauschmedien, die die Basis von Kooperation und<br />
Solidarität, aber auch von Konflikten und Formen der Instrumentalisierung bilden können.<br />
Bedeutsam ist hierbei die Frage der Gleichwertigkeit zwischen den jeweiligen Menschen und<br />
Gruppen.<br />
Austauschprobleme entstehen dort, wo es zu asymmetrischen Austauschbeziehungen<br />
kommt, d. h. wo die Gegenseitigkeit und Gleichwertigkeitsnorm nicht in der Balance sind.<br />
Solche Asymmetrien/ Austauschprobleme können in verschiedenen Bereichen und<br />
Beziehungen auftreten:<br />
• Freundschaften<br />
• Liebesbeziehungen/ Ehen<br />
• Familienbeziehungen<br />
• Nachbarschaften<br />
• Ausbildungsbeziehungen<br />
(z. B. zwischen Lehrern und Schülern)<br />
• Beziehungen am Arbeitsplatz<br />
• Mitgliedschaften.<br />
1 vgl. ebenda, S. 15 ff<br />
2 ebenda, S. 17<br />
3 ebenda, S. 18<br />
25
Menschen mit mehrfachen Ausstattungsdefiziten sind als Tauschpartner unattraktiv, sie<br />
werden – sofern nicht für einen Ausgleich gesorgt werden kann – im Rahmen sozialer<br />
Beziehungen bzw. Beziehungsnetze immer wieder "den Kürzeren ziehen". 1<br />
Bedenkt man, dass die Austauschbeziehungen eine wichtige Grundlage für die<br />
Persönlichkeitsentwicklung und damit für die Identitätsbildung und ein stabiles<br />
Selbstwertgefühl sind, so wird deutlich, dass Ausstattungs- und Austauschprobleme mit<br />
hoher Wahrscheinlichkeit zu Störungen in der Persönlichkeitsstruktur führen werden.<br />
Das Verfügen über einen Ressourcenvorsprung im Ausstattungs- und Austauschbereich<br />
kann zur Machtquelle werden. "Der mit reicheren Quellen versehene Partner erhält dadurch<br />
die Chance, Ausstattung und Beziehungen seiner Tauschpartner in seinem Sinne, genauer:<br />
zu seinen Gunsten zu steuern und zu kontrollieren." 2<br />
Machtprobleme<br />
Gesellschaften sind durch verschiedene Verteilungsmuster charakterisierbar: "Der Zugang<br />
zu soziökonomischen und weiteren Ressourcen als auch zu Teilsystemen [z. B. Bildung,<br />
Wirtschaft, Politik, Kultur] ist nicht nur von menschlichen Bedürfnissen und Fähigkeiten,<br />
sondern auch von der Verfügung über Machtquellen abhängig." 3<br />
Laut Weber bedeutet Macht die Chance, seine Interessen und seinen Willen innerhalb<br />
sozialer Beziehungen auch gegen Widerstreben durchzusetzen. 4<br />
Ausstattungselemente und Tauschmedien, wie<br />
• der Körper (physische Stärke)<br />
• die sozioökonomische Ausstattung<br />
• Informations-, Artikulations- und Entscheidungskompetenzen<br />
• Handlungskompetenzen<br />
• Organisationskompetenzen<br />
sind wichtige Machtquellen, die von Menschen zum Aufbau aber auch zum Abbau von<br />
Einfluss und Machstrukturen eingesetzt werden. Sozioökonomische Ungleichheit,<br />
Arbeitsteilung und die daraus resultierenden Rollen und Positionen, Einflussnahme auf das<br />
Denken, Verhalten und die Lebenssituation von Menschen kann dieses behindern, "weil es<br />
sich um Macht von Menschen über Menschen handelt". 5<br />
<strong>Die</strong> Frage, ob Macht problematisch ist, also Machtprobleme zur Folge hat, ist abhängig von<br />
den Regeln, wie in einer Gesellschaft der Zugang und die Verteilung von Gütern und<br />
Positionen wirksam wird. Staub-Bernasconi unterscheidet in dem Zusammenhang<br />
• Behinderungsregeln und Behinderungsmacht<br />
• Begrenzungsregeln und Begrenzungsmacht.<br />
1 vgl. ebenda, S. 23<br />
2 ebenda, S. 23<br />
3 ebenda, S. 24<br />
4 Vgl. Weber, M., Wirtschaft und Gesellschaft, <strong>Studie</strong>nausgabe, Tübingen 1980, S. 28<br />
5 Staub-Bernasconi, a.a.O., S. 25<br />
26
Benachteiligung als Behinderungsmacht<br />
Behinderungsmacht ist darauf angelegt, die Möglichkeiten anderer zu beschneiden, sie z. B.<br />
durch Vorenthaltung von Gütern und Handlungsfreiräumen zu behindern. Behinderungen<br />
beziehen sich z. B. auf<br />
• den Zugang zu materiellen und symbolischen Gütern,<br />
• die Lernchancen zur Entwicklung von emotionalen, moralischen und kognitiven<br />
Erkenntniskompetenzen,<br />
• den Zugang zu Informationen,<br />
• die Lernchancen für routinisierte, rollenbezogene, kognitive und kreative<br />
Handlungskompetenzen,<br />
• den Zugang zu sozialer Mitgliedschaft, Vereinen, gesellschaftlichen Gruppen und<br />
sozialen Teilsystemen.<br />
Behinderungsmacht wird häufig durch Stigmatisierungsprozesse begleitet, in deren Verlauf<br />
bestimmte (äußere) Merkmale von Personen und Personengruppen mit negativen<br />
Bewertungen (Vorurteilen, Stereotypen) belegt und die derart klassifizierten Menschen in<br />
eine Randgruppen- oder Außenseiterposition gedrängt werden.<br />
Stigmatisierungsprozesse werden dadurch begünstigt, dass<br />
• objektive Merkmale (Lebensbedingungen oder gezeigtes Verhalten) bewertet und zur<br />
Assoziierung weiterer Verhaltensweisen führen.<br />
• bei Einzelnen anzutreffende Verhaltensweisen für die gesamte Gruppe generalisiert<br />
werden.<br />
Das Verhalten benachteiligter Menschen in Interaktionsprozessen beeinflusst ihre<br />
Typisierung und ggf. die Auferlegung von Sanktionen. Wichtig ist ihr Benehmen, aber auch<br />
ihre physische Erscheinung und ihre Kleidung. <strong>Die</strong>jenigen, die sich angepasst verhalten und<br />
gesellschaftlichen Normen entsprechen, haben größere Chancen, nicht mit einem negativen<br />
Stigma belegt zu werden.<br />
Keupp definiert folgende Kriterien als relevant für Stigmatisierungsprozesse:<br />
1. Grad, Ausmaß und Sichtbarkeit der Benachteiligung und "Normabweichung"<br />
2. Machtposition der Person<br />
3. soziale Distanz zwischen den "Abweichenden" und den sie bewertenden, mit einem<br />
"Etikett" versehenden Personen bzw. Gruppen<br />
4. Toleranzbreite des Sozialsystems<br />
5. Verfügbarkeit von alternativen Rollen. 1<br />
Stigmatisierungsprozesse führen zur Beeinträchtigung und Veränderung der Identität.<br />
Betroffene übernehmen häufig die ihnen zugeschriebene, stigmatisierte Rolle, z. B. als<br />
aggressiver, gewaltbereiter Jugendlicher oder als erziehungsunfähige Mutter. Das<br />
zugeschriebene Stigma führt zur Selbststigmatisierung und damit zur "self-fulfillingprophecy".<br />
<strong>Die</strong> von Stigmatisierung Betroffenen entsprechen damit spezifischen, an sie<br />
gerichteten Rollenerwartungen.<br />
Benachteiligung und die damit häufig verbundenen Diskriminierungs- und<br />
Stigmatisierungsprozesse führen oft zu Selbsterhöhungen als symbolische Akte:<br />
1 vgl. Keupp, H., Der prozessuale Ansatz einer Theorie abweichenden Verhaltens,<br />
in: Keupp, H. (Hrsg.), Psychische Störungen als abweichendes Verhalten, München 1972, S. 181<br />
27
"Wenigstens bin ich Mann, Deutscher, Weißer...", was wiederum zur Entwertung von<br />
Menschen mit anderen Merkmalen – "Frau, Ausländer, Schwarzer..." führt. 1<br />
Prozesse der Behinderung und Beeinträchtigung im Rahmen von Stigmatisierungsprozessen<br />
wurden und werden häufig noch durch die "öffentliche Meinung", z. B. über die Medien<br />
gefördert.<br />
Positionsdifferenzierung, Statuszuschreibungen und territoriale Differenzierung begünstigen<br />
die soziale Zuordnung bzw. Ausgrenzung von Gruppen an gesellschaftlichen Ressourcen<br />
und an der Teilnahme an administrativen und politischen Entscheidungsprozessen.<br />
<strong>Die</strong>jenigen, die über mehr Machtquellen wie materielle Güter, Bildung, gesellschaftliche<br />
Positionen und intensive Austauschbeziehungen verfügen, haben größere Möglichkeiten,<br />
ihre Interessen und Bedarfe durchzusetzen und Menschen mit nur geringen oder ohne<br />
Machtquellen "zu behindern".<br />
Begrenzungsregeln und Begrenzungsmacht<br />
Durch Begrenzungsmacht, z. B. im Rahmen der Bildungs-, Jugend- und Sozialpolitik, soll<br />
die Teilhabe und Teilnahme an Gütern und an sozialem Austausch für Alle ermöglicht<br />
werden. <strong>Die</strong> Frage der Benachteiligung steht in engem Zusammenhang mit der Verteilung<br />
von Ressourcen in einer Gesellschaft. Dabei ist besonders die Frage zu beachten, wie ggf.<br />
knappe Ressourcen verteilt werden, wie sie zur Absicherung der Grundbedürfnisse und zu<br />
einer optimalen Lebensgestaltung aller Menschen eingesetzt werden. 2<br />
<strong>Die</strong> Bundesrepublik steht offensichtlich bei der zunehmenden Armut vieler Menschen bei<br />
gleichzeitig steigendem Reichtum vor einer gesellschaftlichen Zerreißprobe; der soziale<br />
Friede ist in Gefahr, auf der Strecke zu bleiben. Im Rahmen einiger Thesen wird hier auf<br />
diese Problematik aufmerksam gemacht:<br />
• Aktive Bildungs-, Jugend- und Sozialpolitik sollten verstanden werden als<br />
"Verteilungsinstrument", um den in der Verfassung verankerten Rechten, vor allem<br />
denen der Freiheit und Gleichheit, zu gesellschaftlicher realer Geltung zu verhelfen.<br />
• Das Postulat der Sozialstaatlichkeit in der BRD (vgl. GG, Artikel 20 – demokratischer und<br />
sozialer Bundesstaat) bedeutet: Betonung von Gerechtigkeit, die gleiche Chancen<br />
eröffnet, Hilfe für die Schwächeren und Ausgleich der sozialen Spannungen in der<br />
Gesellschaft. <strong>Die</strong>sem Auftrag wird der Staat durch gestaltende Einwirkungen, Verteilung<br />
und Lenkung nicht mehr gerecht.<br />
• <strong>Die</strong> Forderung, aber auch Bereitschaft, Teilhabe am ökonomischen, sozialen, kulturellen<br />
und politischen Leben auch benachteiligten Bevölkerungsgruppen zu gewährleisten und<br />
damit verbunden auch die Bereitschaft, das selbst Erworbene zu teilen, wird nicht als Ziel<br />
gesicherten menschlichen Zusammenlebens gesehen, sondern als antiquiertes,<br />
nostalgisches Phänomen belächelt.<br />
• Sozialer Frieden erfordert aber eine "soziale Demokratie"; das bedeutet in erster Linie die<br />
gegenseitige Verpflichtung, die gesellschaftliche Spaltung gemeinsam und nach<br />
persönlichem Leistungsvermögen anzugehen und zu überwinden.<br />
Es ist nicht mehr zu übersehen, dass soziale Errungenschaften zur Disposition gestellt<br />
werden. Eine Veränderung des sozialpolitischen Systems musste sicherlich in die Wege<br />
geleitet werden, aber es ist festzustellen, dass in erster Linie in die "weichen" Politikbereiche<br />
eingegriffen wird.<br />
Es entsteht inzwischen der Eindruck, dass Begrenzungsregeln kaum noch als<br />
Machtinstrument zur Durchsetzung einer fairen Ressourcenverteilung eingesetzt werden.<br />
1 vgl. Staub-Bernasconi, a.a.O., S. 33<br />
2 vgl. ebenda, S. 29<br />
28
Damit werden die Handlungsspielräume, über die arme und benachteiligte Menschen in<br />
ihren verschiedenen Lebensbereichen verfügen, weiter eingeschränkt. Ihre deprivierte<br />
Lebenslage reduziert ihre materiellen, sozialen und kulturellen Teilhabechancen.<br />
Abgeleitete Arbeitshypothesen<br />
Abgeleitet aus dem Lebenslagenansatz liegen der <strong>Studie</strong> einige Annahmen bzw.<br />
Arbeitshypothesen zugrunde, deren Relevanz überprüft werden soll:<br />
• <strong>Die</strong> sozioökonomische Lage beeinflusst entscheidend die Handlungsspielräume und<br />
Handlungsmöglichkeiten eines Menschen; sie dominiert auch die Lebenslage in anderen<br />
"Ausstattungsbereichen".<br />
• Ausstattungsdefizite/ Benachteiligungen und die damit verbundene Beeinträchtigung von<br />
Bedürfnisbefriedigung und Teilhabechancen begünstigen selbstzerstörerisches,<br />
abweichendes Verhalten, soziale Isolation, psychische Einbrüche und Apathie.<br />
• Austauschprobleme fördern Ausgrenzungen und soziale Isolation und damit verbunden<br />
Störungen in der Persönlichkeitsentwicklung. Benachteiligte Kinder und Jugendliche<br />
werden in ihrer Identitätsentwicklung und in der Bildung eines stabilen Selbstwertgefühls<br />
beeinträchtigt.<br />
• Behinderungsmacht in Form von Stigmatisierungs- und Ausgrenzungsprozessen<br />
begünstigt die Übernahme des "Fremdkonzepts als Selbstkonzept" und fördert damit die<br />
Aufrechterhaltung und Verfestigung von Armut und Benachteiligung.<br />
• Das "Aushebeln" des Sozialstaatsprinzips reduziert die Begrenzungsmacht durch<br />
Bildungs-, Jugend- und Sozialpolitik und schränkt damit Entwicklungs- und<br />
Teilhabechancen ein.<br />
• Aufgrund von Segregation entwickeln sich in ihren sozialen, ökonomischen und<br />
bildungsmäßigen Strukturen homogene Stadtbezirke. <strong>Die</strong> Segregation ist in der Regel<br />
durch ökonomische Faktoren bedingt. <strong>Die</strong> verschiedenen Charaktere der Region<br />
überlagern sich derart, dass sich zumeist in bestimmten Gebieten die negativ bewerteten<br />
Ausprägungen finden und andere sich durch die Kombination positiv bewerteter<br />
Merkmale auszeichnen.<br />
2.5 Forschungsdesign<br />
Der in dieser <strong>Studie</strong> realisierten Forschung sollen u. a. Prämissen und methodische<br />
Forschungsansätze der Handlungsforschung zugrunde gelegt werden:<br />
• Handlungsforschung wird als eine Strategie angesehen, die die Bedürfnisse und<br />
Interessen der verschiedenen am Forschungsprozess beteiligten Gruppen abzuklären<br />
und miteinander zu verbinden sucht. Sie gilt dann als erfolgreich, wenn alle Beteiligten<br />
ein besseres Verständnis der zugrundeliegenden Problematik gewonnen haben.<br />
• Handlungsforschung geschieht im Interesse der Betroffenen. Sie ist explizit normativ und<br />
parteilich. Ergebnisse dienen u. a. als Grundlage für Lobbyarbeit zugunsten<br />
benachteiligter Kinder und Jugendlicher in Hamburg.<br />
• <strong>Die</strong> Forschungsfragen werden aus den Arbeitszusammenhängen von Experten der<br />
Jugendhilfe entwickelt.<br />
• <strong>Die</strong> Forschungsergebnisse bilden eine Grundlage für eine zielgerichtete Öffentlichkeitsund<br />
Lobbyarbeit sowie für die Entwicklung von Handlungsstrategien und die Gewinnung<br />
von Handlungsspielräumen.<br />
Im folgenden werden die Forschungsansätze/ das methodische Vorgehen und die<br />
eingezogenen Fragestellungen dargestellt.<br />
29
Forschungsansätze/ methodisches Vorgehen<br />
<strong>Die</strong> <strong>Studie</strong> bezieht sich grundsätzlich auf die Situation armer und benachteiligter Kinder und<br />
Jugendlicher in Hamburg. Vertiefende Untersuchungen beziehen sich auf die spezifische<br />
Situation in der Region III in Eimsbüttel (Projektregion, s. o.) und auf das Schanzen- und<br />
Karolinenviertel als innerstädtische Vergleichsregion. Durch diese kleinräumlichen<br />
Untersuchungen werden zum Teil gravierende Abweichungen der Situation in segregierten,<br />
kleinräumigen Regionen (Quartieren) von den eher nivellierenden Hamburger<br />
Durchschnittswerten sichtbar.<br />
Im Rahmen des Forschungsprozesses werden quantitative und qualitative Daten einbezogen<br />
bzw. erhoben.<br />
Quantitative Daten werden durch Analyse und Auswertung vorhandener statistischer<br />
Materialien ermittelt. Soweit zugänglich, werden Quartiersdaten in die Analysen einbezogen<br />
und mit Daten auf Stadtteil-, Bezirks- und Gesamtstadtebene in Beziehung gesetzt.<br />
Als Indikatoren werden dabei folgende Daten einbezogen:<br />
• Bevölkerungsdaten, z. B. nach Alter, Haushaltstypen, Familienstruktur (z. B.<br />
Einelternfamilien), Einkommensstruktur (z. B. Sozialhilfeempfänger) und Erwerbsstruktur<br />
(z. B. Arbeitslose).<br />
• Ergebnisse der Analyse zur Wohn- und Wohnumfeldsituation, die im Rahmen der<br />
Projektarbeit erstellt wurde.<br />
Qualitative Daten werden der Lebenslagenanalyse des Projekts entnommen und im<br />
Rahmen von Gruppendiskussionen und Einzelinterviews mit ExpertInnen verschiedener<br />
Arbeitsfelder und Funktionen erhoben.<br />
Gruppendiskussionen sind als Mittel der Meinungs- und Einstellungserfassung geeignet.<br />
Offenheit und Prozesshaftigkeit sind wesentliche Aspekte des Verfahrens . Bedeutsam ist<br />
dabei u. a. die Dynamik der Diskussionen und die wechselseitige Stimulation der<br />
Teilnehmer, die dazu beiträgt, umfassende Informationen über wesentliche Faktoren zu<br />
gewinnen.<br />
<strong>Die</strong> Einzelinterviews werden als Leitfadeninterviews durchgeführt.<br />
<strong>Die</strong> Befragten werden – ebenso wie die Teilnehmer der Gruppendiskussionen – über<br />
wesentliche Aspekte der <strong>Studie</strong> und die den Interviews bzw. den Diskussionen<br />
zugrundeliegenden Fragestellungen schriftlich informiert (siehe Anlage 1). Den Befragten<br />
wird weitgehende Freiheit in der Gestaltung der Gespräche eingeräumt. <strong>Die</strong> im Leitfaden<br />
(siehe Anlage 2) vorgegebenen Fragen können nach eigenem Ermessen und eigener<br />
Einschätzung beantwortet werden.<br />
Teilnehmer und Teilnehmerinnen<br />
Teilnehmer und Teilnehmerinnen an den Gruppendiskussionen sind Mitarbeiter und<br />
Mitarbeiterinnen aus Einrichtungen der Bereiche Jugendhilfe (ASD, Anbieter von HzE,<br />
OKJA), Schule, REBUS und Kitas in der Region III und im Schanzenviertel (siehe Anlage 3<br />
und 3a).<br />
Einzelinterviews mit Experten/ Opinionleaders werden mit leitenden Mitarbeitern und<br />
Mitarbeiterinnen der Jugendhilfe (öffentliche und freie Träger), der Jugendpolitik, der Schulen<br />
und Hochschulen und des Wohnbereichs durchgeführt (siehe Anlage 4).<br />
30
Themen und Fragestellungen<br />
Folgende generelle Themen und Fragestellungen liegen den Expertengesprächen zugrunde:<br />
• Fragen zu Armut und Benachteiligung von Kindern und Jugendlichen generell, dem<br />
eigenen Verständnis und dem dieser <strong>Studie</strong> zugrundeliegenden Ansatz einer<br />
multidimensionalen Deprivation<br />
• Fragen nach potentiellen Risikogruppen und nach Aspekten, die den Prozess der<br />
Benachteiligung und Ausgrenzung begünstigen<br />
• Auswirkungen von Armut und Benachteiligung auf die Lebenswelt von Kindern und<br />
Jugendlichen<br />
• Wahrnehmung der Situation armer und benachteiligter Kinder und Jugendlicher im<br />
eigenen Arbeits-/ Funktionsbereich<br />
• Ansätze zur Verbesserung der Lebenssituation armer und benachteiligter Kinder und<br />
Jugendlicher unter Berücksichtigung der Möglichkeiten im eigenen Funktionsbereich.<br />
31
3 Armut und Benachteiligung von Kindern und Jugendlichen in Hamburg<br />
"Sind Armut und Benachteiligung von Kindern und Jugendlichen in Hamburg ein Phänomen,<br />
das ein Problem in dieser Stadt darstellt?" war die Eingangsfrage sowohl bei den<br />
Einzelinterviews als auch bei den beiden Gruppendiskussionsrunden, verbunden mit der<br />
zusätzlichen Frage nach dem eigenen Verständnis von Armut und Benachteiligung.<br />
<strong>Die</strong> Aussagen 1 zu diesen Fragen, ergänzt durch Nennungen von Risikogruppen und deren<br />
spezifischen Lebenslagen stehen am Anfang dieses Kapitels. Anhand demographischer und<br />
Strukturdaten wird dann der Nachweis der Segregation armer, benachteiligter<br />
Bevölkerungsgruppen in Hamburg geführt.<br />
In einem "Exkurs" werden "Wohn- und Wohnumfeldprobleme" als sichtbarste Form der<br />
Ausgrenzung dargestellt und anschließend die Aussagen der "Experten auf der Handlungs-<br />
und auf der Leitungsebene" zur Lebenslage und Lebenswelt armer und benachteiligter<br />
Kinder und Jugendlicher generell und der Wahrnehmung deren Situation im eigenen<br />
Funktionsbereich speziell, wiedergegeben.<br />
Das Kapitel wird abgeschlossen mit einem Resümee, in dem auf der Basis der<br />
Untersuchungsergebnisse Aussagen zu den einzelnen Arbeitshypothesen gemacht werden.<br />
3.1 Armut in einer reichen Gesellschaft – ein Phänomen in Hamburg?<br />
Es mag irritierend erscheinen, mit dieser Stadt die Begriffe "Armut" und "Benachteiligung" zu<br />
verbinden, sind doch Aussagen wie<br />
• das Tor zur Welt<br />
• Drehscheibe des Handels Ost-West und Nord-Süd<br />
• das Hoch im Norden<br />
• Boomtown Hamburg<br />
• die wachsende Stadt<br />
• die Stadt mit den meisten Millionären<br />
hinlänglich bekannt.<br />
Hamburg selbst ist sehr daran interessiert, dass dieses Image erhalten bleibt. Über die<br />
Kehrseite der Medaille spricht man nicht – "<strong>Die</strong> im Dunkeln sieht man nicht."<br />
Aus zugänglichem Datenmaterial (vgl. Punkt 3.3) ist hinlänglich bekannt, dass Armut und<br />
Benachteiligung von Kindern und Jugendlichen ein gravierendes Phänomen ist, das aber im<br />
Zentrum der Stadt kaum sichtbar wird. Vor diesem Hintergrund wurden sowohl die<br />
Einzelinterviews als auch die Gruppendiskussionen mit der Frage eröffnet:<br />
Armut und Benachteiligung von Kindern und Jugendlichen – sind das Phänomene, die<br />
ein Problem in dieser Stadt darstellt und ggf. warum?<br />
Ergänzend wurde gefragt: Wie und in welchen Zusammenhängen werden<br />
Armutsphänomene öffentlich, u. a. durch die Medien, diskutiert und dargestellt?<br />
<strong>Die</strong> erste Teilfrage wurde durchgängig bejaht, die Antworten variierten von "Ja", "Ja,<br />
natürlich", "Ja, Armut ist ein gravierendes Problem" bis zu sehr differenzierten Äußerungen.<br />
"Es wäre vermessen zu sagen, Armut würde in dieser Stadt keine Rolle spielen.<br />
...'Wachsende Stadt' hat ja nicht nur den positiven Aspekt, dass hier mehr Menschen<br />
1 Antworten der Gesprächspartner werden sowohl zitiert als auch in ihren inhaltlichen Aussagen dargestellt.<br />
32
herkommen als wegziehen und dass der demographische Faktor dadurch etwas<br />
ausgeglichen wird, sondern hat natürlich auch Schattenseiten." <strong>Die</strong> "Attraktivität" dieser Stadt<br />
führt u. a. dazu, dass Menschen hierher kommen, "die woanders keine Hoffnung mehr<br />
haben... . Ob die Hoffnung dann in Hamburg erfüllt wird, das ist die zweite Frage". Zu diesen<br />
Gruppen, die mit Hoffnungen auf die Verbesserung ihrer Situation nach Hamburg kommen,<br />
gehören sowohl Zuwanderer als auch Menschen aus dem "Hamburger Hinterland" und aus<br />
Ostdeutschland.<br />
<strong>Die</strong> Gruppe der benachteiligten Menschen, die mit der Hoffnung auf eine Verbesserung ihrer<br />
Lebenslage nach Hamburg gekommen und dann gescheitert sind, macht nur einen<br />
(geringen) Teil der Armutspopulation aus. Weit größer ist der Anteil armer und<br />
benachteiligter Kinder und Jugendlicher, die in Hamburg geboren wurden und unter<br />
Armutsbedingungen aufwachsen. Vielfach wird deren Problematik in Einrichtungen der<br />
Jugendhilfe offensichtlich: "Das macht sich besonders in den Kitas bemerkbar." In der Arbeit<br />
der Anbieter von Hilfen zur Erziehung beherrscht die Armutsproblematik in der Regel die<br />
Situation der betreuten Familien. "Wobei wir als Kinder- und Jugendhilfe nur die Spitze des<br />
Eisbergs zu Gesicht bekommen."<br />
Es wird auch auf die Multidimensionalität der Armut hingewiesen: Das Problem beruht nicht<br />
nur auf der sehr schlechten materiellen Situation der Eltern, sondern es erstreckt sich "auf<br />
die Situation, wo man wohnt, auf welche Schule man kommt, welche Angebote man im<br />
Stadtteil hat oder auch nicht hat".<br />
Mehrere Experten sahen in dem an vielen Stellen doch sehr sichtbaren Reichtum ein<br />
problemverschärfendes Phänomen. "Ein generelles Problem ist das, was man politisch als<br />
Auseinanderklaffen von Arm und Reich bezeichnet." …"Hamburg ist durch ein<br />
Spannungsfeld von armen und reichen Bevölkerungsgruppen gekennzeichnet. Insofern ist<br />
es für eine Familie, die arm ist, in Hamburg noch deutlicher sichtbar, was es bedeutet, nicht<br />
arm zu sein. Sie können an vielen Dingen, die ihnen vor Augen geführt werden, nicht<br />
teilnehmen."<br />
Armut als "relative Benachteiligung" im Vergleich zur übrigen Gesellschaft ist in Hamburg<br />
unübersehbar. "In Hamburg prallen die Gegensätze von Reichtum auf der einen Seite und<br />
Armut auf der anderen Seite hart zusammen." Verwiesen wird darauf, "dass wir in einer<br />
Stadt leben mit einer der höchsten Zahlen an Einkommensmillionären ... wenn wir dann<br />
gleichzeitig sehen, dass 20% der unter 6-Jährigen von Sozialhilfe leben, dann zeigt das, in<br />
welcher riesigen Disparität wir hier leben."<br />
Dass jedes fünfte Kind unter sechs Jahren von Sozialhilfe lebt, weist auf die "Infantilisierung<br />
von Armut" hin. Legt man die von der EG definierte Armutsgrenze zugrunde, so wächst<br />
dieser Anteil erheblich. Von vielen Experten wird eine Steigerung dieser Problematik zum<br />
1.1.2005 mit Inkrafttreten der Hartz-IV-Gesetzgebung prognostiziert: "Alle profunden<br />
Analysen [zeigen], dass wir mit 50% Steigerungen rechnen müssen".<br />
<strong>Die</strong> "Infantilisierung von Armut" tritt in spezifischen Regionen der Stadt massiv zu Tage. So<br />
wies ein Interviewpartner darauf hin, dass er "einen sehr engagierten Bericht einer Schule in<br />
St. Pauli gelesen [habe], deren Kinder – über 300 – zu 95% Sozialhilfeempfänger sind ... es<br />
ballt sich in bestimmten Quartieren unglaublich. <strong>Die</strong> Frage ist, ob wir es schaffen, ... den<br />
Trend aufzuhalten oder gar umzukehren."<br />
Wiederholt wird auf die Problematik aufmerksam gemacht, dass zunehmend Kinder<br />
auffallen, die hungern. <strong>Die</strong>s wird insbesondere in Kitas und Schulen offensichtlich, aber auch<br />
Straßensozialarbeiter haben schon vor mehreren Jahren darauf hingewiesen, dass Kinder<br />
hungern. "Dann sagt man erstmal: Hungern? Es gibt Sozialhilfe, heute braucht kein Kind zu<br />
hungern." Leiter und Leiterinnen von Kitas weisen aber auf das Gegenteil hin: "dass die<br />
Kinder ausgehungert in die Einrichtung kommen". Deshalb ist es auch so wichtig, dass<br />
33
"Kinder gerade in sozial benachteiligten Gebieten in eine Einrichtung kommen und dort u. a.<br />
auch etwas zu Essen erhalten".<br />
Sowohl die Situation von Einelternfamilien als auch die Auswirkungen von Arbeitslosigkeit<br />
werden als Hintergrund für steigende Armut und Prozesse der Benachteiligung gesehen:<br />
"Kinderarmut wird häufig durch 'Brüche' in der Biographie ihrer Eltern hervorgerufen: lange<br />
Krankheiten, Arbeitslosigkeit, Trennung und Scheidung ... . "<br />
Armutsprobleme zeigen sich auch im Wohnbereich. Benachteiligte Familien bewohnen<br />
häufig – gemessen an der Anzahl ihrer Mitglieder – zu kleine, enge, auch feuchte<br />
Wohnungen. In dem Zusammenhang wurde darauf hingewiesen, dass Armut auch durch<br />
städtebauliche Missstände und sichtbare bauliche Probleme erkennbar wird. "Dann kamen<br />
die Folgeprobleme, dass die Wohnungen nur noch für bestimmte Bevölkerungsgruppen<br />
'interessant' waren. Das waren dann häufig mehrfach sozial Benachteiligte. ..." In der Folge<br />
entwickeln sich soziale Brennpunkte/ Gettos. Es bilden sich Gebiete, in die "man" nicht geht.<br />
"Selbst wenn sie z. T. relativ gut aussehen, gepflegte Grünanlagen haben, erhalten sie von<br />
außen ein negatives Stigma."<br />
<strong>Die</strong> Mitglieder der Gruppendiskussionen wiesen im Zusammenhang mit der o. g.<br />
Fragestellung auf spezifische Benachteiligungen der Kinder im Bereich der Schule und<br />
Bildung allgemein hin. Besonders bedeutsam sind danach die durch ihre Lebenslage<br />
verhinderten Lernprozesse, aber auch Stigmatisierungs- und Ausgrenzungsprozesse: Den<br />
Kindern fehlt ein großer Erfahrungsreichtum und die damit verbundenen<br />
Verhaltenskompetenzen. Armut von Kindern und Jugendlichen zeigt sich u. a. durch<br />
fehlende Teilnahmechancen, z. B. bei der Mitgliedschaft in Sportvereinen, dem Besuch<br />
kultureller Veranstaltungen und Urlaubsreisen. Ihnen ist es oft peinlich, nicht mitreden und<br />
mithalten zu können.<br />
Sowohl in Kitas als auch in Schulen finden Ausgrenzungsprozesse statt. "Das läuft zum<br />
einen über Kleidung und zum anderen über Verhalten." "Sie können auch keinen eigenen<br />
Stil entwickeln. Sie legen z. T. Verhaltensweisen an den Tag, um Unsicherheiten zu<br />
überspielen, für die sie dann häufig auf Ablehnung stoßen." <strong>Die</strong> Herkunft der Kinder, auch<br />
ihre Lebenslage, ist für Bildungschancen entscheidend. Auch wenn eine Reihe armer Kinder<br />
es sehr gut schafft, sozialkonform zu leben, wird "ein Teil der Kinder durch bestimmte<br />
Prozesse herausgeworfen – etwa durch Stigmatisierung der Schule – weil die Symbole<br />
fehlen, die fehlende Lernaspiration zu Hause, mangelnde Förderung durch Materialien,<br />
Bücher, Spielmaterial, Vereinsmitgliedschaften."<br />
<strong>Die</strong> Misere der Lebenslage mit ihren eingeschränkten Handlungsmöglichkeiten, aber auch<br />
mit ihrer gesellschaftlichen Relevanz, spiegelt die Äußerung einer Expertin wider: "Armut<br />
bedeutet nicht nur, dass wenig Geld da ist; Armut bedeutet ja häufig, dass Familien ganz<br />
abgeschnitten sind von den wichtigen Informationen, die sie eigentlich brauchen, um sich<br />
und ihre Kinder richtig 'erziehen' zu können. <strong>Die</strong>se Armut bedeutet, dass ein Kind, was z. B.<br />
seine Bildungschancen anbelangt, von Anfang an das nehmen muss, was ganz<br />
offensichtlich ist. <strong>Die</strong> Eltern sind froh, wenn sie einen Schulplatz kriegen. Sie fragen nicht<br />
nach: Ist das das Beste für mein Kind? Es ist das, was ihnen [durch die Schule] angeboten<br />
wird."<br />
Es ist anzunehmen/ zu befürchten, dass Kinderarmut zu einer gesellschaftlichen Armut wird,<br />
dass einfach das, was Bildung angeht, was die Fähigkeiten angeht, friedlich miteinander zu<br />
leben, was die Ordnung in einer Gesellschaft betrifft, zu einem gesellschaftlichen Problem<br />
wird. "Ich halte das für ein bedrückendes Phänomen und denke, wir müssen alle miteinander<br />
gucken, wie wir das besser in den Griff kriegen."<br />
Deutlich wird, dass allen Experten die Problematik von Armut und Benachteiligung von<br />
Kindern und Jugendlichen präsent ist – auch denen, die im Rahmen ihrer beruflichen<br />
Tätigkeit mit diesem Thema nicht unmittelbar konfrontiert werden.<br />
34
Bedeutsam bei den Antworten sind u. a. folgende Aspekte:<br />
• "Armut im Reichtum" wird als ein besonders beeinträchtigendes Phänomen gesehen.<br />
• Bei Armut und Benachteiligung im sozioökonomischen Bereich werden auch<br />
Einschränkungen in weiteren Lebensbereichen gesehen, insbesondere bezogen auf die<br />
Bildungssituation und die Verfügbarkeit von Teilhabe- und Teilnahmechancen an<br />
gesellschaftlichen Gütern.<br />
• "Brüche" in der Biographie von Menschen – Krankheit, Arbeitslosigkeit, Trennung und<br />
Scheidung – sind, obwohl es Massenerscheinungen sind, sozial-, jugend- und<br />
bildungspolitisch nicht so abgesichert, dass – entsprechend dem in § 1 Kinder- und<br />
Jugendhilfegesetz definierten Auftrag – junge Menschen in ihrer individuellen und<br />
sozialen Entwicklung ausreichend gefördert werden und so dazu beigetragen wird,<br />
"Benachteiligung zu vermeiden oder abzubauen".<br />
<strong>Die</strong> zweite Teilfrage – wie die Armutsproblematik von Kindern und Jugendlichen<br />
öffentlich, z. B. in den Medien, diskutiert und dargestellt wird – führte zu sehr<br />
differenzierten Reaktionen.<br />
"Wird es überhaupt dargestellt?" – so oder so ähnlich wurde von vielen Experten spontan auf<br />
die Frage reagiert. "Ich finde, dass dieses Thema nicht besonders gut öffentlich diskutiert<br />
wird und auch nicht umfassend durchdrungen wird." Selbstkritisch wird auch geäußert, dass<br />
die eigene Fachgruppe sich nur marginal mit dem Thema befasst: "Mit Armut und deren<br />
Ursachen, deren Konsequenzen und explizit den Auswirkungen beschäftigen wir uns eher<br />
nicht."<br />
Dass den Kindern aus sozial benachteiligten Stadtteilen z. B. intensive Betreuung und<br />
längere Betreuungszeiten fehlen, wird in der Öffentlichkeit und in den Medien nicht diskutiert<br />
– ist kein Thema für die Presse. Dagegen wird in der Presse z. B. berichtet, "dass die<br />
Ferienfreizeiten eines Trägers nicht mehr finanziert werden sollten, weil diese armen Kinder<br />
angeblich in ein 'Luxushaus' in Dänemark kämen".<br />
Kinderarmut ist offensichtlich auch für viele Politiker und Politikerinnen dieser Stadt kein<br />
besonders relevantes und interessantes Thema. Auch "Politik" geht davon aus: "Ach, das<br />
[Hunger] gibt es doch in dem Sinne gar nicht – oder – es sind vielleicht Einzelschicksale. In<br />
meinen Augen sind das keine Einzelschicksale, sondern das sind tausende Kinder in dieser<br />
Stadt, und das ist auch ganz leicht zu erfahren, wenn man sich darum bemüht. ... Wenn ich<br />
z. B. höre, man sollte diesen Kindern, die auch nicht zur Schule gehen, die auffällig sind, das<br />
Kindergeld streichen, ist das z. B. der total verkehrte Ansatz. Dann können wir davon<br />
ausgehen, dass es den Kindern noch schlechter geht und sie keine Möglichkeit für ihre<br />
Zukunft haben."<br />
Wenn in Fachzeitschriften und jetzt auch in dem 2. Armuts- und Reichtumsbericht der<br />
Bundesregierung Kinderarmut "sehr häufig in Zusammenhang gestellt wird mit der<br />
Arbeitslosigkeit der Eltern", so wird das von der Lokalpresse nicht widergespiegelt: In der<br />
Tagespresse lese ich kaum etwas über Armut, "was nicht den Eindruck vermittelt: die sind ja<br />
irgendwie selber Schuld. Es wird ganz stark individualisiert". "Bei Kindern und Jugendlichen<br />
wird bei dem Thema Armut 'blame the parents' gespielt. ... <strong>Die</strong> Frage nach der<br />
Gesamtverantwortung wird dann meistens schuldhaft adressiert: Eltern haben versagt,<br />
Schule hat versagt... . Man findet selten eine Auseinandersetzung darüber, wie ggf. Fehler<br />
oder Unaufmerksamkeiten positiv bearbeitet werden können."<br />
Das Thema wird medial in erster Linie unter ordnungspolitischen Gesichtpunkten<br />
abgehandelt ... und "wird häufig mit einem Verwahrlosungsaspekt versehen", oder mit<br />
Gewalt in Verbindung gebracht: "Weil Kinder, die aus armen und benachteiligten Familien<br />
stammen, gewalttätig geworden sind." Durch das öffentliche Erscheinen von Armut fühlt man<br />
sich belästigt. Bei Kindern wird vielfach noch "so eine gewisse Unschuldsvermutung medial<br />
transportiert."<br />
35
Folgender Auszug aus zwei Interviews spiegelt die Vielfalt der Berichterstattung zu diesem<br />
Thema wider – er dient gleichzeitig als eine Zusammenfassung von Aussagen weiterer<br />
Experten: Gelegentlich findet man Journalisten, mit denen man ein paar Jahre<br />
zusammenarbeitet "und dann kommen vernünftige Dinge [in die Berichterstattung] hinein." ...<br />
Das Interesse ist groß, wenn man das Problem an individuellen Fällen festmachen kann.<br />
"Strukturelle Fragen anzusprechen, ist etwas, das immer schwieriger wird, weil es<br />
offensichtlich auch nicht das Interesse der Medien ist, Menschen bei schwierigen<br />
Sachverhalten ein bisschen zu leiten und pädagogisch zu führen, sondern sie bedienen die<br />
Menschen in erster Linie mit dem, was sie glauben, was die Menschen hören wollen. ...<br />
Leider stößt man auf wenig Verständnis, weil viele [Journalisten], die dort berichten, ...<br />
eigentlich die großen Zusammenhänge mangels Information auch häufig gar nicht<br />
verarbeiten."<br />
Mit Stigmatisierungen wie "Sozialschmarotzer" wird in letzter Zeit etwas mehr Zurückhaltung<br />
geübt. "Noch vor gar nicht langer Zeit haben alle immer nur von Schmarotzern geredet, wenn<br />
sie über Sozialhilfeempfänger berichtet haben. Sie haben das festgemacht an irgendwelchen<br />
Auswüchsen, die es offensichtlich gab; da machten sich die Diskussionen an dem Thema<br />
'Missbrauch der sozialen Sicherungssysteme' fest. Jetzt kommt Hartz IV, ... und es gibt nicht<br />
mehr diese Stigmatisierungen." <strong>Die</strong>se Zurückhaltung in Verbindung mit der Implementierung<br />
von Hartz IV 1 wird gesehen "wegen ... der Vermutung, dass viele bisherige Bezieher von<br />
Versicherungsleistungen in die Gruppe der 'Arbeitslosengeld-II-Bezieher' rutschen, bei<br />
denen die Zuschreibung, dass sie in der sozialen Hängematte liegen und durch<br />
Eigenverschulden in die Situation gekommen sind", nicht greift. "<strong>Die</strong> Missbrauchsdebatte ist<br />
insofern eine völlig perverse; selbst wenn es dort Missbrauch gibt, geht es um Summen, die<br />
gesamtgesellschaftlich so gering sind, dass es eigentlich ein Witz ist. 2 ... Wenn man das 'an<br />
den Pranger stellen' in den Bereichen machen würde, wo wirklich eine relevante Geldmenge<br />
hinterzogen wird... ."<br />
Wenn der Tenor auf die Frage nach der öffentlichen Darstellung des Themas "Armut und<br />
Benachteiligung von Kindern und Jugendlichen in Hamburg" dahin geht, dass nur "selten mal<br />
ein gründlich recherchierter Artikel über Zusammenhänge" veröffentlicht würde, wurde auch<br />
auf die Chance positiver Einflussmöglichkeiten durch die Presse hingewiesen: "Als die<br />
Kinderkuren gestrichen werden sollten, wurde das öffentlich in den Medien diskutiert und<br />
jetzt teilweise zurückgenommen." <strong>Die</strong> Presse vertrat die Ansicht: "Sparen müssen wir alle –<br />
aber muss das sein."<br />
Vielleicht sollten und müssten Vertreter der Institutionen Sozialer Arbeit im Zusammenhang<br />
mit ihren Vernetzungs- und Kooperationsbemühungen ihre Aufmerksamkeit auch auf<br />
mögliche Kooperationsformen mit Presseorganen richten – die Chance für eine "Win-Win-<br />
Situation" vorausgesetzt.<br />
Wann bezeichnen Sie jemanden als arm und benachteiligt?<br />
<strong>Die</strong> Frage nach dem eigenen Verständnis dient dem Erkenntnisgewinn über Inhalte und<br />
Elemente, die diesen Begriffen durch die Experten zugeordnet werden.<br />
<strong>Die</strong> meisten Befragten wiesen zuerst auf die Abhängigkeit von Sozialhilfe oder einem<br />
anderen Einkommen in vergleichbarer Höhe und auf die Sozialhilfehöhe als Armutsgrenze<br />
hin – gelegentlich ergänzt durch die von der EG definierte Armutsgrenze. Von mehreren<br />
Experten wurde angemerkt, dass Sozialhilfe ein "Armutsbekämpfungsprogramm" sei und<br />
1<br />
Möglicherweise hat die engagierte Berichterstattung von Frau Hardinghaus im Hamburger Abendblatt<br />
ebenfalls zu der "Entstigmatisierung" von Sozialhilfeempfängern beigetragen.<br />
2<br />
In Deutschland wurden 2002 24.652 Milliarden Euro für Sozialhilfe insgesamt ausgegeben, dem standen<br />
2.738 Milliarden Euro Einnahmen gegenüber.<br />
Für die Hilfe zum Lebensunterhalt werden ca. 40% der Ausgaben eingesetzt (9.828 Milliarden Euro).<br />
(Statistisches Jahrbuch 2004 für die Bundesrepublik Deutschland, S. 206)<br />
36
darauf hingewiesen, dass das Leben unter Sozialhilfebedingungen von den Betroffenen<br />
subjektiv unterschiedlich empfunden wird. Ausschlaggebend dabei sei z. B.<br />
• ob trotz der materiellen Armut eine Perspektive gesehen wird – das ist in der Regel bei<br />
Studenten der Fall<br />
• das Verfügen über Soziale Netze, z. B. Familie, Freunde, Nachbarschaften<br />
• die Fähigkeit, Angebote und <strong>Die</strong>nstleistungen für die Familie in geeigneter Weise nutzbar<br />
machen zu können<br />
• das Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl der Familienmitglieder<br />
• die Zeit, die eine Familie unter Armutsbedingungen lebt.<br />
<strong>Die</strong> Heterogenität der Begriffe Armut und Benachteiligung wurde benannt, z. B.<br />
Dispositionsarmut, "die durch ein unvorhergesehenes ökonomisch destabilisierendes<br />
Ereignis im Lebenslauf eintreten kann, z. B. Verlust eines Partners, Krankheit,<br />
Arbeitslosigkeit." Deprivation bedeutet dann, "den Ausschluss aus allgemein anerkannten<br />
Standards".<br />
Von mehreren Befragten wurde auf die Relevanz der gesamten Lebenslage der Kinder<br />
hingewiesen. "Bedeutsam ist die Lebenslage der Kinder, die sich in unserer Gesellschaft<br />
natürlich stark an ökonomischen Bedingungen festmacht." So wird Armut z. B. definiert als<br />
"wenig Geld und Mangel an Teilhabe, Mangel an Gelegenheiten und Mangel an Förderung".<br />
Ein Mangel an Förderung wird auch häufig in Verbindung mit der Bildungssituation genannt<br />
und auf "bildungsferne Schichten" hingewiesen: "Elternhäuser mit großer Schwellenangst zur<br />
Schule … . Bei denen geht oft beides einher – Arbeitslosigkeit und/ oder geringes<br />
Einkommen, z. B. bei alleinerziehenden Elternteilen, häufig bei Migrationshintergrund … und<br />
eine dadurch bedingte Ferne zur Schule und vielleicht sogar auch oftmals fehlende<br />
Aspiration."<br />
<strong>Die</strong> Bedeutung eingeschränkter oder fehlender Ressourcen wird wiederholt hervorgehoben:<br />
"Immer dann, wenn es eine deutlich abweichende Einnahmen- und Ausgabensituation gibt,<br />
die dazu führt, dass man sich die Dinge, die für die meisten selbstverständlich sind, nicht<br />
mehr erlauben kann." Solch eine abweichende Ausgabensituation tritt z. B. bei einer<br />
Überschuldung, aber auch bei Suchtkrankheiten wie Alkoholismus oder Drogensucht ein.<br />
Wenn Kinder immer wieder an Grenzen stoßen, die sie in ihren Handlungsmöglichkeiten<br />
einschränken und zu Stigmatisierungen und Ausgrenzungen führen, wird darin ein Aspekt<br />
eines multidimensionalen Ansatzes von Armut gesehen: "Wenn ein Kind in seinem täglichen<br />
Leben immer wieder an Grenzen stößt – bei Klassenreisen, kulturellen Veranstaltungen ... .<br />
Das ist für die Kinder zumindest das Schlimmste... ." Wenn es den Kindern an<br />
Selbstbewusstsein fehlt – dem Gefühl "Hey, ich bin ein tolles Kind" – fühlen sie sich<br />
minderwertig. Das ist oft verbunden mit der Situation, sich outen zu müssen, z. B. nicht zu<br />
einer Geburtstagsfeier einladen zu können, weil die Feier "nicht leistbar" ist. "Wenn die<br />
Kinder in ihren Ausstattungsressourcen nicht mithalten können, sind sie immer in dem Risiko<br />
der Ausgrenzung. ... Wenn Kinder an den Standards, die in ihren Peergroups zählen, nicht<br />
teilhaben können, sind sie Außenseiter." Armut bedeutet für Kinder und Jugendliche auch<br />
"eine Isolation, eine Einsamkeit."<br />
Von den Experten wurden im Zusammenhang mit der o. g. Fragestellung sowohl in den<br />
Einzelinterviews als auch in den Gruppendiskussionen Faktoren genannt, die die<br />
Multidimensionalität von Armut widerspiegeln, z. B.<br />
• langfristig unter Armuts- und Benachteiligungsbedingungen leben müssen<br />
• wenn Ressourcen und Kompetenzen fehlen, sich selbst wieder aus dem Zustand der<br />
Mittelknappheit zu befreien<br />
37
• wenn man den Kindern die Chance nimmt, an Bildung teilzuhaben – der Bildungsbereich<br />
spielt eine ganz große Rolle<br />
• Beeinträchtigungen im Lernbereich – Eltern können ihre Kinder, u. a. wegen eigener<br />
Benachteiligung im Bildungsbereich, nicht fördern<br />
• Kinder lernen nicht, ihren Tag zu organisieren und zu strukturieren – Planungsverhalten<br />
wurde nicht erworben<br />
• Teilnahmemöglichkeiten am "sozialen Miteinander" sind nicht gegeben<br />
• Ausgrenzungen, weil die zur Teilnahme notwendigen Mittel nicht aufgebracht werden<br />
können<br />
• schlechte Wohnsituation – Wohnungen sind zu klein/ eng und schlecht ausgestattet,<br />
signalisieren keine Geborgenheit und Gemütlichkeit<br />
• die Kinder sind nicht angemessen ernährt und gekleidet, die gesamte Versorgung ist<br />
eingeschränkt<br />
• Kinder, die sich ausgeschlossen fühlen, ziehen sich zurück, beteiligen sich nicht mehr<br />
• Kinder können nicht mehr träumen<br />
• sie leisten z. T. verbotene Kinderarbeit, um sich z. B. "gewünschte Güter" kaufen zu<br />
können<br />
• Jugendliche reagieren mit "kriminellem Verhalten"<br />
• innerhalb und außerhalb der Familie gibt es keine Bezugspersonen, die als Modell<br />
angenommen werden.<br />
Es gelingt offensichtlich "dem System" nicht, Kinder und Jugendliche zu reintegrieren. "Wenn<br />
irgendwo jemand erst in dem Kreislauf [der Armut] ist, wandert er immer eine Position weiter<br />
nach außen ... bis er sich irgendwann an dem sozialen und finanziellen 'Saturnring' bewegt<br />
und kein innerer Kontakt mehr da ist."<br />
<strong>Die</strong> Aussagen eines Experten werden hier als zusammenfassende Definition eines<br />
Lebenslagenansatzes zur Beschreibung von Armut und Benachteiligung referiert:<br />
"Armut ist mehr als wenig Geld zu haben. ... Armut ist primär ein soziales Problem, das sich<br />
in zwei Säulen mitteilt: zum einen in der materiellen Mangelausstattung, also Einkommen,<br />
Wohnraumengpässen, Güterausstattung – auch Kommunikations- und Transportmittel,<br />
Zugang zu <strong>Die</strong>nsten – Gesundheitsversorgung, kulturellen <strong>Die</strong>nsten – und ähnliches mehr<br />
und auf der anderen Seite kommt es dann partiell zu bestimmten Verhaltensauffälligkeiten im<br />
Sinne von Abweichungen. Das kann sein: Rückzug, Depressivität, Resignation, aber auch<br />
Aggressivität oder Gleichgültigkeit. <strong>Die</strong> beiden Flügel gehören zusammen – die materielle<br />
und die Verhaltensdimension der Armut.<br />
Bedrückend sind dann auch mentale Auswirkungen also eher eine psychologische<br />
Dimension: dass Phantasien verloren gehen für ein besseres Leben, dass Antrieb<br />
schwächer wird und auch die Lernmotivation und Lernfähigkeit. Das reicht bis hin zu<br />
psychosomatischen, gesundheitlichen Beeinträchtigungen. Insofern sind diese<br />
verschiedenen Dimensionen von der ökonomisch materiellen bis zur Verhaltensdimension<br />
und die psychologischen Aspekte nur im Paket zu begreifen. ..."<br />
Ein gesellschaftspolitisches Verständnis der Problematik wird durch folgende Aussage<br />
ausgedrückt: "Das Risiko, dass die kindliche Entwicklung unter Armutsbedingungen<br />
scheitert, wird privatisiert. <strong>Die</strong> gesellschaftliche Ungleichheit transformiert sich in<br />
Einzelschicksale."<br />
38
3.2 Bürger dieser Stadt<br />
– wie erlangt man den Status Mitglied einer Risikogruppe zu sein?<br />
Welche gesellschaftlichen Gruppen sind besonders gefährdet von Armut und<br />
Benachteiligung betroffen zu sein oder zu werden? Welche Verluste erleiden Menschen<br />
um den Status, Angehöriger einer Risikogruppe zu sein, zu erhalten?<br />
Von der Mehrzahl der Experten wurde auf diese Frage geantwortet, dass Armut und<br />
Benachteiligung in unserer Gesellschaft stark individualisiert werden: Eltern haben versagt,<br />
ggf. noch: Schule hat versagt, Jugendhilfe hat versagt – die Kinder sind auffällig ... . <strong>Die</strong><br />
Frage nach Risikogruppen impliziert aber auch die Frage nach Strukturen und<br />
gesellschaftlichen Bedingungen, die die Möglichkeit, Mitglied einer Risikogruppe zu werden,<br />
begünstigen.<br />
Ein Experte eröffnete das Gespräch mit der Aussage: "Es sind Familien, die durch<br />
Risikofaktoren, die eine Armutsentwicklung und Abwärtsmobilität begünstigen können,<br />
betroffen sind." Als Faktoren wurden genannt:<br />
• niedrige Einkommenssituation<br />
• Anzahl der Kinder<br />
• (fremde) ethnische Herkunft<br />
• Krankheit, Unfall<br />
• Arbeitslosigkeit<br />
• diskontinuierlicher Erwerbsverlauf<br />
• Trennung und Scheidung.<br />
Häufig wird ein Verarmungsprozess "durch mehrere der genannten Faktoren beeinflusst."<br />
Auslöser für den Verarmungsprozess sind oft Brüche wie Krankheit und Arbeitslosigkeit,<br />
aber auch Trennung und Scheidung.<br />
Da einzelne Gruppierungen wiederholt von den Experten benannt und auf ihre spezifische<br />
Situation hingewiesen wurde, werden hier nach generellen Angaben und Problemen von<br />
Risikogruppen Aussagen zu der Lebenslage von<br />
• Einelternfamilien,<br />
• Sozialhilfeempfänger-Familien und<br />
• Jugendlichen als spezielle Risikogruppe<br />
gemacht. Anschließend werden Auswirkungen materieller Armut auf Kinder und Jugendliche<br />
aufgezeigt.<br />
Risikogruppen generell<br />
Ein Interviewpartner reagierte spontan auf die Frage mit dem Hinweis: "Es ist die falsche<br />
Frage zu dieser Zeit – es geht durch alle gesellschaftlichen Gruppen." Der arbeitslose<br />
Informatiker, Ingenieur, etc.. Auf die Problematik, dass z. T. auch sehr qualifizierte<br />
Arbeitskräfte von Arbeitslosigkeit bedroht oder schon betroffen sind, wurde von mehreren<br />
Gesprächsteilnehmern hingewiesen. "Sie haben Existenzängste, im Rahmen von<br />
'Gewinnmaximierung' ihrer Unternehmen 'freigesetzt' zu werden und nach einem Jahr unter<br />
Hartz IV zu fallen." Sofern sie ein Haus oder eine Wohnung gekauft und noch Hypotheken zu<br />
tilgen haben, besteht die Gefahr erheblicher materieller Einschränkungen in der Zukunft.<br />
"Hinzu kommt, dass der Arbeitsplatz für sie auch eine soziale Funktion hatte – Kontakte,<br />
Freunde, informelle Hilfesysteme –, die sie bei länger andauernder Arbeitslosigkeit in der<br />
Regel verlieren." Viele kommen dann in eine Situation der Resignation und<br />
Perspektivlosigkeit. Weiter besteht die Gefahr, dass die Arbeitslosigkeit von vielen<br />
Beschäftigten – besonders von qualifizierten Berufstätigen als "für sie nicht relevant" –<br />
39
verdrängt wird; sie haben in der Regel nicht gelernt, den Wegfall von Erwerbsarbeit zu<br />
kompensieren.<br />
Obwohl diese Problematik wiederholt angesprochen wurde, kam vielfach das Argument,<br />
dass bei dieser Gruppe in der Regel nur eine Dimension ihrer Lebenslage von erheblichen<br />
Einschränkungen betroffen sei. <strong>Die</strong> Gefährdung durch Arbeitslosigkeit wird als weniger<br />
problematisch angesehen, wenn die finanziellen und familiären Verhältnisse vorher stabil<br />
waren. " Es ist sicherlich schwierig, mit weniger auskommen zu müssen, wenn es einem<br />
vorher gut gegangen ist, aber man hat trotzdem eine andere Lebenshaltung entwickelt und<br />
schätzt es [in der Regel] als vorübergehenden Zustand ein und verliert dann [nicht so<br />
schnell] seine anderen Grundhaltungen – die gibt man als Eltern an seine Kinder weiter."<br />
Darüber, dass das Problem "Arbeitslosigkeit" in unserer Gesellschaft allgegenwärtig ist und<br />
dass man diese Problematik sehen müsste, waren sich alle Experten einig. <strong>Die</strong><br />
längerfristigen Auswirkungen – auch auf die Kinder und Jugendlichen – sind z. Z. kaum zu<br />
prognostizieren. Trotzdem wurde übereinstimmend zum Ausdruck gebracht, dass sie mit<br />
dem Begriff "Risikogruppe" Personengruppen mit multidimensionaler Problematik<br />
assoziieren:<br />
• "Es sind Kinder von Alleinerziehenden – sie stellen unter den Familien mit Kindern die<br />
größte Gruppe der Sozialhilfeempfänger.<br />
• Man muss sehen, dass Kinder ein Armutsrisiko sind, zumindest für all diejenigen, die mit<br />
ihrem Einkommen an der Armutsgrenze liegen.<br />
• Als auslösender Faktor kommt ... Trennung ... und bzw. oder Verlust des Arbeitsplatzes<br />
hinzu. Das sind ... zusätzliche Risiken, die dann immer besonders zum Tragen kommen,<br />
wenn Kinder da sind.<br />
• Es gibt einen gewissen Anteil, bei denen das quasi schon über drei Generationen<br />
'vererbt' ist."<br />
Auf die Problematik "tradierter" Benachteiligung wird häufig hingewiesen. In dem<br />
Zusammenhang wird dann wiederholt eine "Kette" von Beeinträchtigungen benannt, die sich<br />
wechselseitig bedingen:<br />
• Schulschwierigkeiten von Kindern "bildungsferner" Eltern, die ihre Kinder bildungsmäßig<br />
nicht unterstützen und fördern können<br />
• keine oder schlechte Schulabschlüsse<br />
• keine qualifizierte Berufsausbildung<br />
• Beschäftigung in prekären Arbeitsverhältnissen.<br />
Arbeitslosigkeit muss als "Schlüsselrisiko" angesehen werden – sie führt zum einen zu<br />
(weiteren) Einbrüchen im materiellen Bereich, aber auch zum Verlust eines<br />
Verantwortungsbereiches, der "Organisation des Alltags" und von Bezugssystemen, ohne<br />
dass diese Verluste kompensiert werden können.<br />
In Gefahr, Mitglied einer Risikogruppe zu werden, "sind natürlich all diejenigen, die Eltern<br />
werden, keine entsprechende Schulausbildung haben und kein entsprechendes Sprungbrett<br />
für die Integration in ein qualifiziertes Arbeitsverhältnis. Es sind diejenigen, die ihr Leben lang<br />
auf Hilfsarbeiten oder auf temporäre Jobs verwiesen sind. In eine solche Familie reingeboren<br />
zu werden, bedeutet ein großes Armutsrisiko für Kinder, weil sich daraus viele<br />
Belastungsfaktoren ergeben."<br />
Bei Migrantenfamilien ist die Gefahr, Mitglied einer Risikogruppe zu werden, relativ groß.<br />
Ausschlaggebend sind häufig ihr rechtlicher Status und die Schwierigkeit, in den<br />
Arbeitsprozess integriert zu werden. Darüber hinaus bildet die oft sehr niedrige<br />
Sprachkompetenz von Eltern ein Risiko für die bildungsmäßige Entwicklung ihrer Kinder.<br />
"Mädchen und Jungen sind z. T. deshalb gefährdet, weil sie unsere Sprache nicht<br />
40
ausreichend beherrschen. ... Im Alltag kommen sie ganz gut damit klar, haben aber nie<br />
Lesen und Schreiben richtig gelernt. Sie sind dann ausgeschlossen von bestimmten<br />
Beeinflussungsmöglichkeiten, sowohl aktiv als auch passiv." ... "<strong>Die</strong> Jugendlichen haben<br />
häufig einen schlechten Schulerfolg – das bedeutet dann auch keinen<br />
Ausbildungsabschluss."<br />
Fehlt die Integration in familiäre Strukturen und in Netzwerke, in denen informelle<br />
Hilfesysteme und Möglichkeiten zum Austausch bestehen könnten, kommt es oft zu<br />
Beeinträchtigungen im sozialen und psychosomatischen Bereich.<br />
Ein verstärkender Faktor wird in der "Gettoisierung von Armut, d. h. in der sozialräumlichen<br />
Ausgrenzung von Armutsbevölkerung" gesehen. Das verstärkt "die Gefahr, dass sich der<br />
Teufelskreis der Armut generativ verfestigt". Eltern und/ oder primäre Bezugspersonen sind<br />
unter Armutsbedingungen "massiv überfordert", was die primäre Sozialisation von<br />
Heranwachsenden erheblich gefährden kann.<br />
Wirtschaftliche Entwicklungen – durch Rationalisierung und Effektivitätssteigerungen werden<br />
viele Menschen weiterhin freigesetzt – und Rückzug des Staates von kompensatorischen<br />
Leistungen sowie "der Aufgabe seines politischen Willens, regulierend in deprivierende<br />
Abläufe einzugreifen", werden dazu beitragen, dass weitere Teile der Bevölkerung von Armut<br />
und Benachteiligung betroffen sein werden. In der Arbeitsmarktpolitik im Rahmen von Hartz<br />
IV wird eher ein armutsverstärkendes Element als eine Maßnahme zur Bekämpfung von<br />
Armut gesehen: "...dass die derzeitige Arbeitsmarktpolitik zu einer Zunahme von Kindern und<br />
Jugendlichen führen wird, die unter den Bedingungen von Armut aufwachsen werden, wenn<br />
keine angemessenen staatlichen Kompensations- und Förderangebote bereitgestellt<br />
werden".<br />
Bezogen sich die letzten Aussagen auf Aufgabenbereiche des Bundes, so wird auch auf<br />
Einschränkungen im Bereich jugend- und bildungspolitischer Angebote in Hamburg<br />
verwiesen: "<strong>Die</strong> Vorschulen kosten jetzt [Beiträge], die Lernmittelfreiheit fällt weg,<br />
Schulschwimmen soll nicht mehr [für alle Schüler] kostenfrei sein – also, da addiert sich<br />
dann für Mehrkinderfamilien einiges zusammen."<br />
<strong>Die</strong> Benennung von Risikogruppen wird ebenso wie eine "Überspezialisierung" in Schulen<br />
als eine Ursache für Stigmatisierungen und Ausgrenzungen angesehen. Durch den aktuellen<br />
bildungspolitischen Trend – in Hamburg setzt man auf eine intensive schulische Selektion –<br />
werden die Bildungschancen von benachteiligten Schülern reduziert und damit ihre<br />
Bildungsbenachteiligung maßgeblich erhöht.<br />
Nach den hier aufgeführten generellen Aussagen zu Risikogruppen, wird dieser Punkt<br />
ergänzt durch Hinweise 1 zu den o. g. spezifischen Risikogruppen.<br />
Einelternfamilien<br />
Werden Trennung und Scheidung als spezifischer Risikofaktor genannt, so werden von den<br />
Experten Einelternfamilien übereinstimmend als die maßgebliche Risikogruppe bezeichnet.<br />
Im Armutsbericht wird darauf hingewiesen, dass "Allein Erziehende ... u. a. aufgrund<br />
unterschiedlicher Partnerschaftsbiographien, Erwerbsstatus und Einkommensverhältnisse<br />
eine sehr heterogene Gruppe [sind], die entsprechend mit sehr unterschiedlichen<br />
Problemlagen konfrontiert ist." 2<br />
1 Hier werden Ergebnisse der Lebenslagen- und Lebensweltanalyse des o. g. HzE-Projekts einbezogen.<br />
Vgl. Becher, U., Erfahrungs- und Endbericht/ ein Handbuch, 1/2004, S. 46 ff<br />
2 Lebenslagen in Deutschland, a.a.O., 2001, S. 98 f.<br />
41
Trotz dieser Heterogenität ist in der Regel die Situation, alleinverantwortlich für die Erziehung<br />
zu sein, mit spezifischen Belastungen verbunden. Darüber hinaus ist der Anteil der materiell<br />
Benachteiligten unter den Einelternfamilien – besonders mit weiblichem Elternteil – sehr<br />
hoch. Ihr Anteil an Sozialhilfeempfängern ist höher als ihr Anteil an Familien mit Kindern<br />
insgesamt. Das niedrige Einkommen alleinerziehender Mütter ist auch im Zusammenhang<br />
mit ihrem schlechten Stand auf dem Arbeitsmarkt und den schlechten Rahmenbedingungen<br />
für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu sehen. 1 Alleinerziehende Mütter, die aus dem<br />
Arbeitsprozess "ausgestiegen waren, um ihr Kind bzw. ihre Kinder zu versorgen und zu<br />
erziehen, haben kaum eine Chance, einigermaßen qualifiziert wieder einzusteigen". Bei<br />
Einelternfamilien ist das häufig "nicht einmal ein Bildungsproblem, sondern ein Problem<br />
fehlender Möglichkeiten, den Alltag, Kinder und Arbeit zu organisieren, weil die<br />
Rahmenbedingungen nicht stimmen. Alle reden von der familienfreundlichen Gesellschaft,<br />
aber davon sind wir ja wohl weit entfernt." "Bei Alleinerziehenden ... ist die Frage garantierter<br />
Kinderbetreuung eine sehr zentrale. .... <strong>Die</strong> grundsätzliche Frage zur Vereinbarkeit von<br />
Familie und Beruf ist: Gibt es diese Kinderbetreuung? Ist sie erschwinglich und gibt es sie<br />
[zu dem Zeitpunkt], wenn ich sie brauche?"<br />
Alleinerziehende Mütter – insbesondere ohne oder mit geringer Arbeitsqualifikation – erleben<br />
häufig eine "Kette" von Benachteiligungen: nicht Vollzeit oder nur temporär arbeiten zu<br />
können, finanziell an oder unter der Armutsgrenze zu liegen, keine Rücklagen bilden zu<br />
können, im Verhältnis zu teuren Wohnraum in benachteiligten Quartieren bezahlen zu<br />
müssen und nicht über die Mittel zu verfügen, um ihre Kinder – besonders in der Pubertät –<br />
an dem für Gleichaltrige normalen Standard teilnehmen zu lassen.<br />
Eine schlechte materielle Situation hat u. a. Auswirkungen auf den Status und die Integration<br />
der Kinder in der Schule. Notwendige Materialien können oft nicht gekauft werden, die<br />
Teilnahme an Freizeiten und Klassenfahrten, insbesondere Auslandaufenthalte, kann oft<br />
nicht finanziert und Freunde können nicht eingeladen werden. <strong>Die</strong>ser Aspekt führt häufig zu<br />
Diskriminierungen und Ausgrenzungen, wodurch die Situation noch weiter belastet wird. <strong>Die</strong><br />
materielle Lage bestimmt in der Regel auch die Wohn- und Wohnumfeldsituation. Inzwischen<br />
findet eine räumliche Segregation benachteiligter Personengruppen in Wohngebieten statt,<br />
die gesellschaftlich diskriminiert werden.<br />
Ausgrenzungen und Diskriminierungen führen zu einem Mangel an Kontakten und<br />
Austauschmöglichkeiten mit Kindern und Jugendlichen anderer gesellschaftlicher Gruppen.<br />
Dadurch werden ihre Chancen zum Erlernen unterschiedlicher Rollen und zum Aufbau<br />
differenzierter sozialer Beziehungen erheblich eingeschränkt. Jugendliche in der Pubertät<br />
leiden offensichtlich besonders unter dieser Situation. Damit kann auch zusammen hängen,<br />
wenn sie in dem Alter schwierig werden. Wenn sie nicht "dazu gehören" und "mithalten"<br />
können, führt das häufig zu Außenseiterpositionen in gleichaltrigen Gruppen. Ihre<br />
Reaktionen sind dann vermehrt Aggression und "abweichendes Verhalten" bis hin zur<br />
Straffälligkeit, aber auch Schuldgefühle; sie übernehmen Verantwortung für Situationen,<br />
unter denen sie selbst leiden.<br />
Kinder von geschiedenen und getrennt lebenden Eltern haben häufig Konflikte in der Familie<br />
und Probleme bei der Trennung erfahren; oft werden sie auch in die Auseinandersetzungen<br />
einbezogen oder übernehmen die Rolle als "Blitzableiter" mit allen Folgeerscheinungen. In<br />
Trennungs- und Scheidungsfamilien entstehen Konflikte auch daraus, "dass keiner mehr<br />
materiell existieren kann. ... [<strong>Die</strong> früheren Partner] begeben sich mit ihrer <strong>ganze</strong>n Energie ...<br />
in einen Zerfleischungsprozess hinein, weil sie nicht gelernt haben, ... mit emotionalen und<br />
persönlichen Konflikten umzugehen." Wer keine Konfliktbewältigung für sich und seine<br />
Familie betreiben kann, ist von weiterer Benachteiligung bedroht.<br />
Kinder lediger Mütter erleben in der Regel keine Trennung mit den z. T. sehr belastenden<br />
Konflikten. Häufig bestehen keine Beziehungen zum leiblichen Vater und damit auch keine<br />
1 vgl. ebenda, S. 107<br />
42
Auseinandersetzungen mit ihm und seiner Rolle. Natürliche Auseinandersetzungen, z. B. in<br />
der Familie zu streiten oder Grenzen auszutesten, entfallen vielfach in Einelternfamilien.<br />
<strong>Die</strong>se Situation kann sich für die Kinder und Jugendlichen auch krankmachend auswirken.<br />
Ein Problem für geschiedene oder getrennt lebende Eltern ist der Verlust sozialer Netze, z.<br />
B. wenn sie die Wohnung wechseln und Freunde und bzw. oder Bekannte die Beziehung zu<br />
ihnen abbrechen und zu dem früheren Partner aufrechterhalten. Verschärft wird die Situation<br />
der Kinder auch bei Rollenüberforderung der Mütter aufgrund unterschiedlicher, z. T.<br />
widersprüchlicher, an sie gerichteter Anforderungen und Erwartungen. <strong>Die</strong> emotionale und<br />
soziale Überforderung der Elternteile führt häufig zu depressiven Verhaltensweisen, was<br />
wiederum zu Einschränkungen ihrer Außenkontakte führt. Kontakte zu Vertretern von<br />
Regeleinrichtungen werden nicht (mehr) gepflegt, was noch dadurch begünstigt wird, dass<br />
Kindertageseinrichtungen und Schulen kaum noch die Funktionen als weitere<br />
Erziehungsorte und Partner der Eltern bei der Bildung und Förderung ihrer Kinder<br />
wahrnehmen. <strong>Die</strong> Einschränkung des Zugangs in Kitas in benachteiligten Regionen<br />
verschärft die Situation zusätzlich.<br />
Segregation und Diskriminierung einerseits, Rückzug und Isolation andererseits sind<br />
Aspekte, die den Prozess der Benachteiligung von Kindern und Jugendlichen in<br />
Einelternfamilien begünstigen. Insbesondere materielle Benachteiligung macht es schwierig,<br />
in das heutige gesellschaftliche Leben gut einzusteigen. <strong>Die</strong> jungen Menschen ziehen sich<br />
immer weiter zurück, wodurch sich ihre Situation häufig weiter verschlechtert. Folgen sind<br />
dann oft:<br />
• Schwierigkeiten in der Schule<br />
• keine Ausbildungsstelle, keine berufliche Qualifizierung<br />
• Krankheiten<br />
• "Ausstieg"<br />
• Übernahme von Verhaltensweisen, die ihnen dann als abweichend angelastet werden.<br />
Es entwickelt sich z. T. eine Opposition gegen die Gesellschaft und ihre Institutionen, was<br />
die Segregation weiter verstärkt und einen Teufelskreis der Benachteiligung hervorruft.<br />
Sozialhilfeempfänger-Familien 1<br />
Gilt der Bezug von Sozialhilfe den Einen – in der Regel Politikern aller Parteien – als<br />
"bekämpfte Armut", so bezeichnen die Anderen – in der Regel Sozialarbeiter und<br />
Sozialpolitiker – Sozialhilfebezug als Leben unter Armutsbedingungen.<br />
In Hamburg ist die Zahl von sozialhilfeabhängigen Kindern unter sieben Jahren von 2001 bis<br />
2003 um gut 1.100 – auf 18.601 – gestiegen. "Sozialsenatorin Birgit Schnieber-Jastram sieht<br />
darin aber kein Zeichen für eine steigende Kinderarmut: Im Gegenteil, Sinn der Sozialhilfe<br />
sei es, ein Abrutschen in Armut zu verhindern. 'Sozialhilfebedürftigkeit von Kindern ist immer<br />
das Resultat der finanziellen, beruflichen und sozialen Situation der Eltern.'" 2<br />
<strong>Die</strong> Gewährung von Sozialhilfe entspricht der sozialpolitischen Orientierung des<br />
Grundgesetzes, nach der die staatliche Gemeinschaft die Verpflichtung hat, die Würde des<br />
Menschen zu achten und zu schützen (Artikel 1 GG). <strong>Die</strong>ser Auftrag findet seine Umsetzung<br />
im Bundessozialhilfegesetz (BSHG), § 1 Abs. 2: "Aufgabe der Sozialhilfe ist es, dem<br />
Empfänger der Hilfe die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des<br />
Menschen entspricht."<br />
1 Der Untersuchungszeitraum des Projekts lag vor der Implementierung von Hartz IV/ Arbeitslosengeld 2, insofern<br />
beziehen sich die Ausführungen noch auf die Empfänger von Sozialhilfe gemäß Bundessozialhilfegesetz.<br />
2 vgl. Hamburger Abendblatt, 25.05.2005<br />
43
Das Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung weist in seinem Bericht zu<br />
"Lebenslagen in Deutschland" darauf hin, dass Verarmungsprozesse von<br />
Familienhaushalten häufig durch folgende Faktoren ausgelöst bzw. begünstigt werden:<br />
• Arbeitslosigkeit und Niedrigeinkommen<br />
• Trennung und Scheidung oder die Phase der Familiengründung<br />
• Bildungs- und Kompetenzdefizite<br />
o fehlende Kompetenzen zu planen und zu wirtschaften, eine unzureichende Kontrolle<br />
von Konsumwünschen, nicht erlernte Markt- und Produktkenntnisse, mangelnde<br />
Fähigkeit, mit Kreditangeboten umzugehen<br />
• berufliche Bildungsdefizite<br />
• Erkrankung, Unfall<br />
• mangelnde Vereinbarkeit von Familien- und Erwerbsarbeit. 1<br />
Bevor hier Aussagen darüber gemacht werden, was es für die Betoffenen bedeutet, unter<br />
Sozialhilfebedingungen (oder mit einem Einkommen in vergleichbarer Höhe) zu leben, einige<br />
grundsätzliche Ausführungen zu Bestimmungen des BSHG:<br />
Krahmer weist in seiner Kommentierung zum BSHG darauf hin, dass die Hilfe bei Vorliegen<br />
einer individuellen Bedarfslage einsetzt, "ohne dass es auf deren Ursache ankommt." 2 Durch<br />
Sozialhilfeleistungen soll sichergestellt werden, "dass jedermann die Führung eines Lebens<br />
ermöglicht wird, das der Würde des Menschen entspricht. <strong>Die</strong>s schließt grundsätzlich auch<br />
die Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft ein. ... Dem Hilfeempfänger ist als<br />
gemeinschaftsgebundenem Wesen über das zum Leben Unerlässliche hinaus vielmehr auch<br />
der soziokulturelle Bedarf zu gewährleisten." 3 Das Bundesverwaltungsgericht begreift "das<br />
Sozialhilferecht als Konkretisierung der Pflicht des Staates zum Schutz der<br />
Menschenwürde". 4 Unter dieser Prämisse sind Kommunen wegen ihrer Verfahrensweisen<br />
gegenüber besonders diskriminierten Personengruppen schon vom<br />
Bundesverwaltungsgericht zu Veränderungen ihrer Handlungsweisen verurteilt worden.<br />
Liest man gelegentlich Presseberichte zur Situation von Sozialhilfeempfängern – wobei sie z.<br />
T. den 0-Ton von Politikern der unterschiedlichen Parteien wieder geben – kann man den<br />
Eindruck gewinnen, dass es Sozialhilfeempfängern bei uns doch sehr gut geht. <strong>Die</strong><br />
"Hängematte", in der sie ruhen, wird vielfach zitiert. Andererseits wird auf die<br />
eingeschränkten Entwicklungschancen der davon betroffenen Kinder hingewiesen.<br />
Sozialhilfe/ Hilfe zum Lebensunterhalt – bekämpfte Armut?<br />
Ab 1. Juli 2003 bis zum 31. Dezember 2004 galten in Hamburg folgende Regelsätze in der<br />
Sozialhilfe:<br />
• Haushaltsvorstand / Alleinstehende: 296 Euro<br />
• Volljährige Haushaltsangehörige: 237 Euro<br />
• Kinder unter 7 Jahre: 148 Euro<br />
• Kinder unter 7 Jahre bei alleinerziehendem Elternteil: 163 Euro<br />
• Kinder vom Beginn des 8. bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres: 192 Euro<br />
• Jugendliche vom Beginn des 15. bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres: 266 Euro<br />
1 vgl. Lebenslagen in Deutschland, a.a.O., 2001, S. 109<br />
2 Krahmer, L., in: Bundessozialhilfegesetz, Lehr- und Praxiskommentar, 5. Auflage, Baden Baden 1998, S. 35<br />
3 ebenda, S. 35<br />
4 ebenda, S. 65<br />
44
Regelsätze sind – neben Mietkosten und einmaligen Hilfen – Teil der Sozialhilfe. Finanziert<br />
werden muss davon die Ernährung, der hauswirtschaftliche Bedarf einschließlich Strom<br />
sowie die persönlichen Bedürfnisse des täglichen Lebens. Zu den persönlichen Bedürfnissen<br />
zählen neben Körperpflege und Reinigung auch die Anschaffung von Hausrat und Wäsche in<br />
geringem Wert sowie die Instandsetzung von Kleidung, Schuhen und<br />
Haushaltsgegenständen in kleinerem Umfang.<br />
Das BSHG führt in § 12 Abs. 2, der den notwendigen Lebensunterhalt regelt, aus: "Bei<br />
Kindern und Jugendlichen umfasst der notwendige Lebensunterhalt auch den besonderen,<br />
vor allem den durch ihre Entwicklung und ihr Heranwachsen bedingten Bedarf." Für Kinder<br />
und Jugendliche zwischen z. B. 8 und 14 Jahren müssen dann die 192 Euro im Monat schon<br />
sehr "gekonnt" verplant und ausgegeben werden, wenn die damit zu finanzierenden Bedarfe<br />
realisiert werden sollen.<br />
Auch wenn Eltern versuchen, mit dem geringen Einkommen verantwortlich und planvoll<br />
umzugehen, gibt es für die Kinder und Jugendlichen vielfältige Schwierigkeiten. Sie<br />
unterscheiden sich oft in ihrer Kleidung und versuchen das zu überspielen, z. B. mit einer<br />
"großen Klappe", aber auch mit aggressivem und auffälligem Verhalten. In der Regel suchen<br />
sie sich Freunde aus dem gleichen Milieu und bilden Cliquen mit z. T. spezifischen<br />
Hilfesystemen, die häufig durch einen hohen Grad an Solidarität gekennzeichnet sind.<br />
Sowohl die Kinder und Jugendlichen als auch ihre Eltern haben keinen bzw. kaum Kontakt<br />
zu Angehörigen anderer gesellschaftlicher Gruppen, was sowohl mit dem Mangel an<br />
Ressourcen als auch mit dem Fehlen von Teilhabechancen zusammen hängt.<br />
Bewegen sich Jugendliche – häufig in Cliquen – auch außerhalb ihres Stadtteils, so haben<br />
sie in der Region doch ihr eigentliches Bezugsgebiet. <strong>Die</strong> Eltern leben die Begrenztheit auf<br />
den Stadtteil vor. "Sozialhilfeempfänger bewegen sich auch nicht an der Elbe zum Spazieren<br />
gehen. ... Sie sind schon sehr gettoisiert." Gebiete außerhalb des Stadtteils sind ihnen oft<br />
fremd und sie haben kaum Sicherheit, sich in unbekannten Gegenden zu bewegen. <strong>Die</strong><br />
Familien fahren auch fast nie gemeinsam in Urlaub. Gelegentlich fahren sie für ein paar<br />
Tage auf einen Campingplatz. Kinder und Jugendliche machen manchmal Urlaub über das<br />
Jugendbetreuungswerk – meistens müssen sie dazu aber "von außen" angeregt werden.<br />
Selten werden Kuren in Anspruch genommen.<br />
Den Betroffenen fehlt häufig das "Know-how" darüber, welche Angebote es gibt – nicht nur<br />
bezogen auf Ferienmaßnahmen – und die Routine, wie man Angebote und Leistungen<br />
nutzen kann. Auch dort, wo es "formal" die entsprechenden Informationen gibt – z. B.<br />
Berichte in der Zeitung zu spezifischen Veranstaltungen, auch im kulturellen Bereich –<br />
können sie diese nicht für sich nutzbar machen. Sie "versacken im Alltag" und es fehlt ihnen<br />
an Verfahrenssicherheit und Handlungsmöglichkeiten.<br />
Auf die besondere Problematik von Sozialhilfeempfängern der zweiten und dritten<br />
Generation haben mehrere Experten aufmerksam gemacht. Es wird darauf hingewiesen,<br />
dass die Entwicklungschancen der jungen Menschen u. a. beeinträchtigt sind, weil sie in<br />
ihrer Kindheit schon soziale Schwierigkeiten und Einschränkungen erfahren haben. Wenn<br />
Kinder und Jugendliche die Abhängigkeit von Sozialhilfe und deren Auswirkungen auf die<br />
Lebenslage der Familie während ihres gesamten Lebens erfahren haben, ist "ihr Impuls, ...<br />
dass das eine veränderbare Situation ist, die sie individuell beeinflussen können, ... wenig<br />
stark ausgeprägt". In der Familie werden bestimmte Einstellungen, Handlungs- und<br />
Verhaltensweisen "gelernt" und als normal empfunden. Wenn es z. B. schon bei den Eltern<br />
Schulschwierigkeiten und Arbeitslosigkeit gegeben hat, "ist die Wahrscheinlichkeit der<br />
Fortsetzung bei den Kindern spontan, dann sieht es für die Kinder schlecht aus: der Zugang<br />
zu Büchern etc. ist gering oder fehlt vollständig, Schulförderung der Kinder durch die Eltern<br />
ist praktisch nicht leistbar – die Eltern haben es selbst nicht gelernt".<br />
45
"Wenn die Kinder zu Hause nicht erleben, dass es sich lohnt sich anzustrengen, dass man<br />
etwas bewirken kann, dass die Selbstwirksamkeit bedeutungsvoll ist – und das erfahren sie<br />
häufig bei ihren Eltern, die nie in einem 'Normalarbeitsverhältnis' integriert waren oder dort<br />
schon lange 'ausgefädelt' wurden – verfügen sie auch über keine Modelle, die ihnen helfen<br />
könnten, entsprechende notwendige Aktivitäten zu entwickeln."<br />
<strong>Die</strong> Gruppe der Jugendlichen aus Sozialhilfeempfänger-Familien ohne Bildungsabschlüsse<br />
ist relativ hoch. Sie können von ihrem Bewusstsein her kaum Wissens- und<br />
Handlungskompetenzen entwickeln. Jugendliche – insbesondere aus tradierten<br />
Armutsfamilien – haben häufig resigniert. Sie sehen für sich keine Perspektiven. "Armut<br />
stigmatisiert, demütigt, isoliert, macht elend."<br />
Jugendliche als spezielle Risikogruppe<br />
In der Regel werden Armut und Benachteiligung den Jugendlichen nicht selbst zugeordnet,<br />
sondern ihren Familien. Das führt dazu, dass sie nicht als Subjekte mit eigenen Ansprüchen<br />
und Rechten wahrgenommen werden. <strong>Die</strong> Auswirkungen ihrer Sozialisation – sowohl in der<br />
Familie als auch in der Schule – werden ihnen meistens als individuelles Versagen<br />
angelastet. Eine Integration in den Arbeitsprozess, insbesondere in eine qualifizierte<br />
Tätigkeit, erreichen sie praktisch nie. "Früher haben sie noch Arbeitsplätze im<br />
Industriebereich gefunden. Klassisch waren Gerüstbau und Niedriglohntätigkeit im Hafen.<br />
<strong>Die</strong>se Arbeitsplätze sind weggefallen." Das Qualifikationsniveau "in der<br />
<strong>Die</strong>nstleistungsgesellschaft ist gestiegen, was dazu führt, dass diejenigen, die keine<br />
abgeschlossene Schulbildung [oder nur einen schlechten Hauptschulabschluss] haben,<br />
rausfallen: sie haben nicht einmal die Chance, sich über Gelegenheitsarbeiten oder prekäre<br />
Arbeitsplätze zu finanzieren." <strong>Die</strong>se Situation trifft auch auf einen relativ großen Anteil<br />
Jugendlicher aus Migrantenfamilien zu.<br />
Mädchen versuchen inzwischen wieder häufiger, ihrer "chancenlosen Situation" durch eine<br />
Schwangerschaft zu begegnen: "Wir haben den deutlichen Hinweis dafür, dass es wieder<br />
mehr junge Mädchen gibt, die schwanger werden, ihre Kinder kriegen und auf entsetzliche<br />
Art und Weise sich durch das Leben kämpfen, ... die in ihrer Situation verharren. Sie werden<br />
häufig durch die Jugendhilfe mit einer HzE unterstützt, was nicht den Effekt hat, dass sie<br />
dann wirklich 'starten' können. ... Ich glaube, das sind Mädchen und junge Frauen, die sehr<br />
gefährdet sind."<br />
Eine spezifische Risikogruppe wird in den minderjährigen unbegleiteten Flüchtlingen<br />
gesehen, die nicht "eingebunden" sind, z. B. in Projekten der Jugendhilfe oder der Kirchen.<br />
".... aber wenn sie nicht durch Sozialarbeit in irgendeiner Weise erfasst werden, sind sie eine<br />
'Zeitbombe', weil sie kaum eine andere Lebenschance haben, als zu dealen."<br />
Auswirkungen materieller Armut auf die Lebenslage von Kindern und Jugendlichen<br />
Materielle Armut ist bei Berücksichtigung des Lebenslagenkonzeptes nicht der einzige<br />
Bereich, der Beeinträchtigungen und Benachteiligungen in der Entwicklung von<br />
Kindern auslöst; fast alle anderen Bereiche werden auch durch materielle Armut beeinflusst.<br />
Eine Teilhabe an der modernen "Markt- und Konsumgesellschaft" ist für die Kinder aufgrund<br />
ihrer finanziellen Situation kaum möglich. Durch diese Einschränkungen können Kinder und<br />
Jugendliche in ihren Aktivitäten, Erfahrungen und bei der Kommunikation mit Gleichaltrigen<br />
beeinträchtigt werden.<br />
Einschränkungen beim Konsum, aber auch Ausgrenzung aus Bildungssystemen und<br />
-angeboten bedeuten für die Persönlichkeitsentwicklung eine "fundamentale Erfahrung des<br />
Aufwachsens. <strong>Die</strong> möglichen Konsequenzen für Kinder sind geringes Selbstwertgefühl,<br />
46
Depressivität, Einsamkeit, Misstrauen, Nervosität, Konzentrationsschwäche und Resignation<br />
in bezug auf berufliche Chancen." 1<br />
Durch Mangel an Wohnraum und Einschränkungen im Wohnumfeld inklusive Mangel an<br />
Einrichtungen der sozialen Infrastruktur und sozialen Netzwerken "entsteht Aggressivität,<br />
häufig verbunden mit zerstörerischer Gewalt an öffentlichen Einrichtungen. Armut und<br />
Ausgrenzung gefährden die Chancen von Kindern bei der Ausbildung ihrer Fähigkeiten und<br />
ihrer persönlichen Autonomie. Sie gefährden das Niveau ihrer Schulbildung und ihrer<br />
beruflichen Ausbildung. <strong>Die</strong> Beeinträchtigung der Entwicklung im Kindesalter kann bewirken,<br />
dass sich Kinder später keinen befriedigenden Platz im beruflichen, sozialen und privaten<br />
Leben sichern können, weil ihnen wichtige Voraussetzungen fehlen. Sie sind im Hinblick auf<br />
ihre Bildungs- und Berufschancen und damit ihre gesellschaftliche und berufliche Integration<br />
benachteiligt." 2<br />
<strong>Die</strong> Auswirkungen von Armut auf junge Menschen sind gravierend. Entwicklungs-,<br />
Erfahrungs- und Lernmöglichkeiten und damit gesellschaftliche Teilhabe sind erheblich<br />
eingeschränkt. <strong>Die</strong>s ist insbesondere der Fall, wenn eine kumulative Deprivation gegeben ist.<br />
Am Anfang dieses Punktes wurde ausgeführt: <strong>Die</strong> Frage nach Risikogruppen impliziert die<br />
Frage nach Strukturen und Bedingungen, die die Möglichkeit, Mitglied einer Risikogruppe<br />
zu werden, begünstigen. <strong>Die</strong> Ausführung der Experten weisen sehr deutlich auf<br />
entsprechende Faktoren hin:<br />
• Erosion der Familien – 72 Scheidungen auf 100 Eheschließungen in Hamburg 2003<br />
• (fehlende) "pädagogische Infrastruktur", die der Vereinbarkeit von "Erziehungsarbeit" und<br />
Berufstätigkeit von Frauen, insbesondere auch alleinerziehenden Frauen, gerecht wird<br />
• ein Schulsystem, dass dem Bedarf an Förderung und Unterstützung von Kindern<br />
"bildungsferner" Eltern nicht entspricht<br />
• eine "<strong>Die</strong>nstleistungsgesellschaft", die keine/ kaum Arbeitsplätze für gering qualifizierte<br />
Schulabgänger bereit hält<br />
• Massenarbeitslosigkeit und die dadurch verursachten Benachteiligungen, die die<br />
genannten Risiken potenzieren<br />
• ein (offensichtlich) stark ausgeprägtes gesellschaftliches Bedürfnis, einer primär<br />
strukturell begründeten Problematik durch Individualisierung und Ausgrenzung zu<br />
begegnen.<br />
Es fragt sich, wie lange unsere Gesellschaft es sich noch leisten kann – nicht nur bei<br />
Berücksichtigung der demografischen Entwicklung – das vorhandene Bildungspotential von<br />
benachteiligten Kindern "brach liegen zu lassen", stellt Bildung doch laut Aussagen<br />
führender Politiker und Wirtschaftsexperten die zukünftige Ressource unserer Gesellschaft<br />
dar.<br />
1 Lebenslagen in Deutschland, a.a.O., S. 115<br />
2 ebenda, S. 115<br />
47
3.3 "Arme" und "reiche" Stadtteile (und Bezirke) in Hamburg<br />
Verteilung von Risikogruppen auf räumliche Gebiete<br />
Schon am Anfang der Projektarbeit wurde konstatiert, dass nicht nur die Lebenslage der<br />
Leistungsempfänger von HzE in der Region III in der Regel von materieller Armut<br />
gekennzeichnet ist, sondern dass sie auch überproportional häufig in sogenannten<br />
benachteiligten Gebieten leben. Während der Gruppendiskussionen und Einzelinterviews<br />
wurde wiederholt zum Ausdruck gebracht, dass Armut auch durch städtebauliche<br />
Missstände und sichtbare bauliche Probleme erkennbar wird. Es entwickeln sich Gettos –<br />
Gebiete, in die "man" nicht geht. "Selbst wenn sie zum Teil relativ gut aussehen, gepflegte<br />
Grünanlagen haben, erhalten sie von außen ein negatives Stigma" (vgl. Punkt 3.1).<br />
Bevor hier die Verteilung "armer" und "reicher" Regionen – gemessen an dem Anteil an<br />
Sozialhilfeempfängern – in Hamburg aufzeigt wird, eine These zum Verständnis:<br />
48<br />
<strong>Die</strong> Verteilung von Armut und Reichtum in Stadtgebieten ist sehr<br />
ungleichmäßig. Aufgrund von Segregationsprozessen bilden sich<br />
Regionen mit positiv bewerteten Faktoren und steigendem Wohlstand<br />
und andererseits Regionen mit negativ bewerteten, benachteiligend<br />
wirkenden Faktoren und zunehmender Armut.<br />
Mit anderen Worten:<br />
Arme Menschen leben in der Regel in kleinen Wohnungen, in<br />
verdichteten, häufig durch Umweltbeeinträchtigungen belasteten<br />
Regionen mit unzureichender bzw. schlechter Infrastruktur.<br />
Wohlhabende und reiche Menschen leben dagegen in großen<br />
Wohnungen, in der Regel in aufgelockerten, attraktiven Wohngebieten;<br />
ihnen steht ein umfassendes Angebot an <strong>Die</strong>nstleistungen und eine<br />
ihren Bedarfen entsprechende Infrastruktur zur Verfügung.<br />
Belegt wird diese These durch Strukturdaten ausgewählter Quartiere in der Region III in<br />
Eimsbüttel und im Schanzenviertel/ Karolinenviertel sowie anhand der jeweils 12 Stadtteile in<br />
Hamburg mit dem höchsten ("arme Stadtteile") und dem niedrigsten ("reiche Stadtteile")<br />
Anteil an Sozialhilfeempfängern 1 (vergleiche Tabelle 1, 1a und 1b). 2<br />
1<br />
<strong>Die</strong> Angaben in den Tabellen 1a und 1 b beziehen sich auf einen anderen Zeitpunkt<br />
– dadurch kommt es aber zu keinen gravierenden Veränderungen.<br />
2<br />
<strong>Die</strong> Strukturdaten werden im Folgenden relativ detailliert, und abschließend in einer Zusammenfassung<br />
komprimiert dargestellt.
Tabelle 1<br />
Anteil der Empfänger und Empfängerinnen von Sozialhilfe<br />
in "armen" und "reichen" Stadtteilen im Zeitvergleich<br />
Stadtteil/<br />
Bezirk insgesamt<br />
Empfänger 2002 1 Empfänger Nov. 2004 2<br />
in % der<br />
Bevölkerung<br />
insgesamt<br />
in % der<br />
Bevölkerung<br />
Jenfeld 4.248 16,5% 1 3.989 15,8% 3<br />
Billbrock 331 16,3% 2 273 15,3% 5<br />
Kl. Grasbrook mit Steinwerder 225 16,0% 3 263 18,2% 1<br />
Hausbruch 2.648 15,3% 4 2.727 15,7% 4<br />
Billstedt 9.827 14,4% 5 9.722 14,2% 6<br />
Veddel 611 13,3% 6 785 16,7% 2<br />
Wilhelmsburg 6.312 13,2% 7 6.541 13,7% 7<br />
St. Pauli 3.379 12,6% 8 3.068 11,4% 11<br />
Dulsberg 2.109 12,2% 9 2.117 12,3% 8<br />
Rothenburgsort 935 11,6% 10 963 11,9% 9<br />
Steilshoop 2.229 11,5% 11 2.280 11,7% 10<br />
Allermöhe 1.522 11,0% 12 1.555 10,9% 12<br />
Wohldorf/ Ohlstedt 16 0,4% 1 16 0,4% 2<br />
Reitbrook 3 0,6% 2 0 0,0% 1<br />
Gr. Flottbek 75 0,7% 3 61 0,6% 4<br />
Nienstedten 42 0,7% 3 32 0,5% 3<br />
Othmarschen 90 0,8% 5 91 0,8% 5<br />
Sasel 170 0,8% 5 194 0,9% 7<br />
Wellingsbüttel 84 0,9% 7 96 1,0% 9<br />
Neuengamme 36 1,0% 8 41 1,2% 12<br />
Bergstedt 98 1,1% 9 97 1,1% 11<br />
Blankenese 155 1,2% 10 131 1,0% 9<br />
Ochsenwerder 27 1,2% 10 18 0,8% 5<br />
Altengamme 29 1,4% 12 19 0,9% 7<br />
Bezirk Eimbüttel 3<br />
Bezirk Hamburg Nord 3<br />
Bezirk Wandsbek 3<br />
Bezirk Altona 3<br />
Bezirk Bergedorf 3<br />
Bezirk Harburg 3<br />
Bezirk Hamburg Mitte 3<br />
Hamburg insgesamt 3<br />
1 Hamburger Statistisches Jahrbuch 2003/2004, S. 110 f<br />
2 Hamburger Abendblatt vom 7.2.2004, S. 15<br />
3 Es liegen nur Daten für 2002 vor<br />
12.392 5,1% 1<br />
14.065 5,1% 1<br />
25.123 6,2% 3<br />
15.184 6,3% 4<br />
8.324 7,1% 5<br />
18.352 9,2% 6<br />
24.683 10,8% 7<br />
120.884 7,1%<br />
49
Tabelle 1 a<br />
Anteil der Empfänger von Hilfen zum Lebensunterhalt an der Gesamtbevölkerung nach Altersstruktur<br />
- Region III Eimsbüttel, 2003<br />
HLU-Empf. 0 bis unter 6 6-bis unter 14 14 bis unter 18 18 bis unter 45 45 bis unter 60 60+<br />
însgesamt insg. HLU. insg. HLU insg. HLU insg. HLU insg. HLU insg. HLU<br />
N % N N % N N % N N % N N % N N % N N %<br />
Bevölkerung<br />
insgesamt<br />
Region<br />
Eidelstedt - Wildacker 1.700 264 15,5% 117 41 35,0% 155 43 27,7% 71 21 29,6% 553 96 17,4% 351 45 12,8% 453 18 4,0%<br />
Eidelstedt - Hörgensweg 3.240 381 11,8% 178 60 33,7% 220 48 21,8% 100 19 19,0% 1.234 174 14,1% 570 57 10,0% 938 23 2,5%<br />
2.299 250 10,9% 116 26 22,4% 181 28 15,5% 105 25 23,8% 799 89 11,1% 400 48 12,0% 698 34 4,9%<br />
Eidelstedt -<br />
Remstückenkamp/<br />
Wiebischenkamp<br />
Eidelstedt - Astweg 2.551 273 10,7% 179 42 23,5% 258 59 22,9% 122 26 21,3% 896 109 12,2% 472 27 5,7% 624 10 1,6%<br />
Eidelstedt 29.979 3.027 10,1% 1.524 435 28,5% 2.257 389 17,2% 1.204 187 15,5% 10.706 1.269 11,9% 5.702 480 8,4% 8.586 267 3,1%<br />
Stellingen - Wegenkamp 1.776 214 12,0% 99 33 33,3% 137 29 21,2% 72 21 29,2% 636 84 13,2% 334 34 10,2% 498 13 2,6%<br />
Stellingen - Linse 2.900 269 9,3% 116 42 36,2% 164 36 22,0% 106 21 19,8% 981 111 11,3% 561 44 7,8% 972 15 1,5%<br />
Stellingen - Spannskamp 1.391 77 5,5% 58 8 13,8% 111 16 14,4% 37 5 13,5% 509 32 6,3% 203 10 4,9% 473 6 1,3%<br />
Stellingen 21.871 1.958 9,0% 932 243 26,1% 1.207 274 22,7% 642 140 21,8% 8.941 741 8,3% 4.959 391 7,9% 7.482 169 2,3%<br />
Region III 51.850 4.985 9,6% 2.456 678 27,6% 3.464 663 19,1% 1.846 327 17,7% 19.647 2.010 10,2% 10.661 871 8,2% 16.068 436 2,7%<br />
Bezirk Eimsbüttel 244.007 12.576 5,2% 11.780 1.529 13,0% 15.030 1.653 11,0% 7.428 862 11,6% 102.765 4.972 4,8% 47.630 2.230 4,7% 59.374 1.330 2,2%<br />
Hamburg 1.714.923 132.619 7,7% 91.568 18.160 19,8% 120.474 19.084 15,8% 62.334 9.085 14,6% 701.584 55.529 7,9% 318.819 20.103 6,3% 420.144 10.658 2,5%<br />
50
Tabelle 1b<br />
Anteil der Empfänger von Hilfen zum Lebensunterhalt an der Gesamtbevölkerung nach Altersstruktur<br />
- Schanzenviertel, Karolinenviertel, 2003<br />
HLU-Empf. 0 bis unter 6 6-bis unter 14 14 bis unter 18 18 bis unter 45 45 bis unter 60 60+<br />
însgesamt insg. HLU insg. HLU insg. HLU insg. HLU insg. HLU insg. HLU<br />
N % N N % N N % N N % N N % N N % N N %<br />
Bevölkerung<br />
insgesamt<br />
Region<br />
St. Pauli - Schulterblatt 3.337 211 6,3% 165 24 14,5% 172 26 15,1% 62 8 12,9% 1.943 88 4,5% 524 35 6,7% 471 30 6,4%<br />
2.134 271 12,7% 177 56 31,6% 122 25 20,5% 68 17 25,0% 1.263 113 8,9% 309 31 10,0% 195 29 14,9%<br />
St. Pauli -<br />
Schanzenstraße<br />
St. Pauli - Lagerstraße 349 38 10,9% 17 4 23,5% 30 5 16,7% 9 4 44,4% 165 10 6,1% 89 10 11,2% 39 5 12,8%<br />
Altona - Altstadt 3.031 192 6,3% 149 22 14,8% 162 21 13,0% 62 5 8,1% 1.577 86 5,5% 496 35 7,1% 585 23 3,9%<br />
Altona - Nord 2.348 302 12,9% 155 51 32,9% 183 63 34,4% 59 16 27,1% 1.329 122 9,2% 327 34 10,4% 295 16 5,4%<br />
2.459 141 5,7% 94 13 13,8% 86 8 9,3% 53 14 26,4% 1.421 52 3,7% 449 34 7,6% 356 20 5,6%<br />
Eimsbüttel -<br />
Doormannsweg<br />
3.107 220 7,1% 120 20 16,7% 139 21 15,1% 79 14 17,7% 1.686 88 5,2% 565 44 7,8% 518 33 6,4%<br />
Eimsbüttel -<br />
Waterloostraße<br />
Eimsbüttel - Fettstraße 2.340 164 7,0% 119 20 16,8% 121 20 16,5% 60 15 25,0% 1.305 61 4,7% 447 32 7,2% 288 16 5,6%<br />
2.142 164 7,7% 111 28 25,2% 149 25 16,8% 60 17 28,3% 1.194 56 4,7% 394 29 7,4% 234 9 3,8%<br />
Eimsbüttel -<br />
Agathenstraße<br />
Sternschanze 316 21 6,6% 15 2 13,3% 23 4 17,4% 7 1 14,3% 138 4 2,9% 26 6 23,1% 107 4 3,7%<br />
Schanzenviertel 21.563 1.724 8,0% 1.122 240 21,4% 1.187 218 18,4% 519 111 21,4% 12.021 680 5,7% 3626 290 8,0% 3.088 185 6,0%<br />
Bezirk Mitte 226.837 26.620 11,7% 12.100 3.678 30,4% 15.147 3.866 25,5% 8.269 1.793 21,7% 101.370 10.620 10,5% 41668 4.318 10,4% 48.283 2.345 4,9%<br />
Bezirk Eimsbüttel 244.007 12.576 5,2% 11.780 1.529 13,0% 15.030 1.653 11,0% 7.428 862 11,6% 102.765 4.972 4,8% 47630 2.230 4,7% 59.374 1.330 2,2%<br />
Bezirk Altona 241.992 16.374 6,8% 13.865 2.218 16,0% 17.438 2.391 13,7% 8.568 1.129 13,2% 99.167 6.841 6,9% 44265 2.429 5,5% 58.689 1.366 2,3%<br />
Hamburg 1.714.923 132.619 7,7% 91.568 18.160 19,8% 120.474 19.084 15,8% 62.334 9.085 14,6% 701.584 55.529 7,9% 318.819 20.103 6,3% 420.144 10.658 2,5%<br />
51
Lebten 2002 7,1% (120.884) der Bewohner in Hamburg von Sozialhilfe/ Hilfe zum<br />
Lebensunterhalt, so war der Anteil an Sozialhilfeempfängern in den "armen" Stadtteilen<br />
Jenfeld (16,5%), Billbrook (16,3%), Kleiner Grasbrook mit Steinwerder (16,0%), Hausbruch<br />
(15,3%) und Billstedt (14,4%) mehr als doppelt so hoch.<br />
Dagegen liegt der Anteil an Sozialhilfeempfängern in sieben "reichen Stadtteilen" unter 1%:<br />
Wohldorf/ Ohlstedt (0,4%), Reitbrook (0,6%), Groß Flottbek (0,7%), Nienstedten (0,7%),<br />
Othmarschen (0,8%), Sasel (0,8%) und Wellingsbüttel (0,9%).<br />
Auffallend ist, dass es bis November 2004 innerhalb der Gruppe der Stadtteile mit dem<br />
höchsten Anteil an Sozialhilfeempfängern, aber auch innerhalb der Stadtteile mit dem<br />
niedrigsten Anteil zwar leichte Verschiebungen gibt, dass sie aber jeweils ihre<br />
"Spitzenplätze" behalten.<br />
Betrachtet man die räumliche Verteilung dieser Stadtteile, so fällt auf, dass im Bezirk Mitte 6<br />
von insgesamt 16 Stadtteilen zu der Gruppe mit den höchsten Anteilen an<br />
Sozialhilfeempfängern zu rechnen sind, aber keiner zu der Gruppe mit den niedrigsten<br />
Anteilen. Genau umgekehrt stellt sich die Situation in Altona dar: von 13 Stadtteilen lebt in 4<br />
Stadtteilen nur ein sehr geringer Anteil Sozialhilfeempfänger und kein Stadtteil gehört zu der<br />
Gruppe mit einem besonders hohen Anteil.<br />
Relativ ausgeglichen und mit einem insgesamt niedrigen Anteil an Sozialhilfeempfängern<br />
(5,1%) stellt sich die Situation im Bezirk Eimsbüttel dar. Hier schwankt der Anteil an<br />
Sozialhilfeempfängern in den Stadtteilen von 2,8% bis 7,7%.<br />
Betrachtet man den Anteil an Sozialhilfeempfängern unter dem Stichwort Infantilisierung<br />
von Armut und berücksichtigt man dabei nicht nur die Bezirks- und Stadtteilebene sondern<br />
auch die Quartiersebene anhand entsprechender Analysen für die Untersuchungsgebiete, so<br />
wird das Ausmaß der Kinderarmut auch in Hamburg deutlich. In dieser grundsätzlich sehr<br />
reichen Stadt leben 19,8% aller Kinder unter 6 Jahre und 15,8% aller Kinder zwischen 6 und<br />
14 Jahre von Sozialhilfe. Im Bezirk Mitte sind es bezogen auf die genannten Altersgruppen<br />
30,4% und 25,5%, in Altona 16,0% und 13,7% und im Bezirk Eimsbüttel 13,0% und 11,0%<br />
(vgl. Tabellen 1a und 1b).<br />
Auf Quartiersebene wird die Segregation von armen und benachteiligten Kindern besonders<br />
deutlich. In vier von sieben Quartieren (Wildacker: 35,0%, Hörgensweg: 33,7%,<br />
Wegenkamp: 33,3 % und Linse: 36,2%) in der Region III in Eimsbüttel leben mehr als 25%<br />
der Kinder unter 6 Jahren von Sozialhilfe, im Schanzenviertel in drei von zehn Quartieren<br />
(St. Pauli Schanzenstraße: 31,6%, Altona-Nord: 32,9% und Eimsbüttel Agathenstraße: 25,2<br />
%). Von den 6- bis 14-Jährigen leben mehr als 20% von Sozialhilfe in 5 Quartieren in der<br />
Region III und in 2 Quartieren im Schanzenviertel. Legt man die Armutsgrenze der EU<br />
zugrunde – 50% des bereinigten Durchschnittseinkommens, das entspricht etwa der<br />
Sozialhilfegrenze +10% – so verdoppelt sich der Anteil fast.<br />
An dieser Stelle sei eine Anmerkung erlaubt: Da die Regierenden dieser Stadt sich im<br />
Augenblick darüber einig sind, dass die Kosten für die Elbphilharmonie von 186 Millionen<br />
Euro aufzubringen seien, stellt sich die Frage, was sie – unter Berücksichtigung des<br />
Sozialstaatsgebots unserer Verfassung (Artikel 20 GG) und der oben dargestellten<br />
Auswirkungen von Kinderarmut – zur Verbesserung der Lebenslage und der<br />
Teilhabechancen armer und benachteiligter Kinder tun werden?<br />
Im Folgenden werden – bezogen auf die ausgewählten Gebiete – Angaben gemacht zur<br />
• Altersstruktur und zum Ausländeranteil<br />
• Haushalts- und Familienstruktur<br />
• Sozialstruktur<br />
• Wohnsituation.<br />
52
Jenfeld<br />
Billbrock<br />
Kl. Grasbrook mit Steinw erder<br />
Hausbruch<br />
Billstedt<br />
Veddel<br />
Wilhelmsburg<br />
St. Pauli<br />
Dulsberg<br />
Rothenburgsort<br />
Steilshoop<br />
Allermöhe<br />
Wohldorf/ Ohlstedt<br />
Reitbrook<br />
Gr. Flottbek<br />
Nienstedten<br />
Othmarschen<br />
Sasel<br />
Wellingsbüttel<br />
Neuengamme<br />
Bergstedt<br />
Blankenese<br />
Ochsenw erder<br />
Altengamme<br />
Bezirk Eimbüttel<br />
Bezirk Hamburg Nord<br />
Bezirk Wandsbek<br />
Bezirk Altona<br />
Bezirk Bergedorf<br />
Bezirk Harburg<br />
Bezirk Hamburg Mitte<br />
Hamburg insgesamt<br />
1 vgl. Tabelle 1<br />
Anteil der Empfänger und Empfängerinnen von Sozialhilfe<br />
in den "ärmsten" und "reichsten" Regionen<br />
im Jahr 2002 1<br />
0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 19% 20%<br />
0,4%<br />
0,6%<br />
0,7%<br />
0,7%<br />
0,8%<br />
0,8%<br />
0,9%<br />
1,0%<br />
1,1%<br />
1,2%<br />
1,2%<br />
1,4%<br />
5,1%<br />
5,1%<br />
6,2%<br />
6,3%<br />
7,1%<br />
7,1%<br />
9,2%<br />
11,6%<br />
11,5%<br />
11,0%<br />
10,8%<br />
12,6%<br />
12,2%<br />
13,3%<br />
13,2%<br />
14,4%<br />
15,3%<br />
16,5%<br />
16,3%<br />
16,0%<br />
53
54<br />
Anteil der Empfänger von Hilfen zum Lebensunterhalt an der Gesamtbevölkerung<br />
im Alter von 0 bis 6 Jahre - Region III Eimsbüttel, 2003 1<br />
Eidelstedt - Wildacker<br />
Eidelstedt - Hörgensw eg<br />
Eidelstedt -<br />
Remstückenkamp/Wiebischenkamp<br />
Eidelstedt - Astw eg<br />
Eidelstedt<br />
Stellingen - Wegenkamp<br />
Stellingen - Linse<br />
Stellingen - Spannskamp<br />
Stellingen<br />
Region III<br />
Bezirk Eimsbüttel<br />
Hamburg<br />
St. Pauli - Schulterblatt<br />
St. Pauli - Schanzenstraße<br />
St. Pauli - Lagerstraße<br />
Altona - Altstadt<br />
Altona - Nord<br />
Eimsbüttel - Doormannsweg<br />
Eimsbüttel - Waterloostraße<br />
Eimsbüttel - Fettstraße<br />
Eimsbüttel - Agathenstraße<br />
Sternschanze<br />
Schanzenviertel<br />
Bezirk Mitte<br />
Bezirk Eimsbüttel<br />
Bezirk Altona<br />
Hamburg<br />
0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0%<br />
Anteil der Empfänger von Hilfen zum Lebensunterhalt an der Gesamtbevölkerung<br />
im Alter von 0 bis 6 Jahre – Schanzenviertel, Karolinenviertel, 2003 2<br />
1 vgl. Tabelle 1a<br />
2 vgl. Tabelle 1b<br />
13,8%<br />
13,0%<br />
0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0%<br />
14,5%<br />
14,8%<br />
13,8%<br />
13,3%<br />
13,0%<br />
16,7%<br />
16,8%<br />
16,0%<br />
19,8%<br />
19,8%<br />
22,4%<br />
21,4%<br />
23,5%<br />
23,5%<br />
26,1%<br />
25,2%<br />
28,5%<br />
27,6%<br />
31,6%<br />
30,4%<br />
32,9%<br />
35,0%<br />
33,7%<br />
33,3%<br />
36,2%
Altersstruktur und Ausländeranteil<br />
Ende 2003 lebten in Hamburg 1.714.923 Menschen; von ihnen waren 274.376 (16,0%) unter<br />
18 Jahre; das sind 31.021 (1,8%) weniger als der Anteil der Bewohner über 65 Jahre (vgl.<br />
Anlage, Tabelle 2, 2a und 2b).<br />
Der Anteil der Kinder unter sechs Jahre beträgt 91.568 (5,3%). Im Bezirk Hamburg Nord<br />
beträgt die Quote sogar nur 4,5% und im Bezirk Eimsbüttel 4,8%. In fünf der zwölf "armen"<br />
Stadtteile liegt der Anteil der Kinder unter sechs Jahre um mehr als 2 Prozentpunkte über<br />
dem Durchschnitt der gesamten Stadt: Billbrook: 11,3%, Veddel: 10,2%, Kleiner Grasbrook<br />
und Steinwerder: 9,6%, Allermöhe: 9,4% und Wilhelmsburg: 7,7%. Der Durchschnittswert<br />
von 7,3% wird in keinem der "reichen" Stadtteile erreicht.<br />
In den beiden o. g. speziellen Untersuchungsgebieten liegt der Anteil der unter 6-Jährigen<br />
lediglich im Quartier St. Pauli-Schanzenstraße mit 8,3% über dem genannten Anteil von<br />
7,3%. Der Anteil der unter 6-Jährigen variiert in den ausgewählten Quartieren von 8,3% bis<br />
3,8%; in der Region III sind es im Durchschnitt 4,7%, im Schanzenviertel 5,2% und im<br />
Karolinenviertel 5,8%.<br />
Ein vergleichbares Bild zeigt sich in diesen Untersuchungsgebieten bei den jungen<br />
Menschen unter 18 Jahren: In der Region III sind es 15,0%, im Schanzenviertel 13,1% und<br />
im Karolinenviertel 14,3%. Sowohl in den "armen" als auch in den "reichen" Stadtteilen liegt<br />
der Anteil der unter 18-Jährigen überwiegend über dem Durchschnittswert von 16%.<br />
Ende 2003 hatten 1.452.391 (84,7%) Hamburger Bewohner die deutsche<br />
Staatsangehörigkeit, 262.532 (15,3%) waren nichtdeutscher Staatsangehörigkeit. In den<br />
"armen" Stadtteilen variiert der Ausländeranteil von Allermöhe mit einer Quote von 14,2% bis<br />
Billbrook mit einer Quote von 71,2% Ausländern, in den "reichen" Stadtteilen von<br />
Altengamme mit einem Anteil von 1,2% bis Blankenese mit einem Anteil an ausländischen<br />
Bewohnern von 11,7%. In den speziellen Untersuchungsgebieten liegt die Quote<br />
ausländischer Bewohner in der Region III bei 14,0%, im Schanzenviertel bei 24,5% und im<br />
Karolinenviertel bei 35,1%. In den einzelnen Quartieren variiert die Quote von 63,9% in St.<br />
Pauli-Lagerstraße bis 10,8% in Stellingen-Spannskamp.<br />
<strong>Die</strong> Ansicht, dass der Anteil von Kindern und Jugendlichen bei den ausländischen<br />
Mitbürgern besonders hoch sei, lässt sich durch das Zahlenmaterial nicht belegen: Der Anteil<br />
der nichtdeutschen Kinder unter sechs Jahren an allen nichtdeutschen Mitbürgern macht in<br />
Hamburg "nur" 4,1% aus und liegt damit um 1,5 Prozentpunkte niedriger als der Anteil der<br />
entsprechenden Altersgruppe deutscher Kinder (5,6%). Bei den unter 18-Jährigen übersteigt<br />
der Anteil nichtdeutscher junger Menschen mit 16,4% den Anteil der deutschen (15,9%)<br />
lediglich um 0,5 Prozentpunkte (vgl. Anlage, Tabelle 3a und 3b). In der Region III liegt die<br />
Quote der nichtdeutschen unter 6-Jährigen bei 4,4%, im Schanzenviertel bei 2,9% und im<br />
Karolinenviertel bei 3,1% der nichtdeutschen Bewohner insgesamt. Bei den unter 18-<br />
Jährigen sind es in der Region III 17,2%, im Schanzenviertel sind es "nur" 14,0% und im<br />
Karolinenviertel 14,6%.<br />
Haushalts- und Familienstruktur<br />
<strong>Die</strong> 1.714.923 Hamburger lebten in insgesamt 910.304 Haushalten. <strong>Die</strong> durchschnittliche<br />
Haushaltsgröße liegt bei 1,9 Personen. <strong>Die</strong>se niedrige Zahl korrespondiert mit der hohen<br />
Zahl an Ein-Personen-Haushalten: 47,9% aller Hamburger Haushalte. Hamburg Nord ist mit<br />
57,3% Ein-Personen-Haushalten der Bezirk mit der höchsten und Bergedorf mit 34,6% der<br />
mit der niedrigsten Quote (vgl. Anlage, Tabelle 4).<br />
Wilhelmsburg ist unter den ausgewählten "armen" Stadtteilen der mit der höchsten Quote an<br />
Ein-Personen-Haushalten (63,4%), Allermöhe der mit der niedrigsten (17,3%). Bei den<br />
55
"reichen" Stadtteilen variierte der Anteil an Ein-Personen-Haushalten von Groß-Flottbek mit<br />
44,7% bis Altengamme mit 21,3%.<br />
Berücksichtigt man den geringen Anteil an Familien mit Kindern in Hamburg – nur in 171.832<br />
(18,9%) der insgesamt 910.304 Haushalte leben Kinder –, stellt sich die Frage nach der<br />
Wertschätzung, die diesem "seltenen Gut" gesellschaftlich entgegen gebracht wird.<br />
Leben insgesamt nicht einmal in jedem fünften Hamburger Haushalt Kinder, so unterscheidet<br />
sich die Situation in Allermöhe mit 47,1% erheblich. <strong>Die</strong> hohe Quote ist sicherlich in<br />
Verbindung mit dem Wohnungsbau in diesem Gebiet zu sehen. In den "armen" Stadtteilen<br />
variiert die Quote der Haushalte mit Kindern von 32,4% in Hausbruch bis 13,5% in St. Pauli<br />
und in den "reichen" Stadtteilen von 30,0% in Altengamme bis 16,7% in Blankenese.<br />
Unter den Bezirken ist Hamburg Nord der mit dem geringsten Anteil an Haushalten mit<br />
Kindern (13,6%) und Bergedorf der mit dem höchsten Anteil (26,9%); das korrespondiert<br />
wohl mit der eher kleinstädtischen bis zum Teil ländlichen Struktur in diesem Bezirk.<br />
Differenziert man den Status der Familien mit Kindern, so zeigt sich, dass in Hamburg in<br />
116.172 (67,6%) der 171.832 Familien Ehepaare mit Kindern zusammen leben. In 45.746<br />
(26,6%) Familien leben Alleinerziehende mit Kindern zusammen und in 9.914 (5,8%) sind es<br />
Nichteheliche Lebensgemeinschaften mit Kindern.<br />
Da Einelternfamilien von allen Befragten als spezifische Risikogruppe benannt wurden, soll<br />
hier die Verteilung genauer betrachtet werden (vgl. Anlage, Tabellen 4.1, 4.1a und 4.1b):<br />
Ist der Anteil an Familien mit Kindern insgesamt mit 13,6% in Hamburg Nord der geringste<br />
von allen sieben Bezirken, so fällt auf, dass hier der Anteil an Einelternfamilien innerhalb der<br />
Gruppe "Familien mit Kindern" mit 31,3% der höchste ist. Ihm folgt Hamburg Mitte mit 29,9%;<br />
den niedrigsten Anteil weist der Bezirk Bergedorf auf (21,3%).<br />
In den "armen" Stadtteilen variiert der Anteil an Einelternfamilien von 16,9% in Allermöhe<br />
(hier liegt der Anteil an Ehepaaren mit Kindern mit 77,4% am höchsten von allen "armen"<br />
Stadtteilen) bis 37,3% in Dulsberg. Auffällig ist, dass in Billbrook die Quote der<br />
Einelternfamilien mit 24,9% relativ niedrig ist, dass dort aber 13,3% der Familien mit Kindern<br />
"Nichteheliche Lebensgemeinschaften mit Kindern" sind – das sind ca. 130% mehr als im<br />
Durchschnitt von Hamburg (5,8%).<br />
<strong>Die</strong> Situation in den "reichen" Stadtteilen weicht von der in den "armen" Stadtteilen erheblich<br />
ab: <strong>Die</strong> höchste Quote an Einelternfamilien von jeweils 20% lebt in Nienstedten und<br />
Othmarschen, die niedrigste mit 11,6% in Reitbrook. Auch der Anteil der Nichtehelichen<br />
Lebensgemeinschaften mit Kindern liegt in diesen Stadtteilen erheblich unter dem<br />
Hamburger Anteil. Am höchsten (4,7%) ist er in Reitbrook – das entspricht zwei Familien. In<br />
Nienstedten, Othmarschen und Blankenese haben jeweils 4,4% der Familien den Status der<br />
Nichtehelichen Lebensgemeinschaft mit Kindern.<br />
In der Region III leben in "nur" 27,2% aller Familien Kinder mit ihrem alleinerziehenden<br />
Elternteil zusammen – der Anteil der Einelternfamilien variiert in den einzelnen Quartieren<br />
aber erheblich: von 24,0% im Astweg bis 37,3% im Wegenkamp.<br />
Im Schanzenviertel beträgt der Anteil an Einelternfamilien 39,8% – er variiert von 19,4% in<br />
St. Pauli-Lagerstraße bis 44,4% in Altona-Altstadt. In sieben der zehn Quartiere des<br />
Schanzenviertels beträgt der Anteil an Einelternfamilien mehr als 35,0%. Dem entspricht<br />
auch der Anteil an Einelternfamilien im Karolinenviertel mit 39,9%.<br />
<strong>Die</strong> hohe Quote Einelternfamilien in diesen als benachteiligt zu bezeichnenden Gebieten<br />
korrespondiert mit ihrer Sozialstruktur.<br />
56
Familien mit Kindern nach Familienstatus, 31.12.1999 in "armen" und "reichen" Stadtteilen 1<br />
68,10% 27,20% 4,70%<br />
61,80% 24,90% 13,30%<br />
71,10% 22,40% 6,60%<br />
77,30% 18,40% 4,30%<br />
Jenfeld<br />
Billbrook<br />
75,40% 21,20% 3,40%<br />
67,70% 27,00% 5,30%<br />
70,90% 23,90% 5,20%<br />
54,20% 36,30% 9,50%<br />
64,30% 29,50% 6,20%<br />
55,40% 37,30% 7,20%<br />
66,60% 27,70% 5,80%<br />
77,40% 16,90% 5,80%<br />
Kleiner Grasbrook mit Steinw erder<br />
Hausbruch<br />
Billstedt<br />
Veddel<br />
Wilhelmsburg<br />
St. Pauli<br />
Dulsberg<br />
Rothenburgsort<br />
Steilshoop<br />
Allermöhe<br />
78,60% 18,50% 2,80%<br />
83,70% 11,60% 4,70%<br />
Wohldorf-Ohlstedt<br />
Reitbrook<br />
76,60% 19,90% 3,50%<br />
75,60% 20,00% 4,40%<br />
Groß Flottbek<br />
Nienstedten<br />
82,60% 15,10% 2,40%<br />
75,60% 20,00% 4,40%<br />
Othmarschen<br />
Sasel<br />
77,30% 19,60% 3,10%<br />
80,10% 16,20% 3,70%<br />
Wellingsbüttel<br />
Neuengamme<br />
77,20% 19,10% 3,70%<br />
77,50% 18,10% 4,40%<br />
Bergstedt<br />
Blankenese<br />
82,30% 15,40% 2,30%<br />
81,60% 15,60% 2,70%<br />
Ochsenw erder<br />
Altengamme<br />
65,30% 28,30% 6,40%<br />
61,60% 31,30% 7,10%<br />
70,60% 24,50% 4,90%<br />
66,20% 27,90% 5,90%<br />
73,70% 21,30% 5,00%<br />
72,30% 22,70% 5,00%<br />
63,70% 29,90% 6,50%<br />
Bezirk Eimsbüttel<br />
Bezirk Hamburg-Nord<br />
Bezirk Wandsbek<br />
Bezirk Altona<br />
Bezirk Bergedorf<br />
Bezirk Harburg<br />
Bezirk Hamburg-Mitte<br />
67,60% 26,60% 5,80%<br />
Hamburg<br />
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%<br />
Ehepaare mit Kindern Alleinerziehende mit Kindern Nichteheliche Lebensgemeinschaften mit Kindern<br />
1 vgl. Tabelle 4.1<br />
57
Familien mit Kindern nach Familienstatus, 31.12.1999 – Region III Eimsbüttel 1<br />
62,20% 32,70% 5,10%<br />
Eidelstedt – Wildacker<br />
65,10% 29,10% 5,80%<br />
Eidelstedt – Hörgensw eg<br />
63,00% 33,30% 3,70%<br />
Eidelstedt – Remstückenkamp/ Wiebischenkamp<br />
71,20% 24,00% 4,80%<br />
Eidelstedt – Astw eg<br />
69,70% 25,80% 4,50%<br />
Eidelstedt<br />
59,70% 37,30% 3,00%<br />
Stellingen – Wegenkamp<br />
62,90% 30,00% 7,10%<br />
Stellingen – Linse<br />
70,70% 24,10% 5,30%<br />
Stellingen – Spannskamp<br />
63,80% 29,60% 6,60%<br />
Stellingen<br />
67,50% 27,20% 5,20%<br />
Region III<br />
65,30% 28,30% 6,40%<br />
Bezirk Eimsbüttel<br />
67,60% 26,60% 5,80%<br />
Hamburg<br />
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%<br />
Ehepaare mit Kindern Alleinerziehende mit Kindern Nichteheliche Lebensgemeinschaften mit Kindern<br />
1 vgl. Tabelle 4.1a<br />
58
Familien mit Kindern nach Familienstatus, 31.12.1991 – Schanzenviertel, Karolinenviertel 1<br />
49,50% 38,90% 11,50%<br />
Schulterblatt<br />
51,10% 40,60% 8,30%<br />
Schanzenstraße<br />
77,40% 19,40% 3,20%<br />
Lagerstraße<br />
46,50% 44,40% 9,00%<br />
Eifflerstraße<br />
58,90% 32,30% 8,90%<br />
Langefelder Straße<br />
44,60% 43,10% 12,30%<br />
Doormannsw eg<br />
41,30% 48,40% 10,30%<br />
Waterloostraße<br />
55,70% 37,30% 7,10%<br />
Fettstraße<br />
52,00% 36,90% 11,10%<br />
Agathenstraße<br />
60,00% 20,00% 20,00%<br />
Sternschanze<br />
50,30% 39,80% 9,90%<br />
Schanzenviertel<br />
51,60% 39,30% 9,10%<br />
Karolinenviertel<br />
63,70% 29,90% 6,50%<br />
Bezirk Mitte<br />
65,30% 28,30% 6,40%<br />
Bezirk Eimsbüttel<br />
66,20% 27,90% 5,90%<br />
Bezirk Altona<br />
67,60% 26,60% 5,80%<br />
Hamburg<br />
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%<br />
Ehepaare mit Kindern Alleinerziehende mit Kindern Nichteheliche Lebensgemeinschaften mit Kindern<br />
1 vgl. Tabelle 4.1b<br />
59
Sozialstruktur<br />
Wurde zu Beginn dieses Punktes eine Unterteilung in "arme" und "reiche" Stadtteile anhand<br />
ihres extrem hohen oder extrem niedrigen Anteils an Sozialhilfeempfängern gemacht, so<br />
werden hier die Leistungsempfänger nach dem BSHG und dem AsylblG zusammengefasst<br />
(vgl. Anlage, Tabellen 5, 5a und 5b).<br />
Im dritten Quartal 2002 erhielten 144.700 (8,4%) Hamburger Leistungen nach dem BSHG<br />
oder nach dem AsylblG. In allen "armen" Stadtteilen liegt der Anteil der Leistungsempfänger<br />
um mindestens 50% und in vier von zwölf um mehr als 100% höher als im Hamburger<br />
Durchschnitt von 8,4%. Einen "Ausreißer" bildet der Stadtteil Billbrook (79,8%) – ebenso wie<br />
Blankenese bei den reichen Stadtteilen (3,2%, obwohl der Anteil an Sozialhilfeempfängern<br />
mit 1,2% angegeben war – vgl. Tabelle 1). <strong>Die</strong>s korrespondiert mit relativ hohen Anteilen<br />
nichtdeutscher Mitbürger, die offensichtlich Leistungen nach dem AsylblG beziehen.<br />
Ganz anders gestaltet sich die Situation in den "reichen" Stadtteilen: Bei Ausgrenzung des<br />
Stadtteils Blankenese (s. o.) variiert der Anteil an Leistungsempfängern nach dem BSHG<br />
und dem AsylblG von jeweils 1,3% in den Stadtteilen Wellingsbüttel, Neuengamme,<br />
Altengamme und Bergstedt bis 0,5% in Wohldorf/ Ohlstedt.<br />
In der Region III liegt die Quote der Leistungsempfänger nach dem BSHG und AsylblG mit<br />
9,3% um gut 50% höher als im Bezirk Eimsbüttel (6,0%). In vier der sieben Quartiere<br />
(Wildacker: 19,1%, Reemstückenkamp/ Wiebischenkamp: 14,2%, Astweg: 12,6% und<br />
Wegenkamp: 16,2%) liegt die Quote um mindestens 50% höher als der Hamburger<br />
Durchschnitt mit 8,4%.<br />
Im Schanzenviertel liegt der Anteil der Leistungsempfänger bei 8,8% und entspricht damit in<br />
etwa dem Hamburger Durchschnitt. In zwei der zehn Quartiere (St. Pauli-Lagerstraße: 14,6%<br />
und Altona-Nord: 14,1%) liegt die Quote um mehr als 50% höher als der Hamburger<br />
Durchschnitt. Entsprechend hoch liegt auch der Anteil der Leistungsempfänger im<br />
Karolinenviertel mit 12,8% und im Bezirk Mitte mit 13,2%. In Altona, dem dritten Bezirk, auf<br />
den sich das Schanzenviertel erstreckt, beträgt der Anteil der Leistungsempfänger 7,8%.<br />
Ähnlich wie in anderen Bundesländern ist der Anteil der Arbeitslosen durch das Inkrafttreten<br />
von Hartz IV/ dem Arbeitslosengeld 2 zum 1.1.2005 gestiegen. Ende Mai 2005 waren gut<br />
101.800 Erwerbspersonen – das entspricht einer Quote von 11,7% – in Hamburg arbeitslos.<br />
<strong>Die</strong> letzten öffentlich zugänglichen Daten – die hier referiert werden – beziehen sich auf den<br />
Zeitpunkt März 2004. Damals waren 86.397 Erwerbspersonen arbeitslos; das entspricht<br />
einem Anteil von 7,3% an der Bevölkerung im Alter 15 bis unter 65 Jahre. Auch hier variiert<br />
die Quote sowohl zwischen den Bezirken als auch zwischen den Stadtteilen und Quartieren<br />
erheblich.<br />
Der Anteil der Arbeitslosen in den Bezirken liegt zwischen 6,2% in Wandsbek und 9,3% in<br />
Hamburg-Mitte. In den "armen" Stadtteilen liegt die Quote zwischen 15,4% in Kleiner<br />
Grasbrook mit Steinwerder und 6,0% in Billbrook – in acht der zwölf Stadtteile liegt die Quote<br />
über 10%.<br />
Wohldorf/ Ohlstedt hat unter den "reichen" Stadtteilen die niedrigste Quote Arbeitsloser. Mit<br />
Ausnahme von Reitbrook – hier lebten zu dem Zeitpunkt 14 Arbeitslose, das entspricht<br />
einem Anteil von 4,2% – machte die Quote der Arbeitslosen in allen "reichen" Stadtteilen<br />
weniger als 50% (3,6% und weniger) des Anteils in Hamburg (7,3%) aus.<br />
Im Schanzenviertel liegt der Anteil der Arbeitslosen bei 8,9%, im Karolinenviertel bei 10,1%.<br />
In der Region III beträgt die Quote 8,3%; sie variiert in den Quartieren von 12,8% im<br />
Reemstückenkamp/ Wiebischenkamp bis 6,6% im Spannskamp.<br />
60
Im Quartier Reemstückenkamp ist mit 8% auch der Anteil der jüngeren Arbeitslosen unter 25<br />
Jahre an der Bevölkerung im Alter von 15 bis 25 Jahre am höchsten von allen Quartieren der<br />
Region III, in der der Anteil 4,6% beträgt. Der Hamburger Durchschnittswert liegt bei einer<br />
Jugendarbeitslosigkeit von 4,1%, der Durchschnittswert im Bezirk Eimsbüttel bei 3,4%.<br />
Damit ist Eimsbüttel der Bezirk mit der niedrigsten Jugendarbeitslosigkeit; der Bezirk mit der<br />
höchsten Quote (4,8%) ist Harburg, gefolgt von Hamburg Mitte mit 4,7%.<br />
Im Schanzenviertel liegt die Jugendarbeitslosigkeit bei 3,7% und variiert in den einzelnen<br />
Quartieren zwischen 5,4% in St. Pauli-Schulterblatt und 1,4% in Eimsbüttel-Waterloostraße.<br />
Im Karolinenviertel beträgt die Quote der arbeitslosen jungen Menschen 5,2%.<br />
In den "armen" Stadtteilen liegt die Arbeitslosigkeit junger Menschen in den Stadtteilen<br />
Veddel (6,5%), Kleiner Grasbrook mit Steinwerder (6,1%) und Wilhelmsburg (6,0%) jeweils<br />
um ca. 50% über der Hamburger Quote von 4,1%.<br />
In den "reichen" Stadtteilen variiert die Jugendarbeitslosigkeit von 3,8% in Neuengamme bis<br />
0,6% in Groß-Flottbek – in drei der zwölf "reichen" Stadtteile liegt der Anteil der jüngeren<br />
Arbeitslosen bei weniger als 1% und entspricht damit weniger als 25% der Hamburger<br />
Quote.<br />
Wohnsituation<br />
<strong>Die</strong> Frage wo und wie man wohnt und wie das Wohnumfeld gestaltet ist, hat für viele<br />
Menschen – insbesondere für Familien – einen hohen Stellenwert. Wenn hier Aussagen zur<br />
Wohnsituation gemacht werden, so beziehen sie sich auf die Einwohnerdichte, auf die Art<br />
der Wohngebäude, auf die Wohnungsgröße und die Wohnfläche je Einwohner in den<br />
"armen" und "reichen" Stadtteilen (vgl. Anlage, Tabelle 6).<br />
<strong>Die</strong> Einwohnerdichte (Einwohner je ha=10.000m²) beträgt im Hamburger Durchschnitt 27 – in<br />
den Bezirken Eimsbüttel und Hamburg Nord liegt sie mit 58 um gut 100% höher. In<br />
Bergedorf beträgt sie 8 – dadurch wird der o. g. kleinstädtische und zum Teil ländliche<br />
Charakter dieses Bezirks verdeutlicht.<br />
In den "armen" Stadtteilen liegt die Einwohnerdichte zwischen 192 in Dulsberg und 4 in<br />
Billbrook, einem Stadtteil mit sehr hohem Industriebesatz und Hafenanlagen. Neben<br />
Dulsberg ist die Einwohnerdichte in St. Pauli (151), Steilshoop (94) und Jenfeld (57)<br />
besonders hoch.<br />
In den "reichen" Stadtteilen variiert die Einwohnerdichte von 56 in Groß-Flottbek bis 1 in<br />
Altengamme und Reitbrook, zwei eher ländlich strukturierten Gebieten. Neben Groß-Flottbek<br />
wird nur noch in Sasel mit 29 die Einwohnerdichte im Hamburger Durchschnitt überschritten.<br />
In Hamburg gibt es 2002 insgesamt 866.646 Wohnungen in Wohn- und<br />
Wohnnebengebäuden; 20,6% dieser Wohnungen befinden sich in Ein- oder<br />
Zweifamilienhäusern. In den stark innerstädtisch geprägten Bezirken liegt die Quote in<br />
Hamburg Mitte mit 9%, Hamburg Nord mit 9,9% und Eimsbüttel mit 16,2% unter dem<br />
Hamburger Durchschnitt.<br />
In den "armen" Stadtteilen variiert der Anteil von Wohnungen in Ein- und<br />
Zweifamilienhäusern von 0,6% in Dulsberg bis Billbrook mit 36,8%. In neun der zwölf<br />
"armen" Stadtteile liegt der Anteil der Wohnungen in Ein- und Zweifamilienhäuser unter dem<br />
Hamburger Durchschnittswert von 20,6%.<br />
Ganz anders gestaltet sich die Situation in den "reichen" Stadtteilen; die Quote liegt<br />
zwischen 39,2% in Othmarschen und 79,2% in Altengamme. In fünf der zwölf Stadtteile liegt<br />
die Quote über 70%, in acht über 50%.<br />
61
<strong>Die</strong>se Form der Privilegierung spiegelt sich auch bei der durchschnittlichen Wohnungsgröße<br />
in diesen Stadtteilen wider: sie liegt zwischen 119,7m² in Wohldorf/ Ohlstedt und 93,2m² in<br />
Bergstedt. In sieben der zwölf Stadtteile liegt die durchschnittliche Wohnungsgröße über<br />
100m².<br />
Von dieser Situation stark abweichend zeigt sich die durchschnittliche Wohnungsgröße in<br />
den "armen" Stadtteilen. Sie variiert zwischen 52,2m² in Dulsberg und 86,3m² in Allermöhe –<br />
in neun der zwölf Stadtteile liegt die Wohnungsgröße unter dem Hamburger Durchschnitt von<br />
71,2m².<br />
<strong>Die</strong> durchschnittliche Wohnungsgröße und insbesondere die Wohnfläche je Einwohner<br />
korrespondiert mit der Haushaltsstruktur. <strong>Die</strong>s wird im Bezirk Hamburg Nord besonders<br />
deutlich. <strong>Die</strong> durchschnittliche Wohnungsgröße beträgt hier "nur" 64,8m² und liegt damit um<br />
6,4m² unter dem Hamburger Durchschnitt (71,2m²). Berücksichtigt man aber, dass in diesem<br />
Bezirk 57,3% aller Haushalte Ein-Personen-Haushalte sind und nur in 13,6% der Haushalte<br />
Kinder leben (vgl. Anlage, Tabelle 4), verändert sich das Bild. So verwundert es dann auch<br />
kaum, dass Hamburg Nord mit 38,4m² der Bezirk mit der größten Wohnfläche je Einwohner<br />
ist; die durchschnittliche Wohnfläche je Einwohner beträgt in Hamburg 36,1m². <strong>Die</strong>se<br />
durchschnittliche Wohnfläche wird in keinem der "armen" Stadtteile erreicht; die geringste<br />
Wohnfläche von nur 17,0m² steht jedem Bewohner von Billbrook zur Verfügung.<br />
Konträr gestaltet sich die Situation in den "reichen" Stadtteilen; in allen liegt die<br />
durchschnittliche Wohnfläche je Einwohner über dem Hamburger Durchschnitt von 36,1m².<br />
Stehen den einzelnen Bewohnern von Altengamme und Neuengamme "nur" 39,6m² bzw.<br />
39,4m² zur Verfügung, so sind es z. B. in Wohldof/ Ohlstedt 54,4m² und in Nienstedten<br />
53,4m².<br />
Jenfeld<br />
Billbrook<br />
Kleiner Grasbrook mit Steinw erder<br />
Hausbruch<br />
Billstedt<br />
Veddel<br />
Wilhelmsburg<br />
St. Pauli<br />
Dulsberg<br />
Rothenburgsort<br />
Steilshoop<br />
Allermöhe<br />
1 vgl. Tabelle 6<br />
62<br />
Wohldorf-Ohlstedt<br />
Reitbrook<br />
Groß Flottbek<br />
Nienstedten<br />
Othmarschen<br />
Sasel<br />
Wellingsbüttel<br />
Neuengamme<br />
Bergstedt<br />
Blankenese<br />
Ochsenw erder<br />
Altengamme<br />
Bezirk Eimsbüttel<br />
Bezirk Hamburg-Nord<br />
Bezirk Wandsbek<br />
Bezirk Altona<br />
Bezirk Bergedorf<br />
Bezirk Harburg<br />
Bezirk Hamburg-Mitte<br />
Hamburg gesamt<br />
Wohnfläche je Einwohner in "armen" und "reichen" Stadtteilen 1<br />
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60<br />
17,0<br />
28,9<br />
25,7<br />
32,7<br />
30,4<br />
26,8<br />
28,5<br />
31,1<br />
31,9<br />
31,7<br />
32,3<br />
26,1<br />
37,9<br />
38,4<br />
37,3<br />
37,2<br />
34,7<br />
32,3<br />
31,7<br />
36,1<br />
39,4<br />
40,0<br />
41,0<br />
39,6<br />
42,6<br />
43,8<br />
44,7<br />
54,4<br />
53,4<br />
52,2<br />
51,6<br />
51,8
Räumliche Verteilung von Risikogruppen – eine Zusammenfassung<br />
Wurde die Höhe des Anteils an Sozialhilfeempfängern als Kriterium zur Benennung "armer"<br />
und "reicher" Stadtteile gewählt, so weist die Analyse der Verteilung weiterer eher<br />
benachteiligter bzw. privilegierter Gruppen auf die Ausdifferenzierung relativ homogener<br />
Stadtteilstrukturen hin, Es findet eine Kumulation sogenannter Risikogruppen, aber auch von<br />
privilegierten Gruppen in segregierten Stadtteilen statt. <strong>Die</strong> Wohn- und Wohnumfeldsituation<br />
korrespondiert mit der Bewohnerstruktur in den jeweiligen Gebieten. Durch die folgende<br />
zusammenfassende Darstellung soll das noch einmal verdeutlicht werden.<br />
• Der Anteil der Sozialhilfeempfänger beträgt 2002 in Hamburg 7,1%.<br />
In den "armen" Stadtteilen variiert er von 11,0% bis 16,5%, in den "reichen" Stadtteilen<br />
von 0,4% bis 1,4% (vgl. Tabelle 1)<br />
• Der Anteil der Leistungsempfänger nach dem BSHG und AsylblG beträgt 2002 in<br />
Hamburg 8,4%. In den "armen" Stadtteilen variiert er von 12,7% bis 20,2%, in den<br />
"reichen" Stadtteilen von 0,5% bis 1,7% (ohne Billbrook und Blankenese, s. o. – vgl.<br />
Tabelle 5).<br />
• Der Anteil der Arbeitslosen beträgt im März 2004 in Hamburg 7,3%.<br />
In den "armen" Stadtteilen variiert er von 7,8% bis 15,4%, in den "reichen" Stadtteilen<br />
von 2,2% bis 4,2% (vgl. Tabelle 5).<br />
• Der Ausländeranteil beträgt in Hamburg 15,3%.<br />
In den "armen" Stadtteilen variiert er von 14,2% bis 71,2%, in den "reichen" Stadtteilen<br />
von 1,4% bis 11,7% (vgl. Tabelle 2).<br />
• Der Anteil der Einelternfamilien beträgt 1999 in Hamburg 26,6%.<br />
Er variiert in den "armen" Stadtteilen von 16,9% bis 37,3%, in den "reichen" Stadtteilen<br />
von 11,6% bis 20% (vgl. Tabelle 4.1).<br />
• <strong>Die</strong> Einwohnerdichte beträgt in Hamburg 2002 27 Einwohner je ha.<br />
In den "armen" Stadtteilen variiert die Zahl von 4 bis 192, in den "reichen" Stadtteilen von<br />
1 bis 56.<br />
Eine niedrige Einwohnerzahl steht in den "armen" Stadtteilen in der Regel mit<br />
Verkehrwegen, Industrie- und Hafengelände in Verbindung, in den "reichen" Stadtteilen<br />
mit großen Hausgrundstücken, Parks und Naherholungsgebieten.<br />
• 20,6% der Wohnungen in Hamburg befinden sich 2002 in Ein- und Zweifamilienhäusern.<br />
In den "armen" Stadtteilen variiert der Anteil von 0,6% bis 36,8%, in den "reichen"<br />
Stadtteilen von 41,9% bis 79,2%.<br />
• <strong>Die</strong> durchschnittliche Wohnungsgröße liegt 2002 in Hamburg bei 71,2m².<br />
In den "armen" Stadtteilen variiert sie von 52,2m² bis 86,3m², in den "reichen" Stadtteilen<br />
von 93,2m² bis 119,7m².<br />
• <strong>Die</strong> durchschnittliche Wohnfläche je Einwohner beträgt 2002 in Hamburg 36,1m².<br />
In den "armen" Stadtteilen variiert sie von 17,0m² bis 32,3m², in den "reichen" Stadtteilen<br />
von 39,6m² bis 54,4m².<br />
<strong>Die</strong> "Verteilung" von Angehörigen verschiedener Risikogruppen auf ausgewählte<br />
Stadtgebiete bestätigt die am Anfang aufgestellte These:<br />
<strong>Die</strong> Verteilung von Armut und Reichtum in Stadtgebieten ist sehr<br />
ungleichmäßig. Aufgrund von Segregationsprozessen bilden sich<br />
Regionen mit positiv bewerteten Faktoren und steigendem Wohlstand<br />
und andererseits Regionen mit negativ bewerteten, benachteiligend<br />
wirkenden Faktoren.<br />
Experten der unterschiedlichen Funktionsbereiche sollten die Auswirkungen des Wohn-/<br />
Wohnumfelds auf die Lebenswelt von benachteiligten Kindern bewusst sein:<br />
63
Bevölkerungs-, Einkommens-, Bildungs- und Beschäftigungsstrukturen, Religion und Ethnien<br />
der Menschen in einem sozialen Raum beeinflussen die Entwicklung spezifischer Milieus.<br />
Kinder und Jugendliche bauen zu den Sozialräumen in denen sie leben und zu den sich<br />
darin entwickelnden Milieus ganz besondere Beziehungen auf. <strong>Die</strong> Sozialräume werden<br />
Teile ihrer Lebenswelt und Grundlage für ihre Identitätsentwicklung. Sozialräumliche<br />
Erfahrungen beeinflussen ihre Handlungsspielräume und ihre Perspektiven und begünstigen<br />
oder behindern ihre Entwicklungschancen.<br />
64
Exkurs: Wohn- und Wohnumfeldproblematik als sichtbare Form der Ausgrenzung<br />
<strong>Die</strong> Herausbildung von Quartieren und Stadtteilen, die in ihrer Bevölkerungsstruktur relativ<br />
homogen sind, wurde schon im Rahmen der verschiedenen Untersuchungen in dem o. g.<br />
HzE-Projekt sichtbar. Beschränkten sich damals die Erkenntnisse auf die Situation in der<br />
Region III in Eimsbüttel, so weisen die in Punkt 3.3 aufgeführten Daten auf ihre Relevanz für<br />
Hamburg insgesamt hin.<br />
Wenn im Grundgesetz auch kein Recht auf Wohnung verankert ist, so ist sie doch<br />
Bestandteil eines Lebens, das der Würde des Menschen entspricht. Wohnungen sind<br />
bedeutsam zur Unterstützung und zum Schutz der Entfaltung der Persönlichkeit. Sie sind<br />
"Heimstätten" der Familien und erfordern deshalb auch einen besonderen sozialen Schutz.<br />
"Ausreichender und bezahlbarer Wohnraum ist wichtig für die Menschen, erfüllt ein<br />
elementares Bedürfnis und bestimmt wesentlich ihre Lebensqualität." 1<br />
<strong>Die</strong> Bundesregierung weist in ihrem zweiten Bericht zu Lebenslagen in Deutschland darauf<br />
hin, dass die Versorgung mit Wohnraum insgesamt einen guten bis sehr guten Standard<br />
erreicht hat. "Regionale Unterschiede sind ... zum anderen auf angespanntere<br />
Wohnungsmärkte in einigen Wachstumsagglomerationen ... zurückzuführen. Allerdings gibt<br />
es auch unter diesen günstigen Rahmenbedingungen Haushalte, die Schwierigkeiten haben,<br />
sich aus eigener Kraft am allgemeinen Wohnungsmarkt angemessen mit Wohnraum zu<br />
versorgen." 2<br />
"Bei mancherorts auftretender sozialräumlicher Konzentration von Arbeitslosigkeit, Armut,<br />
Hilfsbedürftigkeit und Verwahrlosung des öffentlichen Raums sind vor allem in Großstädten<br />
Problemviertel entstanden. ... Besserverdienende und andere sozial stabile Gruppen mit<br />
sicherem Einkommen zogen weg – geblieben sind jene, die sich den Umzug in eine bessere<br />
Gegend aus finanziellen Gründen ... nicht leisten können. <strong>Die</strong> soziale Mischung im Quartier<br />
ging verloren.<br />
<strong>Die</strong>se Trends führten zu sozialen Problemlagen, die sich jedoch nicht gleichmäßig über das<br />
Stadtgebiet verteilen. Es sind soziale Brennpunkte entstanden, mit deren Zunahme zu<br />
rechnen ist. In den benachteiligten Großstadtquartieren nahmen Aggression, Gewalttätigkeit<br />
und Vandalismus zu, zugleich nahm die Bereitschaft, am demokratischen<br />
Willensbildungsprozess mitzuwirken, ab." 3<br />
Aufgrund der entstandenen räumlichen Polarisierung von Problemagglomerationen in<br />
Quartieren und Stadtteilen resümiert die Bundesregierung im zweiten Armutsbericht: "Es<br />
stellt sich dadurch verstärkt die Herausforderung, integrierte Ansätze für eine Verbesserung<br />
der Lebenssituationen der Betroffenen und ihres Lebensumfeldes zu entwickeln."<br />
Im Folgenden werden Aussagen der Experten zur räumlichen Segregation in Hamburg<br />
dargestellt und anschließend die Ergebnisse einer Sozialraumanalyse in dem o. g. Projekt<br />
und der Befragung zur Lebenslage und Lebenswelt der Betroffenen im Rahmen dieser<br />
<strong>Studie</strong> und während der Projektarbeit aufgezeigt.<br />
<strong>Die</strong> Versorgung mit Sozialwohnungen und die Relevanz der Aufhebung von Bindungen<br />
schließen diesen Exkurs ab.<br />
Räumliche Segregation<br />
Im Zusammenhang mit der Frage zur Lebenslage und Lebenswelt armer und benachteiligter<br />
Kinder und Jugendlicher wurde sowohl in den meisten Interviews als auch in den<br />
1 Lebenslagen in Deutschland, 2001, a.a.O., S. 159<br />
2 Lebenslagen in Deutschland, 2005, a.a.O., S. 104<br />
3 Lebenslagen in Deutschland, 2001, a.a.O., S. 170<br />
66
Gruppendiskussionen auf die räumliche Segregation benachteiligter Familien und deren<br />
Auswirkungen auf die jungen Menschen hingewiesen.<br />
<strong>Die</strong> räumliche Segregation wird als Folge von Armut gesehen – "<strong>ganze</strong> Stadteile sind<br />
armutsgeprägt". Kinder erhalten in solchen Milieus wenig Anregungen, "sich pro Soziales<br />
oder pro Bildung oder pro Kommunikation zu verhalten". <strong>Die</strong> Adressen haben auch vielfach<br />
"stigmatisierende Effekte in der Schule, bei den Ausbildungs- und Arbeitsstellen. ... In diesen<br />
Quartieren wird auch das Milieu immer dürftiger."<br />
Es wird darauf hingewiesen, dass sich sogenannte "Soziale Brennpunkte" entwickelt haben,<br />
"wobei derzeit eine kumulative Abwärtsentwicklung stattfindet, verbunden mit einer<br />
dauerhaften Marginalisierung der Bewohner. So heißt es z. B. in einem Gutachten der<br />
THHH 1 aus dem Jahr 2002 über den Stadtteil Wilhelmsburg: 'In den statistisch auffälligen<br />
Quartieren konzentrieren sich tatsächlich die Verlierer des wirtschaftlichen Strukturwandels.<br />
Dort zählen Schulden und Alkohol zu den zentralen Querschnittsthemen'."<br />
Es wird konstatiert, dass der überwiegende Teil der benachteiligten Wohngebiete mit dem<br />
Bau von Großsiedlungen der sechziger und siebziger Jahre korrespondiert, in denen<br />
überwiegend – oder fast ausschließlich – Sozialwohnungen des 1. Förderungsweges gebaut<br />
wurden. So wichtig der Bau von Sozialwohnungen war, ist und auch bleiben wird, so hat<br />
doch die Konzentration – in der Regel von Hunderten z. T. auch Tausenden – von<br />
Sozialwohnungen in einzelnen Quartieren problemverursachende Wirkungen. "Wir haben ja<br />
ein Problem mit unseren Gettos... . Das ist ja nicht vom Himmel gefallen, sondern durch<br />
aktive Wohnungspolitik so gestaltet worden, dass wir diejenigen, die es besonders schwer<br />
haben, in den Großsiedlungen oder in Altstadtkernen haben. ... Alle, die dort rauskonnten –<br />
aufgrund ihrer sozioökonomischen Situation – haben versucht, dort weg zu kommen. <strong>Die</strong><br />
nachgezogen sind, sind die, die es sich nicht anders leisten können, .... es sind vor allem<br />
Familien mit Kindern, Migranten mit Kindern und Einelternfamilien, die häufig von Sozialhilfe<br />
leben."<br />
Altstadtsanierungen führen immer wieder zu Veränderungen, auch wenn der Erhalt der<br />
Struktur des Sanierungsgebietes als formales Ziel definiert wird. Das zeigt sich deutlich in St.<br />
Georg und beginnt auch im Schanzenviertel zu wirken. Kinder und Jugendliche, die<br />
regelmäßige Besucher von Einrichtungen waren, "verschwinden". "<strong>Die</strong> [Familien] haben z. T.<br />
30, 40 Jahre in der selben Wohnung gelebt, d. h. sie hatten über die Wohnung auch ihre<br />
sozialen Kontakte organisiert – sei es auf der Ebene der Hausgemeinschaft, sei es ... auf der<br />
Ebene der Freunde und Bekannten. <strong>Die</strong> mussten dann raus ..., weil sie sich nach der<br />
Sanierung die Wohnung ... nicht mehr leisten konnten." Es wurde darauf hingewiesen, dass<br />
man mit großer Sicherheit davon ausgehen kann, dass viele "umgesiedelt" wurden.<br />
Schwierigkeiten bei der Wohnraumversorgung beruhen vielfach auf finanziellen Problemen,<br />
aber z. T. auch auf dem ethnischen Hintergrund der Wohnungssuchenden. "<strong>Die</strong> Problematik<br />
rührt daher, dass viele von Vermietern nicht genommen werden. Besondere Ethnien wie<br />
Roma und Schwarzafrikaner sind besonders betroffen."<br />
Mietschulden – häufig in Verbindung mit einer allgemeinen Verschuldung – sind vielfach<br />
Ursache dafür, dass Familien in "belastete" Quartiere ziehen müssen. Das Umfeld und die<br />
Nachbarschaft werden dann oft als belastend empfunden. <strong>Die</strong> Wohnung, aber ebenso das<br />
Umfeld – sowohl von der Optik als auch von der Zuschreibung her – führen zu Problemen<br />
und Ausgrenzungen. "Es bildet sich eine bestimmte Art des Umgangs und des<br />
Zusammenlebens und es ist schwer, sich davon abzuheben."<br />
Für die sieben Quartiere der spezifischen Projektregionen in den Stadtteilen Eidelstedt und<br />
Stellingen wurden detaillierte Sozialraumanalysen erstellt. Da die Situation in den Quartieren<br />
1 Technische Hochschule Hamburg-Harburg<br />
67
vergleichbar ist mit der in den anderen Großraumsiedlungen, werden die<br />
Untersuchungsergebnisse hier exemplarisch dargestellt.<br />
Wohn- und Wohnumfeldsituation<br />
<strong>Die</strong> Wohn- und Wohnumfeldsituation / der Sozialraum ist besonders bedeutsam für<br />
Teilhabechancen und die Frage der Integration versus Ausgrenzung von Menschen. Ihre<br />
Handlungsspielräume und deren Grenzen resultieren primär aus<br />
• der Ressourcenausstattung der Bewohner (Einkommen, Bildung, soziale Netzwerke,<br />
soziale Integration etc.)<br />
• den kollektiven Rahmenbedingungen (z. B. Ausstattung des Sozialraums, der Region:<br />
Wohnqualität, Wohnumfeld mit Spiel- und Sportmöglichkeiten, Naherholung, Infrastruktur<br />
und Versorgung, Einzugsbereiche von Vereinen, Kirchengemeinden, Verkehrsanbindung<br />
etc.)<br />
• den subjektiven Nutzungs- und Handlungskompetenzen.<br />
<strong>Die</strong>se Aspekte werden insbesondere auch im Zusammenhang von Entwicklungschancen für<br />
Kinder und Jugendliche gesehen. So bestimmt z. B. § 1.3 des Kinder- und<br />
Jugendhilfegesetzes, dass Jugendhilfe<br />
"1. Junge Menschen in ihrer individuellen Entwicklung fördern und dazu beitragen [soll]<br />
Benachteiligung zu vermeiden oder abzubauen,<br />
.......<br />
4. dazu beitragen [soll], positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien<br />
sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt zu erhalten oder zu schaffen."<br />
Um mehr Informationen zu dieser Situation in der Projektregion zu erhalten, wurden im<br />
Rahmen von Gruppendiskussionen in den Stadtteilteams (MitarbeiterInnen des ASD und der<br />
HzE-Träger) Angaben zur Wohn- und Wohnumfeldsituation in den sieben Quartieren<br />
erhoben. 1 Untersucht wurden bezogen auf das jeweilige Quartier:<br />
• Wohnsituation (Größe, Qualität)<br />
• Wohnumfeld (Anlage, Spielmöglichkeit etc.)<br />
• formale Infrastruktur (inklusive Versorgungsgrad und Inanspruchnahme)<br />
• informelle Infrastruktur (und deren Inanspruchnahme).<br />
Bei der formalen Infrastruktur handelt es sich um institutionelle Angebote, die<br />
schwerpunktmäßig der Jugendhilfe und Sozialen Arbeit aber auch dem Bildungsbereich<br />
zuzuordnen sind. <strong>Die</strong>s sind in erster Linie Kindertageseinrichtungen, Jugendeinrichtungen,<br />
Beratungsstellen und Schulen.<br />
Unter informeller Infrastruktur werden hier Angebote und Einrichtungen verstanden, die<br />
das Alltagsleben der Bewohner entlasten und ihre soziale Einbindung fördern können, aber<br />
auch Freizeitmöglichkeiten und Treffpunkte. Hierzu sind z. B. Verkehrsanbindungen,<br />
Einkaufsmöglichkeiten, Einrichtungen der medizinischen Versorgung ebenso zu zählen wie<br />
(Sport-)Vereine und Freizeitangebote.<br />
An dieser Stelle soll nur ein Resümee in Form von Thesen aus der Analyse der Wohn- und<br />
Wohnumfeldsituation der sieben Quartiere gezogen werden.<br />
• Bei den Quartieren handelt es sich um segregierte Gebiete, die überwiegend durch<br />
Verkehrswege (mehrspurige Straßen und Bahnlinien) gegenüber anderen Wohngebieten<br />
abgegrenzt sind.<br />
1<br />
vgl. Becher, U., Sozialraum- und lebensweltorientierte HzE - Sozialraum- und Lebenslagen-/Lebensweltanalyse,<br />
12/2002, unveröffentlichtes Manuskript, S. 21-50<br />
68
• Der hohe Anteil von sozialhilfebedürftigen Kindern von 0-6 Jahre (aber auch bis 18<br />
Jahre) belegt die Aussage, dass Kinder, insbesondere Kinderreichtum (3 und mehr<br />
Kinder) ein Armutsrisiko bedeuten.<br />
• Der Sachverhalt, dass Familien mit Kindern nur noch einen relativ geringen Anteil an<br />
allen Haushalten ausmachen (Eidelstedt 21,0%, Stellingen 14,9%, Eimsbüttel 16,2%,<br />
Hamburg 18,9%) begünstigt offensichtlich, dass Kinder marginalisiert und diskriminiert<br />
werden.<br />
• <strong>Die</strong> Wohnhäuser und das Wohnumfeld wirken häufig "ansprechend"; sie sind in der<br />
Regel grün und gepflegt – wirken aber steril.<br />
o Vorhandene Spielmöglichkeiten werden nicht genutzt; ein Grund kann ihr geringer<br />
"Aufforderungscharakter" für Aktivitäten der Kinder sein. [<strong>Die</strong> Aussage einer Expertin<br />
mag ggf. eine Begründung dafür sein: "Dort sollten nicht so viele Fertiggeräte<br />
stehen. Naturmaterialien, wie z. B. Baumstämme sollten mehr genutzt werden und<br />
Sandkisten könnten auch anders aussehen. Es sollten Kinder mehr in die Planung<br />
solcher Plätze einbezogen werden, um so besser deren Bedürfnisse berücksichtigen<br />
zu können."]<br />
o Wohnungseigentümer sind mit unterschiedlichen Interessen konfrontiert; denen von<br />
Kindern und Jugendlichen und denen der – meist kinderlosen – Erwachsenen. Es<br />
soll alles möglichst ordentlich und gepflegt aussehen; jedes "Chaos" – z. B. Lärm,<br />
Toben, Schädigung der Rasenfläche – wird als störend empfunden. In diesem<br />
Interessenkonflikt scheinen die Erwachsenen sich durchzusetzen.<br />
o Darüber hinaus gibt es einen Generationenkonflikt zwischen dem Interesse, auf den<br />
Grünflächen zu spielen, d.h. auch laut zu sein (lachen, rufen, schreien) und dem<br />
Interesse nach Ruhe und Ordnung (während des <strong>ganze</strong>n Tages).<br />
• Das Zusammenleben der Bewohner der Quartiere ist weitgehend anonym. <strong>Die</strong><br />
Ausgrenzung von außen begünstigt eine Abgrenzung im Inneren. "Tragfähige"<br />
Nachbarschaften scheinen die Ausnahme zu sein.<br />
• Es gibt eine hohe Korrelation zwischen isolierten Lebensformen und mangelnden<br />
"Treffmöglichkeiten" in den Quartieren.<br />
• Insgesamt gibt es in der Region III ein relativ umfangreiches Angebot an Sozialer<br />
Infrastruktur, die aber von armen und benachteiligten jungen Menschen nur selten<br />
genutzt wird.<br />
o Problem der räumlichen und inhaltlichen Erreichbarkeit – es ist nicht nur eine Frage,<br />
wo etwas angeboten wird, sondern auch was und wie und warum es für die eigene<br />
Situation relevant sein könnte<br />
o Einrichtungen sind durch andere Gruppen "besetzt", und eine Integration wurde nicht<br />
erreicht oder nicht versucht.<br />
<strong>Die</strong> Untersuchung hat eine Diskrepanz zwischen einem häufig "ansprechenden Äußeren"<br />
der Quartiere und z. T. Einschränkungen bezogen auf die "Lebenslage Wohnen und<br />
Wohnumfeld" deutlich werden lassen. <strong>Die</strong> Restriktionen beziehen sich insbesondere auf<br />
• häufig zu kleine Wohnungen gemessen an der Zahl der Mitglieder der Haushalte<br />
• Isolation und Ausgrenzung innerhalb der Quartiere, aber auch von außen<br />
• Stigmatisierung und Diskriminierungen sowohl durch Bewohner des Umfeldes als auch<br />
durch Vertreter von Institutionen, z. B. von Schulen und Behörden<br />
• die Spiel- und Sportmöglichkeiten der Kinder, die sowohl durch Konflikte mit anderen<br />
Bewohnergruppen, als auch durch das Verhalten von Wohnungsbaugesellschaften<br />
begrenzt werden. Es ist zu vermuten, dass das Aufstellen von Verbotsschildern wie auch<br />
der Abbau von Spielgeräten und das Verbot, auf Freiflächen Fußball zu spielen, eher zu<br />
Aggressionen und auch zu Zerstörungen führt, als zu "Wohlverhalten".<br />
69
Lebenslage Wohnen – ein oft beeinträchtigendes Phänomen<br />
Gegenstand dieser Untersuchung zur Kinderarmut war – ebenso wie im Rahmen der<br />
Projektarbeit – u. a. die Frage: In welchen Lebensbereichen zeigen sich [bei<br />
Berücksichtigung eines Lebenslagenmodells] Einschränkungen in ihren<br />
Handlungsmöglichkeiten und damit in ihren Teilhabechancen?<br />
An dieser Stelle werden nur Angaben zum Bereich Wohnen aufgezeigt. Probleme im<br />
Wohnbereich müssen ebenso wie die Situation der Armut insgesamt als ein relatives<br />
Phänomen betrachtet werden. Dem wurde durch die Experten vielfach entsprochen, d. h. es<br />
wurden positive ebenso wie beeinträchtigende Aspekte aufgezeigt.<br />
Als positiv wurde u. a. angemerkt, dass inzwischen in etlichen Hamburger Quartieren, "z. B.<br />
Mümmelmannsberg oder Steilshoop – diesen Großsiedlungen der siebziger Jahre – ... viel<br />
verbessert wurde. <strong>Die</strong> sind begrünt, da gibt es Spielplätze." Beeinträchtigend wirkt eher die<br />
Ballung bestimmter Familien in diesen Quartieren. Auch auf den z. T. sehr guten Standard<br />
von Sozialwohnungen neuerer Jahrgänge wird hingewiesen; das sei meistens dann so,<br />
wenn sie am Rand größerer Sanierungsgebiete gebaut wurden. Aber auch umfassende<br />
Sanierungsmaßnahmen, wie z. B. in der Lenzsiedlung, haben die Wohnqualität verbessert.<br />
Bei Berücksichtigung der Relativität der Situation wurden von den meisten Befragten – auch<br />
von denen, die anerkennend auf Verbesserungen durch Wohnungsbauträger hingewiesen<br />
haben – gleichzeitig erhebliche Beeinträchtigungen benannt.<br />
<strong>Die</strong> Wohnsituation armer und benachteiligter Familien ist häufig gekennzeichnet durch ein<br />
Leben in gettoisierten und stigmatisierten Wohngegenden. Ihre Beeinträchtigung durch<br />
Verkehrslärm (z. B. durch Autos, Eisenbahnen und Fluglärm) und Luftverschmutzung (u. a.<br />
durch die Müllverbrennungsanlage aber auch durch Industrieemissionen) ist relativ hoch. Oft<br />
wohnen sie sehr beengt, häufig unterhalb der als angemessen anerkannten<br />
Wohnungsgröße. <strong>Die</strong> Zimmer sind in der Regel sehr klein und die Wohnungen verfügen oft<br />
über zu wenig Räume, so dass kaum Rückzugsmöglichkeiten für einzelne Familienmitglieder<br />
bestehen, was insbesondere beim Zusammenleben mit pubertierenden Jugendlichen häufig<br />
zu Konflikten führt. Ihre Entfaltungsmöglichkeiten sind dadurch vielfach eingeschränkt.<br />
Wenn Kinder unterschiedlichen Alters ein Zimmer teilen müssen, Freunde der älteren<br />
Geschwister – z. B. der Freund der älteren Schwester – zu Besuch kommen und dort auch<br />
übernachten "wird es problematisch... . Das ist eine Raumsituation, aber auch eine<br />
finanzielle." Gemeinsame Zimmer von Geschwistern führen häufig zu Streit und<br />
Spannungen: "Jeder hat eine andere Welt, hat sich anderes entwickelt, hat andere Freunde,<br />
andere Interessen... ."<br />
Aufgrund der häufig sehr schlechten materiellen Situation der Familien sind die Wohnungen<br />
z. T. schlecht und unzureichend ausgestattet. <strong>Die</strong> Kinder haben kaum einen eigenen Platz,<br />
um ihre Schulaufgaben zu machen, was sich negativ auf die Entwicklung einer<br />
Arbeitshaltung auswirkt und zu Schwierigkeiten, die Schulsachen zu ordnen, führt.<br />
In Wohnunterkünften verschärft sich die Problematik noch erheblich. In der Regel sind die<br />
Bewohner wegen Mietschulden eingewiesen worden. "Bei den älteren Kindern ist es sehr<br />
schnell klar: Ich habe jetzt eine Adresse, die darf ich im Prinzip in der Schule nicht sagen,<br />
weil dann jeder weiß, wo ich wohne." Inzwischen werden Wohnungen in Wohnunterkünften<br />
auch wieder sehr eng belegt. "...Zwillinge, die mussten jetzt mit ihrem Vater in eine<br />
Einzimmerwohnung ziehen."<br />
<strong>Die</strong> besondere Situation von Bewohnern in Wohnunterkünften ist u. a. dadurch<br />
gekennzeichnet, dass sie keinen Mietvertrag haben, sondern einen Nutzungsvertrag, d. h.<br />
das Mietrecht hat für sie keine Gültigkeit, sie können durch einseitige Verordnungen ihren<br />
Wohnraum verlieren. Inzwischen müssen die Bewohner von Unterkünften "alle halbe Jahre<br />
70
nachweisen, dass sie Wohnungen suchen. ... Sie sind dann auf die Verwaltung, die<br />
Sozialarbeiter angewiesen, dass die ihnen den Vertrag verlängern, wenn sie – was die Regel<br />
ist – keine andere Wohnung gefunden haben. ...Arbeiten sie nicht ordentlich mit, wird ihnen<br />
angedroht, dass sie in eine schlechter ausgestattete Unterkunft versetzt werden." Von den<br />
Sozialarbeitern und der Unterkunftsverwaltung würde gesagt: "Wir können keine Rücksicht<br />
auf die Kinder nehmen, wir müssen die Eltern erziehen."<br />
<strong>Die</strong> soziale Integration armer und benachteiligter junger Menschen steht in engem<br />
Zusammenhang mit der Lage und Ausstattung ihrer Wohnungen. Schlechte und<br />
unzureichende Ausstattung führt ebenso wie die Enge der Wohnung häufig dazu, dass die<br />
Kinder und Jugendlichen Freunde und Mitschüler nicht nach Hause einladen. Sie schämen<br />
sich, weil " sie wissen, wie die anderen leben: <strong>Die</strong> haben ein eigenes Zimmer, die sind<br />
medial sehr gut ausgestattet, haben das vierundvierzigste Steifftier und sie selbst haben nur<br />
zwei vom Dom geschossene Stofftiere". Oft nehmen sie selbst keine Einladungen an, weil<br />
eine Gegeneinladung erwartet wird. Häufig erlauben die Eltern auch nicht, dass sie Freunde<br />
mit nach Hause bringen. Vielfach wollen aber auch die Eltern dieser Freunde "aus besseren<br />
sozialen Schichten" nicht, dass ihre Kinder Mitschüler in solchen Siedlungen –häufig als<br />
Gettos bezeichnet – besuchen.<br />
<strong>Die</strong>se Situation führt dann meistens dazu, dass Kinder und Jugendliche sich entweder in die<br />
Wohnungen an Computer, Fernseher oder Gameboy zurückziehen oder mit Gleichaltrigen<br />
im Wohngebiet "rumhängen". In Einzelfällen führt das zur Bildung von Cliquen oder auch zu<br />
Gangs; gelegentlich suchen sie dann "negative Vorbilder". Ihr "Leben" findet häufig draußen<br />
an Cliquentreffpunkten und auf der Straße statt oder sie ziehen sich in die Isolation zurück.<br />
Verschiedene Aspekte der Wohn- und Wohnumfeldsituation eröffnen Handlungsspielräume<br />
oder schränken sie ein.<br />
In vielen Quartieren kommt es aufgrund der Schließung von Gastronomiebetrieben und<br />
Geschäften zu einer Verödung und "zu einer Stabilisierung von Ausgrenzung, die ... ganz<br />
deutlich zu beobachten ist." Dadurch werden "Handlungsmöglichkeiten erheblich reduziert.<br />
Einmal ist die gesellschaftliche Resonanz eine eher negative, aber auch das Milieu selbst<br />
gibt wenig Anregung und wenig Aussicht auf Veränderung."<br />
Zu Einschränkungen der Handlungsspielräume führen auch Schließungen von Einrichtungen<br />
– direkt in oder in unmittelbarer Nähe von benachteiligten Quartieren – wie Bücherhallen,<br />
Schwimmhallen etc. "<strong>Die</strong>se Kinder werden sich keinen weiten Fahrweg leisten und die Eltern<br />
können sie auch nicht irgendwo hinfahren."<br />
Auch die Adresse führt – in Verbindung mit Stigmatisierungsprozessen – zu eingeschränkten<br />
Handlungsspielräumen und damit oft auch zur Vorenthaltung von Chancen: "Wenn man<br />
Zeugnisse aus einer Schule aus solch einer Gegend hat und sich bewirbt oder sich mit solch<br />
einer Adresse bewirbt, dann ... fällt es negativ auf. Das ist die Erfahrung vieler Jugendlicher<br />
– und auch häufig von Erwachsenen."<br />
Von den Betroffenen werden im Bereich Wohnen unterschiedliche Handlungsformen<br />
entwickelt, z. B.<br />
• Nutzung des öffentlichen Raums für private Zwecke<br />
• Erschließung eigener Treffpunkte, z. B. Jugendlicheneck, aber auch Alkoholikereck<br />
• Jugendliche entwickeln häufig eigene Codes, die sie durch Sprache, Kleidung und<br />
Verhalten demonstrieren<br />
• einige versuchen den schlechten Wohnzustand zu verbessern<br />
• andere orientieren sich aus dem Wohngebiet heraus<br />
• eine weitere Gruppe zieht sich in die Isolation zurück<br />
• oder wird – im Gegensatz dazu – aktiv, z. B. in Bürgerforen oder auch bei<br />
Protestaktionen.<br />
71
<strong>Die</strong> Handlungsspielräume, die die Betroffenen in ihrer Lebenslage "Wohnen" haben, wird<br />
durch ihre Situation in anderen Dimensionen beeinflusst: Je höher ihr Bildungsstatus ist<br />
und je größer ihre soziale Integration, desto kreativer und aktiver können sie<br />
Handlungsspielräume nutzen.<br />
Entsprechende Ressourcen und Kompetenzen werden auch bei den<br />
Bewältigungsstrategien und Aktionsformen, mit denen die Betroffenen ihre oft defizitäre<br />
Wohnsituation kompensieren, sichtbar.<br />
Viele benachteiligte Kinder und Jugendliche grenzen ihren Lebensradius ein, d. h. sie<br />
beschränken sich relativ stark auf ihr Wohngebiet und das nähere Umfeld. Fremde Räume<br />
werden vielfach von ihnen und ihren Eltern ebenso gemieden wie spezifische<br />
Kommunikationsstile und Formen von Auseinandersetzungen. Den Familien fehlt häufig das<br />
Selbstbewusstsein ihre Ansprüche und Rechte einzufordern – z. B. auch gegenüber ihrem<br />
Vermieter. "Davor haben sie einfach Angst und das erleben auch ihre Kinder – sie erleben<br />
Eltern, die ... nicht wirklich versuchen, sich bei Ämtern und Institutionen durchzusetzen." <strong>Die</strong><br />
Ängste der Eltern – "Ich bekomme Sozialhilfe, meine Miete wird von der Sozialhilfe bezahlt,<br />
also hab' ich überhaupt kein Recht, mich zu beschweren" – werden von den Kindern gelernt<br />
und sehr oft in ihr eigenes Verhaltensrepertoire aufgenommen.<br />
Defensive und resignative Bewältigungsstrategien zeigen sich ferner darin, dass<br />
• Enge und mangelnder Freiraum Konfliktpotentiale hervorruft bis hin zum Zerbrechen der<br />
Familien<br />
• aus der Familie "ausbrechen" bzw. "abhauen" dann oft die Konsequenz sind<br />
• Handlungsunfähigkeit und in der Folge Verwahrlosungstendenzen auftreten.<br />
Aktive Bewältigungsstrategien zeigen sich z. B. darin, dass<br />
• Eltern und kleinere Kinder einen Schlafraum teilen<br />
• die Eltern im Wohnraum schlafen und leben<br />
• die Familie mit eher wenig finanziellen Mitteln eine praktische und gemütliche Einrichtung<br />
"zaubert".<br />
Benachteiligende Wohnsituationen können sich negativ auf die Identität und die<br />
Personalität der davon betroffenen Menschen auswirken. "Unterstimulierende<br />
Wohngegenden, wie soziale Brennpunkte, stellen eine hohe Belastung für die mentalen<br />
Selbststeuerungen dar." Substitutions- und Verdrängungseffekte auf dem Wohnungsmarkt<br />
"führen zu einer Demoralisierung armer Bevölkerungsgruppen. <strong>Die</strong> soziale Randständigkeit<br />
ist eine schwer zu bewältigende Hürde, den Einstieg in den Ausstieg aus Armut zu<br />
bewältigen." ... "Eigenverantwortung und Selbständigkeit sind dadurch enge Grenzen<br />
gesetzt."<br />
Eine Expertin, die selbst wiederholt in benachteiligten Gebieten tätig war, äußerte: Ich war in<br />
ganz vielen Wohnungen "und es war ... nur schrecklich. Wenn ich mir überlege, dass ich da<br />
jeden Tag reingehen sollte, ich ... hätte auch Depressionen."<br />
Viele von Armut betroffene junge Menschen und ihre Eltern fühlen sich durch die oft<br />
deprivierende Situation psychisch belastet, was häufig zu resignativem Verhalten führt, aber<br />
auch zu Verdrängungsprozessen, indem man sich selbst (nur) als Opfer definiert und die<br />
Verantwortung für die eigene Situation nach außen verlagert. Wenn die Situation sich als<br />
sehr beeinträchtigend auswirkt und keine Möglichkeiten der Verbesserung real oder subjektiv<br />
vorhanden sind, kann die Situation auch Depressionen auslösen. Gekoppelt daran ist oft die<br />
Entwicklung eines Zugehörigkeitsgefühls zu einem als "unten" empfundenem Milieu – das<br />
Außenseiterverständnis wirkt dann meistens auch "identitätsstiftend".<br />
72
In einer Gesellschaft, in der materieller Besitz als Statussymbol angesehen wird, wird<br />
Mangel – auch bezogen auf die Wohnsituation – als Statusverlust empfunden.<br />
In den Gruppendiskussionen ist deutlich geworden, dass Benachteiligungen generell, aber<br />
auch im Wohnbereich, von einem Teil der Betroffenen kompensiert werden können. <strong>Die</strong><br />
Entwicklung von autonomem Handeln und Selbstständigkeit ist wesentlich davon abhängig,<br />
ob Beeinträchtigungen und Benachteiligungen nur einzelne Lebensbereiche oder die <strong>ganze</strong><br />
Lebenslage betreffen. Auch hier sind eine gute Einbindung in soziale Netzwerke, ein (relativ)<br />
hoher Bildungsstatus und die Integration in Erwerbsarbeit geeignete Ressourcen zur<br />
Förderung einer positiven Identitäts- und Persönlichkeitsentwicklung. <strong>Die</strong>se Bedingungen<br />
stehen heute aber den meisten armen und benachteiligten Kindern, Jugendlichen und ihren<br />
Eltern nicht zur Verfügung.<br />
Sozialwohnungen – eine öffentliche Aufgabe<br />
Das zweite Wohnungsbaugesetz (II WoBauG) bestimmt, dass Bund, Länder, Gemeinden<br />
und Gemeindeverbände den Sozialen Wohnungsbau "als vordringliche Aufgabe zu fördern"<br />
haben. "<strong>Die</strong> Förderung des Wohnungsbaus hat das Ziel, den Wohnungsmangel zu<br />
beseitigen... ." 1<br />
Konkretisiert wird dieser Auftrag u. a. im Wohnungsförderungsgesetz (WoFG). § 1 des<br />
Gesetzes formuliert Zweck und Zielgruppen:<br />
"(1) ....regelt die Förderung des Wohnungsbaus.....zur Unterstützung von Haushalten bei<br />
der Versorgung mit Mietwohnraum. ...............<br />
(2) Zielgruppen.....sind Haushalte, die sich am Markt nicht angemessen versorgen<br />
können und auf Unterstützung angewiesen sind."<br />
Als Zielgruppen werden dann u. a. genannt:<br />
Familien mit Kindern, Alleinerziehende, Schwangere, Ältere, Wohnungslose und sonstige<br />
hilfebedürftige Personen.<br />
Als Fördergrundsätze werden u. a. definiert:<br />
• die wirtschaftlichen und sozialen Erfordernisse mit der Erhaltung der Umwelt in<br />
Einklang zu bringen<br />
• die Schaffung und Erhaltung sozial stabiler Bewohnerstrukturen<br />
• die Schaffung und Erhaltung ausgewogener Siedlungsstrukturen, sowie<br />
ausgeglichener wirtschaftlicher, sozialer und kultureller Verhältnisse<br />
• die Erhaltung preisgünstigen Wohnraums im Fall der Förderung der Modernisierung. 2<br />
Mit der Vergabe öffentlicher Gelder für den Bau von Sozialwohnungen ist ein<br />
Belegungsrecht verbunden. "Ein allgemeines Belegungsrecht ist das Recht der zuständigen<br />
Stelle, von dem durch die Förderung berechtigten und verpflichteten Eigentümer.....zu<br />
fordern, eine bestimmte belegungsgebundene Wohnung einem Wohnungssuchenden zu<br />
überlassen, dessen Berechtigung sich aus einer Bescheinigung nach § 5 ergibt." Es müssen<br />
mindestens drei Wohnungssuchende zur Auswahl benannt werden. 3<br />
Wohnberechtigungsscheine werden von der zuständigen Stelle für die Dauer eines Jahres<br />
erteilt. An die Erteilung sind einige Forderungen geknüpft, so z. B. die Aufenthaltsdauer in<br />
dem jeweiligen Geltungsbereich und die Einkommenshöhe.<br />
1 II WoBauG, § 1<br />
2 vgl. § 6 WoFG<br />
3 vgl. § 27 WoFG<br />
73
"In dem Wohnberechtigungsschein ist die für den Wohnraumsuchenden...... nach den<br />
Bestimmungen des Landes maßgebliche Wohnungsgröße nach der Raumzahl oder nach der<br />
Wohnfläche auszugehen." Unter besonderen Bedingungen kann davon abgewichen<br />
werden. 1<br />
In Hamburg gibt es 2003 noch 142.790 Sozialwohnungen, das entspricht einem Anteil von<br />
16,5% aller 2002 verfügbaren Wohnungen.<br />
Den höchsten Anteil an Sozialwohnungen gibt es 2003 im Bezirk Bergedorf: 13.202<br />
Sozialwohnungen, das entsprach 25,4% aller Bergedorfer Wohnungen (vgl. Anlage, Tabelle<br />
7 in Verbindung mit Tabelle 6).<br />
<strong>Die</strong> niedrigste Quote Sozialwohnungen von 6,3% liegt im Bezirk Hamburg Nord, gefolgt vom<br />
Bezirk Eimsbüttel mit 9,3%.<br />
In den "armen" Stadtteilen liegen 2003 13,0% (112.830) aller Hamburger Wohnungen, aber<br />
30% (43.830) aller Sozialwohnungen. Der Anteil der Sozialwohnungen an allen Wohnungen<br />
in den "armen" Stadtteilen beträgt 38,9%.<br />
Sehr verschieden dazu ist die Situation in den 12 "reichen" Stadtteilen. Hier liegen 2003<br />
5,1% (44.615) aller Hamburger Wohnungen, aber "nur" 0,3% (437) aller Sozialwohnungen.<br />
Der Anteil der Sozialwohnungen an allen Wohnungen in den "reichen" Stadtteilen beträgt<br />
knapp 1%.<br />
<strong>Die</strong> Zahl der Sozialwohnungen in den "reichen" Stadtteilen variiert von 0 in Reitbrook und<br />
Wellingsbüttel bis 181 in Bergstedt. In den "armen" Stadtteilen variiert die Zahl von 0 in<br />
Kleiner Grasbrook mit Steinwerder bis 14.664 in Billstedt.<br />
Ist der Anteil an Sozialwohnungen im Bezirk Eimsbüttel mit 11.944 (9,3%) aller Wohnungen<br />
relativ gering, so verdichtet sich ihre Verteilung auf wenige Gebiete. In der Region III liegen<br />
2003 20,6% (26.516) aller Wohnungen im Bezirk, aber 45,1% aller bezirklichen<br />
Sozialwohnungen. Der Anteil der Sozialwohnungen in der Region III beträgt 20,3%.<br />
In den Innenstadtregionen Schanzenviertel und Karolinenviertel ist der Anteil an<br />
Sozialwohnungen sehr gering. Mit 996 bzw. 95 ist er für diese Gebiete von geringer<br />
Relevanz (vgl. Anlage, Tabelle 7a).<br />
<strong>Die</strong> Konzentration von Sozialwohnungen in benachteiligten und benachteiligenden<br />
Stadtteilen führt zu unterschiedlichen Problemen (s. o.). Unter Berücksichtigung des<br />
inzwischen stark reduzierten Baus neuer Sozialwohnungen bei gleichzeitig zu erwartendem<br />
Anstieg anspruchsberechtigter Haushalte ist zu befürchten, dass sich "durch den Wegfall von<br />
Bindungen" an das Belegungsrecht die Versorgungslage armer und benachteiligter Familien<br />
mit Sozialwohnungen gravierend verschlechtern wird. Nach bisherigen Prognosen reduziert<br />
sich der Bestand an Sozialwohnungen aufgrund der Aufhebung von "Bindungen" bis zum<br />
Jahr 2009 in Hamburg auf 103.882 – das sind 27,2% weniger als 2003 (vgl. Anlage, Tabelle<br />
7).<br />
In den 12 "armen" Stadtteilen verringert sich der Anteil an Sozialwohnungen in dieser Zeit<br />
um 8.466 auf 35.456; das entspricht einem Rückgang um 19,3%. In den "reichen" Stadtteilen<br />
wird es bis 2009 einen prognostizierten Rückgang von 24 Sozialwohnungen geben; das<br />
entspricht 5,5%.<br />
Sehr problematisch stellt sich 2009 die Versorgung mit Sozialwohnungen im Bezirk<br />
Eimsbüttel und insbesondere in der Region III dar: Der prognostizierte Rückgang beträgt für<br />
1 vgl. § 27 WoFG, Einzelheiten werden im Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG) geregelt<br />
74
den Bezirk 31,9%, für die Region III 44,1% und für die beiden Stadtteile Eidelstedt 37,1%<br />
und Stellingen 66,7% (vgl. Tabelle 7a).<br />
Bedeutet der hohe Anteil von Sozialwohnungen Segregation speziell materiell benachteiligter<br />
Menschen in spezifische Wohngebiete und sind schon jetzt drohende oder tatsächliche<br />
Räumungsklagen für viele – häufig überschuldete – Familien ein ernstes Problem, so droht<br />
durch Aufhebung der Bindung bei vielen Sozialwohnungen in den nächsten Jahren die<br />
Situation zu eskalieren, da die Wohnungseigentümer dann nicht mehr an die Kostenmiete<br />
gebunden sind.<br />
Drohender Wohnungsverlust – sei es aus Angst, eine höhere Miete nicht bezahlen zu<br />
können oder auf Grund von Verschuldung und drohender Räumungsklage – hat für die<br />
davon Betroffenen gravierende Auswirkungen. Wohnungsnot wird offensichtlich (neben<br />
anderen) zu einem sozialen Schlüsselproblem. Sie beeinträchtigt massiv die psychischen,<br />
familiären und beruflichen Lebensbedingungen und Chancen vieler Menschen.<br />
Da bisher keine bedeutsamen Bauprogramme für Sozialwohnungen durchgeführt oder<br />
geplant werden und ein Umzug auch für viele Familien, insbesondere für Kinder und<br />
Jugendliche, zu einer "Entwurzelung" und damit zu einer weiteren Isolierung führen würde,<br />
stellt sich hier die Frage nicht nur nach wohnungspolitischen, sondern auch nach sozial-<br />
(arbeits-) politischen und jugendpolitischen Konsequenzen.<br />
Resümee<br />
<strong>Die</strong> Wohn- und Wohnumfeldproblematik kann und muss als sichtbare Form der Ausgrenzung<br />
zur Kenntnis genommen werden; die Konzentration armer und benachteiligter<br />
Bevölkerungsgruppen in spezifischen Regionen, wie Großraumsiedlungen und noch nicht<br />
sanierte innerstädtische Gebiete, ist offensichtlich. Gleichzeitig muss anerkannt werden,<br />
dass eine Reihe Wohnungsbauträger des Sozialen Wohnungsbaus, insbesondere auch der<br />
städtische, in letzter Zeit eine große Anzahl Sozialwohnungen und auch <strong>ganze</strong><br />
Großsiedlungen saniert und modernisiert haben. Das mag häufig auch im Zusammenhang<br />
mit dem Auslaufen von Belegungsbindungen stehen.<br />
<strong>Die</strong> Hamburger Verwaltung hat mit mehreren Hamburger Wohnungsbauträgern<br />
Vereinbarungen getroffen, die u. a. eine Lockerung des Belegungsrechts vorsehen. Das<br />
kann für eine soziale Stabilisierung der Bewohnerstrukturen und die Schaffung und<br />
Erhaltung ausgewogener Siedlungsstrukturen ein angemessenes Verfahren sein.<br />
Gleichzeitig muss aber sichergestellt bleiben, dass eine angemessene Versorgung mit<br />
Sozialwohnungen für die im WoFG definierten Zielgruppen gewährleistet wird. Hier scheint<br />
es nach Aussage mehrerer Experten Probleme zu geben.<br />
75
3.4 Armut und Benachteiligung junger Menschen<br />
– ihre Lebenslage und Lebenswelt<br />
"Der multidimensionale Ansatz/ Lebenslagenansatz geht davon aus, dass Armut und<br />
Benachteiligung nicht ausschließlich durch Einkommensprobleme gekennzeichnet sind,<br />
sondern dass die Betroffenen in mehreren Lebensbereichen in ihren<br />
Handlungsmöglichkeiten beeinträchtigt sind." Ausgehend von dieser These wurden die<br />
Experten in den Einzelinterviews und in den Gruppendiskussionen gefragt:<br />
Legt man ein solches Lebenslagenmodell zugrunde:<br />
In welchen Lebensbereichen zeigen sich Einschränkungen in ihren<br />
Handlungsmöglichkeiten und damit in ihren Teilhabechancen?<br />
Bevor Angaben zu den einzelnen Dimensionen wiedergegeben werden, einige generelle<br />
Aussagen:<br />
"Wenn man sagt, Kinder sollen Menschen sein, die nach Autonomie streben können, dann<br />
würde ich fragen: Wo wird ihre Autonomie eingeschränkt? Und was sind wichtige<br />
Lebensbereiche für ein Kind? Das sind<br />
• Bildung,<br />
• Regeneration,<br />
• soziale Teilhabe,<br />
• Partizipation."<br />
Bildung wird von fast allen Gesprächspartnern als Lebenslage benannt, durch die sich Armut<br />
und Benachteiligung manifestieren. "Der Bildungsbereich ... weil er ein Schlüsselbereich ist –<br />
sowohl was die Eltern als auch die Kinder betrifft." Von der Bildungssituation hängen die<br />
Möglichkeiten ab, "wie ich mir – besser oder schlechter – andere Lebensbereiche<br />
erschließen kann und welche Mitwirkungschancen ich habe".<br />
In dem Zusammenhang wird auch auf die eingeschränkte Fähigkeit von Eltern hingewiesen,<br />
vorhandene Informationen für sich und ihre Kinder nutzbar zu machen. "Ich glaube, ...dass<br />
Zugangsmöglichkeiten für Kinder aus armen Familien heute vor allem in dem Bereich von<br />
Gesundheit, im Bereich von Informationen über die dazu gehörende richtige Ernährung, über<br />
all das, was Kinder brauchen, fehlen. Mütter aus der Mittelschicht beschaffen sich mühelos<br />
Informationen, die sie dann auch in Aktivitäten umsetzen [können]." Das tun Mütter, die ihre<br />
Kinder unter ärmlichen Verhältnissen aufziehen, in der Regel nicht. "Möglicherweise können<br />
sie auch gar nicht ... sinnerfassend lesen; dass sie die Bedeutung, den Inhalt verstehen. ...<br />
Wichtig ist auch die Fähigkeit zur Selektion von Informationen ..., zu wissen, was für mich<br />
wichtig ist." Folge eingeschränkter Informationserfassung und -verarbeitung ist u. a.<br />
• Nichtinanspruchnahme von Rechten und <strong>Die</strong>nstleistungen<br />
• fehlende Kompetenz, eigene Interessen durchzusetzen<br />
• fehlende Bereitschaft/ Fähigkeit, zu experimentieren<br />
• Reduzierung auf den Stadtteil.<br />
Stigmatisierungs- und Ausgrenzungsprozesse werden als sehr gravierend für die<br />
Entwicklung benachteiligter Kinder angesehen. "<strong>Die</strong> Benachteiligung ist eindeutig vorhanden<br />
auf der Ebene von Stigmatisierung und [damit verbunden] mangelnder Kommunikation –<br />
also: das Stigma sorgt dafür, dass bestimmte Kommunikationen nicht eintreten. Das ist ein<br />
wesentlicher Punkt der Ausgrenzung. Sie führt dann natürlich dazu, dass [z. B.] in den<br />
Bereichen Bildung und Kultur Mängel entstehen – weniger im Bereich Sport."<br />
Es wird antizipiert, dass die in Hamburg beschlossenen Kürzungen im Jugendhilfe- und<br />
Bildungsbereich problemverschärfend wirken werden. So wurde u. a. geäußert: "Arme<br />
76
Kinder sind zunehmend von Ausgrenzungen betroffen, weil immer mehr Angebote, die<br />
bisher kostenlos beansprucht wurden, jetzt etwas kosten sollen, z. B. in Kitas und in der<br />
Schule. Wenn es um Ausflüge geht oder bestimmte Lehr- und Lernmittel benötigt werden, ist<br />
es immer häufiger, dass diese Dinge Geld kosten. Man muss davon ausgehen, dass Kinder<br />
aus benachteiligten Familien dann weniger Möglichkeiten haben."<br />
In Ergänzung zu den Ausführungen im Bereich Wohnen (vgl. Exkurs Wohnen) werden hier<br />
Aussagen zu folgenden Dimensionen der Lebenslage dargestellt:<br />
• Bildung/ Bildungschancen<br />
• Ausbildungs- und Beschäftigungssituation<br />
• Gesundheit/ Ernährung<br />
• Urlaub und Freizeit<br />
• kulturelle Vielfalt<br />
• gesellschaftliche Teilhabe. 1<br />
Folgende Aspekte werden dabei – soweit Angaben dazu vorliegen – einbezogen:<br />
• Auswirkung der materiellen und ökonomischen Situation auf die jeweilige Dimension<br />
• Beeinflussung der sozialen Integration<br />
• Handlungsspielräume<br />
• Kompensations- und Bewältigungsstrategien<br />
• Auswirkung auf die ideelle und kulturelle Identität und Personalität.<br />
3.4.1 Dimensionen der Lebenslage<br />
Bildung/ Bildungschancen<br />
Ein Ergebnis der KESS 4 <strong>Studie</strong>, die Aussagen über die Kompetenzen von Schülern und<br />
Schülerinnen am Ende ihrer Grundschulzeit macht, weist auf eine starke institutionelle<br />
Selektion bei Hamburger Schülern hin:<br />
"Bei gleichen kognitiven Lernvoraussetzungen und gleicher Leistung haben<br />
Hamburger Grundschulkinder aus sozioökonomisch deprivierten Familien eine<br />
bedeutend geringere Chance, eine schulische Übergangsempfehlung für das<br />
Gymnasium zu erhalten, als Kinder aus sozioökonomisch privilegierten<br />
Elternhäusern." 2<br />
<strong>Die</strong>ses Untersuchungsergebnis entspricht den Erkenntnissen, die im Rahmen der<br />
Lebenslagenanalyse (s. o.) gewonnen wurden.<br />
"<strong>Die</strong> Bildungsbenachteiligung ist ja – statistisch gesehen – nachgewiesen. Es gibt eine<br />
signifikante Verbindung zwischen Herkunft und Schullaufbahn. Kinder aus Armutsmilieus<br />
landen seltener in weiterführenden Schulen. Wenn man untersuchen würde, wieviele<br />
Heimkinder ein Gymnasium besuchen, wäre das Ergebnis bedrückend. Das drückt nicht die<br />
1 <strong>Die</strong> Aussagen werden ergänzt durch Ergebnisse der Lebenslagen-/ Lebensweltanalyse im dem o. g. Projekt.<br />
2 Bos, W., Pietsch M., Erste Ergebnisse aus KESS 4-Kurzbericht, Hamburg, 9/2004, S. 56<br />
77
Intelligenz [der Kinder] aus, sondern das hat ganz andere Hintergründe. ... Das<br />
Sprachmuster ist schon bei Schulantritt ein Selektionskriterium. ..."<br />
<strong>Die</strong>ser Aussage entspricht der Hinweis einer Schulleiterin, die erklärte, dass "Schule" armen<br />
und benachteiligten Kindern oft nicht zutraut, den Anforderungen an Realschulen und<br />
Gymnasien zu genügen und ihnen deshalb auch nur sehr selten eine Empfehlung für eine<br />
höher qualifizierende Schulstufe ausspricht, obwohl sie entsprechende intellektuelle<br />
Leistungen bringen.<br />
Es muss sicherlich anerkannt werden, dass viele dieser Schüler institutionelle Unterstützung<br />
benötigen, um ihre Ausbildung an einer solchen Schule erfolgreich absolvieren zu können,<br />
"denn Kinder, die doch auf eine entsprechende Schule gehen, können in der Regel bei<br />
schulischen Anforderungen weder auf ihre Familie noch auf weitere Personen ihres sozialen<br />
Umfeldes zurückgreifen, so dass sie in der Gefahr sind, schulisch zu scheitern."<br />
Es wurde gleichzeitig darauf hingewiesen, dass die meisten – auch armen und<br />
benachteiligten – Eltern zu Beginn der Schulzeit ihrer Kinder an deren Schulbildung<br />
interessiert sind. Ihnen fehlt es aber häufig an Kompetenzen – sie haben sie in der Regel nie<br />
erworben oder aufgrund eines Problemkonglomerats in ihrem Leben nicht den Kopf dafür frei<br />
– um ihre Kinder in ihrer Schullaufbahn zu unterstützen. Bei Schwierigkeiten bzw.<br />
Auffälligkeiten der Kinder werden sie in der Regel in die Schule "zitiert", aber nicht beteiligt<br />
und ermutigt bzw. unterstützt, wie sie ihren Kindern Freude am Lernen und am Schulbesuch<br />
vermitteln können.<br />
<strong>Die</strong> Schule – vertreten durch die Lehrer – verlangt häufig zuerst von den Eltern und dann von<br />
(Vertretern) der Jugendhilfe, die in der Schule auftretenden Probleme zu lösen bis hin zur<br />
Forderung zu einer stationären Unterbringung der Kinder – möglichst außerhalb von<br />
Hamburg. Lehrer, deren eigene Lebenswelt konträr der vieler Schüler gegenübersteht,<br />
verstehen diese in ihrer – durch ihre Lebenslage geprägten – Lebenswelt nicht;<br />
Einstellungen, Verhaltens- und Handlungsweisen sowie Deutungsmuster der Schüler werden<br />
dann vielfach als abweichendes Verhalten gewertet.<br />
Bildung privilegierterer Kinder wird oft "über Zusatzgeschäfte eingekauft", wie Musikschule,<br />
musikalische Früherziehung, Sportverein – diese Angebote können von den Familien armer<br />
und benachteiligter Kinder in der Regel nicht finanziert werden. "Armut ist oft in<br />
bildungsfernen Schichten verbreitet – dadurch wird die Bildungsferne noch einmal potenziert.<br />
... Hinzu kommt, dass Kinder, die in Armutsverhältnissen leben, oft ungefiltert die Probleme<br />
der Erwachsenen spiegeln." Eltern sind bezogen auf die Bildungssituation kein Vorbild. "<strong>Die</strong><br />
Eltern haben andere Sorgen. ... Jemand, der überschuldet ist, ... liest eben keine Bücher mit<br />
den Kindern."<br />
<strong>Die</strong> häufig bei benachteiligen Schülern anzutreffende geringe Sprachkompetenz –<br />
restringierter Code – beeinträchtigt ihre Bildungschancen erheblich. "Wir wissen ja, dass ...<br />
Sprachkompetenz auch für Nicht-Sprachen-Fächer – wie z. B. Mathematik – von großer<br />
Bedeutung ist. Schon in der 2. Schulklasse müssen Kinder Textaufgaben in der Mathematik<br />
begreifen. ... Das können sie aber nicht, wenn sie nicht in ausreichender Weise sprachfähig<br />
sind."<br />
<strong>Die</strong> Problematik einer eingeschränkten Sprachkompetenz ist für Kinder aus<br />
Migrantenfamilien besonders relevant. Ein besonderes Dilemma ist ihre häufig anzutreffende<br />
"doppelte Halbsprachlichkeit": sie können vielfach weder in ihrer Muttersprache noch in der<br />
deutschen Sprache ausreichend sprechen, lesen und schreiben. Das schränkt dann in der<br />
Regel ihre schulischen Leistungen – und in der Folge oftmals ihr schulisches Interesse – ein,<br />
führt aber auch zu Diskriminierungen und Ausgrenzungen durch deutsche Schüler. Rückzug<br />
– aber gelegentlich auch Aggressionen – sind die Folge.<br />
78
Konkrete Auswirkungen der ökonomischen und materiellen Situation zeigen sich bei<br />
benachteiligten Kindern besonders durch<br />
• mangelnde Rückzugsmöglichkeiten zum Lernen und Experimentieren wegen der<br />
beengten Raumsituation<br />
• Ausgrenzung durch das Bildungssystem – dem "normalen" Bildungssystem fehlen in der<br />
Regel Angebote, um der spezifischen Situation und den Bedarfen zu entsprechen. "Das<br />
System passt nicht zur sozialen und ökonomischen Lage der Kinder."<br />
• Kinder werden in "Sondergruppen" abgeschoben<br />
• die Verfestigung von [abweichenden] Verhaltensweisen und Auffälligkeiten sind oft die<br />
Folge<br />
• kein/ kaum Geld für<br />
o Schulmaterialien und Bücher generell<br />
o Nachhilfeunterricht<br />
o Klassenfahrten<br />
o Praktika<br />
o Pausenverpflegung.<br />
"Aufwendungen [Ausgaben] in der Schule, die für andere Schüler eine Selbstverständlichkeit<br />
sind – spezifische Kleidung, Klassenausflüge, Exkursionen etc. – können nicht geleistet<br />
werden. Das Geld der Familien reicht dafür nicht aus. <strong>Die</strong> Schüler müssten sich dann ... als<br />
'Bedürftige' offenbaren, um eventuell Geld aus der Klassenkasse zu erhalten. Das sind<br />
Einschränkungen, die für die Kinder sehr prägend sind, die auch zu Beeinträchtigungen der<br />
Kommunikation und der Lernfähigkeiten führen."<br />
<strong>Die</strong> soziale Integration im Bereich Schule und Schulumfeld ist oft beeinträchtigt:<br />
• <strong>Die</strong> Institution Schule bietet vielfach keine ausreichenden Fördermöglichkeiten – bei<br />
Berücksichtigung der spezifischen Lernbedingungen – für arme und benachteiligte<br />
Kinder. Das hat häufig Diskriminierungen zur Folge.<br />
• Klassenkameraden wollen Kinder, die nicht "mithalten" können und sich "unangepasst"<br />
verhalten, nicht zum Freund haben. Das schränkt Sozialbeziehungen ein.<br />
• Diskriminierte Schüler – und insbesondere Schulschwänzer – finden sich in Cliquen<br />
zusammen; sie bestärken sich wechselseitig in ihrem Verhalten, das sich dadurch<br />
verfestigt.<br />
• Jugendliche ohne Abschluss und Ausbildung bleiben aufgrund der Beschränktheit ihrer<br />
Lebenslage begrenzt auf ihr Milieu.<br />
Ausgrenzungsprozesse – und damit verbunden häufig soziale Isolation – beeinträchtigen die<br />
Bildungs- und Entwicklungschancen armer und benachteiligter Kinder erheblich. <strong>Die</strong><br />
Angaben der meisten Experten dazu werden hier zusammengefasst:<br />
Kinder aus einer benachteiligten Lebenslage, die durch ihre Familie, aber auch durch ihr<br />
soziales Umfeld nicht in ausreichendem Umfang unterstützt und gefördert werden,<br />
bekommen häufig Schwierigkeiten in der Schule. Sie werden oft u. a. wegen ihrer<br />
Unterversorgtheit, insbesondere in den Bereichen<br />
• Ernährung<br />
(sie kommen ohne Frühstück in die Schule, etliche haben Hunger und können sich allein<br />
deshalb nicht konzentrieren)<br />
• Kleidung<br />
• materieller Ausstattung<br />
(Konsum, Wohnen, Wohnausstattung)<br />
79
• kulturelles Verständnis<br />
• Verhalten<br />
(auf der Basis ihrer Lebenswelt)<br />
stigmatisiert und ausgegrenzt.<br />
<strong>Die</strong> unmittelbaren – aber auch längerfristigen – Handlungsspielräume benachteiligter<br />
Kinder sind in der Regel stark eingeschränkt:<br />
• <strong>Die</strong> Eltern sind oft unsicher, hilflos und nicht in der Lage, ihre Kinder bildungsmäßig<br />
ausreichend zu fördern und zu unterstützen. Professionelle Angebote von außen sind<br />
nicht realisierbar, weil sie sie nicht finanzieren können.<br />
• <strong>Die</strong> Kinder finden kaum Unterstützung in der Schule.<br />
• Es besteht Unsicherheit im Umgang mit anderen Menschen. Es fehlen oft klare<br />
Strukturen und Planungsverhalten bzw. die Fähigkeit zu planen.<br />
• <strong>Die</strong> Eltern "kennen" in der Regel gesellschaftliche Normen und Werte und an sie gestellte<br />
Erwartungen, können ihnen aber oft nicht entsprechen:<br />
o Es besteht ein Bruch zwischen Wissen und Handeln.<br />
o Sie haben Probleme bei der Vermittlung an die Kinder.<br />
o Sie bieten den Kindern keine adäquaten Modelle.<br />
• <strong>Die</strong> Schüler werden ohne oder mit einem schlechten Bildungsabschluss ausgeschult.<br />
Dadurch sind ihre Möglichkeiten für Ausbildung und Beruf erheblich eingeschränkt.<br />
"<strong>Die</strong> haben weitaus geringere ... Chancen als der Durchschnitt ... ihres Jahrgangs, höhere<br />
Bildungsabschlüsse zu erzielen – aber nach wie vor ist es so, dass höhere<br />
Bildungsabschlüsse das Eintrittstor in eine vielfältige und optimalere ... Ausbildungs- und<br />
Berufssituation sind." Mit der nur sehr geringen Möglichkeit, eine weiterführende Schule zu<br />
besuchen "sind auch die Berufs- und Einkommensmöglichkeiten der zweiten und dritten<br />
Generation deutlich eingeschränkt."<br />
Benachteiligte Familien "der ersten Generation", insbesondere wenn die Eltern (Mütter) über<br />
eine relativ gute Schulausbildung verfügen, suchen vielfach nach alternativen Förderungen,<br />
z. B. im Hort oder einer Einrichtung der offenen Kinder- und Jugendarbeit. "Ich glaube, wenn<br />
Familien begriffen haben, dass Bildung ein Schlüssel sein kann, aus der benachteiligten<br />
Lage herauszukommen, d. h. eine Möglichkeit sehen, einen hohen Schulabschluss zu<br />
erreichen und damit eine entsprechend qualifizierte Ausbildung, gibt es welche, die das<br />
hinkriegen. <strong>Die</strong> sind dann auch so organisiert."<br />
Eltern und Kinder entwickeln aufgrund der Schwierigkeiten im Bildungsbereich<br />
unterschiedliche Kompensations- und Bewältigungsstrategien.<br />
Eltern nehmen sich selbst oft – bezogen auf die Bildungssituation ihrer Kinder und in ihrer<br />
Stellung gegenüber dem "System Schule" – als hilflos und ohnmächtig wahr. Sie zeigen<br />
dann vielfach ein Verhalten, mit dem sie der Situation ihrer Kinder wenig gerecht werden<br />
können:<br />
• Laisser-faire-Verhalten, z. B. bei<br />
o Schuleschwänzen<br />
o Weglaufen<br />
o Suchtverhalten, z. B. Alkohol- und Drogenmissbrauch der Kinder und Jugendlichen<br />
• Bestrafungen, z. B. Schlagen, Verbote<br />
• "Zuckerbrot und Peitsche"<br />
• ignorieren und verleugnen von Problemen.<br />
80
Manchmal variieren die Verhaltensweisen von Phasen der Bestrafung und Resignation zu<br />
aktiven Phasen, in denen Eltern versuchen, Hilfe und Unterstützung für ihre Kinder zu<br />
erhalten.<br />
<strong>Die</strong> Kinder/ Schüler kompensieren Frustrationen und Trauer über erfahrene Demütigungen<br />
und Ausgrenzungen häufig durch unangepasstes, rebellisches Verhalten. Sie werden<br />
aggressiv und gelegentlich auch gewalttätig – häufig aus Angst, "abgebügelt" zu werden.<br />
Im Gegensatz dazu stehen Kinder, die auf jeden Fall die Schule gut absolvieren wollen.<br />
Insbesondere wenn sie durch ihre Eltern und/ oder Lehrer Bestätigung und Unterstützung<br />
erfahren, strengen sie sich sehr an, um gute Leistungen zu bringen. Gelegentlich entwickeln<br />
sie dann Formen von "Überangepasstsein" und einen extremen Ehrgeiz.<br />
Bei dem Besuch einer höheren Schule versuchen Jugendliche häufig aus der Familie<br />
herauszukommen – insbesondere wenn das "Familienklima" nicht anerkennend und<br />
unterstützend, sondern womöglich mit Gleichgültigkeit auf ihre Anstrengungen reagiert.<br />
Einschränkende und zum Teil demütigende Erfahrungen, die arme und benachteiligte<br />
Schüler während ihrer Schulzeit machen, haben Auswirkungen auf ihre Identität und<br />
Personalität. Einige Aussagen werden hier stichwortartig wiedergegeben:<br />
• In direktem Kontakt mit Bildungseinrichtungen reagieren sie oft mit dem Gefühl der<br />
Ohnmacht.<br />
• Sie sind vielfach misstrauisch gegen über der Schule und entwickeln Schulangst.<br />
• Ihre Motivation zum Schulbesuch vermindert sich, insbesondere wenn sie Demütigungen<br />
– z. B. durch "öffentliche" Bloßstellung erfahren haben.<br />
• Sie haben meistens ein unsicheres Selbstbild und geringes Selbstwertgefühl.<br />
• Sie fürchten die Konfrontation mit Mitschülern, insbesondere bei Auseinandersetzungen,<br />
die ihre Armut berühren.<br />
• Es fehlen Anstöße, aber auch Wissens- und Handlungskompetenzen, Bildungs- und<br />
kulturelle Angebote für sich als angemessen, interessant und anregend wahrzunehmen.<br />
• Es ist kaum Motivation vorhanden – u. a. wegen fehlender Ermutigung und fehlendem<br />
"Zutrauen" – an "höherer Bildung" teilzunehmen.<br />
• Sie entwickeln häufig die Identität sowohl als Versager als auch als Verlierer.<br />
• Sie suchen und finden Cliquen, in denen "andere" Normen und Regeln gelten.<br />
• In der Regel haben sie ein gutes Gefühl für Situationen – und zeigen damit in einem<br />
hohen Maße Reflexionskompetenzen – ohne sich ggf. aus den entsprechenden<br />
Situationen befreien, sie managen zu können.<br />
Ausbildungs- und Arbeitssituation<br />
Mehrere Gesprächsteilnehmer haben im Zusammenhang mit Angaben zur Bildungssituation<br />
darauf hingewiesen, dass fehlende oder schlechte und niedrige Bildungsabschlüsse die<br />
Chance, einen Ausbildungs- oder Arbeitsplatz zu erhalten, stark reduzieren. <strong>Die</strong>sen<br />
Jugendlichen werden praktisch nur noch sehr unqualifizierte "Jobs" angeboten; "... die<br />
Anforderungen in den Berufen steigen." Auch bei Facharbeitern werden Computerkenntnisse<br />
gefordert. "Das setzt technisches Verständnis und eine relativ hohe Lesekompetenz voraus."<br />
<strong>Die</strong> meisten Experten haben sich bei der Lebenslage umfassend zur Bildungssituation und<br />
nur recht begrenzt zur Ausbildungs- und Arbeitssituation geäußert.<br />
81
<strong>Die</strong> Experten in den Gruppendiskussionen, die z. B. Schüler in Schulpraktika in einem<br />
integrierten Schulprojekt begleiten und in der OKJA mit benachteiligten Jugendlichen<br />
zusammenarbeiten, haben einige weitergehende Angaben gemacht, die hier – überwiegend<br />
in Stichworten zusammengefasst – wiedergegeben werden.<br />
<strong>Die</strong> Ausbildungs- und Beschäftigungssituation armer und benachteiligter junger<br />
Menschen ist vielfach durch folgende Faktoren gekennzeichnet:<br />
• Ihre schlechten Bildungsabschlüsse erschweren bzw. verhindern eine Berufsausbildung.<br />
• Fast nie gelingt ein bruchloser Übergang von der Schule in ein Arbeitsverhältnis.<br />
• Ihnen fehlen oft Modelle für die Realisierung von Erwerbsarbeit.<br />
• "Arbeit" und die mit einem Arbeitsplatz verbundenen Anforderungen und<br />
"Schlüsselqualifikationen" sind ihnen vielfach unbekannt bzw. sie verfügen über kein<br />
entsprechendes Handlungspotenzial.<br />
• Viele machen schon sehr früh die Erfahrung von Arbeitslosigkeit.<br />
• Wenn sie Arbeit finden, ist diese in der Regel<br />
o wenig qualifiziert,<br />
o nicht attraktiv,<br />
o niedrig entlohnt.<br />
• Es gibt nur ein sehr reduziertes Angebot unterschiedlich geeigneter Jobs – inzwischen<br />
werden ihnen u. a. 1-Euro-Jobs angeboten.<br />
• Durch die ihnen im Einzelfall angebotenen Arbeitsplätze erhalten sie weder ein besseres<br />
Prestige noch einen Statusgewinn.<br />
<strong>Die</strong> meisten benachteiligten jungen Menschen haben nach ihrem Schulabschluss kaum eine<br />
Chance, ihre ökonomische und materielle Situation so zu gestalten, dass sie ohne (auch<br />
ergänzende) Transfermittel am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können. Häufig sind die<br />
Eltern schon über einen langen Zeitraum arbeitslos. Viele dieser Jugendlichen sind von<br />
Kindheit an daran gewöhnt, unter den Bedingungen von Arbeitslosen- bzw. Sozialhilfe zu<br />
leben.<br />
• Ihnen fehlen oft Modelle für die Realisierung von Erwerbsarbeit.<br />
• Arbeit und die mit einem Arbeitsplatz verbundenen Anforderungen und<br />
"Schlüsselqualifikationen" sind ihnen vielfach unbekannt bzw. sie verfügen über kein<br />
entsprechendes Handlungspotential.<br />
Eine fehlende Integration in einen Arbeitsprozess beeinflusst auch die soziale Integration<br />
benachteiligter junger Menschen in informelle und formale Netzwerke in der Regel negativ.<br />
• Sie sind häufig isoliert.<br />
• Sie verfügen meistens über keine sozialen Netze, auf die sie in Krisensituationen<br />
„zurückgreifen“ können.<br />
• Sie ziehen sich vollständig zurück und versuchen dadurch vielfach, einer Ausgrenzung<br />
von außen durch Selbstausgrenzung zuvorzukommen.<br />
• Alternativ suchen und finden sie Zugang zu gesellschaftlich nicht anerkannten Gruppen.<br />
<strong>Die</strong> Handlungsspielräume dieser Betroffenengruppe sind in der Regel sehr gering:<br />
• <strong>Die</strong> (tatsächlichen oder vermeintlichen) Anforderungen der Ausbildungs- bzw.<br />
Arbeitsplätze werden als zu große Hürde empfunden – sie antizipieren ihr Scheitern.<br />
• Da sie nicht gewohnt sind zu arbeiten, schaffen sie es oft nicht, den physischen und<br />
arbeitstechnischen Anforderungen eines Arbeitsplatzes gerecht zu werden.<br />
• Aufgrund ihrer geringen beruflichen Qualifikation können sie in der Regel nur<br />
Hilfstätigkeiten ausführen, die sehr schlecht bezahlt werden. Trotz Erwerbsarbeit können<br />
82
von ihnen auch die gesellschaftlich als normal angesehenen Konsumgüter nicht erworben<br />
werden.<br />
Durch die hier aufgezeigte Situation bestimmt, entwickeln diese jungen Menschen<br />
verschiedene Kompensations- und Aktionsformen:<br />
• Sie wissen kaum um ihre potentiellen Fähigkeiten, weil sie nicht angeregt/ angeleitet<br />
wurden, sie zu entwickeln und/ oder weil sie darin nicht bestärkt und anerkannt wurden.<br />
Das führt oft dazu, dass sie sich nicht viel zutrauen.<br />
• Nichtintegration in den Arbeitsprozess führt häufig zu einer "Flucht" in die Krankheit<br />
(psychosomatische Erkrankungen).<br />
• <strong>Die</strong> Zahl minderjähriger junger Frauen, die schwanger werden, wächst. Durch die<br />
Mutterrolle erhalten sie einen Status und Anerkennung. Ihre "Arbeitslosigkeit" ist<br />
gesellschaftlich akzeptiert.<br />
• Gelegentlich haben Arbeitslosigkeit und materielle Armut – insbesondere bei<br />
Jugendlichen – Eigentumsdelikte zu Folge. Gewünschte und nicht bezahlbare Güter<br />
werden entwendet.<br />
In unserer stark materiell ausgerichteten Leistungsgesellschaft sind sowohl Status und<br />
Prestige, als auch individuelle Zufriedenheit und Wohlbefinden sehr stark mit dem Platz in<br />
der Arbeitswelt verbunden. Vielfach definieren sich Menschen über ihre Position am<br />
Arbeitsplatz. Ist dieser Teil des Lebens nicht oder nur partiell ausgefüllt und wenig<br />
gewünscht und anerkannt, so hat das Auswirkungen auf die Identität und Personalität<br />
der Betroffenen:<br />
• Arbeit wird nicht als sinnstiftend empfunden.<br />
• Es werden wenig Chancen für eine Verbesserung der materiellen und sozialen Lage<br />
gesehen – es entwickelt sich Perspektivlosigkeit.<br />
• Eine Möglichkeit, auf normalem und legalem Wege aufzusteigen, ist in der Regel für sie<br />
nicht gegeben, sie verbleiben meistens in ihrem eigenen Herkunftsmilieu.<br />
• Sie erfahren Deprivation als "Normalität".<br />
Zum Teil überschätzen sie aber auch ihre eigene Situation – ihre Eigen-Wahrnehmung passt<br />
nicht zur ihrer Realität.<br />
Jugendarbeitslosigkeit bedeutet für die davon betroffenen jungen Menschen Isolierung aus<br />
dem gesellschaftlichen und politischen Leben. <strong>Die</strong> eingeschränkte materielle und soziale<br />
Situation beschleunigt den Demoralisierungsprozess, d. h. ihre psychische, geistige und<br />
körperlich Beeinträchtigung.<br />
"Fehlende materielle Mittel, die zu einer Existenz unterhalb des gesellschaftlich erreichten<br />
Lebensniveaus führen, können zur nahezu völligen Isolation oder auch zum Abgleiten in<br />
Subkulturen (Banden, Drogen etc.), eventuell auch in die Jugendkriminalität führen." 1<br />
Der soziale Abstieg vollzieht sich bei jugendlichen Arbeitslosen angesichts des mangelhaften<br />
Systems der sozialen Sicherung sehr schnell: sie begegnen uns dann oft wieder in ihren<br />
Rollen als jugendliche Prostituierte, Strichjungen, Trebegänger, bettelnde Jugendliche,<br />
jugendliche (Berufs-) Kriminelle. Es ist ein Zusammenhang zwischen Jugendarbeitslosigkeit<br />
einerseits und Kriminalität, Alkoholismus, Drogenabhängigkeit und Obdachlosigkeit<br />
andererseits festzustellen.<br />
1 von der Haar, H., Stark-von der Haar, E., Jugendarbeitslosigkeit und soziale Sicherheit, Berlin 1982, S. 182<br />
83
Gesundheit/ Ernährung<br />
"Gesundheit ist ein ganz wichtiger Bereich [für die Entwicklung von Kindern]. Arme sind<br />
signifikant benachteiligt, tragen ein höheres Risiko, chronisch zu erkranken." Höhere<br />
Stressoren, "ungünstige" Ernährung und schlechte Wohnbedingungen haben u. a.<br />
erheblichen Einfluss auf die gesundheitliche Situation.<br />
Häufig anzutreffende Mangelernährung – sowohl bezogen auf die Quantität als auch auf die<br />
Qualität – kann zu "sozialem" Minderwuchs aber auch zu Adipositas führen. "...Obst-,<br />
Gemüse- und Milchproduktpreise sind bei einem Einkommen auf Sozialhilfeniveau zu hoch."<br />
Es besteht vielfach Unwissenheit, um preisgünstig saisonal heimisches Obst und Gemüse<br />
einzukaufen und zu verwerten. Häufig sind die Mahlzeiten nicht so beschaffen, "dass man<br />
das als gute Ernährung bezeichnen könnte.<br />
• Häufig fehlt die Fähigkeit, das Geld sachgerecht für gesunde Ernährung auszugeben.<br />
• Vielfach werden Mahlzeiten nicht gemeinsam eingenommen.<br />
• Kinder bekommen oft Geld, um sich etwas zum Essen zu kaufen und setzen es dann<br />
[meistens] in Fast Food etc. um<br />
o sehr einseitige Ernährung<br />
o führt [relativ häufig} zur Fettleibigkeit der Kinder."<br />
"In Kitas und Schulen wird oft festgestellt, dass Kinder morgens ohne Frühstück in die<br />
Schule kommen."<br />
Viele Kinder bewegen sich kaum noch; Toben, Klettern etc. ist relativ selten. Inzwischen gibt<br />
es Erkenntnisse darüber, dass ein Mangel an Bewegung nicht nur Auswirkungen auf die<br />
intellektuelle Entwicklung hat, sondern auch auf Beeinträchtigungen, die in der Regel als<br />
Aufmerksamkeits-Defizit-Syndrom (ADS) oder als Hyperaktivität diagnostiziert werden.<br />
<strong>Die</strong> medizinische Versorgung wird als schlecht abgesichert und defizitär bezeichnet.<br />
"Normale Impfungen und Untersuchungen finden nicht statt." Zahnärzte werden nur selten<br />
oder viel zu spät aufgesucht. <strong>Die</strong>ser Sachverhalt und das häufige "Naschen" von<br />
Süßigkeiten führt bei vielen armen Kindern dazu, dass sie "Zeit ihres Lebens" schlechte<br />
Zähne haben. "<strong>Die</strong> Qualität der Versorgung im Gesundheitssystem ist reduziert. Wir wissen<br />
aus empirischen Erhebungen, dass die 'wenig Gebildeten' kürzere Gesprächszeiten in der<br />
Arztpraxis haben – sie werden weniger beraten."<br />
<strong>Die</strong> hier dargestellten Phänomene stehen in engem Zusammenhang mit der ökonomischen<br />
und materiellen Situation armer und benachteiligter Familien:<br />
• Für eine gesunde, vitaminreiche Ernährung fehlt oft das Geld.<br />
• Kindern fehlt im Winter häufig angemessene warme Kleidung.<br />
• Leben in benachteiligten Quartieren bedeutet vielfach auch hohe gesundheitliche<br />
Belastungen, z. B.<br />
o Verkehrslärm durch Autos, Eisenbahnen und Fluglärm<br />
o Luftverschmutzung, u. a. durch Industrie- und Müllanlagen.<br />
• Fehlende Spiel- und Sportaktivitäten<br />
o Beiträge für Vereine, aber auch Eintrittsgelder können meistens von Einkommen auf<br />
Sozialhilfe-/ Hartz IV-Niveau nicht bezahlt werden<br />
o Spielplätze haben oft keinen Anreizcharakter oder werden z. T. stillgelegt.<br />
• Schlechte gesundheitspolitische Absicherung.<br />
84
• Bestehende Ansprüche, z. B. Kinderkuren, werden nicht realisiert, u. a. wegen fehlender<br />
handlungsrelevanter Informationen oder wegen Ängsten oder Unbehagen, sich als<br />
"bedürftig" outen zu müssen.<br />
• Auch kostenlose Angebote – z. B. von einigen Sportvereinen – werden nicht<br />
wahrgenommen, u. a. "da erwartet wird, dass mal etwas mitgebracht wird, einfach mal<br />
ein Kuchen ...".<br />
<strong>Die</strong> soziale Integration wird u. a. dadurch beeinträchtigt, dass in der Regel von den armen<br />
jungen Menschen weder Mitgliedsbeiträge noch die in Vereinen üblichen "normalen<br />
Gepflogenheiten" (z. B. Kuchen mitbringen) bezahlt werden können. Das hat vielfach<br />
"Rückzugsverhalten" zur Folge, was – sofern es häufiger vorkommt – zu Diskriminierungen<br />
und Ausgrenzungen führt.<br />
Es ist eine Wechselbeziehung von dem Gesundheitszustand sowie dem Erscheinungsbild<br />
und Anerkennung und Integration einerseits versus Stigmatisierung und Ausgrenzung<br />
andererseits festzustellen. "Kinder mit körperlichen Auffälligkeiten oder mit Adipositas<br />
werden ausgegrenzt ... und stark diskriminiert." Exklusion korreliert stark mit dem<br />
Selbstwertgefühl dieser Kinder und Jugendlichen, besonders in der Schule. "In dem Moment,<br />
wo sie selbstbewusst sind – auch dicke ... Schüler – und sagen: 'Jetzt ist es aber gut ...',<br />
trauen die anderen sich nicht mehr. Haben sie ein mangelndes Selbstbewusstsein, ist das<br />
so, dass sie sich zurückziehen und dann können die anderen auch draufhauen."<br />
<strong>Die</strong> Handlungsspielräume armer und benachteiligter junger Menschen und ihrer Familien<br />
sind in der Regel sehr eingeschränkt:<br />
• <strong>Die</strong> meisten haben nur geringe Kenntnisse über gesunde Ernährung – sie verfügen in der<br />
Regel auch über keine Vorbilder.<br />
• Sie haben kaum Möglichkeiten, angemessen einzukaufen, planerisch mit Geld<br />
umzugehen und eine preiswerte und gesunde Ernährung ihrer Kinder sicherzustellen.<br />
• Eine gute medizinische und therapeutische Versorgung ist ebenso wie<br />
Gesundheitsvorsorge aufgrund des eingeschränkten Versicherungsschutzes und<br />
fehlender Mittel für die Übernahme anfallender Kosten vielfach nicht gewährleistet.<br />
Weitere Einschränkungen der Handlungsspielräume im Gesundheits- und<br />
Ernährungsbereich korrespondieren mit der Erosion in Familien: Wenn die "Festigkeit in der<br />
Familie ... nicht mehr stimmt, wenn zusätzliche Probleme wie Alkohol, Drogen, Trennung<br />
oder sonstwas dazu kommen, dann wird es zu Problemen kommen ...".<br />
Aktionsformen der Betroffenen spiegeln häufig ihre Hilflosigkeit und ihr Gefühl der<br />
Ohnmacht wider:<br />
• Sie kaufen ungeprüft Produkte, die "gut sein sollen".<br />
• Medizinische Versorgung wird häufig erst in einer akuten Krankheitssituation genutzt. <strong>Die</strong><br />
Eltern machen sich oft zwar Sorgen um den Gesundheitszustand ihrer Kinder, schaffen<br />
es aber meistens nicht rechtzeitig, die nötigen Schritte zu tun – vielfach muss dann ein<br />
Notarzt gerufen werden.<br />
• Ein relativ hoher Anteil der Betroffenen versucht, durch Suchtverhalten die Problematik<br />
"auszublenden". Neben Rauchen und Alkoholmissbrauch kann es zu unkontrolliertem<br />
Fernsehkonsum und Spielsucht kommen.<br />
Ängste und Unsicherheit haben Auswirkungen auf die Identität und Personalität der<br />
Betroffenen. Das zeigt sich besonders in ihren Beziehungen zu Vertretern des<br />
Gesundheitssystems:<br />
• Sie haben den Eindruck, dass Ärzte sie "barsch" behandeln.<br />
• Benachteiligte Patienten und Ärzte haben keine gemeinsame Sprache.<br />
85
• <strong>Die</strong> Asymmetrie der Beziehung wird vielfach gegenüber diesen Patienten "ausgespielt".<br />
<strong>Die</strong> Reaktionen der Betroffenen auf entsprechende Erfahrungen sind dann häufig:<br />
• Rückzug, Vermeidung entsprechender Situationen<br />
• psychische Beeinträchtigungen/ Erkrankungen wie Sucht, depressives Verhalten bis hin<br />
zur Suizidgefahr<br />
• "Flucht in Religiosität".<br />
Urlaub und Freizeit<br />
Urlaub und Freizeit sind bedeutsam zur Erholung, um "abschalten" zu können, um neue und<br />
vielfach auch andere (als die alltäglichen) Kontakte zu knüpfen, etwas Interessantes zu<br />
erleben, Erfahrungen zu machen, Anregungen zu erhalten. <strong>Die</strong>ser Bereich des Lebens ist für<br />
arme und benachteiligte junge Menschen und ihre Familien nicht relevant. Urlaubsreisen und<br />
Freizeitaktivitäten, die mit Kosten verbunden sind, sind extrem selten oder finden nicht statt.<br />
Mit entsprechenden Aktivitäten einhergehende Erfahrungen und Lernprozesse werden nicht<br />
gemacht.<br />
<strong>Die</strong> Auswirkungen der ökonomischen und materiellen Situation armer und<br />
benachteiligter junger Menschen werden schnell offensichtlich. In der Regel sind weder die<br />
Wohnung noch das Wohnumfeld so gestaltet, dass sie einen angemessenen Rahmen für<br />
Freizeitaktivitäten bieten. Weitere Argumente, die auf Einschränkungen hinweisen:<br />
• Urlaub "findet kaum statt" – selten fahren sie für eine paar Tage auf einen Campingplatz.<br />
<strong>Die</strong> Kinder nehmen gelegentlich an Maßnahmen des Jugenderholungswerkes o. ä. teil.<br />
• Finanzen für Freizeitangebote, z. B. Beiträge für (Sport-) Vereine, Eintrittpreise für<br />
Kinobesuche und sonstige Veranstaltungen stehen nicht zur Verfügung.<br />
• <strong>Die</strong> Kinder haben (fast) nie ein Hobby wie Reiten, Tennis, Spielen eines<br />
Musikinstrumentes – allein der Unterricht, um es zu erlernen, ist für die Familien nicht<br />
finanzierbar.<br />
• Sie haben kein Geld für gemeinsame Unternehmungen mit Freunden.<br />
Durch diese Einschränkungen wird die soziale Integration dieser Kinder erheblich<br />
beeinflusst. Erfahrungen und Erlebnisse aus Urlaub und Freizeitaktivitäten können nicht in<br />
Gleichaltrigengruppen eingebracht und z. B. in Berichten und Aufsätzen in der Schule<br />
mitgeteilt werden, was sehr häufig zu einem Prestigeverlust, aber auch zu Diskriminierung<br />
und Ausgrenzung führt. Damit verbunden ist die Reduktion von Kontakten auf andere<br />
"eingeschränkte" Gruppen. Das bedeutet gleichzeitig eine Verminderung "normaler sozialer<br />
Beziehungen".<br />
Gelegentlich – in einigen Quartieren auch regelmäßig – nehmen Kinder an Freizeitaktivitäten<br />
und Urlaubsmaßnahmen, die von Einrichtungen der Jugendhilfe angeboten werden teil, z. B.<br />
von:<br />
• Abenteuerspielplätzen<br />
• Häusern der Jugend<br />
• Einrichtungen der HzE.<br />
<strong>Die</strong> Handlungsspielräume sind sehr eng; sie zu nutzen bedarf es in der Regel Phantasie,<br />
Selbstaktivität und Informationen, die nur begrenzt bei den jungen Menschen und in ihren<br />
Familien vorhanden sind.<br />
86
Gelegentlich wird der sogenannte "öffentliche Raum", z. B. in der Region III das Niendorfer<br />
Gehege, als "Erlebnispark" genutzt. Auch kostenlose Ferienmaßnahmen wie Fußball,<br />
Turnen, Trampolinspringen sowie Anleitung zur Freizeitgestaltung werden partiell<br />
beansprucht.<br />
Für die Kinder ausländischer Mitbürger bietet alle paar Jahre ein Urlaub bei ihren Familien in<br />
den Herkunftsländern eine "wünschenswerte" Abwechslung.<br />
<strong>Die</strong> geringen Handlungsmöglichkeiten im Urlaub und im Freizeitbereich haben häufig eine<br />
"Strukturlosigkeit des Alltags" zur Folge, die oft über die Ferienzeit hinaus virulent ist.<br />
Als Möglichkeit der Kompensation dieser Situation haben sich einige spezifische<br />
Aktionsformen – besonders bei benachteiligten Jugendlichen – herauskristallisiert:<br />
• "Rumhängen" am Bahnhof<br />
• Zeit in Geschäften verbringen, z. B. Spielwarengeschäften und im Mediamarkt etc.<br />
• Besuch von Geschäften für "junge Mode" (z. B. H&M u. ä.) und Anprobieren von<br />
Bekleidung<br />
• Entwicklung von "Suchtverhalten", z. B.<br />
o Kaufen, Konsum bei gleichzeitiger Gefahr der Überschuldung<br />
o Alkohol, Drogen<br />
o Spielsucht.<br />
Gelegentlich werden auch aktive Bewältigungsstrategien realisiert:<br />
• Angebote von Sommer- und Ferienprogrammen werden genutzt<br />
• gebrauchte und damit preiswerte "Freizeitartikel", z. B. Spiele und Geräte, werden<br />
gekauft<br />
• die Wohnung wird renoviert/ "schöner" gestaltet, um sie in der Folge "vorzeigen" zu<br />
können und sich wohl zu fühlen.<br />
Auch in dieser Dimension der Lebenslage wirken sich die Einschränkungen auf die Identität<br />
und Personalität der betroffenen jungen Menschen aus:<br />
• Sie haben kaum Möglichkeiten, Interessen zu entfalten, da Anregungen von außen<br />
fehlen.<br />
• Erfahrungen mit anderen Kulturen und "urlaubsorientiertem Verhalten" fehlen, was zu<br />
Einschränkungen von Wissen und Handlungsspielräumen führt.<br />
• Vielfach zeigt sich bei diesen jungen Menschen ein geschwächtes Selbstwertgefühl, was<br />
oft die Ausbildung aggressiver, aber auch resignativer Verhaltensweisen zur Folge hat.<br />
• Häufig baut sich Stress auf, da Erholung und Abwechslung fehlen.<br />
Kulturelle Vielfalt<br />
Im Zusammenhang mit der Frage nach Dimensionen der Lebenslage nahm der Bereich der<br />
"kulturellen Vielfalt" bei den Antworten nur einen rudimentären Raum ein. Aspekte zu diesem<br />
Lebensbereich wurden allerdings gelegentlich im Kontext mit anderen Schwerpunkten<br />
genannt; sie bezogen sich z. B. auf<br />
• den Zugang zu "klassischen Kulturgütern" wie Literatur, Musik, Theater<br />
• Stadtteilkultur<br />
• Wertvorstellungen<br />
• das Zusammenleben von jungen Menschen unterschiedlicher Ethnien und mit<br />
unterschiedlichen Kulturen in den Quartieren.<br />
87
Da die Aussagen in erster Linie kontextual mit anderen Themen gemacht wurden, werden<br />
hier exemplarisch einige Gesprächsausschnitte dargestellt, ohne Anspruch, damit der<br />
Komplexität dieser Dimension gerecht zu werden.<br />
Vielfach wurden junge Menschen als von kultureller Vielfalt ausgeschlossen dargestellt: "Der<br />
Verlust des Gefühls, zu dieser Gesellschaft zu gehören, führt zu Resignation und<br />
Aggressionen ... und zur Flucht in irrationale Traumwelten." Von kultureller Vielfalt sind sie zu<br />
einem großen Teil ausgeschlossen oder schließen sich selbst "dadurch aus, dass sie<br />
Stunden vor dem Fernseher sitzen, mit Videospielen umgehen ...".<br />
<strong>Die</strong> genannten Aktivitäten der benachteiligten jungen Menschen scheinen eher Auswirkung<br />
als Ursache der geringen kulturellen Teilhabe zu sein: In Familien, die über Bücher verfügen,<br />
Zugang zu klassischen Bildungsmitteln haben, zu denen auch Musik und Theater zu<br />
subsumieren sind, "herrscht ein anderes Bildungsniveau". "... Selbst wenn Interesse<br />
vorhanden ist, fehlt [bei benachteiligten Familien] ganz klar eine Zugangsmöglichkeit zur<br />
'Aneignung der Welt' ... ." Das gilt für die "Erreichbarkeit hochkultureller Angebote" wie<br />
Theater, Konzerte, aber auch Kino: "all diese Bereiche, die mit dem finanziellen Status<br />
verbunden sind oder mit der finanziellen Machbarkeit".<br />
Bezogen auf den Zugang zu Büchern wurde argumentiert, dass Bücherhallen ja geeignet<br />
seien, diesen Bedarf zu decken. Es wurde allerdings gleichzeitig angemerkt, dass die wieder<br />
beim Bildungsbürger ansetzen. "In einer bestimmten sozialen Schicht ist das überhaupt nicht<br />
der Blickwinkel, sich eintragen zu lassen, einen Mitgliedsausweis zu bekommen, den auch<br />
nicht zu verlieren und dann immer auch die Bücher zurückzubringen – das ist solch ein<br />
System, das die Bildungsbürger entwickelt haben."<br />
Im Rahmen der Gruppendiskussionen wurde weiter argumentiert, dass insbesondere Eltern,<br />
die schon "Sozialhilfeempfänger in der dritten Generation sind", Literatur und Lesen gar nicht<br />
als Wert ansehen und insofern es ihren Kindern auch nicht vermitteln können. <strong>Die</strong> Schulen<br />
versuchen, dieses Defizit zu kompensieren, indem sie meistens mit den 1. Klassen die<br />
Bücherhalle besuchen, dafür sorgen, dass alle Kinder einen Leseausweis erhalten und das<br />
Verfahren des Ausleihens kennenlernen.<br />
Am Beispiel von Theaterbesuchen, die von Seiten einer Schule für Schüler der 8. Klasse<br />
ermöglicht wurden, wurde versucht, den Hintergrund der Ablehnung durch eine Mutter zu<br />
erfassen. <strong>Die</strong> Mutter schrieb, dass sie davon nichts hält, dafür würde sie kein Geld<br />
ausgeben, sie sollten lieber in den Hansapark fahren.<br />
Das Verhalten der Mutter wurde diskutiert, sowohl unter dem Blickwinkel ihres möglichen<br />
kulturellen Verständnisses als auch von Verhaltensweisen, die im Zusammenhang mit dem<br />
Besuch eines Theaters tatsächlich erwartet würden oder eventuell von der Mutter vermutet<br />
werden, für die es in der Familie aber keine Sicherheit gibt. Ein weiteres Argument: "Für mich<br />
ist eine Erfahrung, die ich mit Eltern gemacht habe, die 'aus der Ecke kommen': die haben<br />
auch Angst vor der Überforderung, wenn ihr Kind nach solch einem Erlebnis erstens mit dem<br />
Wunsch nach Mehr kommt und zweitens mit dem Wunsch: 'Erklär mir diesen Teil der Welt.'<br />
Den hat die Mutter aber für sich selbst nie erschließen können. Sie kann ihn nicht erklären –<br />
das macht ihr einfach Angst."<br />
<strong>Die</strong> Teilnahme an einem kulturellen Leben im Stadtteil wird unterschiedlich beurteilt. So<br />
wird darauf hingewiesen, dass das "was in manchen Stadtteilen als Stadtteilkultur oder auch<br />
Kinderkultur etc. zelebriert wird ... häufig an diesen Familien vorbei (geht). Sie sind so<br />
isoliert, dass sie das nicht wahrnehmen, dass sie das gar nicht für sich als spannend, als<br />
relevant oder als irgendwie interessant ansehen. Ich weiß nicht, ob das damit<br />
zusammenhängt, dass sie ... Ankündigungen ... nicht wahrnehmen."<br />
88
Andererseits wurde berichtet, dass es in den verschiedenen Stadtteilen sehr<br />
unterschiedliche räumliche "Beziehungsgeflechte" gibt. "Es gibt Beziehungen, die laufen<br />
unheimlich gut – Beispiel Osdorfer Born, Beispiel Eidelstedt – wo durch ein hohes<br />
Engagement von Schule, von Kultur, von Wohnungsunternehmen, von freiwilligen Helfern<br />
und diesen Quartiersentwicklern ganz viel passiert. Das kommt bei den Menschen auch an.<br />
Das ist nicht so, dass man sagt, das ist irgendein Überbau und darunter wuchert was,<br />
sondern das sind ganz wichtige Ansätze. Es gibt andere Stadtteile, die einfach darunter<br />
leiden, dass sie nie im Fokus des Interesses waren ... . ....Billstedt war nie im Fokus<br />
irgendeines Interesses. Wir haben diese Probleme ... in Kirchdorf zum Teil. Wir haben sie im<br />
Neuwiedental sehr stark – wo das aber auch schon ein bisschen auseinander fließt zwischen<br />
einerseits sehr großen Aktivitäten und andererseits einer Bevölkerungsschicht, die nicht<br />
erreicht wird."<br />
Das Zusammenleben in den Stadtteilen und Quartieren wird auch im Kontext fehlender<br />
kultureller Werte beurteilt. Eine "Kultur der Gemeinschaft, z. B. wechselseitige<br />
Unterstützung" hat für sehr viele Menschen keinen Stellenwert mehr. Soziale Verantwortung<br />
und die Wertschätzung "des Anderen" gelten eher als antiquiert. Allerdings wird auch auf die<br />
Notwendigkeit der "Rückeroberung alter Werte" hingewiesen. Dabei geht es nicht um eine<br />
"blinde" Kopie alter Werte, sondern um eine reflektierte Auswahl als Antwort auf die jetzige<br />
Situation: "Wir haben ja aus meiner Sicht keine Werte und Normen außer dem Konsum. Der<br />
Konsum ist ... der wichtigste Wert überhaupt in unserer Gesellschaft ... . <strong>Die</strong>ser Wert wird ja<br />
auch von Leuten, die nur wenig konsumieren können, übernommen. Wenn sie in dem Bild<br />
bleiben, sind sie wirklich arm... . Ich hoffe ja, dass sich durch die Zuspitzung der sozialen<br />
Gegensätze immer mehr Leute für sich sagen: Ich lehne den Konsum ab. ... Ich habe jetzt<br />
andere Werte."<br />
Migrantenfamilien haben oft noch ein anderes Verständnis – die in vielen Familien "gelebten<br />
Werte", die Tradierung ihrer aus dem Heimatland mitgebrachten Kultur, bietet ihnen vielfach<br />
Sicherheit und Stärke in einer oft "unverständlichen Welt".<br />
Werden Fremde/ Angehörige anderer Ethnien von der Erwachsenen oft als "Konkurrenten"<br />
angesehen und ihr "Anders-sein" als befremdend abgelehnt, so gestaltet sich das<br />
Zusammenleben junger Menschen unterschiedlicher Ethnien und unterschiedlicher<br />
Kulturen relativ problemlos. Vorurteile der Eltern werden zwar gelegentlich verbal wiederholt<br />
– im alltäglichen Verhalten gibt es aber wenig Schwierigkeiten. Wenn "Fremde", z. B. durch<br />
"Vertreter von Institutionen beeinträchtigt" werden, kommt es zum Teil zu solidarischem<br />
Verhalten und zur Bildung von Koalitionen. Trotzdem gibt es Widersprüche: Verbal kommt es<br />
gelegentlich zu Kränkungen/ Anmache – im tatsächlichen Umgang gibt es aber relativ viele<br />
gemeinsame Aktionen, z. B. beim Sport oder beim Hören und Machen von Musik.<br />
Jugendliche nehmen zum Teil ohne Vorurteile "kulturelle Güter" anderer Gruppen auf und<br />
entwickeln eigene kulturelle Standards. Sie sehen sich selbst generell als Subkultur an –<br />
häufig, weil sie Ausgrenzungen erfahren haben. Insgesamt zeigen sie weniger<br />
Berührungsängste.<br />
Grundsätzlich sind arme und benachteiligte junge Menschen von dem, was generell in<br />
unserer Gesellschaft als "kulturelle Vielfalt" verstanden wird, ausgegrenzt. Sie verbleiben<br />
überwiegend in ihrem Milieu und entwickeln ein "Zugehörigkeitsgefühl", das ihr<br />
Selbstkonzept stark prägt und Chancen einschränkt.<br />
89
Gesellschaftliche Teilhabe<br />
Über die Teilhabe armer und benachteiligter junger Menschen an gesellschaftlichen Gütern<br />
inklusive <strong>Die</strong>nstleistungen bzw. über ihre Exklusion wurde im Zusammenhang mit der<br />
Darstellung der verschiedenen Dimensionen ihrer Lebenslage bereits berichtet. Hier soll<br />
unter gesellschaftlicher Teilhabe/ Partizipation der Betroffenen, "die Chance verstanden<br />
werden, an Entscheidungen in verschiedenen Bereichen und auf unterschiedlichen Ebenen<br />
beteiligt zu werden." Benachteiligte junge Menschen sind z. B. Ziel von gesetzgeberischen<br />
und Planungsmaßnahmen, sie selbst sind in der Regel aber weder an der Zieldefinition noch<br />
an der Festlegung der Maßnahmen beteiligt.<br />
Es gibt kaum gesetzliche Bestimmungen, die Mitbestimmung zwingend erforderlich machen.<br />
"Wenn man die UN-Kinderrechtskonvention nimmt, haben wir da einen sehr hohen Anspruch<br />
und es gibt ja auch einige Bundesländer, da wird etwas getan." Hamburg gehört nicht dazu.<br />
"Es heißt: Wir machen eine so gute Kinderpolitik, wir brauchen das alles gar nicht – die<br />
Möglichkeiten, die darin liegen [z. B. aktivierende und motivierende Aspekte], werden<br />
sträflich vernachlässigt."<br />
Es werden allerdings auch Schwierigkeiten gesehen, geeignete Partizipationsformen für<br />
benachteiligte junge Menschen anzuwenden. "<strong>Die</strong> anderen haben ja immer noch durch ihre<br />
Eltern als Stellvertreter die Möglichkeit, im Bildungssystem, im Sozialsystem, im Nahraum<br />
etc. etwas für sich zu erreichen."<br />
Auf die Abhängigkeit zwischen der Realisierung gesellschaftlicher Teilhabe und dem<br />
Bildungsniveau wird aufmerksam gemacht: "Gesellschaftliche Teilhabe/ Mitwirkung und die<br />
Möglichkeit, sich verschiedene Lebensbereiche zu erschließen, ist abhängig von der<br />
Bildungssituation." Erforderlich ist, sich im gesamten politischen Raum nicht nur "als Objekt<br />
zu betrachten, mit dem etwas passiert, sondern auch bestimmte Dinge in die Hand zu<br />
nehmen."<br />
In den Regionen der "Sozialen Stadtentwicklung" wurde festgestellt – und das hat auch<br />
Niederschlag in Konzepten gefunden –, "dass es in Gebieten, die so geschnitten sind, dass<br />
dort nur die benachteiligte Bevölkerung erfasst wird, außerordentlich schwer ist, im Rahmen<br />
von Partizipation und Mitwirkung die Leute einzubeziehen". Informationseingaben werden<br />
von benachteiligten Bevölkerungsgruppen häufig nicht durchschaut. Ebenso können sie oft<br />
die Relevanz bestimmter Vorhaben bezogen auf ihre Lebenssituation nicht erkennen.<br />
Ein weiterer sehr wichtiger Grund für geringe Partizipationsbereitschaft liegt in der<br />
Lebenssituation der Betroffenen. Solange sie mit ihren finanziellen (materiellen), sozialen,<br />
physischen und psychischen Problemen belastet sind, ist kaum damit zu rechnen, dass sie<br />
versuchen, an übergeordneten Entscheidungsprozessen teilzunehmen. <strong>Die</strong>ser Sachverhalt<br />
mag auch die geringe Wahlbeteiligung benachteiligter junger Menschen erklären. Sie muss<br />
wahrscheinlich aber auch im Zusammenhang mit ihrer häufig anzutreffenden<br />
Perspektivlosigkeit und der fehlenden Erwartung, durch die Wahl etwas an ihrer Situation<br />
verändern zu können, gesehen werden.<br />
Ein weiteres Kriterium für ihre geringe gesellschaftliche Teilhabe muss darin gesehen<br />
werden, dass sie über keine "Machtmittel" zur Durchsetzung von Bedarfen und Interessen<br />
verfügen. Sie sind nicht oder nur selten organisiert und verfügen nur über begrenzte<br />
Artikulations- und Handlungskompetenzen. Nur gelegentlich fließen ihre Meinungen in<br />
Gremien ein – angefangen in der Kita und Schule bis hin zu kommunalpolitischen Gremien;<br />
sie vermuten, dass sie doch nichts beeinflussen können. Vertreter von Medien und Politik<br />
empfinden sie häufig als "aalglatt": Wo ist noch jemand, der von ihrer Situation "betroffen ist<br />
und für die Verbesserung ihrer Situation kämpft"?<br />
Eltern haben vielfach Angst, dass sich kritische Äußerungen – aufgrund ihres<br />
Abhängigkeitsverhältnisses – negativ auf ihre Kinder auswirken. Das korreliert mit dem<br />
90
Gefühl, dass sie nicht glauben, Veränderungen erreichen zu können. Bei<br />
Entscheidungsträgern, z. B. den Mitgliedern von Jugendhilfeausschüssen, fehlt der "Blick vor<br />
Ort". Entscheidungen erscheinen oft willkürlich und basieren eher auf eigenen Vorstellungen<br />
und Vermutungen als auf der Basis der von den Betroffenen artikulierten Bedarfe und von<br />
fachlichen und wissenschaftlichen Erkenntnissen.<br />
Unterschiedliche Lebenslagen, Wertvorstellungen und Normen führen zu einer mangelhaften<br />
Übereinstimmung der Ziel- und Problemdefinition zwischen Betroffenen, Experten und<br />
Entscheidungsträgern. Da es aber die Letzteren sind, die aufgrund ihrer Ziel- und<br />
Problemdefinitionen Programme bestimmen, kommt es häufig dazu, dass geplante und<br />
durchgeführte Maßnahmen von den Betroffenen entweder nicht beansprucht werden oder<br />
aber beansprucht werden, jedoch nicht dazu geeignet sind, die Problemsituation<br />
grundsätzlich zu beseitigen und zukünftig zu verhindern. Bisher sind Experten nur selten<br />
geneigt, Betroffene an der Ziel- und Problemdefinition und – damit verbunden – an der<br />
Programmentwicklung zu beteiligen.<br />
<strong>Die</strong> kaum vorhandene gesellschaftliche Teilhabe verstärkt die Gefühle der Ohnmacht und<br />
Chancenlosigkeit der benachteiligten jungen Menschen. Sie sehen sich auf der Seite der<br />
Verlierer, was zu einer weiteren Entmotivierung führt und zur Perspektivlosigkeit und<br />
Resignation beiträgt.<br />
Abschließend zwei Prämissen:<br />
• In einer demokratischen und sozialen Gesellschaft muss jeder Mensch in die Lage<br />
versetzt werden zur Teilnahme am ökonomischen, sozialen, kulturellen und politischen<br />
Leben der Gesellschaft.<br />
• Jeder Mensch wird nur dann seine Einstellungen und sein Verhalten verändern, wenn er<br />
seine Situation als veränderbar ansieht und für sich eine Perspektive erkennen kann.<br />
<strong>Die</strong> Aussagen der Experten zu den verschiedenen Dimensionen der Lebenslage armer und<br />
benachteiligter junger Menschen haben deutlich gemacht, dass materielle Armut –<br />
insbesondere wenn sie über einen längeren Zeitraum "wirkt" – Benachteiligungen der Kinder<br />
und Jugendlichen auch in anderen Bereichen zur Folge hat. Als besonders gravierend<br />
gestalten sich die Benachteiligungen im Bildungsbereich. Das Bildungssystem und die Art,<br />
wie es absolviert bzw. "durchlaufen" wird, prägt die Frage der "Exklusion versus Integration"<br />
der meisten benachteiligten Kinder und Jugendlichen und hat "nachhaltig" Auswirkung auf<br />
ihre zukünftigen Chancen zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und auf die Form ihrer<br />
Lebensgestaltung.<br />
3.4.2 Armut und Benachteiligung – gestaltende Elemente der Lebenswelt<br />
Wie wirken sich Armut und Benachteiligung auf die Lebenswelt der Betroffenen aus?<br />
Lebenswelt sollte hier verstanden werden als "die Form, wie Menschen im Alltag, in ihren<br />
sozialen Beziehungen und Netzen miteinander leben und welche Umgangs- und<br />
Bewältigungsmuster sie in 'Szenen ihres Lebens' entwickelt haben".<br />
Fast übereinstimmend wurde auf diese Frage zum Ausdruck gebracht, dass ein Leben unter<br />
den Bedingungen von Armut und Benachteiligung gravierende Auswirkungen auf Deutungs-<br />
und Verhaltensmuster der Betroffenen hat. In der Regel würden diese dann aber von<br />
"Institutionen und der Gesellschaft" nicht kontextual bewertet, sondern häufig als auffälliges<br />
und abweichendes Verhalten.<br />
Bedeutsam für die Gestaltung der Lebenswelt sind die subjektiven Deutungsmuster der<br />
Betroffenen. "Wenn man es runterbricht auf die Thematik Armut, dann kann man schon<br />
91
sagen, dass die Wahrnehmung der Wirklichkeit verändert wird in diesem Prozess, vor allem<br />
bei chronisch Betroffenen." <strong>Die</strong>se Deutungsmuster haben oft zwei Seiten. Das eine ist eine<br />
resignative Verweigerungshaltung, das andere eine Form der "Überanpassung an die<br />
'Armuts-Lebenslage' im Sinne einer sekundär geprägten Identität, etwa: 'Ich bin gerne<br />
obdachlos', oder: 'Ich bin gerne arbeitslos'. ... Ich identifiziere mich damit im Rahmen meiner<br />
sekundären Devianz, um mir das Ganze noch halbwegs erträglich zu machen."<br />
<strong>Die</strong>ser Sachverhalt wurde u. a. in einer Gruppendiskussion der "Experten auf der<br />
Handlungsebene" erörtert. Es ging um den Aspekt der "Normalität" in einer "nicht normalen<br />
Umwelt". Äußerungen wie: "Das ist doch ganz normal" sind bei benachteiligten Jugendlichen<br />
üblich. Ihr Selbstbild ist: "Mein Umfeld, meine Familie sind normal". "Kinder haben<br />
'Stimmigkeitserlebnisse' mit ihren Eltern und mit ihrem Umfeld. <strong>Die</strong>se passen überhaupt nicht<br />
mit dem zusammen, was [z. B.] Schule erwartet." Jugendliche äußern in der<br />
Zusammenarbeit: "Ich möchte nicht, dass Erwachsene [z. B. in Institutionen] kommen und<br />
mir sagen: 'Wie du lebst ist nicht normal'. Da ist eine ganz große Empfindlichkeit."<br />
Als Hintergrund für das Verhalten der Jugendlichen wird eine große Unsicherheit vermutet.<br />
<strong>Die</strong> Definition ihres Lebens als "normal" haben sie sich als "Panzer" aufgebaut, um<br />
Unsicherheit und Anforderungen, die erstmal als nicht erfüllbar erscheinen, "abwehren" zu<br />
können. "Ich schlage lieber zu, als dass ich geschlagen werde und mach das dann in<br />
meinem stillen Kämmerlein mit mir klar – oder mit Kumpels oder Freunden ... ."<br />
<strong>Die</strong> beiden Strategien – resignative Verweigerung und Überanpassung – sind Verzerrungen<br />
der "Wirklichkeitswahrnehmung", die aber auf der Basis "gelernter Erfahrungen" nicht mehr<br />
kontrolliert werden können und die "wenn sie Eigendynamik entwickeln auch zu immer<br />
weiteren Ausgrenzungen führen – oder zu der Identifikation mit dem 'Randgruppenstatus'."<br />
Dadurch wird auch die Motivation, andere Lebensentwürfe auszuprobieren, immer geringer.<br />
"Dann kommen wir und sagen: die wollen nicht. Im Grunde machen wir denen das, was wir<br />
[unsere Gesellschaft] mit ihnen gemacht haben, noch einmal zum Vorwurf. Das ist die<br />
Ungerechtigkeit." ...<br />
"Ich stelle es mir unendlich schwer vor, in einem solchen [Armuts-] Milieu aufzuwachsen und<br />
dann eine Gesellschaft vorzufinden, die ... latent erwartet: 'Nun versuch doch mal. Es gibt<br />
doch überall Möglichkeiten. Stell dich nicht so an'." ... "<strong>Die</strong> Kinder aus benachteiligten<br />
Familien müssen viel mehr Energien aufwenden, um den Normen der Gesellschaft zu<br />
entsprechen." Über die erforderlichen "zusätzlichen Energien" verfügen sie aber nicht. "Es ist<br />
für sie ungleich schwieriger als für Kinder, die in 'privilegierten' Stadtteilen aufwachsen."<br />
"Armut stigmatisiert, demütigt, macht elend" war der erste Satz einer Antwort auf die o. g.<br />
Frage. "Der Zusammenhang zwischen Herkunft und Lebenswelt inklusive Verhalten,<br />
Umgangsformen, Bewältigungsmuster ist in keinem Land so ausgeprägt wie in Deutschland."<br />
Defizite in der Ernährung, der Versorgung, Missachtung kindlicher Bedürfnisse, fehlende<br />
Anregung und Lernanreize zählen zur Erfahrungswelt armer Kinder.<br />
Der 11. Kinder- und Jugendbericht, aber auch der WHO Gesundheits-Survey<br />
"dokumentieren unmissverständlich die erheblichen negativen Konsequenzen einer<br />
Sozialisation unter Armutsbedingungen". Kinder mit niedrigem sozial-ökonomischen Status<br />
haben häufiger Sprachstörungen, körperliche Entwicklungsstörungen und psychische<br />
Auffälligkeiten. Kinder und Jugendliche reagieren mit seelischen Beeinträchtigungen auf<br />
unterprivilegierte Lebensbedingungen. Sie sind häufiger krank und von Krankheit und<br />
Behinderungen bedroht; sie weisen eine deutlich höhere Neigung zu Unfällen auf.<br />
<strong>Die</strong> materielle Unterversorgung der Eltern/ Sorgeberechtigten, die den jungen Menschen<br />
"Schutz und Unterstützung bieten sollen, hat gravierende Folgen für die psychosoziale<br />
Entwicklung. Sozioökonomische Mängellagen gehen einher mit Schulverweigerung,<br />
emotionalen Beeinträchtigungen und Delinquenz."<br />
92
Isolation und Ausgrenzung werden wiederholt als die bedeutsamsten Phänomene genannt,<br />
die die Lebenswelt der benachteiligten Jugendlichen prägen. Sie haben fast nur Kontakt "zu<br />
Menschen des gleichen Milieus. Damit verbunden ist ein Mangel an Vielfalt von<br />
Ausdrucksformen, von Orientierungen, die es Menschen leichter machen, in bestimmten<br />
Situationen adäquat reagieren zu können."<br />
Wenn man nur ein enges Spektrum an Verhaltensmustern erworben hat, "ist man immer auf<br />
das Wenige angewiesen, was einem zur Verfügung steht, z. B. wird bei auftretenden<br />
Konflikten häufig versucht, diese mit Gewalt zu lösen. Das geschieht in der Regel, wenn die<br />
jungen Leute zu früh nur auf diesen einen Faktor der 'Problemlösung' reduziert sind/ nur<br />
diesen gelernt haben. Es fehlen ihnen dann andere angemessene Formen der<br />
Konfliktbewältigung." "Das 'Prinzip Hoffnung' – es besteht noch der Eindruck, etwas an<br />
seiner Situation ändern zu können – ist bei benachteiligten jungen Menschen kaum<br />
vorhanden. Das hat dann häufig die Einstellung zur Folge: 'Warum soll ich mich noch<br />
anstrengen?' Das heißt, dass ein Mensch sich fallen lässt." Es entsteht die<br />
Selbsteinschätzung: "Ich bin kein aktiver Teilnehmer, der aktiv sein Leben gestalten kann."<br />
Das ist eine fatale Situation.<br />
<strong>Die</strong> Einbindung benachteiligter Jugendlicher in Peer Groups scheint in den letzten Jahren<br />
stark zurückgegangen zu sein. "<strong>Die</strong> Kinder sind nicht mehr gut in der Lage, auf Peer Groups<br />
zurückzugreifen." <strong>Die</strong> u. a. daraus resultierende "Isolation führt zu anderen<br />
Erscheinungsformen des Verhaltens: etwas darstellen, was man gar nicht ist oder zu<br />
gewalttätigen Formen greifen, um Stärke zu zeigen, Masken zu bauen".<br />
Es wird ein enger Zusammenhang zwischen dem Verhalten und den Handlungsstrategien<br />
der jungen Menschen und ihrem "Verbleiben" im eigenen Milieu gesehen. "Sie zeigen ein<br />
Verhalten, das vielfach als 'abweichend' bezeichnet wird – abweichend will ich gar nicht mal<br />
sagen, aber 'unvorteilhaft'."<br />
Benachteiligte junge Menschen zeigen zum Teil sehr unterschiedliche Deutungsmuster und<br />
Verhaltensweisen, mit denen sie versuchen, die häufig einschränkende, bedrückende und<br />
auch "bloßstellende" Situation auszugleichen oder auch abzuwehren. <strong>Die</strong> verschiedenen<br />
Formen ihrer Kompensation implizieren für die jungen Menschen eine subjektive Logik, "weil<br />
sie ihnen ein Stück weit Gleichgewicht bringen und Dinge erträglicher machen. <strong>Die</strong>se<br />
kompensierenden Strategien haben nach meiner Wahrnehmung unterschiedliche Qualitäten:<br />
• Zum einen ist es ein Arrangement mit Lebenslagen, die wir [sie] als bedrückend<br />
empfinden, also eine große Verzichtsbereitschaft, z. B. eine Umgruppierung von<br />
Ausgaben. Gerade bei Eltern beobachten wir oft, dass sie zugunsten der Kinder sparen,<br />
um ihnen noch etwas zu ermöglichen. Bis hin zu Situationen, in denen sie dann unterhalb<br />
unserer Armutsgrenze leben, um durch ihre 'Ressourcenaufteilung' ihren Kindern<br />
Teilhabe an bestimmten Aktivitäten und Gütern zu ermöglichen. Es wird hier kompensiert<br />
im Sinne eines Arrangements, sich einzurichten auf niedrigstem Niveau.<br />
• Das Zweite ... ist diese Grauzone, in der man sich Dinge besorgt über<br />
Gelegenheitstätigkeit, über Tausch. ... Tauschringe, Einkaufsmöglichkeiten und<br />
Ähnliches mehr. Das hat aber keine große ökonomische Bedeutung.<br />
• Das Dritte wäre dann auch die abweichende Karriere – wenn man sich holt, was einem<br />
[aus subjektiver Sicht] zusteht – was aber nicht verbreitet ist. Arme sind nicht häufiger als<br />
andere kriminell oder auffällig. ... <strong>Die</strong> These, dass Armut eine Erhöhung der Kriminalität<br />
begünstigt, ist falsch – die ist empirisch und statistisch nicht haltbar."<br />
Im Folgenden werden verschiedene Sichtweisen der Befragten zur Auswirkung von Armut<br />
und Benachteiligung auf die Lebenswelt der jungen Menschen wiedergegeben. Bei aller<br />
Differenziertheit spiegeln sie überwiegend die drei o. g. Phänomene wider.<br />
Eine von Kindern "manchmal genutzte Kompensationsmöglichkeit [ist es], Heimat außerhalb<br />
ihrer Familie zu suchen. Das können Verwandte oder ... Bekannte, Nachbarn und ...<br />
93
Netzwerke sein". ... "Was sie brauchen ist jemand, zu dem sie eine 'verlässliche Beziehung'<br />
haben können. Verlässlich, damit meine ich, dass sie – wenn sie mal 'Mist gebaut' haben –<br />
nicht sofort 'in die Wüste geschickt' werden und ihnen gesagt wird: 'Du bist ein böses Kind'<br />
oder Ähnliches." Es ist erforderlich, "dass sie dann immer noch Wertschätzung erfahren.<br />
Wenn sie die nicht in ihrer Familie bekommen, dann benötigen sie sie von einer anderen<br />
Stelle, um sich entwickeln zu können."<br />
Der Umgang mit benachteiligenden Situationen wird u. a. als alters- und<br />
geschlechtsabhängig beurteilt: Mädchen helfen häufig im Haushalt, wenn sie ohne "Job" sind<br />
– sie zeigen das "weibliche Helfersyndrom" und erlangen damit Anerkennung, "während es<br />
andere gibt, die verleugnen, ..., die sagen: 'Das ist ja gar nicht so schlimm. Man kann ja mit<br />
dem auskommen, was wir haben." Sie werden aber gleichzeitig "jeden Tag daran erinnert ...:<br />
'Wir können uns das nicht leisten ... . Ich kann dir das nicht kaufen'." Wenn das gelegentlich<br />
aus pädagogischer Sicht als richtig angesehen wird, "so ist es als ständiger Zustand für die<br />
Kinder fatal. ... Für mich ist das wie ein Kasten – man stößt immer gegen die Wand." ...<br />
"Kinder – wenn sie geboren werden – sind ja nicht bösartig, die sind ja nicht gewalttätig, die<br />
lügen nicht. <strong>Die</strong> wollen was wissen, ... , die wollen was erleben und auf einmal kommt da<br />
schon die erste Mauer, vielleicht auch gepaart mit Gewalt." Sie haben kein<br />
Selbstbewusstsein, sie mögen sich auch nicht gern, keiner sagt: "Du bist was Tolles." ...<br />
"Auch den Eltern sagt eben keiner: ... 'Mutter, du machst das toll mit deinen Kindern'."<br />
Deshalb können sie es auch nicht weitergeben. "<strong>Die</strong> [Kinder] verkommen ... emotional, die<br />
wissen gar nicht, wohin mit ihrer Wut."<br />
Benachteiligte junge Menschen "befinden sich in einer deutlich schwierigeren Situation als<br />
andere Teile der Gesellschaft, weil bei uns ... fast alles definiert wird über<br />
Konsummöglichkeiten ... . Wenn es da sehr knapp ist, dann wäre die Art und Weise, wie<br />
man mit Knappheit umgeht – vor allem auch, wie man das Soziale untereinander gestaltet,<br />
von besonders hoher Bedeutung." ... Es gibt Jungen, die versuchen "es ein Stück weit nach<br />
außen zu tragen, indem sie sich u. a. Ressourcen, die ihnen selbst nicht zugänglich sind ...,<br />
auf dem illegalen Weg besorgen." ... "Einige beginnen zu arbeiten, ... indem sie morgens mit<br />
der Mutter putzen gehen. ... Manche schämen sich ihrer Situation und versuchen, jeder<br />
Konfrontation mit diesem Thema aus dem Weg zu gehen."<br />
Der Begriff "Bewältigungsstrategie" wurde u. a. als wenig relevant angesehen:<br />
"Bewältigungsstrategien? Da gibt es nicht viel zu bewältigen, da sind nicht viele<br />
Möglichkeiten. ... Wenn man in seiner Würde richtig durch Armut gekränkt ist, dann gibt es<br />
nicht viele Handlungsmöglichkeiten:<br />
• 'Richtig krank zu werden' als Antwort auf Schwierigkeiten, die aus subjektiver Sicht nicht<br />
mehr zu lösen sind.<br />
• <strong>Die</strong> Möglichkeit, sich 'Parallelwelten' zu bauen durch kriminelle Milieus – also<br />
auszuweichen: 'Wenn ich mein Leben nicht durch 'ehrliche Arbeit' gestalten kann, dann<br />
muss ich es eben als Zuhälter auf St. Pauli machen.' ... Wir [Vertreter der Jugendhilfe]<br />
erleben dann, dass wir an unsere Grenzen stoßen.<br />
• Fluchttendenzen, Rückzug, Resignation, Krankheit, Aggressivität, Gewalt, Kriminalität –<br />
das sind die Bewältigungsstrategien."<br />
Durch die verschiedenen Ausführungen der Experten wird deutlich, dass ein enger<br />
Zusammenhang zwischen der Lebenslage armer und benachteiligter junger Menschen und<br />
ihrer Lebenswelt und den damit verbundenen Aktionsformen besteht.<br />
Viele Jugendliche reagieren auf ihre Alltagserfahrungen: Sie sind mit Situationen konfrontiert,<br />
in denen ihnen soziale Unterlegenheit und Erniedrigung vermittelt werden. Gleichgültigkeit<br />
ihnen gegenüber signalisiert, dass man sie für entbehrlich hält. „In der Schule wird ihre<br />
Inkompetenz öffentlich über Noten, Klassenwiederholungen oder fehlende Schulabschlüsse<br />
deutlich, der Ausbildungsmarkt hält keine Ausbildungsplätze für sie bereit, in der Familie<br />
94
erfahren sie keine Unterstützung, Wohnverhältnisse vermitteln keine Geborgenheit." 1<br />
Grundsätzlich entsteht ein Gefühl der Perspektivlosigkeit.<br />
Aktionsformen, wie z. B. provokative Mutproben, aggressive Randale, körperliche Gewalt,<br />
Aufbrechen von Autos und Rennen auf nächtlichen Straßen „sind Äußerungsformen, mit<br />
denen Selbstwertgefühl aufgebessert und soziale Achtung in der Gruppe hergestellt werden<br />
können ... Ausbruchsversuche, die den Jugendlichen ein Stück ihres verloren gegangenen<br />
Selbstwertgefühls zurück geben." 2<br />
3.4.3 Kreislauf der Armut<br />
Im Zusammenhang mit der Frage nach spezifischen Risikogruppen, die besonders gefährdet<br />
sind von Armut und Benachteiligung betroffen zu sein oder zu werden, wurde die<br />
ergänzende Frage gestellt: Durch welche Aspekte wird nach Ihrer Vorstellung ein<br />
Prozess der Benachteiligung und Ausgrenzung begünstigt?<br />
Wurden einzelne Aspekte ausführlich in Punkt 3.4.1 – Dimensionen der Lebenslage –<br />
dargestellt, so werden an dieser Stelle nur einige wesentliche Aussagen wiedergegeben, die<br />
deutlich machen, wodurch das "Festhalten" in einer Lebenslage der Armut und<br />
Benachteiligung begünstigt wird. Durch ein solches "Festhalten" wird eine Situation<br />
hervorgerufen, die dann vielfach als "soziale Vererbung" bezeichnet wird.<br />
Nach der Darstellung einiger Ausführungen der Experten wird in Verbindung mit<br />
Phänomenen, die bereits an anderer Stelle wiedergegeben wurden, ein "Kreislauf der Armut"<br />
aufgezeigt und resümiert.<br />
"Armut per se ist ja keine Krise. Erst wenn Symptome auftreten wie Verschuldung oder<br />
Wohnraumengpässe oder Perspektivlosigkeit oder Verlust, dann kommt es zum Problem."<br />
Der Prozess der "dauerhaften" Verarmung wird durch das "Auftreten von Risikofaktoren", d.<br />
h. der "Kumulation verschiedener beeinträchtigender und benachteiligender Phänomene"<br />
hervorgerufen.<br />
Es wird darauf hingewiesen, dass Familien mit Sozialhilfebezug oder sehr niedrigem<br />
(Erwerbs-) Einkommen, denen es nicht gelingt, sich innerhalb relativ kurzer Zeit aus dieser<br />
Situation "zu befreien", besonders bedroht sind, in einen Kreislauf der Armut zu geraten. "Es<br />
gibt ganz viele Familien oder Alleinerziehende, die 1 bis 1½ Jahre in der Lage sind, sehr<br />
nach Plan, sehr korrekt" ihre Situation zu regeln, die auch "den Kindern erklären, dass das<br />
und das nicht gekauft werden kann. ... Irgendwann ... bricht dieser Faden ab." Dazu kommt<br />
dieser "Vergeblichkeitsaspekt", z. B., wenn man sich mindestens fünfzigmal vergeblich<br />
beworben hat. Das führt zu Resignation "und zu einer 'Entbindung' aus dieser Gesellschaft."<br />
... "Je länger Bemühungen ohne Erfolg bleiben, desto größer ist das Risiko, dass man<br />
resigniert und sich zurückzieht. ... Das ist fast so ein Prozess der gelernten Hilflosigkeit, dass<br />
die Passivität zunimmt."<br />
Fehlende soziale Netze werden ebenfalls als Ursache, in einen solchen Prozess zu geraten,<br />
benannt: Mich erstaunt, "wie wenig eigene soziale Netze die eigentlich haben, ... die haben<br />
überhaupt niemand. ... Und dann sind wir wieder bei der 'Scham-Sache' – sie möchten nicht,<br />
dass jemand anderes erfährt, dass sie das nicht selbst schaffen." Gleichzeitig sind sie<br />
vielfach nicht in der Lage, sich alleine aus ihrer Problematik zu befreien.<br />
1<br />
Becker, P., Normalisierungsarbeit am Körper, in: Becker, P., Koch, J., (Hrsg.), Was ist normal?,<br />
Weinheim und München 1999., S. 46<br />
2<br />
ebenda, S. 46<br />
95
"Es ist ein Lebensgefühl, das etwas mit Ohnmacht zu tun hat. ... <strong>Die</strong> Menschen haben das<br />
Gefühl, dass sie Objekte sind. Das sind auch Erfahrungen, die Kinder in solchen 'sozialen<br />
Vererbungsprozessen' verinnerlichen. Es passieren ständig Dinge, an denen sie selbst<br />
nichts ändern können. Das setzt sich dann auch bei ihnen als Lebensgefühl fest. ... Schule<br />
wird erlebt als ein Tun von außen, das man nicht beeinflussen kann."<br />
Misserfolgserlebnisse manifestieren solch ein Lebensgefühl, "dass man ohnmächtig ist.<br />
Deshalb lohnt es sich auch nicht, aktiv zu werden." Misserfolgserlebnisse und die Erfahrung,<br />
dass ihnen "von außen [z. B. von Institutionen des Bildungssystems und der Jugendhilfe]<br />
nichts zugetraut wird, führen dazu, dass sich auch nur schwer was verändert."<br />
<strong>Die</strong> Aspekte, die Prozesse der Entstehung und Aufrechterhaltung von Armut und<br />
Benachteiligung "begünstigen", folgen einer gewissen Gesetzmäßigkeit. Armut beruht<br />
primär nicht auf individuellem Verschulden, sondern ist Folge verschiedener<br />
gesellschaftlicher und politischer Gegebenheiten.<br />
Empirische Untersuchungen – siehe auch den 2. Armutsbericht der Bundesregierung –<br />
belegen, dass nahezu ausschließlich solche Personengruppen von Armut und<br />
Benachteiligung betroffen sind, die am untersten Ende der Bildungs-, Arbeits- und<br />
Machthierarchie unserer Gesellschaft leben. Ihre Einfluss- und Teilhabechancen sind stark<br />
eingeschränkt – Diskriminierungs- und Stigmatisierungsprozesse ergänzen ihre<br />
Ausgrenzung.<br />
Häufig werden ihnen negative Verhaltensweisen zugeschrieben, ohne die Ursachen,<br />
Hintergründe und politischen Strukturen, die Armut und Benachteiligung hervorbringen, zu<br />
berücksichtigen. Arme und benachteiligte junge Menschen erfahren häufig einen<br />
Lebensprozess, der beschrieben werden kann als Wechselwirkung (Kreislauf) von<br />
ungenügender (Schul-) Bildung, unqualifizierter und damit schlecht bezahlter Arbeit, häufiger<br />
Arbeitslosigkeit und Wohnungsproblemen. Ihre Lebenslage begünstigt die Ausprägung von<br />
Verhaltensweisen, die die Perpetuierung eines Lebens unter Armutsbedingungen<br />
unterstützen.<br />
Wenn hier vom "Kreislauf der Armut" gesprochen wird, so wird dieser Kreislauf von der<br />
Bildungssituation benachteiligter Kinder aus aufgezeigt. Benachteiligten Schülern wird<br />
meistens eine höher qualifizierende Schulbildung nicht zugetraut. Aufgrund mangelnder<br />
Förderung und Unterstützung durch ihre Eltern und die Institution Schule bleiben ihnen<br />
vielfach qualifizierte Schulabschlüsse versagt. Viele von ihnen haben eine Förderschule<br />
besucht oder die Hauptschule ohne Abschluss verlassen. Verbunden mit der ungenügenden<br />
Schulausbildung ist in der Regel ein sehr anregungsarmes Milieu, das latent vorhandene<br />
Fähigkeiten nicht fördert und aktiviert, sondern die schon benannten Informations-,<br />
Interessens- und Konfliktlösungsdefizite hervorruft.<br />
Es besteht ein direkter Zusammenhang zwischen der Schulbildung und der Qualität des<br />
Arbeitsplatzes. <strong>Die</strong> Vergabe von Ausbildungs- und Anlernstellen ist heute in besonders<br />
starkem Maße an den Erwerb eines Hauptschulabschlusses oder eines noch qualifizierteren<br />
Schulabschlusses geknüpft: Je besser die Schulbildung, um so qualifizierter, befriedigender<br />
und finanziell lohnender ist die Arbeitsstelle. Lohnarbeit am untersten Ende der Hierarchie<br />
bedeutet in der Regel, dass die Betroffenen – wenn sie überhaupt eine Stelle bekommen –<br />
auf solche Arbeitsplätze vermittelt werden, für die keine besondere Ausbildung und wenig<br />
oder gar kein selbstverantwortliches, eigenständiges Denken und Handeln notwendig sind.<br />
Ihre Arbeit ist meistens körperlich anstrengend und die Bezahlung ist schlecht.<br />
Unsichere, schlecht bezahlte Arbeitsplätze haben zur Folge, dass Güter und<br />
<strong>Die</strong>nstleistungen, die in unserer Konsumgesellschaft als Standard gelten, ohne gleichzeitige<br />
Verschuldung nicht erworben werden können. Häufig ist es den benachteiligten Familien<br />
nicht möglich, angemessen großen, ihren finanziellen Verhältnissen entsprechenden<br />
96
Wohnraum zu finden. Sehr häufig leben sie in Großsiedlungen des Sozialen Wohnungsbaus<br />
und unterliegen dort vielfach Ausgrenzungs- und Stigmatisierungsprozessen.<br />
<strong>Die</strong> objektiven Lebensbedingungen finden ihre Resonanz in ihren Verhaltens- und<br />
Aktionsmustern:<br />
• Ausgrenzungs- und Diskriminierungsprozesse von außen führen zur Verschärfung der<br />
Situation. Je länger die Betroffenen entsprechende Erfahrungen machen, um so sicherer<br />
ist es, dass sie Zuschreibungen, die sie erlitten haben, eines Tages auch tatsächlich<br />
übernehmen � "self fulfilling prophecy".<br />
• <strong>Die</strong> Abhängigkeit von Behörden und von finanziellen Zuwendungen führt bei Vielen zur<br />
Unfähigkeit, das eigene Leben zu planen, Initiativen zu entwickeln und Interessen aktiv<br />
zu vertreten. <strong>Die</strong> Folge ist vielfach Apathie, Resignation und Konsummentalität.<br />
• Eine von Armut und Benachteiligung geprägte Lebenssituation und die<br />
Perspektivlosigkeit, die Situation zu verändern, können u. a. Aggressionen, Devianz und<br />
Suchtverhalten fördern.<br />
Auswirkungen einer solchen Lebenswelt auf die Kinder und Jugendlichen sind sehr negativ.<br />
Ihnen fehlen in der Regel Förderung und Unterstützung und ein Anregungsmilieu, das ihnen<br />
gestatten würde, den Kreislauf der Armut zu durchbrechen.<br />
97
3.5 Resümee – das Lebenslagenkonzept als geeigneter Ansatz<br />
zur Analyse von Armut und Benachteiligung junger Menschen<br />
Das Lebenslagenkonzept nach Staub-Bernasconi (vgl. Punkt 2.4) liegt dieser <strong>Studie</strong> als<br />
handlungsleitender Erklärungsansatz zugrunde. An dieser Stelle sollen die aus dem<br />
Lebenslagenkonzept abgeleiteten Arbeitshypothesen resümiert werden. Dabei werden in<br />
erster Linie Erkenntnisse aus der Lebenslagen- und Lebensweltanalyse (vgl. Punkt 3.4)<br />
herangezogen. Sie werden ergänzt durch Aussagen zur Wahrnehmung der Situation<br />
armer und benachteiligter Kinder und Jugendlicher im eigenen Funktionsbereich.<br />
1. <strong>Die</strong> sozioökonomische Lage beeinflusst entscheidend die Handlungsspielräume<br />
und Handlungsmöglichkeiten der jungen Menschen; sie dominiert auch die<br />
Lebenslage in anderen Ausstattungsbereichen.<br />
Eine deprivierte Einkommenslage an der definierten Armutsgrenze beeinflusst fast alle<br />
anderen Dimensionen der Lebenslage der betroffenen Familien und löst in der Regel<br />
Beeinträchtigungen und Benachteiligungen in der Entwicklung von Kindern aus.<br />
<strong>Die</strong> Teilhabe materiell benachteiligter Familien und insbesondere ihrer Kinder an der<br />
modernen "Markt- und Konsumgesellschaft" ist kaum möglich. <strong>Die</strong> Wohnsituation dieser<br />
Familien ist häufig gekennzeichnet durch ein Leben in gettoisierten und stigmatisierten<br />
Wohngebieten. Oft wohnen sie in sehr engen, z. T. schlecht und unzureichend<br />
ausgestatteten Wohnungen. <strong>Die</strong> Zimmer sind in der Regel sehr klein und die Wohnungen<br />
verfügen häufig über zu wenig Räume – gemessen an der Personenzahl –, so dass kaum<br />
Rückzugsmöglichkeiten bestehen. Aufgrund erlebter Stigmatisierungen und Ausgrenzungen<br />
im Zusammenhang mit ihrer Wohnsituation grenzen viele benachteiligte Kinder und<br />
Jugendliche ihren Lebensradius stark ein, d. h. sie beschränken sich relativ stark auf ihr<br />
Wohngebiet.<br />
Kinder, die in materieller Armut oder materieller Mängellage leben, sind in ihrer<br />
Bildungssituation stark benachteiligt. Sie erreichen signifikant niedrigere<br />
Bildungsabschlüsse. Sozioökonomisch benachteiligte Kinder, die durch ihre Familien, aber<br />
auch durch ihr soziales Umfeld nicht ausreichend unterstützt und gefördert werden,<br />
bekommen häufig Schwierigkeiten in der Schule. Sie werden oft – u. a. wegen ihrer<br />
Unterversorgtheit, z. B. in den Bereichen Wohnung, materielle Ausstattung, kulturelles<br />
Verständnis und Verhalten – stigmatisiert und ausgegrenzt. An solchen<br />
Ausgrenzungsprozessen sind sowohl Mitschüler als auch Lehrer beteiligt. Begünstigt werden<br />
entsprechende Prozesse durch ein stark selektierendes Schulsystem. Schüler reagieren auf<br />
erlebte Diskriminierungen häufig mit Lernschwierigkeiten, aber auch mit Schulverweigerung.<br />
"Schüler, ganz gleich ob sie nun eine Förderschule besuchen oder ohne<br />
Hauptschulabschluss ausgeschult werden, haben praktisch keine Chance, in normale<br />
Arbeitsverhältnisse integriert zu werden." Ihre schlechten Bildungsabschlüsse erschweren<br />
bzw. verhindern eine Berufsausbildung. Wenn sie Arbeit finden, ist diese in der Regel wenig<br />
qualifiziert, nicht attraktiv und niedrig bezahlt. Auch bei Erwerbsarbeit können sie meistens<br />
die gesellschaftlich als normal anerkannten Konsumgüter nicht erwerben. Durch die ihnen im<br />
Einzelfall angebotenen Arbeitsplätze erhalten sie in der Regel weder ein besseres Prestige<br />
noch einen Statusgewinn.<br />
Gesundheit ist ein sehr wichtiger Bereich für die Entwicklung von Kindern. Arme junge<br />
Menschen tragen ein höheres Risiko, chronisch zu erkranken. Sowohl aufgrund ihrer oft<br />
schlechten Wohnbedingungen als auch einer vielfach anzutreffenden Mangelernährung, sind<br />
sie in ihrer körperlichen Entwicklung häufig beeinträchtigt. Für eine gesunde, vitaminreiche<br />
Ernährung fehlt oft das Geld. Verstärkt wird ihre beeinträchtigte gesundheitliche Situation bei<br />
98
Vielen durch eine schlecht abgesicherte und defizitäre medizinische Versorgung. Sie wird oft<br />
erst in einer akuten Krankheitssituation genutzt.<br />
Urlaub und Freizeit sind Lebensbereiche, die für arme und benachteiligte junge Menschen<br />
und ihre Familien nicht relevant sind. Mit Kosten verbundene Urlaubsreisen und<br />
Freizeitaktivitäten finden nur extrem selten oder überhaupt nicht statt. <strong>Die</strong> mit<br />
entsprechenden Aktivitäten einhergehenden Erfahrungen und Lernprozesse werden nicht<br />
gemacht, können demzufolge auch nicht in Gleichaltrigengruppen eingebracht oder z. B. in<br />
Berichten und Aufsätzen in der Schule mitgeteilt werden. <strong>Die</strong>ser Sachverhalt bedeutet häufig<br />
einen Prestigeverlust und führt vielfach auch zu Diskriminierungen und Ausgrenzungen.<br />
Kulturelle Vielfalt und Teilnahme am kulturellen Leben der Gesellschaft ist für die meisten<br />
benachteiligten jungen Menschen ausgeschlossen. Der Zugang zu "klassischen<br />
Kulturgütern" wie Literatur, Musik und Theater ist ihnen in der Regel "versperrt". Selbst wenn<br />
ein Interesse an solchen Gütern vorhanden ist, fehlen ihnen neben dem Geld auch<br />
"Zugangsmöglichkeiten zur Aneignung kultureller Welten".<br />
Neben einem nicht an "allgemeinen gesellschaftlichen Vorstellungen orientierten kulturellen<br />
Verständnis" mangelt es vielfach bei den benachteiligten Familien auch an<br />
Verhaltensweisen, die im Zusammenhang z. B. mit Theaterbesuchen erwartet werden oder<br />
von den Betroffenen vermutet werden, für die sie aber keine Sicherheit haben.<br />
Eine "Kultur der Gemeinschaft" in den Stadtteilen und Quartieren hat für viele Menschen nur<br />
noch einen geringen Stellenwert. Soziale Verantwortung und die Wertschätzung "des<br />
Anderen" kommen im Zusammenleben in benachteiligten Wohngebieten kaum noch zum<br />
Tragen. Angehörige anderer Ethnien werden von den Erwachsenen vielfach als<br />
"Konkurrenten" empfunden. Das Zusammenleben junger Menschen unterschiedlicher<br />
Ethnien und Kulturen gestaltet sich dagegen relativ problemlos: Sie sehen sich gemeinsam<br />
als Subkultur an, häufig weil sie Ausgrenzungen erfahren haben.<br />
In den Interviews und Gruppendiskussionen wird darauf hingewiesen, dass von einem Teil<br />
der Betroffenen Benachteiligungen in verschiedenen Lebensbereichen kompensiert werden<br />
können. <strong>Die</strong> Entwicklung von autonomem Handeln und Selbständigkeit ist wesentlich davon<br />
abhängig, ob Beeinträchtigungen und Benachteiligungen nur einzelne Dimensionen oder die<br />
gesamte Lebenslage betreffen. Eine gute Einbindung in soziale Netzwerke, ein (relativ)<br />
hohes Bildungsniveau und die Integration in Erwerbsarbeit sind geeignete Ressourcen,<br />
Krisen und Konfliktsituationen konstruktiv zu bewältigen und eine positive Identität und<br />
Personalität zu entwickeln.<br />
2. Ausstattungsdefizite/ Benachteiligungen und die damit verbundenen<br />
Beeinträchtigungen von Bedürfnisbefriedigung und Teilhabechancen begünstigen<br />
selbstzerstörerisches und abweichendes Verhalten, soziale Isolation, psychische<br />
Einbrüche und Apathie.<br />
<strong>Die</strong> Auswirkungen von Armut und die damit verbundenen Einschränkungen der<br />
Bedürfnisbefriedigung an "Ausstattungsgütern" (s. o.) sind gravierend. Entwicklungs-,<br />
Erfahrungs- und Lernmöglichkeiten – und damit verbunden auch gesellschaftliche Teilhabe –<br />
sind bei benachteiligten Menschen erheblich beeinträchtigt. <strong>Die</strong>s ist insbesondere der Fall,<br />
wenn eine kumulative Deprivation vorliegt.<br />
Von Armut und Benachteiligung betroffene junge Menschen und ihre Eltern fühlen sich durch<br />
ihre oft deprivierende Lebenslage psychisch belastet, was häufig zu Perspektivlosigkeit und<br />
resignativem Verhalten führt. Wenn keine Möglichkeiten der Verbesserung ihrer Situation<br />
real oder subjektiv vorhanden sind, kann das auch Depressionen auslösen. Gekoppelt daran<br />
ist oft die Entwicklung eines Zugehörigkeitsgefühles zu einem als "unten" empfundenen<br />
Milieu – das Selbstverständnis als Außenseiter wirkt dann meistens auch "identitätsstiftend".<br />
99
Auf Ablehnungen, z. B. durch Bildungseinrichtungen oder Arbeitgeber, reagieren sie mit<br />
Ohnmachtsgefühlen, Enttäuschung, Hilflosigkeit, Ängsten. Auch Wut bestimmt dann vielfach<br />
ihr Verhalten.<br />
Fluchttendenzen, Rückzug, Resignation, Krankheit, aber auch Aggressivität, Gewalt,<br />
Kriminalität, sind Formen der Kompensation ihrer Lebenslage, mit denen sie versuchen, für<br />
sich ein Stück weit "Gleichgewicht" zu erlangen und Dinge erträglicher zu machen.<br />
3. Austauschprobleme fördern Ausgrenzungen und soziale Isolation und damit<br />
verbundene Störungen in der Persönlichkeitsentwicklung. Benachteiligte Kinder<br />
und Jugendliche werden in ihrer Identitätsentwicklung und in der Bildung eines<br />
stabilen Selbstwertgefühls beeinträchtigt.<br />
Austauschprobleme entstehen dort, wo es zu asymmetrischen Beziehungen kommt. <strong>Die</strong>se<br />
ergeben sich besonders häufig dort, wo Abhängigkeiten bestehen, z. B. in der Schule,<br />
gegenüber Einrichtungen der Jugendhilfe aber auch gegenüber Behörden. Asymmetrische<br />
Beziehungen werden dadurch hervorgerufen, dass bei den Stellen, von denen eine Leistung<br />
vergeben wird, auf die die Betroffenen angewiesen sind, die Artikulations- und<br />
Informationsmacht liegt. Dadurch steuern sie vielfach die Interpretation der Situation<br />
benachteiligter Familien. <strong>Die</strong> Deutungs- und Handlungsmuster der Betroffenen werden dabei<br />
in der Regel nicht beachtet. Probleme entstehen u. a. dann, wenn die Benachteiligten in der<br />
Situation Inhalt und Bedeutung der ihnen gegebenen Informationen nicht verstehen und<br />
ihnen die Fähigkeit zur Selektion von Informationen fehlt. <strong>Die</strong> Folge eingeschränkter<br />
Informationserfassung und -verarbeitung ist u. a. die Nichtinanspruchnahme von Rechten<br />
und <strong>Die</strong>nstleistungen und fehlende Kompetenzen, eigene Interessen durchzusetzen. <strong>Die</strong><br />
Asymmetrie der Beziehungen wird vielfach gegenüber den Betroffenen "ausgespielt". <strong>Die</strong>se<br />
reagieren dann häufig mit Rückzug – sie versuchen, entsprechende Situationen zu<br />
vermeiden. Psychische Beeinträchtigungen/ Erkrankungen wie Sucht, depressives Verhalten<br />
bis hin zu Suizidgefahr und Fluchtverhalten können als Folge auftreten.<br />
Schüler aus benachteiligten Familien benötigen institutionelle Unterstützung, um Schule<br />
erfolgreich absolvieren zu können; vielfach anzutreffende geringe Sprachkompetenzen –<br />
restringierter Code – beeinträchtigen ihre Bildungschancen erheblich. Problemverstärkend<br />
wirkt sich oft aus, dass Lehrer, deren eigene Lebenswelt konträr der vieler benachteiligter<br />
Schüler gegenüber steht, diese in ihrer – durch ihre Lebenslage geprägten – Lebenswelt<br />
nicht verstehen. Deutungsmuster, Einstellungen, Verhalten und Handlungsweisen der<br />
Schüler werden dann vielfach als abweichendes Verhalten gewertet. Das hat häufig<br />
Ausgrenzungen – Kinder werden in "Sondergruppen" abgeschoben – und Stigmatisierungen<br />
zur Folge. Entsprechende Prozesse setzen sich bei den Mitschülern fort. Klassenkameraden<br />
wollen Kinder, die nicht mithalten und mitreden können und sich "unangepasst" verhalten,<br />
nicht zum Freund haben. Das schränkt Sozialbeziehungen ein.<br />
Auf einschränkende und zum Teil demütigende Erfahrungen während ihrer Schulzeit<br />
reagieren Schüler häufig mit dem Gefühl der Ohmacht. Ein unsicheres Selbstbild und<br />
geringes Selbstwertgefühl sind oft die Folge.<br />
4. Behinderungsmacht in Form von Stigmatisierungs- und Ausgrenzungsprozessen<br />
begünstigt die Übernahme des Fremdkonzeptes als Selbstkonzept und fördert<br />
damit die Aufrechterhaltung und Verfestigung von Armut und Benachteiligung.<br />
Behinderungsmacht beschneidet die gesellschaftliche Teilhabe armer und benachteiligter<br />
Kinder und Jugendlicher – und ihrer Eltern. <strong>Die</strong> sichtbarsten Formen stellen Ausgrenzungen<br />
im Wohn- und Arbeitsbereich und in der Schule sowie die häufig damit verbundenen<br />
Stigmatisierungsprozesse dar.<br />
100
<strong>Die</strong> räumliche Segregation deprivierter Familien in benachteiligte und benachteiligende<br />
Quartiere ist als Folge von materieller Armut anzusehen. So bilden sich in ihrer Struktur<br />
homogene Stadtteile - sie sind "armutsgeprägt". Kinder erhalten in solchen Stadtteilen kaum<br />
Anregungen. <strong>Die</strong> Bewohner solcher Quartiere erfahren Diskriminierungen und<br />
Stigmatisierungen sowohl durch die Bewohner des Umfeldes als auch durch Vertreter von<br />
Institutionen, z. B. von Schulen und Behörden. <strong>Die</strong> soziale Kontrolle durch Institutionen<br />
Sozialer Arbeit ist in solchen Gebieten besonders dicht.<br />
Segregationsprozesse im Wohnbereich beeinflussen die Entwicklung spezifischer Milieus.<br />
Kinder und Jugendliche bauen zu den sozialen Räumen, in denen sie leben, besondere<br />
Beziehungen auf. Sozialräumliche Erfahrungen schränken ihre Handlungsspielräume und<br />
Perspektiven ein.<br />
In der Schule fallen arme Kinder oft schon in der ersten Klasse wegen ihrer unzureichenden<br />
Kleidung und Ernährung, aber auch wegen Konzentrations- und Lernschwierigkeiten auf.<br />
Häufig werden ihnen negative Verhaltensweisen zugeschrieben, ohne die Ursachen,<br />
Hintergründe und politischen Strukturen, die Armut und Benachteiligungen hervorbringen, zu<br />
berücksichtigen. <strong>Die</strong> Frage "Warum sind sie so geworden?" wird nicht gestellt. "Da werden<br />
Kinder in der Schule auffällig und dann immer nur nach unten durchgereicht." Schulen wirken<br />
Ausgrenzungsprozessen nicht entgegen, sondern verstärken sie häufig. "Wir sind ein<br />
segregierendes Schulsystem. Wer es nicht schafft, wird abgeschult."<br />
Schlechte oder keine Schulabschlüsse erschweren bzw. verhindern oft eine<br />
Berufsausbildung und die Integration in den Arbeitsprozess. <strong>Die</strong> daraus häufig resultierende<br />
Arbeitslosigkeit führt dazu, dass die davon betroffenen jungen Menschen sich vollständig<br />
zurückziehen, um Ausgrenzungen von außen durch Selbstausgrenzung zuvorzukommen.<br />
Arbeitslosigkeit bedeutet für die davon betroffenen jungen Menschen Isolierung vom<br />
gesellschaftlichen Leben. Eintretende Demoralisierungsprozesse verhindern Lernchancen<br />
bezogen auf Erkenntnis- und Handlungskompetenzen ebenso wie Mitgliedschaften in<br />
Vereinen und gesellschaftlichen Gruppen außerhalb des Milieus.<br />
Junge Menschen – insbesondere aus tradierten Armutsfamilien – haben oft resigniert. Sie<br />
entwickeln häufig die Identität als Versager und Verlierer.<br />
5. Das "Aushebeln" des Sozialstaatsprinzips reduziert die Begrenzungsmacht durch<br />
Bildungs-, Jugend- und Sozialpolitik und schränkt damit Entwicklungs- und<br />
Teilhabechancen ein.<br />
Armut und Benachteiligung stehen in engem Zusammenhang mit der Verteilung von<br />
Ressourcen in einer Gesellschaft. Durch das in der deutschen Verfassung festgeschriebene<br />
Sozialstaatsprinzip wird das Ziel der Chancengleichheit verfolgt. Daraus ergibt sich der<br />
Auftrag an den Gesetzgeber, "für einen Ausgleich der sozialen Gegensätze und damit für<br />
eine gerechte Sozialordnung zu sorgen". Es geht um die "Angleichung der tatsächlichen<br />
Voraussetzungen zum Erwerb materieller und immaterieller Güter". 1<br />
<strong>Die</strong>ser Auftrag an den Gesetzgeber bedeutet, dass z. B. durch Armut und Benachteiligung<br />
beeinträchtigte Kinder, die durch ihre Familien und ihr Umfeld nicht ausreichend gefördert<br />
und in ihrer Entwicklung und Bildung nicht entsprechend ihrer Situation unterstützt werden,<br />
durch jugend- und bildungspolitische Angebote und Aktivitäten die Chance zu materieller,<br />
sozialer und kultureller Teilhabe erhalten.<br />
"Ein Sozialstaat entwickelt eine emanzipatorische Gerechtigkeitspolitik, also eine Politik, die<br />
Chancenungleichheit ausgleicht. ... Der Sozialstaat erschöpft sich also nicht in der Fürsorge<br />
1 Jarass in: Jarass, H., Pieroth, B., Kommentar zum Grundgesetz, München, 2004, S. 574, RZ 108<br />
101
für Benachteiligte, sondern zielt auf den Abbau der strukturellen Ursachen für diese<br />
Benachteiligung." 1<br />
<strong>Die</strong>se im Grundgesetz definierte Aufgabe wird sowohl auf Bundesebene als auch auf der<br />
Ebene des Stadtstaates Hamburg offensichtlich zur Disposition gestellt – und zwar sowohl<br />
auf der finanziellen Ebene als auch auf der Ebene spezifischer Formen der Förderung. Dazu<br />
einige Aussagen der Experten:<br />
• Es ist "wahnsinnig viel gekürzt worden in den letzten Jahren. Das spiegelt sich im<br />
Haushaltsplan wider." Hingewiesen wird auf den Kita-Bereich und auf Schließungen, z.<br />
B. von Schulen, Bücherhallen, Schwimmhallen sowie auf mangelnden Neubau von<br />
Sozialwohnungen. <strong>Die</strong> Einsparungen sind "von der Masse her nicht etwas, was den<br />
Haushalt sanieren würde. ... Wenn man volkswirtschaftlich denkt, wird es mehr Kosten<br />
verursachen, wenn Kinder nicht frühzeitig erreicht werden."<br />
• Sparmaßnahmen wirken sich sehr problematisch aus, z. B. in Kitas. Sie sind "die<br />
zentralen Bildungseinrichtungen 2 im frühen Kindesalter. ... Wenn da was wegbricht, ist<br />
das eine Katastrophe."<br />
• Probleme werden auch bezogen auf Formen und Inhalte von Angeboten gesehen: "Mit<br />
den bisher bestehenden Lernmethoden genügen schulpädagogische Regeleinrichtungen<br />
den Bedürfnissen von Schülern, die unter den Bedingungen von Armut leben, nicht." Um<br />
der Situation der Schüler gerecht zu werden, "bedarf es pädagogischer Professionalität<br />
bei Lehrern, um bei Leistungs-, Lern- und Verhaltensproblemen die zugrundeliegende<br />
Armutsproblematik zu erkennen. ... Das ist bedauerlicherweise kein Bestandteil der<br />
regulären Lehrerausbildung."<br />
Sofern sozialer Frieden – und das bedeutet speziell auch Entwicklungs- und<br />
Bildungschancen für arme und benachteiligte Kinder und Jugendliche – gesichert werden<br />
soll, ist es erforderlich, für die verschiedenen Aufgabenbereiche der "Begrenzungsmacht" die<br />
Ressourcen – Finanzen, Personal, Kompetenzen – zur Verfügung zu stellen, die sie zur<br />
Erfüllung ihrer Aufgaben bedürfen. Das impliziert eine stärkere Wahrnehmung gestaltender<br />
Funktionen durch Politik und Verwaltung.<br />
6. Aufgrund von Segregation entwickeln sich in ihren sozialen, ökonomischen und<br />
bildungsmäßigen Strukturen homogene Stadtbezirke. <strong>Die</strong> Segregation ist in der<br />
Regel durch ökonomische Faktoren bedingt. <strong>Die</strong> verschiedenen Charaktere der<br />
Region überlagern sich derart, dass sich zumeist in bestimmten Gebieten die<br />
negativ bewerteten Ausprägungen finden und andere sich durch die Kombination<br />
positiv bewerteter Merkmale auszeichnen.<br />
<strong>Die</strong> Verteilung von "armen" und "reichen" Regionen in Hamburg ist im Rahmen dieser <strong>Studie</strong><br />
aufgezeigt worden (vgl. Punkt 3.3). <strong>Die</strong> Analyse weist auf die Ausdifferenzierung relativ<br />
homogener Stadtteile mit entweder eher benachteiligter oder privilegierter Bevölkerung hin.<br />
<strong>Die</strong> Bildung benachteiligter Regionen spiegelt die Mechanismen des Wohnungsmarktes und<br />
die wohnungspolitischen Grundentscheidungen wider. Schon seit Langem gibt es einen<br />
"segmentierten" Wohnungsmarkt, d. h. der Wohnungsmarkt ist sehr eingeschränkt für<br />
Bevölkerungsgruppen mit niedrigem Einkommen – es entstehen sozialräumliche Gebiete,<br />
die gekennzeichnet sind durch einen hohen Anteil an Haushalten mit extrem niedrigen<br />
Einkommen, gemessen am Durchschnitt der Bevölkerung, einem hohen Anteil an<br />
Sozialhilfeempfängern, einem besonders hohen Anteil an Kindern und Jugendlichen mit<br />
schlechten Bildungschancen und –abschlüssen sowie einem hohen Anteil von jugendlichen<br />
und Langzeitarbeitslosen, von Einelternfamilien und einem (relativ) hohen Anteil an<br />
Ausländerfamilien.<br />
1 Prantl, H., Kein schöner Land, die Zerstörung der sozialen Gerechtigkeit, München, 2005, S. 202<br />
2 vgl. § 22, Abs. 2 Kinder- und Jugendhilfegesetz: "<strong>Die</strong> Aufgabe umfasst die Betreuung, Bildung und Erziehung<br />
des Kindes. ..... soll sich an den Bedürfnissen der Kinder und ihrer Familien orientieren."<br />
102
In benachteiligten Stadtteilen bilden sich Milieus, zu denen die dort lebenden jungen<br />
Menschen spezifische Beziehungen aufbauen – diese Sozialräume werden Teil ihrer<br />
Lebenswelt.<br />
<strong>Die</strong> aufgestellten Arbeitshypothesen werden durch die zum Ausdruck gebrachten<br />
Erfahrungen und Erkenntnisse der befragten Experten, aber auch durch die Ergebnisse der<br />
sozialräumlichen Untersuchung, bestätigt.<br />
103
4 Konsequenzen<br />
<strong>Die</strong>se <strong>Studie</strong> ist als Soziale Arbeit auf der Makroebene angelegt (vgl. Punkt 1). Wurden<br />
bisher in erster Linie erfahrungswissenschaftliche Erkenntnisse über die Lebenslage und<br />
Lebenswelt armer und benachteiligter Kinder und Jugendlicher in Hamburg, sowie über<br />
Aspekte, die zur Aufrechterhaltung eines Kreislaufs der Armut und Benachteiligung führen,<br />
dargestellt, so sollen im Folgenden Konsequenzen "skizziert" werden.<br />
Entsprechend der Anlage der <strong>Studie</strong> beruhen die in diesem Kapitel gemachten Aussagen<br />
primär auf Antworten auf die Frage: Welche Ansätze zur Verbesserung der<br />
Lebenssituation armer und benachteiligter Kinder und Jugendlicher können (auch)<br />
unter Berücksichtigung der Möglichkeiten in Ihrem Funktionsbereich realisiert<br />
werden? Mit wem könnte bzw. sollte dabei kooperiert werden?<br />
<strong>Die</strong> hier aufgezeigten Konsequenzen beziehen sich auf<br />
• die gesellschaftliche und politische Ebene.<br />
• Konsequenzen für eine Sozialpolitik und Wohnungspolitik<br />
• die Ebene der Jugendhilfe unter Berücksichtigung der Zielsetzung des KJHG 1 .<br />
Abgeschlossen werden das Kapitel sowie die <strong>Studie</strong> mit einem Exkurs:<br />
• Bildung als primäre Ressource, den Kreislauf von Armut und Benachteiligung zu<br />
durchbrechen.<br />
<strong>Die</strong> durch die befragten Experten vorgebrachten Angaben zur Verbesserung der<br />
Lebenssituation werden gelegentlich durch "Rahmeninformationen" ergänzt.<br />
Mehrere Experten haben im Zusammenhang mit der o. g. Frage nach Verbesserung der<br />
Lebenssituation darauf hingewiesen, dass Armut und Benachteiligung eine<br />
mehrdimensionale Problematik zugrunde liegt. Armut als mehrdimensionales Problem<br />
tangiert in erster Linie Wohnen, Stadtplanung, Bildung, Soziale Arbeit und Jugendhilfe, "so<br />
dass hier Einzelakteure nicht vom Fleck kommen können. Wir müssen eine Kooperation<br />
haben mit den Stellen, in denen uns Armut auch begegnet – also z. B.<br />
Wohnungsunternehmen, Schulen, Jugendhilfe, Institutionen des Gesundheitssystems, der<br />
außerschulische Jugendbereich – das ist ein wichtiges Feld." Stadtteilkonferenzen könnten<br />
koordinierende Funktionen übernehmen; "hier müssten auch Projekte entwickelt und<br />
realisiert werden. Armut muss ja auch mal vorbei sein." Bestehende, positive, ermutigende<br />
Beispiele in Hamburg könnten Modelle/ Lernfelder für andere sein.<br />
Kooperationsprojekte könnten Ressourcen im Stadtteil besser nutzen. Daraus ergeben sich<br />
Möglichkeiten, Aktivitäten und Handlungsstrategien "ohne nennenswerte finanzielle<br />
Sonderaufwendungen" zu konzipieren und zu realisieren. Ziele in entsprechenden<br />
Kooperationen/ Vereinbarungen sind:<br />
• die Realisierung multidimensionaler Handlungsansätze für eine ziel- und<br />
aufgabenorientierte Problemlösung,<br />
• die Bündelung von Kompetenzen und Ressourcen,<br />
• der Abbau von Konkurrenz einerseits und wechselseitiger Vorurteile andererseits,<br />
• die Überwindung von Ressortdenken und ressortbezogener Bereitstellung materieller<br />
und immaterieller Mittel (vgl. Anlage 6, Voraussetzungen für gelingende Kooperationen).<br />
1 Kinder- und Jugendhilfegesetz, SGB VIII<br />
104
4.1 Konsequenzen auf der gesellschaftlichen Ebene<br />
Problemstellung<br />
<strong>Die</strong> meisten Menschen in unserer Gesellschaft assoziieren im Zusammenhang mit Armut in<br />
erster Linie eine Aufgabe von Jugendhilfe und Sozialer Arbeit. Es soll hier überhaupt nicht in<br />
Frage gestellt werden, dass Jugendhilfe den Auftrag hat, "junge Menschen in ihrer<br />
individuellen und sozialen Entwicklung zu fördern und dazu beizutragen, Benachteiligung zu<br />
vermeiden oder abzubauen". Bedenkt man aber, dass die Verfestigung und<br />
Aufrechterhaltung von Armut und Benachteiligung von Kindern und Jugendlichen durch<br />
gesellschaftliche Stigmatisierungs- und Diskriminierungsprozesse sowie Segregation<br />
"begünstigt" werden, so muss es auch auf der gesellschaftlichen und<br />
gesellschaftspolitischen Ebene zu einer Veränderung von Einstellungen und<br />
Verhaltensweisen kommen.<br />
Armut und Benachteiligung von Kindern und Jugendlichen sind zur Zeit in Hamburg<br />
offensichtlich keine wirklich relevanten gesellschaftlichen und politischen Themen.<br />
Individualisierungsprozesse – die Familie hat ihre Armut individuell zu verantworten –<br />
erleichtern Schuldzuweisungen. Gelegentlich werden für "Sonderfälle" Lösungen<br />
herbeigeführt<br />
• eine Wohnung für Familie X<br />
• eine Spende für Familie Y.<br />
Das Zusammenspiel struktureller und gesellschaftlicher Ursachen und Hintergründe wird<br />
nicht thematisiert, kommt kaum zum Tragen. Es wird der "Eindruck vermittelt: die sind ja<br />
irgendwie selber schuld". Bei Kindern und Jugendlichen wird bei dem Thema Armut "blame<br />
the parents" gespielt. "... <strong>Die</strong> Frage nach Gesamtverantwortung wird dann meistens<br />
schuldhaft adressiert: Eltern haben versagt ... ." Dass sich Eltern vor zwanzig, dreißig Jahren<br />
in einer vergleichbaren Situation befanden wie ihre Kinder heute und ihre Entwicklungs- und<br />
Teilhabechancen vergleichbar eingeschränkt waren, wird kaum reflektiert.<br />
Stigmatisierungen und Diskriminierungen sind "Verfahren", die auch durch Politik und Presse<br />
angewandt werden. <strong>Die</strong> Relevanz, dass strukturelle Bedingungen ihren "individuellen<br />
Niederschlag" finden (vgl. Punkt 3.4) – Armut also bei Einzelnen sichtbar wird – begünstigt,<br />
dass man ihnen ein Stigma "anheften" kann, das dann sozial wirksam wird. Dass die mit<br />
einem Stigma belegten Handlungsweisen für die Betroffenen bedeutsam sind, um ihre<br />
Mängellage zu verarbeiten, findet keine Beachtung. Segregation im Wohnbereich (vgl. P.<br />
3.3), aber auch im Bildungs- sowie Ausbildungs- und Arbeitsbereich sind vielfach die Folge<br />
von Diskriminierungs- und Stigmatisierungsprozessen. "Wir haben eine immer stärkere<br />
Segregationsbewegung. ... <strong>Die</strong> Privilegierten bleiben unter sich."<br />
Dass in einer Zeit, in der der Geburtenrückgang beklagt wird, Familien mit Kindern<br />
unerwünscht sind, ist nur schwer zu verstehen: "Durch kinderreiche Familien sinken die<br />
Vermietungschancen für die restlichen Wohnungen in einem Haus, zumindest der Mietpreis<br />
sinkt." Dass es kaum neue Wohnungen für kinderreiche Familien gibt, wurde ebenfalls<br />
deutlich gemacht: "<strong>Die</strong> politische Situation – wachsende Stadt – ist für solche Erwartungen<br />
an Investoren nicht gerade förderlich."<br />
Segregation und Exklusion armer und benachteiligter Gruppen beeinträchtigen diese nicht<br />
nur in ihren Teilhabechancen – die Kinder und Jugendlichen speziell in ihren Entwicklungs-<br />
und Bildungschancen – sondern gefährden auch den sozialen Frieden in einer Gesellschaft.<br />
Sozialer Frieden erfordert eine "soziale Demokratie". Das bedeutet in erster Linie die<br />
gegenseitige Verpflichtung, die gesellschaftliche Spaltung gemeinsam und nach<br />
105
persönlichem Leistungsvermögen anzugehen und zu überwinden. Davon sind wir – nicht nur<br />
in Hamburg – weit entfernt. Eine Notwenigkeit dafür wird kaum noch gesehen. Experten<br />
haben u. a. darauf hingewiesen, dass die "Sprengkraft", die eine Armutssozialisation zu einer<br />
Gefährdung der Staatsloyalität werden lässt, derzeit "politisch ausgeblendet" wird.<br />
Konsequenzen<br />
<strong>Die</strong> hier skizzierten Problemstellungen bedürfen Konsequenzen auf der gesellschaftlichen<br />
Ebene. Wenn arme und benachteiligte Menschen sich in einer Gesellschaft integrieren<br />
sollen, muss diese Gesellschaft eine Bereitschaft zur Integration haben.<br />
Eine solche Bereitschaft würde bei Berücksichtigung der heutigen gesellschaftspolitischen<br />
Situation einen Paradigmenwechsel bedeuten – das erfordert auch ein verändertes<br />
Menschenbild und die Auseinandersetzung mit Normen und Werten. Bedeutsam ist, dass<br />
das primäre Ziel der Verfassung – "<strong>Die</strong> Würde des Menschen ist unantastbar!" – in der<br />
Gesellschaft seinen Niederschlag findet. Das impliziert die "Akzeptanz von Anderssein". Das<br />
Anderssein benachteiligter junger Menschen – sogenanntes abweichendes und auffälliges<br />
Verhalten – muss vor dem Hintergrund ihrer Lebenslage und Lebenswelt gesehen werden.<br />
Um das zu erreichen, kommen sowohl der Presse als auch den Parteien und weiteren<br />
gesellschaftlich relevanten Gruppen, z. B. Gewerkschaften und Kirchen, eine Moderatoren-,<br />
aber auch eine Lobbyfunktion zu. Eine Voraussetzung, einen entsprechenden Prozess<br />
einzuleiten bzw. zu verstärken ist darin zu sehen, dass in Hamburg die JugendpolitikerInnen<br />
"sich auch öfter über die Parteigrenzen einig" sind. Offensichtlich bedeutet das aber nicht,<br />
dass man sich auch innerhalb der einzelnen Parteien bezogen auf die Situation und die<br />
Bedarfe benachteiligter junger Menschen einig ist. Über die Forderung, dass jedes Kind so<br />
gefördert werden muss, "dass es reelle Chancen an gesellschaftlicher, insbesondere<br />
bildungsbezogener Teilhabe hat", besteht kein Einvernehmen.<br />
Berücksichtigt man, dass Bildung eine wesentliche Ressource für die weitere technische und<br />
wirtschaftliche Entwicklung unserer Gesellschaft ist, so muss diese Gesellschaft<br />
gewährleisten, dass allen Gruppen junger Menschen Bildungschancen eröffnet werden.<br />
"Auch die materielle Stabilisierung ökonomisch bedrohter Familien, die Förderung elterlicher<br />
Erziehungskompetenz, die Sicherung sozialer Unterstützung für Familien in Problemlagen,<br />
die Hilfestellung in Krisen und Konfliktsituationen, kann nicht allein Aufgabe der Schule und<br />
Jugendhilfe sein. Soziale und schulische Integration braucht eine Kultur, die allem<br />
menschlichen Leben eine Bedeutung zumisst als Grundbedingung für emanzipatorische<br />
Entwicklungsprozesse in einer Demokratie."<br />
Ein stabiles Selbstwertgefühl stellt ebenso wie ein (relativ) hohes Bildungsniveau eine<br />
Ressource gegen die Verfestigung von Armut und Benachteiligung dar. "Wenn man sich mal<br />
anschaut, wie Menschen, die unter ... [benachteiligenden] Bedingungen leben und sich ihr<br />
Selbstwertgefühl erhalten oder erarbeitet haben ... ganz anders mit den gleichen<br />
Phänomenen umgehen, ist es ... die Frage, ob unsere Gesellschaft so strukturiert ist, dass<br />
sie Menschen, die in solchen 'abweichenden Lebenssituationen' sind, Chancen gibt,<br />
Selbstwertgefühl zu entwickeln. Es besteht die Notwendigkeit, die Form, wie sie ihre<br />
Situation kompensieren, auch als Leistung anzusehen." ... "<strong>Die</strong> Chance, ob Benachteiligte<br />
Teilhabemöglichkeiten bekommen, liegt darin, ob eine Gesellschaft oder Gemeinschaft<br />
Integrationskraft hat oder nicht."<br />
<strong>Die</strong> Segregation benachteiligter Bevölkerung in benachteiligte Wohngebiete, verbunden mit<br />
der in den nächsten Jahren virulent werdenden Aufhebung von Bindungen – Rückgang in<br />
Hamburg von 2003 bis 2009 um gut 27% auf 103.882 Wohnungen – birgt ebenfalls soziale<br />
Sprengkraft, die durch Kooperation von Wohnungseigentümern und Trägern Sozialer Arbeit<br />
allein nicht "aufgefangen" werden kann. "Es ist eine gesellschaftspolitische Frage, was an<br />
Steuerungsinstrumentarien aufrechterhalten oder entwickelt wird, um es möglich zu machen,<br />
dass auch Menschen mit einem geringen Einkommen angemessen wohnen können."<br />
106
Berücksichtigt man die Auswirkungen, die – neben finanzieller Armut – Stigmatisierungs-,<br />
Diskriminierungs- und Segregationsprozesse auf benachteiligte Familien haben, so wird<br />
deutlich, dass eine Veränderung des "sozialen Klimas" in der Gesellschaft erforderlich ist, um<br />
dieser Problematik zu begegnen. Das bedeutet Setzung von Werten wie Solidarität und<br />
Integrationskraft. Jeder Mensch hat den Anspruch, in seiner Eigen- und Besonderheit<br />
geachtet zu werden; das impliziert eine akzeptierende Einstellung und Haltung ihnen<br />
gegenüber. Dazu bedarf es eines Beitrages aller zu einer offenen, sozialen, gerechten – d. h.<br />
durch Chancengleichheit gekennzeichneten – Gesellschaft. "Gemeinschaft und Solidarität<br />
sind Dinge, die man lernt."<br />
4.2 Konsequenzen für eine Sozial- und Wohnungspolitik<br />
Begrenzungsmacht, z. B. im Rahmen der Bildungs-, Jugend-, Sozial- und Wohnungspolitik<br />
soll die Teilhabe und Teilnahme an Gütern und an sozialem Austausch für Alle ermöglichen<br />
(vgl. Punkt 2.5).<br />
Sozialpolitik und Wohnungspolitik sind Instrumente, mit denen der Staat seiner gestaltenden<br />
Funktion gerecht werden soll. "Sozialstaat und Demokratie gehören zusammen, sie bilden<br />
eine Einheit. ...[Sozialpolitik] sorgt für annähernd vergleichbare Lebenschancen." 1 Es wird<br />
inzwischen deutlich, dass der Staat dem Postulat der Sozialstaatlichkeit durch gestaltende<br />
Einwirkungen – z. B. im Rahmen der Gesetzgebung –, Verteilung und Lenkung nicht mehr<br />
gerecht wird.<br />
Problemstellung<br />
Im Rahmen der Befragung wurde fast in allen Interviews und in den Gruppendiskussionen<br />
auf die sich im Zusammenhang mit der Sozialhilfe abzeichnenden Probleme hingewiesen<br />
und Befürchtungen geäußert, dass sich durch Hartz IV 2 die Zahl materiell armer Menschen<br />
erhöhen würde. <strong>Die</strong>ser Sachverhalt ist inzwischen eingetreten. Friedrich Hengsbach weist<br />
darauf hin, dass "die Bündnisgrünen bekennen, Fehler gemacht zu haben und lernen zu<br />
wollen. Denn Hartz IV sei nicht armutsfest und die Gefahr der Ausgrenzung bedrohlich." 3<br />
Der Wegfall von einmaligen Leistungen bei Hartz IV wird zwar einerseits begrüßt, weil die<br />
Betroffenen nicht mehr gezwungen sind, Einzelanträge zu stellen mit den damit häufig<br />
verbundenen Unsicherheiten. Andererseits wird darauf hingewiesen: "<strong>Die</strong> Betroffenen<br />
werden [von dem niedrigen Betrag] garantiert nicht jeden Monat 20 bis 30 Euro zurücklegen,<br />
weil im nächsten Winter das Kind größer geworden ist und einen neuen Wintermantel<br />
braucht. Das sind Dinge, die so nicht klappen."<br />
<strong>Die</strong> hohe Verschuldung vieler benachteiligter Familien – aber inzwischen auch der<br />
Jugendlichen – wird häufig angesprochen. Trotz der hohen Zahl an Ver- und<br />
Überschuldungen und Privatinsolvenzen ist eine "Ausdünnung der<br />
Schuldnerberatungsstellen im behördlichen Bereich zu verzeichnen". <strong>Die</strong>ses wirkt<br />
problemverstärkend – durch entsprechende Unterstützung "könnte man wirklich<br />
Katastrophen aufhalten". Hier führen vermeintliche Einsparungen in der Regeln zu<br />
Kostensteigerungen durch möglichen Wohnungs- und Arbeitsplatzverlust.<br />
<strong>Die</strong> Auswirkungen von Jugendarbeitslosigkeit hatten in einer Vielzahl der Gespräche einen<br />
hohen Stellenwert. Es wurde wiederholt darauf hingewiesen, dass Jugendarbeitslosigkeit für<br />
1 Prantl, H., a.a.O., S. 32 f.<br />
2 Zum Zeitpunkt der Untersuchung (Oktober 2004 bis Januar 2005) lagen noch keine Erkenntnisse zu Hartz IV vor.<br />
3 Hengsbach, F., Konvertiten, in: Frankfurter Rundschau, 16.7.2005, S. 11<br />
107
die davon betroffenen jungen Menschen Exklusion aus dem gesellschaftlichen und<br />
politischen Leben bedeutet.<br />
<strong>Die</strong> eingeschränkte materielle und soziale Situation beschleunigt den<br />
Demoralisierungsprozess, d. h. ihre psychische, geistige und körperliche Beeinträchtigung.<br />
Jugendliche Arbeitslose verlieren häufig ihre Zeitstruktur und haben Probleme mit der<br />
Strukturierung ihres Tagesablaufs, was ihnen häufig wieder als persönliches Versagen<br />
angelastet wird, obwohl es im Kontext ihrer Lebenslage "normal" ist.<br />
Der soziale Abstieg vollzieht sich bei jugendlichen Arbeitslosen angesichts des mangelhaften<br />
Systems der sozialen Sicherung sehr schnell. Auch in Phasen konjunktureller und<br />
struktureller Arbeitslosigkeit kommt es immer wieder zu Interpretationen, dass die<br />
Betroffenen selbst für ihre Arbeitslosigkeit verantwortlich sind – im Sinne von "blame the<br />
victim".<br />
<strong>Die</strong> Experten weisen darauf hin, dass der spezifischen Situation benachteiligter arbeitsloser<br />
Jugendlicher Rechnung getragen werden muss. Das impliziert, dass insbesondere<br />
Programme zu deren "Nachqualifizierung" in Verbindung mit Arbeitsangeboten entwickelt<br />
werden müssen.<br />
Arbeitslosigkeit wird als die Situation benannt, durch die Armut und Benachteiligung<br />
verfestigt wird. Demzufolge ist "der Arbeitsmarkt, der Zugang zu Arbeit, vielleicht auch die<br />
Umverteilung von Arbeit, ein wichtiges Kriterium" zur Verbesserung der Lebenssituation. "Wir<br />
wissen, dass Viele, die in Armut leben, geringe Qualifikationen haben, wodurch sich<br />
aufgrund des veränderten Arbeitsmarktes ihre Eingliederung in stabile<br />
Erwerbsarbeitsverhältnisse erschwert."<br />
<strong>Die</strong> Notwendigkeit, Lücken im System der sozialen Sicherung zu schließen, wurde<br />
wiederholt betont. Besonders Familienleistungen sind unzureichend. "Der<br />
Kindergeldzuschlag ab Januar 2005 löst das Problem nicht grundlegend."<br />
Kleinteilig auf Stadtteilebene und Quartiersebene gibt es keine geeigneten Maßnahmen,<br />
"grundsätzlich die Arbeitslosenzahlen und Sozialhilfezahlen zu verändern. Wir können mit<br />
den Mitteln, über die wir auf der untersten kommunalen Ebene verfügen, nur Einfluss darauf<br />
nehmen, dass die Menschen mit der Situation in der sie leben, vielleicht anders und besser<br />
umgehen." Dadurch ändert sich ihre prekäre Situation nur gering. "Sie sind in der nächsten<br />
Krisensituation in der Gefahr, wieder in den Kreislauf von Armut zu rutschen."<br />
Verschiedene sozialpolitische Problemstellungen bezogen sich auf den Bereich der<br />
Wohnungspolitik – hier wurden dann auch einige Konsequenzen aufgezeigt.<br />
<strong>Die</strong> hohe Segregation benachteiligter Familien in "arme" Stadtteile, insbesondere in<br />
Großsiedlungen mit ihren Hochhäusern, wird im Zusammenhang mit notwendigen<br />
Verbesserungen wiederholt benannt. <strong>Die</strong> Strukturen haben sich dort verfestigt. <strong>Die</strong> Familien<br />
"kommen gar nicht mehr raus ... deswegen schon nicht, weil wir sie gar nicht mehr raus<br />
lassen, ... wegen der niedrigen Mieten. .. Es ist nicht gut, dass diese Menschen in dieser<br />
Ballung dort leben. Sie lernen voneinander – immer das gleiche, aber nicht das, was sie<br />
lernen sollten. ... Da bilden sich Gettos."<br />
Durch die Ballung benachteiligter Bevölkerungsgruppen in benachteiligten Stadtteilen<br />
werden die aus Armut und Benachteiligung resultierenden Probleme verschärft. "<strong>Die</strong> Stadt<br />
muss versuchen, das zu lösen. Ich glaube, dass wir das lange aus dem Blick verloren haben<br />
und dass man da mit Programmen näher herangehen muss." Notwendig ist ein Masterplan<br />
für einen Zeitraum von zehn Jahren.<br />
Zur Zeit ist es so, dass die Wohnungsbaugesellschaften der Analyse zustimmen, "dass sie<br />
das Problem erkennen und dass sie es auch nicht verfestigen wollen. Dass sie dazu<br />
108
eitragen wollen, dass eine soziale Stadtentwicklung mit einer entsprechend vernünftigen<br />
Durchmischung möglich sein muss. ... Wenn wir die [benachteiligten] Familien unterbringen<br />
wollen ... stellen wir fest: die werden einfach aussortiert. <strong>Die</strong> kommen nicht in den Genuss in<br />
eine bestimmte Wohnung in einem bestimmten Viertel zu ziehen, weil sich dort schon<br />
genügend dieser Leute befinden .... ." <strong>Die</strong> Wohnungsbaugesellschaften sagen deutlich – in<br />
der mittleren Managementebene: "Wir haben da lieber Leerstände, als so eine Familie<br />
zusätzlich aufzunehmen, mit der wir uns noch viel mehr Probleme einkaufen; die schicken<br />
wir lieber zurück. <strong>Die</strong> werden obdachlos – viele dieser Familien werden obdachlos."<br />
<strong>Die</strong>se Aussage findet ihre Bestätigung in folgendem Hinweis: Es ist in den letzten<br />
Jahrzehnten viel Geld für den Sozialen Wohnungsbau und den Einkauf von Bindungen<br />
ausgegeben worden. Wir erleben aber im Moment, "dass nicht all diese Haushalte von der<br />
Wohnungswirtschaft akzeptiert werden".<br />
<strong>Die</strong> Frage, ob Innenstadtsanierung ebenfalls zur Verdrängung armer und benachteiligter<br />
Mieter führe, wurde problematisiert. Es muss unterschieden werden, ob "man konkrete<br />
Personen verdrängt, ... oder entzieht man einem abstrakten Personenkreis Angebote und<br />
damit natürlich auch Chancen?" Es wird versucht zu verhindern, dass konkrete Personen<br />
bzw. Personengruppen verdrängt werden. "Dass durch eine erfolgreiche Aufwertung dann in<br />
diesem Stadtgebiet bestimmte Angebote ... – z. B. preiswerter Wohnraum – abgezogen wird,<br />
ist zwangsläufig. Das führt letztendlich dazu, dass sich dieser Stadtteil verändert, sich also<br />
eine andere Sozialstruktur einstellt." Damit ist noch nicht die Frage beantwortet, wo die<br />
Familien bleiben. Insgesamt habe Hamburg immer noch ein akzeptables Mietenniveau und<br />
relativ viele Wohnungen des Sozialen Wohnungsbaus und von Wohnungsbaugesellschaften.<br />
Der Sachverhalt, dass gut ein Viertel aller Sozialwohnungen im Zeitraum zwischen 2003 bis<br />
2009 aus der Bindung fallen, wird nur bedingt als Problem gesehen. "Nur weil die<br />
Wohnungen aus der Bindung gehen, können noch keine zwanzigprozentigen<br />
Mieterhöhungen durchgesetzt werden. Das ist abhängig von der Enge des<br />
Wohnungsmarktes." Der wird nach Ansicht der "Experten auf der Handlungsebene" aber für<br />
viele benachteiligte Familien immer enger.<br />
Ansätze zur Verbesserung der Lebenssituation<br />
<strong>Die</strong> Stabilisierung der Bewohnerstruktur, insbesondere in Großsiedlungen des sozialen<br />
Wohnungsbaus, stand im Mittelpunkt vieler Gespräche. <strong>Die</strong>s ist ein Ziel, das dann<br />
besonderer Anstrengungen und Konzepte bedarf, wenn es um die Unterbringung von<br />
Personen und Familien geht, die sogenannte "Problemfälle" des Wohnungsmarktes<br />
darstellen.<br />
Durch "Flexibilisierung dürfen Sozialwohnungen frei belegt werden, damit sich keine<br />
einseitige Belegungsstruktur verfestigt. ... Dafür müssen sie aber die Leute woanders<br />
unterbringen – in entsprechender Zahl." [Bisher ist offensichtlich nicht sichtbar geworden, wo<br />
"diese Leute" untergebracht werden.]<br />
Zur besseren Integration der benachteiligten Familien müssen "der Wohnungswirtschaft<br />
einerseits Risiken genommen werden ... und es müssen auf der anderen Seite soziale<br />
Risiken abgefedert werden, etwa durch aufsuchende Sozialarbeit, Beratung, auch durch<br />
Benennung von Ansprechpartnern für die Wohnungswirtschaft, ... ggf. 'Wohnen auf Probe'".<br />
Wohnungsunternehmen, Bau- und Sozialbehörde haben einen Kooperationsvertrag<br />
abgeschlossen, "zur unterstützenden Begleitung der Integration [von Problemfamilien] ins<br />
Wohnumfeld". Der öffentliche Träger garantiert "Formen der materiellen Unterstützung, damit<br />
die Gesellschaften ihre Risiken besser kalkulieren können – die wirtschaftlichen, aber auch<br />
Risiken mit der Nachbarschaft." <strong>Die</strong> [bezirklichen] Fachstellen dürften/ sollten Betroffene<br />
nicht nur "benennen" und dann zu den Wohnungsunternehmern schicken "nach dem Motto:<br />
109
Entweder nehmen sie die oder die nehmen sie nicht". Es muss vorher von der "öffentlichen<br />
Hand" überlegt werden: Geht das? Und: Unter welchen Bedingungen geht das?<br />
Begleitmaßnahmen sind notwendig. "<strong>Die</strong> Mitarbeiter der Fachstellen und der Gesellschaften<br />
sollen bei der Belegung verantwortlich zusammenarbeiten." Um ihrem Auftrag gerecht<br />
werden zu können, benötigen die Fachstellen ausreichend qualifizierte Mitarbeiter,<br />
Entscheidungskompetenzen, aber auch Wohnungskontingente.<br />
Wohnungsunternehmen, die zum Teil selbst erhebliche Aktivitäten entwickeln, fühlen sich<br />
gelegentlich von der Stadt alleingelassen; sie benötigen Unterstützung durch bezirkliche<br />
Stellen, durch Sozialämter oder auch durch den Sozialpsychiatrischen <strong>Die</strong>nst. <strong>Die</strong><br />
Einschränkung dieses <strong>Die</strong>nstes wirkt sich problematisch aus, da von Räumungen auch Fälle,<br />
die "im psychiatrischen Bereich gelagert sind", betroffen sind. Wenn dann erst nach einer<br />
Wartezeit von einem dreiviertel Jahr ein Termin vergeben wird, kann es zwischenzeitlich zu<br />
erheblichen Krisen und Konflikten kommen.<br />
"Der Sozialstaat kann auch in Hamburg nur gelingen, wenn sowohl die soziale Sicherung im<br />
monetären Bereich, als auch die Unterstützung in prekären Lebenslagen gleichermaßen<br />
beachtet werden."<br />
Aus den verschiedenen Beiträgen zeichnet sich ab, dass offensichtlich in Hamburg bei der<br />
Wohnraumförderung die Bestimmungen des § 6 des Wohnraumfördergesetzes höchste<br />
Priorität haben: "Bei der Förderung sind zu berücksichtigen: ... 3. die Schaffung und<br />
Erhaltung sozial stabiler Bewohnerstrukturen."<br />
Angehörige der in § 1 Abs. 2 genannten Zielgruppen, insbesondere wenn ihre Lebenslage<br />
durch Probleme gekennzeichnet ist – was bei benachteiligten Familien häufig der Fall ist –<br />
sind in Gefahr, Verlierer dieses Vorgehens zu werden.<br />
<strong>Die</strong> Verfahren der Flexibilisierung der Belegung scheinen noch sehr undeutlich zu sein:<br />
• Wer übernimmt welches Risiko?<br />
• Wer übernimmt für was die Verantwortung?<br />
• Welche Kompetenzen haben die neuen Fachstellen?<br />
Untersuchungen in dem o. g. Projekt haben gezeigt, dass vielfach eine Hilfe zur Erziehung<br />
beendet oder verkürzt werden könnte, wenn für Familien mit einer Wohnraumproblematik<br />
geeigneter Wohnraum zur Verfügung gestellt würde. Ebenso wurde auf den Bedarf an<br />
Einzimmerwohnungen hingewiesen. Es könnten gelegentlich Heimunterbringungen von<br />
Jugendlichen vermieden werden, wenn sie in Nachbarschaft zu ihrer Familie selbständig<br />
wohnen könnten.<br />
Es muss verhindert werden, dass Familien mit Kindern unsanierte Wohnungen in<br />
Großsiedlungen am Stadtrand erhalten. Für die Familien, insbesondere die Kinder, bedeutet<br />
ein entsprechender Umzug meistens eine Entwurzelung, Verlust von Freunden und Peer-<br />
Groups und Desintegration in die neuen Wohngebiete.<br />
Um die beiden Zielsetzungen des Gesetzes<br />
• Wohnraumversorgung benachteiligter Gruppen<br />
• Schaffung und Erhaltung sozial stabiler Bewohnerstrukturen<br />
in Einklang zu bringen, ist eine "problembezogene" Kooperation relevanter Einrichtungen in<br />
den Stadtteilen und Quartieren erforderlich, um eine Integration Aller zu gewährleisten.<br />
110
4.3 Konsequenzen auf der Ebene der Jugendhilfe<br />
unter Berücksichtigung der Zielsetzung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes<br />
Zielgruppen der Jugendhilfe, insbesondere der Hilfen zur Erziehung, sind häufig von Armut<br />
und Benachteiligung betroffen. Im 10. Kinder- und Jugendbericht wird darauf hingewiesen,<br />
dass eine "Armutspolitik, die das gesamte Lebensumfeld von Kindern und Familien<br />
berücksichtigt", dringend geboten ist.<br />
Problemstellung<br />
Maßnahmen der Jugendhilfe – und der Sozialen Arbeit generell – müssen folgenden<br />
Problemen ihrer Zielgruppen Rechnung tragen:<br />
• Betroffenheit von Lebenssituationen, die meistens materiell und sozial unzureichend<br />
abgesichert sind<br />
• Auswirkungen von Diskriminierung und Segregation<br />
• reduzierte Zugangschancen zu Rechten und <strong>Die</strong>nstleistungen<br />
• geringe Mobilitätschancen durch Bildungs- und Qualifikationsdefizite<br />
• Wohnungsprobleme, u. a. durch Verknappung preiswerten Wohnraums<br />
• zunehmende Verschuldung<br />
• Berufsnot junger Menschen<br />
• Ausgliederung aus dem Arbeitsmarkt/ hohe Arbeitslosigkeit.<br />
Viele Schwierigkeiten armer und benachteiligter Kinder und Jugendlicher entstehen dadurch,<br />
dass sie und ihre Eltern häufig chronisch belastenden, sie überfordernden Situationen<br />
ausgesetzt sind. <strong>Die</strong> wesentlichen Aspekte werden in folgenden Thesen zusammengefasst:<br />
• Benachteiligende Lebens- und Wohnbedingungen und die häufig vorhandene (auch<br />
vermutete) Ausweglosigkeit, seine Lage zu verändern, führen häufig zu Aggressionen,<br />
Suchtverhalten und Rückzug.<br />
• <strong>Die</strong> Auswirkungen auf die Kinder sind in der Regel sehr negativ. Sie erfahren ihre<br />
Lebenssituation von vornherein als normal. Ihnen wird jedoch vermittelt, dass sie anders<br />
sind. Sie entwickeln Störungen aufgrund der schlechten Lebensbedingungen, ihnen fehlt<br />
in der Regel positive Zuwendung und ein Anregungsmilieu – innerhalb und außerhalb<br />
ihrer Familie –, das ihnen gestatten würde, den Kreislauf durch bessere Ausbildung und<br />
aussichtsreichere Arbeitschancen zu durchbrechen.<br />
• Armut und Benachteiligung beinhalten ein Zusammenwirken von ökonomischen,<br />
psychischen und sozialen Faktoren. Sie stellen sich als "kumulative Deprivation" dar<br />
und schlagen sich – differenziert nach der Dauer, die jemand unter den Bedingungen<br />
zubringt – auch in soziokulturellen Lebenslagen nieder, d. h. auch in Verhaltensweisen,<br />
Wert- und Zielvorstellungen sowie in den Anpassungsprozessen der betroffenen<br />
unterprivilegierten Gruppen an die sie einschränkenden Lebensbedingungen.<br />
<strong>Die</strong> Aussagen der Experten machen deutlich:<br />
• <strong>Die</strong> "Versäulung" innerhalb der Jugendhilfe, aber z. B. auch zwischen den Bereichen<br />
Jugendhilfe, Gesundheit, Schule, Wohnen, Stadtentwicklung, separiert Problemlagen, die<br />
von den Betroffenen als "Einheit" wahrgenommen werden. "Das Hilfesystem lässt<br />
Zusammenhänge verloren gehen."<br />
• <strong>Die</strong> soziale Isolation der betroffenen Familien macht einen Teil der Problematik aus.<br />
• Eine multidimensionale Betrachtung der Lebenslagen der Betroffenen muss in den<br />
Prozess sozialarbeiterischer Handlungsansätze einbezogen werden.<br />
• Lebenswelt- und sozialraumorientierte Handlungsstrategien mit z. B. Ansätzen der<br />
Partizipation und Vernetzung müssen neu diskutiert, konzipiert und realisiert werden.<br />
112
Arbeitsstrukturen, aber auch tradierte Vorgehensweisen im "System Jugendhilfe" wirken<br />
sich zum Teil problemverschärfend aus. So wird z. B. die noch immer übliche<br />
"Kommstruktur" kritisiert, weil sie von benachteiligten Familien vielfach nicht genutzt werden<br />
kann: <strong>Die</strong>nste und Leistungen können nur nachgefragt werden, wenn die Betroffenen über<br />
ausreichende Informationen und Handlungspotentiale verfügen, um sie für sich in Anspruch<br />
nehmen zu können.<br />
Auch der "Rückgriff" auf die Eltern und die Form, wie das häufig geschieht, wird in Frage<br />
gestellt: "Sie [die Eltern] werden immer verantwortlich gemacht und von jedem 'angezeigt',<br />
aber es ist keiner da, der wirklich die Zeit hat, ihnen Hintergründe etc. verständlich zu<br />
machen. Ich weiß auch nicht, wie man eine 25- oder 30-jährige Sozialisation in einem<br />
verbalen Kontext umbiegen könnte. Wir sind in der Regel 'Verbalakrobaten'."<br />
<strong>Die</strong> "Schuldzuschreibung" an die Eltern begünstigt die oft an den Allgemeinen Sozialdienst<br />
der Jugendämter herangetragene Erwartung/ Forderung: "<strong>Die</strong> Kinder müssen da raus." ...<br />
"Man muss ... den Rahmen der Verhältnismäßigkeit betrachten ...: Was löst das aus bei den<br />
Kindern, die wir aus ihrem sozialen Umfeld nehmen? Was macht das mit ihrer Biografie?<br />
Was macht das mit ihrer Identität, so einen harten Eingriff 'mal eben' durchzuführen?"<br />
Verhaltensweisen im eigenen Arbeitsbereich werden problematisiert und kritisch reflektiert:<br />
"Für mich ist es die nicht vorhandene Bereitschaft, Verantwortung für das, was man selber<br />
tut, zu übernehmen und damit auch für die eigene Arbeit. ..., dass alle versuchen, sich der<br />
Verantwortung zu entziehen, und ... Konzepte gesucht werden, ... die möglichst offen lassen,<br />
wer eigentlich wann, warum, wofür verantwortlich ist und wer welche Entscheidung und die<br />
daraus resultierenden Konsequenzen zu tragen hat."<br />
In den Gruppendiskussionen wird darauf hingewiesen, dass die "Überspezialisierung" –<br />
sowohl bei den Sozialarbeitern als auch bei den Lehrern – ein Teil des Problems ist: "Der<br />
eine ist spezialisiert auf diese Sorte Kinder, Menschen, Benachteiligte ... und der andere auf<br />
Andere." Seit Mitte der siebziger Jahre ... haben wir uns "immer detaillierter auf irgendwas<br />
eingelassen und haben dabei Leben und seine alltäglichen Abläufe aus dem Auge verloren".<br />
Es wurden besondere Schulklassen, Kitas, etc. geschaffen. "... Und jetzt sind wir immer noch<br />
damit beschäftigt, uns zu spezialisieren. ... Das ist für mich eine gesellschaftliche<br />
Geschichte, weil von der persönlichen Spezialisierung sowohl das ... Einkommen als auch<br />
der gesellschaftliche Status abhängt."<br />
Das Fazit einer Diskussion zu Spezialdiensten und -einrichtungen in der Jugendhilfe mündet<br />
in die Aussage: "Man müsste das Augenmerk auf präventive Maßnahmen legen, ... auf<br />
normale Lebensmöglichkeiten richten. Dann müsste man gar nicht diese ganz teuren<br />
[Spezial-] Geschichten in diesem Maße veranstalten und bezahlen. Ich glaube, dass sich<br />
dann ganz viel von alleine ergeben würde. Wir passen ja ständig Kinder an Umgebungen an,<br />
die für sie künstlich sind."<br />
Tenor aus mehreren Einzelinterviews, aber auch aus Gruppendiskussionen war die<br />
Annahme, dass die Vorenthaltung von Entwicklungs- und Teilhabechancen sich nicht nur<br />
deprivierend für die von der einschränkenden Lebenssituation betroffenen jungen Menschen<br />
auswirkt, sondern dass es dadurch längerfristig auch zu Beeinträchtigungen der<br />
gesellschaftlichen Kohäsion kommt: "Was diese Gesellschaft einer bestimmten<br />
marginalisierten Gruppe, wie den Heranwachsenden, verwehrt, bleibt nicht ohne<br />
Konsequenzen für die sozialintegrative Balance dieses demokratischen Rechtsstaats."<br />
113
Zielsetzungen des Kinder- und Jugendhilfegesetzes<br />
<strong>Die</strong> Umsetzung der Menschwürde: "<strong>Die</strong> Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten<br />
und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt" 1 , wird für den Politikbereich der<br />
Jugendhilfe im § 1 des Kinder- und Jugendhilfegesetzes geregelt: "Jeder junge Mensch hat<br />
ein Recht auf Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung zu einer<br />
eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit.<br />
...<br />
Jugendhilfe soll zur Verwirklichung des Rechts ......... insbesondere<br />
1. junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung fördern und dazu<br />
beitragen, Benachteiligung zu vermeiden und abzubauen,<br />
2. Eltern und andere Erziehungsbeteiligte bei der Erziehung beraten und unterstützen,<br />
3. ........<br />
4. dazu beitragen, positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien<br />
sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt zu erhalten oder zu schaffen."<br />
Prinzipien und Zielbestimmungen des KJHG<br />
Mit Inkrafttreten des KJHG sollten folgende Prinzipien für "eine moderne Jugendhilfe"<br />
handlungsleitend sein:<br />
• Leistung statt Eingriff<br />
• Prävention statt Reaktion<br />
• Flexibilisierung statt Bürokratisierung<br />
• Demokratisierung statt Bevormundung<br />
Sie sollten ihre Umsetzung in folgenden "Handlungsprinzipien" finden:<br />
• primäre und sekundäre Prävention<br />
• lebensweltorientiertes Handeln<br />
• Dezentralisierung und Regionalisierung<br />
• Alltagsorientierung<br />
• integrative Orientierung<br />
• Existenzsicherung / Alltagsbewältigung<br />
• Partizipation und Freiwilligkeit<br />
• Einmischung (in andere Politikbereiche) 2<br />
<strong>Die</strong> Institutionen der Jugendhilfe haben nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz<br />
Handlungsstrategien auf der individuellen (Meso-) Ebene sowie auf der jugend- und<br />
gesellschaftspolitischen Ebene zu realisieren: "Der Abbau sozialer Ungleichheit, die<br />
Sicherung der allgemeinen Förderung junger Menschen und der Ausgleich besonderer<br />
Benachteiligungen durch individuelle Angebote und Leistungen gehören zu einer offensiven<br />
Jugendhilfe, die dem Sozialstaatsgebot, der Chancengleichheit und der Emanzipation<br />
verpflichtet ist. Um diese Ziele zu verwirklichen, sind für Kinder und Jugendliche<br />
Bedingungen zu schaffen, die die Entfaltung und Integration von Spontaneität, Aktivität,<br />
Initiative, Kommunikation, Selbstregulierung, Selbstorganisation und Konfliktbereitschaft<br />
fördern und sichern." 3<br />
1<br />
Artikel 1 Abs. 1 Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland<br />
2<br />
Münder u. a., Frankfurter Lehr- und Praxiskommentar, SGB VIII, a.a.O., Einleitung, RZ 10, S. 69 f.<br />
3<br />
ebenda, Einleitung, RZ 2, S. 67<br />
114
Mit diesem Auftrag verbunden sind sowohl Querschnittsaufgaben als auch<br />
Einmischungsstrategien.<br />
Sozialraum- und lebensweltorientierte Ansätze in der Sozialen Arbeit beinhalten<br />
Handlungsstrategien, die geeignet sind, den o. g. Ansprüchen im Rahmen der Jugendhilfe<br />
weitgehend Rechnung zu tragen. Angesichts des Zusammenhangs von psychosozialen<br />
Beeinträchtigungen von Menschen und ihrer Desintegration und Marginalisierung in<br />
gettoisierten Stadtteilen sollen soziale Probleme nicht primär durch individuelle Hilfesettings<br />
„behandelt“ werden, sondern – ausgehend von der Problemstruktur und Lebenslage der<br />
Menschen – definiert und verändert werden.<br />
Demzufolge entwickelt und realisiert sozialraumorientierte Soziale Arbeit u.a.<br />
Handlungsstrategien, die<br />
• sich auf Konflikte und Widersprüche in der (jeweiligen) Gesellschaft beziehen.<br />
• Probleme in ihrem sozial- ökologischen Kontext bearbeiten.<br />
• auf unterschiedlichen Handlungsebenen realisiert werden und verschiedene Methoden<br />
integrieren.<br />
• Aktivierung und Beteiligung der Bevölkerung als Grundsatz ihrer Arbeit ansehen.<br />
• die Verbesserung der Lebensbedingungen und Teilnahmechancen der Bewohner zum<br />
Ziel haben.<br />
Ziel ist die Veränderung von sich nachteilig auswirkenden gesellschaftlichen Entwicklungen<br />
und Tatbeständen und die Schaffung einer familienfreundlichen Umwelt. Das bedeutet auch,<br />
Beiträge zu leisten zur Beseitigung von Disparitäten im lokalen und sozialen Bereich.<br />
Sozialräume sind so zu gestalten, dass sie "tragfähig und belastbar“ sind, d.h., dass dort<br />
auch anfallende Schwierigkeiten und Konflikte aufgefangen werden können. Das erfordert,<br />
dass in Krisen und Konfliktsituationen Unterstützungssysteme (Ressourcen) und<br />
Kompetenzen verfügbar sind. Dazu notwendig ist eine regionale, kleinräumig erreichbare –<br />
formale und informelle – Infrastruktur, die sich entlastend und integrierend auf die<br />
Lebenssituation der Bewohner auswirkt bzw. deren Entlastung und Integration begünstigt,<br />
fördert, ermöglicht. Gefordert sind präventive, niedrigschwellige Angebote im Viertel.<br />
Sozialraum- und lebensweltorientierte Sozialarbeit trägt folgenden Aspekten<br />
sozialarbeiterischen und sozialpolitischen Handelns Rechnung:<br />
• Multidimensionale Sichtweise der Lebenslage von Menschen und deren<br />
Problemsituationen.<br />
• Einbeziehung des Sozialraums als ein Phänomen, das Einstellungen und<br />
Verhaltensweisen beeinflusst und sich auf die Entwicklung von Menschen sowohl<br />
begünstigend als auch benachteiligend auswirken kann.<br />
• Betrachtungen von Verhaltensweisen im Kontext der jeweiligen<br />
sozioökonomischen Bedingungen.<br />
• Partizipation der Betroffenen - das beinhaltet auch Aufgabe der Defizitorientierung<br />
Sozialer Arbeit zugunsten der Einbeziehung der Vorstellungen und Lösungswege<br />
benachteiligter Menschen, deren Kompetenzen und Ressourcen als bedeutsam<br />
für den Veränderungsprozess berücksichtigt werden.<br />
• Unterstützung benachteiligter Menschen bei der Einflussnahme auf administrative<br />
und politische Entscheidungsprozesse entsprechend ihrer Interessen und<br />
Bedarfe.<br />
• Parteilichkeit der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen – das bedeutet<br />
Interessenvertretung und Lobbyfunktion zugunsten stigmatisierter Gruppen.<br />
• Einmischung in andere Politikbereiche und Arbeit auf unterschiedlichen<br />
Handlungsebenen.<br />
115
• Vernetzung relevanter formaler und informeller Institutionen auf regionaler Ebene<br />
– Ziel ist u.a. die quantitative und qualitative Verbesserung der Infrastruktur und<br />
damit der Lebenssituation der Menschen in der Region.<br />
• Selbstevaluation der professionellen Arbeit, das bedeutet kontinuierliche Auswertung<br />
und Bewertung der eigenen Praxis, ggf. Korrekturen der Arbeitsansätze und Variation<br />
von Aktivitäten entsprechend der Problematik, die der Arbeit zugrunde liegt und der<br />
Ziele, die zur Lösung der Problematik definiert werden.<br />
<strong>Die</strong> Entwicklung und Realisierung sozialraum- und lebensweltorientierter Sozialer Arbeit<br />
bedeutet einen Paradigmenwechsel bei den Handlungsstrategien: "von der<br />
Defizitorientierung zur Ressourcenorientierung". <strong>Die</strong> Professionellen der Jugendhilfe werden<br />
mit der Forderung konfrontiert, Routine und bisheriges professionelles Handeln zu<br />
reflektieren und gegebenenfalls auch zu variieren, d. h., sich auf neue professionelle<br />
Handlungsstrategien einzulassen. Das impliziert, die eigene Sichtweise über Probleme,<br />
Krisen, Verhaltensweisen, Einstellungen und Denkstrukturen der Zielgruppe in Frage zu<br />
stellen und gegebenenfalls alternative Einschätzungen und Bewertungen zu erarbeiten.<br />
<strong>Die</strong> Entwicklung ergänzender bzw. alternativer Handlungsstrategien erfordert ggf.<br />
• ein verändertes Menschenbild<br />
• die Infragestellung vermeintlicher gesellschaftlicher Normalität bezogen auf die Situation<br />
der Zielgruppen und die Akzeptanz von Anderssein – solange andere durch das<br />
Anderssein nicht behindert, gefährdet, verletzt, benachteiligt oder diskreditiert werden<br />
• Arbeit auf unterschiedlichen Handlungsebenen<br />
• Realisierung unterschiedlicher methodischer Arbeitsansätze.<br />
Mit der Entwicklung und Realisierung lebenswelt- und sozialraumorientierter Ansätze in der<br />
Jugendhilfe sind positive Entwicklungen und Chancen verbunden. Es besteht nicht nur die<br />
Forderung, sondern auch die Chance, in seiner Arbeit „anzuhalten“ und „zu reflektieren“, um<br />
aus den gewonnenen Erkenntnissen und Ergebnissen – gemeinsam mit anderen – etwas<br />
Neues zu entwickeln und dabei die gemeinsame Verantwortung eines Teams zu erleben.<br />
Konsequenzen für die Jugendhilfe<br />
Sozialraum- und lebensweltorientierte Ansätze in der Sozialen Arbeit sind geeignet, dem<br />
Auftrag des Kinder- und Jugendhilfegesetzes gerecht zu werden. Wichtig ist es "von einem<br />
ressortbezogenen Ansatz zu einem gebietsbezogenen Ansatz zu kommen". Vorurteile und<br />
Abgrenzungsprobleme zwischen Mitarbeitern verschiedener Institutionen und<br />
Arbeitsbereiche "müssen durch gemeinsame Aufgaben überwunden werden".<br />
Prämisse für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen sollte sein: "Wer mit Kindern arbeitet,<br />
muss Kinder mögen." ... "<strong>Die</strong> Jugendlichen sind 'hungrig' darauf, dass sie eine Mischung von<br />
Anerkennung einerseits sowie verlässliche Regeln und Grenzen andererseits erhalten. <strong>Die</strong><br />
Wertschätzung und die Grenzen – beides ist ganz notwendig." Es bedeutet auch<br />
"ernstgenommen zu werden".<br />
Im Folgenden werden Angebote und Aktivitäten sowie Aufgaben und Formen von<br />
Vernetzungen aufgezeigt, die von den Experten als notwendig für die Verbesserung der<br />
Lebenssituation benachteiligter junger Menschen und ihrer Eltern angesehen werden:<br />
• Eine erweiterte soziale Infrastruktur, um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu<br />
verbessern. Kinderkrippen müssen ausgebaut, Kitas verlässlicher gestaltet werden.<br />
• "Angebote an Orten, wo benachteiligte Kinder sind, z. B. Kitas, Schulen,<br />
Freizeiteinrichtungen, dahingehend ergänzen, dass Armutslagen entschärft werden."<br />
116
• Frühzeitige Hilfen geben, z. B. Sprachförderung für Kinder – nicht nur von ausländischen<br />
Mitbürgern. Dazu bedarf es einer Qualifizierung der Mitarbeiterinnen.<br />
• Beratungsangebote für Familien zur "Bewältigung von Belastungen der familiären<br />
Interaktion, die u. a. durch Gewalt in der Familie und durch Diskriminierungen und<br />
Stigmatisierungen beeinflusst wird".<br />
• Familienbildung und Beratung im Bereich der Familienförderung. 1<br />
Es geht um<br />
o Entlastung von belastenden sozialen und ökonomischen Umständen.<br />
o Vermittlung von Erkenntnissen und Erweiterung der Handlungsmöglichkeiten.<br />
o Aktivierung von Selbsthilfe.<br />
Beratungsangebote für benachteiligte Familien sollten sich u. a. auf handlungsrelevante<br />
Informationen beziehen, die dazu beitragen<br />
o <strong>Die</strong>nste und Leistungen besser in Anspruch nehmen zu können.<br />
o administrative und sonstige sie betreffende Entscheidungen besser zu verstehen<br />
und Einfluss auf entsprechende Entscheidungen nehmen zu können.<br />
o den Alltag und die eigene Lebenslage durch Erweiterung der Handlungsspielräume<br />
und -kompetenzen besser zu managen.<br />
Beratung zu pädagogischen Aspekten. Es geht darum<br />
o Eltern zu erreichen, die andere Einrichtungen nicht "anlaufen".<br />
o Erkenntnisse zu vermitteln über die (normale) Entwicklung von Kindern und über<br />
Erfordernisse für deren (gute) Förderung und Entwicklung<br />
o zu vermitteln, dass Krisen und Konflikte "normal" sind – besonders in der Trotzphase<br />
und der Pubertät – und für die Entwicklung von Autonomie, Selbstwert und Identität<br />
der Kinder bedeutsam sind, dass es zu ihrer Bewältigung aber (aggressions- und<br />
gewaltfreier) Konfliktlösungsstrategien bedarf.<br />
<strong>Die</strong> Inanspruchnahme der skizzierten Angebote soll durch "Präsenz vor Ort" und durch<br />
"Niedrigschwelligkeit" gefördert werden.<br />
Im folgenden werden Bedürfnisse von Kindern gegenüber ihren Eltern/ihrer Familie sowie<br />
ihrer Umwelt und von Eltern aufgezeigt, die bei der Entwicklung von Handlungsansätzen<br />
Berücksichtigung finden sollten.<br />
Bedürfnisse von Kindern/jungen Menschen gegenüber ihren Eltern/Familien<br />
• ein zufriedenes, ausgeglichenes Elternhaus<br />
o materielle Sicherheit<br />
o Vermittlung des Gefühls von Sicherheit und Zuversicht<br />
• kindliche Individualität<br />
• Beständigkeit<br />
• geregelter Tagesablauf<br />
• Versorgung mit kindgerechter Nahrung und Kleidung<br />
• gesundheitliche Betreuung<br />
• Regeln und Grenzen<br />
• "Kontrolle" ihrer Handlungen versus "Gleichgültigkeit", aber auch kontrollfreie Räume<br />
1 vgl. § 16 Kinder- und Jugendhilfegesetz<br />
117
Bedürfnisse von Kindern/jungen Menschen gegenüber ihrer Umwelt<br />
• Freiräume und Bewegungsmöglichkeiten in einer kindgerechten Umgebung<br />
• Gestaltungsspielräume und Natur<br />
• ein verständnisvolles Umfeld<br />
• Freunde<br />
• Bildung<br />
• Ausbildung<br />
• gesicherte Zukunftsperspektiven<br />
o Chancengleichheit<br />
o reale Entwicklungschancen<br />
• feste Bezugspersonen<br />
• Kontinuität<br />
• verbindliche Rollen und Regeln<br />
• Zeit und Aufmerksamkeit<br />
• Träume und Perspektiven.<br />
Bedürfnisse von Eltern<br />
• finanzielle/materielle Sicherheit<br />
• angemessene Wohnungen<br />
• familienfreundliche Arbeitsplätze<br />
• (kompetente) Gesprächspartner und soziale Netze<br />
• Entlastungen in belasteten und konflikthaften Situationen<br />
o Kitas, Ganztagsschulen<br />
• unterstützende Angebote<br />
o Erreichbarkeit<br />
• Rat und Tat für eine gelingende Bewältigung ihrer Alltags- und Erziehungsprobleme.<br />
Bezogen auf die Bedarfe der Kinder ist es nicht nur wichtig, ihnen in der Zusammenarbeit<br />
gerecht zu werden, sondern auch den Eltern zu helfen, die Kompetenzen zu erwerben, um<br />
den Bedarfen ihrer Kinder zu entsprechen.<br />
Vernetzungen und die Entwicklung von Kooperationsprojekten werden von den meisten<br />
Experten als absolut notwendig zur Verbesserung der Lebenssituation armer und<br />
benachteiligter junger Menschen und ihrer Familien angesehen. In ihren Äußerungen<br />
bezogen sich Vernetzungen zum einen auf die verschiedenen Aufgabenbereiche der<br />
Jugendhilfe, zum anderen auf Einrichtungen der Jugendhilfe in Kooperation mit anderen für<br />
den jeweiligen Sozialraum relevanten Institutionen. 1<br />
• "Es müsste eigentlich selbstverständlich sein, dass alle in einem Gebiet in der<br />
Jugendhilfe Tätigen miteinander kooperieren. Das ist unverzichtbar, da Jugendhilfe nur<br />
als Ganzes wirksam werden kann" bezogen auf die Lebenssituation von Menschen.<br />
• "Verpflichtung zu vernetzter Arbeit" – das wären die Bedingungen: <strong>Die</strong> bisher übliche<br />
Überweisungs-/ Delegationspraxis muss unterbrochen werden, man muss an die<br />
Strukturen ran "und sich auch gemeinsam verantwortlich für die Kinder fühlen". ... "<strong>Die</strong><br />
einzelnen Mitarbeiter müssen das auch noch lernen. Wir sind ja auch entfremdet und<br />
entsolidarisiert."<br />
1 <strong>Die</strong> Mitglieder der beiden Gruppendiskussionen arbeiten zum überwiegenden Teil in Kooperationsprojekten<br />
zusammen, was ihre Vorschläge sicherlich positiv beeinflusst hat.<br />
118
• Sozialraum- und lebensweltorientierte Handlungsstrategien bieten auch die Möglichkeit,<br />
bestehende Denk- und Handlungsmuster zu verändern. Wenn Kooperation gemeinsame<br />
Verantwortung impliziert, sollte das Anlass sein, "ganz radikal" Arbeitsansätze neu zu<br />
konzipieren. "Wenn wir ein Problem sehen, erfinden wir nicht die 'Spezialantwort' darauf,<br />
sondern wir sagen: Sozialarbeit und Bildungsarbeit gehören zusammen und gehören in<br />
eine Region. Dort gibt es Kindergärten und Schulen. <strong>Die</strong> statte ich gut aus und denke<br />
nicht in Spezialangeboten, in die ja auch viel Geld fließt." Wenn die "Basis" gut<br />
ausgestattet ist, werden die "kleinen Steinchen ... nicht mehr gebraucht." <strong>Die</strong> dortigen<br />
Mitarbeiter "sollen rein in die Region – wenn jemand dazu den Mut hätte!"<br />
• Neben den klassischen Bereichen Jugendhilfe und Schule sollten weitere Bereiche in<br />
regionale Vernetzung (ggf. nur punktuell) einbezogen werden, z. B.<br />
o der Gesundheitsbereich<br />
o Wohnungsbaugesellschaften<br />
o der Kultur- und Sportbereich.<br />
Im Rahmen der Stadtentwicklung – in der Regel in benachteiligten Quartieren – ist ein<br />
koordiniertes Vorgehen erstrebenswert: "Es geht darum, in diesen Gebieten koordinierte und<br />
gemeinsame Aktivitäten zu entwickeln und zu kultivieren."<br />
Im Zusammenhang mit angestrebten Vernetzungen im Rahmen sozialraum- und<br />
lebensweltorientierter Sozialer Arbeit, die von der Fachbehörde initiiert werden, wird es als<br />
notwendig angesehen, dass Kooperationen nicht nur auf regionaler Ebene gefordert werden,<br />
sondern dass sich entsprechende Vernetzungen und gemeinsame Verantwortlichkeiten auch<br />
auf der Behördenebene etablieren. Dem Amt für Familie, Jugend und Sozialordnung käme<br />
dabei im Rahmen seiner Einmischungsfunktion die Aufgabe zu, Einfluss auf andere<br />
Politikbereiche zu nehmen. 1 <strong>Die</strong> Jugendhilfe hat allerdings keine Direktionsrechte; sie kann<br />
nur Mahner und Anreger sein.<br />
Auf jugendpolitischer Ebene wird im Zusammenhang mit dem Thema Kinderarmut ebenfalls<br />
die Notwendigkeit zu kooperativen Vorgehensweisen – sowohl bei der Problemanalyse als<br />
auch bei der Entwicklung von Programmen – gesehen. Kinderarmut kann "nur in einer weit<br />
angelegten Kooperation der Parteien bekämpft werden, ... weil das ein so breites Spektrum<br />
hat".<br />
<strong>Die</strong> Entwicklung sozialraum- und lebensweltorientierter Handlungsstrategien ist mit einem<br />
fachlichen Paradigmenwechsel verbunden. Er erfordert veränderte fachliche Sichtweisen<br />
und Kompetenzen sowie besondere Ressourcen, aber auch eine Umverteilung von<br />
Ressourcen.<br />
Für den Kita-Bereich wurde von einer Vielzahl der Experten eine bessere personelle<br />
Ausstattung für Einrichtungen in benachteiligten Regionen als unabdingbar angesehen.<br />
Frühförderung wird als dringend erforderlich eingeschätzt, um die Eröffnung von<br />
Bildungschancen zu ermöglichen. Dazu sind "qualifizierte Mitarbeiter – besonders im Bereich<br />
Sprachförderung – aber auch kleine Gruppen notwendig. <strong>Die</strong> Gruppen zu vergrößern, das<br />
macht für die Kinder [z. B.] aus Blankenese nichts – aber die, die es wirklich nötig haben, für<br />
die ist dann noch weniger Zeit da. Gleichzeitig sollen sie sprachlich gefördert werden".<br />
Kooperation benötigt Mitarbeiter, die diese Funktion übernehmen können. Es wird als<br />
notwendig angesehen, Gemeinwesenarbeiter in den Stadtteilen mit dieser Aufgabe zu<br />
betrauen. In diesem Zusammenhang sei an die "Richtlinien für die Arbeit der Ämter für<br />
soziale <strong>Die</strong>nste" erinnert, die Ende der achtziger Jahre die Implementierung sozialraum- und<br />
lebensweltorientierter Handlungsstrategien ebenso vorsahen, wie die Schaffung von Stellen<br />
für Gemeinwesenarbeiter. <strong>Die</strong> seiner Zeit entwickelten Arbeitsansätze für die Arbeit des ASD<br />
1 vgl. § 81 Kinder- und Jugendhilfegesetz<br />
119
wurden zugunsten der mit Inkrafttreten des KJHG geschaffenen Hilfe zur Erziehung in den<br />
Hintergrund gedrängt.<br />
Kooperationsprojekte bedürfen, ebenso wie die Entwicklung und Förderung von<br />
Selbsthilfeprojekten "kleinräumiger Zentren", "wo verschiedene Professionen und<br />
Kompetenzen angesiedelt werden". Das können vorhandene Räume sein an Stellen, die von<br />
den Betroffenen normalerweise aufgesucht werden, z. B. in Schulen oder Kitas, aber auch<br />
leere Ladenlokale in den Quartieren.<br />
<strong>Die</strong> Entwicklung veränderter und alternativer Handlungsstrategien sollte – zumindest in der<br />
Implementierungsphase – begleitet werden durch<br />
• Beratung und arbeitsfeldbezogene Qualifizierung<br />
• Evaluation<br />
• Praxisforschung.<br />
Vertreter der Wissenschaft und Praxis in der Jugendhilfe "sollten besser miteinander<br />
kooperieren, nicht nur auf der Ebene der Analyse und Evaluation, sondern auch auf der<br />
Handlungsebene".<br />
<strong>Die</strong> Notwendigkeit der Ausbildung von Fachkräften wird ebenfalls zum Ausdruck gebracht:<br />
• "Das Thema Armut und armutsrelevante Sozialpädagogik muss an den Hochschulen<br />
vertreten werden."<br />
• Fachberatung für die Praxis, Vorträge zu der Problematik, Praxis-/ Projektbegleitung,<br />
Evaluation .. "In die Praxis gehen ... als 'Kooperationspartner'."<br />
• <strong>Die</strong> Analyse von Armuts-Lebenslagen im Rahmen von Praxisforschung. "Wir haben gute<br />
Datenbanken, aber wir wissen wenig über die subjektiven Formen der Verarbeitung ... ."<br />
Abschließend einige Prämissen für die Entwicklung und Realisierung von Vernetzungen/<br />
Kooperationsprojekten im Rahmen sozialraum- und lebensweltorientierter<br />
Handlungsstrategien in der Jugendhilfe.<br />
• Kooperationsprojekte müssen unter ihren jeweiligen Bedingungen einen<br />
Entwicklungsprozess mit eigenen Lern- und Erkenntnisphasen machen.<br />
• Partnerschaft muss wachsen. Es ist u. a. erforderlich, gemeinsame<br />
Aufgabenstellungen und Verantwortlichkeiten zu definieren.<br />
• Zu Beginn der Zusammenarbeit ist Konkurrenz nicht auszuschließen, aber es bedarf<br />
eines gewissen wechselseitigen Basisvertrauens, das durch große Transparenz und<br />
die Bereitschaft, Konflikte zu thematisieren, gestärkt werden kann.<br />
• Partnerschaftliche Formen der Zusammenarbeit bedürfen immer eines<br />
Entwicklungsprozesses. Bedeutsam ist, dass dieser Prozess bewusst gestaltet bzw.<br />
beeinflusst wird.<br />
<strong>Die</strong> Möglichkeiten der Jugendhilfe, Armut und Benachteiligungen junger Menschen und ihrer<br />
Familien "zu vermeiden oder abzubauen" 1 sind sicherlich gering. Im Rahmen sozialraum-<br />
und lebensweltorientierter Handlungsstrategien obliegt es den Vertretern der Jugendhilfe<br />
aber, Ursachen, Strukturen und Bedingungen von Armut und Benachteiligung zu<br />
analysieren, die Betroffenen zu aktivieren, sich offensiv mit ihrer Lebenslage und Lebenswelt<br />
auseinanderzusetzen, Vernetzungen aufzubauen und die u. a. im Rahmen von Evaluation<br />
deutlich gewordenen Einschränkungen, Belastungen und Benachteiligungen in der (jugend-<br />
und sozialpolitischen) Öffentlichkeit zu demonstrieren. Verbunden damit ist eine<br />
Lobbyfunktion.<br />
1 vgl. §1 Abs. 1 Kinder- und Jugendhilfegesetz<br />
120
Exkurs: Bildung als primäre Ressource,<br />
den Kreislauf von Armut und Benachteiligung zu durchbrechen<br />
<strong>Die</strong> Bildungssituation armer und benachteiligter junger Menschen wurde in allen Interviews<br />
und Gruppendiskussionen erörtert. Der "Kreislauf der Armut" (vgl. Punkt 3.4.3) wird in engem<br />
Zusammenhang mit einer ungenügenden Schulbildung gesehen: Benachteiligten Schülern<br />
wird meistens eine höher qualifizierende Schulbildung nicht zugetraut. Aufgrund mangelnder<br />
Förderung und Unterstützung durch ihre Eltern und die Institution Schule, bleiben ihnen<br />
häufig qualifizierte Schulabschlüsse versagt. Viele von ihnen haben eine Förderschule<br />
besucht oder die Hauptschule ohne Hauptschulabschluss verlassen. Es wird aber auch<br />
darauf hingewiesen, dass von einem Teil der Betroffenen Benachteiligung in verschiedenen<br />
Lebensbereichen kompensiert werden kann. Eine gute Einbindung in soziale Netzwerke, ein<br />
(relativ) hohes Bildungsniveau und die Integration ins Erwerbsleben sind geeignete<br />
Ressourcen, Krisen und Konfliktsituationen konstruktiv zu bewältigen und eine positive<br />
Identität und Personalität zu entwickeln. <strong>Die</strong> Frage, ob es Kindern und Jugendlichen gelingt,<br />
den Kreislauf der Armut zu durchbrechen, hängt maßgeblich von ihren Partizipationschancen<br />
am Bildungssystem ab.<br />
Anspruch und Wirklichkeit<br />
Auf Bildung als "wirtschaftliche Ressource" in einer hochentwickelten Industrienation, die<br />
kaum über Bodenschätze verfügt, wird in unserem Land schon seit einiger Zeit auch von<br />
Seiten der Politik und Wirtschaft hingewiesen. Randolf Rodenstock, Präsident der<br />
Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft betont in einem Interview in der Frankfurter<br />
Rundschau: "Wenn wir den Kindern in der Schule nicht genügend Aufmerksamkeit, Geld und<br />
Zeit ... widmen, dann programmieren wird die Arbeitslosen der Zukunft. Das ist absolut<br />
unverantwortlich. ... Wir brauchen ein komplettes Förderpaket für die jungen Menschen, mit<br />
Ganztagsschulen, aber auch mit Ferienunterricht. Gleichzeitig muss die Überfrachtung mit<br />
Wissen abgebaut werden, soziale Kompetenzen und Teamfähigkeit müssen entwickelt<br />
werden, lebenslanges Lernen muss für die jungen Menschen selbstverständlich werden. ...<br />
<strong>Die</strong> zentrale Frage ist, wovon werden wir in Zukunft leben? Da reichen keine fleißigen<br />
Hände, sondern da muss in die Köpfe der Menschen investiert werden. Wir müssen<br />
langfristig denken und unser Bildungssystem in Ordnung bringen." 1 Dass es bei dieser<br />
Forderung nicht primär um Bildungschancen für benachteiligte Kinder geht, belegt der<br />
folgende Satz: "Wir tun das, damit unsere Firmen in Deutschland überleben können." 2<br />
Vielleicht könnte eine Lösung des Problems des Geburtenrückgangs und des<br />
"millionenfachen Bedarfs" an qualifizierten Arbeitskräften in 20 bis 30 Jahren darin liegen, die<br />
Bildungsreserven benachteiligter junger Menschen zu aktivieren. Dabei sollten aber die<br />
Eröffnung von Bildungschancen und Möglichkeiten der gesellschaftlichen Teilhabe im<br />
Vordergrund stehen und nicht primär die Interessen der Wirtschaft.<br />
Karl Lauterbach, Direktor des Instituts für Gesundheitsökonomie und Klinische Epidemiologie<br />
der Universität Köln hat sich ebenfalls zur Bildungspolitik geäußert. Er sieht eine<br />
Abhängigkeit der Finanzierbarkeit der sozialen Sicherungssysteme und des ökonomischen<br />
Wachstums vom Bildungssystem. Im Vordergrund seiner Überlegungen stehen aber bessere<br />
Bildungschancen für Kinder aus bildungsfernen Familien. "Wir brauchen einen Neuanfang<br />
mit dem Hauptziel 'Chancengleichheit'."<br />
Einen Ansatz zur Erreichung dieses Zieles sieht er in einer Vorschulpflicht. "Es zeigt sich<br />
immer stärker, dass in der Altersgruppe der Drei- bis Sechsjährigen das Potenzial für die<br />
spätere Intelligenz und Lernfähigkeit aufgebaut wird. Es geht um spielerisches Lernen in<br />
einer qualitativ hochwertigen Vorschule. ... <strong>Die</strong> Gebührenfreiheit ist die Voraussetzung für<br />
1 Randolf Rodenstock, "Wir brauchen keine Fachidioten", Frankfurter Rundschau, 19.7.2005, S. 27<br />
2 ebenda<br />
121
den Aufbau einer Vorschule. ... Wenn wir Kindern durch den Besuch einer solchen<br />
Einrichtung Bildungschancen für die nächsten Jahrzehnte ihres Lebens eröffnen, dann ist die<br />
Vorschulpflicht keine vermessene Forderung, sondern im Interesse aller." 1<br />
Sehr pragmatisch hat sich die Bundesvereinigung Deutscher Arbeitgeberverbände geäußert:<br />
"Ohne Humankapital keine Zukunft." Bildungspotenziale werden nur unterdurchschnittlich<br />
ausgeschöpft, Begabungsreserven liegen brach.<br />
Hier werden Ansprüche an eine bessere Bildungssituation benachteiligter Kinder gestellt, die<br />
in erster Linie gesamtgesellschaftliche Ziele verfolgen und nicht primär diese Kinder mit ihren<br />
Bedarfen an Bildungschancen im Blick haben. Zwei Aspekte werden aber dabei sehr<br />
deutlich:<br />
• Bildungspotenziale und Bildungsreserven der benachteiligten jungen Menschen werden<br />
nicht in Frage gestellt<br />
• Bildung muss – insbesondere in bildungsfernen Familien – schon sehr früh im Vorschul-/<br />
Kindertagesstättenbereich beginnen. Das bedeutet, dass Jugendhilfe und Schule<br />
gefordert sind, dem Bildungsanspruch benachteiligter Kinder gerecht zu werden.<br />
Bisherige Untersuchungen in Hamburg bieten Ergebnisse, nach denen das hiesige, sehr<br />
differenzierte Bildungssystem nicht dazu geeignet ist, den definierten Ansprüchen gerecht zu<br />
werden. Hier soll keine vertiefende Auseinandersetzung mit den Pisa-Ergebnissen geführt<br />
werden. Um Deutschland mit Finnland und Hamburg mit Bayern zu vergleichen, ist es<br />
sicherlich auch nötig, "intervenierende Variablen" zu berücksichtigen. Trotzdem gilt eine<br />
Aussage auch für Hamburg: Deutsche Schulen sortieren ihren Nachwuchs zu früh und<br />
meistens unumkehrbar aus.<br />
Ein Ergebnis der Hamburger KESS 4-<strong>Studie</strong>, die Aussagen über die Kompetenzen von<br />
Schülern und Schülerinnen am Ende ihrer Grundschulzeit macht, weist auf eine starke<br />
institutionelle Selektion bei Hamburger Schülern hin:<br />
"Bei gleichen kognitiven Lernvoraussetzungen und gleicher Leistung haben<br />
Hamburger Grundschulkinder aus sozioökonomisch deprivierten Familien eine<br />
bedeutend geringere Chance, eine schulische Übergangsempfehlung für das<br />
Gymnasium zu erhalten, als Kinder aus sozioökonomisch privilegierten<br />
Elternhäusern." 2<br />
Auf diesen Sachverhalt hatte auch die Leiterin einer Grundschule in einer<br />
Gruppendiskussion hingewiesen: Schule traut es armen und benachteiligten Schülern oft<br />
nicht zu, den Anforderungen an Realschulen und Gymnasien zu genügen und spricht ihnen<br />
deshalb auch nur sehr selten eine Empfehlung für eine höherqualifizierende Schulstufe aus,<br />
obwohl sie entsprechende intellektuelle Leistungen bringen. <strong>Die</strong>se Aussage deckt sich mit<br />
Ergebnissen der KESS-4-<strong>Studie</strong>.<br />
"<strong>Die</strong> Abhängigkeit des Bildungserfolges der Kinder vom sozioökonomischen Status der<br />
Eltern ist in Deutschland am Ende der Sekundarstufe so hoch wie in keinem anderen Land,<br />
das an der Pisa-Untersuchung teilgenommen hat. ... In Hamburg ist diese Koppelung ...<br />
ebenfalls deutlich ausgeprägt." 3 .... "Betrachten wir den Zusammenhang des<br />
sozioökonomischen Status der Elternhäuser und der Schullaufbahnempfehlung, ... wird<br />
deutlich, dass ein Kind aus oberen Schichten ... in Hamburg die 4,25-fache Chance hat, eine<br />
Gymnasialempfehlung zu erhalten als ein Kind, das aus einer Arbeiter- bzw.<br />
Facharbeiterfamilie stammt. Vergleicht man nur die Kinder miteinander, die die gleichen<br />
kognitiven Grundfähigkeiten besitzen, ist die Chance immer noch 3,03-fach so hoch - ... ." 4<br />
1<br />
Lauterbach, K., "Es geht um Chancen einer Generation", Frankfurter Rundschau, 30.5.2005<br />
2<br />
Bos, W., Pietsch M., Erste Ergebnisse aus KESS 4-Kurzbericht, Hamburg, 9/2004, S. 56<br />
3<br />
ebenda, S. 47<br />
4<br />
ebenda, S. 53<br />
122
Haben Kinder von Arbeitern kaum eine Chance, die Schule mit dem Abitur abzuschließen,<br />
so zeigt die LAUF-<strong>Studie</strong> – Lernausgangslage an Förderschulen –, eine in Anlehnung an die<br />
Hamburger LAU-<strong>Studie</strong> im Rahmen eines Projektseminars der Universität Hamburg 1999<br />
durchgeführte Untersuchung, dass der überwiegende Teil der Schüler in Förderschulen aus<br />
benachteiligten Familien kommt. 1<br />
Dem Ergebnisreport der Untersuchung zufolge, kann "'der' Förderschüler in typologischer<br />
Vereinfachung mit folgenden Schlagworten beschrieben werden: niedrigere Intelligenz,<br />
geringere Schulleistungen, niedrigerer Schul-, Ausbildungs- und Erwerbsstatus der Eltern,<br />
höhere Arbeitslosigkeit der Eltern, mehr Geschwister (bei weniger Wohnraum), häufiger<br />
alleinstehende Eltern, geringerer Bücherbestand, seltener Deutsch als Muttersprache,<br />
erheblich längerer Fernsehkonsum, dürftigerer Besitz an persönlichen Konsumgütern". 2<br />
Es gelingt den Förderschulen nicht, ein weiteres Auseinanderdriften der<br />
Leistungsentwicklung zu verhindern. "<strong>Die</strong> Förderschule konnte eine progressive Öffnung der<br />
Leistungsschere nicht verhindern und keine kompensatorischen Wirkungen entfalten." 3<br />
Wocken weist ausdrücklich darauf hin, dass nicht alle Kinder aus benachteiligten Familien<br />
eine Förderschule besuchen, aber die, die Schüler dieser Schulform sind, stammen fast<br />
ausschließlich aus benachteiligten Familien. "Lernbehinderungen sind kein isoliertes<br />
Intelligenzdefizit. <strong>Die</strong> Schule für Lernbehinderte ist und bleibt eine Schule für sozial<br />
Benachteiligte. <strong>Die</strong> Förderschule kann die Erwartung einer kompensatorischen oder<br />
optimalen Leistungsförderung nicht einlösen." 4<br />
Dem entspricht die Aussage eines Interviewpartners, der darauf hinwies, dass Lehrer an<br />
Hauptschulen schwierige Schüler mit dem Hinweis auf die kleineren Gruppen und die<br />
größeren Förderungschancen an Förderschulen überweisen. " Der Schritt kann nie falsch<br />
gewesen sein – das ist sozusagen die Immunisierungsstrategie, die in der<br />
Selektionspädagogik liegt: Es können drei Dinge passieren, wenn ich jemand auf die<br />
Sonderschule schicke ... . Erstens: Der blüht auf in der Sonderschule und kommt wieder<br />
zurück (ein sehr kleiner Anteil), dann war die Entscheidung richtig, weil er es ja geschafft hat.<br />
Zweitens: Er läuft in der Sonderschule so mit, dann war die Entscheidung auch richtig. Und<br />
drittens: Wenn er in der Sonderschule versagt, war sie auch richtig, denn noch nicht einmal<br />
da hat er es geschafft. Was immer passiert – aus der subjektiven Sicht des Abgebenden –<br />
hat man sich richtig verhalten. ... Jede Art von Ausgrenzungsmöglichkeit ... schafft auch<br />
sofort die Fälle dafür. ... So wird man auch für die geschlossene Unterbringung, wenn sie<br />
erstmal da ist, auch Fälle finden."<br />
Wenn sich auch der Anteil der Schüler in Hamburg, die ohne Hauptschulabschluss die<br />
Schule verlassen, vom Schuljahr 2000/ 2001 bis zum Schuljahr 2003/ 2004 um 1,6<br />
Prozentpunkte verringert hat: von 12,9% (1.867) auf 11,3% (1.785) Schulabgänger, so ist<br />
dieser Anteil doch erschreckend hoch, wenn man bedenkt, dass diese jungen Menschen<br />
praktisch keine Chance haben, eine qualifizierte Berufsausbildung zu erreichen.<br />
In den Bezirken, die von ihrer Bevölkerungszahl jeweils Großstädten entsprechen, variiert<br />
der Anteil der Absolventen an allgemeinbildenden Schulen ohne Hauptschulabschluss von<br />
6,9% in Eimsbüttel bis13,4% in Altona; den zweithöchsten Rang nimmt Hamburg Mitte mit<br />
13,2% ein (vgl. Anlage, Tabellen 8 und 8a).<br />
1<br />
Wocken, K., Leistung, Intelligenz und Soziallage von Schülern mit Lernbehinderungen, in:<br />
Zeitschrift für Heilpädagogik, 12/2000, S. 492 ff<br />
2<br />
ebenda, S. 499 f<br />
3<br />
ebenda, S. 500<br />
4<br />
ebenda, S. 501<br />
123
124<br />
Jenfeld<br />
Billbrook<br />
Kleiner Grasbro ok mit St einwerder<br />
Hausb ruch<br />
Billstedt<br />
Veddel<br />
Wilhelmsburg<br />
St. Pauli<br />
Dulsberg<br />
Rothenburgsort<br />
Steilshoop<br />
Allermöhe<br />
Wo hld orf -Ohlsted t<br />
Reitbrook<br />
Groß Flottbek<br />
Nienstedten<br />
Ot hmarschen<br />
Sasel<br />
Wellingsbüttel<br />
Neuengamme<br />
Bergstedt<br />
B lankenese<br />
Ochsenwerder<br />
Alt engamme<br />
Bezirk Eimsbüttel<br />
Bezirk Hamburg-Nord<br />
B ezirk Wandsbek<br />
Bezirk Altona<br />
Bezirk Bergedorf<br />
Bezirk Harburg<br />
Bezirk Hamburg-Mitte<br />
Hamburg gesamt<br />
1 vgl. Tabelle 8<br />
Schulabschlüsse, Absolventen an allgemeinbildenden Schulen 2003/2004<br />
in "armen" und "reichen" Stadtteilen 1<br />
11,6%<br />
8,3% 38,6%<br />
7,5% 35,9%<br />
3,2% 19,4%<br />
4,1% 72,1%<br />
4,5% 40,0%<br />
2,3% 41,9%<br />
3,1%<br />
14,6% 6,6%<br />
20,0% 9,8%<br />
19,1% 10,4%<br />
16,4%<br />
20,0%<br />
16,7%<br />
22,2%<br />
52,3%<br />
60,7%<br />
44,9%<br />
6,9% 45,8%<br />
11,2% 34,3%<br />
11,6% 31,4%<br />
13,4% 34,2%<br />
9,7% 28,6%<br />
12,8% 19,6%<br />
13,2% 25,7%<br />
11,3% 31,5%<br />
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%<br />
ohne Hauptschulabschluss mit anderen Schulabschlüssen mit Allgemeiner Hochschulreife
Schulabschlüsse, Absolventen an allgemeinbildenden Schulen 2003/2004<br />
Schanzenviertel/ Karolinenviertel und Region III Eimsbüttel 1<br />
8,30% 38,60%<br />
St. Pauli<br />
39,10%<br />
Altona-Altstadt<br />
7,10% 31,40%<br />
Altona-Nord<br />
7,30% 54,00%<br />
Eimsbüttel<br />
13,20% 25,70%<br />
Bezirk Mitte<br />
13,40% 34,20%<br />
Bezirk Altona<br />
6,90% 45,80%<br />
Bezirk Eimsbüttel<br />
4,60% 36,80%<br />
Eidelstedt<br />
7,00% 24,70%<br />
Stellingen<br />
6,10% 29,10%<br />
Region III<br />
6,90% 45,80%<br />
Bezirk Eimsbüttel<br />
11,30% 31,50%<br />
Hamburg gesamt<br />
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%<br />
ohne Hauptschulabschluss mit anderen Schulabschlüssen mit Allgemeiner Hochschulreife<br />
1 vgl. Tabelle 8a<br />
125
<strong>Die</strong> Zahlen beziehen sich ausschließlich auf die Absolventen an den dort ansässigen<br />
Schulen und nicht auf Absolventen aus den jeweiligen Stadtteilen – in einigen Stadtteilen<br />
sind überhaupt keine Schulen angesiedelt. Vergleicht man den Anteil aller Absolventen ohne<br />
Hauptschulabschluss in den "armen" Stadtteilen mit denen in den "reichen" Stadtteilen, so<br />
ergibt sich ein Verhältnis von 16,3%: 4,7%, d. h. der Anteil in den "armen" Stadtteilen ist gut<br />
dreimal so hoch wie in den "reichen".<br />
Bezogen auf die Ergebnisse der LAUF-<strong>Studie</strong> resümiert Wocken: "Es hat sich nichts, aber<br />
rein gar nichts, zum Besseren gewendet – im Gegenteil: <strong>Die</strong> Ergebnisse sprechen eher für<br />
eine Zunahme von sozialen Benachteiligungen, die morgige Verfassung der Förderschule<br />
lässt keine Besserung, sondern eher eine weitere Zuspitzung der sozialen Abdrift erwarten.<br />
Sorglosigkeit wäre fatal, ... ." 1<br />
Bildung – mehr als Wissensvermittlung<br />
Bei den zur Zeit geführten Diskussionen um Schulsysteme steht die Messung von<br />
Schulerfolg im Vordergrund. Das weist auf eine sehr einseitige Betrachtungsweise hin.<br />
Bildung umfasst u. a. den Erwerb von<br />
• Sozialkompetenzen<br />
• Wissenskompetenzen<br />
• Haltungskompetenzen<br />
• Reflexionskompetenzen<br />
• Handlungskompetenzen.<br />
Mit der Erlangung von Bildung sollten u. a. folgend Zielvorstellungen verbunden sein:<br />
• Fähigkeit und Bereitschaft, bestehende soziale, politische und wirtschaftliche Strukturen<br />
zu erkennen und zu verändern.<br />
• Ermöglichung kritischen Denkens und individueller Selbstbestimmung<br />
• Fähigkeit zur kritischen Reflexion, die die Entwicklung alternativer Ideen impliziert.<br />
Letztendlich geht es um die Erziehung zu mündigen Bürgern, die sich kreativ mit den<br />
Herausforderungen in Gesellschaft, Politik und Wirtschaft auseinandersetzen und zu<br />
alternativem Denken und Handeln fähig sind.<br />
Hentig hat – auch im Zusammenhang mit der Einrichtung der Labor-Schule in Bielefeld<br />
Anfang der 70er Jahre – darauf hingewiesen, dass Bildung die Vorraussetzungen für<br />
emanzipierte, soziale und politisch-demokratische Handlungen schaffen soll. Es geht um<br />
Verfahren zur Bewältigung einer noch unbekannten, sich schnell entwickelnden Welt.<br />
Bedeutsam sind in dem Zusammenhang der Erwerb von Fähigkeiten zur Kritik, Kooperation,<br />
Kommunikation, Kreativität (die vier K's) und zur Partizipation. Letzteres umfasst<br />
Mitbestimmung, Mitentscheidung und Mitverantwortung. 2<br />
Bildung ist nicht alleinige, aber primäre Aufgabe von Schulen. In diesem Exkurs wird auch<br />
auf die Relevanz der Frühförderung durch Kindertageseinrichtungen eingegangen. Trotzdem<br />
kommt der Schule eine zentrale Bedeutung bei dem "Erwerb von Bildung" zu. Sie beeinflusst<br />
in einem hohen Maße die sozialen und wirtschaftlichen Chancen ihrer Schüler durch die<br />
Vermittlung von Kenntnissen, Fertigkeiten und Wertvorstellungen.<br />
Der Erziehungswissenschaftler Peter Struck weist die Vorstellung der deutschen<br />
Kultusminister zurück, "dass hohe Klassenfrequenzen einem guten Abschneiden nicht im<br />
1 ebenda, S. 502<br />
2 vgl. Hentig, H. von, <strong>Die</strong> Wiederherstellung der Politik, München, 1973, S. 130 ff<br />
126
Wege stehen". Er erklärt: "Dabei haben Länder mit durchweg niedrigen Klassenfrequenzen<br />
bessere Resultate [bei Pisa] erzielt. Besonders effizient sind parallel zu größeren<br />
Regelklassen laufende Kleinklassen für sozial benachteiligte Schüler, die nicht – wie mit der<br />
deutschen Hauptschule – als Restgruppe abgewertet werden, sondern als bloß<br />
vorübergehend andersartig im Sinne einer eigentümlichen unebenen Lernlandschaft<br />
begriffen werden." 1<br />
Der Pädagoge Rainer Domisch, der sowohl das deutsche als auch das finnische<br />
Schulsystem sehr gut kennt, weist auf die große Abhängigkeit des Lernerfolgs vom sozialen<br />
Hintergrund der Schüler in deutschen Schulen hin. "Um diese unbefriedigende Lage zu<br />
ändern und so viele Begabungen eines Schülerjahrgangs wie möglich zu fördern, kommt<br />
man um Korrekturen von Schulsystemen nicht herum." Sein Lösungsvorschlag: "Längere<br />
gemeinsame Lernzeiten in einer gemeinsamen Schule für unterschiedliche Lerner,<br />
schulübergreifende Standards, mehr gemeinsame Förderung statt früher Selektion, mit<br />
einem hohen Leistungsstandard für alle. ...<br />
Schulsysteme sollten sich mehr an den Bedürfnissen von Kindern und Schülern orientieren,<br />
anstatt diese relativ früh den Bedingungen von Systemen zuzuordnen. Dadurch entwickelt<br />
sich eine andere Einstellung in der Lernkultur. Es gibt keine 'falschen' Schüler in der<br />
'richtigen' Schule, sondern 'richtige' Schüler in allen Schulen, welche Schüler nicht<br />
ausgrenzen oder abschieben können." 2<br />
Eliteschulen sind in vielen Ländern "kein Thema". Offensichtlich erwerben "gute Schüler"<br />
durch Aufgaben, die sie in den dortigen Gesamtschulen übernehmen – z. B. Unterstützung<br />
und Hilfestellung für andere Schüler, Erklären von Lerninhalten – neben einer Verfestigung<br />
ihres kognitiven Wissens kommunikative und soziale Kompetenzen, die für ihr weiteres<br />
Leben sehr wertvoll sind.<br />
Problemfeld Schule<br />
Der Schulerfolg von Schülern ist abhängig<br />
• von der Übereinstimmung der normativen Orientierung in Familie und Schule sowie vom<br />
Grad der Unterstützung, die die Schularbeit in der Familie erfährt.<br />
• von der sozialen Integration eines Kindes in den Klassenverband, von den<br />
identitätsstiftenden Erfahrungen, die aus erfolgreicher Interaktion mit den<br />
Klassenkameraden erwachsen.<br />
• vom Selbstkonzept eines Schülers, insbesondere vom Grad an Erfolgszuversicht und<br />
Optimismus.<br />
<strong>Die</strong>se Voraussetzungen sind bei armen und benachteiligten Schülern in der Regel nicht<br />
gegeben. Offensichtlich stellt sich die Institution Schule nicht als Ort des interessierten<br />
Lehrens und Lernens, sondern als vielschichtiges Problemfeld für Schüler mit einem<br />
schlechten sozioökonomischen Hintergrund und niedrigem sozialen Status dar. Sie<br />
unterliegen häufig Selektionsprozessen und damit der Segregation. Befragte Experten<br />
weisen darauf hin, dass an solchen Ausgrenzungsprozessen sowohl Mitschüler als auch<br />
Lehrer beteiligt sind. "Schüler werden durch Mitschüler und Lehrer diskriminiert, bestraft und<br />
ausgegrenzt." Sie reagieren darauf mit Lernschwierigkeiten, aber auch mit Verweigerungen<br />
bis hin zur Schulverweigerung.<br />
Es muss sicherlich anerkannt werden, dass viele Schüler institutionelle Unterstützung<br />
benötigen, um ihre Ausbildung an höher qualifizierenden Schulen erfolgreich absolvieren zu<br />
können, "denn Kinder, die doch auf eine entsprechende Schule gehen, können in der Regel<br />
1 Struck, P., Pisa und die Folgen, in: Frankfurter Rundschau, 5.7.2005, S. 27<br />
2 Domisch, R., Keine Trendwende in Sicht, Frankfurter Rundschau, 12.7.2005, S.25<br />
127
ei schulischen Anforderungen weder auf ihre Familie noch auf weitere Personen ihres<br />
sozialen Umfeldes zurückgreifen, so dass sie in der Gefahr sind, schulisch zu scheitern" (vgl.<br />
Punkt 3.4.1).<br />
Viele Experten äußerten sich zu Problemstellungen, die durch das Verhalten von<br />
Mitarbeitern oder durch Strukturen und Verfahren der Institution Schule hervorgerufen<br />
werden. Neben den unangemessen seltenen Empfehlungen für eine höherqualifizierende<br />
Schule wurden u. a. folgende Situationen als Probleme definiert:<br />
• <strong>Die</strong> meisten – auch armen und benachteiligten – Eltern sind zu Beginn der Schulzeit ihrer<br />
Kinder an deren Schulbildung interessiert. Ihnen fehlt es aber häufig an Kompetenzen –<br />
sie haben sie in der Regel nie erworben oder aufgrund eines Problemkonglomerats in<br />
ihrem Leben haben sie nicht den Kopf dafür frei –, um ihre Kinder in ihrer Schullaufbahn<br />
zu unterstützen. Bei Schwierigkeiten bzw. Auffälligkeiten der Kinder werden sie in der<br />
Regel in die Schule "zitiert", aber nicht beteiligt und ermutigt bzw. unterstützt, wie sie<br />
ihren Kindern Freude am Lernen und am Schulbesuch vermitteln können.<br />
• <strong>Die</strong> Schule (vertreten durch die Lehrer) verlangt zuerst von den Eltern und dann von<br />
(Vertretern) der Jugendhilfe, die in der Schule auftretenden Probleme zu lösen bis hin zur<br />
Forderung einer stationären Unterbringung der Kinder – möglichst außerhalb von<br />
Hamburg.<br />
• Lehrer, deren eigene Lebenswelt konträr der vieler Schüler gegenübersteht, verstehen<br />
diese in ihrer – durch ihre Lebenslage geprägte – Lebenswelt nicht; Einstellungen,<br />
Verhaltens- und Handlungsweisen und Deutungsmuster der Schüler werden dann<br />
vielfach als abweichendes Verhalten gewertet.<br />
• Lehrer sind in der Regel nicht auf die Schwierigkeiten benachteiligter Schüler vorbereitet:<br />
o Sie haben in ihrem Studium keine/ kaum eine Vorbereitung auf die Auswirkungen<br />
von Armut und Benachteiligung auf die Lebenswelt der Schüler erfahren.<br />
o Ihnen wird häufig das Ergebnis von Pisa angelastet. Reaktion von "Politik und<br />
Verwaltung" ist in erster Linie die Festlegung strengerer Maßstäbe. Eine Evaluation<br />
des Systems, das diese Pisa-Ergebnisse produziert hat – inklusive der Didaktik, der<br />
räumlichen und inhaltlichen Lehr- und Lernbedingungen, der Formen der<br />
Kooperation innerhalb und außerhalb der Schule, in der Klasse (Partizipation der<br />
Schüler) und mit den Eltern – fehlt in der Regel.<br />
o Teamarbeit, Fortbildung, Supervision zur Unerstützung der Lehrer generell und bei<br />
(sozial-)pädagogischen Fragen/ Problemen speziell sind eher die Ausnahme als die<br />
Regel.<br />
o Bestehende Arbeitszeitmodelle verhindern bzw. erschweren die Arbeitsbedingungen<br />
und die Realisierung von Formen der Aufgabenwahrnehmung, wie sie z. B. in<br />
Finnland üblich sind.<br />
• Lehrer in "Brennpunktschulen" fühlen sich vielfach überlastet. Sie haben kaum noch die<br />
Erwartung auf Besserung. "Wenn man täglich Elend in die Klassen gespült bekommt ...<br />
oder 30 Kinder in der Klasse hat, dann führt das auch zur Krümmung der eigenen<br />
Berufsperspektive. ... <strong>Die</strong>se Lehrer brauchen Unterstützung, brauchen Kooperation."<br />
• Einerseits wird eine permanente Bedrohung durch Einsparungen wahrgenommen,<br />
andererseits verschwinden "ganz viele Ressourcen in diesen Multiplikatorentätigkeiten".<br />
.. "Es gibt in unserem Bereich [Schule] so etwas wie einen Aufstieg, einen<br />
Wertezuwachs, Statusgewinn, wenn man möglichst wenig mit Kindern zu tun hat."<br />
• <strong>Die</strong> Aufgabe der Integration benachteiligter Kinder und ihrer Eltern in das System/ in die<br />
Struktur der Schule kann bei einem "Grundsatz-Ansatz der Rationalisierung öffentlicher<br />
Einrichtungen" nicht erfüllt werden. "<strong>Die</strong> Lehrerschaft, die sich im Wesentlichen in den<br />
letzten drei Jahren nur im Konflikt mit ihren Institutionen befindet – über mehr Arbeitszeit,<br />
Umorganisation und Privatisierungsmodelle etc. –,beschäftigt sich nicht mit ihren Kindern<br />
... ."<br />
128
• Lehrer sind an Elternabenden irritiert/ verunsichert, wenn z. B. ausländische Eltern –<br />
dank einer "Übersetzungshilfe" – Probleme ansprechen. "Sie waren nur darauf bedacht,<br />
Ordnung ... aufrecht zu halten, das ist zum Teil wirklich erschreckend. ... Das ist keine<br />
persönliche Unfähigkeit, sondern eher institutionsbedingt."<br />
• Das System und die Strukturen in der Schule behindern Lehrer augenscheinlich "etwas<br />
zu erbringen, was in anderen Ländern offensichtlich besser ist. Das ist eine große<br />
Enttäuschung."<br />
• "<strong>Die</strong> Förderschüler sind die ärmsten aller Schüler ... . Solche Befunde sollten uns<br />
nachdenklich stimmen – wenn eine Sozialisation unter Armutsbedingungen zu Gettos<br />
ohne Mauern führt."<br />
Das "System Schule" hat für Lehrer prägende Auswirkungen. <strong>Die</strong> in den letzen Jahren<br />
zunehmenden Anforderungen, gepaart mit Schuldzuweisungen, führen wohl nur selten zu<br />
Motivations- und Leistungssteigerung einerseits und zu mehr Verständnis für die Probleme<br />
benachteiligter Schüler sowie größerer Wertschätzung ihnen gegenüber andererseits. Das<br />
schlimmste ist aber für Schüler, "wenn ein Lehrer zynisch wird. ... Es gibt Verletzungen –<br />
nach wie vor – von Kindern durch Lehrkräfte."<br />
<strong>Die</strong> Vorstellung, dass man Eltern das Kindergeld entziehen sollte, wenn sie sich nicht<br />
ausreichend um ihre Kinder kümmern [können], wird u. a. als "aberwitzig" bezeichnet, mache<br />
"aber die Hilflosigkeit deutlich, mit der Institutionen auf diese Thematik reagieren. Richtig ist,<br />
dass die Schule wahrscheinlich zunehmend Erziehungsaufgaben wahrnehmen muss, weil<br />
die Eltern damit überfordert sind. Da ist die Frage: Warum? Und mit welchen Instrumenten<br />
kriegt man das in den Griff? Nicht, indem man denen, die unter Geldnot leiden, auch noch<br />
das Kindergeld entzieht. Dann wird es nur noch schlimmer." Eine Auseinandersetzung mit<br />
den wirklichen Problemen in "Armutsfamilien", mit den Ursachen der Problematik und die<br />
Auswirkungen auf die Kinder/ Schüler findet praktisch nicht statt.<br />
<strong>Die</strong> bisherigen Ausführungen verdeutlichen, dass das sehr differenzierte Bildungssystem in<br />
Hamburg arme und benachteiligte Schüler weiter ausgrenzt und ihre Bildungschancen nicht<br />
erhöht.<br />
<strong>Die</strong> Darstellung einiger der genannten Probleme von armen und benachteiligten Schülern im<br />
und durch das System Schule sollte nicht zu wechselseitigen Schuldzuweisungen führen,<br />
sondern Ausgangspunkt für Veränderungen zugunsten benachteiligter Kinder in<br />
gemeinsamer Verantwortung und Kooperation von Vertretern der Institutionen Schule und<br />
Jugendhilfe und der Eltern sein. Dabei sollten sozialraum- und lebensweltorientierte<br />
Handlungsstrategien zugrunde gelegt werden.<br />
Konsequenzen für eine sozialraum- und lebensweltorientierte (Schul-)Bildung<br />
In "KESS 4" wird darauf hingewiesen: "Eine herausragende Stellung in der Konstruktion<br />
gesellschaftlicher Ungleichheit fällt heute der Bildung zu." 1<br />
Demzufolge ist eine Schulbildung notwendig, die nicht nur materiell und sozial besser<br />
gestellte Kinder qualifiziert, sondern gleichberechtigt auch arme und benachteiligte Kinder,<br />
um Teilhabechancen zu eröffnen (Sozialstaatspostulat), aber auch als Ressource für die<br />
Gesellschaft und Wirtschaft.<br />
Inzwischen setzt sich (wieder) in der Jugendhilfe, aber auch im Bereich Schule die<br />
Erkenntnis durch, dass für das Verständnis und die Entwicklung von Akzeptanz und Achtung<br />
gegenüber den Zielgruppen die Kenntnis, aber auch die Einbeziehung des Sozialraums und<br />
ihrer Lebenswelt erforderlich sind. <strong>Die</strong> Umsetzung impliziert einen Paradigmenwechsel bei<br />
1 Bos, u. a., KESS 4, a.a.O., S. 23<br />
129
den Handelnden – ganz gleich, ob es Lehrer, Sozialarbeiter, Erzieher etc. sind (vgl.<br />
entsprechende Ausführungen in Punkt 4.3). Im Rahmen der Diskussionen wurde darauf<br />
hingewiesen: "Bezogen auf ihre Lebenslage benötigen die Kinder Verständnis für ihre<br />
Lebenswelt und die Eröffnung von Teilhabechancen sowohl in der Kita und der Schule als<br />
auch durch sonstige Institutionen bzw. Mitarbeiter der Jugendhilfe."<br />
Von den Experten wurden Ansätze zu notwendigen Veränderungen und<br />
Aufgabenstellungen benannt, die geeignet sein können, die Entwicklungs- und<br />
Bildungschancen und damit die Teilhabechancen von armen und benachteiligten Kindern/<br />
Schülern zu verbessern. <strong>Die</strong> Aussagen beziehen sich nicht ausschließlich auf das System<br />
Schule sondern verweisen auf eine Gesamtverantwortung von Eltern und den Institutionen<br />
Schule und Jugendhilfe.<br />
<strong>Die</strong> Bedeutung der Kitas als Ort der Frühförderung aber auch als Ort<br />
"erziehungsergänzender Maßnahmen" für benachteiligte Kinder wurde insbesondere in den<br />
Gruppendiskussionen hervorgehoben.<br />
<strong>Die</strong> Tageseinrichtungen für Kinder haben vielfältige Möglichkeiten, in unterschiedlichen<br />
Formen ihren Bildungsauftrag wahrzunehmen:<br />
• Kinder erleben strukturierte Tagesabläufe in Gemeinschaft mit anderen Kindern.<br />
• Spiel und Toben fördern u. a. ihre Kreativität, aber auch Rücksichtnahme gegenüber<br />
anderen.<br />
• Das Erlernen und Einhalten von Regeln, aber auch das Mitgestalten eines Tagesablaufs<br />
werden eingeübt.<br />
• "Spielerisches" Lernen und Sprachförderung erleichtern den Kindern den Einstieg in die<br />
Schule.<br />
• Anerkennung und (Be-)Achtung stärken sie in ihrem Selbstwertgefühl.<br />
Auch wenn diese "Möglichkeiten" nicht zu jeder Zeit und in jeder Kita gleichermaßen<br />
ausgeschöpft werden, so sind sie potentiell gegeben, wenn die Rahmenbedingungen in den<br />
Einrichtungen eine Chance dafür bieten. <strong>Die</strong> Situation in einer Kita sollte so gestaltet werden,<br />
"dass Kinder sich wohlfühlen und sich selbst auch lieben können. ... Das haben diese Kinder<br />
nicht und das führt genau zum Gegenteil: dass sie aggressiv werden."<br />
Durch die Veränderungen im Kita-Bereich ist es praktisch nicht möglich, dass benachteiligte<br />
Kinder einen Ganztagesplatz erhalten, wenn die Mütter/ Eltern nicht berufstätig sind. Obwohl<br />
hinlänglich bekannt ist, dass viele Eltern wegen ihrer eigenen Probleme und<br />
Benachteiligungen überfordert sind, ihrem Erziehungsauftrag voll zu entsprechen, und Kitas<br />
dies im Rahmen ihrer Funktion als "zweiter Erziehungsort" kompensieren könnten, muss<br />
man "das Kind fast als 'Sorgerechtsfall' deklarieren, um einen Ganztagesplatz zu bekommen.<br />
... Wo alle <strong>Studie</strong>n darauf hinweisen, dass man sie so früh wie möglich sprachlich und sozial<br />
integrieren muss, dass die Zugangschancen stimmen müssen, passiert in der Praxis genau<br />
das Gegenteil."<br />
Bedenkt man, welche Kosten entstehen, wenn diese Kinder in ihrer persönlichen und<br />
schulischen Entwicklung scheitern, müsste eine gebührenfreie Ganztagesbetreuung, die<br />
erzieherische und Bildungsfunktionen einschließt, für benachteiligte Kinder im Alter von drei<br />
bis sechs Jahren selbstverständlich sein. Dabei ist wichtig, "dass der Mittagstisch dabei ist,<br />
dass das garantiert ist".<br />
Für den Bereich der Schule werden folgende Hinweise zur Verbesserung der<br />
Bildungschancen gemacht:<br />
• Wegen der starken institutionellen Selektion im Rahmen des Schulsystems in Hamburg<br />
wird gefordert, zu verhindern, dass Kinder "selektiert" und in Sonderschulen und<br />
Spezialeinrichtungen "delegiert" werden. Es sollte den Kindern vermittelt werden, dass<br />
130
sie ins "Regelsystem Schule gehören und dort auch erwünscht sind." ... "Es ist wichtig,<br />
dass am Ende der Grundschule alle Schüler und ihre Eltern integriert sind – später wird<br />
es unheimlich schwer."<br />
• Es wird darauf hingewiesen, dass "Kinder vor Ort – dort wo sie ausgegrenzt werden, sei<br />
es in der Kita oder in der Schule – Akzeptanz ihrer Lebensverhältnisse erfahren<br />
(müssen)". Kinder, auch solche mit abweichendem Verhalten, dürfen nicht in<br />
Spezialeinrichtungen untergebracht werden: "Sonst ist ihr Lebenslauf schon<br />
vorprogrammiert, wenn sie immer weitergeschickt werden".<br />
• Das Bildungsangebot in der Schule sollte zentrale Aspekte der Lebenswirklichkeit<br />
benachteiligter Schüler stärker berücksichtigen.<br />
• In die letzten Klassen sollten mehr Praxisanteile integriert werden – dadurch wird bei<br />
vielen benachteiligten Schülern ein größeres Interesse an "Schule" geweckt, gleichzeitig<br />
aber auch ein besserer Einstieg in die Erwerbsarbeit vorbereitet.<br />
• <strong>Die</strong> Gliederung des Schulsystems bis zur 9. Klasse sollte aufgehoben werden. <strong>Die</strong><br />
Hauptschule sollte abgeschafft werden, weil sie in diesem gegliederten System zur<br />
"Restschule" wird und es "für die Lehrer, die dort arbeiten, kaum möglich ist, ... noch<br />
irgendeine motivierende Situation hinzubekommen". Gleichzeitig sollte das<br />
"Sitzenbleiben" abgeschafft werden. Es wird als "Ressourcenverschwendung"<br />
angesehen.<br />
• Zur Förderung der Bildungssituation werden Ganztagsschulen "für absolut erforderlich"<br />
gehalten. "<strong>Die</strong> Bedingungen, die zur Zeit dafür geboten werden, sind aber aus<br />
personellen und inhaltlichen Gründen nicht akzeptabel."<br />
<strong>Die</strong> zur Zeit (auch) in Hamburg angedachten "Modelle von Ganztagsschulen" entsprechen<br />
nicht den Anforderungen, die in der heutigen Gesellschaft an Schule gestellt werden. "...<br />
wenn dann einfach nur ein 'Pädagogischer Mittagstisch' sowie einige musische, sportliche<br />
und technische Kurse im Sinne einer verlängerten Aufbewahranstalt an die alte<br />
Halbtagsschule angehängt werden, dann wertet man erstens die nachmittags liegenden<br />
Fächer ab, und zweitens werden die Schüler damit nicht leistungsfähiger, sondern bloß<br />
erschöpft. ..."<br />
"Eine Ganztagsschule braucht jedenfalls deutlich mehr Personal, Ausstattung und<br />
Erziehungskompetenz – über Bildungskompetenz hinaus – als eine lediglich verlängerte<br />
Halbtagsschule, denn eine Ganztagsschule ist stets auch Lebensmittelpunkt junger<br />
Menschen, was eine Halbtagsschule nie sein kann."<br />
In einem Interview wurde zu diesem Thema darauf hingewiesen, "dass es dringend geboten<br />
wäre, in all diesen Situationen, wo wir Probleme haben, Ganztagsschulen einzurichten, und<br />
zwar nicht diese ominösen Krücken, .... sondern richtige Ganztagsschulen. Ich glaube, dass<br />
man damit mehrere Probleme auf einmal angehen könnte." Mit einer so konzipierten<br />
Ganztagsschule würden nicht nur Bildungs- und Erziehungsfunktionen geleistet, sondern es<br />
könnten auch Verpflegungsprobleme vieler Kinder abgebaut oder sogar gelöst werden.<br />
Auf das Phänomen, dass Schulen nicht nur Lernorte, sondern auch Erziehungsorte sind,<br />
wurde von vielen Experten hingewiesen:<br />
• Ein Teil der Erziehungsverantwortung muss aufgrund des "Nicht-Vorhandenseins" der<br />
Eltern für diese Aufgabe – unabhängig davon, ob durch Berufstätigkeit und Krankheit<br />
oder weil sie es nicht gelernt oder aber verlernt haben – von der Schule übernommen<br />
werden. Hier geht es darum Entwicklungsmöglichkeiten über einen langen Zeitraum<br />
anzubieten.<br />
• Der Druck auf Eltern – sie haben die Wahl, etwas mit uns zusammen zu machen (was<br />
wir wollen), wenn nicht, sorgen wir dafür, dass das Kind aus der Familie genommen wird<br />
– ist kontraproduktiv. Manchmal kann es allerdings auch notwendig sein. Druck kann im<br />
Einzelfall u. a. dann sinnvoll sein, wenn die zugrundeliegende Anforderung für die<br />
131
Betroffenen einsichtig und leistbar ist und mit der Vermittlung von Vertrauen und<br />
Wertschätzung verbunden ist.<br />
• Gleichzeitig sollte der Frage nachgegangen werden, wie man den Eltern (wieder) die<br />
Möglichkeit geben kann, handlungsfähig, "Chef ihres Lebens" zu werden. In den<br />
Gruppendiskussionen wurden in dem Zusammenhang Modelle von Elternarbeit<br />
angedacht, die in Kooperation von Vertretern der Schulen und Jugendhilfe durchgeführt<br />
werden sollten. Ansätze der Familienbildung 1 könnten dafür eine Grundlage bilden.<br />
• Es gibt verschieden "Modelle", in unserer Gesellschaft, die nicht mehr richtig laufen und<br />
"vom Band fliegen müssten": in der Jugendhilfe, im Gesundheitswesen, in der Schule.<br />
Wir brauchen einen Masterplan, um das zu verändern. Dabei sollten folgende Aspekte<br />
einbezogen werden:<br />
o Eltern müssten in die Lage versetzt werden, ihren Versorgungs- und<br />
Erziehungsauftrag besser zu erfüllen.<br />
o <strong>Die</strong> "heutigen" Kinder müssen in die Lage versetzt werden, nicht wieder in die<br />
"Lücken" ihrer Eltern hineinzugehen/ ihre Formen der Benachteiligung zu<br />
perpetuieren.<br />
o Dazu benötigen wir eine konzertierte Aktion von allen Institutionen: Schule, Kultur,<br />
Jugendhilfe, Gesundheitswesen.<br />
• Schule muss (aber) ein anderer Lernort werden. Alles deutet darauf hin, dass Schule ein<br />
Ort ganzheitlichen Lernens und Erziehens werden muss. "Da müsste dann auch die<br />
Ausbildung der Lehrerschaft anders sein – es müssten stärker sozialpädagogische<br />
Anteile integriert werden. Dann kann Schule eine ganz wesentliche und sinnvolle<br />
Funktion haben."<br />
Kooperation und Vernetzung werden als bedeutsames Prinzip veränderter<br />
Handlungsstrategien angesehen: "Ich muss mich notwendigerweise mit allen (o. g.)<br />
Institutionen ..., die in irgendeiner Weise an Erziehungsprozessen beteiligt sind,<br />
zusammensetzen, um für das Individuum den bestmöglichen Weg zu gewährleisten." –<br />
<strong>Die</strong>ses Prinzip sollte sowohl auf der Mikroebene realisiert werden als auch auf der Meso-<br />
und Makroebene/ der regionalen und Stadt-Staaten-Ebene.<br />
Zu dem Aspekt der Kooperation werden weitergehende Aussagen gemacht:<br />
• <strong>Die</strong> Zusammenarbeit von Institutionen der Schule und der Jugendhilfe soll der Stärkung<br />
und Weiterentwicklung des Gesamtzusammenhangs von Bildung, Erziehung und<br />
Betreuung dienen. Notwendig ist die gemeinsame Verantwortung für die Kinder in einer<br />
Region. Dabei ist es erforderlich, anzufangen gemeinsam "an einem Strang zu ziehen,<br />
sonst geht es nicht, sonst werden wir durch dieses Konkurrenzsystem in unserer<br />
Gesellschaft auseinanderdividiert."<br />
• Als notwendig wird angesehen, Probleme dort zu lösen, wo sie zum ersten Mal sichtbar<br />
werden. "Wenn es in der Kita Probleme gibt, müssen sie nicht erst in der Schule entdeckt<br />
werden."<br />
Im Einzelfall sollten zur Realisierung einer ganzheitlichen Förderung und Unterstützung von<br />
Kindern und Familien, die Probleme haben, gemeinsame (Lehrer, Sozialarbeiter)<br />
Erziehungskonferenzen abgehalten werden. Auch im Bereich von Schule ist es erforderlich –<br />
vergleichbar der Situation in der Jugendhilfe – Ressourcen und Kompetenzen der Kinder und<br />
ihrer Eltern zu benennen/ herauszufinden: "Das, was die Betroffenen können, muss mit<br />
einbezogen werden." In dem Zusammenhang wird sowohl auf die Notwendigkeit von<br />
Elternarbeit hingewiesen als auch auf die Schaffung von Sozialraumbudgets, über die die<br />
Menschen, die in dem entsprechenden Sozialraum wohnen, selbst entscheiden. Ein solcher<br />
– auf Partizipation der Bewohner ausgerichteter – Haushalt bietet den Betroffenen<br />
Lernfelder. "Sie machen dabei Lernprozesse, werden politisiert, haben eine Ahnung, was<br />
1 vgl. § 16 Kinder- und Jugendhilfegesetz<br />
132
dort passiert. Mitbestimmung/ Mitentscheidung fördert auch ihr Selbstwertgefühl und ihre<br />
Identität."<br />
Kooperation und Vernetzung als organisatorischer Rahmen für Veränderungen<br />
Es ist relativ müßig, über eine Gesamtverantwortung von Vertretern unterschiedlicher<br />
Institutionen – Schule, Kultur, Jugendhilfe, Gesundheitswesen – zu diskutieren ohne einen<br />
organisatorischen Rahmen, der eine Zusammenarbeit dieser Institutionen ermöglicht, zu<br />
schaffen.<br />
Wichtig ist, dass keine in Hamburg einheitliche Organisationsform vorgegeben wird, sondern<br />
dass sich in verschiedenen Regionen prozesshaft Kooperationsformen entwickeln, die –<br />
nach einer Konzeptions- und Entwicklungsphase – dann durch Vereinbarungen/ Verträge<br />
geregelt – verbindlich für das gemeinsame Handeln werden. Bedeutsam ist dabei, dass jede<br />
beteiligte Institution neben der gemeinsamen Aufgabenwahrnehmung – das gemeinsame<br />
Dritte – ihre fachliche Autonomie und ihr professionelles Ethos behält. Darüber hinaus muss<br />
sich für alle beteiligten Stellen eine Win-Win-Situation ergeben. Einrichtungen der<br />
Jugendhilfe im Zusammenhang mit den geplanten Ganztagsschulen zum "Ausfallbürgen"<br />
einzusetzen, wo die Zeitressourcen der Lehrer nicht für einen Ganztagsbetrieb reichen,<br />
würde den genannten Kriterien widersprechen.<br />
Hier einige Überlegungen für eine prozesshaft zu entwickelnde Kooperationsstruktur:<br />
• Es ist für die potentiellen Kooperationspartner wichtig, in einem ersten Schritt zu<br />
erfahren, welche Einrichtungen es in der Region gibt und sich in den jeweiligen Aufgaben<br />
und Rollen kennenzulernen.<br />
o Das könnte z. B. durch die Teilnahme von Mitarbeitern des ASD 1 , der OKJA 2 und<br />
REBUS an Schulleiter- und Lehrerkonferenzen geschehen mit dem Ziel<br />
- Förderung des gegenseitigen Verständnisses<br />
- Informationen über den Sozialraum zu vermitteln<br />
- Transparenz zu schaffen:<br />
aufzeigen, warum bisher wie gehandelt wurde und welche Probleme, aber<br />
auch Ressourcen, in der Region gesehen werden<br />
- wechselseitiger Nutzbarmachung von Ressourcen.<br />
• Es sollten weitere (Jugendhilfe-)Einrichtungen in die Schulen "reingeholt" werden. "Das<br />
heißt ja nicht, dass sie jetzt den Lehrplänen unterworfen werden sollen – im Gegenteil:<br />
sie sollen ihre Fähigkeiten und Aktionsformen einbringen. Bildungsarbeit der OKJA darf/<br />
soll in der Schule nicht nach Lehrplan angeboten werden, sondern nach den<br />
Bedürfnissen, Interessen und Fähigkeiten der Schüler – ohne Pflicht, teilnehmen zu<br />
müssen."<br />
• In einer ersten Phase der Kooperation zwischen Schule und Jugendhilfe/ ASD, HzE-<br />
Trägern (z. B. im Rahmen fallunabhängiger Arbeit) könnten feste Ansprechpartner für<br />
einzelne Jahrgänge benannt werden, die dann regelmäßig zu Gesprächen in die Schule<br />
kommen. Wenn sich ein Problem andeutet, kann gemeinsam überlegt werden, wie es<br />
abgebaut/ gelöst werden kann. Ein entsprechender institutionalisierter Reflexionsprozess<br />
wäre sinnvoll. So könnte viel schneller interveniert/ geholfen/ unterstützt werden.<br />
Eine solche Kooperation darf nicht zur Instrumentalisierung der Sozialarbeit werden nach<br />
dem Motto "Kommt mal vorbei, das muss 'abgestellt' werden".<br />
• Bei einer weitergehenderen Kooperation muss der "Plan" von unten kommen. <strong>Die</strong><br />
Mitarbeiter und Vertreter der Leitungsebene der potentiell kooperierenden Institutionen<br />
sollten als "Konzeptionsentwickler" fungieren.<br />
1 Allgemeiner Sozialer <strong>Die</strong>nst<br />
2 Offene Kinder- und Jugendarbeit<br />
133
o Von "oben" (Schulräte/ Schulbehörde) sollte dann die "Erlaubnis" kommen, den Plan<br />
umzusetzen.<br />
o <strong>Die</strong> entsprechenden Ebenen der Politik sollten rechzeitig an der Planentwicklung<br />
beteiligt werden.<br />
• Es geht u. a. darum – nach einer gemeinsamen Problemanalyse und Ziel-/<br />
Aufgabenbeschreibung – "festzulegen, wer eigentlich wann zuständig ist" und welche<br />
Handlungsstrategien eingesetzt werden sollen, damit keine Konkurrenz entsteht. Das<br />
setzt institutionalisierte, verbindliche Kommunikations- und Entscheidungsstrukturen<br />
voraus.<br />
o Es ist notwendig, gemeinsam fachliche Qualifikationen zu erlangen und Standards zu<br />
entwickeln, durch die die Betroffenen miteinbezogen werden.<br />
• Es müssen "Modelle auf Zeit" sein, weil sich die Situation im Stadtteil – u. a. durch<br />
Sanierungsmaßnahmen und demografische Entwicklungen – verändert.<br />
Armut und Benachteiligung von Kindern sind eindeutig Bildungshemmnisse. Das bedeutet<br />
jedoch nicht, dass es keine Veränderungsmöglichkeiten gibt. In einem ersten Schritt könnte<br />
eine kooperative sozialraum- und lebensweltorientierte Bildungsarbeit einen Beitrag leisten.<br />
Voraussetzung dafür ist die Bereitschaft und Fähigkeit der Beteiligten, in Alternativen zu<br />
denken und zu handeln.<br />
Zu der Frage nach Ansätzen zur Verbesserung der Lebenssituation armer und benachteiliger<br />
Kinder, wurde nicht nur auf die dafür notwendigen Veränderungen hingewiesen, sondern es<br />
wurden auch Aktivitäten benannt, die geeignet sind, Voraussetzungen für Prozesse zur<br />
Erweiterung der Bildungschancen dieser Kinder zu schaffen.<br />
Das Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung hat sich – zum Teil in<br />
Kooperation mit anderen Institutionen – der Herausforderung gestellt und verschiedene<br />
Aktivitäten in die Wege geleitet:<br />
• Schon 1996 wurden die LAU-Untersuchungen – Erhebung der Lernausgangslagen –<br />
begonnen. <strong>Die</strong> Ergebnisse zeigen die hohe Korrelation von sozialer Herkunft und<br />
Schulerfolg. Sie bieten eine gute Grundlage für Veränderungsprozesse.<br />
• Es wurden in Hamburg durch das Kriminologische Institut Hannover 1993 und 2000<br />
Gewaltstudien erstellt. Auch hier wurde festgestellt, dass die soziale Lage klarer<br />
Prädikator für aggressives und gewaltförmiges Handeln ist. <strong>Die</strong>se Erkenntnisse haben an<br />
den Hamburger Schulen zu einer Auseinandersetzung mit der Problematik geführt – mit<br />
dem Ergebnis, gemeinsam mit dem Institut nach Lösungen zu suchen. Es wurden eine<br />
"Beratungsstelle Gewaltprävention", Suchtpräventionszentren und an einer Vielzahl von<br />
Schulen "Streitschlichter-Projekte" implementiert.<br />
• Durch Einrichtung der "Verlässlichen Halbtagsschule" haben die Grundschulen mehr<br />
Lernzeit für die Schüler zur Verfügung. Untersuchungsergebnisse haben gezeigt, dass<br />
durch die größeren Zeitressourcen und eine bessere Personalsituation erkennbare<br />
Fortschritte im Leistungsbereich erzielt wurden. Dazu haben auch die Bemühungen, den<br />
Unterricht differenzierter und kindgemäßer zu gestalten, beigetragen.<br />
• Im Rahmen der Lehrerfortbildung wird versucht, über Multiplikatoren Kollegen in den<br />
Schulen für Veränderungsprozesse zu gewinnen. – Ansätze von Teamarbeit, Kollegiale<br />
Fallberatung, Supervision und Evaluation sind u. a. Inhalte von Lehrerfortbildungen.<br />
• Künftige Lehrkräfte sollen während ihres Studiums an der Universität stärker mit der<br />
Praxis in Berührung gebracht werden – es sollte schon möglichst früh ein Praktikum in<br />
das Studium integriert werden.<br />
• Implementierung des Projekts "Start", gemeinsam vom Institut und fünf Hamburger<br />
Stiftern. Ziel ist die Förderung von leistungsmäßig guten Schülern mit<br />
Migrationshintergrund, die sich auch gesellschaftlich engagieren. Es geht um die<br />
Unterstützung dieser Schüler von der 8. Klasse bis zum Abitur, sowohl durch eine<br />
134
finanzielle Zuwendung als auch mit technischer Ausrüstung. Start-Stipendiaten können<br />
aber auch an Workshops teilnehmen, in denen sie "nichtschulische" Kompetenzen und<br />
Tugenden erwerben können.<br />
Das Institut führt gemeinsam mit dem Unesco-Institut für Pädagogik das "Family-Literacy-<br />
Project" an insgesamt neun Standorten in Hamburg durch. Ziel dieses Projektes ist es in<br />
erster Linie, die Integration von Kindern mit Migrationshintergrund und ihren Familien in das<br />
Bildungssystem – sowie in die Gesellschaft insgesamt – zu unterstützen und zu fördern.<br />
<strong>Die</strong> Eltern, insbesondere die Mütter, sind Ansprechpartner in dem Projekt. Sie nehmen u. a.<br />
am Unterricht teil, sie erhalten von Förderlehrern Anregungen, wie sie ihre Kinder im<br />
schulischen Bereich unterstützen und fördern können und sie beteiligen sich auch an<br />
außerschulischen Aktivitäten, z. B. an Besuchen von Bücherhallen, Museen etc. und lernen<br />
so Kultureinrichtungen in Deutschland kennen.<br />
<strong>Die</strong> Aktivitäten des Projekts, die sich direkt auf die Situation der Kinder in der Schule<br />
beziehen, werden begleitet durch ein Angebot an Sprachunterricht und Gruppenaktivitäten<br />
mit dem Schwerpunkt "Literacy".<br />
Das Projekt, das auch Teil eines Modellvorhabens der Bund-Länder-Kommission (BLK) und<br />
eines entsprechenden EU-Programms ist, wird sehr positiv eingeschätzt. Es besteht ein<br />
intensiver Austausch mit vergleichbaren Projekten in anderen Ländern, z. B. England.<br />
Neben diesen Beispielen werden hier 3 weitere Projekte skizziert, die von Schulen in<br />
Kooperation mit Betrieben bzw. Einrichtungen der Jugendhilfe realisiert werden. 1<br />
Das LISt-Projekt 2 an der Gesamtschule Eidelstedt<br />
<strong>Die</strong> Schüler ab der 8. Klasse werden mit Unterstützung betrieblicher Lernorte, die im Stadtteil<br />
angesiedelt sind, beschult. Sie erhalten so eine praxisnahe Berufsorientierung. Das Projekt<br />
ist sehr erfolgreich: Es haben sich ausreichend Betriebe gefunden, in denen die Schüler ihre<br />
Praxistage absolvieren können. Sie erleben dort die "Ernsthaftigkeit" in Betrieben und an<br />
Arbeitsplätzen. Sie sind pünktlich, sie lernen "Sekundärtugenden" und erlangen eine andere<br />
Einstellung zum Lernen. "Sie kommen in einer anderen Verfassung in die Schule zurück."<br />
<strong>Die</strong> Ausbildungsleiter in den Betrieben lernen Hauptschüler in einer Weise kennen, die ihrem<br />
bisherigen Bild über diese Schüler widerspricht: dass sie nämlich etwas können und über<br />
vielfältige Kompetenzen verfügen. So wurden schon Ausbildungsplätze im dualen System an<br />
ehemalige Praktikanten vergeben, wobei die persönlichen Kontakte und Erfahrungen, die mit<br />
den Schülern gemacht werden, in einem hohen Grad ausschlaggebend sind.<br />
Das Projekt "Kinderleicht" im Schanzenviertel<br />
Das Projekt wird in Trägerschaft von SME 3 und der Schule Altonaer Straße durchgeführt. Es<br />
ist eine Antwort auf die Situation benachteiligter Schüler, die häufig bereits beim Übergang in<br />
die Sekundarstufe I den Anschluss an die Altersgruppe verlieren.<br />
Projektziel ist, der Versagenskette der "Risikokinder" im Schanzenviertel entgegenzuwirken.<br />
"Der Ansatz enthält eine intensive Zusammenarbeit von Sozialpädagogischen Fachkräften,<br />
schulischen Lehrkräften und Erziehern der Kindertagesstätten." 4 Es wird an den Nahtstellen/<br />
1<br />
Bei Interesse an mehr Informationen zu diesen Projekten – auch zu dem "Familiy-Literacy-Project" – besteht<br />
sicherlich die Möglichkeit, diese von den jeweiligen Trägern zu erhalten.<br />
2<br />
"Lernen im Stadtteil"<br />
3<br />
Stadtteilbezogene Milieunahe Erziehungshilfen<br />
4<br />
Kinderleicht, Rahmenbedingungen, 3/4<br />
135
Übergängen unterrichtsergänzend und familienfördernd gearbeitet. <strong>Die</strong> Kinder werden in<br />
ihrer sozialen und intellektuellen Entwicklung zielgerichtet gestützt, so dass der schulische<br />
Lernprozess erfolgreich gelingt und damit die soziale Integration möglich ist.<br />
Kooperationsprojekt Schule – Jugendhilfe<br />
In diesem Projekt arbeitet Das Rauhe Haus mit fünf Hamburger Schulen zusammen.<br />
Ausgangssituation für die Kooperation waren Zerstörungen in einem Stadtteil. Es ging zuerst<br />
darum, destruktive Aktivitäten "zu einer produktiven Aktivität hinzuführen".<br />
Im Mittelpunkt dieses Kooperationsprojekts stehen die Verhinderung der Überweisung von<br />
Schülern in eine Sonderschule und die Unterstützung für einen qualifizierten Schulabschluss,<br />
der die Chance für einen guten "Absprung" eröffnet.<br />
In den fünf Schulen – unterschiedlicher Schulformen – arbeitet Das Rauhe Haus mit<br />
verschiedenen Handlungsstrategien mit Schülern und Eltern sowie Lehrern zusammen:<br />
Gemeinsam mit betroffenen Schülern und ihren Eltern wird das jeweilige Arbeits- und<br />
Lernverhalten reflektiert, es werden gemeinsam Lernpläne aufgestellt, die vertraglich<br />
festgehalten und von den Beteiligten überprüft werden. Mit Beratungslehrern und<br />
Sozialpädagogen der Schulen werden z. B. regelmäßige Fallbesprechungen durchgeführt.<br />
Darüber hinaus wird Elternberatung in unterschiedlichen Formen angeboten.<br />
Neben der sozialpädagogischen Unterstützung arbeitet Das Rauhe Haus mit dem Medium<br />
"Bewegung und Spiel". Dadurch werden Grundlagen gelegt für die Entwicklung der<br />
Sprachkompetenzen, für Eigenaktivitäten, für die – materielle und soziale – Gestaltung von<br />
Räumen und Situationen.<br />
Unverständlich ist sowohl für den Jugendhilfeträger als auch für die beteiligten Schulen, dass<br />
trotz der sehr positiv angelaufenen Projekte einige der Schulstandorte geschlossen werden<br />
sollen.<br />
Bildung als primäre Ressource,<br />
den Kreislauf von Armut und Benachteiligung zu durchbrechen<br />
<strong>Die</strong>se These kann uneingeschränkt bestätigt werden. Es sind nicht mangelnde Potenziale,<br />
fehlendes Interesse und Ignoranz, die Lernprozesse behindern und sogar zerstören, sondern<br />
Armut und Benachteiligung. Es geht bei Bildungsprozessen darum, Kinder im Kontext ihrer<br />
Lebenslage und Lebenswelt zu sehen und diese auch als "normal" und nicht als abweichend<br />
zu akzeptieren – für die Kinder sind sie "Normalität". Es geht darum, Kinder z. B. mit ihren<br />
Bedürfnissen u. a. nach Anerkennung und Wertschätzung, ihrer Kreativität, ihrer Neugierde,<br />
ihrem Wissensdrang, ihrem Wunsch nach Bewegung und Toben – aber auch nach Ruhe, in<br />
den Mittelpunkt zu stellen.<br />
<strong>Die</strong> Eltern benötigen Hilfestellungen und Ermutigung, um ihre Kinder in ihrer<br />
Bildungssituation zu fördern und zu unterstützen.<br />
Wenn Erkenntnisse die Voraussetzung für Veränderungen sind, dann mögen Erkenntnisse<br />
und Erfahrungen, die im Rahmen dieser <strong>Studie</strong> sichtbar werden, zu Veränderungsprozessen<br />
führen. <strong>Die</strong> aufgezeigten Problemstellungen bieten eine Grundlage dafür. <strong>Die</strong> Hinweise zu<br />
Verbesserungen der Lebenslage und die damit verbundenen Ansätze für Vernetzungen und<br />
Kooperationen im Rahmen einer sozialraum- und lebensweltorientierten (Schul-) Bildung und<br />
Jugendhilfe bieten eine Basis, um bestehende Strukturen und Systeme zu hinterfragen und<br />
ggf. Alternativen zu entwickeln.<br />
136
Wie würde die Arbeit in Schulen, aber auch in Kitas und Jugendhilfeeinrichtungen bewertet,<br />
wenn folgende Erfolgskriterien zugrunde gelegt würden:<br />
• Das soziale Klima in der Institution.<br />
• <strong>Die</strong> Anerkennung und Wertschätzung, die ihren jeweiligen Zielgruppen entgegengebracht<br />
werden.<br />
• <strong>Die</strong> Kreativität und die Freude am Lernen, die im Rahmen der Aktivitäten zwischen<br />
Experten und den jungen Menschen sichtbar werden.<br />
Dafür sind neben einem Paradigmenwechsel bei den betroffenen Experten auch eine<br />
Veränderung der Rahmenbedingungen einschließlich veränderter Arbeitsbedingungen<br />
notwendig.<br />
Erforderlich sind eine Gesellschaft und eine Politik, für die die Vermeidung und der Abbau<br />
von Benachteiligung und die Schaffung positiver Lebensbedingungen für junge Menschen<br />
und einer kinder- und familienfreundlichen Umwelt 1 handlungsleitende Prinzipien sind.<br />
1 §1 Abs. 3 Kinder- und Jugendhilfegesetz<br />
137
138
Literaturliste<br />
- Becher, U., Erfahrungs- und Endbericht/ ein Handbuch, 1/2004<br />
- Becher, U., Kruse, I., Armutsrisiken für Einelternfamilien – Einelternfamilien – ein Armutsrisiko?<br />
Potsdam, 2001<br />
- Becher, U., Sozialraum- und lebensweltorientierte HzE - Sozialraum- und Lebenslagen-/<br />
Lebensweltanalyse,12/2002, unveröffentlichtes Manuskript<br />
- Becker, P., Koch, J., (Hrsg.), Was ist normal?, Weinheim und München, 1999<br />
- Beisenherz, H.G., Kinderarmut in der Wohlstandsgesellschaft, Opladen, 2002<br />
- BMSFSJ (Hrsg.), 10. Kinder- und Jugendbericht, Drucksache 13/11368,<br />
- BMFSFJ (Hrsg.), 11. Kinder- und Jugendbericht, Berlin, 2/2002<br />
- Bos, W., Pietsch M., Erste Ergebnisse aus KESS 4 – Kurzbericht, Hamburg, 9/2004<br />
- Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung (Hrsg.), Lebenslagen in Deutschland, Bonn, 2001<br />
- Butterwegge, Ch. (Hrsg.), Kinderarmut in Deutschland, Frankfurt am Main, 2000<br />
- Christiansen, U., Obdachlos weil arm, Gießen, 1973<br />
- Deutscher Bundestag, Drs. 15/5015, Lebenslagen in Deutschland,<br />
2. Armuts- und Reichtumsbericht, Berlin, 3/2005<br />
- Deutsches Kinderhilfswerk (Hrsg.), Kinderreport Deutschland 2004, München 2004<br />
- Haar, H. von der, Stark-von der Haar, E., Jugendarbeitslosigkeit und soziale Sicherheit, Berlin,1982<br />
- Heiner, M. u.a., Methodisches Handeln in der Sozialen Arbeit, Freiburg, 1994<br />
- Hentig, H. von, <strong>Die</strong> Wiederherstellung der Politik, München, 1973<br />
- Hochstrasser, F. u. a., <strong>Die</strong> Fachhochschule für Soziale Arbeit, Bern, Stuttgart, Wien, 1997<br />
- Jarass, H., Pieroth, B., Kommentar zum Grundgesetz, München, 2004<br />
- Keupp, H. (Hrsg.), Psychische Störungen als abweichendes Verhalten, München, 1972<br />
- Münder u. a.. (Hrsg.), Frankfurter Kommentar zum SGB VIII: Kinder- und Jugendhilfe,<br />
Weinheim, 4. Auflage, 2003<br />
- Palloks, K., Konzeption zum Forschungsvorhaben "Indikatoren zur Messung der Armutssituation<br />
von Kindern und Jugendlichen", Unveröffentlichtes Manuskript, Potsdam, 2000<br />
- Prantl, H., Kein schöner Land, die Zerstörung der sozialen Gerechtigkeit, München, 2005<br />
- Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein (Hrsg.),<br />
Hamburger Statistisches Jahrbuch 2003/2004<br />
- Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein (Hrsg.),<br />
Statistisches Jahrbuch Hamburg, 2004/2005<br />
- Weber, M., Wirtschaft und Gesellschaft, <strong>Studie</strong>nausgabe, Tübingen, 1980<br />
- Frankfurter Rundschau vom 30.5.2005<br />
- Frankfurter Rundschau vom 5.7.2005<br />
- Frankfurter Rundschau vom 12.7.2005<br />
- Frankfurter Rundschau vom 19.7.2005<br />
- Hamburger Abendblatt vom 25.5.2005<br />
- Hamburger Abendblatt vom 7.2.2004<br />
- Zeitschrift für Heilpädagogik, 12/2000<br />
- Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland<br />
- Kinder- und Jugendhilfegesetz / SGB VIII, §§ 1, 16, 22, 81<br />
- Bundessozialhilfegesetz § 1 Abs. 2<br />
- Wohnraumförderungsgesetz, WoFG, §§ 6, 27<br />
- Zweites Wohnungsbaugesetz, II WoBauG, § 1<br />
139
140
Anlagen<br />
Anlage 1 Anschreiben an Experten<br />
Anlage 2 Interviewleitfaden<br />
Anlage 3 u. 3a Teilnehmer der Gruppendiskussionen<br />
Anlage 4 Gesprächspartner in Einzelinterviews<br />
Anlage 5 Strukturdaten<br />
Tabelle 2 Bevölkerung nach Ausländeranteil und Altersstruktur<br />
in "armen" und "reichen" Stadtteilen<br />
Tabelle 2a Bevölkerung nach Ausländeranteil und Altersstruktur<br />
Region III Eimsbüttel<br />
Tabelle 2b Bevölkerung nach Ausländeranteil und Altersstruktur<br />
Schanzenviertel/ Karolinenviertel<br />
Tabelle 3a Deutsche und nichtdeutsche Bevölkerung nach Altersstruktur<br />
Region III Eimsbüttel<br />
Tabelle 3b Deutsche und nichtdeutsche Bevölkerung nach Altersstruktur<br />
Schanzenviertel/ Karolinenviertel<br />
Tabelle 4 Haushaltsstruktur 1999 in "armen" und "reichen" Stadtteilen<br />
Tabelle 4.1 Familien mit Kindern nach Familienstatus, 31.12.1999<br />
in "armen" und "reichen" Stadtteilen<br />
Tabelle 4.1a Familien mit Kindern nach Familienstatus, 31.12.1999<br />
Region III Eimsbüttel<br />
Tabelle 4.1b Familien mit Kindern nach Familienstatus, 31.12.1999<br />
Schanzenviertel/ Karolinenviertel<br />
Tabelle 5 Sozialstruktur in "armen" und "reichen" Stadtteilen<br />
Tabelle 5a Sozialstruktur – Region III Eimsbüttel<br />
Tabelle 5b Sozialstruktur – Schanzenviertel/ Karolinenviertel<br />
Tabelle 6 Wohnsituation in "armen" und "reichen" Stadtteilen 2002<br />
Tabelle 7 Versorgung mit Sozialwohnungen<br />
in "armen" und "reichen" Stadtteilen<br />
Tabelle 7a Versorgung mit Sozialwohnungen<br />
Region III Eimsbüttel<br />
Tabelle 7b Versorgung mit Sozialwohnungen<br />
Schanzenviertel/ Karolinenviertel<br />
Tabelle 8 Schulabschlüsse,<br />
Absolventen an allgemeinbildenden Schulen 2003/2004<br />
in "armen" und "reichen" Stadtteilen<br />
Tabelle 8b Schulabschlüsse,<br />
Absolventen an allgemeinbildenden Schulen 2003/2004<br />
Schanzenviertel/ Karolinenviertel und Region III Eimsbüttel<br />
Anlage 6 Voraussetzungen für gelingende Kooperationen<br />
Anlage 7 Mitglieder der Lenkungsgruppe des Projekts<br />
"Sozialraum- und lebensweltorientierte Hilfen zur Erziehung ..."<br />
141
ANLAGE 1<br />
Prof. Dr. Ursel Becher<br />
Kippingstrasse 2<br />
20144 Hamburg<br />
Tel: (0 40) 41 35 23<br />
Fax: (0 40) 41 35 42<br />
Hamburg, 25. September 2004<br />
<strong>Studie</strong> zu Armut und Benachteiligung von Kindern und Jugendlichen in Hamburg<br />
ANREDE<br />
ich wende mich mit der Bitte an Sie, Sie im Rahmen der o. g. <strong>Studie</strong> als Opinionleader 1 befragen<br />
zu dürfen.<br />
Im Rahmen des Projekts „Sozialraum- und lebensweltorientierte Hilfen zur Erziehung (HzE) unter<br />
Einbeziehung eines Sozialraumbudgets“ in der Region III in Eimsbüttel sind wir wiederholt auf<br />
Aspekte von Kinderarmut gestoßen.<br />
Obwohl Kinderarmut insbesondere im Bereich der Wissenschaft, aber gelegentlich auch im<br />
Rahmen sozialarbeiterischer Praxis thematisiert wird und auch auf individuelle und<br />
gesellschaftliche Folgen hingewiesen wird, entsteht der Eindruck, dass Armut ein stark<br />
tabuisiertes Thema ist. Das mag mit der vermeintlichen und tatsächlichen Ohnmacht der<br />
handelnden Experten ebenso wie mit dem eingetretenen gesellschaftlichen Klima und einem<br />
Mangel an problemlösenden Angeboten und Handlungsstrategien zusammenhängen. Trotzdem<br />
wird es als notwendig angesehen, eine möglichst praxisnahe <strong>Studie</strong> zu dieser Problematik zu<br />
erstellen, da davon auszugehen ist, dass Kinderarmut auch in Hamburg ein wachsendes Problem<br />
ist. Waren bisher Einelternfamilien und kinderreiche Familien (drei und mehr Kinder) besonders<br />
verarmungsgefährdete Gruppen, so wird durch die Umsetzung von Harz IV eine weitere<br />
Armutspopulation entstehen – es wird geschätzt, dass durch die Umsetzung des Gesetzes zum<br />
1. Januar 2005 weitere ca. 500.000 Kinder und Jugendliche in Deutschland von materieller Armut<br />
und den in der Regel daraus resultierenden Folgeerscheinungen betroffen sein werden.<br />
Schon im 10. Kinder- und Jugendbericht wurde darauf hingewiesen, dass ein zentraler Punkt der<br />
Jugendhilfe der Abbau von Benachteiligung ist (vgl. § 1 Abs. 3 Satz 1 KJHG). "Dringend geboten<br />
ist eine kommunale Armutspolitik, die das gesamte Lebensumfeld von Kindern und Familien<br />
berücksichtigt." Im 11. Jugendbericht wird auf die Multidimensionalität von Armut und<br />
Benachteiligung hingewiesen. Gleichzeitig wird aber die ökonomische Benachteiligung als<br />
Ursache sozialer Ausgrenzungen und Benachteiligungen benannt.<br />
In der <strong>Studie</strong> wird ein multidimensionaler Ansatz zur Erfassung und Erklärung von Armut und<br />
Benachteiligung realisiert. Im Rahmen des Forschungsprozesses werden quantitative und<br />
qualitative Daten erhoben, die sich primär auf die Region III in Eimsbüttel und auf das<br />
Schanzenviertel als innerstädtische Vergleichsregion beziehen.<br />
1 <strong>Die</strong> Mitglieder der Gruppendiskussionen erhielten ein entsprechendes Schreiben.
Quantitative Daten werden durch Analyse und Auswertung vorhandener statistischer Materialien<br />
erhoben. Sowohl für die Region III als auch für das Schanzenviertel wird versucht – soweit<br />
vorhanden – Quartiersdaten der Analyse zugrunde zu legen und dann mit Daten auf Stadtteil-,<br />
Bezirks- und Gesamtstadtebene in Beziehung zu setzen.<br />
Qualitative Daten wurden (Lebenslagenanalysen des Projekts) und werden im Rahmen von<br />
Gruppendiskussionen und Einzelinterviews mit Experten verschiedener Arbeitsfelder und<br />
Funktionen erhoben.<br />
Dem mit Ihnen als Opinionleader geplanten Einzelinterview liegen folgende generelle Themen<br />
und Fragestellungen zugrunde:<br />
• Fragen nach Armut und Benachteiligung von Kindern und Jugendlichen generell, dem<br />
eigenen Verständnis und dem dieser <strong>Studie</strong> zugrundeliegenden Ansatz einer<br />
multidimensionalen Deprivation<br />
• Fragen nach potentiellen Risikogruppen und nach Aspekten, die den Prozess der<br />
Benachteiligung und Ausgrenzung begünstigen<br />
• Auswirkungen von Armut und Benachteiligung auf die Lebenswelt von Kindern und<br />
Jugendlichen<br />
• Wahrnehmung der Situation armer und benachteiligter Kinder und Jugendlicher im eigenen<br />
Arbeits-/ Funktionsbereich<br />
• Ansätze zur Verbesserung der Lebenssituation armer und benachteiligter Kinder und<br />
Jugendlicher unter Berücksichtigung der Möglichkeiten in dem eigenen Funktionsbereich.<br />
Allen Befragten wird weitgehende Freiheit in der Gestaltung des Gesprächs eingeräumt. <strong>Die</strong> im<br />
Leitfaden vorgegebenen Fragenkomplexe können nach eigenem Ermessen und eigener<br />
Einschätzung beantwortet werden.<br />
<strong>Die</strong> Einzelinterviews sollen in dem Zeitraum Mitte Oktober 2004 bis Mitte Januar 2005<br />
durchgeführt werden (parallel dazu werden die Gruppendiskussionen in den beiden Gebieten<br />
Region III in Eimsbüttel und Schanzenviertel durchgeführt). Ich werde versuchen, Sie in der 42.<br />
Woche anzurufen, um ggf. einen Interviewtermin mit Ihnen zu vereinbaren.<br />
Für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung im Voraus vielen Dank.<br />
Mit freundlichen Grüßen<br />
Prof. Dr. Ursel Becher
ANLAGE 2<br />
Interview-Leitfaden<br />
Dr. Ursel Becher<br />
Hamburg, 10/2004<br />
1 Armut und Benachteiligung von Kindern – ist das ein Phänomen, das ein Problem in<br />
dieser Stadt darstellt und ggf. warum?<br />
Wie und in welchen Zusammenhängen werden Armutsphänomene öffentlich, u. a.<br />
durch Medien, diskutiert und dargestellt?<br />
1.1 Wann bezeichnen Sie jemanden als arm und benachteiligt (eigenes Verständnis)?<br />
1.2 Der multidimensionale Ansatz/ Lebenslagenansatz geht davon aus, dass Armut und<br />
Benachteiligung nicht ausschließlich durch Einkommensprobleme gekennzeichnet<br />
sind, sondern dass arme Menschen in mehreren Lebensbereichen in ihrer<br />
Handlungsmöglichkeiten eingeschränkt sind – die EU definiert Personen, Familien<br />
und Gruppen als arm „die über so geringe (materielle, kulturelle und soziale) Mittel<br />
verfügen, dass sie von der Lebensweise ausgeschlossen sind, die in dem<br />
Mitgliedsstaat in dem sie leben als Minimum angesehen werden“ (50% des<br />
bereinigten Äquivalenzeinkommens).<br />
� Legt man also ein solches Lebenslagenmodell zugrunde: In welchen<br />
Lebensbereichen zeigen sich Einschränkungen in ihrer Handlungsmöglichkeiten<br />
und damit in ihren Teilhabechancen?<br />
2 Wen sehen Sie ggf. als spezifische Risikogruppe an?<br />
Welche Gruppen sind besonders gefährdet von Armut und Benachteiligung betroffen<br />
zu sein bzw. zu werden?<br />
2.1 Durch welche Aspekte wird nach Ihrer Vorstellung ein Prozess der Benachteiligung<br />
und Ausgrenzung begünstigt?<br />
3 Wie wirkt sich Armut und Benachteiligung auf die Lebenswelt der Betroffenen aus?<br />
� <strong>Die</strong> Form, wie Menschen im Alltag in ihren sozialen Beziehungen und Netzen<br />
miteinander leben und welche Umgangs- und Bewältigungsmuster sie in „Szenen<br />
ihres Lebens“ entwickelt haben.<br />
4 (Wie) nehmen Sie die Situation armer und benachteiligter Kinder und Jugendlicher in<br />
Ihrem eigenen Arbeits-/ Funktionsbereich wahr?<br />
5 Welche Ansätze zur Verbesserung der Lebenssituation armer und benachteiligter<br />
Kinder und Jugendlicher könnten unter Berücksichtigung der Möglichkeiten in Ihrem<br />
Funktionsbereich realisiert werden?<br />
5.1 Mit wem könnte bzw. sollte dabei kooperiert werden?<br />
5.2 Warum erscheint Ihnen die genannte Kooperation wünschenswert?
ANLAGE 3<br />
Liste der Teilnehmer an den Gruppendiskussionen in der Region III<br />
Herr Georg Becker AckerpoolCo - HdJ - Eidelstedt<br />
Frau Mareike Boeken Das Rauhe Haus<br />
Herr Lutz Busch Jugendamt/ ASD Region III<br />
Frau Sigrun Ferber Vereinigung Hamburger Kindertagesstätten<br />
Frau Fischer Kita Remstückenkamp<br />
Herr Julian Gietzelt Das Rauhe Haus<br />
Frau Claudia Heiden Jugendamt/ ASD Region III<br />
Frau Christiane Mettlau REBUS<br />
Frau Karin Möller Max-Träger-Schule<br />
Herr Gunnar Rachul Mobi Eidelstedt<br />
Herr Martin Reichert Gesamtschule Eidelstedt<br />
Frau Helga Wendland Gesamtschule Eidelstedt<br />
Frau Susanne Wolf Das Rauhe Haus<br />
ANLAGE 3a<br />
Liste der Teilnehmer an den Gruppendiskussionen im Schanzenviertel<br />
Frau Stefanie Büchner ASD Eimsbuettel<br />
Herr Gerhardt Schule Altonaer Strasse<br />
Frau Simone Giebel Sozialarbeit und Segeln<br />
Frau Barbara Haarmann Jesus Center e.V.<br />
Herr Jens Heitmann ASD Altona<br />
Herr Lolo Koffivi Afrika-Club<br />
Frau Dagmar Mein Kinderglück e.V.<br />
Frau Anette Mohr KIZ e.V.<br />
Frau Ditte Nowak SME e.V.<br />
Frau Gisela Rathjens Schule Ludwigstraße<br />
Herr Fred Rathjens Streetlife e.V., Rahlstedt<br />
Frau Ragna Riensberg NaSchEi<br />
Frau Martina Tomczak ASD Eimsbuettel
ANLAGE 4<br />
Gesprächspartner in den Einzelinterviews<br />
Herr Prof. Dr. Harald Ansen HAW Hamburg<br />
Fachbereich Sozialpädagogik<br />
Frau Bettina Bliebenich Bürgerschaft, Jugendpolitische Sprecherin (CDU<br />
Frau Christiane Bloemeke Bürgerschaft, Jugendpolitische Sprecherin (GAL)<br />
Herr Peter Daschner Institut für Lehrerbildung<br />
Frau Ute Florian Bezirksamt Mitte<br />
Jugend- und Sozialdezernat<br />
Herr Joachim Gerbing Verband Kinder- und Jugendarbeit Hamburg e.V.<br />
Herr Dr. Wolfgang Hammer Amt für Familie, Jugend und Sozialordnung<br />
Frau Prof. Dr. Birgit Herz Universität Hamburg<br />
Institut für Behindertenpädagogik<br />
Frau Dr. Andrea Hilgers Bürgerschaft, Jugendpolitische Sprecherin (SPD)<br />
Herr Matthias Kock Amt für Wohnen, Stadterneuerung und Bodenordnung<br />
Herr Michael König Jugendamt Eimsbüttel, Region III<br />
Herr <strong>Die</strong>ter Polkowski Amt für Wohnen, Stadterneuerung und Bodenordnung<br />
Herr Prof. Dr. Wulf Rauer Universität Hamburg, FB ErzWiss<br />
Deutscher Kinderschutzbund, Landesverband Hamburg<br />
Herr Michael Sachs<br />
Herr Gapski<br />
Frau Köllmann<br />
Herr Redlich<br />
GWG - Gesellschaft f. Wohnen und Bauen mbH<br />
Frau Treeß <strong>Stiftung</strong> Das Rauhe Haus<br />
Abteilung Kinder- und Jugendhilfe
ANLAGE 5<br />
Tabelle 2<br />
Bevölkerung nach Ausländeranteil und Altersstruktur in "armen" und "reichen" Stadtteilen 1<br />
davon:<br />
STADTGEBIET<br />
Bevölkerung<br />
unter 6 bis unter 10 bis unter 15 bis unter 21 bis unter 45 bis unter 65 Jahre<br />
unter<br />
Ausländer<br />
Region<br />
insgesamt<br />
6 Jahren 10 Jahren 15 Jahren 21 Jahren 45 Jahren 65 Jahren und älter 18Jahren<br />
N % N % N % N % N % N % N % N % N %<br />
Jenfeld 25 212 4 984 19,8% 1 660 6,6% 1 096 4,3% 1 431 5,7% 2 020 8,0% 8 270 32,8% 6 457 25,6% 4 278 17,0% 5 207 20,7%<br />
Billbrook 1 783 1 269 71,2% 201 11,3% 112 6,3% 145 8,1% 196 11,0% 710 39,8% 303 17,0% 116 6,5% 542 30,4%<br />
Kleiner Grasbrook mit Steinwerder 1 445 936 64,8% 138 9,6% 43 3,0% 46 3,2% 101 7,0% 717 49,6% 293 20,3% 107 7,4% 265 18,3%<br />
Hausbruch 17 371 2 433 14,0% 1 164 6,7% 914 5,3% 1 188 6,8% 1 492 8,6% 5 547 31,9% 4 207 24,2% 2 859 16,5% 4 027 23,2%<br />
Billstedt 68 512 15 434 22,5% 4 211 6,1% 2 939 4,3% 3 999 5,8% 5 128 7,5% 22 875 33,4% 18 400 26,9% 10 960 16,0% 13 768 20,1%<br />
Veddel 4 708 2 717 57,7% 478 10,2% 260 5,5% 322 6,8% 358 7,6% 1 980 42,1% 982 20,9% 328 7,0% 1 228 26,1%<br />
Wilhelmsburg 47 847 16 341 34,2% 3 691 7,7% 2 395 5,0% 3 022 6,3% 3 438 7,2% 17 645 36,9% 10 927 22,8% 6 729 14,1% 10 854 22,7%<br />
St. Pauli 26 923 8 401 31,2% 1 294 4,8% 711 2,6% 844 3,1% 1 145 4,3% 14 461 53,7% 6 181 23,0% 2 287 8,5% 3 385 12,6%<br />
Dulsberg 17 179 4 098 23,9% 940 5,5% 483 2,8% 623 3,6% 882 5,1% 8 217 47,8% 3 547 20,6% 2 487 14,5% 2 418 14,1%<br />
Rothenburgsort 8 092 2 194 27,1% 436 5,4% 316 3,9% 369 4,6% 530 6,5% 3 107 38,4% 1 874 23,2% 1 460 18,0% 1 373 17,0%<br />
Steilshoop 19 516 3 453 17,7% 1 139 5,8% 786 4,0% 1 110 5,7% 1 518 7,8% 6 622 33,9% 5 442 27,9% 2 899 14,9% 3 812 19,5%<br />
Allermöhe 14 264 2 026 14,2% 1 347 9,4% 1 013 7,1% 1 135 8,0% 1 230 8,6% 6 118 42,9% 2 643 18,5% 778 5,5% 4 144 29,1%<br />
Wohldorf-Ohlstedt 4 241 153 3,6% 274 6,5% 194 4,6% 275 6,5% 278 6,6% 1 207 28,5% 1 227 28,9% 786 18,5% 890 21,0%<br />
Reitbrook 501 7 1,4% 21 4,2% 11 2,2% 25 5,0% 26 5,2% 159 31,7% 152 30,3% 107 21,4% 71 14,2%<br />
Groß Flottbek 10 905 1 654 15,2% 669 6,1% 426 3,9% 482 4,4% 562 5,2% 3 707 34,0% 2 987 27,4% 2 072 19,0% 1 851 17,0%<br />
Nienstedten 6 502 669 10,3% 410 6,3% 267 4,1% 309 4,8% 332 5,1% 1 989 30,6% 1 850 28,5% 1 345 20,7% 1 157 17,8%<br />
Othmarschen 11 473 1 294 11,3% 634 5,5% 433 3,8% 490 4,3% 544 4,7% 3 596 31,3% 3 272 28,5% 2 504 21,8% 1 840 16,0%<br />
Sasel 22 016 995 4,5% 1 237 5,6% 948 4,3% 1 092 5,0% 1 376 6,3% 6 055 27,5% 6 674 30,3% 4 634 21,0% 3 973 18,0%<br />
Wellingsbüttel 9 493 589 6,2% 501 5,3% 330 3,5% 361 3,8% 444 4,7% 2 644 27,9% 2 954 31,1% 2 259 23,8% 1 401 14,8%<br />
Neuengamme 3 418 82 2,4% 216 6,3% 148 4,3% 194 5,7% 210 6,1% 1 124 32,9% 916 26,8% 610 17,8% 675 19,7%<br />
Bergstedt 9 035 320 3,5% 503 5,6% 415 4,6% 526 5,8% 608 6,7% 2 618 29,0% 2 540 28,1% 1 825 20,2% 1 786 19,8%<br />
Blankenese 13 152 1 544 11,7% 721 5,5% 458 3,5% 570 4,3% 692 5,3% 3 859 29,3% 4 003 30,4% 2 849 21,7% 2 103 16,0%<br />
Ochsenwerder 2 288 82 3,6% 123 5,4% 98 4,3% 132 5,8% 121 5,3% 775 33,9% 586 25,6% 453 19,8% 407 17,8%<br />
Altengamme 2 140 25 1,2% 126 5,9% 103 4,8% 127 5,9% 142 6,6% 692 32,3% 552 25,8% 398 18,6% 431 20,1%<br />
Bezirk Eimsbüttel 244 007 33 471 13,7% 11 780 4,8% 7 554 3,1% 9 380 3,8% 11 598 4,8% 96 691 39,6% 65 069 26,7% 41 935 17,2% 34 238 14,0%<br />
Bezirk Hamburg-Nord 276 354 37 092 13,4% 12 422 4,5% 7 084 2,6% 8 821 3,2% 12 208 4,4% 120 355 43,6% 66 948 24,2% 48 516 17,6% 33 738 12,2%<br />
Bezirk Wandsbek 407 350 42 856 10,5% 21 992 5,4% 15 216 3,7% 19 573 4,8% 24 661 6,1% 134 564 33,0% 108 714 26,7% 82 630 20,3% 69 043 16,9%<br />
Bezirk Altona 241 992 39 797 16,4% 13 865 5,7% 8 668 3,6% 10 878 4,5% 13 220 5,5% 92 407 38,2% 60 367 24,9% 42 587 17,6% 39 871 16,5%<br />
Bezirk Bergedorf 117 388 11 311 9,6% 7 046 6,0% 5 212 4,4% 7 014 6,0% 8 440 7,2% 41 176 35,1% 28 974 24,7% 19 526 16,6% 23 541 20,1%<br />
Bezirk Harburg 199 715 40 331 20,2% 12 358 6,2% 8 304 4,2% 10 970 5,5% 13 835 6,9% 70 876 35,5% 48 307 24,2% 35 065 17,6% 38 420 19,2%<br />
Bezirk Hamburg-Mitte 228 117 57 674 25,3% 12 105 5,3% 7 494 3,3% 9 672 4,2% 13 346 5,9% 95 175 41,7% 55 187 24,2% 35 138 15,4% 35 525 15,6%<br />
Hamburg gesamt 1 714 923 262 532 15,3% 91 568 5,3% 59 532 3,5% 76 308 4,4% 97 308 5,7% 651 244 38,0% 433 566 25,3% 305 397 17,8% 274 376 16,0%<br />
1 Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein, Stand: 29.06.2004<br />
Melderegister 31.12.2003
ANLAGE 5<br />
Tabelle 2a<br />
Bevölkerung nach Ausländeranteil und Altersstruktur<br />
Region III Eimsbüttel 1<br />
davon:<br />
STADTGEBIET<br />
unter<br />
18Jahren<br />
65 Jahre<br />
und älter<br />
45 bis unter<br />
65 Jahren<br />
21 bis unter<br />
45 Jahren<br />
15 bis unter<br />
21 Jahren<br />
10 bis unter<br />
15 Jahren<br />
6 bis unter<br />
10 Jahren<br />
unter<br />
6 Jahren<br />
Ausländer<br />
Bevölkerung<br />
insgesamt<br />
Region<br />
N % N % N % N % N % N % N % N % N %<br />
Eidelstedt - Wildacker 1 700 196 11,5% 117 6,9% 73 4,3% 106 6,2% 110 6,5% 490 28,8% 517 30,4% 287 16,9% 343 20,2%<br />
Eidelstedt - Hörgensweg 3 240 619 19,1% 178 5,5% 114 3,5% 140 4,3% 154 4,8% 1 146 35,4% 848 26,2% 660 20,4% 498 15,4%<br />
Eidelstedt - Reemstückenkamp/<br />
Wiebischenkamp 2 299 395 17,2% 116 5,0% 98 4,3% 108 4,7% 162 7,0% 717 31,2% 600 26,1% 498 21,7% 402 17,5%<br />
Eidelstedt - Astweg 2 551 288 11,3% 179 7,0% 122 4,8% 169 6,6% 181 7,1% 804 31,5% 641 25,1% 455 17,8% 559 21,9%<br />
Eidelstedt 29 979 3 934 13,1% 1 524 5,1% 1 100 3,7% 1 485 5,0% 1 796 6,0% 9 786 32,6% 8 068 26,9% 6 220 20,7% 4 985 16,6%<br />
Stellingen - Wegenkamp 1 776 285 16,0% 99 5,6% 80 4,5% 76 4,3% 114 6,4% 575 32,4% 472 26,6% 360 20,3% 308 17,3%<br />
Stellingen - Linse 2 900 382 13,2% 116 4,0% 73 2,5% 113 3,9% 153 5,3% 912 31,4% 856 29,5% 677 23,3% 386 13,3%<br />
Stellingen - Spannskamp 1 391 150 10,8% 58 4,2% 55 4,0% 67 4,8% 65 4,7% 470 33,8% 331 23,8% 345 24,8% 206 14,8%<br />
Stellingen 21 871 3 342 15,3% 932 4,3% 611 2,8% 745 3,4% 1 072 4,9% 8 362 38,2% 5 710 26,1% 4 439 20,3% 2 781 12,7%<br />
Region III 51 850 7 276 14,0% 2 456 4,7% 1 711 3,3% 2 230 4,3% 2 868 5,5% 18 148 35,0% 13 778 26,6% 10 659 20,6% 7 766 15,0%<br />
Bezirk Eimsbüttel c 244 007 33 471 13,7% 11 780 4,8% 7 554 3,1% 9 380 3,8% 11 598 4,8% 96 691 39,6% 65 069 26,7% 41 935 17,2% 34 238 14,0%<br />
Hamburg insgesamt h 1 714 923 262 532 15,3% 91 568 5,3% 59 532 3,5% 76 308 4,4% 97 308 5,7% 651 244 38,0% 433 566 25,3% 305 397 17,8% 274 376 16,0%<br />
1 Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein, Stand: 29.06.2004<br />
Melderegister 31.12.2003
ANLAGE 5<br />
Tabelle 2b<br />
Bevölkerung nach Ausländeranteil und Altersstruktur<br />
Schanzenviertel / Karolinenviertel 1<br />
davon:<br />
STADTGEBIET<br />
unter<br />
18Jahren<br />
65 Jahre<br />
und älter<br />
45 bis unter<br />
65 Jahren<br />
21 bis unter<br />
45 Jahren<br />
15 bis unter<br />
21 Jahren<br />
10 bis unter<br />
15 Jahren<br />
6 bis unter<br />
10 Jahren<br />
unter<br />
6 Jahren<br />
Ausländer<br />
Bevölkerung<br />
insgesamt<br />
Region<br />
N % N % N % N % N % N % N % N % N %<br />
St. Pauli - Schulterblatt 3 337 893 26,8% 165 4,9% 101 3,0% 88 2,6% 125 3,7% 1 863 55,8% 682 20,4% 313 9,4% 399 12,0%<br />
St. Pauli - Schanzenstraße 2 134 668 31,3% 177 8,3% 67 3,1% 70 3,3% 91 4,3% 1 225 57,4% 396 18,6% 108 5,1% 367 17,2%<br />
St. Pauli - Lagerstraße 349 223 63,9% 17 4,9% 18 5,2% 16 4,6% 8 2,3% 162 46,4% 110 31,5% 18 5,2% 56 16,0%<br />
Altona - Altstadt 3 031 628 20,7% 149 4,9% 86 2,8% 88 2,9% 98 3,2% 1 529 50,4% 613 20,2% 468 15,4% 373 12,3%<br />
Altona - Nord 2 348 645 27,5% 155 6,6% 79 3,4% 122 5,2% 82 3,5% 1 288 54,9% 412 17,5% 210 8,9% 397 16,9%<br />
Eimsbüttel - Doormannsweg 2 459 476 19,4% 94 3,8% 45 1,8% 56 2,3% 100 4,1% 1 359 55,3% 553 22,5% 252 10,2% 233 9,5%<br />
Eimsbüttel - Waterloostraße 3 107 557 17,9% 120 3,9% 69 2,2% 88 2,8% 118 3,8% 1 629 52,4% 717 23,1% 366 11,8% 338 10,9%<br />
Eimsbüttel - Fettstraße 2 340 640 27,4% 119 5,1% 61 2,6% 71 3,0% 110 4,7% 1 244 53,2% 548 23,4% 187 8,0% 300 12,8%<br />
Eimsbüttel - Agathenstraße 2 142 502 23,4% 111 5,2% 79 3,7% 86 4,0% 84 3,9% 1 154 53,9% 481 22,5% 147 6,9% 320 14,9%<br />
Sternschanze 316 48 15,2% 15 4,7% 8 2,5% 17 5,4% 8 2,5% 135 42,7% 30 9,5% 103 32,6% 45 14,2%<br />
Schanzenviertel 21 563 5 280 24,5% 1 122 5,2% 613 2,8% 702 3,3% 824 3,8% 11 588 53,7% 4 542 21,1% 2 172 10,1% 2 828 13,1%<br />
Karolinenviertel 3 797 1 331 35,1% 220 5,8% 115 3,0% 127 3,3% 187 4,9% 2 038 53,7% 820 21,6% 290 7,6% 542 14,3%<br />
Bezirk Hamburg-Mitte 228 117 57 674 25,3% 12 105 5,3% 7 494 3,3% 9 672 4,2% 13 346 5,9% 95 175 41,7% 55 187 24,2% 35 138 15,4% 35 525 15,6%<br />
Bezirk Eimsbüttel 244 007 33 471 13,7% 11 780 4,8% 7 554 3,1% 9 380 3,8% 11 598 4,8% 96 691 39,6% 65 069 26,7% 41 935 17,2% 34 238 14,0%<br />
Bezirk Altona 241 992 39 797 16,4% 13 865 5,7% 8 668 3,6% 10 878 4,5% 13 220 5,5% 92 407 38,2% 60 367 24,9% 42 587 17,6% 39 871 16,5%<br />
Hamburg insgesamt 1 714 923 262 532 15,3% 91 568 5,3% 59 532 3,5% 76 308 4,4% 97 308 5,7% 651 244 38,0% 433 566 25,3% 305 397 17,8% 274 376 16,0%<br />
1 Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein, Stand: 29.06.2004<br />
Melderegister 31.12.2003
ANLAGE 5<br />
Tabelle 3a<br />
Deutsche und nichtdeutsche Bevölkerung nach Altersstruktur – Region III Eimsbüttel 1<br />
ins-<br />
gesamt 0 bis unter 6 6-bis unter 14 14 bis unter 18 18 bis unter 45 45 bis unter 65 65+<br />
Region<br />
davon:<br />
gesamt<br />
N % N % N % N % N % N % N %<br />
deutsch 1.504 88,5% 111 94,9% 134 86,5% 58 81,7% 468 84,6% 472 91,3% 261 90,9%<br />
Eidelstedt – Wildacker 1.700<br />
nichtdeutsch 196 11,5% 6 5,1% 21 13,5% 13 18,3% 85 15,4% 45 8,7% 26 9,1%<br />
Eidelstedt –<br />
deutsch 2.621 80,9% 151 84,8% 168 76,4% 74 74,0% 879 71,2% 727 85,7% 622 94,2%<br />
3.240<br />
Hörgensweg<br />
nichtdeutsch 619 19,1% 27 15,2% 52 23,6% 26 26,0% 355 28,8% 121 14,3% 38 5,8%<br />
Eidelstedt –<br />
deutsch 1.904 82,8% 98 84,5% 143 79,0% 88 83,8% 606 75,8% 505 84,2% 464 93,2%<br />
Remstückenkamp/<br />
2.299<br />
nichtdeutsch 395 17,2% 18 15,5% 38 21,0% 17 16,2% 193 24,2% 95 15,8% 34 6,8%<br />
Wiebischenkamp<br />
deutsch 2.263 88,7% 160 89,4% 220 85,3% 106 86,9% 745 83,1% 592 92,4% 440 96,7%<br />
Eidelstedt – Astweg 2.551<br />
nichtdeutsch 288 11,3% 19 10,6% 38 14,7% 16 13,1% 151 16,9% 49 7,6% 15 3,3%<br />
deutsch 26.045 86,9% 1.346 88,3% 1.899 84,1% 1.024 85,0% 8.705 81,3% 7.137 88,5% 5.934 95,4%<br />
Eidelstedt 29.979 nichtdeutsch 3.934 13,1% 178 11,7% 358 15,9% 180 15,0% 2.001 18,7% 931 11,5% 286 4,6%<br />
Stellingen –<br />
deutsch 1.491 84,0% 83 83,8% 113 82,5% 58 80,6% 503 79,1% 393 83,3% 341 94,7%<br />
1.776<br />
Wegenkamp<br />
nichtdeutsch 285 16,0% 16 16,2% 24 17,5% 14 19,4% 133 20,9% 79 16,7% 19 5,3%<br />
deutsch 2.518 86,8% 99 85,3% 131 79,9% 89 84,0% 779 79,4% 759 88,7% 661 97,6%<br />
Stellingen – Linse 2.900<br />
nichtdeutsch 382 13,2% 17 14,7% 33 20,1% 17 16,0% 202 20,6% 97 11,3% 16 2,4%<br />
deutsch 1.241 89,2% 52 89,7% 96 86,5% 34 91,9% 406 79,8% 313 94,6% 340 98,6%<br />
1.391<br />
nichtdeutsch 150 10,8% 6 10,3% 15 13,5% 3 8,1% 103 20,2% 18 5,4% 5 1,4%<br />
Stellingen –<br />
Spannskamp<br />
deutsch 18.529 84,7% 793 85,1% 938 77,7% 516 80,4% 7.136 79,8% 4.890 85,6% 4.256 95,9%<br />
Stellingen 21.871 nichtdeutsch 3.342 15,3% 139 14,9% 269 22,3% 126 19,6% 1.805 20,2% 820 14,4% 183 4,1%<br />
deutsch 44.574 86,0% 2.139 87,1% 2.837 81,9% 1.540 83,4% 15.841 80,6% 12.027 87,3% 10.190 95,6%<br />
Region III 51.850 nichtdeutsch 7.276 14,0% 317 12,9% 627 18,1% 306 16,6% 3.806 19,4% 1.751 12,7% 469 4,4%<br />
deutsch 210.536 86,3% 10.732 91,1% 12.994 86,5% 6.313 85,0% 85.284 83,0% 55.885 85,9% 39.328 93,8%<br />
Bezirk Eimsbüttel 244.007 nichtdeutsch 33.471 13,7% 1.048 8,9% 2.036 13,5% 1.115 15,0% 17.481 17,0% 9.184 14,1% 2.607 6,2%<br />
deutsch 1.452.391 84,7% 80.754 88,2% 99.270 82,4% 51.320 82,3% 563.137 80,3% 370.074 85,4% 287.836 94,2%<br />
Hamburg 1.714.923 nichtdeutsch 262.532 15,3% 10.814 11,8% 21.204 17,6% 11.014 17,7% 138.447 19,7% 63.492 14,6% 17.561 5,8%<br />
1 Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein, Stand: 29.06.2004<br />
Melderegister 31.12.2003
ANLAGE 5<br />
Tabelle 3b<br />
Deutsche und nichtdeutsche Bevölkerung nach Altersstruktur – Schanzenviertel / Karolinenviertel 1<br />
ins-<br />
gesamt 0 bis unter 6 6-bis unter 14 14 bis unter 18 18 bis unter 45 45 bis unter 65 65+<br />
Region<br />
davon:<br />
gesamt<br />
N % N % N % N % N % N % N %<br />
deutsch 2.444 73,2% 148 89,7% 120 69,8% 28 45,2% 1.493 76,8% 415 60,9% 240 76,7%<br />
St. Pauli – Schulterblatt 3.337<br />
nichtdeutsch 893 26,8% 17 10,3% 52 30,2% 34 54,8% 450 23,2% 267 39,1% 73 23,3%<br />
deutsch 1.466 68,7% 154 87,0% 80 65,6% 27 39,7% 925 73,2% 210 53,0% 70 64,8%<br />
St. Pauli – Schanzenstraße 2.134<br />
nichtdeutsch 668 31,3% 23 13,0% 42 34,4% 41 60,3% 338 26,8% 186 47,0% 38 35,2%<br />
deutsch 126 36,1% 12 70,6% 11 36,7% 4 44,4% 61 37,0% 32 29,1% 6 33,3%<br />
St. Pauli – Lagerstraße 349<br />
nichtdeutsch 223 63,9% 5 29,4% 19 63,3% 5 55,6% 104 63,0% 78 70,9% 12 66,7%<br />
deutsch 2.403 79,3% 135 90,6% 120 74,1% 44 71,0% 1.249 79,2% 433 70,6% 422 90,2%<br />
Altona-Altstadt 3.031<br />
nichtdeutsch 628 20,7% 14 9,4% 42 25,9% 18 29,0% 328 20,8% 180 29,4% 46 9,8%<br />
deutsch 1.703 72,5% 111 71,6% 99 54,1% 31 52,5% 995 74,9% 290 70,4% 177 84,3%<br />
Altona-Nord 2.348<br />
nichtdeutsch 645 27,5% 44 28,4% 84 45,9% 28 47,5% 334 25,1% 122 29,6% 33 15,7%<br />
deutsch 1.983 80,6% 88 93,6% 65 75,6% 36 67,9% 1.170 82,3% 414 74,9% 210 83,3%<br />
Eimsbüttel – Doormannsweg 2.459<br />
nichtdeutsch 476 19,4% 6 5,3% 21 24,4% 17 32,1% 251 17,7% 139 25,1% 42 16,7%<br />
deutsch 2.550 82,1% 108 94,7% 113 81,3% 65 82,3% 1.390 82,4% 553 77,1% 321 87,7%<br />
Eimsbüttel – Waterloostraße 3.107<br />
nichtdeutsch 557 17,9% 12 10,4% 26 18,7% 14 17,7% 296 17,6% 164 22,9% 45 12,3%<br />
deutsch 1.700 72,6% 103 89,6% 77 63,6% 32 53,3% 996 76,3% 354 64,6% 138 73,8%<br />
Eimsbüttel – Fettstraße 2.340<br />
nichtdeutsch 640 27,4% 16 13,9% 44 36,4% 28 46,7% 309 23,7% 194 35,4% 49 26,2%<br />
deutsch 1.640 76,6% 99 86,1% 108 72,5% 43 71,7% 955 80,0% 323 67,2% 112 76,2%<br />
Eimsbüttel – Agathenstraße 2.142<br />
nichtdeutsch 502 23,4% 12 48,0% 41 27,5% 17 28,3% 239 20,0% 158 32,8% 35 23,8%<br />
deutsch 268 84,8% 13 52,0% 16 69,6% 5 71,4% 113 81,9% 22 73,3% 99 96,1%<br />
Sternschanze 316<br />
nichtdeutsch 48 15,2% 2 0,2% 7 30,4% 2 28,6% 25 18,1% 8 26,7% 4 3,9%<br />
deutsch 16.283 75,5% 971 99,8% 809 68,2% 315 60,7% 9.347 77,8% 3.046 67,1% 1.795 82,6%<br />
Schanzenviertel 21.563<br />
nichtdeutsch 5.280 24,5% 151 45,8% 378 31,8% 204 39,3% 2.674 22,2% 1.496 32,9% 377 17,4%<br />
deutsch 2.466 64,9% 179 81,4% 114 52,8% 56 52,8% 1.521 70,9% 418 51,0% 178 61,4%<br />
Karolinenviertel 3.797<br />
nichtdeutsch 1.331 35,1% 41 18,6% 102 47,2% 50 47,2% 624 29,1% 402 49,0% 112 38,6%<br />
deutsch 170.392 75,1% 9.712 80,3% 10.488 69,2% 5.871 71,0% 72.588 71,6% 40.476 73,8% 31.257 89,0%<br />
Bezirk Mitte 226.837<br />
nichtdeutsch 56.445 24,9% 2.388 19,7% 4.659 30,8% 2.398 29,0% 28.782 28,4% 14.342 26,2% 3.876 11,0%<br />
deutsch 210.536 86,3% 10.732 91,1% 12.994 86,5% 6.313 85,0% 85.284 83,0% 55.885 85,9% 39.328 93,8%<br />
Bezirk Eimsbüttel 244.007<br />
nichtdeutsch 33.471 13,7% 1.048 8,9% 2.036 13,5% 1.115 15,0% 17.481 17,0% 9.184 14,1% 2.607 6,2%<br />
deutsch 202.195 83,6% 12.311 88,8% 14.078 80,7% 6.854 80,0% 78.359 79,0% 50.606 83,8% 39.987 93,9%<br />
Bezirk Altona 241.992<br />
nichtdeutsch 39.797 16,4% 1.554 11,2% 3.360 19,3% 1.714 20,0% 20.808 21,0% 9.761 16,2% 2.600 6,1%<br />
deutsch 1.452.391 84,7% 80.754 88,2% 99.270 82,4% 51.320 82,3% 563.137 80,3% 370.074 85,4% 287.836 94,2%<br />
Hamburg 1.714.923<br />
nichtdeutsch 262.532 15,3% 10.814 11,8% 21.204 17,6% 11.014 17,7% 138.447 19,7% 63.492 14,6% 17.561 5,8%<br />
1 Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein, Stand: 29.06.2004<br />
Melderegister 31.12.2003
ANLAGE 5<br />
Tabelle 4<br />
Haushaltsstruktur 1999 in "armen" und "reichen" Stadtteilen 1<br />
Stadtgebiet<br />
STADTGEBIET<br />
Haushalte<br />
Personen<br />
je<br />
Haushalt<br />
Ein-Personen-<br />
Haushalte<br />
Haushalte mit<br />
Kindern<br />
N N N % N %<br />
Jenfeld 11 402 2,2 4 431 38,9 3 124 27,4<br />
Billbrook 741 2,5 318 42,9 233 31,4<br />
Kleiner Grasbrook mit Steinwerder 729 2,0 353 48,4 152 20,9<br />
Hausbruch 6 896 2,4 2 052 29,8 2 233 32,4<br />
Billstedt 32 336 2,1 12 609 39,0 8 319 25,7<br />
Veddel 2 106 2,2 862 40,9 642 30,5<br />
Wilhelmsburg 21 345 2,2 8 527 39,9 5 727 26,8<br />
St. Pauli 17 268 1,6 10 944 63,4 2 336 13,5<br />
Dulsberg 10 786 1,6 6 574 60,9 1 553 14,4<br />
Rothenburgsort 4 324 1,9 2 088 48,3 891 20,6<br />
Steilshoop 9 106 2,1 3 317 36,4 2 365 26,0<br />
Allermöhe 4 243 2,7 732 17,3 1 997 47,1<br />
Wohldorf-Ohlstedt 1 753 2,3 526 30,0 459 26,2<br />
Reitbrook 226 2,3 70 31,0 43 19,0<br />
Groß Flottbek 5 606 1,9 2 507 44,7 1 085 19,4<br />
Nienstedten 3 044 2,1 1 237 40,6 639 21,0<br />
Othmarschen 5 672 1,9 2 595 45,8 1 008 17,8<br />
Sasel 9 795 2,2 3 167 32,3 2 350 24,0<br />
Wellingsbüttel 4 724 2,0 1 828 38,7 846 17,9<br />
Neuengamme 1 460 2,3 413 28,3 388 26,6<br />
Bergstedt 3 927 2,2 1 310 33,4 947 24,1<br />
Blankenese 6 990 1,9 3 289 47,1 1 167 16,7<br />
Ochsenwerder 979 2,4 267 27,3 266 27,2<br />
Altengamme 854 2,5 182 21,3 256 30,0<br />
Bezirk Eimsbüttel 140 694 1,7 72 402 51,5 22 847 16,2<br />
Bezirk Hamburg-Nord 170 049 1,6 97 516 57,3 23 159 13,6<br />
Bezirk Wandsbek 200 560 2,0 83 354 41,6 42 450 21,2<br />
Bezirk Altona 126 223 1,9 60 534 48,0 24 310 19,3<br />
Bezirk Bergedorf 51 752 2,2 17 897 34,6 13 900 26,9<br />
Bezirk Harburg 94 273 2,1 37 733 40,0 22 496 23,9<br />
Bezirk Hamburg-Mitte 126 753 1,8 66 446 52,4 22 670 17,9<br />
Hamburg gesamt 910 304 1,9 435 882 47,9 171 832 18,9<br />
1 Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein, Stand: 29.06.2004<br />
Statistische Auswertung des Melderegisters, Haushaltsgenerierung vom 31.12.1999
ANLAGE 5<br />
Tabelle 4.1<br />
Familien mit Kindern nach Familienstatus 31.12.1999 in "armen" und "reichen" Stadtteilen 1<br />
Familien mit Kindern<br />
Ehepaare<br />
Alleinerziehende<br />
Nichteheliche<br />
Region<br />
insgesamt<br />
mit Kindern<br />
mit Kindern<br />
Lebensgemeinschaften mit Kindern<br />
N % N % N %<br />
Jenfeld 3 124 2 129 68,1% 849 27,2% 146 4,7%<br />
Billbrook 233 144 61,8% 58 24,9% 31 13,3%<br />
Kleiner Grasbrook mit Steinwerder 152 108 71,1% 34 22,4% 10 6,6%<br />
Hausbruch 2 233 1 727 77,3% 411 18,4% 95 4,3%<br />
Billstedt 8 319 5 633 67,7% 2 242 27,0% 444 5,3%<br />
Veddel 642 484 75,4% 136 21,2% 22 3,4%<br />
Wilhelmsburg 5 727 4 063 70,9% 1 369 23,9% 295 5,2%<br />
St. Pauli 2 336 1 266 54,2% 848 36,3% 222 9,5%<br />
Dulsberg 1 553 861 55,4% 580 37,3% 112 7,2%<br />
Rothenburgsort 891 573 64,3% 263 29,5% 55 6,2%<br />
Steilshoop 2 365 1 574 66,6% 654 27,7% 137 5,8%<br />
Allermöhe 1 997 1 545 77,4% 337 16,9% 115 5,8%<br />
Wohldorf-Ohlstedt 459 361 78,6% 85 18,5% 13 2,8%<br />
Reitbrook 43 36 83,7% 5 11,6% 2 4,7%<br />
Groß Flottbek 1 085 831 76,6% 216 19,9% 38 3,5%<br />
Nienstedten 639 483 75,6% 128 20,0% 28 4,4%<br />
Othmarschen 1 008 762 75,6% 202 20,0% 44 4,4%<br />
Sasel 2 350 1 940 82,6% 354 15,1% 56 2,4%<br />
Wellingsbüttel 846 678 80,1% 137 16,2% 31 3,7%<br />
Neuengamme 388 300 77,3% 76 19,6% 12 3,1%<br />
Bergstedt 947 731 77,2% 181 19,1% 35 3,7%<br />
Blankenese 1 167 905 77,5% 211 18,1% 51 4,4%<br />
Ochsenwerder 266 219 82,3% 41 15,4% 6 2,3%<br />
Altengamme 256 209 81,6% 40 15,6% 7 2,7%<br />
Bezirk Eimsbüttel 22 847 14 918 65,3% 6 473 28,3% 1 456 6,4%<br />
Bezirk Hamburg-Nord 23 159 14 267 61,6% 7 247 31,3% 1 645 7,1%<br />
Bezirk Wandsbek 42 450 29 960 70,6% 10 401 24,5% 2 089 4,9%<br />
Bezirk Altona 24 310 16 088 66,2% 6 790 27,9% 1 432 5,9%<br />
Bezirk Bergedorf 13 900 10 244 73,7% 2 961 21,3% 695 5,0%<br />
Bezirk Harburg 22 496 16 261 72,3% 5 105 22,7% 1 130 5,0%<br />
Bezirk Hamburg-Mitte 22 670 14 434 63,7% 6 769 29,9% 1 467 6,5%<br />
Hamburg gesamtgesamt 171 832 116 172 67,6% 45 746 26,6% 9 914 5,8%<br />
1 Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein, Stand: 29.06.2004: Statistische Auswertung des Melderegisters, Haushaltsgenerierung vom 31.12.1999
ANLAGE 5<br />
Tabelle 4.1a<br />
Familien mit Kindern nach Familienstatus, 31.12.1999 – Region III Eimsbüttel 1<br />
Nichteheliche<br />
Lebensgemeinschaften<br />
mit Kindern<br />
Alleinerziehende<br />
mit Kindern<br />
Ehepaare<br />
mit Kindern<br />
Familien mit<br />
Kindern<br />
insgesamt<br />
Region<br />
N % N % N %<br />
Eidelstedt – Wildacker 217 135 62,2% 71 32,7% 11 5,1%<br />
Eidelstedt – Hörgensweg 327 213 65,1% 95 29,1% 19 5,8%<br />
300 189 63,0% 100 33,3% 11 3,7%<br />
Eidelstedt – Remstückenkamp/<br />
Wiebischenkamp<br />
Eidelstedt – Astweg 313 223 71,2% 75 24,0% 15 4,8%<br />
Eidelstedt 3.173 2.212 69,7% 819 25,8% 142 4,5%<br />
Stellingen – Wegenkamp 201 120 59,7% 75 37,3% 6 3,0%<br />
Stellingen – Linse 283 178 62,9% 85 30,0% 20 7,1%<br />
Stellingen – Spannskamp 133 94 70,7% 32 24,1% 7 5,3%<br />
Stellingen 1.837 1.172 63,8% 544 29,6% 121 6,6%<br />
Region III 5.010 3.384 67,5% 1.363 27,2% 263 5,2%<br />
Bezirk Eimsbüttel 22.847 14.918 65,3% 6.473 28,3% 1.456 6,4%<br />
Hamburg 171.832 116.172 67,6% 45.746 26,6% 9.914 5,8%<br />
1<br />
Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein, Stand: 29.06.2004<br />
Statistische Auswertung des Melderegisters, Haushaltsgenerierung vom 31.12.1999
ANLAGE 5<br />
Tabelle 4.1b<br />
Familien mit Kindern nach Familienstatus, 31.12.1991 – Schanzenviertel, Karolinenviertel 1<br />
Nichteheliche<br />
Lebensgemeinschaften<br />
mit Kindern<br />
Alleinerziehende<br />
mit Kindern<br />
Ehepaare<br />
mit Kindern<br />
Familien mit<br />
Kindern<br />
insgesamt<br />
Region<br />
N % N % N %<br />
Schulterblatt 321 159 49,5% 125 38,9% 37 11,5%<br />
Schanzenstraße 133 68 51,1% 54 40,6% 11 8,3%<br />
Lagerstraße 31 24 77,4% 6 19,4% 1 3,2%<br />
Eifflerstraße 288 134 46,5% 128 44,4% 26 9,0%<br />
Langefelder Straße 248 146 58,9% 80 32,3% 22 8,9%<br />
Doormannsweg 204 91 44,6% 88 43,1% 25 12,3%<br />
Waterloostraße 252 104 41,3% 122 48,4% 26 10,3%<br />
Fettstraße 212 118 55,7% 79 37,3% 15 7,1%<br />
Agathenstraße 225 117 52,0% 83 36,9% 25 11,1%<br />
Sternschanze 15 9 60,0% 3 20,0% 3 20,0%<br />
Schanzenviertel 1929 970 50,3% 768 39,8% 191 9,9%<br />
Karolinenviertel 405 209 51,6% 159 39,3% 37 9,1%<br />
Bezirk Mitte 22670 14.434 63,7% 6.769 29,9% 1.467 6,5%<br />
Bezirk Eimsbüttel 22847 14.918 65,3% 6.473 28,3% 1.456 6,4%<br />
Bezirk Altona 24310 16.088 66,2% 6.790 27,9% 1.432 5,9%<br />
Hamburg 171832 116.172 67,6% 45.746 26,6% 9.914 5,8%<br />
1 Haushaltsgenerierung des Melderegisters
ANLAGE 5<br />
Tabelle 5<br />
Sozialstruktur in "armen und "reichen" Stadtteilen 1<br />
Bevölkerung Anteil der Arbeitslosen<br />
Leistungs-empfänger/ innen<br />
im Alter von<br />
nach BSHG und AsylblG<br />
Bevölkerung<br />
15-65 Jahre<br />
insgesamt<br />
insgesamt<br />
März 2004<br />
4)<br />
Anteil der Arbeitslosen<br />
4) Bevölkerung Anteil der jüngeren Arbeitslosen<br />
an der Bevölkerung im an der Bevölkerung<br />
im Alter von<br />
unter 25 Jahre<br />
Alter 15 bis unter 65 im Alter 15 bis unter 65<br />
Stadtgebiet<br />
15-25 Jahre an der Bevölkerung 15-25 Jahre<br />
Jahren<br />
Jahren<br />
. 3.Quart. 2002 31.12.2003 März 2004 März 2004 31.12.2003 März 2004<br />
N N % N N % N N %<br />
Jenfeld 25 212 5 086 20,2 16 747 1 675 10,0 3 521 147 4,2<br />
Billbrook 1 783 1 423 79,8 1 209 72 6,0 325 5 1,5<br />
Kleiner Grasbrook mit Steinwerder 1 445 288 19,9 1 111 163 15,4 220 13 6,1<br />
Hausbruch 17 371 2 791 16,1 11 246 1 142 10,2 2 323 109 4,7<br />
Billstedt 68 512 11 553 16,9 46 403 4 488 9,7 8 818 418 4,7<br />
Veddel 4 708 746 15,8 3 320 419 12,6 718 47 6,5<br />
Wilhelmsburg 47 847 7 262 15,2 32 010 3 589 11,2 6 275 377 6,0<br />
St. Pauli 26 923 3 622 13,5 21 787 2 211 10,1 2 852 138 4,8<br />
Dulsberg 17 179 2 511 14,6 12 646 1 471 11,6 2 461 144 5,9<br />
Rothenburgsort 8 092 1 028 12,7 5 511 629 11,4 1 086 43 4,0<br />
Steilshoop 19 516 2 500 12,8 13 582 1 183 8,7 2 576 152 5,9<br />
Allermöhe 14 264 1 834 12,9 9 991 776 7,8 2 065 85 4,1<br />
Wohldorf-Ohlstedt 4 241 23 0,5 2 712 61 2,2 417 3 0,7<br />
Reitbrook 501 X X 337 14 4,2 41 X X<br />
Groß Flottbek 10 905 86 0,8 7 256 190 2,6 1 019 6 0,6<br />
Nienstedten 6 502 46 0,7 4 171 98 2,3 531 6 1,1<br />
Othmarschen 11 473 123 1,1 7 412 219 3,0 938 14 1,5<br />
Sasel 22 016 226 1,0 14 105 419 3,0 2 054 32 1,6<br />
Wellingsbüttel 9 493 119 1,3 6 042 180 3,0 759 7 0,9<br />
Neuengamme 3 418 45 1,3 2 250 76 3,4 315 12 3,8<br />
Bergstedt 9 035 121 1,3 5 766 189 3,3 874 13 1,5<br />
Blankenese 13 152 419 3,2 8 554 260 3,0 1 125 17 1,5<br />
Ochsenwerder 2 288 40 1,7 1 482 41 2,8 191 7 3,7<br />
Altengamme 2 140 27 1,3 1 386 50 3,6 233 3 1,3<br />
Bezirk Eimsbüttel 244 007 14 524 6,0 173 358 11 091 6,4 23 278 788 3,4<br />
Bezirk Hamburg-Nord 276 354 18 653 6,7 199 511 13 762 6,9 28 610 1 054 3,7<br />
Bezirk Wandsbek 407 350 30 464 7,5 267 939 16 746 6,2 43 216 1 639 3,8<br />
Bezirk Altona 241 992 18 956 7,8 165 994 11 813 7,1 24 647 1 061 4,3<br />
Bezirk Bergedorf 117 388 10 176 8,7 78 590 5 087 6,5 14 166 553 3,9<br />
Bezirk Harburg 199 715 21 775 10,9 133 018 12 161 9,1 25 096 1 215 4,8<br />
Bezirk Hamburg-Mitte 228 117 30 152 13,2 163 708 15 185 9,3 28 580 1 349 4,7<br />
Hamburg gesamt 1 714 923 144 700 8,4 1 182 118 86 397 7,3 187 593 7 705 4,1<br />
1<br />
Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein, Stand: 29.06.2004<br />
Sonderauswertung PROSA 3. Quartal 2002: <strong>Die</strong> Daten für die Leistungsempfänger nach dem Bundessozialhilfegesetz (BSHG) und dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) stammen aus dem Projekt Sozialhilfeautomation (PROSA) des<br />
Senatsamtes für Bezirksangelegenheiten. Im Unterschied zur amtlichen Sozialhilfestatistik, die eine Stichtagszählung ist, sind in diesen Daten alle Personen enthalten, die innerhalb eines Quartals Leistungen nach dem BSHG und AsylbLG<br />
empfangen haben
ANLAGE 5<br />
Tabelle 5a<br />
Sozialstruktur<br />
Region III Eimsbüttel 1<br />
Anteil der<br />
Bevölkerung Arbeitslosen<br />
Leistungs-empfänger/<br />
Bevölkerung<br />
im Alter von<br />
innen nach BSHG und<br />
insgesamt<br />
15-65 Jahre<br />
AsylblG insgesamt<br />
März 2004<br />
4)<br />
Anteil der<br />
Arbeitslosen<br />
an der<br />
Bevölkerung im<br />
Alter 15 bis<br />
unter 65 Jahren<br />
4)<br />
Anteil der jüngeren<br />
Bevölkerung Arbeitslosen<br />
an der<br />
im Alter von unter 25 Jahre<br />
Bevölkerung im<br />
15-25 Jahre an der Bevölkerung 15-25<br />
Alter 15 bis unter<br />
Jahre<br />
65 Jahren<br />
. 3.Quart. 2002 31.12.2003 März 2004 März 2004 31.12.2003 März 2004<br />
N N % N N % N N %<br />
Stadtgebiet<br />
Eidelstedt - Wildacker 1 700 324 19,1 1 117 127 11,4 170 4 2,4<br />
Eidelstedt - Hörgensweg 3 240 380 11,7 2 148 242 11,3 354 22 6,2<br />
Eidelstedt - Reemstückenkamp/ Wiebischenkamp 2 299 326 14,2 1 479 189 12,8 261 21 8,0<br />
Eidelstedt - Astweg 2 551 322 12,6 1 626 115 7,1 294 17 5,8<br />
Eidelstedt 29 979 2 805 9,4 19 650 1 619 8,2 3 181 166 5,2<br />
Stellingen - Wegenkamp 1 776 287 16,2 1 161 117 10,1 203 5 2,5<br />
Stellingen - Linse 2 900 309 10,7 1 921 177 9,2 289 14 4,8<br />
Stellingen - Spannskamp 1 391 90 6,5 866 57 6,6 159 4 2,5<br />
Stellingen 21 871 1 999 9,1 15 144 1 269 8,4 2 313 89 3,8<br />
Region III 51 850 4 804 9,3 34 794 2 888 8,3 5 494 255 4,6<br />
Bezirk Eimsbüttel 244 007 14 524 6,0 173 358 11 091 6,4 23 278 788 3,4<br />
Hamburg insgesamt 1 714 923 144 700 8,4 1 182 118 86 397 7,3 187 593 7 705 4,1<br />
1<br />
Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein, Stand: 29.06.2004<br />
Sonderauswertung PROSA 3. Quartal 2002: <strong>Die</strong> Daten für die Leistungsempfänger nach dem Bundessozialhilfegesetz (BSHG) und dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) stammen aus dem Projekt<br />
Sozialhilfeautomation (PROSA) des Senatsamtes für Bezirksangelegenheiten. Im Unterschied zur amtlichen Sozialhilfestatistik, die eine Stichtagszählung ist, sind in diesen Daten alle Personen enthalten, die<br />
innerhalb eines Quartals Leistungen nach dem BSHG und AsylbLG empfangen haben
ANLAGE 5<br />
Tabelle 5b<br />
Sozialstruktur<br />
Schanzenviertel / Karolinenviertel 1<br />
Anteil der<br />
Leistungs- Bevölkerung Arbeitslosen<br />
empfänger/ innen im Alter von<br />
nach BSHG und 15-65 Jahre<br />
Bevölkerung AsylblG insgesamt März 2004<br />
insgesamt<br />
4)<br />
Anteil der<br />
Arbeitslosen<br />
an der<br />
Bevölkerung im<br />
Alter 15 bis<br />
unter 65 Jahren<br />
4)<br />
Anteil der jüngeren<br />
Bevölkerung Arbeitslosen<br />
an der<br />
im Alter von unter 25 Jahre<br />
Bevölkerung im<br />
15-25 Jahre an der Bevölkerung 15-25<br />
Alter 15 bis<br />
Jahre<br />
unter 65 Jahren<br />
. 3.Quart. 2002 31.12.2003 März 2004 März 2004 31.12.2003 März 2004<br />
N N % N N % N N %<br />
Stadtgebiet<br />
St. Pauli - Schulterblatt 3 337 262 7,9 2 670 241 9,0 315 17 5,4<br />
St. Pauli - Schanzenstraße 2 134 239 11,2 1 712 155 9,1 230 11 4,8<br />
St. Pauli - Lagerstraße 349 51 14,6 280 29 10,4 32 X X<br />
Altona - Altstadt 3 031 241 8,0 2 240 187 8,3 274 11 4,0<br />
Altona - Nord 2 348 330 14,1 1 782 159 8,9 219 6 2,7<br />
Eimsbüttel - Doormannsweg 2 459 169 6,9 2 012 168 8,3 236 11 4,7<br />
Eimsbüttel - Waterloostraße 3 107 230 7,4 2 464 219 8,9 280 4 1,4<br />
Eimsbüttel - Fettstraße 2 340 190 8,1 1 902 190 10,0 228 8 3,5<br />
Eimsbüttel - Agathenstraße 2 142 170 7,9 1 719 130 7,6 210 7 3,3<br />
Sternschanze 316 20 6,3 173 X x 25 X X<br />
Schanzenviertel 21 563 1 902 8,8 16 954 1 478 8,9 2 049 75 3,7<br />
Karolinenviertel 3 797 487 12,8 3 045 308 10,1 422 22 5,2<br />
Bezirk Hamburg-Mitte a 228 117 30 152 13,2 163 708 15 185 9,3 28 580 1 349 4,7<br />
c<br />
Bezirk Eimsbüttel b 244 007 14 524 6,0 173 358 11 091 6,4 23 278 788 3,4<br />
Bezirk Altona h 241 992 18 956 7,8 165 994 11 813 7,1 24 647 1 061 4,3<br />
Hamburg insgesamt 1 714 923 144 700 8,4 1 182 118 86 397 7,3 187 593 7 705 4,1<br />
1<br />
Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein, Stand: 29.06.2004<br />
Sonderauswertung PROSA 3. Quartal 2002: <strong>Die</strong> Daten für die Leistungsempfänger nach dem Bundessozialhilfegesetz (BSHG) und dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) stammen aus dem Projekt<br />
Sozialhilfeautomation (PROSA) des Senatsamtes für Bezirksangelegenheiten. Im Unterschied zur amtlichen Sozialhilfestatistik, die eine Stichtagszählung ist, sind in diesen Daten alle Personen enthalten, die<br />
innerhalb eines Quartals Leistungen nach dem BSHG und AsylbLG empfangen haben
ANLAGE 5<br />
Tabelle 6<br />
Wohnsituation in "armen" und "reichen" Stadtteilen, 2002<br />
Stadtteil/ Bezirk EinwohnerInnen<br />
je ha<br />
Wohnungen in Wohn- und Wohnnebengebäuden<br />
insgesamt<br />
davon in Ein- und<br />
Zweifamilienhäusern<br />
in %<br />
Durchschnittliche<br />
Wohnungsgröße<br />
in m²<br />
Wohnfläche<br />
je Einwohner<br />
in m²<br />
Jenfeld 57 10.599 19,4 70,5 28,9<br />
Billbrook 4 579 36,8 59,8 17,0<br />
Kleiner Grasbrook mit Steinwerder 5 680 2,8 53,4 25,7<br />
Hausbruch 19 7.337 32,6 77,3 32,7<br />
Billstedt 48 30.169 19,0 69,1 30,4<br />
Veddel 17 2.017 2,0 61,0 26,8<br />
Wilhelmsburg 17 20.388 14,7 67,0 28,5<br />
St. Pauli 151 13.350 2,6 62,4 31,1<br />
Dulsberg 192 10.577 0,6 52,2 31,9<br />
Rothenburgsort 17 4.316 5,9 59,2 31,7<br />
Steilshoop 94 8.613 4,1 72,7 32,3<br />
Allermöhe 13 4.205 36,4 86,3 26,1<br />
Wohldorf-Ohlstedt 3 1.923 74,9 119,7 54,4<br />
Reitbrook 1 192 78,6 111,5 42,6<br />
Groß Flottbek 56 5.175 41,9 95,5 44,7<br />
Nienstedten 21 3.286 48,6 104,5 53,4<br />
Othmarschen 27 5.896 39,2 101,6 52,2<br />
Sasel 29 9.739 68,8 98,9 43,8<br />
Wellingsbüttel 27 4.606 56,0 105,6 51,6<br />
Neuengamme 2 1.376 76,9 98,3 39,4<br />
Bergstedt 14 3.878 56,8 93,2 40,0<br />
Blankenese 24 6.768 47,2 101,2 51,8<br />
Ochsenwerder 2 927 74,4 101,3 41,0<br />
Altengamme 1 849 79,2 99,5 39,6<br />
Bezirk Eimsbüttel 58 128.941 16,2 71,7 37,9<br />
Bezirk Hamburg-Nord 58 163.751 9,9 64,8 38,4<br />
Bezirk Wandsbek 31 196.208 31,6 77,6 37,3<br />
Bezirk Altona 38 118.891 23,5 75,4 37,2<br />
Bezirk Bergedorf 8 51.883 33,7 78,3 34,7<br />
Bezirk Harburg 14 91.690 25,4 70,1 32,3<br />
Bezirk Hamburg-Mitte 36 115.282 9,0 62,6 31,7<br />
Hamburg gesamt 27 866.646 20,6 71,2 36,1
ANLAGE 5<br />
Tabelle 7<br />
Versorgung mit Sozialwohnungen<br />
in "armen" und "reichen" Stadtteilen 1<br />
2003 2009 Rückgang bis 2009<br />
Stadtgebiet<br />
N N %<br />
Jenfeld 5 468 4 112 24,8%<br />
Billbrook 39 0 100,0%<br />
Kleiner Grasbrook mit<br />
0 0<br />
Steinwerder<br />
0,0%<br />
Hausbruch 3 211 1 999 37,7%<br />
Billstedt 14 664 11 286 23,0%<br />
Veddel 692 414 40,2%<br />
Wilhelmsburg 7 698 7 135 7,3%<br />
St. Pauli 2 175 2 163 0,6%<br />
Dulsberg 1 037 1 025 1,2%<br />
Rothenburgsort 739 611 17,3%<br />
Steilshoop 6 094 4 606 24,4%<br />
Allermöhe 2 114 2 114 0,0%<br />
Wohldorf-Ohlstedt 6 6 0,0%<br />
Reitbrook 0 0 0,0%<br />
Groß Flottbek 36 36 0,0%<br />
Nienstedten 0 0 0,0%<br />
Othmarschen 61 61 0,0%<br />
Sasel 42 36 14,3%<br />
Wellingsbüttel 0 0 0,0%<br />
Neuengamme 26 20 23,1%<br />
Bergstedt 181 181 0,0%<br />
Blankenese 58 58 0,0%<br />
Ochsenwerder 15 3 80,0%<br />
Altengamme 12 12 0,0%<br />
Bezirk Eimsbüttel 11 944 8 137 31,9%<br />
Bezirk Hamburg-Nord 10 252 8 376 18,3%<br />
Bezirk Wandsbek 36 692 23 862 35,0%<br />
Bezirk Altona 19 718 14 002 29,0%<br />
Bezirk Bergedorf 13 202 9 187 30,4%<br />
Bezirk Harburg 21 567 16 733 22,4%<br />
Bezirk Hamburg-Mitte 27 007 21 177 21,6%<br />
Hamburg gesamt 142 790 103 882 27,2%<br />
1 Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein, Stand: 29.06.2004<br />
Hamburgische Wohnungsbaukreditanstalt
ANLAGE 5<br />
Tabelle 7a<br />
Tabelle 7b<br />
Versorgung mit Sozialwohnungen<br />
Region III Eimsbüttel 1<br />
Stadtgebiet<br />
2003<br />
N<br />
2009<br />
N<br />
Rückgang bis 2009<br />
%<br />
Eidelstedt - Wildacker 633 529 16,4%<br />
Eidelstedt - Hörgensweg 520 337 35,2%<br />
Eidelstedt -<br />
Reemstückenkamp/<br />
Wiebischenkamp 990 318 67,9%<br />
Eidelstedt - Astweg 299 299 0,0%<br />
Eidelstedt 4 159 2 616 37,1%<br />
Stellingen - Wegenkamp 268 0 100,0%<br />
Stellingen - Linse 330 185 43,9%<br />
Stellingen - Spannskamp 81 27 66,7%<br />
Stellingen 1 232 395 67,9%<br />
Region III 5 391 3 011 44,1%<br />
Bezirk Eimsbüttel 11 944 8 137 31,9%<br />
Hamburg 142 790 103 882 27,2%<br />
Versorgung mit Sozialwohnungen<br />
Schanzenviertel / Karolinenviertel 2<br />
Stadtgebiet<br />
2003<br />
N<br />
2009<br />
N<br />
Rückgang bis 2009<br />
%<br />
St. Pauli - Schulterblatt 184 184 0,0%<br />
St. Pauli - Schanzenstraße 187 187 0,0%<br />
St. Pauli - Lagerstraße 10 10 0,0%<br />
Altona - Altstadt 66 66 0,0%<br />
Altona - Nord 137 129 5,8%<br />
Eimsbüttel - Doormannsweg 83 70 15,7%<br />
Eimsbüttel - Waterloostraße 208 192 7,7%<br />
Eimsbüttel - Fettstraße 61 61 0,0%<br />
Eimsbüttel - Agathenstraße 60 60 0,0%<br />
Sternschanze 0 0 0,0%<br />
Schanzenviertel 996 959 3,7 %<br />
Karolinenviertel 95 95 0 %<br />
Bezirk Hamburg-Mitte a 27 007 21 177 21,6%<br />
Bezirk Eimsbüttel c 11 944 8 137 31,9%<br />
Bezirk Altona b 19 718 14 002 29,0%<br />
Hamburg insgesamt h 142 790 103 882 27,2%<br />
1 Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein, Stand: 29.06.2004<br />
Hamburgische Wohnungsbaukreditanstalt
ANLAGE 5<br />
Tabelle 8<br />
Schulabschlüsse, Absolventen an allgemeinbildenden Schulen, 2003/2004<br />
mit<br />
mit<br />
mit<br />
mit Allgemeiner<br />
ohne Hauptschulabschluss<br />
Hauptschulabschluss Realschulabschluss Fachhochschulreife Hochschulreife Zusammen<br />
N % N % N % N % N % N<br />
Stadtgebiet<br />
Jenfeld 42 14,6% 127 44,3% 97 33,8% 2 0,7% 19 6,6% 287<br />
Billbrook - - - - - - - - - - -<br />
Kleiner Grasbrook mit Steinwerder - - - - - - - - - - -<br />
Hausbruch 5 11,6% 12 27,9% 26 60,5% - - - - 43<br />
Billstedt 108 20,0% 215 39,9% 160 29,7% 3 0,6% 53 9,8% 539<br />
Veddel 23 52,3% 21 47,7% - - - - - - 44<br />
Wilhelmsburg 108 19,1% 235 41,6% 161 28,5% 2 0,4% 59 10,4% 565<br />
St. Pauli 12 8,3% 36 24,8% 33 22,8% 8 5,5% 56 38,6% 145<br />
Dulsberg 23 7,5% 36 11,8% 115 37,6% 22 7,2% 110 35,9% 306<br />
Rothenburgsort 8 22,2% 15 41,7% 13 36,1% - - - - 36<br />
Steilshoop 2 3,2% 30 48,4% 17 27,4% 1 1,6% 12 19,4% 62<br />
Allermöhe 27 16,4% 61 37,0% 77 46,7% 0 0,0% 0 0,0% 165<br />
Wohldorf-Ohlstedt - - 2 1,9% 57 53,3% - - 48 44,9% 107<br />
Reitbrook - - - - - - - - - - -<br />
Groß Flottbek - - - - - - - - - - -<br />
Nienstedten 2 20,0% 2 20,0% 6 60,0% - - - - 10<br />
Othmarschen 13 4,1% 20 6,3% 51 16,2% 4 1,3% 227 72,1% 315<br />
Sasel 7 4,5% 25 16,1% 59 38,1% 2 1,3% 62 40,0% 155<br />
Wellingsbüttel 3 2,3% 34 26,4% 36 27,9% 2 1,6% 54 41,9% 129<br />
Neuengamme - - - - - - - - - - -<br />
Bergstedt 18 16,7% 29 26,9% 61 56,5% - - - - 108<br />
Blankenese 8 3,1% 33 12,6% 58 22,1% 4 1,5% 159 60,7% 262<br />
Ochsenwerder - - - - - - - - - - -<br />
Altengamme - - - - - - - - - - -<br />
Bezirk Eimsbüttel 125 6,9% 347 19,2% 455 25,2% 51 2,8% 825 45,8% 1803<br />
Bezirk Hamburg-Nord 219 11,2% 390 20,0% 615 31,5% 57 2,9% 670 34,3% 1951<br />
Bezirk Wandsbek 437 11,6% 931 24,7% 1150 30,6% 64 1,7% 1182 31,4% 3764<br />
Bezirk Altona 287 13,4% 486 22,7% 604 28,2% 31 1,4% 732 34,2% 2140<br />
Bezirk Bergedorf 134 9,7% 397 28,9% 435 31,6% 17 1,2% 393 28,6% 1376<br />
Bezirk Harburg 281 12,8% 728 33,3% 731 33,4% 19 0,9% 429 19,6% 2188<br />
Bezirk Hamburg-Mitte 302 13,2% 651 28,4% 710 31,0% 40 1,7% 588 25,7% 2291<br />
Hamburg 1785 11,3% 3983 25,2% 4761 30,2% 291 1,8% 4965 31,5% 15785
ANLAGE 5<br />
Tabelle 8a<br />
Schulabschlüsse, Absolventen an allgemeinbildenden Schulen 2003/2004<br />
Schanzenviertel/ Karolinenviertel und Region III Eimsbüttel<br />
ohne<br />
mit<br />
mit<br />
mit Fach- mit Allgemeiner<br />
Hauptschulabschluss Hauptschulabschluss Realschulabschluss hochschulreife Hochschulreife Zusammen<br />
N % N % N % N % N % N<br />
Stadtgebiet<br />
St. Pauli 12 8,3% 36 24,8% 33 22,8% 8 5,5% 56 38,6% 145<br />
Altona-Altstadt 88 39,1% 91 40,4% 46 20,4% 0 0,0% 0 0,0% 225<br />
Altona-Nord 23 7,1% 42 12,9% 150 46,2% 8 2,5% 102 31,4% 325<br />
Eimsbüttel 19 7,3% 41 15,7% 40 15,3% 20 7,7% 141 54,0% 261<br />
Bezirk Mitte 302 13,2% 651 28,4% 710 31,0% 40 1,7% 588 25,7% 2291<br />
Bezirk Altona 287 13,4% 486 22,7% 604 28,2% 31 1,4% 732 34,2% 2140<br />
Bezirk Eimsbüttel 125 6,9% 347 19,2% 455 25,2% 51 2,8% 825 45,8% 1803<br />
Eidelstedt 7 4,6% 50 32,9% 36 23,7% 3 2,0% 56 36,8% 152<br />
Stellingen 19 7,0% 90 33,2% 92 33,9% 3 1,1% 67 24,7% 271<br />
Region III 26 6,1% 140 33,1% 128 30,3% 6 1,4% 123 29,1% 423<br />
Bezirk Eimsbüttel 125 6,9% 347 19,2% 455 25,2% 51 2,8% 825 45,8% 1803<br />
Hamburg gesamt 1785 11,3% 3983 25,2% 4761 30,2% 291 1,8% 4965 31,5% 15785
ANLAGE 6<br />
Voraussetzungen für gelingende Kooperationen<br />
<strong>Die</strong> Mitwirkung in einer sozialräumlichen Kooperation/ Vernetzung muss "gewollt" sein.<br />
"Gewollt sein" bedeutet nicht unbedingt, dass die beteiligten Träger von sich aus eine<br />
entsprechende Vernetzung initiiert hätten – das Wollen kann auch auf "Einsicht in die<br />
Notwendigkeit" beruhen, wenn diese Einsicht zu einer reflektierten Entscheidung "dafür" geführt<br />
hat.<br />
Kooperation erfordert eine gemeinsame Abklärung von Bedarfen und Interessen<br />
• bezogen auf gemeinsame Aufgabenstellung<br />
• bezogen auf die Bedingungen in der Region und die Lebenslage der Betroffenen<br />
• bezogen auf institutionelle Bedarfe und Interessen der beteiligten Einrichtungen und Träger<br />
o Win-Win-Situation für alle Beteiligten<br />
o Planungssicherheit und Absicherung der Stellen<br />
Weitere Erfordernisse für das Gelingen von Kooperationen:<br />
• einen "Anwalt für die Projektidee" mit koordinierenden Funktionen<br />
• eine fachliche Philosophie, die prozesshaft entwickelt / hergestellt wird<br />
• die Bereitschaft der beteiligten Institutionen, die eigenen Interessen und Ansprüche<br />
zugunsten gemeinsamer Ziele und Aufgabenstellungen zu variieren und/oder zugunsten<br />
anderer aufzugeben<br />
• die Schaffung von etwas "Drittem", was durch gemeinsame Planungen und<br />
Aktivitäten/Angebote entsteht, z. B. Veränderung der<br />
o Organisationsstrukturen<br />
o Verantwortlichkeiten und Entscheidungsstrukturen<br />
o Arbeitsinhalte und –formen<br />
• Initiierung und Begleitung der Projektentwicklung<br />
o Berücksichtigung der Erkenntnis, dass nicht gleichzeitig konsolidiert (im Sinne<br />
von Einsparungen) und fachlich umstrukturiert werden kann.<br />
Prämissen, die die Grundlage für Kooperation darstellen:<br />
• gemeinsame Verantwortung<br />
• gleichberechtigte Partnerschaft – Egalität, z. B. pro Träger eine Stimme<br />
• Transparenz und einen offenen Informationsaustausch<br />
• die Wahrnehmung und Berücksichtigung von Interessen Einzelner und von Gruppen<br />
o ggf. Erstellung von "Interessenshierarchien".<br />
• eine prozesshafte Entwicklung mit abgestimmter inhaltlicher und zeitlicher Planung<br />
• ein fachlicher Paradigmenwechsel<br />
o Akzeptanz von sozialraum- und lebensweltorientierten Handlungsstrategien<br />
o Sicherstellung von Qualifizierung, Fachberatung und Evaluation.<br />
• Denken und Realisieren von Alternativen.
Kooperationen drohen zu scheitern, wenn<br />
• sie "aufoktroyiert" werden<br />
• die finanzielle Absicherung der beteiligten Institutionen – auf einer arbeitsfähigen Basis –<br />
nicht gewährleistet ist<br />
o führt zu Ab- und Ausgrenzungen<br />
• von der Prämisse ausgegangen wird, dass man weiterarbeitet wie bisher und nur die<br />
Zielgruppen besser auf die jeweiligen Angebote aufmerksam gemacht werden<br />
• versucht wird, Trägerinteressen durchzusetzen versus Entwicklung von Angeboten und<br />
Hilfen, die den Bedarfen von Kindern und Jugendlichen und ihren Eltern entsprechen und<br />
einen Beitrag zur Verbesserung ihrer Lebenssituation leisten<br />
• Auseinandersetzungen um Menschenbilder, fachliche Positionen, Prinzipien und Ziele der<br />
Arbeit "ausgespart" werden<br />
• Vernetzung zur Durchsetzung (egoistischer) administrativer, politischer oder<br />
einrichtungsbezogener Interessen funktionalisiert wird<br />
• administrative und politische Regularien "starr" gehandhabt werden (müssen)<br />
• mangelnde Bereitschaft besteht, eigene Interessen zugunsten eines Gesamtzieles<br />
zurückzustellen.
ANLAGE 7<br />
Mitglieder der Lenkungsgruppe des Projekts<br />
"Sozialraum- und lebensweltorientierte Hilfen zur Erziehung<br />
unter Einbeziehung der Implementierung eines Sozialraumbudgets"<br />
in der Region III in Eimsbüttel<br />
Ann Bandick Mobile Pflegeambulanz Ann Bandick GmbH<br />
Kay Gramberg Landesbetrieb Erziehung und Berufsbildung<br />
Günter Heinemann Das Rauhe Haus<br />
Martin Höft Großstadt-Mission Jugendhilfe gGmbh<br />
Elmar Hüwel Hamburger Kinder- und Jugendhilfe e.V.<br />
Michael König Jugendamt Eimsbüttel<br />
Ela Lang ASP Wegenkamp e.V., Projekt Gästewohnung<br />
Maren Peters SOS Kinderdorf e.V. Hilfeverbund Hamburg<br />
Holger Requardt Landesbetrieb Erziehung und Berufsbildung<br />
Myriam Schrank <strong>Stiftung</strong> Abendroth-Haus<br />
Hilde Stiefvater Das Rauhe Haus<br />
Helga Wallat Jugendamt Eimsbüttel