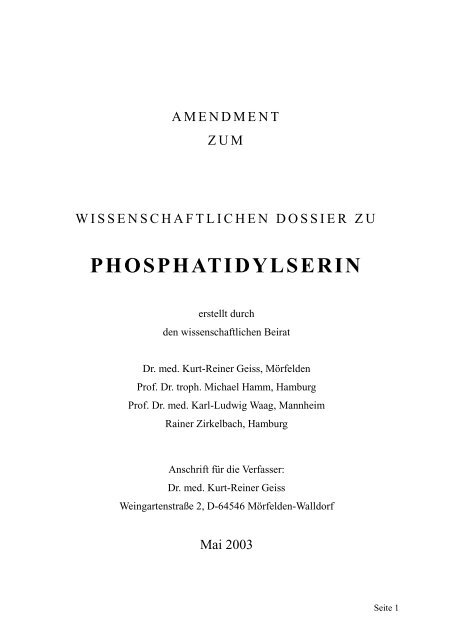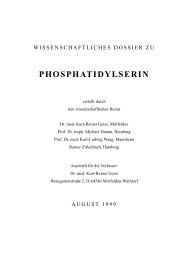haltigen IQ PLUS Brain Bar - beim Forschungsinstitut ISME
haltigen IQ PLUS Brain Bar - beim Forschungsinstitut ISME
haltigen IQ PLUS Brain Bar - beim Forschungsinstitut ISME
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
AMENDMENT<br />
ZUM<br />
WISSENSCHAFTLICHEN DOSSIER ZU<br />
PHOSPHATIDYLSERIN<br />
erstellt durch<br />
den wissenschaftlichen Beirat<br />
Dr. med. Kurt-Reiner Geiss, Mörfelden<br />
Prof. Dr. troph. Michael Hamm, Hamburg<br />
Prof. Dr. med. Karl-Ludwig Waag, Mannheim<br />
Rainer Zirkelbach, Hamburg<br />
Anschrift für die Verfasser:<br />
Dr. med. Kurt-Reiner Geiss<br />
Weingartenstraße 2, D-64546 Mörfelden-Walldorf<br />
Mai 2003<br />
Seite 1
Einleitung<br />
Im August 1999 erstellten die Mitglieder des wissenschaftlichen Beirates des<br />
Institutes <strong>ISME</strong> (Dr. med. K.-R. Geiß, Prof. Dr. troph. M. Hamm, Prof. Dr.<br />
med. K.-L. Waag und R. Zirkelbach) ein Dossier zu Phosphatidylserin (PS). In<br />
der Anlage enthielt das Dossier des weiteren ein „Expert report on the safety of<br />
Phosphatidylserine PS 50“ erstellt durch die RCC Ltd. Itingen, Switzerland,<br />
Oktober 1998, eine Produktbeschreibung eines Schokoriegels mit<br />
Phosphatidylserin mit dem Arbeitstitel <strong>Brain</strong>Storm Booster <strong>Bar</strong>, sowie eine<br />
lebensmittelrechtliche Bewertung des Institut Nehring GmbH vom 17.08.1999.<br />
Die Firma Giventis GmbH führte zum 01.07.2001 den Riegel unter dem Namen<br />
<strong>IQ</strong> <strong>PLUS</strong> <strong>Brain</strong> <strong>Bar</strong> in den österreichischen Markt ein. Das Bundesministerium<br />
für soziale Sicherheit und Generationen erließ am 13.12.2001 folgenden<br />
Bescheid zur werblichen Nutzung der gesundheitsbezogenen Angaben<br />
(Healthclaims): <strong>IQ</strong> <strong>PLUS</strong> steigert die geistige Leistungsfähigkeit<br />
wissenschaftlich belegt bei Personen in der zweiten Lebenshälfte mit einem<br />
ernährungsbedingten Phosphatidylserin-Mangel bei regelmäßiger Anwendung.<br />
Bei regelmäßiger Anwendung (3-4 Riegel pro Woche) dient <strong>IQ</strong> <strong>PLUS</strong> zur<br />
Verbesserung der Merk- und Lernfähigkeit, Steigerung der Aufmerksamkeit,<br />
Erhöhung der Konzentration (siehe Anlage 1).<br />
Das Interesse an diesem Nährstoff wird des Weiteren durch eine Reihe von<br />
Publikationen belegt, die nach der Fertigstellung des <strong>ISME</strong> PS-Dossiers 08/1999<br />
veröffentlicht wurden.<br />
Seite 2
In der Folgezeit diskutierten die Autoren des <strong>ISME</strong> PS-Dossiers, 08/1999 mit<br />
verschiedenen internationalen Behörden und Wissenschaftlern aus<br />
unterschiedlichen Fachbereichen, die ernährungsphysiologische Bedeutung und<br />
Wirkung von Phosphatidylserin.<br />
Obwohl in vielen Bereichen unter den Diskussionspartnern ein breiter Konsens<br />
gefunden wurde, ergaben sich aber auch weiterführende Fragen / Aspekte zu<br />
Phosphatidylserin:<br />
1. In dem <strong>ISME</strong> PS-Dossier vom August 1999 wurde auf eine Änderung<br />
der Ernährungsgewohnheiten hingewiesen, die hypothetisch eine<br />
erniedrigte tägliche PS-Aufnahme vermuten lies. Die Größenordnung<br />
wurde jedoch nicht spezifiziert.<br />
2. Es blieb offen, inwieweit die Wirkung von Soja-PS mit dem des<br />
Rinder-PS vergleichbar ist, dies insbesondere unter dem Aspekt, dass<br />
die Mehrzahl der älteren klinischen Studien mit Rinder-PS<br />
durchgeführt wurde. Demgegenüber zeigte eine im Jahr 2001 von<br />
Jorissen veröffentlichte Studie erstmalig und völlig kontrovers zu<br />
bisherigen Ergebnissen keine Beeinflussung der kognitiven<br />
Leistungsparameter nach der Applikation von Soja-PS.<br />
3. Unter dem Aspekt einer nutritiv bedingten niedrigeren täglichen PS-<br />
Aufnahme (und damit möglicherweise einer Minder- oder<br />
Unterversorgung) blieb ebenfalls die Frage offen, inwieweit eine<br />
tägliche PS-Zufuhr in der Größenordnung von 100 – 300 mg –<br />
entsprechend den klinischen Studien an älteren Menschen – auch zur<br />
Verbesserung der kognitiven Leistungsfähigkeit bei jüngeren<br />
Probanden führen könnte.<br />
Seite 3
4. Im August 1999 lagen noch keine Studien zu dem <strong>IQ</strong> <strong>PLUS</strong> <strong>Brain</strong> <strong>Bar</strong><br />
vor, so dass hier die Frage der Wirksamkeit von PS in der Matrix eines<br />
Riegels nicht beantwortet werden konnte.<br />
Das vorliegende Amendment dient zur Beantwortung dieser Fragen.<br />
Seite 4
1. Veränderung der nutritiven Versorgung<br />
In einer ernährungswissenschaftlichen Stellungnahme zur Veränderung der<br />
nutritiven Versorgung von Phosphatidylserin, Prof. Dr. M. Hamm, Juli 2002,<br />
wurden die Verzehrsdaten von 1986 (früher) zur 2000 (heute) verglichen. Das<br />
Ergebnis ist in Tabelle 1 dargestellt.<br />
Tabelle 1<br />
PS-Aufnahme<br />
80er Jahre<br />
(früher)<br />
PS-Aufnahme<br />
2000 (heute)<br />
relativ viel Fleisch<br />
und Wurst<br />
Light-Esser<br />
(fettarme<br />
Milchprodukte,<br />
Magerfische)<br />
Vegetarier<br />
250 mg 180 mg 100 mg < 50 mg<br />
Diese Überschlagsrechnung zeigt eine nutritive Minderversorgung zwischen<br />
früher und heute in einem Größenordnungsbereich von 70 – 150 mg PS pro Tag,<br />
bei vegetarischer Ernährung sogar von 200 – 250 mg pro Tag.<br />
Der Autor kommt zu der Schlussfolgerung, dass eine nahrungsergänzende<br />
Aufnahme von PS insbesondere bei Vegetariern, bei Personen während einer<br />
Gewichtsreduktion und bei Menschen, die sich bewusst fett- und cholesterinarm<br />
ernähren und daher wenig Fleisch/ -produkte essen sowie bei älteren Menschen<br />
mit einer abnehmenden körpereigenen PS-Synthese angeraten werden sollte.<br />
(siehe Anlage 2)<br />
Gerade die körpereigene PS-Synthese wird – und dies altersunabhängig –<br />
jedoch auch durch die allgemeinen Ernährungsgewohnheiten deutlich<br />
beeinflusst (Exkurs: Fischverzehr, Versorgung mit Omega-3-Fettsäuren und<br />
Einfluss auf den PS Gehalt im Gehirn, Anlage 1 der Ernährungs-<br />
Seite 5
wissenschaftlichen Stellungnahme zur Veränderung der nutritiven Versorgung<br />
mit Phosphatidylserin (PS) von Prof. Dr. troph M. Hamm, s. Anlage 2)):<br />
Der relativ niedrige Fischverzehr (gemäß dem Ernährungsbericht der DGE,<br />
(Deutsche Gesellschaft für Ernährung) aus dem Jahr 2000 ca. 20 g pro Tag je<br />
Kopf der Bevölkerung) und die hieraus resultierende unzureichende Zufuhr der<br />
Omega-3-Fettsäuren (Docosahexaensäure, Eicosapentaensäure) als wesentliche<br />
Substrate wirken sich somit nachteilig auf die körpereigene PS-Synthese aus.<br />
Unter Berücksichtigung der bereits erwähnten Änderung der<br />
Ernährungsgewohnheiten sieht der Verfasser bezüglich der ungünstigen<br />
Verzehrssituation der Omega-3-Fettsäuren hier ein weiteres Argument für eine<br />
nahrungsergänzende PS Aufnahme.<br />
Seite 6
2. Vergleich der Wirksamkeit von Soja-PS versus Rinder-PS<br />
Die meisten Studien, welche vor 1991 durchgeführt und bis 1998 publiziert<br />
wurden, fanden unter der Verwendung von Rinder-PS statt. In einer eigenen<br />
Metaanalyse (siehe <strong>ISME</strong> PS-Dossier, 08/1999, 9.3, Seite 14 – 16) sowie in der<br />
publizierten Metaanalyse von Louis-Sylvestre 1999, die insgesamt 1224<br />
Personen aus 9 verschiedenen doppelblind, placebokontrollierten, klinischen<br />
Studien (Delwaide et a., 1986, Ransmayr et al., 1987, Palmieri et al., 1987,<br />
Villardita et al., 1987, Amaducci et al., 1988, Crook et al., 1991, Crook et al.,<br />
1992, Cenacchi et al., 1993 und Gindin et al., 1995) erfasste und nach<br />
standardisierten psychometrischen Testverfahren (Cenacchi et al 1993)<br />
analysierte , ergaben sich übereinstimmende Ergebnisse zur Verbesserung der<br />
geistigen Leistungsfähigkeit bei Personen mit einer altersbedingten<br />
Hirnleistungsminderung (Age Related Cognitive Decline (ARCD) und Age<br />
Associated Memory Impairment (AAMI)).<br />
Bei neueren Studien (z. B. Benton, et al., 2001, Crook et al., 1998, Gindin, et al.,<br />
1993, Jorissen et al., 2001, Kidd et al., 2000, Schreiber et al., 2000) sowie den<br />
beiden Studien zum <strong>IQ</strong> <strong>PLUS</strong> <strong>Brain</strong> <strong>Bar</strong> (Schwarz et al., 2002 und Weiß et al.,<br />
2003) wurde Soja-PS appliziert.<br />
Aus wissenschaftlicher Sicht muss jedoch angemerkt werden, dass es aufgrund<br />
der zeitlichen Trennung der Soja-PS- und Rinder-PS-Studien nicht möglich ist,<br />
eine Metaanalyse dieser neueren und älteren Studien im Sinne eines direkten<br />
Vergleiches der angewandten psychometrischen Testverfahren und der<br />
Probandenkollektive durchzuführen, da<br />
Seite 7
und<br />
• Die verwendeten psychometrischen Testverfahren völlig unterschiedlich<br />
sind,<br />
• bei den neueren Studien vorwiegend junge, gesunde Probanden ohne<br />
Beeinträchtigung der Hirnleistung untersucht wurden, und somit die<br />
Probandenkollektive in ihren Charakteristika zu heterogen sind<br />
• in den verschiedenen Untersuchungen völlig unterschiedliche<br />
Hauptzielparameter definiert wurden.<br />
In der Tat gibt es nur zwei Studien, welche im direkten Vergleich Rinder- und<br />
Soja-PS die wissenschaftlichen Kriterien einer Metaanalyse erfüllen würden<br />
(Crook et al., 1991 und Crook, 1998). In beiden Studien wurden Probanden mit<br />
ARCD/ AAMI untersucht. 1991 nach der Applikation von 300 mg Rinder PS<br />
über 3 Monate und 1998 die gleiche Menge Soja-PS mit der gleichen<br />
Applikationsdauer. In beiden Studien gelangen die gleichen psychometrischen<br />
Testverfahren zur Anwendung. Das Ergebnis ist in Tabelle 2 dargestellt.<br />
Tabelle 2<br />
Verbesserung in Prozent<br />
Testinstrumentarium Soja-PS Rinder-PS Placebo<br />
Remembering names<br />
immediately after introduction<br />
Learning and remembering<br />
written information<br />
Remembering names one hour<br />
after introduction<br />
48 40 13<br />
40 37 7<br />
33 27 9<br />
Vergleicht man jedoch die Ergebnisse aller vorliegenden Studien – gleich unter<br />
welchen Bedingungen und mit welchen Methoden bei welchen Probanden<br />
Seite 8
gemessen – dann zeigt sich, dass sowohl eine regelmäßige Rinder- als auch<br />
Soja-PS-Applikation, die kognitive Leistungsfähigkeit verbessert. Dies wird<br />
eindrucksvoll anhand von 30 Overviews, 21 tierexperimentellen und 61 Human<br />
Intervention Studies dokumentiert.<br />
Einzige Ausnahme bleibt die Studie von Jorissen et al., 2001, bei der kein<br />
Nachweis zur Verbesserung der kognitiven Leistungsfähigkeit ermittelt werden<br />
konnte. Diese Studie weist jedoch erhebliche Mängel auf; einige wesentliche<br />
Kritikpunkte veröffentlichte Thomas Crook in seiner Stellungnahme vom 28.<br />
Oktober 2002 in “Is Soy Phosphatidylserine (SPS) as Effective as bovine<br />
Cortex Derived PS (BCPS) (siehe Anlage 3).<br />
Seite 9
3. PS Wirkung bei jungen Probanden<br />
In den vorausgegangenen Kapiteln wurde bereits dargestellt, dass die Mehrzahl<br />
aller PS-Studien an älteren Menschen mit Hirnleistungsminderungen<br />
durchgeführt wurde. Aufgrund der übereinstimmenden Ergebnisse dieser<br />
Untersuchungen überprüften eine Reihe von Autoren (Monteleone et al., 1992,<br />
Fahey et al., 1998, Fernholz et al., 2000, Benton et al., 2001, Pasteur et al., 2002,<br />
Weiß, et al., 2003 Publikation in Preparation) in Studien an jungen, gesunden<br />
Probanden die Wirksamkeit einer nahrungsergänzenden PS-Applikation.<br />
Hypothetisch legten die Autoren hierbei im Wesentlichen folgende Theorie<br />
ihren Arbeiten zugrunde: Phosphatidylserin reichert sich vorrangig in der<br />
Zellwand des neuronalen Gewerbes an. Die maßgebliche Funktion von PS im<br />
Nervengewebe bezieht sich auf die Einbindung von Proteinen in der<br />
Zellmembranmatrix. Diese Proteinstrukturen in der Zellmembran sind für<br />
sämtliche wichtigen Schaltfunktionen an der Zelloberfläche verantwortlich (vgl.<br />
<strong>ISME</strong> PS-Dossier, August 1999, 3, Seite 5 und 6). Insgesamt kommt es also zu<br />
einer verbesserten Signalübertragung respektive Kommunikation zwischen den<br />
Hirnzellen und konsekutiv zu einer verminderten Stressreaktion des Gehirns.<br />
Die Studienergebnisse entsprechen dieser Hypothese: Phosphatidylserin<br />
reduziert sowohl physisch als auch mental provozierte Stressparameter bei<br />
jungen, gesunden Probanden.<br />
Eine weitere jedoch offene, nicht placebokontrollierte Studie wurde von Kidd et<br />
al. bei Kindern durchgeführt, die unter ADHD (Attention Deficit Hyperactivity<br />
Disorder) leiden. Bei insgesamt 25 von 27 Kindern kam es zu einer deutlichen<br />
Verbesserung des Verhaltens.<br />
Seite 10
4. Die Wirksamkeit des <strong>IQ</strong> <strong>PLUS</strong> <strong>Brain</strong> <strong>Bar</strong>s bei Personen in<br />
der zweiten Lebenshälfte sowie jungen, gesunden Menschen<br />
Eine erste offene, nicht placebokontrollierte Verlaufsbeobachtung wurde im<br />
Jahr 2002 am Ludwig Boltzmann Institut unter Leitung von Prof. Dr. med. B.<br />
Schwarz in Wien durchgeführt. In das Probandenkollektiv wurden 29 Personen<br />
im Durchschnittsalter von 60 Jahren eingeschlossen. Mit den modernsten<br />
Methoden validierter psychologischer Tests erfolgte die Bestimmung des<br />
kognitiven Leistungsniveaus (Konzentration, Aufmerksamkeit und<br />
Gedächtnisleistung) der Probanden vor, während und nach 12-wöchiger<br />
Einnahme des Riegels. Nach weiteren 12 Wochen Riegelkarenz wurde eine<br />
abschließende Testserie durchgeführt. Hauptergebnis war, dass Parameter die<br />
vom Zeitraum der Bewältigung abhängig sind, sich während der Substitution<br />
von PS mit dem <strong>IQ</strong> <strong>PLUS</strong> <strong>Brain</strong> <strong>Bar</strong> verbesserten und nach Absetzen wieder<br />
verschlechterten. Der Studienleiter sieht diese Wirkung übereinstimmend mit<br />
Ergebnisse früheren Arbeiten bei anderen Kollektiven. (Ergebnisdokumentation<br />
siehe Anlage 4)<br />
Seite 11
Prof. Dr. med. M. Weiß (Sportmedizinisches Institut der Universität<br />
Paderborn) führte bei jungen, gesunden Probanden eine Untersuchung über die<br />
Verbesserung der kognitiven Leistungsfähigkeit und Stressbewältigung durch<br />
Phosphatidylserin durch. Diese klinische Studie mit dem <strong>IQ</strong> <strong>PLUS</strong> <strong>Brain</strong> <strong>Bar</strong><br />
erfolgte nach dem randomisierten, doppelblind, placebokontrolliertem<br />
Verfahren. Als wesentliches Ergebnis konnten sich die Probanden der<br />
Verumgruppe in den psychometrischen Tests gegenüber der Placebogruppe<br />
signifikant verbessern. Vor allem war übereinstimmend - mit den Ergebnissen<br />
der Studie von Prof. Schwarz - die Bearbeitungsgeschwindigkeit gestiegen und<br />
gleichzeitig die Fehlerzahl gesunken, jeweils ausgeprägter und signifikant<br />
gegenüber der Kontrollgruppe. Der Studienleiter interpretiert dies, als eine<br />
verbesserte kognitive Informationsverarbeitung des Erkennens, Entscheidens<br />
und Reagierens durch erhöhte Konzentration und Reaktion. Die Paderborner<br />
Studie bestätigt somit die aus zahlreichen Publikationen bekannte PS-Wirkung<br />
auf die kognitive Leistungsfähigkeit mit ARCD/AAMI nun auch an jungen,<br />
gesunden Menschen (siehe Ergebnisdokumentation, Anlage 5)<br />
Beide Studien belegen die Wirksamkeit von Soja-PS sowohl an älteren als auch<br />
an jungen gesunden Probanden in der Matrix eines Riegels (<strong>IQ</strong> <strong>PLUS</strong> <strong>Brain</strong><br />
<strong>Bar</strong>).<br />
Seite 12
5. Zusammenfassung<br />
Durch geänderte Ernährungsgewohnheiten (Fett- und cholesterinarme Kost,<br />
niedriger Fischverzehr insbesondere von Fettfischen) ergibt sich im Vergleich<br />
von 1986 zu 2000 eine erniedrigte tägliche PS-Zufuhr in der Größenordnung<br />
von durchschnittlich 70 – 150 mg PS pro Tag, bis maximal 200 – 250 mg PS pro<br />
Tag. Aus ernährungsphysiologischer Sicht sollte eine nahrungsergänzende PS-<br />
Zufuhr – und dies altersunabhängig – empfohlen werden.<br />
Metaanalysen zu den mit Rinder-PS und Soja-PS vorliegenden Studien sind<br />
wegen der immensen Unterschiede der Studiendesigns und Testverfahren und<br />
nicht zuletzt auch wegen der zeitlichen Trennung nicht möglich. Die Ergebnisse<br />
der neueren und älteren Studien zeigen jedoch übereinstimmend, dass durch die<br />
regelmäßige Applikation von PS in einer Dosierung von 100 – 300 mg pro Tag<br />
eine Verbesserung der geistigen Leistungsfähigkeit erzielt wird. Es kann<br />
heutzutage jedoch nur geschätzt werden, dass das Ausmaß der Verbesserung der<br />
geistigen Leistungsfähigkeit bei beiden Substanzen unterschiedlicher Herkunft<br />
vergleichbar ist. Die Jorissen Studie bleibt von 61 Human Intervention Studies<br />
die einzige die den Ergebnissen aller anderen kontrovers gegenüber steht.<br />
Die Wirkung von PS bei jungen, gesunden Probanden lies sich in mehreren<br />
Studien (die vorrangig mit Soja-PS durchgeführt wurden) ebenfalls belegen.<br />
Eine mögliche Beeinflussung der geistigen Leistungsfähigkeit und des<br />
Verhaltens bei Kindern mit ADHD bleibt abzuwarten.<br />
Seite 13
Mit dem <strong>IQ</strong> <strong>PLUS</strong> <strong>Brain</strong> <strong>Bar</strong> wurden zwei Studien an einem Kollektiv mit<br />
älteren Menschen und einer Gruppe mit jüngeren, gesunden Probanden<br />
durchgeführt. Die Ergebnisse, die in beiden Studien gefunden wurden, stimmen<br />
überein mit der bekannten und bereits publizierten PS Wirkung und bestätigen<br />
somit die Wirksamkeit von Soja-PS in der Matrix eines Riegels.<br />
Seite 14
6. Beurteilung der Healthclaims zu dem phosphatidylserin-<br />
<strong>haltigen</strong> <strong>IQ</strong> <strong>PLUS</strong> <strong>Brain</strong> <strong>Bar</strong><br />
Aufgrund der neueren Studien zu PS sowie den Studien zum Riegel lassen sich<br />
folgende gesundheitsbezogenen Angaben formulieren:<br />
Der <strong>IQ</strong> <strong>PLUS</strong> <strong>Brain</strong> <strong>Bar</strong> enthält 200 mg PS und kann so eine<br />
ernährungsbedingte verminderte PS-Zufuhr / PS-Unterversorgung ausgleichen.<br />
<strong>IQ</strong> <strong>PLUS</strong> steigert die geistige Leistungsfähigkeit.<br />
Bei regelmäßiger Anwendung (3-4 Riegel pro Woche) führt <strong>IQ</strong> <strong>PLUS</strong> <strong>Brain</strong> <strong>Bar</strong><br />
wissenschaftlich belegt, besonders in Zeiten erhöhter geistiger Beanspruchung<br />
zur Verbesserung der Merk- und Lernfähigkeit, Steigerung der Aufmerksamkeit<br />
sowie zur Erhöhung der Konzentration.<br />
Seite 15
f,ro<br />
r<br />
r-<br />
r<br />
,...<br />
I<br />
,...<br />
r<br />
r<br />
..<br />
r0t<br />
.<br />
ro-<br />
-<br />
,...<br />
I<br />
,...<br />
r<br />
ro-<br />
r<br />
GZ 333.902/3-IXlB/12a/01<br />
BUNDESMINISTERIUM<br />
FÜR SOZIALE SICHERHEIT UND GENERATIONEN<br />
SEKTION IX<br />
Bescheid<br />
eingelangt am:<br />
{J.<br />
1t DEZ. 2001<br />
Fris IfTetm in: ."'" .k?._...........................<br />
Der Bundesminister für soziale Sicherheit und Generationen qibt gemäß<br />
übc~::>rüf': "Q"'"'''''''''''''''' ......<br />
"or~c:ncrkl: .~.........................<br />
§,9 Abs: 3 des Leb.ensmittelgesetzes 1975 (LMG1975), BGB!. Nr. 86, zuletzt<br />
geändert durch das Bundesgesetz BGB!.I Nr. 98/2001, dem Antrag der Firma<br />
,. ,,; Giventis;GesmbH;iWeingartenstr.2,0-64546 Mörfelden-Walldorf,vertreten<br />
. ,durch.Schön herr Rechtsanwälte OEG, Tuchlauben 17,1014 Wien,<br />
vom 13. März 2001, zuletzt modifiziertmit Schreiben vom 28. November 2001, für<br />
.da.s Produkt "<strong>IQ</strong><strong>PLUS</strong>"Folqe und lässt die qesundheitsbezoqene Anqabe<br />
"<strong>IQ</strong>Plussteigert die geistige Leistungsfähigkeit wissenschaftlich<br />
.'belegt bei Personen in der zweiten Lebenshälfte mit einem<br />
ernährLingsbedingten Phospatidylserin-Mangel bei regelmäßiger<br />
Anwendung.<br />
. BeiregelmäßigerAnwendung(3-4Riegelpro Woche) dient<br />
:(QPluszur Verbesserung der Merk-und Lernfähigkeit, Steigerung<br />
der Aufmerksamkeit, Erhöhung der Konzentration."<br />
zu.<br />
r<br />
- Für die Zulassung ist gemäß § 1 Abs. 1 der Bundes-<br />
Verwaltungsabgabenverordnung 1983, BGB!.Nr.24, Ld.g.F., gemäß Tarifpost 94.<br />
-<br />
I'""<br />
.<br />
r<br />
r<br />
eine Bundesverwaltungsabgabe von 225 S (€ 16,35) in Bundesstempelmarken zu<br />
entrichten.
! " .....<br />
-2-<br />
Beqründunq<br />
Eine Begründung des Bescheides entfällt gemäß § 58 Abs. 2 des Allgemeinen<br />
Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 -AVG, BGBLNr. 51, Ld.g.F., da dem<br />
Parteibegehren vollinhaltlich stattgegeben wurde.<br />
Re c h t sm itt el bel eh ru n q<br />
; Gegen di,esenBescheid ist ein ordentliches Rechtsmittel nicht zulässig.<br />
Hinweis<br />
,<br />
Gegen die~er1;8escheid kann innerhalb von sechs Wochen nach seiner<br />
Zustellung Beschwerde <strong>beim</strong> Verwaltungs- oder Verfassungsgerichtshof erhoben<br />
werden. Sie muss yon einem Rechtsanwalt unterschrieben sein. Die Beschwerde<br />
ist gebührenpflichtig.<br />
Erqeht an:<br />
Firma<br />
Giventis GesmbH.<br />
z.Hd. Schönherr Rechtsanwälte OEG<br />
Tuchlauben 17<br />
1014 Wien<br />
lq~ die Richtigkeit<br />
,
Ernährungswissenschaftliche Stellungnahme<br />
zur Veränderung der nutritiven Versorgung<br />
mit Phosphatidylserin (PS)<br />
erstellt durch<br />
Prof. Dr. troph. Michael Hamm<br />
Ernährungswissenschaftier und Mitglied des wissenschaftlichen<br />
Beirates des <strong>ISME</strong>, privates <strong>Forschungsinstitut</strong> für Sport, Medizin<br />
und Ernährung
I. Einleitung<br />
Allgemein gilt, dass der Gehalt eines Organs an Phospholipiden<br />
umso größer ist, je lebenswichtiger es ist. Phospholipide sind<br />
für den gesamten Zellstoffwechsel von herausragender<br />
Bedeutung. Den höchsten Gehalt weisen die Membranen von<br />
Nervenzellen auf mit der vorrangigen Funktion der Beteiligung<br />
an der Signalübertragung.<br />
Phospholipide werden mit der Nahrung aufgenommen. Sie sind<br />
in tierischen und pflanzlichen Lebensmitteln enthalten. Das<br />
Phospholipid Phospatidylserin findet sich jedoch praktisch nur<br />
in tierischen Lebensmitteln - allen voran in Innereien und<br />
Fleisch. Über diese Lebensmittel erfolgt auch hauptsächlich die<br />
PS-Aufnahme. Eier und pflanzliche Lebensmittel, mit<br />
Ausnahme von Hülsenfrüchten, können dagegen für die<br />
Berechnung der PS-Versorgung weitgehend vernachlässigt<br />
werden. Demzufolge sind Vegetarier - insbesondere Veganer -<br />
die Bevölkerungsgruppe mit der geringsten PS-Aufnahme.<br />
Einerseits sind die in der Nahrung enthaltenen Phospholipide<br />
für die Erhaltung von Gesundheit und Leistungsfähigkeit von<br />
großem Wert, andererseits sind sie aufgrund der Möglichkeit,<br />
dass sie im Körper selbst synthetisiert werden, keine<br />
essentiellen Nährstoffe im klassischen und engeren Sinn.<br />
Allerdings lässt die Eigensynthese mit zunehmendem Alter<br />
deutlich nach.<br />
Es stellt sich die Frage nach einer angemessenen<br />
Nahrungsaufnahme bzw. Zufuhrempfehlung für Phospholipide.<br />
Die WHO (1974) geht von einer täglichen Lecithinaufnahme<br />
von 3 g bis 5 g Lecithin pro Tag aus.<br />
Bereits 1997 diskutierte Feldheim die geschätzte unterschiedliche<br />
tägliche Lecithinaufnahme mit der Nahrung in<br />
verschiedenen Ländern, z. B. 3 g in den USA, 1,9 g in<br />
Frankreich und Irland sowie etwa 1,4 g in Deutschland.<br />
Es mehren sich die Anzeichen dafür, dass durch eine<br />
ausreichende Phospholipidaufnahme über die Nahrung viele<br />
Stoffwechselprozesse optimiert werden können. Beispielsweise<br />
2
elegen verschiedene Studien eine Steigerung der kognitiven<br />
Leistungsfähigkeit, wenn PS im Bereich von 100 bis 300 mg<br />
täglich substituiert wird. Ein Rückgang der<br />
Phospholipidaufnahme mit der Nahrung könnte sich dagegen<br />
nachteilig auswirken.<br />
11. Verzehrsveränderungen und nutritive<br />
Minderversorgung von PS<br />
Verschiedene Gesichtspunkte kommen zusammen und müssen<br />
in die Diskussion einbezogen werden. Veränderungen in der<br />
Verbrauchereinstellung (z. B. Akzeptanz von Innereien),<br />
gesteigertes Ernährungsbewusstsein (z. .B. fett- und<br />
cholesterinbewusstes Essen) und nicht zuletzt Lebensmittelkrisen<br />
wie BSE und MKS haben insgesamt dazu geführt, dass<br />
der Verzehr PS-haltiger Lebensmittel rückläufig ist. Folgende<br />
Zahlen sollen dies verdeutlichen. Technologische<br />
Bearbeitungsprozesse von Fetten und Ölen (Raffination,<br />
Fetthärtung) reduzieren den Phospholipidgehalt fast vollständig<br />
und tragen so ebenfalls zu einer sinkenden PS-Aufnahme bei.<br />
Da insbesondere für Fleisch erst ab 1986 von<br />
Verbrauchszahlen nach Abzug von Knochen, Tierfutter und<br />
Verlusten differenzierte Verzehrszahlen vorliegen, wird<br />
beispielhaft ein Vergleich der Verzehrsdaten von 1986 (früher)<br />
und 2000 (heute) vorgenommen. So hat sich in Deutschland<br />
der Verzehr von Innereien von 2 kg pro Kopf und Jahr im Jahre<br />
1986 auf 1 kg im Jahre 2000 verringert. Besonders PS-haltige<br />
Innereien wie Gehirn sind praktisch gänzlich vom Speiseplan<br />
gestrichen. Der Gesamtfleischverzehr ist im Vergleichszeitraum<br />
von 68,3 kg pro Kopf und Jahr (1986) auf 61,4 kg (2000)<br />
gesunken. Dabei haben sich zusätzlich Veränderungen in der<br />
Präferenz einzelner Fleischarten ergeben (z. B. Zunahme bei<br />
Geflügel, Abnahme bei Rindfleisch).<br />
3
Tab. 1: Verzehr einzelner Lebensmittel früher und heute<br />
Lebensmittel 1986 2000<br />
pro Kopf und Jahr pro Kopf und Jahr<br />
Innereien 2,0 kg 1,0 kg<br />
Rindfleisch 15,7 kg 9,7 kg<br />
Schweinefleisch 43,1 kg 39,6 kg<br />
Geflügel 6,0 kg 9,3 kg<br />
Quelle: ZMP-Bilanz Vieh und Fleisch 2001<br />
Für die ebenfalls PS-<strong>haltigen</strong> Lebensmittel wie Milch und<br />
Milchprodukte sowie Fisch mit leicht ansteigender Verzehrstendenz<br />
liegen laut Ernährungsbericht 2000 der Deutschen<br />
Gesellschaft für Ernährung folgende mittlere täQliche<br />
Verzehrsdaten vor:<br />
. Milch und Milchprodukte: Frauen zirka 200 g und Männer<br />
zirka 225 g<br />
. Käse und Quark: Frauen und Männer zirka 35 g<br />
. Fisch und Fischwaren werden im Durchschnitt unter 20 g pro<br />
Kopf und Tag verzehrt.<br />
Bei Milch und Milchprodukten werden diejenigen mit<br />
geringerem Fettgehalt empfohlen und zum Teil auch bevorzugt<br />
(Trinkmilch mit 1,5 % Fett statt 3,5 % Fett), wodurch die<br />
Phospholipidaufnahme um zirka 50 Prozent aus dieser<br />
Lebensmittelgruppe gesunken sein dürfte.<br />
Der Eierkonsum ist übrigens zwischen 1992 bis Ende 2001 mit<br />
durchschnittlich 224 Stück pro Kopf und Jahr nahezu konstant<br />
geblieben. Da jedoch Eier ebenso wie pflanzliche Lebensmittel<br />
praktisch kein PS enthalten (Juneja, 1997), wurden diese<br />
Lebensmittel nicht in die Berechnung der PS-Aufnahme im<br />
Vergleich früher-heute einbezogen.<br />
4
111. Schätzung der täglichen PS-Aufnahme und nutritiven<br />
Minderversorgung im Vergleich früher-heute<br />
Folgende Daten ermöglichen eine annähernde Berechnung.<br />
Tab. 2: PS-Gehalte einzelner Lebensmittel<br />
Lebensmittel PS-Gehalt in mg/100 9<br />
leber (Schwein)<br />
50<br />
Niere (Schwein)<br />
Milz(Schwein)<br />
Hirn(Rind)<br />
Innereien (Mittelwert)<br />
Rindfleisch<br />
218<br />
239<br />
713<br />
305<br />
69<br />
Schweinefleisch 57<br />
Geflügel (Bein)<br />
Geflügel (Brust)<br />
Geflügel (Mittelwert)<br />
HerinQ<br />
Makrele<br />
134<br />
85<br />
109,5<br />
360<br />
480<br />
Milch(3,5 % Fett)<br />
1<br />
Milch(1,5 % Fett)<br />
Weiße Bohnen<br />
ca. 0,5<br />
107<br />
Quelle: Souci, Fachmann, Kraut 2000<br />
Welche PS-Menge lässt sich mit den Empfehlungen einer<br />
ausgewogenen Mischkost erreichen?<br />
Zugrundegelegt werden hinsichtlich der Gruppe tierischer<br />
Proteinträger:<br />
wöchentlich 3-4 Fleischportionen ä 100-1209<br />
wöchentlich 1-2 Fischportionen ä 150-2009<br />
täglich % Liter Milch oder Sauermilch<br />
täglich 1-2 Scheiben Käse<br />
wöchentlich 3-4mal Wurst<br />
wöchentlich 2-3 Eier<br />
5
Daraus lässt sich eine annähernde tägliche PS-Zufuhr von zirka<br />
130 mg ableiten, falls man sich tatsächlich an diesen<br />
Verzehrsempfehlungen orientiert. Gegessen wird aber<br />
bekanntlich anders, z. B. mehr Fleisch und Wurst sowie<br />
deutlich weniger Fisch, wobei vor allem die fettreichen<br />
Meeresfische als PS-Quellen in Frage kommen (siehe Anlage<br />
1, Exkurs zu Omega-3-Fettsäuren und PS-Gehalt im Gehirn).<br />
Abschließend wird die PS-Aufnahme im früher/heute-Vergleich<br />
sowie bei unterschiedlichen Kostgewohnheiten gegenüber<br />
gestellt, um daraus das Ausmaß einer möglichen nutritiven<br />
Minderversorgung abzuschätzen.<br />
Tab. 3: Tägliche PS-Aufnahme im Vergleich<br />
PS-Aufnahme PS-Aufnahme Light-Esser Vegetarier<br />
80er Jahre 2000 (fettarme<br />
(früher) (heute) Milchprodukte,<br />
relativ viel Fleisch und Wurst Magerfische)<br />
250 mg 180 mg 100 mg < 50 mg<br />
In die Berechnung einbezogen wurden die Verzehrsdaten von<br />
1986 und 2000 sowie die bekannten PS-Gehalte der tierischen<br />
Lebensmittel außer Eiern unter Mittelwertbildung bei<br />
verschiedenen Fettgehalten innerhalb einer Lebensmittelgruppe.<br />
IV. Seh Iussfolgeru ng<br />
Diese Überschlagsrechnung zeigt eine nutritive Minderversorgung<br />
zwischen früher und heute in einem<br />
Größenordnungsbereich von 70 mg bis 150 mg PS pro Tag, je<br />
nachdem die derzeit übliche Mischkost oder eine besonders<br />
(fett- )kalorienbewusste Ernährung praktiziert wird, bei<br />
vegetarischer Ernährung sogar von 200 mg bis 250 mg PS pro<br />
Tag.<br />
6
Eine nahrungsergänzende Aufnahme von PS kann also<br />
insbesondere<br />
. Vegetariern<br />
. Personen während einer Gewichtsreduktion<br />
. Menschen, die sich bewusst fett- und cholesterinarm<br />
ernähren und daher wenig Fleisch essen sowie<br />
. älteren Menschen mit einer abnehmenden körpereigenen<br />
Phosphatidylserinsynthese<br />
angeraten werden, um einer nutritiven Mindermöglicherweise<br />
Mangelversorgung vorzubeugen.<br />
7<br />
bzw.<br />
Eine tägliche zusätzliche Aufnahme von mindestens 100 mg bis<br />
max. 300 mg PS erscheint plausibel und erklärt auch die<br />
Verbesserung der geistigen Leistungsfähigkeit, die sich mit<br />
einer nahrungsergänzenden Zufuhr im Berei'chvon 100 mg bis<br />
300 mg PS in verschiedenen Studien erreichen ließ.<br />
Hamburg, im Juli 2002<br />
~/l'~ ~<br />
Prof. Dr. troph. Michael Hamm<br />
Ernährungswissenschaftier und<br />
Mitglied des Wissenschaftlichen Beirates von <strong>ISME</strong>
ANLAGE 1<br />
EXKURS: Fisch verzehr, Versorgung mit Omega-3-Fettsäuren<br />
(Docosahexaensäure) und Einfluß auf den PS-Gehalt im Gehirn<br />
Der Fischverzehr in Deutschland liegt gegenwärtig bei knapp<br />
20 Gramm pro Tag je Kopf der Bevölkerung (vgl.<br />
Ernährungsbericht 2000). Das entspricht einer auch für die US-<br />
Bevölkerung angenommenen täglichen Zufuhrmenge von<br />
maximal 100 mg langkettiger Omega-3-Fettsäuren<br />
(Eicosapentaensäure und Docosahexaensäure) aus dem<br />
Fischfett. In einem in der Ernährungs-Umschau 2002<br />
publizierten Konsensus-Statement des Arbeitskreises Omega-3<br />
werden dagegen mindestens 300 mg dieser Fettsäuren aus<br />
fetthaitigen Kaltwasserfischen empfohlen.<br />
Aus verschiedenen Gründen hat sich die Versorgungslage mit<br />
Omega-:3-Fettsäuren in der menschlichen<br />
Ernährung~geschichte - vor allem nach Einsetzen der<br />
industriellen Nahrungsmittelproduktion - dramatisch geändert.<br />
Es wird angenommen, dass der Urmensch eine ausreichende<br />
und im.. Verhältnis zu Omega-6-Fettsäuren ausgewogene<br />
Omega-3-Fettsäuren-Menge (Verhältnis 2: 1 bis 1:1) verzehrte<br />
(so genannte Steinzeitdiät). Erst durch das Sesshaftwerden und<br />
die veränderte. Futtergrundlage der landwirtschaftlichen<br />
Nutztiere sowie das insgesamt veränderte Nahrungsspektrum<br />
des Menschen kam es zu einer verringerten Omega-3-<br />
Fettsäuren-Aufnahme und vor allem in den letzten Jahrzehnten<br />
zu einem deutlichen Überwiegen an Omega-6-Fettsäuren.<br />
Derzeit beträgt die Relation> 20: 1, während die Deutsche<br />
Gesellschaft für Ernährung ein Omega-6- zu Omega-3-<br />
Verhältnis von 5: 1 empfiehlt. .<br />
Insgesamt lässt sich die heutige Fettaufnahme wie folgt<br />
beschreiben:<br />
- zu hohe anteilige Energiebereitstellung aus Fetten<br />
- zu hohe Aufnahme gesättigter Fettsäuren<br />
- zu hohe Aufnahme mehrfach ungesättigter Omega-6-<br />
Fettsäuren und<br />
- zu geringe Aufnahme von Omega-3-Fettsäuren sowohl<br />
pflanzlichen wie maritimen Ursprungs<br />
8
Daraus resultiert die Empfehlung von wöchentlich mindestens<br />
zwei Fischmahlzeiten und die bevorzugte Verwendung von<br />
alpha-Linolensäure-<strong>haltigen</strong> Pflanzenölen (z.B. Rapsöl oder<br />
Leinöl). Die Omega-3-Fettsäure alpha-Linolensäure ist im<br />
menschlichen Stoffwechsel Ausgangssubstanz für die<br />
biologisch aktiveren Omega-3-Fettsäuren Eicosapentaensäure<br />
und Docosahexaensäure. Die Umwandlung ist allerdings stark<br />
begrenzt und beträgt maximal 10 Prozent, so dass der Verzehr<br />
von fetthaitigen Meeresfischen die effizienteste und sicherste<br />
Form der Versorgung mit langkettigen Omega-3-Fettsäuren<br />
darstellt.<br />
Die Omega-3-Fettsäure Docosahexaensäure maritimen<br />
Ursprungs hat eine besondere Bedeutung bei der Entwicklung<br />
der Gehirn- und Sehleistung. Bekanntlich sind mehrfach<br />
ungesättigte Fettsäuren wesentliche funktionelle Bestandteile<br />
von Zellmembranen. Etwa 60 Prozent der Gesamtfettsäuren<br />
der Retina und 40 Prozent der mehrfach ungesättigten<br />
Gehirnlipide be$tehen aus Docosahexaensäure. Dabei besteht<br />
ein enger Zusammenhang zwischen Docosahexaensäuregehalt<br />
in den Membranphospholipiden und der Biosynthese sowie<br />
Anreicherung von Phosphatidylserin im Gehirn.<br />
Docosahexaensäure ist die dominierende mehrfach<br />
ungesättigte Fettsäure im Phosphatidylserinmolekül und<br />
beeinflusst so entscheidend dessen Synthese. Ein Mangel an<br />
Omega-3-Fettsäuren führt zu einer selektiven und signifikanten<br />
Reduzierung von PS im Gehirn (vgl. Garcia et al. 1998 und<br />
Hamilton et al. 2000).<br />
Diese physiologischen Voraussetzungen einer ausreichenden<br />
Omega-3-Fettsäure-Versorgung mit der Nahrung im Hinblick<br />
auf die körpereigene PS-Synthese liefern vor dem Hintergrund<br />
der diesbezüglich ungünstigen Verzehrssituation ein weiteres<br />
Argument für eine nahrungsergänzende PS-Aufnahme.<br />
9
Literatur:<br />
Deutsche Gesellschaft für Ernährung<br />
Ernährungsbericht 2000, Frankfurt 2000.<br />
10<br />
(Hrsg.):<br />
FAOIWHO (1974): Seventeenth Report of the Joint FAOIWHO<br />
Expert Committee on Food Additives. World Health Org. techno<br />
Rep. Ser., No. 539.<br />
Feldheim, W.: Lecithin - ein fast essentieller Nährstoff. In:<br />
Informationsdienst Fleisch aus Deutschland (Hrsg. CMA)<br />
1/1997.<br />
Garcia MC et al. (1998): Effect of docosahexaenoic acid on the<br />
synthesis of phosphatidylserine in rat brain microsomes and C6<br />
glioma cells. J. Neurochem 70, 24-30.<br />
Hamilton J, et al. (2000): n-3 fatty acid deficiency decreases<br />
phosphatidylserine accumulation selectively in neuronal tissues.<br />
Lipids 35, 863-869.<br />
Juneja, LR (1997): Egg yolk lipids, Chapter 6. Hen eggs. Their<br />
basic and applied science, 74-79, edited by Yamamoto T,<br />
Juneja LR, Hatta H, Kim M.<br />
Kuksis, A (1989): Animal sources of phospholipids, Chapter 4.<br />
Lecithins: Sources, Manufacture & Uses, 40-44, edited by<br />
Szuhaj BF.<br />
Schneider, M (1999): Egg lipids: processing and application.<br />
Proceedings from the VIII Symposium on the quality of eggs<br />
and egg products, Bologna, Volume 2, 381-385.<br />
Souci, S.W.; Fachmann, E.; Kraut, H. (2000): Food<br />
Composition and Nutrition Tables; medpharm Scientific<br />
Publishers Stuttgart.<br />
ZMP (Zentrale Markt- und Preisberichtsstelle für Erzeugnisse<br />
der Land-, Forst- und Ernährungswirtschaft GmbH Bonn):<br />
Marktbilanz 2001.
1<br />
''''''<br />
<strong>ISME</strong><br />
Privates <strong>Forschungsinstitut</strong> für<br />
Sport, Medizin & Ernährung GmbH<br />
Weingartenstr. 2<br />
64546 Mörfelden<br />
Prof. Dr. troph. Michael Hamm<br />
Rothenbaumchaussee 22<br />
20148 Hamburg<br />
Ernährungswissenschaftliehe Stellungnahme<br />
zum <strong>IQ</strong>Plus@-Riegel(Giventis GmbH)als <strong>Brain</strong>food<br />
Hamburg, 5. September 2001<br />
'"<br />
Das vorliegende Functional Food-Produkt ist ein mit Phosphatidylserin (PS)<br />
angereichertes Lebensmittel in der Verzehrsform eines Riegels, das aufgrund<br />
seiner ernährungsphysiologisch sinnvollen Zusammensetzung zu Recht als<br />
umfassendes <strong>Brain</strong>food-Produkt angesehen werden kann und sich deutlich von<br />
einer isolierten Verabreichung von PS in Kapselform unterscheidet.<br />
Es ist hinlänglich bekannt, dass für die Gehirnleistung die Nährstoffe<br />
Kohlenhydrate, Proteine und Vitamine - insbesondere die der B-Gruppe - eine<br />
- bedeutende Rolle spielen-und eine-unabdingbare"Funktionsvoraussetzung<br />
darstellen. Dies gilt für alle, Altersgruppen und bei allen mentalen<br />
Anforderungen.<br />
Die Ernährung beeinflusst auf vielfältige Weise die intellektuelle<br />
Leistungsfähigkeit und die Biochemie des Gehirns. Zum einen kann ein<br />
Energie- und Nährstoffmangel die mentalen Leistungen (z. B. Lern- und<br />
Konzentrationsfähigkeit) empfindlich beeinträchtigen. Zum anderen hat die<br />
Zusammensetzung der Nahrung (Protein-, Kohlenhydrat- und Phospholipidgehalt)<br />
entscheidenden Einfluss auf hormonelle Regelkreise, Aktivitäten von<br />
Neurotransmittern (Nervenbotenstoffen) und die Funktionstüchtigkeit der<br />
Zellmembranen (sog. Membranfluidität), also auf Faktoren, die insgesamt die<br />
Gehirn- und Nervenleistung mitbestimmen. Diese ernährungsphysiologischen<br />
Voraussetzungen gelten in jedem Lebensalter.<br />
Besonders herausgestellt werden muss die Bedeutung der Nahrungskohlenhydrate<br />
als Energiequelle für das in besonderem Maße glukoseabhängige<br />
Gehirn- und Nervensystem in Verbindung mit einem ausreichenden<br />
B-Vitamin-Angebot als Coenzymbestandteile im Energiestoffwechsel. Da<br />
Gehirnzellen so gut wie keine Vorratsspeicher für Glukose besitzen, stellt der<br />
zirkulierende Blutzucker die Hauptenergiequelle für das Gehirn dar. Im Zustand<br />
des abfallenden Blutzuckerspiegels, für den es unterschiedliche individuelle<br />
Empfindlichkeitsschwellen gibt, lassen Konzentrationsfähigkeit und<br />
Aufmerksamkeit merklich nach. Deshalb haben kohlenhydratreiche Mahlzeiten<br />
auch eine so große Bedeutung für die kognitive Leistungsfähigkeit.
;<br />
Kein Makronährstoff ist im Zusammenhang mit dem Thema <strong>Brain</strong>food so gut<br />
erforscht wie die Bedeutung der Nahrungskohlenhydrate. Der la Plus@-Riegel<br />
weist in seiner Nährstoffverteilung 57 Energieprozent Kohlenhydrate,<br />
27 Energieprozent Fette sowie 16 Energieprozent Proteine auf, was im übrigen<br />
der von allen Ernährungsinstitutionen und Gesundheitsorganisationen<br />
empfohlenen Nährstoffrelation entspricht.<br />
Der Einfluss der Kohlenhydrate auf die Gehirnleistung ist übrigens als kurzfristig<br />
zu bezeichnen. Das betrifft sowohl den Mangel als auch eine durch Zufuhr bzw.<br />
nachfolgenden Anstieg der Blutglukose resultierende Wirkung. In diesem<br />
Zusammenhang sind insbesondere auch kohlenhydratreiche Zwischenmahlzeiten,<br />
z. B. in Form eines Riegels, zu empfehlen. Der körperlich leicht<br />
Arbeitende, mehr geistig nervlich Beanspruchte profitiert dabei insbesondere<br />
vom geringen Fettkalorienanteil des la Plus@-Riegels.<br />
Proteine (Eiweißstoffe) sind dagegen mehr die stoffliche Grundlage des<br />
--- ---<br />
Lernens. Eiweiß schafft die räumlichen und stofflichen Voraussetzungen für<br />
Lernen im Neuronennetzwerk. Mit der Speicherung eines Gedächtnisinhalts<br />
geht eine erhöhte Produktion bestimmter Eiweißstoffe in den Nervenzellen<br />
einher. Die Zusammenhänge lassen sich leicht erklären: Wenn Informationen<br />
aufgenommen, verarbeitet und gespeichert werden, führt dies zu stofflichen<br />
Veränderungen im Gehirn - die Eindrücke müssen in irgendeiner Form<br />
erinnerbar festgehalten werden. Eine Substanz, die wegen ihrer Beschaffenheit<br />
dafür von Natur aus bestens in Frage kommt, ist das Eiweiß bzw. Protein, und<br />
zwar gerade aufgrund seiner Fähigkeiten, sein Aussehen und seine spezifische<br />
Erkennbarkeitvielfältig zu verändern-r--Wissenschaftler bezeichnendeshalbdie<br />
Eiweißstoffe, mit denen offensichtlich Informationen im Langzeitgedächtnis<br />
stofflich verankert werden, als Gedächtnismoleküle.<br />
Über ihre Funktion als Baustoffe für Neuronen (Nervenzellen), Synapsen<br />
(SchaltersteIlen zwischen den Nervenzellen) und Gedächtnismolekülen hinaus<br />
übernehmen Proteine <strong>beim</strong> Denken und Lernen noch weitere differenzierte<br />
Aufgaben. So sind die Eiweißbausteine Aminosäuren Vorstufen von Nervenbotenstoffen<br />
(Neurotransmitter). Ein für die Gedächtnisleistung besonders<br />
wichtiger Neurotransmitter ist das Acetylcholin. Dabei wird die Aminosäure<br />
Serin in Cholin umgewandelt, das wiederum für die körpereigene Herstellung<br />
des Neurotransmitters Acetylcholin benötigt wird. Dieser neben Serotonin am<br />
besten untersuchte Nervenbotenstoff ist vor allem für die schnelle Informationsübermittlung<br />
sowohl <strong>beim</strong> Lernen als auch Abrufen von gespeicherten<br />
Informationen wichtig. Ohne Acetylcholin könnte man sich gar nichts merken!<br />
Die Lernfähigkeit und ein gutes Gedächtnis beruhen also auf einer hohen<br />
Acetylcholin-Dichte in einem reich ausgebildeten Neuronennetzwerk.<br />
Cholin, der Baustein des Acetylcholins, wird zum Teil im Körper selbst gebildet,<br />
andererseits stammt dieser Neurotransmitterbaustein aus der Nahrung und ist<br />
in lecithinhaitigen Produkten als sog. Phosphatidylcholin vorhanden. Die im<br />
la Plus@-Riegelenthaltenen Lecithine (Phospholipide) bestehen nicht nur aus<br />
reinem Phosphatidylserin sondern stellen ebenfalls eine bedeutende<br />
Phosphatidylcholi nquelle dar.<br />
2
Vitamine greifen als Coenzymbestandteile bzw. Enzymaktivatoren in den<br />
Stoffwechsel der Makronährstoffe ein. Bekannt sind insbesondere die<br />
Zusammenhänge zwischen Vitamin B1 und dem Kohlenhydratstoffwechsel<br />
sowie zwischen Vitamin B6 und dem Proteinstoffwechsel. Für die Vitamine B1<br />
und B6 sowie B12 wurde lange Zeit die Bezeichnung neurotrope Vitamine<br />
("Nervenvitamine") verwendet, weil sie in enger Beziehung zum Stoffwechsel<br />
der Nervenzellen stehen. So haben sie als Coenzymbestandteile eine<br />
besondere Bedeutung im Energie- und Eiweißstoffwechsel des neuronalen<br />
Systems.<br />
Besonders Vitamin B1(Thiamin) ist als Coenzym für den hohen Glukoseumsatz<br />
der Gehirn- und Nervenzellen unverzichtbar. Ein Mangel würde deshalb auch<br />
alle energieabhängigen Leistungen im Gehirn und Nervensystem<br />
beeinträchtigen. Abnehmende Konzentrationsfähigkeit und zunehmende<br />
Reizbarkeit können die Folgen sein. Man sprach sogar in Amerika schon von<br />
"Junk food disease" und meinte damit die ersten Anzeichen der nervenschädigenden<br />
Erkrankung Beriberi vergleichbaren Symptome als Folge sehr<br />
einseitiger Ernährung von Schulkindern und Jugendlichen. Verhaltensprobleme<br />
und Lernschwierigkeiten sollten die Folgen eines ausgeprägten Vitamin-B1-<br />
Mangels sein.<br />
Vitamin B6 (Pyridoxin) wird dagegen für die Neurotransmittersynthese aus<br />
Aminosäuren und alle anderen Reaktionen im Eiweißstoffwechsel benötigt.<br />
Vitamin B1 ist dabei gleichzeitig wiederum energetische Voraussetzung für die<br />
Nervenerregbarkeit und die Erregungsfortleitung, Niacin und Pantothensäure<br />
-- -sind ebenfalls-zentr-aJeCoenzymtakto.r:enim~EnerQiestoffwechsel. -<br />
Fazit:<br />
Die umfassende Rezeptur des <strong>IQ</strong> Plus@-Riegelsmacht deutlich, dass für die<br />
Gesamtbeurteilung des Functional Food als <strong>Brain</strong>food-Produkt keineswegs<br />
allein die spezifische Wirkung der PS-Anreicherung herangezogen werden<br />
kann. Diese Phospholipidkomponente ist zwar eine zentrale und innovative<br />
Substanz, deren Bedeutung für die Gehirnleistung ausgehend zunächst bei<br />
älteren Menschen untersucht wurde und zunehmend auch an anderen Altersgruppen<br />
erforscht und bestätigt wird. Das breite Spektrum an den erörterten<br />
Nährstoffen ist allerdings für den Gesamtkomplex der kognitiven<br />
Leistungsfähigkeit in den Bereichen Merk- und Lernfähigkeit sowie<br />
Aufmerksamkeit und Konzentration sowohl <strong>beim</strong> Schulkind als auch <strong>beim</strong><br />
geistig-nervlich geforderten Erwachsenen mitentscheidend. Nicht zuletzt wird<br />
aus diesen Gründen auch die Verzehrsform eines Functional Food gewählt.<br />
Literatur:<br />
Hamm, M.: <strong>Brain</strong>food. Fitmacher für kluge Köpfe. Mosaik Verlag, München<br />
1999.<br />
Prof. Dr. troph. Michael Harnrn ~. hfi I A , A A .<br />
Ernährungswissenschaftier und t ('ßYVVVV'"<br />
Mitglied im Wissenschaftlichen Beirat von <strong>ISME</strong><br />
3
October 28, 2002<br />
Is Soy Phosphatidylserine (SPS) As Effective As Bovine Cortex Derived PS (BCPS)<br />
Thomas Crook, PhD<br />
President, Psychologix Inc.<br />
A recent study (Jorissen et al, 2001) published in a European nutrition journal has drawn some<br />
attention in the North American press and led at least one writer (Nutrition Action Newsletter,<br />
October, 2002) to question whether Phosphatidylserine (PS) derived from soy (S-PS) is as effective in<br />
treating Age-Associated Memory Impairment as that derived from the brains of cattle (BCPS). The<br />
investigators used many of the same subject selection criteria and followed the design of a clearly<br />
positive BCPS study that my colleagues at Stanford and Vanderbilt Universities and I published more<br />
than a decade ago in the journal Neurology (Crook et al,1991). Investigators in the recent study found<br />
no significant effect for either a 300mg dose, which we and other investigators found effective, or a<br />
600mg dose. They concluded, “ a daily supplement of S-PS does not affect memory or other cognitive<br />
functions in older individuals with memory complaints.”<br />
The extensive body of evidence supporting the argument that PS improves learning and memory<br />
among older adults (and older laboratory animals) is reviewed for a general audience in two of my<br />
books (Crook and Adderly, 1998; Crook, 1999) and for a scientific audience in a third (Crook and<br />
Gershon, 1991). Beyond that, perhaps the world’s foremost authority on PS, Dr. Parris Kidd, has<br />
written very extensively on the effects of the compound from a molecular to a clinical level ( Kidd,<br />
2000 ). There are literally dozens of studies supporting the efficacy of PS. However, it is true that,<br />
with the exception of two studies ( Gindin et al, 1993; Crook,1998), clinical trials testing PS among<br />
older adults with memory impairment were conducted with BCPS. Of course, trials with any product<br />
derived from the brains of cattle came to an abrupt halt with the emergence of Bovine Spongiform<br />
Encephalopathy( BSE, “ Mad Cow Disease”) in the early 1990’s.<br />
In view of the very substantial body of evidence supporting the effects of BCPS on cognition<br />
and this negative finding with S-PS, one must ask whether the disparity is most likely the result of<br />
differences between S-PS and BCPS or, differences between how studies with the two compounds<br />
were conducted.<br />
As noted, Jorissen and colleagues used many of the same subject selection criteria and a very<br />
similar design to that used in the BCPS study my colleagues and I published a decade earlier. There<br />
were differences, however, particularly in the tests chosen to measure the effects of PS and in the<br />
“power” of the study. Regarding the latter point, our study had nearly twice as many subjects per<br />
treatment group, however, that may not be the critical difference. The choice of tests is a matter of<br />
greater importance in that an appropriate test should meet specific criteria (Crook, Johnson, and<br />
Larrabee, 1987), principal among which are that it must clearly relate to the clinical problems the<br />
subject is experiencing and that it must be “valid.” Validity is the most important feature of any<br />
psychological test and means the test measures what it purports to measure. Specifically, in the case of<br />
later-life memory impairment, a valid test must relate clearly to the memory problems people<br />
experience in everyday life and must be sensitive to the clear linear decline that occurs with advancing<br />
age (that is people in their 30s should perform at a higher level than people in their 40s and so on).
Also, among older people, the test must distinguish between those with quite modest clinical problems<br />
and those whose problems are more severe.<br />
In our study, all tests used to measure PS effects were shown in nearly 100 scientific<br />
publications to be relevant to the problems of older people and to fulfill the other necessary criteria for<br />
validity. We tested many thousands of people around the world and showed repeatedly that test<br />
performance declines markedly, and in a linear manner through the adult years (eg., Crook and West,<br />
1990). We also showed that the tests clearly distinguish between older persons with modest clinical<br />
problems and those whose problems are more severe (eg.,Youngjohn, Larrabee, and Crook, 1992). By<br />
contrast, there is clear evidence that many of the tests used by Jorissen and his colleagues to assess the<br />
effects of S-PS were invalid. The tests were all abstract and had no apparent relation to the problems<br />
experienced by older individuals in everyday life and, beyond that, many were not sensitive to the<br />
decline in memory that occurs with advancing age. How, for example, can a test be used to assess the<br />
effects of a compound on Age-Associated Memory Impairment if older people perform as well as<br />
young people on the test and, even among older people, those with serious memory problems do as<br />
well as those with modest problems?<br />
Jorissen and his colleagues, themselves, present data that call into question the validity of all<br />
three of their primary measures of efficacy. They write as follows “There were no “severity of<br />
memory decline effects for delayed recall…delayed recognition sensitivity………and delayed<br />
recognition reaction time………..after the washout period.” This means that, when neither S-PS nor<br />
placebo were being administered, older people with mild memory problems did just as well on these<br />
“primary outcome measures” as did those with quite serious problems.<br />
So, how can a test measure the effect of a treatment in any disorder if people severely afflicted<br />
with the disorder score at levels that are not significantly different from those who show only mild<br />
symptoms. In the case of headache pain, for example, if investigators use a scale to measure analgesic<br />
effects on which, when untreated, people who have an excruciating migraine score no higher than<br />
those with only a mild headache, they would find the most potent analgesic to be ineffective? The<br />
scale would clearly be invalid. Similarly, any treatment for Age-Associated Memory Impairment will<br />
appear ineffective if the primary measures of efficacy do not distinguish between persons with severe<br />
memory loss and those with mild memory problems and, in the Jorissen et al study, they do not. The<br />
authors do not seem to appreciate this straightforward point and, instead, focus on test-retest<br />
reliability, that is the extent to which test results remain constant over repeated administrations.<br />
Indeed, they write:<br />
“ Another factor that could have influenced the results concerns the sensitivity of the<br />
cognitive tests to detect treatment effects, defined as test-retest reliability.”(page 130)<br />
This statement is clearly erroneous. Test-retest reliability is necessary to detect treatment effects but, it<br />
means nothing in itself. For example, the ability of older individuals to recall experiences from early<br />
life is highly reliable, that is it varies little from day to day, however, it is quite a poor measure of the<br />
effectiveness of drugs designed to improve memory. The ability to recall early life experiences<br />
declines little among healthy older people and, thus, a test measuring that ability will be insensitive to<br />
even highly effective treatments for Age-Associated Memory Impairment.<br />
Aside from the primary outcome measures, Jorissen et al chose an extensive battery of other<br />
tests but most of these had nothing to do with memory and, in most cases scores, did not decline with<br />
age. So, how is it that one would choose them to measure the effects of a compound in Age-<br />
Associated Memory Impairment? To be blunt, the choice makes no sense.<br />
There has been only a single S-PS study in Age-Associated Memory Impairment published in<br />
North America (Crook, 1998) and in that study we simply compared the magnitude of effect with S-PS
to that seen previously with BCPS and concluded that S-PS is at least as effective as BCPS. A<br />
placebo-controlled trial was performed by Gindin et al (1993) in Israel and that trial was positive. In<br />
light of these findings and the clear limitations of the Jorissen et al study, my colleagues and I stand<br />
firmly by our assertion that S-PS is an effective treatment for AAMI. Indeed, in our experience it is the<br />
only available treatment shown effective.<br />
REFERENCES<br />
Crook, T. The PS Factor. Vancouver, B.C.: Natural Factors Publications, 1999.<br />
Crook, T. & Adderly, B. The Memory Cure. New York, New York: Simon and Schuster, 1998.<br />
Crook, T. Treatment of age-related cognitive decline: Effects of phosphatidylserine. In R.M. Katz &<br />
R. Goldman (Eds.) Anti-Aging Medical Therapeutics, Vol. II, 20-28, 1999.<br />
Crook, T.H., Johnson, B.A., & Larrabee, G.L. Evaluation of drugs in Alzheimer’s disease and Age-<br />
Associated Memory Impairment. In O. Benkert, W. Maier, & K. Rickels (Eds.), Methodology for the<br />
Evaluations of Psychotropic Drugs. Berlin-Heidelberg: Springer-Verlag, pages 37-55, 1990.<br />
Crook, T. & Gershon, S. (Eds.) Diagnosis and Treatment of Adult-Onset Cognitive Disorders. Old<br />
Saybrook, Connecticut: Psymark Communications, 1991.<br />
Crook , T., Tinklenberg, J., Yesavage, J., Petrie, W., Nunzi, M.G., & Massari, D. Effects of<br />
Phosphatidylserine in Age-Associated Memory Impairment. Neurology. 41(5), 644-649, 1991.<br />
Ginden, J., Kedar, D., Naar, S., et al. The effect of herbal phosphatidylserine on memory and mood in<br />
community elderly. Gerontologist, 33, 121-134, 2001.<br />
Jorissen, B.L., Brouns, F., Van Boxtel, M.P.J., Ponds, R.W., Verhey, P.R.J., Jolles, J., & Riedel, W.J.<br />
The influence of soy-derived phosphatidylserine on cognition in Age-Associated Memory Impairment.<br />
Nutritional Neuroscience 4, 121-124, 2001.<br />
Kidd, P.M. Dietary Phospholipids as Anti-Aging Nutraceuticals. In R. Klatz & R. Goldman (Eds.)<br />
Anti-Aging Medical Therapeutics, Vol. IV. Chicago, Health Quest Publications, 2000.<br />
Youngjohn, J.R., Larrabee, G.J., & Crook, T.H. Discriminating Age-Associated Memory Impairment<br />
from Alzheimer’s disease. Psychological Assessment: A Journal of Consulting and Clinical<br />
Psychology, 4 (1), 54-59, 1992.
i..TJI,..<br />
TA."'" Ludwig ßoltzmann Institut<br />
fOrGesundheitsökonomie<br />
Univ.Prof.Dr.Bemhard Schwarz<br />
wissenschaftl. und admin. Leiter<br />
p.A. Bank Austria Creditanstalt<br />
Abt 8877TZJ Gesundheitszentrum<br />
Julius Tandler Platz 3<br />
A-1090 Wien<br />
Telefon: 050505-54500<br />
Fax: 050505-54535<br />
E-mail: bemhard.schwarz@ba-ca.com<br />
Vert~,iUfsbeobachtung von Konsumentlnnen eines Phosphatidylserin-hältigen<br />
Nahrungs riegels<br />
Aufrnerksamkeits~chwäche !;IndKonzentrationsstörungen sind ein häufig geäußertes Problem<br />
von Personen in unci~ußerhalb des Erwerbslebens. Frühere Arbeiten haben berichtet,<br />
.'. :" '9ass_ei.nM.angel ~
~<br />
.-<br />
,...<br />
,...<br />
,....<br />
~ Universität<br />
Paderbom<br />
Universität Paderborn . 33095 Paderborn<br />
Fakultät für Naturwissenschaft<br />
Department Sport & Gesundheit<br />
Sportmedizinisches Institut<br />
Prof. Dr. med. Michael Weiß<br />
,.... Untersuchung über die Verbesserung der kognitiven Leistungsfähigkeit und<br />
Stressbewältigung durch Phosphatidylserin (PS) bei jungen, gesunden Menschen<br />
Te1efon(05251)600 oder<br />
Durchwahl60-3184<br />
Telefax (05251) 60-3188<br />
Email: weisS@sportmed.<br />
uni-paderoom.de<br />
,.... Die vorliegende Studie geht auf die Anforderungssituation in der modernen<br />
Informationsgesellschaft ein, die unter Stress schnelle Entscheidungen und damit vom<br />
,....<br />
Gehirn eine erhöhte Leistung abverlangt. In einer Placebo kontrollierten Doppelblind-Studie<br />
wurde die Wirkung einer mehrwöchigen Verabreichung von 200mg Phosphatidylserin (PS)<br />
aus Sojalecithin in dem <strong>IQ</strong> <strong>PLUS</strong> <strong>Brain</strong> <strong>Bar</strong> der Firma Giventis untersucht. Stressor war das<br />
Lesen eines Textes von Immanuel Kant unter Sprachverzögerung (delayed auditory<br />
feedback, DAF), woran sich psychometrische Messverfahren zur Erfassung von kognitiver<br />
Leistungsfähigkeit, Merkfähigkeit,Aufmerksamkeit und Konzentrationsfähigkeit anschlossen<br />
(Stroop-Colour-Word-Test und D2-Test). Gemessen wurden außerdem die<br />
Himstromleistungen (EEG) und Bluthormonspiegel, Blutbild, Herzfrequenz und Blutzucker<br />
vor, während und nach dem Testablauf, der identisch wiederholt wurde nachdem je 10<br />
Probanden täglich für die Dauer von 6 Wochen einen Riegel mit PS (Verum) oder ohne PS<br />
(Placebo) verzehrt hatten.<br />
,...<br />
,....<br />
,...<br />
,...<br />
,....<br />
Die Probanden der Verum-Gruppe konnten sich in den psychometrischen Tests nach<br />
vorausgegangenem DAF-Stress gegenüber der Placebo-Gruppe signifikantverbessern. Vor<br />
allem war übereinstimmend mit neueren Ergebnissen die Bearbeitungsgeschwindigkeit<br />
gestiegen und gleichzeitig die Fehlerzahl gesunken, jeweils ausgeprägter und z.T. signifikant<br />
gegenüber der Kontrollgruppe,was einer verbesserten kognitiven Informationsverarbeitung<br />
des Erkennens, Entscheidens und Reagierens durch erhöhte Konzentration und Reaktion<br />
entspricht Die physiologischen Reaktionen wie Anstieg der Herzfrequenz und der<br />
Katecholamine zur Mobilisierung von Leistungsreserven wurde nicht beeinflusst. Auf<br />
zentraler Ebene konnten im EEG in bestimmten Hirnregionen des Frontal- und<br />
Schläfenlappens eindeutige Effekte nachgewiesen werden im Bereich der Delta-, Theta- und<br />
Beta-Frequenzen, was entsprechend der Literatur einer besseren Stressbewältigung<br />
entspricht PS bewirkt also eine verbesserte Fokussierung und Konzentration eine<br />
vorgegebene kognitive Leistungen unter bzw. nach einer Stress-Exposition. Der zugrunde<br />
liegende PS-Einbau in Strukturen des Gehims und die damit verbundene bessere<br />
Signalübertragung ist aus Tierversuchen weitgehend bekannt, und -der daraus resultierende<br />
Effekt war in der vorliegenden Studie elektroencephalographisch und durch Korrelationen<br />
von EEG-Parametem mit Bluthormonspiegeln nachweisbar. Die natürlichen Mechanismen,<br />
die zur Bewältigung einer physischen oder psychischen Anforderung (Coping) die<br />
Aktivierungder Körperfunktionenauslösen, wurden dabei nicht verändert.<br />
Die vorliegende Studie bestätigt die aus zahlreichen Publikationen bekannte P8-Wirkung auf<br />
die kognitive Leistungsfähigkeit bei Probanden mit ARCD/AAMInun auch an jungen,<br />
gesunden Menschen.<br />
Gez. Prof. Dr. med. Michael Weiß, Internist, Sportmedizin<br />
Dr. med. K.-R. Geiß, Allgemeinarzt, Emährungsmedizin, Sportmedizin<br />
r""vriaht. ~nnrimM;7'ini~h~ Tn!ditlltTTnivp.1'SitIU Parlerhom. Prof f)r. med. M. Weiß