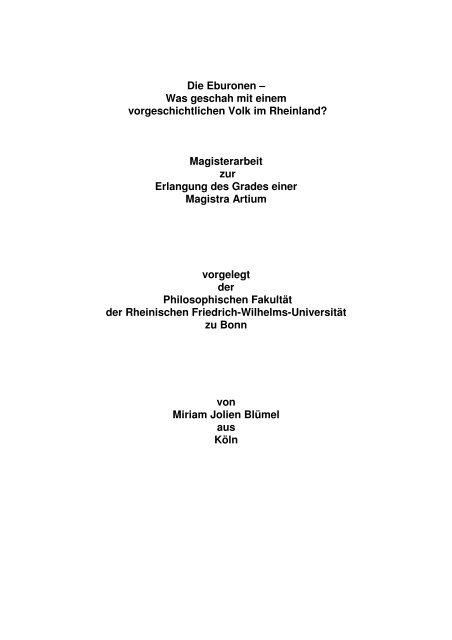Die Eburonen - Miriam Blümel, Miriam Jolien Blümel
Die Eburonen - Miriam Blümel, Miriam Jolien Blümel
Die Eburonen - Miriam Blümel, Miriam Jolien Blümel
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Die</strong> <strong>Eburonen</strong> –<br />
Was geschah mit einem<br />
vorgeschichtlichen Volk im Rheinland?<br />
Magisterarbeit<br />
zur<br />
Erlangung des Grades einer<br />
Magistra Artium<br />
vorgelegt<br />
der<br />
Philosophischen Fakultät<br />
der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität<br />
zu Bonn<br />
von<br />
<strong>Miriam</strong> <strong>Jolien</strong> <strong>Blümel</strong><br />
aus<br />
Köln
Eidesstattliche Erklärung<br />
An Eides Statt versichere ich, dass die Arbeit<br />
<strong>Die</strong> <strong>Eburonen</strong> – Was geschah mit einem vorgeschichtlichen Volk im<br />
Rheinland?<br />
von mir selbst und ohne jede unerlaubte Hilfe angefertigt wurde, dass sie noch<br />
keiner anderen Stelle zur Prüfung vorgelegen hat und dass sie weder ganz, noch im<br />
Auszug veröffentlicht worden ist. <strong>Die</strong> Stellen der Arbeit – einschließlich Tabellen,<br />
Karten, Abbildungen usw. -, die anderen Werken dem Wortlaut oder Sinn nach<br />
entnommen sind, habe ich in jedem einzelnen Fall als Entlehnung kenntlich<br />
gemacht.
Inhaltsverzeichnis Seite<br />
Vorwort<br />
I. Einleitung 1<br />
II. Historisches 2<br />
III. Archäologisches 14<br />
a) Neun Fundplätze im linksrheinischen Rheinland<br />
1. Niederzier-Hambach (Kr. Düren), spätlatènezeitliches 14<br />
„Mehrhausgehöft“ (Hambach 382)<br />
2. Beringen (Belgien), Goldschatzdepot 19<br />
3. Heers (Belgien), Münzschatz 21<br />
4. Kreuzweingarten (Kr. Euskirchen), „Alter Burgberg“ 24<br />
5. Jülich-Bourheim (Kr. Düren), spätlatènezeitliches 27<br />
Einzelgehöft<br />
6. Eschweiler-Laurenzberg (Kr. Aachen), 29<br />
spätlatènezeitliches „Mehrhausgehöft“<br />
7. Inden (Kr. Düren), spätlatènezeitlicher Opferplatz (?) 34<br />
8. Kreuzau-Winden (Kr. Düren), 39<br />
Abschnittswall „Hochkopf“<br />
9. Bonn-Muffendorf, spätlatènezeitliche Grabenanlage 41<br />
b) Auswertung der Befunde und Funde 1-9 44<br />
c) Zur Situation auf der rechten Rheinseite: <strong>Die</strong> Sugambrer 47<br />
1. Der Petersberg bei Königswinter, 48<br />
spätlatènezeitliche Befestigung<br />
2. <strong>Die</strong> Erdenburg bei Bensberg (Rhein.- Berg. Kreis) 49<br />
3. Köln-Porz, latènezeitliches „Vielhausgehöft“ 50
d) Analyse des Haustyps der <strong>Eburonen</strong> (keltische 52<br />
Mehrhausgehöfte) im Unterschied zum germanischen<br />
Langhaus<br />
IV. Kontinuität oder Diskontinuität? 56<br />
1. Tongeren (Civitas Tungrorum) 58<br />
2. Eburonische Münzen nach 50 v. Chr.? 60<br />
3. Analyse der archäobotanischen Untersuchungen 64<br />
4. Pulheim-Brauweiler, ein Beispiel für Kontinuität 71<br />
durch Siedlungsplatzverschiebung<br />
5. Aachen-Kornelimünster, gallo-römischer Tempelbezirk 76<br />
„Varnenum“<br />
V. Wo haben die <strong>Eburonen</strong> ihre Toten bestattet? 80<br />
VI. Zusammenfassung/Fazit 88<br />
Literaturverzeichnis 92<br />
Abbildungsnachweis 103<br />
Anhang/Abbildungen
Vorwort<br />
An dieser Stelle möchte ich die Gelegenheit wahrnehmen, mich bei allen Personen<br />
zu bedanken, die Anteil am Zustandekommen der vorliegenden Arbeit hatten.<br />
In erster Linie ist Prof. H. E. Joachim zu nennen, der diese Magisterarbeit betreut<br />
hat. Ganz besonders danke ich auch den Mitarbeitern des Rheinischen<br />
LandesMuseums Bonn, welche mit „gutem Rat“ zur Seite standen, allen voran Dr.<br />
Michael Schmauder.<br />
Schließlich danke ich meinem Vater, Michael <strong>Blümel</strong>, und meinem Onkel, Harald<br />
Sieber, die sich die Zeit genommen haben, vorab die Arbeit durchzulesen und mit<br />
mir zu besprechen.<br />
<strong>Die</strong>se Magisterarbeit widme ich meiner Großmutter, Gertrud Schäfer, geboren<br />
1926 in Oberzier (Kr. Düren).
I. Einleitung<br />
Einstieg und Ausgangspunkt für die Überlegung, mich dem Thema „<strong>Eburonen</strong>“ im<br />
Rahmen einer Magisterarbeit zu widmen, war mein Referat anlässlich eines<br />
Mittelseminars der Abteilung für Vor- und Frühgeschichtliche Archäologie des<br />
Instituts für Kunstgeschichte und Archäologie der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-<br />
Universität Bonn zur Vorbereitung einer Ausstellung im Rheinischen LandesMuseum<br />
Bonn 2007 - Krieg und Frieden. Kelten, Römer und Germanen - bei Dr. Michael<br />
Schmauder. Es behandelte das Volk der <strong>Eburonen</strong>, welches bis 50 v. Chr. auf der<br />
linken Rheinseite ansässig war. Angeblich hatte es dann aufgehört zu existieren, da<br />
Caesar in seinem Buch „De Bello Gallico“ den Eindruck vermittelt, den Stamm der<br />
<strong>Eburonen</strong> vollständig vernichtet zu haben.<br />
Zahlreiche archäologische Funde und Befunde weisen allerdings darauf hin, dass<br />
Teile der Bevölkerung noch nach 50 v. Chr. existierten, auch wenn sie in der<br />
schriftlichen Überlieferung nicht mehr unter dem ethnischen Kollektiv „<strong>Eburonen</strong>“ zu<br />
fassen sind.<br />
Meine Idee ist es, mit dieser Magisterarbeit eine Kompilation sämtlicher Quellen über<br />
die <strong>Eburonen</strong> zu veröffentlichen, die derzeit vorliegen.<br />
Im zweiten, kürzeren Teil werde ich die historischen Quellen zu den <strong>Eburonen</strong><br />
beleuchten, ihr dort genanntes Siedlungsgebiet, ihre Stammesstruktur und ihre<br />
Anführer vorstellen. In diesem Zuge ergibt sich direkt die prekäre Frage nach der<br />
Problematik der ethnischen Zuordnung. Dürfen wir archäologische<br />
Hinterlassenschaften einem bestimmten Volk oder Stamm zuschreiben, nur weil ein<br />
antiker Geschichtsschreiber von jenen Menschen behauptet, sie hätten sich mit<br />
diesem Namen bezeichnet oder wären dort ansässig gewesen? Sollten nicht<br />
vielmehr in umgekehrter Reihenfolge die Auswertung der archäologischen Zeugnisse<br />
Rückschlüsse liefern auf eine mögliche gemeinsame Identität, z.B. aufgrund<br />
ähnlicher Beschaffenheit der Sachkultur?<br />
Der dritte Teil liefert alle bislang existenten achäologischen Quellen. Es handelt sich<br />
um Siedlungsplätze, wo „<strong>Eburonen</strong>“ den schriftlichen Quellen gemäß gelebt haben<br />
sollen, zwei belgische Schatzfunde und um eine potentielle Kultstätte. Im<br />
Zusammenhang der Siedlungsplätze wird sich immer wieder die Frage ergeben, ob<br />
Befunde und Funde eher dem germanischen oder eher dem keltischen Kulturbereich<br />
1
zuzuordnen sind, inwieweit sie sich untereinander vergleichen lassen und wie sie<br />
miteinander zeitlich und räumlich in Verbindung stehen. Mit diesen Auswertungen im<br />
Detail werde ich versuchen, eine Antwort auf die folgenden Fragen zu finden: Haben<br />
wir es bei den vorgestellten Fundplätzen wirklich mit <strong>Eburonen</strong> zu tun oder nicht?<br />
Und wenn ja: was geschah mit diesem vorgeschichtlichen Volk hier im Rheinland?<br />
II. Historisches<br />
- <strong>Die</strong> Geschehnisse 54 – 51 v. Chr., die <strong>Eburonen</strong> in Caesars „Bellum Gallicum,<br />
ihr Siedlungsgebiet, ihre Stammeskultur und ihre Anführer - die Problematik der<br />
ethnischen Fragestellung -<br />
<strong>Die</strong> wichtigste schriftliche Quelle über das Volk der <strong>Eburonen</strong> ist Caesars „Gallischer<br />
Krieg“ 1 . Als allererstes erwähnt er sie in seinem zweiten Buch und zählt sie zu den<br />
„germani cisrhenani“, also zu den diesseitigen, d.h. linksrheinischen Germanen. In<br />
Abschnitt 4 nennt Caesar die <strong>Eburonen</strong> zusammen mit den Kondrusen, Kärosern,<br />
Aduatukern und Kämanern, welche mit einem Namen Germanen heißen.<br />
Von ihrem Siedlungsgebiet sagt er, es befinde sich zwischen Maas und Rhein 2 .<br />
So heißt es z.B. im Buch 5, Kapitel 24:<br />
„Eine Legion, welche er (Caesar) kürzlich jenseits des Po ausgehoben hatte<br />
und fünf Kohorten schickte er in das Gebiet der <strong>Eburonen</strong>, dessen größter Teil<br />
zwischen der Mosa und dem Rhein ist; welcher unter der Herrschaft des<br />
Ambiorix und Catuvolcus standen.“<br />
Außer dem Siedlungsgebiet nennt Caesar auch gleich die beiden Anführer der<br />
<strong>Eburonen</strong>. Der Stamm wurde nämlich von diesen beiden in verschiedenen<br />
Territorien herrschenden Fürsten regiert. Ambiorix regierte im Westen als Nachbar<br />
der Aduatuker und sein Bruder Catuvolcus in der Mitte des Stammesgebietes. Im<br />
Nordwesten müssen die <strong>Eburonen</strong> laut Caesar bis an die See gewohnt haben. Ihr<br />
Gebiet grenzte dort an das der Menapier. Ihre westlichen Nachbarn waren die<br />
Aduatuker, die südlichen die Segnier und Condrusen. Noch weiter im Süden war das<br />
Territorium der Treverer, deren clientes sie waren, d.h. sie waren ihnen<br />
1 G.J. Caesar, Gallischer Krieg. Übersetzungs-Bibliothek griechischer und römischer Klassiker, Band<br />
560 (Hollfeld 1997).<br />
2
tributpflichtig 3 . <strong>Die</strong> zentrale Befestigung des <strong>Eburonen</strong>gebiets hatte den Namen<br />
„Aduatuca“.<br />
In Buch 6, Kapitel 32 schreibt Caesar dazu:<br />
„Dann teilte er sein Heer in drei Teile und brachte das Gepäck der sämtlichen<br />
Legionen nach Aduatuka. Das ist der Name eines festen Platzes. <strong>Die</strong>ser<br />
befindet sich mitten im Gebiet der <strong>Eburonen</strong>...“<br />
54 v. Chr. errichteten die Römer im Gebiet der <strong>Eburonen</strong> ein Winterlager. Es stand<br />
unter dem Befehl der Legaten L. Aurunculeius Cotta und Q. Titurius Sabinus und<br />
beherbergte eine Legion und fünf Kohorten.<br />
Ungefähr 15 Tage nachdem das Winterlager aufgebaut war, überfielen eburonische<br />
Krieger das Lager, obwohl Stammesmitglieder es zuvor mit Getreide beliefert hatten.<br />
Dabei wurden ein Fünftel der Armee getötet, auch beide Legaten fielen und nur<br />
wenigen römischen Soldaten gelang die Flucht in ein südwestlich gelegenes<br />
Winterlager des Titus Labienus im Gebiet der Remer.<br />
Caesar deutete diesen Überfall als Aufstand und Verrat, geplant und durchgeführt<br />
von Ambiorix. Durch die Niederlage der Römer angespornt gelang es diesem<br />
darüber hinaus, die Aduatuker und die Nervier für einen erneuten massiven Angriff<br />
auf das Winterlager des Q. Tullius Cicero im Gebiet der Nervier zu gewinnen.<br />
<strong>Die</strong>ser konnte durch die Vorwarnung Caesars nur knapp einer Niederlage entgehen,<br />
diesmal wurden die <strong>Eburonen</strong> und ihre Verbündeten vernichtet oder in die Flucht<br />
geschlagen. Ab 53 v. Chr., dem sechsten Jahr des gallischen Kriegs, nahm sich<br />
Caesar fest vor, sich ganz auf den Kampf sowohl gegen die Treverer als auch gegen<br />
die <strong>Eburonen</strong> zu konzentrieren. <strong>Die</strong> komplette Armeebesetzung unter dem Befehl<br />
des Q. Tullius Cicero wurde erneut nach Aduatuca geschickt, diesmal unter dem<br />
Schutz der 14. Legion. Das eburonische Gebiet wurde der allgemeinen Plünderung<br />
preisgegeben. Es folgten 2000 sugambrische Reiter, die zunächst vor allem Vieh<br />
erbeuteten, dann aber gegen das römisch besetzte Aduatuca vorrückten. Ihr Angriff<br />
scheiterte allerdings. Ambiorix gelang die Flucht, Catuvolcus beging Selbstmord.<br />
Den führerlosen Stamm plante Caesar, einfach auszurotten 4 .<br />
2<br />
s. Abb. 1<br />
3<br />
H.v. Petrikovits, Germani Cisrhenani, in: H.Beck/ H. Jankuhn, R. Wenskus (Hrsg.), RGA Erg.-Bde. 1<br />
(Berlin 1986) 92.<br />
4<br />
H.-E. Joachim, <strong>Die</strong> <strong>Eburonen</strong> – Historisches und Archäologisches zu einem ausgerotteten Volk<br />
caesarischer Zeit, in: G.v. Büren/ E. Fuchs (Hrsg.), Jülich: Stadt – Territorium – Geschichte zum<br />
3
Dazu schreibt er im Buch 6, Kapitel 34:<br />
„Wenn er (Caesar) die Angelegenheit beendet und den Stamm<br />
verbrecherischer Menschen getötet wissen wollte, mussten mehrere Scharen<br />
abgesandt und die Soldaten vereinzelt werden...“<br />
Und in Kapitel 43 heißt es:<br />
„Alle Dorfschaften und Gehöfte, derer man ansichtig geworden war, wurden<br />
angezündet, Beutevieh wurde aus allen Gegenden weggetrieben...“<br />
Obwohl Caesar im Jahr 53 v. Chr. eine gewaltige Streitmacht gegen die <strong>Eburonen</strong><br />
eingesetzt hatte und plastisch von den Morden unter der Bevölkerung und der<br />
Verwüstung des Landes spricht, ist trotzdem wahrscheinlich, dass sein Erfolg nicht<br />
allzu groß war 5 . Ambiorix entkam immerhin seinen Verfolgern, und der Verwüstung<br />
des Landes wurden dadurch Grenzen gesetzt, dass die römischen Truppen sich in<br />
dem dicht bewaldeten Gebiet nicht frei und in den gewohnten Schlachtordnungen<br />
bewegen konnten. Wenn wirklich kein Teil des <strong>Eburonen</strong>landes und kein<br />
Stammeskrieger verschont geblieben wäre, hätte einer der Heerführer namens<br />
Hirtius zwei Jahre später nicht vom Gegenteil berichtet:<br />
In Buch 8, Kapitel 24, Abschnitt 4 schreibt er:<br />
„Er (Caesar) selbst brach auf, um das Gebiet des Ambiorix in eine völlige<br />
Wüste zu verwandeln. Nachdem er die Hoffnung aufgegeben hatte, den völlig<br />
verängstigten Flüchtling (Ambiorix) in seine Gewalt zu bekommen, hielt er es<br />
danach für seine Ehre am angemessensten, dessen Gebiet so vollständig der<br />
Bürger, der Gebäude und des Viehs zu berauben, dass Ambiorix, von den<br />
Seinen gehasst, wenn das Schicksal einige überleben ließe, wegen des<br />
furchtbaren Unglücks nicht mehr zu seinem Stamm heimkehren könnte.<br />
Nachdem Caesar in alle Teile des Gebietes von Ambiorix entweder Legionen<br />
oder Hilfstruppen abkommandiert und alles durch Massaker, Feuer und<br />
Plünderung verwüstet, sowie eine große Anzahl Menschen getötet oder<br />
gefangengenommen hatte, sandte er Labienus in das Land der Treverer…“<br />
Es wird also deutlich, dass Ambiorix im Jahr 53 v. Chr. zwar die direkte Gewalt über<br />
die <strong>Eburonen</strong> verloren hatte, der Stamm offensichtlich aber weiterexistierte und in<br />
der Folgezeit Ambiorix auch wieder Einfluss gewann. So sah Caesar sich zwei Jahre<br />
75jährigen Jubiläum des Jülicher Geschichtsvereins 1923 e.V., Jülicher Geschichtsblätter 1999/2000<br />
(Kleve 2000)159.<br />
5 W. Eck, Geschichte der Stadt Köln. 1: Köln in römischer Zeit: Geschichte einer Stadt im Rahmen des<br />
Imperium Romanum (Köln 2004) 41 ff.<br />
4
später, ab 51 v. Chr. erneut gezwungen, gegen die <strong>Eburonen</strong> vorzugehen. Hirtius<br />
spricht von weiteren Legionen und Hilfstruppen, die er dabei eingesetzt hat.<br />
Wiederum ist die Rede von Verwüstung und von einer großen Zahl von Menschen,<br />
die getötet oder gefangen genommen wurde. Aber von der Vernichtung des<br />
Stammes spricht er nicht. Ceasars Ziel war es, bei den <strong>Eburonen</strong> so viel Hass gegen<br />
Ambiorix zu erregen, dass es ihm unmöglich war, zu seinem Volk zurückzukehren.<br />
Auch sollte den <strong>Eburonen</strong> die Möglichkeit genommen werden, erneut eine<br />
romfeindliche Machtstellung zu erlangen. Zumindest letzteres ist Caesar auf jeden<br />
Fall gelungen: <strong>Die</strong> <strong>Eburonen</strong> verschwinden nach 50 v. Chr. als politische<br />
Gemeinschaft mit diesem Namen aus der Geschichte. Nur wird, wenn man den<br />
Bericht Caesars und vor allem Hirtius im 8. Buch ohne Vorannahmen liest, eben<br />
nicht von der totalen Auslöschung oder auch nur der Mehrheit der Bevölkerung<br />
gesprochen. Caesar will rhetorisch lediglich den Eindruck erwecken. Immerhin galt<br />
es, Rom von seinen Erfolgen zu überzeugen oder auch Soldatennachschüben die<br />
Angst vor dem „Barbarenland“ zu nehmen.<br />
Seine Vorgangsweise gegen die <strong>Eburonen</strong> hatte Caesar schon mal an früherer<br />
Stelle gerechtfertigt 6 , nämlich in Buch 5, Kapitel 28, als er schrieb:<br />
„...es war kaum zu glauben, dass der unbekannte und unbedeutende Staat der<br />
<strong>Eburonen</strong> freiwillig das römische Volk mit Krieg zu überziehen gewagt hatte...“<br />
Verwirrung hat Caesar mit der Angabe über das eburonische castellum Aduatuca<br />
angerichtet: Er sagte, es liege mitten im Gebiet der <strong>Eburonen</strong> 7 . Das kaiserzeitliche<br />
Aduatuca, also das castellum, das nach der „Vernichtung“ der <strong>Eburonen</strong> entstand<br />
(siehe Kapitel IV, Abschnitt 1), liegt zweifelsfrei im Stadtgebiet vom heutigen<br />
Tongeren. Das alte Winterlager Aduatuca aus der Zeit des Gallischen Krieges kann<br />
sich rein von der Logik her allerdings nicht in dessen unmittelbarer Nähe befunden<br />
haben. Tongeren liegt nämlich nicht in der Mitte des ehemaligen <strong>Eburonen</strong>gebiets,<br />
sondern links der Maas, also bestenfalls am äußersten Westrand ihres Gebiets. Es<br />
gibt hierfür zwei Lösungsmöglichkeiten:<br />
1. die Angabe Caesars über die Gebietsausdehnung und das castellum Aduatuca ist<br />
falsch.<br />
2. Aduatuca (Tongeren) lag nicht mehr im <strong>Eburonen</strong>gebiet, ist also nicht mit dem von<br />
6 Joachim 2000, 159.<br />
5
Caesar angeführten <strong>Eburonen</strong>-Aduatuca identisch. <strong>Die</strong> einheimische Vorgänger-<br />
Siedlung des kaiserzeitlichen Aduatuca, also Tongeren, müsste demnach noch im<br />
Aduatuker-Gebiet gelegen haben, was letztendlich der Ortsname auch nahe legen<br />
würde. Jedenfalls gibt es bislang noch kein archäologisch nachgewiesenes<br />
Winterlager Aduatuca aus dem Jahr 54/53 v. Chr.<br />
Kommen wir im weiteren zur Frage der ethnischen Einordnung der <strong>Eburonen</strong>:<br />
Eigentlich war der Rhein für die Römer immer die Grenze zwischen Germanen und<br />
Kelten 8 und dennoch bezeichnet Caesar einige linksrheinische Stämme als<br />
linksrheinische Germanen (germani cisrhenani). <strong>Die</strong> <strong>Eburonen</strong> erwähnt er in diesem<br />
Zusammenhang an drei Stellen 9 :<br />
Buch 2, Kapitel 4:<br />
„...die Kondrusen, <strong>Eburonen</strong>, Käröser, Pämanen, welche mit einem Namen<br />
Germanen heißen...“<br />
Buch 6, Kapitel 32:<br />
„<strong>Die</strong> Segni und Condruser aus der Völkerschaft und der Zahl der Germanen,<br />
die zwischen den <strong>Eburonen</strong> und den Treverern wohnen, schickten Gesandte zu<br />
Caesar, um ihn zu bitten, sie nicht als Feinde zu behandeln und nicht zu<br />
meinen, dass es eine gemeinschaftliche Unternehmung aller Germanen, die<br />
diesseits des Rheins sich befänden, sei...“<br />
Buch 6, Kapitel 5:<br />
„Es waren dem Gebiet der <strong>Eburonen</strong> benachbart und durch fortlaufende<br />
Wälder und Sümpfe geschützt die Menapier...“<br />
In jedem Fall zählt Cäsar die <strong>Eburonen</strong> zu den Germanen, ohne explizit zu<br />
behaupten, dass sie tatsächlich Germanen sind 10 .<br />
Der Name der <strong>Eburonen</strong> ist jedoch mit Sicherheit als keltisch anzusprechen. Er<br />
leitet sich ab vom keltischen „eburos“, d.h. Eibe oder Taxusbaum, von denen es laut<br />
Caesar eine große Anzahl in Gallien und Germanien gab 11 . Im übertragenen Sinn<br />
7<br />
Petrikovits 1986, 92 ff.<br />
8<br />
H. Galsterer, Romanisation am Niederrhein in der frühen Kaiserzeit. In: Thomas Grünewald (Hrsg.),<br />
Germania inferior. Besiedlung, Gesellschaft und Wirtschaft an der Grenze des römisch-germanischen<br />
Welt. RGA Erg.-Bde. 28 (Berlin/New York 2001) 20.<br />
9<br />
Petrikovits 1986, 88.<br />
10<br />
Petrikovits 1986, 92.<br />
11<br />
W. Kaemmerer, Eschweiler in seiner Geschichte I (Eschweiler 1964) 42 ff.<br />
6
könnte er bedeutet haben: das Volk „denen die Eibe heilig ist“. <strong>Die</strong> Verehrung der<br />
Eibe ist in der keltischen Religion eher nachzuweisen, als in der germanischen. Ein<br />
heiliger Baum war ganz konkret mit dem Territorium eines Stammes verwurzelt,<br />
wodurch er dem dazugehörigen Menschenverband im wahrsten Sinne des Wortes<br />
als Stamm-Baum galt 12 . Heilige Bäume im Kollektiv gaben als Hain, Wald oder<br />
baumumstandene Lichtung Kultstätten ab, die nicht unbedingt einen Schrein oder<br />
ein Götterbild brauchten. Der Mythologie zufolge besaß die Eibe die Eigenschaften<br />
aller heiligen Bäume in Potenz: Sie ist immergrün und trägt rote Beeren, die als Gift<br />
und Arznei Verwendung finden. Bedingt durch diese Eigenschaften sei sie der Baum<br />
mit der stärksten Verbindung zur Anderswelt. Auch antike Geschichtsschreiber, wie<br />
z.B. Lucans überliefern, dass die Eibe bei den Kelten einen kultischen Stellenwert<br />
hatte. Bei Massilia, schreibt er, gab es einen großen Hain mit Eiben, der den<br />
gallischen Göttern geweiht war. Aus dem Inselkeltischen gibt es Erzählungen, dass<br />
Eibenzweige, in denen Ogham-Zeichen eingeritzt waren, zu magischen und<br />
divinatorischen (zukunftsvorhersehenden) Zwecken verwendet wurden. Der eine der<br />
beiden Anführer, Catuvolcus, hatte sich übrigens mit Eibengift suizidiert, das ist das<br />
in Holz, Rinde, Nadeln und Samen enthaltene Alkaloid Taxin 13 .<br />
Hierzu schreibt Caesar im Buch 6, Kapitel 31:<br />
„Als Catuvolcus, der König der Hälfte der <strong>Eburonen</strong>, der mit Ambiorix<br />
gemeinschaftlich den Plan geschmiedet hatte, vom Alter geschwächt, die<br />
Strapazen des Krieges oder der Flucht nicht ertragen konnte, tötete er<br />
sich....mit Eibenbaum, von dem es in Gallien und Germanien eine große Menge<br />
gibt.“<br />
Denkbar ist hierbei also auch, dass es sich bei dem Eibengift um eine rituelle<br />
Selbsttötung handelte.<br />
Auch überlieferte Ortsnamen wie Aduatuca oder Personennamen (wie Ambiorix und<br />
Catuvolcus) sind keltisch. <strong>Die</strong> Bestandteiler beider Fürstennamen, allen voran aber<br />
die Nachsilbe –rix lassen den Vergleich und die Zusammengehörigkeit mit anderen,<br />
eindeutig keltischen Namensformen jener Zeit erkennen 14 . <strong>Die</strong> Nachsilbe –rix kehrt<br />
bei den Namen der meisten gallischen Stammesfürsten wieder, die damals als<br />
12 S. Botheroyd, Lexikon der keltischen Mythologie (München 1992) s.v. „Bäume“ 29 ff.<br />
13 H. Beck/ H. Jankuhn, R. Wenskus (Hrsg.), Reallexikon der germanischen Altertumskunde 1986)<br />
348-350 s.v. <strong>Eburonen</strong> (G. Neumann).<br />
14 Kaemmerer 1964, 47 ff.<br />
7
Gegner Caesars in Erscheinung traten. Sie entspricht zwar dem lateinischen rex, hat<br />
aber ebenso wenig wie dieses die enge Bedeutung von König an sich. Vielmehr<br />
impliziert das keltische –rix den Begriff und Sinn eines Stammesfürsten, vergleichbar<br />
mit dem frühgermanischen Herzog. Im Stamm des Namens Ambiorix steckt das<br />
keltische ambi, was sich mit Fluss oder Wasser übersetzen lässt. Demnach könnte<br />
der Name Ambiorix etwa die Bedeutung von „Flussbeherrscher“ gehabt haben. In<br />
der Tat war er Herrscher über ein Gebiet, das zwischen zwei großen Flüssen, dem<br />
Rhein und der Maas, gelegen hat. Auch der Name Catuvolcus ist keltischen<br />
Ursprungs. Catu bedeutet Kampf. Der andere Name volcus könnte sich ableiten von<br />
volco =schnell, wonach Catuvolcus als „schneller Krieger“ zu übersetzen wäre.<br />
Es ist möglich, dass nicht alle <strong>Eburonen</strong> ausschließlich keltisch gesprochen, sondern<br />
dass dies aus Prestigegründen wohl vor allem bei der Oberschicht üblich war. Ihre<br />
ursprüngliche Sprache könnte wirklich eine germanische und noch zur Zeit von<br />
Caesars Gallischen Krieg verbreitet gewesen sein. Es gibt linguistische Belege, dass<br />
sich selbst im Innergermanischen Fürsten und andere hochgestellte Personen<br />
keltische Namen aus Prestigegründen zugelegt haben 15 .<br />
Trotzdem bleibt es fraglich, ob sich die <strong>Eburonen</strong> eher als „Kelten“ oder eher als<br />
„Germanen“ verstanden haben, ob sich ihnen die Frage dieser ethnischen<br />
Zuordnung überhaupt jemals gestellt hat, ganz zu schweigen davon, dass es sich bei<br />
den beiden Bezeichnungen ohnehin nur um Konstrukte, um Fremdbezeichnungen<br />
antiker Autoren der betreffenden Völker handelte. Haben sie sich überhaupt als<br />
geschlossene Volksgemeinschaft verstanden und wenn ja, wie würde diese mit ihren<br />
archäologischen Hinterlassenschaften für uns greifbar werden?<br />
Ethnische Interpretationen von Bodenfunden gelten häufig als zentrales Anliegen<br />
archäologischer Forschung 16 . In erster Linie stand in der Vergangenheit oftmals der<br />
Versuch dahinter, nationale Identitäten zu bekräftigen, indem man archäologische<br />
Funde den eigenen Vorfahren zuschrieb. <strong>Die</strong>ses nationalstaatliche „Modell“ kann<br />
jedoch nicht auf früh- oder vorgeschichtliche Verhältnisse projiziert werden. Zwar<br />
erwähnen antike Berichte, wie eben jene von Caesar, eine Vielzahl von<br />
„Völkernamen“, doch handelte es sich dabei in erster Linie um klassifizierende,<br />
ordnende Beschreibungen aus der Fremdperspektive, die über Vorstellungen und<br />
15 A. Scherer, in: Corolla linguistica, Festschr. F. Sommer, 1955, 199-210.<br />
8
Verhältnisse bei den verschiedenen „Barbarengruppen“ allenfalls bedingten<br />
Aufschluss geben. <strong>Die</strong> allen voran sprachlich definierten (und daher keine Ethnien<br />
repräsentierenden) Kelten, Germanen oder Slawen lassen sich nicht jeweils einer<br />
homogenen „archäologischen Kultur“ zuordnen, sondern werden jeweils mit einer<br />
größeren Zahl von regionalen Gruppen in Verbindung gebracht 17 .<br />
Gustav Kossinna hatte 1927 noch behauptet, dass „streng umrissene, scharf sich<br />
heraushebende, geschlossene archäologische Kulturprovinzen unbedingt mit<br />
bestimmten Völker- und Stammesgebieten“ zusammenfallen 18 . Sicherlich stehen<br />
hinter einer geschlossenen Kulturgruppe bestimmte soziale Vorgänge und Zustände.<br />
Wer aber behauptet, dass es sich um Vorgänge und Zustände handelt, die von<br />
einem Stammesbewusstsein geleitet waren? Es ist jedenfalls nicht anzunehmen,<br />
dass eine klar definierte Kultur gleichzeitig neben der anderen lag. Es wird immer<br />
wieder Räume dazwischen gegeben haben, die weder der einen noch der anderen<br />
voll angehörten und deren verbindende Züge zu einer Zeit mehr in die eine, zu einer<br />
anderen Epoche mehr in die entgegen gesetzte Richtung deuten konnten, ohne<br />
dass wir stets mit ethnischen Wechseln zu rechnen brauchen 19 . Ebenso kann es im<br />
Fall der <strong>Eburonen</strong> gewesen sein.<br />
Seitdem sich die Sozialwissenschaften seit den 1960er Jahren und angesichts<br />
heutiger politischer Entwicklungen verstärkt mit „Ethnizität“ und sozialen „Identitäten“<br />
beschäftigten, haben damit verbundene Fragen auch für die Archäologie an<br />
Bedeutung und Aktualität gewonnen. Ein Ausdruck dessen ist u.a. die Herausbildung<br />
der „contextual archeology“: Sie versucht, Funde und Befunde in ihrem jeweiligen<br />
Kontext zu sehen, d.h. vor allem die „Sachkultur“ mehr als Bedeutungsträger zu<br />
verstehen. <strong>Die</strong>ser Tendenz entspricht beispielsweise auch die neuere<br />
Forschungsströmung „Vom Text zum Kontext“ in der volkskundlichen<br />
Erzählforschung, eine der am längsten „etablierten“ Richtungen des Faches 20 . <strong>Die</strong><br />
moderne Kontextforschung begann in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg mit der<br />
16 S. Brather, Ethnische Interpretationen in der frühgeschichtl. Archäologie: Geschichte, Grundlagen<br />
und Alternativen. Ergänzungsbände zum RGA 42 (2004) 613 ff.<br />
17 Brather 2004, 623.<br />
18<br />
G. Kossinna, Ursprung und Verbreitung der Germanen in vor- und frügeschichtlicher Zeit II (1927),<br />
297.<br />
19<br />
R. Wenskus, Stammesbildung und Verfassung. (Köln/Graz 1961) 135-136.<br />
20 L. Röhrich, Erzählforschung. In: R.W. Brednich (Hrsg.), Grundriss der Volkskunde (Berlin 2001) 515.<br />
9
Entdeckung großer ErzähIerpersönlichkeiten und setzte sich damit von der noch<br />
immer vorherrschenden romantischen Vorstellung von der Anonymität und<br />
Kollektivität des „wahren Volksgutes“ ab. Das Forschungsinteresse verlagerte sich<br />
nun mehr von den eigentlichen Erzählungen hin zu den Erzählern, den<br />
Erzählgelegenheiten, den Erzählweisen, den Wechselwirkungen zwischen den<br />
Erzählungen und den gesellschaftlichen Systemen. Indem Kontextanalyse das<br />
gesamte Lebensumfeld der mündlichen Traditionen in der Gesellschaft in die<br />
Betrachtung einschloss, strebte sie keine Erklärung für diese Überlieferung an,<br />
sondern fragte nach ihrer Bedeutung, ihrem Sinn und ihrer Funktion. <strong>Die</strong>se sind<br />
kontextabhängig, d.h. der Kontext bestimmt in der konkreten Situation über die<br />
Bedeutung des Übermittelten: Er fungiert als der Interpretant der<br />
Volksüberlieferung 21 . Ebenso ließe sich dieses volkskundliche Modell auf die<br />
archäologische Fundinterpretation übertragen.<br />
<strong>Die</strong> Eroberung Galliens war um 50 v. Chr. mit den Feldzügen gegen die Stämme<br />
zwischen Rhein und Maas abgeschlossen. In das weitgehend verwüstete und auch<br />
entvölkerte <strong>Eburonen</strong>gebiet wanderten wohl zunächst ohne ausdrücklichen<br />
römischen Schutz die rechtsrheinischen Ubier ein, wobei unklar ist, ob ihre reguläre<br />
Umsiedlung bereits während der ersten Statthalterschaft Agrippas (39/38 v. Chr.)<br />
oder während seiner zweiten Statthalterschaft (20-18 v. Chr.) vorgenommen wurde 22 .<br />
Marcus Vipsanius Agrippa war zweifacher Statthalter Galliens und Gründer des<br />
oppidum Ubiorum, der frühesten Ansiedlung auf heutigem Kölner Boden 23 . Seine<br />
Tochter war Agrippina, die Ältere 24 . Sie und Germanicus wiederum hatten Agrippina,<br />
die Jüngere zur Tochter, welche im Jahr 50 n. Chr. den Status der Colonia für ihren<br />
Geburtsort im oppidum Ubiorum bewirkte: Colonia Claudia Ara Agrippinensium 25 .<br />
Im westlichen ehemaligen <strong>Eburonen</strong>gebiet wurden Texuandrer, wahrscheinlich<br />
Reste der <strong>Eburonen</strong> angesiedelt und im südlichen Gebiet Reste von Aduatukern und<br />
weiteren versprengten <strong>Eburonen</strong>. In diesem südlichen Teil entstand dann der Stamm<br />
21 R.W. Brednich, Methoden der Erzählforschung. In: S. Göttsch/A. Lehmann, Methoden der<br />
Volkskunde. Positionen, Quellen, Arbeitsweisen der Europäischen Ethnologie (Berlin 2007) 67-68.<br />
22 Joachim 2000, 160.<br />
23 H. Cancik/H. Schneider (Hrsg.), Der neue Pauly. Enzyklopädie der Antike (Stuttgart/Weimar 1996)<br />
294 s.v. „Agrippa“.<br />
24 Der neue Pauly, 297.<br />
25 Der neue Pauly, 298.<br />
10
der Tungrer, von dem sich heute die Stadt Tongeren ableitet. Auch der nördliche<br />
Stamm der Baetasier und der südliche Stamm der Sunucer könnte sich aus Resten<br />
der <strong>Eburonen</strong> zusammengesetzt haben. Durch die Vermischung mit den Ubiern<br />
werden diese Rest-<strong>Eburonen</strong> mit Sicherheit auch die Grundlage der neuen<br />
Bevölkerung der neuen Ubier Stadt, dem Oppidum Ubiorum, gebildet haben und<br />
waren somit auch die Vorfahren der späteren Agrippinenser 26 .<br />
Bei der „Vernichtung“ der <strong>Eburonen</strong> wird es sich wohl in erster Linie um die des<br />
namentragenden Hauptverbandes gehandelt haben, wobei einige an der Peripherie<br />
siedelnden pagi wohl weitestgehend ungeschoren davon kamen 27 .<br />
Ein Sippenverband wird im gallischen Raum als pagus bezeichnet, mehrere pagi<br />
ergeben einen Stamm. Solche Zusammenschlüsse können entweder auf<br />
gemeinsamer Abstammung beruhen oder das Ergebnis politischer Entscheidungen<br />
sein 28 .<br />
Wahrscheinlich waren die Sippenverbände der <strong>Eburonen</strong>, ähnlich wie die der<br />
übrigen Stämme zwischen Rhein und Maas, sowie im freien Germanien,<br />
Gemeinschaften aus gleichberechtigten sozialen Gruppen. Der Kern jeder<br />
Gemeinschaft war die Familie, die zusammen in einem Wohnstallhaus oder<br />
Mehrhausgehöft lebte, in der Regel als Großfamilie. Sie betrieb Ackerbau und<br />
Viehzucht an ihrem Wohnort. Ausschlaggebend für Erb- und Besitzansprüche war<br />
die Abstammung vom Vater. Trotzdem hatten auch Frauen in diesem<br />
Gemeinschaftssystem eine ebenbürtige Position, denn sie garantierten den<br />
Fortbestand der eigenen Sippe, die Solidarität mit der angeheirateten Sippe und<br />
standen unter dem Schutz der eigenen Verwandtschaft und des Ehemanns.<br />
Jede Gemeinschaft hatte außerdem ihre „Experten“: Priester, Heilkundige, Seher(-<br />
innen), Handwerker oder andere Personen mit außergewöhnlichen Qualitäten 29 .<br />
Auch „Anführer“ zählen hierzu. Einer von allen erwählten und akzeptierten<br />
Persönlichkeit mit entsprechenden Kompetenzen übertrug der Stamm die politische<br />
Verantwortlichkeit, vor allem in Notsituationen, wie z.B. die der römischen<br />
Bedrohung. <strong>Die</strong>se „Experten“ sollten Ratschläge geben, die anerkannt wurden,<br />
26 H. Galsterer, Von den <strong>Eburonen</strong> zu den Agrippinensiern. Aspekte der Romanisierung am Rhein.<br />
Kölner Jahrbuch für Vor- und Frühgeschichte 23, 1990, 117-118.<br />
27 Galsterer 2001a, 21.<br />
28 U. Heimberg, Gesellschaft im Umbruch. Aspekte der Romanisierung – 1. Gleichheitsnormen<br />
zwischen Rhein und Maas, in: Das Rheinische LandesMuseum Bonn, H. 4 (1997), 81.<br />
29 Heimberg 1997, 84.<br />
11
keine Befehle, die Gehorsam verlangten. Nach Beendigung der Krise traten sie in<br />
der Regel wieder zurück, auch wenn ihr Erfolg zu deren Lösung beigetragen hatte.<br />
Im Fall der <strong>Eburonen</strong> gab es sogar zwei Anführer. Sie konnten die Notsituation<br />
jedoch nicht zum positiven wenden und zogen „ihre“ Konsequenzen auf andere Art<br />
und Weise.<br />
Genauso wenig wie Führungspersönlichkeiten ihren Status in Friedenszeiten<br />
aufrecht erhielten, gab es keine Armee von Kriegern im Sinne eines stehenden,<br />
einsatzbereiten Heeres. Deshalb standen die römischen Truppen bei den<br />
Eroberungszügen auch nicht ebenbürtigen Armeen gegenüber, sondern<br />
heterogenen Stammesmilizen, deren Stärke eher der Guerillakampf war 30 . Insofern<br />
richteten sich die Kampfhandlungen zwangsläufig auch gegen die ansässige<br />
Bevölkerung: Zwar konnte sie sich in einer Schlacht durch Ausweichen in Wälder,<br />
Sümpfe und Dünen entziehen. Äcker, Weiden und Siedlungen waren dem Feind<br />
dann folglich schutzlos ausgeliefert. Dessen Taktik verlangte jetzt Plünderung,<br />
Verwüstung und komplette Zerstörung. Caesars Invasionen hatten also gerade in<br />
den weniger entwickelten Gebieten wie dem Territorium der <strong>Eburonen</strong> die<br />
katastrophalsten Auswirkungen. Zu der Kriegsführung der „Verbrannten Erde“ kam<br />
eine grausame Dezimierung der Bevölkerung. Außer die <strong>Eburonen</strong> traf es außerdem<br />
die Nervier, Aduatuker, Menapier und Moriner an der Küste mit besonderer Härte.<br />
Den Kriegswirren muss wohl eine Zeit der Orientierungslosigkeit und Verzweiflung<br />
gefolgt sein, gezeichnet vom Ende traditioneller Zusammenhalte und ausgewogener<br />
Machtverhältnisse, von Identitätsverlust, der Zerstörung von Existenzgrundlagen, von<br />
Hungersnöten, Bevölkerungsrückgang und materieller Armut.<br />
30 U. Heimberg, Was bedeutet Romanisierung? Das Beispiel Niedergermanien. Antike Welt 29 (1998)<br />
19-40, 26-27.<br />
12
III. Archäologisches<br />
a) Neun Fundplätze im linksrheinischen Rheinland<br />
1. Niederzier-Hambach (Kr.Düren), spätlatènezeitliches „Mehrhausgehöft“<br />
(Hambach 382)<br />
Der Fundort Niederzier-Hambach befindet sich im Westen der Jülicher Lößbörde<br />
zwischen Jülich und Bergheim, im Bürgerwald oder Hambacher Forst 31 . Er wurde<br />
1977 bei den Erschließungsarbeiten für den Braunkohletagebau Hambach I entdeckt<br />
und in jährlichen Grabungskampagnen von 1977 – 1982 untersucht. Es wurde ein<br />
2,7 ha großes, durch Doppelgräben eingegrenztes Siedlungsareal freigelegt, auch<br />
bekannt als Hambach 382.<br />
Es ließen sich zwei Bauphasen nachweisen, eine ältere und eine jüngere<br />
Siedlungsphase innerhalb der Spätlatènezeit.<br />
Das Areal wurde von zwei parallel verlaufenden und noch deutlich sichtbaren<br />
Spitzgräben umfasst, welche in die jüngere Bauphase datieren. <strong>Die</strong> beiden Gräben<br />
waren 5 bzw. 3 m breit und 2 m tief. Innen wurden sie von einem 5 - 6 m breiten<br />
Streifen begleitet, der die Lage der einstigen Holz-Erde-Mauer anzeigte. <strong>Die</strong>ser<br />
Mauertyp ist ein Holzrahmenwerk, das mit Erde verfüllt wurde und dessen Balken<br />
verzapft und mit Holznägeln befestigt waren 32 . Im Norden wurde sie von einem<br />
Zweikammertor unterbrochen.<br />
Über das Innenareal verteilten sich 120 mehrere kleine Gruben und 2128<br />
Pfostengruben. Somit konnten im Planum 266 Bauten rekonstruiert werden. Es<br />
handelte sich um Bauten mit rechteckigem bis viereckigem Grundriss: 32<br />
Neunpfostenbauten, ein Achtpfostenbau, 116 Sechspfostenbauten, 117<br />
Vierpfostenbauten. <strong>Die</strong> Bauweise sowie Funde von verbranntem Flechtwerkverputz<br />
zeigen, dass es sich um lehmverputzte Fachwerkbauten gehandelt haben muss 33 .<br />
Durch Pfostengrubenüberschneidungen und Ausgrenzung von Gebäuden, die nicht<br />
gleichzeitig bestanden haben können, gelang die Einteilung in zwei Bauphasen<br />
31 J. Gechter-Jones, Hausformen und Siedlungsbild der spätlatènezeitlichen Siedlung Niederzier-<br />
Hambach 382, Kr. Düren, Deutschland. Arch. Austriaca 810, 1996, 238 ff.<br />
32 J. Göbel, Das Modell der spätlatènezeitlichen befestigten Siedlung Niederzier. Archäologie im<br />
Rheinland 1992, 192-194.<br />
33 Göbel 1992a, 194.<br />
13
innerhalb der Stufe Latène D 34 . Somit konnte ein Modell für die jüngere Bauphase<br />
herausgearbeitet werden, welches folgende Befunde liefert: Doppelgräben, Streifen<br />
des erodierten Walles, Brunnen, 15 Neunpfostenbauten, 41 Sechspfostenbauten, 46<br />
Vierpfostenbauten 35 . Mit der Einteilung der Gebäudetypen konnten im Süden der<br />
Anlage sechs Hofkomplexe ausgemacht werden 36 . Sie könnten somit aus<br />
Wohnhaus, Wirtschaftsgebäuden, Stallungen und Speichern bestanden haben.<br />
Insbesondere sind der Brunnen und die Befestigungsanlage als<br />
„Gemeinschaftswerke“ zu interpretieren. <strong>Die</strong> Beschaffenheit der Gebäude muss<br />
weitestgehend identisch gewesen sein, d.h. es gibt keinen bautechnischen Hinweis<br />
auf Eliten bzw. andere herausragende Merkmale innerhalb der sozialen Struktur.<br />
Vermutlich haben wir es mit einer weitgehend egalitären Gesellschaft zu tun, ähnlich<br />
wie sie in Teil II der Arbeit zu den linksrheinischen Germanen beschrieben wurde.<br />
Hambach 382 war eine landwirtschaftliche Siedlung. <strong>Die</strong> vorhandene Kapazität an<br />
Speichergebäuden reichte nur aus für den Eigenbedarf, überschüssige Produktion<br />
wurde vermutlich verhandelt. <strong>Die</strong> wenigen Schlackenfunde, darunter auch eine<br />
Luppe, sind kein hinreichendes Indiz für die Produktion von Eisen. Jedoch weisen<br />
zwei Eisenbarrenhorte auf zumindest lokale Handelstätigkeit hin 37 . Sie lagen in<br />
Bündeln zu 12 und 91 Stück in zwei Gruben im Norden der Siedlung 38 . Depots von<br />
Eisenbarren können sowohl zu profanen Zwecken in den Boden gekommen sein, als<br />
auch Hinweis auf eine Opferdeponierung bergen 39 . Barren haben ihren eigenen<br />
standardisierten Metallwert, der sie auf eine ähnliche Stufe stellt, wie die Münzen.<br />
Besonders wenn Barren sich in Depots zu monotoner Gleichförmigkeit aufhäufen,<br />
verstärkt sich der Verdacht auf ihre Bestimmung als Gerätegeld. Niederlegungen in<br />
einem sakralen Kontext wird z.B. auch bei den Eisenbarrenfunden in La Tène<br />
vermutet, wo zwei Dutzend von ihnen zum Vorschein kamen, sowie bei den<br />
schwertförmigen Eisenbarren aus dem Fluss Limmat in Zürich 40 .<br />
34 s. Abb. 2<br />
35 s. Abb. 3<br />
36 s. Abb. 4<br />
37 s. Abb. 5<br />
38 J. Gechter-Jones: <strong>Die</strong> befestigte spätlatènezeitliche Siedlung Niederzier, Kr. Düren. In: G. Uelsberg<br />
(Hrsg.): Krieg und Frieden-Kelten, Römer, Germanen. Katalog Rheinisches LandesMuseum (Bonn<br />
2007) 163 – 165.<br />
39 F. Müller, Götter, Gaben, Rituale (Mainz 2002) 199 -204.<br />
40 s. Abb. 6<br />
14
Neben einigen Fibeln und einer eisernen Pflugschar fand sich noch zerbrochene<br />
Keramik, die in der nächsten Zeit von Joachim erstmalig publiziert wird.<br />
Der spektakulärste Fund auf dem Boden von Hambach 382 war mit Sicherheit der<br />
Goldhort, der am 17. Mai 1978 am westlichen Siedlungsrand gefunden wurde 41 . Es<br />
handelte sich um insgesamt zwei Halsringe, einen Armring aus Gold sowie um 46<br />
Goldmünzen 42 . <strong>Die</strong> Grube mit dem Schatz befand sich unmittelbar am Wall des<br />
inneren Grabens. Den Erdverfärbungen nach zu urteilen, hatte wohl ursprünglich ein<br />
angespitzter Pfosten in ihr gesteckt. Bei der Auffindung lag der Schatz eingebettet in<br />
die Scherben einer Tonschale 43 . Ihre Form ist im Latène D des südlichen<br />
Niederrheingebietes verbreitet. <strong>Die</strong> beiden Goldhalsringe mit den Pufferenden<br />
entsprechen der Form, wie man sie für den keltischen Raum als Torques bezeichnet.<br />
<strong>Die</strong> Halsringe der Kelten nannten schon die Römer „Torques“ (lat. „die Gedrehten,<br />
die Gewundenen“) 44 . Es gab sie seit der Frühlatènezeit , in der sie hauptsächlich in<br />
Frauenbestattungen der keltischen Elite zu finden waren. Ab der Mittellatènezeit<br />
verschwanden sie aus den Frauengräbern und traten danach in keltischen Gräbern<br />
nicht mehr auf. Ab dieser Zeit wurden Halsringe von Männern der gehobenen<br />
keltischen Gesellschaftsschicht für sich entdeckt. Torques aus Gold waren selbst bei<br />
ihnen der gesellschaftlichen, politischen und militärischen Elite vorbehalten. Über<br />
das Statussymbol hinaus wird dem Torques auch eine magische Bedeutung<br />
zugesprochen, die über das profane Schmuckstück hinausging. Vielleicht sollte er<br />
Kriegern Kraft und Unbesiegbarkeit im Kampf verleihen 45 .<br />
Von den Hambacher Torques war einer noch ganz erhalten, allerdings hatte man<br />
ihm einen Puffer mitsamt des Schaftes abgebrochen. Vom zweiten Torques fehlte<br />
die hintere Hälfte des Ringkörpers. Der Ringkörper besteht aus 0,5 mm starkem<br />
getriebenen Goldblech, eine Goldröhre von 15 cm äußerem Durchmesser. Der<br />
Verschluss der Ringe besteht aus einem praktischen Mechanismus:<br />
41 s. Abb. 7<br />
42 J. Göbel, Der spätkeltische Goldschatz von Nierderzier. Bonner Jahrb. 191, 1991, 27-84.<br />
43 s. Abb. 8<br />
44 P. J. Muenzer, Torques oder die Wunderwelt der keltischen Halsringe (1996) 9 ff. .<br />
45 Muenzer 1996, 15.<br />
15
An den linken Puffer ist ein unverzierter, spulenförmiger Steg angelötet, dessen<br />
Endscheibe von 9 mm Durchmesser ein einfacher Haken aufsitzt. Rastet dieser in<br />
den Schlitz der Endscheibe des rechten Puffers ein, ist der Ring geschlossen 46 .<br />
Der Armring besteht aus zwei gegossenen Teilen, wie auf Abb. 9 von der<br />
Schatzauffindung gut zu erkennen ist.<br />
Alle Hambacher Ringe sind aufgrund gleicher Fertigungs-, Form- und<br />
Verzierungselemente zeitlich zusammengehörig und stammen aus der Produktion<br />
eines Goldschmieds oder zumindest aus der gleichen Werkstatt.<br />
Hinsichtlich Form und Design sind die Halsringe von Beringen 47 sowie die<br />
verschollenen Ringe von Formigliana den Niederzierer Ringen am ähnlichsten 48 49 .<br />
Von den 46 geborgenen Goldmünzen 50 sind 26 Regenbogenschüsselchen. Hierbei<br />
handelt es sich um kleine, beim Schlagen schüsselförmig gewölbte Goldmünzen.<br />
Der Name stammt aus dem Volksglauben, nach dem diese Goldmünzen dort zu<br />
finden seien, wo der Regenbogen auf die Erde trifft 51 .<br />
Auf der konkaven, d.h. der nach innen gewölbten Seite, sind bei einigen Kreuzsterne<br />
eingestempelt, andere tragen die Motive von Vogelköpfen oder von Blattkränzen. <strong>Die</strong><br />
Typen mit den Vogelköpfen wurden vermutlich im Stammesgebiet der keltischen<br />
Vindeliker geprägt 52 . <strong>Die</strong>ses befand sich im Alpenvorland zwischen Bodensee und<br />
Inn, also im heutigen Südbayern. <strong>Die</strong> Vindeliker hatten eine eigene Münzprägung,<br />
die aber wiederum stark von den keltischen Boiern inspiriert war 53 . Ihr Hauptort war<br />
wahrscheinlich das Oppidum von Manching. <strong>Die</strong> anderen 20 Statere gehören alle<br />
demselben Typ an: auf der Vorderseite erscheint ein ziemlich verwilderter,<br />
bekränzter Kopf nach rechts, auf der Rückseite sieht man ein nach rechts<br />
springendes Pferd über einer Kugel 54 . <strong>Die</strong>se Münzart wurden neueren<br />
Forschungserkenntnissen zufolge von den <strong>Eburonen</strong> selber geprägt und<br />
46 Muenzer 1996, 41.<br />
47 s. Kapitel III, Abschnitt 2.<br />
48 A. Furger-Gunti, Der Goldfund von Saint-Louis bei Basel und ähnliche keltische Schatzfunde.<br />
Zeitschr. Schweiz. Arch u. Kunstgesch. 39, 1982, 36 ff.<br />
49 s. Abb. 10<br />
50 s. Abb. 11<br />
51 H. Birkhan, Kelten. Versuch einer Gesamtdarstellung ihrer Kultur (Wien 1997) 377.<br />
52 s. Abb. 12<br />
53 G. Dembski, Münzen der Kelten (Wien 1998) 36.<br />
16
entsprechen dem Typ nach Simone Scheers Lummen-Niederzier 55 . Modell standen<br />
die Statere der keltischen Ambianer, ein Stamm, der in der westlichen Belgica<br />
siedelte und von dem sich noch heute der Name der Stadt Amiens ableitet 56 . <strong>Die</strong><br />
eburonischen Imitationen unterscheiden sich in einigen Details: <strong>Die</strong> Münzen sind<br />
etwas kleiner, leichter, flach statt gewölbt, haben eine andere Legierung mit weniger<br />
Goldanteil und dafür mehr Silbergehalt als die ambianischen Statere. Außer in<br />
Niederzier fanden sie sich noch an drei anderen Stellen auf „<strong>Eburonen</strong>“- Gebiet und<br />
zwar in Lummen, Namêche, Fontaine-Valmont. Von den genannten Orten liegt nur<br />
Lummen in der unmittelbaren Nähe von Beringen 57 .<br />
Fraglich bleibt uns dennoch, warum die <strong>Eburonen</strong> ausgerechnet Münzen der<br />
Ambianer nachgeprägt haben, die soweit süd-westlich siedelten 58 . Denkbar ist, dass<br />
aus anderen Gründen, wie Handel oder Heirat, Kontakte zu den Ambiani bestanden<br />
haben könnten. Vielleicht war diese Münzserie auch gar nicht die einzige, die so weit<br />
nördlich in Gallien im Umlauf war, eine andere ist uns bis heute nur nicht bekannt.<br />
<strong>Die</strong> ambianischen Kopien müssen auf jeden Fall vor Beginn des Gallischen Krieges<br />
geprägt worden sein. Archäologen schätzen die Zeitspanne um 80 v. Chr. Da die<br />
Münzen Gebrauchsspuren zeigen, geht man davon aus, dass sie 5-10 Jahre im<br />
Umlauf waren.<br />
<strong>Die</strong> Statere des Typs Scheers Lummen-Niederzier datieren die Niederlegung des<br />
gesamten Goldhortes von Niederzier folglich um 75-70 v. Chr.<br />
Zur Interpretation des Goldschatzfundes hatte man vor der Analyse der<br />
ambianischen Münzkopien ursprünglich angenommen, dass er mit der Aufgabe der<br />
Siedlung entweder beabsichtigt oder unbeabsichtigt zurückgelassen wurde 59 . Außer<br />
an der Stelle, wo der Schatz gelegen hatte, wurden noch an sechs weiteren Stellen<br />
im Siedlungsareal Pfosten oder Pfähle entfernt, dessen Pfostenlöcher innerhalb<br />
54 s. Abb. 13<br />
55 S. Scheers, Les statères bifaces du type Lummen-Niederzier, un monnayage éburon antérieur à la<br />
conquête romaine. In: M. Lodewijckx (Hrsg.) Archeological and historical aspects of West-European<br />
societies. Album Amicorum André Van Doorselaer. Acta Arch. Lovaninensia Monogr. 8 (Löwen 1996).<br />
87-94.<br />
56 s. Abb. 14<br />
57 C. Creemers, S. Scheers, Wichtige Fundstücke als Zeugnisse der <strong>Eburonen</strong> in Nordostbelgien. In:<br />
G. Uelsberg (Hrsg.): Krieg und Frieden-Kelten, Römer, Germanen. Katalog Rheinisches<br />
LandesMuseum (Bonn 2007) 196-174.<br />
58 s. Abb. 17<br />
59 Göbel 1991, 33.<br />
17
kurzer Zeit wieder verfüllt worden waren. Da sich diese Pfostenlöcher auf keinen Fall<br />
mit Siedlungsbefunden in Verbindung bringen lassen, ist eine der möglichen<br />
Annahmen, dass es sich vielleicht um eine Art Kultpfähle gehandelt haben könnte,<br />
die ein bestimmtes Kultareal „umzäunten“. Es hätte sich um eine der letzten<br />
Aktivitäten der Bewohner handeln können, bevor sie die Siedlung verließen: Sie<br />
waren Stammesmitglieder der <strong>Eburonen</strong>, die der römischen Bedrohung 53 v. Chr.<br />
weichen mussten.<br />
<strong>Die</strong> Datierung der ambianischen Münzkopien zeigen uns jedoch, dass der Schatz<br />
schon ca. 20 Jahre vorher in den Boden gekommen sein muss, dessen Deponierung<br />
also gar nichts mit dem Einfall der Römer zu tun hatte.<br />
Auf jeden Fall wurde die Siedlung ohne vorherigen Kampf aufgegeben und<br />
verlassen, da keinerlei Anzeichen auf eine Brandzerstörung hinweisen. Vermutlich<br />
lebte schon lange niemand mehr in Hambach 382, als römische Legionen das Land<br />
verwüsteten.<br />
2. Beringen (Belgien), Goldschatzdepot<br />
Im Oktober 1995 wurde beim Bau eines Wohnhauses zwischen der Voetbalstreet<br />
und Molenlaan im belgischen Beringen ein Goldschatz entdeckt 60 . Ähnlich wie der<br />
Hortfund von Niederzier bestand er aus einem vollständigen goldenen Torques,<br />
einem Bruchstück eines zweiten Torques, dem Teilstück eines tordierten Armbands<br />
sowie aus 25 goldenen Stateren 61 . Wie die Vergleichfunde aus Hambach sind die<br />
Halsringe innen hohl und haben Enden in Form von Pufferköpfen. Der<br />
Schließmechanismus ist der gleiche, wie der in Hambach beschriebene 62 . <strong>Die</strong><br />
Halsringe haben einen Außendurchmesser von 14 cm. (Der Hambacher Halsring<br />
hatte einen Außendurchmesser von 15 cm). <strong>Die</strong> Halsringe aus Beringen ähneln<br />
denen aus Niederzier so sehr, da sie vermutlich aus derselben Werkstatt stammen,<br />
vielleicht sind sie sogar die Arbeit ein- und desselben Goldschmieds. Das Armband<br />
besteht aus tordiertem (gedrehten) Golddraht, der in einer Schlaufe endet. Auch<br />
60 L. van Impe/G. Creemers/R. van Laere/S. Scheers/H. Wouters/B. Ziegaus, De Keltische goudschat<br />
van Beringen (prov. Limburg). Arch. Vlaanderen 6, 1997/1998, 9–132.<br />
61 s. Abb. 15 + 15a<br />
62 s. Abb. 16<br />
18
sämtliche Münzen bestehen aus Gold. 22 von ihnen gehören wieder zum Typ der<br />
Regenbogenschüsselchen, die drei übrigen sind Statere des Typus Scheers II (au<br />
croissant) 63 , alle wurden von den keltischen Atrebaten hergestellt, die wie die<br />
Ambianer in der westlichen Belgica ansässig waren 64 .<br />
<strong>Die</strong> Regenbogenschüsselchen haben ihre übliche leichte Schüsselform. Beide<br />
Flächen, die konkave und die konvexe Seite, enthalten keine Abbildungen. Trotzdem<br />
handelt es sich um bestempelte Goldmünzen, erfolgt mit mehreren Stempelpaaren.<br />
Solche motivlosen, schüsselförmigen Statere befanden sich übrigens auch in den<br />
Funden von Siena in Norditalien und von Wallersdorf (Niederbayern) 65 . Aufgrund der<br />
Vergleichsfunde Siena und Wallersdorf wird der Schatz von Beringen durch seine<br />
Münzen ins 2. Jhdt. v. Chr. datiert, seine Niederlegung erfolgte also früher als in<br />
Niederzier-Hambach 66 .<br />
<strong>Die</strong> weite Verbreitung von Regenbogenschüsselchen und ihr Vorkommen in<br />
Schatzfunden, die zum Teil über Hunderte von Kilometern Entfernung (Niederzier-<br />
Siena) große Ähnlichkeiten aufweisen, zeigen auf der einen Seite die Wertschätzung<br />
bei verschiedenen keltischen Stämmen, auf der anderen Seite sind sie auch ein<br />
Beleg für Kontakte über weite räumliche Distanzen hinweg.<br />
Möglicherweise galten Regenbogenschüsselchen, ähnlich wie die Torques, bei den<br />
Kelten als Prestigeobjekte. Vielleicht war es üblich, sie als Gastgeschenke zu<br />
verwenden, als Tributzahlungen oder Frauen als Mitgift mit in die Ehe zu geben.<br />
<strong>Die</strong> stereotype Zusammensetzung von Funden wie Beringen und Niederzier im<br />
Zusammenhang mit Halsring und Armreif schließt meines Erachtens auch eine<br />
Niederlegung als Opfergabe nicht aus.<br />
Große Ähnlichkeiten mit den Torques aus Niederzier-Hambach und Beringen hatten<br />
die beiden Torques von Formigliana im Vercellese (Italien). Auch mit einem<br />
Durchmesser von 16 cm kamen sie sehr nah an die Maße dieser weitaus nördlicher<br />
gelegenen Funde heran. Sie sind bis heute verschollen, es existieren lediglich noch<br />
alte Photographien von ihnen 67 . Der Fundort Beringen liegt eher am Nordwestrand<br />
des <strong>Eburonen</strong>gebiets, vielleicht befand er sich auch schon auf dem Territorium der<br />
63 S. Scheers, Traité de numismatique celtique II. La Gaule belgique (Paris 1977).<br />
64 s. Abb. 17<br />
65 s. Abb. 18<br />
66 van Impe u.a. 1997/98, 68.<br />
67 s. Abb. 10<br />
19
Aduatuker 68 . Im letzteren Fall könnte es sich vielleicht um eine Art Tributzahlung der<br />
<strong>Eburonen</strong> an die Aduatuker handeln, denen die <strong>Eburonen</strong>, genau wie den Treverern<br />
tributpflichtig waren.<br />
3. Heers (Belgien), Münzschatz<br />
In Heers in der Nähe von Tongeren wurde ebenfalls ein bedeutender Münzschatz<br />
gefunden 69 . Er besteht aus goldenen Stateren, von denen 78 von den <strong>Eburonen</strong><br />
stammen, 21 von den keltischen Nerviern, eine von den Veliocassen und eine von<br />
den Treverern. Sowohl die Münzen der <strong>Eburonen</strong> als auch die der Nervier zeigen<br />
übereinstimmende Motive und lassen keine Gebrauchsspuren erkennen. Letzteres<br />
bedeutet, dass sie frisch aus den Prägewerkstätten in die Erde kamen und noch<br />
nicht im Umlauf waren. <strong>Die</strong> Zusammensetzung mit Münzen anderer Stämme und<br />
deren typologische Einordnung spricht dafür, dass die eburonischen Münzen zur Zeit<br />
des Gallischen Kriegs geprägt wurden. Vielleicht wurde das Geld benötigt im<br />
Aufstand von Ambiorix im Jahr 54 v. Chr. Nach dem siegreichen Überfall der<br />
<strong>Eburonen</strong> auf das Winterlager Aduatuca, hatte Ambiorix auch die Nervier, Aduatuker<br />
und Treverer als Verbündete gewinnen können. Anscheinend konnten die Münzen<br />
nicht mehr ihre Zweckbestimmung erfüllen, da Caesars Rachefeldzug ihrer<br />
Bezahlung zuvorkam.<br />
<strong>Die</strong> 78 eburonischen Statere entsprechen dem Typ Scheers 31 I 70 . Gewicht und<br />
Goldgehalt sind sehr gering, im Vergleich zu den Münzfunden der Vorkriegszeit. <strong>Die</strong><br />
Anfertigung außerordentlich großer Mengen an Stateren als Kriegsgeld zwang<br />
vermutlich die keltischen Führer, ihren Goldgehalt drastisch zu senken. <strong>Die</strong> Triskelen<br />
(Dreierwirbel) auf den Vorderseiten der eburonischen Münzen sind auch auf<br />
germanischen Geldstücken der gleichen Zeitstellung abgebildet und wurden vor<br />
allem in Hessen gefunden 71 . Es ist denkbar, dass Kontakte zu rechtsrheinischen,<br />
germanischen Stämmen wie z.B. den Ubiern bestanden haben, deren Motiv sich auf<br />
68 s. Abb. 19<br />
69 Creemers/Scheers 2007, 171.<br />
70 C. Klages, Spuren in das vorrömische Bonn. In: Forschungen zur Vorgeschichte und Römerzeit im<br />
Rheinland. Beih. D. Bonner Jahrb. 57, 2008, 226.<br />
71 Creemers/Scheers 2007, 173.<br />
20
den eburonischen Münzen wiederfindet 72 . Caesar selbst schreibt, dass die <strong>Eburonen</strong><br />
durch germanische Verbündete von der anderen Rheinseite unterstützt wurden 73 .<br />
Das Oppidum auf dem Dünsberg im Kreis Gießen in Hessen war damals noch der<br />
Hauptort der Ubier auf rechtsrheinischem Gebiet. 13 solche goldenen<br />
Dreiwirbelstatere wurden hier gefunden, die aller Wahrscheinlichkeit auch auf dem<br />
Dünsberg geprägt wurden. Sie repräsentieren immerhin die dominierende<br />
Goldprägung im Münzumlauf auf dem Dünsberg. Mit den goldenen<br />
Dreiwirbelstateren beginnt in Mittelhessen in einem fortgeschrittenen Abschnitt der<br />
Stufe LT D1 eine eigene Prägetradition. <strong>Die</strong> Münzen stehen hiermit zeitlich ganz am<br />
Ende der keltischen Goldprägung. Der Dünsberg war in der späten Latènezeit als<br />
Zentraloppidum zweifellos das wichtigste ubische Zentrum 74 . Für die Münzprägung<br />
auf dem Dünsberg spricht der Fund einer Münzpatrize 75 . Mit den Patrizen wurden<br />
eiserne Münzstempel beprägt, wie sie mehrfach aus spätkeltischen<br />
Zusammenhängen bezeugt sind 76 . Patrizen ermöglichten ein effektives<br />
Münzproduktionsverfahren und sind insbesondere dort zu vermuten, wo eine große<br />
Menge an fast identischen Münzen vorhanden ist. Bei der Patrize vom Dünsberg<br />
handelt es sich um eine zylindrische Form aus Bronzelegierung 77 . Allerdings zeigt<br />
der Stempel das Rückseitenbild einer treverischen Münze vom „Titelberg-Typ“,<br />
welche in Mittelhessen aber überhaupt nicht vorkommt. Der Fund könnte jedoch als<br />
Mobilität bei der Ausübung des Münzprägehandwerks interpretiert werden: Stempel<br />
scheinen über längere Entfernungen mitgenommen worden und an verschiedenen<br />
Orten verwendet worden zu sein 78 . So untermauert meiner Ansicht nach gerade der<br />
Fund einer „fremden“ Patrize das Argument für den Dünsberg als<br />
Münzprägezentrum.<br />
<strong>Die</strong> Statere von Heers erreichen nur noch ein Durchschnittsgewicht von 7,3 g im<br />
Gegensatz zu ehemals 7,7 g. Quantitative Analysen haben ergeben, dass der<br />
72 s. Abb. 20<br />
73 N. Roymans, Ethnic Identity and Imperial Power. The Batavians in the Early Roman Empire.<br />
Amsterdam Arch. Studies 10 (Amsterdam 2004) 44.<br />
74 J. Schulze-Forster, <strong>Die</strong> latènezeitlichen Funde vom Dünsberg (ungedr. Diss. Marburg 2002) 113.<br />
75 Ders., 129.<br />
76 S. Sievers u.a, Vorbericht über die Ausgrabungen 1996-1997 im Oppidum von Manching. Germania<br />
76, 1998, 647, Abb. 6.<br />
77 Schulze-Forster 2002, Tafel M 15, 286-289.<br />
21
Goldanteil nur noch zwischen 40 und 60 % beträgt, Silber und Kupfer zulegiert<br />
wurden 79 . <strong>Die</strong> goldenen Dreiwirbelstatere bilden das Schlussglied in der Kette der<br />
goldenen Regenbogenschüsselchen. Ihre Laufzeit reicht bis an das Ende der Stufe<br />
LT D1, also in das zweite Viertel des 1. Jhdt. v.Chr. Es erscheint mir nicht<br />
unwahrscheinlich, dass der Münzschatz von Heers sogar auf dem Dünsberg geprägt<br />
wurde.<br />
In Abschnitt 1 dieses Kapitels habe ich bereits angesprochen, dass diese<br />
Regenbogenschüsselchenart ikonographisch in Tradition der vindelikischen<br />
Goldprägung steht. Der Dreierwirbel ist ein typisch keltisches Symbol und gehört<br />
neben Palmetten, Ranken, Lotusblüten und Spiralmustern zu den Leitmotiven der<br />
latènezeitlichen Ornamentik 80 . <strong>Die</strong> Rückseite der Statere zeigen ein Pferdemotiv, das<br />
stark an die Münzen der Treverer erinnert, der benachbarte Stamm, dessen Klienten<br />
die <strong>Eburonen</strong> waren. Wiederum schreibt hierzu Caesar, dass Ambiorix seinen<br />
Aufstand gegen die Römer auf Drängen von Indutiomarus, dem Führer der Treverer,<br />
anzettelte. Tatsächlich war Indutiomarus die Schlüsselfigur in der antirömischen<br />
Koalition von 54 v. Chr. <strong>Die</strong> Münzen von Heers verraten uns also einiges über die<br />
Bündnispolitik der <strong>Eburonen</strong> gegen Caesar in ihren letzten Jahren 81 .<br />
4. Kreuzweingarten (Kr. Euskirchen), „Alter Burgberg“<br />
In dem Voreifelort Kreuzweingarten im Kreis Euskirchen liegt auf einer<br />
vorgeschobenen Bergzunge der „Alte Burgberg“, ein eisenzeitlicher Ringwall, dessen<br />
Erdwälle heute noch gut sichtbar im Gelände sind 82 . Sie verlaufen auf einer Höhe<br />
zwischen 250 und 260 m ü.N.N. Der nach Norden, Westen und Süden stark<br />
abschüssige Burgberg wurde mit einem Verteidigungssystem aus Wall und Graben<br />
gesichert 83 . Im Osten sind ein zweiter Wall und Gräben vorgelagert, die durch einen<br />
Eingang in der Mitte passiert werden konnten 84 .<br />
78 Schulze-Forster 2002, 129.<br />
79 Creemers/Scheers 2007, 173.<br />
80 Birkhan 1997, 357.<br />
81 Roymans 2004, 44.<br />
82 s. Abb. 21 – 21b.<br />
83 s. Abb. 22<br />
22
Zwischen 1921 und 1928 fanden Ausgrabungen durch das damalige<br />
Provinzialmuseum Bonn auf dem „Alten Burgberg“ statt. Im Laufe dieser Jahre<br />
konnten in 38 Schnitten die Wälle und die Gräben sowie ein Teil der Innenfläche<br />
untersucht werden 85 . <strong>Die</strong> Wälle waren errichtet worden aus trocken gesetzten<br />
Mauerschalen, mit Erdreich verfüllt. <strong>Die</strong> Mauern sicherten senkrechte und<br />
waagerechte Balkenlagen an den beiden Außenseiten. <strong>Die</strong> sichtbaren Außenbalken<br />
wiederum verbanden waagerechte Hölzer, die das Wallsystem festigten. Der Wall<br />
war ursprünglich 5,50 m breit 86 .<br />
<strong>Die</strong>se Bauweise entspricht dem Typ des sogenannten „murus gallicus“, einer<br />
gallischen Mauer. <strong>Die</strong> Bezeichnung murus gallicus stammt von Caesar selbst, den<br />
das Verteidigungswerk der Kelten offensichtlich imponiert hatte. Er beschreibt es<br />
ausführlich in Buch 7, Abschnitt 23:<br />
„Man legt gerade Balken aus einem Stück senkrecht zur Mauerrichtung in immer<br />
gleichem Zwischenraum von zwei Fuß nebeneinander auf die Erde. <strong>Die</strong>se Balken<br />
werden innerhalb des Mauerwerks zusammengeklammert und mit einer starken<br />
Erdschicht belegt. <strong>Die</strong> genannten Zwischenräume werden vorne mit großen Steinen<br />
ausgefüllt. Ist diese Schicht gelegt und fest verbunden, kommt oben eine weitere<br />
Balkenlage darauf. Dabei hält man genau denselben Abstand ein, doch liegen die<br />
Balken nicht aufeinander, sondern sind in gleichen Zwischenräumen versetzt.<br />
Dadurch aber, dass immer Steine zwischen sie kommen, werden die Balken fest<br />
zusammengehalten. So wird der ganze Bau Lage um Lage fortgesetzt, bis die<br />
richtige Mauerhöhe erreicht ist. Der regelmäßige Wechsel der in geraden Linien<br />
sauber geschichteten Balken und Steine gibt dem Werk ein gefälliges und<br />
abwechslungsreiches Aussehen. <strong>Die</strong>se Bauweise ist aber auch sehr nützlich und<br />
vorteilhaft zum Schutz von Städten, weil der Stein vor Brand schützt, gegen den<br />
Mauerbrecher aber das Holz. Gewöhnlich sind die Querbalken im Inneren des<br />
Mauerwerks noch durch fortlaufende vierzig Fuß lange Balken miteinander<br />
verbunden, so dass man sie weder durchbrechen noch auseinander zerren kann.<br />
Trotz der von Caesar beschriebenen Brandbeständigkeit zeigt der Befund, dass<br />
Teile der äußeren Wallanlage offensichtlich durch Brand zerstört wurden.<br />
Trockenheit, den Brand begünstigender Wind und eine hohe<br />
Entzündungstemperatur könnten Faktoren dafür gewesen sein 87 .<br />
Bei einem Schnitt durch die Innenfläche konnten zahlreiche Pfostenlöcher<br />
festgestellt werden. Aufgrund des kleinen Querschnitts ließen sich allerdings keine<br />
84 H.G. Horn (Hrsg.), <strong>Die</strong> Römer in Nordrhein-Westfalen (Stuttgart 1987) 425-429.<br />
85 s. Abb. 23<br />
86 H.E. Joachim, in: Führer zu vor- und frühgeschichtlichen Denkmälern, Bd. 26, Mainz 1974, 149-152.<br />
87 Birkhan 1997, 345-346.<br />
23
klaren Hausgrundrisse erkennen. An Funden gab es nur ein paar Keramikscherben<br />
und zwar die spätlatènezeitlicher Typen 88 . <strong>Die</strong> Scherben und der Mauertyp des<br />
murus gallicus ermöglichen eine Datierung ins 1. Jhdt. v. Chr.<br />
Aus der Spärlichkeit der Funde innerhalb des Ringwalls schloss man bislang auf<br />
eine nicht ständige Besiedlung, so dass sich die Vermutung aufdrängt, die ansässige<br />
Bevölkerung hat die „Alteburg“ lediglich als „Fliehburg“ zu Verteidigungszwecken<br />
benutzt.<br />
<strong>Die</strong> Brandschichten am Außenwall belegen, dass die „Alteburg“ im Zuge von<br />
Kampfverhandlungen zerstört wurde. So kommen die Auseinandersetzungen<br />
zwischen römischen Truppen und eburonischen Stämmen oder deren Verbündeten<br />
hierfür beispielhaft in Frage. Caesar schreibt hierzu in Buch 7, Abschnitt 15, dass<br />
die Gallier an einem Tage zwanzig solcher Burgen verbrannt hätten, damit sie nicht<br />
mit den Vorräten den Römern in die Hände fielen 89 . Im Gegensatz zu Niederzier-<br />
Hambach wird mit dem Fundort Kreuzweingarten erstmalig ein Kriegsschauplatz der<br />
Jahre 53-50 v. Chr. greifbar.<br />
Ein beeindruckender Vergleichsbefund zum oben beschriebenen Typ des Murus<br />
Gallicus befindet sich nicht allzu weit entfernt in Otzenhausen im Hunsrück und somit<br />
auf dem ehemaligen Territorium der verbündeten Treverer 90 . Dort wird seit 1999 in<br />
umfangreichen Grabungskampagnen eine der gigantischsten Ringwallanlagen<br />
Europas erforscht. Den Besucher beeindrucken heute noch gewaltige Sturzwälle von<br />
10 m Höhe und 40 m Breite 91 . Sie stammen von einer Mauer, die ursprünglich ca. 20<br />
m hoch und ca. 25 m breit war und dem Typ des murus gallicus entspricht 92 . <strong>Die</strong><br />
Innenfläche der Wallburg lässt sich in eine 12 ha große Hauptburg und eine 6,5 ha<br />
umfassende Vorburg gliedern. <strong>Die</strong> heute sichtbaren Steinwälle sind das Ergebnis<br />
eines fast 400 Jahre dauernden Bauprozesses. Im Volkskmund ist der Ringwall von<br />
Otzenhausen auch als Hunnenring bekannt; man hatte ihn ursprünglich mit dem<br />
Einfall der Hunnen in Verbindung gebracht. <strong>Die</strong> Gründe für den Bau dieses<br />
88<br />
s. Abb. 23a<br />
89<br />
N. Reinartz, Der Ringwall von Kreuzweingarten. In: Kreuzweingarten, Rheder, Kalkar (Siegburg<br />
1969) 22.<br />
90<br />
T. Fritsch, Der „Hunnenring“ bei Otzenhausen. AID 2, 2007, 62-65.<br />
91 s. Abb. 24<br />
92 s. Abb. 25<br />
24
gigantischen Verteidigungswerks liegen allerdings auch hier in historischen Abläufen<br />
des 1. Jhdts. v. Chr.: römische Okkupation und Bedrohung germanischer Stämme<br />
von der rechten Rheinseite. Im Zuge der Auseinandersetzungen mit den Römern<br />
wurde die Anlage kampflos aufgegeben und geriet in gallorömischer Zeit nahezu in<br />
Vergessenheit. Auf dem „Hunnenring“ belegen die Reste eines kleinen römischen<br />
Tempels, dass auch dort weiterhin Opferungen dargebracht wurden. Jedoch fehlen<br />
in der Festung jegliche Siedlungsspuren aus gallorömischer Zeit.<br />
5. Jülich-Bourheim (Kr. Düren), spätlatènezeitliches Einzelgehöft<br />
Der eisenzeitliche Fundort von Jülich-Bourheim liegt am Rand des<br />
Braunkohletagebaus Inden I, fast 40 km entfernt von Köln. Während einer<br />
Rettungsgrabung von 1994 bis 1995 kamen im Areal eines römerzeitlichen Landguts<br />
(villa rustica) die Reste einer eisenzeitlichen Vorgängersiedlung zutage. Es handelt<br />
sich um eine spätlatènezeitliche Hofanlage von ca. 0,6 ha Innenfläche, welche von<br />
einem Spitzgraben mit Erdwall umgeben war 93 . Allerdings lag dieser bei der<br />
Ausgrabung nur noch vor in Form von zwei separaten Grabenstücken und einem<br />
Endstück. Es wird sich damals aber um einen Graben gehandelt haben, der die<br />
gesamte Siedlung umfasst hat. Vermutlich diente er als Begrenzung dieser<br />
Hofanlage, die geringe Größe spricht allerdings diesmal nicht für eine<br />
Verteidigungsanlage. Seine ursprüngliche Tiefe und Breite ließ sich auf ca. 1,80 x<br />
2,50 m berechnen 94 . In der Südostecke der Grabenanlage führte ein Tor in den<br />
Innenbereich, ein Kammertor ähnlich dem Befund von Niederzier-Hambach.<br />
Eisenzeitliche Siedlungen, die von Grabensystemen umgeben sind, findet man im<br />
niederrheinischen Flachland äußerst selten. Solche Umfassungsgräben, wie sie aus<br />
Niederzier-Hambach und Jülich-Bourheim bekannt sind, zeigen ein spitzbodiges<br />
Profil und tragen daher die passende Bezeichnung „Spitzgraben“ 95 . <strong>Die</strong> Anzahl der<br />
Pfostenlöcher, die entlang des Grabens gefunden wurden, sind allerdings zu wenige,<br />
93<br />
s. Abb. 26<br />
94<br />
B. Päffgen, Ein befestigter „Herrenhof“ der jüngeren Latènezeit bei Bourheim. Arch. im Rheinland<br />
1995, 1996, 48.<br />
95<br />
s. Göbel 1991 (Muffendorf) 49 u. Simons 1989, 110.<br />
25
um eine Holz-Erde-Mauer Konstruktion wie im Vergleichsbefund Hambach 382<br />
anzunehmen. An eisenzeitlichen Befunden lagen innerhalb des Hofareals<br />
Pfostengruben, Siedlungsgruben, Gräben sowie eine ausgedehnte Schicht von<br />
Kulturschrott vor 96 . <strong>Die</strong>ser Schicht voll Kulturschrott war es zu verdanken, dass sie<br />
sich „konservierend“ über die Befunde gelegt hatte und diese deshalb überhaupt in<br />
dieser Qualität erhalten geblieben waren. Aus 100 eisenzeitlichen Pfostengruben<br />
ließ sich der größte Teil (70 %) zu 14 Gebäuden rekonstruieren und zwar zu zwei<br />
großen Gebäuden, bestehend aus zehn und neun Pfosten, drei Sechspfosten- und<br />
acht Vierpfostenbauten. <strong>Die</strong> Gebäudegrundrisse mit vier Pfosten werden als<br />
gestelzte Speicherbauten interpretiert, wohingegen die Sechspfostenbauten<br />
wahrscheinlich als Ställe verwendet wurden. Als Wohngebäude anzusprechen sind<br />
jedoch sicherlich die beiden „großen Gebäude“, da diese mit mehr als 30 m 2<br />
Innenfläche genug Raum zum Leben boten. <strong>Die</strong> gesamte Hochfläche war also nur<br />
äußerst dünn bebaut, es ergibt sich eine Dichte von lediglich 14 Pfosten auf 100 m 2 .<br />
<strong>Die</strong> geborgene Keramik stellt die größte Fundgattung von Jülich-Bourheim dar.<br />
Insgesamt kamen 2159 Keramikscherben zutage, die sich Gefäßen wie Schalen,<br />
Schüsseln, Näpfen, Töpfen, Fässern, Flaschen, Deckeln und Böden zuordnen<br />
ließen 97 98 . Das „Design“ der Keramik wirkt mit seinem begrenzten Formenspektrum<br />
sehr einheitlich. Einige Formen stehen mit ihrem facettiertem oder schräg nach innen<br />
abgestrichenem Rand noch in mittellatènezeitlicher Tradition. Der größte Anteil an<br />
Gefäßen hat jedoch einbiegende, meist verdickte Ränder, wie sie typisch sind für<br />
spätlatènezeitliche Keramik. In der Regel sind die Gefäße handaufgebaut und<br />
unverziert. Vergleicht man die Keramik mit LT D - zeitlichem Material aus anderen<br />
Siedlungen wie Hambach 382 und Bonn-Muffendorf (siehe Abschnitt 9 dieses<br />
Kapitels) kann eine große Ähnlichkeit beobachtet werden. <strong>Die</strong> Keramikfunde aus<br />
Bourheim konnten somit ebenfalls in die Stufe LT D datiert werden.<br />
Weitere Fundgattungen bestanden in Form von Webgewichten, Spinnwirteln, ein<br />
löffelartiger Metallgegenstand sowie Steingeräte.<br />
96 P. Kießling, <strong>Die</strong> jüngerlatènezeitliche Befestigung von Jülich-Bourheim und verwandte Anlagen.<br />
(Magisterarb.Bonn 1999) 19 ff.<br />
97 Kießling 1999, 43 ff.<br />
98 s. Abb. 27<br />
26
Der einzige weitere, für die Datierung maßgebliche Fund außer der Keramik war<br />
noch ein Fragment von einem kobaltblauen Armring mit sieben Rippen (s. Kapitel V).<br />
Seine Herstellung datiert in die Zeit zwischen LT C und D.<br />
Es konnten keine Funde gesichtet werden, die jünger waren als LT D1, das<br />
bedeutet, dass die Siedlung nicht über die 1. Hälfte des 1. Jhdt. v. Chr. hinaus<br />
bestanden haben kann.<br />
Im Gegensatz zu Hambach 382 konnte anhand der Pfostenlöcher nur eine einzige<br />
Siedlungsphase nachgewiesen werden.<br />
Bei Jülich-Bourheim handelte es sich also um ein umwalltes Einzelgehöft,<br />
wahrscheinlich ein sich selbst versorgender, landwirtschaftlich geprägter Hof. Caesar<br />
bezeichnete solche Einzelhöfe in Gallien als „aedificium“. <strong>Die</strong> moderne Forschung<br />
hat ihnen den treffenderen Namen „Flachlandoppidum“ gegeben.<br />
Auch Jülich-Bourheim lag auf ehemaligem <strong>Eburonen</strong>gebiet. Wie in Niederzier-<br />
Hambach ist auch hier kein direkter Zusammenhang zwischen dem Verlassen der<br />
Siedlung und der angeblichen Vernichtung der einheimischen Bevölkerung durch die<br />
römischen Truppen zu sehen. Zumindest konnte archäologisch kein<br />
Zerstörungshorizont nachgewiesen werden. Das Gehöft wurde offensichtlich<br />
planmäßig geräumt.<br />
6. Eschweiler-Laurenzberg (Kr. Aachen), spätlatènezeitliches<br />
„Mehrhausgehöft“<br />
Im Gebiet der Abgrabungen für den Braunkohlentagebau „Zukunft-West“ wurde<br />
1974 eine weitere eisenzeitliche Siedlung ausgegraben 99 . Auf einer Fläche von ca.<br />
121 600 m 2 wurden über 100 Bodenverfärbungen sichtbar, von denen viele als<br />
Pfostenlöcher insgesamt 68 Gebäuden zugeordnet werden konnten. <strong>Die</strong><br />
Pfostenlöcher konnten nach ihrer Flächengröße, Form und Tiefe in drei<br />
Gebäudetypen unterschieden werden: 28 waren ehemals kleine Ständerbauten mit<br />
vier Pfosten, vermutlich Speicher, 17 Gebäude mit sechs Pfosten waren mit 6,50 m 2<br />
Größe wahrscheinlich kombinierte Stall-Speicher, 23 Bauten mit neun Pfosten und<br />
dem größten Quadratmeteranteil von 15 m 2 offenbar Wohnhäuser.<br />
27
Ist die oben vorgeschlagene Funktionszuweisung korrekt, stehen 23 Wohngebäude<br />
45 Speicher- und Stallgebäuden gegenüber 100 .<br />
Mehrere Gebäude in der vorliegenden Vielzahl und für verschiedene Zwecke<br />
errichtet, werden als „Mehrhausgehöft“ oder „Vielhausgehöft“ bezeichnet. Mit dem<br />
weilerartigen Gehöftgruppencharakter handelt es sich um einen Bautyp, der offenbar<br />
an süddeutschen Vorbildern orientiert ist.<br />
Das nächste südlich gelegene, nachgewiesene Vielhausgehöft ist die keltische<br />
Siedlung von Bundenbach im Hunsrück 101 mit teilrekonstruiertem Siedlungsbild 102 .<br />
<strong>Die</strong> Altburg von Bundenbach war die erste, nahezu vollständig erforschte<br />
späteisenzeitliche Höhensiedlung des Mosellandes und darüber hinaus des<br />
gesamten westkeltischen Kulturbereichs 103 . Sie war drei bis vier Generationen<br />
besetzt und zwar in der Zeitspanne von 170 bis etwa 60 v. Chr. <strong>Die</strong> Befestigung<br />
bestand in Form eines Abschnittswalls gegen den leicht zugänglichen westlichen<br />
Höhenzug. In ihrer stärksten Bebauungsphase, Latène C, handelte es sich um eine<br />
6 m breite, doppelschalige Trockenmauer, mit Erdverfüllung zwischen den<br />
Mauerschalen. Sie war sogar begehbar in Form eines im Fachwerk errichteten<br />
Wehrgangs. Auf der eineinhalb Hektar großen Innenfläche der Altburg konnten über<br />
3600 Pfostengruben freigelegt werden. Aus ihrer Tiefe sowie aus ihrer Anordnung<br />
ließen sich ein Drittel zu Gebäudegrundrissen zusammenfügen. Es ergaben sich<br />
eine Anzahl von Speicher- und Wohnbauten, die sich in relativ lockerer Streuung<br />
über das Burggelände verteilten. Es handelte sich um 20 größere Baugrundrisse<br />
(Wohn- oder Wirtschaftsbauten), 108 Kleinbauten mit vier Pfosten (Speicher- oder<br />
Wehrbauten), 6 Bauten mit neun Pfosten (Speicher), 10 Bauten verschiedener Art<br />
(Torbauten). Somit stehen laut Schindler 104 20 Wohn- und Wirtschaftsbauten 170<br />
Speicherbauten gegenüber, wenn wir davon ausgehen, dass die Vier-, Sechs und<br />
Neunpfostengrundrisse wie üblich dem Speichertyp zugeschrieben werden.<br />
99 K.H. Knörzer, Subfossile Pflanzenreste aus der jüngerlatènezeitlichen Siedlung bei Laurenzberg,<br />
Gem. Eschweiler, Kr. Aachen. Bonner Jahrb. 180, 1980, 442.<br />
100 H.E. Joachim, Jüngerlatènezeitliche Siedlungen bei Eschweiler, Kr. Aachen. Bonner Jahrb. 180,<br />
1980, 363 ff.<br />
101 s. Abb. 28<br />
102 s. Abb. 29 u. 29a<br />
103 R. Schindler, <strong>Die</strong> Alteburg bei Bundenbach. Eine befestigte Höhensiedlung des 2./1. Jahrhunderts<br />
v. Chr. im Hunsrück. Trierer Grabungen und Forschungen 10 (Mainz 1977) 93.<br />
104 Schindler 1977, 81.<br />
28
Interpretiert man diese unverhältnismäßig hohe Zahl an Vorratsspeichern und die<br />
dem gegenüberstehende geringe Zahl der Wohnbauten, könnten wir es bei der<br />
Altburg mit einem stark befestigten Etappenplatz zu tun haben, an dem bei<br />
langanhaltenden Abwehrkämpfen gegen rechtsrheinische Invasoren Proviant und<br />
Kriegsgerät gelagert wurde. Jedenfalls fiel die Altburg Kampfhandlungen zum Opfer:<br />
ein katastrophaler Brand vernichtete die Anlage in der Zeit um 60 v. Chr. Somit kann<br />
die Altburg noch keine Rolle in den treverisch-römischen Auseinandersetzungen<br />
gespielt haben, sondern die germanischen Stämme waren das bedrohende Moment.<br />
Das Verhältnis der Gebäude von Eschweiler-Laurenzberg wirkt im Gegensatz zur<br />
Altburg wesentlich ausgeglichener.<br />
Im Gegensatz zu Niederzier-Hambach und Jülich-Bourheim war die Siedlung<br />
Eschweiler-Laurenzberg nicht von einem Grabensystem umgeben und auch nicht<br />
wie die Altburg durch einen Abschnittswall befestigt.<br />
Aus 67 Gruben wurden Bodenproben für archäobotanische Untersuchungen<br />
entnommen: Von den meisten Proben konnten fast ausnahmslos Samen und<br />
Früchte in oft gutem Erhaltungszustand nachgewiesen werden. Hierbei handelte es<br />
sich in erster Linie um Getreide, vor allem Gerste und kaum Grünpflanzen. <strong>Die</strong>s<br />
bedeutet wohl, dass das Vieh, vornehmlich im Freiland gehalten wurde und kaum in<br />
den Stallungen gefüttert wurde.<br />
<strong>Die</strong> Ernährungsgrundlage der eisenzeitlichen Bewohner von Eschweiler-Laurenzberg<br />
beruhte also hauptsächlich auf dem Anbau von Getreide 105 . Neben der Gerste war<br />
unter den Weizenfunden vor allem die Emmer am häufigsten vertreten 106 . Der<br />
Vergleich mit anderen archäobotanischen Befunden aus eisenzeitlichen Siedlungen<br />
im Rheinland zeigt, dass sich nach der Hallstattzeit das Verhältnis der Funde von<br />
Weizen zu Gerste umgekehrt hat. Besonders nach den vorliegenden Laurenzberger<br />
Ergebnissen ist in dieser Zeit der Anbau von Emmer durch den Gerstenanbau<br />
zurückgedrängt worden. Bei solchen derart auffälligen Änderungen in den<br />
angebauten Hauptgetreidearten stellt sich die Frage, welche Gründe es für diesen<br />
Wechsel gegeben haben mag. Da keine klimatischen Ursachen zu erkennen sind,<br />
die fortan das Gedeihen von Gerste begünstigt hätten, ist es denkbar, dass eine<br />
Änderung in der Bevölkerungszusammensetzung eine Rolle gespielt haben könnte.<br />
105 Knörzer 1980, 446 ff.<br />
106 s. Abb. 30<br />
29
In der vorrömischen Eisenzeit sind germanische Volksgruppen aus dem Norden und<br />
Osten in das linksrheinische Tiefland eingewandert und vermischten sich mit der dort<br />
ansässigen (hallstattzeitlichen) Bevölkerung. Im germanischen Siedlungsgebiet<br />
spielte der Anbau von Gerste nämlich eine weitaus bedeutendere Rolle. Deshalb<br />
können wir annehmen, dass die zugewanderten Gruppen ihre landwirtschaftlichen<br />
Gepflogenheiten mit ins Rheinland brachten. <strong>Die</strong>ses Bild fügt sich hervorragend ein<br />
in das Modell von Willerding (1979) 107 , nach dem sich durch bisher bekannt<br />
gewordene Getreidefundkombinationen Anbaugebiete abgrenzen lassen. Dabei<br />
konnte er nämlich ein deutliches Nord-Südgefälle vom skandinavischen<br />
Gerstengebiet zum süddeutschen Weizen-Gerstengebiet nachweisen.<br />
Welchen Vorteil brachte der Anbau der Gerste als neue Kulturpflanze der<br />
Bevölkerung von Eschweiler-Laurenzberg? Gerste wurde als Sommergetreide<br />
angebaut. 108 Sie hat eine extrem kurze Wachsdauer von neun Wochen und war in<br />
archäobotanischen Proben (s. hierzu Kapitel IV, Abschnitt 3) mit Flughafer-Pollen<br />
vermengt. Flughafer wächst ausschließlich in den Sommermonaten. Sommerfrucht-<br />
Anbau ist ein wesentlicher Unterschied zu den keltischen und römischen<br />
Fundstellen, in denen potentielle Wintergetreide wie Dinkel und Nacktweizen von<br />
besonderer Bedeutung sind. Wintergetreide bringt stets höheren Ertrag als<br />
Sommergetreide. Dennoch bietet der Anbau von Sommergetreide den großen<br />
Vorteil, dass Sommerfrüchte eine wesentlich kürzere Wachstumsdauer haben als<br />
Winterfrüchte. Man erhält nach weniger als einem halben Jahr den Ertrag und nicht<br />
erst wie bei Wintergetreide nach mehr als zehn Monaten. <strong>Die</strong> Felder konnte man<br />
anschließend von August bis Ende Februar als Viehweide benutzen, zumindest<br />
solange kein Schnee lag, und erhielt somit gleichzeitig eine natürliche Düngung der<br />
Anbauflächen. Von den Sommergetreiden war die Gerste sicherlich von Interesse,<br />
weil sie geringe Ansprüche an Klima und Bodenbearbeitung stellt, dafür aber relativ<br />
hohe Erträge einbringt. Gerste hat von allen Getreiden den höchsten Zuckergehalt<br />
und eignet sich daher unter anderem sehr gut zum Bierbrauen. Emmer, die zweite<br />
107<br />
U. Willerding, Botanische Beiträge zur Kenntnis von Vegetation und Ackerbau im Mittelalter. Vortr.<br />
u. Forsch. 22, 1979, 271 ff.<br />
108<br />
A. Kreuz, „tristem“ cultu aspectuque“? Archäobotanische Ergebnisse zur frühen germanischen<br />
Landwirtschaft in Hessen und Mainfranken. In: A. Haffner/S. von Schnurbein (Hrsg.), Kelten,<br />
Germanen, Römer im Mittelgebirgsraum zwischen Luxemburg und Thüringen. Akten des<br />
30
größere vorgefundene Getreidegruppe, ist gut zum Brotbacken geeignet und<br />
besonders eiweißreich. Deshalb konnte sie der damaligen Bevölkerung mit ihrem<br />
Nährgehalt vielleicht einen gewissen Fleischersatz liefern.<br />
Ähnlich wie in Jülich-Bourheim überwiegt in Eschweiler-Laurenzberg die Keramik<br />
gegenüber allen anderen Funden 109 110 . Sie ist von meist gröberer Machart, hart<br />
gebrannt und fast ausschließlich handgefertigt, also nicht auf der Scheibe gedreht 111 .<br />
Auch hier haben wir es mit einem üblichen Spektrum von Töpfen, Schalen, Schüssel<br />
oder Fässern zu tun, allerdings mit keinem hervorstechenden Formenreichtum. Eine<br />
Besonderheit, vor allem auf Schüsseln, stellt die Randpichung dar, eine Art<br />
„Lackung“, die oberflächendeckend oder partiell aufgetragen wurde 112 . <strong>Die</strong><br />
Laurenzberger Ware lässt sich in den Übergang von Latène C zu D einordnen,<br />
genauso wie die Fibel-, Geräte- und Waffenfunde der Siedlung. Zwischen der<br />
Keramik der rheinischen Lößbörde und dem angrenzenden Gebiet der keltischen<br />
Treverer zeigen sich hingegen deutliche Unterschiede 113 . <strong>Die</strong> Gefäßformen, die auf<br />
der Alteburg bei Bundenbach gefunden wurden, sind zwar auch handaufgebaut,<br />
darüber hinaus aber im keltischen Stil verziert 114 . <strong>Die</strong> Keramik von Laurenzberg<br />
erscheint dagegen unverziert, formenarm, wesentlich gröber und weniger<br />
formenschön.<br />
<strong>Die</strong> Fibeln lassen sich durch die erkennbare Bügelform und Größe der Spiralrolle mit<br />
unterer und oberer Sehne in die gleiche Zeitstellung datieren 115 . <strong>Die</strong><br />
Glasarmringfragmente sind blau oder violett und zum Teil mit gelber Fadenauflage<br />
versehen 116 . Solche Typen sind in dieser Zeit vorrangig im Raum zwischen Maas<br />
und Rur hergestellt worden 117 . Das bedeutet, sie wurden von dort nach Eschweiler-<br />
Laurenzberg importiert oder hier selber hergestellt. Ton-Schleuderkugeln und<br />
Internationalen Kolloquiums zum DFG-Schwerpunktprogramm „Romanisierung“ vom 28. bis 30.<br />
September 1998 in Trier. Koll. Vor- u. Frühgesch. 5 (Bonn 2000) 236 ff.<br />
109 Joachim 1980, 367 ff.<br />
110 s. Abb. 31<br />
111 s. Abb. 32 u. 33<br />
112 s. Abb. 34<br />
113 W.E. Stöckli, Römer, Kelten und Germanen. Bonner Jahrb. 193, 1993, 135.<br />
114 s. Abb. 35, Keramikauswahl<br />
115 s. Abb. 36 u. 36a<br />
116 s. Abb. 37<br />
117 Th.E.Haevernick, <strong>Die</strong> Glasarmringe und Ringperlen der Mittel- und Spätlatènezeit auf dem<br />
europäischen Festland (1960).<br />
31
Lanzenspitzen können nur allgemein der jüngeren Latènezeit zugeordnet werden.<br />
Den Werkzeugen wie Ledermesser, Tüllenmeißel und Hohleisen 118 entsprechen<br />
Funde aus dem keltischen Raum, so z.B. vom Dünsberg in Hessen und aus<br />
Manching in Bayern 119 .<br />
Eschweiler-Laurenzberg war also eine Vielhausgehöft-Siedlung, die in der Zeit von<br />
ca. 125 – 100 v. Chr. bestand. Wie die Auswertung der Funde besagt, anscheinend<br />
nur eine Generation lang. Unklar ist, warum sie aufgegeben wurde, doch ist auch<br />
hier wieder ein Zusammenhang mit römischen Invasoren aufgrund der frühen<br />
Zeitstellung auszuschließen. Wenn die einheimische Bevölkerung <strong>Eburonen</strong> waren,<br />
hatten sie in dieser Zeit deutlich vermischte ethnische Merkmale: sie bauten ihr<br />
Getreide auf „germanische“ Weise an aber bauten ihre Häuser nach keltischen<br />
Vorstellungen, wie uns die Siedlung auf der Altburg von Bundenbach zeigt. Auch<br />
Teile ihrer Sachkultur wie Tonschleuderkugeln, Glasarmringe, Lanzenspitzen und die<br />
Werkzeuge sind als keltisch anzusprechen.<br />
7. Inden (Kr. Düren), spätlatènezeitlicher Opferplatz (?)<br />
Im Zusammenhang mit der Grabung einer urnenfelderzeitlichen Siedlung im<br />
Tagebau Inden stieß man im Frühjahr 2000 am Rande des untersuchten Areals auf<br />
weitere, deutlich verschiedene Pfostengruben 120 . <strong>Die</strong>se Pfostengruben<br />
unterschieden sich nach Umriss, Profil und Verfüllung nämlich von den<br />
urnenfelderzeitlichen Befunden. <strong>Die</strong> Verfüllungen enthielten Brandschutt, die<br />
Grubenwände machten zum Teil einen verziegelten Eindruck. Manche enthielten<br />
Keramikfragmente von Schalen mit nach innen gebogenem Rand – typische<br />
Gefäßformen der Latènezeit im Rheinland.<br />
<strong>Die</strong> neuentdeckte latènezeitliche Siedlung brachte jedoch auch außergewöhnliche<br />
Funde ans Tageslicht: Aus einer der Gruben konnte eine menschliche<br />
118 s. Abb. 38<br />
119 J. Gerhard, <strong>Die</strong> Metallfunde vom Dünsberg. Materialien zur Vor- und Frühgeschichte von Hesen 2<br />
(Wiesbaden 1977), ders., Werkzeug und Gerät aus dem Oppidum von Manching. <strong>Die</strong> Ausgrabungen<br />
in Manching 5 (Wiesbaden 1974).<br />
120 B. Päffgen/K. P. Wendt, Ein spätlatènezeitlicher Opferplatz der <strong>Eburonen</strong> bei Inden. Arch.<br />
Rheinland 2000 (2001) 61–62.<br />
32
Schädelkalotte sowie ein kompletter Pferdeschädel geborgen werden 121 . Nach dem<br />
Schädel aus dem Oppidum von Manching 122 handelt es sich bei Inden um den<br />
zweiten vollständigen latènezeitlichen Pferdeschädel, der aus Deutschland<br />
überhaupt bekannt ist 123 124 . Von einem Pferd stammten außerdem noch ein<br />
Unterkieferfragment und 15 weitere Knochen. <strong>Die</strong> Knochen stammen von<br />
mindestens zwei verschiedenen Pferden, die vom Erscheinungsbild her ziemlich<br />
klein gewesen sein dürften, mit einem kräftigen Kopf, starken Vorderextremitäten<br />
und schlanken Hinterläufen, vielleicht ähnlich dem Aussehen der Isländerponys. <strong>Die</strong><br />
Pferde aus Inden dürften aufgrund ihres Körperbaus als Reittiere verwendet worden<br />
sein. Somit sind diese Knochenfunde die ersten archäologischen Belege für<br />
Reitpferde der einheimischen latènezeitlichen Bevölkerung überhaupt.<br />
Eine Auffälligkeit am Pferdeschädel ist das Fehlen beider Nasenbeinenden. Wir<br />
können davon ausgehen, dass dies auf einen Schlag mit einem scharfen<br />
Gegenstand, zum Beispiel mit einem Beil, zurückzuführen ist. Möglicherweise ist das<br />
Pferd auch durch diesen Schlag zu Tode gekommen.<br />
Bei einem Vergleichsfund in Vertault an der Côte d’Or in Burgund gab es eine<br />
Opferstätte, sowohl mit Pferde- als auch mit Hundeskeletten 125 126 . Über 30 Pferde-<br />
und mehr als 150 Hundeopfer sind in Gruben entdeckt worden, welche ins 1. Jhdt. v.<br />
Chr. datieren 127 und somit von Zeitstellung und Befundsituation mit der Grube von<br />
Inden vergleichbar wären. <strong>Die</strong> Pferde hatte man durch einen Schlag auf den Schädel<br />
getötet, anschließend kürzere Zeit der Verwesung ausgesetzt und schließlich in<br />
Gruben bestattet. Hunde und Schafe wurden ähnlich behandelt, waren jedoch nicht<br />
der Verwesung ausgesetzt worden. Mehrmals wurden die Gruben geöffnet, um neue<br />
Opfer beizusetzen. Alle bislang im gallischen Raum untersuchten Befunde haben<br />
ergeben, dass die geopferten Pferde nicht verzehrt worden waren, sondern<br />
121 s. Abb. 39<br />
122 s. Abb. 40<br />
123 H. Berke/B. Päffgen/St. Wendt, Der <strong>Eburonen</strong> kleine Pferde. Arch. Rheinland 2001 (2002) 46–47.<br />
124 s. Abb. 41<br />
125 A. Haffner, Heiligtümer und Opferkulte der Kelten (Stuttgart 1995) 32.<br />
126 s. Abb. 42<br />
127 P. Méniel, Les sacrifices d’animaux chez les Gaulois (Paris 1992) 34.<br />
33
verwesten, obwohl Pferdefleisch im Alltag wohl durchaus auf dem Speiseplan<br />
gestanden hat.<br />
Pferde spielten in der keltischen Religion eine wichtige Rolle. Wir kennen den<br />
Grabbrauch, vornehmen Toten ihr Pferd mit ins Grab zu geben. Besonders häufig<br />
sind Pferde auf keltischen Münzen, den Regenbogenschüsselchen abgebildet. Als<br />
eine Schützerin der Pferde wurde in der Kaiserzeit die ursprünglich keltische Göttin<br />
Epona in weiten Teilen des Römischen Reichs verehrt. Epona leitet sich ab vom<br />
keltischen „epo“ = Pferd und der Göttlichkeit andeutenden Endung „ona“, bedeutet<br />
somit entweder „Pferdegöttin“ oder „göttliches Pferd“ 128 . Bekannt ist ihre Darstellung<br />
von zahlreichen Monumenten, so z.B. aus Alesia 129 . Manchmal wird sie im<br />
Damensitz reitend abgebildet, manchmal ohne Sattel auf dem Pferd sitzend, von<br />
einer Stute oder von anderen jungen Pferden umgeben. Alle Reit- und Lasttiere<br />
sowie die Menschen vom Reiter bis Fuhrknecht standen unter Eponas Schutz. Für<br />
die ihr anvertrauten Tiere wurde von Epona das Wirken einer Muttergöttin erwartet:<br />
sie sollte die Tiere beschützen, für ihre Gesundheit und ihr Wohlergehen sorgen, sie<br />
gegebenfalls heilen und für gesunde Fohlen sorgen. <strong>Die</strong> Bedeutung des Pferdes für<br />
die Kelten wird umso nachvollziehbarer, wenn man sich vor Augen hält, dass die<br />
Kelten ihren Aufstieg und ihre Verbreitung mindestens ebenso ihrer Geschicklichkeit<br />
bei der Pferdezucht verdanken wie ihrer hervorragenden Eisenverarbeitungstechnik.<br />
Neben den Pferdeknochen fanden sich in Inden auch noch Knochen anderer<br />
Tierarten, anteilmäßig noch besonders viele von Rindern, Schafen und<br />
Schweinen 130 .<br />
Auch ein Blick in den rechtsrheinischen, germanischen Raum, nämlich nach<br />
Oberdorla bei Mühlhausen in Thüringen, weist Parallelen auf.<br />
Oberdorla gilt als erstes germanisches Dorfheiligtum, das bisher auf deutschem<br />
Boden vollständig untersucht wurde 131 . In dem thüringischen Opfermoor wurden<br />
über sieben nachgewiesene Stadien, von der Hallstattzeit bis ins frühe Mittelalter,<br />
Tierknochen, Menschenknochen, Holzidole, Keramik und weitere kultische<br />
128 Botheroyd 1992, 104-106.<br />
129 s. Abb. 43<br />
130 Berke u.a. 2002, 47.<br />
131 G. Behm-Blancke, Heiligtümer der Germanen und ihrer Vorgänger in Thüringen: die Kultstätte<br />
Oberdorla. Weimarer Monographien zur Ur- und Frühgeschichte 38,1 (Stuttgart 2003) 267.<br />
34
Gegenstände deponiert 132 . Der heilige Ort von Oberdorla setzte sich aus fünf<br />
Komponenten zusammen, dem Moor, einem Kultsee, Kultquellen im Moor sowie<br />
einem „heiligen Hain“ 133 . Aus der 3. Opferperiode, welche der späten Latène- und<br />
frühen Römischen Kaiserzeit entspricht, stammen die berühmten Astgabelidole.<br />
Östlich von ihrem ehemaligen Standort fanden sich zahlreiche Knochen der<br />
Opfertiere. <strong>Die</strong> Skelettteile stammen vom Pferd, Rind, Schwein, Schaf, Ziege, Hund<br />
und Hecht, sowie von einem Menschen. Eine vollständig erhaltene Tonschale stand<br />
ohne erkennbaren Inhalt vor dem letzten Idolpaar. Von ihr wird angenommen, dass<br />
sie die Opferspeise für die Idole enthalten hat 134 . <strong>Die</strong> Tatsache, dass den Holzidolen<br />
Tieropfer und Mahlzeiten zugedacht waren, lässt den besonderen Charakter dieser<br />
Hölzer deutlich werden. Allen Anschein nach hatten sie eine bestimmte göttliche<br />
Symbolik für die einheimische, elbgermanische Bevölkerung 135 .<br />
Vom Pferd wurde in Oberdorla eine Reihe von Einzelknochen gefunden. Vereinzelt<br />
wurde auch eine vollständige Pferdeextremität niedergelegt, aber ohne Schulterblatt.<br />
Depots von unbeschädigten Langknochen mit Schädel waren eher eine Seltenheit in<br />
Oberdorla. Im Gegensatz zu der einen menschlichen Schädelkalotte von Inden<br />
kamen in Oberdorla 201 menschliche Skelettreste zu tage, davon sogar 5 vollständig<br />
erhaltene Schädel. Mit Ausnahme einer Körperbestattung eines jungen Mädchens<br />
wurden auf den Heiligtümern ausschließlich Knochen niedergelegt, diese Tatsache<br />
spricht für den von archäologischer Seite wiederholt angenommenen germanischen<br />
Brauch der Leichenzerstückelung 136 .<br />
Viele Indizien sprechen übrigens für eine keltische „einheimische“ Bevölkerung, die<br />
am Ende der Spätlatènezeit unter dem Einfluss der eingewanderten Elbgermanen<br />
stand. Zum Beispiel weisen die Beschaffenheit der Kultareale in Oberdorla<br />
Ähnlichkeiten auf mit den keltischen Viereckschanzen 137 . <strong>Die</strong> Holzidole scheinen<br />
vom gleichen Typ zu sein wie die keltischen Kultstelen 138 . Letztgenannte erinnern<br />
allerdings auch an die Kultsäule der späteren germanischen Sachsen, die Irminsul,<br />
132 Behm-Blancke 2003, 27 ff.<br />
133 Ders., 24-27.<br />
134 Ders., 52-53<br />
135 Ders., Kap. VII<br />
136 Ders., 149.<br />
137 s. Abschnitt 9 „Bonn-Muffendorf“<br />
138 Behm-Blancke 2003, 49.<br />
35
welche Karl der Große in den fränkisch-sächsischen Auseinandersetzungen fällen<br />
ließ 139 , oder an die Weltenesche „Yggdrasil“, dem Lebensbaum aus der<br />
germanischen Mythologie. In der Snorra Edda, der Edda des isländischen Mönchs<br />
Snorri Sturluson, findet sich noch ein Hinweis auf das Tierknochenopfer und zwar in<br />
Gylfaginning 44 (<strong>Die</strong> Täuschung des Königs Gylfi): Thor bietet seinem Besucher,<br />
dem Bauern Egil seine Böcke Zähneknirscher und Zähneknisterer als Mahlzeit an,<br />
wenn die Knochen nicht verletzt würden. Nach dem Essen legt der Gott die Knochen<br />
auf die Felle und erweckt die Tiere mit seinem Hammer Mjöllnir wieder zum Leben.<br />
Ein Teilnehmer am Mahl hat jedoch einen Knochen mit den Zähnen beschädigt,<br />
daher lahmt einer der Böcke 140 .<br />
Ein anderes Ritual in Zusammenhang mit tierischem Gebein beinhaltet der zweite<br />
Merseburger Zauberspruch:<br />
„Phol und Wodan ritten in den Wald<br />
da wurde der Fuß von Balders Fohlen verrenkt;<br />
da besang es Sintgunt und Sunna, ihre Schwester,<br />
da besang es Friia und Volla, ihre Schwester,<br />
da besang es Wodan, der dies gut konnte:<br />
Sei es Beinrenkung, sei es Blutrenkung, sei es Gliedrenkung:<br />
Bein zu Bein, Blut zu Blut, Glied zu Gliedern, als wenn sie geleimt wären!<br />
(oder: dass sie gelenkig sind) 141<br />
Eine bedeutende Charaktereigenschaft des Gottes Wodan (Odin) war der<br />
Totenzauber, d.h. die Fähigkeit, Tote wieder zum Leben zu erwecken. <strong>Die</strong>s gelang<br />
ihm durch die Ausübung von Runenmagie 142 .<br />
Wieder zurück in Inden im Braunkohletagebau sind an verbleibenden Funden außer<br />
den genannten Knochenfunden aus derselben Grube noch Keramikreste, Fragmente<br />
von blauen Glasarmringen und tönerne Schleuderkugeln zu nennen 143 . <strong>Die</strong><br />
Wirkungsweise solcher tönerner Schleuderkugeln 144 beschreibt Cäsar im Gallischen<br />
Krieg, Buch 5, Kapitel 43:<br />
139 H.W. Hammerbacher, Irminsul. Das germanische Lebensbaum-Symbol (Kiel 2000).<br />
140 Ders., 103.<br />
141 R. Simek, Lexikon der germanischen Mythologie (Stuttgart 1984) 477.<br />
142 H. Obleser, Odin (Wailblingen 1993) 208.<br />
143 s. Abb. 41<br />
144 s. Abb. 44<br />
36
„Am siebenten Tag der Belagerung fingen die Nervier an, glühende Kugeln aus<br />
gegossenem Ton .... auf die Baracken .... zu werfen. <strong>Die</strong>se fingen schnell Feuer<br />
und verbreiteten es nach dem ganzen Orte des Lagers...“<br />
Zusammenfassend betrachtet könnte die komplette Befundsituation in Inden mit den<br />
Knochendepots und Brandresten für die Interpretation des Platzes als eine Opfer-<br />
oder Kultstätte der <strong>Eburonen</strong> sprechen. <strong>Die</strong>s untermauert vor allem die<br />
naturräumliche Lage des Platzes als Kennzeichen eines Kultplatzes sowie die<br />
Niederlegung von Opfergaben und deren Resten in Gruben, wird aber auch durch<br />
die Auswahl bestimmter Tierknochen wie Extremitäten und Schädel für die<br />
Deponierung bestätigt, ein Ritus, der durch viele Vergleichsfunde belegt ist, wie z.B.<br />
jene von Vertault und Oberdorla.<br />
8. Kreuzau-Winden (Kr. Düren), Abschnittswall „Hochkopf“<br />
Über der Rur in Kreuzau-Winden bei Düren erhebt sich der „Hochkopf“, eine<br />
Bergzunge, die zum Flusstal hin steil und felsig abfällt 145 . In der Zeit um Christi<br />
Geburt scheint sie von der einheimischen Bevölkerung zur Verteidigung, also als<br />
Fluchtburg, in Gebrauch gewesen zu sein 146 . Der von Natur aus durch den schroffen<br />
Buntsandsteinfelsen gesicherte Platz wurde nämlich mit einem Abschnittswall zum<br />
ungeschützten Hinterland an der Rückseite zu einer Befestigung ausgebaut. Noch<br />
heute ist ein Wall in ausgezeichnetem Erhaltungszustand von 170 m Länge im<br />
Gelände zu sehen. Er ist 3 m hoch und hat zum Teil auffallend steile Böschungen 147 .<br />
Der geschützte Teil der Bergzunge war etwa 500 m lang und 300 m breit. Im<br />
Rahmen eines Grabungsprogrammes in den 30er Jahren der damaligen rheinischen<br />
Provinzialverwaltung, das u.a. die Erforschung der rheinischen Wallanlagen zum Ziel<br />
hatte, wurde ein Teil des Abschnittswalls mit einem 4 m breiten Schnitt untersucht.<br />
Dabei erwies sich der heutige Wall als der Versturz einer 4 m dicken Mauer, deren<br />
aus Buntsandstein gesetzte Fronten auf über 1 m Höhe erhalten waren. Das Innere<br />
bestand aus wechselnden Lagen von Steingeröll, Lehm und reichlichen Resten von<br />
145 s. Abb. 45<br />
146 Joachim 1974a, 46-48.<br />
147 s. Abb. 46<br />
37
Holzgebälk, die Vorder- und Rückfront zusammenhielten und durch parallel zur<br />
Mauerführung laufende Balken verbunden waren.<br />
<strong>Die</strong>se Mauer stand auf einer Aufschüttung, der Fuß der Vorderfront 0,80 m über dem<br />
gewachsenen Boden.<br />
<strong>Die</strong>ser Befund weist hin auf eine keltische Holz-Stein-Erde-Mauer und zwar vom<br />
Kastenbau-Typ. <strong>Die</strong>ser Mauertyp basiert nach Ian Ralston 148 auf<br />
Nebeneinanderstellungen einer Reihe von aneinandergrenzenden Kästen aus<br />
horizontalem Balkenwerk gebaut, welche verschiedenartige Verfüllungen enthalten<br />
können. Das Kastensystem ergibt sich durch die Anordnung von Holzbalken in der<br />
Diagonalen und Vertikalen, so dass Fächer von gleicher Größe und Abstand<br />
entstehen 149 . Im Fall von Kreuzau-Winden kann es sich laut Befund bei der<br />
Verfüllung der Kästen nur um Geröll und Lehm gehandelt haben.<br />
<strong>Die</strong> Kastenbau-Mauer war ein gängiger Typ im eisenzeitlichen Europa, dessen<br />
Wurzeln vielleicht noch bis ins Neolithikum zurückreichen. Bekannte europäische<br />
Beispiele sind die Anlage von Biskupin in Polen 150 sowie jene am Wittnauer Horn in<br />
der Schweiz 151 .<br />
Das Spektrum der Funde war nur gering: Im Innern der Mauer lagen zwei<br />
vorgeschichtliche Scherben, beides Stücke von Schalen, glatt und ohne Verzierung,<br />
daher nicht genau zu datieren. <strong>Die</strong> eine hat allerdings einen mit feinem Sand<br />
durchsetzten Ton und damit eine rauhe Oberfläche, wie sie typisch ist für<br />
spätlatènezeitliche Keramik im Rheinland 152 . Außerdem fanden sich noch<br />
Wandscherben eines weißtonigen Krugs 153 , der am ehesten in frühe römische Zeit<br />
datiert 154 .<br />
Der Befund des Mauertyps und die Keramikfunde bieten einen Anhaltspunkt dafür,<br />
dass die Anlage etwa um die Zeitenwende benutzt und auch zerstört wurde:<br />
Eindeutig steht fest, dass die Anlage durch einen großen Brand zerstört wurde. Das<br />
148 I. Ralston, Celtic fortifications (Gloucestershire 2006) 49 ff.<br />
149 s. Abb. 47<br />
150 s. Abb. 48<br />
151 Ralston 2006, 50.<br />
152 s. Abb. 49<br />
153 s. Abb. 50 u. 50a<br />
154 Jahresbericht 1938, Bonner Jahrbücher 145, 1940, 298 ff.<br />
38
Holzwerk war durchweg verkohlt, im Mauerkern das Gestein vollständig verglüht.<br />
Ziegelrote Lehmbänder und zu Asche verglühter Sand zeugen ebenso von einer<br />
massiven Hitzeeinwirkung.<br />
Somit wäre - vorsichtig spekuliert - die Abschnittsbefestigung von Kreuzau-Winden<br />
einer der Hinweise auf ein Fortleben eburonischer Bevölkerung nach 50 v. Chr.<br />
Zumindest waren einheimische Bewohner vorhanden, die sich auf fortifikatorische<br />
Weise zur Wehr setzten. <strong>Die</strong> Bauart der Anlage schließt römischen Ursprung aus,<br />
d.h. sie wurde noch am ehesten im Einsatz gegen Römer verwendet.<br />
9. Bonn-Muffendorf, spätlatènezeitliche Grabenanlage<br />
1991 wurde im Bonner Ortsteil Muffendorf auf einem Baugrundstück eine<br />
spätlatènezeitlliche, rechteckige Grabenanlage mit Innenbebauung freigelegt 155 156 .<br />
Genau wie in Niederzier-Hambach und Jülich-Bourheim handelte es sich um einen<br />
Spitzgraben, diesmal 52,5 m lang und 1,6 – 2,0 m breit und bis zu 1 m tief 157 . Im<br />
Norden knickte der Graben rechtwinklig nach Osten ab. Innerhalb des Grabens<br />
zeichnete sich parallel zum Graben ein 4 m breiter, weitgehend befundleerer Streifen<br />
ab, auf dem wohl ein Wall angeschüttet war. <strong>Die</strong>ser war jedoch völlig wegerodiert. Im<br />
Bereich des südlichen Grabens wurden Pfostengruben angeschnitten, die<br />
möglicherweise auf eine Brücke hindeuten könnten. Auch die Grabung auf der<br />
Innenfläche der Anlage zeigte zahlreiche Klein- und Pfostengruben, die auf eine<br />
dichte Bebauung in mehreren Bauphasen schließen lassen. Aus den Gruben kamen<br />
Brandlehm mit Flechtwerkabdrücken sowie einige Knochenbruchstücke und Zähne<br />
von Rindern und Schweinen zutage.<br />
<strong>Die</strong> meisten Funde sind jedoch Keramikscherben, die in die Stufe Latène D1<br />
datieren. Es handelt sich um handgemachte, nachgedrehte Ware. <strong>Die</strong> schlichten<br />
Gefäße, Töpfe, Schalen und Fässer haben einziehende, verdickte Ränder,<br />
gelegentlich mit Fingertupfen an der inneren Randlippe, sowie Flaschen mit<br />
155 J. Göbel, Eine spätlatènezeitliche Anlage in Muffendorf. Arch. Rheinland 1991 (Stuttgart 1992) 49-<br />
51<br />
156 s. Abb. 51<br />
157 s. Abb. 52<br />
39
gepichten Rändern. <strong>Die</strong> Metallfunde beschränkten sich auf einige Eisennägel und<br />
eine Bronzenadel.<br />
Noch unbekannt ist, wann die Siedlung aufgegeben wurde. In der obersten<br />
Verfüllung des Spitzgrabens fanden sich jedenfalls noch Reste von zwei römischen<br />
Brandgräbern des ausgehenden 1. Jhdt., die auf eine kontinuierliche<br />
Siedlungstätigkeit bis in römische Zeit hier in Bonn-Muffendorf schließen lassen.<br />
Vergleichbare Anlagen sind bisher nur aus dem süddeutschen Raum bekannt,<br />
keinesfalls aber vom Niederrhein. Der Befund erinnert deutlich an das Aussehen<br />
einer keltischen Viereckschanze, eine Wall-Graben-Anlage mit rechteckigem<br />
Grundriss. Von Frankreich bis nach Böhmen ist dieser keltische Bautyp zahlreich<br />
verbreitet 158 . Seit über anderthalb Jahrhunderten Forschungsarbeit sah man in ihnen<br />
sowohl römische Lager als auch keltische Fliehburgen, Gehöfte, Viehgehege oder<br />
reine Kultbezirke im Sinne von Tempelanlagen. Zur letzteren Schlussfolgerung<br />
trugen insbesondere die Funde von Fellbach-Schmiden in Baden-Württemberg bei.<br />
Hier wurden Holzfiguren in Form von zwei antithetischen Steinböcken aus einem<br />
Kultschacht geborgen. Insbesondere die Schachtanlagen mit Verfüllungen in Form<br />
von kultischen Gegenständen, die Umwallung als Erdwerk ohne fortifikatorische<br />
Einbauten und die formalen Beziehungen zu den späteren gallo-römischen<br />
Umgangstempeln waren immer wichtige Indizien für eine kultische Deutung. <strong>Die</strong><br />
Forschungsergebnisse der letzten beiden Jahrzehnte sprechen jedoch in einigen<br />
Fällen für eine hauptsächlich profane Nutzung. <strong>Die</strong> Viereckschanzen von Ehningen<br />
in Nordwürttemberg, Bopfingen-Flochberg und Riedlingen beispielsweise waren wohl<br />
doch eher rechteckige Kleinhöfe oder Mittelpunkte bäuerlicher Dorfsiedlungen.<br />
Im Falle der Anlage von Bonn-Muffendorf scheidet eine Interpretation als rein<br />
kultischer Bezirk weitestgehend aus. <strong>Die</strong> dichte Innenbebauung und die zahlreichen<br />
Siedlungsfunde sprechen für eine ähnlich profane Nutzung wie die drei oben<br />
aufgeführten süddeutschen Beispiele. Beim Freilegen der Fläche im nordwestlichen<br />
Teil der Anlage wurde festgestellt, dass die landwirtschaftliche Nutzung einen sehr<br />
158 G. Wieland, <strong>Die</strong> spätkeltischen Viereckschanzen in Süddeutschland – Kultanlagen oder<br />
Rechteckhöfe? In: A. Haffner, Heiligtümer und Opferkulte der Kelten. Arch. Deutschland, Sonderh.<br />
1995. 85 – 99.<br />
40
tiefgründigen, humosen Boden erzeugt hatte 159 . Ein denkbarer Vergleich des<br />
Befundes von Bonn-Muffendorf geht vielleicht dennoch in den süddeutschen<br />
keltischen Raum, aber diesmal zu den sogenannten „Herrenhöfen“ der<br />
Hallstattzeit 160 . Hierbei handelt es sich um kleine, mit Gräben und Palisaden<br />
befestigte Höfe, welche neuerdings als einfache, landwirtschaftliche Höfe ohne<br />
gehobene soziale Stellung interpretiert werden.<br />
Eine solches Kleingehöft mit subsistenzwirtschaftlichem Betrieb, d.h. mit einer<br />
zunächst profanen Zweckbestimmung, schließt keinesfalls aus, dass die Anwohner<br />
auch religiöse und rituellen Handlungen ausgeführt hätten. Ganz im Gegenteil muss<br />
man sich vor Augen halten, dass in der hier diskutierten vorgeschichtlichen Zeit<br />
profanes und sakrales Leben im Alltag der damaligen Menschen keineswegs die<br />
Trennung erfuhr, wie es in unserer modernen Gesellschaft heute der Fall ist. Allein<br />
auf Grund dieser Überlegung schließt sich die Interpretation in nur die eine oder die<br />
andere Richtung meines Erachtens von vornherein aus.<br />
159 Göbel 1992b, 51.<br />
160 K. Leidorf, Südbayerische „Herrnhöfe“ der Hallstattzeit. Arch. Denkmalpflege Niederbayern 1985,<br />
129 ff.<br />
41
) Auswertung der Befunde und Funde 1-9:<br />
Welche Merkmale an der einheimischen Bevölkerung, nennen wir sie<br />
<strong>Eburonen</strong>, sind als „keltisch“ anzusprechen, welche als „germanisch“?<br />
Fundorte 1-9 „Keltische“<br />
Befunde/Funde<br />
1. Niederzier-Hambach Doppelte Spitzgräben,<br />
Holz-Erde-Mauer,<br />
Zweikammertor,<br />
lehmverputzte<br />
Fachwerkbauten,<br />
Eisenbarrenhorte,<br />
Torques, Armringe,<br />
Tonschale vom Goldhort,<br />
Münzen,<br />
Regenbogenschüsselchen<br />
2. Beringen Torques, Armband,<br />
Statere,<br />
3. Heers Statere<br />
Regenbogenschüsselchen<br />
4. Kreuzweingarten Murus gallicus,<br />
Keramikscherben<br />
5. Jülich-Bourheim Partieller Spitzgraben mit<br />
Wall, Kammertor,<br />
Wirtschafts- und<br />
Wohngebäude, Keramik,<br />
Webgewichte, Spinnwirtel,<br />
Glasarmringfragment,<br />
„Flachlandoppidum“<br />
6. Eschweiler-Laurenzberg Vielhausgehöft, Keramik,<br />
Glasarmringfragmente,<br />
Fibeln, Geräte, Waffen,<br />
42<br />
„Germanische“<br />
Befunde/ Funde<br />
Einheitliche<br />
Gebäudestrukur = Hinweis<br />
auf egalitäre<br />
Gesellschaftsstruktur?<br />
Gerstenanbau
Tonschleuderkugeln,<br />
Lanzenspitzen,<br />
Werkzeuge,<br />
7. Inden Pfostengruben,<br />
Pferdeopfer ohne<br />
vorangegangenen Verzehr<br />
des Fleisches,<br />
Keramikreste,<br />
Tonschleuderkugeln,<br />
Glasarmringfragmente<br />
8. Kreuzau-Winden Holz-Stein-Erde-Mauer<br />
„Kastenbau-Typ“,<br />
Keramikscherben<br />
9. Bonn-Muffendorf Rechteckige Anlage mit<br />
Spitzgraben und Wall,<br />
Knochenbruchstücke/<br />
Zähne von Rindern und<br />
Schweinen, Keramik<br />
43<br />
Pferdeopfer, Anzeichen für<br />
Leichenzerstückelung<br />
<strong>Die</strong> oben angeführte Tabelle zeigt eine überdeutliche Orientierung der<br />
spätlatènezeitlichen Bevölkerung der neun vorgestellten Fundorte zum keltischen<br />
Kulturraum. In Latène D, also 150-15 v. Chr., bestand ein intensivierter Kontakt der<br />
Niederrhein- bzw. Maas-Region zur südlichen Latènekultur 161 . Eine besondere<br />
Funddichte an latènezeitlichem Material existiert in der östlichen Hälfte des Rhein-<br />
Maas-Deltas und im Maasgebiet zwischen Maastricht und Venlo. Zu den wichtigsten<br />
Beispielen gehört sicherlich die Masse an keltischen Glasarmringen, die ich in<br />
Kapitel V dieser Arbeit vorstellen werde, die Übernahme keltischer Fibeltypen wie<br />
der Nauheimer Fibel, die Beliebtheit von keltischem Schmuck wie den Goldtorques,<br />
161 N.Roymans, On the latènisation of Late Iron Age material culture in the Lower Rhine/Meuse area.<br />
In: S.Möller/ W.Schlüter/ S.Sievers (Hrsg.), Keltische Einflüsse im nördlichen Mitteleuropa während<br />
der mittleren und jüngeren vorrömischen Eisenzeit. Akten des Internationalen Kolloquiums in<br />
Osnabrück vom 29. März bis 1. April 2006 (Bonn 2007) 317 ff.
die Herstellung von Langschwertern und die Münzprägung. Ab Latène D2 gibt es<br />
Hinweise auf eine eigene Münzprägung am Niederrhein und in der Maasregion, allen<br />
voran die Goldmünzen des Typs Scheers 31 (s. Kapitel III, Abschnitt 3, „Heers“).<br />
Welche Gründe könnte es gegeben haben für eine zunehmende „Latènisierung“ der<br />
materiellen Kultur, hervorgebracht durch die einheimische Bevölkerung?<br />
1. In erster Linie ist denkbar, dass Bevölkerungsgruppen aus dem Süden hier<br />
eingewandert sind und ihre Latènekultur mitbrachten. <strong>Die</strong>se Migration kann natürlich<br />
auch schon wesentlich früher, in Latène C, erfolgt sein und die Sachkultur sich<br />
allmählich in der Bevölkerung am Niederrhein etabliert haben.<br />
2. Objekte im Latène-Stil wurden von der niederrheinischen Bevölkerung über ihre<br />
Handelsbeziehungen in den Süden importiert. Besonders ist hier an Fibeln und<br />
Waffen zu denken, die im Latènestil verziert sind.<br />
3. Materielle Kultur im Latène-Stil wurde vor Ort in lokalen Produktionsstätten selber<br />
hergestellt. Das Formenspektrum der Latène-Kultur wurde nicht nur kopiert, sondern<br />
erhielt eigene, spezifische Ausprägungen, welche es zu einer lokalen Besonderheit<br />
machte.<br />
Der Prozess der „Latènisierung“ beinhaltete nicht nur das Hervorbringen einer<br />
neuen, materiellen Kultur, sondern auch neue soziale Verbindungen und damit<br />
verbundene Ideen und Wertevorstellungen. <strong>Die</strong> Einführung von Langschwertern,<br />
Goldtorques und Goldmünzen ist ein Indikator für veränderte Machtverhältnisse in<br />
der niederrheinischen Bevölkerung. Herstellung und Gebrauch dieser neuen Güter<br />
wurden aller Wahrscheinlichkeit nach von den sozialen Eliten gesteuert und dienten<br />
wohl einer Art „Elitenkommunikation“ untereinander, vor allem, um sich mit den<br />
neuen Prädikaten von den Unterschichten abzuheben.<br />
Von der späten Bronzezeit und der frühen Eisenzeit aus lässt sich also eine<br />
Entwicklung beobachten, die von einer eher egalitären zu einer hierarchisierten<br />
Gesellschaftsstruktur überging und Eliten sowie zentrale Ortsstrukturen<br />
herausbildete.<br />
Reichmann bezeichnet die Bevölkerung, die in der linksrheinischen Lößbörde in der<br />
späten Latènezeit ansässig war als Maas-Waal-Gruppe 162 und definiert sie<br />
162 C. Reichmann, Zur Besiedlungsgeschichte des Lippemündungsgebiets während der jüngeren<br />
vorrömischen Eisenzeit und der ältesten römischen Kaiserzeit (Wesel 1979) 296.<br />
44
insbesondere über die keltisch orientierte Hausbauweise (s. Kapitel III, Abschnitt d)<br />
und die hervorgebrachte Keramik.<br />
<strong>Die</strong> Keramik der Mittel- und Spätlatènezeit zeigt in den rheinischen Lößbörden<br />
stärkere Anlehnung an den Süden als die Keramik am nördlichen Niederrhein und in<br />
den Niederlanden 163 . Gefäßformen und –verzierungen weisen hier im<br />
Siedlungsmaterial Parallelen zum Süden auf, wenn auch die typische<br />
Drehscheibenkeramik der Latènekultur fehlt. Das spätlatènezeitliche<br />
Keramikspektrum wirkt noch uniformer als das mittellatènezeitliche 164 . <strong>Die</strong> Ränder<br />
der Gefäße sind sehr selten facettiert, auch schärfer profilierte Formen fehlen. <strong>Die</strong><br />
Mehrheit hat oben eine stark einziehende Mündung. Verzierungen sind allerdings<br />
eher selten, sie bestehen nur in Form von Fingertupfen auf Fässern, Lackung und<br />
Kammstrich. Nachgewiesen werden konnten sowohl Hoch- als auch Breitformen,<br />
d.h. im wesentlichen Fässer und Schalen.<br />
<strong>Die</strong> Lößbörde liegt an der Peripherie der keltischen Oppida-Zivilisation. Sowohl in der<br />
Keramik als auch in der übrigen materiellen Kultur wurde hier die spezialisierte<br />
Entwicklung dieser Stadtkultur nur bedingt nachvollzogen. Vor allem fehlt in den<br />
Dorf- und Weilersiedlungen des linken Rheinlandes bis jetzt die typische<br />
Drehscheibenware der Latènekultur.<br />
c) Zur Situation auf der rechten Rheinseite: <strong>Die</strong> Sugambrer<br />
Nachdem wir in Teil a) des III. Kapitels die Befund- und Fundsituationen derjenigen<br />
Plätze kennengelernt haben, die bislang als eburonisch gelten, sowie uns mit deren<br />
Zerstörung oder Aufgabe auseinandergesetzt haben, ist es notwendig, im folgenden<br />
einen Blick über den Rhein, also auf das rechte Rheinufer zu werfen. Hier befand<br />
sich das Territorium der Sugambrer, jenes „Nachbarstammes“, der 53 v. Chr. nach<br />
Ende des Kriegs mit römischer Billigung auf eburonischem Gebiet plünderte. Wie<br />
lassen sich archäologisch die Beziehungen zwischen Römern und den<br />
Einheimischen auf der rechten Rheinseite fassen?<br />
163 Simons 1989, 81.<br />
164 <strong>Die</strong>ss. 1989, 72.<br />
45
Das Siedlungsgebiet der Sugambrer erstreckte sich etwa zwischen Sieg und Lippe<br />
mit einem Siedlungskern zwischen, Rhein, Lippe und Wupper 165 . Im Unterschied zu<br />
den als römerfreundlich geltenden Ubiern nahmen die Sugambrer bis zu ihrer<br />
Niederlage 8 v. Chr. eine römerfeindliche Haltung ein. <strong>Die</strong>s machte sich zum Beispiel<br />
bemerkbar, als sie Truppen der von Caesar geschlagenen Usipeter und Tenkterer<br />
Aufnahme gewährten und deren Auslieferung an die Römer ablehnten 166 .<br />
1. Der Petersberg bei Königswinter, spätlatènezeitliche Befestigung<br />
Der Petersberg bei Königswinter ist nach dem Ölberg die zweithöchste Erhebung im<br />
Siebengebirge. In jedem Fall aber ist er der Berg mit der größten besiedelbaren<br />
Fläche auf seinem Plateau 167 168 . Deshalb wurde er auch schon seit der jüngeren<br />
Steinzeit bewohnt. Den ersten Höhepunkt der Besiedlung erfuhr der Petersberg<br />
allerdings in der Spätlatènezeit in der Stufe Latène D. Noch heute ist ein ca. 450 m<br />
langer Hauptwall im Nordwesten und Osten erhalten sowie ein Vorwall im Nordwest-<br />
Abschnitt 169 .<br />
Der Hauptwall war eine Basaltsteinmauer in Trockenmauertechnik erbaut, vermutlich<br />
3 m breit und 1,20 m hoch 170 . Im Innern des Hauptwalls verlief noch zusätzlich eine<br />
hölzerne Palisadenwand.<br />
<strong>Die</strong> geborgenen Funde, im wesentlichen Bruchstücke von Keramik, zeigen ähnlich<br />
wie bei den eburonischen Plätzen keltische Merkmale. Kulturell betrachtet liegt der<br />
Petersberg zu dieser Zeit im Grenzbereich zwischen mittelrheinisch-keltisch<br />
beeinflussten Gebieten und dem „freien Germanien“.<br />
<strong>Die</strong> Burg auf dem Petersberg gehört laut Caesar zu dem Typ Kleinburgen, die er<br />
castellum nannte 171 . Allem Anschein nach wurde sie in der zweiten Hälfte des 1.<br />
165 J. Heinrichs, Sugambrer. RGA XXX (Berlin/New York 2006) 124.<br />
166 Gallischer Krieg Buch 4, Kapitel 16, Abschnitt 2 ff.<br />
167 H.E. Joachim, Archäologisches vom Petersberg bei Königswinter. Bonner Universitätsbl. 1997, 41-<br />
50.<br />
168 s. Abb. 53<br />
169 s. Abb. 54<br />
170 s. Abb. 54a<br />
171 H.E.Joachim, <strong>Die</strong> Ausgrabungen auf dem Petersberg bei Königswinter. Bonner Jahrb. 182, 1982,<br />
413.<br />
46
Jhdt. v. Chr. unzerstört aufgegeben. <strong>Die</strong>se Zeitstellung lässt uns wieder vermuten,<br />
dass sie angesichts der römischen Eroberung im Rheinland aufgegeben wurde,<br />
ähnlich wie einige der oben angeführten eburonischen Beispiele. Wahrscheinlich ist<br />
die Burg gar nicht Schauplatz von Kampfhandlungen geworden, jedenfalls gibt es<br />
keine Brandschichten oder andere Spuren von Zerstörung.<br />
2. <strong>Die</strong> Erdenburg bei Bensberg (Rhein.-Berg.Kreis)<br />
Am Rande der Bergischen Landes, nur 15 km Luftlinie von Köln entfernt, erhebt sich<br />
hinter dem Bensberger Schlossberg eine Bergkuppe, die im Volksmund seit über<br />
200 Jahren unter dem Namen „Erdenburg“ bekannt ist. Deutlich erkennt man hier die<br />
Ringwälle einer alten Fliehburg, die sich gut erhalten um die ganze Anlage ziehen 172 .<br />
Ursprünglich gehörten sie zu einem Wall-Graben-System mit aufgesetztem<br />
Wehrgang und zwingerartigem Toreingang im Westen 173 .<br />
Erstmalig wurden 1935 Ausgrabungen vom Kölner Museum für Vor- und<br />
Frühgeschichte unter der Leitung von Prof. Werner Buttler durchgeführt 174 nachdem<br />
der „Reichsführer SS“, Heinrich Himmler, im Rahmen der Stiftung „Deutsches<br />
Ahnenerbe“ die Schirmherrschaft über die Ausgrabungen übernommen hatte.<br />
Hauptsächlich fand man Scherben von Tongefäßen wie Trink- und Eßschalen. Aus<br />
ihnen folgerte man, dass die Erdenburg in der Spätlatènezeit, also etwa 1.Jhdt.<br />
v.Chr. errichtet wurde und zwar, wie auf dem Petersberg, vom Stamm der<br />
Sugambrer, die zu dieser Zeit zwischen Ruhr und Sieg ansässig waren. <strong>Die</strong><br />
Pfostenlöcher ermöglichten die Rekonstruktion einer hölzernen Wehranlage: Mit<br />
einem Plan-Grundriss konnte das ganze Wehrsystem zeichnerisch rekonstruiert<br />
werden 175 . Nach Buttlers Auffassung musste es in den Auseinandersetzungen mit<br />
den Römern eine militärisch-strategisch wichtige Rolle gespielt haben. In Köln, dem<br />
damaligen „Oppidum Ubiorum“ befand sich seit 38 v.Chr. ein festes Legionslager<br />
und gleichzeitig das Stammesheiligtum der römerfreundlichen Ubier, die Ara<br />
Ubiorum. Vermutlich sollte die Erdenburg zur Observierung dieses Platzes und zur<br />
172 s. Abb. 55<br />
173 Horn 1987, 353-355.<br />
174 W. Buttler/ H. Schleif, Prähist. Zeitschr. 28/29, 1937/38, 184-232.<br />
175 s. Abb. 56<br />
47
Abwehr der in Köln liegenden 10. Legion dienen, vielleicht sogar als Stützpunkt für<br />
germanische Einfälle in die römische Provinz.<br />
Im Herbst 1968 führte das Institut für Ur- und Frühgeschichte der Uni Köln erneute<br />
Grabungen durch, und zwar im gleichen Wallabschnitt, den sich damals Buttler<br />
schon vorgenommen hatte. <strong>Die</strong> C14 Analyse der Holzkohle ergab ein Alter von 310<br />
± 80 Jahre v. Chr. <strong>Die</strong> Erdenburg war demnach in römischer Zeit also schon<br />
vorhanden gewesen. Natürlich ist es denkbar, dass sie in den germanisch-römischen<br />
Auseinandersetzungen wieder benutzt wurde 176 . Genau wie der Petersberg wurde<br />
die Erdenburg um die Mitte des 1. Jhdt. v.Chr. unzerstört wieder aufgegeben. Bis zu<br />
beiden Anlagen sind die römischen Truppen offensichtlich nicht vorgedrungen.<br />
Interessant wäre in diesem Zusammenhang die Fragestellung, inwieweit die<br />
Sugambrer auf der rechten Rheinseite eine durchgehende Verteidigungslinie von<br />
Fliehburgen zum Rhein hin errichtet hatten. In Betracht zu ziehen wären hier m.E.<br />
noch der Güldenberg in der Wahner Heide (Siegkreis), der Lüderich bei Overath und<br />
weitere Anlagen, auf derselben Achse liegend (wie z.B. die Wallburg in Erberich bei<br />
Odenthal), die bislang noch nicht archäologisch untersucht wurden.<br />
3. Köln-Porz-Lind, latènezeitliches „Vielhausgehöft“<br />
Im Kölner Ortsteil Porz-Lind wurden in den Jahren 1973 – 1977 in einer Senke der<br />
Niederterrasse westlich der Wahner Heide eine Rettungsgrabung auf einem<br />
latènezeitlichen Siedlungsplatz durchgeführt 177 . <strong>Die</strong> Siedlung, ein Vielhausgehöft<br />
nach dem von den <strong>Eburonen</strong> bekannten keltischen Typus, lag an einem später<br />
vertorften Gewässer. Vermutlich waren auch die Gebäude von Porz-Lind in<br />
Fachwerktechnik errichtet. Sie bildeten ein Gehöft aus einem Wohnhaus und<br />
mehreren „gestelzten“ Speicherbauten zur Vorratshaltung 178 . Dem säurehaltigen<br />
Torfboden war es zu verdanken, dass Europas größtes Fundspektrum an<br />
latènezeitlichen Holzfunden und Pflanzenarten hier geborgen werden konnte.<br />
Hunderte von Holzobjekten stammen aus dem Haus- und Hofbereich und seiner<br />
176 H.E. Joachim, Rhein. Berg. Kalender 1974, 67.<br />
177 H.E. Joachim, Porz-Lind. Ein mittel- bis spätlatènezeitlicher Siedlungsplatz im „Linder Bruch“.<br />
Rhein. Ausgr. 47 (Mainz 2002) 40-42.<br />
178 s. Abb. 57<br />
48
Einrichtung, dienten für Umzäunungen und zur Viehhaltung, gehörten zu<br />
Behältnissen, stammen von Wagen und Waffen, andere waren Brotschieber oder<br />
Stampfer für das Backhandwerk, dienten zum Getreideanbau, zur Milchzubereitung,<br />
zur Pflanzenfaserverarbeitung und sogar zur Birkensaftgewinnung. Aus dem<br />
letzteren stellte die einheimische Bevölkerung, die Sugambrer, Klebemittel her. Im<br />
Vordergrund der landwirtschaftlichen Tätigkeit des Gehöfts standen Viehzucht,<br />
Milchproduktion und Ackerbau. An weiteren anorganischen Funden sind noch<br />
Keramik, Webgewichte, Gusstiegel und Schleuderkugeln zu nennen. <strong>Die</strong> keramische<br />
Ware zeigt Verbindungen zum Gebiet der Treverer, ein Indiz für die Tatsache, dass<br />
auch bei den Sugambrern keine Sicherheit besteht, ob es sich eher um Kelten oder<br />
um Germanen gehandelt hat.<br />
<strong>Die</strong> außerordentlich gut erhaltenen Holzfunde ermöglichten eine hervorragende<br />
dendrochronologische Untersuchung 179 . <strong>Die</strong> jahrringgenaue Bestimmung von 20<br />
Hölzern erbrachte, dass Porz-Lind auf jeden Fall in der Zeit von 189 – 111 v. Chr.,<br />
mit einem Schwerpunkt um 140 v. Chr. bestanden haben muss. Ein weiteres,<br />
jüngeres Dendrodatum sagt uns, dass Porz-Lind außerdem um 42 v. Chr. existierte,<br />
was letztendlich belegt, dass die Siedlung vom 2. Jhdt. v. Chr. bis in die 2. Hälfte des<br />
1. Jhdt. v. Chr. bestanden hat. Holz, das nach 42 v. Chr. geschlagen wurde, konnte<br />
nicht mehr aufgefundnen werden, aber einige römische Funde und die Ergebnisse<br />
der Pollenanalyse liefern den Hinweis, dass Sugambrer hier bis in die 1. Hälfte des<br />
1. Jhdt.n. Chr. gesiedelt haben. Da es auch in Porz-Lind keinen Hinweis auf<br />
Zerstörungen gibt, bleibt rätselhaft, warum der Platz aufgegeben wurde. Vermutlich<br />
war es die Nähe zur römischen Rheingrenze, die die Bewohner zwang, ihre Siedlung<br />
aufzugeben.<br />
Kaiser Tiberius hatte übrigens bereits im Jahre 8 v. Chr. 40 000 von den Kämpfen<br />
bei Oberaden verbliebenen Sugambrern von der rechten Rheinseite an den<br />
Niederrhein umgesiedelt, welche sich als „Verbündete auf Gedeih und Verderb“<br />
ergeben hatten 180 .<br />
Bei Auswertung dieser drei „sugambrischen“ Fundplätze fällt also auf, dass die<br />
beiden „Fluchtburgen“ Petersberg und Erdenburg ungefähr in der gleichen Zeit<br />
aufgegeben wurden, wie die eburonische Anlage von Kreuzweingarten. Beim<br />
179 Ders., Ein Siedlungsplatz der Jüngeren Eisenzeit in Köln-Porz, „Linder Bruch“. Rechtsrhein. Köln<br />
29, 2003, 9.<br />
180 Horn 1987, 36;141.<br />
49
Siedlungsplatz Porz-Lind besteht, wenn auch nicht lange, eine Kontinuität der<br />
Bevölkerung bis in die römische Zeit. Damit unterscheidet sich die rechtsrheinische<br />
Siedlung deutlich von jenen linksrheinischen auf <strong>Eburonen</strong>gebiet.<br />
d) Analyse des Haustyps der <strong>Eburonen</strong> (keltische Mehrhausgehöfte) im<br />
Unterschied zum germanischen Langhaus<br />
Im Teil a) der Fundplatzbeschreibung haben wir im Falle der Siedlungen von<br />
Niederzier-Hambach und Eschweiler-Laurenzberg von sogenannten „Vielfach“- oder<br />
„Mehrhaus“-Gehöften gesprochen. Da dieser Hoftyp ein bedeutendes Merkmal der<br />
keltischen Gesellschaften darstellt, ist es nicht unerheblich, gerade als Abgrenzung<br />
zur Fragestellung „germanisch“ oder „keltisch“, diesen näher im Bezug auf die<br />
<strong>Eburonen</strong> zu analysieren und den Unterschied zum germanischen Haustyp<br />
herauszuarbeiten.<br />
<strong>Die</strong> Siedlungsentwicklung im eisenzeitlichen Rheinland ist durch zwei<br />
unterschiedliche Siedlungsmuster gekennzeichnet 181 : eine Streusiedlungsstruktur<br />
(wie Jülich-Bourheim und Bonn-Muffendorf) und eine Dorfstruktur, mit z.T. äußerer<br />
Befestigung (wie Niederzier-Hambach und Eschweiler-Laurenzberg) 182 . Im<br />
<strong>Eburonen</strong>gebiet zwischen Rhein und Maas hatten sich zwei Regionen mit<br />
gegensätzlichen Wirtschaftsformen herausgebildet: Der fruchtbare Lößgürtel im<br />
Süden zwischen Köln und Maastricht wurde genutzt zum Anbau von Getreide, die<br />
Schotterböden und die sandigen Dünen des Nordens eigneten sich besser als<br />
Weideland und zur Viehwirtschaft. Beide Varianten geben sich archäologisch in den<br />
Hauslandschaften zu erkennen 183 :<br />
Im Norden finden wir zweischiffige Wohnstallhäuser vor.<br />
Es handelt sich um 10 – 20 m lange Pfostenbauten mit mittlerer Stützreihe, hohen<br />
Reetdächern und gegenüberliegenden Eingängen an den Langseiten, die den<br />
Wohnbereich mit Herdstelle vom Stallbereich trennten. <strong>Die</strong>ser Bautyp entspricht dem<br />
181 s. Abb. 58<br />
182 A. Simons, Wirtschafts- und Siedlungsweisen in der Bronze- und Eisenzeit des Rheinlandes. In: A.<br />
J. Kalis/J. Meurers-Balke (Hrsg.), 7000 Jahre bäuerliche Landwirtschaft: Entstehung, Erforschung,<br />
Erhaltung. Archäo-Physika 13 (Köln 1993) 66.<br />
50
des sogenannten „Typ Haps“ welcher durch Grabungen in den 60er Jahren auf dem<br />
niederländischen Kamps Veld bei der Ortschaft Haps in der Provinz Nordbrabant als<br />
eisenzeitliche Bauform nachgewiesen wurde 184 . Als auffällige Eigenschaft der<br />
Grundrisse von Haps springt das Vorhandensein von nur einer Mittelpfostenreihe ins<br />
Auge, was bedeutet, die Häuser sind zweischiffig 185 . <strong>Die</strong> Mittelpfosten sind<br />
Firstsäulen und tragen einen großen Teil des Dachgewichts. Neben den Firstsäulen<br />
spielen auch die Außenwandpfosten eine wichtige Rolle als Träger der Dachflügel.<br />
<strong>Die</strong> Wand des Hauses steht sozusagen „frei“ unter dem Dach, mit einer Höhe von<br />
bis zu 3 m. Außenwand- und Wandpfosten sind untereinander von Rähmen<br />
verbunden, die vermutlich an den beiden Eingangsbereichen unterbrochen werden.<br />
Unter einem Rähm ist ein Längsholz zu verstehen, das auf den Ständerenden<br />
aufgesetzt ist und diese horizontal verbindet. Hiermit bildet es den wichtigsten<br />
Gefügeteil im Längsverband des Hauses.<br />
Oftmals liegen die Eingänge beim Langhaus nicht genau in der Mitte der langen<br />
Wände. Damit erhält das Haus einen kürzeren und in einen längeren Teil. Bei<br />
einigen Befunden zeichnete sich ab, dass die Trennungswände von Viehboxen<br />
immer im längeren Teil liegen. Wie zusätzlich auch die Feuerstellen andeuten, war<br />
der kürzere Teil der Wohnbereich.<br />
<strong>Die</strong> durchschnittliche Länge der Häuser vom Typ Haps beträgt 14 m, ihre<br />
durchschnittliche Breite 5,1 m. <strong>Die</strong> beschriebenen Wohnstallhäuser treten jedoch<br />
nicht ausschließlich auf, sie sind vielmehr die Hauptgebäude von Hofanlagen. In<br />
Haps gehörten auch Speichergebäude zum Wirtschaftsbetrieb, und zwar drei Stück<br />
zu einem Langhaus. Reichmann konnte ähnliches für eisenzeitliche Höfe in<br />
Westfalen beobachten, z.B. für Telgte-Wöste, Soest-Ardey und Vreden-Borken 186 . In<br />
Haps wurden in einigen Pfostengruben, die man zu Speichern rechnete, erhebliche<br />
Mengen von Keramikscherben gefunden 187 . <strong>Die</strong>s könnte ein Hinweis sein, dass eine<br />
Reihe dieser Bauten mit vier oder mehr Pfosten dazu dienten, kleine Schutzdächer<br />
über Werkstätten zu tragen, zum Beispiel zur Herstellung von Keramik.<br />
183 U. Heimberg, Römische Villen an Rhein und Maas. Bonner Jahrb 202/203, 20002/2003, 59.<br />
184 G.J. Verwers, Das Kamps Veld in Haps in Neolithikum, Bronzezeit und Eisenzeit (Leiden 1972) 63<br />
ff.<br />
185 s. Abb. 59<br />
186 C. Reichmann, Ländliche Siedlungen der Eisenzeit und des Mittelalters in Westfalen. Offa 39, 1982,<br />
164.<br />
51
Im Süden zwischen Köln und Maas hingegen gab es, wie in weiten Teilen Mittel- und<br />
Nordgalliens üblich und damit im zentralkeltischen Bereich, „Mehrhausgehöfte“-<br />
bestehend aus Wohnhäusern, Ställen und Speichern. Hier waren nämlich Wohnen<br />
und Viehhaltung im Unterschied zu den germanischen Langhäusern getrennt. <strong>Die</strong><br />
Häuser sind in Bezug auf Größe und Struktur nahezu identisch (s. Niederzier-<br />
Hambach, Eschweiler-Laurenzberg und Vergleichsfund Bundenbach). An der<br />
Gleichförmigkeit der Häuser lässt sich ablesen, dass die Haushalte einander<br />
gleichgestellt waren. <strong>Die</strong> Sippen und Sippenverbände waren gleichberechtigt<br />
innerhalb der Gemeinschaft, es gab keine erkennbaren Führungsschichten oder<br />
elitären Verbände.<br />
Wohnhaus, Stall und Speicher waren also die wesentlichen Bestandteile, die ein<br />
keltisches Gehöft ausmachten 188 . Auch Zäune dürften zu den Siedlungen gehört<br />
haben, die den engeren Hausbereich abgrenzten und die freilaufenden Haustiere<br />
draußen bzw. drinnen hielten. Das Wohnhaus war ein Pfostenbau mit Satteldach 189 .<br />
Zwischen den Eckpfosten standen in der Mitte der Schmalseiten noch Firstständer<br />
zum Auflegen des Dachbelags. Zur gegenseitigen Stabilisierung und als oberer<br />
Wandabschluss waren gegenüberstehende Pfostenpaare durch Kopf- oder<br />
Jochbalken miteinander verzimmert und ebenfalls in der Längsachse durch<br />
Rähmbalken miteinander verbunden. <strong>Die</strong> Haustür befand sich zwischen Rähmbalken<br />
und Türpfosten. Damit sie die Wohnung einigermaßen dicht verschloss, war am<br />
Boden ein Schwellbalken eingelassen. <strong>Die</strong> Wände waren grundsätzlich mit<br />
lehmverputztem Flechtwerk gearbeitet. Der Dachbelag bestand ebenfalls gänzlich<br />
aus organischem Material, vermutlich handelte es sich um Reet-, Rinde- oder<br />
Holzschindeln.<br />
Neben dem Wohnhaus entstand auf ähnlich schlichtem Grundriss ein völlig anderer<br />
Bau. Der Unterschied bestand lediglich in der Größe der Fläche und der reduzierten<br />
Anzahl der Pfostenlöcher. Wie aus Teil a) dieses Kapitels bereits bekannt ist,<br />
werden Gebäudegrundrisse mit vier Pfostenlöchern meist als Speicherbauten<br />
interpretiert. Allerdings besaß der Speicher im Gegensatz zum Wohnhaus weitaus<br />
187 Verwers 1972, 94.<br />
188 H. Nortmann, Haus, Speicher, Zaun. Elemente einer keltischen Siedlung im Modell. Funde u.<br />
Ausgr. Bezirk Trier 31, 1999, 7–15.<br />
189 s. Abb. 60<br />
52
stabilere Ständer. Damit größere und schwerere Erntemengen und andere Vorräte<br />
gelagert werden konnten, mussten die Bauten stabil sein. Um Schutz vor<br />
Feuchtigkeit und vor Schädlingen zu gewährleisten, standen sie auf Stelzen vom<br />
Boden abgehoben. <strong>Die</strong> Wohnhäuser hingegen waren unmittelbar im Boden<br />
fundamentiert und setzten damit gerade die tragenden Hölzer der Bodenfeuchte aus.<br />
Selbst das als extrem widerstandsfähig geltende Eichenholz fängt unter diesen<br />
Bedingungen in Bodennähe bald an zu rotten. In absehbarer Zeit, vielleicht schon<br />
nach einer Generation, war also ein Neubau fällig. Vielleicht war aber auch gerade<br />
dies der Gedanke der dahinter steckte: Jeder baute individuell für sich und seine<br />
Familie ein eigenes Haus, das nur die eigene Lebenszeit überdauerte.<br />
<strong>Die</strong> einheimische Bevölkerung der rheinischen Lößbürde bevorzugte also<br />
augenscheinlich diesen keltischen Typ des Mehrhausgehöfts gegenüber der<br />
„germanischen“ Bauform des Wohnstall-Langhauses.<br />
53
IV. Kontinuität oder Diskontinuität?<br />
Aus Kapitel II, das sich mit den historischen Quellen auseinandersetzt, wissen wir<br />
bereits, dass der Krieg gegen die <strong>Eburonen</strong> spätestens im Jahre 50 v. Chr.<br />
abgeschlossen war. Ferner haben wir im Vorfeld erfahren, dass, gemäß Strabos<br />
Überlieferungen, die Umsiedlung der römerfreundlichen Ubier in das entvölkerte<br />
Gebiet auf Anordnung Agrippas 38 v. Chr. erfolgte. Das bedeutet, dass das<br />
ehemalige Land der <strong>Eburonen</strong> mindestens zwei Jahrzehnte siedlungsleer war. Im<br />
allgemeinen jedoch ist festzustellen, dass die spätlatènezeitlichen Siedlungen in den<br />
Lößbörden des südlichen Niederrheingebietes im frühen 1. Jhdt. v. Chr. abbrechen,<br />
die römischen Plätze hingegen schwerpunktmäßig ab der Mitte des 1. Jhdt. n. Chr.<br />
einsetzen 190 . <strong>Die</strong> Ergebnisse der archäobotanischen Untersuchungen der<br />
Getreidepollen aus der fraglichen Zeitstellung, auf die ich in Abschnitt 3 explizit<br />
eingehen werde, untermauern den archäologischen Befund. Sie liefern uns den<br />
Nachweis, dass der Bewuchs sich veränderte: <strong>Die</strong> auf Ackerbau hinweisenden<br />
Getreidepollen verschwanden und wurden durch Baumpollen ersetzt. Das bedeutet,<br />
dass der Wald weiter vordrängte und keine Landwirtschaft mehr betrieben wurde.<br />
Insofern bestanden dort auch keine Siedlungen mehr. <strong>Die</strong> Pollenanalysen bezeugen,<br />
dass die ersten römischen Ansiedlugen wieder in der Mitte des 1. Jhdt. n.Chr.<br />
begannen. Erst dann verdrängten die Getreidepollen wieder die Baumpollen.<br />
Offensichtlich wurde der junge Wald wieder teilweise gerodet, um Ackerland zu<br />
gewinnen 191 .<br />
Siedlungsplätze wie Pulheim-Brauweiler, welchen ich in Abschnitt 4 näher vorstellen<br />
werde, zeigen, dass Kontinuität nicht zwingend Platzkontinuität durch räumliche<br />
Überlagerung der Vorgängersiedlung bedeuten muss. <strong>Die</strong> frührömische<br />
Nachfolgersiedlung konnte genauso gut auch wenige Meter weiter errichtet worden<br />
sein, nachdem die alte, latènezeitliche aufgegeben wurde. Sie wurde eben nur noch<br />
nicht von den Archäologen entdeckt. <strong>Die</strong>se Platzverschiebung wäre natürlich in<br />
jedem Falle als Kontinuität der Siedlungstätigkeit zu werten.<br />
190 J.-N. Andrikopoulou-Strack, <strong>Eburonen</strong> – und was dann? In: G. Brands (Hrsg.), Rom und die<br />
Provinzen. Bonner Jahrb. Beih. 53 (Mainz 2001) 163–172.<br />
191 M. Gechter, Das römische Bonn – Ein historischer Überblick. In: M. van Rey (Hrsg.), Geschichte<br />
der Stadt Bonn 1. Bonn von der Vorgeschichte bis zum Ende der Römerzeit (Bonn 2001) 56.<br />
54
Auch verschiedene Funde keltischer Münztypen, vorgestellt in Abschnitt 2, die<br />
später als in das Jahr 50 v. Chr. datieren, könnten einen Hinweis liefern auf das<br />
Fortleben eburonischer Stammesangehöriger nach dem Gallischen Krieg. <strong>Die</strong>se<br />
Münzen wurden nämlich nicht mehr im Kernland der <strong>Eburonen</strong> gefunden, sondern in<br />
den Randbereichen anderer Stämme und wo sich zum Teil neue Stammeskulturen<br />
formiert hatten. Auch der Fragestellung, wo diese Münzen geprägt wurden und von<br />
wo aus sie in Umlauf gebracht wurden, wird in Abschnitt 2 näher beleuchtet.<br />
Eine dieser nach 50 v. Chr. neu entstandenen Stammesverbände auf ehemals<br />
eburonischem Gebiet waren die Tungrer, ebenso wie die jetzt linksrheinisch<br />
siedelnden Ubier, die Cugerner, die Bataver, die Cananefaten, die Texuandrer und<br />
die Frisiavonen 192 193 . Besonders interessant ist in diesem Zusammenhang auch der<br />
Name der im Rhein-Maas-Delta neu siedelnden Texuandrer 194 : Er leitet sich<br />
vermutlich ab von taxus, dem lateinischen Wort für Eibe. Somit wäre der Name<br />
dieses „neuen“ Stammesgebildes nur die lateinisierte Bezeichnung für die <strong>Eburonen</strong><br />
und könnte soviel bedeuten wie: Volk der Eibe 195 . <strong>Die</strong> Texuandrer finden sogar<br />
Erwähnung bei Plinius, der ihr Wohngebiet nördlich vom Waal, östlich des Peel,<br />
südlich der Demer und westlich vom Escaut angibt 196 . Im Gebiet der Betuwe, der<br />
heutigen Provinz Gelderland, zwischen Waal und Oude Rijn gelegen, wurde bei<br />
einem Stammesrest der <strong>Eburonen</strong> nur die Führungsschicht durch die Römer<br />
ausgewechselt. <strong>Die</strong> Adelsschicht des germanischen Stammes der Chatten, der<br />
rechtsrheinisch im Mittelrheintal siedelte, stand in starken sozialen Spannungen zum<br />
Rest des Stammes. Daher wurde der Adel von den Römern angewiesen, sich als<br />
neue Oberschicht einiger führerloser Stammesverbände an der Betuwe anzusiedeln.<br />
Seit jenem Zeitpunkt wurde dieser neu gebildete Stamm Bataver genannt. Weitere<br />
Reststämme ursprünglich eburonischer Herkunft kennen wir außerdem aus den<br />
Gebieten um Aachen und Heerlen mit den Sunukern und Baetasii. In Kornelimünster<br />
192 s. Abb. 61 u. 61a<br />
193 H. Galsterer, Gemeinden und Städte in Gallien und am Rhein. In: G. Precht (Hrsg.), Genese,<br />
Struktur und Entwicklung römischer Städte im 1. Jahrhundert n. Chr. in Nieder- und Obergermanien.<br />
Xantener Ber. 9 (Mainz 2001) 5.<br />
194 Gechter 2001, 56.<br />
195 S. Scheers, Frappe et circulation monétaire sur le territoire de la future Civitas Tungrorum. Rev.<br />
Belge Num. 142, 1996, 24.<br />
196 Plinius, NH, 4, 98; Der Kleine Pauly, I, Stuttgart 1964, 146.<br />
55
ei Aachen ist eine Tempelanlage der Sunuker bekannt, die ich in Abschnitt 5<br />
vorstelle.<br />
Das Kernland der <strong>Eburonen</strong>, die Lößbörden zwischen Rhein und Maas sowie<br />
Teilgebiete davon bis ungefähr zur Höhe von Xanten blieben jedoch weitgehend<br />
siedlungsleer 197 198 .<br />
Wahrscheinlich bildeten die Tungrer ab der Zeit der römische Neustrukturierungen<br />
den größten Bevölkerungsanteil im ursprünglichen <strong>Eburonen</strong>gebiet 199 200 .<br />
Gehen wir im folgenden Abschnitt 1 der Frage auf die Spur, inwieweit sich ehemalige<br />
<strong>Eburonen</strong> in der neu gegründeten Civitas Tungrorum, dem Hauptort der Tungrer auf<br />
ursprünglich eburonischem Gebiet, befanden und zu dessen Aufbau beitrugen:<br />
1. Tongeren (Civitas Tungrorum)<br />
<strong>Die</strong> Stadt Tongeren, heute in Belgien gelegen, hieß in vorgeschichtlicher Zeit<br />
Aduatuca und war das Zentrum der römischen Civitas Tungrorum 201 . <strong>Die</strong>se wurde<br />
unter Kaiser Augustus als Teil der neu entstandenen Provinz Gallia Belgica im<br />
letzten Jahrzehnt vor Christus gegründet 202 . Unklar ist nach wie vor, ob der Name<br />
der Tungrer von einer von Caesar nicht genannten Teilgruppe der ehemaligen<br />
Germani cisrhenani stammt, von einer umgesiedelten rechtsrheinischen Gruppe<br />
oder eine gänzliche Neuschöpfung aus dieser Zeit darstellt.<br />
<strong>Die</strong> neueren Auswertungen der bisherigen Grabungsbefunde und –funde haben<br />
ergeben, dass Tongeren wahrscheinlich 10 v. Chr. nicht als Militärlager, wie<br />
ursprünglich angenommen, sondern als Civitashauptstadt der Tungrer gegründet<br />
wurde. <strong>Die</strong> vielen militärischen Funde und Befunde, die in diese Zeit datieren, lassen<br />
sich evtl. dadurch erklären, dass nur die römische Armee die technische Kenntnis<br />
197 Gechter 2001, 56.<br />
198 s. Abb. 62<br />
199 J. van Heesch, Tungrer/Tungri. Historisch. RGA² XXXI (2006) 336.<br />
200 s. Abb. 61<br />
201 S. Zimmer, Tungrer/Tungri. Sprachlich. RGA² XXXI (2006) 335.<br />
202 A. Vanderhoeven, Aspekte der frühesten Romanisierung Tongerens und des zentralen Teiles der<br />
civitas Tungrorum. In: TH. Grünewald/S. Seibel (Hrsg.), Kontinuïtät und Diskontinuïtät. Germania<br />
inferior am Beginn und am Ende der römischen Herrschaft. Beiträge des deutsch-niederländischen<br />
Kolloquiums in der Katholieke Universiteit Nijmegen (27. bis 30.06.2001). RGA Ergbd. 35 (Berlin, New<br />
York 2003) 119.<br />
56
und das Potential menschlicher Arbeitskraft besaß, um ein solches Unternehmen in<br />
Angriff zu nehmen 203 .<br />
Tongeren war in seiner jüngeren Phase, in augusteischer bis vorflavischer Zeit, von<br />
einer Befestigung aus Spitzgräben, Palisaden und Erdwällen umgeben 204 205 . Erst in<br />
der späteren Phase wurde eine Stadtmauer errichtet. <strong>Die</strong> Befunde innerhalb der<br />
Umwehrung jedenfalls liefern ein Indiz gegen eine denkbare Ansiedlung ehemaliger<br />
eburonischer Stammensangehöriger: Hier standen Wohnstallhäuser eines<br />
niederrheinischen Typs, also germanische Langhäuser 206 . <strong>Die</strong>se Tatsache<br />
widerspricht ganz klar der eburonischen Hausbauweise, die ich im vorangehenden<br />
Kapitel analysiert habe. <strong>Die</strong> Bautechnik kann also unwahrscheinlich von Menschen<br />
eburonischer Abstammung angewandt worden sein. Ferner zeigte eine im Zentrum<br />
der Stadt untersuchte Ansammlung von vier Wohnstallhäusern eine starke<br />
hierarchische Gliederung 207 . Drei normale Wohnstallhäuser mit deutlich erkennbaren<br />
Stallteilen umgaben ein Wohnstallhaus ohne Stallteil mit zwei viereckigen Kellern. In<br />
einem Pfostenloch fand sich ein Bauopfer und ein Hort mit zehn republikanischen<br />
und augusteischen Denaren. Letzteres Haus weckt den Eindruck, als habe man<br />
versucht, aus einem germanischen Haustyp eine römische Wohnung zu machen.<br />
Auch diese hierarchische Differenzierung spricht eindeutig gegen die bisher<br />
bekannten eburonischen Befunde.<br />
Allerdings ist bei der Frage nach Kontinuität oder Diskontinuität auch zu bedenken,<br />
dass seit dem Feldzug gegen die <strong>Eburonen</strong> und dem Bau der Civitas Tungrorum<br />
bereits 40 Jahre vergangen sind, d.h. eine ganze Generation.<br />
Im Bereich der Graben- und Pfostenlochverfüllungen befand sich vor allem<br />
spätaugusteische und tiberische Keramik, vergleichbar mit jener der entstehenden<br />
zeitgleichen Militärlagern Oberaden, Rödgen und Dangstetten. Außerdem fand man<br />
Terra Sigillata und römische Münzen, wie z.B. ein Münzschatz aus neun silbernen<br />
Denaren aus der Kielenstraat in Tongeren 208 . Trotzdem wurden in Tongeren und in<br />
203 Vanderhoeven 2003, 129.<br />
204 Ders., 123.<br />
205 s. Abb. 63<br />
206 s. Abb. 64<br />
207 Ders., 130.<br />
208 C.Creemers/A.Vanderhoven, Vom Land zur Stadt. <strong>Die</strong> Entstehung des römischen Tongeren. In: G.<br />
Uelsberg (Hrsg.): Krieg und Frieden-Kelten, Römer, Germanen. Katalog Rheinisches LandesMuseum<br />
(Bonn 2007) 265.<br />
57
der Gegend um Tongeren in der 2. Hälfte des 1. Jhdt. v. Chr. immer noch<br />
einheimische Münzen als Zahlungsmittel verwendet. <strong>Die</strong>se Münzfunde liefern uns<br />
damit ein Indiz für ein mögliches Fortleben eburonischer Stammesangehöriger nach<br />
50 v. Chr. und sollen im folgenden Abschnitt 2 thematisiert werden.<br />
2. Eburonische Münzen nach 50 v. Chr.?<br />
In Tongeren wurden im Süd-West-Sektor der römischen Siedlung Bronzemünzen<br />
gefunden mit der Aufschrift AVAVCIA 209 . <strong>Die</strong>ser Münztyp trägt die genannte<br />
Aufschrift auf der Vorderseite und zeigt entweder ein galoppierendes Pferd oder ein<br />
Hakenkreuz, sowohl rechtsdrehend als auch linksdrehend 210 211 . Bei der Aufschrift<br />
AVAVCIA handelt es sich vermutlich um einen Personennamen, konkret gesagt um<br />
einen einheimischen Anführer, der die Münzen in der Zeitspanne von 30 – 20 v. Chr.<br />
im Umlauf brachte. Neben den AVAVCIA-Münzen gab es insgesamt 10 Funde eines<br />
ähnlichen Münztyps auf ehemaligem <strong>Eburonen</strong>gebiet. <strong>Die</strong>se tragen die Aufschrift<br />
ANNAROVECI und bestehen aus Silber 212 .<br />
Genau wie bei den Treverern wird auf ehemaligem <strong>Eburonen</strong>gebiet, nachdem das<br />
Gold verschwunden war, Silbergeld geprägt, im Falle der ANNAROVECI-Münzen mit<br />
einem geringen Gewicht von 1,60 g. So schließen diese Münzen chronologisch<br />
vermutlich die Lücke zwischen den AVAVCIA-Münzen und den Triskelstateren, die<br />
noch zu Caesars Zeit in Umlauf waren und datieren hiermit in die Jahre 45 – 30 v.<br />
Chr. 213 . Von ihrer Motivgebung mit Pferd und Sonnenrad stehen die Münzen m.E.<br />
deutlich in der Tradition der Vorgängermünzen vom Typ Lummen-Niederzier und der<br />
Triskelstatere, die ich bereits in Kapitel III, Abschnitt 3, vorgestellt habe. <strong>Die</strong><br />
Münzfunde sprechen dafür, dass in der Region um Tongeren ein spezielles<br />
Währungsgebiet vorherrschte, das sich deutlich unterschied vom Gebiet der Nervier<br />
im Westen und dem Gebiet der Treverer im Süden 214 . <strong>Die</strong>ses existierte bereits vor<br />
209 Vanderhoeven 2003, 125.<br />
210 Scheers 1996b, 14.<br />
211 s. Abb. 65<br />
212 s. Abb. 65a<br />
213 Scheers 1996b, 11.<br />
214 Scheers 1996b, 25.<br />
58
Caesars Invasion und bestand auch noch danach, wie die ANNAROVECI und<br />
AVAVCIA Münzen beweisen. In jedem Fall handelt es sich um eine<br />
Währungskontinuität, was wiederum bedeutet, das einheimische politische<br />
Machthaber auch nach 50 v. Chr. vorhanden gewesen sein müssen. Bekannt sind<br />
die ANNAROVECI und AVAVCIA Münzen auch unter dem Namen „Aduatuci“ 215 ,<br />
namentlich vermutlich eine Ableitung von Aduatuca Tungrorum 216 .<br />
<strong>Die</strong> Aduatuci-Münzen wurden nicht nur in Tongeren, sondern im ganzen<br />
Niederrheingebiet gefunden 217 . Außer in der Region Tongeren gibt es eine weitere<br />
Fundkonzentration vor allem in Nijmegen, in Haltern, in Oberaden, in Asberg und<br />
rechts und links des Rheinlaufs. Auch in Köln in der augusteischen Anlage des<br />
Kölner Domareals wurde dieser Münztyp gefunden 218 . <strong>Die</strong> Münzen entsprechen den<br />
Typen Scheers 217 I - III 219 und datieren in die Jahre 15 - 1 v. Chr 220 . Johannes<br />
Heinrichs spricht sogar von einem Prototypen, der sich im niedergermanischen<br />
Bereich als Prägung der Tungrer oder Sunuker mit einem Umlaufhöhepunkt<br />
zwischen 7 v. Chr. und der Zeitenwende entwickelt hatte 221 .<br />
Eine andere Spur des Fortlebens ehemaliger eburonischer Stammesangehöriger<br />
glaube ich auf dem Dünsberg in Hessen zu finden, welcher bereits in Kapitel III,<br />
Abschnitt 3, Erwähnung findet 222 .<br />
30 v. Chr. fand hier ein Machtwechsel statt: <strong>Die</strong> Chatten eroberten das Oppidum der<br />
Ubier. Ab dieser Zeitspanne finden immerhin bereits die ersten Umsiedlungen der<br />
Ubier auf linksrheinisches Gebiet statt, die größten Maßnahmen vermutlich unter<br />
Agrippa während seiner 2. Statthalterschaft 19 v. Chr. Mit dem Verlust ihres<br />
215 M. Gechter, <strong>Die</strong> frühe ubische Landnahme am Niederrhein. In: V. A. Maxfied/M. J. Dobson (Hrsg.),<br />
Roman Frontier Studies 1989. Proceedings of the XVth International Congress of Roman Frontier<br />
Studies (Exeter 1991) 439.<br />
216 E. Nuber, 1974 Der frührömische Münzumlauf in Köln, Kölner Jahrbuch für Vor- und<br />
Frühgeschichte 14, 51.<br />
217 s. Abb. 66<br />
218 s. Abb. 67, Münzauswahl<br />
219 s. Abb. 68, classe I=744, classe II=745-746, classe III=747<br />
220 J. Heinrichs, Vor dem Oppidum Ubiorum. In: G.A. Lehmann/Rainer Wiegels (Hrsg.), Römische<br />
Präsenz und Herrschaft in Germanien der augusteischen Zeit. Der Fundplatz von Kalkriese im Kontext<br />
neuerer Forschungen und Ausgrabungsbefunde. Beiträge zu der Tagung des Fachs Alte Geschichte<br />
der Universität Osnabrück und der Kommission „Imperium und Barbaricum“ der Göttinger Akademie<br />
der Wissenschaften in Osnabrück vom 10. – 12. Juni 2004 (Osnabrück 2004) 246.<br />
221 Ders., 295.<br />
222 s. Abb. 69<br />
59
Hauptoppidums wird die Bereitschaft von ubischer Seite zu römischem Protektorat<br />
um so nachvollziehbarer 223 . Ab dieser Zeit taucht eine neue Münzprägung auf dem<br />
Dünsberg auf: Es handelt sich um die Regenbogenschüsselchen der sogenannten<br />
Untergruppe Bochum 224 , kupferne Regenbogenschüsselchen mit Dreiwirbel.<br />
Namensgebend war der Schatzfund von Bochum mit denselben Münztypen 225 .<br />
Ikonographisch tritt eine Veränderung ein von den chattischen Münzen gegenüber<br />
dieser neuen Münzserie und zwar insbesondere im Beizeichenspektrum 226 . Bei den<br />
Beizeichen handelt es sich um Kringelmarken, die nun nicht mehr im unteren Teil der<br />
Kugelpyramide auftreten, sondern formiert in mehrgliedrigen Gebilden unterhalb der<br />
obersten Pyramidenkugel 227 . Neben dem elfmal vertretenen Grundtypen sind sieben<br />
Beizeichenvarianten am Dünsberg belegt. Einige sind als ubisch klassifizierbar, die<br />
meisten jedoch gehören bereits in die linksrheinische Siedlungsphase. Überhaupt<br />
lässt die große Varianz der Bochumer Beizeichen breiten Spielraum für<br />
Prägeherrren aus verschiedenen Ethnien zu, wie z.B. Ubier, Chatten, Bataver.<br />
Chatten und Bataver haben bereits vor 30 v. Chr. ubische Münztypen nachgeprägt.<br />
Nachprägungen warfen nach keltisch-germanischen Vorstellungen übrigens keine<br />
hoheitlichen Probleme auf, da Münztypen nicht urheberrechtlich geschützt waren. So<br />
konnte jeder (aristokratische) Eigentümer von erforderlichem Prägemetall die<br />
Emission von Münzen in Auftrag geben 228 . Während des Gallischen Kriegs siedelten<br />
Ubier und Chatten benachbart zwischen Lahnmündung und dem Raum Kassel.<br />
Beide Stämme prägten dieselben germanischen Münztypen, die ursprünglich aber<br />
von den Ubiern auf dem Dünsberg emittiert worden waren: <strong>Die</strong><br />
Regenbogenschüsselchen mit Dreierwirbel und die Quinare mit „Tanzendem<br />
Männlein“ (Scheers 57) 229 . Bei den Ubiern sind beide Typen ab ca. 70 v. Chr. im<br />
Umlauf, bei den Chatten ab 45 v. Chr. Ca. 40 v. Chr. setzen im Raum<br />
223 J. Heinrichs, Ubier, Chatten, Bataver. Mittel- und Niederrhein ca. 70-71 v. Chr. anhand<br />
germanischer Münzen. In: Th. Grünewald/S. Seibel (Hrsg.), Kontinuität und Diskontinuität. Germania<br />
inferior am Beginn und am Ende der römischen Herrschaft. Beiträge des deutsch-niederländischen<br />
Kolloquiums in der Katholieke Universiteit Nijmegen (27. bis 30.06.2001). RGA Ergbd. 35 (Berlin,<br />
New York 2003) 322.<br />
224 s. Abb. 70 + 70a<br />
225 Schulze-Forster 2002, 125.<br />
226 Heinrichs 2003, 323.<br />
227 Ders., 322.<br />
228 Ders., 317.<br />
229 Scheers 1977<br />
60
s’Hertogenbusch (proto-) batavische Regenbogenschüsselchen mit chattischen<br />
Beizeichen ein. Um 30 v. Chr. enden diese ursprünglich chattisch-batavischen<br />
Beizeichen, bestehend aus Kringeln an unterschiedlichen Stellen im Münzbild beider<br />
Typen. <strong>Die</strong> Regenbogenschüsselchen erhalten jetzt die oben beschriebenen neuen<br />
Markierungen 230 . Den Schritt zur Einführung eines neuen Beizeichensystems ist am<br />
ehesten einer nicht-chattischen Gruppe zuzutrauen.<br />
In der Einleitung zu Kapitel IV habe ich bereits die Vermutung angestellt, dass es<br />
sich bei dem neu entstandenen Stamm der Bataver um eine Symbiose chattischer<br />
Adeliger mit ehemaligen eburonischen Stammesverbänden handeln könnte.<br />
Vielleicht wäre es möglich, dass der eburonische Anteil der neu entstandenen<br />
Bataver die Inspiration für die neue Münzmarkierung gegeben hat? <strong>Die</strong> reichliche<br />
Verwendung Bochumer Regenbogenschüsselchen in römischen Militärlagern zeigt<br />
uns, dass sogar die Römer die einheimische Prägung akzeptierten, zumindest als<br />
Kleingeld auf einer geringen nominalen Wertstufe 231 .<br />
230 Heinrichs 2003, 328.<br />
231 Ders., 326.<br />
61
3. Analyse der archäobotanischen Untersuchungen:<br />
- Stimmen die Ergebnisse mit den Siedlungsabbrüchen um 50 v. Chr.<br />
überein?<br />
- Sind die Aufgaben von Siedlungen evtl. auch auf andere Faktoren als<br />
die römische Bedrohung zurückzuführen?<br />
Unter Archäobotanik verstehen wir die Analyse von Pflanzenpollen, die aus vor- oder<br />
frühgeschichtlichen Erdschichten stammen 232 . <strong>Die</strong>se Pollenanalyse, auch<br />
Palynologie genannt, befasst sich mit der Untersuchung von Blütenstaub, also den<br />
Pollen und Sporen, die in ihrer Gesamtheit auch als Mikroreste bezeichnet werden.<br />
Ergänzt wird die Pollenanalyse oftmals durch botanische Großrestanalysen, d.h.<br />
Untersuchungen von Makroresten aller Pflanzenteile wie Samen, Blättchen, ganze<br />
Früchte bis hin zu vollständigen Baumstämmen. <strong>Die</strong> Erforschung pflanzlicher Mikro-<br />
und Makroreste konzentriert sich überwiegend auf die Familien der Abteilung<br />
Samenpflanzen, deren Arten Pollen, Samen, Früchte und Holz bilden. <strong>Die</strong>s ist<br />
nämlich nicht bei allen Pflanzenarten der Fall. <strong>Die</strong> Großrestanalysen als<br />
Forschungszweig innerhalb der Archäobotanik werden uns im weiteren jedoch nicht<br />
interessieren.<br />
Pollenanalytische Untersuchungen ermöglichen es, die Vegetationsgeschichte zu<br />
rekonstruieren. <strong>Die</strong> Interpretation von Pollendiagrammen gibt Hinweise auf die<br />
Beeinflussung der natürlichen Vegetation durch die Menschen und damit auf deren<br />
Wirtschaftsweise 233 . Bei der Pollenanalyse werden Blütenstaub und Sporen<br />
untersucht, die auf den Boden abgesunken und unter günstigen Bedingungen in<br />
feuchten Ablagerungen wie in Mooren, Sümpfen, Auen oder Bachtälern eingebettet<br />
worden sind 234 . Nur in diesen Feuchtböden können sich Pollen erhalten, denn sie<br />
werden ansonsten wie alle organischen Substanzen in durchlüfteten Schichten von<br />
Mikroorganismen zerstört. Aus den Feuchtbödenschichten werden Profilsäulen<br />
entnommen und von oben nach unten zentimeterweise untersucht, um eine zeitlich<br />
differenzierte Abfolge der Vegetationsgeschichte zu erlangen. Das Pollenmaterial<br />
gewinnt man letztendlich, indem die Bodenprobe im Labor mit verschiedenen<br />
232 S. Jacomet/A. Kreuz, Archäobotanik. Aufgaben, Methoden und Ergebnisse vegetations- und<br />
agrargeschichtlicher Forschung (Stuttgart 1999) 23 ff.<br />
233 Simons 1989, 95.<br />
62
chemischen Lösungen von allem Beiwerk „gereinigt“ wird. <strong>Die</strong> übrig gebliebenen<br />
Pollen können dann unter dem Mikroskop bestimmt und ausgezählt werden. Da viele<br />
Pflanzenarten und Gehölze charakteristische Pollenkörner produzieren, sind sie<br />
eindeutig zuzuordnen.<br />
Vor der Einführung der Landwirtschaft war das Rheinland vollständig mit dichten<br />
Wäldern bedeckt. Nachweisbar ist gerodetes Waldland durch das Vorkommen von<br />
Kräuter- und Gräserpollen. Siedlungsland wird durch Unkrautpollen wie Beifuss,<br />
Knöterich, Gänsefußgewächse und Großen Wegerich belegt. Hinweise auf Ackerbau<br />
liefern hingegen Getreidepollen und Pollen von Ackerunkraut wie Klatschmohn,<br />
Kornblume oder Kornrade.<br />
Neben Rodung und Besiedlung ist natürlich auch das Klima ein wesentlicher Faktor<br />
für die Landschaftsveränderung. Der Nachweis wärmeliebender oder kälteresistenter<br />
Pflanzen ermöglicht Aussagen zum damaligen Klima. Es lassen sich sogar<br />
Aussagen über ihre Wuchsorte treffen, denn bestimmte Pflanzen sind typisch für<br />
bestimmte Standorte, z.B. wachsen Pappeln und Weiden in flussnahen Auen,<br />
während Eichen, Eschen und Ulmen in höheren und trockeneren Lagen zu finden<br />
sind. Mit Hilfe der Pollenanalyse kann also gleichzeitig die Besiedlungs-,<br />
Vegetations- und Klimageschichte einer Region rekonstruiert werden.<br />
Während der gesamten späten vorrömischen Eisenzeit kam es in der Rheinischen<br />
Lößbörde zu bisher noch nie da gewesenen Entwaldungen zum Zwecke der<br />
Landwirtschaft. <strong>Die</strong> Lößbörde trägt den Namen ihrer Böden, die ausschließlich aus<br />
Lockergesteinen aufgebaut sind 235 . Bodenbildende Gesteine sind Löß und<br />
Auenlehme, Sande und Kies kommen nur lokal an Talböschungen, an denen der<br />
Löß erodiert ist, an die Oberfläche. Das lockere und hohlraumreiche Gefüge des<br />
Lösses, sein günstiger Wasser- und Lufthaushalt sowie sein hoher Gehalt an leicht<br />
verwitterbaren Mineralien machen ihn zu einem landwirtschaftlich sehr<br />
leistungsfähigem Gestein.<br />
<strong>Die</strong> Jülicher Börde ist ein Lößgebiet im westlichen Teil der Niederrheinischen Bucht.<br />
An ihrem westlichen Rand zwischen Aachen und Jülich liegt die sogenannte<br />
234 K.-H. Knörzer/R. Gerlach/J. Meurers-Balke/A. J. Kalis/U. Tegtmeier/W. D. Becker/A. Jürgens,<br />
PflanzenSpuren. Archäobotanik im Rheinland: Agrarlandschaft und Nutzpflanzen im Wandel der<br />
Zeiten. Mat. Bodendenkmalpfl. Rheinland 10 (Köln 1999), 13 ff.<br />
235 F. Bunnik, Pollenanalytische Ergebnisse zur Vegetations- und Landwirtschaftsgeschichte der<br />
Jülicher Lößbörde von der Bronzezeit bis in die frühe Neuzeit. Bonner Jahrb. 195, 1995, 315.<br />
63
Aldenhovener Platte 236 . Mit beiden Gebieten befinden wir uns also mitten auf<br />
ehemaligem eburonischen Territorium.<br />
Natürliche Wälder waren in der späten Eisenzeit hier kaum noch vorhanden, bzw.<br />
die wenigen noch bestehenden Wälder zu Wirtschaftswäldern umgewandelt worden.<br />
<strong>Die</strong> Analysen des Pollenmaterials stammen aus Boslar in der Nähe von Jülich 237 . Es<br />
handelt sich um Moorablagerungen aus dem in Frage kommenden Zeitabschnitt,<br />
deren Werte in ein Diagramm 238 eingetragen werden, welches sich folgendermaßen<br />
auswerten lässt 239 : <strong>Die</strong> Phase D1a entspricht der Späteren Eisenzeit (Latène C-D),<br />
also den Jahren ca. 250 – 50 v. Chr. Deutlich ist zu erkennen, dass das<br />
Pollenspektrum in vieler Hinsicht denen der vorangehenden Phase gleicht, was auf<br />
eine Kontinuität im Wirtschaftssystem deutet. Anscheinend hatte sich im Verlauf der<br />
späteren Eisenzeit die Viehwirtschaft noch verstärkt: Erstmals werden jetzt<br />
Feuchtgebiete in die Nutzung als Weidelandschaft mit einbezogen. Hierfür sprechen<br />
die Pollen von Wiesenpflanzen wie Spitzwegereich, Daucus carota (Wilde Möhre),<br />
Dotterblume, Mädesüß, Wiesensilge und Wiesenknopf in Bereichen von Talauen.<br />
Eine solche Grünlandwirtschaft ist der Haltung von Rindern angepasst 240 . Kiefern<br />
(Pinus) sind der vorherrschende Baumpollen-Typ, mit Werten, die mit den heutigen<br />
zu vergleichen sind. Bedingt durch die starke Weidelandkultur kam es in der Phase<br />
an den Talhängen zu starken Erosionen in der Lößdecke, dass stellenweise die<br />
nährstoffarmen Terrassensande und –kiese freigelegt wurden: Deshalb konnten sich<br />
die Kiefern so gut ausbreiten. <strong>Die</strong> von Simons 241 für die späte Eisenzeit<br />
rekonstruierte Siedlungslandschaft steht mit dem pollenanalytischen Befund in<br />
Einklang: Es dominierte eine fast vollständig entwaldete Landschaft mit intensivem<br />
Ackerbau und zerstreut vorkommenden Eichen-Restbeständen 242 243 . Genau gesagt,<br />
236 A. J. Kalis, <strong>Die</strong> menschliche Beeinflussung der Vegetationsverhältnisse auf der Aldenhovener Platte<br />
(Rheinland) während der vergangenen 2000 Jahre. Rhein.Ausgr. 24, 1983, 332.<br />
237 s. Abb. 71<br />
238 s. Abb. 72<br />
239 F. Bunnik, Archäologische Betrachtungen zum Kulturwandel in den Jahrhunderten um Christi<br />
Geburt. In: AI 18, 1995, 171 ff..<br />
240 Knörzer u.a 1999, 38.<br />
241 Simons 1989, 179 ff.<br />
242 Bunnik 1995a, 336.<br />
243 s. Abb. 73, Landschaftsbild<br />
64
wurde die Landschaft in der späten Eisenzeit so großflächig und intensiv von<br />
menschlichen Wirtschaftsmaßnahmen geprägt, wie noch nie zuvor 244 .<br />
<strong>Die</strong> Phase D1b entspricht der frühen Römischen Kaiserzeit, den Jahren 50 v. Chr. –<br />
220 n. Chr. <strong>Die</strong> Pollenzusammensetzung des unteren Abschnitts, also ungefähr der<br />
Jahrzehnte 50 - 10 v. Chr. weist auf eine kurzfristige aber ausgeprägte<br />
Waldregeneration hin. Auf den ehemaligen Heideflächen konnten sich Kiefern<br />
(Pinus) weiter ausbreiten, auf den feuchten Talsohlen die Erle (Alnus) und in den<br />
Mischwäldern die Buche (Fagus sylvatica). <strong>Die</strong>se Kurven spiegeln eine deutlich<br />
nachlassende landwirtschaftliche Tätigkeit in der oben genannte Zeitspanne.<br />
<strong>Die</strong> archäobotanische Quellenlage spricht also dafür, dass die Rheinische Lößbörde<br />
nicht mehr in dem Umfang wie bislang für landwirtschaftliche Zwecke genutzt wurde.<br />
Dagegen lässt der Anstieg der Nichtbaumpollen-Kurve (NBP-Kurve) im oberen<br />
Abschnitt der Phase D1 b, also in den Jahrzehnten ab der Zeitenwende, auf eine<br />
erneute Ausweitung der landwirtschaftlich genutzten Freifläche schließen. Erneut<br />
erreichen Getreidepollen hohe Werte. Auch die Hinweise auf Viehhaltung nehmen<br />
im oberen Abschnitt wieder deutlich zu: hohe Anteile von Plantago lanceolota und<br />
von Arten des feuchten Grünlands dokumentieren die Bedeutung der<br />
Grünlandwirtschaft, zumal die Kurve der Erle (Alnus) wieder absinkt.<br />
<strong>Die</strong> bis zu 10% angestiegene Kurve von Pteridium aquilinium und die hohen Pinus-<br />
Werte weisen auf eine nachlassende Beweidung der Heide hin, in deren Folge sich<br />
Adlerfarn und Kiefer weiter ausbreiten konnten. Offensichtlich hat sich während der<br />
frühen Kaiserzeit in der Jülicher Lößbörde die Viehwirtschaft grundlegend geändert,<br />
wobei nun Schafe und Ziegen wohl keine Rolle mehr gespielt haben dürften. Das<br />
Pollendiagramm spricht auch stimmig für eine Neubesiedlung des Gebiets ab dem<br />
frühen 1. Jdht. n. Chr. <strong>Die</strong> Rheinische Lößbörde kann also für einen Zeitraum von 50<br />
Jahren nicht im Sinne des ursprünglichen Siedlungsmusters bewohnt gewesen sein.<br />
<strong>Die</strong> naheliegendste Erklärung für den Siedlungsrückgang wären Caesars letzte<br />
Feldzüge hier am Rhein 53 – 51 v. Chr. gegen die <strong>Eburonen</strong>.<br />
Doch vielleicht lassen sich auch Indizien finden, dass die römische Bedrohung nicht<br />
der einzige Auslöser für die einheimische Bevölkerung war, ihre Siedlung<br />
aufzugeben.<br />
244 Bunnik 1995b, 187.<br />
65
<strong>Die</strong> Spur führt in das Forschungsgebiet der Dendrochronologie. Ihre Aufgabe ist es,<br />
Hölzer unbekannten Alters z.T. bis auf das Jahr genau zu datieren 245 . <strong>Die</strong> Methode<br />
stützt sich auf die Ausprägung von Jahrringen, die ein Baum zu seiner „Lebenszeit“<br />
bildet. In Gebieten jahreszeitlich bedingter klimatischer Veränderungen unterteilt sich<br />
der biologische Jahresrhythmus der Bäume in eine Wachstums- und in eine<br />
Ruhephase. In der Zeit von Herbst bis Frühling ruht der Baum. Mit den ersten<br />
wärmeren Tagen im Jahr beginnt die Wachstumsphase.<br />
<strong>Die</strong>se erste Wachstumsperiode, die bis zum Sommer andauert, bildet das<br />
sogenannte Frühholz aus. Frühholz ist charakteristisch durch seine weiten, dem<br />
Flüssigkeitstransport dienenden Zellen und ist von heller Färbung. Ende Juni bis<br />
Anfang Juli beginnt der Baum dann, sich wieder auf die kalte Jahreszeit<br />
vorzubereiten. Er bildet nun das sogenante „Spätholz“. Dessen Zellen sind kleiner<br />
und kompakter und sind zur Stärkung des Stammes bestimmt. Spätholz hat deshalb<br />
eine dunkle Färbung. Gemeinsam jedoch ordnen sich Frühholz- und Spätholz-Zellen<br />
ringförmig an und bilden den sogenannten Jahrring.<br />
Den Dendrochronologen Schmidt und Gruhle ist es gelungen, innerhalb der<br />
Dendrochronologie ein neues Verfahren der sogenannten Homogenitätsanalyse zu<br />
entwickeln 246 : Das Baumwachstum wird durch die jeweiligen klimatischen<br />
Bedingungen deutlich beeinflusst, wobei das jährlich wechselnde Klima zu<br />
charakteristischen Mustern, d.h. zu einer nahezu unverwechselbaren, einmaligen<br />
Aufeinanderfolge engerer und breiterer Jahrringe führt. Daher zeigen zeitgleich<br />
gewachsene Bäume einer Art innerhalb einer Klimaregion derart deutliche<br />
Übereinstimmungen, dass die Analyse von Jahrringen erfolgreich als<br />
Datierungsverfahren eingesetzt werden kann. Um etwa in Deutschland<br />
flächendeckend datieren zu können, mussten regionale Jahrringkalender für den<br />
nord-, west-, ost- und süddeutschen Raum aufgebaut werden 247 . Beim Aufbau<br />
solcher Jahrringkalender wurde deutlich, dass die Ähnlichkeit des Baumwachstums<br />
(Jahrringbreite) über die Jahrzehnte und Jahrhunderte in ihrem Ausmaß deutliche<br />
245<br />
F.H. Schweingruber: Der Jahrring. Standort, Methodik, Zeit und Klima in der Dendrochronologie<br />
(Bern 1983).<br />
246<br />
B. Schmidt/W. Gruhle, Globales Auftreten ähnlicher Wuchsmuster von Bäumen –<br />
Homogenitätsanalyse als neues Verfahren für die Dendrochronologie und Klimaforschung. Mit einem<br />
archäologischen Kommentar von Th. Fischer. Germania 84 (2), 2006, 431 – 465.<br />
247<br />
Schmidt/Gruhle 2006, 431 ff.<br />
66
Unterschiede aufweist. Als Ursache hierfür kommen in erster Linie klimatische<br />
Faktoren in Betracht. Um zu prüfen, ob sich aus den Jahrringänderungen des<br />
Baumwachstums Klimainformationen gewinnen lassen, wurde der Grad der<br />
Wachstumsübereinstimmung der Eichen Westeuropas für die letzten 8000 Jahre<br />
berechnet 248 . <strong>Die</strong> Jahrringbreiten werden zunächst in sogenannte „Wuchswerte“,<br />
also Zahlenwerte transformiert. Werden sämtliche Jahrringkurven eines Standorts<br />
bzw. mehrerer Standorte miteinander korreliert und in einer Mittelkurve<br />
zusammengefasst, so entsteht daraus eine zeitlich schwankende<br />
Homogenitätskurve pro Standort oder Region. Sie beschreibt den Zeitverlauf hoher<br />
oder niedriger Ähnlichkeit des Wachstums. Der Homogenitätsgrad ist die<br />
Korrelationsfunktion zwischen zwei Jahrringkurven in einem Zeitfenster von 20 – 50<br />
Jahren. Das Zeitfenster sollten höchstens 50 Jahre breit sein, um auch kurzzeitige<br />
Veränderungen zu erfassen.<br />
<strong>Die</strong> Wuchshomogenität wurde von Schmidt und Gruhle unter anderen für die Jahre<br />
500 v. Chr. bis 500 n. Chr. ermittelt. Zur Erfassung auch kurzzeitiger Schwankungen<br />
wurde sie hier in einem Zeitfenster von 20 Jahren berechnet und mit<br />
archäologischen Funden verglichen 249 .<br />
Wie war das Klima, als die Siedlungen in der Rheinischen Lößbörde in der Mitte des<br />
1. Jhdt. v.Chr. abbrechen, d.h. also in der Zeit von der Caesar behauptet, die<br />
<strong>Eburonen</strong> hätten aufgehört zu existieren? Das Diagramm nach Schmidt/Gruhle 250<br />
zeigt uns deutlich einen Klimaumschwung in eine Trockenphase um 50 v. Chr., kurz<br />
vor Position 38, dem Bau des Bohlenwegs VI am Dümmer im Jahr 46 v. Chr. Auch<br />
die vergangenen Jahrzehnte, ca. 90 – 55. v. Chr. waren im Vergleich wesentlich<br />
niederschlagsreicher. Der klimatische Einbruch ist keinesfalls so dramatisch, wie im<br />
Jahr 145 v. Chr., in dem die Siedlung von Porz-Lind in der Rheinniederung entstand<br />
(Position 36 251 ). <strong>Die</strong>s war nur möglich aufgrund der hohen Trockenheit, denn bei<br />
normalem Rheinpegel wäre der Platz wahrscheinlich zu feucht gewesen. Meines<br />
Erachtens ging der Siedlungsabbruch im eburonischen Kerngebiet mit dem Einbruch<br />
248 Schmidt/Gruhle, Niederschlagsschwankungen in Westeuropa während der letzten 8000 Jahre –<br />
Versuch einer Rekonstruktion mit Hilfe eines neuen dendrochronologischen Verfahrens (Grad der<br />
Wuchshomogenität). Arch. Korrbl. 33, 2003, 281 ff.<br />
249 Schmidt/Gruhle 2003, 292.<br />
250 s. Abb. 74<br />
251 Schmidt/Gruhle 2003, 291.<br />
67
der Trockenphase einher mit einem weiteren Faktor: Bekannt ist bereits, dass die<br />
Landschaft in der späten Eisenzeit überwiegend durch landwirtschaftliche<br />
Nutzflächen geprägt war. Der Wald war fast völlig verdrängt und großflächig hatte<br />
sich Ackerland und in den Auen Grünland ausgedehnt. <strong>Die</strong> Degeneration der<br />
Vegetationsdecke führte zu verstärkter Abspülung des Bodens 252 . Möglicherweise<br />
hatte die Trockenheit das ohnehin schon überbeanspruchte Ackerland zusätzlich<br />
ausgedörrt? Vielleicht war es zu Waldbränden gekommen, die die ohnehin schon<br />
geringen Waldbestände noch mehr dezimierten? Gebrannt haben wird es auf jeden<br />
Fall, wenn nicht aufgrund der trockenen Wälder, dann mit Sicherheit durch die<br />
Kampfhandlungen zwischen Römern und <strong>Eburonen</strong>, nicht zu vergessen die Taktik<br />
der „verbrannten Erde“.<br />
Möglicherweise ist es dieses multikausale Erklärungsmodell, was letztendlich dazu<br />
führte, dass hier erstmal niemand mehr siedelte: der besiegte und geschrumpfte<br />
Stamm der <strong>Eburonen</strong>, die Verwüstungen durch den Krieg, der vorangegangene<br />
Raubbau am Siedlungsland und die Auswirkungen der trockenen Sommer.<br />
In römischer Zeit, von etwa 40 v. Chr. bis etwa 180/190 n. Chr., dürfte nach der<br />
Homogenitäts-Kurve das Klima wieder niederschlagsreicher gewesen sein. Somit hat<br />
sich wohl auch die Landschaft der Rheinischen Lößbörde wieder erholt, so dass<br />
neue Siedlungen nach der Zeitenwende hier gebaut wurden. Seit Beginn des 1. Jhdt.<br />
n. Chr. entstanden zumindest die ersten kleineren Ansiedlungen im Bereich der<br />
neuangelegten römischen Fernstraße von Köln über Bavai nach Boulogne-sur-Mer.<br />
<strong>Die</strong>se Straßenposten betrieben jedoch noch keine so ausgedehnte Landwirtschaft,<br />
dass sie in den Pollen nachgewiesen werden könnten. Erst um die Jahrhundertmitte<br />
entwickelte sich die ländliche Besiedlung in einem großen Schub 253 .<br />
252 Knörzer u.a. 1999, 41.<br />
253 Gechter 2001, 58.<br />
68
4. Pulheim-Brauweiler, ein Beispiel für Kontinuität durch<br />
Siedlungsplatzverschiebung<br />
Im Rahmen der Planung von Baumaßnahmen für das Gewerbegebiet Süd in<br />
Pulheim-Brauweiler wurden 1997-1999 durch das Rheinische Amt für<br />
Bodendenkmalpflege eine römische Siedlungsstelle inklusive späteisenzeitlicher<br />
Vorgängerbebauung entdeckt und untersucht. Das Grabungsareal lag im Südosten<br />
der Ortschaft Brauweiler und wurde nach Norden von der Sachsstraße begrenzt 254 .<br />
Durch die Grabungen gelang es, eine kontinuierlich genutzte Siedlungsstelle<br />
nachzuweisen, deren Besiedlung in der Spätlatènezeit begann und bis in das 3.<br />
Jhdt. n. Chr. Bestand hatte.<br />
<strong>Die</strong> jüngste Siedlung der Phase I umfasst eine Ansammlung eisenzeitlicher Gruben<br />
und Pfostengruben, die vor allem im nordöstlichen Untersuchungsgebiet lagen 255 .<br />
Der in den Pfostengruben geborgene Keramikabfall datiert die Siedlung in Latène D.<br />
Es handelt sich, wie üblich bei latènezeitlicher Keramik aus dem Rheinland,<br />
überwiegend um handaufgebaute Ware mit verdicktem Rand bzw. einwärts<br />
gebogenen Rändern 256 . Aus den Befunden ließen sich vier Gebäude rekonstruieren<br />
(Häuser IV, VI, VII und IX 257 ). Es handelt sich auf der Karte um die blau<br />
gekennzeichneten Befunde. Ihre Anordnung lässt erahnen, dass sie sich zu einem<br />
Gehöft gruppierten, das wir im Fall von Jülich-Bourheim in Kapitel III, Abschnitt 5,<br />
bereits als Einzelgehöft, bestehend aus mehreren Gebäuden kennen gelernt haben.<br />
Bei den Häusern handelte es sich um Holzständerbauten (Pfostenhäuser), deren<br />
Gefache mit Lehm ausgekleidet waren (vgl. Kapitel III, Abschnitt d). Aufgrund der<br />
Größe der Gebäude ist vor allem eine Interpretation als Ställe oder Speicher<br />
denkbar. Haus IV ist ein Neun-Pfostenhaus und könnte mit einer Fläche von 5 x 6 m<br />
zu Wohnzwecken gedient haben 258 .<br />
254 T. Otten/S. Peters/ P. Tutlies, Pulheim-Brauweiler- Ein Bauerngehöft in den Jahrhunderten um<br />
Christi Geburt. Pulheimer Beitr. 24 (2000) 7 ff.<br />
255 <strong>Die</strong>ss., 18.<br />
256 s. Abb. 75, Keramikauswahl<br />
257 s. Abb. 76<br />
258 J.-N. Andrikopoulou-Strack/W.-D. Fach/I. Herzog/Th. Otten/S. Peters/P. Tutlies, Der frührömische<br />
und kaiserzeitliche Siedlungsplatz in Pulheim-Brauweiler. Bonner Jahrb. 200, 2000, 420.<br />
69
Alle Bauten der ersten Siedlungsphase waren nach Nordwesten ausgerichtet und<br />
passten sich mit ihren Schmalseiten auf diese Weise der im Rheinland<br />
vorherrschenden Hauptwindrichtung an.<br />
In Siedlungsphase II wurden sechs Gebäude errichtet, die sich alle in ihrer<br />
Ausrichtung an einem 105 m langen Graben (Graben 1) orientierten 259 . Es handelt<br />
sich um die Befunde II, III, V, VIII und X, die auf der Karte lilafarben gekennzeichnet<br />
sind. An seinem südlichen Ende biegt der Graben nach Osten um. Wahrscheinlich<br />
handelte es sich, ähnlich wie in Jülich-Bourheim oder Bonn-Muffendorf, um einen<br />
Graben, der das ganze Siedlungsareal umfasste. Vermutlich diente er auch hier<br />
weniger zu Verteidigungszwecken als vielmehr zum Schutz vor frei lebenden Tieren<br />
bzw. Schutz des innerhalb der Umzäunung weidenden Viehs 260 . <strong>Die</strong> Häuser II und X<br />
waren die größten mit einer Grundfläche von 22,5 und 30 m 2 . Bei ihnen dürfte es<br />
sich wieder um Wohnhäuser gehandelt haben. <strong>Die</strong> Häuser I und VIII waren<br />
Sechspfostenbauten mit 6 bzw. 13,5 m 2 und damit typische Speicherbauten. Haus<br />
VIII fiel durch seine besonders großen Pfostengruben auf. Möglicherweise war die<br />
massive Bauweise für einen zweigeschossigen Speicher notwendig. Zur<br />
Wasserversorgung der Siedlungsphase II gab es zwei Brunnen (Befunde 1 und 7),<br />
die das in geringer Tiefe anstehende Grundwasser nutzbar machten. Das aus den<br />
Gruben geborgene Fundspektrum an Keramik datiert Siedlungsphase II in<br />
frührömische Zeit. Einheimische Siedlungskeramik war zur dieser Zeit immer noch<br />
im Gebrauch, jedoch vergesellschaftet mit römischer Keramik des 1. Jhdts. n. Chr.,<br />
wie z.B. mit Halterner Kochtöpfen, Reibschalen, Krügen, Dolien (große<br />
Vorratsgefäße), Terra Sigillata und Belgische Ware. <strong>Die</strong>se zweite Besiedlungsphase<br />
datiert also bereits in die frühe römische Kaiserzeit, zeigt aber mit den oben<br />
beschriebenen Holzständerbauten als Wohn- und Speicherbauten, dass die<br />
ursprüngliche einheimische Siedlungsweise von der ansässigen Bevölkerung<br />
beibehalten worden war.<br />
<strong>Die</strong> Keramik der Phase II unterscheidet sich deutlich von jener der nachfolgenden<br />
Phase III. Einheimische Keramik tritt in Phase III auf jeden Fall nicht mehr auf. In den<br />
Gruben befanden sich Gefäßformen, die für das 2. und beginnende 3. Jhdt. n. Chr.<br />
typisch sind.<br />
259 s. Abb. 77<br />
260 T. Otten/S. Peters/ P. Tutlies 2000, 23.<br />
70
<strong>Die</strong> Karte zeigt, dass in der römischen Siedlungsphase III das alte Siedlungsgelände<br />
zugunsten einer Neuanlage im Westen komplett aufgegeben wird 261 . Es handelt sich<br />
um eine Hoffläche von ca. 85 x 95 m mit nahezu quadratischer Form. Innerhalb der<br />
Hoffläche konnten drei am Rande liegende Pfostenbauten A – A’, B und C sowie ein<br />
Schwellbalkenbau G an der Innenseite des Nordgrabens nachgewiesen werden. Im<br />
Unterschied zum Pfostenhaus werden bei einem Schwellbalkenbau die tragenden<br />
Elemente nicht in einer Pfostengrube versenkt und befestigt, sondern mit einer<br />
Verzapfung auf einem waagrecht in der Flucht der Gebäudeaußenwände liegenden<br />
viereckig bearbeiteten Stamm fundamentiert 262 . Vermutlich handelte es sich bei den<br />
Bauten A - A’ um Wohngebäude. In den Befunden gab es eine enorme Dichte an<br />
Dachziegelfragmenten - Reste der abgegangenen Dachbedeckung - welche<br />
wiederum nur bei Wohnhäusern einen Sinn gemacht hätte. In der Nordhälfte der<br />
Hoffläche befanden sich mit Bezug zu Bau A kleine Grubenhäuser C - E.<br />
Grubenhäuser sind Pfostenbauten, die auf kleinem Grundriss stehen und dessen<br />
Bodenniveau deutlich abgetieft unter dem Umgebungsniveau liegt. Möglich sind<br />
Vier- bis Sechspfostenkonstruktionen 263 . <strong>Die</strong> Siedlung der Phase III versorgten die<br />
Brunnen 2, 3, 4, 5 mit Wasser, welche sich auf engstem Raum<br />
nebeneinanderstehend befanden.<br />
Aufgrund der Zusammensetzung des Fundmaterials und vor allem wegen des<br />
Fehlens sämtlicher Hinweise auf eine folgende Steinbauphase kann vermutlich<br />
bereits um die Mitte bis 2. Hälfte des 3. Jhdt. n. Chr. ein Abbrechen der<br />
Siedlungstätigkeit angenommen werden. Ein denkbarer Grund hierfür könnten die<br />
seit 259 beginnenden Übergriffe der Germanen über die Rheingrenze sein, die 275<br />
mit der Auflösung des gallischen Sonderreichs einen vorläufigen Höhepunkt<br />
nahmen. Hinweise auf eine gewaltsame Zerstörung der Phase II liegen auch in der<br />
Zusammensetzung der Grubenverfüllung einiger Pfostengruben von Bau A vor 264 .<br />
Als Konsequenz ist für den Siedlungsort Pulheim-Brauweiler festzuhalten, dass<br />
archäologische Funde und Befunde hier für eine Siedlungskontinuität von der<br />
261 s. Abb. 78<br />
262 T. Otten/S. Peters/ P. Tutlies 2000, 43.<br />
263 <strong>Die</strong>ss., 43.<br />
264 Andrikopoulou-Strack u.a. 2000, 446.<br />
71
Spätlatènezeit bis in das 3. Jhdt. n. Chr. sprechen 265 . <strong>Die</strong>s untermauern übrigens<br />
auch die archäobotanischen Untersuchungen.<br />
Während der Ausgrabungen wurden insgesamt 26 Bodenproben mit einem Volumen<br />
zwischen zwei und fünf Litern aus Pfostengruben und Siedlungsgruben geborgen 266 .<br />
Mit über 400 Stück enthielten die Proben viele verkohlte Pflanzenreste, meist<br />
verkohltes Getreide, Früchte und Samen von Ackerunkräutern 267 . Sie stammen fast<br />
ausschließlich aus Befunden der Bauphase II, also des frühen 1. Jhdts. n. Chr.. Nur<br />
wenige Proben konnten aus den Phasen I und III geborgen bzw. bis jetzt untersucht<br />
werden. <strong>Die</strong> Auswertung zeigte, dass Gerste mit 90 % in allen Proben vorkommt,<br />
gefolgt von Dinkel mit 50 % 268 . In verschwindend geringen Anteilen gibt es noch<br />
Körner von Emmer und Rispenhirse. <strong>Die</strong> Getreide werden ergänzt durch Lein und<br />
Leindotter 269 , d.h. beides ölhaltige Früchte, sowie durch Erbsen. Interessant ist<br />
dieses Artenspektrum im Hinblick auf die Romanisierung des Rheinlandes. Aus<br />
Kapitel III, Abschnitt 6, wissen wir bereits, dass der Anbau von Gerste in der<br />
Rheinischen Lößbörde eine wichtige Rolle gespielte hat. Der häufigste Spelzweizen<br />
war Emmer, im Verlauf der Eisenzeit nahm der Dinkel an Bedeutung zu. Besonders<br />
charakteristisch für das Rheinland sind für die Zeit auch Hirsen, die Kolben- und<br />
Rispenhirse 270 . Dagegen wurden in der Blütezeit der römischen Provinz, im 2. und 3.<br />
Jhdt. n. Chr., in den römischen Landgütern (villae rusticae) vor allen Dingen<br />
ertragreiche Getreide wie Saatweizen und nach wie vor Dinkel angebaut. Hirsearten<br />
und Leindotter hatten ihre Bedeutung jetzt verloren. Das Pflanzenspektrum der<br />
frühkaiserzeitlichen Siedlungsphase II erweckt in seiner Zusammensetzung also<br />
eher einen eisenzeitlichen Eindruck. Das geringe Vorkommen von Emmer,<br />
Hirsearten und Leindotter ist jedoch untypisch für die rheinische Eisenzeit. <strong>Die</strong><br />
Zusammensetzung der Pflanzen entspricht aber auch nicht den typisch römischen<br />
Artenspektren aus den villae rusticae. Ähnlich verhält es sich mit der Auswertung der<br />
Bodenproben von Ackerunkräutern. Bemerkenswert ist das Auftreten zahlreicher<br />
265<br />
W.D. Becker/Th. Otten/ P. Tutlies, Siedlungskontinuität bei Pulheim. Arch.Rheinland 1999<br />
(Köln/Bonn 2000) 75.<br />
266<br />
W.D. Becker, Archäobotanische Untersuchungen zur Ausgrabung Pulheim-Brauweiler. Pulheimer<br />
Beitr. 24 (2000) 47 ff..<br />
267 Becker u.a. 2000, 75.<br />
268 s. Abb. 79<br />
269 s. Abb. 79a<br />
270 s. Abb. 79b<br />
72
Gewächse, die auf übernutzten und verhagerten Böden sprießen. Solche<br />
Unkrautspektren sind eher typisch für die Eisenzeit, in der durch jahrhundertelangen<br />
Ackerbau ohne besondere Düngung die Böden ausgelaugt wurden. Erst die<br />
revolutionären, landwirtschaftlichen Verfahren der Römerzeit waren imstande, die<br />
Böden zu schonen.<br />
Sowohl bei den Kulturpflanzen als auch bei den Ackerunkräutern machen die<br />
Pflanzenfunde der frührömischen Besiedlungsphase von Pulheim-Brauweiler den<br />
Eindruck eines „Zwischenstadiums“. Sie stehen zwischen den als typisch<br />
eisenzeitlich und den als typisch römisch anzusehenden Pflanzenspektren. Deshalb<br />
liegt die für diese Arbeit entscheidende Annahme nahe, dass es zwischen der<br />
eisenzeitlichen und der frühkaiserzeitlichen Landwirtschaft in der Region keinen<br />
abrupten Wechsel, sondern einen kontinuierlichen Übergang gegeben hat. D.h. im<br />
Klartext, es muss eine einheimische Bevölkerung nach 50 v. Chr. existiert haben, die<br />
ihren gewohnten Ackerbau bis zur Etablierung der römischen Landanwesen<br />
weitergeführt hat. Um wen sollte es sich handeln, wenn nicht um<br />
Stammesangehörige der ehemaligen <strong>Eburonen</strong>?<br />
Übrigens gab es im Jahr 2005 nochmals Ausgrabungen am nördlichen Ostrand von<br />
Pulheim-Brauweiler 271 . Es wurde eine Fläche von 80 x 70 m vollständig untersucht,<br />
über 90 Befunde wurden dokumentiert und komplett ausgegraben. Etwa 80 % davon<br />
ließen sich einer Hofstelle der Späthallstattzeit zuweisen, lediglich vereinzelte<br />
Befunde konnten als weit älter oder auch deutlich jünger angesprochen werden.<br />
900 m entfernt, in Pulheim-Sinthern, konnte bei Ausgrabungen im Jahr 2003 eine<br />
Fläche von 35 x 60 m mit mehr als 108 Befunden untersucht werden 272 . <strong>Die</strong>se<br />
ließen sich einer späthallstatt- bis frühlatènezeitlichen Siedlungsstelle zuweisen, die<br />
um 450 v. Chr. existiert hatte.<br />
<strong>Die</strong> Auswertung von Pulheim-Brauweiler hat gezeigt, wie wichtig die<br />
Berücksichtigung des Umfeldes einer römischen Fundstelle bereits während der<br />
Prospektion und der Konzeption der Ausgrabung ist. Nur bei der Einbeziehung des<br />
Umfeldes eines römischen Landgutes, das bereits Hinweise auf eine ältere<br />
271<br />
K. Frank, Pulheim-Brauweiler: Auf dem Weg zur eisenzeitlichen Siedlungslandschaft. Arch.<br />
Rheinland 2005 (2006) 53.<br />
272<br />
K. Frank, Eine eisenzeitliche Siedlung bei Sinthern. Arch. Rheinland (Stuttgart 2003) 68-71.<br />
73
Besiedlung aufzeigt, lassen sich die Fragen nach Kontinuität seit der Spätlatènezeit<br />
beantworten 273 . Es bleibt daher ein wichtiges Forschungsziel im Rheinland, diese<br />
Siedlungen aufzuspüren und damit die Siedlungskonstanz zu beweisen 274 .<br />
5. Aachen-Kornelimünster, gallo-römischer Tempelbezirk „Varnenum“<br />
Oberhalb von Aachen-Kornelimünster, an der Landstraße, die nach Breinig führt,<br />
wurde in den Jahren 1908 - 1924, bzw. noch später, 1986 - 1987, eine<br />
Tempelanlage archäologisch untersucht, deren nachgebaute Fundamente heute frei<br />
zugänglich sind 275 . Festgestellt wurden anlässlich der früheren Grabungen bereits<br />
drei sogenannte „Umgangstempel“ F, F1 und G 276 . Gallo-römische Umgangstempel<br />
sind ein weit verbreiteter Kultbautyp in der Tempelarchitektur der germanischen<br />
Provinzen Roms 277 . Der konventionelle gallo-römische Tempel mit porticus, also<br />
Umgang, ist in seiner Grundrissform durch zwei konzentrisch verlaufende<br />
Mauerzüge rechteckiger oder quadratischer Form charakterisiert. Nach wie vor<br />
akzeptiert ist die 1919 von R. Schultze vorgeschlagene Rekonstruktion des<br />
Tempeltyps im Aufgehenden mit turmartig erhöhter cella, Fenstern im Obergaden,<br />
Giebeldach und einem die zentrale cella umgebende und überdachte porticus.<br />
Tempel F1 ist in seinen Ausmaßen wie auch in seiner Mauertechnik der<br />
bedeutendste. Bemerkenswert waren auch die zahlreichen Reste von Wandmalerei.<br />
Zusammen mit den Befunden der Grabungen in den 80er Jahren ergab sich eine<br />
Gesamtzahl von 72 Mauerzügen des gesamten Areals 278 .<br />
Zur Datierung der Anlage ließen sich vier verschiedene Bauperioden differenzieren:<br />
Periode I zeigt sich in den wenigen erhaltenen Resten der Stickung und der<br />
Fundamente von Haus H 279 . Absolutchronologisch kann Periode I in ihrem Beginn<br />
273 Andrikopoulou-Strack u.a. 2000, 446.<br />
274 Becker u.a. 2000, 41.<br />
275 s. Abb. 80<br />
276 E. Gose, Der Tempelbezirk von Cornelimünster. Bonner Jahrb. 155-156, 1955-1956, 169-177.<br />
277 H.H. Steenken, Umgangstempel, RGA XXXII (2006) 422.<br />
278 W.M. Koch, Neue Grabungen im gallorömischen Tempelbezirk Varnenum. AIR 1987, 67-69.<br />
279 s. Abb. 81<br />
74
mit einer Latène C - Scherbe in Verbindung gebracht werden, die unter dem<br />
Fundament von Haus E geborgen wurde. <strong>Die</strong> erste Anlage hier in Kornelimünster<br />
dürften wir also frühestens in die Mitte des 3. Jhdt. v. Chr. datieren, da dieser<br />
Keramiktypus eine relativ lange Laufzeit hat.<br />
Periode III wird durch einen Münzfund unter Haus D in die Regierungszeit<br />
Vespasians datiert, also 69-79 n.Chr. <strong>Die</strong> Perioden II und IV ordnen sich diesen<br />
beiden absolut-datierten Perioden entsprechend relativchronologisch an.<br />
In Periode II datiert der Tempel G, da er genau in der Achse des späteren Tores<br />
liegt. Es ist anzunehmen, dass das Tor aus Periode IV den ursprünglichen Platz des<br />
Zugangs zum Tempelbezirk wieder aufgenommen hat. Neben dieser Beobachtung<br />
wird die Datierung auch durch die sonst bei Periode II angewandte Mauertechnik<br />
gestützt. Wahrscheinlich gehört auch der Tempel F1 zu Periode II, wie die<br />
Ähnlichkeiten im Material und in der Konstruktion zu Tempel G aufzeigen. Durch den<br />
Nachweis von Feuerstellen in Befunden ist ab dieser Periode II auch eine Reihe von<br />
Wohnbauten denkbar. Periode IV schließt den Bezirk durch eine Temenosmauer mit<br />
der Toranlage nach Süden ab, kann aber zeitlich nicht näher eingegrenzt werden.<br />
Das Temenos (griechisch: Heiligtum) bezeichnet den umgrenzten Bezirk eines<br />
Heiligtums 280 .<br />
Neben einer Vielzahl von Kleinfunden wie Fibeln, Nadeln, Nägel, Münzen und<br />
Keramik sind besonders drei Bronzetäfelchen an herausragenden Funden zu<br />
nennen, die bereits in den 60er Jahren zu Tage kamen:<br />
Zwei Täfelchen waren mit ihren Inschriften dem Gott Varnenus oder Varneno<br />
geweiht 281 . Es bleibt umstritten, ob es sich bei diesem um eine lokale Quellgottheit<br />
handelt, zumal Quellgottheiten meistens eher weiblich sind. Unklar bleibt auch, ob<br />
dieser Name keltischen oder germanischen Ursprungs ist.<br />
Das dritte Bronzetäfelchen richtet sich in seiner Inschrift an die Göttin Sunuxsal oder<br />
Sunucsal, welche als Stammesgöttin der Sunuker gedeutet wird. Im Zuge der<br />
Neustrukturierungen nach dem Gallischen Krieg befanden sich diese geographisch<br />
zwischen Aachen und Zülpich, territorial also zwischen Ubiern und Tungrern<br />
gelegen. Erwähnung finden die Sunuker oder Sunuci bei Plinius dem Älteren in<br />
280 H. Koepf/G.Binding, Bildwörterbuch der Architektur (Stuttgart 2005) 460.<br />
281 Gose 1955, 171.<br />
75
seiner „Naturalis historia“ als Verbündete der Tungrer. In Tacitus’ Geschichtswerk<br />
kommen sie kurz bei der Schilderung des Bataveraufstands 69 und 70 n. Chr. vor<br />
(IV, 66). Der Anführer der Bataver, Julius Civilis, hatte sich laut Tacitus im Jahr 70 n.<br />
Chr. nun auch der Hilfe der Sunuker versichert und aus ihrer Jungmannschaft<br />
Kohorten zusammengestellt. Es gelang ihm dabei, den Maasübergang zu erzwingen<br />
und sogar die Tungrer für seine Sache zu gewinnen. Als letztes wurden die Sunuker<br />
in der Zeit Kaiser Hadrians (117-138) als Kohorte unter dem Oberbefehl des<br />
Cantifanus, Sohn des Albanus: Coh. I. Sunucor – ex pedite Cantifani, Albani (filii),<br />
Sunuco, erwähnt. Zusammenfassend gesagt, erscheinen die Sunuker als ein<br />
germanischer Stamm mit stark keltisierter bzw. romanisierter Führungsschicht.<br />
Vom Territorium der Sunuker stammt noch ein Weihestein an Sunuxsal aus dem<br />
Propsteier Wald bei Eschweiler 282 . <strong>Die</strong>ser 1856 gefundene Stein trägt die Inschrift:<br />
„Der Göttin Sunuxsal hat diesen Stein Ulpius Hunicius gesetzt und damit gern sein<br />
Gelübde erfüllt.“ Auf dem fehlenden Oberteil sind deutlich Reste des Gewandes<br />
einer sitzenden weiblichen Person und die Vorderbeine eines liegenden Tieres zu<br />
erkennen, wahrscheinlich von einem Hund. Vermutlich wurde der Stein während der<br />
Christianisierung zerbrochen. Insgesamt sind noch neun weitere Weiheinschriften<br />
vom Niederrhein bekannt, die meisten sind jedoch im Gebiet der Ubier gefunden<br />
worden, wie die Funde von Köln, Bonn und Remagen. Auf den Weihedenkmälern<br />
mit Bildschmuck wird Sunuxsal als Fruchtbarkeitsgöttin dargestellt. Allein schon vom<br />
Wortstamm ist natürlich ein Zusammenhang mit dem Stammesnamen der Sunuker<br />
nicht von der Hand zu weisen.<br />
Aufgrund der Datierung von Periode I in Varnenum gehe ich davon aus, dass eine<br />
kultische Anlage hier bereits zur Zeit der <strong>Eburonen</strong> existierte. Nach dem Gallischen<br />
Krieg wurde der Tempel von den Sunukern weiter genutzt und mit römischem<br />
Einfluss ausgebaut. Aufgrund der Münzdatierung von Periode III bestand<br />
„Varnenum“ mindestens bis ins letzte Drittel des 1. Jhdt. n.Chr., also bis in<br />
fortgeschrittene romanisierte Zeit.<br />
282 Kaemmerer 1964, 68.<br />
76
V. Wo haben die <strong>Eburonen</strong> ihre Toten bestattet?<br />
Bislang konnten Gräber im Bereich des eburonischen Kerngebietes<br />
nicht nachgewiesen werden. Sind die zahlreichen Funde von<br />
Glasarmringbruchstücken am Niederrhein evtl. ein Hinweis auf<br />
Beigaben von Brandbestattungen?<br />
Glasarmringe waren Bestandteil der keltischen Frauentracht zwischen Frankreich<br />
und Ungarn 283 . Aus Siedlungen und Brandgräbern der nördlichen Mittelgebirge sind<br />
die nahtlosen, verschiedenfarbigen Armringe aus Glas ebenfalls zahlreich überliefert.<br />
Aus der linken Hälfte des Rheinlands stammen eine Vielzahl von<br />
Glasarmringfragmenten, aus denen sich eine Stückzahl von 375 Armringen ermitteln<br />
ließ 284 . Z.B. gehörten sie auch in den in Kapitel III vorgestellten Siedlungen von<br />
Jülich-Bourheim, Eschweiler-Laurenzberg und Inden mit zum Fundspektrum. 212<br />
Glasarmringe stammen allein von einem Siedlungsplatz und seiner Umgebung in<br />
Erkelenz-Lövenich 285 . <strong>Die</strong>se Anzahl und das Spektrum der gefundenen Formen<br />
sprechen für die damalige Existenz einer Glasmacherwerkstatt, die hier in jüngerer<br />
Latènezeit ansässig war 286 . <strong>Die</strong> Herstellung von Glasarmringen war aufgrund der<br />
komplexen Technologie und Rohstoffbeschaffung nur in wenigen, spezialisierten<br />
Werkstätten möglich.<br />
Zudem würde es sich bei Erkelenz-Lövenich um die nördlichste Glasmacherwerkstatt<br />
in West- und Mitteleuropa handeln, die bisher nachgewiesen konnte. Der Platz wäre<br />
insofern sogar vergleichbar mit den großen latènezeitlichen Produktionszentren wie<br />
Manching, Basel-Glasfabrik und dem Dürrnberg bei Hallein. <strong>Die</strong> verbleibenden 163<br />
Ringe, bzw. ihre Fragmente, sind in der Mehrzahl als Einzelfunde zu betrachten, da<br />
sie unter der Erdoberfläche vor allem bei Prospektionsmaßnahmen entdeckt wurden.<br />
Bei den Glasringformen lassen sich 15 Reihen unterscheiden 287 . <strong>Die</strong> am häufigsten<br />
verbreiteten sind die blauen fünfrippigen Ringe der Reihe 17, dicht gefolgt von Form<br />
6 mit vier-, sechs-, sieben-, acht- und neunrippigen Armringen. Gleich häufig mit den<br />
letztgenannten kommen auch blaue dreirippige Ringe der Reihe 11 a bzw. blaue mit<br />
283<br />
M. Seidel, Keltische Glasarmringe zwischen Thüringen und dem Niederrhein. Germania 83, 2005,<br />
1.<br />
284<br />
Seidel 2005, 7/ H.E. Joachim, <strong>Die</strong> jüngereisenzeitlichen Glasarmringe des Rheinlandes. Bonner<br />
Jahrb. 2007.<br />
285 s. Abb. 82<br />
286 Joachim 2008<br />
287 <strong>Die</strong> Reiheneinteilung entspricht der von R.Gebhard, Der Glasschmuck aus dem Oppidum von<br />
Manching. <strong>Die</strong> Ausgr. in Manching 11 (Stuttgart 1989) 11 ff.<br />
77
D-förmigem Profil der Reihe 38 vor. <strong>Die</strong> Tatsache, dass die fünfrippigen, blauen<br />
Ringe der Reihe 17 nicht nur häufig im Rheinland, sondern auch oft in den<br />
Niederlanden, Belgien und Westfalen verbreitet sind, untermauert den Verdacht auf<br />
eine Produktionsstätte bei Erkelenz-Lövenich 288 .<br />
Bei den Ringfarben überwiegen blaue Exemplare in einem Farbspektrum von hell<br />
über kobalt bis ultramarin oder blauschwarz. In geringer Anzahl liegen noch<br />
purpurfarbige, braune, bernsteinfarbene, hellgrüne, gelbe oder durchsichtige Ringe<br />
vor.<br />
<strong>Die</strong> Vielzahl der Funde und ihre Variationsbreite lässt folgern, dass es sich bei den<br />
von der einheimischen weiblichen Bevölkerung der jüngeren Latènezeit im Rheinland<br />
getragenen Glasarmringen um einen populären Trachtbestandteil gehandelt haben<br />
muss. Aufgrund ihres breiten Variationsspektrums ist Roymans der Ansicht, dass<br />
fast jede keltische Frau am Niederrhein bzw. an der Maas einen oder mehr Armringe<br />
besessen hat 289 . Er geht davon aus, dass die Glasarmringe als ein Ausdruck von<br />
Geschlechtsidentität in weiten Teilen der Bevölkerung zu betrachten sind.<br />
Unterschiede in den Farben, Formen und Verzierungen mögen dieses<br />
Geschlechtssymbol noch zusätzlich unterstrichen haben. <strong>Die</strong> Verteilungskarte der<br />
linksrheinischen Armringfunde lässt zusätzlich spekulieren, dass die Armringe auch<br />
als ein Ausdruck regionaler Identität bzw. Abgrenzung gedient haben müssen 290 .<br />
Nördlich des Rheins sowie an den westlichen Küstengebieten wurden nämlich keine<br />
Armringe mehr gefunden 291 .<br />
Aus der gesamten rheinischen Lößbörde sind aus dieser Zeitstellung keine Gräber<br />
geschweige denn Nekropolen bekannt. Könnten die zahlreichen Einzelfunde an<br />
Glasarmringfragmenten vielleicht ein Hinweis sein auf Bestattungen der<br />
eburonischen Gesellschaft für ihre Toten?<br />
Sicherlich ist zur Beantwortung einer solchen Frage ein vergleichender Blick sowohl<br />
in den keltischen als auch in den germanischen Kulturbereich vonnöten, um zu<br />
sehen, wie andernorts Bestattungen in der Spätlatènezeit ausgesehen haben.<br />
Das nächste in Frage kommende Gräberfeld auf keltischer Seite ist die Nekropole<br />
der Treverer von Wederath-Belginum im Kreis Bernkastel-Wittlich. Wederath ist das<br />
288 Joachim 2008<br />
289 Roymans 2007, 323.<br />
290 s. Abb. 83<br />
78
seltene Beispiel eines vom 4. Jhdt. v. Chr. bis zum 4. Jhdt. n. Chr. durchgehend<br />
belegten Brandgräberfeldes und bietet daher ideale Möglichkeiten zur Erforschung<br />
siedlungsgeschichtlicher Fragen, vor allem für die mit der Romanisierung des<br />
Trevererstammes zusammenhängenden Probleme und Fragen 292 . In der uns<br />
interessierenden Spätlatènezeit von ca. 150/130 – 30/20 v. Chr. werden die<br />
Bestattungsarten und –riten der Mittellatènezeit im wesentlichen übernommen: Der<br />
Leichenbrand wird in Brandgrubengräbern beigesetzt, d.h. als Anhäufung oder<br />
Schüttung auf der Grubensohle deponiert, aber auch in Gefäßen aufbewahrt 293 . <strong>Die</strong><br />
Grabgruben sind muldenförmig und unter der Humusschicht anzutreffen, meistens<br />
von quadratischer bis rechteckiger Form 294 . Da die Abstände zwischen den Gräbern<br />
relativ groß sind, könnten sie ursprünglich von kleinen flachen Hügeln bedeckt<br />
gewesen sein. Das Beigabengut setzt sich zusammen aus Tracht- und<br />
Schmuckbestandteilen und aus Gefäßkeramik. Frauengräber sind durchweg reicher<br />
mit Gefäßkeramik ausgestattet als Männergräber. Männergräber sind wieder<br />
identifizierbar durch die Renaissance der Waffenbeigabensitte in Latène D1, die bis<br />
zum Ende der Mittellatènezeit verschwunden war. In Latène D2 zwischen 70 und 20<br />
v. Chr., also auch noch in der Zeit nach dem Gallischen Krieg bleiben<br />
Bestattungsart, Grabbau und Beigabensitte weitestgehend unverändert 295 .<br />
Der Beigaben an Trachtbestandteilen in den Frauengräbern bestehen u.a. auch aus<br />
buntem Glasschmuck. Es gibt Ketten, zusammengesetzt aus Hunderten von blauen<br />
Glasperlen verschiedener Größen. Auch an Armschmuck fanden sich Ringe aus<br />
ein- und mehrfarbigem Glas 296 .<br />
Auch das Gräberfeld von Horath im Saar-Moselraum ist ein wichtiges Beispiel für ein<br />
Gräberfeld der Mittel- und Spätlatènezeit 297 . Bis auf wenige Ausnahmen wurden hier<br />
291 Roymans 2007, 323.<br />
292 C.H. Möller, <strong>Die</strong> latènezeitlichen Gräber von Wederath-Belginum. Ein Überblick über<br />
Forschungsstand, Fragestellungen und Methodologie einer Auswertung. In: R. Cordie (Hrsg.),<br />
Belginum. 50 Jahre Ausgrabungen und Forschungen (Mainz 2007) 62.<br />
293 A. Haffner, Gräber – Spiegel des Lebens. Schriftenreihe Rhein. Landesmus. Trier 2 (Mainz 1989)<br />
49 ff.<br />
294 s. Abb. 84<br />
295 Haffner 2007, 71.<br />
296 Haffner 2007, 67.<br />
297 A. Miron, Das Gräberfeld von Horath. Untersuchungen zur Mittel- und Spätlatènezeit im Saar-<br />
Mosel-Raum. Trierer Zeitschr. 49, 1986, 7-189.<br />
79
in dieser Zeitstellung nur Brandbestattungen festgestellt 298 . Es lassen sich fünf<br />
verschiedene Bestattungsarten unterscheiden:<br />
1. Gräber vom Typ Koosbüsch: <strong>Die</strong>ser Typ heißt nach einem<br />
Brandgrab am gleichnamigen Fundort. <strong>Die</strong> Scheiterhaufenrückstände<br />
wie Asche, verkohlte Holzreste oder Leichenbrand wurden hier mitsamt<br />
den Resten verbrannter Gefäße oder Metallgegenstände aufgelesen und<br />
an anderer Stelle in kleine Gruben oder Mulden geschüttet.<br />
2. Urnengräber: Am häufigsten wurde der ausgelesene Leichenbrand in<br />
Urnen deponiert. Insgesamt 50 Gräber sind dieser Bestattungsart<br />
zuzurechnen.<br />
3. Leichenbrandaufschüttungen: Hiermit wird eine Bestattungsart<br />
umschrieben, bei der der ausgelesene Leichenbrand direkt auf der<br />
Grabsohle deponiert wurde. Davon gibt es in Horath insgesamt 32<br />
Gräber.<br />
4. Urnengräber mit Leichenbrandschüttung: <strong>Die</strong>se stellen eine<br />
Kombination der beiden zuletzt beschriebenen Bestattungsarten dar: Der<br />
Leichenbrand findet sich sowohl freiliegend auf der Grabsohle als auch<br />
in Urnen.<br />
5. Brandplatten: Gelegentlich wurden runde Holzkohleschichten bzw.<br />
stark mit Holzkohle durchzogene, flache Mulden festgestellt, die als<br />
„Brandplatten“ bezeichnet werden. Eine mögliche Interpretation ist, dass<br />
es sich um „Feuerplätze“ handelte, wo Feuer abgebrannt wurden.<br />
Vermutlich sind diese Feuer im Rahmen ritueller Vorgänge entzündet<br />
worden; unklar ist aber, was und ob überhaupt etwas verbrannt wurde.<br />
Auch in Horath war das Beigabenspektrum variationsreich. Den größten Anteil an<br />
der Fundmasse hat die Keramik. Ferner findet sich wieder das übliche Spektrum mit<br />
Waffen, Tier- und Speisebeigaben, Gegenstände des alltäglichen Gebrauchs und<br />
Trachtbestandteile, darunter auch Glasschmuck.<br />
298 G. Mahr, A. Miron, Das Brandgräberfeld von Horath „Kaisergarten“, Kreis Bernkastel-Wittlich.<br />
Trierer Zeitschr. 43/44, 1980/81, 18.<br />
80
Mit einem letzten Blick in den keltischen Raum will ich noch kurz betrachten, wie das<br />
Gräberfeld von Hoppstädten-Weiersbach in der Spätlatènezeit beschaffen war. Auch<br />
hier wurden die Toten in Flachgräberfeldern bestattet, bis zur Mitte des 1. Jhdt. n.<br />
Chr. überwog die Bestattung in kammerartig angelegten Gräbern 299 . Das wichtigste<br />
Beigabenspektrum war scheibengedrehte Keramik, nach welcher eine ganze<br />
Chronologie für Hoppstädten-Weiersbach aufgestellt werden konnte. Auch die<br />
Beigabe von Wagen- und Pferdegeschirrteilen bis in Latène D2b ist herausragend<br />
für dieses Gräberfeld.<br />
Zusammenfassend für die drei Nekropolen aus dem Territorium der Treverer können<br />
wir also feststellen, dass in der jüngeren Latènezeit die Bestattung des<br />
Leichenbrands inklusive Beigaben in Grabgruben unter der Erdoberfläche üblich<br />
war. Inwieweit könnte dieser Grabbrauch für die Fundstellen von Glasarmringen in<br />
der Rheinischen Lößbörde zutreffend sein? Da in keinem Fall Leichenbrand<br />
gefunden wurde und auch keine Keramik, in der er sich mutmaßlich hätte befinden<br />
können, kann der Leichenbrand nur auf die Grabensohle aufgeschüttet worden sein,<br />
wie es etwa in Wederath und Horath vorgekommen ist. Natürlich ist auch denkbar,<br />
dass er durch das vermehrte Durchpflügen der Böden abhanden gekommen war<br />
oder einfach nicht mehr als solcher im Zuge der Prospektionsmaßnahmen<br />
identifiziert werden konnte. Bei allen mutmaßlichen Bestattungen könnte es sich<br />
ausschließlich nur um Frauenbestattungen gehandelt haben. Selbst wenn sich es bei<br />
den Glasarmringen um die weibliche Beigabensitte schlechthin gehandelt hat, z.B.<br />
als Ausdruck einer regionalen Identität durch das lokale Produktionszentrum, bleibt<br />
die Frage, wie und wo die männlichen Bewohner bestattet sind.<br />
Unter den nächstgelegenen Gräberfeldern aus dem rechtsrheinischen Raum<br />
befinden sich wohl jene des Lippe-Mündungsgebietes. Bei der Bestattung der<br />
einheimischen Bevölkerung handelt es sich im allgemeinen um schlichte<br />
299 R. Gleser, Analyse und Deutung des spätkeltisch-frührömischen Brandgräberfeldes mit<br />
Wagengräbern von Hoppstädten-Weiersbach. Vorbericht. In: Kelten, Germanen, Römer im<br />
Mittelgebirgsraum zwischen Luxemburg und Thüringen. Kolloquien zur Vor- und Frühgeschichte<br />
Band 5 (Bonn 2000) 289.<br />
81
Brandgräber 300 . Zu Beginn der jüngeren Eisenzeit verwendete man noch häufiger<br />
Urnen aus Ton, in denen der aus der Scheiterhaufenasche ausgelesene<br />
Leichenbrand gesondert beigesetzt wurde. Später schüttete man die<br />
Verbrennungsreste vom Scheiterhaufen dann oft unsortiert in die Grabgrube<br />
(Brandgrubengrab). Nur das wertvolle Metall wurde offenbar regelmäßig<br />
aufgehoben. Dennoch geschah dies nicht immer sorgfältig, so dass häufiger Reste<br />
metallener Beigaben und Trachtteile in die Grabgruben gerieten. Obwohl die<br />
metallenen Teile der Tracht, Fibeln, eiserne Gürtelhaken oder bronzene Armringe<br />
meist sehr schlicht gestaltet sind, verraten sie doch einen starken Einfluss aus dem<br />
Bereich des keltischen Raumes.<br />
In Wesel-Bislich wurden bereits im Jahr 1925 auf der Düne „Gunz“ und in ihrer Nähe<br />
12 Brandgräber und ein Brandplatz entdeckt, die hier ab der Spätlatènezeit angelegt<br />
worden waren 301 . Alle Brandgräber lagen auch hier nur wenige cm unter der<br />
Oberfläche, mit einer Spannbreite in ihrer Eintiefung von 25 – 55 cm. Entweder<br />
befanden sich Knochen und/oder Leichenbrand in einer beigesetzten Urne oder die<br />
Brandknochen lagen auf der Grubensohle verstreut. Im Vergleich mit den bisher<br />
angeführten linksrheinischen Gräberfeldern fallen diese rechtsrheinischen<br />
Grabgruben auf durch ihre Beigabenarmut. In allen Gräbern, bis auf Nr. 1 und Nr. 8,<br />
befand sich nämlich höchstens nur je eine Beigabe, z.B. in Form eines verbrannten<br />
Gefäßes, einer Fibel oder eines Gegenstandes aus Eisen.<br />
Auch aus dem Gebiet von Rees-Haldern im Kreis Kleve ist eine Reihe von<br />
Brandgräberfeldern aus der älteren bis jüngeren Eisenzeit bekannt, von der Kuppe<br />
„Spelmannsberg“ mit 41 Gräbern, von der Kuppe „Sommersberg“ mit 90 Gräbern<br />
und von der Sanddüne „Colettenberg“ mit 81 Gräbern 302 . <strong>Die</strong> tiefschwarzen, runden<br />
bis ovalen Brandgruben mit vergleichbarer Tiefe und Breite zeigten nahezu den<br />
gleichen Bestattungsritus von Wesel-Bislich. Allerdings sticht bei manchen Gräbern<br />
der Kuppe „Sommersberg“ eine Beigabe besonders hervor, ein typischer Bestandteil<br />
der niederrheinischen Tracht: Auf dem „Sommersberg“ enthielt Grab 21 drei Stücke<br />
eines Armbandes aus blauem Glas. Das Armband war im Feuer zersprungen und<br />
300 C. Reichmann, <strong>Die</strong> Besiedlung des Lippemündungsgebietes in frührömischer Zeit. In: G. Uelsberg<br />
(Hrsg.): Krieg und Frieden-Kelten, Römer, Germanen. Katalog Rheinisches LandesMuseum (Bonn<br />
2007) 72-79.<br />
301 Reichmann 1979, 426 ff.<br />
302 Reichmann 2007, 373;381;387;402.<br />
82
verzogen. Auch in Grab 35 befanden sich die verschlackten Reste eines blauen<br />
Armbandes und von weißem verschlackten Glas. Dasselbe blaue Armband taucht<br />
weiterhin auf in den Gräbern 33, 41, 53, 73 und 76. In Grab 53 lag sogar die Hälfte<br />
eines blauen Glasarmringes mit gelber Fadenauflage. Eine eiserne Latènefibel<br />
kommt in den anderen Gräbern als weitere beobachtbare Beigabenart vor, außer in<br />
Grab 35 jedoch nicht vergesellschaftet mit den Glasarmringen. Bis auf<br />
Gefäßfragmente stellen die Glasarmringbruchstücke fast ausschließlich die einzige<br />
Beigabe in den genannten Grabgruben dar.<br />
Vom „Colettenberg“ stammen dunkelblaue bis violette Glasarmringfragmente nur aus<br />
den Gräbern 6, 57 und 81.<br />
Gemäß Seidel dominieren hier am rechtsseitigen Niederrhein blaue fünfrippige<br />
Ringe der Reihe 17 und einfache Ringe mit D-förmigem Profil und Fadenauflage der<br />
Form 6 303 .<br />
Nach Reichmann stellen die Glasarmringe hier am Niederrhein eine Abgrenzung der<br />
Spätlatènezeit dar 304 . Auch Reichmann ist der Ansicht, dass diese Glasarmringe<br />
während der Spätlatènezeit zur üblichen Frauentracht gehört haben und zum<br />
größten Teil (insbesondere die blauen Formen) auch am Niederrhein selbst<br />
hergestellt wurden. Denkbar ist, dass die zu dieser Zeit auf der rechten Rheinseite<br />
siedelnden germanischen Sugambrer die Glasarmringe aus der eburonischen<br />
Werkstatt bezogen haben, oder aber zumindest die Anregung zur Herstellung dieser<br />
Glasringformen. Reichmann hält es daher auch nicht für ausgeschlossen, dass es<br />
sich um den Import einer Grabsitte von westlich des Rheins gehandelt haben<br />
könnte 305 .<br />
Gehen wir davon aus, dass es sich bei den Einzelfunden an Glasarmringfragmenten<br />
der linksrheinischen Lößbörde tatsächlich um Bestattungen handelt, bin ich der<br />
Meinung, dass die Grabriten der <strong>Eburonen</strong> eher umgekehrt, also von germanischer<br />
Seite beeinflusst waren. Trotz der überverhältnismäßigen Orientierung zum<br />
keltischen Kulturgebiet, spräche der beigabenarme, spartanische Grabbrauch für<br />
einen germanischen Ritus. Sonderbar bliebe aber auch im Vergleich mit diesem die<br />
303 Seidel 2005, 25.<br />
304 Ders., 128.<br />
305 Reichmann 2007, 133.<br />
83
ein singuläre Beigabe von Glasarmringen. Zudem haben wir es im Gräberfeld von<br />
Rees-Haldern mit durch das Feuer stark deformierten und zerschmolzenen<br />
Bruchstücken zu tun, Beigaben, die mit dem Leichnam verbrannt wurden. <strong>Die</strong>ser<br />
Zustand entspricht nicht jenen Fragmenten der linksrheinischen Lößbörde.<br />
84
VI. Zusammenfassung/Fazit<br />
<strong>Die</strong> vorliegende Magisterarbeit thematisiert die archäologischen<br />
Hinterlassenschaften einer späteisenzeitlichen Bevölkerung in einem<br />
Siedlungsgebiet zwischen Rhein und Maas unter Einbeziehung der schriftlichen<br />
Überlieferungen durch den Feldherrn Gaius Julius Caesar im „Gallischen Krieg“.<br />
Caesar bezeichnet diese einheimische Bevölkerung mit dem Namen „<strong>Eburonen</strong>“ und<br />
identifziert sie gleichzeitig als „Germani Cisrhenani“ – diesseitige, also<br />
linksrheinische Germanen. <strong>Die</strong> Untersuchungen dieser Arbeit haben jedoch gezeigt,<br />
dass es sich bei den Bewohnern um eine weitestgehend „latènisierte“ Bevölkerung<br />
handelte, deren kultureller Fokus sich weitaus mehr auf den keltischen Raum<br />
richtete, als über den Rhein zu den „Germanen“. <strong>Die</strong> wichtigsten Beispiele hierfür<br />
sind sicherlich mit der Namensetymologie, Haus- und Hofbauweise und der<br />
materiellen Sachkultur, allen voran den niederrheinischen Glasarmringen, geliefert.<br />
Ab 50 v. Chr. existierte im umrissenen Siedlungsgebiet kein politischer<br />
Zentralverband mehr mit dem Namen „<strong>Eburonen</strong>“. Caesar war es gelungen, diesen<br />
als Vergeltungsschlag für den Angriff eburonischer Stammeskrieger auf ein<br />
römisches Winterlager zu zerstören. Jedoch ist es Caesar entgegen seiner<br />
propagandistischen Behauptungen im „Gallischen Krieg“ nicht gelungen, alle<br />
Bewohner restlos auszulöschen. Hierfür sprechen archäologische und<br />
archäobotanische Befunde innerhalb der Rheinischen Lößbörde, dass es nicht<br />
überall einen Abbruch von Siedlungstätigkeit gegeben hat, allen voran die Gründung<br />
von Tongeren, die Neuformierung des Stammes der „Texuandrer“, die<br />
Siedlungsphasen von Pulheim-Brauweiler und der Umlauf „eburonischer“ Münzen<br />
nach 50 v. Chr. Der historischen Überlieferung und den archäologischen Befunden<br />
zufolge war der Kern des ursprünglich von <strong>Eburonen</strong> besiedelten Gebietes zwischen<br />
Rhein und Maas allerdings ab der 2. Hälfte des 1. Jhdt. weitestgehend<br />
siedlungsleer 306 .<br />
<strong>Die</strong> Siedlung von Hambach-Niederzier (Hambach 382) bricht schon mindestens 2<br />
Jahrzehnte vor 50 v. Chr. ab. Der Alte Burgberg von Kreuzweingarten fällt 50-53 v.<br />
Chr. den Kampfhandlungen zum Opfer. Das „Flachlandoppidum“ von Jülich-<br />
306 Klages 2008, 225.<br />
85
Bourheim wird in der Mitte des 1. Jhdt. kampflos geräumt, das „Mehrhausgehöft“ von<br />
Eschweiler-Laurenzberg bereits am Anfang des Jahrhunderts. <strong>Die</strong><br />
Abschnittsbefestigung von Kreuzau-Winden wird erst um die Zeitenwende zerstört.<br />
<strong>Die</strong> allmähliche Wiederbesiedlung des linksrheinischen Raums fand erst statt<br />
während Agrippas Statthalterschaft am Niederrhein. Allerdings hatte Agrippa dieses<br />
Amt während zwei verschiedenen Perioden inne: Seine 1. Statthalterschaft war von<br />
39/38 v. Chr., die zweite von 20-18 v. Chr 307 . Agrippa siedelte ab 38 v. Chr. die<br />
Ubier, die bis dato noch rechtsrheinisch siedelten, auf der linken Rheinseite an.<br />
Heinrichs ist allerdings der Meinung, dass die gezielte Umsiedlung erst in die zweite<br />
gallische Statthalterschaft fiel 308 . Als der Bau der Fernstraße Lyon-Niederrhein 18 v.<br />
Chr. die Südeifel erreichte, mussten im fraglichen Rheinabschnitt besondere<br />
Sicherungsmaßnahmen getroffen werden. Tacitus überliefert uns, dass daher die<br />
Umsiedlung der Ubier im Raum zwischen Remagen und Krefeld ausdrücklich auf<br />
defensive Art und Weise geschehen müsse (Germ. 28,4). <strong>Die</strong> Datierung in die zweite<br />
Statthalterschaft deckt sich laut Heinrich auch mit den Münzfunden: <strong>Die</strong> erste<br />
Prägephase ubischer Quinare (ca. 60 – 45 v. Chr.) ist hier bisher nicht belegt, die<br />
zweite (ca. 45 - 30) nur selten, doch der Hauptanteil an Funden entfällt auf die dritte<br />
Prägephase (ca. 30 - 15). Von den häufigen Vertretern der Prägephase III wurden<br />
die meisten noch rechtsrheinisch geprägt und zur linken Rheinseite mitgebracht. <strong>Die</strong><br />
abschließende ubische Prägephase IV wird wieder seltener ab 15 v. Chr. <strong>Die</strong>ser<br />
numismatische Befund würde belegen, dass die Hauptumsiedlung der Ubier ab 19 v.<br />
Chr. von Agrippa durchgeführt wurde. <strong>Die</strong>se Tatsache entspräche auch ganz und<br />
gar den Bedürfnissen der Ubier, die immerhin 30 v. Chr. ihr Zentraloppidum auf dem<br />
Dünsberg an die Chatten verloren hatten und aller Wahrscheinlichkeit nach<br />
gezwungen waren, auch weitere der rechtsrheinischen Siedlungen aufzugeben.<br />
Gechter nimmt im Bezug auf die Wiederbesiedlung von Bonn an, dass diese<br />
aufgrund einheimischer Keramikfunde aus der Zeit um 40 v. Chr. noch während der<br />
ersten Statthalterschaft von Agrippa begann 309 . Galsterer hält eher „ein langsames<br />
Einsickern von ubischen und anderen Bevölkerungsteilen, denen Agrippa dann die<br />
endgültige staatsrechtliche Form durch Errichtung einer civitas Ubiorum socia nobis<br />
307 Gechter 2001, 56.<br />
308 Heinrichs 2003, 337.<br />
309 Heinrichs 2003, 134 ff.<br />
86
gab“, für möglich 310 . Joachim schließt sich dem an, hält es aber außerdem für<br />
denkbar, dass sich ubische Verbände bzw. Teilstämme schon zu Caesars Zeiten an<br />
von Natur begünstigten Plätzen wie Bonn (Bonna) und Neuss (Novaesium)<br />
niedergelassen haben 311 . <strong>Die</strong> neue Heimat der Ubier wurde also das ehemalige<br />
Kernland der <strong>Eburonen</strong>, die Lößbörden zwischen Maas und Rhein inklusive der<br />
Nordeifel sowie der nordwärts gelegene Raum bis in die Höhe von Xanten.<br />
Gerade wenn der Umzug zumindest teilweise schon in den 50er Jahren eingesetzt<br />
hat, können wir davon ausgehen, dass sich viele überlebende eburonische<br />
Stammesmitglieder den zugezogenen Ubiern angeschlossen haben. Noch<br />
wahrscheinlicher ist der Anschluss an den Stamm der Treverer, da diese<br />
Bündnispartner während des Gallischen Kriegs waren. Genausogut könnte ich mir<br />
vorstellen, dass versprengte <strong>Eburonen</strong> auf die rechte Rheinseite gegangen sind, zu<br />
den dort noch siedelnden ubischen Stämmen, ebenso wie zu den Sugambrern oder<br />
den Usipetern.<br />
Im Rhein-Maas-Delta wurde aus Restgruppen der <strong>Eburonen</strong> der Stamm der<br />
Texuandrer neu zusammengefasst 312 . Im Gebiet um Aachen formierten sich die<br />
Sunuker und um Heerlen die Baetasier. Im Gebiet der heutigen Provinz Gelderland<br />
vermischten sich Stammesreste der <strong>Eburonen</strong> und Menapier mit der<br />
Führungsschicht der Chatten, was zur Gründung des Stammes der Bataver führte.<br />
Das Volk der <strong>Eburonen</strong> bleibt weiter existent, allerdings unter neuen Vorzeichen,<br />
beziehungsweise in ein größeres Umfeld integriert.<br />
Als abschließende Betrachtung aus der Schlussfolgerung bleibt am Ende nicht mehr<br />
allein die Frage nach Kontinuität oder Diskontinuität der <strong>Eburonen</strong>, sondern stellt<br />
sich vielmehr nach Kontinuität und Wandel, letztere wichtige Begrifflichkeiten aus<br />
dem volkskundlichen Kanon. Neue Perspektiven in sich wandelnder Zeit zu finden<br />
war von jeher die Aufgabe des Menschen, wenn sich seine Lebensgrundlage,<br />
Lebensformen und Lebensumstände durch äußere Ereignisse veränderten.<br />
310 Galsterer 2001a, 21.<br />
311 H.E. Joachim, <strong>Die</strong> späte Eisenzeit am Niederrhein. In: G. Uelsberg (Hrsg.): Krieg und Frieden-<br />
Kelten, Römer, Germanen. Katalog Rheinisches LandesMuseum (Bonn 2007) 54.<br />
312 Gechter 2001, 56.<br />
87
Deshalb beende ich diese Arbeit mit den diesbezüglichen Gedanken des<br />
Volkskundlers Wolfgang Kaschuba 313 :<br />
„Kontinuität beschreibt die Sicherheit des Gewohnten, die Macht des Vertrauten, das<br />
die Menschen zusammenhält und zugleich bindet. Und davon handelt Kultur in<br />
hohem Maße, von Kontinuitäten und Traditionen als gesellschaftliche Ressource.<br />
Doch verweist Kultur auf dieses Dauerhafte nicht deshalb, weil sich in ihr ein<br />
vorwiegend statisches Prinzip verkörpert, sondern weil sie im Gegenteil den Wandel<br />
steuert, der allerdings mit symbolischen Sicherheitsmarkierungen versehen sein<br />
muss. Wie Menschen soziale Veränderungen kulturell bewältigen, wie sie den<br />
Verlust an Kontinuität und Tradition kompensieren, indem sie sich neue Traditionen<br />
aufbauen, wie sie gewohnte Formen beibehalten, um ihnen neue Bedeutungen zu<br />
geben – dies müssen unsere Leitfragen sein....“<br />
313 W. Kaschuba, Einführung in die Europäische Ethnologie (München 1999) 182.<br />
88
Literaturverzeichnis<br />
Gaius Julius Caeasar:<br />
G.J. Caesar, Gallischer Krieg. Übersetzungs-Bibliothek griechischer und römischer<br />
Klassiker, Band 560 (Hollfeld 1997).<br />
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
Andrikopoulou-Strack u.a. 2000:<br />
J.-N. Andrikopoulou-Strack/W.-D. Fach/I. Herzog/Th. Otten/S. Peters/P. Tutlies, Der<br />
frührömische und kaiserzeitliche Siedlungsplatz in Pulheim-Brauweiler. Bonner<br />
Jahrb. 200, 2000, 409–488.<br />
Andrikopoulou-Strack 2001:<br />
J.-N. Andrikopoulou-Strack, <strong>Eburonen</strong> – und was dann? In: G. Brands (Hrsg.), Rom<br />
und die Provinzen. Bonner Jahrb. Beih. 53 (Mainz 2001) 163-172.<br />
Becker 2000:<br />
W.D. Becker, Archäobotanische Untersuchungen zur Ausgrabung Pulheim-<br />
Brauweiler. Pulheimer Beitr. 24 (2000) 45 – 56.<br />
Becker u.a. 2000:<br />
W.D. Becker/Th. Otten/ P. Tutlies, Siedlungskontinuität bei Pulheim. Arch.Rheinland<br />
1999 (Köln/Bonn 2000) 72-78.<br />
Behm-Blancke 2003:<br />
G. Behm-Blancke, Heiligtümer der Germanen und ihrer Vorgänger in Thüringen: die<br />
Kultstätte Oberdorla. Weimarer Monographien zur Ur- und Frühgeschichte 38,1<br />
(Stuttgart 2003).<br />
Berke u.a. 2002:<br />
H. Berke/B. Päffgen/St. Wendt, Der <strong>Eburonen</strong> kleine Pferde. Arch. Rheinland 2001<br />
(2002) 46–47.<br />
Birkhan 1997:<br />
H. Birkhan, Kelten. Versuch einer Gesamtdarstellung ihrer Kultur (Wien 1997).<br />
Botheroyd 1992:<br />
S. Botheroyd, Lexikon der keltischen Mythologie (München 1992).<br />
Brather 2004:<br />
S. Brather, Ethnische Interpretationen in der frühgeschichtl. Archäologie: Geschichte,<br />
Grundlagen und Alternativen. Ergänzungsbände zum RGA 42 (2004).<br />
Brednich 2007:<br />
R.W. Brednich, Methoden der Erzählforschung. In: S.Göttsch/A.Lehmann, Methoden<br />
der Volkskunde. Positionen, Quellen, Arbeitsweisen der Europäischen Ethnologie<br />
(Berlin 2007) 57-78.<br />
89
Bunnik 1995a:<br />
F. Bunnik, Pollenanalytische Ergebnisse zur Vegetations- und<br />
Landwirtschaftsgeschichte der Jülicher Lößbörde von der Bronzezeit bis in die frühe<br />
Neuzeit. Bonner Jahrb. 195, 1995, 313-350.<br />
Bunnik 1995b:<br />
F. Bunnik, Archäologische Betrachtungen zum Kulturwandel in den Jahrhunderten<br />
um Christi Geburt. In: AI 18, 1995, 187-193.<br />
Buttler/Schleif 1937/38:<br />
W. Buttler/ H. Schleif, Prähist. Zeitschr. 28/29, 1937/38,184-232.<br />
Cancik/Schneider 1996:<br />
H. Cancik/H.Schneider (Hrsg.), Der neue Pauly. Enzyklopädie der Antike<br />
(Stuttgart/Weimar 1996).<br />
Creemers/Scheers 2007:<br />
C.Creemers, S. Scheers, Wichtige Fundstücke als Zeugnisse der <strong>Eburonen</strong> in<br />
Nordostbelgien. In: G. Uelsberg (Hrsg.): Krieg und Frieden-Kelten, Römer,<br />
Germanen. Katalog Rheinisches LandesMuseum (Bonn 2007) 196-174.<br />
Creemers/Vanderhoeven 2007:<br />
C.Creemers/A.Vanderhoeven, Vom Land zur Stadt. <strong>Die</strong> Entstehung des römischen<br />
Tongeren. In: G. Uelsberg (Hrsg.): Krieg und Frieden-Kelten, Römer, Germanen.<br />
Katalog Rheinisches LandesMuseum (Bonn 2007) 263-269.<br />
Dembski 1998:<br />
G. Dembski, Münzen der Kelten (Wien 1998).<br />
Eck 2004:<br />
W. Eck, Geschichte der Stadt Köln. 1: Köln in römischer Zeit: Geschichte einer Stadt<br />
im Rahmen des Imperium Romanum (Köln 2004).<br />
Frank 2003:<br />
K. Frank, Eine eisenzeitliche Siedlung bei Sinthern. Arch. Rheinland (Stuttgart 2003)<br />
68-71.<br />
Frank 2006:<br />
K. Frank, Pulheim-Brauweiler: Auf dem Weg zur eisenzeitlichen Siedlungslandschaft.<br />
Arch. Rheinland 2005 (2006) 53–56.<br />
Fritsch 2007:<br />
T. Fritsch, Der „Hunnenring“ bei Otzenhausen. AID 2, 2007, 62-65.<br />
Furger-Gunti 1982:<br />
A. Furger-Gunti, Der Goldfund von Saint-Louis bei Basel und ähnliche keltische<br />
Schatzfunde. Zeitschr. Schweiz. Arch u. Kunstgesch. 39, 1982, 36 ff.<br />
90
Galsterer 1990:<br />
H. Galsterer, Von den <strong>Eburonen</strong> zu den Agrippinensiern. Aspekte der<br />
Romanisierung am Rhein. Kölner Jahrbuch für Vor- und Frühgeschichte 23, 1990,<br />
117-126.<br />
Galsterer 2001a:<br />
H. Galsterer, Romanisation am Niederrhein in der frühen Kaiserzeit. In: Thomas<br />
Grünewald (Hrsg.), Germania inferior. Besiedlung, Gesellschaft und Wirtschaft an<br />
der Grenze des römisch-germanischen Welt. RGA Erg.-Bde. 28 (Berlin/New York<br />
2001) 20-35.<br />
Galsterer 2001b:<br />
H. Galsterer, Gemeinden und Städte in Gallien und am Rhein. In: G. Precht (Hrsg.),<br />
Genese, Struktur und Entwicklung römischer Städte im 1. Jahrhundert n. Chr. in<br />
Nieder- und Obergermanien. Xantener Ber. 9 (Mainz 2001).<br />
Gebhard 1989:<br />
R. Gebhard, Der Glasschmuck aus dem Oppidum von Manching. <strong>Die</strong> Ausgr. in<br />
Manching 11 (Stuttgart 1989).<br />
Gechter 1991:<br />
M. Gechter, <strong>Die</strong> frühe ubische Landnahme am Niederrhein. In: V. A. Maxfied/M. J.<br />
Dobson (Hrsg.), Roman Frontier Studies 1989. Proceedings of the XVth International<br />
Congress of Roman Frontier Studies (Exeter 1991) 439-441.<br />
Gechter 2001:<br />
M. Gechter, Das römische Bonn – Ein historischer Überblick. In: M. van Rey (Hrsg.),<br />
Geschichte der Stadt Bonn 1. Bonn von der Vorgeschichte bis zum Ende der<br />
Römerzeit (Bonn 2001) 35–180.<br />
Gechter-Jones 1996:<br />
J. Gechter-Jones, Hausformen und Siedlungsbild der spätlatènezeitlichen Siedlung<br />
Niederzier-Hambach 382, Kr. Düren, Deutschland. Arch. Austriaca 810, 1996, 238 ff.<br />
Gechter-Jones 2007:<br />
J. Gechter-Jones, <strong>Die</strong> befestigte spätlatènezeitliche Siedlung Niederzier, Kr. Düren.<br />
In: G. Uelsberg (Hrsg.): Krieg und Frieden-Kelten, Römer, Germanen. Katalog<br />
Rheinisches LandesMuseum (Bonn 2007), 163-165.<br />
Gerhard 1974:<br />
J. Gerhard, <strong>Die</strong> Metallfunde vom Dünsberg. Materialien zur Vor- und Frühgeschichte<br />
von Hesen 2 (Wiesbaden 1977), ders., Werkzeug und Gerät aus dem Oppidum von<br />
Manching. <strong>Die</strong> Ausgrabungen in Manching 5 (Wiesbaden 1974).<br />
91
Gleser 2000:<br />
R. Gleser, Analyse und Deutung des spätkeltisch-frührömischen Brandgräberfeldes<br />
mit Wagengräbern von Hoppstädten-Weiersbach. Vorbericht. In: Kelten, Germanen,<br />
Römer im Mittelgebirgsraum zwischen Luxemburg und Thüringen. Kolloquien zur<br />
Vor- und Frühgeschichte Band 5 (Bonn 2000).<br />
Göbel 1991:<br />
J. Göbel, Der spätkeltische Goldschatz von Nierderzier. Bonner Jahrb. 191, 1991,<br />
27-84.<br />
Göbel 1992a:<br />
J. Göbel, Das Modell der spätlatènezeitlichen befestigten Siedlung Niederzier.<br />
Archäologie im Rheinland 1992, 192-194.<br />
Göbel 1992b:<br />
J. Göbel, Eine spätlatènezeitliche Anlage in Muffendorf. Arch. Rheinland 1991<br />
(Stuttgart 1992).<br />
Gose 1955/56:<br />
E. Gose, Der Tempelbezirk von Cornelimünster. Bonner Jahrb. 155-156, 1955-1956,<br />
169-177.<br />
Haevernick 1960:<br />
Th.E.Haevernick, <strong>Die</strong> Glasarmringe und Ringperlen der Mittel- und Spätlatènezeit<br />
auf dem europäischen Festland (1960).<br />
Haffner 1989:<br />
A. Haffner, Gräber – Spiegel des Lebens. Schriftenreihe Rhein. Landesmus. Trier 2<br />
(Mainz 1989).<br />
Haffner 1995:<br />
A. Haffner, Heiligtümer und Opferkulte der Kelten (Stuttgart 1995).<br />
Hammerbacher 2000:<br />
H.W. Hammerbacher, Irminsul. Das germanische Lebensbaum-Symbol (Kiel 2000).<br />
Heimberg 1997:<br />
U. Heimberg, Gesellschaft im Umbruch. Aspekte der Romanisierung – 1.<br />
Gleichheitsnormen zwischen Rhein und Maas, in: Das Rheinische LandesMuseum<br />
Bonn, H. 4 (1997), 79-85.<br />
Heimberg 1998:<br />
U. Heimberg, Was bedeutet Romanisierung? Das Beispiel Niedergermanien. Antike<br />
Welt 29 (1998), 19-40.<br />
Heimberg 2002/2003:<br />
U. Heimberg, Römische Villen an Rhein und Maas. Bonner Jahrb 202/203,<br />
20002/2003, 57-148.<br />
92
Heinrichs 2003:<br />
J. Heinrichs, Ubier, Chatten, Bataver. Mittel- und Niederrhein ca. 70-71 v. Chr.<br />
anhand germanischer Münzen. In: Th. Grünewald/S. Seibel (Hrsg.), Kontinuität und<br />
Diskontinuität. Germania inferior am Beginn und am Ende der römischen Herrschaft.<br />
Beiträge des deutsch-niederländischen Kolloquiums in der Katholieke Universiteit<br />
Nijmegen (27. bis 30.06.2001). RGA Ergbd. 35 (Berlin, New York 2003) 266-344.<br />
Heinrichs 2004:<br />
J. Heinrichs, Vor dem Oppidum Ubiorum. In: G.A. Lehmann/Rainer Wiegels (Hrsg.),<br />
Römische Präsenz und Herrschaft in Germanien der augusteischen Zeit. Der<br />
Fundplatz von Kalkriese im Kontext neuerer Forschungen und Ausgrabungsbefunde.<br />
Beiträge zu der Tagung des Fachs Alte Geschichte der Universität Osnabrück und<br />
der Kommission „Imperium und Barbaricum“ der Göttinger Akademie der<br />
Wissenschaften in Osnabrück vom 10. – 12. Juni 2004 (Osnabrück 2004).<br />
Heinrichs 2006:<br />
J. Heinrichs, Sugambrer. RGA XXX (Berlin/New York 2006) 124 - 127.<br />
Horn 1987:<br />
H.G. Horn (Hrsg.), <strong>Die</strong> Römer in Nordrhein-Westfalen (Stuttgart 1987).<br />
Jacomet/Kreuz 1999:<br />
S. Jacomet/A. Kreuz, Archäobotanik. Aufgaben, Methoden und Ergebnisse<br />
vegetations- und agrargeschichtlicher Forschung (Stuttgart 1999).<br />
Joachim 1974a:<br />
H.E. Joachim, in: Führer zu vor- und frühgeschichtlichen Denkmälern, Bd. 26, Mainz<br />
1974.<br />
Joachim 1974b:<br />
H.E. Joachim, Rhein. Berg. Kalender 1974.<br />
Joachim 1980:<br />
H.E. Joachim, Jüngerlatènezeitliche Siedlungen bei Eschweiler, Kr. Aachen. Bonner<br />
Jahrb.180, 1980, 358-371.<br />
Joachim 1982:<br />
H.E. Joachim, <strong>Die</strong> Ausgrabungen auf dem Petersberg bei Königswinter. Bonner<br />
Jahrb. 182, 1982, 393 – 439.<br />
Joachim 1997:<br />
H.E. Joachim, Archäologisches vom Petersberg bei Königswinter. Bonner<br />
Universitätsbl. 1997, 41-50.<br />
93
Joachim 2000:<br />
H.-E. Joachim, <strong>Die</strong> <strong>Eburonen</strong> – Historisches und Archäologisches zu einem<br />
ausgerotteten Volk caesarischer Zeit, in: G.v. Büren/ E. Fuchs (Hrsg.), Jülich: Stadt –<br />
Territorium – Geschichte zum 75jährigen Jubiläum des Jülicher Geschichtsvereins<br />
1923 e.V., Jülicher Geschichtsblätter 1999/2000 (Kleve 2000) 157–170.<br />
Joachim 2002:<br />
H.E. Joachim, Porz-Lind. Ein mittel- bis spätlatènezeitlicher Siedlungsplatz im „Linder<br />
Bruch“. Rhein. Ausgr. 47 (Mainz 2002).<br />
Joachim 2003:<br />
H.E. Joachim, Ein Siedlungsplatz der Jüngeren Eisenzeit in Köln-Porz, „Linder<br />
Bruch“. Rechtsrhein. Köln 29, 2003, 1-10.<br />
Joachim 2007:<br />
H.E. Joachim, <strong>Die</strong> späte Eisenzeit am Niederrhein. In: G. Uelsberg (Hrsg.): Krieg und<br />
Frieden-Kelten, Römer, Germanen. Katalog Rheinisches LandesMuseum (Bonn<br />
2007) 48-58.<br />
Joachim 2008:<br />
H.E. Joachim, <strong>Die</strong> jüngereisenzeitlichen Glasarmringe des Rheinlandes. Erscheint in<br />
Bonner Jahrb. 2007 (2008).<br />
Kaemmerer 1964:<br />
W. Kaemmerer, Eschweiler in seiner Geschichte I (Eschweiler 1964).<br />
Kalis 1983:<br />
A.J. Kalis, <strong>Die</strong> menschliche Beeinflussung der Vegetationsverhältnisse auf der<br />
Aldenhovener Platte (Rheinland) während der vergangenen 2000 Jahre.<br />
Rhein.Ausgr. 24, 1983, 331ff.<br />
Kaschuba 1999:<br />
W. Kaschuba, Einführung in die Europäische Ethnologie (München 1999).<br />
Kießling 1999:<br />
P. Kießling, <strong>Die</strong> jüngerlatènezeitliche Befestigung von Jülich-Bourheim und<br />
verwandte Anlagen. (Magisterarb.Bonn 1999).<br />
Klages 2008:<br />
C. Klages, Spuren in das vorrömische Bonn. In: Forschungen zur Vorgeschichte und<br />
Römerzeit im Rheinland. Hans-Eckart Joachim zum 70. Geburtstag gewidmet. Beih.<br />
Bonner Jahrb. 57, 2008, 225-236.<br />
Knörzer 1980:<br />
K.H. Knörzer, Subfossile Pflanzenreste aus der jüngerlatènezeitlichen Siedlung bei<br />
Laurenzberg, Gem. Eschweiler, Kr. Aachen. Bonner Jahrb. 180, 1980, 454-455.<br />
94
Knörzer u.a. 1999:<br />
K.-H. Knörzer/R. Gerlach/J. Meurers-Balke/A. J. Kalis/U. Tegtmeier/W. D. Becker/A.<br />
Jürgens, PflanzenSpuren. Archäobotanik im Rheinland: Agrarlandschaft und<br />
Nutzpflanzen im Wandel der Zeiten. Mat. Bodendenkmalpfl. Rheinland 10 (Köln<br />
1999).<br />
Koch 1987:<br />
W.M. Koch, Neue Grabungen im gallorömischen Tempelbezirk Varnenum. AIR<br />
1987, 67-69.<br />
Koepf/Binding 2005:<br />
H. Koepf/G. Binding, Bildwörterbuch der Architektur (Stuttgart 2005).<br />
Kossinna 1927:<br />
G. Kossinna, Ursprung und Verbreitung der Germanen in vor- und<br />
frühgeschichtlicher Zeit II (1927).<br />
Kreuz 2000:<br />
A. Kreuz, „tristem cultu aspectuque“? Archäobotanische Ergebnisse zur frühen<br />
germanischen Landwirtschaft in Hessen und Mainfranken. In: A. Haffner/S. von<br />
Schnurbein (Hrsg.), Kelten, Germanen, Römer im Mittelgebirgsraum zwischen<br />
Luxemburg und Thüringen. Akten des Internationalen Kolloquiums zum DFG-<br />
Schwerpunktprogramm „Romanisierung“ vom 28. bis 30. September 1998 in Trier.<br />
Koll. Vor- u. Frühgesch. 5 (Bonn 2000) 236 ff.<br />
Leidorf 1985 :<br />
K. Leidorf, Südbayerische „Herrnhöfe“ der Hallstattzeit. Arch. Denkmalpflege<br />
Niederbayern 1985, 129 ff.<br />
Mahr/Miron 1980/81:<br />
G. Mahr, A. Miron, Das Brandgräberfeld von Horath „Kaisergarten“, Kreis Bernkastel-<br />
Wittlich. Trierer Zeitschr. 43/44, 1980/81, 7-262.<br />
Méniel 1992 :<br />
P. Méniel, Les sacrifices d’animaux chez les Gaulois (Paris 1992).<br />
Miron 1986:<br />
A. Miron, Das Gräberfeld von Horath. Untersuchungen zur Mittel- und Spätlatènezeit<br />
im Saar-Mosel-Raum. Trierer Zeitschr. 49, 1986, 7-189.<br />
Möller 2007:<br />
C.H. Möller, <strong>Die</strong> latènezeitlichen Gräber von Wederath-Belginum. Ein Überblick über<br />
Forschungsstand, Fragestellungen und Methodologie einer Auswertung. In: R.<br />
Cordie (Hrsg.), Belginum. 50 Jahre Ausgrabungen und Forschungen (Mainz 2007)<br />
59-108.<br />
Müller 2002:<br />
F. Müller, Götter, Gaben, Rituale (Mainz 2002).<br />
Muenzer 1996:<br />
P. J. Muenzer, Torques oder die Wunderwelt der keltischen Halsringe (1996).<br />
95
Nortmann 1999:<br />
H. Nortmann, Haus, Speicher, Zaun. Elemente einer keltischen Siedlung im Modell.<br />
Funde u. Ausgr. Bezirk Trier 31, 1999, 7-15.<br />
Nuber 1974:<br />
E. Nuber, Der frührömische Münzumlauf in Köln. Kölner Jahrbuch für Vor- und<br />
Frühgeschichte, 1974, 28-89.<br />
Obleser 1993:<br />
H. Obleser, Odin (Wailblingen 1993).<br />
Otten u.a. 2000:<br />
T. Otten/S. Peters/ P. Tutlies, Pulheim-Brauweiler- Ein Bauerngehöft in den<br />
Jahrhunderten um Christi Geburt. Pulheimer Beitr. 24 (2000) 7 – 44.<br />
Päffgen 1996:<br />
B. Päffgen, Ein befestigter „Herrenhof“ der jüngeren Latènezeit bei Bourheim. Arch.<br />
im Rheinland 1995, 1996, 47-50.<br />
Päffgen 2001:<br />
B. Päffgen/K. P. Wendt, Ein spätlatènezeitlicher Opferplatz der <strong>Eburonen</strong> bei Inden.<br />
Arch. Rheinland 2000 (2001) 61–62.<br />
Ralston 2006:<br />
I. Ralston, Celtic fortifications (Gloucestershire 2006).<br />
Reichmann 1979:<br />
C. Reichmann, Zur Besiedlungsgeschichte des Lippemündungsgebiets während der<br />
jüngeren vorrömischen Eisenzeit und der ältesten römischen Kaiserzeit (Wesel<br />
1979).<br />
Reichmann 1982:<br />
C. Reichmann, Ländliche Siedlungen der Eisenzeit und des Mittelalters in Westfalen.<br />
Offa 39, 1982, 163-182.<br />
Reichmann 2007:<br />
C. Reichmann, <strong>Die</strong> Besiedlung des Lippemündungsgebietes in frührömischer Zeit.<br />
In: G. Uelsberg (Hrsg.): Krieg und Frieden-Kelten, Römer, Germanen. Katalog<br />
Rheinisches LandesMuseum (Bonn 2007) 72-79.<br />
Reinartz 1969:<br />
N.Reinartz, Der Ringwall von Kreuzweingarten. In: Kreuzweingarten, Rheder, Kalkar<br />
(Siegburg 1969).<br />
Röhrich 2001:<br />
L. Röhrich, Erzählforschung. In: R.W. Brednich (Hrsg.), Grundriss der Volkskunde<br />
(Berlin 2001) 515-542.<br />
96
Roymans 2004:<br />
N. Roymans, Ethnic Identity and Imperial Power. The Batavians in the Early Roman<br />
Empire. Amsterdam Arch. Studies 10 (Amsterdam 2004).<br />
Roymans 2007:<br />
N. Roymans, On the latènisation of Late Iron Age material culture in the Lower<br />
Rhine/Meuse area. In: S.Möller/ W.Schlüter/ S.Sievers (Hrsg.), Keltische Einflüsse<br />
im nördlichen Mitteleuropa während der mittleren und jüngeren vorrömischen<br />
Eisenzeit. Akten des Internationalen Kolloquiums in Osnabrück vom 29. März bis 1.<br />
April 2006 (Bonn 2007) 311-327.<br />
Scheers 1977:<br />
S. Scheers, Traité de numismatique celtique II. La Gaule belgique (Paris 1977).<br />
Scheers 1996a:<br />
S. Scheers, Les statères bifaces du type Lummen-Niederzier, un monnayage éburon<br />
antérieur à la conquête romaine. In: M. Lodewijckx (Hrsg.) Archeological and<br />
historical aspects of West-European societies. Album Amicorum André Van<br />
Doorselaer. Acta Arch. Lovaninensia Monogr. 8 (Löwen 1996) 87-94.<br />
Scheers 1996b :<br />
S. Scheers, Frappe et circulation monétaire sur le territoire de la future Civitas<br />
Tungrorum. Rev. Belge Num. 142, 1996, 5-51.<br />
Scherer 1955:<br />
A. Scherer, in: Corolla linguistica, Festschr. F. Sommer, 1955, 199-210.<br />
Schindler 1977:<br />
R. Schindler, <strong>Die</strong> Alteburg bei Bundenbach. Eine befestigte Höhensiedlung des 2./1.<br />
Jahrhunderts v. Chr. im Hunsrück. Trierer Grabungen und Forschungen 10 (Mainz<br />
1977).<br />
Schmidt/Gruhle 2003:<br />
Schmidt/Gruhle, Niederschlagsschwankungen in Westeuropa während der letzten<br />
8000 Jahre – Versuch einer Rekonstruktion mit Hilfe eines neuen<br />
dendrochronologischen Verfahrens (Grad der Wuchshomogenität). Arch. Korrbl. 33,<br />
2003, 281 – 299.<br />
Schmidt/Gruhle 2006:<br />
B. Schmidt/W. Gruhle, Globales Auftreten ähnlicher Wuchsmuster von Bäumen –<br />
Homogenitätsanalyse als neues Verfahren für die Dendrochronologie und<br />
Klimaforschung. Mit einem archäologischen Kommentar von Th. Fischer. Germania<br />
84 (2), 2006, 431 – 465.<br />
Schulze-Forster 2002:<br />
J. Schulze-Forster, <strong>Die</strong> latènezeitlichen Funde vom Dünsberg (ungedr. Diss.<br />
Marburg 2002).<br />
97
Schweingruber 1983:<br />
F.H. Schweingruber: Der Jahrring. Standort, Methodik, Zeit und Klima in der<br />
Dendrochronologie (Bern 1983).<br />
Seidel 2005:<br />
M. Seidel, Keltische Glasarmringe zwischen Thüringen und dem Niederrhein.<br />
Germania 83, 2005, 1–43.<br />
Sievers u.a. 1998<br />
S. Sievers u.a, Vorbericht über die Ausgrabungen 1996-1997 im Oppidum von<br />
Manching. Germania 76, 1998, 619-402.<br />
Simek 1984:<br />
R. Simek, Lexikon der germanischen Mythologie (Stuttgart 1984).<br />
Simons 1989:<br />
A. Simons, Bronze- und eisenzeitliche Besiedlung in den Rheinischen Lößbörden.<br />
Archäologische Siedlungsmuster im Braunkohlengebiet. BAR International Series<br />
467 (Oxford 1989).<br />
Simons 1993:<br />
A. Simons, Wirtschafts- und Siedlungsweisen in der Bronze- und Eisenzeit des<br />
Rheinlandes. In: A. J. Kalis/J. Meurers-Balke (Hrsg.), 7000 Jahre bäuerliche<br />
Landwirtschaft: Entstehung, Erforschung, Erhaltung. Archäo-Physika 13 (Köln 1993)<br />
63-73.<br />
Steenken 2006:<br />
H.H. Steenken, Umgangstempel, RGA XXXII (Berlin/New York 2006) 422-429.<br />
Stöckli 1993:<br />
W.E. Stöckli, Römer, Kelten und Germanen. Bonner Jahrb. 193, 1993, 121-140.<br />
Petrikovits 1986:<br />
H.v. Petrikovits, Germani Cisrhenani, in: H.Beck/ H. Jankuhn, R. Wenskus (Hrsg.),<br />
RGA Erg.-Bde. 1 (Berlin 1986) 88 ff.<br />
Vanderhoeven 2003:<br />
A. Vanderhoeven, Aspekte der frühesten Romanisierung Tongerens und des<br />
zentralen Teiles der civitas Tungrorum. In: Th. Grünewald/S. Seibel (Hrsg.),<br />
Kontinuität und Diskontinuität. Germania inferior am Beginn und am Ende der<br />
römischen Herrschaft. Beiträge des deutsch-niederländischen Kolloquiums in der<br />
Katholieke Universiteit Nijmegen (27. bis 30.06.2001). RGA Ergbd. 35 (Berlin, New<br />
York 2003) 119–144.<br />
Van Heesch 2006:<br />
J. van Heesch, Tungrer/Tungri. Historisch. RGA² XXXI (2006).<br />
98
Van Impe u.a. 1997/1998 :<br />
L. van Impe/G. Creemers/R. van Laere/S. Scheers/H. Wouters/B. Ziegaus, De<br />
Keltische goudschat van Beringen (prov. Limburg). Arch. Vlaanderen 6, 1997/1998,<br />
9–132.<br />
Verwers 1972:<br />
G.J.Verwers, Das Kamps Veld in Haps in Neolithikum, Bronzezeit und Eisenzeit<br />
(Leiden 1972).<br />
Wenskus 1961:<br />
R. Wenskus, Stammesbildung und Verfassung. (Köln/Graz 1961).<br />
Wieland 1995:<br />
G. Wieland, <strong>Die</strong> spätkeltischen Viereckschanzen in Süddeutschland – Kultanlagen<br />
oder Rechteckhöfe? In: A. Haffner, Heiligtümer und Opferkulte der Kelten. Arch.<br />
Deutschland, Sonderh. 1995, 85 – 99.<br />
Willerding 1979:<br />
U. Willerding, Botanische Beiträge zur Kenntnis von Vegetation und Ackerbau im<br />
Mittelalter. Vortr. u. Forsch. 22, 1979, 271 ff.<br />
Zimmer 2006:<br />
S. Zimmer, Tungrer/Tungri. Sprachlich. RGA² XXXI (Berlin/New York 2006).<br />
99
Abbildungsnachweis<br />
Abb. 1: Joachim 2000, 158.<br />
Abb. 2: M. Thoma, Der gallorömische Tempelbezirk auf dem Martberg bei Pommern an der<br />
Mosel, Kreis Cochem-Zell (Koblenz 2006) 163.<br />
Abb. 3: Joachim 2000, 163.<br />
Abb. 4: Kunow /Wegner, Urgeschichte im Rheinland. Jahrbuch 2005 des Rheinischen<br />
Vereins für Denkmalpflege und Landschaftsschutz (Köln 2006), 447.<br />
Abb. 5: <strong>Blümel</strong> 2007, Dauerausstellung Rheinisches LandesMuseum Bonn<br />
Abb. 6: Müller 2002, 201.<br />
Abb. 7: <strong>Blümel</strong> 2007, Sonderausstellung Krieg und Frieden, RLMB<br />
Abb. 8: <strong>Blümel</strong> 2007, Dauerausstellung RLMB<br />
Abb. 9: C. Klages, Keltisches Gold und Geld am südlichen Niederrhein. In: G. Uelsberg<br />
(Hrsg.): Krieg und Frieden-Kelten, Römer, Germanen. Katalog Rheinisches<br />
LandesMuseum (Bonn 2007) 88.<br />
Abb. 10: Furger-Gunti 1982, 24.<br />
Abb. 11: Klages 2007, 87.<br />
Abb. 12: Dembski 1998, 39.<br />
Abb. 13: Scheers 1996a, 90.<br />
Abb. 14: Klages 2007, 88.<br />
Abb. 15: <strong>Blümel</strong> 2007, Sonderausstellung Krieg und Frieden, RLMB<br />
Abb. 15a: <strong>Blümel</strong> 2007, Sonderausstellung Krieg und Frieden, RLMB<br />
Abb. 16: Van Impe u.a. 1997/1998, 34.<br />
Abb. 17: Birkhan 1997, Karte 1, Anhang.<br />
Abb. 18: Van Impe u.a. 1997/98, 48.<br />
Abb. 19: <strong>Blümel</strong> 2007, Sonderausstellung Krieg und Frieden, RLMB<br />
Abb. 20: Eck 2004, 34.<br />
Abb. 21-21b: <strong>Blümel</strong> 2007<br />
Abb. 22: Reinartz 1969, 22.<br />
Abb. 23: Reinartz 1969, 20.<br />
Abb. 23a: <strong>Blümel</strong> 2008, Depot Meckenheim<br />
Abb. 24: <strong>Blümel</strong> 2007<br />
Abb. 25: <strong>Blümel</strong> 2007<br />
Abb. 26: Joachim 2000, 169.<br />
Abb. 27: Kießling 1999, Tafel 22.<br />
Abb. 28: Schindler 1977, 96.<br />
Abb. 29: <strong>Blümel</strong> 2007<br />
Abb. 29a: <strong>Blümel</strong> 2007<br />
Abb. 30: Joachim 1980, 447.<br />
Abb. 31: Stöckli 1993, 134.<br />
Abb. 32: <strong>Blümel</strong> 2008, Depot Meckenheim<br />
Abb. 33: <strong>Blümel</strong> 2008, Depot Meckenheim<br />
Abb. 34: <strong>Blümel</strong> 2008, Depot Meckenheim<br />
Abb. 35: Schindler 1977, 63.<br />
Abb. 36: <strong>Blümel</strong> 2008, Depot Meckenheim<br />
Abb. 36a: Stöckli 1993, 136.<br />
Abb. 37: <strong>Blümel</strong> 2008, Depot Meckenheim<br />
Abb. 38: Joachim 1980, 409.<br />
Abb. 39: Päffgen 2001, 62.<br />
Abb. 40: J. Boessneck, <strong>Die</strong> Tierknochenfunde aus dem Oppidum von Manching. <strong>Die</strong><br />
Ausgrabungen in Manching 6 (Wiesbaden 1971) Tafel 2.<br />
Abb. 41: <strong>Blümel</strong> 2007, Sonderausstellung Krieg und Frieden, RLMB<br />
Abb. 42: Haffner 1995, 32.<br />
Abb. 43: Botheroyd 1992, 104.<br />
100
Abb. 44: <strong>Blümel</strong> 2008, Depot Meckenheim<br />
Abb. 45: Bonner Jahrb. 145, 1940, 299.<br />
Abb. 46: <strong>Blümel</strong> 2007<br />
Abb. 47: Ralston 2006, 49.<br />
Abb. 48: Ralston 2006, 51.<br />
Abb. 49: <strong>Blümel</strong> 2008, Depot Meckenheim<br />
Abb. 50: <strong>Blümel</strong> 2008, Depot Meckenheim<br />
Abb. 50a: <strong>Blümel</strong> 2008, Depot Meckenheim<br />
Abb. 51: Göbel 1992b, 50.<br />
Abb. 52: Göbel 1992b, 49.<br />
Abb. 53: Joachim 1982, 395.<br />
Abb. 54: Joachim 1997, 44.<br />
Abb. 54a: Joachim 1997, 44.<br />
Abb. 55: <strong>Blümel</strong> 2007<br />
Abb. 56: <strong>Blümel</strong> 2007, Tafel am archäologischen Denkmal<br />
Abb. 57: Joachim 2003, 9.<br />
Abb. 58: Simons 1993, 66.<br />
Abb. 59: Verwers 1972, 86.<br />
Abb. 60: Nortmann 1999, 7.<br />
Abb. 61: Heimberg 1998, 24.<br />
Abb. 61a: R. Talbert, Barrington Atlas of the Greek and Roman World (Princeton/New<br />
Jersey 2000) 11.<br />
Abb. 62: Gechter 1991, 440.<br />
Abb. 63: Vanderhoeven 2003, 124.<br />
Abb. 64: A. Vanderhoeven, Das vorflavische Tongeren: die früheste Entwicklung der Stadt<br />
anhand von Funden und Befunden. In: G. Precht (Hrsg.), Genese, Struktur und<br />
Entwicklung römischer Städte im 1. Jahrhundert n. Chr. in Nieder- und<br />
Obergermanien. Xantener Ber. 9 (Mainz 2001) 165.<br />
Abb. 65/65a: Scheers 1996b, 15.<br />
Abb. 66: Nuber 1974, 52.<br />
Abb. 67: Nuber 1974, Tafel 1.<br />
Abb. 68: Scheers 1977, planche XXVI.<br />
Abb. 69: J. Schulze-Forster, Der Dünsberg und die jüngsten keltischen Münzen in Hessen.<br />
In: J. Metzler/D. Wigg-Wolf (Hrsg.), <strong>Die</strong> Kelten und Rom. Neue numismatische<br />
Forschungen. SFMA 19 (Mainz 2005) 160.<br />
Abb. 70: Schulze-Forster 2002, Tafel M2.<br />
Abb. 70a: Schulze-Forster 2005, 162.<br />
Abb. 71: Bunnik 1995a, 319.<br />
Abb. 72: Bunnik 1995b, 171.<br />
Abb. 73: Knörzer u.a. 1999, 41.<br />
Abb. 74: Schmidt/Gruhle 2003, 293.<br />
Abb. 75: Otten u.a. 2000, 19.<br />
Abb. 76: Otten u.a. 2000, 17.<br />
Abb. 77: Otten u.a. 2000, 22.<br />
Abb. 78: Otten u.a. 2000, 29.<br />
Abb. 79: Becker 2000, 44.<br />
Abb. 79a: Becker 2000, 49.<br />
Abb. 79b: Becker 2000, 49.<br />
Abb. 80: <strong>Blümel</strong> 2007<br />
Abb. 81: Koch 1987, 69.<br />
Abb. 82: <strong>Blümel</strong> 2007, Sonderausstellung Krieg und Frieden, RLMB.<br />
Abb. 83: Roymans 2007, 323.<br />
Abb. 84: Haffner 1989, 57.<br />
101