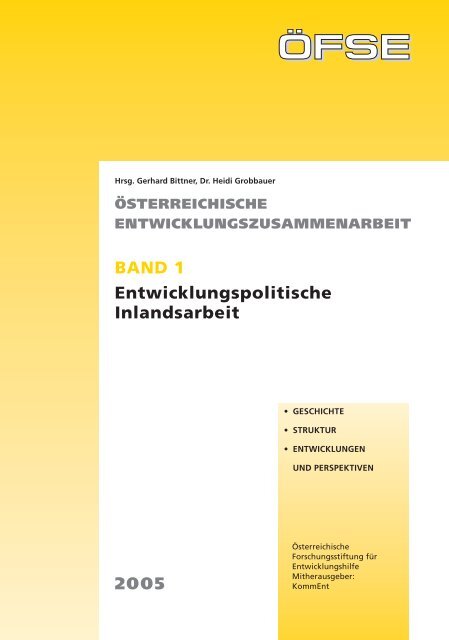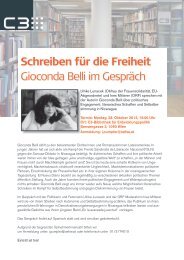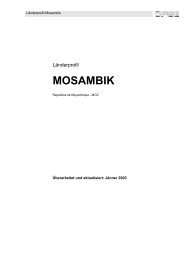ÖSTERREICHISCHE ENTWICKLUNGSZUSAMMENARBEIT ... - ÖFSE
ÖSTERREICHISCHE ENTWICKLUNGSZUSAMMENARBEIT ... - ÖFSE
ÖSTERREICHISCHE ENTWICKLUNGSZUSAMMENARBEIT ... - ÖFSE
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Hrsg. Gerhard Bittner, Dr. Heidi Grobbauer<br />
<strong>ÖSTERREICHISCHE</strong><br />
<strong>ENTWICKLUNGSZUSAMMENARBEIT</strong><br />
BAND 1<br />
Entwicklungspolitische<br />
Inlandsarbeit<br />
2005<br />
• GESCHICHTE<br />
• STRUKTUR<br />
• ENTWICKLUNGEN<br />
UND PERSPEKTIVEN<br />
Österreichische<br />
Forschungsstiftung für<br />
Entwicklungshilfe<br />
Mitherausgeber:<br />
KommEnt
<strong>ÖSTERREICHISCHE</strong><br />
<strong>ENTWICKLUNGSZUSAMMENARBEIT</strong><br />
BAND 1<br />
Entwicklungspolitische<br />
Inlandsarbeit<br />
2005<br />
• GESCHICHTE<br />
• STRUKTUR<br />
• ENTWICKLUNGEN UND<br />
PERSPEKTIVEN<br />
Österreichische<br />
Forschungsstiftung<br />
für Entwicklungshilfe<br />
1090 Wien, Berggasse 7
Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek<br />
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie;<br />
detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar<br />
<strong>ÖSTERREICHISCHE</strong> <strong>ENTWICKLUNGSZUSAMMENARBEIT</strong><br />
Band 1<br />
Entwicklungspolitische Inlandsarbeit<br />
1. Aufl. − Wien: Südwind-Verl., 2004<br />
ISBN 3-900592-92-6<br />
Impressum<br />
Medieninhaber und Hersteller:<br />
Österreichische Forschungsstiftung für<br />
Entwicklungshilfe (<strong>ÖFSE</strong>)<br />
A-1090 Wien, Berggasse 7<br />
Telefon:(+43 1) 317 40 10<br />
e-mail: office@oefse.at<br />
internet: http://www.oefse.at, http://www.eza.at<br />
Redaktion: Gerhard Bittner<br />
Cover und Basisgestaltung: grieder graphik<br />
Layout: Alexandra Erös<br />
Druck: Facultas, Wien, 2005.<br />
ISBN 3-900592-92-6<br />
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Übersetzung,<br />
Vervielfältigung und Verbreitung, vorbehalten.<br />
Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form<br />
ohne schriftliche Genehmigung des Herausgebers<br />
reproduziert oder unter Verwendung elektronischer<br />
Systeme verarbeitet, verfielfältigt oder verbreitet<br />
werden.
VORWORT<br />
VORWORT<br />
INHALT<br />
Die Entwicklungspolitik hat im Rahmen der internationalen Beziehungen wieder mehr Gewicht er-<br />
halten. Mit dem Beschluss der Millenniumsziele (MDGs) bis 2015 die Armut weltweit zu halbieren,<br />
hat die internationale Staatengemeinschaft ehrgeizige Ziele gesetzt. Von der Verwirklichung der<br />
MDGs hängt nicht nur die Glaubwürdigkeit der Industrienationen ab, sondern vor allem auch die<br />
gemeinsame Zukunft der „Einen Welt“. Terror und gewaltsame Konflikte rücken die friedenspo-<br />
litische Dimension der Entwicklungspolitik wieder mehr in den Vordergrund. Entwicklungspolitik<br />
kann ein konkreter Beitrag zu mehr Gerechtigkeit und nachhaltiger Friedenssicherung sein.<br />
Die konkrete Entwicklungszusammenarbeit verfolgt die praktische Umsetzung der Entwicklungs-<br />
politik. Die Maßnahmen, Budgethilfen, Projekte und Programme sollen dazu beitragen, die Rah-<br />
menbedingungen für humanitäre, soziale und wirtschaftliche Entwicklung zu verbessern. Dabei<br />
geht es nicht nur um den Transfer von finanziellen Mitteln. Als wichtige EZA-Maßnahme wird die<br />
so genannte „Entwicklungspolitische Inlandsarbeit“ gesehen, mit der die Öffentlichkeit in den Ge-<br />
berländern sowohl über die Entwicklungspolitik als auch über die Entwicklungszusammenarbeit<br />
informiert und auf konkrete Handlungsmöglichkeiten hingewiesen wird. Seit den 1990er Jahren<br />
hat die entwicklungspolitische Inlandsarbeit nicht nur international, sondern auch in Österreich<br />
zunehmend an Bedeutung gewonnen.<br />
Die <strong>ÖFSE</strong> versteht sich auch als „Gedächtnis“ der österreichischen Entwicklungspolitik und ist<br />
bemüht, durch angewandte Forschung Zusammenhänge in ausgewählten EZA-Bereichen zu do-<br />
kumentieren. Die vorliegende Publikation der Österreichischen Forschungsstiftung für Entwick-<br />
lungshilfe versucht daher, die Entwicklung des Bereiches „Entwicklungspolitische Inlandsarbeit“<br />
in Österreich seit ihren Anfängen darzustellen und zu diskutieren.<br />
Wir danken den Autorinnen und Autoren, den vielen Personen, die uns beim Zustandekommen<br />
der Publikation unterstützt haben und nicht zuletzt dem Bundesministerium für auswärtige Ange-<br />
legenheiten und der Austrian Development Agency - ADA, für die Finanzierung.<br />
Univ.Prof. Dr. Klaus Zapotoczky<br />
Wien, August 2005<br />
<strong>ÖSTERREICHISCHE</strong> EZA – BAND 1 3
INHALT<br />
INHALT<br />
Einleitung ........................................................................................... 9<br />
1. Überblick ...........................................................................................13<br />
1.1. Eigenständiger Bereich der Entwicklungspolitik .......................................14<br />
1.2. Inlandsarbeit schafft Bewegung ...........................................................14<br />
1.3. Themenorientierung Wirtschaft ...........................................................15<br />
1.4 Vorgaben durch internationale Konferenzen...........................................15<br />
1.5. Öffentlich und/oder Privat ..................................................................16<br />
1.6. Inlandsarbeit als kritisches EZA-Element .................................................16<br />
1.7. Inlandsarbeit versus Armutsbekämpfung? ..............................................18<br />
1.8. Beteiligung und Mitgestaltung ............................................................18<br />
1.9. Organisationsstrukturen im Wandel ......................................................19<br />
1.10. Aktuelle Spannungsfelder .................................................................20<br />
1.11. Neue Rahmenbedingungen ...............................................................21<br />
1.12. Weiterentwicklung des Anliegens........................................................22<br />
Helmuth Hartmeyer<br />
2. Rückblick ...........................................................................................23<br />
2.1. Die Entdeckung der Entwicklungspolitischen Informationsarbeit ..................23<br />
2.2. Ein neues Arbeitsfeld entsteht: Die entwicklungspolitische Bildungsarbeit ......24<br />
2.3. Solidarisches Handeln konkret .............................................................27<br />
2.3.1. Anti-Apartheid-Bewegung in Österreich ..............................................27<br />
2.3.2. Fairer Handel in Österreich .............................................................29<br />
2.4. Tagesordnung: Weltinnenpolitik ..........................................................30<br />
Gerhard Bittner<br />
3. Entwicklungspolitische Inlandsarbeit. Öffentliche Maßnahmen ..................33<br />
3.1. Überblick ......................................................................................33<br />
3.2. Förderungen über KommEnt, Förderpolitik, Rahmenbedingungen ................37<br />
3.2.1. Gründungsgeschichte ..................................................................38<br />
3.2.2. Die Aufgaben ...........................................................................39<br />
3.2.3. Ende KommEnt-Tätigkeit ..............................................................40<br />
3.3. Die Etablierung neuer Themenfelder ....................................................41<br />
3.4. ADA – Abteilung Entwicklungspolitische Kommunikation und Bildung ...........43<br />
3.5. Förderungen anderer Ministerien, der Länder und Gemeinden .....................43<br />
3.6. Förderungen durch die Europäische Kommission ......................................44<br />
<strong>ÖSTERREICHISCHE</strong> EZA – BAND 1 5
INHALT<br />
Gerhard Bittner<br />
4. Entwicklungspolitische Inlandsarbeit. Maßnahmen privater<br />
Einrichtungen und Nichtregierungsorganisationen ...................................45<br />
4.1. Überblick ......................................................................................45<br />
4.2. Arbeitsgemeinschaft Entwicklungszusammenarbeit – AGEZ .........................49<br />
4.3. Die Informationsarbeit der christlichen Kirchen ........................................50<br />
4.3.1. Evangelische Kirchen A.B. und H.B. ...................................................52<br />
4.3.2. Katholische Kirche ......................................................................52<br />
4.3.3. Andere christlichen Kirchen ............................................................63<br />
4.4. Private Entwicklungsorganisationen .....................................................63<br />
4.5. Spendenvorgänge, Fundraising ...........................................................68<br />
5. Entwicklungspolitische Inlandsarbeit konkrete Organisationsmaßnahmen<br />
in ausgewählten Themenbereichen ........................................................71<br />
5.1. Bildung und Begegnung ....................................................................72<br />
5.1.1. Service- und Beratungsstellen .........................................................72<br />
5.1.2. Orte der Begegnung ...................................................................75<br />
5.1.3. Praktika, Lerneinsätze und Projektreisen..............................................78<br />
5.2. Entwicklungspolitische Bildungsarbeit und Globales Lernen ........................78<br />
5.2.1. Vom entwicklungspolitischen zum globalen Lernen .................................79<br />
5.2.2. Globales Lernen in Österreich .........................................................79<br />
5.2.3. Lehrgänge Globales Lernen ............................................................80<br />
5.2.4. Schulen ..................................................................................80<br />
5.2.5. Jugendarbeit und Erwachsenenbildung ..............................................81<br />
5.3. Wissenschaft und Forschung ...............................................................82<br />
5.3.1. Bibliotheken und Dokumentationen ..................................................83<br />
5.3.2. Studienbegleitende Bildung für Studierende aus Entwicklungsländern ............87<br />
5.3.3. Forschungseinrichtungen ..............................................................87<br />
5.3.4. Entwicklungstagungen .................................................................91<br />
5.4. Themenbezogene Programme ............................................................93<br />
5.4.1. Fairer Handel. Wirtschaft und Entwicklung ..........................................93<br />
5.4.2. Gender ................................................................................ 100<br />
5.4.3. Umwelt ................................................................................ 101<br />
5.4.4. Friede, Menschenrechte .............................................................. 102<br />
5.4.5. Tourismus .............................................................................. 106<br />
5.4.6. Allgemeine Entwicklungspolitik ..................................................... 108<br />
6 <strong>ÖSTERREICHISCHE</strong> EZA – BAND 1
INHALT<br />
5.5. Kunst und Kultur ........................................................................... 109<br />
5.5.1. Kulturarbeit; Kulturaustausch ....................................................... 110<br />
5.5.2. Interkulturelles Lernen................................................................ 112<br />
5.5.3. Weitere Initiativen .................................................................... 112<br />
5.6. Publikationen ............................................................................... 113<br />
5.6.1. Zeitschriften und Buchreihen ........................................................ 113<br />
5.6.2. Wissenschaftliche Publikationen .................................................... 116<br />
5.6.3. Internet ................................................................................ 117<br />
5.6.4. EZA-Datenbanken im Internet ....................................................... 119<br />
5.6.5. Entwicklungspolitische Newsletter .................................................. 121<br />
5.7. Filme, Fernsehen und Radio .............................................................. 121<br />
5.7.1. Förderung von Filmprojekten ........................................................ 121<br />
5.7.2. Filmfestivals ........................................................................... 122<br />
5.7.3. Filmproduktionen der OEZA ......................................................... 122<br />
5.7.4. ORF-Radio Ö1 ......................................................................... 123<br />
5.7.5. Freie nichtkommerzielle Radiostationen ............................................ 123<br />
5.8. Öffentlichkeitsarbeit ...................................................................... 124<br />
5.8.1. Kampagnen ........................................................................... 125<br />
5.8.2. KommEnt-Studie „Öffentlichkeitsarbeit der NRO“ ................................ 128<br />
5.9. Öffentlichkeitsarbeit der OEZA .......................................................... 130<br />
5.9.1. Die Öffentlichkeitsarbeit der Österreichischen<br />
Entwicklungszusammenarbeit imBKA/Außenministerium 1992 bis 2000 ............... 130<br />
5.9.2. Die Programmperiode 1999 – 2001 ................................................ 131<br />
5.9.3. Die Öffentlichkeitsarbeit der ÖEZA seit 2000 ...................................... 133<br />
5.9.4. Die Informationsinitiativen 2000 bis 2004.......................................... 133<br />
5.9.5. Weitere Schwerpunkte ............................................................... 135<br />
5.10. Public Support ............................................................................. 136<br />
6. Organisationsdarstellungen ................................................................ 141<br />
Helmuth Hartmeyer<br />
7. Internationaler Vergleich, internationale Perspektiven.......................... 167<br />
7.1. Überblick .................................................................................... 167<br />
7.2. Aufwändungen im Detail ................................................................. 167<br />
7.3. Global Education Network Europe (GENE) ............................................ 169<br />
7.4. DEEEP......................................................................................... 170<br />
7.5. Trialog ........................................................................................ 170<br />
<strong>ÖSTERREICHISCHE</strong> EZA – BAND 1 7
INHALT<br />
8. Impulse............................................................................................ 171<br />
Vorwort ............................................................................................ 171<br />
Petra C. Gruber<br />
Globale Friedensgestaltung .................................................................... 172<br />
Kurt Luger<br />
Online aus der Armut? Kommunikation für nachhaltige Entwicklung ................. 175<br />
Franz Nuscheler<br />
Globales Politikverständnis ..................................................................... 178<br />
Kunibert Raffer<br />
Globales Wirtschaften ........................................................................... 181<br />
Klaus Seitz<br />
Lernen im Horizont der Einen Welt ........................................................... 183<br />
Roland Steidl<br />
Plädoyer für eine andere Art des Wachstums ............................................... 185<br />
Helmut Voitl<br />
Helfen - Die Kunst der Verantwortung ...................................................... 187<br />
Anhang............................................................................................ 191<br />
Entwicklungspolitische Inlandsarbeit – Akteure ............................................ 191<br />
Entwicklungspolitische Inlandsarbeit – Finanzdaten ...................................... 198<br />
Tabellenverzeichnis .............................................................................. 199<br />
AutorInnenhinweise ............................................................................. 202<br />
8 <strong>ÖSTERREICHISCHE</strong> EZA – BAND 1
EINLEITUNG<br />
EINLEITUNG<br />
Das Thema „Entwicklungspolitik“ scheint an einem Wendepunkt. Mit der vielfach erlebbaren Glo-<br />
balisierung schwinden Raum- und Zeitdistanzen. Ebenso oft die Betroffenheit und ein Ernstneh-<br />
men sozialer und wirtschaftlicher Ungleichheit.<br />
Entwicklungspolitische Inlandsarbeit will die Einsicht in diese Ungleichheiten sowie in weltweite<br />
Interdependenzen vermitteln und persönliches Engagement für Gerechtigkeit und Frieden fördern.<br />
Viele gesellschaftliche Rahmenbedingungen dafür haben sich gewandelt. Die Situation in den Ent-<br />
wicklungsregionen unserer Welt ist durch Information der Medien präsent, weltweiter Tourismus<br />
ist ein weiteres Element persönlicher Erfahrungen. Dennoch: Eine vertiefende Auseinanderset-<br />
zung mit Entwicklungsfragen scheint immer weniger zu gelingen. Sie stellt unbequeme Fragen,<br />
auch an den eigenen Lebensstil. Hinzu kommt wirtschaftliche Unsicherheit, Unabwägbarkeit in<br />
der Lebensplanung, Außensteuerungen nehmen zu. Werte unterliegen einem Wandel, ohne in<br />
einer bewusst auf Pluralität orientierten Gesellschaft eine allgemein gültige Orientierung finden<br />
zu können. Globalisierung gestalten kann aber nur, wer klare Wertvorstellungen jenseits des Wirtschaftens<br />
hat. 1<br />
Zudem ist der Optimismus früherer „Entwicklungsdekaden“ einer nüchternden, manchmal nega-<br />
tiven Einschätzung entwicklungspolitischer Maßnahmen gewichen. Die Ohnmacht, Entwicklungen<br />
in einem überschaubaren Zeitablauf steuern und realisieren zu können, ist deutlicher geworden.<br />
Entwicklung wohin? 2<br />
So ist auch „entwicklungspolitisches Bewusstsein“ heute anders ausgeprägt. Die Zeit der Entwick-<br />
lungstheorien und Weltwirtschaftskonzepte als öffentlich beachtete „Weltthemen“ scheint vorbei.<br />
Im Vordergrund steht eine Debatte um rasch wechselnde Spezialthemen von globaler Dimension,<br />
oft als Kurzzeitereignis anlässlich von UN-Großkonferenzen und mit NGO-Beteiligung inszeniert.<br />
Die „Dritte Welt“, oder wie immer man das Thema Entwicklungspolitik 3 umschreibt, ist trotz aller<br />
Anstrengungen der öffentlichen wie privaten Akteure heute anders, vielleicht aber auch selbst-<br />
verständlicher präsent.<br />
Entwicklungspolitische Impulse haben sich diesen Rahmenbedingungen angepasst. Der Begriff<br />
„Gerechtigkeit“ wird in der entwicklungspolitischen Informations- und Bildungsarbeit heute oft<br />
durch „Fairness“ ersetzt. Allerdings handelt es sich dabei nicht um eine aufgearbeitete Konzepti-<br />
on der Gerechtigkeit als Fairness 4 , wie dies John Rawls bereits 1971 versucht hat.<br />
„Fair“, insbesondere im Zusammenhang mit dem Fairen Handel, ist in den vergangenen Jahren<br />
zum bestimmenden Begriff in der entwicklungspolitischen Landschaft geworden. Viele Analysen<br />
und Hinweise in dieser Publikation belegen dies. Die überragende Bedeutung des Begriffes „Fair“<br />
1 Rau, Johannes (2002). Dialog der Kulturen-Kultur des Dialogs, Freiburg in Breisgau, 172-190.<br />
2 Weizäcker, Friedrich von (1993). Die Geografie des Menschen, Wien, 55-72.<br />
3 Nuscheler, Franz (2004). Lern- und Arbeitsbuch Entwicklungspolitik, Bonn, 76.<br />
4 Rawls, John (2003). Gerechtigkeit als Fairneß. Ein Neuentwurf, Frankfurt.<br />
<strong>ÖSTERREICHISCHE</strong> EZA – BAND 1 9
EINLEITUNG<br />
in der entwicklungspolitischen Inlandsarbeit bringt aber auch einen weiteren, überraschenden<br />
Zugang: Inlandsarbeit bearbeitet Wirtschaftsthemen. Ausgehend von fair gehandelten Produkten<br />
oder „Fair Play“ und „Fairen Wochen“ werden globale Zusammenhänge dargestellt. Die Reform<br />
der WTO, die GATS – Verhandlungen oder das TRIPS – Abkommen werden dadurch thematisiert.<br />
Nur nachrangig werden Länder- und Kulturthemen angeboten. Wirtschaft und Entwicklung ist<br />
damit auch in der Inlandsarbeit längst ein Schwerpunkt geworden.<br />
Ein zweiter Schwerpunkt ist die Vermittlung konkreter Entwicklungszusammenarbeit. In den ver-<br />
gangenen Jahren hat dieses Anliegen sowohl in der öffentlichen wie privaten EZA an Bedeutung<br />
gewonnen. Öffentlichkeitsarbeit ist zum begleitenden Element von EZA – Maßnahmen gewor-<br />
den. Öffentliche wie private Geldgeber wollen dadurch vielfach ihr Auslandsengagement präsent<br />
halten. Informationsanliegen müssen mit Marketingansätzen verschränkt werden. Ohne Zweifel<br />
ist eine EZA-Öffentlichkeitsarbeit bedeutend. Nur über die öffentliche und für die veröffentlichte<br />
Meinung scheint es möglich, die Politik zu beinflussen 5 . Inhalt und Form der Öffentlichkeitsarbeit<br />
werden aber zunehmend kritisch hinterfragt.<br />
Entwicklungspolitische Informations-, Bildungs-, Kultur- und Öffentlichkeitsarbeit – in der vorlie-<br />
genden Broschüre sprechen wir vereinfacht von „entwicklungspolitisccher Inlandsarbeit” - steht<br />
heute vor großen Herausforderungen. Unverändert scheinen die Ansprüche zu gelten:<br />
Ziel ist es, eine Änderung der öffentlichen Meinung zu bewirken, Basis für eine Motivation zu persönlichem<br />
Engagement zu legen und entwicklungspolitische Maßnahmen zu begleiten. 6<br />
Da ist manches zu tun. Eine zukunftsorientierte entwicklungspolitische Inlandssarbeit in öffent-<br />
licher wie privater Trägerschaft muss sich als eigenständiger Bereich verstehen. Man kann auch<br />
von einer „dritten Säule” 7 sprechen. Inlandsarbeit ist keine bloße Unterstützung von Spenden-<br />
aufrufen, keine Transfermaßnahme von Öffentlichkeitsarbeit und kein Anhängsel einer ausland-<br />
sorientierten bi- und multilateralen Kooperation. Entwicklungspolitische Inlandssarbeit muss ihre<br />
traditionellen Grenzen überschreiten. Sie muss endgültig raus aus ihrem Nischendasein.<br />
Versteht man den Paradigmenwechsel richtig, werden in der heute überschaubaren Entwicklungs-<br />
zusammenarbeit in den kommenden Jahren EZA-Projektmaßnahmen an Bedeutung verlieren.<br />
Zunehmend stellt sich die Frage, ob – insbesondere bilaterale – Programme und Projekte den<br />
notwendigen gesamtwirtschaftlichen Strukturwandel fördern. 8 Internationale Kooperationen,<br />
vor allem EU-Programme werden nationale Projekte neu definieren und eingrenzen. Das mit den<br />
Millennium Development Goals verbundene Ziel, 2015 die Armut weltweit zu reduzieren, bedarf<br />
erweiterter Anstrengungen, die über das traditionelle Verständnis von Entwicklungszusammenar-<br />
beit hinausreichen.<br />
5 Freudenschuss-Reichl, Irene (2005). Südwind-Magazin Nr.3.<br />
6 Jäggle/Sibitz (1978). „Öffentlichkeitsarbeit 3. Welt“ in Österreich, IBE 5.<br />
7 Wieczorek-Zeul, Heidemarie (2001). Entwicklungsplitische Debatte im deutschen Bundestag<br />
8 Nuscheler, Franz (2004). Lern- und Arbeitsbuch Entwicklungspolitik 5. Auflage.<br />
10 <strong>ÖSTERREICHISCHE</strong> EZA – BAND 1
EINLEITUNG<br />
Maßnahmen der Inlandsarbeit erhalten in diesem Kontext eine bedeutsame Rolle. Sie sind, weil<br />
am konkreten Menschen orientiert, anders – und innerhalb einer kohärenten Entwicklungspolitik<br />
– mit mehr Selbstbewusstsein neu zu verorten.<br />
Die Österreichische Forschungsstiftung für Entwicklungshilfe bearbeitet seit ihrer Gründung 1967<br />
Grundlagen und Realisierung österreichischer wie internationaler Entwicklungspolitik.<br />
1995 erschien eine letzte Analyse der entwicklungspolitischen Inlandsarbeit. 9 KommEnt, als staat-<br />
liche Agentur 1995 gegründet, um vom BMaA geförderte Projekte im Bereich der entwicklungs-<br />
politischen Inlandsarbeit zu beraten, prüfen und Entscheidungsgrundlagen für das BMaA zu erar-<br />
beiten, war in den vergangenen zehn Jahren im Auftrag des Bundesministeriums für auswärtige<br />
Angelegenheiten wesentlich an der Gestaltung entwicklungspolitischer Inlandsarbeit beteiligt.<br />
Die nun vorliegende Publikation richtet wiederum den Focus auf diese Inlandsarbeit. Wie bereits<br />
1995 haben Gerhard Bittner und Helmuth Hartmeyer mit Unterstützung genannter Personen den<br />
Großteil der Textarbeit geleistet. Es ging den Autoren um eine objektive, auch in ihren geschicht-<br />
lichen Entwicklungen bearbeitete Darstellung öffentlicher wie privater Maßnahmen. Zahlen und<br />
Daten, Organisationsbeschreibungen sowie Impulse fachkompetenter AutorInnen ergänzen die<br />
Publikation.<br />
An der Entstehung und Produktion der vorliegenden Publikation waren viele Personen beteiligt.<br />
Unser Dank gilt den AutorInnen, die uns für den Abschnitt 8 Impulse zu Aspekten der entwick-<br />
lungspolitischen Inlandsarbeit zur Verfügung gestellt haben. Weiters danken wir den vielen Perso-<br />
nen, die uns Texte für Spezialfragen überlassen haben. Barbara Weisböck hat Internetrecherchen<br />
zu entwicklungspolitischen Organisationen im Rahmen eines <strong>ÖFSE</strong> - Praktikums durchgeführt,<br />
Katharina Zucker schließlich Korrekturarbeiten erledigt. Wertvolle Hinweise verdanken wir den<br />
ExpertInnen Heinz Gabler, Hans Göttel, Irmgard Strach-Kirchner und Judith Zimmermann-Hößl.<br />
Wesentliche Unterstützung erhielten wir von den <strong>ÖFSE</strong> - MitarbeiterInnen. Ganz besonders dan-<br />
ken wir Alexandra Erös, die das Manuskript erstellt und es bis zur Publikationsreife immer wieder<br />
auf den neuesten Stand gebracht hat.<br />
Eine auf globale Entwicklung bedachte Politik wird ihren zivilgesellschaftlichen Rückhalt nur in<br />
informierten und engagierten Bürgerinnen und Bürgern finden. Es bleibt kein Ausweg: Analog<br />
zur Befriedung Europas, die durch Bildung der Europäischen Union gelungen scheint, ist eine<br />
weltweite Friedenspolitik zu entwickeln, die Freiheit, Wohlstand und weltweite nachhaltige Lebensbedingungen<br />
ermöglicht. 10<br />
Entwicklungspolitische Inlandsarbeit schafft dafür Grundlagen.<br />
Gerhard Bittner<br />
<strong>ÖFSE</strong><br />
Dr. Heidi Grobbauer<br />
KommEnt<br />
9 Bittner, Gerhard/Helmuth Hartmeyer (1995), Die Entwicklungspolitische Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit der österreichischen<br />
Nichtregierungsorganisationen, <strong>ÖFSE</strong><br />
10 Global Marshall Plan, 2003/2004<br />
<strong>ÖSTERREICHISCHE</strong> EZA – BAND 1 11
1. ÜBERBLICK<br />
ÜBERBLICK<br />
Martin Jäggle und Bernd Sibitz veröffentlichten 1975 eine erste Analyse und Dokumenta-<br />
tion der „Öffentlichkeitsarbeit 3. Welt“ 1 . Sie verwiesen darin auf ihre umfassende Verwen-<br />
dung des Begriffs „Öffentlichkeitsarbeit“, der die Information der Öffentlichkeit, Werbung,<br />
aber auch Bewusstseinsbildung mit einschloss.<br />
20 Jahre später gaben Gerhard Bittner und Helmuth Hartmeyer 1995 einen aktuellen Über-<br />
blick zur entwicklungspolitischen Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit 2 . Die Publikation<br />
hatte das Ziel, im Zusammenhang mit dem EU-Beitritt Österreichs eine auch für den inter-<br />
nationalen Gebrauch gedachte Darstellung des Bereiches zu geben.<br />
Vorbemerkung<br />
In der vorliegenden Publikation wird der Begriff Öffentlichkeitsarbeit als Public Relation, das heißt<br />
als Beziehungen zur Öffentlichkeit verwendet. Diese werden seit einiger Zeit zunehmend dialo-<br />
gisch orientiert gestaltet 3 . Für (soweit erkennbar) Einwegkommunikation wird in der Publikation<br />
der Begriff Informationsarbeit verwendet. Der Begriff Bildungsarbeit umschreibt Lernprozesse, die<br />
im guten Fall auf eine hohe Partizipation der Lernenden und deren eigenständige Weiterarbeit<br />
abzielen. Weiters findet sich in der Publikation auch der Begriff der Kulturarbeit, der Elemente<br />
der Informationsarbeit, der Öffentlichkeitsarbeit und der Bildungsarbeit beinhalten kann. Schließ-<br />
lich finden sich noch die Begriffe Kampagnenarbeit, Anwaltschaft, Lobbying und Fundraising als<br />
spezifische Aufgaben insbesondere von NGOs. Der Begriff entwicklungspolitische Inlandsarbeit<br />
umfasst alle genannten Arbeitsbereiche.<br />
„Entwicklungspolitische Bildungs- und Informationsarbeit stellt einen qualitativen Anspruch: Eine<br />
differenzierte und anspruchsvolle Auseinandersetzung mit den Themen soll informieren, neuen<br />
Formen des Lernens Raum geben….“ 4 Es ist ein hoher Anspruch, dem sich Akteure der Entwick-<br />
lungszusammenarbeit damit stellen. Kann es doch nicht nur darum gehen, Wissen zu vermitteln,<br />
sondern Bewusstsein für das Erkennen von Ursachen und Zusammenhängen zu schaffen. Zudem<br />
stellt sich die Frage, wie individuelles und gemeinschaftliches Engagement für eine gerechtere<br />
Welt bewirkt werden können.<br />
Dieses entwicklungspolitische Handeln ist das Ziel jeder entwicklungspolitischen Inlandsarbeit. In-<br />
halte wie Methoden unterliegen dabei zeitbedingten Veränderungen. Ausgangspunkt ist aber<br />
immer der Begriff der Gerechtigkeit.<br />
1 Jäggle, Martin/Bernd Sibitz (1975). Information und Bewusstseinsbildung. „Öffentlichkeitsarbeit 3. Welt“ in Österreich.<br />
Analyse und Dokumentation. IBE-Forschungsdokumentation 4. Wien. Die selben Autoren publizierten in der Folge zum<br />
gleichen Titel Vorschläge für Programme und einen Maßnahmenkatalog<br />
2 Bittner, Gerhard/Helmuth Hartmeyer (1995). Die Entwicklungspolitische Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit der Österreich-<br />
ischen Nichtregierungsarbeit, <strong>ÖFSE</strong>, Wien.<br />
3 Mayr, Brigitte (2004). Der Schlüssel heißt Dialog, in: Südwind Magazin, (10), 42-43.<br />
4 Hanak, Irmi. Entwicklung kommunizieren, in JEP 1/98, 53-73.<br />
<strong>ÖSTERREICHISCHE</strong> EZA – BAND 1 13
ÜBERBLICK<br />
Heute sehen wir diesen Begriff um die Zukunftsdimension „Nachhaltigkeit“ erweitert:<br />
„Das umfassende Prinzip der Nachhaltigkeit will gerechte Verhältnisse nicht nur zwischen<br />
den lebenden Menschen, sondern auch in Hinblick auf die zukünftigen Generationen 5 “.<br />
Dieser Hinweis soll die Zukunftsorientierung von Entwicklungspolitik verdeutlichen. Entwicklungs-<br />
politische Inlandsarbeit ist herausgefordert, Visionen und Perspektiven ebenso einzubringen wie<br />
konkretes Handeln zu ermöglichen.<br />
Die vorliegende Publikation bemüht sich um eine systematische Darstellung und Aufarbeitung<br />
entwicklungspolitischer Inlandsarbeit in Österreich. Vorweg wird auf markante Positionen und<br />
Entwicklungen hingewiesen.<br />
1.1. Eigenständiger Bereich der Entwicklungspolitik<br />
Die entwicklungspolitische Inlandsarbeit – der Begriff wird hier als Gesamtheit aller oben darge-<br />
stellter Teilmaßnahmen verwendet – ist heute ein selbstverständlicher und eigenständiger Bereich<br />
in der Entwicklungszusammenarbeit. Er überschreitet durch seine politische Dimension die Gren-<br />
zen der EZA. Dies ist auch ein Grund für manche Anfragen und Konflikte. Dennoch: Es gehört<br />
heute zum Selbstverständnis einer als Teil einer Entwicklungspolitik verstandenen EZA, Informati-<br />
ons- und Bildungsarbeit zu fördern Die Anerkennung hat aber noch eine weitere Dimension: Es ist<br />
gelungen, über den engeren EZA-Bereich hinaus neue Themenfelder zu erschließen. Mit AkteurIn-<br />
nen in diesen Politikfeldern wurden Kooperationen geschlossen. Programme und Projekte in den<br />
Entwicklungsländern werden dadurch thematisch ergänzt.<br />
Diese Entwicklung erfolgte in den vergangenen Jahren entlang der Generaldebatte zum Thema<br />
„Globalisierung“, etwa in den Politikbereichen Umwelt, Klima, Arbeit, Weltwirtschaft/Internati-<br />
onaler Handel oder Gender. Es waren Themen, die sich bald in Programmatik und Monitoring<br />
von Auslandsprojekten fanden. Entwicklungspolitische Inlandsarbeit hat so Auswirkungen auf die<br />
unmittelbare EZA-Projektarbeit.<br />
Dies wird auch in der politischen Ausrichtung vieler öffentlicher und privater EZA-Auslandsprojek-<br />
te sichtbar. Hinweise dazu finden sich u.a. in neu entwickelten Instrumenten wie Gender- oder<br />
Umweltverträglichkeitsprüfungen und seit 2000 im Oberziel der Armutsbekämpfung durch die<br />
Millenniumsentwicklungsziele (MDGs)<br />
1.2. Inlandsarbeit schafft Bewegung<br />
Waren die ausgehenden 1960er Jahre von Demokratiekritik und neuen internationalen Sicht-<br />
weisen geprägt (Stichwort Befreiung), eröffnet sich heute eine andere Welt: Informierte, in-<br />
ternational erfahrene, oftmals durch höhere Bildung herausgeforderte und befähigte junge<br />
Menschen stellen neue Grundfragen zu globaler Entwicklung. Die Schlagworte der Dritte-Welt-<br />
Bewegung in den 1970er und 1980er Jahren „Global denken – lokal handeln“ oder „Hilfe zur<br />
Selbsthilfe“ greifen diesen engagierten Menschen in den neuen sozialen Bewegungen zu kurz:<br />
5 Liessmann, Konrad Paul (2004). Der Geschmack der Nachhaltigkeit, in: Almanach 2004. Europahaus Burgenland.<br />
14 <strong>ÖSTERREICHISCHE</strong> EZA – BAND 1
ÜBERBLICK<br />
Sie fordern eine neue Weltverantwortung bei internationalen Organisationen wie den nationalen<br />
Regierungen, nicht nur durch eine Erhöhung der EZA-Budgets.<br />
Die neuen sozialen Bewegungen haben die traditionelle Dritte Welt-Arbeit auf lokaler Ebene ab-<br />
gelöst. Engagierte Personen in politischen Parteien oder Kirchen sind vielen um Individualität,<br />
aber auch um Solidarität bemühten Menschen gewichen. Manche EZA-Akteure bedauern diese<br />
Entwicklung, wird doch eine früher klar strukturierte gesellschaftliche Verankerung durch infor-<br />
melle Strukturen ersetzt.<br />
Diese Solidaritätsarbeit, oft durch Kampagnen und aktuelle Themenstellungen eher kurzfristig<br />
orientiert, spricht Personen an, die frei von Organisationsbindung Entwicklungspolitik als eine<br />
wesentliche Maßnahme zur Weltveränderung begreifen. Ihre Arbeitsweisen entsprechen zudem<br />
oft in ihrer Spontanität heutiger medialer Vermittlung.<br />
1.3. Themenorientierung Wirtschaft<br />
Es wird überraschen, aber entwicklungspolitische Inlandsarbeit ist von Wirtschaftsthemen domi-<br />
niert. Der faire Handel ist das Grundthema bis heute. Inlandsarbeit nimmt ökonomische Mikrobe-<br />
ziehungen als Thema auf, erweitert dies aber durch Informationsarbeit und Bewusstseinsbildung<br />
zu globalen Wirtschaftsthemen.<br />
Produkte des fairen Handels, Kampagnen zu konkreten Handelsbeziehungen (Kleidung, Öl, Blu-<br />
men, Teppiche) sind nur Ausgangspunkte für Bildungsvorgänge zu weltwirtschaftlichen Zusam-<br />
menhängen. Die Rolle der WTO oder internationale Abkommen wie GATS oder TRIPS werden<br />
diskutiert.<br />
Die Absatzzahlen des fairen Handels in Österreich sind trotz Aufwärtsentwicklungen in den<br />
letzten Jahren bescheiden. Dennoch gelingt es mit dem „Nischenprodukt“ Fairer Handel als In-<br />
formationsinstrument große Teile der Öffentlichkeit zu erreichen. Forderungen nach gerechten<br />
Produktions- und Arbeitsbedingungen in Entwicklungsländern werden so im Bewusstsein der<br />
österreichischen Bevölkerung verankert. Als neues Dilemma muss aber aufgrund der Produkt-<br />
platzierung in großen Handelsketten auch deren Umgang mit menschengerechten Arbeits-<br />
bedingungen bearbeitet werden.<br />
1.4 Vorgaben durch internationale Konferenzen<br />
Viele Bildungsinhalte orientieren sich seit den 1990er Jahren an den Themensträngen entlang der<br />
großen internationalen Konferenzen: 1992 zu Umwelt und Entwicklung in Rio, 1993 zu den Men-<br />
schenrechten in Wien, 1995 zu Frauen in Beijing, 1996 zur Weltbevölkerung in Kairo, 2002 Rio+10<br />
in Johannesburg, 2003 zu den ICT in Genf oder zuletzt die UN-Konferenz zu MDGs+5 (2005) um<br />
einige der wichtigsten zu nennen.<br />
Seit Rio 1992 haben NGOs nicht nur öffentlichkeitswirksame Vor- und Begleitkonferenzen durch-<br />
geführt, sondern nehmen auch in den Regierungsdelegationen teil, was für das Lobbying ihrer<br />
Anliegen neue Spielräume eröffnet hat.<br />
Die Entwicklungsfinanzierung ist in den letzten Jahren erneut ein wesentliches Thema geworden.<br />
<strong>ÖSTERREICHISCHE</strong> EZA – BAND 1 15
ÜBERBLICK<br />
Nachdem der Großteil der Industriestaaten unverändert weit weg von der Erfüllung des 1970<br />
beschlossenen Ziels ist, 0,7% des Bruttonationalproduktes (BNP) seines Reichtums für Entwick-<br />
lungszusammenarbeit auszugeben, hat nach einer erfolgreichen internationalen Entschuldungs-<br />
kampagne (Jubilee 2000), die auch in Österreich insbesondere von kirchlichen Organisationen<br />
getragen war, der UN-Beschluss des Jahres 2000, bis 2015 die acht Millenniumsentwicklungsziele<br />
zu erreichen, der Forderung nach Erhöhung der Ausgaben für EZA neuen Schwung verliehen. Ak-<br />
tuell widmet sich die nullkommasieben-Kampagne diesem Anliegen.<br />
1.5. Öffentlich und/oder Privat<br />
Eine wesentliche Veränderung in der entwicklungspolitischen Inlandsarbeit ergab sich in den ver-<br />
gangenen Jahren durch den Aufbau eines eigenständigen Informationsbereiches in der öffent-<br />
lichen EZA. Zuerst im ressortzuständigen Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten,<br />
heute in der Austrian Development Agency (ADA) geht es nicht nur um die Förderung von NGO-<br />
Projekten, sondern wird auch Inlandsarbeit im Interesse öffentlicher Anliegen und Leistungen aus<br />
Steuermitteln durchgeführt. Als Markenzeichen wurde „Österreichische Entwicklungszusammen-<br />
arbeit (OEZA)“ eingeführt.<br />
Neu gegründete oder mit öffentlichen Aufträgen betraute NGOs wie auch PR-Agenturen wur-<br />
den zu neuen Partnern. Die Öffentlichkeitsarbeit der OEZA des Bundes unterscheidet sich hier<br />
kaum von vergleichbaren Vorgängen in anderen Politikfeldern und Ministerien. Politikmarketing<br />
und PR-Maßnahmen werden durch Aufträge ausgelagert. Das Anwachsen von verwaltungsnahen<br />
NGOs ist dadurch auffällig. Ein weiteres Merkmal für diese Verschränkungen ist der Wechsel von<br />
Fachpersonal aus der NGO-Umwelt in die öffentliche EZA.<br />
Unumkehrbar scheint die Neugestaltung der EZA-Inlandsarbeit: Neben privaten Organisationen<br />
mit ihren vielfältigen, oft von Freiwilligenleistung getragenen Angeboten gibt es eine, auch im<br />
Interesse der Begleitung öffentlicher EZA-Leistung zu verantwortende Informationsarbeit.<br />
Beide Zugänge sind auch international üblich. Das geforderte Zusammenwirken der beiden Berei-<br />
che bedarf einer dialogischen Auseinandersetzung, ohne das Primat der Finanzierung als Macht-<br />
instrument anzuwenden.<br />
1.6. Inlandsarbeit als kritisches EZA-Element<br />
Entwicklungspolitische Inlandsarbeit setzt eine erweiterte Dimension der globalen politischen Zu-<br />
sammenhänge voraus. Zugleich bedeutet dies oft eine kritische Auseinandersetzung mit den kon-<br />
kreten EZA-Maßnahmen auf internationaler Ebene ebenso wie in Österreich.<br />
Diese notwendige Funktion entwicklungspolitischer Inlandsarbeit bringt sie zugleich in ein Finan-<br />
zierungsdilemma: Sowohl in der öffentlichen wie in der privaten EZA werden fast alle Bildungs-<br />
maßnahmen aus EZA-Gesamtbudgets finanziert. Öffentliche Stellen in Bund und Ländern, ebenso<br />
private Organisationen stehen vor der Frage: Wie viel Finanzmittel dürfen/müssen in konkrete<br />
Auslandsmaßnahmen gehen? Der öffentliche Diskurs darüber scheint zudem gegen eine Auswei-<br />
tung von Finanzmitteln zu sein, die in Österreich verbleiben.<br />
16 <strong>ÖSTERREICHISCHE</strong> EZA – BAND 1
ÜBERBLICK<br />
Öffentlichkeitsarbeit wird in öffentlicher wie privater EZA als PR-Maßnahme, Leistungsnachweis<br />
oder Spendenmarketing legitimiert. Dies führt zum Versuch, messbare Größen zu definieren, wie<br />
etwa die EZA-Zustimmung in der österreichischen Bevölkerung.<br />
In diesem Zusammenhang ist die bisherige Tätigkeit der OEZA zu hinterfragen. War das Kon-<br />
zept auf Zustimmung bei Bevölkerung wie politisch Verantwortlichen orientiert oder ist der Erfolg<br />
– analog zu Spendenorganisationen – auch am Finanzertrag, also einer Erhöhung von Budget-<br />
mitteln zu messen? Das EZA-Budget wurde jedenfalls trotz der OEZA-Öffentlichkeitsarbeit ab 1995<br />
massiv gekürzt, auch wenn diese Kürzungen nicht in gleicher Weise wie die Förderungen entwick-<br />
lungspolitischer Inlandsarbeit weitergegeben wurden.<br />
Probleme sind neben dem Kosten/Nutzen-Denken der Vorrang betriebswirtschaftlichen Denkens<br />
auch in der NGO-Welt und eine Vorliebe zu ständiger Umstrukturierung. Schulen, Universitäten<br />
wie Erwachsenenbildung unterliegen einer bisher unbekannten Beschleunigung von Strukturan-<br />
passungsprogrammen, ohne begonnene (und oft sinnvolle) Maßnahmen leben zu können. Ent-<br />
wicklungspolitische Bildungsarbeit ist nicht nur davon mittelbar betroffen, auch an sie werden<br />
ähnliche Erwartungen gestellt.<br />
Professionalisierung und Spezialisierung brachten aber auch eine stärkere Abgrenzung zur EZA-<br />
Auslandsarbeit. Die Vernetzung ist dort am engsten, wo Inlandsarbeit im Zusammenhang mit der<br />
organisationseigenen Projektarbeit wahrgenommen wird.<br />
Die Nichtregierungsorganisationen (NGOs) verstehen sich im „Dritten Sektor“ zunehmend als Non-<br />
Profit Organisationen (NPOs). Sie positionieren sich damit weniger mit ihrer Mission als mit ihren<br />
Dienstleistungsangeboten. NPOs gründen gemeinnützige GesmbH., ehrenamtliche Mitarbeit ist<br />
rückläufig. Die Organisationen bedienen sich des betriebswirtschaftlichen Vokabulars und verän-<br />
derten in Folge einer Leistungsvertragslogik oft auch ihre inhaltliche Positionierung 6 .<br />
Diese Veränderungen im Selbstverständnis von NPOs, ihr Verhältnis zu öffentlichen Einrichtungen<br />
hat auch die Organisationen der entwicklungspolitischen Inlandsarbeit erreicht. Insgesamt wird<br />
aber in der österreichischen EZA das Verhältnis Staat und private Organisationen wenig thematisiert.<br />
Ein Versuch war die <strong>ÖFSE</strong>-Tagung „Kooperation Staat und Privat“ 1996. 7<br />
Eingebettet ist dies in einen offenen Diskurs zu Stellenwert und Selbstverständnis von NGOs als<br />
Ausdruck einer lebendigen Zivilgesellschaft. Längst erschöpfen sich deren Leistungen nicht mehr<br />
im Informations- oder Bildungsangebot. Viele NGOs verstehen sich heute auch als soziale Bewe-<br />
gungen, die Entscheidungen politisch mitgestalten wollen. Kritisch zu hinterfragen sind aber dann<br />
auch ihre Legitimität und organisationsinterne Entscheidungsprozesse 8 .<br />
Um eine Klärung in der österreichischen EZA bemüht, hat die Austrian Development Agency<br />
(ADA) im Herbst 2004 eine entsprechende Initiative gestartet und möchte sie mit einem Doku-<br />
ment zur Kooperation von Staat und Privat 2005 abschließen.<br />
6 Zauner, Alfred/ P. Heimerl/et al. (2004). Von der Subvention zum Leistungsvertrag, Wien.<br />
7 Österreichische Forschungsstiftung für Entwicklungshilfe (<strong>ÖFSE</strong>) (Hg.) (1996). Der Dritte Sektor in der Entwicklungspolitik.<br />
<strong>ÖFSE</strong> Edition 4,Wien.<br />
8 Vgl. Leggewie, Claus (2003). Jenseits des Staates, in: DIE PRESSE, 18.01.2003.<br />
<strong>ÖSTERREICHISCHE</strong> EZA – BAND 1 17
ÜBERBLICK<br />
1.7. Inlandsarbeit versus Armutsbekämpfung?<br />
Das unlösbare Dilemma der Finanzierung entwicklungspolitischer Inlandsarbeit verschärft sich<br />
mit ihrem Erfolg: Mehr Aktivitäten und Maßnahmen, mehr Personal können mehr Bewusstsein<br />
für internationale Solidarität und höheren Informationsstand bewirken. Zugleich schmälert dies<br />
Finanzierungsmöglichkeiten in EZA-Budgets bei Maßnahmen zur Armutsbekämpfung in Entwick-<br />
lungsländern.<br />
Die Auseinandersetzung, wie hoch der Aufwand im Inland an der Gesamtheit der EZA-Mittel<br />
erreichen darf, macht dies deutlich. Dieser Diskurs findet in der öffentlichen weniger als in der<br />
privaten EZA statt.<br />
Die UN-Millenniumsentwicklungsziele legen den Entscheidungsträgern für ein Abwägen beider<br />
Positionen eine hohe Latte. Zudem könnten die MGDs in einer verkürzten Sicht eine Rückkehr zur<br />
traditionellen Entwicklungshilfe bedeuten: EZA-Maßnahmen in den Entwicklungsländern ohne<br />
kritische Reflexion globaler Entwicklung, insbesondere der Entwicklung in den Industriestaaten<br />
selbst.<br />
Bereits einer der europäischen Gründerväter internationaler Zusammenarbeit, Albert Schweitzer<br />
– oft des Paternalismus geziehen – ,hat auf den Zusammenhang zwischen Gesinnung und konkre-<br />
ten Maßnahmen hingewiesen 9 . Zu oft wird Machbarkeit globaler Entwicklung durch Programme<br />
und Projekte übertrieben dargestellt und ist dann auch eine Grundlage für berechtigte Anfragen<br />
nach den Erfolgen der Entwicklungspolitik.<br />
Zu erinnern ist an die in öffentlicher wie privater EZA formulierten Festlegungen, entwicklungspo-<br />
litische Inlandsarbeit entsprechend zu dotieren. Vom Ziel, zwei Prozent der Official Development<br />
Assistance (ODA), wurde 2003 gerade der halbe Wert erreicht. Die katholische EZA gab von den<br />
angestrebten 15 nur fünf Prozent für Bildungsmaßnahmen aus.<br />
1.8. Beteiligung und Mitgestaltung<br />
Inlandsarbeit bewirkt Beteiligung und Mitgestaltung. Die Aktionszugänge für Personen und ge-<br />
meinsames Engagement können sehr unterschiedlich sein. Mitunter werden innerhalb der Ent-<br />
wicklungszusammenarbeit diese verschiedenen Formen kontrovers diskutiert, oftmals wird eine<br />
Maßnahme für sich allein als von geringer Relevanz bezeichnet.<br />
Als Maßnahmen der Beteiligung können folgende Grundmuster benannt werden:<br />
Maßnahme Mediator Wirkungsart<br />
Spenden Organisation Geschenk<br />
Kauf Unternehmen Konsum<br />
Investieren Bankwesen Kapitalbildung<br />
9 Roland Steidl. Plädoyer für eine andere Art des Wachstums, Abschnitt 8<br />
18 <strong>ÖSTERREICHISCHE</strong> EZA – BAND 1
ÜBERBLICK<br />
Diese Grundformen der Beteiligung – Freiwilligenarbeit ist als Zeitspenden zu sehen – als ein Er-<br />
gebnis entwicklungspolitischer Inlandsarbeit bedeuten auch zugleich eine große Verankerung von<br />
Entwicklungspolitik in der Gesellschaft. An erster Stelle ist das Spendenwesen zu nennen, dann<br />
folgt der Faire Handel und in jüngster Zeit das Ethische Investment.<br />
Aktive Mitgestaltung wird durch Arbeit etwa im Bereich von Solidaritäts- und Aktionsgruppen, in<br />
EZA-Projekten bei „Lerneinsätzen“ bis hin zur Tätigkeit in professioneller Auslandsarbeit erzielt.<br />
Schließlich sind vielfältige Formen von Lobbying und Kampagnenarbeit zu erwähnen.<br />
1.9. Organisationsstrukturen im Wandel<br />
Die Beziehung der öffentlichen EZA zu den österreichischen NGOs ist aus historischen Gründen<br />
positiv besetzt. Allerdings haben sich viele EZA-Organisationen auch in der Bildungsarbeit zu-<br />
nehmend als Auftragnehmer öffentlicher Projekte definiert. Lange Zeit haben die NGOs dadurch<br />
die Schaffung einer staatlichen EZA-Agentur verhindern können, sind aber selbst immer mehr in<br />
finanzielle und inhaltliche Abhängigkeiten geraten 10 .<br />
Die öffentliche EZA begann ab 1992 mit dem Aufbau einer eigenständigen Informations- und<br />
Öffentlichkeitsarbeit. Nach Beratung durch das Institut für Kommunikationsplanung (IKP) wurde<br />
ab 1994 die Trennung zwischen staatlicher Öffentlichkeitsarbeit zur EZA und der Förderung von<br />
entwicklungspolitischer Inlandsarbeit von NGOs vollzogen. Für zweiteres wurde die Gesellschaft<br />
für Kommunikation und Entwicklung (KommEnt) gegründet, die von 1994 bis 2005 im Auftrag<br />
des BMaA (ab 2004 im Auftrag der ADA) alle EZA-Förderungen im Bereich der Inlandsarbeit ab-<br />
wickelte. Die Letztentscheidung über Fördergenehmigungen verblieb im BMaA und lag ab 2004<br />
bei der ADA.<br />
Die in der EU üblichen „Calls for proposals“ werden mit der Gründung der EZA-Agentur ADA auch<br />
österreichische Praxis werden. Entwicklungspolitische Informationsarbeit könnte sich dadurch<br />
zweifach verändern:<br />
- Zum einen bedeuten Ausschreibungen eine starke inhaltliche Vorgabe des Geldgebers.<br />
Zum definierten Thema oder Bereich werden Ideen abverlangt. Eigenständiges Arbeiten<br />
im NGO-Bereich wird dadurch zumindest eingeschränkt.<br />
- Zum anderen bedeuten Ausschreibungsergebnisse Grundlagen für klare Aufträge. Die<br />
NGOs werden zu Dienstleistern öffentlicher Einrichtungen, durchaus vergleichbar einem<br />
Unternehmen. Dies könnte – analog zu EZA-Projektorganisationen - einen Identitätswan-<br />
del bewirken.<br />
In vielen Staaten Europas ist die Stärkung bügerschaftlichen Engagements, bzw. zivilgesellschaftli-<br />
cher Strukturen zu einem wichtigen gesellschaftspolitischen Thema geworden. Neue Studien ver-<br />
weisen auf die unverzichtbare Rolle von NGOs aber auch auf die Notwendigkeit, das Verhältnis<br />
zwischen Staat und dem Non-Profit-Bereich neu zu diskutieren. 11<br />
10 Obrovsky, Michael (2001). Standortbestimmung der entwicklungspolitischen NGOs in Österreich, in: Journal für<br />
Entwicklungspolitik, 2/01,139-140.<br />
11 "Unterstützung des freiwilligen bürgerschaftlichen Engagements-der Beitrag des Bundes bei der Gestaltung gesetzlicher<br />
und finanzieller Rahmenbedingungen", Prognos AG (2005), Basel.<br />
<strong>ÖSTERREICHISCHE</strong> EZA – BAND 1 19
ÜBERBLICK<br />
„Die Aktivitäten von NROs werden in der entwicklungspolitischen Praxis hauptsächlich aus<br />
einer engen Projektperspektive beurteilt, ohne dass Fragen des Zusammenspiels von Staat,<br />
Markt und NROs unter Aspekten der Komplementarität, Konkurrenz oder Substitution<br />
kritisch diskutiert werden. Die Rolle von NRO wird hinsichtlich ihrer Leistungsfähigkeit im<br />
Erreichen von Projektzielen beurteilt. Institutionelle und politische Dynamiken bleiben<br />
außen vor. 12 ”<br />
1.10. Aktuelle Spannungsfelder<br />
Die Umorientierung der Fördermaßnahmen der OEZA insbesondere nach der KommEnt-Gründung<br />
ergab nachhaltige Veränderungen. Die in früheren Jahren an Organisationsbezüge gebundenen<br />
Förderungen wurden durch Einzelprojektförderungen ersetzt. Nur teilweise wurde dies durch so<br />
genannte „Kernfunktionsförderungen“ kompensiert. 13<br />
Die „Filetierung“ von Fördermaßnahmen wurde durch die EU-Förderpolitik verstärkt. Jahrelang<br />
EU-geförderte Projekte wie „weltumspannend arbeiten“ oder die Informationsarbeit von WIDE<br />
wurden später nicht mehr gefördert und in ihrer Struktur gefährdet.<br />
Beide Entwicklungen haben einen Wandel ergeben. Die Umstellung der Förderpolitik auf eine<br />
Vielzahl von Einzelprojekten schränkte den Gestaltungsspielraum der NGOs ein, sowohl inhaltlich<br />
als auch finanziell. Die Projektorientierung bedeutet auch für die Personalführung neue Zugänge.<br />
MitarbeiterInnen identifizieren sich mehr mit „ihrem“ Projekt als mit der Organisation, Personal-<br />
entwicklung und -kontinuität haben aufgrund befristeter (Projekt)arbeitszeitverträge an Priorität<br />
verloren.<br />
Geschäftsführungen verwalten „Projektauftragsbücher“. Die Beliebigkeit wird durch die Bedie-<br />
nung von öffentlichen „Calls for Proposals“ gefördert. Man beteiligt sich vielfach, ohne wirkliches<br />
Engagement dahinter setzen zu können. Ausschreibungsvorgänge und Anbotlegung werden vor-<br />
rangig als technischer Vorgang gesehen, Inhalte und Kreativität rücken in den Hintergrund. Die<br />
große Betonung der Projektierungsphase, die ressourcenintensiv und zumeist unbezahlt erfolgt,<br />
lässt das Vorhaben bereits als erledigt gelten, bevor es zur Realisierung kommt. Es kommt hinzu,<br />
dass die administrativ gebundenen Kapazitäten wachsen.<br />
Ausschreibungen haben weitere Auswirkungen. Zum einen ist aufgrund einer Ausschreibung nicht<br />
Förderung, sondern oft Leistungsverrechnung in Form von Werk- oder Auftragsverträgen die Kon-<br />
sequenz. Die damit gegebene Umsatzsteuerpflicht verteuert die Maßnahme um 20 Prozent und<br />
schmälert um diesen Betrag die öffentlichen EZA-Mittel. Die Abführung der Umsatzsteuer bedeu-<br />
tet wiederum eine Staatseinnahme aus diesem Titel. So werden aus EZA-Mitteln über den Umweg<br />
von Ausschreibungen Nettoeinnahmen des Staates.<br />
12 Kuhn, Berthold (2005) Entwicklungspolitik zwischen Markt und Staat. Möglichkeiten und Grenzen zivilgesellschaftlicher<br />
Organisationen, Frankfurt/Main, 58.<br />
13 Auf Dauer ausgerichtete Projekte einzelner Organisationen (wie z.B. die Beratungsleistungen in den Regionalstellen<br />
der Südwind Agentur, die Bibliothek und Dokumentation der <strong>ÖFSE</strong>, des LAI und der Frauensolidarität, das Südwind<br />
Magazin, die Ringvorlesungen des Mattersburger Kreises, die Begegnungsprogramme von ÖOG und AAI Graz) wurden<br />
zu Kernfunktionsprojekten ernannt. Die NGOs können davon ausgehen, dass diese Projekte nach dem Going Concern<br />
Prinzip auch in den Folgejahren gefördert werden, wenn die entsprechenden Mittel zur Verfügung stehen.<br />
20 <strong>ÖSTERREICHISCHE</strong> EZA – BAND 1
ÜBERBLICK<br />
In Förderprojekten werden hingegen Eigenmittel verlangt, über welche EZA-Inlandsorganisatio-<br />
nen oft nicht verfügen. Ihre Eigenmittelaufbringung erfolgt nicht über unmittelbar zugeordne-<br />
te Spendenaktionen. In Österreich wie auch in anderen europäischen Ländern ist „Bildung“ ein<br />
nachrangiges Spendenziel. Eine Reihe von Inlandsorganisationen erhalten die Eigenmittel daher<br />
als „Transfergelder“ von spendensammelnden Auslandsorganisationen. 14 Die zuständigen Verga-<br />
begremien sehen über Ausschreibungsvorgänge gesteuerte Bildungsprojekte oft in ihrer Unab-<br />
hängigkeit gefährdet.<br />
Spenden als Substitut einzubringen, erscheint fragwürdig, zumal sich als Alternative die Finan-<br />
zierung eigener Strukturen anbietet, z.B. die Bildungsarbeit in der eigenen spendensammelnden<br />
Organisation zu stärken, statt sie über Dritte und oft im Einflußbereich öffentlicher Stellen zu<br />
fördern.<br />
1.11. Neue Rahmenbedingungen 15<br />
In den letzten Jahren ist eine globalisierungskritische Bewegung entstanden, die außerhalb der in-<br />
stitutionalisierten Organisationen wirkt. Zu mittlerweile symbolischen Manifestationen der neuen<br />
Bewegung kam es in Seattle anlässlich des WTO-Gipfels im Dezember 1999, in Göteborg beim EU-<br />
Gipfel Mitte Juni 2001 und in Österreich in Salzburg beim Weltwirtschaftsforum Anfang Juli 2001.<br />
Die Intensitätskurve stieg mit dem G8-Gipfel in Genua Ende Juli 2001, bei dem die staatlichen<br />
Behörden massiver als bisher zu gewalttätigen Maßnahmen griffen. Den bislang unübertroffenen<br />
Höhepunkt bot die globalisierungskritische Bewegung mit dem Weltsozialforum in Porto Alegre<br />
in Brasilien im Februar 2002, das nicht zuletzt als ein Gegengipfel zum Weltwirtschaftstreffen in<br />
New York zustande kam, diesen Oppositionscharakter aber durch die Akzentuierung des utopi-<br />
schen und visionären Diskurses überwinden konnte.<br />
Diese Serie von Demonstrationen und Gegengipfeln trägt deutlich entwicklungspolitischen Cha-<br />
rakter, geht aber über den Kernbereich der traditionellen entwicklungspolitischen Themen, in je-<br />
dem Fall aber über Fragen der Entwicklungszusammenarbeit weit hinaus. Es handelt sich um eine<br />
globalisierungskritische Bewegung, von der die Frage der weltweiten Verteilung von Macht und<br />
Reichtümern radikaler als bislang gestellt wird. Kennzeichnend ist auch die breite Trägerschaft<br />
und Beteilung, sodass sich hier die unterschiedlichsten AkteurInnen und Organisationen treffen,<br />
von Kirchen über Nichtregierungsorganisationen, Studierende, WissenschafterInnen, Basisgruppen<br />
bis zu Gewerkschaften und einigen PolitikerInnen.<br />
An all diesen Großveranstaltungen, die nicht nur eine große Menge an jungen AktivistInnen<br />
anziehen, sondern auch von den Medien rezipiert werden, beteiligen sich die Organisationen<br />
der österreichischen Entwicklungspolitik wenig bis gar nicht. Aktivitäten dazu werden eher von<br />
kleinen Organisationen gesetzt, nicht aber von den mit größeren Finanzmitteln ausgestatteten<br />
„Traditionsinstitutionen“.<br />
Es scheint eine Kluft zu geben zwischen einerseits den so dynamischen Bewegungen, die sich<br />
lautstark unter breiter Beteiligung auf der Straße manifestieren, und andrerseits den institutiona-<br />
lisierten Organisationen der professionellen Entwicklungszusammenarbeit.<br />
14 Vgl. nähere Ausführungen dazu in: Österreichisches Institut für Spendenwesen. Spendenstudien 1996, 2000 und 2004.<br />
15 Der nachfolgende Text basiert auf einem Manuskript von Gerald Faschingeder, Direktor des Paulo Freire Zentrums in Wien.<br />
<strong>ÖSTERREICHISCHE</strong> EZA – BAND 1 21
ÜBERBLICK<br />
Auffällig ist aber auch eine Abschwächung von Gemeinwesenarbeit und -orientierung. Dies be-<br />
günstigt die individuelle, aber unverbindliche Mitgliedschaft bei neuen Bewegungen. Dritte-Welt-<br />
Gruppen sind nicht mehr existent, auch weil ein ortsgebundenes Engagement kaum mehr gelebt<br />
wird (siehe Niedergang von Parteisektionen, Pfarrgemeinden, Aktionsgruppen). Neue Bewegun-<br />
gen bedienen die Sehnsucht nach Veränderung, aber eben in einer anderen, mehr unverbindli-<br />
chen, der heutigen Zeit sehr entsprechenden Form.<br />
Ist dies nun eine Generationenfrage? Tatsächlich lässt sich die neue internationale Protestbewe-<br />
gung unschwer als Jugendbewegung erkennen, wenn sich auch viele Personen über 30 beteiligen.<br />
Aus der Koalition zwischen dem jugendlichen Protest und den alten entwicklungspolitischen Kern-<br />
anliegen ist u.a. im September 2000 die ATTAC - Bewegung entstanden. Der Gründungsimpuls für<br />
ATTAC, die „Association pour une Taxation des Transactions Financières et pour l’aide aux citoyen“<br />
ging 1997 von der französischen Monatszeitschrift „Le Monde Diplomatique“ aus. Unter den Mit-<br />
gliedern finden sich freilich viele, die früher schon in der „Szene“ aktiv waren, aber auch andere,<br />
die hier eine niederschwellige Möglichkeit finden, sich zu engagieren. Der Erfolg von ATTAC ist<br />
auch Ausdruck der mangelnden Möglichkeiten, sich in Österreich entwicklungspolitisch zu enga-<br />
gieren.<br />
Sind diese Entwicklungen Kristallisationspunkt einer neuen Generation von Menschen, die sich für<br />
den Gang der Welt interessieren? Bedeutet dies neue Rahmenbedingungen für eine „neue ent-<br />
wicklungspolitische Zivilgesellschaft“? Diese Frage zu beantworten erfordert auch eine Klärung<br />
dessen, was unter Zivilgesellschaft verstanden und welche Rahmenbedingungen für ihre Entfaltung<br />
entwickelt werden. 16<br />
1.12. Weiterentwicklung des Anliegens<br />
Die Idee einer gerechten Gesellschaft lebt vom Vertrauen in eine Weltordnung, die eine Vertei-<br />
lung knapper Güter für alle Betroffenen zufriedenstellend regelt. 17 Ein Ziel, dessen Verwirkli-<br />
chung jede Generation in der ihr eigenen Art anstrebt.<br />
Inlandsarbeit fördert und sichert Generationenwechsel bei den entwicklungspolitisch Engagierten.<br />
Immer waren überzeugte Menschen und nicht Programme und Strukturen Träger der Entwick-<br />
lungspolitik. Die österreichische Entwicklungszusammenarbeit braucht diese Akteure, auch im In-<br />
teresse der Wissensweitergabe über mehrere Generationen hinweg.<br />
Inlandsarbeit hilft dies für die Zukunft abzusichern. Sie ist zugleich die kostengünstigste Maßnah-<br />
me einer sich notwendigerweise stets wandelnden EZA-Entwicklung. Historische Verweise belegen<br />
dies: Die Nachkriegsgeneration entdeckte internationale Bezüge und humanitäre Verpflichtungen<br />
in traditionellen Jugendbewegungen, die 1968er-Generation erweiterte dies – auch angesichts<br />
des Vietnamkrieges – zu einer Dritten-Welt-Bewegung und brachte in EZA-Maßnahmen Profes-<br />
sionalität. Heute setzen junge Menschen neue Akzente in einer global vernetzten Welt. Um ein<br />
„Gutes Leben für alle“ sorgen sich viele und wollen eine „Entpolitisierung“ der EZA sowie anderer<br />
Politikbereiche, die nur mit Blick auf internationale Entwicklungen verändert werden können,<br />
verhindern.<br />
16 Strachwitz, Rupert Graf (2005), Die Rahmenbedingungen der Zivligesellschaft und ihre Reform, Maecenata actuell Nr. 52.<br />
17 Haubl, Rudolf (2003). Neidisch sind immer nur die Anderen, München.<br />
22 <strong>ÖSTERREICHISCHE</strong> EZA – BAND 1
2. RÜCKBLICK<br />
RÜCKBLICK<br />
Der folgende Abschnitt nimmt seinen Ausgangspunkt im Jahr 1975. Es wurde damals die<br />
erste umfassende Analyse der entwicklungspolitischen Inlandsarbeit veröffentlicht. Der<br />
historische Rückblick konzentriert sich auf eine Darstellung der Anfänge der entwicklungs-<br />
politischen Bildungsarbeit und die Beschreibung von zwei konkreten Beispielen solidari-<br />
schen Handelns. Den Abschluss bildet eine Einschätzung der für den Bereich markanten<br />
Entwicklungen in den 1990er Jahren.<br />
2.1. Die Entdeckung der Entwicklungspolitischen Inlandsarbeit<br />
1975 erschien eine erste umfassende Bestandsaufnahme und Analyse der Inlandsarbeit zum The-<br />
menbereich Dritte Welt 1 . Martin Jäggle und Bernd Sibitz 2 untersuchten die Informationsarbeit<br />
von 43 entwicklungspolitisch arbeitenden Organisationen und Aktionsgruppen, die ihre eigene<br />
Arbeit wie folgt klassifizierten: Bei 29 Organisationen erfüllte sie unmittelbar den Zweck der Wer-<br />
bung, um über Spendenappelle Geld und Personal zu beschaffen; bei 30 Organisationen diente<br />
sie der Information (in erster Linie über die eigenen Entwicklungshilfeprojekte, nur am Rande<br />
über Entwicklungsländer, kaum über Entwicklungspolitik) und nur 10 der 43 Organisationen und<br />
Gruppen wiesen ihrer Öffentlichkeitsarbeit die Funktion der Bewusstseinsbildung zu (d.h. durch<br />
Bildung Einstellungen zu verändern und zum Engagement zu motivieren) 3 .<br />
Die Inlandsarbeit Dritte Welt wurde bis weit in die 1970er Jahre von kirchlichen (sprich katholi-<br />
schen) und kirchennahen Organisationen geprägt. Die meisten verstanden ihre Arbeit als weitge-<br />
hend „unpolitisch“ und wandten sich v.a. an den kirchlichen Bereich selbst. Es gab kaum Maßnah-<br />
men, die sich an die Massenmedien, die Politik, die Wirtschaft oder an die Schulen richteten.<br />
Auf ein weiteres Strukturmerkmal in dieser Zeit wies Gerald Hödl in seiner Aufarbeitung der Au-<br />
ßen- und Entwicklungspolitik der Zweiten Republik bis zum EU-Beitritt 1995 hin: „Sowohl die bila-<br />
terale technische Hilfe als auch die Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit in Österreich wurden (und<br />
werden) zum überwiegenden Teil von NGOs geleistet, der Staat tritt in diesen Bereichen lediglich<br />
als Financier in Erscheinung“ 4.<br />
1 Der Begriff Dritte Welt wird, so er in der Publikation Verwendung findet, nicht unter Anführungszeichen gestellt. Er<br />
wurde in den 1950er Jahren vom französischen Journalisten Alfred Sauvy geprägt. Er verstand ihn analog zum Begriff<br />
Dritter Stand in Anlehnung an die Französische Revolution. Vgl. auch Nuscheler, Franz (1987). Lern- und Arbeitsbuch<br />
Entwicklungspolitik, Bonn, 41 f.<br />
2 Jäggle, Martin/Bernd Sibitz (1975). Information und Bewusstseinsbildung. „Öffentlichkeitsarbeit 3. Welt“ in Österreich.<br />
Analyse und Dokumentation. IBE-Forschungsdokumentation 4. Wien<br />
3 Die Bezeichnungen „Öffentlichkeitsarbeit“ und „Bewusstseinsbildung“ werden in Anlehnung an die Publikation Jäggle,<br />
Martin/Bernd Sibitz (1975). Information und Bewusstseinsbildung. „Öffentlichkeitsarbeit 3. Welt“ in Österreich. Analyse<br />
und Dokumentation. IBE-Forschungsdokumentation 4,Wien verwendet.<br />
4 Vgl. Hödl, Gerald (2004). Österreich und die Dritte Welt. Außen- und Entwicklungspolitik der zweiten Republik bis zum<br />
EU-Beitritt 1995, Wien.<br />
<strong>ÖSTERREICHISCHE</strong> EZA – BAND 1 23
RÜCKBLICK<br />
Neben dem Bereich „Kirche“ war der Bereich Hochschule der zweitwichtigste Aktionsbereich. Auf<br />
Empfehlung der Rektorenkonferenz wurden in Kooperation von Österreichischer Hochschüler-<br />
schaft (ÖH) und dem Institut für Internationale Zusammenarbeit (IIZ) erste Blockseminare an den<br />
Universitäten angeboten. Reguläre Lehr- und Forschungsangebote gab es aber keine Hand voll<br />
und sie konzentrierten sich auf die Fächer Geografie und Geschichte. Letzteres galt bis in die spä-<br />
ten 1980er Jahre hinein auch für den Unterricht an den Schulen. Eine besondere Initiative bildete<br />
eine mehrjährige einschlägige Untersuchung von Lehrplänen und Schulbüchern am Institut für<br />
Ethnologie der Universität Wien im Verlaufe der 1970er Jahre.<br />
Prof. Walter Dostal resümierte damals:<br />
„Es geht nicht darum das Informationsangebot zu erhöhen, sondern um das Erkennen von<br />
Problemen und Strukturzusammenhängen. Und weiter: Entwicklungshilfe bedeutet nicht<br />
ein Feld für einen unkomplizierten Aktivismus finden zu wollen. Vielmehr beginnt Ent-<br />
wicklungshilfe bereits im Inland.“<br />
Die Bemühungen der ÖH und der Rektorenkonferenz führten zunächst zu keiner institutionel-<br />
len Verankerung von Entwicklungsfragen an den Universitäten. Die Gründung des Mattersburger<br />
Kreises zu Beginn der 1980er Jahre war die interdisziplinäre Antwort auf dieses Defizit, um dieser<br />
Aufgabe in neuer Form nachzugehen. Es gelang, einen Topf für Lehrveranstaltungen einzurichten<br />
und eigene Verzeichnisse wiesen auf die entwicklungspolitischen Angebote an den Universitäten<br />
hin. Neben der ÖH engagierten sich v.a. die noch jungen Afro-Asiatischen Institute, die Begegnun-<br />
gen zwischen den Studierenden aus den Entwicklungsländern und der österreichischen Bevölke-<br />
rung herstellten und ihren StipendiatInnen Lernmöglichkeiten boten.<br />
2.2. Ein neues Arbeitsfeld entsteht: Die entwicklungspolitische Bildungsarbeit<br />
Das Wiener Institut für Entwicklungsfragen (seit 1987 das Wiener Institut für Entwicklungsfragen<br />
und Zusammenarbeit) wurde in den 1960er Jahren gegründet, um Verständnis für die Probleme<br />
der Entwicklung und Entwicklungsländer in Österreich zu wecken und dadurch die Voraussetzung<br />
zu schaffen, zur Lösung der Probleme beizutragen. Das VIDC richtete 1970 anlässlich des internati-<br />
onalen Erziehungsjahres eine Tagung zum Thema „Schule und 3. Welt“ aus, bei der Winfried Böll<br />
ein Plädoyer für kritische Informationsarbeit ablegte:<br />
„Wer in Politik und Verwaltung Aufgaben der Veränderung gegen das Beharrungsstreben<br />
der großen Interessen und die Trägheit der eingefahrenen Wähleransichten zu leisten hat,<br />
weiß, dass der Zweifel an der Weisheit der üblichen Lösungen ... die eigene Position stärkt.<br />
Er muss daher daran interessiert sein, dass die institutionellen Voraussetzungen für mehr<br />
Kritik, allerdings für sachkundigere Kritik, geschaffen werden.“<br />
Das Wiener Institut für Entwicklungsfragen gab in den Folgejahren (1970 bis 1974) eine Sonderrei-<br />
he „Materialien für den Unterricht über Entwicklungsländer“ heraus. Dies war eine erstmalige Ini-<br />
tiative in Österreich, die im Einklang mit der Tradition der 1960er Jahre noch aus rein wissenschaft-<br />
lichen, vorwiegend länderkundlich ausgerichteten Texten ohne didaktische Hinweise bestand.<br />
Das Institut bot jedoch auch bereits Ausstellungen und audiovisuelle Medien zum Verleih für die<br />
Bildungsarbeit an und initiierte die ersten Dritte-Welt-Wochen an Schulen. Die in den 1970er Jah-<br />
ren gültigen Lehrpläne für die Schulen enthielten kaum Hinweise auf Entwicklungsfragen.<br />
24 <strong>ÖSTERREICHISCHE</strong> EZA – BAND 1
RÜCKBLICK<br />
Unterricht dazu wurde in erster Linie in den Fächern Geografie und Geschichte in der Oberstufe<br />
der Gymnasien angeboten. Der Erlass „Politische Bildung in den Schulen“ aus dem Jahr 1978, der<br />
einen 30 Jahre alten Erlass zur staatsbürgerlichen Erziehung ablöste, erklärte dann Politische Bil-<br />
dung zum fächerübergreifenden Unterrichtsprinzip. Ein wesentliches Anliegen war die „Erziehung<br />
zu einem demokratisch fundierten Österreichbewusstsein, zu einem gesamteuropäischen Denken<br />
und zu einer Weltoffenheit, die vom Verständnis für die existenziellen Probleme der Menschheit<br />
getragen ist“. „Politische Bildung“, so der Erlass, „soll die Fähigkeit und Bereitschaft fördern,<br />
für unantastbare Grundwerte wie Freiheit und Menschenwürde einzutreten, Vorurteile abzubau-<br />
en und sich für die Belange Benachteiligter einzusetzen; sie soll die Einsicht vermitteln, dass das<br />
Herbeiführen einer gerechten Friedensordnung für das Überleben der Menschheit notwendig ist;<br />
sie soll ein klares Bewusstsein schaffen, dass die Erreichung dieses Zieles weltweit den Einsatz<br />
aller Kräfte erfordert und als persönliche Verpflichtung eines jeden Menschen aufgefasst werden<br />
muss.“<br />
Getragen war der Erlass von der Überzeugung, dass es die Aufgabe und Verantwortung der Schule<br />
ist, aus jungen Menschen durch Unterricht und Erziehung verantwortlich handelnde Mitglieder der<br />
Gesellschaft zu machen. Um die Lehrkräfte zu motivieren und zu qualifizieren, erstellten einige<br />
außerschulische Organisationen Fortbildungsangebote, etwa das Österreichische Lateinamerika-<br />
Institut, das Wiener Institut, die österreichische UNESCO-Kommission oder der (seit 1977) beim Jugend-<br />
rat für Entwicklungshilfe eingerichtete Arbeitsbereich Schule, der später ein Kernbereich des 1979<br />
neu gegründeten Österreichischen Informationsdienstes für Entwicklungspolitik (ÖIE) wurde.<br />
Die schulische Arbeit war somit am Ende der 1970er Jahre zu einem strategischen Kernbereich<br />
in der entwicklungspolitischen Inlandsarbeit geworden. Die Entwicklungspolitischen Nachrichten<br />
(EPN) trugen dem Rechnung, indem sie in den 1980er Jahren regelmäßige Schwerpunktnummern<br />
zum Themenbereich „Schule und Dritte Welt“ veröffentlichten.<br />
Eine gravierende Änderung betraf zu dieser Zeit das Verständnis von Öffentlichkeitsarbeit als solcher.<br />
Martin Jäggle und Bernd Sibitz formulierten im zweiten Teil ihrer Studie (1978) dazu: 5<br />
„Ziel der Öffentlichkeitsarbeit Dritte Welt ist eine Änderung der öffentlichen Meinung<br />
zum Problembereich Dritte Welt, ist die Motivierung vieler zu persönlichem Engagement,<br />
ist die Verankerung des Problembereichs in der Lebenssituation der Angesprochenen; sie<br />
bedeutet die Verpflichtung zum Angebot konkreter Handlungsalternativen und bedeutet<br />
in erster Linie nicht kapitalintensives, sondern personalintensives Agieren.“<br />
Dies bedeutete eine markante Erweiterung des Begriffs Öffentlichkeitsarbeit. Öffentlichkeitsar-<br />
beit sollte bewusstseinsbildend wirken, die Menschen bei ihren eigenen Interessen ansprechen<br />
und zum Handeln motivieren.<br />
Mit der Kampagne „Jute statt Plastik“ und dem Projekt „Lernfeld Dritte Welt“ (mit modellhaften<br />
Dritte-Welt-Projekttagen an Schulen) wurde 1977 und 1978 die Probe aufs Exempel dieses Ansat-<br />
zes gemacht. Neben der kritischen und teils sehr intellektuellen Auseinandersetzung mit Inhalten<br />
fanden sich zunehmend methodische Ansätze, die alle Sinne der Menschen ansprachen und da-<br />
durch mehr emotionale Wirkung erzielten.<br />
5 Jäggle, Martin/Bernd Sibitz (1975). Information und Bewusstseinsbildung. „Öffentlichkeitsarbeit 3. Welt“ in Österreich.<br />
Analyse und Dokumentation. IBE-Forschungsdokumentation 4, Wien.<br />
<strong>ÖSTERREICHISCHE</strong> EZA – BAND 1 25
RÜCKBLICK<br />
Im Bereich der EZA-Organisationen der Katholischen Kirche können die Umbenennung des „Ös-<br />
terreichischen Entwicklungshelferdienstes“ in „Österreichischer Entwicklungsdienst (ÖED)“, der<br />
in Wiener Neustadt 1977 entstandene Fastenkalender „Einfach anders leben“ und schließlich das<br />
„Entwicklungspolitische Programm der Katholischen Kirche Österreichs“ aus 1980 als Belege für ei-<br />
nen umfassenderen Bildungsansatz innerhalb der kirchlichen Informationsarbeit genannt werden.<br />
1979 wurde der Österreichische Informationsdienst für Entwicklungspolitik (ÖIE) gegründet. Er<br />
wurde in den 1980er Jahren zum Dreh- und Angelpunkt der entwicklungspolitischen Inlandsarbeit<br />
in Österreich. Über die Kampagne „Hunger ist kein Schicksal, Hunger wird gemacht“ gelang es<br />
erstmals, nicht-konfessionelle und katholische Informationsarbeit zu verbinden. Und mit seiner<br />
ausgeprägten föderalen Struktur mit Regionalstellen in allen Bundesländern erwarb sich der ÖIE<br />
Modellcharakter, der auch international Anerkennung fand.<br />
Der ÖIE war zu Beginn nicht nur Service- und Koordinationsstelle für Bildung, Information und<br />
Kampagnen, sondern wollte auch selbst Alternativen leben: Durch keine Trennung von Kopf- und<br />
Handarbeit, gleiches Gehalt für alle, starke basisdemokratische Elemente bei der Planung und<br />
Durchführung von Arbeitsprogrammen. Einiges hat sich nicht bewährt und wurde schrittweise<br />
über Bord geworfen. Es war jedenfalls der Versuch, über die Ambivalenz von Theorie und Praxis<br />
nicht nur zu reden, sondern die Theorie in der Praxis auch zu erproben.<br />
Die Bildungsarbeit des ÖIE wurde in den 1980er Jahren stark nachgefragt. Die Zuwachsraten bei<br />
den Beratungs- und anderen Serviceleistungen waren hoch und es gelang, über Kontakte mit dem<br />
Bundesministerium für Unterricht und Kunst (BMUK) bzw. diversen Landesschulräten und Pädago-<br />
gischen Instituten und Akademien einzelne Maßnahmen zu festen Angeboten zu machen:<br />
- Es wurde jährlich ein entwicklungspolitischer Grundsatzerlass für alle Schulen erstellt.<br />
- Das BMUK finanzierte im Rahmen des Unterrichtsversuchs „Development Education“ einen<br />
gesamtösterreichischen ReferentInnenvermittlungsdienst, über den EZA-Fachleute in die<br />
Schulen eingeladen werden konnten.<br />
- Das BMUK unterstützte pro Jahr die Produktion eines Heftes Dritte Welt im Unterricht, das<br />
zwischen 1979 und 1995 17-mal erschien.<br />
- Das BMUK beauftragte den ÖIE mit der Durchführung einer fächerübergreifenden Schul-<br />
buchanalyse, deren Ergebnisse von einigen Verlagen 6 berücksichtigt wurden.<br />
- Mehrere Pädagogische, Berufspädagogische und Religionspädagogische Institute räumten<br />
dem ÖIE die Möglichkeit ein, regelmäßig Fortbildungsseminare anzubieten.<br />
- In zunächst enger Zusammenarbeit mit dem Pädagogischen Institut Wien und dem Landes-<br />
schulrat Steiermark wurde 1990 ein viersemestriger Lehrgang für Entwicklungspolitik ge-<br />
startet, der in anderen Bundesländern sechs Mal wiederholt wurde. Es handelte sich dabei<br />
um ein entwicklungspädagogisches Fortbildungsangebot, das auch für Nicht-LehrerInnen<br />
(Erwachsenenbildung, Jugendarbeit, Sozialarbeit) offen war. 7<br />
6 z.B. die Verlage Ueberreuter, Ed. Hölzel.<br />
7 Das Konzept erfuhr später in Oberösterreich, Kärnten und Wien in Lehrgängen Globales Lernen eine Fortsetzung und<br />
Weiterentwicklung.<br />
26 <strong>ÖSTERREICHISCHE</strong> EZA – BAND 1
2.3. Solidarisches Handeln konkret<br />
RÜCKBLICK<br />
Neben der Herausbildung von entwicklungspolitischer Bildungsarbeit als eigener Strang von ent-<br />
wicklungspolitischer Inlandsarbeit stellten und stellen die Solidaritätsarbeit und der Einsatz für die<br />
Verbesserung der Lebensumstände der Menschen in den Entwicklungsländern durch Anwaltschaft<br />
und Lobbying eine unverändert wichtige Aufgabe von entwicklungspolitischer Inlandsarbeit dar.<br />
Es werden im Folgenden zwei Beispiele dargestellt, die stellvertretend für zahlreiche länder- wie<br />
themenbezogene Initiativen und Kampagnen stehen. Sie stehen auch stellvertretend für die un-<br />
terschiedlichen methodischen Ansätze des direkten Engagements für die Menschen und ihre Or-<br />
ganisationen in der Dritten Welt.<br />
2.3.1. Anti-Apartheid-Bewegung in Österreich 8<br />
Der SchülerInnenaufstand von Soweto 1976 hatte die Notwendigkeit internationaler Solidarität<br />
mit dem Widerstand in Südafrika neuerlich verdeutlicht. Eine damals noch kleine Gruppe grün-<br />
dete 1977 die „Anti-Apartheid-Bewegung (AAB) in Österreich“. Sie war eine überparteiliche und<br />
überkonfessionelle Organisation. Eine der Hauptintentionen hinter der Formierung einer Anti-<br />
Apartheid Bewegung war es, Interessierten aus verschiedenen politischen und weltanschaulichen<br />
Lagern eine überparteiliche Plattform für ideelle und materielle Solidarität anzubieten.<br />
1977 erschien erstmals das „Informationsbulletin der Anti-Apartheid-Bewegung“, das sich im Ver-<br />
lauf des Bestehens der Anti-Apartheid-Bewegung zu einer Fachzeitschrift für das Südliche Af-<br />
rika entwickelte und heute im Magazin INDABA fortbesteht. 1980 startete die Anti-Apartheid<br />
Bewegung (international mit anderen europäischen AABs abgesprochen) die erste österreichische<br />
Kampagne zur Freilassung Nelson Mandelas und aller anderen politischen Gefangenen. Die welt-<br />
weite Mobilisierung bedeutete auch den ersten Anstoß zur „verhandelten“ Abschaffung der verfassungsverankerten<br />
Apartheid in Südafrika. 9<br />
Wesentlich für den Beitrag, den die Anti-Apartheid-Bewegung in den Folgejahren zur interna-<br />
tionalen Solidarität Österreichs leisten konnte, war die breite politische und materielle Unter-<br />
stützung, die ihren Zielen aus allen demokratischen politischen Parteien und Institutionen zuteil<br />
wurde. Für die „Abschaffung der gesetzlich festgelegten Rassendiskriminierung“ engagierten sich<br />
Persönlichkeiten aus SPÖ und ÖVP, aus Gewerkschaften und Kirchen, Liberale, Grüne und Kom-<br />
munistInnen ebenso wie Nichtorganisierte. Die Anti-Apartheid-Bewegung dankte anlässlich ihrer<br />
Selbstauflösung Ende 1993 ausdrücklich den „Freunden und Sympathisanten in der Bundesregie-<br />
rung, im Parlament, in den politischen Parteien, Kirchen und Interessensverbänden“.<br />
1984 veröffentlichten Walter Sauer und Theresia Zeschin das Buch „Die Apartheid-Connection“ 10 ,<br />
in dem erstmals sämtliche öffentlich zugänglichen Informationen über die politische, militärische,<br />
wirtschaftliche und kulturelle Kollaboration Österreichs mit Südafrika zusammengestellt wurden.<br />
Das Buch bildete die Grundlage für jährlich wiederkehrende „Südafrika-Boykottwochen“.<br />
8 Die Darstellung basiert auf Informationen, die der langjährige Vorsitzende der Anti-Apartheid-Bewegung in Österreich<br />
und nunmehrige Obmann des Dokumentationszentrums Südliches Afrika, Walter Sauer, zur Verfügung stellte.<br />
9 Vgl. Mandela, Nelson (1994). Der lange Weg zur Freiheit. Autobiografie, Frankfurt . 676 - 678.<br />
10 Sauer, Walter/Theresia Zeschin (Hg.) (1984). Die Apartheid-Connection. Österreichs Bedeutung für Südafrika, Wien.<br />
<strong>ÖSTERREICHISCHE</strong> EZA – BAND 1 27
RÜCKBLICK<br />
Sie wurden gemeinsam mit dem Österreichischen Informationsdienst für Entwicklungspolitik (ÖIE)<br />
und einer auf den Früchteboykott spezialisierten Aktionsgruppe veranstaltet. 1987 gelang es, die<br />
ersten „apartheidfreie Zonen“ Österreichs zu konstituieren: Bildungshäuser (wie etwa Schloss<br />
Puchberg bei Wels), die sich verpflichteten, in ihren Großküchen keine südafrikanischen Produkte<br />
zu verwenden. Es folgten Universitätsmensen, das Allgemeine Krankenhaus der Stadt Linz und<br />
einzelne Gemeinden. Während in allen U-Bahn-Stationen Wiens die Plakate „Kauft keine Früchte<br />
aus Südafrika“ hingen (und die Fahrgäste zu sehr verschiedenartigen Reaktionen animierten),<br />
wurde in Programmkinos ein Filmspot zur selben Thematik gespielt.<br />
Neben der Sanktionenfrage bildete die Entkolonisierung des völkerrechtswidrig von Südafrika<br />
besetzten Namibia seit jeher einen der Schwerpunkte der Tätigkeit der AAB. 1988 führte die AAB<br />
eine bundesweite Informationskampagne über die SWAPO (South Western People’s Organisation)<br />
und über Namibia durch. Im Dezember desselben Jahres wurde bei Verhandlungen zwischen Süd-<br />
afrika, der SWAPO, Kuba und Angola sowie den Vereinten Nationen schließlich ein Durchbruch<br />
erzielt, der den Beginn der Übergangsphase zur Unabhängigkeit mit 1. April 1989 terminisierte.<br />
Die Kirchen in Österreich reagierten in diesen Jahren unterschiedlich. Während die Evangelische<br />
Kirche rasch ihre ablehnende Position zum Apartheid-Regime äußerte, fand die Katholische Kir-<br />
che erst später zu einer klaren Linie. In der Vollversammlung der Koordinierungsstelle wurde am<br />
2.10.1985 die Unterstützung von Boykottmaßnahmen beschlossen. Einer Kirchendelegation unter<br />
Führung von Weihbischof Florian Kuntner wurde daraufhin von den südafrikanischen Behörden<br />
die Einreise verweigert. Der Besuch von Vertretern der Österreichischen Kommission Iustitia et Pax<br />
kam erst mit Verzögerung 1992 zustande.<br />
Doch auch für Südafrika zeichnete sich nach den Jahren der Repression und des Ausnahmezustan-<br />
des die Befreiung ab. Die Legalisierung des ANC durch das südafrikanische Minderheitsregime<br />
und die Freilassung Nelson Mandelas im Februar 1990 – beides auch durch die internationalen<br />
Sanktionen erzwungen – leiteten die Verhandlungsphase über die Übertragung der politischen<br />
Macht an demokratisch gewählte RepräsentantInnen der gesamten südafrikanischen Bevölkerung<br />
ein. Mit dem Ende der institutionalisierten Apartheid war auch ein Endpunkt der Tätigkeit der<br />
Anti-Apartheid-Bewegung absehbar. In den Vordergrund traten nunmehr Aktionen zur Unterstüt-<br />
zung des ANC in dieser neuen schwierigen Phase seiner Tätigkeit, Kampagnen zur Befreiung der<br />
verbleibenden politischen Gefangenen sowie zur Aufrechterhaltung der österreichischen Sank-<br />
tionen (insbesondere des in Österreich nur mangelhaft durchgeführten UNO-Waffenembargos).<br />
Eine groß angelegte humanitäre Aktion kam den Opfern der Inkatha-Gewalttätigkeit in Natal,<br />
insbesondere Frauen und Kindern, zugute.<br />
Mit der Etablierung des Transitional Executive Council sah die österreichische Anti-Apartheid-<br />
Bewegung am 27. November 1993 ihren Vereinszweck als erfüllt an: Die Einigung der politisch<br />
relevanten Kräfte in Südafrika auf die Bildung eines Übergangsrates, hieß es in einer Erklärung<br />
der AAB, bedeute das Ende der völker- und menschenrechtswidrigen Apartheid als rechtlichem<br />
System. Mit einstimmigem Beschluss der Hauptversammlung wurde die Organisation nach 17-jäh-<br />
rigem Bestand aufgelöst. Weiterführende Aufgaben werden heute vom Dokumentations- und<br />
Kooperationszentrum Südliches Afrika (SADOCC) wahrgenommen. SADOCC betreibt in Wien ei-<br />
ne Spezialbibliothek, publiziert das Magazin INDABA und tritt auch mit Veranstaltungen an die<br />
Öffentlichkeit.<br />
28 <strong>ÖSTERREICHISCHE</strong> EZA – BAND 1
2.3.2. Fairer Handel in Österreich 11<br />
RÜCKBLICK<br />
Auf die Frage, welche Unterstützung für die benachteiligten Menschen in den Entwicklungslän-<br />
dern besonders sinnvoll erscheint und von jedem Einzelmenschen geleistet werden kann, wird von<br />
vielen der Faire Handel zur Antwort gegeben.<br />
Die Geschichte begann am 14. April 1976. Die neu gegründete EZA 3. Welt-Entwicklungszusam-<br />
menarbeit mit der Dritten Welt GesmbH stellte das erste Paket Indio-Kaffee vor. Nach niederländi-<br />
schem Vorbild wurde von nun an Kaffee von guatemaltekischen Kleinbauern ohne Zwischenhan-<br />
del nach Österreich gebracht.<br />
Dies so wie die erfolgreichen Aktionen zur Kampagne „Jute statt Plastik“ ließen in kürzester Zeit<br />
vielerorts – oft gefördert durch kirchliche Gemeinden – neue Dritte-Welt-Gruppen entstehen, die<br />
EZA-Produkte vertrieben. Aus den größeren wurden rasch sog. Dritte-Welt-Läden. 1982 erfolgte<br />
die Gründung des nationalen Dachverbandes Arbeitsgemeinschaft zur Förderung der Weltläden<br />
(ARGE Weltläden).<br />
Gegen Ende der 1980er Jahre geriet die Welt des Fairen Handels europaweit in Aufruhr. Auf Druck<br />
der ProduzentInnen, die forderten, dass der Faire Handel mehr Menschen erreichen müsste, wur-<br />
de in Holland die Stiftung Max Havelaar gegründet. Dezidiertes Ziel war, fair gehandelte Produkte<br />
in die Supermärkte zu bringen.<br />
Im Herbst 1992 hoben EZA 3. Welt und die ARGE Weltläden die österreichische Gütesiegelorga-<br />
nisation TransFair Österreich aus der Taufe. Mit der Gründung von TransFair bekannten sich zum<br />
ersten Mal alle wichtigen Entwicklungsorganisationen zum Fairen Handel, indem sie Mitglied von<br />
TransFair wurden. Viele Institutionen wie Bildungshäuser oder Rathäuser konnten seitdem für fair<br />
gehandelte Produkte gewonnen werden.<br />
Zugleich wollten zahlreiche Gruppen eigene Initiativen setzen und gründeten neue Weltläden.<br />
Von 1988 auf 1993 verdoppelte sich die Anzahl der österreichischen Weltläden auf rund 60. Es<br />
ging Hand in Hand mit Schritten der Professionalisierung: Viele Läden suchten sich – unterstützt<br />
von der EZA 3. Welt und der ARGE Weltläden – einen besseren Standort. Regelmäßige Öffnungs-<br />
zeiten, Werbung sowie kaufmännische Planung und Kontrolle wurden selbstverständlich. 1995 ga-<br />
ben sich die Läden ein einheitliches Logo und eine gemeinsame Identität: Aus Dritte-Welt-Läden,<br />
Robin-Hood-Läden oder Aller-Welt-Läden wurden nun österreichweit Weltläden, die sich mit dem<br />
Slogan „Gerecht Handeln – Sinnvoll Kaufen“ als die Fachgeschäfte für Fairen Handel profilierten.<br />
Die Anstellung von bezahlten MitarbeiterInnen wurde zum Hebel, um die Servicequalität in den<br />
Läden zu erhöhen und damit die Absatzchancen für die ProduzentInnen zu verbessern. Ehrenamt-<br />
liches Engagement blieb aber weiter ein wichtiger Pfeiler.<br />
2001 stieg die OEZA in die Mitfinanzierung eines umfangreichen Marketingprojektes von Trans-<br />
Fair 12 ein. Bei einer Bilanzpressekonferenz im Dezember 2003 konnte darüber informiert werden,<br />
dass der Faire Handel in Österreich inzwischen bei 50.000 Menschen in den Entwicklungsländern<br />
zu einer dauerhaften Verbesserung ihrer sozialen und wirtschaftlichen Lage beitrug.<br />
11 Die Darstellung basiert auf Informationen, die Jean-Marie Krier, der langjährige Geschäftsführer der EZA 3.Welt GmbH<br />
und spätere Marketingbeauftragte der Arge Weltläden, zur Verfügung stellte.<br />
12 TransFair wurde 2001 in Fairtrade umbenannt.<br />
<strong>ÖSTERREICHISCHE</strong> EZA – BAND 1 29
RÜCKBLICK<br />
2.4. Tagesordnung: Weltinnenpolitik<br />
Es brachten gerade die 1990er Jahre eine Reihe inhaltlicher und organisatorischer Veränderungen<br />
und Weiterentwicklungen.<br />
Die intensiven Diskussionen schon im Vorfeld und vor allem nach der UN-Weltkonferenz zu Um-<br />
welt und Entwicklung in Rio de Janeiro 1992, die Durchführung der ersten Gesamtösterreichischen<br />
Entwicklungskonferenzen in Eisenstadt, Linz und Wien 1991, 1992 und 1994, die Erhöhung der<br />
Mittel für die OEZA Anfang der 1990er Jahre und damit einhergehend auch eine Erhöhung der<br />
Fördermittel für entwicklungspolitische Inlandsarbeit sowie neu auch für entwicklungspolitische<br />
Kulturarbeit, der bevorstehende EU-Beitritt Österreichs und die damit verbundene noch stärke-<br />
re Internationalisierung der entwicklungspolitischen Arbeit in Österreich stellten die öffentlichen<br />
Einrichtungen ebenso wie die privaten Organisationen vor inhaltliche Herausforderungen, denen<br />
Schritt um Schritt Rechnung getragen werden musste.<br />
Thematische Erweiterungen<br />
Die Konferenz von Rio etwa machte das Thema „Nachhaltigkeit“ zu einer Leitformel in zahlrei-<br />
chen internationalen und auch österreichischen Dokumenten. Der Begriff – 1718 von Hans Carl<br />
von Carlowitz geprägt, um einen schonenden Umgang mit Holzressourcen zu fordern – ist ein<br />
Mainstream-Thema geworden und wird vielleicht zu beliebig angewandt. 13 Aber so deutlich wie<br />
noch nie zuvor in der Geschichte der EZA wurde zur Diskussion gestellt, wie sehr die Entwick-<br />
lungen in den benachteiligten Regionen der Welt mit unserem Wirtschaftssystem und Lebensstil<br />
verbunden und davon abhängig sind. 14<br />
Es folgten weitere UN-Konferenzen, etwa zu Menschenrechten und Entwicklung (Wien 1993),<br />
Frauen und Entwicklung (Peking 1995) oder Weltbevölkerung (Kairo 1996). Sie beeinflussten die<br />
nationale Agenda ebenso wie internationale Kampagnen für die Entschuldung der Entwicklungs-<br />
länder oder gegen Rassismus und Ausländerfeindlichkeit in Europa.<br />
Neue Akteure<br />
Von den 43 Einrichtungen, die Martin Jäggle und Bernd Sibitz 1975 untersuchten – darunter 29<br />
Entwicklungshilfeeinrichtungen, acht sonstige Organisationen sowie sechs Aktionsgruppen – ha-<br />
ben 30 Jahre später nur drei Organisationen 15 ihre Tätigkeit eingestellt. Fünf Organisationen sind<br />
in anderen Einrichtungen aufgegangen. 16 Selbst von den sechs untersuchten Aktionsgruppen be-<br />
stehen noch drei.<br />
13 Liessmann, Konrad Paul (2004). Der Geschmack der Nachhaltigkeit, in: Almanach 2004. Europahaus Burgenland,<br />
Eisenstadt, 11-23.<br />
14 Freudenschuss-Reichl, Irene (2005). Zukunftsfähig leben. Spiritualität und Praxis der Nachhaltigkeit<br />
15 Arbeitsgemeinschaft für ausländische Studenten (AGAS), Internationales Forum und Weltkampagne zur Bekämpfung<br />
von Hunger und Not.<br />
16 ÖED und IIZ, das Institut für Bildungs- und Entwicklungsforschung (IBE), der Jugendrat für Entwicklungshilfe und die<br />
Entwicklungshilfe der Erzdiözese Wien.<br />
30 <strong>ÖSTERREICHISCHE</strong> EZA – BAND 1
RÜCKBLICK<br />
Die Beschreibungen aus 1975 könnten für die meisten Organisationen auch heute übernommen<br />
werden. Dies zeigt insgesamt eine bemerkenswerte Kontinuität. Zugleich wird für die vergange-<br />
nen drei Jahrzehnte auf das große Organisationswachstum hingewiesen.<br />
Anfang 2005 waren über 200 private Organisationen in der entwicklungspolitischen Inlandsarbeit<br />
tätig. 17<br />
Die 1990er Jahre brachten den Auf- und Ausbau einer Reihe neuer Organisationen.<br />
Das „Klimabündnis“ (eine Gemeinschaft von Kommunen im Norden und Indianerverbänden im<br />
Regenwald zum Schutz des Weltklimas) wurde vom ÖIE nach Österreich gebracht. Ihm sind bis<br />
heute 500 Städte und Gemeinden in Österreich beigetreten.<br />
Die Gründung der Gütesiegelorganisation „Fairtrade“ eröffnete dem Fairen Handel neue Aktions-<br />
räume, indem die Produkte in Supermärkten angeboten wurden. Der Kauf und Konsum von unter<br />
Wahrung der Menschenrechte produzierten und fair gehandelten Produkten gehört heute zu den<br />
bestbekannten Handlungsmöglichkeiten für jene, denen sozial und ökologisch verantwortungs-<br />
volle Wirtschafts- und Lebensformen ein Anliegen sind.<br />
Der Tatsache, dass immer mehr Menschen Urlaub in Entwicklungsländern machen, trug die OEZA<br />
mit der Gründung von „respect“ Rechnung. Es werden sowohl die Reisenden als auch die Touris-<br />
muswirtschaft in ihrer Verantwortlichkeit für einen nachhaltigen Tourismus angesprochen. Mit der<br />
Fachstelle „Weltbilder“ wurde eine spezialisierte Einrichtung für audiovisuelle Medien geschaf-<br />
fen, die Kontakt zu kommerziellen Anbietern ebenso aufnahm wie zu Bildungseinrichtungen. Der<br />
Großteil der Diözesankommissionen der Katholischen Kirche schloss sich in einem neuen Verbund<br />
zusammen, dem sie dem Namen „Welthaus“ gaben. Das Projekt „weltumspannend arbeiten“ bau-<br />
te von Oberösterreich ausgehend die entwicklungspolitische Bildungsarbeit im ArbeitnehmerIn-<br />
nen-Bereich aus. Das Netzwerk „Women in Development Europe“ (WIDE) entwickelte eine eigene<br />
Organisationsstruktur und richtete fachspezifische Arbeitskreise ein. Das Wiener Institut für Ent-<br />
wicklung und Zusammenarbeit (VIDC) schuf die Abteilung „Kulturen in Bewegung“ und setzte mit<br />
dem Festival „Sura Za Afrika“ 1996 einen ersten Höhepunkt im bis dahin vernachlässigten Feld der<br />
entwicklungspolitischen Kulturarbeit. Das gleiche VIDC begründete auch die Sportinitiative „Fair<br />
Play“, die sich der antirassistischen Informationsarbeit widmete.<br />
Die letzten 10 bis15 Jahre sahen in jedem Fall ein hohes Maß an Spezialisierung und Professiona-<br />
lisierung. Dazu trugen auch eine Reihe von Workshops und Weiterbildungsprogrammen bei, wie<br />
sie unter anderem von KommEnt angeboten wurden.<br />
17 siehe Gesamtliste im Anhang<br />
<strong>ÖSTERREICHISCHE</strong> EZA – BAND 1 31
ENTWICKLUNGSPOLITISCHE INLANDSARBEIT<br />
3. ENTWICKLUNGSPOLITISCHE<br />
INLANDSARBEIT<br />
ÖFFENTLICHE MASSNAHMEN<br />
Maßnahmen in der entwicklungspolitischen Inlandsarbeit waren lange Zeit Aufgabe von<br />
Nichtregierungsorganisationen (NGOs). Öffentliche EZA-Einrichtungen förderten diese<br />
Maßnahmmen über Subventionen, Zuschüsse und Aufträge. Erst zu Beginn der 1990er<br />
Jahre begann der Aufbau eigenständiger Strukturebenen in der entwicklungspolitischen<br />
Inlandsarbeit öffentlicher Stellen, insbesondere im ressort zuständigen Bundesministerium<br />
für auswärtige Angelegenheiten.<br />
3.1. Überblick<br />
Nach einer Reorganisation in der EZA-Sektion gab es nach 1992 eine neue Zuständigkeit für die<br />
Informationsarbeit. Es wurde ein Referat eingerichtet, welches mit einer eigenen Budgetlinie do-<br />
tiert wurde.<br />
1993 ersuchte das Bundeskanzleramt (BKA), das zu jener Zeit für die bilaterale Programm- und<br />
Projekthilfe zuständig war, mehrere Kommunikationswissenschafter – einige waren auch bei pri-<br />
vaten Projektträgern der Entwicklungszusammenarbeit leitend tätig – um ihren Rat bezüglich<br />
einer Stärkung der öffentlichen Präsenz der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit. Die<br />
Fachleute empfahlen dem BKA, für die Erstellung und Umsetzung eines Öffentlichkeitsarbeits-<br />
konzepts die professionelle Beratung einer für die Thematik sensiblen PR-Agentur in Anspruch zu<br />
nehmen. Das BKA beauftragte daraufhin das Institut für Kommunikationsplanung (IKP) mit einer<br />
Analyse und Bewertung der Ist-Situation.<br />
IKP führte in Folge österreichweite Erhebungen durch und entwarf unter Nutzung vorhandener Er-<br />
fahrungen im entwicklungspolitischen und im Kommunikationsbereich das erste Kommunikations-<br />
konzept der Entwicklungszusammenarbeit. IKP griff dabei auch auf die Ergebnisse einschlägiger<br />
Studien (Reihe IBE-Forschungsdokumentationen) zurück: Insbesondere Jäggle/Sibitz, Information<br />
und Bewusstseinsbildung – „Öffentlichkeitsarbeit Dritte Welt“ in Österreich Teil I und II (1975 und<br />
1978) sowie Gabler „Öffentlichkeitsarbeit Dritte Welt in Schweden, den Niederlanden und Öster-<br />
reich“ (1977) und die Untersuchungen von Luger zu Dritter Welt in den österreichischen Medien.<br />
Die Umsetzung dieses Konzepts im Jahre 1994 kann als tatsächlicher Beginn der Informations-<br />
bzw. Öffentlichkeitsarbeit der Österreichischen Entwicklungszusammenarbeit (im BKA, ab 1995 im<br />
Außenministerium) angesehen werden.<br />
Es beinhaltete unter anderem die folgenden Punkte:<br />
1. Die öffentlichen Einrichtungen, v.a. das zuständige Ministerium, sind aufgefordert, selbst<br />
und verstärkt entwicklungspolitische Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben. Staatliche und<br />
nicht-staatliche Öffentlichkeitsarbeit sollten klar getrennt werden.<br />
<strong>ÖSTERREICHISCHE</strong> EZA – BAND 1 33
ENTWICKLUNGSPOLITISCHE INLANDSARBEIT<br />
2. Mindestens 2% der ODA sollten für Öffentlichkeitsarbeit aufgewändet werden 1 .<br />
Die Ausgaben 1994 für Inlandsarbeit – fast zur Gänze Förderungen an NGOs – machten mit<br />
ca. 3,85 Mio. EURO etwa 5% der Programm- und Projekthilfe des Außenministeriums aus<br />
(etwas weniger als 1% der ODA).<br />
Nach einem Einbruch in der Folge des Sparpakets 1999 lagen die Förderbeiträge nach Erhö-<br />
hungen 2004 und 2005 wiederum bei 3,6 Mio. EURO.<br />
Mit seinen öffentlichen Gesamtausgaben für entwicklungspolitische Informationsarbeit<br />
liegt Österreich seit Jahren im guten Durchschnitt innerhalb der DAC-Länder.<br />
3. Die Nahtstellen zwischen Industrie- und Entwicklungsländern sollen dargestellt und ver-<br />
ständlich kommuniziert werden.<br />
4. Es bräuchte eine Öffentlichkeitsarbeit, die nicht nur einseitig informiert, sondern im Nah-<br />
bereich der Dialoggruppen das Gespräch sucht.<br />
5. Die Öffentlichkeitsarbeit sollte auf die OEZA-Schwerpunktländer mit der Botschaft „Eine<br />
Welt“ im Mittelpunkt konzentriert werden. Es müsse keine gemeinsamen thematischen<br />
Schwerpunkte mit den NRO geben. Das Ministerium überlässt es den NRO selbst, inwieweit<br />
sie inhaltlich zusammenarbeiten wollen, und setzt selbst inhaltliche Schwerpunkte für die<br />
eigene Informationsarbeit und seine Förderungspolitik.<br />
6. Eine unabhängige Projektprüf- und -begleitstelle sollte zur Beratung für Organisationen<br />
und des Ministeriums bei der Prüfung der zur Förderung eingereichten Projekte eingerich-<br />
tet werden.<br />
In Umsetzung des Konzeptes ab 1994 sowie der darauf aufbauenden Arbeitsprogramme wurde<br />
entwicklungspolitische Informationsarbeit von der Österreichischen Entwicklungszusammenarbeit<br />
auf zweierlei Weise geleistet:<br />
Durch Förderung von einschlägigen NGO-Projekten sowie durch (den Aufbau der) Öffentlichkeits-<br />
arbeit für die Österreichische Entwicklungszusammenarbeit. Die Förderungen von Projekten wur-<br />
den über die Gesellschaft für Kommunikation und Entwicklung (KommEnt) abgewickelt, die minis-<br />
teriumseigene Informationsarbeit zur OEZA erfolgte direkt über die EZA-Sektion bzw. über ein neu<br />
eingerichtetes Informationsbüro der OEZA, das bei der PR-Agentur Trimedia angesiedelt wurde.<br />
Entwicklungszusammenarbeitsgesetz 2002<br />
Im Bundesgesetz über die Entwicklungszusammenarbeit 2 wird neben der grundsätzlichen Ver-<br />
pflichtung des Bundes zur Entwicklungszusammenarbeit im Rahmen seiner internationalen Ent-<br />
wicklungspolitik (§1/1) festgehalten, dass Entwicklungspolitik alle Maßnahmen des Bundes zu um-<br />
fassen hat, welche die nachhaltige wirtschaftliche und soziale Entwicklung der Entwicklungsländer<br />
fördern (§1/2) und vor allem die Bekämpfung der Armut, Sicherung des Friedens und Erhaltung<br />
der Umwelt zum Ziel haben (§1/3). Unter den Vorhaben, die vom Bund durchgeführt werden bzw.<br />
jenen von Organisationen, die gefördert werden können, wird ausdrücklich die entwicklungspoli-<br />
tische Informations-, Bildung-, Kultur- und Öffentlichkeitsarbeit genannt (§ 2/3g).<br />
1 Development Information Day, 13./14.9.1993 in New York.<br />
2 49. Bundesgesetz: Entwicklungszusammenarbeitsgesetz 2002. in: Bundesgesetzblatt, Jg. 2002, 29.3.2002, Teil I, S.<br />
259-263.<br />
34 <strong>ÖSTERREICHISCHE</strong> EZA – BAND 1
ENTWICKLUNGSPOLITISCHE INLANDSARBEIT<br />
Der Bund anerkannte damit die Tatsache, dass die Durchführung und Förderung solcher Vorhaben<br />
längst integrativer Bestandteil der österreichischen Entwicklungspolitik war, und reagierte auch<br />
auf eine Kritik des Bundesrechnungshofes bereits aus dem Jahr 1989, dass die Durchführung und<br />
Förderung dieser Vorhaben nicht ausdrücklich gesetzlich geregelt war. Es führte vor allem der<br />
Druck von Nichtregierungsorganisationen dazu, dass auch die Begriffe „Bildungs- und Kulturar-<br />
beit“ in den Gesetzestext aufgenommen wurden, der in ersten Entwürfen nur die Begriffe „Infor-<br />
mations- und Öffentlichkeitsarbeit“ anführte.<br />
Die Maßnahmen der entwicklungspolitischen Inlandsarbeit werden entsprechend den internationa-<br />
len DAC-Richtlinien in die EZA-Jahresstatistiken eingerechnet. Sie sind Bestandteil der Official De-<br />
velopment Assistence (ODA). Für Österreich sehen die Zahlen für ausgewählte Jahre wie folgt aus:<br />
Tabelle 1<br />
ÖFFENTLICHE AUSGABEN FÜR INLANDSARBEIT<br />
1996 2000 2001 2002 2003<br />
Maßnahmen, in Tsd. EURO 5.569 4.371 5.739 5.539 4.380<br />
in Prozent zu Gesamt-ODA 1,38 0,92 0,81 1,00 0,98<br />
Diese öffentlichen Leistungen, finanziert aus dem Bundeshaushalt, teilen sich in mehrere Kompo-<br />
nenten: Fördermaßnahmen für NGO-Projekte, den zuordenbaren KommEnt-Aufwand und Eigeni-<br />
nitiativen der Österreichischen Entwicklungszusammenarbeit (OEZA). Für die ausgewählten Jahre<br />
ergibt des folgendes Bild:<br />
Tabelle 2<br />
OEZA–BUDGET FÜR INLANDSARBEIT In Tsd. EURO 3<br />
1996 2000 2001 2002 2003<br />
Gesamtaufwand 4.700 4.172 5.547 5.382 4.174<br />
davon<br />
Informationsarbeit des BMaA 0.787 0.889 1.305 1.034 1.613<br />
Förderungen (KommEnt) 3.550 3.017 3.826 4.063 2.119<br />
EU – Kofinanzierung 182 145 126 36 93<br />
Auszahlung Aufwand KommEnt 182 121 291 249 349<br />
Quelle: EZA-Statistik<br />
Die Tabelle zeigt die Entwicklung bei der OEZA-eigenen Informationsarbeit und bei den Förde-<br />
rungen, die aus dem OEZA-Budget finanziert wurden. Bei der OEZA-Informationsarbeit und dem<br />
KommEnt-Begleitaufwand handelt es sich um Maßnahmen, die in der Eigenverantwortung des<br />
Bundes durchgeführt wurden. Die eingangs erwähnte Neuordnung in der EZA zeigt sich am deut-<br />
lichen Anstieg eigenverantworteter Informationsmaßnahmen des BMaA.<br />
3 Die Zahlen weichen von der bei KommEnt geführten Statistik ab, da dort jahresbedingte Vorauszahlungen Abgrenzungen<br />
erschweren.<br />
<strong>ÖSTERREICHISCHE</strong> EZA – BAND 1 35
ENTWICKLUNGSPOLITISCHE INLANDSARBEIT<br />
Die Förderungen, die über KommEnt abgewickelt wurden, gingen ausschließlich an private Organi-<br />
sationen, ebenso die Mittel für EU–Kofinanzierungen als Anteil an genehmigten EU-Bildungs- und<br />
Öffentlichkeitsarbeitsprojekten von NGOs. Die von KommEnt ausbezahlten Summen unterscheiden<br />
sich aufgrund von anderen Zahlungsfristen von den oben dargestellten Leistungen, die die EZA-<br />
Statistik als Grundlage haben. Die KommEnt-Förderungen sind unter 3.2. nochmals erläutert.<br />
Tabelle 3<br />
FINANZIERUNG ÖFFENTLICHE INFORMATIONS- UND BILDUNGSARBEIT 2003<br />
In Tsd. EURO in Prozent<br />
OEZA – Bundeshaushalt 4.174 95,3<br />
Andere Ministerien 21 0,5<br />
Länder, Gemeinden, Kammern 185 4,2<br />
Gesamt 4.380 100,0<br />
Seit 1.1.2004 ist die Austrian Development Agency (ADA) vom BMaA mit der operativen Abwicklung<br />
des OEZA-Budgets beauftragt. Die ADA erstellt das Detailbudget, das der Aufsichtsrat genehmigt.<br />
Gemessen am OEZA-Budget hat sich der Gesamtaufwand für entwicklungspolitische Informations-<br />
arbeit wie folgt entwickelt. Die Tabelle zeigt wiederum ausgewählte Jahre, die Gesamtdarstellung<br />
findet sich im Anhang.<br />
Tabelle 4<br />
OEZA–BUDGET UND INFORMATIONSMASSNAHMEN In Tsd. EURO und Prozent<br />
1996 2000 2001 2002 2003<br />
EZA-Budget (ohne ERP) 76.435 56.447 54.878 56.614 53.284<br />
OEZA-Informationsarbeit 4.700 4.172 5.547 5.382 4.174<br />
Informationsarbeit in Prozent 6,15 7,39 10,11 9,51 7,72<br />
Quelle: EZA-Statistik<br />
Die Tabelle zeigt den großen Rückgang des OEZA-Budgets nach 1996. Erst 2004 kam es wieder zu<br />
einer deutlichen Erhöhung auf 71,6 Mio. EURO. Prozentuell war die Informationsarbeit allerdings<br />
von den Budgetkürzungen weniger als andere aus dem OEZA-Haushalt dotierte Bereiche betroffen.<br />
Auch ist eine prozentuell höhere Dotierung aus dem gestaltbaren OEZA-Budget für Informations-<br />
arbeit nachzuweisen, als dies auf die Gesamtheit der privaten EZA zutreffen dürfte 4 .<br />
4 Siehe Abschnitt 4.3.2, Katholische Kirche.<br />
36 <strong>ÖSTERREICHISCHE</strong> EZA – BAND 1
ENTWICKLUNGSPOLITISCHE INLANDSARBEIT<br />
3.2. Förderungen über KommEnt, Förderpolitik, Rahmenbedingungen<br />
Ein wesentliches Ergebnis der Reorganisation der EZA zu Beginn der 1990er-Jahre war die Etablie-<br />
rung eines eigenen Informationsreferats in der EZA-Verwaltung. Zuvor war die Informationsarbeit<br />
fast ausschließlich über Förderprojekte der NGOs erfolgt. Die staatliche EZA war dadurch als „Ei-<br />
genmarke“ ungenügend präsent. Es wurde wie bereits erwähnt ein Informationsbüro der OEZA<br />
eingerichtet, das im Auftrag der Sektion die Informationsarbeit der OEZA beriet und durchführte.<br />
Das dahinter liegende Prinzip der personellen Besetzung sollte sich in den kommenden Jahren,<br />
auch bei der Gründung der Austrian Development Agency (ADA) 2004, wiederholen: NGO-erfah-<br />
rene und gegenüber der staatlichen EZA und Entwicklungspolitik kritische Personen wechselten in<br />
öffentliche Verantwortungen. Mit ihrer neuen Aufgabe ist aber auch ein Rollenwechsel verbunden,<br />
der von beiden Partnern – der öffentlichen Verwaltung wie den NGOs - bearbeitet werden muss.<br />
In diesem Zusammenhang ist auch darauf hinzuweisen, dass es in den Jahren ab 1990 zu großen<br />
Budgetsteigerungen gekommen war. Von 1990 bis 1994 stieg der EZA-Bundeshaushalt von ATS<br />
382 Mio (27,7 Mio EURO) auf ATS 995,8 (72,4 Mio EURO). Die Informationsarbeit profitierte da-<br />
von. Die Herausbildung neuer Programme und Strukturen lässt nach den 1970er-Jahren durchaus<br />
für diesen Zeitraum den Begriff „2. Gründerzeit“ zu.<br />
Tabelle 5<br />
FÖRDERUNGEN AUS OEZA-BUDGET, ABWICKLUNG ÜBER KOMMENT, in Mio. Euro<br />
1996 2000 2001 2002 2003<br />
Information u. Bildung 2,348 1,599 1,731 1,813 1,309<br />
Publikation u. Wissenschaft 0,873 1,081 0,973 0,909 1,054<br />
Kultur, audiovis. Medien, Film 0,406 0,382 0,408 0,542 0,404<br />
Tourismus — 0,058 0,064 0,118 —<br />
Öffentlichkeitsarbeit — — — — 0,473<br />
Themenspez. Ausschreibung * 0,363 0,013 — 0,353 —<br />
Gesamt 3,990 3,133 3,176 3,735 3,240<br />
* Ausschreibungen/Spezialthemen:<br />
1996 Sura Za Afrika<br />
2000 Afrika bezogene Projekte<br />
2002 Rio + 10<br />
Nimmt man die laut EZA-Statistik für Förderungen von NGO-Projekten an KommEnt ausbezahlten<br />
Zahlen, ergeben sich Differenzen. Überhänge aus dem EZA-Budget des Bundes stellen KommEnt-<br />
Verpflichtungen an bereits bewilligte Förderprojekte und künftige Schwerpunkte dar.<br />
<strong>ÖSTERREICHISCHE</strong> EZA – BAND 1 37
ENTWICKLUNGSPOLITISCHE INLANDSARBEIT<br />
3.2.1. Gründungsgeschichte<br />
Der Förderbereich – die Prüfung, Begleitung und Kontrolle der Förderprojekte – wurde durch<br />
Übertragung an KommEnt (Gesellschaft für Kommunikation und Entwicklung) 1994 auf eine qua-<br />
lifizierte Grundlage gestellt.<br />
Im Vorfeld dieser Strukturänderungen war es zu heftigen Differenzen zwischen der Sektionslei-<br />
tung und mehreren NGOs gekommen. Insbesondere der Österreichische Informationsdienst für<br />
Entwicklungspolitik (ÖIE) war ins Schussfeld der Kritik geraten. Von einer „Alimentierung der<br />
EZA-Nichtregierungsorganisationen“ war etwa die Rede – so der damalige entwicklungspolitische<br />
Sprecher der ÖVP und Leiter der Parteiakademie und heutige Präsident des Nationalrates Andreas<br />
Khol. Das lange Zeit gute Verhältnis zwischen öffentlicher Verwaltung und den NRO war schwer<br />
gestört. Als eine Antwort wurde 1988 die NGO-Interessensvertretung Arbeitsgemeinschaft Ent-<br />
wicklungszusammenarbeit (AGEZ) gegründet.<br />
Für den Förderbereich wurde das in den Niederlanden etablierte System einer aus der Hoheitsver-<br />
waltung ausgelagerten Agentur (Dutch National Commission for International Cooperation and<br />
Sustainable Development–NCDO) eingerichtet.<br />
In einer ersten Stufe war dies in Form einer Dienstleistungsfunktion für die EZA-Sektion zur<br />
Projektabwicklung vorgesehen, Stufe 2 sollte zur eigenständigen Projektgenehmigung durch<br />
KommEnt führen.<br />
Der Gründungsprozess vor 1994 war aus heutiger Sicht etwas kurios gelaufen. Die damals größten<br />
EZA-Informationsorganisationen, der bereits erwähnte ÖIE, die <strong>ÖFSE</strong> und das VIDC wurden einge-<br />
laden, einen Vorschlag zur Gründung einer „österreichischen NCDO“ vorzulegen.<br />
Bereits 1992 und 1993 wurden die drei Organisationen – hinzu kam auf Drängen des katholischen<br />
Bildungsbereichs die Kofinanzierungsstelle (KFS) – als „Trägerorganisationen“ mit der Abwicklung<br />
von Förderprojekten beauftragt. Die Organisationen erbrachten diese Dienstleistungen unentgelt-<br />
lich, obgleich sie zuvor noch in der Kritik des Ministeriums gestanden waren und nicht unerhebli-<br />
che finanzielle Einbußen – insbesondere hatte dies den ÖIE betroffen – erleiden mussten.<br />
Die Förderprojekte Dritter wurden somit vor der KommEnt-Gründung im Auftrag der EZA-Sekti-<br />
on für zwei Jahre von „Trägerorganisationen“ abgewickelt. Anträge wurden aufbereitet und in<br />
eigens eingerichteten Fachbeiräten beraten. Die endgültige Zustimmung erfolgte dann durch das<br />
BMaA. Aufgrund der bereits beschriebenen Budgetentwicklung kam es in diesen Jahren zu nur<br />
wenigen Ablehnungen aus finanziellen Gründen. Im Gegenteil: Eine Reihe von Organisationen eta-<br />
blierte neue Programme, die kontinuierliche Förderungen erforderlich machten, was in den späte-<br />
ren Jahren in Folge des Drucks auf die Budgetlinie zu Problemen bei der Finanzierung führte.<br />
Die drei Trägerorganisationen ÖIE, <strong>ÖFSE</strong> und VIDC verhielten sich zum Vorschlag der EZA-Sektion<br />
nach Schaffung einer neuen, von ihnen gemeinsam getragenen „Förderstruktur“ reserviert. Die<br />
unklaren Erwartungen und die frühere Kritik mahnten zur Vorsicht. Doch noch während der ein-<br />
setzenden Diskussion präsentierte das Institut für Kommunikationswissenschaft der Universität<br />
Salzburg im Herbst 1994 ein Konzept, welches es im Auftrag des Ministeriums erstellt hatte. Es sah<br />
die Gründung einer unabhängigen Förderstelle vor, mit Sitz in Salzburg.<br />
Das Institut selbst übernahm die wissenschaftliche Beratung und Begleitung von KommEnt und<br />
38 <strong>ÖSTERREICHISCHE</strong> EZA – BAND 1
stellte drei MitarbeiterInnen für den Vorstand ab. 5<br />
5 Univ. Prof. Dr. Kurt Luger wurde zum Vorsitzenden bestellt.<br />
ENTWICKLUNGSPOLITISCHE INLANDSARBEIT<br />
Die Förderstelle KommEnt war entstanden. Von der eigentlichen „Zwischenlösung“ blieb die Ein-<br />
richtung von Fachbeiräten und eine interessante Episode in der EZA-Geschichte Österreichs.<br />
3.2.2. Die Aufgaben<br />
Am 28.11.1994 wurde zwischen dem BKA und KommEnt ein Werkvertrag unterzeichnet, der<br />
KommEnt mit der Beratung, Prüfung, Koordination und Begleitung der Förderungsvorschläge<br />
sowie der geförderten Vorhaben im Bereich der entwicklungspolitischen Bildungs-, Kultur- und<br />
Öffentlichkeitsarbeit beauftragte. Zugleich wurde festgelegt, dass KommEnt im Rahmen dieses<br />
Auftrages unabhängig und eigenständig sowie in direktem Kontakt mit den FörderungswerberIn-<br />
nen bzw. dem BKA (später BMaA) handelte.<br />
Im ersten Werkvertrag, der von 1994 bis 1997 abgeschlossen wurde, erhielt KommEnt unter an-<br />
derem den Auftrag, „Vorbereitungsmaßnahmen für die allfällige Phase II der Projektstelle zu<br />
treffen.” Eine nähere Ausführung wurde nicht gegeben. Da aber in den Vorbereitungsarbeiten<br />
zur Einrichtung der Projektstelle die Entwicklung der niederländischen Organisation NCDO eine<br />
maßgebliche Vorbildfunktion einnahm, konnte davon ausgegangen werden, dass unter Phase II<br />
in groben Zügen der Status von NCDO verstanden wurde. Die Erwartung war, dass KommEnt über<br />
die Förderungen eigenständig entscheiden werde. Haushaltsrechtlichen Bestimmungen standen<br />
dem aber entgegen. In den Folgewerkverträgen 1997 bis 2000 und 2000 bis 2003 wurden dennoch<br />
erweiterte Aufgaben und Befugnisse von KommEnt festgelegt:<br />
Neben der Abwicklung der Anträge, Verträge und Berichte übernahm KommEnt eine Reihe ande-<br />
rer Aufgaben: Die Ausarbeitung und Weiterentwicklung von Förderrichtlinien, die Durchführung<br />
von Weiterbildungsveranstaltungen, die Evaluierung von Programmen und Projekten, Kontakte<br />
zu ähnlichen Organisationen im Ausland.<br />
Ein gesellschaftspolitisch pluralistisch zusammengesetztes Kuratorium, dem VertreterInnen aus Po-<br />
litik, Verwaltung, Wissenschaft, den Medien, aus Interessenvertretungen, Kirchen und NGOs ange-<br />
hören, zeichnete für die längerfristige Planung von KommEnt verantwortlich und verabschiedete<br />
für jeweils drei Jahre gültige Förderprogramme, um sie dem BMaA vorzulegen. Das KommmEnt-<br />
Leitbild, welches die inhaltlichen, methodischen und strategischen Perspektiven beschrieb, an de-<br />
nen sich KommEnt in seiner Arbeit orientierte, konnte auf der KommEnt-Homepage ebenso ein-<br />
gesehen werden wie alle Förderunterlagen und eine öffentlich zugängliche Projektdatenbank.<br />
KommEnt gelang es, institutionalisierte Kontakte zu Ministerien (BMaA, BM:BWK, BMU, BMWA)<br />
aufzubauen, ebenso zu Landesregierungen, Interessensverbänden sowie zu Dachverbänden von<br />
Nichtregierungsorganisationen aus den Bereichen EZA, Umwelt, Menschenrechte.<br />
KommEnt trug dadurch zur breiten Verankerung der entwicklungspolitischen Inlandsarbeit im<br />
öffentlichen Raum bei. Die hohe kommunikative Dimension (mit NGO-Tagen, regelmäßigen Re-<br />
flexionsgesprächen und qualifizierter Beratung) unterschied KommEnt wesentlich von Auftrag-<br />
nehmern, die Projekte der Informationsarbeit auf der Basis vorgegebener Terms of Reference und<br />
Kalkulationen durchführen.<br />
<strong>ÖSTERREICHISCHE</strong> EZA – BAND 1 39
ENTWICKLUNGSPOLITISCHE INLANDSARBEIT<br />
KommEnt betreute mehrheitlich Projekte, die von unterschiedlichen öffentlichen wie privaten<br />
Stellen finanziert wurden und vielfach einen nicht unerheblichen Eigenmittelanteil ausweisen.<br />
Diese Finanzierungsform unterscheidet sich deutlich von klassischen Auftragsvergaben durch eine<br />
jeweils einzige Stelle.<br />
KommEnt band in die Erledigung seiner Aufgaben über Fachbeiräte - auf Ersuchen der OEZA im<br />
Außenministerium wurde bei KommEnt neben den bestehenden Fachbeiräten 2003 ein Beirat<br />
für Öffentlichkeitsarbeit eingerichtet – Fachleute aus Wissenschaft, Bildung, Medien, Kultur und<br />
Verwaltung ein. In den Fachbeiräten wirkten auch Personen aus Entwicklungsländern mit, die in<br />
Österreich leben. Durch ein besonderes Augenmerk auf Schwerpunkte in der EZA trug KommEnt<br />
zur Überwindung der strukturellen Trennung zwischen sog. Inlands- und Auslandsarbeit bei.<br />
Für die genannten Phasen bestanden jeweils von KommEnt mit Fachleuten erstellte und vom Au-<br />
ßenministerium genehmigte Förderprogramme. Förderbestimmungen und - unterlagen sowie die<br />
Form der Förderabwicklung waren im Einzelnen auch mit dem Bundesministerium für Finanzen<br />
abgestimmt. Verpflichtende Bilanzrichtlinien für größere FördernehmerInnen sowie die Festle-<br />
gung von sogenannten Kernfunktionen (zeitlich nicht begrenzte „Dienstleistungen“ von Projekt-<br />
trägern) tragen zu einer gesicherten Förderabwicklung bei.<br />
Die Programme wurden im Auftrag des BMaA und des BM:BWK als ein verbindlicher Rahmen<br />
für Programme und Projekte der von den beiden Ressorts geförderten entwicklungspolitischen<br />
Inlandsarbeit (einschließlich EU-Kofinanzierungsprojekte) erstellt.<br />
Zudem stellten die Programme die Transparenz über Förderpolitik und Förderentscheidungen und<br />
die Grundlage für die aktive Umsetzung der Förderpolitik und für das Monitoring ihrer öffentli-<br />
chen wie internen Auswirkungen sicher.<br />
Als inhaltliche Schwerpunkte für 2004 bis 2006 wurden definiert:<br />
- Überwindung von Armut/sozialer Benachteiligung<br />
- Friedensförderung durch gewaltfreie Konfliktlösung<br />
- Förderung nachhaltiger Entwicklung; es wurde aus Anlass der Millennium Development<br />
Goals 2004 ein eigener Call for Proposals durchgeführt.<br />
- Stärkung des Dialogs der Kulturen<br />
3.2.3. Ende des Rahmenwerkvertrags zwischen KommEnt und ADA<br />
Mit der Gründung der Austrian Development Agency (ADA) wurde auch innerhalb dieser neu-<br />
en EZA-Agentur eine eigene Abteilung für entwicklungspolitische Inlandsarbeit eingerichtet. Das<br />
über KommEnt abgewickelte Förderprogramm bedurfte somit einer neuen Zuordnung. In Abstim-<br />
mung mit dem BMaA entschied die ADA im Juni 2005, den aus ihrer Sicht strategisch wichtigen<br />
Bereich der entwicklungspolitischen Inlandsarbeit stärker zu integrieren. Der Rahmenwerkvertrag,<br />
der KommEnt mit der Abwicklung der Fördervorhaben im Bereich der entwicklungspolitischen<br />
Inlandsarbeit sowie der Beratung des BMaA bzw. der ADA in diesem Förderbereich beauftragte,<br />
wird daher nicht verlängert und endet mit September 2005.<br />
Die ADA betonte, dass strategische Ueberlegungen die Grundlage für diese Entscheidung<br />
bildeten. Durch organisatorische Integration der entwicklungspolitischen Inlandsarbeit in das<br />
40 <strong>ÖSTERREICHISCHE</strong> EZA – BAND 1
ENTWICKLUNGSPOLITISCHE INLANDSARBEIT<br />
ADA-Unternehmenskonzept soll der Stellenwert dieses Arbeitsfeldes zukünftig erhöht und mehr<br />
Kohärenz in die ADA-Maßnahmen sowie eine Stärkung der ADA-Beziehungen zur Zivilgesellschaft<br />
erreicht werden. 6 Zudem sprachen wirtschaftliche Überlegungen für diese Veränderung: Die In-<br />
tegration wird zu einer Entlastung des Förderbudgets beitragen, da bisherige Verwaltungsauf-<br />
wände nun für Projekt- und Programmbeiträge frei werden. Die seit 1992 tätigen Fachbeiräte zur<br />
Beratung von Anträgen in der entwicklungspolitischen Inlandsarbeit werden von der ADA zur<br />
weiteren Mitwirkung eingeladen.<br />
Für eine umfassende Bewertung der KommEnt-Tätigkeit kommt diese Publikation zu früh. Die in<br />
der entwicklungspolitischen Inlandsarbeit engagierten NGOs bewerteten die KommEnt-Tätigkeit<br />
unterschiedlich. Mitunter wurde die zu enge Anbindung an die EZA-Sektion im BMaA und deren<br />
Forderungen nach verstärkter NGO-Öffentlichkeitsarbeit im Dienst der OEZA kritisiert. Schließlich<br />
war die völlige Unabhängigkeit von KommEnt nach dem beschriebenen Beispiel der niederländi-<br />
schen NCDO nicht gelungen.<br />
Im Zuge des Entscheidungsprozesses der ADA zur zukünftigen Gestaltung des Förderbereichs<br />
sprach sich die Mehrheit der AGEZ-Mitgliedsorganisationen für eine Beibehaltung einer eigen-<br />
ständigen Struktur von KommEnt aus. Die Transparenz zu gewährten Förderungen und die Ein-<br />
richtung der vier Fachbeiräte wurden als wesentlicher Fortschritt gesehen 7 .<br />
3.3. Die Etablierung neuer Themenfelder und Aktionsbereiche<br />
Sowohl KommEnt als auch das Informationsbüro der OEZA fanden Anerkennung und es gab Klar-<br />
heit über die Auftragshoheit des Außenministeriums. Beide Agenturen waren aber in ihrem ope-<br />
rativen Auftrag stark eingeschränkt: Weder KommEnt noch das Informationsbüro konnten sich als<br />
eigenständige EZA-Akteure verstehen. Vor allem KommEnt wurde auch auf Druck der NGOs auf<br />
eine Verwaltungseinrichtung – um Koordinations- und Weiterbildungsmaßnahmen ergänzt – be-<br />
schränkt. Eigenständige operative Maßnahmen der entwicklungspolitischen Inlandsarbeit standen<br />
KommEnt nur eingeschränkt offen.<br />
Für in der IKP-Studie 1993 vorgesehene weitere inhaltliche Maßnahmen mussten andere Formen<br />
durch die EZA-Sektion gefunden werden:<br />
Den Zielgruppen EntscheidungsträgerInnen und Medien wurde eine besondere Priorität einge-<br />
räumt. Für die Themenfelder Tourismus, Arbeitswelt und Frauen und Entwicklung wurden eige-<br />
ne Strukturen gefördert (die vormals Teile des ÖIE-Programms waren) und der Aktionsbereich<br />
Film/Pädagogische Medien wurde ebenfalls in einer neuen Schiene angesiedelt. Das VIDC konnte<br />
den neuen Schwerpunkt „Kulturen in Bewegung“ einrichten. Auch der Faire Handel fand sich im<br />
inhaltlichen Konzept des Ministeriums wieder. Ursprünglich über Eigenfinanzierung aus Lizenz-<br />
gebühren geplant, führt heute Fairtrade Marketingmaßnahmen insbesondere mit öffentlichen<br />
Förderungen durch. Der Bereich Schule behielt im Förderbereich seinen führenden Stellenwert.<br />
Konzepte zum universitären Bereich wurden hintangestellt.<br />
6 KommEnt-Newsletter II/05<br />
7 AGEZ-Brief an ADA, 2. Mai 2005<br />
<strong>ÖSTERREICHISCHE</strong> EZA – BAND 1 41
ENTWICKLUNGSPOLITISCHE INLANDSARBEIT<br />
Es ist interessant, dass damit die in den Studien Jäggle/Sibitz 1975/1978 und Gabler 1977 publizier-<br />
ten Vorschläge – soweit sie nicht bereits anlässlich der Gründung des ÖIE 1979 realisiert wurden<br />
– in das neue Konzept der OEZA aufgenommen wurden.<br />
Das Thema Tourismus wurde ab 1997 durch die „Reiseagentur“ respect forciert. Bei der Bildungs-<br />
und Schulstelle BAOBAB wurde 1998 die „Medienstelle Weltbilder“ eingerichtet - in der Bundesre-<br />
publik Deutschland eine unmittelbar dem BMZ zugeordnete Einrichtung für Produktion und Ver-<br />
trieb entwicklungspolitischer Medien. Die Südwind Agentur vertrieb die offiziellen Länder- und<br />
Sachthemenpublikationen des BMaA, das Thema „Arbeit“ wurde über die ÖGB-Initiative „Welt-<br />
umspannend arbeiten“ gefördert.<br />
Merkmale all dieser strukturellen Entwicklungen sind: Sie erfolgten auf Vorschlag der EZA-Sektion<br />
im BMaA „von oben“ und waren im Themen- und Zielgruppenkonzept in der IKP-Studie enthal-<br />
ten. Im Zentrum standen Maßnahmen, die einer verstärkten Öffentlichkeitsarbeit der OEZA dien-<br />
lich waren. Ein entsprechender Hinweis darauf wurde deutlich eingefordert, jeder Außenauftritt<br />
wurde auch als Maßnahme der OEZA vermarktet. Der Zugriff der öffentlichen Verwaltung auf die<br />
entsprechenden NGOs konnte auch deshalb ausgeübt werden, da diese zumeist über keine größe-<br />
re Eigenmittelbasis verfügten.<br />
Bestehende NGOs oder neu errichtete Initiativen (wie respect, weltumspannend arbeiten, Weltbil-<br />
der Medienstelle) übernahmen Aufgaben einer öffentlich gewünschten und mitgestalteten Infor-<br />
mationsarbeit. Zur Finanzierung war kein Eigenmittelanteil notwendig. Die Letztverantwortung<br />
lag bei den privaten Trägern. Sie identifizierten sich mit den neuen Aufgaben, wurden Dienstleis-<br />
ter öffentlicher Maßnahmen und stellen diese als Eigenleistung dar. Vorgaben kamen vom BMaA.<br />
Sie wurden auch deshalb bereitwillig umgesetzt, weil dies mit (zusätzlichem) Geld verbunden war.<br />
Die in der IKP-Studie 1993 geforderte Trennung zwischen einer staatlichen Öffentlichkeitsarbeit<br />
und der geförderten Informationsarbeit von NGOs erfolgte daher nur teilweise. In wenigen Fäl-<br />
len gab es eine völlig eigenständige Umsetzung von Inlandsarbeit. Ein herausragendes Beispiel<br />
war die Informationsinitiative „Die Zukunft der Entwicklungszusammenarbeit“. Die EZA - Sektion<br />
im Bundesminsiterium für Auswärtige Angelegenheiten hatte sich 2000 das Ziel gesetzt, einer<br />
sinkenden Aufmerksamkeit und Ermüdung in der Entwicklungspolitik durch aktive Maßnahmen<br />
zu begegnen. Die Initiative wurde im Frühjahr 2001 vor allem durch Einschaltungen und Spots in<br />
Printmedien sowie in Rundfunk und Fernsehen über einen Zeitraum von etwa sechs Wochen ge-<br />
staltet. Zudem wurde die Website www.eza.gv.at eingerichtet und die Broschüre „Engagment für<br />
Entwicklung“ publiziert. Die Gesamtkosten betrugen rund 218.000 EURO.<br />
Bei kofinanzirten Maßnahmen kam es über direkte Mitgestaltung oft zu einer stärkeren Ver-<br />
schränkung als vor der Etablierung des eigenen Referats in der EZA-Sektion. Die beschriebenen<br />
Phänomene zeigen sich auch in anderen EZA-Bereichen. Förderung oder Auftrag ist eine unge-<br />
klärte Frage, die auch mit dem Selbstverständnis des öffentlichen Geldgebers zusammenhängt.<br />
Insgesamt ist dies ein neues Phänomen, das in Verbindung mit „New Public Management“ zu<br />
einem Positionswandel vieler verwaltungsnaher Non-Profit-Organisationen Sie können ihre Akti-<br />
vitäten nicht mehr als freie Subventionsempfänger entfalten, sondern sehen sich zunehmend in<br />
der Rolle eines leistungsvertraglich gebundenen Dienstleisters 8 .<br />
8 Zauner, Alfred et al. (2005).Vom Subventions- zum Leistungsvertrag. Forschungsbericht der WU, Wien.<br />
42 <strong>ÖSTERREICHISCHE</strong> EZA – BAND 1
ENTWICKLUNGSPOLITISCHE INLANDSARBEIT<br />
3.4. ADA – Abteilung Entwicklungspolitische Kommunikation und Bildung<br />
Die Gründung der ADA bedeutete auch die Einrichtung einer eigenen Abteilung für entwick-<br />
lungspolitische Kommunikation und Bildung. Im Wesentlichen kommt der Abteilung eine koordi-<br />
nierende Funktion zu, um im Bereich der entwicklungspolitischen Inlandsarbeit (insgesamt und im<br />
Besonderen im Bereich der geförderten NGO-Arbeit) zu nachhaltiger Wirksamkeit, zu erforderli-<br />
chen Synergien, zu einer optimierten Außendarstellung, zu größtmöglicher Effizienz und damit<br />
in Summe zu einer bestmöglichen Erfüllung der Ziele der ADA und zur Stärkung ihrer Identität<br />
beizutragen.<br />
Die Abteilung nahm ihren Aufgabenbereich 2004 und 2005 in Zusammenarbeit mit KommEnt<br />
wahr. Ab Oktober 2005 übernimmt die ADA die alleinige Gesamtverantwortung.<br />
Die ADA wirkt in Gremien wie dem Global Education Network Europe, in der Strategiegruppe<br />
Globales Lernen, in Fachbeiräten des Paulo Freire Zentrums, von Respect und von Fairtrade oder<br />
im Arbeitskreis Public Support mit. Diese Tätigkeiten sind programmatisch auf eine Verbindung<br />
von EZA und Entwicklungspolitik hin ausgerichtet.<br />
3.5. Förderungen anderer Ministerien, der Länder und Gemeinden<br />
Entwicklungspolitische Informationsmaßnahmen werden außerhalb des Bundesministeriums für<br />
auswärtige Angelegenheiten insbesondere durch das Bundesministerium für Bildung, Wissen-<br />
schaft und Kultur gefördert. Die Leistungen anderer Ministerien sind geringfügig.<br />
Bei einzelnen Landesregierungen bestehen Förderansätze für Informationsmaßnahmen, die über<br />
den engeren entwicklungspolitischen Bereich hinausführen. Die EZA-Zuständigen der Landesre-<br />
gierungen führen jährlich ein Informationstreffen durch. Die Koordination obliegt der Fachabtei-<br />
lung beim Amt der Niederösterreichischen Landesregierung.<br />
Ministerien, Länder und Gemeinden fördern Projekte in der Regel über Struktur- oder Projekt-<br />
finanzierung von NGOs oft aus unterschiedlichen Fördertöpfen. Bei Ländern und Gemeinden ist<br />
immer ein lokaler Bezug wesentlich.<br />
Tabelle 6<br />
BILDUNGSMASSNAHMEN 1996 BIS 2003 In Tsd. EURO<br />
1996 2000 2001 2002 2003<br />
Bundesministerien 9 596 46 21 59 21<br />
Länder, Gemeinden, Kammern 273 153 171 97 185<br />
Quelle: EZA-Statistik<br />
Die hohen Jahresleistungen der Ministerien, Länder und Gemeinden 1996 erklären sich aus den<br />
Förderungen des Afrikafestivals „Sura Za Afrika“.<br />
9 In den Leistungen der Ministerien sind bis 2002 auch im kleinen Umfang Maßnahmen der Ostzusammenarbeit enthalten.<br />
Ab 2003 wurden diese Mittel über KommEnt abgewickelt.<br />
<strong>ÖSTERREICHISCHE</strong> EZA – BAND 1 43
ENTWICKLUNGSPOLITISCHE INLANDSARBEIT<br />
3.6. Förderungen durch die Europäische Kommission<br />
Für die entwicklungspolitische Inlandsarbeit in Österreich relevante EU-Förderungen kommen aus<br />
der Budgetlinie B7-6000. Sie war 2003 und 2004 mit je €20 Mio. EURO dotiert. Insgesamt ist der<br />
Anteil an EU-Kofinanzierungsmitteln für entwicklungspolitische Bildungsprojekte in Österreich in<br />
den letzten Jahren stark rückläufig. Es werden höhere Beträge für weniger Projekte ausgeschüttet<br />
und es sind zehn Staaten dazu gekommen. Die NGOs beklagen zudem den hohen administrati-<br />
ven Aufwand, die langen Vorlaufzeiten und die geringe Planungssicherheit. Die beim EU-Beitritt<br />
genährte Erwartung, an zusätzliche Finanzmittel heranzukommen, ist einer nüchternen Einschät-<br />
zung gewichen.<br />
Eine Auswertung der von der Europäischen Kommission 2003 geförderten Projekte zeigt, dass vor<br />
allem die Projekte aus den größeren EU-Staaten gefördert wurden. Die inhaltliche Schwerpunkt-<br />
setzung lag auf den Themen Handel, Fairer Handel und Landwirtschaft.<br />
Insgesamt zeigt sich eine Tendenz von Bildungsprojekten hin zu Informationsprojekten. Ebenso<br />
werden in den meisten Projekten vor allem die Probleme in den Entwicklungsländern angespro-<br />
chen. (Es gab 2003 kein gefördertes Projekt direkt zum Themenbereich Globalisierung.)<br />
Die Budgetlinie sieht keine Förderung für Kulturprojekte, für Beratungs- und Dokumentations-<br />
strukturen, für größere Ausstellungen und Filme sowie für Austauschprogramme vor.<br />
44 <strong>ÖSTERREICHISCHE</strong> EZA – BAND 1
ENTWICKLUNGSPOLITISCHE INLANDSARBEIT<br />
4. ENTWICKLUNGSPOLITISCHE<br />
INLANDSARBEIT<br />
MASSNAHMEN PRIVATER EINRICHTUNGEN<br />
UND NICHTREGIERUNGSORGANISATIONEN<br />
Die entwicklungspolitische Inlandsarbeit mit ihren Ausprägungen in Bildungsmaßnahmen,<br />
Kulturvermittlung, Informations- und Öffentlichkeitsarbeit zählt zu den wichtigen Aktivi-<br />
täten privater EZA-Einrichtungen und NGOs. Wie bereits dargestellt hat sich zu Beginn der<br />
1970er Jahre eine Reihe von Initiativen entschlossen, Information zu Entwicklungsländern,<br />
Entwicklungsproblemen und Entwicklungshilfe- bzw. -zusammenarbeit in ihre Gesamtpro-<br />
gramme aufzunehmen.<br />
Hinzu kamen in Folge viele lokale und überregionale Organisationen, die fast ausschließ-<br />
lich in der Informationsarbeit tätig sind. Insgesamt können von den über 800 privaten<br />
EZA-AkteurInnen etwa 200 als „EZA-Bildungseinrichtungen“ bezeichnet werden.<br />
4.1. Überblick<br />
Aus Anlass des Beitritts Österreichs zur Europäischen Union wurde 1995 eine Analyse zur entwick-<br />
lungspolitischen Inlandsarbeit publiziert 1 . Der nun vorliegende Überblick zur privaten Initiativen<br />
führt diese Arbeit fort.<br />
Tabelle 7<br />
PRIVATE EZA-BILDUNGSEINRICHTUNGEN – Stand April 2005<br />
Private Akteure Bildungseinrichtungen Weltläden<br />
Burgenland 18 8 3<br />
Kärnten 29 7 6<br />
Niederösterreich 71 13 19<br />
Oberösterreich 91 20 12<br />
Salzburg 60 19 9<br />
Steiermark 67 16 18<br />
Tirol 44 9 11<br />
Vorarlberg 45 7 14<br />
Wien 384 112 8<br />
Gesamt 2 809 211 100<br />
Quelle: www.eza.at – Datenbank EZA-Institutionen, 14.4.2005.<br />
1 Bittner, Gerhard/Helmuth Hartmeyer (1995). Die entwicklungspolitische Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit der österreichischen<br />
Nichtregierungsorganisationen, Wien.<br />
2 Vergleichszahlen für 1996: 704 private EZA-Akteure, davon 83 (Dritte)Welt Läden, in: Österreichische Forschungsstiftung<br />
für Entwicklungshilfe (Hg.) (1996). Österreichische Entwicklungszusammenarbeit. Teil A, Wien.<br />
<strong>ÖSTERREICHISCHE</strong> EZA – BAND 1 45
ENTWICKLUNGSPOLITISCHE INLANDSARBEIT<br />
Von den insgesamt 809 privaten EZA-Organisationen in Österreich sind 211 zur Gänze oder teil-<br />
weise in der Inlandsarbeit tätig. Die 100 Weltläden wurden in der Tabelle als zusätzliche Informa-<br />
tion aufgenommen. Viele Läden verstehen sich auch als Teil der entwicklungspolitischen Inlands-<br />
arbeit und sind – mit ihren Trägervereinen im Hintergrund – lokale AkteurInnen.<br />
Die privaten EZA-Organisationen sind zeit- und themenbedingt in ein sich ständig wandelndes<br />
Umfeld eingebettet und unterliegen zivilgesellschaftlichen Konjunkturen. 3 Die privaten AkteurIn-<br />
nen sind nicht nur aufgrund ihrer Anzahl für die österreichische Entwicklungspolitik seit Beginn<br />
der Entwicklungshilfe/Entwicklungszusammenarbeit in Österreich prägend. Sie erwirtschaften aus<br />
Spenden, Mitgliedsbeiträgen und privaten (kirchlichen) Zuschüssen jährlich ein höheres Projektvo-<br />
lumen als das EZA-Budget. Als Vergleich wurden die für Projekte und Programme in den Ländern<br />
des Südens (EZA) sowie in Mittel- und Osteuropa (OZA) an die OECD gemeldeten Zahlen heran-<br />
gezogen.<br />
Tabelle 8<br />
EZA BUDGET UND ZUSCHÜSSE PRIVATER ORGANISATIONEN in Mio. EURO<br />
EZA-Budget<br />
(ohne ERP, inkl. Osthilfe)<br />
2000 2001 2002 2003<br />
75,15 65,90 67,14 63,86<br />
Private Organisationen 77,61 70,16 70,54 74,45<br />
Quelle: <strong>ÖFSE</strong> – Österreichische Entwicklungspolitik, 2002 und 2003.<br />
Dennoch muss darauf hingewiesen werden, dass der prozentuelle Anteil an Bildungsausgaben in<br />
der öffentlichen EZA höher ist, als dies auf die Gesamtheit der privaten EZA-Maßnahmen zutrifft.<br />
Zwar gibt es analog zur ODA-Statistik keine Detailstatistik privater EZA-Leistungen zu Bildungs-<br />
maßnahmen. Die offiziellen Daten der katholischen Organisationen lassen allerdings diesen<br />
Schluss zu. War der Anteil öffentlicher Bildungsmaßnahmen am Gesamtbudget 2003 bei zehn<br />
Prozent gelegen, lag das Ergebnis für die KOO-Mitgliedsorganisationen bei fünf Prozent. Es ist<br />
nicht anzunehmen, dass dieses Ausmaß im nichtkirchlichen Bildungsbereich wesentlich höher ist.<br />
Ein bedeutsamer Teil des Finanzaufwandes für Inlandsarbeit fließt in Personalkosten. Bildungsar-<br />
beit hat daher auch eine beschäftigungspolitische Dimension. Durch die Anstellung junger Mitar-<br />
beiterInnen kommt zudem ein interne Ressourcenaufbau in der EZA zum Tragen. Die Ausweitung<br />
der entwicklungspolitischen Inlandsarbeit hat dies lange Zeit deutlich gemacht.<br />
Strukturell kann man zwischen EZA-AkteurInnen im kirchlichen Bereich und konfessionell unab-<br />
hängigen Nichtregierungsorganisationen unterscheiden. Sie sind großteils zusammengefasst in<br />
der seit 1988 tätigen „Arbeitsgemeinschaft Entwicklungszusammenarbeit – AGEZ“, dem Dachver-<br />
band privater EZA-Einrichtungen.<br />
3 Österreichische Forschungsstiftung für Entwicklungshilfe (Hg.) (1996). Österreichische Entwicklungszusammenarbeit.<br />
Teil A, Wien.<br />
46 <strong>ÖSTERREICHISCHE</strong> EZA – BAND 1
ENTWICKLUNGSPOLITISCHE INLANDSARBEIT<br />
Kirchliche Einrichtungen wie auch nicht-konfessionelle Entwicklungsorganisationen haben lange<br />
Jahre das Geschehen in der entwicklungspolitischen Bildungsarbeit geprägt. Sie waren und sind<br />
bedeutsame TrägerInnen und VorreiterInnen späterer öffentlicher Maßnahmen. 4<br />
Eine weiterhin große Bedeutung in der entwicklungspolitischen Inlandsarbeit haben Spenden-<br />
vorgänge. Sie werden ausschließlich von privaten Organisationen konzipiert und getragen. 314<br />
Organisationen führen regelmäßig EZA-relevante Spendenaktionen durch. 5<br />
Auch wenn die aufgebrachten Finanzmittel beträchtlich sind, bedeutsamer scheinen Spendenauf-<br />
rufe als Informationsmedium zu sein. Keine andere Informationsmaßnahme erreicht eine ähnlich<br />
hohe Zahl von Personen wie die rund 300 EZA-Spendeninitiativen.<br />
Allerdings hat die Konkurrenz am Spendenmarkt zugenommen. Spendenaufrufe nach nationalen<br />
und internationalen Katastrophen (Hochwasser Österreich 2002 oder Tsunami in Asien 2004) be-<br />
einflussen durch ihre Dominanz zumindest kurzfristig Beteiligung und Ergebnisse anderer Spen-<br />
denvorgänge. Das Spendenziel „Entwicklungshilfe/EZA“ unterliegt wie andere Bereiche großen<br />
Schwankungen.<br />
Tabelle 9<br />
SPENDENZIEL ENTWICKLUNGSHILFE/EZA<br />
1996 2000 2004<br />
Beteiligung in Prozent 11 23 13<br />
Quelle: ÖIS-Spendenstudien<br />
Ein Grund für den Rückgang 2004 gegenüber 2000 liegt zudem in der Kinderorientierung vie-<br />
ler EZA-Spendenvorgänge, etwa zum Thema Straßenkinder. Die Befragten ordneten daher diese<br />
Spendenziele verstärkt dem Bereich „Kinder“ zu (Steigerung 2000 auf 2004 von 42 auf 47 Pro-<br />
zent). Zugleich korrespondieren diese Zahlen mit den Langzeituntersuchungen zur Akzeptanz von<br />
EZA-Leistungen.<br />
Ein weiterer Hinweis auf einen enger gewordenen Spendenmarkt zeigen die Jahresergebnisse<br />
ausgewählter Spendenorganisationen.<br />
4 Bittner, Gerhard/Hans Bürstmayr (1997). Nichtregierungsorganisationen in der EZA. in: Dimensionen 2000, Wien, 435-449.<br />
5 http://www.eza.at/search2.php?tar=s, Datenbank – EZA-Spendenvorgänge. (Abfrage 14.4.2005)<br />
<strong>ÖSTERREICHISCHE</strong> EZA – BAND 1 47
ENTWICKLUNGSPOLITISCHE INLANDSARBEIT<br />
Tabelle 10<br />
EZA-SPENDENVOLUMEN NACH SPENDENZIELEN IM VERGLEICH<br />
Ausgewählte Organisationen in Mio. EURO<br />
Humanitäre Hilfe<br />
EZA<br />
1995 2000 2003<br />
Ärzte ohne Grenzen 0,02 4,10 6,52<br />
Caritas/Augustsammlung 4,19 3,58 3,14<br />
Dreikönigsaktion 8,90 10,34 12,16<br />
Umwelt<br />
Tiere<br />
Kinder<br />
Greenpeace 3,37 5,34 8,84<br />
Vier Pfoten 1,66 3,27 4,63<br />
SOS-Kinderdorf 6 12,07 17,89 15,92<br />
Quelle: ÖIS<br />
Private EZA-Einrichtungen haben in den vergangenen Jahren mehrfach die Steuerabsetzbarkeit<br />
von Spenden für Privatpersonen und Unternehmen gefordert. Das Institut für Höhere Studien 7<br />
untersuchte 2002 die möglichen ökonomischen und sozialpolitischen Auswirkungen. Nach der<br />
Tsunami-Katastrophe in Asien um die Jahreswende 2004/2005 wurde aufgrund eines Entschlie-<br />
ßungsantrages im österreichischen Nationalrat vom März 2005 eine Projektarbeitsgruppe im<br />
Bundesministerium für Finanzen eingerichtet. Ziel ist die Erarbeitung von Modellen bis Ende des<br />
Jahres 2005.<br />
Die bedeutsame Wirkweise privater Informationsmaßnahmen kann auch an Veränderungen von<br />
Begriffen abgelesen werden. „Entwicklungshilfe“ wurde zu Beginn der 1980er-Jahre durch den<br />
Begriff „Entwicklungszusammenarbeit“ ersetzt. Ähnliches erfolgte rund zehn Jahre später mit der<br />
Zuordnung „Länder im Süden“ für die Begriffe „Entwicklungsländer“ oder „Dritte Welt“.<br />
In den Jahren ab 1994 ergaben sich durch das stärkere Herausbilden von öffentlichen Maßnahmen<br />
der entwicklungspolitischen Inlandsarbeit Veränderungen. Informationsarbeit wird heute als fes-<br />
ter Bestandteil der öffentlichen EZA gesehen. Dies bedeutet für die private entwicklungspolitische<br />
Inlandsarbeit sich mit den Interessen des Staates abzustimmen und das eigene Profil zu schärfen.<br />
Die private entwicklungspolitische Inlandsarbeit steht vor einem grundlegend neuen Problem: Sie<br />
bewirbt sich – von staatlichen Stellen anerkannt und dennoch um Eigenständigkeit bemüht – um<br />
öffentliche Fördermittel.<br />
6 Zahlen SOS-Kinderdorf ohne Legate und Patenschaften.<br />
7 Institut für Höhere Studien (IHS) (Hg.) (2002). Steuerliche Begünstigungen für Spenden im Bereich Soziales und<br />
Entwicklungszusammenarbeit, Wien.<br />
48 <strong>ÖSTERREICHISCHE</strong> EZA – BAND 1
ENTWICKLUNGSPOLITISCHE INLANDSARBEIT<br />
Anders als vor 1994 konkurrieren die privaten Entwicklungsorganisationen dabei mit Maßnahmen<br />
des Bundes, der über die EZA-Sektion bzw. ab 1.1.2004 über die ADA eine eigenständige Inlands-<br />
arbeit konzipiert und durchführt bzw. durchführen (lässt). Das frühere Informationsmonopol der<br />
privaten Organisationen ist gebrochen.<br />
4.2. Arbeitsgemeinschaft Entwicklungszusammenarbeit – AGEZ<br />
Die AGEZ ist eine Plattform von mehr als 30 entwicklungspolitischen NGOs. Sie wurde 1988 von<br />
zehn Organisationen und Dachverbänden gegründet, um die gemeinsamen Anliegen gegenü-<br />
ber der Öffentlichkeit und gegenüber dem Staat besser vertreten zu können. Die AGEZ ist seit<br />
1991 als Verein organisiert. Die Finanzierung erfolgt ausschließlich aus Eigenmitteln der Mitglieds-<br />
organisationen.<br />
Die AGEZ will das Bewusstsein dafür stärken, dass die Fragen der Nord-Süd-Beziehungen von<br />
grundlegender Bedeutung für die Zukunft sind. Sie weist darauf hin, dass Entwicklungspolitik<br />
eine alle Politikbereiche umfassende Aufgabe ist und nicht auf die Entwicklungszusammenarbeit<br />
eingeschränkt werden darf. Sie will eine Entwicklungszusammenarbeit fördern, die durch ökono-<br />
mische Selbstbestimmung, politische Partizipation und kulturelle Entfaltung zu mehr Gerechtig-<br />
keit zwischen Süden und Norden beiträgt, den Benachteiligten in der Dritten Welt zur Seite steht<br />
und dass in Österreich mehr Mittel für eine so verstandene EZA bereitgestellt werden. Sie will die<br />
Kooperation von öffentlichen und privaten EZA-Einrichtungen verbessern und mit allen gesell-<br />
schaftlichen Kräften in Österreich, die an weltweiter Gerechtigkeit, Entfaltung des Friedens und<br />
Sicherung der Lebensgrundlagen interessiert sind, in einen konstruktiven Dialog treten.<br />
Mit einem Dokument 8 zur Bedeutung der Nicht-Regierungs-Organisationen machte die AGEZ auf<br />
den Stellenwert der österreichischen NGOs in der EZA und Entwicklungspolitik aufmerksam. Im<br />
aktuellen Prozess der ADA zu einer Neubewertung des Verhältnisses Staat – Privat bringt die AGEZ<br />
zur entwicklungspolitischen Inlandsarbeit ihre Positionen ein.<br />
Zur Bewältigung ihrer Aufgaben hat die AGEZ Arbeitskreise eingerichtet, in denen Positionspa-<br />
piere und Forderungskataloge erstellt und diskutiert werden. Deren Übermittlung erfolgt zumeist<br />
mit begleitender Pressearbeit. Die gemeinsamen Schwerpunkte in der Inlandsarbeit werden in<br />
der Plattform entwicklungspolitischer Inlandsarbeit der AGEZ und EU-Plattform – PEPI erarbeitet.<br />
Der Vorstand entscheidet über die thematischen Schwerpunktsetzungen und die Beteiligung an<br />
Kampagnen ( vgl. Abschnitt 6 – AGEZ-Kampagnen). Zu ausgewählten Themen werden Subarbeits-<br />
gruppen eingerichtet: Rio+10, WTO, UNTAD, Zucker, Antirassismus oder zwei Prozent der ODA für<br />
Inlandsarbeit.<br />
8 Arbeitsgemeinschaft Entwicklungszusammenarbeit-AGEZ (Hg.) (2002). Wir machen den Unterschied, Wien.<br />
<strong>ÖSTERREICHISCHE</strong> EZA – BAND 1 49
ENTWICKLUNGSPOLITISCHE INLANDSARBEIT<br />
4.3. Die Inlandsarbeit der christlichen Kirchen<br />
Die ökumenische Zusammenarbeit in Österreich hat auch in der Inlandsarbeit der christlichen Kir-<br />
chen Tradition: Vielfach wurden und werden die Kontakte der beiden großen christlichen Kirchen,<br />
der Evangelischen Kirchen A.B. und H.B. sowie der Katholischen Kirche zur informellen Zusam-<br />
menarbeit, z.B. bei gemeinsam getragenen Maßnahmen der entwicklungspolitischen Inlandsar-<br />
beit, genutzt. Anders als etwa in Deutschland besteht keine institutionelle Vernetzung.<br />
Eine bedeutsame Veränderung ergab sich durch den Prozess rund um das „Sozialwort des Öku-<br />
menischen Rates der Kirchen in Österreich“ ab 2000. Nach dreijähriger Vorbereitungszeit haben<br />
die 14 christlichen Kirchen in Österreich im November 2003 ein gemeinsames Dokument heraus-<br />
gegeben, das auch Leitlinien zur entwicklungspolitischen Inlandsarbeit aufgenommen hat.<br />
In den beiden Kapiteln 7 „Gerechtigkeit weltweit“ und 8 „Zukunftsfähigkeit: Verantwortung in<br />
der Schöpfung“ finden sich Eigenverpflichtungen an die Kirchen selbst wie auch Forderungen<br />
an staatliche Stellen und an die internationale Gebergemeinschaft. Die Kirchen sind aufgerufen,<br />
„mehr Mittel als bisher für Bewusstseinsbildung zu Fragen der internationalen Politik und mehr<br />
Ressourcen für die Mitgestaltung internationaler Vorgänge bereitzustellen“ 9 . Diese Grundfragen<br />
sind Teil einer Reflexion, die diakonische Einrichtungen – auch in der EZA – zunehmend heraus-<br />
fordert: Sie sind oft Dienstleister öffentlicher Aufträge geworden und müssen sich der Frage ihrer<br />
ursprünglichen Identität neu stellen. 10 Verbunden ist diese Identitätsfrage mit der Entwicklung so-<br />
zialethischer Aspekte in der Spendenkultur als Finanzierungsbasis für EZA-Maßnahmen. Aus dem<br />
„Almosen geben“ hat sich – parallel zum entwicklungspolitischen Gedanken „Hilfe zur Selbsthil-<br />
fe“ – spätestens ab den 1970er Jahren das solidarische Handeln als theologisches Grundmuster<br />
entwickelt. Dabei werden Paternalismus, Gönnertum oder ausschließliche Mitleidsdarstellungen<br />
kritisiert. 11<br />
Den erfreulichen Bemühungen steht vielfach eine ernüchternde Bilanz in den Kirchengemeinden<br />
gegenüber: Die Zahl der Kirchenmitglieder nimmt ebenso ab wie die Zahl der Gottesdienstbe-<br />
sucherInnen. Die Kirchengemeinden als TrägerInnen der „Dritte Welt Bewegung“ noch in den<br />
1980er Jahren haben viel an Schwung verloren. Die Aktions- und Selbstbesteuerungsgruppen von<br />
damals haben Probleme mit Mitgliederzahlen, Identität und Generationennachfolge.<br />
Mehr als der aktuell diskutierte Mitgliederschwund christlicher Kirchen, insbesondere vieler skan-<br />
dalbedingter Austritte in der Katholischen Kirche, mindert die Schwächung des Intensivsegmentes<br />
auch die entwicklungsrelevanten Ressourcen.<br />
Gab es 1980, in den Gründungsjahren einer entwicklungspolitischen Inlandsarbeit 1,6 Mio. Besuche-<br />
rInnen in katholischen Sonntagsgottesdiensten, sank diese Zahl etwas mehr als 20 Jahre später auf<br />
unter 900.000 Personen und damit um über 40 Prozent. Im gleichen Zeitraum hat die Mitglieder-<br />
zahl um eine halbe Million Menschen abgenommen. Dies sind weniger Personen als der Verlust im<br />
Intensivsegment. Die Relationen für die Jahre 1990 und 2003 zeigen ein noch dramatischeres Bild.<br />
9 Sozialwort des Ökumenischen Rates der Kirchen in Österreich, Wien 2003, 274.<br />
10 Fleßa, Stefan (2004). Wo sind die barmherzigen Samariter?, in: Frankfurter Rundschau, Nr. 170.<br />
11 Müller, Oliver (2005). Vom Almosen zum Spendenmarkt. Sozialethische Aspekte christlicher Spendenkultur, Freiburg.<br />
50 <strong>ÖSTERREICHISCHE</strong> EZA – BAND 1
ENTWICKLUNGSPOLITISCHE INLANDSARBEIT<br />
Zur Verdeutlichung des strukturellen Wandels innerhalb der christlichen Kirchen in Österreich und<br />
als Verweis auf die heute deutlich schwächeren lokalen Verankerungen wird auf unten stehende<br />
Tabelle verwiesen.<br />
Tabelle 11<br />
KIRCHENMITGLIEDER 12 UND GOTTESDIENSTBESUCHERINNEN 13<br />
Evangelische Kirche A.B. und H.B.<br />
1980 1990 2003<br />
Mitglieder 423.162 388.706 374.022<br />
Katholische Kirche<br />
Mitglieder 6.372.645 6.081.454 5.915.421<br />
Gottesdienstbesucher 1.591.791 1.339.050 881.279<br />
Quelle: ÖSTAT, Österreichische Bischofskonferenz.<br />
Entwicklungspolitische Inlandsarbeit in den Kirchen war immer vom Bemühen um einen „alterna-<br />
tiven Lebensstil" mitgeprägt 14 . Sowohl damit verbundene aktuelle Zeitbezüge, wie auch die oben<br />
erwähnten strukturellen Veränderungen sind Gründe für einen starken Wandel bei Themen und<br />
Maßnahmen.<br />
Anzumerken wäre noch, dass aus vielen kirchlichen Basisgruppen in den 1990er Jahren<br />
(Dritte)Weltläden entstanden sind. Diese Entwicklung verweist auf die „Weltorientiertheit“ kirch-<br />
licher (Eine/Dritte)-Welt-Gruppen.<br />
Die Weltläden wiederum sind Vorreiter des „Fairen Handels“. Auch hier sei auf Begrifflichkeiten<br />
hingewiesen, ist doch das Wort „fair“ in den vergangenen Jahren in vielen Bereichen, insbesonde-<br />
re in der Werbung zu einem Schlüsselbegriff geworden. Es ist kritisch zu hinterfragen, ob entwick-<br />
lungspolitisch korrekt „fair“ durch „gerecht“ ersetzt werden müsste.<br />
Zuletzt sei noch darauf verwiesen, dass entwicklungspolitische Inlandsarbeit auch Ethik im Fund-<br />
raising thematisiert. Immer wider entzündet sich dieses Thema am Beispiel des Marketinginst-<br />
rumentes „Kinderpatenschaften" 15 . An der Entwicklung neuer Qualitätsstandards in diesem Be-<br />
reich haben die Kirchen maßgeblich mitgewirkt. Die eigenständigen Kontrolleinrichtungen für<br />
Spendenverwaltung wurden mit der Einführung des Österreichischen Spendegütesiegels 2002 in<br />
beiden Kirchen eingestellt.<br />
12 Kirchenmitglieder aus Daten Volkszählungen 1981, 1991 und 2001.<br />
13 Für die Evangelischen Kirchen A.B. und H.B. liegen keine Daten zum Gottesdienstbesuch vor.<br />
14 Riedlsperger, Alois SJ (1980). Zur Ethik des alternativen Lebensstils, Innsbruck.<br />
15 Scheunpflug, Annette (2005). Die öffentliche Darstellung von Kinderpatenschaften, Nürnberg.<br />
<strong>ÖSTERREICHISCHE</strong> EZA – BAND 1 51
ENTWICKLUNGSPOLITISCHE INLANDSARBEIT<br />
4.3.1. Evangelische Kirchen A.B. und H.B.<br />
Die Evangelischen Kirchen A.B. und H.B. haben ihre Informations- und Bildungsaktivitäten primär<br />
über die Einrichtung „Evangelischer Arbeitskreis für Entwicklungszusammenarbeit-EAEZ“ (kurz<br />
Evangelische Entwicklungszusammenarbeit) gebündelt. Trägerorganisationen der 2001 gegrün-<br />
deten EAEZ sind die Aktion Brot für Hungernde, die Diakonie Auslandshilfe, der Evangelische Ar-<br />
beitskreis für Weltmission–EAWM und die Kindernothilfe Österreich. Der EAEZ setzt inhaltlich auf<br />
konkrete Projekterfahrungen und thematisiert darüber hinaus eigenständige Schwerpunkte.<br />
Wie viele Kirchen in der Diaspora – die Evangelische Kirche zählt heute rund vier Prozent an der<br />
Gesamtbevölkerung – prägt sie entwicklungspolitische Arbeit deutlich über ihren Bereich hinaus.<br />
Als ein Bespiel kann die Kampagne um eine kritische Bewertung des OMV-Engagements im Su-<br />
dan genannt werden. Ende der 1990er Jahre hatte die OMV mit anderen Konsortialpartnern ei-<br />
ne Erdölexploration im Südsudan begonnen, in deren Umfeld es zu Menschenrechtsverletzungen<br />
gekommen ist. Die – auch international getragene – Kampagne „European Coalition Oil in Sudan<br />
– ECOS“ wurde wesentlich vom EAWM koordiniert. Eine vergleichbare Entwicklung gibt es ab<br />
2003 zum Thema AIDS.<br />
Die evangelischen Einrichtungen setzen ihre bescheidenen Ressourcen über ihre Kirchengrenzen<br />
hinweg ein. Die Aktion „Brot für Hungernde“ engagiert sich in der Kampagne zu fair gehandelten<br />
Blumen. Die Auslandshilfe der Diakonie ist ein wesentlicher Träger in der Migranten- und Flüchtlings-<br />
betreuung. Dadurch wird mit „Menschenrechten“ ein wichtiges Thema in die EZA eingebracht.<br />
Strukturell bestehen mit der Aktion Brot für Hungernde, dem EAWM und der Auslandshilfe der<br />
Diakonie offizielle Einrichtungen der evangelischen Kirchen. Sie werden durch der Kirche nahe<br />
stehende Organisationen, etwa die Kindernothilfe ergänzt, die auch Trägerorganisationen oder<br />
Mitglieder der Evangelischen Entwicklungszusammenarbeit sind.<br />
Zu erwähnen sind zudem Einrichtungen, die im weiteren Sinn dem evangelikalen Bereich zuzu-<br />
ordnen sind, etwa die Wycliff-Bibelgesellschaft oder Licht für die Welt – bis 2004 als Christoffel<br />
Blindenmission bekannt.<br />
4.3.2. Katholische Kirche<br />
Entwicklungspolitische Inlandsarbeit innerhalb der Katholischen Kirche wird auf drei Ebenen geleistet:<br />
- Zum einen sind es die offiziellen, von den Diözesen beauftragten und in deren Verwal-<br />
tungsapparat miteinbezogenen Strukturen. Dazu zählen die Diözesankommissionen bzw.<br />
Welthaus-Einrichtungen. Sie stellen auch die Verbindung zu den Aktivitäten der Pfarrge-<br />
meinden dar.<br />
- Eine weitere Aktionsebene bilden die kirchlichen Hilfswerke und Bildungseinrichtungen<br />
wie die Welthäuser. Sie arbeiten als offizielle Einrichtungen der Katholischen Kirche inner-<br />
halb der „Koordinierungsstelle für Internationale Entwicklungsförderung und Mission der<br />
Österreichischen Bischofskonferenz – KOO“ zusammen.<br />
- Schließlich gibt es eine Vielzahl von katholischen Organisationen, die nicht als offizielle<br />
Einrichtungen gelten.<br />
52 <strong>ÖSTERREICHISCHE</strong> EZA – BAND 1
ENTWICKLUNGSPOLITISCHE INLANDSARBEIT<br />
Den größten Einblick in die entwicklungspolitische Inlandsarbeit der katholischen Organisationen<br />
bietet die Koordinierungsstelle der Österreichischen Bischofskonferenz für Internationale Entwick-<br />
lung und Mission – KOO. Sie hat 1978/1979 das Grundsatzprogramm der Katholischen Kirche im<br />
Auftrag der Österreichischen Bischofskonferenz erstellt. 16 Neu war die Verankerung einer „An-<br />
waltschaft“, auch im Sinn einer „Option für die Armen“. Ein wichtiges Dokument für diese Orien-<br />
tierung stellte die Enzyklika „Populorum Progressio“ von Papst Paul VI. aus dem Jahr 1977 dar.<br />
Bereits 1974 hatte der Österreichische Synodale Vorgang mehrfach auf die Bedeutung einer<br />
weltweiten Partnerschaft hingewiesen. Erstmals wurde der Beschluss gefasst, in allen Haushalten<br />
kirchlicher Strukturen (Diözesen, Pfarrgemeinden, usw.) einen Beitrag aufzunehmen. Als Richtlinie<br />
wurde je ein Prozent für Mission und Entwicklungsförderung empfohlen. 17<br />
Eine „Modernisierung“ des Dokumentes aus 1980 erfolgte ab 1997. Das neue Programm wur-<br />
de um wesentliche Themen wie Globalisierung und Verschuldung erweitert und war damit für<br />
die kommenden Jahre auch Grundlage für ein entwicklungspolitisches Engagement im Sinn ei-<br />
ner Anwaltschaft. 18 Wiederum war eine Enzyklika ein wichtiges Ausgangsdokument für die Neu-<br />
orientierung. In „Sollicitudo Rei Socialis“ spricht Papst Johannes Paul II. 1987 die Kluft zwischen<br />
dem reichen Norden und dem armen Süden sowie Entwicklungshemmnisse an und benennt sie<br />
u.a. als „Strukturen der Sünde“. Ein Begriff, der bei Entwicklungsexperten außerhalb des katholi-<br />
schen Bereiches auf Verständnisschwierigkeiten gestoßen ist.<br />
Herausragendes Beispiel für diese neue Sicht war dann die „Entschuldungskampagne“, die ab<br />
1996 von den KOO-Mitgliedsorganisationen wesentlich mitgetragen wurde. Ebenso hat die KOO<br />
die „nullkomasieben Kampagne“ mitinitiert und ist aktuell in der Trägerschaft engagiert.<br />
Ein neues Dokument des Päpstlichen Rates Iustitia et Pax „Compendium of the social doctrine of<br />
the church“ 19 wurde im Oktober 2004 vorgestellt. Es ist eine erstmalige und umfassende Zusam-<br />
menschau der Katholischen Soziallehre und wird vielfach unzutreffend als „Sozialkatechismus“<br />
bezeichnet. Die entwicklungspolitisch relevanten Abschnitte werden in den kommenden Jahren<br />
kirchliches Denken und Handeln beeinflussen.<br />
Der entwicklungspolitischen Inlandsarbeit wird im KOO-Programm von 1998 breiter Raum einge-<br />
räumt. Auch eine neue quantitative Forderung findet sich in diesem Leitbild. 15 Prozent der (für<br />
Mission und EZA) zur Verfügung stehenden Finanzmittel sollen für Bildungsarbeit und Anwalt-<br />
schaft eingesetzt werden.<br />
Die Realität sieht anders aus. Dies zeigen die diesem Bereich zugeordneten Aufwendungen der<br />
KOO-Mitgliedsorganisationen. Betrug der Bildungsaufwand 1990 4,7 Prozent der Eigenmittel,<br />
stieg er in der zweiten Hälfte der 1990er Jahre an, fiel aber 2003 wieder auf 5,2 Prozent.<br />
16 Entwicklungspolitik der Katholischen Kirche in Österreich, Jänner 1980.<br />
17 Österreichischer Synodaler Vorgang, Dokumente 1974, Beschluss 2.3.7.<br />
18 Koordinierungsstelle der Österr. Bischofskonferenz für Internationale Entwicklung und Mission-KOO (1998).<br />
Leitlinien für die Zusammenarbeit der Katholischen Kirche in Österreich mit den Partnerinnen und Partnern in der „Dritten<br />
Welt“, Wien.<br />
19 Zum Zeitpunkt der Drucklegung ist das Dokument nur in italienischer und englischer Sprache erschienen. Die deutsche<br />
Fassung wird derzeit erarbeitet.<br />
<strong>ÖSTERREICHISCHE</strong> EZA – BAND 1 53
ENTWICKLUNGSPOLITISCHE INLANDSARBEIT<br />
Tabelle 12<br />
BILDUNGSARBEIT DER KOO-MITGLIEDSORGANISATIONEN – EIGENMITTEL<br />
1990 1994 1998 2000 2003<br />
in Mio. EURO 1,92 2,92 3,24 3,90 3,02<br />
in Prozent 4,7 5,3 7,4 6,7 5,2<br />
Quelle: KOO-Jahresberichte.<br />
Pfarrgemeinderäte<br />
In den rund 3.000 katholischen Gemeinden Österreichs werden regelmäßig Pfarrgemeinderäte<br />
gewählt, zu deren Aufgabe auch Verantwortung um Weltkirche, Mission und EZA zählt. Etwa<br />
30 Prozent der Pfarrgemeinden haben eine Fachvertretung eingerichtet. Die Zahlen für die PGR-<br />
Periode 2002-2007 konnten nur für Linz, Salzburg St. Pölten und Wien erhoben werden. In den<br />
anderen Diözesen gibt es keine Aufzeichnungen. Für die Vorperiode wurden keine wesentlichen<br />
Veränderungen festgestellt.<br />
Tabelle 13<br />
WELTKIRCHENVERANTWORTUNG IN PFARRGEMEINDEN<br />
Nominierte Pfarrgemeinderat-Verantwortliche, nach PGR-Wahl 2002<br />
Pfarrgemeinderäte<br />
PGR in Linz, Salzburg, St. Pölten, Wien<br />
Ausschüsse/Verantwortliche Weltkirche<br />
Quelle: PGR – Referate der Diözesen, Datenerhebung ED – Salzburg, Jänner 2005.<br />
Ordensgemeinschaften<br />
1.800<br />
In Österreich sind mehr als 50 weibliche und männliche Ordensgemeinschaften als missionierende<br />
Orden tätig. 20 Viele Ordensgemeinschaften führen im Rahmen ihrer weltkirchlichen Verantwor-<br />
tung und aufgrund ihrer Missionstätigkeit Bildungsmaßnahmen durch, die über ihren engeren<br />
Wirkungsbereich hinausreichen.<br />
Diese Aktivitäten werden über Ordensvertretungen in der Koordinierungsstelle gebündelt. An<br />
größeren Aktivitäten sind „Steyler Missionsorden SVD“, die Initiative „Franziskaner für Ost- und<br />
Mitteleuropa“, der Salesianerorden Don Bosco mit „Jugend eine Welt“ und die Missionsprokura-<br />
tur der Jesuiten zu erwähnen. Sie treten auch als Spendenwerber öffentlich auf.<br />
Anders, aber in ihren Missionsniederlassungen zahlenmäßig stark vertreten sind Frauenorden tä-<br />
tig. Durch ihre Rückbindungen an Pfarrgemeinden vermitteln Ordensangehörige viel Information<br />
über aktuelle Entwicklungen in den Ländern im Süden.<br />
20 http://www.eza.at/search2.php?tar=o, Datenbank – Institutionen, Abfrage „Ordensgemeinschaften“ (April 2005).<br />
54 <strong>ÖSTERREICHISCHE</strong> EZA – BAND 1<br />
570
Spannungsfeld Mission-Entwicklungsförderung<br />
ENTWICKLUNGSPOLITISCHE INLANDSARBEIT<br />
Ihren Missionsauftrag unterstützt die Katholische Kirche durch fachspezifische Einrichtungen. Die<br />
Päpstlichen Missionswerke mit ihrer weltweiten Struktur und der österreichischen Einrichtung<br />
„missio Austria“ zählen dazu. Das früher viel diskutierte Verhältnis zwischen Mission und Entwick-<br />
lungszusammenarbeit schien mit dem Dokument aus 1980 inhaltlich geklärt. Überraschend hat es<br />
aber Ende der 1990er-Jahre neuerlich eine Belebung erfahren. Diesmal ging es nicht so sehr um<br />
die Begriffsbestimmung als um Strukturfragen.<br />
Unter anderem wurde die Zuerkennung von Sammelgeldern – etwa zwischen missio Austria und<br />
der Dreikönigsaktion – oder eine Mitwirkung in bestehenden Bildungskooperationen – etwa Mit-<br />
gliedschaften bei BAOBAB – neu in Diskussion gebracht. Deutlich wird dies in der Erzdiözese Wien.<br />
Das Referat für Mission und Entwicklung versteht sich vor allem als innerkirchliches Instrument<br />
einer missionarischen Bewusstseinsbildung. Folgerichtig wurde die Welthausstruktur ausgeglie-<br />
dert. Aber auch die inhaltlichen Debatten um eine Neuorientierung im Afro-Asiatischen Institut in<br />
Wien und eine drauf erfolgte Statutenordnung 1998 sowie das geringe Interesse der Erzdiözese<br />
Wien an einer notwendigen Gebäudesanierung sind Hinweise für inhaltliche Neubewertungen. 21<br />
Im römischen Dokument „Cooperatio Missionalis“ aus 2002 22 werden diese Fragen erneut ange-<br />
sprochen.<br />
Bereits ab 1986, später vor allem im Zusammenhang mit dem Kirchenvolksbegehren 1995 und<br />
dem nachfolgenden „Dialog für Österreich“ 1998, ergaben sich Auseinandersetzungen um einen<br />
neuen Kirchenkurs. Für die entwicklungspolitische Inlandsarbeit bedeutete dies Auswirkungen.<br />
Eine dem weltweiten Frieden und der Gerechtigkeit verpflichtete Kirche hatte Informations- und<br />
Bildungsmaßnahmen in ihre Organisationsgestalt aufgenommen. Dies kommt auch in den Voten<br />
des Delegiertentages zum „Dialog für Österreich“ vom Oktober 1998 zum Ausdruck. 23 Im entspre-<br />
chenden Arbeitskreisdokument wird eigens von der Notwendigkeit einer verstärkten Bildungs-<br />
arbeit gesprochen.<br />
Nun wird befürchtet, dass dies von Kirchenleitungen aufgegeben und ein innenorientiertes, dem<br />
klassischen Missionsansatz verschriebenes Engagement bevorzugt wird. „Missionarische Bewusst-<br />
seinbildung“ gilt als neuer Schlüsselbegriff.<br />
Hinzu kam, dass einige Gründerpersönlichkeiten wie auch öffentliche Mahner in der katholischen<br />
EZA verstorben waren und deren Schutzfunktion wegfiel:<br />
Der ehemalige Leiter des Institutes für Internationale Zusammenarbeit (IIZ), Prof. Otto Winkler<br />
(IIZ) verstarb 1991. Weihbischof Florian Kuntner starb als KOO-Bischof 1994, Prof. Herta Pammer,<br />
ehemals KFBÖ und KOO 1995, Eduard Ploier (OED) 1998 und schließlich Erzbischof Alois Wagner<br />
als Gründervater vieler katholischer Hilfswerke und Einrichtungen 2002. Eine „Entpolitisierung“<br />
bei Laienorganisationen und Bischöfen wird befürchtet. 24<br />
21 Man mag diese – heute nicht abgeschlossene – Diskussion vordergründig als Organisationsentwicklungen oder<br />
Sparmaßnahmen darstellen. Dahinter steht allerdings auch ein Unbehagen des traditionellen Missionsanliegens, nicht<br />
einen dem offiziellen Kirchenverständnis gerecht werdenden Stellenwert zu finden.<br />
22 Koordinierungsstelle der Österr. Bischofskonferenz für Internationale Entwicklung und Mission – KOO (2003).<br />
Jahresbericht 2003.<br />
23 Dialog für Österreich, Delegiertentag Salzburg 1998 – Votum 12/3, Seite 62<br />
24 Ornauer, Helmut (2005). in: Die Furche, Nr.2/2005.<br />
<strong>ÖSTERREICHISCHE</strong> EZA – BAND 1 55
ENTWICKLUNGSPOLITISCHE INLANDSARBEIT<br />
Schon 2000 hatten in Sorge um eine Verengung kirchlicher Positionen die Bischöfe Kardinal König,<br />
Erzbischof Wagner und Weihbischof Fasching in einem Dokument „Entwicklung ist ein anderes<br />
Wort für Friede“ 25 Stellung genommen.<br />
Das Spannungsfeld Mission – Entwicklungsförderung ist auch mit den Begriffen „Inkulturation“<br />
und „Globalisierung“ verknüpft und nicht abgeschlossen. Bereits 1991 hatten die damaligen Kardinäle<br />
Franz König und Joseph Ratzinger, heute Papst Benedikt XVI. dies in einem Streitgespräch 26<br />
angesprochen und auf die neue Gefahr eines „Eurozentrismus“ in Verbindung mit dem römischen<br />
Zentralismus hingewiesen. Andererseits werden Forderungen nach einer „Globalisierung der Soli-<br />
darität“ und einer Politikordnung auf Weltebene erhoben, die einen gerechten Wettbewerb und<br />
die Gleichberechtigung aller Länder ermöglichen 27 .<br />
Strukturfragen<br />
Die ohnehin sehr komplexe EZA-Organisationslandschaft erhält in den Einrichtungen der Katholi-<br />
schen Kirche eine zusätzliche, kaum darzustellende Vielfalt. Die Herkunftsgeschichte entwicklungs-<br />
politischer Inlandsarbeit wurzelt wesentlich in Spendenaufrufen für Auslandsprojekte. Sie ist da-<br />
durch vielfach im Auslandsbereich eingebunden. Sie hat weiterhin einen spendenrelevanten Be-<br />
zug, ist identitätsstiftend und wird ebenso als Marketingmaßnahme organisationsbezogen einge-<br />
setzt. Die Spendenmittel sind beträchtlich.<br />
Tabelle 14<br />
OFFIZIELLE EZA- UND MISSIONSSAMMLUNGEN DER KATHOLISCHEN KIRCHE<br />
1970 bis 2003 – in Mio. EURO<br />
1970 1980 1990 2000 2003<br />
Caritas-Augustsammlung 28 — 3,27 3,54 3,58 3,10<br />
DKA – Sternsingeraktion 1,07 3,63 7,62 10,34 12,10<br />
KfbÖ – Familienfasttag 0,78 1,77 2,43 2,43 2,39<br />
KMBÖ – Bruder in Not 1,10 2,56 3,26 3,48 3,65<br />
MIVA – Christophorussammlung 0,19 0,82 1,45 1,72 1,77<br />
missio-Kollekten 29 0,96 2,36 3,05 3,14 2,87<br />
Gesamt 4,10 14,41 21,35 24,69 25,88<br />
Quelle: ÖIS/<strong>ÖFSE</strong><br />
25 Österreichische Kommission Iustitia et pax. Stellungnahme: Entwicklung ist ein anderes Wort für Friede, für mehr<br />
weltweite Solidarität, September 2000.<br />
26 DIE ZEIT 1991, Nr. 9<br />
27 Marx Reinhard, Nacke Bernhard (2004). Gerechtigkeit ist möglich, Freiburg im Breisgau<br />
28 Die Caritas-Augustsammlung wird seit 1973 durchgeführt.<br />
29 Bei missio wurden die beiden verpflichtenden Kollekten „Sonntag der Weltkirche“ und die „Epiphaniesammlung“<br />
gemeinsam dargestellt.<br />
56 <strong>ÖSTERREICHISCHE</strong> EZA – BAND 1
ENTWICKLUNGSPOLITISCHE INLANDSARBEIT<br />
Dennoch lassen sich auch hier Veränderungen im Intensivsegment zeigen: Gottesdienstorientier-<br />
te Spendenvorgänge verzeichnen nur mehr bescheidene Zuwächse bzw. stagnieren. Auch Spen-<br />
denvorgänge kirchlicher Einrichtungen sind heute zum Umdenken in Richtung professionelles<br />
Fundraising gezwungen.<br />
Spendenstatistiken sind nicht nur Hinweise auf wirtschaftliche Wachstumsphasen, sondern auch<br />
Befunde zivilgesellschaftlicher Entwicklungen. Die Entdeckung der „Dritte-Welt-Arbeit“ zeigt sich<br />
nach der Pionierphase der Entwicklungshilfe in den 1960er Jahren ab 1970. Im folgenden Jahr-<br />
zehnt verdreifachte sich der Spendenertrag, dann schwächte sich der Trend laufend ab. Auffällig<br />
ist die Stagnation der Caritas-Augustsammlung, die Katastrophen thematisiert.<br />
Geldmittel für kirchliche EZA-Bildungsarbeit kommen aus auslandsorientierten Spendenvorgän-<br />
gen, werden im eigenen Bereich eingesetzt oder als „Weiterleitungen“ als Fördermittel an andere<br />
Bildungseinrichtungen gegeben. Die in Tabelle 14 erwähnten Organisationen sind, vergleichbar<br />
öffentlichen Stellen, bedeutsame Förderungsgeber.<br />
In den letzten Jahren haben einige der genannten Spendenorganisationen Förderungen zurück-<br />
genommen. Beispiele sind Rückzüge von Mitgliedschaften und Finanzengagements (missio bei<br />
BAOBAB, KMBÖ bei Fairtrade und DKA sowie KFBÖ beim AAI-Wien). Zwar zählt die Verhältnis-<br />
mäßigkeit des Mitteleinsatzes zwischen In- und Ausland sowie beim Aufwand für das Fundrai-<br />
sing zu den strittigen Fragen in Entscheidungsgremien. Die dargestellten Spendenerträge zeigen<br />
aber durchaus das Potenzial für erhöhten Aufwand der kirchlichen Inlandsarbeit. Es ist daher eher<br />
mangelnder politischer Wille und Kosten/Nutzen-Denken und weniger Finanzknappheit Ursache<br />
für die eher rückläufige Entwicklung.<br />
Dies sind auch Gründe für so manch gescheiterten Versuch, Inlandsarbeit zu bündeln und neue<br />
Organisationsstrukturen zu versuchen. So ist u.a. auf das bereits von 1983 bis 1986 tätige „Ent-<br />
wicklungspolitische Bildungszentrum (EBZ)“ von ÖED und AAI-Wien, einer „Vorläuferorganisa-<br />
tion“ zum späteren BAOBAB - zu verweisen. Entwicklungen kirchlicher Inlandsarbeit, die sich zu<br />
wiederholen scheinen – siehe die Entwicklungen bei BAOBAB oder Horizont3000 ab 2002.<br />
Bis heute bleibt eine Konsolidierung entwicklungspolitischer Inlandsarbeit immer wieder in Versu-<br />
chen stecken. An strukturellen Veränderungen sind seit 1994 vier Ereignisse besonders zu benennen:<br />
- Baobab<br />
Die Gründung der Bildungs- und Schulstelle Baobab 1992 war von der Einsicht geprägt,<br />
dass im Schulbereich durch Zusammenführung kirchlicher und anderer privater Aktivitäten<br />
größere Wirkung zu erzielen wäre. Für den nichtkirchlichen Bereich war der Österreichi-<br />
sche Informationsdienst für Entwicklungspolitik (ÖIE) – heute Südwind Agentur – der wich-<br />
tigste Partner. Der Österreichische Entwicklungsdienst (ÖED), weitere Einrichtungen wie<br />
missio Austria und die das Referat Weltkirche in der Erzdiözese Wien übernahmen Träger-<br />
funktionen bzw. Mitfinanzierungen. Rund zehn Jahre später zogen sich einige kirchliche<br />
Einrichtungen aus der Trägerschaft wieder zurück.<br />
<strong>ÖSTERREICHISCHE</strong> EZA – BAND 1 57
ENTWICKLUNGSPOLITISCHE INLANDSARBEIT<br />
- Welthaus<br />
Analog zur bereits früher gelungenen Regionalisierung des ÖIE (später Südwind Agentur)<br />
erfolgte ab 1995 der Aufbau von „Welthaus-Einrichtungen“. Sie wurden an die bestehen-<br />
den diözesanen und damit offiziellen EZA-Verantwortungen gebunden. Sie verstanden sich<br />
aber darüber hinaus als gemeinsame Plattformen Katholischer Bildungsarbeit. Es war da-<br />
mit auch die lange Zeit offene Diskussion nach Akzeptanz staatlicher Förderungen auch für<br />
den Informationsbereich der Katholischen Kirche positiv beantwortet.<br />
- Öffentliche Förderungen für Inlandsarbeit<br />
Die Katholische Kirche hatte in der EZA – anders als etwa im Schul- oder Sozialbereich –<br />
lange Zeit sehr zurückhaltend öffentliche Förderungen angesprochen, da eine zu große<br />
Abhängigkeit von öffentlichen Stellen befürchtet wurde. Ursprünglich nur im Bereich der<br />
Studienförderung (z.B. Afro-Asiatische Institute), später bei der Personalentsendung (Ins-<br />
titut für Internationale Entwicklung – IIZ und Österreichischer Entwicklungsdienst – ÖED)<br />
kam es nun auch – noch vor der Etablierung der Kofinanzierungsstelle - KFS und damit der<br />
staatlichen Förderung von kirchlichen Auslandsprojekten – zur Mitfinanzierung katholi-<br />
scher Inlandsarbeit.<br />
- Fusion ÖED, IIZ und KFS führt zu Horizont3000<br />
Eine weitere, für die entwicklungspolitische Inlandsarbeit relevante Strukturverände-<br />
rung war die Fusion der Organisationen IIZ, ÖED und KFS. Sie führte 2001 zur Gründung<br />
von Horizont3000. Die neue Durchführungsorganisation in der Katholischen Kirche hat-<br />
te neben der Personalentsendung, der Projektdurchführung auch die ÖED/IIZ-Informa-<br />
tions- und Bildungsagenden ins Programm genommen. Kurzzeitig war damit neben der<br />
Südwind-Agentur die größte Informations- und Bildungsstruktur Österreichs geschaffen.<br />
Mit dem Bemühen um Länderinformationen verbunden war u.a. der Aufbau der Website<br />
www.stiads.at – Stimmen aus dem Süden. Dies sollte mit Ressourcen ehemaliger Expertin-<br />
nen und Experten als Signal einer partnerschaftlichen Bildungsarbeit verstanden werden.<br />
Bereits 2003 musste Horizont3000 das Gesamtprogramm aufgrund von internen wie ex-<br />
ternen Finanzierungsproblemen einschränken. In diesem Zusammenhang wurde der fast<br />
zur Gänze aus Eigenmittel finanzierte Bildungsbereich aufgelöst. Die Trägerorganisationen<br />
und Eigentümer von Horizont3000 sahen keine Möglichkeit, die eigenständige Inlandsar-<br />
beit von Horizont3000 weiterzuführen und konzentrierten ihren Mitteleinsatz wiederum<br />
organisationsintern.<br />
58 <strong>ÖSTERREICHISCHE</strong> EZA – BAND 1
Diözesane Bildungsaktivitäten 30<br />
ENTWICKLUNGSPOLITISCHE INLANDSARBEIT<br />
Die Organisationsstruktur der Katholischen Kirche ist diözesan orientiert. Aus diesem Grund wird<br />
in Folge versucht, EZA-Bildungsmaßnahmen geordnet nach Diözesen zu geben und ein vergleich-<br />
bares Beschreibungsmuster anzuwenden. Über EZA-Bildungsaktivitäten der Militärdiözese ist<br />
nichts bekannt.<br />
Diözese Eisenstadt<br />
- Struktur und Finanzen<br />
In der kleinsten Diözese Österreichs gibt es seit vielen Jahren eine Bündelung von welt-<br />
kirchlicher Anliegen. In der „Fastenaktion“ erfolgt eine Koordinierung verschiedenster Ein-<br />
richtungen. Spendenmittel werden auch für Bildungsmaßnahmen eingesetzt.<br />
- Inhaltliche Entwicklung<br />
Die Diözese setzt keine eigenständigen Schwerpunkte.<br />
- Außenkooperationen<br />
Kontakte bestehen mit dem Europahaus Burgenland bzw. der SWA-Regionalstelle.<br />
Diözese Feldkirch<br />
- Struktur und Finanzen<br />
Vergleichbar zu Eisenstadt sind die Ressourcen in der kleinen Diözese begrenzt. Die zu-<br />
ständige Diözesankommission für Weltkirche und Entwicklung koordiniert auch Bildungs-<br />
maßnahmen. Allerdings ist auf die große Dichte pfarrlicher Aktivitäten, die sich auch in der<br />
Trägerschaft einiger Weltläden zeigt, hinzuweisen.<br />
Als große Einrichtung ist das Aussätzigenhilfswerk mit Sitz in Bregenz zu nennen, das mit<br />
missio Austria eine enge Verbindung hat.<br />
- Inhaltliche Entwicklung<br />
Die Diözese setzt keine eigenständigen Schwerpunkte.<br />
- Außenkooperationen<br />
Gute Kontakte bestehen zum Land Vorarlberg und zur AGEZ – Vorarlberg.<br />
Diözese Graz-Seckau<br />
- Struktur und Finanzen<br />
Das Welthaus Graz ist die diözesane Einrichtung aller kirchlicher Aktivitäten der Entwick-<br />
lungszusammenarbeit und Mission und ist zugleich Hauptakteur in der Inlandsarbeit. Die<br />
Diözese Graz-Seckau stellt dem Welthaus zwei Prozent des Haushaltes für internationale<br />
Zusammenarbeit zur Verfügung. 20 Prozent der EZA-Mittel werden für Informations- und<br />
Bildungsmaßnahmen gegeben.<br />
In der Steiermark wurde 1989 eine „Plattform entwicklungspolitischer Gruppen“ eingerich-<br />
tet. Das Sekretariat ist im Welthaus beheimatet.<br />
Aktuell wird der Versuch unternommen, durch eine Regionalisierung dem Schwerpunkt<br />
30 Die nachfolgenden Darstellungen wurden den verantwortlichen Stellen zur Begutachtung übermittelt und deren<br />
Reaktionen soweit möglich berücksichtigt.<br />
<strong>ÖSTERREICHISCHE</strong> EZA – BAND 1 59
ENTWICKLUNGSPOLITISCHE INLANDSARBEIT<br />
Graz entgegenzuwirken und lokale Strukturen, etwa durch Kooperationen mit Stadtbibli-<br />
otheken, zu fördern. Eigenständige kirchliche Akteure in der Bildungsarbeit sind das Afro-<br />
Asiatische Institut Graz die Dreikönigsaktion sowie missio.<br />
- Inhaltliche Entwicklung<br />
Wichtige Themen sind rund um den Fairen Handel angesiedelt. Aktuell wird das Thema<br />
„Ernährungssicherheit“ bearbeitet. Zudem ergeben sich durch die bereits langjährige Inte-<br />
gration der Ostzusammenarbeit weitere Bildungsschwerpunkte. Zehn Prozent der Osthilfe<br />
werden in diese Maßnahmen investiert.<br />
- Außenkooperationen<br />
Mit dem Land Steiermark und den Städten Gleisdorf und Graz bestehen gute Kontakte in<br />
der Zusammenarbeit zum Fairen Handel, das Welthaus ist im Beirat des Landes vertreten.<br />
Diözese Gurk-Klagenfurt<br />
- Struktur und Finanzen<br />
Neben der Diözesankommission für Weltkirche und Mission bieten nur missio, das Missi-<br />
onskloster Wernberg, die Missionsaktion des slowenischen Seelsorgeamtes, die Kfb und die<br />
Katholische Hochschulgemeinde Bildungsangebote.<br />
- Inhaltliche Entwicklung<br />
Es gibt keine eigenständige Themensetzung.<br />
- Außenkooperationen<br />
keine<br />
Diözese Innsbruck<br />
- Struktur und Finanzen<br />
Die mit der Welthaus-Gründung verbundene Strukturerwartung wurde in Innsbruck sehr<br />
konsequent entwickelt. Die großen kirchlichen Akteure sind in dieser Struktur innerhalb<br />
der Caritas und unter einer Leitung zusammengefasst. Auch wenn die beteiligten Einrich-<br />
tungen unter ihrer „Marke“ eigenständig auftreten, bietet das Welthaus insbesondere für<br />
die Bildungsagenden eine arbeitsteilige und abgestimmte Vorgangsweise.<br />
Das Welthaus wird aus diözesanen Mitteln kofinanziert, in einem Beirat sind andere Bil-<br />
dungsakteure wie die Diözesanstellen der DKA oder Kfb eingebunden. Mit den Ordens-<br />
werken besteht loser Kontakt.<br />
- Inhaltliche Entwicklung<br />
Das Welthaus setzt eigenständige Themen, die auch von der Auslandsarbeit bei Caritas,<br />
Bruder und Schwester in Not sowie missio Tirol gestützt werden. Es gibt ein großes Ange-<br />
bot an Workshops und Vorträgen zu entwicklungspolitischen Themen sowie zu interkultu-<br />
rellem Lernen.<br />
- Außenkooperationen<br />
Kontakte bestehen zum Amt der Tiroler Landesregierung; die Welthaus-Akteure arbei-<br />
ten in der AGEZ-Tirol mit und sind mit lokalen Initiativen wie etwa Weltläden vernetzt.<br />
60 <strong>ÖSTERREICHISCHE</strong> EZA – BAND 1
Diözese Linz<br />
- Struktur und Finanzen<br />
ENTWICKLUNGSPOLITISCHE INLANDSARBEIT<br />
In der Diözese Linz besteht eine Diözesankommission für Weltkirche und Entwicklungsför-<br />
derung, die innerhalb der Welthausgruppe tätig ist. Sie nimmt sowohl die ihr zukommen-<br />
de Beratungsfunktion innerhalb diözesaner Vorgänge als auch eine Koordinationsfunktion<br />
und die Vertretung nach außen wahr.<br />
Die Diözese Linz leistet etwa ein Prozent vom Gesamthaushalt für Auslandshilfe, davon<br />
je ein Drittel für Mission, Entwicklungszusammenarbeit und Osthilfe. 2004 standen rund<br />
110.000 EURO zur Verfügung, die Verwaltung dieses Fonds ist Aufgabe des Welthauses.<br />
An großen kirchlichen Akteuren mit Inlandsarbeit ist die Missionsverkehrsarbeitsgemein-<br />
schaft – MIVA zu nennen.<br />
- Inhaltliche Entwicklung<br />
In der Diözese Linz ist seit jeher die Weltkirchenverantwortung nicht nur auf der diözesa-<br />
nen, sondern auch auf Pfarrebene fest verankert.<br />
Die Gruppen haben sich in den vergangenen zehn Jahren zunehmend mit inlandsrelevan-<br />
ten Fragen beschäftigt. Eine Konsequenz dieser Entwicklung war die vielfache Umbenen-<br />
nung in Eine-Welt-Gruppen. Das Welthaus Linz hat seit 2002 eine eigenständige Mediathek<br />
über die Diözesanverwaltung angeboten. Thematische Schwerpunkte sind Impulse entlang<br />
der großen internationalen Konferenzen (WTO, Umwelt), Fairtrade, Ernährungssicherheit<br />
und die Spendenberatung.<br />
- Außenkooperationen<br />
Abstimmungen in der Bildungsarbeit erfolgen über die AGEZ Oberösterreich, die Südwind<br />
Agentur, das Land Oberösterreich und die Städtepartnerschaften. Etwa alle drei Jahre fin-<br />
det ein Treffen der oberösterreichischen Eine-Welt-Gruppen statt, die vom Welthaus Linz<br />
eingeladen werden.<br />
Erzdiözese Salzburg<br />
- Struktur und Finanzen<br />
In der Erzdiözese Salzburg ist mit der Diözesankommission für Weltkirche und Entwick-<br />
lungszusammenarbeit (DKWE) eine offizielle kirchliche Stelle eingerichtet. DKWE ist auch<br />
Mitglied der Welthaus-Gruppe und ist insbesondere für die Inlandsarbeit, auch im Tiroler<br />
Diözesananteil zuständig. Die Finanzierung erfolgt aus Diözesanmitteln und Beiträgen der<br />
Pfarrgemeinden (56.000/2004), die zehn Cent pro Katholik für die DKWE-Tätigkjeit über-<br />
geben. Insgesamt stehen rund 225.000 EURO für eigene Bildungsarbeit sowie Förderungen<br />
lokaler Gruppen und Auslandsprojekte – insbesondere in den Partnerdiözesen der Erzdiö-<br />
zese Salzburg – zur Verfügung.<br />
Lokale Aktivitäten werden durch jährliche „Eine-Welt-Feste“ in den verschiedenen Regi-<br />
onen unterstützt. Eigenständige kirchliche Bildungsorganisationen leisten noch das AAI-<br />
Salzburg und BONDEKO sowie „Alle Missionsorden Salzburgs – AMOS“.<br />
Das Bildungshaus St. Virgil setzt eigenständige Angebote zu entwicklungspolitisch relevan-<br />
ten Themen.<br />
- Inhaltliche Entwicklung<br />
Wirtschaftsthemen rund um den Fairen Handel sowie die von der Welthaus-Gruppe<br />
<strong>ÖSTERREICHISCHE</strong> EZA – BAND 1 61
ENTWICKLUNGSPOLITISCHE INLANDSARBEIT<br />
bearbeiteten Themen sind Schwerpunkte. Weiters ergeben sich Informationsangebote aus<br />
den offiziellen Diözesanpartnerschaften mit Bolivien, Kongo und Südkorea.<br />
Bei der DKWE ist eine Materialstelle eingerichtet.<br />
- Außenkooperationen<br />
Mit dem Land Salzburg bestehen über den Entwicklungspolitischen Beirat gute Kontakte.<br />
Kirchliche Organisationen sind Mitglieder in der EZA-Plattform Salzburg und kooperieren<br />
mit Akteuren aus dem nichtkirchlichen Bereich.<br />
Diözese St. Pölten<br />
- Struktur und Finanzen<br />
Wie in der Diözese Eisenstadt bildet die „Fastenaktion“ die Sammelorganisation für Projek-<br />
te in Afrika, Asien, Lateinamerika und Österreich. Die Diözesankommission für Weltkirche<br />
und Entwicklungsförderung – WEKEF ist für die Bildungs- und Lobbyarbeit zuständig.<br />
Eine anderen Diözesen vergleichbare Welthausinitiative besteht nicht, dennoch arbeitet<br />
WEKEF im Welthaus-Verband mit.<br />
- Inhaltliche Entwicklung<br />
Aktuelle Themen sind die MDGs, damit verbunden die Unterstützung der 0,7-Prozent-<br />
Kampagne sowie das Thema „Welthandel-WTO“, auch am Beispiel „Fairer Handel“, Ernäh-<br />
rungssicherheit und Frauenthemen.<br />
- Außenkooperationen<br />
Über ein „Aktionsteam“ bestehen Kontakte zu anderen EZA-Einrichtungen, insbesondere<br />
zum Südwind. Kaum Kontakte gibt es zum Amt der Niederösterreichischen Landesregierung.<br />
Erzdiözese Wien<br />
- Struktur und Finanzen<br />
In der Erzdiözese Wien – sie umfasst die Stadt Wien sowie das östliche Niederösterreich<br />
– gibt es keine Diözesankommission sondern ein Referat für Weltkirche und Mission, das<br />
auch die Bildungsaktivitäten kirchlicher EZA- und Missionseinrichtungen zu koordinieren<br />
versucht. Ein Beirat umfasst alle für Weltkirche relevanten diözesanen Einrichtungen.<br />
Das im Referat ursprünglich angesiedelte „Welthaus Wien“ wurde aus Diözesanmitteln<br />
nicht weiterfinanziert und ist nun der Katholischen Aktion zugeordnet. Die Mitwirkung<br />
des Referates bei BAOBAB wurde 2003 zurückgelegt. Das Referat wird aus Diözesanmitteln<br />
mit jährlich rund 140.000 EURO dotiert und finanziert damit nur mehr Missionsprojekte..<br />
- Inhaltliche Entwicklung<br />
Für die Erzdiözese Wien können zwei inhaltliche Entwicklungen beschrieben werden. Das<br />
Referat versteht sich als Stabstelle zur Stärkung eines missionarischen Bewusstseins. Erste<br />
Zielgruppen sind die PGR-Verantwortlichen. Das Welthaus nimmt eine breitere Themen-<br />
stellung wahr. Zielgruppen sind kirchliche Gruppen oder Schulen, etwa über das Religions-<br />
pädagogische Institut. Schwerpunktthemen sind Fairer Handel und Weltwirtschaft<br />
- Außenkooperationen<br />
Zu anderen EZA-Einrichtungen in Wien sowie in den niederösterreichischen Diözesanteilen<br />
gibt es Kontakte durch das Welthaus. Zur Gänze fehlen Kooperationen des Referates mit<br />
öffentlichen Stellen in der Stadt Wien und dem Land Niederösterreich.<br />
62 <strong>ÖSTERREICHISCHE</strong> EZA – BAND 1
4.3.3. Andere christliche Kirchen<br />
ENTWICKLUNGSPOLITISCHE INLANDSARBEIT<br />
Über eine entwicklungspolitische Bildungsarbeit weiterer christlicher Kirchen in Österreich ist we-<br />
nig bekannt. Bedeutsam war mit Sicherheit die gemeinsame Erstellung des Sozialwortes 2003 31 ,<br />
das auch wichtige Impulse für eine Innenorientierung geben wollte. Von besonderem Interesse<br />
war die erstmalige Mitwirkung orthodoxer Kirchen.<br />
So ist darauf zu verweisen, dass alle christlichen Kirchen Österreichs nicht nur eine Anhebung der<br />
öffentlichen EZA-Mittel gefordert haben, sondern sich in ihrem Bereich zu einem eigenständigen<br />
Stufenplan zur Erhöhung eigener Finanzmittel verpflichtet haben.<br />
Schließlich ist auf die Entwicklungsorganisation der Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten hinzu-<br />
weisen. Die „Adventist Development Agency (ADRA)“ wurde 1992 in Österreich gegründet und<br />
wirkt neben ihrer Tätigkeit in der humanitären Hilfe u.a. an Informationsmaßnahmen innerhalb<br />
der EU-Plattform und der nullkommasieben-Kampagne mit.<br />
4.4. Private Entwicklungsorganisationen<br />
Die Landschaft der privaten Entwicklungsorganisationen mit Bildungsbezug abseits einer Einbin-<br />
dung in den Bereich der christlichen Kirchen ist äußerst vielfältig. Die Vielfalt bedingt auch das<br />
Fehlen einer Koordinationsstruktur, wie sie für die Kirchen teilweise gegeben ist. Dies macht auch<br />
eine Darstellung nach Interessen oder Aktivitäten so schwierig.<br />
Insgesamt ist auf eine beachtliche Ausweitung entwicklungspolitischer Inlandsarbeit durch priva-<br />
te, nichtkirchliche Einrichtungen hinzuweisen. Der bereits erwähnte Anstieg von EZA-Bundesmit-<br />
teln Anfang der 1990er Jahre und neue Spendenorganisationen waren dafür wesentlich. Hinzu<br />
kam eine thematische Annäherung der EZA zu verwandten Bereichen, etwa dem Umwelt- oder<br />
dem Friedensthema. Das Klimabündnis, das Institut für Frieden und Entwicklung oder Ärzte ohne<br />
Grenzen sind Beispiele dafür.<br />
Die privaten, keiner Kirche zuordenbaren Entwicklungsorganisationen bieten ein buntes Bild. Eine<br />
übersichtliche Darstellung ist nicht möglich. Aus diesem Grund soll versucht werden, einen Über-<br />
blick nach Bundesländern geordnet zu geben. Wichtige Auskünfte gaben Verantwortliche in den<br />
lokalen Südwind-Strukturen.<br />
Burgenland<br />
Entwicklungspolitische Inlandsarbeit wird im Burgenland nur von wenigen privaten Initia-<br />
tiven geleistet. Die wichtigste Adresse ist das Europahaus Burgenland, ein selbstständiger<br />
Verein. Hier befindet sich auch (im Einvernehmen mit der Südwind-Bundesagentur) die<br />
SWA-Regionalstelle Burgenland.<br />
Weitere kleine Privatinitiativen sind auf lokaler Ebene tätig, so etwa das St. Christophorus<br />
Haus in Oberschützen, oder an verschiedenen Schulen. Eine der wenigen friedenspolitischen<br />
Institutionen mit entwicklungspolitischer Orientierung besteht in Schlaining seit vielen<br />
Jahren mit dem dortigen Friedenszentrum.<br />
31 Sozialwort des Ökumenischen Rates der christlichen Kirchen in Österreich, 2003, Wien.<br />
<strong>ÖSTERREICHISCHE</strong> EZA – BAND 1 63
ENTWICKLUNGSPOLITISCHE INLANDSARBEIT<br />
Kärnten<br />
Die private EZA im Burgenland bemängelt die fehlende EZA-Verantwortung im Amt der Bu-<br />
genländischen Landesregierung, wo eine solche Kompetenzzuordnung nicht eingerichtet ist.<br />
Die von NGOs und Initiativen getragene private EZA im Bundesland ist bei geringer insti-<br />
tutioneller Ausprägung klein. Dies entspricht der allgemein schwachen Ausprägung zivil-<br />
gesellschaftlichen Engagements in Kärnten. Seit 1995 besteht ein Entwicklungspolitischer<br />
Beirat beim Amt der Kärntner Landesregierung mit Fördermitteln, war aber über mehrere<br />
Jahre nicht aktiv. Erst 2004 nahm er seine Tätigkeit wiederum auf.<br />
Dem Beirat gehören Vertretungen aus politischen Parteien, dem universitären Bereich,<br />
kirchlichen Organisationen und sechs Mitglieder weiterer NGOs an.<br />
Der Beirat empfiehlt auch Förderungen für Informationsarbeit.<br />
Im Bundesland besteht ein Dachverband der privaten EZA-Organisationen, Sitz des Verban-<br />
des ist der Österreichische Informationsdienst für Entwicklungspolitik (ÖIE – Kärnten).<br />
Das Bündnis für Eine Welt mit Sitz in Villach ist die herausragende Bildungsorganisation.<br />
Ein Teilprojekt ist die Klimabündniskoordination in Kärnten. Entsprechend groß sind auch<br />
thematische Verschränkungen. Die schulische Bildungsarbeit ist dem Prinzip des „Globalen<br />
Lernens“ verpflichtet. Über globalisierungskritische Themen wird versucht, entwicklungs-<br />
politisches mit sozial- und umweltpolitischem Engagement zu verbinden. Kooperationen<br />
bestehen mit Schulen und Gemeinden, Gewerkschaften, dem Ernteverband und weiteren<br />
Initiativen. Mit dem Pädagogischen Institut (PI) besteht eine Kooperation zur Belletristik<br />
aus dem Süden. Informationsangebote bietet das Bündnis Eine Welt/ÖIE u.a. mit seiner<br />
Bibliothek und Rundbriefen. Weitere Informationsangebote bestehen durch die Universität<br />
Klagenfurt. Im Bundesland sind aktuell sechs Weltläden tätig.<br />
Niederösterreich<br />
Im Bundesland Niederösterreich ist eine regionale Zweiteilung gegeben. Wie im kirchlichen<br />
Bereich durch die unterschiedliche Diözesanzuständigkeit besteht auch bei anderen priva-<br />
ten Einrichtungen eine Regionalorientierung. Deutlich wird dies in den beiden Südwind-<br />
Regionalstellen in St. Pölten (West) und Wr. Neustadt (Süd). Allen Bildungsmaßnahmen<br />
sind thematische und organisatorische Zugänge gleich: Der Faire Handel, Frauenfragen<br />
und interkultureller Dialog sind Einstiege für Workshops an Schulen und in Gruppen. Da-<br />
durch konzentrieren sich Bildungsaktivitäten auch auf Schulstandorte. Verstärkt wird dies<br />
durch die an diesen Orten eingerichteten Weltläden.<br />
Thematische Zusammenarbeit gibt es mit dem Klimabündnis, dem auch durch das Amt der<br />
NÖ-Landesregierung mit dem Fairen Handel ein Förderungsschwerpunkt eingeräumt wurde.<br />
In Niederösterreich besteht beim Amt der Landesregierung ein „Arbeitskreis Entwicklungs-<br />
politik“. Mitglieder sind nur die beiden Südwind-Regionalstellen. Für 2005 ist die Veröf-<br />
fentlichung eines entwicklungspolitischen Positionspapiers geplant.<br />
Zu erwähnen sind noch grenzüberschreitende Kontakte nach Tschechien und in die Slowa-<br />
kei, die über das EU-Programm „INTERREG“ und Vermittlung des Landes gefördert werden.<br />
64 <strong>ÖSTERREICHISCHE</strong> EZA – BAND 1
Oberösterreich<br />
Steiermark<br />
ENTWICKLUNGSPOLITISCHE INLANDSARBEIT<br />
In Oberösterreich gibt es eine große Organisationsdichte. Weiterhin bestehen viele lokale<br />
Initiativen, die oft neben ihrer Auslandsorientierung Bildungsarbeit leisten. Die Arbeitsge-<br />
meinschaft Entwicklungszusammenarbeit OÖ versucht dies zu koordinieren und ist Platt-<br />
form für gemeinsame Aktionen und Kampagnen. Zuletzt wurde 2001 zum Fairen Handel<br />
eine landesweite Aktion durchgeführt. Die AGEZ-OÖ wird derzeit von der Regionalstellen<br />
Oberösterreich der Südwind-Agentur betreut.<br />
Neben den Informationsbüros von Südwind und WEKEF/Welthaus in Linz besteht auch in<br />
Braunau mit dem Informationszentrum 3Welt eine leistungsfähige Bildungsorganisation<br />
von regionaler Bedeutung. Die ÖGB-Initiative „weltumspannend arbeiten“ war lange Zeit<br />
auf das Bundesland konzentriert, hat sich 2004 aber als eine österreichweite Aufgabe neu<br />
orientiert.<br />
Beim Amt der OÖ-Landesregierung gibt es keinen entwicklungspolitischen Beirat, Förde-<br />
rungen für Bildungsarbeit werden organisationsbezogen gegeben. Das Land vergibt alle<br />
zwei Jahre den Eduard Ploier Preis, auch für Personen und Einrichtungen der Inlandsarbeit.<br />
Das Schwerpunktthema der letzten Jahre war der Faire Handel, auch als „Aufhänger“<br />
für Workshops, Ausstellungen oder Diskussionsveranstaltungen. Trotz der großen Orga-<br />
nisationsdichte sind die Weltläden im Bundesland weniger verbreitet. Themen des Fairen<br />
Handels führen aber weiter zu Fragen der Weltwirtschaft, der Bedeutung internationaler<br />
Organisationen (WTO, u.a.). Im Bundesland gibt es mehrere lokale ATTAC-Gruppen, die<br />
Kontakte zur entwicklungspolitischen Szene pflegen.<br />
Grundlagen für entwicklungspolitische Informations- und Bildungsarbeit bieten u.a. die<br />
Mediathek der Südwind – Agentur sowie die Initiative 3Welt in Braunau.<br />
Die privaten EZA-Einrichtungen haben im Bundesland Steiermark zwei Vernetzungsebe-<br />
nen: Die Arbeitsgemeinschaft Entwicklungszusammenarbeit koordiniert die „professionel-<br />
len“ NGOs. Auch hier ist eine Eingrenzung auf AkteurInnen der Inlandsarbeit wie in ande-<br />
ren Bundesländern bemerkenswert.<br />
Eine zweite Vernetzung besteht in der Plattform entwicklungspolitischer Gruppen, die<br />
zweimal jährlich einen Informationsaustausch lokaler steirischer Initiativen ermöglicht.<br />
Die größte, nicht dem kirchlichen Bereich zuzuordnende Einrichtung im Bundesland ist<br />
Südwind Steiermark mit einem anderen Regionaleinrichtungen ähnlichen Programm. Das<br />
Büro in Graz ist in enger Kooperation mit dem Klimabündnis tätig. Aktuelle Themenstel-<br />
lungen sind die Millennium Development Goals, Globales Lernen oder Produkteworkshops<br />
zu fair gehandelten Waren. Einen besonderen Schwerpunkt bieten ReferentInnenangebote<br />
mit vorwiegend Studierenden aus Entwicklungsländern. Dadurch will man diesen Ländern<br />
„eine Stimme geben“. Wichtigste Zielgruppen sind Schulen und Gemeinden.<br />
Um eine Regionalisierung im Bundesland bemüht wird ein entwicklungspolitisches Medi-<br />
enpaket für örtliche Bibliotheken und Büchereien angeboten. Weitere regionale Zentren<br />
sind die Weltläden in ihren sehr unterschiedlichen Ausprägungen mit der Besonderheit<br />
der steirischen „Eine Welt Laden“-Kette, die nicht der ARGE Weltläden zugezählt werden<br />
kann. Der Faire Handel ist auch Ausgangspunkt für das Gespräch mit politischen Gemein-<br />
den, etwa aktuell in Gleisdorf oder Knittelfeld.<br />
<strong>ÖSTERREICHISCHE</strong> EZA – BAND 1 65
ENTWICKLUNGSPOLITISCHE INLANDSARBEIT<br />
Salzburg<br />
Weitere wichtige Einrichtungen sind das Grazer Büro für Frieden und Entwicklung, WUS<br />
Austria mit dem Bemühen um Studienförderung auch im Zusammenhang mit der Ostzu-<br />
sammenarbeit und ATTAC-Steiermark.<br />
Die Zusammenarbeit mit dem Amt der Steirischen Landesregierung wird durch einen Ent-<br />
wicklungspolitischen Beirat gewährleistet. Rund 30 Prozent des vom Land zur Verfügung<br />
gestellten Budgets werden für Inlandsarbeit gegeben. 2002 kam es nach einer Entwick-<br />
lungspolitischen Enquete zu einem Entschluss des Landtages, den Fairen Handel zu unter-<br />
stützen und in öffentlichen Einrichtungen fair gehandelte Produkte zu fördern.<br />
Auf Gemeindeebene wurde das Grazer Büro für Frieden und Entwicklung bereits erwähnt,<br />
die Städtepartnerschaften in Leibnitz und Mürzzuschlag sind nur wenig in die Inlandsarbeit<br />
eingebunden. An der Universität Graz ist ein Wahlfach „Global Studies“ in Vorbereitung.<br />
Im Bundesland Salzburg sind rund 15 private Einrichtung in der Bildungsarbeit tätig. Die<br />
größten Organisationen haben gemeinsam mit kirchlichen Einrichtungen die „Plattform<br />
entwicklungspolitischer Gruppen“ ins Leben gerufen. Dieser Plattform gehören keine Aus-<br />
landsorganisationen an und sie versteht sich nicht als Vertretung privater EZA-Anliegen ge-<br />
genüber der EZA des Landes Salzburg. Die Plattform versucht eine inhaltliche Abstimmung,<br />
insbesondere zur Öffentlichkeitsarbeit und eine Terminkoordination, als Ansprechpartner<br />
ist Südwind-Salzburg tätig.<br />
Private Organisationen sind weiters im „Entwicklungspolitischen Beirat“ beim Amt der Salz-<br />
burger Landesregierung eingebunden. Über diese Struktur haben sich auch Schwerpunkte<br />
bei den Zielgruppen ergeben: Den Schulbereich sowie Kultur (hier gemeinsam mit dem<br />
AAI-Salzburg) bearbeitet Südwind, Bildungsmaßnahmen für Studierende aus EL das AAI, In-<br />
tersol bemüht sich um Projekte und Öffentlichkeitsarbeit, der Kirchenbereich wird von der<br />
Diözesankommission vertreten. Das Zusammenspiel privater und öffentlicher EZA hat auch<br />
eine – nicht schriftlich festgelegte – Budgetaufteilung zur Folge. 20 Prozent des Landes-<br />
haushaltes werden für Inlandsarbeit eingeplant, wobei 16 Prozent an die Plattform gehen.<br />
Südwind ist die größte EZA-Bildungsorganisation in Salzburg. Ursprünglich Teil der Süd-<br />
wind-Österreichstruktur ist Südwind Salzburg heute selbstständig, kooperiert aber inhalt-<br />
lich mit der SWA-Bundesstelle. Themenschwerpunkte waren in den letzten Jahren der Fai-<br />
re Handel, der etwa die Grundlage für zwei Drittel der 200 jährlich abgehaltenen Schul-<br />
workshops darstellt. Für 2005 ist ein Umzug in das Zentrum „ARGE-Kultur“ in Salzburg-<br />
Nonntal geplant und soll zusätzliche Kooperationsmöglichkeiten, auch durch die dann zentrale<br />
Lage bringen.<br />
Die Bedeutung des Fairen Handels ist auch in der Niederlassung der EZA-GmbH. im Bundes-<br />
land Salzburg, seit 2005 in Köstendorf begründet. Dieser Zugang sowie die Weltläden im<br />
Land werden für Bildungsmaßnahmen genutzt.<br />
Als Einrichtung der katholischen Erwachsenenbildung bemüht sich das Bildungshaus St.<br />
Virgil um entwicklungspolitische Angebote im Eigenprogramm sowie in Kooperation mit<br />
verschiedenen, auch nichtkirchlichen EZA-Initiativen.<br />
Eine Besonderheit ist die Website www.salzb.org.at. Sie wurde als Personeninitiative 2001<br />
eingerichtet und versteht sich als Internetplattform Salzburger EZA-Organisationen.<br />
Neben Selbstdarstellungen gibt es einen Überblick zu Veranstaltungen und Angeboten.<br />
66 <strong>ÖSTERREICHISCHE</strong> EZA – BAND 1
Tirol<br />
Vorarlberg<br />
ENTWICKLUNGSPOLITISCHE INLANDSARBEIT<br />
Die privaten EZA-Organisationen haben sich im Bundesland Tirol zur „Arbeitsgemeinschaft<br />
Entwicklungszusammenarbeit“ zusammengeschlossen. Die AGEZ-Tirol versteht sich als ent-<br />
wicklungspolitisches Sprachrohr und begleitet die EZA im Amt der Tiroler Landesregierung<br />
kritisch. Die AGEZ-Mitglieder sind vorwiegend inlandsorientiert, eine Kooperation mit<br />
Auslandseinrichtungen fehlt wie in anderen Bundesländern. Eine zusätzliche Vernetzung<br />
bietet die „Plattform gegen GATS und für eine gerechte Welt“. In ihr wirken private und<br />
kirchliche Einrichtungen mit. Sie wurde von Südwind Tirol ab 2002 aufgebaut und koordi-<br />
niert. Aktuell ist das Welthaus zuständig.<br />
Die größte private Bildungseinrichtung ist Südwind-Tirol. Zu den aktuellen Schwerpunkten<br />
zählen der Schulbereich mit den rund 60 Workshops – wichtigstes Themen sind auch hier der<br />
Faire Handel, jährliche Ausstellungen, das Projekt „Education for Global Citizenship“, das<br />
Thema „Frauenarbeitswelten“ sowie der Aufbau lokaler Bildungsstützpunkte in Hall, Inns-<br />
bruck und Landeck als Versuch, Maßnahmen der Erwachsenenbildung zu setzen. Einen neu-<br />
en Schwerpunkt stellt ab 2004 der „Arbeitskreis Globales Lernen“ mit Beteiligung von Ent-<br />
wicklungsorganisationen, Universitäten und Pädagogischen Fortbildungseinrichtungen dar.<br />
Zu den Besonderheiten der Regionalstelle Tirol der SWA zählt die Nord/Süd-Bibliothek. Sie<br />
wird gemeinsam mit dem Klimabündnis getragen. Hervorzuheben ist weiters das Thema<br />
Film, das am Standort Innsbruck besonders durch das jährliche Filmfestival gepflegt wird.<br />
Eine Kooperation besteht mit der ARGE Weltläden, die ihre Marketingabteilung in Inns-<br />
bruck beheimatet hat. Die große Zahl von Weltläden im Bundesland verweist auch auf eine<br />
allgemeine Entwicklung der 1990er Jahre. Solidaritäts- und Aktionsgruppen haben eine<br />
institutionelle (und unternehmerische) Wandlung erfahren.<br />
Im Bundesland Vorarlberg besteht eine „Arbeitsgemeinschaft Entwicklungszusammenar-<br />
beit“, die kirchliche Einrichtungen, konfessionell ungebundene AkteurInnen und Einrich-<br />
tungen der Erwachsenenbildung umfasst. Wesentliche Aufgabe ist der Informationsaus-<br />
tausch, die AGEZ versteht sich aber auch als Sprachrohr gegenüber der öffentlichen EZA<br />
beim Amt der Vorarlberger Landesregierung.<br />
Für die konkrete Inlandsarbeit außerhalb der kirchlichen Strukturen ist die Südwind-Regio-<br />
nalstelle die bedeutendste Einrichtung. Sie ist in das Programm der SWA – Bundesagentur<br />
eingebunden. Hauptzielgruppen sind im pädagogischen Bereich Schulen, Kindergärten und<br />
offene Jugendarbeit. Workshops werden – auch in Kooperation mit Weltläden – in Schulen,<br />
Pfarrgemeinden, offenen Jugendgruppen, öffentlichen Bibliotheken, Ferienprogrammen in<br />
den Gemeinden und Bildungshäusern angeboten. Wichtige Themen sind der Faire Handel,<br />
die Clean Clothes Campagne oder Fair Play. Darüber hinaus werden entwicklungspolitische<br />
Themen im Rahmen von Südwind-Ausstellungen und Diskussionen aufbereitet. Kooperati-<br />
onspartner außerhalb der entwicklungspolitischen AkteurInnen sind der ÖGB, ATTAC, das<br />
Katholische Bildungswerk, offene Jugendarbeit oder die Grüne Bildungswerkstatt.<br />
Informationsmöglichkeiten bietet die SWA-Bibliothek, die Einbindung in den Österreichi-<br />
schen Bibliotheksverband ergab ein zusätzliches Interesse. Die Arbeitsgemeinschaft der<br />
Weltläden hat ihren Hauptsitz in Feldkirch, weiterhin ist die Dichte der Läden gemessen an<br />
der Einwohnerzahl die größte aller Bundesländer.<br />
<strong>ÖSTERREICHISCHE</strong> EZA – BAND 1 67
ENTWICKLUNGSPOLITISCHE INLANDSARBEIT<br />
Wien<br />
Das Amt der Vorarlberger Landesregierung fördert die SWA-Regionalstelle sowie Projekte<br />
der Inlandsarbeit, soweit ein Bezug zum Bundesland Vorarlberg gegeben ist.<br />
Die entwicklungspolitische Landschaft im Bundesland Wien, zugleich Stadtgemeinde, ist<br />
durch eine auch in anderen Politikfeldern gegebene Sondersituation gekennzeichnet: Die<br />
Vielzahl von Österreichniederlassungen privater EZA-Organisationen verdeckt den Mangel<br />
an kommunal orientierten Initiativen.<br />
So sind die Angebote entwicklungspolitischer Inlandsarbeit zahlreich aber kaum konkret<br />
auf Wien bzw. seine Bezirke abgestimmt. Der Versuch, etwa durch Bezirkspartnerschaften<br />
diese Situation zu verändern, ist kaum weiterentwickelt worden.<br />
Eine auf das Profil einer Großstadt zugeschnittene EZA-Bildungsarbeit besteht daher nicht.<br />
Nur wenige Ansätze, etwa zu Schulthemen oder im universitären Bereich bewegen sich be-<br />
wusst im städtischen Umfeld. Private Einrichtungen haben teilweise ihrer in Wien tätigen<br />
Bundesstelle die Wienagenden übergeben. Ein Beispiel dafür ist die Südwind- Agentur.<br />
Diese Sondersituation findet sich auch in der geringen Wahrnehmung von Aktivitäten in<br />
der öffentlichen EZA. Entwicklungspolitische Inlandsarbeit ist in Wien oft thematisch mit<br />
Integrations- und Migrationsthemen verschränkt. So ist für die privaten EZA-Organisatio-<br />
nen das Amt der Landesregierung kaum Ansprechpartner für Förderungen.<br />
4.5 Spendenvorgänge, Fundraising<br />
Historisch gesehen kann man die Entstehung entwicklungspolitischer Inlandsarbeit auch Spenden-<br />
vorgängen zuordnen. Viele, insbesondere kirchliche EZA-Organisationen haben mit ihren Spen-<br />
denaufrufen Informationsblätter, Materialien und Behelfe zumindest für die verantwortlichen<br />
Spendensammler erstellt. Schließlich zeigen auch die jeweiligen Sammelaufrufe wie Plakate ein<br />
interessantes Zeitbild entwicklungspolitischen Bewusstseins.<br />
Die Studien des Österreichischen Institutes für Spendenwesen 32 aus den Jahren 1996, 2000 und<br />
2004 33 belegen die große Akzeptanz des Spendenzieles „Entwicklungszusammenarbeit“. Rund<br />
drei Viertel der Bevölkerung spenden zumindest einmal im Jahr Geld. Dies ergibt für 2004 ein<br />
Spendenvolumen von rund 400 Mio. EURO jährlich. Etwa 40 Prozent des Volumens sind auslands-<br />
orientiert. Die Entwicklungszusammenarbeit hat hier eine starke Verankerung.<br />
Ab etwa 1990 kam es in Österreich zu Ausweitungen im Spendenmarkt. Die Professionalisierung<br />
im Fundraising und neue Informationstechnologie führten zum Entstehen neuer Spendenorga-<br />
nisationen. Die Dominanz kirchlicher Einrichtungen ging zu Ende, der Spendenmarkt geriet in<br />
Bewegung. Auch im EZA-Bereich wurden mehrere Organisationen aktiv, die bereits in anderen eu-<br />
ropäischen Ländern tätig waren. Zu erwähnen sind Ärzte ohne Grenzen, World Vision, die Schwes-<br />
tern Marias oder Licht für die Welt – Christoffel Blindenmission.<br />
Aktuell zu erwähnen ist die große Spendenbereitschaft nach der Flutkatastrophe zur Jahreswende<br />
2004/05 in Südostasien.<br />
32 Das Österreichische Institut für Spendenwesen ist Teil der <strong>ÖFSE</strong><br />
33 Institut für Markt- Meinungs und Medienforschung (Hg.) (2005). Spendenmonitor 2004, Linz<br />
68 <strong>ÖSTERREICHISCHE</strong> EZA – BAND 1
ENTWICKLUNGSPOLITISCHE INLANDSARBEIT<br />
Innerhalb von vier Wochen wurden mit großer Unterstützung der Medien, insbesondere der Akti-<br />
on „Nachbar in Not“ 34 fast 30 Mio. EURO gespendet.<br />
Die Bedeutung von Spendenvorgängen liegt primär in der Prägung politischen Bewusstseins.<br />
Spenden bedeutet Engagement für ein Anliegen, Unterstützung einer zivilgesellschaftlichen Ein-<br />
richtung, die gleichsam als Mediator privates Engagement übernimmt. Über Spendenvorgänge<br />
erhalten EZA-Organisationen ihren gesellschaftlichen Rückhalt und können dies gegenüber dem<br />
Staat nachweisen.<br />
Ebenso bedeutsam sind Spendenvorgänge für die Organisationsfinanzierung. Diese Einnahmen<br />
werden aber zumeist deutlich überschätzt. Nur rund zehn Prozent der NPO-Finanzierung kommen<br />
aus Spendeneinnahmen 35 auch wenn dies auf österreichische EZA-Einrichtungen in höherem Prozentsatz<br />
zutreffen mag. 36<br />
Dennoch ist Spendengeld für die Organisationen überaus wertvoll: Es ist „Entwicklungsgeld“, als<br />
einzige Finanzierungsquelle nicht abrechnungspflichtig, ermöglicht also freies Gestalten.<br />
Mit dem Boom am Spendenmarkt kam die Forderung nach Transparenz und Qualitätsstandards.<br />
Internationale Spendenorganisationen kamen mit einem anderen Spendenverständnis nach Ös-<br />
terreich. Irritationen zu Ethik im Fundraising und neuen Werbemethoden waren die Folge. Die<br />
EZA-Organisationen waren schließlich maßgeblich an der Erarbeitung eines Regulatives beteiligt,<br />
das mit dem Österreichischen Spendegütesiegel 2002 einen Ausweis fand. Die nach dreijähriger<br />
Probephase durchgeführte Evaluierung hat im Dezember 2004 zu einer Weiterentwicklung des<br />
Spendegütesiegels geführt 37 .<br />
Die große Spendenaktivität der österreichischen Bevölkerung aus Anlass der Tsunami-Katastrophe<br />
hatte 2005 eine weitere Konseqenz: Im Bundesministerium für Finanzen wurde eine Projektgrup-<br />
pe mit dem Ziel eingerichtet, bis Ende 2005 Modelle für eine Steuerabsetzbarkeit von privaten<br />
Spenden und Unternehmensspenden zu erarbeiten. Bereits 2002 hatte das Institut für Höhere<br />
Studien eine entsprechende Studie vorgelegt 38 .<br />
34 Die Aktion „Nachbar in Not“, 1992 aus Anlass der Kriege in Ex-Jugoslawien eingerichtet, hat 2003 in der Rechtsform<br />
einer Stiftung eine inhaltliche Veränderung vorgenommen: Als „Nachbarn“ werden damit auch Menschen in fernen<br />
Ländern verstanden. Spendenkampagnen ergaben sich zuletzt für Ruanda, Sudan/Region Darfur und die von der<br />
Flutkatastrophe betroffenen Länder in Südostasien.<br />
35 Anheier/Salamon. John-Hopkins-Studie, u.a., in: Badelt, Christoph (2003, 3. Auflage). Handbuch der Nonprofit<br />
Organisationen.<br />
36 Bittner, Gerhard (2002). Armut und Spenden, in: Österreichische Forschungsstiftung für Entwicklungshilfe (Hg.) (2003).<br />
Österreichische Entwicklungspolitik 2002. Berichte, Analysen, Informationen. Armutsbekämpfung – zur Umsetzung der<br />
Millennium Development Goals, Wien, 25-30.<br />
37 Für die Vergabe des Österreichischen Spendegütesiegels ist weiterhin die Kammer der Wirtschaftstreuhänder zuständig.<br />
38 Institut für Höhere Studien (IHS) (2002). Steuerliche Begünstigungen für Spenden im Bereich Soziales und Entwicklungszusammenarbeit,<br />
Wien.<br />
<strong>ÖSTERREICHISCHE</strong> EZA – BAND 1 69
ENTWICKLUNGSPOLITISCHE INLANDSARBEIT<br />
5. ENTWICKLUNGSPOLITISCHE<br />
INLANDSARBEIT<br />
KONKRETE ORGANISATIONSMASSNAHMEN<br />
IN AUSGEWÄHLTEN THEMENBEREICHEN<br />
Der folgende Abschnitt gibt einen Überblick zu Aktionsfeldern in der entwicklungspoliti-<br />
schen Inlandsarbeit. Einzelne Vorhaben werden zur Illustration näher dargestellt. Es ist<br />
damit keine Bewertung der Qualität dieser Maßnahmen verbunden. Die Beispiele dienen<br />
der Veranschaulichung der ersten Abschnitte dieser Publikation bzw. als Beleg für die Viel-<br />
fältigkeit der Gesamtmaßnahmen.<br />
Die Darstellungen der Programme und Projekte beruhen im Wesentlichen auf Berichten und Web-<br />
veröffentlichungen der namentlich genannten Organisationen. Die Vielfalt wird durch Zusammen-<br />
fassung in „Themenzentren“ gebündelt. Wir sprechen daher von:<br />
- Bildung und Begegnung<br />
- Entwicklungspolitischer Bildungsarbeit und Globalem Lernen<br />
- Wissenschaft und Forschung<br />
- themenbezogenen Programmen wie Fairer Handel, Tourismus, usw.<br />
- Kunst und Kultur<br />
- Publikationen<br />
- Öffentlichkeitsarbeit<br />
- Film, Fernsehen und Radio<br />
- Schwerpunktthemen und Kampagnen<br />
- Öffentlichkeitsarbeit der OEZA<br />
- Public Support<br />
Diese Gliederung führt zu einer teilweisen Mehrfachnennung von Organisationen, die in den ver-<br />
schiedenen Themenfeldern tätig sind.<br />
Für die themenorientierte Darstellung im vorliegenden Abschnitt 5 wollten und konnten die Heraus-<br />
geber keinen Anspruch auf Vollständigkeit erfüllen und sind für die Auswahl verantwortlich. Sie<br />
sind ebenso verantwortlich für mögliche Fehlbewertungen. Schließlich mussten auch eventuelle Ver-<br />
änderungen, die nach Redaktionsschluss Ende August 2005 stattfanden, unberücksichtigt bleiben.<br />
Um ausreichend Information bereitzustellen, wurde wichtigen Organisationen in der vorliegenden<br />
Publikation zusätzlicher Raum für Eigendarstellung gegeben. Diese Eigendarstellungen sind im<br />
Abschnitt 6 enthalten. Eine Gesamtliste der Akteure in der Entwicklungspolitischen Inlandsarbeit<br />
findet sich im Anhang.<br />
<strong>ÖSTERREICHISCHE</strong> EZA – BAND 1 71
ENTWICKLUNGSPOLITISCHE INLANDSARBEIT<br />
Eine analoge, wenn auch nicht deckungsgleiche Themenorientierung besteht in den Finan-<br />
zierungsansätzen der aus dem EZA-Budget geförderten Projekte und Programme von EZA-<br />
Organisationen.<br />
Das von 1995 bis 2005 durch KommEnt verwaltete Fördervolumen wurde bereits im Abschnitt 3<br />
dargestellt und wird hier nochmals als Gesamtüberblick in Erinnerung gerufen:<br />
Tabelle 15<br />
NGO-FÖRDERUNGEN AUS EZA-BUDGET - ABWICKLUNG KOMMENT in Tsd. EURO<br />
1996 2000 2001 2002 2003<br />
NGO-Förderungen 3.550 3.017 3.826 4.063 2.119<br />
5.1. Bildung und Begegnung<br />
Überblick<br />
Der Abschnitt „Bildung und Begegnung“ umfasst drei Bereiche:<br />
- Die Service- und Beratungsstellen stehen allen Interessierten offen und wenden sich im<br />
Besonderen an jene, die im pädagogischen Bereich tätig sind.<br />
- „Orte der Begegnung“ sind öffentliche Veranstaltungszentren und Treffpunkte für Grup-<br />
pen und Einzelpersonen. Durch ihre Geschichte sind viele dieser Einrichtungen auch stark<br />
mit der Förderung von Studierenden aus Entwicklungsländern verbunden.<br />
- Praktika und Projektreisen erfreuen sich immer größerer Beliebtheit und sprechen im Be-<br />
sonderen junge Menschen an.<br />
5.1.1. Service- und Beratungsstellen<br />
Die Entwicklung einer allgemein zugänglichen bundesweiten Beratungs- und Servicestruktur für<br />
entwicklungspolitische Inlandsarbeit begann 1979 mit der Gründung des Österreichischen Infor-<br />
mationsdienstes für Entwicklungspolitik (ÖIE). Ende der 1980er Jahre war dieser Prozess so gut<br />
wie abgeschlossen. Organisationspolitische Veränderungen in den 1990er Jahren – aus dem ÖIE<br />
wurde die Südwind Agentur und im katholischen Bereich konstituierte sich die Welthausgruppe<br />
– bedeuteten keine grundlegenden Veränderungen in der Ausrichtung.<br />
Es gibt heute Service- und Beratungsstellen in allen Bundesländern: Das Europahaus Burgenland in<br />
Eisenstadt mit einer Außenstelle in Oberschützen, Baobab, missio, das Interkulturelle Zentrum, die<br />
Servicestelle Menschenrechtsbildung und das Forum Umweltbildung in Wien, Südwind Niederös-<br />
terreich-Süd in Wiener Neustadt und Südwind Niederösterreich-West in St. Pölten, die Südwind<br />
Agentur Oberösterreich in Linz, die Informationsstelle für Internationale Beziehungen in Braunau;<br />
Südwind Steiermark und die Mediathek des Welthauses sowie das Büro für Frieden und Entwick-<br />
lung in Graz; das Bündnis für Eine Welt/ÖIE Kärnten in Villach; Südwind Salzburg; die Südwind<br />
72 <strong>ÖSTERREICHISCHE</strong> EZA – BAND 1
ENTWICKLUNGSPOLITISCHE INLANDSARBEIT<br />
Agentur Tirol in Innsbruck und die Südwind Agentur Vorarlberg in Dornbirn.<br />
Alle Orte sind inzwischen langjährige Treffpunkte und Servicestellen für an Information und Bil-<br />
dung Interessierte. Ihre Hauptfunktionen sind die Fachberatung von MultiplikatorInnen, der Ver-<br />
kauf und Verleih von Materialien, sie dienen als Anlaufstellen für Anfragen, bieten kleineren Ver-<br />
einen Orte der Versammlung und fördern die Ehrenamtlichkeit in ihrem Umfeld.<br />
Die Afro-Asiatischen Institute in Wien, Graz und Salzburg, das Österreichische Lateinamerika-Institut<br />
und die Österreichische Orientgesellschaft/Hammer-Purgstall in Wien bieten auf bestimmte Weltre-<br />
gionen bezogene Informationen und interkulturellen wie teilweise auch interreligiösen Dialog an.<br />
Die Austrian Development Agency (ADA) beantwortet als Informationsbüro der Österreichischen<br />
Entwicklungs- und Ostzusammenarbeit Anfragen zur OEZA und schickt bei Bedarf die offiziell<br />
erhältlichen Dokumente und Materialien zu.<br />
SÜDWIND Agentur/Bundesorganisation<br />
Die Südwind Agentur (SWA) ist aus dem Österreichischen Informationsdienst für Entwicklungs-<br />
politik hervorgegangen, der 1979 gegründet wurde und in seinen Nachfolgeorganisationen 2004<br />
ein Vierteljahrhundert alt wurde. Eigentümer der Agentur ist der Verein „Südwind – Verein für<br />
entwicklungspolitische Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit“.<br />
Der Verein Südwind-Entwicklungspolitik (und damit auch die Agentur) verstehen sich als eine<br />
Plattform für Menschen, die für menschenwürdige Lebensbedingungen in den Entwicklungslän-<br />
dern und eine nachhaltige Entwicklung eintreten. Der Verein und seine Agentur haben sich zum<br />
Ziel gesetzt, die Öffentlichkeit über Entwicklungsprobleme und Entwicklungspolitik zu informie-<br />
ren. Das Ziel der Informationsarbeit ist sowohl die Auseinandersetzung mit den Auswirkungen der<br />
Globalisierung als auch die Förderung des Kontakts mit Lebensstil, Kunst und Kultur der Menschen<br />
in der südlichen Welt.<br />
Verein und Agentur sind Initiator und Mitträger verschiedener Kampagnen wie zuletzt zum The-<br />
ma Wasser, zum Fairen Handel oder zu sauberer Kleidung (Clean Clothes).<br />
Das zentrale Anliegen der SWA ist das Globale Lernen. Dieses Lernkonzept schließt inhaltlich an<br />
die Globalisierung der Lebensverhältnisse an. Angeboten werden Beratungen, Workshops, päd-<br />
agogische Bibliotheken und Materialien sowie Weiterbildungen. Die SWA entwickelte erlebnis-<br />
orientierte Ausstellungen speziell für Kinder und Jugendliche, in denen diese selbst tätig werden.<br />
Für Führungen stehen geschulte Fachleute aus den jeweiligen Herkunftsregionen zur Verfügung.<br />
Die Beratungstätigkeiten in den Regionalstellen umfassen sowohl die methodische Unterstützung<br />
bei der Vorbereitung und Umsetzung des Bildungskonzepts „Globales Lernen“ als auch das An-<br />
gebot von für die Praxis erprobten Materialien, die verliehen und verkauft werden. Für Referate,<br />
Diskussionen oder für die Leitung von Workshops zu entwicklungspolitischen Themen gibt es die<br />
Möglichkeit, geschulte ReferentInnen anzufordern. Produkteworkshops bieten eine Auseinander-<br />
setzung mit Rohstoffen und Produkten, die in Entwicklungsländern erzeugt und in Europa konsu-<br />
miert werden. Die Lebensbedingungen der Menschen, die diese Produkte erzeugen, sollen kennen<br />
gelernt und ein Gefühl der Solidarität geweckt werden.<br />
Den Kindern und Jugendlichen wird in anschaulicher Form vermittelt, welche Wege unsere Kon-<br />
sumgüter zurücklegen, welches Ausmaß an Arbeit und welche Geschichte in ihnen steckt.<br />
<strong>ÖSTERREICHISCHE</strong> EZA – BAND 1 73
ENTWICKLUNGSPOLITISCHE INLANDSARBEIT<br />
Südwind – Einrichtungen in den Bundesländern<br />
Die SWA unterhält Regionalstellen im Burgenland, in Wien, Oberösterreich, Tirol und Vorarlberg.<br />
In Niederösterreich, Salzburg, Steiermark und Kärnten sind seit Mitte der 1990er Jahre jeweils<br />
eigene Vereine Träger der vergleichbaren Tätigkeit. Deren Projekte werden ebenfalls aus öffent-<br />
lichen Mitteln gefördert. In Kärnten liegt ein besonderer Schwerpunkt auf der Erwachsenenbil-<br />
dung, in Niederösterreich Süd auf grenzüberschreitenden (EU-)Projekten.<br />
Bildungs- und Schulstelle Baobab<br />
Baobab wurde 1993 vom ÖIE, dem ÖED und der Dreikönigsaktion der Katholischen Jungschar<br />
als gemeinsame Bildungs- und Schulstelle ins Leben gerufen. Seit 1998 ist Baobab als Verein kon-<br />
stituiert. Heute tragen fünf Institutionen 1 als Mitgliedsorganisationen Arbeit und Anliegen von<br />
Baobab als Bildungs- und Schulstelle für Globales Lernen. Die Beratung von LehrerInnen, Ver-<br />
antwortlichen in Kinder- und Jugendarbeit sowie ein online-ReferentInnenservice gehören zur<br />
Kernkompetenz.<br />
In einer von Baobab und <strong>ÖFSE</strong> betreuten Organisations- und ReferentInnen-Datenbank werden<br />
Organisationen sowie Einzelpersonen, die Bildungsveranstaltungen zu Globalem Lernen anbieten,<br />
erfasst.<br />
Um die inhaltliche Abstimmung, Vernetzung und Kooperation zwischen entwicklungspolitischen<br />
Organisationen zu fördern, sammelt und dokumentiert Baobab in „Planungslisten“ Informationen<br />
über geplante Aktivitäten und Publikationen jener österreichischen Organisationen, die zu den<br />
Themen Entwicklung, Umwelt, Interkulturalität, Menschenrechte, Frieden arbeiten.<br />
Weltbilder – Medienstelle<br />
1998 wurde in Kooperation mit der OEZA bei Baobab die Medienstelle „Weltbilder“ eingerich-<br />
tet. Sie fördert die Verbreitung von Filmen, Videos und DVDs zu entwicklungspolitischen Themen<br />
unter besonderer Berücksichtigung der österreichischen Schwerpunktregionen sowie Schwer-<br />
punktthemen der OEZA und macht sie durch den Erwerb der Lizenzen für Bildungszwecke zu-<br />
gänglich.<br />
In der Reihe „Weltbilder“ erscheinen Filme zu Nord-Süd-Themen, die einen Einblick in den All-<br />
tag und die Probleme des Südens geben. Die Filme dokumentieren internationale Entwicklungen,<br />
greifen aktuelle Fragen auf und informieren über die Anliegen der Österreichischen Entwicklungs-<br />
zusammenarbeit. Damit wird ein Beitrag zur Kommunikation über globale Entwicklungen und<br />
Entwicklungszusammenarbeit geleistet.<br />
Die Medien werden österreichweit im Verleih und Verkauf angeboten. Zu ausgewählten Doku-<br />
mentar- und Spielfilmen werden schriftliche Hintergrundinformationen und Arbeitshilfen erstellt.<br />
Durch die Bereitstellung didaktischen Begleitmaterials wird die Qualität der pädagogischen Nut-<br />
zung der Filme für Unterrichts- und Bildungszwecke gefördert.<br />
Eine neue Initiative ist seit 2005 die Beratung von ORF-JournalistInnen. Eine Arbeitsgruppe von<br />
JournalistInnen, NRO-VertreterInnen und MitarbeiterInnen der OEZA führte in den letzten Jahren<br />
mehrere Gespräche mit Sendungsverantwortlichen im ORF.<br />
1 Dreikönigsaktion der Katholischen Jungschar, Horizont3000, Südwind Agentur, Jugend Eine Welt, <strong>ÖFSE</strong>.<br />
74 <strong>ÖSTERREICHISCHE</strong> EZA – BAND 1
ENTWICKLUNGSPOLITISCHE INLANDSARBEIT<br />
Es gibt u.a. einen regelmäßigen Newsletter, mit dem die Redaktionen im ORF über aktuelle<br />
Schwerpunkte in der entwicklungspolitischen Inlandsarbeit, über aktuelle Veranstaltungen und<br />
interessante Gäste, die nach Österreich kommen, informiert werden. BAOBAB wertet jede Woche<br />
das Fernsehprogramm nach Filmen zu entwicklungspolitischen Themen aus und stellt diese Film-<br />
tipps als wöchentliche kostenlose Serviceleistung zur Verfügung.<br />
Welthaus – Einrichtungen<br />
Die Welthaus-Einrichtungen entstanden Mitte der 1990er-Jahre durch Kooperation katholischer<br />
Informations- und Bildungsstellen. Eine nähere Beschreibung findet sich im Abschnitt 4. Welthaus<br />
bietet über seine diözesanen Stellen (in Graz, Linz, Innsbruck, Salzburg, St. Pölten und Wien) ein<br />
vielfältiges Service, insbesondere für katholische Pfarrgemeinden und Schulen.<br />
5.1.2. Orte der Begegnung<br />
Es zählt heute nicht zu den Schwerpunkten in der österreichischen EZA, Orte der Begegnung zu<br />
fördern. So haben sich nur wenige Einrichtungen herausgebildet, die als multifunktionale Begeg-<br />
nungszentren bezeichnet werden können. Es sind die Afro-Asiatischen Institute in Graz und Wien<br />
sowie – mit Einschränkungen – das Österreichische Lateinamerikainstitut, das Afro-Asiatische Ins-<br />
titut in Salzburg, die Österreichische Orientgesellschaft Hammer-Purgstall und das Centre Univer-<br />
sitaire International. Es ist bemerkenswert, dass deren Errichtung mehrheitlich auf Überlegungen<br />
aus dem Beginn einer strukturierten Entwicklungszusammenarbeit um 1960 zurückgeht und in<br />
Verbindung mit der Förderung von Studierenden aus Entwicklungsländern zu sehen ist. Letztere<br />
sollen die Möglichkeit zur Begegnung mit ihren österreichischen KollegInnen erhalten.<br />
Die entwicklungspolitische Inlandsarbeit kann dadurch kaum auf eigene Hausstrukturen zurück-<br />
greifen. Eine Folge sind die geringe Verortung auch lang bestehender Einrichtungen an einer<br />
Adresse und die räumliche Zersplitterung.<br />
Erst Anfang der 1990er Jahre entstand mit der Idee eines entwicklungspolitischen Zentrums in Wien<br />
wiederum der Versuch, eine Vielfalt an EZA-Aktivitäten an einem Ort zu bündeln. Das Zentrum<br />
„Berggasse 7“ im 9. Wiener Gemeindebezirk wurde 1993 eröffnet und versammelte auf 2.400<br />
m² eine große Anzahl von Organisationen. Mit dem Zentrum wurde auf die Verbreiterung von<br />
Themen und Zielgruppen Rücksicht genommen:<br />
Die neu gegründete Bildungs- und Schulstelle Baobab deckte den pädagogischen Bereich ab, das<br />
Ludwig-Boltzmann-Institut für Menschrechte (BIM) führte über die engere EZA hinaus. Der ÖIE<br />
war der Informations- und Bildungsarbeit, die <strong>ÖFSE</strong> dem Wissenschafts- und Dokumentationsbe-<br />
reich verpflichtet. Der Österreichische Entwicklungsdienst (ÖED, ab 2001 Horizont3000) errichtete<br />
im Gebäude sein Vorbereitungszentrum für ausreisende ExpertInnen. Die Kofinanzierungsstelle<br />
(KFS, heute Teil von Horizont3000) war eine weitere Mieterin. Von ihrer Gründung an hatte die<br />
Arbeitsgemeinschaft Entwicklungszusammenarbeit (AGEZ) als NGO-Dachverband ihr Büro in der<br />
Berggasse.<br />
Hinzu kamen später der Verein Frauensolidarität und in ihren Gründungszeiten TransFair (heute<br />
Fairtrade), Oikocredit, die Initiative zu ethischer Geldveranlagung, die Genderorganisation WIDE<br />
und Christian Solidarity International. Die <strong>ÖFSE</strong> war Initiatorin und für das Projekt hauptverant-<br />
<strong>ÖSTERREICHISCHE</strong> EZA – BAND 1 75
ENTWICKLUNGSPOLITISCHE INLANDSARBEIT<br />
wortlich. Das Projekt Berggasse 7 scheiterte nach rund zehn Jahren an Managementfehlern und<br />
aus Kostengründen.<br />
Das geringe Interesse an der Förderung von Begegnungsorten zeigt sich heute auch an deren<br />
räumlichen Zuständen. Fehlende Investitionen vermitteln oft nach außen ein eher tristes Bild.<br />
Die baulichen Gegebenheiten und Raumausstattungen entsprechen kaum dem Standard von<br />
Bildungseinrichtungen und Begegnungsstätten. Dies steht auch in einem großen Gegensatz zu<br />
Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit vieler EZA-Einrichtungen, für die längst ein zeitgemäßes<br />
Erscheinungsbild selbstverständlich geworden ist.<br />
Afro-Asiatisches Institut in Wien (AAI Wien)<br />
Das AAI in Wien wurde 1959 als kirchliche Stiftung gegründet. Es will interkulturellen und in-<br />
terreligiösen Austausch ermöglichen, um einerseits das Wissen über afrikanische und asiatische<br />
Kulturen zu fördern und andererseits den fremden Kulturen in Wien eine Plattform zu bieten.<br />
Das AAI ist das meist frequentierte entwicklungspolitische Begegnungszentrum in Österreich. Ein<br />
besonderes Anliegen seiner Bildungsarbeit ist es, entwicklungspolitische und interkulturelle Pro-<br />
gramme für Schulen, Jugendgruppen und die Erwachsenenbildung anzubieten. Die Schulaktionen<br />
umfassen Gespräche mit StudentInnen aus Afrika und Asien. Die vorhandenen sakralen Einrich-<br />
tungen (Hindutempel, Kapelle und Moschee) sind zudem ein Anziehungspunkt für an Religionen<br />
interessierte Menschen.<br />
Ein anderer Bereich der Bildungsarbeit findet im Forum für Studierende seinen Ausdruck. Gesell-<br />
schaftspolitische Themen bilden die Basis für die Auseinandersetzung mit entwicklungspolitischen<br />
Fragestellungen. Workshops, Seminare, Kulturabende und Exkursionen sind Teil des studienbeglei-<br />
tenden Bildungsangebots.<br />
In den vergangenen Jahren gab es Diskussionen zur inhaltlichen Ausrichtung des AAI. 1998 wurde<br />
vom Wiener Erzbischof ein neues Statut mit mehr innerkirchlicher Orientierung verordnet. Interne<br />
Probleme führten zu maßgeblichen Kürzungen öffentlicher Förderungen. Das AAI gab sich 2004<br />
ein neues Leitbild, das wieder stärkere entwicklungspolitische Komponenten aufweist.<br />
Afro-Asiatisches Institut Graz (AAI Graz)<br />
Das Institut ist mit seinem Bildungs- und Kulturprogramm ein Informationszentrum für Entwick-<br />
lungsfragen und fördert den internationalen Kulturaustausch. Darüber hinaus bietet es studienbe-<br />
gleitende Bildungsmaßnahmen für Studierende aus Entwicklungsländern. Neben allgemeinen Be-<br />
ratungs- und Informationsleistungen und der Betreuung einer internationalen Galerie gibt es An-<br />
gebote für Schul- und Jugendgruppen v. a. zu interkulturellen Themen und Fragen der Integration.<br />
Ziel der Bildungsarbeit des AAI Graz ist es, den entwicklungspolitischen Diskurs in einer lebendi-<br />
gen Kommunikationsstruktur zu ermöglichen. Zu einem besonders erfolgreichen Event der inter-<br />
kulturellen Begegnung hat sich der Multikultiball entwickelt, der jährlich an der Universität Graz<br />
stattfindet. Das AAI Graz feierte 2004 seinen 40. Geburtstag.<br />
76 <strong>ÖSTERREICHISCHE</strong> EZA – BAND 1
Afro-Asiatisches Institut Salzburg (AAI Salzburg)<br />
ENTWICKLUNGSPOLITISCHE INLANDSARBEIT<br />
Das AAI Salzburg wurde im Jahr 1988 gegründet. Es initiiert und fördert Diskussionen zu weltpo-<br />
litischen Fragestellungen und tritt als Anwalt für gerechte Strukturen ein. Das Institut ist Mitglied<br />
der International Intercultural Management Group (IICMG), ein Zusammenschluss mehrerer ein-<br />
schlägig tätiger Institutionen und Organisationen auf EU-Ebene.<br />
Über Seminare und Workshops wird der interkulturelle Austausch gefördert. Auch über Musik<br />
und Tanz wird der Salzburger Bevölkerung das Leben der Menschen in anderen Kontinenten nä-<br />
her gebracht.<br />
Österreichisches Lateinamerika-Institut (ÖLAI)<br />
Das LAI wurde 1965 als Verein mit dem Ziel gegründet, den Dialog zwischen Österreich und La-<br />
teinamerika zu intensivieren.<br />
Zu den Zielsetzungen des Instituts gehören neben der Förderung von wirtschaftlichen Beziehun-<br />
gen zwischen Lateinamerika und Österreich sowohl die Planung und Durchführung österreichi-<br />
scher Maßnahmen der Entwicklungszusammenarbeit als auch die Vertiefung der kulturellen und<br />
wissenschaftlichen Beziehungen. Einen wesentlichen Teil der Aktivitäten macht die Informations-<br />
arbeit zu Lateinamerika aus.<br />
Österreichische Orientgesellschaft/Hammer-Purgstall (ÖOG)<br />
Die ÖOG pflegt die Kontakte zwischen Österreich und den Ländern des islamischen Orients, infor-<br />
miert über Einrichtungen und Entwicklungen in Nordafrika, im Nahen und Mittleren Osten, in den<br />
Ländern Zentralasiens und Südkaukasiens, betreut Studierende aus diesen Ländern und will den<br />
interkulturellen Dialog vertiefen.<br />
Die ÖOG bietet laufend Sprachkurse, Informations- und Bildungsveranstaltungen an und orga-<br />
nisiert kulturelle und gesellschaftliche Veranstaltungen, wie z. B. Exkursionen. Im Rahmen dieser<br />
Veranstaltungen werden auch ReferentInnen und KünstlerInnen vermittelt. Darüber hinaus steht<br />
allen Interessierten, besonders aber auch den Studierenden des Orient-Lehrgangs, eine Bibliothek<br />
zur Verfügung.<br />
Centre International Universitaire (CIU)<br />
Seit 2003 heißt der ehemalige Club International Universitaire „Centre International Universi-<br />
taire“. Das CIU wurde 1931 als erste österreichische Betreuungsorganisation für ausländische Stu-<br />
dierende gegründet. Ziel des CIU ist es, als Begegnungsstätte für ausländische und österreichische<br />
Studierende und AkademikerInnen zu dienen.<br />
Der Bildungs- und Kulturaustausch dient der Förderung der internationalen Völkerverständigung.<br />
Die Beratungstätigkeit umfasst Auskünfte zu den Themen Auslandsstudium, Auslandspraktikum<br />
und Studieren in Österreich für ausländische Studierende.<br />
<strong>ÖSTERREICHISCHE</strong> EZA – BAND 1 77
ENTWICKLUNGSPOLITISCHE INLANDSARBEIT<br />
5.1.3. Praktika, Lerneinsätze und Projektreisen<br />
Aus der Einsicht, dass durch die Begegnungen von Menschen gegenseitiges Verständnis und neue<br />
Lernformen entstehen können, hat in den letzten Jahren eine Reihe von Organisationen Reise-<br />
und Austauschprogramme entwickelt, die sich zunehmend großer Beliebtheit erfreuen. Diese An-<br />
gebote haben vielfach die klassischen „Entwicklungshelfereinsätze“ abgelöst. Letztere hatten sich<br />
schon früh zu professionellen ExpertInnen-Einsätzen weiterentwickelt. Die neue Freiwilligenarbeit<br />
in den Entwicklungsländern wird als Lernfeld für internationale Erfahrung gesehen.<br />
Anders als zur Hochblüte der projektbegleitenden Mitwirkung österreichischer Fachkräfte in den<br />
1970er und 1980er Jahren finden sich neue Rahmenbedingungen: Großteils kleinere Initiativen<br />
bieten basisorientierte „Schnupperaufenthalte“ an. Von den TeilnehmerInnen wird erwartet, dass<br />
sie die Reise und den Aufenthalt selbst finanzieren und Vorbereitungskurse besuchen.<br />
Jährlich dürften mehr als 300 vorwiegend junge Menschen diese Form einer Begegnung mit Men-<br />
schen in den Entwicklungsländern nutzen. Sie sind derzeit ein zu wenig anerkannter Teil der EZA.<br />
An der Fachhochschule für Sozialarbeit in Wien wurde eine Erhebung zu den verschiedenen Ange-<br />
boten durchgeführt, die in einer besser koordinierten Vor- und Nachbereitung der Reiseprogram-<br />
me und Lerneinsätze münden soll.<br />
Einzelne Studienrichtungen schreiben verpflichtend Projekteinsätze vor. Einen Überblick bietet<br />
das <strong>ÖFSE</strong>-Informationsservice. 2<br />
5.2. Entwicklungspolitische Bildungsarbeit und Globales Lernen<br />
Überblick<br />
Es gab im Bildungsbereich in den letzten 10 bis 15 Jahren deutliche inhaltliche wie strukturelle<br />
Veränderungen.<br />
Die früher vorrangige Befassung mit den Verhältnissen in den Entwicklungsländern wich zuneh-<br />
mend einer immer intensiveren Auseinandersetzung mit den dahinter liegenden globalen Zusam-<br />
menhängen. Die Betrachtung der Situation „dort“ wurde erweitert um eine Analyse der Ursachen<br />
für die weltweiten Fehlentwicklungen „hier“. Begrifflichkeiten wie „Weltwirtschaft“ und vor al-<br />
lem „Globalisierung“ fanden Eingang in den Fächerkanon in den Schulen und in die Lehrveran-<br />
staltungen an den Universitäten.<br />
Projekte wie Workshops zum „Kritischen Konsum“ oder Fortbildungskurse wie die Lehrgänge zum<br />
„Globalen Lernen“ finden großen Zuspruch. Die professionellen Beratungsstrukturen der NGOs<br />
werden von den MultiplikatorInnen der Bildungsarbeit rege in Anspruch genommen.<br />
Es ist positiv, dass das BM:BWK zuletzt einige Initiativen zur Unterstützung für das „Globale Ler-<br />
nen“ gesetzt hat. Es ist allerdings ein Nachteil, dass es seine finanzielle Unterstützung in Bildung<br />
(und auch Wissenschaft) für den Arbeitsbereich insgesamt im letzten Jahrzehnt deutlich zurück-<br />
gefahren hat.<br />
2 <strong>ÖFSE</strong> – Infoservice www.eza.at – Infothek/Personalentsendung.<br />
78 <strong>ÖSTERREICHISCHE</strong> EZA – BAND 1
ENTWICKLUNGSPOLITISCHE INLANDSARBEIT<br />
In der Jugendarbeit, die noch in den 1960er und 1970er Jahren ein maßgeblicher Träger der EZA<br />
und damit auch der Inlandsarbeit in Österreich war (wie etwa die Katholische Landjugend oder<br />
der Jugendrat für Entwicklungshilfe), ging das institutionalisierte Engagement stark zurück. Dies<br />
liegt nicht zuletzt im Vertrauensverlust begründet, den Parteien und Kirchen und damit auch die<br />
ihr zugeordneten Jugendeinrichtungen erfahren haben.<br />
Auch die traditionelle Erwachsenenbildung (in Volkshochschulen und Bildungswerken der Kirchen)<br />
hat sich verändert und steht unter Konkurrenz zu einer boomenden Medienlandschaft, zu vielfälti-<br />
gen kommerziellen Freizeitangeboten und nicht zuletzt auch zur Flexibilisierung der Arbeitswelt.<br />
5.2.1. Vom Entwicklungspolitischen zum Globalen Lernen<br />
1988 wurde bei einem an der Universität Klagenfurt im Rahmen der vom Europarat initiierten Eu-<br />
ropäischen Nord-Süd-Kampagne abgehaltenen Symposium zur entwicklungspolitischen Bildungs-<br />
arbeit erstmals die Forderung erhoben, ein Unterrichtsprinzip „Entwicklungspolitik“ einzuführen.<br />
Diese Forderung wurde bei einer vom Bildungsministerium unterstützten Enquete inhaltlich wei-<br />
tergeführt und später in eine Forderung nach einem Prinzip Globales Lernen umformuliert. Im Be-<br />
sonderen wollte man damit das entwicklungspolitische und das interkulturelle Lernen verbinden.<br />
Die Forderung nach einem Unterrichtsprinzip Globales Lernen ging davon aus, dass Wissensver-<br />
mittlung notwendig ist, aber alleine nicht ausreicht. Es sollte die „Eine Welt“ konkret erfahrbar<br />
gemacht werden, Neugier und das Streben nach Freiheit und Kreativität gefördert und Vorschläge<br />
zu politischer Veränderung in Diskussion gebracht werden. Durch forschendes Lernen, aktive Be-<br />
gegnung vor allem mit Menschen aus den außereuropäischen Ländern und den steten Austausch<br />
von Erfahrungen innerhalb und außerhalb der Schule wollte man bessere Voraussetzungen für<br />
im Lichte der Globalisierung veränderte Lernbedürfnisse, den Abbau von Vorurteilen und die Er-<br />
schließung von Handlungs- und Entscheidungsräumen schaffen.<br />
Die Initiative für eine bessere Verankerung der entwicklungspolitischen Bildung im Unterricht<br />
blieb ohne Erfolg. Es fehlte ihr auch eine starke Lobby und in der Wissenschaft ist das Thema bis<br />
heute ein Randthema geblieben.<br />
Heute kommt hinzu, dass der Wandel des Staates vom Wohlfahrtsstaat zum Wettbewerbsstaat<br />
Bildung im Allgemeinen und Schule im Besonderen zusätzlich gefährdet. Es gibt Einsparungen<br />
gerade bei den allgemeinbildenden und den sozialfördernden Maßnahmen. Die Ausrichtung der<br />
Lerninhalte und der organisatorischen Rahmenbedingungen auf die Verwertbarkeit junger Men-<br />
schen für den Arbeitsmarkt verringern die Möglichkeiten für selbstbestimmte Lernprozesse.<br />
5.2.2. Globales Lernen in Österreich<br />
Die Inhalte und Bildungskonzepte, die mit dem Begriff „Globales Lernen“ verbunden werden,<br />
leiteten die AkteurInnen, die aus der Entwicklungspolitik kommen, zu einem guten Teil vom<br />
Schweizer Forum „Schule für Eine Welt“ ab. Darunter verstehen sie die Vermittlung einer globalen<br />
Perspektive und Hinführung zum persönlichen Urteilen und Handeln in globaler Perspektive auf<br />
allen Stufen der Bildungsarbeit. Die Fähigkeit, Sachlagen und Probleme in einem weltweiten und<br />
ganzheitlichen Zusammenhang zu sehen, bezieht sich nicht auf einzelne Themenbereiche, sie wird<br />
<strong>ÖSTERREICHISCHE</strong> EZA – BAND 1 79
ENTWICKLUNGSPOLITISCHE INLANDSARBEIT<br />
vielmehr als eine Perspektive des Denkens, Urteilens, Fühlens und Handelns, eine Beschreibung<br />
wichtiger sozialer Kompetenzen für die Zukunft gesehen.<br />
KritikerInnen am Konzept „Globales Lernen“ halten fest, dass es zu unkonkret sei und die Ziele<br />
nicht klar genug definiert seien.<br />
Über die inhaltliche Ausrichtung des „Globalen Lernens“ gibt es immer wieder auch Diskussionen<br />
unter AkteurInnen aus den Bereichen Umweltbildung, Menschenrechtserziehung und Interkultu-<br />
relles wie Interreligiöses Lernen.<br />
Eine von der im Jahr 2003 gegründeten „Strategiegruppe Globales Lernen“ 3 in Auftrag gegebe-<br />
ne Zustandsanalyse zum „Globalen Lernen“ hat die inhaltliche Vielfalt, die um den Begriff noch<br />
herrscht, deutlich gemacht. Die Strategiegruppe hat in ihrer Arbeit seitdem bei zwei Studientagen<br />
der wissenschaftlichen Einbettung des Lernbereichs und der Entwicklung von qualitativen Bewer-<br />
tungskriterien ein besonderes Augenmerk geschenkt.<br />
Seit 2003 baut Baobab im Rahmen seiner Website www.globaleducation.at eine Dokumentations-<br />
und Informationsplattform zum „Globalen Lernen“ in Österreich auf. Entwicklung und aktueller<br />
Diskurs des Themas auf den Ebenen der schulischen, außerschulischen und universitären Bildung<br />
und Ausbildung werden dokumentiert und online zur Verfügung gestellt.<br />
5.2.3. Lehrgänge Globales Lernen<br />
Pädagogische und Religionspädagogische Akademien sowie Pädagogische und Religionspädago-<br />
gische Institute setzen Konzepte des Globalen Lernens im Rahmen ihrer Kooperationen mit NGOs<br />
bei Lehrgängen und LehrerInnenfortbildungsveranstaltungen um. Am Pädagogischen Institut der<br />
Stadt Wien wurde eine Abteilung für Globales Lernen eingerichtet.<br />
Ein Lehrgang Globales Lernen besteht in Kärnten. Ausgangspunkt des Lehrgangs ist der beidsei-<br />
tige Anspruch an Globales Lernen, eine Vision für das Leben in einer human gestalteten Weltge-<br />
sellschaft zu entwickeln und eine Orientierung für das eigene Leben zu finden. Ziel ist es, Rah-<br />
menbedingungen zu schaffen, in denen Bildungsprozesse entwickelt, Fähigkeiten entfaltet und<br />
Einstellungen reflektiert werden können.<br />
In Vorbereitung sind Lehrgänge an der Religionspädagogischen Akademie in Wien-Strebersdorf<br />
und an der Pädagogischen Akademie des Bundes in Linz.<br />
5.2.4. Schulen<br />
Es würde den Rahmen dieser Publikation überschreiten, die vielfältigen entwicklungspolitischen<br />
Aktivitäten an den Schulen auch nur ansatzweise zu beschreiben. Beispielhaft seien nur die vielen<br />
Workshops im Rahmen der Programme zum „Kritischen Konsum“, Projekte im Rahmen von Ani-<br />
mationsausstellungen oder die Umsetzung des Gästeeinsatzes der Welthaus-Gruppe erwähnt.<br />
Das Interkulturelle Zentrum fördert die Anbahnung von Schulpartnerschaften, die Südwind Agen-<br />
tur koordiniert die jährlich stattfindende Global Education Week in Österreich und die UNESCO-<br />
3 Der Strategiegruppe gehören VertreterInnen des Bildungsministeriums, der Schulpraxis, der Wissenschaft, der ADA, von<br />
KommEnt und einiger NGOs an.<br />
80 <strong>ÖSTERREICHISCHE</strong> EZA – BAND 1
ENTWICKLUNGSPOLITISCHE INLANDSARBEIT<br />
Schulen tragen ebenfalls seit vielen Jahren zum internationalen Informationsaustausch bei.<br />
Eine noch sehr junge Entwicklung ist die fallweise Aufnahme des „Globalen Lernens“ in die Leit-<br />
bildprozesse, die in den Schulen eingesetzt haben.<br />
5.2.5. Jugendarbeit und Erwachsenenbildung<br />
Überblick zur Jugendarbeit<br />
Der Arbeitskreis Public Support beim Wiener Institut für Entwicklungsfragen beschäftigt sich seit<br />
einiger Zeit mit der Frage, wie Jugendliche mit entwicklungspolitischen Themen besser erreicht<br />
werden können. Die Fragestellung schließt an nationale und internationale Untersuchungen zum<br />
Politikverständnis und Freizeitverhalten von Jugendlichen an und ist auch getragen von der Sorge<br />
um die Generationennachfolge in einigen EZA-Organisationen.<br />
Augenscheinlich sind die breite Themenvielfalt, die Jugendliche anspricht, sowie die Bereitschaft<br />
zu Engagement, das allerdings zeitlich begrenzt sein soll. Die „Neuen Medien“ wie das Internet<br />
spielen eine zentrale Rolle.<br />
Katholische Jugend Österreich – Entwicklungspolitisches Referat Enchada<br />
Enchada organisiert seit 1992 Jugendaustauschprogramme mit Tamil Nadu (Südindien), 2000 wur-<br />
de ein Austauschprogramm mit El Salvador aufgenommen. 2002 fanden Gegenbesuche von Ju-<br />
gendgruppen aus Österreich in El Salvador und Indien statt. Die Besuche sind in einen kontinuier-<br />
lichen Kommunikationsprozess zwischen den Jugendlichen eingebunden.<br />
Die Jugendaktion „Schoko4oneworld“ lädt Jugendliche dazu ein, selbst initiativ zu werden und<br />
fair gehandelte Schokolade zu verkaufen oder dafür zu werben, um so auf Ungerechtigkeiten in<br />
der Welt aufmerksam zu machen. Das Projekt „Fairnetzung“ bietet drei aus verschiedenen Län-<br />
dern stammenden Gruppen die Chance, sich über Internet zu selbst ausgewählten Themen zu<br />
äußern um anschließend und darauf basierend eine Diskussion zu eröffnen. Dieses Pilotprojekt,<br />
das mit dem Jugendaustauschprogramm verbunden ist, soll die Eigenständigkeit und auch Eigen-<br />
verantwortlichkeit von Jugendlichen fördern und die unterschiedlichen Perspektiven in einer glo-<br />
balisierten Welt deutlich machen.<br />
Im Bereich der Inlandsarbeit werden Workshops, Materialien und Kurse zu den Themen Fairer<br />
Handel, Verschuldung und Arbeit angeboten. Zu den Materialien gehören u.a. ein entwicklungs-<br />
politisches Wissensquiz und ein Materialienkoffer („Voikoffa“), gefüllt mit Spielen, Liedern, Bil-<br />
dern und anderen Gedankenanstößen. Wettbewerbe, z.B. der Kreativkunstwettbewerb „Welt-<br />
FairFärben“, bieten den Jugendlichen die Möglichkeit, sich auf kreative Weise mit dem Thema<br />
Globalisierung auseinanderzusetzen.<br />
Don Bosco-Jugend für Eine Welt<br />
Der Verein Jugend für Eine Welt unterstützt weltweit Berufsausbildungs- und Sozialprogramme.<br />
Rund um das Thema Fußball werden Fairness und Chancengleichheit weltweit angesprochen. In<br />
öffentlichen Aktionen und Gruppenbewerben werden die Millenniumsentwicklungsziele Jugend-<br />
lichen näher gebracht und auf einer DVD werden konkrete Projekte vorgestellt.<br />
<strong>ÖSTERREICHISCHE</strong> EZA – BAND 1 81
ENTWICKLUNGSPOLITISCHE INLANDSARBEIT<br />
Unicef Austria<br />
Unicef Austria hat sich zum Ziel gesetzt, weltweit die Rechte der Kinder zu fördern und sich dafür<br />
öffentlich einzusetzen.<br />
Der Verkauf von Unicef-Grußkarten sowie die Durchführung von Spendenaktionen und Benefiz-<br />
veranstaltungen in Österreich dienen der Finanzierung von Projekten für Kinder in Entwicklungs-<br />
ländern und sind auch Teil der Öffentlichkeitsarbeit. Der Schwerpunkt der Öffentlichkeits- und<br />
Informationsarbeit liegt neben dem Verkauf von verschiedensten Artikeln aus dem Unicef Shop<br />
vor allem auch in der Informationsarbeit durch Vorträge, Tagungen und Veranstaltungen mit den<br />
prominenten Unicef-BotschafterInnen, um über die Rechte der Kinder zu informieren.<br />
Überblick zur Erwachsenenbildung<br />
Entwicklungspolitik ist in den Erwachsenenbildungseinrichtungen ein zumeist punktuelles The-<br />
ma. In der kirchlichen Erwachsenenbildung sind oftmals Gäste aus Entwicklungsländern ein Anlass<br />
für Vorträge und Gesprächsrunden. Von einem dauerhaften Engagement und damit einem regel-<br />
mäßigen Angebot in der kirchlichen Erwachsenenbildung kann man nicht sprechen. Es ist eine<br />
Schwachstelle der kirchlichen EZA-Bildungsarbeit, das Potenzial ihrer eigenen Strukturen zu wenig<br />
einzubeziehen. Dies betrifft Bildungswerke wie Bildungshäuser, die – anders als kirchliche Kenn-<br />
zahlen zu Mitgliedern oder GottesdienstbesucherInnen – oft beachtliche BesucherInnenzuwächse<br />
vermelden können. 4<br />
In den Volkshochschulen überwiegen berufsbegleitende Angebote und vielfältige Freizeitkurse,<br />
die sich einer besseren Nachfrage erfreuen als Politische Bildung.<br />
Seit einigen Jahren finden Multimediaschauen im Zusammenhang mit Auslandsreusen oder Expe-<br />
ditionen großen Zuspruch. Entwicklungspolitischen Zusammenhänge kommen jedoch oft zu kurz.<br />
Die Akademien der politischen Parteien bieten immer wieder Informationsveranstaltungen und<br />
Seminare zu aktuellen Nord-Süd-Themen an.<br />
5.3. Wissenschaft und Forschung<br />
Überblick<br />
Der Themenbereich „Wissenschaft und Forschung“ umfasst eine große Breite. Der Bogen spannt<br />
sich von den (wissenschaftlichen) Fachbibliotheken über studienbegleitende Bildungsmaßnahmen<br />
für Studierende aus Entwicklungsländern bis hin zu Aktivitäten im Forschungsbereich.<br />
Eine dem Anliegen entsprechende Darstellung aller Initiativen würde über den Rahmen dieser Publikation<br />
weit hinausgehen. Die <strong>ÖFSE</strong> hat 1997 ein Handbuch zum Gesamtbereich veröffentlicht. 5<br />
4 Siehe u.a. Forum Katholischer Erwachsenenbildung.<br />
5 Studieren, Lehren, Forschen-Österreich und Dritte Welt (1994), <strong>ÖFSE</strong>-Handbuch, Wien.<br />
82 <strong>ÖSTERREICHISCHE</strong> EZA – BAND 1
5.3.1. Bibliotheken und Dokumentationen<br />
ENTWICKLUNGSPOLITISCHE INLANDSARBEIT<br />
Die Strukturentwicklung in der EZA hat etwa ab 1965 zum Aufbau von Bibliotheks- und Dokumen-<br />
tationseinrichtungen geführt. Viele Organisationen haben zunächst eigenständige „Handappara-<br />
te“ in den 1970er und 1980er Jahren gepflegt, diese aber oft aus Kapazitätsgründen anderen Ein-<br />
richtungen, etwa der Österreichischen Forschungsstiftung für Entwicklungshilfe (<strong>ÖFSE</strong>) übergeben.<br />
Zu Beginn der 1990er Jahre kam es zu einer gegenläufigen Entwicklung. 6 Bibliotheken und Doku-<br />
mentationen wurden als Grundlage für ein professionelles EZA-Management gesehen. Herausra-<br />
gende Neugründung war 1993 jene der Bildungs- und Schulstelle Baobab, die erstmals kirchenun-<br />
abhängige und kirchliche Trägerschaften zusammenführte.<br />
Der Verein Frauensolidarität begann ab 1994 die Fachbibliothek zu professionalisieren. Das LAI<br />
hatte bereits in den Jahren davor seine Bibliothek neu orientiert. In den Bundesländern kam es zu<br />
eigenständigen Sammlungen in den Regionalstellen der Südwind Agentur, in kirchlichen Einrich-<br />
tungen zu Konzentrationen rund um die bestehenden Diözesankommissionen für Weltkirche und<br />
Entwicklungsförderung. Diese übernahmen später als Welthaus-Einrichtungen in unterschiedlicher<br />
Weise Bibliotheksfunktionen.<br />
Diese „Gründerzeit“, bald unterstützt durch neue Informations- und Kommunikationstechnolo-<br />
gien, ergab eine neue Bibliothekslandschaft. Mit dem Informationsverbund Globale Entwicklung<br />
(IGE, vormals Informations- und Dokumentationsverbund) entstand ab 1993 eine Kooperations-<br />
plattform. Zu Beginn war der Bereich noch ausreichend aus öffentlichen Mitteln dotiert, doch<br />
bald geriet er unter Kostendruck. Es wurden Rationalisierungen im erst neu entstandenen Umfeld<br />
gefordert. Die großen Einrichtungen wurden in mehreren Studien untersucht, Szenarien einer<br />
Zusammenarbeit bis hin zu einer Zusammenlegung entworfen.<br />
Die Forderung der öffentlichen Geldgeber nach mehr privaten Mitteln konnte nicht erfüllt wer-<br />
den. Alle internationalen Vergleiche zeigen ein ähnliches Finanzierungsmuster: Bibliotheks- und<br />
Dokumentationseinrichtungen werden – so sie über den organisationsinternen Bereich hinauswir-<br />
ken – aus öffentlichen Mitteln finanziert. Auch Hoffnungen, maßgebliche Kofinanzierungen aus<br />
anderen Bundesministerien zu erhalten, führten trotz entsprechender Bemühungen der EZA-Sek-<br />
tion im BMaA nicht zum Erfolg.<br />
Für den Standort Wien ergab sich ab 1993 mit dem entwicklungspolitischen Zentrum in der Berg-<br />
gasse 7 ein neuer Bibliotheksfokus. Mit der <strong>ÖFSE</strong> und mit Baobab, anfangs noch mit dem Ludwig<br />
Boltzmann Institut für Menschenrechte (BIM) gelang die Schaffung eines Bibliothekszentrums.<br />
Später ergänzte die Frauensolidarität das Konzept.<br />
Es gelang nicht, die Bibliotheken von missio Austria (ehemals Päpstliche Missionswerke Öster-<br />
reichs) und des Dokumentations- und Kooperationszentrums Südliches Afrika (SADOCC) in eine<br />
engere Kooperation zu integrieren. missio lehnte 1996 ein Übersiedlungsangebot in das Biblio-<br />
thekszentrum Berggasse 7 ab.<br />
6 Österreichische Forschungsstiftung für Entwicklungshilfe (1996). Österreichische Entwicklungszusammenarbeit. EZA-<br />
Handbuch. Teil C, Wien.<br />
<strong>ÖSTERREICHISCHE</strong> EZA – BAND 1 83
ENTWICKLUNGSPOLITISCHE INLANDSARBEIT<br />
Informationsverbund Globale Entwicklung (IGE)<br />
Die Koordination der umfangreichen EZA-Bibliothekslandschaft sollte über den Informationsver-<br />
bund Globale Entwicklung (IGE), 1993 als Informations- und Dokumentationsverband (IuD) ge-<br />
gründet, erreicht werden. Vergleichbare Netzwerke bestehen in der Schweiz und Deutschland.<br />
Anders als in den Nachbarländern standen in Österreich eine Harmonisierung der Erschließungs-<br />
sprache und eine gemeinsame technologische Entwicklung und das gemeinsame Angebot im In-<br />
ternet im Vordergrund.<br />
Die Technologieentwicklung überholte bald das ursprüngliche Konzept, das einen einheitlichen<br />
IT-Standard anstrebte. Auch ergaben die sehr unterschiedlichen Größenordnungen bei den Ver-<br />
bundpartnern einen differenzierten Bedarf nach Zusammenarbeit.<br />
Die Bestandsentwicklung sowie die Nutzungsfrequenz der Verbundpartner zeigt dies.<br />
Tabelle 16<br />
IGE-BESTAND MONOGRAFIEN 1997 UND 2003 – SOWIE BIBLIOTHEKSBESUCHE<br />
Bestände Bibliotheksbesuche<br />
1997 2003 1997 2003<br />
Baobab 7 1.910 3.361 1.000 600<br />
Frauensolidarität 2.500 5.600 1.000 1.100<br />
KSÖ 8 14.900 15.000 280 20<br />
LAI 7.000 10.475 1.582 669<br />
<strong>ÖFSE</strong> 37.346 44.354 5.767 4.638<br />
Südwind NÖ-West 9 k. A. 1.100 k. A. 380<br />
Südwind Salzburg 2.000 3.500 800 283<br />
Südwind Agentur Oberösterreich 10 830 1.460 300 300<br />
Südwind Agentur Tirol 1.300 1.400 672 300<br />
Südwind Agentur Vorarlberg 1.004 1.900 k. A. 250<br />
missio 6.500 7.000 160 160<br />
Quelle: <strong>ÖFSE</strong> – Erhebung 2004<br />
7 Aufgrund der Umstellung des Bibliotheksystems im Spätsommer 2003 war keine Gesamtjahresstatistik bis Ende 2003<br />
möglich. Die angeführten Daten wurden auf Basis des 1. Halbjahres 2004 hochgerechnet.<br />
8 Dass trotz jährlicher Neuzugänge die Gesamtzahl in etwa konstant bleibt, erklärt sich aus den räumlichen Begrenzungen,<br />
die zu Aussonderungen älterer Titel führen.<br />
Die BesucherInnen-Zahl ist zurückgegangen, da der Kursbetrieb umgestaltet und teilweise in andere Bildungshäuser<br />
ausgelagert wurde. Aus diesem Grund fallen diese KursteilnehmerInnen als BenutzerInnen aus. Im Übrigen dient die<br />
Bibliothek primär den KSÖ-MitarbeiterInnen für ihre Arbeiten.<br />
9 Der angegebene Bestand ist ein ungefährer Wert, wobei bei der Übertragung in das neue System Literatur vor dem<br />
Erscheinungsjahr 1994 nicht berücksichtigt wird.<br />
10 Eine genaue Statistik für das Jahr 2003 ist aufgrund der Systemumstellung nicht möglich. Bei den angeführten Zahlen<br />
handelt es sich um Schätzwerte.<br />
84 <strong>ÖSTERREICHISCHE</strong> EZA – BAND 1
ENTWICKLUNGSPOLITISCHE INLANDSARBEIT<br />
Eine von KommEnt beauftragte Potenzialstudie ergab 1996 eine notwendige Weiterentwicklung<br />
in der Informationstechnologie. Das Internet war für die großen Einrichtungen längst Realität ge-<br />
worden. 2000 wurden nochmals die vier größten Fachbibliotheken bei BAOBAB, Frauensolidarität,<br />
dem Österreichischen Lateinamerika Institut (ÖLAI) und der <strong>ÖFSE</strong> evaluiert und eine gemeinsame<br />
Literaturdatenbank entwickelt.<br />
Die regionalen Info-Stellen mit Schulorientierung gingen danach einen anderen Weg. BAOBAB als<br />
gesamtösterreichische Bildungs- und Schulstelle verließ die gemeinsame Datenbank und erreichte<br />
2003 mit einem neuen Verbund eine arbeitsteilige Kooperation der entwicklungspolitischen Me-<br />
diatheken. Nicht integriert sind in diesen Verbund vorerst die fachspezifischen Einrichtungen der<br />
Katholischen Kirche, insbesondere die Welthaus-Stellen. Sie sind weiterhin – auch untereinander<br />
– eigenständig tätig.<br />
Dadurch ergab sich zwangsläufig eine Veränderung der IGE-Aufgaben. 2004 wurde der Verbund<br />
seiner ursprünglichen Funktion als Technologieplattform entbunden. In Zukunft werden Erfahrungs-<br />
austausch, Weiterbildung und gemeinsame Projekte Inhalt sein.<br />
Bibliotheken verstehen sich heute mehr denn je als Orte des Wissens, der Informationsvermit-<br />
tlung, aber auch der Begegnung, von Personen wie virtuell. Nie zuvor gab es eine solch intensive<br />
Nutzung der Angebote, ob in der EZA oder weit darüber hinaus – ohne ihr Wirken ist Alltags- wie<br />
Wissenschaftsleben unvorstellbar geworden.<br />
Große Bedeutung haben Bibliotheken und Dokumentationen für EntscheidungsträgerInnen in<br />
Politik und Verwaltung erlangt. Unter dem neuen Begriff „Informationbroking“ werden Doku-<br />
mente und Fakten erhoben, selektiert und aufbereitet. Dies sind neue Dienstleistungen, die auch<br />
durch eine Neuorientierung in der Bibliothekarsausbildung verankert wurden.<br />
Österreichische Forschungsstiftung für Entwicklungshilfe<br />
Die Österreichische Forschungsstiftung für Entwicklungshilfe (<strong>ÖFSE</strong>) wurde 1967 mit dem Ziel<br />
gegründet, ein „Informations-, Dokumentations- und Forschungszentrum“ in Wien einzurichten.<br />
Die <strong>ÖFSE</strong> ist seitdem zur größten wissenschaftlichen Fachbibliothek zu Fragen der Entwicklung-<br />
spolitik und EZA gewachsen. 2003 verfügte die Bibliothek über mehr als 60.000 Bände. Die Fakten-<br />
dokumentation umfasst Datenbanken zu EZA-Akteuren, Projekten oder Webangeboten. Jährlich<br />
besuchen etwa 5.000 Personen die <strong>ÖFSE</strong>-Bibliothek, die Tendenz ist seit dem online-Angebot über<br />
www.oefse.at rückläufig.<br />
Frauensolidarität<br />
Der Verein Frauensolidarität hat sich zum Ziel gesetzt, die Öffentlichkeit über frauenspezifische<br />
Themen wie Frauenförderung in der Entwicklungszusammenarbeit, Frauenhandel und Prosti-<br />
tutionstourismus oder Bevölkerungspolitik zu informieren – und das in vielfältigster Weise. In<br />
ihrer Inlandsarbeit in Österreich verbindet die Frauensolidarität feministische und entwicklung-<br />
spolitische Konzepte. Neben der Bibliothek beschäftigt sich die seit 1982 erscheinende Zeitschrift<br />
„Frauensolidarität“ ebenfalls mit den genannten Themen und greift besonders auch die aktuellen<br />
internationalen Entwicklungen in ihren Kommentaren und Analysen auf.<br />
<strong>ÖSTERREICHISCHE</strong> EZA – BAND 1 85
ENTWICKLUNGSPOLITISCHE INLANDSARBEIT<br />
Entwicklungspolitische Bildungs- und Schulstelle Baobab<br />
Der zentrale Aufgabenbereich von Baobab ist die Führung einer entwicklungspädagogischen<br />
Bibliothek und Mediathek. Im Vordergrund steht dabei die zielgruppenorientierte und bedarfs-<br />
gerechte Erschließung und Bereitstellung relevanter Informationen (Literatur, audiovisuelle Me-<br />
dien, Adressen, Internetlinks).<br />
Das Angebot von Baobab richtet sich an LehrerInnen aller Schultypen, SchülerInnen, StudentInnen<br />
sowie MultiplikatorInnen in der außerschulischen Bildung. Als Serviceleistung publiziert Baobab<br />
zweimal jährlich eine umfassende Zusammenstellung relevanter Information zu allen Materialien<br />
und Medien.<br />
Seit Juni 2003 ist der neue Bibliothekskatalog online verfügbar und umfasst das Netzwerk den<br />
Bestand von neun entwicklungspolitischen Infotheken. Baobab obliegt die Koordination, das Con-<br />
trolling der Daten sowie die entsprechenden Rückmeldungen an die regionalen Mediatheken.<br />
Baobab bietet darüber hinaus für Schulen, Kindergärten und die außerschulische Erwachsenen-<br />
bildung Workshops zum „Globalen Lernen“ an. Vermittelt werden theoretische Grundlagen sowie die<br />
Umsetzung in der pädagogischen Praxis anhand spezifischer Themen und konkreter Materialien.<br />
Dokumentations- und Kooperationszentrum Südliches Afrika (SADOCC)<br />
Ziel des Dokumentations- und Kooperationszentrums Südliches Afrika ist die Bereitstellung von<br />
Information und Expertise für WissenschafterInnen und Studierende, staatliche Behörden, Firmen,<br />
JournalistInnen und entwicklungspolitische Organisationen, außerdem der Aufbau solidarischer<br />
Beziehungen Österreichs und der Europäischen Union zu den Ländern der Southern African De-<br />
velopment Community (SADC) sowie die Bewältigung des Erbes von Kolonialismus, Apartheid und<br />
Destabilisierung im südlichen Afrika.<br />
Die hauseigene Bibliothek, die thematisch einschlägige Spezialliteratur umfasst, bietet allen In-<br />
teressierten die Möglichkeit, sich in wissenschaftliche Erforschungen über das südliche Afrika zu<br />
vertiefen. Neben einem Zeitungsarchiv mit Texten über Entwicklungen aus dem südlichen Afri-<br />
ka wird auch eine Foto- und Videosammlung angeboten. Auf Anfrage stellt SADOCC auch the-<br />
menspezifische Dossiers und Unterlagen zusammen.<br />
Vier Mal jährlich veröffentlicht SADOCC das Magazin INDABA, in dem JournalistInnen und<br />
Fachleute aus Österreich, Europa und dem südlichen Afrika über politische, wirtschaftliche und<br />
kulturelle Entwicklungen berichten.<br />
86 <strong>ÖSTERREICHISCHE</strong> EZA – BAND 1
ENTWICKLUNGSPOLITISCHE INLANDSARBEIT<br />
5.3.2. Studienbegleitende Bildung für Studierende aus Entwicklungsländern<br />
Mit diesem Begriff verbinden sich Bildungsmaßnahmen von EZA-Stipendienorganisationen. Im Be-<br />
mühen um eine „politische Bildung“ gibt es für Studierende aus Entwicklungsländern 11 seit den<br />
frühen 1980er Jahren entsprechende Angebote. Vielfach wird die Bedeutung dieser Zielgruppe<br />
für die österreichische EZA in der konkreten Ausformung der Bildungszusammenarbeit (BZA) unterschätzt.<br />
12<br />
Die Inhalte wie Termine der Bildungsangebote werden zwischen den BZA-Einrichtungen im Kon-<br />
takt-Komitee-Studienförderung Dritte Welt (KKS) abgesprochen. Die Veranstaltungen, konzipiert<br />
für StipendiatInnen aus Entwicklungsländern, sind nicht öffentlich.<br />
5.3.3. Forschungseinrichtungen<br />
Faschingeder/Zauner gaben 2004 einen Überblick 13 zu den Rahmenbedingungen entwicklungsbe-<br />
zogener Forschung in Österreich. Unter anderem stellen sie fest, dass Österreich mit Einrichtun-<br />
gen, die sich der entwicklungsbezogenen Forschung widmen, unterversorgt ist. Forschungsförde-<br />
rung fällt jedoch in die Zuständigkeit mehrerer Ressorts und es gibt in Österreich kein systemati-<br />
sches Konzept. Sie beruht vor allem auf dem persönlichen Interesse und Engagement einer Reihe<br />
von inner- wie außeruniversitärer Personen und Institutionen.<br />
Faschingeder und Zauner machen weiters die schwierige Situation neuer Ansätze insbesondere für<br />
JungforscherInnen deutlich,<br />
„denn es fehlt an Österreichs Hochschulen an strukturellen Verbindlichkeiten für die<br />
Lehre. Und wo keine Lehre betrieben wird, dort ist auch keine einschlägige Forschung<br />
sichergestellt. Eine Reihe von WissenschafterInnen führten einzelne entwicklungsbezoge-<br />
ne Forschungsprojekte durch, die jedoch zumeist, bei allen Bekenntnissen zur Inter- oder<br />
Transdisziplinarität eine starke Fachgebundenheit aufweisen. Für junge ForscherInnen ist<br />
es schwer, im Rahmen eines solchen inkonsistenten Forschungsumfeldes einen Platz zu fin-<br />
den. Umgekehrt kommt die kleine Wissenschaftsgemeinde kaum zu neuen Zugängen und<br />
einer personellen Verjüngung. Um an dieser Situation etwas zu ändern, braucht es das<br />
konzertierte Engagement der öffentlichen Hand sowie der Wissenschafts- und Forschungs-<br />
einrichtungen und der WissenschafterInnen selbst.“<br />
Es fühlte das Außenministerium sich bislang inhaltlich eher für „Forschung für Entwicklung“ zu-<br />
ständig, während „Forschung über Entwicklung“ vor allem die Sache des Ministeriums für Bildung,<br />
Wissenschaft und Kultur war.<br />
11 Im Studienjahr 2004/2005 gab es rund 5.000 ordentliche HörerInnen aus Entwicklungsländern in Österreich.<br />
12 Bittner, Gerhard (1999). in: Österreichische Forschungsstiftung für Entwicklungshilfe. <strong>ÖFSE</strong> Edition 9. Education for<br />
Transition: One Europe – one world?, Wien.<br />
13 Journal für Entwicklungspolitik 1/04.<br />
<strong>ÖSTERREICHISCHE</strong> EZA – BAND 1 87
ENTWICKLUNGSPOLITISCHE INLANDSARBEIT<br />
Österreichische Akademie der Wissenschaften (ÖAW)<br />
Die ÖAW ist die führende Trägerin außeruniversitärer akademischer Forschung. Sie betreibt heute<br />
Forschungseinrichtungen an acht Standorten in Österreich. Die ÖAW besteht aus der mathema-<br />
tisch-naturwissenschaftlichen und der philosophisch-historischen Klasse.<br />
Eine Kommission für Entwicklungsfragen wurde im Jahr 1981 gegründet. Sie wurde nach der UN-<br />
Konferenz „Science and Technology for Development“, die 1979 in Wien tagte, eingerichtet.<br />
Die Kommission für Entwicklungsfragen führt wissenschaftliche Fragestellungen mit entwicklungs-<br />
politischen Zielsetzungen zusammen. Die Kommission hat sich zum Ziel gesetzt, den entwicklungs-<br />
politischen Ansatz im Wissenschaftsbereich zu fördern und auszubauen.<br />
Die Arbeit der Kommission umfasst neben der Förderung von kooperativen Forschungsvorhaben<br />
mit Partnern in den Entwicklungsländern auch eine Beratungstätigkeit und die Veranstaltung von<br />
Symposien zu entwicklungspolitischen Themen. Die Beratung zu wissenschaftlichen Fragen der<br />
Entwicklungszusammenarbeit ist für wissenschaftliche Einrichtungen und Förderstellen gedacht.<br />
Die Kommission ist Kontakt- und Vermittlungsstelle für verschiedene Organisationen und Einrich-<br />
tungen aus den Bereichen Wissenschaft, Wirtschaft und Entwicklungszusammenarbeit, sowohl im<br />
In- als auch im Ausland.<br />
Internationale Entwicklung – Entwicklungsstudien 14<br />
Ende der 1970er Jahre wurde auf Initiative und Drängen Studierender und mit tatkräftiger Unter-<br />
stützung der Österreichischen Hochschülerschaft der „Mattersburger Kreis für Entwicklungspolitik<br />
an den Österreichischen Universitäten“ gegründet. Die Beteiligten waren sich darin einig, dass Ös-<br />
terreich etwas nachzuholen hatte: Anders als in vielen industrialisierten Ländern gab es in Öster-<br />
reich keine Einrichtung an den Universitäten, die sich mit „Entwicklungsforschung“ beschäftigte.<br />
Eine Dekade später hatte sich in der Sache immer noch nichts geändert und so kam es zum Antrag<br />
einer ProponentInnengruppe von Lehrenden an der Universität Wien, der Senat möge ein überfa-<br />
kultäres Institut einrichten, das sich in Lehre und Forschung der Entwicklungsstudien annehme.<br />
Die Namen „Entwicklungsstudien“ bzw. „Entwicklungsforschung“ (Development Studies) waren<br />
im deutschen Gebrauch bereits durch andere wissenschaftliche Disziplinen besetzt (Pädagogik,<br />
Psychologie). Die Senatskommission, welche die Einrichtung der neuen Disziplin vorbereitete, ent-<br />
schloss sich daher, die Einrichtung eines Instituts und einer Studienrichtung für „Internationale<br />
Entwicklung” vorzuschlagen. Es wurde 1994 gegründet. Das zuständige Ministerium sah jedoch<br />
keinen Bedarf und lehnte die Einrichtung ab. Anfang 1999 stimmte der Senat ein zweites Mal<br />
für die Institutsgründung. Schließlich sah das Konzept des akademischen Senats für die Neuorga-<br />
nisation der Universität mit dem Jahr 2000 erneut ein überfakultäres „Institut für Internationale<br />
Entwicklung“ vor: Auch dieser Beschluss musste unter Druck des Ministeriums zurückgenommen<br />
werden. „Internationale Entwicklung” an der Universität Wien blieb daher in der Sache und in der<br />
Form ein „Projekt”.<br />
14 Basierend auf Informationen, die Prof. Walter Schicho, der Leiter des Studienganges Internationale Entwicklung, zur<br />
Verfügung stellte.<br />
88 <strong>ÖSTERREICHISCHE</strong> EZA – BAND 1
ENTWICKLUNGSPOLITISCHE INLANDSARBEIT<br />
Das „Projekt Internationale Entwicklung” ist ein konkreter, aber auch ein ideeller Ort der Begeg-<br />
nung. Studierende, PraktikerInnen aus den Bereichen Politik und EZA sowie akademische Lehre-<br />
rInnen haben mit geringen finanziellen Mitteln, aber mit viel Engagement und Selbstverantwor-<br />
tung diese Einrichtung geschaffen. In ihren Arbeitsbereich fällt:<br />
- die Organisation interdisziplinärer Zusammenarbeit in den Bereichen<br />
„Entwicklungsforschung”, „Nord-Süd-Beziehungen” und „Entwicklungspolitik”<br />
- die Koordination der Lehre und die Herausgabe eines kommentierten<br />
Vorlesungsverzeichnisses<br />
- die Organisation eines Wahlfachs und eines Individuellen Diplomstudiums<br />
„Internationale Entwicklung”<br />
- die Veranstaltung von Vorträgen und von Workshops<br />
Das Projekt erhält dafür von der Universität Mittel für die Lehre und Räume für den Betrieb eines<br />
Sekretariats. Ohne die uneigennützige Unterstützung anderer Institute, allen voran der Afrikanis-<br />
tik, und die innovative Kompetenz der Lehrenden wie der Basisgruppe der Studierenden wäre an-<br />
gesichts einer rasch wachsenden Zahl von StudentInnen der Betrieb längst zusammengebrochen,<br />
denn auch im Rahmen der neuesten Organisationsreform (UG 2002) haben die zuständigen Gremi-<br />
en der Universität Wien noch keine Form der Institutionalisierung für das „Projekt IE“ gefunden.<br />
141 Studierende begannen im Studienjahr 2002/03 mit dem Individuellen Diplomstudium Inter-<br />
nationale Entwicklung; 2003/04 waren es bereits 430 Zulassungsbescheide. In den ersten drei Stu-<br />
dienjahren haben fast 1.000 Personen das neue Studienangebot gewählt. Ein bedeutender Anteil<br />
der Studierenden kommt aus dem benachbarten Ausland.<br />
Das Besondere an der Studienrichtung „Internationale Entwicklung“ ist ein Dreifaches:<br />
- Zum einen ist es eine „Bewegung von unten“: Es waren die Hochschülerschaft, verschie-<br />
dene Studienrichtungsvertretungen (vor allem die der Geschichte) und junge, kaum oder<br />
nicht etablierte WissenschafterInnen, die den Mattersburger Kreis, die Ringvorlesungen<br />
Außereuropäische Geschichte und die zugehörigen Publikationen ins Leben gerufen ha-<br />
ben. Das erklärt den Widerstand der etablierten Wissenschaft und des Wissenschaftsminis-<br />
teriums.<br />
- Zum Zweiten ist die „Internationale Entwicklung“ eine kritische Bewegung: Ziel der Ausbil-<br />
dung und der wissenschaftlichen Arbeit ist die wissenschaftlich fundierte und distanzierte<br />
Auseinander-setzung mit den unterschiedlichen Institutionen, Organisationen und Vorgän-<br />
gen der verschiedenen sozialen, politischen und wirtschaftlichen Räume, in denen Entwick-<br />
lung im Vordergrund steht. Das kritische Engagement erklärt nicht nur das Desinteresse<br />
der Wirtschaft, sondern auch denkühlen Abstand der Akteure der Wissenschaftsbürokratie<br />
und der Entwicklungszusammenarbeit.<br />
- Zum Dritten ist die IE eine Disziplin, die weder nationale noch europäische Interessen in<br />
den Vordergrund stellt, sondern eine globale Sicht der Weltentwicklung fordert und sich<br />
gegen die Asymmetrie von Macht und Ressourcenverteilung im modernen Weltsystem<br />
stellt.<br />
<strong>ÖSTERREICHISCHE</strong> EZA – BAND 1 89
ENTWICKLUNGSPOLITISCHE INLANDSARBEIT<br />
Interdisziplinäres Forschungszentrum für Entwicklungszusammenarbeit (IEZ)<br />
Das IEZ Linz wurde im Jahr 1989 gegründet. Das Institut arbeitet Forschungs- und EZA-Projekte<br />
aus und realisiert diese mit Hilfe nationaler und internationaler GeldgeberInnen.<br />
Es sollen die komplexen sozialen, kulturellen, geschlechtsrollenspezifischen, politischen, ökono-<br />
mischen und historischen Zusammenhänge, die vom „europäischen Blick auf die südliche Hemis-<br />
phäre“ oft vernachlässigt werden, durch interdisziplinäres Forschen und Handeln hergestellt und<br />
berücksichtigt werden.<br />
Im Bereich Öffentlichkeitsarbeit will das IEZ für die Anliegen der EZA – insbesondere der Armuts-<br />
bekämpfung – sensibilisieren: Neben inner- und außeruniversitären Veranstaltungen zu entwick-<br />
lungspolitischen Fragestellungen entstanden in den letzten Jahren Radio- und TV-Dokumentatio-<br />
nen zu den Projekten, die die Arbeit des Institutes einer breiten Öffentlichkeit zugänglich machen.<br />
Zudem werden die Ergebnisse in Publikationen dargestellt.<br />
Österreichisches Lateinamerika-Institut (LAI)<br />
Das LAI will den Dialog zwischen Österreich und Lateinamerika intensivieren. Zu den Zielsetzun-<br />
gen des Instituts gehört auch die Vertiefung der kulturellen und wissenschaftlichen Beziehungen.<br />
Einen nicht geringen Teil der Aktivitäten macht die Öffentlichkeitsarbeit für Lateinamerika und<br />
die iberischen Länder in Österreich aus.<br />
Das Entstehen eines eigenen Lehrgangs an der Universität ist als ein Erfolg der Bemühungen des<br />
Instituts zu erwähnen. Der inzwischen als außeruniversitärer Lehrgang anerkannte interdisziplinä-<br />
re Lehrgang für höhere Lateinamerika-Studien ist als ein akademisches Weiterbildungsangebot für<br />
AkademikerInnen, Studierende im zweiten Studienabschnitt, aber auch für Berufstätige gedacht.<br />
Inhaltlich bietet der Lehrgang den TeilnehmerInnen ein breites und interdisziplinäres Panorama<br />
Lateinamerikas und verbindet wissenschaftliche Analysen mit praxisorientierten Darstellungen.<br />
Seine Grundsätze sind Internationalität, Interkulturalität, Wissenschaftlichkeit und Praxisorientie-<br />
rung.<br />
Österreichische Orientgesellschaft (ÖOG)<br />
In der seit 2001 bestehenden Orient-Akadamie, dem Lehrgang für Akademische Orientstudien,<br />
werden eine Reihe von Vorträgen und Vorlesungen sowie Symposien und Arbeitskreise zur Ori-<br />
ent- und Islamkunde angeboten. Den Lehrgang zeichnet eine interdisziplinäre Zusammenarbeit<br />
verschiedener Universitätsinstitute aus. Die Lehrveranstaltungen sind so angesetzt, dass auch Be-<br />
rufstätige teilnehmen können (grundsätzlich werden Abend- oder Wochenendveranstaltungen<br />
angeboten). Eine akademische Qualifikation der TeilnehmerInnen ist nicht erforderlich, hingegen<br />
sind Englisch-Kenntnisse für das Literaturstudium notwendig. Am Ende des Lehrganges erhalten<br />
die TeilnehmerInnen – bei positiver Absolvierung – ein Diplom der Orient-Akademie.<br />
Paulo Freire Zentrum<br />
Eine neue Gründung im Grenzbereich von Wissenschaft und Bildung stellt das Paulo Freire Zen-<br />
trum dar. Ein 2000 begonnener Reflexionsprozess zur Praxis der österreichischen EZA im Zusam-<br />
menhang mit den Entwicklungstagungen 2001 und 2003 hat den Bedarf nach Stärkung des wis-<br />
senschaftlichen und pädagogischen Arbeitens zu globalen Themen gezeigt.<br />
90 <strong>ÖSTERREICHISCHE</strong> EZA – BAND 1
ENTWICKLUNGSPOLITISCHE INLANDSARBEIT<br />
Diesem Anliegen will sich das 2004 gegründete Zentrum widmen. Mattersburger Kreis und <strong>ÖFSE</strong><br />
haben eine Organisationsstruktur gefunden, um mit dem Zentrum den Dialog von Wissenschaft,<br />
Bildung und Praxis in der Entwicklungspolitik zu fördern.<br />
5.3.4. Entwicklungstagungen 15<br />
Bereits zu Beginn der 1990er Jahre fanden Entwicklungspolitische Konferenzen – 1991 in Eisen-<br />
stadt, 1992 in Linz und 1994 in Wien – statt. Veranstalter war – im Auftrag des zuständigen Minis-<br />
teriums – der Österreichische Informationsdienst für Entwicklungspolitik (ÖIE).<br />
Im Frühjahr 1999 wurde in der Redaktion des Journals für Entwicklungspolitik (JEP) 16 begonnen,<br />
über einen neuen Reflexionsprozess nachzudenken, um auf Veränderungen in der entwicklungs-<br />
politischen Szene zu reagieren. Grundlegend war die Vermutung, dass es für eine wirksame Ent-<br />
wicklungszusammenarbeit mehr braucht als die Vermittlung von sozialtechnologischen Kompe-<br />
tenzen, nämlich vielmehr Freiräume zum Nachdenken über Ziele und Wege. Nachgedacht werden<br />
sollte nicht nur über Realitäten im engeren Arbeitsumfeld, sondern auch über die Makrostruktu-<br />
ren, über all das, was als Neoliberalismus, Globalisierung und auch als Globalisierungskritik be-<br />
zeichnet wird.<br />
Die Verantwortlichen gingen davon aus, dass es an alternativen Modellen fehlt, auf die hinge-<br />
arbeitet werden könnte. Im neoliberalen Kontext werden viele Maßnahmen der EZA selbst zu<br />
Implementierungsschritten des Neoliberalismus. Selbstreflexion sollte davor schützen, die eigene<br />
Organisation zur Trägerin eines subtilen Neoliberalismus zu machen. „Wisse, was du tust“, lautet<br />
die Maxime der Stunde, die das WAS vor das WIE stellt und damit die Priorisierung der Inhalte vor<br />
den Verfahrensweisen einfordert.<br />
Die Chance der Wissenschaft zur Analyse aus Distanz sollte zu einer Intervention in die Praxis<br />
genutzt werden. Gemeinsam mit der Arbeitsgemeinschaft Entwicklungszusammenarbeit (AGEZ)<br />
wurde der Prozess eingeleitet. Höhepunkt dieser Reflexion war die Tagung, die als „Erste Gesam-<br />
tösterreichische Entwicklungstagung“ in Salzburg 2001 ausgeschrieben wurde. Mehr als 330 Per-<br />
sonen nahmen teil. „Zivilgesellschaft“ stellte den zentralen Begriff dar, um den herum im Rahmen<br />
von fünf Workshops eine breite Diskussion über Identität und Perspektiven der zivilgesellschaftlichen<br />
Organisationen geführt wurde. 17<br />
Die entwicklungspolitische Praxis mit Blick auf politische Grundfragen und mit Hilfe theoretischer<br />
Beiträge zu reflektieren, fand breite Zustimmung und wurde fortgesetzt. Der zweite Reflexions-<br />
vorgang startete 2002 und im Dezember 2003 fand die „Zweite Entwicklungstagung“ in Graz<br />
statt. Für November 2005 ist die dritte Tagung in Linz geplant.<br />
15 Die Darstellung basiert auf Informationen, die Gerald Faschingeder, der Koordinator der Entwicklungstagungen 2001<br />
und 2003 zur Verfügung stellte.<br />
16 Vierteljahreszeitschrift des Mattersburger Kreises.<br />
17 Faschingeder, Gerald (2002): Wisse, was du tust. Dokumentation des entwicklungspolitischen Reflexionsprozesses<br />
2001 und der Gesamtösterreichischen Entwicklungstagung, 25.-27.10.2001, JEP Book 4, Wien. .<br />
<strong>ÖSTERREICHISCHE</strong> EZA – BAND 1 91
ENTWICKLUNGSPOLITISCHE INLANDSARBEIT<br />
Tabelle 17<br />
ENTWICKLUNGSTAGUNGEN<br />
Themen, TeilnehmerInnen und Veranstaltungsorte<br />
Thema TN Veranstaltungsort<br />
1991 Global denken, lokal handeln 500 Eisenstadt, Schloss Esterházy<br />
1992 Entwicklung und Umwelt 550 Linz, Haus der Kaufmannschaft<br />
1994 Das Rätsel Entwicklung 450 Wien, Messegelände<br />
2001 Die Zukunft der Zivilgesellschaft 330 Salzburg, Residenz und Universität<br />
2003 Globalisierung Ent-wickeln 400 Graz, Universität<br />
2005 Eigentum anders Linz, Universität<br />
Der bisherige Verlauf seit 2001 machte den Bedarf an entwicklungspolitischer Diskussion deutlich.<br />
Es wurde klarer, dass die EZA-Organisationen ihren Themenkanon erweitern mussten. Wer den<br />
Willen zur Weltveränderung ernst nahm, musste über die Projektzusammenarbeit weit hinaus<br />
denken. Fragen der Wirtschaftspolitik, der Ökologie, der Menschenrechte und andere mehr spie-<br />
len eine bedeutende Rolle.<br />
Der Begriff „Globalisierung“ stand deshalb im Mittelpunkt der zweiten Tagung. Der Begriff hatte<br />
als unhinterfragte Selbstverständlichkeit über Jahre hinweg auf Titelseiten von Büchern und Zeit-<br />
schriften gestanden. Im Zuge des Projektes wurden viele Aspekte der Globalisierung diskutiert:<br />
Von der „neoliberalen“ oder „konzerndefinierten“ Globalisierung bis zur völligen Ablehnung des<br />
Begriffs reichte die Palette.<br />
In der Auseinandersetzung mit Realitäten und Zusammenhängen zeigte sich die Notwendigkeit,<br />
Alternativen zu den vorherrschenden politökonomischen Rahmenbedingungen zu entwickeln. So-<br />
wohl die Entwicklungszusammenarbeit als auch die globalisierungskritische Bewegung haben für<br />
sich die Wichtigkeit solcher Visionen als Ausgangs- und Orientierungspunkte erkannt.<br />
Die Tagungen 2001 und 2003 waren – anders als ihre Vorläufer anfangs der 1990er Jahre – we-<br />
sentlich durch die Teilnahme junger, zumeist studentischer TeilnehmerInnen geprägt. Es ist Ziel, in<br />
den kommenden Jahren den Kreis auf die gesamte EZA-Szene und darüber hinaus zu erweitern.<br />
92 <strong>ÖSTERREICHISCHE</strong> EZA – BAND 1
5.4. Themenbezogene Programme<br />
5.4.1. Fairer Handel<br />
Überblick<br />
Wirtschaft und Entwicklung<br />
ENTWICKLUNGSPOLITISCHE INLANDSARBEIT<br />
Handelspolitik bedeutet für die Mehrheit der Entwicklungsländer noch immer in erster Linie Roh-<br />
stoffpolitik, weil nur eine Minderheit die Abhängigkeit von Rohstoffexporten – ein Erbe aus der<br />
Kolonialzeit – zurückdrängen konnte. Die großen Schwankungen der Weltmarktpreise für Kaffee,<br />
Tee, Kakao oder Bananen sind noch nicht beendet. Die Preise, zu denen ProduzentInnen ihre<br />
Produkte verkaufen müssen, machen einen immer kleineren Teil des Preises aus, den Konsumen-<br />
tInnen als Endpreis dafür bezahlen.<br />
Als Reaktion auf diese Entwicklung ist in den vergangenen drei Jahrzehnten eine Handelsbewe-<br />
gung entstanden, die sich im Interesse der ProduzentInnen sowie im Interesse kritischer Konsu-<br />
mentInnen im Norden für faire Handelsbeziehungen einsetzt.<br />
Fairer Handel soll durch den Ankauf von Produkten zu „fairen Preisen“ KleinproduzentInnen ei-<br />
ne Absatzchance durch gerechte Rahmenbedingungen bei Zwischenhändlern und kommerziellen<br />
Handelsorganisationen schaffen. Als bedeutender Grundsatz gilt der garantierte Ausschluss von<br />
Kinderarbeit.<br />
Gleichzeitig ist damit aber auch die Öffentlichkeit im Norden angesprochen. KonsumentInnen<br />
haben die Chance, den Gedanken „global denken, lokal handeln“ auf einfache Weise selbst um-<br />
zusetzen: Der tägliche Einkauf ermöglicht einen konkreten Beitrag für globale Veränderungen<br />
– die KäuferInnen erhalten dafür sozial- und umweltverträglich hergestellte Produkte von ausge-<br />
zeichneter Qualität.<br />
Mit dem Fairen Handel ist das Thema „Wirtschaft und Entwicklung“ zum zentralen Inhalt von<br />
vielen Maßnahmen entwicklungspolitischer Inlandsarbeit geworden. Dabei fällt eine Akzentver-<br />
schiebung auf. Zu Beginn des Fairen Handels in den 1970er bis in die 1980er Jahre stand die Infor-<br />
mation über Herkunftsland und Mechanismen der unfairen Herstellungs- wie auch Handelsbedin-<br />
gungen zum Produkt im Vordergrund. Der Verkauf von Kaffee, Tee oder Honig in den Alternativ-<br />
läden diente dabei als Hilfsmittel für entwicklungspolitische Bildungs- und Aufklärungsarbeit. Die<br />
KundInnen waren vorwiegend solidaritätsbewegte Menschen, denen eine einfache Aufmachung<br />
wenig ausmachte. Am Beginn des Fairen Handels stand der Slogan „trade not aid“, der im Gefol-<br />
ge der Unabhängigkeit vieler ehemaliger Kolonien in der internationalen Diskussion eine wichtige<br />
Rolle spielte.<br />
<strong>ÖSTERREICHISCHE</strong> EZA – BAND 1 93
ENTWICKLUNGSPOLITISCHE INLANDSARBEIT<br />
Schon damals kristallisierten sich die Punkte heraus, die bis heute das Herzstück des Fairen<br />
Handels bilden:<br />
- langfristige Partnerschaften mit organisierten Gruppen von benachteiligten<br />
ProduzentInnen<br />
- möglichst direkter Handel, d.h. Ausschaltung des Zwischenhandels, wo immer möglich<br />
- besserer Preis für die ProduzentInnen (garantierter Mindestpreis, Zahlungen über dem<br />
Weltmarktpreis, Vorauszahlungen)<br />
- Transparenz für ProduzentInnen und KonsumentInnen<br />
- Verkauf gekoppelt mit Informationsarbeit.<br />
Weltwirtschaftliche Themen werden über die Öffentlichkeitsarbeit des Fairen Handels transpor-<br />
tiert. Dabei ist bewusst, dass der Faire Handel in keiner Weise globale handelspolitische Reformen<br />
ersetzen kann. 18<br />
Mit dem Schritt „heraus aus der Soli-Ecke – hinein in den Supermarkt“ sollten seit Mitte der<br />
1990er Jahre fair gehandelt Produkte auch über Handelsketten abgesetzt und damit eine weit-<br />
aus breitere Käuferschicht gewonnen werden. Auch die Partner in der Wirtschaft mussten ange-<br />
sprochen werden. Die neue Situation, sich auch am kommerziellen Absatzmarkt behaupten zu<br />
müssen, verlangte eine geänderte Kommunikationsstrategie, d.h. eine starke Orientierung am<br />
(Social) Marketing. Für die Nonprofit-Akteure bedeutete dies einen umfassenden Neuansatz und<br />
eine Ausweitung der bisherigen Aktivitäten zur Vermittlung ihrer sozialen Anliegen. Um im Wett-<br />
bewerb bestehen zu können, benötigen die FairTrade-Produkte zur erfolgreichen Durchsetzung<br />
am heimischen Markt – genauso wie eine Marke – gewisse Anforderungen hinsichtlich Bekannt-<br />
heit, werblichem Auftritt und Nutzenstiftung, um von KonsumentInnen, Markenartikelindustrie,<br />
Handel und Gastronomie ausreichend akzeptiert zu werden. Mit dieser Richtungsentscheidung<br />
war nunmehr ein Prozess eingeleitet, der nicht nur für die Kommunikationspolitik weit reichende<br />
Konsequenzen für die maßgeblichen FairTrade-Organisationen (wie die Gütesiegelinitiative FAIR-<br />
TRADE – ehemals TransFair– , Weltläden – Fachgeschäfte für den Fairen Handel und die Import-<br />
gesellschaft EZA3Welt) hatte. Social Marketing verstanden als ein Grundsatz der Unternehmens-<br />
führung, als ein Führungs- und Handlungskonzept hat auch entscheidende Auswirkungen auf<br />
Struktur, Arbeitsweise – also auf das gesamte Selbstverständnis einer Organisation.<br />
Die zunehmende Wirtschaftsorientierung des Fairen Handels lässt sich auch anhand der internen<br />
Entwicklung festmachen: Weltläden verstehen sich heute als „Fachgeschäfte des Fairen Handels“,<br />
präsentieren sich und ihre Angebote in einem professionellen Umfeld und handeln mehr als frü-<br />
her aufgrund betriebswirtschaftlicher Grundlagen. Sie sind als profitorientierte Unternehmen<br />
nicht dem Dritten Sektor formal zuzuordnen, auch wenn als Eigentümer oft im Hintergrund ge-<br />
meinnützige, entwicklungspolitisch orientierte Vereine tätig sind. Der Anfang der 1990er Jahre<br />
begonnene Weg, fair gehandelte Produkte auch über Handelsketten abzusetzen, hat die Wirt-<br />
schaftsorientierung verstärkt.<br />
18 Gerster, Richard (2001), Globalisierung und Gerechtigkeit, Bern.<br />
94 <strong>ÖSTERREICHISCHE</strong> EZA – BAND 1
EZA-Fairer Handel GmbH<br />
ENTWICKLUNGSPOLITISCHE INLANDSARBEIT<br />
Die Importgesellschaft für fair gehandelte Produkte wurde 1975 mit Sitz in Salzburg gegründet.<br />
Träger sind nach wie vor die Aktion 3.Welt (A3W) und katholische Entwicklungsorganisationen.<br />
Neben dem Import von Waren ist das Handelsunternehmen seit seiner Gründung auch in der<br />
Inlandsarbeit tätig. Im Selbstverständnis der internationalen Fair Trade Organisationen heißt es<br />
dazu<br />
„Fair Trade Organisationen engagieren sich – gestärkt durch VerbraucherInnen – aktiv für<br />
die Unterstützung der ProduzentInnen, für Bewusstseinsbildung und Kampagnenarbeit,<br />
um die Regeln und Praktiken des konventionellen Marktes zu verändern.“ 19<br />
EZA-Fairer Handel GmbH leistet diese Informationsarbeit insbesondere über Produktinformatio-<br />
nen, durch den newsletter EZA-INFO und Kampagnen, auch in Verbindung mit den KundInnen<br />
wie Weltläden oder Entwicklungsorganisationen.<br />
FAIRTRADE Österreich (bis 2002 Transfair)<br />
Im Jahr 2003 feierte die Gütesiegelinitiative FAIRTRADE Österreich (bis 2002 TransFair) ihr zehn-<br />
jähriges Bestehen. FAIRTRADE Österreich ist eine gemeinnützige Initiative, getragen von einer<br />
breiten, überparteilichen Öffentlichkeit. Dazu gehören 28 Organisationen aus den Bereichen Ent-<br />
wicklungspolitik, Kirche, Ökologie und Soziales. Die Finanzierung erfolgte 2003 zu 47 Prozent aus<br />
öffentlichen Förderungen, weitere 27 Prozent stammten von Trägerorganisationen, 15 Prozent<br />
aus Lizenzeinnahmen und der Rest wurde durch Sponsoring und Spenden aufgebracht.<br />
FAIRTRADE zertifiziert fair gehandelte Produkte mit dem Gütesiegel. Das FAIRTRADE-Gütesiegel<br />
ist in Österreich als Marke registriert und geschützt. Zu den Aufgaben von FAIRTRADE gehören<br />
die Gewinnung von Lizenznehmern aus der Markenartikelindustrie, Ausweitung der Distributi-<br />
on durch Neulistung in Supermärkten, Gewinnung neuer KonsumentInnen, Erweiterung des Pro-<br />
duktsortiments sowie Öffentlichkeitsarbeit und Lobbying.<br />
Die Produktangebote haben sich verbreitert:<br />
Tabelle 18<br />
FAIRTRADE-PRODUKTE IN PROZENT/UMSATZ 2003<br />
Kaffee 43<br />
Banane 34<br />
Schokolade 14<br />
Tee 3<br />
Orangensaft 3<br />
Zucker 1<br />
Kakao 2<br />
19 International Federation for Alternative Trade, 2001 – http://www.ifat.org<br />
<strong>ÖSTERREICHISCHE</strong> EZA – BAND 1 95
ENTWICKLUNGSPOLITISCHE INLANDSARBEIT<br />
Die Vorreiter des Fairen Handels, die EZA GmbH und die Weltläden, sowie elf entwicklungspoli-<br />
tisch engagierte Organisationen sahen die Chancen richtig voraus: Es gelang, die Produkte des Fai-<br />
ren Handels über die Alternativläden hinaus auch in den Regalen der Supermärkte zu platzieren.<br />
Über 3.000 Geschäfte führen inzwischen mit dem FAIRTRADE-Siegel gekennzeichnete Produkte.<br />
Die nachfolgende Tabelle zeigt am Beispiel Kaffee das gelungene Wachstum auf beiden Verkaufs-<br />
schienen: Die Vermarktung von FAIRTRADE-Kaffee kam auch dem traditionellen Vertrieb über die<br />
EZA GmbH in Salzburg bzw. Weltläden zugute – die Verkaufsmengen stiegen deutlich an.<br />
Tabelle 19<br />
VERKAUFSMENGEN GRÜNER KAFFEE – FAIR TRADE Angaben in 1.000 kg<br />
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004<br />
EZA GmbH/Salzburg 266 274 258 298 376 414 470<br />
übrige FAIRTRADE-Produkte 68 81 61 110 93 118 133<br />
Gesamt 334 355 319 408 469 532 603<br />
Die bedeutendsten Handelsunternehmen (u.a. Spar, Billa, Merkur, ADEG) und Lebensmittelver-<br />
arbeiter (Meinl, Zotter, Pfanner) sind mittlerweile zu Partnern und Trägern des fairen Handels<br />
geworden. FAIRTRADE wird von entwicklungspolitischen Einrichtungen getragen, wodurch ein<br />
großes Potenzial an engagierten Personen und Netzwerken motiviert werden kann. Auch auf<br />
politischer Ebene ist es gelungen, sich als Partner und Experte zu positionieren. Das Europaparla-<br />
ment, die österreichische Bundesregierung, Länder und Gemeinden sowie Interessensvertretungen<br />
unterstützen diese Initiative. Der Bekanntheitsgrad des Gütesiegels liegt in der Bevölkerung nun-<br />
mehr bei über 40 Prozent.<br />
Der Kaffeekonsum in Österreich lag 2003 bei 49.200 Tonnen Röstkaffee, das waren 58.000 Ton-<br />
nen grüner Kaffee. Hauptexportländer waren Brasilien, Kolumbien und Vietnam. Der Marktanteil<br />
von fair gehandeltem Kaffee lag in Österreich etwas unter einem Prozent. Diese Fakten bele-<br />
gen am „Urprodukt“ des Fairen Handels Kaffee, dass trotz der großen Medienpräsenz 20 und der<br />
Gewinnung attraktiver neuer Handelspartner 21 die Verbreitung am Gesamtmarkt mit etwa ein<br />
Prozent noch bescheiden ist.<br />
Der von FAITRADE dargestellte Marktanteil von zwei Prozent ergibt sich aufgrund anderer Berech-<br />
nungen. FAITRADE verwendet Umfrageergebnisse von Meinungsforschungsinstituten.<br />
20 Wie die jährlich publizierten Nachweise von FAIRTRADE zeigen, gelingt es in hohem Ausmaß, für das Thema Fairer<br />
Handel einen breiten Raum in den Medien (ORF, Tageszeitungen, Zeitschriften) und in der öffentlichen Diskussion<br />
(Parlament, Landtage, Gemeinderäte) zu sichern.<br />
21 Pfanner (2001), Meinl (2001), Starbucks (2002), Natur Pur (2002), „Ja Natürlich!“ (2002), Saeco (2003), Bio Wertkost<br />
(2003).<br />
96 <strong>ÖSTERREICHISCHE</strong> EZA – BAND 1
Tabelle 20<br />
MARKTANTEILE RÖSTKAFFEE 22 in Tonnen<br />
22 Der Röstverlust auf grünen Kaffee beträgt 15 Prozent.<br />
ENTWICKLUNGSPOLITISCHE INLANDSARBEIT<br />
2001 2002 2003<br />
Österreich Gesamt 47.000 47.200 49.200<br />
FAIRTRADE lt. Lizenzeinnahmen 354 407 463<br />
Es bleiben einige kritische Punkte: Entfernt sich die ursprünglich auch konsumkritisch getragene<br />
Initiative durch hohe Akzeptanz als Träger einer entwicklungspolitischen Öffentlichkeitsarbeit von<br />
ihren Zielen, etwa der Information zu Produktionsbedingungen? Ein anderer immer wieder disku-<br />
tierter Punkt ist das Angebot eines fair gehandelten Produktes in unfair gestalteten Arbeitsbedin-<br />
gungen. Die Präsentation von fair gehandelten Produkten an Orten wie etwa im Casino Seefeld<br />
zeigt auch eine Entkoppelung von alternativen Lebensstilen.<br />
Auch wird die selbstständige Finanzierung der laufenden Organisationskosten von FAIRTRADE<br />
über die Lizenzeinnahmen nicht so rasch wie geplant erreicht werden.<br />
Zusammengefasst kann gesagt werden, dass die öffentliche Wirksamkeit des fairen Handels als<br />
Teil der entwicklungspolitischen Inlandsarbeit hervorragend ist. Fair gehandelte Produkte bieten<br />
für Parlamente, politische und kirchliche EntscheidungsträgerInnen, Prominente bis hin zu sozial<br />
orientierten Unternehmen Identifikationsmöglichkeiten für weltweite Perspektiven. Diese Akzep-<br />
tanz findet sich auch bei Geldgebern, von der EU über nationale öffentliche Förderstellen oder<br />
kirchliche Organisationen.<br />
Das Angebot fair gehandelter Produkte ist erheblich größer als die Nachfrage. Um noch mehr<br />
KonsumentInnen zu überzeugen und als dauerhafte KundInnen zu gewinnen, braucht es neben<br />
professionellen Beziehungen zu ProduzentInnen, Industrie und Handel auch kontinuierliche Bil-<br />
dungs- und Öffentlichkeitsarbeit, Marketing und Werbung. Mit Kampagnen wie „Bittere Oran-<br />
gen“ (gegen Kinderarbeit in der Produktion von Orangensaft) oder „Doppelter Genuss“ (die das<br />
zweifach Gute im Produkt anspricht: „Man tut sich selbst und anderen etwas Gutes“), mit Aktions-<br />
wochen in allen Bundesländern (Faire Wochen), mit der Gewinnung von PolitikerInnen und vielen<br />
Prominenten für den Fairen Handel, mit Lobbying für Landtagsbeschlüsse wie in der Steiermark<br />
und in Niederösterreich, um die öffentliche Beschaffung auf fair gehandelte Produkte umzustellen<br />
sowie mit den jüngeren Siegelinitiativen für fair gehandelte Blumen und Teppiche (Step) wurden<br />
erfolgreiche Beispiele gesetzt.<br />
Arbeitsgemeinschaft Weltläden<br />
Die mit Abstand breiteste Palette an fair gehandelten Produkten führen die Weltläden – die Fach-<br />
geschäfte des Fairen Handels. Die Arbeitsgemeinschaft Weltläden oder kurz Arge Weltläden ist die<br />
Dachorganisation von österreichischen Weltläden und deren Trägern. Sie wurde 1982 von damals<br />
zwölf Dritte-Welt-Läden gegründet. Heute hat die Arge mehr als 80 Mitglieder. Der Jahresumsatz<br />
der Weltläden betrug 2004 7,7 Mio. EURO.<br />
<strong>ÖSTERREICHISCHE</strong> EZA – BAND 1 97
ENTWICKLUNGSPOLITISCHE INLANDSARBEIT<br />
Das Ziel ist, die Kooperation zwischen den Weltladen-Gruppen zu verbessern, ihre Interessen vor<br />
allem gegenüber den Importeuren fair gehandelter Produkte zu vertreten und die Öffentlichkeit<br />
über entwicklungspolitische Zusammenhänge zu informieren.<br />
Mit verschiedenen Aktivitäten wird versucht, eine breitere Öffentlichkeit auf den Fairen Handel<br />
aufmerksam zu machen, z.B. durch gemeinsame Kampagnen und Marketingaktivitäten (Kaffee-<br />
kampagne, Textilkampagne, Entschuldungskampagne, Professionalisierungskampagne, „Frühstü-<br />
cke mit Afrika“, Kampagne gegen Kakaobutterersatz, Made in Dignity, „Land Macht Satt“, Euro-<br />
päischer Weltladentag/World Fair Trade Day).<br />
Auch die Beratungstätigkeit bei der Gründung oder beim Umzug von Weltläden wird von der<br />
Arge Weltläden übernommen. Ebenso wird den Weltläden ein Katalog mit allen fair gehandelten<br />
Produkten zur Verfügung gestellt. Die Arge ist auch um die Fortbildung der Weltladen-Mitarbei-<br />
terInnen zu entwicklungspolitischen Themen bemüht. Dreimal im Jahr gibt es eine Weltladen-<br />
Konferenz zu Themen wie Marketing, Dialog mit HandelspartnerInnen oder Entwicklungspolitik.<br />
Alle zwei Jahre findet eine gesamteuropäische Weltladenkonferenz statt. Zusätzlich gibt es vier-<br />
teljährlich das Kommunikations- und Mitteilungsblatt „Weltladen aktuell“.<br />
Weltläden sind heute unternehmerisch besonders erfolgreich, wenn sie in Frequenzlagen liegen<br />
und auch vom Hochpreissegment leben können. Ihre Entwicklung geht in Richtung professionelle<br />
Betriebsführung (Standort, Öffnungszeiten, geschultes und bezahltes Personal).<br />
Weltcafé<br />
Ein neues Projekt ist die Errichtung eines Weltcafés in Wien. Analog zu den Weltläden wird ver-<br />
sucht, fair gehandelte Produkte in einem darauf orientierten Gastronomiebetrieb anzubieten. Das<br />
erste Weltcafé wird zum Jahresende 2005 eröffnet.<br />
Weltumspannend Arbeiten<br />
Der Träger der Initiative „weltumspannend arbeiten“ ist der Verein VABIKU (Verein zur Förderung<br />
von ArbeitnehmerInnenbildung und -kultur Oberösterreich). Er wurde 1996 auf Initiative des ÖGB<br />
OÖ gegründet und weitete inzwischen seine Tätigkeit österreichweit aus.<br />
Die Bildungsarbeit von „weltumspannend arbeiten“ bringt oberösterreichischen BetriebsrätInnen,<br />
FunktionärInnen und GewerkschaftssekretärInnen – ausgehend von deren eigener Arbeits- und<br />
Lebenssituation – internationale Zusammenhänge näher und motiviert sie, für die Rechte der Ar-<br />
beitnehmerInnen weltweit selbst aktiv zu werden.<br />
In der Studie „Betriebsratsarbeit im internationalen Kontext. Globalisierung oö. Unternehmen<br />
aus der Sicht der Arbeitnehmervertretung“, die „weltumspannend arbeiten“ im Jahr 2000 in Ko-<br />
operation mit der Universität Linz durchführte, wurden 70 Betriebsrats-Vorsitzende in oberöster-<br />
reichischen Unternehmen befragt, die Niederlassungen in Entwicklungsländern haben. Auf die<br />
Frage: „Interessierst du dich für die Lebens- und Arbeitsbedingungen der KollegInnen in diesen<br />
Niederlassungen?“, antworteten 41,7 Prozent der Befragten mit „Ja“. Es war ein guter Grund,<br />
oberösterreichische BetriebsrätInnen beim Aufbau von internationalen Kontakten und Kooperati-<br />
onen im eigenen Konzern zu unterstützen.<br />
GewerkschafterInnen bietet „weltumspannend arbeiten“ bei der Umsetzung der gemeinsamen<br />
Ziele Hilfestellung durch:<br />
98 <strong>ÖSTERREICHISCHE</strong> EZA – BAND 1
ENTWICKLUNGSPOLITISCHE INLANDSARBEIT<br />
- Unterstützung bei der Durchführung von Kampagnen und Aktionen (Solidaritätsnetzwerk<br />
für verfolgte GewerkschafterInnen, Clean Clothes Kampagne, Absicherung Sozialer Min-<br />
deststandards, CSR, WTO/GATS/TRIPS, Finanzmärkte, Fairer Handel, ...)<br />
- Unterstützung bei internationaler Vernetzung auf Betriebsebene<br />
- Erstellung von Materialien (z.B. Videos wie „Globalisierung von unten“, Ausstellungen wie<br />
„weltumspannend arbeiten“, Publikationen)<br />
- Organisation von Veranstaltungen<br />
- ReferentInnentätigkeit bei Schlüssel-Zielgruppen der Organisation (Hauptamtliche, Spit-<br />
zenfunktionärInnen, Betriebsratsvorsitzende, Konzern- und Europabetriebsräte)<br />
- vielfältigen Einsatz von Medien, die Durchführung von gewerkschaftlichen Bildungsreisen<br />
(Brasilien und Mexiko) und die Begleitung von Arbeitsgruppen (z.B. Papier Global, Philippi-<br />
nen, Indien)<br />
Der inhaltliche Fokus ist derzeit auf die südlichen Länder (z.B. Kontakte zu Brasilien, Mexiko, Ko-<br />
lumbien und Philippinen, bald auch Indien) gerichtet.<br />
„weltumspannend arbeiten“ stellt auch eine Verbindung zwischen Gewerkschaften und NGOs dar,<br />
bringt Themen und Anliegen von Gewerkschaften in NGOs ein, aber auch umgekehrt. 2004 wurde<br />
eine Änderung des Wirkungskreises beschlossen. Die Initiative versteht sich nun über Oberöster-<br />
reich hinaus als bundesweite Organisation.<br />
ICEP – Institut zur Cooperation bei Entwicklungs-Projekten<br />
Seit seinem Beginn 1996 stützt ICEP seine Arbeit auf zwei Eckpfeiler. Dies ist zum einen die Durch-<br />
führung von Projekten in Zentralamerika und Ostafrika im Sektor Bildung/Ausbildung. Zum an-<br />
deren versteht sich ICEP als Akteur entwicklungspolitischer Öffentlichkeitsarbeit in Österreich und<br />
Europa – insbesondere als Informations- und Vermittlungsstelle für Wirtschaftsunternehmen zum<br />
Thema „Nachhaltige Entwicklung“.<br />
Mit der ICEP-Initiative corporAID werden Unternehmen auf die Möglichkeit hingewiesen, ei-<br />
nen Beitrag zur globalen Armutsbekämpfung zu leisten, ohne auf ihre Profitorientierung zu<br />
verzichten. ICEP gibt seit 2003 das corporAID-Magazin heraus und informiert Wirtschaftsunterneh-<br />
men zu entwicklungspolitischen Themen bzw. bietet damit eine Plattform deren soziales Engage-<br />
ment einer breiteren Öffentlichkeit zu kommunizieren. Eine enge Verbindung besteht mit der CSR<br />
-Initiative sowie der Österreichischen Industriellen Vereinigung (IV) und der Wirtschaftskammer<br />
Österreich (WKÖ).<br />
CSR-Initaitive<br />
Corporate Social Responsibility (CSR) will wirtschaftlichen Erfolg mit gesellschaftlicher Verantwor-<br />
tung verbinden. In Österreich haben sich 2002 die Industriellenvereinigung, die Wirtschaftskam-<br />
mer Österreich und das Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft zur Initiative CSR-Austria<br />
zusammengeschlossen. Eine Einladung zur Mitträgerschaft erging anfangs auch an Entwicklungs-<br />
organisationen. Caritas, SOS-Kinderdorf und WWF haben sich der Initiative angeschlossen.<br />
Die Arbeitsgemeinschaft Entwicklungszusammenarbeit (AGEZ) hat einen eigenständigen Prozess<br />
initiiert. Gemeinsam mit Gewerkschaften, der Arbeiterkammer, dem Ökobüro und amnesty inter-<br />
national wird ein NGO-Netzwerk zu CSR vorbereitet. Geplante Umsetzung ist die Jahreswende<br />
2005/2006.<br />
<strong>ÖSTERREICHISCHE</strong> EZA – BAND 1 99
ENTWICKLUNGSPOLITISCHE INLANDSARBEIT<br />
Ethisches Investment<br />
Entwicklungspolitische Inlandsarbeit erfolgt in einem eingeschränkten Ausmaß auch über Instru-<br />
mente des Ethischen Investments. Oikocredit Austria bietet die Zeichnung von Genossenschafts-<br />
anteilen, die der Finanzierung von günstigen Krediten in Entwicklungsländern dienen. Teilweise<br />
wird das Kapital auch Mikrofinanzinstitutionen (MFI) zur Verfügung gestellt.<br />
Das UN-Jahr der Mikrokredite 2005 wird für Informationsmaßnahmen genutzt.<br />
5.4.2. Gender<br />
Überblick<br />
Der Begriff Gender bezieht sich auf die soziale Organisation von Geschlechtlichkeit, die sich mit<br />
anderen Formen von sozialen Unterschieden wie Klasse, Kaste, Rasse, ethnischer Zugehörigkeit,<br />
Religionszugehörigkeit, sexueller Orientierung und „Behinderung” überschneidet.<br />
Geschlechterbeziehungen werden als Ausdruck von Machtbeziehungen verstanden, die im Haus-<br />
halt und in anderen sozialen Institutionen wie der lokalen Gemeinschaft, Märkten, staatlichen<br />
Einrichtungen und Organisationen der Zivilgesellschaft sichtbar sind.<br />
Das Bekenntnis zu einer nicht-diskriminierenden Geschlechterpolitik ist im österreichischen EZA-<br />
Gesetz verankert.<br />
Frauensolidarität<br />
Der Verein Frauensolidarität ist seit 1982 in Österreich aktiv und engagiert sich für Frauenrechte in<br />
Afrika, Asien und Lateinamerika. In ihrer Inlandsarbeit in Österreich verbindet die Frauensolidari-<br />
tät feministische und entwicklungspolitische Konzepte.<br />
Sie trägt mit ihrer Arbeit zur Durchsetzung von Frauenrechten bei und engagiert sich für eine<br />
Welt frei von Sexismus und Rassismus. Als entwicklungspolitische Organisation steht sie im Dialog<br />
mit Frauenbewegungen aus dem Süden und stärkt durch Vernetzung das solidarische Handeln.<br />
Zu den Aufgaben der Frauensolidarität zählen die Betreuung der Bibliothek und Dokumentations-<br />
stelle „Frauen und Dritte Welt“ sowie die Herausgabe der vierteljährlich erscheinenden Zeitschrift<br />
„Frauensolidarität“, die über Frauenrechte, Frauenbewegungen und Frauenkultur in den Ländern<br />
des Südens informiert und das Nord-Süd-Verhältnis aus feministischer Sicht reflektiert. Ein wei-<br />
terer Schwerpunkt in ihrer entwicklungspolitischen Öffentlichkeitsarbeit ist das Thema „Globali-<br />
sierung und Frauen-Arbeitswelt“ mit besonderer Berücksichtigung der Süd- und Frauenseite (wie<br />
u.a. die Mobilisierungskampagne für Verhaltenskodizes von multinationalen Unternehmen – eine<br />
Weiterführung der Clean Clothes Kampagne). Außerdem macht Frauensolidarität Radio: „Radio<br />
Women on Air“ heißt die Frauen-Sendeschiene jeden Dienstag von 13-14 Uhr auf Radio Orange<br />
94.0 im Rahmen der Global Dialogues. Darüber hinaus organisiert der Verein auch eigene Vorträ-<br />
ge, Diskussionsrunden und Kunstveranstaltungen.<br />
100 <strong>ÖSTERREICHISCHE</strong> EZA – BAND 1
Women in Development Europe – WIDE<br />
ENTWICKLUNGSPOLITISCHE INLANDSARBEIT<br />
WIDE Österreich wurde 1992 gegründet. Es ist ein Netzwerk von entwicklungspolitischen NGOs,<br />
Wissenschafterinnen und engagierten Einzelfrauen.<br />
Ziel von WIDE ist es, die Realität von Frauen in der Öffentlichkeit sichtbar zu machen und eine<br />
gezielte Politik von Frauen für Frauen zu erreichen. Ein besonderes Ziel ist es, in der Entwicklungs-<br />
zusammenarbeit einen geschlechtsspezifischen Ansatz zu integrieren, um besonders auch Frauen<br />
zu stärken.<br />
Die Inlandsarbeit von WIDE hat das Ziel, ein kritisches Bewusstsein im Hinblick auf die Stärkung<br />
von Frauen in Projekten der Entwicklungszusammenarbeit zu fördern. Bei diesen Bemühungen<br />
werden vor allem entwicklungspolitische NGOs angesprochen. Dieses Anliegen wird umgesetzt<br />
durch das Abhalten von Genderseminaren, diversen Veranstaltungen und durch verschiedene<br />
Publikationen. Bei den österreichweit durchgeführten Genderseminaren wird gezeigt, wie ge-<br />
schlechtsspezifische Aspekte sinnvoll in die EZA eingebracht werden können und zu einer Quali-<br />
tätssteigerung führen. Zu den Publikationen zählen Dokumentationen der Genderseminare und<br />
anderer Veranstaltungen sowie Leitfäden für eine gendergerechte Sprache und für die praktische<br />
Anwendung von Genderkriterien. Weiters werden Schriften und Stellungnahmen zu nationalen<br />
und internationalen Dokumenten veröffentlicht.<br />
Verein Joan Robinson<br />
Der Verein zur Förderung frauengerechter Verteilung ökonomischen Wissens – Joan Robinson –<br />
wurde 2002 gegründet. Er will dazu beitragen, Frauen Macht über den Zugang zu ökonomischem<br />
Wissen und den Umgang damit verschaffen. Der Verein will bewirken, dass ökonomisches Wissen<br />
anders verteilt wird und zum Empowerment von Frauen in Nord, Süd und Ost beiträgt sowie ins-<br />
besondere in der Entwicklungszusammenarbeit wirksam wird. Ziel ist eine frauenfreundliche Öko-<br />
nomie, die die materielle Versorgung sichert, aber nicht das Leben dominiert und beschränkt.<br />
5.4.3. Umwelt<br />
Klimabündnis Österreich<br />
Auf den Berliner Amazonientagen 1988 entstand die erste Idee zu einem Bündnis zwischen der<br />
COICA (Koordination indigener Organisationen des Amazonasgebietes) und europäischen Städten<br />
zur Halbierung der klimaschädlichen Emissionen und zur Unterstützung der indigenen Völker in<br />
ihren Anstrengungen für den Erhalt des Waldes.<br />
Das im August 1990 verabschiedete „Manifest europäischer Städte zum Bündnis mit den Indi-<br />
anervölkern Amazoniens“ beschreibt Kooperationsprojekte mit den Regenwaldvölkern und die<br />
Grundgedanken kommunaler Klimaschutzprogramme. Der Österreichische Informationsdienst für<br />
Entwicklungspolitik (ÖIE) brachte die Klimabündnis-Idee nach Österreich und übernahm die Bun-<br />
deskoordination.<br />
Das Land Salzburg trat 1990 als erstes Bundesland dem Klimabündnis bei. Graz, Klagenfurt, Linz,<br />
Wien, Wiener Neustadt, Salzburg, Schwaz und Götzis traten als erste Gemeinden der einzelnen<br />
Bundesländer dem Klimabündnis bei.<br />
<strong>ÖSTERREICHISCHE</strong> EZA – BAND 1 101
ENTWICKLUNGSPOLITISCHE INLANDSARBEIT<br />
1993 wurde die Partnerschaft zwischen Klimabündnis Österreich und der FOIRN (Federação das<br />
Organizações Indígenas do Rio Negro) begründet.<br />
Ein Jahr später, 1994, wurde Klimabündnis Österreich als gemeinnützige Förderungs- und Bera-<br />
tungsGmbH gegründet. Die Bundeskoordination wurde von Villach nach Wien verlegt. Eigentümer<br />
waren zu gleichen Teilen das Institut für Internationale Zusammenarbeit (IIZ, heute Horizont3000),<br />
der ÖIE (heute Südwind) und die Umweltberatung Österreich.<br />
Im Juni 1997 startete das Projekt „Betriebe im Klimabündnis“ in Wien. Später folgten Salzburg,<br />
Oberösterreich, Steiermark und schließlich Kärnten.<br />
Der europaweite „Autofreie Tag“ am 22. September wurde im Jahr 2000 das erste Mal in Öster-<br />
reich abgehalten und von Klimabündnis und Energieverwertungsagentur koordiniert. 80 Gemein-<br />
den nahmen aktiv daran teil. Die Ökostaffel (Öko-Staffellauf) fand im Sommer 2001 das erste Mal<br />
statt. Es ist dies eine faire Tour für Klimaschutz und Nachhaltigkeit quer durch Österreich.<br />
Das Jahr 2003 stand im Zeichen der zehnjährigen Klimabündnis-Partnerschaft zwischen Österreich<br />
und Rio Negro. 2003 traten auch die ersten osteuropäischen Gemeinden dem Klimabündnis bei.<br />
2004 zählten zum Klimabündnis Österreich 512 Mitgliedsstädte/gemeinden, 250 Klimabündnisbe-<br />
triebe und 70 Schulen.<br />
Forum Umweltbildung<br />
Das Forum Umweltbildung ist eine Initiative des Bundesministeriums für Land- und Forstwirt-<br />
schaft, Umwelt und Wasserwirtschaft und des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und<br />
Kultur. Projektträger ist der Umweltdachverband.<br />
Der Schwerpunkt der Arbeit liegt bei Projekten im Umweltbildungsbereich. Ziel ist die Diskussion<br />
und Bearbeitung von umweltrelevanten Themen und die gleichzeitige Förderung eines kritischen<br />
Bewusstseins. Dabei werden Themen wie Nachhaltigkeit, Ökologisierung von Schulen, Ökologi-<br />
sierung der Lehrlingsausbildung und Biodiversität behandelt. In einigen Projekten arbeitet das<br />
Forum Umweltbildung in enger Kooperation mit in- und ausländischen Organisationen.<br />
Das Forum wendet sich besonders an Schulen, LehrerInnen, ÖkopädagogInnen, Universitäten,<br />
Gemeinden, Jugendliche sowie an alle in diesen Bereichen Interessierten, u. a. mit Tagungen, Se-<br />
minaren und der Zeitschrift „Umwelt und Bildung“. Die Website www.umweltbildung.at bietet<br />
Hintergrundinformationen zu Nachhaltiger Entwicklung.<br />
5.4.4. Friede, Menschenrechte<br />
IUFE – Institut für Umwelt, Friede und Entwicklung<br />
Das IUFE wurde 1998 gegründet. Es ist ein ÖVP-nahes Forum, das eine sozial gerechte und ökolo-<br />
gisch verträgliche Entwicklung fördern möchte.<br />
Das Institut ist bestrebt, durch die Kooperation mit anderen AkteurInnen (sowohl aus dem ent-<br />
wicklungspolitischen Bereich als auch aus Kreisen, die sich bisher weniger mit der Thematik be-<br />
schäftigt haben) und ExpertInnen, vor allem auch aus dem Ausland, Ressourcen zu bündeln und<br />
optimieren und neue PartnerInnen für das Anliegen der Entwicklungspolitik zu finden.<br />
102 <strong>ÖSTERREICHISCHE</strong> EZA – BAND 1
ENTWICKLUNGSPOLITISCHE INLANDSARBEIT<br />
Im Rahmen von Veranstaltungen, Publikationen, Studienreisen und Pressearbeit werden die Zu-<br />
sammenhänge und wechselseitigen Abhängigkeiten von Umwelt – Friede – Entwicklung themati-<br />
siert. In Podiumsdiskussionen, Konferenzen und Hintergrundgesprächen wird die Auseinanderset-<br />
zung mit entwicklungspolitisch relevanten Themen, wie z. B. Nachhaltige Entwicklung, gefördert.<br />
Der Fokus bei den Zielgruppen liegt bei den (politischen) EntscheidungsträgerInnen, insbesondere<br />
innerhalb der ÖVP.<br />
FIAN – First Food Informations- und Aktionsnetzwerk<br />
FIAN Österreich wurde 1989 gegründet und setzt sich für das Menschenrecht auf Ernährung ein.<br />
Mit Hilfe von Kampagnen wird versucht, Verletzungen dieses Rechts, etwa die Vertreibung von<br />
Landbevölkerung durch ein Staudammprojekt, aufzuzeigen und zu bekämpfen. FIAN Internati-<br />
onal besteht seit 1986 und besitzt Beraterstatus bei den Vereinten Nationen, wo es sich für die<br />
Verwirklichung der sozialen und wirtschaftlichen Rechte einsetzt. Im Zusammenhang mit den Mil-<br />
lenium Entwicklungszielen bearbeitet die Initiative das Thema „Ernährungssicherheit“.<br />
Gesellschaft für bedrohte Völker<br />
Die Gesellschaft für bedrohte Völker wurde 1985 als Menschenrechtsorganisation für ethnische<br />
und religiöse Gruppen und Minderheiten gegründet und ist ein gemeinnütziger Verein. Ziel ist die<br />
Förderung indigener Völker durch Inlandsarbeit in Österreich.<br />
Europahaus Burgenland<br />
Institut für politische Bildung, Infostelle für Europa- und Entwicklungsfragen<br />
Das Europahaus Burgenland (früher Europahaus Eisenstadt) wurde im September 1966 gegründet.<br />
Seit 1977 existiert eine Partnerschaft mit dem ÖIE/Südwind Agentur.<br />
Ziel der Organisation ist es, zur politischen Bildung im Burgenland beizutragen und als Informa-<br />
tionsstelle für europa- und entwicklungspolitische Fragen zu dienen. LehrerInnenweiterbildun-<br />
gen, wissenschaftliche Kolloquien und Aktionswochen mit Schulen, Gemeinden, Bildungshäusern,<br />
KünstlerInnen und Weltläden sowie die Bildung von Kleingruppen, die über einen längeren Zeit-<br />
raum ein Thema bearbeiten, sind Teile der umfassenden Bildungsarbeit. Ein Programm des Euro-<br />
pahauses experimentiert mit hierzulande unüblichen und in anderen europäischen Ländern be-<br />
liebten Versammlungsformen wie Studienzirkeln, Bibliotheksgesprächen oder dem gemeinsamen<br />
öffentlichen Singen im Freien. Die vom Europahaus Burgenland publizierte Zeitschrift „Forum<br />
Europahaus Burgenland“ befasst sich vor allem mit den aktuellen Themen des Europahauses und<br />
bietet einen Rückblick und eine Vorschau auf die Veranstaltungen der Institution. Die Europahaus<br />
Burgenland Almanache sind Jahrbücher, in denen Mitglieder und ReferentInnen der Organisation<br />
über Themen und Aktivitäten des vergangenen Jahres schreiben.<br />
Ein Teil der anlaufenden Kosten wird durch die Erträge der Initiative „Kunst für das Europahaus“<br />
finanziert.<br />
Grazer Büro für Frieden und Entwicklung<br />
Seit 1988 unterhält die Stadt Graz dieses inhaltlich und organisatorisch unabhängige Friedenszent-<br />
rum. Das Grazer Büro für Frieden und Entwicklung ist eine kommunale Einrichtung zur Förderung<br />
des Friedensgedankens. Mit Graz hat sich erstmals eine Stadtgemeinde mit Zustimmung aller po-<br />
litischen Parteien verpflichtet, kontinuierlich und systematisch Bildungs- und Projektarbeit in den<br />
<strong>ÖSTERREICHISCHE</strong> EZA – BAND 1 103
ENTWICKLUNGSPOLITISCHE INLANDSARBEIT<br />
Bereichen Frieden, Entwicklung, Toleranz, Versöhnung und Schutz der Menschenrechte zu einem<br />
eigenen kommunalpolitischen Anliegen zu machen.<br />
Das Friedensbüro Graz will in allererster Linie die Öffentlichkeit informieren und so die Bevölke-<br />
rung für die oben angeführten Bereiche sensibilisieren.<br />
Ausgehend von aktuellen Geschehnissen oder grundsätzlichen Problemstellungen wird eine um-<br />
fassende Inlandsarbeit geleistet. Es gibt Bildungsangebote für LehrerInnen, Universitäten und in<br />
der Erwachsenenbildung. Das Friedensbüro verfügt über eine friedens- und entwicklungspoliti-<br />
sche Bibliothek und Videothek und bietet darüber hinaus auch noch Beratung zu verschiedenen<br />
Themenkreisen an.<br />
Die Zeitschrift „friedensZeit“ erscheint einmal im Monat und veröffentlicht Hintergrundwissen zu<br />
den Themenbereichen Menschenrechte, Friedensarbeit und Entwicklungspolitik, um Informatio-<br />
nen abseits der Berichterstattung in den Massenmedien bereitzustellen. In der Zeitung findet sich<br />
auch ein in Kooperation mit oneworld.at erstellter Veranstaltungskalender für den Raum Graz zu<br />
friedens- und entwicklungspolitisch relevanten Veranstaltungen.<br />
FairPlay<br />
Die Initiative „FairPlay. Viele Farben. Ein Spiel“ wurde vom Wiener Institut für Entwicklungs-<br />
fragen und Zusammenarbeit (VIDC) 1997 im Rahmen des EU Jahres gegen Rassismus gestartet.<br />
Diese erste österreichweite interkulturelle Initiative im Bereich des Sports macht die Popularität<br />
und die integrative Kraft des Fußballs für die antirassistische und entwicklungspolitische Inlands-<br />
arbeit nutzbar. Einen Schwerpunkt setzt FairPlay im Bereich „Sport & Development“, insbesondere<br />
bei den ungleichen Beziehungen zwischen Europa und Afrika.<br />
FairPlay ist Partner der Europäischen Kommission und wurde vom Europarat als vorbildliches Bei-<br />
spiel im Kampf gegen Intoleranz gewürdigt. FairPlay wird vom Weltfußballverband FIFA unter-<br />
stützt und ist Gründungsmitglied und zentrale Koordinationsstelle des europäischen Netzwerks<br />
Football Against Racism in Europe (FARE). Seit 2001 ist FairPlay im Rahmen des FARE-Netzwerks<br />
ein exklusiver Partner im Unterstützungsprogramm des europäischen Fußballverbands UEFA, der<br />
mit seinem Meridian Partnerprogramm mit dem afrikanischen Fußballverband CAF selbst entwick-<br />
lungspolitisch aktiv ist.<br />
Die wichtigsten Ziele im Rahmen der entwicklungspolitischen Inlandsarbeit sind:<br />
- Information einer breiten (Sport-)Öffentlichkeit über Inhalt und Ziele der OEZA und The-<br />
matisierung der Nord-Süd-Problematik im Sport<br />
- Information der Akteure der österreichischen Sport-Community (Vereine, Verbände, Fan-<br />
clubs, StadionbesucherInnen, SpielerInnen, Sportmedien und SponsorInnen) über konkrete<br />
Handlungsmöglichkeiten im Bereich der Nord-Süd-Kooperation<br />
Asylkoordination<br />
Der Verein von AusländerInnen, Flüchtlingshilfsorganisationen und -betreuerInnen wurde im Jahr<br />
1991 gegründet. Es kam zum Zusammenschluss, weil die Hilfestellung für MigrantInnen nicht<br />
mehr effektiv war.<br />
104 <strong>ÖSTERREICHISCHE</strong> EZA – BAND 1
ENTWICKLUNGSPOLITISCHE INLANDSARBEIT<br />
Die Asylkoordination Österreich informiert über die Situation und Probleme von MigrantInnen<br />
und Flüchtlingen. Der Verein zeigt konkrete Probleme – auch anhand von Einzelfällen – auf und<br />
leitet Informationen an MedienvertreterInnen weiter. Seit 1993 erscheint die Zeitschrift „asylko-<br />
ordination aktuell“.<br />
Seit 1999 koordiniert die Asylkoordination das Projekt „Schule ohne Rassismus“ in Ostösterreich.<br />
In diesem Projekt wird gemeinsam mit SchülerInnen, LehrerInnen und Eltern ein Projektplan für<br />
das gesamte Schuljahr erarbeitet. „Schule ohne Rassismus“ ist ein europäisches Projekt, in dem<br />
SchülerInnen über Workshops und Rollenspiele aktiv an der Auseinandersetzung mit dem auch<br />
entwicklungspolitisch relevanten Thema Rassismus beteiligt sind.<br />
Eine Fachbibliothek bietet die Möglichkeit für journalistische Recherchen und dient als Informati-<br />
onsquelle für alle anderen Interessierten.<br />
Ludwig Boltzmann Institut für Menschenrechte (BIM)<br />
Das Institut wurde 1992 als außeruniversitäre Forschungseinrichtung gegründet. Das BIM legt sei-<br />
nen Arbeitsschwerpunkt auf menschenrechtliche Forschung, und zwar auf nationaler und interna-<br />
tionaler Ebene. Ziel ist es, neben der Grundlagenforschung auch verstärkt angewandte und empi-<br />
rische Forschung zu betreiben, um so praxisrelevante Daten und Studien diversen Organisationen<br />
als Entscheidungsgrundlage zur Verfügung stellen zu können. In diesem Sinn versteht sich das BIM<br />
als Bindeglied zwischen Forschung und Praxis.<br />
Servicestelle Menschenrechtsbildung<br />
Die Stelle wurde 1997 am BIM eingerichtet. Das Projekt ist als Kooperation des BIM mit dem BMB-<br />
WK entstanden. Den internationalen Rahmen dafür bildete die UN-Dekade für Menschenrechts-<br />
erziehung (1995-2004).<br />
Die Servicestelle befasst sich mit der Umsetzung von Menschenrechtsthemen an österreichischen<br />
Schulen, aber auch in außerschulischen Einrichtungen. Das Angebot reicht von Beratung über<br />
die Konzeption und Durchführung von Trainings und Fortbildungen bis zur Materialentwicklung.<br />
Zielgruppe sind LehrerInnen, SchülerInnen und im Bildungsbereich tätige Institutionen und Orga-<br />
nisationen.<br />
Die Stelle bietet Literatur, Materialien für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen und Broschü-<br />
ren in deutscher und englischer Sprache zu Menschenrechten allgemein, zur Menschenrechts-<br />
bildung und zu Themen wie Rassismus und Fremdenfeindlichkeit, Kinderrechte, Frauenrechte,<br />
Flüchtlinge an.<br />
ai.academy<br />
Amnesty International Österreich bietet die Gelegenheit, sich Grundwissen und -fähigkeiten zu<br />
Menschenrechten anzueignen oder zu vertiefen. Die Angebote sind vorwigend für junge Men-<br />
schen konzipiert und betreffen auch internationale Menschenrechtsthemen.<br />
<strong>ÖSTERREICHISCHE</strong> EZA – BAND 1 105
ENTWICKLUNGSPOLITISCHE INLANDSARBEIT<br />
5.4.5. Tourismus<br />
Der Ferntourismus hat in den vergangenen Jahrzehnten ein großes Ausmaß angenommen. Erfah-<br />
rungen auf Urlaubsreisen prägen vielfach das Bild fremder Länder und Kulturen. Vergleicht man<br />
für 1990 und 2000 die erfassten Tourismusregionen zeigt sich dies an folgenden Zahlen.<br />
Tabelle 21<br />
TOURISMUS IN ENTWICKLUNGSLÄNDER<br />
URLAUBSREISEN NACH REISEZIELEN in Tsd. Personen<br />
Tourismusregionen 1990 2000<br />
Afrika 89,5 209,6<br />
Asien 61,6 140,1<br />
Karibik, Mittelamerika 15,4 62,5<br />
Südamerika 10,7 14,9<br />
Türkei 186,3 329,5<br />
Gesamt Entwicklungsländer 363,4 756,6<br />
Quelle: Statistik Austria.<br />
Diese Auslandsorientierung zeigt sich auch im innerösterreichischen Urlaubsverhalten. Mit rund<br />
1,7 Mio. Urlaubsreisen im Jahr 2000 wurde ein geringerer Wert als zehn Jahre (1,8 Mio./1990)<br />
zuvor erreicht. In den letzten Jahren sind u.a. aufgrund politischer und gesundheitlicher Unsicher-<br />
heiten die Urlaubsreisen in Entwicklungsländer wieder rückläufig.<br />
Die Schwerpunktländer im Entwicklungsländer-Tourismus sind:<br />
Tabelle 22<br />
URLAUBSREISEN IN ENTWICKLUNGSLÄNDER in Tsd. Personen<br />
Schwerpunktländer 1990 2000 2001 2002<br />
Ägypten k.A.. 60,5 62,7 57,0<br />
China k.A.. 27,3 14,3 12,7<br />
Marokko k.A. 15,5 13,0 12,1<br />
Mexiko k.A. 17,4 11,4 8,8<br />
Republik Südafrika k.A. 20,2 15,9 12,4<br />
Türkei 186,3 329,5 366,3 294,7<br />
Thailand 1,5 43,0 25,8 24,6<br />
Tunesien k.A. 112,0 110,6 59,7<br />
Quelle: Statistik Austria.<br />
106 <strong>ÖSTERREICHISCHE</strong> EZA – BAND 1
ENTWICKLUNGSPOLITISCHE INLANDSARBEIT<br />
Die Österreichische Entwicklungszusammenarbeit hat in den vergangenen Jahren die Information<br />
der Urlaubsreisenden durch das Anbot von „Sympathie _ Magazinen“ begleitet. Diese Magazine<br />
werden vom Studienkreis für Tourismus in Starnberg/Deutschland publiziert und geben auch ei-<br />
nen Einblick in die Entwicklungsprobleme des Reiselandes.<br />
respect – Institut für Integrativen Tourismus und Entwicklung<br />
respect wurde 1995 auf Initiative der OEZA im Außenministerium gegründet. Der deutsche Studi-<br />
enkreis für Tourismus und Entwicklung und KommEnt leisteten Unterstützungs- und Aufbauarbeit.<br />
Der Arbeitsschwerpunkt von respect lag auf touristischer Bildungs-, Informations- und Forschungs-<br />
arbeit auf globaler Ebene mit besonderem Fokus auf die Beziehungen zwischen Industriestaaten<br />
und Ländern des Südens. Zu Beginn 2003 fusionierten respect und IITF (Institut für Integrativen<br />
Tourismus und Freizeitforschung) zu einer gemeinsamen Institution, dem heutigen respect – Insti-<br />
tut für Integrativen Tourismus und Entwicklung.<br />
Respect konnte gute Kontakte und Kooperationen mit Reiseveranstaltern aufbauen, die in der Wei-<br />
terbildung der professionellen TouristikerInnen, aber auch in verbesserter Öffentlichkeitsarbeit für<br />
die Zielgruppe der KundInnen dieser Reiseveranstalter sowie in Angebotsverbesserungen mündeten.<br />
Im Jahr 2000 konnte respect die Entwicklung und Verabschiedung eines freiwilligen Verhaltensko-<br />
dex im Kampf gegen Kindersextourismus zusammen mit der österreichischen Tourismuswirtschaft<br />
vereinbaren. Damit bekannte sich die österreichische Tourismuswirtschaft erstmals zu ihrer Verant-<br />
wortung nicht nur im ökologischen, sondern auch im sozialen Bereich.<br />
2003 publizierte respect eine Burma-Broschüre mit den wichtigsten gesellschaftlichen und po-<br />
litischen Hintergründen sowie Dos & Don´ts für die Zielgruppe der TouristInnen. Die Broschüre<br />
weist auf die Lage der Menschenrechte in Burma hin und wird von Reiseveranstaltern und Airlines<br />
(AUA) den Reiseunterlagen beigelegt. Bei der Erstellung der Studie und Broschüre legte respect<br />
Wert auf eine differenzierte Haltung in einer Diskussion, die zwischen den Extrempositionen der<br />
unumschränkten Tourismus-Befürwortung und der Forderung nach Tourismus-Boykott nicht zu-<br />
letzt durch die Arbeit von respect erst in Gang kam.<br />
An die breite Öffentlichkeit wenden sich Informationskampagnen wie zum Beispiel die „Wohl-<br />
fühltipps für Urlaubsreisende“: Prominente ÖsterreicherInnen konnten gewonnen werden, sich<br />
für faire und zukunftsfähige Reisen auszusprechen.<br />
Schließlich wurden umfangreiche Materialien für die Bildungsarbeit im Zusammenhang mit Ent-<br />
wicklungspolitik und Tourismus erstellt: Das Handbuch „Reisen mit Respekt – Tipps für verant-<br />
wortungsvolles Reisen“, die CD-ROM „fair reisen“ sowie mehrere Bildungsmappen für den Unter-<br />
richt. Das Thema Tourismus/Nachhaltigkeit/Entwicklungszusammenarbeit hat durch die alljährliche<br />
stattfindende „Schule des Sanften Reisens“ mit Workshopcharakter ebenso wie durch Lehrver-<br />
pflichtungen an Universitäten und Fachhochschulen verstärkt Einzug in die formale Ausbildung<br />
gehalten.<br />
<strong>ÖSTERREICHISCHE</strong> EZA – BAND 1 107
ENTWICKLUNGSPOLITISCHE INLANDSARBEIT<br />
5.4.6. Allgemeine Entwicklungspolititk<br />
Die Internationale Akademie des Renner Instituts<br />
Die Internationale Akademie des Renner Instituts veranstaltet laufend Vorträge und Seminare zu<br />
aktuellen entwicklungspolitischen Themen. Die Zielgruppe sind im Umfeld der SPÖ Interessierte<br />
an internationalen Fragestellungen.<br />
Neue Initiativen<br />
Die entwicklungspolitische Bildungsarbeit ist in den letzten Jahren auch durch eine Themen-<br />
erweiterung gekennzeichnet. Dies ist auch an institutionellen Kooperationen ablesbar (vgl. Ab-<br />
schnitt 1).<br />
ATTAC<br />
An der Gründung von ATTAC Austria im Jahr 2000 waren 50 Personen aus den unterschiedlichsten Ge-<br />
sellschaftsbereichen wie Wissenschaft, Gewerkschaft, Umweltbewegung, Kirche und Jugend beteiligt.<br />
ATTAC – Assosiation pou une Taxation des Transactions Financieres a`l aide aux Citoyens - setzt sich<br />
ein für die Stabilisierung und demokratische Kontrolle der Finanzmärkte sowie gegen die Privati-<br />
sierung der öffentlichen Dienste. ATTAC Österreich will mit seiner Arbeit gegen ein Ohnmachtsge-<br />
fühl auftreten, das die Globalisierung hervorruft, und die Gestaltbarkeit globaler Zusammenhän-<br />
ge sichtbar machen. ATTAC fordert die Politik zu einer Demokratisierung der Wirtschaft auf, damit<br />
sich diese auf langfristige Überlebensinteressen der Menschheit ausrichtet. 23<br />
Die Öffentlichkeitsarbeit von ATTAC hat einen kritischeren Umgang mit der Globalisierungsent-<br />
wicklung gefördert.<br />
So ist das internationale Freihandelsabkommen GATS in Österreich zu einem breiter diskutierten<br />
Thema geworden.<br />
Die Arbeit von ATTAC ist breit angelegt und umfasst Vorträge und Publikationen. Workshops für<br />
LehrerInnen und SchülerInnen werden ebenso angeboten wie Tagungen und die Veranstaltung ei-<br />
ner jährlichen Sommerakademie. „ATTACtionen“ sind kreative und gewaltlose Straßenaktionen.<br />
ATTAC finanziert sich aus Mitgliedsbeiträgen und Spenden. Neben privaten SpenderInnen wird AT-<br />
TAC von über 70 Organisationen aus den unterschiedlichsten Gesellschaftsbereichen unterstützt.<br />
Sonstige<br />
Im Rahmen der Bildungsarbeit von ÖGB, Wirtschaftskammer, Arbeiterkammer und Industriel-<br />
lenvereinigung finden anlassbezogen entwicklungspolitische Veranstaltungen statt. Es gibt kein<br />
strukturiertes Informationsangebot.<br />
23 Küblböck, Karin (2001). ATTAC – Potenzial für gesellschaftliche Veränderung. in: Journal für Entwicklungspolitik 2/01,<br />
201-209.<br />
108 <strong>ÖSTERREICHISCHE</strong> EZA – BAND 1
5.5. Kunst und Kultur<br />
Überblick<br />
ENTWICKLUNGSPOLITISCHE INLANDSARBEIT<br />
Kulturelle Angebote innerhalb der entwicklungspolitischen Inlandsarbeit haben in Österreich Tra-<br />
dition. Die Präsentation reicht von exotischen Darbietungen in den 1960er Jahren bis zu aktuellen<br />
Trommelkursen für ÖsterreicherInnen, gemeinsamen Auftritten österreichischer Musikschaffender<br />
mit afrikanischen KünstlerInnen bis hin zu Ausstellungen und experimenteller Video-Art. Viele<br />
EZA-Akteure bieten heute kulturelle Programme an.<br />
Das vom VIDC 1996 ausgerichtete Festival „Sura za Afrika“ bedeutete einen großen Anschub für<br />
die entwicklungspolitische Kulturarbeit in Österreich. Vor allem der Bereich der Weltmusik hat sich<br />
in den letzten zehn Jahren in Konzerten, Austauschprogrammen und im CD-Handel gut etabliert.<br />
Ein elektronisches Kulturprojekt mit den Tonga (Zimbabwe) im Rahmen der Ars Electronica in Linz<br />
wurde international ausgezeichnet. Initiativen in der bildenden Kunst oder auch klassischen Musik<br />
fanden hingegen in der Öffentlichkeit noch wenig Widerhall. Auch noch nicht gelungen ist es, Kul-<br />
tur zu einem stärkeren integralen Bestandteil der Entwicklungszusammenarbeit vor Ort zu machen.<br />
Kulturelle Angebote entwickeln sich auch an thematischen Rändern der EZA. Zu verweisen ist<br />
etwa auf die Theaterarbeit nach der Methode von Augusto Boal in der Erwachsenenbildung oder<br />
das SOG.theater. Hinzu kommt eine immer stärkere Wahrnehmung der Kultur aus den Entwick-<br />
lungsländern durch den professionellen Kulturbetrieb, insbesondere in der Weltmusik.<br />
Kunst ist ein Teil des kulturellen Ganzen, in dem KünstlerInnen als kreative GestalterInnen von<br />
gesellschaftlichem Wissen agieren: „Kunst ist visionär, kritisch, widerspruchsfreudig, innovativ,<br />
tabuverletzend, manchmal radikal, sie kann tradierte Barrieren zerstören und neue, ungewisse<br />
Wege beschreiten“. 24<br />
In der Geschichte der österreichischen EZA finden sich – abgesehen von dekorativen Elementen<br />
– nur wenige tiefergreifende Ansätze. Exemplarisch zu nennen sind die Festivals des VIDC, das<br />
Kulturaustauschprogramm der Arge Zimbabwe in Linz, die Initiative Losito in Salzburg, die 1984<br />
gegründete AAI-Galerie Karl Strobl, Lesungen und Theateraufführungen ebenso wie die vielbe-<br />
achteten Filmwochen in Innsbruck und Salzburg oder die künstlerischen Plakatgestaltungen der<br />
Aktion Familienfasttag der Katholischen Frauenbewegung.<br />
Die Ziele nachhaltiger entwicklungspolitischer Kulturarbeit sind:<br />
-- Entwicklungspolitische Kulturarbeit soll attraktiv und faszinierend sein.<br />
- Kunst/Kultur wird als Teil aller Lebensbereiche verstanden: Mobilität, Ernährung, Grund-<br />
werte, Demokratiebildung, Partizipation.<br />
- Kulturaustausch und -begegnung sind Kontakte mit „positivem Grundklang“. Es geht nicht<br />
nur um Problemdarstellungen oder Mitleid, sondern um die Förderung kultureller Vielfalt<br />
- Entwicklungspolitische Kulturarbeit will Orte schaffen für Dialoge zwischen Kulturschaf-<br />
fenden und Publikum (einerseits) und zwischen den Kulturen (andererseits). Es geht um<br />
interkulturellen Dialog.<br />
- „Fremde“/Menschen anderer Kulturen werden als kreative und wertvolle Gegenüber, bzw.<br />
Teile desselben „Organismus“ erlebt.<br />
24 Tutzinger Manifest, 2001.<br />
<strong>ÖSTERREICHISCHE</strong> EZA – BAND 1 109
ENTWICKLUNGSPOLITISCHE INLANDSARBEIT<br />
- Reflektierende Kunst wird gegenüber dem Massenspektakel gestärkt.<br />
- Das Wort „global“ wird mit Bedeutung und Leben gefüllt.<br />
- Künstlerische Ausdrucksformen können Orientierungen im Dialog der Kulturen schaffen.<br />
5.5.1. Kulturarbeit; Kulturaustausch<br />
„kulturen in bewegung" – VIDC 25<br />
Die österreichische Initiative „kulturen in bewegung“ im VIDC hat außereuropäische und grenz-<br />
überschreitende Kulturarbeit zum Programm gemacht. Es werden Schaufenster zu den Kulturen<br />
der Welt geöffnet, indem sie Kunst aus Asien, Afrika und Lateinamerika in österreichische Dörfer<br />
und Städte bringt:<br />
Frauen-Rap aus Senegal, Batimbo-Trommeln aus Burundi, Filme aus Lateinamerika, Fotografie aus<br />
Afrika, Malerei aus Vietnam, indische Handbemalungen, Metall-Skulpturen aus Zimbabwe, Thea-<br />
ter aus Argentinien, orientalische Erzählabende, türkische dj-lines, Dance-Performance aus Haiti,<br />
Videokunst aus Südafrika...<br />
Diese Arbeit wird seit rund zehn Jahren von der OEZA gefördert. Spezifische Projekte werden<br />
zudem von der Europäischen Kommission, der Kunstsektion im Bundeskanzleramt, der Stadt Wi-<br />
en und anderen öffentlichen Gebern und privaten SponsorInnen unterstützt. „kulturen in bewe-<br />
gung“ erbringt folgende Service-Leistungen:<br />
- Der Vermittlungsservice umfasst u.a. Musikbands, Tanzensembles, Bildende KünstlerInnen, Per-<br />
formance-KünstlerInnen und Workshop-LeiterInnen aus Afrika, Asien und Lateinamerika.<br />
- Die Beratungen zu interkulturellen Kulturveranstaltungen bieten Hilfestellung für Einrich-<br />
tungen wie Schulen, Gemeinden und Kulturzentren.<br />
- Es werden Organisationen bei der Konzeption und Durchführung von Tourneen, Festivals,<br />
Ausstellungen, Installationen, Medienprojekten, Videoproduktionen und Austauschprojek-<br />
ten unterstützt.<br />
- Es wird über aktuelle Entwicklungen der Kulturszene in und Entwicklungskooperationen<br />
mit Afrika, Asien und Lateinamerika informiert.<br />
- Der Weltkulturkalender in Print (zweimonatig) und im Internet (www.vidc.org/kulturenin-<br />
bewegung) bietet einen Überblick über Projekte und Veranstaltungen in ganz Österreich.<br />
„kulturen in bewegung“ ist zur zentralen Anlaufstelle für zugewanderte KünstlerInnen aus Af-<br />
rika, Asien/arabischer Raum und Lateinamerika/Karibik geworden und versteht sich nicht nur als<br />
Vermittlungs-Agentur, sondern vielmehr als Wegbegleiter. Die Servicestelle unterstützt Projekt-<br />
ideen und eröffnet Zugänge zum heimischen Bildungs- und Kulturbetrieb. Die KünstlerInnen-Da-<br />
tei umfasst mehrere hundert Personen verschiedener Kunstsparten und Herkunftsregionen. Die<br />
KünstlerInnen sind zentrale AkteurInnen des vielzitierten „Dialogs der Kulturen“. Ihre Konzerte,<br />
Aufführungen, Ausstellungen und Lesungen eröffnen dem österreichischen Publikum Schaufens-<br />
ter zur kulturellen Vielfalt in den südlichen Kontinenten. Jährlich werden zwischen 100 bis 150<br />
Veranstaltungen österreichweit betreut. Das erreichte Publikum wird auf 100.000 bis 200.000 Per-<br />
sonen geschätzt.<br />
25 Die Darstellung basiert auf Informationen, welche Franz Schmidjell, langjähriger Mitarbeiter bei „kulturen in bewegung“,<br />
zur Verfügung stellte.<br />
110 <strong>ÖSTERREICHISCHE</strong> EZA – BAND 1
ENTWICKLUNGSPOLITISCHE INLANDSARBEIT<br />
„kulturen in bewegung“ bringt KünstlerInnen aus ihren Heimatländern nach Österreich. Der Kul-<br />
turaustausch konzentriert sich auf Schwerpunkt- und Kooperationsländer der OEZA. Damit wird<br />
eine Verdichtung der vielfältigen Beziehungen angestrebt. Neben der Kulturarbeit zu den Schwer-<br />
punktländern hat der Kulturaustausch eine hohe Bedeutung für die Kulturschaffenden vor Ort.<br />
Die künstlerische Weiterentwicklung, neue Kontakte, Anerkennung zu Hause und Einkommen<br />
zum Überleben sind der Mehrwert von Tourneen für die engagierten Kulturschaffenden.<br />
Kindergärten, Schulen und Freizeiteinrichtungen sind wichtige PartnerInnen bei diesem Angebot.<br />
Die Palette von Workshop-Modulen ist vielfältig: Afro-Dance- und Trommel-Workshops oder ori-<br />
entalische Geschichtenerzählungen gehören ebenso zum Repertoire wie Workshops zu Recycling-<br />
Art, Papierspinnen und Verpackungskunst.<br />
„kulturen in bewegung“ war im letzten Jahrzehnt in Österreich wesentlich an der Verbreitung<br />
von Musik aus dem Süden beteiligt. Erfolge gab es auch in der Sparte Bildende Kunst. Andere Be-<br />
reiche blieben unterbelichtet: Literatur, Theater, Film/Video, Neue Medien oder Architektur.<br />
Auch die Verbindung von Auslands- und Kulturarbeit wurde wichtig. Kulturschaffende spielen<br />
beim sozialen Wandel und bei der Aufbauarbeit in den Entwicklungsländern eine zentrale Rolle.<br />
Ein international anerkanntes Beispiel ist die Kooperation mit der Theatergruppe Ndere Troupe<br />
aus Uganda. Heute existiert ein Netzwerk von 1.300 lokalen Entwicklungstheatergruppen und ein<br />
Theaterzentrum in Kampala.<br />
Losito<br />
Die Salzburger Initiative wurde von rückgekehrten EntwicklungshelferInnen gegründet und pflegt<br />
seit über 20 Jahren den Kulturaustausch zwischen westafrikanischen Regionen und dem Raum<br />
Salzburg. Schwerpunkte sind u.a. Angebote für Kinder und Jugendliche.<br />
Österreichische UNESCO Kommission<br />
Die österreichische UNESCO-Kommission ist die österreichische Nationalagentur der UNESCO, der<br />
Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft, Kultur und Kommunikation. Sie<br />
wurde im Jahr 1949 gegründet. Die UNESCO-Kommission war lange Zeit eine Untergliederung des<br />
Bildungsministeriums, heute ist sie ein eigenständiger Verein.<br />
Ziel und Aufgabe der UNESCO-Kommission ist es, die Bundesregierung, die Landesregierungen<br />
und andere Stellen in UNESCO-Belangen zu beraten, an der Verwirklichung der UNESCO-Pro-<br />
gramme in Österreich mitzuarbeiten, die Öffentlichkeit über die Arbeit der UNESCO, etwa die<br />
Weltdekade für kulturelle Entwicklung 1988 bis 1997 oder die Deklaration zur kulturellen Vielfalt<br />
2001 zu informieren und Institutionen, Fachorganisationen und ExpertInnen mit der UNESCO in<br />
Verbindung zu bringen.<br />
Die Kommission veranstaltet im Rahmen ihrer Inlandsarbeit Tagungen und Seminare und gibt<br />
zusammen mit anderen Institutionen regelmäßig Publikationen heraus. Entwicklungspolitische<br />
Fragestellungen spielen dabei eine maßgebliche Rolle.<br />
<strong>ÖSTERREICHISCHE</strong> EZA – BAND 1 111
ENTWICKLUNGSPOLITISCHE INLANDSARBEIT<br />
5.5.2. Interkulturelles Lernen<br />
Interkulturelles Zentrum (IZ)<br />
Das IZ wurde 1987 gegründet. Ziel ist, die Kooperation und Verständigung in interkulturellen Zu-<br />
sammenhängen nachhaltig zu verbessern und gewaltfreie Konfliktlösungen zwischen Menschen<br />
verschiedener Kulturen zu fördern.<br />
Als Beitrag zur Friedenssicherung in Südosteuropa wurde 2001 das Programm „Youthnet“ ge-<br />
schaffen, das Kontakte und gemeinsame Projekte für und von Jugendlichen in den Balkanländern<br />
ermöglichen soll.<br />
Ein Schwerpunktbereich der Inlandsarbeit des IZ ist die Beratung von verschiedensten Organisa-<br />
tionen sowohl auf regionaler Ebene (Landesjugendreferate, Landes- und Bezirksschulräte, Päda-<br />
gogische Institute), nationaler (die Bundesministerien BMBWK, BMUJF, BMaA) und auch interna-<br />
tionaler Ebene (die UNESCO, der Europarat und die Europäische Union). Insbesondere versucht<br />
das IZ durch Information und Öffentlichkeitsarbeit die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen für<br />
interkulturelle Jugend- und Schulprojekte zu verbessern.<br />
5.5.3. Weitere Initiativen<br />
In der Kunst- und Kulturarbeit bestehen neben eventbezogenen Kurzzeitinitiativen kleinere Ein-<br />
richtungen, die bereits auf eine beachtliche Kontinuität hinweisen können.<br />
AAI-Galerie Karl Strobl<br />
Die Galerie wurde 1984 vom Afro-Asiatischen Institut in Wien als permanenter Ausstellungsraum<br />
eingerichtet und nach dem langjährigen Rektor Msgr. Karl Strobl benannt. Die AAI – Galerie war<br />
für lange Zeit die einzige Möglichkeit für junge KünstlerInnen aus Afrika, Asien und Lateinameri-<br />
ka ihre Werke zu präsentieren.<br />
Die Galerie wurde in Verbindung mit der entwicklungspolitisch orientierten Buchhandlung „buch-<br />
welt“ geführt. Um 1995 wurde die Galerie verpachtet und umbenannt, 2005 geschlossen. Zur<br />
Drucklegung der Publikation wird das erste „Weltcafè“ Wiens in den Galerieräumen vorbereitet.<br />
Cross Cultural Communication (CCC)<br />
CCC wurde 1990 als Brücke der AfrikanerInnen zur österreichischen Gesellschaft gegründet. CCC<br />
ist eine Nichtregierungsorganisation und setzt sich für afrikanische Kultur in Österreich ein. Durch<br />
das Sichtbarmachen von afrikanischer Kultur soll auch die Vielfältigkeit von afrikanischen Lebens-<br />
weisen der Öffentlichkeit gezeigt werden.<br />
Projekt @rtscreen<br />
Das Projekt @rtscreen, das auf der Homepage http://www.artscreen.at den Raum für visuelle und<br />
virtuelle Kunst öffnet, stellt eine neue Dimension von Kunstinformation dar und bietet KünstlerIn-<br />
nen jeglicher Kunstrichtung und Herkunft die Möglichkeit über Kunst den Weg zur interkulturel-<br />
len Kommunikation zu finden.<br />
112 <strong>ÖSTERREICHISCHE</strong> EZA – BAND 1
Kasumama Afrika Festival<br />
ENTWICKLUNGSPOLITISCHE INLANDSARBEIT<br />
Im Jahr 1996 entstand nach einer intensiven Auseinandersetzung mit afrikanischen Trommelrhyth-<br />
men aus der losen Gruppe Kasumama der Verein zur Förderung des interkulturellen Austausches.<br />
Der Verein organisiert jährlich ein Kulturfestival – das Kasumama Afrika Festival, dessen Programm<br />
der Völkerverständigung dienen will. In Afrika-Schulworkshops wird den SchülerInnen die Mög-<br />
lichkeit gegeben, Afrika von seiner ganz alltäglichen Seite her kennen zu lernen. Die meist von<br />
afrikanischen Menschen geleiteten Workshops gibt es zu den Themen Kunst-Handwerk, Märchen,<br />
Spiele, Rhythmus und Musik.<br />
Africult Festival, Panafest<br />
Es handelt sich um zwei Initiativen in Wien, die Begegnungsmöglichkeiten in und mit der African<br />
Community schaffen. Konzentriert auf wenige Tage werden sowohl kulturelle Veranstaltungen als<br />
auch begleitende Dialogprogramme angeboten.<br />
5.6. Publikationen<br />
5.6.1. Zeitschriften und Buchreihen<br />
Das Südwind-Magazin 26<br />
Das Magazin für internationale Politik, Kultur und Entwicklung wurde 1979 als „Entwicklungs-<br />
politische Nachrichten“ (EPN) gegründet und folgte zu diesem Zeitpunkt dem „Entwicklungshil-<br />
fe-Informationsdienst“ des Österreichischen Jugendrates. Es entwickelte sich aus dem früheren<br />
Szeneblatt der Solidaritätsbewegung zu einem anerkannten und mehrfach ausgezeichneten Fach-<br />
medium für entwicklungspolitische und globale Fragestellungen.<br />
Die Redaktion verfolgt den Anspruch, Entwicklungspolitik nicht als Nischenbereich zu verstehen,<br />
sondern als Herausforderung für alle Politikbereiche. Im Südwind-Magazin wird „die so genannte<br />
Dritte Welt nicht isoliert, sondern zunehmend als Teil der globalen Vernetzung und mit vielen<br />
Zwischentönen betrachtet“, bemerkte die Tageszeitung Der Standard in ihrer Rubrik „Die aktuelle<br />
Zeitschrift“ (4.2.2003).<br />
2003 wurde der Monatszeitschrift die besondere Anerkennung des renommierten Claus Gatterer-<br />
Preises für sozial engagierten Journalismus ausgesprochen. „Für die Jury ist das Südwind-Magazin<br />
ein hervorragendes Beispiel, wie seriös und zugleich kritisch über das Problem der Globalisierung<br />
geschrieben werden kann“, begründete Jury-Vorsitzender Fred Turnheim die Entscheidung. In ih-<br />
rem Glückwunschtelegramm anlässlich der Preisverleihung betonte die damals für Entwicklungs-<br />
politik verantwortliche österreichische Außenministerin Benita Ferrero-Waldner, dass der Südwind<br />
für sie immer eine Stimme war, auf die sie großen Wert gelegt habe, wenngleich sie sicherlich<br />
nicht immer mit ihm einer Meinung war. Ferrero-Waldner: „Ich schätze ihn dennoch ganz be-<br />
sonders, da er ein breites Spektrum an Meinungen wiedergibt. Unbestreitbar ist Südwind damit<br />
ein wesentlicher Bestandteil der entwicklungspolitischen Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit in<br />
Österreich.“<br />
26 Die Darstellung basiert auf Informationen, die Irmgard Strach-Kirchner, Chefredakteurin des Südwind-Magazins, zur<br />
Verfügung stellte.<br />
<strong>ÖSTERREICHISCHE</strong> EZA – BAND 1 113
ENTWICKLUNGSPOLITISCHE INLANDSARBEIT<br />
Das Südwind-Magazin ist der „Information der Öffentlichkeit über die soziale, politische, wirt-<br />
schaftliche und kulturelle Wirklichkeit in den Ländern der so genannten Dritten Welt sowie über<br />
Entwicklungspolitik und internationale Zusammenarbeit im Sinne eines nachhaltigen Abbaues der<br />
Kluft zwischen Nord und Süd“ verpflichtet (Blattlinie). Dies schließt auch eine kritische Beleuch-<br />
tung der staatlichen Aktivitäten im Bereich der Entwicklungspolitik mit ein. Es ist dies ein schwie-<br />
riger Spagat, denn die OEZA fördert das Magazin seit seinem Bestehen maßgeblich.<br />
Das Südwind-Magazin wird in Österreich mit Schwerpunkt Wien vertrieben und ist in erster Li-<br />
nie über den Abonnementverkauf erhältlich. Es gibt ca. 6.000 bezahlte AbonnentInnen, dies<br />
entspricht geschätzten 18.000 LeserInnen. Unter ihnen sind viele MultiplikatorInnen, vor allem<br />
Lehrerinnen und Lehrer. Der Großteil der LeserInnen ist zwischen 30 und 49 Jahre alt und hat Uni-<br />
versitätsabschluss oder Matura.<br />
Vergleichbare Zeitschriften im deutschsprachigen Raum kämpfen gegen einen anhaltenden Le-<br />
serInnenschwund. Südwind hingegen kann nach Rückgängen in den 1990er Jahren einen lang-<br />
samen, jedoch stetigen Zuwachs der AbonnentInnenzahlen verzeichnen. Maßgeblich scheint die<br />
Umstellung auf Vierfarbdruck zu Jahresbeginn 2002 gewesen zu sein.<br />
Seit 1997 wird der gesamte Heftinhalt auch auf einer Website zugänglich gemacht. Alle Beiträge<br />
seit Mitte 1999 sind in einem unbeschränkt zugänglichen Archiv auffindbar.<br />
Weltnachrichten<br />
Die Weltnachrichten werden vierteljährlich von der Austrian Development Agency (ADA) heraus-<br />
gegeben. Bis 2003 lag die Herausgeberschaft in der Sektion Entwicklungs- und Ostzusammenar-<br />
beit im Außenministerium. Die Weltnachrichten erscheinen seit 1999 und haben die Publikation<br />
„öe“ (Österreichische Entwicklungszusammenarbeit), die vorwiegend einzelne Länder- und The-<br />
menschwerpunkte der OEZA präsentierte, abgelöst. Die Weltnachrichten, die gratis bezogen wer-<br />
den können, informieren über Projekte, Programme, PartnerInnen und aktuelle Themen der OEZA<br />
und räumen den staatlich Verantwortlichen entsprechend Raum für ihre Darstellungen ein. Die<br />
Auflage der Weltnachrichten beträgt 7.000 Stück und wendet sich vorrangig an Entscheidungsträ-<br />
gerInnen in Politik, Verwaltung, Medien, Wirtschaft und NGOs.<br />
Alle Welt<br />
Die Zeitschrift der Päpstlichen Missionswerke in Österreich – heute missio Austria – erscheint sechs-<br />
mal im Jahr und ist mit einer Jahresauflage von 547.000 Stück (2004) das auflagenstärkste Print-<br />
medium in der österreichischen EZA. „Alle Welt“ versteht sich als Mitgliederzeitschrift und wird<br />
auch über die katholischen Pfarrgemeinden vertrieben. Die rund 85.000 (2004) AbonnentInnen<br />
können daher mit missio-Mitgliedern gleichgesetzt werden. Die Inhalte reichen von Länderinfor-<br />
mationen, Berichten aus Missionsniederlassungen bis zu Spendenaufrufen.<br />
114 <strong>ÖSTERREICHISCHE</strong> EZA – BAND 1
Entwicklungspolitische Zeitungsbeilagen 27<br />
ENTWICKLUNGSPOLITISCHE INLANDSARBEIT<br />
Entwicklungspolitische Themen finden in den großen Publikumsmedien meist wenig Aufmerksam-<br />
keit. 1996 wurde daher auf Basis der aktuellen Nachrichtenforschung über die Dritte Welt von der<br />
Buchmarketing GmbH ein Zeitungsbeilagen-Projekt konzipiert mit der Zielsetzung entwicklungs-<br />
politische Themen anschaulich für eine breite Zielgruppe zu vermitteln.<br />
Die erste von der OEZA geförderte Beilage erschien 1997 in Kooperation mit der Südwind Agen-<br />
tur zum Thema „Bittere Orangen“ in der Zeitung „Der Standard“. 2.000 zusätzliche Exemplare<br />
wurden an Schulen als Klassenlektüre verbreitet. 2004 wurden etwa 12.000 Exemplare einer Ku-<br />
rier-Beilage in Hauptschulen sowie allgemeinbildenden und berufsbildenden höheren Schulen im<br />
Unterricht eingesetzt. Begleitend zur Beilage stellt Baoab jeweils thematisch passende Materialien<br />
wie Videos und Broschüren zur Verfügung. Im gesamten Projektzeitraum 1997 bis 2004 wurde die<br />
Zeitungsbeilage von über 1.000 LehrerInnen im Unterricht eingesetzt. Auch NGOs und Weltläden<br />
haben die Möglichkeit, die Sonderbeilage in der gewünschten Auflage gratis anzufordern und an<br />
ihre Zielgruppen zu verbreiten.<br />
Seit 1999 ist die Arbeitsgemeinschaft Entwicklungszusammenarbeit – AGEZ fixe Kooperationspart-<br />
nerin des Projektes. Sie schlägt jährlich drei Themen vor; das ausgewählte Thema wird gemeinsam<br />
mit der Zeitungsredaktion und einem Redaktionsteam, das sich abwechselnd aus verschiedenen<br />
NGOs zusammensetzt, realisiert.<br />
Seit 2002 ist MEDIAoffice Projektträgerin. Die Kooperation erfolgt seither mit dem Kurier. Die<br />
entwicklungspolitische Kurier-Beilage erreicht etwa 850.000 LeserInnen. Begleitend gibt es eine<br />
Online-Version, die allerdings noch keine Interaktionsmöglichkeiten vorsieht.<br />
Bis 2005 erschienen folgende von der OEZA geförderte Beilagen:<br />
2005 Millenniums Entwicklungsziele Kurier<br />
2005 Millenniums Entwicklungsziele Oberösterreichische Rundschau<br />
2004 UN-Jahr des Reises Kurier<br />
2003 UN-Jahr des Wassers Kurier<br />
2002 Umwelt & Entwicklung Kurier<br />
2001 Arm & Reich Standard<br />
2000 Clean Clothes Standard<br />
1999 Südfrüchte Standard<br />
1998 Tourismus Salzburger Nachrichten<br />
1997 Bittere Bohnen Standard<br />
1997 Bittere Orangen Standard<br />
27 Die Darstellung basiert auf Informationen, die Evi Scheipel, Projektleiterin bei MEDIAOffice, zur Verfügung stellte.<br />
<strong>ÖSTERREICHISCHE</strong> EZA – BAND 1 115
ENTWICKLUNGSPOLITISCHE INLANDSARBEIT<br />
5.6.2. Wissenschaftliche Publikationen 28<br />
Es lässt sich für Österreich ein engagiertes Interesse an wissenschaftlicher Auseinandersetzung mit<br />
entwicklungspolitischen Fragen feststellen. Dies ist umso bemerkenswerter, da personelle und fi-<br />
nanzielle Ressourcen für diese Arbeit zwar seit Jahren urgiert werden, aber eigens dafür bis heute<br />
kaum zur Verfügung stehen. Die Leistungen hängen von WissenschafterInnen ab, die ihr Wissen<br />
und ihre Zeit einsetzen, oder von Studierenden, die ihre Ausbildungszeit dafür nutzen. 29<br />
Forschungsförderung fällt in den Aufgabenbereich des Wissenschaftsministeriums und kann auf-<br />
grund der hohen Dauerkosten aus Mitteln der OEZA nicht gefördert werden. Die Förderung von<br />
wissenschaftlichen Buchpublikationen ist „als eine gewisse Motivation dafür zu sehen, sich mit<br />
entwicklungspolitischen Fragestellungen wissenschaftlich und publizistisch auseinander zu setzen<br />
und den öffentlichen Diskurs darüber zu fördern“, heißt es im entsprechenden Policy-Paper der<br />
OEZA zu „Wissenschaftlichen Buchpublikationen“.<br />
Es konnte diese Motivation erreicht werden. Die Förderung einschlägiger Buchpublikationen hat<br />
sich seit 1997 in etwa verdoppelt. 2003 wurden die Produktion und der Vertrieb von zwölf ent-<br />
wicklungspolitischen Büchern (dies schließt die Zeitschriftenförderung nicht ein) aus Mitteln der<br />
OEZA gefördert, inhaltlich zu ganz unterschiedlichen Themenbereichen: Im „Handbuch-Buch Af-<br />
rika“ wurden die Ergebnisse einer sehr intensiven Forschungstätigkeit veröffentlicht, im Reader<br />
„Südasien in der Neuzeit“ die Vorträge einer entwicklungspolitischen Ringvorlesung oder im Band<br />
„Die Praxis der Entwicklungszusammenarbeit“ die Erfahrungen in der EZA-Kooperation unter Be-<br />
achtung spezifisch österreichischer Gegebenheiten theoretisch reflektiert.<br />
Alle Förderinformationen können unter www.komment.at/projektrecherche mit der Abfrage „Ak-<br />
tivitäten/Medien (Print)“ eingesehen werden.<br />
Die aus Mitteln der OEZA geförderten Publikationen decken nicht das Spektrum an Veröffent-<br />
lichungen von in Österreich geleisteten wissenschaftlichen Arbeiten mit entwicklungspolitischer<br />
Relevanz ab. Zum redaktionellen Zeitpunkt ließen sich insgesamt 25 in Österreich herausgegebene<br />
Buchreihen zum gegenständlichen Themenbereich identifizieren. Rund ein Drittel davon wurde<br />
ohne Förderung aus Mitteln der OEZA veröffentlicht.<br />
Journal für Entwicklungspolitik (JEP)<br />
Das JEP erscheint 2005 in seinem 22. Jahr: Etwa 85 Einzelhefte und einige Sondernummern stell-<br />
ten und stellen nicht nur die aktuellen Arbeiten und Forschungsergebnisse von VertreterInnen der<br />
wissenschaftlichen Gemeinde Österreichs vor, sondern es gibt auch renommierte internationale<br />
Beiträge.<br />
Buchreihen des Vereins für Geschichte und Sozialkunde<br />
Die entwicklungspolitische Informationsarbeit des Vereins für Geschichte und Sozialkunde umfasst<br />
die Herausgabe von mehreren Publikationsreihen. Zwischen 1992 und 2004 sind 23 Sammelbände<br />
des Vereins für Geschichte und Sozialkunde erschienen, von denen ein guter Teil im Zusammen-<br />
hang gemeinsam mit Ringvorlesungen im Studium Internationale Entwicklung produziert wurde.<br />
28 Die Darstellung basiert auf Informationen, die KommEnt, zur Verfügung stellte.<br />
29 Vgl. Abschnitt 5.8. Studium Internationale Entwicklung.<br />
116 <strong>ÖSTERREICHISCHE</strong> EZA – BAND 1
ENTWICKLUNGSPOLITISCHE INLANDSARBEIT<br />
Die Vorlesungen und damit der Vertrieb der Bücher wurden in den letzten Jahren von Wien auch<br />
auf andere österreichische Universitäten ausgeweitet.<br />
In der Edition „Weltregionen“ geht es um den Entwurf von größeren sozialen, wirtschaftlichen<br />
und kulturellen Entwicklungszusammenhängen. Die Reihe will kein enzyklopädisches Wissen ab-<br />
liefern, sondern beispielhaft Strukturen und Lebenswelten darstellen.<br />
Eine weitere Buchreihe beschäftigt sich mit dem Themenkomplex „Geschichte, Entwicklung und<br />
Globalisierung“. Es werden aktuelle Entwicklungsprozesse aus inter- und intradisziplinärer Pers-<br />
pektive untersucht.<br />
Buchreihen der <strong>ÖFSE</strong><br />
Die <strong>ÖFSE</strong> publiziert zwei Buchreihen. Die „<strong>ÖFSE</strong>-Edition“ hat sich die Darstellung entwicklungs-<br />
politischer Vorgänge zum Ziel gesetzt. Das „<strong>ÖFSE</strong>-Forum“ veröffentlicht Hochschulschriften zu<br />
entwicklungspolitisch relevanten Themen.<br />
Südwind-Buchwelt<br />
Die Südwind GmbH wurde 1984 mit dem Ziel gegründet, den Vertrieb entwicklungspolitischer Lite-<br />
ratur österreichweit zu fördern. 1993 erfolgte die Fusion mit der Buchwelt-GmbH. Südwind unter-<br />
hält zwei Geschäfte in Wien, die Bücher, fair gehandelte Waren und CDs mit Weltmusik anbieten.<br />
Über Werbekataloge und Magazinbeilagen informiert Südwind-Buchwelt über sein Sortiment, das<br />
über den Versandhandel in ganz Österreich beziehbar ist. Die Homepage bietet einen Literatur-<br />
überblick zu verschiedenen Themen und Regionen und informiert über Sachbücher, Frauenbücher<br />
und Kinderbücher. In Kooperation mit dem Mandelbaum Verlag produziert der Südwind Verlag<br />
Titel zur Nord-Süd Problematik mit speziellem Österreich-Bezug.<br />
5.6.3. Internet<br />
Überblick<br />
Die Entwicklung der Online-Kommunikation war im vergangenen Jahrzehnt generell von einer<br />
starken Dynamik geprägt. Diese Dynamik schlug sich auch in der entwicklungspolitischen Inlands-<br />
arbeit nieder.<br />
Ein 1995 erstelltes Konzept zur Vernetzung von entwicklungspolitischen Informationsstellen sah<br />
noch den heute nicht mehr vorstellbaren postalischen Austausch von Disketten als Trägermedien vor.<br />
Die neuen Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) wurden noch gar nicht erwähnt.<br />
Das hat sich sehr schnell verändert. Die rasanten Entwicklungen im Bereich der IKT wurden mit<br />
großem Engagement verfolgt und es wurden beachtenswerte Resultate erreicht. Auch wenn es<br />
für Zugriffszahlen noch sehr unsichere Zähl- und Bewertungsstandards gibt, werden aus Doku-<br />
mentationsgründen beispielhaft einige Internet-Kennzahlen genannt.<br />
<strong>ÖSTERREICHISCHE</strong> EZA – BAND 1 117
ENTWICKLUNGSPOLITISCHE INLANDSARBEIT<br />
Als relevante Zugriffszahlen für die ausgewählten Webseiten dienen Jahresergebnisse zu „Visits“.<br />
Tabelle 23<br />
INTERNET-KENNZAHLEN 2004 – VISITS<br />
agez.at Arbeitsgemeinschaft Entwicklungszusammenarbeit 36.000<br />
attac.at ATTAC-Austria 10.000<br />
cck.at Clean-Clothes-Campaign 85.000<br />
dka.at Dreikönigsaktion der KJSÖ 96.000<br />
eza.at <strong>ÖFSE</strong> 360.000<br />
fairtrade.at FAIRTRADE (ehemals TransFair) 58.000<br />
lai.at ÖLAI 92.000<br />
oneworld.at Südwind-Agentur 450.000<br />
swa.at Südwind-Agentur 70.000<br />
Es gibt kaum mehr eine Organisation, die sich nicht auch mit einer eigenen Website im Internet<br />
präsentiert.<br />
Wichtig für Weiterentwicklungen in diesem Bereich dürfte es sein, internationale Verschränkun-<br />
gen mit AkteurInnen in südlichen Partnerländern zu vertiefen und dabei deren technische Stan-<br />
dards und Möglichkeiten zu berücksichtigen und in Ergänzung zu großen Suchmaschinen die Nut-<br />
zerInnen auf einfachem und raschem Wege zu präzisen qualitativen Ergebnissen hinzuführen.<br />
Internet-Portale<br />
Mit „oneworld.at“ und „eza.at“ haben die Südwind Agentur und die <strong>ÖFSE</strong> zwei entwicklungs-<br />
politische Portale in Österreich aufgebaut. „eza.at“ versteht sich als Service zu entwicklungspo-<br />
litischen Grundinformationen und Fakten. „oneworld.at“ vernetzt über 30 österreichische Part-<br />
nerorganisationen und präsentiert deren aktuelle Projekte und Veranstaltungen. Beide Adressen<br />
können auf beachtenswerte Entwicklungen ihrer monatlichen Besuchszahlen verweisen.<br />
Seit 2003 gibt es unter der Federführung von <strong>ÖFSE</strong> und Südwind Agentur eine Arbeitsgruppe zur<br />
Einrichtung einer Informationsplattform im Internet. Beabsichtigt ist, relevante entwicklungspoli-<br />
tische Inhalte themenorientiert und nutzerInnenfreundlich anzubieten.<br />
Unter www.globalethemen.at ist ein niederschwelliger Interneteinstieg zu internationalen Fragen,<br />
insbesondere für die Zielgruppe Jugendliche geplant. Dies soll in Kooperation von Organisationen,<br />
die relevante Inhalte anbieten, erreicht werden.<br />
118 <strong>ÖSTERREICHISCHE</strong> EZA – BAND 1
OneWorld.at 30<br />
ENTWICKLUNGSPOLITISCHE INLANDSARBEIT<br />
Der erste Zugang zu den „Neuen Medien“ entstand ca. 1992. Es wurden erste Modems mit Mail-<br />
zugang angeschafft. Ab 1994 gab es auf dem Magnet-Server Foren mit entwicklungspolitischem<br />
Bezug. Dieser Ansatz hat sich nicht durchgesetzt, weil die entwicklungspolitische Szene damals<br />
kaum mit Internetzugängen versorgt war und die Bedienungsfreundlichkeit gering war.<br />
Mitte 1996 wurde das Konzept zu „oneworld.at“ entwickelt. Die Kernidee war, eine prominente<br />
Web-Adresse zu etablieren, über die möglichst alle relevanten Organisationen in Österreich, aber<br />
auch internationale Einrichtungen auffindbar sein sollten. Die ersten Partner waren: Südwind<br />
Agentur, Südwind-Magazin, Südwind-Buchwelt, Klimabündnis Österreich, TransFair Österreich,<br />
ARGE Weltläden und die Österreichische Entwicklungszusammenarbeit im BMaA. Die Koordinati-<br />
on lag bei der Südwind Agentur.<br />
Im November 1997 wurde „oneworld.at“ Partner von OneWorld Europe, einem Verbund, dem<br />
inzwischen über 1.500 NGOs in über 100 Staaten angehören. Im Dezember 1997 übernahm die<br />
AGEZ die Trägerschaft von „oneworld.at“.<br />
In einer Datenbank können die Termine für entwicklungspolitische Veranstaltungen, Ausstellun-<br />
gen, Diskussionen oder Vorträge geordnet nach Bundesland und Zeitraum abgefragt werden. Die<br />
VerbundpartnerInnen können die Termine selbst eintragen und pflegen.<br />
Die Anzahl der an „oneworld.at“ teilnehmenden Websites ist kontinuierlich gestiegen. 31 Sie um-<br />
fassen einen breiten Bogen der NRO-Szene und repräsentieren unterschiedliche Themen, Inte-<br />
ressensgebiete und Zielgruppen. Vertreten sind unter anderen die AGEZ als Dachverband, Or-<br />
ganisationen, die Projektarbeit in Entwicklungsländern durchführen, der Faire Handel, Kultur,<br />
Frauenorganisationen, Menschenrechts-, Umwelt- und Bildungsorganisationen, konfessionelle<br />
Organisationen und Kampagnen.<br />
Informationsservice eza.at<br />
Das Informationsservice www.eza.at der <strong>ÖFSE</strong> wurde mithilfe eines EU-Projektes im Jahr 2000 ein-<br />
gerichtet. eza.at versteht sich als Dokumentationsmedium, zentraler Bestandteil ist ein umfang-<br />
reiches Datenbankangebot. Darüber hinaus wird Hintergrundinformation zu wichtigen entwick-<br />
lungspolitischen Grundlagen, Leistungen und Akteuren geboten.<br />
Das Konzept wurde in Kooperation mit oneworld.at erarbeitet und redaktionell laufend abge-<br />
stimmt. eza.at kooperiert auf europäischer Ebene mit EUFORIC, einer Plattform wissenschaftlicher<br />
Informationseinrichtungen.<br />
5.6.4. EZA-Datenbanken im Internet<br />
Datenbanken ersetzen seit Beginn der 1980erJahre Faktendokumentationen auf Papier. Die Inter-<br />
netentwicklung hat die öffentliche Zugänglichkeit zu den Daten maßgeblich erleichtert. Mehrere<br />
Datenbankangebote unterstützen heute die entwicklungspolitische Informationsarbeit.<br />
30 Die Darstellung basiert auf Informationen, die Rupert Helm und Helmut Adam zur Verfügung stellten.<br />
31 Stand Dezember 2004 – 29 Partnereinrichtungen.<br />
<strong>ÖSTERREICHISCHE</strong> EZA – BAND 1 119
ENTWICKLUNGSPOLITISCHE INLANDSARBEIT<br />
Datenbank-Angebote<br />
Die wichtigsten Angebote nach Themen und Inhalten:<br />
Akteure und Projekte<br />
www.ada.gv.at<br />
Die Austrian Development Agency (ADA) bereitet eine Projektdatenbank der aus Mitteln<br />
der OEZA geförderten Projekte vor.<br />
www.eza.at – Projekte<br />
Die Projektdatenbank im Infoservice der <strong>ÖFSE</strong> enthält seit 1996 finanzierte Auslandsprojek-<br />
te von Bund, Ländern und Gemeinden sowie privater Organisationen ab einer Größe von<br />
EURO 10.000. Es werden rund 2000 Projekte jährlich neu dokumentiert.<br />
www.eza.at – Institutionen<br />
Die Organisationsdatenbank im Infoservice der <strong>ÖFSE</strong> umfasst mehr als 1.500 öffentliche<br />
wie private EZA-Institutionen in Österreich sowie internationale Organisationen.<br />
www.koo.at<br />
Die Koordinierungsstelle für Entwicklungsförderung und Mission bietet einen Überblick<br />
der wichtigsten EZA-Einrichtungen der Katholischen Kirche Österreichs.<br />
Service, Veranstaltungen und Bildungsangebote<br />
www.oneworld.at<br />
Die Datenbank der Südwind Agentur versteht sich als Plattform entwicklungspolitischer<br />
Akteure und enthält laufend aktualisierte Veranstaltungsangebote.<br />
www.baobab.at<br />
Die Datenbank der Bildungs- und Schulstelle Baobab bietet Hinweise zu Veranstaltungsange-<br />
boten und ReferentInnen. Zielgruppe sind Schulen sowie Jugend- und Erwachsenenbildung.<br />
www.globaleducation.at bzw. www.baobab.at<br />
Es lassen sich über 1.000 Videos, Diareihen, CDs, CD-ROMs, Musikkassetten, entwicklungs-<br />
politische Spiele, DVDs, d.h. entwicklungspädagogische Materialien für alle Altersstufen<br />
recherchieren. Koordiniert von Baobab können diese über Verleihstellen in allen Bundes-<br />
ländern ausgeborgt oder erworben werden.<br />
Literatur, weiterführende Webangebote<br />
www.eza.at – Wissenschaftsliteratur<br />
Der Katalog zu wissenschaftlicher Literatur (mit rund 60.00 Bänden) bietet eine gemeinsa-<br />
me Suche für die Bibliotheken von Frauensolidarität, Lateinamerika-Institut und <strong>ÖFSE</strong>.<br />
www.bibvb.ac.at/ – Literatur<br />
Der Verbund wissenschaftlicher Bibliotheken – ALEPH umfasst alle wichtigen Universitäts-<br />
und Forschungseinrichtungen.<br />
120 <strong>ÖSTERREICHISCHE</strong> EZA – BAND 1
Spenden<br />
ENTWICKLUNGSPOLITISCHE INLANDSARBEIT<br />
www.eza.at – Webadressen (Infosservice <strong>ÖFSE</strong>)<br />
Die Datenbank zu Webangeboten im Infoservice der <strong>ÖFSE</strong> umfasst rund 200 erschlossene<br />
Webseiten zu entwicklungspolitisch relevanten Themen.<br />
www.eza.at – online-Archiv<br />
Das online-Archiv der <strong>ÖFSE</strong> umfasst wichtige Dokumente zur österreichischen und interna-<br />
tionalen Entwicklungspolitik und ist mit Volltextsuche ausgestattet.<br />
www.eza.at – Spendendatenbank<br />
Die Datenbank als Teil von www.spenden.at des Österreichischen Institutes für Spendenwe-<br />
sen gibt Auskunft zu rund 180 Spendenorganisationen mit EZA-Bezug.<br />
5.6.5. Entwicklungspolitische Newsletters<br />
Die Informationstechnologie hat Ende der 1990er Jahre zu einem Boom an elektronischen News-<br />
lettern geführt. Über viele Jahre waren aus Gründen des hohen Arbeitsaufwandes und hoher<br />
Kosten „Vereinsnachrichten“ reduziert worden. Nun bietet eine Anzahl von Organisationen und<br />
Einrichtungen elektronische Newsletters an. Eine Dokumentation findet sich auf www.oefse.at.<br />
Ein neues Arbeitsfeld ist im e-learning entstanden. Es wird seit kurzem auch in einzelnen entwick-<br />
lungspolitischen Informationsprojekten erprobt.<br />
5.7. Filme, Fernsehen und Radio<br />
5.7.1. Förderung von Filmprojekten<br />
Die Förderung von Filmprojekten fällt primär in den Aufgabenbereich der Österreichischen Film-<br />
förderung bzw. des Bundeskanzleramtes. Es werden jedoch seit ca. zehn Jahren Filmproduktionen<br />
auch aus Mitteln der OEZA gefördert, da sich das Medium Film im besonderen Maße eignet, kom-<br />
plexe Zusammenhänge anschaulich darzustellen. Es wird von den ProduzentInnen geförderter Fil-<br />
me verlangt, dass sie eine TV-Ausstrahlung oder den Einsatz des Films bei internationalen Festivals<br />
vereinbaren, und sie müssen die Filmrechte für die entwicklungspolitische Bildungsarbeit kosten-<br />
los zur Verfügung stellen. Die Filme werden dann als Videos über die Fachstelle „Weltbilder“ bei<br />
Baobab vertrieben oder verliehen.<br />
In den Jahren 1997, 1998 und 2000 fanden medienpädagogische Projekte („CLIP“) statt, in wel-<br />
chen SchülerInnen unter beratender Mitwirkung des ORF Kurzfilme zu gemeinsamen Schwerpunk-<br />
ten produzierten und bei einer Gala zur Aufführung brachten. Die besten Beiträge wurden in der<br />
ORF-Sendung „Heimat Fremde Heimat” ausgestrahlt.<br />
<strong>ÖSTERREICHISCHE</strong> EZA – BAND 1 121
ENTWICKLUNGSPOLITISCHE INLANDSARBEIT<br />
5.7.2. Filmfestivals 32<br />
In den letzten Jahren haben sich in einzelnen Bundesländern einige regionale Filmfestivals ent-<br />
wickelt: Ein jährliches Südfilmfest in Amstetten, alle zwei Jahre eine Lateinamerika-Filmwoche in<br />
Salzburg, seit 2004 entwicklungspolitische Filmtage in Linz und, seit neuestem Frauenfilmtage und<br />
eine Filmwoche im Rahmen der Global Education Week in Wien.<br />
Allen gemeinsam ist, dass Begegnungen und Gespräche mit FilmemacherInnen neben einem viel-<br />
fältigen Begleitprogramm zu den Angeboten gehören.<br />
Cinematograph Innsbruck<br />
Im Jahr 1972 wurde der Cinematographische Salon im Olympia-Kino in Innsbruck durch das Film-<br />
referat der Österreichischen Hochschülerschaft eröffnet. Um das Filmschaffen einer interessierten<br />
Öffentlichkeit allgemein zugänglich zu machen, wurde 1989 der Cinematograph-Filmverleih ge-<br />
gründet.<br />
Der Cinematograph Innsbruck will durch Filme aus verschiedenen Kontinenten andere Lebenswei-<br />
sen darstellen und auf die gesellschaftliche und politische Situation der BewohnerInnen eines Lan-<br />
des aufmerksam machen. Er will damit die BesucherInnen zu einer kritischen Auseinandersetzung<br />
mit den Kulturen anderer Länder anregen.<br />
1992 fand zum ersten Mal das international organisierte America-Filmfestival statt, dessen<br />
Anliegen es zunächst war, Filme unbekannter RegisseurInnen aus Lateinamerika zu zeigen. Später<br />
wurde das Filmangebot mit Filmproduktionen aus allen Kontinenten ausgeweitet. Seit 1999 hat<br />
das Festival den Namen „Internationales Film Festival Innsbruck“.<br />
Es bietet FilmemacherInnen aus Entwicklungsländern eine Plattform für ihre Filme und prämiert<br />
in Wettbewerben einzelne Filme. Im Rahmen des Programms gibt es für SchülerInnen spezielle<br />
Filmvorführungen und begleitende Informationen.<br />
5.7.3. Filmproduktionen der OEZA 33<br />
Die OEZA hat im Bereich der Filmproduktionen in den letzten Jahren eine rege Kooperationstä-<br />
tigkeit entwickelt. Eine besondere Rolle nahm das Fernsehen ein, da dieses Medium für die brei-<br />
te Öffentlichkeit die Hauptquelle jeder Information über Entwicklungsländer darstellt. Die OEZA<br />
hat sich um einen systematischen Austausch und Kontakt mit dem ORF Fernsehen bemüht, um<br />
Entwicklungsfragen und EZA als Themen zu positionieren. Es gelang, die Produktion zahlreicher<br />
Filme zu unterstützen, die in unterschiedlichen Sendeleisten des ORF (wie Kultur, Religion, Maga-<br />
zin) ausgestrahlt wurden.<br />
Zuletzt gab es unter dem Titel „Ferne Nachbarn“ eine Kooperation mit 3Sat/ORF, in der zwölf Do-<br />
kumentationen über Partnerländer der Entwicklungs- und Ostzusammenarbeit produziert wurden.<br />
32 Die Darstellung basiert auf Informationen, die von Petra Leber, frühere Programmreferentin bei KommEnt, zur<br />
Verfügung gestellt wurden.<br />
33 Die Darstellung basiert auf Informationen, die Heidi Frank, Referentin für Öffentlichkeitsarbeit in der ADA, zur<br />
Verfügung stellte.<br />
122 <strong>ÖSTERREICHISCHE</strong> EZA – BAND 1
ENTWICKLUNGSPOLITISCHE INLANDSARBEIT<br />
Im Mittelpunkt standen relevante entwicklungspolitische Fragestellungen, die in Kombination mit<br />
Informationen über Land und Leute veranschaulicht wurden. Pro Film wurden ca. drei Projek-<br />
te der OEZA und ihrer PartnerInnen ausgewählt, die Lösungsansätze für Entwicklungsprobleme<br />
sichtbar machen sollten.<br />
Die Herausforderungen wurden aus der subjektiven Perspektive konkreter Personen beleuchtet.<br />
Die redaktionelle Verantwortung lag bei der Fernsehredaktion, die OEZA unterstützte die Reisen<br />
der Fernsehteams inhaltlich, logistisch und finanziell. Baobab stellte begleitende Infopakete zu-<br />
sammen, damit die Filme auch in der Bildungsarbeit eingesetzt werden können.<br />
5.7.4. ORF-Radio Ö1<br />
Die Kooperation mit dem Radiosender Ö1, der für seine umfangreiche und hochstehende inter-<br />
nationale Berichterstattung bekannt ist, stellt für die OEZA eine wichtige Maßnahme dar, um<br />
ihre auf Breite ausgerichteten Initiativen auch qualitativ zu vertiefen. Im Rahmen der Sendereihe<br />
„Journal Panorama“ produzierte der ORF eine Reihe von Beiträgen. Zuletzt gab es in der Reihe<br />
„Gedanken zum Tag“ im Februar 2004 eine sechsteilige Serie rund um die Millenniums-Entwick-<br />
lungsziele der Vereinten Nationen. Fachleute der OEZA reflektierten auf ganz persönliche Art ihre<br />
Erfahrungen und Eindrücke aus der Alltagsarbeit.<br />
5.7.5. Freie nichtkommerzielle Radiostationen<br />
Im Vergleich zu vielen anderen europäischen Ländern fand die Liberalisierung des Rundfunks in<br />
Österreich verhältnismäßig spät statt. Eine erste Fassung des Privatradiogesetzes wurde 1988 be-<br />
schlossen und es hat bereits mehrere Novellierungen gegeben. Freie, nicht auf Gewinn orientierte<br />
Radiosender suchten unmittelbar darauf erstmals um Mittel der OEZA an. KommEnt erstellte ein<br />
Policy Paper, das die Förderkriterien für den Bereich festlegte.<br />
Bis 2004 wurden für zehn Projekte insgesamt 77.000 EURO aus OEZA-Mitteln zur Verfügung ge-<br />
stellt. Gefördert wurde u.a. die Vernetzung mit Partnerstationen in anderen Kontinenten oder<br />
die Ausbildung von Interessierten für die Gestaltung entwicklungspolitischer Sendungen. Im In-<br />
ternetportal www.noso.at kann man inzwischen viele Programme unabhängig von der Sendezeit<br />
hören.<br />
<strong>ÖSTERREICHISCHE</strong> EZA – BAND 1 123
ENTWICKLUNGSPOLITISCHE INLANDSARBEIT<br />
5.8. Öffentlichkeitsarbeit<br />
Überblick<br />
Öffentlichkeitsarbeit 34 ist der nach außen hin sichtbarste Beleg für die vielfältigen Initiativen und<br />
Informationsmaßnahmen der entwicklungspolitischen Inlandsarbeit. Als Instrument zur Bekannt-<br />
machung und Legitimierung entwicklungspolitischer Anliegen in der Bevölkerung hat dieser Kom-<br />
munikationsbereich – verglichen mit anderen Aktivitäten – stark an Bedeutung dazu gewonnen.<br />
AkteurInnen in der öffentlichen wie privaten EZA betreiben heute Öffentlichkeitsarbeit, wie dies<br />
für Wirtschaftsunternehmen oder Interessensverbände seit langem selbstverständlich ist. In kaum<br />
einem anderen Berufsfeld der EZA-Inlandsarbeit gab es zuletzt so große personelle Zuwächse wie<br />
in den Bereichen Public Relations (PR) und Marketing.<br />
Die Gründe sind vielfältig und liegen primär in der zunehmenden Bedeutung der „Informations-<br />
und Mediengesellschaft“, die es auch für Non-Profit-Organisationen notwendig macht, eigene<br />
Aktivitäten und Leistungen öffentlich zu präsentieren, um wahrgenommen zu werden.<br />
In der Praxis geht die entwicklungspolitische Öffentlichkeitsarbeit allerdings weit über die klas-<br />
sische Medienarbeit hinaus. Neben maßgeschneiderten Informationsprogrammen und PR-Kam-<br />
pagnen für die unterschiedlichsten Zielgruppen bemüht sich entwicklungspolitische Öffentlich-<br />
keitsarbeit besonders um die Beziehungspflege zu staatlichen, politischen und gesellschaftlichen<br />
Institutionen sowie um gute Kontakte zu ExpertInnen, MultiplikatorInnen und nahestehenden<br />
Organisationen. Diese Form der Öffentlichkeitsarbeit integriert häufig Elemente aus der entwick-<br />
lungspolitischen Bildungsarbeit, dem politischen Lobbying sowie aus dem Bereich des Marketing<br />
und Fundraising. Allerdings sind nicht nur gute „public relations“, sondern auch gute interne<br />
„relations“ im Hinblick auf erfolgreiche Kooperationen, Netzwerkbildungen und die finanzielle<br />
Absicherung von Organisationen gefragt. Diese interne PR sorgt vor allem dafür, dass Mitarbeite-<br />
rInnen, kooperierende Organisationen, Mitglieder und Förderer über die Ziele und Aktivitäten der<br />
Organisationen stets aktuell informiert sind bzw. sich mit ihnen auch gut identifizieren können.<br />
Der Fülle an Aufgaben und AnsprechpartnerInnen entwicklungspolitischer Öffentlichkeitsarbeit<br />
stehen meist knapp bemessene Zeit- und Kommunikationsbudgets in den Organisationen gegen-<br />
über. Dies birgt die Gefahr, dass Kommunikations-Konzepte nicht professionell genug umgesetzt<br />
und somit komplexe entwicklungspolitische Inhalte verkürzt dargestellt werden. Parallel dazu sind<br />
auch die Entwicklungen im Medienumfeld mit zu bedenken: Das „globale Dorf“ scheint kaum an-<br />
derswo mehr verwirklicht als in der Informationslandschaft. Überregionale Medien bieten heute<br />
eine unvergleichlich höhere Berichterstattung zu internationalen Vorgängen an als früher, so dass<br />
entwicklungspolitische Information heute eine mit Nachrichten, Fakten und Ereignissen prinzipiell<br />
gut versorgte Gesellschaft voraussetzen kann. Allerdings sind Medienunternehmen mittlerweile<br />
einem großen wirtschaftlichen Druck ausgesetzt: Personelle und finanzielle Ressourcen für ausge-<br />
dehnte Recherchen zu komplexen entwicklungspolitischen Fragestellungen stehen kaum mehr zur<br />
Verfügung, Inhalte und Sendezeiten richten sich oft mehr nach dem Geschmack der Werbekun-<br />
dInnen als nach dem Informations- und Bildungsauftrag des Mediums. Diese Selektionskriterien<br />
34 Die Begriffe „Öffentlichkeitsarbeit“ und „Public Relations (PR)“ werden im Text synonym verwendet.<br />
124 <strong>ÖSTERREICHISCHE</strong> EZA – BAND 1
ENTWICKLUNGSPOLITISCHE INLANDSARBEIT<br />
erschweren es den Organisationen zusehends, relevante Beiträge unterzubringen, die eine aus-<br />
gewogene und in ihren komplexen Zusammenhängen fundierte Berichterstattung über entwick-<br />
lungspolitische Anliegen erlauben würden.<br />
Nicht zuletzt aus diesem Grund haben sich in der entwicklungspolitischen Zielgruppenarbeit dia-<br />
logische Kommunikationsstrukturen besser entwickelt als in der Produkt-PR. Entwicklungspoliti-<br />
sche Öffentlichkeitsarbeit vertritt in erster Linie eine gesellschafts- und verständigungsorientierte<br />
Sichtweise. Dabei geht es den entwicklungspolitischen AkteurInnen primär um die Schaffung von<br />
Problembewusstsein für globale Herausforderungen in der breiten Bevölkerung und weniger um<br />
die Darstellung ihrer eigenen Organisationen. Viele setzen mittlerweile verstärkt auf Direktkon-<br />
takte, um ihre Zielgruppen zu erreichen, sie über alternative Handlungsoptionen für den Alltag<br />
zu informieren und sie zur aktiven Mitarbeit an globalen Herausforderungen zu ermutigen. Ent-<br />
wicklungspolitische Öffentlichkeitsarbeit durchläuft seit jeher viele Etappen, wobei der Weg von<br />
der bloßen Gewinnung von Aufmerksamkeit für globale Anliegen bis hin zur Einbindung der Ziel-<br />
gruppen in die aktive Umsetzung entwicklungspolitischer Ziele ein weiter ist. Dies gilt umso mehr<br />
in einer sich schnell wandelnden, globalisierten Welt. Entwicklungspolitische Öffentlichkeitsarbeit<br />
bedeutet daher wohl auch weiterhin „(global) work in progress“.<br />
5.8.1. Kampagnen<br />
Überblick<br />
„Jute statt Plastik“, „Hunger ist kein Schicksal – Hunger wird gemacht“ und „Entwicklung statt<br />
Rüstung“ waren die ersten und bekanntesten Kampagnen in den 1970er und 1980er Jahren. Seit<br />
den 1990er Jahren fanden die Kampagnen immer mehr im Gleichklang mit internationalen Kam-<br />
pagnen statt, wozu auch international ausgerichtete NGOs wie Amnesty International, Greenpeace<br />
oder der World Wildlife Fund for Nature maßgeblich beitrugen. Die Erlassjahrkampagne 2000<br />
war ein Beispiel einer international ausgerufenen Initiative im entwicklungspolitischen Bereich.<br />
Kampagnen, die sich für eine Steigerung der staatlichen Ausgaben für EZA einsetzten („Unter-<br />
schreiben Sie für 500 Millionen“ und die aktuelle „0,7%-Kampagne“), waren österreichische In-<br />
landsinitiativen, die sich ebenfalls an internationalen Verpflichtungen orientierten.<br />
Alle größeren Kampagnen und Schwerpunktprogramme orientierten sich – wie im Abschnitt 1<br />
erwähnt – seit den 1990er Jahren an den Themensträngen entlang der großen internationalen<br />
Konferenzen: 1992 zu Umwelt und Entwicklung in Rio, 1993 zu den Menschenrechten in Wien,<br />
1995 zu Frauen in Beijing, 1996 zur Weltbevölkerung in Kairo, 2002 Rio+10 in Johannesburg, 2003<br />
zu den Informations- und Kommunikationstechnologien in Genf, um einige der wichtigsten zu<br />
nennen. Seit Rio 1992 haben NGOs nicht nur öffentlichkeitswirksame Vor- und Begleitkonferenzen<br />
durchgeführt, sondern nehmen auch in den Regierungsdelegationen teil, was für das Lobbying<br />
ihrer Anliegen neue Spielräume eröffnet hat.<br />
Thematisch sind in den letzten Jahren insbesondere Fragen der Globalisierung (rund um die WTO,<br />
GATS 35 , das multilaterale Investitionsabkommen) und der weltweiten Arbeits- und Produktions-<br />
bedingungen (das Thema Fairer Handel, die Kampagne Clean Clothes, das Thema Kinderarbeit,<br />
die soziale und ökologische Verantwortlichkeit von Unternehmen) in den Mittelpunkt gerückt.<br />
35 GATS: multilaterales Abkommen zur Liberalisierung des Welthandels.<br />
<strong>ÖSTERREICHISCHE</strong> EZA – BAND 1 125
ENTWICKLUNGSPOLITISCHE INLANDSARBEIT<br />
Der Themenbereich Gender wird von Organisationen wie WIDE und Frauensolidarität mit noch<br />
unbeständigem Erfolg in die Programmdiskussionen rund um die verschiedenen Schwerpunkte<br />
eingebracht.<br />
AGEZ-Kampagnen<br />
Die Arbeitsgemeinschaft Entwicklungszusammenarbeit – AGEZ ist für die meisten Kampagnen als<br />
Dachorganisation für die NGO-Initiativen verantwortlich. Sie führte in den vergangenen Jahren<br />
die folgenden Kampagnen durch:<br />
Tabelle 24<br />
AGEZ-KAMPAGNEN<br />
2003/2004 „0,7% Kampagne“: Aufgrund des knappen Budgets eine Lobbying-, weniger<br />
eine Öffentlichkeitskampagne. Sie tritt für die qualitative und quantitative Ver-<br />
besserung der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit ein.<br />
2003/2004 ECA-Watch-Kampagne<br />
Forderung nach Sozial- und Umweltstandards bei Exportkreditagenturen<br />
2002/2003 STOP GATS-Kampagne<br />
2001-2003 Schwerpunktthema „Globalisierung – Macht – Lebensbedingungen“<br />
1998/1999 „Globale Partnerschaft für Arbeit“ (mit dem Thema Arbeit als Schwerpunkt in<br />
der entwicklungspolitischen Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit)<br />
Zuvor hatte die AGEZ schon 1995, 1998 und 1999 drei entwicklungspolitische Aktionstage orga-<br />
nisiert.<br />
Aus Anlass der zahlreichen internationalen Konferenzen seit 1992 verstärkte die AGEZ im Be-<br />
sonderen ihre Lobbying-Aktivitäten zu den dabei angesprochenen Themen. So beteiligte sich die<br />
AGEZ in Vorbereitung auf die UN-Konferenz „Rio+10“ in Johannesburg (2002) an einer NGO-<br />
Plattform für Umwelt und Entwicklung und ist seitdem auch Mitglied im Österreichischen Rat für<br />
Nachhaltige Entwicklung und im Forum der Österreichischen Nachhaltigkeitsstrategie.<br />
Clean Clothes Kampagne 36<br />
Die Clean Clothes Kampagne wurde 1990 in den Niederlanden ins Leben gerufen. Am Anfang<br />
stand die Untersuchung eines niederländischen Instituts über die Produktionsbedingungen des<br />
Bekleidungsriesen C&A und seiner Zulieferbetriebe. Die Ergebnisse sowie die Erkenntnis, dass von<br />
nationalen Regierungen und internationalen Organisationen kaum grundlegende Verbesserungen<br />
der Arbeitsbedingungen in den Weltmarktfabriken zu erwarten waren, führten zu einer Initiative,<br />
36 Die Darstellung basiert auf Informationen, die Helmut Adam, Geschäftsführer der Südwind Agentur, zur Verfügung<br />
stellte.<br />
126 <strong>ÖSTERREICHISCHE</strong> EZA – BAND 1
ENTWICKLUNGSPOLITISCHE INLANDSARBEIT<br />
um mit Hilfe der Macht der KonsumentInnen eine „saubere“ Produktion von Bekleidungsstücken<br />
zu erreichen. Seitdem haben sich elf europäische Länder der Kampagne angeschlossen.<br />
In Österreich startete die Clean Clothes Kampagne Ende 1996. VertreterInnen des Vereins Frauen-<br />
solidarität, der Informationsgruppe Lateinamerika (IGLA), der Südwind Agentur und der AGEZ ar-<br />
beiteten die Grundlagen für eine österreichweite Kampagne aus, der sich 1997 zahlreiche katho-<br />
lische Organisationen anschlossen. Unabhängig davon hatte sich in Oberösterreich die Initiative<br />
„weltumspannend arbeiten“ schon seit einiger Zeit mit dem Thema befasst. Neben dem Aufbau<br />
eines breiten Netzes von unterstützenden Organisationen in Österreich selbst war von Anbeginn<br />
an die internationale Zusammenarbeit von großer Bedeutung.<br />
Von 1999 bis 2002 übernahm die Frauensolidarität die österreichweite Koordination und übergab<br />
sie danach an die Südwind Agentur.<br />
Die Kampagne setzt sich für die Rechte der ArbeiterInnen und eine Verbesserung der Arbeits-<br />
bedingungen in der internationalen Bekleidungs- und Sportartikelindustrie ein. Sie agiert nicht<br />
gegen eine bestimmte Firma oder Marke, um nicht durch Boykott die Arbeitsplätze in den Pro-<br />
duktionsländern zu gefährden.<br />
Der Druck zeitigte erste Erfolge: Eine Gewerkschaftsgründung bei Jaqalanka Ltd, einem Zuliefer-<br />
betrieb von Nike, Lee und Wrangler; die Wiedereinstellung von entlassenen ArbeiterInnen bei<br />
einem Zulieferbetrieb von S.Oliver in Indonesien; die Einführung von Gewerkschaftsrechten bei<br />
North Sails Lanka, einem Zulieferbetrieb des österreichischen Surfartikelherstellers Boards&More.<br />
Die Inlandsarbeit in Österreich ist umfangreich: Seminare und Workshops, Theateraufführungen,<br />
7000 AbonenntInnen des Rundbriefs, Urgent Actions, über 300 LäuferInnen beim Vienna City Ma-<br />
rathon, Berichte in den Medien.<br />
Nullkommasieben-Kampagne<br />
Entwicklungsfinanzierung ist in den letzten Jahren erneut ein wesentliches Thema geworden.<br />
Nachdem der Großteil der Industriestaaten unverändert weit weg von der Erfüllung des 1970<br />
beschlossenen Ziels, 0,7 Prozent des Bruttonationaleinkommens für Entwicklungszusammenarbeit<br />
auszugeben, wurde nach einer erfolgreichen internationalen Entschuldungskampagne (Jubilee<br />
2000) die nullkommasieben-Kampagne gestartet. Der UN-Beschluss des Jahres 2000, bis 2015 die<br />
acht Millenniumsentwicklungsziele zu erreichen, und die Forderung nach Erhöhung der EZA-Aus-<br />
gaben werden dadurch unterstützt.<br />
Kampagnenforderungen sind u.a.<br />
- eine parlamentarische Beschlussfassung zu einem verbindlichen Stufenplan, um das 0,7<br />
Prozent-Ziel bis 2010 zu erreichen,<br />
- eine Restrukturierung des EZA-Bundeshaushaltes<br />
- sowie eine Qualitätsverbesserung der EZA durch eine kohärente Entwicklungspolitik<br />
Träger der Kampagne sind Mitgliedsorganisationen der AGEZ, das Kampagnenbüro war bis 2005<br />
in der AGEZ und ist nun in der Südwind-Agentur beheimatet. In anderen Ländern gibt es parallele<br />
Kampagnenvorgänge.<br />
<strong>ÖSTERREICHISCHE</strong> EZA – BAND 1 127
ENTWICKLUNGSPOLITISCHE INLANDSARBEIT<br />
Millennium Entwicklungsziele<br />
Eine Darstellung der Hauptaktivitäten zu diesem internationalen Schwerpunkt findet sich im Ab-<br />
schnitt zur Öffentlichkeitsarbeit der OEZA.<br />
5.8.2. KommEnt-Studie „Öffentlichkeitsarbeit der NRO“ 37<br />
KommEnt führte 2003 eine PR-Expertise „Öffentlichkeitsarbeit zur Entwicklungszusammenarbeit<br />
im NGO-Bereich“ durch. Elf Organisationen nahmen an dieser explorativen Studie teil. Es handel-<br />
te sich um NGOs mit unterschiedlichen Zielsetzungen und Tätigkeitsbereichen: einige aus dem<br />
entwicklungspolitischen Bildungsbereich, andere aus der EZA-Projektarbeit, wieder andere aus<br />
dem Bereich der humanitären Hilfe. Im Hinblick auf die ungleich strukturierten Kommunikati-<br />
onsabteilungen in den einzelnen NGOs wurde der Expertise ein sehr weiter Begriff von Öffent-<br />
lichkeitsarbeit zu Grunde gelegt. Dadurch war es möglich, die differierenden Leistungsumfänge<br />
von Öffentlichkeitsarbeit in den NGOs zu berücksichtigen, die häufig neben der klassischen PR<br />
auch entwicklungspolitische Bildungs- und Kulturarbeit einbeziehen oder Marketing-orientierte<br />
Ansätze aufweisen.<br />
Kriterien für die Bewertung des Datenmaterials 38 waren vorrangig die schriftlichen und mündli-<br />
chen Angaben der einzelnen NGOs gemessen am Theorie-Modell von Grunig und Hunt. 39 Soweit<br />
es um die Einschätzung der Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit hinsichtlich der Dialogfähigkeit<br />
ging, wurden diese Informationen zusätzlich durch Eigenrecherchen (z.B. über Informationsbro-<br />
schüren, Veranstaltungskalender, Studium der Homepage) ergänzt.<br />
Die wichtigsten Ergebnisse waren:<br />
- Der Stellenwert, den die Öffentlichkeitsarbeit in den NGOs als Beitrag zur Erreichung der<br />
Organisationsziele einnimmt, wurde von allen Organisationen als „sehr hoch“ eingestuft.<br />
- Laut wissenschaftlicher Definition ist Öffentlichkeitsarbeit eine „langfristig angelegte und<br />
geplante Funktion des Managements". Die Praxis in den NGOs entspricht diesem Bild. Die<br />
Kommunikationsplanung der Öffentlichkeitsarbeit erfolgt nach festen Konzepten, eine<br />
Rücksprache mit der Geschäftsleitung über die aktuelle Kommunikation erfolgt zum über-<br />
wiegenden Teil zumindest einmal wöchentlich. In etwa einem Drittel der Organisationen<br />
werden die Aufgaben der Öffentlichkeitsarbeit von der Geschäftsführung selbst wahrge-<br />
nommen.<br />
- Die Qualifikation der MitarbeiterInnen für den Aufgabenbereich der Öffentlichkeitsarbeit<br />
ist hoch: 55 Prozent haben einschlägige Lehrgänge oder ein Hochschulstudium absolviert.<br />
- Grundsätzlich lassen sich in allen NGOs Ansätze einer organisations- und marketingbezo-<br />
genen, einer gesellschaftsbezogenen und einer verständigungsorientierten Sichtweise von<br />
Öffentlichkeitsarbeit ausmachen.<br />
- Bei der Frage, welche Wirkungen die NGOs mit ihren Öffentlichkeitsarbeitsprogrammen<br />
37 Die Studie wurde von Brigitte Mayr, Absolventin am Institut für Kommunikationswissenschaft an der Universität<br />
Salzburg, durchgeführt.<br />
38 Die Daten wurden mittels Fragebogen und in Leitfädengesprächen erhoben.<br />
39 Grunig, Todd/James Hunt 1994. Public Relations Techniques, Fort Werth, 9.<br />
128 <strong>ÖSTERREICHISCHE</strong> EZA – BAND 1
ENTWICKLUNGSPOLITISCHE INLANDSARBEIT<br />
bei den Zielgruppen hervorrufen wollen, gaben die auf EZA ausgerichteten NGO gleichran-<br />
gig die Kommunikationsziele „Aufmerksamkeit wecken“, „Informationsstand erweitern“<br />
und „Einstellung der Zielgruppen verändern“ an.<br />
- Die NGOs mit dem Schwerpunkt Bildungsarbeit strebten vorrangig (zu 70 Prozent) die Ver-<br />
änderung der „Einstellung der Zielgruppen“ und des „Verhaltens der Zielgruppen“ an.<br />
- Eine Interpretation der Öffentlichkeitsarbeit nach den vier Modellen von Grunig und Hunt<br />
brachte folgende Ergebnisse:<br />
Die NRO aus dem Bereich EZA betrieben Öffentlichkeitsarbeit vorwiegend nach den Mo-<br />
dellen „Publicity“, „Information“ und „Persuasion“. Ihre Öffentlichkeitsarbeit bewegte<br />
sich daher im Bereich der Ein-Weg- bzw. asymmetrischen Zwei-Weg-Kommunikation. Sie<br />
war eher organisations-dominant. Das Dialogmodell nach Grunig und Hunt spielte in der<br />
externen Kommunikation nur bei jener Organisation eine Rolle, welche unter anderem<br />
auch in der entwicklungspolitischen Bildungsarbeit engagiert war.<br />
Die NGOs aus dem Bereich Bildung wiesen ihrer Öffentlichkeitsarbeit die Aufgabe der „Be-<br />
wusstseinsbildung“ und der „Erarbeitung von Handlungsoptionen“ zu. Dies geschah über<br />
Direktkontakte mit bzw. über dialogische Beziehungen zu den Zielgruppen. Das Kommu-<br />
nikationsverhältnis gestaltete sich in diesen Teilnehmergruppen zwischen den Organisatio-<br />
nen und ihren Zielgruppen relativ ausgewogen. Nach Grunig und Hunt ist im Dialogmodell<br />
neben der Kommunikation auch noch ein Handlungsauftrag für die Öffentlichkeitsarbeit<br />
gegeben.<br />
- Die Frage, wie dialogisch die Zielgruppenarbeit der NGOs verfasst war, muss differenziert<br />
beantwortet werden.<br />
- Bereits aus den Interpretationen nach den Theoriemodellen von Grunig und Hunt ließ sich<br />
ableiten, dass jene NGOs, die großes Augenmerk auf die entwicklungspolitische Bildungs-<br />
arbeit legten, gewöhnlich dialogischer vorgingen als jene, die vorwiegend im humanitären<br />
bzw. karitativen Bereich tätig waren. Dies traf zumindest auf die Kommunikation mit den<br />
meisten externen Zielgruppen zu.<br />
- Jedoch investierten fast alle NGOs viel an interpersoneller Kommunikation durch die Kon-<br />
taktpflege zu MedienvertreterInnen, KooperationspartnerInnen, Opinionleadern und Mul-<br />
tiplikatorInnen sowie PolitikerInnen im Bereich des Lobbyings.<br />
- Obwohl ca. 90 Prozent der NGOs Lobbying und Kontakte zu Opinionleadern als wichti-<br />
gen Bestandteil ihrer Öffentlichkeitsarbeit angaben, wurden diese Teilöffentlichkeiten<br />
häufig nicht als strategische Zielgruppen wahrgenommen, sondern nahmen offenbar eine<br />
Art „Mitläufer-Position“ in der Öffentlichkeitsarbeit ein. Ähnlich verhielt es sich bei den<br />
Teilöffentlichkeiten „Medien“ und „KooperationspartnerInnen“. Die Zielgruppe „Mitarbei-<br />
ter-Innen“ wurde nur von einer Organisation explizit als solche genannt.<br />
- Die NGOs wünschten sich mehr Informationen über die Rezeptionskanäle und Zugänge<br />
ihrer Zielgruppen zu entwicklungspolitischen Themen. Weiters waren Daten aus der Trend-<br />
forschung (jugendliches Freizeitverhalten, Konsum, Spendenmotive, etc.) gefragt.<br />
- Alle elf NGOs evaluierten ihre Öffentlichkeitsarbeit. Es überwog die summative Evaluation<br />
(Ergebnismessung) und es wurden vorwiegend quantitative Daten gesammelt.<br />
<strong>ÖSTERREICHISCHE</strong> EZA – BAND 1 129
ENTWICKLUNGSPOLITISCHE INLANDSARBEIT<br />
5.9. Öffentlichkeitsarbeit der OEZA 40<br />
5.9.1. Die Öffentlichkeitsarbeit der Österreichischen<br />
Entwicklungszusammenarbeit im BKA/Außenministerium 1992 bis 2000<br />
Diese Phase war bestimmt vom Aufbau einer eigenen Presse-, Medien- und Publikationstätigkeit<br />
– zur Information der EntscheidungsträgerInnen und breiterer Teilzielgruppen insbesondere über<br />
die Situation in den ÖEZA-Partnerländern, die Tätigkeit der in- und ausländischen Projektträger<br />
sowie die österreichischen Leistungen.<br />
Dies erfolgte durch Service für JournalistInnen, Medienkooperationen, eine beträchtliche Anzahl<br />
von Fernseh- und Radiosendungen gemeinsam mit dem ORF sowie die Herausgabe der „Weltnach-<br />
richten“ und spezielle Publikationen.<br />
Zweiter Schwerpunkt der ÖEZA-Öffentlichkeitsarbeit waren „Kooperationsprojekte“ mit NGOs,<br />
die sich an breitere, für die ÖEZA interessante Teilzielgruppen wandten und für die dabei die Zu-<br />
sammenarbeit mit einer staatlichen Stelle kein grundsätzliches Problem darstellte. Ein wichtiges<br />
Ziel war, in diese Informationsprojekte auf geeignete Weise eine EZA-bezogene Sichtweise einzu-<br />
bringen und mitzukommunizieren. Es handelte sich durchwegs um Projekte, die den Dialoggrup-<br />
pen vor allem auch Handlungsmöglichkeiten boten.<br />
Es gab unter anderem Kooperationen mit:<br />
- dem Klimabündnis Österreich zum Schutz indigener Völker, zur globalen Klimaproblematik<br />
und Regenwalderhaltung: Zielgruppen waren österreichische Gemeinden, Entscheidungs-<br />
trägerInnen und Umweltinteressierte.<br />
- dem Lateinamerika Institut zum ÖEZA-Regenwaldprogramm in Form einer Ausstellung<br />
zum Regenwald und österreichweiten Veranstaltungen.<br />
- dem VIDC im Rahmen des Festivals Sura za Afrika. Zielgruppen waren Kulturinteressierte,<br />
Kulturinitiativen und die Medien.<br />
- dem Museum für Völkerkunde bei Ausstellungen zu Bhutan und Afrika.<br />
- TransFair/FAIRTRADE zu Fairem Handel und weltweiten Handelsfragen für die Zielgruppe<br />
KonsumentInnen.<br />
- „weltumspannend arbeiten”, einer Initiative im ÖGB Oberösterreich zu globalen Abhän-<br />
gigkeiten und Solidarität im Bereich der Arbeitswelt. Die Zielgruppen waren Arbeitnehme-<br />
rInnen und Gewerkschaften.<br />
- dem Studienkreis für Tourismus und Entwicklung sowie mit respect – Institut für Integrati-<br />
ven Tourismus und Entwicklung für die Zielgruppe FerntouristInnen.<br />
- der Medienstelle Weltbilder bei Baobab beim Vertrieb der vom ORF mit der ÖEZA produ-<br />
zierten Filme an die Zielgruppen LehrerInnen, MultiplikatorInnen, Schulen.<br />
40 Der Text basiert auf einer Darstellung, die Christine Jantscher, die Leiterin der Öffentlichkeitsarbeit der OEZA in der<br />
ADA, zur Verfügung stellte.<br />
Zu den Begriffen ÖEZA und OEZA: Bis 2003 wurde das Akronym ÖEZA für den Gesamtbereich der Österreichischen<br />
Entwicklungszusammenarbeit (als Branchenbegriff und als konkreter Akteur im Außenministerium) angewendet. Ab<br />
2004 bezeichnet OEZA die Österreichische Entwicklungs- und Ostzusammenarbeit des Außenministeriums und der<br />
ADA. Hinweise in den Fußnoten liegen in der Verantwortung der Redaktion.<br />
130 <strong>ÖSTERREICHISCHE</strong> EZA – BAND 1
ENTWICKLUNGSPOLITISCHE INLANDSARBEIT<br />
Die ÖEZA ermöglichte durch Auftragsprojekte den oben erwähnten NGOs 41 mehrjährige Initial-<br />
phasen von Vorhaben, für die wegen ihrer finanziellen Größenordnung keine Finanzierungsmög-<br />
lichkeit aus ÖEZA-Fördermitteln bestand.<br />
Danach war in einigen Fällen eine EU-Kofinanzierung der Projekte möglich bzw. konnten diese in<br />
das Förderbudget der ÖEZA aufgenommen werden.<br />
5.9.2. Die Programmperiode 1999 bis 2001<br />
Im Dreijahresprogramm der ÖEZA wurden die erwarteten Ergebnisse der Öffentlichkeitsarbeit der<br />
ÖEZA im Außenministerium wie folgt festgehalten 42 :<br />
- Die Akteure der Inlandsarbeit verstehen ihre Tätigkeit als Kommunikation und kennen<br />
die Bedeutung von entsprechendem und schrittweisem Vorgehen: Kommunikation, Er-<br />
innerung, Akzeptanz der Botschaften, Einstellungsbildung und -änderung, Verhaltens-<br />
änderung.<br />
- “Österreichische Entwicklungszusammenarbeit” ist als Bezeichnung für den Gesamtbereich<br />
(“die Branche”) eingeführt und bekannt.<br />
- Als „Botschaften“ werden in diesem Zusammenhang insbesondere kommuniziert: „Eine<br />
Welt für Alle; Entwicklungspolitik ist Lebenspolitik; Entwicklungszusammenarbeit geht alle<br />
an; Partner und Partnerinnen in der Welt; Auf der Suche nach neuen Wegen; Es ist noch<br />
viel zu tun.“<br />
- Die Akteure wollen Umfang und Stellenwert der Branche und ihrer Leistungen vergrößern.<br />
- Die Trennung in (entwicklungspolitische) „Inlands/Informations-” und (EZA)-„Auslands/Pro-<br />
jektorganisationen” ist überwunden.<br />
- Es gibt eine verstärkte Kooperation in der Öffentlichkeitsarbeit mit gesellschaftlich rele-<br />
vanten Gruppierungen und Einrichtungen: Parteien, Interessensvertretungen, Bildungsein-<br />
richtungen, etc.<br />
- Die Zustimmung der ÖsterreicherInnen zu einer qualitativ und quantitativ verbesserten<br />
Entwicklungszusammenarbeit liegt im EU-Durchschnitt.<br />
- Die Schwerpunktländer der Programm- und Projekthilfe Österreichs (insbesondere in Afri-<br />
ka) sind in der Öffentlichkeit zunehmend bekannt.<br />
- Den Akteuren und EntscheidungsträgerInnen im Bereich ist bewusst:<br />
Entwicklungspolitische Öffentlichkeitsarbeit ist wichtig, sie ist aber kein Ersatz für Entwick-<br />
lungszusammenarbeit und Entwicklungspolitik.<br />
Für die beiden Bereiche der Förderung und der Öffentlichkeitsarbeit der ÖEZA im Außenministe-<br />
rium wurden getrennte Aufgabenfelder definiert:<br />
41 BAOBAB, Museum für Völkerkunde, LAI, respect, TransFair, VIDC, „weltumspannend arbeiten“.<br />
42 Dreijahresprogramm der ÖEZA 1999-2001. Die Zielsetzungen galten auch für die von der ÖEZA im BMaA geförderten<br />
Informationsvorhaben.<br />
<strong>ÖSTERREICHISCHE</strong> EZA – BAND 1 131
ENTWICKLUNGSPOLITISCHE INLANDSARBEIT<br />
Die aus Mitteln der Österreichischen Entwicklungszusammenarbeit geförderte Informations-, Bil-<br />
dungs- und Öffentlichkeitsarbeit der Nichtregierungsorganisationen/der zivilen Gesellschaft ist<br />
schwerpunktmäßig „Mikrokommunikation“, das heißt, sie wendet sich schwerpunktmäßig an<br />
spezialisierte Zielgruppen und umfasst insbesondere Maßnahmen der Bewusstseinsbildung sowie<br />
vertiefende Beiträge in Bildung, Kultur und Wissenschaft.<br />
Die Öffentlichkeitsarbeit der Österreichischen Entwicklungszusammenarbeit im Außenministeri-<br />
um ist schwerpunktmäßig „Makrokommunikation“ und wendet sich insbesondere an Entschei-<br />
dungsträgerInnen, Verwaltung, Wirtschaft sowie an breitere Zielgruppen in der österreichischen<br />
Bevölkerung.<br />
Mit der Umsetzung der Aktivitäten sowie der damit zusammenhängenden organisatorischen Auf-<br />
gaben in einem „Informationsbüro der Österreichischen Entwicklungszusammenarbeit“ war die<br />
PR-Agentur IKP 43 , später Trimedia Communications Austria beauftragt. 44<br />
Der Aufbruch der Öffentlichkeitsarbeit der Österreichischen Entwicklungszusammenarbeit war<br />
von einer hohen Produktivität gekennzeichnet. Zahlreiche Publikationen zu den Schwerpunktlän-<br />
dern und -themen der ÖEZA 45 und vor allem auch umfassende Projekte (wie Sura za Africa oder<br />
die Bhutanausstellung) kennzeichneten diese Phase.<br />
Es wurde eine Reihe von begleitenden Studien und Evaluierungen durchgeführt und in Doku-<br />
mentationen und Imageanalysen der Medienberichterstattung zeigte sich, dass die Berichterstat-<br />
tung (infolge von JournalistInnenreisen, Medienkooperationen und anderen Serviceleistungen des<br />
ÖEZA-Informationsbüros) in einem beträchtlichen Ausmaß an Umfang und Qualität zugenom-<br />
men hatte. Insbesondere im Rahmen der Kooperationsprojekte (wie FairTrade oder Klimabündnis)<br />
wurde die ÖEZA auch auf Landes- und Gemeindeebene zunehmend als Faktor wahrgenommen.<br />
Die Öffentlichkeitsarbeit der ÖEZA setzte sich damals auch das Ziel, „Österreichische Entwicklungs-<br />
zusammenarbeit“ als Marke der EZA-Branche bei öffentlichen und privaten Stellen österreichweit<br />
bekannt zu machen, positiv zu besetzen und von einem negativen Entwicklungs- und Katastro-<br />
phenhilfe-Image abzugrenzen.<br />
Wenn auch die Positionierung dieser Marke an sich erfolgreich war, scheiterten die Bemühungen,<br />
die (Wort-)Marke für die gesamte öffentliche und private EZA-Branche eine Dachmarke einzufüh-<br />
ren, an organisationspolitischen und inhaltlichen Spannungen zwischen privaten EZA-Organisati-<br />
onen und dem öffentlichen Hauptfinancier Außenministerium, da es nicht gelang, die Marke vom<br />
Auftritt des Außenministeriums abzuheben. 46<br />
43 IKP hatte bereits 1994 den Auftrag zur Konzepterstellung einer EZA-Öffentlichkeitsarbeit erhalten. Das Studienergebnis<br />
wurde nie publiziert.<br />
44 Für 1999 und 2002 fanden EU-weite Ausschreibungen der Öffentlichkeitsarbeit der ÖEZA im Außenministerium und<br />
damit der Tätigkeit des Informationsbüros statt.<br />
45 Die von der EZA-Sektion beauftragten und von der Südwind Agentur publizierten Länder- und Themeninformationen<br />
„öe“ erschienen ab 1996 und wurden 2001 wieder eingestellt.<br />
46 Der EZA-Sektion gelang es nicht, das ursprünglich neutrale Logo zu verankern. Ab 2000 wurde der Begriff<br />
„Österreichische Entwicklungszusammenarbeit“ in das Logo des BMaA eingebaut.<br />
132 <strong>ÖSTERREICHISCHE</strong> EZA – BAND 1
5.9.3. Die Öffentlichkeitsarbeit der ÖEZA seit 2000<br />
ENTWICKLUNGSPOLITISCHE INLANDSARBEIT<br />
Die Öffentlichkeitsarbeit der ÖEZA stand zu Beginn 2000 vor neuen Herausforderungen: Die<br />
Akteure der ÖEZA und das Thema im Allgemeinen waren verstärkt in Bedrängnis. Budgetkür-<br />
zungen sowie eine Änderung der politischen Situation nach der Regierungsbildung von ÖVP und<br />
FPÖ 47 verlangten eine Neuorientierung und eine geänderte Kommunikationsstrategie.<br />
In der ÖEZA im BMaA war man überzeugt, dass die Strategie der letzten Jahrzehnte, also vor<br />
allem die Orientierung an der gesellschaftspolitischen Funktion von Entwicklungszusammenarbeit,<br />
nämlich – je nach ideeller und politischer Herkunft – Nächstenliebe, Solidarität, Gerechtigkeit, er-<br />
gänzt werden musste. Man sah sich gefordert, vermehrt den „Produktnutzen“ zu definieren und<br />
zu kommunizieren. 48 Er lautete: „Die Entwicklungszusammenarbeit macht die Welt sicherer und<br />
stabiler. Die Entwicklungszusammenarbeit hilft aber auch eine gerechtere Welt zu schaffen und<br />
jedenfalls die größte Armut zu lindern.“ Und: „Eine ordentlich dotierte und gut funktionierende<br />
Entwicklungszusammenarbeit fördert auch das Image Österreichs im Ausland.“<br />
Diese Überlegungen führten dazu, dass die Öffentlichkeitsarbeit der ÖEZA im Außenministerium<br />
die Informationsinitiative „Zukunft der Entwicklungszusammenarbeit“ startete, bei der erstmals<br />
auch Mittel der klassischen Werbung eingesetzt wurden.<br />
5.9.4. Die Informationsinitiativen 2000 bis 2004<br />
Um Entwicklungszusammenarbeit stärker ins öffentliche Bewusstsein zu heben, mussten Kräfte<br />
und Botschaften gebündelt werden. Zusätzlich zu laufenden Medienaktivitäten sowie der Heraus-<br />
gabe von Berichten und Publikationen sollte einmal jährlich ein umfassender Informationsschwer-<br />
punkt gesetzt werden. Die ÖEZA konzentrierte sich auf den Dialog mit Medien und Entschei-<br />
dungsträgerInnen als Kernzielgruppen.<br />
Darüber hinaus sollten Maßnahmen der Massenkommunikation bei breiten Bevölkerungsschichten<br />
die öffentliche Wahrnehmung der EZA steigern und deren Bekanntheit deutlich heben. 49<br />
Die Zukunft der Entwicklungszusammenarbeit 2000/2001<br />
Armut, Friede, Umwelt standen als Kernthemen der EZA im Mittelpunkt. Der Aspekt der Sicherheit<br />
wurde zunehmend in die Kommunikation integriert. Erstmals fand auch der Versuch statt, Ent-<br />
wicklungszusammenarbeit stärker zu personalisieren und mit glaubwürdigen ImageträgerInnen<br />
zu verbinden. Der Akteur „Die Österreichische Entwicklungszusammenarbeit im Außenministerium“<br />
wurde mit seinen RepräsentantInnen stärker in den Vordergrund gerückt. 50<br />
47 Im Regierungsprogramm 2000 findet sich keine Aufwertung der Entwicklungszusammenarbeit.<br />
48 Dies ist ein Hinweis auf das Kosten/Nutzen-Denken in der Inlandsarbeit, das u.a. vom BMaA forciert wurde (vgl. auch<br />
Abschnitt 1).<br />
49 Siehe auch Abschnitt zu Public Support.<br />
50 Die Kampagnen stießen auch aufgrund der starken Personalisierung von Außenministerin Dr. Benita Ferrero-Waldner<br />
in der NGO-Szene auf Kritik. Es wurde im Vorfeld des Bundespräsidentschaftswahlkampfes 2004 der Aufbau eines<br />
Kandidatinnenprofils vermutet. Ferrero-Waldner war dann tatsächlich 2004 Kandidatin der ÖVP.<br />
<strong>ÖSTERREICHISCHE</strong> EZA – BAND 1 133
ENTWICKLUNGSPOLITISCHE INLANDSARBEIT<br />
Neben Fachveranstaltungen mit ExpertInnen und Medienkooperationen (Presse, Wiener Zeitung,<br />
Kurier und Ö1 „Journal Panorama“, div. ORF Beiträge) kam erstmals klassische Werbung in TV<br />
und Printmedien zum Einsatz. Mit einer eigenen Website und einer Broschüre „Engagement für<br />
Entwicklung“ sowie einer Telefon-Hotline wurde ein Angebot zur aktiven Beteiligung an diesem<br />
neuen Kommunikationsprozess gemacht und die Möglichkeit des persönlichen Engagements ins<br />
Zentrum gerückt.<br />
Die gesamte Imagekampagne war für Aktivitäten der NGOs offen, um diese einer breiteren Öf-<br />
fentlichkeit als Handlungsangebote zugänglich zu machen. Damit sollten auch stärkere Synergien<br />
mit der geförderten Öffentlichkeitsarbeit erreicht werden.<br />
Neu war auch ein Finanzierungskonzept, das Sponsoringmaßnahmen für Inseratschaltungen in<br />
Printmedien und TV-Spot-Ausstrahlungen von Privatsendern beinhaltete. Die TV-Spots im ORF wa-<br />
ren aufgrund des gewährten Sozialtarifs realisierbar.<br />
Entwicklungszusammenarbeit als Chance<br />
Inhaltlich war die Informationsinitiative 2002 ausgerichtet auf das internationale entwick-<br />
lungs- und umweltpolitische Großereignis des Jahres, den Weltgipfel zu Nachhaltiger Ent-<br />
wicklung in Johannesburg, Südafrika. Die Sujets, die für die klassische Inserat- und TV-Wer-<br />
bung produziert wurden, vermittelten den Zusammenhang von Armut und Sicherheit, Er-<br />
haltung des Lebensraumes und die Unterstützung des Fairen Handels als effektive Beiträge<br />
der Entwicklungszusammenarbeit zur globalen Nachhaltigkeit. Mit drei TV-Spots, Medien-<br />
kooperationen mit „Der Standard“, den „Salzburger Nachrichten“ und dem Radiosender<br />
Ö1 sowie durch Gratis-Inseratschaltungen der Verlage in den verschiedensten Zeitungen<br />
und Magazinen konnten eine hohe Aufmerksamkeit und Reichweite erreicht werden.<br />
Weiterführende Informationen über nachhaltige Entwicklungsprojekte und Möglichkeiten, selbst<br />
aktiv zu werden, boten neben der Website www.eza.gv.at 51 der aktualisierte Leitfaden „Enga-<br />
gement für Entwicklung“ sowie eine Sonderausgabe der Weltnachrichten „Nachhaltige Entwick-<br />
lung“. 2002 gab es erstmals auch einen gemeinsamen Jahresschwerpunkt („Nachhaltige Entwick-<br />
lung“) mit dem Bereich der über KommEnt geförderten NGO-Projekte.<br />
Acht Ziele für die Welt<br />
Im September 2000 einigten sich alle Mitgliedstaaten der UNO auf acht Entwicklungsziele, die bis<br />
2015 die Richtlinie der internationalen Entwicklungszusammenarbeit vorgeben. Um ein entspre-<br />
chendes Bewusstsein auch in Österreich dafür zu schaffen, startete die ÖEZA im November 2003<br />
die Informationsinitiative mit dem Titel „Acht Ziele für die Welt“.<br />
Die Millenniums-Entwicklungsziele wurden in Medienkooperationen (Presse, Kurier und Kleine<br />
Zeitung, ORF-Radio Ö1) und in einem TV-Spot als internationale Initiative und politisches Rahmen-<br />
werk zur nachhaltigen Verbesserung der Lebensbedingungen der Menschen in aller Welt vorge-<br />
stellt. Projektbeispiele sollten veranschaulichen, welchen Beitrag die ÖEZA dazu konkret leistet.<br />
Im Rahmen der Förderung wurden österreichische NGOs eingeladen, mit ihrer Inlandsarbeit<br />
diesen Themenschwerpunkt zu ergänzen und zu vertiefen. Elf Projektvorhaben wurden in der<br />
51 Die Website wurde nach Ablauf der Kampagne 2002 und dem Relaunch der Außenministeriumshomepage 2002/03<br />
in die ÖEZA-Seiten integriert.<br />
134 <strong>ÖSTERREICHISCHE</strong> EZA – BAND 1
ENTWICKLUNGSPOLITISCHE INLANDSARBEIT<br />
Gesamthöhe von 325.000 EURO gefördert. Ein Workshop von KommEnt trug zu deren Vernetzung<br />
bei. Den inhaltlichen Bogen zwischen den Aktivitäten der OEZA und der NGOs spannte ein ge-<br />
meinsames Logo.<br />
Die zweite Phase der Informationskampagne, von Oktober bis Dezember 2004, vertiefte die all-<br />
gemeine Information über die Millenniums-Entwicklungsziele und widmete sich dem ersten Ent-<br />
wicklungsziel: Der Halbierung der extremen Armut und des Hungers auf der Welt. Mit einer Fach-<br />
veranstaltung zum Thema Ernährungssicherheit gemeinsam mit dem Lebensministerium sowie im<br />
Rahmen von Medienkooperationen mit zwei großen Bundesländer-Tageszeitungen gelang es, die<br />
Vernetzung und Zusammenarbeit mit anderen österreichischen EZA-AkteurInnen auf Bundes- und<br />
Länderebene zu verstärken.<br />
Mit dem Thema der Millenniums-Entwicklungsziele stellte sich die Österreichische Entwicklungs-<br />
zusammenarbeit auch einer neuen Kommunikationsaufgabe: Einerseits sollten, wie bisher, die<br />
Notwendigkeit, Sinnhaftigkeit und Wirksamkeit der konkreten österreichischen EZA-Leistungen<br />
dargestellt werden. Zunehmend sollte aber auch deutlich gemacht werden, wie Österreich als Teil<br />
und Partner der internationalen Gemeinschaft an der Erfüllung gemeinsamer Aufgaben mitwirkt.<br />
Es wird dies eine herausfordernde Aufgabe, da die Leistungen der EU und der Vereinten Nationen<br />
im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit in der österreichischen Bevölkerung wenig bekannt<br />
sind und zudem beide Institutionen mit anhaltend geringen Imagewerten kämpfen.<br />
5.9.5. Weitere Schwerpunkte<br />
Medienarbeit<br />
Da die Medien maßgeblich dazu beitragen, „Weltbilder“ zu kreieren, und damit auch das öffentli-<br />
che Bild der Österreichischen Entwicklungszusammenarbeit prägen (können), blieben die Medien-<br />
arbeit und der Dialog mit den JournalistInnen ein Schwerpunkt in der Öffentlichkeitsarbeit der<br />
OEZA. Zahlreichen Hörfunk- und PrintjournalistInnen wurde im Rahmen von JournalistInnenreisen<br />
die Möglichkeit geboten, Entwicklungszusammenarbeit vor Ort zu erfahren und so auch eine per-<br />
sönliche Beziehung zum Thema aufzubauen.<br />
Öffentlichkeitsarbeit für die Österreichische Ostzusammenarbeit<br />
Die Österreichische Ostzusammenarbeit ressortiert seit 2000 im Außenministerium. Im Vergleich<br />
zur Entwicklungszusammenarbeit mit den Ländern des Südens gab es bis 2003 kaum inneröster-<br />
reichische Öffentlichkeitsarbeit. Mit zwei Beiträgen in der Doku-Reihe „Ferne Nachbarn“, mit Me-<br />
dienkooperationen und Schaltungen in „Die Presse” und „Der Standard” begann der systemati-<br />
sche Aufbau der Kommunikationsarbeit. Der Heranführung Südosteuropas an die Europäische<br />
Union und der Rolle Österreichs kommt dabei zentrale Bedeutung zu. Wesentlich stärker stehen<br />
hier auch Aspekte der politischen und wirtschaftlichen Stabilität, der Friedenssicherung in Öster-<br />
reich und Europa sowie Wirtschafts- und Beschäftigungsfragen im Mittelpunkt.<br />
<strong>ÖSTERREICHISCHE</strong> EZA – BAND 1 135
ENTWICKLUNGSPOLITISCHE INLANDSARBEIT<br />
5.10. Public Support 52<br />
Im Rahmen ihrer seinerzeitigen EU-Ratspräsidentschaft luden die Niederlande 1997 ExpertInnen<br />
aus allen EU-Mitgliedsstaaten zu einer Konferenz über das Phänomen einer anhaltend starken Un-<br />
terstützung der europäischen Öffentlichkeit für die Sache der Entwicklungszusammenarbeit bei<br />
einer zeitgleichen und kontinuierlichen Reduktion der öffentlichen Ausgaben für diese Zwecke. 53<br />
In den in unregelmäßigen Abständen durchgeführten Meinungsumfragen des Eurobarometers<br />
(zuletzt im März 2003 in den damals 15 EU-Mitgliedsstaaten) halten es 82,5 Prozent (Österreich<br />
68,7 Prozent und damit an letzter Stelle) der EU-EuropäerInnen für sehr wichtig oder wichtig, den<br />
Menschen in den armen Ländern Afrikas, Asiens, Südamerikas zu helfen sich zu entwickeln.<br />
Der Vorsitzende der Maastricht-Konferenz, der damalige niederländische EZA-Minister Jan Pronk,<br />
konfrontierte die TeilnehmerInnen mit drei Thesen zur Erklärung des angesprochenen Phänomens<br />
der „underperformance“:<br />
These I:<br />
Trotz budgetärer Probleme in fast allen EU-Mitgliedstaaten kann aus den Meinungsumfragen kei-<br />
ne „aid fatigue“ festgestellt werden: Diese anhaltend positive Grundeinstellung kontrastiert(e)<br />
allerdings mit den von vielen Mitgliedsstaaten verfolgten Budgetpolitiken, welche kontinuierlich<br />
die Mittel für EZA-Ausgaben reduzierten.<br />
These II:<br />
Die Unterstützung der Öffentlichkeit für die Anliegen der EZA reflektiert sich nicht in der Bud-<br />
getpolitik der Regierungen: Die Diskrepanz erklärt sich zum guten Teil aus der schwachen/ge-<br />
schwächten Ausprägung, mit der die Öffentlichkeit ihre Anliegen in Sachen EZA gegenüber den<br />
Regierungen vertritt. Bei einer tiefer gehenden Befragung zeigt es sich jedoch auch, dass etwa nur<br />
ein weit geringerer Teil der Bevölkerung bereit wäre, auf andere staatliche Leistungen zugunsten<br />
der EZA zu verzichten. Es darf angenommen werden, dass sich auf Grund anderer budgetärer Ziel-<br />
vorgaben diese Verzichtsbereitschaft seither weiter reduziert hat. Fundamentale Veränderungen<br />
in der Struktur der europäischen Gesellschaften haben die Ausprägung der Unterstützung für die<br />
EZA reduziert. Die „alten“ EZA-Koalitionen (solidarisch, christlich-ethisch, ökonomisch bewegte<br />
Interessen) hätten an Einfluss verloren, neue Gruppen (z.B. Umwelt, KonsumentInnen) seien ent-<br />
standen bzw. im Entstehen, haben aber nicht oder noch nicht den Verlust an Einfluss kompensie-<br />
ren können. Diese neuen Gruppen hätten aber auch einen anderen Zugang und Verständnis von<br />
den Anliegen der EZA (z.B. sind sie mehr „single-issue“ orientiert, weniger an der Lösung von<br />
prinzipiellen Fragen und Problemen interessiert).<br />
These III:<br />
Die politische Durchsetzungsfähigkeit der EZA-BefürworterInnen hat auf Grund dieser strukturel-<br />
len gesellschaftlichen Veränderungen abgenommen, die „Szene“ ist differenzierter geworden: Als<br />
möglichen Lösungsansatz empfahlen die Organisatoren daher die Formierung von „strategischen<br />
Allianzen“ unter den verschiedenen Interessensgruppen.<br />
52 Die Darstellung basiert auf Informationen, die Erich Andrlik, Direktor des VIDC und Koordinator des AK Public Support,<br />
zur Verfügung stellte.<br />
53 Conference on Public Support for International Co-operation, Maastricht,16.-17. April 1997.<br />
136 <strong>ÖSTERREICHISCHE</strong> EZA – BAND 1
ENTWICKLUNGSPOLITISCHE INLANDSARBEIT<br />
Die Ergebnisse des erwähnten Eurobarometers sind für Österreich im europäischen Vergleich alles<br />
andere als schmeichelhaft. „Desinteresse und Skepsis“ betiteln die Autoren einer dieser Studien<br />
die Haltung der ÖsterreicherInnen zu den gestellten Fragen. Wenngleich sich die Ergebnisse nur<br />
selten wirklich dramatisch vom EU-Durchschnitt unterscheiden, so ist es doch auffallend, dass bei<br />
praktisch allen Fragen Österreich am – negativen – Ende der Skalen rangiert. Diese Konsistenz des<br />
Negativen war dann auch 1998 Anlass für die Gründung eines informellen Arbeitskreises „Public<br />
support for international (development) co-operation“, in welchem VertreterInnen des BMaA, von<br />
KommEnt und der AGEZ bzw. einzelner ihrer Mitgliedsorganisationen gemeinsam mit ExpertIn-<br />
nen (wie MeinungsforscherInnen, SoziologInnen, KommunikationswissenschafterInnen) in einem<br />
ersten Schritt die wissenschaftlichen Grundlagen für Handlungsanleitungen der entwicklungspoli-<br />
tischen Inlandsarbeit im Lichte der oben beschriebenen Thesen analysierten.<br />
Es wurden eine Reihe von Maßnahmen gesetzt und deren Ergebnisse diskutiert, im besonderen<br />
eine Synopsis der empirischen Forschung zur EZA in Österreich, eine Reihe von Meinungsumfragen<br />
sowohl über die Einstellung der ÖsterreicherInnen zur EZA und EZA-relevanten Themen als auch<br />
zu einzelnen Schwerpunktbereichen der EZA-Öffentlichkeitsarbeit (wie FairTrade), Fokusgruppen-<br />
untersuchungen von einzelnen Zielgruppen/Dialoggruppen und EZA-AktivistInnen sowie auch ei-<br />
ne Analyse über die sich verändernden Wertehaltungen in der österreichischen Gesellschaft und<br />
die damit verbunden Möglichkeiten für die Schaffung von „rainbow coalitions“.<br />
Über den Arbeitskreis „Public Support“ wird das Stimmungsbild der österreichischen Bevölkerung<br />
zur Entwicklungszusammenarbeit laufend beobachtet. Dies erfolgt durch Beauftragung von Mei-<br />
nungsumfragen. Teilweise kann auf frühere Umfragen verschiedener EZA-Akteure zurückgegrif-<br />
fen werden.<br />
<strong>ÖSTERREICHISCHE</strong> EZA – BAND 1 137
ENTWICKLUNGSPOLITISCHE INLANDSARBEIT<br />
Tabelle 25<br />
ERGEBNIS MEINUNGSUMFRAGEN 1988 BIS 2004<br />
EZA-ZUSTIMMUNG IN DER <strong>ÖSTERREICHISCHE</strong>N BEVÖLKERUNG<br />
Jahr Auftraggeber Fragestellung Prozentzahl<br />
1988 KMBÖ/ÖED „Für manche Länder in Asien, Südamerika oder<br />
Afrika wird von den Europäern Entwicklungshilfe<br />
geleistet. Finden Sie es grundsätzlich richtig, daß<br />
Österreich Entwicklungshilfe leistet, oder finden<br />
Sie das nicht richtig?“<br />
1992 VIDC<br />
Gallup*<br />
1993 TransFair,<br />
VIDC<br />
ifes*<br />
1995 TransFair,<br />
VIDC<br />
ifes*<br />
1999 TransFair,<br />
VIDC<br />
ACNielsen*<br />
2001 BMaA,<br />
VIDC<br />
Fessel-GfK*<br />
2004 Fair Trade,<br />
VIDC<br />
Karmasin*<br />
*Meinungsforschungsinstitut<br />
„Für manche Länder in Asien, Lateinamerika oder<br />
Afrika wird von den Europäern Entwicklungshilfe<br />
geleistet. Finden Sie es grundsätzlich richtig, daß<br />
Österreich Entwicklungshilfe leistet, oder finden<br />
Sie das nicht richtig?“<br />
Richtig<br />
Nicht richtig<br />
Unentschieden<br />
Richtig<br />
Nicht richtig<br />
Wie oben Richtig<br />
Unentschieden<br />
Nicht richtig<br />
Wie oben Richtig<br />
„Manche Länder in der 3. Welt (Asien, Afrika, Lateinamerika)<br />
werden von den Industriestaaten unterstützt.<br />
Finden Sie es grundsätzlich richtig, daß<br />
auch Österreich solche Entwicklungshilfe leistet,<br />
oder finden Sie das nicht richtig?“<br />
„Manche Länder in der 3.Welt (Asien, Afrika,<br />
Lateinamerika) werden von den Industriestaaten<br />
unterstützt. Finden Sie es grundsätzlich richtig,<br />
daß auch Österreich solche Entwicklungshilfe<br />
(Entwicklungszusammenarbeit) leistet oder finden<br />
Sie das nicht richtig?“<br />
„Sprechen wir nun über das Thema Entwicklungszusammenarbeit:<br />
Manche Länder der 3.<br />
Welt (Asien, Afrika, Lateinamerika) werden von<br />
den Industriestaaten unterstützt. Finden Sie es<br />
grundsätzlich richtig, daß auch Österreich solche<br />
Entwicklungshilfe (Entwicklungszusammenarbeit)<br />
leistet, oder finden Sie das nicht richtig?“<br />
Unentschieden<br />
Keine Angaben<br />
Nicht richtig<br />
Unentschieden,<br />
weiß nicht<br />
Richtig<br />
Nicht richtig<br />
Weiß nicht<br />
Richtig<br />
Nicht richtig<br />
Weiß nicht<br />
Richtig<br />
Nicht richtig<br />
Weiß nicht<br />
138 <strong>ÖSTERREICHISCHE</strong> EZA – BAND 1<br />
76%<br />
10%<br />
14%<br />
60%<br />
12%<br />
28%<br />
71%<br />
9%<br />
19%<br />
1%<br />
66%<br />
19%<br />
15%<br />
86%<br />
8%<br />
6%<br />
83%<br />
6%<br />
11%<br />
66%<br />
10%<br />
24%
ENTWICKLUNGSPOLITISCHE INLANDSARBEIT<br />
Insgesamt liegen die Antworten in Österreich im EU-Trend einer grundsätzlich starken Befürwor-<br />
tung der Bedeutung von Entwicklungszusammenarbeit. Zugleich ist aber auch ein Anstieg bei<br />
den „Weiß nicht“-Antworten zu bemerken, der eine Verunsicherung über die Effektivität der EZA<br />
zum Ausdruck bringt. Wenngleich mit den bisherigen Aktivitäten dieses Arbeitskreises gewisse Er-<br />
kenntnisse und Grundlagen für weitere Vorgehensweisen in der entwicklungspolitischen Inlands-<br />
arbeit geschaffen wurden, so fehlt es noch an brauchbaren Handlungsanleitungen. Vor allem wird<br />
eine weitere Vertiefung des Wissens über die Motivationslagen/Ansprechbarkeit (d.h. Auswahl<br />
der „messages“) von bereits identifizierten bzw. möglichen anderen Zielgruppen/Dialoggruppen<br />
erforderlich sein (z.B. Jugendliche), um damit auch einen Schritt näher zu dem Ziel der Schaffung<br />
gesellschaftspolitischer Koalitionen zum Wohle der EZA und Entwicklungspolitik zu gelangen.<br />
<strong>ÖSTERREICHISCHE</strong> EZA – BAND 1 139
6. ORGANISATIONS-<br />
DARSTELLUNGEN<br />
Organisationen<br />
Die <strong>ÖFSE</strong>-Publikation „Die entwicklungspolitische Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit der öster-<br />
reichischen Nichtregierungsorganisationen“ aus 1995 umfasste auch eine mit den Organisationen<br />
abgestimmt Darstellung. Dies wird im folgenden Abschnitt wiederholt. Die <strong>ÖFSE</strong> hat aus diesem<br />
Grund ausgewählte Organisationen zu kurzen Selbstdarstellungen eingeladen. Dort wo keine<br />
Rückmeldung erfolgt ist, wurde auf den in der <strong>ÖFSE</strong>-Instiutionendatenbank auf www.eza.at ent-<br />
haltenen Text zurückgegriffen. Die Organisationen wurden gebeten, auch Finanzdaten für die<br />
Jahre 1996 und 2004 zu übermitteln, sofern die Organisationen im Jahr 1996 bereits tätig waren.<br />
Die uns übergebenen Daten sind in die Darstellungen aufgenommen worden.<br />
<strong>ÖFSE</strong>-INSTITUTIONENDATENBANK<br />
http://www.eza.at/search.html<br />
<strong>ÖSTERREICHISCHE</strong> EZA – BAND 1 141
Organisationen<br />
AFRO-ASIATISCHES INSTITUT GRAZ<br />
8010 Graz, Leechgasse 22<br />
� ++43(+316)/32 44 34<br />
� http://www.aai-graz.at<br />
private Einrichtung<br />
Dr. Wolfgang Messner<br />
(Politische Verantwortung)<br />
Mag. Vauti-Scheucher Angelika, Mag. Alois<br />
Kölbl, Ing. Georg Neumann (Geschäftsführung)<br />
Das Afro-Asiatische Institut Graz wurde als<br />
kirchliche Stiftung mit staatlicher Rechtspersönlichkeit<br />
1962 gegründet, das AAI- Gebäude<br />
wurde 1964 fertiggestellt . Das Institut ist<br />
durch ein gemeinsames Selbstverständnis den<br />
Partnerinstituten Salzburg und Wien verbunden<br />
und versteht sich als Betreuungsorganisation<br />
für Studierende aus Entwicklungsländern.<br />
Eine enge Zusammenarbeit besteht mit der<br />
Katholischen Hochschulgemeinde Graz. Das<br />
Institut führt ein eigenes Stipendienprogramm<br />
durch und bietet ein umfangreiches Bildungsprogramm<br />
für den Hochschulort Graz an. Das<br />
Institut ist mit seinem Bildungs- und Kulturprogramm<br />
(Symposien, Vorträge, Lesungen, Ausstellungen,<br />
Konzerte) ein Informationszentrum<br />
für Entwicklungsfragen und fördert den internationalen<br />
Kulturaustausch. Darüber hinaus<br />
bietet es studienbegleitende Bildungsveranstaltungen<br />
im entwicklungspolitischen Kontext<br />
für Studierende aus Entwicklungsländern. Die<br />
Einrichtungen des Instituts stehen allen Studierenden<br />
zur Verfügung. Die vierteljährlich<br />
erscheinende Zeitschrift GLOBUS informiert<br />
über das Veranstaltungsprogramm. Zum Gesamtprogramm<br />
des Institutes zählt die Führung<br />
eines internationalen Studentenheimes mit<br />
etwa 30 Plätzen und einer eigenen Cafeteria.<br />
Das AAI-Graz ist Mitgliedsorganisation der Koordinierungsstelle.<br />
Finanzierung<br />
Umsatz in EURO 1996 2004<br />
Öffentliche Finanzierung 227.884 251.262<br />
private Mittel 233.606 298.784<br />
Gesamt 461.490 550.046<br />
AFRO-ASIATISCHES INSTITUT SALZBURG<br />
5020 Salzburg, Wiener- Philharmoniker-Gasse 2<br />
� ++43(+662)/84 14 13<br />
� http://www.aai-salzburg.at<br />
private Einrichtung<br />
Sattlecker Gertraud<br />
(Politische Verantwortung)<br />
Mag. Dr. Erbler Josef<br />
(Geschäftsführung)<br />
Das Afro-Asiatische Institut Salzburg wurde<br />
1988 vom damaligen Erzbischof Dr. Karl Berg<br />
als kirchliche Stiftung gegründet. Das AAI-Salzburg<br />
hat sich dem Programm und Selbstverständnis<br />
der beiden Partnerinstitute in Graz<br />
und Wien angeschlossen und versteht sich als<br />
Betreuungsorganisation für Dritte Welt-Studierende<br />
am Hochschulort Salzburg. Mit der<br />
Katholischen Hochschulgemeinde Salzburg<br />
besteht eine enge Kooperation, das Institut ist<br />
auch in den Räumen der Katholischen Hochschulgemeinde<br />
untergebracht.<br />
Tätigkeitsbereiche des Afro-Asiatischen Instituts<br />
- Stipendienprogramme<br />
- Entwicklungspolitische Bildungs- und<br />
Kulturarbeit<br />
- Referat für Interkulturelles Management<br />
- Consulting Agentur für Reintegration<br />
- Interkulturelles StudentInnenheim<br />
St. Josef<br />
Finanzierung<br />
Umsatz in EURO 1996 2004<br />
Öffentliche Finanzierung 240.124 80.324<br />
private Mittel 86.075 137.185<br />
Gesamt 326.199 217.409<br />
142 <strong>ÖSTERREICHISCHE</strong> EZA – BAND 1
AFRO-ASIATISCHES INSTITUT WIEN<br />
1090 Wien,Türkenstraße 3<br />
� ++43(+1)/310 51 45-0<br />
� http://www.aai-wien.at<br />
Kirchliche Stiftung mit Rechtspersönlichkeit<br />
für den staatlichen Bereich<br />
DI Mag. Spiegelfeld Konstantin<br />
(Rektor)<br />
Lang Gerhard<br />
(Wirtschaftlicher Leiter)<br />
Das Afro-Asiatische Institut Wien wurde als<br />
kirchliche Stiftung mit Rechtspersönlichkeit<br />
für den staatlichen Bereich 1959 gegründet.<br />
Ziel des AAI-Wien ist der interkulturelle und<br />
interreligiöse Dialog, sowie die Förderung<br />
und Betreuung von Studierenden aus Entwicklungsländern,<br />
vorwiegend am Hochschulort<br />
Wien. Die drei Tätigkeitsbereiche gliedern sich<br />
in Studienförderung und Sozialhilfen, in den<br />
Bildungs- und Wirtschaftsbereich. Das Institut<br />
bietet für rund 70 Studierende Stipendienmöglichkeiten<br />
an, führt ein Studentenheim mit<br />
insgesamt ca. 70 Plätzen. Im internationalen<br />
Begegnungszentrum befinden sich ein islamischer,<br />
ein hinduistischer und christlicher Gottesdienstraum,<br />
weiters eine Mensa und ein Cafe.<br />
Im Bildungsbereich bietet das AAI Angebote<br />
sowohl für Studierende aus den Entwicklungsländern,<br />
aber auch für ein an Entwicklungszusammenarbeit<br />
und an interkulturellen Themen<br />
interessiertes Publikum. Mit den Partnerinstituten<br />
in Graz und Salzburg verbindet das AAI-<br />
Wien ein gemeinsames Selbstverständnis und<br />
Grundsatzprogramm.<br />
Finanzierung<br />
Umsatz in EURO 1996 2004<br />
Öffentliche Finanzierung 871.800 390.000<br />
private Mittel 2.034.200 910.000<br />
Gesamt 2.906.000 1.300.000<br />
Organisationen<br />
AMNESTY INTERNATIONAL ÖSTERREICH<br />
1150 Wien, Moeringgasse 10<br />
� ++43(+1)/780 08<br />
� http://www.amnesty.at<br />
private Einrichtung<br />
Mag. Patzelt Heinz<br />
(Geschäftsführung)<br />
Österreich ist Bestandteil der weltweit tätigen<br />
Menschrechtsorganisation. amnesty international<br />
ist um die Einhaltung der Menschenrechte<br />
bemüht, die in der Allgemeinen Erklärung der<br />
Menschenrechte ( UNO - Deklaration von 1948)<br />
festgelegt sind. Dazu dienen Appellaktionen<br />
(wie urgent actions), Lobbyingaktivitäten, Bewusstseinsbildung<br />
und Recherche. amnesty<br />
international hat in Österreich mehr als 4.500<br />
aktive Mitglieder, darüber hinaus fördern mehr<br />
als 70.000 Personen die Tätigkeit. In Österreich<br />
bestehen mehr als 130 lokale ai-Gruppen.<br />
Die Tätigkeit des Vereines wird vorwiegend aus<br />
Spenden finanziert.<br />
Finanzierung<br />
Umsatz in EURO 1996 2004<br />
Öffentliche Finanzierung — —<br />
private Mittel — 3.929.294<br />
Gesamt — 3.929.294<br />
<strong>ÖSTERREICHISCHE</strong> EZA – BAND 1 143
Organisationen<br />
AGEZ – ARBEITSGEMEINSCHAFT<br />
<strong>ENTWICKLUNGSZUSAMMENARBEIT</strong><br />
1090 Wien, Berggasse 7<br />
� ++43(+1)/317 40 16<br />
� http://www.agez.at<br />
private Einrichtung<br />
Steinbauer Heribert (Politische Verantwortung)<br />
Mag. Schachner Elfriede (Geschäftsführung)<br />
Die Arbeitsgemeinschaft Entwicklungszusammenarbeit<br />
- AGEZ entstand 1988 als lose Plattform<br />
nichtstaatlicher entwicklungspolitischer<br />
Organisationen. 1991 hat sich die Initiative als<br />
Verein konstituiert. Der AGEZ gehören derzeit<br />
(2005) 30 private und kirchliche TrägerInnen<br />
der Entwicklungszusammenarbeit sowie der<br />
entwicklungspolitischen Bildungs-, Kultur-, Öffentlichkeits-<br />
und Lobbyarbeit an. Ziel ist die<br />
Vertretung gemeinsamer entwicklungspolitischer<br />
Interessen gegenüber öffentlichen Stellen,<br />
insbesondere des Bundes, und die Information<br />
der breiten Öffentlichkeit zu Anliegen der<br />
Entwicklungszusammenarbeit und -politik. Die<br />
AGEZ will eine Entwicklungspolitik und -zusammenarbeit<br />
fördern, die durch ökonomische<br />
Selbstbestimmung, politische Partizipation und<br />
kulturelle Entfaltung zu mehr Gerechtigkeit<br />
zwischen Süden und Norden beiträgt, den Benachteiligten<br />
im Süden zur Seite steht und die<br />
Diskriminierung der Frauen abbaut. Die AGEZ<br />
tritt für gerechte weltwirtschaftliche Rahmenbedingungen,<br />
für Kohärenz zwischen den verschiedenen<br />
Politikbereichen, insbesondere der<br />
Wirtschafts- und Entwicklungspolitik sowie für<br />
die qualitative und quantitative Verbesserung<br />
der österreichischen EZA ein. Zur Bündelung<br />
der Kräfte der Mitgliedsorganisationen hat die<br />
AGEZ laufende sowie themenspezifische adhoc-Arbeitskreise<br />
eingerichtet. Die Forderung<br />
nach Erhöhung der öffentlichen EZA-Leistungen<br />
wird seit 2003 durch die nullkommasieben<br />
Kampagne unterstützt.<br />
Finanzierung<br />
Umsatz in EURO 1996 2004<br />
Öffentliche Finanzierung — —<br />
private Mittel 66.205 91.600<br />
Gesamt 66.205 91.600<br />
ATTAC ÖSTERREICH<br />
Netzwerk zur demokratischen Kontrolle der<br />
Finanzmärkte<br />
1050 Wien, Margaretenstrasse 166<br />
� ++43(+1)/544 00 10<br />
� http://www.attac.at<br />
private Einrichtung<br />
Mag. Küblböck Karin<br />
(Politische Verantwortung)<br />
ATTAC, die „Association pour une Taxation des<br />
Transactions financières pour l‘Aide aux Citoyens"<br />
(Verein zur Besteuerung von Finanztransaktionen<br />
zum Wohle der Menschen) entstand<br />
1998 als Antwort auf die verheerenden sozialen<br />
Auswirkungen der Finanzkrise in Südostasien.<br />
Mittlerweile gibt es die Bewegung in ca. 50<br />
Ländern. Attac Österreich wurde 2000 gegründet<br />
und umfasst 2005 etwa 25 Regionalgruppen,<br />
20 Inhaltsgruppen sowie rund 2.500 Mitglieder.<br />
Die Koordination erfolgt durch einen<br />
Vorstand bestehend aus 9 Personen mindestens<br />
50% davon Frauen.<br />
Attac beschäftigt sich mit wirtschaftspolitischen<br />
Themen wie Steuergerechtigkeit, Privatisierung<br />
und Liberalisierung, Finanzmärkten, Verschuldung<br />
- auf internationaler (WTO, Inetnationale<br />
Finanzinstitutuionen), EU- sowie nationaler<br />
Ebene.<br />
Die Aktivitäten von Attac Österreich umfassen<br />
eine breit angelegte Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit<br />
- Kampagnen Veranstaltungen, Vorträge,<br />
Publikationen, Straßenaktionen, Pressearbeit,<br />
sowie Lobby- und Vernetzungsaktivitäten<br />
auf nationaler und internationaler Ebene.<br />
Das Prinzip Gender Mainstreaming ist seit 2001<br />
in den Statuten von Attac verankert.<br />
Finanzierung<br />
Umsatz in EURO 1996 2004<br />
Öffentliche Finanzierung — 2.923<br />
private Mittel — 163.620<br />
Gesamt — 166.543<br />
144 <strong>ÖSTERREICHISCHE</strong> EZA – BAND 1
AUSTRIAN DEVELOPMENT AGENCY (ADA)<br />
1010 Wien, Zelinkagasse 2<br />
� ++43(+1)/90 3 99-0<br />
� http:// www.ada.gv.at<br />
Botschafter Dr. Michael Linhart<br />
(Geschäftsführung)<br />
Mag. Helmuth Hartmeyer<br />
(Leiter Entwicklungspolitische Kommunikation<br />
& Bildung )<br />
Mag. Christine A. Jantscher<br />
(Leiterin Information & Öffentlichkeitsarbeit)<br />
Die Austrian Development Agency (ADA) ist<br />
für die Umsetzung der Programme und Projekte<br />
der Österreichischen Entwicklungs- und<br />
Ostzusammenarbeit (OEZA) verantwortlich<br />
und verwaltet das entsprechende Budget. Arbeitsgrundlage<br />
ist das Dreijahresprogramm der<br />
Österreichischen Entwicklungspolitik, das vom<br />
Außenministerium erstellt wird und die zentralen<br />
entwicklungspolitischen Positionen und<br />
strategischen Rahmenbedingungen festlegt.<br />
Seit Oktober 2005 wickelt die ADA auf dieser<br />
Basis die Förderung der entwicklungspolitischen<br />
Bildungs- Informations-, Kultur- und<br />
Öffentlichkeitsarbeit in Österreich ab und leistet<br />
damit einen strategisch wichtigen Beitrag<br />
zu einer kohärenten Entwicklungspolitik. Um<br />
Transparenz über die staatlichen Leistungen<br />
zu gewährleisten und in der Öffentlichkeit<br />
Verständnis und Akzeptanz für Entwicklungszusammenarbeit<br />
und die Anliegen der Partnerländer<br />
zu wecken, informiert die ADA durch<br />
vielfältige Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit<br />
(Publikationen, Medienarbeit, Informationskampagnen,<br />
etc.) über Ziele und Aktivitäten<br />
der OEZA.<br />
Organisationen<br />
BAOBAB ENTWICKLUNGSPOLITISCHE<br />
BILDUNGS- UND SCHULSTELLE<br />
Weltbilder Medienstelle<br />
1090 Wien, Berggasse 7<br />
� ++43(+1)/319 30 73<br />
� http://www.globaleducation.at<br />
http://www.baobab.at<br />
private Einrichtung<br />
Drexler Alfons (Politische Verantwortung)<br />
Mag. Tebbich Heide (Geschäftsführung)<br />
Die 1993 gegründete Bibliothek und Mediathek<br />
BAOBAB verleiht Materialien und Medien<br />
an LehrerInnen, SchülerInnen, StudentInnen sowie<br />
MultiplikatorInnen in der außerschulischen<br />
Bildung und möchte damit zu einer weltoffenen<br />
Bildungsarbeit über globale Entwicklung<br />
anregen sowie für Fragen des Zusammenlebens<br />
in der „Einen Welt" sensibilisieren.<br />
Der Bestand der Mediathek umfasst ca. 5.000<br />
didaktische Unterrichtsmaterialien, Monografien,<br />
Kinder- und Jugendbücher, Spiele und<br />
Medien. Im Online-Katalog ist sowohl der Bestand<br />
von BAOBAB als auch der regionalen<br />
entwickungspolitischen Mediatheken in allen<br />
Bundesländern erschlossen.<br />
Die von BAOBAB betreute Datenbank für Bildungsangebote<br />
umfasst Vorträge, Workshops,<br />
Ausstellungen ect. zu interkulturellen und entwicklungspolitischen<br />
Themen von über 300 ReferentInnen<br />
aus ganz Österreich.<br />
In der Reihe „Weltbilder", einer Initiative der<br />
Medienstelle BAOBAB und der Österreichischen<br />
Enwicklungszusammenarbeit im Außenamt,<br />
werden Filme zu Nord-Südthemen für die<br />
Bildungsarbeit zugänglich gemacht. Als Serviceleistung<br />
werden Beratung zur Durchführung<br />
von Projekten und Veranstaltungen sowie<br />
Workshops zum Globalen Lernen für LehrerInnen,<br />
KindergärtnerInnen und MultiplikatorInnen<br />
angeboten.<br />
Finanzierung<br />
Umsatz in EURO 1996 2004<br />
Öffentliche Finanzierung — 176.080<br />
private Mittel — 69.420<br />
Gesamt — 245.500<br />
<strong>ÖSTERREICHISCHE</strong> EZA – BAND 1 145
Organisationen<br />
BROT FÜR HUNGERNDE<br />
Evangelische Frauenarbeit in Österreich<br />
1180 Wien, Martinstrasse 25<br />
� ++43(+1)/405 76 31<br />
� http://members.eunet.at/efa-brot<br />
private Einrichtung<br />
Barbara Heyse-Schaefer<br />
(Politische Verantwortung)<br />
rot für Hungernde ist eine entwicklungspolitische<br />
Aktion der evangelischen Kirche<br />
Österreich und wird von der evangelischen<br />
Frauenarbeit durchgeführt. Ziel ist die Förderung<br />
von Projekten in Entwicklungsländern,<br />
die entwicklungspolitische Informations- und<br />
Bildungsarbeit innerhalb der evangelischen<br />
Kirche, insbesondere der Frauenarbeit sowie<br />
an Schulen. Brot für Hungernde ist für die<br />
Durchführung von vier jährlichen Spenden-<br />
aktionen verantwortlich. Die Spenden-<br />
erträge werden für Projekte verwendet. Projekt-<br />
partner sind überwiegend Partnerkirchen in<br />
den Ländern des Südens und kirchennahe Organisationen.<br />
Das Hilfswerk ist mit seiner Tätigkeit<br />
in die Evangelische Arbeitsgemeinschaft<br />
für Entwicklungszusammenarbeit (EAEZ), den<br />
entwicklungspolitischen Dachverband der Evangelischen<br />
Kirche Österreichs, eingebunden. Brot<br />
für Hungernde bietet auch Volontariate für<br />
junge Menschen mit abgeschlossener Berufsausbildung<br />
bei Projektpartnern im Süden an.<br />
Finanzierung<br />
Umsatz in EURO 1996 2004<br />
Öffentliche Finanzierung — 2.200<br />
private Mittel — 132.500<br />
Gesamt — 134.700<br />
CLEAN CLOTHES KAMPAGNE<br />
1080 Wien, Laudongasse 40<br />
� ++43(+1)/405 55 15 -306<br />
� http://www.cleanclothes.at<br />
Kerl Stefan (Koordinator)<br />
Die CCK wurde 1989 in den Niederlanden gegründet<br />
und verfolgt als Ziel die Verbesserung<br />
der Arbeitsbedingungen der - mehrheitlich<br />
weiblichen - Beschäftigten in der internationalen<br />
Textil- und Sportbekleidungsbranche, die<br />
häufig unter unzumutbaren, menschenunwürdigen<br />
arbeits- und sozialrechlichen Verhältnissen<br />
arbeiten müssen. In Österreich begann die<br />
Kampagne 1996 anzulaufen. Trägerorganisationen<br />
sind die Frauensolidarität, die Informationsgruppe<br />
Lateinamerika, das Referat der<br />
Erzdiözese Wien für Mission und Entwicklung,<br />
die Südwind Agentur, der Verein Südwind<br />
Steiermark, Missio Austria, Weltumspannend<br />
Arbeiten und Horizont 3000. 2002 übernahm<br />
die Südwind Agentur, die seit 2001 im Rahmen<br />
eines EU-Projektes für die Kampagne arbeitet,<br />
die österreichweite Koordination.<br />
Finanzierung<br />
Umsatz in EURO 1996 2004<br />
Öffentliche Finanzierung — 97.500<br />
private Mittel — 32.500<br />
Gesamt — 130.000<br />
146 <strong>ÖSTERREICHISCHE</strong> EZA – BAND 1
CENTRE INTERNATIONAL UNIVERSITAIRE (CIU)<br />
1010 Wien, Schottengasse 1<br />
� ++43(+1)/533 65 33<br />
� http://www.ciu.at<br />
private Einrichtung<br />
Jahn Christian (Geschäftsführung)<br />
Das Centre International Universitaire wurde<br />
1931 als „Internationaler Studentenklub“ in<br />
der Rechtsform eines Vereins gegründet. Er ist<br />
damit die älteste Betreuungsorganisation für<br />
ausländische Studierende in Österreich. Nach<br />
1945 und mit dem Ansteigen der Studierenden<br />
aus Entwicklungsländern hat das CIU sein<br />
Programm auf diese Zielgruppe ausgedehnt.<br />
Die Tätigkeit wird aus öffentlichen Mitteln des<br />
Bundes finanziert.<br />
Finanzierung<br />
Umsatz in EURO 1996 2004<br />
Öffentliche Finanzierung — 31.000<br />
private Mittel — 18.170<br />
Gesamt — 49.170<br />
DREIKÖNIGSAKTION<br />
Organisationen<br />
Hilfswerk der Katholischen Jungschar Österreichs<br />
1160 Wien, Wilhelminenstraße 91/2 F<br />
� ++43(+1)/481 09 91<br />
� http://www.dka.at<br />
Mag. Klawatsch-Treitl Eva<br />
(Politische Verantwortung)<br />
Mag. Gleirscher Christoph (Geschäftsführung)<br />
Die Katholische Jungschar engagiert sich mit<br />
ihrem Hilfswerk, der Dreikönigsaktion, weltweit<br />
für eine solidarische und gerechtere Welt.<br />
90.000 SternsingerInnen verkünden die Weihnachtsbotschaft<br />
und sammeln für Mitmenschen<br />
in der „Dritten Welt“.<br />
500 Hilfsprojekte in 60 Ländern werden jährlich<br />
unterstützt – in den Bereichen Bildungs-, Sozial-,<br />
Pastoral- und Menschenrechtsarbeit.<br />
Bildungsarbeit und Anwaltschaft regen zu solidarischem<br />
Handeln im Alltag an.<br />
Das Programm „Lern Einsatz“ ermöglicht Interessierten,<br />
ein Monat bei ProjektpartnerInnen<br />
zu verbringen.<br />
„Partner unter gutem Stern“ ermöglicht ganz<br />
gezielt Projektpartnerschaften für Personen<br />
oder Gruppen.<br />
Die Sternsingeraktion wird seit 1955 durchgeführt<br />
und ist heute die größte entwicklungspolitische<br />
Spendenaktion in Österreich. Die<br />
Abwicklung der Kofinanzierungen mit öffentlichen<br />
Stellen erfolgt über Horizont 3000. ProjektpartnerInnen<br />
sind teilweise kirchliche Strukturen<br />
in Übersee. Die Bearbeitung der Projekte<br />
erfolgt über das zentrale Büro in Wien,<br />
die Projektentscheidungen werden von den Diözesanvertretungen<br />
getroffen.<br />
Finanzierung<br />
Umsatz in EURO 1996 2004<br />
Öffentliche Finanzierung 1.727.882 25.000<br />
private Mittel 9.840.920 13.371.249<br />
Gesamt 11.568.802 13.396.249<br />
<strong>ÖSTERREICHISCHE</strong> EZA – BAND 1 147
Organisationen<br />
ENCHADA<br />
Entwicklungsspolitisches Bildungsreferat der<br />
Katholischen Jugend Österreich<br />
1010 Wien, Johannesgasse 16/1<br />
� ++43(+1)/512 16 21-36<br />
� http://www.kath-jugend.at<br />
private Einrichtung<br />
Ute Mayerhofer<br />
(Koordination)<br />
ENCHADA ist das entwicklungspolitische Bildungsreferat<br />
der Katholischen Jugend Österreich<br />
und macht entwicklungspolitische Bildungs-<br />
und Öffentlichkeitsarbeit für Jugendliche<br />
und junge Erwachsene in Österreich. Das<br />
Jugendaustauschprogramm zwischen der Katholischen<br />
Jugend Österreichs und der TCYM<br />
- der Katholischen Jugend Tamil Nadu in Indien<br />
existiert seit 1992 und wird seit 2000 auch<br />
auf El Salvador ausgedehnt. Der Besuch selbst<br />
dauert einen Monat, der umfangreiche Vor-<br />
und Nachbereitungszyklus erstreckt sich über<br />
einen längeren Zeitraum. Enchada vernetzt im<br />
Arbeitskreis Entwicklungspolitik Österreich die<br />
entwicklungspolitischen Aktivitäten der Katholischen<br />
Jugend auf Diözesanebene.<br />
ENCHADA bietet Seminare zur entwicklungspolitischen<br />
Jugendarbeit, erarbeitet pädagogische<br />
Materialien und führt Jugendprojekte durch.<br />
Finanzierung<br />
Umsatz in EURO 1997* 2004<br />
Öffentliche Finanzierung 15.988 24.477<br />
private Mittel 21.516 29.583<br />
Gesamt 37.504 54.060<br />
* 1996 wurde die Abrechnung von Enchada noch über<br />
die KJLÖ abgewickelt - daher eigner Ausgabeposten<br />
aufgrund von Computerumstellung und Archivierung<br />
schwer nachvollziehbar.<br />
EUROPAHAUS BURGENLAND<br />
Institut f. polit. Bildung, Infostelle f. Europa-<br />
und Entwicklungsfragen<br />
7000 Eisenstadt, Campus 2<br />
� ++43(+2682)/704-5933<br />
� http://www.europahausburgenland.net<br />
private Einrichtung<br />
Axmann-Spielberger Edith<br />
(Politische Verantwortung)<br />
Mag. Göttel Johann (Geschäftsführung)<br />
Das Europahaus Burgenland - Institut für politische<br />
Bildung, Informationsstelle für Europa-<br />
und Entwicklungsfragen - wurde 1966 von der<br />
Österreichischen Jungarbeiterbewegung ins Leben<br />
gerufen und wird durch einen Verein von<br />
interessierten BürgerInnen getragen, unterstützt<br />
von Wissenschaftern und Künstlern. Im<br />
Auftrag der Südwind-Agentur ist das Europahaus<br />
für die entwicklungspolititsche Bildungs-<br />
und Öffentlichkeitsarbeit im Burgenland als<br />
Regionalstelle verantwortlich<br />
Finanzierung<br />
Umsatz in EURO 1996 2004<br />
Öffentliche Finanzierung 135.530 184.000<br />
private Mittel 23.620 51.000<br />
Gesamt 159.150 235.000<br />
148 <strong>ÖSTERREICHISCHE</strong> EZA – BAND 1
EUROPEAN UNIVERSITY CENTER FOR<br />
PEACE STUDIES<br />
7461 Stadtschlaining, Rochusplatz 1<br />
� ++43(+3355)/2498-515<br />
� http://www.epu.ac.at<br />
private Einrichtung<br />
Dr. Mader Gerald<br />
(Politische Verantwortung)<br />
Dr. Fischer Dietrich, Mag. Dr. Tuschl Ronald<br />
(Geschäftsführung)<br />
The EPU is an international NGO with UNESCO<br />
status. It was founded in 1988 by Gerald Mader<br />
in his capacity as President of the ASPR, with<br />
the support of European UNESCO Commissions.<br />
The original curriculum of the EPU was designed<br />
along the lines of Johan Galtung´s „Plan<br />
for a Master of Peace and Conflict Resolution“<br />
which he had developed for the University of<br />
Hawaii. Since 1990 the EPU has been offering<br />
post-graduate programmes in peace studies.<br />
Primary goals of the EPU are: spreading the<br />
idea of peace in the spirit of UNESCO; giving<br />
scientific and educational support to peace<br />
building in Europe as inspired by the OSCE<br />
process; promoting a „world domestic policy“<br />
based on sustainable development, co-operative<br />
responsibility and ecological security; contributing<br />
to the development of a global peace<br />
culture; training and improving individual capabilities<br />
in peace-making and conflict resolution.<br />
Finanzierung<br />
Umsatz in EURO 1996 2004<br />
Öffentliche Finanzierung 83.574 —<br />
private Mittel 67.532 —<br />
Gesamt 151.106 —<br />
Organisationen<br />
EVANGELISCHER ARBEITSKREIS FÜR<br />
WELTMISSION<br />
1180 Wien, Martinstrasse 25<br />
� ++43(+1)/408 80 73<br />
� http://www.evang-eza.a/<br />
private Einrichtung<br />
Mag. Golda Manfred<br />
(Politische Verantwortung)<br />
Mag. Mernyi Gottfried (Geschäftsführung)<br />
Der Evangelische Arbeitskreis für Weltmission<br />
wurde als offizielle Einrichtung der Evangelischen<br />
Kirche Österreichs 1954 als Verein gegründet.<br />
Mit dem Ziel der Solidaritätsarbeit<br />
für mehr Gerechtigkeit, insbesondere im ökonomischen<br />
Bereich werden Projekte, Bildungsarbeit<br />
und Personalentsendung durchgeführt.<br />
Der EAWM kooperiert eng mit der Basler<br />
Mission, wo er auch in der Abgeordnetenversammlung<br />
stimmberechtigt ist, und unterhält<br />
besondere Beziehungen zu den Presbyterianischen<br />
Kirchen in Kamerun, Ghana und dem<br />
Sudan. Neben der Expertenentsendung, die<br />
in Kooperation mit der Basler Mission durchgeführt<br />
wird, hat der EAWM auch ein eigenes<br />
Programm für Begegnungsreisen (Reisen und<br />
Lernen). Der EAWM koordiniert die Sudan<br />
Plattform Austria.<br />
Finanzierung<br />
Umsatz in EURO 1996 2004<br />
Öffentliche Finanzierung 10.523 11.365<br />
private Mittel 123.533 190.257<br />
Gesamt 134.056 201.622<br />
<strong>ÖSTERREICHISCHE</strong> EZA – BAND 1 149
Organisationen<br />
FAIRPLAY/VIDC<br />
Viele Farben. Ein Spiel.<br />
1040 Wien, Möllwaldplatz 5/3<br />
� ++43(+1)/713 35 94-93<br />
� http://www.fairplay.or.at<br />
private Einrichtung<br />
FairPlay. Viele Farben. Ein Spiel. ist ein Projekt<br />
des Wiener Instituts für Entwicklungsfragen<br />
und Zusammenarbeit (VIDC) und arbeitet seit<br />
dem Europäischen Jahr gegen Rassismus 1997<br />
an der Konzeption und Durchführung von antirassistischen<br />
und integrativen Maßnahmen im<br />
Sportbereich, insbesondere im Fußball. FairPlay<br />
ist außerdem die Koordinationsstelle des europäischen<br />
Netzwerkes FARE Football Against Racism<br />
in Europe, welches von der Europäischen<br />
Kommission und dem europäischen Fußballverband<br />
UEFA unterstützt wird.<br />
Finanzierung<br />
Umsatz in EURO 1996 2004<br />
Öffentliche Finanzierung — 107.836<br />
private Mittel — 114.597<br />
Gesamt — 223.433<br />
FAIRTRADE<br />
1040 Wien, Wohllebengasse 12-14/7<br />
� ++43(+1)/533 09 56<br />
� http://www.fairtrade.at<br />
private Einrichtung<br />
Novy Traude<br />
(Politische Verantwortung)<br />
DI Studeny Barbara (Geschäftsführung)<br />
FAIRTRADE wurde 1993 unter dem Namen<br />
TransFair Österreich 1993 als Verein gegründet.<br />
Ziel ist es, fair gehandelte Produkte über den<br />
alternativen Markt hinaus auch im kommerziellen<br />
Handel zu etablieren. FAIRTRADE bemüht<br />
sich für fair gehandelten Produkte wie Kaffee,<br />
Tee, Bananen oder Fruchtsäfte große österreichische<br />
Handelshäuser und Warenketten zu<br />
interessieren. Diese Produkte sind mit dem Fairtrade<br />
- Siegel ausgezeichnet, ihr Erwerb bedeutet<br />
bessere Lebens- und Arbeitsbedingungen<br />
für die Produzenten. FAIRTRADE schließt mit<br />
Importgesellschaften Lizenzverträge ab und<br />
finanziert so einen Teil der Vereinstätigkeit.<br />
2003 waren dies 15 Prozent vom Gesamtumsatz,<br />
weitere 11 Prozent kommen aus Spenden<br />
und Mitgliedsbeiträgen, die Haupteinnahmen<br />
(74 Prozent) kommen aus öffentlichen und<br />
privaten Zuschüssen. Trägerorganisationen<br />
des Vereines sind etwa 30 Einrichtungen der<br />
österreichischen Entwicklungszusammenarbeit,<br />
insbesondere aus der Evangelischen und<br />
Katholischen Kirche. Auf internationaler Ebene<br />
kooperiert FAIRTRADE mit 18 weiteren Fair<br />
Trade Organisationen in einem gemeinsamen<br />
Dachverband.<br />
Finanzierung<br />
Umsatz in EURO 1996 2004<br />
Öffentliche Finanzierung 130.359 544.537<br />
private Mittel 84.217 384.871<br />
Gesamt 214.576 929.408<br />
150 <strong>ÖSTERREICHISCHE</strong> EZA – BAND 1
FIAN<br />
Food First Informations- & Aktionsnetzwerk<br />
1080 Wien, Laudongasse 40<br />
� ++43(+1)/405 55 15-316<br />
� http://www.fian.at<br />
private Einrichtung<br />
Mag. Herwig Adam (Obmann)<br />
DI Gertrude Klaffenböck (Koordination)<br />
Das Recht sich zu ernähren ist eines der grundlegendsten<br />
Menschenrechte. Es ist im internationalen<br />
Pakt über wirtschaftliche, soziale<br />
und kulturelle Menschenrechte (WSK-Pakt)<br />
verankert und damit für alle Paktstaaten völkerrechtlich<br />
verbindlich. Angemessene Ernährung,<br />
Zugang zu Land, Wasser oder Saatgut<br />
sind keine milden Gaben, sondern Rechte. FIAN<br />
unterstützt Menschen bei der Einforderung ihrer<br />
Rechte und bringt Unrechtssituationen an<br />
die Öffentlichkeit. Durch Eilaktionen, kontinuierliche<br />
Fallarbeit, Information der Betroffenen<br />
über ihre Rechte, Kampagnen und Öffentlichkeitsarbeit<br />
arbeitet FIAN für die weltweite Verwirklichung<br />
des Rechts sich zu ernähren.<br />
FIAN International wurde 1986 gegründet und<br />
umfasst derzeit über 20 Sektionen & Koordinationen<br />
sowie Mitglieder in mehr als 60 Staaten<br />
und hat Beraterstatus bei den Vereinten Nationen.<br />
Die österreichische Sektion von FIAN besteht<br />
seit 1989 und arbeitet derzeit zu folgenden Bereichen:<br />
- Blumenkampagne<br />
- "FAO-Leitlinien für das Recht auf Nahrung"<br />
- Das Recht auf Wasser als Teil des Rechts auf<br />
Nahrung<br />
- Stärkung des Menschenrechtsansatzes in der<br />
Entwicklungszusammenarbeit.<br />
Finanzierung<br />
Umsatz in EURO 1996 2004<br />
Öffentliche Finanzierung — 115.000<br />
private Mittel — 10.000<br />
Gesamt — 125.000<br />
FRAUENSOLIDARITÄT<br />
Organisationen<br />
Initiative für Frauen in der Dritten Welt<br />
1090 Wien, Berggasse 7/1. Stock<br />
� ++43(+1)/ 3174020-0<br />
� http://www.frauensolidaritaet.org<br />
private Einrichtung<br />
Mag. Lunacek Ulrike<br />
(Politische Verantwortung)<br />
Die Frauensolidarität informiert mit Bildungs-<br />
und Öffentlichkeitsarbeit zu Frauen in Afrika,<br />
Asien und Lateinamerika und zum Nord-Süd-<br />
Verhältnis aus feministischer Sicht. Sie trägt mit<br />
ihrer Arbeit zur Durchsetzung von Frauenrechten<br />
bei und engagiert sich für eine Welt frei<br />
von Sexismus und Rassismus. Als entwicklungspolitische<br />
Organisation steht sie im Dialog mit<br />
Frauenbewegungen aus dem Süden und stärkt<br />
durch Vernetzung das solidarische Handeln.<br />
Die Frauensolidariät gibt seit 1982 die gleichnamige<br />
Zeitschrift heraus. Seit 1994 führt sie<br />
eine umfangreiche Bibliothek und Dokumentation<br />
zu entwicklungspolitisch relevanten Frauenthemen.<br />
Finanzierung<br />
Umsatz in EURO 1996 2004<br />
Öffentliche Finanzierung 135.000 181.000<br />
private Mittel 35.000 40.000<br />
Gesamt 170.000 221.000<br />
<strong>ÖSTERREICHISCHE</strong> EZA – BAND 1 151
Organisationen<br />
GESELLSCHAFT FÜR BEDROHTE VÖLKER<br />
- ÖSTERREICH<br />
1030 Wien, Untere Viaduktgasse 53/7A<br />
� ++43(+1)/503 49 90<br />
� http://www.gfbv.at<br />
private Einrichtung<br />
Dr. Hans Bogenreiter (Geschäftsführung)<br />
Mag. Alfred Brandhofer (Obmann)<br />
Die Gesellschaft für bedrohte Völker wurde<br />
1985 als Menschenrechtsorganisation für ethnische<br />
und religiöse Gruppen und Minderheiten<br />
gegründet und ist ein gemeinnütziger Verein.<br />
Die Stammorganisation besteht seit 1970 in<br />
Deutschland. Ziel ist die Förderung indigener<br />
Völker durch Informations- und Bildungsarbeit<br />
in Österreich. Weiter werden Auslandsprojekte<br />
durchgeführt.<br />
Die GfbV Österreich ist Mitglied der Dachorganisation<br />
GFBV-International, die wiederum<br />
Beobachterstatus im Wirtschafts- und Sozialrat<br />
der UNO hat.<br />
Finanzierung<br />
Umsatz in EURO 1996 2004<br />
Öffentliche Finanzierung — 3.717<br />
private Mittel 193.197 148.094<br />
Gesamt 193.197 151.811<br />
GRAZER BÜRO FÜR FRIEDEN UND<br />
ENTWICKLUNG<br />
8010 Graz, Wielandgasse 7<br />
� ++43(+316)/872-2183<br />
� http://www.friedensbuero-graz.at<br />
private Einrichtung<br />
Mag. Gerhold Ernst-Christian<br />
(Politische Verantwortung)<br />
Mag. Dr. Kumpfmüller Karl<br />
(Geschäftsführung)<br />
Das GBFE wurde 1988 auf Anregung der Grazer<br />
Friedensbewegung als Verein gegründet.<br />
Ziel ist die Informations- und Bildungsarbeit zu<br />
Friedens- und Entwicklungsthemen für den Bereich<br />
der Stadt Graz. Die Finanzierung erfolgt<br />
aus Mitteln der Stadtgemeinde Graz<br />
Finanzierung<br />
Umsatz in EURO 1996 2004<br />
Öffentliche Finanzierung 108.370 113.646<br />
private Mittel 8.168 13.199<br />
Gesamt 116.538 126.845<br />
152 <strong>ÖSTERREICHISCHE</strong> EZA – BAND 1
INITIATIVE DRITTE WELT BRAUNAU<br />
5280 Braunau, Krankenhausgasse 6<br />
� ++43(+7722)/664 70<br />
� http://www.i3w-braunau.at<br />
private Einrichtung<br />
Johann Außerhuber<br />
(Politische Verantwortung)<br />
Schmid Friedrich (Geschäftsführung)<br />
Die Initiative wurde 1978 gegründet und will<br />
Anregungen für eine bewußte Reflexion der<br />
eigenen Lebensweise und der gesellschaftlichen<br />
Situation in Bezug auf die Dritte Welt<br />
geben und Schlußfolgerungen im eigenen<br />
Lebensbereich ziehen. Die erste Aufgabe des<br />
Vereins war die Errichtung und Führung eines<br />
Dritte-Welt-Ladens, um Initiativen, Projekte<br />
und Einrichtungen in den Ländern der Dritten<br />
Welt zu fördern. Weiters ist der Initiative die<br />
Bewußtseinsbildung und die Schaffung gerechter<br />
Strukturen ein Anliegen. Dies erfolgt durch<br />
Information über die Lebens-, Produktions- und<br />
Handelsbedinungen der Menschen in den Ländern<br />
der „Dritten Welt“ sowie Aufklärung über<br />
die ungerechten Austauschbedingungen durch<br />
eigene Projektdurchführung sowie Mittelweitergabe,<br />
in Ausnahmefällen Katatrophenhilfe.<br />
Seit 1992 ist die Initiative Dritte Welt Braunau<br />
auch als Südwind-Agentur (SWA) tätig. Im Juni<br />
2001 wurde die I3W mit dem Eduard Ploier<br />
Preis für Entwicklungszusammenarbeit der Diözese<br />
Linz und des Landes OÖ ausgezeichnet.<br />
Finanzierung<br />
Umsatz in EURO 1996 2004<br />
Öffentliche Finanzierung — 421.580<br />
private Mittel — 78.778<br />
Gesamt — 500.358<br />
INSTITUT FÜR UMWELT - FRIEDE<br />
- ENTWICKLUNG<br />
1120 Wien, Tivoligasse 73<br />
� ++43(+1)/814 20-25<br />
� http://www.iufe.at<br />
Organisationen<br />
Verein<br />
DI Schaller Hermann<br />
(Politische Verantwortung)<br />
Dr. Gruber Petra C. (Geschäftsführung)<br />
Der Gründung des Instituts (1998) lag die Überzeugung<br />
zugrunde, dass die Politikbereiche<br />
Umwelt, Friede und Entwicklung nicht mehr<br />
getrennt behandelt werden können. Mittels<br />
Veranstaltungen, Networking, Publikationen<br />
und Öffentlichkeitsarbeit zielt das Institut auf<br />
nachhaltige Entwicklungen in Süd und Nord,<br />
unterstützt gerechtere weltwirtschaftliche<br />
und -politische Rahmenbedingungen sowie<br />
ein ganzheitlicheres Bewusstsein, Denken und<br />
Handeln jeder/s Einzelnen.<br />
Finanzierung<br />
Umsatz in EURO 1996 2004<br />
Öffentliche Finanzierung — 57.000<br />
private Mittel — 14.000<br />
Gesamt — 71.000<br />
<strong>ÖSTERREICHISCHE</strong> EZA – BAND 1 153
Organisationen<br />
INSTITUT ZUR COOPERATION BEI<br />
ENTWICKLUNGS-PROJEKTEN - ICEP<br />
1040 Wien, Favoritenstr.24/9<br />
� ++43(+1)/969 02 54<br />
� http://www.icep.at<br />
private Einrichtung<br />
Dr. Chavanne Stephan<br />
(Politische Verantwortung)<br />
Dr. Weber Bernhard<br />
(Geschäftsführung)<br />
Das Institut zur Cooperation bei Entwicklungsprojekten<br />
wurde im September 1996 als überparteilicher,<br />
überkonfessioneller, nicht-gewinn-<br />
orientierter Verein gegründet. Ein Schwerpunkt<br />
von ICEP ist die Kooperation mit der österreichischen<br />
Wirtschaft.<br />
ICEP führt in Ostafrika und Mittelamerika gemeinsam<br />
mit professionellen lokalen Partnern<br />
ausbildungsorientierte Entwicklungsprojekte<br />
durch.<br />
2003 gründete ICEP die corporAID Pöattform,<br />
um Wirtschaft, Entwicklung und globale Armutsbekämpfung<br />
für die österreichische Wirtschaft<br />
zu thematisieren. Außenwirkung erreicht<br />
die Plattform über das corporAID Magazin, das<br />
vierteljährlich mit einer Auflage von 45.000<br />
Stück als Supplement des WirtschaftsBlatts sowie<br />
im Abo- und Sonderversand die Zielgruppe<br />
erreicht. Eine zweite Kommunikationsschiene<br />
stellt corporAID Multilogue dar, ein Lernforum<br />
für Verantwortungsträger der Wirtschaft.<br />
Um auch zukünftige Führungskräfte für das<br />
Thema zu sensibilisieren, führt ICEP Informationsveranstaltungen<br />
für Studierende an<br />
österreichischen Wirtschaftsuniversitäten<br />
durch. Fokus ist die globale gesellschaftliche<br />
Verantwortung von Unternehmen - Corporate<br />
Social Responsibility CSR.<br />
Finanzierung<br />
Umsatz in EURO 1996 2004<br />
Öffentliche Finanzierung — 41.000<br />
private Mittel — 95.000<br />
Gesamt — 136.000<br />
INTERDISZIPLINÄRES FORSCHUNGSINSTITUT<br />
FÜR <strong>ENTWICKLUNGSZUSAMMENARBEIT</strong> DER<br />
UNIVERSITÄT LINZ<br />
4040 Linz, Rudolfstraße 3<br />
� ++43(+732)/733 750-0<br />
� http://www.iez.jku.at<br />
private Einrichtung<br />
Univ.Prof. Dr. Sandgruber Roman<br />
(Institutsvorstand)<br />
Das Interdisziplinäre Forschungsinstitut für<br />
Entwicklungszusammenarbeit - IEZ wurde 1989<br />
gegründet und ist in enger Kooperation mit<br />
dem Institut für Soziologie an der Universität<br />
Linz tätig.<br />
Ziel ist die Vorbereitung und Durchführung von<br />
Forschungs- und EZA-Projekten in Zusammenarbeit<br />
mit Forschungsinstitutionen in Ländern<br />
der Dritten Welt einerseits und lokalen Selbsthilfegruppen<br />
andererseits. Die Durchführung<br />
der Projekte erfolgt mit Hilfe nationaler und<br />
transnationaler Geldgeber. Schwerpunktregionen<br />
sind Ostafrika ( Tanzania), südliche Afrika<br />
( Zimbabwe), Melanesien ( Papua Neuguinea),<br />
Bhutan und Nepal.<br />
Das IEZ kooperiert auch mit NGOs, zB. wie Öko-<br />
Himal zur Erstellung einer Studie zur Armutsbekämpfung<br />
in Nepal.<br />
Das IEZ wird über einen Unterstützungsverein<br />
„Verein für Entwicklungsförderung ( Dritte<br />
Welt)” mit Sitz in Linz sowohl materiell als auch<br />
bei der Auswahl und Gestaltung verschiedener<br />
Forschungsprojekte unterstützt.<br />
154 <strong>ÖSTERREICHISCHE</strong> EZA – BAND 1
INTERKULTURELLES ZENTRUM<br />
1050 Wien, Bacherplatz 10<br />
� ++43(+1)/586 75 44-0<br />
� http://www.iz.or.at<br />
private Einrichtung<br />
Dr. Rüdiger Teutsch (Geschäftsführung)<br />
Das Interkulturelle Zentrum (IZ) engagiert sich<br />
für die Begegnung und Kommunikation von<br />
Menschen aus verschiedenen Kulturen und bildet<br />
dafür interkulturelle Fachleute aus. Seit 17<br />
Jahren unterstützt das IZ die grenzüberschreitende<br />
Zusammenarbeit von Schulen, die internationale<br />
Jugendarbeit sowie Integration und<br />
kulturelle Bildung in Österreich. Auftraggeber<br />
sind internationale Institutionen (Europäische<br />
Union, Europarat, UNESCO) sowie verschiedene<br />
Ministerien in Österreich (BM:BWK, BMAA,<br />
BMSG, BMWA). Kooperationspartner sind Gemeinden,<br />
Universitäten, Schulen, Jugendorganisationen,<br />
Vereine und Einrichtungen der Erwachsenenbildung.<br />
Das Interkulturelle Zentrum ist ein gemeinnütziger,<br />
unabhängiger Verein, der von einem<br />
ehrenamtlichen Vorstand aus Expert/innen und<br />
einer hauptamtlichen Geschäftsführung geleitet<br />
wird. Im Wiener Büro arbeitet ein Team von<br />
14 Mitarbeiter/innen an der Umsetzung interkultureller<br />
Projekte- sie kooperieren dabei mit<br />
einem weltweiten Netz von Sozialwissenschaftler/innen,<br />
Pädagog/innen und Aktivist/innen.<br />
Das Interkulturelle Zentrum wurde vom Europarat<br />
mit dem World Aware Award for Global<br />
Education 2000 sowie dem World Aware Award<br />
for Education 2005 ausgezeichnet.<br />
Finanzierung<br />
Umsatz in EURO 1996 2004<br />
Öffentliche Finanzierung — 753.300<br />
private Mittel — 56.700<br />
Gesamt — 810.000<br />
JUGEND EINE WELT<br />
Don Bosco Aktion Austria<br />
Organisationen<br />
1130 Wien, St. Veit Gasse 25<br />
� ++43(+1)/87 839-531<br />
� http://www.jugendeinewelt.at<br />
private Einrichtung<br />
P. Obermüller Petrus SDB<br />
(Politische Verantwortung)<br />
Ing. Heiserer Reinhard<br />
(Geschäftsführung)<br />
Jugend Eine Welt wurde 1997 als Verein gegründet<br />
um die internationale Arbeit der Salesianer<br />
Don Boscos zu unterstützen. Dies geschieht<br />
durch Projektförderung, in erster Linie<br />
Bildungs- und Sozialprojekte für Kinder und<br />
Jugendliche (Straßenkinderprogramme, Berufsausbildungszentren,<br />
Jugendzentren und<br />
Wohnheime, Schulen), durch die Organisation<br />
von Volontariatseinsätzen (Afrika, Asien, Lateinamerika<br />
und Osteuropa), durch Bildungs-<br />
und Öffentlichkeitsarbeit zu entwicklungspolitischen<br />
Themen ( z.B. Kampagne „Fußball für<br />
Straßenkinder“) sowie durch Fundraising.<br />
Als Träger unterschiedlicher Initiativen im Bereich<br />
der entwicklungspolitischen Inlandsarbeit<br />
profitiert Jugend Eine Welt von seinem weltweiten<br />
Netzwerk und der langjährigen Erfahrung<br />
seiner Partner in der Entwicklungszusammenarbeit.<br />
Die Salesianer Don Boscos sind weltweit einer<br />
der größten Orden der katholischen Kirche.<br />
Gegründet 1859 von Don Bosco in Turin, in Österreich<br />
tätig seit 1903. Ihr Hauptaugenmerk<br />
gilt der Jugend. Bildung- und Ausbildungsangebote<br />
sowie Sozial- und Gemeinwesenarbeit<br />
ergänzen die pastoralen Angebote.<br />
Finanzierung<br />
Umsatz in EURO 1996 2004<br />
Öffentliche Finanzierung — 350.600<br />
private Mittel — 1.455.200<br />
Gesamt — 1.805.200<br />
<strong>ÖSTERREICHISCHE</strong> EZA – BAND 1 155
Organisationen<br />
KATHOLISCHE FRAUENBEWEGUNG<br />
ÖSTERREICHS- FAMILIENFASTTAG<br />
1010 Wien, Spiegelgasse 3/II<br />
� ++43(+1)/515 52/36 95 - 36 97<br />
� http://www.teilen.at<br />
http://www.kfb.at<br />
private Einrichtung<br />
Hauft Margit (Politische Verantwortung)<br />
Mag. Ehart Isabella (Geschäftsführung)<br />
Die Aktion Familienfasttag besteht als Initiative<br />
der Katholischen Frauenbewegung Österreichs<br />
seit 1958 und zählt zu den ältesten Spendensammlungen<br />
der katholischen Kirche. Die formale<br />
Einbindung in die Gesamttätigkeit der<br />
KFBÖ ist über den 1948 gegründeten Verein<br />
„Katholisches Frauenwerk in Österreich“ gegeben.<br />
Ziel der Aktion Familienfasttag mit dem<br />
Motto „Teilen, macht mehr daraus“ ist es in der<br />
Fastenzeit als Zeichen der Solidarität mit jenen,<br />
die keinen Platz in der Wohlstandsgesellschaft<br />
haben, einen persönlichen Verzicht zu leisten.<br />
Das beim Fasten ersparte Geld wird als symbolischer<br />
Akt des Teilens für Frauenförderungsprojekte<br />
in Asien und Lateinamerika und für<br />
Bildungs- und Informationsarbeit in Österreich<br />
zur Verfügung gestellt. Die Aktion Familienfasttag<br />
wird österreichweit in der Fastenzeit<br />
durchgeführt. Im Referat Entwicklungsförderung<br />
erfolgt die Gesamtschau zur Aktion Familienfasttag<br />
und der entwicklungspolitischen<br />
Arbeit der kfb. In der seit 1994 mit der Dreikönigsaktion<br />
bestehenden „Arbeitsgemeinschaft<br />
Projektarbeit“, erfolgt die Projektbearbeitung<br />
und -abwicklung. Entscheidungen über die Mittelvergabe<br />
erfolgen in den zuständigen Gremien<br />
der kfb. Die KFB vergibt alle 2 Jahre den mit<br />
7000 Euro dotierten Herta Pammer Preis für<br />
Leistungen der frauenspezifischen, entwicklungspolitischen<br />
publizistischen Berichterstattung,<br />
Bildungsarbeit und Forschung.<br />
Finanzierung<br />
Umsatz in EURO 1996 2004<br />
Öffentliche Finanzierung — 974.252<br />
private Mittel — 2.308.963<br />
Gesamt — 3.283.215<br />
KATHOLISCHE MÄNNERBEWEGUNG<br />
ÖSTERREICHS<br />
1010 Wien, Spiegelgasse 3/II<br />
� ++43(+1)/51 552-36 62<br />
� http://www.seisofrei.at<br />
http://www.kmb.or.at<br />
private Einrichtung<br />
Raimund Löffelmann<br />
(Politische Verantwortung)<br />
Mag. Reichart Christian (Geschäftsführung)<br />
Die Aktion SEI SO FREI ist eine Einrichtung der<br />
Katholischen Männerbewegung. Sie arbeitet<br />
als Nichtregierungsorganisation (NRO) mit<br />
Menschen unabhängig von ihrer politischen,<br />
religiösen und ethnischen Zugehörigkeit zusammen<br />
und setzt sich für eine lebenswerte<br />
Welt ein. Die Aktion SEI SO FREI ist die entwicklungspolitische<br />
Aktion der Katholischen Männerbewegung.<br />
Sie konzentriert ihre Entwicklungszusammenarbeit<br />
auf Schwerpunktländer<br />
in Lateinamerika und Afrika. Sie unterstützt<br />
landwirtschaftliche Entwicklung, Ausbildungs-<br />
und Gesundheitsprogramme, Kleinhandwerk<br />
und basisorientierte Bildungsinitiativen.<br />
Die Aktion SEI SO FREI der Katholischen Männerbewegung<br />
Österreichs - KMBÖ führt im<br />
Rahmen der Aktion Bruder in Not ein eigenes<br />
Projektprogramm durch. Sie wird in den Diözesen<br />
Feldkirch, Graz, Innsbruck, Klagenfurt,<br />
Linz, Salzburg und Wien druchgeführt. Die<br />
KMB-Österreich bemüht sich um eine Koordinierung<br />
der Aktion, so wird als Vorbereitung<br />
und Bildungsbegeleitung der „Adventkalender“<br />
als gesamtösterreichische Initiative erstellt.<br />
Spenden werden aus der Aktion SEI SO<br />
FREI, der Augustsammlung und anderen Aktionen<br />
eingenommen<br />
156 <strong>ÖSTERREICHISCHE</strong> EZA – BAND 1
KLIMABÜNDNIS ÖSTERREICH<br />
Gemeinnützige Förderungs- und Beratungs-<br />
GmbH<br />
1060 Wien, Mariahilfer Straße 89/24<br />
� ++43(+1)/581 58 81<br />
� http://www.klimabuendnis.at<br />
private Einrichtung<br />
Mehl Wolfgang (Geschäftsführung)<br />
Die Initiative Klimabündnis wurde 1988 ausgehend<br />
vom Umweltforum Frankfurt in Österreich<br />
gegründet. 1990 erfolgte die Errichtung<br />
eines eigenständigen Vereins. Bis 1995 war der<br />
Sitz der österreichischen Koordinationsstelle in<br />
Villach. Mit Jahresbeginn 1995 wurde Klimabündnis<br />
Österreich als gemeinnützige Förderungs-<br />
und Beratungs-GmbH errichtet. Gesellschafter<br />
sind: Horizont 3000, Südwind-Verein<br />
für entwicklungspolitische Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit<br />
und „die umweltberatung“.<br />
Ziel ist es, politische Gemeinden durch Beitritt<br />
zum Klimabündnis zu einem geänderten Umweltverhalten,<br />
etwa durch Maßnahmen zur<br />
Absenkung des CO-Gehalts der Luft, zu bewegen.<br />
Das Klimabündnis versteht sich als Plattform<br />
aller lokalen Bemühungen, wo Gemeinden<br />
dem Klimabündnis beigetreten sind bzw.<br />
ein Beitritt eingeleitet ist. Die Initiative führt<br />
das Register aller österreichischen Partner des<br />
Klimabündnisses. Die 585 beigetretenen Gemeinden<br />
verpflichten sich zur Reduktion der<br />
Treibhausgas-Emission (v.a. CO 2 ) bis zum Jahr<br />
2010 um 50 %, zum Verzicht auf die Verwendung<br />
von Tropenholz und zur Unterstützung<br />
der indianischen Partner in Amazonien bei ihren<br />
Bemühungen zum Erhalt ihrer Lebensweise<br />
und des Regenwaldes.<br />
Finanzierung<br />
Umsatz in EURO 1996 2004<br />
Öffentliche Finanzierung 224.000 1.440.000<br />
private Mittel 56.000 360.000<br />
Gesamt 280.000 1.800.000<br />
KOMMENT<br />
Organisationen<br />
Gesellschaft für Kommunikation und<br />
Entwicklung<br />
5020 Salzburg, Sigmund-Haffner-Gasse 18/1<br />
� ++43(+662)/84 09 53<br />
� http://www.komment.at<br />
private Einrichtung<br />
Ao.Univ.Prof. Dr. Luger Kurt<br />
(Politische Verantwortung)<br />
Dr. Grobbauer Heidi (Geschäftsführung)<br />
Die Gesellschaft für Kommunikation und Entwicklung<br />
- KommEnt - wurde 1994 als Verein<br />
gegründet und berät alle, die sich durch ihre<br />
Informations-, Bildungs-, Kultur- und Öffentlichkeitsarbeit<br />
mit Nord-Süd Fragen und Fragen<br />
der Entwicklungszusammenarbeit auseinandersetzen.<br />
Außerdem vermittelt KommEnt<br />
zwischen Projektträgern und dem Staat, d.h.<br />
KommEnt berät bei der Erstellung von Projektanträgen,<br />
prüft Projektanträge, schlägt der<br />
ADA Projekte zur Förderung vor und dokumentiert,<br />
prüft und evaluiert durchgeführte Projekte.<br />
Zielsetzungen sind die qualitative Verbesserung<br />
und Verankerung der entwicklungspolitischen<br />
Informations-, Bildungs-, Kultur- und<br />
Öffentlichkeitsarbeit in der österreichischen<br />
Politik, Transparenz und eine gute Kooperation<br />
mit NGOs und die Initiierung und Intensivierung<br />
von Kommunikationsprozessen.<br />
Nach der Gründung der Austrian Developement<br />
Agency (ADA) wurde die Funktion von<br />
KommEnt diskutiert und eine Veränderung<br />
im Frühjahr 2005 entschieden. Dies ist im Abschnitt<br />
3 dargestellt.<br />
<strong>ÖSTERREICHISCHE</strong> EZA – BAND 1 157
Organisationen<br />
KOORDINIERUNGSSTELLE DER ÖSTERR.<br />
BISCHOFSKONFERENZ FÜR INTERNATIONALE<br />
ENTWICKLUNG UND MISSION<br />
1090 Wien, Türkenstraße 3/3<br />
� ++43(+1)/317 03 21<br />
� http://www.koo.at<br />
private Einrichtung<br />
Bischof Dr. Schwarz Ludwig, SDB<br />
(Vorsitzender)<br />
Ing. Hödl Heinz (Geschäftsführung)<br />
Die Koordinierungsstelle (KOO) ist eine Facheinrichtung<br />
der Österreichischen Bischofskonferenz,<br />
der 24 Mitgliedsorganisationen sowie<br />
der weiblichen und männlichen Missionsorden.<br />
Sie fördert, koordiniert und kontrolliert<br />
das entwicklungspolitische und missionarische<br />
Engagement. Die KOO will zur Bewusstseinsbildung<br />
und zum solidarischen Handeln der<br />
Menschen in Österreich beitragen. Sie vertritt<br />
die entwicklungspolitischen und weltkirchlichen<br />
Anliegen und Grundsätze der Katholischen<br />
Kirche gegenüber den Trägern der wirtschaftlichen<br />
und politischen Verantwortung<br />
international, vor allem aber in Österreich. Die<br />
Mitgliedsorganisationen beschäftigen sich mit<br />
Entwicklungszusammenarbeit und Pastoralarbeit<br />
sowie mit Katastrophenhilfe in Afrika, Asien<br />
und Lateinamerika, aber auch in Österreich.<br />
Die Arbeit in Österreich umfasst Bildungs-,<br />
Öffentlichkeits- und anwaltschaftliche Arbeit.<br />
Sie arbeiten in den Bereichen Grundsatzarbeit,<br />
Projektpolitik, Bildungs- sowie Öffentlichkeitsarbeit,<br />
internationale Missionsarbeit und Anwaltschaft<br />
zusammen. Die Tätigkeit erfolgt im<br />
Rahmen der „Leitlinien für die Zusammenarbeit<br />
der Katholischen Kirche in Österreich mit<br />
den Partnerinnen und Partnern in der „Dritten<br />
Welt.“ Die KOO ist national mit zahlreichen<br />
nichtkirchlichen Organisationen vernetzt. International<br />
erfolgt die Abstimmung vor allem<br />
über die internationale Dachorganisation der<br />
Katholischen Entwicklungshilfewerke CIDSE.<br />
Finanzierung<br />
Umsatz in EURO 1996 2004<br />
Öffentliche Finanzierung — —<br />
private Mittel 250.000 283.000<br />
Gesamt 250.000 283.000<br />
KULTUREN IN BEWEGUNG/VIDC<br />
1040 Wien, Möllwaldplatz 5/3<br />
� ++43(+1)/713 35 94<br />
� http://www.vidc.org/kultureninbewegung<br />
http://www.movingcultures.org<br />
private Einrichtung<br />
kulturen in bewegung ist Servicestelle und<br />
Veranstalter für integrative Kulturprojekte mit<br />
KünstlerInnen aus Afrika, Asien und Lateinamerika<br />
und versteht sich als Vermittler und als<br />
Agentur zwischen KünstlerInnen aus dem Süden<br />
und Kulturveranstaltern in Österreich.<br />
kulturen in bewegung fördert die Emanzipation<br />
der künstlerischen Produktionen des Südens<br />
innerhalb der österreichischen Kulturlandschaft.<br />
Begleitende Informationsarbeit und<br />
persönliche Kommunikation mit den KünstlerInnen<br />
in Form von Workshops und Diskussionen<br />
sind ein wesentliches Element.<br />
kulturen in bewegung als Partner der österreichischen<br />
Entwicklungszusammenarbeit organisierte<br />
zahlreiche Kulturaustauschprojekte,<br />
um Interesse und Neugier an den Kulturen der<br />
Welt zu wecken und entwicklungspolitische Zusammenhänge<br />
sichtbar zu machen. Gleichzeitig<br />
wird ein Beitrag zur Integration von in Österreich<br />
lebenden Kulturschaffenden aus Afrika,<br />
Asien und Lateinamerika geleistet.<br />
Das jährliche Weltkulturfestival „moving cultures“<br />
bietet in Kopperation mit Konzerthäusern<br />
und Clubs ein Forum für aktuelle Weltmusik-<br />
Produktionen. Für 2006 ist im Rahmen der EU<br />
Präsidentschaft ein Kulturfestival unter dem<br />
Titel Latino/Caribe geplant, in dem auch die<br />
Bereiche Film, Literatur und Bildende Kunst integriert<br />
werden sollen.<br />
Finanzierung<br />
Umsatz in EURO 1996 2004<br />
Öffentliche Finanzierung 950.000 370.000<br />
private Mittel 250.000 77.000<br />
Gesamt 1.200.000 447.000<br />
158 <strong>ÖSTERREICHISCHE</strong> EZA – BAND 1
MATTERSBURGER KREIS<br />
1090 Wien, Berggasse 7<br />
� ++43(+1)/317 40 18<br />
� http://www.mattersburgerkreis.at<br />
private Einrichtung<br />
a.o.Univ.Prof. Dr. Novy Andreas<br />
(Politische Verantwortung)<br />
Dr. Gerald Faschingeder<br />
(Geschäftsführer)<br />
Der Mattersburger Kreis wurde in der Rechtsform<br />
eines Vereins 1982 konstituiert. Ziel ist<br />
die Förderung wissenschaftlicher Auseinandersetzungen<br />
mit Entwicklungsfragen und eine<br />
Stärkung von Forschung und Lehre. Der Verein<br />
führt Veranstaltungen durch und stellt mit seinem<br />
„Journal für Entwiclklungspolitik‘“ (JEP)<br />
Raum für wissenschaftliche Beiträge zu entwicklungspolitischen<br />
Themen zur Verfügung.<br />
Nach 2001 erwuchsen dem Mattersburger<br />
Kreis (gemeinsam mit der AGEZ - Arbeitsgemeinschaft<br />
Entwicklungszusammenarbeit) als<br />
Träger der gesamtösterreichischen Entwicklungstagungen<br />
neue Aufgaben, die sich gut<br />
mit seinen neuen und erneuerten Publikationsreihen<br />
(das JEP, wechselte mit 2003 den Verlag<br />
und erscheint seither in verjüngtem Gewand)<br />
verknüpfen lassen. Seine Mitglieder beteiligen<br />
sich an der entwicklungspolitischen Lehre<br />
an der Universität Wien wie auch an anderen<br />
Hochschulen.<br />
Finanzierung<br />
Umsatz in EURO 1996 2004<br />
Öffentliche Finanzierung — 40.000<br />
private Mittel — 35.000<br />
Gesamt — 75.000<br />
MISSIO AUSTRIA<br />
1015 Wien, Seilerstätte 12, PF 14<br />
� ++43(+1)/513 77 22<br />
� http://www.missio.at<br />
Organisationen<br />
kirchliche Einrichtung mit eigener<br />
Rechtspersönlichkeit<br />
Dr. Maasburg Leo-M.<br />
(Politische Verantwortung)<br />
Mag. Mazal Christian (Geschäftsführung)<br />
Missio Austria (Päpstliche Missionswerke in Österreich)<br />
bildet gemeinsam mit den Päpstlichen<br />
Missionswerken in über 140 Ländern die offizielle<br />
Einrichtung der Weltkirche für Mission<br />
und Entwicklung. Missio hat folgende Aufgaben:<br />
Die missionarische Bewusstseinsbildung in<br />
Österreich und die Unterstützung der pastoralen<br />
und sozialen Anliegen der Ortskirchen des<br />
Südens. Missio will eine Brücke zwischen Nord<br />
und Süd sein, Interesse für die Weltkirche wecken<br />
und Spenden für pastorale und soziale<br />
Projekte sammeln. Die Zeitschrift „alle welt“<br />
berichtet über Kulturen, Kirchen und Kontinente.<br />
Missio bietet Medien für MultiplikatorInnen<br />
an. Jährlich findet eine internationale<br />
Studientagung statt, durch Kampagnen setzt<br />
sich Missio für Anliegen wie den Kampf gegen<br />
Sextourismus, AIDS und die Ausbeutung von<br />
Frauen und Kindern ein. Mit der jährlichen,<br />
weltweiten Kirchensammlung am „Sonntag<br />
der Weltkirche“ (Oktober) werden die ärmsten<br />
Diözesen der Welt unterstützt. Die Kirchensammlung<br />
am 6. Jänner unterstützt die Ausbildung<br />
von „Priestern aus allen Völkern“. Missio<br />
Austria betreut zahlreiche Projekte in Afrika,<br />
Asien, Lateinamerika und Ozeanien.<br />
In der Ostzusammenarbeit unterstützt Missio-ProEuropa<br />
die Kirchen in osteuropäischen<br />
Reformstaaten. Die von der Österreichischen<br />
Bischofskonferenz bereit gestellten Mittel werden<br />
für die Renovierung kirchlicher Gebäude,<br />
sowie pastorale und soziale Projekte der Kirchen<br />
eingesetzt.<br />
Finanzierung<br />
Umsatz in EURO 1996 2004<br />
Öffentliche Finanzierung — 6.428<br />
private Mittel 15.974.450 17.880.553<br />
Gesamt 15.974.450 17.886.981<br />
<strong>ÖSTERREICHISCHE</strong> EZA – BAND 1 159
Organisationen<br />
NULLKOMMASIEBEN KAMPAGNE<br />
1080 Wien, Laudongasse 40<br />
� ++43(+1)/ 405 55 15<br />
� http://www.nullkommasieben.at<br />
Kerl Stefan<br />
(Koordinator)<br />
40 entwicklungspolitische, soziale und umweltpolitische<br />
NGOs haben gemeinsam im<br />
Jahr 2003 eine Plattform für die 0,7 Kampagne<br />
gegründet. Das Ziel der Kampagne ist die<br />
Erfüllung der internationalen Zusage der österreichischen<br />
Bundesregierung (1970, UNO<br />
Resolution 2626) 0,7% des Bruttonationaleinkommens<br />
für die Entwicklungszusammenarbeit<br />
(EZA) zur Verfügung zu stellen.<br />
Beim EU-Gipfel in Barcelona 2002 wurde vereinbart,<br />
dass die EU-Länder einen Durchschnitt<br />
von 0,33% bzw. 0,39% bis zum Jahr 2006 erreichen<br />
sollen. Dieses Ziel wurde bei der UN-Entwicklungsfinanzierungskonferenz<br />
in Monterrey<br />
auch von Österreich bestätigt.<br />
Die Kampagne fordert daher von der österreichischen<br />
Bundesregierung einen verbindlichen<br />
Stufenplan zur Erhöhung der Mittel der<br />
öffentlichen EZA auf 0,7% des BNE bis 2010<br />
und die Verbesserung der Qualität der österreichischen<br />
EZA. Das Sekretariat der Kampagane<br />
ist seit 2005 in der Südwind-Agentur beheimatet<br />
Finanzierung<br />
Umsatz in EURO 1996 2004<br />
Öffentliche Finanzierung — —<br />
private Mittel — 48.067<br />
Gesamt — 48.067<br />
OIKOCREDIT AUSTRIA<br />
Vereinigung zur Förderung der Ökumenischen<br />
Entwicklungsgenossenschaft<br />
3430 Tulln, Etzelgasse 9<br />
� ++43(+2272)/81 22 2<br />
� http://www.oikocredit.org/sa/at<br />
http://www.oikocredit.org<br />
private Einrichtung<br />
Dr. Wychera Robert<br />
(Politische Verantwortung)<br />
Maria Schachamayr<br />
(Geschäftsführung)<br />
Oikocredit (EDCS) wurde 1975 als Initiative<br />
christlicher Kirchen gegründet und als Kreditgenossenschaft<br />
konstituiert. Die Idee dieser<br />
alternativen Form der Geldanlage ist, dass<br />
Einzelpersonen oder Kirchengemeinden einen<br />
Teil ihres Vermögens, nicht benötigter Rücklagen,<br />
als Genossenschaftseinlage zur Verfügung<br />
stellen. Sie verzichten auf hohe Kapitalerträge.<br />
Mit dem Kapital werden über zinsgünstige<br />
Darlehen ausgewählte Projekte in den Ländern<br />
des Südens finanziert. Durch diese Form der<br />
Solidarität soll „nicht-bankfähigen“ Menschen<br />
im Süden, die vom „normalen“ Bankgeschäft<br />
ausgeschlossen sind, die Möglichkeit der Hilfe<br />
zur Selbsthilfe gegeben werden. Der Sitz der<br />
Kreditgenossenschaft ist in den Niederlanden.<br />
Der österreichische Förderkreis besteht seit<br />
1990 als Verein. Die nationalen Förderkreise<br />
bringen rund 80% des Anteilkapitals auf<br />
(2004 über 200 Mio EURO) und sind um eine<br />
Verbreiterung des Anliegens von Oikocredit<br />
bemüht. Öikocredit Austria hält bei einem Anteliskapital<br />
von 3,5 Mio (2004). Die Vereinstätigkeit<br />
erfolgt großteils ehrenamtlich.<br />
Finanzierung<br />
Umsatz in EURO 1996 2004<br />
Öffentliche Finanzierung — —<br />
private Mittel 9.500 23.000<br />
Gesamt 9.500 23.000<br />
160 <strong>ÖSTERREICHISCHE</strong> EZA – BAND 1
<strong>ÖSTERREICHISCHE</strong> FORSCHUNGSSTIFTUNG<br />
FÜR ENTWICKLUNGSHILFE – <strong>ÖFSE</strong><br />
1090 Wien, Berggasse 7<br />
� ++43(+1)/317 40 10<br />
� http://www.oefse.at<br />
Stiftung<br />
Univ. Prof. Dr. Zapotoczky Klaus<br />
(Kuratoriumsvorsitzender)<br />
Bittner Gerhard (Geschäftsführer)<br />
Mag. Zauner Atiye (Wissenschaftliche Leitung)<br />
Die Österreichische Forschungsstiftung für Entwicklungshilfe<br />
<strong>ÖFSE</strong> wurde vom Afro-Asiatischen<br />
Institut Wien und dem Österreichischen<br />
Akademischen Austauschdienst in der Rechtsform<br />
einer Stiftung 1967 gegründet. Ziel ist Aufbau<br />
und Führung einer entwicklungspolitischen<br />
Dokumentation mit einer öffentlich zugänglichen<br />
wissenschaftliche Fachbibliothek, die neben<br />
über 45.000 Monographien und 130 laufenden<br />
Zeitschriften auch Zugang zum Weltbank<br />
Informationskiosk bietet. Der Wissenschaftsbereich<br />
der <strong>ÖFSE</strong> bietet Informationen, Analysen<br />
und Beratungen zu den Schwerpunktthemen:<br />
Österreichische Entwicklungszusammenarbeit<br />
und -politik, Internationale Entwicklungs- und<br />
Wirtschaftspolitik, Bildungszusammenarbeit,<br />
Bildung und nachhaltige Entwicklung sowie<br />
Armutsbekämpfungsstrategien. Die <strong>ÖFSE</strong> bietet<br />
mit eza.at ein umfassendes Informationsservice<br />
zur österreichischen und internationalen Entwicklungspolitik<br />
an. Über Datenbanken können<br />
Projekte und Programme der österreichischen<br />
EZA, wissenschaftliche Literatur und Medien,<br />
sowie Organisationsdaten abgerufen werden.<br />
Finanzierung<br />
Umsatz in EURO 1996 2004<br />
Öffentliche Finanzierung 1.551.036 1.086.161<br />
private Mittel 368.119 159.035<br />
Gesamt 1.919.125 1.245.196<br />
Organisationen<br />
<strong>ÖSTERREICHISCHE</strong> ORIENT-GESELLSCHAFT<br />
HAMMER-PURGSTALL<br />
1010 Wien, Dominikanerbastei 6/6<br />
� ++43(+1)/512 89 36<br />
� http://www.orient-gesellschaft.at<br />
private Einrichtung<br />
Emer. Univ. Prof. Dr. Dostal Walter<br />
(politische Verantwortung)<br />
Dr. Haas Siegfried (Geschäftsführer)<br />
Die Österreichische Orient-Gesellschaft Hammer-Purgstall<br />
wurde als „Hammer-Purgstall-<br />
Gesellschaft“ 1958 in der Rechtsform eines Vereins<br />
gegründet. Eine Namensänderung erfolgte<br />
1985. Ziel ist die Förderung von Studierenden<br />
aus islamischen Ländern des Nahen und Mittleren<br />
Ostens sowie Nordafrikas. Die ÖOG führt<br />
ein umfangreiches Stipendienprogramm durch<br />
und zählt zu den großen Betreuungsorganisationen<br />
für Studierende aus Entwicklungsländern.<br />
Darüber hinaus wird entwicklungspolitische<br />
Bildungs- und Informationsarbeit geleistet.<br />
Dies ist nicht nur auf die Zielgruppe der ausländischen<br />
Studenten beschränkt. Im Sinn des<br />
Namensgebers, des österreichischen Forschers<br />
und Volksbildners Hammer-Purgstall bietet die<br />
Gesellschaft Angebote für Erwachsenenbildung<br />
und Sprachkurse an ( Orient- Akademie; Lehrgang<br />
für akademische Orient- Studien). Das Informationszentrum<br />
für Zentralasien und Südkaukasien<br />
steht für Anfragen zur Verfügung.<br />
<strong>ÖSTERREICHISCHE</strong> EZA – BAND 1 161
Organisationen<br />
<strong>ÖSTERREICHISCHE</strong>S LATEINAMERIKA<br />
-INSTITUT<br />
1090 Wien, Schlickgasse 1<br />
� ++43(+1)/310 74 65<br />
� http://www.lai.at<br />
private Einrichtung<br />
Dr. Ferrero-Waldner Benita, Dr. Farnleitner<br />
Johannes (politische Verantwortung)<br />
Dr. Hittmair Siegfried, Mag. Reinberg Stefanie<br />
(Geschäftsführung)<br />
Das Österreichische Lateinamerika-Institut (LAI)<br />
wurde 1965 als Verein gegründet. Ziel des Instituts<br />
ist die Förderung der Beziehungen zwischen<br />
Österreich und Lateinamerika.<br />
Darüber hinaus ist das LAI eine Betreuungsorganisation<br />
für Studierende aus Lateinamerika<br />
und vergibt im Rahmen eines Stipendienprojekts<br />
des BMaA Stipendien für Studierende aus<br />
dem iberoamerikanischen Raum.<br />
In der Öffentlichkeits- und Bildungsarbeit bietet<br />
das Institut neben Spanisch- und Portugiesischsprachkursen<br />
einen Interdisziplinären Lehrgang<br />
für Höhere Lateinamerika-Studien, der mit dem<br />
Master of Arts (MA) abschließt.<br />
Im Kulturbereich werden u.a. Lesungen, Ausstellungen<br />
und Konzerte lateinamerikanischer<br />
KünstlerInnen geboten. Weiters engagiert sich<br />
das LAI in der wissenschaftlichen Kooperation<br />
mit Lateinamerika und führt eine entwicklungspolitische<br />
Bibliothek und Dokumentationsstelle,<br />
die auf den iberoamerikanischen<br />
Raum spezialisiert und in den IGE (Informationsverbund<br />
für globale Entwicklung) und den<br />
Quadrilog-Prozess, eine enge Kooperation von<br />
vier entwicklungspolitischen Bibliotheken, eingebunden<br />
ist.<br />
Finanzierung<br />
Umsatz in EURO 1996 2004<br />
Öffentliche Finanzierung 327.536 311.200<br />
private Mittel 562.706 652.900<br />
Gesamt 890.242 964.100<br />
PAULO FREIRE ZENTRUM<br />
1090 Wien, Berggasse 7<br />
� ++43(+1)/3174017<br />
� http://www.paulofreirezentrum.at<br />
private Einrichtung<br />
a.o.Univ.Prof. Dr. Novy Andreas<br />
(Politische Verantwortung)<br />
Mag. Dr. Faschingeder Gerald<br />
(Geschäftsführung)<br />
Das Paulo Freire Zentrum für transdisziplinäre<br />
Entwicklungsforschung und –bildung, gegründet<br />
2004, ist ein Freiraum für die Reflexion politischer<br />
Praxis. Es versteht die Praxis (Aktion<br />
und Reflexion) in Forschung - Bildung - Politik<br />
als Teile eines Prozesses, dessen Endziel die<br />
Aufhebung von Unterdrückung ist. Initiiert und<br />
ermöglicht wurde das Paulo Freire Zentrum<br />
durch eine Kooperation von <strong>ÖFSE</strong> und Mattersburger<br />
Kreis.<br />
Finanzierung<br />
Umsatz in EURO 1996 2004<br />
Öffentliche Finanzierung — 55.700<br />
private Mittel — 5.978<br />
Gesamt — 61.678<br />
162 <strong>ÖSTERREICHISCHE</strong> EZA – BAND 1
RESPECT<br />
Institut für IntegrativenTourismus<br />
& Entwicklung<br />
1150 Wien, Diefenbachgasse 36/3<br />
� ++43(+1)/89 56 245<br />
� http://www.respect.at<br />
private Einrichtung<br />
Dantine Wilhelm (politische Verantwortung)<br />
Mag. Silvia Stuppäck<br />
(Geschäftsführung)<br />
respect ist eine unabhängige, nicht auf Gewinn<br />
ausgerichtete, internationale Organisation zur<br />
Informations-, Bildungs-, Öffentlichkeits- und<br />
Forschungsarbeit. respect widmet sich dem Themenbereich<br />
des weltweiten Tourismus. Die Devise<br />
von respect ist , Tourismus und Entwicklung<br />
global, komplex vernetzt und im Hinblick auf<br />
das Leben und die Lebensqualität aller Menschen<br />
in „einer“ Welt zu betrachten. respect<br />
ist auch eine Fach- und Servicestelle der Österreichischen<br />
Entwicklungszusammenarbeit, die<br />
sich in dieser Funktion besonders für einen verantwortungsvollen<br />
und nachhaltigen Tourismus<br />
in Entwicklungsländern einsetzt. respect möchte<br />
die entwicklungs- und nachhaltigkeitspolitische<br />
Stimme im österreichischen Tourismus sein.<br />
Finanzierung<br />
Umsatz in EURO 1996 2004<br />
Öffentliche Finanzierung — 281.700<br />
private Mittel — 31.300<br />
Gesamt — 313.000<br />
SADOCC<br />
Organisationen<br />
Dokumentations- und Kooperationszentrum<br />
Südliches Afrika<br />
1040 Wien, Favoritenstraße 38/18/2<br />
� ++43(+1)/505 44 84<br />
� http://www.sadocc.at<br />
private Einrichtung<br />
Univ. Prof. Dr. Sauer Walter<br />
(Geschäftsführung)<br />
Ziel des Dokumentations- und Kooperationszentrums<br />
Südliches Afrika ist die Information und<br />
Expertise für Wissenschaftler und Studierende,<br />
staatliche Behörden, Firmen, Journalisten und<br />
entwicklungspolitische Organisationen, der<br />
Aufbau solidarischer Beziehungen Österreichs<br />
und der Europäischen Union zu den Ländern<br />
der Southern African Development Community<br />
(SADC) sowie die Bewältigung des Erbes von<br />
Kolonialismus, Apartheid und Destabilisierung<br />
im südlichen Afrika. Das Dokumentations- und<br />
Kooperationszentrum Südliches Afrika unterhält<br />
eine Bibliothek zum Themenkreis südliches<br />
Afrika, veranstaltet Vorträge, Dia- Abende und<br />
Diskussionen und veröffentlicht die Zeitschrift<br />
INDABA.<br />
<strong>ÖSTERREICHISCHE</strong> EZA – BAND 1 163
Organisationen<br />
SOS-KINDERDORF INTERNATIONAL<br />
6021 Innsbruck, Hermann Gmeiner Straße 51<br />
P.O. Box 443<br />
� http://www.sos-childrensvillages.org<br />
private Einrichtung<br />
Helmut Kutin (Präsident)<br />
Richard Pichler (Generalsekretär)<br />
1949 wurde von Hermann Gmeiner in Imst das<br />
erste Kinderdorf gegründet. 1960 wird SOS-<br />
Kinderdorf International gegründet und 1963<br />
beginnt die Arbeit außerhalb Europas.<br />
SOS-Kinderdorf International ist als koordinierender<br />
Dachverband tätig und operativ weder<br />
in Österreich noch im Ausland aktiv.<br />
Im Jahr 2000 unterhält SOS-Kinderdorf International<br />
in 132 Ländern 438 Kinderdörfer und<br />
1277 andere soziale Einrichtungen wie Kindergärten,<br />
Schulen, Jugendhäuser, Lehrwerkstätten,<br />
Sozialzentren, Krankenhäuser (in Entwicklungsländern)<br />
und Nothilfsprogramme. In den<br />
SOS-Kinderdörfern und Jugendeinrichtungen<br />
sind rund 60.000 Kinder/Jugendliche zuhause.<br />
Finanzierung<br />
Umsatz in EURO 1996 2004*<br />
Öffentliche Finanzierung 9.116.000 14.518.000<br />
private Mittel 201.559.000 281.584.000<br />
Gesamt 210.675.000 296.102.000<br />
*Zahlen SOS-Kinderdorf 2003<br />
SÜDWIND-AGENTUR<br />
1080 Wien, Laudongasse 40<br />
� ++43(+1)/405 55 15<br />
� http://www.suedwind-agentur.at<br />
private Einrichtung<br />
Mag. Helmut Adam (Geschäftsführung)<br />
Die Südwind - Agentur, Agentur für Süd-Nord-<br />
Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit GesmbH,<br />
ging 1997 aus dem ÖIE (Österreichischer Informationsdienst<br />
für Entwicklungspolitik) hervor.<br />
Seit 1997 ist der Trägerverein der Agentur umbenannt<br />
in „Südwind - Verein für entwicklungspolitische<br />
Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit<br />
(Kurzform: Südwind - Entwicklungspolitik) . Ziel<br />
ist mittels entwicklungspolitischer Bildungs-,<br />
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit die nachhaltige<br />
globale Entwicklung zu fördern, Bewußtsein<br />
zu erzeugen, Wissen zu vermitteln und über<br />
Süd und Nord Verflechtungen aufzuklären.<br />
Finanzierung<br />
Umsatz in EURO 1996 2004<br />
Öffentliche Finanzierung 1.427.000 1.168.000<br />
private Mittel 364.000 459.000<br />
Gesamt 1.791.000 1.627.000<br />
164 <strong>ÖSTERREICHISCHE</strong> EZA – BAND 1
WELTHAUS WIEN<br />
1010 Wien, Stephansplatz 6<br />
� ++43(+1)/ 51 552-3353<br />
� htttp://www.welthaus.at/wien<br />
private Einrichtung<br />
Dr. Christa Buzzi<br />
(politische Verantwortung)<br />
Christoph Watz<br />
(Geschäftsführung)<br />
Welthaus ist der Zusammenschluß von kirchlichen<br />
entwicklungspolitischen Organisationen<br />
in Graz, Linz, Salzburg, Innsbruck, St. Pölten<br />
und Wien. Gemeinsam setzen sie sich unter einem<br />
Namen für eine nachhaltige, zukunftsfähige<br />
Gesellschaft ein, in der Menschenwürde und<br />
Gerechtigkeit eine tragende Rolle spielen.<br />
In der Erzdiözese Wien wird das Welthaus von<br />
Einrichtungen der Katholischen Aktion getragen.<br />
Finanzierung<br />
Umsatz in EURO 1996 2004<br />
Öffentliche Finanzierung — 55.520<br />
private Mittel — 44.490<br />
Gesamt — 100.010<br />
WELTUMSPANNEND ARBEITEN<br />
Organisationen<br />
Das entwicklungspolitische Projekt des<br />
ÖGB OÖ<br />
4020 Linz, Wienerstraße 2<br />
� ++43(+732)/65 47 84<br />
� http://www.weltumspannend-arbeiten.at<br />
private Einrichtung<br />
Wilhelm Haberzettl<br />
(politische Verantwortung)<br />
Mag. Sepp Wall Strasser, Sabine Letz<br />
(Geschäftsführung)<br />
Weltumspannend Arbeiten wurde 1996 auf Initiative<br />
des ÖGB Oberösterreich gegründet. Im<br />
Rahmen der Gewerkschaftsbewegung sollen<br />
die Auswirkungen der Globalisierung im Norden<br />
und im Süden durchschaubarer gemacht<br />
werden, die Begegnung von Gewerkschaftern<br />
aus Nord und Süd ermöglicht, internationale<br />
Fragen thematisiert und Aktionen auf Betriebs-<br />
und Gewerkschaftsebene organisiert werden.<br />
Die Einrichtung bietet auch einen Überblick zu<br />
Kampagnen und Einrichtungen, die sich um die<br />
Durchsetzung von Arbeits- und Sozialrechten<br />
bemühen.<br />
<strong>ÖSTERREICHISCHE</strong> EZA – BAND 1 165
Organisationen<br />
WIDE NETZWERK<br />
1040 Wien, Wohllebengasse 12-14/VII<br />
� ++43(+1)/317 40 31<br />
� http://www.oneworld.at/wide<br />
private Einrichtung<br />
Mag. Schneider Renate<br />
(politische Verantwortung)<br />
Golda Hannah (Geschäftsführung)<br />
1992 gegründetes Netzwerk von Vertreterinnen<br />
aus entwicklungspolitischen NGOs - derzeit 18<br />
Organisationen - fördert die Integration von<br />
geschlechtsspezifischen Ansätzen in der Entwicklungspolitik.<br />
Finanzierung<br />
Umsatz in EURO 1996 2004<br />
Öffentliche Finanzierung 27.929 47.500<br />
private Mittel 1.853 8.500<br />
Gesamt 29.782 56.000<br />
WIENER INSTITUT FÜR ENTWICKLUNGS-<br />
FRAGEN UND ZUSAMMENARBEIT<br />
1040 Wien, Möllwaldplatz 5/3<br />
� ++43(+1)/713 35 94<br />
� http://www.vidc.org<br />
private Einrichtung<br />
Mag. Prammer Barbara<br />
(politische Verantwortung)<br />
Dr. Andrlik Erich (Geschäftsführung)<br />
Das Wiener Institut für Entwicklungsfragen und<br />
Zusammenarbeit wurde 1987 gegründet und<br />
ist ein unabhängiger, privater Fonds. Es trat die<br />
Nachfolge des 1962 von Bruno Kreisky und Jawahalal<br />
Nehru gegründeten Nord-Süd-Forums<br />
„Wiener Instituts für Entwicklungsfragen“ an.<br />
Das VIDC setzt sich mit Schwerpunktthemen der<br />
Österreichischen Entwicklungszusammenarbeit<br />
auseinander und sieht seine Aufgabe vor allem<br />
in der Vernetzung von Nichtregierungsorganisationen,<br />
Nord-Süd-Initiativen und interessierten<br />
Einzelpersonen, aber auch von in- und<br />
ausländischen ExpertInnen und WissenschafterInnen.<br />
Es werden Workshops, Informationsveranstaltungen<br />
und Konferenzen zu aktuellen<br />
Entwicklungen im Süden wie auch im Norden<br />
abgehalten und Serviceleistungen für Träger<br />
von Kleinprojekten angeboten. Im Rahmen der<br />
Informations-, Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit<br />
des VIDC nimmt der Kulturaustausch zwischen<br />
Lateinamerika, Afrika, Asien und Europa<br />
einen besonderen Stellenwert ein. „kulturen in<br />
bewegung“ bemüht sich seit 1996 als Servicestelle<br />
um Kulturkooperationen und -programme.<br />
Auch die anti-diskriminatorische Initiative<br />
„Fair-Play“ ist im VIDC angesiedelt.<br />
Finanzierung<br />
Umsatz in EURO 1996 2004<br />
Öffentliche Finanzierung 2.223.901 2.151.599<br />
private Mittel 41.595 85.419<br />
Gesamt 2.265.496 2.237.018<br />
166 <strong>ÖSTERREICHISCHE</strong> EZA – BAND 1
INTERNATIONALER VERGLEICH<br />
7. INTERNATIONALER VERGLEICH,<br />
INTERNATIONALE PERSPEKTIVEN<br />
In den vergangenen Jahrzehnten haben alle OECD-Staaten eigene Budgetlinien für entwicklungs-<br />
politische Inlandsarbeit eingerichtet. Für einen Vergleich der Aufwendungen für entwicklungs-<br />
politische Inlandsarbeit auf internationaler Ebene kann die OECD-Statistik herangezogen werden.<br />
Das Development Assistance Committee (DAC) erhebt im Rahmen der ODA-Statistik auch die Leis-<br />
tungen für Development Awareness. Dabei wird nicht zwischen Förderungen von NGO-Projekten<br />
und Informationsarbeit der EZA-Administration unterschieden.<br />
7.1. Überblick<br />
Im internationalen Vergleich der DAC-Geberländer findet sich Österreich bei der entwicklungs-<br />
politischen Inlandsarbeit im Vorderfeld, wenn man die Ausgaben in Relation zur gesamten ODA setzt.<br />
Tabelle 26<br />
INTERNATIONALER VERGLEICH DER AUSGABEN FÜR ENTWICKLUNGSPOLITISCHE<br />
INLANDSARBEIT (DEVELOPMENT AWARENESS) 2003<br />
in % der ODA pro Kopf in Mio US $<br />
Belgien 1,31 2,35 24,33<br />
Spanien 1,18 0,54 23,07<br />
Niederlande 1,15 2,82 45,76<br />
Österreich 0,98 0,61 4,95<br />
Norwegen 0,67 2,98 13,60<br />
Schweiz 0,67 1,19 8,74<br />
Finnland 0,63 0,68 3,53<br />
Luxemburg 0,58 2,51 1,13<br />
Dänemark 0,35 1,14 6,13<br />
Deutschland 0,16 0,13 10,59<br />
Quelle: OECD, DAC: IDS online (August 2005), eigene Berechnungen<br />
7.2. Aufwendungen im Detail<br />
Susanne Höck aktualisierte 2003 im Auftrag des Nord-Süd Zentrums des Europarates eine<br />
KommEnt-Untersuchung aus dem Jahr 1996 zu den Strukturen und Ausgaben für die entwick-<br />
lungspolitische Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit in Irland, den Niederlanden, Österreich und der<br />
Schweiz. Die Untersuchung wurde 2003 um Deutschland, Großbritannien und Norwegen erweitert.<br />
166 <strong>ÖSTERREICHISCHE</strong> EZA – BAND 1
INTERNATIONALER VERGLEICH<br />
Es waren die Angaben in den einzelnen Ländern über deren jeweilige Ausgaben nicht 100%ig<br />
vergleichbar, dennoch lässt sich trotz teils fragmentarischer Datenlage ein gewisser Grundtrend im<br />
Untersuchungszeitraum (1998-2003) erkennen. 1<br />
Die nachstehende Tabelle zeigt die Leistungen in den sieben Staaten (für Förderungen und für die<br />
EZA-Informationsarbeit). 2<br />
Tabelle 27<br />
INLANDSARBEIT - INTERNATIONALER VERGLEICH<br />
Bevölke-<br />
rung in<br />
Mio<br />
Österreich Deutschland<br />
Irland<br />
Niederlande<br />
Norwegen Schweiz Großbrit.<br />
8.1 82.2 3.8 16 4.5 7.2 60<br />
ODA in % des BNE<br />
1998 — — — — — 0.32 —<br />
1999 0.26 0.26 0.31 0.79 0.88 0.35 0.24<br />
2000 0.23 0.27 0.29 0.84 0.76 0.34 0.32<br />
2001 0.34 0.27 0.33 0.82 0.80 0.34 0.32<br />
2002 0.26 0.27 0.40 0.81 0.89 0.32 0.31<br />
2003 0.20 — — — — — —<br />
Förderungen und Info in Mio EUR<br />
1998 — 9.21* 1.53 27.69 6.14 0.86 — Großbrit.<br />
1999 5.36 7.18* 1.33 28.89 6.91 4.98 2.65 1998/99<br />
2000 4.37 7.89* 1.73 30.62 7.72 3.59 5.64 1999/2000<br />
2001 5.73 — 2.47 32.88 7.64 4.97 8.35 2000/2001<br />
2002 5.38 — 2.35 32.87 — — 8.11 2001/2002<br />
2003 5.38 8.8* 3.26 — — — 10.54 2002/2003<br />
Ausgaben in % of ODA<br />
1998 — 0.18* 0.86 0.91 0.53 0.10 — UK<br />
1999 1.08 0.14* 0.61 0.92 0.57 0.50 0.07 1998/99<br />
2000 0.95 0.14* 0.69 0.87 0.59 0.37 0.11 1999/2000<br />
2001 0.96 — 0.77 0.87 0.53 0.54 0.18 2000/2001<br />
2002 — — 0.56 0.87 — — 0.17 2001/2002<br />
2003 — — 0.71 0.88 — — 0.19 2002/2003<br />
Ausgaben pro Kopf der Bevölkerung in EUR<br />
1998 — 0.112* 0.403 1.730 1.364 0.119 — UK<br />
1999 0.660 0.087* 0.350 1.800 1.536 0.692 0.044 1998/99<br />
2000 0.540 0.096* 0.455 1.910 1.716 0.498 0.094 1999/2000<br />
2001 0.700 — 0.650 2.060 1.698 0.690 0.139 2000/2001<br />
2002 0.660 — 0.618 2.050 — — 0.135 2001/2002<br />
2003 0.660 0.107* 0.858 — — — 0.176 2002/2003<br />
*ohne Ausgaben der Länder, # geschätzt<br />
Quellen: OEDC/DAC, BMZ, DEA, DFID, KommEnt, NCDE, NCDO, <strong>ÖFSE</strong> 2002, RORG<br />
Wechselkurse vom 28.2.2004: Norwegen: 1NOK=0.114 EUR; Schweiz:1SFR=0.634 EUR; Großbritannien: 1GBP=1.4977 EUR<br />
1 Vgl. Susanne Höck: Structures for the Support of Development Education in Europe. In: ZEP, 2/2004, S. 7-14.<br />
2 Großbritannien, Irland, die Niederlande, Norwegen und Österreich weisen getrennte Budgetlinien aus.<br />
<strong>ÖSTERREICHISCHE</strong> EZA – BAND 1 167
INTERNATIONALER VERGLEICH<br />
In den Niederlanden wurden die Ausgaben pro Kopf in den letzten Jahren maßgeblich gesteigert.<br />
Sie betragen auch in Norwegen über 2 EURO Pro Kopf. Beide Staaten erfüllen zugleich seit Jahren<br />
das 0,7%-Ziel bei den Ausgaben für Entwicklungszusammenarbeit. Die Ausgaben in Österreich, Ir-<br />
land (mit einer Steigerung von EURO 0,40/Kopf 1998 auf 0,86 2003) und der Schweiz bewegen sich<br />
zwischen EURO 0,50 und 1,00 pro Person, während sie in Deutschland und Großbritannien unter<br />
EURO 0,20 betragen, in beiden Ländern jedoch zuletzt erhöht wurden.<br />
Gemessen am Anteil der Aufwendungen für entwicklungspolitische Informationsarbeit an der<br />
ODA erreicht kein Land auch nur annähernd das UNDP-Ziel von 3% 3 . Österreich und die Nieder-<br />
lande gaben 2002 0,97% bzw. 0,87% aus, doch müssen diese Zahlen auch in Beziehung zu den<br />
absoluten Zahlen der ODA gesetzt werden. Während in den Niederlanden die ODA 0,8% des<br />
BNE ausmacht, betrug sie in Österreich zuletzt 0,2% (2003). Die Ausgaben in Österreich betrugen<br />
EURO 5,23 Mio, in den Niederlanden machten sie EURO 32,88 Mio aus. In Norwegen (mit einem<br />
Anteil an der ODA von 0,53%) betrugen sie 2001 EURO 7,64 Mio.<br />
7.3. Global Education Network Europe (GENE)<br />
In Europa mehren sich die Beispiele der Einrichtung staatlich finanzierter, jedoch eigenständi-<br />
ger Strukturen zur Förderung entwicklungsbezogener Inlandsarbeit (NCDO in den Niederlanden<br />
seit über 30 Jahren, ncde in Irland seit 1979 4 , Stiftung Bildung und Entwicklung in der Schweiz,<br />
Development Education Association (dea) in Großbritannien, KommEnt in Österreich, die NGO-<br />
Plattform RORG in Norwegen, aktuelle Diskussionen über Modelle in Deutschland, Belgien und<br />
Portugal und seit jüngstem auch in Tschechien, der Slowakei, Slowenien und Polen).<br />
Koordiniert vom Nord-Süd Zentrum des Europarates hat sich seit 2001 ein Netzwerk (Global<br />
Education Network Europe) gebildet, welches den inhaltlichen und strategischen Austausch zu<br />
Fragen der qualitativen und quantitativen Förderung von entwicklungspolitischer Bildungsarbeit<br />
unterstützt.<br />
Es wird als erforderlich anerkannt, nationale Anstrengungen im Bereich der EZA-Inlandsarbeit<br />
europaweit zu koordinieren: Über die erwähnten Strukturen gelingt es, europäische EZA-Schwer-<br />
punkte, insbesondere solche der EU, sowie europaweite EZA-Kampagnen der Staaten wie der<br />
zivilen Gesellschaft vertiefend und koordiniert auf nationaler Ebene zu begleiten.<br />
Gemeinsam ist allen Staaten, welche im Netzwerk vertreten sind, dass sie über intermediäre Ko-<br />
ordinations- und Förderstrukturen verfügen. Die insgesamt zwölf Mitglieder haben sich über ein<br />
gemeinsames Programm verständigt, um die qualitative wie quantitative Förderung der entwick-<br />
lungspolitischen Inlandsarbeit, im Besonderen die Bildungsarbeit, zu unterstützen. Anliegen im<br />
Arbeitsprogramm sind, die Anliegen von GENE auf der Agenda der jeweiligen EU-Ratsvorsitze zu<br />
etablieren, aktuelle Daten zu den Strukturen und Ausgaben im Bereich zur Verfügung zu stellen,<br />
Theorie und Praxis der Evaluation von entwicklungspolitischer Bildungsarbeit zu fördern, sowie<br />
Wissen und Erfahrungen bei Lehrplanentwicklungen, Ausbildungsvorgängen und Fortbildungs-<br />
programmen auszutauschen.<br />
3 Vgl. UNDP: Human Development Report 1993, S.8.<br />
4 Seit 2002 ist das National Committee on Development Education als Development Education Unit Teil von Development<br />
Co-operation Ireland.<br />
168 <strong>ÖSTERREICHISCHE</strong> EZA – BAND 1
7.4. DEEEP<br />
INTERNATIONALER VERGLEICH<br />
Im Bereich der NGO-Gemeinschaft innerhalb der EU hat sich 2003 das Netzwerk DEEEP (Deve-<br />
lopment Education Exchange in Europe Project) etabliert. Es wird in Koordination mit CONCORD<br />
durchgeführt, der Nachfolgeeinrichtung des Verbindungsausschusses der NGOs, der bis 2001 die<br />
Lobbying-Aktivitäten der NGOs gegenüber der Europäischen Kommission koordinierte.<br />
DEEEP möchte im Besonderen die gesamteuropäische Vernetzung und das wechselseitige Lernen<br />
unterstützen. Jährliche Summer Schools (2003 in Portugal zur Rolle von entwicklungspolitischer<br />
Bildungsarbeit in Schulen, 2004 in Belgien zu ihrer Rolle gegenüber den Medien) bieten Gele-<br />
genheit zu Fortbildung und Training. Der regelmäßige Informationsaustausch erfolgt über einen<br />
Newsletter, Arbeitsgruppentreffen und eine jährliche Konferenz.<br />
7.5. Trialog<br />
Eine Berliner Konferenz mit dem programmatischen Titel „From dialogue to trialog“ befasste sich<br />
1999 mit der Frage, wie die Kooperation zwischen NGOs aus dem Westen, Süden und Osten ver-<br />
bessert werden könnte. Es wurde im Jahr 2000 das Projekt „Trialog“ gestartet, das die Basis eines<br />
lebendigen Netzwerkes wurde und aus Hunderten NGOs vor allem aus dem Bereich der Entwick-<br />
lungszusammenarbeit besteht.<br />
Ziel von Trialog ist es, den Austausch von Erfahrungen und Informationen zu entwicklungspoli-<br />
tischen Themen über die Plattform und auch durch verschiedene andere Aktivitäten zu intensi-<br />
vieren. Trialog ist ein Projekt, das entwicklungspolitische Themen im Hinblick auf eine nunmehr<br />
erweiterte EU verfolgt und den Dialog und die Zusammenarbeit zwischen NGOs aus Österreich,<br />
den anderen EU-Ländern (insbesondere den neuen) und den Entwicklungsländern fördern will.<br />
Es wurde eine NGO-Datenbank eingerichtet, die nicht nur für interne Zwecke zur besseren Koope-<br />
ration, sondern auch für alle anderen interessierten Personen zur Verfügung steht.<br />
Trialog erachtet die Öffentlichkeitsarbeit in Österreich als wichtigen Bestandteil der Entwicklungs-<br />
zusammenarbeit. Sie richtet sich an drei verschiedene Gruppen. Zur ersten zählen PolitikerInnen<br />
auf lokaler, regionaler und nationaler Ebene. ExpertInnen für Entwicklungszusammenarbeit infor-<br />
mieren über die möglichen Auswirkungen von politischen Entscheidungen und Veränderungen<br />
in Österreich auf die Entwicklungsländer. Eine weitere Zielgruppe sind JournalistInnen und alle<br />
anderen interessierten Personen, die in ihrer Funktion als KonsumentInnen und WählerInnen ge-<br />
sehen werden. Es werden Broschüren und Zeitungsartikel erstellt. Inserate und Kampagnen sollen<br />
auf die Arbeit von Trialog hinweisen. Für kleinere Zielgruppen werden Ausstellungen, Diskussions-<br />
veranstaltungen, Theaterstücke, Protestmärsche, Workshops und Seminare organisiert. Der dritte<br />
Teil der Tätigkeiten richtet sich an alle Institutionen und Organisationen, die im formalen sowie<br />
informellen Bildungsbereich tätig sind. Über Weiterbildungen und Materialienzusammenstellun-<br />
gen für den Unterricht werden PädagogInnen über Entwicklungsfragen informiert.<br />
<strong>ÖSTERREICHISCHE</strong> EZA – BAND 1 169
8. IMPULSE<br />
Vorwort<br />
IMPULSE<br />
Entwicklungspolitische Inlandsarbeit umfasst ein breites Spektrum an Themenzugängen. Dies be-<br />
darf nicht nur einer Überprüfung bearbeiteter Themen und Maßnahmen, sondern eines ständigen<br />
Prozesses des Nachdenkens. Mitunter scheint diese Aufgabe innerhalb der entwicklungspolitischen<br />
Inlandsarbeit zu kurz zu kommen. Die Entwicklung von Perspektiven ist aber Grundlage von qua-<br />
litativ abgesicherten Informations- und Bildungsmaßnahmen.<br />
Die Herausgeber wollten diesem Umstand in einem eigenen Abschnitt Rechnung tragen. Sie ha-<br />
ben Expertinnen und Experten eingeladen, Impulse für eine Weiterentwicklung der entwicklungs-<br />
poltischen Inlandsarbeit zu geben. Diese Beiträge verstehen sich als Anstöße und Ausgangspunkte<br />
für Perpektiven.<br />
Die Herausgeber danken den AutorInnen für ihre Beiträge.<br />
<strong>ÖSTERREICHISCHE</strong> EZA – BAND 1 170
IMPULSE<br />
Petra C. Gruber<br />
Globale Friedensgestaltung<br />
„Since wars begin in the minds of men, it is in the minds of men<br />
that the defences of peace must be constructed“ (Verfassung der UNESCO)<br />
Konflikte sind an sich nicht negativ, sie haben durchaus innovatives Potenzial für das menschliche<br />
Zusammenleben. Es geht darum, ihre gewaltförmige Eskalation zu vermeiden. Nachhaltige, sprich<br />
zukunftsfähige Entwicklungen sind Voraussetzung für Frieden und umgekehrt. Beides kann weder<br />
importiert oder exportiert noch erzwungen werden. Beides hängt eng mit Offenheit, Reflexion<br />
und Werten zusammen, oder einfach der Bereitschaft jeder/s Einzelnen, zu lernen. Beides braucht<br />
förderliche, glokale Rahmenbedingungen, also von der lokalen bis zur globalen Ebene.<br />
Politik mit anderen Mitteln?<br />
Krieg ist von Menschen gegen Menschen gemacht – und bislang offenbar gewollt. Die Hoffnung<br />
auf eine friedliche Welt hat sich mit dem Ende des Kalten Krieges nicht erfüllt. Krieg, nach Carl<br />
von Clausewitz „ein Akt der Gewalt, um den Gegner zur Erfüllung unseres Willens zu zwingen“,<br />
gilt noch immer als „Politik mit anderen Mitteln“. Und diese „blutige Politik“ fasziniert nach wie<br />
vor viele Menschen mehr als das, wodurch und wie sich Frieden konstituiert. Unzählige Studien<br />
thematisieren die „neuen Kriege“, die heute mehrheitlich innerstaatlichen gewalttätigen Ausein-<br />
andersetzungen. Am Krieg als „Bad News“ und damit „Good, Big News“ wollen und können viele<br />
profitieren. Nicht zuletzt die Massenmedien, die auch durch ihre Selektion und Interpretation<br />
internationaler Ereignisse unsere Wahrnehmung von der Wirklichkeit prägen. Die Aufteilung der<br />
Welt in Gut und Böse lässt Andersartigkeit und kulturelle Vielfalt als Bedrohung erscheinen, nährt<br />
den Fanatismus und trägt dazu bei, dass viele Menschen Krieg weiterhin als ultima ratio, als letzte<br />
Möglichkeit der Konfliktlösung akzeptieren. Zudem wird einer alle Lebensbereiche penetrieren-<br />
den Sicherheitspolitik der Weg geebnet (der „gläserne Mensch“).<br />
Angesichts eines angeblichen „Kampfes der Kulturen“ und der Bedrohung durch den Terrorismus<br />
haben die USA ihre Sicherheitspolitik auf „präventive Selbstverteidigung“ gegen potentielle Fein-<br />
de ausgerichtet. Die Europäische Sicherheitsstrategie kommt laut deutschem Friedensgutachten<br />
2004 einer de-facto-Militarisierung gleich. Doch wenn nicht an den tieferen Ursachen angesetzt<br />
wird, machen Militärausgaben von jährlich 900 Milliarden Dollar die Welt nicht sicherer. Beispiels-<br />
weise hat der illegitime und ineffiziente „Antiterror-Krieg“ im Irak unzähligen, unschuldigen<br />
Menschen das Leben gekostet, Tausende in die Flucht gezwungen, die menschliche Würde verletzt<br />
und die Lebensbedingungen auch künftiger Generationen zerstört. Der große Bedarf an humani-<br />
tärer Nothilfe und Wiederaufbaumaßnahmen geht zulasten langfristiger Entwicklungsbemühun-<br />
gen. Der Irak dient mittlerweile als neuer „Terroristen-Standort“ und so ist dieser Krieg selbst zur<br />
Friedensbedrohung geworden.<br />
Krieg zeigt sich als Problemlöser untauglich. Verbannen wir ihn! Schon Ghandi formulierte, dass<br />
ein fortgesetztes „Aug um Aug die Welt erblinden lässt“.<br />
171 <strong>ÖSTERREICHISCHE</strong> EZA – BAND 1
Friedensursachen<br />
IMPULSE<br />
Monokausale Erklärungen für Gewalt, wie sog. ethnische Gründe greifen viel zu kurz. Meist han-<br />
delt es sich um komplexe Ursachengeflechte. Zentrale Bedeutung kommt der Beseitigung der poli-<br />
tischen, der sozio-ökonomischen und ökologischen Missstände zu. Statt nachträglich zu reagieren,<br />
gilt es, die Eskalation gesellschaftlicher Auseinandersetzungen zu verhindern. Krisen kann bspw.<br />
durch Früherkennung und „early action“, durch Vertrauensbildung und Abrüstung vorgebeugt<br />
werden. Abgesehen von der humanitären Katastrophe und den Umweltzerstörungen spart Krisen-<br />
prävention auch Milliarden Dollar ein, die wiederum zur Förderung nachhaltiger Entwicklungen<br />
verwendet werden können.<br />
Unbestritten, unsere Geschichte ist voller Kriege - aber auch unzähliger und unbeachteter, friedli-<br />
cher Konfliktaustragungen. Krieg ist keine Naturgesetzmäßigkeit. Der Mensch ist fähig, bewusst<br />
wahrzunehmen und erkenntnisorientiert zu lernen. Es bedarf eines Umfeldes, das die authenti-<br />
sche Realisierung der Persönlichkeit (Freiheitsbegriff nach Fromm, der die Übernahme von Ver-<br />
antwortung inkludiert) und inneren Frieden ermöglicht – die Voraussetzung für eine liebe- und<br />
respektvolle Beziehung zu Anderen, zum Fremden. Insbesondere über Bildung können „humane“<br />
und soziale Kompetenzen zur Handhabung unterschiedlicher Wahrnehmungen und Weltsichten<br />
gefördert werden. Für die Einübung von Gewaltlosigkeit bietet nicht zuletzt die Zivilgesellschaft<br />
Lern- und Erfahrungsfelder.<br />
Frieden bedeutet nicht nur die Abwesenheit von Krieg im Sinne „Personaler Gewalt“. Ein positiver<br />
Friedensbegriff schließt auch die im Zusammenhang mit Armut und Umweltzerstörung stehen-<br />
den Ungerechtigkeiten mit ein - die strukturelle Gewalt (Johann Galtung), die die Lebenschancen<br />
des Menschen beeinträchtigt. Armut meint mehr als die mangelnde Abdeckung der existentiellen<br />
Grundbedürfnisse und ist nicht bloß das Gegenstück zu materiellem Reichtum. Armutsbekämp-<br />
fung bedeutet auch, Zugang zu Bildung und Gesundheitsdiensten, die sozio-kulturelle Teilhabe<br />
der Menschen und ihre politische Partizipation an Entscheidungen die sie betreffen, zu ermögli-<br />
chen. Ein integrativer, auf den Menschenrechten basierender Friedens- und Entwicklungsbegriff<br />
umfasst zudem Gewaltlosigkeit und Respekt vor allem Leben, Selbstvertrauen und Selbstachtung,<br />
eine sozial gerechte und ökologisch verträgliche wirtschaftliche Entwicklung, gute Regierungsfüh-<br />
rung und eine intakte Umwelt.<br />
Entwicklungspolitik als vorsorgende Friedenspolitik und Zukunftspolitik zu verstehen, impliziert<br />
freilich, sie finanziell entsprechend auszustatten. Schon ein Teil der enormen Anstrengungen und<br />
materiellen Aufwendungen der Kriegsgeschichte für gewaltlose Konfliktbearbeitung eingesetzt,<br />
würde den Umgang der Menschen und der Nationen miteinander entscheidend verändern. Das<br />
setzt voraus, dass keine Kultur das Wahre, das Gute, das Schöne für sich beansprucht und damit<br />
andere demütigt und bedroht. Eine friedliche Konfliktkultur gründet auf Dialog, Verständnis und<br />
Empathie, Solidarität, Gastlichkeit und Liebe. Ein weltweites, friedliches Zusammenleben kann<br />
nicht gegen- sondern nur miteinander gesichert werden. Derzeit steht einer internationalen Ko-<br />
operationskultur der unilateralistische Hegemonieanspruch der USA und die (friedenspolitische)<br />
Marginalisierung der Vereinten Nationen entgegen. Hinsichtlich des erforderlichen neuen Politik-<br />
konzeptes und der Akteure sei auf Franz Nuschelers Plädoyer für Global Governance verwiesen.<br />
Betont werden soll das Erfordernis einer echten, auf gegenseitigem Respekt beruhenden Partner-<br />
schaft, die kulturelle Vielfalt als Quelle des Reichtums anerkennt – Lernkultur statt Geberbeleh-<br />
rung ist die Maxime.<br />
<strong>ÖSTERREICHISCHE</strong> EZA – BAND 1 172
IMPULSE<br />
Paradigma des Lebendigen<br />
Unumgänglich ist auch eine Abkehr vom noch dominierenden, längst überholten, mechanistischen<br />
Weltbild hin zu einer integrativen Sichtweise, zu einer Wiederentdeckung der Zusammenhänge.<br />
Die moderne Naturwissenschaft hat gezeigt, dass das vermeintliche Nullsummenspiel der Natur,<br />
wonach es immer Gewinner und Verlierer gibt, tatsächlich ein „Plussummenspiel“ ist, d.h. der Vor-<br />
teil des einen bringt auch Vorteile für den anderen (win-win). „Competition“ (Wettbewerb) meint<br />
ursprünglich zusammen (nach zukunftsfähigen Problemlösungen zu) suchen. In diesem Sinne ist<br />
die wirtschaftliche Globalisierung kooperativ und ökosozial zu gestalten, wie es sich beispielsweise<br />
die Global Marshall Plan Initiative zum Ziel gesetzt hat.<br />
Natur ist im Grunde nicht materiell, sondern eher lebendig und ganzheitlich. Der Mensch ist Teil<br />
bzw. Beteiligter einer größeren Wirklichkeit. Es geht um eine Wiederverbindung von innen und<br />
außen, Individuum und Universum, Ratio und Emotio Frieden wird damit nicht nur möglich, son-<br />
dern für unsere Weiterentwicklung, für die menschliche Zukunft notwendig.<br />
Frieden lässt sich nicht einfach machen. Frieden braucht nicht nur Geduld. Frieden ist eine Kunst,<br />
formuliert es der alternative Nobelpreisträger Hans-Peter Dürr. Dafür bedarf es nicht nur einer au-<br />
ßergewöhnlichen, gemeinsamen Anstrengung von vielen und verschieden talentierten Menschen.<br />
Frieden verlangt vor allem umfassende Einsicht und Einfühlung in den Gesamtzusammenhang.<br />
Dann, so lautet die frohe Botschaft, ist Frieden möglich. Die entscheidende Frage ist, ob wir Frie-<br />
den wirklich wollen.<br />
Zum Weiterlesen:<br />
Petra C. Gruber (Hg.): Zeit für Nachhaltigkeit. Wien 2005<br />
Hans-Peter Dürr: Die Kunst des Friedens / Global Challenges Network<br />
INEF/SEF-Publikationen; insbesondere auch zur zivilen Bearbeitung bestehender Konflikte<br />
und zur Friedenskonsolidierung<br />
Volker Matthies: Eine Welt voller Kriege? Wider das Gerede von Krieg und Kriegsgeschrei. In: Fues,<br />
T./Hippler, J. (Hg.): Globale Politik, Entwicklung und Frieden in der Weltgesellschaft. Bonn 2003.<br />
Dt. Friedensgutachten 2004<br />
Friedensberichte des Österreichischen Studienzentrums für Frieden und Konfliktlösung (ÖSFK)<br />
173 <strong>ÖSTERREICHISCHE</strong> EZA – BAND 1
Kurt Luger<br />
Online aus der Armut?<br />
Kommunikation für nachhaltige Entwicklung<br />
„Nur der Stumpfsinnige glaubt, die Welt hört da auf, wo er selbst aufhört.“<br />
Thomas Bernhard. Auslöschung.<br />
IMPULSE<br />
Kluge Köpfe in den Entwicklungsländern versuchen mit Hilfe von Computer und Internet den<br />
Abstand zwischen Reich und Arm zu verkleinern. Sie wollen das Wissen der Welt aus dem Cyber-<br />
space herunter laden und Anschluss an die globale Welt des vermeintlich ständigen Wohlstands<br />
und Fort schritts finden. Die Kluft zwischen Reich und Arm, zwischen Zentrum und Peripherie,<br />
zwischen Norden und Süden wächst aber ungemindert, obgleich die Zahl der Internet-Nutzer ra-<br />
sant zunimmt. Von den geschätzten 500 Millionen Telefonen und Com puter, die den Zugang ins<br />
WorldWideWeb ermöglichen, stehen nur etwa fünf Prozent in der Dritten Welt, dort leben aber<br />
vier Fünftel der Weltbevöl kerung. Mit Mausklick aus der Armut geht so einfach also nicht.<br />
Die UNO, die Entwicklungsbanken, die Industrie und auch Geberländer forcieren seit etlichen Jah-<br />
ren den Ausbau der Informationsinfrastruktur und von Kommunikationsnetzen in den Entwick-<br />
lungsländern. Es herrscht Einigkeit darüber, dass der Zugang zu Information eine notwendige Vo-<br />
raussetzung für den Weg aus der Armut ist. Gleichzeitig besteht Unsicherheit hinsichtlich sozialer<br />
und kultureller Konsequenzen, die der Einschluss neuer Informations- und Kommunikationstech-<br />
niken (ICT) für Entwicklungsstrategien mit sich bringt. Man weiß aus Erfah rung: Technik alleine<br />
– ob alt oder ganz neu - ist kein Allheilmittel, es kommt auf die Logik dahinter an. Die neuen<br />
Kommuni kationstechniken eröffnen neue, vielversprechende Wege. Der Zugang und Gebrauch<br />
von Internet wächst daher in den Entwicklungsländern derzeit rascher als irgendwo anders auf<br />
dieser Welt. Aber wie daraus langfristig in den Entwicklungsländern einen Prozess in Gang setzen,<br />
der Armut reduziert, relevantes Wissen verbreitet und langfristig einen höheren Lebensstandard<br />
ermöglicht?<br />
Neue Technik – andere Logik<br />
Kritiker meinen, über die neuen Informations- und Kommunikationstechnologien käme ledig lich<br />
der technikgläubige Entwicklungsansatz wieder in Mode.Was nutzt den Subsistenzbauern am<br />
Rande des Global Village ein Laptop, ein Telefon, ein Internetanschluss? Wieso wird nicht gefragt:<br />
Was nutzt dieselbe Konfiguration dem Bergbauern oder der Gemüsehändlerin im Nationalpark<br />
Hohe Tauern, im Marchfeld, im nördlichen Waldviertel? Dennoch haben sie diese Ausstattung in<br />
wachsendem Ausmaß, denn sie bringt Erleichterung, Annehmlichkeit, führt zu raffinierteren Pro-<br />
dukten und bietet einfachen Zugang zu einer Fülle von Bildungs- und Wissensangeboten. Telefon<br />
ist längst nicht mehr wegzudenken aus den Haushalten, fast jede Alpenhütte verfügt heute über<br />
einen Anschluss, und je weiter weg von der Agglome ration, umso wichtiger wird dieser. Mit der<br />
Telefonie kommt die weite Welt ins Dorf, auch neues Wissen.<br />
<strong>ÖSTERREICHISCHE</strong> EZA – BAND 1 174
IMPULSE<br />
Wie bei jeder Innovation ziehen anfänglich die besser Gebildeten in den Städten und nicht die<br />
ohne Schulbildung in entlegenen Dörfern einen Nutzen daraus. Aber die neuen Informationstech-<br />
niken bieten Möglichkeiten für alle, und im Entwicklungseinsatz können sie zu Techniken und<br />
Werkzeugen zur Armutsbekämpfung werden. Jenseits der Chancen für den einzelnen erfordert<br />
dies allerdings eine Zusammenarbeit von Staat, Wirtschaft, ziviler Gesellschaft und Entwicklungs-<br />
organisationen, im optimalen Fall eine nationale entwicklungspolitische Kraftanstrengung.<br />
Die neuen Technologien verfügen über ein demokratisches Potenzial, das jenes der etablierten<br />
Medien weit überragt. In Gesellschaften, wo Information bislang vorenthalten wurde oder der<br />
Zensur unterliegt, ist das spürbarer als bei uns. Die Bürger in den Industriestaaten können aus<br />
einer Fülle von Medienprodukten auswählen, dennoch führen die Filter der Massenmedien zu<br />
fragmentierten Weltbildern, zu einer ideologischen Sichtweise des Nord-Süd-Konflikts. Das macht<br />
Bildungs- und Kulturarbeit für nachhaltige Entwicklung unverzichtbar und es wird ihr Einsatz auch<br />
in Zukunft notwendig sein, denn sie baut die Fragmente zusammen. Sie bietet einen Diskurs an,<br />
der den vielen Stimmen aus den Entwicklungsländern Ausdruck verleiht und sie deckt Interessens-<br />
lagen auf. Im Gegensatz zum Selbst bedienungsmedium Internet wirken die Informationsverbrei-<br />
tung einer Abendnachrichtensen dung im Fernsehen oder die Auswahl der gedruckten Artikel in<br />
einer Tageszeitung wie autoritäre Nachrichtenverteilung. Einer oder ganz wenige entscheiden<br />
darüber, was Neuigkeit und Meldung wird. Studien über journalisti sche Nachrichtenwerte und die<br />
Aufmerksamkeitsregeln weisen aus, dass genau an dieser Schlüsselstelle das Demokratieverständ-<br />
nis einer Gesellschaft seinen Niederschlag findet. Dieses System wird zusehends hermetischer, die<br />
Medienkonzentration nimmt zu und die Vielfalt der Meinungen ab. Es verfügen immer weniger<br />
aber größere Konzerne über die Macht Themen auf die Tagesordnung zu setzen und damit die<br />
Öffentlichkeiten mit Diskussionsstoff zu versorgen.<br />
Die internationale Kultur- und Medienindustrie gehört zu den wenigen absoluten Globalisie-<br />
rungs-gewinnern. Sie hat den weltweiten Verbrauchermarkt im Visier und definiert die Entwick-<br />
lungs-länder als riesigen Hoffnungs- und Absatzmarkt für Güter und Ideologien. In den westlichen<br />
Medien wird immer noch standhaft verschwiegen, wie die globalen Zusammenhänge funktionie-<br />
ren, und taucht die Peripherie nach wie vor nur in den Medien der Zentren auf, wenn es zu Kriegs-<br />
handlungen oder Katastrophen kommt bzw. es exotisch Staunenswertes zu berichten gibt. Die<br />
Ignoranz gegenüber den Entwicklungsprozessen in der Dritten Welt wird selten durchbrochen<br />
und wäre der Tsunami nur über Indonesien hereingebrochen und nicht auch über die Traum-<br />
strände in Thailand und Sri Lanka, die Medien hätten ungleich weniger Notiz davon genommen.<br />
Neue Technik – neue Ordnung<br />
Im Kontrast zu dieser perspektivischen Verengung durch den medialen Tunnelblick auf Asien, Af-<br />
rika oder Lateinamerika bestehen über die neuen Techniken noch nie gekannte Möglich keiten zur<br />
Informierung jedes/r einzelnen. Schnellstes Nachrichtenmedium und Enzyklopädie, Spielkonsole<br />
und grenzenlose Bildungsinstanz, Mobilisierungsinstrument und fast forward-Brieftaube in einem<br />
– das Internet steht als Synonym für neue Kommunikationstechnologien und diese verändern die<br />
Kommunikationsbeziehungen zwischen Nord und Süd.<br />
175 <strong>ÖSTERREICHISCHE</strong> EZA – BAND 1
IMPULSE<br />
Das hat auch Konsequenzen auf die entwicklungspolitische Öffentlichkeits- und Bildungs arbeit.<br />
Auf tausenden Websites, die von NGOs oder einzelnen Aktueren der zivilen Gesell schaft in den<br />
Entwicklungsländern ins Netz gestellt wurden, sind Informationen in einem Umfang abzuholen,<br />
von denen seinerzeit die Verfechter einer Neuen Weltinformations- und Kommunikationsordnung<br />
(NWIKO) nicht einmal zu träumen gewagt hätten. Der gerechtere und besser ausbalancierte Infor-<br />
mationsfluss zwischen Nord und Süd, eine Forderung, die von den non-aligned countries, vielen<br />
NGOs und der MacBride-Kommission über die UNESCO schon in den 1970er Jahren pointiert vor-<br />
getragen wurde, ist also möglich – nicht aufgrund einer demokratischeren Weltordnung, sondern<br />
primär aufgrund der neuen Technologien. Sichtweisen, Sachverhalte und authentische Beiträge<br />
aus dem Süden sind jetzt also vom Schreibtisch aus abrufbar, sie aber hierzulande in den politi-<br />
schen Diskurs zu integrieren und ihnen auf kleinen und großen Bühnen Gehör zu verschaffen ist<br />
eine noch zu lösende Aufgabe.<br />
Mit dem Aufkommen neuer Medien verschwinden nicht die schon etablierten, aber es ändern<br />
sich ihre Funktionen. Das Fernsehen wird auch in Zukunft das globale Leitmedium sein, weil es<br />
faszi niert, Bild und Ton in einer den Haushalten adäquaten Choreographie zusammenführt und in<br />
einer dramaturgischen Weise vermittelt. Komfort wird großgeschrieben, ebenso Unter haltung für<br />
die Massen und während der Hauptsendezeit am Abend ist das Medium größter Freizeitgestalter.<br />
Zeitung und Zeitschrift – sofern es sich nicht um ein Nischenprodukt für eine ganz spezifische<br />
Zielgruppe handelt – haben tendenziell die Rolle des Nachlese-Mediums und Dokumentaristen<br />
angenommen. Das Papierformat kann man überall hin mitnehmen, ob der Stoff auf Fakten oder<br />
Emotion beruht, das zusammengetragene Aufregende dient zur Nachbe arbeitung von Aktuel-<br />
lem, kann also bei der Einordnung von Geschehnissen helfen. Der Hörfunk wurde längst zum<br />
Tagesbegleiter in den Industriegesellschaften, er lebt von Musik und Ser viceangeboten. In den<br />
Entwicklungsländern wird er als Bildungsmedium unentbehr lich bleiben. Aber dort, in den entle-<br />
genen Tälern des Himalaja und der Anden, oder in den weiten Wüsten gebieten Afrikas existieren<br />
nach wie vor traditionelle Medien und indigene Kommunikations formen, ziehen Märchenerzähler<br />
oder Sänger von Dorf zu Dorf und vermitteln das Berichtens werte. Über solche Kanäle wird auch<br />
indigenes Wissen weiter gegeben, das für die Identität und den Zusammenhalt einer Gruppe von<br />
entscheidender Bedeutung sein kann. An manchen Orten existieren sie gleichwohl neben den mo-<br />
dernen Techniken, verlieren allenfalls an Bedeutung wie das lokale Wissen an Wichtigkeit einbüßt<br />
oder erst durch Anstösse von aussen wieder Wertschätzung erfährt.<br />
Die Dialektik von Altem und Neuen und das Zusammenspiel von Wissen und Technik stellen für<br />
die entwick lungspolitische Arbeit eine große Herausforderung dar – egal ob in der Bildungs- und<br />
Öffentlichkeitsarbeit hierzulande oder beim Projekteinsatz vor Ort. Das Spektrum an Kommu-<br />
nikation ist größer geworden – hier wie dort. In unserer sogenannten Wissensgesell schaft wird<br />
die Selektion zusehends ein Problem, Überfluß allenthalben, wäh rend die Gesellschaften in den<br />
Entwicklungsländern vom Mangel geprägt sind, es an Zugängen, Informationen und an Ressour-<br />
cen fehlt. Trotz der rasanten technischen Entwick lung, der globalen Knopf druck-Information und<br />
der ungeheuren Mobilität haben sich die grundsätzlichen Indikatoren für Armut kaum verän-<br />
dert, stehen die politischen Vorzeichen trotz beherzter entwicklungspo litischer Rhetorik schnell<br />
auf Wüstensturm. Die Notwendigkeit für eine gerechtere Chancen verteilung einzutreten besteht<br />
weiterhin, hier wie dort, aber das Anliegen kann jetzt stärker vernetzt und dialogisch angegan-<br />
gen werden.<br />
<strong>ÖSTERREICHISCHE</strong> EZA – BAND 1 176
IMPULSE<br />
Franz Nuscheler<br />
Globales Politikverständnis<br />
Die Frage der Beherrschbarkeit von Weltproblemen, denen sich in der „globalen Risikogesell-<br />
schaft“ (Ulrich Beck) kein Staat und keine Gesellschaft entziehen kann, ist zum zentralen Gestal-<br />
tungsproblem der Weltpolitik geworden. Mit der Globalisierung von Ökonomie und Technologie,<br />
von Kommunikation und Transportsystemen internationalisieren sich auch Fehlentwicklungen. In<br />
einer zunehmend interdependenten Welt kommt ein nationales Inseldenken einem Realitätsver-<br />
lust und einer Erkenntnisverweigerung gegenüber den Herausforderungen der vielschichtigen<br />
Interdependenzen gleich. Auch Probleme in scheinbar weit entfernten Regionen – wie Kriege,<br />
Umweltzerstörungen oder armutsbedingte Migrationen – haben grenz- oder gar kontintentüber-<br />
greifende Bumerangeffekte. Spätestens seit dem 11. September 2001 reden Sicherheitspolitiker<br />
und Terrorismusexperten über eine „globalisierte Unsicherheit“. Und die entwicklungspolitische<br />
Bildungsarbeit muss auch darüber reden.<br />
Schon vorher stellte der israelische Politologe Yehezkel Dror (1995) in einem Bericht an den Club<br />
of Rome die skeptische Frage: „Ist die Erde noch regierbar?“ Seine Antwort lautete: Auf her-<br />
kömmliche und in unserem Denken noch tief verwurzelte Weise nicht mehr. Weil sich die Schere<br />
zwischen der Globalisierung der Weltprobleme und der Fähigkeit der Staatenwelt, sie mit den<br />
herkömmlichen Verfahren und Instrumenten der nationalstaatlichen Macht- und Interessenpolitik<br />
zu bewältigen, immer weiter öffnet, muss die Politik, um ihrer eigenen Ohnmachtsfalle entgehen<br />
zu können, neue Wege in der Innen- und Außenpolitik beschreiten, und müssen die Menschen<br />
lernen, global zu denken.<br />
Mit anderen Worten: Wenn sich die Probleme globalisieren, muss sich auch die Politik globalisie-<br />
ren. Dann genügt auch nicht mehr ein punktuelles und reaktives Krisenmanagement, wie es die<br />
G 7/8 oder der Internationale Währungsfonds gelegentlich praktizieren, sondern es müssen neue<br />
Ordnungsstrukturen geschaffen und neue Steuerungsmechanismen gefunden werden. Wenn die<br />
Welt im 21. Jahrhundert noch regierbar sein soll, muss sie anders regiert werden als noch im soe-<br />
ben vergangenen Jahrhundert. Willy Brandt hatte schon vor über zwei Jahrzehnten in der Einlei-<br />
tung zum Brandt-Bericht betont – und es ist bekannt, dass in diesem globalen Politikverständnis<br />
eine ideelle Wahlverwandtschaft zwischen ihm und Bruno Kreisky bestand:<br />
„Ob es uns passt oder nicht: Wir sehen uns mehr und mehr Problemen gegenüber, welche die<br />
Menschheit insgesamt angehen, so dass auch die Lösungen hierfür in steigendem Maße inter-<br />
nationalisiert werden müssen. Die Globalisierung von Gefahren und Herausforderungen – Krieg,<br />
Chaos, Selbstzerstörung – erfordert eine Art Weltinnenpolitik, die über den Horizont von Kirchtür-<br />
men, aber auch über nationale Grenzen weit hinausreicht.“<br />
Den Versuch, Antworten auf diese Herausforderungen zu finden, nennen die einen – wie Willy<br />
Brandt – Weltinnenpolitik oder Globalpolitik, andere Weltordnungspolitik, viele inzwischen Global<br />
Governance, nachdem die Commission on Global Governance diesen Begriff in die internationale<br />
Diskussion eingeführt hat. Aber auch mit diesem Begriff werden noch immer sehr unterschiedliche<br />
Vorstellungen verbunden.<br />
177 <strong>ÖSTERREICHISCHE</strong> EZA – BAND 1
IMPULSE<br />
Wichtig ist die folgende Klarstellung: Global Governance heißt nicht Global Government, also<br />
Weltregierung oder Weltstaat. Ein solcher ist weder eine realistische noch eine erstrebenswerte<br />
Option, weil ein solcher bürokratischer „Welt-Kingkong“ kaum demokratische Legitimation ge-<br />
winnen könnte und weit entfernt von den in den einzelnen Weltregionen zu lösenden Problemen<br />
wäre. Die Vision von Global Governance entspricht eher der bereits von Immanuel Kant in seinem<br />
Traktat über den „Ewigen Frieden“ anvisierten Weltföderation von freien Republiken. Auch seine<br />
Begründung, warum sich souveräne Staaten auf eine solche friedensstiftende Föderation einlas-<br />
sen, bleibt gültig: Es ist die „Not“, politische Handlungsfähigkeit zu erhalten.<br />
Was bedeutet dann Global Governance? Das normative und erst in Ansätzen realisierte Konzept<br />
beruht auf verschiedenen Formen und Ebenen der internationalen Koordination und Koopera-<br />
tion. Internationale Organisationen übernehmen diese Koordinationsfunktion und so genannte<br />
Regime (wie das Handelsregime der WTO) übersetzen den Willen zur Kooperation in verbindliche<br />
Regelwerke. In solchen Regimen verpflichten sich die Staaten durch vertragliche Vereinbarungen<br />
zur Bearbeitung von gemeinsamen Problemen. Auch Supermächte lassen sich zumindest selektiv<br />
auf solche Regime ein, weil sie etwas regeln, was ihnen für das eigene Wohlergehen wichtig ist<br />
und was sie nicht mehr allein regeln können. Gleichzeitig ist der besonders von der „einzigen<br />
Supermacht“ USA praktizierte Unilateralismus ein großer Stolperstein auf dem Weg zum Multila-<br />
teralismus von Global Governance.<br />
Global Governance meint aber nicht nur ein Mehr an einem zwischenstaatlich organisierten Mul-<br />
tilateralismus, sondern auch ein Zusammenwirken von staatlichen und nicht-staatlichen Akteuren<br />
von der lokalen bis zur globalen Ebene, ohne das die Menschheitsprobleme nicht mehr bewäl-<br />
tigt werden können. Diese Public-Private Partnership bezieht sich nicht nur auf die wachsende<br />
Bedeutung von global operierenden multinationalen Unternehmen („Multis“), die zu Kraftbol-<br />
zen der Globalisierung wurden, sondern auch auf die zunehmend transnational organisierten<br />
Nichregierungsorganisationen, die sich als „Globalisierungswächter“ profilierten. Sie gehören<br />
längst zur Dramaturgie von Weltkonferenzen und erheilten in einzelnen „weichen“ Politikfeldern<br />
(Umwelt-, Entwicklungs- und Menschenrechtspolitik) neben der konsultativen auch eine mitge-<br />
staltende Funktion.<br />
Die Staatenwelt kann nicht mehr wie auf dem Wiener Kongress in diplomatischer Exklusivität<br />
schalten und walten. Deshalb sprach UN-Generalsekretär Kofi Annan von einer „stillen Revoluti-<br />
on“ hinter den Kulissen der Staatenwelt. Die Nationalstaaten bleiben zwar die Hauptakteure der<br />
internationalen Politik, die weiterhin allein autoritative Entscheidungen treffen können, und sie<br />
bilden die tragenden Pfeiler der Global Governance-Architektur. Diese ist aber ohne netzwerkar-<br />
tige Verstrebungen mit der Wirtschafts- und Gesellschaftswelt nicht mehr tragfähig. „Public-pri-<br />
vate Partnership“ bedeutet auch, dass der Staat in Kooperation mit gesellschaftlichen Gruppen<br />
gemeinsame Problemlösungen erarbeiten muss. Sowohl auf lokaler und nationaler als auch auf<br />
globaler Ebene haben sich längst partizipatorische „bottom-up“-Entscheidungsverfahren als leis-<br />
tungsfähiger gegenüber zentralistischen und bürokratischen „top-down“-Verfahren erwiesen.<br />
Dies gilt auch und besonders für die Entwicklungspolitik.<br />
Global Governance ist kein romantisches Projekt für eine heile Welt, die es nicht gibt, sondern<br />
eine realistische Antwort auf die Herausforderungen der Globalisierung und der globalen Risiken.<br />
Es ist ein evolutionäres Projekt, das sich nur schrittweise entwickelt.<br />
<strong>ÖSTERREICHISCHE</strong> EZA – BAND 1 178
IMPULSE<br />
Ein genaueres Hinsehen auf internationale Politikprozesse zeigt jedoch, dass das Glas eher halb<br />
voll denn halb leer ist. In den zahlreichen internationalen Organisationen und Verhandlungspro-<br />
zessen werden bereits kooperative Denk- und Verhaltensmuster geübt und finden globale Lern-<br />
prozesse statt. Der Problemdruck der steigenden Transaktionskosten bei Verzicht auf Kooperation<br />
wird auch die Global Players zur Regulation der unbändigen Eigendynamik der Globalisierung und<br />
auch die „einsame Supermacht“ wieder zur internationalen Kooperation zwingen, weil sie nicht<br />
allein das Problem der Regierbarkeit der Welt lösen kann. Die Alternative liegt in der Chaotisie-<br />
rung der Welt und im Rückfall in Hobbsche Horrorszenarien.<br />
179 <strong>ÖSTERREICHISCHE</strong> EZA – BAND 1
Kunibert Raffer<br />
Globales Wirtschaften<br />
IMPULSE<br />
Seit etwa 1980 “überrollte” eine Wirtschaftsideologie die Welt und beseitigte kritische Ansätze in<br />
der Wirtschafts- und Sozialwissenschaft weitgehend. Die Politik der 1930er hat erneut Konjunktur:<br />
ihre Fehler werden wieder gemacht - und ein paar neue dazu. Da die Argumente von damals nicht<br />
mehr gebraucht werden können, dient “Globalisierung” als Rechtfertigung - sie erzwänge “Refor-<br />
men”, auf unsere Märkte drängende Entwicklungsländer zwingen zu “Einschnitten”. Schlagworte<br />
wie Privatisierung, Deregulierung, Liberalisierung und ausgeglichene Budgets kennzeichnen den<br />
Neoliberalismus. Langsam aber zielstrebig werden die sozialen Errungenschaften eines Jahrhun-<br />
derts zerstört. Die Auflösung der bipolaren Welt verstärkte diese Entwicklung.<br />
Neoliberalismus läßt sich als Umverteilung zugunsten der Reichen und als “Zurück in die Zeit vor<br />
dem demokratischen Wohlfahrtstaat” beschreiben. Als neues Instrument dienen internationale<br />
Verträge, wie der Maastricht Vertrag, um neoliberale Wirtschaftspolitik auch in Zukunft “einzu-<br />
zementieren”. Von neoliberalen Regierungen ausgehandelt, schränken sie die Entscheidungsfrei-<br />
heit zukünftiger, demokratisch gewählter Regierungen in bisher ungekannter Weise ein. Die WTO<br />
empfahl sich in ihrem Jahresbericht 1998 (Seite 4) explizit als Mittel zum Demokratieabbau. Die<br />
ökonomisch willkürlich und unbegründbar gewählten Maastricht Kriterien beschränken die Akti-<br />
onsradien neugewählter Regierungen, keynesianische Politik wurde erstmals unter Geldstrafe ge-<br />
stellt. Das MAI, das im Rahmen der WTO wiederbelebt werden sollte, oder die NAFTA beschränken<br />
die demokratische Willensbildung drastisch zugunsten privater Gewinne. Die EU “Gesetzgebung”<br />
erfolgt geheim hinter verschlossenen Türen durch die hierfür nicht demokratisch legitimierte Exe-<br />
kutivgewalt. Sie implementiert neoliberale Reformen. Das “Parlament”, im Model der Europäi-<br />
schen Wirtschaftsgemeinschaft vor 1945 ehrlicherweise gar nicht vorgesehen, ist keine Legislative,<br />
neuerdings aber ein etwas größeres Feigenblatt. Die neue EU Verfassung erhebt Neoliberalismus<br />
in den Verfassungsrang. Die weltweite antidemokratische Stoßrichtung ist leicht erklärbar: Politik<br />
gegen die Bevölkerungsmehrheit ist langfristig in Demokratien nicht möglich. D. Rodriks berühm-<br />
ter Artikel über Reformen (Journal of Economic Literature 1996) stellt fest, daß “viele Ökonomen”<br />
klammheimlich autokratische Reformen zu Lasten der Demokratie bevorzugen, da die Bevölke-<br />
rung ihre Vorschläge ablehnt, es aber “für politisch unkorrekt” halten, dies zu “artikulieren”, eine<br />
inhärente Demokratiefeindlichkeit, die schon Karl Polanyi entdeckte.<br />
Die Divergenz zwischen offiziell als Begründung verwendeter Theorie und neoliberaler Praxis<br />
zeigt sich schon darin, daß der zentrale Punkt des neoklassischen Marktmodells, die Konsumen-<br />
tensouveränität, durch Verträge abgebaut wird. Die Konsument(inn)en werden bewußt entmün-<br />
digt. Bei genmodifizierter Nahrung wird eine genaue Kennzeichnung bekämpft und diese zen-<br />
trale Marktvoraussetzung ausreichender Information als Handelshemmnis bezeichnet. Das Recht<br />
der Entwicklungsländer prüfen zu dürfen, was sie am Weltmarkt kaufen - laut GATT ein nicht-<br />
tarifäres Handelshemmnis - wurde nur gegen massiven Widerstand durchgesetzt. Generell wird<br />
Risiko einseitig zu Lasten der Konsument(inn)en umverteilt, was die Markteffizienz zerstört, aber<br />
ungerechtfertigte Profite ermöglicht. Der vom Art. 2 des WTO-Abkommens über sanitäre und phy-<br />
tosanitäre Maßnahmen geforderte wissenschaftliche Nachweis bedeutet, daß potentiell gefährli-<br />
che Produkte nicht präventiv – ohne „wissenschaftlichen Nachweis” - verboten werden dürfen.<br />
<strong>ÖSTERREICHISCHE</strong> EZA – BAND 1 180
IMPULSE<br />
Würde Contergan heute neu eingeführt dürfte es nicht wegen befürchteter Mißbildungen bei<br />
Neugeborenen verboten werden. Es ist zu befürchten, dass “ausreichende wissenschaftliche<br />
Beweise” frühestens erbracht wären, nachdem viele Kinder bereits an Mißbildungen leiden.<br />
Politiker(innen), die heute stolz auf ihre Unterschrift auf den WTO-Verträgen hinweisen, dürften<br />
dann wohl zutiefst gekränkt jede Schuld von sich weisen.<br />
Die Privatisierung der Pensionsvorsorge ist ein weiteres Beispiel. Die überschuldeten Entwicklungs-<br />
länder dienten nach 1982 als “Probelabor” neoliberaler Umverteilungspolitik. Private Pensionsvor-<br />
soge - erstmals in Chile von der Militärjunta eingeführt - kann zwar die beim öffentlichen System<br />
gerügten Probleme keinesfalls lösen, wie auch J. Stiglitz klar zeigte, sie ist aber für Fondsverwalter<br />
extrem profitabel, verbleibt doch jedes Risiko bei den “Versicherten” und dem Staat als Ausfalls-<br />
hafter, während Gewinne über hohe Verwaltungsgebühren privat lukriert werden. Der britische<br />
“mis-selling” Skandal (für ihre Pension Vorsorgende wurden durch Anlageexperten großflächig<br />
falsch beraten und dadurch zu ihrem finanziellen Schaden Kunden privater Firmen) oder die ers-<br />
ten Erfahrungen Lateinamerikas zeigen, daß die versprochenen Vorteile nicht eintreten, während<br />
die Gebühren auch ein Drittel aller Einzahlungen der “Versicherten” ausmachen können (die Ver-<br />
waltungskosten des öffentlichen Systems Österreichs liegen bei etwa 2%). Pensionsfonds haben<br />
trotz hoher, gleich vorab abgebuchter Gebühren, keine wirkliche Haftung. Legen sie in Enron, Par-<br />
malat oder Woldcom Aktien an, ist nicht ihr Kapital weg – es gibt Profit ohne jedwedes Risiko.<br />
Während Sozialdemokraten früher wirtschaftlich “unvertretbare” Forderungen (10-Stunden-Tag,<br />
40-Stunden Woche) stellten, bekämpfen “Sozialdemokraten” heute ganz neoliberal unrealisti-<br />
sches “Besitzdenken”. Anzeichen von Widerstand bleiben überraschend schwach - auch wenn der<br />
Fall des GATS hoffen läßt - hoffentlich werden sie stärker, bevor es wie in den 1930ern erneut zur<br />
Katastrophe kommt.<br />
181 <strong>ÖSTERREICHISCHE</strong> EZA – BAND 1
Klaus Seitz<br />
Lernen im Horizont der Einen Welt<br />
IMPULSE<br />
Am 1. März ist in New York der Startschuss für die UN-Dekade „Bildung für eine nachhaltige Ent-<br />
wicklung“ (2005 – 2014) gefallen. Mit der Ausrufung dieser Weltdekade bekräftigen die Vereinten<br />
Nationen eine Erkenntnis, die sich schon wie ein roter Faden durch die „Agenda 21“ zieht: der<br />
Weg zu einer global nachhaltigen Entwicklung führt über die Bildung. Denn ohne Bildung und<br />
ohne eine kompetente, verantwortungsbewusste und handlungsfähige Zivilgesellschaft kann die<br />
Verwirklichung dieses ambitionierten Aktionsprogramms, auf das sich die Staatengemeinschaft<br />
1992 beim Erdgipfel in Rio verständigt hatte, nicht gelingen. Bildung ist der Schlüssel für einen<br />
gesellschaftlichen Wandel, der die Welt aus den sozialen und ökologischen Sackgassen der Globa-<br />
lisierung herausführen kann.<br />
Die Vereinten Nationen haben der nun eröffneten Weltdekade eine große Vision vorangestellt,<br />
die Vision einer Welt, in der alle Menschen Zugang zu Bildungsangeboten haben, „die es ihnen er-<br />
möglichen, sich Wissen und Werte anzueignen, sowie Verhaltensweisen und Lebensstile zu erlernen,<br />
die für eine lebenswerte Zukunft und eine positive gesellschaftliche Veränderung notwendig sind“.<br />
Diese Vision beinhaltet eine doppelte Herausforderung: es geht einerseits um die konsequente<br />
Orientierung der Bildung an der Vermittlung von Kenntnissen, Einstellungen und Kompetenzen,<br />
derer alle Menschen, besonders aber die junge Generation, zur Mitgestaltung unserer zusammen-<br />
wachsenden Welt bedürfen. Es geht anderseits aber auch um die universelle Verwirklichung des<br />
Menschenrechtes auf Bildung.<br />
Diese doppelte Vision ist keinesfalls utopisch; den politischen Willen und entsprechende Prioritä-<br />
ten in Bildungspolitik und Entwicklungszusammenarbeit vorausgesetzt, erweisen sich beide Ziele<br />
als realistisch und erreichbar. Bisher allerdings ist die Welt noch nicht auf Kurs.<br />
Wenngleich sich die Staaten der Welt in der Millenniumserklärung verpflichtet haben, bis zum<br />
Jahr 2015 allen Menschen einen Zugang zu einer qualifizierten Grundbildung zu ermöglichen,<br />
werden wohl, halten die bisherigen Trends an, die meisten armen Staaten der Welt dieses Ziel<br />
verfehlen. Noch immer sind mehr als 113 Millionen Kinder weltweit vom Besuch einer Schule aus-<br />
geschlossen. Im Rahmen der Weltdekade werden daher besondere Anstrengungen darauf ver-<br />
wendet werden müssen, „Bildung für alle“ zu verwirklichen. Dies beinhaltet, neben einer deutli-<br />
chen Steigerung der internationalen Entwicklungsleistungen für die Grundbildung, auch für die<br />
Bildungsarbeit in den Industriestaaten eine weitreichende Verpflichtung: nämlich gezielt darauf<br />
zu achten, dass ein „Lernen für Nachhaltigkeit“ und ein „Globales Lernen“ insbesondere bildungs-<br />
fernen und sozial benachteiligten Bevölkerungsgruppen zugute kommt.<br />
Auch von einer umfassenden Verankerung des Leitbildes einer nachhaltigen Entwicklung auf allen<br />
Stufen des Bildungswesens, wie von der Agenda 21 vor dreizehn Jahren gefordert, kann noch kei-<br />
neswegs die Rede sein. Die vielfältigen Bemühungen zur Förderung der entwicklungspolitischen<br />
Bildung, die hier in dieser Publikation dokumentiert sind, stimmen allerdings sehr zuversichtlich:<br />
einer breiten Allianz der verschiedenen gesellschaftlichen Kräfte, die sich für ein Globales Lernen,<br />
die entwicklungspolitische Bildung und eine Bildung für Nachhaltigkeit engagieren, kann es ohne<br />
Zweifel gelingen, die notwendige Bildungswende auf den Weg zu bringen.<br />
<strong>ÖSTERREICHISCHE</strong> EZA – BAND 1 182
IMPULSE<br />
Um diese Anstrengungen weiter zu bündeln und zu stärken, dafür bietet die UN-Dekade einen<br />
vorzüglichen Rahmen. Die Weltdekade kann auch den innovativen pädagogischen Konzepten und<br />
Ideen für ein Lernen im Horizont der einen Welt, die von engagierten Lehrerinnen und Lehrern<br />
oder von zivilgesellschaftlichen Initiativen in der Praxis erprobt und entwickelt wurden, zum Durch-<br />
bruch verhelfen. Die Umsetzung der UN-Dekade ist eine weltweite Gemeinschaftsaufgabe, die in<br />
grenzüberschreitenden pädagogischen Aktivitäten ihren Niederschlag finden muss, in der inter-<br />
natonalen Kooperation und im wechselseitigen Lernen zwischen den Kulturen und Regionen.<br />
Als eine globale Bildungsinitiative macht die UN-Dekade sichtbar, dass Bildung heute in einem<br />
erweiterten, globalen Handlungsrahmen begriffen und konzipiert werden muss. Um die Chancen,<br />
Risiken und Verwerfungen bewältigen zu können, die die Globalisierung mit sich bringt, werden<br />
weitreichende Umbauten unserer herkömmlichen Bildungskonzepte und der nationalstaatlichen<br />
Bildungssysteme notwendig sein. Den entwicklungspolitischen Akteuren muss dabei freilich vor<br />
allem daran gelegen sein, dass die anstehende „pädagogische Globalisierung“ nicht die Form ei-<br />
nes globalen Bildungsmarktes annimmt, auf dem die Armen und Benachteiligten im Norden wie<br />
im Süden keine Chance haben.<br />
183 <strong>ÖSTERREICHISCHE</strong> EZA – BAND 1
Roland Steidl<br />
Plädoyer für eine andere Art des Wachstums<br />
I<br />
IMPULSE<br />
„Auf die Füße kommt die Welt erst wieder, wenn sie sich beibringen lässt, dass ihr Heil<br />
nicht in Maßnahmen sondern in neuen Gesinnungen besteht.“<br />
Albert Schweitzer<br />
Es wird uns nicht gelingen, das Krisenpotential, die Ungerechtigkeit und die Zerstörung der Natur,<br />
die die Dampfwalze namens Globalisierung über die Erde bringt, primär mit technischen oder po-<br />
litischen Mitteln zu lösen. Was nützen die besten Maßnahmen, wenn unsere Herzen vom Geist des<br />
Profits, der Ausbeutung und des Wachstums um jeden Preis besessen sind ? Oder von der schieren<br />
Angst, zu den „Loosern“ zu gehören, wenn wir nicht perfekt im immer härter werdenden Wett-<br />
bewerb mitspielen…<br />
Nein, was wir brauchen, ist ein Prozeß gründlichster Entmythologisierung der Götzen der Mo-<br />
derne. Es muß uns gelingen, die permanente Beschwörung von Wirtschaftswachstum „auf Teufel<br />
komm’ raus“ als Illusion zu erkennen. „Illusion“ heißt wörtlich „Verspottung“. Die gängige Wirt-<br />
schaftsideologie spottet also der Wirklichkeit.<br />
Und – was noch wichtiger ist: sie verengt unser Verständnis von Menschsein.<br />
Wenn wir den Menschen – also uns selbst – nurmehr als Produzenten, Konsumenten und als Res-<br />
source sehen, dann verkümmert zwangsläufig auch unser reales Menschsein. Eben dieses Mensch-<br />
sein in seiner Vielgestaltigkeit und Ganzheit zu bewahren, ja wiederzugewinnen, muß uns zum<br />
ernstgemeinten Anliegen werden.<br />
Um noch einmal Albert Schweitzer zu zitieren:<br />
„Erst wenn die Sehnsucht, wieder wahrhaft Mensch zu werden, in dem modernen Menschen<br />
entzündet wird, kann er sich aus der Verirrung heimfinden, in der er jetzt, von Wissens-<br />
dünkel und Könnensstolz geblendet, herumwandelt. Nur dann ist er auch in der Lage, dem<br />
Drucke der Lebensverhältnisse, die sein Menschentum bedrohen, entgegenzuarbeiten.“<br />
<strong>ÖSTERREICHISCHE</strong> EZA – BAND 1 184
IMPULSE<br />
II<br />
„Wir sind ein Teil der Erde, und sie ist ein Teil von uns. Die duftenden Blumen sind unsere<br />
Schwestern, die Rehe, das Pferd, der große Adler- sind unsere Brüder. Die felsigen Höhen,<br />
die saftigen Wiesen, die Körperwärme des Ponys – und des Menschen – sie alle gehören<br />
zur gleichen Familie.“<br />
Häuptling Seattle<br />
Die Rede des Indianerhäuptlings Seattle an den „großen Häuptling in Washington“ ist nicht au-<br />
thentisch. Aber sie ist dem ursprünglichen Geist eines „Mutter Erde“ verbundenen Volkes stimmig<br />
nachempfunden. Es ist ein Geist der Geschwisterlichkeit. Ich könnte auch den Sonnengesang des<br />
Heiligen Franziskus zitieren. Hier steht nicht Funktionalität, System oder Nutzen im Vordergrund<br />
sondern das Bewusstsein der Einheit der Schöpfung.<br />
Das Erspüren und Erleben dieser Einheit gehört zweifellos zum Höchsten, was dem Menschen<br />
möglich ist. Einsicht in die wahre Natur des Lebens. Ein Zugang zur Welt in der Wärme der Be-<br />
ziehung – anstatt in technoid-instrumentalisierender Kälte. Die Wahrnehmung der Welt, wie sie<br />
der „weiße Mann“ pflegt, ist der Wahrnehmung des „roten Mannes“ im Grunde qualitativ un-<br />
terlegen. Das hat nichts mit Romantizismus zu tun. Es ist an der Zeit, dass die westliche Welt<br />
über ihre Irrtümer und Einseitigkeiten hinauswächst und auf einer neuen Bewußtseinsebene die<br />
Verbundenheit mit Erde und Kosmos wiedergewinnt. Ervin Laszlo spricht im Manifest des Clubs of<br />
Budapest von der Notwendigkeit eines planetarischen Bewusstseins.<br />
III<br />
„Jeder Mensch ist mitverantwortlich für das gegenwärtige und zukünftige Wohlergehen<br />
der Menschheitsfamilie und für das Leben auf der Erde. Der Geist menschlicher Solidarität<br />
und die Einsicht in die Verwandtschaft alles Lebendigen werden gestärkt, wenn wir in Ehr-<br />
furcht vor dem Geheimnis des Seins, in Dankbarkeit für das Geschenk des Lebens und in<br />
Bescheidenheit hinsichtlich des Platzes der Menschen in der Natur leben.“<br />
Michail Gorbatschow<br />
Ehrfurcht, Geheimnis des Seins, Dankbarkeit, Geschenk des Lebens, Bescheidenheit – ein großer<br />
und mutiger Politiker schwingt sich in die Region der Spiritualität. Und in der Tat: die großen He-<br />
rausforderungen unserer Zeit werden ungelöst bleiben, das Krisenpotential wird wachsen, wenn<br />
wir nicht lernen, eine zeitgemäße Form von Spiritualität und ein substantielles Ethos zu leben.<br />
Ohne diese beiden werden alle anderen Bemühungen unfruchtbar bleiben. Denn nur sie können<br />
uns jene Freiräume eröffnen, die wir benötigen, um wirklich anders zu leben und zu handeln.<br />
Wir? – Das sind vor allem und zunächst wir Menschen des sogenannten entwickelten Westens.<br />
Wir brauchen ein anderes Wachstum – eines des Geistes und der Seele und der Verantwortung.<br />
185 <strong>ÖSTERREICHISCHE</strong> EZA – BAND 1
Helmut Voitl<br />
Helfen - Die Kunst der Verantwortung<br />
IMPULSE<br />
Was tun wir, wenn wir helfen? Ist Hilfe, das Geben, per se positiv? Warum läuft es biswei-<br />
len schief? Warum wird Hilfe von jenen, denen geholfen wurde, oft negativ empfunden?<br />
Wie ist ein Ausgleich zwischen Geben und Nehmen möglich? Wer helfen will oder Hilfe<br />
zu verantworten hat, sei es auf privater oder institutioneller Ebene, wird sich solche und<br />
weitere Fragen zu stellen haben. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Gesprächsrunde<br />
begeben sich bewusst in eine Tabuzone des öffentlichen Diskurses. 1<br />
Die Begriffe „Kunst“ und „Verantwortung“ in einen Zusammenhang zu bringen, erscheint vorerst<br />
ungewöhnlich, ja man könnte aus diesem Kontext sogar einen Widerspruch herauslesen. Aber<br />
wenn man die Annahme zulässt, dass „Verantwortung“ nicht nur durch Prägung und Erziehung<br />
entsteht, sondern dass „Verantwortung“ ursächlich auch mit Intuition verbunden ist, dann kann<br />
Verantwortung durchaus auch als im Kontext zur Kunst stehend gesehen werden. Es ist jene Intui-<br />
tion, die Menschen befähigt Kultur zu schaffen und zu erhalten. Wenn diese Intuition wirksam ist,<br />
darf von „Kunst“ gesprochen werden, Intuition und Kunst gehören zusammen. Wenn Verantwor-<br />
tung – im Sinne der Ursprünglichkeit des Begriffs – „kreativ“ zur Wirkung gelangt, dann kann von<br />
„Kunst“ im Zusammenhang mit Verantwortung gesprochen werden.<br />
Ist die Verbindung zur Intuition und damit zur lebendigen Kreativität abgeschnitten, dann besteht<br />
die Gefahr, dass „Verantwortung“ zum Dogma, zur Ideologie wird und den politischen Interpreta-<br />
tionen und dem Missbrauch ausgeliefert ist.<br />
Ich möchte hier weder den Begriff „Verantwortung“ zu definieren versuchen, oder gar für die<br />
„Kunst der Verantwortung“ Rezepte anbieten. Meine Haltung zu diesem Begriff beschreibt eines<br />
Satz des Thomas von Aquin vorzüglich: „Eher fühle und empfinde ich was Verantwortung ist, als<br />
dass ich deren Bedeutung exakt definieren kann“.<br />
Was ich in diesem Impulsreferat dazu sagen kann, setzt sich aus einer Kette von Erfahrungen<br />
zusammen, die ich gemeinsam mit meiner Frau und Partnerin Elisabeth Guggenberger in vielen<br />
Jahren sozial-orientierter Arbeit 2 als Journalisten und Filmemacher erwerben konnte. Aktuelle<br />
Erfahrungen sammelten wir in den vergangenen 6 Monaten bei unserer Arbeit als „Helfende“ für<br />
Tsunami-Betroffene in Sri Lanka.<br />
Bei dieser Aufgabe sehen wir uns herausgefordert uns dem Begriff „Verantwortung“ im Zusam-<br />
menhang mit dem Helfen zu stellen. Helfen besteht aus Geben und Nehmen. Frei nach Martin<br />
Buber ist das Geben und Nehmen eine Handlung, ein (sich ständig verändernder) Prozess zwischen<br />
einem ICH und einem DU. Und so wie sich das ICH nur durch das DU erfahren lässt, kann sich auch<br />
der GEBENDE als solcher nur durch den NEHMENDEN erfahren – und umgekehrt. Das bedeutet<br />
1 Anlässlich einer Veranstaltung der Investkredit Bank AG am 18.Mai 2005 mit dem Titel „HILFE VERANTWORTEN<br />
– UNVERANTWORTLICH HELFEN“, hielt Filmregisseur Helmut Voitl das Impuls-Referat „Helfen – Die Kunst der<br />
Verantwortung“.<br />
2 Siehe „Planquadrat“…..<br />
<strong>ÖSTERREICHISCHE</strong> EZA – BAND 1 186
IMPULSE<br />
daher, dass das was das Helfen ist, nur durch einen Prozess zwischen Geber und Nehmer, zwischen<br />
Ich und Du erfahrbar und erkennbar wird. Helfen ist also ein „Geschehen“ zwischen Wesenhaftem<br />
und nicht etwas, das bloß „gemacht“ zu werden braucht. Es ist ein direkter, unmittelbarer (partizi-<br />
pativer) Prozess, der den Geber wie den Nehmer und ihr gemeinsames „Werk“ kreiert und formt.<br />
Die Entscheidung sich auf einen derartigen Prozess einzulassen und ihn konsequent gegen alle<br />
Störfaktoren durchzuhalten, erzeugt jene „inspirierte“ Atmosphäre, in der eine verantwortungs-<br />
bewusste „Haltung im Tun“ entsteht – nämlich „Die Kunst der Verantwortung“.<br />
HELFEN im Sinne der Katastrophenhilfe, Entwicklungshilfe, – ganz allgemein – der sozialen Hilfe,<br />
ist immer wieder gesellschaftspolitisch bedingten Störfaktoren ausgesetzt, die in die „Unverant-<br />
wortlichkeit“ führen können. Dazu nur einige Beispiele:<br />
1. Die oft medial erzeugte und geschürte Erwartungshaltung bei den Spendern:<br />
Dazu gehört vor allem die Erwartung des möglichst raschen (und herzeigbaren) Erfolges.<br />
Ein „Abfahrtslauf“ der Helfer und NGOs ist die Folge. Wer erreicht mit wie viel neu gebau-<br />
ten Häusern um wie viel Sekunden früher das Ziel? Am Jahrestag einer Katastrophe muss<br />
das Ziel erreicht sein! Ein Albtraum für Helfer, die sich einem Prozess des Austauschs mit<br />
den „Nehmenden“ verpflichtet fühlen.<br />
2. Wenn Hilfe zum nationalen und internationalen Prestige erhoben wird: Welches Land sam-<br />
melt mehr Spenden, welches hat die „besseren Projekte“, welche Regierung handelt, welche<br />
nicht? Faktoren, die für die Helfer vor Ort sehr oft kontraproduktiv wirken.<br />
3. Wenn das Spenden nur unter dem Aspekt der Steuerabschreibung und der Werbewirksam-<br />
keit gesehen wird – und dies dem Helfer als zu beachtende Bedingung diktiert wird.<br />
4. Die Eigendynamik mancher Hilfsorganisationen: Zum Beispiel wollen oft manche Hilfsor-<br />
ganisationen von Staaten, in denen sie tätig sind und deren Politik unabhängig sein. Diese<br />
Haltung ist oft ideologisch gefärbt, nicht selten auch „missionarisch“ geprägte „Besserwis-<br />
serei“ und steht einer ebenbürtigen Beziehung zwischen Geber und Nehmer im Wege.<br />
5. Oft wirken folgende psychologisch bedingte Strukturen und Haltungen bei Gebern wie<br />
Nehmern als Störfaktoren: Wer gibt, hat Anspruch! Wer nimmt, fühlt sich verpflichtet!<br />
Jener der gibt, fühlt sich frei und daher auch mächtig! Wer nimmt fühlt sich schuldig, oft<br />
auch ohnmächtig!<br />
So agieren Helfer – oft völlig unbewusst – als Reiche für Arme, als Mächtige gegenüber<br />
Ohnmächtigen, als Starke für Schwache. In diesem Fall verhindert die Dominanz der Hel-<br />
fer jeden partizipativen Prozess zwischen einem Ich und einem Du. Hilfe kann wie Unter-<br />
drückung wirken.<br />
Für einen Ausweg aus der „Unverantwortlichkeit“ kann es kein Rezept geben, nur Hinweise auf<br />
Orientierungspunkte, die zu einer „Kunst der Verantwortung“ beim Helfen führen können. Nur<br />
drei Beispiele:<br />
1. Transparenz und Offenheit. Damit meine ich eine Form des aufeinander Zugehens, bei der<br />
nichts verborgen bleibt, bei der Spekulation und Manipulation ausgeschlossen sind. Die<br />
jeweiligen Standpunkte müssen allen Beteiligten klar und einsichtig sein.<br />
187 <strong>ÖSTERREICHISCHE</strong> EZA – BAND 1
IMPULSE<br />
2. Ständig Fragen stellen und auch das eigene Tun immer wieder hinterfragen. Das hier zu-<br />
grunde liegende Prinzip ist einfach: Die richtigen Fragen führen zu richtigen Antworten!<br />
Wenn eine Frage als solche nicht verstanden wird, oder nicht verstanden werden will, dann<br />
bedarf das der Frage zugrunde liegende Thema einer weiteren, gemeinsamen „Aufarbei-<br />
tung“ – die dann zu einer Klarheit in den Begriffen und Antworten führen wird.<br />
3. Der inhärenten, ständigen Veränderung des Prozesses zwischen Geber und Nehmer „Raum<br />
und Zeit“ geben. In diesem Zusammenhang spreche ich von der „Lust an der Verände-<br />
rung“. Diese Verhaltensweise ist das Gegenteil vom „Kleben an Auffassungen und Ses-<br />
seln“. Das als Richtig geltende als etwas betrachten, das in Frage gestellt werden kann und<br />
darf, öffnet den Weg zu unvorhersehbaren Möglichkeiten, oft auch Lösungen.<br />
Zur „Kunst der Verantwortung“ gehört für mich auch das „Zweifel empfinden können und dür-<br />
fen“. Der Zusammenhang von Verantwortung und Zweifel ist kein Widerspruch. Verantwortung<br />
ist nicht dort am Stärksten, wo kein Zweifel besteht sondern dort, wo sie trotz des Zweifels wirkt.<br />
Im Sinne des hier Gesagten, wird Verantwortung auch nicht als etwas „Belastendes“, als etwas,<br />
das „schwer zu tragen ist“, empfunden werden. Ein Gleichklang von Aufgabe, Herausforderung,<br />
Arbeit, Kreativität und Spiel wird sich einstellen….Wenn dem so ist, dann darf von der „Verant-<br />
wortung als Kunst“ gesprochen werden.<br />
<strong>ÖSTERREICHISCHE</strong> EZA – BAND 1 188
ANHANG<br />
ANHANG<br />
ENTWICKLUNGPOLITISCHE INLANDSARBEIT – AKTEURE<br />
BURGENLAND<br />
Organisation Ort<br />
Diözesankommission für Weltkirche und Entwicklungsförderung<br />
der Diözese Eisenstadt 7000 Eisenstadt<br />
SÜDWIND-Agentur Burgenland c/o Europahaus Eisenstadt 7000 Eisenstadt<br />
Österreichisches Studienzentrum für Frieden und Konfliktlösung 7461 Stadtschlaining<br />
Europahaus Burgenland - Institut f. polit. Bildung, Infostelle f.<br />
Europa- und Entwicklungsfragen 7000 Eisenstadt<br />
European University Center for Peace Studies 7461 Stadtschlaining<br />
Katholische Frauenbewegung Eisenstadt-Familienfasttag 7001 Eisenstadt<br />
Dreikönigsaktion - Hilfswerk der Katholischen Jungschar Diözese<br />
Eisenstadt 7000 Eisenstadt<br />
Katholische Männerbewegung Eisenstadt 7000 Eisenstadt<br />
KÄRNTEN<br />
Organisation Ort<br />
Diözesankommission für Weltkirche und Entwicklungsförderung<br />
Klagenfurt 9020 Klagenfurt<br />
Dreikönigsaktion - Hilfswerk der Katholischen Jungschar Diözese<br />
Gurk-Klagenfurt 9020 Klagenfurt<br />
Katholische Aktion „Bruder und Schwester in Not“ / Diözese Gurk 9020 Klagenfurt<br />
Katholische Frauenbewegung Klagenfurt-Familienfasttag 9020 Klagenfurt<br />
ÖIE-Kärnten, Bündnis für Eine Welt 9500 Villach<br />
Städtepartnerschaft Villach - Canchugo 9500 Villach<br />
NIEDERÖSTERREICH<br />
Organisation Ort<br />
Aktion Teilen der Katholischen Jugend Niederösterreich 3100 St. Pölten<br />
Arbeitsgemeinschaft Schöpfungsverantwortung 2340 Mödling<br />
Arbeitskreis Weltkirche - Vikariat unter dem Wienerwald 2700 Wiener Neustadt<br />
Berufspädagogisches Institut Mödling 2340 Mödling<br />
Diözesankommission für Weltkirche und Entwicklungsförderung<br />
St. Pölten - Welthaus St. Pölten 3100 St. Pölten<br />
Dreikönigsaktion - Hilfswerk der Katholischen Jungschar Diözese<br />
St. Pölten 3100 St. Pölten<br />
190 <strong>ÖSTERREICHISCHE</strong> EZA – BAND 1
ANHANG<br />
HIFA - Hilfe für Alle 3203 Rabenstein<br />
Katholische Frauenbewegung St. Pöltner-Familienfasttag 3100 St. Pölten<br />
Katholische Männerbewegung St. Pölten 3100 St. Pölten<br />
Miriam - Bildungsprojekt zur Frauenförderung 3400 Klosterneuburg<br />
Oikocredit Austria, Vereinigung zur Förderung der Ökumenischen<br />
Entwicklungsgenossenschaft 3430 Tulln<br />
SÜDWIND NÖ-Süd 2700 Wiener Neustadt<br />
SÜDWIND NÖ-West 3100 St. Pölten<br />
OBERÖSTERREICH<br />
Organisation Ort<br />
Aktion SEI SO FREI / Diözese Linz 4020 Linz<br />
Aktion Teilen der Katholischen Jugend Oberösterreich 4020 Linz<br />
ArbeitsGemeinschaft EntwicklungsZusammenarbeit Oberösterreich 4020 Linz<br />
Arbeitskreis Weltkirche und Entwicklungsförderung Linz<br />
- Welthaus Linz 4020 Linz<br />
Begegnungszentrum für aktive Gewaltlosigkeit 4820 Bad Ischl<br />
Benediktinerstift Kremsmünster - Aktion Barreiras 4550 Kremsmünster<br />
CONA - Gerechter Nord-Süd-Handel 4551 Ried/Traunkreis<br />
Dreikönigsaktion - Hilfswerk der Katholischen Jungschar Diözese Linz 4020 Linz<br />
Fachhochschule für Sozialarbeit Öberösterreich 4040 Linz<br />
Gesellschaft für bedrohte Völker - Regionalgruppe Oberösterreich 4040 Linz<br />
Initiative Dritte Welt Braunau 5280 Braunau<br />
Interdisziplinäres Forschungsinstitut für Entwicklungszusammenarbeit<br />
der Universität Linz 4040 Linz<br />
Katholische Frauenbewegung Linz-Familienfasttag 4020 Linz<br />
MIVA - Missions-Verkehrs-Arbeitsgemeinschaft 4651 Stadl-Paura<br />
Pax Christi Österreich - Katholische Friedensbewegung 4040 Linz<br />
Städtepartnerschaft Wels-Chichigalpa 4600 Wels<br />
Südwind Oberösterreich - Verein für entwicklungspolitische<br />
Informations- und Öffentlichkeitsarbeit 4020 Linz<br />
Verein zur Förderung von ArbeitnehmerInnenbildung und -kultur<br />
in Oberösterreich 4020 Linz<br />
Weltumspannend Arbeiten - Das entwicklungspolitische Projekt<br />
des ÖGB OÖ 4020 Linz<br />
Werkstatt Frieden & Solidarität ( vormals Friedenswerkstatt Linz) 4020 Linz<br />
<strong>ÖSTERREICHISCHE</strong> EZA – BAND 1 191
ANHANG<br />
SALZBURG<br />
Organisation Ort<br />
African Medical and Research Foundation, Gesellschaft für Medizin und<br />
Forschung in Afrika e.V. 5020 Salzburg<br />
Afro-Asiatisches Institut Salzburg 5020 Salzburg<br />
Aktion SEI SO FREI / Erzdiözese Salzburg 5020 Salzburg<br />
BONDEKO - Missionshaus Liefering 5020 Salzburg<br />
Diözesankommission für Weltkirche und Entwicklungszusammenarbeit<br />
Salzburg - Welthaus Salzburg 5020 Salzburg<br />
Dreikönigsaktion - Hilfswerk der Katholischen Jungschar<br />
Diözese Salzburg 5020 Salzburg<br />
EZA - Entwicklungszusammenarbeit mit der Dritten Welt Ges. m.b.H. 5101 Bergheim<br />
Friedensbüro Salzburg 5020 Salzburg<br />
INTERSOL - Verein zur Förderung Internationaler Solidarität 5020 Salzburg<br />
Katholische Frauenbewegung Salzburg-Familienfasttag 5020 Salzburg<br />
KommEnt - Gesellschaft für Kommunikation und Entwicklung 5020 Salzburg<br />
Liebenzeller Mission Österreich 5111 Bürmoos<br />
LOSITO Austria, Kulturverein 5020 Salzburg<br />
ÖKO-HIMAL Gesellschaft für ökologische Zusammenarbeit<br />
Alpen-Himalaya 5020 Salzburg<br />
Städtepartnerschaft Salzburg-León 5020 Salzburg<br />
Städtepartnerschaft Salzburg-Singida 5020 Salzburg<br />
Südwind - Verein für entwicklungspolitische Bildungs- und<br />
Öffentlichkeitsarbeit Salzburg 5020 Salzburg<br />
Verein „Friends of Kilimanjaro“ 5020 Salzburg<br />
Verein der Erklärung von Salzburg für solidarische Entwicklung 5020 Salzburg<br />
STEIERMARK<br />
Organisation Ort<br />
Afro-Asiatisches Institut Graz 8010 Graz<br />
Aktion Sei So Frei - Bruder in Not / Diözese Graz-Seckau 8010 Graz<br />
ArbeitsGemeinschaft EntwicklungsZusammenarbeit Steiermark 8010 Graz<br />
ARGE Jugend gegen Gewalt und Rassismus 8010 Graz<br />
Dreikönigsaktion - Hilfswerk der Katholischen Jungschar Diözese<br />
Graz-Seckau 8010 Graz<br />
Erklärung von Graz für solidarische Entwicklung 8010 Graz<br />
ETC - Europäisches Trainingszentrum für Menschenrechte und<br />
Demokratie 8010 Graz<br />
Grazer Büro für Frieden und Entwicklung 8010 Graz<br />
Katholische Frauenbewegung Graz-Familienfasttag 8010 Graz<br />
OMEGA 8010 Graz<br />
192 <strong>ÖSTERREICHISCHE</strong> EZA – BAND 1
Österreichisches Nord-Süd-Institut für Entwicklungszusammenarbeit<br />
Steiermark 8010 Graz<br />
Städtefreundschaft Pedra Badejo-Leibnitz 8430 Leibnitz<br />
Südwind Steiermark - Verein für Entwicklungspolitische Bildungs-<br />
und Öffentlichkeitsarbeit 8010 Graz<br />
Verein der Erklärung von Graz für solidarische Entwicklung 8010 Graz<br />
Welthaus Diözese Graz-Seckau 8010 Graz<br />
World University Service Austria 8010 Graz<br />
TIROL<br />
Organisation Ort<br />
ANHANG<br />
Afro-Asiatisches Institut Innsbruck - Unterstützungsverein für<br />
Studenten aus der Dritten Welt 6020 Innsbruck<br />
Aktion SEI SO FREI - Bruder und Schwester in Not / Diözese Innsbruck 6020 Innsbruck<br />
ArbeitsGemeinschaft EntwicklungsZusammenarbeit Tirol 6020 Innsbruck<br />
Dreikönigsaktion - Hilfswerk der Katholischen Jungschar<br />
Diözese Innsbruck 6020 Innsbruck<br />
Katholische Frauenbewegung Innsbruck-Familienfasttag 6020 Innsbruck<br />
Österreichisches Lateinamerika-Institut Landesgruppe Tirol/Vorarlberg 6020 Innsbruck<br />
SOS- Kinderdorf Österreich 6020 Innsbruck<br />
SÜDWIND-Agentur Tirol 6020 Innsbruck<br />
Welthaus Innsbruck 6020 Innsbruck<br />
VORARLBERG<br />
Organisation Ort<br />
Aktion Bruder und Schwester in Not - Diözese Feldkirch 6800 Feldkirch<br />
ArbeitsGemeinschaft EntwicklungsZusammenarbeit Vorarlberg 6850 Dornbirn<br />
Arbeitsgemeinschaft Weltläden 6800 Feldkirch<br />
Diözesankommission für Weltkirche und Entwicklungsförderung der<br />
Diözese Feldkirch 6800 Feldkirch<br />
Dreikönigsaktion - Hilfswerk der Katholischen Jungschar<br />
Diözese Feldkirch 6800 Feldkirch<br />
Katholische Frauenbewegung Feldkirch-Familienfasttag 6800 Feldkirch<br />
SÜDWIND-Agentur Vorarlberg 6850 Dornbirn<br />
WIEN<br />
Organisation Ort<br />
Afrikanische Frauenorganisation in Wien 1090 Wien<br />
Afro-Asiatisches Institut Wien 1090 Wien<br />
Aktion Kritisches Christentum 1040 Wien<br />
Aktion Regen, Verein für Entwicklungszusammenarbeit 1210 Wien<br />
<strong>ÖSTERREICHISCHE</strong> EZA – BAND 1 193
ANHANG<br />
Aktion SEI SO FREI - Bruder in Not / Erzdiözese Wien 1010 Wien<br />
Aktion SEI SO FREI Österreich 1010 Wien<br />
amnesty international Österreich 1150 Wien<br />
Arbeitsgemeinschaft Christentum und Sozialdemokratie 1150 Wien<br />
Arbeitsgemeinschaft Christinnen und Christen für die Friedensbewegung 1150 Wien<br />
Arbeitsgemeinschaft Entwicklungshilfe-Flüchtlingshilfe der Kath. Aktion<br />
der Erzdiözese Wien 1010 Wien<br />
ArbeitsGemeinschaft EntwicklungsZusammenarbeit 1090 Wien<br />
Arbeitsgemeinschaft für Entwicklungspolitik 1014 Wien<br />
Arbeitsgemeinschaft Katholischer Jugend Österreich 1010 Wien<br />
Arbeitsgemeinschaft Österreichische Lateinamerika-Forschung 1090 Wien<br />
Ärzte ohne Grenzen - Médecins Sans Frontieres 1020 Wien<br />
Association for Democracy in Africa 1092 Wien<br />
Asyl in Not, Unterstützungskomitee für politisch verfolgte<br />
AusländerInnen 1090 Wien<br />
asylkoordination Österreich 1080 Wien<br />
ATTAC Österreich - Netzwerk zur demokratischen Kontrolle der<br />
Finanzmärkte 1050 Wien<br />
Austrian Burma Center - Zentrum für Menschenrechte,<br />
Informationsaustausch und Kulturförderung 1220 Wien<br />
Austrian Development Agency - Österreichische Gesellschaft für<br />
Entwicklungszusammenarbeit 1010 Wien<br />
AYBOBO österreichisch-haitianischer Kulturkontakt 1080 Wien<br />
BAOBAB Entwicklungspolitische Bildungs- und Schulstelle 1090 Wien<br />
Brot für Hungernde - Evangelische Frauenarbeit in Österreich 1090 Wien<br />
CARE Österreich, Verein für Entwicklungszusammenarbeit und<br />
Humanitäre Hilfe 1030 Wien<br />
Caritas Österreich 1160 Wien<br />
Christian Solidarity International - Christen in Not 1070 Wien<br />
Clean Clothes Kampagne 1080 Wien<br />
Club International Universitaire 1010 Wien<br />
Diakonie Österreich 1080 Wien<br />
Dreikönigsaktion - Hilfswerk der Katholischen Jungschar Erzdiözese Wien 1010 Wien<br />
Dreikönigsaktion - Hilfswerk der Katholischen Jungschar Österreichs 1160 Wien<br />
Eco & Culture - Internationales Institut für Ökologie und Kultur 1070 Wien<br />
EMPEZAMOS - Einsatz für EINE solidarische Welt 1160 Wien<br />
ENCHADA - Entwicklungsspolitisches Bildungsreferat der Katholischen<br />
Jugend Österreich 1010 Wien<br />
Entwicklungshilfeklub 1020 Wien<br />
Erlaßjahr 2000 Österreich 1090 Wien<br />
EU-Plattform österreichischer entwicklungspolitischer<br />
Nicht-Regierungs-Organisationen 1080 Wien<br />
Evangelische Akademie Wien 1090 Wien<br />
194 <strong>ÖSTERREICHISCHE</strong> EZA – BAND 1
Evangelische Studentengemeinde in Österreich 1090 Wien<br />
Evangelischer Arbeitskreis für Entwicklungszusammenarbeit 1096 Wien<br />
Evangelischer Arbeitskreis für Weltmission 1096 Wien<br />
FairPlay. Viele Farben. Ein Spiel. 1040 Wien<br />
FAIRTRADE 1040 Wien<br />
FIAN - Food First Informations- & Aktionsnetzwerk 1080 Wien<br />
forum REISEN & UMFELD 1090 Wien<br />
Frauensolidarität - Initiative für Frauen in der Dritten Welt 1090 Wien<br />
Gesellschaft für bedrohte Völker - Österreich 1030 Wien<br />
Gesellschaft für Österreichisch-Arabische Beziehungen 1150 Wien<br />
GLOBAL 2000 1120 Wien<br />
Greenpeace 1050 Wien<br />
Guatemala Solidarität Österreich 1090 Wien<br />
Hilfswerk Austria 1010 Wien<br />
Horizont 3000 - Österreichische Organisation für<br />
Entwicklungszusammenarbeit 1040 Wien<br />
Informationsgruppe Lateinamerika 1061 Wien<br />
Institut für Umwelt, Friede und Entwicklung 1120 Wien<br />
Institut zur Cooperation bei Entwicklungs-Projekten - ICEP 1040 Wien<br />
Interkulturelles Zentrum 1050 Wien<br />
Internationaler Versöhnungsbund, Österreichischer Zweig 1080 Wien<br />
Iustitia et Pax Österreichische Kommission 1090 Wien<br />
Joan Robinson - Verein zur Förderung frauengerechter Verteilung<br />
ökonomischen Wissens 1090 Wien<br />
Jugend Eine Welt - Don Bosco Aktion Austria 1130 Wien<br />
Katholische Frauenbewegung Österreichs- Familienfasttag 1010 Wien<br />
Katholische Frauenbewegung Wien - Familienfasttag Wien 1010 Wien<br />
Katholische Männerbewegung Österreichs 1010 Wien<br />
Kindernothilfe Österreich 1010 Wien<br />
Klimabündnis Österreich, Gemeinnützige Förderungs- und<br />
Beratungs-GmbH 1060 Wien<br />
Kontaktstelle für Weltreligionen 1090 Wien<br />
Koordinierungsstelle der Österr. Bischofskonferenz für Internationale<br />
Entwicklung und Mission 1090 Wien<br />
KUKELE- Kulturen Kennen Lernen 1090 Wien<br />
Kulturen in Bewegung 1040 Wien<br />
LEFÖ - Beratung, Bildung und Begleitung für Migrantinnen 1050 Wien<br />
Licht für die Welt - Christoffel Blindenmission 1120 Wien<br />
Ludwig Boltzmann Institut für Menschenrechte 1010 Wien<br />
Ludwig Boltzmann Institut für Zeitgenössische Lateinamerikaforschung 1090 Wien<br />
Mattersburger Kreis für Entwicklungspolitik an den österreichischen<br />
Hochschulen 1090 Wien<br />
Menschen für Menschen 1060 Wien<br />
ANHANG<br />
<strong>ÖSTERREICHISCHE</strong> EZA – BAND 1 195
ANHANG<br />
Menschen für Solidarität, Ökologie und Lebensstil 1130 Wien<br />
Missio - Päpstliche Missionswerke in Österreich 1015 Wien<br />
O,7 Kampagne 1080 Wien<br />
Österreichische Forschungsstiftung für Entwicklungshilfe 1090 Wien<br />
Österreichische Orient-Gesellschaft Hammer-Purgstall 1010 Wien<br />
Österreichische Stiftung für Weltbevölkerung und Internationale<br />
Zusammenarbeit 1060 Wien<br />
Österreichischer Austauschdienst - Agentur für internationale Bildungs-<br />
und Wissenschaftskooperation 1090 Wien<br />
Österreichischer Austauschdienst - Büro für Akademische Kooperation<br />
und Mobilität 1090 Wien<br />
Österreichisches LateinamerikaInstitut 1090 Wien<br />
Österreichweite Plattform gegen weibliche Genitalverstümmelung 1120 Wien<br />
Paulo Freire Zentrum 1090 Wien<br />
Planet Society Austria 1090 Wien<br />
Plattform gegen kommerzielle sexuelle Ausbeutung von Kindern 1150 Wien<br />
Radio Afrika Center 1050 Wien<br />
Referat für Mission und Entwicklung der Erzdiözese Wien 1010 Wien<br />
Renner-Institut 1120 Wien<br />
Reporter ohne Grenzen 1050 Wien<br />
respect - Institut für Integrativen Tourismus & Entwicklung 1150 Wien<br />
SADOCC - Dokumentations- und Kooperationszentrum Südliches Afrika 1040 Wien<br />
SID - Society for International Development, Vienna Chapter 1190 Wien<br />
Solidaritätskomitee für El Salvador 1050 Wien<br />
Solidaritätskomitee für Guatemala 1020 Wien<br />
SOS-Kinderdorf International 1190 Wien<br />
Sudan-Plattform-Austria 1096 Wien<br />
SÜDWIND-Agentur 1080 Wien<br />
SÜDWIND-Agentur Regionalstelle Wien 1080 Wien<br />
Südwind-Buchwelt BuchhandelsGmbH 1034 Wien<br />
TRIALOG, EU-Enlargement and NGDOs 1040 Wien<br />
Unsere kleinen Brüder und Schwestern - Verein zur Unterstützung<br />
von Waisenkindern 1070 Wien<br />
Verein Grenzenlos - Europäischer Freiwilligendienst 1090 Wien<br />
Welthaus Wien 1010 Wien<br />
WIDE Österreich - Netzwerk Women in Development Europe 1040 Wien<br />
Wiener Institut für Entwicklungsfragen und Zusammenarbeit 1040 Wien<br />
World Vision - Gesellschaft für Entwicklungshilfe und<br />
Völkerverständigung 1150 Wien<br />
WWF - WORLD WIDE FUND FOR NATURE Österreich 1162 Wien<br />
196 <strong>ÖSTERREICHISCHE</strong> EZA – BAND 1
ENTWICKLUNGPOLITISCHE INLANDSARBEIT - FINANZDATEN<br />
Entwicklungspolitische Inlandsarbeit<br />
EZA-BUDGET 1995 BIS 2003, ausbezahlte Mittel in Tsd. Euro<br />
NGO Förderungen/<br />
ab 1995 über KommEnt<br />
ANHANG<br />
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003<br />
7.003 3.550 2.820 3.366 4.331 3.017 3.826 4.063 2.119<br />
EU-Kofi — 182 293 363 436 145 126 36 93<br />
KommEnt Aufwand 261 182 363 233 203 121 291 249 349<br />
ÖA des BMA 671 787 865 939 206 889 1.305 1.034 1.613<br />
Summe aus EZA Budget 7.935 4.700 4.341 4.901 5.176 4.172 5.547 5.382 4.174<br />
in % des EZA Budgets 12,46 6,15 6,71 7,10 8,57 7,39 10,11 9,51 7,73<br />
EZA Budget 63.670 76.435 64.657 69.039 60.405 56.447 54.878 56.614 53.284<br />
Quelle:EZA-Statistik<br />
Entwicklungspolitische Inlandsarbeit<br />
BUDGET ANDERER MINISTERIEN, DER LÄNDER UN GEMEINDEN 1995 BIS 2003,<br />
ausbezahlte Mittel in Tsd. Euro<br />
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003<br />
anderer Ministerien 143 596 12 12 74 46 21 59 21<br />
Länder und Gemeinden,<br />
Kammern<br />
Summe aus dem Budget<br />
anderer BM, Gemeinden<br />
und Ländern<br />
Quelle:EZA-Statistik<br />
Entwicklungspolitische Inlandsarbeit<br />
189 273 92 104 107 153 171 97 185<br />
332 870 105 116 182 199 192 156 206<br />
GESAMTÜBERSICHT UND ODA-ANTEIL 1995 BIS 2003 in Tsd. Euro<br />
Summe aus<br />
EZA-Budget<br />
Summe aus dem<br />
Budget anderer<br />
BM, Gemeinden<br />
und Ländern<br />
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003<br />
7.935 4.700 4.341 4.901 5.176 4.172 5.547 5.382 4.174<br />
332 870 105 116 182 199 192 156 206<br />
GESAMT 8.267 5.569 4.446 5.017 5.357 4.371 5.739 5.539 4.380<br />
Gesamt in %<br />
der ODA<br />
1,82 1,38 1,01 1,22 1,16 0,92 0,81 1,00 0,98<br />
ODA in 1000 € 454.295 404.924 438.645 412.864 462.044 477.111 706.926 551.947 446.781<br />
Quelle:EZA-Statistik<br />
<strong>ÖSTERREICHISCHE</strong> EZA – BAND 1 197
ANHANG<br />
TABELLENVERZEICHNIS<br />
Tabelle 1<br />
ÖFFENTLICHE AUSGABEN FÜR INLANDSARBEIT S 35<br />
Tabelle 2<br />
OEZA–BUDGET FÜR INLANDSARBEIT S 35<br />
Tabelle 3<br />
FINANZIERUNG ÖFFENTLICHE INFORMATIONS- UND BILDUNGSARBEIT 2003 S 36<br />
Tabelle 4<br />
OEZA–BUDGET UND INFORMATIONSMASSNAHMEN S 36<br />
Tabelle 5<br />
FÖRDERUNGEN AUS OEZA-BUDGET, ABWICKLUNG ÜBER KOMMENT S 37<br />
Tabelle 6<br />
BILDUNGSMASSNAHMEN 1996 BIS 2003 S 43<br />
Tabelle 7<br />
PRIVATE EZA-BILDUNGSEINRICHTUNGEN S 45<br />
Tabelle 8<br />
EZA BUDGET UND ZUSCHÜSSE PRIVATER ORGANISATIONEN S 46<br />
Tabelle 9<br />
SPENDENZIEL ENTWICKLUNGSHILFE/EZA S 47<br />
Tabelle 10<br />
EZA-SPENDENVOLUMEN NACH SPENDENZIELEN IM VERGLEICH S 48<br />
Tabelle 11<br />
KIRCHENMITGLIEDER UND GOTTESDIENSTBESUCHERINNEN S 51<br />
Tabelle 12<br />
BILDUNGSARBEIT DER KOO-MITGLIEDSORGANISATIONEN – EIGENMITTEL S 54<br />
Tabelle 13<br />
WELTKIRCHENVERANTWORTUNG IN PFARRGEMEINDEN S 54<br />
Tabelle 14<br />
OFFIZIELLE EZA- UND MISSIONSSAMMLUNGEN DER KATHOLISCHEN KIRCHE S 56<br />
Tabelle 15<br />
NGO-FÖRDERUNGEN AUS EZA-BUDGET - ABWICKLUNG KOMMENT S 72<br />
198 <strong>ÖSTERREICHISCHE</strong> EZA – BAND 1
Tabelle 16<br />
ANHANG<br />
IGE-BESTAND MONOGRAFIEN 1997 UND 2003 – SOWIE BIBLIOTHEKSBESUCHE S 84<br />
Tabelle 17<br />
ENTWICKLUNGSTAGUNGEN S 92<br />
Tabelle 18<br />
FAIRTRADE-PRODUKTE IN PROZENT/UMSATZ 2003 S 95<br />
Tabelle 19<br />
VERKAUFSMENGEN GRÜNER KAFFEE – FAIR TRADE S 96<br />
Tabelle 20<br />
MARKTANTEILE RÖSTKAFFEE S 97<br />
Tabelle 21<br />
TOURISMUS IN ENTWICKLUNGSLÄNDER<br />
URLAUBSREISEN NACH REISEZIELEN S 106<br />
Tabelle 22<br />
URLAUBSREISEN IN ENTWICKLUNGSLÄNDER S 106<br />
Tabelle 23<br />
INTERNET – KENNZAHLEN 2004 – VISITS S 118<br />
Tabelle 24<br />
AGEZ-KAMPAGNEN S 126<br />
Tabelle 25<br />
ERGEBNIS MEINUNGSUMFRAGEN 1988 BIS 2004<br />
EZA-ZUSTIMMUNG IN DER <strong>ÖSTERREICHISCHE</strong>N BEVÖLKERUNG S 138<br />
Tabelle 26<br />
INTERNATIONALER VERGLEICH DER AUSGABEN FÜR ENTWICKLUNGS-<br />
POLITISCHE INLANDSARBEIT (DEVELOPMENT AWARENESS) 2003 S 167<br />
Tabelle 27<br />
INLANDSARBEIT - INTERNATIONALER VERGLEICH S 168<br />
<strong>ÖSTERREICHISCHE</strong> EZA – BAND 1 199
ANHANG<br />
AUTORENHINWEISE<br />
Gerhard Bittner<br />
Geb. 1949, Jugendarbeit Erzdiözese Wien 1968 bis 1970, Vikariat Unter dem Wienerwald 1970<br />
bis 1979, Bildungshaus St.Benhard Wr.Neustadt 1976 bis 1979, Generalsekretär Afro-Asiatisches<br />
Institut in Wien 1979 bis 1990, Geschäftsführer Österreichische Forschungsstiftung für Entwick-<br />
lungshilfe ab 1979.<br />
Petra C. Gruber<br />
Geb. 1971, Sozialwirtschaft-Studium Univ. Linz; Schwerpunkte: Umwelt- & Entwicklungspolitik,<br />
1996 bis1999 Interdisziplinäres Forschungsinstitut für Entwicklungszusammenarbeit/Linz; 2000 Af-<br />
rican Medical Research Foundation (AMREF); Seit 2001 Institut für Umwelt – Friede – Entwicklung<br />
(IUFE)/Wien; Geschäftsführung, Forschungsreisen nach Südafrika, Tanzania, Zimbabwe, Uganda; ö.<br />
Delegationsmitglied bei der UN Konferenz über Nachhaltige Entwicklung, Jo’burg 2002, Mitglied<br />
des Forums Nachhaltiges Österreich, Div. Publikationen zu Nachhaltigen Entwicklungen & Globa-<br />
lisierungen.<br />
Helmuth Hartmeyer<br />
Geb. 1950, AHS-Lehrer in Wien 1973 bis 1986, Geschäftsführer des Österreichischen Informations-<br />
dienstes für Entwicklungspolitik 1986 bis 1993, Geschäftsführer der Gesellschaft für Kommuni-<br />
kation und Entwicklung 1994 bis 2003, ist seit 2004 Leiter der Abteilung Entwicklungspolitische<br />
Kommunikation und Bildung in der Austrian Development Agency (ADA).<br />
Kurt Luger<br />
Geb. 1952, Studium der Kommunikations- und Wirtschaftswissenschaften in München und Salz-<br />
burg. Leiter der Abteilung Internationale und Interkulturelle Kommunikation am Institut für Pu-<br />
blizistik- und Kommunikationswissenschaft der Universität Salzburg.<br />
Vorsitzender der Österreichischen Gesellschaft für Kommunikationsfragen und Herausgeber der<br />
Zeitschrift „Medien Journal“, Mitbegründer der Gesellschaft für ökologische Zusammenarbeit Al-<br />
pen-Himalaya, Öko-Himal.<br />
Franz Nuscheler<br />
Geb. 1938, Professor für Vergleichende Internationale Politik an der Universität Duisburg-Essen<br />
1974 bis 2003; Gründungsdirektor des Instituts für Entwicklung und Frieden (INEF).<br />
Mitglied des Kuratoriums der Österreichischen Forschungsstiftung für Entwicklungshilfe, Mitglied<br />
des Entwicklungspolitischen Beirates im Österreichischen Außenministerium.<br />
200 <strong>ÖSTERREICHISCHE</strong> EZA – BAND 1
Kunibert Raffer<br />
ANHANG<br />
Geb. 1951, Professor am Institut für Wirtschaftswissenschaften der Universität Wien, 1979-80 und<br />
1983-84 Konsulent der UNIDO, 1998 Mitarbeit im UNDP-Forschungsprojekt „International Deve-<br />
lopment Cooperation and Global Public Goods“, WS 2002-03 Gastprofessor am Centre for the<br />
Study of International Institutions (CSI), SOWI-Fakultät, Universität Innsbruck,<br />
Forschungsschwerpunkte:Internationaler Handel, Internationale Finanzen, Entwicklungshilfe<br />
Klaus Seitz<br />
Geb. 1959, seit 2000 Redakteur der Zeitschrift Entwicklungspolitik, Frankfurt am Main, und Pri-<br />
vatdozent für Allgemeine Erziehungswissenschaft und Internationale Bildungsforschung an der<br />
Universität Hannover.<br />
Roland Steidl<br />
Geb. 1956, hat Philosophie, Germanistik und ev. Theologie an den Universitäten Köln, Wuppertal<br />
und Wien studiert; langjährige Tätigkeit im Bereich Umweltethik und im Kontext des Konziliaren<br />
Prozesses für Gerechtigkeit, Frieden und die Bewahrung der Schöpfung; seit 1990 in verschiedenen<br />
Funktionen im Aus- und Fortbildungsbereich des Diakoniewerks Gallneukirchen tätig; FH- Dozent;<br />
freiberuflich: Radio, Vorträge und Seminare; Ausbildung zum Geistlichen Begleiter.<br />
Voitl Helmut<br />
Geb. 1939, österreichischer Jounalist und Filmemacher, Schwerpunkt Dokumentation, mehrfach<br />
für sein Filmschaffen ausgezeichnet. Gemeinsam mit Elisabeth Guggenberger Auslandsaufenthalt<br />
während der Tsunami -Katastrophe 200/2005 in Sri Lanka, Start einer Hilfsaktion zugunsten der<br />
Flutopfer.<br />
<strong>ÖSTERREICHISCHE</strong> EZA – BAND 1 201