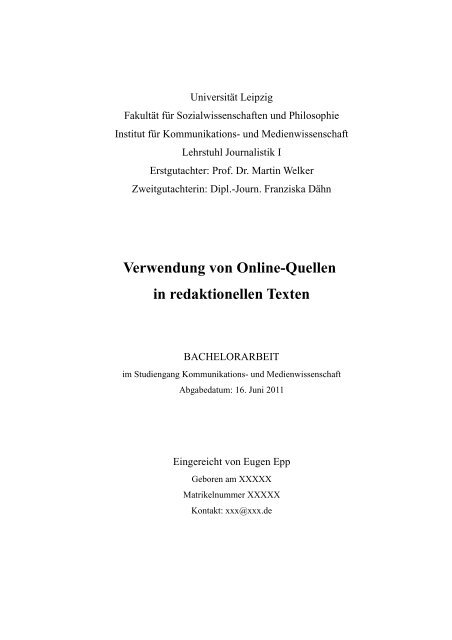Verwendung von Online-Quellen in redaktionellen Texten - Scribito
Verwendung von Online-Quellen in redaktionellen Texten - Scribito
Verwendung von Online-Quellen in redaktionellen Texten - Scribito
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Universität Leipzig<br />
Fakultät für Sozialwissenschaften und Philosophie<br />
Institut für Kommunikations- und Medienwissenschaft<br />
Lehrstuhl Journalistik I<br />
Erstgutachter: Prof. Dr. Mart<strong>in</strong> Welker<br />
Zweitgutachter<strong>in</strong>: Dipl.-Journ. Franziska Dähn<br />
<strong>Verwendung</strong> <strong>von</strong> <strong>Onl<strong>in</strong>e</strong>-<strong>Quellen</strong><br />
<strong>in</strong> <strong>redaktionellen</strong> <strong>Texten</strong><br />
BACHELORARBEIT<br />
im Studiengang Kommunikations- und Medienwissenschaft<br />
Abgabedatum: 16. Juni 2011<br />
E<strong>in</strong>gereicht <strong>von</strong> Eugen Epp<br />
Geboren am XXXXX<br />
Matrikelnummer XXXXX<br />
Kontakt: xxx@xxx.de
Inhaltsverzeichnis<br />
1.E<strong>in</strong>leitung ......................................................................................................................... 4<br />
2. Recherche ........................................................................................................................ 6<br />
2.1 Bedeutung der Recherche im Journalismus ................................................................... 6<br />
2.2 Das Internet als Recherchemittel .................................................................................... 8<br />
3. <strong>Quellen</strong> ........................................................................................................................... 10<br />
3.1 <strong>Quellen</strong> im Journalismus .............................................................................................. 10<br />
3.2 Internetquellen .............................................................................................................. 11<br />
4. Forschungsstand: Ausgewählte Studien zu <strong>Onl<strong>in</strong>e</strong>-Recherche<br />
und Internetquellen ..................................................................................................... 15<br />
5. Methode ......................................................................................................................... 19<br />
5.1 Inhaltsanalyse ............................................................................................................... 19<br />
5.2 Stichprobe und Messpunkte ......................................................................................... 19<br />
5.2.1 Süddeutsche Zeitung ................................................................................................. 20<br />
5.2.2 Leipziger Volkszeitung .............................................................................................. 21<br />
5.2.3 Dresdner Neueste Nachrichten .................................................................................. 21<br />
5.3 Codebuch ….................................................................................................................. 21<br />
6. Ergebnisse der Inhaltsanalyse ..................................................................................... 23<br />
6.1 Überblick: Artikel mit <strong>Onl<strong>in</strong>e</strong>-<strong>Quellen</strong> ......................................................................... 23<br />
6.2 Nähere Analyse der <strong>Onl<strong>in</strong>e</strong>-<strong>Quellen</strong> ............................................................................. 25<br />
6.3 Analyse der Zeitungen ….............................................................................................. 29<br />
6.3.1 Süddeutsche Zeitung ................................................................................................. 29<br />
6.3.2 Leipziger Volkszeitung .............................................................................................. 31<br />
6.3.3 Dresdner Neueste Nachrichten .................................................................................. 33<br />
6.4 Vergleich der Zeitungen ............................................................................................... 33<br />
7. Typologie <strong>von</strong> <strong>Onl<strong>in</strong>e</strong>-<strong>Quellen</strong> ..................................................................................... 36<br />
8. Zusammenfassung und Fazit ....................................................................................... 40<br />
9. Literaturverzeichnis ..................................................................................................... 42<br />
10. Abbildungs- und Tabellenverzeichnis ....................................................................... 47<br />
Anhang
1. E<strong>in</strong>leitung<br />
Iran, Juni 2009: nach den Präsidentschaftswahlen gehen <strong>in</strong> der islamischen Republik<br />
Tausende Anhänger des unterlegenen Herausforderers Mir Hosse<strong>in</strong> Mossawi auf die<br />
Straße, weil sie dem Gew<strong>in</strong>ner der Wahlen, Amts<strong>in</strong>haber Mahmud Ahmad<strong>in</strong>eschad,<br />
Wahlfälschung vorwerfen. Ihre Proteste gegen das Regime koord<strong>in</strong>ieren die meist jungen<br />
Aufständischen über den <strong>Onl<strong>in</strong>e</strong>-Kurznachrichtendienst Twitter und dokumentieren sie mit<br />
Kurzfilmen auf der Videoplattform YouTube. Da die Regierung kaum ausländische<br />
Journalisten zulässt, werden die Informationen aus dem Internet zu wichtigen <strong>Quellen</strong> für<br />
westliche Medien und weltweit rege genutzt (vgl. Schumacher 2009; Berger 2009).<br />
Deutschland, Februar 2009: nachdem Karl-Theodor zu Guttenberg zum<br />
Bundeswirtschaftsm<strong>in</strong>ister berufen wird, veröffentlichen e<strong>in</strong>e Reihe <strong>von</strong> Medien <strong>in</strong><br />
Deutschland die zehn Vornamen des CSU-Politikers. Darunter allerd<strong>in</strong>gs e<strong>in</strong>en zu viel –<br />
den Vornamen „Wilhelm“ hatte e<strong>in</strong> User <strong>in</strong> Guttenbergs E<strong>in</strong>trag bei der <strong>Onl<strong>in</strong>e</strong>-<br />
Enzyklopädie Wikipedia e<strong>in</strong>gefügt, auf welche die Redaktionen ansche<strong>in</strong>end bl<strong>in</strong>d vertraut<br />
hatten. Der anonyme Wikipedianer deckt den Schw<strong>in</strong>del schließlich selbst über das<br />
Journalismus-Watchblog Bildblog (2009) auf.<br />
Diese beiden Beispiele aus jüngerer Vergangenheit zeigen, <strong>in</strong> welchem Spannungsfeld aus<br />
Chancen und Risiken sich Journalisten bewegen, wenn sie im Internet recherchieren. Wie<br />
auch <strong>in</strong> vielen anderen gesellschaftlichen Bereichen und Berufsgruppen hat der<br />
„Strukturwandel der Kommunikation“ (Bucher/Büffel 2005: 86), den das Internet<br />
ausgelöst hat, auch den Journalismus und se<strong>in</strong>e Arbeitsweisen nicht nur verändert, sondern<br />
gleichzeitig vor Herausforderungen gestellt. Auf der e<strong>in</strong>en Seite bietet das Internet<br />
zahlreiche Informationen, die sich schnell und unkompliziert f<strong>in</strong>den und abrufen lassen.<br />
Andererseits aber ist die Glaubwürdigkeit der <strong>Quellen</strong> oft fragwürdig und ihr Urheber<br />
unbekannt.<br />
Die Werkzeugkiste der journalistischen <strong>Onl<strong>in</strong>e</strong>-Recherche enthält Instrumente wie Google,<br />
Wikipedia, Nachrichtenportale und Unternehmenswebsites, aber auch Blogs, Foren und<br />
soziale Netzwerke. All diese Spielarten des Netzes können im journalistischen Alltag zu<br />
wichtigen und ergiebigen <strong>Quellen</strong> werden, solange sie kritisch und verantwortungsbewusst<br />
genutzt werden, denn ke<strong>in</strong>e <strong>von</strong> ihnen ist unumstritten. Auch <strong>in</strong> der wissenschaftlichen<br />
Diskussion wird die Nutzung <strong>von</strong> <strong>Onl<strong>in</strong>e</strong>-<strong>Quellen</strong> zwar nicht abgelehnt, aber teilweise<br />
skeptisch beäugt (vgl. Machill/Beiler/Zenker 2008; Haller 2008: 196f., Meier 2003: 252).<br />
Was die gesellschaftlichen Funktionen des Journalismus angeht, so bieten <strong>Onl<strong>in</strong>e</strong>quellen<br />
4
hier das Potential zu e<strong>in</strong>er deliberativen Öffentlichkeit, eröffnen sie doch e<strong>in</strong>er großen<br />
Anzahl <strong>von</strong> Interessenvertretern die Möglichkeit, sich zu Wort zu melden und damit die<br />
Asymmetrie der Massenkommunikation abzuschwächen (vgl. Habermas 2008: 161).<br />
Dass das Internet nicht nur die Gesellschaft <strong>in</strong>sgesamt, sondern auch den Journalismus<br />
mehr und mehr durchdr<strong>in</strong>gt, lässt sich neben den Alltagsbeobachtungen auch empirisch<br />
zeigen: während 2005 noch durchschnittlich 66 M<strong>in</strong>uten täglich für <strong>Onl<strong>in</strong>e</strong>-Recherche<br />
aufgewendet wurden (vgl. Weischenberg/Mailk/Scholl 2006: 80), waren es 2007 bereits 79<br />
M<strong>in</strong>uten (vgl. Machill/Beiler/Zenker 2008: 189-192). 2009 gaben <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er weiteren Studie<br />
mehr als die Hälfte der befragten Journalisten an, e<strong>in</strong> bis drei Stunden täglich onl<strong>in</strong>e zu<br />
verbr<strong>in</strong>gen (vgl. Keel/Bernet 2009: 9). Vor der Folie dieser Entwicklungen und der Frage,<br />
wie sie sich auch für den Rezipienten nachvollziehbar im journalistischen Produkt<br />
niederschlagen, entstand diese Arbeit. Sie orientiert sich an folgenden Forschungsfragen:<br />
� Wie hoch ist der Anteil <strong>von</strong> Beiträgen mit <strong>Onl<strong>in</strong>e</strong>-<strong>Quellen</strong> <strong>in</strong> <strong>redaktionellen</strong> <strong>Texten</strong>?<br />
� In e<strong>in</strong>em zweiten Schritt werden die Beiträge mit <strong>Onl<strong>in</strong>e</strong>-<strong>Quellen</strong> näher untersucht:<br />
Welche Art <strong>von</strong> Internetquellen werden wie oft und für welche Themen verwendet?<br />
Welchen Stellenwert haben diese <strong>Quellen</strong>?<br />
� Lassen sich Muster bei der <strong>Verwendung</strong> <strong>von</strong> <strong>Onl<strong>in</strong>e</strong>-<strong>Quellen</strong> erkennen, so dass<br />
diese bzgl. ihrer Funktionen im Journalismus klassifiziert werden können?<br />
Um e<strong>in</strong>er Antwort auf diese Fragen näher zu kommen, wurden drei deutsche<br />
Tageszeitungen e<strong>in</strong>er Inhaltsanalyse unterzogen. Die Ergebnisse werden im Anschluss an<br />
e<strong>in</strong>e Zusammenfassung e<strong>in</strong>iger grundlegender journalismustheoretischer Überlegungen zu<br />
<strong>Quellen</strong> und Recherche, jeweils mit besonderem Fokus auf die Internetvariante, vorgestellt.<br />
Außerdem wird am Ende e<strong>in</strong>e Typologisierung <strong>von</strong> <strong>Onl<strong>in</strong>e</strong>-<strong>Quellen</strong> vorgenommen.<br />
5
2. Recherche<br />
2.1 Bedeutung der Recherche im Journalismus<br />
Der Journalismus spielt <strong>in</strong> demokratischen Gesellschaften e<strong>in</strong>e prägende Rolle. Über die<br />
Frage aber, was genau Journalismus sei, gibt es <strong>in</strong> der Wissenschaft verschiedene<br />
Auffassungen, e<strong>in</strong>e allgeme<strong>in</strong>gültige Def<strong>in</strong>ition fehlt noch. Dies ist <strong>in</strong>sbesondere auf die<br />
Offenheit des Berufes gemäß Artikel 5 des Grundgesetzes zurückzuführen. Die wichtigsten<br />
Merkmale und Aufgaben des Journalismus können wie folgt beschrieben werden:<br />
„Journalismus recherchiert, selektiert und präsentiert Themen, die neu,<br />
faktisch und relevant s<strong>in</strong>d. Er stellt Öffentlichkeit her, <strong>in</strong>dem er die<br />
Gesellschaft beobachtet, diese Beobachtung über periodische Medien e<strong>in</strong>em<br />
Massenpublikum zur Verfügung stellt und dadurch e<strong>in</strong>e geme<strong>in</strong>same<br />
Wirklichkeit konstruiert. Diese konstruierte Wirklichkeit bietet Orientierung<br />
<strong>in</strong> e<strong>in</strong>er komplexen Welt.“ (Meier 2007: 13)<br />
Indem er Öffentlichkeit und damit Transparenz herstellt, kann der Journalismus als<br />
konstitutiv für die Demokratie angesehen werden. Daher wird er oft auch als „vierte<br />
Gewalt“ im Staat bezeichnet. Der Journalismus kontrolliert und kritisiert, <strong>in</strong>formiert die<br />
Bevölkerung, trägt zur Me<strong>in</strong>ungsbildung der Bürger bei und bewahrt sich dabei e<strong>in</strong>e<br />
redaktionelle Unabhängigkeit <strong>von</strong> politischen und wirtschaftlichen Interessen (vgl. Meier<br />
2007: 15f.).<br />
In diesem Kontext nimmt die Recherche e<strong>in</strong>e entscheidende Rolle e<strong>in</strong>. Da der<br />
Journalismus <strong>in</strong> der Regel über Ereignisse berichtet, zu denen die Rezipienten ke<strong>in</strong>en<br />
direkten Zugang haben und über die sie lediglich aus den Massenmedien <strong>in</strong>formiert werden<br />
(vgl. Luhmann 1996: 9), ist es erstens erforderlich, dass diese Informationen zutreffend<br />
s<strong>in</strong>d und zweitens, dass sie <strong>von</strong> den Rezipienten als glaubwürdig erachtet werden.<br />
Medienangebote s<strong>in</strong>d somit auch immer „Vertrauensgüter“ (Neuberger 2002: 47). Die<br />
Recherche trägt <strong>in</strong> hohem Maße dazu bei, dass beide Bed<strong>in</strong>gungen erfüllt werden, sie ist<br />
e<strong>in</strong> entscheidender Faktor für die Qualität e<strong>in</strong>er Information und e<strong>in</strong>es journalistischen<br />
Produkts an sich (vgl. Arnold 2009).<br />
Haller (2008: 246) def<strong>in</strong>iert die Recherche als „Verfahren zur Beschaffung und Beurteilung<br />
<strong>von</strong> Aussagen über reales Geschehen, die ohne dieses Verfahren nicht preisgegeben, also<br />
nicht publik würden. Im weiteren S<strong>in</strong>ne ist es e<strong>in</strong> Verfahren zur Rekonstruktion<br />
erfahrbarer, d.h. s<strong>in</strong>nlich wahrgenommener Wirklichkeit mit den Mitteln der Sprache.“<br />
6
Ludwig (2007: 21) nennt sie e<strong>in</strong> „nachträgliches Rekonstruieren <strong>von</strong> Ereignissen und<br />
Zusammenhängen“. Mittels der Recherche sollen „Aussagen über Vorgänge beschafft,<br />
geprüft und beurteilt werden“ (Haller 2008: 39). Ziel der Recherche im journalistischen<br />
Bereich ist es stets, die beschafften Informationen s<strong>in</strong>nvoll zusammenzufügen und zu<br />
publizieren (vgl. Haller 2008: 51; Preger 2004: 18).<br />
Es können im Wesentlichen drei Recherchiertypen unterschieden werden: die<br />
ereignisbezogene Recherche, die Themenrecherche sowie die Enthüllungsrecherche (vgl.<br />
Haller 2008: 39). Während die ereignisbezogene Recherche meist zur Überprüfung oder<br />
Vervollständigung <strong>von</strong> Fakten und damit erst als Reaktion auf e<strong>in</strong>e bereits vorhandene<br />
Information stattf<strong>in</strong>det, bildet die Themenrecherche <strong>in</strong> der Regel erst den E<strong>in</strong>stieg <strong>in</strong> e<strong>in</strong><br />
für den Rechercheur bisher noch kaum erschlossenes Gebiet. Die Enthüllungsrecherche<br />
schließlich bedient sich meist <strong>in</strong>vestigativer Recherchetechniken und zielt auf<br />
Informationen ab, die ursprünglich nicht an die Öffentlichkeit gelangen sollten. E<strong>in</strong>e<br />
kle<strong>in</strong>schrittigere E<strong>in</strong>teilung, die sich mehr an den praktischen Bed<strong>in</strong>gungen der Recherche<br />
und dem konkreten Vorgehen orientiert, bietet Weischenberg (2001b: 136), <strong>in</strong>dem er die<br />
Material-Recherche, Vor-Ort-Recherche, Publikations-Recherche, <strong>in</strong>vestigative Recherche,<br />
Scheckbuch-Recherche und <strong>Onl<strong>in</strong>e</strong>-Recherche unterscheidet.<br />
Dass das Recherchieren zum grundlegenden Handwerkszeug für Journalisten gehört,<br />
darüber besteht ke<strong>in</strong>erlei Diskussion. Trotzdem (oder gerade deshalb) wird vielerorts e<strong>in</strong>e<br />
mangelnde Recherchebereitschaft im deutschen Journalismus beklagt. Bei e<strong>in</strong>er<br />
repräsentativen Journalistenbefragung <strong>von</strong> Weischenberg/Malik/Scholl (2006) gaben die<br />
Befragten an, lediglich knapp e<strong>in</strong> Fünftel (117 M<strong>in</strong>uten) ihrer Arbeitszeit auf<br />
Recherchetätigkeiten zu verwenden. Es kann verschiedene Gründe dafür geben, dass nicht<br />
mehr bzw. tiefgehender recherchiert wird. E<strong>in</strong>er dieser Gründe ist der zunehmende<br />
Zeitdruck <strong>in</strong> den Redaktionen, dem ausführliche Recherchen zum Opfer fallen. Nicht<br />
umsonst bezeichnen Brendel/Brendel (2004: 11) die Recherche auch als „das mühselige<br />
Beschaffen <strong>von</strong> Wissen“. Des Weiteren benötigen Rechercheure Geld und ihre<br />
recherchierten Geschichten aufgrund ihrer Komplexität mehr Platz im Medium als e<strong>in</strong>e<br />
simple Agenturnachricht (vgl. Preger 2004: 95 ff.) – beides ist oft schlichtweg nicht<br />
vorhanden.<br />
E<strong>in</strong>en weiteren H<strong>in</strong>weis auf das Fehlen e<strong>in</strong>er Recherchekultur <strong>in</strong> Deutschland (vgl. Preger<br />
2004: 125) könnte das vorherrschende Selbstverständnis der Journalisten geben. Sie<br />
verstehen sich eher als neutrale Vermittler, die die Bevölkerung <strong>in</strong>formieren und komplexe<br />
7
Sachverhalte allgeme<strong>in</strong>verständlich erklären wollen, so das Ergebnis der Befragung <strong>von</strong><br />
Weischenberg/Malik/Scholl (2006: 102). Nur e<strong>in</strong> ger<strong>in</strong>ger Teil der befragten Journalisten<br />
sah sich <strong>in</strong> der Pflicht, beruflich Missstände zu kritisieren, politisch E<strong>in</strong>fluss zu nehmen<br />
oder Partei für Benachteiligte zu ergreifen. Gerade dabei aber handelt es sich um Motive,<br />
die e<strong>in</strong> besonders hohes Maß an Recherche erfordern würden. Vor dem H<strong>in</strong>tergrund der<br />
vorangegangenen normativen Überlegungen, <strong>in</strong> denen recherchierende Journalisten auch<br />
als Korrektiv e<strong>in</strong>er Gesellschaft verstanden werden, wirkt diese Weigerung, „heiße Eisen“ -<br />
eventuell auch aus Furcht vor den Folgen – anzufassen, alarmierend. Auffällig ist zudem,<br />
dass sich dieses Verständnis <strong>von</strong> Journalismus und journalistischer Recherche teilweise<br />
stark <strong>von</strong> dem anderer Länder, besonders der USA, unterscheidet (vgl. Weischenberg 2002:<br />
449-465; Donsbach 1993).<br />
2.2 Das Internet als Recherchemittel<br />
Die Recherche via Internet ist aus der journalistischen Arbeit nicht mehr wegzudenken,<br />
muss aber durchaus ambivalent beurteilt werden. Auf der e<strong>in</strong>en Seite bietet das Internet<br />
recherchierenden Journalisten e<strong>in</strong>ige Vorteile, die den Arbeitsalltag enorm erleichtern<br />
können. So liegen Informationen, die offl<strong>in</strong>e erst mühsam ermittelt werden müssen, im<br />
Internet oft schon abrufbereit und geordnet vor, woraus sich e<strong>in</strong>e deutliche Zeitersparnis im<br />
Vergleich zur Offl<strong>in</strong>e-Recherche ergibt. Außerdem kann über das Internet auf e<strong>in</strong>e nahezu<br />
unbegrenzte Bandbreite <strong>von</strong> Informationen aus verschiedenen <strong>Quellen</strong> zugegriffen werden,<br />
was vor allem bei Randthemen <strong>von</strong> Bedeutung se<strong>in</strong> kann. Zudem ist der Zugriff rund um<br />
die Uhr möglich.<br />
Kritiker h<strong>in</strong>gegen bezeichnen das Internet als „Informationsmüllhalde“ (Meier 2002: 300).<br />
Aufgrund der leichten Erreichbarkeit besteht die Gefahr, dass aus Bequemlichkeitsgründen<br />
ergiebigere, aber auch aufwändigere Rechercheformen vernachlässigt werden, da das<br />
Internet nur e<strong>in</strong>en recht niedrigen Aktivitätsgrad bei der Informationsbeschaffung erfordert.<br />
Die dort bereitgestellten Informationen s<strong>in</strong>d zudem oft schwer überprüfbar bzgl. ihrer<br />
Herkunft, Richtigkeit und Relevanz (vgl. Welker 2010: 127). Da pr<strong>in</strong>zipiell jedem User die<br />
Möglichkeit offen steht, Inhalte im Netz zu veröffentlichen, ist deren Status <strong>in</strong> vielen<br />
Fällen äußerst unklar, vor allem wenn die Quelle anonym bleibt. Durch das World Wide<br />
Web ist e<strong>in</strong>e neue Öffentlichkeit entstanden, <strong>in</strong> der sich jeder zu Wort melden kann und die<br />
e<strong>in</strong>en stark erleichterten Zugang zu publizierten Inhalten bietet. Auch die Trennung<br />
zwischen Kommunikatoren und Rezipienten verschwimmt daher mehr und mehr. Im<br />
8
Mittelpunkt der Debatte steht dabei die Wahrung der Qualität im Journalismus, die durch<br />
das Internet e<strong>in</strong>igen Beobachtern als gefährdet ersche<strong>in</strong>t. Brendel/Brendel (2004: 59) raten<br />
daher dazu, Informationen nicht ohne Gegenkontrolle zu übernehmen und nicht verifizierte<br />
Fakten bei der Veröffentlichung als solche zu kennzeichnen. Allerd<strong>in</strong>gs sollte dieses<br />
Vorgehen nicht nur für Ergebnisse der <strong>Onl<strong>in</strong>e</strong>-Recherche gelten, sondern taugt auch als<br />
allgeme<strong>in</strong>er Grundsatz für den Umgang mit Rechercheerträgen.<br />
Die Journalisten selbst bewerten den E<strong>in</strong>fluss des Internets auf ihre Arbeit zwar als<br />
zunehmend, aber auch als durchaus positiv, da es die Arbeit erleichtert. Daneben s<strong>in</strong>d sie<br />
sich auch durchaus der potentiellen Gefahren bewusst, das Internet gewann <strong>in</strong> den<br />
vergangenen Jahren aber stetig an Glaubwürdigkeit (vgl. Keel/Bernet 2005: 4). Genutzt<br />
wird das Internet meist für e<strong>in</strong>e Recherche, die außen beg<strong>in</strong>nt und als Basisrecherche<br />
angelegt ist (vgl. Ludwig 2002: 195). Für die Ermittlung <strong>von</strong> zusätzlichen Informationen,<br />
Kontaktdaten oder Statistiken ist <strong>in</strong> der Tat mittlerweile das Web die erste Adresse (vgl.<br />
Machill/Beiler/Zenker 2008, Keel/Bernet 2009). Die Vielzahl der potentiellen <strong>Quellen</strong> und<br />
e<strong>in</strong>e daraus resultierende Unübersichtlichkeit stellt neue Ansprüche an die Journalisten, die<br />
herausgefordert s<strong>in</strong>d, mit diesen Möglichkeiten kompetent und verantwortungsvoll<br />
umzugehen und sie für ihre Recherchen nutzbar zu machen. Die <strong>Verwendung</strong> <strong>von</strong> <strong>Onl<strong>in</strong>e</strong>-<br />
<strong>Quellen</strong> kann deshalb auch als Indiz für e<strong>in</strong>e große Bandbreite an genutzten <strong>Quellen</strong> und<br />
als Qualitätsmerkmal der Recherche gelten. Das Netz spielt somit e<strong>in</strong>e wichtige Rolle <strong>in</strong><br />
den Redaktionen, hat die Offl<strong>in</strong>e-Recherche aber ke<strong>in</strong>eswegs komplett verdrängt: „Das<br />
Internet ist sicher nicht das Recherche-Allzweck- und -Allheilmittel; die herkömmlichen<br />
<strong>Quellen</strong> haben nicht ausgedient“ (Meier 2002: 302).<br />
9
3. <strong>Quellen</strong><br />
3.1 <strong>Quellen</strong> im Journalismus<br />
<strong>Quellen</strong> s<strong>in</strong>d „grundsätzliche Informationsmöglichkeiten, unabhängig da<strong>von</strong>, für wen sie<br />
bestimmt s<strong>in</strong>d und wie es um deren Zugänglichkeit bestellt ist“ (Ludwig 2007: 191). Sie<br />
eröffnen dem Journalisten die Möglichkeit, Informationen über Geschehnisse und<br />
Vorgänge <strong>in</strong> Erfahrung zu br<strong>in</strong>gen, an denen er nicht selbst beteiligt bzw. anwesend war,<br />
oder fremde Ansichten und Argumente zu erfahren. Damit s<strong>in</strong>d <strong>Quellen</strong> <strong>von</strong> großer<br />
Bedeutung für den Prozess der Rekonstruktion <strong>von</strong> Wirklichkeit. Dem Journalismus<br />
kommt dabei e<strong>in</strong>e Gatekeeper-Rolle zu: er steht zwischen den <strong>Quellen</strong> und dem Publikum,<br />
se<strong>in</strong>e Aufgabe ist die E<strong>in</strong>ordnung und Bewertung des Materials (vgl. Weischenberg 2001b:<br />
135) und schließlich die Entscheidung, welche Informationen welcher <strong>Quellen</strong> gültig und<br />
für die Rezipienten relevant s<strong>in</strong>d. Von der E<strong>in</strong>schätzung des Journalisten hängt letztendlich<br />
ab, welche Informationen se<strong>in</strong>e Zuschauer, Hörer oder Leser erreichen.<br />
Die Mitteilungen, die sich durch Recherche aus <strong>Quellen</strong> gew<strong>in</strong>nen lassen, können den<br />
Status e<strong>in</strong>er Aussage oder e<strong>in</strong>es Arguments annehmen (vgl. Haller 1994). Aussagen<br />
beschreiben Sachverhalte, und zwar so objektiv bzw. <strong>in</strong>tersubjektiv nachvollziehbar wie<br />
möglich. Da diese Sachverhalte s<strong>in</strong>nlich wahrnehmbar s<strong>in</strong>d, können die Aussagen darüber<br />
überprüft und ggf. als gültig e<strong>in</strong>gestuft werden. Dah<strong>in</strong>gegen haben Argumente stets e<strong>in</strong>en<br />
<strong>in</strong>terpretativen, subjektiven Charakter. Sie können noch weniger als Aussagen <strong>in</strong> die<br />
Kategorien „richtig“ oder „falsch“ e<strong>in</strong>geordnet werden, lassen sich jedoch auf ihre<br />
Plausibilität h<strong>in</strong> überprüfen.<br />
<strong>Quellen</strong> können <strong>in</strong> verschiedener Ausprägung auftreten: beispielsweise Akteure, „die über<br />
relevante Informationen verfügen und (…) befragt werden können“ oder „Dokumente, die<br />
derartige Informationen enthalten“ (Neuberger/Nuernbergk/ Rischke 2009: 297). Diese<br />
Klassifizierung greift auf die Unterscheidung zwischen lebenden und leblosen <strong>Quellen</strong><br />
zurück. Weitere Kategorien als die des Akteurs, <strong>in</strong> die <strong>Quellen</strong> e<strong>in</strong>geordnet werden können,<br />
s<strong>in</strong>d Sprecher, die sich im Namen anderer äußern, Zeugen und Experten (vgl. Haller 2008:<br />
80ff.).<br />
Von besonderer Bedeutung, ja unverzichtbar ist e<strong>in</strong> kritischer Umgang mit jeder Quelle.<br />
Bei der <strong>Quellen</strong>kritik ist nicht nur <strong>von</strong> Belang, wer die Quelle ist, sondern auch die Motive,<br />
die h<strong>in</strong>ter ihren Äußerungen stehen. Haller (2008: 89) br<strong>in</strong>gt es auf folgende Faustformel:<br />
„Je offener der Informant über se<strong>in</strong>e Motive spricht, desto eher darf ihm Vertrauen<br />
10
geschenkt werden. (…) Je authentischer und kompetenter er ist, desto zuverlässiger s<strong>in</strong>d<br />
se<strong>in</strong>e Angaben.“ Als Qualitätskriterien e<strong>in</strong>er Quelle können somit ihre Authentizität,<br />
Unvore<strong>in</strong>genommenheit und ihr Sachwissen (vgl. Haller 2008) extrahiert werden. Während<br />
sich dies bei lebendigen <strong>Quellen</strong> möglicherweise oft – wenn auch bei weitem nicht immer -<br />
recht e<strong>in</strong>fach im direkten Kontakt feststellen lässt, müssen auch leblose <strong>Quellen</strong> auf ihre<br />
Verfasser und deren Beweggründe h<strong>in</strong> überprüft werden, was sich teilweise schwierig<br />
gestaltet.<br />
Informationen, die nicht recherchiert werden müssen, sondern dem Journalisten zur<br />
Verfügung gestellt werden („Public Relations“), sollten <strong>in</strong> Anbetracht der oben erwähnten<br />
Qualitätskriterien mit besonderer Vorsicht behandelt werden. Im Regelfall stehen h<strong>in</strong>ter<br />
diesen Informationen wirtschaftliche, politische oder weltanschauliche Interessen, die <strong>in</strong><br />
der Öffentlichkeit positiv dargestellt werden sollen. Die Mehrheit der Journalisten schätzen<br />
den E<strong>in</strong>fluss <strong>von</strong> PR auf ihre Arbeit zwar tendenziell als eher ger<strong>in</strong>g e<strong>in</strong> (vgl.<br />
Weischenberg/Malik/Scholl 2006: 123), empirische Studien legen aber andere Schlüsse<br />
nahe: so ergab e<strong>in</strong>e Input-Output-Analyse <strong>von</strong> Baerns (1991), dass knapp zwei Drittel der<br />
journalistischen Beiträge <strong>in</strong> den Medien maßgeblich auf PR-Material zurückgehen. Auch<br />
wenn sich für das Verhältnis zwischen Journalismus und Öffentlichkeitsarbeit bessere<br />
Erklärungsmodelle als die Determ<strong>in</strong>ationsthese <strong>von</strong> Baerns, wonach die PR die <strong>in</strong> den<br />
Medien stattf<strong>in</strong>denden Themen und deren Tim<strong>in</strong>g kontrolliere, f<strong>in</strong>den (v.a. das<br />
Intereffikationsmodell <strong>von</strong> Bentele/Liebert/Seel<strong>in</strong>g, 1997), so zeigen die Ergebnisse doch<br />
den erheblichen E<strong>in</strong>fluss <strong>in</strong>teressengeleiteter <strong>Quellen</strong>.<br />
Grundsätzlich ist bei jeder <strong>Quellen</strong>recherche auch das Bewusstse<strong>in</strong> <strong>von</strong>nöten, dass<br />
Objektivität zwar e<strong>in</strong> gerade im Journalismus gern gebrauchtes Wort, als<br />
Wirklichkeitskonzept aber nicht tragfähig ist. Jede Quelle berichtet aus subjektiver<br />
Perspektive, auch wenn die behandelten Sachverhalte möglicherweise objektiv feststellbar<br />
s<strong>in</strong>d (vgl. Haller 1994). Der Journalismus bewegt sich <strong>in</strong> diesem Spannungsfeld <strong>von</strong><br />
Objektivität und Konstruktion <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er „funktionalen Widersprüchlichkeit“ (Haller 1994:<br />
277), die aber gerade se<strong>in</strong> Wesen als Konstrukteur sozialer Wirklichkeit (vgl. Pörksen<br />
2004) ausmacht.<br />
3.2 Internetquellen<br />
Das Internet hat sich <strong>in</strong> den vergangenen Jahren rasant zum Leitmedium entwickelt,<br />
<strong>in</strong>sbesondere für die Generation der unter 20-jährigen. Diese Entwicklung stellt den<br />
11
Journalismus vor neue Aufgaben und Herausforderungen, eröffnet ihm aber auch die<br />
Möglichkeit, aus den <strong>Quellen</strong> des Netzes zu schöpfen (vgl. Simons 2011). So<br />
unübersichtlich wie das Internet, so heterogen s<strong>in</strong>d auch die dort vorhandenen <strong>Quellen</strong> und<br />
Informationsmöglichkeiten, <strong>von</strong> denen hier e<strong>in</strong>ige kurz angerissen werden.<br />
„Das Neue am Internet ist, dass sich im Pr<strong>in</strong>zip jeder an der öffentlichen Kommunikation<br />
beteiligen kann“, beschreibt Neuberger (2007: 63) e<strong>in</strong> wesentliches Merkmal der digitalen<br />
Revolution. Doch gerade dar<strong>in</strong> besteht oft das Problem: die vielfältigen<br />
Partizipationsmöglichkeiten erschweren die Qualitätsbewertung der <strong>Onl<strong>in</strong>e</strong>-<strong>Quellen</strong>.<br />
Praktisch bedeutet das, dass Herkunft und Wahrheitsgehalt <strong>von</strong> Informationen <strong>in</strong> vielen<br />
Fällen unklar s<strong>in</strong>d. Auf theoretischer Ebene verstärkt dieses Phänomen die<br />
Entgrenzungsersche<strong>in</strong>ungen (vgl. Weischenberg 2001a: 77) im Journalismus, da durch<br />
Laien, die sich im Internet ebenfalls zu Wort melden und damit die Grenzen zwischen<br />
Kommunikatoren und Publikum verwischen (vgl. Neuberger 2002: 27), e<strong>in</strong>e trennscharfe<br />
Def<strong>in</strong>ition <strong>von</strong> Journalismus nahezu unmöglich wird. Auch mit Blick auf diese <strong>Onl<strong>in</strong>e</strong>-<br />
Publizisten fragen Weischenberg/Malik/Scholl (2006: 16): „Wie sehr kann man<br />
Weihwasser verdünnen, ohne dass es se<strong>in</strong>e Wirkung verliert?“ und diagnostizieren e<strong>in</strong>e<br />
Deprofessionalisierung des Journalismus. Gleichzeitig aber bieten die neuen<br />
Möglichkeiten auch e<strong>in</strong>en qualitativen Zugew<strong>in</strong>n an Recherchemöglichkeiten. Durch die<br />
zunehmenden Publikationsmöglichkeiten können sich nun mehr und auch bisher<br />
artikulationsschwache Interessengruppen Gehör verschaffen und e<strong>in</strong>e breite Öffentlichkeit<br />
erreichen.<br />
Zu diesen nicht-professionellen <strong>Onl<strong>in</strong>e</strong>-<strong>Quellen</strong> gehören Weblogs, soziale Netzwerke,<br />
Twitter oder Foren, also Internetangebote, die geme<strong>in</strong>h<strong>in</strong> unter dem Überbegriff „Social<br />
Web“ oder „Web 2.0“ (vgl. zu den Begriffen Schmidt 2008) zusammengefasst werden. Auf<br />
diesen Internetseiten wird der Faktor Partizipation ganz besonders evident, leben sie doch<br />
da<strong>von</strong>, dass User Informationen über sich selbst und ihre Ansichten mit der Welt teilen.<br />
Indem solche Seiten ihre Nutzer <strong>von</strong> Konsumenten zu potentiellen Produzenten werden<br />
lassen, kommen Me<strong>in</strong>ungen und Sachverhalte zur Sprache, die <strong>in</strong> den Massenmedien nicht<br />
thematisiert werden. Im Gegenzug werden die klassischen Medien teilweise erst durch<br />
Bewegungen im Netz auf diese Themen aufmerksam und heben sie auf die Agenda. Die<br />
Nutzung derartiger Communitys ist besonders bei jungen Nutzern sehr beliebt, auch wenn<br />
die Mitmach-Bereitschaft der User im Social Web noch auf relativ niedrigem Niveau<br />
verharrt (vgl. Busemann/Gscheidle 2009). Gerade <strong>in</strong> den letzten fünf Jahren hat das Social<br />
12
Web <strong>in</strong> se<strong>in</strong>en verschiedenen Ausformungen enorm an Bedeutung gewonnen. Während<br />
Nutzer z.B. über den Microblogg<strong>in</strong>gdienst Twitter Kurznachrichten <strong>von</strong> maximal 140<br />
Zeichen Länge absetzen können, geben soziale Netzwerke ihren Mitgliedern e<strong>in</strong>e<br />
Plattform, um sich mite<strong>in</strong>ander zu vernetzen. Journalisten können diese Dienste u.a.<br />
nutzen, um sich Überblick über aktuelle Stimmungen zu verschaffen, neue relevante<br />
Informationen darüber zu erhalten oder selbst mit Rezipienten <strong>in</strong> Kontakt zu treten.<br />
E<strong>in</strong>e Führungsrolle im Web 2.0 haben Weblogs (kurz: Blogs) übernommen: „Weblogs<br />
werden fast ausschließlich <strong>von</strong> Individuen betrieben, berichten oder kommentieren aus<br />
e<strong>in</strong>er subjektiven Perspektive, die Selektion der Inhalte und der Verl<strong>in</strong>kungen erfolgt nach<br />
eigenen Kriterien“ (Bucher/Büffel 2005: 90). E<strong>in</strong>ige dieser Blogs übernehmen bereits<br />
quasi-journalistische Funktionen, andere werden durch Expertenwissen und<br />
Augenzeugenberichte bei bestimmten Themen zu wichtigen <strong>Quellen</strong>, die sich klassische<br />
Medien zunutze machen können. Da jedoch die Autoren oft nicht identifizierbar und die<br />
Darstellungen sehr subjektiv gefärbt s<strong>in</strong>d (vgl. Eberwe<strong>in</strong> 2008: 19-21), erfordert auch diese<br />
<strong>Quellen</strong>art e<strong>in</strong>e reflektierte Herangehensweise. Weitere partizipative Formate, die für<br />
Journalisten als <strong>Quellen</strong> relevant se<strong>in</strong> können, s<strong>in</strong>d Podcasts oder Wikis wie die <strong>Onl<strong>in</strong>e</strong>-<br />
Enzyklopädie Wikipedia, die e<strong>in</strong>en weiteren großen Vorzug des Social Web offenbart: die<br />
freiwillige und unbezahlte Erzeugung <strong>von</strong> Wissensgütern durch Zusammenarbeit <strong>von</strong><br />
vielen E<strong>in</strong>zelnen (vgl. Schmidt 2008: 27).<br />
Ist bisher ausschließlich über private Angebote im Netz gesprochen worden, so existieren<br />
dennoch auch im Internet professionelle Anbieter <strong>von</strong> Informationen. Meist handelt es sich<br />
dabei um Institutionen, die auch außerhalb des Internets Bedeutung haben, aber im Netz<br />
über sich und ihre Aktivitäten <strong>in</strong>formieren: Unternehmen, Behörden, Parteien, Verbände,<br />
etc. Auf diesen Präsenzen werden <strong>von</strong> Journalisten vor allem Kontaktmöglichkeiten,<br />
Zahlen und Fakten sowie H<strong>in</strong>tergrundmaterial nachgefragt (vgl. Keel/Bernet 2005: 4).<br />
Aufgrund ihres professionellen Charakters, ihrer Bekanntheit und ihres Renommees abseits<br />
des Internets genießen diese Angebote, besonders solche <strong>von</strong> Verwaltungen und<br />
Hochschulen, meist e<strong>in</strong>en größeren Vertrauensbonus (vgl. Keel/Bernet 2009: 18), dennoch<br />
müssen auch ihre Inhalte kritisch geprüft werden, da es sich <strong>in</strong> der Regel um PR-Auftritte<br />
handelt. Daraus entsteht die Gefahr e<strong>in</strong>er „<strong>in</strong>strumentellen Manipulation“ (Welker 2010:<br />
124) der Medien durch gezielt gestreute, e<strong>in</strong>seitige Informationen. Brendel/Brendel (2004:<br />
14) stellen diese Gefahr der <strong>in</strong>teressengeleiteten Information im Netz sehr plakativ dar:<br />
13
„Was sich <strong>in</strong> Datenbanken oder Internet bef<strong>in</strong>det, wurde vorher schon <strong>von</strong><br />
jemandem e<strong>in</strong>gegeben. Und dieser jene hat nicht e<strong>in</strong>fach aus Lust und Laune<br />
irgendwelche Geheimnisse <strong>in</strong> die Tastatur gehämmert, sondern sich<br />
höchstwahrsche<strong>in</strong>lich ziemlich gründlich Gedanken darüber gemacht, was er<br />
e<strong>in</strong>gibt und was nicht“<br />
Fraglich ersche<strong>in</strong>t dabei, wie sehr PR dabei noch auf den Journalismus angewiesen ist.<br />
Durch die aufgeweichten Grenzen im Kommunikationsprozess können Kommunikatoren<br />
und Rezipienten zum<strong>in</strong>dest technisch gesehen problemlos selbstständig mite<strong>in</strong>ander <strong>in</strong><br />
Kontakt treten, die Gatekeeper-Rolle des Journalismus wird obsolet. Diese Entwicklung<br />
wird <strong>in</strong> der Kommunikationswissenschaft unter dem Begriff der Dis<strong>in</strong>termediation<br />
verhandelt (vgl. Neuberger 2007: 68). Stattdessen gew<strong>in</strong>nt das „Gatewatch<strong>in</strong>g“ an<br />
Bedeutung – der Überblick darüber, welche Angebote es im Netz gibt und wie sich diese <strong>in</strong><br />
der journalistischen Arbeit nutzen lassen (vgl. Bruns 2005).<br />
Ke<strong>in</strong>e <strong>Quellen</strong> im eigentlichen S<strong>in</strong>n, sondern eher Wegweiser zu den <strong>Quellen</strong> s<strong>in</strong>d<br />
Suchmasch<strong>in</strong>en. Auch wenn Suchmasch<strong>in</strong>en im Dickicht des Internets praktisch<br />
unverzichtbar s<strong>in</strong>d, e<strong>in</strong>e schnelle und kostengünstige Recherche ermöglichen und deshalb<br />
<strong>von</strong> Journalisten auch sehr stark frequentiert werden, s<strong>in</strong>d auch hier e<strong>in</strong>ige Stolperste<strong>in</strong>e zu<br />
beachten (vgl. Wyss/Keel 2007). Suchmasch<strong>in</strong>en an sich treffen bereits e<strong>in</strong>e Vorselektion<br />
der <strong>Quellen</strong> und verzerren somit die <strong>von</strong> den Journalisten wahrgenommene Wirklichkeit.<br />
Doch auch wenn dieser Umstand pragmatischerweise den technischen<br />
Funktionsmechanismen <strong>von</strong> Suchmasch<strong>in</strong>en geschuldet ist, wird deren selektive Wirkung<br />
durch die weit verbreitete Nutzungsweisen noch verstärkt. So berücksichtigt der größte<br />
Teil lediglich die auf den ersten Ergebnisseiten angezeigten <strong>Quellen</strong> und ist teilweise nicht<br />
<strong>in</strong> der Lage, die Möglichkeiten <strong>von</strong> Suchmasch<strong>in</strong>en adäquat auszuschöpfen<br />
(Machill/Beiler/Zenker 2008: 215-290). Außerdem beschränken sich die meisten Nutzer<br />
auf den Dienst des Marktführers Google, was zum Schlagwort der „Googleisierung“<br />
(Wegner 2005) führte.<br />
Ebenfalls ke<strong>in</strong>e Quelle im eigentlichen S<strong>in</strong>n ist die E-Mail. Sie erfüllt lediglich den Zweck<br />
e<strong>in</strong>es Mediums zwischen Sender und Empfänger. Die Quelle ist <strong>in</strong> diesem Fall also nicht<br />
die E-Mail selbst, sondern die Person, mit der die Korrespondenz geführt wird.<br />
14
4. Forschungsstand: Ausgewählte Studien zu <strong>Onl<strong>in</strong>e</strong>-Recherche<br />
und Internetquellen<br />
In dem Maß, wie sowohl die Bedeutung <strong>von</strong> <strong>Onl<strong>in</strong>e</strong>-Recherche und Internetquellen im<br />
Journalismus sowie die des Internets <strong>in</strong>sgesamt zugenommen haben, wurden diese Felder<br />
auch zunehmend Gegenstand der Journalismusforschung. An dieser Stelle sollen e<strong>in</strong>ige<br />
Ergebnisse dieser Forschung zusammengefasst werden, aus Platzgründen muss sich dieser<br />
Überblick allerd<strong>in</strong>gs auf e<strong>in</strong>ige ausgewählte empirische Studien zu den Themenkomplexen<br />
Internetrecherche und -nutzung <strong>von</strong> Journalisten sowie <strong>Verwendung</strong> <strong>von</strong> <strong>Onl<strong>in</strong>e</strong>-<strong>Quellen</strong><br />
beschränken.<br />
Machill/Beiler/Zenker (2008) untersuchten <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er nicht-repräsentativen Beobachtung <strong>von</strong><br />
235 Journalisten aus verschiedenen Medien deren Recherchemethoden mit besonderem<br />
Augenmerk auf die <strong>Onl<strong>in</strong>e</strong>-Recherche. Die Journalisten verwendeten durchschnittlich<br />
mehr als dreie<strong>in</strong>halb Stunden täglich für Recherchetätigkeiten. E<strong>in</strong> Großteil der<br />
Rechercheprozesse galt der Erweiterungsrecherche (51,3%), es folgte die<br />
Themenrecherche (40,8%). Der Anteil der computergestützten Recherchemittel betrug<br />
47% und lag damit knapp über dem nicht-computergestützter Mittel (40,6%, die dritte<br />
Klasse bildeten Agenturen). Am häufigsten aus der Riege der computergestützten<br />
Recherchemittel wurde die E-Mail verwendet, vor Suchmasch<strong>in</strong>en, verschiedenen<br />
<strong>Onl<strong>in</strong>e</strong>angeboten und journalistischen <strong>Onl<strong>in</strong>e</strong>angeboten. Bei den verschiedenen<br />
<strong>Onl<strong>in</strong>e</strong>angeboten fanden die Seiten <strong>von</strong> Unternehmen, staatlichen Institutionen und<br />
Verbänden die größte Beachtung. Durchschnittlich recherchierten die beobachteten<br />
Journalisten 79 M<strong>in</strong>uten täglich im Netz. Kritisch merken die Autoren an, dass nur sehr<br />
selten e<strong>in</strong> <strong>Quellen</strong>check beobachtet werden konnte: „E<strong>in</strong>e Überprüfung der Informationen<br />
f<strong>in</strong>det kaum noch statt“ (Machill/Beiler/Zenker 2008: 162). H<strong>in</strong>sichtlich <strong>von</strong><br />
Tageszeitungen zeigt die Studie, dass <strong>in</strong> den dortigen Redaktionen noch öfter offl<strong>in</strong>e als<br />
onl<strong>in</strong>e recherchiert wird, entgegen dem Trend <strong>in</strong> den anderen Medien.<br />
In e<strong>in</strong>er repräsentativen Befragung <strong>von</strong> Deutschschweizer Journalisten im Jahr 2009<br />
stellten Keel/Bernet fest, dass das Internet persönliche Gespräche und die Tageszeitung als<br />
wichtigstes Arbeits<strong>in</strong>strument überholt hat. Am häufigsten nutzten die Befragten das Netz,<br />
um Informationen zu suchen und zu überprüfen. Die höchste Glaubwürdigkeit wurde dabei<br />
Angeboten <strong>von</strong> Verwaltungen und Unternehmen entgegengebracht, als am<br />
unglaubwürdigsten beurteilten die Journalisten soziale Netzwerke, Blogs und Foren. Die<br />
15
Internetnutzung hatte sich gegenüber den Vorgängeruntersuchungen der Autoren <strong>von</strong> 2005<br />
und 2002 deutlich erhöht, mehr als die Hälfte der Befragten gab, täglich e<strong>in</strong>s bis drei<br />
Stunde im Netz zu verbr<strong>in</strong>gen.<br />
Das Internet wird auf verschiedene Weise im journalistischen Alltag genutzt und<br />
angewendet. Spr<strong>in</strong>ger/Woll<strong>in</strong>g (2008) entwickelten dafür auf Grundlage e<strong>in</strong>er<br />
Beobachtungsstudie e<strong>in</strong>e Typologie, die die vier häufigsten Funktionen des Internets im<br />
Rechercheprozess auflistet. Die Autoren identifizierten e<strong>in</strong>erseits die Nutzung <strong>von</strong><br />
Webquellen als „Türöffner“, um e<strong>in</strong>en ersten Blick auf e<strong>in</strong> Thema zu erhalten. Des<br />
Weiteren nahm das Internet e<strong>in</strong>e Kontroll- und Korrekturfunktion e<strong>in</strong>, bspw. um<br />
Schreibweisen zu überprüfen. Als weitere Funktionen nennen Spr<strong>in</strong>ger/Woll<strong>in</strong>g die<br />
Telefonbuchfunktion, mittels derer Journalisten Kontaktdaten <strong>von</strong> potentiellen <strong>Quellen</strong><br />
ausf<strong>in</strong>dig machen, sowie das Internet als Ersatz <strong>von</strong> Experten<strong>in</strong>terviews. Im letzteren Fall<br />
suchen Journalisten Spezialwissen auf verschiedenen Internetseiten, statt sich an<br />
anerkannte Experten, z.B. aus dem akademischen Bereich, zu wenden. Dies ist oft der Fall,<br />
wenn die Informationen lediglich als H<strong>in</strong>tergrundwissen benötigt werden und nicht zitiert<br />
werden sollen. Auffällig ist, dass sämtliche genannten Funktionen das Internet lediglich als<br />
Hilfsmittel sehen, dass im H<strong>in</strong>tergrund e<strong>in</strong>gesetzt wird: ke<strong>in</strong>e der Funktionen hat e<strong>in</strong>e<br />
explizite, vordergründige Relevanz für das journalistische Produkt und kann somit auch<br />
nicht vom Rezipienten nachvollzogen werden.<br />
Die Bezüge zu Internetseiten als <strong>Quellen</strong>, die letztlich auch Erwähnung <strong>in</strong> journalistischen<br />
<strong>Texten</strong> f<strong>in</strong>den, sche<strong>in</strong>en bei Forschungen zu Social-Web-Angeboten eher gegeben zu se<strong>in</strong>.<br />
So ermittelten Neuberger/Vom Hofe/Nuernbergk (2010) für Twitter, dass knapp 70% der<br />
70 befragten <strong>Onl<strong>in</strong>e</strong>-Redaktionen nach eigenen Angaben bereits aus dem<br />
Kurznachrichtendienst zitiert hätten. In 94% der Redaktionen wird Twitter zur Recherche<br />
e<strong>in</strong>gesetzt, allerd<strong>in</strong>gs zeigt die Häufigkeit und Beurteilung der Recherche via Twitter e<strong>in</strong><br />
durchaus vielschichtiges Bild: zwei Drittel halten Twitter für „eher unwichtig“, die<br />
Bewertung ist im Großen und Ganzen ausgewogen. Am häufigsten wird der Dienst<br />
genutzt, um e<strong>in</strong> Stimmungsbild zu aktuellen Themen zu bekommen oder über Twitter<br />
selbst als <strong>Onl<strong>in</strong>e</strong>-Phänomen zu berichten. Auch Verweise auf weitere <strong>Onl<strong>in</strong>e</strong>-<strong>Quellen</strong><br />
spielen e<strong>in</strong>e Rolle. Twitter nimmt der Untersuchung zufolge bei den computergestützten<br />
Recherchemitteln ke<strong>in</strong>en Spitzenplatz e<strong>in</strong>, ist aber die meistgenutzte Social-Web-<br />
Anwendung. Den <strong>von</strong> Zeit zu Zeit formulierten Vorwurf, im Internet recherchierende<br />
Journalisten wollten ihre Sorgfaltspflichten über Bord werfen, bestätigt die Studie nicht: <strong>in</strong><br />
16
nahezu allen befragten Redaktionen gilt die Regel, Twitter um weitere Recherchewege zu<br />
ergänzen und Webseiten, die über Twitter gefunden werden, nur zu verwenden, wenn der<br />
Anbieter bekannt und vertrauenswürdig ist.<br />
Daneben hat sich zum Verhältnis zwischen Journalismus und Weblogs durch e<strong>in</strong>ige<br />
Studien gerade <strong>in</strong> der Mitte der letzten Dekade zum<strong>in</strong>dest vorübergehend e<strong>in</strong> relativ<br />
ergiebiger Forschungszweig herangebildet. Der Stellenwert <strong>von</strong> Bloggern gegenüber<br />
klassischen, professionellen Journalisten wird <strong>in</strong> der Kommunikationswissenschaft<br />
durchaus kontrovers diskutiert. Die E<strong>in</strong>schätzungen reichen <strong>von</strong> „Pseudojournalismus“<br />
(Machill 2005) über e<strong>in</strong> eher komplementäres Verhältnis zum Journalismus (vgl.<br />
Neuberger/Nuernbergk/Rischke 2007) bis h<strong>in</strong> zum größtenteils gleichwertigen<br />
„Netzwerkjournalismus“ (Bucher/Büffel 2005), wobei dieser Pluralismus an Me<strong>in</strong>ungen<br />
sicherlich auch der extremen Heterogenität der Blogosphäre zuzuschreiben ist.<br />
Rezipienten nutzen Blogs vor allem, weil sie sich durch das Medienangebot nicht gut<br />
genug <strong>in</strong>formiert fühlen oder weil sie Informationen zu Nischenthemen suchen, die <strong>in</strong><br />
Massenmedien nicht behandelt werden (vgl. Zerfaß/Bogosyan 2007: 2). Insgesamt hält<br />
sich die Nutzung jedoch stark <strong>in</strong> Grenzen (vgl. Busemann/Gscheidle 2009). Mit<br />
Journalismus werden die Publizisten im Netz nur <strong>von</strong> wenigen Nutzern <strong>in</strong> Verb<strong>in</strong>dung<br />
gebracht, Trepte/Re<strong>in</strong>ecke (2008) zeigten aber experimentell, dass Leser zwar bezüglich<br />
Qualität und ethischen Standards höhere Erwartungen an Tageszeitungen als an Blogs<br />
stellen, letztlich aber den Inhalt und nicht die Herkunft e<strong>in</strong>es Artikels beurteilen.<br />
Unter Journalisten ist die Nutzung <strong>von</strong> Blogs und vergleichbaren Web-2.0-<strong>Quellen</strong> eher<br />
ger<strong>in</strong>g: <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Befragung <strong>von</strong> 5311 Medienschaffenden im Jahr 2005 gaben lediglich 15%<br />
der Befragten an, Blogs zu nutzen (vgl. Welker 2007), <strong>in</strong> ähnlicher Größenordnung (18%)<br />
bewegt sich der Anteil derer, die <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Studie <strong>von</strong> News aktuell (2007) e<strong>in</strong>e häufige bzw.<br />
gelegentliche Nutzung <strong>von</strong> Blogs angaben. Wenn Journalisten Blogs zu Recherchezwecken<br />
nutzen, suchen sie nach eigenen Angabe <strong>in</strong> den meisten Fällen nach Themenideen. E<strong>in</strong>e<br />
große Rolle spielt auch die Suche nach Berichten <strong>von</strong> Augenzeugen, die aufgenommen und<br />
zitiert werden können. Immerh<strong>in</strong> 81% stimmten <strong>in</strong> der gleichen Befragung <strong>von</strong><br />
Redaktionsleitern der These zu, dass Blogger <strong>Quellen</strong> seien, die der Journalismus nutzen<br />
könne (vgl. Neuberger/Nuernbergk/Rischke 2007). Auf diese Weise dient das Internet also<br />
auch dazu, stärker <strong>von</strong> der Basis berichten zu können, wenn auch über den Umweg<br />
„<strong>Onl<strong>in</strong>e</strong>-Quelle“. Journalisten, die selbst Blogs betreiben, verstanden 2004 <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er<br />
explorativen Befragung Weblogs als „Themenkompass und zugleich Frühwarnsystem“, mit<br />
17
dem sich „Entwicklungen <strong>von</strong> Me<strong>in</strong>ungen und Trends beobachten“ (Welker 2007: 101)<br />
ließen. In e<strong>in</strong>er weiteren Studie gab die Hälfte der befragten Nachrichtenredaktionsleiter<br />
an, bereits aus Weblogs zitiert zu haben (vgl. Neuberger /Nuernbergk/Rischke 2009).<br />
Allerd<strong>in</strong>gs fällt auf, dass gerade Redaktionen <strong>von</strong> Tageszeitungen <strong>in</strong> Sachen Blognutzung<br />
e<strong>in</strong> tendenzielles Des<strong>in</strong>teresse aufweisen und h<strong>in</strong>ter anderen Medien herh<strong>in</strong>ken (vgl.<br />
Welker 2007: 107; Neuberger/Nuernbergk/Rischke 2009: 306).<br />
Mit der Frage, wie oft und auf welche Weise <strong>Onl<strong>in</strong>e</strong>-<strong>Quellen</strong> <strong>in</strong> journalistischen Beiträgen<br />
verwendet und zitiert werden, hat sich bisher lediglich e<strong>in</strong>e Arbeit dezidiert beschäftigt.<br />
Welker (2011) analysierte dazu <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er bislang unveröffentlichten Längsschnittstudie<br />
Beiträge der deutschen Leitmedien Tagesschau, RTL aktuell, Süddeutsche Zeitung und<br />
Frankfurter Allgeme<strong>in</strong>e Zeitung über drei Jahre h<strong>in</strong>weg. 5% der Beiträge enthielten<br />
demnach Internetverweise, lediglich <strong>in</strong> 3,9% der Artikel wurden journalistische <strong>Onl<strong>in</strong>e</strong>-<br />
<strong>Quellen</strong> im eigentlichen S<strong>in</strong>n zitiert, wobei für die FAZ der ger<strong>in</strong>gste und für RTL aktuell<br />
der höchste Anteil an <strong>Onl<strong>in</strong>e</strong>-<strong>Quellen</strong> festgestellt wurde. Jedoch ließ sich im Lauf der Jahre<br />
(2004-2007) <strong>in</strong>sgesamt e<strong>in</strong>e deutliche Zunahme der Verweise auf Internetquellen<br />
konstatieren, was sich jedoch nicht für jedes Medium e<strong>in</strong>deutig feststellen ließ. Die<br />
meisten der zitierten <strong>Quellen</strong> hatten e<strong>in</strong>e eher untergeordnete Funktion, vermittelten<br />
Informationen zum <strong>in</strong>ternationalen politischen Geschehen. Am häufigsten wurden<br />
professionelle Seiten oder Homepages <strong>von</strong> NGOs zitiert.<br />
18
5. Methode<br />
5.1 Inhaltsanalyse<br />
Unter der Inhaltsanalyse versteht man „e<strong>in</strong>e empirische Methode zur systematischen,<br />
<strong>in</strong>tersubjektiv nachvollziehbaren Beschreibung <strong>in</strong>haltlicher und formaler Merkmale <strong>von</strong><br />
Mitteilungen“ (Früh 2007: 25). Manifeste Texte werden also quantifizierend h<strong>in</strong>sichtlich<br />
bestimmter Merkmale untersucht, um daraus Rückschlüsse auf den Kommunikator<br />
(diagnostischer Ansatz) oder den Rezipienten (prognostischer Ansatz) zu ziehen bzw. um<br />
Texte zu beschreiben (formal-deskriptiver Ansatz). Dieses Verfahren bietet die Vorteile,<br />
dass auch Texte <strong>von</strong> bzw. über Personen analysiert werden können, die nicht (mehr)<br />
erreichbar s<strong>in</strong>d. Außerdem kann der Forscher unabhängig <strong>von</strong> Probanden und Zeitdruck<br />
agieren (vgl. dazu und zum Folgenden Früh 2007).<br />
Um die Intersubjektivität zu gewährleisten, wird die Inhaltsanalyse anhand e<strong>in</strong>es<br />
Kategoriensystems durchgeführt, mit dem sich im S<strong>in</strong>ne der jeweiligen Problemstellung<br />
relevante Textmerkmale <strong>in</strong> verschiedentlichen Ausprägungen beschreiben lassen.<br />
Grundsätzlich ist zu beachten, dass die Inhaltsanalyse immer nur e<strong>in</strong>en Realitätsausschnitt<br />
untersuchen und darstellen kann. Meist werden Stichproben analysiert, die Ergebnisse<br />
lassen sich je nach Repräsentativität der Stichprobe verallgeme<strong>in</strong>ern. Die Analyse<br />
geschieht im Regelfall durch geschulte Codierer, die vom Forscher <strong>in</strong> das<br />
Kategoriensystem e<strong>in</strong>gewiesen werden, so dass e<strong>in</strong>e möglichst hohe Übere<strong>in</strong>stimmung<br />
(Intercoderreliabilität) erreicht werden kann. Im Fall der vorliegenden Untersuchung s<strong>in</strong>d<br />
Codierer und Forscher identisch. Dieses Vorgehen birgt das Risiko, dass methodische<br />
Schwächen unbewussterweise konsequent fortgeführt werden, andererseits aber können<br />
damit abweichende Interpretationen des Codebuchs als unwahrsche<strong>in</strong>lich gelten.<br />
5.2 Stichprobe und Messpunkte<br />
Als Stichprobe wurden drei deutsche Tageszeitungen ausgewählt: die Süddeutsche Zeitung<br />
(SZ), die Leipziger Volkszeitung (LVZ) sowie die Dresdner Neueste Nachrichten (DNN).<br />
Dieser Stichprobe lag e<strong>in</strong>e geschichtete Stichprobe zugrunde, deren Schichten sich an der<br />
<strong>in</strong> der Literatur üblichen Klassifizierung <strong>von</strong> Tageszeitungen <strong>in</strong> überregionale Zeitungen,<br />
Regionalzeitungen und Lokalzeitungen (vgl. Meyn 1996: 62-79) orientierte. Aus jeder<br />
dieser Schichten wurde e<strong>in</strong> Vertreter willkürlich gezogen.<br />
Innerhalb dieser Zeitungen beschränkte sich die Analyse <strong>in</strong> zweierlei Weise: e<strong>in</strong>erseits auf<br />
19
Artikel <strong>in</strong> den Ressorts Seite 1, Politik, Wirtschaft und Lokales; andererseits auf die<br />
journalistischen Darstellungsformen Nachricht und Bericht. Die Beschränkung geschah<br />
aus forschungsökonomischen Gründen, kann aber plausibel begründet werden. Es wurden<br />
die Ressorts ausgewählt, die <strong>in</strong> besonderer Weise die gesellschaftliche Funktion des<br />
Journalismus abbilden und <strong>in</strong> den e<strong>in</strong>zelnen Zeitungen auch e<strong>in</strong>en angemessenen Umfang<br />
haben. Nachrichten und Berichte als analysierte Darstellungsformen gehören jeweils zu<br />
den „ausschließlich tatsachenbetonten Darstellungsformen“ (Mast 2004: 243f.), d.h. für<br />
diese Genres spielen <strong>in</strong> ganz besonderer Weise Recherche und <strong>Quellen</strong> e<strong>in</strong>e<br />
hervorgehobene Rolle, denn schließlich sollen durch sie die Rezipienten korrekt <strong>in</strong>formiert<br />
werden. Als Nachricht (auch „Meldung“ genannt) wird dabei e<strong>in</strong>e „um Objektivität<br />
bemühte Mitteilung e<strong>in</strong>es allgeme<strong>in</strong> <strong>in</strong>teressierenden aktuellen Sachverhalts <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em<br />
bestimmten formalen Aufbau“ (LaRoche 2008: 78) verstanden. Dieser Aufbau zeigt sich<br />
<strong>in</strong>sbesondere <strong>in</strong> der Pyramidenform und der Beantwortung der W-Fragen. Da ke<strong>in</strong>e genaue<br />
Def<strong>in</strong>ition der Darstellungsform Bericht existiert (vgl. Mast 2004: 249), sollen darunter<br />
tatsachenorientierte Texte, deren Länge über den üblichen Umfang e<strong>in</strong>er Nachricht<br />
h<strong>in</strong>ausgeht, verstanden werden. Die Abgrenzung zwischen diesen beiden Formen ist<br />
fließend, besitzt aber letztlich für die Untersuchung auch ke<strong>in</strong>erlei Relevanz.<br />
Die Inhaltsanalyse wurde an <strong>in</strong>sgesamt 36 Ausgaben durchgeführt. In dieser Stichprobe<br />
befanden sich jeweils zwölf Ausgaben jeder Zeitung. Der Erhebungszeitraum erstreckte<br />
sich über sechs Monate <strong>von</strong> September 2010 bis Februar 2011, pro Monat wurden zwei<br />
Ausgaben jeder Zeitung analysiert. Damit kann diese Studie zweifellos ke<strong>in</strong>erlei Anspruch<br />
auf Repräsentativität erheben, die Stichprobe ließ sich jedoch im Rahmen der vorhandenen<br />
Möglichkeiten gut bewältigen und lässt Rückschlüsse auf die <strong>Verwendung</strong> <strong>von</strong> <strong>Onl<strong>in</strong>e</strong>-<br />
<strong>Quellen</strong> <strong>in</strong>sgesamt und <strong>in</strong> den drei konkreten Redaktionen zu. Als Messpunkte wurden<br />
folgende Daten zufällig ermittelt: 8. September 2010, 26. September 2010, 14. Oktober<br />
2010, 19. Oktober 2010, 16. November 2010, 19. November 2010, 17. Dezember 2010, 29.<br />
Dezember 2010, 10. Januar 2011, 18. Januar 2011, 20. Februar 2011, 26. Februar 2011.<br />
Fiel e<strong>in</strong>er der Messpunkte auf e<strong>in</strong>en Sonn- oder Feiertag, wurde die jeweils nächste<br />
Ausgabe <strong>in</strong> die Stichprobe e<strong>in</strong>bezogen.<br />
5.2.1 Süddeutsche Zeitung<br />
Die Süddeutsche Zeitung ersche<strong>in</strong>t im Süddeutsche Verlag und wurde 1945 gegründet. Sie<br />
gehört zu den überregionalen Abonnementzeitungen, oft auch „Qualitätszeitungen“<br />
20
genannt (vgl. Raabe/Pürer 2007: 16). Mit e<strong>in</strong>er verkauften Auflage <strong>von</strong> knapp 430.000<br />
Exemplaren (vgl. IVW 2010c) gilt sie derzeit als erfolgreichster Vertreter dieser Gattung.<br />
Außerdem wird sie unter Journalisten sehr stark rezipiert – <strong>in</strong> der Befragung <strong>von</strong><br />
Weischenberg/Malik/Scholl (2006: 134) wurde sie als meistgenutztes Pr<strong>in</strong>tprodukt genannt<br />
– und kann somit als Leitmedium <strong>in</strong> Deutschland gelten.<br />
5.2.2 Leipziger Volkszeitung<br />
Die Leipziger Volkszeitung existiert seit 1894 und ersche<strong>in</strong>t <strong>in</strong> der Leipziger Verlags- und<br />
Druckereigesellschaft. Im vierten Quartal 2010 erreichte die LVZ-Stadtausgabe e<strong>in</strong>e<br />
verkaufte Auflage <strong>in</strong> Höhe <strong>von</strong> 136.000 Exemplaren (vgl. IVW 2010b). Das Blatt ersche<strong>in</strong>t<br />
als Regionalzeitung vor allem im Großraum Leipzig und Umgebung, dort ist die LVZ die<br />
derzeit e<strong>in</strong>zige regionale Abonnement-Zeitung. Die LVZ liefert den Mantelteil für<br />
<strong>in</strong>sgesamt acht Lokalausgaben.<br />
5.2.3 Dresdner Neueste Nachrichten<br />
Die Dresdner Neuesten Nachrichten wurden 1990 nach der deutschen Wiedervere<strong>in</strong>igung<br />
als Lokalzeitung für Dresden gegründet, die Auflage betrug im vierten Quartal 2010 etwa<br />
25.000 Exemplare (vgl. IVW 2010a). Sie ersche<strong>in</strong>t als Lokalausgabe der Leipziger<br />
Volkszeitung und übernimmt daher bis auf ger<strong>in</strong>gfügige Änderungen im Layout auch den<br />
Mantelteil der LVZ.<br />
Daraus ergibt sich e<strong>in</strong>e methodische Besonderheit: da die Mäntel <strong>in</strong> LVZ und DNN<br />
übere<strong>in</strong>stimmen, mussten für die DNN die Ressorts Seite 1, Politik und Wirtschaft nicht<br />
analysiert werden – die Ergebnisse wären logischerweise identisch mit denen der LVZ.<br />
Außerdem ließen sich anhand der Analyse <strong>von</strong> Teilen, die <strong>von</strong> auswärtigen Redaktionen<br />
zugeliefert werden, ohneh<strong>in</strong> ke<strong>in</strong>e Aussagen über die Rechercheleistungen der DNN-<br />
Redaktion und ihren Umgang mit <strong>Onl<strong>in</strong>e</strong>-<strong>Quellen</strong> treffen. Daher wurde für die DNN<br />
lediglich der Lokalteil analysiert.<br />
5.3 Codebuch<br />
Für die Inhaltsanalyse wurde e<strong>in</strong> Codebuch mit e<strong>in</strong>em Kategoriensystem erstellt, das e<strong>in</strong>e<br />
Symbiose aus dem Raster der Untersuchung <strong>von</strong> Welker (2011) und eigenen Überlegungen<br />
bildet. Mit dem Kategoriensystem werden sowohl re<strong>in</strong> formale als auch <strong>in</strong>haltliche<br />
Variablen erfasst. Zunächst werden alle Artikel auf <strong>Onl<strong>in</strong>e</strong>-<strong>Quellen</strong> h<strong>in</strong> untersucht, <strong>in</strong><br />
21
e<strong>in</strong>em zweiten Schritt werden die Beiträge, die <strong>Onl<strong>in</strong>e</strong>-<strong>Quellen</strong> enthalten, näher analysiert.<br />
Die <strong>in</strong>haltlichen Variablen fokussieren sich auf die Merkmale der Internetquellen sowie der<br />
Artikel, <strong>in</strong> die sie e<strong>in</strong>gebettet s<strong>in</strong>d.<br />
Dabei werden die Art der <strong>Onl<strong>in</strong>e</strong>-Quelle und der Angabe sowie Intensität und Potenz der<br />
jeweiligen Quelle erhoben. In der Kategorie „<strong>Onl<strong>in</strong>e</strong>-Quelle“ wurden die e<strong>in</strong>zelnen<br />
Variablen <strong>in</strong> die Unterkategorien „professionell“ (Seiten, die <strong>von</strong> Institutionen,<br />
Unternehmen, Organisationen, etc. zu PR-Zwecken betrieben werden), „nicht-<br />
professionell“ (Seiten oder Inhalte, die <strong>von</strong> Privatpersonen betrieben werden), „Medien“<br />
und „Sonstige“ unterteilt, um der Gefahr e<strong>in</strong>er zu kle<strong>in</strong>teiligen Analyse zu entgehen.<br />
Zudem werden die Position des Artikels auf der Seite und die Art der Quelle, d.h. ob die<br />
Quelle als journalistische Quelle im eigentlichen S<strong>in</strong>n oder als Serviceh<strong>in</strong>weis fungiert,<br />
analysiert. Genaue Angaben zum verwendeten Analyseraster f<strong>in</strong>den sich im Anhang.<br />
22
6. Ergebnisse der Inhaltsanalyse<br />
6.1 Überblick: Artikel mit <strong>Onl<strong>in</strong>e</strong>-<strong>Quellen</strong><br />
Zunächst soll an dieser Stelle <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Gesamtschau dargestellt werden, wie die Ergebnisse<br />
der Inhaltsanalyse alle Artikel mit <strong>Onl<strong>in</strong>e</strong>-<strong>Quellen</strong> betreffend ausfallen, bevor diese näher<br />
spezifiziert werden.<br />
Insgesamt wurden 2331 Artikel analysiert, da<strong>von</strong> enthielten 166 m<strong>in</strong>destens e<strong>in</strong>e <strong>Onl<strong>in</strong>e</strong>-<br />
Quelle. Das entspricht e<strong>in</strong>em Anteil <strong>von</strong> 7,1%. Dabei be<strong>in</strong>halteten 155 Artikel e<strong>in</strong>e <strong>Onl<strong>in</strong>e</strong>-<br />
Quelle, neun enthielten zwei <strong>Quellen</strong>, jeweils e<strong>in</strong>mal wurden drei oder gar mehr als drei<br />
Internetquellen zitiert. Insgesamt wurden 181 <strong>Onl<strong>in</strong>e</strong>quellen gefunden. Auf den Titelseiten<br />
enthielten 7,6% der Artikel <strong>Onl<strong>in</strong>e</strong>-<strong>Quellen</strong>, während es im Ressort Wirtschaft lediglich<br />
2,1% waren. In der Politik-Berichterstattung wurden <strong>in</strong> 6,2% der Beiträge <strong>Onl<strong>in</strong>e</strong>-<strong>Quellen</strong><br />
verwendet, den höchsten Wert erzielt aber das Lokale mit e<strong>in</strong>em Anteil <strong>von</strong> 9,6% (Tabelle<br />
1).<br />
Dieses Ergebnis relativiert sich bei e<strong>in</strong>em ersten näheren Blick auf die <strong>Quellen</strong> aber sehr<br />
bald, denn <strong>in</strong> gut zwei Drittel der Artikel fungieren die <strong>Onl<strong>in</strong>e</strong>-<strong>Quellen</strong> lediglich als<br />
Serviceh<strong>in</strong>weise, die ke<strong>in</strong>erlei direkte Relevanz für die Recherche haben. Vielmehr dient<br />
diese Art <strong>von</strong> <strong>Quellen</strong> dazu, dem Leser e<strong>in</strong>e Hilfestellung bei der Suche nach weiteren<br />
Informationen zu geben. Als Servicequellen wurde sowohl H<strong>in</strong>weise auf <strong>Onl<strong>in</strong>e</strong>auftritte<br />
des jeweiligen Mediums als auch auf externe Angebote gewertet. Besonders häufig greifen<br />
LVZ und DNN darauf zurück. Wie Tabelle 2 zeigt, bleibt der Anteil an der Gesamtzahl der<br />
Artikel zwar relativ moderat, gleichzeitig aber besteht der Großteil der angegebenen<br />
<strong>Onl<strong>in</strong>e</strong>-<strong>Quellen</strong> aus Serviceh<strong>in</strong>weisen. Bei der LVZ zählen mehr als drei Viertel aller<br />
Internetquellen <strong>in</strong> diese Kategorie, bei den DNN s<strong>in</strong>d es gar knapp 85%. Die<br />
Serviceh<strong>in</strong>weise zogen sich dabei durch alle Ressorts, wurden aber besonders häufig im<br />
Lokalteil verwendet – hier zeigt die Auswertung aller Zeitungen, dass etwa neun <strong>von</strong> zehn<br />
<strong>Onl<strong>in</strong>e</strong>-<strong>Quellen</strong> Servicequellen waren. Da<strong>von</strong> verwies e<strong>in</strong> Zehntel auf eigene Angebote.<br />
LVZ und DNN als Regional- bzw. Lokalzeitung sehen sich offenbar <strong>in</strong> besonderer Weise <strong>in</strong><br />
der Pflicht, ihre Leser mit weiterführenden Angeboten zu versorgen und diesbezüglich<br />
e<strong>in</strong>en Mehrwert zu schaffen. Die Süddeutsche Zeitung als überregionale Zeitung<br />
verzichtete dagegen weitestgehend auf weiterführende H<strong>in</strong>weise.<br />
23
Tabelle 1: Artikel mit <strong>Onl<strong>in</strong>e</strong>-<strong>Quellen</strong> (<strong>in</strong>klusive Serviceh<strong>in</strong>weise) nach Ressorts<br />
Analysierte<br />
Artikel<br />
Artikel mit<br />
<strong>Onl<strong>in</strong>e</strong>-<strong>Quellen</strong><br />
Anteil<br />
Seite 1 198 15 7,6%<br />
Politik 519 32 6,2%<br />
Wirtschaft 473 10 2,1%<br />
Lokales 1141 109 9,6%<br />
Gesamt 2331 166 7,1%<br />
Tabelle 2: Artikel mit Serviceh<strong>in</strong>weisen nach Ressorts und Zeitungen<br />
Seite 1<br />
SZ<br />
LVZ<br />
DNN<br />
Politik<br />
SZ<br />
LVZ<br />
DNN<br />
Wirtschaft<br />
SZ<br />
LVZ<br />
DNN<br />
Lokales<br />
SZ<br />
LVZ<br />
DNN<br />
Gesamt<br />
SZ<br />
LVZ<br />
DNN<br />
Analysierte<br />
Artikel<br />
198<br />
86<br />
112<br />
-*<br />
519<br />
324<br />
195<br />
-*<br />
473<br />
312<br />
161<br />
-*<br />
1141<br />
56<br />
513<br />
572<br />
2331<br />
778<br />
981<br />
572<br />
Artikel mit<br />
Serviceh<strong>in</strong>weisen<br />
11 0<br />
11<br />
8 3<br />
5<br />
3 1<br />
2<br />
95 0<br />
40<br />
56<br />
105<br />
4<br />
58<br />
56<br />
Anteil <strong>Onl<strong>in</strong>e</strong>-<strong>Quellen</strong><br />
5,6%<br />
0,0%<br />
9,8%<br />
1,5%<br />
0,9%<br />
2,6%<br />
0,6%<br />
0,3%<br />
1,2%<br />
8,3%<br />
0,0%<br />
7,8%<br />
9,8%<br />
4,9%<br />
0,5%<br />
7,3%<br />
11,4%<br />
* Da die DNN den Mantel der LVZ übernehmen, wurde hier lediglich der Lokalteil codiert.<br />
Um die Serviceh<strong>in</strong>weise bere<strong>in</strong>igt, liegt der Anteil der Artikel mit <strong>Onl<strong>in</strong>e</strong>-<strong>Quellen</strong> im<br />
eigentlichen S<strong>in</strong>n somit bei lediglich 2,2%, <strong>in</strong>sgesamt 61 der angegebenen <strong>Quellen</strong><br />
gehören hierzu (Tabelle 3). Mit Blick auf die Ressorts erreicht nun die Politik den höchsten<br />
Wert (4,8%), vor den Ressorts Seite 1, Wirtschaft und Lokales. Der Gesamtanteil liegt<br />
dabei relativ niedrig. Vergleicht man diese Ergebnisse mit den Daten, die Welker (2011) <strong>in</strong><br />
se<strong>in</strong>er ähnlich angelegten Untersuchung präsentiert, ist gar e<strong>in</strong> deutlicher Rückgang<br />
festzustellen – damals enthielten 3,9% der Artikel journalistische <strong>Onl<strong>in</strong>e</strong>-<strong>Quellen</strong> im<br />
eigentlichen S<strong>in</strong>n. Erklärt werden kann diese Diskrepanz allerd<strong>in</strong>gs durch die<br />
unterschiedlichen Zeitungen, die untersucht wurden: die Leipziger Volkszeitung und die<br />
24<br />
17<br />
6<br />
11<br />
41<br />
25<br />
16<br />
11 7<br />
4<br />
112<br />
1<br />
43<br />
66<br />
181<br />
39<br />
76<br />
66
Dresdner Neuesten Nachrichten, die beide nicht zu den <strong>von</strong> Welker analysierten<br />
Qualitätsmedien gehören, verfolgen bzgl. der <strong>Verwendung</strong> <strong>von</strong> <strong>Onl<strong>in</strong>e</strong>-<strong>Quellen</strong> allem<br />
Ansche<strong>in</strong> nach andere Strategien als die Süddeutsche Zeitung. Sie verwenden diese<br />
<strong>Quellen</strong> <strong>in</strong> erster L<strong>in</strong>ie als unterstützenden Service, während im Text selbst eher auf<br />
klassische <strong>Quellen</strong> zurückgegriffen wird bzw. die Internetquellen nicht explizit genannt<br />
werden.<br />
Tabelle 3: Artikel mit <strong>Onl<strong>in</strong>e</strong>-<strong>Quellen</strong> im eigentlichen S<strong>in</strong>n nach Ressorts<br />
Analysierte<br />
Artikel<br />
Artikel mit <strong>Onl<strong>in</strong>e</strong>-<br />
<strong>Quellen</strong> i.e.S.<br />
Anteil<br />
Seite 1 198 4 2,0%<br />
Politik 519 25 4,8%<br />
Wirtschaft 473 7 1,5%<br />
Lokales 1141 14 1,2%<br />
Gesamt 2331 50 2,2%<br />
6.2 Nähere Analyse der <strong>Onl<strong>in</strong>e</strong>-<strong>Quellen</strong><br />
Im vorhergehenden Abschnitt wurde gezeigt, dass e<strong>in</strong> Großteil der identifizierten <strong>Onl<strong>in</strong>e</strong>-<br />
<strong>Quellen</strong> <strong>in</strong> Wirklichkeit lediglich als Serviceh<strong>in</strong>weise für die Leser dienen. Sie spielen<br />
damit ke<strong>in</strong>e direkte Rolle für die Information der Leser über e<strong>in</strong>en Sachverhalt durch die<br />
Zeitung und haben ke<strong>in</strong>e explizit journalistische Funktion. Deshalb beschränken sich die<br />
folgenden Ausführungen und Zahlen auf <strong>Quellen</strong>, die gemäß des Codebuchs als <strong>Quellen</strong><br />
im eigentlichen S<strong>in</strong>n gelten können. Gleichzeitig werden als Bezugsgröße nicht mehr –<br />
sofern nicht anders angegeben – die Artikel mit <strong>Onl<strong>in</strong>e</strong>-<strong>Quellen</strong>, sondern die <strong>Quellen</strong> (im<br />
eigentlichen S<strong>in</strong>n) selbst verwendet, da es auch Artikel gab, die mehrere Internetquellen<br />
enthielten und die e<strong>in</strong>zelnen <strong>Quellen</strong> so besser beschrieben werden können.<br />
Insgesamt wurden <strong>in</strong> den analysierten Beiträgen der drei Tageszeitungen 61 solcher<br />
<strong>Onl<strong>in</strong>e</strong>-<strong>Quellen</strong> zitiert. Dabei hielten sich professionelle <strong>Quellen</strong>, die der<br />
Öffentlichkeitsarbeit zugerechnet werden können, größtenteils die Waage mit nicht-<br />
professionellen <strong>Quellen</strong>: 24 Mal wurde auf Inhalte professionell betriebener Seiten<br />
verwiesen, 21 Mal auf Seiten, die <strong>von</strong> Privatpersonen verwaltet werden oder zu den<br />
partizipativen Formaten gehören (Abbildung 1). In der erstgenannten Kategorie stachen<br />
besonders die Seiten <strong>von</strong> NGOs, Vere<strong>in</strong>en und ähnlichen Organisationen heraus, sie<br />
machten deutlich mehr als die Hälfte der professionellen <strong>Quellen</strong> und nahezu e<strong>in</strong> Drittel<br />
der Gesamtzahl aus. Möglicherweise besteht hier e<strong>in</strong>e ger<strong>in</strong>gere Hemmschwelle bzgl. der<br />
25
Nennung als bei profitorientierten Unternehmen, deren Seiten nur sechsmal zitiert wurden.<br />
Zudem s<strong>in</strong>d NGOs auch aufgrund ihrer ger<strong>in</strong>geren Ressourcen oftmals dazu gezwungen,<br />
die Kanäle im Netz mehr als klassische Wege der Kommunikation zu nutzen, was sie dann<br />
oftmals effektiver und professioneller als Unternehmen und Behörden tun.<br />
Anzahl der <strong>Quellen</strong><br />
30<br />
25<br />
20<br />
15<br />
10<br />
5<br />
0<br />
Abbildung 1: <strong>Onl<strong>in</strong>e</strong>-<strong>Quellen</strong> nach <strong>Quellen</strong>arten<br />
NGOs,<br />
etc.<br />
Unternehmen<br />
Behörden<br />
professionell Nicht-professionell sonstige<br />
Was die nicht-professionellen Seiten angeht, so lässt sich zwar ke<strong>in</strong>e derart starke<br />
Konzentration auf e<strong>in</strong>e <strong>Quellen</strong>art feststellen, dennoch wurde mit neun <strong>von</strong> <strong>in</strong>sgesamt 21<br />
Nennungen am häufigsten aus sozialen Netzwerken zitiert, wobei ausschließlich die<br />
Plattform facebook herangezogen wurde. Doch auch andere Social-Media-Kanäle wie<br />
Twitter und Blogs fanden Beachtung. Signifikanten Anteil haben zudem H<strong>in</strong>weise auf<br />
Berichte anderer Medien, die siebenmal gezählt wurden. Dieser Anteil ist jedoch nicht so<br />
groß, dass er die These <strong>von</strong> der Selbstreferentialität der Medien (vgl. z.B.<br />
Machill/Beiler/Zenker 2008: 172) stützen würden. Stattdessen sorgt es für Transparenz,<br />
wenn Beiträge anderer Redaktionen nicht stillschweigend abgekupfert oder<br />
zusammengefasst werden – <strong>in</strong>wieweit das über die <strong>Quellen</strong>nennungen h<strong>in</strong>aus trotzdem<br />
geschieht, bleibt zunächst e<strong>in</strong>mal offen. Des Weiteren wurde neunmal zwar auf <strong>Onl<strong>in</strong>e</strong>-<br />
Inhalte verwiesen, jedoch ke<strong>in</strong>e Seite genannt. Corporate Blogs und Suchmasch<strong>in</strong>en<br />
wurden <strong>in</strong> der Stichprobe nicht erwähnt.<br />
<strong>Quellen</strong>arten<br />
Zu welchen Themen werden <strong>Onl<strong>in</strong>e</strong>-<strong>Quellen</strong> zitiert? Diese Frage lässt sich recht e<strong>in</strong>deutig<br />
26<br />
Foren<br />
soz.<br />
Netzwerke<br />
Twitter<br />
Videoportale<br />
Blogs<br />
nicht<br />
näher<br />
benannt<br />
Medien
eantworten, da sich e<strong>in</strong> bevorzugter Themenkomplex herauskristallisierte: 26 <strong>von</strong> 61<br />
<strong>Onl<strong>in</strong>e</strong>-<strong>Quellen</strong> und damit fast die Hälfte wurde <strong>in</strong> Artikeln zu Entwicklungen der<br />
Internationalen Politik zitiert (Tabelle 4). Bei ke<strong>in</strong>em anderen Thema wurde e<strong>in</strong> ähnlich<br />
hoher Anteil beobachtet, lediglich <strong>in</strong> den Lokalnachrichten wurden elf <strong>Onl<strong>in</strong>e</strong>-<strong>Quellen</strong><br />
verwendet, was sich jedoch durch die weitaus größere Fallzahl im Lokalteil relativiert.<br />
Artikel zu anderen Themen wurde nur vere<strong>in</strong>zelt mit Interneth<strong>in</strong>weisen versehen. Da<br />
jedoch nur die Themen der Beiträge mit <strong>Onl<strong>in</strong>e</strong>-<strong>Quellen</strong> erfasst wurden, können ke<strong>in</strong>e<br />
Angaben über den Anteil an der Gesamtzahl der Beiträge <strong>in</strong> den Tageszeitungen gemacht<br />
werden.<br />
Tabelle 4: <strong>Onl<strong>in</strong>e</strong>-<strong>Quellen</strong> nach Themen<br />
Thema Zitierte<br />
<strong>Onl<strong>in</strong>e</strong>-<strong>Quellen</strong><br />
Internationale Politik 26<br />
Lokalnachrichten 11<br />
Privatwirtschaft 6<br />
Wissenschaft 4<br />
Soziales 3<br />
Regierungspolitik 2<br />
Kommunalpolitik 2<br />
Katastrophen 2<br />
Volkswirtschaft 2<br />
Lokale Term<strong>in</strong>e 1<br />
Parteipolitik 1<br />
Landespolitik 1<br />
EU-Politik 0<br />
Lohnend ist auch e<strong>in</strong> näherer Blick auf die <strong>Quellen</strong>, die <strong>in</strong> der <strong>in</strong>ternationalen Politik-<br />
Berichterstattung zitiert werden. Es handelt sich <strong>in</strong> der Hälfte der Fälle um nicht-<br />
professionelle <strong>Quellen</strong> (13 <strong>von</strong> 26), dabei wird alle<strong>in</strong> fünfmal auf soziale Netzwerke und<br />
viermal auf Blogs Bezug genommen. H<strong>in</strong>zu kamen sechs allgeme<strong>in</strong>e Nennungen des<br />
Internets. Diese Beobachtung legt die Interpretation nahe, dass bei <strong>in</strong>ternationalen<br />
Politikthemen Social-Media-<strong>Quellen</strong> verstärkt <strong>von</strong> Journalisten genutzt werden – dies war<br />
<strong>in</strong>sbesondere bei den Revolutionen <strong>in</strong> Nordafrika, die sich während des ausgewerteten<br />
Zeitraums ereigneten, und bei Berichterstattung aus autoritären Systemen (z.B. Ch<strong>in</strong>a) der<br />
27<br />
61
Fall. Offensichtlich eröffnet das Internet hier den Redaktionen die Möglichkeit, auch auf<br />
<strong>in</strong>offiziellem Weg Informationen zu f<strong>in</strong>den, die ansonsten schwer aufzutreiben wären und<br />
wird deshalb rege genutzt bzw. zitiert.<br />
Abschließend wurden für jede der gefundenen <strong>Onl<strong>in</strong>e</strong>-<strong>Quellen</strong> die Art der Angabe, die<br />
Position des Artikels auf der Seite, die Intensität der Quelle und die Potenz analysiert. In<br />
mehr als der Hälfte der Fälle wurde ke<strong>in</strong>e URL angegeben, sondern lediglich der Name der<br />
Seite genannt. Wird die Quelle im Text genannt, ersche<strong>in</strong>t diese Vorgehensweise aus<br />
stilistischen Gründen bei Zeitungen durchaus nachvollziehbar. Als eher bedenklich ist<br />
dagegen e<strong>in</strong>zustufen, dass bei knapp e<strong>in</strong>em Viertel der <strong>Quellen</strong> weder der Name der Seite<br />
noch die URL genannt wurde, sprich e<strong>in</strong>fach auf Inhalte aus „dem Internet“ verwiesen<br />
wurde. Diese extrem unpräzise <strong>Quellen</strong>angabe macht es dem Leser schwer, die Quelle zu<br />
beurteilen und h<strong>in</strong>terlässt e<strong>in</strong>en <strong>in</strong>transparenten E<strong>in</strong>druck. In sechs <strong>von</strong> 61 Fällen wurde<br />
nur die URL genannt, nur fünfmal wurden sowohl Seitenname als auch URL angegeben.<br />
Die Analyse des Stellenwerts der <strong>Onl<strong>in</strong>e</strong>-<strong>Quellen</strong> und der Artikel, <strong>in</strong> denen sie vorkommen,<br />
ergab durchgehend durchschnittliche Werte. Auf e<strong>in</strong>er Skala <strong>von</strong> e<strong>in</strong>s bis drei, wobei e<strong>in</strong>s<br />
e<strong>in</strong>en schwer auff<strong>in</strong>dbaren Artikel und drei den Aufmacher auf der jeweiligen Zeitungsseite<br />
markierte, lagen die Artikel mit <strong>Onl<strong>in</strong>e</strong>-<strong>Quellen</strong> durchschnittlich bei 2,1 – die Artikel fielen<br />
zwar auf der Seite auf, standen aber nicht direkt im Vordergrund (Tabelle 5). Dennoch<br />
enthielten mehr Aufmacher als kle<strong>in</strong>e Artikel <strong>Onl<strong>in</strong>e</strong>-<strong>Quellen</strong>, was sich schlichtweg auf<br />
den mangelnden Platz <strong>in</strong> kle<strong>in</strong>en Beiträgen zurückführen lässt. In diesen Artikeln hat die<br />
Information Vorrang vor e<strong>in</strong>er ausführlichen <strong>Quellen</strong>angabe.<br />
Tabelle 5: Position, Intensität und Potenz der <strong>Onl<strong>in</strong>e</strong>-<strong>Quellen</strong> bzw. Artikel mit <strong>Onl<strong>in</strong>e</strong>-<strong>Quellen</strong><br />
1 -<br />
ger<strong>in</strong>g<br />
2 -<br />
mittel<br />
3 -<br />
hoch<br />
Arithmetisches<br />
Mittel<br />
Standardabweichung<br />
Position 13 27 21 2,1 0,7<br />
Intensität 20 25 16 1,9 0,8<br />
Potenz 33 15 13 1,7 0,8<br />
Welche Bedeutung hatten die <strong>Quellen</strong> <strong>in</strong>nerhalb der Artikel? Auch hier pendelte sich der<br />
Wert <strong>in</strong> der Mitte e<strong>in</strong>, bei 1,9, was <strong>in</strong> etwa e<strong>in</strong>er genaueren Beschreibung der Quelle<br />
entsprach. Gleichzeitig aber wurde <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Drittel der Beiträge die Internetquelle<br />
lediglich am Rande erwähnt. Nur e<strong>in</strong> Fünftel nahm e<strong>in</strong>e dom<strong>in</strong>ierende Funktion <strong>in</strong> ihrem<br />
Artikel e<strong>in</strong>. Entsprechend schwach stellte sich auch die Potenz der <strong>Onl<strong>in</strong>e</strong>-<strong>Quellen</strong> dar.<br />
28
Mehr als die Hälfte der zitierten <strong>Quellen</strong> fungierte nur als ergänzende Quelle, während<br />
lediglich e<strong>in</strong> Fünftel als konstituierende Quelle, die die Grundlage der Berichterstattung<br />
bildete, verwendet wurde.<br />
6.3 Analyse der Zeitungen<br />
6.3.1 Süddeutsche Zeitung<br />
In 27 <strong>von</strong> 778 untersuchten Artikeln verwendete die Süddeutsche Zeitung <strong>Onl<strong>in</strong>e</strong>-<strong>Quellen</strong>,<br />
das entspricht e<strong>in</strong>em Anteil <strong>von</strong> 3,5% (Tabelle 6). Vergleicht man dieses Ergebnis mit den<br />
Daten aus der Untersuchung <strong>von</strong> Welker (2011), der allerd<strong>in</strong>gs mehr als doppelt so viele<br />
Beiträge analysierte, ist festzustellen, dass der Anteil der Artikel mit <strong>Onl<strong>in</strong>e</strong>-<strong>Quellen</strong> um<br />
0,6 Prozentpunkte zurückgegangen ist. Aufgrund der gewachsenen Relevanz des Internets<br />
wäre anzunehmen, dass sich dieser Wert erhöht haben würde, diese Annahme bestätigt sich<br />
aber offenbar nicht. Im Ressort Politik war der Anteil mit 4,9% am höchsten, während die<br />
Ressorts Wirtschaft und Lokales nur sehr selten auf <strong>Onl<strong>in</strong>e</strong>-<strong>Quellen</strong> zurückgriffen. Auch<br />
tauchten <strong>in</strong> der Politik-Berichterstattung vermehrt Artikel mit mehr als e<strong>in</strong>er erwähnten<br />
<strong>Onl<strong>in</strong>e</strong>-Quelle auf. In drei Vierteln der Beiträge wurde, wenn überhaupt, lediglich e<strong>in</strong>e<br />
<strong>Onl<strong>in</strong>e</strong>-Quelle verwendet, fünfmal wurden zwei, e<strong>in</strong>mal drei und e<strong>in</strong>mal gar vier<br />
Internetquellen genannt.<br />
Tabelle 6: Artikel mit <strong>Onl<strong>in</strong>e</strong>-<strong>Quellen</strong> <strong>in</strong> der Süddeutschen Zeitung<br />
Analysierte<br />
Artikel<br />
Artikel mit <strong>Onl<strong>in</strong>e</strong>-<br />
<strong>Quellen</strong><br />
Anteil<br />
Seite 1 86 4 4,7%<br />
Politik 324 16 4,6%<br />
Wirtschaft 312 6 1,9%<br />
Lokales 56 1 1,8%<br />
Gesamt 778 26 3,7%<br />
Die 36 e<strong>in</strong>zelnen <strong>Quellen</strong> wurden dabei vornehmlich bei Beiträgen zu Themen der<br />
<strong>in</strong>ternationalen Politik genutzt. Mehr als die Hälfte der identifizierten <strong>Onl<strong>in</strong>e</strong>-<strong>Quellen</strong><br />
bezogen sich auf dieses Themenfeld. Alle übrigen Themengebiete wurden nur<br />
verhältnismäßig selten mit Informationen aus <strong>Onl<strong>in</strong>e</strong>-<strong>Quellen</strong> bespielt. Am häufigsten<br />
zitierte die Süddeutsche Zeitung aus anderen Medien (Tabelle 7). Knapp zwei <strong>von</strong> zehn<br />
29
verwendeten <strong>Onl<strong>in</strong>e</strong>-<strong>Quellen</strong> nahmen auf e<strong>in</strong> anderes journalistisches Internetangebot<br />
Bezug. Recht hoch liegt allerd<strong>in</strong>gs auch der Anteil <strong>von</strong> <strong>Quellen</strong> aus dem Social-Web-<br />
Sektor: Blogs, Twitter und vor allem soziale Netzwerke konnten ebenfalls signifikante<br />
Ergebnisse erzielen. Nimmt man diese nicht-professionellen <strong>Onl<strong>in</strong>e</strong>-<strong>Quellen</strong> zusammen,<br />
machen sie 16 <strong>von</strong> 39 angegebenen Internetquellen aus – e<strong>in</strong> durchaus beträchtlicher<br />
Anteil. Offenbar spielen Social-Web-Angebote bei der Recherche der SZ e<strong>in</strong>e<br />
ernstzunehmende Rolle. Auch die Webauftritte <strong>von</strong> NGOs oder Parteien wurden zitiert.<br />
Insgesamt bietet sich beim Blick auf die <strong>Onl<strong>in</strong>e</strong>-<strong>Quellen</strong> der SZ aber e<strong>in</strong> recht<br />
ausgewogenes Bild, ke<strong>in</strong>e <strong>Quellen</strong>art wurde zu mehr als 20% verwendet.<br />
Tabelle 7: Meistverwendete <strong>Onl<strong>in</strong>e</strong>-<strong>Quellen</strong> <strong>in</strong> der Süddeutschen Zeitung<br />
<strong>Onl<strong>in</strong>e</strong>-Quelle Erwähnungen<br />
Medien 7<br />
Nicht näher spezifiziert 6<br />
Soziales Netzwerk 6<br />
NGOs/Vere<strong>in</strong>e/Parteien/<br />
Verbände<br />
Blog 4<br />
Tabelle 8: Position, Intensität und Potenz der <strong>Onl<strong>in</strong>e</strong>-<strong>Quellen</strong><br />
bzw. Artikel mit <strong>Onl<strong>in</strong>e</strong>-<strong>Quellen</strong> <strong>in</strong> der Süddeutschen Zeitung<br />
1 -<br />
ger<strong>in</strong>g<br />
2 - mittel 3 -<br />
hoch<br />
5<br />
Arithmetisches<br />
Mittel<br />
Standardabweichung<br />
Position 6 15 15 2,3 0,7<br />
Intensität 12 19 5 1,8 0,7<br />
Potenz 19 13 4 1,6 1<br />
Die dom<strong>in</strong>ierende Art der Angabe ist die Nennung des Namen der Seite und wurde <strong>in</strong> mehr<br />
als der Hälfte der Fälle (21 Mal) verwendet. Jedoch wurde auch neunmal weder die Seite<br />
noch die URL genannt. Die Artikel, <strong>in</strong> denen <strong>Onl<strong>in</strong>e</strong>-<strong>Quellen</strong> zitiert werden, haben auf der<br />
jeweiligen Seite zu gleichen Teilen Aufmacherformat oder mittlere Größe (Tabelle 8). Der<br />
Durchschnittswert liegt hier bei 2,3, die Artikel genießen also e<strong>in</strong>en mittleren Stellenwert<br />
im Layout. Die Intensität der <strong>Quellen</strong> h<strong>in</strong>gegen ist ger<strong>in</strong>g: nur fünfmal dom<strong>in</strong>ierte e<strong>in</strong>e<br />
Quelle den Großteil des Artikels, woh<strong>in</strong>gegen e<strong>in</strong> Drittel der <strong>Quellen</strong> lediglich kurz<br />
erwähnt wurden. Der Durchschnittswert liegt somit bei 1,8. Folgerichtig fungierte mehr als<br />
die Hälfte der <strong>Quellen</strong> auch nur als ergänzende <strong>Quellen</strong> <strong>in</strong> der Komposition des Artikels.<br />
30
Viermal konnte immerh<strong>in</strong> beobachtet werden, dass die <strong>Onl<strong>in</strong>e</strong>-Quelle den Hauptanlass für<br />
die Berichterstattung bildete – der Durchschnittswert lag bei 1,6.<br />
6.3.2 Leipziger Volkszeitung<br />
Die Leipziger Volkszeitung nahm <strong>in</strong> 15 <strong>von</strong> 981 analysierten Artikeln Bezug auf <strong>Onl<strong>in</strong>e</strong>-<br />
<strong>Quellen</strong> im eigentlichen S<strong>in</strong>n, das s<strong>in</strong>d gerade e<strong>in</strong>mal 2,0% (Tabelle 9). Zehn der Artikel<br />
tauchten im Ressort Politik auf, das entsprach dort e<strong>in</strong>em Anteil <strong>von</strong> 5,1%. Außerdem<br />
wurden im Wirtschaftsressort e<strong>in</strong>mal (0,6%) und im Lokalteil viermal (0,8%)<br />
Internetseiten <strong>in</strong> Beiträgen zitiert. Auf der Titelseite verzichtete die LVZ vollends auf<br />
<strong>Onl<strong>in</strong>e</strong>-<strong>Quellen</strong>. Erstaunlich ist der recht hohe Anteil im Politikressort, dieser Trend<br />
vermag sich jedoch nicht <strong>in</strong> den übrigen Ressorts fortzusetzen. Während die Leipziger<br />
Volkszeitung also verhältnismäßig oft Serviceh<strong>in</strong>weise <strong>in</strong>s Internet setzt, spielen <strong>in</strong> der<br />
journalistischen Arbeit Internetquellen offenbar ke<strong>in</strong>e große Rolle. Zwölf Artikel enthielten<br />
jeweils e<strong>in</strong>e <strong>Onl<strong>in</strong>e</strong>-Quelle, dreimal wurden zwei <strong>Quellen</strong> aus dem Netz zitiert. Insgesamt<br />
wurden <strong>in</strong> der LVZ-Stichprobe 18 <strong>Onl<strong>in</strong>e</strong>-<strong>Quellen</strong> im engeren S<strong>in</strong>n verwendet.<br />
Tabelle 9: Artikel mit <strong>Onl<strong>in</strong>e</strong>-<strong>Quellen</strong> <strong>in</strong> der Leipziger Volkszeitung<br />
Analysierte<br />
Artikel<br />
Artikel mit <strong>Onl<strong>in</strong>e</strong>-<br />
<strong>Quellen</strong><br />
Anteil<br />
Seite 1 112 0 0,0%<br />
Politik 195 10 5,1%<br />
Wirtschaft 161 1 0,6%<br />
Lokales 513 4 0,8%<br />
Gesamt 981 15 2,0%<br />
Die <strong>Verwendung</strong> der <strong>Onl<strong>in</strong>e</strong>-<strong>Quellen</strong> bzgl. verschiedener Themen verteilt sich bei der LVZ<br />
sehr gleichmäßig auf niedrigem Niveau. Jeweils viermal wurden im Bereich Internationale<br />
Politik bzw. Lokalnachrichten <strong>Onl<strong>in</strong>e</strong>-<strong>Quellen</strong> zitiert. Die restlichen zehn <strong>Quellen</strong> verteilen<br />
sich auf die Sektoren Regierungspolitik, Landespolitik, Kommunalpolitik, Katastrophen,<br />
Privatwirtschaft, Soziales und lokale Term<strong>in</strong>e. In ke<strong>in</strong>em dieser Themenfelder wurden<br />
jedoch mehr als zwei Internetquellen zitiert. Zwar fällt es schwer, aufgrund der ger<strong>in</strong>gen<br />
Datenbasis belastbare Aussagen zu treffen, doch sticht auch hier der Schwerpunkt bei<br />
<strong>in</strong>ternationaler Politik-Berichterstattung <strong>in</strong>s Auge.<br />
Welche Internetquellen verwendet die Leipziger Volkszeitung? Hier kristallisiert sich e<strong>in</strong>e<br />
deutliche Bevorzugung <strong>von</strong> Internetangeboten heraus, die <strong>von</strong> NGOs, Vere<strong>in</strong>en, etc.<br />
31
verwaltet werden. Siebenmal wurden auf solche Angebote verwiesen, ke<strong>in</strong>e andere<br />
<strong>Quellen</strong>art wurde öfter zitiert. Das verwundert kaum, denn besonders im lokalen Bereich<br />
spielen Vere<strong>in</strong>e und ähnliche E<strong>in</strong>richtungen e<strong>in</strong>e gewichtige Rolle. Insgesamt wurden<br />
doppelt so viele professionelle <strong>Quellen</strong> (10) wie nicht-professionelle (5) zitiert.<br />
Benutzergenerierte Inhalte genießen bei der LVZ demnach ke<strong>in</strong>en hohen Stellenwert <strong>in</strong> der<br />
Recherche, die Zeitung zieht eher PR-Inhalte vor. Dreimal wurde zudem unspezifisch auf<br />
das Internet verwiesen.<br />
Die Hälfte der <strong>Onl<strong>in</strong>e</strong>-<strong>Quellen</strong> wurde mittels des Namens der Seite angegeben. Weitere<br />
Praktiken, die zu beobachten waren, waren die Nennung der URL bzw. der komplette<br />
Verzicht auf e<strong>in</strong>e nähere <strong>Quellen</strong>angabe. Seitenname und URL wurden h<strong>in</strong>gegen niemals <strong>in</strong><br />
Komb<strong>in</strong>ation genannt. Internetquellen wurden <strong>in</strong> der LVZ <strong>in</strong> erster L<strong>in</strong>ie <strong>in</strong> Artikeln <strong>von</strong><br />
mittlerer Bedeutung genannt, <strong>in</strong>sgesamt neunmal. Sechsmal tauchten sie <strong>in</strong> Aufmachern<br />
auf, nur dreimal <strong>in</strong> kle<strong>in</strong>eren Beiträgen (Tabelle 10). Daraus ergibt sich e<strong>in</strong> Durchschnitt<br />
<strong>von</strong> 2,2. Darüber h<strong>in</strong>aus wurde e<strong>in</strong>e recht ger<strong>in</strong>ge Intensität und Potenz der <strong>Onl<strong>in</strong>e</strong>-<strong>Quellen</strong><br />
festgestellt. Die Hälfte der <strong>Quellen</strong> wurde nur beiläufig <strong>in</strong> dem Artikel erwähnt<br />
(Durchschnitt 1,7), gleichzeitig war bei der Mehrzahl der <strong>Quellen</strong> im eigentlichen S<strong>in</strong>n<br />
festzustellen, dass sie im Artikel nicht über die Position e<strong>in</strong>er ergänzenden Quelle<br />
h<strong>in</strong>auskamen (Durchschnitt 1,6).<br />
Tabelle 10: Position, Intensität und Potenz der <strong>Onl<strong>in</strong>e</strong>-<strong>Quellen</strong><br />
bzw. Artikel mit <strong>Onl<strong>in</strong>e</strong>-<strong>Quellen</strong> <strong>in</strong> der Leipziger Volkszeitung<br />
1 -<br />
ger<strong>in</strong>g<br />
2 -<br />
mittel<br />
3 -<br />
hoch<br />
Arithmetisches<br />
Mittel<br />
Standardabweichung<br />
Position 3 9 6 2,2 0,7<br />
Intensität 9 5 4 1,7 0,8<br />
Potenz 11 2 5 1,6 0,9<br />
6.3.3 Dresdner Neueste Nachrichten<br />
Da die Dresdner Neuesten Nachrichten den Mantelteil, d.h. Seite 1, Politik, Wirtschaft und<br />
Feuilleton <strong>von</strong> der Leipziger Volkszeitung übernehmen, machte es hier nur S<strong>in</strong>n, den<br />
Lokalteil zu untersuchen. In der Stichprobe befanden sich 572 Artikel, <strong>von</strong> denen zehn<br />
<strong>Onl<strong>in</strong>e</strong>-<strong>Quellen</strong> enthielten (1,7%). Sämtliche diese Beiträge enthielten jeweils e<strong>in</strong>e<br />
Internetquelle und lieferten Nachrichten zum lokalen Geschehen <strong>in</strong> Dresden und<br />
Umgebung.<br />
32
Den überwältigenden Großteil der verwendeten <strong>Quellen</strong> bildeten hier professionelle<br />
<strong>Quellen</strong>: Seiten <strong>von</strong> NGOs, Vere<strong>in</strong>en und Parteien fanden viermal Erwähnung, Behörden<br />
dreimal, Unternehmen immerh<strong>in</strong> noch zweimal. Ansonsten wurde lediglich e<strong>in</strong>mal auf e<strong>in</strong><br />
soziales Netzwerk Bezug genommen. Diese <strong>Quellen</strong> wurden zur Hälfte mit Nennung der<br />
Seite angegeben, bei der ger<strong>in</strong>gen Fallzahl bleiben die Unterschiede zu den übrigen<br />
Alternativen aber recht aussagelos. Jedoch gab es ke<strong>in</strong>e Seite, die nur mit der URL zitiert<br />
wurde.<br />
Die Artikel mit <strong>Onl<strong>in</strong>e</strong>-<strong>Quellen</strong> hatten im Layout der DNN jeweils e<strong>in</strong>e eher ger<strong>in</strong>ge<br />
Bedeutung (Durchschnitt 1,7), lediglich e<strong>in</strong>mal enthielt e<strong>in</strong> Aufmacher-Artikel e<strong>in</strong>en<br />
journalistischen Internetverweis (Tabelle 11). Vergleichsmäßig hoch liegt dagegen die<br />
Intensität der <strong>Quellen</strong> (Durchschnitt 2,4): ganze siebenmal dom<strong>in</strong>ierte e<strong>in</strong>e Internetquelle<br />
den jeweiligen Artikel. Den gleichen Durchschnittswert ergab die Analyse der Potenz –<br />
sieben <strong>Quellen</strong> bildeten die Grundlage für den Artikel, was ebenfalls als hoher Anteil<br />
anzusehen ist.<br />
Tabelle 11: Position, Intensität und Potenz der <strong>Onl<strong>in</strong>e</strong>-<strong>Quellen</strong><br />
bzw. Artikel mit <strong>Onl<strong>in</strong>e</strong>-<strong>Quellen</strong> <strong>in</strong> den Dresdner Neuesten Nachrichten<br />
1 -<br />
ger<strong>in</strong>g<br />
2 - mittel 3 -<br />
hoch<br />
Arithmetisches<br />
Mittel<br />
Standardabweichung<br />
Position 4 5 1 1,7 0,6<br />
Intensität 2 1 7 2,4 0,8<br />
Potenz 3 0 7 2,4 0,9<br />
6.4 Vergleich der Zeitungen<br />
Im Vergleich der analysierten Zeitungen zeigt sich, dass die Süddeutsche Zeitung <strong>von</strong> allen<br />
Publikationen am häufigsten <strong>in</strong> ihren Artikeln <strong>Onl<strong>in</strong>e</strong>-<strong>Quellen</strong> zitiert. Das Gefälle zu den<br />
übrigen Zeitungen lässt sich durch die unterschiedliche Ausrichtung erklären: während die<br />
SZ als überregionale Zeitung sehr stark auf nationale und globale Themen <strong>in</strong> den<br />
Vordergrund rückt, s<strong>in</strong>d die LVZ und die DNN als Regional- bzw. Lokalzeitung eher auf<br />
Themen aus ihrem deutlich kle<strong>in</strong>eren Verbreitungsgebiet fokussiert. Lokale Themen<br />
wiederum lassen sich meist besser vor Ort und persönlich recherchieren als im<br />
weltumspannende Internet, dass auf der anderen Seite für Zeitungen wie die Süddeutsche<br />
e<strong>in</strong>e wichtige Rolle spielt.<br />
Insgesamt fällt auch der deutlich differenziertere Umgang mit Internetquellen bei der<br />
33
Süddeutschen Zeitung auf. Die Zeitung verwendet deutlich häufiger <strong>Quellen</strong> aus dem<br />
Social Web, was für e<strong>in</strong>e gute Kenntnis des Internets durch die Redakteure und die<br />
Recherchestärke der Redaktion <strong>in</strong>sgesamt spricht. Auch kann hier e<strong>in</strong>e gewisse<br />
Fortschrittlichkeit <strong>in</strong> der Recherche konstatiert werden, während die LVZ noch e<strong>in</strong>e recht<br />
konservative L<strong>in</strong>ie fährt, <strong>in</strong>dem sie <strong>in</strong> erster L<strong>in</strong>ie professionelle <strong>Quellen</strong> (hier vor allem<br />
NGOs/Vere<strong>in</strong>e/Verbände) zitiert – und zwar auch im überregionalen Teil. Bei den DNN<br />
wiederum kann die fast ausschließliche <strong>Verwendung</strong> professioneller <strong>Quellen</strong> mit der<br />
lokalen Ausrichtung erklärt werden: auf lokaler Ebene spielen alltägliche Verlautbarungen<br />
<strong>von</strong> örtlichen Vere<strong>in</strong>en u.ä. e<strong>in</strong>e größere Rolle als teils anonyme Äußerungen im Internet.<br />
Alle Zeitungen kennzeichneten die verwendeten <strong>Onl<strong>in</strong>e</strong>-<strong>Quellen</strong> überwiegend durch die<br />
Nennung des Seitennamens. Diese Art der <strong>Quellen</strong>angabe ersche<strong>in</strong>t für Tageszeitungen<br />
auch als die s<strong>in</strong>nvollste. An dieser Stelle ergab die Untersuchung ke<strong>in</strong>e relevanten<br />
Unterschiede. Kritisch muss allerd<strong>in</strong>gs angemerkt werden, dass alle Blätter regelmäßig das<br />
Internet als Quelle nannten, ohne die Herkunft der Information näher zu spezifizieren.<br />
Dieses Vorgehen beraubt den Leser der Möglichkeit, sich selbst mit der Quelle näher<br />
ause<strong>in</strong>anderzusetzen. E<strong>in</strong> solches Vorgehen verwundert gerade bei der Süddeutschen<br />
Zeitung, die als „Qualitätszeitung“ hier zu besonderer Sorgfalt verpflichtet wäre und<br />
dennoch <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Viertel der Fälle auf e<strong>in</strong>e präzise <strong>Quellen</strong>angabe verzichtete.<br />
Bei den übrigen Merkmalen ließen sich ke<strong>in</strong>e größeren Unterschiede feststellen. Im<br />
Durchschnitt wurden die Artikel mit <strong>Onl<strong>in</strong>e</strong>-<strong>Quellen</strong> so platziert, dass sie zwar nicht sofort<br />
<strong>in</strong>s Auge fielen, aber dennoch e<strong>in</strong>e wichtige Rolle auf der Seite spielten. Bemerkenswert<br />
ist, dass die DNN, wenn sie <strong>Onl<strong>in</strong>e</strong>-<strong>Quellen</strong> verwenden, diesen auch e<strong>in</strong>en recht hohen<br />
Stellenwert <strong>in</strong>nerhalb des Artikels e<strong>in</strong>räumen. Die <strong>Quellen</strong> wurden hier <strong>in</strong> den Beiträgen<br />
deutlich ausführlicher behandelt als <strong>in</strong> LVZ und SZ, die ihre <strong>Onl<strong>in</strong>e</strong>-<strong>Quellen</strong> meist nur<br />
beiläufig nennen. Offenbar wird im Lokalen also eher auf e<strong>in</strong>e qualitativ starke<br />
<strong>Verwendung</strong> <strong>von</strong> <strong>Onl<strong>in</strong>e</strong>-<strong>Quellen</strong> gesetzt – wenn sie vorkommen, s<strong>in</strong>d sie meist auch<br />
elementar wichtig für den Inhalt des Artikels.<br />
Es muss noch e<strong>in</strong>mal angemerkt werden, dass die Ergebnisse weder für die Zeitungen<br />
selbst noch für bestimmte Zeitungstypen repräsentativ se<strong>in</strong> können. Gleichwohl lassen sich<br />
auf dieser Basis erste Rückschlüsse ziehen. Verallgeme<strong>in</strong>ert man also die Ergebnisse bzgl.<br />
der e<strong>in</strong>zelnen Tageszeitungen auf die Zeitungstypen, für die sie <strong>in</strong> dieser Untersuchung<br />
exemplarisch standen (überregionale/regionale/lokale Presse), so kann die<br />
Schlussfolgerung gezogen werden, dass im überregionalen Journalismus <strong>Onl<strong>in</strong>e</strong>-<strong>Quellen</strong><br />
34
e<strong>in</strong>en deutlich höheren Stellenwert genießen. Sie werden häufiger und differenzierter<br />
verwendet, was auch zu dem Begriff des „Qualitätsjournalismus“, der oft mit diesen<br />
Zeitungen verbunden wird, passt. Auch e<strong>in</strong> anderer Begriff, der gern als Kategorie für die<br />
überregionale Presse verwendet wird – der des Leitmediums – kann <strong>in</strong> diesem<br />
Zusammenhang <strong>in</strong>teressant se<strong>in</strong>: offenbar machen sich die großen Zeitungen als erstes die<br />
neuen Möglichkeiten der Recherche zunutze und setzen damit e<strong>in</strong>en Trend, der evtl. <strong>in</strong><br />
Zukunft auch <strong>von</strong> den übrigen, kle<strong>in</strong>eren Redaktionen aufgenommen werden wird.<br />
Im Unterschied zur überregionalen Presse konzentrieren sich Regional- und<br />
Lokalzeitungen eher auf Ereignisse <strong>in</strong> ihrem geografischen Ersche<strong>in</strong>ungsraum. Daraus<br />
folgt <strong>in</strong> vielen Fällen, dass sich nach wie vor herkömmliche Recherchetechniken als<br />
s<strong>in</strong>nvoller darstellen – das berichtenswerte Geschehen spielt sich besonders im<br />
Lokalressort eher vor Ort als im Internet ab, zumal der Kontakt zwischen <strong>Quellen</strong> und<br />
Journalisten auf dieser Ebene deutlich e<strong>in</strong>facher herzustellen ist. Allerd<strong>in</strong>gs liegt auch die<br />
Vermutung nahe, dass Regional- und Lokalzeitungen <strong>Onl<strong>in</strong>e</strong>-<strong>Quellen</strong> noch mit Skepsis<br />
begegnen und diese daher eher spärlich und nur im E<strong>in</strong>zelfall, falls ke<strong>in</strong>e weiteren <strong>Quellen</strong><br />
verfügbar s<strong>in</strong>d, verwenden.<br />
35
7. Typologie <strong>von</strong> <strong>Onl<strong>in</strong>e</strong>-<strong>Quellen</strong><br />
<strong>Onl<strong>in</strong>e</strong>-<strong>Quellen</strong> werden im Journalismus offensichtlich zu verschiedenen Zwecken und auf<br />
verschiedene Arten e<strong>in</strong>gesetzt. Auf der Basis der vorangegangenen Untersuchung lässt sich<br />
e<strong>in</strong>e Typologie <strong>von</strong> <strong>Onl<strong>in</strong>e</strong>-<strong>Quellen</strong> entwerfen, die zeigen soll, wie und wofür welche<br />
Internetquellen <strong>in</strong> <strong>redaktionellen</strong> <strong>Texten</strong> verwendet werden (können). Da e<strong>in</strong>e re<strong>in</strong><br />
quantitative Studie <strong>in</strong> diesem Umfang zwar e<strong>in</strong>en Überblick bieten, aber nur recht<br />
e<strong>in</strong>geschränkt über nähere qualitative Merkmale Auskunft geben kann, fließen auch<br />
weitere Beobachtungen und Schlussfolgerungen, die sich im Zuge der empirischen wie<br />
theoretischen Arbeit ergaben, <strong>in</strong> die Typologie mit e<strong>in</strong>.<br />
Typ 1: <strong>Onl<strong>in</strong>e</strong>-<strong>Quellen</strong> als „Schlüsselloch“<br />
Redaktionen verwenden <strong>Onl<strong>in</strong>e</strong>-<strong>Quellen</strong>, wenn konventionelle Methoden wie bspw.<br />
Korrespondentenberichte oder Meldungen <strong>von</strong> Nachrichtenagenturen nicht erhältlich oder<br />
nicht verlässlich s<strong>in</strong>d. Besonders oft ist dies bei Berichten aus Ländern, <strong>in</strong> denen totalitäre<br />
Regime herrschen und Me<strong>in</strong>ungs- und Pressefreiheit stark e<strong>in</strong>geschränkt s<strong>in</strong>d, der Fall. In<br />
diesen Situationen gew<strong>in</strong>nen <strong>in</strong>sbesondere Inhalte, die <strong>von</strong> <strong>in</strong>offiziellen <strong>Quellen</strong> e<strong>in</strong>gestellt<br />
werden, an Gewicht: Blogs <strong>von</strong> Oppositionsbewegungen oder deren Twitter-Accounts<br />
ersetzen professionelle Berichterstattung und werden so zum „Schlüsselloch“, durch das<br />
Journalisten und Lesern e<strong>in</strong> E<strong>in</strong>blick <strong>in</strong> für gewöhnlich abgeriegelte Gebiete ermöglicht<br />
wird. Dieser Typus macht die besondere Rolle, die sowohl das Internet als auch der<br />
Journalismus für die Demokratie, besonders im Bereich der Grundrechte Presse- und<br />
Me<strong>in</strong>ungsfreiheit, spielen kann und spielen soll, deutlich. Von der <strong>Verwendung</strong> solcher<br />
<strong>Quellen</strong> lässt sich auf e<strong>in</strong>e gewisse Recherchestärke der Redaktion schließen – <strong>in</strong> der<br />
Untersuchung wurden diese <strong>Onl<strong>in</strong>e</strong>-<strong>Quellen</strong> vor allem <strong>von</strong> der Süddeutschen Zeitung<br />
zitiert.<br />
M<strong>in</strong>destens der Vollständigkeit halber muss allerd<strong>in</strong>gs auch angemerkt werden, dass im<br />
Untersuchungszeitraum die weltpolitische Großwetterlage den Schlüsselloch-Effekt<br />
besonders hervortreten ließ: die Revolutionen <strong>in</strong> Nordafrika (Libyen, Ägypten, Tunesien)<br />
<strong>von</strong> Dezember 2010 bis zum Ende des untersuchten Zeitraums wurden maßgeblich <strong>von</strong><br />
Bloggern und Twitterusern getragen, was diesen <strong>Quellen</strong> e<strong>in</strong>e besondere Relevanz verlieh<br />
und das Ergebnis womöglich leicht verzerrt.<br />
36
Typ 2: <strong>Onl<strong>in</strong>e</strong>-<strong>Quellen</strong> als Ereignis<br />
Das Internet als Plattform zu sehen, auf der Informationen lediglich als Reaktion auf<br />
Geschehen bereitgestellt werden, greift zu kurz. Indem das Internet immer größeren<br />
E<strong>in</strong>fluss auf die systemischen Zusammenhänge der Gesellschaft und die Welt des<br />
e<strong>in</strong>zelnen Bürgers gew<strong>in</strong>nt, wird es selbst zum Ereignis und gew<strong>in</strong>nt an Nachrichtenwert.<br />
Dementsprechend wird auch über Entwicklungen <strong>in</strong>nerhalb des Internets berichtet: die<br />
<strong>Onl<strong>in</strong>e</strong>-Aktivitäten der Bundeskanzler<strong>in</strong>, Morddrohungen <strong>in</strong> sozialen Netzwerken oder<br />
umstrittene Bilder und Texte, die auf den Webseiten <strong>von</strong> Politikern und Parteien<br />
auftauchen.<br />
All diese <strong>Quellen</strong> werden zunächst selbst zum Ereignis und dann zur Nachricht, <strong>in</strong>dem sie<br />
die gängigen Relevanzkriterien (vgl. Eilders 1997: 19-51) erfüllen. Bildet das Internet die<br />
Grundlage für Berichterstattung, so ist allerd<strong>in</strong>gs scharf darauf zu achten, ob es sich<br />
tatsächlich um <strong>Quellen</strong> handelt oder ob lediglich über Internetangebote u.ä. berichtet wird,<br />
ohne direkt Bezug auf <strong>Onl<strong>in</strong>e</strong>-<strong>Quellen</strong> zu nehmen. Erst wenn auf Internetquellen verwiesen<br />
bzw. aus dem Netz zitiert wird, kann <strong>von</strong> <strong>Onl<strong>in</strong>e</strong>-<strong>Quellen</strong> als Ereignis gesprochen werden.<br />
Andererseits ist lediglich das Internet an sich Gegenstand der Berichterstattung. Diese<br />
Unterscheidung ist, sofern sie wirklich nötig wird, wie z.B. zu Def<strong>in</strong>itionszwecken im<br />
wissenschaftlichen Kontext, oft fließend und somit nicht immer e<strong>in</strong>fach zu treffen.<br />
Typ 3: <strong>Onl<strong>in</strong>e</strong>-<strong>Quellen</strong> als Informationslieferant<br />
Dieser Typus entspricht wohl der wichtigsten Funktion <strong>von</strong> <strong>Quellen</strong>, die auch als deren<br />
herausstechendes Merkmal <strong>in</strong> dieser Arbeit genannt wurde: <strong>Quellen</strong> sollen dem<br />
Journalisten Informationen über Geschehnisse, Vorgänge, Ansichten und Argumente<br />
vermitteln, die ihm sonst verborgen geblieben wären und die <strong>in</strong> Artikel e<strong>in</strong>gearbeitet<br />
werden. Das Design der Studie br<strong>in</strong>gt es mit sich, dass die <strong>Onl<strong>in</strong>e</strong>-<strong>Quellen</strong> hier nicht nur<br />
als Informationslieferant für den Journalisten gelten können, sondern auch für das<br />
Publikum. Durch die explizite Nennung der Quelle wird der Ursprung e<strong>in</strong>er Information<br />
auch für den Leser nachvollziehbar.<br />
<strong>Onl<strong>in</strong>e</strong>-<strong>Quellen</strong>, die <strong>in</strong> erster L<strong>in</strong>ie als Informationslieferant fungieren, bieten vor allem<br />
Informationen, die auch über klassische Wege beschafft werden könnten: Zahlen, Daten,<br />
Namen, etc. Hier erweist sich das Internet mit se<strong>in</strong>en schnellen und unkomplizierten<br />
Zugriffsmöglichkeiten auf große Datenmengen als geeignetes Mittel der<br />
Informationsbeschaffung. Mit den Ergebnissen der durchgeführten Inhaltsanalyse lässt sich<br />
37
dieser Typ allerd<strong>in</strong>gs nur e<strong>in</strong>geschränkt nachweisen. Als Erklärung dafür kann angeführt<br />
werden, dass die Informationen oft ke<strong>in</strong>e ausdrückliche <strong>Quellen</strong>nennung erfordern, da es<br />
sich um allgeme<strong>in</strong> bekannte und zugängliche Fakten handelt, beispielsweise wenn das<br />
Alter e<strong>in</strong>es Politikers mittels Internet recherchiert wird. Zudem lässt die Diskrepanz<br />
zwischen zitierten <strong>Onl<strong>in</strong>e</strong>-<strong>Quellen</strong> und der Nutzungshäufigkeit <strong>von</strong> z.B.<br />
Unternehmensseiten durch Journalisten, die e<strong>in</strong>schlägige Befragungs- und<br />
Beobachtungsstudien (vgl. Keel/Bernet 2005; Machill/Beiler/Zenker 2007; Keel/Bernet<br />
2009) ausweisen, vermuten, dass Informationen, die häufig auch außerhalb des Internets<br />
(etwa als Pressemitteilung) vorliegen, <strong>von</strong> diesen Seiten <strong>in</strong> Artikel übernommen werden,<br />
ohne direkt auf deren Ursprung im Internet zu verweisen. E<strong>in</strong> solches Vorgehen lässt sich<br />
mit der Inhaltsanalyse nicht nachvollziehen, sollte aber auch <strong>in</strong> dieser Typologie nicht<br />
unterschlagen werden.<br />
Typ 4: <strong>Onl<strong>in</strong>e</strong>-<strong>Quellen</strong> als Me<strong>in</strong>ungsbild<br />
Da das Internet jedermann die Möglichkeit e<strong>in</strong>räumt, unkompliziert und schnell se<strong>in</strong>e<br />
Ansichten zu äußern und zu verbreiten, bietet es e<strong>in</strong>en enormen Pluralismus an<br />
Me<strong>in</strong>ungen, zum<strong>in</strong>dest aber an Me<strong>in</strong>ungsäußerungen. Journalisten, denen oft der<br />
e<strong>in</strong>geschränkte Wahrnehmungsradius e<strong>in</strong>er abgeschiedenen Elite unterstellt wird, können<br />
das Netz nutzen, um sich e<strong>in</strong>en Überblick über das aktuell vorherrschende Me<strong>in</strong>ungsbild<br />
zu Themen, über die berichtet wird, zu verschaffen. Befragungen zeigen, dass dies<br />
durchaus auch <strong>in</strong> der Praxis geschieht (vgl. Neuberger/Nuernbergk/Rischke 2007; Welker<br />
2007: 101).<br />
Besonders gut für diesen Typus eignen sich Plattformen, die sich durch die Partizipation<br />
der User konstituieren oder eigens zum Zweck <strong>von</strong> Me<strong>in</strong>ungsaustausch und -äußerung<br />
geschaffen wurden – wie soziale Netzwerke, Blogs und Foren. Hier lässt sich e<strong>in</strong><br />
allgeme<strong>in</strong>es Me<strong>in</strong>ungsklima zu aktuellen Themen feststellen, welches allerd<strong>in</strong>gs stets auf<br />
subjektiven Wahrnehmungen des Redakteurs fußt und ke<strong>in</strong>erlei Anspruch auf<br />
Repräsentativität erheben kann. Dennoch können so Tendenzen <strong>in</strong>nerhalb der <strong>Onl<strong>in</strong>e</strong>-<br />
Community beobachtet werden. Es sollte dabei aber auch beachtet werden, dass diese<br />
Geme<strong>in</strong>schaft meist nur e<strong>in</strong>en sehr kle<strong>in</strong>en Teil der Bevölkerung abbildet und sich durch<br />
spezielle Merkmale auszeichnet. So wird beispielsweise <strong>in</strong> Fragen der Netzpolitik unter<br />
den „Netizens“ e<strong>in</strong>e andere, wenngleich womöglich auch sehr viel differenzierte und<br />
fachkundigere Me<strong>in</strong>ung vertreten werden als vom Rest der Bevölkerung. Außerdem<br />
38
können illustrative Zitate <strong>von</strong> E<strong>in</strong>zelpersonen ausf<strong>in</strong>dig gemacht werden. Hier besteht<br />
allerd<strong>in</strong>gs die verschärfte Gefahr, besonders extreme Äußerungen, die ke<strong>in</strong>eswegs der<br />
vorherrschenden Me<strong>in</strong>ung <strong>in</strong>nerhalb der Netzgeme<strong>in</strong>de entsprechen, <strong>in</strong> den Vordergrund zu<br />
rücken.<br />
Der <strong>Verwendung</strong> solcher <strong>Quellen</strong> geht e<strong>in</strong>e relativ aufwändige Recherche voraus,<br />
manchmal erfordert sie auch e<strong>in</strong>e gute Vernetzung des Redakteurs <strong>in</strong> den relevanten<br />
Netzwerken und <strong>in</strong> jedem Fall e<strong>in</strong>en besonders reflektierten Umgang mit dem Internet. Aus<br />
theoretischer Sicht s<strong>in</strong>d Zitate aus nicht-professionellen <strong>Quellen</strong> zu begrüßen: sie verleihen<br />
Teilnehmern, die im öffentlichen Diskurs für gewöhnlich unterrepräsentiert s<strong>in</strong>d, e<strong>in</strong>e<br />
Stimme.<br />
Typ 5: <strong>Onl<strong>in</strong>e</strong>-<strong>Quellen</strong> als Service<br />
Nicht immer verwenden Zeitungen <strong>Onl<strong>in</strong>e</strong>-<strong>Quellen</strong> als streng journalistisches Mittel. In<br />
vielen Fällen dient der Verweis auf Internetangebote, meistens außerhalb des eigentlichen<br />
Artikels, als Service, der dem Leser den Weg zu weiterführenden Informationen zum<br />
Thema weisen soll. In der Studie konnte beobachtet werden, dass diese „L<strong>in</strong>ks“ meist zu<br />
den Seiten <strong>von</strong> NGOs oder aber zu Internetseiten des Mediums selbst führen. Ersteres kann<br />
als Hilfestellung für den Leser <strong>in</strong>terpretiert werden, da vor allem <strong>in</strong> kurzen Artikeln meist<br />
nicht alle Informationen zu dem Thema untergebracht werden können und der Leser die<br />
fehlenden Stücke schnell onl<strong>in</strong>e f<strong>in</strong>den kann. Beim Verweis auf die eigene Webseite<br />
schw<strong>in</strong>gt h<strong>in</strong>gegen der unangenehme Beigeschmack mit, die Zeitung wolle so höhere<br />
Klickzahlen für ihre Internetpräsenz generieren.<br />
Vor allem LVZ und DNN setzten auf Serviceh<strong>in</strong>weise, was auf e<strong>in</strong>e weite Verbreitung<br />
dieser Art <strong>von</strong> <strong>Onl<strong>in</strong>e</strong>-<strong>Quellen</strong> bei Regional- und Lokalzeitungen schließen lässt. Versteht<br />
man den Anspruch des Journalismus auf dieser geografischen Ebene so, dass – mit Haller<br />
(2003) gesprochen – die „Leser über alles Wichtige […] so <strong>in</strong>s Bild gesetzt werden, dass<br />
sie das aktuelle Geschehen verstehen (begreifen, e<strong>in</strong>ordnen und bewerten) und – im<br />
Lokalen und Regionalen – für sich verwerten können“, dann können Internetverweise<br />
dieser Art durchaus als Beitrag zum Erfüllen der Orientierungs- und Nutzwertfunktion des<br />
(Lokal-)Journalismus gewertet werden.<br />
39
8. Zusammenfassung und Fazit<br />
Im journalistischen Arbeitsalltag hat das Internet <strong>in</strong> den vergangenen Jahren stetig an<br />
Bedeutung gewonnen: auf der e<strong>in</strong>en Seite s<strong>in</strong>d immer mehr relevante Inhalte im Netz<br />
verfügbar, auf der anderen Seite wird das Internet folgerichtig immer stärker <strong>von</strong><br />
Journalisten zu Recherchezwecken genutzt. Allerd<strong>in</strong>gs schlagen sich diese Entwicklungen<br />
nur sehr e<strong>in</strong>geschränkt <strong>in</strong> den journalistischen Produkten nieder, die für den Leser<br />
zugänglich s<strong>in</strong>d, wie die durchgeführte Inhaltsanalyse zeigte. In den drei analysierten<br />
Zeitungen enthielten lediglich 2,2% der Artikel <strong>Onl<strong>in</strong>e</strong>-<strong>Quellen</strong> im eigentlichen S<strong>in</strong>n,<br />
rechnet man die Serviceh<strong>in</strong>weise h<strong>in</strong>zu, s<strong>in</strong>d es immerh<strong>in</strong> 7,1%. Die meisten dieser<br />
<strong>Quellen</strong> kamen im Politik-Ressort zum E<strong>in</strong>satz, hier war es vor allem die Berichterstattung<br />
über die Internationale Politik, <strong>in</strong> der vermehrt die <strong>Verwendung</strong> <strong>von</strong> Internetangeboten<br />
beobachtet werden konnte. Professionelle und nicht-professionelle <strong>Quellen</strong> hielten sich<br />
dabei größtenteils die Waage, am häufigsten wurden Seiten <strong>von</strong> NGOs/Verbänden/Vere<strong>in</strong>en<br />
und Inhalte aus sozialen Netzwerken zitiert.<br />
Die Analyse der Zeitungen ergab, dass die Süddeutsche Zeitung deutlich öfter <strong>Onl<strong>in</strong>e</strong>-<br />
<strong>Quellen</strong> <strong>in</strong> ihren Artikeln nennt als es Leipziger Volkszeitung und Dresdner Neueste<br />
Nachrichten tun. Auch greift die SZ tendenziell auf e<strong>in</strong> breiteres Spektrum an <strong>Onl<strong>in</strong>e</strong>-<br />
<strong>Quellen</strong> zu. Bei den Dresdner Neuesten Nachrichten werden h<strong>in</strong>gegen nur sehr selten<br />
Internetquellen verwendet. Allerd<strong>in</strong>gs neigen DNN und LVZ zu e<strong>in</strong>er starken <strong>Verwendung</strong><br />
<strong>von</strong> Serviceh<strong>in</strong>weisen.<br />
Die stetig steigende Nutzung des Internets durch Journalisten lässt sich für den Leser also<br />
kaum nachvollziehen: das Netz taucht nach wie vor nur im Ausnahmefall als Quelle <strong>in</strong><br />
journalistische Beiträgen auf. Wie lässt sich diese Diskrepanz erklären? Sicherlich muss<br />
sich nicht jede journalistische Handlung im Internet auch im Endprodukt dokumentiert<br />
f<strong>in</strong>den, denn oft dient die Internetrecherche lediglich dem Auff<strong>in</strong>den <strong>von</strong> H<strong>in</strong>tergrund- oder<br />
Kontakt<strong>in</strong>formationen. Trotzdem zeigen die Untersuchungsergebnisse, dass das Internet als<br />
Quelle immer noch deutlich unterrepräsentiert ist. Hier ergeben sich Fragen, die mit der<br />
Inhaltsanalyse als Methode bzw. den Möglichkeiten e<strong>in</strong>er Bachelorarbeit nicht zu<br />
beantworten waren und an welche die Journalismusforschung anschließen kann: Werden<br />
Informationen aus dem Internet verwendet, ohne dass auf die Quelle h<strong>in</strong>gewiesen wird?<br />
Warum werden Internetquellen tendenziell selten zitiert, mangelt es an Vertrauen? E<strong>in</strong>e<br />
Methodenkomb<strong>in</strong>ation aus Beobachtung, Befragung und Inhaltsanalyse könnte darüber<br />
Aufschluss geben, während sich an dieser Stelle nur Korrelationen zu anderen Studien<br />
40
herstellen lassen.<br />
Allerd<strong>in</strong>gs sollte auch noch e<strong>in</strong>mal darauf h<strong>in</strong>gewiesen werden, dass im Journalismus der<br />
Rückgriff auf <strong>Onl<strong>in</strong>e</strong>-<strong>Quellen</strong> nicht per se e<strong>in</strong> Indikator für Qualität se<strong>in</strong> muss. Es lässt sich<br />
daraus zwar teilweise schließen, wie vertraut Redaktionen mit den Möglichkeiten des<br />
Internets s<strong>in</strong>d, wie sie sich diese zunutze machen und wie offen sie E<strong>in</strong>flüssen aus dem<br />
Netz gegenüberstehen, über die Qualität der <strong>Quellen</strong> und der dar<strong>in</strong> enthaltenen<br />
Informationen sagt deren bloße <strong>Verwendung</strong> allerd<strong>in</strong>gs noch nichts aus. Vielmehr ist es<br />
unabd<strong>in</strong>gbar, dass Journalisten – egal aus welchen Ressorts und <strong>von</strong> welchen Medien –<br />
sich e<strong>in</strong>en verantwortungsvollen und reflektierten Umgang mit dem Internet und se<strong>in</strong>en<br />
Inhalten aneignen. Dazu gehört e<strong>in</strong>erseits technische Kompetenz, aber auch die Fähigkeit,<br />
die dargebotenen Informationen bzgl. ihrer Glaubwürdigkeit und Qualität e<strong>in</strong>zuschätzen.<br />
Diese <strong>Quellen</strong>kritik ist im Internet oft noch dr<strong>in</strong>gender als bei herkömmlichen <strong>Quellen</strong>.<br />
Nur so kann gewährleistet werden, dass die Möglichkeiten des WWW für den modernen<br />
Journalismus ausgeschöpft werden, ohne dass er se<strong>in</strong>e gesellschaftlichen Pflichten<br />
vernachlässigt.<br />
41
9. Literaturverzeichnis<br />
Arnold, Klaus (2009): Qualitätsjournalismus. Die Zeitung und ihr Publikum. Konstanz:<br />
UVK.<br />
Baerns, Barbara (1985): Öffentlichkeitsarbeit oder Journalismus. Zum E<strong>in</strong>fluss im<br />
Mediensystem. Köln: Wissenschaft und Politik.<br />
Bentele, Günter/Liebert, Tobias/Seel<strong>in</strong>g, Stefan (1997): Von der Determ<strong>in</strong>ation zur<br />
Intereffikation. E<strong>in</strong> <strong>in</strong>tegriertes Modell zum Verhältnis <strong>von</strong> Public Relations und<br />
Journalismus. In: Bentele, Günter/Haller, Michael (Hrsg.): Aktuelle Entstehung <strong>von</strong><br />
Öffentlichkeit. Akteure – Strukturen – Veränderungen. Konstanz: UVK, S. 225-250.<br />
Berger, Jens (2009): Aufstand der Generation Twitter. <strong>Onl<strong>in</strong>e</strong>:<br />
http://derstandard.at/1244460878451/Jens-Berger-Aufstand-der-Generation-Twitter (letzter<br />
Aufruf: 10. Juni 2011).<br />
Bildblog (2009): Wie ich Freiherr <strong>von</strong> Guttenberg zu Wilhelm machte. <strong>Onl<strong>in</strong>e</strong>:<br />
http://www.bildblog.de/5704/wie-ich-freiherr-<strong>von</strong>-guttenberg-zu-wilhelm-machte/ (letzter<br />
Aufruf: 10. Juni 2011).<br />
Brendel, Matthias/Brendel, Frank (2004): Richtig recherchieren. Wie Profis Informationen<br />
besorgen: e<strong>in</strong> Handbuch für Journalisten, Rechercheure und Öffentlichkeitsarbeiter (6.<br />
Aufl.). Frankfurt am Ma<strong>in</strong>: FAZ-Institut.<br />
Bruns, Peter (2005): Gatewatch<strong>in</strong>g. Collaborative <strong>Onl<strong>in</strong>e</strong> News Production. New York:<br />
Peter Lang.<br />
Bucher, Hans-Jürgen/Büffel, Steffen (2005): Vom Gatekeeper-Journalismus zum Netzwerk-<br />
Journalismus. Weblogs als Beispiel journalistischen Wandels unter den Bed<strong>in</strong>gungen<br />
globaler Weltorganisation. In: Behmer, Markus/Blöbaum, Bernd/Scholl, Arm<strong>in</strong>/Stöber,<br />
Rudolf: Journalismus und Wandel. Analysedimensionen, Konzepte, Fallstudien.<br />
Wiesbaden: VS Verlag, S. 85-122.<br />
Busemann, Katr<strong>in</strong>/Gscheidle, Mart<strong>in</strong> (2009): Web 2.0: Communitys bei jungen Nutzern<br />
beliebt. In: Media Perspektiven, Heft 7, S. 356-364.<br />
Donsbach, Wolfgang (1993): Redaktionelle Kontrolle im Journalismus. E<strong>in</strong> <strong>in</strong>ternationaler<br />
Vergleich. In: Mahle, Walter A.: Journalisten <strong>in</strong> Deutschland. Nationale und <strong>in</strong>ternationale<br />
Vergleiche und Perspektiven. München: Ölschläger, S. 143-160.<br />
Eberwe<strong>in</strong>, Tobias (2008): Informationsbeschaffung 2.0. Weblogs als Quelle<br />
journalistischer Recherche. <strong>Onl<strong>in</strong>e</strong>: http://www.coolepark.de/wp-content/uploads/2008/01/<br />
42
weblogs-als-quelle-journalistischer-recherche-prepr<strong>in</strong>t.pdf (letzter Aufruf: 10. Juni 2011).<br />
Eilders, Christiane (1997): Nachrichtenfaktoren und Rezeption. E<strong>in</strong>e empirische Analyse<br />
zur Auswahl und Verarbeitung politischer Information. Opladen: Westdeutscher Verlag.<br />
Früh, Werner (2007): Inhaltsanalyse. Theorie und Praxis (6. Aufl.). Konstanz: UVK.<br />
Habermas, Jürgen (2008): Hat die Demokratie noch e<strong>in</strong>e epistemische Dimension?<br />
Empirische Forschung und normative Theorie. In: ders. (Hrsg.): Ach, Europa. Kle<strong>in</strong>e<br />
politische Schriften. Frankfurt am Ma<strong>in</strong>: Suhrkamp, S. 138-191.<br />
Haller, Michael (1994): Recherche und Nachrichtenproduktion als Konstruktionsprozesse.<br />
In: Weischenberg, Siegfried/Merten, Klaus/Schmidt, Siegfried J.: Die Wirklichkeit der<br />
Medien. E<strong>in</strong>e E<strong>in</strong>führung <strong>in</strong> die Kommunikationswissenschaft. Opladen: Westdeutscher<br />
Verlag, S. 277-290.<br />
Haller, Michael (2003): Qualität und Benchmark<strong>in</strong>g im Pr<strong>in</strong>tjournalismus. In: Bucher,<br />
Hans-Jürgen/Altmeppen, Klaus-Dieter: Qualität im Journalismus. Grundlagen,<br />
Dimensionen, Praxismodelle. Wiesbaden: Westdeutscher Verlag, S. 181-201.<br />
Haller, Michael (2008): Recherchieren. E<strong>in</strong> Handbuch für Journalisten (7. Aufl.).<br />
Konstanz: UVK.<br />
IVW (2011a): Dresdner Neueste Nachrichten. <strong>Onl<strong>in</strong>e</strong>: http://daten.ivw.eu/<strong>in</strong>dex.php?<br />
menuid=1&u=&p=&detail=true (letzter Aufruf: 20. April 2011).<br />
IVW (2011b): Leipziger Volkszeitung Stadtausgabe. <strong>Onl<strong>in</strong>e</strong>: http://daten.ivw.eu/<strong>in</strong>dex.php?<br />
menuid=1&u=&p=&detail=true (letzter Aufruf: 20. April 2011).<br />
IVW (2011c): Süddeutsche Zeitung. <strong>Onl<strong>in</strong>e</strong>: http://daten.ivw.eu/<strong>in</strong>dex.php?<br />
menuid=1&u=&p=&detail=true (letzter Aufruf: 20. April 2011).<br />
Keel, Guido/Bernet, Marcel (2005): Journalisten im Internet 2005. E<strong>in</strong>e Befragung <strong>von</strong><br />
Deutschschweizer Medienschaffenden zum beruflichen Umgang mit dem Internet. <strong>Onl<strong>in</strong>e</strong>:<br />
http://www.iam.zhw<strong>in</strong>.ch/forschung (letzter Aufruf: 10. Juni 2011).<br />
Keel, Guido/Bernet, Marcel (2009): Journalisten im Internet 2009. E<strong>in</strong>e repräsentative<br />
Befragung <strong>von</strong> Schweizer Medienschaffenden zum beruflichen Umgang mit dem Internet.<br />
<strong>Onl<strong>in</strong>e</strong>: http://www.l<strong>in</strong>guistik.zhaw.ch/fileadm<strong>in</strong>/user_upload/l<strong>in</strong>guistik/_Institute_und_<br />
Zentren/IAM/PDFS/Forschung/Projekte/Studie_Internet_2009.pdf (letzter Aufruf: 10. Juni<br />
2011).<br />
Machill, Marcel (2005): Pseudojournalismus. Interview <strong>von</strong> Ellen Großhans. In: Leipziger<br />
Volkszeitung, 22. September 2005.<br />
Machill, Marcel/Beiler, Markus/Zenker, Mart<strong>in</strong> (2008): Journalistische Recherche im<br />
43
Internet. Bestandsaufnahme journalistischer Arbeitsweisen <strong>in</strong> Zeitungen, Hörfunk,<br />
Fernsehen und <strong>Onl<strong>in</strong>e</strong>. Unter Mitarbeit <strong>von</strong> Johannes R. Gerstner. Berl<strong>in</strong>: Vistas.<br />
Mast, Claudia (2004): ABC des Journalismus. E<strong>in</strong> Handbuch (10. Aufl.). Konstanz: UVK.<br />
Meier, Klaus (2002): Grundlagen journalistischer Recherche im Internet. In: ders. (Hrsg.):<br />
Internetjournalismus. Konstanz: UVK, S. 297-357.<br />
Meier, Klaus (2003): Qualität im <strong>Onl<strong>in</strong>e</strong>-Journalismus. In: Bucher, Hans-<br />
Jürgen/Altmeppen, Klaus-Dieter: Qualität im Journalismus. Grundlagen, Dimensionen,<br />
Praxismodelle. Wiesbaden: Westdeutscher Verlag, S. 247-268.<br />
Meier, Klaus (2007): Journalistik. Konstanz: UVK.<br />
Meyn, Hermann (1996): Massenmedien <strong>in</strong> der Bundesrepublik Deutschland. Berl<strong>in</strong>: Ed.<br />
Colloquium.<br />
Neuberger, Christoph (2002): Alles Content, oder was? Vom Unsichtbarwerden des<br />
Journalismus im Internet. In: Hohlfeld, Ralf/Meier, Klaus/Neuberger, Christoph:<br />
Innovationen im Journalismus. Forschung für die Praxis. Münster: LIT, S. 25-70.<br />
Neuberger, Christoph (2007): Nutzerbeteiligung im <strong>Onl<strong>in</strong>e</strong>-Journalismus. Perspektiven<br />
und Probleme der Partizipation im Internet. In: Rau, Harald (Hrsg.): Zur Zukunft des<br />
Journalismus. Frankfurt am Ma<strong>in</strong>/Berl<strong>in</strong>: Lang, S. 61-94.<br />
Neuberger, Christoph/Nuernbergk, Christian/Rischke, Melanie (2007): Weblogs und<br />
Journalismus: Konkurrenz, Ergänzung oder Integration? In: Media Perspektiven, Heft 2,<br />
S. 96-112.<br />
Neuberger, Christoph/Nuernbergk, Christian/Rischke, Melanie (2009): „Googleisierung“<br />
oder neue <strong>Quellen</strong> im Netz? Anbieterbefragung III: Journalistische Recherche im Internet.<br />
In: dies. (Hrsg.): Journalismus im Internet. Profession – Partizipation – Technisierung.<br />
Wiesbaden: VS Verlag, S. 295-334.<br />
Neuberger, Christoph/Vom Hofe, Hanna Jo/Nuernbergk, Christian (2010): Twitter und<br />
Journalismus. Der E<strong>in</strong>fluss des „Social Web“ auf die Nachrichten (2. Aufl.). Düsseldorf:<br />
Landesanstalt für Medien Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen.<br />
News aktuell (2007): Media Studie 2007. 2.0 und dann? Journalismus im Wandel.<br />
Hamburg.<br />
LaRoche, Walther <strong>von</strong> (2008): E<strong>in</strong>führung <strong>in</strong> den praktischen Journalismus. Mit genauer<br />
Beschreibung aller Ausbildungswege Deutschland, Österreich und Schweiz (18. Aufl.).<br />
Berl<strong>in</strong>: Econ.<br />
Ludwig, Johannes (2007): Investigativer Journalismus. Recherchestrategien – <strong>Quellen</strong> –<br />
44
Informanten (2. Aufl.). Konstanz: UVK.<br />
Luhmann, Niklas (1996): Die Realität der Massenmedien. Wiesbaden: Westdeutscher<br />
Verlag.<br />
Pörksen, Bernhard (2004): Journalismus als Wirklichkeitskonstruktion. In: Löffelholz,<br />
Mart<strong>in</strong> (Hrsg.): Theorien des Journalismus. E<strong>in</strong> diskursives Handbuch. Wiesbaden: VS<br />
Verlag, S. 334-347.<br />
Preger, Sven (2004): Mangelware Recherche. Münster: LIT.<br />
Raabe, Johannes/Pürer, He<strong>in</strong>z (2007): Presse <strong>in</strong> Deutschland (3. Aufl.). Konstanz: UVK.<br />
Schmidt, Jan (2008): Was ist neu am Social Web? Soziologische und<br />
kommunikationswissenschaftliche Grundlagen. In: Zerfaß, Ansgar/Welker,<br />
Mart<strong>in</strong>/Schmidt, Jan: Kommunikation, Partizipation und Wirkungen im Social Web.<br />
Grundlagen und Methoden – Von der Gesellschaft zum Individuum. Köln: Halem, S.18-40.<br />
Schumacher, Hajo (2009): Der Iran twittert plötzlich Morgenluft. <strong>Onl<strong>in</strong>e</strong>:<br />
http://www.welt.de/wirtschaft/webwelt/article3941684/Der-Iran-twittert-ploetzlich-<br />
Morgenluft.html (letzter Aufruf: 10. Juni 2011).<br />
Simons, Anton (2011): Journalismus 2.0. Konstanz: UVK.<br />
Spr<strong>in</strong>ger, N<strong>in</strong>a/Woll<strong>in</strong>g, Jens (2008): Recherchoogeln. Wie Journalisten das Internet für<br />
ihre Arbeit nutzen. In: Quandt, Thorsten/Schweiger, Wolfgang (Hrsg.): Journalismus<br />
onl<strong>in</strong>e – Partizipation oder Profession? Wiesbaden: VS Verlag, S. 45-59.<br />
Trepte, Sab<strong>in</strong>e/Re<strong>in</strong>ecke, Leonard (2008): Qualitätserwartungen und ethischer Anspruch<br />
bei der Lektüre <strong>von</strong> Blogs und Tageszeitungen. In: Publizistik. Vierteljahreshefte für<br />
Kommunikationsforschung. 53. Jg., Heft 4, S. 509-534.<br />
Wegner, Jochen (2005): Die Googleisierung der Medien. In: Lehmann, Kai/Schetsche,<br />
Michael (Hrsg.): Die Google-Gesellschaft. Vom digitalen Wandel des Wissens. Bielefeld:<br />
transcript, S. 235-240.<br />
Weischenberg, Siegfried (2001a): Das Ende e<strong>in</strong>er Ära? Aktuelle Beobachtungen zum<br />
Studium des künftigen Journalismus. In: Kle<strong>in</strong>steuber, Hans J.: Aktuelle Medientrends <strong>in</strong><br />
den USA. Journalismus, politische Kommunikation und Medien im Zeitalter der<br />
Digitalisierung. Wiesbaden: VS Verlag, S. 61-82.<br />
Weischenberg, Siegfried (2001b): Nachrichten-Journalismus. Anleitungen und Qualitäts-<br />
Standards für die Medienpraxis. Wiesbaden: Westdeutscher Verlag.<br />
Weischenberg, Siegfried (2002): Journalistik. Theorie und Praxis aktueller<br />
Medienkommunikation, Bd. 2: Medientechnik, Medienfunktionen, Medienakteure<br />
45
(Nachdruck <strong>von</strong> 1995). Opladen: WestdeutscherVerlag.<br />
Weischenberg, Siegfried/Malik, Maja/Scholl, Arm<strong>in</strong> (2006): Die Souffleure der<br />
Mediengesellschaft. Report über die Journalisten <strong>in</strong> Deutschland. Konstanz: UVK.<br />
Welker, Mart<strong>in</strong> (2007): Medienschaffende als Weblognutzer. Wer sie s<strong>in</strong>d, was sie denken.<br />
In: Rau, Harald (Hrsg.): Zur Zukunft des Journalismus. Frankfurt am Ma<strong>in</strong>/Berl<strong>in</strong>: Lang, S.<br />
95-116.<br />
Welker, Mart<strong>in</strong> (2010): <strong>Quellen</strong> onl<strong>in</strong>e: Schöne neue Recherchewelt? In: Welker,<br />
Mart<strong>in</strong>/Elter, Andreas/Weichert, Stephan (Hrsg.): Pressefreiheit ohne Grenzen? Grenzen<br />
der Pressefreiheit. Köln: Halem, S. 107-133.<br />
Welker, Mart<strong>in</strong> (2011): Frequencies and types of onl<strong>in</strong>e sources <strong>in</strong> quality media: Can we<br />
presuppose the emerg<strong>in</strong>g of a deliberative public sphere? Unveröffentlichtes Manuskript.<br />
Wyss, V<strong>in</strong>zenz/Keel, Guido (2005): Google als Trojanisches Pferd? Konsequenzen der<br />
Internet-Recherche <strong>von</strong> Journalisten für die journalistische Qualität. In: Machill,<br />
Marcel/Beiler, Markus (Hrsg.): Die Macht der Suchmasch<strong>in</strong>en. The Power of Search<br />
Eng<strong>in</strong>es. Köln: Halem, S. 143-163.<br />
Zerfaß, Ansgar/Bogosyan, Jan<strong>in</strong>e (2007): Blogstudie 2007. Informationssuche im Internet<br />
– Blogs als neues Recherchetool (Ergebnisbericht). <strong>Onl<strong>in</strong>e</strong>:<br />
http://www.communicationmanagement.de/fileadm<strong>in</strong>/cmgt/PDF_Publikationen_download/<br />
Blogstudie2007-Ergebnisbericht.pdf (letzter Aufruf: 10. Juni 2011).<br />
46
10. Abbildungs- und Tabellenverzeichnis<br />
Abbildungen<br />
Abbildung 1: <strong>Onl<strong>in</strong>e</strong>-<strong>Quellen</strong> nach <strong>Quellen</strong>arten …........................................................... 25<br />
Tabellen<br />
Tabelle 1: Artikel mit <strong>Onl<strong>in</strong>e</strong>-<strong>Quellen</strong> (<strong>in</strong>klusive Serviceh<strong>in</strong>weise)<br />
nach Ressorts ..................................................................................................... 23<br />
Tabelle 2: Artikel mit Serviceh<strong>in</strong>weisen nach Ressorts und<br />
Zeitungen ............................................................................................................ 23<br />
Tabelle 3: Artikel mit <strong>Onl<strong>in</strong>e</strong>-<strong>Quellen</strong> im eigentlichen S<strong>in</strong>n nach<br />
Ressorts ............................................................................................................. 24<br />
Tabelle 4: <strong>Onl<strong>in</strong>e</strong>-<strong>Quellen</strong> nach Themen ............................................................................ 26<br />
Tabelle 5: Position, Intensität und Potenz der <strong>Onl<strong>in</strong>e</strong>-<strong>Quellen</strong> bzw.<br />
Artikel mit <strong>Onl<strong>in</strong>e</strong>-<strong>Quellen</strong> ................................................................................ 27<br />
Tabelle 6: Artikel mit <strong>Onl<strong>in</strong>e</strong>-<strong>Quellen</strong> <strong>in</strong> der Süddeutschen Zeitung ................................. 28<br />
Tabelle 7: Meistverwendete <strong>Onl<strong>in</strong>e</strong>-<strong>Quellen</strong> <strong>in</strong> der Süddeutschen<br />
Zeitung …........................................................................................................... 29<br />
Tabelle 8: Position, Intensität und Potenz der <strong>Onl<strong>in</strong>e</strong>-<strong>Quellen</strong> bzw.<br />
Artikel mit <strong>Onl<strong>in</strong>e</strong>-<strong>Quellen</strong> <strong>in</strong> der Süddeutschen Zeitung ................................. 29<br />
Tabelle 9: Artikel mit <strong>Onl<strong>in</strong>e</strong>-<strong>Quellen</strong> <strong>in</strong> der Leipziger Volkszeitung …............................. 30<br />
Tabelle 10: Position, Intensität und Potenz der <strong>Onl<strong>in</strong>e</strong>-<strong>Quellen</strong> bzw.<br />
Artikel mit <strong>Onl<strong>in</strong>e</strong>-<strong>Quellen</strong> <strong>in</strong> der Leipziger Volkszeitung ….......................... 31<br />
Tabelle 11: Position, Intensität und Potenz der <strong>Onl<strong>in</strong>e</strong>-<strong>Quellen</strong> bzw.<br />
Artikel mit <strong>Onl<strong>in</strong>e</strong>-<strong>Quellen</strong> <strong>in</strong> den Dresdner Neuesten<br />
Nachrichten …................................................................................................... 32<br />
47
ANHANG<br />
I Codebuch<br />
Nummer<br />
Überschrift<br />
Medium<br />
1] Süddeutsche Zeitung<br />
2] Leipziger Volkszeitung<br />
3] Dresdner Neueste Nachrichten<br />
Datum – Datum der Ausgabe<br />
Seite – Seite, auf der der Artikel <strong>in</strong> der Ausgabe ersche<strong>in</strong>t<br />
Ressort<br />
1] Seite 1<br />
2] Politik<br />
3] Wirtschaft<br />
4] Lokales<br />
Thema des Artikels<br />
1] Regierungspolitik Innen und Außen<br />
2] Parteipolitik<br />
3] Landespolitik<br />
4] Kommunalpolitik<br />
5] EU-Politik<br />
6] Internationale Politik<br />
7] Katastrophen und Terrorismus<br />
8] Privatwirtschaft<br />
9] Volkswirtschaft<br />
10] Soziales und Religion<br />
11] Wissenschaft, Forschung und Technik (ke<strong>in</strong>e Politik!)<br />
12] lokale Veranstaltungen<br />
XLVIII
13] Lokalnachrichten<br />
Anzahl der <strong>Onl<strong>in</strong>e</strong>-<strong>Quellen</strong><br />
1] e<strong>in</strong>e<br />
2] zwei<br />
3] drei<br />
4] mehr als drei<br />
<strong>Onl<strong>in</strong>e</strong>-Quelle<br />
a) professionelle Internetangebote<br />
1] offizielle Internetseite e<strong>in</strong>er Behörde<br />
E<strong>in</strong>e Internetseite, die erkennbar <strong>von</strong> e<strong>in</strong>er staatlichen oder kommunalen E<strong>in</strong>richtung<br />
betrieben wird<br />
„Auf der Seite des M<strong>in</strong>isteriums ist zu lesen ...“<br />
2] offizielle Internetseite e<strong>in</strong>es Unternehmens<br />
E<strong>in</strong>e Internetseite, die erkennbar <strong>von</strong> e<strong>in</strong>em Unternehmen als Website betrieben wird.<br />
„Wie Mercedes auf se<strong>in</strong>er Internetseite mitteilte ...“<br />
3] offizielle Internetseiten <strong>von</strong> NGOs, Vere<strong>in</strong>en, Parteien und Verbänden<br />
E<strong>in</strong>e Internetseite, die <strong>von</strong> e<strong>in</strong>er nicht-kommerziellen Nicht-Regierungs-Organisation<br />
betrieben wird. Dazu zählen auch Seiten <strong>von</strong> staatlichen Stiftungen, politischen Parteien<br />
und akademischen/ wissenschaftlichen E<strong>in</strong>richtungen.<br />
„Laut der Internetseite <strong>von</strong> Greenpeace ...“<br />
4] Corporate Blog<br />
Blog, das <strong>von</strong> e<strong>in</strong>em Unternehmen betrieben wird und zu e<strong>in</strong>er Seite im S<strong>in</strong>ne <strong>von</strong> 2]<br />
gehört.<br />
„Wie Google <strong>in</strong> dem unternehmenseigenen Blog mitteilt ...“<br />
b) nicht-professionelle Internetangebote<br />
6] privates Blog<br />
Internetseite mit tagebuchartigem Charakter <strong>in</strong> umgekehrt-chronologischer Reihenfolge,<br />
die <strong>von</strong> e<strong>in</strong>er oder mehreren Privatperson(en) betrieben wird<br />
„Wie Marcus Beckedahl auf se<strong>in</strong>em Blog Netzpolitik.org schreibt ...“<br />
7] Twitter<br />
Kurznachrichten, die über den Microblogg<strong>in</strong>gdienst Twitter.com abgesetzt werden<br />
„... twittert XY“<br />
8] soziales Netzwerk<br />
XLIX
Internetseite, auf der sich Nutzer mit persönlichen Daten (Profile) anmelden, mite<strong>in</strong>ander<br />
kommunizieren und selbst Inhalte bereitstellen können. Seiten, die für ihre Nutzer lediglich<br />
e<strong>in</strong>e Diskussionsplattform zu e<strong>in</strong>em bestimmten Thema bereitstellen, gelten nicht als<br />
soziale Netzwerke, sondern als Foren (10])<br />
„... hatte Fotos bei Facebook gepostet“<br />
9] Videoportale<br />
Portale, die hauptsächlich aus dem Austausch/Bereitstellen <strong>von</strong> Videos bestehen.<br />
„In e<strong>in</strong>em Video, das derzeit auf YouTube kursiert, ...“<br />
10] Foren<br />
Seiten, die <strong>in</strong> erster L<strong>in</strong>ie zur Diskussion unter den Nutzern über e<strong>in</strong> bestimmtes Thema<br />
dienen.<br />
„In Internetforen laufen heiße Diskussionen“<br />
c) Medien<br />
5] <strong>Onl<strong>in</strong>e</strong>auftritte redaktioneller Medien<br />
Alle redaktionelle journalistische Medien (re<strong>in</strong>e <strong>Onl<strong>in</strong>e</strong>medien, <strong>Onl<strong>in</strong>e</strong>angebote <strong>von</strong> Pr<strong>in</strong>t-<br />
oder Funkmedien)<br />
„Spiegel <strong>Onl<strong>in</strong>e</strong> berichtet ...“<br />
d) Service<br />
11] Internetangebot des Mediums (Service)<br />
Verweis auf Inhalte auf der Website des Mediums<br />
12] andere Internetangebote mit Servicecharakter als das des Mediums<br />
alle Angebote (außer denen des Mediums selbst), auf die nicht im Fließtext, sondern als<br />
weiterführender H<strong>in</strong>weis verwiesen wird<br />
„Mehr Informationen zum Studiengang unter www.kmw.uni-leipzig.de“<br />
e) Sonstige<br />
13] Suchmasch<strong>in</strong>en<br />
Angebote, die das Internet auf bestimmte Begriffe h<strong>in</strong> durchsuchen<br />
„Gibt man xxx bei Google e<strong>in</strong>, erhält man 20.000 Treffer“<br />
14] nicht näher spezifiziert<br />
„In e<strong>in</strong>em Video, das im Internet zu sehen ist ...“<br />
Art der Quelle<br />
1] Quelle im eigentlichen S<strong>in</strong>n<br />
wird im Fließtext angegeben und gibt Auskunft über e<strong>in</strong>en Sachverhalt, e<strong>in</strong>e Aussage oder<br />
e<strong>in</strong> Argument<br />
L
2] Serviceh<strong>in</strong>weis<br />
wird abgesetzt vom Text oder ohne direkten Bezug auf die Quelle als weiterführender<br />
H<strong>in</strong>weis angegeben<br />
Art der Angabe<br />
1] weder Name der Seite noch URL genannt<br />
2] nur Name der Seite genannt<br />
3] nur URL genannt<br />
4] Name der Seite und URL genannt<br />
Position<br />
1] niedrige Gewichtung<br />
Artikel fällt als letzter auf<br />
2] mittlere Gewichtung<br />
Artikel drängt sich <strong>in</strong> den Vordergrund, nur der Aufmacher ist zentraler<br />
3] Aufmacher<br />
nur 1x pro Seite<br />
Intensität<br />
1] ger<strong>in</strong>g: wird nur erwähnt<br />
2] mittel: wird genau beschrieben oder m<strong>in</strong>destens 5 Zeilen des Artikels gehen<br />
ausschließlich auf Inhalte der Seite zurück<br />
3] hoch: dom<strong>in</strong>iert mehr als ¾ des Artikels<br />
Potenz<br />
1] ger<strong>in</strong>g: ergänzende Quelle<br />
2] mittel: mehr als ergänzende Quelle<br />
3] hoch: konstituierende Quelle (Quelle ist Anlass der Berichterstattung?)<br />
<strong>Onl<strong>in</strong>e</strong>-Quelle2<br />
Art der Quelle2<br />
Art der Angabe2<br />
Position2<br />
Intensität2<br />
Potenz2<br />
etc.<br />
LI
II Datenbasis<br />
Ergebnisse der Inhaltsanalyse nach <strong>Onl<strong>in</strong>e</strong>-<strong>Quellen</strong> (die Kategorie „Anzahl der <strong>Quellen</strong>“<br />
bezieht sich auf die Analyse<strong>in</strong>heit Artikel). Die genauen Bezeichnungen und Def<strong>in</strong>itionen<br />
der Variablen können im Codebuch nachvollzogen werden.<br />
Gesamte<br />
Stichprobe<br />
Gesamt Im eig.<br />
S<strong>in</strong>n<br />
Süddeutsche<br />
Zeitung<br />
Gesamt Im eig.<br />
S<strong>in</strong>n<br />
Leipziger<br />
Volkszeitung<br />
Gesamt Im eig.<br />
S<strong>in</strong>n<br />
Dresdner Neueste<br />
Nachrichten<br />
Gesamt Im eig.<br />
S<strong>in</strong>n<br />
<strong>Onl<strong>in</strong>e</strong>-<strong>Quellen</strong> 181 61 39 36 76 18 66 10<br />
Ressort<br />
Seite 1 17 5 6 6 11 0 -- --<br />
Politik 41 33 25 22 16 12 -- --<br />
Wirtschaft 11 8 7 7 4 1 -- --<br />
Lokales 112 15 1 1 45 5 66 10<br />
Themen<br />
Regierungspolitik 3 2 1 0 2 2 -- --<br />
Parteipolitik 3 1 2 1 1 0 -- --<br />
Landespolitik 3 1 0 0 3 1 -- --<br />
Kommunalpolitik 2 2 0 0 2 2 -- --<br />
EU-Politik 1 0 0 0 1 0 -- --<br />
Internationale Politik 30 26 23 22 7 4 -- --<br />
Katastrophen 3 2 1 1 2 1 -- --<br />
Privatwirtschaft 7 6 5 5 2 1 -- --<br />
Volkswirtschaft 3 2 2 2 1 0 -- --<br />
Soziales 9 3 2 2 7 2 -- --<br />
Wissenschaft 4 4 2 2 2 0 -- --<br />
Lokale Term<strong>in</strong>e 30 1 0 0 19 1 11 0<br />
Lokalnachrichten 83 11 1 1 27 4 55 10<br />
Anzahl der <strong>Quellen</strong><br />
e<strong>in</strong>e 155 -- 22 -- 68 -- 64 --<br />
zwei 9 -- 5 -- 4 -- 1 --<br />
drei 1 -- 1 -- 0 -- 0 0<br />
> 3 1 -- 1 -- 0 -- 0 0<br />
<strong>Onl<strong>in</strong>e</strong>-Quelle<br />
Behörde 6 3 2 1 1 1 3 3<br />
Unternehmen 6 6 2 2 2 2 2 2<br />
NGO etc 15 15 5 5 7 7 4 4<br />
Corp. Blog 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
Priv. Blog 4 4 4 4 0 0 0 0<br />
Twitter 5 5 4 4 1 1 0 0<br />
Soz. Netzwerk 10 9 7 6 2 2 1 1<br />
LII
Gesamte<br />
Stichprobe<br />
Gesamt Im eig.<br />
S<strong>in</strong>n<br />
Süddeutsche<br />
Zeitung<br />
Gesamt Im eig.<br />
S<strong>in</strong>n<br />
Leipziger<br />
Volkszeitung<br />
Gesamt Im eig.<br />
S<strong>in</strong>n<br />
Dresdner Neueste<br />
Nachrichten<br />
Gesamt Im eig.<br />
S<strong>in</strong>n<br />
Video 2 2 0 0 2 2 0 0<br />
Foren 1 1 1 1 0 0 0 0<br />
Medien 7 7 7 7 0 0 0 0<br />
Eigener Service 19 0 1 0 14 0 4 0<br />
Externer Service 97 0 0 0 44 0 52 0<br />
Suchmasch<strong>in</strong>en 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
Nicht näher spezifiziert 9 9 6 6 3 3 0 0<br />
Art d. Quelle<br />
Im eig. S<strong>in</strong>n 61 61 36 36 18 18 10 10<br />
Service 120 0 3 3 58 58 56 56<br />
Angabe<br />
Weder Name noch URL 17 15 10 9 4 4 3 2<br />
Name 35 35 21 21 11 9 5 5<br />
URL 121 6 5 3 60 5 54 0<br />
Name & URL 8 5 3 3 1 0 4 3<br />
Position<br />
ger<strong>in</strong>g 47 13 6 6 19 3 22 4<br />
mittel 79 27 17 15 33 9 29 5<br />
hoch 55 21 16 15 24 6 15 1<br />
Intensität<br />
ger<strong>in</strong>g 140 20 15 12 67 9 58 2<br />
mittel 25 25 19 19 5 5 1 1<br />
hoch 16 16 5 5 4 4 7 7<br />
Potenz<br />
ger<strong>in</strong>g 150 33 22 19 69 11 59 3<br />
mittel 15 15 13 13 2 2 0 0<br />
hoch 13 13 4 4 5 5 7 7<br />
LIII
Eigenständigkeitserklärung<br />
Hiermit versichere ich, dass ich die vorliegende Bachelorarbeit selbstständig verfasst habe.<br />
Ich versichere, dass ich ke<strong>in</strong>e anderen als die angegebenen <strong>Quellen</strong> benutzt und alle<br />
wörtlich oder s<strong>in</strong>ngemäß aus anderen Werken übernommenen Aussagen als solche<br />
gekennzeichnet habe und dass die e<strong>in</strong>gereichte Arbeit weder vollständig noch <strong>in</strong><br />
wesentlichen Teilen Gegenstand e<strong>in</strong>es anderen Prüfungsverfahrens gewesen ist.<br />
Leipzig, den 10. Juni 2011 ___________________