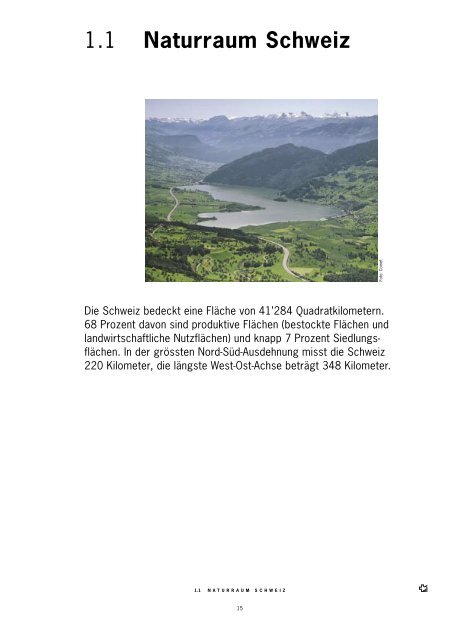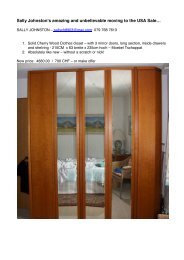1.1 Naturraum Schweiz - English Forum Switzerland
1.1 Naturraum Schweiz - English Forum Switzerland
1.1 Naturraum Schweiz - English Forum Switzerland
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>1.1</strong> <strong>Naturraum</strong> <strong>Schweiz</strong><br />
Die <strong>Schweiz</strong> bedeckt eine Fläche von 41’284 Quadratkilometern.<br />
68 Prozent davon sind produktive Flächen (bestockte Flächen und<br />
landwirtschaftliche Nutzflächen) und knapp 7 Prozent Siedlungsflächen.<br />
In der grössten Nord-Süd-Ausdehnung misst die <strong>Schweiz</strong><br />
220 Kilometer, die längste West-Ost-Achse beträgt 348 Kilometer.<br />
<strong>1.1</strong> NATURRAUM SCHWEIZ<br />
15<br />
Foto: Comet
<strong>1.1</strong>.1 GEOGRAFISCHE GLIEDERUNG<br />
Der schweizerische <strong>Naturraum</strong> lässt sich grob in Alpen, Mittelland und<br />
Jura einteilen (Fig. <strong>1.1</strong>.1). Rund 12 Prozent der Landesfläche von<br />
41’284 Quadratkilometer entfallen auf den Jura, 23 Prozent auf das<br />
Mittelland und 65 Prozent auf den Alpenraum. Nur ein Teil des alpinen<br />
Raumes ist dauernd bewohnt, vor allem die Talsohlen und sonnigen<br />
Terrassen. Der grösste Teil umfasst temporär bewirtschaftete und<br />
besiedelte Alpweidgebiete sowie nicht bewohnbare Gebiete über der<br />
Waldgrenze. Der höchste Punkt der <strong>Schweiz</strong>er Alpen befindet sich mit<br />
4634 Metern auf der Dufourspitze (Monte Rosa, Kanton Wallis). Der<br />
tiefste Punkt ist mit 193 Metern der Seespiegel des Lago Maggiore<br />
(Kanton Tessin). Der Jura weist Mittelgebirgscharakter auf: Sein höchster<br />
Punkt liegt mit 1679 Metern auf dem Mont Tendre (Kanton Waadt).<br />
Zwischen diesen beiden Gebirgszügen liegt das Mittelland, das wirtschaftliche<br />
und bevölkerungsmässige Schwerpunktgebiet der<br />
<strong>Schweiz</strong>.<br />
<strong>1.1</strong>.2 GEOLOGIE, RELIEF UND BÖDEN<br />
Geologisch betrachtet gehört die ganze <strong>Schweiz</strong> zum alpinen<br />
Gebirgssystem (Fig. <strong>1.1</strong>.2). Dieser Gebirgszug weist eine lange Entwicklungsgeschichte<br />
auf, die vor etwa 100 Millionen Jahren begann,<br />
als die europäische und die afrikanische Kontinentalplatte gegeneinander<br />
gestossen wurden. Die Alpen sind ein Deckengebirge, aufgebaut<br />
aus einem mehr als 25 Kilometer mächtigen Stapel übereinander<br />
<strong>1.1</strong> NATURRAUM SCHWEIZ<br />
16<br />
Geografische Gliederung Fig. <strong>1.1</strong>.1<br />
Gliederung gemäss der <strong>Schweiz</strong>erischen Forststatistik, Bundesamt für Statistik<br />
1 Wachter 1995, S. 47f.<br />
Jura<br />
Mittelland<br />
Voralpen<br />
Alpen<br />
Alpensüdseite<br />
Geologische Übersicht Fig. <strong>1.1</strong>.2<br />
Quelle: Bundesamt für Wasser und Geologie
geschobener Gesteinspakete (Decken). Die Gesteine, aus denen die<br />
Alpen gebildet wurden, sind entweder Meeresablagerungen aus dem<br />
Urmittelmeer (Tethys) des Erdmittelalters oder aber noch ältere kristalline<br />
Gesteine wie Granit und Gneis.<br />
Die Entstehung des Mittellands ist mit der alpinen Gebirgsbildung<br />
verknüpft. In diesem Becken hat sich bei der Alpenfaltung im<br />
Tertiär (vor etwa 36 bis 5 Millionen Jahren) der Abtragungsschutt des<br />
werdenden Gebirges gesammelt (Molasse).<br />
Der Jura ist erst in einer späten Phase der Alpenfaltung (vor<br />
etwa 5 Millionen Jahren) entstanden, indem sich die letzten Schübe<br />
auch auf den westlichen und den nördlichen Rand des Molassegebiets<br />
auswirkten. Durch den Widerstand des französischen Zentralmassivs<br />
sowie der Vogesen und des Schwarzwalds drängten sich die Falten<br />
gegen das Pariser Becken hin. Nicht alle Gebiete wurden gleichzeitig<br />
und gleich stark von der Faltung erfasst. Deshalb können der<br />
Faltenjura im Westen und der Tafeljura im Nordosten unterschieden<br />
werden.<br />
Die Modellierung der Täler und die Gestaltung der Landschaft sind<br />
– geologisch gesehen – jüngeren Datums. In den letzten 2 Millionen<br />
Jahren haben sowohl Gletscher, die während mehrerer Eiszeiten bis ins<br />
Mittelland vordrangen, als auch die Alpenflüsse, die vor allem während<br />
der Warmzeiten aktiv waren, durch Erosion die verschiedensten Bergund<br />
Talformen hervorgebracht. Im Mittelland wurde durch Moränen, Seeund<br />
Flussablagerungen eine kleinräumige Landschaft gebildet.<br />
Die Entstehung der Böden ist vor allem auf eine seit dem<br />
Ausklingen der letzten Eiszeit einsetzende und bis heute andauernde<br />
Vernetzung von physikalischen, chemischen und biologischen Prozessen<br />
zurückzuführen. Neben der Gesteinsbeschaffenheit und den<br />
Grundwasserverhältnissen spielen dabei vor allem auch Klima, Relief<br />
<strong>1.1</strong> NATURRAUM SCHWEIZ<br />
17<br />
und biologische Faktoren eine entscheidende Rolle. Während auf<br />
silikatreichem Untergrund (Granite, Gneise) vor allem saure Böden entstehen,<br />
führt ein kalkreicher Fels eher zu basischen Böden. Die ertragreichsten<br />
Böden bildeten sich auf den eiszeitlichen und nacheiszeitlichen<br />
Gletscher-, Fluss- und Seeablagerungen.<br />
<strong>1.1</strong>.3 WASSERHAUSHALT, GEWÄSSER<br />
UND GLETSCHER<br />
63 Prozent der oberirdischen Wasservorräte von über 210 Milliarden<br />
Kubikmeter lagern in den natürlichen Seen, 35 Prozent sind in den<br />
Gletschern gespeichert und die übrigen 2 Prozent in künstlichen Seen.<br />
Die Grundwasserreserven sind sehr schwierig abzuschätzen: Man<br />
nimmt an, dass sich die verfügbaren Reserven in einer Grössenordnung<br />
von 50 Milliarden Kubikmeter bewegen.<br />
Zwei Drittel der Niederschläge fliessen über die Oberflächengewässer<br />
ab, ein Drittel verdunstet. Durch Reservenveränderungen,<br />
insbesondere durch abschmelzende Gletscher wurden von 1901 bis<br />
1980 im Durchschnitt jährlich 284 Millionen Kubikmeter Wasser in den<br />
Wasserkreislauf eingespiesen.<br />
Die <strong>Schweiz</strong> gehört fünf europäischen Stromgebieten an1 : Rund<br />
68 Prozent des Abflusses werden durch den Rhein in die Nordsee entwässert,<br />
28 Prozent über Rhone, Po und Etsch ins Mittelmeer und 4<br />
Prozent durch den Inn ins Schwarze Meer (Fig. <strong>1.1</strong>.3a). Fast alle grösseren<br />
Flüsse durchqueren auf ihrem Lauf einen oder mehrere Seen. Die<br />
Rückhaltewirkung der stehenden Gewässer führt zu Abflussverzögerungen<br />
und damit zu Unterschieden in der Wasserführung. Fliessgewässer,<br />
die aus dem alpinen Raum gespiesen werden, haben eine<br />
Wasserführung, die wesentlich durch die Schnee- und Gletscher-<br />
Gewässersystem und Entwässerung Fig. <strong>1.1</strong>.3a<br />
Saône<br />
Rhone<br />
Quelle: Burri 1998, S. 35, verändert<br />
18 % zum Mittelmeer<br />
Rhein<br />
68 % zur Nordsee<br />
Aare<br />
Rhein<br />
Doubs Reuss<br />
Genfersee<br />
Saane<br />
Rhone<br />
Aare<br />
Diveria<br />
9.3 % zum Mittelmeer<br />
Bodensee<br />
Po<br />
0.3 % zum Mittelmeer<br />
4.4 % zum Schwarzen Meer<br />
Entwässerung: 68 % zur Nordsee 27.6 % zum Mittelmeer 4.4 % zum Schwarzen Meer<br />
Limmat<br />
Toce<br />
Maggia<br />
Linth<br />
Thur<br />
Mera<br />
Rhein<br />
Adda<br />
Inn<br />
Poschiavo<br />
Rombach<br />
Donau<br />
Etsch
Längenänderungen der Gletscher in den <strong>Schweiz</strong>er Alpen 1998/99 Fig. <strong>1.1</strong>.3b<br />
Quelle: Gäggeler et al. 2000, S. 26<br />
wachsend<br />
stationär (+/– 1m)<br />
schwindend<br />
nicht klassiert<br />
<strong>1.1</strong> NATURRAUM SCHWEIZ<br />
18<br />
Aletschgletscher einst und heute<br />
schmelze bestimmt ist (Abflussspitze im Sommer). Die Flüsse im<br />
Mittelland weisen Abflussspitzen, sofern solche überhaupt vorhanden<br />
sind, eher im Frühling auf.<br />
Die Flussdichte, das heisst die Fliessgewässerlänge bezogen<br />
auf einen Quadratkilometer ist in der <strong>Schweiz</strong> von Gebiet zu Gebiet<br />
unterschiedlich. Die Bodenbeschaffenheit spielt dafür die entscheidende<br />
Rolle. Im höheren westlichen Jura und in den nördlichen Kalkalpen<br />
kann die Flussdichte unter 1 Kilometer pro Quadratkilometer sinken, in<br />
der Ajoie (Kanton Jura) zum Beispiel auf 0,4. Auf schwer durchlässigem<br />
Untergrund wie Lehm und Mergel nimmt die Flussdichte zu. Längs<br />
der Grossen Schliere (Kanton Obwalden) beträgt sie beispielsweise 3<br />
Kilometer pro Quadratkilometer. 2<br />
Seit dem letzten Gletschervorstoss um 1850 haben ansteigende<br />
Temperaturen alle Alpengletscher weit zurückschmelzen lassen.<br />
Nur zwischen 1910 und 1920 ist infolge kühlerer Sommertemperaturen<br />
etwa die Hälfte von ihnen etwas vorgestossen. Von den<br />
insgesamt 121 Gletschern des Messnetzes der schweizerischen<br />
Gletscherbeobachtung konnte 1999 bei 98 Gletschern eine<br />
Zungenveränderung festgestellt werden: 9 Gletscher sind vorgestossen,<br />
85 sind auf dem Rückzug und 4 Gletscher veränderten ihre<br />
Zungenposition nur unwesentlich (Fig. <strong>1.1</strong>.3b). Die Maximalwerte wurden<br />
mit einem Rückzug von 106 Meter beim Allalingletscher und mit<br />
einem Vorstoss von 83 Meter am Turtmanngletscher gemessen. 3<br />
Der Aletschgletscher hat sich seit seinem letzten Hochstand von<br />
1859/60 bis heute um mehr als 3 Kilometer zurückgezogen, und<br />
die vergletscherte Fläche hat sich von ungefähr 105 auf knappe 87<br />
Quadratkilometer verkleinert.<br />
(rechts)<br />
Holzhauser Hanspeter Dr. (links), Martens F.<br />
2 Wiesli 1986, S. 48.<br />
3 Gäggeler et al. 2000. Fotos:
<strong>1.1</strong>.4 KLIMA<br />
Die <strong>Schweiz</strong> nimmt aufgrund ihrer Lage in Mitteleuropa in klimatischer<br />
Hinsicht eine Mittelstellung zwischen den ozeanisch beeinflussten<br />
Gebieten im Westen und den kontinentalen im Osten Europas ein. Sie<br />
weist ein Klima mit vielen Eigentümlichkeiten auf. Diese ergeben sich<br />
aus der Höhengliederung des Landes, dem Gegensatz zwischen der<br />
atlantischen und der südlichen Alpenflanke und aus der klimatischen<br />
Eigenart einiger abgeschlossener Räume (Fig. <strong>1.1</strong>.4a bis c).<br />
Entscheidend für die Temperaturverhältnisse eines Ortes ist<br />
seine Höhenlage. Generell nimmt die mittlere Jahrestemperatur pro<br />
100 Meter Höhenzunahme um durchschnittlich 0,7 Grad Celsius ab.<br />
Allerdings ist besonders im Gebirge die Hangexposition prägend, so<br />
dass es zu starken lokalen Unterschieden kommen kann. Hinzu<br />
kommt, dass sich im Winter in den Niederungen des Mittellands häufig<br />
Kaltluftseen bilden, an deren Obergrenze eine Hochnebeldecke entsteht,<br />
die den Wärmeaustausch verhindert. Weil bei sonnigem Wetter<br />
<strong>1.1</strong> NATURRAUM SCHWEIZ<br />
19<br />
darüber höhere Temperaturen herrschen, wird von einer Temperaturumkehr<br />
oder Inversion gesprochen. Kaltluftseen bescheren in<br />
abgeschlossenen Talbecken oft sehr tiefe Wintertemperaturen (zum<br />
Beispiel in La Brévine, Kanton Neuenburg, mit Wintertemperaturen bis<br />
minus 41 Grad Celsius).<br />
Auch in der Niederschlagsverteilung spiegelt sich das Relief<br />
wider. Regen bringen insbesondere die westlichen Winde, die feuchte<br />
Meeresluft heranführen. Darum wirken westexponierte Hänge des<br />
Juras und die gesamte Nordabdachung der Alpen als wichtigste<br />
Regenfänger. Relativ trocken sind das westliche Mittelland im Regenschatten<br />
des Juras und die Nordostschweiz im Regenschatten des<br />
Schwarzwalds. Im inneralpinen Raum bilden verschiedene Bündner<br />
Täler, das Rhonetal und südliche Walliser Täler eigentliche Trockeninseln.<br />
Die Südabdachung der Alpen (Tessin, südliche Bündner Täler)<br />
zeichnet sich zwar durch eine hohe Niederschlagsmenge, aber durch<br />
wesentlich weniger Niederschlagstage als im schweizerischen Mittel<br />
aus.<br />
Mittlere jährliche Sonnenscheindauer Fig. <strong>1.1</strong>.4a<br />
Quelle: Meteo<strong>Schweiz</strong><br />
Stunden pro Jahr<br />
1500–1600<br />
1600–1700<br />
1700–1800<br />
1800–1900<br />
1900–2 000<br />
2 000–2 100<br />
2 100–2 200<br />
2 200–2 300
Jahresniederschläge Fig. <strong>1.1</strong>.4b<br />
Quelle: Meteo<strong>Schweiz</strong><br />
Wetterrekorde 1 Fig. <strong>1.1</strong>.4c<br />
Klimatische Parameter Ort Werte Datum<br />
Wärmster Ort (Jahresmittel) Locarno-Monti 11,5 °C 2<br />
Wärmerekord Basel 39,3 °C 28.07.1921<br />
Kälteste Messstelle (Jahresmittel) Jungfraujoch – 7,9 °C 2<br />
Kälterekord La Brévine – 41,8 °C 12.0<strong>1.1</strong>987<br />
Sonnigster Ort Cimetta 2181 h 2<br />
Höchste Niederschlagsmenge (Tagesrekord) Camedo TI 414 mm 10.09.1983<br />
Trockenster Ort (Jahresmittel) Ackersand VS 521 mm 2<br />
Längste Trockenperiode Lugano 104 Tage ab 28.1<strong>1.1</strong>980<br />
Grösste Neuschneemenge (Tagesrekord) Klosters 130 cm 29./30.<strong>1.1</strong>982<br />
Grösste Schneehöhe Säntis 816 cm April 1999<br />
Höchste Windgeschwindigkeit, Berge Jungfraujoch 285 km/h 27.02.1990<br />
Höchste Windgeschwindigkeit, Niederungen Glarus 190 km/h 15.07.1985<br />
1 Messnetz der Meteo<strong>Schweiz</strong><br />
2 Langjähriger Durchschnittswert<br />
Quelle: Meteo<strong>Schweiz</strong><br />
Millimeter pro Jahr<br />
400–700<br />
700–1100<br />
1100–1400<br />
1400–1800<br />
1800–2 400<br />
2 400–3 000<br />
<strong>1.1</strong> NATURRAUM SCHWEIZ<br />
20
<strong>1.1</strong>.5 NATÜRLICHE VEGETATION UND NUTZUNG<br />
Über 4000 Meter Höhendifferenz liegen zwischen dem höchsten und<br />
dem tiefsten Punkt der <strong>Schweiz</strong>. Je nach Höhenlage unterscheidet sich<br />
die Pflanzendecke, was als vertikale Abfolge der Vegetationsstufen<br />
beschrieben werden kann. Die Grenzen verlaufen dabei im Süden bis<br />
zu 300 Meter höher als im Norden (Fig. <strong>1.1</strong>.5). Fast in der ganzen<br />
<strong>Schweiz</strong> würden natürlicherweise Wälder vorherrschen. Der Mensch<br />
hat durch seine Tätigkeiten seit dem Sesshaftwerden in die<br />
Naturlandschaft eingegriffen und sie zu einer Kulturlandschaft geformt.<br />
Die Höhenstufen lassen sich wie folgt unterteilen4 :<br />
– Kolline Stufe (bis 600 Meter, Rebengrenze): Vor der Besiedlung<br />
durch den Menschen dominierte der Laubwald die natürliche Pflanzenwelt.<br />
Nach der Rodung wurden die Flächen für den Obst- und<br />
4 Wiesli 1986, S. 44f.<br />
<strong>1.1</strong> NATURRAUM SCHWEIZ<br />
21<br />
Ackerbau genutzt. Heute ist diese Stufe geprägt durch<br />
Verkehrsachsen und Siedlungen.<br />
– Montane Stufe (bis rund 1200 Meter, Laubwaldgrenze): Der Laubwald<br />
bildete ursprünglich das charakteristische Landschaftselement.<br />
Der Ackerbau tritt hinter die Viehhaltung zurück.<br />
– Subalpine Stufe (bis etwa 2000 Meter, Nadelwaldgrenze): Nadelholzbestände<br />
sind dominierend. Die natürliche Waldgrenze bewegt<br />
sich zwischen 1800 Meter im Norden und 2400 Meter in gewissen<br />
inneralpinen Lagen.<br />
– Alpine Stufe (von 2500 bis 3300 Meter, Schneegrenze): Sie zeichnet<br />
sich durch nur im Sommer nutzbaren Alpweiden aus. In den höheren<br />
Lagen löst sich die Vegetationsdecke allmählich auf.<br />
– Nivale Stufe: Diese liegt im Bereich der Schneegrenze und ist vorwiegend<br />
durch Fels, Schnee und Eis gekennzeichnet.<br />
Vegetationsstufen Fig. <strong>1.1</strong>.5<br />
4 000 m<br />
3 500 m<br />
3 000 m<br />
2 500 m<br />
2 000 m<br />
1 500 m<br />
1 000 m<br />
500 m<br />
Quelle: Burri 1998, S. 60, verändert<br />
Nordschweiz Wallis Südschweiz<br />
Schneestufe<br />
Schneegrenze<br />
Obere Alpenstufe<br />
Nadelwaldgrenze<br />
Untere Alpenstufe<br />
Laubwaldgrenze<br />
Bergstufe<br />
Rebengrenze<br />
Hügelstufe
<strong>1.1</strong>.6 ROHSTOFFE<br />
Die <strong>Schweiz</strong> gilt als rohstoffarmes Land, und die vorhandenen<br />
Lagerstätten sind von geringer Ausdehnung (siehe Kapitel 2.5 Stoffe<br />
und Abfälle). Vor allem die in den Alpen gelegenen Rohstoffvorkommen<br />
sind bei der Gebirgsbildung verfaltet, zerrissen oder zerquetscht worden,<br />
so dass der Abbau heute unwirtschaftlich ist. In der Gegenwart<br />
werden eigentlich nur nichtmetallische Rohstoffe wie Ton, Mergel,<br />
Kalkgestein, Sand, Kies, Gips, Salz sowie Bausteine abgebaut und vor<br />
allem für Bauzwecke verwendet (Fig. <strong>1.1</strong>.6).<br />
<strong>1.1</strong>.7 NATURGEFAHREN<br />
Unter Naturgefahren werden sämtliche Vorgänge und Einflüsse der<br />
Natur verstanden, welche nachteilige Auswirkungen für Menschen oder<br />
ihr Eigentum haben könnten. Dazu gehören Überschwemmung,<br />
Murgang, Steinschlag, Sturm, Hagel, Felssturz, Rutschung, Lawine,<br />
Erdbeben, Trockenheit, Blitzschlag und Waldbrand. Naturkatastrophen<br />
sind in den letzten Jahren weltweit intensiver und häufiger geworden.<br />
Aufgrund der wachsenden räumlichen Nutzung durch den Menschen<br />
hat das Schadenpotenzial zugenommen (Fig. <strong>1.1</strong>.7).<br />
Seit 1972 werden die Unwetterschäden registriert. Erfasst werden<br />
dabei naturbedingte Wasser- und Rutschungsschäden als Folge<br />
von Gewittern, Dauerregen und Schneeschmelze. Unwetterschäden<br />
sind verantwortlich für den überwiegenden Teil der Schäden durch<br />
Naturkatastrophen.<br />
<strong>1.1</strong> NATURRAUM SCHWEIZ<br />
22<br />
Rohstoffproduktion Fig. <strong>1.1</strong>.6<br />
Tausend Tonnen pro Jahr<br />
8 000<br />
7 000<br />
6 000<br />
5 000<br />
4 000<br />
3 000<br />
2 000<br />
1000<br />
0<br />
Kies und Sand<br />
Zementrohstoff<br />
Quelle: Labhart 1993, S. 169<br />
Geschätzte Schadensummen von Unwettern, Hagel, Lawinen und Schneedruck Fig. <strong>1.1</strong>.7<br />
Millionen Franken<br />
1300<br />
1200<br />
1100<br />
1000<br />
900<br />
800<br />
700<br />
600<br />
500<br />
400<br />
300<br />
200<br />
100<br />
0<br />
1977 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 2000 3<br />
1 Elementarschäden an Gebäuden (19 Kantone ohne AI, GE, OW, SZ, TI, UR, VS)<br />
2 Entschädigungen inkl. Abschätzkosten<br />
55 000<br />
Schotter<br />
3 Daten zu Lawinen und Schneedruck noch nicht verfügbar<br />
Quellen: Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft; Vereinigung kantonaler Feuerversicherungen; <strong>Schweiz</strong>erische Hagel-Versicherungs-Gesellschaftt<br />
Ziegeleiton<br />
Baustein<br />
Gips-Rohgestein<br />
Salz<br />
Lawinen und Schneedruck 1<br />
Hagel 2<br />
Unwetter
Lawinen im Februar 1999<br />
Hauptursache für die verheerenden Lawinenniedergänge<br />
im Februar 1999 waren die in<br />
kurzer Zeit gefallenen grossen Schneemengen.<br />
Starke Winde, die den Schnee verfrachteten,<br />
verschärften die Situation noch zusätzlich.<br />
Gesamthaft sind in den <strong>Schweiz</strong>er Alpen<br />
im Winter 1998/1999 rund 1200 Schadenlawinen<br />
niedergegangen. Betroffen war der<br />
gesamte Alpennordhang sowie weite Teile<br />
des Wallis und Graubündens. 17 Menschen<br />
starben im Februar 1999 in den Lawinen, 11<br />
davon in Gebäuden. Zehntausende Personen<br />
mussten evakuiert werden oder waren mehrere<br />
Tage von der Umwelt abgeschnitten,<br />
weil zahlreiche Verkehrswege unterbrochen<br />
waren.<br />
Quelle: Eidgenössisches Institut für Schnee- und Lawinenforschung<br />
Hochwasser im Mai 1999<br />
Quelle: Eidenössische Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft<br />
<strong>1.1</strong> NATURRAUM SCHWEIZ<br />
23<br />
Neuschneesumme auf rund 1500 m ü.M.<br />
100 cm<br />
200 cm<br />
300 cm<br />
400 cm<br />
> 500 cm<br />
Schadenlawinen<br />
Schadensumme pro Schadenfall<br />
stark: > 2 Millionen Franken<br />
mittel: 0.4–2 Millionen Franken<br />
leicht: < 0.4 Millionen Franken<br />
Ausgedehnte feuchte Luftmassen brachten im Mai 1999 in weiten Teilen der <strong>Schweiz</strong> ausserordentliche Niederschläge. Gesamthaft ist vom<br />
11. bis 22. Mai in der Deutschschweiz und am Alpennordrand die 2- bis 2,5-fache Regenmenge des langjährigen Monatsmittels im Mai gefallen.<br />
Eine Rolle spielten auch die Schneeschmelze und der nasse Vormonat April. Flüsse und Seen traten über die Ufer und überschwemmten<br />
weite Landstriche. In Bern beispielsweise überflutete die Aare rund 500 Häuser und in der Altstadt von Rheinfelden (Kanton Aargau) stand<br />
das Wasser bis 1,5 Meter hoch. Am Thuner-, Brienzer-, Sarner-, Boden- und Zugersee wurden die höchsten Wasserstände des Jahrhunderts<br />
registriert.
Bibliografie<br />
Burri Klaus: <strong>Schweiz</strong> – Suisse – Svizzera – Svizra. Zürich 1998.<br />
Gäggeler Heinz, Hoelzle Martin, Von der Mühll Daniel, Schwikowski Margrit: Die<br />
Gletscher der <strong>Schweiz</strong>er Alpen 1998/1999. In: Die Alpen 10/2000, S. 22 – 33.<br />
2000.<br />
Labhart Toni: Geologie der <strong>Schweiz</strong>. Thun 1993.<br />
Wachter Daniel: <strong>Schweiz</strong> eine moderne Geographie. Zürich 1995.<br />
Wiesli Urs: Die <strong>Schweiz</strong>. Wissenschaftliche Länderkunden Band 26. Darmstadt<br />
1986.<br />
Internetadressen<br />
Earth Observatory (NASA)<br />
http://earthobservatory.nasa.gov<br />
Dieses Angebot der NASA ist für Lehrpersonen und andere Interessierte gedacht:<br />
Daten aus der Fernerkundung werden erklärt und sind so aufbereitet, dass sie am<br />
Bildschirm zu Animationen zusammengestellt werden können. Es enthält zudem<br />
Tipps und Lektionsvorschläge.<br />
WSL – Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft<br />
www.wsl.ch<br />
Eine sehr gut zugängliche Site, die viele der WSL-Produkte online zum Gebrauch<br />
anbietet. So kann man sich beispielsweise Karten der in der <strong>Schweiz</strong> vorhandenen<br />
Lebensraumtypen zusammenstellen oder ein Ozonquiz machen.<br />
Erdkunde-Online<br />
www.erdkunde-online.de<br />
<strong>1.1</strong> NATURRAUM SCHWEIZ<br />
24<br />
Erdkunde-Online richtet sich vor allem an Schülerinnen und Schüler, bietet aber<br />
auch für weitere Interessierte Wissenswertes. Kurzbeschreibungen von rund 200<br />
Ländern sind mit Querverweisen vernetzt und enthalten statistische Daten.