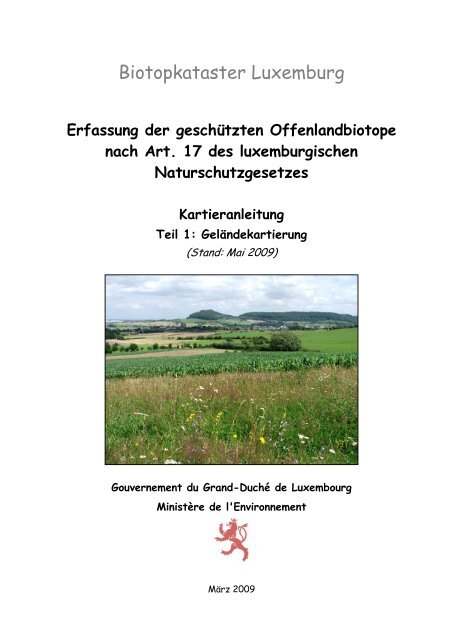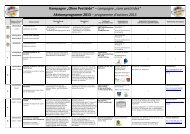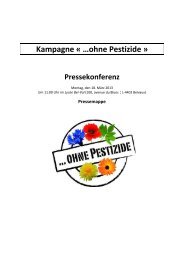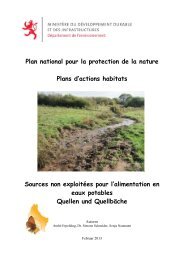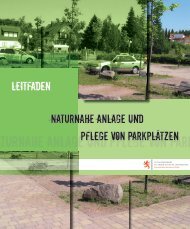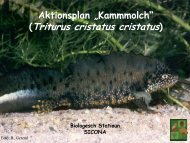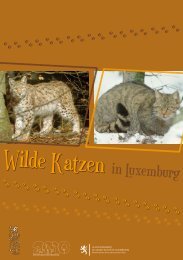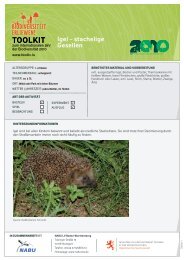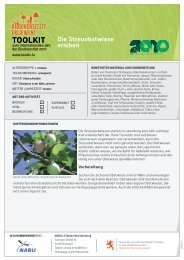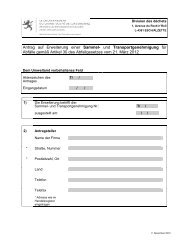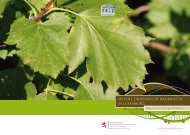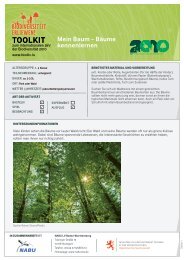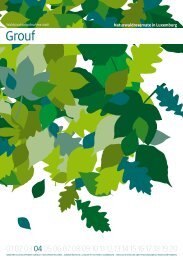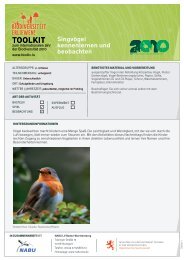Erfassung der geschützten Biotope - Portail de l'environnement
Erfassung der geschützten Biotope - Portail de l'environnement
Erfassung der geschützten Biotope - Portail de l'environnement
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Biotopkataster Luxemburg<br />
<strong>Erfassung</strong> <strong><strong>de</strong>r</strong> <strong>geschützten</strong> Offenlandbiotope<br />
nach Art. 17 <strong>de</strong>s luxemburgischen<br />
Naturschutzgesetzes<br />
Kartieranleitung<br />
Teil 1: Gelän<strong>de</strong>kartierung<br />
(Stand: Mai 2009)<br />
Gouvernement du Grand-Duché <strong>de</strong> Luxembourg<br />
Ministère <strong>de</strong> l'Environnement<br />
März 2009
Biotopkataster Luxemburg<br />
<strong>Erfassung</strong> <strong><strong>de</strong>r</strong> <strong>geschützten</strong> Offenlandbiotope<br />
nach Art. 17 <strong>de</strong>s luxemburgischen<br />
Naturschutzgesetzes<br />
Kartieranleitung<br />
Teil 1: Gelän<strong>de</strong>kartierung<br />
(Stand: Mai 2009)<br />
Bearbeitung:<br />
Sonja Naumann, Dipl.-Geogr.<br />
in Zusammenarbeit mit<br />
Doris Bauer, Dipl.-Ing. (FH) Gartenbau und Landschaftspflege<br />
Claudine Junck, Dipl.-Biol.<br />
Yves Krippel, Dipl.-Agraring.<br />
Simone Schnei<strong><strong>de</strong>r</strong>, Dipl.-Umweltw.<br />
Isabel Schrankel, Dipl.-Geogr.<br />
Claudio Walzberg, Dipl.-Biol.<br />
Mai 2009
Inhaltsverzeichnis<br />
1. EINLEITUNG UND ZIELSETZUNG.....................................................................................1<br />
2. GESETZLICHE VORGABEN: DER ARTIKEL 17 DES NATURSCHUTZGESETZES VOM<br />
19. JANUAR 2004 ...................................................................................................................2<br />
3. VORGEHENSWEISE BEI DER KARTIERUNG ..................................................................3<br />
3.1. Vorbereiten<strong>de</strong> Arbeiten...................................................................................................3<br />
3.1.1. Auswertung vorhan<strong>de</strong>ner Daten .................................................................................3<br />
3.1.2. Beschaffung von Kartiermaterialien............................................................................4<br />
3.2. Gelän<strong>de</strong>kartierung...........................................................................................................5<br />
3.2.1. Übersichtskartierung <strong><strong>de</strong>r</strong> mageren Grünlandflächen ..................................................5<br />
3.2.2. Kartierung <strong><strong>de</strong>r</strong> Art.17-<strong>Biotope</strong> .....................................................................................6<br />
3.3. Hinweise zu Kartierschwelle und Nummerierung ......................................................10<br />
3.4. Fundpunkte seltener Arten...........................................................................................10<br />
3.5. Zweifelsfälle ...................................................................................................................11<br />
4. KARTIERKRITERIEN FÜR DIE ZU ERFASSENDEN ART.17-BIOTOPE........................12<br />
4.1. Nicht nach Fauna-Flora-Habitatrichtlinie geschützte <strong>Biotope</strong>..................................12<br />
4.1.1. Großseggenrie<strong>de</strong> (BK04)..........................................................................................12<br />
4.1.2. Quellen (BK05) .........................................................................................................13<br />
4.1.3. Röhrichte (BK06) ......................................................................................................14<br />
4.1.4. Sand- und Silikatmagerrasen (BK07) .......................................................................14<br />
4.1.5. Stillgewässer (BK08) ................................................................................................15<br />
4.1.6. Streuobst (BK09) ......................................................................................................15<br />
4.1.7. Sumpfdotterblumenwiesen (Calthion) (BK10) ..........................................................16<br />
4.1.8. Sümpfe und Nie<strong><strong>de</strong>r</strong>moore (BK11) ............................................................................17<br />
4.2. Nach Fauna-Flora-Habitatrichtlinie geschützte <strong>Biotope</strong> ...........................................18<br />
4.2.1. Oligo- bis mesotrophe Gewässer mit Schlammuferfluren (3130) .............................18<br />
4.2.2. Oligo- bis mesotrophe Stillgewässer mit Characeen-Vegetation (3140) ..................18<br />
4.2.3. Meso- bis eutrophe Stillgewässer (3150) .................................................................19<br />
4.2.4. Calluna-Hei<strong>de</strong>n (4030)..............................................................................................19<br />
4.2.5. Wachol<strong><strong>de</strong>r</strong>hei<strong>de</strong>n (5130) ..........................................................................................20<br />
4.2.6. Kalk-Pionierrasen (Alysso-Sedion) auf Fels (6110)..................................................20<br />
4.2.7. Kalkmagerrasen (6210) ............................................................................................21
4.2.8. Borstgrasrasen (6230) ..............................................................................................21<br />
4.2.9. Pfeifengraswiesen (6410) .........................................................................................22<br />
4.2.10. Feuchte Hochstau<strong>de</strong>nsäume entlang von Gewässern und Feuchtwäl<strong><strong>de</strong>r</strong>n (6430) 22<br />
4.2.11. Flachland-Glatthaferwiesen (6510).........................................................................23<br />
4.2.12. Zwischenmoore (7140) ...........................................................................................24<br />
4.2.13. Tuffquellen (7220)...................................................................................................24<br />
4.2.14. Silikatschutthal<strong>de</strong>n (8150) ......................................................................................25<br />
4.2.15. Kalkschutthal<strong>de</strong>n (8160) .........................................................................................25<br />
4.2.16. Kalkfelsen (8210)....................................................................................................25<br />
4.2.17. Silikatfelsen (8220) .................................................................................................26<br />
4.2.18. Silikat-Pionierrasen (Sedo-Scleranthetalia) auf Fels (8230)...................................26<br />
4.2.19. Touristisch nicht erschlossene Höhlen (8310)........................................................27<br />
4.2.20. Fels- und Magerrasen-Komplexbiotoptypen (BK01-03) .........................................27<br />
5. LITERATURHINWEISE .....................................................................................................28<br />
ANHANG 1: TABELLARISCHE ÜBERSICHT ÜBER DIE ZU ERFASSENDEN BIOTOPE<br />
UND KARTIERKRITERIEN ...................................................................................................29<br />
ANHANG 2: RECHTLICHE GRUNDLAGEN ...........................................................................I<br />
Anhang 2.1. Artikel 17 <strong>de</strong>s Gesetzes vom 19. Januar 2004 betreffend <strong>de</strong>n Schutz <strong><strong>de</strong>r</strong><br />
Natur und <strong><strong>de</strong>r</strong> natürlichen Ressourcen.................................................................................I<br />
Anhang 2.2. Instructions d’application <strong>de</strong>s dispositions <strong>de</strong> l’article 17 <strong>de</strong> la loi du 19<br />
janvier 2004 concernant la protection <strong>de</strong> la nature et <strong>de</strong>s ressources naturelles ...........II<br />
Anhang 2.3.: Anhang II <strong>de</strong>s "Règlement grand-ducal du 22 mars 2002 instituant un<br />
ensemble <strong>de</strong> régimes d’ai<strong>de</strong>s pour la sauvegar<strong>de</strong> <strong>de</strong> la diversité biologique"............. VII
Kartieranleitung Biotopkataster Luxemburg Einleitung<br />
1. Einleitung und Zielsetzung<br />
Mit <strong>de</strong>m Naturschutzgesetz vom 11. August 1982 wur<strong>de</strong>n in Luxemburg natürliche <strong>Biotope</strong><br />
gezielt geschützt. Die Formulierung <strong>de</strong>s Artikels 14 ("Il est interdit <strong>de</strong> réduire, <strong>de</strong> détruire ou<br />
<strong>de</strong> changer les biotopes tels que mares, marécages, marais, couvertures végétales<br />
constituées par <strong>de</strong>s roseaux ou <strong>de</strong>s joncs, haies, broussailles ou bosquets."), die in sehr<br />
ähnlicher Form in <strong>de</strong>n Artikel 17 <strong>de</strong>s neuen Naturschutzgesetzes vom 19. Januar 2004<br />
übernommen wur<strong>de</strong>, war allerdings nicht sehr präzise gefasst und hat seither zu<br />
Missverständnissen und unterschiedlichen Interpretationen geführt.<br />
Mit <strong>de</strong>n "Instructions d'application <strong>de</strong>s dispositions <strong>de</strong> l'article 17 <strong>de</strong> la loi du 19 janvier 2004<br />
concernant la protection <strong>de</strong> la nature et <strong>de</strong>s ressources naturelles" vom Dezember 2006 gab<br />
<strong><strong>de</strong>r</strong> Umweltminister seiner Verwaltung eine Leitlinie für die administrative Handhabung <strong>de</strong>s<br />
Artikels 17, die eine einheitlichere Anwendung erleichtert und damit die Transparenz <strong>de</strong>s<br />
Gesetzes für die Bürger erhöht.<br />
Über die "Instructions d'application" hinaus, haben die Diskussionen, die im Rahmen <strong><strong>de</strong>r</strong><br />
Ausarbeitung <strong>de</strong>s nationalen Naturschutzplanes zwischen Landwirtschaft und Naturschutz<br />
innerhalb <strong>de</strong>s letzten Jahres geführt wur<strong>de</strong>n, jedoch <strong>de</strong>utlich gemacht, dass bei schwierig zu<br />
erkennen<strong>de</strong>n Biotoptypen noch immer eine Rechtsunsicherheit für <strong>de</strong>n Einzelnen bleibt, da<br />
nicht offensichtlich zu erkennen ist, welche Flächen geschützt sind und welche nicht. Es<br />
wur<strong>de</strong> erkannt, dass zumin<strong>de</strong>st diese schwierig erkennbaren Biotoptypen kartografisch<br />
dargestellt wer<strong>de</strong>n müssen, um die betroffenen Landbesitzer und Landnutzer über die<br />
entsprechen<strong>de</strong>n Vorkommen und Abgrenzungen geschützter <strong>Biotope</strong> unmissverständlich zu<br />
informieren.<br />
Der nationale Naturschutzplan hält daher die Erstellung eines nationalen Katasters <strong><strong>de</strong>r</strong><br />
<strong>geschützten</strong> <strong>Biotope</strong> für folgen<strong>de</strong> Habitattypen als prioritäre Maßnahme fest: "Le cadastre se<br />
focalisera essentiellement sur <strong>de</strong>s biotopes rares et menacés dont l’i<strong>de</strong>ntification sur le<br />
terrain est difficile ou ambiguë. Les biotopes visés sont notamment:<br />
• a. prairies à molinies<br />
• b. prairies maigres <strong>de</strong> fauche (catégorie A)<br />
• c. prairies à Caltha palustris (catégorie A)<br />
• d. pelouses sèches (tous les types) y compris formations <strong>de</strong> Juniperus communis<br />
• e. formations herbeuses à Nardus<br />
• f. lan<strong>de</strong>s<br />
• g. mares, marécages, marais, tourbières, couvertures végétales constituées par <strong>de</strong>s<br />
roseaux ou <strong>de</strong> joncs, mégaphorbiaies <strong>de</strong>s franges nitrophiles<br />
• h. sources<br />
• i. vergers tels qu'ils sont définis par le Ministère <strong>de</strong> l'Environnement."<br />
Ergänzend zum Biotopkataster, bei <strong>de</strong>m lediglich eine kartographische Abgrenzung <strong><strong>de</strong>r</strong><br />
entsprechen<strong>de</strong>n <strong>Biotope</strong> erfolgt, liefern die vom Umweltministerium im Dezember 2006<br />
vorgelegten "Instructions d'application" präzise Handlungsanweisungen für <strong>de</strong>n konformen<br />
Umgang mit <strong>de</strong>n im Kataster dargestellten <strong>Biotope</strong>n.<br />
Aus finanziellen und zeitlichen Grün<strong>de</strong>n wird das zu erstellen<strong>de</strong> Biotopkataster in <strong><strong>de</strong>r</strong><br />
aktuellen Phase auf die schwierig erkennbaren Offenlandbiotope beschränkt. Parallel dazu<br />
sollen in naher Zukunft aber auch entsprechen<strong>de</strong> Kataster für bewal<strong>de</strong>te Flächen erstellt<br />
wer<strong>de</strong>n.<br />
1
Kartieranleitung Biotopkataster Luxemburg Gesetzliche Vorgaben<br />
2. Gesetzliche Vorgaben: <strong><strong>de</strong>r</strong> Artikel 17 <strong>de</strong>s<br />
Naturschutzgesetzes vom 19. Januar 2004<br />
Der Gesetzgeber hat in Artikel 17 <strong>de</strong>s aktuellen Naturschutzgesetzes <strong>de</strong>n Schutz<br />
gefähr<strong>de</strong>ter <strong>Biotope</strong> geregelt. Bereits im Gesetz von 1982 fand sich die Formulierung "Il est<br />
interdit <strong>de</strong> réduire, <strong>de</strong> détruire ou <strong>de</strong> changer les biotopes tels que mares, marécages,<br />
marais, couvertures végétales constituées par <strong>de</strong>s roseaux ou <strong>de</strong>s joncs, haies, broussailles<br />
ou bosquets.", die bei <strong><strong>de</strong>r</strong> Umsetzung <strong><strong>de</strong>r</strong> FFH-Richtlinie 92/43/CEE in nationales Recht im<br />
neuen Naturschutzgesetz vom 19. Januar 2004 übernommen wur<strong>de</strong>. Zusätzlich<br />
aufgenommen wur<strong>de</strong>n weitere, stark gefähr<strong>de</strong>te <strong>Biotope</strong> "sources, pelouses sèches, lan<strong>de</strong>s,<br />
tourbières" sowie alle von <strong><strong>de</strong>r</strong> FFH-Richtlinie visierten <strong>Biotope</strong> und die <strong>Biotope</strong> <strong><strong>de</strong>r</strong> durch<br />
europäisches Recht <strong>geschützten</strong> Arten: "Sont également interdites la <strong>de</strong>struction ou la<br />
déterioration <strong>de</strong>s habitats <strong>de</strong> l’annexe 1 et <strong>de</strong>s habitats d’espèces <strong>de</strong>s annexes 2 et 3."<br />
Demnach hat sich an <strong><strong>de</strong>r</strong> Grundausrichtung <strong>de</strong>s Artikels 17 seit 1982 nichts geän<strong><strong>de</strong>r</strong>t,<br />
abgesehen von <strong><strong>de</strong>r</strong> formalen Aufnahme von zusätzlichen Biotoptypen aufgrund <strong><strong>de</strong>r</strong><br />
europäischen Habitatrichtlinie. Von herausragen<strong><strong>de</strong>r</strong> Be<strong>de</strong>utung ist vor allem die formelle<br />
Unterschutzstellung vieler einheimischer Waldgesellschaften und einiger seltener<br />
Grünlandtypen aus Anhang 1 <strong><strong>de</strong>r</strong> FFH-Richtlinie. Der Schutz von <strong>Biotope</strong>n geschützter<br />
Arten, die in Anhang 2 und 3 <strong>de</strong>s Gesetzes aufgeführt wer<strong>de</strong>n, ist wohl in <strong>de</strong>n meisten Fällen<br />
durch <strong>de</strong>n allgemeinen Biotopschutz mit abge<strong>de</strong>ckt, in Einzelfällen können sich aber auch<br />
zusätzliche Auflagen ergeben.<br />
In <strong>de</strong>n "Instructions d'application <strong>de</strong>s dispositions <strong>de</strong> l'article 17 <strong>de</strong> la loi du 19 janvier 2004<br />
concernant la protection <strong>de</strong> la nature et <strong>de</strong>s ressources naturelles" (siehe Anhang) wer<strong>de</strong>n<br />
die <strong>geschützten</strong> Biotoptypen in Ausprägung und Größe genauer <strong>de</strong>finiert. Die "Instructions<br />
d'application" sind damit auch die Basis für die Abgrenzung <strong><strong>de</strong>r</strong> entsprechen<strong>de</strong>n Flächen im<br />
Rahmen <strong>de</strong>s Biotopkatasters. In einigen Fällen wird bei Biotoptypen aus <strong><strong>de</strong>r</strong> FFH-Richtlinie<br />
keine eigene Definition vorgelegt, son<strong><strong>de</strong>r</strong>n direkt auf die Definition <strong><strong>de</strong>r</strong> EU verwiesen. In<br />
diesen Fällen dient also das "Manuel d'Interprétation <strong>de</strong>s Habitats <strong>de</strong> l'Union Européenne<br />
pour les types d'habitat <strong>de</strong> l'annexe 1" als Grundlage für die Aufnahme in das Biotopkataster.<br />
Im Zusammenhang mit <strong>de</strong>n gesetzlichen Vorgaben ist darauf hinzuweisen, dass je<strong><strong>de</strong>r</strong><br />
Kartierer für seine Kartierung selbst verantwortlich ist. Insbeson<strong><strong>de</strong>r</strong>e die Abgrenzung <strong><strong>de</strong>r</strong><br />
Art.17-<strong>Biotope</strong> ist ein Akt von rechtlicher Relevanz, <strong><strong>de</strong>r</strong> im Zweifelsfall auch vor Gericht<br />
Bestand haben und vom Kartierer begrün<strong>de</strong>t wer<strong>de</strong>n muss.<br />
2
Kartieranleitung Biotopkataster Luxemburg Vorgehensweise<br />
3. Vorgehensweise bei <strong><strong>de</strong>r</strong> Kartierung<br />
3.1. Vorbereiten<strong>de</strong> Arbeiten<br />
3.1.1. Auswertung vorhan<strong>de</strong>ner Daten<br />
Im Vorfeld <strong><strong>de</strong>r</strong> Gelän<strong>de</strong>kartierung sind die bereits vorhan<strong>de</strong>nen Daten zum Kartiergebiet zu<br />
sondieren und als Hintergrundinformation zu benutzen. Auf diese Weise lassen sich viele<br />
Biotoptypen bereits gezielt anlaufen, was sehr viel Zeit sparen kann.<br />
Die für Luxemburg flächenhaft vorliegen<strong>de</strong>n Daten sind in Form verschie<strong>de</strong>ner digitaler<br />
Karten verarbeitet. Die wichtigsten davon sind die BD-Topo (digitale topografische Karten),<br />
sowie die OBS-Karten (Occupation Biophysique du Sol) mit Informationen zu<br />
Flächennutzung und Son<strong><strong>de</strong>r</strong>strukturen. Darüber hinaus liegen verschie<strong>de</strong>ne<br />
Spezialkartierungen (Hei<strong>de</strong>n, Borstgrasrasen, Schilf) ebenfalls für ganz Luxemburg digital<br />
vor. Hinzu kommen einige digital vorhan<strong>de</strong>ne Kartierungen, die nur für verschie<strong>de</strong>ne<br />
Gemein<strong>de</strong>n existieren, etwa Magergrünlandkartierungen und Quellkartierungen. Daneben<br />
liegen Luftbil<strong><strong>de</strong>r</strong> vor, die ebenfalls eine wichtige Informationsquelle sein können.<br />
Diese digital vorhan<strong>de</strong>nen Informationen müssen die Kartierer nicht selber auswerten. Sie<br />
wer<strong>de</strong>n vom Umweltministerium in einer Kartiergrundlage im Maßstab 1:10.000<br />
zusammengestellt. Die Kartierer erhalten diese Kartiergrundlage zusammen mit einem<br />
Luftbild (Befliegung von 2004) ihres Kartiergebietes.<br />
Einige wichtige ältere Informationen liegen nicht digital, son<strong><strong>de</strong>r</strong>n nur auf Papier vor. Dies sind<br />
in erster Linie die alten Biotopkartierungen <strong><strong>de</strong>r</strong> 1980er und 90er Jahre, die (fast)<br />
flächen<strong>de</strong>ckend durchgeführt wur<strong>de</strong>n, sowie Teile <strong><strong>de</strong>r</strong> lan<strong>de</strong>sweit vorliegen<strong>de</strong>n<br />
Kleingewässerkartierung <strong>de</strong>s Naturhistorischen Museums. Hinzu kommen diverse kleinere<br />
Kartierungen (z.B. Pflege- und Entwicklungspläne verschie<strong>de</strong>ner Gebiete).<br />
Diese Daten müssen vor Kartierbeginn manuell von <strong>de</strong>n Kartierern in die Basiskarte<br />
übertragen wer<strong>de</strong>n. Die nicht digital vorliegen<strong>de</strong>n Informationen müssen bei <strong>de</strong>n<br />
betreuen<strong>de</strong>n Institutionen (SIAS, SICONA Centre und Ouest, Naturparke Öewersauer und<br />
Our, sowie Fondation Hëllef fir d’Natur) und evtl. auch beim Musée Nationale d’Histoire<br />
Naturelle (MNHN) nachgefragt wer<strong>de</strong>n.<br />
Wenn bereits <strong>de</strong>taillierte Grünlandkartierungen vorliegen, können die Kartier- und<br />
Bewertungsbögen für die jeweiligen Art. 17-<strong>Biotope</strong> schon im Vorfeld ausgefüllt und nur noch<br />
im Gelän<strong>de</strong> überprüft zu wer<strong>de</strong>n.<br />
Folgen<strong>de</strong> Tabelle gibt die möglichen Datenquellen für die zu kartieren<strong>de</strong>n Biotoptypen<br />
wie<strong><strong>de</strong>r</strong>:<br />
Tab. 1: Datenquellen für die einzelnen Biotoptypen<br />
Biotoptyp Datenquelle Datenlage<br />
Genutztes Grünland Magergrünlandkartierungen, Biotopkartierung Teils gut, teils schlecht<br />
Großseggenrie<strong>de</strong> Biotopkartierung Überwiegend gut<br />
Röhrichte Schilfkartierungen, Biotopkartierung Überwiegend gut<br />
Stillgewässer Kleingewässerkartierungen, BD Topo, Luftbild,<br />
Biotopkartierung<br />
Biotoptyp Datenquelle Datenlage<br />
3<br />
Gut
Kartieranleitung Biotopkataster Luxemburg Vorgehensweise<br />
Hei<strong>de</strong>n Biotopkartierung, spezielle Biotopschutzprojekte Überwiegend gut<br />
Felsbiotope Biotopkartierung ?<br />
Nicht genutzte<br />
Trockenrasen<br />
Biotopkartierung Überwiegend gut<br />
Borstgrasrasen Biotopkartierung, spezielle Biotopschutzprojekte Überwiegend gut<br />
Zwischenmoore Biotopkartierung Überwiegend gut<br />
Feuchte<br />
Hochstau<strong>de</strong>nsäume<br />
Luftbild, Biotopkartierung Gut<br />
Streuobst BD Topo, Luftbild Gut<br />
Quellen BD Topo, Quellkartierungen Überwiegend schlecht<br />
Aus Tab. 1 ist ersichtlich, dass für die meisten <strong><strong>de</strong>r</strong> zu kartieren<strong>de</strong>n <strong>Biotope</strong> ausreichen<strong>de</strong><br />
Datengrundlagen vorliegen, um eine gezielte <strong>Erfassung</strong> durchführen zu können.<br />
Problematisch sind vor allem die Quellbiotope, weil es nur für wenige Gebiete<br />
Quellkartierungen gibt und auf topografischen, geologischen und hydrologischen Karten nur<br />
die größeren Quellen eingezeichnet sind.<br />
Außer<strong>de</strong>m muss in jenen Gemein<strong>de</strong>n, wo noch keine Magergrünlandkartierung vorliegt, ein<br />
größerer Aufwand zur <strong>Erfassung</strong> <strong><strong>de</strong>r</strong> Grünlandbiotoptypen betrieben wer<strong>de</strong>n.<br />
3.1.2. Beschaffung von Kartiermaterialien<br />
Folgen<strong>de</strong> Kartiermaterialien wer<strong>de</strong>n unbedingt benötigt:<br />
• Topografische Karte im Maßstab 1:20.000 zur Orientierung<br />
• Basiskarte mit Hintergrundinformationen im Maßstab 1:10.000 (wird vom<br />
Umweltministerium gestellt)<br />
• Luftbild im Maßstab 1:5.000, Befliegung von 2004 (wird vom Umweltministerium gestellt)<br />
• zusätzliche, nicht digital vorhan<strong>de</strong>ne Kartierungen, insbeson<strong><strong>de</strong>r</strong>e Biotopkartierungen<br />
(wer<strong>de</strong>n vom Betreuer beschafft)<br />
• GPS-Gerät zum Einmessen von punktuellen Quellen, Felsen und Fundpunkten seltener<br />
Pflanzen- und Tierarten<br />
• Kartierbögen:<br />
o Übersichtskartierung Grünlandbiotope (wer<strong>de</strong>n vom Umweltministerium gestellt)<br />
o Bewertungsbögen für Art.17-<strong>Biotope</strong> (wer<strong>de</strong>n vom Umweltministerium gestellt)<br />
• Bestimmungsbuch: Zur Bestimmung <strong><strong>de</strong>r</strong> höheren Pflanzen ist die „Nouvelle Flore <strong>de</strong> la<br />
Belgique, du G.-D. <strong>de</strong> Luxembourg, du Nord <strong>de</strong> la France et <strong>de</strong>s régions voisines“<br />
(LAMBINON et al. 2004) zu empfehlen, <strong><strong>de</strong>r</strong> auch die Nomenklatur <strong><strong>de</strong>r</strong> Arten in <strong>de</strong>n<br />
Kartierbögen folgt<br />
Für die nicht vom Umweltministerium resp. <strong><strong>de</strong>r</strong> betreuen<strong>de</strong>n Institution zu beschaffen<strong>de</strong>n<br />
Kartiermaterialien hat <strong><strong>de</strong>r</strong> Kartierer selbst zu sorgen.<br />
4
Kartieranleitung Biotopkataster Luxemburg Vorgehensweise<br />
3.2. Gelän<strong>de</strong>kartierung<br />
Die Kartierung im Gelän<strong>de</strong> setzt sich aus zwei Teilen zusammen, die getrennt betrachtet<br />
wer<strong>de</strong>n müssen: die eigentliche <strong>Erfassung</strong> <strong><strong>de</strong>r</strong> Art.17-<strong>Biotope</strong> und eine parallel laufen<strong>de</strong><br />
Übersichtskartierung zur <strong>Erfassung</strong> <strong>de</strong>s Magergrünlan<strong>de</strong>s für die Umsetzung <strong><strong>de</strong>r</strong><br />
Biodiversitätsprogramme resp. als Datengrundlage für eine neue Landschaftspflegeprämie.<br />
3.2.1. Übersichtskartierung <strong><strong>de</strong>r</strong> mageren Grünlandflächen<br />
Parallel zum Biotopkataster wer<strong>de</strong>n in einem Kartierdurchgang alle Grünlandflächen erfasst,<br />
die für <strong>de</strong>n Vertragsnaturschutz über die Biodiversitätsprogramme geeignet sind. Als<br />
geeignet für diese Programme wer<strong>de</strong>n jene Grünlandflächen eingestuft, die innerhalb <strong><strong>de</strong>r</strong><br />
Fläche noch Pflanzenarten <strong>de</strong>s Anhangs II <strong>de</strong>s Biodiversitätsreglements aufweisen (RECUEIL<br />
DE LEGISLATION 2002; siehe Anhang). Zu diesen Arten gehören alle Rote Liste-Arten sowie<br />
extra gekennzeichnete Magerkeitszeiger im Grünland, die nicht als gefähr<strong>de</strong>t eingestuft<br />
wer<strong>de</strong>n, aber eine Zeigerfunktion hinsichtlich <strong><strong>de</strong>r</strong> Nährstoffarmut einer Wiese o<strong><strong>de</strong>r</strong> Wei<strong>de</strong><br />
haben. Hierzu gehören beispielsweise Leucanthemum vulgare, Centaurea jacea coll.,<br />
Lychnis flos-cuculi, Saxifraga granulata o<strong><strong>de</strong>r</strong> fast alle Carex-Arten.<br />
Vorgehensweise bei <strong><strong>de</strong>r</strong> Kartierung<br />
Die Kartierung basiert auf ausgewählten Indikatorarten, die zur Aufnahmezeit beson<strong><strong>de</strong>r</strong>s gut<br />
zu sehen und meist weithin sichtbar sind (z.B. Leucanthemum vulgare, Lychnis flos-cuculi).<br />
Wichtig ist, dass <strong><strong>de</strong>r</strong> Kartierzeitraum für die Mahdflächen zwischen Mitte Mai und Mitte Juni<br />
für die Übersichtskartierung eingehalten wird und nur in Ausnahmefällen nach <strong>de</strong>m 1. Schnitt<br />
kartiert wird. Nur vor <strong>de</strong>m ersten Schnitt sind die Indikatorarten in <strong>de</strong>n Mahdflächen optimal<br />
entwickelt und gewährleisten eine möglichst lückenlose <strong>Erfassung</strong>. Bewei<strong>de</strong>te Flächen<br />
können über die gesamte Vegetationsperio<strong>de</strong> erfasst wer<strong>de</strong>n. Deshalb ist es unter<br />
Umstän<strong>de</strong>n sinnvoll, sich zunächst in 1-2 Tagen einen Überblick über die Flächennutzung in<br />
<strong><strong>de</strong>r</strong> jeweiligen Gemein<strong>de</strong> zu verschaffen und die Mahdflächen zu kennzeichnen, die als<br />
Erstes kartiert wer<strong>de</strong>n müssen.<br />
Grundlage für die Übersichtskartierung sind die sogenannten FLIK-Parzellen. Dies sind<br />
Nutzungsparzellen, die eine Nummer besitzen und somit direkt <strong>de</strong>m Landwirt, <strong><strong>de</strong>r</strong> die Fläche<br />
bewirtschaftet, zuzuordnen sind. Diese sind in <strong><strong>de</strong>r</strong> Kartiergrundlage resp. im Luftbild<br />
eingezeichnet. Die Kartierung wird auf <strong>de</strong>m Luftbild im Maßstab 1:5000 eingetragen.<br />
Konkret wird bei <strong><strong>de</strong>r</strong> Übersichtskartierung folgen<strong><strong>de</strong>r</strong>maßen vorgegangen:<br />
Je<strong>de</strong> FLIK-Parzelle in <strong><strong>de</strong>r</strong> Gemein<strong>de</strong> wird gesichtet und nach <strong>de</strong>m Vorkommen <strong><strong>de</strong>r</strong> in <strong>de</strong>n<br />
Artenlisten auf <strong>de</strong>m Aufnahmebogen extra unterstrichenen Indikatorarten wer<strong>de</strong>n die<br />
Nutzungsparzellen in zwei Kategorien eingeteilt:<br />
1. keine Indikatorarten: nicht naturschutzrelevant, Fläche wird nicht im Luftbild<br />
eingetragen und erhält keine Aufnahmenummer<br />
2. Indikatorarten in <strong><strong>de</strong>r</strong> Fläche: die Fläche wird im Luftbild eingetragen und erhält eine<br />
Aufnahmenummer mit einem voranstehen<strong>de</strong>n W (z.B. W1, W2, etc.), sie wird<br />
anschließend aufgesucht und einmal diagonal durchkreuzt. Dabei wer<strong>de</strong>n alle Arten<br />
aus <strong>de</strong>n Artenlisten auf <strong>de</strong>m Aufnahmebogen angekreuzt<br />
In <strong>de</strong>n Artenlisten sind nur gesellschaftstypische und gefähr<strong>de</strong>te Arten aufgeführt; wer<strong>de</strong>n<br />
darüber hinaus weitere gefähr<strong>de</strong>te o<strong><strong>de</strong>r</strong> seltene Arten gefun<strong>de</strong>n, die nicht auf <strong>de</strong>n Listen<br />
stehen, sollte dies vermerkt wer<strong>de</strong>n. Wer sich faunistisch auskennt, kann außer<strong>de</strong>m nach<br />
Tierarten <strong><strong>de</strong>r</strong> Anhänge II, IV und V <strong><strong>de</strong>r</strong> FFH-Richtlinie, Vogelarten nach Anhang I <strong><strong>de</strong>r</strong><br />
Vogelschutz-Richtlinie und Tierarten nach Anhang I <strong>de</strong>s Biodiversitätsreglements Ausschau<br />
halten und sie auf <strong>de</strong>m Aufnahmeblatt vermerken.<br />
5
Kartieranleitung Biotopkataster Luxemburg Vorgehensweise<br />
In <strong>de</strong>m Fall, dass durch die zu kartieren<strong>de</strong> Nutzfläche eine Gemein<strong>de</strong>grenze verläuft, ist<br />
jener Kartierer zuständig, in <strong>de</strong>ssen Gebiet <strong><strong>de</strong>r</strong> Hauptteil <strong><strong>de</strong>r</strong> Fläche liegt. Sind die<br />
Teilflächen in etwa gleich groß, wird die Fläche kartiert und später bei <strong><strong>de</strong>r</strong> Digitalisierung<br />
entschie<strong>de</strong>n, welcher Gemein<strong>de</strong> sie zugeschlagen wird.<br />
Bewertung<br />
Auf <strong><strong>de</strong>r</strong> Basis <strong><strong>de</strong>r</strong> Übersichtskartierung wird eine Bewertung <strong><strong>de</strong>r</strong> kartierten FLIK-Parzellen<br />
vorgenommen. Dies muss nicht unbedingt im Gelän<strong>de</strong> direkt nach <strong><strong>de</strong>r</strong> Kartierung<br />
geschehen, sollte jedoch möglichst zeitnah vorgenommen wer<strong>de</strong>n.<br />
Die Bewertung erfolgt nach folgen<strong>de</strong>m Bewertungsschlüssel:<br />
Kategorie 1: Fläche von regionaler o<strong><strong>de</strong>r</strong> nationaler Be<strong>de</strong>utung<br />
- Kategorie 1a: Fläche mit optimaler, artenreicher und typischer Ausbildung<br />
<strong><strong>de</strong>r</strong> Vegetation, Vorkommen mehrerer gefähr<strong>de</strong>ter Arten o<strong><strong>de</strong>r</strong> einer hoch-<br />
gradig gefähr<strong>de</strong>ten Art in größeren Populationen<br />
- Kategorie 1b: Vegetation entwe<strong><strong>de</strong>r</strong> gut strukturiert, aber leicht artenverarmt<br />
o<strong><strong>de</strong>r</strong> Störeinflüsse in <strong><strong>de</strong>r</strong> Struktur, aber noch Vorkommen von einer o<strong><strong>de</strong>r</strong><br />
mehrerer seltener Arten in größeren Populationen<br />
Kategorie 2: Fläche von lokaler Be<strong>de</strong>utung<br />
- Fläche mit Störeinflüssen<br />
- Teilflächen noch gut strukturiert und mit typischer Artenzusammensetzung<br />
und/o<strong><strong>de</strong>r</strong> Vorkommen gefähr<strong>de</strong>ter Arten in kleineren Populationen<br />
Kategorie 3: Entwicklungsfläche<br />
- starke Störeinflüsse<br />
- Vegetation nur in kleineren Teilflächen noch typisch ausgebil<strong>de</strong>t und/o<strong><strong>de</strong>r</strong><br />
wenige Exemplare o<strong><strong>de</strong>r</strong> randliches Vorkommen gefähr<strong>de</strong>ter Arten<br />
3.2.2. Kartierung <strong><strong>de</strong>r</strong> Art.17-<strong>Biotope</strong><br />
Die Kartierung <strong><strong>de</strong>r</strong> Art.17-<strong>Biotope</strong> erfolgt im Außenbereich bis zur Grenze <strong>de</strong>s Bauperimeters<br />
und basiert auf <strong><strong>de</strong>r</strong> Abgrenzung von Pflanzengesellschaften, die sich räumlich durchaus über<br />
zwei o<strong><strong>de</strong>r</strong> mehr Nutzungsparzellen erstrecken resp. auch nur Teilbereiche einer<br />
Nutzungsparzelle sein können. Es han<strong>de</strong>lt sich um eine Offenlandkartierung, das heißt vom<br />
Wald umschlossene Biotopflächen dürfen nicht berücksichtigt wer<strong>de</strong>n. Ausnahmen wären<br />
nur, wenn es sich um von Wald umschlossene FLIK-Parzellen han<strong>de</strong>lt o<strong><strong>de</strong>r</strong> wenn sich die<br />
Biotopfläche am Waldrand befin<strong>de</strong>t, also noch in Kontakt zum Offenland steht.<br />
Die Kartierung wird wie die Übersichtskartierung auf <strong>de</strong>m Luftbild im Maßstab 1:5.000<br />
eingetragen. Zur Abgrenzung und Definition <strong><strong>de</strong>r</strong> Biotoptypen dienen die speziellen<br />
Kartierbögen.<br />
Diese Kartierbögen sind im Prinzip alle gleich aufgebaut und bewerten die Ausprägung <strong>de</strong>s<br />
Biotoptyps hinsichtlich Struktur, Artenzusammensetzung und Beeinträchtigungen. In <strong><strong>de</strong>r</strong><br />
Kopfzeile wer<strong>de</strong>n zunächst die allgemeinen Daten zur Fläche erfasst, dieser Kopf ist für fast<br />
alle Biotoptypen gleich und sollte unbedingt vollständig ausgefüllt wer<strong>de</strong>n. Im Einzelnen<br />
befin<strong>de</strong>n sich hier:<br />
Flächenco<strong>de</strong> Der Flächenco<strong>de</strong> ist die <strong>de</strong>finitive Erkennungsnummer <strong><strong>de</strong>r</strong> Fläche, <strong><strong>de</strong>r</strong><br />
erst bei <strong><strong>de</strong>r</strong> Dateneingabe auf <strong>de</strong>n Kartierbogen eingetragen wird. Bei<br />
<strong><strong>de</strong>r</strong> Gelän<strong>de</strong>kartierung ist diese Rubrik <strong>de</strong>shalb nicht relevant<br />
Aufnahmenummer Im Gegensatz zur Übersichtskartierung, wo ein W verwen<strong>de</strong>t wird, wird<br />
<strong>de</strong>n Nummern <strong><strong>de</strong>r</strong> Art. 17-<strong>Biotope</strong> ein B vorangestellt (z.B. B1, B2,<br />
6
Kartieranleitung Biotopkataster Luxemburg Vorgehensweise<br />
etc.), die Nummer wird fortlaufend vergeben, unabhängig von <strong><strong>de</strong>r</strong><br />
Verteilung <strong><strong>de</strong>r</strong> Pflanzengesellschaften<br />
Gemein<strong>de</strong> Hier wird <strong><strong>de</strong>r</strong> Name <strong><strong>de</strong>r</strong> Gemein<strong>de</strong> im Sinne <strong><strong>de</strong>r</strong> größeren<br />
Verwaltungseinheit eingetragen, in <strong><strong>de</strong>r</strong> die kartierte Fläche liegt; eine<br />
Gemein<strong>de</strong> kann aus mehreren Sektionen bestehen<br />
Sektion Die Sektionen sind die Gebiete <strong><strong>de</strong>r</strong> eigentlichen Orte, die in einer<br />
Gemein<strong>de</strong> zusammengefasst wur<strong>de</strong>n, die Sektionsgrenzen sind aus<br />
<strong><strong>de</strong>r</strong> Basiskarte ersichtlich<br />
Flurname Der Flurname ist aus <strong><strong>de</strong>r</strong> Basiskarte ersichtlich<br />
Datum<br />
Kartierer Hier wird das Kürzel <strong>de</strong>s Kartierers eingetragen (jeweils erster<br />
Buchstabe <strong>de</strong>s Vor- und Nachnamens)<br />
Foto Nr. Von je<strong><strong>de</strong>r</strong> Fläche sollte min<strong>de</strong>stens ein aussagekräftiges Foto<br />
abgegeben wer<strong>de</strong>n, die Fotonummer dient nur zur I<strong>de</strong>ntifizierung und<br />
Zuordnung <strong>de</strong>s Fotos zu Fläche<br />
Aktuelle Nutzung Bei <strong>de</strong>n meisten Biotoptypen befin<strong>de</strong>t sich im Kopf eine Rubrik zur<br />
aktuellen landwirtschaftlichen Nutzung <strong><strong>de</strong>r</strong> Fläche, hier sollten folgen<strong>de</strong><br />
einheitliche Kürzel benutzt wer<strong>de</strong>n:<br />
Mähwiese: M, Silagewiese: Si, Mähwei<strong>de</strong>: MW, Wei<strong>de</strong>: W, Brache: Br<br />
Bei <strong>de</strong>n Quellen und Felsbiotopen gibt es außer<strong>de</strong>m noch eine Rubrik in <strong><strong>de</strong>r</strong> Kopfzeile, in <strong><strong>de</strong>r</strong><br />
die GPS-Koordinaten bei punktuell ausgebil<strong>de</strong>ten <strong>Biotope</strong>n eingetragen wer<strong>de</strong>n.<br />
Bei <strong>de</strong>n Hochstau<strong>de</strong>nsäumen (6430) ist das Feld zur aktuellen Nutzung durch die Angabe<br />
<strong><strong>de</strong>r</strong> Breite links und rechts <strong>de</strong>s Fließgewässers ersetzt, weil diese in <strong><strong>de</strong>r</strong> Regel als lineare<br />
<strong>Biotope</strong> erfasst wer<strong>de</strong>n. Auch bei an<strong><strong>de</strong>r</strong>en Biotoptypen (z.B. Großseggenried entlang eines<br />
verlan<strong>de</strong>ten Grabens) mit linearer Ausprägung sollte die Breite auf <strong>de</strong>m Kartierbogen<br />
vermerkt wer<strong>de</strong>n.<br />
Bei <strong>de</strong>n Biotoptypen 3130, 3140 und 3150 sowie 4030 und 6230 besteht rein theoretisch die<br />
Möglichkeit, dass Mikromosaike vorgefun<strong>de</strong>n wer<strong>de</strong>n, die sich aufgrund geringer Größe nicht<br />
abgrenzen und darstellen lassen. Hier gibt es die Möglichkeit, Komplexflächen auszuweisen,<br />
d.h. einer Flächennummer wer<strong>de</strong>n zwei o<strong><strong>de</strong>r</strong> mehr Biotoptypen zugeordnet. In <strong><strong>de</strong>r</strong> Kopfzeile<br />
unter <strong><strong>de</strong>r</strong> Rubrik % -Anteil im Komplex muss in diesem Fall <strong><strong>de</strong>r</strong> prozentuale Anteil <strong>de</strong>s<br />
Biotoptyps an <strong><strong>de</strong>r</strong> Gesamtfläche angegeben wer<strong>de</strong>n. Die Bildung von Komplexflächen ist<br />
jedoch nur für diese fünf Biotoptypen möglich. Bei allen an<strong><strong>de</strong>r</strong>en Biotoptypen darf eine<br />
Flächennummer ein<strong>de</strong>utig nur einem Biotoptyp zugeordnet wer<strong>de</strong>n.<br />
Auf Seite 2 <strong><strong>de</strong>r</strong> Kartierbögen befin<strong>de</strong>t sich ein Unterschriftsfeld. Je<strong><strong>de</strong>r</strong> Bogen ist in diesem<br />
Feld eigenhändig von <strong>de</strong>m für die Gemein<strong>de</strong> verantwortlichen Kartierer abzuzeichnen.<br />
Den Hauptteil <strong><strong>de</strong>r</strong> Kartierbögen nimmt die Bewertung ein, die aus <strong>de</strong>n drei Einzelparametern<br />
Struktur, Artenzusammensetzung und Beeinträchtigungen zusammengesetzt ist.<br />
Bei <strong><strong>de</strong>r</strong> Bewertung <strong><strong>de</strong>r</strong> Struktur wird das Vorhan<strong>de</strong>nsein bestimmter, für <strong>de</strong>n jeweiligen<br />
Biotoptyp typischer Strukturmerkmale bewertet, teilweise fließen auch <strong><strong>de</strong>r</strong> Grad <strong><strong>de</strong>r</strong><br />
Verbrachung o<strong><strong>de</strong>r</strong> Verbuschung mit ein. Das Resultat ist eine Einordnung in die<br />
Bewertungskategorien A, B o<strong><strong>de</strong>r</strong> C.<br />
Die Bewertung <strong><strong>de</strong>r</strong> Artenzusammensetzung basiert auf <strong><strong>de</strong>r</strong> Artenliste, die Charakterarten<br />
und seltene Arten enthält. Aus <strong><strong>de</strong>r</strong> Summe <strong><strong>de</strong>r</strong> kartierten Pflanzenarten resultiert eine<br />
Artenzahl, die eine Einordnung in die Kategorien A, B o<strong><strong>de</strong>r</strong> C ermöglicht. Bei einigen<br />
Biotoptypen sind Artengruppen angegeben, die zwar typisch für die Ausprägung sind, aber<br />
7
Kartieranleitung Biotopkataster Luxemburg Vorgehensweise<br />
zu häufig vorkommen und daher nicht in die Bewertung einfließen. Dies ist extra auf <strong>de</strong>m<br />
Kartierbogen vermerkt. Gleiches gilt für die Neophyten in <strong>de</strong>n Feuchtbiotopen, <strong><strong>de</strong>r</strong>en<br />
Erwähnung wichtig ist, die aber für die Artenzahl nicht relevant sind und für die Moose und<br />
Flechten, bei <strong>de</strong>nen nicht davon ausgegangen wer<strong>de</strong>n kann, dass je<strong><strong>de</strong>r</strong> Kartierer sich mit<br />
diesen Artengruppen auskennt.<br />
Der dritte Bewertungsparameter berücksichtigt die Beeinträchtigungen und Störungen <strong>de</strong>s<br />
Biotoptyps. Auch hier wird zunächst eine Einordnung in die Kategorien A, B o<strong><strong>de</strong>r</strong> C<br />
vorgenommen. Dann sollten alle Störfaktoren in <strong><strong>de</strong>r</strong> nachfolgen<strong>de</strong>n Liste angekreuzt bzw.<br />
ergänzt und zusätzlich jene unterstrichen wer<strong>de</strong>n, die für die Gesamtbewertung relevant<br />
sind.<br />
Die Bewertung <strong><strong>de</strong>r</strong> Einzelparameter ergibt eine Gesamtbewertung, die nach folgen<strong>de</strong>m<br />
Schema berechnet wird:<br />
Tab. 2: Errechnen <strong><strong>de</strong>r</strong> Gesamtbewertung aus <strong>de</strong>n Bewertungen <strong><strong>de</strong>r</strong> Einzelparameter<br />
I Habitatstruktur A A A A A A A A A B B B B B B B B B C C C C C C C C C<br />
II Arteninventar A A A B B B C C C A A A B B B C C C A A A B B B C C C<br />
III<br />
A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C<br />
Beeinträchtigungen<br />
Resultat:<br />
Gesamtbewertung<br />
Erhaltungszustand<br />
A A B A B B B B C A B B B B B B B C B B C B B C C C C<br />
Nicht immer sind bei <strong><strong>de</strong>r</strong> Bewertung <strong><strong>de</strong>r</strong> Einzelparameter die Verhältnisse ein<strong>de</strong>utig und die<br />
Entscheidung zur Zuordnung zu einer <strong><strong>de</strong>r</strong> Kategorien ist dann schwierig. In diesen Fällen<br />
kann <strong><strong>de</strong>r</strong> Kartierer aus seinen Erfahrungswerten und seiner subjektiven Einschätzung heraus<br />
eine Entscheidung treffen.<br />
Bei einigen Biotoptypen (Großseggenrie<strong>de</strong>, Röhrichte, Quellen, Stillgewässer, Streuobst)<br />
macht es keinen Sinn, eine Bewertung <strong><strong>de</strong>r</strong> Artenzusammensetzung nach Artenzahlen<br />
vorzunehmen, weil entwe<strong><strong>de</strong>r</strong> <strong><strong>de</strong>r</strong> Biotoptyp von Natur aus artenarm ist (Großseggenrie<strong>de</strong>,<br />
Röhrichte), das Vorkommen bestimmter krautiger Pflanzenarten eine geringere Rolle spielt<br />
als die Strukturparameter (Stillgewässer und Quellen) o<strong><strong>de</strong>r</strong> ein ganz an<strong><strong>de</strong>r</strong>es<br />
Vegetationsstockwerk betrachtet wird (Streuobst). In diesen Fällen wird keine Bewertung<br />
zum Arteninventar vorgenommen und die Gesamtbewertung kann nicht aus <strong><strong>de</strong>r</strong> Bewertung<br />
<strong><strong>de</strong>r</strong> Einzelparameter errechnet wer<strong>de</strong>n. Es erfolgt lediglich eine subjektive<br />
Gesamtbewertung.<br />
Resultierend aus <strong>de</strong>n festgestellten Beeinträchtigungen können, müssen aber nicht,<br />
Pflegemaßnahmen für die kartierte Fläche vorgeschlagen wer<strong>de</strong>n. Die Einschätzung <strong>de</strong>s<br />
Kartierers kann jedoch in diesem Zusammenhang durchaus wichtig sein, <strong>de</strong>shalb wird<br />
empfohlen, diese Rubrik für alle Flächen auszufüllen, wo sich Bedarf ergibt.<br />
Wer sich faunistisch auskennt, kann außer<strong>de</strong>m nach Tierarten <strong><strong>de</strong>r</strong> Anhänge II, IV und V <strong><strong>de</strong>r</strong><br />
FFH-Richtlinie, Vogelarten nach Anhang I <strong><strong>de</strong>r</strong> Vogelschutz-Richtlinie und Tierarten nach<br />
Anhang I <strong>de</strong>s Biodiversitätsreglements Ausschau halten und sie in <strong><strong>de</strong>r</strong> entsprechen<strong>de</strong>n<br />
Rubrik vermerken.<br />
In <strong>de</strong>m Fall, dass durch die zu kartieren<strong>de</strong> Nutzfläche eine Gemein<strong>de</strong>grenze verläuft, ist<br />
jener Kartierer zuständig, in <strong>de</strong>ssen Gebiet <strong><strong>de</strong>r</strong> Hauptteil <strong><strong>de</strong>r</strong> Fläche liegt. Sind die<br />
Teilflächen in etwa gleich groß, wird die Fläche kartiert und später bei <strong><strong>de</strong>r</strong> Digitalisierung<br />
entschie<strong>de</strong>n, welcher Gemein<strong>de</strong> sie zugeschlagen wird.<br />
8
Kartieranleitung Biotopkataster Luxemburg Vorgehensweise<br />
Spezielle Vorgehensweise bei Glatthafer- und Calthion-Wiesen<br />
Im landwirtschaftlich genutzten Grünland geht <strong>de</strong>m Biotopkataster die parallel laufen<strong>de</strong><br />
Übersichtskartierung voraus, insofern nicht schon eine ältere Kartierung vorliegt. Laut <strong>de</strong>n im<br />
Einleitungskapitel erwähnten "Instructions d'application" <strong>de</strong>s Artikels 17 vom Dezember 2006<br />
sind Glatthaferwiesen und Sumpfdotterblumenwiesen nur in ihren besten Ausprägungen<br />
(Kategorie A – Flächen) geschützt (vgl. Kap. 4.1.7 und 4.2.11, Kartierkriterien).<br />
Entsprechend müssen parallel zur Übersichtskartierung <strong><strong>de</strong>r</strong> mageren Grünlandflächen die<br />
Biotopkataster-Kartierbögen für die Glatthaferwiesen resp. Calthion-Wiesen ausgefüllt<br />
wer<strong>de</strong>n, wenn sich eine A-Bewertung ergibt. Der Flächenanteil mit <strong><strong>de</strong>r</strong> A-Bewertung muss<br />
genau gegen schlechter zu bewerten<strong>de</strong> Anteile mit B- o<strong><strong>de</strong>r</strong> C-Bewertung abgegrenzt<br />
wer<strong>de</strong>n. Die B- und C-Bewertung auf <strong>de</strong>n Bögen <strong><strong>de</strong>r</strong> Glatthafer- und<br />
Sumpfdotterblumenwiesen wird für die Biotopkataster-Kartierung gar nicht benötigt, wur<strong>de</strong><br />
aber auf <strong>de</strong>n Bögen belassen für an<strong><strong>de</strong>r</strong>e, spätere Kartierungen.<br />
Spezielle Vorgehensweise bei Streuobstbestän<strong>de</strong>n<br />
Alle Streuobstbestän<strong>de</strong> ab 25 und mehr Hochstammobstbäumen älter als 30 Jahre und einer<br />
Bestandsdichte von 50 Bäumen pro Hektar (vgl. Kap 4.1.6, Kartierkriterien) wer<strong>de</strong>n im<br />
Rahmen <strong>de</strong>s Biotopkatasters kartiert. Befin<strong>de</strong>t sich im Unterwuchs eines solchen Bestan<strong>de</strong>s<br />
eine Glatthaferwiese <strong><strong>de</strong>r</strong> Kategorie A, wer<strong>de</strong>n neben <strong><strong>de</strong>r</strong> W-Nummer für die Wiese zwei<br />
verschie<strong>de</strong>ne Art.17-Kartiernummern (Bx) für die Glatthaferwiese und <strong>de</strong>n Streuobstbestand<br />
vergeben. Befin<strong>de</strong>t sich im Unterwuchs eine laut Übersichtskartierung naturschutzrelevante<br />
Wiese, die aber nicht die Art.17-Kriterien erfüllt, erhält die Fläche eine B-Nummer für das<br />
Streuobst und eine W-Nummer für die Wiese.<br />
Streuobstbestän<strong>de</strong> wer<strong>de</strong>n wie alle an<strong><strong>de</strong>r</strong>en Biotoptypen nicht nach Nutzungsparzellen,<br />
son<strong><strong>de</strong>r</strong>n als zusammenhängen<strong><strong>de</strong>r</strong> Biotoptyp kartiert. Bei <strong><strong>de</strong>r</strong> Abgrenzung ist auf<br />
Bestan<strong>de</strong>slücken zu achten; hier muss abgewägt wer<strong>de</strong>n, ob die Bestan<strong>de</strong>sdichte von 50<br />
Bäumen pro Hektar unterschritten wird und eine Trennung erfolgen muss.<br />
In Grenzfällen sollte die Fläche probeweise digitalisiert und die Anzahl <strong><strong>de</strong>r</strong> Obstbäume durch<br />
eine Luftbildauswertung geschätzt wer<strong>de</strong>n. Aus <strong>de</strong>n Ergebnissen wird eine Entscheidung<br />
getroffen, wo die Abgrenzungen verlaufen sollen und anschließend erst die<br />
Bestandsaufnahme im Gelän<strong>de</strong> vorgenommen.<br />
Spezielle Vorgehensweise bei Stillgewässern<br />
Stillgewässer sind grundsätzlich ab einer Min<strong>de</strong>stgröße von 25qm (inkl.<br />
Verlandungsbereiche) geschützt, insofern sie eine naturnahe Entwicklung aufweisen.<br />
Zusätzlich sind bestimmte Ausprägungen von Stillgewässern über die FFH-Richtlinie<br />
geschützt, wenn sie spezielle Kriterien erfüllen.<br />
Bei <strong><strong>de</strong>r</strong> Kartierung wird zunächst <strong><strong>de</strong>r</strong> Stillgewässerbogen (BK08) ausgefüllt und<br />
anschließend geprüft, ob evtl. FFH-Kriterien zutreffen. Dies wäre das Vorkommen von<br />
Schlammbo<strong>de</strong>nvegetation (3130), Characeen (3140) o<strong><strong>de</strong>r</strong> Schwimblatt- und/o<strong><strong>de</strong>r</strong><br />
Unterwasservegetation (3150). Ist eine o<strong><strong>de</strong>r</strong> mehrere dieser Kriterien erfüllt, muss zusätzlich<br />
zum Stillgewässerbogen noch <strong><strong>de</strong>r</strong> entsprechen<strong>de</strong> FFH-Bogen ausgefüllt wer<strong>de</strong>n (vgl. auch<br />
Kap. 4.1.5 und 4.2.1 bis 4.2.3).<br />
9
Kartieranleitung Biotopkataster Luxemburg Vorgehensweise<br />
3.3. Hinweise zu Kartierschwelle und Nummerierung<br />
Für die einzelnen Art.17-<strong>Biotope</strong> gelten die Vorgaben aus <strong>de</strong>n "Instructions d'application"<br />
(siehe Anhang), wann eine Fläche als geschützter Biotoptyp anzusehen ist und auskartiert<br />
wer<strong>de</strong>n muss. Wichtigste Kartierkriterien sind die hierin festgelegten Min<strong>de</strong>stgrößen. Dazu<br />
kommen bei manchen <strong>Biotope</strong>n zusätzliche Vorgaben, die teilweise <strong>de</strong>n Vorgaben <strong><strong>de</strong>r</strong><br />
Europäischen Union zur FFH-Richtlinie entsprechen (Manuel d'Interprétation <strong>de</strong>s Habitats <strong>de</strong><br />
l'Union Européenne pour les types d'habitat <strong>de</strong> l'annexe 1). Die Kartierkriterien sind<br />
ausführlich in <strong>de</strong>n Kapiteln zu <strong>de</strong>n Kartierkriterien (Kap. 4.1 und 4.2) resp. in <strong><strong>de</strong>r</strong> Übersicht in<br />
<strong><strong>de</strong>r</strong> Tabelle im Anhang I dargestellt.<br />
Wegen <strong><strong>de</strong>r</strong> verschie<strong>de</strong>nen parallel laufen<strong>de</strong>n Kartierungen müssen unterschiedliche<br />
Nummerierungssysteme angewandt wer<strong>de</strong>n, wie bereits in <strong>de</strong>n entsprechen<strong>de</strong>n Kapiteln<br />
erläutert (s.o.). Grundsätzlich wird, weil gemein<strong>de</strong>weise kartiert wird, in je<strong><strong>de</strong>r</strong> Gemein<strong>de</strong><br />
(nicht Sektion!) in Bezug auf die fortlaufen<strong>de</strong> Nummer bei 1 angefangen. Die folgen<strong>de</strong><br />
Tabelle gibt eine Übersicht über die einzelnen Nummerierungen, um Verwirrungen zu<br />
vermei<strong>de</strong>n:<br />
Tab. 3: Nummerierung <strong><strong>de</strong>r</strong> kartierten Flächen<br />
Art.17-<strong>Biotope</strong> einschließlich Kat. A-Flächen<br />
Glatthafer- und Feuchtwiesen und Streuobst mit 25<br />
Altbäumen und mehr<br />
Fortlaufen<strong>de</strong> Nummer (unabhängig von <strong><strong>de</strong>r</strong><br />
Pflanzengesellschaft) mit vorangestelltem B (B1,<br />
B2, etc.)<br />
10<br />
Naturschutzrelevante Grünlandparzellen <strong><strong>de</strong>r</strong><br />
Magergrünland- Übersichtskartierung<br />
Fortlaufen<strong>de</strong> Nummer mit vorangestelltem W<br />
(W1, W2, etc.)<br />
Zu beachten ist, dass die Rubrik „Flächenco<strong>de</strong>“ im Kopf <strong><strong>de</strong>r</strong> Kartierbögen nicht während <strong><strong>de</strong>r</strong><br />
Gelän<strong>de</strong>kartierung ausgefüllt, son<strong><strong>de</strong>r</strong>n erst nach <strong><strong>de</strong>r</strong> Digitalisierung automatisch erstellt und<br />
anschließend bei <strong><strong>de</strong>r</strong> Dateneingabe auf <strong>de</strong>n Bögen vermerkt wird.<br />
3.4. Fundpunkte seltener Arten<br />
Nach Möglichkeit sollten eventuelle Fundpunkte seltener Tier- und Pflanzenarten <strong><strong>de</strong>r</strong><br />
kartierten Flächen in <strong><strong>de</strong>r</strong> Karte eingetragen und die Fundstelle mit <strong>de</strong>m GPS-Gerät<br />
eingemessen wer<strong>de</strong>n. Relevant sind hier bei <strong>de</strong>n Pflanzen insbeson<strong><strong>de</strong>r</strong>e die Rote-Liste-<br />
Arten <strong><strong>de</strong>r</strong> Kategorie CR (Critical = vom Aussterben bedroht) nach <strong><strong>de</strong>r</strong> Roten Liste <strong><strong>de</strong>r</strong><br />
gefähr<strong>de</strong>ten Pflanzen Luxemburgs (COLLING 2005), aber auch die als Endangered (EN =<br />
stark gefähr<strong>de</strong>t) und Rare (R = selten) eingestuften Arten. Einen Augenmerk sollten die<br />
Kartierer auf folgen<strong>de</strong> vier CR-Arten legen, die von beson<strong><strong>de</strong>r</strong>em Interesse sind:<br />
• Euphrasia officinalis subsp. rostkoviana<br />
• Galium spurium<br />
• Polygala amarella<br />
• Ranunculus he<strong><strong>de</strong>r</strong>aceus<br />
Dazu wer<strong>de</strong>n je<strong>de</strong>m Kartierer digital die vorliegen<strong>de</strong>n historischen Daten zur Verfügung<br />
gestellt, die im Rahmen <strong>de</strong>s Katasters überprüft wer<strong>de</strong>n sollen.
Kartieranleitung Biotopkataster Luxemburg Vorgehensweise<br />
3.5. Zweifelsfälle<br />
Naturgegeben können immer Zweifelsfälle vorkommen, z.B. wenn eine Abgrenzung<br />
zwischen <strong>geschützten</strong> und nicht <strong>geschützten</strong> <strong>Biotope</strong>n nicht zweifelsfrei durchgeführt wer<strong>de</strong>n<br />
kann o<strong><strong>de</strong>r</strong> wenn die Fläche nicht zu einem optimalen Zeitpunkt aufgesucht wer<strong>de</strong>n konnte. In<br />
diesen Fällen können die Flächen als Verdachtsflächen markiert wer<strong>de</strong>n und zu einem<br />
späteren Zeitpunkt noch einmal aufgesucht o<strong><strong>de</strong>r</strong> mit an<strong><strong>de</strong>r</strong>en Kartierern und Experten<br />
diskutiert wer<strong>de</strong>n.<br />
Bei Art.17-<strong>Biotope</strong>n, die in einer zusammenhängen<strong>de</strong>n Fläche in unterschiedlich guter<br />
Ausprägung vorliegen, sollte bei gravieren<strong>de</strong>n Unterschie<strong>de</strong>n, z.B. eine A-Bewertung in<br />
einem Teilbereich und eine C-Bewertung in einem benachbarten Teilbereich, eine<br />
Abgrenzung und Trennung vorgenommen wer<strong>de</strong>n. Dies aber nur, wenn bei bei<strong>de</strong>n<br />
Teilbereichen die Min<strong>de</strong>stgröße nicht unterschritten wird.<br />
11
Kartieranleitung Biotopkataster Luxemburg Kartierkriterien<br />
4. Kartierkriterien für die zu erfassen<strong>de</strong>n Art.17-<br />
<strong>Biotope</strong><br />
4.1. Nicht nach Fauna-Flora-Habitatrichtlinie geschützte<br />
<strong>Biotope</strong><br />
Zu dieser Kategorie gehören alle Biotoptypen, die zwar nach Art. 17 <strong>de</strong>s luxemburgischen<br />
Naturschutzgesetzes geschützt sind, aber keinen europaweiten Schutz nach <strong><strong>de</strong>r</strong> Fauna-<br />
Flora-Habitatrichtlinie genießen. Hierzu gehören Röhrichte, Großseggenrie<strong>de</strong>, Feuchtwiesen,<br />
Sümpfe und Nie<strong><strong>de</strong>r</strong>moore, Sand- und Silikatmagerrasen, Streuobstbestän<strong>de</strong>, Quellen (mit<br />
Ausnahme <strong><strong>de</strong>r</strong> Kalktuff-Quellen, die als FFH-Biotoptyp 7220 erfasst wer<strong>de</strong>n) und<br />
Stillgewässer ohne Unterwasser- und Schwimmblattvegetation, Characeen o<strong><strong>de</strong>r</strong><br />
Schlammbo<strong>de</strong>nvegetation.<br />
Die Pflanzengesellschaften, die <strong>de</strong>n einzelnen Biotoptypen zugeordnet wer<strong>de</strong>n und <strong>de</strong>m<br />
Kartierer als Anhaltspunkt dienen sollen, folgen überwiegend <strong><strong>de</strong>r</strong> Nomenklatur von<br />
OBERDORFER 1993a, OBERDORFER 1993b und OBERDORFER 1998 mit Ausnahme <strong><strong>de</strong>r</strong><br />
Wirtschaftswiesen, die nach DIERSCHKE & BRIEMLE 2002 (Arrhenatherion) und POTT 1995<br />
(Calthion) benannt wur<strong>de</strong>n.<br />
4.1.1. Großseggenrie<strong>de</strong> (BK04)<br />
Großseggenrie<strong>de</strong> sind meist artenärmere, von einer o<strong><strong>de</strong>r</strong> wenigen Großseggenarten<br />
dominierte Bestän<strong>de</strong> mit dichtrasigem o<strong><strong>de</strong>r</strong> bultigem Wuchs. Sie fin<strong>de</strong>n sich überwiegend an<br />
flach überschwemmten o<strong><strong>de</strong>r</strong> auch quelligen Stellen, die durchaus zeitweise trocken fallen<br />
können und sind vor allem in Sümpfen, Nie<strong><strong>de</strong>r</strong>mooren, entlang verlan<strong>de</strong>ter Gräben und an<br />
<strong>de</strong>n Ufern von Seen und Teichen verbreitet.<br />
Potenzielle Pflanzengesellschaften:<br />
- Caricetum elatae<br />
- Caricetum gracilis (Carex acuta)<br />
- Caricetum paniculatae<br />
- Caricetum rostratae<br />
- Caricetum vesicariae<br />
- Caricetum vulpinae<br />
- Carex acutiformis-Gesellschaft<br />
- Carex disticha-Gesellschaft<br />
Alle Großseggenrie<strong>de</strong> ab einer Min<strong>de</strong>stgröße von 100m 2 sind laut Naturschutzgesetz<br />
geschützt. Weitere Kartierkriterien sind nicht festgelegt, die zu erfassen<strong>de</strong>n <strong>Biotope</strong> wer<strong>de</strong>n<br />
vor allem durch die typische Artenkombination charakterisiert.<br />
Im Einzelfall können Verzahnungen mit Feuchtwiesen o<strong><strong>de</strong>r</strong> verwandten Gesellschaften<br />
vorkommen, hier wird nach <strong><strong>de</strong>r</strong> Häufigkeit typischer Arten in die ein o<strong><strong>de</strong>r</strong> an<strong><strong>de</strong>r</strong>e Richtung<br />
entschie<strong>de</strong>n. Wenn die Seggenarten mehr als 50% <strong><strong>de</strong>r</strong> Fläche <strong>de</strong>cken, ist <strong><strong>de</strong>r</strong> Bestand als<br />
Seggenried zu kartieren; bei einer Deckung weniger als 50% wird <strong><strong>de</strong>r</strong> Bestand zu <strong>de</strong>n<br />
Feuchtwiesen gestellt und kann damit (bei B- o<strong><strong>de</strong>r</strong> C-Bewertung) aus <strong>de</strong>m Biotopkataster<br />
fallen.<br />
12
Kartieranleitung Biotopkataster Luxemburg Kartierkriterien<br />
4.1.2. Quellen (BK05)<br />
Bei Quellbereichen han<strong>de</strong>lt es sich um permanent o<strong><strong>de</strong>r</strong> zeitweise schütten<strong>de</strong> natürliche<br />
Grundwasseraustritte. Dabei wer<strong>de</strong>n nach Austrittsart die Quelltypen Sturz-, Tümpel-,<br />
Sicker- o<strong><strong>de</strong>r</strong> Sinterquellen unterschie<strong>de</strong>n. Die typische Umgebung umfasst je nach Quelltyp<br />
Quellflur, Quellbach, Kleinseggensumpf, Nasswiese, Nie<strong><strong>de</strong>r</strong>moor, Zwischenmoor o<strong><strong>de</strong>r</strong><br />
Stau<strong>de</strong>nfluren.<br />
Potenzielle Pflanzengesellschaften:<br />
• Silikatquellfluren<br />
- Stellario-alsines-Montietum rivularis (Pott 1995)<br />
- Cardamine amara-Basalgesellschaft (Pott 1995)<br />
• Kalkquellfluren (Tuffquellen, siehe FFH-Biotoptypen, Kap. 4.2.13)<br />
- Cratoneuretum filicino-commutati (Moosgesellschaft)<br />
Nicht immer sind Quellbereiche durch quelltypische Moos- und Pflanzenarten<br />
gekennzeichnet, alle Quellen sind aber typischerweise im Wasser bzw. auf <strong>de</strong>m<br />
Gewässergrund durch charakteristische Quellorganismen besie<strong>de</strong>lt. Sie unterschei<strong>de</strong>n sich<br />
dadurch von Hangwassersammel- und Druckwasseraustritts-Stellen.<br />
Ein wichtiger Faktor ist außer<strong>de</strong>m die Wassertemperatur, Grundwasseraustritte sind im<br />
Sommer immer <strong>de</strong>utlich kälter und im Winter immer <strong>de</strong>utlich wärmer als das<br />
Oberflächenwasser. Bei Schwierigkeiten bei <strong><strong>de</strong>r</strong> Unterscheidung von Oberflächen- und<br />
Grundwasser, z.B. bei stark wasserstauen<strong>de</strong>n, tonigen Bö<strong>de</strong>n, kann daher das Messen <strong><strong>de</strong>r</strong><br />
Wassertemperatur mit einem Thermometer Aufschluss darüber geben, ob es sich bei einer<br />
nassen Stelle tatsächlich um einen Quellaustritt han<strong>de</strong>lt. Laut <strong><strong>de</strong>r</strong> Kartieranleitung zum<br />
Bayerischen Quellerfassungsbogen (BAYERISCHES LANDESAMT FÜR WASSERWIRTSCHAFT<br />
2005) darf die Temperatur im Sommer nicht mehr als 14°C überschreiten und im Winter nicht<br />
unter 8°C liegen.<br />
Alle nicht gefassten und nicht zur Trinkwassergewinnung genutzten Quellen sind nach Art.17<br />
<strong>de</strong>s luxemburgischen Naturschutzgesetzes unabhängig von ihrer Größe geschützt. Hierzu<br />
gehören <strong>de</strong>mnach nicht nur naturnah ausgebil<strong>de</strong>te Quellbereiche, son<strong><strong>de</strong>r</strong>n auch<br />
anthropogen stark verän<strong><strong>de</strong>r</strong>te Quellaustritte, z.B. mit Sohlen- o<strong><strong>de</strong>r</strong> Uferverbau. Betrachtetet<br />
wird bei <strong><strong>de</strong>r</strong> Kartierung <strong><strong>de</strong>r</strong> Quellmund und 10m <strong>de</strong>s Quellbaches.<br />
Der Kartierbogen entspricht einem vereinfachten Verfahren <strong>de</strong>s Bayrischen<br />
Quellerfassungsbogens. Bei Schwierigkeiten mit <strong>de</strong>m Bogen hilft die Kartieranleitung <strong>de</strong>s<br />
Bayrischen Lan<strong>de</strong>samtes für Wasserwirtschaft weiter, die aus <strong>de</strong>m Internet heruntergela<strong>de</strong>n<br />
wer<strong>de</strong>n kann (BAYERISCHES LANDESAMT FÜR WASSERWIRTSCHAFT 2005,<br />
www.bayern.<strong>de</strong>/LFW/projekte/qp/welcome.htm).<br />
Die Quellen sollten, wenn sie auf <strong><strong>de</strong>r</strong> Karte nicht ein<strong>de</strong>utig einzuzeichnen sind (z.B. auf<br />
großen landwirtschaftlichen Nutzflächen ohne Orientierungsmöglichkeit), mit einem GPS-<br />
Gerät eingemessen wer<strong>de</strong>n; bei Einzelquellen wird hierzu die Lage <strong>de</strong>s Quellmun<strong>de</strong>s<br />
berücksichtigt, bei einem Quellsystem/-komplex wird <strong><strong>de</strong>r</strong> topographisch niedrigste und <strong><strong>de</strong>r</strong><br />
höchste Punkt eingemessen.<br />
Sollte sich <strong><strong>de</strong>r</strong> Quellbereich als Quellsystem o<strong><strong>de</strong>r</strong> –komplex über mehr als 100qm<br />
erstrecken, wird zusätzlich zum Quellerfassungsbogen <strong><strong>de</strong>r</strong> Bogen für Sümpfe und<br />
Nie<strong><strong>de</strong>r</strong>moore (BK11, vgl. Kap 4.1.8) ausgefüllt. Außer<strong>de</strong>m wer<strong>de</strong>n alle erkennbaren<br />
Quellaustritte mit einem Punkt in <strong><strong>de</strong>r</strong> Karte markiert. Ist kein ein<strong>de</strong>utiger Quellaustritt<br />
erkennbar, wird symbolisch ein Punkt an die topografisch höchste Stelle <strong>de</strong>s Quellsumpfs<br />
gesetzt.<br />
Zu beachten ist bei <strong>de</strong>n Quellen außer<strong>de</strong>m, dass Quellfluren mit Kalktuff als einziger<br />
Quelltyp nach FFH-Richtlinie geschützt sind und <strong><strong>de</strong>r</strong> entsprechen<strong>de</strong> Bewertungsbogen<br />
ausgefüllt wer<strong>de</strong>n muss (vgl. Kap. 4.2.13.). Bei Schwierigkeiten bei <strong><strong>de</strong>r</strong> Kartierung<br />
13
Kartieranleitung Biotopkataster Luxemburg Kartierkriterien<br />
(insbeson<strong><strong>de</strong>r</strong>e mit <strong><strong>de</strong>r</strong> Bestimmung <strong><strong>de</strong>r</strong> Moose) sollte die Quelle als Verdachtsfläche<br />
gekennzeichnet und anschließend von einem Experten beurteilt wer<strong>de</strong>n.<br />
4.1.3. Röhrichte (BK06)<br />
Röhrichte sind hochwüchsige, meist artenärmere Pflanzenbestän<strong>de</strong> überwiegend am Ufer<br />
o<strong><strong>de</strong>r</strong> im Verlandungsbereich stehen<strong><strong>de</strong>r</strong> o<strong><strong>de</strong>r</strong> fließen<strong><strong>de</strong>r</strong> Gewässer, einschließlich vollständig<br />
verlan<strong>de</strong>ter Gewässer. Im Rahmen <strong>de</strong>s Biotopkatasters wer<strong>de</strong>n nur die<br />
Stillgewässerröhrichte und Schilfröhrichte erfasst, die Fließgewässerröhrichte sind wie alle<br />
an<strong><strong>de</strong>r</strong>en Fließgewässerlebensräume (mit Ausnahme <strong><strong>de</strong>r</strong> Hochstau<strong>de</strong>nsäume) nicht in die<br />
Kartierung integriert.<br />
Stillgewässer- und Schilfröhrichte sind meist hochwüchsig und kommen im<br />
Verlandungsbereich stehen<strong><strong>de</strong>r</strong> und träge fließen<strong><strong>de</strong>r</strong> Gewässer, in versumpften Auen sowie<br />
im Kontakt mit Sümpfen und Nie<strong><strong>de</strong>r</strong>mooren vor. Es han<strong>de</strong>lt sich meist um relativ artenarme<br />
Bestän<strong>de</strong> die nur durch eine Art dominiert wer<strong>de</strong>n.<br />
Potenzielle Pflanzengesellschaften:<br />
- Phragmitetum australis<br />
- Scirpetum lacustris (Schoenoplectus lacustris)<br />
- Typhetum angustifoliae<br />
- Typhetum latifoliae<br />
- Glycerietum maximae<br />
- Glycerio-Sparganietum erecti<br />
- Equisetum fluviatile-Gesellschaft<br />
- Cicuto-Caricetum pseudocyperi<br />
Die Min<strong>de</strong>stgröße für die Aufnahme in das Biotopkataster beträgt für Röhrichte 100m 2 .<br />
Weitere Kartierkriterien sind nicht festgelegt, die zu erfassen<strong>de</strong>n <strong>Biotope</strong> wer<strong>de</strong>n vor allem<br />
durch die typische Artenkombination charakterisiert.<br />
Im Einzelfall können Verzahnungen mit Feuchtwiesen o<strong><strong>de</strong>r</strong> verwandten Gesellschaften<br />
vorkommen, hier wird nach <strong><strong>de</strong>r</strong> Häufigkeit typischer Arten in die ein o<strong><strong>de</strong>r</strong> an<strong><strong>de</strong>r</strong>e Richtung<br />
entschie<strong>de</strong>n. Wenn die Röhrichtarten mehr als 50% <strong><strong>de</strong>r</strong> Fläche <strong>de</strong>cken, ist <strong><strong>de</strong>r</strong> Bestand als<br />
Röhricht zu kartieren; bei einer Deckung weniger als 50% wird <strong><strong>de</strong>r</strong> Bestand zu <strong>de</strong>n<br />
Feuchtwiesen gestellt und kann damit (bei B- o<strong><strong>de</strong>r</strong> C-Bewertung) aus <strong>de</strong>m Biotopkataster<br />
fallen.<br />
4.1.4. Sand- und Silikatmagerrasen (BK07)<br />
Die Sand- und Silikatmagerrasen sind artenreiche, lückige Vegetationsbestän<strong>de</strong>, die in <strong><strong>de</strong>r</strong><br />
Struktur <strong>de</strong>n Kalkmagerrasen ähneln, aber aufgrund <strong><strong>de</strong>r</strong> Basenarmut <strong>de</strong>s Ausgangsgesteins<br />
eine an<strong><strong>de</strong>r</strong>e Artenzusammensetzung besitzen. Sie kommen in Luxemburg vor allem auf<br />
Luxemburger Sandstein und im Zentrum auf Buntsandstein als Sandmagerrasen, im Ösling<br />
als Silikatmagerrasen vor. Problematisch ist die pflanzensoziologische Einordnung dieser<br />
Gesellschaften, zu <strong><strong>de</strong>r</strong> es noch kein anerkanntes System gibt. In Luxemburg ist die<br />
Artenzusammensetzung sowohl auf Tonschiefer als auch auf Sandstein sehr homogen.<br />
Potenzielle Pflanzengesellschaften:<br />
- Thymo-Festucetum (Pott 1995)<br />
- Genisto sagittalis-Phleetum phleoi<strong>de</strong>s (Pott 1995)<br />
- Airo-Festucetum ovinae<br />
- Agrostis tenuis-Dianthus <strong>de</strong>ltoi<strong>de</strong>s-Gesellschaft<br />
- Festuca rubra-Agrostis capillaris-Gesellschaft<br />
14
Kartieranleitung Biotopkataster Luxemburg Kartierkriterien<br />
Aufgrund <strong><strong>de</strong>r</strong> unklaren pflanzensoziologischen Situation wur<strong>de</strong>n diese Vegetationstypen<br />
nicht unter <strong>de</strong>n Schutz <strong><strong>de</strong>r</strong> FFH-Richtlinie gestellt. Da es sich aber hier wie bei <strong>de</strong>n an<strong><strong>de</strong>r</strong>en<br />
Magerrasengesellschaften um bedrohte <strong>Biotope</strong> han<strong>de</strong>lt, wer<strong>de</strong>n sie im Rahmen <strong>de</strong>s<br />
Biotopkatasters als Trockenrasen silikatischer Ausgangsgesteine mit kartiert.<br />
Die Min<strong>de</strong>stgröße für die Kartierung <strong><strong>de</strong>r</strong> Sandmagerrasen beträgt wie bei <strong>de</strong>n meisten<br />
an<strong><strong>de</strong>r</strong>en Magerrasengesellschaften 100m 2 . Weiteres Kartierkriterium ist die typische<br />
Ausbildung <strong><strong>de</strong>r</strong> Vegetation.<br />
4.1.5. Stillgewässer (BK08)<br />
Alle Stillgewässer, die einer naturnahen Entwicklung unterliegen, sind nach Art.17 geschützt.<br />
Eine naturnahe Entwicklung lässt sich vor allem am Zustand <strong><strong>de</strong>r</strong> Ufer ablesen, die keinesfalls<br />
zu intensiv genutzt sein und zumin<strong>de</strong>st teilweise Röhricht-, Seggen- o<strong><strong>de</strong>r</strong> an<strong><strong>de</strong>r</strong>e<br />
Feuchtvegetation aufweisen sollten. Keinesfalls sollten die Ufer sehr steil o<strong><strong>de</strong>r</strong> zu mehr als<br />
50% verbaut sein o<strong><strong>de</strong>r</strong> <strong><strong>de</strong>r</strong> Fischbesatz übermäßig hoch.<br />
Die Min<strong>de</strong>stgröße für Stillgewässer beträgt 25qm, dabei wird ein evtl. vorhan<strong>de</strong>ner<br />
Verlandungsbereich mit eingerechnet. Auch die Abgrenzung auf <strong><strong>de</strong>r</strong> Karte wird durch die<br />
äußere Grenze <strong>de</strong>s Verlandungsbereiches markiert.<br />
Für alle Stillgewässer, die Characeen (Armleuchteralgen), Schlammbo<strong>de</strong>nvegetation o<strong><strong>de</strong>r</strong><br />
typische Unterwasser- o<strong><strong>de</strong>r</strong> Schwimmblattvegetation aufweisen, müssen zusätzlich die<br />
Bögen 3130, 3140 o<strong><strong>de</strong>r</strong> 3150 ausgefüllt wer<strong>de</strong>n, da diese unter die FFH-Richtlinie fallen (vgl.<br />
Kap. 4.2.1 bis 4.2.3).<br />
4.1.6. Streuobst (BK09)<br />
Als geschützt nach Artikel 17 <strong>de</strong>s Naturschutzgesetzes gelten außerhalb <strong>de</strong>s Bauperimeters<br />
Streuobstwiesen mit min<strong>de</strong>stens 25 Hochstamm-Obstbäumen mit einem Min<strong>de</strong>stalter von 30<br />
Jahren und einer Pflanzdichte von min<strong>de</strong>stens 50 Bäumen pro Hektar. Geschützt sind<br />
unabhängig von diesen Kartierkriterien auch alle Obstwiesen, in <strong>de</strong>nen eine <strong><strong>de</strong>r</strong> folgen<strong>de</strong>n<br />
gefähr<strong>de</strong>ten Arten vorkommt: Steinkauz (Athene noctua), Wen<strong>de</strong>hals (Jynx torquilla),<br />
Raubwürger (Lanius excubitor), Gartenschläfer (Eliomys quercinus), Fransenfle<strong><strong>de</strong>r</strong>maus<br />
(Myotis nattereri), Rauhautfle<strong><strong>de</strong>r</strong>maus (Pipistrellus nathusii), Braunes Langohr (Plecotus<br />
auritus).<br />
Als Hochstamm gelten Bäume ab einer Stammhöhe von 180 cm. Gera<strong>de</strong> bei Obstbäumen<br />
müssen hier jedoch +/- 20 cm Toleranz gelten. Für das Biotopkataster wer<strong>de</strong>n nur die<br />
Altbäume ≥ 30 Jahre durch <strong>Erfassung</strong> von Art und Vitalität genau dokumentiert. Die<br />
Jungbäume < 30 Jahre wer<strong>de</strong>n nur gezählt und als Summe auf <strong>de</strong>m Bogen eingetragen. Da<br />
in <strong>de</strong>n siebziger Jahren viele Streuobstwiesen <strong><strong>de</strong>r</strong> verän<strong><strong>de</strong>r</strong>ten Agrarpolitik zum Opfer fielen,<br />
kann davon ausgegangen wer<strong>de</strong>n, dass ältere Bäume meistens älter als 30 Jahre sind. In<br />
<strong><strong>de</strong>r</strong> unteren Altersklasse han<strong>de</strong>lt es sich um Neupflanzungen ab <strong>de</strong>n neunziger Jahren.<br />
Bei <strong><strong>de</strong>r</strong> <strong>Erfassung</strong> <strong><strong>de</strong>r</strong> Altbäume spielt die Vitalität <strong><strong>de</strong>r</strong> Bäume eine größere Rolle. Dabei<br />
be<strong>de</strong>uten:<br />
vital: gesun<strong><strong>de</strong>r</strong> Baum in gutem Pflegezustand mit ausreichen<strong>de</strong>n Zuwächsen<br />
(standortabhängig), kein Totholz;<br />
mäßig vital (für Bäume älter als 10 Jahre): +/- gesun<strong>de</strong> Bäume mit Beeinträchtigungen, die<br />
durch Pflegeeingriffe – wie etwa Schnittmaßnahmen – zu beheben sind und wie<strong><strong>de</strong>r</strong> zu<br />
vitalen Bäumen führen;<br />
abgängig: Bäume mit starken Beeinträchtigungen und einem hohen Totholzanteil. Bei älteren<br />
Bäumen kann dies sehr starker Befall mit Mistel (Viscum album) sein, Astbruch etc.<br />
Zur möglichst genauen Abgrenzung <strong><strong>de</strong>r</strong> Streuobstbestän<strong>de</strong>, die u.U. in <strong>de</strong>m Fall schwierig<br />
wer<strong>de</strong>n kann, wenn die Obstbäume grüppchenweise verstreut sind, sollte die<br />
15
Kartieranleitung Biotopkataster Luxemburg Kartierkriterien<br />
Min<strong>de</strong>stbestandsdichte von 50 Bäumen pro Hektar beachtet wer<strong>de</strong>n. Rechnerisch ergibt dies<br />
für je<strong>de</strong>n Baum eine Fläche von 200qm. Nur wenn diese Bestandsdichte erreicht ist, kann<br />
<strong><strong>de</strong>r</strong> Bestand als zusammenhängen<strong><strong>de</strong>r</strong> Streuobstbestand kartiert wer<strong>de</strong>n. Dies ist im Gelän<strong>de</strong><br />
nur annähernd als Schätzung möglich, in Grenzfällen sollte die Fläche probeweise<br />
digitalisiert und die Anzahl <strong><strong>de</strong>r</strong> Obstbäume durch eine Luftbildauswertung geschätzt wer<strong>de</strong>n.<br />
Aus <strong>de</strong>n Ergebnissen wird eine Entscheidung getroffen, wo die Abgrenzungen verlaufen<br />
sollen und anschließend erst die Bestandsaufnahme im Gelän<strong>de</strong> vorgenommen.<br />
Die Bewertung <strong><strong>de</strong>r</strong> Obstwiesen basiert sowohl auf <strong><strong>de</strong>r</strong> Vitalität <strong>de</strong>s Gesamtbestan<strong>de</strong>s als<br />
auch auf <strong><strong>de</strong>r</strong> ökologischen Wertigkeit, d.h. Anzahl <strong><strong>de</strong>r</strong> Baumhöhlen, Totholzanteile o<strong><strong>de</strong>r</strong><br />
Vorkommen seltener Tierarten. Als beson<strong><strong>de</strong>r</strong>s gut wür<strong>de</strong> man z.B. eine Obstwiese bewerten,<br />
die einen hohen Anteil an Altbäumen mit vielen Baumhöhlen aufweist, die sich in einem<br />
guten Pflegezustand befin<strong>de</strong>n und als vital angesehen wer<strong>de</strong>n können, wo aber auch<br />
stehen<strong>de</strong>s o<strong><strong>de</strong>r</strong> liegen<strong>de</strong>s Totholz in <strong><strong>de</strong>r</strong> Fläche belassen wur<strong>de</strong>. Es han<strong>de</strong>lt sich hier wie bei<br />
einigen an<strong><strong>de</strong>r</strong>en Nicht-FFH-<strong>Biotope</strong>n um eine subjektive Bewertung. Genauso kann <strong><strong>de</strong>r</strong><br />
Kartierer nach seiner Erfahrung entschei<strong>de</strong>n, ob eine ungepflegte, verbuschte Obstwiese<br />
wie<strong><strong>de</strong>r</strong> entbuscht und geschnitten wer<strong>de</strong>n o<strong><strong>de</strong>r</strong> ob diese in einer Landschaft mit vielen<br />
gepflegten Obstwiesen zum Vorteil <strong><strong>de</strong>r</strong> Tierwelt nicht lieber in diesem Zustand belassen<br />
wer<strong>de</strong>n sollte.<br />
4.1.7. Sumpfdotterblumenwiesen (Calthion) (BK10)<br />
Feuchtwiesen vom Typ <strong><strong>de</strong>r</strong> Sumpfdotterblumenwiesen (Calthion) sind mäßig nährstoffreiche,<br />
leicht aufgedüngte, gemähte o<strong><strong>de</strong>r</strong> bewei<strong>de</strong>te Grünlandbestän<strong>de</strong>, die typischerweise durch<br />
Seggen, Binsen und an<strong><strong>de</strong>r</strong>e Feuchte- und Nässezeiger charakterisiert sind. Diese Wiesen<br />
wer<strong>de</strong>n von zumin<strong>de</strong>st zeitweilig auftreten<strong>de</strong>m Grund-, Stau- o<strong><strong>de</strong>r</strong> Quellwasser o<strong><strong>de</strong>r</strong><br />
Überflutungen beeinflusst.<br />
Der Begriff „Calthion“ umfasst mehrere Pflanzengesellschaften, die z.T. sehr unterschiedlich<br />
ausgebil<strong>de</strong>t sind. Hierzu zählen „typische“ Feuchtwiesen wie die Trespen-Wassergreiskraut-<br />
Wiesen im südlichen Gutland o<strong><strong>de</strong>r</strong> die Waldbinsen (Juncus acutiflorus)-Sumpfwiesen im<br />
Ösling. Aber auch Dominanzbestän<strong>de</strong> <strong><strong>de</strong>r</strong> Waldsimse (Scirpus sylvaticus) o<strong><strong>de</strong>r</strong><br />
hochstau<strong>de</strong>nreiche Bestän<strong>de</strong> mit Kohldistel o<strong><strong>de</strong>r</strong> Wal<strong>de</strong>ngelwurz gehören zu diesem<br />
Biotoptyp.<br />
Potenzielle Pflanzengesellschaften:<br />
- Angelico-Cirsietum oleracei<br />
- Bromo-Senecionetum aquatici<br />
- Crepis paludosa-Juncus acutiflorus-Gesellschaft<br />
- Scirpus sylvaticus-Gesellschaft<br />
- Juncus effusus-Gesellschaft<br />
- Polygonum bistorta-Gesellschaft<br />
Kleinflächig können auch Flutrasen <strong>de</strong>s Agropyro-Rumicion in einer<br />
Sumpfdotterblumenwiese auftreten (z.B. kleine, zeitweise wasserüberstaute Mul<strong>de</strong>n), bei<br />
größeren Flächen muss eine Abgrenzung durchgeführt wer<strong>de</strong>n, weil Flutrasen nicht in <strong>de</strong>n<br />
„Instructions d'application“ aufgeführt sind.<br />
Feuchtwiesen vom Typ <strong><strong>de</strong>r</strong> Sumpfdotterblumenwiesen sind nach <strong>de</strong>n „Instructions<br />
d'application“ zum Art.17 nur in ihrer besten Ausprägung, <strong><strong>de</strong>r</strong> Bewertungskategorie A<br />
geschützt. Bei <strong><strong>de</strong>r</strong> Übersichtskartierung <strong><strong>de</strong>r</strong> Grünlandflächen, bei <strong><strong>de</strong>r</strong> alle Nutzparzellen, die<br />
für die Biodiversitätsprogramme geeignet sind, erfasst wer<strong>de</strong>n, wer<strong>de</strong>n die nach Art.17<br />
<strong>geschützten</strong> Bereiche extra auskartiert. Die Min<strong>de</strong>stgröße für diese Flächen <strong><strong>de</strong>r</strong><br />
Bewertungskategorie A liegt bei 1000m 2 . Brachgefallene Flächen sind mitgeschützt, insofern<br />
sie die für die Kategorie A erfor<strong><strong>de</strong>r</strong>liche Artenzusammensetzung und Struktur besitzen.<br />
16
Kartieranleitung Biotopkataster Luxemburg Kartierkriterien<br />
Im Einzelfall können Verzahnungen mit Röhrichten, Seggenrie<strong>de</strong>n o<strong><strong>de</strong>r</strong> an<strong><strong>de</strong>r</strong>en<br />
Feuchtwiesengesellschaften (z.B. Pfeifengraswiesen) vorkommen, hier wird nach <strong><strong>de</strong>r</strong><br />
Häufigkeit und Dominanz typischer Arten in die eine o<strong><strong>de</strong>r</strong> an<strong><strong>de</strong>r</strong>e Richtung entschie<strong>de</strong>n.<br />
4.1.8. Sümpfe und Nie<strong><strong>de</strong>r</strong>moore (BK11)<br />
Unter diesem Sammelbegriff wer<strong>de</strong>n alle Feuchtbiotope zusammengefasst, die laut<br />
„Instructions d'application“ zum Art.17 unter gesetzlichen Schutz fallen, sich aber, weil sie<br />
sich pflanzensoziologisch nicht eingrenzen lassen (z.B. Nassbrachen) o<strong><strong>de</strong>r</strong> häufig nur in sehr<br />
kleinen Bestän<strong>de</strong>n vorkommen und daher nur im Komplex vorkommen (Kleinseggenrie<strong>de</strong>),<br />
bei <strong><strong>de</strong>r</strong> Kartierung nicht als eigenständiger Biotoptyp berücksichtigen lassen. Als<br />
verschie<strong>de</strong>ne Subtypen o<strong><strong>de</strong>r</strong> Ausprägungen wird hier unterschie<strong>de</strong>n zwischen Nassbrachen,<br />
Quellsümpfen, Kleinseggenrie<strong>de</strong>n und Nie<strong><strong>de</strong>r</strong>mooren.<br />
Kartierkriterium für <strong>de</strong>n Subtyp „Nassbrache“ ist zunächst einmal die fehlen<strong>de</strong> o<strong><strong>de</strong>r</strong> nur in<br />
größerem zeitlichen Abstand (z.B. 2-3 jähriger Nutzungsrhythmus bei Lan<strong>de</strong>spflegeflächen)<br />
durchgeführte Nutzung. Darüber hinaus müssen die Flächen aber auch eine <strong>de</strong>utliche<br />
Vernässung und einen gewissen Artenreichtum aufweisen; reine Mä<strong>de</strong>süßbestän<strong>de</strong> z.B., die<br />
auch häufig auf wechselfeuchte Standorte übergreifen, sind von <strong><strong>de</strong>r</strong> Kartierung<br />
ausgeschlossen. Es müssen daher ein<strong>de</strong>utige Vernässungszeiger vorhan<strong>de</strong>n sein.<br />
Die Quellsümpfe dagegen sind durch einen o<strong><strong>de</strong>r</strong> mehrere Quellaustritte, die ein Gebiet von<br />
mehr als 100qm vernässen, gekennzeichnet. Charakteristisch ist ein ganzjährig hoher<br />
Grundwasserstand, dabei können diese Sümpfe mehr o<strong><strong>de</strong>r</strong> weniger artenreich sein. Auch<br />
extrem artenarme Bestän<strong>de</strong> wie z.B. Glyceria-Reinbestän<strong>de</strong> wer<strong>de</strong>n kartiert.<br />
Die Kleinseggenrie<strong>de</strong> sind spezielle Pflanzengesellschaften nasser Standorte, die durch<br />
kleinwüchsige Seggen dominiert wer<strong>de</strong>n. Sie kennzeichnen nährstoffarme, häufig auch<br />
quellige und vermoorte Flächen. Sie nehmen in Luxemburg nur geringe Flächen ein und es<br />
gibt nur wenige Kleinseggenrie<strong>de</strong>, die über 100qm groß sind.<br />
Die Nie<strong><strong>de</strong>r</strong>moore sind in <strong><strong>de</strong>r</strong> Regel durch Vermoorung von Flächen mit hohem<br />
Grundwasserstand o<strong><strong>de</strong>r</strong> aber durch Verlandung von Stillgewässern entstan<strong>de</strong>n. Sie sind<br />
durch eine mehr o<strong><strong>de</strong>r</strong> weniger dicke Torfschicht aus abgestorbenen Torfmoosen o<strong><strong>de</strong>r</strong><br />
Sauergräsern gekennzeichnet. Ein Indiz dafür, dass es sich bei <strong><strong>de</strong>r</strong> Fläche um ein<br />
Nie<strong><strong>de</strong>r</strong>moor han<strong>de</strong>lt, ist das Vorkommen von Sphagnum-Arten; bei <strong>de</strong>gradierten Flächen<br />
ohne rezente Torfbildung kann auch das Vorkommen an<strong><strong>de</strong>r</strong>er Zeigerpflanzen wie z.B.<br />
Sumpfblutauge (Comarum palustre) o<strong><strong>de</strong>r</strong> Schmalblättriges Wollgras (Eriophorum<br />
angustifolium) auf einen Nie<strong><strong>de</strong>r</strong>moorstandort hinweisen.<br />
Potenzielle Pflanzengesellschaften:<br />
- Angelico-Cirsietum oleracei<br />
- Calystegio-Epilobietum hirsuti<br />
- Calystegio-Eupatorietum cannabini<br />
- Carici canescentis-Agrostietum caninae (Pott 1995)<br />
- Caricetum nigrae<br />
- Parnassio-Caricetum nigrae<br />
- Valeriano-Filipenduletum<br />
- Crepis paludosa-Juncus acutiflorus-Gesellschaft<br />
- Juncus effusus-Gesellschaft<br />
- Lysimachia vulgaris-Lythrum salicaria-Gesellschaft<br />
- Polygonum bistorta-Gesellschaft<br />
- Scirpus sylvaticus-Gesellschaft<br />
17
Kartieranleitung Biotopkataster Luxemburg Kartierkriterien<br />
Die Min<strong>de</strong>stgröße für die Abgrenzung <strong>de</strong>s BK11 beträgt 100 qm. Wichtig ist hierbei die<br />
Grenzziehung zum Calthion nach <strong>de</strong>n o.g. Kriterien, da bei <strong>de</strong>n Sumpfdotterblumenwiesen<br />
nur die besten Ausprägungen unter <strong>de</strong>n Schutz von Art.17 fallen.<br />
4.2. Nach Fauna-Flora-Habitatrichtlinie geschützte <strong>Biotope</strong><br />
4.2.1. Oligo- bis mesotrophe Gewässer mit Schlammuferfluren<br />
(3130)<br />
Bei diesem Biotoptyp han<strong>de</strong>lt es sich um Gewässer mit sehr niedrigen, aus einjährigen<br />
Pflanzen aufgebauten Bestän<strong>de</strong>n auf nährstoffärmeren, zeitweise trockenfallen<strong>de</strong>n Ufern<br />
und Teichbö<strong>de</strong>n. Die meisten <strong><strong>de</strong>r</strong> charakteristischen Pflanzenarten sind selten und/o<strong><strong>de</strong>r</strong><br />
gefähr<strong>de</strong>t, einige sind in Luxemburg bereits ausgestorben. In Luxemburg kommen nur<br />
wenige, zumeist nur rudimentär ausgebil<strong>de</strong>te Gesellschaften vor.<br />
Potenzielle Pflanzengesellschaften :<br />
- Cypero-Limoselletum<br />
- Eleocharitetum acicularis<br />
- Juncus bufonius-Gesellschaft<br />
Unter <strong>de</strong>n Schutz <strong><strong>de</strong>r</strong> Fauna-Flora-Habitatrichtlinie und unter Art. 17 fallen nur die Bestän<strong>de</strong>,<br />
die in Kontakt mit einem fließen<strong>de</strong>n o<strong><strong>de</strong>r</strong> stehen<strong>de</strong>n Gewässer stehen. Dabei ist es nicht<br />
relevant, ob es sich um ein primäres o<strong><strong>de</strong>r</strong> ein sekundäres Gewässer han<strong>de</strong>lt. Es muss nur<br />
einer naturnahen Entwicklung unterliegen. Vorkommen außerhalb von Gewässern, z.B. an<br />
feuchten Wegen, wer<strong>de</strong>n nicht kartiert. Ebenfalls nicht aufgenommen wer<strong>de</strong>n reine Bestän<strong>de</strong><br />
<strong><strong>de</strong>r</strong> Krötenbinse (Juncus bufonius) ohne weitere Charakterarten. Die Min<strong>de</strong>stgröße zur<br />
Aufnahme ins Biotopkataster beträgt für diesen Biotoptyp einschließlich Gewässer 25m².<br />
Gelegentlich kann es vorkommen, dass Schlammuferfluren mit <strong>de</strong>n Biotoptypen 3140 o<strong><strong>de</strong>r</strong><br />
3150 einen Komplex bil<strong>de</strong>n. In diesem Fall wer<strong>de</strong>n die Anteile <strong><strong>de</strong>r</strong> bei<strong>de</strong>n Biotoptypen<br />
geschätzt und im Kopf <strong><strong>de</strong>r</strong> Aufnahmebögen unter <strong><strong>de</strong>r</strong> Rubrik „%-Anteil im Komplex“<br />
eingetragen.<br />
4.2.2. Oligo- bis mesotrophe Stillgewässer mit Characeen-<br />
Vegetation (3140)<br />
Dieser Biotoptyp umfasst eine sehr spezielle, submerse Vegetation in nährstoffarmen, kalk-<br />
o<strong><strong>de</strong>r</strong> basenreichen Gewässern, die von Armleuchteralgen (Chara spp.) aufgebaut wird.<br />
Potenzielle Pflanzengesellschaften:<br />
- Charion asperae<br />
- Charion vulgaris<br />
- Nitellion flexilis<br />
- Nitellion syncarpo-tenuissimae<br />
Es ist auch hier unerheblich, ob es sich um ein primäres o<strong><strong>de</strong>r</strong> ein sekundäres Gewässer<br />
han<strong>de</strong>lt, wichtig ist eine naturnahe Entwicklung. Die Min<strong>de</strong>stgröße zur Aufnahme ins<br />
Biotopkataster beträgt für diesen Biotoptyp einschließlich Gewässer 25m².<br />
Bei Schwierigkeiten mit <strong><strong>de</strong>r</strong> Bestimmung und bei tieferen Gewässern, wo Tauchgänge<br />
notwendig wer<strong>de</strong>n, sollte das Gewässer zunächst als Verdachtsfläche aufgenommen und<br />
anschließend ein Experte zu Rate gezogen wer<strong>de</strong>n.<br />
Gelegentlich kann es vorkommen, dass Characeengewässer mit <strong>de</strong>m Biotoptyp 3130 einen<br />
Komplex bil<strong>de</strong>n. In diesem Fall wer<strong>de</strong>n die Anteile <strong><strong>de</strong>r</strong> bei<strong>de</strong>n Biotoptypen geschätzt und im<br />
Kopf <strong><strong>de</strong>r</strong> Aufnahmebögen unter <strong><strong>de</strong>r</strong> Rubrik „%-Anteil im Komplex“ eingetragen.<br />
18
Kartieranleitung Biotopkataster Luxemburg Kartierkriterien<br />
4.2.3. Meso- bis eutrophe Stillgewässer (3150)<br />
Unter diesen Biotoptyp fallen alle meso- bis eutrophen Tümpel, Teiche und Seen, die einer<br />
naturnahen Entwicklung unterliegen. Dabei ist es unerheblich, ob es sich um primäre o<strong><strong>de</strong>r</strong><br />
sekundäre Stillgewässer han<strong>de</strong>lt, wenn ein natürlicher o<strong><strong>de</strong>r</strong> naturnaher Zustand vorliegt.<br />
Potenzielle Pflanzengesellschaften:<br />
- Potamogetonetum lucentis<br />
- Potamogetonetum graminei<br />
- Potamogetono-Naja<strong>de</strong>tum marinae<br />
- Myriophyllo-Nupharetum<br />
- Nymphaeetum albae<br />
- Hippuris vulgaris-Gesellschaft<br />
- Potamogeton-coloratus-Gesellschaft<br />
- Polygonum amphibium-Gesellschaft<br />
- Hydrocharitetum morsus-ranae<br />
- (Lemno-Utricularietum vulgaris)<br />
- Ranunculetum aquatilis<br />
- Ranunculus peltatus-Gesellschaft<br />
- Lemnetum gibbae<br />
- Lemnetum minoris<br />
Die Min<strong>de</strong>stgröße für die Aufnahme als FFH-Biotop beträgt 25m² einschließlich<br />
Verlandungsbereiche.. Zum Schutz nach FFH-Richtlinie ist außer<strong>de</strong>m eine typisch<br />
ausgebil<strong>de</strong>te Vegetation (Magnopotamion o<strong><strong>de</strong>r</strong> Hydrocharition) notwendig, wobei das<br />
alleinige Vorkommen von Wasserlinsen (Lemna minor, Lemna trisulca) nicht ausreicht. Die<br />
Gewässer dürfen für mehrere Monate im Jahr trocken fallen.<br />
Gewässer mit künstlichem Charakter, wie z.B. Retentions- o<strong><strong>de</strong>r</strong> Feuerlöschbecken,<br />
hypertrophe (sehr nährstoffreiche) und langsam fließen<strong>de</strong> Gewässer mit entsprechen<strong><strong>de</strong>r</strong><br />
Vegetation sind in diesem Zusammenhang nicht geschützt und wer<strong>de</strong>n nicht kartiert<br />
(langsam fließen<strong>de</strong> Gewässer sind als Fließgewässer geschützt, diese wer<strong>de</strong>n jedoch im<br />
Rahmen dieses Biotopkatasters nicht erfasst). Nicht durchströmte Altarme von Flüssen sind<br />
dagegen eingeschlossen, selbst wenn sie künstlich entstan<strong>de</strong>n sind.<br />
Gelegentlich kann es vorkommen, dass Gewässer mit Schwimmblatt- o<strong><strong>de</strong>r</strong><br />
Unterwasservegetation mit <strong>de</strong>m Biotoptyp 3130 einen Komplex bil<strong>de</strong>n. In diesem Fall wer<strong>de</strong>n<br />
die Anteile <strong><strong>de</strong>r</strong> bei<strong>de</strong>n Biotoptypen geschätzt und im Kopf <strong><strong>de</strong>r</strong> Aufnahmebögen unter <strong><strong>de</strong>r</strong><br />
Rubrik „%-Anteil im Komplex“ eingetragen.<br />
4.2.4. Calluna-Hei<strong>de</strong>n (4030)<br />
Von <strong>de</strong>n trockenen Hei<strong>de</strong>gesellschaften, die unter diesen FFH-Biotoptyp fallen, kommen in<br />
Luxemburg nur die vom Hei<strong>de</strong>kraut (Calluna vulgaris) geprägten Bestän<strong>de</strong> vor.<br />
Ausschlaggebend für die Ausbildung von Hei<strong>de</strong>vegetation sind saure, sehr nährstoffarme<br />
Bö<strong>de</strong>n und eine sehr spezielle Form früherer Nutzung (Plaggen). Die wenigen<br />
Hei<strong>de</strong>bestän<strong>de</strong>, die es in Luxemburg noch gibt, sind häufig mit Borstgrasrasen verzahnt<br />
(s.u.).<br />
Potenzielle Pflanzengesellschaften:<br />
- Genisto pilosae-Callunetum<br />
- Genisto anglicae-Callunetum (Pott 1995)<br />
- (Vaccinio-Callunetum)<br />
19
Kartieranleitung Biotopkataster Luxemburg Kartierkriterien<br />
Alle Calluna-Hei<strong>de</strong>n ab einer Min<strong>de</strong>stgröße von 100m² sind nach Art.17 <strong>de</strong>s<br />
luxemburgischen Naturschutzgesetzes geschützt. Weiteres Kriterium ist <strong><strong>de</strong>r</strong> Deckungsgrad<br />
<strong><strong>de</strong>r</strong> Zwergsträucher, dieser muss min<strong>de</strong>stens 25% betragen resp. die Vegetation darf<br />
maximal 75% Verbuschungs- o<strong><strong>de</strong>r</strong> Vergrasungsanteil aufweisen. Im Gegensatz zu <strong>de</strong>n<br />
Bestimmungen <strong><strong>de</strong>r</strong> FFH-Interpretation für Luxemburg wer<strong>de</strong>n auch lineare, von Calluna<br />
geprägte Flächen entlang von Wegen, Böschungen etc. ins Biotopkataster aufgenommen.<br />
Entsprechen<strong>de</strong> Flächen auf Schlagfluren wer<strong>de</strong>n nur dann aufgenommen, wenn sie am<br />
Waldrand liegen und die entsprechen<strong>de</strong> Artenzusammensetzung besitzen.<br />
Wie oben bereits angesprochen, besteht häufig eine Verzahnung mit an<strong><strong>de</strong>r</strong>en<br />
Magerrasengesellschaften (z.B. Borstgrasrasen), wo die jeweiligen Biotoptypen in einem<br />
kleinflächigen Mosaik verteilt sind. In diesem Fall, wenn es sich bei allen beteiligten<br />
Biotoptypen um nach Art.17 geschützte Bestän<strong>de</strong> han<strong>de</strong>lt, kann <strong><strong>de</strong>r</strong> gesamte<br />
Magerrasenkomplex als eine einzige Fläche mit einer Nummer aufgenommen wer<strong>de</strong>n (vgl.<br />
Kap. 3.5, Vorgehensweise bei Zweifelsfällen). Die Anteile <strong><strong>de</strong>r</strong> bei<strong>de</strong>n Biotoptypen wer<strong>de</strong>n<br />
geschätzt und im Kopf <strong><strong>de</strong>r</strong> Aufnahmebögen unter <strong><strong>de</strong>r</strong> Rubrik „%-Anteil im Komplex“<br />
eingetragen.<br />
4.2.5. Wachol<strong><strong>de</strong>r</strong>hei<strong>de</strong>n (5130)<br />
Unter <strong>de</strong>n Begriff Wachol<strong><strong>de</strong>r</strong>hei<strong>de</strong>n fallen alle vom Wachol<strong><strong>de</strong>r</strong> geprägten Magerrasen, die<br />
mehr als 10% Deckung von Juniperus communis aufweisen. Hierzu gehören sowohl<br />
Bestän<strong>de</strong> auf Kalk-Halbtrockenrasen als auch solche auf sauren Hei<strong>de</strong>n. In Luxemburg sind<br />
keine solchen Bestän<strong>de</strong> mehr bekannt, nur noch Einzelexemplare auf Kalk-<br />
Halbtrockenrasen.<br />
Potenzielle Pflanzengesellschaften:<br />
- Roso-Juniperetum (Pott 1995, Kalk-Halbtrockenrasen)<br />
- (Dicrano-Juniperetum (Pott 1995, auf Hei<strong>de</strong>n))<br />
Kartierkriterien für diesen Biotoptyp sind eine Min<strong>de</strong>stgröße von 100m² und das Vorkommen<br />
<strong>de</strong>s Wachol<strong><strong>de</strong>r</strong>s auf 10% <strong><strong>de</strong>r</strong> Fläche. Vorwaldstadien sind ausgeschlossen; Vorkommen von<br />
wenigen Exemplaren wer<strong>de</strong>n <strong>de</strong>n jeweiligen Biotoptypen <strong><strong>de</strong>r</strong> Calluna-Hei<strong>de</strong>n o<strong><strong>de</strong>r</strong> Kalk-<br />
Halbtrockenrasen zugeordnet.<br />
4.2.6. Kalk-Pionierrasen (Alysso-Sedion) auf Fels (6110)<br />
Dieser Biotoptyp ist geprägt von lückigen Rasen, die auf Felskuppen, Felsschutt und<br />
Felsbän<strong><strong>de</strong>r</strong>n über basen- o<strong><strong>de</strong>r</strong> kalkreichem Substrat wachsen. Sie sind charakterisiert durch<br />
viele einjährige Arten, Sukkulenten, Moose und Flechten.<br />
Potenzielle Pflanzengesellschaften:<br />
- Cerastietum pumili<br />
- Saxifrago tridactylitis-Poetum compressae<br />
- Alysso alyssoidis-Se<strong>de</strong>tum albi<br />
Für die Kartierung <strong><strong>de</strong>r</strong> Felsen mit Pionierrasen ist keine Min<strong>de</strong>stgröße vorgeschrieben. Somit<br />
wird je<strong><strong>de</strong>r</strong> Felsstandort unabhängig von seiner Größe erfasst, insofern er eine typische<br />
Vegetation aufweist. Dies kann sehr punktuell, z.B. innerhalb von Magergrünlandflächen<br />
sein; hier ist es sinnvoll, die genaue Lage mit einem GPS-Gerät einzumessen.<br />
Nicht unter <strong>de</strong>n Kalk-Pionierrasen erfasst wer<strong>de</strong>n Bestän<strong>de</strong> mit geschlossener Vegetation,<br />
die zu <strong>de</strong>n Kalk-Halbtrockenrasen gestellt wer<strong>de</strong>n und stark verbuschte Partien.<br />
20
Kartieranleitung Biotopkataster Luxemburg Kartierkriterien<br />
4.2.7. Kalkmagerrasen (6210)<br />
Für die Ausbildung von Kalkmagerrasen sind vor allem drei Faktoren ausschlaggebend:<br />
kalkreiches Ausgangsgestein, Nährstoffarmut und Wärmebegünstigung (überwiegend an<br />
Hangbereichen mit südlicher o<strong><strong>de</strong>r</strong> westlicher Exposition). Sie sind bei guter Ausbildung<br />
gekennzeichnet durch einen hohen Artenreichtum, lückige Struktur und Vorkommen vieler<br />
selten gewor<strong>de</strong>ner Arten. Die Artenzusammensetzung variiert am stärksten in Abhängigkeit<br />
von <strong><strong>de</strong>r</strong> Nutzung (Mahd o<strong><strong>de</strong>r</strong> Beweidung) und <strong><strong>de</strong>r</strong> Beschaffenheit <strong>de</strong>s Ausgangsgesteins<br />
(Kalksteine o<strong><strong>de</strong>r</strong> tonreiche Gesteine wie Kalkmergel).<br />
Potenzielle Pflanzengesellschaften:<br />
- Mesobrometum<br />
- Gentiano-Koelerietum<br />
- Xerobrometum<br />
Alle Kalkmagerrasen ab einer Min<strong>de</strong>stgröße von 100 m² fallen unter <strong>de</strong>n gesetzlichen Schutz<br />
<strong>de</strong>s Art. 17. Brachgefallene, versaumte Bestän<strong>de</strong> wer<strong>de</strong>n ebenfalls kartiert, wenn sie eine<br />
typische Artenkombination besitzen, dies gilt auch für Säume am Rand <strong><strong>de</strong>r</strong> Fläche.<br />
Orchi<strong>de</strong>enreiche Ausbildungen sind prioritäre Lebensräume nach FFH-Richtlinie und müssen<br />
extra abgegrenzt wer<strong>de</strong>n. Wenn diese nur eine Teilfläche <strong>de</strong>s kartierten Magerrasens<br />
ausmachen, bekommen sie daher eine eigene Nummer und es wird ein eigener Bogen<br />
ausgefüllt.<br />
Als „orchi<strong>de</strong>enreich“ im Sinne <strong><strong>de</strong>r</strong> FFH-Richtlinie gelten Bestän<strong>de</strong> mit<br />
- min<strong>de</strong>stens einer stark gefähr<strong>de</strong>ten o<strong><strong>de</strong>r</strong> vom Aussterben bedrohten Orchi<strong>de</strong>enart,<br />
- einer gefähr<strong>de</strong>ten o<strong><strong>de</strong>r</strong> seltenen Orchi<strong>de</strong>enart mit min<strong>de</strong>stens 50 Individuen o<strong><strong>de</strong>r</strong><br />
- min<strong>de</strong>stens 5 verschie<strong>de</strong>nen Orchi<strong>de</strong>enarten.<br />
4.2.8. Borstgrasrasen (6230)<br />
Borstgrasrasen kommen in nie<strong><strong>de</strong>r</strong>schlagsreichen Gebieten (höhere Berglagen o<strong><strong>de</strong>r</strong><br />
subatlantisches Klima) auf nährstoffarmen, silikatischen, stark versauerten Bö<strong>de</strong>n vor. Sie<br />
sind in <strong><strong>de</strong>r</strong> Regel durch Beweidung entstan<strong>de</strong>n. Typische Borstgrasrasen sind meist nicht<br />
sehr artenreich, zeichnen sich aber durch das Vorkommen speziell angepasster Pflanzen<br />
aus.<br />
Potenzielle Pflanzengesellschaften:<br />
- (Juncetum squarrosi (feuchte Borstgrasrasen))<br />
- Polygalo-Nar<strong>de</strong>tum<br />
- Festuco-Genistelletum sagittalis<br />
Alle Borstgrasrasen ab einer Min<strong>de</strong>stgröße von 25 m² sind nach Art. 17 gesetzlich geschützt.<br />
Zu beachten ist bei diesem Biotoptyp außer<strong>de</strong>m, dass infolge von Überbeweidung o<strong><strong>de</strong>r</strong> einer<br />
langen Brachephase stark artenverarmte Bestän<strong>de</strong> mit weniger als 3 Charakterarten nicht<br />
unter <strong>de</strong>n gesetzlichen Schutz fallen und daher nicht kartiert wer<strong>de</strong>n.<br />
In Luxemburg besteht teilweise eine Verzahnung mit an<strong><strong>de</strong>r</strong>en Magerrasengesellschaften<br />
(z.B. Calluna-Hei<strong>de</strong>n), wo die jeweiligen Biotoptypen in einem kleinflächigen Mosaik verteilt<br />
sind. In diesem Fall, wenn es sich bei allen beteiligten Biotoptypen um nach Art.17<br />
geschützte Bestän<strong>de</strong> han<strong>de</strong>lt, kann <strong><strong>de</strong>r</strong> gesamte Magerrasenkomplex als eine einzige<br />
Fläche mit einer Nummer aufgenommen wer<strong>de</strong>n. Die Anteile <strong><strong>de</strong>r</strong> bei<strong>de</strong>n Biotoptypen wer<strong>de</strong>n<br />
geschätzt und im Kopf <strong><strong>de</strong>r</strong> Aufnahmebögen unter <strong><strong>de</strong>r</strong> Rubrik „%-Anteil im Komplex“<br />
eingetragen.<br />
21
Kartieranleitung Biotopkataster Luxemburg Kartierkriterien<br />
4.2.9. Pfeifengraswiesen (6410)<br />
Pfeifengraswiesen sind vom namengeben<strong>de</strong>n Pfeifengras (Molinia caerulea) dominierte<br />
Wiesen auf sehr nährstoffarmen wechselfeuchten bis feuchten Bö<strong>de</strong>n. Sie waren traditionell<br />
nur einschürig gemähte Wiesen, <strong><strong>de</strong>r</strong>en Heu zur Einstreu benutzt wur<strong>de</strong>. Sie zeichnen sich<br />
daher durch einige Pflanzenarten aus, die sich erst spät in <strong><strong>de</strong>r</strong> Vegetationsperio<strong>de</strong><br />
entwickeln. Heutzutage wer<strong>de</strong>n die meisten genutzten Pfeifengraswiesen zweimal gemäht,<br />
in diesem Fall tritt das Pfeifengras aber zugunsten an<strong><strong>de</strong>r</strong>er Gräser zurück. Zum FFH-Typ<br />
6410 gehören sowohl die Wiesen auf kalk- o<strong><strong>de</strong>r</strong> basenreichem Substrat als auch jene auf<br />
basenarmem Ausgangsgestein.<br />
Potenzielle Pflanzengesellschaften:<br />
- (Junco-Molinietum (basenarm))<br />
- Molinietum caeruleae (basenreich)<br />
Alle Pfeifengraswiesen ab einer Min<strong>de</strong>stgröße von 100 m² sind nach Art.17 geschützt. Nicht<br />
mit eingeschlossen sind artenarme Dominanzbestän<strong>de</strong> von Molinia caerulea, die z.B. aus<br />
<strong><strong>de</strong>r</strong> Entwässerung von Moorstandorten resultieren können.<br />
4.2.10. Feuchte Hochstau<strong>de</strong>nsäume entlang von Gewässern und<br />
Feuchtwäl<strong><strong>de</strong>r</strong>n (6430)<br />
Dieser Biotoptyp umfasst alle gewässerbegleiten<strong>de</strong>n o<strong><strong>de</strong>r</strong> am Rand von Feuchtwäl<strong><strong>de</strong>r</strong>n<br />
ausgebil<strong>de</strong>ten Säume, die von Hochstau<strong>de</strong>n dominiert wer<strong>de</strong>n. Sie wachsen typischerweise<br />
(und natürlicherweise!) auf stärker nährstoffangereicherten, feuchten Bö<strong>de</strong>n und zeichnen<br />
sich durch das Vorhan<strong>de</strong>nsein von Nitrophyten aus.<br />
Potenzielle Pflanzengesellschaften:<br />
- (Dipsacetum pilosi)<br />
- Epilobio-Geranietum robertiani<br />
- Sambucetum ebuli<br />
- Alliario-Chaerophylletum temuli<br />
- Alliaria petiolata-Gesellschaft<br />
- Galio-Impatietum (Pott 1995)<br />
- Senecioni-Impatietum noli-tangere (Pott 1995)<br />
- Cuscuto-Calystegietum sepium<br />
- Calystegio-Epilobietum hirsuti<br />
- Calystegio-Eupatorietum cannabini<br />
- Urtica dioica-Calystegia sepium-Gesellschaft<br />
- Valeriano-Filipenduletum<br />
- Lysimachia vulgaris-Lythrum salicaria-Gesellschaft<br />
- Thalictrum flavum-Gesellschaft<br />
- Chaerophylletum bulbosi<br />
- Phalarido-Petasitetium hybridi<br />
- Urtico-Aegopodietum podagrariae<br />
- Urtico-Cruciaetetum<br />
Aufgrund <strong><strong>de</strong>r</strong> häufigen Vorkommen <strong><strong>de</strong>r</strong> meisten Arten in an<strong><strong>de</strong>r</strong>en, nicht <strong>geschützten</strong><br />
Biotoptypen gelten sehr spezielle Regeln, wann ein Hochstau<strong>de</strong>nsaum unter Art. 17 fällt.<br />
Folgen<strong>de</strong> Kartierkriterien müssen beachtet wer<strong>de</strong>n:<br />
- Schutz gilt nur für Bestän<strong>de</strong> entlang von Gewässern und Feuchtwäl<strong><strong>de</strong>r</strong>n<br />
- naturnaher Zustand <strong><strong>de</strong>r</strong> Hochstau<strong>de</strong>nsäume: Anteil <strong><strong>de</strong>r</strong> Neophyten<br />
22
Kartieranleitung Biotopkataster Luxemburg Kartierkriterien<br />
- naturnaher Zustand <strong><strong>de</strong>r</strong> Gewässer und Feuchtwäl<strong><strong>de</strong>r</strong>: Ein strukturell mit C bewerteter<br />
Hochstau<strong>de</strong>nsaum (Einfluss <strong><strong>de</strong>r</strong> Gewässerstruktur und <strong><strong>de</strong>r</strong> forstlichen Nutzung)<br />
braucht min<strong>de</strong>stens eine B-Bewertung bei <strong><strong>de</strong>r</strong> Artenzusammensetzung, um in die<br />
Kartierung aufgenommen zu wer<strong>de</strong>n<br />
- Min<strong>de</strong>stgröße 100m²<br />
- Abstand vom Fließgewässer/Waldrand maximal 5m<br />
Ausgeschlossen aus <strong>de</strong>m gesetzlichen Schutz und damit <strong><strong>de</strong>r</strong> Kartierung sind:<br />
- hypertrophe, artenarme Bestän<strong>de</strong> mit einer Dominanz (> 75% Deckung) von<br />
Nitrophyten wie Urtica dioica, Aegopodium podagraria, Rubus sp., etc.<br />
- Bestän<strong>de</strong> entlang von Wegen, Straßen, Entwässerungsgräben, Stillgewässern<br />
- Neophytenreiche Bestän<strong>de</strong> (> 50% Neophyten-Deckung)<br />
- Brachgefallene Feuchtwiesen<br />
Uferfluren mit Dominanz <strong><strong>de</strong>r</strong> Pestwurz (Petasites hybridus) bil<strong>de</strong>n bei <strong><strong>de</strong>r</strong> Bewertung <strong><strong>de</strong>r</strong><br />
Rubrik „Arteninventar“ eine Ausnahme. Sie können bei guter Ausbildung (nicht zu<br />
nährstoffreich) hier mit B bewertet wer<strong>de</strong>n, obwohl sie eine artenärmere Gesellschaft sind,<br />
weil sie typisch sind für die Ufer von Bächen und kleinen Flüssen und dort auch von Natur<br />
aus vorkommen.<br />
4.2.11. Flachland-Glatthaferwiesen (6510)<br />
Glatthaferwiesen sind typischerweise zweimal im Jahr gemähte, nicht o<strong><strong>de</strong>r</strong> nur wenig<br />
gedüngte Wiesen auf mittleren, nicht zu feuchten o<strong><strong>de</strong>r</strong> zu trockenen Bö<strong>de</strong>n, die von <strong><strong>de</strong>r</strong><br />
namengeben<strong>de</strong>n Art, <strong>de</strong>m Glatthafer (Arrhenatherum elatius) dominiert wer<strong>de</strong>n. Interessant<br />
aus naturschutzfachlicher Sicht sind die mageren Ausbildungen mit einem hohen Kraut- und<br />
Blütenreichtum und relativ niedriger Wuchshöhe.<br />
Potenzielle Pflanzengesellschaften:<br />
- Arrhenatheretum salvietosum (basenreich, trocken)<br />
- Arrhenatheretum brometosum (basenreich, trocken)<br />
- Arrhenatheretum ranunculetosum bulbosi (trocken)<br />
- Arrhenatheretum hypochoeretosum radicatae (basenarm, trocken)<br />
- Arrhenatheretum typicum (frisch)<br />
- Arrhenatheretum symphetosum (bei unregelmäßigen Überflutungen)<br />
- Arrhenatheretum lychnetosum (wechselfeucht)<br />
- Arrhenatheretum cirsietosum oleracei (basenreich, wechselfeucht)<br />
- (Arrhenatheretum sanguisorbetosum officinalis (wechselfeucht))<br />
- Arrhenatheretum silaetosum (basenreich, wechselfeucht)<br />
- Festuca rubra-Agrostis capillaris-Gesellschaft<br />
- Alopecuretum pratensis<br />
Wie bei <strong>de</strong>n Calthion-Wiesen sind auch bei <strong>de</strong>n Glatthaferwiesen nur die artenreichsten<br />
Ausbildungen <strong><strong>de</strong>r</strong> Bewertungskategorie A geschützt.<br />
Bei <strong><strong>de</strong>r</strong> Übersichtskartierung <strong><strong>de</strong>r</strong> Grünlandflächen, bei <strong><strong>de</strong>r</strong> alle Nutzparzellen, die für die<br />
Biodiversitätsprogramme geeignet sind, erfasst wer<strong>de</strong>n, wer<strong>de</strong>n die nach Art.17 <strong>geschützten</strong><br />
Bereiche extra auskartiert. Die Min<strong>de</strong>stgröße für diese Flächen <strong><strong>de</strong>r</strong> Bewertungskategorie A<br />
liegt bei 1000m 2 . Brachgefallene Flächen sind mitgeschützt, insofern sie die für die Kategorie<br />
A erfor<strong><strong>de</strong>r</strong>liche Artenzusammensetzung und Struktur besitzen.<br />
Das Vorkommen von artenreichen Glatthaferwiesen ist meist auf gemähte Flächen<br />
beschränkt. Insbeson<strong><strong>de</strong>r</strong>e Mähwei<strong>de</strong>n, die nach <strong>de</strong>m ersten Schnitt bewei<strong>de</strong>t wer<strong>de</strong>n,<br />
können jedoch ebenfalls eine charakteristische Glatthaferwiesenvegetation aufweisen, wenn<br />
23
Kartieranleitung Biotopkataster Luxemburg Kartierkriterien<br />
die Nachbeweidung nicht zu intensiv geschieht. In Einzelfällen können sogar sehr extensiv<br />
genutzte Dauerwei<strong>de</strong>n eine sehr typische Artenzusammensetzung und Struktur <strong><strong>de</strong>r</strong><br />
Glatthaferwiesen besitzen. In diesem Fall, insofern die Kriterien für eine Gesamtbewertung<br />
<strong><strong>de</strong>r</strong> Kategorie A erfüllt sind, sind auch bewei<strong>de</strong>te Flächen schützenswert und wer<strong>de</strong>n in die<br />
Kartierung aufgenommen.<br />
Eingeschlossen sind darüber hinaus auch Streuobstwiesen, die im Unterwuchs eine<br />
Glatthaferwiese <strong><strong>de</strong>r</strong> Kategorie A aufweisen. Zur Nummerierung in diesen Fällen vgl. Kap.<br />
3.2.2., Vorgehensweise bei Streuobstwiesen.<br />
4.2.12. Zwischenmoore (7140)<br />
Als Zwischenmoore wer<strong>de</strong>n Übergangsbestän<strong>de</strong> zwischen <strong>de</strong>n grundwasserbeeinflussten<br />
Nie<strong><strong>de</strong>r</strong>mooren und <strong>de</strong>n Regenwassermooren (Hochmooren) bezeichnet, die eine<br />
min<strong>de</strong>stens 30cm dicke Torfschicht aufweisen. Sie sind durch eine intermediäre Vegetation,<br />
die zwischen Nie<strong><strong>de</strong>r</strong>- und Hochmooren steht, charakterisiert und sind meist durch eine<br />
<strong>de</strong>utliche topographische Aufwölbung gekennzeichnet, die durch das Randlagg begrenzt<br />
wird. Zwischenmoore sind in Luxemburg sehr selten und die meisten Standorte sind bereits<br />
bekannt.<br />
Potenzielle Pflanzengesellschaften:<br />
- Sphagnum cuspidatum-Eriophorum angustifolium-Gesellschaft<br />
- Carici-Menyanthetum (Pott 1995)<br />
- Carici canescentis-Agrostietum caninae (Pott 1995)<br />
- Caricetum rostratae<br />
Für Zwischenmoore gilt eine Min<strong>de</strong>stgröße von 50m² und es muss außer<strong>de</strong>m eine<br />
Torfauflage von min<strong>de</strong>stens 30cm vorhan<strong>de</strong>n sein. In die Abgrenzung wer<strong>de</strong>n <strong><strong>de</strong>r</strong> ganze<br />
Moorkörper mit typischer Vegetation sowie kleinflächig vorhan<strong>de</strong>ne Tümpel, Bulte und<br />
Schlenken mit einbezogen.<br />
Ebenfalls eingeschlossen sind oligo- bis mesotrophe Verlandungsbereiche von Tümpeln,<br />
Weihern und Seen, insofern sie die erfor<strong><strong>de</strong>r</strong>liche Min<strong>de</strong>stgröße und Artenzusammensetzung<br />
aufweisen.<br />
Die Aufnahme <strong><strong>de</strong>r</strong> Moose, insbeson<strong><strong>de</strong>r</strong>e <strong><strong>de</strong>r</strong> Torfmoose (Sphagnum sp.) ist eigentlich<br />
obligatorisch für die Bewertung <strong><strong>de</strong>r</strong> Zwischenmoore, im Rahmen <strong>de</strong>s Biotopkatasters ist sie<br />
jedoch nicht praktikabel, weil sich nicht je<strong><strong>de</strong>r</strong> Kartierer gut mit Moosen auskennt (Torfmoose<br />
sind beson<strong><strong>de</strong>r</strong>s schwierig zu bestimmen!). Deshalb wird bei <strong><strong>de</strong>r</strong> Bewertung <strong>de</strong>s<br />
Arteninventars nur eine allgemeine Aussage zur Moosschicht verlangt, diejenigen Kartierer,<br />
die sich mit Moosen auskennen, sollten jedoch in <strong><strong>de</strong>r</strong> Artenliste die von ihnen sicher<br />
erkannten Arten ankreuzen. In Zweifelsfällen sollte ein Experte zu Rate gezogen wer<strong>de</strong>n.<br />
4.2.13. Tuffquellen (7220)<br />
Tuffquellen sind Quellaustritte im Kalkgestein, die sich durch charakteristische<br />
Kalkausfällungen (Kalksinter) auszeichnen. Da dieser Biotoptyp fast ausschließlich durch<br />
Moosvegetation gekennzeichnet ist (Equisetum telmateia ist die einzige charakteristische<br />
höhere Pflanze), ist die Moos-Artenkenntnis hier ausschlaggebend für die Bewertung. Da<br />
nicht je<strong><strong>de</strong>r</strong> Kartierer diese Artenkenntnis besitzt, wird standardmäßig lediglich eine Nummer<br />
vergeben und nur <strong><strong>de</strong>r</strong> Quell-Kartierbogen ausgefüllt. Die Fläche sollte anschließend von<br />
einem Experten zur <strong>de</strong>taillierten Bewertung aufgesucht wer<strong>de</strong>n. Kartierer, die über gute<br />
Mooskenntnisse verfügen, sollten jedoch <strong>de</strong>n entsprechen<strong>de</strong>n Aufnahmebogen ausfüllen.<br />
Alle nicht gefassten und nicht zur Trinkwassergewinnung genutzten Quellen sind nach Art.17<br />
<strong>de</strong>s luxemburgischen Naturschutzgesetzes unabhängig von ihrer Größe geschützt. Hierzu<br />
24
Kartieranleitung Biotopkataster Luxemburg Kartierkriterien<br />
gehören <strong>de</strong>mnach nicht nur naturnah ausgebil<strong>de</strong>te Quellbereiche, son<strong><strong>de</strong>r</strong>n auch<br />
anthropogen stark verän<strong><strong>de</strong>r</strong>te Quellaustritte, z.B. mit Sohlen- o<strong><strong>de</strong>r</strong> Uferverbau.<br />
4.2.14. Silikatschutthal<strong>de</strong>n (8150)<br />
Unter diesen Biotoptyp fallen alle natürlichen o<strong><strong>de</strong>r</strong> naturnahen Schutthal<strong>de</strong>n, die aus<br />
Silikatgestein aufgebaut wer<strong>de</strong>n.<br />
Potenzielle Pflanzengesellschaften:<br />
- Rumicetum scutati<br />
- Galeopsietum segetum<br />
Für die Kartierung <strong><strong>de</strong>r</strong> Schutthal<strong>de</strong>n ist keine Min<strong>de</strong>stgröße vorgeschrieben. Somit wird je<strong><strong>de</strong>r</strong><br />
Standort <strong>de</strong>s Biotoptyps unabhängig von seiner Größe erfasst, insofern er eine typische<br />
Vegetation aufweist. Ausnahme sind vegetationslose o<strong><strong>de</strong>r</strong> stark verbuschte Schutthal<strong>de</strong>n, im<br />
Abbau befindliche Flächen sowie Vorkommen auf Ablagerungen, Deponien, an Straßen und<br />
Bahnlinien und an<strong><strong>de</strong>r</strong>en künstlich geschaffenen <strong>Biotope</strong>n, diese sind nicht geschützt und<br />
wer<strong>de</strong>n nicht kartiert (Vorsicht, manche Schutthal<strong>de</strong>n an Verkehrswegen können trotz<strong>de</strong>m<br />
primärer Natur sein und sind durch <strong>de</strong>n Verkehrswegebau nur erweitert wor<strong>de</strong>n!). Naturnahe<br />
Sekundärbiotope wie aufgelassene Steinbrüche und Tagebauflächen wer<strong>de</strong>n jedoch mit<br />
einbezogen.<br />
4.2.15. Kalkschutthal<strong>de</strong>n (8160)<br />
Unter diesen Biotoptyp fallen alle natürlichen o<strong><strong>de</strong>r</strong> naturnahen Schutthal<strong>de</strong>n, die aus<br />
Kalkgestein aufgebaut wer<strong>de</strong>n.<br />
Potenzielle Pflanzengesellschaften:<br />
- Gymnocarpietum robertiani<br />
- Galeopsietum angustifoliae<br />
- Vincetoxium hirundinaria-Gesellschaft<br />
- Teucrio botrys-Senecionetum viscosi (Pott 1995)<br />
Für die Kartierung <strong><strong>de</strong>r</strong> Schutthal<strong>de</strong>n ist keine Min<strong>de</strong>stgröße vorgeschrieben. Somit wird je<strong><strong>de</strong>r</strong><br />
Standort <strong>de</strong>s Biotoptyps unabhängig von seiner Größe erfasst, insofern er eine typische<br />
Vegetation aufweist. Ausnahme sind vegetationslose o<strong><strong>de</strong>r</strong> stark verbuschte Schutthal<strong>de</strong>n, im<br />
Abbau befindliche Flächen sowie Vorkommen auf Ablagerungen, Deponien, an Straßen und<br />
Bahnlinien und an<strong><strong>de</strong>r</strong>en künstlich geschaffenen <strong>Biotope</strong>n, diese sind nicht geschützt und<br />
wer<strong>de</strong>n nicht kartiert (Vorsicht, manche Schutthal<strong>de</strong>n an Verkehrswegen können trotz<strong>de</strong>m<br />
primärer Natur sein und sind durch <strong>de</strong>n Verkehrswegebau nur erweitert wor<strong>de</strong>n!). Naturnahe<br />
Sekundärbiotope wie aufgelassene Steinbrüche und Tagebauflächen wer<strong>de</strong>n jedoch mit<br />
einbezogen.<br />
4.2.16. Kalkfelsen (8210)<br />
Zu diesem Biotoptyp gehören alle Felsköpfe und Felsspalten auf kalkigem Substrat, die<br />
typischerweise von vielen Moosen, Flechten und Farnen aufgebaut wer<strong>de</strong>n.<br />
Potenzielle Pflanzengesellschaften:<br />
- Asplenietum trichomano-rutae-murariae<br />
- Asplenio viridis-Cystopteri<strong>de</strong>tum fragilis<br />
Felsen wer<strong>de</strong>n, wenn sie nur durch Moose und Flechten charakterisiert wer<strong>de</strong>n, erst ab einer<br />
Min<strong>de</strong>stgröße von 5 qm aufgenommen. Wachsen jedoch höhere Pflanzen auf, im o<strong><strong>de</strong>r</strong> am<br />
Felsen, die als charakteristische Arten auf <strong>de</strong>n Aufnahmebögen aufgeführt sind, gilt keine<br />
25
Kartieranleitung Biotopkataster Luxemburg Kartierkriterien<br />
Min<strong>de</strong>stgröße. Dies kann sehr punktuell sein; hier ist es sinnvoll, die genaue Lage mit einem<br />
GPS-Gerät einzumessen.<br />
Bei <strong>de</strong>n Felsbiotopen kann es unter Umstän<strong>de</strong>n vorkommen, dass eine <strong>de</strong>taillierte Kartierung<br />
aufgrund <strong><strong>de</strong>r</strong> Topografie nicht möglich ist. In diesem Fall sollte <strong><strong>de</strong>r</strong> Felsen in <strong><strong>de</strong>r</strong> Karte<br />
eingezeichnet und anschließend, soweit möglich, hinsichtlich Struktur und<br />
Beeinträchtigungen bewertet wer<strong>de</strong>n.<br />
Sekundärbiotope an Mauern und Gebäu<strong>de</strong>n sowie in rezenten Abbaugebieten sind nicht in<br />
<strong>de</strong>n gesetzlichen Schutz eingeschlossen, Vorkommen in aufgelassenen Tagebaugebieten<br />
und Steinbrüchen wer<strong>de</strong>n dagegen mit einbezogen und kartiert.<br />
4.2.17. Silikatfelsen (8220)<br />
Zu diesem Biotoptyp gehören alle Felsköpfe und Felsspalten auf silikatischem Substrat, die<br />
typischerweise von vielen Moosen, Flechten und Farnen aufgebaut wer<strong>de</strong>n.<br />
Potenzielle Pflanzengesellschaften:<br />
- Asplenietum septentrionali-adianti-nigri<br />
- Saxifraga sponhemica-Gesellschaft<br />
- Asplenium septentrionale-Gesellschaft<br />
Felsen wer<strong>de</strong>n, wenn sie nur durch Moose und Flechten charakterisiert wer<strong>de</strong>n, erst ab einer<br />
Min<strong>de</strong>stgröße von 5 qm aufgenommen. Wachsen jedoch höhere Pflanzen auf, im o<strong><strong>de</strong>r</strong> am<br />
Felsen, die als charakteristische Arten auf <strong>de</strong>n Aufnahmebögen aufgeführt sind, gilt keine<br />
Min<strong>de</strong>stgröße. Dies kann sehr punktuell sein; hier ist es sinnvoll, die genaue Lage mit einem<br />
GPS-Gerät einzumessen.<br />
Bei <strong>de</strong>n Felsbiotopen kann es unter Umstän<strong>de</strong>n vorkommen, dass eine <strong>de</strong>taillierte Kartierung<br />
aufgrund <strong><strong>de</strong>r</strong> Topografie nicht möglich ist. In diesem Fall sollte <strong><strong>de</strong>r</strong> Felsen in <strong><strong>de</strong>r</strong> Karte<br />
eingezeichnet und anschließend, soweit möglich, hinsichtlich Struktur und<br />
Beeinträchtigungen bewertet wer<strong>de</strong>n.<br />
Sekundärbiotope an Mauern und Gebäu<strong>de</strong>n sowie rezenten Abbauflächen sind nicht in <strong>de</strong>n<br />
gesetzlichen Schutz eingeschlossen, Vorkommen in aufgelassenen Tagebaugebieten und<br />
Steinbrüchen wer<strong>de</strong>n dagegen mit einbezogen und kartiert.<br />
4.2.18. Silikat-Pionierrasen (Sedo-Scleranthetalia) auf Fels (8230)<br />
Dieser Biotoptyp ist geprägt von lückigen Rasen, die auf Felskuppen, Felsschutt und<br />
Felsbän<strong><strong>de</strong>r</strong>n über silikatischem Substrat wachsen. Sie sind charakterisiert durch viele<br />
einjährige Arten, Sukkulenten, Moose und Flechten.<br />
Potenzielle Pflanzengesellschaften:<br />
- (Diantho gratianopolitani-Festucetum pallentis)<br />
- Teucrio botryos-Melicetum ciliatae<br />
- Genista pilosa-Sesleria varia-Gesellschaft<br />
Für die Kartierung <strong><strong>de</strong>r</strong> Felsen mit Pionierrasen ist keine Min<strong>de</strong>stgröße vorgeschrieben. Somit<br />
wird je<strong><strong>de</strong>r</strong> Felsstandort unabhängig von seiner Größe erfasst, insofern er eine typische<br />
Vegetation aufweist. Dies kann sehr punktuell, z.B. innerhalb von Magergrünlandflächen<br />
sein; hier ist es sinnvoll, die genaue Lage mit einem GPS-Gerät einzumessen.<br />
Nicht unter <strong>de</strong>n Silikat-Pionierrasen erfasst wer<strong>de</strong>n Bestän<strong>de</strong> mit geschlossener Vegetation,<br />
die zu <strong>de</strong>n Sand- und Silikatmagerrasen gestellt wer<strong>de</strong>n und stark verbuschte Partien.<br />
26
Kartieranleitung Biotopkataster Luxemburg Kartierkriterien<br />
4.2.19. Touristisch nicht erschlossene Höhlen (8310)<br />
Theoretisch gehören auch die natürlichen Höhlen im Offenland zu <strong>de</strong>n Biotoptypen, die<br />
kartiert wer<strong>de</strong>n müssen. Tatsächlich gibt es nicht sehr viele natürliche Höhlen in Luxemburg,<br />
die zu<strong>de</strong>m meist im Wald liegen. Deshalb wird davon ausgegangen, dass es von diesem<br />
Biotoptyp keine zu kartieren<strong>de</strong>n Vorkommen gibt. Zu<strong>de</strong>m gehören die charakteristischen<br />
Arten, die für eine Bewertung ausschlaggebend sind, zu <strong>de</strong>n Gruppen <strong><strong>de</strong>r</strong> Säugetiere<br />
(insbeson<strong><strong>de</strong>r</strong>e Fle<strong><strong>de</strong>r</strong>mäuse), Lurche und Spinnen. Für diese Tiergruppen müssten sowieso<br />
Experten zu Rate gezogen wer<strong>de</strong>n. Im Falle eines Höhlenfun<strong>de</strong>s durch einen Kartierer wird<br />
daher <strong><strong>de</strong>r</strong> Fundort mit <strong>de</strong>m GPS eingemessen, auf <strong><strong>de</strong>r</strong> Karte eingezeichnet und<br />
anschließend durch einen Experten bewertet.<br />
4.2.20. Fels- und Magerrasen-Komplexbiotoptypen (BK01-03)<br />
Aufgrund <strong><strong>de</strong>r</strong> Tatsache, dass insbeson<strong><strong>de</strong>r</strong>e in <strong>de</strong>n ehemaligen Tagebauflächen <strong>de</strong>s Minette-<br />
Gebietes, die größere Flächen im Sü<strong>de</strong>n Luxemburgs einnehmen, sehr stark ineinan<strong><strong>de</strong>r</strong><br />
verzahnte Komplexbiotope vorkommen, die eine objektive Bewertung <strong><strong>de</strong>r</strong> Bestän<strong>de</strong><br />
unmöglich machen, wur<strong>de</strong>n die FFH-Komplexbiotoptypen BK01 bis BK03 geschaffen.<br />
Bei BK01 han<strong>de</strong>lt es sich um Felsbiotope mit <strong>de</strong>m überwiegen<strong>de</strong>n Vorkommen von<br />
anstehen<strong>de</strong>n Felswän<strong>de</strong>n, die durch Begleitstrukturen wie Felsspalten, Schuttfluren am Fuß<br />
<strong><strong>de</strong>r</strong> Felswand o<strong><strong>de</strong>r</strong> auch kleinflächigere Pionierrasen gekennzeichnet sein kann. Dieser<br />
Komplexbiotoptyp setzt sich aus <strong>de</strong>n FFH-Biotoptypen 8150, 8160, 8110 und 8120<br />
zusammen.<br />
Bei BK02 han<strong>de</strong>lt es sich um Felsbiotope mit einem Schwerpunkt auf <strong>de</strong>n (Block-)<br />
Schutthal<strong>de</strong>n, die durch Begleitstrukturen wie kleinere anstehen<strong>de</strong> Felsen mit Felsspalten<br />
o<strong><strong>de</strong>r</strong> Pionierrasen ergänzt wer<strong>de</strong>n können. Dieser Komplexbiotoptyp setzt sich ebenfalls aus<br />
<strong>de</strong>n FFH-Biotoptypen 8150, 8160, 8110 und 8120 zusammen, hat jedoch mit <strong>de</strong>n<br />
Schutthal<strong>de</strong>nbiotopen einen an<strong><strong>de</strong>r</strong>en Schwerpunkt als BK01.<br />
BK03 umfasst alle Magerrasenbiotope silikatischer als auch basen- und kalkreicher<br />
Gesteine, die sich in <strong>de</strong>n Tagebaugebieten ebenfalls sehr stark verzahnen und kleinflächige<br />
Mosaike ausbil<strong>de</strong>n. Dieser Komplexbiotoptyp setzt sich aus <strong>de</strong>n FFH-<strong>Biotope</strong>n 6110, 6210<br />
und 8230 sowie <strong>de</strong>m Art.17-Biotoptyp BK07 (Silikatmagerrasen) zusammen. Wie für die<br />
Kalk- und Silikatmagerrasen gilt hier eine Min<strong>de</strong>stgröße von 100qm.<br />
Die Möglichkeit, die oben genannten Komplexbiotope zu bil<strong>de</strong>n, gilt nur in <strong>de</strong>n<br />
Tagebaugebieten <strong><strong>de</strong>r</strong> Minette und ähnlichen ehemaligen Abbau- und Steinbruchgebieten.<br />
Außerhalb dieser Gebiete müssen Fels- und Magerrasenbiotope auskartiert resp.<br />
Felsbiotope und Pionierrasen, für die keine Min<strong>de</strong>stgröße vorgeschrieben ist, notfalls mit<br />
<strong>de</strong>m GPS eingemessen und punktuell in die Karte eingetragen wer<strong>de</strong>n.<br />
27
Kartieranleitung Biotopkataster Luxemburg Literatur<br />
5. Literaturhinweise<br />
COLLING, G. 2005: Red List of the Vascular Plants of Luxembourg. Ferrantia 42, Luxembourg<br />
(kann aus <strong>de</strong>m Internet heruntergela<strong>de</strong>n wer<strong>de</strong>n aus <strong><strong>de</strong>r</strong> Rubrik „listes rouges“ auf <strong><strong>de</strong>r</strong> Seite<br />
<strong>de</strong>s Naturhistorischen Museums www.mnhn.lu)<br />
COMMISSION EUROPEENNE, DG ENVIRONNEMENT 1999: Manuel d’Interpretation <strong>de</strong>s Habitats<br />
<strong>de</strong> l’Union Européenne. EUR 15/2<br />
CONZE, U, & U. CORDES 2006: Biotopkataster Rheinland-Pfalz – Allgemeine Angaben zum<br />
Biotopkataster (www.osiris-projekt.rlp.<strong>de</strong>/kartierung/070413_bk_allgemein.pdf)<br />
CONZE, U, & U. CORDES 2006: Biotopkataster Rheinland-Pfalz – <strong>Erfassung</strong> <strong><strong>de</strong>r</strong> <strong>geschützten</strong><br />
<strong>Biotope</strong> (nach §28 LNatSchG RLP) (www.osiris-projekt.rlp.<strong>de</strong>/kartierung/070413_bk_p28_<br />
kartieranleitung.pdf)<br />
CONZE, U, & U. CORDES 2006: Biotopkataster Rheinland-Pfalz – <strong>Erfassung</strong> <strong><strong>de</strong>r</strong> FFH-<br />
Lebensräume (www.osiris-projekt.rlp.<strong>de</strong>/kartierung/070413_bk_ffh_kartieranleitung.pdf)<br />
DIERSCHKE, H. & G. BRIEMLE 2002: Kulturgrasland. Ulmer, Stuttgart<br />
ELLENBERG, H. 1996: Vegetation Mitteleuropas mit <strong>de</strong>n Alpen. 5. Auflage, Ulmer, Stuttgart<br />
HOTZY, R. & J. RÖMHELD H. 2003: Kartieranleitung zum Bayerischen Quellerfassungsbogen<br />
(BayQEB). Version 2.0, Lan<strong>de</strong>sbund für Vogelschutz e.V:, Hilpoltstein im Auftrag <strong>de</strong>s<br />
Bayerischen Lan<strong>de</strong>samtes für Wasserwirtschaft<br />
(www.bayern.<strong>de</strong>/lfw/projekte/qp/daten/kartanl.pdf)<br />
LAMBINON, J., DELVOSALLE, L. & J. DUVIGNEAUD 2004: Nouvelle Flore <strong>de</strong> la Belgique, du<br />
Grand-Duché <strong>de</strong> Luxembourg, du Nord <strong>de</strong> la France et <strong>de</strong>s Régions voisines. Cinquième<br />
édition; Meise<br />
OBERDORFER, E. 1993a: Süd<strong>de</strong>utsche Pflanzengesellschaften. Teil II: Sand- und<br />
Trockenrasen, Hei<strong>de</strong>- und Borstgrasgesellschaften, alpine Magerrasen, Saum-<br />
Gesellschaften, Schlag- und Hochstau<strong>de</strong>nfluren. 3. Auflage, Fischer,<br />
Jena/Stuttgart/Lübeck/Ulm<br />
OBERDORFER, E. 1993b: Süd<strong>de</strong>utsche Pflanzengesellschaften. Teil III: Wirtschaftswiesen<br />
und Unkrautgesellschaften. 3. Auflage, Fischer, Jena/Stuttgart/Lübeck/Ulm<br />
OBERDORFER, E. 1998: Süd<strong>de</strong>utsche Pflanzengesellschaften. Teil I: Fels- und<br />
Mauergesellschaften, alpine Fluren, Wasser-, Verlandungs- und Moorgesellschaften. 4.<br />
Auflage, Fischer, Jena/Stuttgart/Lübeck/Ulm<br />
POTT, R. 1995: Die Pflanzengesellschaften Deutschlands. 2. Auflage, Ulmer, Stuttgart<br />
RECUEIL DES LEGISLATION 2002: Régimes d’ai<strong>de</strong>s pour la sauvegar<strong>de</strong> <strong>de</strong> la diversité<br />
biologique. Memorial - Journal Officiel du Grand-Duché <strong>de</strong> Luxembourg , A – N° 36, 4 avril<br />
2002<br />
RECUEIL DES LEGISLATION 2004: Protection <strong>de</strong> la nature et <strong>de</strong>s ressources naturelles.<br />
Memorial - Journal Officiel du Grand-Duché <strong>de</strong> Luxembourg, A-N° 10, 29 janvier 2004<br />
28
Kartieranleitung Biotopkataster Luxemburg Übersichtstabelle<br />
Anhang 1: Tabellarische Übersicht über die zu erfassen<strong>de</strong>n<br />
<strong>Biotope</strong> und Kartierkriterien<br />
Art. 17 - Biotop<br />
Luxemburg Europäische Union (FFH)<br />
Art. 17 Naturschutzgesetz FFH-Interpretation Luxemburg<br />
Co<strong>de</strong> Min<strong>de</strong>st-<br />
größe<br />
Großseggenrie<strong>de</strong> BK04 100qm<br />
Quellen BK05 keine<br />
Röhrichte BK06 100qm<br />
Sand- und<br />
Silikatmagerrasen<br />
BK07 100qm<br />
Bedingungen Co<strong>de</strong> Bedingungen<br />
Typische<br />
Artenkombination<br />
alle nicht gefassten o<strong><strong>de</strong>r</strong><br />
zur Trinkwassergewinnung<br />
genutzten Quellen<br />
Stillgewässerröhrichte<br />
und Schilfröhrichte<br />
Typische<br />
Artenkombination<br />
Stillgewässer BK08 25qm Naturnahe Entwicklung<br />
Streuobstwiesen BK09 keine<br />
min<strong>de</strong>stens 25 Bäume<br />
älter als 30 Jahre,<br />
Bestandsdichte<br />
min<strong>de</strong>stens 50 Bäume<br />
pro ha<br />
- -<br />
7220<br />
(Kalksinterquelle<br />
n)<br />
- -<br />
nur Binnendünen<br />
(existieren in<br />
Luxemburg nicht)<br />
- -<br />
Calthion-Wiesen BK10 1000qm Bewertung Kat. A - -<br />
Sümpfe und<br />
Nie<strong><strong>de</strong>r</strong>moore<br />
BK11 100qm<br />
Subtyp Nassbrache:<br />
fehlen<strong>de</strong> o<strong><strong>de</strong>r</strong><br />
unregelmäßige Nutzung<br />
und Vernässung<br />
Subtyp Quellsumpf:<br />
flächiger Quellaustritt in<br />
einem Quellsystem/komplex<br />
Subtyp Kleinseggenried:<br />
typische<br />
Artenkombination<br />
Subtyp Nie<strong><strong>de</strong>r</strong>moor:<br />
Torfauflage, typische<br />
Artenkombination<br />
29<br />
- -<br />
-
Kartieranleitung Biotopkataster Luxemburg Übersichtstabelle<br />
Stillgewässer,<br />
oligo-mesotroph<br />
Stillgewässer,<br />
meso-eutroph<br />
3130<br />
3140<br />
Trockene Hei<strong>de</strong>n 4030 100qm<br />
25qm siehe FFH 3130, 3140<br />
3150 25qm siehe FFH 3150<br />
alle Hei<strong>de</strong>n, auch lineare<br />
<strong>Biotope</strong>, wer<strong>de</strong>n erfasst,<br />
die die Min<strong>de</strong>stgröße<br />
erfüllen, min<strong>de</strong>stens 25%<br />
Zwergstrauchbe<strong>de</strong>ckung<br />
4030<br />
Wachol<strong><strong>de</strong>r</strong>hei<strong>de</strong>n 5130 100qm siehe FFH 5130<br />
Kalk-Pionierrasen<br />
auf Fels<br />
6110 keine siehe FFH 6110<br />
30<br />
3130: in Luxemburg nur<br />
die Assoziationen <strong><strong>de</strong>r</strong><br />
Nanojuncetea, alleiniges<br />
Vorkommen von Juncus<br />
bufonius reicht nicht aus,<br />
Bestän<strong>de</strong> außerhalb von<br />
Ufern und Stillgewässern<br />
wer<strong>de</strong>n nicht erfasst<br />
3140: oligo-bis<br />
mesotrophe Verhältnisse<br />
und kalkreiches Wasser,<br />
es wer<strong>de</strong>n auch künstlich<br />
angelegte Gewässer<br />
dazu gezählt, wenn sie<br />
naturnah ausgebil<strong>de</strong>t sind<br />
Nur naturnahe<br />
Stillgewässer, beim<br />
Vorkommen von typischer<br />
Vegetation auf großer<br />
Fläche können auch<br />
Stauseen und Altarme<br />
von Flüssen mit<br />
aufgenommen wer<strong>de</strong>n,<br />
keine langsam fließen<strong>de</strong>n<br />
Fließgewässer o<strong><strong>de</strong>r</strong><br />
hypertrophe Gewässer<br />
Lineare <strong>Biotope</strong> an<br />
Wegen o<strong><strong>de</strong>r</strong> Böschungen<br />
wer<strong>de</strong>n nicht erfasst<br />
Voraussetzung:<br />
Vorkommen von<br />
Juniperus communis,<br />
Deckung 10%<br />
Inklusive kleinere<br />
vegetationsfreie Flächen,<br />
Übergänge zu<br />
Silikatfelsvegetation sind<br />
möglich, ausgeschlossen<br />
sind geschlossene<br />
Vegetationsbestän<strong>de</strong><br />
(diese zu Festuco-<br />
Brometea) und<br />
verbuschte/bewal<strong>de</strong>te<br />
Felsen
Kartieranleitung Biotopkataster Luxemburg Übersichtstabelle<br />
Trespen-<br />
Schwingel-Kalk-<br />
Trockenrasen<br />
6210 100qm siehe FFH 6210<br />
Borstgrasrasen 6230 25qm siehe FFH 6230<br />
Pfeifengraswiesen 6410 100qm siehe FFH 6410<br />
Feuchte<br />
Hochstau<strong>de</strong>nflure<br />
n und Waldsäume<br />
Mesophile<br />
Flachland-Wiesen<br />
Übergangs- und<br />
Zwischenmoore<br />
6430 100qm<br />
Maximaler Abstand vom<br />
Gewässer/Waldrand: 5m<br />
6430<br />
6510 1000qm FFH-Bewertung Kat. A 6510<br />
7140 50qm siehe FFH 7140<br />
Tuffquellen 7220 keine siehe FFH 7220<br />
31<br />
Typische<br />
Artenkombination,<br />
orchi<strong>de</strong>enreiche<br />
Ausbildungen sind<br />
prioritäre Habitate,<br />
inklusive brachgefallene,<br />
versaumte Bestän<strong>de</strong>,<br />
insofern typische<br />
Artenkombination<br />
vorhan<strong>de</strong>n<br />
Ausgeschlossen sind<br />
artenarme Ausbildungen<br />
(
Kartieranleitung Biotopkataster Luxemburg Übersichtstabelle<br />
Silikatschutthal<strong>de</strong><br />
n<br />
8150 keine siehe FFH 8150<br />
Kalkschutthal<strong>de</strong>n 8160 keine siehe FFH 8160<br />
Kalkfelsen 8210<br />
Silikatfelsen 8220<br />
Silikat-<br />
Pionierrasen auf<br />
Fels<br />
5qm, wenn<br />
nur Moose<br />
und<br />
Flechten,<br />
wenn<br />
höhere<br />
Pflanzen,<br />
dann keine<br />
Min<strong>de</strong>stgrö<br />
ße<br />
5qm, wenn<br />
nur Moose<br />
und<br />
Flechten,<br />
wenn<br />
höhere<br />
Pflanzen,<br />
dann keine<br />
Min<strong>de</strong>stgrö<br />
ße<br />
siehe FFH 8210<br />
siehe FFH 8220<br />
8230 keine siehe FFH 8230<br />
32<br />
Typische<br />
Artenkombination, keine<br />
sekundären <strong>Biotope</strong> an<br />
Wegen und Straßen,<br />
Sekundärbiotope in<br />
aufgelassenen<br />
Steinbrüchen und<br />
Tagebauflächen sind<br />
eingeschlossen<br />
Typische<br />
Artenkombination, keine<br />
sekundären <strong>Biotope</strong> an<br />
Wegen und Straßen,<br />
Sekundärbiotope in<br />
aufgelassenen<br />
Steinbrüchen und<br />
Tagebauflächen sind<br />
eingeschlossen<br />
Typische<br />
Artenkombination, bei<br />
Schwierigkeiten mit <strong><strong>de</strong>r</strong><br />
Bestandsaufnahme soll<br />
versucht wer<strong>de</strong>n,<br />
wenigstens Struktur und<br />
Beeinträchtigungen zu<br />
erfassen, <strong>Biotope</strong> an<br />
Mauern und Gebäu<strong>de</strong>n<br />
sind ausgeschlossen,<br />
sekundäre <strong>Biotope</strong> in<br />
aufgelassenen<br />
Steinbrüchen und Tagebauen<br />
wer<strong>de</strong>n mit<br />
einbezogen<br />
Typische<br />
Artenkombination, bei<br />
Schwierigkeiten mit <strong><strong>de</strong>r</strong><br />
Bestandsaufnahme soll<br />
versucht wer<strong>de</strong>n,<br />
wenigstens Struktur und<br />
Beeinträchtigungen zu<br />
erfassen, <strong>Biotope</strong> an<br />
Mauern und Gebäu<strong>de</strong>n<br />
sind ausgeschlossen,<br />
sekundäre <strong>Biotope</strong> in<br />
aufgelassenen<br />
Steinbrüchen und Tagebauen<br />
wer<strong>de</strong>n mit<br />
einbezogen<br />
Ausgeschlossen sind<br />
geschlossene<br />
Vegetationsbestän<strong>de</strong><br />
(diese zu<br />
Silikatmagerrasen) und<br />
verbuschte/bewal<strong>de</strong>te<br />
Felsen
Kartieranleitung Biotopkataster Luxemburg Übersichtstabelle<br />
Höhlen/Grotten 8310 keine siehe FFH 8310<br />
Felskomplexe<br />
Tagebaugebiete<br />
Schutthal<strong>de</strong>nkomplexe<br />
Tagebaugebiete<br />
Magerrasenkomplexe<br />
Tagebaugebiete<br />
BK01 keine<br />
siehe 6110, 8210, 8220<br />
und 8230<br />
BK02 keine siehe 8150 und 8160<br />
BK03 keine siehe 6210 und BK07<br />
Keine anthropogenen<br />
Höhlen, wie z.B Stollen;<br />
diese wer<strong>de</strong>n aber als<br />
Lebensraum für FFHrelevante<br />
Arten<br />
(Fle<strong><strong>de</strong>r</strong>mäuse) erfasst<br />
Erläuterungen: Ausschlaggebend für das Biotopkataster sind die Vorgaben <strong>de</strong>s Art.17! Diese<br />
stimmen meist mit <strong>de</strong>n FFH-Bestimmungen überein, aber nicht immer.<br />
33
Anhang 2: Rechtliche Grundlagen<br />
Anhang 2.1. Artikel 17 <strong>de</strong>s Gesetzes vom 19. Januar 2004<br />
betreffend <strong>de</strong>n Schutz <strong><strong>de</strong>r</strong> Natur und <strong><strong>de</strong>r</strong> natürlichen Ressourcen<br />
Art. 17. Il est interdit <strong>de</strong> réduire, <strong>de</strong> détruire ou <strong>de</strong> changer les biotopes tels que mares,<br />
marécages, marais, sources, pelouses sèches, lan<strong>de</strong>s, tourbières, couvertures végétales<br />
constituées par <strong>de</strong>s roseaux ou <strong>de</strong>s joncs, haies, broussailles ou bosquets. Sont également<br />
interdites la <strong>de</strong>struction ou la détérioration <strong>de</strong>s habitats <strong>de</strong> l’annexe 1 et <strong>de</strong>s habitats d’espèces<br />
<strong>de</strong>s annexes 2 et 3.<br />
Sont interdits pendant la pério<strong>de</strong> du 1er mars au 30 septembre:<br />
a) la taille <strong>de</strong>s haies vives et <strong>de</strong>s broussailles à l'exception <strong>de</strong> la taille <strong>de</strong>s haies servant à<br />
l'agrément <strong>de</strong>s maisons d'habitation ou <strong>de</strong>s parcs, ainsi que <strong>de</strong> celle rendue nécessaire par <strong>de</strong>s<br />
travaux effectués dans les peuplements forestiers;<br />
b) l'essartement à feu courant et l'incinération <strong>de</strong> la couverture végétale <strong>de</strong>s prairies, friches ou<br />
bords <strong>de</strong> champs, <strong>de</strong> prés, <strong>de</strong> terrains forestiers, <strong>de</strong> chemins et <strong>de</strong> routes.<br />
Le Ministre peut exceptionnellement déroger à ces interdictions pour <strong>de</strong>s motifs d'intérêt<br />
général.<br />
Le Ministre imposera <strong>de</strong>s mesures compensatoires comprenant, si possible, <strong>de</strong>s restitutions <strong>de</strong><br />
biotopes et d’habitats quantitativement et qualitativement au moins équivalentes aux biotopes et<br />
habitats supprimés ou endommagés.
Anhang 2.2. Instructions d’application <strong>de</strong>s dispositions <strong>de</strong> l’article<br />
17 <strong>de</strong> la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection <strong>de</strong> la<br />
nature et <strong>de</strong>s ressources naturelles<br />
II. Liste <strong>de</strong>s interventions à considérer comme <strong>de</strong>struction, réduction ou<br />
changement <strong>de</strong> biotopes au sens <strong>de</strong> l’article 17 <strong>de</strong> la loi du 19 janvier 2004<br />
1. Définitions<br />
1.1. Mares, marécages, marais, tourbières, couvertures végétales constituées par <strong>de</strong>s<br />
roseaux ou <strong>de</strong>s joncs<br />
• Mare (y compris annexe 1 <strong>de</strong> la loi du 19 janvier 2004: Eaux eutrophes avec végétation <strong>de</strong> type<br />
Magnopotamion ou Hydrocarition): Nappe d'eau stagnante d'au moins 25 m2, pourvue <strong>de</strong> végétation<br />
ou non. La mare peut se <strong>de</strong>ssécher pendant quelques mois par an. Voir également définition au<br />
Manuel d'Interprétation <strong>de</strong>s Habitats <strong>de</strong> l'Union Européenne pour le type d'habitat <strong>de</strong> l'annexe 1.<br />
• Marécage ou marais: Site humi<strong>de</strong> d'au moins 100 m2, généralement en friche, avec associations<br />
végétales constituées par <strong>de</strong>s laîches, <strong>de</strong>s joncs ou d'autres plantes vivaces typiques <strong>de</strong>s milieux<br />
humi<strong>de</strong>s. Les marais abritent en plus une nappe d'eau stagnante généralement peu profon<strong>de</strong>.<br />
• Tourbière (y compris annexe 1: Tourbières <strong>de</strong> transition et tremblantes): Association végétale d'au<br />
moins 50 m2 sur substrat organique décomposé qui forme une certaine épaisseur <strong>de</strong> tourbe. Voir<br />
également définition au Manuel d'Interprétation <strong>de</strong>s Habitats <strong>de</strong> l'Union Européenne pour les types<br />
d'habitat <strong>de</strong> l'annexe 1.<br />
• Couverture végétale constituée par <strong>de</strong>s roseaux ou <strong>de</strong>s joncs: Associations végétales d'au<br />
moins 100 m2 constituées <strong>de</strong> Phragmites australis ou <strong>de</strong> Juncus spec., respectivement voir<br />
marécage, marais.<br />
1.2. Sources<br />
• Source (y compris annexe 1: Sources pétrifiantes avec formation <strong>de</strong> tuf): Tous les types <strong>de</strong> sources<br />
non-utilisées à <strong>de</strong>s fins d'alimentation en eau potable ou captées. Voir également définition au<br />
Manuel d'Interprétation <strong>de</strong>s Habitats <strong>de</strong> l'Union Européenne pour le type d'habitat <strong>de</strong> l'annexe 1.<br />
1.3. Pelouses sèches, lan<strong>de</strong>s<br />
• Pelouse sèche (y compris annexe 1:·Pelouses calcaires karstiques;·pelouses calcaires <strong>de</strong> sables<br />
xériques; pelouses calcaires sèches semi-naturelles; formations <strong>de</strong> Juniperus communis): Formation<br />
herbacée basse d'au moins 100 m2, caractérisée par <strong>de</strong>s conditions écologiques sèches et<br />
généralement pauvres en éléments nutritifs. Voir également définitions au Manuel d'Interprétation<br />
<strong>de</strong>s Habitats <strong>de</strong> l'Union Européenne pour les types d'habitat <strong>de</strong> l'annexe 1.<br />
• Lan<strong>de</strong> (y compris annexe 1:Lan<strong>de</strong>s sèches à callune): Association végétale composée <strong>de</strong> callune ou<br />
<strong>de</strong> genêt d'au moins 100 m2. Voir également définition au Manuel d'Interprétation <strong>de</strong>s Habitats <strong>de</strong><br />
l'Union Européenne pour le type d'habitat <strong>de</strong> l'annexe 1.<br />
1.4. Haies, broussailles, bosquets et lisières <strong>de</strong> forêts<br />
• Haies ou broussailles: Arbustes en ban<strong>de</strong> d'au moins 10 m <strong>de</strong> longueur ou en surface d'au moins<br />
50 m2, n'atteignant que rarement leur hauteur maximale. Parfois <strong>de</strong>s arbres font parti <strong>de</strong>s haies.<br />
Végétation composée d'arbustes et <strong>de</strong> plantes rameuses et épineuses.<br />
• Bosquets: Petit bois en milieu ouvert d'au moins 250 m2<br />
• Lisières <strong>de</strong> forêts: Lisière structurée, composée <strong>de</strong> plusieurs strates (arborescente, arbustive et<br />
herbacée), d'une largeur <strong>de</strong> 15 m <strong>de</strong> profon<strong>de</strong>ur en bordure <strong>de</strong>s futaies <strong>de</strong> hêtre ou <strong>de</strong> chêne d’au<br />
moins 80 ans (à compter à partir <strong>de</strong> l’intérieur <strong>de</strong> la limite cadastrale d'un fond forestier).<br />
1.5. Vergers<br />
II
• Verger: Peuplement d'au moins 25 arbres fruitiers à haute tige d'un âge d'au moins 30 ans et<br />
présentant une <strong>de</strong>nsité minimale <strong>de</strong> 50 arbres par hectare ou peuplement d’arbres fruitiers à hautes<br />
tiges abritant une <strong>de</strong>s espèces menacées énumérées ci-<strong>de</strong>ssous : Chouette chevêche (Athene<br />
noctua), Torcol fourmilier (Jynx torquilla), Pie-grièche grise (Lanius excubitor), Lérot (Eliomys<br />
quercinus), Vespertilion <strong>de</strong> Natterer (Myotis nattereri), Pipistrelle <strong>de</strong> Nathusius (Pipistrellus nathusii),<br />
Oreillard commun (Plecotus auritus).<br />
1.6. Prairies à molinie, formations herbeuses à Nardus<br />
• Prairies à molinie (habitat <strong>de</strong> l'annexe 1 <strong>de</strong> la loi): Voir définition au Manuel d'Interprétation <strong>de</strong>s<br />
Habitats <strong>de</strong> l'Union Européenne. Surfaces d'au moins 100 m2.<br />
• Formations herbeuses à Nardus (habitat <strong>de</strong> l'annexe 1 <strong>de</strong> la loi): Voir définition au Manuel<br />
d'Interprétation <strong>de</strong>s Habitats <strong>de</strong> l'Union Européenne. Surfaces d'au moins 25 m2.<br />
1.7. Prairies maigres <strong>de</strong> fauche (catégorie A), prairies humi<strong>de</strong>s du Calthion (catégorie A)<br />
• Prairies maigres <strong>de</strong> fauche (annexe 1 <strong>de</strong> la loi): Voir définition au Manuel d'Interprétation <strong>de</strong>s<br />
Habitats <strong>de</strong> l'Union Européenne. Prairies maigres <strong>de</strong> fauche d'au moins 1000 m2 <strong>de</strong> la catégorie A<br />
selon la clé <strong>de</strong> cartographie du Ministère <strong>de</strong> l'Environnement.<br />
• Prairies humi<strong>de</strong>s du Calthion: Prairies humi<strong>de</strong>s du Calthion d'au moins 1000 m2 <strong>de</strong> la catégorie A<br />
selon la clé <strong>de</strong> cartographie du Ministère <strong>de</strong> l'Environnement.<br />
1.8. Formations stables à Buxus sempervirens, Hêtraies du Luzulo-Fagetum, Hêtraies à<br />
Ilex du Ilici-Fagion, Hêtraies du Asperulo-Fagetum, Hêtraies calcicoles, Chênaies du<br />
Stellario-Carpinetum, Forêts <strong>de</strong> ravin du Tilio-Acerion, Forêts alluviales résiduelles<br />
• Pour tous ces habitats figurant à l'annexe 1 <strong>de</strong> la loi du 19 janvier 2004: Voir définition au Manuel<br />
d'Interprétation <strong>de</strong>s Habitats <strong>de</strong> l'Union Européenne. Surfaces d'au moins 25 m2 pour les formations<br />
à Buxus sempervirens et d'au moins 1000 m2 pour les autres types d'habitats.<br />
1.9. Eaux oligotrophes avec végétation annuelle <strong>de</strong>s rives exondées (Nanocyperetalia),<br />
eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation benthique à characées, végétation<br />
flottante <strong>de</strong> renoncules <strong>de</strong>s rivières submontagnar<strong>de</strong>s et planitiaires, Boulaies à<br />
sphaigne<br />
• Pour tous ces habitats figurant à l'annexe 1 <strong>de</strong> la loi du 19 janvier 2004: Voir définition au Manuel<br />
d'Interprétation <strong>de</strong>s Habitats <strong>de</strong> l'Union Européenne. Surfaces d'au moins 50 m2 pour les boulaies à<br />
sphaigne et d'au moins 25 m2 pour les autres types d'habitats<br />
1.10. Mégaphorbiaies <strong>de</strong>s franges nitrophiles et humi<strong>de</strong>s <strong>de</strong>s cours d'eau et <strong>de</strong>s forêts<br />
• Mégaphorbiaies <strong>de</strong>s franges nitrophiles et humi<strong>de</strong>s <strong>de</strong>s cours d'eau et <strong>de</strong>s forêts (habitat <strong>de</strong><br />
l'annexe 1 <strong>de</strong> la loi): Voir définition au Manuel d'Interprétation <strong>de</strong>s Habitats <strong>de</strong> l'Union Européenne.<br />
Surfaces d'au moins 100 m2.<br />
1.11. Cours d’eau à écoulement permanent<br />
• Cours d’eau à écoulement permanent: Tous les types <strong>de</strong> cours d'eau à écoulement permanent.<br />
1.12. Eboulis médio-européens siliceux ou calcaires, végétation chasmophytique <strong>de</strong>s<br />
pentes rocheuses siliceuses ou calcaires, grottes non exploitées par le tourisme<br />
• Pour tous ces habitats figurant à l'annexe 1 <strong>de</strong> la loi du 19 janvier 2004: Voir définition au Manuel<br />
d'Interprétation <strong>de</strong>s Habitats <strong>de</strong> l'Union Européenne.<br />
III
1.13. Chemins ruraux à caractère permanent et ban<strong>de</strong>s herbacées en accotement<br />
• Chemin <strong>de</strong> terre: Chemin à caractère permanent non consolidé avec <strong>de</strong>s matériaux à provenance<br />
allochtone d'une longueur d'au moins 25 m ou d'une surface d'au moins 50 m 2 .<br />
• Chemin non imperméabilisé: Chemin consolidé avec <strong>de</strong>s matériaux perméables d'une longueur<br />
d'au moins 25 m ou d'une surface d'au moins 50 m 2 .<br />
• Talus: Bordure <strong>de</strong> chemin en pente avec une couverture herbacée d'une surface d'au moins 50 m 2 .<br />
• Ban<strong>de</strong> herbacée: Bordure <strong>de</strong> chemin avec une couverture herbacée d’une largeur d’au moins 50 cm<br />
et d'une surface d'au moins 50 m 2 .<br />
1.14. Murs en maçonnerie sèche<br />
• Mur en maçonnerie sèche: Mur en maçonnerie sèche d'une longueur d'au moins 5 m.<br />
2. Interventions à considérer comme <strong>de</strong>struction, réduction ou changement <strong>de</strong><br />
biotopes<br />
2.1. Mares, marécages, marais, tourbières, couvertures végétales constituées par <strong>de</strong>s<br />
roseaux ou <strong>de</strong>s joncs<br />
• Remblayage, drainage;<br />
• Fertilisation, chaulage, utilisation <strong>de</strong> bioci<strong>de</strong>s;<br />
• Pour les mares: dénudation durable <strong>de</strong>s rives (art. 14), le pâturage n’étant pas visé;<br />
• Pour les bas-marais et tourbières: pâturage stationnaire permanent,<br />
• Pour les roselières: fauchage et pâturage et brûlage.<br />
2.2. Sources<br />
• Remblayage, drainage, captage;<br />
• Fertilisation, chaulage, utilisation <strong>de</strong> bioci<strong>de</strong>s dans un rayon <strong>de</strong> 30 m<br />
• En milieu forestier: transformation ou <strong>de</strong>struction <strong>de</strong> la végétation naturelle 30 m <strong>de</strong> part et d'autre <strong>de</strong><br />
la source; (voir également article 16)<br />
• En milieu ouvert: transformation <strong>de</strong> cultures en herbe en labour 30 m <strong>de</strong> part et d'autre <strong>de</strong> la<br />
source.<br />
2.3. Pelouses sèches, lan<strong>de</strong>s<br />
• Fertilisation, chaulage, utilisation <strong>de</strong> bioci<strong>de</strong>s, affouragement et semis<br />
• Installation d'enclos nocturnes pour du bétail gardé lors d’un pâturage itinérant;<br />
• Pour les lan<strong>de</strong>s: pâturage stationnaire permanent;<br />
• Pour les pelouses sèches: pâturage stationnaire permanent (y inclus en hiver) avec une charge <strong>de</strong><br />
bétail supérieure à 1 UGB/ha; dans le cas d'une charge <strong>de</strong> bétail supérieure à 1 UGB/ha pâturage du<br />
15 novembre au 1er avril;<br />
2.4. Haies, broussailles, bosquets et lisières <strong>de</strong> forêts<br />
• Défrichement;<br />
• Mise sur souche sur plus <strong>de</strong> 30% <strong>de</strong> leur longueur endéans 3 ans, si la longueur dépasse 100<br />
mètres ; temps <strong>de</strong> retour sur le même tronçon inférieur à 10 ans ;<br />
• Mise sur souche sur plus <strong>de</strong> 50% <strong>de</strong> leur longueur endéans 3 ans, si la longueur est inférieure à 100<br />
mètres ; temps <strong>de</strong> retour sur le même tronçon inférieur à 10 ans ; les haies <strong>de</strong> moins <strong>de</strong> 25 m<br />
pourront être mis sur souche d'un seul trait avec un temps <strong>de</strong> retour <strong>de</strong> 10 ans;<br />
• Réduction définitive du volume <strong>de</strong> plus d'un tiers;<br />
• Utilisation <strong>de</strong> la débroussailleuse rotative (Schlegelmulcher) sauf pour les repousses annuelles.<br />
2.5. Vergers<br />
IV
• Enlèvement <strong>de</strong> vergers définis sous 1.5.<br />
2.6. Prairies à molinie, formations herbeuses à Nardus<br />
• Fertilisation, chaulage, utilisation <strong>de</strong> bioci<strong>de</strong>s;<br />
• Transformation en labour, retournement, resemis;<br />
• Drainage, remblayage;<br />
• Pour les prairies à molinie: pâturage;<br />
• Pour les formations herbeuses à Nardus: affouragement du bétail dans le cas d'un pâturage.<br />
2.7. Prairies maigres <strong>de</strong> fauche (catégorie A), prairies humi<strong>de</strong>s du Calthion (catégorie A)<br />
• Fertilisation avec plus <strong>de</strong> 50 kg N/ha et an, chaulage, utilisation <strong>de</strong> bioci<strong>de</strong>s;<br />
• Affouragement du bétail dans le cas d'un pâturage après la coupe;<br />
• Transformation en labour, retournement, resemis;<br />
• Drainage, remblayage.<br />
2.8. Formations stables à Buxus sempervirens, Hêtraies du Luzulo-Fagetum, Hêtraies à<br />
Ilex du Ilici-Fagion, Hêtraies du Asperulo-Fagetum, Hêtraies calcicoles, Chênaies du<br />
Stellario-Carpinetum, Forêts <strong>de</strong> ravin du Tilio-Acerion, Forêts alluviales résiduelles<br />
• Fertilisation, chaulage, utilisation <strong>de</strong> bioci<strong>de</strong>s, drainage;<br />
• Mise à blanc <strong>de</strong> surfaces d’un seul tenant <strong>de</strong> plus <strong>de</strong> 50 ares;<br />
• Enlèvement <strong>de</strong> plus <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux sta<strong>de</strong>s <strong>de</strong> développement d’âge, dont la phase <strong>de</strong> maturité, sur plus <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>ux tiers <strong>de</strong> la surface pour <strong>de</strong>s surfaces <strong>de</strong> plus <strong>de</strong> 25 ares;<br />
• Enlèvement ou <strong>de</strong>struction <strong>de</strong> tous les vieux arbres à cavité et <strong>de</strong>s arbres morts: seuil minimum<br />
requis 3 vieux arbres à cavité et 1 arbre mort par ha en moyenne (pour autant que le problème <strong>de</strong> la<br />
responsabilité civile soit résolu pour les propriétaires privés);<br />
• Suppression <strong>de</strong> plus <strong>de</strong> 75 % du matériel sur pied <strong>de</strong> la végétation secondaire (arbustive ou<br />
arborescente du sous-bois);<br />
• Introduction d’essences forestières non-typiques <strong>de</strong> l’association forestière sur plus <strong>de</strong> 20% <strong>de</strong> la<br />
surface;<br />
• Utilisation <strong>de</strong> génotypes non locaux/régionaux <strong>de</strong>s essences forestières;<br />
• Pénétration <strong>de</strong>s peuplements, en <strong>de</strong>hors <strong>de</strong>s chemins forestiers et <strong>de</strong>s laies <strong>de</strong> débardage, par <strong>de</strong>s<br />
engins forestiers lourds sur <strong>de</strong>s sols mouillés ou non gelés.<br />
2.9. Eaux oligotrophes avec végétation annuelle <strong>de</strong>s rives exondées (Nanocyperetalia),<br />
eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation benthique à characées, végétation<br />
flottante <strong>de</strong> renoncules <strong>de</strong>s rivières submontagnar<strong>de</strong>s et planitiaires, Boulaies à<br />
sphaigne<br />
• Toute intervention dans l'habitat.<br />
2.10. Mégaphorbiaies <strong>de</strong>s franges nitrophiles et humi<strong>de</strong>s <strong>de</strong>s cours d'eau et <strong>de</strong>s forêts<br />
• Toute intervention qui entraîne la <strong>de</strong>struction durable <strong>de</strong> l'association végétale.<br />
2.11. Cours d’eau à écoulement permanent<br />
• Approfondissement du fond du lit du cours d’eau;<br />
• Enlèvement <strong>de</strong> méandres actuellement encore existants (« Begradigung »),<br />
• Consolidation <strong>de</strong>s berges en vue d’empêcher les phénomènes <strong>de</strong> la dynamique alluviale (érosion,<br />
sédimentation),<br />
• Défrichement <strong>de</strong> la végétation ligneuse le long <strong>de</strong>s cours d’eau ou mise sur souche sur plus d'un tiers<br />
endéans 3 ans ; temps <strong>de</strong> retour sur le même tronçon inférieur à 10 ans.<br />
2.12. Eboulis médio-européens siliceux ou calcaires, végétation chasmophytique <strong>de</strong>s<br />
pentes rocheuses siliceuses ou calcaires, grottes non exploitées par le tourisme<br />
• Toute intervention dans l'habitat.<br />
2.13. Chemins ruraux à caractère permanent et ban<strong>de</strong>s herbacées en accotement<br />
V
• Empierrement d’un ancien chemin <strong>de</strong> terre;<br />
• Recouvrement d’un chemin non imperméabilisé d’un revêtement en macadam, asphalte, goudron ou<br />
béton.<br />
• Destruction par labour ou herbici<strong>de</strong>s totaux <strong>de</strong>s talus ou ban<strong>de</strong>s herbacées le long <strong>de</strong>s chemins<br />
ruraux.<br />
2.14. Murs en maçonnerie sèche<br />
• Enlèvement total ou partiel <strong>de</strong>s murs en maçonnerie sèche ;<br />
• Enlèvement <strong>de</strong> la végétation <strong>de</strong>s murs en maçonnerie sèche (au pied et dans les fentes) par<br />
application d’herbici<strong>de</strong>s, par nettoyage à eau sous pression et par jointage.<br />
VI
Anhang 2.3.: Anhang II <strong>de</strong>s "Règlement grand-ducal du 22 mars<br />
2002 instituant un ensemble <strong>de</strong> régimes d’ai<strong>de</strong>s pour la sauvegar<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong> la diversité biologique".<br />
Annexe II: Liste <strong>de</strong>s espèces végétales menacées nécessitant <strong>de</strong>s mesures <strong>de</strong><br />
protection spéciales dans le cadre du présent règlement<br />
PTERIDOPHYTA Pteridophytes Farnpflanzen<br />
et SPERMATOPHYTA et Spermatophytes und Samenpflanzen<br />
Aceras anthropophorum Acéras homme pendu Gemeiner Fratzenorchis **<br />
Acinos arvensis Sariette acine Stein-Kölme *<br />
Aconitum lycoctonum Aconit tue-loup Wolfseisenhut *<br />
subsp. vulparia<br />
Adonis aestivalis Adonis d'été Sommer-Adonisröschen ***<br />
Adonis annua Adonis d'automne Herbst-Adonisröschen ***<br />
Adonis flammea Adonis couleur <strong>de</strong> feu Flammen-Adonisröschen ***<br />
Agrostemma githago Nielle <strong>de</strong>s blés Konra<strong>de</strong> ***<br />
Agrostis canina Agrostis <strong>de</strong>s chiens Sumpf-Straussgras *<br />
Agrostis vinealis Agrostis <strong>de</strong> sables Sand-Straussgras *<br />
Aira caryophyllea � Canche caryophyllée Nelken-Haferschmiele *<br />
Aira praecox Canche printanière Frühe Haferschmiele *<br />
Ajuga chamaepitys Bugle petit-pin Gelber Günsel ***<br />
Ajuga genevensis Bugle <strong>de</strong> genève Hei<strong>de</strong>-Günsel **<br />
Ajuga pyramidalis Bugle en pyrami<strong>de</strong> Pyrami<strong>de</strong>n-Günsel **<br />
Alchemilla filicaulis Alchémille à tige filiforme Fa<strong>de</strong>nstengel-Frauenmantel *<br />
Alchemilla monticola Alchémille <strong>de</strong>s montagnes Berg-Frauenmantel *<br />
Alchemilla vulgaris Alchémille à lobe aigus Spitzlappiger Frauenmantel *<br />
Allium rotundum � Ail arrondi Run<strong><strong>de</strong>r</strong> Lauch **<br />
Allium scorodoprasum Rocambole Gras-Lauch **<br />
Alopecurus aequalis Vulpin roux Rostgelbes Fuchsschwanzgras *<br />
Alopecurus rendlei Vulpin utriculé Aufgeblasener Fuchsschwanz *<br />
Althaea hirsuta Guimauve hérissée Rauher Eibisch ***<br />
Althaea officinalis Guimauve officinale Echter Eibisch *<br />
Alyssum alyssoi<strong>de</strong>s Alysson calicinal Kelch-Steinkraut *<br />
Amelanchier ovalis Amélanchier Felsenbirne *<br />
Anacamptis pyramidalis Orchis pyramidal Hundswurz *<br />
Anagallis arvensis Mouron bleu Blauer Gauchheil *<br />
subsp. foemina �<br />
Anemone sylvestris Anémone sauvage Grosses Windröschen ***<br />
Antennaria dioica Pied-<strong>de</strong>-chat Katzenpfötchen ***<br />
Anthemis cotula � Camomille puante Stink-Hundskamille ***<br />
Anthericum liliago Phalangère à fleurs <strong>de</strong> lis Astlose Graslilie *<br />
Aphanes inexpectata � Aphane à petits fruits Kleinfrüchtiger Sinau **<br />
Apium nodiflorum Faux cresson Knotenblütiger Sellerie **<br />
Aquilegia vulgaris Ancolie vulgaire Gemeine Alelei *<br />
Arabis glabra Arabette glabre Kahles Turmkraut *<br />
Arabis pauciflora Arabette pauciflore Wenigblütige Gänsekresse *<br />
Arctium tomentosum Bardane tomenteuse Filzklette *<br />
Aristolochia clematitis Aristoloche Gemeine Osterluzei **<br />
Arnica montana Arnica Berg-Wohlverleih ***<br />
Arnoseris minima Arnoséris naine Lämmersalat ***<br />
Artemisia absinthium Armoise absinthe Wermut *<br />
Asarum europaeum Asaret Haselwurz **<br />
Asperula cynanchica Herbe à l'esquinancie Hügel-Meister *<br />
Asplenium billotii Doradille <strong>de</strong> Bilot Lanzett-Streifenfarn *<br />
VII
Asplenium fontanum Doradille <strong>de</strong> Haller Jura-Streifenfarn ***<br />
Asplenium scolopendrium Langue <strong>de</strong> cerf Hirschzunge *<br />
Asplenium Doradille verte Grüner Streifenfarn ***<br />
trichomanes-ramosum<br />
Aster amellus Aster amellus Berg-Aster ***<br />
Avenula pratensis Avoine <strong>de</strong>s prés Rauher Wiesenhafer **<br />
Avenula pubescens Avoine pubescente Flaumiger Wiesenhafer *<br />
Berberis vulgaris Epine-vinette Berberitze **<br />
Berula erecta Petite berle Aufrechte Berle *<br />
Betula alba Bouleau pubescent Moor-Birke *<br />
Bi<strong>de</strong>ns cernua Bi<strong>de</strong>nt penché Nicken<strong><strong>de</strong>r</strong> Zweigzahn *<br />
Blackstonia perfoliata Chlore perfoliée Sommerbitterling ***<br />
Blechnum spicant Blechnum en épi Rippenfarn *<br />
Blysmus compressus Scirpe comprimé Flaches Quellried ***<br />
Botrychium lunaria Botryche lunaire Echte Mondraute **<br />
Briza media Amourette commune Gewöhnliches Zittergras *1<br />
Bromus racemosus Brome en grappe Trauben-Trespe *1<br />
Bromus secalinus � Brome seigle Roggentrespe ***<br />
Bunium bulbocastanum � Noix <strong>de</strong> terre Erdkastanie *<br />
Bupleurum rotundifolium Buplèvre à feuilles ron<strong>de</strong>s Rundblättriges Hasenohr ***<br />
Butomus umbellatus Jonc fleuri Schwanenblume *<br />
Buxus sempervirens Buis Buchsbaum *<br />
Calamagrostis arundinacea Calamagrostis faux-roseau Wald-Reitgras *<br />
Calamagrostis canescens Calamagrostis lancéolé Sumpf-Reitgras **<br />
Calamintha menthifolia Calamint <strong>de</strong>s bois Wald-Bergminze **<br />
Calendula arvensis Souci <strong>de</strong>s champs Acker-Ringelblume ***<br />
Calla palustris Calla Sumpfdrachenwurz ***<br />
Callitriche obstusangula Callitriche à ongles obtus Stumpfeckiger Wasserstern *<br />
Callitriche palustris Callitriche <strong>de</strong>s marais Sumpf-Wasserstern **<br />
Caltha palustris Populage <strong>de</strong>s marais Sumpfdotterblume *<br />
Campanula cervicaria Cervicaire Borstige Glockenblume ***<br />
Campanula glomerata Campanule agglomérée Büschel-Glockenblume **<br />
Campanula patula Campanule étalée Wiesen-Glockenblume ***<br />
Campanula rapunculus Campanule raiponce Rapunzel-Glocken-Blume *1<br />
Cardamine bulbifera Dentaire à bulbilles Zwiebeltragen<strong>de</strong> Zahnwurz *<br />
Carduus acanthoi<strong>de</strong>s Chardon faux-acanthe Stachel-Distel ***<br />
Carex acuta Laîche aiguë Schlanke Segge *1<br />
Carex acutiformis Laîche <strong>de</strong>s marais Sumpf-Segge *1<br />
Carex brizoi<strong>de</strong>s Laîche brize Zittergras-Segge *<br />
Carex canescens Laîche tronquée Graugrüne Segge *<br />
Carex cuprina Laîche cuivrée Falsche Fuchs-Segge *<br />
Carex davalliana Laîche <strong>de</strong> Davall Torf-Segge ***<br />
Carex <strong>de</strong>pauperata Laîche appauvrie Armblütige Segge ***<br />
Carex diandra Laîche arrondie Draht-Segge ***<br />
Carex distans Laîche distante Entferntährige Segge **<br />
Carex disticha Laîche distique Kamm-Segge *1<br />
Carex echinata Laîche étoilée Igel-Segge *<br />
Carex elata Laîche rai<strong>de</strong> Steife Segge ***<br />
Carex flacca Laîche glauque Blaugrüne Segge *1<br />
Carex flava Laîche jaunâtre Gelbe Segge **<br />
Carex hostiana Laîche blon<strong>de</strong> Saum-Segge ***<br />
Carex humilis Laîche humble Erd-Segge *<br />
Carex lepidocarpa Laîche écailleuse Schuppen-Segge *<br />
Carex montana Laîche <strong>de</strong>s montagnes Berg-Segge *<br />
Carex nigra Laîche noire Wiesen-Segge *1<br />
Carex ornithopoda Laîche pied-d'oiseau Vogelfuss-Segge ***<br />
Carex ovalis Laîche <strong>de</strong>s lièvres Hazezegge *1<br />
Carex pallescens Laîche pâle Bleiche Segge *1<br />
Carex panicea Laîche bleuâtre Hirsen-Segge *1<br />
Carex pilosa Laîche poilue Wimper-Segge **<br />
Carex pseudocyperus Laîche faux-souchet Scheinzypergrassegge **<br />
Carex pulicaris Laîche puce Floh-Segge ***<br />
VIII
Carex riparia Laîche <strong>de</strong>s rives Ufer-Segge **<br />
Carex rostrata Laîche à bec Schnabel-Segge *1<br />
Carex strigosa Laîche maigre Dünnährige Segge *<br />
Carex umbrosa Laîche à racines nombreuses Schatten-Segge *<br />
Carex vesicaria Laîche vésiculeuse Blasen-Segge *1<br />
Carex vulpina Laîche <strong>de</strong>s renards Fuchs-Segge *<br />
Carum carvi Carvi, cumin <strong>de</strong>s près Wiesen-Kümmel *1<br />
Catabrosa aquatica Catabrose aquatique Zartes Quellgras ***<br />
Caucalis platycarpos Caucalis à fruits aplatis Möhren-Haftdol<strong>de</strong> ***<br />
Centaurea calcitrapa Centaurée chausse-trape Stern-Flockenblume ***<br />
Centaurea cyanus � Centaurée bleurée Kornblume *<br />
Centaurea jacea Centaurée jacée Echte Flockenblume *1<br />
Centaurea montana Centaurée <strong>de</strong>s montagnes Berg-Flockenblume *<br />
Centaurea stoebe Centaurée du Rhin Rispen-Flockenblume ***<br />
Centaurium erythraea Erythrée petite centaurée Echtes Tausendgül<strong>de</strong>nkraut *<br />
Centaurium pulchellum Erythrée élégante Zierliches Tausendgül<strong>de</strong>nkraut *<br />
Centunculus minimus � Centenille Kleinling **<br />
Cephalanthera damasonium Céphalanthère à gran<strong>de</strong>s fleurs Bleiches Waldvöglein *<br />
Cephalanthera longifolia Céphalanthère à feuilles en épée Schwertblättriges Waldvöglein *<br />
Cephalanthera rubra Céphalanthère rose Rotes Waldvöglein *<br />
Ceratophyllum <strong>de</strong>mersum Cératophylle épineux Gemeines Hornkraut *<br />
Ceterach officinarum Céterach Schuppenfarn *<br />
Chaerophyllum aureum Cerfeuil doré Goldfrüchtiger Kälberkropf ***<br />
Chaerophyllum bulbosum Cerfeuil bulbeux Knollen-Kälberkropf *<br />
Chenopodium bonus-henricus Chénopo<strong>de</strong> Guter Heinrich ***<br />
Chenopodium glaucum Chénopo<strong>de</strong> glauque Graugrüner Gänsefuss **<br />
Chenopodium hybridum Chénopo<strong>de</strong> hybri<strong>de</strong> Unechter Gänsefuss ***<br />
Chenopodium murale Chénopo<strong>de</strong> <strong>de</strong>s murs Mauer-Gänsefuss ***<br />
Chenopodium rubrum Chénopo<strong>de</strong> rouge Roter Gänsefuss *<br />
Chenopodium urbicum Chénopo<strong>de</strong> <strong>de</strong>s village Strassen-Gänsefuss ***<br />
Chenopodium vulvaria Chénopo<strong>de</strong> féti<strong>de</strong> Stinken<strong><strong>de</strong>r</strong> Gänsefuss ***<br />
Chondrilla juncea � Chondrille joncée Binsen-Knorpellattich ***<br />
Chondrilla latifolia Chondrille à larges feuilles Breitblättriger Knorpellattich **<br />
Circaea alpina Circée <strong>de</strong>s alpes Gebirgs-Hexenkraut ***<br />
Circaea x intermedia Circée intermédiaire Mittleres Hexenkraut *<br />
Cirsium acaule Cirse acaule Kratzdistel *<br />
Cirsium oleraceum Cirse maraîcher Kohl-Kratzdistel *1<br />
Coeloglossum viri<strong>de</strong> Coeloglosse vert Grüne Hohlzunge ***<br />
Colchicum autumnale Colchique d’automne Herbstzeitlose *<br />
Comarum palustre Comaret Blutauge *<br />
Conium maculatum Gran<strong>de</strong> ciguë Gefleckter Schierling *<br />
Conopodium majus Conopo<strong>de</strong> dénudé Französische Erdkastanie ***<br />
Conringia orientalis Vélar d'Orient Weisser Ackerkohl ***<br />
Consolida regalis � Dauphinelle consou<strong>de</strong> Ackerrittersporn ***<br />
Convallaria majalis Muguet Maiglöckchen *<br />
Coronopus squamatus � Corne <strong>de</strong> cerf commune Gemeiner Krähenfuss **<br />
Corrigiola litoralis Corrigiole <strong>de</strong>s rives Uferhirschsprung *<br />
Corydalis cava Corydale creuse Hohler Lerchensporn *<br />
Corynephorus canescens Corynéphore Silbergras **<br />
Cotoneaster integerrimus Cotonéaster sauvage Gemeine Zwergmispel *<br />
Crepis foetida Barkhausie féti<strong>de</strong> Stink-Pippau **<br />
Crepis praemorsa Crépis en rosette Rosetten-Pippau ***<br />
Crepis pulchra Crépis élégant Glanz-Pippau ***<br />
Cuscuta epilinum ***<br />
Cuscuta epithymum Petite cuscute Kleesei<strong>de</strong> ***<br />
Cynoclossum officinale Cynoglosse officinale Echte Hundszunge *<br />
Cyperus flavescens Souchet jaunâtre Gelbliches Zypergras ***<br />
Cyperus fuscus Souchet brun Braunes Zypergras *<br />
Cypripedium calceolus Sabot <strong>de</strong> Vénus Frauenschuh ***<br />
Dactylis polygama Dactyle souple Wald-Knäuelgras *<br />
Dactylorhiza fistulosa Orchis latifolia Breitblättriges Knabenkraut *<br />
Dactylorhiza fuchsii Orchis tacheté <strong>de</strong>s bois Fuchs' Flecken-Knabenkraut *<br />
IX
Dactylorhiza incarnata Orchis incarnat Fleischrotes Knabenkraut ***<br />
Dactylorhiza maculata Orchis tacheté Geflecktes Knabenkraut **<br />
Dactylorhiza praetermissa Orchis ignoré Übersehenes Knabenkraut ***<br />
Danthonia <strong>de</strong>cumbens Sieglingie décombante Dreizahn *<br />
Daphne mezereum Bois-gentil Gemeiner Sei<strong>de</strong>lbast *<br />
Dianthus armeria Oeillet velu Rauche Nelke *<br />
Dianthus carthusianorum Oeillet <strong>de</strong>s chartreux Kartäusernelke *<br />
Dianthus <strong>de</strong>ltoi<strong>de</strong>s Oeillet couché Hei<strong>de</strong>-Nelke **<br />
Dianthus gratianopolitanus Oeillet mignardise Pfingst-Nelke *<br />
Digitalis grandiflora Digitale à gran<strong>de</strong>s fleurs Grossblütiger Fingerhut *<br />
Digitalis lutea Digitale jaune Gelber Fingerhut *<br />
Digitaria sanguinalis Digitaire sanguine Bluthirse **<br />
Diphasiastrum tristachyum Lycopo<strong>de</strong> petit-cyprès Zypressen-Flachbärlapp ***<br />
Diplotaxis muralis Diplotaxis <strong>de</strong>s murs Mauer-Doppelsame *<br />
Dipsacus pilosus Cardère velue Behaarte Kar<strong>de</strong> *<br />
Draba muralis Drave <strong>de</strong>s murailles Mauer-Felsenblümchen **<br />
Drosera rotundifolia Rossolis à feuilles ron<strong>de</strong>s Rundblättriger Sonnentau ***<br />
Dryopteris affinis subsp. borreri Dryoptéris écailleux Schuppiger Wurmfarn *<br />
Eleocharis acicularis Scirpe épingle Na<strong>de</strong>l-Sumpfsimse *<br />
Eleocharis ovata Scirpe à inflorescence ovoï<strong>de</strong> Eiförmige Sumpfsimse *<br />
Eleocharis palustris Scirpe <strong>de</strong>s marais Gemeine Sumpfsimse *1<br />
Eleocharis quinqueflora Scirpe pauciflore Armblütige Sumpfsimse ***<br />
Eleocharis uniglumis Scirpe à une écaille Einspelzige Sumpfsimse ***<br />
Epilobium palustre Epilobe <strong>de</strong>s marais Sumpf-Wei<strong>de</strong>nröschen *<br />
Epipactis atrorubens Epipactis brun-rouge Schwarzrote Sitter *<br />
Epipactis leptochila Epipactis à labelle étroit Schmallippige Sten<strong>de</strong>lwurz *<br />
Epipactis microphylla Epipactis à petites feuilles Kleinblättrige Sitter *<br />
Epipactis muelleri Epipactis <strong>de</strong> Müller Müllers Sitter *<br />
Epipactis palustris Epipactis <strong>de</strong>s marais Sumpfwurz **<br />
Epipactis purpurata Epipactis pourpre Violette Sitter *<br />
Epipogium aphyllum Epipogon sans feuilles Wi<strong><strong>de</strong>r</strong>bart *<br />
Eriophorum latifolium Linaigrette à feuilles larges Breitblättriges Wollgras ***<br />
Eriophorum polystachion Linaigrette à feuilles étroites Schmalblättriges Wollgras **<br />
Eriophorum vaginatum Linaigrette vaginée Schei<strong>de</strong>n-Wollgras ***<br />
Eriophorum vaginatum Linaigrette vaginée Schei<strong>de</strong>n-Wollgras ***<br />
Euphorbia dulcis Euphorbe douce Süsse Wolfsmilch *<br />
Euphorbia esula Euphorbe ésule Eselswolfsmilch **<br />
Euphrasia nemorosa Euphraise <strong>de</strong>s bois Hain-Augentrost **<br />
Euphrasia officinalis Euphraise glanduleuse Gemeiner Augentrost ***<br />
subsp. rostkoviana<br />
Euphrasia stricta Euphraise rai<strong>de</strong> Steifer Augentrost **<br />
Falcaria vulgaris � Falcaire Sichelkraut **<br />
Festuca heterophylla Fétuque hétérophylle Verschie<strong>de</strong>nblättriger Schwingel ***<br />
Festuca lemanii Fétuque <strong>de</strong>s moutons Harter Schwingel *<br />
Festuca longifolia Fétuque <strong>de</strong>s moutons Schafschwingel **<br />
subsp. pseudocostei<br />
Filago arvensis � Cotonnière <strong>de</strong>s champs Acker-Filzkraut ***<br />
Filago lutescens Cotonnière jainâtre Gelbes Filzkraut ***<br />
Filago minima Contonnière naine Zwerg Filzkraut **<br />
Filago pyramidata Cotonnière à feuilles Nie<strong><strong>de</strong>r</strong>liegen<strong>de</strong>s Filzkraut ***<br />
Filago vulgaris � Cotonnière alleman<strong>de</strong> Deutsches Filzkraut ***<br />
Filipendula vulgaris Filipendule Knollige Spierstau<strong>de</strong> ***<br />
Fumaria <strong>de</strong>nsiflora Fumeterre à fleurs serrées Dichtblütiger Erdrauch ***<br />
Fumaria parviflora � Fumeterre à petites fleurs Kleinblütiger Erdrauch ***<br />
Fumaria vaillantii � Fumeterre <strong>de</strong> Vaillant Vaillants Erdrauch **<br />
Gagea lutea Gagée <strong>de</strong>s bois Gemeiner Gelbstern *<br />
Gagea pratensis � Gagée <strong>de</strong>s prés Wiesen-Gelbstern ***<br />
Gagea villosa � Gagée <strong>de</strong>s champs Acker-Gelbstern ***<br />
Galium boreale Gaillet boréal Nordisches Labkraut *<br />
Galium glaucum Gaillet glauque Blaugrünes Labkraut ***<br />
Galium pumilum Gaillet âpre Rauhes Labkraut *<br />
Galium tricornutum Gaillet à trois pointes Dreihörniges Labkraut ***<br />
X
Galium verum Gaillet jaune Echtes Labkraut *1<br />
Genista anglica Genêt d'Angleterre Englischer Ginster ***<br />
Genista germanica Genêt d'Allemagne Deutscher Ginster ***<br />
Gentiana cruciata Gentiane croisette Kreuz-Enzian ***<br />
Gentianella ciliata Gentiane ciliée Fransen-Enzian *<br />
Gentianella germanica Gentiane d'Allemagne Deutscher Enzian ***<br />
Geranium pratense Géranium <strong>de</strong>s prés Wiesenstorchschnabel **<br />
Geranium sanguineum Géranium sanguin Blutstorchschnabel *<br />
Geranium sylvaticum Géranium <strong>de</strong>s bois Waldstorchschnabel *<br />
Geum rivale Benoîte <strong>de</strong>s ruisseaux Bach-Nelkenwurz **<br />
Glyceria maxima Glycérie aquatique Wasserschwa<strong>de</strong>n *<br />
Gratiola officinalis Gratiole Gna<strong>de</strong>nkraut ***<br />
Gymna<strong>de</strong>nia conopsea Gymnadénie moucheron Grosse Hän<strong>de</strong>lwurz *<br />
Gymna<strong>de</strong>nia odoratissima Gymnadénie odorante Wohlriechen<strong>de</strong> Hän<strong>de</strong>lwurz ***<br />
Gypsophila muralis Gypsophile <strong>de</strong>s moissons Mauer-Gipskraut ***<br />
Helianthemum nummularium Hélianthème jaune Gelbes Sonnenröschen *<br />
Helichrysum arenarium Immortelle <strong>de</strong>s sables Sand-Strohblume ***<br />
Helleborus foetidus Hellébore féti<strong>de</strong> Stinken<strong>de</strong> Nieswurz *<br />
Herminium monorchis Orchis musc. Einknolle ***<br />
Herniaria glabra Herniaire glabre Kahles Bruchkraut *<br />
Herniaria hirsuta Herniaire velue Behaartes Bruchkraut ***<br />
Hieracium lactucella Epervière petite-laitue Öhrchen-Habichtskraut **<br />
Hieracium pilosella Epervière piloselle Kleines Habichtskraut *1<br />
Hieracium piloselloi<strong>de</strong>s Epervière fausse-piloselle Florentiner Habichtskraut *<br />
Hierochloe odorata Hierochloë odorante Wohlriechen<strong>de</strong>s Mariengras ***<br />
Himantoglossum hircinum Loroglosse Riemenzunge **<br />
Hippocrepis emerus Coronille faux séné Strauchige Kronwicke *<br />
Hippuris vulgaris Pesse Tannenwe<strong>de</strong>l *<br />
Holosteum umbellatum � Holostée en ombelle Doldige Spurre **<br />
Hor<strong>de</strong>um jubatum Orge barbue Mähnengerste *<br />
Hor<strong>de</strong>um secalinum Orge faux-seigle Roggengerste *<br />
Huperzia selago Lycopo<strong>de</strong> sélagine Tannen-Bärlapp **<br />
Hutera cheiranthos Moutar<strong>de</strong> giroflée Lacksenf *<br />
Hydrocotyle vulgaris Ecuelle d'eau Wassernabel ***<br />
Hymenophyllum tunbrigense Hyménophylle <strong>de</strong> Tunbridge Englischer Hautfarn **<br />
Hypericum elo<strong>de</strong>s Millepertuis <strong>de</strong>s marais Sumpf-Johanniskraut ***<br />
Hypochoeris glabra Porcelle glabre Kahles Ferkelkraut ***<br />
Hypochoeris maculata Porcelle tachée Geflecktes Ferkelkraut ***<br />
Iberis amara Ibéris amer Bittere Schleifenblume *<br />
Illecebrum verticillatum Illécèbre verticillé Quirlige Knorpelblume ***<br />
Inula britannica Inule <strong>de</strong>s fleuves Wiesen-Atlant ***<br />
Inula salicina Inule à feuilles <strong>de</strong> saule Wei<strong>de</strong>nblättriger Atlant *<br />
Iris pseudacorus Iris jaune Gelbe Schwertlilie *<br />
Isatis tinctoria Pastel Waid **<br />
Jasione montana Jasione <strong>de</strong>s montagnes Sandknöpchen *<br />
Juncus capitatus Jonc à inflorescence globuleuse Kopf-Binse ***<br />
Juncus filiformis Jonc filiforme Fa<strong>de</strong>n-Binse ***<br />
Juncus squarrosus Jonc rai<strong>de</strong> Sparrige Binse ***<br />
Juncus subnodulosus Jonc à tépales obtus Stumpfblütige Binse **<br />
Juniperus communis Genévrier commun Wachol<strong><strong>de</strong>r</strong> **<br />
Kickxia elatine � Linaire élatine Echtes Tännelkraut **<br />
Kickxia spuria � Linaire bâtar<strong>de</strong> Eiblättriges Tännelkraut **<br />
Koeleria macrantha Koelérie grêle Zierliches Schillergras *<br />
Laburnum anagyroi<strong>de</strong>s Cytise faux-ébénier Goldregen *<br />
Lactuca perennis Laitue vivace Blauer Lattich *<br />
Lactuca saligna Laitue à feuilles <strong>de</strong> saule Wei<strong>de</strong>n-Lattich ***<br />
Lactuca virosa Laitue vireuse Gift-Lattich *<br />
Lapsana communis Lampsane intermédiare Rainkohl *<br />
subsp. intermedia<br />
Laserpitium latifolium Laser blanc Laserkraut *<br />
Lathraea squamaria Lathrée écailleuse Schuppenwurz *<br />
Lathyrus hirsutus � Gesse hérissée Haarige Platterbse ***<br />
XI
Lathyrus niger Gesse noire Schwarze Platterbse *<br />
Lathyrus nissolia � Gesse <strong>de</strong> Nissole Gras-Platterbse ***<br />
Lathyrus sylvestris Gesse <strong>de</strong>s bois Wald-Platterbse *<br />
Leersia oryzoi<strong>de</strong>s Faux riz Reisquecke ***<br />
Legousia speculum-veneris � Miroir <strong>de</strong> Vénus Frauenspiegel **<br />
Lemna trisulca Lentille à trois lobes Dreifurchige Wasserlinse *<br />
Leontodon saxatilis Thrincie Nicken<strong><strong>de</strong>r</strong> Löwenzahn *<br />
Leonurus cardiaca Agripaume Herzgespann ***<br />
Lepidium latifolium . Grand passerage Breitblättrige Kresse *<br />
Leucanthemum vulgare Gran<strong>de</strong> marguerite Weisse Wucherblume *1<br />
Limodorum abortivum Limodore Dingel ***<br />
Limosella aquatica Limoselle Sumpfling *<br />
Linaria arvensis Linaire <strong>de</strong>s champs Acker-Leinkraut ***<br />
Linaria repens Linaire striée Gestreiftes Leinkraut **<br />
Linum austriacum Lin d'Autriche Österreicher Lein ***<br />
subsp. collinum<br />
Linum catharticum Lin purgatif Purgier-Lein *1<br />
Linum tenuifolium Lin à feuilles étroites Schmalblättriger Lein **<br />
Lithospermum arvense � Grémil <strong>de</strong>s champs Acker-Steinsame **<br />
Lithospermum officinale Grémil officinal Echter Steinsame **<br />
Lithospermum Grémil bleu pourpre Rotblauer Steinsame *<br />
purpurocaeruleum<br />
Lolium remotum Ivraie du lin Lein-Lolch ***<br />
Lolium temulentum Ivraie enivrante Taumel-Lolch ***<br />
Lunaria rediviva Lunaire vivace Wil<strong>de</strong>s Silbermatt *<br />
Luzula campestris Luzule champêtre Feld-Hainsimse *1<br />
Luzula multiflora Luzule multiflore Vielblütige Hainsimse *1<br />
Lychnis flos-cuculi Lychnis fleur-<strong>de</strong> coucou Kuckucksblume *1<br />
Lychnis viscaria Lychnis visqueux Pechnelke *<br />
Lycium barbarum Lyciet Bocksdorn *<br />
Lycopodiella inundata Lycopo<strong>de</strong> inondé Sumpf-Bärlapp ***<br />
Lycopodium annotinum Lycopo<strong>de</strong> à feuilles <strong>de</strong> genévrier Schlangen-Bärlapp *<br />
Lycopodium clavatum Lycopo<strong>de</strong> en massue Keulen-Bärlapp ***<br />
Lythrum hyssopifolia Salicaire à feuilles d'hyssope Violetter Wei<strong><strong>de</strong>r</strong>ich ***<br />
Lythrum portula Pourpier d'eau Sumpfquen<strong>de</strong>l *<br />
Malva alcea Mauve alcée Sigmarswurz *<br />
Malva sylvestris Mauve sauvage Wil<strong>de</strong> Malve *<br />
Marrubium vulgare Marrube Andorn ***<br />
Medicago arabica Luzerne tachée Arabischer Schneckenklee *<br />
Medicago minima Luzerne naine Zwerg-Schneckenklee **<br />
Melampyrum arvense � Mélampyre <strong>de</strong>s champs Acker-Wachtelweizen **<br />
Melampyrum cristatum Mélampyre à crêtes Kamm-Wachtelweizen **<br />
Melica ciliata Mélique ciliée Wimper-Perlgras *<br />
Mentha longifolia Menthe à longues feuilles Wald-Minze *<br />
Mentha pulegium Menthe pouliot Polei ***<br />
Mentha spicata Menthe verte Grüne Minze *<br />
Mentha suaveolens Menthe à feuilles ron<strong>de</strong>s Rundblättrige Minze *<br />
Menyanthes trifoliata Trèfle d'eau Sumpfbitterklee *<br />
Mespilus germanica Néflier Mispel *<br />
Meum athamanticum Fenouil <strong>de</strong>s Alpes Bärwurz ***<br />
Minuartia hybrida Alsine à feuilles ténues Zarter Meirich *<br />
Misopates orontium � Muflier <strong>de</strong>s champs Acker-Löwenmaul **<br />
Moenchia erecta Moenchie Weissmiere ***<br />
Molinia caerulea Molinie Pfeifengras *1<br />
Moneses uniflora Pyrole à une fleur Einblütiges Wintergrün ***<br />
Montia minor Montie printanière Kleines Quellkraut ***<br />
Myosotis cespitosa Myosotis cespiteux Rasen-Vergissmeinnicht *<br />
Myosotis discolor � Myosotis versicolore Buntes Vergissmeinnicht **<br />
Myosotis ramosissima Myosotis hérissé Hügel-Vergissmeinnicht *<br />
Myosotis stricta � Myosotis <strong>de</strong>s sables Kleinblütiges Vergissmeinnicht ***<br />
Myosurus minimus � Ratoncule naine Zwerg-Mäuseschwanz ***<br />
Myriophyllum alterniflorum Myriophylle à fleurs alternes Wechselblütiges Tausendblatt *<br />
XII
Myriophyllum verticillatum Myriophylle verticillé Quirl-Tausendblatt *<br />
Najas marina Gran<strong>de</strong> naïa<strong>de</strong> Meer-Nixenkraut *<br />
Narcissus pseudonarcissus Jonquille Gelbe Narzisse *<br />
Nardurus maritimus Nardure unilatéral Strand-Dünnschwanz *<br />
Nardus stricta Nard Borstengras **<br />
Nasturtium officinale Cresson <strong>de</strong> fontaine Echte Brunnenkresse **<br />
Nepeta cataria Herbe aux chats Katzenminze ***<br />
Neslia paniculata Neslie en panicule Rispen-Finkensame ***<br />
Nuphar lutea Nénuphar jaune Gelbe Teichrose *<br />
Nymphaea alba Nénuphar blanc Weisse Seerose *<br />
Nymphoi<strong>de</strong>s peltata Faux-nénuphar Seekanne ***<br />
Odontites vernus � Odontite jaune Gelber Zahntrost **<br />
Oenanthe aquatica Oenanthe phellandre Wasser-Pfer<strong>de</strong>saat *<br />
Oenanthe fistulosa Oenanthe fistuleuse Fluss-Pfer<strong>de</strong>saat ***<br />
Oenanthe peucedanifolia Oenanthe à feuilles <strong>de</strong> peucédan Haarstrang-Pfer<strong>de</strong>saat ***<br />
Ononis spinosa Bugrane épineuse Dornige Hauhechel ***<br />
Onopordum acanthium Onopor<strong>de</strong> acanthe Eselsdistel **<br />
Ophioglossum vulgatum Ophioglosse vulgaire Gemeine Natterzunge **<br />
Ophrys apifera Ophrys abeille Bienen-Ragwurz **<br />
Ophrys fuciflora Ophrys frelon Hummel-Ragwurz **<br />
Ophrys insectifera Ophrys mouche Fliegen-Ragwurz **<br />
Ophrys sphego<strong>de</strong>s Ophrys araignée Spinnen-Ragwurz ***<br />
Orchis coriophora Orchis punaise Wanzen-Knabenkraut ***<br />
Orchis mascula Orchis mâle Kuckucks-Knabenkraut *<br />
Orchis militaris Orchis militaire Helm-Knabenkraut *<br />
Orchis morio Orchis bouffon Kleines Knabenkraut **<br />
Orchis purpurea Orchis pourpré Purpur-Knabenkraut *<br />
Orchis simia Orchis singe Affen-Knabenkraut ***<br />
Orchis ustulata Orchis brûlé Brand-Knabenkraut ***<br />
Oreopteris limbosperma Fougère <strong>de</strong>s montagnes Bergfarn *<br />
Ornithogalum pyrenaicum Asperge <strong>de</strong>s bois Pyrenäen-Milchstern *<br />
Ornithopus perpusillus Pied d'oiseau délicat Kleiner Vogelfuss *<br />
Orobanche alba Orobranche du thym Quen<strong>de</strong>l-Sommerwurz **<br />
Orobanche caryophyllacea Orobranche du gaillet Labkraut-Sommerwurz ***<br />
Orobanche he<strong><strong>de</strong>r</strong>ae Orobranche du lierre Efeu-Sommerwurz *<br />
Orobanche major Orobanche élevée Grosse Sommerwurz ***<br />
Orobanche minor Orobanche du trèfle Kleeteufel ***<br />
Orobanche picridis Orobanche du picris Bitterkraut-Sommerwurz ***<br />
Orobanche purpurea Orobranche pourpré Purpur-Sommerwurz **<br />
Orobanche ramosa Orobanche rameuse Ästige Sommerwurz ***<br />
Orobanche rapum-genistae Orobranche du genêt Ginster-Sommerwurz **<br />
Orobanche teucrii Orobranche <strong>de</strong> la germandrée Gaman<strong><strong>de</strong>r</strong>-Sommerwurz ***<br />
Orthilia secunda Pyrole unilatérale Einseitwendiges Birngrün ***<br />
Osmunda regalis Osmon<strong>de</strong> royale Königsfarn ***<br />
Oxalis corniculata � Oxalis cornu Hornsauerklee *<br />
Papaver argemone � Coquelicot argémone Sandmohn **<br />
Papaver dubium � Petit coquelicot Saatmohn *<br />
Papaver rhoeas Grand coquelicot Klatsch-Mohn *<br />
Parietaria officinalis Pariétaire officinale Aufrechtes Glaskraut ***<br />
Parietaria judaica Pariétaire couchée Aestiges Glaskraut *<br />
Parnassia palustris Parnassie Sumpf-Herzblatt ***<br />
Pedicularis palustris Pédiculaire <strong>de</strong>s marais Sumpf-Läusekraut **<br />
Pedicularis sylvatica Pédiculaire <strong>de</strong>s bois Wald-Läusekraut ***<br />
Peucedanum carviflora Peucédan à feuilles <strong>de</strong> carvi Kümmelblatt-Haarstrang ***<br />
Peucedanum cervaria Herbe aux cerfs Hirschwurz-Haarstrang *<br />
Phleum phleoi<strong>de</strong>s � Fléole <strong>de</strong> Boehmer Glanzlieschgras ***<br />
Pimpinella major Grand boucage Grosse Bibernelle *1<br />
Pimpinella saxifraga Petit boucage Kleine Bibernelle *1<br />
Pinus sylvestris 2 Pin sylvestre Waldkiefer **<br />
Platanthera bifolia Platanthère à <strong>de</strong>ux feuilles Zweiblättriges Breitkölbchen *<br />
Platanthera chlorantha Platanthère <strong>de</strong>s montagnes Berg-Breitkölbchen *<br />
Poa bulbosa Pâturin bulbeux Knolliges Rispengras *<br />
XIII
Poa palustris Pâturin <strong>de</strong>s marais Sumpf-Rispengras *<br />
Podospermum laciniatum Podosperme lacinié Stielsamenkraut ***<br />
Polemonium caeruleum Polémoine Blaue Himmelsleiter *<br />
Polygala amarella Polygala amer Bittere Kreuzblume ***<br />
Polygala calcarea Polygala du calcaire Kalk-Kreuzblume *<br />
Polygala serpyllifolia Polygala à feuilles <strong>de</strong> serpolet Quen<strong>de</strong>l-Kreuzblume *<br />
Polygonatum odoratum Sceau <strong>de</strong> Salomon odorant Wohlriechen<strong>de</strong> Weisswurz *<br />
Polygonum minus Petite renouée Kleiner Knöterich **<br />
Polygonum mite Renouée douce Schlaffer Knöterich **<br />
Polystichum aculeatum Polystic à aiguillons Schildfarn *<br />
Polystichum lonchitis Polystic lonchite Lanzen-Schildfarn **<br />
Polystichum setiferum Polystic à soies Borstiger Schildfarn *<br />
Potamogeton alpinus Potamot <strong>de</strong>s Alpes Alpen-Laichkraut ***<br />
Potamogeton <strong>de</strong>nsus Potamot <strong>de</strong>nse Dichtblättriges Laichkraut *<br />
Potamogeton lucens Potamot à feuilles luisantes Glänzen<strong>de</strong>s Laichkraut *<br />
Potamogeton obtusifolius Potamot à feuilles obtuses Stumpfblättriges Laichkraut *<br />
Potamogeton perfoliatus Potamot à feuilles perfoliées Durchwachsenes Laichkraut **<br />
Potamogeton polygonifolius Potamot à feuilles <strong>de</strong> renouée Knöterichblättriges Laichkraut **<br />
Potamogeton pusillus Potamot fluet Zartes Laichkraut *<br />
Potamogeton trichoi<strong>de</strong>s Potamot à feuilles capillaires Haarblättriges Laichkraut ***<br />
Potentilla arenaria Potentille <strong>de</strong>s sables Sand-Fingerkraut ***<br />
Potentilla erecta Tormentille Blutwurz *<br />
Potentilla leucopolitana Potentille <strong>de</strong> Wissembourg Weissenburger Fingerkraut ***<br />
Potentilla rupestris Potentille <strong>de</strong>s rochers Felsen-Fingerkraut **<br />
Primula veris Primevère officinale Wiesen-Schlüsselblume *<br />
Prunella grandiflora Brunelle à gran<strong>de</strong>s fleurs Grosse Braunelle ***<br />
Prunella laciniata Brunelle découpée Weisse Braunelle **<br />
Prunus mahaleb Bois-<strong>de</strong>-Sainte-Lucie Felsenkirsche ***<br />
Pulicaria dysenterica Pulicaire dysentérique Grosses Flohkraut *<br />
Pulicaria vulgaris Pulicaire annuelle Kleines Flohkraut ***<br />
Pulmonaria montana Pulmonaire <strong>de</strong>s montagnes Berg-Lungenkraut *<br />
Pulsatilla vulgaris Anémone pulsatille Gemeine Kuhschelle **<br />
Pyrola rotundifolia Pyrole à feuilles ron<strong>de</strong>s Rundblättriges Wintergrün *<br />
Quercus pubescens Chêne pubescent Flaumeiche **<br />
Radiola linoi<strong>de</strong>s Faux lin Zwerg-Lein ***<br />
Ranunculus aquatilis Renoncule aquatique Gemeiner Wasserhahnenfuss *<br />
Ranunculus arvensis � Renoncule <strong>de</strong>s champs Ackerhahnenfuss **<br />
Ranunculus circinatus Renoncule divariquée Spreizen<strong><strong>de</strong>r</strong> Wasserhahnenfuss *<br />
Ranunculus fluitans Renoncule flottante Fluten<strong><strong>de</strong>r</strong> Wasserhahnenfuss *<br />
Ranunculus he<strong><strong>de</strong>r</strong>aceus Renoncule à feuilles <strong>de</strong> lierre Efeublättriger Hahnenfuss *<br />
Ranunculus lingua Gran<strong>de</strong> douve Grosser Hahnenfuss ***<br />
Ranunculus peltatus Renoncule peltée Schildförmiger Wasserhahnenfuss*<br />
Ranunculus platanifolius Renoncule à feuilles <strong>de</strong> platane Gebirgs-Hahnenfuss **<br />
Ranunculus sardous � Renoncule sardonie Rauher Hahnenfuss **<br />
Ranunculus sceleratus Renoncule scélérate Gifthahnenfuss **<br />
Ranunculus trichophyllus Renoncule à feuilles capillaires Haarblättriger Wasserhahnenfuss *<br />
Rhinanthus alectorolophus Rhinanthe velu Behaarter Klappertopf **<br />
Rhinanthus angustifolius Rhinanthe à gran<strong>de</strong>s fleurs Grosser Klappertopf ***<br />
Rhinanthus minor Rhinanthe à petites fleurs Kleiner Klappertopf *<br />
Rhynchospora alba Rhynchospore blanc Weisses Schnabelried ***<br />
Rorippa stylosa Rorippa <strong>de</strong>s Pyrénées Pyrenäen-Sumpfkresse ***<br />
Rosa micrantha Rose à petites feuilles Kleinblütige Rose ***<br />
Rosa pimpinellifolia Rose pimprenelle Bibernell-Rose **<br />
Rosa rubiginosa Rose rouillée Weinrose *<br />
Rosa stylosa Rosier à styles unis Säulengrifflige Rose ***<br />
Rosa villosa Rose pomme Apfel-Rose ***<br />
Rumex hydrolapathum Patience <strong>de</strong>s Eaux Hoher Ampfer **<br />
Rumex maritimus Patience maritime Strandampfer **<br />
Rumex scutatus Oseille ron<strong>de</strong> Schildampfer **<br />
Sagina apetala � Sagine apétale Kronenloses Mastkraut **<br />
Sagina nodosa Sagine noueuse Knotiges Mastkraut ***<br />
Sagittaria sagittifolia Flèche d'eau Pfeilkraut **<br />
XIV
Salix repens Saule rampant Kriech-Wei<strong>de</strong> ***<br />
Salvia pratensis Sauge <strong>de</strong>s prés Wiesensalbei **<br />
Salvia verticillata Sauge verticillée Quirlsalbei **<br />
Sanguisorba minor Petite pimprenelle Kleiner Wiesenknopf *1<br />
Sanguisorba officinalis Sanguisorbe Blutkraut **<br />
Saxifraga granulata Saxifrage granulée Knöllchen-Steinbrech *1<br />
Saxifraga rosacea Saxifrage rhénan Rheinischer Steinbrech *<br />
subsp. sternbergii<br />
Saxifraga tridactylites Saxifrage tridactyle Dreifinger-Steinbrech *<br />
Scabiosa columbaria Colombaire Tauben-Skabiose *1<br />
Scabiosa columbaria Colombaire Tauben-Skabiose ***<br />
subsp. sternbergii<br />
Scandix pecten-veneris � Peigne <strong>de</strong> Vénus Na<strong>de</strong>lkerbel ***<br />
Scilla bifolia Scille à <strong>de</strong>ux feuilles Zweiblättriger Blaustern *<br />
Scirpus lacustris Jonc <strong>de</strong>s chaisiers Gemeine Teichsimse **<br />
Scirpus maritimus Scirpe maritime Strand-Simse ***<br />
Scirpus setaceus Scirpe sétacé Borstige Schuppensimse *<br />
Scirpus tabernaemontani Jonc <strong>de</strong>s chaisiers glauque Salz-Teichsimse ***<br />
Sclerochloa dura Sclérochloa dur Hartgras ***<br />
Scorzonera humilis Scorsonère <strong>de</strong>s prés Niedrige Schwarzwurzel **<br />
Scrophularia auriculata Scrofulaire aquatique Wasser-Braunwurz ***<br />
Scrophularia umbrosa Scrofuliaire ailée Geflügelte Braunwurz *<br />
Scutellaria minor Petite scutellaire Kleines Helmkraut ***<br />
Sedum rubens Orpin rougeâtre Rötliches Dickblatt ***<br />
Sedum sexangulare Orpin <strong>de</strong> Bologne Falscher Mauerpfeffer **<br />
Selinum carvifolia Sélin Kümmel-Silge *<br />
Sempervivum tectorum Joubarbe <strong>de</strong>s toits Dach-Hauswurz ***<br />
Senecio aquaticus Séneçon aquatique Wasser-Greiskraut **<br />
Senecio helenitis Séneçon à feuilles spatulées Spatelblättriges Greiskraut **<br />
Senecio sarracenicus Séneçon <strong>de</strong>s saussaies Fluss-Greiskraut ***<br />
Serratula tinctoria Serratule <strong>de</strong>s teinturiers Färber-Scharte ***<br />
Seseli annuum Séséli <strong>de</strong>s steppes Steppenfenchel ***<br />
Seseli libanotis Libanotis Heilwurz *<br />
Sesleria caerulea Seslérie bleuâtre Blaugras *<br />
Setaria pumila � Sértaire glauque Graugrüne Borstenhirse **<br />
Sherardia arvensis � Shérardie <strong>de</strong>s champs Ackerröte **<br />
Silaum silaus Silaüs <strong>de</strong>s près Silau *1<br />
Silene armeria Silene à bouquets Nelken-Leimkraut *<br />
Silene conica Silène conique Kegel-Leimkraut ***<br />
Silene dichotoma � Silène à <strong>de</strong>ux grapes Gabel-Leimkraut ***<br />
Silene noctiflora � Compagnon <strong>de</strong> nuit Echte Nachtnelke ***<br />
Sorbus latifolia Alisier <strong>de</strong> Fontainebleau Breitblättrige Eberesche *<br />
Sparganium emersum Rubanier simple Einfacher Igelkolben **<br />
Sparganium natans Rubanier nain Zwerg-Igelkolben ***<br />
Spergula pentandra Spargoute à cinq étamines Fünfmänniger Spark ***<br />
Spiro<strong>de</strong>la polyrhiza Lentille à plusieurs racines Vierwurzelige Teichlinse *<br />
Stachys alpina Epiaire <strong>de</strong>s Alpes Alpen-Ziest *<br />
Stachys annua � Epiaire annuelle Sommer-Ziest ***<br />
Stachys arvensis � Epiaire <strong>de</strong>s champs Acker-Ziest **<br />
Stachys recta Epiaire dressée Berg-Ziest *<br />
Stellaria palustris Stellaire glauque Sumpfsternmiere ***<br />
Succisa pratensis Succise <strong>de</strong>s prés Teufelsabbiss *<br />
Tamus communis Tamier Schmeerwurz **<br />
Teucrium botrys Germandrée botry<strong>de</strong> Trauben-Gaman<strong><strong>de</strong>r</strong> *<br />
Teucrium chamaedrys Germandrée petit-chêne E<strong>de</strong>lgaman<strong><strong>de</strong>r</strong> *<br />
Teucrium montanum Germandrée <strong>de</strong>s montagnes Berg-Gaman<strong><strong>de</strong>r</strong> ***<br />
Thalictrum flavum Pigamon jaune Gelbe Wiesenraute *<br />
Thalictrum minus subsp. majus Petit pigamon Kleinblättrige Wiesenraute ***<br />
Thelypteris palustris Thélyptéris <strong>de</strong>s marais Sumpffarn ***<br />
Thesium pyrenaicum Thésion <strong>de</strong>s prés Wiesenleinblatt ***<br />
Thlaspi montanum Tabouret <strong>de</strong>s montagnes Berg-Hellerkraut ***<br />
Thymelea passerina Passerine Vogelkopf ***<br />
XV
Thymus praecox Serpolet couché Kriechen<strong><strong>de</strong>r</strong> Thymian *<br />
Thymus pulegioi<strong>de</strong>s Serpolet commun Gemeiner Thymian *1<br />
Torilis arvensis � Torilis <strong>de</strong>s moissons Feld-Klettenkerbel **<br />
Tragopogon pratensis Salsifis <strong>de</strong>s près Wiesen-Bockbart *1<br />
Tragopogon pratensis Salsifis <strong>de</strong>s prés Wiesen-Bocksbart ***<br />
subsp. orientalis<br />
Trichomanes speciosum H Trichomanes remarquable Europäischer Haarfarn ***<br />
Trifolium alpestre Trèfle alpestre Voralpen-Klee ***<br />
Trifolium aureum Trèfle doré Gold-Klee **<br />
Trifolium filiforme Trèfle à petites fleurs Fa<strong>de</strong>n-Klee ***<br />
Trifolium montanum Trèfle <strong>de</strong>s montagnes Berg-Klee *<br />
Trifolium ochroleucon Trèfle jaunâtre Gelblichweisser Klee *<br />
Trifolium rubens Trèfle rougeâtre Purpur-Klee ***<br />
Trifolium striatum Trèfle strié Gestreifter Klee **<br />
Triglochin palustre Troscart <strong>de</strong>s marais Sumpfdreizack ***<br />
Turgenia latifolia Caucalis à larges feuilles Breitblättrige Haftdol<strong>de</strong> ***<br />
Typha angustifolia Massette à feuilles étroites Schmalblättriger Rohrkolben **<br />
Ulex europaeus Ajone d'Europe Gaspeldorn ***<br />
Ulmus laevis Orme lisse Flatterulme ***<br />
Urtica urens Petite ortie Kleine Brennessel ***<br />
Utricularia australis Utriculaire citrine Zitronengelber Wasserschlauch **<br />
Utricularia vulgaris Utriculaire vulgaire Gemeiner Wasserschlauch **<br />
Vaccaria hispanica Saponaire <strong>de</strong>s vaches Saat-Kuhkraut ***<br />
Vaccinium oxycoccos Canneberge Moosbeere ***<br />
Vaccinium vitis-idaea Airelle Preisselbeere ***<br />
Valeriana dioica Valériane dioïque Kleiner Baldrian **<br />
Valerianella <strong>de</strong>ntata � Valérianelle <strong>de</strong>ntée Gezähntes Rapünzchen **<br />
Valerianella rimosa � Valérianelle à oreillettes Geöhrtes Rapünzchen **<br />
Vallisneria spiralis Vallisnérie Wasserschraube **<br />
Verbascum <strong>de</strong>nsiflorum Faux bouillon blanc Grossblütige Königskerze *<br />
Verbascum phlomoi<strong>de</strong>s Molène faux-phlomis Filzige Königskerze ***<br />
Verbascum pulverulentum Molène floconneuse Flockige Königskerze ***<br />
Verbascum thapsus Bouillon blanc Kleinblütige Königskerze *<br />
Veronica anagallis-aquatica Véronique mouron d'eau Wasser-Ehrenpreis ***<br />
Veronica anagallis-aquatica Véronique mouron d'eau Wasser-Ehrenpreis **<br />
subsp. angallis-aquatica<br />
Veronica polita � Véronique luisante Glänzen<strong><strong>de</strong>r</strong> Ehrenpreis **<br />
Veronica praecox Véronique précoce Früher Ehrenpreis ***<br />
Veronica scutellata Véronique à écus Schild-Ehrenpreis **<br />
Veronica teucrium Véronique germandrée Grosser Ehrenpreis ***<br />
Veronica tryphyllos � Véronique trifoliée Dreiteiliger Ehrenpreis ***<br />
Veronica verna � Véronique printanière Frühlings-Ehrenpreis ***<br />
Vicia lathyroi<strong>de</strong>s Fausse gesse Platterbsen-Wicke ***<br />
Vicia pisiformis Vesce à feuilles <strong>de</strong> pois Erbsen-Wicke ***<br />
Vicia tetrasperma Vesce à quatre graines Viersamige Wicke ***<br />
subsp. gracilis �<br />
Vincetoxicum hirundinaria Dompte-venin Schwalbenwurz *<br />
Viola canina Violette <strong>de</strong>s chiens Hundsveilchen **<br />
Viola mirabilis Violette étonnate Wun<strong><strong>de</strong>r</strong>veilchen *<br />
Viola palustris Violette <strong>de</strong>s marais Sumpfveilchen **<br />
Vulpia bromoi<strong>de</strong>s Vulpie queue-d'écureuil Trespen-Fer<strong><strong>de</strong>r</strong>schwingel ***<br />
Vulpia myuros Vulpie queue-<strong>de</strong>-rat Mäuseschwanz-Fe<strong><strong>de</strong>r</strong>schwingel **<br />
Wahlenbergia he<strong><strong>de</strong>r</strong>acea Wahlenbergie Moorglöckchen ***<br />
Xanthium strumarium Lampour<strong>de</strong> glouteron Gemeine Spitzklette ***<br />
BRYOPHYTA BRYOPHYTES MOOSE<br />
Hepaticae et Anthocerotae<br />
Anastrophyllum hellerianum *<br />
Anastrophyllum minutum *<br />
Anthoceros agrestis *<br />
Apometzgeria pubescens *<br />
XVI
Barbilophozia attenuata *<br />
Barbilophozia kunzeana ***<br />
Bazzania flaccida *<br />
Calypogeia azurea ***<br />
Calypogeia suecica ***<br />
Cephalozia catenulata *<br />
Cephalozia connivens ***<br />
Cephalozia lunulifolia *<br />
Cephaloziella hampeana ***<br />
Claypogeia integristipula *<br />
Cololejeunea rossettiana ***<br />
Fossombronia pusilla *<br />
Frulliana fragilifolia *<br />
Geocalyx graveolens ***<br />
Gymnocolea inflata ***<br />
Harpanthus scutatus *<br />
Jungermannia hyalina *<br />
Jungermannia leiantha *<br />
Jungermannia pumila *<br />
Lejeunea ulicina *<br />
Lophocolea fragrans ***<br />
Lophozia bicrenata *<br />
Lophozia heterocolpos ***<br />
Lophozia incisa *<br />
Lophozia longi<strong>de</strong>ns ***<br />
Lophozia obtusa *<br />
Lophozia su<strong>de</strong>tica *<br />
Marsupella emarginata ***<br />
Marsupella funckii ***<br />
Metzgeria fruticulosa ***<br />
Metzgeria temperata ***<br />
Odontoschisma <strong>de</strong>nudatum ***<br />
Pedinophyllum interruptum *<br />
Phaeoceros laevis *<br />
Plagiochila killarniensis ***<br />
Plagiochila spinulosa ***<br />
Porella cordaeana *<br />
Preissia quadrata *<br />
Reboulia hemisphaerica *<br />
Riccardia chamaedryfolia *<br />
Riccardia multifida *<br />
Riccia bifurca *<br />
Riccia fluitans ***<br />
Riccia huebeneriana ***<br />
Ricciocarpos natans ***<br />
Scapania aequiloba ***<br />
Scapania aspera *<br />
Scapania compacta *<br />
Scapania curta *<br />
Scapania mucronata ***<br />
Scapania umbrosa ***<br />
Targionia hypophylla ***<br />
Trichocolea tomentella *<br />
Tritomaria exsecta *<br />
Musci<br />
Acaulon muticum *<br />
Aloina rigida *<br />
Amblystegium confervoi<strong>de</strong>ns *<br />
Amblystegium humile ***<br />
Antitrichia curtipendula *<br />
Aphanorhegma patens *<br />
XVII
Atrichum tenellum *<br />
Aulacomnium palustre *<br />
Bartramia halleriana *<br />
Brachythecium plumosum *<br />
Bryum barnesii *<br />
Bryum bornholmense *<br />
Bryum elegans ***<br />
Bryum intermedium *<br />
Bryum klinggraeffii *<br />
Bryum pallens ***<br />
Bryum radiculosum *<br />
Bryum violaceum *<br />
Buxbaumia aphylla ***<br />
Calliergon stramineum *<br />
Calliergon giganteum *<br />
Campylium stellatum var. stellatum ***<br />
Campylopus fragilis *<br />
Campylopus subulatus ***<br />
Ceratodon conicus *<br />
Cirriphyllum reichenbachianum ***<br />
Cryphaea heteromalla ***<br />
Cynodontium polycarpon ***<br />
Cynodontium strumiferum ***<br />
Dicranella cerviculata *<br />
Dicranum bonjeanii *<br />
Dicranum spurium ***<br />
Dicranum viri<strong>de</strong> H ***<br />
Didymodon acutus *<br />
Didymodon cordatus *<br />
Didymodon glaucus ***<br />
Diphyscium foliosum *<br />
Distichium capillaceum *<br />
Ditrichum lineare ***<br />
Ditrichum pusillum *<br />
Enthostodon fascicularis *<br />
Ephemerum serratum *<br />
Fissi<strong>de</strong>ns incurvus *<br />
Fissi<strong>de</strong>ns limbatus *<br />
Fissi<strong>de</strong>ns rufulus *<br />
Fissi<strong>de</strong>ns viridulus *<br />
Fontinalis squamosa *<br />
Grimmia crinita ***<br />
Grimmia hartmanii ***<br />
Grimmia orbicularis *<br />
Grimmia ovalis *<br />
Grimmia torquata *<br />
Homalothecium nitens ***<br />
Hookeria lucens ***<br />
Hymenostylium recurvirostrum ***<br />
Hypnum lindbergii *<br />
Hypnum pallescens ***<br />
Octodiceras fontanum *<br />
Orthothecium intracatum ***<br />
Orthotrichum pulchellum *<br />
Orthotrichum rivulare ***<br />
Orthotrichum speciosum ***<br />
Orthotrichum stramineum *<br />
Oxystegus tenuirostris *<br />
Phascum curvicolle *<br />
Phascum floerkeanum ***<br />
Philonotis caespitosa *<br />
Philonotis calcarea ***<br />
XVII<br />
I
Plagiomnium ellipticum *<br />
Plagiothecium latebricola *<br />
Plagiothecium platyphyllum *<br />
Plagiothecium ruthei ***<br />
Pleuridium palustre *<br />
Polytrichum strictum ***<br />
Pottia davalliana *<br />
Pseudobryum cinclidioi<strong>de</strong>s *<br />
Pterigynandrum filiforme ***<br />
Ptilium crista-castrensis ***<br />
Ptychomitrium polyphyllum *<br />
Racomitrium aciculare *<br />
Rhabdoweisia fugax *<br />
Rhynchostegiella curviseta *<br />
Rhynchostegiella teesdalei ***<br />
Rhynchostegium megapolitanum *<br />
Schistidium apocarpum subsp. strictum *<br />
Schistostega pennata *<br />
Seligeria donniana *<br />
Seligeria pusilla *<br />
Sphagnum capillifolium ***<br />
Sphagnum cuspidatum ***<br />
Sphagnum fallax ***<br />
Sphagnum girgensohnii ***<br />
Sphagnum squarrosum *<br />
Tetrodontium brownianum ***<br />
Tortula inermis ***<br />
Tortula marginata *<br />
Trichostomum brachydontium *<br />
Weissia brachycarpa *<br />
Weissia con<strong>de</strong>nsa *<br />
Weissia rostellata *<br />
Weissia rutilans *<br />
CHLOROPHYTA CHLOROPHYTES GRÜNALGEN<br />
Characeae<br />
Chara globularis ***<br />
Chara hispidula ***<br />
Chara vulagris *<br />
Nitella flexilis ***<br />
Nitella gracilis ***<br />
Nitella opaca ***<br />
RHODOPHYTA RHODOPHYTES ROTALGEN<br />
Rhodophyceae<br />
Batrachospermun sp. ***<br />
LICHENES LICHENS FLECHTEN<br />
Acrocordia gemmata *<br />
Agonimia allobata **<br />
Anaptychia ciliaris **<br />
Arthonia arthonioi<strong>de</strong>s *<br />
Arthonia byssacea *<br />
Arthonia cinnabarina ***<br />
Arthonia didyma *<br />
Arthonia muscigena **<br />
Arthopyrenia salicis ***<br />
Arthothelium ruanum *<br />
Arthrorhaphis citrinella **<br />
XIX
Arthrorhaphis grisea *<br />
Bacidia biatorina **<br />
Bacidia rosella ***<br />
Bacidia subincompta *<br />
Bacidia viridifarinosa **<br />
Bagliettoa steineri *<br />
Biatora chrysantha *<br />
Biatora epixanthoi<strong>de</strong>s **<br />
Biatora sphaeroi<strong>de</strong>s ***<br />
Biatoropsis usnearum **<br />
Bryoria fuscescens *<br />
Buellia disciformis **<br />
Bunodophoron melanocarpum **<br />
Caloplaca cerina var. cerina **<br />
Caloplaca cerina var. chloroleuca ***<br />
Caloplaca cerinella ***<br />
Caloplaca chrysophthalma ***<br />
Caloplaca flavorubescens ***<br />
Caloplaca herbi<strong>de</strong>lla *<br />
Caloplaca lucifuga ***<br />
Catillaria nigroclavata **<br />
Catinaria atropurpurea **<br />
Cetraria islandica ***<br />
Cetrelia olivetorum ***<br />
Chaenotheca phaeocephala ***<br />
Chaenotheca xyloxena ***<br />
Chaenothecopsis pusilla **<br />
Chaenothecopsis vainioana **<br />
Cladonia cariosa ***<br />
Cladonia cornuta **<br />
Cladonia foliacea *<br />
Cladonia parasitica **<br />
Cladonia phyllophora ***<br />
Cladonia polycarpoi<strong>de</strong>s ***<br />
Cladonia rangiferina *<br />
Cladonia symphycarpa **<br />
Cliostomum griffithii **<br />
Collema cristatum *<br />
Collema flaccidum *<br />
Cresponea premnea var. saxicola ***<br />
Cyphelium sessile ***<br />
Dactylospora parasitica ***<br />
Endocarpon pusillum ***<br />
Enterographa hutchinsiae *<br />
Ephebe lanata ***<br />
Fellhanera bouteillei **<br />
Feltgeniomyces luxemburgensis ***<br />
Flavopunctelia flaventior ***<br />
Fusci<strong>de</strong>a cyathoi<strong>de</strong>s **<br />
Fusci<strong>de</strong>a lightfootii **<br />
Graphis elegans ***<br />
Gyalecta flotowii ***<br />
Gyalecta ulmi ***<br />
Hyperphyscia adglutinata **<br />
Hypogymnia farinacea **<br />
Hypotrachyna revoluta *<br />
Icmadophila ericetorum ***<br />
Illosporium carneum **<br />
Imshaugia aleurites **<br />
Karschia talcophila **<br />
Lau<strong><strong>de</strong>r</strong>lindsaya acroglypta ***<br />
Lecanographa lyncea ***<br />
XX
Lecanora achariana *<br />
Lecanora allophana ***<br />
Lecanora horiza ***<br />
Lecanora pannonica **<br />
Lecanora sambuci *<br />
Lecanora strobilina ***<br />
Leci<strong>de</strong>a sanguineoatra ***<br />
Leci<strong>de</strong>lla laureri **<br />
Lemmopsis arnoldiana **<br />
Lempholemma polyanthes *<br />
Leptogium biatorinum **<br />
Leptogium byssinum *<br />
Leptogium corniculatum ***<br />
Leptogium cyanescens **<br />
Leptogium lichenoi<strong>de</strong>s *<br />
Leptogium subtile ***<br />
Leptogium tenuissimum *<br />
Leptogium teretiusculum *<br />
Lichenoconium reichlingii ***<br />
Lichenopeltella thelidii **<br />
Lobaria pulmonaria ***<br />
Lobaria virens ***<br />
Melanelia exasperata **<br />
Melanelia subargentifera **<br />
Micarea hedlundii ***<br />
Micarea lithinella *<br />
Micarea melaena **<br />
Micarea misella **<br />
Micarea pycnidiophora ***<br />
Mycobilimbia hypnorum ***<br />
Neofuscelia loxo<strong>de</strong>s *<br />
Nephroma parile ***<br />
Normandina pulchella ***<br />
Ochrolechia pallescens ***<br />
Ochrolechia parella **<br />
Ochrolechia turneri **<br />
Omphalina hudsoniana ***<br />
Opegrapha ochrocheila **<br />
Opegrapha rufescens **<br />
Opegrapha variaeformis ***<br />
Pachyphiale fagicola ***<br />
Parmelia submontana ***<br />
Parmeliella tryptophylla ***<br />
Parmotrema chinense ***<br />
Peltigera <strong>de</strong>genii ***<br />
Peltigera elisabethae ***<br />
Peltigera horizontalis **<br />
Peltigera lepidophora ***<br />
Peltigera leucophlebia ***<br />
Peltigera malacea ***<br />
Peltigera neckeri **<br />
Peltigera polydactylon **<br />
Pertusaria coronata **<br />
Pertusaria multipuncta ***<br />
Pertusaria pustulata ***<br />
Phaeophyscia endophoenicea **<br />
Phlyctis agelaea ***<br />
Physcia tribacia **<br />
Placidium pilosellum **<br />
Placidium squamulosum **<br />
Placynthiella oligotropha **<br />
Placynthiella uliginosa **<br />
XXI
Polychidium muscicola ***<br />
Porina leptalea *<br />
Pronectria leptaleae **<br />
Pronectria ornamentata **<br />
Pronectria terrestris **<br />
Pronectria xanthoriae **<br />
Pycnothelia papillaria ***<br />
Pyrenula nitida *<br />
Ramalina fastigiata **<br />
Ramalina fraxinea **<br />
Ramalina pollinaria **<br />
Reichlingia leopoldii *<br />
Rinodina archaea ***<br />
Rinodina griseosoralifera *<br />
Rinodina pyrina ***<br />
Rinodina sicula ***<br />
Sarcosagium campestre var. campestre *<br />
Sarcosagium campestre var. macrosporum ***<br />
Schismatomma umbrinum **<br />
Sclerococcum epiphytorum ***<br />
Skyttea nitschkei *<br />
Solenopsora candicans *<br />
Solorina saccata ***<br />
Sphaerophorus globosus ***<br />
Sphinctrina leucopoda ***<br />
Sphinctrina turbinata ***<br />
Staurothele fissa *<br />
Strangospora moriformis *<br />
Strangospora ochrophora *<br />
Strangospora pinicola *<br />
Strigula affinis ***<br />
Strigula jamesii ***<br />
Strigula taylorii ***<br />
Syzygospora bachmannii ***<br />
Thelocarpon coccosporum ***<br />
Thelocarpon <strong>de</strong>pressellum ***<br />
Thelocarpon intermediellum ***<br />
Thelocarpon lichenicola ***<br />
Thelomma ocellatum ***<br />
Thelotrema lepadinum *<br />
Toninia aromatica **<br />
Toninia sedifolia **<br />
Tremella cladoniae **<br />
Tuckermannopsis chlorophylla **<br />
Tuckermannopsis sepincola ***<br />
Umbilicaria polyphylla *<br />
Usnea cornuta ***<br />
Usnea filipendula *<br />
Usnea florida *<br />
Usnea fulvoreagens **<br />
Usnea hirta **<br />
Usnea subfloridana *<br />
Usnea wasmuthii **<br />
Verrucaria rheitrophila *<br />
Vulpicida pinastri ***<br />
Woessia arnoldiana *<br />
Woessia chloroticula *<br />
Woessia inundata *<br />
Woessia saxenii *<br />
Xanthoparmelia somloënsis ***<br />
Xylographa vitiligo ***<br />
XXII
Catégories:<br />
*** espèces hautement spécialisées et/ou menacées d'extinction, nécessitant <strong>de</strong>s mesures <strong>de</strong><br />
protection d'urgence, resp. figurant à l'annexe II <strong>de</strong> la directive 92/43/CEE (habitats); ai<strong>de</strong>: 90% du<br />
coût <strong>de</strong>s mesures <strong>de</strong> protection<br />
** espèces très spécialisées et/ou fortement menacées, nécessitant <strong>de</strong>s mesures <strong>de</strong> protection<br />
d'urgence, resp. figurant à l'annexe IV <strong>de</strong> la directive 92/43/CEE (habitats); ai<strong>de</strong>: 70% du coût <strong>de</strong>s<br />
mesures <strong>de</strong> protection<br />
* espèces menacées, nécessitant <strong>de</strong>s mesures <strong>de</strong> protection spécifiques; ai<strong>de</strong>: 50% du coût <strong>de</strong>s<br />
mesures <strong>de</strong> protection<br />
(*) espèces encore assez répandues, mais dont le nombre <strong>de</strong> populations viables a fortement<br />
diminué; ai<strong>de</strong>: 50% du coût <strong>de</strong> mesures <strong>de</strong> protection <strong>de</strong>stinées à la sauvegar<strong>de</strong> <strong>de</strong> sites abritant<br />
<strong>de</strong>s populations intactes<br />
H espèces figurant à l'annexe II <strong>de</strong> la directive 92/43/CEE (habitats); ai<strong>de</strong>: 90% du coût <strong>de</strong>s mesures<br />
<strong>de</strong> protection<br />
� espèces végétales liées aux cultures champêtres<br />
1<br />
seulement les populations se trouvant à l'intérieur <strong>de</strong> prairies ou pâturages d'exploitation<br />
2 seulement les peuplements autochtones<br />
XXII<br />
I