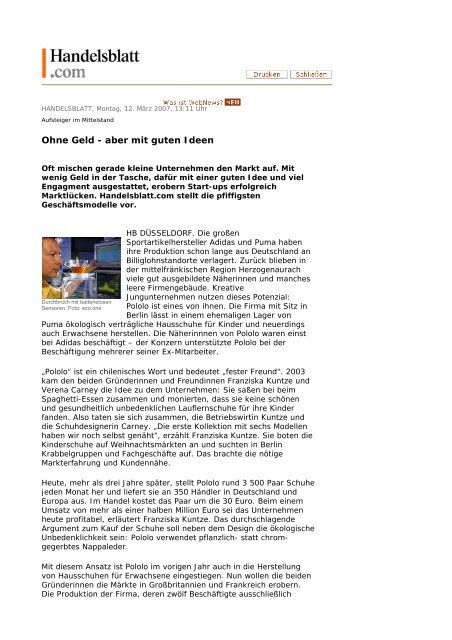Ohne Geld - aber mit guten Ideen - Little Giants
Ohne Geld - aber mit guten Ideen - Little Giants
Ohne Geld - aber mit guten Ideen - Little Giants
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
HANDELSBLATT, Montag, 12. März 2007, 13:11 Uhr<br />
Aufsteiger im Mittelstand<br />
<strong>Ohne</strong> <strong>Geld</strong> - <strong>aber</strong> <strong>mit</strong> <strong>guten</strong> <strong>Ideen</strong><br />
Oft mischen gerade kleine Unternehmen den Markt auf. Mit<br />
wenig <strong>Geld</strong> in der Tasche, dafür <strong>mit</strong> einer <strong>guten</strong> Idee und viel<br />
Engagment ausgestattet, erobern Start-ups erfolgreich<br />
Marktlücken. Handelsblatt.com stellt die pfiffigsten<br />
Geschäftsmodelle vor.<br />
Durchbruch <strong>mit</strong> batterielosen<br />
Sensoren. Foto: eco.one<br />
HB DÜSSELDORF. Die großen<br />
Sportartikelhersteller Adidas und Puma haben<br />
ihre Produktion schon lange aus Deutschland an<br />
Billiglohnstandorte verlagert. Zurück blieben in<br />
der <strong>mit</strong>telfränkischen Region Herzogenaurach<br />
viele gut ausgebildete Näherinnen und manches<br />
leere Firmengebäude. Kreative<br />
Jungunternehmen nutzen dieses Potenzial:<br />
Pololo ist eines von ihnen. Die Firma <strong>mit</strong> Sitz in<br />
Berlin lässt in einem ehemaligen Lager von<br />
Puma ökologisch verträgliche Hausschuhe für Kinder und neuerdings<br />
auch Erwachsene herstellen. Die Näherinnnen von Pololo waren einst<br />
bei Adidas beschäftigt – der Konzern unterstützte Pololo bei der<br />
Beschäftigung mehrerer seiner Ex-Mitarbeiter.<br />
„Pololo“ ist ein chilenisches Wort und bedeutet „fester Freund“. 2003<br />
kam den beiden Gründerinnen und Freundinnen Franziska Kuntze und<br />
Verena Carney die Idee zu dem Unternehmen: Sie saßen bei beim<br />
Spaghetti-Essen zusammen und monierten, dass sie keine schönen<br />
und gesundheitlich unbedenklichen Lauflernschuhe für ihre Kinder<br />
fanden. Also taten sie sich zusammen, die Betriebswirtin Kuntze und<br />
die Schuhdesignerin Carney. „Die erste Kollektion <strong>mit</strong> sechs Modellen<br />
haben wir noch selbst genäht“, erzählt Franziska Kuntze. Sie boten die<br />
Kinderschuhe auf Weihnachtsmärkten an und suchten in Berlin<br />
Krabbelgruppen und Fachgeschäfte auf. Das brachte die nötige<br />
Markterfahrung und Kundennähe.<br />
Heute, mehr als drei Jahre später, stellt Pololo rund 3 500 Paar Schuhe<br />
jeden Monat her und liefert sie an 350 Händler in Deutschland und<br />
Europa aus. Im Handel kostet das Paar um die 30 Euro. Beim einem<br />
Umsatz von mehr als einer halben Million Euro sei das Unternehmen<br />
heute profitabel, erläutert Franziska Kuntze. Das durchschlagende<br />
Argument zum Kauf der Schuhe soll neben dem Design die ökologische<br />
Unbedenklichkeit sein: Pololo verwendet pflanzlich- statt chromgegerbtes<br />
Nappaleder.<br />
Mit diesem Ansatz ist Pololo im vorigen Jahr auch in die Herstellung<br />
von Hausschuhen für Erwachsene eingestiegen. Nun wollen die beiden<br />
Gründerinnen die Märkte in Großbritannien und Frankreich erobern.<br />
Die Produktion der Firma, deren zwölf Beschäftigte ausschließlich
Frauen sind, soll in Franken bleiben. „Wir wollen dazu beitragen, dass<br />
es auch künftig noch professionelle Näherinnen und Näher in<br />
Deutschland gibt“, sagt Franziska Kuntze. bef<br />
Lesen Sie weiter auf Seite 2: Wie ein bayerisches Unternehmen <strong>mit</strong><br />
batterielosen Sensoren durchstartet.<br />
Bahnbrechend neue Technologien können in Startup-Unternehmen oft<br />
besser weitergetrieben werden als in Großkonzernen. Zu lang sind dort<br />
die Wege, zu kompliziert die Absprachen – vor allem, wenn die Idee<br />
noch keinem der bestehenden Geschäftssparten zuzuordnen ist. Das<br />
war ein Grund dafür, dass die <strong>mit</strong>tlerweile vielfach ausgezeichnete<br />
Enocean GmbH aus Oberhaching bei München entstanden ist. >/p><br />
Vor sechs Jahren gründeten fünf ehemalige Siemens-Entwickler das<br />
Unternehmen: Sie hatten im Konzern eine neue Grundlagentechnik<br />
geschaffen, <strong>mit</strong> der Funksensoren ohne Batterie betrieben werden<br />
können. Schnelligkeit war gefragt, denn die positive Resonanz aus<br />
vielen Anwendungsbranchen war groß.<br />
2001 startete Enocean ausgestattet <strong>mit</strong> Wagniskapital von Siemens<br />
und weiteren Venture-Capital (VC)-Gesellschaften, zwei Jahre später<br />
kam das erste Produkt auf den Markt. Die Erfindung passt gut zur<br />
derzeitigen Diskussion über Energieeinsparung: Wenn Sensoren von<br />
Enocean per Fingerdruck betätigt werden, wandeln sie<br />
Umgebungsenergie in elektrische Energie um, <strong>mit</strong> der die Signale<br />
gesendet werden. So können ganz ohne Stromkabel und Batterie<br />
Geräte im Umkreis von 300 Metern gesteuert werden, beispielsweise<br />
Jalousien oder Klimaanlagen.<br />
Rund 50 Firmen nutzen die Sensoren bereits, 200 000 Funkmodule<br />
wurden bislang vermarktet. „Wir fokussieren uns zunächst ganz auf<br />
die Gebäudetechnik“, sagt Vetriebsleiter Andreas Schneider – obwohl<br />
die Anwendungsmöglichkeiten weitaus größer sind. „Unser Ziel ist es,<br />
in einem Marktsegment zum Standard zu werden. Dann ergibt sich die<br />
Lawine von selbst“, hofft er. Schneider hat die Firma <strong>mit</strong> Armin<br />
Anders, Markus Brehler, Frank Schmidt und Oliver Sczesny gegründet.<br />
Profitabel ist das Unternehmen noch nicht, denn Markterschließung<br />
und Forschung kosten viel <strong>Geld</strong>. Doch Experten glauben an die<br />
Zukunftsfähigkeit: Im Herbst 2005 sammelte Enocean weitere zehn<br />
Millionen Euro bei Wagniskapitalgesellschaften ein, darunter 3i,<br />
Wellington und Siemens Venture Capital. Mit dem <strong>Geld</strong> wurde eine<br />
Niederlassung in den USA aufgebaut.<br />
Neben VC-Gesellschaften und den Gründern sind die Mitarbeiter von<br />
Enocean an der GmbH beteiligt. 34 Arbeitsplätze hat das Unternehmen<br />
geschaffen, produziert werden die Funkmodule unter anderem vom<br />
ehemaligen Arbeitgeber der Gründer, Siemens. Wenn der<br />
Wachstumsplan in der industriellen Gebäudetechnik aufgeht, könnten<br />
sich Chancen im privaten Wohnungsbau oder bei Anwendungen in<br />
Autos ergeben. Das ist laut Schneider <strong>aber</strong> Zukunftsmusik: „Wir wollen<br />
uns nicht verzetteln.“ bef<br />
Lesen Sie weiter auf Seite 3: Warum sich ein kleines Modegeschäft<br />
zum Internethändler mausert.<br />
In Dachau kennt man das Traditionshaus in der Innenstadt gut, denn<br />
das Modegeschäft Rauffer verkauft schon seit 1888 feines Tuch für den
Herrn. Anzüge von Hugo Boss oder Mode von Ralph Lauren sind dort<br />
im Angebot. Doch bald soll Rauffer in ganz Deutschland ein Begriff<br />
sein: Hans-Peter Ackermann, Inh<strong>aber</strong> und Geschäftsführer des<br />
Unternehmens, hat den Sprung ins Internetgeschäft gewagt und einen<br />
Online-Shop unter dem Namen Herrenkontor.de eröffnet. Seit August<br />
vorigen Jahres verkauft Herrenkontor dort Herrenmode bekannter<br />
Marken nebst Accessoires.<br />
Die Idee dazu kam dem 38-Jährigen, als er nach neuen Möglichkeiten<br />
suchte, seine Leidenschaft für Mode und Geschäft zu verbinden. Denn<br />
die Wachstumschancen in der 40 000-Einwohner-Stadt Dachau sind<br />
li<strong>mit</strong>iert. Gemeinsam <strong>mit</strong> einem Geschäftspartner aus der<br />
Modebranche hat er zwei Jahre am Konzept von Herrenkontor<br />
gearbeitet. Das junge Unternehmen sucht vor allem die gut betuchte<br />
Kundschaft, denn niedrige Preise stehen nicht im Fokus. Vielmehr will<br />
sich Ackermann von anderen Internetangeboten dieser Art durch<br />
Fachkompetenz bei der Onlineberatung und spezielle Auswahl des<br />
Sortiments abgrenzen.<br />
Anzüge im Online-Shop zu kaufen – das scheint für viele Männer<br />
undenkbar. Ackermann hält dagegen, dass beispielsweise<br />
Geschäftsmänner wenig Zeit zum Kauf hätten und sich ungern am<br />
Samstagnach<strong>mit</strong>tag in die Innenstädte drängen. „Zudem schwankt die<br />
Beratungsqualität im stationären Handel gerade zu diesen Zeiten sehr<br />
stark“, sagt er. Herrenkontor liefert Anzüge und Accessoires <strong>mit</strong><br />
Umtauschfrist nach Hause und hat zur eigenen Überraschung viele<br />
Frauen als Kunden.<br />
Die Umsatzziele für die ersten Monate habe man übertroffen, sagt<br />
Ackermann, ohne Zahlen zu nennen. Zwar ist das Unternehmen schon<br />
in Österreich aktiv, doch vor internationaler Expansion will<br />
Herrenkontor sich erst mal aufs Geschäft in Deutschland<br />
konzentrieren. Ackermanns Ziel ist es, den derzeitigen Marktführer<br />
Herrenausstatter.de zu schlagen. Wenn das gelingt, ist für ihn<br />
langfristig auch ein Online-Shop für Damenmode denkbar –<br />
www.damenkontor.de hat er schon reserviert. bef<br />
Lesen Sie weiter auf Seite 4: Wie ein Amerikaner in Berlin <strong>mit</strong><br />
kostenlosen Stadtführungen eine Dreiviertelmillion Euro umsetzt.<br />
„Free Tour“ prangt auf dem Pappschild des jungen Mannes <strong>mit</strong> dem<br />
roten Shirt am Brandenburger Tor. Pünktlich um elf Uhr finden sich<br />
rund 20 junge Amerikaner, Briten und Kanadier ein, um sich von<br />
einem Muttersprachler <strong>mit</strong> Hochschulstudium in dreieinhalb Stunden<br />
Berlin zeigen zu lassen – und das auch noch kostenlos. Zumindest wird<br />
niemand verpflichtet, dem Stadtführer ein Honorar zu zahlen.<br />
Trinkgelder dagegen sind sehr willkommen und Gäste, die<br />
wiederkommen, um eine andere – kostenpflichtige – Führung zu<br />
buchen, wie etwa die „Kneipentour“ oder die „Drittes-Reich-Tour“. „46<br />
Prozent der Gäste kommen wieder“, freut sich Chris Sandeman, Erbe<br />
der gleichnamigen Sherry-Dynastie und Erfinder von New Berlin Tours.<br />
Seit einiger Zeit bietet er nicht nur Touren in der deutschen Hauptstadt<br />
an, sondern auch in München, Amsterdam und London. Demnächst will<br />
er in Paris starten.<br />
Das Konzept kommt an: Im vergangenen Jahr setzte er <strong>mit</strong> seinem<br />
Unternehmen Sandeman’s New Europe bereits eine Dreiviertelmillion<br />
Euro um. Gestartet war er <strong>mit</strong> 20 000 Euro und dem Wissen um eine
Marktlücke. Dass es <strong>mit</strong>tlerweile so gut läuft, war 2004 für den heute<br />
29-Jährigen noch nicht abzusehen.<br />
Nach seinem Psychologiestudium in den USA war er auf einer<br />
Weltreise in Berlin gelandet und dort hängen geblieben. Er arbeitete<br />
als Stadtführer. Viele Touristen fragten ihn nach einem<br />
englischsprachigen Stadtmagazin <strong>mit</strong> Übernachtungs- und<br />
Ausgehtipps. Weil Sandeman keines empfehlen konnte, mutierte er<br />
kurzerhand zum Verleger und entwarf selbst das New Berlin Magazine.<br />
Hotels, Pensionen und Hostels fanden die Idee gut, doch das Geschäft<br />
<strong>mit</strong> den Anzeigen lief schleppend. So entstand Sandemans zweite<br />
Geschäftsidee: Er schaltete selbst Anzeigen und bot darin eigene<br />
Stadtführungen an – kostenlose.<br />
Heute, drei Jahre später, arbeiten rund 40 Stadtführer allein in Berlin<br />
für Sandeman. Die Konkurrenz reibt sich die Augen. Den meisten sind<br />
kostenlose Touren suspekt, weil sie um den Ruf der Stadtführungen<br />
bangen. Die anderen fragen sich, wie das Unternehmen <strong>mit</strong> seinen<br />
Gratisangeboten <strong>Geld</strong> verdient. Die kostenlosen Stadtmagazine und<br />
Touren sind Lockangebote, Sandeman hat <strong>mit</strong> ihnen quasi einen neuen<br />
Vertriebsweg für die kostenpflichtigen Touren geschaffen. „Gute<br />
Kooperationspartner sind enorm wichtig“, sagt er, seine Magazine<br />
finden ihre Leser – Touristen zwischen 18 und 30 – bei Starbucks,<br />
Dunkin Donuts oder Air Berlin.<br />
Sandeman beschäftigt viele junge Leute aus dem Ausland auf Zeit.<br />
Einen großen Teil ihres Einkommens erhalten die Stadtführer über die<br />
Trinkgelder der kostenlosen Touren. Weil die allermeisten von ihnen<br />
als Kleinunternehmer arbeiten und weniger als 17 500 Euro pro Jahr<br />
umsetzen, müssen sie keine Umsatzsteuer zahlen. Und weil sie oft für<br />
weniger als ein halbes Jahr nach Europa kommen, entsteht meist auch<br />
keine Einkommensteuerpflicht. Sandeman will nun zügig europaweit<br />
expandieren – ein ungewöhnlicher Plan in der lokalen Branche der<br />
Reiseführer. am<br />
Lesen Sie weiter auf Seite 5: Warum ein Ehepaar die Kinderbeteruung<br />
zu einem erfolgreichen Geschäftsmodell macht.<br />
<strong>Ideen</strong> für neue Unternehmen kommen oft dann, wenn man den Mangel<br />
an geeigneten Produkten selbst zu spüren bekommt. So erging es<br />
Jelena und Peter Wahler, als sie nach ihrer Rückkehr aus den USA in<br />
Stuttgart eine Betreuung für ihr zweites Kind suchten. Während ihres<br />
MBA-Studiums in den Staaten hatten sie ihr erstes Kind tagsüber in<br />
einer unternehmerisch geführten Kinderkrippe betreuen lassen. „Wir<br />
waren vom dortigen Konzept begeistert“, erzählt Peter Wahler. Die US-<br />
Kinderkrippe setzte auf gezielte und frühe Förderung der Kinder. Nach<br />
ähnlichen Angeboten suchten die Wahlers in Stuttgart – vergeblich.<br />
Deshalb haben sie nach dem amerikanischen Vorbild im Jahr 2005 das<br />
Unternehmen Giant Leap gegründet und dafür ihre Jobs als Controller<br />
und Beraterin aufgegeben. Giant Leap betreibt Kinderkrippen der<br />
besonderen Art – das zeigt sich schon am Namen: Unter der Marke<br />
„<strong>Little</strong> <strong>Giants</strong>“ eröffnete die Firma im September in Stuttgart das erste<br />
„Early Learning Center“. 30 Plätze für Kinder im Alter von acht Wochen<br />
bis drei Jahren gibt es dort.<br />
Da jedes Kind eine feste Bezugsperson haben soll, kommt auf drei<br />
Plätze eine Betreuerin. In jedem Center gibt es deutschsprachige<br />
Mitarbeiter und englische Muttersprachler. Dadurch sollen die Kinder –
wenn von den Eltern gewünscht – zweisprachig aufwachsen. „Wir<br />
wollen das Leben von Kindern durch altersgerechte Lernerfahrungen<br />
so beeinflussen, dass sie ihre Fähigkeiten voll ausschöpfen können“,<br />
erläutert Peter Wahler das Konzept.<br />
Das hat seinen Preis, auch weil Giant Leap bislang auf staatliche<br />
Förderung verzichtet. Eine Betreuung von Babys an fünf Tagen pro<br />
Woche kostet 1 090 Euro pro Monat. Schon allein wegen des Preises<br />
richtet sich die Firma eher an gut verdienende Eltern und sucht sich<br />
Standorte <strong>mit</strong> hohen Durchschnittseinkommen aus.<br />
Giant Leap ist ein Beispiel dafür, dass Unternehmer die einst rein<br />
staatliche Domäne der Kinderbetreuung zu einem Markt machen – und<br />
das bundesweit: In Stuttgart will die junge Firma bald zusätzlich eine<br />
Kindertagesstätte für Drei- bis Sechsjährige eröffnen und plant<br />
langfristig <strong>mit</strong> einem Schülerhort.<br />
In München und Frankfurt starten derzeit zwei weitere „Early Learning<br />
Center“. Das Angebote kommt offenbar an, denn nach Angaben<br />
Wahlers gibt es für alle Center bereits Wartelisten. Der 36-Jährige und<br />
seine ein Jahr jüngere Frau wollen deswegen in den nächsten Jahren<br />
das Geschäft deutschlandweit ausbauen und das Konzept von „<strong>Little</strong><br />
<strong>Giants</strong>“ <strong>mit</strong> Hilfe von Franchisepartnern vermarkten. bef<br />
Lesen Sie weiter auf Seite 6: Wie ein pensionierter Tüftler <strong>mit</strong><br />
gepanzerten Minenräumbaggern Millionen umsetzt.<br />
Erfahrener Tüftlergeist trifft auf unternehmerisch ambitionierte junge<br />
Männer – keine schlechte Kombination für die Gründung einer Firma.<br />
So war es, als Ingenieur Heinz Rath nach seiner Pensionierung Anfang<br />
2003 an der Managementschule WHU in Koblenz seine Idee vorstellte:<br />
einen Spezialbagger zur Minenräumung. Student Christoph Frehsee,<br />
damals 24 Jahre alt, lauschte dem Vortrag. Rath hatte das ehemalige<br />
Kriegsgebiet in Bosnien besucht und bemerkt, dass es an<br />
kostengünstigem und wirkungsvollem Gerät fehlt, <strong>mit</strong> dem die für die<br />
Bevölkerung tödliche Gefahr durch Landminen beseitigt werden kann.<br />
Frehsee war von der Idee begeistert und suchte <strong>mit</strong> Rath nach<br />
Mitstreitern.<br />
Die fand er im Kreis der WHU-Ehemaligen: Denn auch Tobias Schmidt,<br />
damals bei der Wagniskapitalgesellschaft Atlas Venture beschäftigt,<br />
und der damalige Bertelsmann-Jungmanager Philipp von Michaelis<br />
träumten von der Selbstständigkeit. Der Businessplan überzeugte<br />
mehrere Banken sowie Schmidts Arbeitgeber Atlas, von ihnen kam das<br />
Kapital für den Start des Unternehmens Mine Wolf Systems im<br />
Frühjahr 2004.<br />
Mine Wolf arbeitet vorwiegend <strong>mit</strong> internationalen, nichtstaatlichen<br />
Organisationen zusammen, die in ehemaligen Kriegsgebieten verminte<br />
Flächen säubern. Sie kaufen die gepanzerten Spezialbagger von Mine<br />
Wolf, <strong>mit</strong> denen die Gebiete durchpflügt und die Minen gesprengt<br />
werden. Zwischen 15 000 und 20 000 Quadratmeter schafft das Gerät<br />
im Schnitt pro Tag, Einsatzgebiete sind beispielsweise der Balkan,<br />
Sudan, Jordanien und Kambodscha.<br />
Zwischen drei und vier Mill. Euro Jahresumsatz macht das<br />
Unternehmen <strong>mit</strong> derzeit 30 Mitarbeitern. Die Gründer Schmidt, 29,<br />
von Michaelis, 31, und Frehsee, 26, führen es zusammen <strong>mit</strong> Paul<br />
Collison vom schweizerischen Pfäffikon und von Deutschland aus. Mine
Wolf liefert nicht nur die Technologie, sondern auch verbundene<br />
Dienstleistungen und begleitet die Projekte in den Gebieten. Die<br />
Unternehmer sehen sich jetzt am Ende der Start-up-Phase und wollen<br />
zunächst im Kerngeschäft wachsen. Denn das Einsatzpotenzial ist<br />
groß: Nach Uno-Angaben liegen in über 80 Ländern rund 110 Mill.<br />
Landminen – durch sie werden jedes Jahr 20 000 Menschen<br />
verstümmelt oder getötet.<br />
Fünf bis zehn Maschinen pro Jahr wollen die Jungunternehmer<br />
zusammen <strong>mit</strong> dem Produktionspartner AHWI jährlich ausliefern,<br />
erläutert Mine-Wolf-Gesellschafter von Michaelis. Mit Blick in die<br />
Zukunft können sie sich weitere technologische Lösungen und<br />
Dienstleistungen vorstellen – als eine Art Zulieferer für humanitäre<br />
Organisationen in Ex-Kriegsregionen. bef<br />
Lesen Sie weiter auf Seite 7:Wie aus einer schlecht ins Chinesische<br />
übersetzten Visitenkarte eine clevere Geschäftsidee wurde.<br />
Als Florian Mair vor zwei Jahren wegen eines wichtigen Termins nach<br />
China reisen musste, ließ er sich vor dem Abflug extra einen<br />
persönlichen chinesischen Namen entwerfen und auf die Visitenkarten<br />
drucken. Umso erstaunter war der Münchener Unternehmer, als ihm<br />
sein chinesischer Partner nach der Ankunft in der Volksrepublik dezent<br />
empfahl, die neuen chinesischen Karten doch lieber im Portemonnaie<br />
stecken zu lassen und doch besser auf die englische Version<br />
zurückzugreifen.<br />
Zwei Tage später, bei einem Bier, hatte Mair den Mumm, den Chinesen<br />
nach dem Grund dafür zu fragen. Sein Gegenüber klärte ihn auf, dass<br />
der Name sinngemäß „schwules Pferd“ bedeuten würde. Für den<br />
ehemaligen Unternehmensberater hatte die Blamage letztlich <strong>aber</strong> ihre<br />
<strong>guten</strong> Seiten: Es entstand eine neue Firma daraus. Seit Mitte<br />
Dezember bietet der 38-Jährige auf der Homepage<br />
„mychinaname.com“ Beratung bei der Suche nach chinesische Namen<br />
an – und zwar solche, die in China bei den Geschäftspartnern keine<br />
Lachanfälle auslösen.<br />
Das Geschäftsmodell ist schnell beschrieben: Im Internet geben die<br />
Kunden ihren Namen ein und machen weitere Angaben zu ihrer<br />
Person. Da geht es dann etwa um das Geburtsdatum, die Größe, den<br />
Beruf und Charaktereigenschaften. Alle Informationen werden dann<br />
nach China geschickt, wo sich Fachleute daran machen, einen<br />
passenden Namen auszusuchen. „Es ist fatal, wenn Namen Silbe für<br />
Silbe übertragen werden“, sagt Mair. Deshalb suchen die Spezialisten<br />
vor Ort Namen aus, die ähnlich klingen wie das Original und<br />
gleichzeitig positive Assoziationen wecken unter Chinesen.<br />
Anschließend bekommt der Auftraggeber seinen neuen chinesischen<br />
Namen samt Urkunde und Erklärung per E-Mail zurück.<br />
„Ab 30 Namen pro Tag sind wir profitabel“, sagt Mair, der das<br />
Unternehmen China Name zusammen <strong>mit</strong> zwei Partnern gegründet<br />
hat. Für die fachliche Beratung sorgt dabei Roland Winkler, ein<br />
Sinologe <strong>mit</strong> reichlich Erfahrung in China. Im Dezember ist das<br />
Geschäft angelaufen. Zielgruppe sind Manager, <strong>aber</strong> auch China-<br />
Reisende. Darüber hinaus hoffen Mair und seine Partner, dass viele<br />
Namen einfach verschenkt werden. In der günstigsten Variante kostet<br />
das 25 Euro, Mair selbst nennt sich in China inzwischen „Ma Fu Liang“.<br />
Das soll so viel heißen wie „durchsetzungsfähiger, guter Berater“. In<br />
jedem Fall hat er da<strong>mit</strong> in der Volksrepublik bessere Chancen als
früher, als er noch „schwules Pferd“ hieß. jojo<br />
Informationen zur Zeitverzögerung und Nutzungshinweise:<br />
Die in Handelsblatt.com veröffentlichten Artikel, Daten und Prognosen sind <strong>mit</strong> größter<br />
Sorgfalt recherchiert. Nachrichten und Artikel beruhen teilweise auf Meldungen der<br />
Nachrichtenagenturen AP, dpa, sid, Reuters und Dow Jones. Dennoch können weder die<br />
Verlagsgruppe Handelsblatt, noch deren Lieferanten für die Richtigkeit eine Gewähr<br />
übernehmen. Das Handelsblatt weist ausdrücklich darauf hin, dass die veröffentlichten<br />
Artikel, Daten und Prognosen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren<br />
oder Rechten darstellen. Sie ersetzen auch nicht eine fachliche Beratung. Die<br />
Verlagsgruppe Handelsblatt versichert zudem, dass persönliche Kundendaten <strong>mit</strong> größter<br />
Sorgfalt behandelt und nicht ohne Zustimmung der Betroffenen an Dritte weitergegeben<br />
werden. Alle Rechte vorbehalten.<br />
Währungsdaten sowie die Kurse von Lang & Schwarz werden soweit technisch möglich<br />
ohne Zeitverzögerung angeboten. Andere Börsenkurse werden zeitverzögert um<br />
mindestens folgende Zeitspannen angezeigt: Deutsche Börse AG 15 Min., Börse Stuttgart<br />
AG 15 Min., AMEX 20 Min., NASDAQ 15 Min., NYSE 20 Min.<br />
Die Reproduktion oder Modifikation ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung des<br />
Verlages ist untersagt.<br />
All rights reserved. Reproduction or modification in whole or in part wirthout express<br />
written permission is prohibited.