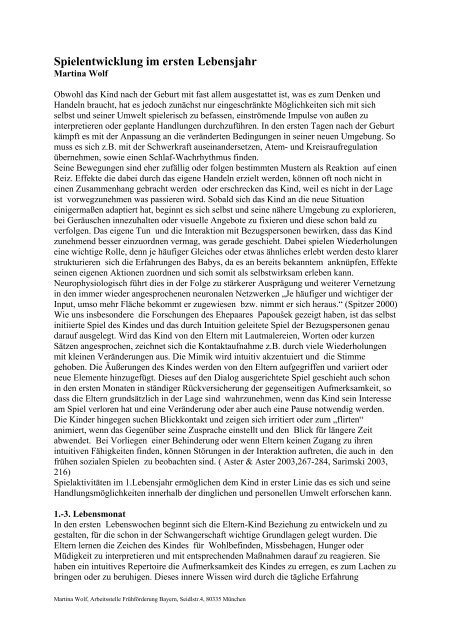Spielentwicklung im ersten Lebensjahr - Harl.e.kin
Spielentwicklung im ersten Lebensjahr - Harl.e.kin
Spielentwicklung im ersten Lebensjahr - Harl.e.kin
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Spielentwicklung</strong> <strong>im</strong> <strong>ersten</strong> <strong>Lebensjahr</strong><br />
Martina Wolf<br />
Obwohl das Kind nach der Geburt mit fast allem ausgestattet ist, was es zum Denken und<br />
Handeln braucht, hat es jedoch zunächst nur eingeschränkte Möglichkeiten sich mit sich<br />
selbst und seiner Umwelt spielerisch zu befassen, einströmende Impulse von außen zu<br />
interpretieren oder geplante Handlungen durchzuführen. In den <strong>ersten</strong> Tagen nach der Geburt<br />
kämpft es mit der Anpassung an die veränderten Bedingungen in seiner neuen Umgebung. So<br />
muss es sich z.B. mit der Schwerkraft auseinandersetzen, Atem- und Kreisraufregulation<br />
übernehmen, sowie einen Schlaf-Wachrhythmus finden.<br />
Seine Bewegungen sind eher zufällig oder folgen best<strong>im</strong>mten Mustern als Reaktion auf einen<br />
Reiz. Effekte die dabei durch das eigene Handeln erzielt werden, können oft noch nicht in<br />
einen Zusammenhang gebracht werden oder erschrecken das Kind, weil es nicht in der Lage<br />
ist vorwegzunehmen was passieren wird. Sobald sich das Kind an die neue Situation<br />
einigermaßen adaptiert hat, beginnt es sich selbst und seine nähere Umgebung zu explorieren,<br />
bei Geräuschen innezuhalten oder visuelle Angebote zu fixieren und diese schon bald zu<br />
verfolgen. Das eigene Tun und die Interaktion mit Bezugspersonen bewirken, dass das Kind<br />
zunehmend besser einzuordnen vermag, was gerade geschieht. Dabei spielen Wiederholungen<br />
eine wichtige Rolle, denn je häufiger Gleiches oder etwas ähnliches erlebt werden desto klarer<br />
strukturieren sich die Erfahrungen des Babys, da es an bereits bekanntem anknüpfen, Effekte<br />
seinen eigenen Aktionen zuordnen und sich somit als selbstwirksam erleben kann.<br />
Neurophysiologisch führt dies in der Folge zu stärkerer Ausprägung und weiterer Vernetzung<br />
in den <strong>im</strong>mer wieder angesprochenen neuronalen Netzwerken „Je häufiger und wichtiger der<br />
Input, umso mehr Fläche bekommt er zugewiesen bzw. n<strong>im</strong>mt er sich heraus.“ (Spitzer 2000)<br />
Wie uns insbesondere die Forschungen des Ehepaares Papouŝek gezeigt haben, ist das selbst<br />
initiierte Spiel des Kindes und das durch Intuition geleitete Spiel der Bezugspersonen genau<br />
darauf ausgelegt. Wird das Kind von den Eltern mit Lautmalereien, Worten oder kurzen<br />
Sätzen angesprochen, zeichnet sich die Kontaktaufnahme z.B. durch viele Wiederholungen<br />
mit kleinen Veränderungen aus. Die M<strong>im</strong>ik wird intuitiv akzentuiert und die St<strong>im</strong>me<br />
gehoben. Die Äußerungen des Kindes werden von den Eltern aufgegriffen und variiert oder<br />
neue Elemente hinzugefügt. Dieses auf den Dialog ausgerichtete Spiel geschieht auch schon<br />
in den <strong>ersten</strong> Monaten in ständiger Rückversicherung der gegenseitigen Aufmerksamkeit, so<br />
dass die Eltern grundsätzlich in der Lage sind wahrzunehmen, wenn das Kind sein Interesse<br />
am Spiel verloren hat und eine Veränderung oder aber auch eine Pause notwendig werden.<br />
Die Kinder hingegen suchen Blickkontakt und zeigen sich irritiert oder zum „flirten“<br />
an<strong>im</strong>iert, wenn das Gegenüber seine Zusprache einstellt und den Blick für längere Zeit<br />
abwendet. Bei Vorliegen einer Behinderung oder wenn Eltern keinen Zugang zu ihren<br />
intuitiven Fähigkeiten finden, können Störungen in der Interaktion auftreten, die auch in den<br />
frühen sozialen Spielen zu beobachten sind. ( Aster & Aster 2003,267-284, Sar<strong>im</strong>ski 2003,<br />
216)<br />
Spielaktivitäten <strong>im</strong> 1.<strong>Lebensjahr</strong> ermöglichen dem Kind in erster Linie das es sich und seine<br />
Handlungsmöglichkeiten innerhalb der dinglichen und personellen Umwelt erforschen kann.<br />
1.-3. Lebensmonat<br />
In den <strong>ersten</strong> Lebenswochen beginnt sich die Eltern-Kind Beziehung zu entwickeln und zu<br />
gestalten, für die schon in der Schwangerschaft wichtige Grundlagen gelegt wurden. Die<br />
Eltern lernen die Zeichen des Kindes für Wohlbefinden, Missbehagen, Hunger oder<br />
Müdigkeit zu interpretieren und mit entsprechenden Maßnahmen darauf zu reagieren. Sie<br />
haben ein intuitives Repertoire die Aufmerksamkeit des Kindes zu erregen, es zum Lachen zu<br />
bringen oder zu beruhigen. Dieses innere Wissen wird durch die tägliche Erfahrung<br />
Martina Wolf, Arbeitsstelle Frühförderung Bayern, Seidlstr.4, 80335 München
miteinander ständig erweitert, so dass die gegenseitige Kompetenz sich zu verstehen und sich<br />
verständlich zu machen ständig zun<strong>im</strong>mt.<br />
Sich gegenseitig zum Lachen bringen zu können und das Gefühl des zunehmenden<br />
Verstehens trägt die Situation und führt dazu, dass sich eine Bindung entwickeln kann.<br />
Das Kind lernt wiederkehrende Reize einzuordnen. Sie tun dies beispielsweise in dem sie das<br />
Kind mit Lautmalereien oder in einer sehr vereinfachten Sprache ansprechen. Sie benutzen<br />
<strong>im</strong>mer wiederkehrende Kitzelspiele oder bewegen das Kind rhythmisch oft mit einer kleinen<br />
Melodie die sie dazu singen. Dabei entstehen, z.B. in der Situation auf dem Wickeltisch, in<br />
der die Partner einander zugewendet sind, kleine Dialoge. Diese Form der Interaktion wird in<br />
erster Linie um ihrer selbst willen geführt und unterscheidet sich von den Handlungen der<br />
einfachen Versorgung des Kindes, so dass man durchaus von einer frühen Form des Spiels<br />
oder zumindest des spielerischen Umgangs miteinander sprechen kann. Das feine Wechselspiel,<br />
das zunächst noch stärker durch den Erwachsenen best<strong>im</strong>mt wird, ist in der<br />
Entwicklung von entscheidender Bedeutung, weil sich eine gegenseitige Bindung entwickelt,<br />
die wiederum eine grundlegende Ausgangsbasis für weiteres Lernen darstellt. Nur ein Kind,<br />
dass sich prinzipiell angenommen und geborgen fühlt und das Verhalten seiner Umwelt mehr<br />
oder weniger einschätzen kann, entwickelt ein angemessenes Erkundungsverhalten, das sich<br />
in diesem Alter beispielsweise durch das Betrachten der Hände, intensives Körperspiel mit<br />
Hand-Hand-, Hand-Bauch-, Fuß-Fuß-, oder Hand-Mund-Kontakt zeigt. Das Explorieren<br />
geschieht in diesem Alter jedoch noch kaum über gezieltes Handeln. Vermutlich lernt der<br />
Säugling seine Hände und deren Funktionsmöglichkeiten besonders über das Betrachten<br />
kennen. An jungen Sch<strong>im</strong>pansen konnte gezeigt werden, dass die Greifentwicklung stark<br />
verzögert war, wenn sie am Betrachten ihrer Hände gehindert worden waren (Held& Bauer<br />
„Visually guided reachingin infant monkeys after restricted rearing“ Sience155/1967). Be<strong>im</strong><br />
symmetrischen und asymmetrischen Einstemmen der Füße oder auch der Unterarme in die<br />
Unterlage wird spielerisch der Umgang mit Gewichtsverlagerungen geübt und die<br />
Beschaffenheit des Untergrundes sowie der stabilen Seite exploriert. Das Kind reagiert auf<br />
Berührungsspiele, getragen oder geschaukelt werden durch aufmerksam werden oder<br />
Beruhigung. Ablehnung oder Überforderung wird z.B. durch Weinen oder vermehrte Unruhe<br />
gezeigt. Visuelle Angebote werden zuerst nur kurz fixiert dann auch verfolgt. Bei<br />
Geräuschen hält das Kind inne und antwortet am Ende des Quartals mit <strong>ersten</strong> Kehllauten und<br />
wendet den Kopf zur Geräuschquelle.<br />
4.-6. Lebensmonat<br />
Im 4. Lebensmonat hat das Kind bereits einfache Konzepte über seine Umwelt entworfen.<br />
Wie das Ehepaar Papouŝek schon in den siebziger Jahren zeigen konnte, reagieren vier<br />
Monate alte Kinder bereits darauf, wenn die Mütter nicht in gewohnter Weise mit ihnen<br />
umgehen. (Papouŝek & Papouŝek 1977, 21) Außerdem unterscheidet das Baby in seinem<br />
Verhalten, ob es von einer fremden oder einer vertrauten Personen angesprochen wird. Ist es<br />
in einer sicheren Ausgangsposition „flirtet“ es auch mit ihm unbekannten Menschen und<br />
an<strong>im</strong>iert diese zu vorsprachlichen Dialogen. Die Kinder haben zunehmend Spaß daran und<br />
freuen sich besonders, wenn sie erleben können, dass sie es sind, die das elterliche Verhalten<br />
durch ihre Lautäußerung, ihren Blick, die M<strong>im</strong>ik oder Gestik auslösen können.<br />
Im Umgang mit Spielzeug werden bewegliche Gegenstände in der Umgebung zunehmend<br />
interessanter. So setzt das Kind z.B. Klangstäbe in Bewegung um ihnen ein Geräusch zu<br />
entlocken. Im 5. Monat beginnen die meisten Babys zu greifen. Sie tun dies in Rückenlage<br />
zunächst mit beiden Armen, die nach vorne gebracht werden, Annäherung von ulnarer Seite<br />
und Beteiligung aller Finger. Die Eltern unterstützen das Kind indem sie das begehrte<br />
Spielzeug festhalten, wenn das Kind sich dem Gegenstand mit tapsigen Bewegungen nähert.<br />
Der Gegenstand wird dann bei den meisten Kindern zum Mund gebracht und dort ausführlich<br />
exploriert. Im Zuge der Nahrungsumstellung exper<strong>im</strong>entiert das Kind auch mit breiiger Kost<br />
Martina Wolf, Arbeitsstelle Frühförderung Bayern, Seidlstr.4, 80335 München
vom Löffel und festeren Lebensmitteln wie Brot. Das Betrachten des Gegenstandes spielt zu<br />
diesem Zeitpunkt eine untergeordnete Rolle. (Largo 2000 , 267)<br />
In Rückenlage erreicht das Kind nun auch seine Füße mit denen es gerne spielt und die<br />
manchmal sogar zum Mund gebracht werden. In der Bauchlage kann das Kind die Position<br />
meist noch nicht gut genug halten um mit Spielzeug zu hantieren.<br />
7.- 9. Lebensmonat<br />
Im 3. Quartal des <strong>ersten</strong> <strong>Lebensjahr</strong>es zeigen die Kinder deutliche Autonomiebestrebungen.<br />
Sie wollen be<strong>im</strong> Anziehen helfen oder alleine essen und haben nur wenig Verständnis für die<br />
Erwachsenen, die nun beginnen Regeln wie „Mit Essen spielt man nicht“ oder „ Komm lass<br />
dich schnell anziehen, dann gehen wir zum Spielen.“ aufzustellen. Jeder Moment ist der<br />
Richtige um die physikalischen Gesetze des Alltags und die Reaktionen der Umwelt auf das<br />
eigene Tun zu erproben. Werden die Brotstückchen zum x ten Mal zu Boden geworfen,<br />
nachdem der erste Hunger gestillt ist, zweifeln selbst die geduldigsten Eltern an der<br />
Sinnhaftigkeit dieser Erfahrungen und fühlen sich unter Umständen provoziert.<br />
Der Wunsch des Kindes selbständig zu handeln und Kausalitäten zu erforschen führt nicht<br />
selten zu Konflikten und Missverständnissen bei deren Bewältigung Erziehungsvorstellungen<br />
und gesellschaftliche Aspekte stärker wie bisher zum tragen kommen.<br />
Innerhalb der dabei abzusteckenden Grenzen des <strong>kin</strong>dlichen Handlungsspielraums kann sich<br />
das Kind jedoch zunehmend als selbstwirksam erleben, wenn es sich beispielsweise in<br />
vielfältiger Weise mit der Kausalität beschäftigt: Das schütteln der Rassel entlockt ihr ein<br />
Geräusch, das entfernte Spielzeug kann an der Schnur herangezogen werden, usw..<br />
Großen Spaß haben die Kinder ab ca. 9 Monaten an Spielen, die Merkfähigkeit<br />
voraussetzen. „Kuck-Kuck-Da“ ist ein Beispiel dafür. Eine vertraute Person verschwindet aus<br />
dem Blickfeld. Das Kind sucht danach – wissend, das auch Dinge, die nicht mehr zu sehen<br />
sind noch vorhanden sein müssen.<br />
Die Bewegungsmöglichkeiten und Positionen als Grundlage für das Spiel sind vielfältig. Der<br />
Raum kann robbend, kreiselnd oder rollend erkundet werden. Als stabile Ausgangspositionen<br />
eigenen sich nun Bauchlage, Seitenlage und Rückenlage. Die meisten Kinder können kurz<br />
frei sitzen.<br />
10. –12. Lebensmonat<br />
Das was mit beginnendem Drang nach Selbständigkeit <strong>im</strong> letzten Quartal begonnen hat setzt<br />
sich nun fort. Die meisten Kinder essen zumindest teilweise selber. Sie versuchen be<strong>im</strong> an-<br />
und auszuziehen zu helfen und können mit dem Löffel hantieren sowie aus der Tasse trinken.<br />
Da das Interesse der Kinder alles was ihnen unterkommt auch spielerisch zu nutzen<br />
keineswegs nachgelassen hat gibt es <strong>im</strong>mer wieder gefährliche, lustige aber auch sehr<br />
anstrengende Momente für die Eltern, die das Kind kaum aus den Augen lassen können. Viele<br />
bedienen sich eines „Laufstalls“, der dem Kind zumindest zeitweise eine reale statt nur einer<br />
verbalen Grenze setzt innerhalb derer sich das Kind durchaus sicher fühlt und genügend Ruhe<br />
findet um zu spielen.<br />
Ihr Forscherdrang äußert sich einerseits in der Liebe zum Detail und andererseits in einer<br />
unerschöpflichen Lust zur Bewegung mit der sie den Raum und alle seine Ecken erkunden.<br />
Das Sprachverständnis ist soweit vorangeschritten, dass das Kind kleine Aufträge versteht<br />
und gerne Geben- Nehmen- Spiele spielt. Aufforderungen denen es nicht nachkommen<br />
möchte lehnt es mit Protest ab.<br />
Es zeigt mit dem Finder und lenkt die Aufmerksamkeit der Erwachsenen ist jedoch ebenso<br />
interessiert wenn die Eltern ihm bei etwas zeigen.<br />
Martina Wolf, Arbeitsstelle Frühförderung Bayern, Seidlstr.4, 80335 München
Übersicht <strong>Spielentwicklung</strong> 1.<strong>Lebensjahr</strong> (Wolf 2005)<br />
Spielräume Spiel- Material Spielthemenpositionen<br />
1.- 3.<br />
Lebensmonat<br />
4.- 6.<br />
Lebensmonat<br />
7.-9.<br />
Lebensmonat- <br />
10.-12.<br />
Lebensmonat<br />
Im Arm der<br />
Bezugspersonen <strong>im</strong><br />
Bett, in der Wiege,<br />
auf dem<br />
Wickeltisch, in der<br />
Badewanne, <strong>im</strong><br />
Tragetuch, <strong>im</strong><br />
Kinderwagen, auf<br />
der Wippe, auf dem<br />
Boden, <strong>im</strong> Autositz<br />
Im Arm der<br />
Bezugspersonen, <strong>im</strong><br />
Bett, auf dem<br />
Wickeltisch, <strong>im</strong><br />
Laufstall, in der<br />
Badewanne, <strong>im</strong><br />
Tragetuch, <strong>im</strong><br />
Kinderwagen, auf<br />
der Wippe, auf dem<br />
Boden, <strong>im</strong> Autositz<br />
Im Arm der<br />
Bezugspersonen, <strong>im</strong><br />
Bett, auf dem<br />
Wickeltisch, <strong>im</strong><br />
Laufstall, in der<br />
Badewanne, <strong>im</strong><br />
Tragetuch, <strong>im</strong><br />
Kinderwagen, auf<br />
der Wippe, auf dem<br />
Boden, <strong>im</strong> Autositz<br />
Auf dem Schoß der<br />
Bezugspersonen, auf<br />
dem Boden in<br />
verschiednen<br />
Z<strong>im</strong>mern und Ecken,<br />
auf dem Sofa, <strong>im</strong><br />
Laufstall, <strong>im</strong><br />
Autositz, am Tisch,<br />
<strong>im</strong> Kinderwagen, <strong>im</strong><br />
Sandkasten, <strong>im</strong><br />
Garten oder be<strong>im</strong><br />
Spazieren gehen, auf<br />
dem Spielplatz<br />
Spielerischer Dialog<br />
zwischen Kind und<br />
Bezugsperson und<br />
die intensive<br />
Auseinandersetzung<br />
mit sich selbst und<br />
der näheren Umwelt<br />
durch<br />
Lageveränderung<br />
Spielerischer Dialog<br />
zwischen Kind und<br />
Bezugsperson sowie<br />
die intensive<br />
Auseinandersetzung<br />
mit sich selbst und<br />
seiner näheren<br />
Umwelt über<br />
Bewegungsspiele<br />
mit dem Körper,<br />
Greifen und oralem<br />
Erkunden<br />
Erkundung des<br />
Raumes sowohl<br />
körperlich als auch<br />
<strong>im</strong> Umgang mit der<br />
dinglichen und<br />
personellen Umwelt<br />
Spiele mit der<br />
Merkfähigkeit, Erforschen<br />
von Kausalitäten,<br />
Hantieren<br />
auch mit kleineren<br />
Gegenständen und<br />
vermehrt visuelles<br />
Explorieren.<br />
Singspiele<br />
Erkundung des<br />
Raumes durch den<br />
Einsatz des ganzen<br />
Körpers und durch<br />
Spielaktivitäten wie<br />
Aus- und Einräumen<br />
(beginnend)<br />
Interesse an kleinen<br />
Dingen und Details,<br />
die es <strong>im</strong> Pinzettengriff<br />
greifen kann<br />
Spaß an Dialogen<br />
oder Singspielen mit<br />
Einsatz von Gesten<br />
u. oft <strong>ersten</strong> Worten<br />
Interesse an Bilderbüchern.<br />
Geben und<br />
Nehmen; Zeigen und<br />
zeigen lassen<br />
Das Kind braucht<br />
kaum eigens dafür<br />
vorgesehenes<br />
Spielmaterial. Es<br />
beschäftigt sich mit<br />
allem was sich in<br />
seiner unmittelbaren<br />
Umgebung befindet;<br />
dabei vor allem mit<br />
sich selbst und<br />
seinem<br />
menschlichen<br />
Gegenüber.<br />
Das Kind interessiert<br />
sich nach wie vor für<br />
alles was sich in<br />
seiner unmittelbaren<br />
Umgebung befindet.<br />
Ungefährliche<br />
Spielzeuge die gut<br />
gegriffen n und oral<br />
exploriert werden<br />
können, kommen<br />
jetzt vermehrt ins<br />
Spiel<br />
Das Kind interessiert<br />
sich für alles;<br />
besonders aber für<br />
Materialien, denen<br />
man Effekte<br />
entlocken kann, wie<br />
z.B. Papier, das<br />
raschelt wenn man<br />
es zusammendrückt<br />
oder Rasseln.<br />
Spielzeug zum<br />
Heranziehen<br />
Gefäße wie<br />
Plastikbecher um<br />
den Raum erkunden<br />
zu können<br />
Das Kind hat Spaß<br />
an alltäglichen<br />
Materialien wie<br />
Plastikschüsseln,<br />
Becher oder andere<br />
ungefährliche<br />
Küchengeräte die es<br />
z.B. aus einem<br />
Schrank oder aus<br />
einer Schublade<br />
räumen darf. Es liebt<br />
Wasser und Sand<br />
und interessiert sich<br />
für Spielsachen wie<br />
Ball, Puppe oder<br />
Stofftier,<br />
Holzkugeln,<br />
Sandspielzeug<br />
Martina Wolf, Arbeitsstelle Frühförderung Bayern, Seidlstr.4, 80335 München<br />
Rückenlage u. gehalten<br />
auf dem Arm der Bezugspersonen:<br />
Ausgangspositionen<br />
um Hände zu betrachten,<br />
zu berühren sowie<br />
zum Mund zu führen,<br />
um hängende Gegenstände<br />
in Bewegung zu<br />
bringen und um in<br />
Interaktion zu treten<br />
Bauchlage: Kind kann<br />
über Eigenaktivität<br />
seine Bewegungsmöglichkeiten<br />
kennen lernen;<br />
die Unterlage und<br />
die Seite explorieren,<br />
Hand –Mund-Kontakt<br />
Rückenlage und<br />
gehalten auf dem Arm<br />
der Eltern:<br />
Ausgangsposition um<br />
Gegenstände zu greifen<br />
und um zu interagieren.<br />
Bauchlage: zunehmend<br />
stabilere Basis für<br />
spielerische<br />
Aktivitäten.<br />
Bauchlage, Seitenlage,<br />
Rückenlage, gehaltener<br />
Sitz<br />
Das Kind kann in<br />
wechselnden Positionen<br />
spielen: verschiedenen<br />
Sitzpositionen (Ring-,<br />
Seit-, Langsitz), Hocke<br />
Vierfüßlerstand,<br />
Kniestand, Stand,<br />
Bauch- und Seitenlage.<br />
Die Rückenlage wird<br />
nur noch selten als<br />
Spielposition benutzt.<br />
Für den Ortswechsel<br />
stehen Rollen,<br />
Kriechen, Robben,<br />
Krabbeln, Gehen,<br />
Seitwärtsgehen,<br />
Rutschen oder<br />
Bärengang zur<br />
Verfügung<br />
Spielpartner<br />
Spielpartner sind in<br />
erster Linie die<br />
direkten Bezugs-<br />
personen ,die mit dem<br />
Kind spielerisch in<br />
Interaktionen treten<br />
und es vorwiegend<br />
intuitiv bei seinen<br />
Aktivitäten unter-<br />
stützen<br />
Spielpartner sind<br />
bekannte aber auch<br />
fremde Personen mit<br />
denen das Kind vom<br />
Schoß der Mutter aus<br />
spielerisch in Interaktionen<br />
tritt. Die<br />
Erwachsenen folgen<br />
meist ihrer Intuition<br />
und passen den Dialog<br />
an die Fähigkeiten des<br />
Kindes an. Das Kind<br />
wird in den Aktivitäten<br />
unterstützt und an den<br />
nächsten Entwicklungs-<br />
schritt herangeführt.<br />
Die direkten<br />
Bezugspersonen sind<br />
als Spielpartner <strong>im</strong>mer<br />
noch sehr wichtig für<br />
das Kind. Sie führen<br />
neue Spielthemen ein<br />
und unterstützen das<br />
Kind. Mit zunehmender<br />
Selbständigkeit des<br />
Kindes kann es<br />
vermehrt zu Konflikten<br />
und Missverständnissen<br />
bezüglich der Intention<br />
des Kindes kommen.<br />
DieBezugspersonen<br />
schaffen ein sicheres<br />
Umfeld in dem das<br />
Kind seinen<br />
Bewegungsdrang<br />
ausagieren kann.<br />
Sie stehen zur<br />
Verfügung um das<br />
Kind zu trösten oder<br />
Hilfestellung zu leisten.<br />
Sie zeigen ihm Grenzen<br />
auf und regen es zu<br />
neuen Spielformen an.
Literatur:<br />
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BzgA). Das Baby. Ein Leitfaden für Eltern.<br />
Köln: Stand April 2003<br />
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BzgA). Kinderspiele. Anregungen zur<br />
gesunden Entwicklung von Klein<strong>kin</strong>dern. Köln: Stand April 2003.<br />
Braus DF. Neurobiologie des Lernens. Psychiatrische Praxis. 2004; 31: 217.<br />
Flitner A, Hrsg. Das Kinderspiel. Neuausgabe 5. Auflage. München: Piper; 1973, 1988.<br />
Lamers W. Spielräume – Raum für Spiel. Düsseldorf: Verlag Selbstbest<strong>im</strong>mtes Leben; 1993.<br />
Lange U, Stadelmann T. Spiel - platz ist überall. Freiburg <strong>im</strong> Breisgau: Herder; 1996.<br />
Largo R. Babyjahre. Die früh<strong>kin</strong>dliche Entwicklung aus biologischer Sicht. Carlsen Verlag<br />
Hamburg1993 aktualisierte Taschenbuchausgabe Piper Verlag Gmbh München 2001.<br />
Luxburg von J. Förderung des Kindes <strong>im</strong> Spiel- ein Dilemma der Therapie.<br />
Beschäftigungstherapie und Rehabilitation. 1990; 3, 210 –216.<br />
Mayr T. Problem<strong>kin</strong>der <strong>im</strong> Kindergarten - ein neues Aufgabenfeld für die Frühförderung.<br />
Frühförderung interdisziplinär. 1997; 16.<br />
Oerter R. Psychologie des Spiels. München: Quintessenz Verlag; 1993. Durchgesehene<br />
Neuausgabe. Weilhe<strong>im</strong>, Basel: Belz Taschenbuch; 1999.<br />
Parham, L. Diane, Play in occupational therapy for children, St.Louis Mosby Year book, Inc.<br />
1997<br />
Papouŝek H, Papouŝek M. Das Spiel in der Frühentwicklung des Kindes. Beiträge zur<br />
Psychologie und Erziehung. Supp.Pädiat.prax.1977; 18: 17-32.<br />
Papouŝek M. Intuitive elterliche Kompetenzen. Frühe Kindheit. 2001:1.<br />
Papouŝek M. Gonthard A. von Hrsg. , Spiel und Kreativität in der frühen Kindheit. Stuttgart:<br />
Klett Cotta; 2003.<br />
Schmid-Krammer, M. Einsichten in das Spiel der Kinder fiduz11 München 2003<br />
Weinberger S. Kindern spielend helfen. Weilhe<strong>im</strong>, Basel: Belz Verlag; 2001.<br />
Spiel gut Arbeitsausschuss, Kinderspiel und Spielzeug e.V. 17. überarbeitete und erweiterte<br />
Ausgabe. Ulm: 1999.<br />
West J. Childcentered play therapy. 2. ed. London: Arnold; 1996.<br />
Wolf M. „Komm spiel mit mir!“ In: Hüter-Becker A, Dölken M, Hrsg. Physiotherapie in der<br />
Pädiatrie. Stuttgart: Georg Thieme Verlag; 2005.<br />
Wolf M. „Und du solltest die Verkäuferin sein…!“ in Becker H., Steding-Albrecht U.;<br />
Ergotherapie <strong>im</strong> Arbeitsfeld Pädiatrie (230-242) Georg Thieme Verlag, Stuttgart 2006<br />
Martina Wolf, Arbeitsstelle Frühförderung Bayern, Seidlstr.4, 80335 München