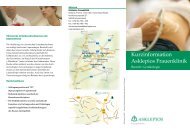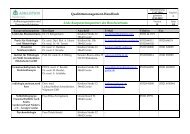Wie eine Volkskrankheit
Wie eine Volkskrankheit
Wie eine Volkskrankheit
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
F O R U M M E D I Z I N<br />
Beim Vorliegen <strong>eine</strong>r milden Form der akuten<br />
Divertikulitis ist <strong>eine</strong> kurzzeitige (2 – 3<br />
Tage) Nahrungskarenz indiziert. Erlaubt sind<br />
orale Flüssigkeitszufuhr und ballaststoff arme<br />
Ernährung, die als Trinknahrung angeboten<br />
werden sollte (Leifeld et al., 2008).<br />
Die in der Regel durchgeführte antibiotische<br />
Th erapie kann oral mit Ciprofl oxazin/Metronidazol<br />
oder Amoxicillin plus Betalactamase-<br />
Inhibitor erfolgen (Lode et al., 2006). Hjern<br />
fand allerdings Hinweise dafür, dass der milde<br />
akute Schub auch ohne Antibiotikatherapie<br />
behandelt werden kann (Hjern et al., 2007).<br />
In s<strong>eine</strong>m Kollektiv erlitten 193 antibiotikafrei<br />
therapierte Patienten nicht mehr Komplikationen<br />
als 118 antibiotisch behandelte. Bei diesem<br />
Vorgehen ist natürlich <strong>eine</strong> engmaschige<br />
klinische Kontrolle erforderlich. Beim schweren<br />
klinischen Erscheinungsbild <strong>eine</strong>s Divertikulitis-Schubes<br />
ohne Komplikation ist <strong>eine</strong><br />
stationäre Behandlung mit intravenöser Gabe<br />
von Antibiotika, Nahrungskarenz und parenteraler<br />
Ernährung angezeigt. Folgende Antibiotika<br />
werden eingesetzt: Aminopenicilline<br />
plus Betalactamase-Inhibitor, Cephalosprine<br />
der 2. und 3. Generation plus Metronidazol<br />
sowie Carbapeneme.<br />
Ob der Einsatz von Aminosalizylaten aufgrund<br />
des antiinfl ammtorischen Eff ekts auch<br />
bei der Sigmadivertikulitis sinnvoll ist, wurde<br />
in mehreren Arbeiten untersucht. Es ergeben<br />
sich Hinweise für <strong>eine</strong>n positiven Eff ekt auf<br />
den Verlauf der rezidivierenden Divertikulitis<br />
im Sinne <strong>eine</strong>r Beschwerdemilderung und Erhaltung<br />
der Remission (Di et al., 2005; Tursi<br />
2005; Tursi et al., 2007). Es handelt sich dabei<br />
allerdings um <strong>eine</strong> „off label“-Th erapie.<br />
Für die analgetische Th erapie sollten nicht-steroidale<br />
Antiphlogistika und Opiate vermieden<br />
werden, da mehrfach <strong>eine</strong> erhöhte Perforationsrate<br />
bei deren Anwendung gezeigt werden<br />
konnte (Leifeld et al., 2008). Die Schmerzbehandlung<br />
kann mit Paracetamol und Spasmolytika<br />
meist erfolgreich durchgeführt werden.<br />
Ziele operativer Th erapie der komplizierten<br />
Divertikulitis sind die vollständige Entfernung<br />
des entzündlichen Herdes sowie die<br />
Beseitigung möglicher Stenosen, Fisteln oder<br />
Blutungsquellen. Zur Vermeidung des Divertkulitisrezidives<br />
wird dem Ausmaß der Resektion<br />
nach aboral, also der Anastomosenhöhe<br />
entscheidende Bedeutung beigemessen. Im<br />
Bereich des rektosigmoidalen Übergangs befi<br />
ndet sich <strong>eine</strong> anatomisch und funktionell<br />
defi nierbare Hochdruckzone (Shafi k et al.,<br />
1999; Stoss, 1990). Dieser Bereich ist unterhalb<br />
des Promontoriums gelegen und erfüllt <strong>eine</strong><br />
Sphinkterfunktion (Stoss, 1990; Shafi k, 1996).<br />
Die Resektion dieses Bereichs und die Anlage<br />
der Anastomose im Bereich des oberen Rektums<br />
senkt nachweislich die Rezidivrate der<br />
Divertikulitis (Benn et al., 1986; Bergamaschi<br />
et al., 1998; Th aler et al., 2003). Es muss nicht<br />
die vollständige Entfernung aller Kolondivertikel<br />
angestrebt werden. Die Resektion bis in die<br />
entzündungsfreie Darmwand und<br />
die Erstellung der Anastomose im<br />
Bereich <strong>eine</strong>s divertikelfreien Kolonwandanteils<br />
sind ausreichend.<br />
Ein Divertikulitisrezidiv tritt nach<br />
Kolon-Resektion lediglich in 2 –<br />
7 % der Fälle bei Einhaltung der<br />
genannten Prämissen auf.<br />
Die Operation kann grundsätzlich<br />
einzeitig oder zweizeitig<br />
durchgeführt werden. Unter<br />
„zweizeitigem“ Vorgehen wird die<br />
Durchführung <strong>eine</strong>r Diskontinuitätsresektion<br />
mit Anlage <strong>eine</strong>s<br />
endständigen Kolostomas verstanden,<br />
welches in <strong>eine</strong>r zweiten Operation<br />
etwa 6 Monate nach dem<br />
Ersteingriff zumeist zurückverlagert<br />
werden kann. Beim einzeitigen<br />
Vorgehen erfolgen im Eingriff<br />
die Resektion des entzündlichen<br />
Darmes und die <strong>Wie</strong>derherstellung<br />
der Kontinuität durch <strong>eine</strong> Anastomose.<br />
Die Kolonresektion kann in off ener oder<br />
in minimal-invasiver (Laparoskopie) Technik<br />
erfolgen. Vorteile der laparoskopischen<br />
Operationstechnik sind das geringere Operationstrauma,<br />
geringerer Schmerzmittelverbrauch<br />
und schnellere Rekonvaleszenz.<br />
Das von Kehlet beschriebene und von<br />
Schwenk propagierte Konzept der „Fast<br />
Track“-Rehabilitation nach Kolonoperationen<br />
führt als interdisziplinäres und interprofessionelles<br />
perioperatives Behandlungsregime<br />
auch in Kombination mit dem<br />
laparoskopischen Verfahren zur Verbesserung<br />
der Behandlungsergebnisse (Schwenk<br />
et al., 2004; Kehlet, 2009).<br />
Therapie in verschiedenen<br />
Stadien<br />
Im Stadium IIa wird zunächst <strong>eine</strong> konservative<br />
Behandlung eingeleitet. Diese Th erapie<br />
kann in bis zu 80 % der Fälle erfolgreich<br />
sein (Kaiser et al., 2005; Ambrosetti et al.,<br />
1998). Problematisch ist die Vielfalt möglicher<br />
Befunde, da sich <strong>eine</strong> gedeckte Perforation<br />
nicht immer bei der Erstuntersuchung<br />
zeigt. Kl<strong>eine</strong>, bei der Erstuntersuchung noch<br />
nicht nachweisbare Abszesse können im<br />
Verlauf einschmelzen und so in ein Stadium<br />
IIb übergehen (Classen et al., 2001). Germer<br />
fand, dass sich der präoperative CT-Befund<br />
im Stadium IIa nur in 33 % der Fälle mit dem<br />
histologischen Befund deckt, in den übrigen<br />
Fällen lag ein Stadium IIb mit Abszedierung<br />
vor (Germer et al., 2007). Ist die Phlegmone<br />
ausgeprägt, wird häufi g Beschwerdefreiheit<br />
nicht erreicht. Eine elektive oder frühelektive<br />
Operation ist in diesen Fällen indiziert. Patienten<br />
mit gering ausgeprägter Phlegmone<br />
und zügiger Beschwerdefreiheit unter konservativer<br />
Behandlung bedürfen zunächst<br />
k<strong>eine</strong>r Operation.<br />
30 HAMBURGER ÄRZTEBLATT 01| 2010<br />
Abb. 3: In der CT deutliche, langstreckige Darmwandverdickung<br />
mit gedeckter Perforation und Abszess<br />
Im Stadium II b (Abb. 3) besteht <strong>eine</strong> eindeutige<br />
Operationsindikation, allerdings hängt<br />
der Operationszeitpunkt vom klinischen Bild<br />
ab. Ist <strong>eine</strong> Peritonitis lokalisiert und <strong>eine</strong> freie<br />
Perforation ausgeschlossen, so ist zunächst<br />
<strong>eine</strong> konservative Behandlung angezeigt. Kl<strong>eine</strong><br />
Abszesse (< 4 cm) werden erst konservativ<br />
behandelt, größere Abszesse sollten interventionell<br />
entlastet werden. Tritt innerhalb von<br />
zwei Tagen k<strong>eine</strong> Besserung des Beschwerdebildes<br />
ein, sollte operiert werden. Bessert<br />
sich das klinische Bild, wird ein frühelektiver<br />
Operationszeitpunkt innerhalb von 7 und 10<br />
Tagen angestrebt. Eine Studie von Ritz et al.<br />
zeigte bei Patienten im Stadium II a und II b,<br />
dass die Operation auch nach antibiotischer<br />
Vorbehandlung im entzündungsfreien Intervall<br />
4 – 6 Wochen nach stationärer Initialaufnahme<br />
laparoskopisch mit guten Ergebnissen<br />
durchgeführt werden kann (Ritz et al., 2008).<br />
Dieser Eingriff kann technisch sehr anspruchsvoll<br />
sein und sollte vom erfahrenen Operateur<br />
durchgeführt werden.<br />
Bei Vorliegen <strong>eine</strong>r diff usen, kotigen oder eitrigen<br />
Peritonitis (Stadium II c) besteht <strong>eine</strong> absolute<br />
Operationsindikation zur Fokussanierung.<br />
Häufi g wird in diesem Stadium <strong>eine</strong> Diskontinuitätsresektion<br />
durchgeführt, da <strong>eine</strong> Anastomoseninsuffi<br />
zienz nach primärer Anastomose<br />
im entzündeten Bauchraum befürchtet wird.<br />
Aber auch bei schwerer Vierquadrantenperitonitis<br />
oder Abszess im Bereich des Beckens<br />
kann <strong>eine</strong> primäre Kontinuitätswiederherstellung<br />
erreicht werden. Eigene Erfahrungen mit<br />
der Behandlung im Konzept der Etappenlavage<br />
zeigen, dass bei kontrollierter Anastomosenheilung<br />
die Stomaanlage vermieden werden<br />
kann. Das Konzept sieht die Anlage <strong>eine</strong>s<br />
temporären Bauchdeckenverschlusses vor, um<br />
täglich im Operationssaal Spülbehandlungen<br />
der Abdominalhöhle durchzuführen bis <strong>eine</strong><br />
Reinigung des Bauchraumes eingetreten ist.<br />
Während der Behandlung können täglich