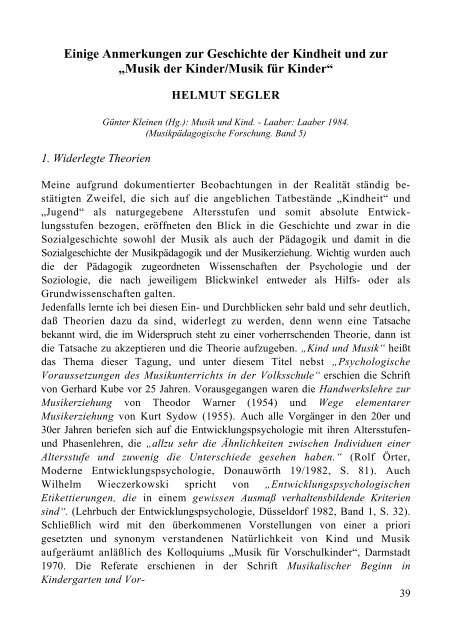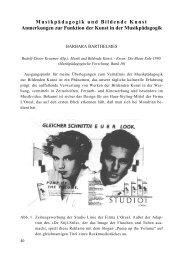Einige Anmerkungen zur Geschichte der Kindheit und zur - AMPF
Einige Anmerkungen zur Geschichte der Kindheit und zur - AMPF
Einige Anmerkungen zur Geschichte der Kindheit und zur - AMPF
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Einige</strong> <strong>Anmerkungen</strong> <strong>zur</strong> <strong>Geschichte</strong> <strong>der</strong> <strong>Kindheit</strong> <strong>und</strong> <strong>zur</strong><br />
„Musik <strong>der</strong> Kin<strong>der</strong>/Musik für Kin<strong>der</strong>“<br />
1. Wi<strong>der</strong>legte Theorien<br />
HELMUT SEGLER<br />
Günter Kleinen (Hg.): Musik <strong>und</strong> Kind. - Laaber: Laaber 1984.<br />
(Musikpädagogische Forschung. Band 5)<br />
Meine aufgr<strong>und</strong> dokumentierter Beobachtungen in <strong>der</strong> Realität ständig bestätigten<br />
Zweifel, die sich auf die angeblichen Tatbestände „<strong>Kindheit</strong>“ <strong>und</strong><br />
„Jugend“ als naturgegebene Altersstufen <strong>und</strong> somit absolute Entwicklungsstufen<br />
bezogen, eröffneten den Blick in die <strong>Geschichte</strong> <strong>und</strong> zwar in die<br />
Sozialgeschichte sowohl <strong>der</strong> Musik als auch <strong>der</strong> Pädagogik <strong>und</strong> damit in die<br />
Sozialgeschichte <strong>der</strong> Musikpädagogik <strong>und</strong> <strong>der</strong> Musikerziehung. Wichtig wurden auch<br />
die <strong>der</strong> Pädagogik zugeordneten Wissenschaften <strong>der</strong> Psychologie <strong>und</strong> <strong>der</strong><br />
Soziologie, die nach jeweiligem Blickwinkel entwe<strong>der</strong> als Hilfs- o<strong>der</strong> als<br />
Gr<strong>und</strong>wissenschaften galten.<br />
Jedenfalls lernte ich bei diesen Ein- <strong>und</strong> Durchblicken sehr bald <strong>und</strong> sehr deutlich,<br />
daß Theorien dazu da sind, wi<strong>der</strong>legt zu werden, denn wenn eine Tatsache<br />
bekannt wird, die im Wi<strong>der</strong>spruch steht zu einer vorherrschenden Theorie, dann ist<br />
die Tatsache zu akzeptieren <strong>und</strong> die Theorie aufzugeben. „Kind <strong>und</strong> Musik“ heißt<br />
das Thema dieser Tagung, <strong>und</strong> unter diesem Titel nebst „Psychologische<br />
Voraussetzungen des Musikunterrichts in <strong>der</strong> Volksschule“ erschien die Schrift<br />
von Gerhard Kube vor 25 Jahren. Vorausgegangen waren die Handwerkslehre <strong>zur</strong><br />
Musikerziehung von Theodor Warner (1954) <strong>und</strong> Wege elementarer<br />
Musikerziehung von Kurt Sydow (1955). Auch alle Vorgänger in den 20er <strong>und</strong><br />
30er Jahren beriefen sich auf die Entwicklungspsychologie mit ihren Altersstufen<strong>und</strong><br />
Phasenlehren, die „allzu sehr die Ähnlichkeiten zwischen Individuen einer<br />
Altersstufe <strong>und</strong> zuwenig die Unterschiede gesehen haben.“ (Rolf Örter,<br />
Mo<strong>der</strong>ne Entwicklungspsychologie, Donauwörth 19/1982, S. 81). Auch<br />
Wilhelm Wieczerkowski spricht von „Entwicklungspsychologischen<br />
Etikettierungen, die in einem gewissen Ausmaß verhaltensbildende Kriterien<br />
sind“. (Lehrbuch <strong>der</strong> Entwicklungspsychologie, Düsseldorf 1982, Band 1, S. 32).<br />
Schließlich wird mit den überkommenen Vorstellungen von einer a priori<br />
gesetzten <strong>und</strong> synonym verstandenen Natürlichkeit von Kind <strong>und</strong> Musik<br />
aufgeräumt anläßlich des Kolloquiums „Musik für Vorschulkin<strong>der</strong>“, Darmstadt<br />
1970. Die Referate erschienen in <strong>der</strong> Schrift Musikalischer Beginn in<br />
Kin<strong>der</strong>garten <strong>und</strong> Vor-<br />
39
schule, Band 1, Situation <strong>und</strong> Aspekte, hrsg. von Sigrid Abel-Struth, Kassel<br />
1970.<br />
Beson<strong>der</strong>s wichtig war die längst fällige Untersuchung <strong>und</strong> Aufarbeitung des<br />
Forschungsstandes <strong>zur</strong> Musikalischen Anlage des kleinen Kindes von Eberhard<br />
Kötter (S. 26 ff.). Die mit schon fast fetischistischen Zügen behaftete Urzelle<br />
<strong>der</strong> Melodik mit Kuckucksterz bis <strong>zur</strong> Pentatonik wurde zwar sehr deutlich<br />
entlarvt, aber noch heute — nach über einem Jahrzehnt — hat sich die Einsicht<br />
nicht unter Musikpädagogen herumgesprochen, daß das rationale System unserer<br />
europäischen Musik <strong>und</strong> die geistige Entwicklung heranwachsen<strong>der</strong> Menschen<br />
nicht parallel zueinan<strong>der</strong> verlaufen (Gegenbeispiel vgl. NMZ, Juni/Juli 1983,<br />
S. 19). Anläßlich des Darmstädter Kolloquiums hieß es auch: „Der traditionelle<br />
Entwicklungsbegriff, <strong>der</strong> Entwicklung als Entfaltung eines Organismus nach<br />
vorgegebenem ,Bauplan' versteht, hat sich als gefährliche Illusion erwiesen.“<br />
(Otto Ewert, S. 9). Und Helga de la Motte-Haber meinte damals bereits: „Ältere<br />
Untersuchungen gilt es von dem sogenannten psychogenetischen Gr<strong>und</strong>gesetz zu<br />
reinigen, das als Variante des biogenetischen Gr<strong>und</strong>gesetzes eine Wie<strong>der</strong>holung<br />
<strong>der</strong> Phylogenese in <strong>der</strong> Ontogenese meint“ (S. 46). Theorien sind zwar wi<strong>der</strong>legt<br />
— ich gehe hier nicht auf weitere Versimpelungen ein —, aber hat Aufklärung vor<br />
sich selber Angst?<br />
2. Zur <strong>Geschichte</strong> <strong>der</strong> <strong>Kindheit</strong><br />
Während die Irrtümer bezüglich <strong>der</strong> immer noch weit verbreiteten musikpsychologischen<br />
Gr<strong>und</strong>lagen des Zusammenhangs von „Kind <strong>und</strong> Musik“ aufgr<strong>und</strong><br />
un<strong>zur</strong>eichen<strong>der</strong> Experimentalsituationen entstanden <strong>und</strong> aufgedeckt<br />
sind, ist hingegen die Meinung, die „<strong>Kindheit</strong>“ sei nur ein Naturzustand <strong>und</strong><br />
nicht auch ein Produkt unserer Vorstellungen <strong>und</strong> gesellschaftlichen Umstände,<br />
viel schwieriger zu korrigieren. Es handelt sich nicht um eine experimentell<br />
bestätigte Theorie, son<strong>der</strong>n — wie so oft — um eine „naive Erkenntnis“.<br />
Die Etablierung <strong>der</strong> „<strong>Kindheit</strong>“ fällt aber historisch zusammen mit <strong>der</strong> Einführung<br />
<strong>der</strong> allgemeinen Schulpflicht im 17. Jahrhun<strong>der</strong>t. Der Streit <strong>der</strong> Theorien ist<br />
heute insofern abgeschlossen, als beide Aspekte eine Rolle spielen: die<br />
biologische Basis <strong>und</strong> genetische Disposition einerseits <strong>und</strong> die soziale Umwelt<br />
<strong>und</strong> Gesellschaftskonstruktion an<strong>der</strong>erseits. Die Aufklärung über den<br />
Tatbestand „<strong>Kindheit</strong>“ <strong>und</strong> seine gesellschaftlichen Bedingungen verdanken wir<br />
einer umfangreichen Literatur <strong>zur</strong> <strong>Geschichte</strong> <strong>der</strong> <strong>Kindheit</strong>, die in deutscher<br />
Sprache erst seit 1975 erschienen ist <strong>und</strong> sicherlich noch<br />
40
keine weite Verbreitung unter Musikpädagogen gef<strong>und</strong>en hat. Hier einige<br />
Beispiele, nach Erscheinungsjahr geordnet:<br />
� Aries, Ph.: <strong>Geschichte</strong> <strong>der</strong> <strong>Kindheit</strong>. Mit einer Einführung von Hartmut v.<br />
Hentig, München/Wien 1975. Originalausgabe: La vie familiale sous l'ancien<br />
régime, Paris 1960<br />
� Könneker, M.-L.: Kin<strong>der</strong>schaukel. Ein Lesebuch <strong>zur</strong> <strong>Geschichte</strong> <strong>der</strong> <strong>Kindheit</strong><br />
in Deutschland 1745-1930. 2 Bände, Darmstadt/Neuwied 1976<br />
� Elschenbroich, D.: Kin<strong>der</strong> werden nicht geboren. Studien <strong>zur</strong> Entstehung <strong>der</strong><br />
<strong>Kindheit</strong>, Frankfurt/Main 1977<br />
� De Mause, Ll. (Hrsg.): Hört ihr die Kin<strong>der</strong> weinen. Eine psychogenetische<br />
<strong>Geschichte</strong> <strong>der</strong> <strong>Kindheit</strong>, suhrkamp taschenbuch wissenschaft 339,<br />
Frankfurt/Main 1977. Originalausgabe: The History of Childhood, New York<br />
1974<br />
� Rutschky, K. (Hrsg.): Schwarze Pädagogik. Quellen <strong>zur</strong> Naturgeschichte <strong>der</strong><br />
bürgerlichen Erziehung, Ullstein-Buch 3318, Frankfurt/Main 1977<br />
� Weber-Kellermann, I.: Die <strong>Kindheit</strong>. Klei<strong>der</strong> <strong>und</strong> Wohnen, Arbeit <strong>und</strong> Spiel.<br />
Eine Kulturgeschichte, Frankfurt/Main 1979<br />
� Gstettner, P.: Die Eroberung des Kindes durch die Wissenschaft. Aus <strong>der</strong><br />
<strong>Geschichte</strong> <strong>der</strong> Disziplinierung, - rororo-Sachbuch 7425, Reinbek h. Hamburg<br />
1981<br />
� Hengst, H. u. a.: <strong>Kindheit</strong> als Fiktion, es 1081, Neue Folge Band 81,<br />
Frankfurt/Main 1981<br />
� Schlumbohm, J. (Hrsg.): Kin<strong>der</strong>stuben. Wie Kin<strong>der</strong> zu Bauern, Bürgern,<br />
Aristokraten wurden, 1700-1850, dtv-Dokumente 2933, München 1983<br />
Rutschky, K.: Deutsche Kin<strong>der</strong>-Chronik. Wunsch- <strong>und</strong> Schreckensbil<strong>der</strong> aus<br />
vier Jahrhun<strong>der</strong>ten, Köln 1983<br />
Kin<strong>der</strong> hatten vor Einführung <strong>der</strong> Schulpflicht <strong>und</strong> noch bis ins späte 18.<br />
Jahrhun<strong>der</strong>t hinein gleichberechtigt teil am Leben <strong>der</strong> Erwachsenen <strong>und</strong> wurden<br />
allmählich von Pädagogen, Ärzten <strong>und</strong> Geistlichen aus <strong>der</strong> Welt <strong>der</strong><br />
Erwachsenen ausgeson<strong>der</strong>t. „<strong>Kindheit</strong>“ wurde etabliert, später noch „Jugend“<br />
o<strong>der</strong> Adoleszenz. Pädagogik <strong>und</strong> Erziehung wurden um 1800 zu einer Kunst<br />
<strong>und</strong> zu einer beson<strong>der</strong>en „Arbeit“ in einer isolierten „pädagogischen Provinz“.<br />
Da Geschichtsschreibung zumeist erst dann einsetzt, wenn die jeweils<br />
ausgewählten „<strong>Geschichte</strong>n“ <strong>zur</strong> Vergangenheit gehören <strong>und</strong> so o<strong>der</strong> so interpretiert<br />
werden, erklärt die Literaturwelle <strong>zur</strong> „<strong>Geschichte</strong> <strong>der</strong> Kind-<br />
41
heit“ offensichtlich auch den Tatbestand, daß die <strong>Kindheit</strong> als eine Idee <strong>der</strong><br />
Aufklärung nach 300 Jahren vorbei ist. Verständlich sind daher unterschiedliche<br />
Reaktionen auf die in diesem Zusammenhang sich wandelnden <strong>und</strong> neues<br />
Bewußtsein bildenden Erfahrungen <strong>und</strong> Einsichten. Wi<strong>der</strong>sprüche wurden<br />
beson<strong>der</strong>s deutlich <strong>und</strong> auch oft polemisch ausgetragen im „Jahr des Kindes“<br />
(1979).<br />
Zum einen setzt das große kulturkritische Jammern ein über die vom Aussterben<br />
bedrohte <strong>Kindheit</strong> (Elkind, D.: The Hurried Child — Das gehetzte<br />
Kind). Verantwortlich gemacht wird die ständige Überfor<strong>der</strong>ung des Kindes<br />
durch eine ungeduldige, leistungsbesessene <strong>und</strong> medienbestimmte Umwelt mit<br />
<strong>der</strong> These: „Unsere Kin<strong>der</strong> werden zu schnell <strong>und</strong> zu früh erwachsen, sie sind<br />
auf dem Wege, Pseudoerwachsene zu werden“ (Elkind, zitiert nach Ernst, II.:<br />
„Keine Zeit mehr, Kind zu sein“, in: Psychologie heute, Dezember 1982, S.<br />
21). Es ist verständlich, wenn Entwicklungspsychologen, Pädagogen <strong>und</strong> Ärzte<br />
annehmen, daß die psychischen <strong>und</strong> kognitiven Wachstumsstufen nicht ohne<br />
schädliche Auswirkungen übersprungen werden können, zumal<br />
Hirnforschungen schnell <strong>zur</strong> Stelle sind <strong>und</strong> solche Vorstellungen bestätigen<br />
(Epstein). Aber soweit ich informiert bin, gibt es keine neue<br />
Entwicklungstheorie, son<strong>der</strong>n gedacht wird in Funktionsbereichen mit je<br />
eigenen Entwicklungsmodellen.<br />
Zum an<strong>der</strong>en sorgt die Feststellung für einige Aufregung, daß <strong>Kindheit</strong><br />
einfach verschwindet, da sie „keine biologische Notwendigkeit, son<strong>der</strong>n ein<br />
soziales Kunstprodukt“ sei (Postrnan, N.: The Disappearance of Childhood, New<br />
York 1982, deutsche Übersetzung im S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main<br />
1983). 'die biologische Basis ist demnach nur noch <strong>der</strong> Säugling <strong>und</strong> das<br />
Kleinkind, die beide auf mütterliche Fürsorge angewiesen sind. Aber: „Zukunftslos<br />
ist die Kin<strong>der</strong>-<strong>Kindheit</strong>, zukunftslos ist das traditionelle Erwachsensein:<br />
Bevorm<strong>und</strong>ung <strong>und</strong> Entmündigung sind Erscheinungen, denen die<br />
altersspezifische Färbung mehr <strong>und</strong> mehr verlorengeht“ (Hengst, s. o. S. 10).<br />
lind weniger aufregend ist auch die Aussage: „Die Kin<strong>der</strong> perzipieren <strong>und</strong><br />
konstruieren eine soziale Welt, die deutlich von dem Bild abweicht, das man sich<br />
gemeinhin von <strong>der</strong> Welt <strong>der</strong> Kin<strong>der</strong> macht“ (Auwärter, M.: Kin<strong>der</strong> sind meistens<br />
traurig. Interviews mit Vier- bis Zehnjährigen, in: Kursbuch 72/1983, S. 129).<br />
Festzuhalten bleibt: ln erster Linie hat sich die Pädagogik die <strong>Kindheit</strong> geschaffen.<br />
„Die Trennung von Erwerbsbetrieb <strong>und</strong> Haushalt, die spätere<br />
Industrialisierung lieferten weitere Gründe für die pädagogische Kasernierung <strong>der</strong><br />
Kin<strong>der</strong>“ (v. Hentig, H.: Was ist eine humane Schule? Drei Vorträge,<br />
München/Wien 1976, S. 24).<br />
42
Und wie sieht es in <strong>der</strong> Gegenwart aus? Die Pädagogik weicht entwe<strong>der</strong> aus in<br />
die Erwachsenenwelt, denn so manche <strong>der</strong> pädagogischen Strategien sind in<br />
Schulen kaum noch wirksam, o<strong>der</strong> von Experten werden allerlei Programme<br />
für störende o<strong>der</strong> als gestört geltende Kin<strong>der</strong> entwickelt. Aber trotz aller<br />
sich als fortschrittlich gebärdenden pädagogischen Bemühungen „kommen<br />
Kin<strong>der</strong> nur als das vor, was sie sein <strong>und</strong> werden sollen, nicht aber als das, was<br />
sie sind . . . Die Lebenswirklichkeit <strong>der</strong> Kin<strong>der</strong> von heute, ihre Vorlieben, ihr<br />
Selbstverständnis, ihre Aneignungsstrategien, ihre Problemlösungen<br />
unterscheiden sich aber erheblich von denen, die in einer vergangenen o<strong>der</strong><br />
imaginierten <strong>Kindheit</strong> bedeutsam waren <strong>und</strong> sind. Weil die Lebenswirklichkeit <strong>der</strong><br />
Kin<strong>der</strong> eine terra incognita ist, sind die Erfolge von Programmen <strong>und</strong><br />
Interventionen so wahrscheinlich wie Lotteriegewinne“ (Hengst, s. o. S. 8).<br />
Vielleicht wird verständlich, weshalb ich anläßlich <strong>der</strong> Tagung in Osnabrück<br />
(1981) davor warnte, die hauptsächlich intrinsisch gesteuerten Aktivitäten <strong>der</strong><br />
Kin<strong>der</strong> nicht auch noch <strong>der</strong> pädagogisch-moralischen Sorge zu unterwerfen<br />
o<strong>der</strong> sie als Motivationsvehikel zu mißbrauchen. „Zum Glück“— sagen die Kin<strong>der</strong><br />
-- „wissen Lehrer <strong>und</strong> Lehrerinnen eigentlich sehr wenig über uns, denn sie<br />
achten meistens nur darauf, was wir nicht tun dürfen o<strong>der</strong> nicht können.“ Ich<br />
habe einiges von Kin<strong>der</strong>n gelernt (vgl. Doehlmann, M.: Von Kin<strong>der</strong>n lernen.<br />
Zur Position des Kindes in <strong>der</strong> Welt <strong>der</strong> Erwachsenen, München 1979).<br />
Ich sehe sogar jetzt — nach zwei weiteren Jahren <strong>der</strong> Beobachtung in an<strong>der</strong>en<br />
deutschsprachigen Regionen <strong>und</strong> europäischen Län<strong>der</strong>n — noch deutlicher<br />
die Lebenswirklichkeit <strong>der</strong> Kin<strong>der</strong> als eine terra incognita <strong>und</strong> nicht etwa als<br />
eine tabula rasa, die erst bepflanzt <strong>und</strong> begossen werden muß, damit Kin<strong>der</strong> zu<br />
zivilisierten Menschen werden J. Locken. J. Rousseau). Deshalb kann ich<br />
nur vorsichtig die Inhalte, Formen <strong>und</strong> die Organisation des Lernens mitbedenken,<br />
wie sie für eine „Freie Schule“ o<strong>der</strong> für ein „Lernzentrum“ diskutiert werden.<br />
Didaktik <strong>und</strong> Methodik bleiben in unserem staatlichen Schulsystem trotz aller<br />
vor<strong>der</strong>gründigen Programme <strong>und</strong> Problemlösungsvorschläge<br />
systemimmanent, denn „Innovationen dieser Art tasten den Status <strong>Kindheit</strong><br />
nicht an. Sie erhöhen die Absatzchancen pädagogischer Verlage, schaffen neue<br />
Lehrstühle <strong>und</strong> Berufsfel<strong>der</strong>, rechtfertigen die Betriebsamkeit alter <strong>und</strong> neuer,<br />
linker <strong>und</strong> rechter, konformer <strong>und</strong> alternativer Experten“ (Hengst, s. o. S. 8).<br />
Die <strong>Kindheit</strong> wird heute längst vermarktet, indem Kin<strong>der</strong> als kleine Erwachsene<br />
angesehen werden. Werbespots im R<strong>und</strong>funk nutzen die unschuldige<br />
Kin<strong>der</strong>stimme, im Fernsehen tritt das niedliche Bild hinzu, Prospekte hantieren<br />
mit modischen Akzenten. Zwar verfügen Kin<strong>der</strong> schon in jüngeren Jahren,<br />
43
als lange angenommen, „über bestimmte kognitive Strukturen <strong>und</strong> Operationen“,<br />
aber es wäre falsch. „jetzt zu schließen, sie seien also doch quasi kleine<br />
Erwachsene“ (Auwärter, s. o. S. 115).<br />
Eine konservative Wende wäre es, sich weiterhin einseitig auf die alte Phasenlehre<br />
<strong>und</strong> auf mangelnde altersstufenbedingte Fähigkeiten zu berufen o<strong>der</strong> gar<br />
die beliebte Formel zu wie<strong>der</strong>holen, Kin<strong>der</strong> seien von Natur aus faul o. ä.<br />
Vielmehr handelt es sich darum, an<strong>der</strong>e Erklärungen <strong>und</strong> Vorstellungen <strong>der</strong><br />
Kin<strong>der</strong> über Erwachsene, über Normen <strong>der</strong> Umwelt <strong>und</strong> über Beziehungen unter<br />
Ungleichaltrigen aufzufinden. Eine Umorientierung <strong>der</strong> Pädagogik ist<br />
notwendig <strong>und</strong> nicht etwa nur eine ,,Antipädagogik“ zu deklarieren. Die<br />
Kin<strong>der</strong> sind durch eine 250-jährige „vernünftige Erziehung“ nicht „ewig<br />
glücklich <strong>und</strong> dem Vaterlande brauchbar“ gemacht worden (Schlumbohm, s. o.<br />
Dokument 42, S. 318).<br />
Alle geschichtlichen Analysen (s. Literatur) kommen trotz unterschiedlicher Ansätze<br />
zu dem Schluß, daß ein Zurück in vergangene <strong>Kindheit</strong>stage nicht möglich<br />
sei.<br />
3. Gibt es eine „Musik <strong>der</strong> Kin<strong>der</strong>“?<br />
Landläufig gedacht muß die Antwort auf die Frage, ob es eine „Musik <strong>der</strong><br />
Kin<strong>der</strong>“ geben kann, selbstverständlich mit „nein“ beantwortet werden, denn<br />
Kin<strong>der</strong> werden geprägt durch die. sie umgebende Kultur. Bei Heranwachsenden<br />
vollzieht sich dieser Enkulturationsprozeß durch Imitation <strong>der</strong> von<br />
Erwachsenen' vorgeführten Verhaltensweisen, durch Identifikation .o<strong>der</strong> auch<br />
durch Wi<strong>der</strong>spruch (Klausmeier). Der Enkulturations- o<strong>der</strong> Adaptationsprozeß ist<br />
aufgr<strong>und</strong> angeblich mangeln<strong>der</strong> rationaler Fähigkeiten des Kindes gekennzeichnet<br />
durch prinzipielles altersbedingtes Unvermögen. Nur Ausnahmen bestätigen<br />
diese Regel. Deshalb predigen Eltern <strong>und</strong> Pädagogen ständig: „Wir wissen besser, was<br />
für dich gut <strong>und</strong> richtig ist, sei bitte brav, leise <strong>und</strong> ,hör zu .,sei daher ,gehorsam, <strong>und</strong><br />
außerdem: frag nicht so dumm, das ist so'. „ Musik ist also eine. geistige Leistung des<br />
erwachsenen Menschen, <strong>und</strong> Kin<strong>der</strong>n muß sie erst mit entsprechenden Methoden<br />
beigebracht werden. Am besten funktioniert dieser Vorgang, wenn die Kin<strong>der</strong> das<br />
wollen, was sie sollen.<br />
Etwas genauer gedacht <strong>und</strong> nach Kenntnisnahme <strong>der</strong> <strong>Geschichte</strong> <strong>der</strong> <strong>Kindheit</strong><br />
kann dieser Sachverhalt, <strong>der</strong> vereinfacht gesehene Zugang <strong>zur</strong> umgebenden<br />
Kultur — hier zum komplexen Phänomen Musik — nicht stimmig sein:<br />
� Die inflationäre Tendenz des Leichtmachens beim Musiklernen wi<strong>der</strong>spricht<br />
sowohl <strong>der</strong> allgemeinen Lerntheorie als auch dem überaus kompli-<br />
44
zierten <strong>und</strong> differenzierten Vorgang <strong>der</strong> Begegnung zwischen Mensch <strong>und</strong><br />
Musik. Und Kin<strong>der</strong> sind Menschen, allerdings an<strong>der</strong>e, als Erwachsene sie sich<br />
bisher vorgestellt haben.<br />
� „Musik“ ist nicht nur als abendländische Musik zu verstehen. Auch Kin<strong>der</strong><br />
haben längst Begegnungen mit vielen „Musiken“ (Blaukopf) aufgr<strong>und</strong><br />
unserer medialen Umwelt <strong>und</strong> allgemeiner Mobilität. Sie stellen einen<br />
neuen Sozialisationstypus dar <strong>und</strong> sind keine „unbeschriebenen Blätter“ in<br />
bezug auf Musik.<br />
� Auch folgende Feststellungen sollten wir für Kin<strong>der</strong> als zutreffend ansehen:<br />
„Von dem in <strong>der</strong> Natur vorkommenden Tonmaterial gelangt in <strong>der</strong> Musik nur ein<br />
verhältnismäßig geringer Teil <strong>zur</strong> Verwendung . . . durch bestimmte<br />
Rationalisierungsprozesse zu bestimmten Tonsystemen zusammengeschlossen . . .<br />
Die Vielfalt <strong>der</strong> Erscheinungsformen erklärt sich aus <strong>der</strong> Unterschiedlichkeit <strong>der</strong><br />
Klangauffassung <strong>und</strong> Klanggestaltung bei den verschiedenen Völkern <strong>und</strong> zu den<br />
verschiedenen Zeiten. Der Komplexität des Objekts Musik steht die Komplexität<br />
des Subjekts Mensch gegenüber, dessen Apperzeptionsvermögen ein höchst<br />
unterschiedliches ist <strong>und</strong> von den mannigfaltigsten Komponenten . . . abhängt“<br />
(MGG, Band 9, Sp. 970).<br />
� Ob Kin<strong>der</strong>, ausgestattet mit kognitiven <strong>und</strong> affektiv en Fähigkeiten, ihr<br />
Ausdrucksbedürfnis, ihre vorhandenen Imaginations- <strong>und</strong> psychodynamischen<br />
Antriebspotentiale in <strong>der</strong> Musik mit üblichen Kin<strong>der</strong>lie<strong>der</strong>n,<br />
pädagogisierten Orff-Instrumenten o<strong>der</strong> mit versimpelnden Folklorearrangements<br />
intensiv verwirklichen können, ist zu bezweifeln. „Musik <strong>der</strong><br />
Kin<strong>der</strong>“ meint eine an<strong>der</strong>e Musik, nämlich die nicht von realen sozialen<br />
Aktionen abgelösten Tonsysteme, Melodiebildungen, Sprech- <strong>und</strong><br />
Bewegungsformen. Pädagogische Musik <strong>und</strong> das Individuum — beson<strong>der</strong>s das<br />
Kind — bleiben außerhalb ihrer gesellschaftlichen Bestimmungen nichts an<strong>der</strong>es<br />
als eine pädagogische Abstraktion, eine soziale Bestätigung des<br />
fieranwachsenden bleibt somit zumindest unbefriedigend.<br />
� Soziale Identifikationen <strong>und</strong> Ich-Stärkungen ereignen sich vorrangig in<br />
Partner- <strong>und</strong> Gruppenbeziehungen. Diese Beziehungen sind die Basis <strong>der</strong><br />
affektiv gesteuerten sprachlichen, melodischen <strong>und</strong> Bewegungshandlungen, die<br />
wie<strong>der</strong>um aus dem Aktions-Kontext verständlich werden mit <strong>der</strong> Absicht,<br />
intensive Kommunikation zu ermöglichen. Der Sinn konstituiert sich aus<br />
<strong>der</strong> Sinnlichkeit <strong>der</strong> unmittelbaren Erfahrung, wofür die unzähligen<br />
Varianten ein Beweis sind. Im Alltagsverständnis vieler Lehrer(innen) handelt<br />
es sich um nutzlose <strong>und</strong> unernste Tätigkeiten, über die sie hinwegsehen o<strong>der</strong><br />
die sie nicht bemerken, da sie keinen son<strong>der</strong>lich wichtigen<br />
Lerngegenstand darstellen.<br />
45
� „Musik <strong>der</strong> Kin<strong>der</strong>“ beruht (nach Piaget) auch auf den schon frühen Fähigkeiten<br />
<strong>der</strong> Kin<strong>der</strong>, konkrete Operationen leisten zu können, die angelegte Bereitschaft<br />
zum Probehandeln ausspielen <strong>und</strong> die Realität symbolisch transformieren zu<br />
können. Kin<strong>der</strong> verfügen — wie wir beobachtet haben — über Tonhöhen- <strong>und</strong><br />
Zeitglie<strong>der</strong>ungen, ohne unser rationales Tonsystem bewußt zu gebrauchen, sie<br />
„verwenden“ nicht z. B. schweifende Tonhöhen o<strong>der</strong> auch Schreie, son<strong>der</strong>n sie<br />
„sind“ in ihren Aktionen sozusagen „Musik“, sie sind — wie es ein 10-jähriges<br />
Mädchen ausdrückte — „komplett voll Musik“. Auch Schrittbelastungen<br />
o<strong>der</strong> Klatschakzente sind nicht im voraus organisiert <strong>und</strong> werden dann<br />
„gestaltet“, son<strong>der</strong>n sie entstehen im existenziellen Vollzug. Ein Beispiel: „Rote<br />
Kirschen eß ich gern“ Typologie III — Auflösen des Kreises — seit 1897<br />
schriftlich überliefert (F. M. Böhme). Bis heute bekannt in norddeutschen<br />
Regionen:<br />
46<br />
Die musikalische Handlung beginnt im Leierton, bevor sie mit unbestimmter<br />
Tonhöhe weitergeführt wird. Sprachlich gab es noch vor 50 Jahren (1932) die<br />
Zeilen: „junge Herren küß ich gern, alte stoß ich nie<strong>der</strong>!“ Die pädagogische<br />
Überformung „in die Schule geh ich gern . . .“ hat sich
überall durchgesetzt. „Als erotisches Symbol scheint die Kirsche in den<br />
Volkslie<strong>der</strong>n ganz Europas beheimatet zu sein“ (Danckert, W.: Symbol,<br />
Metapher, Allegorie im Lied <strong>der</strong> Völker, Bonn-Bad Godesberg 1978 Teil 3:<br />
Pflanzen, S. 1049. Weitere Hinweise S. 1049-1053). Hinzuweisen ist auch auf<br />
die Beobachtung, daß sich hei emotionalen Spannungen auffällige<br />
Verän<strong>der</strong>ungen <strong>der</strong> Tonhöhen ergeben, wobei Lauterwerden gleich höhere<br />
Intonation bedeutet. Je<strong>der</strong> Chorleiter kennt das Phänomen <strong>und</strong> muß es<br />
korrigieren, denn er reproduziert einen „ästhetischen Gegenstand“. In <strong>der</strong><br />
„Musik <strong>der</strong> Kin<strong>der</strong>“ hingegen sind Lautheit <strong>und</strong> Tonhöhe keine voneinan<strong>der</strong><br />
isolierten musikalischen Qualitäten (Neues Handbuch <strong>der</strong> Musikwissenschaft,<br />
Band 10, Wiesbaden 1982, S. 323). Die gesamte Stimmgebung <strong>und</strong><br />
Stimmfärbung ist ein Resultat <strong>der</strong> Aktion <strong>und</strong> nicht isoliertes Produkt einer<br />
„gepflegten“ <strong>und</strong> unerotischen Kin<strong>der</strong>stimme. Atmung <strong>und</strong><br />
Zwerchfellspannung ergeben sich aus <strong>der</strong> Funktion <strong>und</strong> sind organisch richtig, da<br />
sie durch die Bewegungshandlung mit Füßen, Händen, Mimik <strong>und</strong> Gebärden<br />
gestützt sind.<br />
� Eine „ästhetische Bewußtheit - ist - noch '- nicht vorhanden, wenn wir von,<br />
oben herab schauen <strong>und</strong> landläufig denken, aber zu bedenken ist, ob nicht<br />
„Energieüberschur (Spencer), „Spieltrieb“ (Groos) o<strong>der</strong> „Ahmung“<br />
(Fr. G. Jünger) in <strong>der</strong> Einheit von Sprache, Melos <strong>und</strong> Bewegung auf den<br />
Anfang aller Musik verweisen <strong>und</strong> trotz notwendig werden<strong>der</strong> isolieren<strong>der</strong><br />
Lernprozesse erhalten bleiben o<strong>der</strong> zumindest für wichtig gehalten werden sollten.<br />
Die . Frage bleibt, ob unser Schulsystem das leisten kann o<strong>der</strong> überhaupt leisten<br />
will. Ich komme darauf <strong>zur</strong>ück.<br />
� Ein Problem beschäftigt mich noch im Zusammenhang mit den beobachteten<br />
Aktivitäten, die wir als „Tänze <strong>der</strong> Kin<strong>der</strong>“ bezeichnen <strong>und</strong> einer „Musik<br />
<strong>der</strong> Kin<strong>der</strong>“ überordnen (Hoerburger, V./Segler, H.: Klare, klare Seide.<br />
überlieferte Kin<strong>der</strong>tänze aus dem deutschen Sprachraum, 6. erw. Auflage,<br />
Kassel 1983). Mich beschäftigt die Frage, ob es ein „soziales Gedächtnis <strong>der</strong><br />
Menschheit gibt, das ein archaisches Material an Formen <strong>und</strong> Symbolen<br />
speichert, die einem psychischen Ausdrucksbedürfnis entsprechen, das zwar<br />
gebändigt, aber nicht ausgelöscht werden kann“ (Gombrich, E. H.: Aby Warburg.<br />
Eine intellektuelle Biographie, Europäische Verlagsanstalt Nr. 11218). <strong>Einige</strong><br />
vergleichende Beobachtungen <strong>und</strong> die Publikationen von W. Danckert (s.<br />
o.) unterstützen diese Aussage. Die „Musik <strong>der</strong> Kin<strong>der</strong>“ ist ein völlig offenes<br />
Kapitel.<br />
47
4. „Musik für Kin<strong>der</strong>“ o<strong>der</strong> Kin<strong>der</strong>musik<br />
Während die „Musik <strong>der</strong> Kin<strong>der</strong>“ einen <strong>der</strong> ,,Typen gesellschaftlichen Handelns“<br />
(Blaukopf) darstellt, könnte die „Musik für Kin<strong>der</strong>“ als schulisches<br />
Handeln bezeichnet werden, also isoliert vom gesellschaftlichen Handeln<br />
<strong>und</strong> nur bedeutsam für spätere konventionelle Wertideen, die immer einer<br />
Forschung zum Problem werden sollten (M. Weber), denn Übereinkünfte —<br />
wie z. B., Musik diene <strong>der</strong> Charakterbildung o<strong>der</strong> stehe im Dienst <strong>der</strong><br />
Humanität — sind als eurozentrische Denkvoraussetzungen nicht „richtig“,<br />
son<strong>der</strong>n nur gesellschaftlich „gültig“.<br />
„Musik für Kin<strong>der</strong>“ ist oft plakativer Untertitel üblicher Lie<strong>der</strong>bücher — auch z.<br />
B. des Orff-Schulwerkes — <strong>und</strong> ist angeblich entstanden aus <strong>der</strong> Arbeit mit<br />
Kin<strong>der</strong>n. .Ansatzpunkt ist angeblich „altes Kin<strong>der</strong>liedgut“ mit Bindung an<br />
einen Fünftonraum, <strong>der</strong> dem kindlichen Wesen gemäß sein soll, aber alle<br />
Beobachtungen wi<strong>der</strong>sprechen solchen Vorstellungen.<br />
Das Wörtchen „für“ hat eine doppelte Bedeutung: einmal im Sinne des eigenen<br />
Besitzes o<strong>der</strong> des vom Kenner in Besitz Genommenen, zum an<strong>der</strong>en im<br />
Sinne des freien Angebots <strong>und</strong> <strong>der</strong> Empfehlung zu jemandes Gunsten o<strong>der</strong> im<br />
Sinne <strong>der</strong> gezielten Anordnung des Richtigen zum Schutz von jemandem.<br />
Letzteres ist mit „Musik für Kin<strong>der</strong>“ gemeint, für Kin<strong>der</strong>, die in ihrer heilen<br />
<strong>Kindheit</strong> beschützt werden sollen. Es handelt sich um „Kin<strong>der</strong>musik“,<br />
unabhängig davon, welche einzelnen Sparten in Richtlinien für den<br />
Musikunterricht aufgezählt o<strong>der</strong> in Musikbüchern konzeptionell jeweils im<br />
Vor<strong>der</strong>gr<strong>und</strong> stehen. Es handelt sich auf jeden Fall um „pädagogisierte Inhalte“,<br />
diel heutzutage sehr vielschichtig sind <strong>und</strong> von idyllischer musischer Betätigung<br />
bis <strong>zur</strong> Anspruch erhebenden avantgardistischen Musikübung reichen:<br />
— Lied <strong>und</strong> Singen<br />
— Musik machen<br />
— Musik hören<br />
— Musik erfinden<br />
— sich nach Musik bewegen.<br />
Systematisch gelehrt <strong>und</strong> gelernt werden:<br />
— die Töne unseres Musiksystems mit entsprechenden Tonvorstellungen,<br />
verb<strong>und</strong>en mit praktischem Musizieren (Singen, Blockflöte, Orff-Instrumente)<br />
— musikalische Gr<strong>und</strong>begriffe<br />
— in Kombination untereinan<strong>der</strong>: technische Übungen, Gehörübungen,<br />
Gestaltungsübungen.<br />
48
In erster Linie geht die Musik mit dem Kind um <strong>und</strong> nicht das Kind mit <strong>der</strong><br />
Musik.<br />
Abzugrenzen von diesen allgemeinen Inhalten sind die beson<strong>der</strong>en Akzente, die<br />
von Erwachsenen für Kin<strong>der</strong> gesetzt werden, um sie zu eigenen Produktionen<br />
an<strong>zur</strong>egen, wie z. B. Kin<strong>der</strong>lie<strong>der</strong> selber machen (P. Schleuning o<strong>der</strong> M. Küntzel-<br />
Hansen), Haste Töne (I. Merkt) o<strong>der</strong> die Improvisationsansätze von L.<br />
Friedemann <strong>und</strong> Klangexperimente von C. Meyer-Denkmann. Auch Bartok<br />
bezeichnete seine Sammlung von Klavierstücken mit dem Titel Für Kin<strong>der</strong>. Zu<br />
den deutlich abzugrenzenden Konzepten, die nicht mehr eine „autonome, vom<br />
Erwachsenendasein unterscheidende <strong>Kindheit</strong>“ annehmen <strong>und</strong> - unbeabsichtigt<br />
unterstützt von <strong>der</strong> Entwicklungspsychologie - <strong>zur</strong> „kognitiven (<strong>und</strong><br />
affektiven) Infantilisierung <strong>der</strong> Kin<strong>der</strong>“ führen (Auwärter, s. o. S. 115), gehören<br />
u. a. Musikbuch Primarstufe Teil A (1971) <strong>und</strong> Teil B (1975). Außer experimentellen<br />
Abschnitten enthalten sie bereits fachliche „Gr<strong>und</strong>anfor<strong>der</strong>ungen“, auf<br />
denen ein interessenspezifischer, freiwilliger Musikunterricht sich aufbauen hißt.<br />
Eine Anregung aus Teil B, S. 19, (für Kin<strong>der</strong>) ergab z. B. folgende<br />
Produktionsergebnisse:<br />
49
Der relativ freie Einsatz <strong>der</strong> Tonhöhen „hoch-mittel-tief“ war den singenden<br />
Schülern (4. Kl.) aus ihren „Pausenhofmelodien“ durchaus geläufig, bereitete<br />
aber große Anfangsschwierigkeiten im Klassenraum <strong>und</strong> in <strong>der</strong> offiziellen<br />
Musikst<strong>und</strong>e. Hier mußte doch „sauber“ gesungen werden, <strong>und</strong> wer das nicht<br />
konnte, hatte den M<strong>und</strong> zu halten <strong>und</strong> galt als unmusikalisch. Erst <strong>der</strong> rhythmisch<br />
improvisierte <strong>und</strong> in freier Tonhöhe gesungene Satz „Wer ist musikalisch?“<br />
(Anregung in Musikbuch Primarstufe B, S. 3) brachte den Durchbruch zu<br />
kreativen Lösungen, an denen sich aber nur Mädchen beteiligten, während die<br />
Jungen den Gesang auf allerlei Instrumenten zu begleiten versuchten.<br />
Die beiden Beispiele entstanden — wie viele an<strong>der</strong>e — als Hausaufgabe <strong>und</strong><br />
wurden im Unterricht einstudiert. Dabei wurden die Raum-Zeit-Probleme <strong>der</strong><br />
Notation durch Einführung einer Zeitleiste bewußt gemacht.<br />
Eine Aufgabe musikpädagogische Forschung wäre es, die gebräuchliche<br />
Unterrichtsliteratur für den Musikunterricht in <strong>der</strong> Gr<strong>und</strong>schule zusammen-<br />
50
zustellen. Die meisten Verlage <strong>und</strong> Autoren sorgen sich um . das „kindgerechte<br />
Material - , um die „kindgemäße Zubereitung <strong>und</strong> tun restlose Motivation <strong>der</strong><br />
Beteiligten. So wurden z. B. die Autoren von Musikbuch Primarstufe A dringend<br />
vom Verlag aufgefor<strong>der</strong>t, Kin<strong>der</strong>lie<strong>der</strong> abzudrucken, weil sonst kaum ein Lehrer<br />
das Buch anschaffen würde. In <strong>der</strong> holländischen Ausgabe des Musikbuchs fehlen<br />
solche Produkte. Schon aus diesem Gr<strong>und</strong> ist eine Dokumentation wichtig, um den<br />
dialektischen Charakter <strong>der</strong> Wirklichkeit aufzuzeigen, überspitzt gesagt: Kindgemäß<br />
ist das Nicht-Kindgemäße. Das insgesamt weite Feld wird andeutungsweise in<br />
einem Überblick <strong>der</strong> jüngeren Fachgeschichte mit kurzem historischem<br />
Rückblick dargestellt in den beiden neuen Schriften Musikunterricht 1-6 <strong>und</strong><br />
Musikunterricht 5-11 (Günter, U./Ott, Th./Ritzel, Fr., in <strong>der</strong> Reihe „Praxis<br />
<strong>und</strong> Theorie des Unterrichtens“, Weinheim/Basel 1982/83). Hinzuzufügen in<br />
<strong>der</strong> wünschenswerten Dokumentation sind die verwirrenden Begriffe „Rhythmische<br />
Erziehung“ - „Rhythmik in <strong>der</strong> Erziehung“ - „Bewegungserziehung“ -<br />
„Rhythmisch-musikalische Erziehung“ - „Tänzerisch-musikalische Erziehung“,<br />
die auf das Dilemma unseres Erziehungssystems verweisen: Alle wollen<br />
mitmischen in dem „pädagogischen Anliegen“, d a s Kind offensichtlich zu einem<br />
harmonisch gebildeten, konfliktfreien, angepaßten Gesellschaftstierchen<br />
emporzuziehen <strong>und</strong> in diesem Sinne zu bilden <strong>und</strong> zu erziehen.<br />
5. <strong>Einige</strong> Folgerungen für den Musikunterricht<br />
Lernorganisation <strong>und</strong> Lerninhalte - auch für den Musikunterricht - bleiben immer<br />
aufeinan<strong>der</strong> bezogen. Einseitige Verän<strong>der</strong>ungen <strong>und</strong> womöglich nur in unserem<br />
Fach haben keine durchgreifenden Konsequenzen, wie es die Gesamtschulrealität in<br />
<strong>der</strong> B<strong>und</strong>esrepublik zeigt, denn alle Ansätze, die Organisationsformen <strong>und</strong><br />
inhaltlichen Innovationen aufeinan<strong>der</strong> abzustimmen, sind entwe<strong>der</strong> an rigiden<br />
staatlichen Erlassen o<strong>der</strong> auch sehr oft an <strong>der</strong> entschuldbaren Unfähigkeit,<br />
Bequemlichkeit bzw. Resignation <strong>der</strong> Lehrer, Eltern <strong>und</strong> Schüler gescheitert.<br />
Trotzdem sind die Berichte auch aus an<strong>der</strong>en Schulen über „schülerzentrierten -<br />
schülerorientierten - interessenspezifischen - kooperativen Unterricht“ nicht<br />
uninteressant, weil sie anzeigen, in welchen Perspektiven gedacht wird <strong>und</strong> welche<br />
Verän<strong>der</strong>ungstendenzen erkennbar werden.<br />
Schülerorientierter Musikunterricht - ein , Traumziel?, so überschreibt Heinz<br />
Meyer seinen Aufsatz in Musik <strong>und</strong> Bildung (April 1982, S. 218ff.) <strong>und</strong> zi-<br />
51
tiert Hilbert Meyer: „Fragen Sie doch mal die Schüler, welche Interessen sie<br />
haben: nach Hause woll'n sie gehn . . . Wenn schulischer Unterricht ernsthaft an<br />
den Bedürfnissen <strong>und</strong> Interessen <strong>der</strong> Schüler . . . orientiert würde, so dürfte<br />
die Schule als Institution — zumindest in ihrer gegenwärtigen Form — zusamrnenbrechen.“<br />
Recht haben die Schüler <strong>und</strong> Recht hat Hilbert Meyer. Bei allen<br />
beachtenswerten Erfahrungen, die Heinz Meyer <strong>und</strong> seine zitierten Genossen<br />
einbringen, bleibt <strong>der</strong> letzte Satz doch eine wichtige Aussage: „Schülerorientierter<br />
Unterricht — ein Traumziel? Ja, ein Traumziel je<strong>der</strong> Didaktik.“ Musikunterricht<br />
alleine kann nichts ausrichten in einem System, das vom Planen aller<br />
Lerninhalte, von zerkleinernden Lernschritten <strong>und</strong> von zusammenhangsloser<br />
Kontrolle des Gelernten bestimmt ist. Dieses System kann nur von unten —<br />
zusammen mit Eltern <strong>und</strong> Kin<strong>der</strong>n — aufgebrochen <strong>und</strong> allmählich verän<strong>der</strong>t<br />
werden, ohne daß sofort eine „systemkritische Didaktik“ verkündet wird, die<br />
selbst — falls sie sich mit Machtansprüchen durchsetzen wollte — keine<br />
„systemkritische Didaktik“ dulden würde.<br />
Überzeugen<strong>der</strong> als im Aufsatz in Musik <strong>und</strong> Bildung — weil ohne viel Gejammer<br />
über Schüler <strong>und</strong> Schule — werden konkrete Erfahrungen neuerdings<br />
vorgelegt in den beiden bereits erwähnten Schriften Musikunterricht 1-6/ 5-<br />
11, die insbeson<strong>der</strong>e den „Projektansatz: Mehr Schülerorientierung“ betonen<br />
<strong>und</strong> ausführlich beschreiben, anstatt vorschnelle Theorien zu entwickeln.<br />
Beson<strong>der</strong>s wichtig ist z.B. „Eine St<strong>und</strong>e ,Unterricht über Unterricht' „, ein<br />
Versuch, <strong>der</strong> in Integrierten Gesamtschulen schon aus ihrem Selbstverständnis<br />
heraus am Beginn <strong>der</strong> Arbeit stand, aber lei<strong>der</strong> nicht durchgehalten wurde. Der<br />
Projektunterricht <strong>der</strong> Oldenburger Gruppe sollte unbedingt fortgesetzt werden<br />
— auch mit selbstkritischen Berichten einschließlich nicht gelungener Beispiele —<br />
<strong>und</strong> zwar mit den gleichen Lehrern <strong>und</strong> ausgeweitet durch Vergrößerung <strong>der</strong><br />
Lehrergruppe. Ansatzpunkt ist vor allem die Gr<strong>und</strong>schule, weil in den älteren<br />
Jahrgängen bereits das „anerzogene Verständnis von Schule <strong>und</strong> Unterricht“<br />
vorherrscht (Heinz Meyer, s. o. S. 223). Die Lehrer sollten sich nicht<br />
entmutigen lassen, denn auch an Staatsschulen können die vielen Leerformeln<br />
in den üblichen Präambeln zu Lehrplänen als Beleg für solche o<strong>der</strong> ähnliche<br />
Versuche dienen. Studentische Gruppen sollten mitarbeiten, um Alternativen<br />
frühzeitig in <strong>der</strong> Praxis kennenzulernen. An<strong>der</strong>e Fachgebiete müßten sich<br />
beteiligen, damit <strong>der</strong> Musikunterricht nicht in eine aussichtslose Außenseiterrolle<br />
gedrängt wird.<br />
Wir wissen längst aus Erfahrung, daß Lernen als Prozeß <strong>der</strong> Aneignung ohne<br />
Erfahrung nicht möglich ist, <strong>und</strong> trotzdem bleiben Tatsachen machtlos<br />
gegenüber menschlichen Vorurteilskräften, die meist aufgr<strong>und</strong> isoliert gelernter<br />
Lerngegenstände mit abgehakten Lernergebnissen <strong>und</strong> -kontrollen ent-<br />
52
standen sind. Lernen ohne Erfahrung ist nicht möglich, aber aus Erfahrung muß<br />
nicht auch unbedingt etwas gelernt werden. Ein Lehrer ist dazu da, mit seinem<br />
vorhandenen Erfahrungsvorsprung die Erfahrungen von Heranwachsenden zu<br />
relativieren <strong>und</strong> Lernen auch durch Verunsicherungen zu ermöglichen, ja, <strong>der</strong> Lehrer<br />
muß sich als Lehrer überflüssig machen können, zumindest sich mit allen<br />
Beteiligten zusammen als ebenfalls Lernen<strong>der</strong> verstehen.<br />
Da die Wertordnung nicht als abgeschlossen gelten kann <strong>und</strong> es sich ohne offene<br />
Perspektive kaum leben läßt — Realität bedeutet doch immer gleichzeitig ihre<br />
Verän<strong>der</strong>ung —, ist <strong>der</strong> Lehrer aus seinem gelernten Verständnis als ich-schwacher<br />
Staatsbeamter, <strong>der</strong> sich nur noch mit seiner kulturkritischen Wehleidigkeit<br />
identifizieren kann, längst historisch überfällig geworden. Dieser Tatbestand wird<br />
als Einsicht noch lange verheimlicht werden, solange die Schule als Zwangs- <strong>und</strong><br />
Regelschule bestehen bleibt. Erst wenn sämtliche staatlichen Schulen gleichberechtigt<br />
mit allen Privatschulen zu „Angebotsschulen“ erklärt sind, werden sich<br />
Einstellungen von Schülern, Eltern <strong>und</strong> Lehrern langsam verän<strong>der</strong>n <strong>und</strong><br />
Kompetenzen neu strukturieren, <strong>und</strong> zwar nicht mehr einseitig von oben nach<br />
unten, son<strong>der</strong>n aufgr<strong>und</strong> offen erkennbarer <strong>und</strong> bejahter menschlicher<br />
Unterschiede nach je erworbenen Fertigkeiten <strong>und</strong> Fähigkeiten.<br />
Als Inhalte für den Musikunterricht in <strong>der</strong> Gr<strong>und</strong>schule können — solange es die<br />
maximal zwei Wochenst<strong>und</strong>en zu je 45 Minuten gibt — nur Gr<strong>und</strong>lagen an<br />
Wissen, Fertigkeiten <strong>und</strong> Fähigkeiten als Voraussetzungen für den Erwerb offener<br />
musikalischer Einstellungen <strong>und</strong> Verhaltensweisen vorgeschlagen werden, die<br />
einen weiteren — hoffentlich — interessenspezifischen Unterricht ermöglichen.<br />
Welche Einsichten im jeweiligen Zusammenhang für Schüler <strong>der</strong> Gr<strong>und</strong>schule<br />
möglich sind, kann nur im speziellen Unterrichtsschritt entschieden werden.<br />
Wenn möglich sollten sich mehrere Lehrkräfte zu Projektplanungen mit unterschiedlichen<br />
Schwerpunkten — Sachunterricht — zusammentun (für<br />
praktische Vorschläge s. G<strong>und</strong>lach, W. (Hrsg.): Handbuch Musikunterricht in <strong>der</strong><br />
Gr<strong>und</strong>schule, Düsseldorf 1984). Ein elementarer Anfang des Musikunterrichts<br />
ist nicht mehr gegeben <strong>und</strong> „kein Gegenstand ist als beziehungsloses Objekt zu<br />
verabsolutieren“ (Schmitt, R.: in NMZ Febr./März 1983, S. 15).<br />
An den in Amt <strong>und</strong> Würden stehenden Denknormen sollte von allen Beteiligten<br />
gerüttelt werden, um etablierte Aufsichtsmächte aus dem Konzept zu bringen.<br />
Und noch ein kurzer Hinweis aus Erfahrung: Unaufmerksame Kin<strong>der</strong> lernen oft<br />
schneller als intelligente Anpasser. Das Lebensprofil heuti-<br />
53
ger Kin<strong>der</strong> ist erheblich vielschichtiger, als Kin<strong>der</strong>psychologen, Kin<strong>der</strong>ärzte, Pädagogen,<br />
Sozialerzieher <strong>und</strong> ihre weiblichen Berufsgenossen teilweise noch immer annehmen.<br />
Neue Auffassungen z. B. von Kreativität sind zu finden in Wieczerkowski, W. u.<br />
a., Lehrbuch <strong>der</strong> Entwicklungspsychologie, s. o. Band 2, S. 207ff. Der<br />
Zusammenhang von „Kind <strong>und</strong> Musik" mag noch durch folgende Überlegungen vertieft<br />
werden:<br />
Nicht das fachspezifische Denken steht im Vor<strong>der</strong>gr<strong>und</strong> <strong>und</strong> nicht irgendein<br />
ästhetisches Material, mit dem emanzipatorisch umgegangen wird, kann<br />
Lebenswirklichkeit verän<strong>der</strong>n, son<strong>der</strong>n aus verän<strong>der</strong>ter Realität im Sinne<br />
demokratischen Fortschritts erwächst solche Musik, die Heranwachsende als „ihre<br />
Musik" produzieren, reproduzieren, tradieren <strong>und</strong> variieren.<br />
� Die Frage, ob <strong>der</strong> Mensch existenziell auf Musik angewiesen ist, kann positiv<br />
nicht nachgewiesen werden, auch wenn es in allen Kulturen „Musik" gibt.<br />
Allerdings steht fest, daß er angewiesen ist auf Emotionen, aus denen ein<br />
Ausdrucksbedürfnis erwächst. Dieses läßt sich aber auch auf ganz an<strong>der</strong>e Art<br />
<strong>und</strong> Weise als durch Musik befriedigen. Insofern sollte auch die Frage stets neu<br />
gestellt werden, warum Musikunterricht in <strong>der</strong> Schule stattfindet o<strong>der</strong><br />
stattfinden sollte.<br />
� Musikpädagogik muß zwar die Untersuchung vieler fachlicher Probleme<br />
einschließlich historischer <strong>und</strong> gesellschaftlicher Bedingtheiten anregen <strong>und</strong><br />
sogar for<strong>der</strong>n, aber sie selbst ist keine Wissenschaft, son<strong>der</strong>n bewegt sich immer<br />
in mehr o<strong>der</strong> weniger begründbaren Denkvoraussetzungen. Daher ist zu<br />
bezweifeln, ob durch empirische Untersuchungen, die in staatliche<br />
Lernprogramme einfließen, die „Musikerziehung" unterrichtspraktisch<br />
effektiver gemacht werden könne, zumal schulische Erziehung überhaupt die<br />
Entwicklung eines Kindes eher zu verzögern scheint, denn die Abhängigkeit von<br />
Erwachsenen wird nicht ausgeglichen, son<strong>der</strong>n verstärkt. „Pädagogische<br />
Maßnahmen <strong>und</strong> Empfehlungen sind nur dann hilfreich, wenn <strong>der</strong> Adressat<br />
ihnen aktiv entgegentritt. Sie profilieren sich am Wi<strong>der</strong>spruch, an <strong>der</strong><br />
Auseinan<strong>der</strong>setzung, an <strong>der</strong> Interaktion. Wenn sie sich selbst nur als Eingriffe<br />
verstehen, die an passiven Erziehungsobjekten vorgenommen werden, bringen<br />
sie nicht Freiheit, son<strong>der</strong>n Unfreiheit. Pädagogik ist zwar ein komplexes,<br />
aber doch kein völlig selbstgenügsames Aggregat von Normen <strong>und</strong><br />
Werten, Kenntnissen <strong>und</strong> Handgriffen. Es kommt darauf an, wie man mit<br />
ihr umgeht" (Kupfer, II.: Erziehung —Angriff auf die Freiheit. Essays gegen<br />
Pädagogik, die den Lebensweg des Menschen mit Hinweisschil<strong>der</strong>n umstellt,<br />
Weinheim/Basel 1980, S. 11).<br />
Prof. Helmut Segler, Rudolf Wilke Straße 11, D-3300 Braunschweig 54<br />
54