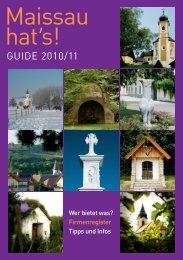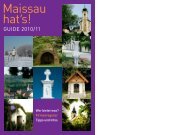Das Schloss Maissau Die Herren von Maissau
Das Schloss Maissau Die Herren von Maissau
Das Schloss Maissau Die Herren von Maissau
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Im Jahre 1645 fiel das <strong>Schloss</strong> und die Befestigung der Stadt dem Schwedensturm zum<br />
Opfer. Heute stellt das <strong>Schloss</strong> dem Betrachter 2 verschiedene Bilder dar. Von der Stadt her<br />
trägt der Südtrakt seit dem Umbau gegen Ende des 19. Jahrhunderts<br />
das Gepräge romanisch-neugotischen Stiles. Der ältere und dem<br />
Wald zu gelegenen Teil stammt aus dem 15. Jahrhundert und offen-<br />
bart noch frühgotische Bauweise, vor allem der Wart- und Wehrturm.<br />
Hier liegt der herrliche <strong>Schloss</strong>wald. In seinem Bann hätten Joseph<br />
<strong>von</strong> Eichendorff die bekannten Verse in den Sinn kommen können:<br />
O Täler weit, o Höhen – o schöner, grüner Wald<br />
Du meiner Lust und Wehen andächtiger Aufenthalt!<br />
Da draußen, stets betrogen, - saust die geschäft ’ ge Welt,<br />
Schlag noch einmal die Bogen – um mich, du grünes Zelt!<br />
Der Waldeingang schiebt sich vor bis ins Weichbild der Stadt, wo er<br />
sich schließlich gemeinsam mit dem Ende des “ Quittenganges ”<br />
( b emerkenswert die Johann-Nepomuk-Statue aus dem Jahre 1773<br />
und die Kreuzweg-Tafeln <strong>von</strong> C.Puzzòlo aus dem Jahre 1994 ) mit<br />
den “ Fähnlein der 7 Aufrechten ” verbrüdert, nämlich mit den<br />
Weinkellern, der sich als feuchtfröhliche Schildwache “ Am Berg ”<br />
versammelt haben.<br />
Kunstgeschichtliches:<br />
Hochburg mit Bergfried 13./14. Jahrhundert, im 16. und 17. Jahr-<br />
hundert erweitert; Umbau um zirka 1870 ( 1879 Großteils abgeschlossen? ) , nach Plänen<br />
<strong>von</strong> Johann Julius Romano <strong>von</strong> Ringe und August <strong>von</strong> Schwendenwein<br />
Vorburg<br />
Zugang <strong>von</strong> Süden zur ehemaligen <strong>von</strong> Wehrgraben geschützten<br />
Vorburg, bestehend aus Torturm mit seitlichen Wirtschaftstrakten. Der<br />
zweigeschossige Torturm, errichtet 1879 an der Stelle eines frühneu-<br />
zeitlichen Vorgängerbaus, mit Walmdach auf abgewellten Konsolen<br />
und gekuppelten Rundbogenöffnungen mit Balustraden im Oberge-<br />
schoß. Stadtseitig eingemauerte skulptierte Wappen in rechteckigen,<br />
verstäbten Rahmungen, links Allianzwappen Abensperg-Traun, be-<br />
zeichnet 1563, rechts Allianzwappen Traun-Polheim, bezeichnet 1583, sowie mittleres<br />
Wappen mit reicher Kartusche, Rahmen bezeichnet 1460.<br />
Beiderseits des Torturmes die langgestreckten, niedri-<br />
gen, zweigeschossigen Wirtschaftstrakte, der östlich aus<br />
den 17. Jahrhundert mit steilem Satteldach und Stich-<br />
kappentonnengewölbe mit angeputzten Graten im<br />
Erdgeschoß, über dem Portal an der West-Seite Kartu-<br />
sche mit Allianzwappen Traun-Zinzendorf, bezeichnet<br />
1638; der westliche Trakt umgebaut um 1896 mit gekup-<br />
pelten Rundfenstern und Polygonalerker.<br />
<strong>Die</strong> Vorburg mit der Hochburg durch seitlich, eine weite<br />
Hofanlage eingrenzende Wehrmauern ( direkte Fortset-<br />
zung der Stadtbefestigung ) verbunden. Im Nord-Westen Zugang zur Hochburg Terrasse<br />
über kleinen, an die Felswand gestellten hexagonalen Wendeltreppenturm mit Pyramiden-<br />
dach, bezeichnet 1879, über dem Portal Wappen der Abensperg-Traun, im Turmoberge-<br />
schoß Fensterscheiben mit Wappen der Herrschaftsfamilien.<br />
Hochburg<br />
Unregelmäßiger Komplex aus verschiedenen Bauzeiten, <strong>von</strong> Resten der mittelalterlichen<br />
Wehranlage umgeben, um kleinen, annähernd quadratischen, sich nach Süden zu haken-<br />
förmig fortsetzenden Hof. Bestimmt <strong>von</strong> den umfassenden baulichen Veränderungen der 2.<br />
Hälfte des 19. Jahrhunderts.<br />
Ältester Teil der mächtige frühgotische Bergfried des 13. Jahrhunderts in der Nord-Ost-<br />
Ecke, im Attikageschoß mit 4 polygonalen turmartigen<br />
Eckerkern, 16. Jahrhundert ( ? ) , das steile Walmdach<br />
und die zierlichen Erkerdächer um 1870; ostseitig frühgoti-<br />
sche Fenster mit Wulstrahmungen sowie Gießerker auf<br />
Kragsteinen; innen hohes Kreuzgratgewölbe auf zarten<br />
Konsolen, 13. Jahrhundert.<br />
Zur mittelalterlichen Anlage gehörig der südlich anschlie-<br />
ßende, heute 2geschossige Trakt, ebenerdig gotische Halle<br />
14. Jahrhundert, mit Kreuzrippengewölbe auf Rundpfeilern<br />
( 2 :3 Achsen ) , seit 1964 Kapelle; darüber ehemaliges Schloßtheater ( vermutlich 16./17.<br />
Jahrhundert ) 1870 abgetragen, 1920 Errichtung eines herrschaftlichen Stiegenhauses.