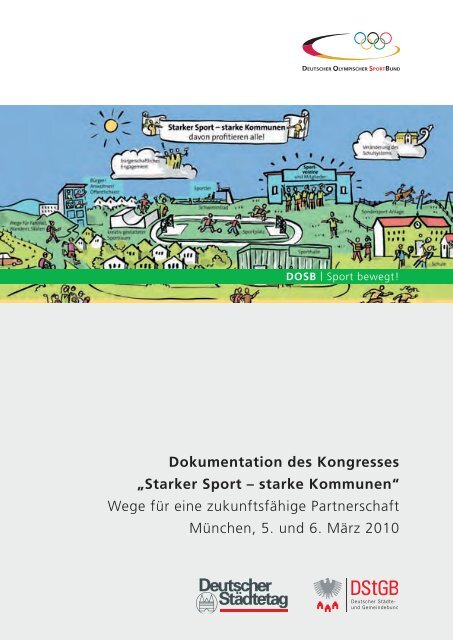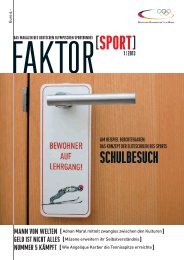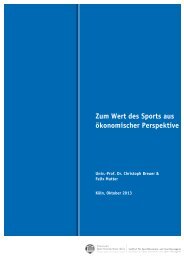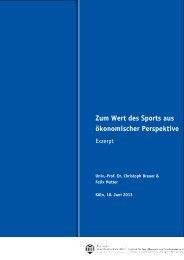Dokumentation des Kongresses - Der Deutsche Olympische ...
Dokumentation des Kongresses - Der Deutsche Olympische ...
Dokumentation des Kongresses - Der Deutsche Olympische ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
DOSB l Sport bewegt!<br />
<strong>Dokumentation</strong> <strong>des</strong> <strong>Kongresses</strong><br />
„Starker Sport – starke Kommunen“<br />
Wege für eine zukunftsfähige Partnerschaft<br />
München, 5. und 6. März 2010
Impressum<br />
Titel: <strong>Dokumentation</strong> <strong>des</strong> <strong>Kongresses</strong> „Starker Sport – starke Kommunen“ I Herausgeber: <strong>Deutsche</strong>r <strong>Olympische</strong>r SportBund I<br />
Geschäftsbereich Sportentwicklung I Ressort Breitensport, Sporträume I Otto-Fleck-Schneise 12 I D-60528 Frankfurt am Main<br />
Tel. +49 (0) 69 / 67 00 360 I Fax. +49 (0) 69 / 67 00 13 60 I E-Mail: siegel@dosb.de I www.dosb.de<br />
Redaktion: Christian Siegel, Andreas Klages I Auflage: 2.500 (Frankfurt am Main, Oktober 2010)
DOSB l Sport bewegt!
Inhaltsverzeichnis<br />
Vorwort 6<br />
Programm 7<br />
Eröffnung<br />
Dr. Thomas Bach 8<br />
Heinrich Haasis 12<br />
Hauptreferat „Starker Sport –<br />
starke Kommunen“, Christian Ude 14<br />
Arbeitskreis 1<br />
Integration durch Sport in der Kommune 22<br />
Arbeitskreis 2<br />
Sportgroßveranstaltungen – Fluch oder Segen? 36<br />
Arbeitskreis 3<br />
Bürgerschaftliches Engagement in der<br />
Kommune – sportliche Ansätze und<br />
kommunale Strukturen 43<br />
Arbeitskreis 4<br />
Quo vadis Sportentwicklung? – Wege und<br />
Methoden für optimierte Entscheidungen 54<br />
Arbeitskreis 5<br />
Leistungssportförderung vor Ort –<br />
Erfolgsfaktor für den Spitzensport 64<br />
Arbeitskreis 6<br />
Sportorganisationen und Kommunen –<br />
starke Partner im Bereich Gesundheit 75<br />
Arbeitskreis 7<br />
Sportvereinsentwicklung im Kontext<br />
schulpolitischer Veränderungen 88<br />
Arbeitskreis 8<br />
Sport fördert die Lebensqualität<br />
aller Generationen vor Ort 104<br />
Arbeitskreis 9<br />
Frauensport(T)räume – der Genderund<br />
Diversityansatz in der kommunalen<br />
Sportentwicklungsplanung 116<br />
Arbeitskreis 10<br />
„Sportstätten der Zukunft“ versus<br />
„Bau- und Planungsrecht“ 124<br />
Arbeitskreis 11<br />
Streit um Lärm – Lärmschutz:<br />
Engpassfaktor der Sportentwicklung? 136<br />
Arbeitskreis 12<br />
Sportförderung und -finanzierung:<br />
Routine versus Königswege? 156<br />
Bilanz und Ausblick 178<br />
Kongressbild 184<br />
Kooperationsvereinbarung 187<br />
Erklärung <strong>des</strong> Präsidiums <strong>des</strong> DOSB 200<br />
Presse 202<br />
Kongressleitung 218<br />
Teilnehmerinnen und Teilnehmer 220<br />
Impressum 2<br />
I 5
Vorwort<br />
Die enge Zusammenarbeit von Kommunen und Sportorganisationen ist für die Entwicklung in den Städten<br />
und Gemeinden wie für den Sport von großer Bedeutung. Im Rahmen <strong>des</strong> <strong>Kongresses</strong> „Starker Sport – starke<br />
Kommunen“ am 5. und 6. März 2010 in München haben der <strong>Deutsche</strong> <strong>Olympische</strong> Sportbund (DOSB), der<br />
<strong>Deutsche</strong> Städtetag (DST) und der <strong>Deutsche</strong> Städte- und Gemeindebund (DStGB) diese Kooperation bilanziert<br />
und Perspektiven für ihre Zusammenarbeit entwickelt.<br />
Die Qualität der Sportanlagen vor Ort sowie die ideelle und finanzielle Unterstützung der Sportvereine sind<br />
wichtige Voraussetzungen für eine vielfältige und aktive Sportlandschaft. Gleichzeitig verbindet sich mit<br />
dem Sport ein hohes Maß an Lebensqualität in den Kommunen: er eröffnet Chancen für Integration sowie<br />
Gesundheitsförderung und kann in vielen Bereichen der Stadtentwicklung eine wichtige Rolle spielen.<br />
Sportvereine, Kommunalpolitik und Sportverwaltung sind einem starken gesellschaftspolitischen<br />
Veränderungsdruck ausgesetzt und mit einer Krise der öffentlichen Haushalte konfrontiert.<br />
<strong>Der</strong> Kongress diskutierte nicht nur diese Engpässe und Herausforderungen, sondern auch Zukunftsstrategien<br />
und Lösungswege jenseits von Patentrezepten, die immer weniger greifen.<br />
<strong>Der</strong> <strong>Deutsche</strong> <strong>Olympische</strong> Sportbund, der <strong>Deutsche</strong> Städtetag und der <strong>Deutsche</strong> Städte- und Gemeindebund<br />
arbeiten seit vielen Jahren kontinuierlich und partnerschaftlich zusammen. Diese Zusammenarbeit wurde<br />
2008 mit einer Kooperationsvereinbarung konkretisiert und intensiviert. <strong>Der</strong> Münchner Kongress im März 2010<br />
ist zugleich ein Meilenstein dieser Vereinbarung.<br />
<strong>Der</strong> vorliegende <strong>Dokumentation</strong>sband gibt die Hauptreden, Expertenvorträge und die Zusammenfassungen<br />
der Arbeitskreise wieder und ist eine reichhaltige Quellen- und Materialsammlung für eine zukunftsfähige<br />
Entwicklung <strong>des</strong> „Sports vor Ort“.<br />
Oberbürgermeisterin<br />
Dr. h.c. Petra Roth<br />
Präsidentin<br />
<strong>Deutsche</strong>r Städtetag<br />
6 I<br />
Dr. Thomas Bach<br />
Präsident <strong>Deutsche</strong>r<br />
<strong>Olympische</strong>r Sportbund<br />
Bürgermeister<br />
Roland Schäfer<br />
Präsident<br />
<strong>Deutsche</strong>r Städte- und<br />
Gemeindebund
Programm<br />
1. Tag: Freitag, 5. März 2010<br />
bis 12.00 Uhr Anreise der Kongressteilnehmerinnen und -teilnehmer<br />
12.00 Uhr Imbiss<br />
13.00 Uhr Eröffnung<br />
Christian Ude, Oberbürgermeister der Lan<strong>des</strong>hauptstadt München<br />
Dr. Thomas Bach, Präsident <strong>des</strong> <strong>Deutsche</strong>n <strong>Olympische</strong>n Sportbun<strong>des</strong><br />
Heinrich Haasis, Präsident <strong>des</strong> <strong>Deutsche</strong>n Sparkassen- und Giroverban<strong>des</strong><br />
14.30 Uhr Kaffeepause<br />
15.00 Uhr Arbeitskreise 1 bis 6<br />
Hauptreferat: „Starker Sport – starke Kommunen“<br />
Christian Ude, Oberbürgermeister der Lan<strong>des</strong>hauptstadt München und<br />
Vizepräsident <strong>des</strong> <strong>Deutsche</strong>n Städtetages<br />
17.30 Uhr Ende der Arbeitskreise<br />
Anschließend Führungen durch den Olympiapark bzw. die BMW Welt<br />
19.30 Uhr Abendveranstaltung in der BMW Welt<br />
2. Tag: Samstag, 6. März 2010<br />
09.00 Uhr Eröffnungs-Plenum<br />
09.30 Uhr Arbeitskreise 7 bis 12<br />
11.30 Uhr Kaffeepause<br />
12.00 Uhr Bilanz und Ausblick<br />
13.00 Uhr Mittagsimbiss<br />
13.30 Uhr Abreise<br />
I 7
Dr. Thomas Bach, Präsident <strong>des</strong><br />
<strong>Deutsche</strong>n <strong>Olympische</strong>n Sportbun<strong>des</strong><br />
8 I<br />
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Ude,<br />
sehr geehrter Herr Haasis,<br />
sehr geehrter Herr Lommer,<br />
sehr geehrte Damen und Herren,<br />
im Namen <strong>des</strong> <strong>Deutsche</strong>n <strong>Olympische</strong>n Sportbun<strong>des</strong><br />
begrüße ich Sie sehr herzlich zum Kongress „Starker<br />
Sport – starke Kommunen“ im Olympiapark München.<br />
Mein besonderer Willkommensgruß gilt dem Oberbürgermeister<br />
der Lan<strong>des</strong>hauptstadt München und<br />
Vizepräsidenten <strong>des</strong> <strong>Deutsche</strong>n Städtetages, Herrn<br />
Christian Ude, sowie dem Präsidenten <strong>des</strong> <strong>Deutsche</strong>n<br />
Sparkassen- und Giroverban<strong>des</strong>, Herrn Heinrich Haasis.<br />
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, lieber Herr Ude,<br />
wie Sie wissen, bin ich derzeit recht häufig in München.<br />
Und spätestens nach dem Erlebnis vom Dienstag dieser<br />
Woche noch viel lieber als zuvor. Ich danke Ihnen und<br />
der Stadt München für den großartigen Empfang unserer<br />
Olympiamannschaft vor wenigen Tagen.<br />
München und Olympia<br />
Am Dienstag haben die Münchner uns allen gezeigt,<br />
was Sportbegeisterung einer Stadt wirklich bedeutet.<br />
Tausende Münchner haben sich auch von strömendem<br />
Regen nicht abhalten lassen, die deutsche Olympiamannschaft<br />
von Vancouver herzlich willkommen zu<br />
heißen. Das war ein beeindrucken<strong>des</strong> Bild, für die Athleten<br />
ebenso wie für alle anderen Beteiligten. Es war<br />
zugleich ein Schub für die Münchner Bewerbung um die<br />
<strong>Olympische</strong>n Winterspiele und Paralympics 2018, wie<br />
man ihn sich deutlicher und fröhlicher nicht hätte wünschen<br />
können. Nach diesem Erlebnis bin ich mir sicher,<br />
dass unsere Bewerbung auf gutem Wege ist.<br />
Kein Ort in Deutschland ist geeigneter als München,<br />
den Beweis anzutreten, dass mit dem Sport vielfältige
Potenziale und Vorteile für die Stadtentwicklung verbunden<br />
sind. Wir sind daher ganz bewusst in den Olympiapark<br />
gekommen, um dies zu unterstreichen.<br />
Die Bewerbung Münchens um die <strong>Olympische</strong>n Winterspiele<br />
und Paralympics 2018 wird sich zudem positiv<br />
auf die Sportentwicklung in ganz Deutschland auswirken.<br />
Das ist ein wichtiges Signal in diesen Zeiten, in denen<br />
Kommunalpolitiker Städte und Gemeinden vor dem finanziellen<br />
Kollaps sehen, der <strong>Deutsche</strong> Städtetag Alarm<br />
schlägt und die Wochenzeitung „Die Zeit“ die Kommunen<br />
schlicht zu den Verlierern der aktuellen Finanzentwicklung<br />
und Finanzpolitik erklärt. Dies zeigt deutlich,<br />
dass der Sport viele Freunde, Partner und Unterstützer<br />
braucht. Hierzu zählt auch die Wirtschaft. Ich bin daher<br />
dem DSGV-Präsidenten dankbar, dass er nicht nur diesen<br />
Kongress unterstützt, sondern auch heute persönlich<br />
gekommen ist.<br />
Lieber Herr Haasis, ich darf auch an dieser Stelle der Sparkassengruppe<br />
als größtem nicht-öffentlichem Sportförderer<br />
in Deutschland für die Unterstützung <strong>des</strong> Breiten- und<br />
Leistungssports sowie der Olympiabewerbung danken.<br />
Kommunen und Sport –<br />
eine starke Partnerschaft<br />
Die öffentliche Sportförderung in Deutschland ist zu<br />
80 Prozent kommunale Sportförderung. In dieser Zahl wird<br />
deutlich, wie wichtig die Städte und Gemeinden für den<br />
organisierten Sport sind. Ich darf mich daher bei allen<br />
kommunalen Vertretern für die Kooperation und Unterstützung<br />
der Kommunen herzlich bedanken.Eine Krise<br />
der Kommunalfinanzen ist daher auch eine Krise <strong>des</strong><br />
Sports. <strong>Der</strong> <strong>Deutsche</strong> <strong>Olympische</strong> Sportbund blickt mit<br />
Sorge auf die Verschlechterung der kommunalen Einnahmensituation,<br />
auf die Unterdeckung der örtlichen Haushalte<br />
und darauf, dass staatliche Aufgaben immer mehr<br />
auf die Kommunen übertragen werden.<br />
<strong>Der</strong> kommunale Investitionsstau von 700 Milliarden Euro<br />
droht sich weiter zu verschärfen. Das Konjunkturpaket II<br />
verschafft dem Sport und den Sportvereinen insgesamt<br />
zwar Spielraum, doch werden die Fragezeichen immer<br />
größer, wie ab 2011 mit der kommunalen Sportförderung<br />
umgegangen wird.<br />
<strong>Der</strong> organisierte Sport ist vor diesem Hintergrund politisch<br />
an der Seite der Kommunen, wenn es darum geht, die<br />
kommunalen Finanzen angemessen auszustatten und die<br />
Einnahmen der Kommunen zu verstetigen. <strong>Der</strong> organisierte<br />
Sport braucht finanzstarke Kommunen. Aber die<br />
Kommunen brauchen auch einen starken Partner Sport.<br />
Die Zusammenarbeit zwischen Kommunen und Sportvereinen<br />
ist von zentraler Bedeutung. Das wird in Zeiten<br />
knapper Kassen wieder bewusster wahrgenommen. Das<br />
muss keine schlechte Grundlage sein, um der Zusammenarbeit<br />
neue Impulse zu geben. <strong>Der</strong> Sport und die<br />
Sportvereine tragen in hohem Maße zur Lebensqualität<br />
bei. <strong>Der</strong> Sport macht Wohnorte zu lebenswerten Orten.<br />
Er schafft Bindung, steht für Identifikation und gemeinschaftlichen<br />
Zusammenhalt. Ein starker Sport macht Kommunen<br />
stark und attraktiv und zu Orten mit hoher<br />
Lebensqualität. Ein gutes Beispiel dafür, was Vereine auf<br />
den verschiedensten Feldern leisten, ist die Auszeichnung<br />
„Sterne <strong>des</strong> Sports“, die der <strong>Deutsche</strong> <strong>Olympische</strong><br />
Sportbund jährlich vergibt, vor wenigen Tagen in Berlin<br />
zum sechsten Mal, in Anwesenheit von Bun<strong>des</strong>kanzlerin<br />
Angela Merkel. Die Auszeichnung steht in besonderer<br />
Weise für die große Vielfalt <strong>des</strong> Sports und die Bereitschaft<br />
der Vereine, gesellschaftliche Verantwortung zu<br />
übernehmen.<br />
<strong>Der</strong> Wettbewerb umfasst zehn Kategorien: von Gesundheits-,<br />
Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen über Angebote<br />
für Kinder, Jugendliche, Familien und Senioren bis<br />
zur Förderung der Leistungsmotivation und Integration.<br />
Diesmal haben insgesamt mehr als 2.500 Sportvereine<br />
ihre Bewerbungen eingereicht.<br />
I 9
Dr. Thomas Bach, Präsident <strong>des</strong><br />
<strong>Deutsche</strong>n <strong>Olympische</strong>n Sportbun<strong>des</strong><br />
Ein weiteres Beispiel ist die Integration, eine der größten<br />
gesellschaftspolitischen Aufgaben der Gegenwart. Sie<br />
kann nirgendwo sonst so gut erfüllt werden wie im Sport<br />
– Sport ist gelebte Integration. Tagtäglich treiben überall<br />
in Deutschland Menschen unterschiedlicher Herkunft,<br />
Hautfarbe, Religion, sozialer Stellung oder Weltanschauung<br />
gemeinsam Sport, lernen sich kennen und respektieren.<br />
Seit fast 21 Jahren erfüllt der Sport <strong>des</strong>halb<br />
selbstverständlich die Aufgaben jenes Projektes, das er<br />
1989 auf Wunsch der Bun<strong>des</strong>regierung startete unter<br />
dem damaligen Titel „Sport für alle – Sport mit Aussiedlern“.<br />
Daraus ist längst mehr geworden. Beispielsweise<br />
unser Projekt „Migrantinnen in den Sport“, in dem Vereine<br />
mit Verbänden und anderen kommunalen Partnern<br />
zusammenarbeiten.<br />
Auch eine zeitgemäße kommunale Gesundheitspolitik<br />
kann nicht auf präventive Ansätze verzichten. Auch hier<br />
sind wir wieder beim Sport und dem flächendeckenden<br />
Angebot der Sportvereine. Ich appelliere daher an die<br />
kommunalen Vertreter, diese Potenziale noch stärker zu<br />
nutzen und den Sport noch umfassender in ihre politischen<br />
Strategien einzubeziehen. Gleichzeitig empfehle<br />
ich den Sportvereinen, sich vor Ort noch stärker zu vernetzen<br />
und die Kooperationen zu intensivieren. Mehr<br />
Netzwerkpartner und mehr Kooperationen erweitern unsere<br />
Handlungsmöglichkeiten.<br />
Nehmen wir das Beispiel Bildung. Die Bedingungen,<br />
wie Kinder und Jugendliche aufwachsen, haben sich deutlich<br />
geändert, ausgelöst durch die Diskussion über die<br />
PISA-Studien zu den Rahmenbedingungen schulischer<br />
und auch außerschulischer Bildung. Die Entwicklung zur<br />
Ganztagsschule ist umunkehrbar und verändert die Lebenswelt<br />
von Kindern und Jugendlichen. Gleichzeitig<br />
spielt Bildung in immer jüngeren Altergruppen und in<br />
immer mehr Institutionen der Kinder- und Jugendhilfe<br />
eine große Rolle. Neben der Schule rückt vermehrt informelles<br />
Lernen in den Blick, wie zum Beispiel Lernen im<br />
Sportverein.<br />
10 I<br />
Für den organisierten, gemeinnützigen Sport kommt es<br />
<strong>des</strong>halb darauf an, systematisch den Anschluss an die<br />
Entwicklung zur Ganztagsschule sicherzustellen. Die Gestaltung<br />
<strong>des</strong> Lebensortes Schule muss auch in einem<br />
Ganztagsschulkonzept die vielfältigen Interessen von<br />
Kindern und Jugendlichen berücksichtigen. Dies liegt<br />
im ganz besonderen Interesse aller am Bildungserfolg Beteiligten,<br />
denn durch neueste pädagogische Studien ist<br />
eindeutig bewiesen, was schon die alten Römer gewusst<br />
haben: „Mens sana in corpore sano“ – auf neues Bildungsstudiendeutsch<br />
übersetzt: Sport und Bewegung<br />
fördern kognitives Lernen.<br />
An diesem Prozess sind verschiedene Institutionen<br />
beteiligt: die Kinder- und Jugendhilfe, die Schule, der<br />
organisierte Kinder- und Jugendsport (Sportvereine,<br />
Sportorganisationen, Jugendverbände im Sport) die örtlichen<br />
Jugend- und Schulämter, die Kinder- und Jugendhilfeausschüsse,<br />
etc. Es ist zwingend notwendig, dass<br />
Sportvereine an der Entwicklung solcher Bildungskonzepte<br />
beteiligt sind und auch im kommunalen Bildungsmanagement<br />
mitwirken.<br />
Das heißt erstens, dass alle Strukturen, die sich im Schulsport<br />
bilden, eine enge Verbindung zum Sportverein<br />
haben müssen. Das heißt zweitens, dass die Netzwerkarbeit<br />
zwischen Sportverein, Schule und Kommune professionalisiert<br />
werden muss und dass hauptamtlich besetzte<br />
zentrale Beratungs- und Koordinierungsstellen bei den<br />
Stadt- und Kreissportbünden einzurichten und bedarfsgerecht<br />
zu erweitern sind. Und das heißt drittens, sicherzustellen,<br />
dass adäquate und ausreichende Sportstätten<br />
zur Verfügung stehen, die sowohl den Anforderungen <strong>des</strong><br />
Schulsports als auch <strong>des</strong> Vereinssports Rechnung tragen.
Demonstrative Sportfreundlichkeit<br />
in den Kommunen<br />
Wir beobachten in den Kommunen gelegentlich eine eher<br />
resignative Sportpolitik. Das müssen wir ersetzen durch<br />
eine demonstrative Sportfreundlichkeit. <strong>Der</strong> Sport ist heute<br />
ein zentrales Politikfeld mit großer gesellschaftlicher Bedeutung.<br />
Sport sichert nicht nur Bildung, Integration und<br />
Prävention, es ist Garant für hohe Lebensqualität in allen<br />
Gemeinden. Wir, Kommunen und Sportorganisationen,<br />
brauchen <strong>des</strong>halb eine noch engere Zusammenarbeit auf<br />
der Basis abgestimmter Strategien.<br />
Ich kann mich, lieber Herr Ude, sehr gut daran erinnern,<br />
wie wir vor etwas mehr als zweieinhalb Jahren hier in<br />
München in Ihrem Rathaus gemeinsam eine Intensivierung<br />
der Zusammenarbeit zwischen dem DOSB und den kommunalen<br />
Verbänden auf den Weg gebracht haben. Daraus<br />
wurde eine Kooperationsvereinbarung, die wir Ende 2008<br />
veröffentlicht haben. Mit diesen Handlungsempfehlun-<br />
gen wollen wir gemeinsam Anregungen und Impulse zur<br />
Weiterentwicklung der Zusammenarbeit von Kommunen<br />
und organisiertem Sport geben.<br />
Dieser Kongress ist somit ein Baustein unserer Vereinbarung.<br />
Es freut mich, dass wir mit dem Kongressort<br />
München an den Ausgangspunkt dieses Prozesses zurückgekehrt<br />
sind. Ich darf Ihnen, Herr Oberbürgermeister<br />
Ude, für die Unterstützung dieses <strong>Kongresses</strong> herzlich<br />
danken. Wir freuen uns auf Ihr Hauptreferat.<br />
Ich wünsche allen Kongressteilnehmerinnen und -teilnehmern<br />
interessante Diskussionen, positive Anregungen<br />
für die weitere Arbeit, angenehme persönliche Kontakte<br />
und Gespräche und uns allen gemeinsam einen guten<br />
Beginn für eine noch intensivere Zusammenarbeit zum<br />
Vorteil <strong>des</strong> Sports, zum Vorteil für unsere Städte und Gemeinden<br />
und vor allem zum Vorteil der dort lebenden<br />
Menschen.<br />
I 11
Heinrich Haasis, Präsident <strong>des</strong> <strong>Deutsche</strong>n Sparkassenund<br />
Giroverban<strong>des</strong><br />
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Ude,<br />
sehr geehrter Herr Dr. Bach,<br />
meine Damen und Herren,<br />
Fair. Menschlich. Nah.<br />
Unter dieser Maxime sind Sparkassen in allen Regionen<br />
Deutschlands aktiv. Und gerade in den Turbulenzen der<br />
Finanzkrise haben sich die Sparkassen und ihr Geschäftsmodell<br />
erneut bewährt: als stabiler Anker <strong>des</strong> Finanzplatzes<br />
Deutschland. Die Sparkassenidee ist über 200 Jahre<br />
alt, doch dabei kein bisschen altmodisch. Es sind Sparkassen,<br />
die gewährleisten, dass der deutschen Wirtschaft<br />
genügen Finanzmittel zur Verfügung gestellt werden.<br />
Es sind die Sparkassen, die den Bürgerinnen und Bürgern<br />
überall in den Regionen einen sicheren Zugang zu Finanzdienstleistungen<br />
ermöglichen – und eine 100-prozentige<br />
Einlagensicherung garantieren. Und es ist das<br />
Geschäftsmodell der Sparkassen, das jeden Tag aufs Neue<br />
beweist: Zentrale Werte wie Vertrauen, Verlässlichkeit<br />
und Verantwortung haben in über 200 Jahren nichts von<br />
ihrer Bedeutung verloren.<br />
12 I<br />
Sparkassen sind anders als Banken. Und darauf sind wir<br />
stolz. Denn im Mittelpunkt unserer Geschäftsphilosophie<br />
und unserer Geschäftspolitik steht der Mensch. Wir sind<br />
lokale Geldinstitute. Wir arbeiten dort, wo unsere Kunden<br />
leben. Unsere Mitarbeiter treffen die Kunden in<br />
der Nachbarschaft, im Verein und in der Freizeit. Jeder<br />
Einzelne von Ihnen ist Botschafter unserer besonderen<br />
Sparkassen-Philosophie. Gerade weil wir in der Region<br />
zu Hause sind, kennen wir die Sorgen und Nöte der<br />
Menschen. Sparkassen sind kommunal gebundene Kreditinstitute,<br />
<strong>des</strong>halb ist es Teil ihres Selbstverständnisses,<br />
sich überall im Land zu Kunst und Kultur, Wissenschaft<br />
und Bildung, Soziales und Sport zu engagieren.<br />
Dieses gemeinwohl-orientierte Engagement war der<br />
Sparkassen-Finanzgruppe in Deutschland 2008 445 Millionen<br />
Euro wert. Über 80 Millionen Euro davon flossen<br />
direkt in die Sportförderung. Hauptziel der Sportförderung:<br />
Die Vereine vor Ort. Die Sparkassen, meine Damen<br />
und Herren, sind Deutschlands Sportförderer Nummer<br />
Eins. Mit den bereits erwähnten 80 Millionen Euro in 2008<br />
wird dies deutlich belegt. Doch Sparkassen sponsern<br />
keine große Fußball-Profi-Vereine. Wir schmücken uns<br />
nicht mit den großen Stars, sind nicht an berühmten<br />
Namen interessiert. Vielmehr kümmern wir uns um die<br />
Vereine vor Ort und um die jungen Talente.<br />
Überall in Deutschland profitieren die Menschen von<br />
sportlichen Angeboten, die von den einzelnen Sparkassen<br />
unterstützt und oft erst ermöglicht werden. Als Sparkassen-Finanzgruppe<br />
wollen wir allerdings nicht nur die<br />
notwendigen sportlichen Rahmenbedingungen schaffen.<br />
Wir fördern den Sport, weil wir Menschen anspornen<br />
wollen: zu besonderen Leistungen, die begeistern und<br />
mitreißen. Damit bleiben die Sparkassen ihrer Geschäftsphilosophie<br />
treu: Fair. Menschlich. Nah. Denn Sparkassen<br />
suchen die Nähe zu ihren Kunden und die Nähe zu den<br />
Bürgern in ihrer Region. Sie und ich wissen, wie wichtig
Vereine für ein Gemeinwesen sind. In den Vereinen findet<br />
ein wesentlicher Teil <strong>des</strong> gesellschaftlichen Lebens statt.<br />
Sparkassen und ihre über 700 Stiftungen unterstützen<br />
die Sportvereine in verschiedenster Form. So werden zum<br />
Beispiel Nachwuchswettbewerbe veranstaltet, verdiente<br />
Sportlerinnen und Sportler der jeweiligen Region geehrt,<br />
Sportfeste und Wettkämpfe organisiert und wichtige<br />
Projekte gefördert. Rund 80 % der Vereine in Deutschland<br />
profitieren so direkt von den Sparkassen in den Regionen.<br />
Ohne dieses Engagement müssten viele Sportvereine ihr<br />
Angebot deutlich einschränken.<br />
Sport begeistert die Menschen: In Deutschland sind<br />
28 Millionen Bürger in rund 91.000 Sportvereinen organisiert.<br />
Dabei sind die Vereine nicht allein ein Treffpunkt<br />
für Sportbegeisterte. Wer sportlich aktiv ist, tut etwas<br />
für seine Gesundheit. Wer Kinder und Jugendliche im<br />
Sportverein trainiert, leistet einen wichtigen Beitrag zur<br />
Persönlichkeitsbildung und Teamfähigkeit junger Menschen.<br />
Insbesondere die Integration ausländischer Mitbürger<br />
gelingt in den Vereinen sehr erfolgreich. Diese<br />
wichtige gesellschaftspolitische Aufgabe hat sich der <strong>Deutsche</strong><br />
<strong>Olympische</strong> Sportbund ganz oben auf seine Agenda<br />
gesetzt. Mit den Sparkassen in den Städten und Gemeinden<br />
hat er einen engagierten Partner.<br />
Olympia Partner Deutschland<br />
Meine Damen und Herren, unser gesellschaftliches Engagement<br />
zu Gunsten <strong>des</strong> Sports erfolgt im Wesentlichen<br />
über das Instrument <strong>des</strong> Sponsoring. Das heißt, für unsere<br />
Leistungen verlangen wir adäquate Gegenleistungen, vor<br />
allem in Form <strong>des</strong> Imagetransfers und kommunikativer<br />
Leistungen <strong>des</strong> Geförderten. Seit nunmehr zwei Jahren<br />
ist die Sparkassen-Finanzgruppe Olympia Partner <strong>des</strong><br />
<strong>Deutsche</strong>n <strong>Olympische</strong>n Sportbun<strong>des</strong>. Das Engagement<br />
reicht dabei vom Breitensport über die Nachwuchsförderung<br />
bis hin zum Spitzensport. <strong>Der</strong> olympische Gedanke<br />
ist dabei der verbindende Aspekt.<br />
Bausteine der Kooperation sind neben der Unterstützung<br />
der Olympiamannschaft die Förderung <strong>des</strong> <strong>Deutsche</strong>n<br />
Sportabzeichens sowie der Eliteschulen <strong>des</strong> Sports. 82 der<br />
insgesamt 153 deutschen Olympioniken von Vancouver<br />
besuchten oder besuchen eine Eliteschule <strong>des</strong> Sports.<br />
Und sie haben unsere Hoffnungen mehr als erfüllt. Ausgedrückt<br />
in Medaillen: 36 der insgesamt 44 Sportler, die<br />
eine Medaille gewannen sind ehemalige und manchmal<br />
noch aktuelle Schülerinnen und Schüler von den Eliteschulen<br />
<strong>des</strong> Sports. Die Sparkassen-Finanzgruppe ist damit<br />
der einzige Olympia Partner, der nicht nur die aktuelle<br />
Olympiamannschaft unterstützt hat, sondern systematisch<br />
und konsequent zur Entwicklung und zum Aufbau der<br />
Mannschaft beiträgt.<br />
München 2018<br />
Seit dem letzten Herbst sind wir nun Nationaler Förderer<br />
der Olympiabewerbung München 2018. Wir erweitern<br />
damit unser gesellschaftliches Engagement und setzen in<br />
einem wirtschaftlich schwierigen Umfeld ein deutliches,<br />
optimistisches Signal für den Sport und für Deutschland<br />
als Austragungsort von sportlichen Großereignissen. Wir<br />
sind überzeugt, dass die <strong>Olympische</strong>n Winterspiele in<br />
München bestens aufgehoben sind. Wir sind sicher, dass<br />
die <strong>Deutsche</strong>n sich vom Olympiafieber anstecken lassen<br />
werden. Und wir stehen <strong>des</strong>halb mit vollem Engagement<br />
hinter der Bewerbung – als Sportförderer Nummer 1, als<br />
Finanzpartner Nummer 1 und als einer der größten Arbeitgeber<br />
am Standort München und in Deutschland.<br />
Diese einmalige Chance für eine Investition in die Zukunft<br />
der bayerischen Lan<strong>des</strong>hauptstadt München, dem Freistaat<br />
Bayern und Deutschlands sollten wir uns nicht entgehen<br />
lassen. Um dieses ehrgeizige Ziel zu erreichen,<br />
bitte ich auch um Ihre Unterstützung.<br />
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!<br />
I 13
Hauptreferat „Starker Sport – starke Kommunen“<br />
Christian Ude, Oberbürgermeister der Lan<strong>des</strong>hauptstadt München und Vizepräsident<br />
<strong>des</strong> <strong>Deutsche</strong>n Städtetages<br />
Meine Damen und Herren,<br />
die Frage gerade bei einem sportbegeisterten und sportpolitisch<br />
erfahrenen Publikum stellt sich sofort: „Ist denn<br />
nicht alles klar?“ Man soll den Sport stärken. Da möchte<br />
man fast sagen, das Konferenzergebnis ist gesichert,<br />
nun macht mal schön. Als wir das Kongressthema vertieft<br />
haben, kam schnell heraus, dass es sehr wohl einige<br />
neue Herausforderungen und neue Fragen gibt. Ich will<br />
nur ein paar Veränderungen andeuten, die deutlich<br />
machen, dass man nicht einfach auf alte sportpolitische<br />
Forderungen rekurrieren und mehr Mittel für den Sport<br />
verlangen kann, sondern sich auch mit neuen Entwicklungen<br />
auseinandersetzen muss.<br />
Erstes Stichwort: Demografischer Wandel. Wir können es<br />
schon nicht mehr hören; es kommt uns zu den Ohren<br />
raus, aber es ist halt trotzdem wahr, dass sich etwas än-<br />
14 I<br />
dert. Z.B., dass es immer mehr Jahrgänge geben wird<br />
wie unsereinen und dass die noch Jahrzehnte vor sich<br />
haben. Dies sind völlig neue Zielgruppen für den Sport,<br />
der bislang natürlich an den jüngeren und körperlich<br />
leistungsstarken Jahrgängen orientiert war, aber jetzt mit<br />
ganzen Lebensdekaden zu tun hat, in denen durchaus<br />
sportliche Aktivität möglich ist und gefördert werden kann.<br />
Und beim demografischen Wandel soll man sich nicht<br />
von vorschnellen Antworten verführen lassen. Ich bringe<br />
von der letzten Hauptversammlung <strong>des</strong> <strong>Deutsche</strong>n Städtetages<br />
ein verkehrspolitisches Beispiel. Wir rechtschaffenen<br />
Kommunalpolitiker haben bisher immer geglaubt,<br />
weil Kinder und Alte wenig mit dem Auto fahren, dass<br />
der demografische Wandel mit immer mehr Alten bedeutet,<br />
dass der motorisierte Verkehr abnehmen wird und<br />
der öffentliche Verkehr dieses Volumen bedienen muss.<br />
Eingehende Untersuchungen haben gezeigt, dass akkurat<br />
das Gegenteil der Fall ist. Die heutige Generation<br />
der 60-Jährigen möchte selbstverständlich, wenn immer<br />
mehr Wehwehchen <strong>des</strong> Alters kommen, auch mit 70, 80<br />
und 90 motorisiert bleiben. Und mit jedem körperlichen<br />
Handicap ist sie stärker auf das eigene Auto angewiesen,<br />
so dass unsere Stadtbaurätin, die eigentlich als Autohasserin<br />
angefangen hat, sich schon zu dem Satz hinreißen<br />
ließ: „<strong>Der</strong> Rollstuhl der Gehbehinderten der Zukunft ist<br />
das Auto“. Alles hat dies bis in die Siedlungsstruktur und<br />
die Verkehrserschließung und für die sog. seniorengerechte<br />
Bauweise enorme Auswirkungen. Ich kann nun<br />
keine Studie vorlegen, die den demografischen Wandel<br />
mit ähnlich abenteuerlichen Auswirkungen für das Sportangebot<br />
ausmalen könnte. Ich warne aber vor der Vorstellung,<br />
dass wir über den demografischen Wandel schon<br />
alles wüssten; auch über die Bedürfnisse und Nachfragesituationen,<br />
die er hervorbringt. Vielleicht sind die Alten,<br />
die es ja noch gar nicht gibt, sondern zu denen wir erst<br />
heranwachsen, ganz anders als wir uns das alte Klischee<br />
vom Altsein vorgestellt haben. Wie werden denn 70-Jährige,<br />
die fit sind wie ein Turnschuh, wie sie immer wieder<br />
so unerträglich oft betonen, wie werden die in 10 oder
20 Jahren sportliche Angebote nachfragen und in Anspruch<br />
nehmen? Eine hochinteressante Frage.<br />
Und wie geht es weiter mit der Infrastruktur der Kommunen?<br />
Ich sage Ihnen in einer etwas saloppen Vereinfachung,<br />
wir sind es 60 Nachkriegsjahre lang gewöhnt,<br />
dass die Infrastruktur der Kommunen immer besser, immer<br />
umfassender, immer aufwändiger wird. Eine lineare<br />
60-jährige Entwicklung, die unser Denken prägt. Entsteht<br />
eine neue Sportart, muss halt eine Halle für diese Sportart<br />
her. Können die Eltern die Kinder nicht betreuen,<br />
müssen Krippen und Kindergärten wie Pilze aus dem Boden<br />
schießen. Die Schließung eines Schwimmba<strong>des</strong><br />
stand ebenso unter Strafe wie die Zusammenlegung von<br />
Bibliotheken. Wir brauchen immer mehr und das immer<br />
besser. Wir sind jetzt am absoluten Ende dieser linearen<br />
Entwicklung angekommen. Nichts spricht dafür, dass die<br />
Kommunen in den nächsten Jahren und Jahrzehnten in<br />
der Lage sein werden, neben den Betriebskosten der bestehenden<br />
Infrastruktur und neben den Investitionen, die<br />
wir schon gefordert und versprochen haben, z.B. den<br />
Ausbau der Kinderbetreuung und neben den Aufgaben,<br />
die wir schon erkannt haben, nämlich neue Integrationsangebote<br />
zu schaffen, auch noch die Sportinfrastruktur<br />
einfach linear weiter verbessern können. Es wird darauf<br />
ankommen, auch mal Zeiten schwindender Mittel zu bewältigen<br />
oder über intensivere Nutzung der vorhandenen<br />
Infrastruktur nachzudenken. Und dann gibt es den gesellschaftlichen<br />
Prozess, der der verbal immer beschworenen<br />
Integration diametral entgegen steht, nämlich die<br />
Realität der Segregation. Wir verzeichnen eine vielfältige<br />
Segregation vor allem in den Großstadtgesellschaften.<br />
Zwischen den Generationen, nicht nur bei Menschen mit<br />
Migrationshintergrund, sondern auch zwischen Einkommensgruppen<br />
oder zwischen Lebensstilen, die entweder<br />
herkunftsbedingt oder einkommensbedingt sind, die<br />
aber miteinander nichts zu tun haben wollen. Umso wichtiger<br />
werden die Integrationsaufgaben, um den sozialen<br />
Zusammenhalt dennoch zu garantieren. Aber es wird<br />
nicht mehr so einfach sein wie in der Vergangenheit,<br />
verschiedene Lebensstile und Altersgruppen zusammenzufassen.<br />
Kurz gesagt, der Sport und damit auch die<br />
Sportpolitik der Kommunen stehen sehr wohl vor völlig<br />
neuen Fragestellungen und noch nicht überschaubaren<br />
Entwicklungen. Dies ist nicht einfach mit einem olympischen<br />
„Schafft mehr Sportstätten, gebt mehr Geld dafür<br />
aus“ zu beantworten.<br />
Zweites Stichwort: Sport und Schule und hier besonders<br />
die Ganztagsschule. Diese stellt eine umwälzende Veränderung<br />
dar und kann Sportstrukturen, die gewachsen<br />
sind, in Frage stellen, kann aber auch eine riesengroße<br />
Chance sein. Ganztagsschule stellt sich in zwei verschiedenen<br />
Formen dar. Es gibt Nachmittagsangebote im<br />
Schulgebäude und auf dem Areal der Schule, die von<br />
den Kommunen irgendwie bespielt werden müssen. Da<br />
werden dann die örtlichen Sportvereine gebeten, Angebote<br />
am Nachmittag zu machen. Das kann diese aber<br />
auch regelrecht auszehren, wenn eine solche eigentlich<br />
staatliche Aufgabe der Nachmittagsschule vom ehrenamtlich<br />
geführten Sportverein organisiert werden soll.<br />
Daneben kennen wir aber auch die schul- und bildungspolitischen<br />
Vorstellungen eines rhythmisierten Unterrichts,<br />
also eines wirklichen echten, auf den ganzen Tag<br />
konzipierten Schulangebots, in dem sich Unterricht, Erholung,<br />
Spiel und Spaß in einer verträglichen Mischung<br />
abwechseln. Da könnten dann die Sportvereine von einer<br />
ganz anderen Seite bedroht werden, weil junge Interessenten<br />
und potentielle Vereinsmitglieder gar keine Chance<br />
mehr haben, einen Sportverein aufzusuchen, sondern<br />
diese Angebote von Schul- und anderen Bildungsträgern<br />
geliefert bekommen. Wir geraten also möglicherweise<br />
entweder in die Situation einer Überforderung der Sportvereine,<br />
schulische Aufgaben übernehmen zu müssen<br />
oder in eine Wettbewerbssituation, weil die Schule nicht<br />
mehr genügend Zeit lässt, um ein traditionelles Engagement<br />
im Verein zu gestalten. Begleitet werden diese Entwicklungen<br />
durch die gymnasialen Schulzeitverkürzung<br />
G8, die auch die Fähigkeit von Schülerinnen und Schülern,<br />
I 15
Hauptreferat „Starker Sport – starke Kommunen“<br />
Christian Ude, Oberbürgermeister der Lan<strong>des</strong>hauptstadt München und Vizepräsident<br />
<strong>des</strong> <strong>Deutsche</strong>n Städtetages<br />
am Nachmittag im Sportverein aktiv zu sein, erheblich einschränkt.<br />
Nicht nur durch schulische Ganztagsangebote<br />
wird das Zeitbudget beschnitten, sondern auch durch die<br />
Belastung mit Lernaufgaben und Nachhilfenotwendigkeiten,<br />
die durch diese Verkürzung von neun auf acht Jahren<br />
bedingt sind. Die Schulen erwarten eine Unterstützung<br />
durch den organisierten Sport, aber das rüttelt an der<br />
klassischen Struktur der Sportvereine. Was passiert denn<br />
in kleineren Kommunen, wenn der Sportverein zwar gerade<br />
noch das Nachmittagsangebot an der Schule sicherstellen<br />
kann, dann aber keine Ressourcen mehr für das<br />
eigene Sportvereinsleben hat? Dies ist eine ganz realistische<br />
Fragestellung. Oder was ist, wenn er, um die eigenen<br />
Strukturen aufrecht erhalten zu können, sich auch noch<br />
an der Schule gewissermaßen an Stelle eingesparter Turnund<br />
Sportlehrer tätig wird. Bei diesen Fragestellungen<br />
wird eine Einsparungslast einfach auf den Sport abgewälzt.<br />
Wenn man genau hinschaut, brauchen wir neue<br />
Antworten, die ich an dieser Stelle nicht aus den Ärmeln<br />
schütteln, sondern nur als Aufgabenstellung und Fragen<br />
benennen kann. Wie werden wir mit dem Thema Ganztagsangebote<br />
in der Schule, Ganztagsschule mit oder<br />
ohne rhythmisierten Angeboten der Schulträger fertig,<br />
wie können wir Sportverein und Schule unter diesen völlig<br />
veränderten Bedingungen, die wir erst seit wenigen<br />
Jahren kennen, optimal verzahnen und das in einer Art<br />
und Weise, bei der die sportlichen Strukturen erhalten<br />
werden und nicht eine Auszehrung oder eine Konkurrenzsituation<br />
aufgenötigt zu bekommen?<br />
Das dritte Stichwort: Sport und Familie. Wir haben demo-<br />
grafische Veränderungen beobachtet und lange genug<br />
öffentlich diskutiert, um zu wissen, dass die Älteren, aber<br />
auch die Familien für die Kommunen eine immer entscheidendere<br />
Rolle spielen werden. Die Familien, nicht<br />
etwa weil ihre Zahl zunimmt, sondern weil diese abnimmt.<br />
Dies ist eine demografische Auszehrung der Kommunen,<br />
der sie entgegenwirken müssen, schon um in der Standortkonkurrenz<br />
zu bestehen. Das verlangt aber besondere<br />
Unterstützungsangebote nicht nur für die ältere Genera-<br />
16 I<br />
tion, weil diese zunimmt, sondern auch für die Familien,<br />
deren Zahl zwar nicht zunimmt, für die die Stadt aber<br />
attraktiver werden muss. Wir müssen um Familien werben,<br />
um sie zu halten, damit sie nicht ins Umland wegziehen<br />
oder um Paare dazu zu ermutigen, Kinder zu bekommen.<br />
Dabei wissen wir: ganz entscheidend sind zunächst die<br />
Kinderbetreuungsangebote. Die Kinderbetreuung unter<br />
drei und über drei Jahren ist für ein Paar, das über die<br />
Familiengründung nachdenkt, das entscheidende Kriterium.<br />
Aber als zweites dürfte schon sehr bald die Frage<br />
kommen, welche Lebensqualität ein Kind und später ein<br />
Jugendlicher an einem Ort auffinden kann, z.B. auch im<br />
Sport. Um es plakativ zu sagen: die Sportangebote tragen<br />
wesentlich zur Attraktivität und Lebensqualität einer<br />
Familie in der Kommune bei. Und sie sind auch ein Entscheidungskriterium,<br />
wo sich eine Familie niederlässt und<br />
wie wohl sie sich an einem Ort fühlt. Wenn man heute ja<br />
alles mit Anglizismen sagen muss, um zu beweisen, dass<br />
man auf der Höhe der Zeit ist, dann hieße das: „Hightech<br />
meets Hightouch“. Menschen, die ihre ganze Ausbildung,<br />
ihre Fort- und Weiterbildung, ihre Berufstätigkeit<br />
und dann auch noch idiotischerweise ihre Freizeit in<br />
fiktiven Welten, in virtuellen Realitäten verbringen, entwickeln<br />
gleichzeitig ein immer intensiveres Bedürfnis<br />
nach tatsächlichen menschlichen Begegnungen. Begegnungen,<br />
die es wirklich gibt, Menschen zu erleben, die<br />
es wirklich gibt, die nicht nur eine virtuelle Darstellung<br />
auf dem Bildschirm sind. Dieses Bedürfnis schreit nach<br />
Sportvereinen. Wo kann man sich mit realen Menschen<br />
messen, mit ihnen die Freizeit verbringen, mit ihnen Geselligkeit<br />
erleben, wenn nicht in Sportvereinen? Gerade<br />
die virtuellen Entwicklungen werden die Notwendigkeit<br />
richtiger menschlicher Kommunikation, menschlichen<br />
Austausches und Wettbewerbs und geselliger Zusammenkünfte<br />
steigern. Dies ist nicht altmodisch wie es oft<br />
in leichtfertigen Urteilen über die Sportvereine und ihre<br />
Mitgliederentwicklung gesagt wird. Wir brauchen die<br />
Sportvereine als Kommunikationsangebot auch in der Zukunft.<br />
Diese müssen sich aber öffnen für Menschen, die
in den kommenden Jahren und Jahrzehnten nun einmal<br />
so sein werden, wie sie sein wollen und eventuell nicht<br />
der klassischen Übungsleitervision entsprechen. Und da<br />
ist ein wenig Modernisierung <strong>des</strong> Selbstverständnisses<br />
auch in den ehrenamtlichen und hauptberuflichen Strukturen<br />
<strong>des</strong> Sports notwendig. Wir wissen aus vielen Befragungen<br />
über Ehrenamtliche, und zwar über solche, die<br />
es tatsächlich sind und solche, die es angeblich oder<br />
wirklich werden wollen, dass die Bereitschaft zum Ehrenamt<br />
heute nach wie vor ungebrochen ist. In bestimmten<br />
Altersgruppen, mit denen der Sport nicht immer was anfangen<br />
kann, sogar zunimmt. Aber dieses Ehrenamt wird<br />
mit den konventionellen Angeboten nicht bedient. Es<br />
gibt kaum noch die Bereitschaft zum Ehrenamt in alter<br />
Form. Darunter leiden die Gewerkschaften, darunter leiden<br />
die Kirchen und die politischen Parteien leiden bloß<br />
<strong>des</strong>halb nicht darunter, weil sie sowieso keinen Nachwuchs<br />
haben. Aber alle Großorganisationen haben damit<br />
zu kämpfen, dass es zwar eine Bereitschaft zum Ehrenamt<br />
gibt, die immer wieder beteuert und auch bewiesen<br />
wird, die sich aber nicht in althergebrachte Strukturen<br />
mit festen zeitlichen Verpflichtungen hineinpressen lässt.<br />
Viele sagen, wie soll das gehen, Übungsleiter müssen<br />
zuverlässig sein, da kann man nicht sagen, nächste Woche<br />
mache ich es und dann drei Wochen seht ihr mich nicht<br />
mehr, das ist mir schon klar. <strong>Der</strong> Sport wird, wie alle anderen<br />
Großorganisationen auch, auf diesen Verhaltenstypus<br />
eingehen müssen. Die Menschen wollen sich nicht<br />
mehr so langfristig binden und in ein Pflichtenkorsett<br />
pressen lassen; sie möchten mehr Spontaneität und Flexibilität<br />
haben. In München haben wir ein Büro für Ehrenamtlichkeit<br />
eingerichtet wie viele andere Städte auch.<br />
Wir haben mit einen immensen Andrang zu tun, was die<br />
Frage nach Möglichkeiten <strong>des</strong> bürgerschaftlichen Engagements<br />
angeht. Wenn den Vereinen die ehrenamtlichen<br />
Helfer ausgehen, müssen sie neue Wege gehen, um wei-<br />
I 17
Hauptreferat „Starker Sport – starke Kommunen“<br />
Christian Ude, Oberbürgermeister der Lan<strong>des</strong>hauptstadt München und Vizepräsident<br />
<strong>des</strong> <strong>Deutsche</strong>n Städtetages<br />
ter auf ehrenamtliche Mitarbeit setzen zu können. Auch<br />
wenn das nicht die klassischen Lebensläufe sind, in der<br />
A-Jugend angefangen und irgendwann Übungsleiter geworden<br />
und das dann 30 Jahre aus Treue zum Verein<br />
weiter gemacht. Das wird es in Zukunft weniger geben<br />
und man wird auf kurzfristige Engagements, auch auf<br />
spontane Interessen, auf befristete Mitarbeitsbereitschaft<br />
zurückgreifen müssen. Wenn dies gewährleistet werden<br />
kann, dann ist der Sport in der Lage, die Attraktivität für<br />
Familien mit Kindern und Jugendlichen auch in Zukunft<br />
sicherzustellen.<br />
Nächstes Stichwort: Sport und Gesundheit. Man braucht<br />
Ihnen nicht darzulegen, welche Bedeutung Sport und<br />
Bewegung bei der Prävention haben, wie wichtig die<br />
Stichworte Bewegungsmangel als Volkskrankheit, Fehlernährung<br />
als Volkskrankheit und Übergewicht als Volkskrankheit<br />
nicht als Statussymbol der Privilegierten, sondern<br />
genauso auch als Massensymptom bei Unterprivilegierten<br />
18 I<br />
ist. Aber diese gesundheitlichen Probleme verlangen<br />
auch zum Teil neue gezielte Antworten und <strong>des</strong>wegen<br />
gebe ich nur zwei Hinweise: Erstens: Die 18.000 qualitätsgesicherten<br />
Angebote <strong>des</strong> DOSB unter dem Siegel<br />
„Sport pro Gesundheit“ sollten noch stärker kommuniziert<br />
werden. Ich glaube, dass die Öffentlichkeit, lustgelenkt<br />
wie sie ist, sich im Moment lieber mehr an olympischen<br />
Siegesfeiern orientiert als am eigenen Problem<br />
der Überernährung. Aber das eigene Problem <strong>des</strong> Übergewichts<br />
ist nun mal mehr und gesundheitspolitisch bedeutsamer;<br />
ich glaube also, dass man diese jetzt nicht so<br />
lustbetonten, nicht so triumphgeschwängerten Themen<br />
verstärkt in die öffentliche Debatte werfen muss. Und<br />
das gilt insbesondere für das neu zu schaffende Präventionsgesetz.<br />
Dort ist es dringend notwendig, Sport und<br />
Bewegung an herausragender Stelle zu definieren. Es darf<br />
nicht zu einer Präventionsdefinition kommen, die vor<br />
allem von kommerziellen Anbietern geprägt wird, die<br />
in Wahrheit viel zu spät mit der Prävention einsetzen.
Sport und Bewegung ist die frühestmögliche Prävention<br />
und sollte <strong>des</strong>halb im Präventionsgesetz auch verankert<br />
werden.<br />
Im Übrigen: Es ist ja nicht so, dass es einen automatischen<br />
Zusammenhang gibt von sportlicher Betätigung und<br />
Gesundheit. Es existieren vielmehr auch sportbedingte<br />
gesundheitliche Risiken und Verschleißerscheinungen.<br />
Dies sollte immer mit berücksichtigt werden.<br />
Fünftes Stichwort: Sport und Integration. Dazu ein ganz<br />
klares Bekenntnis. Ich gebe zu, dass ich auch in meiner<br />
politischen Biografie das Thema Integration viel zu lange<br />
für eine politische Frage gehalten habe, ob man Integration<br />
will oder lieber auf die Rückkehr der Gastarbeiter<br />
nach dem Arbeitsleben setzt, wie es gerade hier in Bayern<br />
lange propagiert worden ist. Dieser politische Streit hat<br />
für die Integration überhaupt nichts gebracht. In der<br />
Zwischenzeit haben die Sportvereine tatsächliche Integration<br />
geleistet und zwar Jahrzehnte lang mit Erfolgsquoten,<br />
die man sich in anderen Bereichen etwa der<br />
Erwachsenenbildung überhaupt nicht vorstellen kann.<br />
Was müssen wir in der Volkshochschule alles anstellen,<br />
um eine Mutter dazu zu bewegen, gegen den Willen<br />
ihres Mannes, während die Kinder in der Schule sind,<br />
einen Volkshochschulkurs Deutsch zu besuchen. Das verlangt<br />
ja eine fast schon geheimdienstliche Absicherung<br />
der Aktion mit Vortäuschung anderer Kursangebote,<br />
damit der Ehemann keine Angst hat, irgendwann kann<br />
die Frau besser deutsch als er. Demgegenüber ist eine<br />
Mitgliedschaft im Sportverein immer schon unverdächtig<br />
gewesen. Man hat zunächst die Sprachbarrieren einfach<br />
überspringen können. Das gelingt nirgendwo so leicht<br />
wie im Sport. Was ich jetzt im Nachhinein auch verstehe:<br />
man muss nur Interviews von Bun<strong>des</strong>ligaspielern im Fernsehen<br />
sehen, um zu wissen, mit welch geringem Wortschatz<br />
man sich als Sportler verständlich machen kann.<br />
Dass soll nicht bösartig klingen, sondern ist eine Anerkennung,<br />
dass der Sport mit Sprachbarrieren die gerings-<br />
ten Probleme hat. Hier erbringt er eine großartige Leistung,<br />
indem Kinder unterschiedlicher Nationalität, Herkunft<br />
und kultureller Prägung sich tatsächlich blitzschnell<br />
am ersten Nachmittag, an dem sie zusammenkommen,<br />
schon auf gemeinsame Spielregeln verständigen können<br />
und die auch einhalten. Das halte ich für eine großartige<br />
Integrationsleistung und <strong>des</strong>wegen sollte der Aspekt Sport<br />
viel selbstbewusster in die Debatte gebracht werden;<br />
beim Integrationsgipfel bei der Bun<strong>des</strong>kanzlerin ist das<br />
schon geschehen. <strong>Der</strong> Sport sichert und ermöglicht Integration<br />
in einer Art und Weise, von der andere Institute<br />
und Fachrichtungen nicht einmal zu träumen wagen.<br />
Da haben die Universitäten und die Schulen weiß Gott<br />
welche Strategien diskutiert. <strong>Der</strong> Sport kann auf jahrzehntelange<br />
Erfolge verweisen und auf Zahlen, die in anderen<br />
Sparten unserer Gesellschaft kaum vorstellbar sind.<br />
Jetzt wird es ungemütlicher.<br />
Stichwort: Sportentwicklung. Ich habe schon angedeutet,<br />
dass dem Anwachsen der Bedürfnisse kein vergleichbares<br />
Anwachsen der finanziellen Möglichkeiten der Kommunen<br />
gegenübersteht. Leider sind die Ansprüche immer<br />
noch erschreckend hoch. Wo immer man sich in der<br />
Nähe von Sportveranstaltungen bewegt, werden im Gespräch<br />
nicht nur Kunstrasenplätze und zusätzliche Vereinsheime,<br />
sondern selbstverständlich auch Dreifachturnhallen<br />
in unterversorgten Stadtteilen, neue Basketballhallen<br />
und weitere Eishallen gefordert, als ob man die aus<br />
dem Ärmel schütteln könnte. Die Wahrheit ist aber, dass<br />
viele Kommunen mit der bloßen Instandhaltung der bestehenden<br />
Infrastruktur schon hoffnungslos überfordert<br />
sind. Deswegen werden wir in Zukunft nicht einfach weiter<br />
Wunschzettel schreiben können. So schwierig dies für<br />
den organisierten Sport auch ist: wir werden höchst unbequeme<br />
Fragen diskutieren müssen, wie z.B. die Frage<br />
der geplanten und baulich von vorneherein vorgesehenen<br />
Mehrfachnutzung oder die Frage der Variabilität, die<br />
man in bestehende Infrastruktur einbauen muss, damit<br />
wir das Weniger, dass wir uns in allen Kommunen auch<br />
I 19
Hauptreferat „Starker Sport – starke Kommunen“<br />
Christian Ude, Oberbürgermeister der Lan<strong>des</strong>hauptstadt München und Vizepräsident<br />
<strong>des</strong> <strong>Deutsche</strong>n Städtetages<br />
in Zukunft noch leisten können, tatsächlich optimal erfüllen.<br />
In aller Deutlichkeit: die Optimierung der Nutzung<br />
und nicht die Verlängerung <strong>des</strong> Wunschzettels sind angesagt.<br />
Das werden die Sportler im Saal nicht gerne<br />
hören, die Kommunalen aber mit Kopfnicken bestätigen.<br />
Ein weiteres Thema, dass uns auf den Nägeln brennt,<br />
ist die Frage „Sportstätten und Nachbarschaft“. Mit einem<br />
absurden Beispiel will ich dies illustrieren. Es gibt in München<br />
ein privilegiertes Viertel, das ist Bogenhausen. Und<br />
dort gibt es eine besonders privilegierte Wohnanlage,<br />
wie mir die Anwohner bestätigen. Dort blickt man vom<br />
zweiten, dritten, vierten Stock das ganze Jahr über auf<br />
den herrlichen Baumbestand <strong>des</strong> Prinzregentenba<strong>des</strong>,<br />
schöner geht es nicht. Aber was sagt mir die Stadtbaurätin<br />
und das auch noch leider zutreffend: diese Häuser<br />
dürften heute nicht mehr gebaut werden. Denn so nah<br />
an einem Schwimmbad erlauben die Immissionswerte<br />
der Baunutzungsverordnung keine Wohnbebauung. Da<br />
frage ich mich manchmal schon, ob wir uns nicht bis zur<br />
Absurdität zu Tode schützen. Wenn wir, das ist die erste<br />
Folgerung, endlich sagen, Kinderlärm ist keine Umweltlast,<br />
sondern Zukunftsmusik, dann muss auch der zweite<br />
Satz folgen dürfen, Sporteinrichtungen sind eine Verbesserung<br />
und Bereicherung der Lebensqualität und sollten<br />
nicht als ein nur noch in Gewerbegebieten erträgliches<br />
Umweltproblem gesetzlich verhindert werden.<br />
Mein vorletztes Stichwort ist nun wieder eher kontrovers,<br />
es ist die Frage der Standards und Pflichtenhefte, die sich<br />
an Sportstätten, Stadien und die Ausrichtung von Großveranstaltungen<br />
richten. Da kracht es auch mal zwischen<br />
den Kommunen und dem organisierten Sport. Ich kann<br />
nur auf die Finanzlage verweisen, die ich schon erwähnt<br />
habe. Es ist gar keine Frage – gerade hier im Olympiapark<br />
– dass höchste architektonische Qualität von Sportstätten<br />
ein Schmuck und eine Zierde der Stadt und ihres Stadtbil<strong>des</strong><br />
darstellen. Wir wissen auch, dass möglichst alle Auflagen<br />
einer Sportdisziplin beachtet werden sollten, wenn<br />
man eine Einrichtung für diese Sportdisziplin schafft und<br />
gleichzeitig auch möchte, dass regionale, nationale und<br />
20 I<br />
internationale Wettbewerbe ausgetragen werden können.<br />
Das ist in Ordnung. Aber ich habe manchmal den Eindruck,<br />
dass die Anforderungen in die Höhe geschraubt<br />
werden und noch mehr in die Höhe und noch mehr in<br />
die Höhe, dass immer mehr Kommunen bei diesem Wettbewerb<br />
die Luft ausgeht. Irgendwann können die Standards<br />
und Pflichtenhefte, auch was Marketing- und<br />
Sponsoringrechte angeht, so anspruchsvoll sein, dass<br />
man nichts mehr für den Sport durchsetzt, sondern ganz<br />
im Gegenteil Partner verliert, weil diese nicht mehr können.<br />
Das bitte ich zu bedenken: ein Mehr an Anforderungen<br />
ist nicht immer ein Mehr an Erfolg. Diese Entwicklung<br />
haben wir im Präsidium <strong>des</strong> <strong>Deutsche</strong>n Städtetages<br />
wiederholt diskutiert. Zum Konfliktthema ist es beim<br />
<strong>Deutsche</strong>n Fußballbund geworden; ich bin aber der Überzeugung,<br />
dass auch alle anderen Disziplinen sich klar<br />
machen müssen, mit wem sie es zu tun haben. Wenn es<br />
hier eine wirklich perfekte Protokollführung gäbe, würde<br />
da jetzt stehen: Beifall der kommunalen Vertreter bei<br />
unverständigem Kopfschütteln der Sportvertreter.<br />
Ich komme zu meiner Schlussbemerkung, die ich mir nicht<br />
verkneifen will und Ihnen nicht ersparen kann. Ist das<br />
Motto dieses <strong>Kongresses</strong> „Starke Kommunen“ wirklich<br />
eine realistische Beschreibung? Noch schaut es ganz gut<br />
aus. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass die Stärke<br />
der Kommunen, den Sport stärken zu können, derzeit<br />
gefährdet ist wie seit Jahrzehnten nicht. Denn wir müssen<br />
die Finanz- und Wirtschaftskrise ausbaden, die uns<br />
noch gar nicht in vollem Umfang erwischt hat. Die Arbeitsmarktfolgen<br />
sind durch Kurzarbeit Gott sei Dank bisher<br />
aufgehalten worden und schlagen jetzt erst durch.<br />
Die steuerlichen Einnahmen sind schon weggebrochen,<br />
aber das kann man ein paar Monate überbrücken und<br />
keiner will mit der Wahrheit rausrücken, bevor die Landtagswahlen<br />
in Nordrhein-Westfalen endlich vorbei sind.<br />
Aber dann, ich sage Ihnen, noch im Mai 2010 werden<br />
Sie hören, wie es wirklich um die öffentlichen Haushalte<br />
steht. Um die kommunalen Finanzen wird es ganz be-
sonders schlecht stehen, weil dem Einbruch bei den Einnahmen<br />
ein Anwachsen bei den Soziallasten gegenübersteht.<br />
Und dies in einem abenteuerlichen Ausmaß, wenn<br />
die Arbeitslosigkeit weiter zunimmt. Und in dieser Situation<br />
wird auch noch die Gewerbesteuer in Zweifel gezogen<br />
durch eine Kommission, die in dieser Woche von<br />
der Bun<strong>des</strong>regierung eingerichtet wurde. Beim Lesen der<br />
Kommentare und Leitartikel der letzten Tage staune ich<br />
wirklich Bauklötze. Mit wie viel Wortgeklingel von Umschichtungen<br />
und Kompensationseffekten, von Ausgabenund<br />
Einnahmenneutralität hier kommentiert wird; es<br />
wird wirklich ein Hütchenspiel betrieben. Man wechselt<br />
so schnell die Worte, bis keiner mehr weiß, wo jetzt das<br />
Geld geblieben ist. Deswegen eine glasklare Aussage,<br />
weil damit das gesamte Motto „Starke Kommunen –<br />
starker Sport“ steht und fällt. Die Gewerbesteuer hat in<br />
einem guten Jahr 40 Mrd. Euro erbracht, in einem schlechten,<br />
nämlich dem letzten, 33 Mrd. Euro. Wir reden also<br />
von 33 bis 40 Mrd. Euro. Wer die Gewerbesteuer abschaffen<br />
will, was jetzt in allen Wirtschaftsteilen der Zeitungen<br />
und Stiftungsmodellen schon wieder gefordert<br />
wird, der nimmt zunächst den Kommunen 33 bis 40 Mrd.<br />
Euro weg. Wohl gemerkt Kommunen, die heute schon<br />
hoffnungslos überschuldet und heute schon so handlungsunfähig<br />
sind, dass dem Oberbürgermeister von Wuppertal<br />
von der Rechtsaufsicht verboten wurde, junge<br />
Leute auszubilden. Er darf keine Verwaltungsinspektoren<br />
und auch keine Stadtgärtner mehr ausbilden. Die Begründung<br />
ist: Du wirst sowie nie wieder Leute einstellen<br />
können, also brauchst du auch keine ausbilden. Dies<br />
wurde rechtsaufsichtlich angeordnet, weil die Kassenlage<br />
nichts anderes hergibt. Und in dieser Situation, in der<br />
sich die Kommunen jetzt schon befinden, sollen 33 bis<br />
40 Mrd. Euro weggenommen werden. Dann heißt aber<br />
der nächste Satz sofort: „Ruhig bleiben, ruhig bleiben,<br />
keine Panik. Es soll ja ein gleichwertiger Ersatz kommen“.<br />
Also 33 bis 40 Mrd. Euro aus einer anderen Quelle. Seltsamerweise<br />
sagt uns niemand, wer um 33 bis 40 Mrd.<br />
Euro mehr belastet werden soll. Man redet von der Umsatzsteuer,<br />
dass hieße der Verbraucher, also alle Bürger<br />
dieses Lan<strong>des</strong>. Man redet von der Einkommens- und Lohnsteuer,<br />
dass hieße, es bleibt noch viel weniger Netto vom<br />
Brutto übrig. Ich habe irgendwie andere Verheißungen<br />
im Ohr. Oder man redet von der Körperschaftssteuer, dann<br />
müsste man doch ganz klar sagen, welche Betriebe sollen<br />
in Zukunft 40 Mrd. Euro mehr bezahlen als jetzt, damit<br />
die heutige Gewerbesteuer verzichtbar ist. Niemand sagt,<br />
woher die Milliarden zusätzlich herkommen sollen. Und<br />
<strong>des</strong>wegen bitte ich den <strong>Deutsche</strong>n Sport, wie er es schon<br />
zu Beginn dieser Dekade vorbildlich gemacht hat, als die<br />
deutschen Bürgermeister in Berlin gegen die Abschaffung<br />
der Gewerbesteuer demonstriert haben zusammen mit<br />
ihrem damaligen Vorsitzenden, Herrn von Richthofen,<br />
um solidarische Unterstützung. Wenn die Kommunen finanziell<br />
ausgeblutet werden, dann befinden sie sich nicht<br />
nur auf der Intensivstation, sondern sind auch vollkommen<br />
außerstande, irgendetwas für den Sport zu tun. Dann<br />
wird es leider überhaupt keine Instandsetzungen, Ausbaumaßnahmen<br />
oder städtische Zuschüsse mehr geben<br />
können. Diesen ernsten Hinweis kann ich Ihnen leider<br />
nicht ersparen, damit das Tagungsmotto realistisch bleibt.<br />
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!<br />
I 21
Arbeitskreis 1: Integration durch Sport in der Kommune<br />
PROF. DR. ULRIKE BURRMANN (TU DORTMUND):<br />
Integrationspotenziale <strong>des</strong> Sports – Erkenntnisse <strong>des</strong><br />
Programms Integration durch Sport<br />
Zur Evaluation <strong>des</strong> DOSB-Programms<br />
Integration durch Sport<br />
Das Programm Integration durch Sport (IdS) ist in mehrfacher<br />
Hinsicht beachtlich dimensioniert: Unter der<br />
Regie <strong>des</strong> <strong>Deutsche</strong>n <strong>Olympische</strong>n Sportbun<strong>des</strong> und in<br />
Abstimmung mit den Lan<strong>des</strong>sportbünden bzw. Lan<strong>des</strong>sportjugenden<br />
der einzelnen Bun<strong>des</strong>länder ist es flächendeckend<br />
verbreitet; etwa 500 Stützpunktvereine wirken<br />
in ihm deutschlandweit mit.<br />
Über 1.100 Übungsleiter betreuen knapp 2.000 integrative<br />
Sportgruppen, in denen insgesamt schätzungsweise<br />
40.000 Teilnehmer gemeinsam Sport treiben, etwa die<br />
Hälfte davon sind Personen mit Migrationshintergrund.<br />
Das Programm ist inhaltlich breit angelegt und umfasst<br />
eine ganze Reihe von verschiedenartigen Programmelementen:<br />
Neben der Integrationsarbeit in den Sportvereinen<br />
sind Starthelfer unterwegs, um die Einrichtung<br />
neuer integrativer Sportgruppen zu initiieren, finden weitere<br />
ein- oder mehrtägige Integrationsmaßnahmen (wie<br />
z.B. Ferienlager oder Sportevents) statt, wird mit Spielmobilen<br />
für das IdS-Programm geworben, werden die<br />
Funktionsträger für ihr Engagement in der sportbezogenen<br />
Integrationsarbeit weiterqualifiziert. Und nicht zuletzt<br />
fließen in das Programm nicht nur Eigenmittel der<br />
Sportorganisationen in beträchtlichem Umfang ein, vielmehr<br />
wird es auch durch Bun<strong>des</strong>mittel mit ca. 5 Mio €<br />
pro Jahr massiv gefördert. Es liegt auf der Hand und bedarf<br />
keiner gesonderten Begründung, dass ein derart voluminöses<br />
Programm wie das IdS-Programm daraufhin<br />
evaluiert werden sollte, ob und inwiefern die mit ihm<br />
verknüpften Erwartungen hinsichtlich der im Sport erreichbaren<br />
Integrationswirkungen in der sozialen Praxis<br />
22 I<br />
<strong>des</strong> (vereinsorganisierten) Sports tatsächlich auch eingelöst<br />
werden. 1<br />
Die empirische Studie war als eine Funktionsträger-<br />
Befragung angelegt, die sich aus drei empirisch abgrenzbaren<br />
Gruppen von Funktionsträgern im IdS-Programm<br />
zusammensetzt: aus den Lan<strong>des</strong>koordinatoren, aus<br />
den Ansprechpartnern der Stützpunktvereine und den<br />
Übungsleitern bzw. Starthelfern. Zunächst wurden 18<br />
Lan<strong>des</strong>koordinatoren (in Ausnahmefällen auch Regionalkoordinatoren)<br />
persönlich-mündlich zu den Aktivitäten<br />
im Rahmen <strong>des</strong> IdS-Programms eingehend befragt. Alle<br />
am Projekt beteiligten Stützpunktvereine wurden über<br />
die Ansprechpartner in eine standardisierte schriftliche<br />
Befragung einbezogen. Sie sind für die Organisation der<br />
Integrationsarbeit in ihren Vereinen verantwortlich. Um<br />
nicht nur Daten auf der Organisationsebene zu erhalten,<br />
wurden schriftliche Befragungen mit unmittelbar beteiligten<br />
Akteuren – mit Starthelfern und Übungsleitern –<br />
zu den praktischen Integrationsmaßnahmen in den Sportgruppen<br />
durchgeführt. Die Rücklaufquoten sind mit<br />
bun<strong>des</strong>weit 68 % bzw. 52 % bei den schriftlichen Befragungen<br />
der Ansprechpartner (N = 336) und der Übungsleiter<br />
(N = 608) ausgesprochen hoch.<br />
Zur argumentativen Grundstruktur und<br />
den Zieldimensionen<br />
Die theoretischen Überlegungen wurden durch die leitende<br />
Frage strukturiert: Durch welche besonderen<br />
Integrationspotenziale zeichnet sich der (vereinsorganisierte)<br />
Sport aus?<br />
1) Die Evaluation <strong>des</strong> DOSB-Programms Integration durch Sport wurde von April 2007 bis März 2009 gefördert durch das BAMF bzw. BMI.
Im Rückgriff auf die Fachliteratur und eigene Studien<br />
zur Integrationsthematik lassen sich solche Integrationspotenziale<br />
plausibilisieren, wobei sich folgende Integrationsdimensionen<br />
auseinander halten und begründen<br />
lassen (vgl. u. a. Baur & Braun, 2003; Baur, 2006): Zum<br />
einen steht eine Integration in den Sport zur Diskussion,<br />
wobei es darum geht, Personen mit Migrationshintergrund<br />
an den Sport heranzuführen und ihre sportlichen Leistungen<br />
zu fördern. Diese Integration in den Sport bildet<br />
aus naheliegenden Gründen die Voraussetzung dafür,<br />
dass zum anderen auch eine Integration durch Sport<br />
angeregt und befördert werden kann. Diese Integration<br />
durch Sport kann als soziale, alltagskulturelle, alltagspolitische<br />
oder sozialstrukturelle Integration gefasst werden:<br />
Die genannten Integrationspotenziale lassen sich als<br />
anzustrebende Integrationsziele definieren. Eine zielorientierte<br />
Integrationsarbeit, so ein weiterer wichtiger<br />
Argumentationsschritt, kann nicht darauf setzen, dass<br />
Integrationsprozesse durch eine Beteiligung an sportlichen<br />
Aktivitäten gleichsam ,von selbst‘ ausgelöst werden,<br />
Integration beim Sporttreiben sozusagen ,automatisch’<br />
bewirkt wird und ,nebenbei mit abfällt’. Die Rede vom<br />
„Sport als gelebter Integration“ legt solche Vorstellungen<br />
zwar nahe, begründet sie aber nicht. Denn es wird dabei<br />
übersehen, dass selbst in manchen Sportgruppen ,jeder<br />
für sich’ sportlich aktiv sein kann, und dass es auch im<br />
Sport anstelle von Integration nicht selten Segregation,<br />
also Abgrenzung gegen andere und Ausgrenzung von<br />
anderen, vorkommt – wenn etwa Vorbehalte und Vorurteile<br />
gegenüber zugewanderten (Mit-)Spielern offen<br />
geäußert oder durch ablehnende Verhaltensweisen signalisiert<br />
werden, oder umgekehrt: indem sich auch<br />
bei gemeinsamem Sporttreiben die Zuwanderer von den<br />
Einheimischen distanzieren. Eine zielorientierte Integrationsarbeit<br />
zeichnet sich dagegen dadurch aus, dass<br />
Integrationsprozesse durch intentionale pädagogische<br />
Arrangements angeregt und gefördert werden. Ihre<br />
Zielorientierung tritt eben darin in Erscheinung, dass sie<br />
die jeweiligen Ziele absichtsvoll anstrebt und die Integrationsarbeit<br />
daraufhin pädagogisch durchdacht plant<br />
und arrangiert. Auch im Sport darf also nicht erwartet<br />
werden, dass Integrationsprozesse ,automatisch ablaufen’,<br />
vielmehr sind sie ,gezielt’ anzuregen, zu unterstützen<br />
und zu fördern.<br />
I 23
Arbeitskreis 1: Integration durch Sport in der Kommune<br />
Bei der Evaluation wurde also folgender Frage empirisch<br />
nachgegangen: Inwiefern werden die verschiedenen Zielsetzungen<br />
durch die Integrationsarbeit im Rahmen <strong>des</strong><br />
Programms Integration durch Sport realisiert? Die nachfolgenden<br />
ausgewählten Befunde und Empfehlungen<br />
beziehen sich auf das skizzierte Raster von Zielsetzungen<br />
von sportbezogenen Zielen über soziale, kulturelle, alltagspolitische<br />
und bis hin zu sozialstrukturellen Integrationszielen.<br />
<strong>Der</strong> Sportverein wird in erster Linie eine Integration in<br />
den Sport anzielen. Es geht um die Heranführung der<br />
Migrantinnen und Migranten an den organisierten Sport.<br />
Es geht aber auch darum, etwas für die Gesundheit und<br />
Fitness zu tun, die sportlichen Leistungen zu verbessern<br />
usw. <strong>Der</strong> (vereinsorganisierte) Sport kann darüber hinaus,<br />
so die Annahme, zur sozialen Integration in die Sportgruppe,<br />
in den Sportverein und womöglich sogar in die<br />
kommunale und regionale Umwelt <strong>des</strong> jeweiligen Vereins<br />
beitragen. Er kann alltagskulturelle ,Normalitätsmuster’,<br />
Kulturtechniken und kulturelle Kompetenzen vermitteln.<br />
Er kann ein Handlungsfeld für alltägliches politisches<br />
Handeln in der unmittelbaren Lebenswelt bereitstellen,<br />
indem er Gelegenheiten zur Beteiligung an der Vereinspolitik<br />
oder zum freiwilligen Engagement eröffnet. Er<br />
24 I<br />
kann vielleicht sogar einen Beitrag zur sozialstrukturellen<br />
Integration leisten, wenn etwa Unterstützungsleistungen<br />
in der Ausbildung erbracht oder bei der Suche nach Arbeitsplätzen<br />
geholfen wird.<br />
Einige Befunde zur Integration<br />
in den Sport<br />
In den meisten Fällen sind Zuwanderer gemeinsam mit<br />
Einheimischen sportlich aktiv. In 8 % aller IdS-Gruppen<br />
sind die MigrantInnen unter sich, in 2 % aller Gruppen<br />
sind weniger als 10 % der TeilnehmerInnen MigrantInnen.<br />
Bezüglich <strong>des</strong> Geschlechts fällt jedoch auf, dass in 27 %<br />
aller Integrationsgruppen keine Frau mit Migrationshintergrund<br />
zu finden ist.<br />
Hinsichtlich der Herkunftsgruppen dominieren in den<br />
Sportgruppen Teilnehmer aus der ehemaligen Sowjetunion,<br />
der Türkei, Polen und dem ehemaligen Jugoslawien.<br />
In drei Viertel aller Integrationsgruppen sind nicht<br />
nur MigrantInnen aus einem Herkunftsland, sondern<br />
Migrantinnen und Migranten verschiedener Herkunftsländer<br />
vertreten.<br />
In den Integrationsgruppen wird erwartungsgemäß eher<br />
deutsch gesprochen, wenn der Zuwandereranteil sehr<br />
niedrig ist und/oder verschiedene Herkunftsgruppen miteinander<br />
Sport treiben.<br />
Hinsichtlich der Altersgruppen dominieren erwartungsgemäß<br />
Heranwachsende. Die Daten deuten darauf hin,<br />
dass jüngere und altersheterogene Gruppen dem Aufbau<br />
multiethnischer Gruppen zuträglicher sind.<br />
Betrachtet man die Sportarten, so wird in den Integrationsgruppen<br />
v.a. Fußball angeboten (in 15 % aller<br />
Gruppen wird Fußball gespielt), gefolgt von Boxen mit<br />
12 %, allgemeine Sport- und Spielgruppen 9 %, Asia-
tische Kampfsportarten 8 % usw. <strong>Der</strong> Zusammenhang<br />
von Sportart und Zuwandereranteil ist v.a. bei den Frauen<br />
besonders eng. Ob und wenn ja, wie viele Migrantinnen<br />
erreicht werden, hängt hochgradig von der Sportart ab.<br />
In fast allen Integrationsgruppen findet das Training<br />
min<strong>des</strong>tens einmal pro Woche statt, in jeder zweiten<br />
Gruppe sogar zwei bis dreimal wöchentlich. Es dominieren<br />
mit 60 % breitensportliche Aktivitäten.<br />
Einige Befunde zur Integration<br />
durch Sport<br />
Neben den sportlichen Aktivitäten in den Sportgruppen<br />
berichten über 80 % der Übungsleiter auch von außersportlichen,<br />
geselligen Aktivitäten, die im letzten halben<br />
Jahr stattgefunden haben. Besonders häufig werden Vereinsfeste<br />
oder das Zusammensitzen vor und nach den<br />
Sportstunden genannt. Darüber hinaus scheinen sich eben<br />
wirklich so was wie soziale Beziehungen und längerfristige<br />
Bindungen zu entwickeln, wenn man die gegenseitigen<br />
privaten Besuche oder das gemeinsame Geburtstag<br />
feiern mitzählt.<br />
Ein Indikator für die alltagspolitische Integration stellt das<br />
ehrenamtliche Engagement im Sportverein dar. Ich gehe<br />
im Folgenden darauf ein, inwieweit es im Programm Integration<br />
durch Sport gelingt, Migrantinnen und Migranten<br />
als AnsprechpartnerIn oder ÜbungsleiterIn zu gewinnen:<br />
23 % der Ansprechpartner, aber fast die Hälfte aller<br />
Übungsleiter weisen einen Migrationshintergrund auf. Es<br />
sind mehr Männer als Frauen als Ansprechpartner oder<br />
Übungsleiter im IdS-Programm tätig. An diesen Daten zeigt<br />
sich zweierlei: Zum einen scheint es zu gelingen, Zuwanderer<br />
für ein ehrenamtliches Engagement zu gewinnen,<br />
also zur alltagspolitischen Integration beizutragen. Zum<br />
anderen haben gerade Zuwanderer eine wichtige Vermittlerfunktion<br />
bei der Gewinnung und Einbindung v.a. von<br />
Migranteninnen. Wird die Sportgruppe von einem Mann<br />
ohne Migrationshintergrund betreut, liegt der Anteil an<br />
weiblichen Migranten unter den Teilnehmern bei 13 %.<br />
<strong>Der</strong> Anteil steigt auf 33 %, wenn die Gruppe von einer<br />
Frau ohne Migrationshintergrund geleitet wird, liegt aber<br />
bei fast 60 %, wenn eine Übungsleiterin mit Migrationshintergrund<br />
die Gruppe betreut.<br />
Nicht unerwähnt bleiben soll das hohe zeitliche Engagement<br />
der Ansprechpartner – die zudem häufig noch<br />
weitere Ehrenämter im Verein ausüben – und der Übungsleiter.<br />
Letztere engagieren sich im Durchschnitt 8 Stunden<br />
pro Woche, wobei nur die Hälfte aller Stunden honoriert<br />
werden.<br />
Wie sieht es mit der Qualifikation der Übungsleiter aus?<br />
80 % der Übungsleiter verfügen entweder über eine verbandliche<br />
Lizenz oder über eine tätigkeitsnahe berufliche<br />
Ausbildung (z.B. Sportlehrer, Übungsleiter). Knapp ein<br />
Drittel haben bisher an min<strong>des</strong>tens einer Weiterbildung,<br />
z.B. Sport interkulturell teilgenommen.<br />
Sportvereine könnten, so die letzte Annahme, auch<br />
einen Beitrag zur sozialstrukturellen Integration leisten.<br />
Nun werden über den Sport keine schulischen und berufsbezogenen<br />
Bildungsgänge eröffnet oder geschlossen,<br />
erfolgen keine beruflichen Einspurungen. Allerdings ist<br />
denkbar, dass Sportvereine womöglich als informelle Bildungseinrichtungen<br />
fungieren, indem etwa der Spracherwerb<br />
aus Anlass sportlicher Aktivität oder im geselligen<br />
Vereinsleben angeregt wird. Es können aber auch verschiedenste<br />
Unterstützungsleistungen erbracht werden<br />
und Sportvereine könnten mancherorts auch als informelle<br />
Instanzen der Jobvermittlung gelten, weil man dort<br />
Mitglieder treffen kann, die über nützliche Kontakte auf<br />
dem Arbeitsmarkt verfügen. Solche Unterstützungsleistungen<br />
werden in einem nicht unerheblichen Ausmaß erbracht,<br />
sie reichen von der (gelegentlichen) Hilfe beim<br />
Ausfüllen von Formularen (83 %), der Hilfe bei der Suche<br />
nach einem Ausbildungsplatz (80 %) bis zur Hausaufgabenbetreuung<br />
(49 %).<br />
I 25
Arbeitskreis 1: Integration durch Sport in der Kommune<br />
Zur Realisierung von Integrationszielen ist es immer förderlich<br />
mit anderen Organisationen zu kooperieren.<br />
Nur 9 % der Stützpunktvereine tun dies nicht. Im Durchschnitt<br />
wird mit 5 Organisationen zusammengearbeitet,<br />
wobei v. a. die Schule, Sport- und Jugendamt genannt<br />
werden. Deutlich weniger Sportvereine – etwa 27 % –<br />
kooperieren mit Migrantenvereinigungen. Kooperation<br />
und Vernetzung brauchen geeignete Rahmenbedingungen<br />
und auch Zeit. Mit zunehmender Förderdauer steigt<br />
auch die Zahl der Sportvereine, die kommunal vernetzt<br />
sind.<br />
Zusammenfassung und Empfehlungen<br />
Ich möchte kurz zusammenfassen und zunächst auf<br />
die Verdienste <strong>des</strong> Programms Integration durch Sport<br />
verweisen. Es müsste deutlich geworden sein, dass<br />
p Zuwanderer durch das IdS-Programm erreicht<br />
werden, allerdings in unterschiedlichem Ausmaß.<br />
Es sind eben mehr Jungen und Männer sowie<br />
Heranwachsende in den Sportgruppen vertreten.<br />
p Es besteht eine hohe Bereitschaft zum freiwilligen<br />
(unentgeltlichen) Engagement in den IdS-Stützpunktvereinen,<br />
v.a. eben auch von Zuwanderern.<br />
p Stützpunktvereine leisten eine Integration in den<br />
Sport u. a. durch niedrigschwellige, regelmäßige<br />
sportliche und gesellige Angebote, die sich an<br />
den Interessen der TeilnehmerInnen orientieren.<br />
p Viele Stützpunktvereine leisten darüber hinaus<br />
auch eine Integration durch Sport, die v.a. soziale<br />
und alltagspolitische, ansatzweise sogar sozialstrukturelle<br />
Integrationsziele umfasst.Integrationsarbeit<br />
findet auch in nicht (mehr) geförderten<br />
Sportgruppen statt. Im Fokus meines Vortrags<br />
standen „nur“ die durch das IdS-Programm geförderten<br />
Gruppen.<br />
26 I<br />
Aufgrund der Evaluationsergebnisse lassen sich auch einige<br />
Herausforderungen ableiten. Diese könnten meines<br />
Erachtens u. a. darin bestehen:<br />
p dass eine (noch) differenziertere Zielgruppenanalyse<br />
erfolgt und zielorientierte Strategiekonzepte<br />
und Maßnahmenkataloge abgeleitet werden.<br />
p ÜbungsleiterInnen und AnsprechpartnerInnen<br />
sollten noch stärker als bisher als „Türöffner“<br />
und MultiplikatorInnen (vgl. spin – sport interkulturell)<br />
genutzt werden.<br />
p Bezüglich spezifischer (interkultureller) Weiterbildungsmaßnahmen<br />
besteht durchaus noch<br />
Nachholbedarf. Außerdem sollten auch Themen<br />
wie Netzwerkarbeit oder Gewinnung von Ehrenamtlichen<br />
auf der Agenda stehen.<br />
p Und schließlich könnte – wie an Beispielen gezeigt<br />
wurde – die Kooperations- und Kommunikationspolitik<br />
weiter ausgebaut werden.<br />
p Das setzt jedoch voraus, dass die Integrationsarbeit<br />
der Sportvereine auch weiterhin durch<br />
geeignete Rahmenbedingungen unterstützt und<br />
befördert werden.<br />
Weiterführende Literatur:<br />
I Baur, J. & Braun, S. (Hrsg.) (2003). Integrationsleistungen von<br />
Sportvereinen als Freiwilligenorganisationen.<br />
Aachen: Meyer & Meyer.<br />
I Baur, J. (2006). Kulturtechniken spielend erlernen. Über die<br />
Integrationspotenziale <strong>des</strong> vereinsorganisierten Sports.<br />
Treffpunkt, 16 (3), S. 3 – 8.<br />
I Baur, J. (2009). (Hrsg.). Evaluation <strong>des</strong> Programms „Integration<br />
durch Sport. Band 1 und 2. ASS-Materialien Nr. 35 und 36.<br />
Universität Potsdam. Zugriff am 7.11.09 unter: http://www.integration-durch-sport.de/de/integration-durch-sport/news/detail/<br />
news/evaluationsbericht_<strong>des</strong>_programms_integration_durch_<br />
sport_veroeffentlicht/11924/na/2009//cHash/ec14948a75/<br />
I Braun, S., Finke, S. & Grützmann, E. (2009). spin – sport<br />
interkulturell: Ein sportbezogenes Modellprojekt zur sozialen<br />
Integration von Mädchen und Frauen mit Zuwanderungsgeschichte.<br />
In Innenministerium NRW & Lan<strong>des</strong>SportBund NRW<br />
(Hrsg.), Sport für Mädchen und Frauen mit Zuwanderungsgeschichte<br />
– Erfahrungen und Perspektiven.<br />
Düsseldorf: Innenministerium NRW.<br />
I Breuer, C. (2009). Sportentwicklungsbericht 2007/2008.<br />
Köln: Sportverlag Strauß.
INGA BERGMANN (LANDESHAUPTSTADT MÜNCHEN, SPORTAMT):<br />
Qualifizierungsoffensive zur interkulturellen Öffnung<br />
im organisierten Sport<br />
Qualifizierungs- und Beratungsprogramm<br />
für Sportvereine und -organisationen<br />
1. Hintergrund und Zielrichtung<br />
Hintergrund ist die kulturelle und ethnische Vielfalt Münchens,<br />
welche gelebte Realität und Herausforderung<br />
zugleich ist. Ziel aller Integrationsbemühungen in München<br />
ist die Förderung der gleichberechtigten Teilhabe<br />
und Partizipation der hier lebenden Menschen mit Migrationshintergrund,<br />
unabhängig davon, ob sie zugewandert<br />
oder hier geboren sind. Das Interkulturelle Integrationskonzept<br />
der Lan<strong>des</strong>hauptstadt München verfolgt<br />
strategisch den Ansatz der interkulturellen Orientierung<br />
und Öffnung von Institutionen. Dadurch soll ein gleichberechtigter<br />
Zugang benachteiligter Gruppen zu allen<br />
Kernbereichen der Gesellschaft erreicht werden. „Sport<br />
verbindet“ – bei Bewegung, Spiel und Sport soll kein<br />
Platz für tief gehende Vorbehalte hinsichtlich Nationalität,<br />
Religion oder Behinderung bleiben.<br />
Das Sportamt im Schul- und Kultusreferat, die Stelle für<br />
interkulturelle Arbeit im Sozialreferat der Lan<strong>des</strong>hauptstadt<br />
München, die Münchner Sportjugend (MSJ) sowie<br />
das Programm „Integration durch Sport“ im Bayerischen<br />
Lan<strong>des</strong>-Sportverband (BLSV) fördern im Rahmen ihrer<br />
Zuständigkeit mit verschiedenen Programmen und Maßnahmen<br />
die interkulturelle Kompetenz wie auch die<br />
Sensibilisierung für einen interkulturell ausgerichteten<br />
Sport. Im organisierten Sport sind interkulturelle Kompetenz<br />
und interkulturelle Ansätze von großer Bedeutung.<br />
Damit die Sportangebote der Stadt tatsächlich alle<br />
Bevölkerungsgruppen erreichen, haben sich die vier genannten<br />
Partner mit dem Modellprojekt gemeinsam auf<br />
den Weg der interkulturellen Öffnung <strong>des</strong> organisierten<br />
Sports begeben.<br />
Die Plattform <strong>des</strong> Sports eignet sich besonders, Hürden<br />
zu überwinden und Vorurteile abzubauen. Sport gehört<br />
zu den wesentlichen Kernbereichen <strong>des</strong> gesellschaftlichen<br />
Lebens und hat einen hohen integrativen Charakter. <strong>Der</strong><br />
I 27
Arbeitskreis 1: Integration durch Sport in der Kommune<br />
Sportbereich wird im Interkulturellen Integrationskonzept<br />
aktuell unter dem Handlungsfeld „Förderung gesellschaftlicher<br />
Teilhabe“ geführt. Damit gehört er zu den 5 zentralen<br />
Aufgabenfeldern in München. Das Integrationspotenzial,<br />
das der Sport bietet, stellt eine große Chance dar.<br />
Und zwar die Chance, von klein auf Sport zu treiben, zu<br />
einem Verein im Stadtteil dazu zugehören, das Vereinsleben<br />
als Vorstandsmitglied mitzugestalten und als Vorbild<br />
für andere zu fungieren.<br />
Sport ist jedoch nicht per se integrativ. Es ist unumstritten,<br />
dass im Sport ebenso Konfliktpotenzial liegt. Beim Sport<br />
kommen Menschen zusammen, aber gerade dadurch<br />
schafft er auch Anlässe für Konflikte durch Nähe, im Wettstreit,<br />
in der Konkurrenz, im Freisetzen von Emotionen,<br />
zwischen konkurrierenden Gruppen.<br />
Zur Erweiterung <strong>des</strong> Angebotes und zum Aufbau von<br />
Lösungsstrategien führen die genannten Kooperationspartner<br />
die Entwicklung eines Qualifizierungs- und<br />
Beratungsprogramms für Sportvereine und Sportorganisationen,<br />
bestehend aus drei Bausteinen durch.<br />
28 I<br />
In erster Linie geht es dabei um die Stärkung der interkulturellen<br />
Kompetenz der Akteurinnen und Akteure im<br />
organisierten Sport sowie um die interkulturelle Öffnung<br />
der Vereine und Organisationen im Besonderen. Ziel der<br />
interkulturellen Öffnung im Sportbereich ist u. a. die Ausweitung<br />
auf neue Zielgruppen und langfristig gesehen<br />
die Gewinnung von Menschen mit Migrationshintergrund<br />
als Funktionsträger/innen und Multiplikatoren/innen.<br />
In der Lan<strong>des</strong>hauptstadt München leben Menschen<br />
aus 184 Nationen. Es werden bis zu 300 verschiedene<br />
Sprachen gesprochen. Schon heute haben 50 Prozent<br />
der Kinder und Jugendlichen bis 18 Jahre einen Migrationshintergrund.<br />
Johann Wolfgang von Goethe sagte<br />
einmal:„<strong>Der</strong> ist nicht fremd, wer teilzunehmen weiß.“<br />
Und teilnehmen am Sport sollte jeder können, egal ob er<br />
dick, dünn, hier oder dort geboren ist, an etwas glaubt<br />
oder nicht glaubt, alt oder jung ist. Die Integration von<br />
Menschen mit anderen kulturellen, sprachlichen und<br />
ethnischen Hintergründen ist eine entscheidende Herausforderung<br />
unserer Zeit. Nur mit einem umfassenden systematischen<br />
Ansatz in der Integrationspolitik können die<br />
Potentiale und Fähigkeiten dieser Menschen gewinnbrin-
gend für alle eingesetzt werden. Dem Sport kommt hier<br />
eine wichtige Rolle zu, er führt die Menschen zusammen.<br />
Die Entwicklung und Umsetzung <strong>des</strong> Qualifizierungsprogramms<br />
wurde an den Verband Interkulturelle Arbeit<br />
(VIA) München vergeben.<br />
2. Projektbeschreibung und<br />
Projektbausteine<br />
An Sportangeboten mangelt es in München mit ca. 700<br />
Sportvereinen nicht. Was fehlt sind kultursensible Sportangebote,<br />
die sich an den Bedürfnissen von Menschen mit<br />
Migrationshintergrund orientieren. Um für den organisierten<br />
Sport mehr Mitglieder mit Zuwanderungsgeschichte<br />
zu gewinnen, müssen Sportvereine sich für neue Gruppen<br />
öffnen und ihre Strategien ändern, was bedeutet sie müssen<br />
selbst aktiv werden.<br />
Mit dem bun<strong>des</strong>weit einmaligen Modellprojekt wird die<br />
Entwicklung einer integrativen und für alle Bevölkerungsgruppen<br />
attraktiven Sportlandschaft in München verfolgt.<br />
Im Rahmen <strong>des</strong>sen sollen die dafür notwendigen Maßnahmen<br />
und Schritte erprobt und in die Fläche gebracht<br />
werden. Im Schulterschluss werden die dafür notwendigen<br />
Schritte und Wege gemeinsam entwickelt und zunächst<br />
im Raum München erprobt. Das Angebot richtet<br />
sich an Münchener Sportvereine und Sportorganisationen<br />
und setzt dort bei zwei relevanten Gruppen an: bei den<br />
Übungsleitern, Trainern und Wettkampfrichtern (Gruppe 1)<br />
sowie bei Vorständen, Funktionären und Geschäftsführern<br />
(Gruppe 2). In der Modellphase ab Frühjahr 2010 werden<br />
10 Sportvereine mittels Fortbildungen und Workshops<br />
auf ihrem Weg der interkulturellen Öffnung begleitet.<br />
Mit den im folgenden beschriebenen Bausteinen sollen<br />
die Akteure vor Ort für interkulturelle Vielfalt und den<br />
Umgang mit Differenz sensibilisiert und bei der interkulturellen<br />
Öffnung unterstützt werden.<br />
Mit dem Angebot werden beide Gruppen erreicht und in<br />
ihrer Rolle gestärkt. Für die interkulturelle Öffnung der<br />
Sportangebote bedarf es neben interkulturellen Schulungen<br />
auch struktureller Maßnahmen (Organisationsentwicklung)<br />
und einer interkulturell sensiblen Öffentlichkeitsarbeit,<br />
für welche in erster Linie Vorstände und Geschäftsführer/innen<br />
zuständig sind.<br />
Baustein 1:<br />
Multiplikatorenschulung<br />
In einem ersten Schritt wurden 12 Multiplikatoren/innen<br />
mit pädagogischem bzw. sportpädagogischem Hintergrund<br />
geschult und ausgebildet werden. Die Schulung<br />
umfasste sechs Module, welche sie zur eigenständigen<br />
Durchführung von Grundlagentrainings zum Aufbau<br />
von interkultureller Sensibilität und Kompetenz sowie Beratungen<br />
der beiden Zielgruppen qualifiziert.<br />
Baustein 2:<br />
Fortbildung „Interkulturelle Kompetenz im Sport“<br />
In enger Kooperation mit den Kooperationspartnern<br />
schulen die ausgebildeten Multiplikatoren und Multiplikatorinnen<br />
die Übungsleiter/innen, Trainer/innen,<br />
Wettkampfrichtern/innen und Vorstände und Entscheidungsträger/innen<br />
in den Sportvereinen.<br />
Bei der Gruppe 1 (Übungsleiter/innen, Trainer/innen u. a.)<br />
stehen die Ziele Vermittlung interkultureller Kompetenz<br />
und Handlungskompetenz in kulturellen Überschneidungssituationen<br />
im Vordergrund. Bei der Gruppe 2 (Vorstände,<br />
Funktionäre/innen u. a.) hingegen geht es verstärkt um<br />
interkulturelle Sensibilisierung und Bewusstseinsbildung.<br />
Baustein 3:<br />
Workshop „Interkulturelle Öffnung im Sport“<br />
Den Vorständen, Geschäftsführer/innen und Entscheidungsträgern/innen<br />
aus Sportvereinen und Sportorganisationen<br />
(Gruppe 2) werden Seminare zur interkulturellen<br />
Öffnung angeboten. Diese haben einen Workshopcharakter<br />
und greifen die Aspekte, die mit der interkulturel-<br />
I 29
Arbeitskreis 1: Integration durch Sport in der Kommune<br />
len Öffnung verbunden sind, auf. Die Zielrichtung hier<br />
ist das Aufzeigen von geeigneten Strategien und Maßnahmen.<br />
Die Zielsetzung hier ist die Beförderung <strong>des</strong><br />
Themas (wie auch der Frage der Bedeutung der interkulturellen<br />
Öffnung im Sport) in die Sportvereine und Organisationen<br />
hinein verbunden mit dem Ziel, Diskussionsprozesse<br />
anzustoßen und bei Bedarf zu begleiten.<br />
3. Evaluation<br />
Um einschätzen zu können, ob die Schritte und der eingeschlagene<br />
Weg auch zum gewünschten Ziel führen,<br />
wurde ein externes Institut mit der Begleitung und Evaluation<br />
beauftragt – das Sozialwissenschaftliche Institut<br />
München (SIM). Inwieweit die im Rahmen <strong>des</strong> Modellprojekts<br />
verfolgte Strategie zielführend war, sowohl für<br />
die Beförderung <strong>des</strong> Themas in die Vereine und Organisationen<br />
hinein als auch für das Anstoßen von interkulturellen<br />
Öffnungsprozessen wird mit Hilfe einer Prozess<br />
begleitenden Evaluation ergründet.<br />
Welche Bedingungen und Voraussetzungen letztendlich<br />
für die aktive Beteiligung von Menschen mit Migrationshintergrund<br />
förderlich sind und die interkulturelle Öffnung<br />
<strong>des</strong> organisierten Sports begünstigen, sind noch zu<br />
wenig bekannt.<br />
Neue Erkenntnisse für eine nachhaltige integrative Sportentwicklung<br />
sollen gewonnen werden. <strong>Der</strong> Schwerpunkt<br />
bisheriger Programme und Aktivitäten in diesem Feld<br />
basierte auf dem Aspekt der Förderung interkultureller<br />
Kompetenz. Interkulturelle Öffnungsprozesse sind jedoch<br />
hoch komplex und erst dann erfolgreich, wenn sie als<br />
Querschnittsaufgabe begriffen und umgesetzt und mit<br />
Ressourcen unterstützt werden. Personal- und Organisationsentwicklung<br />
gehen dabei Hand in Hand und<br />
werden von der Führung wahrgenommen. Mit dem Modellprojekt<br />
möchten die Kooperationspartner diesen<br />
Prozesse gezielt voranbringen.<br />
30 I<br />
Nach der Pilotphase ist die Fortführung der erprobten<br />
Ansätze geplant. Die Vereine, Organisationen und Institutionen<br />
<strong>des</strong> organisierten Sports (der Mehrheitsgesellschaft<br />
wie auch die eigenethnischen Vereine) in München<br />
sollen bei der Öffnung sowie der aktiven Ansprache und<br />
Einbindung von neuen Ziel- und Bevölkerungsgruppen<br />
unterstützt und für die interkulturelle Vielfalt und den<br />
Umgang mit Differenz sensibilisiert werden. Ein mittelbzw.<br />
langfristiges Ziel ist die Gewinnung von Migranten/<br />
innen als Funktionsträger/innen und Multiplikatoren/innen.<br />
Bei den Rahmenbedingungen sind die ehrenamtlichen<br />
Strukturen und das bürgerschaftliche Engagement im<br />
Sportbereich zu beachten. Die Anforderungen hier sind<br />
andere als bei hauptamtlichen Strukturen. Für die Vereine<br />
hat die Kooperation zwischen den Ehren- und Hauptamtlichen<br />
bzw. die Frage, wie die Kooperation funktioniert,<br />
eine hohe Bedeutung. Dies gilt für die Sportlandschaft<br />
und die Strukturen insgesamt. In München sind im<br />
Handlungsfeld Sport verschiedene Akteure aktiv, auf der<br />
Lan<strong>des</strong>ebene der Bayerische Lan<strong>des</strong>sport Verband (BLSV),<br />
auf regionaler Ebene die Münchner Sportjugend (MSJ)<br />
und seitens der Kommune das Sportamt im Schul- und<br />
Kultusreferat der Lan<strong>des</strong>hauptstadt München. Mit vereinten<br />
Kräften verfolgen die genannten Kooperationspartner<br />
mit dem Modellprojekt das Ziel der interkulturellen<br />
Öffnung im organisierten Sport.
PETER LUDES (ERSTER BEIGEORDNETER DER KREISSTADT BERGHEIM):<br />
Integration durch Sport am Beispiel der Kreisstadt Bergheim<br />
I 31
Arbeitskreis 1: Integration durch Sport in der Kommune<br />
PETER LUDES (ERSTER BEIGEORDNETER DER KREISSTADT BERGHEIM):<br />
32 I
I 33
Arbeitskreis 1: Integration durch Sport in der Kommune<br />
PETER LUDES (ERSTER BEIGEORDNETER DER KREISSTADT BERGHEIM):<br />
34 I
Ergebnisse <strong>des</strong> Arbeitskreises 1<br />
I 35
Arbeitskreis 2: Sportgroßveranstaltungen –<br />
Fluch oder Segen?<br />
PROF. DR. WOLFGANG MAENNIG (UNIVERSITÄT HAMBURG):<br />
Sportgroßveranstaltungen: Fluch oder Segen?<br />
36 I
I 37
Arbeitskreis 2: Sportgroßveranstaltungen –<br />
Fluch oder Segen?<br />
PROF. DR. WOLFGANG MAENNIG (UNIVERSITÄT HAMBURG):<br />
38 I
I 39
Arbeitskreis 2: Sportgroßveranstaltungen –<br />
Fluch oder Segen?<br />
Zusammenfassung der Podiumsdiskussion<br />
Im Anschluss an den Vortrag von Prof. Dr. Maennig diskutierte<br />
eine Podiumsrunde die vielfältigen Aspekte, die<br />
Sportgroßveranstaltungen in den Kommunen auslösen.<br />
Unter Beteiligung von Michaela Petermann, Direktorin im<br />
Sportamt Hamburg, Andreas Kroll, Geschäftsführer einer<br />
kommunalen Veranstaltungsagentur aus Stuttgart, Dieter<br />
Donnermeyer, <strong>Deutsche</strong>r Turnerbund und Carsten Cramer,<br />
Vizepräsident der Vermarktungs- und Rechteagentur<br />
Sport FIVE wurde herausgearbeitet, dass es eine einheitliche<br />
Betrachtung und einen Königsweg für diese Frage<br />
nicht geben könne. So seien z.B. die Turnfeste <strong>des</strong> <strong>Deutsche</strong>n<br />
Turnerbun<strong>des</strong> nicht unter Hochglanz-Events einzuordnen;<br />
vielmehr schafften sie in einer Stadt für über<br />
eine Woche ein hohes Engagement und eine Identifizierung<br />
mit der Sportart Turnen. Weiter sei daran gedacht,<br />
in Zukunft solche Turnfeste nicht nur auf Städte zu beschränken,<br />
sondern auch in vergrößertem Rahmen in<br />
Regionen zu gehen.<br />
Hingewiesen wurde auf die Sonderrolle <strong>des</strong> Fußballs und<br />
einiger weniger professionell betriebener Ligen, die ganz<br />
besondere wirtschaftliche Rahmenbedingungen hätten<br />
40 I<br />
und nicht mit den Meisterschaften und internationalen<br />
Veranstaltungen anderer Sportarten in einen Topf geworfen<br />
werden könnten. Einen breiten Raum in der Diskussion<br />
nahm die Frage ein, ob sich Sportgroßveranstaltungen<br />
für die Städte auch „rechnen“ würden. Es herrschte Einigkeit<br />
in der Aussage, dass neben den rein ökonomischen<br />
Betrachtungen auch die „Feel Good- und Image-Effekte“<br />
eine ganz erhebliche Rolle spielen würden. Kontraproduktiv<br />
seien allerdings Veranstaltungen, bei denen die<br />
Diskussion um die Schattenseiten <strong>des</strong> Sports (z.B. Doping,<br />
Wettbetrug etc.) dominieren würden. Alles, was mit<br />
Stadtimage und Stadtmarketing zu tun habe, sei in realen<br />
Geldeinheiten nicht bewertbar und höchstens auf dem<br />
Umweg über die sog. Medienkontakte quantifizierbar.<br />
Würde man diese Effekte mit einrechnen, wäre auch ein<br />
betriebswirtschaftlich finanzielles Minus bei einer Veranstaltung<br />
zumin<strong>des</strong>t leichter darstellbar.<br />
Als Sonderproblem wurde gesehen, dass zahlreiche Neubauten<br />
von Stadien weit außerhalb der Innenstädte<br />
angesiedelt seien; dies führe dazu, dass die Besucher insbesondere<br />
im Gastronomie- und Cateringbereich in den
Innenstädten praktisch nicht mehr spürbar seien. Ebenso<br />
spiele die Lärmthematik, auch die der an- und abreisenden<br />
Zuschauer, bei einer solchen Standortwahl eine gewichtige<br />
Rolle. Hilfreich sei in diesem Zusammenhang ein<br />
Kombiticket mit dem Öffentlichen Personennahverkehr.<br />
Entgegen der Tendenz, Sportveranstaltungen nur noch in<br />
Randlagen der Innenstädte bzw. an der Peripherie durchzuführen,<br />
wurde berichtet, dass manche Veranstalter, und<br />
sei es über Public Viewing, bewusst in die Innenstädte<br />
gingen, um dort Veranstaltungen als großes Event zu feiern.<br />
Hingewiesen wurde noch auf die Vielzahl von kleineren<br />
Veranstaltungen, die es im Jugend- und Seniorenbereich<br />
gebe. Dies sei eine Chance für Mittelstädte und<br />
kleinere Großstädte, sich über solche Veranstaltungen zu<br />
profilieren. Bedauert wurde, dass die sportökonomische<br />
Forschung in all diesen Fragen erst am Anfang stünde<br />
und gesicherte Erkenntnisse immer noch nicht vorlägen.<br />
Als Beispiele für Markenbildung durch Sport wurden hier<br />
u. a. Ratzeburg für Rudern, Gummersbach für Handball<br />
und Tauberbischofsheim für Fechten genannt. Angereichert<br />
wurde diese Diskussion weiter durch Fragen aus<br />
dem Publikum, die u. a. die Pflichtenhefte der ausrich-<br />
tenden Fachverbände, die mangelnde Einbindung von<br />
Vereinen in Sportgroßveranstaltungen, die oft nicht vorhandene<br />
Zusammenarbeit zwischen Tourismuswirtschaft<br />
und Sport sowie die wachsende Anzahl an Beschwerden<br />
von Innenstadtbewohnern bei der Durchführung von<br />
City-Marathons, Ironman-Veranstaltungen etc. problematisierten.<br />
Wichtig sei es, dass prominente Personen als<br />
„Leuchttürme“ hinter den Veranstaltungen stünden; dies<br />
würde die Akzeptanz deutlich erhöhen.<br />
Als Fazit konnte gezogen werden, dass Sportveranstaltungen<br />
je nach Ausrichtung, Größe und finanziellem<br />
Engagement Fluch und Segen sein können. Es herrschte<br />
Übereinstimmung, dass die Stadtmarketing- und Eventcharaktere<br />
solcher Veranstaltungen nicht unterschätzt<br />
werden dürften; insbesondere in den mittelgroßen Städten<br />
und kleineren Großstädten gebe es noch viel Nachholbedarf.<br />
(Niclas Stucke)<br />
Podiumsdiskussion: v.l.n.r. Andreas Kroll, Geschäftsführer<br />
in.Stuttgart; Michaela Petermann, Direktorin Sportamt Hamburg;<br />
Dieter Donnermeyer, <strong>Deutsche</strong>r Turner-Bund im Gespräch mit<br />
Clemens Löcke (links), Agentur Sprechperlen<br />
I 41
Arbeitskreis 2: Sportgroßveranstaltungen –<br />
Fluch oder Segen?<br />
Ergebnisse <strong>des</strong> Arbeitskreises 2<br />
42 I
Arbeitskreis 3: Bürgerschaftliches Engagement in der<br />
Kommune – sportliche Ansätze und kommunale Strukturen<br />
PROF. DR. RALF VANDAMME (STÄDTETAG BADEN-WÜRTTEMBERG):<br />
Modernisierung <strong>des</strong> Ehrenamtes in Sport und Kommune<br />
I 43
Arbeitskreis 3: Bürgerschaftliches Engagement in der<br />
Kommune – sportliche Ansätze und kommunale Strukturen<br />
PROF. DR. RALF VANDAMME (STÄDTETAG BADEN-WÜRTTEMBERG):<br />
44 I
I 45
Arbeitskreis 3: Bürgerschaftliches Engagement in der<br />
Kommune – sportliche Ansätze und kommunale Strukturen<br />
LARS SCHÄFER (LANDESFEUERWEHRVERBAND HESSEN):<br />
Leitfaden zur Gewinnung von Engagierten und Stärkung<br />
von Freiwilligen Feuerwehren in Hessen<br />
Ausgangslage<br />
Die Entwicklung der Mitgliederzahlen in den Hessischen<br />
Feuerwehren hat deutlich gezeigt, dass ein stetiger<br />
Abwärtstrend besteht. Oftmals zu Anfang noch totgeschwiegen<br />
oder auch verharmlost, zeigte die Entwicklung<br />
jedoch ganz deutlich, dass es sich um kein vorübergehen<strong>des</strong><br />
Problem handelt. So verloren die Hessischen Feuerwehren<br />
in den Jahren 1985 bis 2008 immerhin 17.000<br />
Mitglieder, obwohl jährlich über 2.000 Angehörige der<br />
Jugendfeuerwehren in den aktiven Dienst wechselten.<br />
Hinzu kam die anfangs gänzlich unterschätzte Wirkung<br />
<strong>des</strong> Demographischen Wandels. Hier zeigte sich deutlich,<br />
dass das Potential an Jugendlichen immer weniger wird.<br />
Gleichzeitig aber steigt die Nachfrage in allen Vereinen<br />
und Verbänden nach Nachwuchs, um den Mitgliedertrend<br />
zu stoppen.<br />
Zielsetzung <strong>des</strong> Leitfadens<br />
Unsere Zielsetzung bei der Erstellung <strong>des</strong> Leitfadens<br />
war es, eine Handlungshilfe zu bieten für alle Freiwilligen<br />
Feuerwehren. Hierbei war Allen bewusst, dass es kein<br />
Rezeptbuch mit der Garantie <strong>des</strong> Gelingens gibt, sondern<br />
dass es eine Sammlung erprobter Ideen von vielen Freiwilligen<br />
Feuerwehren ist, die Anregungen bieten sollen.<br />
Dies ließ sich nur dadurch erreichen, dass alle relevanten<br />
Institutionen an der Erstellung dieses Leitfadens beteiligt<br />
wurden, um möglichst viele Facetten und Anregungen<br />
zu berücksichtigen. Daher arbeiteten Vertreterinnen und<br />
Vertreter aus folgenden Institutionen mit:<br />
46 I<br />
p Präsidium <strong>des</strong> Lan<strong>des</strong>feuerwehrverban<strong>des</strong> Hessen<br />
p Hessische Jugendfeuerwehr<br />
p Bezirksfeuerwehrverbände<br />
p Hessische Lan<strong>des</strong>feuerwehrschule<br />
p Integrationsbüro <strong>des</strong> Landkreises Offenbach<br />
p Vertreter der Wirtschaft<br />
p Hessisches Ministerium <strong>des</strong> Innern und für Sport<br />
p Handwerkskammer Wiesbaden<br />
p Lan<strong>des</strong>ehrenamtsagentur<br />
p Hessischer Landkreistag<br />
p Hessischer Städte- und Gemeindebund<br />
Die Leitung der Arbeitsgruppe oblag Herrn Dr. Ralf<br />
Vandamme vom Zentrum für regionale Strategien in<br />
Offenbach.<br />
Im Laufe der Entwicklung ergaben sich Feststellungen, die<br />
für alle Akteure interessant waren und nachfolgend möchte<br />
ich Ihnen einige Auszüge aus unserem Leitfaden vorstellen:<br />
Einbindung von unterrepräsentierten<br />
Gruppen<br />
Im Hinblick auf die Demographische Entwicklung war<br />
es unser Ziel, besonders in den Bevölkerungsgruppen um<br />
eine verstärkte Mitarbeit zu werben, die in den Feuerwehren<br />
noch unterrepräsentiert sind. Hier muss es Ziel der<br />
Feuerwehren sein, insbesondere den Personenkreis der<br />
Frauen und der Migrantinnen und Migranten für eine Mitarbeit<br />
zu begeistern. Insofern galt es Standards zu formulieren,<br />
die dazu führen, dass sich Frauen und ausländische<br />
Mitbürgerinnen und Mitbürger wohl fühlen. Für den Bereich<br />
der Frauen wurde der Standard wie folgt formuliert:
p Durch Sprache kann Bewusstsein geändert werden.<br />
Die Verwendung weiblicher Formulierungen<br />
in öffentlichen Mitteilungen trägt dazu bei,<br />
das Image der Freiwilligen Feuerwehr als „Männerverein“<br />
zu ändern.<br />
p Frauen in der Feuerwehr sollten immer wieder in<br />
der Pressearbeit sichtbar gemacht werden.<br />
p Familiäre und berufliche Bedürfnisse sollten<br />
berücksichtigt werden, zum Beispiel bei der<br />
Dienstplangestaltung (Tag und Uhrzeit), aber<br />
auch durch Schaffung von Kinderbetreuung.<br />
p Unterbrechungen im Feuerwehrdienst durch<br />
Schwangerschaft, Elternzeit, Kinderbetreuung<br />
oder ähnliche Anlässe ernst nehmen und gemeinsam<br />
Regelungen finden für diese Zeiten.<br />
p Frauen gezielt als Ausbilderinnen einsetzen<br />
(Vorbildfunktion)<br />
p Vorurteile bei Männern gegenüber Frauen in der<br />
Feuerwehr offen ansprechen und abbauen. Hier<br />
sind ganz besonders Führungskräfte gefordert.<br />
p Für den Einsatz gilt „jeder nach seinen Fähigkeiten“,<br />
es muss also um körperliche Konstitution<br />
gehen und nicht um das Geschlecht als Entscheidungskriterium.<br />
Für den Bereich der Migrantinnen und Migranten ist es<br />
ganz wichtig, z.B. die Ausländerbeiräte und Personen,<br />
die in dieser Bevölkerungsschicht hohes Ansehen genießen<br />
als „Türöffner“ zu nutzen, um hier einen Zugang<br />
zu bekommen.<br />
Das System der ehrenamtlichen Hilfe in Deutschland ist<br />
weltweit weitestgehend unbekannt. Uniformträger genießen<br />
in den Herkunftsländern kein hohes Ansehen, da<br />
I 47
Arbeitskreis 3: Bürgerschaftliches Engagement in der<br />
Kommune – sportliche Ansätze und kommunale Strukturen<br />
sie oft als Staatsgewalt empfunden werden. Gleichzeitig<br />
muss man aber auch immer wieder ehrliche Aufklärung<br />
in den Feuerwehren über die Bedeutung der Einwanderer<br />
in der eigenen Einsatzabteilung und im eigenen Verein<br />
betreiben, um den Zugang zu erleichtern.<br />
Empfohlene Projekt für die Gewinnung dieser Bevölkerungsgruppe<br />
sind:<br />
p Präsenz zeigen bei internationalen Festen.<br />
Wir müssen zu den Menschen gehen und nicht<br />
warten, bis sie zu uns kommen.<br />
p Vorstellung der Arbeit einer Freiwilligen Feuerwehr<br />
in Integrationskursen o. ä.<br />
p Brandschutzerziehung mit Migrantinnen<br />
(Müttern) in Zusammenarbeit mit Kindertagesstätten<br />
und vor Ort ansässigen Gruppen.<br />
p Ansprechpartner für interessierte Migranten<br />
benennen. Dies ist effektiver als in Faltblätter zu<br />
investieren und Massenkampagnen, da Migranten<br />
direkt und individuell erreicht werden wollen.<br />
Entwicklung von Möglichkeiten<br />
der Werbung<br />
Zeiten, in denen ein einfaches DIN-A 4 Blatt reichte<br />
um Begeisterung zu wecken, oder zur Mitarbeit zu motivieren<br />
sind schon lange rum. Printwerbung stellt eine<br />
besondere Herausforderung an den Ersteller, wobei folgende<br />
Punkte besonders zu berücksichtigen sind.<br />
p Es muss ein örtlicher Bezug hergestellt werden.<br />
Bilder sollten die Tatsächlichkeit widerspiegeln,<br />
nicht getreu dem Motto mit BMW werben und<br />
einen Handkarren fahren.<br />
p Layout-Vorgaben <strong>des</strong> Trägers/der Gebietskörperschaft<br />
beachten. Die öffentlich-rechtliche<br />
Feuerwehr ist Bestandteil der kommunalen<br />
Verwaltung.<br />
48 I<br />
p Text in klar formulierte, kurze Sätze fassen,<br />
ggf. nur Schlagworte verwenden. Zum Beispiel:<br />
Aufgaben der Feuerwehr: Retten, Löschen,<br />
Bergen, Schützen<br />
p Kein Fachchinesisch, wenn das Produkt an die<br />
„Normalbevölkerung“ gerichtet ist.<br />
p Rechte an Bildern, Grafiken etc. klären; ggf.<br />
Quellenhinweise verwenden.<br />
p Keine Schnörkelschrift sondern nüchtern-sachliche<br />
Schriftbilder (z.B. Arial) verwenden (ggf. „Hausschrift“<br />
<strong>des</strong> Trägers/der Gebietskörperschaft beachten).<br />
p Schrift nicht zu klein.<br />
p Nicht mit Informationen überfrachten.<br />
Weniger ist mehr!<br />
p Lieber zu verschiedenen Themen mehrere Flyer<br />
mit gleichem Layout anfertigen.<br />
p Keine „Bleiwüste“ basteln – also nicht zu viel<br />
Text. Auflockerung mit Fotos.<br />
p Keine Word-Art-Kunststücke oder Word-ClipArts<br />
verwenden – das ist nicht mehr zeitgemäß.<br />
p Impressum, Ansprechpartner und Kontaktmöglichkeiten<br />
nicht vergessen.<br />
p Fehlerfreie (!) Rechtschreibung.<br />
p Zielgruppe definieren, danach Inhalte ausrichten.<br />
p Evtl. Geld investieren und Profis um Hilfe bitten.<br />
Werbung bedeutet aber auch mit allen Mitteln zu<br />
arbeiten, die der Markt heute so hergibt.<br />
p So kann auch Kinowerbung helfen, wenn die<br />
Kinobettreiber ihre eigene Werbezeit unentgeltlich<br />
zur Verfügung stellen (im Regelfall 1 Minute)<br />
und ein eigener produzierter Film dort gezeigt<br />
werden kann.<br />
p Keine Tage der offenen Tür in der Feuerwache,<br />
sondern Aktionen da machen, wo Menschen sind<br />
(Einkaufszonen, Schulen, Kinos, etc.).
p Demonstration von Vorführungen von Rauchmeldern<br />
durch abbrennen einer Küchenzeile auf<br />
dem Marktplatz (abends) in Absprache mit der<br />
Ordnungsbehörde.<br />
p Bei der Erstellung von Giveaways sollte ein hoher<br />
Wiedererkennungswert vorhanden sein.<br />
p Werbung sollte professionell erfolgen, d. h.<br />
Infostände und Messestände sollten nicht wie<br />
selbstgezimmert wirken, sondern von dem<br />
Äußern her ansprechend sein. Über Sponsoring<br />
lässt sich hierbei viel erreichen.<br />
Zusammenarbeit mit anderen Vereinen<br />
Mitgliederwerbung kann auch gemeinsam betrieben werden,<br />
z.B. von Feuerwehren und Sportvereinen, ist doch<br />
gerade die körperliche Fitness ein unverzichtbarer Bestandteil<br />
der Feuerwehrarbeit. Hier kann es schon helfen – um<br />
jemandem eine Doppelmitgliedschaft zu ermöglichen –<br />
dass Trainings- und Übungszeiten aufeinander abgestimmt<br />
werden zwischen Sportverein und Feuerwehr. Warum<br />
sollte nicht durch den Sportverein ein Fitnessprogramm<br />
für die Feuerwehr angeboten werden, um Interesse am<br />
Sport zu wecken. Dafür könnte im Gegenzug die Feuerwehr<br />
Brandschutzaufklärung betreiben. Wichtig hierbei<br />
ist, offen für Kooperationsmodelle zu sein und gleichzeitig<br />
sicherzustellen, dass beide Kooperationspartner etwas<br />
davon haben.<br />
Was passierte nach Einführung<br />
unseres Leitfadens?<br />
<strong>Der</strong> Leitfaden wurde an sämtliche Feuerwehren <strong>des</strong> Lan<strong>des</strong><br />
Hessen verteilt. Er wurde von Vielen erwartet, allerdings<br />
manchmal auch als etwas angesehen, was man von A–Z<br />
nur befolgen muss und dann kommen ganze Herscharen<br />
von Menschen in die Feuerwehren. Er wird aber gerne<br />
genutzt und ist jeder Führungskraft bekannt. Zusätzlich<br />
hat das Hessische Ministerium <strong>des</strong> Innern und für Sport<br />
in Kooperation mit dem Lan<strong>des</strong>feuerwehrverband eine<br />
Honorarkraft angestellt, die auf Wunsch Informationsveranstaltungen<br />
zu diesem Thema durchführt, selbstverständlich<br />
kostenfrei für die Freiwilligen Feuerwehren.<br />
<strong>Der</strong> Leitfaden ist im Jahr 2007 erschienen und im Jahre<br />
2008 konnte erstmals der Abwärtstrend bei der Mitgliederentwicklung<br />
gestoppt werden. Ob dies alleine an<br />
unserem Leitfaden liegt kann keiner beantworten. Es wäre<br />
auch vermessen dies zu behaupten, aber sicherlich war<br />
und ist er ein Baustein, den Negativtrend zu stoppen.<br />
Die Frage zum Schluss<br />
Natürlich widmen wir uns Alle immer stärker der Gewinnung<br />
von Nachwuchskräften, denn das ist wichtig, um<br />
zukunftsorientiert agieren zu können. Aber mal ganz ehrlich<br />
und Hand aufs Herz, was tun wir eigentlich für unsere<br />
Mitglieder, die schon viele Jahre bei uns ehrenamtlich<br />
Dienst tun?<br />
Sind diese nicht einfach selbstverständlich, weil<br />
sie immer da sind?<br />
Wann haben wir sie das letzte mal gelobt?<br />
Was machen wir, wenn sie nach Jahren gehen,<br />
vielleicht frustriert, ohne dass wir es merken?<br />
Genauso wichtig wie die Nachwuchswerbung ist die<br />
Pflege der Mitglieder denn nur dann, wenn es uns gelingt,<br />
neue Menschen zu gewinnen und gleichzeitig unsere<br />
Mitglieder zu halten, wird es uns gelingen, fit für die Zukunft<br />
zu sein. Gerade in den Feuerwehren ist Jugend<br />
und Erfahrung wichtig und unverzichtbar und somit ein<br />
gesun<strong>des</strong> Gleichgewicht zwischen „jung und alt“.<br />
I 49
Arbeitskreis 3: Bürgerschaftliches Engagement in der<br />
Kommune – sportliche Ansätze und kommunale Strukturen<br />
NORBERT ENGELHARDT (GESCHÄFTSFÜHRER LANDESSPORTBUND NIEDERSACHSEN):<br />
„Unser Ziel: Lokale Engagementpolitik“<br />
Herausforderungen in Niedersachsen<br />
Die Anzahl der freiwillig engagierten Personen im Sport<br />
ist von rund 325.000 innerhalb von 2 Jahren auf nunmehr<br />
254.000 deutlich zurückgegangen. <strong>Der</strong> Arbeitsumfang<br />
der ehrenamtlich Engagierten ist deutlich von 7,3 auf<br />
50 I<br />
16,1 Stunden pro Monat angestiegen. In der Altersgruppe<br />
der 26 – 40 jährigen Mitglieder stellen wir ab dem Jahr<br />
2000 bis heute einen tatsächlichen Mitgliederrückgang<br />
von etwas mehr als 200.000 fest. Eine Altersgruppe, aus<br />
der sich vermutlich in vergangenen Zeiten traditionelle<br />
Ehrenämter rekrutiert haben. Die zu leistende ehrenamtliche<br />
Arbeit verteilt sich damit auf immer weniger Schultern.<br />
Die Klagen aus den Vereinen werden lauter.<br />
Die grundsätzlichen Motive und Bedürfnisse für und an<br />
das bürgerschaftliche Engagement haben sich nicht verändert!<br />
Vier Antworten auf die Frage nach dem ‚Warum’<br />
möchte ich nennen (nach Bernd Ziegler: Freiwilligendienste<br />
aller Generationen:<br />
„Ich will eine sinnvolle und interessante Aufgabe<br />
haben, die Spaß macht und mich weiter bringt“<br />
„Ich will sympathische Menschen treffen und<br />
mich mit ihnen austauschen.“<br />
„Ich kann mich persönlich für die Gesellschaft<br />
stark machen und im kleinen Rahmen etwas bewirken.“<br />
„Ich habe etwas, das ich anderen weitergeben<br />
und mit ihnen teilen kann.“<br />
Diese genannten Beweggründe müssen wir zum Anlass<br />
nehmen, um zukünftig weiter Menschen für das freiwillige<br />
bürgerschaftliche Engagement in unseren Vereinen<br />
und in unserer Organisation zu begeistern. Aber unser<br />
Handeln ist zu sehr auf unsere Strukturen und unsere<br />
jahrzehntelangen Erfahrungen fixiert. Wir brauchen min<strong>des</strong>tens<br />
ergänzende Rekrutierungsprogramme.
Aus der Praxis:<br />
Seit vielen Jahren bieten wir lan<strong>des</strong>weit so genannte<br />
Frauensporttage an, die über attraktive Sportgelegenheiten,<br />
Frauen gezielt in Führungspositionen in Vereinen<br />
bringen sollen. <strong>Der</strong> Veranstaltungstag ist der Höhepunkt,<br />
aber die eigentliche Wirkung erzielen wir über die Mitarbeit<br />
bei der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung.<br />
Unsere verpflichtende Vorgabe für die ausrichtenden<br />
Sportbünde ist die Zusammenarbeit mit den kommunalen<br />
Frauen- bzw. Gleichstellungsbeauftragten. Und<br />
der Erfolg der Frauensporttage führt zu einem größeren<br />
Interesse an der Übernahme von Aufgaben durch interessierte<br />
Frauen. Diese Maßnahme ist nur eine von vielen,<br />
die wir beispielsweise im Handlungsfeld Sportentwicklung<br />
an anderen Stellen auch realisieren. Immer ist eine<br />
nachhaltige Wirkung beabsichtigt, und gleichzeitig die<br />
Mitarbeit in Netzwerken.<br />
Nun zur Frage, in welcher Weise sich<br />
Menschen freiwillig engagieren?<br />
Es gibt einen Strukturwandel im Ehrenamt. Manche wollen<br />
sich weiterhin dauerhaft einbringen, ich bezeichne<br />
es, als das traditionelle und klassische Ehrenamt, das wir<br />
zweifelsohne weiterhin brauchen. Die zu erledigenden<br />
Aufgaben müssen beschrieben und leistbar sein und die<br />
Übernahme sollte vorbereitet sein.<br />
Andere möchten sich lieber kurzfristig, vielleicht sogar<br />
spontan oder über einen begrenzten Zeitraum einbringen.<br />
Neben dem traditionellen Ehrenamt entwickelt sich eine<br />
zweite Säule <strong>des</strong> freiwilligen bürgerschaftlichen Engagements,<br />
insbesondere in Form der Freiwilligendienste im<br />
Sport. Diese FSJ-ler leisten über einen definierten Zeitraum<br />
– vertraglich geregelt – eine wertvolle Leistung für<br />
das Gemeinwesen, weil diese FSJler die Kontakte über<br />
den Sport hinaus pflegen und fördern. Wir brauchen mehr<br />
davon, insbesondere braucht der Sport hier auch eine<br />
klare steuerliche Entlastung und verlässliche Rahmenbedingungen<br />
durch die Politik, der Gesetzgeber ist gefordert.<br />
Unsere Vereine sollten insbesondere eine Funktionsstelle<br />
bzw. eine besondere Zuständigkeit im Vorstand für den<br />
Bereich der Personalentwicklung, der Mitgliederbindung<br />
und -entwicklung einrichten bzw. ausweisen. Diese Aufgabe<br />
verdient einer besonderen Aufmerksamkeit und<br />
kann nicht nur einfach nebenbei gemacht werden. Unser<br />
größtes Kapital sind die Menschen selbst, und die müssen<br />
im Mittelpunkt stehen, und um die müssen wir uns<br />
aktiv kümmern.<br />
Die Entwicklung einer gemeinsamen<br />
kommunalen Strategie zu mehr Bürgerbeteiligung.<br />
Eine gemeinsame kommunale Strategie mit der Zielsetzung<br />
‚mehr Bürgerbeteiligung’ verlangt zu allererst die<br />
Bereitschaft und den guten Willen der Beteiligten zur Zusammenarbeit.<br />
Singuläres Handeln entweder durch die<br />
Sportorganisation selbst oder durch eine Kommune allein<br />
reicht nicht mehr aus. Unter strategischen Gesichtspunkten<br />
verlangt dies nach einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit<br />
und zwar über einen längeren Zeitraum. Eine<br />
institutionalisierte und vereinbarte Zusammenarbeit kann<br />
hilfreich sein.<br />
Hierzu erwarten wir von unseren Vereinsvorständen vor<br />
Ort oder in den Stadtteilen, dass sie selbstverständlich<br />
die politischen Gespräche suchen und pflegen, genauso<br />
wie dies die Sportbünde eben auf ihrer Ebene zu leisten<br />
haben. Diese lokale Engagementpolitik ist zwingend erforderlich,<br />
und hierbei handelt es sich um die Kernaufgabe<br />
der Sportpolitik und der Interessensvertretung für<br />
den Sport durch die gewählten Vorstände. Die Bandbreite<br />
der festzustellenden Aktivitäten ist groß und verlangt<br />
nach gezielten Planungsprozessen. Hier sollten eben auch<br />
I 51
Arbeitskreis 3: Bürgerschaftliches Engagement in der<br />
Kommune – sportliche Ansätze und kommunale Strukturen<br />
Formen der Beteiligung und <strong>des</strong> Austausches verbindlich<br />
und bewusst initiiert werden. Eine Einladung an Interessierte<br />
ist ausdrücklich auszusprechen. In einigen Fällen<br />
erleben wir bereits in Niedersachsen, wie „neue Freiwillige“<br />
aus ganz anderen auch sportfremden Bereichen den<br />
Zugang zu uns finden und auch durchaus positiv überrascht<br />
sind, was bei uns und damit in unserer Organisation<br />
so alles passiert!<br />
Gewinnbringende Zusammenarbeit<br />
von Sportvereinen und kommunalen<br />
Institutionen vor Ort<br />
Mit Blick auf die Sportvereine selbst registrieren wir den<br />
immer größer werdenden Bedarf nach einer gewinnbringenden<br />
Zusammenarbeit der Sportvereine untereinander.<br />
Es geht um die gemeinsame Nutzung bzw. den Bau von<br />
Sportanlagen, es geht um die Betriebs- und Unterhaltungskosten<br />
für eine Sportanlage oder auch um die Erledigung<br />
der administrativen Aufgaben in mehreren Vereinen<br />
in einer gemeinsamen Geschäftsstelle. Es geht auch<br />
um Möglichkeiten der Zusammenarbeit im sportlichen<br />
Bereich. Die ersten Vereine bewegen sich aufeinander zu.<br />
Über eine zunächst lockere Form der Zusammenarbeit<br />
gehen sie Schritt für Schritt hin zu einer vereinbarten Zusammenarbeit.<br />
Das System ist in Bewegung. Als LSB<br />
Niedersachsen bieten wir hierzu Unterstützungsleistungen<br />
an, nämlich durch die Bereitstellung eines qualifizierten<br />
Beratungspools.<br />
Auch eine gewinnbringende Zusammenarbeit mit kommunalen<br />
Institutionen entwickelt sich immer schneller.<br />
Hier arbeiten wir als LSB mit den Sportbünden zusammen<br />
und versuchen immer wieder die Zusammenarbeit beispielsweise<br />
mit Seniorenservicebüros, Integrationsleitstellen<br />
zu forcieren bzw. überhaupt erstmal zu initiieren.<br />
Hierzu nehmen wir auf Lan<strong>des</strong>ebene entsprechende Absprachen<br />
beispielsweise mit Ministerien vor, die dann<br />
gemeinsam auf die nächste Ebene getragen werden. Ein<br />
52 I<br />
schönes und erfolgreiches Beispiel ist das ‚Bewegungsnetzwerk<br />
50 Plus’ mit Unterstützung <strong>des</strong> DOSB, in dem<br />
besonders Modellprojekte zur Netzwerkbildung gefördert<br />
werden, und zwar erfolgreich.<br />
Im Prinzip bedeutet dies, die vorhandenen Handlungsakteure<br />
an einen Tisch und damit ins Gespräch zu bringen.<br />
So trivial wie es klingt, manchmal müssen sich die Menschen<br />
erst kennen lernen. Unseren Sportvereinen sagen<br />
wir, dass es neben dem bisherigen und auch traditionellen<br />
Sportbetrieb, den sie sicher beherrschen, auch noch eine<br />
ebenso attraktive Welt <strong>des</strong> Sports gibt, die uns neue<br />
Chancen eröffnet.<br />
Schließen möchte ich mit einem Blick auf die notwendige<br />
Unterstützung und die abzuleitenden Konsequenzen<br />
für uns selbst aber auch das kommunale Netzwerk.<br />
Wir brauchen<br />
p ein Managementsystem für Freiwilligenarbeit<br />
und bürgerschaftliches Engagement im Sport als<br />
gezielte Maßnahme der Organisationsentwicklung<br />
p eine aktive Mitarbeit <strong>des</strong> Sports im Netzwerk der<br />
Freiwilligenagenturen<br />
p eine Weiterentwicklung <strong>des</strong> Systems der Anerkennung<br />
und Wertschätzung für das traditionelle<br />
Ehrenamt im Sport und der Freiwilligendienste<br />
p die Anerkennung <strong>des</strong> Sports als Träger öffentlicher<br />
Belange und gezielte Förderung auf kommunaler<br />
Ebene<br />
p die Schaffung geeigneter Rahmenbedingungen<br />
durch partnerschaftliche Zusammenarbeit und<br />
gegenseitige Unterstützung.
Ergebnisse <strong>des</strong> Arbeitskreises 3<br />
I 53
Arbeitskreis 4: Quo vadis Sportentwicklung? –<br />
Wege und Methoden für optimierte Entscheidungen<br />
PROF. DR. ALFRED RÜTTEN (UNIVERSITÄT ERLANGEN-NÜRNBERG):<br />
54 I
Zur aktuellen Diskussion der kommunalen<br />
Sportentwicklungsplanung<br />
I 55
Arbeitskreis 4: Quo vadis Sportentwicklung? –<br />
Wege und Methoden für optimierte Entscheidungen<br />
PROF. DR. ALFRED RÜTTEN (UNIVERSITÄT ERLANGEN-NÜRNBERG):<br />
56 I
RUDOLF BEHACKER (LEITER DES SPORTAMTES DER LANDESHAUPTSTADT MÜNCHEN):<br />
Sportentwicklungsplanung – ein Teil der Stadtentwicklung<br />
I 57
Arbeitskreis 4: Quo vadis Sportentwicklung? –<br />
Wege und Methoden für optimierte Entscheidungen<br />
RUDOLF BEHACKER (LEITER DES SPORTAMTES DER LANDESHAUPTSTADT MÜNCHEN):<br />
58 I
ROLAND FRISCHKORN (VORSITZENDER DES SPORTKREISES FRANKFURT):<br />
Sportentwicklungsplanung in Frankfurt<br />
I 59
Arbeitskreis 4: Quo vadis Sportentwicklung? –<br />
Wege und Methoden für optimierte Entscheidungen<br />
ROLAND FRISCHKORN (VORSITZENDER DES SPORTKREISES FRANKFURT):<br />
60 I
STEPHAN SCHNEIDER (KOMMUNALES FREIZEIT- UND SPORTBÜRO STADT VIERNHEIM):<br />
Quo Vadis Sportentwicklung?<br />
Wege und Methoden für optimierte Entscheidungen<br />
Praxisbeispiel Viernheim/Hessen<br />
Die Stadt Viernheim sieht sich als sport- und bewegungsorientierte<br />
südhessische Stadt im Zentrum der Metropolregion<br />
Rhein-Neckar. Sie ist Teil <strong>des</strong> Gesunde-Städte-<br />
Netzwerks in Deutschland, 1. hessische Energiesparstadt<br />
und ab Mai 2010 auch Fairtrade-Stadt. Viernheim lebt<br />
den Gedanken der Bürgerkommune und sieht <strong>des</strong>halb die<br />
kooperative Sportentwicklungsplanung als weiteren,<br />
wichtigen Schritt innerhalb ihres Leitbilds.<br />
Neueste statistische Daten und die demographische<br />
Entwicklung in Viernheim verdeutlichen, warum die<br />
kooperative Sportentwicklungsplanung ein unabdingbarer<br />
Schritt für die Kommune war und ist.<br />
Neben der kommunalpolitischen Lobbybildung ist auch<br />
die Bewusstseinsbildung, Sport als Querschnittsaufgabe<br />
zu betrachten, relativ schnell erreicht worden. Es wurden<br />
und werden hier ständig sinnvolle Ergänzungen eingearbeitet.<br />
Letztlich bilden die Handlungsempfehlungen mit<br />
ca. 30 Projektideen in einer Prioritätenliste die Basis für<br />
das zukünftige, gemeinsame Vorgehen von Verwaltungsstellen,<br />
organisiertem und nichtorganisiertem Sport und<br />
der Kommunalpolitik.<br />
Aus den drei Handlungsfeldern „Angebotsebene“, „Organisationsebene“<br />
und „Sport- und Bewegungsräume“<br />
werden Fallbeispiele mit einer völlig neuen Arbeitsweise<br />
der Sportverwaltung beschrieben.<br />
I 61
Arbeitskreis 4: Quo vadis Sportentwicklung? –<br />
Wege und Methoden für optimierte Entscheidungen<br />
Die finanzielle Grundausstattung ist zunächst sehr gering<br />
und soll die Projektorganisation abdecken. Sobald die<br />
Projekte in der Startphase einer Anschubfinanzierung bedürfen,<br />
werden diese gesondert über Sponsoren und<br />
Förderer, spezielle Haushaltsmittel oder sonstige Zuschüsse<br />
generiert.<br />
Einen Modellcharakter hat z.B. das Projekt „Schwimmfix“,<br />
das es zuvor nur in Deutschland nur in Heidelberg<br />
gab. In Kooperation zwischen allen Grundschulen, dem<br />
Schulamt <strong>des</strong> Landkreises, Vereinen und Institutionen<br />
und unter Federführung der Sportverwaltung wird allen<br />
Schülerinnen und Schülern der 2. Klassen, die nicht<br />
schwimmen können, direkt im Anschluss an den Unterricht<br />
das Schwimmen beigebracht. Nach wenigen Wochen<br />
steht zum Abschluss <strong>des</strong> jeweiligen Kurses der<br />
Erwerb <strong>des</strong> sog. „Seepferdchens“.<br />
Die Sportverwaltung hat auch ein Konzept für ein zukunftsorientiertes<br />
Vereinsmanagement („Fitnessprogramm<br />
für Vereine“) entwickelt, dass viele Probleme der<br />
62 I<br />
Vereine aufgreift sowie Hilfestellungen und Förderungen<br />
anbietet.<br />
Im Bereich der Sportinfrastruktur wird derzeit ein durch<br />
den Sportentwicklungsplan deutlich gewordener Bedarf<br />
an einer offenen, familienorientierten Sportstätte bzw.<br />
Sportlandschaft analysiert. In einem derzeit eher traditionellen<br />
Sportgebiet mit Fußballanlagen soll in Kooperation<br />
zwischen den Nutzern (Vereine, Schulen, Jugendförderung),<br />
den Querschnittsämtern der Verwaltung und der<br />
Kommunalpolitik schrittweise ein Familiensportpark entstehen.<br />
Auch hierzu gibt es einen vom Sportbüro geleiteten<br />
Arbeitskreis.<br />
Es wird deutlich, dass nicht unbedingt die finanzielle<br />
Grundausstattung die wesentlichste Erfolgsgarantie<br />
darstellt, sondern eine möglichst professionelle Personalstruktur<br />
in der Sportverwaltung. Das Sportbüro wird mehr<br />
und mehr vom Verwaltungsinstrument zum Gestaltungsinstrument<br />
und kann so wesentlich zur erfolgreichen<br />
Umsetzung der Sportentwicklungsplanung beitragen.
Ergebnisse <strong>des</strong> Arbeitskreises 4<br />
I 63
Arbeitskreis 5: Leistungssportförderung vor Ort –<br />
Erfolgsfaktor für den Spitzensport<br />
NORBERT BRENNER (STELLV. GENERALSEKRETÄR DEUTSCHER LEICHTATHLETIK-VERBAND):<br />
64 I
Leistungssportförderung vor Ort –<br />
Erfolgsfaktor für den Spitzensport<br />
I 65
Arbeitskreis 5: Leistungssportförderung vor Ort –<br />
Erfolgsfaktor für den Spitzensport<br />
REINHARD RAWE (DIREKTOR DES LANDESSPORTBUNDES NIEDERSACHSEN):<br />
Leistungssportförderung vor Ort – Erfolgsfaktor für<br />
den Spitzensport<br />
Im Artikel 6 der Niedersächsischen Verfassung steht seit<br />
1997: „Das Land, die Gemeinden und die Landkreise<br />
schützen und fördern, Kunst, Kultur und Sport.“ Ähnliche<br />
Formulierungen finden sich in den Verfassungen aller<br />
Bun<strong>des</strong>länder, mit Ausnahme von Hamburg. Ein Rechtsanspruch<br />
auf Sportförderung lässt sich aus diesem Verfassungsauftrag<br />
allerdings nicht ableiten. Auf kommunaler<br />
Ebene ist die Sportförderung nach wie vor eine freiwillige<br />
Leistung. Gleichwohl handelt es sich um eine politische<br />
Willenserklärung, die der Bedeutung <strong>des</strong> Sports für das<br />
Gemeinwohl in unserer Gesellschaft Rechnung tragen soll.<br />
Die Kommunen sind sich im Allgemeinen der gesellschaftlichen<br />
und kommunalpolitischen Bedeutung <strong>des</strong> Sports<br />
bewusst. Rund 80 Prozent der öffentlichen Sportförderung<br />
in Deutschland wird von den Kommunen bereitgestellt –<br />
das entspricht über drei Milliarden Euro jährlich.<br />
Allerdings werden die Folgen und Auswirkungen der aktuellen<br />
Finanz- und Wirtschaftskrise für die Kommunen<br />
immer stärker spürbar. Steigende Verschuldung und zurückgehende<br />
Steuereinnahmen belasten die ohnehin<br />
knappen Finanzhaushalte. Immer mehr Kommunen drohen<br />
handlungsunfähig zu werden. Als unweigerliche<br />
Konsequenz daraus stehen die so genannten freiwilligen<br />
Leistungen der Kommunen mehr denn je auf dem Prüfstand.<br />
Das Subsidiaritätsprinzip – Hilfe zur Selbsthilfe –<br />
steht zur Diskussion. Es werden neue Modelle gesucht,<br />
wie Kosten für Sportanlagen reduziert oder neue Einnahmequellen<br />
erschlossen werden können. Die Krise der<br />
Kommunalfinanzen bedroht somit auch in erheblichem<br />
Maße den Sport im Verein. Bereits im Sportentwicklungsbericht<br />
2008 wird darauf hingewiesen, dass sich von den<br />
etwa 9.600 niedersächsischen Sportvereinen rund 1.200<br />
aus finanziellen Erwägungen in ihrer Existenz bedroht<br />
66 I<br />
sehen. Die aktuelle Entwicklung sollte Anlass sein, das<br />
Zusammenspiel von Kommune und Sport näher zu betrachten.<br />
Was bietet Sport/Leistungssport den<br />
Kommunen?<br />
<strong>Der</strong> Sport wird allgemein als weicher Standortfaktor betrachtet.<br />
Er ist wichtig für die Daseinsvorsorge der Menschen,<br />
hat ein erhebliches Integrationspotential, fördert die<br />
Gesundheit und ist ein verlässlicher Partner für Schulen<br />
und Kindergärten. Auf die Bedeutung <strong>des</strong> Sports als soziale<br />
und gemeinschaftsbildende Kraft wird in öffentlichen<br />
Debatten zu Recht hingewiesen.<br />
Darüber hinaus erfüllt der Sport – insbesondere der<br />
Leistungssport – für die Kommunen weitere relevante<br />
Funktionen: Leistungssport und hochkarätige Sportveranstaltungen<br />
sind auch Werbe- und Imagefaktoren für<br />
die Kommunen. Eine zukunftsorientierte Kommunalpolitik<br />
begreift Sport daher als Investition in die Zukunft.<br />
Leistungssportförderung ist auch immer Wirtschafts- und<br />
Tourismusförderung. <strong>Der</strong> Leistungssport ist somit eine<br />
regionalwirtschaftliche Kraft und schafft Arbeitsplätze vor<br />
Ort. Eine erfolgreiche Sportentwicklung trägt dadurch<br />
ganz konkret zu einer erfolgreichen Kommunalentwicklung<br />
bei. Sicherlich muss relativiert werden, dass Sport<br />
allein noch keine starke Kommune entstehen lässt, dazu<br />
gehören vor allem auch eine starke Wirtschaft, gute Bildungsbedingungen<br />
und weitere Erfolgsfaktoren. Aber<br />
ohne einen starken Sport kann und wird es auch in Zukunft<br />
keine starken Kommunen geben. Deshalb sind wir
alle gut beraten, mit Augenmaß auf allen Ebenen dafür<br />
zu arbeiten, dass wir bei<strong>des</strong> erreichen: starken Sport und<br />
starke Kommunen!<br />
<strong>Der</strong> LSB Niedersachsen hat es sich daher 2007 in einer<br />
gemeinsamen Erklärung mit dem Niedersächsischen Innenministerium<br />
und den drei kommunalen Spitzenverbänden<br />
zur Aufgabe gemacht, dieses Ziel zu erreichen („Sport<br />
tut den Menschen in Kommunen gut!“).<br />
Erfolgsfaktoren für den Spitzensport<br />
in Niedersachsen<br />
Die kommunale Sportförderung bildet die Basis für eine<br />
erfolgreiche Spitzensportförderung. Gerade in einem Flächenland<br />
wie Niedersachsen ist es wichtig, dass Talente<br />
und Begabungen in den Sportvereinen aber auch in den<br />
Schulen erkannt und gefördert werden können. Im Jahre<br />
2002 hat der LSB daher gemeinsam mit dem Niedersächsischen<br />
Kultusministerium und unter Beteiligung der damaligen<br />
Bezirksregierungen ein Modell entwickelt, dass<br />
auf drei Säulen beruht:<br />
1. Zentralisierung:<br />
Sportbetonte Schule/Eliteschule <strong>des</strong> Sports<br />
Die steigende Nachfrage nach Internatsplätzen für Kaderathletinnen<br />
und -athleten mit professioneller sportlicher<br />
Betreuung am Olympiastützpunkt (OSP) in Hannover<br />
erforderte zahlenmäßige Erweiterung und machte einen<br />
Neubau <strong>des</strong> Sportinternats notwendig. Zum Beginn <strong>des</strong><br />
Schuljahres 2010/2011 stehen nunmehr 75 Vollzeit- und<br />
60 Teilzeitplätze für junge Talente sowie 12 Plätze für<br />
erwachsene Spitzensportlerinnen und Spitzensportler bereit.<br />
<strong>Der</strong> LSB nimmt bei der Leistungssportförderung in<br />
Niedersachsen eine zentrale Rolle ein. <strong>Der</strong> LSB fungiert<br />
als Träger <strong>des</strong> OSP, in <strong>des</strong>sen Verantwortung alle derzeit<br />
13 Bun<strong>des</strong>stützpunkte sowie zwei paralympische Trainingsstützpunkte<br />
in Niedersachsen liegen. <strong>Der</strong> LSB stellt<br />
Trainerinnen und Trainer ein, er ist Betreiber <strong>des</strong> Sportin-<br />
ternats und Vertragspartner für das Sportleistungszentrum,<br />
die Medizinische Hochschule Hannover und die Niedersächsische<br />
Polizeiakademie. Durch die Zusammenarbeit<br />
mit zwei hannoverschen Schulen werden schulische und<br />
leistungssportliche Ansprüche sinnvoll koordiniert, damit<br />
die sportlichen Talente trotz der besonderen Anforderungen<br />
keine schulischen Nachteile erfahren. Jährlich fließen<br />
€ 4,8 Mio. aus dem LSB-Haushalt in die Leistungs- und<br />
Spitzensportförderung.<br />
2. Regionalisierung:<br />
Partnerschulen <strong>des</strong> Leistungssports<br />
Hauptberufliche Lan<strong>des</strong>trainerinnen und -trainer betreuen<br />
die Lan<strong>des</strong>leistungszentren (LLZ) und Lan<strong>des</strong>stützpunkte<br />
(LSTP) der niedersächsischen Schwerpunktsportarten auch<br />
in den Regionen von Niedersachsen. Diese Regionalisierung<br />
<strong>des</strong> Leistungssports, die in einem Flächenland dringend<br />
erforderlich ist, wird vom LSB weiter ausgebaut<br />
und stabilisiert, um den lan<strong>des</strong>weiten Zufluss professionell<br />
ausgebildeter Nachwuchsathletinnen und -athleten zum<br />
OSP Hannover weiter zu stärken und abzusichern.<br />
3. Talentfindung und Talentförderung:<br />
Sportfreundliche Schulen<br />
Unstrittig bei allen Talentsichtungsmaßnahmen ist die<br />
herausragende Bedeutung der Schule. Es ist <strong>des</strong>halb<br />
erforderlich, dass Schulen, Sportvereine und Verbände bei<br />
der Talentfindung eng zusammenarbeiten und gemeinsame<br />
Programme entwickeln. Insbesondere vor dem Hintergrund<br />
zunehmender Ganztagsschulen muss es ein<br />
gemeinsames Ziel sein, die Anzahl der an Sichtungsmaßnahmen<br />
beteiligten Schulen deutlich zu erhöhen, die<br />
Talentsichtung zu systematisieren und Methoden zu entwickeln,<br />
wie die gesichteten Talente möglichst ohne<br />
große Aussteigerquote in die Fördermaßnahmen der Vereine<br />
und Verbände aufgenommen werden können. Eine<br />
wesentliche Rolle kommt dabei den hauptberuflichen<br />
Trainerinnen und Trainern der regionalen Lan<strong>des</strong>leistungszentren<br />
(LLZ) und Lan<strong>des</strong>stützpunkte (LSTP) zu, die vor<br />
I 67
Arbeitskreis 5: Leistungssportförderung vor Ort –<br />
Erfolgsfaktor für den Spitzensport<br />
Ort in den niedersächsischen Schwerpunktsportarten<br />
leistungssportgerichtete Kooperationen gemeinsam mit<br />
den Sportlehrkräften der Sportfreundlichen Schulen<br />
entwickeln. Diese Schulen übernehmen somit in Zusammenarbeit<br />
mit Vereinen, Verbänden und Leistungszentren<br />
eine wichtige „Zuführfunktion“ für den Leistungssport.<br />
Erwartungen <strong>des</strong> LSB Niedersachsen<br />
Die aufgeführten Maßnahmen setzen eine langfristig<br />
abgesicherte kommunale Sportförderung voraus. Aus<br />
diesem Grund ist es notwendig, dass sich die Bedeutung<br />
<strong>des</strong> Sports für die Kommunen und für das gemeinschaftliche<br />
Zusammenleben in Niedersachsen und Deutschland<br />
sowohl in der Haushaltsplanung von Bund und Ländern<br />
als auch in den gesetzlichen Regelungen widerspiegeln.<br />
Die besondere Bedeutung <strong>des</strong> Sports gerade auch für<br />
die Gemeinden, Städte und Landkreise muss auch im Rahmen<br />
der staatlichen Haushaltsaufsicht entsprechend berücksichtigt<br />
werden.<br />
<strong>Der</strong> LSB Niedersachsen ist der Ansicht, dass der Sport zur<br />
kommunalen Pflichtaufgabe werden muss. Nur so kann<br />
sichergestellt werden, dass Sportförderung nicht nur als<br />
Kostenfaktor, sondern als rechtliche Verpflichtung wahrgenommen<br />
und mit anderen Förderungsverpflichtungen<br />
gleichgestellt wird. Im Zusammenhang finanzieller Absicherung<br />
tritt der LSB Niedersachsen darüber hinaus für<br />
die Verabschiedung eines Sportgesetzes ein. Langfristig<br />
kann dadurch eine Absicherung der Fördermittel gewährleistet<br />
werden, die den Sport unabhängig von Konzessionsabgaben<br />
und Zweckerträgen aus Lotterien und<br />
Sportwetten macht.<br />
Aber auch unabhängig von gesetzlichen Regelungen<br />
können die Städte und Gemeinden ihren Beitrag für eine<br />
erfolgreiche kommunale Sportentwicklung leisten. So<br />
sollten die Marketing- und Imagepotentiale <strong>des</strong> Sports<br />
stärker wahrgenommen und genutzt werden. Leistungs-<br />
68 I<br />
sportförderung vor Ort kann sowohl ein Erfolgsfaktor für<br />
den Spitzensport als auch für die Kommunalentwicklung<br />
sein. Voraussetzung ist ein strategisch gelungenes Zusammenwirken<br />
der handelnden Akteure vor Ort. Es gilt<br />
die Kompetenzen von organisiertem Sport, Politik und<br />
Wirtschaft gewinnbringend zu verknüpfen. Grundvoraussetzung<br />
für eine erfolgreiche Zukunft kommunaler<br />
Sportentwicklung ist es, die Rolle <strong>des</strong> Sports für die Weiterentwicklung<br />
<strong>des</strong> Lan<strong>des</strong> Niedersachsen positiv darzustellen.<br />
Beispiele aus Niedersachsen zeigen: Erfolgreiche<br />
kommunale Sportpolitik kann auch trotz knapper<br />
Kassen gelingen!<br />
In Öffentlichkeit und Politik Niedersachsens wird seit<br />
geraumer Zeit ein Diskurs über die Bedeutung und die<br />
Form der Spitzensportförderung geführt. Unterschiedlichste<br />
Positionen und Standpunkte treten hierbei zu Tage.<br />
In Hannover möchten beispielsweise die Stadtratsfraktionen<br />
von SPD und CDU eine dauerhafte Arbeitsgruppe<br />
zur Unterstützung und Förderung <strong>des</strong> Spitzensports einrichten.<br />
Nach Meinung von SPD und CDU sei darüber<br />
hinaus zur Förderung <strong>des</strong> Spitzensports die Unterstützung<br />
der Hannover Marketing und Tourismus GmbH (HMTG)<br />
notwendig. <strong>Der</strong> Geschäftsführer der HMTG, Hans Christian<br />
Nolte, behauptet allerdings: „Spitzensport spielt als<br />
Imagefaktor für eine Stadt keine Rolle.“ Die Fraktion der<br />
Grünen im Stadtrat priorisiert wiederum eine stärkere<br />
Breitensportförderung als Basis für den Spitzensport.<br />
Die Debatte zeigt uns zum einen, dass das Thema Leistungssportförderung<br />
wichtig ist und in Politik und Öffentlichkeit<br />
wahrgenommen wird. Zum anderen bestärkten<br />
sie den LSB und seine Mitgliedsvereine darin, gemeinsam<br />
mit den Kommunen weiter an der Erreichung unserer<br />
Ziele zu arbeiten: Einen starken Sport und starke Kommunen.<br />
Denn am gemeinnützigen Sport zu sparen heißt,<br />
am Gemeinwohl der Bürgerinnen und Bürger zu sparen.<br />
Es stellt letztendlich die Bedeutung all jener sozialen,<br />
integrativen und gesundheitlichen Funktionen infrage,<br />
die der Sport anerkanntermaßen in sich vereint.
DIETER SANDEN (LEITER DES SPORTAMTS DER STADT KÖLN):<br />
Leistungssportförderung vor Ort – Erfolgsfaktor für<br />
den Spitzensport aus Perspektive der Stadt Köln<br />
I 69
Arbeitskreis 5: Leistungssportförderung vor Ort –<br />
Erfolgsfaktor für den Spitzensport<br />
DIETER SANDEN (LEITER DES SPORTAMTS DER STADT KÖLN):<br />
70 I
I 71
Arbeitskreis 5: Leistungssportförderung vor Ort –<br />
Erfolgsfaktor für den Spitzensport<br />
ANDREAS DITTMER (DEUTSCHER SPARKASSEN- UND GIROVERBAND):<br />
Leistungssportförderung vor Ort – Erfolgsfaktor für<br />
den Spitzensport<br />
Die Sparkassen haben bei der Entwicklung der regionalen<br />
und lokalen Wirtschaft eine wichtige Rolle. Unsere Mitarbeiter<br />
arbeiten dort, wo unsere Kunden leben. Sie treffen<br />
die Kunden in der Nachbarschaft, in der Freizeit oder<br />
im Verein. Gerade weil wir in der Region zu Hause sind,<br />
kennen wir die Sorgen und Nöte der Menschen.<br />
Sparkassen sind kommunal gebundene Kreditinstitute,<br />
<strong>des</strong>halb ist es Teil ihres Selbstverständnisses, sich überall<br />
im Land für Kunst und Kultur, Wissenschaft und Bildung,<br />
Soziales und Sport zu engagieren. Dieses gemeinwohlorientierte<br />
Engagement war der Sparkassen-Finanzgruppe<br />
in Deutschland im vergangenen Jahr 445 Millionen Euro<br />
wert. Über 80 Millionen Euro davon flossen direkt in die<br />
Sportförderung und kommen den Sportvereinen zu Gute.<br />
72 I<br />
Wir kümmern uns um die Vereine vor Ort. Ein wesentlicher<br />
Teil <strong>des</strong> gesellschaftlichen Lebens findet in den Vereinen<br />
statt. Sie spielen nach wie vor eine wichtige Rolle bei der<br />
Schaffung eines gesunden sozialen Umfel<strong>des</strong> in unserer<br />
Gesellschaft.<br />
Die Sparkassen unterstützen die Vereine in verschiedenster<br />
Form. So werden zum Beispiel Nachwuchswettbewerbe<br />
veranstaltet, verdiente Sportlerinnen und Sportler der jeweiligen<br />
Region geehrt, Sportveranstaltungen unterstützt<br />
und wichtige Projekte gefördert. Doch es bleibt nicht nur<br />
bei der finanzieller Unterstützung.
Ideell gestalten viele Sparkassen-Mitarbeiterinnen und –<br />
Mitarbeiter konstruktiv die Vereinsarbeit mit. Ob im<br />
Vereinsvorstand als Schatzmeister oder als Übungsleiter,<br />
nahezu 100.000 Personen arbeiten ehrenamtlich in<br />
einem Verein.<br />
Ausgehend von der Erwartung, dass die künftige Qualität<br />
<strong>des</strong> Standortes Deutschland von einer hoch begabten<br />
und ebenso hoch engagierten Jugend positiv geprägt<br />
werden kann, wollen wir leistungsfähige und leistungswillige<br />
junge Menschen gezielt fördern. Auch diese Arbeit<br />
ist vor allem in den Regionen zu leisten, allerdings<br />
sollten ihr national schlüssige Konzepte zu Grunde liegen.<br />
Bei den „Eliteschulen <strong>des</strong> Sports“ ist dies der Fall.<br />
<strong>Der</strong> überwiegende Teil der deutschen Olympiamannschaft<br />
hat die guten Bedingungen an einer Eliteschule<br />
<strong>des</strong> Sports genutzt. Von den 43 Medaillengewinnern der<br />
<strong>Olympische</strong>n Spiele in Vancouver durchliefen sogar 36<br />
eine Eliteschule <strong>des</strong> Sports. Unter Ihnen beispielsweise<br />
die Olympiasieger Maria Riesch, Andre Lange, Claudia<br />
Nystad, Stefanie Beckert, Felix Loch oder Tatjana Hüfner.<br />
Seit 1997, also seit ihrer bun<strong>des</strong>weiten Installierung, fördern<br />
wir – und zwar ausschließlich projektbezogen – die<br />
„Eliteschulen <strong>des</strong> Sports“. Hierbei handelt es sich um ein<br />
Verbundsystem von koordinierter schulischer wie auch<br />
sportlicher Entwicklung der jungen Athleten, wobei stets<br />
ein Internat angeschlossen ist, um die jeweils Besten<br />
auch schulisch so konzentriert wie möglich betreuen und<br />
weiter entwickeln zu können.<br />
Die projektbezogene Förderung der zuvor beschriebenen<br />
Verbundsysteme besteht zur Zeit vor allem in der Beschaffung<br />
von Trainingsgeräten, von Laptops für die jungen<br />
Talente zur Übermittlung und Bearbeitung schulischer<br />
Aufgaben an Trainingsstätten sowie in der Auflegung<br />
zukunftsweisender Projekte an einzelnen Standorten,<br />
zum Beispiel für eine sportgerechtere Ernährung.<br />
Unser gesellschaftliches Engagement zu Gunsten <strong>des</strong><br />
Sports erfolgt im Wesentlichen über das Instrument <strong>des</strong><br />
Sponsoring. Das heißt, für unsere Leistungen verlangen<br />
wir adäquate Gegenleistungen, vor allem in Form <strong>des</strong><br />
Imagetransfers und kommunikativer Leistungen <strong>des</strong> Geförderten.<br />
Seit Anfang 2008 sind wir Olympia Partner Deutschland<br />
und haben somit für die Sportförderaktivitäten der Sparkassen-Finanzgruppe<br />
ein Dach gefunden, unter das alle<br />
Institute schlüpfen können.<br />
Die Kooperation mit dem <strong>Deutsche</strong>n <strong>Olympische</strong>n Sportbund<br />
geht bewusst über das klassische Sponsoring der<br />
deutschen Olympiamannschaft hinaus und bezieht die systematische<br />
Talentförderung und die Bereiche <strong>des</strong> Breitensports<br />
mit ein. Zum einen unterstützt die Sparkassen-<br />
Finanzgruppe als Olympia Partner Deutschland die nationalen<br />
Olympiateilnehmer so wie zuletzt in Vancouver<br />
auch in London 2012. Die Athleten kommen natürlich aus<br />
den verschiedensten Regionen und so können unsere Institute<br />
deren Popularität vor Ort in ihre Kommunikationsstrategie<br />
integrieren.<br />
Das Breitensportengagement konzentriert sich auf die<br />
Förderung <strong>des</strong> <strong>Deutsche</strong>n Sportabzeichens. Die Förderung<br />
<strong>des</strong> Nachwuchses an den Eliteschulen <strong>des</strong> Sports bildet<br />
den dritten Baustein unserer Kooperation und zeigt, dass<br />
wir nicht nur die Olympiamannschaft unterstützen sondern<br />
wesentlich zum Aufbau zukünftiger erfolgreicher<br />
Teams beitragen.<br />
Das Engagement als Nationaler Förderer der Bewerbungsgesellschaft<br />
München 2018 ist daher nur die logische<br />
Fortsetzung unserer Leistungen für den Sport und die<br />
Gesellschaft.<br />
I 73
Arbeitskreis 5: Leistungssportförderung vor Ort –<br />
Erfolgsfaktor für den Spitzensport<br />
Ergebnisse <strong>des</strong> Arbeitskreises 5<br />
74 I
Arbeitskreis 6: Sportorganisationen und Kommunen –<br />
starke Partner im Bereich Gesundheit<br />
DR. UTA ENGELS (DEUTSCHER OLYMPISCHER SPORTBUND):<br />
Gesundheitsorientierter Sport im Sportverein –<br />
Chancen für die Entwicklung gesunder Kommunen<br />
I 75
Arbeitskreis 6: Sportorganisationen und Kommunen –<br />
starke Partner im Bereich Gesundheit<br />
DR. UTA ENGELS (DEUTSCHER OLYMPISCHER SPORTBUND):<br />
76 I
I 77
Arbeitskreis 6: Sportorganisationen und Kommunen –<br />
starke Partner im Bereich Gesundheit<br />
DR. UTA ENGELS (DEUTSCHER OLYMPISCHER SPORTBUND):<br />
78 I
I 79
Arbeitskreis 6: Sportorganisationen und Kommunen –<br />
starke Partner im Bereich Gesundheit<br />
DR. ANDREA FRÖHLICH (LEITERIN DES SPORTAMTS DER STADT KASSEL):<br />
Sport und Ernährung in Kasseler Kitas<br />
Projektbeschreibung<br />
In einem viermonatigen Pilotprojekt „Sport und Ernährung<br />
in Kasseler Kitas“ wurde ein zusätzliches Angebot<br />
von sportpädagogischen und gesundheitsorientierten<br />
Praxisstunden durch den stadtteilansässigen Sportverein<br />
angeboten. So konnte exemplarisch ein Stadtteil-Netzwerk<br />
zur Frühförderung der Bewegungs- und Esskultur<br />
von Kindern im 2. Kindergartenjahr aufgebaut werden.<br />
Ergänzend dazu wurden Aktionen zur Information und<br />
Beratung von Erzieherinnen und Familien hinsichtlich<br />
gesundheitsorientierter Bewegungsformen im Sportverein<br />
durchgeführt. Die Konzeption, die Evaluierung und<br />
deren Reflexion wurden dokumentiert und dienen dazu,<br />
flächendeckend in allen städtischen Kitas Sport über<br />
die stadtteilbezogenen Sportvereine anbieten zu können.<br />
Folgende Module wurden durchgeführt:<br />
p zusätzliche Sportstunden in der Kita über die<br />
Übungsleiterin <strong>des</strong> Sportvereins<br />
p Kontaktherstellung zwischen Kita und<br />
Sportvereine und Ansprechpartnern<br />
p Exkursionen mit den Kindern aus der Kita zu<br />
bestimmten Übungsstunden <strong>des</strong> Vereins<br />
p Planung von Aktionen zum Thema Ernährung<br />
für Kinder/Eltern/Erzieherinnen<br />
p Schriftliche <strong>Dokumentation</strong> der Maßnahme mit<br />
Foto- und Video-Aufzeichnungen<br />
p Evaluierung der Sportstunden und Aktionen bei<br />
Kindern/Eltern/Erzieherinnen<br />
p <strong>Dokumentation</strong> <strong>des</strong> Gesamtkonzeptes in einer<br />
Broschüre zur weiteren Anwendung<br />
p Gestaltung und Druck einer Broschüre<br />
80 I<br />
Warum startet die Kassel die Initiative<br />
„Klein, aber Fit in Kassel“<br />
Die neuesten Zahlen sprechen eine deutliche Sprache:<br />
15 % der Kinder und Jugendlichen im Alter von 0 –<br />
17 Jahren sind übergewichtig oder adipös. 58 % der<br />
Mädchen und 38 % der Jungen bewegen sich weniger<br />
als eine Stunde pro Tag.<br />
Genau diesem negativen Trend will der Nationale Aktionsplan<br />
„IN FORM“ entgegenwirken, um das Ernährungsund<br />
Bewegungsverhalten in Deutschland nachhaltig zu<br />
verbessern. Erwachsene sollen gesünder leben, Kinder<br />
gesünder aufwachsen, um damit die Leistungsfähigkeit<br />
für Bildung, Beruf und Privatleben zu steigern. Krankheiten<br />
sollen deutlich zurückgehen, die oftmals durch ungesunden<br />
Lebensstil, wie einseitige Ernährung und Bewegungsmangel<br />
verursacht werden. Jetzt will auch die<br />
Stadt Kassel mit seinem Sportamt dem negativen Trend<br />
entgegenwirken.<br />
Mit dem Start <strong>des</strong> Modellprojektes im Stadtteil Nordshausen<br />
soll im November diesen Jahres mit Hilfe einer<br />
qualifizierten Übungsleiterin ein Sportprogramm über<br />
mehrere Monate in der örtlichen Kita angeboten werden.<br />
Begleitend dazu werden Kinder und Eltern über richtige<br />
Ernährung informiert und wertvolle Tipps für das Alltagsverhalten<br />
gegeben. Unterstützt wird das Projekt vom<br />
Hessischen Ministerium <strong>des</strong> Innern und für Sport sowie<br />
dem Lan<strong>des</strong>sportbund Hessen. Unter dem Motto „Sport<br />
und Ernährung in Kasseler Kindergärten“ ist ab Sommer<br />
nächsten Jahres, auf den Erfahrungen in Nordshausen<br />
aufbauend, in allen Stadtteilen Kassels die Kooperation<br />
von städtischen Kindergärten und örtlichen Sportvereinen<br />
geplant.
Sportstunden<br />
<strong>Der</strong> Sport im Kindergarten mit besonderem Augenmerk<br />
auf die gesunde Ernährung erfolgte nach Handlungsprinzipien,<br />
welche den Kindern durch vielfältige Lernprozesse<br />
den Wechsel vom bloßen Mitmachen und Mitspielen zum<br />
selbstbestimmten Teilnehmen an der Sportstunde ermöglicht.<br />
Dieser Prozess kann nur längerfristig angelegt sein<br />
und geübt werden. So sollten die Kinder zur Mitgestaltung,<br />
Weiterentwicklung und Veränderung angeregt werden,<br />
aktivierende Impulse und Eigeninitiative sollten<br />
herausgefordert werden sowie die freiwillige Leistungsbereitschaft,<br />
eigene Bewegungserfahrungen und Eigeninitiative<br />
gefördert werden.<br />
In den Sportstunden hat sich gezeigt, dass der Bewegungsdrang<br />
bei allen Kindern enorm hoch ist. Bis die Stunde<br />
begann, durften sie sich frei im Raum bewegen, was sie<br />
auch nutzten.<br />
Ernährung<br />
Die Themenschwerpunkte bei der gesunden Ernährung<br />
sind das Trinkverhalten sowie das Kennenlernen einiger<br />
Obst- und Gemüsesorten. Vor den Sportstunden wurde<br />
in der Gruppe gemeinsam mit den Kindern ein Obstteller<br />
vorbereitet. Das ermöglichte ihnen verschiedene Obstsorten<br />
mit allen Sinnen kennen zu lernen, d. h. wie sie<br />
schmecken, wie sie sich anfühlen und wie sie aussehen<br />
(mit und ohne Schale). Darüber hinaus lernen sie, welcher<br />
Teil <strong>des</strong> Obstes gegessen werden kann und dass man es<br />
roh essen kann.<br />
Ziel ist es die Kinder auf diese Weise Schritt für Schritt an<br />
alle Nahrungsmittelgruppen der Ernährungspyramide<br />
heranzuführen, damit sich das Gehörte spielerisch in den<br />
Bewegungsspielen vertiefen kann.<br />
Reflexion<br />
Das Projekt hat gezeigt, wie wichtig die Frühförderung<br />
der Bewegungs- und Esskultur von Kindergartenkindern<br />
ist. Hier werden viele Kinder erreicht, die diese Förderung<br />
dringend brauchen und über den „normalen“ Vereinsweg<br />
nicht oder nur sehr schwer zu erreichen sind.<br />
Die Sportstunden berücksichtigten den zu erwartenden<br />
Entwicklungsstand der Kinder dieses Alters für die Bereiche<br />
Spiel und Sport. Es hat sich allerdings herausgestellt,<br />
dass die Erwartung an die Kinder zum Teil zu hoch angesetzt<br />
gewesen war. So mussten z.B. vermeintlich einfache<br />
Tätigkeiten wie Fangen oder Balancieren über eine 20 cm<br />
breite Langbank mit der Mehrheit der Kinder erst geübt<br />
werden.<br />
Ein hoher Anteil an Mitbestimmung bei der Spiel- und<br />
Geräteauswahl steigert die Motivation enorm. In den<br />
Sportstunden waren auch immer, wenn möglich, eine der<br />
Erzieherinnen anwesend. Das hatte mehrere große Vorteile.<br />
Zum einen der direkte Informationsfluss in beide<br />
Richtungen und zum anderen konnte die anwesende Erzieherin<br />
verfolgen, welche Inhalte zum Thema Ernährung<br />
in welcher Weise besprochen und sportlich umgesetzt<br />
wurden.<br />
Das Projekt hat ergeben, dass die Elternarbeit sehr wichtig<br />
ist. Informationsveranstaltungen wurden leider nur<br />
von ohnehin engagierten Eltern angenommen. Deshalb<br />
müssen andere Wege gefunden werden, um die weniger<br />
Interessierten und Engagierten zu erreichen. Weiterhin<br />
ist eine Öffentlichkeitsarbeit von großer Bedeutung, um<br />
für diesen zukunftweisenden Ansatz in Gremien, Elternschaft<br />
und Bevölkerung ein Bewusstsein zu schaffen für<br />
Sport und Gesundheit.<br />
I 81
Arbeitskreis 6: Sportorganisationen und Kommunen –<br />
starke Partner im Bereich Gesundheit<br />
ECKHARD CÖSTER (LANDESSPORTBUND HESSEN):<br />
82 I
Die Bedeutung und Ziele <strong>des</strong> organisierten Sports<br />
im regionalen Netzwerk Sport und Gesundheit<br />
I 83
Arbeitskreis 6: Sportorganisationen und Kommunen –<br />
starke Partner im Bereich Gesundheit<br />
PIA PAULY (DEUTSCHER TURNER-BUND):<br />
84 I
Turn- und Sportvereine als Partner in der<br />
kommunalen Gesundheitsförderung<br />
I 85
Arbeitskreis 6: Sportorganisationen und Kommunen –<br />
starke Partner im Bereich Gesundheit<br />
PIA PAULY (DEUTSCHER TURNER-BUND):<br />
86 I
Ergebnisse <strong>des</strong> Arbeitskreises 6<br />
I 87
Arbeitskreis 7: Sportvereinsentwicklung im Kontext<br />
schulpolitischer Veränderungen<br />
PROF. DR. GUDRUN DOLL-TEPPER (VIZEPRÄSIDENTIN DES DOSB):<br />
Sportvereinsentwicklung im Kontext<br />
schulpolitischer Veränderungen<br />
Sehr geehrte Damen und Herren,<br />
es freut mich außerordentlich, dass die Themenstellung<br />
unseres Arbeitskreises einen so hohen Zuspruch gefunden<br />
hat und Sie so zahlreich an der Veranstaltung hier in München<br />
teilnehmen. Ihr Interesse zeigt, dass die schulpolitischen<br />
Veränderungen respektive die Schulentwicklung,<br />
für Ihre unterschiedlichen Arbeits- bzw. Aufgabenbereiche<br />
im Sport und in der Kommune von Bedeutung sind und<br />
es notwendig erscheint, die Herausforderungen miteinander<br />
zu diskutieren.<br />
88 I<br />
In meinem Kurzvortrag werde ich versuchen einen Einstieg<br />
für die Auseinandersetzung mit den Leitfragen zu<br />
liefern und die Thematik aus der Sichtweise <strong>des</strong> organisierten<br />
und gemeinnützigen Sports zu beleuchten. Ich<br />
werde dabei (erstens) auf die aktuellen Entwicklungen<br />
und Probleme im Kontext der Schulentwicklung eingehen,<br />
(zweitens) die Bedeutsamkeit der Sportvereine als<br />
Bildungspartner herausstellen sowie (drittens) mögliche<br />
Notwendigkeiten für die zukünftige Zusammenarbeit<br />
zwischen Schule, Jugendhilfe und gemeinnützigen Sport<br />
formulieren.
Vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Wandlungsprozesse<br />
haben sich die Bedingungen <strong>des</strong> Aufwachsens von<br />
Kindern und Jugendlichen in Deutschland deutlich geändert.<br />
Ausgelöst durch die Diskussion der PISA-Studie<br />
kam es zu einer Umgestaltung von Schule und zu Änderungen<br />
der Rahmenbedingungen schulischer und damit<br />
auch zu außerunterrichtlicher und außerschulischer Bildungsprozesse.<br />
Diese haben einen unmittelbaren und<br />
nachhaltigen Einfluss auf die Angebote und Organisationsformen<br />
in den Sportvereinen.<br />
Bildungspolitische Entwicklungen<br />
bedeuten Veränderungen für die<br />
Vereinspraxis<br />
Exemplarisch lassen sich m. E. drei bildungspolitische<br />
Entwicklungen beschreiben, die gegenwärtig von Bedeutung<br />
sind:<br />
1. Bildungseinrichtungen spielen zunehmend in<br />
jüngeren Altersgruppen eine bedeutende Rolle<br />
und Kinder sind zeitlich immer stärker in Institutionen<br />
eingebunden (frühkindliche Bildungsangebote,<br />
Kitas, Horte etc.).<br />
2. Neben den Lernprozessen in Bildungsinstitutionen<br />
rücken vermehrt nonformale Settings und informelles<br />
Lernen in den Blick, vor allem auch der<br />
Sportverein mit seinen vielfältigen eigenständigen<br />
Bildungspotentialen.<br />
3. Die Einführung der Ganztagsschule (GT in voll<br />
gebundener, teilweise gebundener, halboffener,<br />
offener Form sowie das G8GTS-Konzept) sind<br />
unumkehrbar und verändern die Lebenswelt von<br />
Kindern und Jugendlichen.<br />
Richten wir einen Blick in die Vereinspraxis, so zeigen<br />
sich die schulpolitischen Veränderungen in verschiedenen<br />
Ebenen und Bereichen:<br />
Beeinflusst sind die Sportstättenkapazitäten, die Zeitsouveränität<br />
sowie die Trainingszeiten und Sporträume. Die<br />
dadurch bereits entstandenen Engpässe werden in dem<br />
Maße weiter wachsen, wie die Entwicklung der Ganztagsschule<br />
voranschreitet und die G8-Jahrgänge auf den<br />
Gymnasien nachrücken bzw. älter werden. So kollidieren<br />
bereits die außerschulischen Sportangebote am frühen<br />
Nachmittag, mit den längeren Unterrichtszeiten der Schülerinnen<br />
und Schüler und die Trainingszeiten müssen in<br />
der Folge nach hinten verschoben werden. Hat vor Jahren<br />
das Tennistraining bereits um 13:00 Uhr begonnen, so<br />
ist es heute erst möglich ab 15:00 Uhr oder 16:00 Uhr<br />
entsprechende Trainingsgruppen zusammenzustellen. Auf<br />
diese Weise verstärkt sich die Auslastung der Sportanlagen<br />
in den frühen Abendstunden und führt zu organisatorischen<br />
Problemen zwischen der Nachwuchsförderung und<br />
den Interessen der Erwachsenen.<br />
Die Schulzeitverkürzung verstärkt die Problemlage. Mit<br />
der Streichung eines Schuljahres auf dem gymnasialen<br />
Bildungsweg mussten die von der Kultusministerkonferenz<br />
festgelegten 265 Jahrgangswochenstunden bis zum Abitur<br />
von neun auf acht Schuljahre verteilt werden (33 Std.<br />
pro Woche). D. h. für die Schülerinnen und Schüler ist<br />
ein tägliches Unterrichtspensum von sieben bzw. acht<br />
Pflichtstunden zu leisten. Dazu kommt im Anschluss der<br />
zu leistende Zeitaufwand für die Hausaufgaben. Umfragen<br />
zeigen, dass nicht alle Jugendlichen mit dieser Mehrbelastung<br />
zurechtkommen. Eltern berichten beispielsweise,<br />
dass der durch die Schulzeitverkürzung entstandene<br />
Zeitdruck längst das Familienleben bestimmt. Ist die schulische<br />
Leistung nicht ausreichend, so wird das freie Wochenende<br />
für Nachhilfestunden geopfert. Die offensichtliche<br />
Konsequenz dieser Entwicklung ist, dass die Freiräume<br />
für außerschulische Aktivitäten und Teilhabe an<br />
Sportangeboten in den Vereinen geringer werden.<br />
I 89
Arbeitskreis 7: Sportvereinsentwicklung im Kontext<br />
schulpolitischer Veränderungen<br />
Damit wird deutlich, dass die staatlichen Träger und insbesondere<br />
die Sportverbände und Sportvereine aktiv<br />
werden müssen, um das außerunterrichtliche Schulsportleben<br />
und das Sportvereinsleben aufrecht zu erhalten<br />
und zu stärken. <strong>Der</strong> Ausbau von Ganztagsangeboten innerhalb<br />
sämtlicher Schulsysteme erfordert mehr denn je<br />
die Einbindung von Sportvereinsangeboten und Sportvereinsaktivitäten<br />
in den Schulalltag. Nur durch eine aktive<br />
Rolle und die Unterstützung durch die Sportverbände und<br />
Kommunen kann es gelingen, die Rahmenbedingungen<br />
für Kooperationen und deren Finanzierung zu verbessern.<br />
Was kann der Sportverein als Bildungspartner<br />
in der Zusammenarbeit mit der<br />
Schule und den Kommunen leisten?<br />
<strong>Der</strong> Sportverein ist ein über lange Jahre gewachsenes<br />
System, das über vielfältige Bildungspotentiale verfügt.<br />
Im Sportverein werden die Kinder und Jugendlichen nicht<br />
nur mit dem Wettkampfsport und spezifischen Regeln<br />
konfrontiert, sondern sie lernen vor allen Dingen den sozialen<br />
Umgang miteinander sowie gegenseitigen Respekt<br />
und Anerkennung. Damit übernimmt der Sportverein<br />
wichtige Bildungsziele und trägt maßgeblich zur Persönlichkeitsentwicklung<br />
unserer Kinder und Jugendlichen<br />
bei. Als Partner der Schule kann er zudem durch sein<br />
vielfältiges Bewegungsangebot wichtige Funktionen und<br />
Lerngebiete im außerunterrichtlichen Bereich übernehmen<br />
und damit auch die Schule in ihrer Bildungsarbeit<br />
entlasten. Auch die Themen Integration, Prävention und<br />
Fair Play sowie die vielen Handlungsfelder der Kinderund<br />
Jugendhilfe sind wertvolle Sinnperspektiven, die in<br />
unseren Sportvereinen an vielen Stellen sichtbar sind und<br />
aktiv gelebt werden.<br />
Als „Alleinstellungsmerkmal“ der Bildungsleistung ist besonders<br />
das freiwillige bzw. ehrenamtliche Engagement<br />
(Bürgerschaftliches Engagement) hervorzuheben. In keiner<br />
anderen institutionellen Einrichtung werden mehr freiwil-<br />
90 I<br />
lige Stunden geleistet, als in unseren Sportvereinen. <strong>Der</strong><br />
aktuelle Sportentwicklungsbericht verdeutlicht dies mit<br />
einer beeindruckenden Zahl: Inklusive aller freiwilligen<br />
Helferinnen und Helfer, die sich bei Sportvereinsfesten<br />
und Sportveranstaltungen unentgeltlich engagieren, sind<br />
es über 8 Millionen Menschen, die ihren Beitrag zum<br />
bürgerschaftlichen Engagement in Deutschland leisten.<br />
Einmalig ist in diesem Zusammenhang das Qualifizierungssystem<br />
<strong>des</strong> organisierten Sports. In über 600 verschiedenen<br />
Ausbildungsgängen können sich Übungsleiter, Trainer<br />
oder Vereinsmitarbeiter für ein (freiwilliges) Engagement<br />
im Sportverein qualifizieren. Rund 500.000 Engagierte<br />
sind aktuell in Besitz einer DOSB Lizenz. Mit diesem Angebot<br />
ist der organisierte Sport einer der größten Bildungsanbieter<br />
in Deutschland.<br />
Auch über den Bereich der Aus-, Fort- und Weiterbildungen<br />
hinaus wirkt das Engagement im Sportverein auch<br />
auf der Ebene „non-formaler« Lernprozesse, die wie ja<br />
bereits zu Beginn erwähnt, in der bildungspolitischen<br />
Debatte einen immer größeren Raum einnehmen. Untersuchen<br />
zeigen, dass gerade im ehrenamtlichen und<br />
freiwilligen Engagement Bildungsprozesse im Sinne <strong>des</strong><br />
informellen – also nicht bewusst gesteuerten – Lernens<br />
angestoßenen werden. Insbesondere als Ausgleich zu den<br />
formalisierten und verpflichtenden Leistungsüberprüfungen<br />
in der Schule, ist der Sportverein auf diese Weise ein<br />
sinnvoller Bildungspartner.<br />
Bezogen auf die schulpolitischen Veränderungen wird es<br />
für den organisierten und gemeinnützigen Sport zukünftig<br />
darauf ankommen, systematisch den Anschluss an die<br />
Entwicklung zur Ganztagsschule sicherzustellen und eine<br />
bedeutende Rolle innerhalb der kommunalen Bildungslandschaft<br />
zu werden. Es ist erfreulich zu sehen, dass in<br />
unseren Mitgliedsorganisationen bereits viele sinnvolle<br />
Ansätze und Konzeptlösungen bestehen, die Möglichkeiten<br />
aufzeigen, mit den Herausforderungen umzugehen.<br />
Ich denke da insbesondere an die bewährten Lan<strong>des</strong>ko-
operationsprogramme „Sportverein und Schule“, die<br />
Schulsport- und Arbeitsgemeinschaften, die Formen der<br />
bewegten Schule und unsere Schulsportwettbewerbe<br />
(z.B. JTFO).<br />
Die beschriebenen Engpässe in den Hallenkapazitäten<br />
und den zeitlichen Ressourcen von Kindern- und Jugendlichen<br />
können überwunden werden, wenn es auf allen<br />
Ebenen schulpolitischen Handels die grundsätzliche Bereitschaft<br />
gibt, sportliche Aktivitäten und die Bildungspotentiale<br />
<strong>des</strong> Sports als elementare, unverzichtbare und<br />
unaustauschbare Bestandteile für unsere Gesellschaft<br />
anzuerkennen und die vorhandenen Strukturen <strong>des</strong> organisierten<br />
Sports in geeigneter Weise in schulpolitische<br />
Entscheidungen und Entwicklungsprozesse einzubinden.<br />
Notwendigkeiten für eine zukünftige<br />
Sportvereinsentwicklung<br />
Lassen sich mich abschließend einige Merkmale äußern,<br />
die aus meiner Sicht für die zukünftige Sportvereinsentwicklung<br />
im Kontext der Veränderungen unerlässlich sind:<br />
p … Schulpolitik, Kultusbehörden, Kommunen<br />
und der organisierte gemeinnützige Sport müssen<br />
dafür Sorge zu tragen, dass …<br />
p … die Netzwerkarbeit zwischen Schule, Kommune<br />
und Sportverein professionalisiert wird und das<br />
zentrale Beratungs- und Koordinierungsstellen auf<br />
lokaler Ebenen eingerichtet, gefördert und bedarfsgerecht<br />
erweitert werden.<br />
p ... die Zielbereiche ganztägiger Schulen die Öffnung<br />
der eigenen Institution zur Lebenswelt und<br />
dem Schulumfeld beinhalten und Sportvereinsangebote<br />
als sinnvolle Ergänzung ihres Bildungsangebots<br />
einstufen.<br />
p ... adäquate und ausreichende Sportstätten zur<br />
Verfügung stehen, die sowohl den Anforderungen<br />
<strong>des</strong> Schulsports als auch <strong>des</strong> Vereinssports Rech-<br />
nung tragen. Ergänzend hierzu sind Investitionsprogramme<br />
für vereinseigene Sportstätten unerlässlich.<br />
p ... Qualifizierungsmodelle für die Aus- und Fortbildung<br />
zum Übungsleiter im Ganztag entwickelt<br />
und weiter ausgebaut werden.<br />
p ... sportbezogene Strukturen, die über den<br />
eigentlichen Sportunterricht hinausgehen, eng<br />
mit den Sportvereinen verzahnt werden mit<br />
dem Ziel, optimale Entwicklungsmöglichkeiten<br />
für Schülerinnen und Schüler sicherzustellen<br />
und adäquate Lösungen für die Engpässe in der<br />
Sportstättennutzung zu finden.<br />
<strong>Der</strong> Lebensort Schule muss gerade in einem Ganztagsschulkonzept<br />
die vielfältigen Interessen vor allem von<br />
Heranwachsenden berücksichtigen. Zudem ist die Politik<br />
gerade im Hinblick auf die Sportstätten gefordert, ihren<br />
gesamtgesellschaftlichen Auftrag im Blick zu behalten<br />
und gemeinsam mit dem gemeinwohlorientierten Sport<br />
Lösungen für die zunehmende Ressourcenverknappung<br />
zu finden.<br />
Mit der Förderung von Bildungslandschaften und der<br />
Netzwerkarbeit zwischen Schule, Kommune und Sport<br />
kann es Gelingen, die schulpolitischen Veränderungen<br />
anzunehmen, und den Sportverein als bedeutenden Bildungspartner<br />
zu gewinnen.<br />
Damit wäre ich am Ende meines Kurzvortrags und hoffe,<br />
dass meine Mitreferenten im Anschluss bereits einige<br />
Antworten formulieren können, welchen Beitrag beispielsweise<br />
die Kommune zu den Forderungen beisteuern kann.<br />
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.<br />
I 91
Arbeitskreis 7: Sportvereinsentwicklung im Kontext<br />
schulpolitischer Veränderungen<br />
WOLFGANG SOMMERFELD (SPORTAMT MÜNCHEN):<br />
92 I
Sportvereinsentwicklung im Kontext schulpolitischer<br />
Veränderungen: Netzwerkarbeit in München<br />
I 93
Arbeitskreis 7: Sportvereinsentwicklung im Kontext<br />
schulpolitischer Veränderungen<br />
WOLFGANG SOMMERFELD (SPORTAMT MÜNCHEN):<br />
94 I
I 95
Arbeitskreis 7: Sportvereinsentwicklung im Kontext<br />
schulpolitischer Veränderungen<br />
DR. KLAUS BALSTER (DEUTSCHE SPORTJUGEND):<br />
Wie kann in Netzwerken für alle Seiten<br />
gewinnbringend agiert werden?<br />
Vorwort<br />
Mit dem Thema will ich nicht nur gegenwartsbezogen,<br />
sondern auch zukunftsorientiert umgehen, sofern es<br />
der kurze Vortragsrahmen erlaubt. Darum sind einige<br />
Passagen als Vision, als Zukunftsbilder angelegt. Visionen<br />
sind ein wichtiges Instrument, weil sie Hoffnungen beschreiben,<br />
eben Glauben an mögliche Verbesserungen<br />
bzw. Veränderungen.<br />
Mein Ausgangspunkt<br />
Ich wähle den Begriff Netzwerk und lege ihn als eine<br />
„Zweckgerichtetheit einer Zusammenarbeit“ verschiedener<br />
Bildungsakteure aus. Dieses Netzwerk soll das Recht auf<br />
Persönlichkeitsentfaltung (GG 2.1) durch ein bildungsgerechtes<br />
Aufwachsen und eine individuelle ganzheitliche<br />
Bildungsförderung realisieren.<br />
96 I<br />
Eine ganzheitliche Bildungsförderung ist für mich mehr als<br />
das, was Schulen zu leisten vermögen. Weil die meisten<br />
Bildungsprozesse außerhalb von Schule stattfinden und<br />
Kinder und Jugendliche immer komplexere Unterstützungsleistungen<br />
für ihre Lebensausrichtung benötigen, gibt es<br />
keine Alternative für ein systematisches, vernetztes Handeln<br />
unterschiedlicher Akteure. Keiner schafft es alleine.<br />
Mein Ausgangspunkt ist ein gemeinsames von gleichberechtigten<br />
Netzwerkpartnern verabredetes ganzheitliches<br />
Erziehungs- und Bildungsverständnis mit dem Leitprinzip:<br />
„Was Kindern und Jugendlichen nützt und nicht einer Institution<br />
oder Einrichtung“. <strong>Der</strong> organisierte Sport ringt<br />
zurzeit um eine einheitliche Position.
Welche Ausgangspunkte für<br />
Gelingensbedingungen sind in den<br />
Blick zu nehmen?<br />
Um sich zu positionieren, sind Antworten zu folgenden<br />
grundlegenden Fragen zu geben:<br />
Welches Zukunftsleitbild wollen wir?<br />
Warum hat eine Gesellschaft keine Zukunftskraft, die Kinder<br />
und Jugendliche nicht in den Blick nimmt und welche<br />
Zukunftsausrichtung verfolgt der gemeinnützige Sport?<br />
Welche Basiskompetenzen sind vonnöten?<br />
Warum muss unser Gegenstandsfeld – insbesondere die<br />
Bedeutung der Bildung im und durch Sport für die Entwicklung<br />
Heranwachsender – zu den Basiskompetenzen<br />
gehören? Was unternimmt der organisierte Sport, damit<br />
Bewegungskompetenz als ein Grundrecht anerkannt ist?<br />
Wodurch entfaltet sich Netzwerkwirksamkeit?<br />
Warum schaffen es nur funktionierende Qualitäts-Netzwerke,<br />
Wirksamkeitsmöglichkeiten zu entfalten und welche<br />
Strukturen richtet der organisierte Sport hierzu ein?<br />
Welchen Netzwerktyp wollen wir haben?<br />
p „Kooperation von Jugendhilfe und Schule“<br />
Beide pädagogischen Systeme arbeiten eigenständig<br />
und bei bestimmten Bildungsaufgaben gemeinsam.<br />
p „Schule und Gestaltung von Schulentwicklung“<br />
Eigenverantwortliche Schulen erweitern mit Hilfe<br />
anderer Bildungsakteure ihr Bildungsangebot.<br />
p „Lebenslanges Lernen, Weiterbildung, Wirtschaft“<br />
Jeder Bildungsakteur steuert in einem Kooperationsverbund<br />
seine Bildungsleistung bei.<br />
p „Sozialer Raum als Bildungsraum“<br />
Die Bildungspartner als gleichberechtigte Netzwerkpartner<br />
gestalten gemeinsam ein ganzheitliches Erziehungsund<br />
Bildungsangebot, das sich an den sozialräumlichen<br />
Bedürfnissen der Menschen ausrichtet.<br />
Mein favorisierter Typ<br />
<strong>Der</strong> Typ „Sozialer Raum als Bildungsraum“ betrachtet die<br />
Gestaltung der sozialräumlichen Lebensbedingungen als<br />
Grundlage für Bildungsprozesse. Dem liegt ein Verständnis<br />
zugrunde, dass eine ganzheitliche Bildung nicht von<br />
einem Bildungsakteur alleine realisiert werden kann und<br />
auch nicht in der Ganztagsschule. Diese Akteure sind<br />
in einem systematischen und koordinierten Netzwerk in<br />
einem sozialräumlichen Setting gleichberechtigt miteinander<br />
verbunden und gestalten Sozialraumentwicklung.<br />
Dort gehen sie gemeinsam auf die Bedürfnisse der Menschen<br />
ein und vermeiden Segregationen.<br />
Ein Ganztagsangebot für Kinder und Jugendliche ist unbestritten<br />
notwendig. Aber, ob das bisherige Format der<br />
Ganztagsschule die einzige Form bleiben sollte, ist künftig<br />
viel offener zu diskutieren. Alternativen ist vorurteilsfrei<br />
ein Entfaltungsrahmen zu bieten.<br />
Welche künftige Positionierung nimmt der<br />
gemeinnützige Sport ein?<br />
Um aber die Anschlussfähigkeit <strong>des</strong> gemeinnützigen<br />
Kinder- und Jugendsports an gegenwartsbezogene<br />
I 97
Arbeitskreis 7: Sportvereinsentwicklung im Kontext<br />
schulpolitischer Veränderungen<br />
Entwicklungen zu schaffen, müssen sich die Mitgliedsorganisationen<br />
<strong>des</strong> Sports künftig positionieren.<br />
Beispielsweise fährt man im Bun<strong>des</strong>land NRW zweigleisig.<br />
Die hiesige Lan<strong>des</strong>regierung betreibt massiv die schulzentrierte<br />
Entwicklungsvariante (Typ: „Schule und Gestaltung<br />
von Schulentwicklung“) und der Sport unterstützt dabei.<br />
Parallel dazu aber diskutiert der organisierte Sport (Lan<strong>des</strong>sportbund/Sportjugend<br />
NRW) seine künftige Verortung –<br />
etwa hin zu Typ: „Sozialer Raum als Bildungsraum“.<br />
Welche Gelingensbedingungen haben<br />
funktionierende Netzwerke?<br />
Sie sind politisch gewollt, koordiniert und finanziert<br />
<strong>Der</strong> Impuls für eine Netzwerkbildung kommt von der<br />
Kommune oder geht vom organisierten Sport bzw. anderen<br />
Gruppierungen und Interessenvertretungen aus.<br />
Notwendiger finanzieller Garant ist die jeweilige Kommune;<br />
ggf. im Verbund mit dem Land. Verbundsysteme<br />
mit verschiedenen Trägern sind eine zukunftsweisende<br />
Alternative. Netzwerke haben eine hauptberufliche, verlässliche<br />
Koordinationsstelle, die unabhängig von parteipolitischen<br />
Absichten agiert. Die Netzwerke haben eine<br />
langfristige Platzierung.<br />
Sie verfügen über Personen mit umfassenden<br />
Kompetenzen<br />
In den Netzwerken werden von den einzelnen Netzwerk-<br />
Akteuren Personen entsandt, die für ein verlässliches und<br />
nachhaltiges Handeln stehen. Die benannten Personen<br />
der Netzwerk-Akteure weisen ein qualitatives Profil auf,<br />
sind kompetente und entscheidungsbefugte Personen.<br />
Sie haben eine stabile Infrastruktur, transparente<br />
Prozessverläufe, eine verlässliche Ergebniskontrolle<br />
und ein angemessenes Klima<br />
<strong>Der</strong> strukturelle und inhaltliche Netzwerkrahmen wird<br />
nicht von außen gelenkt und beeinflusst. Es herrscht ein<br />
98 I<br />
Vertrauensklima mit einer gemeinsamen Sprache auf<br />
Augenhöhe. Das tragende Gerüst <strong>des</strong> Netzwerkes und<br />
koordinierende Basis sind: Verbindlichkeit, hauptberufliche<br />
Professionalität und Verlässlichkeit. Die Netzwerktreffen<br />
werden immer von allen Kooperationspartnern<br />
besucht und finden regelmäßig statt. Das Netzwerk versteht<br />
sich als ein „dynamisches reflexives System“, das<br />
sich prozesshaft weiterentwickelt, qualifiziert und sich<br />
evaluieren lässt.<br />
Sie stellen sich Hindernissen und überwinden<br />
Barrieren, beispielsweise:<br />
p Parteipolitisches Taktieren<br />
p Unterschiedliche intentionale Ausrichtung<br />
der beteiligten Netzwerkinstitutionen bzw.<br />
-organisationen<br />
p Überfrachtete Zielausrichtung<br />
p Mangelnde Passfähigkeit und unzureichende Kompetenzen<br />
der Personen der Netzwerk-Akteure<br />
p Keine verlässliche finanzielle Basis und gesicherte<br />
Infrastruktur<br />
Nach- und Zukunftswort<br />
Jeder von uns ist schon jetzt – bewusst oder unbewusst<br />
– Teil eines Netzwerkes. Es ist schwieriger, eine Netzwerkkooperation<br />
zu halten, als eine einzugehen. <strong>Der</strong> gemeinnützige<br />
Sport muss sich positionieren und politisch<br />
angemessen handeln. Jeder, der sich bewegt, bewegt ist,<br />
bewegt handelt und bewegt auf Partner zugeht, belebt<br />
den Dialog für ein Netzwerk. Gemeinsam wünsche ich uns,<br />
dass wir unser Wissen und Können verantworten wollen<br />
und sollen und praktische Taten folgen lassen.<br />
Literatur:<br />
I <strong>Deutsche</strong> Sportjugend (2009):<br />
Positionspapier – Bildungslandschaften im Sozialraum. Münster
KLAUS HEBBORN (BEIGEORDNETER DES DEUTSCHEN STÄDTETAGES):<br />
Sportvereinsentwicklung im Kontext schulpolitischer<br />
Veränderungen<br />
Paradigmenwechsel in der kommunalen<br />
Bildungspolitik<br />
Seit geraumer Zeit, verstärkt seit der ersten Pisa-Studie<br />
im Jahre 2001, wird auch im kommunalen Bereich eine<br />
intensive Diskussion über Bildungsreformen geführt. In<br />
vielen Städten hat sich ein Paradigmenwechsel vollzogen:<br />
Während die kommunale Rolle in der Bildung lange Zeit<br />
auf die Bereitstellung der notwendigen Infrastruktur und<br />
Ausstattung beschränkt war (z.B. sog. äußere Schulangelegenheiten),<br />
entwickeln viele Städte und Gemeinden<br />
zunehmend bildungspolitische Konzepte in Richtung<br />
einer „kommunalen Bildungspolitik“.<br />
<strong>Der</strong> Wandel <strong>des</strong> kommunalen Aufgabenverständnisses<br />
in der Bildung erfolgt nicht nur aufgrund der Aufgabe<br />
kommunaler Daseinsvorsorge, sondern aus der Erkenntnis,<br />
dass ein modernes und funktionieren<strong>des</strong> Bildungswesen<br />
sowie entsprechend qualifizierte Bürger/innen von<br />
zentraler Bedeutung für die örtliche Struktur- und Wirtschaftsentwicklung<br />
sind. Im Wettbewerb der Städte als<br />
Standorte, der durch die demografische Entwicklung<br />
noch verstärkt wird, wird die Bildung zu einem entscheidenden<br />
kommunalen Politikfeld. Zudem erweist sich,<br />
dass die Weichenstellungen für erfolgreiche Bildungsprozesse<br />
auf der kommunalen Ebene erfolgen. Hier entscheidet<br />
sich Erfolg oder Misserfolg von Bildung, werden<br />
die Grundlagen für berufliche Perspektiven und gesellschaftliche<br />
Teilhabe gelegt. Daher ist jede Investition in<br />
die Bildung nicht nur eine Zukunftsinvestition; sie vermeidet<br />
vielmehr auch im präventiven Sinne von den Kommunen<br />
zu tragende Folgekosten und gesellschaftliche<br />
Desintegration.<br />
Vor diesem Hintergrund haben viele Städte ihr Engagement<br />
im Bildungswesen neu definiert. Unter dem Oberziel<br />
der Förderung von Qualitätsentwicklung und mehr<br />
Chancengleichheit stehen dabei folgende Aspekte und<br />
Zielsetzungen im Vordergrund:<br />
Zum einen geht es darum, die unterschiedlichen und<br />
traditionell überwiegend getrennt agierenden Bildungsbereiche<br />
zu einem Gesamtsystem von Erziehung, Bildung<br />
und Betreuung weiterzuentwickeln und hierfür stabile<br />
Organisationsstrukturen zu schaffen. Entsprechende<br />
Konzepte werden mit unterschiedlichen Begrifflichkeiten<br />
– etwa „kommunale/regionale Bildungslandschaft“ oder<br />
„Bildungsnetzwerke“ bezeichnet. Zum anderen wird angestrebt,<br />
Bildungseinrichtungen stärker mit Konzepten<br />
der Stadtteil- bzw. Quartiersentwicklung zu verzahnen.<br />
Dies gilt insbesondere für die Schule, die sich in einem<br />
grundlegenden Umstrukturierungsprozess befinden. Vom<br />
mehr oder weniger ausschließlichen Lernort entwickelt<br />
I 99
Arbeitskreis 7: Sportvereinsentwicklung im Kontext<br />
schulpolitischer Veränderungen<br />
sie sich zunehmend zu einer Einrichtung, die über die Vermittlung<br />
von Wissen, Kenntnissen und Qualifikationen<br />
hinaus vor allem im Zuge der Entwicklung <strong>des</strong> Ganztagsbetriebes<br />
vielfältige Bildungs- und Erziehungsaufgaben<br />
wahrnimmt bzw. wahrzunehmen hat. Schule von heute<br />
ist zunehmend Lebensraum von Kindern und Jugendlichen,<br />
in dem sich vielfältige soziale Probleme und gesellschaftliche<br />
Entwicklungen manifestieren. Sie ist ebenso<br />
Lernort wie Integrations- und Sozialisationsinstanz. Kinder<br />
und Jugendliche mit ihrer gesamten Lebensrealität, ihren<br />
Lebenssituationen und Problemen, sind konstituierende<br />
Bedingungen für die Institution und ihren Auftrag. Umgekehrt<br />
können durch die Einbeziehung <strong>des</strong> Sozialraumes<br />
wichtige Impulse für qualitative Schulentwicklung erfolgen,<br />
etwa durch die Einbeziehung sozialpädagogischer<br />
Unterstützung und Beratung oder ehrenamtliches Engagement.<br />
Leitbild „Kommunale Bildungslandschaft“<br />
In der aktuellen bildungspolitischen Diskussion stehen<br />
überwiegend die Schulen im Focus <strong>des</strong> Interesses.<br />
Gleichwohl darf ein ganzheitliches Bildungsverständnis<br />
als Grundlage aller Reformbemühungen nicht aus dem<br />
100 I 1) www.staedtetag.de/imperia/md/content/veranstalt/2007/58.pdf<br />
Blick geraten. Bildung ist mehr als Schule. Kognitives,<br />
soziales und emotionales Lernen müssen miteinander<br />
verbunden und in verbindliche Vernetzungsstrukturen<br />
einbezogen werden. Die kulturelle Bildung, die kognitives<br />
Lernen ergänzt, Kreativität fördert und Integration<br />
unterstützt, ist in ein Gesamtkonzept umfassender Bildung<br />
zu integrieren.<br />
Zur Programmatik kommunaler Bildungspolitik hat der<br />
<strong>Deutsche</strong> Städtetag Ende 2007 auf dem Kongress „Bildung<br />
in der Stadt“ die „Aachener Erklärung“ veröffentlicht,<br />
in der die kommunale Bildungslandschaft im Sinne<br />
eines Gesamtkonzeptes von Erziehung, Bildung und Betreuung<br />
als Leitidee skizziert wird. 1<br />
Grundlegende Prinzipien dieses Ansatzes sind Dezentralität,<br />
Kooperation und Vernetzung. Insgesamt geht es<br />
darum, die örtliche Bildungsentwicklung durch eine dauerhafte<br />
und institutionelle Kooperation der unterschiedlichen<br />
Zuständigkeiten, Akteure und Professionalitäten<br />
zu fördern und die dafür notwendigen organisatorischen<br />
Strukturen im Sinne eines „kommunalen Bildungsmanagements“<br />
zu schaffen. Den Städten kommt dabei eine<br />
wichtige Rolle bei der Steuerung und Moderation der zielorientierten<br />
Zusammenarbeit zu.<br />
Schule und Sport als Partner<br />
Es gibt handfeste Gründe für eine Verstärkung der Zusammenarbeit<br />
von Schulen und Sportvereinen:<br />
Zum einen kann das schulische Bildungsangebot im<br />
Sinne eines ganzheitlichen Bildungsbegriffes durch<br />
Sport- und Bewegungsangebote im Rahmen <strong>des</strong> Ganztagsbetriebes<br />
sinnvoll erweitert werden. Dabei dürfen<br />
diese Angebote allerdings den regulären Sportunterricht<br />
nicht ersetzen. Zum anderen erhalten die Sportvereine<br />
über ihr Engagement an den Schulen Zugang zu nahezu
allen Kindern und Jugendlichen. Dies eröffnet für Mitgliedergewinnung,<br />
Talentsuche und -förderung neue<br />
Perspektiven für die Sportvereine. <strong>Der</strong> Aufbau stabiler<br />
Kooperationsbeziehungen zwischen Schulen und Sportvereinen<br />
führt somit auf beiden Seiten zu einer Win-<br />
Win-Situation.<br />
Schließlich wird der Stellenwert <strong>des</strong> Sportes und seine<br />
Verankerung in der kommunalen Bildungslandschaft<br />
gefördert.<br />
Die verstetigte und intensivierte Kooperation mit den<br />
Schulen stellt den organisierten Sport mit seiner vorwiegend<br />
ehrenamtlichen Struktur gleichwohl vor nicht<br />
unbeträchtliche Herausforderungen: Die Sportvereine<br />
müssen sich neuen pädagogischen Herausforderungen<br />
stellen angesichts der Heterogenität der sportbezogenen<br />
Interessen und Voraussetzungen der Kinder und Jugendlichen.<br />
Im Hinblick darauf ist eine Intensivierung von<br />
Aus- und Fortbildung von Übungsleitern/innen notwendig.<br />
Auch muss für den Einsatz am Nachmittag zusätzliches<br />
Personal akquiriert werden. Insgesamt bedeutet die verstärkte<br />
Zusammenarbeit mit den Schulen für den organisierten<br />
Sport einen Paradigmenwechsel in dem Sinne,<br />
dass die Kinder und Jugendlichen nicht mehr ausschließlich<br />
zu den Sportvereinen kommen, sondern vielmehr<br />
die Vereine dort Angebote unterbreiten, wo Kinder und<br />
Jugendliche sind.<br />
Probleme und offene Fragen<br />
Wenngleich eine institutionalisierte Zusammenarbeit<br />
zwischen Schulen und Sportvereinen nachdrücklich zu<br />
befürworten ist, stellt sich gleichwohl eine Reihe von Problemen<br />
und offenen Fragen, die gelöst werden müssen.<br />
Zunächst ist bereits derzeit festzustellen, dass der zunehmende<br />
Ganztagsbetrieb an den Schulen Auswirkungen<br />
auf die Nachfrage nach Vereinsangeboten am Nachmittag<br />
hat. Wenn im Zuge <strong>des</strong> Ganztags zunehmende Sport-<br />
und Bewegungsangebote im schulischen Kontext angeboten<br />
werden, dürften sich die zeitlichen Möglichkeiten<br />
und auch das Interesse für außerschulisches Sporttreiben<br />
tendenziell verringern. Ein Konfliktpunkt in diesem Zusammenhang<br />
sind auch Probleme und Konkurrenzen bei<br />
der Belegung von Hallen bzw. Sportstätten zwischen<br />
Ganztagsschulen und Sportvereinen. Auf die veränderten<br />
personellen Anforderungen an die Sportvereine – mehr<br />
Übungsleiter, veränderte pädagogische Anforderungen,<br />
andere Einsatzzeiten – wurde bereits hingewiesen.<br />
Diese Probleme müssen vor Ort im Dialog und in partnerschaftlicher<br />
Zusammenarbeit gelöst werden. Auch dabei<br />
dürfte eine institutionalisierte Zusammenarbeit zwischen<br />
den Schulen und Sportvereinen hilfreich und förderlich<br />
sein.<br />
Gelingensbedingungen für eine<br />
erfolgreiche Zusammenarbeit Schule –<br />
Sportverein<br />
Nach den bisherigen Erfahrungen können einige<br />
Gelingensbedingungen für die erfolgreiche Kooperation<br />
von Schulen und Sportvereinen identifiziert werden:<br />
p Integrierte kommunale Planungen, insbesondere<br />
in den Bereichen Schule, Jugendhilfe und Sport<br />
p Aufbau dauerhafter Strukturen für Kooperation<br />
und Vernetzung (z.B. kommunale Bildungsbüros)<br />
p Beteiligung <strong>des</strong> Sports auf allen Ebenen und ggf.<br />
Abschluss von Kooperationsvereinbarungen mit<br />
Schulen bzw. Kommunen<br />
p Stärkung der Beteiligungs- und Mitwirkungsrechte<br />
<strong>des</strong> Sports bzw. externer Partner an den<br />
Schulen<br />
p Schaffung notwendiger Rahmenbedingungen<br />
und Ressourcenausstattung durch Länder und<br />
Kommunen<br />
I 101
Arbeitskreis 7: Sportvereinsentwicklung im Kontext<br />
schulpolitischer Veränderungen<br />
Die Realisierung dieser Rahmenbedingungen stellt die<br />
beteiligten Partner vor nicht unerhebliche Herausforderungen.<br />
Dies gilt insbesondere in der aktuellen Wirtschaftsund<br />
Finanzkrise, die insbesondere den Kommunen wenig<br />
Handlungsspielräume lässt. Umso wichtiger erscheint<br />
daher, durch Kooperationen Kräfte zu bündeln und Ressourcen<br />
effektiv einzusetzen.<br />
Fazit<br />
Viele Kommunen haben sich auf den Weg gemacht,<br />
ihr Engagement im Bereich von Schule und Bildung auszuweiten<br />
und stärker auf Qualitätsentwicklung sowie<br />
Chancengerechtigkeit hinzuwirken. Die kommunale Bil-<br />
Ergebnisse <strong>des</strong> Arbeitskreises 7<br />
102 I<br />
dungslandschaft im Sinne eines vernetzten Systems von<br />
Erziehung, Bildung und Betreuung ist dabei als Leitidee<br />
die programmatische Grundlage für kommunales Handeln.<br />
Durch die Vernetzung unterschiedlicher Professionalitäten,<br />
Kompetenzen und Ressourcen entsteht ein „Mehrwert“<br />
für die Bildung von Kindern und Jugendlichen, aber auch<br />
Erwachsenen vor Ort in den Kommunen.<br />
<strong>Der</strong> Sport ist ein unverzichtbarer Bestandteil der kommunalen<br />
Bildungslandschaft. Er ist gut beraten, im Sinne<br />
seiner sozialen Verantwortung, aber auch im Interesse der<br />
Sportentwicklung insgesamt sich in diesem Bereich noch<br />
stärker zu engagieren. Die Kooperation mit den Schulen<br />
steht dabei im Mittelpunkt und bietet für beide Seiten<br />
Perspektiven für eine zukunftsfähige Weiterentwicklung.
I 103
Arbeitskreis 8: Sport fördert die Lebensqualität<br />
aller Generationen vor Ort<br />
MINISTERIALDIREKTOR DIETER HACKLER (LEITER DER ABTEILUNG „ÄLTERE MENSCHEN“<br />
DES BUNDESMINISTERIUMS FÜR FAMILIE, SENIOREN, FRAUEN UND JUGEND):<br />
Neue Chancen für Zielgruppen durch<br />
kommunale Vernetzung<br />
Meine sehr geehrten Damen und Herren,<br />
vielen Dank für die freundlichen Einführungsworte. Ich<br />
freue mich sehr, an Ihrem Kongreß teilnehmen zu können<br />
– nicht nur, weil er in der bayerischen Lan<strong>des</strong>hauptstadt<br />
stattfindet, sondern vor allem, weil er sich neuartiges<br />
und ganz wichtiges Thema zu eigen gemacht hat: die Zusammenarbeit<br />
und Vernetzung von Sport und Kommunen,<br />
von der sowohl beide Kooperationspartner als auch<br />
die Bürgerinnen und Bürger profitieren sollen. Es sollen<br />
neue Handlungsspielräume für die örtliche Praxis eröffnet,<br />
Perspektiven einer künftigen Zusammenarbeit und<br />
mögliche Schnittstellen mit kommunaler Stadtentwicklung<br />
aufgezeigt werden. Es geht darum, Synergie zu<br />
erzeugen, eine – wie das heute auf Neudeutsch so schön<br />
heißt: „win-win-Situation“ für alle Beteiligten.<br />
Dass in den kommenden Jahrzehnten der Anteil der älteren<br />
Menschen an der Gesamtbevölkerung stark wachsen<br />
wird, ist mittlerweile ein Gemeinplatz geworden. Über<br />
die Auswirkungen in den verschiedenen gesellschaftlichen<br />
Bereichen herrscht aber vielfach noch Unkenntnis. Viele<br />
Kommunen werden sich erst allmählich bewusst, dass<br />
durch den demographischen Wandel eine Vielzahl von<br />
Problemen auf sie zukommt. Ich nenne nur die wichtigsten:<br />
Rückgang <strong>des</strong> Steueraufkommens durch den Rückgang<br />
der arbeitenden Bevölkerung und steigende Anforderungen<br />
an Betreuungs-, Versorgungs- und Pflegeangeboten<br />
für die älteren Menschen; hinzu kommen alten- und behindertengerechte<br />
Einrichtungen <strong>des</strong> öffentlichen Lebens.<br />
104 I<br />
Sport und Bewegung sind eine zentrale Voraussetzung<br />
dafür, Gesundheit und Wohlbefinden so lange es geht zu<br />
erhalten und damit eine möglichst weitgehende Selbstständigkeit<br />
der älteren Menschen bis ins hohe Alter zu<br />
ermöglichen. Eine gute kommunale Versorgung mit Sportangeboten<br />
ist <strong>des</strong>halb für die Zukunft eine essentielle<br />
Notwendigkeit und wird als Frage der Lebensqualität beim<br />
Attraktivitätswettbewerb der Gemeinden um Einwohner<br />
zukünftig eine nicht zu unterschätzende Rolle spielen.<br />
Obwohl die Kommunalpolitik wie auch die Sportförderung<br />
nach den Vorgaben <strong>des</strong> Grundgesetzes grundsätzlich<br />
keine Bun<strong>des</strong>aufgaben sind, hat das Bun<strong>des</strong>seniorenministerium<br />
bereits in den 90er Jahren im Rahmen seiner<br />
Möglichkeiten begonnen, die älteren Menschen zu<br />
mehr Teilhabe an der Gesellschaft zu ermuntern und die<br />
Kommunen auf deren großes Potential hinzuweisen.<br />
Als Beispiele nenne ich nur die Entwicklung von Seniorenorganisationen,<br />
Seniorenbüros und zahlreiche Modellprojekte<br />
zur Partizipation und zum Engagement von Seniorinnen<br />
und Senioren in der Gesellschaft, d. h. vor<br />
Ort in ihren Kommunen.<br />
Einige konkrete Beispiele:<br />
Aus Umfragen wissen wir, dass eine große Zahl älterer<br />
Menschen nach Abschluss ihres Erwerbslebens bzw. der<br />
Familienphase nicht nur ihre Freizeit genießen, sondern<br />
an den Entwicklungen in ihrer Kommune teilhaben und<br />
insbesondere ihr konkretes Lebensumfeld mitgestalten<br />
wollen. Dafür sind sie gern bereit, erhebliche Ressourcen<br />
an Zeit, Energie und Ideen einzubringen.
Erfahrungswissen für Initiativen – EFI –<br />
seniorTrainer – seniorKompetenzteams<br />
Davon ausgehend, hat das Modellprojekt „Erfahrungswissen<br />
für Initiativen – EFI“ ein Curriculum für sogenannte<br />
seniorTrainer und -Trainerinnen entwickelt, das interessierten<br />
Senioren eine Ausbildung in Teamarbeit und Öffentlichkeitsarbeit,<br />
Moderation von Gruppenprozessen<br />
und Zusammenarbeit mit hauptamtlichen Kräften in Kommunen<br />
und Verbänden vermittelt. Diese Fähigkeit können<br />
die seniorTrainer dann für die Allgemeinheit einsetzen,<br />
indem sie Projekte anstoßen, freiwillige Initiativen durchführen,<br />
beraten und unterstützen.<br />
Allein zwischen 2000 und 2005 sind in diesem EFI-Programm<br />
mehr als 1000 seniorTrainer und -Trainerinnen ausgebildet<br />
worden, die mehr als 3000 freiwillige Projekte<br />
durchgeführt oder betreut haben. Fast alle Bun<strong>des</strong>länder<br />
haben das EFI-Programm weitergefördert oder ausgebaut.<br />
Es hat sich ein bun<strong>des</strong>weites Netz von seniorTrainern<br />
und seniorKompetenzteams gebildet, das in Verein EFI<br />
Deutschland zusammengeschlossen ist. Kommunen, in<br />
denen solche seniorKompetenzteams arbeiten, berichten<br />
darüber äußerst positiv.<br />
Selbstorganisation älterer Menschen<br />
in ihren Kommunen<br />
Immer mehr Kommunen müssen schon heute Schwimmbäder,<br />
Bibliotheken, Theater und Museen schließen, weil<br />
ihr Finanzspielraum zunehmend enger wird. Ein Modellprojekt<br />
mit dem Titel „Selbstorganisation älterer Menschen<br />
in ihren Kommunen“ hat von 2006 bis 2009 erfolgreich<br />
erprobt, wie ältere Menschen kommunale Einrichtungen<br />
in Eigenregie übernehmen und sie mit viel freiwilligem<br />
Engagement und wenig kommunaler Finanzunterstützung<br />
für die Allgemeinheit weiterführen, zum Teil sogar ihr<br />
Programm ausbauen können. Auch Nachbarschaftshilfe,<br />
Lesepatenschaften und Hausaufgabenhilfe an Schulen<br />
sowie Betreuungsdienste für Hochaltrige und Behinderte<br />
gehören zum Aufgabenspektrum solcher selbstorganisierter<br />
Projekte von Älteren für die Gemeinde.<br />
Programm „Aktiv im Alter“<br />
Im Jahr 2008 haben wir das Programm „Aktiv im Alter“<br />
aus der Taufe gehoben, das Kommunen auf das Potential<br />
ihrer älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger erschließen<br />
und beide in Kooperation miteinander bringen soll. Insgesamt<br />
175 Kommunen erproben in diesem Modellprojekt,<br />
wie sie in sogenannten „Lokalen Foren“ mit ihren<br />
engagementbereiten Bürgerinnen und Bürgern über den<br />
zusätzlichen Bedarf an kommunalen Dienstleistungen<br />
diskutieren und beraten können, wie aufgrund dieser<br />
Kommunikationsprozesse sich ältere Menschen Projekte<br />
suchen und durchführen können, die für alle Mitbürger<br />
einen Gewinn bedeuten.<br />
Die Resonanz auf dieses Projekt ist überwältigend positiv.<br />
Nicht nur Großstädte, deren Bezirke, mittlere und kleine<br />
Städte, sondern auch Landkreise und kleine Dörfer machen<br />
zur Zeit konkrete Erfahrungen mit der Teilhabe von<br />
engagementbereiten Mitbürgern an einer Gestaltung der<br />
Kommune, mit der Kooperation von haupt- und ehrenamtlichen<br />
Projektmitarbeitern, an einer Vernetzung von<br />
Kommunen und bürgerschaftlichem Engagement zum<br />
Wohle der Allgemeinheit.<br />
Die Leitsätze einer solchen produktiven Kooperation sind<br />
in dem Memorandum „Mitgestalten – Mitentscheiden“<br />
zusammengefasst, das unter Federführung der BAGSO<br />
in einer Kooperation von Bund, Ländern, kommunalen<br />
Spitzenverbänden, Kirchen und Trägerverbänden der<br />
Freien Wohlfahrtspflege, Freiwilligenverbänden, Städtenetzwerken<br />
und dem DOSB 2008 entstanden ist. Die<br />
große Akzeptanz dieses für eine kooperative und partizi-<br />
I 105
Arbeitskreis 8: Sport fördert die Lebensqualität<br />
aller Generationen vor Ort<br />
pative Gesellschaft beispielhaften Memorandums wird<br />
u. a. daran sichtbar, dass inzwischen mehr als 1.000 Personen<br />
<strong>des</strong> öffentlichen Lebens, Organisationen und Kommunen<br />
diese Leitsätze mit ihrer Unterschrift bekräftigt<br />
haben. Sie sind auf der Homepage <strong>des</strong> Programms „Aktiv<br />
im Alter“ zu finden. Auch aus der Wirtschaft kommen<br />
immer neue Partner hinzu, zuletzt Galeria Kaufhof, die<br />
<strong>Deutsche</strong> Postbank und die Versicherungsgruppe Generali.<br />
Letztere fördert im übrigen sogar fünf eigene Standorte<br />
<strong>des</strong> Programms „Aktiv im Alter“.<br />
Ein wichtiges Kapitel <strong>des</strong> Memorandums betrifft das<br />
Thema Sport, Gesundheit und Prävention. Es erhebt die<br />
Forderung, den Zugang zu Bewegungsaktivitäten und<br />
Sport für Ältere zu verbessern und auch für Menschen<br />
ohne Vereinszugehörigkeit attraktive Betätigungsfelder<br />
zu erschließen. Vorgeschlagen wird, das Angebotsspektrum<br />
für die verschiedenen Zielgruppen stetig zu erweitern<br />
und stärker zu vernetzen. Diese Forderungen will<br />
das neue, vom BMFSFJ geförderte Projekt „Bewegungsnetzwerk<br />
50plus“ in der Fläche verwirklichen. Wir versprechen<br />
uns davon sehr viel.<br />
Viele der im Modellprogramm „Aktiv im Alter“ entwickelten<br />
Projekte übrigens betreffen bereits sportliche Aktivitäten<br />
und werden von örtlichen Sportgruppen betreut.<br />
Besonders originell finde ich persönlich die TÜF-Party<br />
(Tanz über fünfzig) in Ahlen und das „Abrocken 40plus“<br />
in Denzingen/Emmendingen. In Kakenstorf gibt es Bogenschießen,<br />
in Leipzig eine Sporttyp-Beratung, in Weinstadt<br />
wird eine Tischtennisgruppe aufgebaut und beim<br />
örtlichen Sportverein in Wilstermarsch/Kreis Steinburg ein<br />
„Schnupperturnen“. Hier zeigt sich deutlich, wie sich die<br />
Intentionen von „Aktiv im Alter“ und <strong>des</strong> vom BMFSFJ<br />
geförderten, neu anlaufenden Projekts <strong>des</strong> DOSB, dem<br />
„Bewegungsnetzwerk 50plus“, überschneiden.<br />
106 I<br />
„Bewegungsnetzwerk 50plus“<br />
Ziel dieses Projekts sind die lebensbegleitende Aktivierung<br />
körperlicher und geistiger Ressourcen sowie Präventionsmaßnahmen<br />
zur gesundheitlichen Stabilisierung<br />
und zum möglichst langen Erhalt der Selbstständigkeit<br />
und Lebensqualität. Eines seiner Elemente trägt den<br />
Titel „Aktiv bis 100“ – ein besonderes Modul für Hochaltrige.<br />
Neue Forschungen der Neurobiologie, u. a. Versuche<br />
mit Jonglierübungen von 55–65jährigen, zeigen,<br />
dass auch das ältere Gehirn in hohem Maße lernfähig ist<br />
und sogar neue Nervenzellen bildet – unter der Voraussetzung,<br />
dass genügend körperliche und geistige Stimulation<br />
vorliegt. Diese Erkenntnis hat die Hirnforschung<br />
revolutioniert und eröffnet ganz neue Perspektiven, in<br />
denen auch dem Sport eine besondere Bedeutung zukommen<br />
wird. Das „Bewegungsnetzwerk 50plus“ befindet<br />
sich schon auf dem richtigen Weg, die neuen Erkenntnisse<br />
in die Praxis umzusetzen.<br />
In Kooperation mit Standorten der Programme „Aktiv im<br />
Alter“ und „Freiwilligendienste aller Generationen« soll<br />
es modellhafte Einzelmaßnahmen für selbstorganisiertes<br />
Engagement in den Kommunen entwickeln und erproben.<br />
Bürgerinnen und Bürgern jeden Alters und der unterschiedlichen<br />
Lebensbereiche soll Gelegenheit für körperliche<br />
Aktivitäten und die Pflege eines aktiven Lebensstils bis<br />
ins hohe Alter hinein geboten werden. <strong>Der</strong> Schwerpunkt<br />
liegt auf Aktivierungs- und Qualifizierungsprogrammen für<br />
die Generation 50plus, sowie in einem Sonderprogramm<br />
für bewegungsungewohnte hochaltrige Menschen. Wir<br />
sind uns der Verantwortung gegenüber denjenigen bewußt,<br />
die nicht einmal mehr in Vereine kommen können,<br />
weil ihre körperlichen Beeinträchtigungen so schwer sind.<br />
Es gilt, Sportvereine zu motivieren, ihre Bewegungskompetenzen<br />
in Kooperationen mit Partnern einzubringen,<br />
um auch alten Leuten zu Hause oder in Pflegeeinrichtungen<br />
ein attraktives Bewegungsangebot machen zu können.<br />
Es gibt hierfür bereits hervorragende Konzepte, die<br />
in der Fläche umsetzen werden müssen.
Alle Bestandteile <strong>des</strong> Projekts erfolgen in Kooperation<br />
zwischen Sportvereinen, Kommunen, sozialen bzw. kirchlichen<br />
Einrichtungen und der Zielgruppe der älteren Menschen.<br />
Sportvereine werden dabei in ihren Bestrebungen<br />
zur Vernetzung unterstützt. Dabei sollen in den Kommunen<br />
neue Zugangswege und neue Angebotsformen erschlossen<br />
bzw. erarbeitet werden, die die Zielgruppen der<br />
älteren Menschen besser erreichen können. Hier ist die<br />
Zusammenarbeit zwischen Kommunen, Trägerorganisationen<br />
und den örtlichen Sportgruppen eine Chance, viele<br />
Menschen anzusprechen, die bisher durch die Maschen<br />
gefallen sind.<br />
Die Betätigung in Sportvereinen unterstützt nicht nur die<br />
körperliche und geistige Fitness der älteren Generation,<br />
sondern auch die Knüpfung von Kontakten, Geselligkeit,<br />
intergenerationelle Kontakte und Erfahrungen, gegenseitige<br />
Unterstützung und gemeinsame Aktivitäten. Bessere<br />
Kenntnis der Möglichkeiten von Kommune und<br />
einzelnen Trägerverbänden oder Organisationen untereinander<br />
sowie bessere Information über die Bedürfnisse<br />
einzelner Zielgruppen – wie ältere Menschen, Hochaltrige,<br />
Familien oder junge Menschen – erlauben es, passgenaue<br />
Angebote zu entwickeln und anzubieten, die<br />
am richtigen Ort zur richtigen Zeit die richtigen Menschen<br />
ansprechen. Dies trägt zu einer familienfreundlichen und<br />
generationenverbindenden Kommune bei. Durch eine bessere<br />
Vernetzung untereinander können darüber hinaus<br />
weitere Vorteile für alle Beteiligten entstehen.<br />
Diskussionen und Vorschläge über vielerlei für die Allgemeinheit<br />
nützliche Projekte können sich entwickeln und<br />
verbreitet werden. Man kann leichter Hinweise auf mögliche<br />
Verwirklichungen erhalten und weitergeben. Nicht<br />
nur attraktive Angebote der Freizeitgestaltung machen auf<br />
sich aufmerksam, sondern auch soziale Problembereiche<br />
und Brennpunkte sprechen sich schneller herum. Mehr<br />
Menschen können sich engagieren. Die Wege für Information<br />
wie für Überzeugungsarbeit werden kürzer. Vernetzung<br />
bedeutet: Die Identifikation der Bürger mit ihren<br />
Vereinen, mit ihrer Kommune wächst. <strong>Der</strong> Zusammenhalt<br />
wird größer. Lebensqualität und die Bereitschaft zum bürgerschaftlichen<br />
Engagement steigen. Ein Gewinn für alle.<br />
Im Sport, meine Damen und Herren, muss das Rad <strong>des</strong><br />
Ehrenamts nicht erst neu erfunden werden: hier rotiert es<br />
bereits kräftig und hält alle Generationen in Schwung.<br />
Sport und Bewegung liegt mit 11 % unter allen Tätigkeitsbereichen<br />
<strong>des</strong> freiwilligen Engagements an der Spitze.<br />
Über 90 % aller freiwillig im Sport Engagierten gehören<br />
einem Verein an; in anderen Bereichen trifft dies nur auf<br />
35 % zu. Und während die Mitgliederzahlen in anderen<br />
Einrichtungen bedenklich bröckeln, stieg die Anzahl der<br />
Sportvereine in den letzten 15 Jahren von 85.000 auf rund<br />
90.000 – mit insgesamt fast 24 Mio. Mitgliedern. Sport<br />
ist ohne Übertreibung die größte „Bürgerbewegung“ in<br />
Deutschland.<br />
Meine Damen und Herren: Körperlich und geistig fit zu<br />
bleiben, ist nach wie vor das höchste Lebensgut für ältere<br />
Menschen. Dahinter steht der Wunsch, so lange wie<br />
möglich selbstständig und unabhängig bleiben zu können.<br />
Voraussetzung dafür sind vor allem körperliche und<br />
geistige Aktivität. Regelmäßige Bewegung kann bis ins<br />
höchste Alter noch die körperliche Leistungsfähigkeit<br />
verbessern und Erkrankungen verhindern. Nicht umsonst<br />
sagt der Volksmund: „Wer rastet, der rostet“.<br />
Ich begrüße es <strong>des</strong>halb, dass der DOSB in Form seines<br />
neuen „Bewegungsnetzwerks“ an einem großen gesellschaftspolitischen<br />
Projekt mitarbeitet: die Herausforderungen<br />
<strong>des</strong> demographischen Wandels anzunehmen<br />
und durch eine Vernetzung mit Kommunen und der Bevölkerung<br />
zu positiven Lösungen für alle zu kommen.<br />
Wir dürfen auf die Ergebnisse gespannt sein.<br />
Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen für Ihre<br />
Aufmerksamkeit.<br />
I 107
Arbeitskreis 8: Sport fördert die Lebensqualität<br />
aller Generationen vor Ort<br />
URSULA WOLTERING (LEITERIN DER LEITSTELLE „ÄLTER WERDEN IN AHLEN“):<br />
Aktiv vor Ort – lokale Seniorennetzwerke in NRW<br />
In der Stadt Ahlen haben die Seniorenarbeit und<br />
der Seniorensport in einem dreijährigen Modellprojekt<br />
<strong>des</strong> Ministeriums für Generationen, Familie,<br />
Frauen und Integration neue Wege der Zusammenarbeit<br />
entwickelt und erprobt. Das Ergebnis dieser<br />
sympathischen Verbindung liegt nun vor.<br />
Das Projekt „Aktiv vor Ort – lokale Seniorennetzwerke<br />
in NRW“ wurde von 2007 – 2009 vom Ministerium für<br />
Generationen, Familie, Frauen und Integration gefördert<br />
und in drei Städten unter der Moderation <strong>des</strong> Freiburger<br />
Kreises durchgeführt. Ziel war es eine stärkere Zusammenarbeit<br />
zwischen der Seniorenarbeit und dem Seniorensport<br />
zu erwirken. In Ahlen, einer Mittelstadt mit<br />
55.000 EinwohnerInnen und 40 Sportvereinen, in denen<br />
17.000 Mitglieder aktiv sind, wurde das Projekt mit drei<br />
Schwerpunkten durchgeführt: Entwicklung von neuen<br />
Sport- und Bewegungsangeboten für ältere Menschen,<br />
Öffentlichkeitsarbeit für ein zeitgemäßes Altersbildung<br />
und für die Bewegungsangebote für die Generation 50+<br />
sowie eine Vernetzung zwischen den Trägern und Vereinen,<br />
um eine nachhaltige Zusammenarbeit jenseits der<br />
Projektförderung zu erreichen. Die Projektsteuerung übernahm<br />
die Lenkungsgruppe, bestehend aus Haupt- und<br />
Ehrenamtlichen aus Senioren- und Bildungsarbeit und dem<br />
Sport.<br />
Basis der Projektumsetzung ist das Ahlener SINN-Netzwerk<br />
„Senioren in neuen Netzwerken“, welches viele Angebote<br />
der Seniorenarbeit in Ahlen vereint und um weitere<br />
Kooperationen erweitert wurde. Das SINN-Netzwerk ist<br />
ein gemeinsames Forum von über 60 ehren- und hauptamtlichen<br />
Projekten, Trägern und Initiativen der Seniorenarbeit,<br />
die gemeinsam an der Engagementförderung und<br />
Angebotsentwicklung in Ahlen arbeiten. Das folgende<br />
108 I<br />
Schaubild verdeutlicht die Vielfalt und Kooperationsstruktur:<br />
2007 – Grundlagen schaffen, Lernen<br />
und Weiterentwickeln<br />
In einer neuen Broschüre wurden alle nicht-kommerziellen<br />
Angebote für Menschen ab 50 aus den Bereichen<br />
Bewegung und Gesundheit zusammengefasst. Durch die<br />
Recherche entstand eine erste Zusammenarbeit aller<br />
AnbieterInnen, der Bestand wurde erfasst und den NutzerInnen<br />
wurde ein guter Überblick ermöglicht. Erstaunlich:<br />
während in früheren Broschüren der Seniorenarbeit<br />
nur 15 Sportangebote für Ältere verzeichnet waren, kamen<br />
nun über 70 zu Tage – eine positive Überraschung<br />
für alle Beteiligten.<br />
Zu Beginn <strong>des</strong> Projektes erfolgte auch eine allgemeine<br />
Qualifizierung zum „Sport der Älteren“ für Übungsleiter-<br />
Innen, die im Projektverlauf neu gegründete Angebote<br />
übernahmen.
Gestartet wurde das Projekt mit einer Informationsveranstaltung<br />
mit wissenschaftlichem Impulsreferat, der eine<br />
große Auftaktveranstaltung mit Schnupperangeboten,<br />
Darbietungen und Austausch- und Kontaktmöglichkeiten<br />
folgte. Hier, wie auch bei den folgenden Angeboten (Bewegung<br />
auf Bestellung, zahlreiche Schnupperangebote<br />
der Vereine …) war die Resonanz überwiegend enttäuschend<br />
gering. Die Lenkungsgruppe lernte aus dieser Erfahrung<br />
und schlug im Jahr 2008 ganz andere Wege ein.<br />
2008 – neue Angebotsformate,<br />
Öffentlichkeitsarbeit und Auswertung<br />
Die Erkenntnisse zur Attraktivität, Akzeptanz und Vermittelbarkeit<br />
unterschiedlicher Angebots- und Bewegungsformen<br />
aus den Jahr 2007 wurden genutzt, um ein ganz<br />
anderes Angebotsformat zu entwickeln. Eckdaten waren:<br />
Motivationsfaktor Gesundheitsförderung, Start einer<br />
neuen Gruppe von Gleichgesinnten, Verknüpfung von<br />
Sport mit Geselligkeit, begrenzte Laufzeit <strong>des</strong> Angebotes<br />
mit abschließender Wertschätzung der Teilnehmenden.<br />
Mit dem „Aktiv vor Ort – Gesundheitspass“ wurden diese<br />
Wünsche umgesetzt. Das Projekt bot eine medizinische<br />
und physiotherapeutische Vor- und Nachuntersuchung, ein<br />
wöchentliches Walkingangebot, monatlich ein Schnupperangebot,<br />
außerdem Ernährungsberatung, Geselligkeit<br />
und eine abschließende Ehrung mit Preisverleihung. Das<br />
Projekt konnte 80 Personen aktivieren und 50 dauerhaft<br />
zu Bewegung motivieren – ein großer Erfolg. Es war angelegt<br />
auf ein Jahr.<br />
Das Projekt Gesundheitspass wurde fragebogengestützt<br />
evaluiert: Die vier wichtigsten Gründe zur Teilnahme<br />
waren, etwas für die Gesundheit zu tun, Walking bzw.<br />
Nordic-Walking als Bewegungsangebot zu nutzen, die<br />
Mischung aus Gesundheit, Sport und Geselligkeit zu genießen<br />
und die Möglichkeit zu haben, mit einer neuen<br />
Gruppe zu starten und sich somit nicht der Gefahr auszusetzen,<br />
keinen sozialen Anschluss zu finden.<br />
Fortgesetzt wurde 2008 zudem die Qualifizierung von<br />
ÜbungsleiterInnen, nun in dem Bereich „Prävention“.<br />
Das hier gewonnene Wissen konnte direkt in neuen<br />
Angeboten, wie im „Aktiv vor Ort-Gesundheitspass“<br />
angewandt werden.<br />
I 109
Arbeitskreis 8: Sport fördert die Lebensqualität<br />
aller Generationen vor Ort<br />
Für eine gezielte Öffentlichkeitsarbeit wurde das Informations<strong>des</strong>ign<br />
weiterentwickelt. Dabei garantierte die<br />
Corporate Identity stets den Wiedererkennungswert der<br />
Angebote <strong>des</strong> Projektes „Aktiv vor Ort“ und <strong>des</strong> SINN-<br />
Netzwerkes. Neben der Pressearbeit, dem Einsatz <strong>des</strong><br />
Newsletters <strong>des</strong> Oldie Computer Club Ahlen und der Internetpräsenz<br />
www.senioren-ahlen.de, wurde ein monatlich<br />
erscheinender Flyer erstellt. So wurde über die<br />
Sportangebote und deren gesundheitlichen Nutzen und<br />
Risiken gezielt informiert, wodurch die Resonanz auf<br />
die Schnupperangebote deutlich erhöht werden konnte.<br />
2009 – Vernetzung, Verankerung<br />
und Verstetigung<br />
Im Anschluss an den Erfolg <strong>des</strong> „Aktiv vor Ort – Gesundheitspasses“<br />
wurde „Im Gleichgewicht von Körper, Seele<br />
und Geist“ für Menschen ab 50 Jahren aufgelegt. Hier<br />
ging es um eine ganzheitliche Ansprache von Menschen<br />
in biographischen Übergangssituationen. Bewegung,<br />
Körperwahrnehmung, Kreativität, Besinnlichkeit und Sinnsuche<br />
waren zentrale Kernelemente. Zusätzlich wurde<br />
das Projekt gezielt mit älteren Frauen mit Migrationshintergrund<br />
durchgeführt.<br />
In einer Veranstaltung zum Thema Sturzprophylaxe wurden<br />
ÜbungsleiterInnen, Fachleute aus der Pflege wie auch<br />
SeniorInnen informiert. 2010 werden ÜbungsleiterInnen<br />
hierzu durch den Kreissportbund Warendorf qualifiziert,<br />
die künftig ihr Wissen an SeniorInnen und an MultiplikatorInnen<br />
aus Seniorentreffpunkten etc. weitergeben.<br />
Das Netzwerk Seniorensport benennt erstmals konkrete<br />
AnsprechpartnerInnen in den Vereinen und wird von der<br />
Leitstelle „Älter werden in Ahlen“ und dem Stadtsportverband<br />
Ahlen getragen. Ziel ist die Initiierung attraktiver<br />
Angebote, Vernetzung und Kooperation sowie die Gewährleistung<br />
eines Informationsflusses zwischen den NetzwerkpartnerInnen.<br />
110 I<br />
<strong>Der</strong> Pakt für den Sport wurde zwischen dem Stadtsportverband<br />
Ahlen und der Stadt Ahlen geschlossen und bindet<br />
den Sport der Älteren sportpolitisch ein. Die in den<br />
monatlichen Flyern 2008 vorgestellten Sportarten wurden<br />
zum Projektende noch einmal in einer Broschüre zusammengefasst<br />
und publiziert. Auf der Lan<strong>des</strong>fachtagung im<br />
Oktober 2010 in Köln wurden die Projektergebnisse der<br />
Öffentlichkeit präsentiert.<br />
Fazit<br />
In der Umsetzung und Evaluation <strong>des</strong> Projektes konnten<br />
die Nutzungsbedingungen von Bewegungsangeboten erfasst<br />
werden. Das Streben nach Gesundheit ist die stärkste<br />
Motivationsquelle. Zusätzlich muss ein Angebot einen<br />
deutlichen Mehrwert bieten und z.B. Gesundheits- und<br />
Bewegungsangebote sowie Geselligkeit verknüpfen. Zudem<br />
sollte das Bewegungsangebote gerade für Neulinge<br />
möglichst in einer neuen Gruppe zu starten.<br />
Ein vielfältiges Informations<strong>des</strong>ign im Sinne <strong>des</strong> Crossmarketing<br />
hilft zudem ganz gezielt einzelne Zielgruppen zu<br />
erreichen oder eine breite Menge an Menschen aufmerksam<br />
zu machen. Die Nachhaltigkeit war in Ahlen stets der<br />
Maßstab der Arbeit. Das SINN-Netzwerk neue PartnerInnen<br />
im Sport gewinnen, welche auch in Zukunft das Engagement<br />
im Bereich Bewegung und Gesundheit im Netzwerk<br />
erhöhen. Ein gelungenes Beispiel dieser Verstetigung ist<br />
die Fortsetzung der Walkinggruppen in Vereinsträgerschaft,<br />
die Fortsetzung der Sturzprophylaxeveranstaltungen mit<br />
den frisch ausgebildeten ÜbungsleiterInnen durch die VHS<br />
und die weitere Zusammenarbeit mit den nun benannten<br />
AnsprechpartnerInnen für Seniorensport in den Vereinen<br />
sowie der sportpolitische „Pakt für Sport“.<br />
Stand: April 2010<br />
Internet: www.senioren-ahlen.de
MICHAEL HÖHN (DEUTSCHER OLYMPISCHER SPORTBUND):<br />
Projekt „Bewegungsnetzwerk 50 plus“ –<br />
Förderung von Sport und Bewegung für Ältere durch<br />
ein vernetztes Angebote in der Kommune<br />
Die Förderung von Sport und Bewegung in den Kommunen<br />
ist ein wichtiger Baustein für die Bewältigung der<br />
demografischen und gesellschaftlichen Entwicklungen.<br />
Sportvereine können die Lebensqualität im Quartier erheblich<br />
erhöhen und mit ihren zahlreichen Angeboten<br />
maßgeblich zur Erhaltung von Gesundheit und Selbständigkeit<br />
und zur Partizipation der Generation 50 plus beitragen.<br />
Ein entscheidender Aspekt wird in Zukunft die<br />
verstärkte Vernetzung von Sportvereinen und -verbänden<br />
mit Akteuren aus dem kommunalen Umfeld sein. <strong>Der</strong><br />
Sport braucht Verbündete in den Kommunen, um seine<br />
Potentiale besser auszuschöpfen, sich stärker einzubinden<br />
und die Kommunen, als Orte der Daseinsvorsorge,<br />
mit Sport- und Bewegungsangeboten zu bereichern.<br />
Im Modelprojekt „Bewegungsnetzwerk 50 plus“ greift<br />
der <strong>Deutsche</strong> <strong>Olympische</strong> SportBund (DOSB) diesen Aspekt<br />
auf und knüpft die Förderung von Sport und Bewegung<br />
der Älteren an den Aufbau von Netzwerken mit<br />
kommunalen Akteuren. Gefördert vom Bun<strong>des</strong>ministerium<br />
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend führt der<br />
DOSB zusammen mit 10 Mitgliedsorganisationen verschiedene<br />
modellhafte Maßnahmen durch, um Sport<br />
und Bewegung für die Generation 50 plus in den Kommunen<br />
zu fördern. In allen beteiligten Projekten will man<br />
dieses Ziel durch Kooperationen zwischen Sportvereinen,<br />
Kommunen, Gesundheitsorganisationen, sozialen und<br />
kirchlichen Einrichtungen erreichen. Netzwerke zwischen<br />
Sportvereinen und Partnern aus dem kommunalen Umfeld<br />
bieten die Möglichkeit zu:<br />
p einer verbesserten Zielgruppenorientierung<br />
durch neue Zugangswege,<br />
p sozialer Teilhabe der Generation 50 plus,<br />
p Empowerment von Sport und kommunalen<br />
Kooperationspartnern,<br />
p Strukturbildung durch nachhaltige Kooperationen<br />
und Vernetzungen,<br />
p differenzierten und vielseitigen Sport- und<br />
Bewegungsangeboten angelehnt an Bedürfnissen<br />
und Lebenspraxis der Generation 50 plus.<br />
I 111
Arbeitskreis 8: Sport fördert die Lebensqualität<br />
aller Generationen vor Ort<br />
Das „Bewegungsnetzwerk 50 plus“<br />
umfasst folgende Teilprojekte:<br />
DOSB: „Koordinationsstelle Netzwerkplanung“<br />
<strong>Der</strong> DOSB plant in Form einer Koordinationsstelle die nachhaltige<br />
Entwicklung kommunaler Netzwerkbeziehungen<br />
und die Kooperation mit Partnern außerhalb <strong>des</strong> Sports,<br />
wie z.B. der Bun<strong>des</strong>arbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen<br />
(BAGSO). Ein weiteres Hauptaugenmerk<br />
liegt auf der Konzeption einer internetbasierten Wissensbörse<br />
zur Netzwerkarbeit im Sport, die als Informationsund<br />
Kommunikationsplattform fungieren und zu einer<br />
weiteren Strukturbildung in den Kommunen beitragen<br />
soll. Zusätzlich kooperiert der DOSB mit dem <strong>Deutsche</strong>n<br />
Behindertensportverband, den LSBs Bremen, Sachsen-<br />
Anhalt und Schleswig-Holstein, um Einzelmaßnahmen<br />
zur Vernetzung durchzuführen.<br />
Lan<strong>des</strong>sportbund Hessen:<br />
„Bewegungs-Starthelfer für Ältere“<br />
<strong>Der</strong> Lan<strong>des</strong>sportbund Hessen will mit seinem Projekt Bewegungs-Starthelfer<br />
für Ältere“ die Ansprache und<br />
Betreuung sportfremder Menschen 50 plus in Bewegungsgruppen<br />
und Sportvereinen verbessern. Die Bewegungs-<br />
Starthelfer sollen zur Überwindung von Zugangsbarrieren<br />
beitragen, die Älteren für einen aktiven Lebensstil<br />
gewinnen und dauerhaft in eine neue oder bereits bestehende<br />
Gruppe im Verein integrieren.<br />
In den Modellregionen Stadt und Kreis Offenbach verfolgt<br />
der LSB Hessen die Gewinnung von „Bewegungs-Starthelfern“<br />
über bereits bestehende Netzwerkstrukturen<br />
und durch neue Kooperationspartner, wie der Lan<strong>des</strong>ehrenamtsagentur.<br />
Die Bewegungs-Starthelfer begleiten<br />
Menschen ab 50 auf dem Weg zu Sport und Bewegung<br />
und orientieren sich an den persönlichen Bedürfnissen<br />
und Interessen der Menschen 50 plus. Damit sollen neue<br />
Zielgruppen für einen sanften Einstieg in den Sportverein<br />
angesprochen werden.<br />
112 I<br />
DTB: „Aktiv bis 100“<br />
<strong>Der</strong> <strong>Deutsche</strong> TurnerBund legt mit seinem Projekt „Aktiv<br />
bis 100“ den Fokus auf die Zielgruppe der Hochaltrigen.<br />
Gemeinsam mit kommunalen Akteuren soll in den beiden<br />
ausgewählten Modellregionen Achern(Baden) und Frankfurt(Hessen)<br />
ein Bewegungsprogramm für Hochaltrige<br />
umgesetzt werden. Die Gewinnung und dauerhafte Motivierung<br />
von Hochaltrigen, die bisher keinen Zugang<br />
zu Sport- und Bewegungsangeboten hatten, ist eine wichtige<br />
Aufgabe <strong>des</strong> Netzwerks. Für den Aufbau der Netzwerkstrukturen<br />
sind vor allem Partner aus dem Senioren,-<br />
Sozial- und Gesundheitswesen gefragt. Neben Einzelansprachen<br />
und Informationen in Veranstaltungen der<br />
Netzwerkpartner, ist hier besonders die Erschließung von<br />
Kontakten zu Hochaltrigen über die Netzwerkpartner –<br />
die oftmals schon Verbindungen zur Zielgruppe haben –<br />
und teilweise über die Angehörigen notwendig. Ältere<br />
Menschen gewinnt man oft nicht mit den klassischen<br />
Mitteln der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Es müssen<br />
Strategien entwickelt werden, die Menschen in ihrer Lebenspraxis<br />
anzusprechen, da wo sie Probleme haben und<br />
wo Bewegung zur Verbesserung der Lebensqualität beitragen<br />
kann.<br />
LSB Thüringen: „Strukturentwicklung zum Ausbau<br />
von Sport- und Bewegungsangeboten für Ältere“<br />
Die angestrebte Strukturentwicklung durch das Teilprojekt<br />
<strong>des</strong> LSB Thüringen erfolgt zusammen mit den Kreis- und<br />
Stadtsportbünden, sowie ausgewählten Sportfachverbänden<br />
und den vorrangig ehrenamtlich tätigen Seniorensportbetreuer/innen.<br />
Die in den 23 Städten und Kreisen<br />
tätigen Seniorensportbetreuerinnen und -betreuer haben<br />
die Aufgabe, in ihrem Tätigkeitsbereich neue Netzwerke<br />
im Bereich Ältere aufzubauen oder sich an bestehende anzugliedern,<br />
um das Thema „Sport und Bewegung“ in<br />
die regionale Altenhilfeplanung zu integrieren. Eine bestehende<br />
Kooperationsvereinbarung zwischen dem LSB<br />
Thüringen und dem Gemeinde- und Städtebund Thüringen<br />
bietet hierfür eine gute Grundlage. Mit der Analyse<br />
der regionalen Vernetzungsstrukturen hat der LSB Thü-
ingen zahlreiche Erkenntnisse zum Vernetzungsgrad<br />
und Arbeitsstand in den regional sehr unterschiedlichen<br />
Landkreisen und Städten gesammelt. Ausgehend von<br />
wesentlichen Erfolgsfaktoren und Handlungsempfehlungen<br />
gründet der LSB Thüringen nun gemeinsam mit<br />
den Seniorensportbetreuer/innen neue Kooperationen<br />
und Netzwerke für den Sport der Älteren.<br />
Lan<strong>des</strong>sportbund Niedersachsen: „Strategieentwicklung<br />
zum Ausbau von Sport- und Bewegungsangeboten<br />
für Ältere in kommunalen Netzwerken“<br />
<strong>Der</strong> LSB Niedersachsen strebt den Ausbau von Sport- und<br />
Bewegungsangeboten für Ältere in Zusammenarbeit mit<br />
Gesundheits- und Seniorenorganisationen an. Ein großer<br />
Schwerpunkt liegt dabei auf der Vernetzung zwischen<br />
Sportvereinen und Senioren-Service-Büros in ausgewählten<br />
Modellregionen, wie Gronau/Leine und Helmstedt.<br />
Eine Grundlage für die Strategieentwicklungen bilden<br />
Struktur- und Bedarfsanalysen in den verschiedenen Regionen.<br />
Die Aufgabe der lokalen Netzwerke soll sein,<br />
zu einer Verbreiterung <strong>des</strong> Sport- und Bewegungsangebots<br />
für ältere Menschen in ihrem unmittelbaren Lebensumfeld<br />
beizutragen und Zugangsbarrieren zu Sportund<br />
Bewegungsangeboten zu senken. Mit Hilfe dieser<br />
Kooperationen bezweckt man die Ansprache der Generation<br />
50 plus zu verbessern und Ideen-Werkstätten<br />
und Aktionstage zu organisieren.<br />
Lan<strong>des</strong>sportbund Nordrhein-Westfalen:<br />
Generationenprojekt „Jung & Alt – gemeinsam<br />
sportlich aktiv“<br />
Ziel <strong>des</strong> Projekts ist die Gewinnung neuer Partner zur<br />
Förderung der Generationenbeziehungen im Sport. <strong>Der</strong><br />
LSB Nordrhein-Westfalen will gemeinsam mit Fachverbänden<br />
an fünf Standorten kommunale Netzwerke aufbauen,<br />
um in Kooperation mit vielfältigen externen<br />
Partnern Mitglieder aller Generationen für Jung & Alt –<br />
Projekte zu gewinnen. Die Sportvereine bieten nicht<br />
nur die Chance zur Begegnung und Unterstützung der<br />
Generationen in den Kommunen, sondern auch ein Er-<br />
lebnis- und Tätigkeitsfeld für Alt und Jung. Mit den<br />
kommunalen Netzwerken sollen neue gemeinsame Erfahrungsräume<br />
für Kinder, Jugendliche und älteren<br />
Menschen ab 50 Jahren geschaffen werden. Darüber<br />
hinaus werden Tätigkeitsfelder für Ältere und Jüngere<br />
im Sportverein aufgezeigt und neu erschlossen.<br />
Badischer Sportbund:<br />
„Gewinnung neuer Zielgruppen“<br />
Sport eignet sich in hohem Maße, die Integration von<br />
Migrantinnen und Migranten in die Gesellschaft zu<br />
unterstützen. <strong>Der</strong> Badische Sportbund beabsichtigt mit<br />
kommunalen Partnern und insbesondere mit Migrantenvereinen<br />
Netzwerke zu entwickeln, um neue Zugangswege<br />
zur Zielgruppe der älteren Migranten/-innen zu<br />
erproben und diese für Sport und Bewegung anzusprechen.<br />
Mit speziell auf die Zielgruppe älterer Menschen<br />
zugeschnittenen Angeboten sollen Neueinsteigerinnen<br />
und -einsteiger für Gesundheitssportangebote gewonnen<br />
werden. Dafür strebt man eine enge Kooperation<br />
mit Migranten-Kulturvereinen und -Selbsthilfeorganisationen<br />
an.<br />
Weitere Informationen:<br />
Broschüre zur „Netzwerkarbeit im Sport – aufgezeigt am Sport der<br />
Älteren“ erschienen. In der Broschüre werden Grundsätze <strong>des</strong><br />
Netzwerkmanagements, sowie viele Praxistipps u. a. zu Erfolgsfaktoren<br />
und Stolpersteinen von Netzwerkarbeit aufgezeigt.<br />
Laufende Berichterstattung zum Projekt auf<br />
www.richtigfit-ab50.de/projekte<br />
Die Präsentation der Projektergebnisse erfolgt im Herbst 2011 auf<br />
einer Fachtagung<br />
Internet: www.richtigfit-ab50.de<br />
I 113
Arbeitskreis 8: Sport fördert die Lebensqualität<br />
aller Generationen vor Ort<br />
DR. KAROLA KURR (SPORTMANAGERIN DES TUS GRIESHEIM):<br />
Sport fördert die Lebensqualität für alle Generationen –<br />
TuS Griesheim 1899 e.V.<br />
Griesheim liegt im Landkreis Darmstadt-Dieburg und hat<br />
ca. 26.500 Einwohner. <strong>Der</strong> TuS Griesheim ist ein Mehrspartenverein<br />
mit 3.900 Mitgliedern und zeichnet sich<br />
durch seine exzellente und mehrfach prämierte Vereinsarbeit<br />
aus. <strong>Der</strong> Verein möchte für seine Mitglieder ein<br />
attraktiver Verein sein, der sich seiner Verantwortung für<br />
die gesellschaftlichen Bereiche Gesundheit, Kultur, Umwelt<br />
und Soziales bewusst ist.<br />
Oberste Priorität genießt die Zufriedenheit der Vereinsmitglieder,<br />
die sowohl die Qualität <strong>des</strong> Angebots als auch<br />
die Organisation so schätzen, dass sie die Botschaft nach<br />
außen tragen und damit Interesse bei anderen wecken.<br />
Es wird ein Angebot für alle Altersklassen, Geschlechter<br />
und soziale Gruppen angeboten. <strong>Der</strong> Verein möchte mit<br />
seinem Engagement das Gesundheitsbewusstsein und<br />
die Bereitschaft zur Leistung und zur Eigeninitiative der<br />
Mitglieder stärken und ihre Lebensfreude und Lebensqualität<br />
steigern.<br />
Was kann der Verein im Bereich Familien und Senioren<br />
leisten? <strong>Der</strong> TuS Griesheim sieht die Zielgruppen Familien<br />
und Senioren als einen wichtigen Schwerpunkt seiner<br />
Vereinsarbeit. <strong>Der</strong> Sport ist ein Integrationsfaktor auf vielfältigen<br />
Ebenen und ermöglicht somit ein Heranführen<br />
und Binden an den Verein. <strong>Der</strong> TuS Griesheim stellt sich<br />
seiner sozialen Verantwortung und möchte durch sein Angebot<br />
der demographischen Entwicklung gerecht werden.<br />
Im Jahr 2005 wurde das „Griesheimer Bündnis für Familie“<br />
gegründet. Man hat sich zum Ziel gesetzt, die Arbeit<br />
der Vereine und Institutionen vor Ort miteinander zu<br />
vernetzen, um Familien mit ihren Betreuungsaufgaben zu<br />
entlasten und um Austausch zu bieten. Die Einwohner<br />
114 I<br />
Griesheims profitieren von diesem Netzwerk. Familien fühlen<br />
sich in Griesheim wohl. Dies spiegelt sich, entgegen<br />
dem Trend im Landkreis Darmstadt-Dieburg, in der wachsenden<br />
Einwohnerzahl wieder.<br />
Ein effektives und intaktes Netzwerk erfordert eine sinnvolle<br />
Netzwerkstruktur. Gremien müssen installiert, Steuerungs-<br />
und Entscheidungsprozesse eingerichtet werden.<br />
Evaluationsverfahren zur Informationsgewinnung über<br />
den Nutzen sowie der Effektivität und Effizienz <strong>des</strong> Netzwerkes<br />
und <strong>des</strong>sen Projekte sind unablässig.<br />
Die Netzwerkarbeit in der Kommune ist eine der wichtigsten<br />
Ressourcen für den Verein. Die engsten Partner <strong>des</strong><br />
Vereins sind die Stadt Griesheim, der Landkreis, die Schulen,<br />
die Kindergärten und die anderen Vereine vor Ort.<br />
Das Netzwerk ermöglicht Kooperationen, Reduzierung<br />
von finanziellen Aufwendungen, Realisierung großer vereinsübergreifender<br />
und institutionsübergreifender Projekte,<br />
uvm. Die Beständigkeit und Erreichbarkeit fester<br />
Ansprechpartner erleichtert und verbessert die Zusammenarbeit.<br />
Koordinierungsaufgaben liegen im hauptamtlichen<br />
Bereich der Stadt, der Schulen und <strong>des</strong> Vereins,<br />
um den Kommunikationsfluss zu gewährleisten.<br />
Auch das Netzwerk <strong>des</strong> TuS Griesheim zeigt Schwächen.<br />
So stößt der Verein durch monetäre Probleme, personelle<br />
Strukturen (Ehrenamtlichkeit versus Hauptamtlichkeit)<br />
und dem Faktor Zeit immer wieder an seine Grenzen.<br />
Nichts<strong>des</strong>totrotz ist eine gute Vernetzung eine wichtige<br />
Voraussetzung und erheblicher Bestandteil einer erfolgreichen<br />
Vereinsarbeit.
Ergebnisse <strong>des</strong> Arbeitskreises 8<br />
I 115
Arbeitskreis 9: Frauensport(T)räume – der Gender- und<br />
Diversityansatz in der kommunalen Sportentwicklungsplanung<br />
PROF. DR. PETRA GIESS-STÜBER (ALBERT-LUDWIGS-UNIVERSITÄT FREIBURG):<br />
Frauensport(T)räume – Gender Mainstreaming in der<br />
Sportentwicklungsplanung<br />
In Freiburg im Breisgau wurde ein komplexes Projekt zur<br />
Sportentwicklungsplanung durchgeführt, in dem erstmalig<br />
die Leitideen <strong>des</strong> EU-Programms Gender Mainstreaming<br />
Berücksichtigung fanden. In Eckl, Gieß-Stüber & Wetterich<br />
(2005) werden Grundlagen, empirische Daten, Ergebnisse<br />
genderbezogener Analysen, Problemfelder und Handlungsempfehlungen<br />
ausführlich dargestellt.<br />
Gender Mainstreaming in der Sportentwicklungsplanung<br />
bedeutet, dass zu prüfen ist, ob z.B. Angebote Jungen<br />
und Mädchen, Männer und Frauen gleichermaßen ansprechen,<br />
die Angebote in der Kommune so gestaltet<br />
116 I<br />
sind, dass alle Bürgerinnen und Bürger für sich einen geeigneten<br />
Ort – also eine geeignete Sportstätte – und ein<br />
geeignetes Sportangebot finden können, ob die (Spitzen-)<br />
Sportförderung ausgeglichen ist, wie Vereine ihre Führungskräfte<br />
und ÜbungsleiterInnen rekrutieren u. a. m.<br />
In dem Bild, das Barbara Stiegler (2000) zeichnet, werden<br />
die anstehenden Entscheidungsprozesse mit dem Flechten<br />
eines Zopfes verglichen. Den in politischen Organisationen<br />
üblichen Strängen Sachgerechtigkeit, Machbarkeit<br />
und Kosten wird von Beginn an die Frage der Geschlechterverhältnisse<br />
hinzugefügt.
Umsetzung von Gender Mainstreaming<br />
in der Sportentwicklungsplanung<br />
Implementierungsstrategien, die für Gender Mainstreaming<br />
in Organisationen empfohlen werden, sind nicht<br />
vollständig auf ein Forschungs- und Planungsprojekt zu<br />
beziehen. Entsprechend üblicher Implementierungsstrategien<br />
werden im Folgenden die zentralen Arbeitsschritte<br />
in Freiburg kommentierend skizziert:<br />
Zielklärung<br />
Angestrebt sind Handlungsempfehlungen, die auf<br />
Chancengleichheit und Gleichstellung von Mädchen und<br />
Jungen/ Frauen und Männern im Sport abzielen.<br />
Geschlechterdifferenzierende Analyse<br />
Grundlage einer geschlechtergerechten Sportentwicklungsplanung<br />
ist die Kenntnis <strong>des</strong> Forschungsstan<strong>des</strong> zu<br />
geschlechtsbezogenen Entwicklungstendenzen im Sport<br />
sowie die Kompetenz, auf der Grundlage geschlechtertheoretischer<br />
Erkenntnisse Entwicklungspotenziale zu erkennen.<br />
Unter der Perspektive von Gender Mainstreaming<br />
müssen alle Daten zu Sport- und Bewegungsverhalten<br />
und -bedarf, zu Infra- und Angebotsstruktur geschlechterdifferenziert<br />
erhoben und ausgewertet werden. Zu<br />
welchen Themen spezifische empirische Studien, Fachgespräche<br />
oder Dokumentenanalysen erforderlich sind,<br />
hängt von den jeweiligen lokalen Gegebenheiten und Interessenlagen<br />
ab.<br />
Geschlechtergerechte Partizipation im<br />
Planungsprozess<br />
Arbeits- und Planungsgruppen wurden – wo immer möglich<br />
– mit Frauen und Männern besetzt. Grenzen wurden<br />
diesem Bemühen dadurch gesetzt, dass Dezernats-, Organisations-<br />
und Vereinsleitungen i. d. R. durch Männer<br />
vertreten werden. So ergibt sich in Steuerungsgruppen<br />
„quasi automatisch“ das traditionelle, rollentypische Bild:<br />
Frauen vertreten Frauen-, Kinder- und Jugendinteressen.<br />
Politik, Verwaltung und Sport werden überwiegend durch<br />
Männer repräsentiert. Wenn ein solcher Effekt vermieden<br />
werden sollte, müssten im Planungsprozess sehr früh<br />
Auswahlkriterien jenseits institutioneller Hierarchien im<br />
Sinne von Gender Mainstreaming abgestimmt werden.<br />
Steuerung<br />
Die Beachtung von Gender Mainstreaming in dem gesamten<br />
Prozess wurde von der Projektleitung gesteuert<br />
(Top down). In der Phase der kooperativen Planungssitzungen<br />
wurde in allen Sitzungen darauf geachtet, dass<br />
Input (die Darstellung ausgewählter Forschungsergebnisse<br />
und Arbeitsblätter), die Arbeit in Kleingruppen und<br />
Output – wo immer sachgerecht und angemessen – Geschlechteraspekte<br />
berücksichtigen. Im Sinne der Idee von<br />
Gender Mainstreaming als Querschnittsaufgabe werden<br />
alle diesbezüglichen Arbeiten und Ergebnisse in die Forschungsberichte<br />
integriert und nicht gesondert dargestellt.<br />
So wird das Ziel erreicht, die Geschlechterperspektive in<br />
die Handlungsempfehlungen auf allen Ebenen und in<br />
allen Bereichen aufzunehmen. Die Kategorie Gender wird<br />
impliziter Bestandteil aller Diskussionen und Darstellungen,<br />
ohne immer wieder als „Sonderthema“ benannt zu<br />
werden.<br />
Controlling<br />
Wichtig ist es, von Beginn an mit zu planen, wie die genderbezogenen<br />
Zielsetzungen überprüft werden können<br />
(Controlling). Die Handlungsempfehlungen sehen in dem<br />
vorliegenden Projekt z.B. vor, dass weiterhin Daten geschlechterdifferenziert<br />
erhoben werden (hierzu zählen z.B.<br />
Erhebungen und Analysen der vorhandenen Sportangebote,<br />
der Nutzung vorhandener Sportgelegenheiten (Hallen,<br />
Räume, Plätze), der finanziellen Ressourcen). Es wird<br />
empfohlen, mittels eines dann möglichen Längsschnittvergleichs<br />
ein Controlling in den Feldern vorzunehmen,<br />
in denen aktuell Frauen oder Männer systematisch unterrepräsentiert<br />
sind.<br />
I 117
Arbeitskreis 9: Frauensport(T)räume – der Gender- und<br />
Diversityansatz in der kommunalen Sportentwicklungsplanung<br />
Bewertung <strong>des</strong> Versuchs, Gender<br />
Mainstreaming in die Sportentwicklungsplanung<br />
zu implementieren<br />
Das Bemühen, Gender Mainstreaming in die Sportentwicklungsplanung<br />
zu integrieren, soll abschließend<br />
unter einer pragmatischen Perspektive diskutiert werden<br />
(ausführlicher in Gieß-Stüber, 2006).<br />
Nimmt man das Gender Mainstreaming Prinzip wirklich<br />
ernst, so bedeutet es eine Innovation von Entscheidungsprozessen<br />
in Organisationen und wird damit zu einer<br />
radikalen (an die Wurzel gehenden) Veränderung (vgl.<br />
Stiegler 2000). Die Grenzen einer konsequenten Umsetzung<br />
von Gender Mainstreaming werden dadurch markiert,<br />
dass min<strong>des</strong>tens die drei folgenden wesentlichen<br />
Voraussetzungen (noch) nicht erfüllt werden können:<br />
1. Genderkompetenz bei allen involvierten<br />
verantwortlichen Personen;<br />
2. Gender Mainstreaming als ausdrückliches Ziel<br />
aller Beteiligten;<br />
3. Die Möglichkeit, Gender Mainstreaming „top<br />
down“ einzuführen.<br />
In der vorliegenden Projektkonstellation musste eine<br />
Sensibilisierung für Genderaspekte <strong>des</strong> Vorhabens teilweise<br />
durch die wissenschaftliche Begleitung erfolgen,<br />
da die Genderkompetenz-Schulungen für die Stadtverwaltung<br />
erst parallel zu diesen Arbeiten begannen. So<br />
fehlte erforderliches Genderwissen breitflächig sowohl in<br />
den unterschiedlichen Projektgruppen als auch in den<br />
kooperativen Planungsgruppen. Dies kann zu unergiebigen<br />
Grundsatzdiskussionen und zu einer ablehnenden<br />
Haltung gegenüber der Thematisierung von Genderaspekten<br />
führen. Die Moderation <strong>des</strong> Planungsverfahrens<br />
erfordert diplomatische Kompetenz.<br />
118 I<br />
Das Konzept der kooperativen Planung eignet sich sehr<br />
gut für das Anliegen, da alle Handlungsempfehlungen<br />
konsensual verabschiedet werden und so eine hohe Legitimität<br />
in der späteren politischen Umsetzung bekommen.<br />
Zudem werden Verantwortliche <strong>des</strong> kommunalen Sports<br />
erreicht, die im Ergebnis alle Fragen der Infrastruktur,<br />
Angebotsebene und Organisation geschlechterdifferenziert<br />
diskutiert und entschieden haben. So wird ein hoher<br />
Grad an Sensibilisierung in einer Stadt erreicht. Die Öffentlichkeit<br />
und Transparenz <strong>des</strong> Projekts (kontinuierliche<br />
Begleitung in der lokalen Presse) führt dazu, dass zukünftig<br />
InteressenvertreterInnen auf die Handlungsempfehlungen<br />
zurückgreifen können. In jedem Falle muss<br />
Gender Mainstreaming zentrale Zielsetzung von Sportentwicklungsplanung<br />
sein und nicht als „Nebenprodukt“<br />
mitlaufen, wenn überhaupt ein politischer Effekt erwartet<br />
wird.<br />
Gender Mainstreaming in der Sportentwicklungsplanung<br />
erfüllt (noch) nicht alle Frauenträume, verspricht aber<br />
für Frauen gute Aussichten auf neue Bewegungsräume<br />
und nähert sich der Utopie einer geschlechtergerechten<br />
sport- und bewegungsfreundlichen Stadt.<br />
Literatur:<br />
I Eckl, Stefan; Gieß-Stüber, Petra & Wetterich; Jörg (2005).<br />
Kommunale Sportentwicklungsplanung und Gender Mainstreaming.<br />
Konzepte, Methoden und Befunde aus Freiburg.<br />
Münster: Lit.<br />
I Gieß-Stüber, P., Eckl S. & Wetterich, J. (2004). Sport und Bewegung<br />
in Freiburg. Band 1: Sportwissenschaftliche und genderpolitische<br />
Grundlagen <strong>des</strong> Projekts „Sportentwicklungsplanung<br />
Freiburg“. Unveröffentlichter Projektbericht an die Stadt Freiburg.<br />
(http://www.sport.uni-freiburg.de/institut/Arbeitsbereiche/<br />
paedagogik/projekte/SEP-Ergebnisband1)<br />
I Gieß-Stüber, P. (2006). Gender Mainstreaming in der Sportentwicklungsplanung<br />
– Erste Erfahrungen und Perspektiven. In<br />
Gieß-Stüber, P. & Sobiech, G. (Hrsg.). Gleichheit und Differenz in<br />
Bewegung – Entwicklungen und Perspektiven für die Geschlechterforschung<br />
in der Sportwissenschaft (S. 113—122). Hamburg:<br />
Czwalina.<br />
I Stiegler, Barbara (2000): Wie Gender in den Mainstream kommt.<br />
Konzepte, Argumente und Praxisbeispiele zur EU-Strategie<br />
<strong>des</strong> Gender Mainstreaming. Friedrich-Ebert-Stiftung (Hrsg.),<br />
Abt. Arbeits- und Sozialforschung. Bonn.
SUSANNE WILDNER (GLEICHSTELLUNGSBEAUFTRAGTE DER STADT HALLE AN DER SAALE):<br />
Frauensport(T)räume in Halle an der Saale<br />
Bevor ich mich dem eigentlichen Thema meines<br />
Beitrages zuwenden werde, möchte ich die Hauptpunkte<br />
benennen:<br />
p Halle – Die Stadt<br />
p Halle – eine Stadt mit sportlicher Tradition und<br />
Gegenwart<br />
p HALLES STARKE FRAUEN<br />
p Kommunale Sportpolitik versus Gender- und<br />
Diversityansätze?!<br />
p Vision<br />
Halle – Die Stadt<br />
Nicht jede und jeder kennt das 1200 Jahre alte Halle an<br />
der Saale und so stelle ich es Ihnen als Einstieg in meine<br />
Ausführungen einfach kurz vor.<br />
Meine Heimatstadt liegt im Herzen Deutschlands und<br />
bildet gemeinsam mit dem nur knapp 40 Kilometer östlich<br />
befindlichen Leipzig eine bedeutende, traditionsreiche<br />
Metropolregion. Die Stadt Halle ist mit rund 230.500 Einwohnerinnen<br />
und Einwohnern und einer Fläche von<br />
135 km² die nach der Bevölkerung größte Stadt <strong>des</strong> Lan<strong>des</strong><br />
Sachsen-Anhalt und die viertgrößte im Osten Deutschlands.<br />
Sie liegt am Ufer der Saale und verfügt auch sonst<br />
über eine günstige Verkehrsanbindung: Flughafen Leipzig-Halle,<br />
Autobahnkreuz A9/A14, IC-Anbindung, Saalehafen<br />
Trotha. Sie ist die Kulturhauptstadt Sachsen-Anhalts<br />
und so gibt es in der Geburtsstadt Händels viel zu hören<br />
(u. a. Händel-Festspiele, Kinderchorfestival), zu feiern<br />
(Laternenfest, Salzfest), zu sehen (Himmelsscheibe, Stiftung<br />
Moritzburg, Stadtgottesacker, Frackesche Stiftungen,<br />
Dom, Marienbibliothek), und man kann sich unterhalten<br />
lassen (Oper, vier Sprechtheater, das älteste Varieté<br />
Deutschlands). Als einen wichtigen Wirtschafts-, Technologie-<br />
und Wissenschaftsstandort kennzeichnen vor<br />
allem Firmen aus dem Dienstleistungssektor, dem verarbeitenden<br />
Gewerbe und dem Technologiebereich die<br />
Unternehmenslandschaft. Die bekanntesten Unternehmen<br />
in der Stadt Halle sind die Halloren Schokoladenfabrik<br />
GmbH, die Kathi Rainer Thiele GmbH und der KSB Konzern.<br />
Weiterhin sind zahlreiche Einrichtungen vertreten,<br />
wie jene der Max-Planck-Gesellschaft oder <strong>des</strong> Fraunhofer<br />
Instituts und nicht zuletzt die Martin-Luther-Universität<br />
Halle-Wittenberg.<br />
Halle ist auch eine Stadt, in der man seine freie Zeit<br />
sehr abwechslungsreich gestalten kann: Sie verfügt über<br />
71 km² Wasser-und Grünfläche und man erholt sich<br />
herrlich im Bergzoo, im Botanischen Garten, auf der Galopprennbahn,<br />
auf der Peißnitzinsel, am Saaleufer oder<br />
in einem der fünf Kinos. Sport getrieben wird in 154 Vereinen<br />
auf 63 Sportplätzen, fünf Tennisanlagen und in<br />
einer Vielzahl weiterer Sporteinrichtungen (u. a. gibt es<br />
in Halle vier Frei- und ebenso vier Hallenbäder.)<br />
Halle – eine Stadt mit sportlicher<br />
Tradition und Gegenwart<br />
Das Jahr 1781 gilt als Geburtsstunde der organisierten<br />
sportlichen Betätigung in unserer Stadt. In diesem Jahr<br />
führte August Hermann Niemeyer an den Franckeschen<br />
Stiftungen sportliche Leibesübungen als Ergänzung zum<br />
Schulunterricht ein. 1848 wurde der erste Turnverein<br />
für die breite Öffentlichkeit gegründet. Es folgten immer<br />
mehr Sportvereine, die sich am Ende <strong>des</strong> 19.Jahrhunderts<br />
auch anderen Sportarten zuwandten: So entstand<br />
I 119
Arbeitskreis 9: Frauensport(T)räume – der Gender- und<br />
Diversityansatz in der kommunalen Sportentwicklungsplanung<br />
im Jahr 1896 der VfL Halle 96, Halles ältester Fußballverein,<br />
der bis heute besteht. Reichlich 100 Jahre später<br />
gibt es eine vielfältige Vereinslandschaft im Sportbereich:<br />
<strong>Der</strong>zeit bieten 185 Vereine 68 Sportarten an und die<br />
herausragende Rolle <strong>des</strong> organisierten Sportes im Leistungssport<br />
– und Freizeitbereich wird dadurch hinreichend<br />
deutlich.<br />
Eine tragende Rolle spielt der Hallesche Stadtsportbund<br />
(SSB) als Dachverband und damit Interessenvertretung<br />
der Sportvereine unserer Stadt, der als erster seiner Art<br />
in den neuen Bun<strong>des</strong>ländern im Jahr 1991 gegründet<br />
wurde. Gegenwärtig gehören ihm ca. 36.000 Mitglieder,<br />
davon rund 14.900 Frauen und Mädchen an. Das sind<br />
etwas über 41 % und damit 5 % mehr als der Lan<strong>des</strong>durchschnitt<br />
von Sachsen-Anhalt.Dieser bemerkenswerte<br />
Anteil der weiblichen Sporttreibenden spiegelt sich allerdings<br />
noch nicht im Bereich der Verantwortung im Präsidium<br />
bzw. Beirat Tragenden wider. Generell hat sich der<br />
SSB das Ziel gesetzt, die Potentiale der Frauen und Mädchen<br />
auch in Vereins- und Verbandsfunktionen stärker<br />
als bisher zu nutzen. <strong>Der</strong>zeit werden nur rund 28 % der<br />
Wahlfunktionen von Frauen wahrgenommen.<br />
Zwei Aspekte sollen nicht unerwähnt bleiben: Neben den<br />
vielen sportbegeisterten Hallenserinnen und Hallensern<br />
stammt eine ganze Reihe deutscher Spitzensportlerinnen<br />
und -sportler aus der Saalestadt, deren Erfolgsbiografien<br />
oft ihren Anfang in den sportorientierten Schulen (Sekundarschule<br />
und Gymnasium) nahmen.<br />
Halles Starke Frauen<br />
Mit klangvollen Namen, wie: Saalehaie, Lizards, Wildcats<br />
oder Lions gehen sie deutschlandweit in den Bun<strong>des</strong>ligen<br />
auf Erfolgsjagd.<br />
Sie sind als faire Sportsfrauen überall willkommen und<br />
als entschlossene Gegnerinnen gefürchtet.<br />
120 I<br />
Was auffällt:<br />
Hallenserinnen kämpfen und siegen im Team, der Erfolg<br />
stellt sich nicht nur, aber überwiegend in Mannschaftssportarten<br />
ein!<br />
Saalehaie: … Schwimmen klingt zunächst nicht nach<br />
Mannschaft und doch holten die jungen Frauen <strong>des</strong> SV<br />
Halle 2006 und 2007 den Titel <strong>des</strong> deutschen Mannschaftsmeisters<br />
im Schwimmen der Frauen an die Saale;<br />
2008 war es „nur“ der dritte Platz und jüngst, in Rom,<br />
errang Daniela Schreiber einen Vize-Weltmeister-Titel.<br />
Lizards: … Das Tier im Logo der Reideburger Radpolo-<br />
Frauen mutet beinahe ebenso exotisch an, wie die Sportart<br />
selbst. Halle-Reideburg ist deutschlandweit eben<br />
nicht nur durch verdiente Männer bekannt sondern auch<br />
durch zwei Damen-Radpolo-Mannschaften, die in der<br />
1. Bun<strong>des</strong>liga von sich reden machen.<br />
Wildcats: … Handball hat in Halle an der Saale eine lange<br />
Tradition; so fand 1925 hier das erste Handball-Länderspiel<br />
statt. Seit 1989 hat sich der SV UNION Halle-Neustadt<br />
ausschließlich dem Mädchen- und Frauenhandball<br />
verschrieben und spielt seither ununterbrochen in der<br />
2. Damenhandball-Bun<strong>des</strong>liga.<br />
Lions: … Viele Mädchen und Frauen in Halle haben es<br />
irgendwann einmal mit Basketball versucht! Das ist nicht<br />
verwunderlich, denn 25 <strong>Deutsche</strong> Meistertitel bei den<br />
Damen seit 1960 bleiben auch im Breitensport nicht<br />
ohne Wirkung. Auch in der Saison 2009/2010 sind die<br />
„Löwinnen“ ganz vorn in der Bun<strong>des</strong>liga zu finden.<br />
Die Schach-Frauen <strong>des</strong> USV sind auch ohne ein Maskottchen<br />
im Namen sehr erfolgreich und sicherten sich<br />
im Jahr 2007 die <strong>Deutsche</strong> Meisterschaft. Zahlreiche<br />
Fans, die der leise Sport durchaus verzeichnet, sind stolz<br />
auf die sechs Topp-Spielerinnen, die bei Wettkämpfen<br />
eine Mannschaft bilden und immer gleichzeitig gegen<br />
zwei gegnerische Teams antreten müssen.<br />
Was aber gelten die Prophetinnen in der eigenen Stadt<br />
und wie wird ihr positives Image für die Weiterentwicklung<br />
<strong>des</strong> Sportes in Halle genutzt?
Städtische Wahrnehmung, Zuschauergunst und Sponsoreninteresse<br />
sind eindeutig und unbeirrt auf die männlichen<br />
Kollegen, so u. a. im Fuß- und Handball, gerichtet.<br />
Diese allerdings versuchen seit Jahren erfolglos der Tristess<br />
der 3. und 4. Liga zu entfliehen … Es ist an der Zeit, die<br />
Ursachen dieser Unterbewertung zu analysieren und positive<br />
Perspektiven aufzuzeigen.<br />
Kommunale Sportpolitik versus Gender –<br />
und Diversityansätze?!<br />
Drei Ebenen, die zusammen wirken:<br />
p Stadt Halle, Stabsstelle Sport und Bäder:<br />
Verwaltung der Sportstätten und Fördermittelvergabe<br />
p Stadtrat, hier Sportausschuss, beratender Ausschuss<br />
(gemäß §48 Abs. 1 GO LSA)<br />
l Angelegenheiten der Vereins- und Sportartentwicklung<br />
sowie der Förderung <strong>des</strong> Sportes<br />
(Vergabe der Sportfördermittel und Investitionszuschüsse)<br />
l Entscheidungen der Stadtplanung und Stadtentwicklung,<br />
die Angelegenheiten der Sportentwicklung<br />
sowie der Standort für Sporteinrichtungen<br />
und Bäder<br />
l Festlegung von Nutzungsmöglichkeiten und<br />
Gebühren für Nutzung von Einrichtungen<br />
p Stadtsportbund Halle e.V.:<br />
Dachverband <strong>des</strong> organisierten Sportes mit ca.<br />
36.000 Mitgliedern<br />
Die formale Genderanalyse zeigt folgende Situation:<br />
p Stadt Halle, Stabsstelle Sport und Bäder:<br />
19 Beschäftigte davon 12 Frauen und 9 Männer; aber<br />
nur 1 von 4 Leitungsfunktionen wird von einer Frau<br />
wahrgenommen. Ein Grundsatzbeschluss zur Anwendung<br />
der Strategie <strong>des</strong> Gender Mainstreaming in der<br />
Stadtverwaltung Halle wurde bereits im Jahr 2006 gefasst.<br />
I 121
Arbeitskreis 9: Frauensport(T)räume – der Gender- und<br />
Diversityansatz in der kommunalen Sportentwicklungsplanung<br />
p Sportausschuss:<br />
11 Mitglieder davon 4 Frauen und 7 Männer; Den<br />
Vorsitz hat ein Mann inne. 9 sachkundige Einwohnerinnen<br />
und Einwohner davon 2 Frauen und 7 Männer.<br />
p Stadtsportbund Halle e.V.:<br />
36.000 Mitglieder davon 14.900 Frauen und Mädchen<br />
und 21.100 Männer und Jungen. Präsidium: 10 Mitglieder<br />
davon 2 Frauen und 8 Männer. <strong>Der</strong> Präsident<br />
ist männlich. Beirat: 10 Mitglieder, 10 Männer. Den<br />
Vereinsvorsitz in den 154 Mitgliedsvereinen haben 25<br />
Frauen inne, das entspricht 16 %. Insgesamt in Wahlfunktionen<br />
aktiv sind leider nur 28 % der Sportlerinnen.<br />
Fazit:<br />
Frauen und Mädchen sind nicht weniger sportbegeistert<br />
als Männer und Jungen und erst recht nicht weniger erfolgreich!<br />
Woran liegt es also, dass sie wesentlich seltener<br />
einflussreiche Positionen als Stabsstellenleiterinnen, Ausschussvorsitzende,<br />
Präsidentinnen, Vereinsvorsitzende …<br />
anstreben bzw. übernehmen? Liegt es am mangelnden<br />
Selbstbewusstsein, ungünstigen Rahmenbedingungen<br />
zur Ausübung solcher Funktionen oder traut die Gesellschaft<br />
eine solche Aufgabe Frauen nicht zu?<br />
Da in Halle an der Saale nicht auf tiefergreifende und belegbare<br />
Analyseergebnisse zurückgegriffen werden kann,<br />
das Problem als solches aber von den 3 agierenden Ebenen<br />
(Kommune, Politik und Interessenvertretung) erkannt<br />
wurde, gibt es auch erste Überlegungen zur nachhaltigen<br />
Einführung der Strategie <strong>des</strong> Gender- und Diversityansatzes<br />
in die Sportentwicklungsplanung unserer Stadt.<br />
122 I<br />
Vision<br />
Dieser sehr komplexe Prozess wird schon jetzt von begleitenden<br />
Aktivitäten der Akteurinnen und Akteure unterstützt:<br />
1. Die Oberbürgermeisterin von Halle, Frau Dagmar<br />
Szabados gehörte im vergangenen Jahr zu den Unterstützerinnen<br />
<strong>des</strong> Aktionsjahres „Frauen gewinnen!“<br />
und hat diese Unterstützung erfolgversprechend weitergeführt.<br />
In Kürze wird es in Halle an der Saale<br />
den Startschuss für einen lokalen „Unterstützerinnen-<br />
Verbund“ im Sportbereich geben!<br />
Diesem Kreis werden aktive Frauen aus verschiedenen<br />
Bereichen <strong>des</strong> öffentlichen Lebens angehören und ihr<br />
gemeinsames Ziel wird es sein, Frauensport(T)räume<br />
in unserer Stadt Wirklichkeit werden zu lassen.<br />
2. Die Stadtverwaltung, insbesondere die Stabsstelle<br />
Sport wird in allen Bereichen ihrer Tätigkeit die Strategien<br />
und Ziele einer modernen, zukunftsorientierten<br />
Kommune verfolgen.<br />
3. <strong>Der</strong> Stadtsportbund Halle e.V. hat sich anspruchsvolle<br />
Aufgaben gestellt:<br />
p Steigerung der Mitgliederzahl von Frauen und<br />
Mädchen<br />
p Vorbereitung aktiver Spielerinnen am Ende der<br />
leistungssportlichen Laufbahn auf Vereins- und<br />
Verbandsfunktionen<br />
p Aktive Einflussnahme auf die frauen- und<br />
familienfreundliche Gesamtgestaltung und im<br />
Umbau befindlicher Sportanlagen<br />
4. <strong>Der</strong> Stadtrat, namentlich der Sportausschuss wird diesen<br />
von Nachhaltigkeit geprägten Prozess der qualitativen<br />
Weiterentwicklung kommunaler Sportplanung<br />
mit hohem Engagement begleiten und unterstützen.
Ergebnisse <strong>des</strong> Arbeitskreises 9<br />
I 123
Arbeitskreis 10: „Sportstätten der Zukunft“ versus<br />
„Bau- und Planungsrecht“<br />
WALTER SCHNEELOCH (VIZEPRÄSIDENT DES DOSB):<br />
„Sportstätten – Impulsgeber der Sportentwicklung“<br />
Sehr geehrte Damen und Herren,<br />
liebe Kolleginnen und Kollegen,<br />
ich begrüße Sie alle ganz herzlich zu diesem Arbeitskreis<br />
und bin darüber froh, dass wir hier gemeinsam Gelegenheit<br />
haben, mit dem Thema Sportstätten eine der zentralen<br />
Herausforderungen und Ressourcen <strong>des</strong> Sports in<br />
Deutschland aufzugreifen. Ich sage das nicht nur als Präsident<br />
<strong>des</strong> Lan<strong>des</strong>sportbun<strong>des</strong> Nordrhein-Westfalen,<br />
sondern auch als Vizepräsident Breitensport/Sportentwicklung<br />
<strong>des</strong> DOSB, der für dieses immer wichtiger werdende<br />
Thema im DOSB-Präsidium Verantwortung trägt.<br />
Da meine Mitreferenten die Engpässe der Praxis sowie die<br />
grundsätzlich-wissenschaftlichen Dimensionen der Sportstättenentwicklung<br />
aufgreifen werden und damit auch<br />
für die notwendige Anbindung <strong>des</strong> Themas an die Realität<br />
sorgen, darf ich ein wenig in die Zukunft blicken und<br />
mich vor allem den „strategischen Fragen der Sportstättenentwicklung“<br />
widmen, die Ihnen ja auch im Programmheft<br />
versprochen wurden. Ich gehe davon aus, dass Sie<br />
124 I<br />
Verständnis dafür haben, dass ich mich diesen Fragen vor<br />
allem aus der Perspektive <strong>des</strong> Vereinssports unter dem<br />
Dach <strong>des</strong> DOSB nähere und Ihnen für die Diskussion zehn<br />
Thesen vorschlagen.<br />
Ich darf zunächst eine Klarstellung vornehmen: <strong>Der</strong> Sportraumbegriff<br />
hat sich stark ausdifferenziert. Man kann<br />
grob drei Bereiche unterscheiden: (1) <strong>Der</strong> „Sportraum Natur<br />
und Landschaft“, (2) die großen Stadien bzw. „Sport<br />
Venues“ <strong>des</strong> Profisports und der Großveranstaltungen<br />
sowie (3) die Sportanlagen <strong>des</strong> Breiten-, Vereins-, Wettkampf-<br />
und Schulsports. Ich möchte mich ausschließlich<br />
auf diesen letzten Bereich konzentrieren – auch wenn<br />
die anderen beiden nicht weniger wichtig sind für den<br />
Sport. <strong>Der</strong> Grund für diese Konzentration ist nicht nur in<br />
der Zeitbegrenzung <strong>des</strong> Arbeitskreises zu suchen, sondern<br />
auch darin, dass die zentralen sportstättenpolitischen<br />
Herausforderungen weniger im Bereich der Eventarenen<br />
oder im Kunstrasenbereich liegen, sondern im Bereich<br />
der Sportstätten für den Vereins- und Breiten- sowie Schulsport.
(1) Zu Beginn möchte ich eine ebenso schlichte wie zentrale<br />
Grundposition hervorheben: Sportstätten sind<br />
(neben dem Ehrenamt) DIE zentrale Ressource der Sportentwicklung<br />
und Voraussetzung für die Gemeinwohlbeiträge<br />
<strong>des</strong> Vereinssports. Es ist notwendig, dass dieser<br />
Zusammenhang wieder bewusster wahrgenommen wird.<br />
Die Zeit, in der die Sportstätten als „vergessenes Thema<br />
<strong>des</strong> Sports“ bezeichnet wurden (so z.B. bei einer Veranstaltung<br />
<strong>des</strong> LSB NRW im Jahr 2001) muss unbedingt<br />
der Vergangenheit angehören. Ohne Sportstätten kein<br />
Sport!<br />
(2) Die Sportstätten in Deutschland sind mit zahlreichen<br />
Herausforderungen konfrontiert: An erster Stelle ist der<br />
gigantische Sanierungsstau zu nennen. Es gibt zudem Veränderungen<br />
in der Sportnachfrage und somit einen veränderten<br />
Sportstättenbedarf. Neben den vielen weiteren<br />
Herausforderungen sei stellvertretend noch die Entwicklung<br />
zur Ganztagsschule erwähnt, die erhebliche Konsequenzen<br />
auf die Verfügbarkeit von Sportstätten für die<br />
Vereine hat. Es besteht somit – ganz allgemein – ein hoher<br />
Innovations-, Modernisierungs-, Sanierungs- und Investitionsbedarf.<br />
Im Gegensatz zur Situation der 1960er und<br />
1970er Jahre (zumin<strong>des</strong>t für den westlichen Teil unseres<br />
Lan<strong>des</strong>) sind die Sportstätten derzeit kein Katalysator <strong>des</strong><br />
Sports, sondern ein Engpassfaktor der Sportentwicklung.<br />
Das Thema „Sportstätten“ bedarf also einer deutlich höheren<br />
fachlichen, politischen, sportverbandlichen etc.<br />
Aufmerksamkeit.<br />
(3) Quantitativ betrachtet, erscheint die Anzahl der<br />
Sportanlagen in Deutschland als grundsätzlich bedarfsgerecht,<br />
was Neubaubedarf nicht ausschließt.<br />
(4) Im Vordergrund steht – das deutete ich bereits an – ein<br />
sehr umfangreicher qualitativer Handlungsbedarf. Den Sanierungsbedarf<br />
beziffert der DOSB auf mind. 42 Mrd. EUR<br />
für Sportstätten insgesamt. Das <strong>Deutsche</strong> Institut für Urbanistik<br />
sieht nur für kommunaleigene Sportstätten einen<br />
Bedarf von 35 Mrd. EUR. Dies bedeutet, dass der Sanie-<br />
rungsbedarf im Infrastrukturbereich im Sport höher ist<br />
als im Bereich von Trinkwassersystemen, Krankenhäusern<br />
und Verwaltungsgebäuden. Wir reden also über kein<br />
nachrangiges Problem! <strong>Der</strong> Zustand der von unseren Vereinen<br />
genutzten Sportstätten verschlechtert sich – dies<br />
zeigen uns auch die regelmäßigen Vereinsbefragungen <strong>des</strong><br />
Sportentwicklungsberichts. Qualitative Defizite in der<br />
vereinsgenutzten kommunalen Infrastruktur sind im Übrigen<br />
auch ein Nachteil für Vereine im Wettbewerb mit<br />
anderen Sportanbietern vor Ort.<br />
(5) Veränderungen und Anpassungen <strong>des</strong> Sportstättenspektrums<br />
werden sich somit ganz überwiegend im<br />
Bestand vollziehen. Hierbei bleiben regelkonforme Sportanlagen<br />
bedeutsam, insbesondere für den Vereins- und<br />
Schulsport. Sie werden jedoch zunehmend durch regeloffene<br />
Anlagen ergänzt, insbes. multifunktionale und<br />
kleinräumige Anlagen und Hallen bzw. Räume für den<br />
gesundheits- und fitnessorientierten Sport, den Sport<br />
der Älteren etc. Das Sportstättenspektrum wird sich stark<br />
ausdifferenzieren.<br />
(6) Die uns vorliegenden Zahlen belegen, dass die Anzahl<br />
von Sportanlagen, die sich in Eigentum oder Trägerschaft<br />
von Vereinen befinden, zunehmen. Sportvereine und<br />
-verbände werden mehr Verantwortung für „ihre“ Sportstätten<br />
übernehmen und tun dies bereits vielfach. Dies<br />
muss auch förderpolitische Konsequenzen haben: Öffentliche<br />
Förderlinien müssen vereinseigene Sportstätten<br />
stärker in den Blick nehmen und berücksichtigen. Ein<br />
aktuelles Gegenbeispiel ist das Konjunkturpaket II –<br />
Sportvereine waren hier zwar nicht formal, aber förderpraktisch<br />
außen vor.<br />
(7) Apropos Sportstättenförderung: Ich bedanke mich bei<br />
allen Vertretern in den Kommunen und auch bei den<br />
Ländern für die unterschiedlichen Förderinitiativen im Bereich<br />
Sportstätten- und Bädersanierung und -Neubau<br />
der letzten Jahre. Ich appelliere an Sie, diese Anstrengun-<br />
I 125
Arbeitskreis 10: „Sportstätten der Zukunft“ versus<br />
„Bau- und Planungsrecht“<br />
gen auch zukünftig fortzuführen. Zurzeit sind die Auswirkungen<br />
der negativen Entwicklung der kommunalen<br />
Haushalte noch durch das Konjunkturpaket II und weitere<br />
Faktoren stark abgemildert. Aber spätestens im nächsten<br />
Jahr werden die Verteilungskämpfe härter. Ich fordere die<br />
auf kommunaler Ebene für Sport Verantwortlichen auf,<br />
noch stärker die Abstimmung und den Schulterschluss<br />
mit den Vertretern <strong>des</strong> organisierten Sports zu suchen und<br />
umgekehrt. Sparen Sie nicht am, sondern mit dem Sport<br />
oder noch besser: Sparen Sie gar nicht im Sport, sondern<br />
investieren Sie in Sportstätten – es ist eine gute Investition.<br />
Gemeinsame politische Plattformen und Solidarpakte<br />
für den Sport, getragen von den Sportorganisationen<br />
und der kommunalen Sportpolitik und –Verwaltung sind<br />
notwendiger denn je!<br />
Wir stehen darüber hinaus auch vor der Aufgabe, städtebauliche<br />
Förderprogramme noch stärker für den Sport<br />
zu erschließen. Wir hätten uns das Konjunkturpaket II<br />
noch sportfreundlicher gewünscht, aber es war ein richtiger<br />
Ansatz. Wir nehmen mit Freude zur Kenntnis, dass<br />
das Ramsauer-Ministerium ein Pilotprojekt „Stadtentwicklung<br />
und Sportstätten“ aufgelegt hat. <strong>Der</strong> DOSB wird in<br />
Kürze eine Förderbroschüre „Sportstätten und EU-Förderung“<br />
auflegen. Diese Ansätze müssen wir vertiefen und<br />
ausweiten. Es gibt vielfältige sportbezogene Potenziale in<br />
den übrigen Programmen der Stadtentwicklung und der<br />
Städtebauförderung – ich nenne die „Soziale Stadt“ als<br />
ein Beispiel. Und insgesamt gilt, dass Stadtentwicklung<br />
und Sport noch stärker aufeinander zugehen müssen.<br />
(8) Angesichts der vielfältigen Herausforderungen sollte es<br />
unser gemeinsames Interesse sein, die weitere Sportstättenentwicklung<br />
wissensbasiert zu begleiten. Wir brauchen<br />
mehr Analysen, Studien und wissenschaftliche Begleitung.<br />
Ich freue mich daher über Studien aus den letzten<br />
Jahren, sei es von Prof. Kähler oder von Dr. Wetterich<br />
und Kollegen. Auch der DOSB hat in den vergangenen<br />
Jahren hierzu einige Fachveranstaltungen durchgeführt<br />
126 I<br />
und Initiativen ergriffen. Ich habe jedoch kein Verständnis,<br />
dass die Länder die Sportstättenstatistik eingestellt<br />
haben, ohne ein anderes Analyseinstrument an ihre Stelle<br />
zu setzen.<br />
(9) Zu den Stichworten „Klimaschutz“ und „Qualität“:<br />
Die Sportstättenentwicklung in Deutschland muss ökologischer<br />
werden. Dieser Aspekt ist auch mir persönlich<br />
besonders wichtig! Energetische Sanierung, Ressourcenschonung<br />
und mehr Energieeffizienz schonen nicht nur<br />
den Geldbeutel, sondern gehen auch mit mehr Qualität<br />
einher. Darüber hinaus sind klimaschonendere Sportanlagen<br />
auch ein Beitrag <strong>des</strong> Sports zu den Klimaschutzstrategien<br />
Deutschlands und beinhalten Mobilisierungspotenziale<br />
für ein umwelt- und klimafreundliches Verhalten<br />
unserer 27 Millionen Mitglieder. Schließlich sollte<br />
nicht unerwähnt bleiben, dass über die Handlungsfelder<br />
Umwelt- und Klimaschutz weitere Fördermöglichkeiten<br />
für die Sportstättensanierung erschlossen werden.<br />
(10) Angesichts der vielfältigen Herausforderungen und<br />
einer stärkeren Rolle der Vereine im Sportstättenbereich<br />
bei gleichzeitigem Rückbau von entsprechenden Ressourcen<br />
im öffentlichen Bereich, wird der Unterstützungsund<br />
Beratungsbedarf der Sportvereine (und nicht nur von<br />
ihnen) ansteigen. Hier sind vor allem die Sportbünde und<br />
-verbände gefordert. Im Übrigen ist darauf hinzuweisen,<br />
dass Innovationen im Sportstättenbereich immer stärker<br />
von den Vereinen ausgehen. Es muss darum gehen, diese<br />
Stärken zu stärken. Es gibt bereits vielfältige Aktivitäten<br />
der Sportverbände, z.B. der Lan<strong>des</strong>sportbünde in Hessen,<br />
Nordrhein-Westfalen und Württemberg. Diese Ansätze<br />
gilt es zu verstetigen und auszubauen.<br />
Ich möchte aufgrund der Zeitvorgabe an dieser Stelle zum<br />
Ende meiner Ausführungen kommen, auch wenn man<br />
noch weitere zentrale Themen ansprechen könnte, z.B.<br />
die Gefahren und Chancen der Ganztagsschule für die<br />
Nutzungsprofile von Sportstätten, die Vielfalt der Betreibermodelle,<br />
die besonders schwierige Situation der Bäder,
neue und kooperative Ansätze der Sportstättenentwicklungsplanung<br />
etc.<br />
Zeitgemäße Sportstätten sind in hohem Maße Innovations-<br />
und Impulsgeber für die Vereinsentwicklung. Sie<br />
unterstützen die Angebots- und Mitgliederentwicklung<br />
sowie die Zielgruppenarbeit im Verein und sie sind Treffund<br />
Mittelpunkte <strong>des</strong> Vereinslebens. So verstanden,<br />
können Sportstätten wieder stärker zu Katalysatoren der<br />
Sport- und Vereinsentwicklung werden.<br />
Problemstellung<br />
Bei der Frage, welche Sportanlagen heute und in Zukunft<br />
der Sportnachfrage der Menschen entsprechen, ist zu beachten,<br />
dass Sport – und insbesondere die zur Verfügung<br />
gestellten Sportanlagen – lange ein „Musterbeispiel für<br />
Eindeutigkeit und Überschaubarkeit“ (Breuer & Rittner,<br />
2002, S. 21) darstellte. Die existierenden, überwiegend<br />
wettkampforientierten Anlagen waren funktional auf die<br />
Bedürfnisse <strong>des</strong> Schul- und Vereinssports und die Nutzung<br />
durch spezifische Sportarten zugeschnitten und bedienten<br />
insbesondere die Altersgruppen der Kinder, Jugendlichen<br />
und jungen Erwachsenen.<br />
Aufgrund <strong>des</strong> dynamischen und umfassenden Strukturwandels<br />
und <strong>des</strong> inneren Differenzierungsprozesses <strong>des</strong><br />
Sportsystems sowie angesichts gravierender Veränderun-<br />
Die Verantwortlichen <strong>des</strong> deutschen Pavillons auf der Expo<br />
Weltausstellung, die in 55 Tagen im chinesischen Shanghai<br />
eröffnet wird, haben dies erkannt und mit Unterstützung<br />
<strong>des</strong> DOSB umgesetzt: Eine zeitgemäße und vereinseigene<br />
Sportstätte in einer süddeutschen Kleinstadt gehört zu<br />
den zentralen deutschen Exponaten und steht stellvertretend<br />
für eine moderne Stadt- und Sportentwicklung in<br />
Deutschland! <strong>Der</strong> ausdrückliche Sportstättenbezug im<br />
deutschen Pavillon greift unmittelbar das Motto der Expo<br />
„Better City – Better Life“ und das Leitmotiv dieses <strong>Kongresses</strong><br />
„Starker Sport – starke Städte“ auf.<br />
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.<br />
DR. STEFAN ECKL (INSTITUT FÜR KOOPERATIVE PLANUNG UND SPORTENTWICKLUNG):<br />
„Sportstätten der Zukunft“ versus<br />
„Bau- und Planungsrecht“<br />
gen weiterer gesellschaftlicher Rahmenbedingungen, insbesondere<br />
im Hinblick auf die demographische Entwicklung,<br />
hat seit einigen Jahren die Fragestellung an Relevanz<br />
gewonnen, ob die vorhandenen Sportanlagen noch zukunftsfähig<br />
sind und wie sie sich an eine veränderte Sportnachfrage<br />
der Bevölkerung und an die veränderten Rahmenbedingungen<br />
anpassen können und müssen.<br />
Mit dieser Diskussion um die Weiterentwicklung und<br />
Qualität nachhaltiger, zukunftsorientierter Sportanlagen<br />
wird ein komplexes Aufgabenfeld beschrieben, <strong>des</strong>sen<br />
Bearbeitung heute in der Sportwissenschaft noch in den<br />
Anfängen steht.<br />
Mit dem Forschungsprojekt <strong>des</strong> Bun<strong>des</strong>instituts für Sportwissenschaft<br />
„Grundlagen zur Weiterentwicklung von<br />
Sportanlagen“ soll dieses Manko behoben werden. Die<br />
Ergebnisse <strong>des</strong> Forschungsprojekts sollen als Basis dienen,<br />
I 127
Arbeitskreis 10: „Sportstätten der Zukunft“ versus<br />
„Bau- und Planungsrecht“<br />
in späteren Forschungs- und Arbeitsschritten Vorschläge<br />
für die konkrete Planung und Gestaltung nachfragegerechter<br />
und nachhaltiger Sportanlagen zu entwickeln.<br />
Das vorliegende Forschungsprojekt bezieht sich dabei<br />
ausschließlich auf Sportanlagen als „speziell für den Sport<br />
geschaffene Anlagen“ (BISp, 2000, S. 15). Darunter werden<br />
sowohl nicht regelkonforme und offen zugängliche<br />
Sportanlagen (z.B. Bolzplatz, Freizeitspielfeld, Trendsportanlage),<br />
die für das informelle und selbstorganisierte<br />
Sporttreiben explizit bereitstehen, als auch regelkonforme<br />
Sportanlagen, die sich an den standardisierten Vorgaben<br />
der Sportarten und <strong>des</strong> Wettkampfsports orientieren,<br />
subsumiert. Sportgelegenheiten („vom Sport nutzbare,<br />
aber für andere Zwecke geschaffene Anlagen“ 1 ) bleiben<br />
dabei unberücksichtigt.<br />
Untersuchungs<strong>des</strong>ign<br />
Die Untersuchung umfasst drei Teilbereiche: Aufbauend<br />
auf vorhandenen Untersuchungen werden auf der Basis<br />
einer Synopse von 22 repräsentativen Bevölkerungsbefragungen<br />
aus den Jahren 1999 bis 2008 und damit eines<br />
Datensatzes, der Angaben von 25.797 Personen im Altersbereich<br />
von 14 bis 75 Jahren enthält, Daten zum Sportverhalten,<br />
zu bevorzugten Sport- und Bewegungsräumen<br />
und zu Wünschen und Bedarfen der Bevölkerung in Bezug<br />
auf Sportanlagen generiert. 2<br />
Auf einer zweiten Untersuchungsebene werden die aus<br />
der Rezeption der sportwissenschaftlichen Diskussion<br />
und dem ersten Analyseschritt gewonnenen Erkenntnisse<br />
und Thesen in die Zukunft projiziert. Die Prognostizierung<br />
zukünftiger Entwicklungslinien im Sportanlagenbau<br />
erfolgt durch eine Expertenbefragung in Form einer<br />
zweiwelligen Delphi-Studie. Dabei stehen die Fragen im<br />
Vordergrund, wie sich die zu erwartenden Veränderungen<br />
in Gesellschaft und Sport auf Sportanlagen allgemein<br />
128 I<br />
und auf die Herausbildung innovativer Anlagenkonzeptionen<br />
im Besonderen auswirken werden.<br />
Die dritte Phase beinhaltet auf der Basis eines erarbeiteten<br />
Klassifizierungsschemas eine konkrete Analyse modellhafter<br />
Sportanlagen, wobei zunächst ein Untersuchungsinstrumentarium<br />
entwickelt und anschließend exemplarisch<br />
bei elf strukturell unterschiedlichen Objekten angewandt<br />
wird.<br />
Zusammenfassung der Ergebnisse<br />
Insgesamt weisen die Ergebnisse darauf hin, dass bei<br />
einer Betrachtung der quantitativen Entwicklung einerseits<br />
nicht von einem weiteren Wachstum der Anzahl<br />
der Sportanlagen auszugehen ist. Auf der anderen Seite<br />
wird es wenig wahrscheinlich sein, dass bisher vom Sport<br />
genutzte Flächen in großem Maßstab aufgegeben werden.<br />
Insgesamt wird ein Umstrukturierungsprozess der<br />
Sportanlagenstruktur zu beobachten sein. Dabei ist nach<br />
Ansicht der Experten beispielsweise eine Reduzierung<br />
von regelkonformen Sportaußenanlagen (Sportplätze mit<br />
Naturrasen- oder Tennenbelag, Leichtathletik-Kampfbahnen)<br />
zugunsten von ganzjährig nutzbaren Belägen und<br />
multifunktionalen Außensportanlagen für den Freizeitsport<br />
zu erwarten, während die Nachfrage nach kleineren<br />
Hallen und Räumen unterschiedlicher Couleur wahrscheinlich<br />
zunehmen wird.<br />
In Bezug auf das Merkmal Witterungsschutz wird die<br />
Nachfrage nach gedeckten Sportanlagen, insbesondere<br />
kleineren Räumen, weiter ansteigen. Dabei werden mit<br />
geringerer Intensität auch kostengünstige Überdachungen<br />
und alternative Formen <strong>des</strong> Witterungsschutzes<br />
(z.B. „Kalthalle“) virulent.<br />
Regelkonformität wird zwar nach wie vor ein unverzicht-<br />
bares Kriterium im Sportanlagenbau sein wird (insbesondere<br />
aus Sicht <strong>des</strong> Schul- und Vereinssports), jedoch<br />
1) BISp, 2000, S. 15. Zu den definitorischen Festlegungen vgl. Wetterich, Eckl & Schabert, 2009, S. 25–29.<br />
2) Datengrundlage und Ergebnisse sind ausführlich beschrieben bei Wetterich, Eckl & Schabert, 2009, S. 74–117.
nicht mehr die dominierende Rolle spielen wird, wie dies<br />
heute der Fall ist. Dabei werden auf der einen Seite die<br />
regelkonformen Sportanlagen vermehrt durch regeloffene<br />
Anlagentypen ergänzt werden. Auf der anderen Seite<br />
genießen Umbauten bzw. Ergänzungen von bestehenden<br />
Sportanlagen um Einrichtungen für den nicht im Verein<br />
organisierten Freizeitsport hohe Priorität. Diese funktionale<br />
Erweiterung traditioneller, regelkonformer Sportanlagen<br />
in Richtung Freizeitsport wird sich in der Hauptsache im<br />
Bestand vollziehen.<br />
In Bezug auf die Zugänglichkeit der Sportanlagen ist<br />
zusammenfassend ein besonders konfliktreiches Themenfeld<br />
für die Weiterentwicklung von Sportanlagen auszumachen.<br />
Dabei ist tendenziell von einer Verringerung<br />
der Zugangsbeschränkungen auszugehen – allerdings nur<br />
für ausgesuchte Sportfreianlagen und Sporthallen.<br />
Bei Betrachtung der Ausstattung und <strong>des</strong> Komforts zu-<br />
künftiger Sportanlagen kann festgehalten werden, dass<br />
es keine einheitliche Entwicklung geben wird, sondern<br />
dass eine Ausdifferenzierung der Ausstattung der Sportanlagen<br />
gemäß den Ansprüchen unterschiedlicher Zielgruppen<br />
zu beobachten sein wird. Dabei weisen die<br />
Ergebnisse darauf hin, dass einerseits die Nachfrage nach<br />
Sportanlagen mit hohem Komfortniveau (z.B. Räume mit<br />
qualitätvoller Ausstattung und hoher Aufenthaltsqualität<br />
für das wachsende Segment <strong>des</strong> Gesundheitssports insbesondere<br />
für die älteren Sportaktiven) mit hoher Wahrscheinlichkeit<br />
zunehmen wird. Auf der anderen Seite wird<br />
auch für Sport- und Bewegungsräume mit einfacher Ausstattung<br />
ein großer Bedeutungszuwachs vorhergesagt.<br />
In Bezug auf Größe und Gliederung der Sportanlagen<br />
kann insgesamt sowohl bei Sportfreiflächen als auch bei<br />
Turn- und Sporthallen in Ansätzen eine Entwicklung zu<br />
einer kleinräumigen Struktur und Gliederung konstatiert<br />
werden. Bei den untersuchten Modellprojekten werden<br />
unterschiedliche Nutzungsbereiche bzw. Aktivitäts- und<br />
Ruhezonen in vielfältiger Weise miteinander kombiniert.<br />
Teilweise sind die Räume flexibel verkleiner- bzw. erweiterbar.<br />
Gerade diese modulare Erweiter- bzw. Rückbaubarkeit<br />
insbesondere bei Sporthallen und -räumen wird<br />
sehr positiv bewertet und in Zukunft wahrscheinlich zunehmen,<br />
wenngleich die Intensität dieses Prozesses eher<br />
gering eingeschätzt wird.<br />
Die Berücksichtigung von ökologischen Aspekten bei der<br />
Planung, dem Bau und dem Betrieb von Sportanlagen<br />
wird sich nach den Ergebnissen der Delphi-Studie weiter<br />
verstärken.<br />
In Bezug auf Finanzierung, Betrieb und Kosten ist von<br />
einer durch veränderte wirtschaftliche Rahmenbedingungen<br />
hervorgerufenen Tendenz zu neuen Finanzierungsund<br />
Betriebsformen (z.B. verstärkte Übertragung <strong>des</strong><br />
Betriebs von Sportanlagen an die Vereine) sowie zu einfachen<br />
und veränderbaren Bauformen auszugehen.<br />
Anhand der analysierten Untersuchungsobjekte zeigt<br />
sich jedoch, dass sich die tatsächlichen Kosten einer<br />
Sportanlage nur schwer nachprüfen lassen. Hier sind<br />
unter dem Aspekt einer ökonomischen Nachhaltigkeit<br />
weitere Analysen auf der Basis von Lebenszyklusbetrachtungen<br />
notwendig.<br />
I 129
Arbeitskreis 10: „Sportstätten der Zukunft“ versus<br />
„Bau- und Planungsrecht“<br />
Bei Betrachtung der Aspekte Erreichbarkeit und Standort<br />
besitzen in Zukunft vor allem wohnungsnahe Sport- und<br />
Bewegungsräume hohe Priorität. Schnelle Erreichbarkeit<br />
und eine dezentrale, wohnungsnahe Versorgung mit<br />
Sport- und Bewegungsräumen sind zentrale Bedürfnisse<br />
seitens der Bevölkerung.<br />
Als zentrales Ergebnis in Bezug auf die Planung von<br />
zukünftigen Sportanlagen kann konstatiert werden, dass<br />
die Individualisierung im Sportanlagenbau in Zukunft<br />
verstärkt mit der Anwendung partizipativer Planungsverfahren<br />
korrespondieren wird.<br />
Zusammenfassend weisen alle Ergebnisse der Studie darauf<br />
hin, dass im zukünftigen Sportanlagenbau eine<br />
zunehmende Anlagenvielfalt und eine Diversifikation von<br />
Sportanlagentypen zu beobachten sein wird. Dabei wird<br />
die Orientierung an den Bedürfnissen vor Ort dazu führen,<br />
dass lokal ganz unterschiedliche individuelle Ausprägungs-<br />
und Gestaltungsformen von Sportanlagen zu<br />
beobachten sein werden.<br />
Ausblick<br />
Mit dem vorliegenden Forschungsprojekt liegen wichtige<br />
Ergebnisse und Grundlagen für eine Weiterentwicklung<br />
von Sportanlagen vor. Die Ergebnisse machen deutlich,<br />
dass sich die Sportanlagenstruktur in einem grundlegenden<br />
Wandlungsprozess befindet, dass aber viele Entwicklungen<br />
und Innovationen in den nächsten Jahren zuerst<br />
einmal mit geringer Intensität und Dynamik auftreten<br />
werden. Insbesondere wird eine Abkehr von den verbreiteten<br />
regelkonformen Sportanlagen für den Schul- und<br />
Vereinssport, die nach wie vor eine große Bedeutung für<br />
viele Sportlergruppen besitzen, nicht sofort in größerem<br />
Maße stattfinden. Insgesamt wird sich die zukünftige<br />
Weiterentwicklung von Sportanlagen daher weitgehend<br />
im Bestand vollziehen, wobei Sanierungen weit über die<br />
baulich-technische Sanierung hinausgehen müssen. Es<br />
130 I<br />
wird darauf ankommen, bei einer Sanierung nicht den<br />
Zustand der Anlage wieder herzustellen, sondern den Bestanderhalt<br />
mit nachfrageorientierten Modernisierungen<br />
und Innovationen zu verbinden. Insofern wird es eine der<br />
ersten Aufgaben im Sportanlagenbau darstellen, das<br />
Potenzial der bestehenden, oft auf den Wettkampf- und<br />
Schulsport zugeschnittenen Sportanlagen für andere<br />
sportliche Nutzungen zu eruieren und über Ergänzungen<br />
und Funktionsanpassungen die Flexibilität, Variabilität<br />
und damit die multifunktionale Nutzung dieser Anlagen<br />
zu erhöhen.<br />
Gleichzeitig ist zu erwarten, dass die bestehenden<br />
Sportanlagen im Zuge eines sich verstärkenden Wandlungsprozesses<br />
zunehmend durch neue und alternative<br />
Anlagentypen und Gestaltungskonzeptionen ergänzt<br />
bzw. ersetzt werden. Auf diese Veränderungsprozesse<br />
muss sich die Sportstättenplanung und -beratung einstellen.<br />
Dabei müssen bauliche Lösungen, die auf die<br />
spezifischen Eigenschaften eines Anlagentyps ausgerichtet<br />
sind, im Sinne eines experimentellen Sportstättenbaus<br />
erarbeitet und in weiteren Modellprojekten auf ihre bauliche<br />
Umsetzung und Praktikabilität überprüft werden,<br />
um bei künftigen Planungen Vorschläge für notwendige<br />
Innovationen machen zu können.<br />
Literaturverzeichnis:<br />
I Breuer, C. & Rittner, V. (2002). Berichterstattung und<br />
Wissensmanagement im Sportsystem. Konzeption einer<br />
Sportverhaltensberichterstattung für das Land<br />
Nordrhein-Westfalen. Köln: Sport und Buch Strauß.<br />
I Bun<strong>des</strong>institut für Sportwissenschaft (BISp) (Hrsg.). (2000).<br />
Leitfaden für die Sportstättenentwicklungsplanung.<br />
Schorndorf: Hofmann.<br />
I Wetterich, J., Eckl, S. & Schabert, W. (2009). Grundlagen zur<br />
Weiterentwicklung von Sportanlagen. Köln: Sportverlag Strauß.
KLAUS-MICHAEL DENGLER (STADTDIREKTOR IM REFERAT FÜR STADTPLANUNG<br />
UND BAUORDNUNG, MÜNCHEN):<br />
Sportstätten der Zukunft versus Bau- und Planungsrecht<br />
I 131
Arbeitskreis 10: „Sportstätten der Zukunft“ versus<br />
„Bau- und Planungsrecht“<br />
KLAUS-MICHAEL DENGLER (STADTDIREKTOR IM REFERAT FÜR STADTPLANUNG<br />
UND BAUORDNUNG, MÜNCHEN):<br />
132 I
I 133
Arbeitskreis 10: „Sportstätten der Zukunft“ versus<br />
„Bau- und Planungsrecht“<br />
KLAUS-MICHAEL DENGLER (STADTDIREKTOR IM REFERAT FÜR STADTPLANUNG<br />
UND BAUORDNUNG, MÜNCHEN):<br />
134 I
Ergebnisse <strong>des</strong> Arbeitskreises 10<br />
I 135
Arbeitskreis 11: Streit um Lärm – Lärmschutz:<br />
Engpassfaktor der Sportentwicklung?<br />
ANNEMARIE ERLENWEIN (STELLV. LEITERIN DER SPORTABTEILUNG DES<br />
INNENMINISTERIUMS NORDRHEIN-WESTFALEN):<br />
„Streit um Lärm – Lärmschutz:<br />
Engpassfaktor der Sportentwicklung“<br />
Sehr geehrte Damen und Herren,<br />
meine Aufgabe ist es, das Thema „Sportstättenlärm“ –<br />
oder wie ich lieber sage „Sportstättengeräusche“ – so<br />
vor Ihnen zu entfalten, dass Sie einschätzen können, ob<br />
es sich hier tatsächlich um einen Engpassfaktor für die<br />
Sportentwicklung einer Stadt handeln kann, oder um ein<br />
objektives Problem, das nach bestimmten Regeln gelöst<br />
werden kann, oder vielleicht auch nur um ein in Teilen<br />
selbst produziertes.<br />
Als Ausgangspunkt will ich einen Zielkonflikt benennen<br />
und dann eine typische Situation beschreiben. <strong>Der</strong> Ziel-<br />
136 I<br />
konflikt besteht darin, dass die Sporttreibenden ein berechtigtes<br />
Interesse daran haben, möglichst gut erreichbare<br />
Sportstätten in den Innenbereichen von Kommunen wie<br />
in der Nähe von Wohngebieten oder in ihnen zu haben,<br />
also den viel beschworenen Sportplatz um die Ecke. Auf<br />
der anderen Seite haben Nachbarn von Sportstätten und<br />
jedweder anderer Anlagen, von denen Lärm ausgeht, ein<br />
Recht auf Ruheschutz. Dieses Recht besteht im Hinblick<br />
auf Industrieanlagen, auf Gaststätten, sonstige gewerbliche<br />
Einrichtungen, aber eben auch bezogen auf Sportstätten.<br />
In solchen Zielkonflikten sind Regelungen zur<br />
Problembewältigung erforderlich. Sie sind staatlicherseits<br />
getroffen. Dazu gleich mehr.
Sportgeräusche<br />
Zunächst ein paar Worte zur Eigenart von Sportgeräuschen:<br />
In erster Linie handelt es sich um menschliche Geräusche<br />
– bei der körperlichen Anstrengung, bei Zurufen<br />
<strong>des</strong> Trainers bzw. Schiedsrichters bei Freuden- bzw. Unmutsbezeugungen<br />
und Applaus von Zuschauern. Die so<br />
genannten technischen Geräusche sind z.B. die von<br />
Startklappen, Schiedsrichterpfeifen, das Plop von Tennisbällen,<br />
das Auftreffgeräusch <strong>des</strong> Fußballs im Tor u. ä.<br />
Die typische Konfliktsituation entsteht, wenn es bei<br />
einem manchmal schon seit Jahren bestehenden Nebeneinander<br />
von Sportplatz und Wohnbebauung zu mehr<br />
oder anderen Nutzungen der Sportstätte kommt oder<br />
wenn es einen Zuzug neuer Nachbarn gibt, deren Toleranzschwelle<br />
niedriger ist als <strong>des</strong> Vorgängers. Dann beschweren<br />
sich Nachbarn – meistens bei der Kommune –<br />
und bemühen ggf. auch die Gerichte, um Abhilfe zu<br />
schaffen.<br />
Eine höchstrichterliche Entscheidung, nämlich eine <strong>des</strong><br />
Bun<strong>des</strong>verwaltungsgerichtes Ende der 80ger Jahre <strong>des</strong><br />
vergangenen Jahrtausends – es handelt sich dabei um<br />
die so genannte Tegelsbarg-Entscheidung, war es auch,<br />
die damals den Höhepunkt zahlreicher gerichtlicher Auseinandersetzungen<br />
markierte. Gegenstand waren die<br />
Geräusche, die vom Fußballspiel und sonstigen Nutzungen<br />
einer Hamburger Sportanlage inmitten eines Wohngebietes<br />
ausgingen. Das Bun<strong>des</strong>verwaltungsgericht hatte<br />
die Entscheidung zum Anlass genommen, dem Staat<br />
einiges ins Stammbuch zu schreiben darüber, dass und<br />
wie er diesen Konflikt regeln könne.<br />
Damals gab es zur Bewertung von Sportgeräuschen nur<br />
die so genannte „Technische Anleitung Lärm“ (TA Lärm),<br />
die bezüglich Methodik und Messverfahren auf technisch<br />
verursachten Lärm abstellte, nicht aber auf die Geräusche<br />
von Anlagen nutzenden Menschen. Dies führte einmal<br />
zu einer Überbewertung menschlich verursachter<br />
Geräusche gegenüber den technischen Geräuschen z.B.<br />
eines Gewerbebetriebs und zu auf Industrieproduktion<br />
abgestellten Ruhezeitenregelungen und damit zur Nichtberücksichtigung<br />
spezifischer sportlicher Notwendigkeiten<br />
wie Spielen am Wochenende. Zum anderen gab es<br />
keine begünstigende Regelung für Altanlagen. Deshalb<br />
haben sich die Sportverbände und die Sportministerien<br />
der Länder intensiv beim Bund dafür eingesetzt, dass es<br />
eine „Spezialvorschrift“ für die Sportgeräusche geben<br />
sollte. Sie sollte im Hinblick auf Methodik und Messverfahren<br />
sicherstellen, dass die Eigenheiten menschlichen<br />
Lärms sachgerecht gemessen und bewertet würden und<br />
die Besonderheiten <strong>des</strong> Sportbetriebs – gerade in arbeitsfreien<br />
Zeiten – ebenso berücksichtigen, wie einen eingeschränkten<br />
Ruheschutz von Nachbarn dort, wo es ein<br />
gewachsenes Miteinander von Sportstätten und Wohnbebauung<br />
gab. Daraus ist die so genannte „Sportanlagenlärmschutzverordnung<br />
(18. BImSchV)“ entstanden, die<br />
18. Durchführungsverordnung zum Bun<strong>des</strong>-Immissionsschutzgesetz<br />
(BImSchG).<br />
Kompetenzverteilung zwischen Bund<br />
und Ländern<br />
An dieser Stelle ein paar Worte zur Kompetenzverteilung<br />
zwischen Bund und Ländern bei Bekämpfung von Lärm,<br />
die bei den Debatten um die Föderalismusreform mehrfach<br />
diskutiert wurden und folgen<strong>des</strong> Ergebnis hatte: die<br />
so genannte Lärmbekämpfung, sofern sie Sportanlagen<br />
berührt, ist Sache <strong>des</strong> Bun<strong>des</strong> im Rahmen der konkurrierenden<br />
Gesetzgebung. Das heißt, Lärm, der im betrieblichen<br />
und funktionalen Zusammenhang von Sportanlagen<br />
entsteht, ist primär zu regeln durch den Bund. Regelungen<br />
zum verhaltensbezogenen Lärm, zum Beispiel bei Freizeitveranstaltungen,<br />
bei Konzerten, bei „Public Viewing-Veranstaltungen“,<br />
etwa bei der Fußball- Weltmeisterschaft,<br />
liegen grundsätzlich in der Kompetenz der Länder – wenngleich<br />
der Bund zu letzteren eine Regelung getroffen hat,<br />
allerdings mit Verweis auf Ländervorschriften, die unberührt<br />
blieben.<br />
I 137
Arbeitskreis 11: Streit um Lärm – Lärmschutz:<br />
Engpassfaktor der Sportentwicklung?<br />
Hier soll nun die Rede sein von den Regelungen zu anlagenbezogenen<br />
Geräuschen: Von seiner Gesetzgebungskompetenz<br />
in Bezug auf anlagenbezogenen Lärm hat<br />
der Bund in Form <strong>des</strong> Bun<strong>des</strong>-Immissionsschutzgesetzes<br />
Gebrauch gemacht. Die Sportanlagenlärmschutzverordnung<br />
als 18. Ausführungsverordnung zum Bun<strong>des</strong>-Immissionsschutzgesetz<br />
ist nach Zustimmung <strong>des</strong> Bun<strong>des</strong>rats<br />
(erfolgt nach über 50 Änderungsanträgen) am 26. Oktober<br />
1991 in Kraft getreten. Sie enthält verbindliche<br />
Maßstäbe zur Beurteilung der von Sportanlagen ausgehenden<br />
Geräusche und legt fest, was in welchen Wohngebieten<br />
als zumutbar zu akzeptieren ist. Nach fast 20<br />
Jahren Geltungsdauer kommen Kommentatoren zum Ergebnis,<br />
dass die einen Beitrag zum Rechtsfrieden geleistet<br />
hätte in einem Spannungsfeld, in dem es vorher eine<br />
Vielzahl von rechtlichen Auseinandersetzungen gab. Allerdings<br />
konnte eine Rechtsverordnung im Immissionsschutzbereich<br />
allein diesen Rechtsfrieden nicht herstellen,<br />
denn eine Ausführungsverordnung zum Bun<strong>des</strong>-Immissionsschutzgesetz<br />
(BImSchG), also eine öffentlich-rechtliche<br />
Vorschrift, kann Zivilgerichte nicht automatisch<br />
binden. Demzufolge hat es im Jahr 1994 auch eine Ergänzung<br />
der einschlägigen Nachbarschutzparagraphen<br />
<strong>des</strong> Bürgerlichen Gesetzbuches gegeben.<br />
Die Ergänzung <strong>des</strong> § 906 Abs. 1 BGB hat dazu geführt,<br />
dass wesentliche Regelungen der Sportanlagenlärmschutzverordnung<br />
auch im Zivilrecht gelten. Das ist von<br />
essentieller Bedeutung, denn ein Nachbar kann sich nach<br />
§ 1004 BGB auch privatrechtlich gegen Geräusche zur<br />
Wehr setzen, die er als unzumutbar empfindet. Unwesentliche<br />
Beeinträchtigungen muss ein Nachbar dulden.<br />
Die Zivilgerichte sind seit 1994 bei der Beurteilung der<br />
Frage, ob die Geräuschimmissionen einer Sportanlage<br />
unwesentlich oder wesentlich sind (das ist der Fachbegriff<br />
aus dem BGB), an die Immissionsrichtwerte der<br />
18. BImSchV gebunden.<br />
138 I<br />
Sportanlagenlärmschutzverordnung<br />
Auch im Verfahren zur Genehmigung von Bauvorhaben<br />
spielt die Sportanlagenlärmschutzverordnung (18. BImSchV)<br />
eine Rolle. Sportstätten sind in der Regel Anlagen im<br />
Sinne <strong>des</strong> Bun<strong>des</strong>-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG).<br />
Deshalb bedürfen sie einer Baugenehmigung. Baugenehmigungen<br />
sind zu erteilen entsprechend den länderspezifischen<br />
Regelungen, wenn dem Vorhaben öffentlich-rechtliche<br />
Vorschriften nicht entgegenstehen. Daraus<br />
folgt, dass im Baugenehmigungsverfahren auch die Vorschriften<br />
der Sportanlagenlärmschutzverordnung (18.<br />
BImSchV) zu beachten sind. Eine Baugenehmigung kann<br />
demnach für eine Sportanlage nicht erteilt werden,<br />
wenn durch ihren Betrieb die Immissionsrichtwerte der<br />
Sportanlagenlärmschutzverordnung (18. BImSchV) voraussichtlich<br />
überschritten würden. Das kann dann der<br />
Fall sein, wenn nicht ausreichende Abstände geplant sind.<br />
Ob und wie Sportanlagen legal betrieben werden oder<br />
nicht, hängt allerdings auch davon ab, wie die Nutzungsfestlegungen<br />
in den Bebauungsplänen aussehen. Bei<br />
Bauleitplanungen, also auch bei der Aufstellung bei Bebauungsplänen,<br />
die das Miteinander der unterschiedlichen<br />
Bebauung regeln müssen, hat die Sportanlagenlärmschutzverordnung<br />
(18. BImSchV) ebenfalls eine Bedeutung,<br />
jedoch nur eine mittelbare. Denn eine Gemeinde<br />
darf keinen Bebauungsplan aufstellen, <strong>des</strong>sen Realisierung<br />
an immissionsschutzrechtlichen Anforderungen der<br />
Sportanlagenlärmschutzverordnung (18. BImSchV) scheitern<br />
würde.<br />
Auf der anderen Seite können Festlegungen von Bebauungsplänen<br />
eine Änderung von Nutzungen verhindern:<br />
z.B. wenn zur Nutzung <strong>des</strong> Schulhofes einer Schule im<br />
Bebauungsplan nur ein Zeitraum am Vormittag aufgeführt<br />
ist und es auch eine Beschränkung gibt auf die Schüler<br />
dieser Schule. Ein solcher Schulhof kann nicht für die<br />
Kinder und Jugendlichen <strong>des</strong> gesamten Wohngebiets geöffnet<br />
werden, wenn daraus ein Lärmpegel entsteht,
der den nach dem Bebauungsplan zulässigen Lärmpegel<br />
(verursacht durch die genau benannten Nutzer in genau<br />
benannten Zeitraum) überschreiten würde.<br />
Die häufiger erfolgte gerichtliche Untersagung solcher<br />
erweiterter Nutzungen hat also überhaupt nichts mit der<br />
Sportanlagenlärmschutzverordnung (18. BImSchV) zu<br />
tun, sondern ausschließlich mit Festlegungen im Bebauungsplan.<br />
Dies zu sagen, ist mir sehr wichtig, weil Ursache<br />
und Wirkung gerade in diesem Bereich häufig falsch<br />
eingeschätzt werden.<br />
Auch wenn bei der Bauleitplanung (Flächennutzungsplan,<br />
Bebauungsplan) der Regelungsgehalt der Sportanlagenlärmschutzverordnung<br />
zu beachten ist, bedeutet<br />
das nicht, dass es überall jedwede Art von Sportanlagen<br />
wird geben können. Wenn z.B. eine Sportanlage zu<br />
nahe an eine Wohnbebauung herangeplant wird, kann<br />
es zu Konflikten kommen, im umgekehrten Falle auch.<br />
Das heißt, einen klassischen Problemfall bei neuer Sportanlage<br />
oder neuer Wohnbebauung gibt es immer dann,<br />
wenn die für den notwendigen Sportbetrieb erforderlichen<br />
Abstände planerisch nicht vorgegeben werden. Die<br />
vor Ort vorhandenen Sportorganisationen müssen also<br />
sehr genau aufpassen, dass von der Kommune nicht von<br />
vornherein Planungsfehler begangen werden, die den<br />
Sportbetrieb unmöglich machen oder erschweren. In<br />
Deutschland sind die Eigentumsrechte und daraus folgende<br />
Rechtspositionen sehr stark geschützt. Deshalb gibt<br />
es bei uns die Besonderheit, dass es in bestimmten Wohngebieten,<br />
in denen es bereits relativ angenehm zu wohnen<br />
ist, auch leise bleiben soll, wohingegen in Mischgebieten,<br />
die ohnehin eine bestimmte Lärmbelastung aushalten<br />
müssen, auch lauter sein darf. Das hat dazu geführt,<br />
dass es rechtliche Festlegungen gibt, wonach es in reinen<br />
Wohngebieten, also z.B. in Einfamilienhausgebieten,<br />
leiser sein muss als in Gebieten, in denen sich z.B. auch<br />
kleine Geschäfte bzw. sonstige Dienstleistungseinrichtungen<br />
befinden, eine unterschiedliche Wohnbebauung<br />
und vielleicht auch noch etwas lautere Straßen. Bei der<br />
rechtlichen Bewertung hilft es überhaupt nicht, dass<br />
es sich bei den Sportaktivitäten um gesellschaftlich gewünschte<br />
oder um gesundheitspolitisch notwendige<br />
handeln kann.<br />
Vielmehr sind bei dem Betrieb jedweder Sportanlage die<br />
an der Gebietstypik der Bauordnungsvorschriften festgemachten<br />
Schutzbedürfnisse der Nachbarn zu berücksichtigen,<br />
darüber hinaus in zeitlicher Hinsicht auch das<br />
unterschiedliche Ruhebedürfnis während der Tages- bzw.<br />
Nachtzeit oder in bestimmten Ruhezeiten an Abenden<br />
bzw. an Sonn- und Feiertagen.<br />
Die Regelungen zum Ruheschutz vor Sportgeräuschen in<br />
der Sportanlagenlärmschutzverordnung (18. BImSchV)<br />
unterscheiden sich von denen in der TA-Lärm vor Industrie-<br />
und Gewerbelärm, weshalb von bestimmten Seiten<br />
behauptet wird, der Sport habe mal wieder für sich Privilegien<br />
herausgeholt, die andere benachteiligten. Deshalb<br />
nenne ich an dieser Stelle einige wesentliche Regelungen,<br />
die zwar nicht Privilegien sind, aber die besonderen<br />
Eigenheiten der Sportausübung bzw. <strong>des</strong> Sportbetriebs<br />
berücksichtigen:<br />
Die Richtwerte in der Sportanlagenlärmschutzverordnung<br />
(18. BImSchV) sind keine Grenzwerte, d. h., bei Überschreitung<br />
liegt nicht automatisch eine erhebliche Geräuschbelästigung<br />
vor. Auch werden die Geräusche über<br />
12 Stunden tagsüber oder bezogen auf 2-stündige<br />
Ruhezeiten abends bzw. sonntags mittags gemittelt, das<br />
heißt, wenn in 4 von insgesamt 12 Stunden tagsüber<br />
Betrieb herrscht auf einer Anlage, dann werden die Geräusche<br />
aus 4 Stunden auf 12 verteilt – sie werden im<br />
Mittel also niedriger.<br />
Eine entsprechende Mittelung gibt es auch für die 2stündigen<br />
Ruhezeiten abends und sonntags. Geräusche<br />
<strong>des</strong> Schulsports werden überhaupt nicht bewertet. Für<br />
den sonntäglichen Wettkampfbetrieb gibt es eine Son-<br />
I 139
Arbeitskreis 11: Streit um Lärm – Lärmschutz:<br />
Engpassfaktor der Sportentwicklung?<br />
derregelung: Wenn weniger als 4 Stunden Betrieb stattfindet<br />
und davon mehr als 30 Minuten in der Zeit von<br />
13:00 bis 15:00 Uhr, dann sind die Geräusche über 4 Stunden<br />
zu mitteln, die Ruhezeit ist also nicht einzuhalten.<br />
Für Sportanlagen ist insbesondere entscheidend, ob durch<br />
Rücksichtnahme auf die Bedürfnisse von Nachbarn<br />
der Betrieb eingeschränkt werden muss oder der Betrieb<br />
untersagt werden kann. Letzteres ist aufgrund der 18.<br />
BImSchV nicht möglich. Hiernach kann es allenfalls zu<br />
Betriebsbeschänkungen kommen, so schmerzhaft sie<br />
auch immer sein können.<br />
Allerdings differenziert die Sportanlagenlärmschutzverordnung<br />
(18. BImSchV) durchaus danach, ob es sich um<br />
neu geplante Anlagen handelt oder um so genannte<br />
Altanlagen. Die Altanlagen sind in einer gewissen Form<br />
bestandsgeschützt, denn die zuständige Behörde kann<br />
bei Sportanlagen, die vor dem Inkrafttreten der Sportanlagenlärmschutzverordnung<br />
(18. BImSchV), also am<br />
26. Oktober 1991, baurechtlich genehmigt oder legal errichtet<br />
wurden, von der Festsetzung von Betriebszeitenbeschränkungen<br />
absehen, wenn die im jeweiligen Fall<br />
geltenden Immissionsrichtwerte um weniger als 5 db(A)<br />
überschritten werden.<br />
Miteinander von Wohnbebauung<br />
und Sportanlage<br />
Ein gewachsenes Miteinander von Wohnbebauung und<br />
Sportanlage soll also Ruheschutz mindernd wirken.<br />
Dazu gibt es inzwischen bestätigende höchstrichterliche<br />
Rechtsprechung.<br />
<strong>Der</strong> von vielen als Privilegierung bezeichnete Altanlagenschutz<br />
stellt keine generelle Erhöhung der Richtwerte<br />
dar, sondern hindert nur Betriebszeitenbeschränkungen.<br />
Alle anderen Pflichten der Betreiber bleiben davon unberührt.<br />
Das ist z.B. die Verpflichtung, durch organisatori-<br />
140 I<br />
sche, bauliche oder technische Maßnahmen die Richtwerte<br />
einzuhalten. Wesentliche Änderungen an so<br />
genannten Altanlagen, insbesondere solche, die einer<br />
Baugenehmigung bedürfen, können allerdings zum<br />
Wegfall dieses Altanlagenschutzes führen.<br />
Wesentlich können Änderungen sein, mit denen beispielsweise<br />
der Betrieb massiv ausgeweitet werden soll,<br />
oder wenn zusätzliche Anlagenteile entstehen usw.<br />
Die Änderung eines Belags etwa von Naturrasen in Kunstrasen<br />
auf einem Sportplatz ist nach nordrhein-westfälischem<br />
Baurecht nicht genehmigungsbedürftig, d. h., in<br />
solchen Fällen bleibt der Altanlagenschutz erhalten.<br />
Weiter ist für den Betrieb einer Sportanlage sehr wichtig,<br />
dass ausnahmsweise auch besonders laute Ereignisse<br />
möglich sein müssen z.B. bei Wettkampfbetrieb ab einem<br />
bestimmten Niveau. Das sind z.B. Spitzenfußballspiele,<br />
Bun<strong>des</strong>ligaspiele oder sonstige – bezogen auf die jeweilige<br />
Sportart – herausragende Veranstaltungen. Sie sind<br />
an 18 Kalendertagen eines Jahres zulässig, wenn die normalen<br />
Immissionsrichtwerte um nicht mehr als 10 db(A)<br />
überschritten werden, wobei für bestimmte Spitzengeräusche<br />
ebenfalls bestimmte Höchstwerte gelten.<br />
Sowohl die Regelung zum Altanlagenschutz als auch die<br />
Zulassung von seltenen Ereignissen an bis zu 18 Kalendertagen<br />
stellen im Hinblick auf andere Lärmregelungen,<br />
insbesondere auf die eingangs erwähnte „Technische<br />
Anleitung Lärm“, durchaus eine deutliche Besserstellung<br />
von Sportanlagen gegenüber beispielsweise Industrieanlagen<br />
dar. Sie sind aber der Tatsache geschuldet, dass<br />
Menschen Sport in der Regel nur in ihrer Freizeit ausüben<br />
können, also vorwiegend am Wochenende und in der<br />
Woche am späten Nachmittag bzw. Abend. Deshalb musste<br />
es hier andere Regelungen geben als zum Industrielärm,<br />
der in der Regel tagsüber während der Woche anfällt.
Dennoch wurden insbesondere aus dem Bereich <strong>des</strong> Zivilrechts<br />
Meinungen vertreten, dass die unangemessen<br />
günstigen Regelungen für Sportanlagengeräusche zurückgeführt<br />
werden müssten. Sie wurden wieder lauter<br />
nach der neuerlichen Änderung der Sportanlagenlärmschutzverordnung<br />
(18. BImSchV) im Zusammenhang mit<br />
der Fußball-Weltmeisterschaft 2006. Dafür wurde nämlich<br />
durch eine Ergänzung der Sportanlagenlärmschutzverordnung<br />
(18. BImSchV) eine weitere Besserstellung<br />
zugelassen:<br />
Für internationale oder nationale Sportveranstaltungen<br />
von herausragender Bedeutung können im öffentlichen<br />
Interesse Ausnahmen von den Bestimmungen zu den seltenen<br />
Ereignissen getroffen werden, einschließlich einer<br />
Überschreitung der 18 Tage, an denen seltene Ereignisse<br />
ohnehin nach der Sportanlagenlärmschutzverordnung<br />
(18. BImSchV) zugelassen sind.<br />
Diese Ausnahmemöglichkeit wird auch auf Verkehrsgeräusche<br />
auf öffentlichen Verkehrsflächen außerhalb der<br />
Sportanlage bezogen. Ausgangspunkt für die Ergänzung<br />
war ein Urteil, das in Berlin im Hinblick auf die Nutzung<br />
<strong>des</strong> Olympiastadions ergangen war. Nach der Sportanlagenlärmschutzverordnung<br />
(18. BImSchV) sind in einem<br />
bestimmten Umfang Verkehrsgeräusche auf Straßen und<br />
Plätzen außerhalb der Sportanlage dieser zuzurechnen,<br />
wenn das Verkehrsaufkommen im Zusammenhang mit<br />
Sportveranstaltungen und der Nutzung der Sportanlage<br />
steht. Mit der Ergänzung wurde sichergestellt, dass zigtausende<br />
Menschen, die bei sportlichen Großveranstaltungen<br />
unsere Stadien füllen, diese auch auf öffentlichen<br />
Wegen und Straßen erreichen können, ohne dass ein<br />
Schweigegebot auferlegt werden muss.<br />
Kritik von Zivilgerichten richtet sich auch auf Verfahrensvorschriften<br />
in der Anlage zur Sportanlagenlärmschutzverordnung<br />
(18. BImSchV), die sich mit Messung und<br />
Bewertung der Sportanlagengeräusche befassen, insbesondere<br />
auf Abschlagsmöglichkeiten, d. h. Möglichkeiten<br />
zur rechnerischen Reduktion <strong>des</strong> gemessenen Lärms.<br />
In einem Urteil <strong>des</strong> NRW-Oberlan<strong>des</strong>gerichts wurde z.B.<br />
eine Abschlagsmöglichkeit als nicht im Zivilverfahren zugelassen<br />
betrachtet. Dabei ging es um einen Abschlag<br />
von 3 db(A) vom ermittelten Beurteilungspegel für eine<br />
Altanlage.<br />
I 141
Arbeitskreis 11: Streit um Lärm – Lärmschutz:<br />
Engpassfaktor der Sportentwicklung?<br />
Auch seltene Sportereignisse wurden in der Entscheidung<br />
statt auf 18 Tage (wie nach der Sportanlagenlärmschutzverordnung<br />
(18. BImSchV) vorgeschrieben) auf 15 Tage<br />
begrenzt. Dafür gab es die Begründung <strong>des</strong> Gerichts,<br />
man wolle ja keine Beschränkung von Betriebszeiten vornehmen,<br />
obwohl das faktisch geschehen ist, und es gebe<br />
zivilrechtlich eine andere beweispflichtige Konstellation!<br />
Tatsächliche und selbsternannte Rechtsexperten argumentieren<br />
auch damit, dass Arbeitsplätze ebenso wichtig<br />
wie die Sportausübung seien und der Eigentumsschutz<br />
<strong>des</strong> Grundgesetzes nicht eingeschränkt werden dürfe,<br />
weshalb die Privilegien <strong>des</strong> Sports abgeschafft werden<br />
müssten.<br />
Diese „Gefechtslage“ muss man bedenken, wenn man<br />
öffentlich eine Änderung der Sportanlagenlärmschutzverordnung<br />
(18. BImSchV) im Sinne einer Verbesserung<br />
für den Sport fordert. Ich halte es für empfehlenswerter,<br />
die bestehenden Regelungen ggf. mit Hilfe eines Akustikspezialisten<br />
intelligent auszuschöpfen, d. h., ggf. Betriebszeiten<br />
unter Berücksichtigung von Ruhezeiten und<br />
sportlichen Notwendigkeiten unter Anwendung aller<br />
sportspezifischen Besonderheiten bei Messung und Bewertung<br />
der Geräusche vernünftig zu verteilen.<br />
142 I<br />
Und bei gerichtlichen Auseinandersetzungen rate ich dringend<br />
dazu, die Anwendbarkeit der Sportanlagenlärmschutzverordnung<br />
(18. BImSchV) offensiv zu begründen<br />
und z.B. Positionen von Gerichten – wie eben beschrieben<br />
– nicht hinzunehmen.<br />
Möglicherweise sollten die Sportorganisationen durch<br />
entsprechende Fortbildungsangebote die Vereine intensiv<br />
aufklären und so fit machen, dass sie in Nachbarschaftskonflikten<br />
sachkundig argumentieren können.<br />
Dann ist es vielleicht auch leichter möglich, mit Nachbarn<br />
eine gütliche Einigung herbeizuführen, denn man kann<br />
nicht bestreiten, dass es auch berechtigte Gründe zu Beschwerden<br />
von Nachbarn geben kann, wenn neben den<br />
typischen Sportgeräuschen, die schon als zu laut empfunden<br />
werden, z.B. Abfall in Vorgärten landet, Bürgersteige<br />
und Gärten zugeparkt werden, wenn an Gartenzäunen<br />
uriniert wird, wenn nach 22:00 Uhr aufgrund<br />
von Lärm von Sportgaststätten tatsächlich die Nachtruhe<br />
gestört wird.<br />
Hier lassen sich oft schon durch organisatorische und<br />
verkehrsleitende Maßnahmen Entlastungen für die Nachbarn<br />
schaffen, was dann auch rechtzeitig getan werden<br />
sollte. Diese sind dann oft bereit, die unvermeidbaren<br />
Sportgeräusche hinzunehmen.<br />
Es nutzt nichts, im Konflikt mit Nachbarn wegen deren<br />
Ruhebedürfnisse anzuführen, dass man ja gesellschaftspolitisch<br />
wichtige Aktivitäten durchführe. Dieses hat vor<br />
Gericht keinerlei Wirkung. Die Richter beurteilen schlicht<br />
und ergreifend die Zumutbarkeit der Geräusche und der<br />
anderen Aktivitäten anhand der rechtlichen Regelungen<br />
und bewerten nicht gesellschaftlich wichtige oder unwichtige<br />
Aktivitäten.
Die Sportgeräusche und der Lärmschutz müssen nicht<br />
ein Engpassfaktor der Sportentwicklung sein. Bei neuen<br />
Sportanlagen sind aber – schlicht gesagt – ausreichende<br />
Abstände zur Wohnbebauung einzuplanen, um uneingeschränkten<br />
Betrieb zu ermöglichen. Dabei muss unterschieden<br />
werden zwischen Sportanlagen, die in einem<br />
Wohngebiet zur Versorgung der Bewohner notwendig<br />
und zulässig sind – das ist sicherlich nicht ein großes<br />
Fußballstadion – und solchen, die an zentralen Orten in<br />
ausreichendem Abstand von Wohnbebauung errichtet<br />
werden können.<br />
Einen umfassenden Schutz wie für Lärm von Kinderspielplätzen,<br />
der nach höchstrichterlicher Entscheidung als<br />
sozial unausweichlicher Lärm überall akzeptiert werden<br />
muss, gibt es für andere Anlagen nicht, auch nicht für<br />
solche zum Bolzen. Kinderspielplätze müssen wegen <strong>des</strong><br />
Alters der Kinder in der Nähe der Wohnungen sein, Bolzplätze<br />
nicht unbedingt. Sie werden daher entsprechend<br />
ihrer Nutzung als Sportanlagen nach der Sportanlagenlärmschutzverordnung<br />
(18. BImSchV) bewertet, wenn sie<br />
für die Sportausübung bestimmt und dauerhaft entsprechend<br />
ausgestattet sind, also wenn dort beispielsweise<br />
ständig Tore stehen. Handelt es sich nur um eine Grasfläche,<br />
auf der gelegentlich gebolzt wird, dürfte eine<br />
Bewertung eher nach den verhaltensbezogenen Lärmschutzregelungen<br />
der Länder erfolgen.<br />
Diese bestehen in der Regel aus Immissionsschutzgesetzen<br />
der Länder und vor allem in der so genannten Freizeitlärmrichtlinie.<br />
<strong>Der</strong>en Regelungen sind durchaus nicht<br />
günstiger als die Regelungen für die Sportanlagen. Zum<br />
Beispiel bei den seltenen Ereignissen sind sie einschränkender<br />
als die der Sportanlagenlärmschutzverordnung<br />
(18. BImSchV) (nur 15 Tage statt 18), und es gibt hier<br />
auch keinen Altanlagenschutz, ebenso keine günstigen<br />
Regelungen bei der Messung und Bewertung insbesondere<br />
der menschlichen Geräusche wie beim Sport.<br />
Mir ist aus Nordrhein-Westfalen – immerhin dem bevölkerungsreichsten<br />
Bun<strong>des</strong>land – kein Fall bekannt, wo der<br />
Betrieb einer bestehenden Sportanlage völlig aufgegeben<br />
werden musste. Einschränkungen <strong>des</strong> Betriebs gibt es<br />
hin und wieder, wenn trotz Anwendung <strong>des</strong> Altanlagenschutzes<br />
die Geräuschbelastung tatsächlich unzumutbar<br />
ist. Das hat oft seine Ursache darin, dass Kommunen in<br />
der Vergangenheit Planungsfehler begangen haben, in<br />
dem sie Sportanlagen und Wohnbebauung zu dicht beieinander<br />
zugelassen hatten.<br />
Die Betreiber von Sportanlagen müssen dann die Betriebszeiten<br />
so arrangieren, dass auch das Ruhebedürfnis<br />
der Nachbarn noch geschützt bleibt. Mit gutem Willen<br />
auf beiden Seiten lassen sich nach meiner Erfahrung vielfach<br />
akzeptable Lösungen für beide Seiten erreichen.<br />
Probleme bei bestehenden Sportanlagen waren in Nordrhein-Westfalen<br />
– das kann ich jedenfalls überschauen –<br />
dann unlösbar, wenn Bebauungspläne Nutzungsregelungen<br />
getroffen hatten, die nicht geändert werden konnten,<br />
weil Nachbarn dagegen waren. Bei neu vorgesehenen<br />
Sportanlagen gab es Probleme dann, wenn die Kommunen<br />
nicht hinreichend Abstand zur Wohnbebauung eingeplant<br />
hatten.<br />
Ich vertrete daher insgesamt die Auffassung, dass der<br />
Lärmschutz kein Engpassfaktor ist, wenn vernünftig,<br />
d. h. unter Berücksichtigung der rechtlichen Vorgaben<br />
geplant wird und wenn eine Sportanlage unter Beachtung<br />
dieser Vorschriften betrieben wird, was überwiegend<br />
möglich ist.<br />
<strong>Der</strong> Lärmschutz ist m. E. „nur“ ein Problem. Dieses muss<br />
aber bei Planung, Bau und Betrieb von Sportanlagen berücksichtigt<br />
werden, und es kann mit den Regelungen<br />
der Sportanlagenlärmschutzverordnung (18. BImSchV) im<br />
Wesentlichen gelöst werden. Nicht mehr, aber auch nicht<br />
weniger.<br />
I 143
Arbeitskreis 11: Streit um Lärm – Lärmschutz:<br />
Engpassfaktor der Sportentwicklung?<br />
PETER HAHN (REFERATSLEITER SPORTENTWICKLUNG UND ABTEILUNGSLEITER SPORTSTÄTTEN<br />
UND UMWELT, LANDESSPORTBUND BERLIN):<br />
144 I
Erfahrungen und Umgang <strong>des</strong> LSB Berlin mit dem Thema<br />
I 145
Arbeitskreis 11: Streit um Lärm – Lärmschutz:<br />
Engpassfaktor der Sportentwicklung?<br />
PETER HAHN (REFERATSLEITER SPORTENTWICKLUNG UND ABTEILUNGSLEITER SPORTSTÄTTEN<br />
UND UMWELT, LANDESSPORTBUND BERLIN):<br />
146 I
I 147
Arbeitskreis 11: Streit um Lärm – Lärmschutz:<br />
Engpassfaktor der Sportentwicklung?<br />
PETER HAHN (REFERATSLEITER SPORTENTWICKLUNG UND ABTEILUNGSLEITER SPORTSTÄTTEN<br />
UND UMWELT, LANDESSPORTBUND BERLIN):<br />
148 I
I 149
Arbeitskreis 11: Streit um Lärm – Lärmschutz:<br />
Engpassfaktor der Sportentwicklung?<br />
BERND SCHIRWITZ (STADT MÜNSTER, SPORTAMT):<br />
150 I
Streit um Lärm – Lärmschutz: Engpassfaktor der<br />
Sportentwicklung?<br />
I 151
Arbeitskreis 11: Streit um Lärm – Lärmschutz:<br />
Engpassfaktor der Sportentwicklung?<br />
BERND SCHIRWITZ (STADT MÜNSTER, SPORTAMT):<br />
152 I
I 153
Arbeitskreis 11: Streit um Lärm – Lärmschutz:<br />
Engpassfaktor der Sportentwicklung?<br />
BERND SCHIRWITZ (STADT MÜNSTER, SPORTAMT):<br />
154 I
Ergebnisse <strong>des</strong> Arbeitskreises 11<br />
I 155
Arbeitskreis 12: Sportförderung und -finanzierung:<br />
Routine versus Königswege?<br />
REINHOLD SPANIEL (BEIGEORDNETER FÜR SPORT UND SOZIALES DER STADT DUISBURG UND<br />
VORSITZENDER DES SPORTAUSSCHUSSES DES DEUTSCHEN STÄDTETAGES):<br />
Sportförderung und -finanzierung:<br />
Routine versus Königswege?<br />
1. Begrüßung/Einleitung<br />
Meine sehr geehrten Damen und Herren,<br />
ich freue mich sehr, dass zum AK 12, zum Thema Sportförderung<br />
und Sportfinanzierung sich so viele Teilnehmer<br />
und Teilnehmerinnen angemeldet haben. Ich habe mir<br />
die Teilnehmerliste angeschaut und festgestellt, dass dieser<br />
Arbeitskreis sehr heterogen zusammengesetzt ist –<br />
aus Teilnehmern und Teilnehmerinnen der Politik, der<br />
Sportverwaltung, der Wissenschaft, aber überwiegend<br />
aus Teilnehmern/Innen <strong>des</strong> organisierten Sports.<br />
Ich begrüße sehr, dass so viele Mitglieder <strong>des</strong> organisierten<br />
Sports sich hier eingefunden haben, weil dies die<br />
Gelegenheit gibt, insbesondere der Sportpolitik und den<br />
Sportverbänden einmal die Zwänge und Probleme der<br />
Sportverwaltung aufzuzeigen.<br />
Trotz vieler Kontakte und Gesprächsrunden mit dem Sport<br />
habe ich auch in letzter Zeit die Erfahrung gemacht,<br />
dass der Ernst der Haushaltslage vieler Kommunen nicht<br />
erkannt wird und nicht verinnerlicht ist. Bei allem Verständnis<br />
für den organisierten und nicht organisierten<br />
Sport will ich einmal einen provokanten Einstieg in die<br />
Problematik wählen: Ich sage, Thema ist nicht die Aussage<br />
„bitte nicht bei mir sparen“, sondern das Thema<br />
lautet:<br />
„Willst Du jetzt auf Kosten deiner Enkel und<br />
Urenkel ein Schwimmbad bauen?“<br />
156 I<br />
Ich sage vorab, wenn Sie in diesen Arbeitskreis gekommen<br />
sind, um den Königsweg der Sportförderung/Finanzierung<br />
zu erfahren, muss ich Ihnen gleich einiges zumuten.<br />
2. Finanzen/Haushaltslage<br />
Lassen Sie mich zum Einstieg in die Problematik einen<br />
Exkurs in die Finanzlage der Kommunen machen. Die öffentlichen<br />
Haushalte werden von der tiefsten und nachhaltigsten<br />
Wirtschaftskrise seit Bestehen der Republik<br />
durchgeschüttelt. Verstärkt durch diese Finanz- und Wirtschaftskrise<br />
stecken besonders in Nordrhein-Westfalen<br />
viele Kommunen in einer „Schuldenfalle“, aus der sie<br />
sich aus eigener Kraft nicht mehr befreien können.<br />
Meine sehr geehrten Damen und Herren, vor 2 Jahren –<br />
also mit dem Haushaltsjahr 2008 – hatte die Stadt Duisburg<br />
ihr Rechnungswesen auf das sogenannte „Neue<br />
Kommunale Finanzmanagement“ (NKF) umgestellt. Damit<br />
war dann auch erstmalig die Verpflichtung zur Aufstellung<br />
einer Bilanz verbunden. Hinter dem Stichwort Bilanz<br />
verbirgt sich vereinfacht gesprochen eine Gegenüberstellung<br />
von Vermögen auf der einen und Schulden auf der<br />
anderen Seite. Die Differenz ist dann das sogenannte Eigenkapital<br />
– negativ oder positiv.<br />
Dazu hat der Gesetzgeber mit der Einführung <strong>des</strong> NKF<br />
eine neue Passage in die Gemeindeordnung aufgenommen,<br />
die ganz lapidar lautet: Die Gemeinde darf sich<br />
nicht überschulden, sie ist überschuldet, wenn nach der<br />
Bilanz das Eigenkapital aufgebraucht ist.
Nun, meine Damen und Herren, das klingt zunächst banal<br />
und hört sich auch nicht sonderlich spannend an. Doch<br />
beim genaueren Hinsehen stellt man fest, dass weitaus<br />
mehr dahinter steckt, als ein bisschen Mathematik. Letztendlich<br />
geht es um all das, was eine Stadt noch an Substanz<br />
ausmacht, all das, was eine Stadt lebenswert macht.<br />
Eines muss man auch im Rest der Republik zur Kenntnis<br />
nehmen: Die grundsätzliche Rechtswidrigkeit <strong>des</strong> kommunalen<br />
Haushaltsgebarens – gerade in vielen Städten<br />
<strong>des</strong> Ruhrgebietes – und das was ich sage gilt jetzt auch<br />
für Duisburg – ergibt sich ja nicht wirklich erst neuerem<br />
Datums. Seit inzwischen zwei Jahrzehnten sind unsere<br />
Haushalte strukturell unterfinanziert. Sie müssen sich<br />
vorstellen, dass wir in Duisburg den laufenden Betriebsaufwand<br />
wie z.B. Personalkosten oder Sozialleistungen<br />
nur über Kredite finanzieren. Das gilt übrigens auch für<br />
den Solidaritätsbeitrag/Ost!<br />
Jetzt stellt sich hier die Gretchen-Frage, ob wir all das<br />
auch unseren Kindern und Urenkeln noch hinterlassen<br />
können. Die Entscheidung, ob unsere Nachkommen später<br />
einmal in einer zukunftsfähigen Stadt aufwachsen<br />
werden, oder in einem urbanen Sozialverband, wird nicht<br />
in 100 Jahren entschieden, sondern hier und heute!<br />
Um es einmal plastisch darzustellen, was das in der Praxis<br />
bedeutet, will ich einmal anhand der Duisburger Situation<br />
folgen<strong>des</strong> ausführen: Bei der Stadtentwicklung, hier Sportinfrastruktur,<br />
wird Duisburg, sobald unsere Eigenmittel<br />
aufgebraucht sind, zu 100 % von der Kommunalaufsicht<br />
an die Leine gelegt. Die pauschale Kreditgenehmigung<br />
die wir früher hatten, ist weggefallen. Jeder Kredit, sei er<br />
auch noch so gering, muss durch die Aufsicht genehmigt<br />
werden. Dabei entscheidet über Genehmigung oder Nicht-<br />
Genehmigung in der Regel nicht die Frage, ob die investive<br />
Maßnahme sinnvoll ist oder nicht, sondern ob es eine<br />
Pflichtaufgabe ist oder nicht.<br />
Sie müssen wissen, dass die Teilnahme an Förderprogrammen,<br />
die einen kommunalen Eigenanteil vorsehen,<br />
von der Kommunalaufsicht grundsätzlich in Frage gestellt<br />
wird. Das führt in der Praxis zu der fatalen Situation,<br />
dass ausgerechnet diejenigen Kommunen, die eine<br />
Förderung am dringendsten nötig haben, so von Hilfen<br />
ausgeschlossen werden.<br />
I 157
Arbeitskreis 12: Sportförderung und -finanzierung:<br />
Routine versus Königswege?<br />
Meine Damen und Herren, wenn diese auf das Eigenkapital<br />
fokussierten Spielregeln so fort bestehen, dann wird<br />
es zwangsläufig zu einer Spirale führen, die eine Zweioder<br />
Dreiklassen Gesellschaft unter den Städten schafft.<br />
Von gleichwertigen Lebensverhältnissen im Land, wie sie<br />
unser Grundgesetz eigentlich vorsieht, wird man dann<br />
schon sehr bald nicht mehr sprechen können. Dies waren<br />
bisher abstrakte und allgemeine Aussagen, ich will es<br />
einmal am Haushalt der Stadt Duisburg konkret darlegen.<br />
Insgesamt haben wir im Etatentwurf 1,4 Mrd. Euro<br />
Aufwendungen veranschlagt.<br />
p Davon entfallen allein 324 Mio. Euro auf den<br />
großen Bereich der Personalaufwendungen inkl.<br />
Versorgung<br />
p Es folgt das weite Feld der Sozial- und Jugendaufwendungen,<br />
knapp 100 Mio. Euro entfallen<br />
auf Hilfen nach SGB XII, also die Grundsicherung<br />
im Alter<br />
p 150 Mio. Euro auf die Hilfen nach SGB II (Hartz<br />
IV) – KdU –<br />
p noch mal knapp 80 Mio. Euro für den Bereich der<br />
Jugendhilfe<br />
p Hinzukommen 114 Mio. Euro an Umlagen an den<br />
Landschaftsverband Rheinland<br />
p Den Abschluss dieser beispielhaften Aufstellung<br />
bilden dann Zinszahlungen für Kredite in Höhe<br />
von 70 Mio Euro<br />
Allein mit diesen wenigen Beispielen kommen wir auf<br />
Aufwendungen von ca. 850 Mio. Euro. Sie sehen leicht,<br />
dass sich ein Einsparvolumen nur aus einem sehr geringen<br />
Teil der Haushaltes erwirtschaften lässt. Nun haben<br />
HH-Konsolidierungsprogramme in Duisburg eine 30jährige<br />
Tradition, davon war auch der Sport nicht ausgenommen!<br />
Ich nenne beispielhaft die wichtigsten Sparbemühungen:<br />
158 I<br />
Im Bereich Sportstätten- und Sportförderung:<br />
p Einführung der Schlüsselgewalt in den städt.<br />
Turnhallen ab Mitte 1978<br />
p Einführung der Schlüsselgewalt auf städt. Sportanlagen<br />
(an Trainingstagen)<br />
p Entgeltpflicht bei der Nutzung von Trainingsbeleuchtungsanlagen<br />
p Erweiterung der Schlüsselgewalt auf städt. Sportanlagen<br />
auf das Wochenende<br />
p Abschaffung der Zuschüsse für Übungsleiter<br />
p Regionalisierung der Sportstättenverwalter<br />
(bis dahin hatte jede städt. Sportanlage einen<br />
zuständigen Verwalter)<br />
p Einsparung aller städt. Sportstättenverwalter<br />
und Reduzierung der Sportstättenunterhaltungskolonne;<br />
dies führte zur Überlassung der städt.<br />
Bezirkssportanlagen an Vereine (ab 1.1.1988); im<br />
1. Zuge waren annähernd 30 Sportanlagen davon<br />
betroffen; in den folgenden Jahren wurde nahezu<br />
alle städt. Sportanlagen an Sportvereine verpachtet.<br />
Die mit Vertragsabschluss vereinbarten<br />
Pauschalzuschüsse wurden über die Vertragslaufzeit<br />
nicht der Kostensteigerung angepasst.<br />
p Reduzierung der Investitionszuschüsse, der<br />
Veranstaltungszuschüsse, der Leistungssportzuschüsse<br />
p Reduzierung der Zuschüsse für Grundbesitzabgaben<br />
um die Kosten für die Müllentsorgung<br />
p Einfrierung der Zuschüsse an Sportvereine zur<br />
Unterhaltung der Sportstätten seit 1988<br />
p Einführung der entgeltpflichtigen Nutzung von<br />
Sportstätten durch Sportvereine seit 1996<br />
Im Bereich der Bäder vergleichbare Einsparungen:<br />
1. Schließung der Wannen- und Brausestationen in<br />
verschiedenen Bädern (1987)<br />
2. Einstellung <strong>des</strong> Angebotes Massage in den städti-<br />
schen Saunen (Personaleinsparung)
3. Verpachtung von Freibädern an Vereine u. a.<br />
4. Verpachtung eines Hallenba<strong>des</strong> an einen Verein<br />
(Hallenbad Neuenkamp – 1994)<br />
5. Verpachtung von weiteren 3 Hallenbädern an<br />
Vereine (2005 – 2010)<br />
6. Organisatorische Veränderungen im Personalbereich<br />
(= Stelleneinsparungen)<br />
p mehrfache Reduzierung der Stellenzahl Badewärterinnen/Kassiererinnen<br />
p Einführung von Teilzeitstellen im Badewärterinnenbereich<br />
(1987)<br />
p Reduzierung der Stellen Hausmaschinisten/<br />
Maschinistenkolonne<br />
p mehrfache Reduzierung der Schwimmmeisterstellen<br />
(ab 1988)<br />
p Aufgabe der Funktion Bezirksbäderverwalter bzw.<br />
Reduzierung der Stellenzahl von 8 auf 0 Stellen<br />
(bis 1998)<br />
7. Gleichzeitige Verbesserung der Einnahmen<br />
p mehrfache Erhöhung der Eintrittspreise<br />
p Wegfall von überhöhten Rabatten (200er-, 80er-<br />
Punktekarten)<br />
p Wegfall von Sondertarifen (50 % Ermäßigung) für<br />
Rentner und Bürger über 60 Jahre (1989)<br />
p Reduzierung der Sondertarife für Schüler, Studenten,<br />
Wehr- und Ersatzdienstleistende, Schwerbehinderte,<br />
Arbeitslose von 50 % auf 30 % Ermäßigung<br />
(1995)<br />
p Einführung von Entgelten für Trainings- und Kursbetrieb<br />
von Vereinen (ab 1996)<br />
Meine Damen und Herren,<br />
sehen Sie mir nach, wenn ich Sie jetzt mit vielen Daten<br />
und Fakten gequält habe, aber Ihnen sollte damit verdeutlicht<br />
werden, wie groß die Sparbemühungen der Stadt<br />
Duisburg in den vergangenen Jahrzehnten im Sportbereich<br />
schon gewesen sind. Ich denke, bei Betrachtung<br />
der Sparbemühungen der vergangenen Jahrzehnte wird<br />
klar, dass beträchtliche Konsolidierungspotentiale kaum<br />
mehr vorhanden sind. Trotzdem, und dies macht die<br />
Dramatik aus, sind wir in Duisburg noch nicht am Ende<br />
<strong>des</strong> „Tals der Tränen“ angekommen. Im Rahmen eines<br />
Haushaltssicherungskonzeptes für die Jahre 2010 ff.<br />
haben wir aktuell noch weitere Sparvorschläge der<br />
Aufsichtsbehörde zu unterbreiten.<br />
Inhalte sind:<br />
p Absenkung der Wassertemperatur in den<br />
Bädern um 2 Grad<br />
p Erhöhung der Eintrittsgelder in den Bädern<br />
für die Vereine<br />
p Erhöhung der Eintrittsgelder der Bäder für<br />
den Bürger<br />
p Nochmalige Erhöhung der Nutzungsentgelte<br />
der Sportstätten<br />
p Schließung von fünf Hallenbädern<br />
p Verkauf unserer Eissporthalle an einem<br />
privaten Investor<br />
Bei der Diskussion über die inhaltliche Ausgestaltung der<br />
konkreten Umsetzung bringt sich der Duisburger Stadtsportbund<br />
sehr konstruktiv ein. Wir haben in Duisburg<br />
ohnehin eine sehr enge und intensive Kooperation zwischen<br />
Sportverwaltung und Stadtsportbund. Wir treffen<br />
uns monatlich in einem Kooperationsausschuss – ohne<br />
Politik! – Das erleichtert die Sacharbeit.<br />
3. Konjunkturprogramm II<br />
Meine Damen und Herren,<br />
haben Sie als Autofahrer schon einmal gleichzeitig auf<br />
dem Brems- und dem Gaspedal gestanden? Geht nicht –<br />
werden Sie sagen! Ich sage: Das machen wir in Duisburg<br />
zur Zeit! Nun, der Hintergrund, der dahinter steht, ist<br />
die Tatsache, dass wir einerseits zur Zeit keine Zuschüsse<br />
und keine Investitionen aus dem bestehenden Haushalt<br />
auszahlen dürfen. Andererseits arbeiten wir massiv daran,<br />
I 159
Arbeitskreis 12: Sportförderung und -finanzierung:<br />
Routine versus Königswege?<br />
im Rahmen <strong>des</strong> Konjunkturprogramms II Mio. in den Bau<br />
von neuen Kunstrasenplätzen und in energetische Sanierung<br />
von Umkleideeinrichtungen und Sanitäranlagen der<br />
Sportvereine zu stecken. Dieser Widerspruch ist den Vereinen<br />
kaum vermittelbar. <strong>Der</strong> Fairness halber muss man<br />
allerdings anerkennen: diese Finanzierungsspritze ist außerordentlich<br />
hilfreich, auch wenn es nur ein Strohfeuer ist.<br />
Meine Damen und Herren,<br />
ich werde jetzt zum Schluss kommen. Sie sehen die Gesamtsituation<br />
für den Sport ist dramatisch; ich meine, es<br />
muss auch für den Sport einen Bestandsschutz geben,<br />
Sparmaßnahmen dürfen nicht grenzenlos sein und den<br />
Sport in seiner Existenz bedrohen und seiner Grundlagen<br />
entziehen. Langfristige Sicherung der kommunalen Sportförderung<br />
wird notwendig sein, denn die größten Förderer<br />
<strong>des</strong> Sports – das vergessen viele – sind die Kommunen!<br />
Unerlässlich ist die Sportentwicklungsplanung, speziell<br />
die integrierte Sportentwicklungsplanung, mit Bestandsaufnahmen<br />
und Bestandsanalysen und insbesondere<br />
der Entwicklung eines gemeinsamen Maßnahmenkataloges,<br />
natürlich in Abstimmung mit allen Interessengruppen.<br />
Wir wollen gesicherte Erkenntnisse für die nächsten<br />
10 bis 15 Jahre gewinnen und somit Planungsdaten<br />
160 I<br />
vorhalten, die eine breite Akzeptanz für den Sport darstellen.<br />
Dazu gehört natürlich auch die Festlegung auf<br />
Schwerpunkte.<br />
<strong>Der</strong> Verfassungsauftrag sieht vor, in den Städten und Gemeinden<br />
annähernd gleiche Lebensbedingungen für die<br />
Bürgerinnen und Bürger sicherzustellen. Darauf müssen<br />
wir als Verantwortliche für den Sport achten und es auch<br />
immer wieder einfordern.<br />
4. Fazit:<br />
Den Königsweg wird es nicht geben – aber die finanzschwachen<br />
Kommunen dürfen nicht ausbluten, damit sie<br />
ihren gesellschaftspolitischen Beitrag leisten können.<br />
Hier muss sich bei der Finanzausstattung der Kommunen<br />
vieles ändern!<br />
Lassen Sie mich zum Schluss sagen:<br />
„Wir sind zwar arm, aber sportlich!“<br />
In diesem Sinne, wie wir im Ruhrgebiet sagen:<br />
„Ein herzliches Glückauf!“
WOLFGANG ROHRBERG (GESCHÄFTSFÜHRER DES ESSENER SPORTBUNDES):<br />
Erwartungen <strong>des</strong> (organisierten) Sports an die<br />
(Kommunal) Politik<br />
<strong>Der</strong> organisierte Sport in den Kommunen steht vor großen<br />
Herausforderungen. Sportanlagen und Sportgelegenheiten<br />
sind eine Grundvoraussetzung für jeden Sport.<br />
Hierbei ist es unerheblich, ob es sich um normierte Sportanlagen,<br />
Bolzplätze, Freiflächen, Grünanlagen oder Waldwege<br />
handelt. Ohne Sportanlagen bzw. Sportgelegenheiten<br />
können sich sportliche Aktivitäten nicht entfalten.<br />
<strong>Der</strong> überwiegende Teil der im kommunalen Besitz befindlichen<br />
Sportanlagen ist weitestgehend überaltert und<br />
bereitet den öffentlichen Trägern aufgrund eines überall<br />
zu verzeichnenden hohen Instandsetzungsbedarfs zunehmend<br />
Probleme. Angesichts leerer Kassen ist eine Besserung<br />
nicht in Sicht, Abhilfe ist auf absehbare Zeit<br />
nicht zu erwarten. Aus der Not heraus werden Sporteinrichtungen/Bäder<br />
geschlossen, dringend notwendige<br />
Instandsetzungsarbeiten nicht mehr durchgeführt. Dieses<br />
geschieht aber nicht ohne lautstarke Protestbewegungen<br />
von Sportlern und Bürgern.<br />
Daher stellt sich die Frage, kann der (organisierte) Sport<br />
in Zeiten leerer Kassen Forderungen stellen, da die Unterstützung<br />
<strong>des</strong> Sports eine freiwillige Leistung ist? Über<br />
70 % der Bevölkerung sind sportlich interessiert. Über<br />
50 % gehen einer sportlichen Aktivität nach und über<br />
25 % und mehr der sportlich aktiven Bevölkerung sind in<br />
Sportvereinen organisiert.<br />
Bsp. Essen: Annähernd 300.000 Essener Einwohner<br />
gehen einer regelmäßigen sportlichen Betätigung nach,<br />
davon sind 130.000 Sportler in fast 600 Sportvereinen<br />
organisiert. Bezogen auf die Einwohnerzahl der Stadt<br />
Essen lag der Organisationsgrad <strong>des</strong> organisierten Sports<br />
bei 21,7 %. Überdies gehen noch ca. 130.000 Einwohner<br />
einer unregelmäßigen sportlichen Betätigung nach<br />
(Quelle: Sportverhaltensberichterstattung 2002). Diese<br />
Zahlen belegen, wie stark der Sport in der Gesellschaft<br />
verankert ist. Sport ist nach wie vor ein wesentlicher<br />
I 161
Arbeitskreis 12: Sportförderung und -finanzierung:<br />
Routine versus Königswege?<br />
Bestandteil der modernen Lebens- und Bewegungskultur<br />
und daher unverzichtbar.<br />
Somit kann der Sport als größte gesellschaftliche Gruppierung<br />
an der Gestaltung seiner Lebensumwelt aktiv<br />
teilhaben und selbstbewusst Forderungen stellen. Ein<br />
„Weiter so wie bisher“ – immer nur neue Sporträume erstellen<br />
und die Instandhaltung bestehender Sporträume<br />
vernachlässigen – wäre der falsche Weg. Ein bloßes Instandsetzen<br />
und Festhalten an traditionellen Sportstätten,<br />
ohne dabei die Forderungen an die veränderten Lebensbedingungen,<br />
an das veränderte Sportverhalten und<br />
die zukünftige Bevölkerungsentwicklung auszurichten,<br />
wäre mit einer modernen Sportentwicklung nicht zu<br />
vereinbaren.<br />
Längst wird Sport nicht nur alleine in den traditionellen<br />
Sportstätten ausgeübt. <strong>Der</strong> größte Teil der Bevölkerung<br />
übt seine sportliche Betätigung unorganisiert in Sportgelegenheiten<br />
wie Wald, Feld, Wiese, Straße und öffentlichen<br />
Plätzen aus. Auch die traditionellen Ballsportarten<br />
sind zwar noch mitgliederstark, fallen aber in der Gesamtbetrachtung<br />
aller Sportaktivitäten weit hinter Radfahren,<br />
Schwimmen (nicht leistungs- und wettkampfbezogen),<br />
Joggen, Fitness und Inlineskating in der Gunst<br />
der Sportinteressierten ab. Die sportinteressierte Bevölkerung<br />
von heute verbindet sportliche Aktivitäten mit<br />
Gesundheitsorientierung, sich fit halten, mit Spaß. <strong>Der</strong><br />
Wettkampferfolg spielt bei den meisten Sporttreibenden<br />
nur eine nachrangige Rolle. Diese Erkenntnisse sollen<br />
nicht den Eindruck erwecken, dass die traditionellen Sportarten<br />
nicht mehr nachgefragt werden oder der Leistungssport<br />
ausgedient hat. <strong>Der</strong> Sport braucht den Spitzensport<br />
ebenso wie den Breiten- und zunehmend den Gesundheitssport.<br />
<strong>Der</strong> Sport heute ist differenzierter und facettenreicher.<br />
Während in vergangenen Jahren/Jahrzehnten<br />
die sportliche Betätigung in der Jugend begann und maximal<br />
bis zur mittleren Lebensphase ausgeübt wurde und<br />
nur wenige bis ins hohe Lebensalter dem Sport treu geblieben<br />
sind, wird heute Sport gerade von einer Vielzahl<br />
162 I<br />
von älteren Menschen als Freizeitbetätigung entdeckt.<br />
Mit zunehmender Alterung der Gesellschaft wird dieser<br />
Anteil steigen, während<strong>des</strong>sen der Anteil jugendlicher<br />
Sporttreibender in zukünftigen Jahren sich zurückentwickeln<br />
wird. Überdies wird ein hoher Anteil der Menschen<br />
einen Migrationshintergrund haben.<br />
All diese Veränderungen dürfen in unserer Sportentwicklung<br />
nicht unberücksichtigt bleiben. Aufgrund mehrjähriger<br />
Erfahrung können wir feststellen, dass sich die<br />
gewonnenen Erkenntnisse über eine moderne und zukunftsgerichtete<br />
Sportstättenentwicklung nicht immer<br />
leicht in Diskussionen einbringen lassen, da überwiegend<br />
noch tradiertes Denken vorherrscht. Die demographische<br />
Bevölkerungsentwicklung und ein verändertes Sportverhalten<br />
werden von den meisten Verantwortlichen, das gilt<br />
gleichermaßen für die Vereins- als auch die politischen<br />
Vertreter, nicht richtig gewertet.<br />
Eine zukünftige und verantwortungsvolle<br />
Sportentwicklung muss die veränderten Rahmenbedingungen,<br />
wie finanzielle Ressourcen,<br />
Bevölkerungsentwicklung und Sportverhalten<br />
einbeziehen und berücksichtigen.<br />
Die Vorgaben <strong>des</strong> Goldenen Plans bestimmen heute noch<br />
weitestgehend die Sportlandschaft. Ein dichtes Netz<br />
an gedeckten und ungedeckten Sportanlagen bestimmt<br />
unser Stadtbild. Eigentlich positiv.<br />
Betrachtet man den Zustand dieser Anlagen, so beschleicht<br />
uns schnell Unbehagen. Daher besteht hoher<br />
Handlungsbedarf.<br />
Die verantwortlich handelnden Akteure, Sportverwaltung<br />
und Sportselbstverwaltung müssen gemeinsam einen<br />
Plan für die Zukunft entwickeln. Es ist unabdingbar, Nutzerzahlen,<br />
Vereins- und Mitgliederentwicklungen vor<br />
Ort miteinander zu vergleichen. Wer versucht, aus Tradi-
tion an Sportanlagen festzuhalten, wird in absehbarer<br />
Zeit feststellen müssen, dass er nicht rettet, sondern vernichtet.<br />
Die heutigen Finanzen reichen nicht annähernd<br />
aus, um den vorhandenen Bestand zu halten, nicht einmal<br />
um notwendige Instandsetzungsarbeiten zu finanzieren.<br />
Darüber wird er feststellen, dass Mitgliederentwicklungen<br />
einen Behalt <strong>des</strong> jetzigen Bestan<strong>des</strong> nicht mehr rechtfertigen.<br />
Weniger ist hier mehr.<br />
Sportanlagen müssen sich an heutigen und zukünftigen<br />
Nutzerzahlen und an deren Nutzerverhalten ausrichten.<br />
Normierte und am Wettkampfbetrieb ausgerichtete Sportanlagen<br />
sind in einer sportgerechten Stadt ebenso Bestandteil<br />
wie freizeitorientierte Sporträume, die eine multifunktionale<br />
Nutzung ermöglichen. Sporträume also, die<br />
von der älteren Bevölkerung als angenehm empfunden<br />
werden. Ein Rückenkurs ist in einer Dreifach-Sporthalle<br />
äußerst unattraktiv, jedoch in einem kleineren, sportgerechten<br />
Raum mit netter Atmosphäre viel geeigneter und<br />
noch dazu in der Erstellung und Unterhaltung erheblich<br />
kostengünstiger. Sportbäder müssen Sportbäder für den<br />
leistungsorientierten Sport bleiben. Wir müssen aber<br />
die Frage zulassen, ob heute alle Bäder für den leistungsorientierten<br />
Sport genutzt werden. Können nicht aus<br />
einem Teil der traditionellen Bäder auch multifunktionale<br />
Sporteinrichtungen werden? Etwa durch Anbau von<br />
weiteren Sporträumen, in denen Sportkurse für Jung und<br />
Alt, für Frauen und Männer angeboten werden oder<br />
Seminarräume für eine Ernährungsberatung, Physiotherapie<br />
etc.? So können auch Stadtbäder wirtschaftlicher<br />
und mit einer hohen Auslastung betrieben werden. Hierzu<br />
bedarf es natürlich Veränderungen, Brechen mit Traditionen.<br />
Benötigen wir heute noch die Vielzahl der leichtathletischen<br />
Einrichtungen wie Rundlaufbahnen, Kugelstoßringe<br />
und Weitsprunggruben, die oftmals mangels<br />
notwendiger Pflege von Unkraut überwuchert sind? Sie<br />
werden heute meistens nur einmal jährlich für Schulsportfeste<br />
genutzt. Die Instandhaltung – wenn sie erfolgt<br />
– kostet Geld, das an anderer Stelle dringend benötigt<br />
wird. Welcher zukünftige 50/60jährige läuft denn noch<br />
die 100m Distanz auf Zeit? Welche Sportanlagen bieten<br />
wir dieser Interessensgruppe zukünftig an? Rückbau<br />
da, wo es verantwortbar ist. Dafür aber an wenigen ausgewählten<br />
Orten gute Sportanlagen, die die Entwicklung<br />
<strong>des</strong> Sports, wie z.B. Leichtathletik, fördern. Und diese<br />
Beispiele können wir für viele Sportarten finden.<br />
Traditionen verändern sich, auch die Wettkampfregeln.<br />
In Zeiten knapper Ressourcen müssen Änderungen von<br />
Wettkampfregeln oder Auflagen für die Teilhabe am<br />
Wettkampfbetrieb mit Augenmaß betrieben werden.<br />
Es ist unter den derzeitigen aktuellen Finanzbedingungen<br />
nicht verantwortbar, dass Verbandsauflagen oder Änderungen<br />
der Wettkampfbedingungen von Vereinen und<br />
Kommunen nicht mehr oder nur unter größten Finanzanstrengungen<br />
aufgebracht werden können. Es mag zwar<br />
für den Spielverlauf interessant sein, dass Spielfeldausmaße<br />
größer oder kleiner werden. <strong>Der</strong> Finanzaufwand zur Änderung<br />
der Spielfeldmarkierungen in Turn- und Sporthallen<br />
ist hingegen zur Angleichung der Norm immens.<br />
Fanblocktrennung, obwohl die Zuschauerzahl im 5. Ligabetrieb<br />
meist die 300er-Grenze selten überschreitet, und<br />
I 163
Arbeitskreis 12: Sportförderung und -finanzierung:<br />
Routine versus Königswege?<br />
eigene Zuwegungen für Gäste mit eigener Buszufahrt etc.<br />
sind Kosten zur Ergänzung von Sportstätten, die nicht<br />
selten die 1 Mio. € überschreiten. Werden sie nicht aufgebracht,<br />
wird der Verein unweigerlich vom Spielbetreib<br />
ausgeschlossen. Kosten, die hierfür aufgebracht werden<br />
müssen, fehlen an anderer Stelle zur Instandsetzung von<br />
Duschen, WCs, Dächern etc. Hier muss der Blick und<br />
die Erwartungshaltung nicht auf andere gerichtet werden,<br />
vielmehr müssen auch wir unsere Handlungsweisen kritisch<br />
überprüfen.<br />
Fazit<br />
Bisher hat der organisierte Sport alle gesellschaftlichen<br />
und wirtschaftlichen Veränderungen der Nachkriegszeit<br />
gut überstanden. Jetzt muss sich aber der Sport auf allen<br />
Ebenen den Veränderungen, die von innen und außen<br />
auf ihn einwirken, stellen.<br />
<strong>Der</strong> Bevölkerungsrückgang bzw. der demografische Wandel<br />
ist für sich noch kein Gradmesser für einen gleichzeitigen<br />
Rückgang der Sportaktivitäten. Jedoch muss selbst<br />
164 I<br />
unter optimistischer Prognose die Aussage für den organisierten<br />
Sport getroffen werden, dass sich der demografische<br />
Wandel in unterschiedlicher Dimension auch auf<br />
unsere Vereine und die Sportlandschaft auswirkt. <strong>Der</strong> Bevölkerungsrückgang<br />
bedeutet für den Sport nicht gleich<br />
das „Aus“. Dazu müssen wir „nur“ die uns vorliegenden<br />
Hinweise und Erkenntnisse aufgreifen und die unabdingbaren<br />
Änderungen herbeiführen. Sportorte können nicht<br />
unendlich Bestand haben. Die verbleibenden unverzichtbaren<br />
Sportanlagen müssen auf einen nutzbaren Zustand<br />
gebracht werden, der es erlaubt, dass sich die Sporttreibenden<br />
in diesen Anlagen wieder wohl fühlen.<br />
Angesichts der großen Nutzerzahl kann und darf<br />
sich die öffentliche Hand auch in schwierigen<br />
Zeiten nicht aus der Förderung verabschieden.<br />
Sport gehört zu einem urbanen Leben. Städte<br />
und Orte ohne eine gute Sportinfrastruktur und<br />
ohne ein aktives Sportleben sind Städte ohne<br />
Lebensqualität.
NICLAS STUCKE (HAUPTREFERENT DES DEUTSCHEN STÄDTETAGES):<br />
Kommunalfinanzen 2010 – Gesamtbild<br />
Die Folgen der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise<br />
werden 2010 in den Kommunen immer stärker spürbar.<br />
Ein Teil der Städte steht vor dem Kollaps und droht handlungsunfähig<br />
zu werden. Dort ist die im Grundgesetz<br />
garantierte kommunale Selbstverwaltung in großer Gefahr.<br />
Die schon seit Jahren bestehenden strukturellen Finanzprobleme<br />
vieler Städte spitzen sich zur Zeit dramatisch<br />
zu. Rekorddefizite in zweistelliger Milliardenhöhe, eine<br />
explodierende Verschuldung durch kurzfristige Kredite,<br />
der stärkste Steuerrückgang seit Jahrzehnten und ungebremst<br />
steigende Sozialausgaben kennzeichnen die Situation<br />
im März 2010.<br />
In diesem Jahr befürchten die Kommunen ein Rekorddefizit<br />
von 12 Mrd. Euro. Das wäre fast die Hälfte mehr als<br />
das Defizit von 8,4 Mrd. Euro in der bisher schwersten<br />
kommunalen Finanzkrise im Jahr 2003. Auch in den Jahren<br />
2011 bis 2013 werden zweistellige Milliardendefizite<br />
erwartet.<br />
Die kurzfristigen Kassenkredite der Kommunen betragen<br />
inzwischen 33,8 Mrd. Euro. Sie sind damit allein in den<br />
ersten drei Quartalen <strong>des</strong> Jahres 2009 um mehr als vier<br />
Mrd. Euro gestiegen. Notleidende Städte brauchen diese<br />
Kredite regelmäßig, weil sie mehr Aufgaben erfüllen<br />
müssen als die Einnahmen hergeben.<br />
Bund, Länder und Kommunen hatten 2009 erhebliche<br />
Steuerverluste. Den stärksten Einbruch ihrer Steuereinnahmen<br />
– um gut 10 % – mussten die Städte, Gemeinden<br />
und Kreise hinnehmen. Das Minus betrug 7,1 Mrd.<br />
Euro. Besonders stark stürzten dabei die Gewerbesteuereinnahmen<br />
ab, um 17,4 %. Viele Städte erlitten dabei<br />
dramatische Verluste von mehr als 40 %. Insgesamt<br />
sank das Gewerbesteueraufkommen von 40 Mrd. Euro in<br />
2008 auf 33,6 Mrd. Euro in 2009.<br />
Die Sozialausgaben der Kommunen stiegen 2009 erstmals<br />
auf rund 40 Mrd. Euro – beinahe doppelt so viel wie<br />
kurz nach der Wiedervereinigung. 2010 wird ein weiterer<br />
Anstieg um fast zwei Mrd. Euro erwartet.<br />
Diese massiv sinkenden Steuereinnahmen und die ständig<br />
steigenden Sozialausgaben drängen die Städte weiter<br />
zu einem strikten Sparkurs und drohen einen Teil der<br />
Kommunen handlungsunfähig zu machen. Fast ein Viertel<br />
ihrer gesamten Ausgaben wenden die Kommunen<br />
inzwischen für soziale Leistungen auf. Deswegen sind die<br />
Städte gezwungen, Sparprogramme zu erarbeiten und<br />
stellen dafür alle Bereiche auf den Prüfstand. Die Städte<br />
reduzieren vor allem ihr Personal, besetzen freiwerdende<br />
Stellen nicht mehr oder nur verzögert. Sie sind gezwungen<br />
wichtige Investitionen in die städtische Infrastruktur<br />
oder IT-Projekte zu stoppen oder zeitlich zu strecken.<br />
Wenn möglich, müssen auch städtische Beteiligungsgesellschaften<br />
Konsolidierungsbeiträge leisten. In zahlreichen<br />
Städten müssen Haushaltssicherungskonzepte neu<br />
aufgestellt oder ausgeweitet werden, die sich die Kommunen<br />
von den Kommunalaufsichtsbehörden genehmigen<br />
lassen müssen. Außerdem steigt in vielen kommunalen<br />
Haushalten der Druck, neue Schulden aufzunehmen.<br />
I 165
Arbeitskreis 12: Sportförderung und -finanzierung:<br />
Routine versus Königswege?<br />
UDO SKALNIK (LEITER DES SPORTAMTS DER LANDESHAUPTSTADT DÜSSELDORF):<br />
166 I
Kommunale Sportförderung durch Gewährung von<br />
Zuschüssen an Sportvereine<br />
I 167
Arbeitskreis 12: Sportförderung und -finanzierung:<br />
Routine versus Königswege?<br />
UDO SKALNIK (LEITER DES SPORTAMTS DER LANDESHAUPTSTADT DÜSSELDORF):<br />
168 I
I 169
Arbeitskreis 12: Sportförderung und -finanzierung:<br />
Routine versus Königswege?<br />
UDO SKALNIK (LEITER DES SPORTAMTS DER LANDESHAUPTSTADT DÜSSELDORF):<br />
170 I
I 171
Arbeitskreis 12: Sportförderung und -finanzierung:<br />
Routine versus Königswege?<br />
FRANK PRIEBE (BÜRGERMEISTER NÖRTEN-HARDENBERG):<br />
Wiedereröffnung <strong>des</strong> Hallenbads Nörten-Hardenberg<br />
durch die Gründung einer Bürgergenossenschaft<br />
Wie ist die Initiative entstanden?<br />
<strong>Der</strong> Betrieb <strong>des</strong> kommunalen Hallenbads Nörten-Hardenberg<br />
– erbaut Anfang der 70er Jahre als typisches Sportund<br />
Lehrschwimmbad – konnte nach etwa 30jährigem<br />
Betrieb nicht mehr aufrechterhalten werden. Gründe dafür<br />
waren einerseits der stetig zunehmende Zuschussbedarf,<br />
der sich daraus ergab, dass der öffentliche Badebetrieb<br />
zu sozial-verträglichen Eintrittspreisen realisiert werden<br />
sollte, und andererseits der im Laufe der Jahre zuneh-<br />
172 I<br />
mende Sanierungsstau und Modernitätsrückstand. Er<br />
führte zu einem erheblichen Investitionsaufwand, der nicht<br />
mehr getätigt werden konnte. Als die relativ hohen<br />
kommunalen Zuschüsse wegen der allgemeinen Finanzlage<br />
nicht mehr gewährt werden konnten, wurde das<br />
Bad zum 30. Juni 2004 geschlossen.<br />
Bereits im Vorfeld der Schließung, noch während sich<br />
diese traurige Entwicklung abzeichnete, hatten viele Bürger<br />
Initiativen zur ‚Rettung <strong>des</strong> Ba<strong>des</strong>’ entwickelt:
p In mehreren öffentlichen Versammlungen<br />
(März und Mai 2002) machte man sich stark für<br />
den Erhalt <strong>des</strong> Hallenbads.<br />
p Es wurde ein Förderverein gegründet, der gemeinsam<br />
mit der Kommune nach Lösungsmöglichkeiten<br />
suchte. Ergebnis:<br />
1. <strong>Der</strong> Förderverein mobilisierte zwar das Bürgerinteresse,<br />
konnte den defizitären Betrieb aber selbst<br />
nicht organisieren.<br />
2. Deshalb wurde das Hallenbad im Rahmen einer<br />
öffentlichen Ausschreibung mit dem Ziel der Übernahme<br />
privaten Investoren angeboten. Hierzu<br />
wurden Sondierungen/Verhandlungsgespräche mit<br />
Interessenten durchgeführt. Das Ergebnis führte<br />
schnell zu der Einsicht, dass das Betriebsrisiko auch<br />
für private Betreiber zu groß ist.<br />
3. Auf der Suche nach alternativen Lösungen wurden<br />
auch Fachtagungen besucht:<br />
l Kreissportbund NOM-Einbeck: Seminar<br />
„Betreibermodelle für Sportanlagen am Beispiel<br />
Schwimmbäder“<br />
l Niedersächsischer Städte- und Gemeindebund:<br />
Seminar „Möglichkeiten <strong>des</strong> Erhalts öffentlicher<br />
Bäder“<br />
l Genossenschaftsverband Norddeutschland:<br />
Tagung „Privatisierung öffentlicher Aufgaben in<br />
Form von Genossenschaften“<br />
Fazit:<br />
p Keine Hallenbadübernahme und Betriebsführung<br />
durch Privatinvestoren oder nur durch Vereine<br />
möglich.<br />
p <strong>Der</strong> Förderverein verfolgt aber weiterhin das Ziel,<br />
das Schwimmbad zu erhalten, um ein öffentliches<br />
Schwimmangebot, breite Lehrschwimmangebote<br />
für Schulen/Vereine sowie gesundheitsförderliches<br />
Schwimmen in Selbsthilfegruppen zu ermöglichen.<br />
p Die Entscheidung für ein alternatives Betreibermodell<br />
ist erforderlich.<br />
Den Förderverein überzeugte vor allem die genossenschaftliche<br />
Idee bzw. das Raiffeisenmotto: „Alle für<br />
einen – einer für alle“. Dabei faszinierte vor allem der<br />
folgende Gedanke:<br />
Vielleicht schaffen ‚viele’ Menschen, Unternehmen,<br />
Vereine und Verbände aus der Region das,<br />
was ‚einer’ allein nicht kann.<br />
Mit der Option eines genossenschaftlichen Betreibermodells<br />
konnte ein Hallenbadangebot<br />
p für die Region erhalten bleiben,<br />
p nach einem attraktiven Konzept gestaltet<br />
p und die Infrastruktur modernisiert und das Gebäude<br />
entsprechend saniert/umgebaut werden.<br />
Bei unserer Hallenbad-Genossenschaft fließen alle Mittel<br />
und Überschüsse nur dem Genossenschaftszweck zu, in<br />
unserem Fall dem Hallenbad. Gegenüber Privat-Investoren<br />
gibt es kein Interesse an Zweckentfremdung der wirtschaftlichen<br />
Überschüsse. Vor diesem Hintergrund wurde<br />
ein sog. Ressourcen-Mix angestrebt:<br />
1. Bürger, Unternehmen und Organisationen<br />
p erwerben Genossenschafts-Anteile und beteiligen<br />
sich somit an der Kapitalbildung,<br />
p übernehmen Führungsverantwortung<br />
p und unterstützen die laufende Erhaltung und Sanierung<br />
der Gebäude und der Technik aktiv und<br />
fachmännisch (handwerklich, organisatorisch…).<br />
2. Einnahmen werden aus Badnutzungsgebühren<br />
und Hallenbad-Nebengewerbe erwirtschaftet<br />
(Sauna-/Wellness-Bereich, Therapie, Aqua-Angebote<br />
…)<br />
3. Schließlich beteiligt sich die Kommune weiterhin<br />
mit einem Sockelbetrag als jährlichem Zuschuss.<br />
I 173
Arbeitskreis 12: Sportförderung und -finanzierung:<br />
Routine versus Königswege?<br />
In der Genossenschaft werden keine fremden Gewinninteressen<br />
realisiert – der laufende Betrieb sowie die<br />
Aufsichtsfunktion werden nach dem Demokratieprinzip<br />
organisiert:<br />
p Je<strong>des</strong> Mitglied hat eine Stimme (in der Mitgliederversammlung)<br />
p Wesentliches Eigenkapital ist das Geschäftsguthaben<br />
der Mitglieder. Je<strong>des</strong> Mitglied zeichnet<br />
einen oder mehrere Geschäftsanteile. Die Höhe<br />
ist in der Satzung geregelt.<br />
p Das Geschäftsguthaben (also die gezeichneten<br />
Anteile) werden bei Austritt aus der Genossenschaft<br />
zurückgezahlt.<br />
p Eine Nachschusspflicht für den Insolvenzfall ist<br />
in der Satzung ausgeschlossen.<br />
p Auf diese Weise bleibt der öffentliche Charakter<br />
weitgehend erhalten – das öffentliche und preiswerte<br />
Schwimmangebot wird gesichert.<br />
Die Organstrukturen Vorstand/Aufsichtsrat/Generalversammlung<br />
sind in dieser Genossenschaft auf einen<br />
professionellen Geschäftsbetrieb ausgerichtet, als Vollkaufmann<br />
unterliegt die eG den Regeln <strong>des</strong> HGB.<br />
Dies sowie die genossenschaftliche Pflichtprüfung führen<br />
zur größeren Sicherheit bei der eG.<br />
<strong>Der</strong> Pflicht-Aufsichtsrat bei unserer Genossenschaft<br />
garantiert eine weit reichende interne Kontrolle <strong>des</strong> Vorstan<strong>des</strong><br />
durch die Mitglieder der Genossenschaft. Anders<br />
als z.B. bei Vereinen sind ihm ohne Berücksichtigung<br />
der Mitglieder bei der Genossenschaft engere Grenzen<br />
gesetzt.<br />
174 I<br />
Wie viele neue Arbeitsplätze wurden geschaffen,<br />
wie viele bestehende erhalten?<br />
Unter kommunaler Betriebsführung gab es zwei Schwimm-<br />
Meister (vollbeschäftigt) und zwei Teilzeit-Reinigungskräfte.<br />
<strong>Der</strong> Sauna- und Gastronomie-Bereich war mit immer<br />
geringerem wirtschaftlichen Erfolg verpachtet (kaum<br />
Nutzung, häufige Schließung).<br />
p Die Genossenschaft hat nunmehr einen hauptamtlichen<br />
Schwimm-Meister (ein Schwimm-Meister<br />
hatte im Vorfeld gekündigt)<br />
p Es wurden acht Mini-Jobs zur Badeaufsicht und<br />
Reinigung geschaffen (die ursprünglich zwei<br />
Teilzeit-Reinigungskräfte wurden an Schulen der<br />
Fleckengemeinde versetzt).<br />
p Im Gastronomiebereich etabliert sich erkennbar<br />
sehr erfolgreich ein Jungunternehmer (zwei Vollzeitkräfte)<br />
p Im Wellnessbereich entstand ein selbstständig<br />
geführter Betrieb (Kosmetikstudio mit einer<br />
Ganztagskraft sowie zwei Teilzeit-Masseuren)<br />
Wie verbindet sich die Schaffung<br />
von Arbeitsplätzen mit dem genossenschaftlichen<br />
Förderauftrag<br />
gegenüber den Mitgliedern?<br />
Die formale Zielsetzung der Hallenbad-Genossenschaft<br />
Nörten-Hardenberg ist der Erhalt <strong>des</strong> dortigen Schwimmbads.<br />
Die Mitglieder der Genossenschaft engagieren sich<br />
für das Hallenbad, um ein öffentliches Schwimmangebot,<br />
Gesundheits- bzw. Wellness-Angebote und ein breites<br />
Lehrschwimmangebot für Schulen & Vereine aufrechtzuerhalten.<br />
Sie versprechen sich davon einen deutlichen<br />
Mehrwert an Lebensqualität vor Ort. Voraussetzung für<br />
die Erreichung dieser Ziele ist der nachhaltige Erfolg <strong>des</strong><br />
Geschäftsbetriebs. Nur die langfristige Qualität und Attraktivität<br />
der im Hallenbad angebotenen Dienstleistungen
sichert dauerhaft stabile Erträge. In diesem Zusammenhang<br />
tragen der sinnvolle und gut überlegte Erhalt und<br />
die Schaffung von Arbeitsplätzen zur Steigerung der<br />
Service-Qualität im Nörtener Schwimmbad ganz konkret<br />
zur Förderung der Mitglieder-Interessen bei. Die Aufwertung<br />
<strong>des</strong> Gastronomie- und Wellness-Bereichs mit privaten<br />
Mitglieder-Subunternehmen bringt der Genossenschaft<br />
ein spürbares Mehr an Besuchern bzw. Erträgen und<br />
den Mitgliedern ganz direkt ein spürbares Plus an Wohlfühlatmosphäre<br />
und Lebensqualität.<br />
Gab oder gibt es ideelle oder materielle<br />
Förderer?<br />
Unternehmen der Region bieten die Möglichkeit <strong>des</strong><br />
kostenlosen Mitnutzens vorhandener Strukturen/Infrastruktur<br />
(z.B. professionelles Controlling und Buchhaltung;<br />
Monitoring der technischen Anlagen). Alle Organe<br />
der EG sind ehrenamtlich besetzt. Über 300 Mitglieder<br />
kümmern sich um „Ihr“ Unternehmen durch ehrenamtlichen<br />
Einsatz. Die Kommune konnte finanziell deutlich<br />
entlastet werden, was selbst den Bund der Steuerzahler<br />
zu einem Lob veranlasst hat.<br />
Welche Schwierigkeiten waren zu<br />
überwinden?<br />
Anfangs geringe Akzeptanz und breite Skepsis seitens<br />
vieler Bürger und auch der Kommunalpolitiker im Hinblick<br />
auf ein solches Betreibermodell (teilweise auch deutliche<br />
Kritik an der Initiative zur bürgerschaftlichen Übernahme<br />
<strong>des</strong> Badbetriebs mit dem Argument, ein Hallenbadbetrieb<br />
sei ‚Aufgabe <strong>des</strong> Staates’).<br />
Nur mit Hilfe großen Engagements und kontinuierlicher<br />
Überzeugungsarbeit gelang es, das Projekt dennoch<br />
umzusetzen. Es hat über ein Jahr gedauert, bis das Vertrauen<br />
der Bürger gesichert war. Bei der Gewinnung<br />
von Mitgliedern kam es vor allem darauf an, behutsam<br />
vorzugehen. Jetzt gibt der Erfolg der Sache Recht und die<br />
Freude über den gelungenen Erhalt <strong>des</strong> Schwimmbads<br />
überwiegt.<br />
Welche Perspektiven für die Zukunft<br />
gibt es?<br />
Langfristige Sicherung eines öffentlichen Gutes (hier:<br />
Erhalt einer kommunalen Einrichtung, die von der Schließung<br />
bedroht ist). Ein öffentliches Schwimmangebot<br />
für alle Altersgruppen, ein breites Schwimmausbildungs-<br />
Angebot für alle Schulen, Kindergärten und viele Vereine<br />
sowie die Gesundheitsförderung von Selbsthilfegruppen<br />
soll durch Bürger-Engagement erhalten werden.<br />
Ermutigen<strong>des</strong> Signal regionalen Lernens:<br />
p durch die Schaffung von weiteren Arbeitsplätzen<br />
innerhalb <strong>des</strong> Hallenbadbereichs<br />
p sowie durch die Chance zur aktiven Teilhabe an<br />
der Gesellschaft (statt resignieren ‚mitmischen’<br />
und auch ganz praktisch mitentscheiden und<br />
sichern helfen, ob es weiterhin Einrichtungen zur<br />
Sicherung öffentlicher Güter geben wird oder<br />
nicht).<br />
Internet: www.hallenbad-noerten-hardenberg.de<br />
I 175
Arbeitskreis 12: Sportförderung und -finanzierung:<br />
Routine versus Königswege?<br />
Ergebnisse <strong>des</strong> Arbeitskreises 12<br />
176 I
Praxisorientierte Problemlösungen für die kommunalen<br />
Sport- und Bäderverwaltungen und Betriebe stehen im<br />
Vordergrund der Aufgaben der ADS. Sie organisiert<br />
Maßnahmen zur Fortbildung der Mitglieder und führt<br />
<strong>des</strong>halb in eigener Regie alljährlich Tagungen mit Fach-<br />
vorträgen durch.<br />
In Zusammenarbeit mit den kommunalen Spitzen-<br />
verbänden (<strong>Deutsche</strong>r Städtetag, <strong>Deutsche</strong>r Städte- und<br />
Gemeindebund, <strong>Deutsche</strong>r Landkreistag) pflegt die ADS<br />
den Kommunikations- und Informationsaustausch<br />
zwischen den Städten, Gemeinden und Gemeinde-<br />
verbänden einerseits und wird anderseits als kompetenter<br />
Ansprechpartner <strong>des</strong> <strong>Deutsche</strong>n <strong>Olympische</strong>n Sport-<br />
bun<strong>des</strong>, der Lan<strong>des</strong>sportbünde, den deutschen Sport-<br />
fachverbänden sowie der <strong>Deutsche</strong>n <strong>Olympische</strong>n<br />
Gesellschaft geschätzt.<br />
Die ADS – Ihr sach- und fachkundiger Gesprächs- und<br />
Beratungspartner in Angelegenheiten <strong>des</strong> kommunalen<br />
Sports.<br />
www.ads-sportverwaltung.de
Bilanz und Ausblick<br />
Kongress „Starker Sport – starke Kommunen“ am 5. und 6. März 2010 in München<br />
Abschlussrunde mit Rudolf Behacker,<br />
Andreas Klages und Niclas Stucke<br />
Sander p Stucke: Sie waren von der ersten Idee<br />
für diesen Kongress dabei. Sie haben den Kongress<br />
mitvorbereitet. Sie haben jetzt die 2 Tage erlebt.<br />
Wie sieht ihre Bilanz aus?<br />
Stucke: Die Kooperationsvereinbarung zwischen Deut-<br />
schem Städtetag, <strong>Deutsche</strong>m Städte- und Gemeindebund<br />
und <strong>Deutsche</strong>m <strong>Olympische</strong>n Sportbund war noch gar<br />
nicht unterschrieben, da saßen wir im Sommer 2008 erstmals<br />
bei einem Brainstorming zusammen, um über einen<br />
möglichen Kongress nachzudenken. Die Kooperationsvereinbarung<br />
kam, die Kongressidee und die Kongresskonzeption<br />
verdichteten sich immer mehr. Als wir dann<br />
im Herbst <strong>des</strong> letzten Jahres mit dem Programm herauskamen,<br />
merkten wir an der Nachfrage und an der Überbuchung<br />
schon im Januar 2010, dass wir offensichtlich<br />
mit unserer Idee nicht ganz falsch gelegen hatten. Das<br />
endgültige Ergebnis haben wir gestern und heute miterlebt.<br />
Wenn ich ein Fazit ziehen darf: In der Tradition <strong>des</strong><br />
DSB-<strong>Kongresses</strong> vom Dezember 2004 in Bremen haben<br />
wir m. E. eine sehr gelungene Veranstaltung hinbekommen.<br />
Wir spüren Rückenwind für das gemeinsame Anliegen<br />
und sollten im gebührenden Abstand überprüfen:<br />
Wie sieht die hier gezogene Bilanz aus, was muss noch<br />
erledigt werden und welche neuen Fragen stellen sich.<br />
Es ist dies aber auch die Gelegenheit, Dank zu sagen: Insbesondere<br />
an die 450 Teilnehmerinnen und Teilnehmer,<br />
ohne die die Diskussionen und der Erfahrungsaustausch<br />
nicht hätten stattfinden können, die bestens vorbereiteten<br />
Referenten und Moderatoren, die Führungs-Akademie<br />
<strong>des</strong> DOSB, die kompetent und professionell das gesamte<br />
Management <strong>des</strong> <strong>Kongresses</strong> bewältigt hat, alle Sponsoren,<br />
die es uns ermöglicht haben, angenehme Rahmenbedingungen<br />
zu schaffen und u. a. keine Teilnehmergebühren<br />
zu nehmen sowie insbesondere der Lan<strong>des</strong>haupt-<br />
178 I<br />
stadt München, ohne deren finanzielle und logistische<br />
Unterstützung dieser Kongress nicht hätte stattfinden<br />
können. Unser Dank gilt aber ganz besonders auch den<br />
beiden anderen mitveranstaltenden Verbänden, die in<br />
konstruktiver und kollegialer Weise und ohne irgendwelche<br />
Reibungen diesen Kongress auf den Weg gebracht haben.<br />
Sander p Klages: Wie schauen sie aus der Sicht <strong>des</strong><br />
DOSB auf diesen Kongress zurück?<br />
Klages: Ich darf mich den Worten <strong>des</strong> Kollegen Stucke<br />
anschließen und mich von meiner Seite aus bedanken –<br />
sowohl beim <strong>Deutsche</strong>n Städtetag als auch beim <strong>Deutsche</strong>n<br />
Städte- und Gemeindebund für die hervorragende<br />
Zusammenarbeit. Ich darf ferner dem Bayerischen Lan<strong>des</strong>-Sportverband<br />
für seine Unterstützung danken.
Rudolf Behacker, Leiter <strong>des</strong> Sportamts der Lan<strong>des</strong>hauptstadt München und Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft <strong>Deutsche</strong>r Sportämter,<br />
Andreas Klages, stellvertretender Direktor Sportentwicklung <strong>des</strong> <strong>Deutsche</strong>n <strong>Olympische</strong>n Sportbun<strong>des</strong> und Niclas Stucke, Hauptreferent <strong>des</strong><br />
<strong>Deutsche</strong>n Städtetages (v.l.n.r.) im Gespräch mit Britta Sander, Agentur Sprechperlen<br />
Wir hatten über 650 Anfragen und die Kapazität <strong>des</strong><br />
<strong>Kongresses</strong> war auf 400 bis 450 Teilnehmer ausgelegt.<br />
Es gab eine sehr hohe Nachfrage und ich denke, diese<br />
Nachfrage und die Kongressdynamik, die Kollege Stucke<br />
eben skizziert hat, unterstreichen nochmals die Wichtigkeit<br />
<strong>des</strong> Themas „Sports und Kommune“ und die Relevanz<br />
<strong>des</strong> <strong>Kongresses</strong>. Wir haben in allen Arbeitskreisen festgestellt,<br />
dass der Sport vor Ort ein sehr facettenreiches<br />
Thema ist. Das wird am Themenspektrum der Arbeitskreise,<br />
bei den Berichten aus den Workshops und beim<br />
„Kongressbild“ deutlich. Diese Themen stehen für Lebensqualität<br />
durch Sport und sind zugleich verbunden<br />
mit vielfältigen Herausforderungen, die auch in den Reden<br />
gestern im Plenum deutlich angesprochen worden sind.<br />
Hier kann ich an Frau Freytag anknüpfen: die Zeit der Kö-<br />
nigswege ist vorbei! Es gibt kaum noch Königswege!<br />
Gleichwohl haben wir einen hohen Handlungsdruck. Es<br />
gilt, Anregungen und Impulse zu geben, Ideen zu vermitteln,<br />
neue Fragen aufzunehmen. Hierfür war der Kongress<br />
eine Plattform.<br />
Es ist gestern sowohl von Herrn Dr. Bach als auch von<br />
Herrn Ude die Kooperationsvereinbarung angesprochen<br />
worden, die die Grundlage dieses <strong>Kongresses</strong> war. Ich<br />
habe mit Freude erfahren, dass in mehreren Bun<strong>des</strong>ländern<br />
und Lan<strong>des</strong>sportbünden, u. a. in NRW und in Hessen,<br />
entsprechende Initiativen nach dem DOSB-Vorbild<br />
entwickelt werden, um die Kooperation zwischen den<br />
Kommunen und den Sportverbänden regional zu intensivieren.<br />
Ich denke, das ist ein deutlicher Beleg für Impulse,<br />
die von diesem Kongress ausgehen.<br />
I 179
Bilanz und Ausblick<br />
Kongress „Starker Sport – starke Kommunen“ am 5. und 6. März 2010 in München<br />
Sander p Behacker: Herr Behacker, schauen wir<br />
zunächst mal aus ihrer lokalen Sicht, der Sicht <strong>des</strong><br />
Sportamtes München auf diese Veranstaltung.<br />
Was nehmen Sie da mit?<br />
Als Sportamtsleiter der Lan<strong>des</strong>hauptstadt München bin<br />
ich zuerst einmal stolz, dass man München als Veranstaltungsort<br />
für diesen Kongress gewählt hat. Über 400 Teilnehmerinnen<br />
und Teilnehmer aus dem organisierten<br />
Sport, den Stadtsportbünden, den Fachsportverbänden,<br />
der kommunalen Sportpolitik und der -verwaltung zeigen,<br />
dass der DOSB, der <strong>Deutsche</strong> Städtetag und der <strong>Deutsche</strong><br />
Städte- und Gemeindebund mit ihrer Wahl <strong>des</strong><br />
Austragungsortes richtig lagen und dies nicht nur weil<br />
München sich mit Garmisch-Partenkirchen und Berchtesgaden<br />
gerade um die <strong>Olympische</strong>n Winterspiele für<br />
2018 bewirbt.<br />
Bei den bekannt schwierigen kommunalen Rahmenbedingungen<br />
läuft derzeit in München der Prozess einer<br />
Sportentwicklungsplanung mit dem Ziel, Handlungsstrategien<br />
für die zukünftige Sportpolitik der Stadt zu entwickeln.<br />
Deshalb bin ich froh, dass Stadträtinnen und<br />
Stadträte aller Fraktionen und viele Mitarbeiterinnen und<br />
Mitarbeiter der Stadtverwaltung Münchens die Gelegenheit<br />
genutzt haben, sich kompetent zu informieren über<br />
die vielfältigen Herausforderungen <strong>des</strong> Fachbereiches<br />
Sport in einer Kommune. Die Erkenntnis, dass es weder<br />
Patentrezepte noch Königswege gibt, deprimiert nicht,<br />
sondern sollte Mut machen den eigenen Weg zu suchen<br />
und ihn dann zielstrebig zu verfolgen. Die sportlich interessierten<br />
Bürgerinnen und Bürger werden es uns danken.<br />
Sander p Behacker: Und nun zu ihrer Rolle in der<br />
Arbeitsgemeinschaft <strong>Deutsche</strong>r Sportämter. Sieht da<br />
die Bilanz anders aus?<br />
Als Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft <strong>Deutsche</strong>r<br />
Sportämter bin ich dem Vizepräsidenten <strong>des</strong> <strong>Deutsche</strong>n<br />
Städtetages und meinem langjährigem „Chef“ Christian<br />
180 I<br />
Ude sehr dankbar, dass er in seinem Hauptvortrag allen<br />
Teilnehmerinnen und Teilnehmern deutlich gemacht hat,<br />
dass das Kongressmotto „Starke Kommunen“ als Voraussetzung<br />
für „Starken Sport“ nur dann Wahrheit werden<br />
könne, wenn diese Kommunen auch wirklich stark<br />
sind.<br />
Die Sportpolitik wird vielerorts mit Gesellschaftspolitik<br />
gleichgesetzt und der Sport in der Kommune zunehmend<br />
eng mit anderen Politikfeldern wie Gesundheits-,<br />
Jugend-, Bildungs-, Sozial-, Steuer-, Finanz-, Energieund<br />
Umweltpolitik verknüpft.<br />
Freiwillige Leistung oder Pflichtaufgabe – egal: <strong>Der</strong> Sport<br />
in all seinen Facetten und positiven Wirkungen ist aus<br />
dem Alltag in den Kommunen nicht wegzudenken. Gerade<br />
<strong>des</strong>halb ist es so wichtig, dass überall in Deutschland<br />
die Sportentwicklung als Teil der Stadtentwicklung<br />
bei allen Planungen von Anfang an mit berücksichtigt<br />
wird. Die Kolleginnen und Kollegen der jeweiligen Stadtverwaltungen<br />
müssen sich an all diesen Prozessen aktiv<br />
beteiligen. Sportentwicklung ist mehr als Sportstättenentwicklung.<br />
Sander p Klages: Aus dem Blickwinkel <strong>des</strong> Sports.<br />
Was sind die wichtigsten Aspekte, die sie von diesem<br />
Kongress mitnehmen?<br />
Klages: <strong>Der</strong> Vereinssport der Zukunft ist noch mehr als<br />
früher und gegenwärtig auf ein „Mehr“ an Zusammenarbeit<br />
angewiesen. Es besteht zudem ein hoher Bedarf<br />
an strategischerem Vorgehen. Sportvereine müssen netzwerk-<br />
und strategiefähiger werden. Das sind anspruchsvolle<br />
Aufgaben, an denen jedoch kein Weg vorbeigeht.<br />
Die Berichte aus den Arbeitskreisen haben diese beiden<br />
Ansätze sehr deutlich herausgearbeitet. Ein „Mehr“ an<br />
Zusammenarbeit erweitert die Perspektiven und damit<br />
die Handlungsmöglichkeiten der Sportvereine vor Ort mit<br />
ihren alltäglichen Aufgaben und Problemen. Wir haben
www.in-Quadro.it<br />
ww ww.in-Quadro.it<br />
WO DER SP SPORT T ZUHAUSE<br />
IST IIST<br />
T<br />
OR<br />
www.olympiapark.de<br />
www www.olympiapark.de<br />
w olympiapark.de kk.de de<br />
MÜNCHEN TICKET<br />
Tel.: 0180 54 81 81 811<br />
(0,14 EUR/Min. aus dem dt. Festnetz,<br />
Mobilfunk max. 0,42 EUR/Min.)<br />
www.muenchenticket.de .de<br />
OLYMPIAPARK<br />
OLY<br />
YMPIAPA<br />
A R RK<br />
MMÜNCHEN<br />
ÜNCHEN<br />
Freizeit FFreizeit<br />
i it in i der d Stadt St dt
Deutschlands<br />
Sportförderer Nummer 1.<br />
Sport verbindet. Er stärkt den Zusammenhalt und schafft Vorbilder. Die Sparkassen-Finanzgruppe ist Deutschlands<br />
Sportförderer Nummer 1. Sparkassen engagieren sich regional wie national. Als Partner <strong>des</strong> <strong>Deutsche</strong>n <strong>Olympische</strong>n<br />
Sportbun<strong>des</strong> ist die Sparkassen-Finanzgruppe im Breiten- und im Spitzensport aktiv und setzt besondere Schwerpunkte<br />
in der Nachwuchsförderung. Das ist gut für den Sport und gut für Deutschland. www.gut-fuer-deutschland.de<br />
Sparkassen. Gut für Deutschland.<br />
S
Bilanz und Ausblick<br />
Kongress „Starker Sport – starke Kommunen“ am 5. und 6. März 2010 in München<br />
in allen Arbeitskreisen viele positive Beispiele für zeitgemäße<br />
und innovative Formen der Vereinsentwicklung<br />
und der Zusammenarbeit von Sportvereinen und Kommunen<br />
aufgearbeitet. Wir fangen somit nicht bei Null<br />
an. Insofern war es auch wichtig, im Kongress die vorhandenen<br />
positiven Ansätze zu bilanzieren.<br />
Wir müssen auch akzeptieren, dass wir – Kommunen<br />
und Sportorganisationen – gelegentlich Interessenunterschiede<br />
haben. Dann ist es doppelt notwendig, miteinander<br />
zu reden.<br />
Apropos „miteinander reden“: Eine kreative Zusammenarbeit<br />
ist immer auch abhängig von einer Vertrauensbasis<br />
zwischen beteiligten Personen. Gestern und heute wurden<br />
viele Kontakte geknüpft, andere aufgebaut. Auch das<br />
ist ein Impuls dieses <strong>Kongresses</strong> – konkrete Netzwerkarbeit!<br />
Sander p Stucke: Und abschließend, Herr Stucke<br />
aus der Sicht <strong>des</strong> <strong>Deutsche</strong>n Städtetages. Welcher<br />
Aspekt ist ihnen ganz besonders wichtig gewesen?<br />
Stucke: Herr Ude hat die Gemeinsamkeiten, aber auch<br />
die noch nicht abgearbeiteten Schnittstellen zwischen<br />
organisiertem Sport und Kommunen gestern herausgearbeitet.<br />
Wir nehmen diesen Kongress und seine Ergebnisse<br />
zum einen natürlich mit in unsere Verbände und<br />
besonders in die vielfältigen Politikfelder hinein, mit<br />
denen der Sport verwoben ist.<br />
Aus einzelnen Arbeitskreisen habe ich die Erkenntnis<br />
mitgenommen, dass diese Themen – vielleicht nicht mit<br />
diesem Aufwand – in vertiefter Form z.B. in Tagesworkshops<br />
– weiter vorangetrieben werden sollten. Die Beispiele<br />
aus der Praxis zeigen, dass Vieles geht – eine Voraussetzung<br />
muss allerdings stimmen, die Menschen aus<br />
dem organisierten Sport und der Kommunalpolitik und –<br />
verwaltung müssen gemeinsam wollen. Wenn die Chemie<br />
zwischen Sportamtsleiter, Stadtsportbundvorsitzendem<br />
und Vorsitzender <strong>des</strong> Sportausschusses in einer Stadt<br />
stimmt, dann ist dies schon die halbe Miete. Wir nehmen<br />
die Ermunterung mit, an den vielen Baustellen rund um<br />
den Sport weiterzuarbeiten, neben dem organisierten<br />
Sport auch den nichtorganisierten Sport im Auge zu behalten<br />
und die Potenziale <strong>des</strong> Sports für die Bürgergesellschaft<br />
in unseren Städten und Gemeinden zu nutzen.<br />
Sander an alle Herren: Zum Abschluss ein kleines<br />
Gedanken-Spiel: Wenn eine Wunschfee vorbeikommen<br />
würde und die hätte für jeden von ihnen<br />
einen Wunsch. Einen Wunsch für die Zukunft,<br />
Herr Klages welchen Wunsch hätten sie?<br />
Klages: Ich habe einen Wunsch an die Kommunen und<br />
würde da anknüpfen, wo Niclas Stucke aufgehört hat.<br />
Ich wünsche mir von den Kommunen, dass der Sport<br />
ein selbstverständlicher Gegenstand der Arbeit in allen<br />
kommunalen Politikfeldern und allen Ämtern wird, im<br />
Gesundheitsamt, bei den Integrationsstellen, im Seniorenbeirat,<br />
etc. Ich glaube, das würde die Handlungsmöglichkeiten<br />
der Vereine und der Kommunen erweitern.<br />
Sander p Stucke: Wie sieht ihr Wunsch aus,<br />
Herr Stucke?<br />
Stucke: Wenn wir etwas mehr Geld hätten, würde dies<br />
auch helfen. Viele im Saal wären enttäuscht, wenn ein<br />
Vertreter der kommunalen Spitzenverbände dies nicht auch<br />
klar sagen würde. Guter Wille bringt eine Menge, die finanzielle<br />
Unterfütterung kann aber auch nicht schaden.<br />
Sander p Behacker: Was wünschen Sie sich außer<br />
mehr Geld?<br />
Ich wünsche mir, dass der Sport in allen Kommunen in<br />
Deutschland als wichtiger Bestandteil der Stadtentwicklung<br />
anerkannt ist und dass er sich mit seinem Wert für<br />
die Stadtgesellschaft in allen Entscheidungen der Stadtspitze<br />
widerspiegelt.<br />
I 183
Kongressbild<br />
184 I
I 185
SCHENKEN SIE IHREM LIEBLINGS-<br />
KINDERGARTEN IHRE STIMME!<br />
IMMY BEW<br />
150 TRIMMY-BEWEGUNGSPARCOURS ZU VERGEBEN!<br />
Mehr Bewegung für unsere Kinder!<br />
Die Molkerei Alois Müller und der <strong>Deutsche</strong> <strong>Olympische</strong> Sportbund<br />
statten im Rahmen ihrer erfolgreichen Aktion „Müller® bewegt Kinder“<br />
Kindergärten mit einem eigenen Trimmy-Bewegungs parcours aus.<br />
Wir gratulieren den 150 Gewinner-Kindergärten 2010!<br />
Insgesamt haben sich in diesem Jahr knapp 1.300 Kindergärten um<br />
einen Müller® Trimmy-Bewegungsparcours beworben. Tatkräftig unterstützt<br />
wurden sie dabei von Eltern, Freunden und Verwandten mit über<br />
1,7 Millionen abegebenen Stimmen.<br />
Auch 2011 werden wieder Müller® Trimmy-Bewegungsparcours vergeben!<br />
Ab November 2010 haben wieder alle Kindergärten in Deutschland die<br />
Chance, sich um einen Müller® Trimmy-Bewegungsparcours zu bewerben.<br />
INFORMIEREN SIE SICH<br />
UNTER WWW.TRIMMY.DE<br />
Eine Initiative der Molkerei Alois Müller GmbH & Co. KG und <strong>des</strong> <strong>Deutsche</strong>n<br />
<strong>Olympische</strong>n Sportbun<strong>des</strong> (DOSB)
Kooperationsvereinbarung<br />
Starker Sport – starke Städte und Gemeinden<br />
I 187
Kooperationsvereinbarung<br />
Starker Sport – starke Städte und Gemeinden<br />
188 I
I 189
Kooperationsvereinbarung<br />
Starker Sport – starke Städte und Gemeinden<br />
190 I
I 191
Kooperationsvereinbarung<br />
Starker Sport – starke Städte und Gemeinden<br />
192 I
I 193
Kooperationsvereinbarung<br />
Starker Sport – starke Städte und Gemeinden<br />
194 I
I 195
Kooperationsvereinbarung<br />
Starker Sport – starke Städte und Gemeinden<br />
196 I
I 197
Kooperationsvereinbarung<br />
Starker Sport – starke Städte und Gemeinden<br />
198 I
I 199
Erklärung <strong>des</strong> Präsidiums <strong>des</strong> DOSB<br />
33. Sitzung <strong>des</strong> DOSB-Präsidiums am 9. März 2010 in Frankfurt/Main<br />
DOSB fordert starke Finanzausstattung der Kommunen<br />
Vizepräsident Walter Schneeloch berichtete vom Kongress<br />
„Starker Sport – starke Kommunen“ am vergangenen<br />
Wochenende in München. Mit 450 Teilnehmern erlebte<br />
dieser eine überwältigende Resonanz. 150 Interessenten<br />
mussten zurückgewiesen werden, weil der Kongress ausgebucht<br />
war. <strong>Der</strong> Teilnehmerkreis setzte sich nicht nur<br />
aus Vertretern/innen von Sportorganisationen zusammen,<br />
sondern umfasste zahlreiche Experten aus Stadt- und<br />
Gemeindeverwaltungen und aus der Sportwissenschaft.<br />
In zwölf von der Führungsakademie moderierten Arbeitskreisen<br />
wurden die Themen <strong>des</strong> <strong>Kongresses</strong> diskutiert.<br />
Eine <strong>Dokumentation</strong> der Veranstaltung soll im Sommer<br />
veröffentlicht werden.<br />
In diesem Zusammenhang sprach Walter Schneeloch auch<br />
die im Rahmen <strong>des</strong> <strong>Kongresses</strong> erörterten Probleme der<br />
kommunalen Finanzen an, die fatale Auswirkungen auf<br />
die Arbeit der Sportvereine Vorort zu haben drohen. Das<br />
DOSB-Präsidium appellierte daher an Bund und Länder,<br />
die finanzielle Handlungsfähigkeit der Kommunen sicher-<br />
200 I<br />
zustellen, eine den kommunalen Aufgaben gerechte Finanzausstattung<br />
zu gewährleisten und in den Beratungen<br />
der geplanten Kommission zu den Gemeindefinanzen<br />
der herausragenden gesellschaftspolitischen Bedeutung<br />
<strong>des</strong> Vereinssports für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft<br />
Rechnung zu tragen.<br />
Erklärung:<br />
Sport im Verein ist ein unverzichtbares Element unserer<br />
Gesellschaft, wenn es beispielsweise um Bildung, Gesundheit<br />
und Integration geht. Ihm kommt eine zentrale<br />
Bedeutung für das Gemeinwohl in Deutschland und –<br />
angesichts eines beschleunigten sozialen Wandels – eine<br />
zentrale gesellschaftliche Integrationsfunktion zu. Er<br />
spielt in den Städten und Gemeinden mit seiner Vielfalt<br />
und seinen zahlreichen Bezügen zu anderen kommunalen<br />
Handlungsfeldern eine zentrale Rolle und ist ein ge-
wichtiger Bestandteil der kommunalen Daseinsvorsorge.<br />
Aufgrund dieser herausragenden gesellschafts- und<br />
kommunalpolitischen Bedeutung <strong>des</strong> Sports fördern die<br />
Kommunen in Deutschland den Sport. Rund 80 % der<br />
Sportförderung in Deutschland ist kommunale Sportförderung<br />
– dies entspricht über 3 Mrd. EUR jährlich.<br />
Die Folgen der Finanz- und Wirtschaftskrise werden zunehmend<br />
in den Kommunen spürbar. Ein Teil der Städte<br />
und Gemeinden droht handlungsunfähig zu werden, die<br />
bereits seit Jahren bestehenden strukturellen Finanzprobleme<br />
vieler Kommunen werden noch verstärkt. Rekorddefizite<br />
in zweistelliger Milliardenhöhe, eine explodierende<br />
Verschuldung durch kurzfristige Kredite, der stärkste<br />
Steuerrückgang seit Jahrzehnten und steigende Sozialausgaben<br />
kennzeichnen die Situation, die eine angemessene<br />
Sportförderung und damit den gesellschaftspolitischen<br />
Mehrwert <strong>des</strong> Sports in hohem Maße gefährdet. <strong>Der</strong><br />
<strong>Deutsche</strong> <strong>Olympische</strong> Sportbund blickt daher mit Sorge<br />
auf die Verschlechterung der kommunalen Einnahmesituation,<br />
auf die strukturelle Unterdeckung der örtlichen<br />
Haushalte und darauf, dass staatliche Aufgaben immer<br />
mehr auf die Kommunen übertragen werden.<br />
Eine Krise der Kommunalfinanzen bedroht auch den Sport<br />
im Verein. <strong>Der</strong> kommunale Investitionsstau von 700 Milliarden<br />
Euro droht, sich weiter zu verschärfen. Das Konjunkturpaket<br />
II verschafft dem Sport und den Sportvereinen<br />
insgesamt zwar Spielraum, doch werden die Fragezeichen<br />
immer größer, was von 2011 an mit der kommunalen<br />
Sportförderung wird. Auf den Sanierungsbedarf im Bereich<br />
Sportstätten von mind. 42 Mrd. EUR wird ausdrücklich<br />
hingewiesen.<br />
„Wir brauchen eine gemeinsame Vorwärtsstrategie und<br />
mehr Kreativität in der Zusammenarbeit, Kommunalpolitik,<br />
Verwaltung und Sportorganisationen“, hatte Münchens<br />
Oberbürgermeister Christian Ude auf dem Kongress am<br />
vergangenen Wochenende festgestellt. DOSB-Präsident<br />
Thomas Bach sagte bei dieser Gelegenheit: „Ein starker<br />
Sport macht Städte und Gemeinden stark und zu Orten<br />
mit hoher Lebensqualität. <strong>Der</strong> Sport verkörpert vielfältige<br />
Potenziale für wichtige kommunale Themen und ist ein<br />
Politikfeld von zentraler Bedeutung“.<br />
<strong>Der</strong> DOSB unterstützt mit seinen über 91.000 Vereinen<br />
die Forderung der kommunalen Spitzenverbände nach<br />
einer angemessenen und nachhaltigen Finanzausstattung.<br />
<strong>Der</strong> organisierte Sport braucht finanzstarke Kommunen.<br />
Die Kommunen brauchen einen starken Partner Sport.<br />
Deshalb fordert der DOSB Bund und Länder dringend auf<br />
1. die finanzielle Handlungsfähigkeit der<br />
Kommunen ist sicherzustellen,<br />
2. eine den kommunalen Aufgaben gerechte<br />
Finanzausstattung zu gewährleisten,<br />
3. und in den Beratungen der geplanten Kommis-<br />
sion zu den Gemeindefinanzen der herausragenden<br />
gesellschaftspolitischen Bedeutung <strong>des</strong><br />
Vereinssports für den Zusammenhalt unserer<br />
Gesellschaft Rechnung zu tragen.<br />
I 201
Presse<br />
GEMEINSAME PRESSEMITTEILUNG DOSB, DST UND DSTGB<br />
Neue Impulse für die Sportentwicklung in Deutschland<br />
durch Vernetzung und Kooperation<br />
Kongress „Starker Sport – starke<br />
Kommunen“ in München<br />
Die Städte und Gemeinden und Sportvereine wollen ihre<br />
Zusammenarbeit ausbauen und ihre Angebote besser<br />
vernetzen. Neue Impulse dazu werden beim Kongress<br />
„Starker Sport – starke Kommunen“ heute und morgen<br />
in München diskutiert.<br />
„Ein starker Sport macht Städte und Gemeinden stark<br />
und zu Orten mit hoher Lebensqualität. <strong>Der</strong> Sport verkörpert<br />
vielfältige Potenziale für wichtige kommunale<br />
Themen und ist ein Politikfeld von zentraler Bedeutung“.<br />
202 I<br />
Mit diesen Worten eröffnete der Präsident <strong>des</strong> <strong>Deutsche</strong>n<br />
<strong>Olympische</strong>n Sportbun<strong>des</strong>, Dr. Thomas Bach den<br />
Kongress „Starker Sport – starke Kommunen“. „Im<br />
Interesse der Sportvereine und der Kommunen gleichermaßen<br />
braucht Deutschland eine demonstrative Sportfreundlichkeit<br />
vor Ort“, so Bach weiter.<br />
<strong>Der</strong> Oberbürgermeister der Lan<strong>des</strong>hauptstadt München<br />
und Vizepräsident <strong>des</strong> <strong>Deutsche</strong>n Städtetages, Christian<br />
Ude, betonte in seiner Rede den elementaren Beitrag <strong>des</strong><br />
Sports für das Gemeinwohl. „Sport ist ein unverzichtbares<br />
Element unserer Gesellschaft, wenn es beispielsweise
um Bildung, Gesundheit und Integration geht. Die Kommunen<br />
fördern den organisierten Sport jährlich mit über<br />
3 Milliarden Euro, das sind rund 80 Prozent der öffentlichen<br />
Sportförderung insgesamt. Wir brauchen eine gemeinsame<br />
Vorwärtsstrategie und mehr Kreativität in der<br />
Zusammenarbeit zwischen Kommunalpolitik, Verwaltung<br />
und Sportorganisationen“, so Ude weiter.<br />
Am Kongress, gemeinsam vom <strong>Deutsche</strong>n <strong>Olympische</strong>n<br />
Sportbund, dem <strong>Deutsche</strong>n Städtetag und dem <strong>Deutsche</strong>n<br />
Städte- und Gemeindebund veranstaltet, nehmen mehr<br />
als 400 Vertreterinnen und Vertreter aus dem organisierten<br />
Sport sowie der kommunalen Sportpolitik und -verwaltung<br />
teil. In zwölf thematischen Arbeitskreisen werden<br />
Perspektiven und neue Wege für eine zukunftsfähige<br />
Partnerschaft erarbeitet. Zu den Themen gehören hierbei<br />
beispielsweise: Integration durch Sport, Sportgroßveranstaltungen,<br />
bürgerschaftliches Engagement im Sport,<br />
Sport und Gesundheitsförderung, Ganztagsschule und<br />
Sportvereine sowie Sportstätten der Zukunft. In allen<br />
Arbeitskreisen wurde deutlich, dass ein „Mehr“ an Kooperation<br />
und Partnerschaft die Handlungsfähigkeit der<br />
Sportvereine und der Kommunen gleichermaßen steigert.<br />
Dies bestätigte auch der Präsident <strong>des</strong> <strong>Deutsche</strong>n Sparkassen-<br />
und Giroverban<strong>des</strong>, Heinrich Haasis: „Sport begeistert<br />
die Menschen. Wer sportlich aktiv ist, tut etwas<br />
für seine Gesundheit. Wer Kinder und Jugendliche im<br />
Sportverein trainiert, leistet einen wichtigen Beitrag zur<br />
Persönlichkeitsbildung und Teamfähigkeit junger Menschen“.<br />
Haasis verwies darauf, dass die Sparkassen der<br />
größte nicht-staatliche Sportförderer in Deutschland sind<br />
und würdigte die Olympiapartnerschaft der Sparkassen-<br />
Gruppe, die seit Herbst 2009 auch Nationaler Förderer<br />
der Olympiabewerbung München 2018 ist.<br />
Die Vorträge, Referate und Ergebnisse der Arbeitskreise<br />
<strong>des</strong> <strong>Kongresses</strong> werden in einer <strong>Dokumentation</strong> im<br />
Sommer 2010 veröffentlicht.<br />
I 203
Presse<br />
GEMEINSAME PRESSEMITTEILUNG VON STÄDTETAG NRW, STÄDTE- UND GEMEINDEBUND NRW<br />
SOWIE LANDESSPORTBUND NRW VOM 13. MÄRZ 2010<br />
Kooperationsvereinbarung von Kommunen und Sport<br />
Die nordrhein-westfälischen Städte und Gemeinden sowie<br />
der Lan<strong>des</strong>SportBund Nordrhein-Westfalen werden ihre<br />
Zusammenarbeit ausbauen. <strong>Der</strong> Präsident <strong>des</strong> Städte- und<br />
Gemeindebun<strong>des</strong> Nordrhein-Westfalen, der Bergkamener<br />
Bürgermeister Roland Schäfer, der Vorsitzende <strong>des</strong> Städtetages<br />
Nordrhein-Westfalen, der Mönchengladbacher<br />
Oberbürgermeister Norbert Bude, und Walter Schneeloch,<br />
Präsident <strong>des</strong> Lan<strong>des</strong>SportBun<strong>des</strong> Nordrhein-Westfalen,<br />
unterzeichneten heute in Düsseldorf eine Kooperationsvereinbarung,<br />
die unter anderem vorsieht, gemeinsame<br />
Veranstaltungen zur kommunalen Sportpolitik zu initiieren<br />
sowie gemeinsam abgestimmte Interessen gegenüber<br />
Dritten zu vertreten.<br />
In der Vereinbarung mit dem Titel „Starker Sport –<br />
starke Städte und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen“<br />
werden die zentrale Rolle der kommunalen Sportpolitik<br />
herausgestellt und konkrete Handlungsempfehlungen<br />
für die künftige Zusammenarbeit der drei Verbände beschrieben.<br />
Kommunen und der organisierte Sport werden<br />
sich rechtzeitig gegenseitig über sportpolitische Aktivitäten<br />
in Nordrhein-Westfalen informieren, an Planungen<br />
beteiligen und die Mitwirkung an Entscheidungen gegenseitig<br />
sicherstellen. Die Vereinbarung baut auf einem<br />
entsprechenden Abkommen auf Bun<strong>des</strong>ebene auf und<br />
berücksichtigt die besonderen Rahmenbedingungen im<br />
Land Nordrhein-Westfalen.
Die herausragende Rolle <strong>des</strong> organisierten Sports mit<br />
fünf Millionen Mitgliedschaften in 20.000 Sportvereinen<br />
ist nach Ansicht von Walter Schneeloch unverzichtbarer<br />
Teil kommunaler Sportpolitik: „Basis für eine gedeihliche<br />
kommunale Sportpolitik ist die enge Zusammenarbeit<br />
zwischen den ehrenamtlich geführten Vereinen und den<br />
kommunalen Entscheidungsträgern. Die Ehrenamtlichen<br />
sind dabei nicht nur auf eine gute Versorgung mit Sportstätten<br />
angewiesen, sie benötigen Planungs- und Handlungssicherheit,<br />
sie müssen auf verlässliche Partner bauen<br />
können, entbürokratisierte Kooperationsstrukturen sowie<br />
zeitgemäße und angemessene Anerkennung.“<br />
<strong>Der</strong> Vorsitzende <strong>des</strong> Städtetages Nordrhein-Westfalen,<br />
Oberbürgermeister Norbert Bude aus Mönchengladbach,<br />
betonte: „Kommunen und organisierter Sport sind sich<br />
einig, dass die Zusammenarbeit zwischen dem organisierten<br />
Vereinssport und der kommunalen Politik weiterentwickelt<br />
und ausgebaut werden muss. Sport ist ein unverzichtbares<br />
Element unserer Gesellschaft und gehört<br />
dazu, wenn beispielsweise Bildungs- und Freizeitangebote<br />
für Kinder und Jugendliche geplant werden, wenn<br />
es um Gesundheitsprävention oder den Umweltschutz<br />
geht. Er ist ein wesentlicher Bestandteil einer integrierten<br />
Stadtentwicklung.“<br />
Auf die vielfältigen Integrationspotenziale <strong>des</strong> Sports wies<br />
der Präsident <strong>des</strong> Städte- und Gemeindebun<strong>des</strong> Nordrhein-Westfalen,<br />
Roland Schäfer, hin: „Sportvereine verfügen<br />
über zielgruppenorientierte vielfältige Programme<br />
und Angebote für Kinder und Jugendliche, Frauen und<br />
Mädchen, Familien, Ältere und Senioren, Migrantinnen<br />
und Migranten, Menschen mit Behinderungen und sind<br />
so Teil der kommunalen Daseinsvorsorge. Sportvereine<br />
sind wichtige soziale Begegnungsstätten, die für alle gesellschaftlichen<br />
Gruppen generationenübergreifend offen<br />
sind und vielfältige nachhaltige Potentiale der sozialen,<br />
kulturellen und alltagspolitischen Integration bieten.“
Presse<br />
PRESSEMITTEILUNG DOSB, 9. MÄRZ 2010<br />
Krise in Kommunen bedroht auch den Sport<br />
Das DOSB-Präsidium befasste sich am Dienstag<br />
mit den Ergebnissen <strong>des</strong> von DOSB und den kommunalen<br />
Spitzenverbänden gemeinsam veranstalteten<br />
<strong>Kongresses</strong> „Starke Städte – starker Sport“.<br />
Nach dem am vergangenen Wochenende in München<br />
ausgerichteten Kongress hat das DOSB-Präsidium<br />
einen Appell an Bund und Länder gerichtet:<br />
Sport im Verein ist ein unverzichtbares Element unserer<br />
Gesellschaft, wenn es beispielsweise um Bildung, Gesundheit<br />
und Integration geht. Ihm kommt eine zentrale<br />
Bedeutung für das Gemeinwohl in Deutschland und –<br />
angesichts eines beschleunigten sozialen Wandels – eine<br />
zentrale gesellschaftliche Integrationsfunktion zu. Er<br />
spielt in den Städten und Gemeinden mit seiner Vielfalt<br />
und seinen zahlreichen Bezügen zu anderen kommunalen<br />
Handlungsfeldern eine zentrale Rolle und ist ein gewichtiger<br />
Bestandteil der kommunalen Daseinsvorsorge.<br />
206 I<br />
Aufgrund dieser herausragenden gesellschafts- und kommunalpolitischen<br />
Bedeutung <strong>des</strong> Sports fördern die<br />
Kommunen den Sport. Rund 80 Prozent der Sportförderung<br />
in Deutschland ist kommunale Sportförderung –<br />
dies entspricht über drei Milliarden Euro jährlich.<br />
Die Folgen der Finanz- und Wirtschaftskrise werden zunehmend<br />
in den Kommunen spürbar. Ein Teil der Städte<br />
und Gemeinden droht handlungsunfähig zu werden,<br />
die bereits seit Jahren bestehenden strukturellen Finanzprobleme<br />
vieler Kommunen werden noch verstärkt.<br />
Rekorddefizite in zweistelliger Milliardenhöhe, eine explodierende<br />
Verschuldung durch kurzfristige Kredite,<br />
der stärkste Steuerrückgang seit Jahrzehnten und steigende<br />
Sozialausgaben kennzeichnen die Situation, die<br />
eine angemessene Sportförderung und damit den gesellschaftspolitischen<br />
Mehrwert <strong>des</strong> Sports in hohem Maße<br />
gefährdet. <strong>Der</strong> <strong>Deutsche</strong> <strong>Olympische</strong> Sportbund blickt<br />
daher mit Sorge auf die Verschlechterung der kommunalen<br />
Einnahmesituation, auf die strukturelle Unterdeckung<br />
der örtlichen Haushalte und darauf, dass staatliche Aufgaben<br />
immer mehr auf die Kommunen übertragen werden.<br />
Eine Krise der Kommunalfinanzen bedroht auch den<br />
Sport im Verein. <strong>Der</strong> kommunale Investitionsstau von<br />
700 Milliarden Euro droht, sich weiter zu verschärfen.<br />
Das Konjunkturpaket II verschafft dem Sport und den<br />
Sportvereinen insgesamt zwar Spielraum, doch werden<br />
die Fragezeichen immer größer, was von 2011 an mit<br />
der kommunalen Sportförderung wird. Auf den Sanierungsbedarf<br />
im Bereich Sportstätten von mind. 42 Mrd.<br />
EUR wird ausdrücklich hingewiesen.<br />
„Wir brauchen eine gemeinsame Vorwärtsstrategie<br />
und mehr Kreativität in der Zusammenarbeit, Kommunal-
politik, Verwaltung und Sportorganisationen“, hatte<br />
Münchens Oberbürgermeister Christian Ude auf dem<br />
Kongress am vergangenen Wochenende festgestellt.<br />
DOSB-Präsident Thomas Bach sagte bei dieser Gelegenheit:<br />
„Ein starker Sport macht Städte und Gemeinden<br />
stark und zu Orten mit hoher Lebensqualität. <strong>Der</strong> Sport<br />
verkörpert vielfältige Potenziale für wichtige kommunale<br />
Themen und ist ein Politikfeld von zentraler Bedeutung.“<br />
<strong>Der</strong> DOSB unterstützt mit seinen über 91.000 Vereinen<br />
die Forderung der kommunalen Spitzenverbände nach<br />
einer angemessenen und nachhaltigen Finanzausstattung.<br />
<strong>Der</strong> organisierte Sport braucht finanzstarke Kommunen.<br />
Die Kommunen brauchen einen starken Partner Sport.<br />
PRESSEMITTEILUNG DOSB, 10. MÄRZ 2010<br />
Kommunen und Sportvereine stehen gemeinsam<br />
vor vielfältigen Herausforderungen, für die es weder<br />
Patentrezepte noch Königswege gibt.<br />
Aber: Ein „Mehr“ an Kooperation und Partnerschaft<br />
zwischen den Sportvereinen und den Kommunen macht<br />
die Sportorganisationen und die Gebietskörperschaften<br />
handlungs- und zukunftsfähiger. Das ist eine Erkenntnis<br />
aus dem Kongress „Starker Sport – starke Kommunen<br />
am 5. und 6. März in München. „Im Interesse der Sportvereine<br />
und der Kommunen gleichermaßen braucht<br />
Deutschland eine demonstrative Sportfreundlichkeit vor<br />
Ort“, sagte der Präsident <strong>des</strong> <strong>Deutsche</strong>n <strong>Olympische</strong>n<br />
Sportbun<strong>des</strong>, Thomas Bach, zu Eröffnung. „Ein starker<br />
Sport macht Städte und Gemeinden stark und zu Orten<br />
mit hoher Lebensqualität“, so Bach weiter. „<strong>Der</strong> Sport<br />
verkörpert vielfältige Potenziale für wichtige kommunale<br />
Themen und ist ein Politikfeld von zentraler Bedeutung.“<br />
Deshalb fordert der DOSB Bund und Länder dringend auf:<br />
1. die finanzielle Handlungsfähigkeit der<br />
Kommunen sicherzustellen,<br />
2. eine den kommunalen Aufgaben gerechte<br />
Finanzausstattung zu gewährleisten und<br />
3. in den Beratungen der geplanten Kommission<br />
zu den Gemeindefinanzen der herausragenden<br />
gesellschaftspolitischen Bedeutung <strong>des</strong> Vereinssports<br />
für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft<br />
Rechnung zu tragen.<br />
„Wir brauchen demonstrative Sportfreundlichkeit vor Ort“<br />
<strong>Der</strong> Oberbürgermeister der Lan<strong>des</strong>hauptstadt München<br />
und Vizepräsident <strong>des</strong> <strong>Deutsche</strong>n Städtetages, Christian<br />
Ude, betonte den elementaren Beitrag <strong>des</strong> Sports für das<br />
Gemeinwohl. „Sport ist ein unverzichtbares Element unserer<br />
Gesellschaft, wenn es beispielsweise um Bildung,<br />
Gesundheit und Integration geht. Die Kommunen fördern<br />
den organisierten Sport jährlich mit über 3 Milliarden<br />
Euro, das sind rund 80 Prozent der öffentlichen Sportförderung<br />
insgesamt. Wir brauchen eine gemeinsame Vorwärtsstrategie<br />
und mehr Kreativität in der Zusammenarbeit<br />
zwischen Kommunalpolitik, Verwaltung und Sportorganisationen“,<br />
so Ude weiter.<br />
Am Kongress, gemeinsam vom <strong>Deutsche</strong>n <strong>Olympische</strong>n<br />
Sportbund, dem <strong>Deutsche</strong>n Städtetag und dem <strong>Deutsche</strong>n<br />
Städte- und Gemeindebund veranstaltet, nahmen mehr<br />
als 400 Vertreterinnen und Vertreter aus dem organisier-<br />
I 207
Presse<br />
ten Sport sowie der kommunalen Sportpolitik und Sportverwaltung<br />
teil. In zwölf thematischen Arbeitskreisen<br />
wurden Perspektiven und neue Wege für eine zukunftsfähige<br />
Partnerschaft erarbeitet.<br />
In den über 50 Einzelvorträgen und Praxisbeispielen wurden<br />
vielfältige Impulse, Anregungen und Perspektiven<br />
für eine neue und intensivere Form der Kooperation vorgestellt<br />
und diskutiert. Ob gemeinsame sportpolitische<br />
Plattformen vor Ort, konkrete thematische Netzwerke<br />
zwischen Vereinen, Ärztekammern und Gesundheitsämtern<br />
im Bereich „Sport und Gesundheit“ bis zu Kooperationsvereinbarungen<br />
auf Lan<strong>des</strong>ebene zwischen Lan<strong>des</strong>sportbünden<br />
und den entsprechenden kommunalen Spitzenverbänden<br />
reicht die Bandbreite dieser für den Sport<br />
bedeutsamen Schnittstelle.<br />
<strong>Der</strong> zuständige DOSB-Ressortleiter Andreas Klages bilanzierte<br />
nach zwei intensiven Kongresstagen: „Erstmals<br />
seit Gründung der Bun<strong>des</strong>republik Deutschland wurde die<br />
für die Sport- und Vereinsentwicklung so wichtige Nahtstelle<br />
<strong>des</strong> Sports vor Ort in einem Kongressformat auf<br />
den Prüfstand gestellt. <strong>Der</strong> Kongress war bereits kurz nach<br />
der Ausschreibung ausgebucht, Teilnehmer aus mehreren<br />
europäischen Ländern besuchten den Kongress, es gab<br />
eine sehr hohe Dynamik und eine Fülle von Impulsen<br />
und Anregungen für die Zukunft. Ich habe den Eindruck,<br />
dass wir in vielen Bereichen erst am Beginn einer systematischen<br />
und strategisch ausgerichteten Kooperation<br />
und Netzwerkbildung stehen. Wir können durch eine<br />
intensivere Zusammenarbeit zwischen Vereinen und<br />
Kommunen noch viele Potenziale für eine zukunftsorientierte<br />
Sport- und Vereinsentwicklung erschließen.“
DOSB-PRESSEMITTEILUNG NR. 12 VOM 23. MÄRZ 2010, KOMMENTAR, PROF. DR. DETLEF KUHLMANN<br />
Auf dem Wege zu demonstrativer<br />
Sportfreundlichkeit vor Ort<br />
Neulich beim bun<strong>des</strong>weiten Kongress „Starker Sport –<br />
starke Kommunen“ <strong>des</strong> <strong>Deutsche</strong>n <strong>Olympische</strong>n Sportbun<strong>des</strong><br />
(DOSB) in München wurde wieder das Lied vom<br />
Sport als unverzichtbares Element unserer Gesellschaft<br />
gesungen. <strong>Der</strong> Sport ist ein unaustauschbares Kulturgut<br />
unserer Zeit. Er stärkt das kommunale Leben in den<br />
Städten und Gemeinden.<br />
Mag sein, dass auch und gerade in der gegenwärtig angespannten<br />
Situation ein Mehr an Partnerschaft zwischen<br />
Sportorganisationen und kommunalen Einrichtungen<br />
vonnöten ist. Das war zumin<strong>des</strong>t eine wichtige Botschaft,<br />
die aus München kommend nun die Runde macht. Was<br />
sie bewirkt, bleibt abzuwarten. Denn aus guten Worten<br />
müssen erst noch gute Taten folgen, die sichtbar machen,<br />
wo in dieser Partnerschaft tatsächlich Schwächen geschwächt<br />
und Stärken gestärkt werden.<br />
Ein starkes Wort hat der Präsident <strong>des</strong> DOSB bei diesem<br />
Kongress geprägt, als er schon bei der Eröffnung dazu<br />
aufrief: „Deutschland braucht eine demonstrative Sportfreundlichkeit<br />
vor Ort“. Dieser Appell betrifft uns alle<br />
„vor Ort“ und kann nur lokal greifen. Anfangen kann<br />
man demzufolge überall – eben „vor Ort“. Wer wollte<br />
sich diesem freundlichen Anliegen nicht gleich freudig<br />
anschließen?<br />
Das Wort von Thomas Bach könnte glatt als neuer plakativer<br />
Slogan taugen. Es lässt sich in Alltags- und Sonntagsreden<br />
wunderbar einstreuen und jeweils „vor Ort“<br />
herrlich ausmalen. Die demonstrative Basis für Sportfreundlichkeit<br />
besteht aus den aktuell genau 27.553.516<br />
Mitgliedschaften in den 90.897 Sportvereinen, die es<br />
„vor Ort“ im ganzen Land gibt. Sie alle können tagtäg-<br />
lich mit all ihren Angeboten und beim Drumherum ihre<br />
Sportfreundlichkeit demonstrieren. Ob diese dann auch<br />
von anderen als solche wahrgenommen wird, das ist eine<br />
ganz andere Sache und hängt nicht zuletzt von den Kommunen<br />
als sportfreundlicher Partner ab.<br />
Insofern ist es – Krisen der Kommunen hin oder her –<br />
beruhigend zu wissen, dass die Städte und Gemeinden,<br />
die sportpolitisch etwas auf sich halten, längst Sportfreundlichkeit<br />
dadurch beweisen, indem sie neuerdings<br />
Sportentwicklungspläne, Leitbilder für den Sport, Förderrichtlinien<br />
oder wie immer die oft buchdicken Konzepte<br />
auch heißen, als verbale Bekenntnisse erstellt haben oder<br />
von Experten haben anfertigen lassen. Als jüngster Referenztext<br />
kann der Oldenburger Sportentwicklungsplan<br />
gelten, an dem übrigens federführend mit Prof. Jürgen<br />
Dieckert, dem emeritierten Sportwissenschaftler und Ehrenpräsidenten<br />
<strong>des</strong> <strong>Deutsche</strong>n Turnerbun<strong>des</strong>, auch einer<br />
der geistigen Väter der Trimm-Dich-Bewegung mitgewirkt<br />
hat. Oldenburg will – so ist im 250-Seiten-Papier<br />
ganz gut nachzulesen – die Vision von der „sportfreundlichen<br />
Stadt“ Wirklichkeit werden lassen. Wenn diesem<br />
Beispiel viele weitere „vor Ort“ folgen, ja dann könnte<br />
es im Schulterschluss mit den kommunalen Partnern irgendwann<br />
schließlich einmal heißen: Willkommen im<br />
Demonstrationszug für „mehr“ und für „bessere“ Sportfreundlichkeit<br />
im ganzen Land!<br />
I 209
Presse<br />
DER STÄDTETAG, HEFT 2/2010<br />
NICLAS STUCKE, HAUPTREFERENT DES DEUTSCHEN STÄDTETAGES<br />
Kommunale Sportpolitik: Bilanz und Aufbruch<br />
Kongress „Starker Sport – starke Städte“<br />
in der Münchner Eventarena<br />
München im verschneiten März 2010: die beeindruckende<br />
Begrüßung der rückkehrenden Olympioniken aus Vancouver<br />
auf dem Münchner Marienplatz, die Abschlussarbeiten<br />
zur Fertigstellung <strong>des</strong> Bewerbungsbuches für die<br />
<strong>Olympische</strong>n und Paralympischen Winterspiele 2018,<br />
intensive Bemühungen zur Rettung <strong>des</strong> Stadions an der<br />
Grünwalderstrasse als Spielstätte für die Sechziger, Diego<br />
Maradona in der Allianz-Arena – der Ruf der Sportstadt<br />
München ist vielschichtig und ausgezeichnet. Ein Grund<br />
mehr, als Austragungsort für den Kongress „Starker<br />
Sport – starke Kommunen“ die Bayrische Lan<strong>des</strong>hauptstadt<br />
zu wählen. 430 Teilnehmerinnen und Teilnehmer<br />
aus dem organisierten Sport, den Stadtsportbünden,<br />
den Fachverbänden, der kommunalen Sportpolitik und<br />
-verwaltung waren der Einladung <strong>des</strong> <strong>Deutsche</strong>n Städtetages,<br />
<strong>des</strong> <strong>Deutsche</strong>n Städte- und Gemeindebun<strong>des</strong><br />
und <strong>des</strong> <strong>Deutsche</strong>n <strong>Olympische</strong>n Sportbun<strong>des</strong> (DOSB)<br />
gefolgt, um an historischer Stelle in zwei Tagen im ehemaligen<br />
Radstadion <strong>des</strong> Olympiaparks die Bedeutung<br />
<strong>des</strong> Sports für die Städte und Gemeinden zu diskutieren<br />
sowie gleichzeitig die vielfältigen Leistungen der Kommunen<br />
für den Sport und im Umfeld der Sportentwicklung<br />
zu betrachten. Aufbauend auf einer Kooperationsvereinbarung,<br />
welche die veranstaltenden Verbände im Jahre<br />
2008 abgeschlossen hatten, sollte herausgearbeitet werden,<br />
wie die enge Zusammenarbeit von Kommunen und<br />
organisiertem Sport zum einen bilanziert wird, zum anderen<br />
aber intensiviert und vorangetrieben werden könnte.<br />
Ausgehend von der Tatsache, dass die Zusammenarbeit<br />
vor allem auf örtlicher Ebene erfolgt, war es Ziel <strong>des</strong><br />
210 I<br />
<strong>Kongresses</strong>, Handlungsspielräume für die konkrete Praxis<br />
vor Ort zu eröffnen und weitere Perspektiven für eine<br />
künftige Zusammenarbeit aufzuzeigen.<br />
Ude: Keine Chance für ein einfaches<br />
„Weiter so“<br />
In seinem Hauptvortrag rief der Münchner Oberbürgermeister<br />
Christian Ude eindringlich dem Auditorium ins<br />
Gedächtnis, dass das Kongressmotto „Starke Kommunen“<br />
als Voraussetzung für „Starken Sport“ nur dann<br />
Wahrheit werden könne, wenn diese Kommunen auch<br />
wirklich stark seien. Insbesondere die finanzielle Situation<br />
der Städte und Gemeinden gebe allerdings zur Zeit<br />
keinerlei Anlass, in dieser Frage optimistisch zu sein. Ude<br />
erteilte allen aktuellen Bestrebungen, die Gewerbesteuer<br />
abzuschaffen bzw. einzuschränken, eine deutliche Absage,<br />
da eine Kompensation für die dann ausfallenden<br />
zweistelligen Milliardenbeträge nirgendwo in Sicht sei.<br />
Nicht nur unter demographischen Gesichtspunkten sei<br />
zu berücksichtigen, dass auch im Sport ein Ende <strong>des</strong><br />
Wachstums unumgänglich sei. Die Entwicklung der letzten<br />
60 Jahre, in der die Infrastruktur der Kommunen<br />
immer besser, immer umfassender und immer aufwendiger<br />
wurde, könne so nicht fortgesetzt werden. „Wir<br />
sind jetzt am absoluten Ende dieser linearen Entwicklung<br />
angekommen. Nichts spricht dafür, dass die Kommunen<br />
in den nächsten Jahren und Jahrzehnten in der Lage<br />
sein werden, neben den Betriebskosten der bestehenden<br />
Infrastruktur und neben den Ersatzinvestitionen auch<br />
noch die Sportinfrastruktur einfach linear weiter zu verbessern“,<br />
so der Vizepräsident <strong>des</strong> <strong>Deutsche</strong>n Städtetages<br />
wörtlich. Er appellierte an Sport und Politik, auch
in Zeiten schwindender Mittel über eine intensivere<br />
Nutzung der vorhandenen Infrastruktur nachzudenken<br />
und dabei auch die veränderten Bedürfnisse und Rahmenbedingungen<br />
wie Segregation in den Städten,<br />
die Ganztagsschulproblematik, die Frage der Verkürzung<br />
der Gymnasialzeit, die Auswirkungen neuer Familienbilder<br />
auf den Sport sowie auch zeitgemäße Modelle <strong>des</strong><br />
ehrenamtlichen Engagements zu berücksichtigen. Weiter<br />
unterstrich er die wachsende Bedeutung der Prävention<br />
im Sport und die hervorragende Rolle, die der organisierte<br />
und nicht organisierte Sport bei allen Integrationsbemühungen<br />
leiste. Abschließend ging Ude auf zwei im<br />
Verhältnis Sport und Kommune nicht gelöste Fragestellungen<br />
ein: Zum einen, dass endlich die Frage <strong>des</strong> Verhältnisses<br />
von Sport und Nachbarschaft insbesondere in<br />
der Lärmproblematik geklärt werden müsse; zum anderen,<br />
dass Sportveranstaltungen in den Kommunen bald<br />
nicht mehr durchgeführt werden könnten, wenn nicht<br />
die Standards und Pflichtenhefte der Verbände auf ein<br />
erträgliches Maß zurückgeschraubt werden könnten.<br />
Bach sagt Unterstützung zu<br />
Dr. Thomas Bach, der Präsident <strong>des</strong> <strong>Deutsche</strong>n <strong>Olympische</strong>n<br />
Sportbun<strong>des</strong> sagte in seinem Beitrag den Kommunen<br />
die Unterstützung <strong>des</strong> organisierten Sports bei der<br />
Verfolgung insbesondere der finanzpolitischen Forderungen<br />
zu. Er dankte den kommunalen Vertretern für die<br />
vielfältige Kooperation und Unterstützung, die der organisierte<br />
Sport vor Ort erhalte; es sei bemerkenswert, dass<br />
nach wie vor die öffentliche Sportförderung in Deutschland<br />
zu 80 % aus kommunalen Haushalten aufgebracht<br />
werde.. Er sah die Zeiten knapper Kassen bei der Zusammenarbeit<br />
zwischen Kommunen und Sportvereinen auch<br />
I 211
Presse<br />
als Chance, der Zusammenarbeit neue Impulse zu geben<br />
und damit zur weiteren Verbesserung der Lebensqualität<br />
vor Ort beizutragen. Gerade das soziale Engagement im<br />
Sport, dokumentiert auch durch die Auszeichnung „Sterne<br />
<strong>des</strong> Sports“, mache Kommunen stark und attraktiv. An<br />
die Sportvereine richtete er die Empfehlung, sich vor Ort<br />
noch stärker zu vernetzen und die Kooperationen zu intensivieren.<br />
„Mehr Netzwerkpartner und mehr Kooperationen<br />
erweitern unsere Handlungsmöglichkeiten“, so<br />
Bach. Am Beispiel der Bildungspolitik zeigte er auf, wie<br />
viele verschiedene Institutionen in den Kommunen zusammenwirken<br />
müssen, um erfolgreich arbeiten zu können.<br />
Es sei zwingend notwendig, dass Sportvereine an<br />
der Entwicklung solcher Bildungskonzepte sich beteiligten<br />
und auch im kommunalen Bildungsmanagement mitwirken<br />
könnten. Abschließend plädierte er für eine demonstrative<br />
Sportfreundlichkeit in den Kommunen; Resignation<br />
sei nicht angesagt. Sport sei nicht mehr nur die<br />
schönste Nebensache der Welt, sondern ein zentrales<br />
Politikfeld mit hoher Bedeutung, so der DOSB Präsident.<br />
Netzwerkarbeit als Erfolgsfaktor<br />
Zwölf Arbeitskreise vertieften die in den Hauptvorträgen<br />
angesprochenen Stichworte. Integration durch Sport,<br />
Sportgroßveranstaltungen, bürgerschaftliches Engagement,<br />
Sportentwicklung vor Ort und Leistungssportförderung<br />
waren die Themen, Gesundheit und Kommune,<br />
Sportvereinsentwicklung und Schule, Lebensqualität aller<br />
Generationen, Frauensport, Sportstätten der Zukunft,<br />
Lärmschutz und Sportfinanzierung schlossen sich an. Politikfelder<br />
also, die sowohl von der Seite <strong>des</strong> organisierten<br />
Sports als auch von den kommunalen Vertretern aus<br />
ihrer jeweiligen Sichtweise eingebracht wurden. Ein Stichwort<br />
zog sich durch die Diskussion fast aller Arbeitskreise:<br />
Verbesserung der Kommunikation und Intensivierung<br />
der Netzwerkarbeit zwischen Kommune und organisiertem<br />
Sport. Es wurde beklagt, dass in der Vergangenheit<br />
zu sehr jeweils mit dem „Tunnelblick“ gearbeitet wurde.<br />
212 I<br />
Heute müsse man erkennen, dass nur im Zusammenwirken<br />
aller Beteiligten die Zukunft für eine nachhaltige und<br />
zukunftsfähige kommunale Sportpolitik liege. Am Beispiel<br />
<strong>des</strong> Arbeitskreises Sport und Gesundheit wurde<br />
herausgearbeitet, welches die Erfolgsfaktoren für einen<br />
gelungenen Netzwerkaufbau sind:<br />
Hauptamtlichkeit zur Sicherung der Kontinuität, Bündelung<br />
vorhandener Kapazitäten, gegenseitiges Vertrauen<br />
der Partner, Themen mit hoher Aufmerksamkeit, konkrete<br />
Vereinbarungen, Intensität der Zusammenarbeit, Beteiligung<br />
aller Ebenen mit ihren unterschiedlichen Möglichkeiten,<br />
Außendarstellung der Aktivitäten, Offenheit bei<br />
den Beteiligten mit der Bereitschaft zu Veränderungen,<br />
Partizipation der Betroffenen. Zusammengefasst: Eine enge<br />
Vernetzung von Sport und Kommune kann große Potentiale<br />
freisetzen und zu einem Mehrwert auf beiden Seiten<br />
beitragen.<br />
Keine Königswege in der kommunalen<br />
Sportpolitik<br />
<strong>Der</strong> Arbeitskreis: „Sportgroßveranstaltungen: Fluch<br />
oder Segen?“ behandelte in einer Podiumsdiskussion die<br />
Schwierigkeiten, die verstärkt auf Kommunen zukommen,<br />
wenn – auch unter dem Zeichen <strong>des</strong> Stadtmarketings<br />
– Städte sich um Sport (Groß-)veranstaltungen<br />
bewerben bzw. diese durchführen. Festgehalten wurde,<br />
dass in diesem Spektrum stark unterschieden werden<br />
müsse: Nationale Meisterschaften im Jugend- oder Juniorenbereich<br />
seien sicherlich nicht mit der Durchführung<br />
von <strong>Olympische</strong>n Spielen oder einer Fußball-WM zu vergleichen.<br />
Nicht immer sei der ökonomische Nutzen einer<br />
solchen Veranstaltung für die Stadt messbar; vielmehr<br />
müsse auch berücksichtigt werden, dass solche Veranstaltungen<br />
einen Wohlfühlfaktor für die Bevölkerung<br />
hätten und die Verbundenheit und Identität mit der Stadt<br />
oder der Region unterstützen könnten. Daher dürfe nicht
polytan Fußballrasen<br />
polytan Hockeyrasen<br />
No. 1in<br />
football turf<br />
®<br />
polytan GmbH<br />
Gewerbering 3<br />
D-86666 Burgheim<br />
Telefon +49 (0) 84 32 - 870<br />
Telefax +49 (0) 84 32 - 8787<br />
E-Mail: info@polytan.com<br />
polytan Laufbahnen<br />
polytan Sportservice<br />
Top Beläge für Top Events<br />
www.polytan.de<br />
ES IST DER UNTERSCHIED, DER ZÄHLT
Weiterbildung Beratung Forum im und für den SPORT<br />
Die Führungs-Akademie<br />
ist die zentrale Weiterbildungseinrichtung <strong>des</strong> <strong>Deutsche</strong>n <strong>Olympische</strong>n Sportbun<strong>des</strong> für Führungskräfte<br />
<strong>des</strong> organisierten Sports auf nationaler und regionaler Ebene. Sie befasst sich<br />
schwerpunktmäßig mit Fragen der Sportentwicklung und <strong>des</strong> Sportmanagements.<br />
Mit Weiterbildungs- und Beratungsangeboten sowie mit der Veranstaltung von Foren bietet<br />
die Führungs-Akademie ein umfassen<strong>des</strong> Leistungsangebot für die Sportorganisationen.<br />
Weiterbildung Beratung Forum<br />
Das Weiterbildungsangebot<br />
der Führungs-Akademie umfasst<br />
Seminare, Workshops<br />
und Trainings zu aktuellen<br />
Themen <strong>des</strong> Sportmanagements<br />
und der Sportentwicklung:<br />
• Jahresprogramm mit<br />
ca. 40 offenen<br />
Seminaren<br />
•<br />
Schulungen<br />
• Weiterbildungsreihen<br />
• E-Learning: Weiterbildungslehrgang<br />
Sportmanagement<br />
(SOMIT)<br />
Unter www.fuehrungs-akademie.de eine Übersicht über unser<br />
vollständiges Angebot.<br />
FÜHRUNGS-AKADEMIE<br />
<strong>Deutsche</strong>r <strong>Olympische</strong>r Sportbund<br />
Willy-Brandt-Platz 2<br />
50679 Köln<br />
Tel.: (0221) 221 220 13<br />
Fax: (0221) 221 220 14<br />
I-Net:www.fuehrungs-akademie.de<br />
Die Führungs-Akademie<br />
bietet den Sportorganisationen<br />
eine praxisorientierte<br />
Managementberatung an.<br />
Umfang, Ausrichtung und<br />
inhaltlicher Schwerpunkt<br />
variieren je nach Fragestellung.<br />
Beispiele für<br />
Beratungsanlässe sind:<br />
• Strategieentwicklung<br />
• Organisationsentwicklung<br />
• Verbandsorganisation<br />
• Personalmanagement<br />
• Entwicklung von<br />
Marketingkonzepten<br />
Mit Foren zur Sportentwicklung<br />
und Sportpolitik<br />
ist die Führungs-Akademie<br />
Impulsgeber für den organisierten<br />
Sport. Die Foren<br />
tragen zur Meinungsbildung<br />
im Sport sowie zur Positionierung<br />
<strong>des</strong> Sports in der<br />
Gesellschaft bei. Beispiele<br />
hierfür sind:<br />
• KÖLNER SPORTREDE ©<br />
• Themenkonferenzen<br />
• Tagungen und<br />
Kongresse
Presse<br />
immer nur darauf gesehen werden, ob sich die eingesetzten<br />
Gelder wirklich „rentieren“ würden. Als gewichtige<br />
Hemmnisse wurden die Pflichtenhefte von Fachverbänden<br />
angesehen, die zum Teil als völlig überzogen bezeichnet<br />
wurden. Diese Tendenz gehe von den internationalen<br />
Großveranstaltungen aus und habe inzwischen leider auch<br />
schon die nationale Ebene erreicht. Fazit dieses Arbeitskreises:<br />
Sportgroßveranstaltungen sind Fluch und Segen.<br />
Mit der schwierigen kommunalpolitischen Praxis beschäftigten<br />
sich zwei weitere Arbeitskreise. Die Frage, ob<br />
Sportlärm einen Engpass in der Sportentwicklung darstelle,<br />
wurde durchaus kontrovers diskutiert. Zum einen<br />
wurde auf die sehr komplexen rechtlichen Grundlagen<br />
und die teilweise divergierende Rechtsprechungspraxis<br />
auf der einen Seite hingewiesen, zum anderen gebe es<br />
zu wenig Kenntnisse und Sensibilität bei zahlreichen<br />
Sporttreibenden für diese Problematik. Handlungsdruck<br />
entstehe insbesondere dann, wenn Sportarten weiterentwickelt<br />
würden und bei Sportangeboten auf bestehenden<br />
Anlagen, die in nächster Nachbarschaft zur Wohnbebauung<br />
angesiedelt seien. Notwendig sei es, zumin<strong>des</strong>t<br />
das bestehende Recht intelligent zu nutzen sowie Anpassungen<br />
<strong>des</strong> Baurechts unter Berücksichtigung sportspezifischer<br />
Belange zu diskutieren. Daneben wurden<br />
Praxisbeispiele genannt, wie Sportvereine und Kommunen<br />
in dieser konfliktträchtigen Frage vor Ort vorausschauend<br />
zusammenarbeiten können.<br />
Gibt es Königswege im Rahmen der Sportförderung<br />
und Sportfinanzierung? Diese Frage musste im entsprechenden<br />
Arbeitskreis verneint werden. Zum einen sei<br />
die finanzielle Situation der Kommunen extrem unterschiedlich,<br />
was die zukünftigen Gestaltungsmöglichkeiten<br />
betreffe, zum anderen sei in der Zukunft kaum damit zu<br />
rechnen, dass die finanziellen Spielräume sich erweitern<br />
würden. Für den organisierten Sport würde dies bedeuten,<br />
dass man mit einem verengten Blick nur für die eigenen<br />
Belange nicht mehr weiterkomme. Alte Denkmuster und<br />
Konkurrenzen müssten überwunden und im Dialog ge-<br />
löst werden; dies könne auch einmal Vereinsfusionen<br />
notwendig machen und die ungeliebte Diskussion um<br />
Hallenbenutzungsgebühren neu beleben.<br />
In der Schlussrunde <strong>des</strong> <strong>Kongresses</strong> wurde ein erstes Fazit<br />
gezogen: Ein wichtiger Schritt sei getan: in vielen Politikfeldern<br />
sei es gelungen, den organisierten Sport mit den<br />
Vertretern der kommunalen Sportpolitik überhaupt erst<br />
einmal an den Tisch und ins Gespräch zu bringen. Auf<br />
dieser Basis könne man konstruktiv weiterarbeiten; es gelte<br />
nun, die gefundenen Erkenntnisse und Anregungen in<br />
die Arbeit in den einzelnen Ländern, aber vor allem auch<br />
vor Ort umzusetzen. Dass die äußeren Rahmenbedingungen<br />
dieses <strong>Kongresses</strong> auch in hervorragender Weise<br />
stimmten, dies war u. a. ein Verdienst der Lan<strong>des</strong>hauptstadt<br />
München, die in beispielhafter Weise diesen Kongress<br />
unterstützt hatte. Die zahlreichen Fachgespräche,<br />
die schon ein Kernpunkt <strong>des</strong> eigentlichen <strong>Kongresses</strong> waren,<br />
konnten in einer beeindruckenden Abendveranstaltung<br />
in der BMW-Welt fortgesetzt und vertieft werden.<br />
Für die kommunale Sportpolitik gehen vom Münchner<br />
Kongress hoffnungsvolle Signale aus.<br />
I 215
Presse<br />
FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG, 10. MÄRZ 2010 (VON CHRISTIAN EICHLER, MÜNCHEN)<br />
Sport an der Basis: Eine Frage der Lebensqualität<br />
<strong>Der</strong> große Sport findet im Kleinen statt: er ist<br />
wichtig für Lebensqualität, Integration und Volksgesundheit.<br />
Doch die Krise der Finanzen ist auch<br />
eine Krise <strong>des</strong> Sports in den Kommunen.<br />
<strong>Der</strong> große Sport findet im Kleinen statt. Im Dorf, in der<br />
Kleinstadt, im Großstadtviertel – dort, wo die breite Basis<br />
ist und der große Teil <strong>des</strong> Sporttreibens. In diesem Sommer<br />
erhält diese lokale Kraft ein globales Schaufenster.<br />
Besucher <strong>des</strong> <strong>Deutsche</strong>n Pavillons auf der Expo in Schanghai<br />
können dann eine Luftaufnahme studieren, auf der<br />
die Sportanlage einer süddeutschen Kleinstadt zu sehen<br />
ist. „Ein starker Sport“, so die Worte, mit denen Thomas<br />
Bach, Präsident <strong>des</strong> <strong>Deutsche</strong>n <strong>Olympische</strong>n Sportbun<strong>des</strong><br />
(DOSB), am Wochenende den Kongress „Starker Sport –<br />
starke Kommunen“ in München eröffnete, „macht Städte<br />
und Gemeinden stark und zu Orten mit hoher Lebens-<br />
216 I<br />
qualität.“ Das vereinseigene Sportgelände <strong>des</strong> TV Rottenburg<br />
ist auserwählt, stellvertretend für diese Art deutscher<br />
Lebensqualität zu stehen.<br />
Sie leidet allerdings in vielen Teilen <strong>des</strong> Lan<strong>des</strong>. <strong>Der</strong> öffentlichen<br />
Hand, speziell den Kommunen, geht es schlecht.<br />
„Wir sind vom Weltmeister <strong>des</strong> Sportstättenbaus in den<br />
siebziger und achtziger Jahren zum Verbandsligisten geworden“,<br />
sagt Andreas Klages, stellvertretender Direktor<br />
für Sportentwicklung im DOSB. Es gebe einen „gigantischen<br />
Sanierungs- und Modernisierungsstau“. Deshalb<br />
seien Sportstätten vom Katalysator <strong>des</strong> Sporttreibens zum<br />
Engpass geworden. Die Folge: „Die alte Aufgabenteilung<br />
Kommune baut, Verein nutzt funktioniert so nicht mehr.<br />
Die Vereine müssen einen höheren Anteil an den Sportstätten<br />
übernehmen.“ So wie in Rottenburg.
„Eine Krise der Finanzen ist immer auch eine<br />
Krise <strong>des</strong> Sports“<br />
Nicht nur die Aufgabenteilung, auch die Kommunikation<br />
der beiden wichtigsten Stützen <strong>des</strong> Breitensports – Klubs<br />
und Kommunen – braucht neue Ideen und Impulse. Das<br />
war der Kernpunkt <strong>des</strong> von Klages mitorganisierten <strong>Kongresses</strong>,<br />
der auf die 2008 geschlossene Kooperation von<br />
DOSB, <strong>Deutsche</strong>m Städtetag und <strong>Deutsche</strong>m Städte- und<br />
Gemeindebund zurückging. Das im Titel genannte, kraftvoll<br />
klingende Doppel „Starker Sport – starke Kommunen“<br />
sei angesichts der finanziellen Realität allerdings „kein<br />
Zustand, sondern eine Forderung“, räumt der Münchner<br />
Oberbürgermeister Christian Ude ein.<br />
„Eine Krise der Finanzen ist immer auch eine Krise <strong>des</strong><br />
Sports“, sagt Klages. In dieser Not rücken Kommunen und<br />
Klubs zusammen. „Die Städte wissen, dass sie starke<br />
Vereine brauchen“, so Ude, „und der Sport weiß, dass<br />
die Städte nicht absaufen dürfen.“ <strong>Der</strong> Kommunalpolitiker<br />
sagt: „Unsere Integrationsaufgaben sind ohne Sport<br />
nicht zu lösen. Die Vereine sind das erste und oft einzige<br />
Instrument der Integration“, dank gemeinsamer Sprache<br />
und gemeinsamer Regeln.<br />
<strong>Der</strong> Arzt kann Sport im Verein verschreiben<br />
Mehr und mehr müssten die Kommunen Teilaufgaben<br />
auslagern, so Ude, der in seiner Eröffnungsrede „mehr<br />
Kreativität in der Zusammenarbeit zwischen Kommunalpolitik,<br />
Verwaltung und Sportorganisationen“ anregte.<br />
Klages, der Mitorganisator <strong>des</strong> <strong>Kongresses</strong>, sieht dafür<br />
zahlreiche Schnittmengen – in Gesundheitspolitik, Prävention,<br />
Integration. <strong>Der</strong> Sport habe „viele Antworten<br />
auf die Herausforderungen der Gesellschaft“, auf demographischen<br />
Wandel, Integration, schulische Entwicklung.<br />
Ein Beispiel ist ein Projekt in Nordhessen, das durch die<br />
Kooperation zwischen kommunalen Gesundheitsämtern,<br />
Krankenkassen, Ärztekammern und Vereinen möglich<br />
wurde. „Wenn jemand dort mit unspezifischen Rückenbeschwerden<br />
oder einer anderen der sogenannten Zivilisationskrankheiten<br />
zum Arzt geht“, so Klages, „kann<br />
der Arzt ihm Sport im Verein verschreiben, und die Kasse<br />
übernimmt die Kosten zum Teil oder sogar ganz.“ Dieses<br />
Angebot, über das viele Kongressteilnehmer „Bauklötze<br />
gestaunt“ hätten, solle demnächst auf ganz Hessen ausgeweitet<br />
werden.<br />
„Die Ganztagsschule ist eine Realität, mit der<br />
der Sport leben muss“<br />
Andererseits ist die Zusammenarbeit zwischen Schulen<br />
und Vereinen durch den Wechsel vom neun- auf das<br />
achtjährige Gymnasium schwieriger geworden. Die Ausweitung<br />
der Schulzeiten in den Nachmittag führt zu<br />
Engpässen bei Hallenzeiten der Klubs und zu schrumpfender<br />
Freizeit bei Schülern, die oft zu Lasten <strong>des</strong> Vereinssports<br />
geht. Das erfordere eine größere Bereitschaft<br />
zur Zusammenarbeit, so Klages, etwa bei Detailabsprachen<br />
über Hallen- und Nutzungszeiten - und ebenso<br />
einen Bewusstseinswandel im organisierten Sport: „Die<br />
Ganztagsschule ist eine Realität, mit der der Sport leben<br />
muss.“<br />
Solche kleinen, in der Summe der Gesellschaft aber gewaltigen<br />
Probleme und die Versuche, sie zu lösen, sind<br />
in der großen Öffentlichkeit nicht sehr präsent, weil dem<br />
Sport an der Basis, so Klages, „Aufmerksamkeit in der<br />
politischen Dimension“ fehle. Die Sportförderung durch<br />
den Bund bekam zuletzt eine Plattform durch die Medaillen<br />
der zahlreichen Staatssportler aus Bun<strong>des</strong>wehr<br />
oder Bun<strong>des</strong>polizei bei den Winterspielen in Vancouver.<br />
Viel weniger bekannt ist, „dass achtzig Prozent der öffentlichen<br />
Sportförderung, über drei Milliarden Euro im<br />
Jahr, von den Kommunen kommen“, wie Ude betont.<br />
<strong>Der</strong> große Sport ist an der Basis. Olympia ist nur das<br />
große Schaufenster.<br />
Text: FAZ.NET<br />
I 217
Kongressleitung<br />
Rudolf Behacker<br />
Dr. Daniel Illmer<br />
Andreas Klages<br />
Heidrun Meissner<br />
Christian Siegel<br />
Niclas Stucke<br />
218 I<br />
Sportamtsleiter der Lan<strong>des</strong>hauptstadt München, Vorsitzender der<br />
Arbeitsgemeinschaft <strong>Deutsche</strong>r Sportämter, Mitglied im Sportausschuss<br />
<strong>des</strong> Bayerischen und <strong>Deutsche</strong>n Städtetags, Mitglied im<br />
Beirat „Sportentwicklung“ <strong>des</strong> DOSB für den Bereich Sportstätten<br />
und kommunaler Sportstättenentwicklung.<br />
Wissenschaftlicher Referent der Führungs-Akademie <strong>des</strong> DOSB.<br />
Zuständig für Konzeption und Beratung. Studium Diplom-Sportwissenschaft<br />
in Frankfurt am Main, Promotion an der TU Karlsruhe.<br />
<strong>Deutsche</strong>r <strong>Olympische</strong>r Sportbund, stellvertretender Direktor Sportentwicklung<br />
und Ressortleiter Breitensport/Sporträume. Arbeitsschwerpunkte:<br />
Sportstättenentwicklung, Sport und Umwelt, Strategie- und<br />
Grundsatzfragen der Sportentwicklung. Über viele Jahre ehrenamtlich<br />
engagiert im Sport und in der politischen Bildungsarbeit.<br />
Eventmanagerin Sportveranstaltungen im Sportamt der Lan<strong>des</strong>hauptstadt<br />
München, Diplom-Sportwissenschaftlerin, Schwerpunkt<br />
Ökonomie & Management (DSHS Köln). Mehrjährige Erfahrung<br />
im Bereich Marketing und Kommunikation bei verschiedenen Agenturen<br />
und Unternehmen der Sport- und Medienbranche.<br />
<strong>Deutsche</strong>r <strong>Olympische</strong>r Sportbund, Referent für Sport- und Strukturentwicklung.<br />
Zahlreiche Veröffentlichungen zu Themen der Sportentwicklung.<br />
Lehrbeauftragter an mehreren Hochschulen in Deutschland<br />
zu den Studienschwerpunkten Sport und Gesellschaft, Sportmanagement,<br />
-ökonomie und -politik.<br />
Hauptreferent beim <strong>Deutsche</strong>n Städtetag in Köln/Berlin, seit 2001<br />
zuständig für Sportpolitik, Weiterbildung, Medienpolitik und Hochschulangelegenheiten.<br />
Zahlreiche Veröffentlichungen zur kommunalen<br />
Sport- und Weiterbildungspolitik; Lehraufträge an der Sporthochschule<br />
Köln und der Bergischen Universität Wuppertal.
�������<br />
��� ����������� ��� ���� �������������<br />
����� ��� � ����� �� �����������<br />
������ �� �������<br />
����������� ��� ��������<br />
���������������������<br />
� �����������������<br />
������������<br />
� ���� ��� ������� ����������<br />
�� �������������<br />
� ���� � ������� ��������� ������<br />
� ���� ����� ������������<br />
� ������������ ���� � ��� �����<br />
� ��� �� ��� �����<br />
��� �������� ������������� �� ����������
Teilnehmerinnen und Teilnehmer<br />
A<br />
Adam, Richard Bewerbungsgesellschaft München 2018 GmbH<br />
Dr. Adloff, Thomas<br />
Prof. Dr. Altenberger,<br />
Kreissportbund Paderborn<br />
Helmut Universität Augsburg<br />
Altenkamp, Monika Lan<strong>des</strong>sportbund Nordrhein-Westfalen<br />
Altrichter, Bruno Stadt Bad Neustadt a. d. Saale<br />
Ambacher, Josef <strong>Deutsche</strong>r Schützenbund<br />
Ammon, Jörg Bayerischer Lan<strong>des</strong>-Sportverband<br />
Dr. Anker, Ingrid Lan<strong>des</strong>hauptstadt München<br />
Aydin, Özlem<br />
B<br />
<strong>Deutsche</strong>r Städtetag<br />
Prof. Dr. Bach, Lüder Universität Bayreuth<br />
Dr. Bach, Thomas <strong>Deutsche</strong>r <strong>Olympische</strong>r Sportbund<br />
Backenköhler, Gerd Harpstedter TB<br />
Dr. Balster, Klaus Sportjugend NRW<br />
Barckmann, Jochen Stadt Flensburg<br />
Baumann, Conny Bayerischer Lan<strong>des</strong>-Sportverband<br />
Baumgarten, Robert Kreissportbund Dresden<br />
Dr. Beck, Manfred Stadt Gelsenkirchen<br />
Beckfeld, Jörg Lan<strong>des</strong>sportbund Nordrhein-Westfalen<br />
Behacker, Rudolf Lan<strong>des</strong>hauptstadt München<br />
Belik, Oliver Lan<strong>des</strong>hauptstadt München<br />
Bergmann, Inga Lan<strong>des</strong>hauptstadt München<br />
Berkenbusch, Hans-Willi Kreissportbund Mettmann<br />
Bernardi, Volker <strong>Deutsche</strong> Squash Marketing und Promotion<br />
GmbH<br />
Bindert, Mark Bündnis 90/Die Grünen – Ratsfraktion<br />
Hannover<br />
Blessing-Kapelke, Ute <strong>Deutsche</strong>r <strong>Olympische</strong>r Sportbund<br />
Dr. Blohm, Eckhard Stadt Prenzlau<br />
Bock, Irmtraud Gemeindetag Baden-Württemberg<br />
Bofinger, Michael SportRegion Stuttgart<br />
Borhof, Anke Lan<strong>des</strong>sportbund Nordrhein-Westfalen<br />
Boßdorf, Hagen SPORTFIVE<br />
Dr. Brandi, Heiner Sportjugend im Lan<strong>des</strong>sportbund Berlin e. V.<br />
Brem, Hermann Sportbeirat Lan<strong>des</strong>hauptstadt München/<br />
BLSV München<br />
Brenner, Norbert <strong>Deutsche</strong>r Leichtathletik-Verband<br />
Brinkmann, Petra CDU-Ratsfraktion Bielefeld<br />
Bruhnke, Reiner Bayerischer Lan<strong>des</strong>-Sportverband<br />
Brunnbauer, Anton Sportamt Regensburg<br />
Budde, Margit Sport StadiaNet GmbH<br />
Bühl, Jürgen Bewerbungsgesellschaft München 2018 GmbH<br />
Burrichter, Wilhelm<br />
Prof. Dr. Burrmann,<br />
Kreissportbund Recklinghausen<br />
Ulrike Technische Universität Dortmund<br />
Buseck, Juergen Sportamt Frankfurt<br />
220 I<br />
C<br />
Cleven, Wilfried Stadtsportbund Mülheim an der Ruhr<br />
Collisi, Birgitt Stadt Bochum<br />
Combüchen, Christian<br />
Corzilius,<br />
FHDW/b.i.b. International College<br />
Bergisch Gladbach<br />
Friedrich-Wilhelm Stadtsportbund Hamm<br />
Cöster, Eckhard Lan<strong>des</strong>sportbund Hessen<br />
Cramer, Carsten<br />
D<br />
SPORTFIVE<br />
Damaschke, Kurt Lan<strong>des</strong>hauptstadt München<br />
Delp, Horst<br />
Dr. Dengler,<br />
Lan<strong>des</strong>sportbund Hessen<br />
Klaus-Michael Lan<strong>des</strong>hauptstadt München<br />
Dr. Dierker, Herbert Senatsverwaltung für Inneres und Sport Berlin<br />
Dietl, Verena Lan<strong>des</strong>hauptstadt München<br />
Dietzen, Stephan EOC<br />
Dittmann, Karl-Martin <strong>Deutsche</strong>r Ringer-Bund<br />
Dittmer, Andreas <strong>Deutsche</strong>r Sparkassen und Giroverband<br />
Dittrich, Bärbel<br />
Prof. Dr. Doll-Tepper,<br />
Lan<strong>des</strong>sportbund Nordrhein-Westfalen<br />
Gudrun Freie Universität Berlin<br />
Donnermeyer, Dieter <strong>Deutsche</strong>r Turner-Bund<br />
Dötschel, Herbert BLSV Sportkreis Nürnberg<br />
Dudzus, Harald<br />
E<br />
Kreissportbund Rhein-Erft<br />
Dr. Eckl, Stefan Institut für Kooperative Planung und<br />
Sportentwicklung<br />
Egleder, Udo Bayerischer Lan<strong>des</strong>-Sportverband<br />
Egli, Inge <strong>Deutsche</strong>r <strong>Olympische</strong>r Sportbund<br />
Ehmke, Sandra Interessengemeinschaft Sport Schwedt<br />
Ehrtmann, Margit <strong>Deutsche</strong>r Handballbund<br />
Eichner, Sönke Stadt Radevormwald<br />
Dr. Eisenmann, Susanne Stadt Stuttgart<br />
Engelhardt, Norbert Lan<strong>des</strong>sportbund Niedersachsen<br />
Dr. Engels, Uta <strong>Deutsche</strong>r <strong>Olympische</strong>r Sportbund<br />
Erdmann, Richard Stadt Roth<br />
Erlenwein, Annemarie Innenministerium <strong>des</strong> Lan<strong>des</strong><br />
Nordrhein-Westfalen<br />
Eser, Frank Sportjugend Hessen<br />
Essig, Natalie Technische Universität München<br />
Etschberger, Franz Sparkasse Berchtesgadener Land<br />
Ewers, Josefine<br />
F<br />
Stadt Potsdam<br />
Fabinski, Wiebke <strong>Deutsche</strong>r <strong>Olympische</strong>r Sportbund<br />
Dr. Fehres, Karin <strong>Deutsche</strong>r <strong>Olympische</strong>r Sportbund<br />
Fellner, Günther Bayerischer Lan<strong>des</strong>-Sportverband<br />
Fiedler, Bernd Stadt Remscheid<br />
Fink, Georg Kreissparkasse Garmisch Partenkirchen
Frey, Alexander Göttinger Sport und Freizeit GmbH & Co. KG<br />
Freytag, Gabriele Führungs-Akademie <strong>des</strong> DOSB<br />
Dr. Friedl, Uwe Stadt Euskirchen<br />
Frischkorn, Roland Sportinitiative Frankfurt – Rhein-Main<br />
Dr. Fröhlich, Andrea<br />
G<br />
Stadt Kassel<br />
Gasche, Cornelia Stadt Hanau<br />
Gatzke, Reinhard Stadt Hilden<br />
Gawehn, Constanze <strong>Deutsche</strong>r <strong>Olympische</strong>r Sportbund<br />
Gebhardt, Franz<br />
Gebhardt, Ursula<br />
Sparkasse Nürnberg<br />
Geggus, Michael Stadtverwaltung Baden-Baden<br />
Gerber, Detlef Lan<strong>des</strong>sportbund Nordrhein-Westfalen<br />
Gerkens, Bert Stadtsportbund Mönchengladbach<br />
Gieseler, Stephan<br />
Prof. Dr. Gieß-Stüber,<br />
Hessischer Städtetag<br />
Petra Albert-Ludwigs Universität Freiburg<br />
Glander, Silvia Freiburger Kreis e. V.<br />
Graffstedt, Frank Stadt Braunschweig<br />
Grillenberger, Martin Bayerisches Staatsministerium<br />
für Unterricht und Kultus<br />
Gröber, Tanja Führungs-Akademie <strong>des</strong> DOSB<br />
Grüner, Brigitte Hansestadt Rostock<br />
Gundlach, Heinrich<br />
H<br />
Kreissportbund Wesel<br />
Haag, Harriet Kinderhaus Herrenstraße<br />
Haardt, Ottmar Kreissportbund Siegen-Wittgenstein<br />
Haase, Achim Lan<strong>des</strong>sportbund Nordrhein-Westfalen<br />
Haasis, Heinrich <strong>Deutsche</strong>r Sparkassen und Giroverband<br />
Hackler, Dieter Bun<strong>des</strong>ministerium für Familie, Senioren,<br />
Frauen und Jugend<br />
Hagg, Christine Stadt Karlsruhe<br />
Hahn, Peter<br />
Dr. Halberschmidt,<br />
Lan<strong>des</strong>sportbund Berlin<br />
Barbara<br />
Hammes-Rosenstein,<br />
Westfälische Wilhelms Universität-Münster<br />
Marie-Theres Stadt Koblenz<br />
Handl, Stefan Bayerische Informationsstelle gegen Extremismus<br />
Hanke, Jürgen Württembergischer Lan<strong>des</strong>sportbund<br />
Hans, Paul Lan<strong>des</strong>sportverband für das Saarland<br />
Hansen, Sönke-Peter Lan<strong>des</strong>sportverband Schleswig-Holstein<br />
Dr. Häntsch, Thomas Göttinger Sport und Freizeit GmbH & Co. KG<br />
Hardy, Dorothea Bayerischer Lan<strong>des</strong>-Sportverband<br />
Hartmann, Hans Jürgen Stadt Bonn<br />
Hartung, Klaus-Dieter Stadtverwaltung Hohen-Neuendorf<br />
Haßmann, Claudia <strong>Deutsche</strong>r Ruderverband<br />
Hebborn, Klaus <strong>Deutsche</strong>r Städtetag<br />
Hedemann, Doris Stadt Oldenburg<br />
Hegemann, Kai CDU Fraktion Stadt Hamm<br />
Heimann, Ulrich Kreissportbund Rheinisch-Bergischer-Kreis<br />
Hein, Jürgen Stadt Büdelsdorf<br />
Heinrich, Kurt Kreissportbund Viersen<br />
Heise, Michael Lan<strong>des</strong>sportbund Nordrhein-Westfalen<br />
Henning, Meike <strong>Deutsche</strong>r <strong>Olympische</strong>r Sportbund<br />
Herrchen, Dieter Stadtverwaltung Elsterwerda<br />
Herrmann, Lutz Stadtverwaltung Schwedt / Oder<br />
Hesse, Hans-Ulrich Sportbeirat Lan<strong>des</strong>hauptstadt München<br />
Hesse, Veit Göttinger Sport und Freizeit GmbH & Co. KG<br />
Himmer, Volker <strong>Deutsche</strong>r Rugby-Verband<br />
Hink, Willi <strong>Deutsche</strong>r Fußball-Bund<br />
Hinnemann, Gisela Lan<strong>des</strong>sportbund Nordrhein-Westfalen<br />
Hofer, Petra Stadt Weilheim<br />
Hofer, Reiner Bayerische Taekwondo Union<br />
Hoffmann, Matthias Stadt Büdelsdorf<br />
Hoffmann, Stefan <strong>Deutsche</strong>r Baseball und Softball Verband<br />
Hohmann, Renate Stadt Aschersleben<br />
Höhn, Michael <strong>Deutsche</strong>r <strong>Olympische</strong>r Sportbund<br />
Holm, Bernd<br />
Dr. Hoppenstedt,<br />
Senatsverwaltung für Inneres und Sport Berlin<br />
Karsten EU-Ausschuss Dt. Städte- und Gemeindebund<br />
Huber, Robert American Football Verband Deutschland<br />
Prof. Dr. Hübner, Horst Bergische Universität Wuppertal<br />
Hübner, Manfred Stadtverwaltung Neutraubling<br />
Husung, Sabine<br />
I<br />
Sportamt Frankfurt am Main<br />
Dr. Illmer, Daniel<br />
J<br />
Führungs-Akademie <strong>des</strong> DOSB<br />
Jacobsen, Dirk SPD-Bun<strong>des</strong>tagsfraktion<br />
Janalik, Heinz <strong>Deutsche</strong>r <strong>Olympische</strong>r Sportbund<br />
Jansen, Björn Stadtsportbund Aachen<br />
Jatho, Tanja Lan<strong>des</strong>sportbund Nordrhein-Westfalen<br />
Jeggle, Thomas Stadt Sindelfingen<br />
Johann, Rimböck Richter Spielgeräte GmbH<br />
John, Eva Stadt Starnberg<br />
Just, Wolfgang<br />
K<br />
Stadt Hannover<br />
Kaesbach, Martina FDP Lan<strong>des</strong>vorstand Hamburg<br />
Prof. Dr. Kähler, Robin Universität Kiel<br />
Kalix, Petra Bayerische Sportförderung<br />
Kalix, Thomas Bayerische Sportförderung<br />
Kämmerer, Werner Bayerischer Lan<strong>des</strong>-Sportverband<br />
Dr. Karafiat, Klaus P. Stadtsportbund Frankfurt (Oder)<br />
Karl, Rupert Bayerischer Lan<strong>des</strong>-Sportverband<br />
Kemper, Georg Sportamt Frankfurt am Main<br />
Kern, Jan <strong>Deutsche</strong>r Leichtathletik-Verband<br />
Kessner, Wolfgang Stadtverwaltung Neutraubling<br />
I 221
Teilnehmerinnen und Teilnehmer<br />
Kirmes, Kerstin Stadt Leipzig<br />
Klages, Andreas <strong>Deutsche</strong>r <strong>Olympische</strong>r Sportbund<br />
Klatt, Ralf-Rainer Magistrat der Wissenschaftsstadt Darmstadt<br />
Dr. Klein, Agnes Stadt Köln<br />
Klement, Justus Stadtbauamt Penzberg<br />
Klement, Ulrich Sportamt Erlangen<br />
Kluger, Lars Sächsisches Staatsministerium für Kultus<br />
und Sport<br />
Knipp, Rüdiger <strong>Deutsche</strong>s Institut für Urbanistik Berlin<br />
Koch, Philipp Stadt Minden<br />
Koch, Uwe Brandenburgische Sportjugend<br />
Prof. Dr. Kolb, Michael Universität Wien<br />
Kolb, Michael Stadt Nürnberg - SportService<br />
Koller, Jutta Lan<strong>des</strong>hauptstadt München<br />
Koller, Peter Bayerischer Lan<strong>des</strong>-Sportverband<br />
König, Edith Bayerischer Lan<strong>des</strong>-Sportverband<br />
Korff, Peter Sparkassenverband Bayern<br />
Kosubek, Hans-Joachim Stadtverwaltung Worms<br />
Kraenzle, Bernd Bayerischer Lan<strong>des</strong>-Sportverband<br />
Dr. Kraus, Ulrike Innenministerium Nordrhein-Westfalen<br />
Krause, Dieter Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund,<br />
GB Sport<br />
Dr. Krech, Joachim Innenministerium Mecklenburg-Vorpommern<br />
Krempl, Bernhard Stadtverwaltung Geiselhöring<br />
Krieger, Dieter <strong>Deutsche</strong>r <strong>Olympische</strong>r Sportbund<br />
Krisch, Gunnar Lan<strong>des</strong>hauptstadt Dresden<br />
Kroll, Andreas in.Stuttgart Veranstaltungsgesellschaft<br />
GmbH & Co. KG<br />
Kruczek, Manfred Ministerium für Bildung, Jugend, Sport,<br />
Brandenburg<br />
Kübler, Heike <strong>Deutsche</strong>r <strong>Olympische</strong>r Sportbund<br />
Dr. Kuder, Thomas vhw – Bun<strong>des</strong>verband für Wohnen und<br />
Stadtentwicklung<br />
Kulac, Reyhan Lan<strong>des</strong>hauptstadt München<br />
Kupfer, Bernd Stadt Mannheim<br />
Dr. Kurr, Karola<br />
L<br />
TUS Griesheim<br />
Lampe, Walter Samtgemeinde Oberharz<br />
Lange, Christa Lan<strong>des</strong>sportbund Niedersachsen<br />
Lassel, Margret Lan<strong>des</strong>sportbund Niedersachsen<br />
Latzel, Katharina <strong>Deutsche</strong>r <strong>Olympische</strong>r Sportbund<br />
Lehmann, Joachim Lan<strong>des</strong>sportbund Nordrhein-Westfalen<br />
Leibbrand, Gabriele <strong>Deutsche</strong>r Tennis Bund (DTB)<br />
Lemmer, Hartmut Solinger Sportbund<br />
Lindner, Arnold Bayerischer Lan<strong>des</strong>-Sportverband<br />
Linke, Christina Stadt Annaberg-Buchholz<br />
Löcke, Clemens Agentur Sprechperlen<br />
Lohwasser, Gerd Stadt Erlangen<br />
222 I<br />
Lommer, Günther Bayerischer Lan<strong>des</strong>-Sportverband<br />
Lu<strong>des</strong>, Peter<br />
M<br />
Prof. Dr. Maennig,<br />
Kreisstadt Bergheim<br />
Wolfgang Universität Hamburg<br />
Mai, Holger Lan<strong>des</strong>hauptstadt München<br />
Mania, Sven Sportstätten- und Bäderbetrieb Dresden<br />
Manthei, Ulrich Sportkreis Fulda-Eder im LSB Hessen<br />
Marchner, Otto Bayerischer Lan<strong>des</strong>-Sportverband<br />
Marx, Rudolf Vogelsbergkreis<br />
Mast-Weisz, Burkhard Stadt Remscheid<br />
Dr. Matlik, Michael Lan<strong>des</strong>sportbund Nordrhein-Westfalen<br />
Meisel, Anja Molkerei Müller<br />
Meißner, Heidrun Lan<strong>des</strong>hauptstadt München<br />
Dr. Melzer, Liane Hansestadt Rostock<br />
Menner, Susanne TU München; Fakultät für Sportwissenschaft<br />
Meyer, Gerd Lan<strong>des</strong>sportverband für das Saarland<br />
Meyer, Matthias Bayerischer Lan<strong>des</strong>-Sportverband<br />
Kreis Regensburg<br />
Micus, Gregor Stadt Krefeld<br />
Dr. Mix, Ulrich Sportamt Bremen<br />
Möller, Adolf-Martin Lan<strong>des</strong>hauptstadt Kiel<br />
Moseler, Heinz Mülheimer SportService<br />
Müller, Christian Stadtrat Lan<strong>des</strong>hauptstadt München<br />
Müller, Wendelin<br />
N<br />
Sportamt der Stadt Wetzlar<br />
Nader, Mansour Playfit<br />
Nakoff, Géraldine Führungs-Akademie <strong>des</strong> DOSB<br />
Naumann, Reinhard Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf, Berlin<br />
Neff, Gabriele FDP-Fraktion im Stadtrat München<br />
Neugebauer, Bernd Bayerische Akademie für Erwachsenenbildung<br />
im Sport<br />
Dr. Niessen, Christoph Lan<strong>des</strong>sportbund Nordrhein-Westfalen<br />
Niggemann, Thomas Lan<strong>des</strong>sportverband Schleswig-Holstein<br />
Noerenberg, Gerold<br />
O<br />
Stadt Neu-Ulm<br />
Oecknigk, Michael Stadtverwaltung Herzberg<br />
Opitz, Gerhard Kreissportbund Olpe<br />
Osterburg, Dagmar Lan<strong>des</strong>sportbund Nordrhein-Westfalen<br />
Ott, Markus Bayerischer Lan<strong>des</strong>-Sportverband<br />
Ott, Peter<br />
P<br />
Bun<strong>des</strong>institut für Sportwissenschaft<br />
Pabst-Bethke, Monika Stadt Büdelsdorf<br />
Pauly, Pia <strong>Deutsche</strong>r Turner-Bund<br />
Pechtel, Hans Präsident Kreissportbund Ennepe-Ruhr<br />
Peter, Angelika Lan<strong>des</strong>sportbund Brandenburg<br />
Petereit, Bianka Städte- und Gemeindebund Brandenburg<br />
Petermann, Michaela Sportamt Hamburg<br />
Pfeifer, Günter Stadt Mainz
Pfeiffer, Alexander Lan<strong>des</strong>sportbund Hessen<br />
Pfeuffer, Peter Bayerischer Lan<strong>des</strong>-Sportverband<br />
Plätzer, Cornelia Bewerbungsgesellschaft München 2018 GmbH<br />
Pohl, Gabriela Stadt Nürnberg – SportService<br />
Pohlmann, Andreas Bun<strong>des</strong>institut für Sportwissenschaft<br />
Pöhnitzsch, Leif Stadtverwaltung Gera<br />
Praum, Peter Sport StadiaNet GmbH<br />
Priebe, Frank Flecken Nörten-Hardenberg<br />
Pütz, Otto<br />
Q<br />
Stadtsportbund Krefeld<br />
Quardokus, Bianca<br />
R<br />
<strong>Deutsche</strong>r <strong>Olympische</strong>r Sportbund<br />
Rauh, Karl Bayerischer Lan<strong>des</strong>-Sportverband<br />
Rawe, Reinhard Lan<strong>des</strong>sportbund Niedersachsen<br />
Reißer, Hans Bayerische Akademie für Erwachsenenbildung<br />
im Sport<br />
Retsch, Klaus Stadt Bochum<br />
Reutter, Horst Stadt Esslingen a.N.<br />
Ritter, Thomas Stadt Hanau<br />
Rödle, Hans-Heinrich Saarländischer Städte- u. Gemeindetag<br />
Rohrberg, Wolfgang Essener Sportbund<br />
Rombey, Wolfgang Stadt Aachen<br />
Roos, Hermann Bayerischer Lan<strong>des</strong>-Sportverband<br />
Rosenbaum, Werner Freie Bürgergruppe Koblenz<br />
Rosenthal, Heiko Stadt Leipzig<br />
Rübner, Anne <strong>Deutsche</strong>r <strong>Olympische</strong>r Sportbund<br />
Rücker, Veronika Führungs-Akademie <strong>des</strong> DOSB<br />
Rump, Boris <strong>Deutsche</strong>r <strong>Olympische</strong>r Sportbund<br />
Ruth, Rainer Sportjugend NRW<br />
Prof. Dr. Rütten, Alfred Friedrich Alexander-Universität Erlangen<br />
Rychter, Oliver<br />
S<br />
StadtSportBund Aachen<br />
Salchow, Jannike Sportamt Hamburg<br />
Sanden, Dieter Sportamt Köln<br />
Sander, Britta Agentur Sprechperlen<br />
Sautter, Daniel Sportregion Rhein-Neckar<br />
Schabert, Wolfgang IKPS Stuttgart<br />
Schaeffer, Horst Peter Senatskanzlei Berlin<br />
Schäfer, Axel SPD Bun<strong>des</strong>tagsfraktion<br />
Schäfer, Lars Landkreis Marburg-Biedenkopf<br />
Schäfer, Gabriela Stadtsportbund Bochum<br />
Scharf, Michael Olympiastützpunkt Rheinland<br />
Schaub, Manfred Stadt Baunatal<br />
Scheifele, Peter Lan<strong>des</strong>hauptstadt München<br />
Schenker, Frank<br />
Scheps, Simone<br />
Stadtverwaltung Jena<br />
Schirwitz, Bernd Sportamt Stadt Münster<br />
Schmal, Ferdi Kreissportbund Warendorf<br />
Schmidt-Volkmar, Dieter Lan<strong>des</strong>sportverband Baden-Württemberg<br />
Schmitz, Hans-Peter Sportjugend NRW<br />
Schmolke, Petra RKB Deutschland 1896<br />
Schmöller, Kloty Bayerischer Lan<strong>des</strong>-Sportverband<br />
Schneeloch, Walter Lan<strong>des</strong>sportbund Nordrhein-Westfalen<br />
Dr. Schneider, Gabriela Lan<strong>des</strong>sportbund Brandenburg<br />
Schneider, Stephan Stadt Viernheim<br />
Schrage, Simon Leibniz Universität Hannover<br />
Schramm, Thomas Sportbund Pfalz<br />
Schreiber, Andre Stadt Bad Reichenhall<br />
Schreiber, Henning Innenministerium <strong>des</strong> Lan<strong>des</strong><br />
Nordrhein-Westfalen<br />
Schröder, Dirk Stadt Hil<strong>des</strong>heim<br />
Schröder, Lothar Duisburgsport<br />
Schröder, Sybille Molkerei Müller<br />
Schuldt, Michael Playfit<br />
Schuller, Philipp Stadtrat Germering<br />
Schulte, Oliver Stadt Schweinfurt<br />
Schulz, Rudolf Sportamt Frankfurt am Main<br />
Schulz, Rüdiger Stadt Aschersleben<br />
Schulz-Algie, Stephan Sportjugend Hessen<br />
Schumacher, Martin Stadt Oldenburg<br />
Schuster, Joachim Stadt Neuenburg am Rhein<br />
Schütze, Karsten Sportamt der Lan<strong>des</strong>hauptstadt Wiesbaden<br />
Schwaiger, Gabriele Lan<strong>des</strong>hauptstadt München<br />
Schwartz, Boris Bewerbungsgesellschaft München 2018 GmbH<br />
Schwarz, Günter Lan<strong>des</strong>hauptstadt München<br />
Schwarz, Nicole<br />
Schwarz-Viechtbauer,<br />
Bayerischer Lan<strong>des</strong>-Sportverband<br />
Karin Österreichisches Institut für Schul- und<br />
Sportstättenbau<br />
Schwarzweller, Martin Sportbund Pfalz<br />
Schweiger, Iris Bewerbungsgesellschaft München 2018 GmbH<br />
Dr. Schweigert, Manfred TV 1891 Türkheim/Leichtathletikkreis Allgäu<br />
Schwind-Gick, Gudrun <strong>Deutsche</strong>r <strong>Olympische</strong>r Sportbund<br />
Schwing, Matthias Lan<strong>des</strong>sportbund Hessen<br />
Seetzen-Orth, Mandy Bayerischer Lan<strong>des</strong>sport-Verband<br />
Seifert, Ulrike Bayerischer Lan<strong>des</strong>sport-Verband<br />
Seitz, Oliver Playparc<br />
Seitz, Rainer Sportbund Pfalz<br />
Siegel, Christian <strong>Deutsche</strong>r <strong>Olympische</strong>r Sportbund<br />
Sigl, Horst Bayerischer Lan<strong>des</strong>-Sportverband<br />
Silva Cousino, Enrique Universität Potsdam<br />
Simdorn, Svend Bezirksamt Treptow-Köpenick, Berlin<br />
Skalnik, Udo Sportamt Düsseldorf<br />
Sommerfeld, Wolfgang Lan<strong>des</strong>hauptstadt München<br />
Sonnenschein, Ralf<br />
Spennemann-Gräbert,<br />
<strong>Deutsche</strong>r Städte- und Gemeindebund<br />
Gunda Innenministerium Schleswig-Holstein<br />
I 223
Teilnehmerinnen und Teilnehmer<br />
Stachowitz, Diana Bayerischer Landtag<br />
Staimer, Horst Sportbeirat Lan<strong>des</strong>hauptstadt München<br />
Stark, Reinhard Badischer Turner-Bund<br />
Stegemann, Christoph Lan<strong>des</strong>sportbund Berlin<br />
Stehle, Manfred Städtetag Baden-Württemberg<br />
Steindl, Hans Stadt Burghausen<br />
Stelzer, Richard Bayerischer Städtetag<br />
Dr. Stephan, Karlheinz Stadt Schrobenhausen<br />
Stindt, Klaus Kreissportbund Unna<br />
Strasser, Steffen Playparc<br />
Strauch, Walter Gemeinde Gröbenzell<br />
Prof. Dr. Strauß, Bernd Universität Münster<br />
Ströbl, Fritz Richter Spielgeräte GmbH<br />
Ströbl, Rosemarie Richter Spielgeräte GmbH<br />
Stroppe, Brigitte Lan<strong>des</strong>hauptstadt München<br />
Strötgen, Harald Stadtsparkasse München<br />
Stucke, Niclas <strong>Deutsche</strong>r Städtetag<br />
Stuhler, Cornelia<br />
T<br />
Molkerei Müller<br />
Täschner, Uwe Stadtverwaltung Plauen<br />
Thielemann, Jürgen SportService Stadt Nürnberg<br />
Tibbe, Heinz Gruppe Planwerk Universität Osnabrück<br />
Tockweiler, Michael U. Sport StadiaNet GmbH<br />
Tomisch, Reinhold D. Ministerium für Bildung, Jugend, Sport,<br />
Brandenburg<br />
Traschkowitsch, Peter SPÖ<br />
Dr. Tress, Josef Lan<strong>des</strong>hauptstadt München<br />
Triftshäuser, Jürgen Lan<strong>des</strong>hauptstadt München<br />
Turan, Günes Universität Augsburg<br />
Dr. Tzschoppe, Petra<br />
U<br />
Lan<strong>des</strong>sportbund Sachsen<br />
Ude, Christian Lan<strong>des</strong>hauptsstadt München<br />
Ulbrich, Reinhard Vorsitzender Sportbund Remscheid<br />
Umbach, Klaus Bun<strong>des</strong>verband <strong>Deutsche</strong>r Gewichtheber<br />
Ungruhe, Thomas <strong>Deutsche</strong> Reiterliche Vereinigung (FN)<br />
Urban, Iris<br />
V<br />
Bayer. Leichtathletikverband<br />
van Bergen, Marc<br />
Prof. Dr. Vandamme,<br />
Ministerium für Kultus, Jugend, Sport,<br />
Baden-Württemberg<br />
Ralf Städtetag Baden-Württemberg<br />
Väthbrückner, Monika Bayerischer Lan<strong>des</strong>sport-Verband<br />
Vaupel, Egon Stadt Marburg/Lahn<br />
Vogg, Florian Bayerischer Lan<strong>des</strong>-Sportverband<br />
Vogt, Gerd Stadtverwaltung Worms<br />
Voltmann-Hummes, Inge Stadt Frankfurt<br />
von Papp, Gunther SportService der Stadt Nürnberg<br />
Dr. Vorleuter, Harald Bayerisches Staatsministerium für Unterricht<br />
und Kultus<br />
224 I<br />
Voss, Michael<br />
W<br />
Bay. Sportjugend im BLSV, Kreis Nürnberg-Stadt<br />
Wagner, Ingo Bayerischer Lan<strong>des</strong>sport-Verband<br />
Waldinger, Peter Sportjugend NRW<br />
Walter, Wolfgang Stadt Paderborn<br />
Wandelt, Heide Kreissportbund Rhein-Sieg<br />
Weber, Gerhard Stadt Regensburg<br />
Wehr, Gaby TVG Holsterhausen 1893, Essen<br />
Wehr, Peter Peter Wehr Consulting GmbH<br />
Weinbach, Walter Stadt Weißenthurm<br />
Weiss-Söllner, Elisabeth Lan<strong>des</strong>hauptstadt München<br />
Wellner, Anne Bayerischer Lan<strong>des</strong>-Sportverband<br />
Werner, Sandra Führungs-Akademie <strong>des</strong> DOSB<br />
Wernert, Ulrike Schul- und Sportamt Karlsruhe<br />
Wessinghage, Ellen Lan<strong>des</strong>sportbund Rheinland-Pfalz<br />
Westram, Lothar Lan<strong>des</strong>sportbund Rheinland-Pfalz<br />
Dr. Wetterich, Jörg IKPS Stuttgart<br />
Wiebe, Thomas Hansestadt Lüneburg<br />
Wienl, Martina Richter Spielgeräte GmbH<br />
Wiesel-Bauer, Lars <strong>Deutsche</strong>r Behindertensportverband/NPC<br />
Wildner, Susanne Stadt Halle (Saale)<br />
Willmerdinger, Günther Stadt Passau<br />
Wirz, Oliver<br />
Wischnewski,<br />
Arbeitsgemeinschaft Schweizerischer Sportämter<br />
Hans-Werner Sportamt Hagen<br />
Witte, Kirsten <strong>Deutsche</strong>r <strong>Olympische</strong>r Sportbund<br />
Wittstock, Isa Stadt Schwedt/Oder<br />
Dr. Wolf, Joachim Stadt Korntal-Münchingen<br />
Woltering, Ursula Stadt Ahlen<br />
Wonik, Martin<br />
Prof. Dr. Wopp,<br />
Lan<strong>des</strong>sportbund Nordrhein-Westfalen<br />
Christian Universität Osnabrück<br />
Wulf, Oliver Bergische Universität Wuppertal<br />
Wunder, Michael Bayerischer Lan<strong>des</strong>-Sportverband<br />
Wüst, Thomas<br />
Z<br />
Global Partners Bayern<br />
Zacher, Heidemarie<br />
Zacher-Schweigert,<br />
Landkreis Unterallgäu<br />
Sandra TV 1891 Türkheim/ Leichtathletikkreis Allgäu<br />
Dr. Zander, Hans-Jürgen Stadt Wolmirstedt<br />
Zeumer, Renate Playfit<br />
Ziffus, Günter Ratsfraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN<br />
Bergisch Gladbach<br />
Zimmermann, Heike SportService der Stadt Nürnberg<br />
Zippel, Norbert <strong>Deutsche</strong>r <strong>Olympische</strong>r Sportbund<br />
Zschippang, Verena <strong>Deutsche</strong>r <strong>Olympische</strong>r Sportbund<br />
Zurek, Beatrix SPD-Stadtratsfraktion München
Wir bedanken uns bei unseren Kooperationspartnern,<br />
Sponsoren und Unterstützern:<br />
Kooperationspartner:<br />
Sponsoren:<br />
Unterstützer:<br />
Die vorliegende <strong>Dokumentation</strong> steht Ihnen als Download unter<br />
ww.dosb.de/de/sportentwicklung/sportentwicklung/tagungen-und-kongresse<br />
zur Verfügung. Hier finden Sie auch zusätzliche Materialien und<br />
Präsentationen der Arbeitskreise 1 bis 12, die nicht oder nur in gekürzter<br />
Fassung Bestandteil dieser <strong>Dokumentation</strong> sind.
<strong>Deutsche</strong>r <strong>Olympische</strong>r SportBund I Otto-Fleck-Schneise 12 I D-60528 Frankfurt am Main<br />
Tel. +49 (0) 69 / 67 00 0 I Fax +49 (0) 69 / 67 49 06 I www.dosb.de I E-Mail office@dosb.de