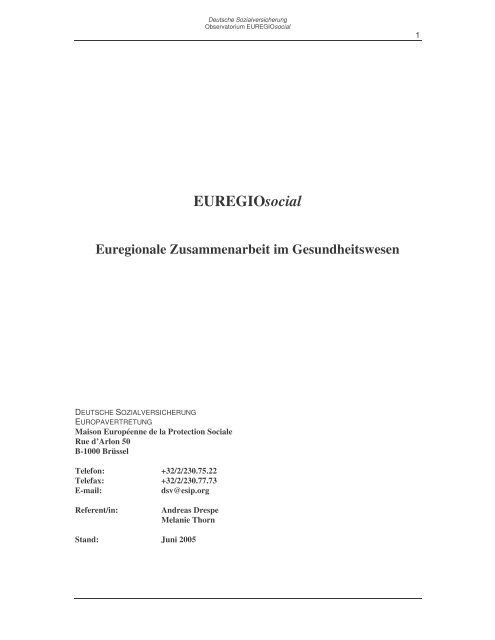EUREGIOsocial - Euregionale Zusammenarbeit im Gesundheitswesen
EUREGIOsocial - Euregionale Zusammenarbeit im Gesundheitswesen
EUREGIOsocial - Euregionale Zusammenarbeit im Gesundheitswesen
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Deutsche Sozialversicherung<br />
Observatorium <strong>EUREGIOsocial</strong><br />
<strong>EUREGIOsocial</strong><br />
<strong>Euregionale</strong> <strong>Zusammenarbeit</strong> <strong>im</strong> <strong>Gesundheitswesen</strong><br />
DEUTSCHE SOZIALVERSICHERUNG<br />
EUROPAVERTRETUNG<br />
Maison Européenne de la Protection Sociale<br />
Rue d’Arlon 50<br />
B-1000 Brüssel<br />
Telefon: +32/2/230.75.22<br />
Telefax: +32/2/230.77.73<br />
E-mail: dsv@esip.org<br />
Referent/in: Andreas Drespe<br />
Melanie Thorn<br />
Stand: Juni 2005<br />
1
Inhaltsverzeichnis<br />
Deutsche Sozialversicherung<br />
Observatorium <strong>EUREGIOsocial</strong><br />
1 Einleitung ................................................................................................................ 9<br />
2 Euregio-Definition ................................................................................................ 10<br />
3 Formen der praktischen <strong>Zusammenarbeit</strong>......................................................... 10<br />
3.1 Allgemeines .......................................................................................................... 10<br />
3.2 Einzelfallaktivitäten .............................................................................................. 10<br />
3.3 Projektbezogen..................................................................................................... 10<br />
3.4 Allgemein institutionell........................................................................................ 11<br />
3.5 Langfristig strategisch......................................................................................... 11<br />
3.6 Die Arbeitsgemeinschaft Europäischer Grenzregionen................................... 11<br />
4 Rechtliche Grundlagen der <strong>Zusammenarbeit</strong>.................................................... 12<br />
4.1 Multilaterale Rahmenabkommen und Madrider Rahmenkonvention des<br />
Europarates .......................................................................................................... 12<br />
4.2 Bi- und trilaterale Abkommen zwischen nationalen Regierungen .................. 12<br />
4.2.1 Karlsruher Übereinkommen ................................................................................... 12<br />
4.3 Abkommen zwischen staatlichen und substaatlichen Instanzen.................... 13<br />
4.3.1 Deutsch-niederländischer Staatsvertrag ................................................................ 13<br />
4.3.2 Französisches Gesetz Loi Joxe ............................................................................. 13<br />
4.3.2.1 Gemischtwirtschaftliche Gesellschaften................................................................. 13<br />
4.3.2.2 Öffentliche Interessensvereinigungen .................................................................... 13<br />
4.4 Europäische Wirtschaftliche Interessensvereinigung (EWIV) ......................... 14<br />
4.5 Vereinsrecht.......................................................................................................... 14<br />
4.6 Stiftungsrecht ....................................................................................................... 14<br />
4.7 Arbeitsvereinbarungen ........................................................................................ 14<br />
4.8 Nationale Trägerstrukturen ................................................................................. 14<br />
5 Euregio und <strong>Gesundheitswesen</strong>......................................................................... 14<br />
5.1 Ausgangslage....................................................................................................... 14<br />
5.2 Versorgungsstrukturen........................................................................................ 15<br />
5.2.1 Inanspruchnahme durch die Bürger ....................................................................... 15<br />
5.2.2 Planung und Finanzierung ..................................................................................... 16<br />
5.3 Wissensaustausch ............................................................................................... 17<br />
6 Sektoren ................................................................................................................ 17<br />
6.1 Öffentlicher Gesundheitsdienst (Public Health)................................................ 17<br />
6.2 Prävention und Früherkennung von Krankheiten............................................. 17<br />
6.3 Ambulante ärztliche Behandlung........................................................................ 17<br />
6.4 Stationäre Akutbehandlung................................................................................. 18<br />
6.5 Arzneien, Heil- und Hilfsmittel............................................................................. 18<br />
6.6 Ambulante und stationäre Rehabilitation .......................................................... 18<br />
6.7 Pflegeleistungen................................................................................................... 19<br />
2
Deutsche Sozialversicherung<br />
Observatorium <strong>EUREGIOsocial</strong><br />
6.8 Ärztlicher Notdienst, Rettungsdienst und Katastrophenschutz ...................... 19<br />
6.9 Service der Krankenkassen ................................................................................ 20<br />
6.10 Verwaltungsvereinfachung ................................................................................. 20<br />
7 Projekte ................................................................................................................. 20<br />
7.1 Ermittlung der Projekte........................................................................................ 20<br />
7.2 Zuordnung der Projekte....................................................................................... 20<br />
7.3 Information Gesamtkarte..................................................................................... 21<br />
7.4 Information Euregio-Karten................................................................................. 21<br />
8 Gesamtkarte Grafik .............................................................................................. 22<br />
8.1 Region Schleswig/ Südjütland ............................................................................ 23<br />
8.1.1 Allgemeines............................................................................................................ 24<br />
8.1.2 Rettungsdienst der Flensburger Feuerwehr........................................................... 24<br />
8.1.3 Strahlentherapie <strong>im</strong> St.-Franziskus-Hospital Flensburg ......................................... 24<br />
8.1.4 Tumorzentrum Flensburg e.V................................................................................. 24<br />
8.1.5 Deutsch-dänische Weiterbildung............................................................................ 25<br />
8.1.6 <strong>Zusammenarbeit</strong> Sønderjyllands Amt, Deutsche Rettungsflugwacht und<br />
Krankenhaus Niebüll .............................................................................................. 25<br />
8.1.7 Kooperation Sønderjyllands Amt und Krankenhaus Niebüll für Entbindungen ...... 25<br />
8.2 Ems Dollart Region .............................................................................................. 26<br />
8.2.1 Allgemeines............................................................................................................ 27<br />
8.2.2 Verbesserung der ambulanten sozialpsychiatrischen Versorgung in der Region .. 27<br />
8.2.3 Fachstelle für Suchtprävention und -information Ems Dollart ................................ 27<br />
8.2.4 Büro Gamma .......................................................................................................... 27<br />
8.2.5 Sonstiges................................................................................................................ 28<br />
8.3 EUREGIO (Gronau)............................................................................................... 29<br />
8.3.1 Allgemeines............................................................................................................ 30<br />
8.3.1.1 EUREGIO-Gründung.............................................................................................. 30<br />
8.3.1.2 Deutsch-niederländischer Grenzraum.................................................................... 30<br />
8.3.1.3 Situation in der EUREGIO...................................................................................... 30<br />
8.3.2 <strong>Euregionale</strong>s Zentrum für <strong>Gesundheitswesen</strong> ....................................................... 31<br />
8.3.3 Grenzüberschreitende Suchthilfe- und Selbsthilfeverbund .................................... 31<br />
8.3.4 Wohn-Versorgungszone Dinxperlo-Suderwick....................................................... 32<br />
8.3.5 Intraluminäre Oxygenierung des Magen-Darm-Traktes ......................................... 33<br />
8.3.6 Verbesserung der funktionalen Genesung von Patienten mit einer Gehirnblutung<br />
(CVA) durch mehrkanalige Elektromyografie gesteuerte Elektrost<strong>im</strong>ulation.......... 33<br />
8.3.7 Diabetes mellitus - Diabetes Fuß ........................................................................... 34<br />
8.3.7.1 Teilprojekt A (Twenteborg Ziekenhuis, Mathias Spital Rheine, Universität Münster)<br />
34<br />
8.3.7.2 Teilprojekt B (Twenteborg Ziekenhuis, Universität Münster).................................. 35<br />
8.3.7.3 Teilprojekt C (BAAT Engineering, Westfälische Wilhelms-Universität) .................. 35<br />
8.3.8 VINCENT 50 – Scanning des diabetischen Fußes ................................................ 35<br />
8.3.8.1 Teilprojekt A (Demcon Oldenzaal, Mindbus Oegstgeest und Vicar Vision<br />
Amsterdam) ........................................................................................................... 37<br />
8.3.8.2 Teilprojekt B (Mathias Spital Rheine und Twenteborgziekenhuis Almelo) ............. 37<br />
8.3.8.3 Teilprojekt C (Fachhochschule Münster und Erasmus Universität Rotterdam -iMTA)<br />
37<br />
8.3.9 The Initiative for Medical Product Development - TIMP ......................................... 37<br />
8.3.10 People to People Action – Wohnen und Psychiatrie .............................................. 38<br />
8.3.11 Grenzüberschreitende Tagesaktivitäten für Menschen mit Behinderung............... 39<br />
8.3.12 People to People – Koordinierung und <strong>Zusammenarbeit</strong> in der Psychiatrie NL/D. 40<br />
3
Deutsche Sozialversicherung<br />
Observatorium <strong>EUREGIOsocial</strong><br />
8.3.13 People to People Projekt – Grenzüberschreitende <strong>Zusammenarbeit</strong> <strong>im</strong> Bereich der<br />
Mitmenschen mit Behinderung............................................................................... 40<br />
8.4 Euregio Rhein-Waal ............................................................................................. 42<br />
8.4.1 Allgemeines............................................................................................................ 43<br />
8.4.2 Grenzüberschreitende Gesundheitsversorgung..................................................... 43<br />
8.4.3 Mobilität in der grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung – MOGG........... 44<br />
8.4.4 <strong>Euregionale</strong>r Einsatz Rettungshubschrauber......................................................... 44<br />
8.4.5 Grenzüberschreitende Nutzung von Gesundheitsversorgung – Erfahrungsaustausch<br />
............................................................................................................................... 44<br />
8.4.6 <strong>Euregionale</strong>s Gesundheitsportal“ – EGP ............................................................... 45<br />
8.4.7 Grensoverschrijdende bijscholing op medisch gebied – Gfo.med ......................... 46<br />
8.4.8 <strong>Euregionale</strong> Koordinationsstelle für Patientenbelange........................................... 46<br />
8.4.9 Projekte in Vorbereitung......................................................................................... 47<br />
8.4.9.1 Vorstudie grenzüberschreitender Einkauf .............................................................. 47<br />
8.4.9.2 Organisatorische Vorgaben der onkologischen Gesundheitsbetreuung für<br />
Brustkrebspatientinnen in der Euregio Rhein-Waal............................................... 47<br />
8.4.9.3 Projektüberschreitende wissenschaftliche Begleitung, Evaluation und Präsentation<br />
48<br />
8.5 Rhein-Maas-Nord.................................................................................................. 49<br />
8.5.1 Allgemeines............................................................................................................ 50<br />
8.5.2 Grenzübergreifende <strong>Zusammenarbeit</strong> Gerontopsychatrie ..................................... 50<br />
8.5.3 Kunden und Qualität (ambulante Pflege) ............................................................... 50<br />
8.5.4 Arztbesuch <strong>im</strong> Nachbarland ................................................................................... 51<br />
8.5.4.1 Chipkarte garantiert ganzheitliche Versorgung über die Grenze ........................... 51<br />
8.5.4.2 Arztbesuch <strong>im</strong> Nachbarland: Einfach und unbürokratisch...................................... 51<br />
8.5.4.3 Mobilitätstrend weist Richtung Deutschland........................................................... 51<br />
8.5.4.4 Patienten fühlen sich gut aufgehoben .................................................................... 51<br />
8.5.4.5 Euregio stellt Gesundheitsversorgung ohne Grenzen unter Beweis...................... 52<br />
8.6 Euregio Maas-Rhein............................................................................................. 53<br />
8.6.1 Allgemeines............................................................................................................ 54<br />
8.6.2 Grenzüberschreitende Gesundheitsversorgung Euregio-Sonderausschuss ......... 54<br />
8.6.3 Kooperation der Universitätskliniken ...................................................................... 54<br />
8.6.4 Onkologische Kooperation CONCERT (Co-operation in Oncological Education<br />
Research and Treatment) ...................................................................................... 55<br />
8.6.5 Kooperationen der Kliniken bei Stoffwechselkrankheiten ...................................... 55<br />
8.6.6 Traumatologie ........................................................................................................ 55<br />
8.6.7 GesundheitsCard international............................................................................... 55<br />
8.6.8 Dialysebehandlung................................................................................................. 56<br />
8.6.9 Zorg Nabij (ZONA) ................................................................................................. 56<br />
8.6.10 Hörgeräte ............................................................................................................... 56<br />
8.6.11 Eurecard – Mobilität und Akzeptanz für Menschen mit Behinderung..................... 56<br />
8.6.12 Grenzüberschreitender Rettungsdienst.................................................................. 57<br />
8.7 Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens........................................................ 58<br />
8.7.1 Allgemeines............................................................................................................ 59<br />
8.7.2 <strong>Gesundheitswesen</strong>................................................................................................. 59<br />
8.8 EuRegio SaarLorLuxRhein.................................................................................. 61<br />
8.8 Allgemeines............................................................................................................ 62<br />
8.8.1 Ärztetagungen ........................................................................................................ 62<br />
8.8.2 Gemeinsame Beratungsstellen von Krankenkassen.............................................. 62<br />
8.8.3 Gegenseitige Versorgung mit Blutprodukten.......................................................... 62<br />
8.8.4 Suchtabhängigkeit.................................................................................................. 63<br />
8.8.5 Pôle de l’Hôpital ..................................................................................................... 63<br />
8.8.6 Grenzüberschreitender Rettungsdienst.................................................................. 64<br />
8.8.7 Zweisprachige Schilder für Arztpraxen................................................................... 64<br />
4
Deutsche Sozialversicherung<br />
Observatorium <strong>EUREGIOsocial</strong><br />
8.9 Region PAMINA .................................................................................................... 65<br />
8.9.1 Allgemeines............................................................................................................ 66<br />
8.9.2 Kooperation zwischen Krankenhäusern................................................................. 66<br />
8.9.3 Vergleichende Studie zur Gesundheit am Oberrhein............................................. 66<br />
8.9.4 Projekt zum Thema Demenz.................................................................................. 66<br />
8.9.5 Grenzüberschreitendes Rettungswesen ................................................................ 67<br />
8.9.6 Verbindungsgruppe Grenzüberschreitendes <strong>Gesundheitswesen</strong> .......................... 67<br />
8.10 Oberrheinkonferenz ............................................................................................. 68<br />
8.10.1 Allgemeines............................................................................................................ 69<br />
8.10.1.1 Institut für regionale <strong>Zusammenarbeit</strong> und europäische Verwaltung ..................... 69<br />
8.10.2 Beispielhafte Projekte <strong>im</strong> stationären Bereich am Oberrhein................................. 69<br />
8.10.2.1 Kooperation St. Josefsklinik Offenburg mit dem Centre Hospitalier Sélestat......... 69<br />
8.10.2.2 <strong>Zusammenarbeit</strong> des Epilepsiezentrums Kork mit den Straßburger<br />
Universitätskliniken Haute Pierre und Hopital Civil................................................ 69<br />
8.10.2.3 Kooperation Herzzentrum Bad Krozingen mit der Klinikgruppe Groupe Hospitalier<br />
Privé du Centre Alsace.......................................................................................... 70<br />
8.10.3 Projekte der Oberrheinkonferenz <strong>im</strong> Gesundheitsbereich ..................................... 70<br />
8.10.3.1 Kartographie „Medizinische Spezialeinrichtungen und Großgeräte“...................... 70<br />
8.10.3.2 EPI-Rhin-Meldesystem: Epidemiologisches Frühwarnsystem für ansteckende<br />
Krankheiten (seit 2001) ......................................................................................... 71<br />
8.10.3.3 Vereinbarungen zum grenzüberschreitenden Rettungsdienst ............................... 72<br />
8.10.3.4 Grenzüberschreitender Bettennachweis ................................................................ 72<br />
8.10.3.5 Veranstaltung „Mobilität von Gesundheitsdienstleistungen am Oberrhein“ ........... 72<br />
8.10.3.6 Gesundheitsbericht für das Oberrheintal (abgeschlossen in 2001) ....................... 72<br />
8.11 Centre - Strasbourg/Offenburg - Euregio in Planung ....................................... 74<br />
8.11.1 Allgemeines............................................................................................................ 75<br />
8.11.2 Arbeitstreffen .......................................................................................................... 75<br />
8.12 RegioTriRhena – zurzeit keine Projekte ............................................................. 77<br />
8.12.1 Allgemeines............................................................................................................ 78<br />
8.13 Hochrhein-Kommission - zur Zeit keine Projekte.............................................. 79<br />
8.13.1 Allgemeines............................................................................................................ 80<br />
8.14 REGIO BODENSEE (Internationale Bodenseekonferenz)................................. 81<br />
8.14.1 Allgemeines............................................................................................................ 82<br />
8.14.2 <strong>Gesundheitswesen</strong>................................................................................................. 82<br />
8.14.3 Gesundheitsförderung <strong>im</strong> Bodenseeraum.............................................................. 82<br />
8.14.4 Sonstiges................................................................................................................ 83<br />
8.14.4.1 Gesundheitsministerkonferenz............................................................................... 83<br />
8.14.4.2 Tagung zur ärztlichen Fortbildung.......................................................................... 83<br />
8.14.4.3 Jahrestagung der Urologen.................................................................................... 83<br />
8.14.4.4 Internationales Ärztetreffen .................................................................................... 83<br />
8.14.4.5 Arbeitsgruppen <strong>im</strong> Krankenhausbereich ................................................................ 83<br />
8.15 ARGE-ALP............................................................................................................. 84<br />
8.15.1 Allgemeines............................................................................................................ 85<br />
8.15.2 Symposium „Erstversorgung und Rehabilitation von Schlaganfallpatienten und<br />
schwer Schädelhirnverletzten“ ............................................................................... 85<br />
8.15.3 Transalpine Prävention Sucht ................................................................................ 85<br />
8.16 Arbeitsgemeinschaft Alpen-Adria....................................................................... 86<br />
8.16.1 Allgemeines............................................................................................................ 87<br />
8.16.2 Projektgruppe „Notfallmedizin <strong>im</strong> Alpen-Adria Raum“............................................ 87<br />
8.16.3 Projekt zur Bewertung und Umsetzung der EUROPET-Richtlinien (Transport von<br />
Risikoneugeborenen) in den Alpen-Adria Mitgliedsregionen: ................................ 87<br />
8.16.4 Projektgruppe “Qualität der Gesundheitsdienste” .................................................. 88<br />
8.16.5 Projektgruppe „Altenhilfe“....................................................................................... 88<br />
8.16.6 Alps Adriatic Disability network .............................................................................. 88<br />
5
Deutsche Sozialversicherung<br />
Observatorium <strong>EUREGIOsocial</strong><br />
8.16.7 Kliniknetzwerk – Kardiologie – Onkologie – Neurologie - Transplantationen......... 89<br />
8.16.8 Arbeitsgruppe „Sozialer Schutz“............................................................................. 89<br />
8.16.9 Arbeitsgruppe „Notruf“............................................................................................ 90<br />
8.17 Salzburg-Berchtesgadener Land-Traunstein..................................................... 91<br />
8.17.1 Allgemeines............................................................................................................ 92<br />
8.17.2 Mobile Drogenprävention „guat beinand“ ............................................................... 92<br />
8.17.3 Grenzüberschreitende AIDS-Hilfe .......................................................................... 92<br />
8.17.4 Plötzlicher Kindstod................................................................................................ 92<br />
8.18 Inn-Salzach-Euregio............................................................................................. 93<br />
8.18.1 Allgemeines............................................................................................................ 94<br />
8.18.2 Notarztdienst mit Navigationssystem ..................................................................... 94<br />
8.18.3 Interregionale Entwicklung von neurologischen Qualifizierungsmaßnahmen <strong>im</strong><br />
Grenzbereich Oberösterreich-Niederbayern .......................................................... 94<br />
8.18.4 Untersuchung „Volkswirtschaftliche Mehrkosten durch die Doppelvorhaltungen <strong>im</strong><br />
<strong>Gesundheitswesen</strong>“................................................................................................ 95<br />
8.18.5 Grenzüberschreitender Rettungshubschrauber Christopherus Europa 3 .............. 95<br />
8.19 EUREGIO Bayerischer Wald-Sumava-Mühlviertel............................................. 96<br />
8.19.1 Allgemeines............................................................................................................ 97<br />
8.19.2 Protein Chip-Net..................................................................................................... 97<br />
8.19.3 MEANDER.............................................................................................................. 97<br />
8.20 Euregio Egrensis.................................................................................................. 98<br />
8.20.1 Allgemeines............................................................................................................ 99<br />
8.20.2 Fachakademie Haus Silberbach ............................................................................ 99<br />
8.20.3 Koordinierungsstelle grenzüberschreitende Kooperation in der Pflegeausbildung 99<br />
8.20.4 Kompetenzzentrum – Vorsprung durch Qualität (VdQ)........................................ 100<br />
8.20.5 Terraintherapie ..................................................................................................... 100<br />
8.20.6 Begegnung deutscher und tschechischer Behinderter......................................... 100<br />
8.20.7 KARO-zielgruppenspezifische grenzüberschreitende Sozialarbeit in der<br />
Prostitutions- und Drogenszene ........................................................................... 100<br />
8.20.8 Netzwerk zur regionalen Qualitätsoffensive ......................................................... 100<br />
8.21 Euroregion Erzgebirge-Krusnohorí .................................................................. 101<br />
8.21.1 Allgemeines.......................................................................................................... 102<br />
8.21.2 Sozialer Atlas ....................................................................................................... 102<br />
8.21.3 Wörterbuch für die Feuerwehr.............................................................................. 102<br />
8.22 Euroregion ELBE/ LABE – derzeit keine Projekte........................................... 103<br />
8.23 Euroregion Neisse-Nisa-Nysa ........................................................................... 104<br />
8.23.1 Allgemeines.......................................................................................................... 105<br />
8.23.2 Euroregionale Expertengruppe Öffentliche Gesundheit....................................... 105<br />
8.23.3 Telekardiologisches Netzwerk Ostsachsen.......................................................... 105<br />
8.23.4 Präventionsarbeit ................................................................................................. 106<br />
8.23.5 Prostituiertenbetreuung ........................................................................................ 106<br />
8.23.6 Ausgewählte Gesundheitskonferenzen................................................................ 107<br />
8.24 Euroregion Spree-Neisse-Bober....................................................................... 108<br />
8.24.1 Allgemeines.......................................................................................................... 109<br />
8.24.2 Projektantrag Interreg III A ................................................................................... 109<br />
8.24.3 Arbeitstagung Rettungswesen in Polen und Deutschland - Möglichkeiten der<br />
grenzüberschreitenden <strong>Zusammenarbeit</strong>............................................................. 109<br />
8.24.4 Arbeitstagung Gesundheitsmonitoring von Kindern und Jugendlichen................ 109<br />
8.24.5 Mitarbeit bei der AG „grenzüberschreitende stationäre Versorgung“ <strong>im</strong> Rahmen des<br />
Projektes EU-MED-EAST..................................................................................... 109<br />
6
Deutsche Sozialversicherung<br />
Observatorium <strong>EUREGIOsocial</strong><br />
8.25 Euroregion PRO EUROPA VIADRINA............................................................... 110<br />
8.25.1 Allgemeines.......................................................................................................... 111<br />
8.25.2 Vorbeugen ist besser als heilen, vorbeugen ist billiger als heilen“ – Suchtprävention<br />
<strong>im</strong> Pr<strong>im</strong>ar- und Sekundarbereich.......................................................................... 111<br />
8.26 Euroregion POMERANIA ................................................................................... 113<br />
8.26.1 Allgemeines.......................................................................................................... 114<br />
8.26.2 Telemedizinisches Netzwerk zur Unterstützung der Tumorversorgung in der<br />
Euregion POMERANIA......................................................................................... 114<br />
8.26.2.1 Teilprojekt Telepathologie .................................................................................... 115<br />
8.26.2.2 Teilprojekt Teleradiologie ..................................................................................... 115<br />
8.26.2.3 Teilprojekt Telekonferenz ..................................................................................... 116<br />
9 Adressenverzeichnis ......................................................................................... 117<br />
9.1 Region Schleswig/Südjütland ........................................................................... 117<br />
9.2 Ems Dollart Region ............................................................................................ 117<br />
9.3 Euregio Gronau .................................................................................................. 117<br />
9.4 Euregio Rhein-Waal ........................................................................................... 118<br />
9.5 Euregio Rhein-Maas-Nord ................................................................................. 118<br />
9.6 Euregio Maas-Rhein........................................................................................... 118<br />
9.7 Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens...................................................... 118<br />
9.8 EuRegio SaarLorLuxRhein................................................................................ 118<br />
9.9 PAMINA ............................................................................................................... 119<br />
9.10 Oberrheinkonferenz ........................................................................................... 119<br />
9.11 Centre - Strasbourg/Offenburg - Euregio in Planung ..................................... 120<br />
9.12 RegioTriRhena.................................................................................................... 120<br />
9.13 Hochrhein-Kommission..................................................................................... 120<br />
9.14 REGIO BODENSEE [Internationale Bodenseekonferenz/IBK] ....................... 120<br />
9.15 ARGE-ALP........................................................................................................... 121<br />
9.16 Arbeitsgemeinschaft Alpen-Adria..................................................................... 121<br />
9.17 Euregio Salzburg-Berchtesgadener Land-Traunstein .................................... 121<br />
9.18 Inn-Salzach-Euregio........................................................................................... 121<br />
9.19 EUREGIO Bayerischer Wald-Sumava-Mühlviertel........................................... 121<br />
9.20 Euregio Egrensis................................................................................................ 122<br />
9.21 Euroregion Erzgebirge-Krusnohorí .................................................................. 122<br />
9.22 Euroregion ELBE/LABE..................................................................................... 122<br />
9.23 Euroregion Neisse-Nisa-Nysa ........................................................................... 123<br />
9.24 Euregio Spree-Neisse-Bober............................................................................. 123<br />
9.25 Euroregion PRO EUROPA VIADRINA............................................................... 124<br />
9.26 Euroregion POMERANIA ................................................................................... 124<br />
7
Deutsche Sozialversicherung<br />
Observatorium <strong>EUREGIOsocial</strong><br />
9.27 Ausschuss der Regionen .................................................................................. 124<br />
9.28 Arbeitsgemeinschaft Europäischer Grenzregionen (AGEG).......................... 124<br />
9.29 Versammlung der Regionen Europas .............................................................. 124<br />
9.30 Kongress der Gemeinden und Regionen Europas ......................................... 125<br />
9.31 Europarat ............................................................................................................ 125<br />
8
Deutsche Sozialversicherung<br />
Observatorium <strong>EUREGIOsocial</strong><br />
1 Einleitung<br />
Die kulturelle und geschichtliche Entwicklung Europas und seiner Staaten zeigt sich auch <strong>im</strong><br />
Verlauf der Staatsgrenzen, die, so wie wir sie heute kennen, durch die verschiedenen<br />
kriegerischen Auseinandersetzungen des 19. und 20. Jahrhunderts zustande kamen. Neben<br />
den bestehenden natürlichen Grenzen der Flüsse, Seen oder Gebirgszüge, setzte die Politik<br />
Trennlinien auch dort, wo sie unnatürliche Effekte auslösen. Da Nationalstaaten<br />
grundsätzlich zur Ausprägung nationaler Zentren neigen, d. h. mehr oder weniger<br />
zentralistisch oder föderal organisiert sind, mussten sich die peripheren Grenzräume<br />
zwangsläufig zu strukturschwächeren Gebieten <strong>im</strong> Vergleich zu den Zentren entwickeln.<br />
Ausnahmen gab und gibt es dort, wo beiderseits grenznah hohe Bevölkerungsdichten einen<br />
Bedarf nach wirtschaftlichem Austausch erzeugen. Die nationalen Politiken führten - ohne<br />
die „Randgebiete“ mit ihrer spezifischen Situation besonders zu beachten - zu den heute<br />
bestehenden bekannten Unterschieden <strong>im</strong> Staats-, Verwaltungs- und Sozialwesen. Bei der<br />
Betrachtung von Grenzregionen muss man auch berücksichtigen, dass gerade die dort<br />
lebenden Menschen lange Zeit Hauptleidtragende der kriegerischen Konflikte der Staaten<br />
waren.<br />
Nach dem Zweiten Weltkrieg mit seinen furchtbaren Ergebnissen bestand allgemein der<br />
dringende Wunsch nach einem dauerhaften Frieden und einer nachhaltigen Verbesserung<br />
der wirtschaftlichen Situation. Dies löste einerseits die Europäische Bewegung mit seinem<br />
Weg in die europäische Integrationspolitik aus, setzte andererseits bei den Menschen in den<br />
Grenzgebieten Bemühungen in Gang, negative Auswirkungen der Grenzbarrieren <strong>im</strong><br />
Interesse der Bürger „vor Ort“ zu neutralisieren. Diese Bestrebungen waren <strong>im</strong> wahrsten<br />
Sinne des Wortes begrenzt durch die fehlenden Regelungskompetenzen lokaler Behörden<br />
und Gremien, die früh erkannten, dass als erster Schritt die Bildung von regionalen<br />
grenzzonalen kommunalen Gruppen bzw. Verbänden notwendig war (50er und 60er Jahre),<br />
um Interessen bündeln zu können. Im Rahmen der Verwirklichung von Schritten der<br />
politischen europäischen Einigung und rechtlichen Harmonisierung, so der Europäische<br />
Binnenmarkt (1. Januar 1993) oder die Wirtschafts- und Währungsunion (1. Januar 1999)<br />
ergaben sich auch für die Grenzregionen zum Vorteil der Bürger neue Bedingungen für eine<br />
Weiterentwicklung der grenzüberschreitenden <strong>Zusammenarbeit</strong>, die sich heute in vielfältiger<br />
Art und Weise darstellt, sei es in Wirtschaft, Kultur, Freizeit, Verwaltung oder auf sozialem<br />
Gebiet. Innerhalb der durch den Vertrag von Maastricht (1992) geschaffenen Europäischen<br />
Union, die völkerrechtlich zwar kein Bundesstaat, aber auch weit mehr als ein Staatenbund<br />
ist, sind die nationalen Binnengrenzen an die EU-Außengrenze „verschoben“ worden;<br />
müsste man da nicht in diesem Zusammenhang das Wort „grenzüberschreitend“ als<br />
Phänomen <strong>im</strong>mer in Anführungszeichen setzen oder besser einen treffenderen Begriff<br />
finden? Um so mehr, als dass nach der Erweiterungsrunde <strong>im</strong> Mai 2004 die Europäische<br />
Union um 10 Mitgliedstaaten größer und sich die Außengrenzen nun nochmals um einige<br />
Tausend Kilometer verschoben haben.<br />
Tatsächlich, es gibt dieses Wort, das zum Synonym für Regionen geworden ist, die ohne<br />
trennende Staatsgrenzen leben wollen: EUREGIO. Bereits 1958 wurde die erste dieser Art<br />
für den Raum Enschede/Gronau an der deutsch-niederländischen Grenze gegründet; sie ist<br />
bis heute Vorbild für andere Regionen, auch wenn sie nicht so heißen.<br />
9
Deutsche Sozialversicherung<br />
Observatorium <strong>EUREGIOsocial</strong><br />
2 Euregio-Definition<br />
Die geografische Definition von Regionen mit grenzüberschreitender <strong>Zusammenarbeit</strong><br />
(nachfolgend also Euregio genannt) wird von den Faktoren Natur, wirtschaftliche Tätigkeit<br />
des Menschen in seiner umfassendsten Bedeutung und Kultur <strong>im</strong> weiten Sinn -<br />
einschließlich Geschichte/Sprachen bis hin zu gemeinsamer Identität - geprägt.<br />
Änderungen der Euregio-Grenzen sind heute wegen fehlender Grenzkonflikte nicht zu<br />
erwarten, aber aus anderen Gründen dennoch möglich. So können Infrastrukturprojekte, wie<br />
neue Verkehrswege durch Tunnel- und Brückenbauten, natürliche Grenzen aufheben und<br />
geänderte Rahmenbedingungen schaffen. Auch können Fördermaßnahmen der EU, mit der<br />
die grenzüberschreitende <strong>Zusammenarbeit</strong> unterstützt wird, auf Euregio-Abgrenzungen<br />
Einfluss nehmen. Nicht zuletzt führen politische Entscheidungen staatlicher Instanzen sowie<br />
grenzübergreifender, regionaler bzw. lokaler Gremien, die aus den unterschiedlichsten<br />
Gründen getroffen werden, zur flächenmäßigen und inhaltlichen Definition einer Euregio. Die<br />
Euregio-Abgrenzungen sind keine starren Gebilde und ihre geographischen Lagen sind nicht<br />
<strong>im</strong>mer deckungsgleich mit den politischen Strukturen oder den Projektstrukturen, was am<br />
Beispiel der Oberrheinkonferenz ihrer drei Mandatsgebiete Pamina, Centre und Regio<br />
TriRhena deutlich wird. Deshalb soll auch eine Neuordnung der Euregionen vorgenommen<br />
werden.<br />
3 Formen der praktischen <strong>Zusammenarbeit</strong><br />
3.1 Allgemeines<br />
Die grenzüberschreitende praktische <strong>Zusammenarbeit</strong> kann in einzelfallorientierte,<br />
projektbezogene, allgemeine institutionelle und in langfristig strategische Formen unterteilt<br />
werden. Am Anfang der geschichtlichen Entwicklung standen sicher einzelne Aktivitäten, um<br />
drängende Probleme zu lösen, die uns heute vielleicht merkwürdig wegen ihrer<br />
Problemstellung vorkommen würden, damals aber schiere Realität waren. So wollte man an<br />
best<strong>im</strong>mten Stellen zusätzliche Grenzübergänge schaffen. Aber auch noch heute gilt es,<br />
manche bürokratische Grenzbarriere einzureißen. Mit welchen Mitteln und wie dies<br />
geschieht, hängt nicht nur von der fachlichen Seite ab, sondern, wie sich zeigt, auch von<br />
dem kulturellen Umfeld der Region und von den dort agierenden Menschen. Wichtig ist auch<br />
das Engagement einzelner Persönlichkeiten und die Schaffung gegenseitigen Vertrauens<br />
über die Grenzen hinweg. Wohl jede Euregio könnte in der regionalen Öffentlichkeit<br />
bekannte Bürger benennen, die sich um die grenzüberschreitende <strong>Zusammenarbeit</strong> verdient<br />
gemacht haben.<br />
3.2 Einzelfallaktivitäten<br />
Einzelfallaktivitäten initiieren oft Netzwerke und Foren, die Betroffene und Beteiligte<br />
zusammenbringen. Öffentliche, private oder gemeinnützige Instanzen können miteinbezogen<br />
werden. Ad-hoc oder auf der Grundlage von Vereinbarungen arbeitet man dort eher in loser<br />
Form zusammen, um zum Beispiel in Gesprächsrunden und -kreisen Erfahrungen und<br />
Meinungen auszutauschen. Es bedarf in der Regel keiner besonderen Rechtsform.<br />
3.3 Projektbezogen<br />
Die projektbezogene Form der <strong>Zusammenarbeit</strong> benötigt grundsätzlich ebenfalls keine<br />
eigene grenzüberschreitende Struktur und Rechtsform, sondern kann auch von bestehenden<br />
Einrichtungen beiderseits der Grenze geplant und durchgeführt werden. Sehr hilfreich, teils<br />
unabdingbar, ist aber die Verknüpfung mit Euregio-Strukturen, gerade bei größeren<br />
Projekten, die zum Beispiel seitens der EU unterstützt werden. Der Abschluss schriftlicher<br />
Vereinbarungen der Projektpartner ist heutzutage standard, zumal die Kompetenz der<br />
Projektleitung in rechtlichen Angelegenheiten zu regeln ist (Rechtsform der Projektleitung). In<br />
Abhängigkeit von den Intentionen des Projektes könnte die Gründung einer Europäischen<br />
10
Deutsche Sozialversicherung<br />
Observatorium <strong>EUREGIOsocial</strong><br />
Wirtschaftlichen Interessensvereinigung (EWIV) in Frage kommen, die die einzige EU-weite<br />
Unternehmensform für wirtschaftliche Aktivitäten ist.<br />
3.4 Allgemein institutionell<br />
Die allgemeine institutionelle <strong>Zusammenarbeit</strong> zeichnet sich dadurch aus, dass ständige<br />
grenzübergreifende Gremien den Rahmen für eine kooperative <strong>Zusammenarbeit</strong> auf vielen<br />
Gebieten darstellen und nicht auf ein einzelnes Projekt beschränkt sind, wobei allerdings die<br />
politischen Entscheidungsmöglichkeiten, so bei der Planung von Projekten, eher gering<br />
eingeschätzt werden. In der Regel sind aber gemeinsam finanzierte Verwaltungskapazitäten<br />
zur Bewältigung der organisatorischen Aufgaben vorhanden. Eine besondere Rechtsform ist<br />
nicht zwingend; so kann das Sekretariat Teil der Aufbauorganisation eines beteiligten<br />
kommunalen Trägers sein, der seine von ihm verauslagten Kosten von den anderen Trägern<br />
<strong>im</strong> Umlageverfahren zurückbekommt.<br />
3.5 Langfristig strategisch<br />
Langfristig strategische Formen der <strong>Zusammenarbeit</strong> entwickeln sich naturgemäß erst in<br />
längeren Zeitabläufen und müssen vor dem Hintergrund der Vertrauensbasis gesehen<br />
werden, die erreicht werden konnte. Das Ziel grenzübergreifender Entwicklungskonzepte ist<br />
die Bereitstellung von Informationen und Analysen für einen integrierten und langfristigen<br />
(ca. 15 bis 20 Jahre) strategischen Ansatz, der die spezifischen Entwicklungsziele und<br />
Prioritäten definiert, in deren Rahmen einzelne Projekte verwirklicht werden können. In<br />
einem zweiten Schritt werden kurzfristige (drei bis fünf Jahre) operationelle Programme<br />
entwickelt. In diesem höchsten Grad der Integration verfügt man über gewachsene<br />
Strukturen, auch hinsichtlich der politischen Entscheidungsfindung, mit denen<br />
verschiedenste Fachbereiche in vielfältiger Art und Weise abgedeckt werden können.<br />
Aufgrund ihrer Kompetenz sind die agierenden Personen und Partnerorganisationen an der<br />
Planung, Programmerstellung und Durchführung von mehreren grenzübergreifenden<br />
Strategien und Programmen beteiligt. In Bezug auf INTERREG-Programme<br />
(Förderprogramme der EU) haben sie gewisse Befugnisse, wie die Vorauswahl von<br />
Projekten. Spezielle Lenkungs- und Begleitausschüsse sind eingerichtet. Es geht nicht<br />
darum, neue grenzüberschreitende Verwaltungseinheiten, sondern Dienstleistungsangebote<br />
für die Bürger in Euregio-Angelegenheiten zu schaffen und die Lebensverhältnisse zu<br />
verbessern.<br />
3.6 Die Arbeitsgemeinschaft Europäischer Grenzregionen<br />
Die 1971 gegründete Arbeitsgemeinschaft Europäischer Grenzregionen (AGEG) mit Sitz in<br />
Gronau ist die älteste Regionalorganisation in Europa. Die Mitgliedschaft in diesem als<br />
gemeinnützig eingetragenen Verein wuchs seither von zehn auf 58. Die AGEG versteht sich<br />
als Ansprechpartner der europäischen Organe einschließlich des Europarates, bei dem sie<br />
einen offiziellen Beobachterstatus hat. 1981 verabschiedete der Verein als<br />
Grundsatzdokument die „Europäische Charta der Grenz- und grenzübergreifenden<br />
Regionen“, die inzwischen in revidierter Fassung vorliegt. Die AGEG leistet(e) konstruktive<br />
Unterstützung bei der Formulierung der INTERREG-Programme, mit denen die Entwicklung<br />
der Grenzregionen seitens der EU gefördert werden soll. Im Zeitraum 1990 bis 2001 wurde<br />
das „Observatorium für grenzüberschreitende <strong>Zusammenarbeit</strong>“ („Linkage Assistance and<br />
Cooperation for the European Border Regions/LACE“) mit finanzieller Unterstützung der<br />
Europäischen Kommission unterhalten. Am Standort Brüssel sowie in weiteren 11<br />
ausgewählten Grenzregionen wurden <strong>im</strong> Rahmen des Kommissionsprogramms „Technical<br />
Assistance Programme“ (TAP) grenzüberschreitende Aktivitäten unterstützt.<br />
11
Deutsche Sozialversicherung<br />
Observatorium <strong>EUREGIOsocial</strong><br />
4 Rechtliche Grundlagen der <strong>Zusammenarbeit</strong><br />
4.1 Multilaterale Rahmenabkommen und Madrider Rahmenkonvention<br />
des Europarates<br />
Auf der Basis internationaler Abkommen können grenzübergreifende Aktivitäten zwischen<br />
öffentlichen Körperschaften unterschiedlicher Ebenen stattfinden, zum Beispiel zwischen<br />
lokalen Behörden und internationalen Organisationen. Der Europarat hat die wichtigsten<br />
Arten von Abkommen in der „Madrider Rahmenkonvention über grenzübergreifende<br />
<strong>Zusammenarbeit</strong> zwischen territorialen Gebietskörperschaften oder Behörden“<br />
zusammengefasst (beschlossen 1982, überarbeitet 1989 und inzwischen von mehr als 20<br />
Ländern ratifiziert). Artikel 2 der Konvention definiert den Begriff „territoriale Gemeinschaften<br />
und Behörden“ als „Gemeinschaften/Behörden oder Körperschaften, die regionale und lokale<br />
Funktionen ausüben“(= Gebietskörperschaften). Die Staaten verpflichteten sich unter<br />
anderem, nationale gesetzliche, administrative und technische Schwierigkeiten bei der<br />
grenzüberschreitenden <strong>Zusammenarbeit</strong> zu beseitigen.<br />
Im Anhang finden sich Modelle für zwischenstaatliche Vereinbarungen für folgende Gebiete:<br />
Förderung der grenzübergreifenden <strong>Zusammenarbeit</strong>; regionale grenzübergreifende<br />
Beratung; kommunale grenzübergreifende Beratung; vertragliche grenzübergreifende<br />
<strong>Zusammenarbeit</strong> zwischen lokalen Gebietskörperschaften sowie Organe für<br />
grenzübergreifende <strong>Zusammenarbeit</strong> zwischen lokalen Gebietskörperschaften. Außerdem<br />
enthält der Anhang diverse Rahmenvereinbarungen zwischen lokalen bzw. regionalen<br />
Gebietskörperschaften: Bildung eines Beratungsgremiums; Koordinierung des Managements<br />
der öffentlichen Belange; Gründung von grenzübergreifenden privatrechtlichen<br />
Vereinigungen; Bildung eines Verwaltungsgremiums; Gewährleistung von öffentlichrechtlichen<br />
Versorgungen oder Dienstleistungen in Grenzgebieten sowie die Bildung von<br />
Organen zur grenzübergreifenden <strong>Zusammenarbeit</strong>.<br />
Im Zusatzprotokoll wird die Einrichtung von ständigen Institutionen zur grenzübergreifenden<br />
<strong>Zusammenarbeit</strong> befürwortet, entweder nach öffentlichem oder privatem Recht sowie mit<br />
rechtlich bindenden Entscheidungsbefugnissen. Die Madrider Konvention ist zwar aus<br />
praktischen (erhebliche Unterschiede in den Verwaltungs- und Rechtssystemen der Staaten)<br />
und rechtlichen Gründen (da nur Konvention) selbst kein Abkommen zur<br />
grenzüberschreitenden <strong>Zusammenarbeit</strong>, schafft aber Grundlagen für die verstärkte<br />
<strong>Zusammenarbeit</strong> mittels zwischenstaatlicher Abkommen, worunter auch das deutschniederländische<br />
fällt.<br />
4.2 Bi- und trilaterale Abkommen zwischen nationalen Regierungen<br />
Hiermit können auf speziellen Fachgebieten Strukturen geschaffen werden, die von ad-hoc<br />
Arbeitsgruppen bis zu Organisationen reichen. Besonders zu nennen sind die<br />
zwischenstaatlichen Kommissionen wie die Oberrheinkonferenz, deren allgemeine Aufgaben<br />
in der grenzüberschreitenden Raumordnung liegen; dazu gehören die<br />
Flächennutzungsplanung ebenso wie öffentliche Dienste und Einrichtungen.<br />
4.2.1 Karlsruher Übereinkommen<br />
Am 23.01.1996 wurde in Karlsruhe das Übereinkommen zwischen Deutschland, Frankreich,<br />
Luxemburg und dem Schweizerischen Bundesrat (letzter handelnd <strong>im</strong> Namen der Kantone<br />
Aargau, Basel-Landschaft, Basel-Stadt, Jura und Solothurn) unterzeichnet, das die<br />
gemeinsame rechtliche Basis für die grenzüberschreitende <strong>Zusammenarbeit</strong> zwischen<br />
Gebietskörperschaften und örtlichen öffentlichen Stellen bildet. Entgegen diesem<br />
Übereinkommen existiert aber <strong>im</strong>mer noch ein französisches Gesetz, wonach die Beteiligung<br />
französischer Kommunen an einem grenzüberschreitenden Zweckverband mit Sitz <strong>im</strong><br />
Ausland der Genehmigung per Dekret des französischen Staatsrates bedarf.<br />
12
Deutsche Sozialversicherung<br />
Observatorium <strong>EUREGIOsocial</strong><br />
4.3 Abkommen zwischen staatlichen und substaatlichen Instanzen<br />
In föderal organisierten Staaten können in manchen Fällen substaatliche Instanzen, wie die<br />
Bundesländer in Deutschland und Österreich, mit anderen staatlichen/substaatlichen<br />
Instanzen internationale Vereinbarungen abschließen, wobei sich freilich die nationalen<br />
Regierungen ihr „Letztes Wort“ vorbehalten, sei es in Form eines Vetorechtes oder durch<br />
aufsichtsrechtliche Auflagen bzw. Maßnahmen. Ein gutes Beispiel für Abkommen dieser<br />
Kategorie ist der nachfolgend beschriebene deutsch-niederländische Staatsvertrag von<br />
Anholt, der 1991 beschlossen und 1993 ratifiziert worden ist.<br />
4.3.1 Deutsch-niederländischer Staatsvertrag<br />
Das „Abkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und den Ländern<br />
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und dem Königreich der Niederlande zur<br />
grenzübergreifenden <strong>Zusammenarbeit</strong> zwischen den lokalen und regionalen<br />
Gebietskörperschaften oder Behörden und anderen öffentlichen Einrichtungen“ ermöglicht<br />
es, öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Verträge zwischen den Gebietskörperschaften<br />
zu schließen. Auf dieser Basis haben die Euregios Ems Dollart und Rhein-Waal inzwischen<br />
ihre eigene grenzübergreifende Rechtspersönlichkeit als deutsch-niederländischer öffentlichrechtlicher<br />
Zweckverband erhalten.<br />
4.3.2 Französisches Gesetz Loi Joxe<br />
Das Gesetz Loi Joxe (1992) erlaubt den französischen regionalen und lokalen<br />
Gebietskörperschaften, sich an grenzübergreifenden Abkommen zu beteiligen und<br />
grenzüberschreitend Körperschaften zu bilden, an denen Gebietskörperschaften gleicher<br />
Ebene anderer Staaten beteiligt sind. Die gemeinsamen Gebilde können als so genannte<br />
„Gemischwirtschaftliche Gesellschaften“ oder „Öffentliche Interessensvereinigungen“ formiert<br />
werden. Abkommen <strong>im</strong> Rahmen dieses Gesetzes bedürfen der Zust<strong>im</strong>mung des<br />
französischen Staatsrates und dürfen die Zuständigkeiten und Verpflichtungen des<br />
Nationalstaates nicht beeinträchtigen.<br />
4.3.2.1 Gemischtwirtschaftliche Gesellschaften<br />
Gemischwirtschaftliche Gesellschaften sind in privatrechtlicher Natur ausgebildet. Sie<br />
erhalten und nutzen öffentliche Mittel/Fonds und erfüllen öffentlich-rechtliche Aufgaben.<br />
Beteiligen können sich neben Privaten auch öffentlich-rechtliche Instanzen, wie<br />
Gebietskörperschaften. Der Anteil der französischen öffentlich-rechtlichen Körperschaften<br />
am Gesamtkapital und bei den Vorstandsst<strong>im</strong>men muss mindestens 50% betragen.<br />
Gemischwirtschaftliche Gesellschaften können außerhalb Frankreichs wie eine<br />
privatrechtliche Körperschaft handeln; Beteiligungen können seit dem Gesetz Loi Joxe auch<br />
von nicht-französischen Körperschaften erworben werden, wobei die genannten<br />
französischen Beteiligungsmehrheiten freilich zu beachten sind. Diese Arten von<br />
Gesellschaften sind für Projekte überlegenswert, weniger als Rechtsform einer Euregio.<br />
4.3.2.2 Öffentliche Interessensvereinigungen<br />
Öffentliche Interessensvereinigungen entstehen durch Abkommen zwischen einerseits<br />
privaten Personen oder Organisationen (ohne Erwerbscharakter) und andererseits<br />
öffentlichen Einrichtungen. Regionale und lokale Gebietskörperschaften können<br />
eingeschlossen werden. Diese Vereinigungen werden dem öffentlichen Recht zugeordnet,<br />
da sie der staatlichen Finanzkontrolle und Aufsicht unterliegen. Diese Rechtsform ist<br />
gleichermaßen für Projekte wie für Euregios denkbar.<br />
13
Deutsche Sozialversicherung<br />
Observatorium <strong>EUREGIOsocial</strong><br />
4.4 Europäische Wirtschaftliche Interessensvereinigung (EWIV)<br />
Die EWIV ist die bisher einzige auf EU-Ebene harmonisierte Unternehmensform privaten<br />
Rechts. Obwohl keine rechtlichen Einschränkungen für die Beteiligung öffentlich-rechtlicher<br />
Körperschaften bestehen, besteht das Hauptproblem darin, dass die EWIV ihrer Natur nach<br />
wirtschaftliche Aktivitäten entfaltet und als Privatunternehmen keine öffentlich-hoheitlichen<br />
Funktionen ausüben darf. Auch aus anderen rechtlichen Gründen scheidet die EWIV als<br />
Rechtsform einer Euregio aus; nach allgemeiner Auffassung kann sie aber dazu beitragen,<br />
grenzüberschreitende Projekte und Institutionen zu unterstützen. In dieser Rechtsform wurde<br />
1993 das Institut für regionale <strong>Zusammenarbeit</strong> und europäische Verwaltung gegründet,<br />
nähere Erläuterungen finden sich <strong>im</strong> Kapitel 7.12.0 (Oberrheinkonferenz).<br />
4.5 Vereinsrecht<br />
Ein gemeinschaftsrechtliches Vereinsstatut existiert zurzeit noch nicht. Die Euregio<br />
SaarLorLuxRhein besitzt als ein nach luxemburgischem Recht eingetragener Verein (asbl)<br />
eigene Rechtspersönlichkeit; anzumerken ist, dass deutsches und luxemburgisches<br />
nationales Vereinsrecht sehr ähnlich gestaltet ist.<br />
4.6 Stiftungsrecht<br />
Auch hierfür besteht kein Gemeinschaftsrecht. Die Euregio Maas-Rhein ist als Stiftung<br />
niederländischen Rechts organisiert, die geschäftsführend tätig ist. Die deutschen<br />
Kommunen sind <strong>im</strong> Regio Aachen e. V. zusammengeschlossen.<br />
4.7 Arbeitsvereinbarungen<br />
In den meisten Fällen beruhen Arbeitsgemeinschaften lediglich auf Vereinbarungen der<br />
beteiligten Partner und nicht auf internationalen Abkommen der oben genannten Arten. In<br />
der Regel sind die Beteiligten eines Staates auf nationaler Ebene organisiert und treten<br />
einzeln oder als gemeinsamer Vereinbarungspartner in der Arbeitsgemeinschaft auf.<br />
4.8 Nationale Trägerstrukturen<br />
Überwiegend sind die Euregio-Träger getrennt national organisiert und besitzen eigene,<br />
parallele Rechtspersönlichkeit, zum Beispiel als Kommunalverbände öffentlichen Rechts,<br />
Vereine oder Stiftungen.<br />
5 Euregio und <strong>Gesundheitswesen</strong><br />
5.1 Ausgangslage<br />
Wie bereits <strong>im</strong> ersten Kapitel festgestellt wurde, waren in der Regel Grenzregionen lange<br />
Zeit durch ihre periphere Lage geprägt, was zu gewissen Strukturschwächen führte, wie<br />
unterdurchschnittliche Einwohnerdichten und Dienstleistungsangebote, weniger ausgebaute<br />
Infrastruktur und geringere Wirtschaftskraft. Vor diesem Hintergrund entwickelte sich die<br />
gesundheitliche Versorgung der Bevölkerung früher ähnlich schwächer als in den zentralen<br />
nationalen Regionen. In der heutigen Zeit, die durch wachsende Mobilität der Menschen,<br />
Güter und Dienstleistungen sowie durch technische Entwicklungen gekennzeichnet ist, mag<br />
dies anders sein. Geblieben ist, dass sich die Vorschriften der Sozialgesetzgebung an den<br />
allgemeinen nationalen Gegebenheiten orientieren und kaum Rücksicht auf die besonderen<br />
Anforderungen in den Euregios nehmen. Das koordinierende Sozialrecht der EU<br />
berücksichtigt zwar die Lebenssituation der Euregio-Bürger, so als Grenzgänger, greift aber<br />
nicht in das alleinige Recht der EU-Mitgliedstaaten ein, ihre Gesundheitssysteme<br />
(einschließlich leistungsrechtlicher Ausgestaltung und Finanzierung) national zu gestalten<br />
und zu organisieren.<br />
14
Deutsche Sozialversicherung<br />
Observatorium <strong>EUREGIOsocial</strong><br />
5.2 Versorgungsstrukturen<br />
Auch in EU-Mitgliedsländern wie Deutschland, in denen Kostenträger mit Anbietern von<br />
Gesundheitsleistungen Verträge zur Sicherung der gesundheitlichen Versorgung<br />
abschließen, behalten sich staatliche Instanzen Vorgaben bzw. Genehmigungen für die<br />
Gestaltung der Rahmen- und Grundstrukturen vor, insbesondere in der Krankenhaus-,<br />
Großgeräte- und Rettungsdienstplanung. Diese Orientierung auf das lediglich eigene<br />
Hoheitsgebiet korrespondiert mit der unterschiedlichen Finanzierung der<br />
Gesundheitssysteme, so in Bezug auf die Vorhaltung und Nutzung der Strukturen, aber auch<br />
hinsichtlich der finanziellen Beteiligung der Bürger<br />
(Sozialversicherungsbeiträge/Steuern/Gebühren/ Patientenzuzahlungen). Eine nicht geringe<br />
Bedeutung für jede Region haben Arbeitsplätze, die <strong>im</strong> <strong>Gesundheitswesen</strong> bestehen;<br />
infolgedessen wird oft angeführt, man müsse darauf achten, sie jeweils auf der nationalen<br />
Seite der Euregio zu belassen und nicht zu „exportieren“. Diese Meinung widerspricht<br />
allerdings der Euregio-Idee, denn zweifellos kann die <strong>Zusammenarbeit</strong> <strong>im</strong><br />
<strong>Gesundheitswesen</strong> dazu beitragen, Unwirtschaftlichkeiten, die durch parallele Strukturen<br />
entstehen, und Versorgungsdefizite <strong>im</strong> Euregio-Raum insgesamt abzubauen und somit die<br />
ganze Euregio zu stärken. Außerdem unterstellt eine solche negative Sichtweise, dass<br />
Kooperationen generell zu Lasten einer nationalen Seite gehen und die Vorteile <strong>im</strong>mer der<br />
jeweils anderen Seite zufließen. Hinzu kommt, dass die ihre Freizügigkeitsrechte<br />
wahrnehmenden Arbeitnehmer in den Euregios <strong>im</strong> Allgemeinen der Frage, in welchem<br />
Gebietsteil der Arbeitsplatz existiert, zu Recht wenig Beachtung schenken. Und die Bürger,<br />
die ihr Leben neu koordinierten, schnellen und wirksamen Rettungsdiensteinsätzen zu<br />
verdanken haben, fragen freilich nicht nach hoheitlichen und finanziellen Zuständigkeiten.<br />
Aber nicht nur in Notfällen verkürzt die möglichst wohnortnahe - eventuell<br />
grenzüberschreitende Behandlung - Krankentransportwege, was aus medizinischen und<br />
ökonomischen Gründen sinnvoll ist.<br />
5.2.1 Inanspruchnahme durch die Bürger<br />
Bei der Betrachtung der Versorgungsstrukturen muss grundsätzlich einerseits zwischen der<br />
ambulanten und stationären Inanspruchnahme unterschieden werden sowie andererseits<br />
zwischen der einschlägigen EWG VO Nr. 1408/71 1 , der deutschen Kostenerstattungsregel<br />
nach § 13 Abs.4-6 SGB V und den Verträgen mit ausländischen Leistungsanbietern nach<br />
§ 140 e SGB V.<br />
Gemäß der EWG-VO 1408/71 wird allen sozialversicherten Bürgern, die sich vorübergehend<br />
<strong>im</strong> EU-Ausland aufhalten, wie zum Beispiel bei Urlaubsreisen, <strong>im</strong> Notfall und ohne vorherige<br />
Genehmigung, diejenige medizinische Leistung gewährt, die unter Berücksichtigung der<br />
Dauer des Aufenthaltes bis zur Rückkehr in den Versicherungsstaat unaufschiebbar ist. Dies<br />
erfolgt i.d.R. als Sachleistung, die sich nach dem Leistungskatalog des jeweiligen<br />
aushelfenden Landes richtet. Daneben können sich Versicherte mit vorheriger Genehmigung<br />
durch ihren Sozialversicherungsträger gezielt zur Behandlung ins Ausland begeben.<br />
(Sogenannte E 112) Sie haben dann nur Anspruch auf die genehmigte Leistung, die i.d.R.<br />
als Sachleistung gewährt wird und sich ebenfalls nach dem Leistungskatalog des jeweiligen<br />
aushelfenden Landes richtet.<br />
Deutschland hat darüber hinaus mit dem Gesundheitssystemmodernisierungsgesetz (GMG)<br />
geregelt, auch ohne Genehmigungsvorbehalt alle außerhalb des Krankenhauses erbrachten<br />
Leistungen, die auch in Deutschland erstattungsfähig sind zu gewähren. Die<br />
grenzüberschreitenden stationären Leistungen stehen jedoch weiterhin unter dem Vorbehalt<br />
einer vorherigen Zust<strong>im</strong>mung der Krankenkasse. Im stationären Bereich besteht damit ein<br />
grundsätzlicher Vorrang zu Gunsten inländischer Leistungserbringer, die vertraglich an die<br />
Krankenkassen gebunden sind. Darüber hinaus besteht in dem Fall der Inanspruchnahme<br />
1 Verordnung EWG Nr. 1408/71 des Rates vom 14. Juni 1971 über die Anwendung der Systeme der<br />
sozialen Sicherheit auf Arbeitnehmer und Selbstständige sowie deren Familienangehörige, die<br />
innerhalb der Gemeinschaft zu- und abwandern. Seit 20.05.2004 VO der (EG) Nr. 883/2004 vom<br />
29.04.2004 zur Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit.<br />
15
Deutsche Sozialversicherung<br />
Observatorium <strong>EUREGIOsocial</strong><br />
einer Kostenerstattung durch das SGB V eine Vorleistungspflicht des Versicherten und die<br />
Erstattung wird beschränkt auf die Höhe der Vergütung, die die Kasse bei entsprechender<br />
Indikation <strong>im</strong> Inland zu tragen hätte, wobei Abschläge vom Erstattungsbetrag wegen<br />
erhöhter Verwaltungskosten und fehlender Wirtschaftlichkeitsprüfung vorgesehen sind 2 .<br />
Von der dritten Möglichkeit, die die Kassen berechtigt, <strong>im</strong> Geltungsbereich des EG-Vertrages<br />
und <strong>im</strong> Europäischen Wirtschaftsraum Verträge mit Leistungserbringern zu schließen, wird<br />
die Kassen häufig nur in Grenzräumen Gebrauch gemacht, hier jedoch bereits seit der Mitte<br />
der neunziger Jahre. Deutschland ist in knapp 26 Euregios eingebunden, deren Aktivitäten<br />
auf dem Gebiet der Gesundheitsversorgung eine große Vielfalt aufweisen.<br />
Mit der Novellierung der EWG-Verordnungen Nr. 1408/71 wurden für die Versicherten<br />
weitere Vereinfachungen eingeführt. Seit dem 01.07.2004 werden die Papiervordrucke, die<br />
für den Zugang zu medizinischen Leistungen bei vorübergehendem Aufenthalt in anderen<br />
Mitgliedstaaten best<strong>im</strong>mt sind, schrittweise bis Ende 2005 durch die europäische<br />
Krankenversicherungskarte (EU-KVK) ersetzt. Der Versicherte muss dann nicht mehr für<br />
jeden Auslandsaufenthalt einen neuen Papiervordruck („Auslandskrankenschein“)<br />
beantragen 3 .<br />
Um unter den drei Handlungsoptionen die jeweils für den Versicherten günstigste Variante<br />
wählen zu können, benötigen die Versicherten Beratungen durch ihre Krankenkasse. Dies<br />
bewahrt sie vor unnötigen Risiken und nicht erstattungsfähigen Kosten. Die Krankenkassen<br />
sind daher aufgefordert ihren Service in diesem Bereich weiter auszubauen.<br />
5.2.2 Planung und Finanzierung<br />
Die Planung und Finanzierung von Versorgungsstrukturen hängt vor allem von der Zahl<br />
seiner Nutzer ab; hierfür zuständige staatliche Instanzen sind daher mit Verweis auf die<br />
Unzulässigkeit „wilder“ Leistungsinanspruchnahmen indirekt legit<strong>im</strong>iert, keine Rücksicht auf<br />
die jenseits vorhandene Einwohnerzahl zu nehmen. Hinzu kommen die oft unterschiedlichen<br />
nationalen, technischen und administrativen Vorschriften für Finanzierung, Budgetierung,<br />
Planung, Errichtung, Vorhaltung und Betrieb von Einrichtungen des <strong>Gesundheitswesen</strong>s. In<br />
diesem Zusammenhang sei auch an die verschiedenen Organisationsstrukturen und<br />
Zuständigkeiten der öffentlichen Verwaltungen in den Staaten erinnert. Schließlich ist ein<br />
Aspekt zu berücksichtigen, der, gleichwohl eher der Vergangenheit zuzuschreiben und in<br />
seiner Bedeutung deutlich abnehmend, mehr oder weniger noch vorhanden ist: Die<br />
verstärkte Auslastung von Kapazitäten, wie Krankenhausbetten, durch jenseitige Euregio-<br />
Bürger könnte <strong>im</strong> subjektiven Empfinden der diesseitigen die Meinung auslösen, dadurch<br />
werde ihre eigene gesundheitliche Versorgung, besonders in Notfallsituationen,<br />
beeinträchtigt. Durch eine Planung für die gesamte Euregio wird aber auch dieser Faktor<br />
bedeutungslos werden können. Einrichtungen der Gesundheitsdienste, die <strong>im</strong> wesentlichen<br />
nicht über das nationale bzw. nationale Euregio-anteilige allgemeine staatliche<br />
Steueraufkommen, sondern durch Versicherungsbeiträge (hier als Nutzungsentgelte)<br />
finanziert werden, sind aus Sicht der Euregio-Bürger wesentlich unproblematischer, weil die<br />
in Anspruch genommene Versorgungsstruktur dann auch von Kostenträgern aus dem<br />
Ausland und nicht allein durch ihn als Steuerzahler finanziell mitgetragen wird. Anzumerken<br />
ist, dass die unterschiedlichen finanziellen Leistungsfähigkeiten von an der Euregio<br />
beteiligten Staaten zusammentreffen können, die umso spürbarer werden, desto stärker<br />
nationale und nicht euregionale Finanzierungsanteile sind, natürlich auch in Abhängigkeit<br />
von der Finanzkraft in der Euregio selbst.<br />
2 Schreiber, Arnold: in ZESAR 10/2004, Grenzüberschreitende Inanspruchnahme von<br />
Krankenhausleistungen aus der Sicht des BMGS., S. 413-416<br />
3 Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der gesetzlichen Krankenkassen: Europa für die<br />
Versicherten gestalten – aktuelle europäische Entwicklungen <strong>im</strong> Bereich der Gesundheitspolitik,<br />
September 2004<br />
16
Deutsche Sozialversicherung<br />
Observatorium <strong>EUREGIOsocial</strong><br />
5.3 Wissensaustausch<br />
Neben der Nutzung gemeinsamer Behandlungskapazitäten und Versorgungsstrukturen<br />
besteht vor dem Hintergrund der unterschiedlichen nationalen Entwicklungen, die in den<br />
Euregios aufeinander treffen, großer Bedarf an Wissens- und Erfahrungsaustausch, der sich<br />
auf administrative, betriebswirtschaftliche, organisatorische, qualitätssichernde,<br />
medizinische, pflegerische und fachlich angrenzende, soziale Fragestellungen erstreckt. Die<br />
jeweiligen Fachleute können voneinander lernen, zum Beispiel Aus-, Fortbildungs- und<br />
Behandlungsmethoden vergleichen sowie gemeinsame Forschung und Wissenschaft<br />
betreiben, einschließlich der Nutzung neuer Techniken, wie der Telematik. In welchen<br />
praktischen Formen diese <strong>Zusammenarbeit</strong> erfolgen könnte, ist bereits <strong>im</strong> dritten Kapitel<br />
beschrieben worden, wobei all dieses selbst dann machbar ist, wenn es (aus den<br />
unterschiedlichsten Gründen) in der Euregio zu einer eher geringen versorgungsstrukturellen<br />
<strong>Zusammenarbeit</strong> kommt.<br />
6 Sektoren<br />
6.1 Öffentlicher Gesundheitsdienst (Public Health)<br />
Die Aufgaben und Strukturen der nationalen Public Health-Systeme sind unterschiedlich,<br />
dennoch kann gesagt werden, dass sie als unmittelbar staatliche Administrationen<br />
organisiert sind und durch allgemeine Steuern finanziert werden. Da in Deutschland die<br />
Bevölkerung nahezu vollständig gesetzlich (90%) oder privat krankenversichert ist und <strong>im</strong><br />
Fall der Krankheit Versicherungsleistungen erhält, kommt dem öffentlichen<br />
Gesundheitsdienst versorgungsmäßig eine finanziell geringe Bedeutung zu; der öffentliche<br />
Gesundheitsdienst ist aber vor dem Hintergrund seiner hoheitlichen Funktionen ein auch in<br />
den Euregios zu berücksichtigender Versorgungsbereich grenzüberschreitender Aktivitäten.<br />
Denkbar sind hier insbesondere Erfahrungsaustausche, Meldedienste und abgest<strong>im</strong>mte<br />
Notfallpläne, unter anderem bei der Bekämpfung von Seuchen.<br />
6.2 Prävention und Früherkennung von Krankheiten<br />
Dieser Versorgungsbereich zeigt in besonderem Maße - neben der Rehabilitation - das<br />
unterschiedliche Niveau von Staaten <strong>im</strong> <strong>Gesundheitswesen</strong> auf, einschließlich der Frage, ob<br />
es sich um Versicherungsleistungen handelt oder nicht, wodurch die bereits erwähnten<br />
Restriktionen <strong>im</strong> Leistungsrecht auftreten. Besondere Schwierigkeiten ergeben sich auch<br />
dadurch, dass Prävention und Früherkennung von Krankheiten naturgemäß nicht dringende<br />
Behandlungsbedürftigkeit voraussetzen und infolgedessen nicht unter das<br />
anspruchsbegründende koordinierende Gemeinschaftsrecht fallen. Da<br />
Versorgungskapazitäten dieses Bereiches üblicherweise nicht extra, sondern <strong>im</strong> Rahmen<br />
ambulanter/stationärer Behandlung oder als öffentlicher Gesundheitsdienst vorgehalten<br />
werden und <strong>im</strong> übrigen auch nicht die kostenintensivsten sind, haben parallele nationale<br />
Versorgungsstrukturen in der Euregio relativ geringe Auswirkungen <strong>im</strong> Hinblick auf die<br />
Gesamtwirtschaftlichkeit des <strong>Gesundheitswesen</strong>s. Um Prävention und Früherkennung von<br />
Krankheiten rechtzeitig durchführen zu können, sind freilich rasche Informationen bei<br />
auftretenden (neuartigen) lokalen Gesundheitsgefahren, zum Beispiel umweltbedingte,<br />
notwendig; eine gute <strong>Zusammenarbeit</strong> <strong>im</strong> Sektor Public Health ist dafür sehr hilfreich.<br />
6.3 Ambulante ärztliche Behandlung<br />
Hier ist es sinnvoll, zwischen hausärztlicher und gebietsärztlicher (fachärztlicher) Versorgung<br />
zu unterscheiden. Der Hausarztbereich zeichnet sich besonders durch die traditionellen,<br />
langjährigen persönlichen Arzt/Patientenbindungen aus - mit der Folge, dass man davon<br />
ausgehen kann, dass es selten zu grenzüberschreitenden Behandlungsfällen kommt;<br />
abgesehen davon wird sich auch aus medizinischer Sicht in wenigen Fällen<br />
Behandlungsbedarf ergeben. Etwas anderes kann bei Gebietsärzten gelten, insbesondere<br />
17
Deutsche Sozialversicherung<br />
Observatorium <strong>EUREGIOsocial</strong><br />
dann, wenn ihre Praxis mit speziellen, aufwendigen technischen Geräten ausgerüstet ist und<br />
sich die Erreichbarkeit für alle Bürger der Euregio günstig gestaltet. In Deutschland bestehen<br />
kooperative Möglichkeiten der ambulanten Versorgung, wie Gemeinschaftspraxen,<br />
Praxisgemeinschaften und Ambulatorien (Polikliniken); wäre es da nicht für die Euregio eine<br />
reizvolle Idee, gemeinsame Ambulanzen mit Arzt- und sonstigem Personal aus allen<br />
beteiligten Ländern zu haben? Die Akzeptanz bei den Bürgern wäre sicher gegeben, zumal<br />
Ambulanzen nicht die Arbeitsplatzmäßigen und finanziellen „Schwergewichte“ wie<br />
Krankenhäuser oder Krankenhausabteilungen darstellen, um deren Standorte sicher heftig<br />
gerungen würde. Natürlich müssten alle rechtlichen Voraussetzungen für gemeinsame<br />
Euregio-Ambulanzen erfüllt sein.<br />
6.4 Stationäre Akutbehandlung<br />
Im kostenintensiven Bereich der stationären Akutversorgung, auf den in Deutschland zirka<br />
ein Drittel aller Leistungsausgaben der gesetzlichen Krankenversicherung entfallen, wirkt<br />
sich der Aufbau und der Betrieb von nationalen parallelen Kapazitäten besonders<br />
unwirtschaftlich aus. Jedes Krankenhaus stellt einen großen regionalen Wirtschaftsfaktor<br />
dar, wodurch die bereits <strong>im</strong> fünften Kapitel erwähnten Schwierigkeiten (unter anderem<br />
bezüglich der Arbeitsplätze) besonders stark ausgeprägt sind. Ein wesentlicher Aspekt der<br />
Krankenhausplanung ist die Einwohnerzahl des Einzugsgebietes und daraus hochgerechnet<br />
die Zahl der möglichen Behandlungsfälle, wodurch sich - auch unter Berücksichtigung<br />
anderer Aspekte - der Bettenbedarf ergibt. Aus ökonomischen und aus medizinischen<br />
Gründen muss man danach streben, zu einer sinnvollen Arbeitsteilung in der Euregio zu<br />
kommen, d. h. nicht jedes Krankenhaus muss alle Fachabteilungen vorhalten. Die<br />
<strong>Zusammenarbeit</strong> ließe sich vielschichtig gestalten: durch einen gemeinsamen Einkauf von<br />
medizinischen und sonstigen Gütern könnte man niedrigere Preise erzielen; durch<br />
gemeinsame Fortbildung des Personals würde ein denkbarer flexibler Einsatz ermöglicht; die<br />
Nutzung telematischer Techniken würde die Übertragung von Patientendaten ermöglichen,<br />
einschließlich Röntgenbilder usw., womit auch unwirtschaftliche Doppeluntersuchungen<br />
vermieden werden könnten. Die stationäre gesundheitliche Akutversorgung könnte<br />
insgesamt verbessert und kostengünstiger organisiert werden. Erste Ansätze gibt es<br />
beispielsweise in der Euregio POMERANIA, in der das Projekt „Telematisches Netzwerk zur<br />
Unterstützung der Tumorversorgung seit Mai 2004 <strong>im</strong> Rahmen der deutsch-polnischen<br />
<strong>Zusammenarbeit</strong> besteht.<br />
6.5 Arzneien, Heil- und Hilfsmittel<br />
Wenn man davon ausgeht, dass die Abgabe von Arzneien, Heil- und Hilfsmitteln nach den<br />
Regeln des Europäischen Binnenmarktes erfolgt, bedarf es keiner besonderen<br />
Planungsmaßnahmen. Möglicherweise ist es sinnvoll, grenzüberschreitende Verträge<br />
zwischen Kostenträgern und Leistungsanbietern zu schließen, was aber an dieser Stelle<br />
nicht Gegenstand der Untersuchung ist. Soweit Verträge bekannt, Euregio-bezogen und<br />
berichtenswert sind, sind sie genannt.<br />
6.6 Ambulante und stationäre Rehabilitation<br />
Im Gegensatz zur stationären Akutversorgung sind stationäre Rehabilitationsbehandlungen<br />
planbar, weil sie sich naturgemäß zeitlich daran anschließen oder sogar unabhängig davon<br />
durchgeführt werden. Ein wesentlicher Unterschied liegt auch darin, dass die Patienten in<br />
speziell dafür eingerichteten Rehabilitationskliniken eingewiesen werden, die nicht überall<br />
vor Ort vorhanden sein können, d. h. oft auch nicht in der Euregio. Das Argument der<br />
bürgernahen Versorgung in der Euregio trifft deshalb auf die stationäre<br />
Rehabilitationsmaßnahme selten zu; anders verhält es sich bei der ambulanten<br />
Rehabilitation: wenn diese wohnortnah durchgeführt werden kann und<br />
Behandlungsbedürftigkeit gegeben ist, dann ist nicht einsehbar, warum nicht eine<br />
Gleichstellung mit der ambulanten ärztlichen Krankenbehandlung vorgenommen werden<br />
kann.<br />
18
Deutsche Sozialversicherung<br />
Observatorium <strong>EUREGIOsocial</strong><br />
6.7 Pflegeleistungen<br />
Grundsätzlich kann bezüglich der Krankenpflegeleistungen auf die Ausführungen zur<br />
ambulanten und stationären Behandlung verwiesen werden. Freilich zeigen sich auf diesem<br />
Gebiet bei Ländervergleichen zum Teil deutliche Unterschiede <strong>im</strong> Leistungsrecht<br />
(Kostenübernahme) und mehr noch <strong>im</strong> Qualitätsniveau, insbesondere, wenn man die<br />
besonderen Anforderungen an die Pflegefachkräfte berücksichtigt, die für eine qualifizierte<br />
Kranken- bzw. Altenpflege erforderlich sind.<br />
6.8 Ärztlicher Notdienst, Rettungsdienst und Katastrophenschutz<br />
Eine gute Versorgungsstruktur ist erst dann gegeben, wenn die Patienten <strong>im</strong> Notfall<br />
schnellstmöglich an den Ort gelangen, an dem die angemessene Versorgung durchgeführt<br />
werden kann. Dass damit die Rettung menschlichen Lebens verbunden ist, braucht nicht<br />
besonders erwähnt zu werden. Es kommt demnach in der Euregio auf eine<br />
grenzüberschreitend abgest<strong>im</strong>mte Planung und Durchführung von Rettungsdiensten an,<br />
wobei auch der ärztliche Notdienst und für den Fall einer allgemein krisenhaften Lage auch<br />
der Katastrophenschutz gemeint ist. Rettungsmittel sowie die dazu benötigte Infrastruktur<br />
und Ausrüstung sind in der heutigen Zeit kompliziert und hochtechnisch, weshalb die<br />
Kompatibilität der Geräte, wie der Funkanlagen und Fahrzeuge, sehr wichtig ist. Die<br />
Einführung europäischer bzw. internationaler Normen war und ist dafür hilfreich. Da es in<br />
diesem Sektor sehr auf die Zeit ankommt, die vergeht, bis das Boden- bzw.<br />
Luftrettungsmittel am Einsatzort eintrifft, ist es wichtig, den Meldeweg zu verkürzen. Hierfür<br />
ist die Koordination der Rettungsleitstellen unabdingbar. Ein gut geführter Rettungsdienst<br />
erhöht in besonders positiver Weise die Akzeptanz einer Euregio bei den Bürgern.<br />
In einer Anhörung des Verkehrs- und Bauausschusses des Deutschen Bundestages am<br />
21.04.1999 wurde aus den Reihen der Telematikindustrie die Forderung erhoben, dass die<br />
Abläufe automatischer Notrufe in allen europäischen Rettungsleitstellen harmonisiert und<br />
vereinheitlicht werden müssten, um eine europaweite Einführung von Verkehrstelematik<br />
gewährleisten zu können. Mit Hilfe der Verkehrstelematik sind sowohl individuelle<br />
Verkehrsinformationen als auch Maßnahmen der Verkehrslenkung möglich. Machbar wird<br />
dies durch satellitengestützte Navigationssysteme oder mobile Telekommunikationstechnik.<br />
Die Europäische Kommission hat als EU-weit einheitliche Notrufnummer („für medizinische<br />
Hilfeersuchen...“) die Ziffernfolge 112 festgelegt. Obwohl die Sinnigkeit dieser Regelung<br />
unbestritten ist und in Notfällen jede Minute zählt, haben nicht alle Mitgliedstaaten die<br />
technische Umsetzung vorgenommen; auch in Deutschland finden sich Regionen, in denen<br />
zur Zeit noch andere Telefonnummern gewählt werden müssen.<br />
Das Institut für Forschung und Systemberatung hat <strong>im</strong> November 2004 hierzu <strong>im</strong> Rahmen<br />
eines Forschungsprojektes eine Studie mit dem Titel „Hindernisse für grenzüberschreitende<br />
Rettungsdienste“ veröffentlicht. Diese Studie erfolgte <strong>im</strong> Auftrag der Bundesanstalt für<br />
Straßenwesen. Die pr<strong>im</strong>äre Handlungsempfehlung der Arbeigruppe I ist die Erstellung eines<br />
Abkommens, indem das Wegerecht, das Versicherungsrecht, die Einsatzannahme, das<br />
Dokumentationswesen, das Berufsrecht insbesondere in Bezug auf die wechselseitige<br />
Anerkennung des eingesetzten Personals, die Finanzierung, das Arzne<strong>im</strong>ittelrecht und die<br />
Medizinprodukte als auch die Festlegung des Einsatzbereiches des grenzüberschreitenden<br />
Rettungsdienstes geregelt werden. Die weiteren Arbeitsgruppen hatten die Organisation der<br />
Rettungsfahrzeuge und –mittel sowie die Standards/ Qualifikation als Schwerpunkt 4 .<br />
4 Institut für Forschung und Systemberatung, nonprofit, in: Protokoll des Workshop<br />
grenzüberschreitender Rettungsdienst, 10+11.November 2004, S.29 ff.<br />
19
Deutsche Sozialversicherung<br />
Observatorium <strong>EUREGIOsocial</strong><br />
6.9 Service der Krankenkassen<br />
Die Krankenkassen verstehen sich nicht nur als Kostenträger, sondern als Dienstleister für<br />
die bei ihnen versicherten Bürger sowie für die Arbeitgeber und Vertragspartner, was unter<br />
anderem durch ihre Beratungstätigkeit zum Ausdruck kommt. Trotz Nutzung des Telefons<br />
und anderer Kommunikationsmittel werden erfahrungsgemäß häufig persönliche Gespräche<br />
seitens der Versicherten bevorzugt, zumal sich diese dann naturgemäß meistens in einer<br />
Krankheitssituation mit ihrem speziellen, vertraulichen Gesprächsbedarf befinden. Es bot<br />
und bietet sich daher an, dass Krankenkassen Geschäftsstellen versichertennah<br />
grenzüberschreitend einrichten, wobei dies in vielerlei Formen geschehen kann, was<br />
Öffnungszeiten usw. betrifft. Da hiermit auch Kosten verbunden sind, haben sich Kassen zu<br />
grenzüberschreitenden Kooperationen entschlossen, um Büroräumlichkeiten einschließlich<br />
der Infrastrukturen gemeinsam mit Partnern zu nutzen.<br />
6.10 Verwaltungsvereinfachung<br />
Unter Berücksichtigung der realen Möglichkeiten ist es <strong>im</strong>mer sinnvoll, Maßnahmen zur<br />
Verwaltungsvereinfachung zu finden. Alle Beteiligten, nicht zuletzt die Bürger, profitieren<br />
davon. Es liegt aber auch <strong>im</strong> Interesse der Versicherungsträger, sich auf diesem Gebiet zu<br />
profilieren. In Deutschland können die gesetzlich Krankenversicherten von ihrem Recht<br />
Gebrauch machen, grundsätzlich zu jedem 1. Januar und für ein Kalenderjahr geltend, ihre<br />
Krankenkasse zu wählen; neben dem Geschäftsstellenservice werden die Krankenkassen<br />
deshalb auch auf dem Feld der Verwaltungsvereinfachung engagiert sein, um <strong>im</strong><br />
Wettbewerb um Versicherte mit guten Lösungen präsent zu sein.<br />
7 Projekte<br />
7.1 Ermittlung der Projekte<br />
Im April 1999 wurden die Euregio-Geschäftsstellen von der Arbeitsgemeinschaft<br />
Europavertretung der Deutschen Sozialversicherung mittels eines bewusst knapp<br />
gehaltenen Fragebogens gebeten, grenzüberschreitende Projekte auf dem Gebiet des<br />
<strong>Gesundheitswesen</strong>s mitzuteilen (Grundangaben). In Auswertung des Rücklaufes wurde<br />
1999 diese Broschüre erstmalig erstellt und 2005 überarbeitet. Zum Teil konnte auch auf<br />
bereits vorliegende Dokumente zurückgegriffen werden. Des Weiteren ergaben sich<br />
Hinweise auf Projekte durch Kenntnisse der Bearbeiter/innen und aus der Literatur. Die<br />
nachfolgende Auflistung erhebt nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. In diesem Sinne ist<br />
die Erweiterungsfähigkeit des Vorhabens, durchaus gegeben, eventuell auch <strong>im</strong> Hinblick auf<br />
Grenzregionen ohne deutsche Beteiligung.<br />
7.2 Zuordnung der Projekte<br />
Alle aufgeführten Projekte der grenzüberschreitenden <strong>Zusammenarbeit</strong> <strong>im</strong><br />
<strong>Gesundheitswesen</strong> sind ihrer jeweiligen Euregio zugeordnet, um sie einzuteilen und einen<br />
geografischen Überblick ermöglichen zu können. Dies bedeutet jedoch nicht unbedingt, dass<br />
sie auch mit Beteiligung der Euregio geplant und durchgeführt werden (siehe dort<br />
aufgeführte Projektpartner). Ebenso kann es sein, dass nur ein Teil einer Euregio oder<br />
mehrere Euregios von Projekten betroffen sind. Um den deutschen Grenzraum lückenlos zu<br />
erfassen und das Ordnungsprinzip beibehalten zu können, sind Euregios auch dann<br />
aufgeführt, wenn sie - wie die Euregio Elbe/Labe - selbst keine Projekte <strong>im</strong><br />
<strong>Gesundheitswesen</strong> planen, durchführen oder sich daran beteiligen. Auch ist hier ohne<br />
Bedeutung, ob sich die Region Euregio oder anders nennt. Um eine spätere Erweiterung<br />
bzw. Diversifizierung der Dokumentation ohne Änderung der Ordnungsziffern ermöglichen zu<br />
können (insbesondere <strong>im</strong> Oberrheingebiet), sind einige Kapitel mit den Vermerken „derzeit<br />
keine Projekte“ versehen.<br />
20
Deutsche Sozialversicherung<br />
Observatorium <strong>EUREGIOsocial</strong><br />
7.3 Information Gesamtkarte<br />
Die Gesamtkarte ermöglicht eine Übersicht über alle Euregios die an Deutschland<br />
angrenzen. Jede der hier mit einer Ziffer aufgeführten Euregio wird mit einer speziellen<br />
Euregio-Karte erläutert, die sich am Anfang des jeweiligen Euregio-Kapitels befindet.<br />
7.4 Information Euregio-Karten<br />
Die Euregio-Karten haben unterschiedliche Maßstäbe. Die Angaben wurden aus den<br />
Regionen mitgeteilt, beruhen auf unterschiedlichen Erhebungsstichtagen und sind ohne<br />
Gewähr. Nach den Regionsnamen sind die Rechtsformen angegeben, in der die Euregio-<br />
Träger bestehen. Ist „ohne Rechtspersönlichkeit“ angegeben, handelt es sich um<br />
Arbeitsgemeinschaften der Beteiligten. Siehe auch das Kapitel „Rechtliche Grundlagen der<br />
<strong>Zusammenarbeit</strong>“. Für jeden Staat sind auch die kommunalen Träger der Euregio benannt,<br />
wobei sich in den Bezeichnungen die Verwaltungsstrukturen widerspiegeln; teilweise sind<br />
nationale Kommunalverbände genannt. Die Einwohnerzahlen der kommunalen Träger<br />
beziehen sich auf einzelne kommunale Träger oder insgesamt auf den beteiligten Staat und<br />
wurden auf Eintausend Einwohner kaufmännisch gerundet.<br />
21
8 Gesamtkarte Grafik<br />
8.6<br />
8.4<br />
(Quelle: ROB 2000, S. 215)<br />
8.5<br />
8.2<br />
8.3<br />
Deutschsprachige<br />
Gemeinschaft<br />
8.8<br />
8.11<br />
8.12<br />
Hochrhein- 8.13<br />
Kommission<br />
Deutsche Sozialversicherung<br />
Observatorium <strong>EUREGIOsocial</strong><br />
8.9<br />
8.1<br />
8.7<br />
8.10<br />
Mandatsgebiet<br />
Oberrheinkonferen<br />
8.14<br />
ARGE<br />
ALP<br />
Alpen 8.16<br />
8.15 Adria<br />
8.20<br />
8.21<br />
8.18<br />
8.22<br />
8.19<br />
8.17<br />
8.26<br />
8.25<br />
8.23<br />
8.24<br />
22
8.1 Region Schleswig/ Südjütland<br />
Deutsche Sozialversicherung<br />
Observatorium <strong>EUREGIOsocial</strong><br />
23<br />
Region Schleswig/ Südjütland<br />
- ohne Rechtspersönlichkeit –<br />
(Gesamt) 692.000 Einwohner<br />
(D) Kreisfreie Stadt Flensburg, Kreise Nordfriesland und<br />
Schleswig-Flensburg<br />
438.000 Einwohner<br />
(DK) Sonderjyllands Amt (Südjütland)<br />
254.000 Einwohner
Region Schleswig/Südjütland<br />
Deutsche Sozialversicherung<br />
Observatorium <strong>EUREGIOsocial</strong><br />
8.1.1 Allgemeines<br />
Die dänische Gesundheitsversorgung garantiert durch lokale Behörden (Gemeinden und<br />
Ämter als nächst höhere Stufe) „freie Heilfürsorge“, und bietet so eigentlich gute<br />
Voraussetzungen für die grenzüberschreitende Arbeit: Verantwortungsbefugnis<br />
weitgehender Art auf lokaler Ebene und unkomplizierte Kostenübernahme für alle Bürger.<br />
Dass sich die <strong>Zusammenarbeit</strong> dennoch nicht einfach gestaltet, ist aus dem bisher relativ<br />
geringen Umfang konkreter Projekte ersichtlich; so startete das Vorhaben 8.1.2 erst <strong>im</strong><br />
November 1998. Im Wesentlichen hat dies zwei Gründe, historische und wirtschaftliche. Der<br />
Raum Schleswig ist während der letzten Jahrhunderte oft „Zankapfel“ zwischen Deutschland<br />
und Dänemark gewesen, letzter Höhepunkt waren die Ereignisse der Kriegsjahre 1939 bis<br />
1945 mit der Besetzung Dänemarks durch deutsche Truppen, was noch bei vielen Dänen<br />
aus eigenem Erleben präsent ist. Die wechselvolle Geschichte des Grenzverlaufes lässt sich<br />
unter anderem daran erkennen, dass in der heutigen Zeit in Südjütland eine deutsche<br />
(dänische Staatsbürger) und in Nordschleswig eine dänische Bevölkerungsminderheit<br />
(deutsche Staatsbürger) vorhanden ist, für die jeweils Minderheitenrechte festgeschrieben<br />
sind (zum Beispiel <strong>im</strong> deutschen Wahlrecht). Dass beiderseits der Grenze deutsche und<br />
dänische Volkszugehörige leben, ist aber auch ein unbestritten integrativer Faktor. Des<br />
weiteren ist die Grenzsituation dadurch geprägt, dass die deutsche Seite mit der Grenzstadt<br />
Flensburg ein attraktives größeres städtisches Zentrum vorweisen kann, in dem auch<br />
speziellere Facheinrichtungen der gesundheitlichen Versorgung wirtschaftlich betrieben<br />
werden. In Dänemark mit seinen ländlichen Gebieten sieht die Situation dagegen völlig<br />
anders aus. Da es an einem ähnlichen Mittelpunkt mangelt und ein Ausgleich entlang des<br />
gesamten Grenzverlaufes von der Nord- bis zur Ostsee nicht hergestellt werden kann,<br />
befürchtet die dänische Seite negative Auswirkungen auf die Arbeitsplatzbilanz <strong>im</strong><br />
Gesundheitssektor.<br />
8.1.2 Rettungsdienst der Flensburger Feuerwehr<br />
Die Feuerwehr der Stadt Flensburg erbringt Rettungsdienstleistungen auch auf dänischer<br />
Seite, geografisch begrenzt auf die Gemeinde Bov (einschließlich der darin verlaufenden<br />
Autobahn E 45, in nördlicher Fahrtrichtung bis zur Ausfahrt 73). Schriftliche Grundlage<br />
hierfür ist das Dokument „Ambulanceordning mellem Flensburg Feuerwehr og<br />
Sønderjyllands Amt“, zu Deutsch: „Ambulanzvereinbarung zwischen der Flensburger<br />
Feuerwehr und dem Amt Südjütland“. Die Kooperation besteht bereits seit einigen Jahren.<br />
8.1.3 Strahlentherapie <strong>im</strong> St.-Franziskus-Hospital Flensburg<br />
Für Patienten aus dem dänischen Südjütland besteht die Möglichkeit, sich <strong>im</strong> St.-Franziskus-<br />
Hospital in Flensburg strahlentherapeutisch behandeln zu lassen. Voraussetzung hierfür ist<br />
die Überweisung durch die Onkologische Abteilung des in Dänemark örtlich eigentlich<br />
zuständigen Krankenhauses in Sønderborg.<br />
8.1.4 Tumorzentrum Flensburg e.V.<br />
Das Tumorzentrum Flensburg e.V. wurde <strong>im</strong> November 1997 von Ärzten des<br />
Malteserkrankenhauses St.-Franziskus-Hospital Flensburg, des Diakonissenkrankenhauses<br />
Flensburg, des Flensburger Ärztevereins e.V., des Martin-Luther-Krankenhauses Schleswig,<br />
des Kreiskrankenhauses Husum, des Kreiskrankenhauses Niebüll und der Asklepius<br />
Nordseeklinik Westerland als gemeinnütziger Verein gegründet. Er ist ein<br />
Kooperationsverbund von Krankenhausärzten und niedergelassenen Ärzten der nördlichen<br />
Region Schleswig-Holsteins - und somit auch der Euregio -, die sich schwerpunktmäßig mit<br />
der Verhütung, Erkennung, Behandlung und Nachsorge von Tumorerkrankungen befassen.<br />
Erklärtes Ziel ist es, auch mit den dänischen Onkologen in Südjütland zusammenzuarbeiten,<br />
wobei es zur Zeit Korrespondenzpartner aus dem Amt Südjütland, dem Krankenhaus<br />
Sønderborg und dem Krankenhaus Haderslev gibt; in den Vereinsorganen Vorstand und<br />
24
Deutsche Sozialversicherung<br />
Observatorium <strong>EUREGIOsocial</strong><br />
Beirat sind sie ebenso wenig wie die Institutionen, aus denen sie kommen, vertreten. Als<br />
wichtigste Aufgabe sieht man an, Prävention, Diagnostik, Therapie und Nachsorge von<br />
Tumorerkrankungen in der Region stetig zu verbessern, was durch die intensive,<br />
fachgebietsbezogene und fachgebietsübergreifende Kooperation der onkologischen<br />
Schwerpunkte der beteiligten Kliniken und der niedergelassenen Ärzte erreicht werden soll.<br />
Die Netzwerkstruktur soll sicherstellen, dass für alle Tumorkranken <strong>im</strong> Einzugsbereich des<br />
Tumorzentrums eine opt<strong>im</strong>ale Versorgung nach dem jeweils medizinischen Kenntnisstand<br />
organisiert werden kann. Das Tumorzentrum Flensburg e.V. behandelt selbst keine<br />
Patienten, es wird aber projektmäßig daran gearbeitet, die grenzüberschreitende<br />
<strong>Zusammenarbeit</strong> mit den dänischen Onkologen zu intensivieren, wobei als Zielvorgabe ein<br />
gemeinsames deutsch-dänisches Tumorzentrum für die Euregio genannt wird.<br />
8.1.5 Deutsch-dänische Weiterbildung<br />
Die grenzüberschreitende Weiterbildung für Krankenschwestern und Krankenpfleger war für<br />
drei Jahre durchgeführt worden und ist mitlerweile ausgelaufen. Träger der Maßnahme<br />
waren die Diakonissenanstalt Flensburg und die Krankenpflegeschule Sønderborg. Es<br />
arbeiten allerdings weiterhin viele deutsche Krankenschwestern und Ärzte an dänischen<br />
Krankenhäusern, was u.a. auf die niedrigeren Arbeitslosenzahlen in Dänemark<br />
zurückzuführen ist.<br />
8.1.6 <strong>Zusammenarbeit</strong> Sønderjyllands Amt, Deutsche Rettungsflugwacht und<br />
Krankenhaus Niebüll<br />
Seit dem 01. April 2005 arbeiten das Sønderjyllands Amt, die deutsche Rettungsflugwacht<br />
und das Krankenhaus Niebüll zusammen. Der Rettungshubschrauber mit Standort in Niebüll<br />
soll die Westküste und die Inseln des süddänischen Amtes Sønderjylland mitversorgen<br />
8.1.7 Kooperation Sønderjyllands Amt und Krankenhaus Niebüll für<br />
Entbindungen<br />
Neuerdings besteht auch zwischen dem Sonderjyllands Amt und dem Krankenhaus Niebüll<br />
die Vereinbarung, dass Frauen aus der dänischen Stadt Tondern und Umgebung in Niebüll<br />
ihr Kind zur Welt bringen können, statt den langen Weg nach Sonderburg oder Aapenrade<br />
auf sich nehmen zu müssen.<br />
25
8.2 Ems Dollart Region<br />
Deutsche Sozialversicherung<br />
Observatorium <strong>EUREGIOsocial</strong><br />
Ems Dollart Region<br />
(D/NL) Grenzüberschreitender deutsch-niederländischer<br />
öffentlich-rechtlicher Zweckverband<br />
(Gesamt) 1.700.000 Einwohner<br />
(D) Kreisfreie Stadt Emden, Landkreise Aurich,<br />
Emsland, Leer und Wittmund<br />
700.000 Einwohner<br />
(NL) Provinzen Groningen und Drenthe<br />
1.000.000 Einwohner<br />
26
Ems Dollart Region<br />
Deutsche Sozialversicherung<br />
Observatorium <strong>EUREGIOsocial</strong><br />
8.2.1 Allgemeines<br />
Die gemeinsame Nordseeküste stellt zweifellos die markanteste geographische<br />
Besonderheit dieser Euregio dar und bildet zusammen mit den vorgelagerten Inseln sowie<br />
der Geest und verschiedenen größeren Moorgebieten die landschaftstypischen Merkmale.<br />
Durch den Küstenraum ergeben sich gemeinsame Interessen, zumal die Euregio eher dünn<br />
besiedelt und ländlich strukturiert ist; die jeweils nächstgelegenen Ballungszentren liegen in<br />
relativ großer Entfernung. Ebenso wie in den anderen Euregios mit deutsch-niederländischer<br />
Beteiligung bestehen allgemein sehr gute nachbarschaftliche Beziehungen, wobei allerdings<br />
die grenzüberschreitende <strong>Zusammenarbeit</strong> <strong>im</strong> <strong>Gesundheitswesen</strong> noch nicht den hohen<br />
Stand wie in weiter südlich gelegenen Euregios erreichen konnte. Vielmehr sind die unter<br />
7.2.1 bis 7.2.4 erwähnten Projekte nicht mehr existent. Derzeit werden keine von der Ems<br />
Dollart Region unterstützten Projekte <strong>im</strong> Bereich des <strong>Gesundheitswesen</strong> durchgeführt. Es<br />
gibt einige bilaterale Kontakte zwischen Krankenhäusern usw. aber nicht in Projektform. Ein<br />
Biotechnologieprojekt wurde zwischen der Ems Dollart Region und der EUREGIO eingeführt<br />
unter Beteiligung der Universität Groningen.<br />
8.2.2 Verbesserung der ambulanten sozialpsychiatrischen Versorgung in der Region<br />
Mit diesem Projekt (Februar 1998 bis Januar 1999) zielten die Projektträger, der Landkreis<br />
Wittmund (D) und das Noorderpoort College Winschoten (NL), auf die Verbesserung der<br />
gesellschaftlichen Integration von Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen und auf die<br />
Schaffung eines nachhaltigen Netzwerkes zwischen den beteiligten Institutionen. Als<br />
Maßnahmen waren unter anderem die Bestandsaufnahme der vorhandenen ambulanten und<br />
stationären sozialpsychiatrischen Versorgung sowie die Herausarbeitung von<br />
Gemeinsamkeiten und Unterschieden in der Behandlungsweise vorgesehen. Akteure, die<br />
unmittelbar oder mittelbar mit dem Fachgebiet zu tun haben, wie Kommunen,<br />
Gesundheitsämter, Krankenhäuser, ambulante Gesundheitsdienste, Bildungseinrichtungen,<br />
Selbsthilfegruppen, Sozialversicherungsträger, Wohlfahrtsverbände und Sozialarbeiter<br />
sollten zu einer umfassenden Verzahnung der stationären und ambulanten Versorgung<br />
angeregt werden. Es ist kein Folgeprojekt entstanden.<br />
8.2.3 Fachstelle für Suchtprävention und -information Ems Dollart<br />
Ziel dieses Projektes ist die Einrichtung einer ständigen binationalen Fachstelle, welche sich<br />
an die Idee des in Nordrhein-Westfalen durchgeführten BINAD-Projektes (Binationale<br />
Drogenfachstelle) anlehnt und die grenzüberschreitend Sucht- und Drogenberatungsstellen<br />
vernetzt und koordiniert. Nicht zuletzt vor dem Hintergrund der unterschiedlichen<br />
Drogenpolitiken in Deutschland und den Niederlanden wird Bedarf für ein gemeinsames<br />
Vorgehen, zum Beispiel bezüglich der Rückführung der sich in den Niederlanden<br />
aufhaltenden deutschen Drogenabhängigen, gesehen. Auch möchte man die<br />
Präventionsarbeit stärken, so in den Schulen. Durch die gemeinsame Nutzung von<br />
Ressourcen erhofft man sich ökonomisch günstige Effekte. Das Projekt ist nicht mehr<br />
existent, es gibt kein Folgeprojekt<br />
8.2.4 Büro Gamma<br />
Das Büro Gamma (Fakultät Pflegekunde der Hanzehogeschool Groningen) vernetzt<br />
verschiedene Gesundheitsdienst und -ausbildungseinrichtungen der Euregio insbesondere<br />
bezüglich des Austausches von Pflegepersonal. Besonders auf niederländischer Seite führt<br />
Personalmangel <strong>im</strong>mer wieder zu Patientenwartelisten und zur zeitweisen Schließung von<br />
Krankenhausabteilungen. In <strong>Zusammenarbeit</strong> mit EURES-Beratern (European Employment<br />
Services, der Arbeitsmarktberatungsdienst der Europäischen Kommission für Arbeitnehmer<br />
und Arbeitgeber) hilft man bei der Personalsuche. Dazu gehört auch die Suche nach<br />
27
Deutsche Sozialversicherung<br />
Observatorium <strong>EUREGIOsocial</strong><br />
geeigneten Praktikantenstellen für die verschiedenen Ausbildungen der Gesundheitspflege<br />
beider Länder. Weitere Vorhaben sind unter anderem die Informationserteilung an<br />
Studenten, die in einer der beiden Länder ein Studium planen, die Erforschung der<br />
Möglichkeit, in der Euregio eine internationale Gesundheitsschule zu errichten sowie die<br />
Kopplung von Bibliotheksbeständen beider Länder. Die Aktivitäten wurden eingestellt. Es<br />
gibt kein Folgeprojekt.<br />
8.2.5 Sonstiges<br />
Die Krankenhäuser und Rettungsdienste haben jeweils eine Arbeitsgruppe gebildet, die auf<br />
regelmäßigen Sitzungen Erfahrungen austauschen und Entwicklungsmöglichkeiten der<br />
weiteren <strong>Zusammenarbeit</strong> diskutieren. Konkrete Projekte wurden noch nicht beschlossen.<br />
28
8.3 EUREGIO (Gronau)<br />
Deutsche Sozialversicherung<br />
Observatorium <strong>EUREGIOsocial</strong><br />
EUREGIO (Gronau)<br />
(D) Kommunalgemeinschaft Rhein-Ems e.V.<br />
(NL) Öffentlich-rechtliche Körperschaften<br />
Regio Achterhoek und Regio Twente<br />
(Gesamt) 3.000.000 Einwohner<br />
(D) Städte Münster und Osnabrück, Kreise Borken,<br />
Coesfeld, Graftschaft Benthe<strong>im</strong>, Steinfurt, Warendorf und Landkreis Osnabrück<br />
2.000.000 Einwohner<br />
(NL) Provinzen Drenthe (z.T.), Overijssel (z.T.)<br />
und Geldern<br />
1.000.000 Einwohner<br />
29
EUREGIO (Gronau)<br />
8.3.1 Allgemeines<br />
Deutsche Sozialversicherung<br />
Observatorium <strong>EUREGIOsocial</strong><br />
8.3.1.1 EUREGIO-Gründung<br />
1958 wurde ein Zusammenschluss von Gemeinden, Städten und Kreisen für<br />
grenzüberschreitende <strong>Zusammenarbeit</strong> unter dem Namen EUREGIO gegründet, eine<br />
niederländische und deutsche Organisation, die die <strong>Zusammenarbeit</strong> über Grenzen hinweg<br />
beinhaltet mit dem Ziel, die Menschen auf beiden Seiten der Grenze einander näher zu<br />
bringen. Nicht zuletzt auch wegen der Vorbildfunktion der EUREGIO ist Gronau,<br />
Deutschland, zum Sitz der Arbeitsgemeinschaft der Europäischen Grenzregionen (AGEG)<br />
gewählt worden: beide Sekretariate befinden sich „unter einem Dach“. Die EUREGIO, die ein<br />
Gebiet <strong>im</strong> Bereich der Flüsse Rhein, Ems und Jssel umfasst, ist nach einem schwierigen<br />
Beginn inzwischen ein Modell für ein Stückchen vereintes Europa geworden, weshalb<br />
nachfolgend ein kurzer Hinweis auf den allgemein für das deutsch-niederländische<br />
Verhältnis geltenden geschichtlichen Hintergrund gestattet sei.<br />
8.3.1.2 Deutsch-niederländischer Grenzraum<br />
Die Grenze zwischen Deutschland und den Niederlanden bestand in der geschichtlichen<br />
Vergangenheit nicht als streng gezogene Linie. Soziale, wirtschaftliche und kulturelle<br />
Verflechtungen bestanden grenzüberschreitend. Mit dem Westfälischen Frieden von<br />
Münster/Osnabrück (1648), bei dem sich die „Republiek der Verenigde Nederlanden“<br />
definitiv vom Deutschen Reich löste, änderte sich anfangs nicht sehr viel. Hier und da<br />
erschien ein Grenzstein, manchmal galt auch ein großer, einzeln stehender Baum als<br />
Grenzmarkierung. Staatsrechtlich gesehen konnte eher von einer Zusammenlegung von<br />
allerlei unterschiedlichen und ungleichwertigen Teilen gesprochen werden: es gab<br />
souveräne „Geweste“, Landstriche (darunter Drenthe) und einige „Zweckgeweste“, darunter<br />
Brabant und Flandern. Bis 1815, als der Wiener Kongreß nach der endgültigen Niederlage<br />
Napoleons die neue europäische Landkarte zeichnete, waren Deutschland und die<br />
Niederlande einige Male in Grenzstreitigkeiten verwickelt. Die Niederlande hatten sich <strong>im</strong><br />
Gegensatz zu Deutschland mit seinen einzelnen Groß- und Kleinstaaten mehr und mehr<br />
zum Einheitsstaat entwickelt. Beide Staaten drifteten politisch, sozial und wirtschaftlich<br />
<strong>im</strong>mer weiter auseinander. Die Staatsgrenze wurde besonders in den Grenzregionen<br />
spürbar; insgesamt verläuft sie vom Dollart als nördlichsten Punkt bis Vaals <strong>im</strong> Süden auf<br />
zirka 584 Kilometern.<br />
8.3.1.3 Situation in der EUREGIO<br />
Das heutige EUREGIO-Gebiet war früher durch Moor und Heidelandschaft geprägt und<br />
lange Zeit waren um die 20 % der Beschäftigten in der Landwirtschaft tätig, heute sind es nur<br />
noch 5 %. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entwickelte sich auf beiden Seiten eine<br />
florierende Textil- und Bekleidungsindustrie, in der an manchen traditionellen Standorten bis<br />
zu 80 % der Beschäftigten arbeiteten. Durch die Verlagerung der Arbeitsplätze in<br />
sogenannte „Billiglohnländer“, vor allem in den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts, kam es in<br />
der EUREGIO zu großen Arbeitsmarktproblemen.<br />
Schwerpunkt des INTERREG III A-Programmes (2000-2008), ist der Bereich „Wirtschaft,<br />
Technologie und Innovation“, insbesondere die Maßnahmenbereiche „Technologie und<br />
Innovation“ sowie „Kooperation KMU“. Von den <strong>im</strong> Rahmen des INTERREG III A-<br />
Programmes bereitgestellten Mitteln in Höhe von 48 Millionen Euro wurden rund 50 % für<br />
diesen Schwerpunkt reserviert.<br />
30
Deutsche Sozialversicherung<br />
Observatorium <strong>EUREGIOsocial</strong><br />
Im <strong>Gesundheitswesen</strong> kommt es nunmehr insbesondere <strong>im</strong> Rahmen des INTERREG III A<br />
Programmes zu einer guten grenzüberschreitenden <strong>Zusammenarbeit</strong>, die der in weiter<br />
südlich gelegenen Euregios vergleichbar ist. So wurden zahlreiche grenzüberschreitende<br />
Projekte <strong>im</strong> medizinisch-technologischen und sozial-gesellschaftlichen Bereich initiiert. Eine<br />
wichtige Rolle spielt dabei das <strong>Euregionale</strong> Servicezentrum für Gesundheit (ESG), das <strong>im</strong><br />
Rahmen eines INTERREG III A- Projektes gegründet wurde.<br />
8.3.2 <strong>Euregionale</strong>s Zentrum für <strong>Gesundheitswesen</strong><br />
Das ESG (www.esg.org) ist ein Service- und Informationsnetzwerk hinsichtlich des<br />
grenzüberschreitenden <strong>Gesundheitswesen</strong>s in der EUREGIO. Dieses Netzwerk wird durch<br />
niederländische und deutsche Universitäten, Hochschulen, Krankenhäuser, Krankenkassen<br />
sowie die Wirtschaft in der EUREGIO gebildet. Folgende Ziele verfolgt das <strong>Euregionale</strong><br />
Servicezentrum für Gesundheit:<br />
• Koordinierung ambulanter und stationärer Versorgung <strong>im</strong> deutsch-niederländischen<br />
Grenzgebiet, u.a. zur Förderung grenzüberschreitender Patientenbehandlungen.<br />
• Wissenschaftliche Koordination zwischen den Krankenhäusern, Hochschulen und<br />
Universitäten in der EUREGIO auf dem Gebiet der medizinischen und medizinischtechnologischen<br />
Wissenschaft.<br />
• Synchronisation der deutsch-niederländischen Gesundheitssysteme <strong>im</strong> Bereich der<br />
Versorgung, Kostenerstattung und Prävention.<br />
• Koordination und Vermittlung zwischen Forschungsprojekten und Industrie.<br />
• Förderung der <strong>Zusammenarbeit</strong> zwischen Gemeinden, Städten, Kreisen und<br />
Provinzen, damit eine gemeinsame Gesundheitspolitik erarbeitet wird.<br />
8.3.3 Grenzüberschreitende Suchthilfe- und Selbsthilfeverbund<br />
Antragsteller und Projektträger ist der Caritasverband für die Diözese Osnabrück e.V.<br />
(Fachverband Suchtkranken- und Drogenhilfe) in <strong>Zusammenarbeit</strong> mit „TACTUS-Intelling<br />
voor Verslavingszorg“ in Enschede sowie dem Kreuzbund Diözese Osnabrück e.V.<br />
(Selbsthilfe- und Helfergemeinschaft für Suchtkranke und deren Angehörige). Die<br />
Projektpartner werden bei der Umsetzung des Projektes durch die BINAD-Fachstellen für<br />
grenzübergreifende <strong>Zusammenarbeit</strong> in der Drogenhilfe und Prävention (Enschede und<br />
Münster) beraten und unterstützt.<br />
Das Projekt umfasst den Aufbau eines grenzüberschreitenden Therapieverbundes zwischen<br />
den beteiligten Partnern, um einen gegenseitigen grenzüberschreitenden Austausch von<br />
bislang beiderseits der Grenze unterschiedlichen Behandlungs- und Betreuungsmethoden<br />
für suchtkranke Menschen zu ermöglichen.<br />
Auf deutscher Seite wird die auf die professionelle Suchthilfe aufbauende Selbsthilfe als<br />
Bestandteil einer umfassenden sozial-medizinischen Hilfe seit langer Zeit mit guten Erfolgen<br />
angewandt. Süchtige werden <strong>im</strong> Rahmen dieser Methodik innerhalb von Selbsthilfegruppen<br />
durch professionelle Helfer bei der Überwindung ihrer Suchtkrankheit unterstützt. Die<br />
Selbsthilfegruppen, denen auch Angehörige der Suchtkranken angehören, wirken der<br />
Vereinsamung suchtkranker Menschen entgegen und haben eine stabilisierende Wirkung.<br />
Selbsthilfegruppen, die eng mit der professionellen Suchthilfe kooperien, sind auf<br />
niederländischer Seite nicht bekannt. Aufgrund der guten Erfolge dieser Behandlungsweise<br />
erkennen die niederländischen Behörden und Mitarbeiter der professionellen Suchthilfe<br />
<strong>im</strong>mer mehr die Bedeutung der Selbsthilfe. Im Rahmen dieses Projektes soll die Selbsthilfe<br />
<strong>im</strong> professionellen Hilfesystem auf niederländischer Seite integriert werden, wobei Patienten<br />
und Hilfeleister bei der Einführung dieser Methodik praktisch begleitet und unterstützt<br />
werden.<br />
31
Deutsche Sozialversicherung<br />
Observatorium <strong>EUREGIOsocial</strong><br />
Da bei Suchtkranken <strong>im</strong> zunehmenden Maße Mehrfachabhängigkeiten auftreten, wird auf<br />
niederländischer Seite in den Behandlungsgruppen nicht nach Suchtstoffen (Alkohol,<br />
Drogen) unterschieden, sondern in gemischten Gruppen suchtstoffübergreifend gearbeitet,<br />
während in Deutschland in der Regel eine suchtmittelspezifische Behandlung erfolgt. In der<br />
Behandlung steht auf niederländischer Seite nicht das Suchtmittel sondern die Ursache der<br />
Sucht <strong>im</strong> Vordergrund. Diese Methodik erzielt gute Erfolge.<br />
Die Selbsthilfe- und Helfergemeinschaft Kreuzbund und der Caritasverband beabsichtigen<br />
die suchtstoffübergreifende Behandlungsmethode in den Selbsthilfegruppen und in der<br />
professionellen Hilfe zu integrieren.<br />
In enger <strong>Zusammenarbeit</strong> mit dem niederländischen Projektleiter werden Kreuzbund und der<br />
Caritasverband auf niederländischer Seite folgende konkrete Maßnahmen durchführen:<br />
• Ausbildung von Multiplikatoren,<br />
• Werben von Teilnehmern an den Selbsthilfegruppen,<br />
• Unterstützung bei der Gestaltung und Durchführung der Selbsthilfegruppen mit<br />
insgesamt 90 Teilnehmern,<br />
• Aufbau eines Ausbildungsprogramms.<br />
TACTUS wird zum Aufbau einer suchtstoffübergreifenden Gruppenarbeit auf deutscher Seite<br />
folgende konkrete Maßnahmen in Kooperation mit dem deutschen Projektleiter umsetzen:<br />
• Information und Praxisberatung der ehrenamtlichen und professionellen Mitarbeiter<br />
von Caritas und Kreuzbund,<br />
• Schulung der Gruppenleiter des Kreuzbundes und der Mitarbeiter des<br />
Caritasverbandes (Hospitationen bei Tactus, Konferenzen, Fachtagungen),<br />
• Unterstützung be<strong>im</strong> Aufbau der suchtstoffübergreifenden Gruppenarbeit (insgesamt<br />
rd. 90 Teilnehmer),<br />
• Betreuung der Gruppenleiter während des Projektes.<br />
Suchtkranke Arbeitnehmer können rd. 25 % ihrer geforderten Arbeitsleistung nicht erbringen.<br />
Der volkswirtschaftliche Gesamtschaden allein durch Alkoholmissbrauch beläuft sich nur in<br />
Deutschland mit 25 bis 40 Milliarden Euro pro Jahr. Für die in der Suchthilfe tätigen<br />
Organisationen und Instanzen hat die Rehabilitation und Integration Suchtkranker ins<br />
gesellschaftliche und beruflich Leben daher höchste Priorität.<br />
Ziel dieses Projektes ist es, <strong>im</strong> Rahmen eines grenzüberschreitenden Therapieverbundes ein<br />
sich gegenseitig ergänzendes Hilfesystem für Suchtkranke aufzubauen, das zu einer<br />
Gesundung und Stabilisierung der Persönlichkeit des Patienten als Voraussetzung zum<br />
Erhalt bzw. Wiedererlangung der Beschäftigungsfähigkeit führen wird.<br />
8.3.4 Wohn-Versorgungszone Dinxperlo-Suderwick<br />
Projektträger und Antragsteller ist das „Dr. Jenny Woon-Zorgcentrum“ in Dinxperlo in<br />
<strong>Zusammenarbeit</strong> mit dem Käthe-Kollwitzhaus in Bocholt, der Europäischen<br />
Seniorenakademie Ahaus und der „Vrijwillige Intensieve Thuiszorg Oost-Gelderland“ (VIT).<br />
Als externer Auftragnehmer beteiligt sich „Activa BV“ in Enschede an dem Projekt. Weitere<br />
Netzwerkpartner sind das Evangelische Johanneswerk e.V. (Träger einer Großzahl von<br />
sozial-medizinischen Einrichtungen in NRW), die Gemeinde Dinxperlo, die Stadt Bocholt<br />
sowie die „Woningstichting Dinxperlo“.<br />
Das Projekt beinhaltet die Einrichtung einer kleinen Wohneinrichtung für 12 deutsche und<br />
niederländische pflegebedürftige Senioren in Suderwick. Die tatsächliche Realisierung dieser<br />
Wohneinrichtung erfolgt unter der Trägerschaft der „Stichting Europaproject Suderwick-<br />
Dinxperlo“, die speziell dazu gegründet werden soll. Außerdem werden 10 deutsche und<br />
niederländische Pfleger/innen bzw. Betreuer/innen weitergebildet, so dass sie sowohl auf<br />
dem deutschen als auch auf dem niederländischen Arbeitsmarkt tätig werden können. Das<br />
Projekt beinhaltet ferner den Aufbau eines deutsch-niederländischen He<strong>im</strong>pflegedienstes mit<br />
ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen.<br />
32
Deutsche Sozialversicherung<br />
Observatorium <strong>EUREGIOsocial</strong><br />
Innerhalb von Dinxperlo-Suderwick herrscht ein Mangel an Altenpflegeplätzen. In<br />
zunehmendem Maße zeigen sich ältere Menschen in Suderwick daran interessiert, <strong>im</strong> „Dr.<br />
Jenny Woon-Zorgcentrum“ wohnen zu können, da sie ansonsten auf He<strong>im</strong>e <strong>im</strong> viel weiter<br />
entfernt gelegenen Bocholt angewiesen sind. Bereits jetzt nehmen deutsche Senioren aus<br />
Suderwick den Mahlzeitservice, die Tagespflege und die Möglichkeit der vorübergehenden<br />
Aufnahme <strong>im</strong> „Dr. Jenny Woon-Zorgcentrum“ in Anspruch. Auch die Organisation „Vrijwillige<br />
Intensieve Thuiszorg“ wird von Suderwicker Senioren bereits um Hilfeleistung gebeten. Die<br />
voraussichtliche Entwicklung der Alterstruktur der Bevölkerung beiderseits der Grenze lässt<br />
vermuten, dass der Bedarf nach Altenpflegeplätzen in den kommenden Jahren stark<br />
ansteigen wird.<br />
Ziel dieses Projektes ist die Verwirklichung eines adäquaten Versorgungsangebotes für<br />
pflegebedürftige ältere Menschen in der Grenzregion.<br />
8.3.5 Intraluminäre Oxygenierung des Magen-Darm-Traktes<br />
Projektträger und Antragsteller ist die „Stichting Inwendig Geneeskundig Onderzoek“ (SIGO)<br />
in Enschede in <strong>Zusammenarbeit</strong> mit dem „Medisch Spectrum Twente“, der Universitätsklinik<br />
der Westfälischen Wilhems-Universität in Münster, der Fachhochschule Münster (Labor für<br />
medizinische Physik und Medizingerätetechnik in Steinfurt) und dem Unternehmen “Medical<br />
Measurement Systems” (MMS) in Enschede.<br />
Das Projekt beinhaltet die Entwicklung einer neuen Methode zur Vorbeugung bzw.<br />
Behandlung eines Darminfarktes (Ischämie, gastrointestinale Durchblutungsstörung), wobei<br />
Sauerstoff durch den Darm selbst (intraluminär) gegeben wird.<br />
Eine ungenügende Durchblutung des Magen-Darm-Traktes führt häufig zu Entzündungen,<br />
Geschwürbildung, Perforation oder sogar zum Absterben eines Darmteils. Eine derartige<br />
Ischämie tritt insbesondere oft als Komplikation bei größeren Operationen auf und wird in<br />
zunehmendem Maße als Ursache chronischer Bauchbeschwerden festgestellt. Die Ursache<br />
einer Ischämie ist eine allgemeine Verschlechterung des Blutkreislaufs des Magen-Darm-<br />
Traktes.<br />
Eine Ischämie kann sowohl einen akuten als auch einen chronischen Verlauf haben. Eine<br />
akute gastrointestinale Ischämie wäre vergleichbar mit einem Herz- oder Hirninfarkt mit<br />
ähnlichen lebensbedrohlichen Konsequenzen. Die herkömmlichen Behandlungsmethoden,<br />
wobei Sauerstoff über den Blutkreislauf zum Darm transportiert wird, haben die hohe<br />
Sterblichkeit durch diese Erkrankung nicht verringern können. Mitte der 80er Jahre wurde<br />
eine exper<strong>im</strong>entelle Behandlungsmethode entwickelt, wobei Sauerstoff über den Magen-<br />
Darm-Trakt selbst gegeben wird. Aufgrund mangelnder technischer Möglichkeiten konnte<br />
diese Methode bisher noch nicht klinisch umgesetzt werden. Durch den derzeitigen<br />
Technikstand wäre es heute möglich, ein erfolgreiches Behandlungskonzept zu entwickeln.<br />
Ziel des Projektes ist die Entwicklung einer neuen Behandlungsmethode zur Verringerung<br />
der (oft fatalen) Konsequenzen von Durchblutungsstörungen des Magen-Darm-Traktes.<br />
8.3.6 Verbesserung der funktionalen Genesung von Patienten mit einer<br />
Gehirnblutung (CVA) durch mehrkanalige Elektromyografie gesteuerte<br />
Elektrost<strong>im</strong>ulation<br />
Antragsteller und verantwortlich für die Durchführung des Projektes ist Roessingh Research<br />
and Development B.V. in Kooperation mit der Hedon Klinik in Lingen, der Westfälischen<br />
Wilhems-Universität, Abt. Nuklearmedizin, zu Münster, TIC Medizintechnik GmbH aus<br />
Dorsten und Demcon Twente B.V. aus Hengelo.<br />
Bei dem Projekt handelt es sich um die Entwicklung einer neuen Technologie, die bei der<br />
Behandlung von Patienten mit einer Gehirnblutung (CVA = cerebro-vasculair accident)<br />
angewandt werden kann. Diese Technologie wird während der Rehabilitationsphase<br />
33
Deutsche Sozialversicherung<br />
Observatorium <strong>EUREGIOsocial</strong><br />
eingesetzt und basiert auf elektrische St<strong>im</strong>ulierung der Armmuskeln durch auf die Haut<br />
geklebte Elektroden.<br />
Aus der Forschung ist bekannt, dass elektronische Muskelst<strong>im</strong>ulation bei CVA-Patienten<br />
positiven Einfluss auf die Möglichkeiten, den Arm zu bewegen hat (Abnahme der Spastizität,<br />
verbesserte Blutzirkulation). Die über dieses Projekt zu entwickelnde Technologie soll dazu<br />
dienen, die Effektivität der Elektrost<strong>im</strong>ulation zu opt<strong>im</strong>ieren. Voraussichtlich ist es eine<br />
wichtige Voraussetzung für die Verbesserung der Wirkung der Elektrost<strong>im</strong>ulation, dass der<br />
Patient diese Behandlung nicht mehr oder weniger passiv über sich ergehen läßt, sondern<br />
dass der elektrische Reiz erst gegeben wird, wenn der Patient den entsprechenden teilweise<br />
gelähmten Muskel selbst anspannt. Die erforderliche Muskelspannung wird durch<br />
Elektromyografie (EMG) gemessen. Im Prinzip ist diese Technologie vorhanden, aber die<br />
Effektivität ist aufgrund der Tatsache begrenzt, dass sie aus nur 1-Kanal EMG-Registrierung<br />
und -St<strong>im</strong>ulierung besteht, wodurch nur ein Muskel st<strong>im</strong>uliert werden kann. Die<br />
Projektpartner erwarten, dass die Wirkung der Behandlungsmethode in wesentlichem Maße<br />
vergrößert werden kann, wenn eine mehrkanalige EMG-gesteuerte Elektrost<strong>im</strong>ulation<br />
eingesetzt wird, die es ermöglicht, ganze Muskelgruppen zu st<strong>im</strong>ulieren und damit<br />
Bewegungsmuster zu trainieren.<br />
Ziel des Projektes ist es, die Wirkung der Rehabilitationsphase von CVA-Patienten durch die<br />
Entwicklung einer anwenderfreundlichen Technologie zu verbessern und den Patienten in<br />
die Lage versetzt die Methode auch zuhause anzuwenden.<br />
8.3.7 Diabetes mellitus - Diabetes Fuß<br />
Antragsteller und Projektträger ist das Twenteborg Ziekenhuis in Almelo in <strong>Zusammenarbeit</strong><br />
mit dem Mathias Spital in Rheine und der Westfälischen Wilhems-Universität Münster (Klinik<br />
und Poliklinik für Orthopädische Rehabilitation).<br />
Das Projekt „Diabetes mellitus – Diabetes Fuss“ besteht aus 3 Teilprojekten mit folgenden<br />
Inhalten:<br />
8.3.7.1 Teilprojekt A (Twenteborg Ziekenhuis, Mathias Spital Rheine, Universität<br />
Münster)<br />
Das Teilprojekt beinhaltet eine durch die teilnehmenden Krankenhäuser beiderseits der<br />
Grenze (mit Unterstützung durch die Universität von Cardiff, Wales) vorgenommene<br />
vergleichende Studie unter 300 deutschen und niederländischen Patienten bzgl. zweier<br />
Behandlungsmethoden des „diabetischen Fusses“ hinsichtlich Genesungszeit,<br />
Kosteneffizienz und Lebensqualität. Der Akzent liegt hierbei auf einen Vergleich der<br />
Anwendung eines neuen Prototyps therapeutischer Schuhe (die in Almelo entwickelten sog.<br />
„MaBal-Schuhe“) mit der bisher wirksamsten Behandlungsmethode mittels Kunststoffgips<br />
(den sog. „Total Contact Cast“). Für die Patientenbehandlung mit dem „Total Contact Cast“<br />
und den „MaBal-Schuhen“ sollen niederländische und deutsche Gipsmeister ausgebildet<br />
bzw. nachgebildet werden. Die erforderliche Patientenzahl wird aus den teilnehmenden<br />
Krankenhäusern und aus den Krankenhäusern in Soest, Dortmund, Werl, Oberhausen,<br />
Kamen, Düsseldorf, Enschede, Hardenberg, Doetinchem und Winterswijk rekrutiert.<br />
Fußerkrankungen als Folge von Diabetes (insbesondere die chronische Wunde „ulcera“)<br />
haben neben der sozial-medizinischen Problematik wesentliche negative wirtschaftliche<br />
Auswirkungen. Betroffene Arbeitnehmer sind für längere Zeit krankgeschrieben. Bei<br />
Nichtbehandlung der Erkrankung können ernsthafte Komplikationen (z.B. Infekte) auftreten,<br />
die zu Amputationen führen können.<br />
Ziel des Teilprojektes sind Verbesserungen in der Behandlung von Fußerkrankungen als<br />
Folge von Diabetes durch die Entwicklung innovativer medizinischer Technologien.<br />
34
Deutsche Sozialversicherung<br />
Observatorium <strong>EUREGIOsocial</strong><br />
8.3.7.2 Teilprojekt B (Twenteborg Ziekenhuis, Universität Münster)<br />
Teilprojekt B beinhaltet die Entwicklung eines standardisierten mobilen Modell-<br />
Untersuchungsplatzes („tool box“) für die Diagnose von diabetischen Fußerkrankungen.<br />
Diese „tool box“ eignet sich für den Gebrauch in Arztpraxen sowie in Kiniken. Mit der „tool<br />
box“ können in einer ungefähr 10 Minuten dauernden Laboruntersuchung kaum sichtbare<br />
Gewebeabweichungen rechtzeitig erkannt werden (bei relativ geringen Kosten), so dass<br />
diese schneller (präventiv) behandelt werden können.<br />
Weiterhin soll ein technisches Patienten-Monitoringsystem entwickelt werden. Damit können<br />
Fußbelastungen und –bewegungen sowie der Tagesablauf des Patienten in seiner täglichen<br />
Umgebung s<strong>im</strong>uliert und analysiert werden. Mit Hilfe von individuell auf den Patienten<br />
abgest<strong>im</strong>mten Vorsorgemaßnahmen, die aus dem Monitoring abgeleitet werden, kann der<br />
Bildung von neuen Fußwunden (ulcera) vorgebeugt werden.<br />
Ziel des Teilprojektes ist die Vorbeugung von Fußerkrankungen aufgrund von Diabetes.<br />
8.3.7.3 Teilprojekt C (BAAT Engineering, Westfälische Wilhelms-Universität)<br />
Teilprojekt C beinhaltet die Entwicklung der Marktreife des in Teilprojekt B entwickelten<br />
Prototyps eines standardisierten mobilen Modell-Untersuchungsplatzes („tool box“) zur<br />
Vorbeugung von diabetischen Fußerkrankungen. Die „tool box“ soll von jedem (Haus-)Arzt<br />
und jedem Versorgenden, der mit Diabetes zu tun hat, genutzt werden können. Dieses stellt<br />
Anforderungen an die „tool box“ hinsichtlich Benutzerfreundlichkeit, Platzbedarf und<br />
Anschaffungskosten.<br />
Ziel des Teilprojektes ist die weitere Entwicklung der „tool box“ zu einem marktreifen Produkt<br />
unter Beachtung der Benutzeranforderungen.<br />
Nach der sog. St. Vincent–Erklärung, die vor über 10 Jahren durch die International Diabetes<br />
Federation und die World Health Organisation verabschiedet worden ist, müssen<br />
Maßnahmen ergriffen werden, um insbesondere die Folgeerkrankungen von Diabetes<br />
zurückzudrängen. Dabei ist wichtig, dass die Medizin sich zum einen der Bedrohung durch<br />
Diabetes bewußt wird und zum anderen den Nutzen der frühzeitigen Erkennung und<br />
Behandlung von Komplikationen erkennt. Daneben müssen tatsächliche Möglichkeiten<br />
geboten werden, um die Komplikationen aufzuspüren und sie in qualitativ und wirtschaftlich<br />
verantwortlicher Weise zu behandeln. Ausgangspunkt dabei ist, so oft wie möglich ambulant<br />
zu behandeln und weniger stationär.<br />
Allgemeine Zielsetzung des Projektes ist die Verbesserung der Qualität und der Effizienz der<br />
Diabetiker-Versorgung in der EUREGIO.<br />
8.3.8 VINCENT 50 – Scanning des diabetischen Fußes<br />
Antragsteller und verantwortlich für die Durchführung des Projektes ist das Twenteborg<br />
Ziekenhuis zu Almelo in Kooperation mit folgenden Partnern:<br />
• Mathias Spital zu Rheine<br />
• Clemens Hospital zu Münster<br />
• Raphaelsklinik zu Münster<br />
• Maria Hilf Hospital zu Stadtlohn<br />
• Streekziekenhuis Koningin Beatrix zu Winterswijk<br />
• Marienhospital zu Steinfurt<br />
• Fachhochschule Münster<br />
• Universität Twente<br />
Als externe Auftragnehmer sind an dem Projekt beteiligt:<br />
• Kenniscentrum MeDaVinci BV zu Amsterdam<br />
35
Deutsche Sozialversicherung<br />
Observatorium <strong>EUREGIOsocial</strong><br />
• Demcon Twente BV zu Oldenzaal<br />
• Firma Micromontage zu Oldenzaal<br />
• Erasmus Universität zu Rotterdam, Institute for Medical Technology Assessment<br />
(IMTA)<br />
• Firma Mindbus, Oegstgeest<br />
• Firma Vicar Vision, Amsterdam<br />
• Firma Sentient Informations Systems, Amsterdam<br />
Das operationelle Projektmanagement wird in Händen des Kenniscentrum MeDaVinci sein.<br />
Die 50 Scanner sollen <strong>im</strong> Rahmen des Projektes bei Diabetespatienten zuhause stationiert<br />
werden. Daneben soll ein Dienstleistungssystem in Form von zwei Call Centern (für die<br />
niederländische Seite in Almelo und für die deutsche Seite in Rheine) organisiert werden.<br />
Die Technologie und das Dienstleistungssystem sollen in der Praxis getestet und <strong>im</strong> Rahmen<br />
der sog. Assessment Study evaluiert werden. Das System „VINCENT 50“ wird es<br />
voraussichtlich ermöglichen, beginnende chronische Fußwunden (Ulcera) als Folge von<br />
Diabetes in einem möglichst frühen Stadium zu erkennen, um dann eine frühzeitige<br />
Behandlung einzuleiten. Der Patient kann selbst täglich mit dem Scanner Aufnahmen von<br />
seinen Fußsohlen machen, die dann für den Patienten gut sichtbar auf dem eigenen<br />
Fernsehbildschirm wiedergegeben werden und zugleich zum Call Center geschickt werden,<br />
wo ein Podotherapeut oder ein spezialisierter Mitarbeiter das empfangene Bild beurteilt und<br />
eventuell mit früheren Aufnahmen vergleicht. Wenn Abweichungen festgestellt werden, wird<br />
dem Patienten geraten, sich so schnell wie möglich durch den Hausarzt, Podotherapeuten<br />
und/oder anderen Therapeuten näher untersuchen zu lassen und falls erforderlich mit der<br />
Behandlung zu beginnen. Sollte der Patient nicht in der Lage sein, selbst Kontakt zum<br />
Therapeuten aufzunehmen, so wird das Call Center den Therapeuten informieren, wonach<br />
ein Besuch be<strong>im</strong> Patienten erfolgt. Sollte der Patient keine Aufnahmen verschicken, dann<br />
wird das Call Center zu dem Patienten Kontakt aufnehmen und ihn auffordern, die Fotos<br />
nachträglich zu verschicken. Die Einrichtung der Call Center auf niederländischer und<br />
deutscher Seite der Grenze ist ebenfalls Bestandteil des Projektes.<br />
Die exper<strong>im</strong>entelle Anwendung der Scanner soll innerhalb dieses Projektes auf zwei Arten<br />
geschehen:<br />
in den Niederlanden: über tägliche Kontrolle durch den Patienten selbst Zuhause;<br />
in Deutschland: über dre<strong>im</strong>onatliche Kontrolle durch den Hausarzt und tägliche Kontrolle<br />
durch den Patienten selbst Zuhause;<br />
Diabetes mellitus hat sich in den letzten Jahren zu einer Volkskrankheit entwickelt. Im<br />
niederländischen und deutschen Teil der EUREGIO leiden schätzungsweise 106.000<br />
Menschen unter dieser Krankheit, eine Anzahl, die sich in den kommenden Jahrzehnten<br />
verdoppeln wird. Fußkrankheiten treffen 5 – 10 % der Diabetespatienten, und gehören damit<br />
zu den am häufigsten auftretenden Komplikationen von Diabetes und bilden den größten<br />
Kostenfaktor bei der Behandlung dieser Krankheit. Um u.a. Amputationen zu verhindern,<br />
muss die Behandlung in einem möglichst frühen Stadium (innerhalb von 48 Stunden)<br />
aufgenommen werden. Darüber hinaus ist Prävention wichtig, weil die Chance auf<br />
Wiederholung bei Auftreten von Fußulzera groß ist (bei rund 75 % der Patienten mit einem<br />
Fußulcus tritt innerhalb von 5 Jahren eine Wiederholung auf). Der vorliegende Projektantrag<br />
ermöglicht es über eine „Kontrolle auf Abstand“ (Telekonsultation) oder in der Praxis des<br />
Hausarztes (durch den Hausarzt oder eine ambulante Pflegeeinrichtung) diabetische<br />
Fußabweichungen sehr schnell festzustellen und zu best<strong>im</strong>men, ob weitere Untersuchungen<br />
und Behandlungen erforderlich sind. Zugleich werden so unnötige Überweisungen<br />
vermieden. Dieser Antrag schließt somit inhaltlich an das bereits früher bewilligte und in der<br />
Durchführung befindliche INTERREG IIIA-Projekt „Diabetes Fuß“ (2-EUR-II-2=60) an, in dem<br />
der Schwerpunkt auf der klinischen Diagnostik (über die sog. TOOL BOX) und Behandlung<br />
(über den sog. MABAL-Schuh) diabetischer Fußleiden liegt.<br />
36
Deutsche Sozialversicherung<br />
Observatorium <strong>EUREGIOsocial</strong><br />
Das Projekt „VINCENT 50 – Scanning des diabetischen Fußes“ besteht aus 3 Teilprojekten<br />
mit folgenden Inhalten:<br />
8.3.8.1 Teilprojekt A (Demcon Oldenzaal, Mindbus Oegstgeest und Vicar Vision<br />
Amsterdam)<br />
Teilprojekt A umfasst die technische Entwicklung eines Fußsohlenscanners auf der Basis<br />
eines bestehenden Prototyps, wofür man ein europäisches Patent bekommen hat. Unter<br />
dem Namen „VINCENT 50“, soll eine Serienproduktion von 50 Exemplaren entstehen, sowie<br />
die Entwicklung der dazugehörenden Software und eines Bildanalysesystems erfolgen.<br />
8.3.8.2 Teilprojekt B (Mathias Spital Rheine und Twenteborgziekenhuis Almelo)<br />
Teilprojekt B wird sich mit der exper<strong>im</strong>entellen Praxisanwendung des Scannsystems auf<br />
beiden Seiten der Grenze beschäftigen und Call Center einrichten.<br />
8.3.8.3 Teilprojekt C (Fachhochschule Münster und Erasmus Universität Rotterdam<br />
-iMTA)<br />
Teilprojekt C umfasst die technische Evaluation und Assessment Study<br />
Die Zielsetzung dieses Projektes liegt darin, die Qualität und Effizienz der Diabetespflege in<br />
der EUREGIO zu verbessern, wodurch die Anzahl der Krankenhausaufnahmen begrenzt<br />
wird, Behandlungskosten und Arbeitsunfähigkeit verringert werden und die Lebensqualität<br />
des Patienten gesichert wird. In der vor gut zehn Jahren formulierten St. Vincent-Erklärung<br />
der Internationalen Diabetes Föderation und der World Health Organisation wurde die<br />
Absicht zum Ausdruck gebracht, man wolle die Anzahl der Amputationen von<br />
Unterschenkeln als Folge diabetischen Fußleidens um 50 % reduzieren. Dieses Projekt<br />
leistet zur Erreichung dieses Ziels einen wesentlichen Beitrag.<br />
8.3.9 The Initiative for Medical Product Development - TIMP<br />
Projektträger und Antragsteller ist die niederländische Stichting „The Initiative for Medical<br />
Productdevelopment (TIMP)“ mit folgenden niederländischen und deutschen Partnern:<br />
- 3T BV, Enschede<br />
- Demcon Twente BV, Hengelo<br />
- Ergo Design, Enschede<br />
- HealthScore, Deventer<br />
- Idéon Twente BV, Oldenzaal<br />
- Indes Industrial Design & Engineering, Hengelo<br />
- Het Roessingh, Rehabilitation Center, Enschede<br />
- TMS International, Enschede<br />
- United Care, Amersfoort<br />
- Universität Twente<br />
- Fachhochschule Münster (neues Mitglied)<br />
- Use-Lab GmbH (neues Mitglied)<br />
- Jüke Systemtechnik GmbH, Altenberge (neues Mitglied)<br />
Darüber hinaus ist die Gesellschaft für Wirtschaftsförderung des Kreises Borken mbH als<br />
Projektpartner beteiligt.<br />
Das Projekt „The Initiative for Medical Productdevelopment EUREGIO (TIMP-EUREGIO)“ ist<br />
eine grenzüberschreitende Weiterentwicklung eines Unternehmensclusters, das vor<br />
37
Deutsche Sozialversicherung<br />
Observatorium <strong>EUREGIOsocial</strong><br />
einigenJahren in den Niederlanden in dem Bereich der medizinischen Produktentwicklung<br />
gestartet ist. In TIMP bündeln die Mitgliedsunternehmen ihre (Entwicklungs-)Kompetenzen<br />
und bieten somit gemeinsam potentiellen Auftraggebern eine breite Produkt- und<br />
Dienstleistungspalette an. Ziel sind sog. TIMP-Projekte, die kooperative Entwicklung neuer<br />
Produkte für den Medizin- und Rehabilitationsmarkt.<br />
Die Zusammensetzung des Clusters beschränkt sich aktuell nur auf Unternehmen und<br />
Institute aus Twente. Diese ergänzen sich gegenseitig, decken aber nicht die gesamte<br />
Wertschöpfungskette ab. Die noch fehlenden Kompetenzpartner und vor allem die Tatsache,<br />
dass der Medizinbereich einer der internationalen Zukunftsmärkte ist, macht eine<br />
euregionale Weiterentwicklung von TIMP sinnvoll.<br />
Das Projekt umfasst folgende Bausteine:<br />
- Aktive Weiterentwicklung des Clusters durch eine deutlich internationale<br />
Profilbildung: Kennen lernen der unterschiedlichen deutsch-niederländischen<br />
Unternehmenskulturen durch regelmäßigen Wissenstransfer zwischen den<br />
Clusterteilnehmern durch thematischer Treffen, TIMP Seminaren (in Kooperation mit<br />
Universitäten/Hochschulen), etc.<br />
- Ausbau einer binationalen Organisationsstruktur: Hierbei steht ein unabhängiger<br />
Koordinator dem Cluster unterstützen zur Seite (Organisation der Clustertreffen,<br />
Begleitung von Projekten, Checks and Balances: Mediation bzw. Moderation des<br />
Clusters).<br />
- Aufbau eines euregionalen Pilotmarktes durch die Einbindung von Universitäten,<br />
Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen (Launching Customers), wobei ein<br />
Technology Assessment, z.B. durch praxisorientierte Diplomarbeiten, gewährleistet<br />
wird.<br />
- Angebot unterstützender Möglichkeiten für den Entwicklungsbereich: z.B. Use-Lab<br />
(Gebrauchstauglichkeit durch kontrollierte S<strong>im</strong>ulation von Abläufen <strong>im</strong> Teststudio),<br />
UCID (User centered industrial design, der zukünftiger Nutzer steht <strong>im</strong>mer <strong>im</strong><br />
Mittelpunkt bei der Entwicklung von neuen Produkten) und ein Care centre (Pflege-<br />
Lab, bei Use-lab) als Testumgebung für neue Produkte <strong>im</strong> Pflegebereich.<br />
Grundlegendes Ziel bildet die Schaffung eines nachhaltigen Clusters, das die Teilnehmer auf<br />
den internationalen Märkten wettbewerbsfähig macht.<br />
8.3.10 People to People Action – Wohnen und Psychiatrie<br />
Antragsteller ist die Stichting RIBW Twente (RIBW = egionale Einrichtung für Betreutes<br />
Wohnen) in <strong>Zusammenarbeit</strong> mit der Stichting RIBW Drenthe, dem Osnbrücker Verein zur<br />
Hilfe für seelisch Behinderte e.V./Wohn- und Übergangswohnhe<strong>im</strong> „Hügelhaus“ Osnabrück,<br />
dem Förderverein Psychosoziale Dienste Ahaus-Gronau e.V./Psychosoziales Zentrum<br />
Gronau, Insel gGmbH für psychosoziale Dienste <strong>im</strong> Kreis Borken und dem Förderkreis<br />
Sozialpsychiatrie Münster e.V.<br />
Das Projekt beinhaltet einen intensiven grenzüberschreitenden Austausch von<br />
Fachkenntnissen und Erfahrungen zwischen Vertretern von Organisationen, die innerhalb<br />
der EUREGIO für die Organisation, Koordination und Begleitung von Projekten <strong>im</strong> Bereich<br />
des betreuten Wohnens für (ehemalige) Psychiatriepatienten verantwortlich sind.<br />
Der Erfahrungs- und Kenntnisaustausch soll durch folgende Aktivitäten („Projektpakete“)<br />
praktisch umgesetzt werden:<br />
1. Arbeitskonferenz (1 Tag) mit Vorträgen und Workshops zum Thema Psychiatrie in<br />
Deutschland und den Niederlanden, aktuelle Entwicklungen in der Psychiatrie,<br />
Anforderung und Qualifikation der Mitarbeiter/innen, betreutes Wohnen für psychisch<br />
kranke Menschen in Deutschland und den Niederlanden.<br />
38
Deutsche Sozialversicherung<br />
Observatorium <strong>EUREGIOsocial</strong><br />
2. Hospitation: grenzüberschreitender Austausch von Mitarbeitern. 12-14<br />
niederländische und deutsche Mitarbeiter der beteiligten psychiatrischen<br />
Einrichtungen werden während einer Woche in einer vergleichbaren Einrichtung <strong>im</strong><br />
Nachbarland tätig sein.<br />
3. Kollegiale Beratung (für Management/Geschäftsführung): 6-8 deutsche und<br />
niederländische Führungskräfte der beteiligten Einrichtungen werden vorab<br />
ausgewählte spezifische Problemfragen/Themen gemeinsam diskutieren, wobei<br />
durch Nutzung der Erfahrungen und Fachkenntnissen der Kollegen aus dem<br />
Nachbarland Lösungsansätze ausgearbeitet werden sollen.<br />
4. Transferkonferenz: Präsentation der Ergebnisse der Austauschaktivitäten für die<br />
Teilnehmer bzw. für Vertreter anderer relevanten Einrichtungen sowie sonstiger<br />
interessierter Organisationen/Instanzen.<br />
Beiderseits der Grenze stellt betreutes Wohnen eine Kernfunktion der psychiatrischen<br />
Gesundheitsversorgung dar. Es fehlen bisher jedoch ein grenzüberschreitender Austausch<br />
sowie eine <strong>Zusammenarbeit</strong> zwischen den für diesen Bereich zuständigen Stellen.<br />
Ziele dieses Projektes sind:<br />
• Förderung des grenzüberschreitenden Austausches von Fachkenntnissen, Ansichten<br />
und Methoden zur Verstärkung von Arbeitsabläufen und -strukturen in der eigenen<br />
Organisation (Synergie-Effekte),<br />
• Entwicklung eines grenzübergreifenden Netzwerkes von Einrichtungen für betreutes<br />
Wohnen für (ehemalige) Psychiatriepatienten,<br />
• Erweiterung der Zugangsmöglichkeiten für Arbeitnehmer in diesem Bereich zum<br />
Arbeitsmarkt <strong>im</strong> Nachbarland.<br />
8.3.11 Grenzüberschreitende Tagesaktivitäten für Menschen mit Behinderung<br />
Antragsteller ist die Stichting Estinea in Aalten in <strong>Zusammenarbeit</strong> mit dem Caritasverband<br />
Bocholt, der Lebenshilfe Bocholt, dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe, dem Kreis<br />
Borken sowie der Provinz Gelderland.<br />
Das Projekt beinhaltet die Durchführung einer Bestands- und Bedarfserhebung der<br />
Tagesaktivitäten für Menschen mit geistiger Behinderung und ggfls. die Entwicklung eines<br />
Pilotprojektes zur Erweiterung bzw. Anpassung des bestehenden Angebotes aufgrund der<br />
Nachfrage. Das Projektgebiet umfasst die Gemeinden Aalten, Winterswijk, Dinxperlo,<br />
Doetinchem, Gendringen, Eibergen, Bocholt, Rhede und Isselburg.<br />
Die Projektpartner werden <strong>im</strong> Rahmen des Projektes insbesondere folgende Aspekte<br />
untersuchen:<br />
- die Angebote für die Tagesgestaltung von Menschen mit geistiger Behinderung <strong>im</strong><br />
Projektgebiet;<br />
- die fachlichen, kulturellen, rechtlichen, personellen und finanziellen<br />
Rahmenbedingungen beiderseits der Grenze (die Partner auf deutscher Seite haben<br />
insbesondere viel Interesse für das niederländische System des sog.<br />
„personengebundenen Budgets“);<br />
- Feststellung, welche Zielgruppen durch die vorhandenen Angebote erreicht werden;<br />
- der Bedarf an Tagesaktivitäten für Behinderte.<br />
In Absprache mit Klienten, Betreuern und Eltern soll geprüft werden, wie Angebot und<br />
Nachfrage besser aufeinander abgest<strong>im</strong>mt werden können. In diesem Zusammenhang<br />
werden Arbeitsbesuche der Mitarbeiter und des Managements der teilnehmenden<br />
Einrichtungen auf deutscher und niederländischer Seite geplant. Die Ergebnisse der Studie<br />
sollen <strong>im</strong> Rahmen eines grenzüberschreitenden Thementreffens mit Vertretern der<br />
beteiligten Einrichtungen vorgestellt werden. Dieses Treffen dient außerdem zum<br />
Erfahrungsaustausch <strong>im</strong> Hinblick auf Tagesaktivitäten sowie auf das auf niederländischer<br />
Seite angewandte nachfragegesteuerte System.<br />
39
Deutsche Sozialversicherung<br />
Observatorium <strong>EUREGIOsocial</strong><br />
Anlass zu diesem Projekt ist die wachsende Zahl von deutschen Klienten, die das Angebot<br />
der Tagesaktivitäten des niederländischen Projektpartners (eine Einrichtung der Fürsorge<br />
und des Pflegedienstes für Menschen mit geistiger Behinderung) in Anspruch nehmen<br />
möchten.<br />
Ziel dieses Projektes ist die Opt<strong>im</strong>ierung der Qualität der Fürsorge und Dienstleistung für<br />
Menschen mit geistiger Behinderung.<br />
8.3.12 People to People – Koordinierung und <strong>Zusammenarbeit</strong> in der Psychiatrie<br />
NL/D<br />
Antragsteller ist die Stichting Mediant-Geestelijke Gezondheidszorg aus Enschede in<br />
Kooperation mit der Stichting RIBW Twente aus Hengelo, dem Gemeinnützigen Verein für<br />
die Rehabilitation psychisch Behinderter Steinfurt e.V., dem Förderkreis für psychisch<br />
Erkrankte und Behinderte aus Lengerich, der Wohn- und Fördereinrichtung der WKP<br />
Lengerich, der Tagesklinik Steinfurt-Borghorst der WKP Lengerich, dem Förderkreis für<br />
psychisch Erkrankte und Behinderte e.V. Kreis Steinfurt, Dezentrales stationäres Wohnen<br />
des Caritas-Verbandes Steinfurt e.V, der Insel GmbH für psychosoziale Dienste <strong>im</strong> Kreis<br />
Borken und dem Lukas Krankenhaus Gronau.<br />
Inhalt des Projektes ist ein intensiver Austausch von Know-how und Erfahrungen <strong>im</strong> Bereich<br />
der psychischen Pflege zwischen Mitarbeitern von zwei niederländischen und acht<br />
deutschen Organisationen. Dieser Austausch umfasst:<br />
1. eine öffentliche Arbeitskonferenz für Mitarbeiter der betroffenen Organisationen und<br />
anderer Interessenten aus Behörden und Verwaltung;<br />
2. ein interner Workshop zur Vorbereitung der Teile 3 und 4;<br />
3. ein 3-5-tägiger grenzüberschreitender Austausch von Pflegepersonal;<br />
4. zwei Mal einen Tag kollegialer Beratung für Führungskräfte der betroffenen Organisationen;<br />
5. eine abschließende eintägige Transferkonferenz für Interessenten aus der Pflege und<br />
dem <strong>Gesundheitswesen</strong> aus dem deutsch-niederländischen Grenzgebiet.<br />
Sowohl auf deutscher als auch auf niederländischer Seite konzentriert sich die Politik auf<br />
dem Gebiet der Psychiatrie auf die Dehospitalisierung der Pflege, einerseits zur<br />
Verbesserung der Lebensqualität der Patienten und andererseits, um effizienteres und<br />
kostengünstigeres Arbeiten zu erreichen. Zugleich herrschen in Deutschland und in den<br />
Niederlanden große Unterschiede in der Arbeitsweise, Struktur, Organisation und<br />
Finanzierung der psychischen Pflege.<br />
Ziele des Projektes sind:<br />
• die St<strong>im</strong>ulierung von grenzüberschreitendem Austausch von Erfahrungen, Know-how<br />
und Methoden, wodurch die Arbeitsweisen und Strukturen in der eigenen<br />
Organisation verstärkt werden können (Synergie-Effekt),<br />
• die Entwicklung eines grenzüberschreitenden nachhaltigen Kooperationsnetzwerks<br />
von Einrichtungen auf dem Gebiet der psychischen Pflege.<br />
• es den Arbeitnehmern in diesem Sektor zu vereinfachen, einen Arbeitsplatz auf der<br />
anderen Seite der Grenze zu finden,<br />
• die Zugänglichkeit von Einrichtungen <strong>im</strong> Nachbarland für Patienten zu verbessern.<br />
8.3.13 People to People Projekt – Grenzüberschreitende <strong>Zusammenarbeit</strong> <strong>im</strong><br />
Bereich der Mitmenschen mit Behinderung<br />
Antragsteller ist das Ferienhe<strong>im</strong> Hof Grothman e.V. in Ledde in <strong>Zusammenarbeit</strong> mit Aveleijn<br />
in Hengelo (eine Organisation <strong>im</strong> Bereich Betreuung und Entwicklung von Behinderten)<br />
sowie der Lebenshilfe Greven. Ferner sind am Projekt beteiligt:<br />
40
Deutsche Sozialversicherung<br />
Observatorium <strong>EUREGIOsocial</strong><br />
• Lebenshilfe Münster<br />
• Lebenshilfe Gronau<br />
• Lebenshilfe Nordhorn<br />
• Urlaub & Pflege, Münster<br />
• Camphill Dorfgemeinschaft, Steinfurt<br />
• Dachverband des deutschen paritätischen Wohlfahrtsverband – Landesverband<br />
NRW e.V.<br />
• Stichting Dagcentra Twente, Hengelo<br />
• Sociaal-pedagogische Dienst, Hengelo<br />
• De Werkwijzer, Oldenzaal<br />
Zielgruppe der <strong>im</strong> Rahmen dieses Projektes geplanten Aktivitäten sind professionelle und<br />
ehrenamtliche Mitarbeiter <strong>im</strong> Bereich der Behindertenarbeit, körperlich und geistig behinderte<br />
Menschen und ihre Angehörigen. Im Rahmen dieses Projektes werden sie<br />
grenzüberschreitend Kenntnisse und Erfahrungen austauschen sowie an gemeinsamen<br />
Begegnungen und Bildungsveranstaltungen teilnehmen. Dazu werden folgende konkrete<br />
Aktivitäten geplant:<br />
Im Bereich Wohnen und Familie<br />
• Drei Begegnungswochenenden in 2003, 2004 und 2005 unter dem Titel „Hallo<br />
Nachbarn“ für geistig Behinderte (Anzahl: 12) und deren Betreuer (Anzahl: 8) , die<br />
beiderseits der Grenze ambulantes oder dezentrales Wohnen für sich nutzen.<br />
Während dieser Wochenenden sollen zwischen den Teilnehmern (Behinderten und<br />
Betreuern) in einer ungezwungenen Atmosphäre Erfahrungen hinsichtlich der<br />
jeweiligen Wohn- und Lebensformen beiderseits der Grenze ausgetauscht werden.<br />
• Zwei grenzüberschreitende Familientage für geistig Behinderte und deren<br />
Angehörige zum Thema „Lebensperspektiven und Wohnen“. Während dieser<br />
Tagungen werden zwischen den Teilnehmern (10 deutschen und 10<br />
niederländischen Familien) Erfahrungen hinsichtlich Lebens- und Wohnformen<br />
ausgetauscht und Fachleute werden die Arbeit und die unterschiedlichen<br />
Wohnformen vorstellen.<br />
Im Bereich Theater, Kunst und Sport<br />
Zwei Begegnungswochenenden pro Jahr mit jeweils rd. 15 Teilnehmern. Deutsche und<br />
niederländische Behinderte werden während dieser Begegnungen kreativ in<br />
unterschiedlichen Bereichen (zeichnen, malen, Theater) miteinander arbeiten.<br />
Ziel dieses Projektes ist die Verbesserung der Lebensbedingungen von Behinderten.<br />
41
8.4 Euregio Rhein-Waal<br />
Deutsche Sozialversicherung<br />
Observatorium <strong>EUREGIOsocial</strong><br />
Euregio Rhein-Waal<br />
(D/NL) Grenzüberschreitender deutsch-niederländischer<br />
öffentlich-rechtlicher Zweckverband<br />
(Gesamt) 2.500.000 Einwohner<br />
(D) Stadt Duisburg, Kreise Kleve und Wesel<br />
1.135.000 Einwohner<br />
(NL) Regios Achterhoek (z.T.), West-Veluwe (z.T.),<br />
Arnhem-Nijmegen, Noord-L<strong>im</strong>burg (z.T.)<br />
Noordoost-Brabant und Rivierengebied (z.T.)<br />
1.365.000 Einwohner<br />
42
Euregio Rhein-Waal<br />
Deutsche Sozialversicherung<br />
Observatorium <strong>EUREGIOsocial</strong><br />
8.4.1 Allgemeines<br />
Wie ein Blick auf die Karte zeigt, ragen die eher ländlich strukturierten deutschen Kreise<br />
Kleve und Wesel geografisch zifpelförmig in die Niederlande hinein, die mit den Städten<br />
Nijmegen und Arnhem zwei Bevölkerungszentren vorweisen können. Hingegen sind die<br />
nächstgelegenen deutschen Zentren Düsseldorf, Essen und Duisburg zirka 80 bis 100<br />
Kilometer entfernt, weshalb es sich naturgemäß anbietet, niederländische<br />
Behandlungsmöglichkeiten durch die ganze Euregio-Bevölkerung zu nutzen.<br />
8.4.2 Grenzüberschreitende Gesundheitsversorgung<br />
Von 1993 bis 1995 hat die Euregio Rhein-Waal das Projekt „Grenzüberschreitende<br />
Gesundheitsversorgung“ durchgeführt, mit dem Bedürfnisse, Hemmnisse sowie<br />
Möglichkeiten einer sinnvollen grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung untersucht<br />
wurden. Die Kooperationspartner wirkten <strong>im</strong> Rahmen der Begleitkommission unterstützend<br />
mit. Die allgemein als positiv bewerteten Ergebnisse und Erfahrungen sind in einem<br />
Abschlußbericht zusammengefasst und 1995 auf einem Symposium in Goch vorgestellt<br />
worden. Als eine Folge daraus wurde das „<strong>Euregionale</strong> Forum zur Gesundheitsversorgung“<br />
als ständiges Gremium eingerichtet.<br />
Erkenntnisse und Erfahrungen der Projektaktivitäten und <strong>Zusammenarbeit</strong> in der Interreg II-<br />
Phase (1996-2002) haben weitere Handlungsfelder aufgezeigt, die in einer kontinuierlichen<br />
Fortsetzung der <strong>Zusammenarbeit</strong> und einer Anpassung der Inhalte und Strukturen (an<br />
europäische und regionale Entwicklungen) gemeinsam unter Einbindung sämtlicher<br />
Beteiligter in kleinen Schritten angepackt werden und einer einvernehmlichen Lösung zu<br />
geführt werden müssen. Wie oben erwähnt wurde <strong>im</strong> Jahre 1995 das <strong>Euregionale</strong> Forum<br />
gegründet. Dieses Forum hat sich weiter entwickelt und in folgenden Bereichen aktiv:<br />
Netzwerk, Informationsaustausch und Entwicklung konkreter Projekte auf dem Gebiet<br />
grenzüberschreitender Projekte <strong>im</strong> Bereich der Gesundheitsversorgung.<br />
Teilnehmer dieses <strong>Euregionale</strong>n Forums:<br />
Amicon Zorgverzekeraar<br />
Anoz Zorgverzekeringen<br />
AOK Rheinland<br />
Apothekerkammer Nordrhein<br />
Apothekerverband Nordrhein e.V.<br />
Ärztekammer Nordrhein<br />
BKK Landesverband NRW<br />
Canisius Wilhelmina Ziekenhuis<br />
CZ Aktief in gezondheid<br />
IKK Nordrhein<br />
Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein<br />
Klinikum Duisburg Wedau Kliniken<br />
Maasziekenhuis Boxmeer<br />
Marienhospital Wesel<br />
NMT, Nederl.Mij. tot bevordering der Tandheelkunde<br />
Paritätische Wohlfahrtsverband<br />
Rheinische Kliniken Bedburg-Hau<br />
RPCF Regionale Patiënten/Consumenten Federatie<br />
Ziekenhuis Rijnstate, Arnhem<br />
St. Antonius Hospital Kleve<br />
St. Bernhard-Hospital Kamp-Lintfort GmbH<br />
St. Maartenskliniek, Nijmegen<br />
43
Deutsche Sozialversicherung<br />
Observatorium <strong>EUREGIOsocial</strong><br />
Universitair Medisch Centrum St Radboud Nijmegen<br />
VGZ Zorgverzekeraar<br />
VdAK/AEV Düsseldorf<br />
Wilhelm-Anton Hospital, Goch<br />
Zahnärztekammer Nordrhein<br />
Die Ergebnisse und Erkenntnisse aus der <strong>Zusammenarbeit</strong> in Interreg I (Analyse<br />
grenzüberschreitender Probleme, Hemmnisse, Bedarfe sowie erster Lösungsansätze) und<br />
der Aktivitäten in Interreg II (Projekte zur Schaffung erster Freiräume in der<br />
grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung) bilden die Basis für weitere innovative<br />
Aktivitäten in Interreg III (01.01.2003 – 31.12.2005).<br />
8.4.3 Mobilität in der grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung – MOGG<br />
Die Mobilität in der grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung in der Euregio Rhein-<br />
Waal setzt dort an,<br />
• wo die bisherigen Möglichkeiten einer bedarfsorientierten Inanspruchnahme<br />
grenzüberschreitender fachärztlicher Versorgung noch nicht genutzt wurden.<br />
• wo „ZOM“ bisher zum Einstieg auf die fachärztliche Basisversorgung, einschließlich<br />
Arzne<strong>im</strong>ittel und Krankenhausbehandlung begrenzt wurde - sinnvolle Ausweitungen<br />
bestehen u.a. bei der Ressourcenausschöpfung für kostenintensive Vorhaltungen von<br />
z.B. Großgeräten.<br />
• wo sich durch eine verstärkte aus „ZOM“ resultierende <strong>Zusammenarbeit</strong> <strong>im</strong><br />
Gesundheitsmarkt eine Mobilität in der Leistungsabwicklung und damit eine<br />
Verbesserung der Versorgung und gleichzeitig eine Opt<strong>im</strong>ierung der Wirtschaftlichkeit<br />
erreichen lässt (z.B. auch <strong>im</strong> Bereich der Planung).<br />
• Es gilt u.a. Informationen und Koordination zielgerichtet zu setzen, z.B. Einbindung der<br />
niederländischen/deutschen Haus- und Fachärzte.<br />
• Aufbau von Vertrauen zwischen den Behandlern für die beste Versorgung ihrer Patienten<br />
aus zwei Gesundheitssystemen.<br />
8.4.4 <strong>Euregionale</strong>r Einsatz Rettungshubschrauber<br />
Die Bedürfnisse und Notwendigkeiten der grenzüberschreitenden <strong>Zusammenarbeit</strong> auf dem<br />
Sektor der Traumatologie werden durch mehrere Studien aufgezeigt. In der Studie<br />
“Grenzüberschreitende Traumatologie” ist einer der wichtigsten Ratschläge, mit einem<br />
konkreten Projekt zu beginnen. Auch in der nationalen Politik sowohl in den Niederlanden als<br />
auch in Deutschland wird der grenzüberschreitenden <strong>Zusammenarbeit</strong> viel Aufmerksamkeit<br />
gewidmet. Die Gesundheitsversorgung und sicherlich auch die Hilfeleistungen bei Unfällen<br />
und Katastrophen (GHOR) sind ein Gebiet, das zusätzlich Aufmerksamkeit erfordert. Das<br />
Projekt ist darauf gerichtet, Probleme/Hindernisse zu beseitigen und so einen strukturellen<br />
Einsatz des medizinischen Hubschrauber-Teams an beiden Seiten des Grenzes möglich zu<br />
machen. Für ein opt<strong>im</strong>ales Ergebnis wird das Projekt mit dem Rettungsdienst in Duisburg<br />
abgest<strong>im</strong>mt und in <strong>Zusammenarbeit</strong> mit ihm durchgeführt. Der Rettungsdienst Duisburg ist<br />
verantwortlich ist für den Einsatz des deutschen Hubschraubers.<br />
8.4.5 Grenzüberschreitende Nutzung von Gesundheitsversorgung –<br />
Erfahrungsaustausch<br />
Zurzeit herrscht in den Niederlanden ein beträchtliches Ungleichgewicht zwischen der<br />
Nachfrage und dem Angebot von Gesundheitsversorgung. Ein Gleichgewicht ist durch eine<br />
Reduzierung der Nachfrage und/oder durch eine Vergrößerung des Angebotes zu erreichen.<br />
Da dies kurzfristig nicht realisiert werden kann, muss nach alternativen Lösungen gesucht<br />
werden muss.<br />
44
Deutsche Sozialversicherung<br />
Observatorium <strong>EUREGIOsocial</strong><br />
Das UMC und das Elkerliek Krankenhaus sind beide gegenwärtig in Deutschland aktiv. Bei<br />
der Durchführung der laufenden Aktivitäten wurde ausgiebig von vorangegangenen<br />
Analysen bestehender Situationen Gebrauch gemacht. Das hat zu einem Entwurf des UMC<br />
St. Radboud und des Elkerliek Krankenhauses geführt, nach dem der eigene Arzt die<br />
Behandlung auch auswärts durchführt. Dieser Arzt behandelt den Patienten in erster Linie<br />
auch weiterhin und operiert diesen an einem anderen Ort. Konkret operieren die Ärzte des<br />
UMC Herzpatienten einer OHO in Bochum, während die Ärzte des Elkerliek Krankenhaus<br />
seit Februar 2003 Patienten der Gynäkologie in Kamp-Lintfort behandeln. Es handelt sich<br />
hierbei um ca. 400 Patienten pro Jahr.<br />
Es gibt zahlreiche und gemäßigt positive Erfahrungen von Ärzten und anderen beteiligten<br />
Mitarbeitern des UMC und des Elkerliek Krankenhauses. „Fallen und wieder Aufstehen“ ist<br />
hier wohl die beste Beschreibung. Dabei standen bis dato nur sehr begrenzte und begrenzt<br />
brauchbare Erfahrungen zur Verfügung. Aus kollegialen Kontakten zu anderen<br />
niederländischen Krankenhäusern ergibt sich, dass diese Situation auch für diese<br />
Krankenhäuser ein Hindernis darstellt, obwohl es auch schon viel Interesse gibt, das<br />
Konzept zu übernehmen. Grundlage hierfür sollte eine Analyse der heutigen Situation,<br />
Erfahrungen und die Beschreibung der tatsächlichen Realisierung sein. Konkret könnte ein<br />
solcher Ansatz wie folgt aussehen:<br />
• Analyse/ Evaluation<br />
• Bündelung der Erfahrungen aus UMC mit Bochum und Elkerliek mit Kamp Lintfort<br />
(fachlich, inhaltlich, juristisch)<br />
• Inventarisierung der Bedarfe Zielgruppen<br />
• Best<strong>im</strong>mung der Art der Präsentation (Material, Präsentationsform,Begleitung)<br />
• Seminar<br />
• Berichterstattung<br />
Das Projekt muss für das Bekanntwerden der grenzübergreifenden <strong>Zusammenarbeit</strong> sorgen.<br />
Insbesondere muss deutlich werden, warum diese Art der <strong>Zusammenarbeit</strong> zu einem<br />
„Patientenfluss“ führen wird. Neben dem Bekanntwerden, liefert das Projekt auch konkret<br />
verwendbares Material, eine Art „how-to-do“. Im Rahmen von Europa kann so die<br />
Gesundheitsversorgungskapazität der Niederlande vergrößert und die Wartezeit der<br />
niederländischen Patienten verkürzt werden. Des weiteren kann das Projekt helfen, die<br />
Auswirkungen die die deutsche Gesundheitsreform hat, zu begrenzen. Das bedeutet, dass<br />
keine Kapazitäten abgebaut werden müssen, die für andere Patienten benutzt werden<br />
können.<br />
8.4.6 <strong>Euregionale</strong>s Gesundheitsportal“ – EGP<br />
Ziel ist die Einrichtung eines euregionalen Gesundheitsportals zur Transparenz und<br />
Information über die Möglichkeiten der Gesundheitsversorgung in der Euregio Rhein-Waal<br />
für die Bevölkerung, d.h. für Patienten/Versicherte; Leistungserbringer, wie z.B. die Ärzte; die<br />
Krankenhäuser; die Apotheken; Krankenversicherer und sonstige Beteiligte<br />
45
Deutsche Sozialversicherung<br />
Observatorium <strong>EUREGIOsocial</strong><br />
8.4.7 Grensoverschrijdende bijscholing op medisch gebied – Gfo.med<br />
In der Interreg II – Phase fanden Problemlösungen durch Modellprojekte statt, die auf einen<br />
freieren Zugang zu Gesundheitsangeboten und –leistungen für die Grenzbevölkerung<br />
gerichtet waren. Eine erweiterte Inanspruchnahme der grenzüberschreitenden fachärztlichen<br />
Versorgung, einschließlich der Arzne<strong>im</strong>ittelversorgung sowie der stationären Behandlung auf<br />
Gegenseitigkeit wurde durch die Krankenversicherer ermöglicht. Zusätzlich wurden<br />
Vereinfachungen <strong>im</strong> administrativen Bereich erprobt.<br />
Fehlende Kenntnis über Behandlungsinhalte und Ausstattung sowie eine mangelnde<br />
Vertrauensbasis zwischen den Behandlern und vor allem Skepzis bei den Versicherten/<br />
Patienten wegen unzureichender Information und Beratung stehen einer sinnvollen und<br />
erfolgreichen Weiterentwicklung der grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung noch <strong>im</strong><br />
Wege. Diese ersten Schritte in der Umsetzung sowie die geplanten Projekte<br />
grenzüberschreitender Gesundheitsversorgung müssen durch die Inhalte dieses Projektes<br />
begleitend ergänzt werden, um eine kontinuierliche Fortentwicklung der Zusammen- und<br />
Projektarbeit zu sichern und auszubauen.<br />
Aufbauend auf bisherigen Aktivitäten der Projektarbeit sollen durch strukturierte<br />
<strong>Zusammenarbeit</strong> und Information – vorwiegend <strong>im</strong> medizinsichen Bereich - Verbesserungen<br />
in folgenden Bereichen erzielt werden:<br />
• Im Informationsaustausch zwischen den medizinischen Leistungserbringern über<br />
- Behandlungsabläufe, -inhalte<br />
- Gesundheitssysteme<br />
- Informationsverfahren, z.B. Protokolle.<br />
• In der strukturierten<strong>Zusammenarbeit</strong> mit der Möglichkeit<br />
• - der Beratung über einen Patienten<br />
- der Konsultation eines Patienten<br />
- ergänzender zeitnaher Behandlung<br />
• In dem Aufbau einer Informationsplattform für Mediziner durch<br />
- Seminare (allgemein/fachgruppenspezifisch)<br />
- Einzelberatungen (mit/ohne Patientenbezug)<br />
• In der Anpassung bekannter, inländischer Verfahren an die grenzüberschreitende<br />
Versorgung/Behandlung<br />
- z.B. Überweisungsformalitäten<br />
- Behandlungsprotokolle, Vordrucke<br />
- lösen von sprachlichen Barrieren<br />
- Vor-/Nach-/Weiterbehandlung und (Rück-)Überweisung von Patienten<br />
8.4.8 <strong>Euregionale</strong> Koordinationsstelle für Patientenbelange<br />
Für die grenzüberschreitende Entwicklung einer übergreifenden Bündelung und Koordination<br />
von Patienten- und Selbsthilfeinitiativen und deren Beteiligung an der euregionalen<br />
Gesundheitsversorgung wird <strong>im</strong> Rahmen dieses Teilprojekts eine grenzüberschreitende<br />
Plattform- bzw. Koordinationsstruktur ausgebildet. Diesen übergreifenden<br />
Koordinationsansatz repräsentiert das Netzwerk, das die niederländischen und deutschen<br />
Projektträger in der Euregio Rhein-Waal bereits ausgebildet haben und in der<br />
grenzüberschreitenden <strong>Zusammenarbeit</strong> weiter ausbilden wollen. Über diese Plattform- und<br />
Koordinationsstruktur kooperieren die Patientenorganisationen und Selbsthilfeinitiativen<br />
miteinander und mit den Partnern und Projektträgern in der euregionalen<br />
Gesundheitsversorgung. Über diese Plattform- und Koordinationsstruktur werden folgende<br />
Projektschwerpunkte umgesetzt:<br />
46
Deutsche Sozialversicherung<br />
Observatorium <strong>EUREGIOsocial</strong><br />
• Weitere strukturelle Ausbildung der Koordinationsplattform zur übergreifenden<br />
Bündelung und <strong>Zusammenarbeit</strong> von euregionalen Patienten/ Konsumenten<br />
Organisationen<br />
• Verbesserung von Transparenz und Information <strong>im</strong> euregionalen <strong>Gesundheitswesen</strong><br />
a.) Bestandsaufnahme und -analyse von strukturellen, organisatorischen,<br />
gesetzgeberischen, finanziellen Rahmenbedingungen - für einzelne Patienten und<br />
Patientengruppen in Deutschland und den Niederlanden sowie Selbsthilfeinitiativen<br />
b.) Erarbeitung und Veröffentlichung einer zweisprachigen Patienteninformation<br />
• Analyse von Handlungsfeldern und Zielen für Patientenbeteiligung bei der Verbesserung<br />
der euregionalen Gesundheitsversorgung<br />
• Fachliche und infrastrukturelle Unterstützung und Begleitung der anderen Teilprojekte <strong>im</strong><br />
Rahmenprojekt.<br />
Dieses Projekt ist bereits abgeschlossen; eine Weiterführung (so genannte 2. Phase) wird<br />
vorbereitet.<br />
8.4.9 Projekte in Vorbereitung<br />
8.4.9.1 Vorstudie grenzüberschreitender Einkauf<br />
Die Erfahrung der beteiligten Krankenhäuser, die auch auf diversen Beobachtungen beruht,<br />
zeigt, dass es große bis sehr große Preisunterschiede zwischen den Niederlanden und den<br />
in Deutschland gekauften Krankenhausartikeln und –leistungen gibt, ohne dass dafür ein<br />
objektiver Grund vorhanden ist. Da die Kosten <strong>im</strong> <strong>Gesundheitswesen</strong> reduziert werden<br />
sollen, können hier die unterschiedlichen Erfahrungen zur Kostenreduzierung genutzt<br />
werden. So könnte beispielsweise von einem dezentralen Einkaufsverfahren auf zentrales<br />
Einkaufsverfahren umgestellt werden. Insbesondere das St. Radboud Krankenhaus, das St.<br />
Bernhard-Hospital und das Elkerliek Krankenhaus haben bereits bei anderen Projekten<br />
zusammengearbeitet und somit eine gute Ausgangslage. Eine gemeinsame<br />
Versorgungslogistik könnte somit Kosten sparen.<br />
8.4.9.2 Organisatorische Vorgaben der onkologischen Gesundheitsbetreuung für<br />
Brustkrebspatientinnen in der Euregio Rhein-Waal<br />
Die Europäische Integration hat dazu geführt, dass sich in vielerlei Hinsicht die Grenzen<br />
geöffnet haben. In der Gesundheitsfürsorge bleibt diese Entwicklung zurück, so auch in<br />
vielen Euregio-Organisationen. In der Euregio Rijn-Waal ist noch in einem sehr geringen<br />
Ausmaß die <strong>Zusammenarbeit</strong> zwischen Ärzten, Krankenhäusern und<br />
Krankenversicherungen entwickelt, insbesondere, wenn es um die Behandlung von<br />
Patienten mit onkologischen Erkrankungen geht. Grenzüberschreitende <strong>Zusammenarbeit</strong><br />
zwischen Hilfeleistenden, Krankenhäusern und Gesundheitsversicherern kann den Patienten<br />
Vorteile bieten:<br />
• Die Behandlung kann <strong>im</strong> nächst liegenden Krankenhaus durchgeführt werden.<br />
• Die <strong>Zusammenarbeit</strong> zwischen Krankenhäusern kann zu Lehreffekten hinsichtlich<br />
der Organisation von Therapiemaßnahmen führen.<br />
• Die <strong>Zusammenarbeit</strong> in Form von Absprachen über Zuweisungen von Patienten<br />
könnten zu Verkürzungen von Wartelisten führen. Der Austausch von<br />
Fachkenntnissen kann die Qualität von Gesundheitsmaßnahmen steigern. Um die<br />
grenzüberschreitende Mobilität hinsichtlich der Gesundheitsfürsorge für<br />
Krebspatienten zu fördern, möchte man sich zuerst auf beiden Seiten der Grenze<br />
am Inhalt der Gesundheitsmaßnahmen orientieren, die vergleichbar zu sein<br />
scheinen. Da das Mammakarzinom ein häufiger Tumor in dieser Region ist,<br />
wurde es ausgesucht für eine Orientierung hinsichtlich der<br />
Gesundheitsmaßnahmen für Mammakarzinompatienten.<br />
47
Deutsche Sozialversicherung<br />
Observatorium <strong>EUREGIOsocial</strong><br />
Im abgelaufenen Dezenium ist man sich <strong>im</strong> zunehmenden Maße der Notwendigkeit bewusst<br />
geworden, nach evidence-basierenden Richtlinien zu arbeiten. Die große Vielfalt von<br />
Informationen aus wissenschaftlichen Untersuchungen, die dem praktischen Arzt zur<br />
Verfügung steht, macht es ihm bald unmöglich, stets auf Neue zu beurteilen, was die beste<br />
Form der Diagnostik und Behandlung einer festgestellten Krankheit ist. Hinzu kommt noch,<br />
dass Variationen in den Therapiemaßnahmen zu weniger opt<strong>im</strong>alen und weniger<br />
kosteneffektiven Behandlungsmaßnahmen führen. Dies hat zur Entwicklung von evidencebased-Richtlinien<br />
geführt. In diesen Richtlinien werden praxisgerechte Vorgehensweisen<br />
hinsichtlich Diagnostik und Behandlung zusammengefasst, die auf der Basis von<br />
verfügbaren wissenschaftlichen Untersuchungen zusammengetragen wurden. Auch in der<br />
Onkologie sind regionale und/ oder nationale Richtlinien für die häufigst vorkommenden<br />
Tumoren entwickelt worden, so auch für das Mammakarzinom. In diesem Projekt wird die<br />
Richtlinien benutzt, um die Behandlung für Brustkrebspatienten in der Euregio Rijn-Waal zu<br />
vergleichen. Dazu ist es notwendig, Einblick zu erlangen in die Richtlinien auf beiden Seiten<br />
der Grenze, die für die Behandlung von Brustkrebs benutzt werden und über die Faktoren,<br />
die dazu führen, dass die Richtlinien mehr oder weniger befolgt werden.<br />
Ein wichtiger Aspekt, der die Benutzung dieser Richtlinien beeinflusst, ist die Qualität der<br />
Richtlinie. Seit 2001 besteht ein international gültiges Instrument das „Appraisal Guidlines für<br />
Research and Evaluation – Instrument (AGREE-Instrument)“, also die Taxierung von<br />
Richtlinien in Forschung und Auswertung. Dieses Instrument dient zur objektiven<br />
Untersuchung der Qualität von Richtlinien in sechs Bereichen. Beobachtet werden der<br />
Geltungsbereich und Zweck einer Leitlinie, die Beteiligung von Interessengruppen in der<br />
Sichtweise der Richtlinien, die methodologische Exaktheit der Leitlinienentwicklung, die<br />
Klarheit und Gestaltung der Leitlinie, die Anwendbarkeit und die redaktionelle<br />
Unabhängigkeit der Leitlinienentwicklungsgruppe. Dabei möchte man wie folgt vorgehen:<br />
Zuerst soll eine Analyse erstellt werden, welche Richtlinie für die Diagnostik und Behandlung<br />
von brustkrebserkrankten Patienten in der Euregio Rijn-Waal gebraucht werden. Danach soll<br />
die Qualität der meist gebrauchten niederländischen und deutschen Richtlinien für die<br />
Behandlung von brustkrebserkrankten Patienten ausgewertet werden. Hierzu sollen die<br />
Richtlinien durch einen Untersucher, einen medizinischen Spezialisten und einen AGREE-<br />
Experten von beiden Ländern mit der Hilfe des AGREE-Instruments geprüft werden, um<br />
Einsicht in die Qualität der benutzten Richtlinien für brustkrebserkrankte Patienten auf beiden<br />
Seiten der Grenze zu erlangen.<br />
8.4.9.3 Projektüberschreitende wissenschaftliche Begleitung, Evaluation und<br />
Präsentation<br />
Während der gesamten Projektlaufzeit werden die Projekte wissenschaftlich begleitet. Es<br />
werden regelmäßig Zwischenberichte erstellt. Am Ende der Projektlaufzeit findet eine<br />
Abschlussevaluation statt. Anschließend wird ein Endbericht vorgestellt.<br />
Es ist vorgesehen dieses Rahmenprojekt grenzüberschreitende Gesundheitsversorgung<br />
innerhalb der Interreg III-Periode zu verlängern bzw. ein neues Rahmenprojekt auszuführen<br />
bis 31.12.2008.<br />
48
8.5 Rhein-Maas-Nord<br />
Deutsche Sozialversicherung<br />
Observatorium <strong>EUREGIOsocial</strong><br />
Euregio Rhein-Maas-Nord<br />
- ohne Rechtspersönlichkeit -<br />
(Gesamt) 1.800.000 Einwohner<br />
(D) Städte Geldern, Kevelaer,<br />
Krefeld, Mönchengladbach,<br />
Nettetal, kreise Kleve (z.T.), Neuss,<br />
Viersen<br />
1.300.000 Einwohner<br />
(NL) Gewest Midden-L<strong>im</strong>burg und<br />
Gewest Nord-L<strong>im</strong>burg<br />
500.000 Einwohner<br />
49
Euregio Rhein-Maas-Nord<br />
Deutsche Sozialversicherung<br />
Observatorium <strong>EUREGIOsocial</strong><br />
8.5.1 Allgemeines<br />
Geschichtlich betrachtet entspricht die Euregio etwa dem Gebiet, das über Jahrhunderte<br />
unter den Herzögen von Geldern und Jülich sowie den geistlichen Herren der Bistümer Köln<br />
und Lüttich eine politische Einheit darstellte. Daraus ergeben sich kulturelle<br />
Gemeinsamkeiten, die zweifellos auch für die grenzüberschreitende <strong>Zusammenarbeit</strong> <strong>im</strong><br />
<strong>Gesundheitswesen</strong> von Vorteil sind. Durch den Ausbau der grenzüberschreitenden<br />
Verkehrswege (Rheinbrücken) hat sich die Euregio, die geographisch gesehen zwischen den<br />
belgisch/niederländischen Überseehäfen - insbesondere Antwerpen - und dem deutschen<br />
Wirtschaftszentrum Rhein/Ruhr liegt, überproportional entwickelt. Nach Ansicht<br />
maßgeblicher Wirtschaftsfachleute und Landespolitiker Nordrhein-Westfalens wird dies in<br />
Zukunft zu Lasten der großen deutschen Häfen Bremen, Bremerhaven und Hamburg eher<br />
noch zunehmen.<br />
8.5.2 Grenzübergreifende <strong>Zusammenarbeit</strong> Gerontopsychatrie<br />
Dieses Projekt wurde 1997 begonnen und endete <strong>im</strong> Juni 2000. Ziel war es,<br />
grenzüberschreitende Betreuungskonzepte und Versorgungsmodelle zu entwickeln, um die<br />
Betreuung von gerontopsychiatrisch veränderten Menschen in der ambulanten und<br />
stationären Versorgung zu verbessern. Dies wurde durch folgende Maßnahmen erreicht:<br />
Informations- und Erfahrungsaustausch, Information der Öffentlichkeit, Personalaustausch,<br />
Dokumentation und Besichtigung von Projekten, Erforschung der Möglichkeit eines<br />
grenzüberschreitenden Dienstes in der Euregio sowie Planung und Durchführung von<br />
Fachtagungen und Informationsveranstaltungen. Beteiligte Partner waren die Provinz<br />
L<strong>im</strong>burg (NL), die Stadt Mönchengladbach sowie die Kreise Neuss und Viersen (D). Bei<br />
diesem Projekt entstanden intensive Verbindungen, die über die reine Projektzeit hinaus<br />
aktiv geblieben sind.<br />
8.5.3 Kunden und Qualität (ambulante Pflege)<br />
Ebenfalls <strong>im</strong> Zeitraum 1997 bis Juni 2000 lief das Projekt „Kunden und Qualität“. Ziel war es,<br />
Erkenntnisse zu gewinnen, um den Markt von hauswirtschaftlicher Versorgung und Pflege in<br />
der Euregio neu zu gestalten. Die Qualität der Versorgung des Bürgers sollte verbessert<br />
wreden. In den Niederlanden ist die „Subvention personengebundenes Budget“ Bestandteil<br />
der Sicherung bei Pflegebedürftigkeit. In Deutschland greifen Leistungen der<br />
Pflegeversicherung. Die Studie führte eine vergleichende Untersuchung von Gesetzen,<br />
Regelungen und deren Ausführungsbest<strong>im</strong>mungen durch sowie eine Befragung von<br />
Pflegebedürftigen, um Bedürfnisse und Nutzungen von Dienstleistungen zu untersuchen.<br />
Darüber hinaus fand eine Befragung von Anbietern statt, um Änderungen, neue<br />
Möglichkeiten und Beschränkungen auf dem Markt zu prüfen. Es erfolgte eine<br />
Zusammenfassung der Ergebnisse, aus denen sich konkrete Maßnahmenvorschläge und<br />
Empfehlungen ergaben. Beteiligt waren die Stadt Mönchengladbach (D), die Gemeinden<br />
Roermond und Weert (beide NL), Krankenversicherer bzw. Pflegekassen beider Länder<br />
sowie deutsche und niederländische Organisationen, die fachlich betroffen waren und auch<br />
heute noch sind (Wohlfahrtsverbände, Selbsthilfegruppen etc.). Nach Rücksprache mit dem<br />
Geschäftsführer Herrn Wallrafen-Dreisow (Altenhe<strong>im</strong>e der Stadt Mönchengladbach GmbH)<br />
war die Studie Anlass, die personenbezogene Budgetierung in die Gesetzgebung<br />
aufzunehmen und ein Pilotprojekt in <strong>Zusammenarbeit</strong> mit den Pflegekassen und dem<br />
Bundesministerium für Gesundheit und Soziales zu gestalten.<br />
50
8.5.4 Arztbesuch <strong>im</strong> Nachbarland<br />
Deutsche Sozialversicherung<br />
Observatorium <strong>EUREGIOsocial</strong><br />
8.5.4.1 Chipkarte garantiert ganzheitliche Versorgung über die Grenze<br />
Eine ärztliche Behandlung <strong>im</strong> Nachbarland gehört noch längst nicht zur Normalität. Viele<br />
Betroffene ziehen einen Arztbesuch <strong>im</strong> Nachbarland gar nicht erst in Erwägung, da sie das<br />
umständliche Verfahren, Wege zur Krankenkasse, komplizierte Formulare und langwierige<br />
Genehmigungsverfahren scheuen. Dank einer Kooperation zwischen der AOK Rheinland<br />
und der niederländischen CZ Actief in Gezondheid, Ärzten, Krankenhäusern und Apothekern<br />
in der Euregio Rhein-Maas-Nord gehört das Problem für die Versicherten dieser<br />
Krankenkassen der Vergangenheit an. Mit einer Chipkarte – der sogenannten<br />
GesundheitsCard oder Zorgpas – können Patienten jeden beliebigen Spezialisten <strong>im</strong><br />
Nachbarland aufsuchen.<br />
8.5.4.2 Arztbesuch <strong>im</strong> Nachbarland: Einfach und unbürokratisch<br />
Mit der euregionalen GesundheitsCard ist nicht nur das Gesundheitssystem <strong>im</strong> Grenzland<br />
durchlässiger geworden. Freiräume für eine Behandlung <strong>im</strong> Nachbarland wurden<br />
geschaffen. Anstatt vor jeder Behandlung die Krankenversicherung aufzusuchen und die<br />
Genehmigung für die folgende Behandlung zu erfragen, brauchen Patienten die<br />
GesundheitsCard lediglich einmal zu beantragen. Diese ist anschließend zwei Jahre lang<br />
gültig. Die Versicherten wenden sich an die Geschäftsstellen der AOK Rheinland und der CZ<br />
Actief in Gezondheid. Hier bekommt man auch eine Liste von allen Ärzten und<br />
Krankenkassen, die man besuchen kann. Alle Ärzte und Krankenhäuser in der euregio sind<br />
involviert. Die große Zahl der Patienten zeigt ein wachsendes Interesse an Leistungen <strong>im</strong><br />
Nachbarland.<br />
8.5.4.3 Mobilitätstrend weist Richtung Deutschland<br />
Insbesondere Niederländer profitieren von den offenen Türen zum deutschen<br />
Gesundheitssystem. Wochen- und monatelange Wartezeiten auf die Behandlung <strong>im</strong><br />
Krankenhaus oder bei Fachärzten gehören <strong>im</strong> Nachbarland nämlich zum Alltag. Kein<br />
Wunder also, dass bereits um die 900 Patienten aus den Städten und Gemeinden von Nord-<br />
und Mittel-L<strong>im</strong>burg die GesundheitsCard beantragt haben. Besonders viele Anfragen kamen<br />
aus den Gemeinden Roermond, Venlo, Weert, Venray, Posterholt und Echt-Susteren. Auf<br />
deutscher Seite haben ca. 200 Patienten aus dem Kreis Mönchengladbach, Krefeld und<br />
Neuss die Gesundheitscard erhalten. Ursachen der ungleichen Mobilitätstendenz sind die<br />
Wartelisten in den niederländischen Krankenhäusern.<br />
8.5.4.4 Patienten fühlen sich gut aufgehoben<br />
Grundsätzlich sind alle ärztlichen Leistungen mit der Chipkarte abgedeckt, bis auf die<br />
zahnärztliche Versorgung. „Aus den Niederlanden kommen besonders viele Patienten, um<br />
sich augenärztlicher, orthopädischer und gynäkologischer Behandlungen und Operationen<br />
zu unterziehen. Gerade in diesen Bereichen sind niederländische Fachärzte und<br />
Spezialisten überlastet“ – erklärt Hans-Willi Schemken von der AOK-Rheinland, Koordinator<br />
des euregionalen Gesundheitsforums. „Durch den Einsatz der Gesundheitskarte konnte der<br />
Arztbesuch <strong>im</strong> Nachbarland sowie die Behandlung in den grenznahen Krankenhäusern<br />
bereits jetzt deutlich vereinfacht werden.“ – so John Stevens von der CZ. Deutsche Patienten<br />
suchen in erster Linie das nahegelegene Krankenhaus in Roermond auf.<br />
51
Deutsche Sozialversicherung<br />
Observatorium <strong>EUREGIOsocial</strong><br />
8.5.4.5 Euregio stellt Gesundheitsversorgung ohne Grenzen unter Beweis<br />
Die Projekte der deutsch-niederländischen euregios Maas-Rhein, rhein-maas-nord und<br />
Rhein-Waal sind Modelle der europäischen Gesundheitsversorgung vor dem Hintergrund der<br />
künftigen Vernetzung von EU-Krankenversicherungskarten. Die Modellprojekte der drei<br />
euregios, finanziert aus dem INTERREG-IIIA-Programm der EU, wurden während des ersten<br />
European Health Care Congress (22. - 24. November 2004) in Düsseldorf als Best-Practice-<br />
Beispiele vorgestellt. Als nächster Schritt <strong>im</strong> Projekt ist ein euregionales Gesundheitsportal<br />
geplant. Hier werden Patienten online nach einem Spezialisten <strong>im</strong> Nachbarland suchen<br />
können. Das Portal ist <strong>im</strong> Frühjahr 2005 eröffnet worden.<br />
52
8.6 Euregio Maas-Rhein<br />
Deutsche Sozialversicherung<br />
Observatorium <strong>EUREGIOsocial</strong><br />
Euregio Maas-Rhein<br />
(NL) Stichting/ Stiftung nach<br />
nationalem Recht<br />
(Gesamt) 3.793.903 Einwohner<br />
(D) Region Aachen 1.245.379 Einwohner<br />
(B) Provinz Lüttich 1.016.762 Einwohner<br />
(B) Provinz L<strong>im</strong>burg 783.927 Einwohner<br />
(NL) Provinz L<strong>im</strong>burg 747.835 Einwohner<br />
(B) Deutschsprachige Gemeinschaft<br />
70.119 Einwohner<br />
53
Euregio Maas-Rhein<br />
Deutsche Sozialversicherung<br />
Observatorium <strong>EUREGIOsocial</strong><br />
8.6.1 Allgemeines<br />
Die Euregio Maas-Rhein war einer der ersten Euregios und wurde 1976 gegründet. Sie<br />
besteht aus 5 Regionen: der Provinz L<strong>im</strong>burg in Belgien und in den Niederlanden, der<br />
Provinz Lüttich, der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens, der Provinz Aachen. Sie ist<br />
administrativ klar strukturiert. Der Vorstand hat eine jährlich wechselnde Präsidentschaft.<br />
Darüber hinaus hat die Euregio einen Rat, der aus 2 Kammern besteht. Die 1. Kammer ist<br />
mit Repräsentanten aus den Verwaltungen und den Parlamenten besetzt. Die 2. Kammer<br />
setzt sich zusammen aus Sachverständigen der verschiedenen relevanten Bereiche (z.B.<br />
der Beschäftigungspolitik, <strong>Gesundheitswesen</strong>, Erziehung und Universitäten). Mit ihren 5<br />
Regionen ist die Euregio wesentlich umfassender als andere Euregios, die häufig nur<br />
bilaterale Kooperationen haben.<br />
Diese Euregio zeichnet sich besonders dadurch aus, dass ein hohes Maß an<br />
Gegenseitigkeit, d.h. möglichst „ausgewogenen“ Möglichkeiten der Inanspruchnahme von<br />
Gesundheitsleistungen in beteiligten Ländern, erreicht werden kann. So sind in den<br />
städtischen Zentren Maastricht (NL) und Aachen (D), die selbst nicht direkte Grenznachbarn<br />
sind, hochqualifizierte Versorgungskapazitäten (Kliniken) vorhanden, die jeweils eher<br />
ländliche Einzugsgebiete auf der anderen Grenzseite haben. Man ist deshalb allgemein<br />
daran interessiert, zu einer <strong>Zusammenarbeit</strong> zu kommen, wobei auch die kulturellen<br />
Gemeinsamkeiten sehr groß sind. Besonderer Erwähnung wert sind die Aktivitäten der AOK<br />
Rheinland, die <strong>im</strong> Interesse ihrer Versicherten und als <strong>im</strong> Wettbewerb stehender<br />
Krankenversicherer stets mit innovativen und serviceorientierten Maßnahmen die<br />
euregionale <strong>Zusammenarbeit</strong> <strong>im</strong> <strong>Gesundheitswesen</strong> fördert und mitgestaltet: dies macht<br />
einen wesentlichen Anteil daran aus, dass diese Euregio, die allgemein anerkannt und<br />
nachweislich positivste Bilanz <strong>im</strong> Rahmen dieser Ausarbeitung vorlegen kann.<br />
Umfangreiche Informationen zu Krankenhauskooperationen wurden in der Broschüre<br />
„Hospital co-operation in border regions in Europe“ von Hope veröffentlicht 5 .<br />
8.6.2 Grenzüberschreitende Gesundheitsversorgung Euregio-Sonderausschuss<br />
Anfang 1994 wurde ein Euregio-Sonderausschuss für die grenzüberschreitende<br />
Gesundheitsversorgung gebildet. Der Auftrag lautete, diesbezügliche Empfehlungen zu<br />
erarbeiten. Als erster deutscher Krankenversicherer war ab Juni 1994 die AOK Rheinland<br />
beteiligt. Verschiedene Projektgruppen erarbeiteten Vorschläge, die seit 1997 unter dem<br />
gemeinsamen Programmnamen „Grenzüberschreitendes Projekt in der Euregio Maas-Rhein<br />
mit der Perspektive eines freieren Zugangs für Behandlungsbedürftige zur Versorgung und<br />
zu Einrichtungen <strong>im</strong> Gesundheitsbereich des Grenzgebiets“ zusammengefasst und von<br />
einem Lenkungsausschuss begleitet werden. Nachfolgend werden Projekte dieses<br />
Programms vorgestellt, die zum Teil seit mehreren Jahren bestehen.<br />
8.6.3 Kooperation der Universitätskliniken<br />
Keine der drei Universitätskliniken in der Euregion Maas-Rhein wird langfristig in der Lage<br />
sein, auf allen Gebieten der Spitzen Medizin die neuesten Technologien vorzuhalten.<br />
Deshalb haben sich die Kliniken aus Effizienzgründen spezialisiert. Aachen ist spezialisiert<br />
für Kinderherzchirurgie, während Maastricht für Elektrost<strong>im</strong>ulationen der Blasen und<br />
Knochenmarkstransplantationen empfohlen wurde. Eine wachsende Anzahl an<br />
medizinischen Unterrichtsfächern hat ein euregionales Netzwerk entstehen lassen, das in<br />
Liège, Maastricht und Aachen regelmäßig zum wissenschaftlichen Austausch tagt.<br />
5 Philippe Harant: „Hospital co-operation in border regions in Europe“, www.a<strong>im</strong>mutual.org/docs/Ljubljana/abstract_orateurs/harant.ppt,<br />
stand 7.November 2003; weiter Informationen<br />
www.epha.org<br />
54
Deutsche Sozialversicherung<br />
Observatorium <strong>EUREGIOsocial</strong><br />
8.6.4 Onkologische Kooperation CONCERT (Co-operation in Oncological Education<br />
Research and Treatment)<br />
Eine weitere Kooperation der Kliniken gibt es <strong>im</strong> Bereich der Onkologie. Das<br />
Universitätsklinikum Aachen hat ein Projekt zum Brust-screening entwickelt. Das Centre der<br />
Universitätshospitäler in Liège hat eine euregionale Tumor – Gewebebank erstellt. Das<br />
„Academisch Ziehkenhuis Maastricht“ wird eine euregionale „Teledetermato-onkology“<br />
aufbauen, die es den medizinischen Spezialisten erlaubt, die Erfahrungen der benachbarten<br />
Länder bei der Diagnose und Behandlung von Hautkrebs zu nutzen.<br />
8.6.5 Kooperationen der Kliniken bei Stoffwechselkrankheiten<br />
Bei den Stoffwechselkrankheiten gibt es eine Kooperation zwischen 5 Kliniken. Dem<br />
„Academisch ziekenhuis Maastricht“, dem Biomedisch „Onderszoeksinstituut – Biomed“<br />
Universitären Campus in Diepenbeek, dem „Centre Hospitalier Universitaire Liège“, dem<br />
Universitätsklinikum Aachen und dem Clinique St. Joseph in Liège. In einer ersten Phase<br />
präsentieren die Kliniken ihre Kapazitäten, ihr Expertenwissen und Forschungsinteressen. In<br />
der zweiten Phase beobachten die Zentren, ob und wie ihre Kooperationen zu einer<br />
wissenschaftlichen Synergie und zu einem ergänzenden Angebot ihrer bereits hoch<br />
spezialisierten Diagnostik und Fachkompetenz beitragen können. Dies dient der<br />
Unterstützung aller Patienten in der Euregio.<br />
8.6.6 Traumatologie<br />
Dieses Projekt ist in vier verschiedene Teile unterteilt. So erstellt die Projektgruppe der<br />
Krankenhäuser und Krankenversicherer eine Bestandsaufnahme, welche vorhandenen<br />
Krankentransportdienste aus Sicht der Notfallaufnahmen für schwerverletzte Unfallpatienten<br />
zur Verfügung stehen. Weiter ermittelt die Projektgruppe Krankenhäuser, welche<br />
Einrichtungen für die stationäre Behandlung best<strong>im</strong>mter Arten von Verletzungen pr<strong>im</strong>är in<br />
Frage kommen (Strukturierung der Traumaversorgung). Außerdem gibt es zwei Projekte, mit<br />
denen die <strong>Zusammenarbeit</strong> und Verantwortlichkeiten der Behörden und Gesundheitsdienste<br />
<strong>im</strong> Falle von großen Unfällen und Katastrophen aufeinander abgest<strong>im</strong>mt und auch<br />
praxisgerecht getestet wird (Rettungs- und Katastrophenübungen). Insgesamt gibt es auch<br />
die Zielvorstellung, verbindliche Vereinbarungen zwischen Kostenträgern und<br />
Leistungsanbietern zu treffen.<br />
8.6.7 GesundheitsCard international<br />
Die AOK Rheinland und die CZ Groep bieten den Versicherten in der Euregio Maas-Rhein<br />
mit der „GesundheitsCard international“ ein erweitertes Angebot grenzüberschreitender<br />
Gesundheitsversorgung. Zu diesen Leistungen zählen die allgemeine fachärztliche<br />
Behandlung, Arzne<strong>im</strong>ittel und stationäre Behandlung. Darüber hinaus werden mit<br />
zusätzlichen Genehmigungen Heil- und Hilfsmittel sowie Leistungen der Spitzenversorgung<br />
möglich. Zu dem Leistungsangebot dieses Modellprojektes zählt nicht die zahnmedizinische<br />
Versorgung.<br />
Die Versicherten können einen Antrag stellen auf die „GesundheitsCard international“ in<br />
allen Geschäftsstellen der AOK Rheinland und der CZ Groep. In wenigen Tagen erhalten sie<br />
die Card, mit der sie unkompliziert den Facharzt <strong>im</strong> Nachbarland aufsuchen können.<br />
Die „GesundheitsCard international“ ist eine Fortentwicklung des von den niederländischen<br />
Krankenversicherern CZ groep Zorgverzekeringen und Zorgverzekeraar 1997 initiierte und<br />
vom niederländischen Gesundheitsministerium geförderte Projekt, sowie das Anfang 1998<br />
eingesetzte deutsche Projekt „Vereinfachte Verfahren der Leistungsbewilligung der<br />
Leistungsinanspruchnahme und der Abrechnung“ (VLA) um grenzüberschreitende<br />
Gesundheitsmaßnahmen bedarfsgerecht zu gestalten.<br />
55
Deutsche Sozialversicherung<br />
Observatorium <strong>EUREGIOsocial</strong><br />
8.6.8 Dialysebehandlung<br />
Nach Meinung der niederländischen Krankenversicherer gibt es auf der niederländischen<br />
Seite zu wenig Dialyseeinrichtungen, zugleich hörte man dort von Überkapazitäten in<br />
Deutschland und Belgien. Das Beratungszentrum für Behandlungseinrichtungen in Utrecht<br />
(NL) ist beauftragt worden, eine diesbezügliche Studie zu erstellen, die Bedarf und<br />
Kapazitäten in der Euregio aufzeigen soll.<br />
8.6.9 Zorg Nabij (ZONA)<br />
Dieses Projekt ist für best<strong>im</strong>mte Patientengruppen eingerichtet worden, für die ein<br />
schematisiertes, gesichertes Verfahren in Bezug auf die Inanspruchnahme<br />
grenzüberschreitender medizinischer Behandlung und die „verwaltungstechnische<br />
Abwicklung“ vereinbart werden könnte, einschließlich der Zust<strong>im</strong>mung des Kostenträgers.<br />
Beispielsweise können in der Maastrichter Klinik bei Kindern keine herzchirurgischen<br />
Eingriffe vorgenommen werden; diese zirka 60 Fälle pro Jahr müssten in das 200 Kilometer<br />
entfernte Utrecht überwiesen werden. Es bietet sich daher an, die Behandlung in der<br />
Hochschulklinik in Aachen (30 Kilometer) durchzuführen. Für einen solchen speziellen Fall<br />
entwickelt ZONA einen Verfahrensweg und Vereinbarungen aller beteiligten Behandler und<br />
Kostenträger.<br />
8.6.10 Hörgeräte<br />
Der Markt für Hörgeräte und Zubehör ist in den EU-Staaten unterschiedlich entwickelt, d. h.<br />
auch das Preisniveau unterscheidet sich erheblich. Das Projekt beinhaltet eine euregionale<br />
Bestandsaufnahme über die zugelassenen Betriebe, Ausbildung der Mitarbeiter, angebotene<br />
Gerätetypen einschließlich Qualitäten und Preise sowie Abrechnungsverfahren. Es sollen die<br />
Möglichkeiten der Gestaltung der grenzüberschreitenden Versorgung von Hörgeräten<br />
aufgezeigt werden, was zu einer Erhöhung der Effektivität und damit möglicherweise zu<br />
Kostensenkungen führen kann.<br />
8.6.11 Eurecard – Mobilität und Akzeptanz für Menschen mit Behinderung<br />
Grenzen dürfen nicht ausgrenzen – diese Forderung ist deshalb auch Ziel einer<br />
grenzüberschreitenden Initiative für mehr Mobilität und Akzeptanz für Menschen mit<br />
Behinderung. Hierzu haben die für die Behindertenpolitik zuständigen Verantwortlichen aus<br />
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Niederländisch-L<strong>im</strong>burg, der Deutschsprachigen<br />
Gemeinschaft Belgiens sowie der Flämischen und Wallonischen Region Belgiens bereits<br />
1999 erste Initiative ergriffen. In zahlreichen Gesprächen wurde ein Modellprojekt entwickelt,<br />
das ein selbstbest<strong>im</strong>mtes Leben und die selbständige Teilnahme von Menschen mit<br />
Behinderung am gesellschaftlichen Leben auch grenzenlos ermöglichen soll. Ziel des<br />
Projektes ist, dass Vergünstigungen auf freiwilliger Basis für Menschen mit Behinderung<br />
länderübergreifend Gültigkeit haben sollen. Die Gesetzgebung hierzu auf europäischer<br />
Ebene ist oft sehr langwierig; bürgerorientierte Aktivitäten auf regional begrenztem Raum<br />
helfen oft schneller weiter. Deshalb haben sich die beteiligten Regionen auf das Projekt<br />
"EURECARD" verständigt. Das Projekt kann dann auch für weiter gehende Maßnahmen <strong>im</strong><br />
europäischen Kontext beispielhaft sein. Die beteiligten Partner hoffen jedenfalls, dass dieses<br />
Projekt auch zur Motivation und Akzeptanzsteigerung bei den Betroffenen und Anbietern von<br />
Vergünstigungen beiträgt. www.eurecard.com<br />
56
Deutsche Sozialversicherung<br />
Observatorium <strong>EUREGIOsocial</strong><br />
8.6.12 Grenzüberschreitender Rettungsdienst<br />
In diesem Projekt werden in den Ländern Belgien, Deutschland und Niederlande der<br />
grenzüberschreitende Rettungsdienst koordiniert. Naturgemäß treten Notfallsituationen<br />
unabhängig von Grenzen ein und der nächstgelegene Rettungsdienst und andere<br />
Notfallversorgungen liegen nicht <strong>im</strong>mer in dem Mitgliedstaat, in dem die Notfallsituation<br />
entstanden ist. In diesem Projekt haben sich die lokalen, regionalen und mitgliedstaatlichen<br />
Verwaltungen, die für den Rettungsdienst verantwortlich sind, zusammengeschlossen und<br />
Vereinbarungen mit den Versicherern, Hospitälern und anderen Partnern getroffen, um einen<br />
effektiven und effizienten grenzüberschreitenden Rettungsdienst in ihrer Euregio zu<br />
gewährleisten.<br />
57
Deutsche Sozialversicherung<br />
Observatorium <strong>EUREGIOsocial</strong><br />
8.7 Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens<br />
Deutschsprachige Gemeinschaft<br />
Belgiens<br />
(B) Autonome Gemeinschaft gemäß<br />
Verfassung<br />
(Gesamt) 70.000 Einwohner<br />
(B) Eupener Land<br />
mit den Gemeinden Eupen, Kelmis,<br />
Lontzen und Raeren<br />
(B) Belgische Eifel<br />
mit den Gemeinden Amel, Büllingen,<br />
Burg-Reuland<br />
Bütgenbach und St. Vith<br />
58
Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens<br />
Deutsche Sozialversicherung<br />
Observatorium <strong>EUREGIOsocial</strong><br />
8.7.1 Allgemeines<br />
Das Königreich Belgien ist ein Bundesstaat, der drei autonome Gemeinschaften, drei<br />
Regionen und vier Sprachgebiete umfasst. Die drei Gemeinschaften sind die Flämische<br />
Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft und als kleinster Bestandteil des Staates die<br />
Deutschsprachige Gemeinschaft. Letztere verfügt ebenso wie die beiden großen<br />
Gemeinschaften über politische Eigenständigkeit. Ab 1815 (Wiener Kongress) gehörten das<br />
Eupener Land, die Eifel und ein Teil der ehemaligen Abtei Stavelot-Malmedy als Kreise<br />
Eupen und Malmedy zur Rheinprovinz des Königreiches Preußen bzw. zum Deutschen<br />
Reich. Durch den Vertrag von Versailles ist seit 1919 das Territorium der Deutschsprachigen<br />
Gemeinschaft zusammen mit den wallonischen Gemeinden des Raumes Malmedy Belgien<br />
angegliedert. Im Mai 1940 wurde Eupen-Malmedy nach dem Einmarsch deutscher Truppen<br />
zum deutschen Reichsgebiet erklärt. Diese Phase endete fünf Jahre später mit der<br />
bedingungslosen Kapitulation des Deutschen Reiches; die Region wird seitdem wieder von<br />
Belgien verwaltet. Seit Mitte der 60er Jahre bis 1994 hat Belgien vier große Staatsreformen<br />
durchgeführt, mit denen die föderale Struktur des Bundesstaates und die Autonomie seiner<br />
drei Gemeinschaften weiterentwickelt wurden. Amts-, Schul- und Gerichtssprache ist neben<br />
dem Flämisch und Französisch auch Deutsch. Die Mehrsprachigkeit der Bevölkerung<br />
befördert die Bereitschaft, grenzüberschreitend aktiv zu werden. Praktisch jeder zehnte<br />
Beschäftigte findet Arbeit außerhalb der Deutschsprachigen Gemeinschaft, was aber auch<br />
eine Abwanderung von qualifizierten Fachkräften nach sich zieht. Die Arbeitslosenquote lag<br />
<strong>im</strong> Jahr 2003 bei 6,4 Prozent. Der belgische Landesdurchschnitt lag <strong>im</strong> gleichen Zeitraum bei<br />
12,1 Prozent. Seit 1990 stieg die Bevölkerungszahl um 7,3 Prozent und man zählt mehr<br />
Beschäftigte, Arbeitgeber und Selbständige. Diese erfreulichen Werte sprechen für die<br />
Attraktivität des Wirtschaftraumes und seine Lebensqualität. Legislativorgan ist das<br />
Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft. Es besteht aus 25 direkt gewählten<br />
Mitgliedern, wobei die Wahl zeitgleich mit den Wahlen zum Europaparlament erfolgt. Es<br />
beschließt die Kraft seiner Kompetenz zu erlassenen Dekrete, die <strong>im</strong> deutschen<br />
Sprachgebiet Gesetzeskraft besitzen. Exekutivorgan ist die Regierung der<br />
Deutschsprachigen Gemeinschaft, die in Anwendung der Dekrete Erlasse ausgibt, alle<br />
notwendigen Einzelentscheidungen trifft sowie die tägliche Politik führt. Diese vom Parlament<br />
ebenfalls für fünf Jahre gewählte Regierung besteht aus vier Ministern, wobei einer zugleich<br />
auch Ministerpräsident ist. Jeder Minister wird von einem Beraterstab, seinem Kabinett,<br />
unterstützt. Der Regierung steht für die Durchführung ihrer Aufgaben eine<br />
Verwaltungsbehörde, das Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft, zur Verfügung.<br />
8.7.2 <strong>Gesundheitswesen</strong><br />
Die Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens ist aktives Mitglied der Euregionen Maas-<br />
Rhein (alle Gebietsteile) und SaarLorLux (nur mit dem Gebiet „Belgische Eifel“), weshalb<br />
bezüglich der bereits bestehenden gemeinsamen Aktivitäten auf die Kapitel 7.6 und 7.8<br />
verwiesen werden kann. Es seien jedoch an dieser Stelle besonders die Punkte genannt, für<br />
die aus spezieller Sicht der Deutschsprachigen Gemeinschaft Handlungsbedarf besteht, der<br />
durch euregionale <strong>Zusammenarbeit</strong> sowohl in der Beantwortung der Nachfrage als auch in<br />
qualitativer Hinsicht ein Mehrwert darstellen würde:<br />
• Grenzüberschreitende Leistungsinanspruchnahme orientiert an den Bedürfnissen der<br />
Grenzbevölkerung und <strong>im</strong> Rahmen einer einfachen Verfahrensgestaltung;<br />
• Harmonisierung der Übermittlung von Daten bei Krankenhäusern, die auf schriftlicher<br />
Basis Vereinbarungen zur Kooperation haben (unter Berücksichtigung des<br />
Datenschutzes);<br />
59
Deutsche Sozialversicherung<br />
Observatorium <strong>EUREGIOsocial</strong><br />
• Nutzung <strong>im</strong> gemeinsamen Interesse von vorhandenen Versorgungsmöglichkeiten und<br />
Steigerung der Wirtschaftlichkeit und Effizienz der Leistungsanbieter;<br />
• Untersuchung und Vergleich der Versorgungsqualität aufgrund gemeinsamer Kriterien<br />
zur Messung des Zufriedenheitsgrades der stationär aufgenommenen Patienten bei<br />
gleichzeitiger Kooperation der Krankenhäuser;<br />
• Ausschöpfung preiswerter Leistungsangebote grenzüberschreitend in Teilbereichen, wie<br />
Hilfsmitteln;<br />
• <strong>Euregionale</strong> Kooperation in der qualitätsgesicherten Altenpflege und<br />
• <strong>Euregionale</strong> Gesundheitsberichterstattung.<br />
In Verbindung mit den zunehmend auftretenden Erkrankungen aufgrund von<br />
Umwelteinflüssen macht es Sinn, grenzüberschreitend Verfahren und Analysen zu<br />
entwickeln, die die Kausalität erfassen sowie entsprechende präventive Maßnahmen zu<br />
entwickeln. Dieses Wissen kann auf ambulanter Ebene, speziell bei der Beratung von<br />
Wohnungsanpassungs- bzw. Neuplanungen von kollektiv und individuellen Infrastrukturen<br />
relevant sein. Die Planung, Begleitung und Bewertung könnte auf Euregio-Ebene erfolgen.<br />
Die Erkenntnisse darüber könnten <strong>im</strong> Euregio-Rat unmittelbar an die Teilregionen<br />
weitergeleitet werden. Des Weiteren möchte man zu gesundheitsfördernden Modellprojekten<br />
kommen, die durch Universitäten begleitet und evaluiert würden, und zwar unter<br />
Berücksichtigung unterschiedlicher kultureller und sprachlicher Faktoren. Solche Projekte<br />
eignen sich besonders für den Schulbereich - ebenso könnten damit die interkulturellen<br />
Kontakte gefördert werden, die sowohl die sprachliche, die lebensstilgeprägte als auch die<br />
gesundheitliche Ebene fördernd mitberücksichtigen.<br />
8.7.3 ArGe „<strong>Zusammenarbeit</strong> <strong>im</strong> <strong>Gesundheitswesen</strong>“<br />
Die ArGe „<strong>Zusammenarbeit</strong> <strong>im</strong> <strong>Gesundheitswesen</strong>“ traf sich bisher zu den Themen:<br />
<strong>Zusammenarbeit</strong> in der Pr<strong>im</strong>ärprävention <strong>im</strong> Hinblick auf Seuchenhygiene; gegenseitige<br />
Informationen bei akuten grenzübergreifenden seuchenhygienischen Maßnahmen sowie die<br />
<strong>Zusammenarbeit</strong> <strong>im</strong> Umweltschutz, zum Beispiel bei der Planung oder sonstigen<br />
Maßnahmen, die die gesundheitlichen Belange der Bevölkerung <strong>im</strong> Wesentlichen berühren.<br />
Die ArGe möchte sich künftig auch der Akutversorgung von Patienten widmen.<br />
Zweijährlich findet eine euregionale Gesundheitskonferenz statt, die von dieser AG konzipiert<br />
und organisiert wird.<br />
8.7.4 <strong>Zusammenarbeit</strong> <strong>im</strong> stationären Bereich<br />
Eine konkrete <strong>Zusammenarbeit</strong> wird zwischen dem Krankenhaus St. Josef in Prüm (D) und<br />
der St. Josef-Klinik in St. Vith (B) praktiziert. Seit mehreren Jahren fährt das Krankenhaus in<br />
Prüm stationäre Patienten nach St. Vith zu computer-tomographischen Untersuchungen. Die<br />
Kooperation wird von allen Beteiligten als vorteilhaft bezeichnet. Die <strong>Zusammenarbeit</strong><br />
zwischen beiden Einrichtungen wurde 1998 intensiviert, insbesondere <strong>im</strong> Bereich der<br />
Pflegedienstleistung. Gemeinsame Projekte sind in Planung. 1999 fand man Ansätze zur<br />
<strong>Zusammenarbeit</strong> <strong>im</strong> Informatikbereich, Standards sollen angepasst werden.<br />
Weitere <strong>Zusammenarbeit</strong> ist geplant <strong>im</strong> Bereich der grenzüberschreitenden notärztlichen<br />
Versorgung.<br />
60
8.8 EuRegio SaarLorLuxRhein<br />
Deutsche Sozialversicherung<br />
Observatorium <strong>EUREGIOsocial</strong><br />
Euregio Saar LorLuxRhein<br />
(L) Eingetragener Verein nach nationalem<br />
Vereinsrecht<br />
(Gesamt) 5.200.000 Einwohner<br />
(D) Saarland, Regionen Trier, Westpfalz und Kreis Birkenfeld<br />
(B) Provinz Luxemburg und<br />
Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens (z.T)<br />
(F) Arrondissements Meurthe-et-Moselle,<br />
Meuse, Moselle und Vosges<br />
(L) Großherzogtum Luxemburg<br />
61
EuRegio SaarLorLuxRhein<br />
Deutsche Sozialversicherung<br />
Observatorium <strong>EUREGIOsocial</strong><br />
8.8 Allgemeines<br />
Viermal innerhalb von nur 40 Jahren erlebte das Land an der Saar einen Wechsel seiner<br />
territorialen Zugehörigkeit, was zumeist mit Kriegshandlungen einherging. Für die Menschen<br />
war dies mit erheblichen Einschränkungen verbunden, die bis hinein ins private, tägliche<br />
Leben reichte. Es waren diese ganz konkreten Erfahrungen, die dazu führten, dass<br />
besonders hier europapolitische Zielvorstellungen diskutiert und mit Engagement die<br />
Entwicklung freundschaftlicher Beziehungen zwischen Deutschland und Frankreich<br />
vorangetrieben wurde. Die Region vereint romanische und germanische Kultur. Ferner ist sie<br />
mit früher einseitig auf Bergbau, Eisen- und Stahl ausgerichteteten Industrie in besonderer<br />
Weise vom notwendigen wirtschaftlichen Strukturwandel der letzten Jahrzente betroffen.<br />
Bereits vor 50 Jahren wurde die Universität des Saarlandes, eine französische Gründung,<br />
auf das gemeinsame Europa ausgerichtet. Der kontinuierliche Ausbau der<br />
grenzüberschreitenden Kontakte führte zu vielfältigen und transregionalen und<br />
transnationalen Aktivitäten. Heute gibt es eine Vielzahl von stabilen Kooperationen auf allen<br />
Ebenen und Fachgebieten. Anzumerken ist auch, dass sich in dieser Euregio die höchste<br />
Quote von Grenzgängern findet; des Weiteren sind die Bürger wohnsiedlungsmobil und<br />
Unternehmen aktiv in Bezug auf grenzüberschreitende Niederlassungen.<br />
8.8.1 Ärztetagungen<br />
1998 trafen sich mehr als 100 Fachbesucher aus der Euregio <strong>im</strong> „Hôpital Neuropsychatrique<br />
de l’État“ in Ettelbrück, um über das Thema „Systemisches Arbeiten in der psychiatrischen<br />
Institution“ Vorträge zu hören, zu diskutieren und grenzüberschreitend Erfahrungen<br />
auszutauschen. Ebenfalls 1998 trafen sich bereits zum vierten Mal Hals-, Nasen- und<br />
Ohrengebietsärzte (HNO), diesmal organisiert von der Luxemburger HNO-Ärztegesellschaft,<br />
die als Referenten namhafte internationale Experten gewinnen konnte. Das Hauptthema<br />
bezog sich auf die praxisorientierte Schwindel-Diagnostik und -Therapie.<br />
8.8.2 Gemeinsame Beratungsstellen von Krankenkassen<br />
Die Marktführer der gesetzlichen Krankenversicherung in der Euregio, die deutsche AOK <strong>im</strong><br />
Saarland und die französische Krankenkasse Caisse Pr<strong>im</strong>aire d’ Assurance Maladie<br />
(CPAM), unterhalten zwei gemeinsame Beratungsstellen in Frankreich. Die erste wurde<br />
1995 in Saargemünd eingerichtet, worauf wegen des guten Erfolges eine zweite 1997 in<br />
Forbach folgte. Insgesamt werden 23.000 Grenzgänger betreut.<br />
8.8.3 Gegenseitige Versorgung mit Blutprodukten<br />
Am 1. Dezember 1997 ereignete sich der bisher schwerste Eisenbahnunfall in Luxemburg,<br />
der nahezu 100 Verletzte forderte. Der entsprechend hohe akute Bedarf an Blutkonserven<br />
konnte nicht aus Luxemburg gedeckt werden. Dank schnellen Handelns kam jedoch Hilfe<br />
aus dem französischen Nancy. Aus dieser Erfahrung heraus wurde 1998 ein Abkommen<br />
zwischen dem Luxemburger Roten Kreuz und dem lothringischen Etablissement de<br />
transfusion sanguine geschlossen, das die gegenseitige Versorgung mit Blutprodukten <strong>im</strong><br />
Katastrophenfall (Naturereignisse, Verkehrsunfälle) nunmehr auf vertraglicher Grundlage<br />
regelt.<br />
62
Deutsche Sozialversicherung<br />
Observatorium <strong>EUREGIOsocial</strong><br />
8.8.4 Suchtabhängigkeit<br />
Bereits 1992 unterzeichneten Repräsentanten Luxemburgs, des Saarlandes, Lothringens<br />
und aus Rheinland-Pfalz ein Abkommen betreffs der <strong>Zusammenarbeit</strong> zur Prävention und<br />
Behandlung von Suchtkrankheiten (Drogen, Alkohol, Tabak, Medikamente). Dieser<br />
sogenannten „Gruppe von Mohndorf“ trat 1994 auch die Deutschsprachige Gemeinschaft<br />
Belgiens bei. 1998 wurde die Zahl der Drogenabhängigen mit Aufenthalt in Luxemburg auf<br />
zirka 2.000 geschätzt. Im gleichen Jahr wurde das Abkommen erneuert; seine fünf<br />
Schwerpunkte betreffen die <strong>Zusammenarbeit</strong> bei der Sammlung epidemiologischer und<br />
toxikologischer Daten, die Fortsetzung des Erfahrungsaustausches zwischen den<br />
Fachleuten und zuständigen Behördenvertretern, die allgemeine Entwicklung gemeinsamen<br />
Handelns, die Errichtung eines Informatiknetzwerkes zur schnellen gegenseitigen<br />
Unterrichtung sowie schließlich die gemeinsame Planung, Durchführung und Evaluierung<br />
präventiver und therapeutischer Maßnahmen zur Bekämpfung der Suchtabhängigkeit in der<br />
Euregio.<br />
8.8.5 Pôle de l’Hôpital<br />
Das Pôle de l'Hôpital ist ein mit öffentlichen Mitteln unterstütztes Unternehmen, das sich als<br />
kompetentes Zentrum für den grenzüberschreitenden Gesundheitsbereich profiliert. Ziel ist,<br />
den Austausch zwischen Unternehmen und Pflegeeinrichtungen <strong>im</strong> wirtschaftlichen und<br />
technologischen Bereich in der Region SaarLorLux zu fördern. Es unterstützt die Gründung<br />
und den Ausbau von Unternehmen und arbeitet mit kompetenten Partnern aus den<br />
Bereichen Medizin, Industrie und Finanzdienstleistungen zusammen. Des Weiteren führt es<br />
Technologieberatung durch, vermittelt Technologiepartner (Kompetenzzentren und<br />
Forschungseinrichtungen der Universitäten <strong>im</strong> Saar-Lor-Lux-Raum) und beobachtet und<br />
analysiert den Gesundheitsmarkt. Das Pôle de ‘Hôpital verbreitet wissenschaftliche und<br />
technische Fachinformationen und organisiert grenzüberschreitende Technologie-<br />
Transfertage; bisherige Themen waren: „Absatzmöglichkeiten für medizinische Kunststoffe in<br />
der Region Saar-Lor-Lux“; Perspektiven und Märkte <strong>im</strong> Bereich der Hygiene und Kosmetik“<br />
sowie „Energieeffizienz <strong>im</strong> Krankenhaus“.<br />
Außerdem fördert die Einrichtung den Austausch und die <strong>Zusammenarbeit</strong> zwischen<br />
Krankenhausleitungen auf fachlicher Ebene, um Probleme und Lösungen <strong>im</strong> Bereich der<br />
Umstrukturierung, der Organisation, des Betriebs und der Finanzierung der<br />
Pflegeeinrichtungen <strong>im</strong> Saar-Lor-Lux-Raum zu analysieren. Auch zu diesem<br />
Themenkomplex werden grenzüberschreitende Fachtagungen veranstaltet, die bisher betitelt<br />
waren: "Wem nutzt die Akkreditierung oder die Qualitätssicherung <strong>im</strong> Krankenhaus in<br />
Deutschland, Belgien, Frankreich und Luxemburg?"; "Die Absatzmärkte des Outsourcings in<br />
der Krankenhauslogistik in der Region SaarLorLux" sowie "Die Entsorgung von Abfällen aus<br />
dem Krankenhauswesen in der Region SaarLorLux".<br />
Pôle de l’Hôpital bietet Hilfestellung bei der Aus- und Weiterbildung, zum Beispiel durch die<br />
Untersuchung des individuellen Aus- und Weiterbildungsbedarfs in Unternehmen und<br />
Pflegeeinrichtungen, der bedarfsorientierten Vermittlung von Partnern mit entsprechenden<br />
Fachkompetenzen sowie durch die Erarbeitung und Betreuung von Aus- und<br />
Weiterbildungsplänen. Weitere Leistungen des Unternehmens sind der Übersetzungsservice<br />
für den Bereich <strong>Gesundheitswesen</strong> (Übersetzungen Französisch-Deutsch/Deutsch-<br />
Französisch) und die Hilfestellung bei der Antragstellung für europäische Förderprogramme.<br />
Aus der Reihe vielfältiger - und vorbildlicher - Projekte sei noch das Adressbuch „Sanitas“<br />
genannt, das in seiner Ausgabe 1998/1999 mehr als 450 Einrichtungen des regionalen<br />
<strong>Gesundheitswesen</strong>s auflistet (Krankenhäuser, Forschungseinrichtungen, Unternehmen. In<br />
dieser von Pôle de l’Hôpital herausgegebenen Bestandsaufnahme sind neben den üblichen<br />
Adress- bzw. Kommunikationskoordinaten auch die Schwerpunkte der jeweiligen Geschäfts-<br />
und Forschungstätigkeit angegeben.<br />
63
Deutsche Sozialversicherung<br />
Observatorium <strong>EUREGIOsocial</strong><br />
8.8.6 Grenzüberschreitender Rettungsdienst<br />
Bisher wurden nur in Ausnahmefällen grenzüberschreitende Rettungsmittel eingesetzt. Da<br />
es jedoch einige Gebietsteile gibt, bei denen dies die Regel sein müsste, wird die derzeitige<br />
Situation von eigentlich allen lokalen Beteiligten als unbefriedigend angesehen. 1998 legte<br />
das Innenministerium des Saarlandes einen Entwurf für eine „Vereinbarung zwischen dem<br />
Saarland und dem Departement Moselle über die <strong>Zusammenarbeit</strong> in der Notfallrettung“ vor,<br />
der zur Zeit noch diskutiert wird. Die Vereinbarung soll regeln: Kompetenzen der<br />
Rettungsleitstellen (wer entscheidet über was?); Rettungsmittel, die zur Verfügung stehen<br />
(wer fährt wohin?) und entstehende Kosten, d. h. Einbindung der Kostenträger (wer zahlt<br />
was und wann in welcher Höhe?). Allerdings enthält der Entwurf keine grenzüberschreitende<br />
Versorgungsstruktur für die Rettungsleitstellen. Und: Grenzüberschreitende Einsätze sollen<br />
nur auf Anforderung der anderen Seite möglich sein. Man vermutet, dass aus Frankreich<br />
solche Hilferufe wahrscheinlich sehr selten kommen. Die Rettungsleitstelle des Saarlandes<br />
hätte gerne eine flächendeckende Matrix der nächst erreichbaren Rettungsstellen gehabt. So<br />
wäre es möglich geworden, überall in der Euregio einen gleich schnellen Einsatz des<br />
angemessenen Rettungsmittels zu garantieren.<br />
Die für den Rettungsdienst verantwortlichen Ärzte fordern, die zur Zeit noch<br />
unterschiedlichen Hilfsfristen anzugleichen, die in Deutschland 15 und in Frankreich 20<br />
Minuten betragen; Hilfsfrist ist der Zeitraum zwischen dem Eingang der Notfallmeldung in der<br />
Rettungsleitstelle und dem Eintreffen des medizinischen Personals am Einsatzort. Außerdem<br />
ist unbefriedigend, dass <strong>im</strong> Saarland noch <strong>im</strong>mer eine andere Notrufnummer (19222) zu<br />
wählen ist als in Frankreich und Luxemburg, wo die EU-weit vereinbarte Nummer 112 gilt.<br />
8.8.7 Zweisprachige Schilder für Arztpraxen<br />
In der Euregio ist man bestrebt, die Zweisprachigkeit besonders zu fördern. Vor diesem<br />
Hintergrund wurde aus dem Landtag des Saarlandes der Wunsch geäußert, dass die<br />
Schilder der Arztpraxen in Deutsch und Französisch gestaltet werden. Diesbezügliche<br />
Vorschriften berühren das ärztliche Standesrecht und sind in den Satzungen der<br />
Landesärztekammern zu regeln. Die zuständige Kammer des Saarlandes begrüßte zwar den<br />
Vorschlag, verwies aber zugleich darauf, dass es sich bewährt habe, auf der Ebene der<br />
Bundesärztekammer Veränderungen <strong>im</strong> Standesrecht abzust<strong>im</strong>men, die dann in<br />
entsprechende Novellierungen der Musterberufsordnung einfließen. Gemäß Beschluss der<br />
Bundesärztekammer sind zweisprachige Arztpraxenschilder untersagt. Die saarländischen<br />
Standesvertreter wollen sich nunmehr in den Gremien auf Bundesebene für eine Änderung<br />
dieser noch aktuellen Beschlusslage einsetzen.<br />
64
8.9 Region PAMINA<br />
Deutsche Sozialversicherung<br />
Observatorium <strong>EUREGIOsocial</strong><br />
Regio PAMINA<br />
- grenzüberschreitender Zweckverband -<br />
(Gesamt) 1.519.000 Einwohner<br />
(D) Kreisfreie Stadt Landau, Landkreise Gemershe<strong>im</strong> und südliche Weinstraße,<br />
Mittelbereich Dahn,<br />
Stadtkreise Baden-Baden und Karlsruhe, Landkreise Karlsruhe und Rastatt<br />
1.255.000 Einwohner<br />
(F) Arrondissements Wissembourg,<br />
Hauenau und Saverne<br />
264.000 Einwohner<br />
65
PAMINA<br />
Deutsche Sozialversicherung<br />
Observatorium <strong>EUREGIOsocial</strong><br />
8.9.1 Allgemeines<br />
Mit der Unterzeichnung der Willenserklärung von Weißenburg 1988 wurde der PAMINA-<br />
Raum gegründet, der ein Gebiet von etwa 6.000 m² umfasst, ca. 1,5 Millionen Menschen<br />
beherbergt, und sich aus drei Teilräumen zusammensetzt: die Südpfalz (PA), die Region<br />
Mittlerer Oberrhein (MI) und das Nordelsass (NA).<br />
Seit 1991 ist der PAMINA-Raum INTERREG-Programmgebiet. Mit der Gründung des<br />
Grenzüberschreitenden Zweckverbandes REGIO PAMINA am 22. Januar 2003 wurde die<br />
vielfältige grenzüberschreitende <strong>Zusammenarbeit</strong> <strong>im</strong> PAMINA-Raum auf eine rechtliche<br />
Basis gestellt. Der Zweckverband ist seit 2004 Verwaltungsbehörde für die INTERREG-<br />
Mittel.<br />
Oberstes Ziel des Zweckverbandes REGIO PAMINA ist es, die lokale und regionale<br />
grenzüberschreitende <strong>Zusammenarbeit</strong> in den verschiedensten Themenfeldern zu fördern,<br />
zu unterstützen und zu koordinieren. Vorhandenes soll gebündelt, neue Initiativen und<br />
Projekte sollen angestoßen und umgesetzt werden, um die grenzüberschreitenden<br />
Beziehungen <strong>im</strong> gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Alltag zu erleichtern und <strong>im</strong>mer<br />
wieder mit neuem Leben zu erfüllen.<br />
Im Bereich des <strong>Gesundheitswesen</strong>s wurden verschiedene Projekte auf den Weg gebracht,<br />
die zum Teil über INTERREG-Mittel mitfinanziert wurden.<br />
8.9.2 Kooperation zwischen Krankenhäusern<br />
Die Krankenhäuser von Wissembourg und Bad Bergzabern arbeiten <strong>im</strong> Rahmen einer<br />
grenzübergreifenden Kooperation seit vielen Jahren zusammen. Schwerpunkt ist die<br />
notärztliche Versorgung.<br />
8.9.3 Vergleichende Studie zur Gesundheit am Oberrhein<br />
Im Rahmen von INTERREG II wurde gemeinsam mit dem Programmgebiet Oberrhein-Mitte-<br />
Süd das Projekt „Gesundheit <strong>im</strong> Oberrheintal: ein grenzüberschreitender Vergleich“<br />
durchgeführt. Ziel war es, den Informationsaustausch <strong>im</strong> Hinblick auf die Gesundheit der<br />
Bevölkerung und das Versorgungsangebot zwischen Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz<br />
und dem Elsass zu verbessern und den Aufbau einer echten <strong>Zusammenarbeit</strong> zwischen<br />
Einrichtungen der Gesundheitsbeobachtung sowie die Analyse gegenseitiger<br />
Ergänzungsmöglichkeiten voranzubringen.<br />
8.9.4 Projekt zum Thema Demenz<br />
Im Rahmen des INTERREG III-Programms wurde das Projekt „Alt verwirrt – allein<br />
gelassen?“ durchgeführt, mit dem Ziel, die Lebensqualität demenzkranker Menschen zu<br />
verbessern. In den drei Teilräumen des PAMINA-Raumes wurde versucht, durch ein<br />
Betreuungskonzept ältere, demenzkranke Personen in ihrer vertrauten Umgebung zu<br />
begleiten und einen Umzug so lange wie möglich herauszuzögern. Mit Hilfe einer<br />
wissenschaftlichen Begleitstudie wurden die unterschiedlichen Versorgungsangebote und -<br />
ansätze analysiert und bewertet.<br />
Träger der Aktion waren der Landeswohlfahrtsverband, die Pfalzklinik für Psychiatrie und<br />
Neurologie in Klingenmünster, sowie der Conseil Général du Bas-Rhin in Strasbourg. Die<br />
wissenschaftliche Begleitung des Projektes erfolgte gemeinsam durch das Zentralinstitut für<br />
Seelische Gesundheit in Mannhe<strong>im</strong> und die Universität Strasbourg, Centre de Gérontologie,<br />
in einem grenzüberschreitenden Forschungsverbund.<br />
Als Abschlussveranstaltung des Projektes wurde am 12. November 2004 <strong>im</strong> Kongresshaus<br />
Baden-Baden die deutsch-französische Fachtagung „Demenz – neue Angebote für<br />
Betroffene und ihre Angehörigen“ durchgeführt. Ziel der Fachtagung war es, die<br />
66
Deutsche Sozialversicherung<br />
Observatorium <strong>EUREGIOsocial</strong><br />
unterschiedlichen Ansätze der Betreuungs- und Unterstützungsangebote sowie die<br />
Ergebnisse und Erkenntnisse aus der wissenschaftlichen Begleitung vorzustellen. Damit<br />
sollen in der PAMINA-Region auf der Grundlage der Erfahrungen mit den unterschiedlichen<br />
Versorgungssystemen in Deutschland und Frankreich gemeinsam bestmögliche<br />
Hilfsinstrumente für demenziell erkrankte Menschen entwickelt werden.<br />
8.9.5 Grenzüberschreitendes Rettungswesen<br />
Vor dem Hintergrund einer geplanten Vereinbarung der Arbeitsgruppe „Gesundheitspolitik“<br />
der Oberrheinkonferenz über das grenzüberschreitende Rettungswesen befürwortete der<br />
Vorstand des Zweckverbandes <strong>im</strong> Oktober 2004 die Durchführung eines Pilotprojektes zur<br />
Erarbeitung und Umsetzung einer Vereinbarung, die <strong>im</strong> Bereich des PAMINA-Raumes die<br />
Einsatzmodalitäten <strong>im</strong> Notfall regelt.<br />
8.9.6 Verbindungsgruppe Grenzüberschreitendes <strong>Gesundheitswesen</strong><br />
Der grenzüberschreitende Zweckverband beteiligt sich an der Einrichtung einer<br />
Verbindungsgruppe zur Verbesserung des grenzüberschreitenden <strong>Gesundheitswesen</strong>s, die<br />
seitens des französischen Secrétaire d’Etat für den Bereich der Krankenversicherung<br />
eingefordert wurde. Teilnehmer sind neben Vertretern der Kassen, der praktizierenden Ärzte<br />
sowie der Patienten auch Experten der grenzüberschreitenden Strukturen. Der PAMINA-<br />
Raum wird als ein Testgebiet fungieren, in dem modellhafte Kooperationen durchgeführt<br />
werden.<br />
67
8.10 Oberrheinkonferenz<br />
Deutsche Sozialversicherung<br />
Observatorium <strong>EUREGIOsocial</strong><br />
68
Oberrheinkonferenz<br />
8.10.1 Allgemeines<br />
Deutsche Sozialversicherung<br />
Observatorium <strong>EUREGIOsocial</strong><br />
8.10.1.1 Institut für regionale <strong>Zusammenarbeit</strong> und europäische Verwaltung<br />
Zur Unterstützung der deutsch-französischen <strong>Zusammenarbeit</strong> in der Region Oberrhein<br />
wurde 1993 das Institut für regionale <strong>Zusammenarbeit</strong> und europäische Verwaltung mit Sitz<br />
in Kehl in der Rechtsform EWIV gegründet. Gründungsmitglieder sind: (D) Land Baden<br />
Württemberg, Stadt Kehl, Kehler Akademie, Fachhochschule für öffentliche Verwaltung in<br />
Kehl, (F) Staat Frankreich, Region Elsaß, Departement Bas-Thin/Niederrhein, Communauté<br />
Urbaine de Strasbourg und die Robert-Schumann-Universität in Strasbourg. Seine<br />
Hauptaufgaben sieht das Institut in den Bereichen Ausbildung, Forschung, Beratung und<br />
Vernetzung der beteiligten Institutionen und weiteren kooperierenden Partnern.<br />
8.10.2 Beispielhafte Projekte <strong>im</strong> stationären Bereich am Oberrhein<br />
8.10.2.1 Kooperation St. Josefsklinik Offenburg mit dem Centre Hospitalier Sélestat<br />
Die Kooperation zwischen der St. Josefsklinik und dem Centre Hospitalier in Sélestat findet<br />
bereits seit dem Jahr 1996 statt. Gefördert durch das Interreg II-Programm Oberrhein-Mitte-<br />
Süd wurden nicht nur Sprachkurse abgehalten, sondern auch zwei deutsch-französische<br />
Wörterbücher erarbeitet und herausgegeben. Regelmäßig und in jedem Jahr finden<br />
Austauschbeziehungen zwischen deutschen und französischen KrankenpflegeschülerInnen<br />
statt. Die Ausbildungsabschnitte werden auf die Krankenpflegeausbildung anerkannt.<br />
Hospitationen finden in vielen Fachdisziplinen statt (z.B. Anästhesie, OP-Personal, Personal<br />
der Intensivstation, Hebammen, Endoskopiepersonal, Stationspersonal, Verwaltung, Ärzte,<br />
Schulleitung etc.). Bis zur Beendigung des Interreg II-Projektes <strong>im</strong> Jahr 2000 nahmen<br />
insgesamt 224 Personen am Austausch und weitere 647 an den Großveranstaltungen teil.<br />
Die Auseinandersetzung mit den ökonomischen Rahmenbedingungen und der damit<br />
eingeführten Strukturabläufe (PMSI, DRG) war Grundlage der Kooperation. Ein<br />
vergleichbares Projekt <strong>im</strong> Bereich des <strong>Gesundheitswesen</strong>s hat es in der Region Oberrhein<br />
zuvor nicht gegeben.<br />
8.10.2.2 <strong>Zusammenarbeit</strong> des Epilepsiezentrums Kork mit den Straßburger<br />
Universitätskliniken Haute Pierre und Hopital Civil<br />
Patienten aus dem Elsaß und aus Luxemburg werden in Kork in geringer Zahl schon lange<br />
betreut; die Tendenz ist aber deutlich steigend. Die <strong>Zusammenarbeit</strong> des Epilepsiezentrums<br />
Kork mit den Straßburger Universitätskliniken Hautepierre und Hôpital Civil wurde durch<br />
persönliche Kontakte aufgebaut und intensiviert.<br />
Das Epilepsiezentrum Kork hat sogar einen eigenen Kinderbereich. Der Kinderklinik lag sehr<br />
an einem Austausch über Problempatienten, auch an der Diskussion über gemeinsame<br />
Patienten und das entsprechende Vorgehen bei ihnen. Etwa alle 3 Monate findet ein Treffen<br />
statt, um ausgewählte Fälle zu besprechen. Weitere Kontakte wurden geknüpft, u.a. mit<br />
neurochirurgischen Kollegen aus Grenoble oder auch der amerikanischen neurologischen<br />
Gesellschaft. Eine weitere diesbezügliche <strong>Zusammenarbeit</strong> ist geplant. Schwierig ist nur die<br />
Kostenübernahme für die Untersuchungen. Die Kosten wurden bisher durch unser Haus<br />
getragen, da die Krankenkassen eine derart differenzierte Untersuchung nur in Deutschland<br />
finanzieren. Sprachschwierigkeiten werden auf unkonventionellem Weg behoben.<br />
69
Deutsche Sozialversicherung<br />
Observatorium <strong>EUREGIOsocial</strong><br />
8.10.2.3 Kooperation Herzzentrum Bad Krozingen mit der Klinikgruppe Groupe<br />
Hospitalier Privé du Centre Alsace<br />
Nach einer schon seit langen Jahren bestehenden <strong>Zusammenarbeit</strong> zwischen dem Herz-<br />
Zentrum Bad Krozingen und Kliniken der Groupe Hospitalier Privé du Centre Alsace in<br />
Colmar, z.B. auch durch die Teilnahme an einer Studie <strong>im</strong> Rahmen des Interreg I<br />
Programms, und <strong>im</strong> Hinblick auf die großen Herausforderungen <strong>im</strong> französischen und<br />
deutschen <strong>Gesundheitswesen</strong>, haben die Verantwortlichen beider Kliniken beschlossen, die<br />
bisherige <strong>Zusammenarbeit</strong> konkreter und verbindlicher zu fassen. Am 18. Februar 2002<br />
wurde hierüber eine Vereinbarung geschlossen mit konkreten Zielen und den hierzu<br />
erforderlichen Organisationsformen.<br />
Die <strong>Zusammenarbeit</strong> wird durch drei Arbeitsgruppen, <strong>im</strong> medizinisch-ärztlichen Bereich, <strong>im</strong><br />
pflegerischen und <strong>im</strong> administrativen Bereich, unterstützt, vor allem in den<br />
Themenschwerpunkten Erfahrungsaustausch und Technologietransfer, Vergleiche von<br />
Behandlungskonzepten, Organisation- und Führungsstrukturen, Personaleinsatz, Aus- und<br />
Weiterbildung, gemeinsame Studien und grenzüberschreitende <strong>Zusammenarbeit</strong> <strong>im</strong> Rahmen<br />
von weiteren Programmen der Europäischen Union. Die Arbeitsgruppen haben die Aufgabe,<br />
in ihren jeweiligen Bereichen Konzeptionen für konkrete Projekte zu erarbeiten. Einmal <strong>im</strong><br />
Jahr berichten sie einer gemeinsamen Sitzung den Geschäftsführungen über die Aktivitäten<br />
und unterbreiten entsprechende Vorschläge für weitere konkrete Umsetzungsschritte.<br />
Die bisherigen Erfahrungen aus der Arbeit dieser Gruppen sind sehr ermutigend, obwohl die<br />
Sprachbarriere sich <strong>im</strong>mer wieder als besonderes Problem herausstellt. Durch die<br />
mittlerweile eingetretene Öffnung innerhalb der Europäischen Union ist jedoch in nächster<br />
Zeit eine größere Durchlässigkeit in der Patientenversorgung zu erwarten. Durch den<br />
bisherigen Erfahrungsaustausch über Behandlungskonzepte und durch die Arbeit an<br />
gemeinsamen medizinischen Studien partizipieren die Patienten beider Einrichtungen bereits<br />
jetzt schon von dieser grenzüberschreitenden <strong>Zusammenarbeit</strong><br />
8.10.3 Projekte der Oberrheinkonferenz <strong>im</strong> Gesundheitsbereich<br />
8.10.3.1 Kartographie „Medizinische Spezialeinrichtungen und Großgeräte“<br />
Bereits <strong>im</strong> Februar 1997 wurde von der Arbeitsgruppe die erste Kartographie des<br />
spezialisierten Versorgungsangebots <strong>im</strong> Oberrheingebiet erstellt.<br />
Ziel war es, den Mitgliedsländern, die der Oberrheinkonferenz angehören, Informationen<br />
über das Angebot an medizinischen Leistungen <strong>im</strong> Grenzraum zu geben, noch bestehende<br />
Bedarfslücken aufzuzeigen und die Möglichkeiten der grenzüberschreitenden<br />
<strong>Zusammenarbeit</strong> auf verschiedenen medizinischen Gebieten zu erfassen. Hintergrund dieser<br />
Maßnahme ist natürlich, dass solche Einrichtungen und Geräte, deren Anschaffung und<br />
Vorhaltekosten hoch sind, auch ausgelastet sind.<br />
Nach in den vergangenen Jahren vorgenommenen Verbesserungen des<br />
Versorgungsangebots war eine aktualisierte Neuauflage der Karten nötig geworden. Durch<br />
ein Urteil des Europäischen Gerichtshofes ist auch die grenzüberschreitende ambulante<br />
Behandlung möglich gemacht und dadurch die Mobilität erleichtert worden. So können<br />
Spezialgeräte zur Diagnostik <strong>im</strong> Nachbarland in Anspruch genommen werden, wenn <strong>im</strong><br />
eigenen Land die Wartezeiten zu lang sind.<br />
Außerdem wurde eine Abmachung zwischen den jeweiligen Auslandsverbindungen der<br />
Krankenversicherungen unterzeichnet und ermöglicht so die Dialysebehandlung elsässischer<br />
Patienten in Südbaden.<br />
Ein weiteres positives Beispiel grenzüberschreitender <strong>Zusammenarbeit</strong> betrifft die<br />
Versorgung Schwerbrandverletzter aus dem Elsass in der berufsgenossenschaftlichen Klinik<br />
Ludwigshafen<br />
70
Deutsche Sozialversicherung<br />
Observatorium <strong>EUREGIOsocial</strong><br />
Die Kartographie „Medizinische Spezialeinrichtungen und Großgeräte“ wurde deshalb<br />
aktualisiert und um einige Einrichtungen ergänzt. Wichtig war auch die Erfassung des<br />
gesamten aktuellen Mandatsgebiets der Oberrheinkonferenz. Enthalten sind in der<br />
Kartographie: ambulante sowie stationäre Dialyseeinrichtungen, Zentren für<br />
Schwerbrandverletzte, Zentren für Kardiologie, Zentren für Transplantationen, Zentren für<br />
Cochlear-Implantationen, Kernspintomographie, Geräte für Strahlentherapie sowie<br />
Positronenemissionstomographie (PET). Die Kartographie soll alle 6 Monate fortgeschrieben<br />
werden.<br />
8.10.3.2 EPI-Rhin-Meldesystem: Epidemiologisches Frühwarnsystem für<br />
ansteckende Krankheiten (seit 2001)<br />
Ziel des Meldesystems ist es, <strong>im</strong> Gesundheitsbereich die bestehenden Meldewege zu<br />
ergänzen und den Informationsfluss zwischen den Behörden entlang der Rheinschiene<br />
weiter zu verbessern. Es ist nicht beabsichtigt, die bestehenden Instrumente auf<br />
Länderebene zu ersetzen.<br />
Am Oberrhein sind regelmäßig epidemische Phänomene zu beobachten. Im Winter und<br />
Frühjahr treten vereinzelt Fälle von Hirnhautentzündung auf. Jedes Jahr sind auch<br />
Grippewellen zu verzeichnen. Tuberkulosepatienten und -patientinnen können mit<br />
Familienmitgliedern oder Arbeitskollegen jenseits der Landesgrenzen Kontakt gehabt haben.<br />
Aufgrund der geographischen Lage des Oberrheins am Schnittpunkt vielgenutzter<br />
Transitstrecken <strong>im</strong> Straßen-, Luft- und Schienenverkehr besteht jederzeit die Möglichkeit,<br />
dass Krankheiten auch von außerhalb eingeschleppt werden.<br />
Zu diesem Zweck wurde auf Initiative der AG Gesundheitspolitik der Oberrheinkonferenz ein<br />
grenzüberschreitendes Meldesystem für übertragbare Krankheiten, "EPI-Rhin", initiiert,<br />
dessen Funktionsweise die folgende ist:<br />
In jedem der drei Staaten wird eine für "EPI-Rhin" verantwortliche Person bezeichnet. Die<br />
verantwortlichen Ansprechpartner nehmen Meldungen aus dem eigenen Land entgegen und<br />
leiten sie an den Partner in den betreffenden Nachbarländern weiter. Erhält ein<br />
Ansprechpartner Meldungen von einem der beiden anderen "EPI-Rhin" Verantwortlichen, so<br />
leitet er sie umgekehrt an die zuständigen Kollegen <strong>im</strong> eigenen Land weiter.<br />
In Deutschland sind dies die Amtsärzte, in der Schweiz die Kantonsärzte und in Frankreich<br />
die médecins inspecteurs de santé publique.<br />
Eine Meldung <strong>im</strong> Rahmen von EPI-Rhin soll erfolgen, wenn bei einer ansteckenden<br />
Krankheit mehrere Fälle <strong>im</strong> grenznahen Raum auftreten, der Wohnort eines oder mehrerer<br />
Patienten in einem Partnerland liegt, der Wohnort eines oder mehrerer Kontaktpersonen, bei<br />
denen eine Untersuchung oder eine Behandlung notwendig sein könnte, in einem<br />
Partnerland liegt, die Infektionsquelle in einem Partnerland liegt.<br />
Zahlreiche Anwendungsfälle haben seither die Effektivität des Meldesystems belegt.<br />
Datenschutzrechtliche Bedenken in Verbindung mit den meldepflichtigen Krankheiten und<br />
Vorkommnissen konnten vollständig ausgeräumt werden.<br />
Im weiteren hat die Arbeitsgruppe Gesundheitspolitik drei Treffen der beteiligten Ärzte des<br />
Meldesystems durchgeführt, die jeweils auch den Charakter einer Fortbildungsveranstaltung<br />
zu best<strong>im</strong>mten Erkrankungen und den Meldewegen <strong>im</strong> Nachbarland hatten, sowie der<br />
Vernetzung dienten.<br />
71
Deutsche Sozialversicherung<br />
Observatorium <strong>EUREGIOsocial</strong><br />
8.10.3.3 Vereinbarungen zum grenzüberschreitenden Rettungsdienst<br />
Ein Schwerpunktthema ist der Bereich des grenzüberschreitenden Rettungsdienstes <strong>im</strong><br />
Oberrheingebiet. Eine exper<strong>im</strong>entelle Umsetzung der Absprache über den<br />
grenzüberschreitenden Rettungsdienst zwischen dem Elsass und Baden-Württemberg bei<br />
der Landesgartenschau Kehl/Strasbourg 2004 fand theoretisch statt, allerdings gab es<br />
keinen konkreten Anwendungsfall. Ein Hauptproblem besteht auf deutscher Seite noch in der<br />
Abgeltung der Leistungen. Mittlerweile kann der französische Rettungsdienst Sondersignale<br />
in Deutschland in Anspruch nehmen, gleichzeitig setzen sich die Vertreter des SAMU dafür<br />
ein, dass dies auch umgekehrt möglich ist.<br />
Im Verhältnis zur Schweiz arbeitet man derzeit daran, die zwischen den deutschen und den<br />
französischen Partnern entwickelten Regelungen zu übertragen. Ein Vertragsentwurf<br />
zwischen Aargau und Basel-Stadt und dem Land Baden-Württemberg liegt vor.<br />
Frankreich besteht für den grenzüberschreitenden Rettungsdienst weiterhin auf dem<br />
Abschluss eines Staatsvertrags. Von Deutschland und der Schweiz wird dies nicht für<br />
notwendig erachtet, beide sehen dies aber nicht als Hinderungsgrund.<br />
8.10.3.4 Grenzüberschreitender Bettennachweis<br />
Die AG Gesundheitspolitik arbeitet derzeit an einem Bettennachweissystem für das gesamte<br />
Mandatsgebiet der Oberrheinkonferenz, das über das Internet abgerufen werden kann. Für<br />
die Versorgung Schwerverletzter ist es notwendig, schnell einen Überblick über geeignete<br />
Krankenhäuser mit freien OP-Kapazitäten und Intensivpflegeplätzen zu bekommen.<br />
Es wurden verschiedene <strong>im</strong> Oberrheingebiet bereits bestehende bzw. in der Entwicklung<br />
befindliche Abrufsysteme auf ihre Übertragbarkeit überprüft. Derzeit werden die technischen<br />
Möglichkeiten zur Verknüpfung der Systeme sowie die Kosten dieser Maßnahme geprüft.<br />
8.10.3.5 Veranstaltung „Mobilität von Gesundheitsdienstleistungen am Oberrhein“<br />
Am 28. September 2005 findet in Basel eine trinationale Veranstaltung zum Thema „Mobilität<br />
von Gesundheitsdienstleistungen am Oberrhein“ statt. Als Themenschwerpunkte sind<br />
vorgesehen: Versorgung bei spezialisierten Bedürfnissen und Leistungen (z.B. zentrales<br />
Bettennachweissystem, grenzüberschreitender Rettungsdienst, gemeinsame Nutzung<br />
medizinischer Großgeräte), regionale Strukturprobleme und moderne Konzepte integrierter<br />
Versorgung (z.B. Kooperation St. Josefsklinik Offenburg mit Selestat, Kooperation<br />
Herzzentrum Bad Krozingen-Klinik Colmar, Behandlung elsässischer Schwerbrandverletzter<br />
in Ludwigshafen) und Perspektiven durch Kooperationen in der Versorgungsplanung (z.B.<br />
Know-how-Export durch Fachsprechstunden <strong>im</strong> Nachbarland, Südpfalz-Nordelsass Lösung<br />
struktureller Defizite <strong>im</strong> Bereich Südpfalz-Nordelsass).<br />
8.10.3.6 Gesundheitsbericht für das Oberrheintal (abgeschlossen in 2001)<br />
Der Bericht "Gesundheit <strong>im</strong> Oberrheintal" vergleicht grenzüberschreitend Kennzahlen zur<br />
gesundheitlichen und sozialen Situation der Bevölkerung <strong>im</strong> Elsass und den Gebieten der<br />
deutschen Bundesländer Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz <strong>im</strong> Mandatsgebiet der<br />
Oberrheinkonferenz.<br />
Der Gesundheitsbericht ist ein gemeinsames Projekt des Observatoire Régional de la Santé<br />
d'Alsace (ORSAL) mit dem Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg (LGA) und dem<br />
Ministerium für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit Rheinland-Pfalz (MASFG) unter<br />
dem Dach der Deutsch-französisch-schweizerischen Oberrheinkonferenz und ihrer<br />
Arbeitsgruppe Gesundheitspolitik. Es wurde gefördert <strong>im</strong> Rahmen des EU-Programms<br />
INTERREG II Oberrhein Mitte-Süd und PAMINA.<br />
Der über 300 Seiten starke Bericht soll Entscheidungsträgern bei der grenzüberschreitenden<br />
<strong>Zusammenarbeit</strong> <strong>im</strong> Gesundheitsbereich als Informationsgrundlage dienen.<br />
Festgestellt wurden:<br />
Ein Rückgang der Sterblichkeit auf beiden Seiten des Rheins um -12 % bei den Männern<br />
und –14 % bei den Frauen zwischen 1988-90 und 1995-97. Dabei ist die Sterblichkeit unter<br />
den Männern <strong>im</strong> Elsass und der Südpfalz um etwa 10 % höher als auf der badischen<br />
72
Deutsche Sozialversicherung<br />
Observatorium <strong>EUREGIOsocial</strong><br />
Rheinseite. Bei den Frauen liegt die Sterblichkeit <strong>im</strong> Elsass um 14 % niedriger als in der<br />
Südpfalz und etwa gleich hoch wie in Baden.<br />
Herz-Kreislauf-Erkrankungen als Todesursache sind in den deutschen Gebieten des<br />
Oberrheintals bei Frauen und Männern bedeutender. Im Elsass dagegen haben<br />
Krebserkrankungen bei den Männern eine größere Bedeutung, obwohl <strong>im</strong> Bereich der Herz-<br />
Kreislauf-Erkrankungen das Elsass <strong>im</strong> Vergleich zum französischen Mittelwert eine höhere<br />
Sterblichkeit aufweist.<br />
Todesfälle sind <strong>im</strong> Elsass <strong>im</strong> Zusammenhang mit Tabakkonsum und<br />
Straßenverkehrsunfällen häufiger, in Baden dagegen gibt es mehr Sterbefälle mit Bezug zu<br />
übermäßigem Alkoholkonsum.<br />
Deutliche Unterschiede beiderseits des Rheins gibt es in den medizinischen Praktiken und<br />
der Inanspruchnahme des medizinischen Versorgungssystems durch die Bevölkerung -<br />
darauf weisen mehrere Kennzahlen aus dem Kapitel "Mutter und Kind" hin. Während die<br />
Säuglingssterblichkeit <strong>im</strong> gesamten Oberrheintal praktisch gleich ist, sind folgende<br />
Unterschiede zu beobachten:<br />
• Eine deutlich häufigereZahl von Entbindungen durch Kaiserschnitt in den deutschen<br />
Fachkliniken<br />
• Eine deutlich höhere Anzahl von Schwangerenvorsorgeuntersuchungen in Deutschland<br />
• Ein dreifach häufigerer Einsatz der Periduralanästhesie bei Entbindungen <strong>im</strong> Elsass.<br />
Die Gesamtpublikation wurde an alle interessierten Stellen am Oberrhein abgegeben und<br />
auch auf der Homepage der Oberrheinkonferenz zum Download bereitgestellt:<br />
www.oberrheinkonferenz.org/gesundheit<br />
Mittlerweile arbeiten die Experten an einem weiteren Bericht zum grenzüberschreitenden<br />
Vergleich der Schulgesundheit. Hierbei werden folgende Schwerpunkte verglichen:<br />
Übergewicht, Impfungen, Seh- und Hörstörungen der Kinder <strong>im</strong> Zeitpunkt ihrer Einschulung.<br />
73
Deutsche Sozialversicherung<br />
Observatorium <strong>EUREGIOsocial</strong><br />
8.11 Centre - Strasbourg/Offenburg - Euregio in Planung<br />
74<br />
Centre - Strasbourg/ Offenburg<br />
Errichtung der Euregio „Centre“ ist geplant derzeit Arbeitsgemeinschaft<br />
(Gesamt) 1.358.367 Einwohner<br />
(D) Ortenau-Kreis 405.607 Einwohner<br />
(D) Landkreis Emmendingen 149.043 Einwohner<br />
(F) Südlicher Teil des Department du Bas Rhin 803.717 Einwohner
Deutsche Sozialversicherung<br />
Observatorium <strong>EUREGIOsocial</strong><br />
Centre - Strasbourg/Offenburg - Euregio in Planung<br />
8.11.1 Allgemeines<br />
Der Oberrhein hat insgesamt gesehen eine relativ fortgeschrittene grenzüberschreitende<br />
Kooperation auch <strong>im</strong> Bereich des <strong>Gesundheitswesen</strong>s. Projekte in diesem Bereich werden<br />
pr<strong>im</strong>är über die Oberrheinkonferenz beantragt. Deren Mandatsgebiet unterteilt sich in die<br />
drei Teilräume (von Nord nach Süd) Regio PAMINA, Centre und RegioTriRhena. Die Regio<br />
PAMINA und Regio TriRhena sind bereits Euregios. Für das Gebiet Centre (um<br />
Strasbourg/Ortenaukreis) besteht allerdings bisher nur eine Arbeitsgemeinschaft, und zwar<br />
seit 1999. Möglicherweise wird sich die grenzüberschreitende <strong>Zusammenarbeit</strong> <strong>im</strong> Bereich<br />
Centre künftig <strong>im</strong> Zuge des geplanten Eurodistrikts weiter verdichten bzw. verselbständigen.<br />
In Kehl sind vier grenzüberschreitende Einrichtungen seit 2003 unter dem Dach des<br />
"Kompetenzzentrums für grenzüberschreitende und europäische Fragen" konzentriert<br />
(www.kompetenz-zentrum.org). Dazu gehört neben der INFOBEST u.a. auch das Euro-<br />
Institut.<br />
Wo genau liegt das Kooperationsgebiet?<br />
Die Arbeitsgemeinschaft umfasst in Deutschland den Ortenaukreis und den Landkreis<br />
Emmendingen, auf der französischen Seite die Arrondissements Strasbourg-Ville,<br />
Strasbourg-Campagne, Molshe<strong>im</strong> und Sélestat-Erstein (somit den südlichen Teil des<br />
Département du Bas-Rhin).<br />
Der Einzugsbereich der INFOBEST deckt sich in etwa mit dem der AG Centre. Sie ist keine<br />
eigene Euregio, sondern ein Element darin. Sie informiert und berät die breite Öffentlichkeit<br />
über grenzüberschreitende Fragen, Leben und Arbeiten <strong>im</strong> Nachbarland, über die<br />
Europäische Union, und über grenzüberschreitende Projekte. Sie hat engen Kontakt zu den<br />
Verwaltungen und Sozialversicherungsträgern vor Ort, veranstaltet in <strong>Zusammenarbeit</strong> mit<br />
diesen, grenzüberschreitende Bürgersprechtage und sonstige punktuelle Veranstaltungen<br />
wie z.B. Experten-Workshops, diese in <strong>Zusammenarbeit</strong> mit dem EU-Programm EURES-T.<br />
Für Herbst 20005 plant INFOBEST einen solchen Workshop zum Thema<br />
Krankenversicherung in Deutschland, Frankreich und der Schweiz / Systeme und Reformen.<br />
8.11.2 Arbeitstreffen<br />
Die Informations- und Beratungsstellen arbeiten täglich mit den Behörden der drei Länder<br />
zusammen und treffen dadurch <strong>im</strong>mer wieder auf problematische Fälle, die durch<br />
grenzüberschreitende Sachverhalte bedingt sind. Die INFOBESTen haben eine<br />
Scharnierfunktion zwischen den Behörden der drei Länder, die aufgrund der verschiedenen<br />
Sprachen, der unterschiedlichen Kulturen und des ungleichen Behördensystems<br />
Schwierigkeiten in der Kontaktaufnahme haben<br />
Zur Information der französischen, deutschen und schweizerischen Seite über den Ablauf<br />
und das Funktionieren der einzelnen nationalen Systeme, sowie zur Aufklärung der<br />
Probleme, die sich den Grenzgängern auf jedem Gebiet stellen, planen die INFOBEST<br />
Kehl/Strasbourg und die INFOBEST Vogelgrund/Breisach - in <strong>Zusammenarbeit</strong> mit den<br />
anderen INFOBESTen - insgesamt vier Arbeitstreffen (jeweils eins pro INFOBEST und pro<br />
Haushaltsjahr). Die Arbeitstreffen behandeln folgende Themen behandeln:<br />
Arbeitstreffen zum Thema Krankenversicherung in den drei Ländern:<br />
Das Treffen ermöglicht einen Informationsaustausch v.a. über Reformen der<br />
Krankenversicherung und ihre Auswirkungen auf Grenzgänger. Insbesondere soll auf die in<br />
Deutschland bereits <strong>im</strong> Jahr 2004 eingeleiteten Reformen und deren Weiterführung <strong>im</strong> Jahr<br />
2005 sowie auf die ebenfalls in Frankreich zu erwartenden gesetzlichen Neuregelungen<br />
eingegangen werden.<br />
75
Deutsche Sozialversicherung<br />
Observatorium <strong>EUREGIOsocial</strong><br />
Arbeitstreffen zum Thema Arbeitslosenversicherung in den drei Ländern:<br />
Vor dem Hintergrund wirtschaftlicher Krisenzeiten kommt dem Vergleich des Rechts auf<br />
Arbeitslosenunterstützung in den drei Ländern besondere Bedeutung zu. Das Arbeitstreffen<br />
soll dabei insbesondere auch aktuelle nationale Gesetzesreformen und die Koordinierung<br />
durch das Gemeinschaftsrecht mit ihren Auswirkungen auf die Grenzgänger behandeln.<br />
Arbeitstreffen zum Thema Steuern in den drei Ländern:<br />
Aus vergleichendem Blickwinkel sollen die wichtigsten steuerlichen Fragen- und<br />
Problembereiche (Grenzgängerstatus, Besteuerung der Renten, besondere Aspekte der<br />
nationalen Steuergesetzgebung etc.) behandelt und ihre Auswirkungen auf die –<br />
insbesondere auch berufliche – Mobilität der Bürger erörtert werden.<br />
Arbeitstreffen zum Thema Langzeiterkrankung und Erwerbsminderung in den drei Ländern:<br />
Im Anschluss an das <strong>im</strong> Jahr 2000 von der INFOBEST PAMINA EURES-Seminar soll<br />
insbesondere der aktuelle Stand bei den Anerkennungsverfahren über die<br />
Erwerbsminderung von Grenzgängern beleuchtet werden.<br />
Im Anschluss an die Arbeitstreffen planen die INFOBESTen die Erstellung eines allgemein<br />
zugänglichen Informationsblattes, welches die wichtigsten Punkte zu dem besprochenen<br />
Thema beinhaltet.<br />
76
Deutsche Sozialversicherung<br />
Observatorium <strong>EUREGIOsocial</strong><br />
8.12 RegioTriRhena – zurzeit keine Projekte<br />
Regio TriRhena<br />
2,25 Millionen Einwohner<br />
8700 km²<br />
(D) Freiburger Regio-Gesellschaft e.V.<br />
(CH) Verein Regio Basiliensis<br />
(F) Kommunalverband Regio du Haut-Rhin<br />
77
RegioTriRhena - zurzeit keine Projekte -<br />
Deutsche Sozialversicherung<br />
Observatorium <strong>EUREGIOsocial</strong><br />
8.12.1 Allgemeines<br />
Die RegioTriRhena ist ein trinationaler Lebens- und Wirtschaftsraum, der Südbaden, die<br />
Nordwestschweiz und das Oberelsass umfasst. Dieses Gebiet mit rund 2,3 Millionen<br />
Einwohnern ist durch eine jahrhundertelange gemeinsame Geschichte geprägt, was sich bis<br />
heute in Sprache, Architektur und Kultur ausdrückt.<br />
Viele Industrie- und Dienstleistungsbetriebe haben sich in der Grenzregion angesiedelt. Dies<br />
macht die Region zu einem wichtigen Wirtschaftsstandort, unter anderem in den Bereichen<br />
Life Sciences, Banken, Transport und Messewesen. Sie bietet ein attraktives Lebensumfeld<br />
und ein außergewöhnlich vielfältiges Kultur- und Freizeitangebot.<br />
78
Deutsche Sozialversicherung<br />
Observatorium <strong>EUREGIOsocial</strong><br />
8.13 Hochrhein-Kommission - zur Zeit keine Projekte<br />
Hochrhein Kommission<br />
Ohne Rechtspersönlichkeit<br />
Keine Angaben über Einwohner und Fläche möglich<br />
79
Deutsche Sozialversicherung<br />
Observatorium <strong>EUREGIOsocial</strong><br />
Hochrhein-Kommission - zur Zeit keine Projekte<br />
8.13.1 Allgemeines<br />
Aufbauend auf der 1997 gegründeten Hochrheinkommission (HRK) wird zurzeit eine<br />
Vereinbarung für die grenzüberschreitende <strong>Zusammenarbeit</strong> am Hochrhein ausgearbeitet.<br />
Grundlage ist die derzeit bestehende Kooperationsvereinbarung auf der Grundlage des<br />
Karlsruher Übereinkommens (KaÜ).<br />
Die seit März 2005 vorliegende Projektskizze dient als Grundlage für die Erarbeitung des<br />
„Regionalentwicklungsprogramm Hochrhein“. Die Projektskizze legt neben Zielsetzung,<br />
Beteiligten, Zeitplan und Finanzierung insbesondere den Schwerpunkt, die<br />
Projektorganisation sowie den methodischen Ansatz zur Programmdefinition fest.<br />
Ein Politikbereich ist dem grenzüberschreitenden <strong>Gesundheitswesen</strong> gewidmet. Inwieweit<br />
hier zukünftig eigene Projekte entwickelt werden, bleibt abzuwarten. Bislang ist die<br />
Hochrhein Kommission über die Euregio Oberrheinkonferenz in diesem Bereich vertreten.<br />
80
Deutsche Sozialversicherung<br />
Observatorium <strong>EUREGIOsocial</strong><br />
8.14 REGIO BODENSEE (Internationale Bodenseekonferenz)<br />
Regio Bodensee<br />
Ohne Rechtspersönlichkeit<br />
(Gesamt) 3.517.000 Einwohner<br />
(D) Landkreise Konstanz, Sigmaringen, Ravensburg, Lindau,<br />
Oberallgäu und Bodenseekreis, Stadt Kempten<br />
1.137.00 Einwohner<br />
(A) Bundesland Vorarlberg<br />
362.000 Einwohner<br />
(CH) Kantone Appenzell Ausserrhoden, Appenzell Innerrhoden, Schaffhausen, St. Gallen,<br />
Thurgau und Zürich<br />
1.987.000 Einwohner<br />
(FL) Fürstentum Liechtenstein<br />
31.000 Einwohner<br />
81
Deutsche Sozialversicherung<br />
Observatorium <strong>EUREGIOsocial</strong><br />
REGIO BODENSEE [Internationale Bodenseekonferenz]<br />
8.14.1 Allgemeines<br />
Das überragende Strukturmerkmal dieser Region ist der See und seine Landschaft. Dies hat<br />
schon sehr früh zu einer gemeinsamen Behandlung ökologischer bzw. wasserwirtschaftlicher<br />
Belange und zu einem gemeinsamen Bewusstsein mit entsprechenden Aktivitäten geführt.<br />
Die hohe Qualität der Landschaft (Kulturraum, Erholungsgebiet, Trinkwasserspeicher für<br />
Millionen Menschen) setzt den Nutzungsmöglichkeiten und -ansprüchen des Tourismus, der<br />
Wirtschaft der Siedlungsentwicklung und des Verkehrs Grenzen. Die Bevölkerung der<br />
Region hat über alle Grenzen hinweg aufgrund der gemeinsamen Geschichte sowie der<br />
alemannischen Abstammung eine einheitliche Sprache und eine ähnliche Mentalität. Positiv<br />
wirkt sich in der <strong>Zusammenarbeit</strong> aus, dass die Partnerstaaten in der Bodenseeregion<br />
jeweils über eine föderative Ordnung verfügen, wenn auch in unterschiedlicher Ausprägung.<br />
Von einem einheitlichen Wirtschaftraum kann man allerdings nicht sprechen. Die Schweiz<br />
befindet sich an der EU-Außengrenze, wodurch der freie Verkehr von Personen,<br />
Dienstleistungen und Waren nur eingeschränkt möglich ist. Man erhofft sich aber von den<br />
sektoralen Vereinbarungen, die heuer zwischen der EU und der Schweiz abgeschlossen<br />
wurden, Verbesserungen in diesen Fragen. Eines wird jedoch bestehen bleiben: Der<br />
Bodensee als natürliche Barriere, vor allem bei den Verkehrsverbindungen.<br />
8.14.2 <strong>Gesundheitswesen</strong><br />
Be<strong>im</strong> <strong>Gesundheitswesen</strong> und <strong>im</strong> sozialen Bereich soll nach Ansicht der Verantwortlichen vor<br />
Ort die <strong>Zusammenarbeit</strong> in der Bodenseeregion weiter verbessert werden; entsprechende<br />
Einrichtungen sollen grenzüberschreitend genutzt werden. Allerdings erschweren die<br />
unterschiedlichen versicherungsrechtlichen Rahmenbedingungen der Bodenseeanrainer die<br />
Behandlung von Patienten aus den Nachbarstaaten. Das deutsch-schweizerische<br />
Sozialabkommen regelt, dass die Krankenkassen eine Behandlung von Patienten in den<br />
Nachbarstaaten nach vorheriger Zust<strong>im</strong>mung bis zur Höhe vergleichbarer geltender Sätze <strong>im</strong><br />
Inland übernehmen. Grundsätzlich sollen Versicherte jedoch Leistungen <strong>im</strong> Inland nutzen.<br />
Grenzgänger und in Büsingen am Hochrhein wohnende Personen können sich auch ohne<br />
Zust<strong>im</strong>mung der Krankenkassen in der Schweiz behandeln lassen. Im Falle von<br />
Spezialbehandlungen (zum Beispiel Strahlenbehandlung Krebskranker) konnte erreicht<br />
werden, dass die gesamten Kosten einer Strahlenbehandlung in der Schweiz von deutschen<br />
Krankenkassen voll übernommen werden.<br />
8.14.3 Gesundheitsförderung <strong>im</strong> Bodenseeraum<br />
Ziel des Projektes „Gesundheitsförderung und -prävention <strong>im</strong> Bodenseeraum“, das 1998<br />
begonnen wurde, dient zur Information der Bevölkerung. Vor dem Hintergrund der<br />
differenzierten Organisationsformen der Gesundheitssysteme der Bodenseeanrainerstaaten<br />
hat man sich gerade dieses Themas angenommen, weil man es ansonsten für schwierig<br />
hält, über Gesundheit einheitlich und verbindlich zu informieren. Es wird angestrebt, eine<br />
möglichst große Zielgruppenvielfalt zu erreichen, über einen längeren Zeitraum zu wirken,<br />
sowie eine gewisse Nachhaltigkeit (fachliche Effekte) zu erreichen. Das Projekt war zunächst<br />
vorgesehen bis 2003. Da es sich sehr bewehrt hatte wird es nunmehr unbefristet fortgeführt.<br />
Als Maßnahme wird jährlich ein Wettbewerb für Laien und Fachleute ausgeschrieben, mit<br />
dem Projekte, Ideen und Initiativen zur Gesundheitsförderung aus dem Bodenseeraum<br />
prämiert werden. Die Wettbewerbsergebnisse werden anschließend auf einer<br />
Wanderausstellung präsentiert. Schließlich wird ein Symposium durchgeführt, welches sich<br />
in erster Linie an Fachleute und Entscheidungsträger richtet. Projektpartner sind die, die<br />
Region tragenden Körperschaften (in Deutschland Baden-Württemberg und Bayern) mit<br />
Ausnahme Liechtensteins.<br />
82
8.14.4 Sonstiges<br />
Deutsche Sozialversicherung<br />
Observatorium <strong>EUREGIOsocial</strong><br />
8.14.4.1 Gesundheitsministerkonferenz<br />
Im Rahmen der jährlichen Dornbirner Messe treffen sich Vertreter der<br />
Gesundheitsministerien und weitere Fachvertreter zu einer internationalen Tagung.<br />
8.14.4.2 Tagung zur ärztlichen Fortbildung<br />
Seit 1957 findet einmal jährlich die „Internationale Ärztliche Fortbildungstagung Bodensee“<br />
statt. Hierfür ist ein wissenschaftlicher Beirat eingerichtet worden, dem 20 Mitglieder<br />
angehören.<br />
8.14.4.3 Jahrestagung der Urologen<br />
Ebenfalls jährlich wird das „Bodenseetreffen der Urologen“ durchgeführt.<br />
8.14.4.4 Internationales Ärztetreffen<br />
In unregelmäßigen Abständen wird das „Internationale Ärztetreffen der Kantonsärzte, Physici<br />
und Amtsärzte“ veranstaltet.<br />
8.14.4.5 Arbeitsgruppen <strong>im</strong> Krankenhausbereich<br />
Im Krankenhausbereich bestehen lose Arbeitsgruppen (Kontakte) zwischen einigen<br />
Krankenhäusern der Region zwecks Erfahrungsaustauschs.<br />
83
8.15 ARGE-ALP<br />
Deutsche Sozialversicherung<br />
Observatorium <strong>EUREGIOsocial</strong><br />
ARGE-ALP<br />
- ohne Rechtspersönlichkeit -<br />
(Gesamt) 34.174.000 Einwohner<br />
(D) Freistaat Bayern und Bundesland<br />
Baden-Württemberg<br />
21.915.000 Einwohner<br />
(A) Bundesländer Salzburg, Tirol und<br />
Vorarlberg<br />
1.517.000 Einwohner<br />
(CH) Kantone Graubünden, St. Gallen und<br />
Ticino/ Tessin<br />
925.000 Einwohner<br />
(I) Autonome Provinzen Bozen-Südtirol,<br />
Trient und Region Lombardei<br />
9.817.000 Einwohner<br />
84
ARGE-ALP<br />
Deutsche Sozialversicherung<br />
Observatorium <strong>EUREGIOsocial</strong><br />
8.15.1 Allgemeines<br />
Die Länder des Alpenraumes haben ungeachtet ihrer Trennung durch Staatsgrenzen eine<br />
Vielzahl von Gemeinsamkeiten. Neben ähnlichen geographischen und ökologischen<br />
Gegebenheiten weisen sie enge wirtschaftliche und soziale Bindungen auf und haben viele<br />
gemeinsame Wurzeln in Geschichte und Kultur. Dazu kommt die Erkenntnis, dass die<br />
zahlreichen Folgen ökonomischer und gesellschaftlicher Entwicklung nicht an den<br />
Staatsgrenzen haltmachen. Die Bewohner der Alpenländer und ihre Regierungen sehen sich<br />
daher auch bei der Gestaltung ihres Lebensraumes auf vielen Gebieten mit ähnlichen oder<br />
gleichen Fragen konfrontiert. Vor dem Hintergrund der Bergwelt mit natürlichen Grenzen<br />
werden die Schwerpunkte in der <strong>Zusammenarbeit</strong> daher auf den Gebieten Kultur,<br />
Tourismus, Umwelt und Verkehr gesetzt. Im <strong>Gesundheitswesen</strong> veranstaltet man<br />
gemeinsame medizinische Tagungen.<br />
8.15.2 Symposium „Erstversorgung und Rehabilitation von Schlaganfallpatienten<br />
und schwer Schädelhirnverletzten“<br />
Die Versorgung und Rehabilitation von Schlaganfallpatienten und schwer Schädel-Hirn-<br />
Verletzten stand am 11.05.1998 <strong>im</strong> Mittelpunkt einer internationalen Tagung, an der<br />
Mediziner aus Deutschland, Österreich, Italien und der Schweiz teilnahmen. Veranstalter<br />
waren das Bayerische Gesundheitsministerium in <strong>Zusammenarbeit</strong> mit dem Klinikum der<br />
Universität Regensburg und dem Bezirksklinikum Regensburg. Als Konferenzort war<br />
Regensburg gewählt worden, da es mit seiner als sehr gut bezeichneten<br />
Versorgungsstruktur nach Ansicht der Fachwelt Impulse und Ideen für die Planung ähnlicher<br />
Projekte in anderen Regionen geben kann. Insbesondere wurden die hiesigen Möglichkeiten<br />
zur schnellen Erstversorgung von Patienten außerhalb der Ballungsräume erläutert; dazu<br />
gehören ein opt<strong>im</strong>iertes Rettungssystem, medizinische Spezialeinheiten und moderne<br />
Kommunikationstechniken (Telemedizin). Auch <strong>im</strong> Bereich der Rehabilitation bietet der<br />
Standort Regensburg Behandlungsmöglichkeiten, die in anderen Mitgliedsregionen der<br />
ARGE-ALP noch nicht vorhanden sind.<br />
8.15.3 Transalpine Prävention Sucht<br />
Zur Verbesserung der überregionalen <strong>Zusammenarbeit</strong> von Fachleuten aus Tirol, Bayern<br />
und Südtirol wurde 1998 ein Projekt gestartet, welches seinen Schwerpunkt in der<br />
schulischen Suchtprävention hat. Projektpartner sind die Caritas-Fachambulanzen für<br />
Suchtkranke in Traunstein und Miesbach, das Deutsche Landesschulamt Bozen<br />
(Dienststelle für Gesundheitserziehung) sowie die Kontakt + Co. Suchtpräventionsstelle Tirol<br />
(Innsbruck), in deren Händen auch die Projektleitung liegt.<br />
85
8.16 Arbeitsgemeinschaft Alpen-Adria<br />
Deutsche Sozialversicherung<br />
Observatorium <strong>EUREGIOsocial</strong><br />
Arbeitsgemeinschaft Alpen-Adria<br />
Keine Rechtspersönlichkeit<br />
(D) Bayern,<br />
(A) Oberösterreich, Kärnten, Steiermark, Burgenland<br />
(I) Friuli-Venezia Giulia, Ticino, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto<br />
(Sl) Slovenija<br />
(Hu) Vas, Zala, Somogy, Baranya, Györ-Mosen-Sopron,<br />
(KR) Hrvatska<br />
86
Arbeitsgemeinschaft Alpen-Adria<br />
Deutsche Sozialversicherung<br />
Observatorium <strong>EUREGIOsocial</strong><br />
8.16.1 Allgemeines<br />
Am 20. November 1978, wurde in Venedig das, was zuvor eine informelle<br />
Freundschaftsbeziehung unter Grenzregionen war, offiziell in eine Gemeinschaft verwandelt,<br />
die sich auf eine gemeinsame Tradition und eine miteinander erlebte Geschichte stützt.<br />
Durch die Unterzeichnung des Absichtsprotokolls besiegelten die Länder, Regionen und<br />
Republiken nicht nur formell die Entstehung der Arbeitsgemeinschaft Alpen-Adria, sondern<br />
tagen auch einen wichtigen Schritt in Richtung einer neuen Zukunft Europas.<br />
Die Ausführungen zur ARGE-ALP (8.15.1) gelten auch hier. In den letzten 15 Jahren kam die<br />
besondere Problematik hinzu, die sich durch die Auswirkungen der negativen Entwicklungen<br />
in Südosteuropa ergaben (Kroatien und Slowenien waren bekanntlich ehemals<br />
jugoslawische Republiken). Die Arbeitsgemeinschaft Alpen-Adria war stets bemüht, ihren<br />
Möglichkeiten entsprechend zu helfen.<br />
8.16.2 Projektgruppe „Notfallmedizin <strong>im</strong> Alpen-Adria Raum“<br />
Anlässlich des Meetings am 03. und 04. Oktober 2004 mit dem Titel „Emergency Medical<br />
Services and Helicopter Transport in the Alps Adriatic Working Community. Thoratic Trauma<br />
and Cardiac Arrest” wurde ein Referentennetzwerk gegründet. Diesem Netzwerk haben sich<br />
die Republiken Slowenien und Kroatien das Bundesland Kärnten, die Komitate Györ-Moson-<br />
Sopron und Vas (Ungarn) sowie die Regionen Venetien, Lombardei und Friaul-Julisch<br />
Venetien angeschlossen.<br />
Als Koordinator dieser Projektgruppe fungiert Dr. Elio Carchietti, Verantwortlicher der<br />
Flugrettung der Region Friaul-Julisch Venetien. Er hat für 2004 vorgeschlagen, die bereits in<br />
die Wege geleiteten Diskussionsrunde „Einheitliche Notfallkarte für den Zugang zur<br />
medizinischen Notversorgung“ fortzusetzen. 2004 wurde das Hauptaugenmerk auf Herz-,<br />
Kreislauf-, und Hirngefäßerkrankungen gelegt.<br />
Auf der organisatorischen Ebene soll das Referentennetzwerk gefestigt und in ein<br />
„Fachnetzwerk zur Definition von diagnostischen und therapeutischen Verfahren“<br />
umgewandelt werden. In einem ersten Schritt sollen Treffen zwischen Fachleuten zum<br />
Austausch und Vergleich von vorhandenem Wissen stattfinden. Im Anschluss daran sollen<br />
den politischen und institutionellen Referenten Vorschläge für eine mögliche weitere<br />
Vorgangsweise unterbreitet werden. Das Ziel besteht in einer Vereinheitlichung und<br />
Integration der Interventionsmaßnahmen durch den Austausch der jeweiligen Modelle und<br />
der verfügbaren wissenschaftlichen Erkenntnisse. Die Kommission IV Gesundheit und<br />
soziale Angelegenheiten würde dabei die Rolle eines Moderators und Förderers<br />
übernehmen und in dieser Funktion dem Netzwerk bei geeigneten Institutionen die<br />
notwendige Unterstützung gewähren. Die Stärkung und Erweiterung des Netzwerks und<br />
seiner Arbeit sowie die Entwicklung spezifischer transnationaler Kooperationsprojekte, die<br />
mit Hilfe eines <strong>im</strong>mer aktiveren Netzwerks realisiert werden können.<br />
8.16.3 Projekt zur Bewertung und Umsetzung der EUROPET-Richtlinien (Transport<br />
von Risikoneugeborenen) in den Alpen-Adria Mitgliedsregionen:<br />
Datenerhebung und Expertenworkshop<br />
Dieses Projekt wird von der Projektgruppe „Schutz von Kindern mit Risikofaktoren“<br />
durchgeführt unter der Projektleitung von Frau Vlasta Mocnik Drnovsek. Ziel der ersten<br />
Projektphase ist die Bewertung und Umsetzung der Richtlinien und europäischen Standards<br />
für den Transport von risikoneugeborenen in den Mitgliedsregionen der Arbeitsgemeinschaft<br />
Alpen-Adria. Diese Richtlinien und Standards wurden von EUROPET (European Network for<br />
Perinatal Transport) entwickelt und veröffentlicht. Die weiteren Projektphasen sehen eine<br />
<strong>Zusammenarbeit</strong> zwischen dem Alpen-Adria Netzwerk und dem europäischen Netzwerk<br />
EUROPET vor, wobei das Hauptaugenmerk auf technische Standards <strong>im</strong><br />
Entwicklungsstadium gelegt werden soll (G. Sedin, Universitätskinderklinik Uppsala,<br />
87
Deutsche Sozialversicherung<br />
Observatorium <strong>EUREGIOsocial</strong><br />
Schweden). Derzeit verfügen sowohl Slowenien als auch Friaul-Julisch Venetien über ein<br />
eigenes Programm zur Erhebung von Daten <strong>im</strong> Bereich der Perinatalmedizin. Da sich die<br />
beiden Programme in Bezug auf die Art und den Umfang der erhobenen Daten ähneln,<br />
sollen sie zu einem einzigen Programm zusammengefasst werden. In einem ersten<br />
Workshop sollen neben Slowenien und Friaul-Julisch Venetien auch andere umliegende<br />
Alpen-Adria Regionen (z.B. Kärnten, Kroatien, Trentino-Südtirol, ungarische Komitate)<br />
teilnehmen. Darüber hinaus wird ein Vergleich und die Evaluierung mit der Entwicklung von<br />
Indikatoren der Qualität der Mutter-Kind-Dienste (einschließlich des Transports schwangerer<br />
Frauen und Neugeborener) und deren Wirksamkeit ermöglicht.<br />
8.16.4 Projektgruppe “Qualität der Gesundheitsdienste”<br />
Diesem Projekt haben sich die Region Venetien, die Republik Slowenien, die ungarischen<br />
Komitate Vas, Zala, Baranya und Györ-Moson-Sopron sowie die österreichischen<br />
Bundesländer Burgenland und Steiermark angeschlossen. Im Anschluss an die beiden<br />
Projektgruppentreffen vom 22. April 2002 in Cividale del Friuli und vom 14. April 2003 in S.<br />
Daniele (Udine) wurde beschlossen, eine Untersuchung über bestehende Qualitätssysteme<br />
durchzuführen. Zu diesem Zweck wurde ein Fragebogen erstellt, der zumindest einem<br />
Krankenhaus pro Region vorgelegt werden soll. Der Fragebogen wurde nach den Kriterien<br />
des EFQM-Modells für Excellence (EFQM: European Foundation for Quality Management)<br />
erstellt. Die Fragebogenitems beziehen sich in erster Linie auf den Krankenhaustyp, auf das<br />
bestehende Qualitätssystem und auf die Aktivitäten, die bereits zum Thema Qualität<br />
durchgeführt werden. Der Fragebogen steht in italienischer und englischer Sprache zur<br />
Verfügung. Die Region Venetien, die sich dem Projekt angeschossen hat, hat <strong>im</strong> September<br />
2003 den Fragebogen für das Krankenhaus Belluno zukommen lassen. Aufgrund des<br />
großen Interesses für das Projekt wurde <strong>im</strong> Laufe des Jahres 2003 von zahlreichen<br />
Mitgliedern der EFQM Health Sector Group (Niederlande, Portugal, Tschechische Republik,<br />
Türkei) die Möglichkeit in Aussicht gestellt, dem Projekt eine europäische D<strong>im</strong>ension zu<br />
verleihen, falls sich neben den Alpen-Adria Regionen noch weitere europäische Regionen<br />
oder Staaten am Projekt beteiligen würden. Die europäische D<strong>im</strong>ension könnte auch in einer<br />
<strong>Zusammenarbeit</strong> mit der European Society for Quality in Healthcare und den<br />
Qualitätsorganisationen der verschiedenen Länder bestehen.<br />
8.16.5 Projektgruppe „Altenhilfe“<br />
Dieses Projekt wird koordiniert von Gulyas Zoltan (Komitat Györ-Moson-Sopron) und wurde<br />
<strong>im</strong> Laufe des Jahres 2003 in einer einfacheren Form als ursprünglich von Dr. Zavaroni<br />
geplant wieder aufgenommen. Der neue Fragebogen wurde von der Universität Györ erstellt<br />
und <strong>im</strong> Juli 2003 übermittelt. Wie <strong>im</strong> ursprünglichen Projekt ging der Fragebogen an alle<br />
Mitgliedsregionen der Arbeitsgemeinschaft Alpen-Adria. Im November 2003 und Januar<br />
2004 fanden in Györ zwei Treffen zum Thema und zu den ersten Ergebnissen statt. Der<br />
ausgefüllte Fraugebogen wurde <strong>im</strong> Januar 2004 an die Universität Györ geschickt. Die<br />
Ergebnisse sollten Mitte 2004 vorliegen. Die DSV konnte leider nicht ermitteln, was die<br />
Auswertung ergeben hat.<br />
8.16.6 Alps Adriatic Disability network<br />
Im Jahre 2003 entstand innerhalb der Arbeitsgemeinschaft Alpen-Adria eine Projektgruppe<br />
„Disability network“, die <strong>im</strong> Jahr 2004 zu einer Arbeitsgruppe aufgewertet wurde. Diese<br />
Arbeitsgruppe steht unter Leitung von Friaul-Julisch Venetien und befasst sich mit<br />
gemeinsamen Fragen der Behindertenfürsorge. Eine Reihe von Informationsveranstaltungen<br />
in den beteiligten Ländern sind geplant und wurden zum Teil bereits durchgeführt. Es wurden<br />
<strong>im</strong> Rahmen der Plenarkonferenz gemeinsame Wege aufgezeigt, wie der freie<br />
Personenverkehr für Menschen mit Behinderungen in Europa erleichtert werden kann.<br />
Dieses Thema wurde insbesondere <strong>im</strong> Licht der bevorstehenden Einführung der<br />
europäischen Krankenversicherungskarte behandelt.<br />
88
Deutsche Sozialversicherung<br />
Observatorium <strong>EUREGIOsocial</strong><br />
8.16.7 Kliniknetzwerk – Kardiologie – Onkologie – Neurologie - Transplantationen<br />
Das Ziel in diesen Bereichen besteht darin, durch konkrete Vergleiche ein gegenseitiges<br />
Kennen lernen und den Austausch von Best Practices zu ermöglichen. Dies soll wiederum<br />
zur Stärkung von Partnerschaften und zur gemeinsamen Teilnahme an Programmen und<br />
Projekten der EU führen.<br />
Für die Kardiologen besteht das Ziel darin, den Wissens- und Erfahrungsaustausch <strong>im</strong><br />
Alpen-Adria Raum zu fördern (Stipendien) und die Basis für die <strong>Zusammenarbeit</strong> an<br />
transnationalen Projekten von gemeinsamen Interesse in den Bereichen Prävention und<br />
Heilung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu legen.<br />
Im Bereich der Onkologie plant die Alpen-Adria Thoracic Oncology Multidisciplinary Group<br />
(ATOM, eine wissenschaftliche Vereinigung, die besonders in Friaul-Julisch Venetien aktiv<br />
ist) mit der Unterstützung der Kommission IV Kooperationen bei klinischen Studien zu<br />
initiieren. Auch sollen klinische Informationen und Informationen über die klinische Praxis der<br />
jeweils untersuchten Krankheiten <strong>im</strong> Internet veröffentlicht und dadurch verglichen werden.<br />
Zur Förderung dieses Wissens- und Erfahrungsaustausches beabsichtigt die Projektgruppe,<br />
auf der Website von Alpen-Adira eine Liste der laufenden klinischen Studien und der<br />
Publikationen zur Verfügung zu stellen.<br />
Die Neurologen planen ein erstes Treffen, bei dem sich die teilnehmenden Regionen und<br />
Staaten (Friaul-Julisch Venetien, Venetien, Slowenien, Kroatien und Kärnten) kennen lernen<br />
sollen, um die jeweiligen Stärken sowie jene Bereiche zu identifizieren, in denen Synergien<br />
möglich sind. Auch soll eine Übersicht über die in den teilnehmenden Staaten und Regionen<br />
angebotenen Dienstleistungen und die zur Verfügung stehenden Technologien erstellt<br />
werden.<br />
Für transnationale Kooperationen <strong>im</strong> <strong>Gesundheitswesen</strong> sind Transplantationen von<br />
größtem Interesse. Diese Relevanz ergibt sich besonders auch aufgrund des <strong>im</strong> Jahr 2004<br />
getroffenen Abkommens zwischen der Region Venetien und der Republik Kroatien.<br />
8.16.8 Arbeitsgruppe „Sozialer Schutz“<br />
Diese Arbeitsgruppe war von 2001 bis 2003 aktiv und wurde von Béla Pörös aus dem<br />
Komitat Baranya koordiniert. Sie befasst sich mit den sozialen Problemen der Menschen in<br />
der Euregion und führte zum Austausch von Erfahrungen und Vorschlägen, die diesen<br />
Bereich verbessern und unterstützen konnten. Es wurden vier Bereiche abgedeckt:<br />
• Erarbeitung einer Alpen-Adria Sozialdatenbank,<br />
• Soziale Probleme von älteren Menschen, <strong>Zusammenarbeit</strong> mit der Projektgruppe<br />
„Altenhilfe“ der Arbeitsgruppe Gesundheitsvorsorge<br />
• Drogenabhängigkeit<br />
• Betreuung von Risikokindern und Risikofamilien<br />
Die letzte Sitzung der Arbeitsgruppe fand am 01.12.2003 statt, der vorgelegte Bericht über<br />
die Änderungen in der Sozialpolitik nach der EU-Erweiterung und über die Notwendigkeit der<br />
<strong>Zusammenarbeit</strong> zwischen Einrichtungen und Organisationen, die <strong>im</strong> Bereich Sozialpolitik<br />
tätig sind, wurde diskutiert und genehmigt.<br />
89
Deutsche Sozialversicherung<br />
Observatorium <strong>EUREGIOsocial</strong><br />
8.16.9 Arbeitsgruppe „Notruf“<br />
Die Arbeitsgruppe hat derzeit zwei Projekte: die Betreuung des Herzstillstandes vor der<br />
Einlieferung ins Krankenhaus und die Betreuung des Schlaganfalls. Bei einem Treffen <strong>im</strong><br />
Oktober 2004 wurden das Dispatch-Modell sowohl für den Notruf bei Herzstillstand als auch<br />
bei Schlaganfall und die Ergebnisse eines ersten Versuchs vorgestellt.<br />
90
Deutsche Sozialversicherung<br />
Observatorium <strong>EUREGIOsocial</strong><br />
8.17 Salzburg-Berchtesgadener Land-Traunstein<br />
Euregio Salzburg - Bertesgadener Land - Traunstein<br />
(D) Eingetragener Verein nach nationalem Vereinsrecht<br />
(A) Eingetragener Verein nach nationalem Vereinsrecht<br />
(Gesamt) 600.000 Einwohner<br />
(D) Landkreise Traunstein und Berchtesgadener Land<br />
265.000 Einwohner<br />
(A) Gemeinden des Landes Salzburg einschließlich der Landeshauptstadt Salzburg<br />
35.000 Salzburg<br />
91
Deutsche Sozialversicherung<br />
Observatorium <strong>EUREGIOsocial</strong><br />
Euregio Salzburg-Berchtesgadener Land-Traunstein<br />
8.17.1 Allgemeines<br />
Die EuRegio an Saalach und Salzach sieht Chancen, die Menschen einander näher zu<br />
bringen, den Wirtschaftsraum als attraktiven Standort besser zu nutzen und gemeinsame<br />
Projekte mit Unterstützung der EU verwirklichen zu können. Bei den Überlegungen zur<br />
„Grenzziehung“ der EuRegio, die offiziell 1995 gegründet wurde, hat man auf tatsächliche<br />
Betroffenheit, bestehende gemeinsame Anliegen und Beziehungen sowie Grenznähe<br />
abgestellt.<br />
8.17.2 Mobile Drogenprävention „guat beinand“<br />
Dieses seit 1997 bestehende Projekt umfasst den Aufbau und Betrieb einer langfristig<br />
angelegten und kontinuierlichen Struktur für zeitgemäße Suchtvorbeugung, die<br />
personenorientierte Maßnahmen beinhaltet sowie gesellschaftliche und euregionale<br />
Rahmenbedingungen miteinbezieht. Projektpartner sind die Caritas-Fachambulanz für<br />
Suchtkranke in Bad Reichenhall und der Verein AKZENTE SALZBURG sowie seit der<br />
zweiten Projektphase auch die Caritas Ambulanz Kreis Traunstein. Das Projekt wurde als<br />
Folgeprojekt auf Gemeindeebene installiert, damit die Betroffenen vor Ort umfassende<br />
Betreuung erhalten.<br />
8.17.3 Grenzüberschreitende AIDS-Hilfe<br />
Das Gesundheitsamt Bad Reichenhall und die AIDS-Hilfe Salzburg arbeiten bei Prävention<br />
sowie Beratung und Betreuung Betroffener zusammen.<br />
8.17.4 Plötzlicher Kindstod<br />
1997 wurde in Salzburg ein Projekt gestartet, welches sich mit der Thematik „Plötzlicher<br />
Kindstod“ (Sudden Infant Death Syndrom/SIDS) befasst. Ziele sind die Verminderung von<br />
Todesfällen sowie der Abbau von Elternängsten. Das Vorhaben wurde um Kooperationen<br />
mit den Krankenhäusern in Bad Reichenhall und Traunstein bzw. Südtirol weiter ausgebaut<br />
und ist mitlerweile abgeschlossen. Ein Elternaufklärungsvideo über den Kindstod wurde<br />
realisiert und wird seither von den Krankenhäusern gezeigt.<br />
92
8.18 Inn-Salzach-Euregio<br />
Deutsche Sozialversicherung<br />
Observatorium <strong>EUREGIOsocial</strong><br />
Inn-Salzach-Euregio<br />
(D) Eingetragener Verein nach nationalem Vereinsrecht<br />
(A) Eingetragener Verein nach nationalem Vereinsrecht<br />
(Gesamt) 862.000 Einwohner<br />
(D) Kreisfreie Stadt Passau, Landkreise Passau (südl. Donau), Rottal-Inn,<br />
Mühldorf, Altötting und Traunstein (Nord)<br />
599.000 Einwohner<br />
(A) Kreise Branau, Ried <strong>im</strong> Innkreis, Grieskirchen und Schärding<br />
263.000 Einwohner<br />
93
Inn-Salzach-Euregio<br />
8.18.1 Allgemeines<br />
Deutsche Sozialversicherung<br />
Observatorium <strong>EUREGIOsocial</strong><br />
Inn und Salzach sind zwei Flüsse, die den Menschen und seine Landschaft über<br />
Jahrhunderte hinweg geprägt haben. Im 13. und 14. Jahrhundert kam mit der Schifffahrt der<br />
Aufschwung für den internationalen Handel. Salz aus Tirol und Getreide aus den<br />
bayerischen Regionen wurde den Inn abwärts bis zum Schwarzen Meer transportiert.<br />
Industrialisierung, allgemeiner Strukturwandel und die Landflucht änderten<br />
Wirtschaftsbeziehungen und Lebensweisen. Da der Untere Inn als Europareservat<br />
ausgewiesen ist, liegen in der Euregio die Schwerpunkte der <strong>Zusammenarbeit</strong> auf den<br />
Gebieten Umwelt/Natur, Tourismus und Landwirtschaft.<br />
8.18.2 Notarztdienst mit Navigationssystem<br />
Sei Mai 1998 fährt der Fridolfinger Notarztdienst (D) verstärkt auch Einsätze in Österreich.<br />
Da die Ärzte auf der anderen Seite der Grenze oft nicht so ortskundig sind, drohte bei der<br />
Suche des Einsatzortes wertvolle Zeit verloren zu gehen. Mit dem neuen Navigationssystem<br />
auf Basis der Satellitenortung, welches mit finanzieller Förderung durch die Euregio<br />
beschafft wurde, hat sich dies geändert.<br />
8.18.3 Interregionale Entwicklung von neurologischen Qualifizierungsmaßnahmen<br />
<strong>im</strong> Grenzbereich Oberösterreich-Niederbayern<br />
Die demographische Entwicklung bringt es mit sich, dass die Anzahl von Menschen mit<br />
erworbenen Hirnschädigungen, und Demenzerkrankungen zun<strong>im</strong>mt. Die Altershe<strong>im</strong>e,<br />
Pflegeeinrichtungen, Therapie- und Betreuungseinrichtungen erfüllen eine unverzichtbare<br />
Arbeit in der Versorgung von Patienten nach Schlaganfällen, nach Schädel-Hirnverletzungen<br />
oder Menschen, die an einer Parkinsonerkrankung, multiplen Sklerose oder Epilepsie leiden.<br />
Das betreuende Pflege- und Therapiepersonal in den diversen Institutionen ist zunehmend<br />
aufgefordert und verpflichtet, fach- und krankheitsspezifische Fort- und Weiterbildung<br />
vorzuweisen.<br />
In Oberösterreich gibt es laut durchgeführter Analysen kaum Schulungsangebote, die auf die<br />
Grundlagen der Neurorehabilitation und der Unterstützung und Betreuung von Menschen mit<br />
neurologischen Erkrankungen näher eingehen. Aber auch bei Angehörigen von Menschen<br />
mit erworbenen Hirnschädigungen wurde deutlich, dass insbesondere Problemsituationen <strong>im</strong><br />
Umgang mit den Erkrankten für die Angehörigen kaum zu bewältigen sind.<br />
In Niederbayern besteht ebenso ein hoher Bedarf an praxisorientierten<br />
Qualifizierungsangeboten für die Rehabilitation und pflegerische Betreuung von Menschen<br />
mit neurologischen Erkrankungen und die Unterstützung der Angehörigen.<br />
Die Gesamtstrategie dieses Projektes zielt darauf hin, Qualifizierungsangebote für die<br />
Rehabilitation und Versorgung von Patienten mit neurologischen Erkrankungen zu<br />
entwickeln. Ziel ist es, innerhalb des Grenzbereiches Oberösterreich/Niederbayern, ein<br />
einheitliches Grundverständnis zu vermitteln, das die aktuellen Entwicklungen in Pflege,<br />
Betreuung, Therapie und Rehabilitation von Menschen mit neurologischen Erkrankungen<br />
berücksichtigt. Das heißt, es werden krankheitsbezogene (z.B. Epilepsie, Schlaganfall,<br />
Schädel-Hirn-Trauma, Demenz) Fortbildungen entwickelt, die die besonderen Bedürfnisse<br />
von Personen mit der jeweiligen Erkrankungsgruppe berücksichtigen und den Schwerpunkt<br />
auf die Weiterbildung von interdisziplinären Teams setzen.<br />
94
Deutsche Sozialversicherung<br />
Observatorium <strong>EUREGIOsocial</strong><br />
8.18.4 Untersuchung „Volkswirtschaftliche Mehrkosten durch die<br />
Doppelvorhaltungen <strong>im</strong> <strong>Gesundheitswesen</strong>“<br />
Bedarfsplanungen, sowohl <strong>im</strong> stationären als auch <strong>im</strong> ambulanten Bereich, berücksichtigen<br />
weder auf bayerischer noch auf österreichischer Seite vergleichbare<br />
Gesundheitseinrichtungen <strong>im</strong> jeweiligen Nachbarland. Dies führt dazu, dass nur wenige<br />
Kilometer voneinander entfernt gleichartige Einrichtungen auf- und ausgebaut werden, ohne<br />
dass die Planungen aufeinander abgest<strong>im</strong>mt sind.<br />
Neben den sicher nicht unerheblichen Investitionskosten, die sich die Träger sparen<br />
könnten, ist in vielen Fällen auch eine wirtschaftliche Auslastung nicht oder nur unzureichend<br />
gegeben.<br />
Im Rahmen dieses Projektes wird wissenschaftlich untersucht, wie hoch die Mehrkosten<br />
durch die Doppelvorhaltungen <strong>im</strong> <strong>Gesundheitswesen</strong> sind. Aufgezeigt werden sollen auch<br />
Wege einer grenzübergreifenden <strong>Zusammenarbeit</strong> und gemeinsame Nutzung von<br />
Einrichtungen. Auch sollen Möglichkeiten aufgezeigt werden, die Gesundheitsvorsorge der<br />
Grenzbevölkerung zu opt<strong>im</strong>ieren, die Kosten <strong>im</strong> <strong>Gesundheitswesen</strong> zu senken und<br />
vorhandene Gesundheitseinrichtungen wirtschaftlicher auszulasten.<br />
8.18.5 Grenzüberschreitender Rettungshubschrauber Christopherus Europa 3<br />
Im Gebiet der Inn-Salzach-Euregio ist seit nunmehr zwei Jahren ein grenzüberschreitender<br />
Rettungshubschrauber installiert, der gemeinsam von ADAC und ÖAMTC betrieben wird.<br />
Rund 1000 Einsätze flog dieser Hubschrauber bereits <strong>im</strong> ersten Probejahr, insgesamt sind<br />
damit 300.000 Menschen in Oberösterreich und 500.000 Menschen in Bayern<br />
notfallmedizinisch bestens versorgt.<br />
95
Deutsche Sozialversicherung<br />
Observatorium <strong>EUREGIOsocial</strong><br />
8.19 EUREGIO Bayerischer Wald-Sumava-Mühlviertel<br />
Euregio Bayerischer Wald, Sumava, Mühlviertel<br />
96<br />
(D/CZ/A) trilateraler kommunaler Verband,<br />
die nationalen Sektoren sind in Vereine organisiert<br />
(CZ) Landkreise Ceský, Krumlov, Prachatice, Domazlice und Klatovy<br />
(D) Landkreise Cham, Regen Freyung-Grafenau, Deggendorf, Straubing, Straubin-Stadt,<br />
Passau, Passau-Stadt<br />
(Gesamt) 1.260.000Einwohner<br />
16.345 km²
Deutsche Sozialversicherung<br />
Observatorium <strong>EUREGIOsocial</strong><br />
Euregio Bayerischer Wald, Sumava, Mühlviertel<br />
8.19.1 Allgemeines<br />
Die Euregio bayerischer Wald –Böhmerwald wurde 1994 als trilateraler kommunaler<br />
Verband gegründet. Zielsetzung war dabei vor allem, die gegenseitigen<br />
grenzüberschreitenden soziokulturellen Kontakte zu koordinieren, zu unterstützen und zu<br />
fördern. Seit dieser Zeit betreibt die Euregio bayerischer Wald – Böhmerwald die<br />
Verwirklichung der Idee grenzenloser Partnerschaften. Sie versucht, Gemeinsamkeiten aus<br />
Geschichte, Kultur und aus dem öffentlichen Leben zu intensivieren. Die EUREGIO ist<br />
geprägt vom Gedanken der guten Nachbarschaft. Das Gemeinsame und das Miteinander<br />
sollen <strong>im</strong> Vordergrund stehen.<br />
8.19.2 Protein Chip-Net<br />
Bildung eines grenzüberschreitenden wissenschaftlichen Netzwerkes zur Entwicklung von<br />
„Protein Chips“ <strong>im</strong> Bereich der Lebensmittelsicherheit, Nutzung des komplementären<br />
Wissens und Ausbau der Synergien in der Forschung und Entwicklung von Proteinchips als<br />
Diagnostiksystem, Entwicklung eines „Protein Chips“ als Demonstrationsprojekt <strong>im</strong> Bereich<br />
Verbraucherschutz zur Gewährleistung der Lebensmittelsicherheit: Detektion von<br />
Lebensmittelallergenen und Pilsgiften in Nahrungsmitteln. Träger ist IFA Tulln<br />
8.19.3 MEANDER<br />
Der zentrale Ausgangspunkt des Projektes liegt in der Betrachtung des Systems Familie mit<br />
einem behinderten Kind. Dieses gesamte Familiensystem ist durch die Behinderung des<br />
Kindes in seinem Gleichgewicht gestört und oftmals sogar gefährdet, da die Familie<br />
Belastungen vielfacher Art hat. Das Projekt ist auf zwei Zielgruppen ausgerichtet, einerseits<br />
auf Angehörige von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen, zweitens auf Mitarbeiter<br />
von Institutionen, Vereinen etc., die in der Betreuungsarbeit von Kindern und Jugendlichen<br />
mit Behinderungen tätig sind. Inhalte sind der fachliche Austausch <strong>im</strong> In- und Ausland,<br />
Symposium, Unterstützung der Familien, Beratungs- und Betreuungsangebote, präventive<br />
Ansätze zur Abwendung von Überlastungs- und Krisensituationen, Aufbau von Angeboten in<br />
ländlichen Gebieten für betroffene Familien. Träger ist die Caritas für Menschen mit<br />
Behinderungen.<br />
97
8.20 Euregio Egrensis<br />
Deutsche Sozialversicherung<br />
Observatorium <strong>EUREGIOsocial</strong><br />
Euregio Egrensis<br />
(CZ/D) Eingetragene Vereine nach nationalem Vereinsrecht<br />
(Gesamt) 1.900.000 Einwohner<br />
17.000 km ²<br />
98
Euregio Egrensis<br />
8.20.1 Allgemeines<br />
Deutsche Sozialversicherung<br />
Observatorium <strong>EUREGIOsocial</strong><br />
Die EUREGIO EGRENSIS hat nach ihrer Satzung den Zweck, zu Verständigung und<br />
Toleranz beizutragen sowie umfassend, friedlich und partnerschaftlich über die Grenzen<br />
zwischen dem Freistaat Bayern, den Freistaaten Sachsen und Thüringen sowie der<br />
Tschechischen Republik hinweg zusammenzuwirken. Die EUREGIO EGRENSIS koordiniert<br />
und fördert <strong>im</strong> Geiste guter Nachbarschaft und Freundschaft die grenzüberschreitende<br />
<strong>Zusammenarbeit</strong> und Entwicklung.<br />
Das Dreiländereck Bayern-Sachsen/Thüringen-Böhmen hat eine über 800-jährige<br />
wechselvolle Geschichte und war bis zum Zweiten Weltkrieg ein eng verflochtener<br />
gemeinsamer Lebens- und Wirtschaftsraum <strong>im</strong> Brennpunkt Europas.<br />
Nach dem Zweiten Weltkrieg brachen mit der Schließung der Grenzen alle Beziehungen in<br />
der Region ab. Eine <strong>Zusammenarbeit</strong> in den unterschiedlichsten Bereichen – ob soziale,<br />
wirtschaftliche oder kulturelle Kontakte – war unmöglich geworden. Jeder Teilraum<br />
entwickelte sich zwangsläufig unabhängig vom Grenznachbarn. Gemeinsam war allen<br />
Teilregionen in den folgenden Jahrzehnten, dass jede gegen die Nachteile ankämpfen<br />
musste, die sich aus ihrer nunmehr peripheren Lage <strong>im</strong> eigenen jeweiligen Staatsgefüge<br />
ergaben.<br />
Die Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten sowie die politische Wende in Mittel-<br />
und Osteuropa 1989/1990 stellten eine historische Zäsur dar und haben für die Region<br />
Bayern-Sachsen/Thüringen-Böhmen grundlegend neue Rahmenbedingungen geschaffen,<br />
die den gesamten Raum nachhaltig verändern werden.<br />
Das Gesamtgebiet der EUREGIO EGRENSIS erstreckt sich auf rund 20 000 km 2 und zwei<br />
Millionen Einwohner. Etwa 50 % davon entfallen auf den bayerischen Teil, ca. 30 % auf den<br />
sächsisch/thüringischen sowie 20 % auf den tschechischen Teil. Es umschließt in etwa das<br />
Gebiet von Greiz und Plauen <strong>im</strong> Norden bis Schwandorf <strong>im</strong> Süden sowie von Kronach,<br />
Bayreuth und Amberg <strong>im</strong> Westen bis Tachov und Karlsbad <strong>im</strong> Osten.<br />
Im Bereich des Kurwesens hat die EUREGIO EGRENSIS eine ihrer Stärken. Im „Kurherz<br />
Europas“ (http://www.kurherzeuropas.com) gibt es eine Vielzahl an Kurorten, die so dicht<br />
aneinander gereiht sind, wie nirgendwo sonst in Europa. Diese Bäderlandschaft <strong>im</strong><br />
sächsischen, böhmischen, bayerischen Raum bietet eine Vielzahl an unterschiedlichen<br />
Kurbehandlungen an.<br />
8.20.2 Fachakademie Haus Silberbach<br />
Die Fachakademie Haus Silberbach wird zurzeit vom Evangelischen Jugend- und<br />
Fürsorgewerk Berlin ins Leben gerufen. Die Fachakademie will <strong>im</strong> deutsch-tschechischen<br />
Grenzraum Qualifizierungen und Beratungen v.a. für Fragen sozialer Randgruppen anbieten.<br />
Das Fort- und Weiterbildungsangebot soll sich u.a. an Mitarbeiter der öffentlichen und freien<br />
Träger des psychosozialen Bereichs sowie an Behörden und Verbände aus Bayern und<br />
Tschechien wenden.<br />
8.20.3 Koordinierungsstelle grenzüberschreitende Kooperation in der<br />
Pflegeausbildung<br />
Die Beruflichen Fortbildungszentren der Bayerischen Wirtschaft (bfz) richten ab dem Jahr<br />
2005 eine Koordinierungsstelle grenzüberschreitende Kooperation in der Pflegeausbildung<br />
ein. Ziel ist es, eine dauerhafte gemeinsame Ausbildung auf europäischem Niveau zu<br />
schaffen. Es sollen u.a. gemeinsame Unterrichtseinheiten und –Materialien entwickelt<br />
werden.<br />
99
Deutsche Sozialversicherung<br />
Observatorium <strong>EUREGIOsocial</strong><br />
8.20.4 Kompetenzzentrum – Vorsprung durch Qualität (VdQ)<br />
Das Kompetenzzentrum „Vorsprung durch Qualität“ ist Ansprechpartner für Fachverbände<br />
und Einrichtungen <strong>im</strong> Bereich Kur, Prävention und Rehabilitation. In diesem Rahmen werden<br />
in der Region eine Vielzahl von praxisorientierten Qualitätsmanagement-Instrumenten<br />
angeboten (z.B. Durchführung von internen Qualitätsaudits, Qualitätszirkel,<br />
Ausbildungsangebote zur Vorbereitung von Qualitäts-Verbundzertifizierungen und<br />
eigenständige Ausbildung).<br />
Ergebnis: Erfolgreiche Zertifizierung der Sächsischen Staatsbäder Bad Elster und Bad<br />
Brambach 2003. www.medkur.de<br />
8.20.5 Terraintherapie<br />
Es handelt sich um eine Bewegungstherapie, die auf die Heilung von<br />
Stoffwechselkrankheiten abzielt, die auf Bewegungsmangel zurückzuführen sind.<br />
Gemeinsame sächsisch-tschechische Arbeit an der Anpassung der klassischen Kl<strong>im</strong>a-<br />
Terraintherapie an neue Standards zum Einsatz in den Kurorten. www.medkur.de<br />
8.20.6 Begegnung deutscher und tschechischer Behinderter<br />
Austausch über die Lage der Behinderten in den beiden Staaten. Insbesondere wird über die<br />
bestehenden (Sachsen) und die <strong>im</strong> Aufbau befindlichen (Tschechien) Selbsthilfegruppen,<br />
deren Inhalte und Möglichkeiten. www.Hephata.de<br />
8.20.7 KARO-zielgruppenspezifische grenzüberschreitende Sozialarbeit in der<br />
Prostitutions- und Drogenszene<br />
Das Projekt bemüht sich um die Eindämmung der mit Prostitution und Drogenmissbrauch<br />
verbundenen Gesundheits- und Sozialrisiken bis zur Hilfe bei Schutz- und<br />
Resozialisierungsmaßnahmen. Es wird eine sehr starke Öffentlichkeits- und<br />
Informationsarbeit durchgeführt. www.KARO-sozialprojekt.de<br />
8.20.8 Netzwerk zur regionalen Qualitätsoffensive<br />
Das Projekt baut auf zwei Säulen auf:<br />
1. Entwicklung von Instrumenten zur Ergebnisqualitätsmessung <strong>im</strong> Kur- und<br />
Rehabilitationsbereich<br />
2. Modellentwicklung für die Integration des Kurwesens in ein zukunftsfähiges System<br />
der Gesundheitsfürsorge und Prävention<br />
Geplant ist die Entwicklung der <strong>Zusammenarbeit</strong>, Knowhow-Transfer zwischen den<br />
Kooperationspartnern und die Schaffung der Voraussetzungen dazu. www.medkur.de<br />
100
8.21 Euroregion Erzgebirge-Krusnohorí<br />
Deutsche Sozialversicherung<br />
Observatorium <strong>EUREGIOsocial</strong><br />
Euroregion Erzgebirge-Krusnohorí<br />
Freiwillige Interessengemeinschaft der Gebietskörperschaften<br />
Erzgebirge/Krusnohori 2.248 km² auf sächsischem Gebiet<br />
3.090 km² auf tschechischem Gebiet<br />
mit Höhenlagen zwischen 2000 und 1214 m (Fichtelberg) bzw. 1244 m (Keilberg)<br />
(Gesamt) 767.947 Einwohner<br />
(D) 437.086 Einwohner<br />
(CZ) 330.888 Einwohner<br />
101
Euroregion Erzgebirge-Krusnohori<br />
Deutsche Sozialversicherung<br />
Observatorium <strong>EUREGIOsocial</strong><br />
8.21.1 Allgemeines<br />
Die Euroregion Erzgebirge mit ihren Kreisen Annaberg, Freiberg, Mittlerer Erzgebirgskreis<br />
uns Stollberg, liegt <strong>im</strong> Südosten der Bundesrepublik Deutschland und bildet mit der<br />
Grenzanbindung seiner Kreise Annaberg, Mittlerer Erzgebirgskreis und Freiberg an die<br />
Tschechische Republik einen Teil der östlichen Außengrenze der Europäischen Union.<br />
Westlich grenzt die Euregio Egrensis und östlich die Euroregion Elbe/Labe an die Euroregion<br />
Erzgebirge.<br />
8.21.2 Sozialer Atlas<br />
Zu einen der ersten Initiativen des Regionalbüros der Grenzregion gehörte die Erstellung<br />
eines sozialen Atlas. In ihm werden sämtliche Projekte <strong>im</strong> sozialen Bereich vorgestellt. Ziel<br />
ist es eine Kontaktaufnahme der einzelnen Projekte untereinander zu erleichtern und einen<br />
gegenseitigen Austauschprozess anzustoßen. Mittlerweile ist der Atlas vergriffen. Eine neue<br />
Auflage mit Überarbeitung ist jedoch in Planung.<br />
8.21.3 Wörterbuch für die Feuerwehr<br />
Um grenzüberschreitende Hilfestellungen <strong>im</strong> Bereich des Brandschutzes zu ermöglichen,<br />
gibt das Regionalbüro ein Deutsch-Tschechisches Wörterbuch zur Technologie der<br />
Brandbekämpfung heraus. In der Broschüre werden alle wichtigen Fachtermini für<br />
Feuerwehrleute vom Deutsch ins Tschechische übersetzt und umgekehrt. Dadurch sollen<br />
grenzübergreifende Einsätze der Feuerwehr erleichtert werden.<br />
Die Broschüre wird von dem Regionalbüro und den Beteiligten als Erfolg angesehen,<br />
weswegen man nun ein medizinisches Wörterbuch, besonders für die erste Hilfe,<br />
herausgeben möchte. Der Nachfolger des Brandschutzwörterbuchs richtet sich besonders<br />
an Rettungskräfte, soll aber auch von normalen Bürgern genutzt werden können.<br />
102
Deutsche Sozialversicherung<br />
Observatorium <strong>EUREGIOsocial</strong><br />
8.22 Euroregion ELBE/ LABE – derzeit keine Projekte<br />
Euregio Elbe/ Labe<br />
(Gesamt) 1.400.000 Einwohner<br />
5.547 km ²<br />
(D) Dresden, Pirna, Freital, Meißen<br />
908.000 Einwohner<br />
(CZ) Ustí nad Labem, Decín, Teplice, Litomerice<br />
496.000 Einwohner<br />
103
8.23 Euroregion Neisse-Nisa-Nysa<br />
Deutsche Sozialversicherung<br />
Observatorium <strong>EUREGIOsocial</strong><br />
104<br />
Euroregion Neisse Nisa Nysa<br />
Freiwillige Interessengemeinschaft<br />
(D) Kommunalgemeinschaft Eureregion Neisse e.V.<br />
(CZ) Regionenverband: Regionálni sdruzení EUROREGION NISA<br />
(P) Gemeindeverband Stowarzyszenie Gmin Polskich EUROREGIONNU NYSA<br />
Gesamt: 1.775.000 Einwohner<br />
(D) 656.000 Einwohner<br />
(CZ) 435.000 Einwohner<br />
(P) 684.000 Einwohner
Euroregion Neisse Nisa Nysa<br />
Deutsche Sozialversicherung<br />
Observatorium <strong>EUREGIOsocial</strong><br />
8.23.1 Allgemeines<br />
Die Euroregion Neisse-Nisa-Nysa (ERN) umfasst drei Grenzgebiete, die am<br />
Berührungspunkt der Tschechischen Republik, der Bundesrepublik Deutschland und der<br />
Republik Polen gelegen sind. Diese drei Gebiete sind miteinander durch viele gemeinsame<br />
Probleme und Interessen verbunden, die aus der jahrhundertealten wechselvollen<br />
Geschichte des europäischen Kontinents resultieren. Die Euroregion entstand auf der<br />
Initialkonferenz, die <strong>im</strong> Mai 1991 in Zittau unter der Schirmherrschaft der Präsidenten der<br />
drei Länder: Vaclav Havel, Richard von Weizsäcker und Lech Wał sa und unter Beteiligung<br />
von über 300 Vertretern der tschechischen, deutschen und polnischen Bevölkerung<br />
stattfand. Ende 1991 erklärten 34 Gemeinden der ehemaligen Jelenia Góra-Wojewodschaft,<br />
fünf Landkreise aus Nordtschechien und neun Landkreise sowie eine Kreisfreie Stadt aus<br />
Ostsachsen ihren Beitritt zur Euroregion. Die offizielle Entstehung der Euroregion fällt auf<br />
den 21. Dezember 1991 – dies ist das Datum der ersten Ratssitzung in Zittau, in der<br />
dieDelegierten der drei Seiten den Beschluss fassten, die neue, erste in Mittel- und<br />
Osteuropa grenzüberschreitende Struktur „EUROREGION NEISSE-NISA-NYSA“ zu<br />
gründen.<br />
Das Gebiet der Euroregion Neisse-Nisa-Nysa umfasste 2002 eine Fläche von etwa 13 000<br />
km², davon beträgt der deutsche Anteil 35 Prozent, der polnische 44 Prozent und der<br />
tschechische 21 Prozent. In diesem Gebiet wohnen fast 1,7 Millionen Menschen, davon<br />
leben auf der deutschen Seite 39 Prozent, auf der polnischen Seite 35 Prozent und auf der<br />
tschechischen fast 26 Prozent der Menschen. Im mittleren und südlichen Teil der Euroregion<br />
dominiert die Gebirgslandschaft (Isergebirge, Zittauer Gebirge, Lausitzer Gebirge,<br />
Riesengebirge) und das Sudeten- und Untersudetenhochland. Der nördliche Teil ist<br />
gekennzeichnet durch Heide- und Teichlandschaften.<br />
Seit Schaffung der Euroregion Neisse-Nisa-Nysa konnten die Bedingungen für die<br />
<strong>Zusammenarbeit</strong> der Grenzgebiete verbessert werden. Im Rahmen gemeinsamer<br />
Arbeitsgruppen und Kommission entstand ein reger Erfahrungsaustausch in den Bereichen<br />
Infrastruktur, Wirtschaft, Umwelt, ländlicher Raum, <strong>Gesundheitswesen</strong>, Sicherheit,<br />
Tourismus, Kultur und Bildung. Heute gibt es insgesamt 14 grenzüberschreitende<br />
Euroregionale Expertengruppen (EUREX); eine davon ist die EUREX Öffentliche<br />
Gesundheit.<br />
8.23.2 Euroregionale Expertengruppe Öffentliche Gesundheit<br />
Zu den Aufgabenschwerpunkten der Arbeitsgruppe zählen:<br />
- laufender epidemiologischer Datenaustausch zwischen Liberec, Jelenia Góra, Löbau-<br />
Zittau und Görlitz,<br />
- grenzüberschreitender praktizierter Seuchenschutz,<br />
- Austausch und Veröffentlichung von Badewasserqualitäten für die gesamte Euroregion<br />
sowie<br />
- Informationsaustausch zu den vorhandenen medizinischen Einrichtungen einschließlich<br />
vorhandener Laborkapazitäten <strong>im</strong> Rahmen des medizinischen Katastrophenschutzes.<br />
Besonders hervorzuheben sind dabei folgende Projekte:<br />
8.23.3 Telekardiologisches Netzwerk Ostsachsen<br />
In einer Laufzeit vom Januar 2003 bis Dezember 2004 wurde in Trägerschaft des<br />
Städtischen Klinikums Görlitz ein grenzüberschreitendes Netzwerk zum Management von<br />
Infarkten und Rhythmusstörungen auf Basis eines Telekardiologischen Netzwerkes<br />
geschaffen.<br />
105
Deutsche Sozialversicherung<br />
Observatorium <strong>EUREGIOsocial</strong><br />
Neben der Schaffung, Verbesserung und Vereinheitlichung der medizinischen Infrastruktur<br />
zur Betreuung von kardiologischen Notfallpatienten auf deutscher und polnischer Seite,<br />
diente das Projekt gleichzeitig der Ausbildung deutscher und polnischer Studenten und Ärzte<br />
am Klinikum Görlitz.<br />
Es wurde ein einheitlicher Versorgungs- und Behandlungsablauf von kardiologischen<br />
Notfallpatienten in fachlicher, apparativer und logistischer Hinsicht erarbeitet. Darin enthalten<br />
sind die telemetrische Übermittlung von Notfall-EKGs an ein kardiologisches Zentrum,<br />
Lenkung der Notfallpatienten an die jeweilige medizinische Einrichtung, Vorbereitung des<br />
behandelnden Krankenhauses auf die Einweisung des kardiologischen Notfallpatienten<br />
sowie Beratung von Ärzten und Patienten anhand übermittelter Befunde. Mit Schaffung einer<br />
verbesserten medizinischen Infrastruktur ist es möglich, die indikationsgerechte Zuweisung<br />
von Patienten zu den jeweiligen kooperierenden Einrichtungen mit einer höheren Effizienz in<br />
der Behandlung durchzuführen.<br />
Die Weiterführung nach Ablauf der Förderung basiert auf einer dauerhaften <strong>Zusammenarbeit</strong><br />
zwischen den Rettungsdiensten, den Leitstellen und den Krankenhäusern auf deutscher und<br />
polnischer Seite <strong>im</strong> Interesse der Durchsetzung der europäischen Leitlinien zu einheitlicher<br />
Versorgung- und Behandlung von kardiologischen Notfallpatienten.<br />
8.23.4 Präventionsarbeit<br />
In <strong>Zusammenarbeit</strong> mit der ERN mit dem Staatsministerium für Soziales, Gesundheit,<br />
Jugend und Familie wurde 1997 das Projekt in Trägerschaft der Arbeiterwohlfahrt<br />
Kreisverband Bautzen e.V zum Aufbau eines Netzwerkes sowie zur Weiterbildung <strong>im</strong><br />
Bereich der grenzüberschreitenden Suchtprävention initiiert und in einem Folgevorhaben<br />
2002 fortgeführt. Der zunehmende Handlungsbedarf bestand insbesondere auf dem Gebiet<br />
der Drogen- und Suchprävention <strong>im</strong> Bereich der Jugendarbeit und der<br />
Bildungseinrichtungen. Ziel war es, die Beschäftigten auf dem Gebiet der Drogen und<br />
Suchtmittel zu sensibilisieren und entsprechend weiterzubilden.<br />
Dabei galt es einen Beitrag in der Kommunikation und Kooperation der in der<br />
Suchtprävention tätigen Mitarbeiter und Institutionen/ Organisationen durch<br />
ressortübergreifende Vernetzungsstrukturen der Bereiche Gesundheit, Soziales, Bildung,<br />
Jugend und Polizei zu leisten. Es wurden flächendeckende vernetzte Präventionsangebote<br />
in der Suchtprävention erarbeitet und die nachbarlichen Beziehungen durch die Aufstellung<br />
gemeinsamer Ziele der <strong>Zusammenarbeit</strong> und damit die Entwicklung einer Identität für den<br />
Lebensraum Grenzregion verbessert.<br />
Unter dem Motto „Grenzüberschreitende Präventionsarbeit gegen AIDS“ haben sich 2002<br />
etwa 195 Jugendliche aus den Nachbarländern Polen und Tschechien zu einem trilateralen<br />
Jugendtreffen in Zittau eingefunden. In gemischten trilateralen Kleingruppen wurde zunächst<br />
die Ausstellung der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung „Liebesleben“ besucht.<br />
Zu erfahren war mit Unterstützung der Fachmitarbeiter Wissenswertes über Sexualität,<br />
Verhütung, Prävention, Toleranz und Aids.<br />
8.23.5 Prostituiertenbetreuung<br />
Unter dem Titel „Psychosoziale und grenzüberschreitende Prävention in den<br />
Prostitutionsszenen der ERN fand in Trägerschaft des Diakonischen Werkes Zittau von 1996<br />
– 2001 ein Projekt <strong>im</strong> Rahmen der Sozialhilfearbeit statt. Es wurden mobile Beratungen in<br />
verschiedenen Prostitutionsszenen durchgeführt, Zielgruppen Informationen über<br />
Geschlechtskrankheiten vermittelt sowie HIV/AIDS und Beratungsangebote örtlicher<br />
Einrichtungen entwickelt. Frauen in diesen Szenen erhielten nach Möglichkeit eine<br />
allgemeine Lebensberatung und Ausstiegshilfen und venerologische Untersuchungen<br />
organisiert.<br />
In Trägerschaft des Multikulturellen Zentrums Zittau e.V. wurde in den Jahren 2002 und 2003<br />
vom Projekt KOBRA-NET „Dienst am Menschen unterwegs“ in der Euroregion Neisse ein<br />
grenzübergreifendes Netzwerk gegen Frauen- und Kinderhandel aufgebaut.<br />
106
Deutsche Sozialversicherung<br />
Observatorium <strong>EUREGIOsocial</strong><br />
In diesem Zusammenhang wurden gemeinsam mit dem BGS, dem Gesundheitsamt des<br />
Landkreises Löbau – Zittau, KOBRA-NET, tschechischen und polnischen NGOs der<br />
Euroregion Neisse, die <strong>im</strong> Streetwork in Prostitutions- und Drogenszenen medizinische,<br />
soziale und rechtliche Unterstützungsangebote leisteten, monatliche Grenzprojekte<br />
durchgeführt. Ziel dieses Projektes war es, über das Verteilen von Infomaterialien und<br />
Kondomen, unmittelbar an den PKW Grenzübergängen präventiv über die medizinische<br />
Situation der Prostituierten, damals noch auf dem Straßenstich, zu informieren.<br />
Die Grenzprojekte liefen in den Abend und Nachstunden, in denen man Freiertransit<br />
vermuten konnte. Im gemeinsamen Streetwork auf polnischer und tschechischer Seite der<br />
Euroregion Neisse, wurde KOBRA-NET sehr bald darauf aufmerksam, dass viele der<br />
Prostituierten keinesfalls freiwillig arbeiten. Immer mehr Frauen suchten Ausstiegshilfe über<br />
KOBRA-NET. Die Menschenhändlerringe reagierten auf das Streetwork durch NGOs und die<br />
erhöhte Ermittlungsbereitschaft der Polizei, indem sich der Straßenstrich <strong>im</strong> Polen und<br />
Tschechien auflöste und Zwangsprostitution in bordellartige Einrichtungen verlagerte. In<br />
diesem Zusammenhang wurde der Streetworkzugang durch KOBRA-NET in Polen und<br />
Tschechien extrem erschwert, zumal gewachsene Kooperationspartner in Polen und<br />
Tschechien wegbrachen. Ab diesem Zeitpunkt, etwa Mitte 2003, entwickelte sich das Projekt<br />
KOBRAnet zur Fachberatungsstelle für Opfer von Menschenhandel in Sachsen und wird als<br />
diese heute vom Land Sachsen mit zwei Zweigstellen finanziert.<br />
8.23.6 Ausgewählte Gesundheitskonferenzen<br />
03.- 04.05.1995 - Chirurgentagung unter Berücksichtigung der grenzüberschreitenden<br />
Notfallversorgung in Görlitz<br />
Dazu wurden 200 deutsche, 50 polnische und 50 tschechische Chirurgen erwartet. Neben<br />
Fragen der Therapie wurde die Rettung von Menschen <strong>im</strong> grenzüberschreitenden Einsatz<br />
der Rettungsdienste behandelt.<br />
12.05.1995 – Sozialkonferenz „Östliche EU-Außengrenze – Herausforderung für die Region<br />
aus der Sicht des Sozialministers Dr. Geisler<br />
Im Ergebnis der Konferenz konnte die grenzüberschreitende <strong>Zusammenarbeit</strong> bei der<br />
Prävention von sexuellen Erkrankungen und Aids auf eine neue qualitative Stufe gehoben<br />
werden.<br />
12.05.1999 – Fachkonferenz zur Suchproblematik in der Euroregion Neiße zum Thema<br />
„Eltern-Kinder-Sucht“<br />
Als Ergebnis der Konferenz wurde die Erziehungsverantwortung zum Schutz unserer Jugend<br />
in der Familie bei den Eltern, in den Schulen und in der Mitverantwortung der zuständigen<br />
Ämter und Organisationen gesehen.<br />
Die fachliche <strong>Zusammenarbeit</strong> in den drei Ländern wurde verbessert und erste<br />
Schülermultiplikatoren zur Problematik Sucht konnten bis zu diesem Zeitpunkt ausgebildet<br />
werden.<br />
107
8.24 Euroregion Spree-Neisse-Bober<br />
Deutsche Sozialversicherung<br />
Observatorium <strong>EUREGIOsocial</strong><br />
108<br />
Euroregion Spree-Neisse-Bober<br />
Eingetragener Verein<br />
Gesamt 906.500 Einwohner<br />
(D) 266.500 Einwohner<br />
1812 km²<br />
(P) 640.000 Einwohner<br />
7981 km²
Spree-Neiße Bober<br />
Deutsche Sozialversicherung<br />
Observatorium <strong>EUREGIOsocial</strong><br />
8.24.1 Allgemeines<br />
Die drei Flüssenamen in der deutschen und polnischen Lausitz geben der Euroregion ihre<br />
Bezeichnung. Sie ist eine von vier Euroregionen entlang der deutsch-polnischen Grenze und<br />
entstand 1993. Ihre Dachorganisation ist die AGEG. Auf der deutschen Seite ist die<br />
Euroregion als eingetragener Verein organisiert, in dem Kommunen und Unternehmen,<br />
Hochschulen, Institutionen, Vereine und Bürger auf freiwilliger Basis zusammenarbeiten.<br />
Satzungsgemäß ist es die Aufgabe der Euroregion Spree-Neiße-Bober, die Probleme der<br />
Grenzregion überwinden zu helfen, eine regionale Identität zu entwickeln, Deutsche und<br />
Polen in einer gemeinsamen Wirtschaftsregion mit verbesserten und vor allem<br />
gleichwertigen Lebensverhältnissen zusammenzuführen. Auf dem polnischen Territorium ist<br />
die Euroregion als Verband der polnischen Gemeinden organisiert, d.h. es gibt nur<br />
kommunale Mitglieder. Eine Rahmenvereinbarung regelt die <strong>Zusammenarbeit</strong> zwischen dem<br />
deutschen und dem polnischen Teil der Euroregion Spree-Neiße-Bober/ Sprewa-Nysa-Bóbr<br />
Die deutsch-polnische Gesundheitsakademie ist ein in Deutschland eingetragener Verein,<br />
mit paritätischer Besetzun <strong>im</strong> Vorstand. Ziel ist die Koordinierung und Ist-Analyse von<br />
Gesundheitsmaßnahmen in der Euregio.<br />
8.24.2 Projektantrag Interreg III A<br />
Die deutsch-polnische Gesundheitsakademie hat für den Zeitraum 2005 bis 2007 ein<br />
Interreg III A Projekt beantragt, innerhalb dessen eine Ist-Analyse der gesundheitlichen<br />
Versorgung und Erarbeitung von Vorschlägen zur Realisierung grenzüberschreitender<br />
Kooperationen gefertigt werden soll.<br />
8.24.3 Arbeitstagung Rettungswesen in Polen und Deutschland - Möglichkeiten<br />
der grenzüberschreitenden <strong>Zusammenarbeit</strong><br />
Diese Arbeitstagung in Dychow/ Republik Polen zeigte Möglichkeiten auf, wie<br />
grenzüberschreitende <strong>Zusammenarbeit</strong> <strong>im</strong> Rettungswesen in Polen und Deutschland<br />
aufgebaut werden kann. Sie fand am 29./30.06.2005 statt.<br />
8.24.4 Arbeitstagung Gesundheitsmonitoring von Kindern und Jugendlichen<br />
Am 28.09.2005 wird in Frankfurt/Oder eine Arbeitstagung stattfinden, die als Ausgangspunkt<br />
für gemeinsame Präventionsmaßnahmen in den Euroregionen Pomerania, Pro Europa<br />
Viadrina, Spree-Neiße Bober über ein Gesundheitsmonitoring von Kindern und Jugendlichen<br />
berät.<br />
8.24.5 Mitarbeit bei der AG „grenzüberschreitende stationäre Versorgung“ <strong>im</strong><br />
Rahmen des Projektes EU-MED-EAST<br />
Dieses Förderprogramm, wurde abgeschlossen zwischen dem Freistaat Sachsen, dem<br />
westlichen Tschechien und dem südlichen Polen. Es ist in drei Unterarbeitsgruppen<br />
unterteilt. Die AG grenzüberschreitende stationäre Versorgung konzentriert sich auf den<br />
Bereich der Telemedizin. Sie versucht die Vernetzung des Datenaustauschs zwischen den<br />
einzelnen Krankenhäusern zu unterstützen. Darüber hinaus soll ein verlässlicher Austausch<br />
von Qualitätsstandards erfolgen. Die AG Logistik hat das Ziel Einkaufsgemeinschaften <strong>im</strong><br />
Bereich der Arzne<strong>im</strong>ittelversorgung und z.B. be<strong>im</strong> Geräteeinkauf. Die dritte AG beschäftigt<br />
sich mit der Ausbildung in Gesundheitsberufen: Hier findet zunächst einmal nur ein<br />
Austausch über Ausbildungsinhalte der Projektteams aus 3 Ländern in Breslau statt.<br />
109
8.25 Euroregion PRO EUROPA VIADRINA<br />
Deutsche Sozialversicherung<br />
Observatorium <strong>EUREGIOsocial</strong><br />
110<br />
Euroregion PRO EUROPA VIADRINA<br />
Eingetragener Verein nach nationalem Vereinsrecht<br />
(Gesamt) 849.000 Einwohner<br />
10.726 km²<br />
(D) Landkreise Märkisch-Oderland, Landkreis Oder-Spree, Stadt Frankfurt (Oder)<br />
(P) 29 Gemeinden siehe Karte
Euroregion Pro Europa Viadrina<br />
Deutsche Sozialversicherung<br />
Observatorium <strong>EUREGIOsocial</strong><br />
8.25.1 Allgemeines<br />
Das Gebiet der Euroregion Pro Europa Viadrina erstreckt sich links und rechts der Oderufer.<br />
Der Fluss ist das charakteristische Landschaftsmerkmal. Die Trägerschaft der Euroregion<br />
Pro Europa Viadrina hat auf deutscher Seite der Verein „Mittlere Oder e. V.”, in Polen der<br />
„Verein der polnischen Gemeinden der Euroregion Pro Europa Viadrina”. Die Mitglieder, die<br />
die Arbeit der Trägervereine wesentlich mittragen, sind auf der deutschen Seite die<br />
Landkreise Märkisch-Oderland, Landkreis Oder-Spree, die Stadt Frankfurt (Oder) sowie<br />
zahlreiche wichtige Institutionen aus Wirtschaft, Kultur und anderen gesellschaftlichen<br />
Bereichen. Auf der polnischen Seite gehören 29 Gemeinden dem Verein an.<br />
Die Euregion soll integrieren und das Zusammenwachsen <strong>im</strong> deutsch-polnischen<br />
Grenzbereich auf verschiedenen Ebenen initiieren, unterstützen und fördern. Sie soll zur<br />
Hebung des Lebensniveaus und zur Erhöhung der Wirtschaftskraft beitragen. Die Arbeit der<br />
Euroregion Pro Europa Viadrina verfolgt das Ziel, die Region beiderseits der Grenze auf eine<br />
noch stärker verflochtene, gemeinsame Zukunft vorzubereiten, weshalb sie die Erweiterung<br />
der Europäischen Union unterstützt und mitgetragen hat.<br />
Die Euroregion Pro Europa Viadrina wurde am 23.12.1993 gegründet. Die Gesamtregion<br />
umfasst ein Territorium von 10.726 km² mit einer Bevölkerung von 849.000 Menschen<br />
8.25.2 Vorbeugen ist besser als heilen, vorbeugen ist billiger als heilen“ –<br />
Suchtprävention <strong>im</strong> Pr<strong>im</strong>ar- und Sekundarbereich<br />
Antragsteller und Projektträger ist der Landkreis Oder-Spree. Durchgeführt wird das Projekt<br />
von dem Gesundheitsamt des oben genannten Landkreises. Die Maßnahme wird in den<br />
Jahren 2001-2006 auf der deutschen und polnischen Seite der Euroregion durchgeführt. Das<br />
Projekt wird von zahlreichen Partnern unterstützt. Unter anderem durch das staatliche<br />
Schulamt, die Krankenkassen, durch den Caritasverband Brandenburg und durch die<br />
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Auf der polnischen Seite gehört der<br />
Landkreis Sulencin zu den Trägern des Projektes. Die Maßnahme versteht sich als Beitrag<br />
zur Pr<strong>im</strong>ären Prävention von gesundheitsfördernden Maßnahmen für Kinder und<br />
Jugendliche. Ziel des Projektes ist es, durch Wissensvermittlung und – Erweiterung eine<br />
gesunde Entwicklung der Kinder zu einer stabilen Persönlichkeit zu fördern. Dabei sollen<br />
Kinder, Lehrer und Erzieher, sowie Eltern <strong>im</strong> Sinne eines Lebenskompetenztrainings mit<br />
Problemen einer gesunden Lebensweise, dem Umgang mit Suchtmitteln, Veränderung von<br />
Verhaltensmustern bekannt und vertraut gemacht. Unterschiedliche Methoden,<br />
Verfahrensweisen und Modelle werden dazu dienen den Zielgruppen Wissen über die<br />
Themen wie: gesunde Ernährung, Bewegung, Hygieneverhalten, Drogen und Süchte zu<br />
vermitteln. Zu diesem Zweck werden in der ersten Stufe Seminare für Pädagogen<br />
durchgeführt, um Sie zu der eingenständigen Umsetzung zu befähigen. In der zweiten Stufe<br />
werden in den ausgesuchten Klassen Unterrichtsstunden durchgeführt. Dazu ist die<br />
Einbindung von externen Fachkräften notwendig. In der zweiten Stufe werden auch die<br />
Eltern der beteiligten Schüler einbezogen.<br />
Ausgangspunkt für die Präventionsarbeit <strong>im</strong> Schulbereich bildet der von der WHO<br />
propagierter Lebenskompetenzansatz. Gemeint ist damit die Förderung aller der<br />
Fähigkeiten, die einen angemessenen Umgang mit den Mitmenschen sowie mit Problemen<br />
und Strasssituationen <strong>im</strong> alltäglichen Leben ermöglichen. Dieser Ansatz berücksichtigt, dass<br />
Präventionsbotschaften, die auf reiner Wissensvermittlung beruhen, wenig effektiv sind.<br />
Vielmehr ist der Einzelne in seinem Handeln <strong>im</strong>mer in Beziehung zu seinem sozialen Umfeld<br />
zu sehen. Das heißt, dass nur Kinder, die über ein reflektiertes Bild ihrer eigenen Person<br />
verfügen und die Kenntnisse über Stärken und Schwächen haben, in der Lage sind, eine<br />
111
Deutsche Sozialversicherung<br />
Observatorium <strong>EUREGIOsocial</strong><br />
gesunde Distanz zu negativen und gesundheitsgefährdenden Einflüssen zu bekommen. Um<br />
diesen Bedarf Rechnung zu tragen sowie auf Grund der gesundheitspolitischen<br />
Verantwortung des Gesundheitsamtes wurde die Idee entwickelt, langfristig ein Programm<br />
<strong>im</strong> Grundschulbereich zu <strong>im</strong>plementieren, dass dem von der WHO geforderten<br />
Labenskompetenzansatz entspricht. Ziel ist es, durch die Einbindung des Programms in den<br />
Schulalltag, die Kinder in ihrer psychosozialen Kompetenz zu stärken und sie mit Strategien<br />
auszustatten, die sie zur Bewältigungen illegaler Suchtmittel benötigen. Neben der<br />
Förderung einer gesundheitlichen Lebensweise soll damit langfristig ein Beitrag zur<br />
Suchtvorbeugung und deren negativen Folgeerscheinungen geleistet werden.<br />
112
8.26 Euroregion POMERANIA<br />
Deutsche Sozialversicherung<br />
Observatorium <strong>EUREGIOsocial</strong><br />
Euroregion POMERANIA<br />
Eingetragener Verein der Kommunalgemeinschaften<br />
(P) Stadt Szczecin, Verband der polnischen Gemeinden der Euroregion Pomerania,<br />
(D) Kommunalgemeinschaft Europaregion Pomerania e.V.,<br />
(S) der Gemeindeverband Skane<br />
Gesamt 3.500.000 Einwohner<br />
40.000 km²<br />
113
POMERANIA<br />
8.26.1 Allgemeines<br />
Deutsche Sozialversicherung<br />
Observatorium <strong>EUREGIOsocial</strong><br />
Die EUROREGION POMERANIA verbindet deutsche und polnische Gebiete sowie seit<br />
Februar 1998 auch schwedische Gebiete miteinander. Auf Grund der geographischen Lage<br />
stellt sie ein Bindeglied sowohl zwischen Mittel- und Osteuropa als auch nach Skandinavien<br />
dar. An die historisch gewachsene West-Ost und Nord-Süd-Verbindungen auf dem Gebiet<br />
der POMERANIA wird jetzt unter den Gesichtspunkten der weiteren europäischen<br />
Integration angeknüpft, wodurch schrittweise die in der EU angestrebte Harmonisierung der<br />
Lebensbedingungen auch bei den Mitgliedern der POMERANIA erreicht werden soll.<br />
Mitglieder und Statistik<br />
Die am 15. Dezember 1995 in Szczecin (Polen) gegründete EUROREGION POMERANIA<br />
hat seit der Vertragsunterzeichnung in Lund (Schweden) am 26. Februar 1998 vier<br />
Mitglieder:<br />
• die Stadt Szczecin<br />
• den Verband der Polnischen Gemeinden der EUROREGION POMERANIA (früher<br />
kommunaler Zweckverband der Gemeinden Westpommerns "POMERANIA" mit der<br />
Mehrheit der Gemeinden und Städte der Wojewodschaft Westpommern)<br />
• die Kommunalgemeinschaft Europaregion POMERANIA e.V. (mit zwei kreisfreien<br />
Städten und sechs Landkreisen der Länder Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg)<br />
• den Gemeindeverband Skåne (mit 33 schwedischen Kommunen)<br />
Die Gesamtregion umfasst ein Territorium von über 40.000 km² mit einer Bevölkerung von<br />
3,5 Millionen Menschen.<br />
8.26.2 Telemedizinisches Netzwerk zur Unterstützung der Tumorversorgung in der<br />
Euregion POMERANIA<br />
Die flächendeckende und hochwertige Versorgung von Tumorpatienten in einer dünn<br />
besiedelten Region ist eine, nicht nur für den betroffenen Patienten, wichtige<br />
gesundheitspolitische Aufgabe. Die Möglichkeiten, sowohl zur Früherkennung und frühen<br />
Diagnostik, als auch zur effektiven Therapie und Nachsorge dieser Patienten sind aus<br />
sozialen Gründen regional zu organisieren und unter Berücksichtigung ökonomischer<br />
Rahmenbedingungen vorzuhalten. Der Einzugsbereich des Tumorzentrums Vorpommern<br />
umfasst 600.000 Einwohner mit ca. 2.500 Neuerkrankungen pro Jahr.<br />
Das Projekt hat die Zielsetzung, die Patientenversorgung in Vorpommern und den<br />
angrenzenden Gebieten der Euregion Pomerania zu verbessern. Durch den Aufbau einer<br />
Kommunikationsinfrastruktur zwischen den medizinischen Einrichtungen in Vorpommern und<br />
grenzüberschreitend nach Police und Szczecin werden Mediziner, die regional für die<br />
Betreuung von erkrankten Personen verantwortlich sind, standortübergreifend<br />
zusammengeführt. Der Patient muss nicht mehr durch die Region reisen, um sich bei den<br />
betreuenden Medizinern vorzustellen, sondern die medizinischen Daten werden <strong>im</strong> Rahmen<br />
einer Tumorkonferenz über moderne Kommunikationswege übermittelt. Das Opt<strong>im</strong>um an<br />
lokaler Kompetenz und der technisch notwenigen Infrastruktur lässt sich so in unserer<br />
Region nutzen, wodurch ein wertvoller Beitrag zu einer effektiven und kostengünstigen<br />
Patientenversorgung <strong>im</strong> Flächenland Vorpommern geleistet werden kann.<br />
Der Projektträger ist das Tumorzentrum Vorpommern e.V. in <strong>Zusammenarbeit</strong> mit dem IAI<br />
(Institut für Angewandte Informatik) der Fachhochschule Stralsund.<br />
114
Deutsche Sozialversicherung<br />
Observatorium <strong>EUREGIOsocial</strong><br />
Unter der operativen Leitung des Tumorzentrums Vorpommern erfolgt die telemedizinische<br />
Zusammenschaltung folgender Partner:<br />
• Universitätsklinik Greifswald<br />
• Klinikum der Hansestadt Stralsund<br />
• Sana-Krankenhaus Rügen in Bergen<br />
• Asklepios-Klinik in Pasewalk<br />
• Christophorus-Diakoniewerk in Ueckermünde<br />
Außerhalb der Projektförderung:<br />
• Pomorska Akademia Medyczna in Szeczecin<br />
• Krankenhaus Police<br />
8.26.2.1 Teilprojekt Telepathologie<br />
Zu einer guten Versorgung der Tumorpatienten gehört auch eine kompetente Beurteilung<br />
von Gewebeproben, die während einer Operation entnommen werden und von einem<br />
Pathologenmikroskopisch untersucht werden müssen. Im Telemedizinischen Netzwerk wird<br />
daher auch der Aufbau eines Telepathologie-Verbundes unterstützt. In diesem Verbund<br />
werden die 3 Pathologie- Institute in Vorpommern an der Universität Greifswald, am Klinikum<br />
am Sund in Stralsund und an der Asklepios-Klinik in Pasewalk zusammengeschaltet. Die<br />
Pathologieeinrichtungen können so ein kompetentes Netzwerk zur Bereitstellung Ihres<br />
Know-Hows bilden.<br />
In jeder Einrichtung werden fernsteuerbare Mikroskoparbeitsplätze eingerichtet, die über<br />
Kommunikationsverbindungen miteinander verbunden sind. Die Bilder von Gewebeschnitten<br />
können so direkt übersandt und gemeinsam diskutiert werden. Das Sana- Krankenhaus in<br />
Bergen wird als Einrichtung ohne eigenen Pathologen mit in das Netzwerk eingebunden<br />
werden, um so die Unterstützung durch die 3 Pathologie- Institute zu erhalten. So können<br />
dort entnommene Gewebeproben mit Hilfe des fernsteuerbaren Mikroskops durch die<br />
Pathologen des Verbundes untersucht werden. Die Gewebeproben müssen somit nicht<br />
mehr zum nächstgelegenen Pathologie- Institut transportiert werden, was zu einer großen<br />
Zeitersparnis führt.<br />
8.26.2.2 Teilprojekt Teleradiologie<br />
Das Teilprojekt Teleradiologie ermöglicht die Übermittlung von Bild- und Patientendaten von<br />
einem Ort zum anderen unter Nutzung von Telekommunikationseinrichtungen,<br />
beispielsweise die Übertragung von Bilddaten vom Ort der Entstehung (z.B. Krankenhaus A)<br />
zu einem externen Radiologen (Krankenhaus B). Mögliche Anwendungsszenarien sind:<br />
• Second Opinion:<br />
Einholung einer zweiten Meinung, um konsiliarisch die Verdachtsdiagnose abzusichern.<br />
• Vertretungsdienst:<br />
Durchführung einer externen Befundung <strong>im</strong> Rahmen der radiologischen Betreuung von<br />
Standorten zum Zwecke der Krankheits- bzw. Urlaubsvertretung<br />
• Bereitschaftsdienst:<br />
Übertragung von Bildern zum Diensthabenden Oberarzt nach Hause zum Zwecke der<br />
Entscheidung über das weitere Prozedere<br />
• Notfallversorgung:<br />
Zeitnahe Übertragung von Bildern an Spezialisten zur Abklärung des weiteren Procederes.<br />
Beispiel: Klärung des neurochirurgischen Behandlungsbedarfs <strong>im</strong> Rahmen eines<br />
Notfallkonsils bei Schädel-Hirn-Traumen<br />
115
Deutsche Sozialversicherung<br />
Observatorium <strong>EUREGIOsocial</strong><br />
• Teleradiologische Befundung:<br />
Radiologische Betreuung von bildgebenden Systemen in kleineren Krankenhäusern durch<br />
radiologische Zentren<br />
• Befundübermittlung an Überweiser:<br />
Übertragung von Bildmaterial und Arztbrief an den überweisenden Arzt<br />
• Wissenschaftlicher Austausch:<br />
Austausch von Bildmaterial <strong>im</strong> Rahmen von Forschungsprojekten<br />
8.26.2.3 Teilprojekt Telekonferenz<br />
Das Teilprojekt Telekonferenz konzentriert sich sehr stark auf die teleradiologische<br />
Tumorkonferenz. Die örtliche Bindung der interdisziplinären Tumorkonferenz wird<br />
aufgehoben und unabhängig vom Ort gemacht. Bei jedem Teilnehmer wird ein<br />
teleradiologisches Konferenzsystem installiert, dass allen Beteiligten den Zugang zu den<br />
Falldaten inklusive radiologischer Bilder ermöglicht. Es werden Online-<br />
Kommunikationskanäle (Audio, Video) bereitgestellt. Das Konferenzsystem kann als<br />
Einzelplatzsystem <strong>im</strong> Arbeitsz<strong>im</strong>mer eines Tumorexperten oder als Gruppenarbeitsplatz <strong>im</strong><br />
Konferenzraum realisiert werden. Während der Konferenz erlaubt das System allen<br />
Beteiligten, die Bild- und Falldaten zu begutachten und Befunde zu demonstrieren. Das<br />
Konferenzsystem wird ein kooperatives Arbeiten ermöglichen. Das Bedeutet, dass Bildserien<br />
ausgewählt werden können und Aktionen wie das Vergrößern und Verschieben von Bildern<br />
oder das Verändern von Helligkeit und Kontrast s<strong>im</strong>ultan ausgeführt werden können. Die<br />
Aktionen eines Partners werden unmittelbar auf die Bildarbeitsplätze aller anderen<br />
Beteiligten übertragen und dort ebenfalls ausgeführt. Alle Konferenzteilnehmer sehen somit<br />
zu jedem Zeitpunkt denselben Bildschirminhalt.<br />
116
9 Adressenverzeichnis<br />
Anmerkung<br />
Deutsche Sozialversicherung<br />
Observatorium <strong>EUREGIOsocial</strong><br />
Nachfolgend sind Adressen und Telekommunikationsnummern von Geschäftsstellen<br />
aufgeführt, die über grenzüberschreitende Projekte Auskünfte geben oder vermitteln können.<br />
Zum Teil sind auch die Ansprechpartner/innen für den Bereich des <strong>Gesundheitswesen</strong>s<br />
angegeben.<br />
9.1 Region Schleswig/Südjütland<br />
Region Sønderjylland/ Schleswig<br />
Regionskontor<br />
Frau Gertraudt Jepsen<br />
Hærvejen 11b<br />
BovSønderjyllands Amt (DK)<br />
DK - 6330 Padborg<br />
9.2 Ems Dollart Region<br />
Ems Dollard Regio<br />
Molenstraat 5<br />
NL – 9693 EJ Nieuweschans<br />
9.3 Euregio Gronau<br />
EUREGIO<br />
Enscheder Str. 362<br />
D-48599 Gronau<br />
Telefon:<br />
Telefax:<br />
Homepage:<br />
E-mail:<br />
Ansprechpartner:<br />
Telefon-Durchwahl<br />
E-mail<br />
Telefon:<br />
Telefax:<br />
Homepage:<br />
E-mail:<br />
Ansprechpartner:<br />
Telefon-Durchwahl:<br />
E-mail<br />
Telefon:<br />
Telefax:<br />
Homepage:<br />
E-mail:<br />
Ansprechpartner:<br />
Telefon-Durchwahl<br />
E-mail<br />
117<br />
+45/74.67.05.01<br />
+45/74.67.05.21<br />
www.sja.dk/sja/RegionDE.nsf/links<br />
/forside<br />
sekretariat@region.dk<br />
Mikael Harild<br />
+45/74.33.52.58<br />
mh@sja.dk<br />
+31/597/52.15.10<br />
+31/597/52.25.11<br />
edr@edr.org<br />
R.C.E. Neef (NL)<br />
+31/597/52.15.10<br />
eric.neef@der.org<br />
+49/2562/702.0<br />
+49/2562/702.59<br />
www.euregio.de<br />
info@euregio.de<br />
J. B. Oostenbrink<br />
Stv. Geschäftsführer<br />
j.oostenbrink@euregio.de
9.4 Euregio Rhein-Waal<br />
Euregio Rhein Waal<br />
Emmericher Str. 24<br />
D-47533 Kleve<br />
9.5 Euregio Rhein-Maas-Nord<br />
Euregio Rhein-Maas-Nord<br />
Marktstraße 30<br />
D 41236 Mönchengladbach<br />
9.6 Euregio Maas-Rhein<br />
Euregio Maas-Rijn<br />
Gouvernement<br />
L<strong>im</strong>burglaan 10<br />
NL-6229 GA Maastricht<br />
Deutsche Sozialversicherung<br />
Observatorium <strong>EUREGIOsocial</strong><br />
Telefon:<br />
Telefax:<br />
Homepage:<br />
E-mail:<br />
Ansprechpartner:<br />
Telefon-Durchwahl<br />
E-mail<br />
Telefon:<br />
Telefax:<br />
Homepage:<br />
E-mail:<br />
Ansprechpartner:<br />
Telefon-Durchwahl<br />
E-mail<br />
Telefon:<br />
Telefax:<br />
Homepage:<br />
E-mail:<br />
Ansprechpartner:<br />
Telefon-Durchwahl<br />
E-mail<br />
9.7 Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens<br />
Königreich Belgien<br />
Regierung der<br />
Deutschsprachigen Gemeinschaft<br />
Ministerium für Jugend und<br />
Familie, Denkmalschutz,<br />
Gesundheit und Soziales<br />
Klötzerbahn 32<br />
B-4700 Eupen<br />
9.8 EuRegio SaarLorLuxRhein<br />
EuRegio SaarLorLuxRhein asbl 1,<br />
av. De la Gare<br />
L-1611 Luxembourg<br />
Telefon:<br />
Telefax:<br />
Homepage:<br />
E-mail:<br />
Ansprechpartner:<br />
Telefon-Durchwahl<br />
E-mail<br />
Telefon:<br />
Telefax:<br />
Homepage:<br />
E-mail:<br />
Ansprechpartner:<br />
Telefon-Durchwahl<br />
E-mail<br />
118<br />
+49/2821/79.30.0<br />
+49/2821/79.30.30<br />
www.euregio.org<br />
Thea Oostrik-Remers<br />
+49/2821/79.30.23<br />
remers@euregio.org<br />
+49/2161/25.923.0<br />
+49/2161/25.923.39<br />
Eurelia Ölbey<br />
+49/2161/25.923.34<br />
Eurelia.oelbey@euregio-rmn.de<br />
+31/43/389.74.92<br />
+31/43/389.72.87<br />
www.euregio-mr.org<br />
Isabelle Jeanfils<br />
+31/43/389.73.41<br />
isabellejeanfils@euregio-mr.nl<br />
+32/87/59.64.00<br />
+32/87/55.70.21<br />
www.dglive.be<br />
Minister Hans Niessen<br />
Kab.Niessen@dgov.be<br />
+352/400811717<br />
www.euregio@lu<br />
www.euregio@pt.lu
Région Lorraine<br />
Hôtel de Région<br />
Place Gabriel Hocquard<br />
B.P. 81004<br />
F-57036 Metz Cedex 1<br />
Pôle de l’Hôpital<br />
7, rue de bois Richard<br />
F - 57490 l’Hôpital<br />
9.9 PAMINA<br />
INFOBEST PAMINA<br />
L’Ancienne Douane<br />
F-67630 Lauterbourg<br />
9.10 Oberrheinkonferenz<br />
Deutsch-Französisch-<br />
Schweizerische<br />
Oberrheinkonferenz<br />
Gemeinsames Sekretariat<br />
Rehfußplatz 11<br />
D-77697 Kehl<br />
Euro Institut<br />
Institut für regionale<br />
<strong>Zusammenarbeit</strong> und<br />
Europäische Verwaltung EWIV<br />
Fachhochschule für öffentliche<br />
Verwaltung Kehl<br />
Kinzigallee 1<br />
D-77694 Kehl<br />
Deutsche Sozialversicherung<br />
Observatorium <strong>EUREGIOsocial</strong><br />
Telefon:<br />
Telefax:<br />
Homepage:<br />
E-mail:<br />
Ansprechpartner:<br />
Telefon-Durchwahl<br />
E-mail<br />
Telefon:<br />
Telefax:<br />
Homepage:<br />
E-mail:<br />
Ansprechpartner:<br />
Telefon-Durchwahl<br />
E-mail<br />
Telefon:<br />
Telefax:<br />
Homepage:<br />
E-mail:<br />
Ansprechpartner:<br />
Telefon-Durchwahl<br />
E-mail<br />
Telefon:<br />
Telefax:<br />
Homepage:<br />
E-mail:<br />
Ansprechpartner:<br />
Telefon-Durchwahl<br />
E-mail<br />
Telefon:<br />
Telefax:<br />
Homepage:<br />
E-mail:<br />
Ansprechpartner:<br />
Telefon-Durchwahl<br />
E-mail<br />
119<br />
+33/03.87.33.61.74<br />
+33/03.87.33.61.89<br />
Maria Leprevost<br />
+33/387/33.61.74<br />
leprevom@cr-lorraine.fr<br />
+33/03.87.29.89.90<br />
+33/03.87.82.30.96<br />
pole.hopital@wanadoo.fr<br />
Cynthia Karmann<br />
+33/387/29.89.90<br />
+49/7277/97.20.0<br />
+49/7277/97.20.55<br />
www.regio-pamina.org<br />
Andrea Goldowsky<br />
+49/7277/97.233.0<br />
andrea.goldowsky@regiopamina.org<br />
+49/7851/93.49.0<br />
+49/7851/93.49.50<br />
www.oberrheinkonferenz.org<br />
Fr. Saskia Heetel<br />
saskia.heetel@<br />
oberrheinkonferenz.de<br />
+49/7851/89.413<br />
+49/7851/89.474
Deutsche Sozialversicherung<br />
Observatorium <strong>EUREGIOsocial</strong><br />
9.11 Centre - Strasbourg/Offenburg - Euregio in Planung<br />
INFOBEST Strasbour/Kehl<br />
B.P. 10<br />
F-67017 Strasbourg Cédex<br />
9.12 RegioTriRhena<br />
RegioTriRhena<br />
Secrétariat<br />
Pont du Palmrain<br />
F-68128 Village Neuf<br />
9.13 Hochrhein-Kommission<br />
Regionalverband<br />
Hochrhein Bodensee<br />
Im Wallgraben 50<br />
D-79761 Waldshut-Tiengen<br />
Telefon:<br />
Telefax:<br />
Homepage:<br />
E-mail:<br />
Ansprechpartner:<br />
Telefon-Durchwahl<br />
E-mail<br />
Telefon:<br />
Telefax:<br />
Homepage:<br />
E-mail:<br />
Ansprechpartner:<br />
Telefon-Durchwahl<br />
E-mail<br />
Telefon:<br />
Telefax:<br />
Homepage:<br />
E-mail:<br />
Ansprechpartner:<br />
Telefon-Durchwahl<br />
E-mail<br />
9.14 REGIO BODENSEE [Internationale Bodenseekonferenz/IBK]<br />
Internationale<br />
Bodenseekonferenz<br />
Regio Büro<br />
c/o Landratsamt<br />
Benediktinerplatz 1<br />
D-78467 Konstanz<br />
Telefon:<br />
Telefax:<br />
Homepage:<br />
E-mail:<br />
Ansprechpartner:<br />
Telefon-Durchwahl<br />
E-mail<br />
120<br />
+49/7851/94.79.0<br />
+49/7851/94.79.10<br />
www.ortenaukreis.de<br />
annemarie.jarry@ortenaukreis.de<br />
Anne-Marie Jarry oder<br />
Herr Dr. Michael Jansen<br />
+49/7851/94.79.30<br />
m.janssen@infobest.org<br />
+33/389/67.30.75<br />
+33/389/66.71.39<br />
http://www.regio-tri.com<br />
conseil.regio@telmat-net.fr<br />
+49/7751/911 .0<br />
+49/7751/911 530<br />
www.hochrheinkommission.org<br />
Herr Charly Hoffmann<br />
+49/7751/911 513<br />
hoffmann@hochrhein.org<br />
Herr Gerhard Thönen für (CH)<br />
+41/62/874 47 47<br />
+49/7531/52.722<br />
+49/7531/52.869<br />
regio.bodensee@t-online.de<br />
http://www.ktsg.ch<br />
Roman Wüst<br />
(Vorsitzender der IBK-<br />
Gesundheitskommission), Kanton<br />
St. Gallen (CH)<br />
+41/71/229.35.67<br />
roman.wuest@gd-sekr.sg.ch
9.15 ARGE-ALP<br />
ARGE ALP<br />
Amt der Tiroler Landesregierung<br />
Abteilung Europäische Integration<br />
Herr Dr. Wolfgang Mayerhofer<br />
Eduard-Wallnöfer Platz 30<br />
A-6010 Innsbruck<br />
Deutsche Sozialversicherung<br />
Observatorium <strong>EUREGIOsocial</strong><br />
Telefon:<br />
Telefax:<br />
Homepage:<br />
E-mail:<br />
Ansprechpartner:<br />
Telefon-Durchwahl<br />
Telefax:<br />
E-mail<br />
9.16 Arbeitsgemeinschaft Alpen-Adria<br />
Arbeitsgemeinschaft<br />
Alpen-Adria<br />
Geschäftsstelle Kärnten<br />
Generalsekretariat<br />
Völkermarkter Ring 21<br />
A-9021 Klagenfurt<br />
Telefon:<br />
Telefax:<br />
Homepage:<br />
E-mail:<br />
Ansprechpartner:<br />
Telefon-Durchwahl<br />
E-mail<br />
9.17 Euregio Salzburg-Berchtesgadener Land-Traunstein<br />
EuRegio Salzburg-<br />
Berchtesgadener Land-<br />
Traunstein<br />
Sägewerkstraße 3<br />
D-83395 Freilassing/Obb.<br />
9.18 Inn-Salzach-Euregio<br />
Geschäftsstelle<br />
Inn-Salzach-Euregio<br />
am Landratsamt Rottal-Inn<br />
Industriezeile 54<br />
A-5280 Braunau<br />
Telefon:<br />
Telefax:<br />
Homepage:<br />
E-mail:<br />
Ansprechpartner:<br />
Telefon-Durchwahl<br />
E-mail<br />
Telefon:<br />
Telefax:<br />
Homepage:<br />
E-mail:<br />
Ansprechpartner:<br />
Telefon-Durchwahl<br />
E-mail<br />
9.19 EUREGIO Bayerischer Wald-Sumava-Mühlviertel<br />
EUREGIO Bayerischer Wald-<br />
Sumava-Mühlvierte<br />
Sektion Bayern<br />
Wolfkerstr. 3<br />
D-94078 Freyungl<br />
Telefon:<br />
Telefax:<br />
Homepage:<br />
E-mail:<br />
Ansprechpartner:<br />
Telefon-Durchwahl<br />
E-mail<br />
121<br />
+43/512/508.2340<br />
+43/512/508.2345<br />
www.tirol.gv.at<br />
eu.int.@tirol.gv.at<br />
Claudio Lardi,<br />
Kanton Graubünden (CH)<br />
+41/81/257.2701<br />
+41/81/257.2151<br />
Claudio.Lardi@ekud.gr.ch<br />
+43/463/536.2821<br />
+43/463/536.2820<br />
http://www.alpeadria.org<br />
post.alpeadria@ktn.gv.at<br />
Univ. doz. Dr. Hellwig Valentin<br />
hellwig.valentin@ktn.gv.at<br />
+49/8654/772109<br />
+49/8654/772112<br />
www.euregio.sbg.at<br />
office@euregio.sbg.at<br />
Steffen Rubach<br />
Geschäftsführer<br />
rubach.euregio@tzf.de<br />
+43/7722/65100<br />
+43/7722/65100-8144<br />
www.inn-salzach-euregio.at<br />
office@innsalz.at<br />
Silke Sickinger<br />
Geschäftsführerin<br />
+49/8551/571/32<br />
www.euregio.at<br />
info@euregio-bayern.de<br />
Frau Hazmukova
9.20 Euregio Egrensis<br />
Euregio Egrensis<br />
Arbeitsgemeinschaft Bayern e.V.<br />
Fikentscherstraße 24<br />
95615 Marktredwitz<br />
Euregio Egrensis<br />
Arbeitsgemeinschaft Böhmen e.V<br />
Nám stí Ji ího z Pod brad 33<br />
CZ 350 02 Cheb<br />
Euregio Egrensis<br />
Arbeitsgemeinschaft Vogtland/<br />
Westerzgebirge e.V.<br />
Friedensstraße 32<br />
08523 Plauen<br />
Deutsche Sozialversicherung<br />
Observatorium <strong>EUREGIOsocial</strong><br />
Telefon:<br />
Telefax:<br />
Homepage:<br />
E-mail:<br />
Ansprechpartner:<br />
Telefon-Durchwahl<br />
E-mail<br />
Telefon:<br />
Telefax:<br />
Homepage:<br />
E-mail:<br />
Ansprechpartner:<br />
Telefon-Durchwahl<br />
E-mail<br />
Telefon:<br />
Telefax:<br />
Homepage:<br />
E-mail:<br />
Ansprechpartner:<br />
Telefon-Durchwahl<br />
E-mail<br />
9.21 Euroregion Erzgebirge-Krusnohorí<br />
Euroregion Erzgebirge<br />
Am Sankt Niclas Schacht 13<br />
D-09599 Freiberg<br />
Euroregion Krusnohori<br />
Mestske Divadlo 15<br />
CZ 43401 Most<br />
9.22 Euroregion ELBE/LABE<br />
Kommunalgemeinschaft<br />
Euroregion Oberes Elbtal/<br />
Osterzgebirge e.V.<br />
Dr.-Wilhelm-Külz-Str. 6<br />
D-01796 Pirna<br />
Telefon:<br />
Telefax:<br />
Homepage:<br />
E-mail:<br />
Ansprechpartner:<br />
Telefon-Durchwahl<br />
E-mail<br />
Telefon:<br />
Telefax:<br />
Homepage:<br />
E-mail:<br />
Ansprechpartner:<br />
Telefon-Durchwahl<br />
E-mail<br />
Telefon:<br />
Telefax:<br />
Homepage:<br />
E-mail:<br />
Ansprechpartner:<br />
Telefon-Durchwahl<br />
E-mail<br />
122<br />
+49/9231/6692-0<br />
+49/9231/6692-29<br />
www.euregio-egrensis.de<br />
info@euregio-egrensis.de<br />
Frau Michaela Zenk<br />
Stv. Geschäftsführerin<br />
+49/9231/66921-5<br />
michaela.zenk@euregioegrensis.de<br />
+420/354 423 144<br />
+420/354 423 144<br />
http://www.euregio-egrensis.org<br />
+49/3741/21 43 653<br />
+49/3741/21 43 652<br />
www.euregioegrensis.de<br />
info@euregioegrensis.de<br />
Frau Petra Klein<br />
+49/3741/21 43 654<br />
klein@euregioegrensis.de<br />
www.euroregion-erzgebirge.de<br />
Frau Ebenhöh<br />
Geschäftsführerin<br />
+49/3731-781-304<br />
ebenhoeh@euroregionerzgebirge.de<br />
Mgr.Frantisek Bina<br />
00420 35 – 7706128<br />
euroregion@mumost.cz<br />
+49 (0) 35 01 / 52 00 13<br />
+49 (0) 35 01 / 52 74 57<br />
www.euroregion-elbe-labe.de<br />
info@euroregion-elbe-labe.de
Svazek obcí<br />
Euroregion Labe<br />
Velká Hradebni 8<br />
CZ - 40001 Ústí nad Labem<br />
9.23 Euroregion Neisse-Nisa-Nysa<br />
Kommunalgemeinschaft<br />
Euroregion Neisse e.V.<br />
Rathenaustraße 18a<br />
02763 Zittau<br />
Euroregion Nisa<br />
regionální sdružení<br />
T . 1. máje 858/26<br />
46001 Liberec III<br />
Stowarzyszenie Gmin Polskich<br />
Euroregionu Nysa<br />
ul. 1 Maja 57<br />
58-500 Jelenia Gora<br />
Deutsche Sozialversicherung<br />
Observatorium <strong>EUREGIOsocial</strong><br />
Telefon:<br />
Telefax:<br />
Homepage:<br />
E-mail:<br />
Ansprechpartner:<br />
Telefon-Durchwahl<br />
E-mail<br />
Telefon:<br />
Telefax:<br />
Homepage:<br />
E-mail:<br />
Ansprechpartner:<br />
Telefon-Durchwahl<br />
E-mail<br />
Telefon:<br />
Telefax:<br />
Homepage:<br />
E-mail:<br />
Ansprechpartner:<br />
Telefon-Durchwahl<br />
E-mail<br />
Telefon:<br />
Telefax:<br />
Homepage:<br />
E-mail:<br />
9.24 Euregio Spree-Neisse-Bober<br />
Euroregion Spree-Neisse-Bober<br />
Berliner Straße 7<br />
D-03172 Guben<br />
Euroregion<br />
Sprewa Nysa Bóbr<br />
ul. Piastowska 18<br />
PL - 66-620 Gubin<br />
Ansprechpartner:<br />
Telefon-Durchwahl<br />
E-mail<br />
Telefon:<br />
Telefax:<br />
Homepage:<br />
E-mail:<br />
Ansprechpartner:<br />
Telefon-Durchwahl<br />
E-mail<br />
Telefon:<br />
Telefax:<br />
Homepage:<br />
E-mail:<br />
Ansprechpartner:<br />
Telefon-Durchwahl<br />
E-mail<br />
123<br />
Tel.: +420 (0) 47 / 5241437-8<br />
Fax: +420 (0) 47 / 5211603<br />
www.euroregion-labe.cz<br />
euroregion-labe@mag-ul.cz<br />
www.neisse-nisa-nysa.com<br />
watterott@euroregion-neisse.de<br />
Gerhard Watterott<br />
Geschäftsführer<br />
Sekretärin:Frau Kugler<br />
+49/3583/57500<br />
kugler@euroregion-neisse.de<br />
www.neisse-nisa-nysa.com<br />
" # $ %&"&<br />
*** '<br />
!<br />
' ( )#<br />
( '<br />
+ ,$ - .<br />
' # . ) " ")#<br />
+49/3561/3133<br />
www.euroregion-snb.de<br />
info@euroregion-snb.de<br />
Ilona Petrick<br />
Geschäftsführerin<br />
petrick@euroregion-snb.de<br />
+48/ 0 68 / 3 59 56 47<br />
+48)/0 68 / 3 59 56 47<br />
www.euroregion-snb.de<br />
info@euroregion-snb.pl<br />
Bozena Buchowicz<br />
Geschäftsführerin
Deutsche Sozialversicherung<br />
Observatorium <strong>EUREGIOsocial</strong><br />
9.25 Euroregion PRO EUROPA VIADRINA<br />
/ ' 012 /31204<br />
546174<br />
#8 ."<br />
9 .& ":2; <<br />
9.26 Euroregion POMERANIA<br />
Geschäftsstelle<br />
Kommunalgemeinschaft<br />
Europaregion Pomerania e.V.<br />
Ernst-Thälmann-Str.4<br />
D-17321 Löcknitz<br />
9.27 Ausschuss der Regionen<br />
Ausschuss der Regionen<br />
79, Rue Belliard<br />
B-1040 Brüssel<br />
Telefon:<br />
Telefax:<br />
Homepage:<br />
E-mail:<br />
Ansprechpartner:<br />
Telefon-Durchwahl<br />
E-mail<br />
Telefon:<br />
Telefax:<br />
Homepage:<br />
E-mail:<br />
Ansprechpartner:<br />
Telefon-Durchwahl<br />
E-mail<br />
Telefon:<br />
Telefax:<br />
Homepage:<br />
E-mail:<br />
Ansprechpartner:<br />
Telefon-Durchwahl<br />
E-mail<br />
124<br />
+49/335/66594-0<br />
+49/335/66594-20<br />
www.euroregion-viadrina.de<br />
info@euroregion-viadrina.de<br />
Frau Kleemann<br />
+32/2/28.22.211<br />
+32/2/28.22.325<br />
9.28 Arbeitsgemeinschaft Europäischer Grenzregionen (AGEG)<br />
Arbeitsgemeinschaft<br />
Europäischer Grenzregionen<br />
c/o EUREGIO<br />
Enscheder Str.362<br />
D-48599 Gronau<br />
Telefon:<br />
Telefax:<br />
Homepage:<br />
E-mail:<br />
Ansprechpartner:<br />
Telefon-Durchwahl<br />
E-mail<br />
9.29 Versammlung der Regionen Europas<br />
Versammlung der<br />
Regionen Europas<br />
Immeuble Europe<br />
Place des Halles 20<br />
Telefon:<br />
Telefax:<br />
Homepage:<br />
E-mail:<br />
Ansprechpartner:<br />
Telefon-Durchwahl<br />
E-mail<br />
kleemann@euroregionviadrina.de<br />
+49/39754/529-0<br />
+49/3974/529-29<br />
www.pomerania.net<br />
info@pomerania.net<br />
Herr Heise<br />
+49/2562/702.0<br />
+49/2562/702.59<br />
info@eaebr.net<br />
Jens Gabbe/ Geschäftsführer<br />
+33/388/22.07.07<br />
+33/388/75.67.19
Deutsche Sozialversicherung<br />
Observatorium <strong>EUREGIOsocial</strong><br />
9.30 Kongress der Gemeinden und Regionen Europas<br />
Kongress der Gemeinden<br />
und Regionen Europas<br />
Palais de L’Europe<br />
F-67075 Strasbourg Cedex<br />
9.31 Europarat<br />
Generalsekretariat des Europarates<br />
Direktion für lokale und regionale<br />
Gebietskörperschaften<br />
Abteilung für grenzüberschreitende<br />
<strong>Zusammenarbeit</strong><br />
F-67075 Strasbourg Cedex<br />
Telefon:<br />
Telefax:<br />
Homepage:<br />
E-mail:<br />
Ansprechpartner:<br />
Telefon-Durchwahl<br />
E-mail<br />
Telefon:<br />
Telefax:<br />
Homepage:<br />
E-mail:<br />
Ansprechpartner:<br />
Telefon-<br />
Durchwahl<br />
E-mail<br />
+33/388/41.20.00<br />
+33/388/41.27.51<br />
+33/388/41.20.00<br />
+33/388/41.27.81<br />
125