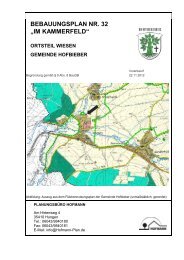Landschaftsplan. Gemeinde Hofbieber - Rathaus
Landschaftsplan. Gemeinde Hofbieber - Rathaus
Landschaftsplan. Gemeinde Hofbieber - Rathaus
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Landschaftsplan</strong>.<br />
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Hofbieber</strong>
Auftraggeber: Der <strong>Gemeinde</strong>vorstand der<br />
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Hofbieber</strong><br />
Schulweg 5<br />
36145 <strong>Hofbieber</strong><br />
Verfasser: Ketter-Eichert und Hinz<br />
Architekten und Landschaftsarchitekten<br />
Großenbacher Tor 7<br />
36088 Hünfeld<br />
Bearbeiter: Dipl.Ing. L. Hinz<br />
Dipl. Ing. (FH), MSc M. Schuster<br />
Datum: Vorentwurf 12 / 2001<br />
Vorentwurf, 1. Überarbeitung 06 / 2002<br />
Entwurf 10 / 2002<br />
Entwurf, 1. Überarbeitung 10 / 2003<br />
Entwurf, 2. Überarbeitung 03 / 2004
<strong>Landschaftsplan</strong> <strong>Hofbieber</strong> Seite - I -<br />
-Inhaltsverzeichnis-<br />
Inhaltsverzeichnis:<br />
1 EINFÜHRUNG ......................................................................................................................... 1<br />
1.1 AUFGABENSTELLUNG........................................................................................................ 1<br />
1.2 ZIELE, GRUNDSÄTZE, VORGABEN...................................................................................... 2<br />
1.3 VORGEHENSWEISE UND PLANUNGSABLAUF ....................................................................... 4<br />
2 ALLGEMEINE GRUNDLAGEN............................................................................................. 7<br />
2.1 ÜBERBLICK ÜBER DAS PLANUNGSGEBIET........................................................................... 7<br />
2.2 NATURRÄUMLICHE AUSGANGSSITUATION ......................................................................... 8<br />
2.3 HISTORISCHE ENTWICKLUNG DER KULTURLANDSCHAFT .................................................... 9<br />
2.4 PLANUNGSRELEVANTE VORGABEN.................................................................................. 11<br />
2.4.1 Regionalplan Nordhessen 2000..............................................................................11<br />
2.4.2 Landschaftsrahmenplan..........................................................................................12<br />
2.4.3 Rahmenkonzept Biosphärenreservat Rhön......................................................... 12<br />
2.4.4 Rechtliche Bindungen und sonstige Rahmenbedingungen .................................. 13<br />
3 BIOTOP- UND NUTZUNGSSTRUKTUREN ....................................................................... 15<br />
3.1 METHODIK...................................................................................................................... 15<br />
3.2 ERFASSUNG DER BIOTOP- UND NUTZUNGSSTRUKTUREN................................................... 16<br />
3.2.1 Wälder.............................................................................................................. 18<br />
3.2.2 Gehölze ............................................................................................................ 20<br />
3.2.3 Gewässer.......................................................................................................... 20<br />
3.2.4 Brachflächen .................................................................................................... 21<br />
3.2.5 Gesteinsbiotope und sonstige Habitate .............................................................. 21<br />
3.2.6 Grünlandflächen............................................................................................... 22<br />
3.2.7 Ackerflächen und Gärten .................................................................................. 24<br />
3.2.8 Friedhöfe, Sportanlagen und sonstige Freiflächen............................................. 24<br />
3.2.9 Bebaute Bereiche.............................................................................................. 25<br />
3.2.10 Deponien.......................................................................................................... 25<br />
4 ERFASSUNG UND BEWERTUNG DER AKTUELLEN UND KÜNFTIGEN<br />
LEISTUNGSFÄHIGKEIT DER SCHUTZGÜTER ......................................................................... 26<br />
4.1 SCHUTZGUT BODEN ........................................................................................................ 26<br />
4.1.1 Gesetzliche und planerische Vorgaben .............................................................. 26<br />
4.1.2 Bestandsbewertung ........................................................................................... 27<br />
4.2 SCHUTZGUT WASSER ...................................................................................................... 33<br />
4.2.1 Gesetzliche und planerische Vorgaben .............................................................. 33<br />
4.2.2 Bestandsbewertung Grundwasser...................................................................... 35<br />
4.2.3 Bestandsbewertung Oberflächengewässer ......................................................... 39<br />
4.3 SCHUTZGUT KLIMA......................................................................................................... 44<br />
4.3.1 Gesetzliche und planerische Vorgaben .............................................................. 44<br />
4.3.2 Bestandsbewertung ........................................................................................... 44<br />
4.4 SCHUTZGUT BIOTOPE UND ARTEN ................................................................................... 49<br />
4.4.1 Gesetzliche und planerische Vorgaben .............................................................. 49<br />
4.4.2 Bestandsbewertung Biotope und Nutzungen....................................................... 51<br />
4.4.3 Arten ................................................................................................................ 53<br />
4.4.4 Biotopkomplexe und Biotopsteckbriefe .............................................................. 61<br />
4.4.4.1 „Milseburg, Stellberg und oberes Biebertal“ ..................................................62<br />
4.4.4.2 „Talauen der Bieber mit Goldbach und Traisbach“.........................................64<br />
4.4.4.3 „Talauen von Riegel- und Igelbach“ ..............................................................65<br />
4.4.4.4 „Talaue der Haune“ ......................................................................................66<br />
4.4.4.5 „Talaue der Nässe“ .......................................................................................67<br />
4.4.4.6 „Talauen der Nüst mit Birkenbach, Schwarzbach und Grubenwasser<br />
mit Gickershauk und Schwarzehauk“.............................................................68<br />
4.4.4.7 „Hozzelberg / Nüster-Berg“ ..........................................................................69<br />
4.4.4.8 „Lothar-Mai-Haus mit Bomberg“ ..................................................................70<br />
4.4.4.9 „Kleiner Ziegenkopf, Hohlstein und Schackenberg mit Mambachtal“ .............71<br />
4.4.4.10 „Schröcksküppel und Ulrichshauk“ ...............................................................72
<strong>Landschaftsplan</strong> <strong>Hofbieber</strong> Seite - II -<br />
-Inhaltsverzeichnis-<br />
4.4.4.11 „Kirschberg und Schweinsberg“ ....................................................................73<br />
4.4.4.12 „Hessenliede und Bieberstein“ ......................................................................74<br />
4.4.4.13 „Hofberg und Schnurberg“............................................................................75<br />
4.4.4.14 Rote Liste Arten und gefährdete Arten...........................................................76<br />
4.4.5 Belastungen, Beeinträchtigungen und Konflikte................................................. 83<br />
4.5 SCHUTZGUT NATURERLEBNIS UND ERHOLUNG................................................................. 84<br />
4.5.1 Gesetzliche und planerische Vorgaben .............................................................. 84<br />
4.5.2 Bestandsbewertung ........................................................................................... 85<br />
5 LEITBILDER UND ENTWICKLUNGSZIELE.................................................................... 91<br />
6 ENTWICKLUNG UND MASSNAHMEN ............................................................................. 96<br />
6.1 ALLGEMEINE ZIELE UND GRUNDSÄTZE............................................................................ 96<br />
6.1.1 Schutzgut Arten und Biotope ............................................................................. 97<br />
6.1.2 Schutzgut Boden ............................................................................................... 97<br />
6.1.3 Schutzgut Wasser.............................................................................................. 97<br />
6.1.4 Schutzgut Klima................................................................................................ 98<br />
6.1.5 Schutzgut Landschaftsbild und Erholungswert................................................... 98<br />
6.2 SCHUTZGEBIETE, OBJEKTE UND FLÄCHEN RECHTLICHER BINDUNG................................... 99<br />
6.2.1 Naturschutzgebiete ........................................................................................... 99<br />
6.2.2 Landschaftsschutzgebiete................................................................................ 100<br />
6.2.3 Naturdenkmale ............................................................................................... 100<br />
6.2.4 Schutz bestimmter Lebensräume und Landschaftsbestandteile<br />
(§ 15 d HENatG)............................................................................................. 101<br />
6.2.5 FFH- und Vogelschutzgebiete ......................................................................... 102<br />
6.2.6 Biosphärenreservat......................................................................................... 102<br />
6.2.7 Flächen zur Durchführung von Kompensationsmassnahmen............................ 103<br />
6.2.8 Flächen mit vertraglichen Bindungen.............................................................. 104<br />
6.2.9 Biotopverbund ................................................................................................ 105<br />
6.2.10 Hinweise zum Arten- und Biotopschutz............................................................ 108<br />
6.2.11 Sonstige Darstellungen ................................................................................... 108<br />
6.2.11.1 Darstellungen gemäß Forstgesetz.................................................................108<br />
6.2.11.2 Darstellungen gemäß Denkmalschutzgesetz.................................................108<br />
6.2.11.3 Darstellungen nach Hess. Wassergesetz.......................................................108<br />
6.3 LANDSCHAFTSPFLEGERISCHE MASSNAHMEN ................................................................. 109<br />
6.3.1 Erhalt, Pflege und Entwicklung naturschutzfachlich wertvoller Flächen und<br />
Bereiche ......................................................................................................... 110<br />
6.3.1.1 Flächenhafte Biotoptypen u./o. Strukturen ...................................................110<br />
6.3.1.2 Linienhafte Biotoptypen u./o. Strukturen .....................................................125<br />
6.3.1.3 Punktuelle Biotoptypen u./o. Strukturen.......................................................125<br />
6.3.2 Neuanlagen und Nutzungsänderungen............................................................. 126<br />
6.3.2.1 Waldneuanlage ...........................................................................................126<br />
6.3.2.2 Anpflanzung standortgerechter Gehölze.......................................................127<br />
6.3.2.3 Nutzungsänderungen...................................................................................127<br />
6.3.3 Beseitigung und Minimierung von Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes und<br />
Landschaftsbildes ........................................................................................... 130<br />
6.3.3.1 Altlasten, Altlastenverdachtsflächen ............................................................130<br />
6.3.3.2 Erosion.......................................................................................................130<br />
6.3.3.3 Deponien....................................................................................................131<br />
6.3.3.4 Gewässerverbau..........................................................................................132<br />
6.3.3.5 Gewässergüte .............................................................................................133<br />
6.3.3.6 Aufforstung in sensiblen Bereichen .............................................................133<br />
6.3.3.7 Intensive Weidenutzung..............................................................................133<br />
6.3.3.8 Intensive Mahdnutzung...............................................................................134<br />
6.3.3.9 nicht standortgerechte Gehölze....................................................................134<br />
6.3.3.10 Verkehrsweg innerhalb von Amphibien-Lebensräumen................................135<br />
6.3.3.11 Sonstige Belastungen und Beeinträchtigungen .............................................135<br />
6.3.4 Allgemeine Handlungsempfehlungen............................................................... 136<br />
6.3.4.1 Ortsrandgestaltung......................................................................................136<br />
6.3.4.2 Grünordnerische Massnahmen.....................................................................138<br />
6.3.4.3 Bereich mit besonderer Berücksichtigung klimatischer Zusammenhänge ......139<br />
6.3.4.4 Bereich mit besonderer Berücksichtigung des Landschaftsbildes und<br />
der Landschaftsgestaltung ...........................................................................139
<strong>Landschaftsplan</strong> <strong>Hofbieber</strong> Seite - III -<br />
-Inhaltsverzeichnis-<br />
6.4 LANDSCHAFTSPLANERISCHE HINWEISE.......................................................................... 140<br />
6.4.1 ... zur Waldbewirtschaftung............................................................................. 140<br />
6.4.2 ... zur landschaftsgebundenen Freizeit- und Erholungsnutzung ........................ 142<br />
6.4.3 ... zur Siedlungsentwicklung ............................................................................ 146<br />
7 UMSETZUNGSHINWEISE................................................................................................. 152<br />
8 LITERATURVERZEICHNIS.............................................................................................. 160<br />
PLAN- UND KARTENMATERIAL............................................................................................... 165<br />
Karte 1: Planungsvorgaben (1 : 25.000)<br />
Karte 2: Biotoptypen und Nutzungen (1 : 10.000)<br />
Karte 3: Schutzgut Boden (1 : 25.000)<br />
Karte 4: Schutzgut Grundwasser (1 : 25.000)<br />
Karte 5: Schutzgut Oberflächengewässer (1 : 25.000)<br />
Karte 6: Schutzgut Klima (1 : 25.000)<br />
Karte 7: Schutzgut Biotope und Arten (1 : 10.000)<br />
Karte 8: Schutzgut Landschaftsbild und<br />
Erholungswert (1 : 25.000)<br />
Karte 9: Leitbild (1 : 10.000)<br />
Karte 10a: Entwicklung - Schutzgebiete,<br />
Objekte und Flächen rechtlicher Bindung (1 : 10.000)<br />
Karte 10b: Entwicklung -<br />
Landschaftspflegerische Massnahmen (1 : 10.000)
<strong>Landschaftsplan</strong> <strong>Hofbieber</strong> Seite - IV -<br />
-Inhaltsverzeichnis-<br />
Abbildungsverzeichnis:<br />
ABB.-NR.: 1. „Lage im Raum und infrastrukturelle Anbindung” ............................................................. 7<br />
ABB.-NR.: 2. „Geländemorphologie”...................................................................................................... 9<br />
ABB.-NR.: 3. „Überblick: Planungsvorgaben”..................................................................................... 11<br />
ABB.-NR.: 4. „Methodik zur Erfassung der aktuellen Biotop- und Nutzungsstrukturen”......................... 15<br />
ABB.-NR.: 5. „Landschaftsausschnitt von Wallings über Schwarzbach” ............................................... 16<br />
ABB.-NR.: 6. „Überblick: Biotop- und Nutzungsstrukturen”................................................................ 16<br />
ABB.-NR.: 7. „Flächenbilanz Biotoptypen- und Nutzungskartierung” .................................................... 17<br />
ABB.-NR.: 8. „Buchenwald an der Hessenliede” ................................................................................... 19<br />
ABB.-NR.: 9. „Naturnaher Fließgewässerabschnitt am Oberlauf der Bieber”.......................................... 20<br />
ABB.-NR.: 10. „Bieberweiher”.............................................................................................................. 20<br />
ABB.-NR.: 11. „Feuchte Hochstaudenflur bei Danzwiesen”................................................................... 21<br />
ABB.-NR.: 12. „Milseburg” .................................................................................................................. 22<br />
ABB.-NR.: 13. „Kalksteinbruch bei Elters” ........................................................................................... 22<br />
ABB.-NR.: 14. „intensive Ziegenstandweide auf potentiell artenreichem Standort” ................................ 22<br />
ABB.-NR.: 15. „Goldhaferwiese bei Danzwiesen”................................................................................. 23<br />
ABB.-NR.: 16. „Kalkmagerrasen an der Hessenliede”............................................................................ 23<br />
ABB.-NR.: 17. „Ackerfläche” ............................................................................................................... 24<br />
ABB.-NR.: 18. „Naturlehrpfad an der Fohlenweide”.............................................................................. 24<br />
ABB.-NR.: 19. „Grillplatz im Biebertal”................................................................................................ 24<br />
ABB.-NR.: 20. „Aussichtspunkt auf dem Gipfel der Milseburg” ............................................................ 24<br />
ABB.-NR.: 21. „Wanderwege in der Milseburger Kuppenrhön”............................................................. 25<br />
ABB.-NR.: 22. „Ortslage <strong>Hofbieber</strong>”..................................................................................................... 25<br />
ABB.-NR.: 23. „Ortslage Elters” ........................................................................................................... 25<br />
ABB.-NR.: 24. „Überblick: Bewertung Boden” ................................................................................... 30<br />
ABB.-NR.: 25. „Erosion auf Ackerstandort”.......................................................................................... 32<br />
ABB.-NR.: 26. „Überblick: Bewertung Grundwasser” ......................................................................... 35<br />
ABB.-NR.: 27. „Überblick: Bewertung Oberflächengewässer”............................................................. 39<br />
ABB.-NR.: 28. „Strukturreicher Fließgewässerabschnitt”....................................................................... 41<br />
ABB.-NR.: 29. „Strukturarmer Fließgewässerabschnitt” ........................................................................ 41<br />
ABB.-NR.: 30. „Bachaue”..................................................................................................................... 42<br />
ABB.-NR.: 31. „Überblick: Bewertung Klima”.................................................................................... 45<br />
ABB.-NR.: 32. „Überblick: Bewertung Biotope und Arten”................................................................. 51<br />
ABB.-NR.: 33. „Bachnelkenwurz” ........................................................................................................ 55<br />
ABB.-NR.: 34. „Trollblume”................................................................................................................. 55<br />
ABB.-NR.: 35. „Wacholder” ................................................................................................................. 56<br />
ABB.-NR.: 36. „Arnika” ....................................................................................................................... 56<br />
ABB.-NR.: 37. „Ackerwachtelweizen” .................................................................................................. 56<br />
ABB.-NR.: 38. „Stattliches Knabenkraut”.............................................................................................. 57<br />
ABB.-NR.: 39. „Rotes Waldvögelein”................................................................................................... 57<br />
ABB.-NR.: 40. „Schwarzstorch”............................................................................................................ 58<br />
ABB.-NR.: 41. „Überblick: Bewertung Landschaftsbild und Erholung” ............................................... 85<br />
ABB.-NR.: 42. „Viehweide vor der Milseburg” ..................................................................................... 88<br />
ABB.-NR.: 43. „Überblick: Leitbilder und Entwicklungsziele” ............................................................ 91<br />
ABB.-NR.: 44. „Entwicklung und Massnahmen: allgemeine Ziele und Grundsätze”............................... 96<br />
ABB.-NR.: 45. „Überblick: Entwicklung: Schutzgebiete, Objekte und Flächen rechtlicher Bindung”.... 99<br />
ABB.-NR.: 46. „Überblick: Entwicklung: Landschaftspflegerische Massnahmen”.............................. 109<br />
Fotonachweis:<br />
S. 58, Schwarzstorch: Robert Groß, GDT<br />
alle anderen Fotos: M. Schuster
<strong>Landschaftsplan</strong> <strong>Hofbieber</strong> Seite - V -<br />
-Inhaltsverzeichnis-<br />
Tabellenverzeichnis:<br />
Tabelle-Nr. 1: „Arbeitsschritte der <strong>Landschaftsplan</strong>bearbeitung“.............................................................. 4<br />
Tabelle-Nr. 2: „Ortsteile der <strong>Gemeinde</strong> <strong>Hofbieber</strong> mit Gemarkungsgrößen und<br />
Einwohnerzahlen 1939 bis 2000“..................................................................................... 8<br />
Tabelle-Nr. 3: „Bodenverhältnisse im <strong>Gemeinde</strong>gebiet <strong>Hofbieber</strong>“......................................................... 28<br />
Tabelle-Nr. 4: „Wertstufen Biotoptypen und Nutzungen“........................................................................ 52<br />
Tabelle-Nr. 5: „Übersicht der Biotopkomplexe innerhalb des <strong>Gemeinde</strong>gebietes <strong>Hofbieber</strong>“.................61<br />
Tabelle-Nr. 6: „Milseburg, Stellberg und oberes Biebertal“..................................................................... 62<br />
Tabelle-Nr. 7: „Talauen der Bieber mit Goldbach und Traisbach“...........................................................64<br />
Tabelle-Nr. 8: „Talauen von Riegel- und Igelbach“..................................................................................65<br />
Tabelle-Nr. 9: „Talaue der Haune“............................................................................................................66<br />
Tabelle-Nr. 10: „Talaue der Nässe“............................................................................................................ 67<br />
Tabelle-Nr. 11: „Talauen der Nüst mit Birkenbach, Schwarzbach und<br />
Grubenwasser mit Gickershauk und Schwarzehauk“......................................................68<br />
Tabelle-Nr. 12: „Hozzelberg / Nüster-Berg“............................................................................................... 69<br />
Tabelle-Nr. 13: „Lothar-Mai-Haus mit Bomberg“...................................................................................... 70<br />
Tabelle-Nr. 14: „Kleiner Ziegenkopf, Hohlstein und Schackenberg mit Mambachtal“..............................71<br />
Tabelle-Nr. 15: „Schröcksküppel und Ulrichshauk“................................................................................... 72<br />
Tabelle-Nr. 16: „Kirschberg und Schweinsberg“........................................................................................ 73<br />
Tabelle-Nr. 17: „Hessenliede und Bieberstein“...........................................................................................74<br />
Tabelle-Nr. 18: „Hofberg und Schnurberg“.................................................................................................75<br />
Tabelle-Nr. 19: „Rote Liste Pflanzenarten“.................................................................................................76<br />
Tabelle-Nr. 20: „Regional seltene Pflanzenarten“.......................................................................................79<br />
Tabelle-Nr. 21: „Landschaftsräume und Eignung für die landschaftsbezogene Erholung“........................87<br />
Tabelle-Nr. 22: „Leitbilder und Entwicklungsziele“.................................................................................. 92<br />
Tabelle-Nr. 23: „Flächen mit rechtlicher Bindung: Kompensationsmassnahmen“...................................103<br />
Tabelle-Nr. 24: „Biotopverbund, Kern- und Verbindungsflächen“...........................................................106<br />
Tabelle-Nr. 25: „Entwicklungsflächen: Besondere Laubwaldbereiche“................................................. 110<br />
Tabelle-Nr. 26: „Entwicklungsflächen: Erlenbruchwald und Erlenbruch-Hutewald“............................ 110<br />
Tabelle-Nr. 27: „Entwicklungsflächen: Grünland feuchter bis nasser Standorte“.................................. 111<br />
Tabelle-Nr. 28: „Entwicklungsflächen: feuchte Hochstaudenflur“......................................................... 113<br />
Tabelle-Nr. 29: „Entwicklungsflächen: Goldhaferwiese“....................................................................... 114<br />
Tabelle-Nr. 30: „Entwicklungsflächen: Magerrasen auf Kalkgestein“....................................................115<br />
Tabelle-Nr. 31: „Entwicklungsflächen: Magerrasen auf Basaltgestein“................................................. 115<br />
Tabelle-Nr. 32: „Entwicklungsflächen: Borstgrasrasen“.........................................................................115<br />
Tabelle-Nr. 33: „Entwicklungsflächen: Trockene Hochstaudenflur“......................................................116<br />
Tabelle-Nr. 34: „Entwicklungsflächen: Sonstiges Extensivgrünland“....................................................117<br />
Tabelle-Nr. 35: „Entwicklungsflächen: Steinbruch, offen“.....................................................................122<br />
Tabelle-Nr. 36: „Entwicklungsflächen: Stillgewässer, naturnah“............................................................123<br />
Tabelle-Nr. 37: „Entwicklungsflächen: Zusammenfassung“...................................................................124<br />
Tabelle-Nr. 38: „Geplante Aufforstungsflächen“...................................................................................... 126<br />
Tabelle-Nr. 39: „Anpflanzung standortgerechter Gehölze“.......................................................................127<br />
Tabelle-Nr. 40: „Nutzungsänderungen: Acker in Grünland in Bachauen“................................................127<br />
Tabelle-Nr. 41: „Nutzungsänderungen: Acker in Grünland im Wasserschutzgebiet Wittges“.................129<br />
Tabelle-Nr. 42: „Nutzungsänderungen: Acker in Grünland angrenzend an sensible Biotopbereiche“.....129<br />
Tabelle-Nr. 43: „Altlasten, Altlastenverdachtsflächen“............................................................................ 130<br />
Tabelle-Nr. 44: „Pot. Erosionsgefährdungen“........................................................................................... 131<br />
Tabelle-Nr. 45: „Deponien“.......................................................................................................................130<br />
Tabelle-Nr. 46: „Gewässerverbau“............................................................................................................132<br />
Tabelle-Nr. 47: „Gewässergüte“................................................................................................................133<br />
Tabelle-Nr. 48: „Intensive Weidenutzung“................................................................................................134<br />
Tabelle-Nr. 49: „Intensive Mahdnutzung“.................................................................................................134<br />
Tabelle-Nr. 50: „nicht standortgerechte Gehölze“.....................................................................................134<br />
Tabelle-Nr. 51: „Ortsrandgestaltung“........................................................................................................136<br />
Tabelle-Nr. 52: „Grünordnerische Massnahmen“......................................................................................138<br />
Tabelle-Nr. 53: „Schwerpunkträume der landschaftsgebundenen Freizeit- und Erholungsnutzung“.......145<br />
Tabelle-Nr. 54: „Siedlungsflächenerweiterungen“....................................................................................149<br />
Tabelle-Nr. 55: „Bedeutung und Umsetzung von Aussagen und Darstellungen im <strong>Landschaftsplan</strong>“.... 155
<strong>Landschaftsplan</strong> <strong>Hofbieber</strong> Seite - 1 -<br />
-Grundlagen-<br />
1 Einführung<br />
1.1 Aufgabenstellung<br />
Die Aufgaben und Inhalte der kommunalen <strong>Landschaftsplan</strong>ung sowie die<br />
Verpflichtung zur Aufstellung von Landschaftsplänen ergeben sich aus dem Hessischen<br />
Naturschutzgesetz.<br />
So sind gemäß § 4 des Hessischen Naturschutzgesetzes die "örtlichen Erfordernisse und<br />
Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege [...] auf der Grundlage des<br />
Landschaftsprogramms in Landschaftsplänen mit Text, Karte und Begründung<br />
flächendeckend darzustellen". Die Landschaftspläne werden von den Trägern der<br />
Bauleitplanung im Benehmen mit den für Naturschutz und Landschaftspflege<br />
zuständigen Behörden der unteren Verwaltungsstufe als „Integrierter Fachplan<br />
Naturschutz“ aufgestellt.<br />
Aufgabe der Landschaftspläne ist es, den Zustand von Natur und Landschaft<br />
darzustellen und zu bewerten". Sie legen für die verschiedenen Naturräume des<br />
Plangebietes Leitbilder und die Maßnahmen fest, die notwendig sind, um das jeweilige<br />
Leitbild zu verwirklichen. Gebiete mit besonderer Bedeutung für Naturschutz und<br />
Landschaftspflege sind darzustellen. Die Pläne sollen Angaben enthalten über<br />
• die konkretisierten Ziele und Grundsätze des Naturschutzes und der Landschaftspflege,<br />
• die Beurteilung des vorhandenen und zu erwartenden Zustands von Natur und Landschaft<br />
nach Maßgabe dieser Ziele einschließlich der sich daraus ergebenden Konflikte,<br />
• die Erfordernisse und Maßnahmen<br />
- zur Vermeidung, Minderung oder Beseitigung von Beeinträchtigungen von Natur<br />
und Landschaft,<br />
- zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung bestimmter Teile von Natur und<br />
Landschaft im Sinne des Vierten Abschnitts sowie der Biotope und<br />
Lebensgemeinschaften der Tiere und Pflanzen wild lebender Arten,<br />
- auf Flächen, die wegen ihres Zustands, ihrer Lage oder ihrer natürlichen Entwicklungsmöglichkeiten<br />
für den Naturschutz und die Landschaftspflege oder zum Aufbau<br />
eines Biotopverbunds besonders geeignet sind,<br />
- zum Aufbau und Schutz des Europäischen ökologischen Netzes „Natura 2000“,<br />
- zum Schutz, zur Verbesserung der Qualität und zur Regeneration von Böden, Gewässern,<br />
Luft und Klima,<br />
- zur Erhaltung und Entwicklung von Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur<br />
undLandschaft, auch als Erlebnis- und Erholungsraum des Menschen,<br />
• Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen einschließlich der dafür erforderlichen Flächen.<br />
Die <strong>Gemeinde</strong> <strong>Hofbieber</strong> verfügt bereits über einen <strong>Landschaftsplan</strong>, der bis 1988<br />
erarbeitet wurde. Die Inhalte und Aussagen des <strong>Landschaftsplan</strong>es sind heute jedoch<br />
weitgehend überholt bzw. nicht mehr aktuell. Darüber hinaus sind die rechtlichen<br />
Rahmenbedingungen verändert.
<strong>Landschaftsplan</strong> <strong>Hofbieber</strong> Seite - 2 -<br />
-Grundlagen-<br />
Die <strong>Gemeinde</strong> <strong>Hofbieber</strong> hat deshalb beschlossen, den <strong>Landschaftsplan</strong> an die<br />
veränderten Gegebenheiten und gesetzlichen Rahmenbedingungen anzupassen und<br />
grundlegend fortzuschreiben.<br />
1.2 Ziele, Grundsätze, Vorgaben<br />
Entsprechend den Vorgaben des hess. Naturschutzgesetzes sind "Natur und Landschaft<br />
[...] auf Grund ihres eigenen Wertes und als Lebensgrundlage des Menschen auch in<br />
Verantwortung für die künftigen Generationen im besiedelten und unbesiedelten<br />
Bereich so zu schützen, zu pflegen und zu entwickeln, dass<br />
• die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts,<br />
• die Regenerationsfähigkeit und nachhaltige Nutzungsfähigkeit der Naturgüter,<br />
• die Tier- und Pflanzenwelt einschließlich ihrer Lebensstätten und Lebensräume sowie<br />
• die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und Landschaft auf<br />
Dauer gesichert sind.<br />
Die o.a. Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege sind dabei gemäß den<br />
Aussagen des Bundesnaturschutzgesetzes insbesondere nach Maßgabe folgender<br />
Grundsätze zu verwirklichen, soweit es im Einzelfall zur Verwirklichung erforderlich,<br />
möglich und unter Abwägung aller Anforderungen nach § 1 Abs. 2 angemessen ist:<br />
1. Die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts ist zu erhalten und zu verbessern;<br />
Beeinträchtigungen sind zu unterlassen oder auszugleichen.<br />
2. Unbebaute Bereiche sind als Voraussetzung für die Leistungsfähigkeit des<br />
Naturhaushalts, die Nutzung der Naturgüter und für die Erholung in Natur und<br />
Landschaft insgesamt und auch im einzelnen in für ihre Funktionsfähigkeit<br />
genügender Größe zu erhalten. In besiedelten Bereichen sind Teile von Natur und<br />
Landschaft, auch begrünte Flächen und deren Bestände, in besonderem Maße zu<br />
schützen, zu pflegen und zu entwickeln.<br />
3. Die Naturgüter sind, soweit sie sich nicht erneuern, sparsam zu nutzen; der<br />
Verbrauch der sich erneuernden Naturgüter ist so zu steuern, daß sie nachhaltig zur<br />
Verfügung stehen.<br />
4. Boden ist zu erhalten; ein Verlust seiner natürlichen Fruchtbarkeit ist zu vermeiden.<br />
5. Beim Abbau von Bodenschätzen ist die Vernichtung wertvoller Landschaftsteile oder<br />
Landschaftsbestandteile zu vermeiden; dauernde Schäden des Naturhaushalts sind zu<br />
verhüten.
<strong>Landschaftsplan</strong> <strong>Hofbieber</strong> Seite - 3 -<br />
-Grundlagen-<br />
Das Hessische Naturschutzgesetz konkretisiert die o.a. Grundsätze wie folgt:<br />
• Die Kulturlandschaften des Landes sind in ihrer Vielgestaltigkeit zu erhalten und ihren<br />
naturräumlichen Eigenarten entsprechend zu entwickeln und zu gestalten; dazu gehört eine<br />
ordnungsgemäße Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft. Dabei ist zu berücksichtigen, dass<br />
Lebensräume, Vielfalt, Schönheit und Erholungswert von Natur und Landschaft auch aus<br />
der Vielfalt der menschlichen Nutzung herrühren.<br />
• Verkehrs- und Versorgungseinrichtungen sowie Siedlungen und Bauten werden im Rahmen<br />
ihrer Zweckbestimmung so geplant und gestaltet, dass sie möglichst wenig Fläche<br />
außerhalb im Zusammenhang bebauter Ortsteile in Anspruch nehmen und insbesondere die<br />
Lebensräume und Wanderwege von Tieren sowie die Gestalt und Nutzung der Landschaft<br />
möglichst wenig beeinträchtigen. Wanderwege und Landschaftsteile, die Lebensräume<br />
bedrohter Arten verbinden oder vernetzen, werden besonders geschützt; Wanderwege von<br />
Tieren sollen bei Zerschneidung durch geeignete Maßnahmen wie Querungshilfen neu<br />
geschaffen werden.<br />
• Wertvolle Lebensräume, insbesondere Feuchtgebiete sowie Trocken- und Magerstandorte,<br />
werden erhalten; auf geeigneten Flächen werden sie wiederhergestellt.<br />
• Talauen werden geschützt und erhalten.<br />
• Im besiedelten Bereich werden Lebensräume für wild lebende Tiere und Pflanzen sowie<br />
Flächen zur Verbesserung des örtlichen Klimas erhalten und geschaffen, soweit dies mit<br />
einer geordneten städtebaulichen Entwicklung vereinbar ist.<br />
Die Errichtung des Europäischen ökologischen Netzes „Natura 2000“ ist zu fördern.<br />
Sein Zusammenhalt ist zu wahren und, auch durch die Pflege und Entwicklung eines<br />
Biotopverbunds, zu verbessern. Der Erhaltungszustand der Biotope von<br />
gemeinschaftlichem Interesse, insbesondere der dem Netz „Natura 2000" angehörenden<br />
Gebiete, der Arten von gemeinschaftlichem Interesse und der europäischen Vogelarten<br />
ist zu überwachen. Die besonderen Funktionen der Gebiete von gemeinschaftlicher<br />
Bedeutung und der Europäischen Vogelschutzgebiete innerhalb des Netzes „Natura<br />
2000" sind zu erhalten und bei unvermeidbaren Beeinträchtigungen soweit wie möglich<br />
wiederherzustellen.<br />
Zur Umsetzung der europarechtlichen Vorgaben, insbesondere des Art. 10 der<br />
Richtlinie 79/409/EWG des Rates vom 2. April 1979 über die Erhaltung der wild<br />
lebenden Vogelarten (ABl. EG Nr. L 103 S. 1) (Vogelschutz-Richtlinie), der Art 10, 11,<br />
18 und 22 Buchst. c der Richtlinie 92/43/EWG des Rates zur Erhaltung der natürlichen<br />
Lebensräume sowie der wild lebenden Tiere und Pflanzen (ABl. EG Nr. L 206 S. 7)<br />
(FFH-Richtlinie) und im Rahmen der Umsetzung des Art. 3 der Richtlinie 1999/22/EG<br />
des Rates über die Haltung von Wildtieren in Zoos (ABl. Nr. L 94 S. 24) (Zoo-<br />
Richtlinie), sowie zur Verwirklichung der Ziele und Grundsätze des Naturschutzes und<br />
der Landschaftspflege ist die wissenschaftliche Forschung und die Umweltbeobachtung<br />
im Sinne von § 12 Abs. 2 des Gesetzes über Naturschutz und Landschaftspflege<br />
(BNatSchG) in der Fassung des Gesetzes zur Neuregelung des Rechts des<br />
Naturschutzes und der Landschaftspflege und zur Anpassung anderer<br />
Rechtsvorschriften (BNatSchGNeuregG) vom 25. März 2002 (BGBl. I S. 1193), auch<br />
zur Erfüllung der dem Lande obliegenden Berichtspflichten, sowie die Aus- und<br />
Fortbildung und die Öffentlichkeitsarbeit einschließlich einer altersgemäßen<br />
Naturpädagogik zu unterstützen und nach Möglichkeit zu fördern.
<strong>Landschaftsplan</strong> <strong>Hofbieber</strong> Seite - 4 -<br />
-Grundlagen-<br />
1.3 Vorgehensweise und Planungsablauf<br />
Die Arbeiten zur Fortschreibung des <strong>Landschaftsplan</strong>es der <strong>Gemeinde</strong> <strong>Hofbieber</strong><br />
wurden im Februar 2000 mit der Durchführung des Einleitungstermines begonnen.<br />
Grundsatz und Zielsetzung war während der Bearbeitung des <strong>Landschaftsplan</strong>es, die<br />
verschiedenen Arbeitsschritte und Ergebnisse der einzelnen Bearbeitungsphasen<br />
transparent und nachvollziehbar darzustellen. Die Bürgerinnen und Bürger, die<br />
gemeindlichen Gremien sowie verschiedenen Fachbehörden wurden intensiv sowohl<br />
zeitlich als auch inhaltlich in die Erarbeitung des <strong>Landschaftsplan</strong>es einbezogen.<br />
Vielfältige Diskussionsprozesse mit zahlreichen Reibungspunkten und fachlichen<br />
Auseinandersetzungen begleiteten dabei den <strong>Landschaftsplan</strong> bis zu seinem heutigen<br />
Bearbeitungsstand.<br />
Der Zielsetzung, einen pragmatischen <strong>Landschaftsplan</strong> mit hoher Akzeptanz in der<br />
gesamten Bevölkerung und nicht nur für die Schubladen der Fachbehörden zu<br />
erarbeiten, konnte sich durch zeitliche und inhaltliche Kompromisse aller an der<br />
Aufstellung Beteiligten weitgehend angenähert werden.<br />
TABELLE-NR. 1: „ARBEITSSCHRITTE DER LANDSCHAFTSPLANBEARBEITUNG“<br />
Datum Arbeitsschritt<br />
17.02.2000 Einleitungstermin, Abstimmung der Arbeitsinhalte und<br />
Vorgehensweise mit der <strong>Gemeinde</strong> <strong>Hofbieber</strong> und betr. Fachbehörden<br />
sowie Vertretern der Naturschutzverbände<br />
März / April 2000 Grundlagenermittlung, Zusammenstellung der Plan- und<br />
Kartengrundlagen, Auswertung vorhandener Grundlagen und<br />
Planungsvorgaben, Luftbildauswertung ...<br />
April bis September 2000 Bestandsaufnahmen vor Ort, Erfassung der Biotop- und<br />
Nutzungstypen durch Geländearbeit, Kartierung, weitere Grundlagenermittlung,<br />
Aufbereitung der Kartierungs- und Arbeitsergebnisse<br />
26. u. 28. September 2000 Allgemeine Bürgerinformationsveranstaltungen zum <strong>Landschaftsplan</strong><br />
<strong>Hofbieber</strong> dezentral in den Ortsteilen <strong>Hofbieber</strong> und Elters, öffentliche<br />
Vorstellung der Inhalte, Vorgehensweise und bisherigen Arbeitsergebnisse,<br />
vor allem der Bestandsaufnahmen und Kartierungen vor Ort<br />
September bis Dezember 2000 Auswertung der Bestandsaufnahmen u. vorh. Materialien,<br />
Aufbereitung von Plan- und Kartenmaterial<br />
Dezember bis März 2001 Beteiligung der einzelnen Ortsteile über Ortsvorsteher und<br />
Ortslandwirte anhand von Planausschnitten mit entspr. Legende,<br />
diverse Ortstermine in den Ortsteilen zur Erläuterung der<br />
Planunterlagen: Überprüfung, Ergänzung und Korrektur der<br />
bisherigen Kartierungs- und Arbeitsergebnisse, Einarbeitung der<br />
Hinweise und Anregungen aus den jeweiligen Ortsteilen<br />
April bis Juni 2001 Analyse und Bewertung der Schutzgüter Boden, Grundwasser,<br />
Oberflächengewässer, Klima, Arten und Biotope, Landschaftsbild und<br />
Erholungswert, Erarbeitung und Erstellung thematischer Karten zur<br />
Schutzgutbetrachtung, Aufbereitung der Arbeitsergebnisse<br />
April - September 2001 Überprüfung der flächendeckenden Biotop- und Nutzungskartierung,<br />
ggfs. Ergänzung u. Korrektur der Bestandsaufnahme bzw.<br />
Kartierungen vor Ort<br />
06. Juni 2001 Vorstellung der bisherigen Arbeitsergebnisse zur Analyse und<br />
Bewertung der Schutzgüter, Abstimmung der weiteren
<strong>Landschaftsplan</strong> <strong>Hofbieber</strong> Seite - 5 -<br />
-Grundlagen-<br />
Datum Arbeitsschritt<br />
Vorgehensweise mit der <strong>Gemeinde</strong>verwaltung <strong>Hofbieber</strong><br />
18. Juni 2001 Vorstellung der bisherigen Arbeitsergebnisse zur Analyse und<br />
Bewertung der Schutzgüter, Abstimmung der weiteren<br />
Vorgehensweise mit den Fachbehörden und Naturschutzverbänden<br />
18. Juni 2001 Bürgerinformationsveranstaltung zur Vorstellung der bisherigen<br />
Arbeitsergebnisse zur Analyse und Bewertung der Schutzgüter,<br />
Abstimmung der weiteren Vorgehensweise, Bildung eines<br />
planungsbegleitenden Arbeitskreises "<strong>Landschaftsplan</strong>"<br />
Juli / August 2001 Überarbeitung der bisherigen Arbeitsergebnisse, Korrekturen und<br />
Ergänzungen, Einarbeiten von Hinweisen und Anregungen,<br />
Entwicklung von Leitbildern und Entwicklungszielen<br />
28. August 2001 1. Sitzung des Arbeitskreises <strong>Landschaftsplan</strong>:<br />
Diskussion und Formulierung von Leitbildern und Entwicklungszielen<br />
August / September 2001 Überarbeitung der bisherigen Arbeitsergebnisse, Korrekturen und<br />
Ergänzungen, Einarbeiten von Hinweisen und Anregungen,<br />
Entwicklung von Maßnahmen<br />
25. September 2001 2. Sitzung des Arbeitskreises <strong>Landschaftsplan</strong>:<br />
Diskussion und Entwicklung von Maßnahmen<br />
Oktober bis Dezember 2001 Überarbeitung der bisherigen Arbeitsergebnisse, Korrekturen und<br />
Ergänzungen, Einarbeiten von Hinweisen und Anregungen,<br />
Aufbereitung der Arbeitsergebnisse, Erstellung der Entwicklungskarte<br />
als Vorentwurf<br />
12. Dezember 2001 3. Sitzung des Arbeitskreises <strong>Landschaftsplan</strong>:<br />
Vorstellung und Diskussion der bisherigen Arbeitsergebnisse zu den<br />
Entwicklungs- und Planungsansätzen, Maßnahmen,<br />
Entwicklungskarte als Vorentwurf<br />
Dezember 2001 bis März 2002 Information und Beteiligung der einzelnen Ortsteile über<br />
Ortsvorsteher und Ortslandwirte anhand von Planausschnitten mit<br />
entspr. Legende der Entwicklungskarte<br />
April / Mai 2002 Auswertung der getroffenen Anregungen, Hinweise und Bedenken aus<br />
den einzelnen Ortsteilen<br />
30. April 2002 Abstimmung der eingegangenen Anregungen, Hinweise und<br />
Bedenken mit der <strong>Gemeinde</strong> <strong>Hofbieber</strong>, Diskussion über eine<br />
mögliche Einarbeitung in den <strong>Landschaftsplan</strong><br />
06. Juni 2002 4. Sitzung des Arbeitskreises <strong>Landschaftsplan</strong>:<br />
Vorstellung und Diskussion der eingegangenen Anregungen,<br />
Hinweise und Bedenken aus den Ortsteilen, mögliche Einarbeitung in<br />
den <strong>Landschaftsplan</strong><br />
Juli bis September 2002 Überarbeitung des Vorentwurfes der Entwicklungskarte, Einarbeitung<br />
der Hinweise, Anregungen und Bedenken<br />
24. Oktober 2002 Vorstellung der bisherigen Arbeitsergebnisse<br />
***<br />
(Entwicklungskarte) und Abstimmung der weiteren Vorgehensweise<br />
mit den Fachbehörden und Verbänden
<strong>Landschaftsplan</strong> <strong>Hofbieber</strong> Seite - 6 -<br />
-Grundlagen-<br />
Datum Arbeitsschritt<br />
bis Oktober 2003 Überarbeitung und Abstimmung der Planungsaussagen mit<br />
Fachbehörden, Gremien und Bürgern,<br />
Darstellung des <strong>Landschaftsplan</strong>es in Text und Karte<br />
13. November 2003 Vorstellung des <strong>Landschaftsplan</strong>entwurfes in Text und Karte,<br />
Abstimmungsgespräch mit der Bauverwaltung der <strong>Gemeinde</strong><br />
<strong>Hofbieber</strong><br />
03. März 2004 Öffentliche Informationsveranstaltung zur Vorstellung des <strong>Landschaftsplan</strong>entwurfes<br />
in Text und Karte<br />
März 2004 Bürger- und Behördenbeteiligung nach § 4 (1) HENatG i.V.m.<br />
§ 3 (1) BauGB<br />
ca. April 2004 Auswertung und Abwägung der Bürger- und Behördenbeteiligung,<br />
Überarbeitung des <strong>Landschaftsplan</strong>entwurfes, Korrekturen und<br />
Ergänzungen, Einarbeiten von Hinweisen und Anregungen<br />
ca. Mai 2004 Beschluß des <strong>Landschaftsplan</strong>es durch die <strong>Gemeinde</strong>vertretung<br />
ca. Juni 2004 Einleitung des Anzeigeverfahrens beim Regierungspräsidium Kassel<br />
*** aufgrund von Neuregelungen in der Naturschutzgesetzgebung (Novellierung Bundesnaturschutzgesetz<br />
und Hessisches Naturschutzgesetz) sowie der Natura2000-Thematik (4. Tranche der<br />
FFH-Gebietsmeldungen sowie Vogelschutzgebietsmeldungen) wurde die weitere Bearbeitung des<br />
<strong>Landschaftsplan</strong>es im Oktober 2002 zunächst unterbrochen und nach Abschluß des o.g. Meldeverfahrens<br />
im August 2003 wieder aufgenommen.
<strong>Landschaftsplan</strong> <strong>Hofbieber</strong> Seite - 7 -<br />
-Grundlagen-<br />
2 Allgemeine Grundlagen<br />
2.1 Überblick über das Planungsgebiet<br />
Die <strong>Gemeinde</strong> <strong>Hofbieber</strong> liegt innerhalb des Landkreises Fulda, ca. 11 km nordöstlich<br />
der Stadt Fulda (Oberzentrum), und gehört damit zum Verwaltungsbereich des<br />
Regierungspräsidiums Kassel. Unmittelbar westlich grenzen die <strong>Gemeinde</strong>n Petersberg<br />
und Hünfeld, östlich Tann und Hilders, südlich die <strong>Gemeinde</strong> Poppenhausen und<br />
Dipperz sowie nördlich das <strong>Gemeinde</strong>gebiet Nüsttal an das <strong>Gemeinde</strong>gebiet <strong>Hofbieber</strong><br />
an. Im Nordosten bildet die <strong>Gemeinde</strong>grenze gleichzeitig die Landesgrenze zwischen<br />
Hessen und Thüringen.<br />
Seit 1991 liegen Teilbereiche des <strong>Gemeinde</strong>gebietes innerhalb des Biosphärenreservates<br />
Rhön. Vorgesehen ist hier eine Integration des gesamten <strong>Gemeinde</strong>gebietes in das<br />
Biosphärenreservat.<br />
ABB.-NR.: 1. „Lage im Raum und infrastrukturelle Anbindung”
<strong>Landschaftsplan</strong> <strong>Hofbieber</strong> Seite - 8 -<br />
-Grundlagen-<br />
TABELLE-NR. 2: „ORTSTEILE DER GEMEINDE HOFBIEBER MIT GEMARKUNGSGRÖßEN UND EINWOHNER-<br />
ZAHLEN 1939 BIS 2000“<br />
Ortsteile Gemarkungsgröße<br />
in ha<br />
Einwohner<br />
1939<br />
Einwohner<br />
1950<br />
Einwohner<br />
1985<br />
Einwohner<br />
2000<br />
Allmus 579,29 164 242 196 173<br />
Danzwiesen 487,62 105 128 79 79<br />
Elters 987,36 382 535 522 568<br />
<strong>Hofbieber</strong> 751,62 702 900 1.452 1.854<br />
Kleinsassen/<br />
Schackau<br />
838,33 464 624 491 521<br />
Langenbieber 1.138,51 590 862 837 908<br />
Mahlerts 377,26 91 139 66 67<br />
Niederbieber 567,34 327 447 418 526<br />
Obergruben 320,18 119 200 50 50<br />
Obernüst/Wallings/<br />
Boxberg/Nüsterrasen<br />
580,14 219 337 212 197<br />
Rödergrund/Egelmes 135,32 120 138 96 106<br />
Schwarzbach 987,98 446 627 470 511<br />
Steens 106,58 bei Elters bei Elters bei Elters bei Elters<br />
Traisbach 369,58 137 197 174 212<br />
Wiesen/Mittelberg 330,90 157 256 304 374<br />
Wittges 160,34 96 121 89 99<br />
Langenberg 0 0 40 42<br />
Summen: 8.718,35 4.119 5.753 5.496 6.287<br />
2.2 Naturräumliche Ausgangssituation<br />
Das <strong>Gemeinde</strong>gebiet <strong>Hofbieber</strong> liegt in der naturräumlichen Haupteinheit "Vorder- und<br />
Kuppenrhön" und ist Teil des "Hessischen Bruchschollenlandes", welches dem<br />
Osthessischen Bergland angehört.<br />
Das westliche <strong>Gemeinde</strong>gebiet mit den Gemarkungen Langenbieber, Niederbieber,<br />
Wiesen, Traisbach und Allmus liegt in der naturräumlichen Untereinheit "Westliches<br />
Rhönvorland". Gekennzeichnet wird der beschriebene Landschaftsraum durch<br />
flachwellige Rücken und breite Kuppen, wobei ein dichtes Gewässernetz, das über den<br />
Traisbach und die Bieber in westlicher Richtung zur Haune entwässert, in flachen<br />
Tälern die Landschaft gliedert. Die flachhängige Topographie und gute<br />
Standortbedingungen ermöglichen eine intensive ackerbauliche Nutzung. Die Bachauen<br />
werden überwiegend intensiv als Grünland genutzt.
<strong>Landschaftsplan</strong> <strong>Hofbieber</strong> Seite - 9 -<br />
-Grundlagen-<br />
ABB.-NR.: 2. „Geländemorphologie”<br />
Der östliche Bereich des <strong>Gemeinde</strong>gebietes liegt in der naturräumlichen Untereinheit<br />
der "Milseburger Kuppenrhön", einem insgesamt hügeligen Landschaftsraum mit<br />
einzelnen Basalt- und Phonolithkuppen. Während die Höhen überwiegend bewaldet<br />
sind, ist in den zum Teil tief eingeschnittenen Tälern ein engmaschiges Nutzungsmosaik<br />
aus Acker- und Grünlandnutzung festzustellen. Landschaftsgliedernd wirken sich hier<br />
die verschiedenen Fließgewässer aus. Die klimatisch ungünstigeren Verhältnisse in den<br />
höheren Lagen haben auf Flachhängen und im Bereich von Hochebenen einen hohen<br />
Grünlandanteil zur Folge. Die günstigeren Lagen um Schwarzbach und nordöstlich von<br />
<strong>Hofbieber</strong> werden intensiv als Acker genutzt. Insgesamt herrscht im östlichen Teil des<br />
<strong>Gemeinde</strong>gebietes eine eng verzahnte Acker - Grünland - Mischnutzung mit<br />
eingestreuten Waldparzellen vor.<br />
2.3 Historische Entwicklung der Kulturlandschaft<br />
Zeugnisse erster Besiedelung gibt MÜLLER (1994) auf den Zeitraum von ca. 8.000 bis<br />
5.700 v.Chr. (Mesolithikum) an und belegt dies u.a. durch Steinartefakten (z.B. Klinge<br />
aus bräunlichschwarzem Hornstein westlich von Schackau). Weitere Kleingeräte (Äxte,<br />
Schaber, ...) und zwei Hügelgräber mit Grabbeigaben im Bereich Bieberstein entstammen<br />
der Bronzezeit (ca. 1.600 bis 1.200 v.Chr.). Die Ringwallanlage „Oppidum<br />
Milseburg“ (ein 1.300 m langer Steinwall mit 32,5 ha Fläche) bei Danzwiesen war vom<br />
6./5. Jhd. bis ins 1. Jhd. v.Chr. besiedelt. Funde aus dem ersten Jahrtausend sind nach<br />
MÜLLER bisher nicht bekannt. Zeugen des Mittelalters finden sich auf der Milseburg als<br />
Überreste einer kleinen Turmburg, die vom 11. bis 13. Jhd. bestanden hat.<br />
Einhergehend mit den Siedlungstätigkeiten entwickelten sich die Menschen vom „Jäger<br />
und Sammler“ hin zu „Ackerbau und Viehzucht“. Der Beginn der heutigen Ortschaften<br />
und die Ausweitung des Kulturlandes (Rodungs- und Siedlungstätigkeiten) wurden
<strong>Landschaftsplan</strong> <strong>Hofbieber</strong> Seite - 10 -<br />
-Grundlagen-<br />
durch die Gründung des Klosters Fulda (744) begünstigt. Der Höhepunkt der<br />
Rodungstätigkeiten im osthessischen Raum ist etwa um 1.150 anzusetzen.<br />
Anfangs kleine Flächen wurden gerodet und in abwechselnden Nutzungen (primitive<br />
Pflugscharen) bestellt. Mitunter stellten sich Brachflächen ein, die sich auch wieder zu<br />
Wald entwickeln konnten. So bildeten sich abwechslungsreiche Strukturen aus Ackerund<br />
Grünlandflächen (Feld-Heide-Wirtschaft) sowie verschiedene Waldnutzungen<br />
(Niederwald, Waldweide) heraus.<br />
Durch Kriege, Epidemien und Hungernöte im hohen Mittelalter wurden gerade in den<br />
Mittelgebirgsregionen einzelne Dörfer wieder aufgegeben (Wüstungen). In der<br />
Konsequenz konnten sich Landschaftsteile wiederbewalden.<br />
Im späten Mittelalter (16./17. Jhd.) erreichte der Ackerbau wieder eine große<br />
Ausdehnung. Dies bedingte einen Rückgang der Waldflächen, die jetzt ohnehin stark<br />
genutzt wurden (Waldweide, Brenn- und Bauholz, Köhlerei, ...). Auch der<br />
dreissigjährige Krieg konnte diese Tendenz nur kurz unterbrechen. Ab der zweiten<br />
Hälfte des 17. Jhd. nahm die Bevölkerung zu und die Intensivierung der Landnutzung<br />
setzte mehr und mehr ein. Noch besteht ein abwechslungsreiches Nutzungsmosaik und<br />
es ist vom Höhepunkt der Artenvielfalt in Feld und Flur auszugehen.<br />
Ab Anfang/Mitte des 19. Jhd. wurden erste Bodenmeliorationen (Fließgewässerbegradigungen,<br />
Entwässerungen, Wegebau) durchgeführt. Mit der Erfindung der<br />
Mineraldüngung (Justus v. Liebig) und dem Einsatz erster Maschinen in der<br />
Landwirtschaft wurden höhere Erträge erzielt.<br />
Seit dem 18. Jhd. versuchten die Landesherren durch hoheitliche Anordnungen<br />
(Mehrfachnutzung Obst, Bodenaufwuchs, Brennholz) den Obstanbau auszuweiten. Dies<br />
bedingte gerade in Ortsnähe umfangreiche Bestände (Obstbaumgürtel).<br />
Im 19. Jhd. und in der ersten Hälfte des 20. Jhd. wurden Teile der Rhön durch<br />
Aufforstungen (vermehrt durch Nadelgehölze) entscheidend verändert (Preußischer<br />
Rhön-Aufbauplan von 1935, Dr. Hellmuth-Plan 1938).<br />
Die Melioration von landwirtschaftlichen Flächen wird ab dieser Zeit verstärkt. Die<br />
Blockschuttweiden wurden in den 1930er Jahren durch den Reichsarbeitsdienst<br />
abgeräumt, feuchte Standorte wurden durch Drainagen entwässert und so besser nutzbar<br />
gemacht. Mit dem verstärkten Düngereinsatz und entsprechend höheren Erträgen<br />
tendierte man in den höheren Mittelgebirgslagen zu Ungunsten des Ackerbaus eher zur<br />
Grünlandnutzung (Weide, Wiese) oder zur Aufforstung.<br />
Die kleinteiligen Nutzungen der Feldflächen erschwerten jedoch die maschinelle<br />
Bewirtschaftbarkeit. Deswegen wurden Verkoppelungen (Flurbereinigung)<br />
durchgeführt, die neue Zuschnitte der Landschaften bewirkten. Es entstanden größere<br />
Schläge mit einem entsprechenden Netz von Feldwegen. Abwechslungsreiche<br />
Nutzungsbilder mit entsprechendem Durchsatz von Feldgehölzen verschwanden<br />
mitunter. Ab Mitte des 20. Jhd. wuchsen auch die Flächen für Siedlungen und Strassen<br />
entsprechend an.<br />
Ab etwa 1980 entwickelte sich die kleinbäuerliche Landwirtschaft in immer größere<br />
Dimensionen der Haupterwerbsbetriebe mit entsprechendem Rückgang der<br />
Nebenerwerbsbetriebe. Damit einher gingen Tendenzen zu Flächenintensivierungen und<br />
Nutzungsumwandlungen bzw. Nutzungsaufgaben auf seither extensiv genutzten<br />
Grundstücken. Somit besteht eine Verantwortung, die aktuellen Vorkommen naturnaher<br />
Lebensräume und die darauf lebenden Tier- und Pflanzenarten in ihrem Bestand<br />
dauerhaft zu sichern, zu erhalten und zu pflegen.
<strong>Landschaftsplan</strong> <strong>Hofbieber</strong> Seite - 11 -<br />
-Grundlagen-<br />
2.4 Planungsrelevante Vorgaben<br />
ABB.-NR.: 3. „Überblick: Planungsvorgaben”<br />
2.4.1 Regionalplan Nordhessen 2000<br />
<strong>Hofbieber</strong> gehört als Kleinzentrum zum Mittelbereich des Oberzentrums Fulda. Der<br />
überwiegende Teil des <strong>Gemeinde</strong>gebietes ist im Regionalplan als Bereich für die<br />
Landwirtschaft dargestellt. Die Randbeiche der Ortslagen werden vorwiegend als<br />
Bereiche für Landschaftsnutzung und -pflege ausgewiesen. Der Brutto-Wohnsiedlungsflächenbedarf<br />
für die <strong>Gemeinde</strong> wird mit 23 ha für den Zeitraum von 1998 bis 2010<br />
angegeben. Siedlungszuwachsflächen sind nur für den Ortsteil <strong>Hofbieber</strong> ausgewiesen.<br />
In allen anderen Ortsteilen können die erforderlichen Wohnsiedlungsflächen innerhalb<br />
und am Rande der Ortslagen in den Bereichen für Landschaftsnutzung und -pflege bis<br />
zu einer Größe von 5 ha ausgewiesen werden.
<strong>Landschaftsplan</strong> <strong>Hofbieber</strong> Seite - 12 -<br />
-Grundlagen-<br />
2.4.2 Landschaftsrahmenplan<br />
Der Landschaftsrahmenplan für die Region Nordhessen liegt seit 2000 vor. Im<br />
Landschaftsrahmenplan werden die überörtlichen Erfordernisse und Maßnahmen zur<br />
Verwirklichung der Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege dargestellt.<br />
So werden für das <strong>Gemeinde</strong>gebiet <strong>Hofbieber</strong> im Landschaftsrahmenplan vor allem<br />
folgende Entwicklungsaussagen dargestellt:<br />
• die Naturschutz- und Landschaftsschutzgebiete als Flächen mit rechtlichen Bindungen,<br />
• die Flächen für den Biotopverbund und die Biotopentwicklung, hier das gesamte östliche<br />
<strong>Gemeinde</strong>gebiet als Schwerpunktraum der Biotopverbundkonzeption Magerrasen, Heiden<br />
und Bergwiesen sowie das Fließgewässer Bieber in den Abschnitten Kleinsassen,<br />
Langenbieber und Niederbieber als Schwerpunktraum des Biotopverbundes Fließgewässer,<br />
• die gepl. Ortsumgehung Schwarzbach als großräumige Beeinträchtigung des<br />
Naturhaushaltes,<br />
• das gesamte <strong>Gemeinde</strong>gebiet <strong>Hofbieber</strong> als "Erholungsraum herausragender Bedeutung",<br />
• Landschaftsräume im Bereich der Milseburg, den Talraum der Nässe, Hänge und<br />
Hochflächen um das Fließgewässer Bieber sowie der Talraum der Bieber als freizuhaltende<br />
Flächen aus Gründen des Landschaftsbildes,<br />
• Räume mit besonderer Bewirtschaftung und Pflege aus Gründen des Boden- und<br />
Grundwasserschutzes im östlichen <strong>Gemeinde</strong>gebiet, vor allem im Bereich<br />
erosionsgefährdeter Hanglagen.<br />
Obwohl nach Novellierung des Hess. Naturschutzgesetzes 2002 die Planungsebene des<br />
Landschaftsrahmenplanes nicht mehr besteht, wurden die Aussagen des<br />
Landschaftsrahmenplanes (Entwurf 1999) in den <strong>Landschaftsplan</strong> integriert und entspr.<br />
berücksichtigt.<br />
2.4.3 Rahmenkonzept Biosphärenreservat Rhön<br />
Der überwiegende Teil der <strong>Gemeinde</strong> <strong>Hofbieber</strong> liegt innerhalb des im März 1991 von<br />
der UNESCO anerkannten Biosphärenreservat Rhön. Das erarbeitete Rahmenkonzept<br />
versteht sich als integriertes Gesamtkonzept für die Entwicklung der gesamten Region<br />
auf Basis ihrer naturräumlichen Grundlagen. Die Ziele und Grundsätze sind demnach<br />
auch auf weite Teile der <strong>Gemeinde</strong> <strong>Hofbieber</strong> anzuwenden. Wichtige gemeindebezogene<br />
Vorgaben ergeben sich dabei aus der Zonierung und den fachlichen<br />
Zielsetzungen bzw. Leitbildern.<br />
Die überwiegenden Teile des <strong>Gemeinde</strong>gebietes sind der Entwicklungszone des<br />
Biosphärenreservates zuzuordnen. Kleinere Teilbereiche der <strong>Gemeinde</strong> befinden sich<br />
innerhalb der Pflegezone (Milseburg, Wallings/Boxberg) bzw. Kernzone (Bubenbader<br />
Stein).<br />
Unter der Zielsetzung des Biosphärenreservates "Erhaltung und Entwicklung der<br />
charakteristischen Kulturlandschaft Rhön" sind folgende Leitbilder für das<br />
<strong>Gemeinde</strong>gebiet von Bedeutung:
<strong>Landschaftsplan</strong> <strong>Hofbieber</strong> Seite - 13 -<br />
-Grundlagen-<br />
... zur Entwicklung der Ökosysteme:<br />
• Erhalt und Entwicklung natürlicher und naturnaher Ökosysteme,<br />
• Erhalt und Entwicklung extensiv genutzter Ökosysteme mit hoher Bedeutung für den Erhalt<br />
des genetischen Potentials,<br />
• Erhalt und Verbesserung der Funktionen von Ökosystemen im Naturhaushalt,<br />
• Verringerung der Belastungen des Naturhaushaltes.<br />
... zur Entwicklung der Nutzungsformen:<br />
• Erhalt bzw. Umstellung auf umweltschonende Nutzungsformen und -intensitäten,<br />
• keine wesentlichen Belastungen von Boden, Wasser und Luft sowie der Lebensräume von<br />
Tieren und Pflanzen,<br />
• Erhalt und Entwicklung herkömmlicher Nutzungsformen zur Pflege der Kulturlandschaft.<br />
2.4.4 Rechtliche Bindungen und sonstige Rahmenbedingungen<br />
- Naturschutzgebiet<br />
Innerhalb des <strong>Gemeinde</strong>gebietes sind drei rechtsverbindlich ausgewiesene<br />
Naturschutzgebiete zu beschreiben. Es handelt sich hier um das Naturschutzgebiet<br />
Milseburg (46,46 ha) und das Naturschutzgebiet Bieberstein bei Langenbieber (7 ha),<br />
sowie in Teilbereichen um das Naturschutzgebiet Stellberg bei Wolferts (12,5 ha).<br />
- Landschaftsschutzgebiet<br />
Der überwiegende Teil des <strong>Gemeinde</strong>gebietes <strong>Hofbieber</strong> befindet sich innerhalb des<br />
Landschaftsschutzgebietes "Hessische Rhön". Darüberhinaus ist für den Bereich der<br />
Hauneaue ein Landschaftsschutzgebiet ausgewiesen.<br />
- Naturdenkmale<br />
Innerhalb des <strong>Gemeinde</strong>gebietes sind verschiedene Naturdenkmale ausgewiesen. Es<br />
handelt sich hier überwiegend um alten Baumbestand und geologisch besondere<br />
Formationen.<br />
- FFH - und Vogelschutzgebietsmeldungen (Natura 2000)<br />
Innerhalb des <strong>Gemeinde</strong>gebietes <strong>Hofbieber</strong> ist das Naturschutzgebiet Milseburg als<br />
FFH - Gebiet gemeldet. Zur weiteren Meldung vorgesehen (Stand August 2003) ist die<br />
Hessenliede und der Kugelberg bei <strong>Hofbieber</strong>, der Liedenküppel in unmittelbarer<br />
Benachbarung der Milseburg sowie das Naturschutzgebiet Stellberg bei Wolferts.
<strong>Landschaftsplan</strong> <strong>Hofbieber</strong> Seite - 14 -<br />
-Grundlagen-<br />
Das östliche <strong>Gemeinde</strong>gebiet <strong>Hofbieber</strong>s, ca. östlich der Linie Schwarzbach - Elters -<br />
Schackau, ist gemäß Vogelschutzrichtlinie zur Meldung als Vogelschutzgebiet<br />
vorgesehen.<br />
- Flächennutzungsplan:<br />
Die <strong>Gemeinde</strong> <strong>Hofbieber</strong> verfügt über einen Flächennutzungsplan, der seit 1998<br />
rechtskräftig ist. Für die <strong>Landschaftsplan</strong>ung relevante Planungskategorien des<br />
Flächennutzungsplanes sind u.a.:<br />
• Art der baulichen Nutzung,<br />
• Einrichtungen und Anlagen zur Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen des<br />
öffentlichen und privaten Bereichs,<br />
• Flächen für Sport- und Spielanlagen,<br />
• Flächen für den überörtlichen Verkehr<br />
• Flächen für Versorgungsanlagen<br />
• Grünflächen<br />
• Hauptversorgungs- und Hauptabwasserleitungen<br />
• Wasserflächen<br />
• Flächen für Aufschüttungen, Abgrabungen oder für die Gewinnung von Bodenschätzen<br />
• Flächen für die Landwirtschaft<br />
• Waldflächen<br />
• Planungen, Nutzungsregelungen, Massnahmen und Flächen für Massnahmen zum Schutz,<br />
zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft<br />
• Regelungen für die Stadterhaltung und für den Denkmalschutz<br />
- Bebauungspläne<br />
Die verbindliche Bauleitplanung der <strong>Gemeinde</strong> <strong>Hofbieber</strong> wird über diverse<br />
rechtskräftige bzw. z.Zt. in Aufstellung befindliche Bebauungspläne geregelt.<br />
- Dorferneuerungen, Dorfentwicklungsplanungen<br />
Die Ortsteile Kleinsassen und Schwarzbach waren Förderschwerpunkte der<br />
Dorferneuerung mit zahlreichen kommunalen und privaten Dorferneuerungsmaßnahmen.<br />
Der Ortsteil Langenbieber ist zur Zeit aktueller<br />
Dorferneuerungsschwerpunkt innerhalb des <strong>Gemeinde</strong>gebietes.
<strong>Landschaftsplan</strong> <strong>Hofbieber</strong> Seite - 15 -<br />
-Biotop- und Nutzungsstrukturen-<br />
3 Biotop- und Nutzungsstrukturen<br />
3.1 Methodik<br />
Zur Erfassung der aktuellen Biotop- und Nutzungsstrukturen wird die folgende<br />
Vorgehensweise zur Anwendung gebracht:<br />
Auswertung der Inhalte und Vorgaben des<br />
<strong>Landschaftsplan</strong>es 1988 der <strong>Gemeinde</strong> <strong>Hofbieber</strong><br />
Feldarbeiten:<br />
Im Jahr 2000: Biotop- und Nutzungskartierung<br />
nach Kartierschlüssel, vgl. Kap.<br />
4.3<br />
Im Jahr 2001: Div. Überprüfungen und<br />
Ergänzungen (u.a. Grünlandintensitäten,<br />
Gewässerstrukturen,<br />
Artnachweise von Pflanzen und<br />
Tieren)<br />
Ergebnis: Karte Nr. 2<br />
Vorarbeiten:<br />
Literaturarbeiten:<br />
Einarbeitung und Überprüfung div. Vorgaben und<br />
Informationen, vgl. Kap. 5.4.3 (Bewertung):<br />
Landschaftsrahmenplan 1999, Hessische<br />
Biotopkartierung, Flächenschutzkarte, Botanisch<br />
wertvolle Gebiete („Potentiell Natürliche<br />
Vegetation“), Zoologischer Artenschutz im<br />
Biosphärenreservat Rhön, Pflegepläne der<br />
Naturschutzgebiete, Gewässerstrukturgüte und deren<br />
Defizitkarten, Amphibienschutz im Landkreis Fulda,<br />
Sonstige Artnachweise, ...<br />
Zusammenstellung der Ergebnisse und Informationen:<br />
Biotopkomplexe und Biotopsteckbriefe<br />
vgl. u.a. Anhang I,<br />
Auswertung der Luftbildkarten (1:5.000) und<br />
Erstellen einer Arbeitskarte TK 1:10.000<br />
einhergehend mit Kap. 5.4 (Bewertung der Bestandsaufnahme)<br />
ABB.-NR.: 4. „Methodik zur Erfassung der aktuellen Biotop- und Nutzungsstrukturen”<br />
Für die Feldkartierung wurde der nachfolgende Kartierschlüssel in Anlehnung an die<br />
Anleitung zur Hess. Biotopkartierung (vgl. HESS. MIN. F. LANDESENTWICKLUNG,<br />
WOHNEN, LANDWIRTSCHAFT, FORSTEN UND NATURSCHUTZ, 1994; HESS. MIN. F.<br />
UMWELT, LANDWIRTSCHAFT UND FORSTEN, 1999) unterschieden. Ergänzend wird auf<br />
die Arbeiten von BOCKHOLT, FUHRMANN & BRIEMLE (1996) und BRIEMLE, EICKHOFF &<br />
WOLF (1991) verwiesen.
<strong>Landschaftsplan</strong> <strong>Hofbieber</strong> Seite - 16 -<br />
-Biotop- und Nutzungsstrukturen-<br />
3.2 Erfassung der Biotop- und Nutzungsstrukturen<br />
Wie für den osthessischen Naturraum typisch, besteht das Planungsgebiet aus einer<br />
mosaikartigen Verteilung von Wäldern, Wiesen und Feldern und nicht zu vergessen den<br />
einzelnen Ortslagen der Großgemeinde.<br />
Festzustellen ist, dass sich Wälder z.T.<br />
großflächig verteilen, aber auch<br />
eingestreut die (Halb-)Offenlandschaft<br />
bereichern. In der landwirtschaftlichen<br />
Nutzung wechseln sich verschiedene<br />
Ackernutzungen und –brachen mit einer<br />
Spannbreite von Grünlandintensitäten mit<br />
entsprechenden Pflanzengesellschaften ab.<br />
Durchzogen wird das Planungsgebiet von<br />
einem reichhaltigen Netz an Fließge-<br />
wässern, welche zumeist als naturnah mit<br />
standortgerechten Ufergehölzen angesprochen<br />
werden können. Hier sind auch<br />
ABB.-NR.: 5. „Landschaftsausschnitt von<br />
Wallings über Schwarzbach”<br />
Stillgewässer von der Quelle über den Amphibientümpel bis zum Fischteich<br />
anzuführen. In wechselnder Verteilung finden sich vielfältige flächige und linienhafte<br />
Feldgehölze sowie Einzelbäume (Laub / Obst) in unterschiedlichen Ausprägungen.<br />
ABB.-NR.: 6. „Überblick: Biotop- und Nutzungsstrukturen”
<strong>Landschaftsplan</strong> <strong>Hofbieber</strong> Seite - 17 -<br />
-Biotop- und Nutzungsstrukturen-<br />
Flächenbilanz Biotoptypen- und Nutzungskartierung<br />
ABB.-NR.: 7. „Flächenbilanz Biotoptypen- und Nutzungskartierung”<br />
Erfassungsgenauigkeit 1:10.000,<br />
ohne Verkehrsflächen und Fließgewässer
<strong>Landschaftsplan</strong> <strong>Hofbieber</strong> Seite - 18 -<br />
-Biotop- und Nutzungsstrukturen-<br />
Entsprechend den geomorphologischen Verhältnissen zeigt sich der östliche Teil des<br />
<strong>Gemeinde</strong>gebietes im Vergleich zum westlichen Teil als kleinstrukturierter und<br />
vielfältiger, der Grünlandanteil ist hier auch höher. Ebenso ist hier eine höhere Dichte<br />
von die Landschaft gliedernden Gehölz- und Saumbiotopen vorzufinden.<br />
Die zusammengefasste Flächenbilanz zeigt:<br />
Waldflächen: 3.598 ha<br />
Stillgewässerflächen: 6,25 ha<br />
Brachflächen: 64,23 ha<br />
Steinbrüche: 1,13 ha<br />
Grünlandflächen: 2.477,19 ha<br />
Ackerflächen: 1.650,36 ha<br />
Grünflächen: 60,22 ha<br />
Bebauung: 236,18 ha<br />
Deponieflächen: 8,43 h<br />
Alle Flächen in ca. ha (Erfassungsgenauigkeit 1:10.000), ohne Verkehrsflächen und Fließgewässer,<br />
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Hofbieber</strong> gesamt: 8.718 ha.<br />
3.2.1 Wälder<br />
Der Flächenanteil der Waldflächen in den einzelnen Gemarkungen des <strong>Gemeinde</strong>gebietes<br />
<strong>Hofbieber</strong> ist sehr unterschiedlich. So entfallen die höchsten Prozentsätze auf<br />
die Gemarkungen mit den größten zusammenhängenden Waldflächen: Schwarzbach mit<br />
592 ha, was einem Anteil an der Gesamtfläche der Gemarkung von 60 % entspricht und<br />
Langenbieber mit 600 ha und einem Prozentsatz von 53 % der Gemarkungsfläche. Die<br />
kleineren Gemarkungen Wittges und Rödergrund/Egelmes hingegen haben prozentual<br />
weniger als 8 % forstwirtschaftlich genutzte Gemarkungsfläche.<br />
Je nach den standörtlichen Bedingungen ergibt sich in den übrigen Gemarkungen eine<br />
Spanne von 21 - 28 % in Obernüst, <strong>Hofbieber</strong>, Niederbieber und zwischen 30 - 45 % in<br />
Traisbach, Langenberg, Kleinsassen, Wiesen, Obergruben, Mahlerts, Danzwiesen,<br />
EIters/Steens und AlImus.<br />
Eine Vielzahl von kleineren Waldparzellen gliedert und belebt das Landschaftsbild in<br />
weiten Teilen des <strong>Gemeinde</strong>gebietes, mit Ausnahme der Ebene westlich <strong>Hofbieber</strong>.<br />
Die Besitzstruktur weist 55 % der Holzbodenfläche als Staatswald aus. Den zweitgrößten<br />
Flächenanteil nimmt der Kleinprivatwald ein. Dieser konzentriert sich vor allem<br />
auf die Gemarkungen Langenbieber, Niederbieber und Allmus und tritt im übrigen<br />
<strong>Gemeinde</strong>gebiet als kleine flurgliedernde Wälder auf. Im südlichen Bereich, in Kleinsassen<br />
und Danzwiesen sind die Forstflächen vorwiegend Großprivatwald in der Verwaltung<br />
der Guttenberg'schen Forstverwaltung. Gliedervermögen und <strong>Gemeinde</strong>wald<br />
spielen eine untergeordnete Rolle.<br />
Heute verteilt sich die Baumartenzusammensetzung nach Baumartengruppen im Durchschnitt<br />
aller Waldbesitzarten auf 10% Eiche, 35 % Buche, 35 % Fichte und 25 % Kiefer<br />
sowie in geringeren Anteilen auf Bergahorn, Esche, Douglasie und Lärche.<br />
Die Altersklassenverhältnisse sind besonders bei der Fichte stark zugunsten junger<br />
Altersklassen verschoben. Allgemein ist der Anteil an Jungwuchsflächen aufgrund<br />
Schneebruch und Sturm der Jahre 82 - 84 sowie 90 / 91 sehr hoch.
<strong>Landschaftsplan</strong> <strong>Hofbieber</strong> Seite - 19 -<br />
-Biotop- und Nutzungsstrukturen-<br />
Wälder wurden im Zuge der Feldarbeiten nicht eigenständig behandelt. In Ermangelung<br />
der Daten der Forsteinrichtung wurde die flächenhafte Abgrenzung der<br />
Topographischen Karte (TK 25) übernommen. Abweichungen und Besonderheiten im<br />
Zuge der Feldarbeiten wurden kategorisiert. Informationsgewinne über besondere<br />
Waldbereiche entstanden hauptsächlich durch Literaturauswertung, aber auch durch<br />
stichprobenartige Kontrollen.<br />
Differenziert wurden im Rahmen der Erarbeitung des <strong>Landschaftsplan</strong>es:<br />
• Waldflächen gemäß Topographischer Karte (TK)<br />
• Erlenbruchwälder<br />
• Sonstige Laubwaldbestände (in flächenhafter Abweichung zur TK, Altbestand)<br />
• Laubwald-/Mischwald-Aufforstungen (seit ca. 1985)<br />
• Sonstige Nadelwaldbestände (in flächenhafter Abweichung zur TK, Altbestand)<br />
• Nadelwald-Aufforstungen (seit ca. 1985)<br />
• Waldränder<br />
Weiterhin sind als Habitate und Strukturen zu nennen:<br />
• Felsformationen, natürlich anstehend<br />
• Blockschutthalden<br />
• Lesesteinwälle / Lesesteinhaufen<br />
• Besondere Reliefausprägungen<br />
Als Besonderheiten sind die naturnahen<br />
Laubwaldgesellschaften (u.a. Waldmeister-Buchenwald,<br />
Orchideen-Buchenwald und Bergseggen-<br />
Buchenwald) zu beschreiben, die in folgenden<br />
Gemarkungsteilen vorkommen: Milseburg / Liedenküppel,<br />
Stellberg, Bubenbader Stein, Schackenberg /<br />
Ziegenkopf, Wadberg, Hohlstein / Fuchsstein,<br />
Hessenliede / Kugelberg / Bieberstein, Sandberg,<br />
Bomberg, Großer Grubenhauck, Schwarzehauk /<br />
Gickershauk, Nüster-Berg / Hozzel-Berg / Boxberg.<br />
ABB.-NR.: 8. „Buchenwald an der<br />
Hessenliede”<br />
Erlen-Auwälder finden sich fragmentarisch an den verschiedenen Bachläufen sowie an<br />
feuchten Hängen.
<strong>Landschaftsplan</strong> <strong>Hofbieber</strong> Seite - 20 -<br />
-Biotop- und Nutzungsstrukturen-<br />
3.2.2 Gehölze<br />
Gehölze durchziehen als flächige, lineare oder punktuelle Bestände das <strong>Gemeinde</strong>gebiet<br />
<strong>Hofbieber</strong> in vielfältigen Arten und Ausprägungen. Unterschieden wurden im<br />
einzelnen:<br />
• Laubbäume (hier vor allem markante Einzelbäume, Altbäume, Neupflanzungen)<br />
• Obstbäume (Altbäume, Neupflanzungen)<br />
• Hecken- und Feldgehölze trockener bis frischer Standorte<br />
• Feld- und Ufergehölze frischer bis nasser Standorte<br />
• Standortfremde Gehölze<br />
3.2.3 Gewässer<br />
Die Gewässer innerhalb des <strong>Gemeinde</strong>gebietes wurden in folgenden Kategorien erfasst<br />
und differenziert:<br />
• Stillgewässer, naturnaher Zustand<br />
• Stillgewässer, naturferner Zustand<br />
• Quellen<br />
ABB.-NR.: 10. „Bieberweiher”<br />
• Fließgewässer (Mittelgebirgsbäche und Gräben)<br />
ABB.-NR.: 9. „Naturnaher Fließgewässerabschnitt am<br />
Oberlauf der Bieber”
<strong>Landschaftsplan</strong> <strong>Hofbieber</strong> Seite - 21 -<br />
-Biotop- und Nutzungsstrukturen-<br />
3.2.4 Brachflächen<br />
Als Brachflächen wurden periodisch oder dauerhaft nicht genutzte Flächen<br />
unterschieden. Hierbei handelt es sich um:<br />
• Feuchte Hochstaudenflächen und Röhrichte<br />
• Brachflächen frischer Standorte<br />
• Brachflächen trockener Standorte<br />
Hervorzuheben sind die feucht-anmoorigen Standorte, die über Jahrhunderte periodisch<br />
genutzt wurden und aufgrund ihrer besonderen Bedingungen einer Vielzahl von<br />
spezialisierten Arten Lebensraum bieten. Da einige Flächen in der jüngeren<br />
Vergangenheit nicht mehr –auch bzw. gerade weil sie schlecht/nicht befahrbar sind– in<br />
die wirtschaftlichen Betriebsabläufe passen, entwickelten sich Brachen.<br />
Anzuführen ist auch ein Schilfröhrichtbestand.<br />
3.2.5 Gesteinsbiotope und sonstige Habitate<br />
Größere Vorkommen, die mitunter<br />
unregelmäßig genutzt/gepflegt werden,<br />
finden sich bei Danzwiesen, bei Öchenbach<br />
und am Riegelbach.<br />
Die Gesteinsbiotope und sonstigen Habitate innerhalb des <strong>Gemeinde</strong>gebietes wurden<br />
wie folgt kartiert, wobei sowohl Vorkommen im Wald als auch im Offenland<br />
beschrieben werden:<br />
• Steinbrüche (Basalt / Phonolith, Kalk)<br />
• Felsformationen, natürlich anstehend (Basalt / Phonolith, Kalk)<br />
• Blockschutthalden<br />
• Lesesteinwälle / Lesesteinhaufen<br />
• Besondere Reliefausprägungen<br />
ABB.-NR.: 11. „Feuchte Hochstaudenflur bei<br />
Danzwiesen”
<strong>Landschaftsplan</strong> <strong>Hofbieber</strong> Seite - 22 -<br />
-Biotop- und Nutzungsstrukturen-<br />
Besonderer Wert ist hier einerseits auf die erdgeschichtlichen Felsbildungen und<br />
Blockschutthalden (zumeist Basalt / Phonolith, auch Kalk) zu legen.<br />
Von Bedeutung sind aber auch offen gelassene Steinbrüche, die u.a. mit ihren<br />
Gesteinswänden besondere Lebensraumbedingungen sowie geologischen Anschauungsunterricht<br />
bieten.<br />
ABB.-NR.: 12. „Milseburg” ABB.-NR.: 13. „Kalksteinbruch bei Elters”<br />
3.2.6 Grünlandflächen<br />
Dauergrünlandflächen wurden hinsichtlich vorkommender Pflanzenarten und –gesellschaften,<br />
Aufwuchsdichte und –menge sowie Nutzungsintensitäten unterschieden:<br />
• Grünlandflächen frischer Standorte, intensiv genutzt<br />
• Grünlandflächen frischer Standorte, mittlere Nutzungsintensität<br />
• Grünlandflächen frischer Standorte, extensiv genutzt<br />
• Grünlandflächen feuchter bis nasser Standorte<br />
• Goldhaferwiesen<br />
• Magerrasen auf Kalkgestein<br />
• Magerrasen auf Basaltgestein<br />
• Borstgrasrasen<br />
Grünländer nehmen nach dem Wald den<br />
größten Flächenanteil im <strong>Gemeinde</strong>gebiet<br />
ein. Neben den mittel bis intensiv<br />
genutzten Flächen (zusammen fast 2.200<br />
ha und knapp 89% des Gesamtgrünlandes)<br />
müssen die besonderen Grünlandtypen<br />
Erwähnung finden.<br />
ABB.-NR.: 14. „intensive Ziegenstandweide auf<br />
potentiell artenreichem Standort”
<strong>Landschaftsplan</strong> <strong>Hofbieber</strong> Seite - 23 -<br />
-Biotop- und Nutzungsstrukturen-<br />
Artenreiche extensiv genutzte Frischwiesen (zumeist dem Typ Glatthaferwiese<br />
zuzuordnen) kommen verteilt im Planungsgebiet vor und nehmen mit gut 220 ha fast<br />
9% des Grünlandes ein.<br />
Feuchtwiesen finden sich “Im Loels” nördlich von Allmus sowie Restvorkommen in<br />
den Bachauen von Bieber, Nässe, Nüst und Riegelbach oder begleitend von<br />
Quelltöpfen.<br />
Markante und artenreiche Goldhaferwiesen<br />
(knapp 36 ha) wurden nördlich von<br />
Wallings bis Boxberg sowie südlich,<br />
östlich und nördlich der Milseburg<br />
vorgefunden.<br />
Als Vertreter der besonders nährstoffarmen Standorte lassen sich die Kalkmagerrasen,<br />
Basaltmagerrasen und Borstgrasrasen mit jeweils gut 3 ha nennen.<br />
Artenreiche Kalkmagerrasen kommen vor<br />
bei Wallings / Boxberg, am Schnurberg,<br />
an der Hessenliede und bei Öchenbach;<br />
Basaltmagerrasen am Stöckküppel, am<br />
Schröcksküppel und am Ulrichshauk bei<br />
Schwarzbach sowie am Kirschberg,<br />
Schweinsberg und Kleiner Grubenhauck<br />
bei Langenberg / Obergruben.<br />
Borstgrasrasen finden sich am Fuß der<br />
Milseburg sowie westlich und östlich<br />
davon und kleinflächig noch bei Steens<br />
und bei Öchenbach.<br />
ABB.-NR.: 15. „Goldhaferwiese bei Danzwiesen”<br />
ABB.-NR.: 16. „Kalkmagerrasen an der<br />
Hessenliede”
<strong>Landschaftsplan</strong> <strong>Hofbieber</strong> Seite - 24 -<br />
-Biotop- und Nutzungsstrukturen-<br />
3.2.7 Ackerflächen und Gärten<br />
Zum Zeitpunkt der Kartierungen (in der jeweiligen Betriebsstruktur können<br />
Veränderungen entstehen) wurden hier folgende Biotoptypen differenziert:<br />
• Ackerflächen<br />
• Nutzgärten<br />
• Grünlandeinsaaten auf Ackerstandorten<br />
• Brachflächen auf Ackerstandorten<br />
3.2.8 Friedhöfe, Sportanlagen und sonstige Freiflächen<br />
Im Rahmen der Bearbeitung des <strong>Landschaftsplan</strong>es wurden innerhalb des<br />
<strong>Gemeinde</strong>gebietes folgende Anlagen und Einrichtungen unterschieden und dargestellt:<br />
• Friedhöfe<br />
• Sportplätze<br />
• Golfplatz<br />
• Grillplätze<br />
• Naturlehrpfad<br />
• Spielplätze<br />
• Zeltplatz<br />
ABB.-NR.: 17. „Ackerfläche”<br />
ABB.-NR.: 18. „Naturlehrpfad an der<br />
Fohlenweide”<br />
ABB.-NR.: 19. „Grillplatz im Biebertal” ABB.-NR.: 20. „Aussichtspunkt auf dem Gipfel<br />
der Milseburg”
<strong>Landschaftsplan</strong> <strong>Hofbieber</strong> Seite - 25 -<br />
-Biotop- und Nutzungsstrukturen-<br />
ABB.-NR.: 21. „Wanderwege in der Milseburger<br />
Kuppenrhön”<br />
3.2.9 Bebaute Bereiche<br />
Bebaute Bereiche wurden sowohl in den Ortslagen als auch als div. Einzelbebauungen<br />
in den Gemarkungen erfasst, wobei Verkehrsflächen nicht einbezogen wurden.<br />
ABB.-NR.: 22. „Ortslage <strong>Hofbieber</strong>” ABB.-NR.: 23. „Ortslage Elters”<br />
3.2.10 Deponien<br />
Die innerhalb des Planungsgebietes festgestellten Deponiestandorte wurden hinsichtlich<br />
geplanter Folgenutzungen differenziert:<br />
• Deponiefläche, Folgenutzung Landwirtschaft<br />
• Deponiefläche, Folgenutzung Naturschutz
<strong>Landschaftsplan</strong> <strong>Hofbieber</strong> Seite - 26 -<br />
-Bewertung-<br />
4 Erfassung und Bewertung der aktuellen und künftigen<br />
Leistungsfähigkeit der Schutzgüter<br />
Der Naturhaushalt ist als komplexes Wirkungsgefüge biotischer und abiotischer<br />
Faktoren für den Menschen in seiner Gesamtheit nicht erfaßbar. Es bestehen jedoch<br />
Informationen über einzelne, im Naturhaushalt ablaufende Prozesse, die für Mensch,<br />
Tier und Pflanze bestimmte Leistungen erfüllen können. Die "Leistungsfähigkeit des<br />
Naturhaltes" definiert also das Vermögen des Naturhaushaltes, bestimmte Leistungen<br />
für bestimmte Ziele erbringen zu können.<br />
Die Erfassung und Bewertung der aktuellen und künftigen Leistungsfähigkeit der<br />
Schutzgüter läßt sich anhand folgender Fragestellungen darstellen:<br />
"Was ist wertvoll, schutzwürdig, erhaltenswürdig ?"<br />
"Wie und wodurch sind Leistungen und Funktionen der Schutzgüter beeinträchtigt ?"<br />
"Was würde mit Leistungen und Funktionen der Schutzgüter geschehen bei<br />
Realisierung geplanter Vorhaben ?"<br />
4.1 Schutzgut Boden<br />
Der Boden ist ein knappes und nicht vermehrbares Gut. Er ist Lebensgrundlage und<br />
Lebensraum für Pflanzen, Tiere und Menschen. Darüber hinaus auch Stofftransformator,<br />
Puffer und Filter in den Wasser- und Stoffkreisläufen des Naturhaushaltes<br />
sowie nicht zuletzt prägendes Element in Natur und Landschaft. Aufgrund seiner<br />
vielfältigen Funktionen im Naturhaushalt gehört der Boden zu den wertvollsten und<br />
schützenswertesten Gütern der Menschheit. Als Bindeglied zwischen belebtem<br />
Naturraum und unbelebtem Untergrund obliegt den Böden eine zentrale Stellung im<br />
Ökosystem. Die Böden einer Landschaft sind miteinander durch Stofftransporte<br />
verknüpft, beeinflussen sich somit in ihren Eigenschaften und bilden mit anderen<br />
Bestandteilen der Landschaft ein gemeinsames Wirkungsgefüge. Der Boden ist somit<br />
Schnittstelle zu den Schutzgütern Arten und Biotope, Wasser und Klima / Luft.<br />
4.1.1 Gesetzliche und planerische Vorgaben<br />
Gemäß Bundes - Bodenschutzgesetz sind die Funktionen des Bodens zu sichern oder<br />
wiederherzustellen.<br />
In § 1 (1) des Bundesnaturschutzgesetzes wird die nachhaltige Sicherung der Leistungsfähigkeit<br />
des Naturhaushaltes und der Nutzungsfähigkeit von Naturgütern als Lebensgrundlage<br />
des Menschen genannt. Nach § 2 (1) BNatschG sind Böden so zu erhalten,<br />
dass sie ihre Funktionen im Naturhaushalt erfüllen können. Geschlossene Pflanzendecken<br />
sollen zum Erosionsschutz gesichert und auf ungenutzten Böden eine
<strong>Landschaftsplan</strong> <strong>Hofbieber</strong> Seite - 27 -<br />
-Bewertung-<br />
standortgerechte Vegetation entwickelt werden. Darüber hinaus wird im BNatschG ein<br />
Entsiegelungsgebot (§2 (1) Nr.11) formuliert. Die landwirtschaftliche Bewirtschaftung<br />
muß standortangepaßt erfolgen und die nachhaltige Bodenfruchtbarkeit und langfristige<br />
Nutzbarkeit der Flächen muß gewährleistet werden (§ 5 (4)).<br />
Das Hess. Naturschutzgesetz regelt einen möglichst geringen Flächenverbrauch von<br />
Siedlungen, Bauten sowie Verkehrs- und Versorgungseinrichtungen. Nach § 4 (2) Nr.<br />
3e HENatG sollen im <strong>Landschaftsplan</strong> die Erfordernisse und Massnahmen " [...] zum<br />
Schutz, zur Verbesserung der Qualität und zur Regeneration von Böden [...] "<br />
dargestellt werden. Eine landwirtschaftliche Nutzung wird als ordnungsgemäß definiert,<br />
"wenn sie Erosion verhindert, die Humusbildung fördert, sowie den Eintrag von<br />
Schadstoffen in Gewässer [...] vermeidet".<br />
Das Baugesetzbuch verpflichtet die <strong>Gemeinde</strong>n als Träger der Bauleitplanung<br />
Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß zu beschränken. Darüber hinaus sollen<br />
im Flächennutzungsplan die für bauliche Anlagen vorgesehenen Flächen kenntlich<br />
gemacht werden, deren Böden erheblich mit umweltgefährdenden Stoffen belastet sind<br />
(§ 5 (3) BauGB).<br />
Im Regionalplan Nordhessen 2000 sind für das <strong>Gemeinde</strong>gebiet <strong>Hofbieber</strong> Bereiche für<br />
die Landwirtschaft, Bereiche oberflächennaher Lagerstätten sowie Bereiche für den<br />
Abbau oberflächennaher Lagerstätten dargestellt.<br />
Der Entwurf des Landschaftsrahmenplanes Nordhessen weist für die östlichen<br />
Teilbereiche des <strong>Gemeinde</strong>gebietes Räume mit besonderer Bewirtschaftung aus<br />
Gründen des Bodenschutzes aus. Der Landschaftsrahmenplan weist hier auf den Erhalt<br />
und die Schaffung einer permanenten Vegetationsdecke in stark erosionsgefährdeten<br />
Hanglagen bzw. Überschwemmungsgebieten hin.<br />
In der Flächenschutzkarte Hessen (02/2002) sind Waldflächen im östlichen<br />
<strong>Gemeinde</strong>gebiet als Wälder mit Bodenschutzfunktion ausgewiesen.<br />
4.1.2 Bestandsbewertung<br />
Das Schutzgut Boden innerhalb des <strong>Gemeinde</strong>gebietes wird zunächst anhand der<br />
geologischen Ausgangssituation und der sich entsprechend entwickelten Bodentypen<br />
und -arten beschrieben. Eine anschließende Bewertung des Schutzgutes erfolgt über die<br />
verschiedenen Funktionen des Bodens innerhalb des <strong>Gemeinde</strong>gebietes sowie die<br />
bestehenden und potentiellen Belastungen und Beeinträchtigungen dieser Funktionen<br />
(VGL. SCHACHTSCHABEL ET AL., 1992; ARBEITSGRUPPE BODENKUNDE, 1982; MARKS ET<br />
AL., 1989; GRUEHN, 1992).<br />
Geologische und bodenkundliche Ausgangsituation<br />
Geologisch geprägt wird das <strong>Gemeinde</strong>gebiet vor allem durch Sedimente der Trias, hier<br />
überwiegend Sandsteine, die somit auch das Fundament des Gebietes darstellen.<br />
Weiterhin prägend sind erdgeschichtlich jüngere Gesteine (Tertiär), welche aus der<br />
vielfältigen vulkanischen Tätigkeit sowie verschiedenen Umlagerungsprozessen
<strong>Landschaftsplan</strong> <strong>Hofbieber</strong> Seite - 28 -<br />
-Bewertung-<br />
hervorgegangen sind. Daneben sind stellenweise auch kalkige und tonig-mergelige<br />
Gesteine des Muschelkalks, sehr selten auch tonig-feinsandige Ablagerungen (Unterer<br />
Keuper) erhalten geblieben. Die nur noch reliktisch vorhandenen vulkanischen Gesteine<br />
und ihre Verwitterungsprodukte bilden ausgedehnte Höhenrücken mit Hochflächen und<br />
die für das <strong>Gemeinde</strong>gebiet besonders auffälligen Kegel und breiten Kuppen. Die<br />
Höhenrücken bestehen z.T. aus mächtigen basaltischen Lavadecken oder aus<br />
vulkanischen Sedimenten (Gesteinsschutt, Tuffe). Die das Landschaftsbild prägenden<br />
Kegel im östlichen <strong>Gemeinde</strong>gebiet (Milseburg, Stellberg, Ziegenkopf) stellen durch die<br />
Erosion im Niveau des Buntsandsteins herauspräparierte Dome und Gänge dar, welche<br />
in der Regel aus Phonolithen und Trachyten bestehen. Erdgeschichtlich junge<br />
Ablagerungen des Quartär sind im <strong>Gemeinde</strong>gebiet in größerer Verbreitung vorhanden,<br />
sie sind auf zahlreichen Hängen in Form von Lößlehm- und Hangschuttdecken sowie<br />
Fließerden verbreitet und nehmen oft größere Flächen ein. Die jüngsten Ablagerungen<br />
finden sich im Bereich der Täler.<br />
Ausgehend von der o.a. geologischen Situation sind die häufigsten Bodenverhältnisse<br />
des <strong>Gemeinde</strong>gebietes wie folgt zu beschreiben (VGL. FNP HOFBIEBER, 1998):<br />
TABELLE-NR. 3: „BODENVERHÄLTNISSE IM GEMEINDEGEBIET HOFBIEBER“<br />
Bodentyp Bodenart Ausgangsgestein Vorkommen innerhalb des<br />
<strong>Gemeinde</strong>gebietes<br />
Pararendzina,<br />
Rendzina (geringe<br />
Entwicklungs-tiefe)<br />
Braunerden und Pelosole<br />
mit hohem<br />
und mittl.<br />
Basengehalt (geringe<br />
bis mittlere<br />
Entwicklungstiefe)<br />
Ranker-, Regosol-<br />
Braunerden mit<br />
hohem Basengehalt<br />
(geringe bis rnittl.<br />
En-wicklungstiefe)<br />
Braunerden mit geringem<br />
Basengehalt,<br />
örtl Podsol-Braunerden,<br />
örtlich<br />
pseudovergleyt<br />
Schluff bis<br />
schluffi-ger Lehm,<br />
Lehm bis toniger<br />
Lehm, meist steinig<br />
Schluffiger Lehm<br />
bis lehmiger Ton<br />
Lehmiger Schluff<br />
bis sandig toniger<br />
Lehm, meist<br />
skeletthaltig<br />
Schwach lehmiger<br />
Sand bis sandiger<br />
Lehm, skeletthaltig<br />
Löss, Kalkstein Großflächig an der Hessenliede, Kugelberg<br />
sowie am Hofberg (Bereich<br />
<strong>Hofbieber</strong>)<br />
Tonige Sandst., u.<br />
Arkosen (Sandst.<br />
m. Feldspat u.<br />
Glimmer), Tonsteine,<br />
örtl. carbonathaltig<br />
Kleinflächig am Wadberg (südl. v.<br />
Langenbieber, Nordabdachung des<br />
Schackenberges (bei Schackau), Kohlberg<br />
(nordwestl. v. Elters), Westflanke<br />
der Oberbemhardser Höhe sowie südwestlich<br />
von Kleinsassen<br />
Basalt Insbesondere die Basaltkuppen und<br />
deren steileren Hangbereiche<br />
Sandig-lehmige<br />
Sandsteine<br />
Kleinflächig u. a. am Kirschberg u.<br />
Schweinsberg (südl. v. Langenberg),<br />
Kleiner u. Großer Gruben Hauck<br />
(südL v. Obergruben), Schackenberg<br />
(östl. v. Schackau), Hohlstein, Milseburg<br />
und Stellberg.<br />
Häufigster Bodentyp der <strong>Gemeinde</strong><br />
mit großen zusammenhangenden<br />
Flächen nordöstl. der Ortslagen v.<br />
Egelmes, Wittges und Elters, sowie<br />
südl. v. Langenbieber bzw. westl. v.<br />
Kleinsassen
<strong>Landschaftsplan</strong> <strong>Hofbieber</strong> Seite - 29 -<br />
-Bewertung-<br />
Bodentyp Bodenart Ausgangsgestein Vorkommen innerhalb des<br />
<strong>Gemeinde</strong>gebietes<br />
Podsolbraunerden m.<br />
geringem<br />
Basengehalt,<br />
Pseudogley-Parabraun-erden,<br />
örtl<br />
Podsole<br />
Parabraunerden mit<br />
mittlerem<br />
Basengehalt, örtl.<br />
Pseudogley-<br />
Parabraunerden<br />
Pseudogley-<br />
Braunerden u. Parabraunerden,Pseudogleye<br />
Auenböden, Gleye,<br />
örtl. Anmoorgleye<br />
Schluffiger Sand<br />
bis lehmiger Sand,<br />
skeletthaltig<br />
Schwach lehmiger<br />
Schi. bis schluffigtoniger<br />
Lehm, vereinz.<br />
skeletthaltig<br />
Lehmiger Schluff<br />
bis schluffigtoniger<br />
Lehm, oft<br />
skeletthaitig<br />
Schluffig-sandiger<br />
Lehm - toniger<br />
Lehm.<br />
Sandsteine Ausgedehnte Flächen nördlich von<br />
<strong>Hofbieber</strong>; häufig Waldstandorte<br />
Lößlehm, Löß Ausgedehnte Flächen südöstl, v. Elters<br />
und östlich v. Kleinsassen<br />
Vorwiegend Lößlehm<br />
mit Gesteinsbeimengungen<br />
Auenlehm In den Tallagen der Fließgewässer<br />
Die derzeitigen Funktionen des Schutzgutes Boden innerhalb des <strong>Gemeinde</strong>gebietes<br />
<strong>Hofbieber</strong> lassen sich wie folgt beschreiben:<br />
Funktion des Bodens als Lebensraum für Pflanzen und Tiere<br />
Böden bieten Lebensgrundlage und Lebensraum für Menschen, Tiere, Pflanzen und<br />
Bodenorganismen und sind somit Voraussetzung für eine standortgemäße Vielfalt an<br />
Arten, Lebensgemeinschaften und Landschaftsstrukturen.<br />
Die Bereiche des <strong>Gemeinde</strong>gebietes, in denen der Boden besondere Biotopfunktionen<br />
übernimmt, sind kleinflächig über das gesamte Planungsgebiet verteilt. Feuchtstandorte<br />
vorwiegend in den Auenbereichen der verschiedenen Fließgewässer sowie Trockenstandorte<br />
in Hang- und Kuppenlagen nehmen hier eine besondere Bedeutung ein.
<strong>Landschaftsplan</strong> <strong>Hofbieber</strong> Seite - 30 -<br />
-Bewertung-<br />
ABB.-NR.: 24. „Überblick: Bewertung Boden”<br />
Funktion des Bodens als Produktionsstandort der Landwirtschaft<br />
Die Produktionsfunktion des Bodens beschreibt seine Bedeutung als Standort der<br />
Pflanzen in Land- und Forstwirtschaft, wird hier somit vor allem im Hinblick auf seine<br />
landwirtschaftliche Nutzbarkeit betrachtet. Die Eignung des Bodens für die Erzeugung<br />
von Biomasse wird durch das Zusammenwirken von Boden, Relief und Klima<br />
bestimmt. Das Ertragspotential eines Bodens wird im wesentlichen durch seine<br />
physiologische und mechanische Durchwurzelbarkeit sowie durch seine Fähigkeit,<br />
Wasser in pflanzenverfügbarer Form zu speichern, bestimmt.<br />
Unter Berücksichtigung der o.a. Kriterien ist für das <strong>Gemeinde</strong>gebiet <strong>Hofbieber</strong><br />
festzustellen, dass die Böden mit hoher natürlicher Produktivität und entsprechendem<br />
Ertragspotential sich vor allem großflächig im Bereich der ebenen Flächen der<br />
Braunerden auf Lößlehmböden im Westen des <strong>Gemeinde</strong>gebietes zwischen den<br />
Ortslagen Traisbach, Allmus, Wiesen und Niederbieber, darüber hinaus im Auenbereich<br />
der Bieber zwischen Wiesen, Niederbieber und Langenbieber befinden. Kleinflächig<br />
sind Bereiche mit hohem Ertragspotential westlich der Ortslage Obernüst und nördlich<br />
der Ortslage <strong>Hofbieber</strong> zu beschreiben.
<strong>Landschaftsplan</strong> <strong>Hofbieber</strong> Seite - 31 -<br />
-Bewertung-<br />
Großflächige zusammenhängende Wälder und damit forstwirtschaftlich bedeutsame<br />
Standorte sind vor allem im Norden, Süden und Osten des <strong>Gemeinde</strong>gebietes zu finden,<br />
darüber hinaus kleinflächig im gesamten Planungsgebiet punktuell eingestreut.<br />
Funktion des Bodens als Lagerstätte oberflächennaher Rohstoffe<br />
Der Boden kann als Lagerstätte für Rohstoffe beschrieben werden.<br />
Eine großflächige z.Zt. teilweise im Abbau befindliche Lagerstätte oberflächennaher<br />
Rohstoffe (Kalkstein) befindet sich südwestlich der Ortslage <strong>Hofbieber</strong> im Bereich des<br />
Schnurberges.<br />
Darüber hinaus sind weitere Gebiete oberflächennaher Lagerstätten innerhalb des<br />
<strong>Gemeinde</strong>gebietes zu beschreiben:<br />
• Kalksteinvorkommen am Kugelberg nordöstlich der Ortslage Langenbieber,<br />
• Phonolithvorkommen am Hohlstein westlich der Ortslage Steens,<br />
• Phonolithvorkommen nordöstlich der Ortslage Kleinsassen,<br />
• Kalksteinvorkommen nordwestlich der Ortslage <strong>Hofbieber</strong>.<br />
Funktion des Bodens als Archiv wissenschaftlicher Informationen<br />
Die landschaftsgeschichtliche Bedeutung von Böden bzw. Bodenformen setzt sich aus<br />
natur- und kulturhistorischen Aspekten zusammen. Bestimmende Elemente für den<br />
Wert eines Bodens als naturgeschichtliche Urkunde sind beispielsweise seine Seltenheit<br />
und die wissenschaftliche Bedeutung für die pedologische, geologische und<br />
mineralogische Forschung.<br />
Die wissenschaftliche Bedeutung des Bodens wurde für den <strong>Landschaftsplan</strong> <strong>Hofbieber</strong><br />
durch die ausgewiesenen Bodendenkmäler erfasst. Diese lassen sich vor allem<br />
südöstlich der Ortslage <strong>Hofbieber</strong>, zwischen <strong>Hofbieber</strong>, Elters und Schackau sowie im<br />
südöstlichen Bereich des <strong>Gemeinde</strong>gebietes, südöstlich der Ortslage Kleinsassen im<br />
Bereich und Umfeld der Milseburg finden.<br />
Funktion des Bodens als Schutz anderer Naturgüter<br />
Böden sind Bestandteil des Naturhaushaltes, insbesondere mit ihren Wasser- und<br />
Nähstoffkreisläufen. Sie wirken als Abbau-, Ausgleichs- und Aufbaumedium für<br />
stoffliche Einwirkungen, insbesondere auch zum Schutz des Grundwassers. Die<br />
Regelungsfunktion eines Bodens beruht dabei auf seiner Fähigkeit zur Regulierung von<br />
Stoff- und Energieflüssen im Naturhaushalt, wobei die Leistungen des Bodens<br />
bezüglich der Regelungsfunktion sehr vielfältig sind.<br />
Eine besondere Schutz- und Regelungsfunktion kommt dem Boden innerhalb des<br />
<strong>Gemeinde</strong>gebietes vor allem in folgenden Teilbereichen zu:
<strong>Landschaftsplan</strong> <strong>Hofbieber</strong> Seite - 32 -<br />
-Bewertung-<br />
• südlich der Ortslagen Wiesen u. Niederbieber,<br />
• südlich der Ortslage Langenbieber,<br />
• im Bereich Milseburg,<br />
• südöstlich der Ortslage Schackau,<br />
• nördlich, südwestlich u. südöstlich der Ortslage Elters<br />
• südlich der Ortslage Mahlerts,<br />
• nördlich der Ortslage Obernüst.<br />
Darüber hinaus weisen die Böden in den Auenbereichen der Fließgewässer eine<br />
besondere Schutzfunktion für andere Naturgüter auf.<br />
Wälder mit Bodenschutzfunktion<br />
Wälder mit Bodenschutzfunktionen sind großflächig südöstlich der Ortslage <strong>Hofbieber</strong>,<br />
im Bereich der Milseburg , östlich der Ortslage Schackau, nördlich von Obernüst sowie<br />
westlich der Fohlenweide zu beschreiben. Darüber hinaus befinden sich Wälder mit<br />
Bodenschutzfunktionen im gesamten östlichen Teil des <strong>Gemeinde</strong>gebietes.<br />
Belastungen, Beeinträchtigungen und Konflikte<br />
- Erosion / Erosionsgefährdung<br />
Als besonders erosionsgefährdete Bereiche<br />
sind Flächen nördlich Traisbach, nördlich<br />
Allmus, südwestlich Wiesen, nordwestlich<br />
Schwarzbach, zwischen Egelmes und Wittges,<br />
nördlich Elters sowie südlich Langenbieber zu<br />
bewerten.<br />
ABB.-NR.: 25. „Erosion auf Ackerstandort”<br />
- landwirtschaftliche Intensivnutzungen<br />
Als potentiell bodenbelastend sind die intensiven ackerbaulichen Nutzungen innerhalb<br />
der Wasserschutzgebiete südlich Langenbieber, östlich <strong>Hofbieber</strong> und östlich Wittges<br />
zu bewerten, darüber hinaus auch z.T. in den Auenbereichen der Bieber .
<strong>Landschaftsplan</strong> <strong>Hofbieber</strong> Seite - 33 -<br />
-Bewertung-<br />
- Flächenversiegelungen<br />
Beeinträchtigungen der Bodenfunktionen durch Flächenversiegelungen ergeben sich vor<br />
allem in den Ortslagen Niederbieber, Langenbieber, Kleinsassen, Elters, Schackau und<br />
Mahlerts jeweils in den Auenbereichen der Fließgewässer.<br />
- Veränderung natürlicher Standortbedingungen<br />
Als potentiell konfliktträchtig sind die Bereiche zu beschreiben, in denen bestehende<br />
Standortbedingungen z.B. durch Entwässerung, Düngung, Nutzungsintensivierung, ...<br />
verändert werden. Hier sind Teilbereiche zwischen den Ortslagen Traisbach, Allmus,<br />
Wiesen und Niederbieber, aber auch Flächen nördlich von <strong>Hofbieber</strong> im Bereich der<br />
L 3258 zu nennen.<br />
- Deponien, Altlasten<br />
Punktuelle Belastungen und Konflikte des Bodens bestehen im Bereich der Deponien<br />
südwestlich Wiesen und nordwestlich <strong>Hofbieber</strong>. Potentielle Gefährdungen der<br />
Bodenfunktionen gehen von evtl. Altlasten nördlich Traisbach, westlich Kleinsassen,<br />
südlich Elters, östlich Langenberg, westlich und östlich Schwarzbach sowie südlich<br />
Obernüst und nördlich Boxberg aus.<br />
4.2 Schutzgut Wasser<br />
Das Schutzgut Wasser ist in seinem Auftreten sowohl als Grundwasser als auch<br />
Oberflächengewässer ein wichtiger abiotischer Bestandteil der Ökosysteme und als<br />
Lebensgrundlage für alle Lebewesen unverzichtbar.<br />
4.2.1 Gesetzliche und planerische Vorgaben<br />
Nach § 1 a Wasserhaushaltsgesetz sind Gewässer als Bestandteil des Naturhaushaltes so<br />
zu bewirtschaften, [...] "dass sie dem Wohl der Allgemeinheit und im Einklang mit ihm<br />
auch dem Nutzen einzelner dienen und dass jede vermeidbare Beeinträchtigung<br />
unterbleibt", insbesondere sind Verunreinigungen zu vermeiden und eine sparsame<br />
Verwendung des Wassers geboten. "Abwasser ist so zu beseitigen, daß das Wohl der<br />
Allgemeinheit nicht beeinträchtigt wird [...]" (§ 18 a WHG).<br />
Das Baugesetzbuch regelt, daß bei der Aufstellung von Bauleitplänen die Belange des<br />
Wassers zu berücksichtigen sind (§ 1 (5) Nr. 7 BauGB).<br />
Nach Aussage des Bundesnaturschutzgesetzes ist der Verbrauch sich erneuernder<br />
Naturgüter so zu steuern, dass diese nachhaltig zur Verfügung stehen (§ 2 (1) Nr. 2<br />
BNatschG). Nicht oder gering beeinträchtigte Gewässer sind einschließlich ihrer<br />
Uferzonen und Rückhalteflächen zu erhalten, zu entwickeln oder wiederherzustellen.
<strong>Landschaftsplan</strong> <strong>Hofbieber</strong> Seite - 34 -<br />
-Bewertung-<br />
Änderungen des Grundwasserspiegels, die zu einer Zerstörung oder nachhaltigen<br />
Beeinträchtigung schutzwürdiger Biotope führen können, sind zu vermeiden (§ 2 (1)<br />
Nr.4 BNatschG).<br />
Im Hess. Naturschutzgesetz wird als Ziel die Sicherung der Regenerationsfähigkeit und<br />
nachhaltige Nutzung der Naturgüter zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von<br />
Natur und Landschaft genannt. Gemäß § 2a (2) Nr. 2 gilt eine nicht ordnungsgemäße<br />
fischereiwirtschaftliche Nutzung als Eingriff in Natur und Landschaft und ist deshalb zu<br />
vermeiden. Als ordnungsgemäße Nutzung gilt, wenn die Gewässergüte nicht<br />
beeinträchtigt und die Funktion der Gewässer und ihrer Ufer als Lebensraum erhalten<br />
und gefördert wird (§ 2a (2) Nr. 2 HENatG).<br />
Nach Hessischem Wassergesetz sind "die oberirdischen Gewässer so zu bewirtschaften,<br />
dass der Zustand mäßiger Belastung nicht überschritten wird [...]" (§ 26 (1) HWG ). Die<br />
Gewässerunterhaltung soll dazu beitragen, das natürliche Erscheinungsbild und die<br />
ökologischen Funktionen der Gewässer zu erhalten. Nicht naturnah ausgebaute<br />
Gewässer [...] sind in einem angemessenen Zeitraum wieder in einen naturnahen<br />
Zustand zurückzuführen (§ 59 HWG). Uferbereiche sind gemäß § 68 HWG<br />
einschließlich ihrer Befestigung und ihres Bewuchses zu schützen. Grundwasser ist "so<br />
zu bewirtschaften, dass nur das langfristige Dargebot entnommen und eine erhebliche<br />
Beeinträchtigung des Naturhaushaltes vermieden wird" (§ 43 HWG).<br />
Der Landschaftsrahmenplan trifft hinsichtlich des qualitativen Zustandes des<br />
Grundwassers, der Belastungen mit Nitrat u. Pflanzenschutzmitteln keine besonderen<br />
Aussagen für das <strong>Gemeinde</strong>gebiet <strong>Hofbieber</strong>. Auch zur Grundwasserverschmutzungsempfindlichkeit<br />
werden keine speziellen Aussagen für das <strong>Gemeinde</strong>gebiet <strong>Hofbieber</strong><br />
formuliert. Nach Aussage des LRP besteht innerhalb des <strong>Gemeinde</strong>gebietes <strong>Hofbieber</strong><br />
überwiegend ein sehr geringes bis geringes Rückhaltevermögen und damit hohes bis<br />
sehr hohes Nitratauswaschungsrisiko. Der Zustand der Fließgewässer innerhalb des<br />
<strong>Gemeinde</strong>gebietes hinsichtlich Morphologie, Auennutzung, Durchgängigkeit,<br />
Gewässergüte und Anzahl von Naturschutzgebieten wird im Landschaftsrahmenplan<br />
vorwiegend als sehr gut beurteilt.
<strong>Landschaftsplan</strong> <strong>Hofbieber</strong> Seite - 35 -<br />
-Bewertung-<br />
4.2.2 Bestandsbewertung Grundwasser<br />
ABB.-NR.: 26. „Überblick: Bewertung Grundwasser”<br />
Grundwasser ist eine Ressource, deren qualitative und quantitative Sicherung nicht nur<br />
aufgrund ihrer Nutzbarkeit für Trink- oder Brauchwasser geboten ist. Vielmehr bildet es<br />
als Bestandteil des Naturhaushaltes einen Wert an sich, der auch um seiner selbst<br />
Willen zu schützen, zu erhalten und zu entwickeln ist. Darüber hinaus hat es eine<br />
elementare Bedeutung als Teil der aquatischen Lebensräume.<br />
Das Schutzgut Grundwasser wird im Rahmen des <strong>Landschaftsplan</strong>es hinsichtlich der<br />
Kriterien Grundwasserbeschaffenheit, Grundwasserneubildung, Grundwasserhöffigkeit,<br />
Grundwasserergiebigkeit und Verschmutzungsempfindlichkeit bewertet. Darüber<br />
hinaus werden die verschiedenen Feuchtbereiche und Wasseraustritte, die Wassergewinnungs-<br />
und Speicheranlagen sowie die wasserwirtschaftlich geschützten Flächen<br />
dargestellt. Die Aussagen über bestehende und geplante Belastungen, Beeinträchtigungen<br />
und Konflikte runden die Bewertung des Schutzgutes Grundwasser<br />
innerhalb des <strong>Gemeinde</strong>gebietes <strong>Hofbieber</strong> ab (VGL. DÖRHÖFER, JOSOPAIT, 1980;<br />
MARKS ET AL., 1989; HESS. LANDESAMT FÜR BODENFORSCHUNG, 1985).
<strong>Landschaftsplan</strong> <strong>Hofbieber</strong> Seite - 36 -<br />
-Bewertung-<br />
Allgemeine Ausgangsituation<br />
Das <strong>Gemeinde</strong>gebiet <strong>Hofbieber</strong> zählt zur hydrologischen Großeinheit "Osthessisches<br />
Buntsandsteingebiet". Hauptgrundwasserleiter sind die sandig entwickelten<br />
Schichtanteile des Buntsandsteins, die den größten Teil des Untersuchungsgebietes<br />
ausmachen (HESS. LANDESANSTALT FÜR UMWELT, 1985). Die Grundwasserförderung<br />
erfolgt aus Grundwasserklüften in ca. 100 m Tiefe.<br />
Grundwasserbeschaffenheit<br />
Die Grundwasserbeschaffenheit ist im nördlichen <strong>Gemeinde</strong>gebiet sowie im Bereich<br />
südlich Kleinsassen als sehr weich zu beschreiben. Als hart kann die<br />
Grundwasserbeschaffenheit in den Bereichen <strong>Hofbieber</strong> und Allmus bewertet werden,<br />
während die Grundwasserbeschaffenheit in den überwiegenden Teilen des<br />
<strong>Gemeinde</strong>gebietes als weich zu bezeichnen ist.<br />
Für die Wasserversorgungsanlagen Elters, Kleinsassen, Langenbieber, Milseburg,<br />
Gruppenwasserwerk Vorderrhön kann ein Härtebereich von 1 (bis 7,3 gdH)<br />
beschrieben werden. Für die Wasserversorgungsanlagen <strong>Hofbieber</strong>, Langenberg,<br />
Schwarzbach ist der Härtebereich 2 (7,3 bis 14,0 gdH) festzustellen.<br />
Grundwasserneubildung<br />
Aufgrund der relativ hohen Niederschlagswerte (600 - 1000 mm/a), der guten Wasserwegsamkeit<br />
der Sandsteinschichten und der günstigen Durchlässigkeit der sandigen<br />
Verwitterungsbildungen ist die Grundwasserneubildung als gut einzustufen.<br />
Die durchschnittliche jährliche Grundwasserneubildungsrate beträgt<br />
• östl. Langenbieber, <strong>Hofbieber</strong> weniger als 50 mm,<br />
• westl. <strong>Hofbieber</strong> bis Traisbach 50 bis100 mm,<br />
• westl. Rand der Ortslage Wiesen 100 bis 150 mm<br />
Grundwasserhöffigkeit<br />
Die Grundwasserhöffigkeit ist abhängig von den geologischen Formationen und der<br />
Lage der Grundwasserleiter. So ergibt sich innerhalb des <strong>Gemeinde</strong>gebietes <strong>Hofbieber</strong><br />
folgende Grundwasserhöffigkeit:<br />
• auf Basalt und Tonstein sowie Buntsandstein im Mittel bis zu 3 l/s./km² = 100 mm<br />
Neubildungsrate,<br />
• auf Muschelkalk im Mittel bis zu 9 l/s./km² = 300 mm Neubildungsrate.<br />
Das <strong>Gemeinde</strong>gebiet <strong>Hofbieber</strong> ist insgesamt ein "Grundwasser-Überschußgebiet". Die<br />
derzeitigen Trinkwassererschließungsgebiete sind aufgrund der relativ kleinen<br />
Einzugsbereiche auf den örtlichen Bedarf ausgerichtet.
<strong>Landschaftsplan</strong> <strong>Hofbieber</strong> Seite - 37 -<br />
-Bewertung-<br />
Grundwasserergiebigkeit<br />
Die Grundwasserergiebigkeit liegt im gesamten <strong>Gemeinde</strong>gebiet im mittleren Bereich,<br />
hier mit 5 - 15 l / s mittlere Ergiebigkeit pro Bohrung im Hauptwasserstockwerk.<br />
Verschmutzungsempfindlichkeit<br />
Die Verschmutzungsempfindlichkeit des Grundwassers ist abhängig von der Durchlässigkeit<br />
des Grundwasserleiters und der Mächtigkeit der Deckschichten.<br />
Verhältnismäßig leicht zu verunreinigen ist das Grundwasser im Untersuchungsgebiet<br />
dort, wo die Grundwasserklüfte nur von dünnen Lößlehm- oder Sandüberdeckungen<br />
geschützt werden, so z.B. im Bereich nördlich von Obernüst. Zudem sind alle<br />
Ausstriche carbonatischer Gesteine (Muschelkalk) stark gefährdet. Ansonsten liegt die<br />
Verschmutzungsempfindlichkeit des Grundwassers im gesamten <strong>Gemeinde</strong>gebiet<br />
aufgrund durchlässiger Grundwasserleiter und geringmächtiger Deckschichten im<br />
mittleren Bereich.<br />
Feuchtbereiche und Wasseraustritte<br />
Innerhalb des <strong>Gemeinde</strong>gebietes sind diverse Feuchtbereiche und natürliche<br />
Wasseraustritte, vor allem im südlichen und östlichen Teil, zu beschreiben.<br />
Wassergewinnungs- und Speicheranlagen<br />
Innerhalb des <strong>Gemeinde</strong>gebietes <strong>Hofbieber</strong> bestehen folgende Wassergewinnungs- und<br />
Speicheranlagen:<br />
• Hochbehälter <strong>Hofbieber</strong><br />
• Tiefbrunnen Langenbieber<br />
• Hochbehälter Schwarzbach<br />
• Quelle Elters Nord<br />
• Quelle Elters Süd<br />
• Hochbehälter Kleinsassen<br />
• Kleinsassen, Zeltplatz<br />
• Tiefbrunnen II<br />
• Tiefbrunnen I
<strong>Landschaftsplan</strong> <strong>Hofbieber</strong> Seite - 38 -<br />
-Bewertung-<br />
Wasserwirtschaftlich geschützte Flächen<br />
Innerhalb des <strong>Gemeinde</strong>gebietes sind folgende Wasserschutzgebiete mit den<br />
Wasserschutzzonen I, II und III zu beschreiben:<br />
• südlich der Ortslagen Wiesen u. Niederbieber,<br />
• südlich der Ortslage Langenbieber,<br />
• Bereich Milseburg,<br />
• südöstlich der Ortslage Schackau,<br />
• nördlich, südwestlich u. südöstlich der Ortslage Elters.<br />
Darüber hinaus sind folgende wasserwirtschaftlich zu schützende Flächen zu nennen:<br />
• südlich der Ortslage Mahlerts,<br />
• nördlich der Ortslage Obernüst.<br />
Belastungen, Beeinträchtigungen und Konflikte<br />
- landwirtschaftliche Intensivnutzungen<br />
Als Belastung und potentielle Beeinträchtigung des Grundwassers sind die intensiven<br />
ackerbaulichen Nutzungen innerhalb der Wasserschutzgebiete südlich Langenbieber,<br />
östlich <strong>Hofbieber</strong> und östlich Wittges zu bewerten, darüber hinaus auch z.T. in den<br />
Auenbereichen der Bieber.<br />
- Flächenversiegelungen<br />
Belastungen durch Flächenversiegelungen ergeben sich vor allem in den Ortslagen<br />
Niederbieber, Langenbieber, Kleinsassen, Elters, Schackau und Mahlerts jeweils in den<br />
Auenbereichen der Fließgewässer.<br />
- Altlasten und Deponien<br />
Punktuelle Belastungen und Konflikte des Grundwassers bestehen im Bereich der<br />
Deponien südwestlich Wiesen und nordwestlich <strong>Hofbieber</strong>. Potentielle Gefährdungen<br />
des Grundwassers gehen von evtl. Altlasten nördlich Traisbach, westlich Kleinsassen,<br />
südlich Elters, östlich Langenberg, westlich und östlich Schwarzbach südlich Obernüst<br />
und nördlich Boxberg aus.
<strong>Landschaftsplan</strong> <strong>Hofbieber</strong> Seite - 39 -<br />
-Bewertung-<br />
4.2.3 Bestandsbewertung Oberflächengewässer<br />
ABB.-NR.: 27. „Überblick: Bewertung Oberflächengewässer”<br />
Die Oberflächengewässer in ihren verschiedensten Ausprägungen und Erscheinungsformen<br />
nehmen innerhalb des Naturhaushaltes wichtige Regelungs- und Lebensraumfunktionen<br />
wahr, die diese nur in einem naturnahen Zustand uneingeschränkt erfüllen<br />
können. Deshalb ist die Beurteilung der Naturnähe das Kriterium zur Bewertung des<br />
Zustandes der Oberflächengewässer im <strong>Gemeinde</strong>gebiet <strong>Hofbieber</strong>.<br />
Die Situation der Oberflächengewässer innerhalb des <strong>Gemeinde</strong>gebietes wird im<br />
Rahmen des <strong>Landschaftsplan</strong>es hinsichtlich der Kriterien Gewässergüte und<br />
Gewässerstrukturgüte bewertet. Darüber hinaus wird flächendeckend für das gesamte<br />
<strong>Gemeinde</strong>gebiet die Bedeutung für die Abflußregulation ermittelt und dargestellt. Die<br />
Abgrenzung und Ausweisung der Auenbereiche und Retentionsräume unterstreicht die<br />
besondere Bedeutung der Bachauen innerhalb des <strong>Gemeinde</strong>gebietes. Die Aussagen<br />
über bestehende und geplante Belastungen, Beeinträchtigungen und Konflikte runden<br />
die Bewertung des Schutzgutes Oberflächengewässer innerhalb des <strong>Gemeinde</strong>gebietes<br />
<strong>Hofbieber</strong> ab (VGL. HESS. MINISTERIUM FÜR UMWELT, LANDWIRTSCHAFT UND<br />
FORSTEN, 1999; HESS. LANDESAMT FÜR UMWELT UND GEOLOGIE, 2000).
<strong>Landschaftsplan</strong> <strong>Hofbieber</strong> Seite - 40 -<br />
-Bewertung-<br />
Allgemeine Ausgangssituation<br />
Das Planungsgebiet gehört zum Einzugsgebiet der Weser und wird überwiegend von<br />
der Fulda, dem westlichen Quellfluß der Weser entwässert. Im äußersten Südosten der<br />
<strong>Gemeinde</strong> bilden von Süd nach Nord die Kuppen Bubenbader Stein, Milseburg,<br />
Oberbernhardser Höhe und Hohlstein die natürliche Wasserscheide zum östlichen<br />
Quellfluß der Weser, der Ulster.<br />
Den Hauptwasserlauf des Gebietes bildet die Bieber. Sie entspringt in der Nähe des<br />
Teufelstein (<strong>Gemeinde</strong> Poppenhausen), nimmt bei Schackau und Wiesen als wichtige<br />
Zuflüsse, den Mambach und den Trais-Bach auf und mündet bei Mittelberg in die<br />
Haune, die am Westrand, auf einer Strecke von etwa 1 km, die <strong>Gemeinde</strong>grenze<br />
darstellt. Den nördlichen und nordöstlichen Teil des <strong>Gemeinde</strong>gebietes entwässert die<br />
Nüst, die am Kleinen Grubenhauck entspringt und bei Hünfeld ebenfalls in die Haune<br />
mündet. Ihr wichtigster Zufluß ist die Nässe, die ihr Quellgebiet zwischen Hohlstein<br />
und Bomberg hat. Die Haune mündet bei Bad Hersfeld in die Fulda.<br />
Das <strong>Gemeinde</strong>gebiet ist darüber hinaus reich an kleineren Oberflächengewässern. Die<br />
vorhandenen Fließgewässer haben hier ihre Quellgebiete oder treten zumindest mit<br />
ihren Oberläufen in das Gebiet ein. Die kleineren, größtenteils regulierten Bäche fließen<br />
zu Gewässern 3. Ordnung zusammen. Die Wasserscheide für Gewässer 3. Ordnung<br />
quert das <strong>Gemeinde</strong>gebiet und teilt es in die Einzugsbereiche von Bieber und Nässe.<br />
Die Einzugsbereiche entwässern in nördliche und westliche Richtung zur Haune.<br />
Stehende Gewässer sind natürlich innerhalb des <strong>Gemeinde</strong>gebietes <strong>Hofbieber</strong> nicht<br />
vorhanden. Die festgestellten Stillgewässer sind ausnahmslos künstlich angelegt.<br />
Gewässergüte<br />
Die biologische Gewässergüte ist ein Maß für die biologische Wasserqualität der<br />
Fließgewässer, die nach DIN 38410 anhand der am Gewässergrund lebenden<br />
Fischnährtiere (Saprobien) bestimmt wird (VGL. HMULF, 1999).<br />
Die Fließgewässer innerhalb des <strong>Gemeinde</strong>gebietes <strong>Hofbieber</strong> weisen überwiegend die<br />
Gewässergüteklasse II (mäßig belastet), Oberläufe u. Zuflüsse z.T. auch gering belastet<br />
(I - II) auf. Als unbelastet (Gewässergüteklasse I) sind Teilabschnitte des Riegelbaches<br />
und des Oberlaufes der Bieber einzustufen.<br />
Einzelne Teilabschnitte weisen die Gewässergüteklasse II - III u. schlechter, kritisch<br />
belastet u. schlechter auf. Zu nennen sind hier:<br />
• Teilabschnitte der Bieber, nördlich der Ortslage Kleinsassen,<br />
• Teilabschnitte des Grubenwassers, im Bereich der Ortslage Obergruben,<br />
• Teilabschnitte des Nüstzulaufes im Bereich der Ortslage Langenberg,<br />
• Teilabschnitte des Traisbachzulaufes, östlich der Ortslage Allmus.
<strong>Landschaftsplan</strong> <strong>Hofbieber</strong> Seite - 41 -<br />
-Bewertung-<br />
Gewässerstrukturgüte<br />
Die Gewässerstruktur beschreibt das ökologisch-morphologische Erscheinungsbild<br />
eines Gewässers einschließlich seiner Ufer- und Auenbereiche. Wesentliche Aspekte<br />
sind dabei u.a. das Fließverhalten, Form und Material des Gewässerbettes, Ufer- und<br />
Sohlenstruktur, Ausprägung der Ufervegetation sowie die Beschaffenheit des Gewässerumfeldes.<br />
Die Naturnähe dieser Strukturen entscheidet mit über die Qualität des<br />
Lebensraumes.<br />
Die Gewässerstrukturgüte kennzeichnet somit die ökologische Qualität der Gewässerstruktur<br />
im Vergleich zum potentiellen natürlichen Zustand. Die Gewässerstrukturgüte<br />
zeigt an, inwieweit ein Gewässer in der Lage ist, in dynamischen Prozessen sein Bett zu<br />
verändern und als Lebensraum für aquatische und amphibische Organismen zu dienen<br />
(VGL. HMULF, 1999).<br />
Die Gewässerstrukturgüte wird nach HMULF (1999) in einer siebenstufigen Skala<br />
abnehmender Qualität von Klasse 1 (naturnah / unveränderter Zustand) bis Klasse 7<br />
(vollständig veränderter Zustand) dargestellt.<br />
Alle Fließgewässer innerhalb des <strong>Gemeinde</strong>gebietes sind in den überwiegenden<br />
Teilabschnitten deutlich bis stark verändert. Der Anteil an naturnahen, unveränderten<br />
bzw. nur gering veränderten Gewässerabschnitten ist demgegenüber nur sehr gering. Zu<br />
nennen sind hier Abschnitte im Bereich des Oberlaufes der Bieber, im Bereich des<br />
Mambaches und im Oberlauf der Nässe.<br />
Verrohrte Gewässerabschnitte der Fließgewässer sind vor allem in den Ortslagen<br />
Kleinsassen (Bieber), Elters (Nässe), Schwarzbach (Schwarzbach) zu finden. Darüber<br />
hinaus sind auch kleinere Teilabschnitte außerhalb der Ortslagen, vor allem auch im<br />
Bereich der unbenannten Zuflüsse, vollständig verrohrt.<br />
ABB.-NR.: 28.<br />
„Strukturreicher<br />
Fließgewässerabschnitt”<br />
ABB.-NR.: 29.<br />
„Strukturarmer<br />
Fließgewässerabschnitt”
<strong>Landschaftsplan</strong> <strong>Hofbieber</strong> Seite - 42 -<br />
-Bewertung-<br />
Stillgewässer<br />
Die Stillgewässer innerhalb des <strong>Gemeinde</strong>gebietes <strong>Hofbieber</strong> sind anthropogenen<br />
Ursprungs.<br />
Bedeutung für die Abflußregulation<br />
Die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes, aufgrund der Vegetationsstruktur sowie der<br />
Boden- und Reliefbedingungen, Oberflächenwasser im Ökosystem zurückzuhalten, den<br />
Direktabfluß zu verringern und damit zu ausgeglichenen Abflußverhältnissen<br />
beizutragen, wird als Abflußregulationsfunktion bezeichnet. Die Abflußregulationsfunktion<br />
läßt sich somit aus der Hangneigung, des betr. Bodentyps und der jeweiligen<br />
Flächennutzung ermitteln.<br />
Die mittleren jährlichen Abflußhöhen im Planungsgebiet sind im wesentlichen abhängig<br />
von der Bodeneigenschaft, der Hangneigung und der jeweiligen Flächennutzung. Das<br />
bedeutet für das <strong>Gemeinde</strong>gebiet <strong>Hofbieber</strong>, dass im westlichen Teil des<br />
<strong>Gemeinde</strong>gebietes relativ niedrige Abflußhöhen zwischen 100 - 200 mm bzw. 200 - 300<br />
mm, bei zunehmender Reliefenergie Abflußhöhen zwischen 300 - 400 mm, im Bereich<br />
der Milseburg sogar zwischen 400 - 500 mm zu beschreiben sind.<br />
In Gebieten mit hoher Reliefenergie kann über Vegetationsbestände, insbesondere<br />
durch Waldflächen, der Direktabfluß erheblich verringert werden und die<br />
Grundwasserneubildung erhöht werden. So ist bei standortgerechten mittelalten bis<br />
alten Forstbeständen der Gesamtabfluß am geringsten (ca. 30 %) und nimmt zu auf<br />
Vegetationsdecken mit geringer Rauhigkeit wie Brachland, Grünland (ca. 40 %) und<br />
Ackerkulturen sowie auf Schwarzbrachen (keine Winterbestellung) (>65 %).<br />
Insgesamt ist für das <strong>Gemeinde</strong>gebiet <strong>Hofbieber</strong> festzustellen, dass insbesondere den<br />
Waldflächen im östlichen Teil des <strong>Gemeinde</strong>gebietes eine hohe Bedeutung und<br />
wichtige Funktion für die Abflußregulation zukommt.<br />
Bachauen, Retentionsräume<br />
Als Bachaue wird der Bereich des Talraumes<br />
verstanden, der periodisch durch das Fließgewässer<br />
überflutet wird, wobei sowohl der direkte Uferbereich<br />
des Fließgewässers, als auch der Bereich, der nur bei<br />
einem Hundertjährigen Hochwasser überflutet wird,<br />
dazu gehören (VGL. LRP, 2000; HESS. WASSERGESETZ).<br />
Auenbereiche zählen zu den ökologisch vielseitigsten<br />
Biotoptypen Mitteleuropas, mit einer Vielzahl von<br />
Funktionen innerhalb des Naturhaushaltes.<br />
Da innerhalb des <strong>Gemeinde</strong>gebietes <strong>Hofbieber</strong> keine<br />
rechtsverbindlich ausgewiesenen Überschwemmungs<br />
ABB.-NR.: 30. „Bachaue”
<strong>Landschaftsplan</strong> <strong>Hofbieber</strong> Seite - 43 -<br />
-Bewertung-<br />
gebiete bestehen, ausreichend dimensionierte Retentionsräume und Auenbereiche aber<br />
als untrennbare Bestandteile des Ökosystems Fließgewässer zu betrachten sind, wurden<br />
für die einzelnen Fließgewässer innerhalb des <strong>Gemeinde</strong>gebietes Bachauen und<br />
Retentionsräume in Abhängigkeit von Topographie und Relief der Landschaft<br />
abgegrenzt.<br />
Belastungen, Beeinträchtigungen und Konflikte<br />
Als häufigste Belastung der Fließgewässer ist der fehlende Uferrandstreifen in weiten<br />
Teilabschnitten der verschiedenen Gewässer mit einer unmittelbar an das Gewässerbett<br />
heranreichenden intensiven Nutzung zu beschreiben. Betroffen sind hier Abschnitte<br />
aller Fließgewässer innerhalb des <strong>Gemeinde</strong>gebietes, wobei in den stärker<br />
landwirtschaftlich genutzten Teilräumen des <strong>Gemeinde</strong>gebietes eine Häufung dieser<br />
Belastung auftritt.<br />
Standortfremde Gehölze in den unmittelbaren Uferbereichen sind vor allem in den<br />
Gewässerabschnitten festzustellen, die innerhalb zusammenhängender Waldflächen<br />
verlaufen.<br />
Eine vollständige Verrohrung von Gewässerabschnitten ist insbesondere in den<br />
Ortslagen Kleinsassen, Schackau, Niederbieber, Elters, Allmus und Schwarzbach<br />
vorhanden.<br />
Begradigt und naturfern ausgebaut sind vor allem die unbenannten Zuflüsse zum<br />
Traisbach zwischen den Ortslagen Traisbach, Allmus und Niederbieber.<br />
Querbauwerke im Gewässerbett und damit Einschränkungen und Behinderungen der<br />
biologischen Durchgängigkeit sind in jedem Fließgewässer innerhalb des<br />
<strong>Gemeinde</strong>gebietes vorhanden.<br />
Landwirtschaftliche Intensivnutzungen im unmittelbaren Gewässerrandbereich bzw. in<br />
den Retentionsräumen der einzelnen Fließgewässer sind vor allem innerhalb der<br />
Auenbereiche der Bieber westlich der Ortslage Niederbieber und des Traisbaches mit<br />
seinen Zuflüssen, zu beschreiben.<br />
Allgemeine Flächenversiegelungen innerhalb des gesamten <strong>Gemeinde</strong>gebietes führen<br />
zu einer Belastung der Vorfluter.
<strong>Landschaftsplan</strong> <strong>Hofbieber</strong> Seite - 44 -<br />
-Bewertung-<br />
4.3 Schutzgut Klima<br />
Luft und Klima sind bedeutsam als Medien im Ökosystem bzw. als die<br />
Systemausprägung mitgestaltende Faktoren und unmittelbare Lebensgrundlage des<br />
Menschen, aber auch von Pflanzen und Tieren. Während die reine unbelastete Luft als<br />
Lebensgrundlage und für das Wohlbefinden des Menschen eine zentrale Rolle spielt, ist<br />
für die Ausprägung von Vegetation und Fauna auch das Zusammenwirken klimatischer<br />
Elemente wie Temperatur, Niederschlag, Wind und Luftfeuchte von Bedeutung.<br />
4.3.1 Gesetzliche und planerische Vorgaben<br />
Grundsätzlich wird durch das Bundesnaturschutzgesetz die nachhaltige Sicherung der<br />
Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes und der Nutzungsfähigkeit von<br />
Naturgütern als Lebensgrundlage des Menschen und künftiger Generationen festgesetzt.<br />
Nach § 2 (1) Nr. 6 BNatschG werden der Schutz und die Verbesserung des örtlichen<br />
Klimas durch Massnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege sowie die<br />
Vermeidung von Beeinträchtigungen als Grundsätze genannt. Waldflächen und andere<br />
klimatisch günstig wirksame Gebiete sollen erhalten, entwickelt und wiederhergestellt<br />
werden.<br />
Neben der allgemeinen Aussage, dass die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des<br />
Naturhaushaltes zu sichern ist, nennt das Hess. Naturschutzgesetz den Erhalt und die<br />
Schaffung von Flächen zur Verbesserung des örtlichen Klimas als Grundsatz ( § 2 (1)<br />
Nr. 5 ).<br />
Nach Baugesetzbuch § 1 (5) Nr. 7 sind Klima und Luft bei der Aufstellung von<br />
Bauleitplänen zu berücksichtigen.<br />
In der Flächenschutzkarte Hessen (02/2002) sind verschiedene Waldflächen im<br />
östlichen <strong>Gemeinde</strong>gebiet als Wälder mit Klimaschutzfunktion ausgewiesen.<br />
4.3.2 Bestandsbewertung<br />
Das Schutzgut Klima innerhalb des <strong>Gemeinde</strong>gebietes wird zunächst anhand der<br />
allgemeinen lokal- und kleinklimatischen Ausgangsdaten beschrieben. Eine<br />
anschließende Bewertung des Schutzgutes erfolgt über die Darstellung der<br />
Kaltluftentstehungsgebiete, der Leitbahnen für den Luftaustausch, der Klima<br />
ausgleichenden Gebiete, der Gebiete mit Klima- und / oder Immissionsschutzfunktion,<br />
der kleinklimatischen Sonderstandorte und windhöffigen Bereiche. Die Darstellung<br />
bestehender und geplanter Belastungen, Beeinträchtigungen und Konflikte runden die<br />
Bewertung des Schutzgutes Klima innerhalb des <strong>Gemeinde</strong>gebietes <strong>Hofbieber</strong> ab (VGL.<br />
NIEDERSÄCHSISCHES LANDESAMT FÜR ÖKOLOGIE, 1999).
<strong>Landschaftsplan</strong> <strong>Hofbieber</strong> Seite - 45 -<br />
-Bewertung-<br />
ABB.-NR.: 31. „Überblick: Bewertung Klima”<br />
Klimatische Ausgangssituation<br />
Die Kuppenrhön liegt in einer klimatischen Übergangszone zwischen dem kontinental<br />
beeinflussten südlichen und östlichen Deutschland und dem überwiegend der<br />
atlantischen Luftzufuhr ausgesetzten Nordwestdeutschland. Aufgrund der geographischen<br />
Lage zwischen der “Hohen Rhön“ mit ihrem rauhen Klima und dem relativ<br />
milden “Fuldaer Becken“ nimmt das Planungsgebiet eine klimatische Mittelstellung ein.<br />
Von Westen nach Osten wird das Wetter zunehmend rauher.<br />
Die mittlere jährliche Temperatur beträgt in der westlichen <strong>Gemeinde</strong>hälfte 8° C<br />
(<strong>Hofbieber</strong>, Niederbieber, Langenbieber, Allmus, Wiesen, Traisbach), in der östlichen<br />
<strong>Gemeinde</strong>hälfte 7° C (Schwarzbach, Obernüst, Elters, Kleinsassen) und auf der<br />
Milseburg 4,6° C.<br />
Die langjährig gemessenen mittleren Niederschlagshöhen betragen im westlichen<br />
<strong>Gemeinde</strong>gebiet 600 - 700 mm (<strong>Hofbieber</strong>, Niederbieber, Langenbieber, Allmus,<br />
Wiesen, Traisbach), im östlichen <strong>Gemeinde</strong>gebiet 700 - 800 mm (Schwarzbach, Elters,<br />
Obernüst), im südöstlichen <strong>Gemeinde</strong>gebiet 800 - 900 mm (Kleinsassen, Danzwiesen)<br />
und auf der Milseburg 1.100 mm.
<strong>Landschaftsplan</strong> <strong>Hofbieber</strong> Seite - 46 -<br />
-Bewertung-<br />
Die durchschnittliche Anzahl der Frosttage pro Jahr beträgt etwa 100 Tage. Die Zahl<br />
der Tage mit Schneedecke beträgt im langjährigen Mittel ca. 70 - 80 Tage.<br />
Die Hauptwindrichtungen sind Südwest mit einem Anteil von 30 % im Jahresmittel und<br />
Nordost mit einem Anteil von 15 %.<br />
Kaltluftentstehungsgebiete<br />
Als Kaltluft bezeichnet man bodennahe Luftschichten, die sich bei nächtlicher<br />
Ausstrahlung besonders stark abkühlen, weil aus dem Boden nur wenig Wärme<br />
nachgeliefert wird. Kaltluft entsteht vor allem über Arealen mit Böden, die eine geringe<br />
Wärmespeicherfähigkeit aufweisen und mit isolierenden Vegetationsstrukturen<br />
bestanden sind. Kaltluft wird dann als Frischluft bezeichnet, wenn relativ geringe<br />
lufthygienische Belastungen der Kaltluft auftreten. Kaltluft- bzw. Frischluftentstehungsgebiete<br />
sind die Bereiche, in denen aufgrund der vorherrschenden<br />
Strukturen Kalt- u./o. Frischluft entstehen kann.<br />
Da die Entstehung von Kaltluft insbesondere während nächtlicher Ausstrahlungsbedingungen<br />
über Flächen mit starker Abkühlung und guten Abflußmöglichkeiten<br />
besonders ausgeprägt ist, stellen landwirtschaftlich genutzte Flächen mit geringem<br />
Gehölz- und Baumbestand je nach Neigung des Geländes Kaltluftquellgebiete mit<br />
unterschiedlicher Aktivität dar.<br />
Größere zusammenhängende Kaltluftentstehungsgebiete sind vor allem im Bereich der<br />
großflächig landwirtschaftlich genutzten Flächen im westlichen Teil des<br />
<strong>Gemeinde</strong>gebietes mit nur geringem Gehölzbestand, hier insbesondere nördlich und<br />
westlich der Ortslage <strong>Hofbieber</strong> zu beschreiben.<br />
Leitbahnen für den Luftaustausch<br />
Kaltluftleitbahnen für den lokalen Luftaustausch sind verbindende Oberflächenstrukturen,<br />
die über Luftaustauschprozesse einen Transport relativ wenig belasteter und<br />
kühler Luftmassen ermöglichen.<br />
Als Leitbahnen für den Luftaustausch sind die tiefer gelegenen Bachtäler und<br />
Auenbereiche der Fließgewässer innerhalb des <strong>Gemeinde</strong>gebietes zu beschreiben,<br />
wobei insbesondere die Bachtäler der Bieber, Nässe und Nüst hier als wichtige Leitbahn<br />
für den Luftaustausch innerhalb des <strong>Gemeinde</strong>gebietes wirken können.<br />
Klima ausgleichende Gebiete<br />
Wälder sind durch ein ausgeglichenes, feuchtmildes Bestandsklima charakterisiert, das<br />
vom Menschen als angenehm empfunden wird. Durch die Strahlungsreduktion am Tage<br />
und die verminderte Ausstrahlung während der Nacht erfahren die Klimaelemente im<br />
Stammraum des Waldes eine starke Dämpfung, so daß sich ein Klima mit geringen<br />
Temperaturschwankungen bilden kann. Wälder wirken sich somit stark Klima<br />
ausgleichend mit sowohl aus thermischer als auch aus lufthygienischer Sicht hohem<br />
bioklimatischem Wert aus.
<strong>Landschaftsplan</strong> <strong>Hofbieber</strong> Seite - 47 -<br />
-Bewertung-<br />
Den großen zusammenhängenden Waldflächen an den nördlichen und südlichen<br />
<strong>Gemeinde</strong>grenzen kommt somit eine wichtige Klima ausgleichende Wirkung und<br />
Bedeutung zu.<br />
Gebiete mit Klima- und / oder Immissionsschutzfunktion<br />
Zusammenhängende Waldbestände können die Immissionskonzentrationen der<br />
Luftmassen senken, weil sie Luftschadstoffe filtern.<br />
Als Waldflächen mit besonderer Klima- und Immissionsschutzfunktion sind die<br />
zusammenhängenden Waldgebiete östlich der Ortslage <strong>Hofbieber</strong>, östlich der Ortslage<br />
Schackau, südöstlich von Kleinsassen sowie westlich der Ortslage Schwarzbach zu<br />
beschreiben.<br />
kleinklimatische Sonderstandorte<br />
Als kleinklimatische Sonderstandorte innerhalb des Planungsgebietes wurden die<br />
südexponierten und gehölzfreien Hanglagen, die sich durch kleinräumige<br />
Klimaunterschiede zur unmittelbaren Umgebung auszeichnen, erfasst und dargestellt.<br />
Zu nennen sind hier vor allem Südhangbereiche am Farrod, am Schnurberg, am<br />
Melmesberg, am Kirschberg, die Hangbereiche nördlich der Ortslage Obernüst sowie<br />
Südhänge östlich der Ortslagen Schackau und Elters, darüberhinaus mit besonderer<br />
Bedeutung die Hang- und Kuppenbereiche der Milseburg.<br />
In den Talniederungen der Bieber, Nässe und des Traisbaches herrscht ein ziemlich<br />
kühles Klima vor. Aus landschaftsplanerischer Sicht nehmen klimatische Extrem- und<br />
Sonderstandorte innerhalb des <strong>Gemeinde</strong>gebietes eine besondere Stellung ein. In diesen<br />
Lagen können kleine Vegetationsbestände anderer Klimabereiche gedeihen, welche für<br />
die Region eine Besonderheit darstellen. In der Regel weisen Wärmeinseln eine höhere<br />
Artenvielfalt auf als die kühlere Umgebung. Viele Tierarten bevorzugen die<br />
Wärmeinseln einer Region als Lebensraum, und für einige Arten sind die dort<br />
vorkommenden Temperaturmaxima lebensnotwendig.<br />
Besonders milde Klimainseln befinden sich im westlichen <strong>Gemeinde</strong>gebiet, hier<br />
• im südl. Tal- und Hangbereich von <strong>Hofbieber</strong>, zwischen der Hessenliede und dem Hofberg,<br />
• im Bereich des Südwesthanges des Hofberges und des Schnurberges,<br />
• der Südhang des Farrod bei Allmus,<br />
• der Südhang des Melmes Berg bei Egelmes.<br />
Auch im insgesamt kühleren östlichen <strong>Gemeinde</strong>gebiet sind die Südhänge ebenfalls<br />
relativ mild. Typische Wärmeinseln finden sich im östlichen <strong>Gemeinde</strong>gebiet vor allem<br />
• am Südhang des Kohlberg bei Elters.<br />
• in den Tal- und Böschungsbereichen nordöstlich von Langenberg,
<strong>Landschaftsplan</strong> <strong>Hofbieber</strong> Seite - 48 -<br />
-Bewertung-<br />
• in deTal- und Böschungsbereichen bei Obergruben,<br />
• der Südhangbereich der Milseburg.<br />
Im Gegensatz zu den wärmeren Südhanglagen bildet sich an den Nordhängen und auf<br />
den Hochlagen ein relativ kühles Kleinklima aus. Typisch für das <strong>Gemeinde</strong>gebiet<br />
<strong>Hofbieber</strong> ist der wechsel von relativ warmen Lagen mit entsprechender Vegetationsausbildung<br />
und relativ kühlen Bereichen.<br />
windhöffige Bereiche<br />
Der Landschaftsraum westlich der Ortslage <strong>Hofbieber</strong> zeichnet sich durch eine geringe<br />
Geländemorphologie und relative Strukturarmut aus. Darüber hinaus unterliegt er den<br />
Einflüssen häufig auftretender Westwinde. Da der hier beschriebene Landschaftsraum<br />
zudem von Weiträumigkeit und Großflächigkeit geprägt wird, kann er als besonders<br />
windhöffig bezeichnet werden.<br />
Belastungen, Beeinträchtigungen und Konflikte<br />
Belastungen und Beeinträchtigungen des Kleinklimas bzw. Konflikte mit<br />
kleinklimatischen Wirkungen ergeben sich vor allem durch Barrieren und<br />
Strömungshindernisse wie Siedlungsflächen und bauliche Anlagen sowie Straßenkörper<br />
in den kleinklimatischen Leitbahnen.<br />
Zu nennen sind hier vor allem Bebauung und Barrieren in Form von Strassenkörpern im<br />
Bereich der Auen von Bieber, Nässe, Nüst und Birkenbach.
<strong>Landschaftsplan</strong> <strong>Hofbieber</strong> Seite - 49 -<br />
-Bewertung-<br />
4.4 Schutzgut Biotope und Arten<br />
Die unterschiedlichen Pflanzendecken sind durch vielfältige Faktoren (Gestein, Boden,<br />
Wasser, Klima, Nährstoffe, Nutzungseinflüsse, Wuchskonkurrenzen, ...) beeinflusst<br />
entstanden und bieten den auf ihnen vorkommenden Tier- und Pflanzenarten vielfältige<br />
Lebensräume. Somit konnten sich über die Jahrhunderte vielzählige Lebensraumbedingungen<br />
entwickeln, die einer breiten Vielfalt von Lebewesen eine Heimat bieten.<br />
Aufgrund verschiedener menschlicher Bemühungen, Ertragssteigerungen in der<br />
Landnutzung zu erzielen, sind weniger ertragreiche oder schwer zu bewirtschaftende<br />
Landschaftsteile (wie z.B. extensiv genutzte Grünländer, Feuchtwiesen, feuchte<br />
Hochstaudenfluren, Magerstandorte, klein strukturierte Bereiche, ...) durch Düngung,<br />
Entwässerung, Beseitigung von Strukturen (Gehölze, Säume, Fließgewässerschlenken,<br />
...) Nutzungsaufgabe oder auch Versiegelung verloren gegangen. Damit einhergehend<br />
haben sich die Lebensraumbedingungen für auf diese Standorte angewiesene Tier- und<br />
Pflanzenarten vielerorts verschlechtert. Ein Indikator für diese Entwicklung sind die<br />
sog. Roten Listen der gefährdeten Biotoptypen oder auch der Tier- und Pflanzenarten.<br />
4.4.1 Gesetzliche und planerische Vorgaben<br />
Gemäß § 1 des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) sind Natur und Landschaft [...]<br />
im besiedelten und unbesiedelten Bereich so zu schützen, zu pflegen, zu entwickeln<br />
und, soweit erforderlich, wiederherzustellen, dass [...] die Tier- und Pflanzenwelt<br />
einschließlich ihrer Lebensstätten und Lebensräume [...] auf Dauer gesichert sind.<br />
Hierzu ist insb. ein Biotopverbund (vgl. § 3) zu schaffen, welcher den heimischen Tierund<br />
Pflanzenarten und deren Populationen einschließlich ihrer Lebensräume [...] dient.<br />
Besondere Bedeutung kommt im weiteren (§ 31) dem Schutz von oberirdischen<br />
Gewässern einschließlich ihrer Gewässerrandstreifen und Uferzonen zu, welche als<br />
Lebensräume erhalten bleiben und weiterentwickelt werden sollen, um großräumige<br />
Vernetzungsfunktion auf Dauer erfüllen zu können. Zum Aufbau des Europäischen<br />
ökologischen Netzes „Natura 2000“, insb. zum Schutz der Gebiete von gemeinschaftlicher<br />
Bedeutung, sind die Richtlinien 79/409/EWG (Vogelschutzrichtlinie) und<br />
92/43/EWG (Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie, FFH) anzuführen.<br />
§ 39 schließlich formuliert die Aufgaben des Artenschutzes, welche u.a. den Schutz der<br />
Tiere und Pflanzen und ihrer Lebensgemeinschaften vor Beeinträchtigungen durch den<br />
Menschen sowie den Schutz, die Pflege, die Entwicklung und die Wiederherstellung der<br />
Biotope wild lebender Tier- und Pflanzenarten umfassen.<br />
Die Aussagen des BNatSchG werden im Hessischen Naturschutzgesetz (HENatG)<br />
aufgegriffen und konkretisiert. So nennt § 1a die Grundsätze des Naturschutzes und der<br />
Landschaftspflege und unterstreicht u.a. die Bedeutung wertvoller Lebensräume, wie<br />
insb. Feuchtgebiete sowie Trocken- und Magerstandorte sowie Talauen. Hierbei ist<br />
insb. die Errichtung des Europäischen ökologischen Netzes „Natura 2000“ zu fördern<br />
und zu verbessern, dies auch durch die Pflege und Entwicklung eines Biotopverbundes.<br />
Ein Biotopverbund besteht nach § 1b HENatG und nach Maßgabe der Landschaftspläne<br />
aus Kernflächen, Verbindungsflächen und Verbindungselementen; er soll einen<br />
angemessenen Anteil der Landesfläche umfassen. § 1b (3) nennt als Teile des<br />
Biotopverbundes des Landes Hessen: gesetzlich geschützte Biotope nach § 15d;
<strong>Landschaftsplan</strong> <strong>Hofbieber</strong> Seite - 50 -<br />
-Bewertung-<br />
Naturschutzgebiete, Gebiete im Sinne der §§ 20a und 20b (Natura 2000) sowie<br />
Biosphärenreservate oder Teile dieser Gebiete und weitere Flächen und Elemente.<br />
Gemäß § 2a (HENatG) „leisten die umwelt- und naturverträgliche Land-, Forst- und<br />
Fischereiwirtschaft einen wichtigen Beitrag für die Erhaltung der Kulturlandschaft in<br />
Hessen.“ Dementsprechend gelten die ordnungsgemäßen [...] Bodennutzungen:<br />
• Die landwirtschaftliche Nutzung des Bodens, wenn sie Erosionen verhindert, die<br />
Humusbildung fördert, sowie den Eintrag von Schadstoffen in Gewässer und die<br />
Beeinträchtigung von Lebensräumen wildlebender Tiere und Pflanzen vermeidet;<br />
• die fischereiwirtschaftliche Nutzung der Gewässer, wenn sie die Gewässergüte nicht<br />
beeinträchtigt und die Funktion der Gewässer und ihrer Ufer als Lebensraum für die<br />
gewässerabhängigen Tiere und Pflanzen des jeweiligen Naturraumes erhält und fördert;<br />
• 3. die Forstwirtschaft im Rahmen des § 5 des Hessischen Forstgesetzes<br />
nicht als Eingriff.<br />
Der Regionalplan Nordhessen zeigt für das <strong>Gemeinde</strong>gebiet <strong>Hofbieber</strong> die drei<br />
Naturschutzgebiete (Milseburg, Stellberg, Bieberstein). Für die Hauneaue und einen<br />
Teil der Traisbachaue ist ein Bereich für Schutz und Entwicklung von Natur und<br />
Landschaft dargestellt.<br />
Der Landschaftsrahmenplan Nordhessen 1999 (REGIERUNGSPRÄSIDIUM KASSEL, 1999,<br />
S. 66 FF.) trifft für das Gebiet der <strong>Gemeinde</strong> <strong>Hofbieber</strong> die folgenden Aussagen:<br />
Regional bedeutsame Vogel-Brutgebiete...<br />
• Habelsberg, Boxberg, Roßberg<br />
• Haunewiesen zwischen Steinau und Margretenhaun<br />
Lokal bedeutsame Vogel-Brutgebiete...<br />
• Nüst und Aschenbach<br />
• NSG „Stellberg“ und „Milseburg“<br />
• Bieber von der Quelle bis zur Mündung<br />
• Schwarzes Kreuz<br />
• Schneeberg / Wadberg<br />
• Bomberg<br />
An Schutzkategorien nach HENatG und ForstG sowie Vertragsnaturschutz (HELP)<br />
werden dargestellt: bestehende Naturschutzgebiete, geplantes Naturschutzgebiet (lt.<br />
Flächenschutzkarte), Landschaftsschutzgebiete, Kernzone des Biosphärenreservates<br />
Rhön, FFH-Gebietsmeldungen, Naturdenkmale, Schutzwald und Vertragsnaturschutzflächen.
<strong>Landschaftsplan</strong> <strong>Hofbieber</strong> Seite - 51 -<br />
-Bewertung-<br />
Weiterhin werden die Kategorie „Schutzfunktion Natur“ der Flächenschutzkarte sowie<br />
die Aussagen der Hessischen Biotopkartierung (HB) in die Biotopbewertung<br />
einbezogen.<br />
Wichtige Hinweise, gerade für Waldbereiche wie die Hessenliede oder den<br />
Schwarzehauk, lieferten die „Botanisch wertvollen Flächen“ aus BOHN (1996).<br />
Das Raumregister aus dem Projekt „Zoologischer Artenschutz im BR Rhön“<br />
(ALTMOOS, M. & ECKSTEIN, R., 1998) wird für den Bereich der <strong>Gemeinde</strong> <strong>Hofbieber</strong><br />
dargestellt und die Informationen aus der Tierartendatenbank ausgewertet. Weiterhin<br />
von Belang sind Informationen über Amphibienvorkommen (NABU KREISVERBAND<br />
FULDA E.V., AK AMPHIBIENSCHUTZ, 1999) sowie über Fledermäuse (L. HERZIG, SCHR.<br />
MITTEILUNG 2001; DIETZ, M., 2003).<br />
4.4.2 Bestandsbewertung Biotope und Nutzungen<br />
ABB.-NR.: 32. „Überblick: Bewertung Biotope und Arten”<br />
Die Bestandsaufnahme an „Biotopen und Nutzungen“ wird nach Bedeutungen<br />
eingestuft. Kriterien hierbei sind Naturnähe, Alter und Ersetzbarkeit, Diversität und<br />
Ausprägung, Vorkommen von seltenen Tier- und Pflanzenarten, ... (BASTIAN &<br />
SCHREIBER, 1999).
<strong>Landschaftsplan</strong> <strong>Hofbieber</strong> Seite - 52 -<br />
-Bewertung-<br />
Es werden die folgenden Kategorien gebildet:<br />
TABELLE-NR. 4: „WERTSTUFEN BIOTOPTYPEN UND NUTZUNGEN“<br />
Wertstufe Biotoptypen und Nutzungen<br />
sehr hoch Waldflächen<br />
Erlenbruchwald<br />
Grünlandflächen<br />
Grünland frischer<br />
Standorte, extensiv<br />
genutzt<br />
Grünland feuchter bis<br />
nasser Standorte<br />
Goldhaferwiese<br />
Magerrasen auf<br />
Kalkgestein<br />
Magerrasen auf<br />
Basaltgestein<br />
Borstgrasrasen<br />
hoch Waldflächen<br />
Sonstiger Laubwald<br />
Laubwald-/Mischwald-<br />
Aufforstung<br />
Waldrand<br />
mittel Grünlandflächen<br />
Grünland frischer<br />
Standorte und mittlerer<br />
Nutzungsintensität<br />
niedrig Wälder<br />
Sonstiger Nadelwald<br />
Nadelwald-Aufforstung<br />
Grünlandflächen<br />
Grünland frischer<br />
Standorte, intensiv<br />
genutzt<br />
Gewässer<br />
Quellen<br />
(Fließgewässer, nicht<br />
bewertet)<br />
Stillgewässer, naturnah<br />
Gehölze<br />
Laubbaum<br />
Obstbaum<br />
Hecken- und Feldgehölz<br />
Ackerflächen und<br />
Gärten<br />
Ackerbrache<br />
Gehölze<br />
Standortfremdes Gehölz<br />
Ackerflächen und<br />
Gärten<br />
Acker<br />
Nutzgarten<br />
Ackereinsaat<br />
Brachflächen<br />
Feuchte Hochstaudenflur<br />
und Röhricht<br />
Brachflächen<br />
Brachfläche trockener<br />
Standorte<br />
Brachflächen<br />
Brachfläche frischer<br />
Standorte<br />
Gewässer<br />
Stillgewässer, naturfern<br />
Deponiefläche,<br />
Folgenutzung<br />
Landwirtschaft<br />
Gesteinsbiotope,<br />
sonstige Habitate<br />
und Strukturen<br />
Steinbruch (Basalt und<br />
Kalk)<br />
Fels, natürlich (Basalt und<br />
Kalk)<br />
Blockschutthalde<br />
Lesesteinwall u. -haufen<br />
Besond. Reliefausprägung<br />
Deponiefläche,<br />
Folgenutzung Naturschutz<br />
Friedhöfe,<br />
Sportanlagen<br />
Friedhof<br />
Naturlehrpfad<br />
Friedhöfe,<br />
Sportanlagen<br />
Sportplatz<br />
Golfplatz<br />
Grillplatz<br />
Spielplatz<br />
Zeltplatz<br />
Nicht bewertet werden Waldflächen gemäß Topographischer Karte sowie die<br />
besiedelten Bereiche.<br />
Dargestellt werden auch Vorkommen von Tier- und Pflanzenarten, die aus der eigenen<br />
Kartierung aber auch aus der Literaturauswertung (NSG-Pflegepläne, Tierartendatenbank,<br />
Botanisch wertvolle Flächen, Hess. Biotopkartierung, ...) entstammen.<br />
Artnennungen sind im Zusammenhang „Biotopkomplexe“ weiter unten zu finden.
<strong>Landschaftsplan</strong> <strong>Hofbieber</strong> Seite - 53 -<br />
-Bewertung-<br />
4.4.3 Arten<br />
Das <strong>Gemeinde</strong>gebiet <strong>Hofbieber</strong> bietet Lebensraum für eine Vielzahl von Vertretern der<br />
Pflanzen- und Tierwelt. Sind es in den intensiv genutzten Bereichen (Land-,<br />
Forstwirtschaft, Siedlung und Verkehr) überwiegend Arten mit geringen<br />
Habitatansprüchen (Ubiquisten), so kommen in den naturschutzfachlich höher zu<br />
bewertenden Bereichen vielfältige Arten und Artengesellschaften vor. Ausführliche<br />
Auflistungen finden sich in den anschließenden Biotopsteckbriefen der<br />
Biotopkomplexe.<br />
Vegetationskundlich betrachtet (VGL. BOHN, 1996; PLANUNGSBÜRO HENNING, 1988;<br />
BREHM, 1988; RUNGE, 1994; ...) bestehen neben den Nadel- und Mischwäldern flächige<br />
Buchenwälder, welche je nach Standortverhältnissen und Zusammensetzungen der<br />
Kraut- und Strauchschicht in sog. Hainsimsen-Buchenwälder (Luzulo-Fagetum),<br />
„Flattergras-Hainsimsen-Buchenwälder“ (Milium-Variante des Luzulo-Fagetum),<br />
„Perlgras-Buchenwälder“ (Melico-Fagetum), „Waldmeister-Buchenwälder“ (Galio<br />
odorati-Fagetum) und z.B. „Zahnwurz-Buchenwälder“ (Dentario-Fagetum) zu<br />
unterscheiden sind.<br />
Buchenwälder kommen flächendeckend in verschiedenen Ausprägungen im<br />
<strong>Gemeinde</strong>gebiet vor. Auf Kuppenlagen kommen vereinzelt auch Traubeneichen-<br />
Hainbuchenwälder (Galio-Carpinetum) vor. BOHN (1996) beschreibt für den Osthang<br />
des Bubenbader Steines die Hochlagenform des Frauenfarn-Hainsimsen-Buchenwaldes<br />
(Luzulo-Fagetum athyrietosum, Hypnum cupressiforme-Variante, Gymnocarpium<br />
dryopteris-Fazies) auf einem blockreichen Phonolith-Standort. Er definiert es als naturnahes<br />
Restvorkommen und eine Rarität für die Rhön.<br />
Auf feuchteren Standorten durchmischen Hainbuchen und Stieleichen die Bestände, sie<br />
treten vorwiegend im nördlichen und westlichen Bereich der <strong>Gemeinde</strong> auf. Auf<br />
staufeuchten Böden bestehen kleinflächig „Moorbirkenwälder“ sowie „Erlen-<br />
Eschen-Auwälder“, so östlich von Danzwiesen. Relikte dieser Vorkommen finden sich<br />
noch an Fließgewässern als Galeriewälder.<br />
Besonderheiten sind die Bestände von „Edellaub-Hang-Blockschuttwäldern“, auch<br />
Sommerlinden-Bergulmen-Hang- und Blockschuttwald genannt, (Tilio platyphylli –<br />
Ulmetum glabrae) sowie der „Platterbsen-Buchenwälder“ (Lathyro-Fagetum), oft in<br />
Verbindung mit „Orchideen-Buchenwäldern“ (Carici-Fagetum) oder auch Bergseggen-<br />
(Carex montana)-Buchenwälder.<br />
Als Vertreter der Krautschicht in den genannten Waldtypen sind beispielhaft<br />
anzuführen: Waldmeister (Galio odoratum), Hainsimse (Luzula luzuloides), Flattergras<br />
(Milium effusum), Perlgras (Melico nutans, M. uniflora), Berg-Segge (Carex montana),<br />
Finger-Segge (Carex digitata), Akelei (Aquilegia vulgaris), Rotes Waldvögelein<br />
(Cephalanthera rubra), Sauerklee (Oxalis acetosella), Seidelbast (Daphne mezereum),<br />
Türkenbundlilie (Lilium martagon), Haselwurz (Asarum europaeum), Vogelfuß-Segge<br />
(Carex ornithopoda), Tollkirsche (Atropa bella-donna), Weißes Waldvögelein<br />
(Cephalanthera damasonium), Quirlblättrige Weißwurz (Polygonatum verticillatum),<br />
Vielblütige Weißwurz (Polygonatum multiflorum), Maiglöckchen (Convallaria<br />
majalis), Kleine Goldnessel (Lamiastrum galeobdolon), Berg-Platterbse (Lathyrus<br />
linifolius), Großes Zweiblatt (Listera ovata), Wildes Silberblatt (Lunaria rediviva),<br />
Vogel-Nestwurz (Neottia nidus-avis), Einbeere (Paris quadrifolia), Ährige<br />
Teufelskralle (Phyteuma spicatum), Zwiebeltragende Zahnwurz (Dentaria bulbifera),
<strong>Landschaftsplan</strong> <strong>Hofbieber</strong> Seite - 54 -<br />
-Bewertung-<br />
Echtes Lungenkraut (Pulmonaria officinalis), Platanenblättriger Hahnenfuß<br />
(Ranunculus platanifolius) und Berg-Johannisbeere (Ribes alpinum).<br />
Besondere Baumarten sind z.B. Moor-Birke (Betula pubescens), Echte Mehlbeere<br />
(Sorbus aria), Elsbeere (Sorbus torminalis) und Berg-Ulme (Ulmus glabra).<br />
Die aufgrund der Artvorkommen besonders zu betonenden Waldbereiche finden sich in<br />
den Gemarkungsteilen Milseburg / Liedenküppel, Stellberg, Bubenbader Stein,<br />
Schackenberg / Ziegenkopf, Wadberg, Hohlstein / Fuchsstein, Hessenliede / Kugel<br />
berg / Bieberstein, Sandberg, Bomberg, Großer Grubenhauck, Schwarzehauk /<br />
Gickershauk, Nüster-Berg / Hozzel-Berg / Boxberg.<br />
Von besonderer Bedeutung in der <strong>Gemeinde</strong> <strong>Hofbieber</strong> sind felsige Sonderstandorte,<br />
welche z.B. rund um die Milseburg aufgrund der Standortfaktoren Boden- und<br />
Nährstoffarmut sowie Klima besondere Lebensraumbedingungen bieten. BREHM ET AL.<br />
(1988) schreiben, dass sich wärmeliebende Arten, die an den sonnenexponierten<br />
Standorten gedeihen, mit präalpinen und arktisch-alpinen Arten vergesellschaften. Sie<br />
bezeichnen die Pfingstnelken-Felsgesellschaft (Festuca lemanii - Dianthus<br />
gratianopolitanus - Felsgesellschaft) und die Strichfarn - Felsspaltengesellschaft<br />
(Woodsio - Asplenietum septentrionalis) als eiszeitliche Relikte und somit als besonders<br />
schützenswert.<br />
Anzuführen sind hier z.B.: Südlicher Wimpernfarn (Woodsia ilvensis), Schnittlauch<br />
(Allium schoenoprasum), Weinbergs-Lauch (Allium vineale), Katzenpfötchen<br />
(Antennaria dioica), Pfingst-Nelke (Dianthus gratianopolitanus), Nordischer Strichfarn<br />
(Asplenium septentrionale), Blasses Habichtskraut (Hieracium schmidtii), Berg-<br />
Fetthenne (Sedum fabaria), Große Fetthenne (Sedum maximum), Berg-Johannisbeere<br />
(Ribes alpinum), Gewöhnliche Zwergmispel (Cotoneaster integerrimus), Nelken-<br />
Leimkraut (Silene armeria), Turmkraut (Turritis glabra), Pfirsichblättrige<br />
Glockenblume (Campanula persicifolia), Schwalbenwurz (Vincetoxicum hirundinaria),<br />
Scharfer Mauerpfeffer (Sedum acre) und Heidelbeere (Vaccinium myrtillus).<br />
Auf diesen Lebensräumen wurden nach Angaben von BREHM et al. auch 222<br />
verschiedene Moosarten und weiterhin zahlreiche Flechtenarten von verschiedenen<br />
Wissenschaftlern festgestellt.<br />
Hinsichtlich des Grünlandes (VGL. AUCH HESS. BIOTOPKARTIERUNG; RUNGE, 1994) ist<br />
festzustellen, dass großflächig die in der Artenausstattung nivellierten Gesellschaften<br />
der Weidelgraswirtschaftswiesen und –weiden (Molinio-Arrhenatheretea) dominieren.<br />
Auf feuchten und z.T. auch natürlich nährstoffreichen Standorten sind Feuchtwiesen<br />
(knapp 12 ha mit 63 Einzelflächen), Quellen oder auch Feuchtbrachen (knapp 6 ha mit<br />
23 Einzelflächen) erhalten geblieben. Pflanzensoziologisch sind hier die Gesellschaften<br />
der Teichröhrichte (Scirpo-Phragmitetum), verschiedene Quellfluren- (Montio-Cardaminetalia)<br />
und Kleinseggen-Gesellschaften (Scheuchzerio-Cariceta nigrae),<br />
verschiedene Ausprägungen von Feuchtwiesengesellschaften (Molinion caeruleae) oder<br />
Mädesüß-Fluren (Valeriano officinalis – Filipenduletum ulmariae) bzw. Sumpfdotterblumenwiesen<br />
(Calthion palustris) zu beschreiben, in denen jeweils Charakterarten<br />
anzutreffen sind. Zu den Feuchtarten zählen auch die Pflanzen in bzw. an
<strong>Landschaftsplan</strong> <strong>Hofbieber</strong> Seite - 55 -<br />
-Bewertung-<br />
Fließgewässern sowie an manchen Stillgewässern, die u.a. aus den Gesellschaften<br />
Bachbungen-Teichwasserstern-Ges. (Veronico beccabungae-Callitrichetum stagnalis),<br />
Wasserpfeffer-Zweizahn-Ges. (Bidenti tripartitae – Polygonetum hydropiperis) und /<br />
oder der Pestwurz-Uferflur (Petasitetum hybridi) entstammen.<br />
An Arten kommen hier z.B: vor: Schnabel-Segge (Carex rostrata), Blasen-Segge<br />
(Carex vesicaria), Geflecktes Knabenkraut (Dacthylorhiza maculata), Breitblättriges<br />
Knabenkraut (Dacthylorhiza majalis),<br />
Sumpf-Weidenröschen (Epilobium palustre),<br />
verschiedene Wollgräser (Eriophorum<br />
spec.), Bach-Nelkenwurz (Geum rivale),<br />
Teufelsabbiß (Succisa pratensis), Trollblume<br />
(Trollius europaeus), Sumpf-<br />
Veilchen (Viola palustris), Sumpfdotterblume<br />
(Caltha palustris), Sumpf-Schafgarbe<br />
(Achillea ptarmica), Sumpflabkraut<br />
(Galium palustre), Blaues Pfeifengras<br />
(Molinia caerulea), Sumpf-Vergißmeinnicht<br />
(Myosotis palustre) und Weiße<br />
Pestwurz (Petasites albus).<br />
ABB.-NR.: 33. „Bachnelkenwurz”<br />
ABB.-NR.: 34. „Trollblume”<br />
Die Arten auf Feuchtflächen kommen verteilt<br />
über das <strong>Gemeinde</strong>gebiet vor, wobei als<br />
Besonderheiten die Bestände nördlich Allmus<br />
„Im Loels“, am Riegel- und Igelbach, am<br />
Mambach sowie nahe dem „Schwarzehauk“<br />
aufzuzählen sind. Ein Vorkommen östlich von<br />
Danzwiesen ist aufgrund seiner Artenausstattung<br />
als außerordentlich bedeutsam, aufgrund<br />
der feuchten Bodenverhältnisse als<br />
äußerst sensibel und durch das zunehmende<br />
Erlenwachstum als gefährdet zu bezeichnen.<br />
Weitere Vorkommen finden sich kleinflächig<br />
und linear begleitend von verschiedenen<br />
Fließgewässern als Säume.<br />
Sonstige extensiv genutzte Grünländer (ca. 220 ha auf 208 Teilflächen), Goldhaferwiesen<br />
(35 ha auf 31 Teilflächen), Kalkmagerrasen (rund 3 ha auf 7 Teilflächen),<br />
Basaltmagerrasen (rund 3 ha auf 6 Teilflächen), Borstgrasrasen (knapp 4 ha auf<br />
8 Teilflächen) sowie Trockenbrachen (rund 4 ha auf 17 Teilflächen sowie<br />
verschiedentlich an Wegrändern) bestehen auf mittleren-trockenen Standorten (z.T. aber<br />
auch mit wechselfeuchten Übergängen). Ihnen ist ein mittlerer bis geringer<br />
Nährstoffvorrat gemeinsam, die Artenzusammensetzungen begründen sich nicht zuletzt<br />
auf der Zusammensetzung des Bodens und des Ausgangsgesteins.<br />
An Pflanzengesellschaften sind hier zu nennen: Glatthafer-Wiese (Arrhenatheretum<br />
elatioris), Goldhafer-Wiese (Trisetum flavescentis), Trespen-Halbtrockenrasen<br />
(Mesobrometum erecti) und Borstgras-Rasen (Nardo-Callunetea).
<strong>Landschaftsplan</strong> <strong>Hofbieber</strong> Seite - 56 -<br />
-Bewertung-<br />
Artnachweise liegen u.a. vor für: Arnika (Arnica montana), Zittergras (Briza media),<br />
Büschel-Glockenblume (Campanula glomerata), Silberdistel (Carlina acaulis),<br />
Stengellose Kratzdistel (Cirsium acaule), Gefranster Enzian (Gentianella ciliata),<br />
Deutscher Enzian (Gentianella germanica),<br />
Mücken-Händelwurz (Gymnadenia<br />
conopsea), Gewöhnliches Sonnenröschen<br />
(Helianthemum nummularium),<br />
Berg-Sandrapunzel (Jasione montana),<br />
ABB.-NR.: 35. „Wacholder”<br />
Gewöhnlicher Wacholder (Juniperus communis),<br />
Acker-Wachtelweizen (Melampyrum<br />
arvense), Borstgras (Nardus<br />
stricta), Kriechende Hauhechel (Ononis<br />
ABB.-NR.: 36. „Arnika”<br />
repens), Fliegen-Ragwurz (Ophrys<br />
insectifera), Stattliches Knabenkraut<br />
(Orchis mascula), Helm-Knabenkraut<br />
(Orchis militaris), Wald-Läusekraut<br />
(Pedicularis sylvatica), Kugel-Teufelskralle<br />
(Phyteuma orbiculare), Weiße<br />
Waldhyazinthe (Platanthera bifolia),<br />
Schopfige Kreuzblume (Polygala<br />
comosa), Küchenschelle (Pulsatilla<br />
ABB.-NR.: 37. „Ackerwachtelweizen”<br />
vulgaris), Wundklee (Antyllis vulneraria),<br />
Harzer Labkraut (Galium harcynicum),<br />
Wald-Storchschnabel (Geranium sylvaticum),<br />
Kleines Habichtskraut (Hieracium<br />
pilosella), Wald-Rispengras (Poa chaixii), Feld-Thymian (Thymus pulegioides),<br />
Wiesenbocksbart (Tragopogon pratensis) und Goldhafer (Trisetum flavescens).<br />
Gesellschaften der Extensivgrünländer finden sich verteilt im <strong>Gemeinde</strong>gebiet, die z.T.<br />
sehr kleinflächigen Vorkommen von Magerrasen zeigen sich als sehr artenreich und<br />
lassen sich mitunter als exklusiv bezeichnen. Die Goldhaferwiesen-Vorkommen rund<br />
um die Milseburg sowie im nordöstlichen <strong>Gemeinde</strong>gebiet von Wallings bis Boxberg<br />
und die Magerrasen bei Wallings/Boxberg, am Schnurberg, an der Hessenliede und bei<br />
Öchenbach sowie am Stöckküppel, am Schröcksküppel, am Ulrichshauk, am<br />
Kirschberg und Schweinsberg sowie am Kleinen Grubenhauck sind zu betonen.<br />
Bei Obergruben besteht ein wegbegleitender Trockensaum auf sandigem Boden, auf<br />
dem die genannte Berg-Sandrapunzel wächst. Südlich von Kleinsassen wurde ein
<strong>Landschaftsplan</strong> <strong>Hofbieber</strong> Seite - 57 -<br />
-Bewertung-<br />
Borstgrasrasenrelikt mit einer Fichtenaufforstung vorgefunden, in der ein Ex. der<br />
Weißen Waldhyazinthe geblüht hat.<br />
Krautsäume an Gebüschen, Wegrändern sowie an Nutzungsgrenzen bestehen u.a. aus<br />
den Gesellschaften: Goldkälberkropf-Ges. (Chaerophylletum aurei), Brennessel-<br />
Giersch-Saum (Urtico dioicae – Aegopodietum), Mastkraut-Silbermoos-Trittges. (Bryo<br />
argentei – Saginetum procumbentis) und Weidelgras-Breitwegerich-Trittrasen (Lolio<br />
perennis – Plantaginetum majoris).<br />
Besondere Ackerwildkrautgesellschaften sind selten anzutreffen, es wurden jedoch<br />
Vorkommen der Kornblume (Centaurea cyanus) oder des Klatschmohns (Papaver<br />
rhoeas) festgestellt.<br />
Eine Übersicht über die besonderen und geschützten Pflanzenvorkommen im<br />
<strong>Gemeinde</strong>gebiet schließt an die Biotopsteckbriefe an.<br />
Daraus ist zu ersehen, dass 60 Arten den Roten Listen oder sonstigen Schutzkategorien<br />
angehören (13 Bundesartenschutzverordnung, 16 RL Deutschland, 58 RL Hessen),<br />
sowie zahlreiche weitere Arten als regional selten eingestuft werden.<br />
Als Besonderheiten sind neben den 11 Orchideenarten (Rotes Waldvögelein,<br />
Geflecktes Knabenkraut, Breitblättriges Knabenkraut, Rotbraune Stendelwurz, Mücken-<br />
Händelwurz, Fliegen-Ragwurz, Stattliches Knabenkraut, Helm-Knabenkraut, Weiße<br />
Waldhyazinthe, Weißes Waldvögelein, Großes Zweiblatt, Vogel-Nestwurz) nochmals zu<br />
nennen: Katzenpfötchen, Arnika, Silberdistel,<br />
Pfingst-Nelke, Wollgräser, Gefranster Enzian,<br />
Deutscher Enzian, Kugelige Teufelskralle,<br />
Küchenschelle, Trollblume.<br />
ABB.-NR.: 38. „Stattliches Knabenkraut” ABB.-NR.: 39. „Rotes Waldvögelein”
<strong>Landschaftsplan</strong> <strong>Hofbieber</strong> Seite - 58 -<br />
-Bewertung-<br />
Aber auch die Tierwelt weist artenreiche Vorkommen auf. So wurden aus der Gruppe<br />
der Säugetiere z.B. der Feldhase, die Haselmaus oder der Dachs beobachtet.<br />
Fledermäuse kommen in entsprechend strukturierten Waldgebieten z.B. rund um die<br />
Milseburg / Liedenküppel, Ziegenkopf / Schackenberg / Hohlstein, Bieberstein /<br />
Kugelberg oder die Fohlenweide vor. Von Bedeutung sind hier für deren<br />
Wanderungsbewegungen lineare Elemente in der Landschaft wie z.B. die Ufergehölze<br />
an Fließgewässern, weswegen die Bachauen als Korridore für z.B. Jagdaktivitäten<br />
(Sommerlebensräume) fungieren. Lebensräume für die Jungenaufzucht, sog. Wochenstuben,<br />
beschreibt HERZIG (2001) in verschiedenen Gebäuden in Kleinsassen, Elters,<br />
Langenbieber, Niederbieber und <strong>Hofbieber</strong> sowie im Schloss Bieberstein. Als<br />
Überwinterungsquartiere fungieren verschiedene Keller und Stollen sowie mit übergeordneter<br />
Bedeutung der Milseburg-Tunnel der ehem. Bahntrasse. Artvorkommen sind<br />
gem. HERZIG, L. (2001) UND DIETZ, M. (2003) Braunes Langohr, Großes Mausohr,<br />
Wasserfledermaus, Fransenfledermaus, Kleine Bartfledermaus, Breitflügelfledermaus,<br />
Bechsteinfledermaus, Großer Abendsegler und Zwergfledermaus.<br />
Die Vogelwelt ist zunächst hinsichtlich ihrer Lebensräume zu unterteilen in Arten des<br />
Waldes, der reich gegliederten Landschaft, der offenen Landschaft, der Gewässer und<br />
der besiedelten Bereiche. Hier sind wiederum weit verbreitete Arten mit<br />
vergleichsweise geringen Ansprüchen an ihren Lebensraum von solchen mit<br />
spezielleren Anforderungen zu unterscheiden (Eckstein, R. in Altmoos, M; Brehm, J. et<br />
al., 1988; eigene Kartierungen, 2000-2001).<br />
Aus der Gruppe der Waldbewohner sind somit u.a.<br />
anzuführen: Schwarzstorch (mindestens als<br />
Nahrungsgast, auch in benachbarten Bachauen),<br />
Schwarzspecht, Waldschnepfe, Hohltaube, Klappergrasmücke,<br />
Kleiber, Waldbaumläufer, Waldlaubsänger<br />
und Kuckuck.<br />
ABB.-NR.: 40. „Schwarzstorch”<br />
Foto: Robert Groß, GDT
<strong>Landschaftsplan</strong> <strong>Hofbieber</strong> Seite - 59 -<br />
-Bewertung-<br />
In u.a. mit Gehölzanteilen gegliederten aber auch mit Wäldern durchsetzten<br />
Landschaftsteilen sind beispielhaft anzutreffen: Raubwürger, Neuntöter, Rebhuhn,<br />
Rotmilan, Mäusebussard, Dorngrasmücke, Mönchsgrasmücke und Heckenbraunelle.<br />
In der offenen Landschaft sind es vor allem die Wiesenbrüter, die im <strong>Gemeinde</strong>gebiet<br />
zu bemerken sind. Hier wurden verschiedene Vorkommen von Braunkehlchen (u.a.<br />
Talaue der Bieber mit Goldbach und Traisbach) oder auch Wiesenpiepern festgestellt.<br />
Diese Arten benötigen extensiv genutzte Grünländer oder zumindest randliche<br />
Strukturen zum Nestbau und zur Aufzucht ihrer Jungen. Von Bedeutung sind hier auch<br />
Koppelpfähle von Viehweiden, die gerne als Singwarte genutzt werden. Nahezu<br />
flächendeckend im <strong>Gemeinde</strong>gebiet wurden am Himmel singende Feldlerchen<br />
beobachtet.<br />
Von den Arten der Gewässer sind vor allem die Wasseramsel, der Eisvogel und die<br />
Gebirgsstelze zu nennen, welche z.B. von der Bieber oder der Nüst bekannt sind.<br />
Aus den besiedelten Bereichen mit landwirtschaftlichen Gehöften und strukturreichen<br />
Gärten sind insbesondere die Schleiereule sowie die Mehl- und die Rauchschwalbe zu<br />
betonen.<br />
In den im <strong>Gemeinde</strong>gebiet vorhandenen Gewässerlebensräumen wurden Amphibien<br />
festgestellt. Hier sind zu nennen: Grasfrosch, Erdkröte, Teichmolch, Bergmolch,<br />
Kammolch und Feuersalamander.<br />
An Reptilien sind die Waldeidechse, die Glattnatter und die Kreuzotter hervorzuheben.<br />
Vorkommen sind die Teiche und Feuchtgebiete nördlich von Allmus, nordwestlich von<br />
Egelmes, westlich von Wittges, nordöstlich von Schloss Bieberstein / Weihershof, an<br />
der Fohlenweide, am Mambach, im Bereich Thiergarten, am Igelbach sowie an der<br />
Milseburg und am Bubenbader Stein und das Waldgebiet Wolfstannen / Schwarzes<br />
Kreuz (ECKSTEIN, R. IN ALTMOOS, M; NABU KV FULDA, AK AMPHIBIENSCHUTZ,<br />
1999; EIGENE KARTIERUNGEN, 2000-2001).<br />
Von den im <strong>Gemeinde</strong>gebiet verlaufenden Fließgewässern sind Fischarten bekannt:<br />
Bachforelle, Groppe, Dreistachliger Stichling, Bachneunauge (ECKSTEIN, R. IN<br />
ALTMOOS, M.).<br />
Aus der Gruppe der Insekten liegen Informationen (U.A. ECKSTEIN, R. IN ALTMOOS,<br />
M.; BREHM, J. ET AL., 1988; EIGENE KARTIERUNGEN, 2000-2001) über Schmetterlinge<br />
vor. Es sind an besonderen Arten (alphabetisch geordnet) bekannt: Admiral, Aurorafalter,<br />
Baldrianscheckenfalter, Baumweißling, Blaugrasfalter, Brauner Eichenzipfelfalter,<br />
Brauner Waldvogel, Braunkolbiger Dickkopffalter, Brombeerzipfelfalter,<br />
C-Falter, Distelfalter, Dukatenfalter, Gelbwürfeliger Dickkopffalter, Gemeiner<br />
Dickkopffalter, Goldene Acht, Graubrauner Dickkopffalter, Großer Kohlweißling,<br />
Großes Ochsenauge, Großer Perlmutterfalter, Großer Schillerfalter, Grünaderweißling,
<strong>Landschaftsplan</strong> <strong>Hofbieber</strong> Seite - 60 -<br />
-Bewertung-<br />
Hainveilchenperlmutterfalter, Hauhechelbläuling, Hufeisenklee-Heufalter, Hundsveilchenperlmutterfalter,<br />
Kaisermantel, Kleiner Feuerfalter, Kleiner Fuchs, Kleiner<br />
Kohlweißling, Kleiner Malvendickkopffalter, Kleiner Perlmutterfalter, Kleines Wiesenvögelchen,<br />
Landkärtchen, Mauerfuchs, Milchfleck, Perlbinde, Perlgrasfalter, Schachbrettfalter,<br />
Schwalbenschwanz, Schwarzer Apollo, Schwarzkolbiger Dickkopffalter,<br />
Senfweißling, Skabiosenscheckenfalter, Tagpfauenauge, Veilchenperlmutterfalter,<br />
Violetter Waldbläuling, Waldbrettspiel, Zitronenfalter und Zwergbläuling.<br />
Die Auflistungen werden durch verschiedene historische Angaben ergänzt, die sich in<br />
den Biotopsteckbriefen finden.<br />
An Widderchen ist u.a. das Thymian-Widderchen bekannt.<br />
Es wäre wissenswert, den regional bis landesweit bedeutsamen Nachweis des<br />
Schwarzen Apollo (Milseburg, Stand 1988; historisch belegt an Schloss Bieberstein<br />
und Ziegenkopf / Hohlstein) auf das aktuelle Vorkommen und seine Verbreitung hin zu<br />
überprüfen. „Hot Spots“ von Informationen über Schmetterlinge sind das Gebiet rund<br />
um die Milseburg / Stellberg, die Fohlenweide, Wolfstannen und Bomberg.<br />
Bekannte Heuschrecken aus dem Bereich der Milseburg sind: Brauner Grashüpfer,<br />
Bunter Grashüpfer, Gemeine Eichenschrecke, Gemeiner Grashüpfer, Gemeine<br />
Strauchschrecke, Pyrenäische Plumpschrecke, Schwarzfleckiger Grashüpfer, Sumpf-<br />
Grashüpfer, Verkannter Grashüpfer und Zwitscher-Heupferd.<br />
In Bachauen, insbesondere an Ufersäumen, wurden an Libellen festgestellt (EIGENE<br />
BEOBACHTUNGEN, 2000-2001): Blauflügelige Prachtlibelle und Gebänderte<br />
Prachtlibelle.
<strong>Landschaftsplan</strong> <strong>Hofbieber</strong> Seite - 61 -<br />
-Bewertung-<br />
4.4.4 Biotopkomplexe und Biotopsteckbriefe<br />
Die verschiedenen Informationen aus der o.a. Bewertung sowie den vorhandenen<br />
rechtlichen Kategorien und sonstigen fachlichen Informationen (Literaturrecherche)<br />
werden räumlich in Beziehung gebracht.<br />
Hierzu werden die besonders wertvollen Bereiche (Naturschutzgebiete, Biotopwertstufe<br />
„ sehr hoch“, besondere Waldbereiche, ...) zu Kernflächen abgegrenzt. Puffer- und<br />
Ergänzungsflächen (z.B. Bachauen, sonstige Verbindungsflächen) anderer Biotopwertstufen<br />
werden definiert. In der Summe ergeben sich Biotopkomplexe, welche auch<br />
flächenmäßig quantifiziert werden können. Informationen, wie z.B. über die<br />
betreffenden Biotoptypen oder die zahlreich vorkommenden Tier- und Pflanzenarten,<br />
über die Gebiete finden sich in den Biotopsteckbriefen im Anhang.<br />
Innerhalb des <strong>Gemeinde</strong>gebietes <strong>Hofbieber</strong> sind nunmehr folgende Biotopkomplexe zu<br />
beschreiben:<br />
TABELLE-NR. 5: „ÜBERSICHT DER BIOTOPKOMPLEXE INNERHALB DES GEMEINDEGEBIETES HOFBIEBER“<br />
Nr. Bezeichnung Fläche Biotopkomplex anteilige Kernfläche<br />
1 Milseburg, Stellberg und oberes Biebertal 704 201<br />
2 Talauen der Bieber mit Goldbach und<br />
Traisbach<br />
513 60<br />
3 Talauen Riegel- und Igelbach 44 11<br />
4 Talaue der Haune 17 7,5<br />
5 Talaue der Nässe 344 31<br />
6 Talauen der Nüst mit Birkenbach,<br />
Schwarzbach und Grubenwasser<br />
321 75<br />
7 Hozzelberg / Nüster-Berg 258 141<br />
8 Lothar-Mai-Hütte mit Bomberg 49 6,5<br />
9 Kleiner Ziegenkopf, Hohlstein und<br />
Schackenberg mit Mambachtal<br />
361 172<br />
10 Schröcksküppel und Ulrichshauk 40 11<br />
11 Kirschberg und Schweinsberg 37 12<br />
12 Hessenliede und Bieberstein 126 86<br />
13 Hofberg und Schnurberg 110 10<br />
alle Flächenangaben in ca. ha, Erfassungsgenauigkeit 1:10.000<br />
2.924 824
<strong>Landschaftsplan</strong> <strong>Hofbieber</strong> Seite - 62 -<br />
-Bewertung-<br />
4.4.4.1 „Milseburg, Stellberg und oberes Biebertal“<br />
TABELLE-NR. 6: „MILSEBURG, STELLBERG UND OBERES BIEBERTAL“<br />
Bezeichnung: Milseburg, Stellberg und oberes Biebertal<br />
Lage: Südöstlich von Kleinsassen<br />
Gesamtfläche: ca. 704 ha<br />
... davon Kernflächen: ca. 201 ha<br />
Biotoptypen: Hainsimsen-Buchenwälder, Hainsimsen-Zahnwurz-Buchenw., Orchideen-B.,<br />
Sommerlinden-Bergulmen-Blockschuttwald, Traubeneichen-Trockenwald,<br />
Frauenfarn-Hainsimsen-Buchenwald<br />
Felsbildungen und Blockschutthalden / Lesesteinwälle an Milseburg,<br />
Bubenbader Stein und Stellberg, Quellgebiet und oberes Bachtal mit<br />
reichhaltigen Feld- / Ufer- und Einzelgehölzen, Borstgrasrasen,<br />
Goldhaferwiesen, Extensivgrünländer, feuchte Hochstaudenfluren<br />
ergänzt durch: sonstige Buchen- / Misch- und Nadelwälder, div.<br />
Grünländer, Äcker, Ortslage, Parkplätze, Bieberweiher<br />
Bes. Pflanzenarten: Achillea ptarmica, Actaea spicata, Allium schoenoprasum, Antennaria<br />
dioica, Anthyllis vulneraria, Arabis hirsuta, Arnica montana, Asarum<br />
europaeum, Asplenium septentrionale, Astragallus glycyphyllos, Briza<br />
media, Calluna vulgaris, Campanula latifolia, Campanula persicifolia,<br />
Campanula trachelium, Carex remota, Carex sylvatica, Carlina acaulis,<br />
Chaerophyllum hirsutum, Circaea lutetiana, Cirsium acaule, Colchicum<br />
autumnale, Convallaria majalis, Cotoneaster integerrimus, Crepis paludosa,<br />
Dacthylorhiza maculata, Dactylorhiza majalis, Daphne mezereum,<br />
Dianthus gratianopolitanus, Epilobium palustre, Epipactis atrorubens,<br />
Eriophorum spec., Eupatorium cannabinum, Euphrasia rostkoviana,<br />
Festuca altissima, Festuca ovina agg., Galium harcynicum, Galium<br />
sylvaticum, Geranium sylvaticum, Geum rivale, Hieracium pilosella,<br />
Hieracium schmidtii, Hieracium sylvaticum, Juniperus communis,<br />
Lamiastrum galeobdolon, Lathyrus vernus, Lilium martagon, Lunaria<br />
rediviva, Nardus stricta, Orchis mascula, Paris quadrifolia, Petasites albus,<br />
Pedicularis sylvatica, Phyteuma orbiculare, Phyteuma spicatum,<br />
Platanthera bifolia (1 Ex.), Poa chaixii, Polypodium vulgare, Polygala<br />
comosa, Pulmonaria officinalis, Ranunculus platanifolius, Ribes alpinum,<br />
Scleranthus perennis, Sedum fabaria, Silene armeria, Solidago virgaurea,<br />
Sorbus aria, Sorbus torminalis, Succisa pratensis, Thelypteris phegopteris,<br />
Thymus praecox hesperites, Thymus pulegioides, Trisetum flavescens,<br />
Trollius europaeus (> 150 Ex.), Vaccinium myrtillus, Vincetoxicum<br />
hirundinaria, Viola palustris, Woodsia ilvensis<br />
historisch belegt: Centaurea pseudophrygia, Digitalis grandiflora, Diphasium<br />
(=Lycopodium) complanatum, Gentianella germanica, Huperzia selago,<br />
Leucojum vernum, Rosa coriifolia, Serratula tinctoria, Thesium pyrenaicum<br />
Zahlreiche Moos- und Flechtenarten<br />
Bes. Tierarten: Säugetiere: Haselmaus, Siebenschläfer, Gartenschläfer<br />
Fledermäuse (Milseburgtunnel): Zwergfledermaus, Braunes Langohr,<br />
Großes Mausohr, Wasserfledermaus,<br />
Fransenfledermaus, Kleine Bartfledermaus,<br />
Breitflügelfledermaus, Bechsteinfledermaus<br />
Vögel: Baumpieper (BP), Feldlerche (NG),<br />
Fichtenkreuzschnabel (BP), Gartenrotschwanz<br />
(BP), Gelbspötter (BP), Heckenbraunelle (BP),<br />
Hohltaube (NG), Kernbeißer (BP),<br />
Klappergrasmücke (NG), Kleinspecht, Kolkrabe
<strong>Landschaftsplan</strong> <strong>Hofbieber</strong> Seite - 63 -<br />
-Bewertung-<br />
(NG), Kuckuck (NG), Mönchsgrasmücke (BP),<br />
Neuntöter (BP), Rotmilan (BP), Schwarzspecht<br />
(NG), Schwarzstorch (NG), Sperber (BP),<br />
Sumpfmeise (BP), Tannenmeise (BP),<br />
Trauerschnäpper (BP), Wacholderdrossel (NG),<br />
Weidenmeise (BP)<br />
historisch (1919-1970) belegt, aktuelle Vorkommen nicht<br />
überprüft: Baumfalke, Bekassine, Bergfink, Bluthänfling,<br />
Brachpieper, Dohle, Dorngrasmücke, Erlenzeisig,<br />
Feldschwirl, Gebirgsstelze, Graureiher, Grauschnäpper,<br />
Grauspecht, Grünspecht, Habicht, Haubenmeise,<br />
Heidelerche, Kernbeißer, Kiebitz, Nachtigall, Rauhfußkauz,<br />
Rebhuhn, Ringdrossel, Saatkrähe, Schleiereule,<br />
Schwanzmeise, Seidenschwanz, Steinkauz,<br />
Sommergoldhähnchen, Sumpfmeise, Sumpfrohrsänger,<br />
Tannenhäher, Wachtel, Wachtelkönig, Waldbaumläufer,<br />
Waldkauz, Waldlaubsänger, Waldohreule, Weidenmeise,<br />
Wiesenpieper, Waldschnepfe, Wanderfalke, Wiedehopf,<br />
Wintergoldhähnchen, Ziegenmelker, Weidenmeise<br />
Amphibien / Reptilien: Bergmolch, Teichmolch, Erdkröte,<br />
Feuersalamander, Grasfrosch, Waldeidechse<br />
Insekten: Schmetterlinge / Widderchen (Milseburg / Stellberg):<br />
Kleiner Fuchs, Aurorafalter, Großer Schillerfalter,<br />
Brauner Waldvogel, Landkärtchen, Brombeerzipfelfalter,<br />
Gelbwürfeliger Dickkopffalter, Kleines<br />
Wiesenvögelchen, Milchfleck, Skabiosenscheckenfalter,<br />
Zitronenfalter, Perlbinde, Tagpfauenauge,<br />
Großes Ochsenauge, Baldrianscheckenfalter,<br />
Gemeiner Dickkopffalter, Schwalbenschwanz,<br />
Waldbrettspiel, Schwarzer Apollo, Großer Kohlweißling,<br />
Grünaderweißling, Kleiner Kohlweißling,<br />
C-Falter, Violetter Waldbläuling, Schwarzkolbiger<br />
Dickkopffalter, Braunkolbiger Dickkopffalter,<br />
Admiral, Distelfalter, /<br />
Thymian-Widderchen<br />
Heuschrecken: Pyrenäische Plumpschrecke,<br />
Schwarzfleckiger Grashüpfer, Brauner Grashüpfer,<br />
Verkannter Grashüpfer, Sumpf-Grashüpfer,<br />
Gemeiner Grashüpfer, Gemeine Eichenschrecke,<br />
Bunter Grashüpfer, Gemeine Strauchschrecke,<br />
Zwitscher-Heupferd<br />
Datenquellen: Eigene Kartierungen 2000-2001; Hess. Biotopkartierung; Bohn, U.;<br />
Eckstein, R. in Altmoos, M.; Brehm, J. et al.; Herzig, L.; Dietz, M.
<strong>Landschaftsplan</strong> <strong>Hofbieber</strong> Seite - 64 -<br />
-Bewertung-<br />
4.4.4.2 „Talauen der Bieber mit Goldbach und Traisbach“<br />
TABELLE-NR. 7: „TALAUEN DER BIEBER MIT GOLDBACH UND TRAISBACH“<br />
Bezeichnung: Talauen der Bieber mit Goldbach und Traisbach<br />
Lage: Unterhalb der Ortslage Kleinsassen nach Schackau, Zufluß von der<br />
Fohlenweide, nach Langenbieber, Zufluß vom Goldbach, nach Langenbieber,<br />
Niederbieber und Wiesen bis zur Mündung in die Haune an der westlichen<br />
<strong>Gemeinde</strong>grenze. Zufluß vom Traisbach über Allmus und Traisbach mit<br />
kleineren Grabenläufen.<br />
Gesamtfläche: ca. 513 ha<br />
... davon Kernflächen: ca. 60 ha<br />
Biotoptypen: Bachlauf der Bieber mit zahlreichen Seitenbächen und Grabenzuflüssen, in<br />
weiten Teilen gesäumt durch Ufergaleriewald, Amphibientümpel<br />
(Fohlenweide + nördlich Allmus), Hecken- / Feld- und Einzelgehölze,<br />
Feuchtwiesenreste, Extensivgrünländer, Feuchte Hochstaudenflur (Im Loels),<br />
Kalkschotterhang<br />
ergänzt durch: div. Grünländer, Äcker, div. Laub- / Mischwälder,<br />
Fischteiche, Ortslagen, Kläranlagen, Schwimmbad<br />
Bes. Pflanzenarten: Aquilegia vulgaris, Asarum europaeum, Betula pubescens, Calluna vulgaris,<br />
Carex paniculata, Carex rostrata, Carex vesicaria, Dactylorhiza<br />
maculata, Eleocharis spec., Equisetum fluviatile, Festuca ovina agg.,<br />
Galium palustre, Geranium sylvaticum, Geum rivale, Hieracium pilosella,<br />
Koeleria pyramidata, Ligustrum vulgare, Molinia caerulea, Myosurus<br />
minimus, Onobrychis viciifolia, Phyteuma orbiculare, Phyteuma spicatum,<br />
Primula elatior, Salix eleagnos, Thelypteris limbosperma, Thymus<br />
pulegioides, Trisetum flavescens, Vaccinium myrtillus, Veronica anagallisaquatica,<br />
Viola palustris,<br />
Sphagnum spec.<br />
Bes. Tierarten: Säugetiere:<br />
Vögel: Braunkehlchen (> 3 BV), Eisvogel (NG),<br />
Gartenbaumläufer, Rotmilan (BP), Schwarzstorch<br />
(NG), Wasseramsel (BP), Zwergtaucher (BP)<br />
historisch belegt (Kleinsassen), aktuelle Daten nicht<br />
vorliegend: Bekassine, Brachpieper, Erlenzeisig,<br />
Fichtenkreuzschnabel, Gebirgsstelze, Gelbspötter,<br />
Grauschnäpper, Grünspecht, Heidelerche, Hohltaube,<br />
Kleinspecht, Mauersegler, Mittelspecht, Raubwürger,<br />
Schwanzmeise, Seidenschwanz, Tannenhäher,<br />
Waldschnepfe, Weidenmeise, Wendehals<br />
Amphibien / Reptilien: Bergmolch, Erdkröte, Feuersalamander,<br />
Grasfrosch, Kammolch, Teichmolch<br />
Fische: Bachforelle, Groppe<br />
Insekten: Schmetterlinge (Fohlenweide): Kleiner Fuchs, Brauner<br />
Waldvogel, Landkärtchen, Kaisermantel, Kleines<br />
Wiesenvögelchen, Goldene Acht, Zitronenfalter,<br />
Tagpfauenauge, Kleiner Feuerfalter, Großes<br />
Ochsenauge, Schachbrettfalter, Gemeiner<br />
Dickkopffalter, Schwalbenschwanz, Waldbrettspiel,<br />
Großer Kohlweißling, Kleiner Kohlweißling,<br />
Hauhechelbläuling, Violetter Waldbläuling, Brauner<br />
Eichenzipfelfalter, Schwarzkolbiger Dickkopffalter,<br />
Braunkolbiger Dickkopffalter, Admiral<br />
Datenquellen: Eig. Kartierungen 2000-`01; Hess. Biotopkart.; Eckstein, R. in Altmoos, M.
<strong>Landschaftsplan</strong> <strong>Hofbieber</strong> Seite - 65 -<br />
-Bewertung-<br />
4.4.4.3 „Talauen von Riegel- und Igelbach“<br />
TABELLE-NR. 8: „TALAUEN VON RIEGEL- UND IGELBACH“<br />
Bezeichnung: Talauen von Riegel- und Igelbach<br />
Lage: Am südlichen <strong>Gemeinde</strong>rand von FA Thiergarten in westliche Richtung<br />
Gesamtfläche: ca. 44 ha<br />
... davon Kernflächen: ca. 11 ha<br />
Biotoptypen: Enger Bachtalkomplex mit Feucht- und Extensivgrünländern,<br />
Amphibientümpel und Quellen, Ufer- / Feldgehölze, Erlenbruchwaldrest<br />
ergänzt durch: div. Grünländer, Laubmisch- / Nadelwälder, Fischteiche<br />
Bes. Pflanzenarten: Carex acuta, Chaerophyllum hirsutum, Convallaria majalis, Dactylorhiza<br />
maculata, Geum rivale, Molinia caerulea, Myosotis palustre, Trollius<br />
europaeus<br />
Bes. Tierarten: Säugetiere:<br />
Vögel:<br />
Amphibien / Reptilien: Bergmolch, Erdkröte, Feuersalamander,<br />
Grasfrosch, Teichmolch<br />
Fische: Bachforelle, Groppe<br />
Insekten: Libellen: Gebänderte Prachtlibelle<br />
Datenquellen: Eigene Kartierungen 2000-2001; Hess. Biotopkartierung; Planungsbüro H.<br />
Henning
<strong>Landschaftsplan</strong> <strong>Hofbieber</strong> Seite - 66 -<br />
-Bewertung-<br />
4.4.4.4 „Talaue der Haune“<br />
TABELLE-NR. 9: „TALAUE DER HAUNE“<br />
Bezeichnung: Talaue der Haune<br />
Lage: Südwestlich von Wiesen an der westlichen <strong>Gemeinde</strong>grenze<br />
Gesamtfläche: ca. 17 ha<br />
... davon Kernflächen: ca. 7,5 ha<br />
Biotoptypen: Fließgewässerabschnitt mit Ufergehölzsaum, Feucht- und Extensivgrünländer<br />
Bes. Pflanzenarten: Geum rivale<br />
Bes. Tierarten: Säugetiere:<br />
ergänzt durch div. Grünländer, Entwässerungsgräben<br />
Vögel:<br />
Amphibien / Reptilien:<br />
Insekten: Libellen: Blauflügelige Prachtlibelle<br />
Datenquellen: Eigene Kartierungen 2000-2001, Hess. Biotopkartierung
<strong>Landschaftsplan</strong> <strong>Hofbieber</strong> Seite - 67 -<br />
-Bewertung-<br />
4.4.4.5 „Talaue der Nässe“<br />
TABELLE-NR. 10: „TALAUE DER NÄSSE“<br />
Bezeichnung: Talaue der Nässe mit Waldgebiet Wolfstannen / Schwarzes<br />
Kreuz<br />
Lage: Östlich von Elters, vorbei an Wittges, am Weihershof und an Egelmes bis zur<br />
nördlichen <strong>Gemeinde</strong>grenze<br />
Gesamtfläche: ca. 344 ha<br />
... davon Kernflächen: ca. 31 ha<br />
Biotoptypen: Fließgewässerkomplex der Nässe (Luße) mit Quellgebiet und einigen<br />
Seitenzuflüssen. Überwiegend mit Ufergehölzsaum, Extensivgrünländern<br />
(z.T. mit artenreichen Magersäumen), Feuchtgrünland nördl. Egelmes und<br />
westl. Schwarzes Kreuz, naturnahe Teiche bei Wittges, Erlenbruchwaldreste<br />
westlich Schwarzes Kreuz, Feld- / Einzelgehölze, offener Steinbruch,<br />
Amphibientümpel im Wald<br />
ergänzt durch: Fischteiche, div. Grünländer, Äcker<br />
Bes. Pflanzenarten: Astragallus glycyphyllos, Briza media, Carex montana, Carex pilulifera,<br />
Carex vesicaria, Cirsium acaule, Crepis biennis, Crepis paludosa,<br />
Danthonia decumbens, Festuca ovina agg., Geranium sylvaticum, Geum<br />
rivale, Helianthemum nummularium, Hieracium pilosella, Iris<br />
pseudacorus, Linum catharticum, Lysimachia nemorum, Nardus stricta,<br />
Onobrychis viciifolia, Ononis repens, Orchis mascula, Petasites albus,<br />
Phyteuma orbiculare, Polygala comosa, Salix eleagnos, Succisa pratensis,<br />
Thymus pulegioides, Trisetum flavescens, Vaccinium myrtillus<br />
Bes. Tierarten: Säugetiere:<br />
Vögel: Gebirgsstelze (BV), Neuntöter (BP),<br />
Schwarzstorch (NG)<br />
Amphibien / Reptilien: Kreuzotter<br />
Fische: Bachforelle, Dreistachliger Stichling<br />
Insekten: Schmetterlinge (Wolfstannen): Kleiner Fuchs, Aurorafalter,<br />
Brauner Waldvogel, Landkärtchen, Kaisermantel,<br />
Hainveilchenperlmutterfalter, Veilchenperlmutterfalter,<br />
Brombeerzipfelfalter, Perlgrasfalter,<br />
Kleines Wiesenvögelchen, Goldene Acht,<br />
Blaugrasfalter, Graubrauner Dickkopffalter,<br />
Zitronenfalter, Perlbinde, Tagpfauenauge, Senfweißling,<br />
Großes Ochsenauge, Schachbrettfalter, Gemeiner<br />
Dickkopffalter, Schwalbenschwanz, Waldbrettspiel,<br />
Großer Kohlweißling, Grünaderweißling, Kleiner<br />
Kohlweißling, Hauhechelbläuling, Kleiner Malvendickkopffalter,<br />
Schwarzkolbiger Dickkopffalter,<br />
Distelfalter<br />
Datenquellen: Eigene Kartierungen 2000-2001; Hess. Biotopkartierung; Eckstein, R. in<br />
Altmoos, M.
<strong>Landschaftsplan</strong> <strong>Hofbieber</strong> Seite - 68 -<br />
-Bewertung-<br />
4.4.4.6 „Talauen der Nüst mit Birkenbach, Schwarzbach und Grubenwasser mit<br />
Gickershauk und Schwarzehauk“<br />
TABELLE-NR. 11: „TALAUEN DER NÜST MIR BIRKENBACH, SCHWARZBACH UND GRUBENWASSER MIT<br />
GICKERSHAUK UND SCHWARZEHAUK“<br />
Bezeichnung: Talauen der Nüst mit Birkenbach, Schwarzbach und<br />
Grubenwasser mit Gickershauk und Schwarzehauk<br />
Lage: Verlauf der Nüst entlang der L 3176 durch Mahlerts bis Wallings mit den<br />
Zuflüssen Grubenwasser von Obergruben (inkl. Grünlandkomplex rund um<br />
Obergr.); Grabenläufen von Langenberg und Hausarmen, Dörnbachshof,<br />
Obernüst / Boxberg; Schwarzbach und Birkenbach<br />
Gesamtfläche: ca. 321 ha<br />
... davon Kernflächen: ca. 75 ha<br />
Biotoptypen: Fließgewässerkomplex mit Teilbereichen und Schwerpunkten:<br />
Obergruben/Grubenwasser + Langenberg/Hausarmen: großflächige<br />
Extensivgrünländer, Feuchtwiesenreste, Goldhaferwiese, Basaltmagerrasen<br />
am Kleinen Gruben, kleinflächig Sandmagerrasen, Ufer- / Feld- und<br />
Einzelgehölze<br />
bei Mahlerts und am Oberdörnbachshof: Feuchtwiesenreste, feuchte<br />
Hochstaudenfluren, Ufer- / Feld- und Einzelgehölze<br />
am oberen Schwarzbach: Laubwaldkomplex, Extensivgrünländer, Ufer- /<br />
Feld- und Einzelgehölze<br />
am Birkenbach / Gickershauk: feuchte Hochstaudenfluren, Waldkomplex<br />
am Schwarzehauk: Feuchtgrünland, feuchte Hochstaudenfluren,<br />
Amphibientümpel, Waldkomplex (Bergseggen-Perlgras-Buchenwald,<br />
Traubeneichen-Hainbuchenwald)<br />
ergänzt durch: div. Grünländer, Äcker, sonstige Laubmisch- / Nadelwälder<br />
Bes. Pflanzenarten: Calluna vulgaris, Carex pilulifera, Crepis mollis, Crepis paludosa,<br />
Dactylorhiza maculata, Galium harcynicum, Geum rivale, Hieracium<br />
pilosella, Jasione montana, Juniperus communis, Nardus stricta,<br />
Phyteuma orbiculare, Phyteuma spicatum, Rhinanthus minor, Solidago<br />
virgaurea<br />
Bes. Tierarten: Säugetiere:<br />
Vögel: Gebirgsstelze (BV), Neuntöter (> 3 BP), Rotmilan<br />
(NG)<br />
Amphibien / Reptilien: Bergmolch, Teichmolch, Erdkröte, Grasfrosch<br />
Fische: Bachforelle, Groppe, Bachneunauge<br />
Insekten: Libellen: Gebänderte Prachtlibelle<br />
Schmetterlinge: Brauner Waldvogel, Landkärtchen,<br />
Kaisermantel, Zitronenfalter, Tagpfauenauge,<br />
Waldbrettspiel, Großer Kohlweißling,<br />
Grünaderweißling, Braunkolbiger Dickkopffalter<br />
Datenquellen: Eigene Kartierungen 2000-2001; Hess. Biotopkartierung; Eckstein, R. in<br />
Altmoos, M.
<strong>Landschaftsplan</strong> <strong>Hofbieber</strong> Seite - 69 -<br />
-Bewertung-<br />
4.4.4.7 „Hozzelberg / Nüster-Berg“<br />
TABELLE-NR. 12: „HOZZELBERG / NÜSTER BERG“<br />
Bezeichnung: Hozzelberg / Nüster-Berg<br />
Lage: Nördlich Wallings / Obernüst / Boxberg,<br />
an der nord-östlichen <strong>Gemeinde</strong>grenze südlich des<br />
ehemaligen Grenzstreifens zur DDR<br />
Gesamtfläche: ca. 258 ha<br />
... davon Kernflächen: ca. 141 ha<br />
Biotoptypen: Buchenwaldgesellschaften, Goldhaferwiesen, Extensivgrünländer,<br />
Kalkmagerrasen, ausgeprägte Krautsäume und Wegesränder, Feld- /<br />
Einzelgehölze<br />
ergänzt durch div. Grünländer, Äcker, sonstige Laubmischwälder<br />
Bes. Pflanzenarten: Briza media, Carlina acaulis, Geum rivale, Gymnadenia conopsea,<br />
Lilium martagon, Listera ovata, Melampyrum arvense, Onobrychis<br />
viciifolia, Orchis mascula, Orchis militaris, Phyteuma orbiculare,<br />
Polygala comosa, Pulsatilla vulgaris<br />
Bes. Tierarten: Säugetiere:<br />
Vögel: Neuntöter (BP)<br />
Amphibien / Reptilien:<br />
Insekten:<br />
Datenquellen: Eigene Kartierungen 2000-2001; Hess. Biotopkartierung; Planungsbüro H.<br />
Henning
<strong>Landschaftsplan</strong> <strong>Hofbieber</strong> Seite - 70 -<br />
-Bewertung-<br />
4.4.4.8 „Lothar-Mai-Haus mit Bomberg“<br />
TABELLE-NR. 13: „LOTHAR-MAI-HAUS MIT BOMBERG“<br />
Bezeichnung: Lothar-Mai-Haus mit Bomberg<br />
Lage: Südöstlich und östlich Steens<br />
Gesamtfläche: ca. 49 ha<br />
... davon Kernflächen: ca. 6,5 ha<br />
Biotoptypen: Extensivgrünländer (z.T. als strukturreiche Huteweide), Feuchtgrünland,<br />
Borstgrasrasen (z.T. ruderalisiert), Grabenlauf mit Ufergehölzen, Streuobst,<br />
Hecken- / Einzelgehölze<br />
ergänzt durch div. Grünländer<br />
Bes. Pflanzenarten: Arnica montana, Calluna vulgaris, Carlina acaulis, Cirsium acaule,<br />
Danthonia decumbens, Festuca ovina agg., Galium harcynicum, Geranium<br />
sylvaticum, Hieracium pilosella, Juniperus communis, Lathyrus linifolius,<br />
Nardus stricta, Ranunculus nemorosus, Solidago virgaurea, Thymus<br />
pulegioides, Trisetum flavescens<br />
Bes. Tierarten: Säugetiere:<br />
Vögel: Neuntöter (BV)<br />
Amphibien / Reptilien:<br />
Insekten: Schmetterlinge: Kleiner Fuchs, Brauner Waldvogel,<br />
Landkärtchen, Hundsveilchenperlmutterfalter,<br />
Großer Perlmutterfalter, Kaisermantel, Hainveilchenperlmutterfalter,<br />
Perlgrasfalter, Kleines<br />
Wiesenvögelchen, Hufeisenklee-Heufalter, Goldene<br />
Acht, Zwergbläuling, Zitronenfalter, Tagpfauenauge,<br />
Kleiner Perlmutterfalter, Mauerfuchs, Kleiner<br />
Feuerfalter, Dukatenfalter, Großes Ochsenauge,<br />
Schachbrettfalter, Baldrianscheckenfalter, Gemeiner<br />
Dickkopffalter, Waldbrettspiel, Großer Kohlweißling,<br />
Kleiner Kohlweißling, Hauhechel-Bläuling, Violetter<br />
Waldbläuling, Braunkolbiger Dickkopffalter,<br />
Admiral, Distelfalter<br />
Datenquellen: Eigene Kartierungen 2000-2001; Hess. Biotopkartierung; Eckstein, R. in<br />
Altmoos, M.
<strong>Landschaftsplan</strong> <strong>Hofbieber</strong> Seite - 71 -<br />
-Bewertung-<br />
4.4.4.9 „Kleiner Ziegenkopf, Hohlstein und Schackenberg mit Mambachtal“<br />
TABELLE-NR. 14: „KLEINER ZIEGENKOPF, HOHLSTEIN UND SCHACKENBERG MIT MAMBACHTAL“<br />
Bezeichnung: Kleiner Ziegenkopf, Hohlstein und Schackenberg mit<br />
Mambachtal<br />
Lage: Östlich und südöstlich von Schackau und südlich von Elters<br />
Gesamtfläche: ca. 361 ha<br />
... davon Kernflächen: ca. 172 ha<br />
Biotoptypen: Stark reliefierte Waldbereiche (Buchenwaldgesellschaften, z.B.: Zahnwurz-<br />
B., Platterbsen-B., z.T. Edellaubholz-Blockschuttwald, Traubenkirschen-<br />
Erlen-Eschenwald) und Kuppenlagen mit engem Bachtal, Goldhaferwiesen,<br />
Extensivgrünländern (z.T. mit Quellsümpfen), Ufer-, Hecken- und<br />
Einzelgehölze, Streuobstbestände, ausgeprägte Krautsäume, Kalksteinbruch<br />
ergänzt durch div. Grünländer, Äcker, Fischteiche<br />
Bes. Pflanzenarten: Actaea spicata, Anthyllis vulneraria, Aquilegia vulgaris, Arenaria<br />
serpyllifolia, Arnica montana, Asarum europaeum, Atropa bella-donna,<br />
Briza media, Calamintha acinos, Calamintha clinopodium, Calluna vulgaris,<br />
Campanula glomerata, Campanula persicifolia, Carex disticha, Carex<br />
flacca, Carex montana, Carlina acaulis, Cephalanthera damasonium,<br />
Cirsium acaule, Crepis biennis, Dactylorhiza maculata, Daphne mezereum,<br />
Festuca ovina agg., Galium pumilum, Geranium sylvaticum, Geum rivale,<br />
Gymnadenia conopsea, Helianthemum nummularium, Hieracium pilosella,<br />
Hieracium praealtum, Hieracium sylvaticum, Koeleria pyramidata,<br />
Juniperus communis, Ligustrum vulgare, Lilium martagon, Linum<br />
catharticum, Listera ovata, Melampyrum arvense, Mentha aquatica,<br />
Milium effusum, Onobrychis viciifolia, Ononis repens, Paris quadrifolia,<br />
Phyteuma orbiculare, Phyteuma spicatum, Platanthera bifolia, Polygala<br />
comosa, Prunella grandiflora, Pulsatilla vulgaris, Ranunculus bulbosus,<br />
Rhamnus cathartica, Rhinanthus alectorolophus, Sanicula europaea,<br />
Scabiosa columbaria, Solidago virgaurea, Sorbus aria, Thlaspi perfoliatum,<br />
Thymus pulegioides, Tragopogon pratensis, Trisetum flavescens, Vaccinium<br />
myrtillus<br />
Bes. Tierarten: Säugetiere:<br />
Vögel: Baumpieper (BV), Gartenrotschwanz (NG), Pirol<br />
(NG), Raubwürger (NG), Rotmilan (BV),<br />
Tannenhäher (NG), Trauerschnäpper (NG)<br />
Amphibien / Reptilien:<br />
Insekten: Schmetterlinge: Aurorafalter, Baumweißling<br />
(Historisch belegt: Landkärtchen,<br />
Hainveilchenperlmutterfalter, Veilchenperlmutterfalter,<br />
Braunfleckiger Perlmutterfalter, Faulbaumbläuling,<br />
Perlgrasfalter, Kleines Wiesenvögelchen, Segelfalter,<br />
Senfweißling, Kleiner Ameisenfeuerfalter,<br />
Ehrenpreisscheckenfalter, Gemeiner Scheckenfalter,<br />
Trauermantel, Schwarzer Apollo, Grünaderweißling)<br />
Datenquellen: Eigene Kartierungen 2000-2001; Hess. Biotopkartierung; Bohn, U.;<br />
Eckstein, R. in Altmoos, M.
<strong>Landschaftsplan</strong> <strong>Hofbieber</strong> Seite - 72 -<br />
-Bewertung-<br />
4.4.4.10 „Schröcksküppel und Ulrichshauk“<br />
TABELLE-NR. 15: „SCHRÖCKSKÜPPEL UND ULRICHSHAUK“<br />
Bezeichnung: Schröcksküppel und Ulrichshauk<br />
Lage: Westlich / südwestlich von Schwarzbach<br />
Gesamtfläche: ca. 40 ha<br />
... davon Kernflächen: ca. 11 ha<br />
Biotoptypen: Exponierte Felskuppen mit Basaltmagerrasen, Extensivgrünländern,<br />
Trockenbrachen, Laubwäldern, Feld- / Einzelgehölze<br />
ergänzt durch div. Grünländer, Äcker<br />
Bes. Pflanzenarten: Geum rivale, Orchis mascula<br />
Bes. Tierarten: Säugetiere:<br />
Vögel: Neuntöter (BV)<br />
Amphibien / Reptilien:<br />
Insekten:<br />
Datenquellen: Eigene Kartierungen 2000-2001; Hess. Biotopkartierung
<strong>Landschaftsplan</strong> <strong>Hofbieber</strong> Seite - 73 -<br />
-Bewertung-<br />
4.4.4.11 „Kirschberg und Schweinsberg“<br />
TABELLE-NR. 16: „KIRSCHBERG UND SCHWEINSBERG“<br />
Bezeichnung: Kirschberg und Schweinsberg<br />
Lage: Südlich von Langenberg<br />
Gesamtfläche: ca. 37 ha<br />
... davon Kernflächen: ca. 12 ha<br />
Biotoptypen: Exponierte Felskuppen mit Basaltmagerrasen, Extensivgrünländern (z.T. als<br />
reich strukturierte Huteweiden), Kalksteinbruch, Feld- / Einzelgehölze<br />
ergänzt durch div. Grünländer, Äcker, Wälder<br />
Bes. Pflanzenarten: Aquilegia vulgaris, Calluna vulgaris, Carlina acaulis, Crepis biennis,<br />
Galium harcynicum, Phyteuma orbiculare, Primula elatior, Sorbus aria,<br />
Tragopogon pratensis, Vaccinium myrtillus<br />
Bes. Tierarten: Säugetiere:<br />
Vögel: Neuntöter (BV),<br />
Amphibien / Reptilien:<br />
Insekten:<br />
Datenquellen: Eigene Kartierungen 2000-2001; Hess. Biotopkartierung
<strong>Landschaftsplan</strong> <strong>Hofbieber</strong> Seite - 74 -<br />
-Bewertung-<br />
4.4.4.12 „Hessenliede und Bieberstein“<br />
TABELLE-NR. 17: „HESSENLIEDE UND BIEBERSTEIN“<br />
Bezeichnung: Hessenliede und Bieberstein<br />
Lage: Südöstlich von <strong>Hofbieber</strong><br />
Gesamtfläche: ca. 126 ha<br />
... davon Kernflächen: ca. 86 ha<br />
Biotoptypen: Orchideen-Buchenwald, Platterbsen-Buchenwald, Sommerlinden-<br />
Bergulmen-Blockschuttwald, Perlgras-Buchenwald,<br />
Kalkmagerrasen, Extensivgrünländer, Trockenbrachen und –säume, Heckenund<br />
Einzelgehölze<br />
ergänzt durch sonstige Laubmisch- und Nadelwälder, div. Grünländer, Äcker<br />
Bes. Pflanzenarten: Actaea spicata, Alliaria petiolata, Anthyllis vulneraria, Aquilegia vulgaris,<br />
Asarum europaeum, Astragalus glycyphyllos, Berberis vulgaris, Briza<br />
media, Calluna vulgaris, Carduus nutans, Carex ornithopoda, Carex<br />
sylvatica, Carlina acaulis, Cephalanthera damasonium, Cephalanthera<br />
rubra, Convallaria majalis, Coronilla varia, Cotoneaster integerrimus, Crepis<br />
biennis, Daphne mezereum, Epipactis atrorubens, Festuca ovina agg.,<br />
Gymnadenia conopsea, Helianthemum nummularium, Hieracium<br />
pilosella, Koeleria pyramidata, Lamiastrum galeobdolon, Lathyrus vernus,<br />
Lilium martagon, Melampyrum arvense, Neottia nidus-avis, Onobrychis<br />
viciifolia, Ononis repens, Ophrys insectifolia, Orchis mascula, Primula<br />
veris, Scabiosa columbaria, Sorbus torminalis, Vincetoxicum hirundinaria<br />
Bes. Tierarten: Säugetiere:<br />
Fledermäuse (Bieberstein): historisch belegt: Mopsfledermaus,<br />
Wasserfledermaus<br />
Vögel: Rotmilan, Waldkauz<br />
Amphibien / Reptilien: Erdkröte, Glattnatter<br />
Insekten: Schmetterlinge / Widderchen: Brauner Waldvogel,<br />
Grünaderweißling<br />
(historisch belegt: Thymian-Ameisenbläuling,<br />
Waldbrettspiel, Schwarzer Apollo, Beilfleck-Widderchen)<br />
Datenquellen: Eigene Kartierungen 2000-2001; Hess. Biotopkartierung; Bohn, U.;<br />
Eckstein, R. in Altmoos, M.; Herzig, L.; Planungsbüro H. Henning
<strong>Landschaftsplan</strong> <strong>Hofbieber</strong> Seite - 75 -<br />
-Bewertung-<br />
4.4.4.13 „Hofberg und Schnurberg“<br />
TABELLE-NR. 18: „HOFBERG UND SCHNURBERG“<br />
Bezeichnung: Hofberg und Schnurberg<br />
Lage: Exponierte Hanglagen westlich / südwestlich von <strong>Hofbieber</strong><br />
Gesamtfläche: ca. 110 ha<br />
... davon Kernflächen: ca. 10 ha<br />
Biotoptypen: Kalkmagerrasen, Kalksteinbruch (z.T. in Verfüllung), Extensivgrünländer,<br />
Feld- und Einzelgehölze<br />
ergänzt durch div. Grünland, Äcker, Mischwald, Laubwaldaufforstung und<br />
Golfplatz<br />
Bes. Pflanzenarten: Allium vineale, Berberis vulgaris, Briza media, Carex spec., Carlina acaulis<br />
(> 200 Ex.), Coronilla varia, Gentianella ciliata (> 15 Ex.), Gentianella<br />
germanica (> 100 Ex.), Geum rivale (> 200 Ex.), Gymnadenia<br />
conopsea, Juniperus communis, Listera ovata, Melampyrum arvense<br />
(> 10 Ex.), Onobrychis viciifolia, Ophrys insectifera, Orchis mascula,<br />
Phyteuma orbiculare (> 100 Ex., 1000 ?), Polygala comosa (> 200 Ex.),<br />
Pulsatilla vulgaris, Ranunculus bulbosus, Rhinanthus alectorolophus,<br />
Salvia verticillata, Sedum acre, Thymus pulegioides<br />
Bes. Tierarten: Säugetiere:<br />
Vögel: Perdix perdix (BV), Rotmilan (NG)<br />
Amphibien / Reptilien:<br />
Insekten:<br />
Datenquellen: Eigene Kartierungen 2000-2001; Hess. Biotopkartierung; Eckstein, R. in<br />
Altmoos, M.; Planungsbüro H. Henning
<strong>Landschaftsplan</strong> <strong>Hofbieber</strong> Seite - 76 -<br />
-Bewertung-<br />
4.4.4.14 Rote Liste Arten und gefährdete Arten<br />
TABELLE-NR. 19: „ROTE LISTE PFLANZENARTEN“<br />
Nr. Name, wiss. Name, deutsch<br />
RL BRD,<br />
BArtSchV<br />
RL Hessen<br />
1,<br />
Milseburg<br />
...<br />
2, Talauen<br />
Bieber ...<br />
3, Talauen<br />
Riegel-<br />
/Igelbach<br />
4, Talaue<br />
Haune<br />
5, Talaue<br />
Nässe<br />
6, Talauen<br />
Nüst ...<br />
7,<br />
Hozzelberg /<br />
Nüster-Berg<br />
8, Lothar-<br />
Mai-Hütte<br />
9, Kl.<br />
Ziegenkopf<br />
...<br />
10,<br />
Schröcksküppel<br />
...<br />
11,<br />
Kirschberg /<br />
Schweinsbe<br />
rg<br />
12,<br />
Hessenliede<br />
/ Bieberstein<br />
1 Antennaria dioica Katzenpfötchen 3, § 2 �<br />
2 Aquilegia vulgaris Akelei § 3 � � � �<br />
3 Arnica montana Arnika, Berg- 3, § 2 � � �<br />
4 Asplenium<br />
septentrionale<br />
Wohlverleih<br />
Nordischer<br />
Strichfarn<br />
(V) �<br />
5 Briza media Zittergras V � � � � � �<br />
6 Campanula<br />
glomerata<br />
Büschel-<br />
Glockenblume<br />
3 �<br />
7 Carex ornithopoda Vogelfuß-Segge 3 �<br />
8 Carex paniculata Rispen-Segge V �<br />
9 Carex rostrata Schnabel-Segge 3 �<br />
10 Carex vesicaria Blasen-Segge V � �<br />
11 Carlina acaulis Silberdistel § 3 � � � � � � �<br />
12 Cephalanthera Rotes<br />
rubra<br />
Waldvögelein<br />
13 Cirsium acaule Stengellose<br />
Kratzdistel<br />
14 Crepis mollis Weichhaariger<br />
Pippau<br />
15 Dacthylorhiza Geflecktes<br />
maculata<br />
Knabenkraut<br />
16 Dactylorhiza Breitblättriges<br />
majalis<br />
Knabenkraut<br />
17 Danthonia<br />
decumbens<br />
3 �<br />
V � � � �<br />
3 3 �<br />
3 3 � � � � �<br />
3 3 �<br />
Dreizahn V � �<br />
18 Daphne mezereum Seidelbast § � � �<br />
19 Dianthus<br />
gratianopolitanus<br />
Pfingst-Nelke 3, § R �<br />
20 Epilobium palustre Sumpf-<br />
Weidenröschen<br />
V �<br />
21 Epipactis<br />
Rotbraune<br />
atrorubens Stendelwurz<br />
22 Eriophorum spec. Wollgras, spec. 2 / 3 �<br />
3 � �<br />
13,<br />
Hofberg /<br />
Schnurberg
<strong>Landschaftsplan</strong> <strong>Hofbieber</strong> Seite - 77 -<br />
-Bewertung-<br />
Nr. Name, wiss. Name, deutsch<br />
RL BRD,<br />
BArtSchV<br />
RL Hessen<br />
1,<br />
Milseburg<br />
...<br />
23 Euphrasia<br />
rostkoviana<br />
Wiesen-Augentrost 3 �<br />
24 Festuca ovina agg. Echter<br />
Schafschwingel<br />
2, Talauen<br />
Bieber ...<br />
3, Talauen<br />
Riegel-<br />
/Igelbach<br />
4, Talaue<br />
Haune<br />
5, Talaue<br />
Nässe<br />
6, Talauen<br />
Nüst ...<br />
7,<br />
Hozzelberg /<br />
Nüster-Berg<br />
8, Lothar-<br />
Mai-Hütte<br />
9, Kl.<br />
Ziegenkopf<br />
...<br />
10,<br />
Schröcksküppel<br />
...<br />
11,<br />
Kirschberg /<br />
Schweinsbe<br />
rg<br />
12,<br />
Hessenliede<br />
/ Bieberstein<br />
V � � � � � �<br />
25 Galium pumilum Niedriges Labkraut V �<br />
26 Gentianella ciliata Gefranster Enzian 3 3 �<br />
27 Gentianella<br />
germanica<br />
Deutscher Enzian 3 2 �<br />
28 Geum rivale Bach-Nelkenwurz V � � � � � � � � � �<br />
29 Gymnadenia Mücken-<br />
V � � � �<br />
conopsea<br />
30 Helianthemum<br />
nummularium<br />
31 Hieracium<br />
schmidtii<br />
Händelwurz<br />
Gewöhnliches<br />
Sonnenröschen<br />
Blasses<br />
Habichtskraut<br />
V � � �<br />
R �<br />
32 Iris pseudacorus Gelbe Schwertlilie § �<br />
33 Jasione montana Berg-Sandrapunzel V �<br />
34 Juniperus<br />
Gewöhnlicher<br />
V � � � � �<br />
communis<br />
Wacholder<br />
35 Lilium martagon Türkenbund § V � � � �<br />
36 Linum catharticum Purgier-Lein § V � �<br />
37 Melampyrum Acker-<br />
3 � � � �<br />
arvense<br />
Wachtelweizen<br />
38 Nardus stricta Borstgras V � � � �<br />
39 Ononis repens Kriechende<br />
V � � �<br />
Hauhechel<br />
40 Ophrys insectifera Fliegen-Ragwurz 3 3 � �<br />
41 Orchis mascula Stattliches<br />
V � � � � � �<br />
42 Orchis militaris<br />
Knabenkraut<br />
Helm-Knabenkraut 3 3 �<br />
43 Pedicularis<br />
sylvatica<br />
Wald-Läusekraut 3, § 2 �<br />
44 Phyteuma Kugelorbiculare<br />
Teufelskralle<br />
45 Platanthera bifolia Weiße<br />
Waldhyazinthe<br />
46 Polygala comosa Schopfige<br />
Kreuzblume<br />
3 3 � � � � � � � �<br />
3 3 � �<br />
V � � � � �<br />
13,<br />
Hofberg /<br />
Schnurberg
<strong>Landschaftsplan</strong> <strong>Hofbieber</strong> Seite - 78 -<br />
-Bewertung-<br />
Nr. Name, wiss. Name, deutsch<br />
RL BRD,<br />
BArtSchV<br />
RL Hessen<br />
1,<br />
Milseburg<br />
...<br />
2, Talauen<br />
Bieber ...<br />
3, Talauen<br />
Riegel-<br />
/Igelbach<br />
4, Talaue<br />
Haune<br />
5, Talaue<br />
Nässe<br />
6, Talauen<br />
Nüst ...<br />
7,<br />
Hozzelberg /<br />
Nüster-Berg<br />
8, Lothar-<br />
Mai-Hütte<br />
9, Kl.<br />
Ziegenkopf<br />
...<br />
10,<br />
Schröcksküppel<br />
...<br />
11,<br />
Kirschberg /<br />
Schweinsbe<br />
rg<br />
12,<br />
Hessenliede<br />
/ Bieberstein<br />
47 Primula veris Echte<br />
Schlüsselblume<br />
V �<br />
48 Prunella<br />
grandiflora<br />
Große Brunelle V �<br />
49 Pulsatilla vulgaris Küchenschelle 3, § 3 � � �<br />
50 Ranunculus<br />
nemorosus<br />
51 Rhinanthus<br />
alectorolophus<br />
52 Scabiosa<br />
columbaria<br />
53 Scleranthus<br />
perennis<br />
Wald-Hahnenfuß V �<br />
Zottiger<br />
Klappertopf<br />
V � �<br />
Tauben-Skabiose V � �<br />
Ausdauerndes<br />
Knäuelkraut<br />
V �<br />
54 Sedum fabaria Berg-Fetthenne R �<br />
55 Silene armeria Nelken-Leimkraut R �<br />
56 Succisa pratensis Teufelsabbiß V � �<br />
57 Thymus<br />
hesperites<br />
praecox<br />
Westlicher<br />
Thymian<br />
R �<br />
58 Trollius europaeus Trollblume 3, § 2 � �<br />
59 Viola palustris Sumpf-Veilchen V � �<br />
60 Woodsia ilvensis Südlicher<br />
Wimpernfarn<br />
2, § 2 �<br />
Summen 16, 13 58<br />
13,<br />
Hofberg /<br />
Schnurberg
<strong>Landschaftsplan</strong> <strong>Hofbieber</strong> Seite - 79 -<br />
-Bewertung-<br />
TABELLE-NR. 20: „REGIONAL SELTENE PFLANZENARTEN“<br />
Nr. Name, wiss. Name, deutsch<br />
RL BRD,<br />
BArtSchV<br />
RL Hessen<br />
1,<br />
Milseburg<br />
...<br />
2, Talauen<br />
Bieber ...<br />
3, Talauen<br />
Riegel-<br />
/Igelbach<br />
4, Talaue<br />
Haune<br />
5, Talaue<br />
Nässe<br />
6, Talauen<br />
Nüst ...<br />
7,<br />
Hozzelberg /<br />
Nüster-Berg<br />
8, Lothar-<br />
Mai-Hütte<br />
9, Kl.<br />
Ziegenkopf<br />
...<br />
10,<br />
Schröcksküppel<br />
...<br />
11,<br />
Kirschberg /<br />
Schweinsbe<br />
rg<br />
12,<br />
Hessenliede<br />
/ Bieberstein<br />
Achillea ptarmica Sumpf-Schafgarbe �<br />
Actaea spicata Christophskraut � � �<br />
Alliaria petiolata Lauchhederich �<br />
Allium<br />
schoenoprasum<br />
Schnittlauch �<br />
Allium vineale Weinbergs-Lauch �<br />
Anthyllis<br />
vulneraria<br />
Wundklee � � �<br />
Arabis hirsuta Rauhe Gänsekresse �<br />
Arenaria<br />
serpyllifolia<br />
Quendel-Sandkraut �<br />
Asarum europaeum Haselwurz � � � �<br />
Astragalus Süßer Tragant � � �<br />
glycyphyllos<br />
Atropa bella-donna Tollkirsche �<br />
Berberis vulgaris Berberitze � �<br />
Betula pubescens Moor-Birke �<br />
Calamintha acinos Steinquendel �<br />
Calamintha<br />
clinopodium<br />
Wirbeldost �<br />
Calluna vulgaris Heidekraut � � � � � � �<br />
Campanula latifolia Breitblättrige<br />
�<br />
Campanula<br />
persicifolia<br />
Campanula<br />
trachelium<br />
Glockenblume<br />
Pfirsichblättrige<br />
Glockenblume<br />
Nesselblättrige<br />
Glockenblume<br />
� �<br />
�<br />
Carduus nutans Nickende Distel �<br />
Carex acuta Schlanksegge �<br />
Carex disticha Kamm-Segge �<br />
Carex flacca Blau-Segge �<br />
Carex montana Berg-Segge � �<br />
Carex pilulifera Pillen-Segge � �<br />
Carex remota Winkel-Segge �<br />
13,<br />
Hofberg /<br />
Schnurberg
<strong>Landschaftsplan</strong> <strong>Hofbieber</strong> Seite - 80 -<br />
-Bewertung-<br />
Nr. Name, wiss. Name, deutsch<br />
RL BRD,<br />
BArtSchV<br />
RL Hessen<br />
1,<br />
Milseburg<br />
...<br />
2, Talauen<br />
Bieber ...<br />
3, Talauen<br />
Riegel-<br />
/Igelbach<br />
4, Talaue<br />
Haune<br />
5, Talaue<br />
Nässe<br />
6, Talauen<br />
Nüst ...<br />
7,<br />
Hozzelberg /<br />
Nüster-Berg<br />
8, Lothar-<br />
Mai-Hütte<br />
9, Kl.<br />
Ziegenkopf<br />
...<br />
10,<br />
Schröcksküppel<br />
...<br />
11,<br />
Kirschberg /<br />
Schweinsbe<br />
rg<br />
12,<br />
Hessenliede<br />
/ Bieberstein<br />
Carex sylvatica Wald-Segge � �<br />
Cephalanthera Weißes<br />
� �<br />
damasonium Waldvögelein<br />
Chaerophyllum<br />
hirsutum<br />
Circaea lutetiana Gewöhnliches<br />
Hexenkraut<br />
Berg-Kälberkropf � �<br />
�<br />
Colchicum autumn. Herbst-Zeitlose �<br />
Convallaria majalis Maiglöckchen � � �<br />
Coronilla varia Bunte Kronwicke � �<br />
Cotoneaster Gewöhnliche<br />
� �<br />
integerrimus<br />
Zwergmispel<br />
Crepis biennis Wiesen-Pippau � � � �<br />
Crepis paludosa Sumpf-Pippau � � �<br />
Eleocharis spec. Sumpfbinse �<br />
Equisetum Teich-<br />
�<br />
fluviatile<br />
Eupatorium<br />
cannabinum<br />
Schachtelhalm<br />
Wasserdost �<br />
Festuca altissima Wald-Schwingel �<br />
Galium harcynicum Harzer Labkraut � � � �<br />
Galium palustre Sumpflabkraut �<br />
Galium sylvaticum Wald-Labkraut �<br />
Geranium Wald-<br />
� � � � �<br />
sylvaticum Storchschnabel<br />
Hieracium pilosella<br />
Hieracium<br />
praealtum<br />
Kleines<br />
Habichtskraut<br />
Hieracium Waldsylvaticum<br />
Habichtskraut<br />
Iris pseudacorus Gelbe Schwertlilie �<br />
Koeleria<br />
Pyramidenpyramidata<br />
Lamiastrum<br />
galeobdolon<br />
Kammschmiele<br />
Lathyrus linifolius Berg-Platterbse �<br />
� � � � � � �<br />
� �<br />
� � �<br />
Kleine Goldnessel � �<br />
�<br />
13,<br />
Hofberg /<br />
Schnurberg
<strong>Landschaftsplan</strong> <strong>Hofbieber</strong> Seite - 81 -<br />
-Bewertung-<br />
Nr. Name, wiss. Name, deutsch<br />
Lathyrus vernus Frühlings-<br />
Platterbse<br />
RL BRD,<br />
BArtSchV<br />
RL Hessen<br />
1,<br />
Milseburg<br />
...<br />
2, Talauen<br />
Bieber ...<br />
3, Talauen<br />
Riegel-<br />
/Igelbach<br />
4, Talaue<br />
Haune<br />
5, Talaue<br />
Nässe<br />
6, Talauen<br />
Nüst ...<br />
7,<br />
Hozzelberg /<br />
Nüster-Berg<br />
8, Lothar-<br />
Mai-Hütte<br />
9, Kl.<br />
Ziegenkopf<br />
...<br />
10,<br />
Schröcksküppel<br />
...<br />
11,<br />
Kirschberg /<br />
Schweinsbe<br />
rg<br />
12,<br />
Hessenliede<br />
/ Bieberstein<br />
� �<br />
Ligustrum vulgare Liguster � �<br />
Listera ovata Großes Zweiblatt � � �<br />
Lunaria rediviva Wildes Silberblatt �<br />
Lysimachia Hain-<br />
�<br />
nemorum<br />
Gilbweiderich<br />
Mentha aquatica Wasser-Minze �<br />
Milium effusum Flattergras �<br />
Molinia caerulea Blaues Pfeifengras � �<br />
Myosotis palustre Sumpf-<br />
�<br />
Myosurus minimus<br />
Vergißmeinnicht<br />
Kleines Mäuseschwänzchen<br />
�<br />
Neottia nidus-avis Vogel-Nestwurz �<br />
Onobrychis<br />
viciifolia<br />
Futter-Esparsette E � � � � � �<br />
Paris quadrifolia Einbeere � �<br />
Petasites albus Weiße Pestwurz � �<br />
Phyteuma spicatum Ährige<br />
� � � �<br />
Poa chaixii<br />
Teufelskralle<br />
Wald-Rispengras �<br />
Polypodium<br />
vulgare<br />
Gewöhnlicher<br />
Tüpfelfarn<br />
�<br />
Primula elatior Gr. Schlüsselblume � �<br />
Pulmonaria Echtes<br />
�<br />
officinalis Lungenkraut<br />
Ranunculus Knolliger<br />
bulbosus<br />
Hahnenfuß<br />
Ranunculus<br />
platanifolius<br />
Platanenblättriger<br />
Hahnenfuß<br />
�<br />
Rhamnus cathartica Echter Kreuzdorn �<br />
Rhinanthus minor Kleiner<br />
Klappertopf<br />
�<br />
13,<br />
Hofberg /<br />
Schnurberg<br />
� �<br />
Ribes alpinum Berg-Johannisbeere �<br />
Salix eleagnos Lavendel-Weide � �<br />
Salvia verticillata Quirlblütiger Salbei E �
<strong>Landschaftsplan</strong> <strong>Hofbieber</strong> Seite - 82 -<br />
-Bewertung-<br />
Nr. Name, wiss. Name, deutsch<br />
RL BRD,<br />
BArtSchV<br />
RL Hessen<br />
1,<br />
Milseburg<br />
...<br />
2, Talauen<br />
Bieber ...<br />
3, Talauen<br />
Riegel-<br />
/Igelbach<br />
4, Talaue<br />
Haune<br />
5, Talaue<br />
Nässe<br />
6, Talauen<br />
Nüst ...<br />
7,<br />
Hozzelberg /<br />
Nüster-Berg<br />
8, Lothar-<br />
Mai-Hütte<br />
9, Kl.<br />
Ziegenkopf<br />
...<br />
10,<br />
Schröcksküppel<br />
...<br />
11,<br />
Kirschberg /<br />
Schweinsbe<br />
rg<br />
12,<br />
Hessenliede<br />
/ Bieberstein<br />
Sanicula europaea Sanikel �<br />
Sedum acre Scharfe Mauerpfeffer �<br />
Solidago virgaurea Gewöhnliche<br />
� � � �<br />
Goldrute<br />
Sorbus aria Echte Mehlbeere � � �<br />
Sorbus torminalis Elsbeere � �<br />
Thelypteris<br />
limbosperma<br />
Berg-Lappenfarn �<br />
Thelypteris<br />
phegopteris<br />
Buchenfarn �<br />
Thlaspi perfoliatum<br />
Thymus<br />
pulegioides<br />
Tragopogon<br />
pratensis<br />
Trisetum<br />
flavescens<br />
Vaccinium<br />
myrtillus<br />
Stengelumfassende<br />
s Hellerkraut<br />
Veronica anagallisaquatica<br />
Vincetoxicum<br />
hirundinaria<br />
Wasserehrenpreis �<br />
Feld-Thymian � � � � � �<br />
Wiesenbocksbart � �<br />
Goldhafer � � � � �<br />
Heidelbeere � � � � �<br />
Schwalbenwurz � �<br />
�<br />
13,<br />
Hofberg /<br />
Schnurberg
<strong>Landschaftsplan</strong> <strong>Hofbieber</strong> Seite - 83 -<br />
-Bewertung-<br />
4.4.5 Belastungen, Beeinträchtigungen und Konflikte<br />
An Belastungen und Beeinträchtigungen sind hier vor allem zu nennen:<br />
In den Bachauen<br />
An allen Fließgewässern, besonders im westlichen Bereich an Bieber und Traisbach<br />
sowie deren Zuflüssen aber auch an verschiedenen Abschnitten und Zuflüssen von<br />
Nässe und Nüst wurden festgestellt:<br />
• Intensive Ackernutzungen,<br />
• Fehlende Ufergehölze,<br />
• Fehlende Uferrandstreifen,<br />
• Standortfremde Gehölze,<br />
• Verrohrungen,<br />
• Begradigte und ausgebaute Wasserläufe,<br />
• schlechte Gewässerqualitäten,<br />
• sonstige Intensivnutzungen,<br />
• Trennwirkungen durch Verkehrsstrassen.<br />
Weiterhin bestehen im <strong>Gemeinde</strong>gebiet <strong>Hofbieber</strong> Konfliktsituationen durch:<br />
• Flächen für potentiellen Lagerstättenabbau (Kugelberg, Schnurberg, Gangolfshof),<br />
• Trennwirkungen durch Verkehrsstrassen (in Waldbereichen: Bieberstein, Thiergarten,<br />
Fohlenweide, Hohlstein),<br />
• Wanderwege in sensiblen Biotopbereichen (Stellberg, Milseburg, Mambachtal,<br />
Hessenliede, Nüster-Berg / Hozzelberg),<br />
• Intensive Mahd- bzw. Weidenutzungen auf Einzelflächen mit potentiell wertvollen<br />
Beständen (Obergruben, Schackau, Goldbachshof, Danzwiesen) bzw. (Oberdörnbachshof,<br />
Schwarzbach, Rödergrund, Elters, Niederbieber, Milseburg),<br />
• Geplante bauliche Anlagen in zusammenhängenden Biotopkomplexen,<br />
• Eine Fichtenaufforstung auf einem Borstgrasrasen bei Kleinsassen sowie<br />
verschiedene geplante Waldmehrungen auf artenreichen Standorten.
<strong>Landschaftsplan</strong> <strong>Hofbieber</strong> Seite - 84 -<br />
-Bewertung-<br />
4.5 Schutzgut Naturerlebnis und Erholung<br />
Vielfalt, Eigenart und Schönheit des Landschaftsbildes sind eine wesentliche Grundlage<br />
für den Erholungswert der Landschaft und somit eine wichtige Voraussetzung für die<br />
landschaftsbezogene Erholung. Das Landschaftsbild hat daher auch wesentlichen<br />
Einfluß auf die physische und psychische Gesundheit des Menschen. Bei dem<br />
Schutzgut Landschaftsbild und Erholung geht es vornehmlich um die Wirkung der<br />
landschaftsprägenden Elemente auf den Menschen sowie um das Erlebnispotential.<br />
Dieses Schutzgut ist weniger ein Wert an sich, sondern vielmehr in seiner Wertigkeit<br />
durch menschliche Wahrnehmung definiert. Neben den optischen Eindrücken sind es<br />
auch die übrigen Sinneswahrnehmungen, die das Landschaftserleben ausmachen. Art<br />
und Intensität dieses Erlebens hängen wiederum von der Situation, der<br />
Erwartungshaltung und der jeweiligen Tätigkeit der betreffenden Menschen ab.<br />
Während das Landschaftsbild anhand ästhetischer Wertmaßstäbe noch objektiv<br />
bewertet werden kann, sind für das Landschaftserleben eher individuelle, subjektive<br />
Maßstäbe ausschlaggebend.<br />
4.5.1 Gesetzliche und planerische Vorgaben<br />
Gemäß Bundesnaturschutzgesetz ist die Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und<br />
Landschaft als Lebensgrundlage des Menschen und künftiger Generationen und als<br />
Voraussetzung für seine Erholung in Natur und Landschaft nachhaltig zu sichern.<br />
"Unbebaute Bereiche sind wegen ihrer Bedeutung für den Naturhaushalt und für die<br />
Erholung insgesamt und auch im einzelnen in der dafür erforderlichen Größe und<br />
Beschaffenheit zu erhalten" (§ 2 ( 1 ) Nr. 11 BNatSchG). "Die Landschaft ist in ihrer<br />
Vielfalt, Eigenart und Schönheit auch wegen ihrer Bedeutung als Erlebnis- und<br />
Erholungsraum des Menschen zu sichern. Ihre charakteristischen Strukturen und<br />
Elemente sind zu erhalten. Vor allem im siedlungsnahen Bereich sind ausreichend<br />
Flächen für die Erholung bereitzustellen" (§ 2 ( 1 ) Nr. 12 BNatSchG).<br />
Nach Hess. Naturschutzgesetz § 1 a (1) Nr.1 sind "die Kulturlandschaften des Landes<br />
[...] in ihrer Vielgestaltigkeit zu erhalten und ihren naturräumlichen Eigenarten<br />
entsprechend zu entwickeln und zu gestalten". Bauvorhaben sollen so geplant und<br />
gestaltet werden, dass die Gestalt und Nutzung der Landschaft möglichst wenig<br />
beeinträchtigt wird. Im <strong>Landschaftsplan</strong> sind die Erfordernisse und Massnahmen "zur<br />
Erhaltung und Entwicklung von Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und<br />
Landschaft auch als Erlebnis- und Erholungsraum des Menschen" darzustellen (§ 4 (2)<br />
Nr. 3 f HENatG).<br />
Im Baugesetzbuch (§ 1 (1) Nr. 3 und 4) wird dargelegt, dass bei Aufstellung von<br />
Bauleitplänen die sozialen und kulturellen Bedürfnisse der Bevölkerung [...] die<br />
Belange von Sport, Freizeit und Erholung, sowie die Erhaltung, Erneuerung und<br />
Fortentwicklung vorhandener Stadtteile sowie die Gestaltung des Orts- und<br />
Landschaftsbildes zu berücksichtigen sind.<br />
Im Regionalplan Nordhessen 2000 sind für das <strong>Gemeinde</strong>gebiet <strong>Hofbieber</strong><br />
Waldzuwachsflächen im gesamten <strong>Gemeinde</strong>gebiet sowie Bereiche für
<strong>Landschaftsplan</strong> <strong>Hofbieber</strong> Seite - 85 -<br />
-Bewertung-<br />
Landschaftsnutzung und -pflege, vor allem in den Randbereichen der Ortslagen<br />
dargestellt.<br />
Der Landschaftsrahmenplan Nordhessen bewertet die Raumtypen im westlichen Teil<br />
des <strong>Gemeinde</strong>gebietes vorwiegend mit mittlerer Vielfalt. Eine hohe bis in Teilbereichen<br />
auch sehr hohe Vielfalt weisen die Raumtypen im östlichen Teil des <strong>Gemeinde</strong>gebietes<br />
auf.<br />
In der Flächenschutzkarte Hessen (02/2002) sind Waldflächen im südlichen<br />
<strong>Gemeinde</strong>gebiet als Wälder mit Erholungsfunktion ausgewiesen.<br />
4.5.2 Bestandsbewertung<br />
ABB.-NR.: 41. „Überblick: Bewertung Landschaftsbild und Erholung”
<strong>Landschaftsplan</strong> <strong>Hofbieber</strong> Seite - 86 -<br />
-Bewertung-<br />
Zur Bewertung der Bedeutung und Eignung des <strong>Gemeinde</strong>gebietes <strong>Hofbieber</strong> für<br />
Naturerlebnis und Erholung wird das gesamte <strong>Gemeinde</strong>gebiet in räumlich abgrenzbare<br />
Raumtypen, den Landschaftsbildeinheiten differenziert. Die verschiedenen Landschaftsbildeinheiten<br />
werden dann hinsichtlich ihrer Eignung für die landschaftsbezogene<br />
Erholung und das Naturerlebnis beurteilt. Ergänzend werden die landschaftstypischen<br />
und landschaftsbedeutsamen Strukturen und Elemente innerhalb des <strong>Gemeinde</strong>gebietes<br />
beschrieben. Die Darstellung der verschiedenen Einrichtungen zur Erschließung der<br />
Erholungslandschaft als Gradmesser für die Nutzbarkeit der Landschaft zur Erholung<br />
rundet die Bewertung der Bedeutung und Eignung des <strong>Gemeinde</strong>gebietes <strong>Hofbieber</strong> für<br />
Naturerlebnis und Erholung ab. Abschließend zeigt die Darstellung der auf die<br />
Erholungsnutzung wirkenden Beeinträchtigungen und Belastungen aktuelle und zu<br />
erwartende Konfliktsituationen auf (VGL. MARKS ET AL., 1989; KIEMSTEDT, SCHARPF,<br />
1989; GAREIS-GRAHMANN, 1993; GRUEHN, 1992).<br />
Allgemeine Ausgangssituation<br />
Der Ortsteil Langenbieber ist als Erholungsort, der Ortsteil <strong>Hofbieber</strong> als Luftkurort<br />
prädikatisiert.<br />
Landschaftsbildeinheiten<br />
Legt man Kriterien wie Naturräumliche Ausstattung, Nutzung und Struktur der<br />
Landschaft, Ausbildung von Relief und Topographie, Einflüsse visueller Belastungen<br />
und Beeinträchtigungen sowie Auswirkungen baulicher Anlagen und Einrichtungen zu<br />
Grunde, lassen sich innerhalb des <strong>Gemeinde</strong>gebietes <strong>Hofbieber</strong> räumlich klar<br />
voneinander abzugrenzende Teileinheiten beschreiben. Die Differenzierung der<br />
Landschaft in abgrenzbare Landschaftsbildeinheiten ist Grundlage für die nachfolgende<br />
Ermittlung und Bewertung von Eigenart, Vielfalt und Naturnähe.<br />
Für den Landschaftsraum <strong>Hofbieber</strong> lassen sich folgende Landschaftsbildeinheiten<br />
abgrenzen:<br />
(1) Vorwiegend landwirtschaftlich genutzter Teilraum ohne bzw. nur mit gering<br />
ausgebildeten gliedernden Strukturen nördlich bzw. nordwestlich der Ortslage<br />
<strong>Hofbieber</strong>,<br />
(2) Vorwiegend landwirtschaftlich geprägter Teilraum mit stärkerer Strukturierung und<br />
ausgebildeter Topographie südlich bzw. südwestlich der Ortslage <strong>Hofbieber</strong>,<br />
(3) Durch Wald geprägter Teilraum mit stärker ausgebildeter Topographie um die<br />
Ortslagen Schackau, Elters und Kleinsassen,<br />
(4) Landwirtschaftlich geprägter Teilraum mit hohem Grünlandanteil und stark<br />
ausgebildeter Topographie im Nordosten des <strong>Gemeinde</strong>gebietes,<br />
(5) Kleinstrukturiertes Nutzungsmosaik mit hohem Waldanteil und stark ausgeprägter<br />
Topographie südöstlich der Ortslage Kleinsassen.
<strong>Landschaftsplan</strong> <strong>Hofbieber</strong> Seite - 87 -<br />
-Bewertung-<br />
Bedeutung und Eignung für die landschaftsbezogene Erholung<br />
Die von einer Landschaft ausgehenden Eindrücke sprechen prinzipiell alle Sinnesorgane<br />
des Menschen an, wobei jedoch der überwiegende Teil der Sinneswahrnehmung über<br />
das Auge erfolgt. Dabei stellen die Faktoren Vielfalt, Eigenart und Naturnähe die<br />
wesentlichen Bestimmungsgrößen des landschaftsästhetischen Erlebnisses im Rahmen<br />
naturbezogener Erholungsformen dar.<br />
Als Naturnähe wird dabei die Urwüchsigkeit und Ungestörtheit einer Landschaft<br />
bezeichnet, wobei entscheidend ist, ob sich die Vegetation für den Beobachter scheinbar<br />
von selbst und ohne lenkende Eingriffe des Menschen entwickeln konnte. Die Naturnähe<br />
gibt somit den Naturcharakter einer Landschaft wieder. Dieser wird dadurch<br />
bestimmt, ob und wieweit er scheinbar dem Betrachter Naturelemente und spontane<br />
Naturprozesse signalisiert.<br />
Mit dem Begriff "Vielfalt" wird die Vielzahl von Strukturen, Formen und Farben,<br />
natürlichen und kulturellen Erscheinungen, Einzelelementen und räumlichen<br />
Konfigurationen eines Landschaftsraumes erfasst und beschrieben. Die Vielfalt ergibt<br />
sich so vor allem durch den kleinräumigen Wechsel gliedernder Elemente und<br />
unterschiedlicher Nutzungsstrukturen.<br />
Die "Eigenart" einer Landschaft wird geprägt durch die natürlichen Standortfaktoren<br />
und jeweils spezifische historische, sozioökonomische und kulturelle Konstellationen.<br />
Der Begriff Eigenart beschreibt somit die Unverwechselbarkeit, das Typische einer<br />
Landschaft.<br />
Die Bedeutung und Eignung für die landschaftsbezogene Erholung läßt sich für die<br />
einzelnen Teilräume des <strong>Gemeinde</strong>gebietes <strong>Hofbieber</strong> wie folgt darstellen:<br />
TABELLE-NR. 21: „LANDSCHAFTSRÄUME UND EIGNUNG FÜR DIE LANDSCHAFTSBEZOGENE ERHOLUNG“<br />
Landschaftsraum Vielfalt Eigenart Naturnähe Eignung f. die<br />
landschaftsbezogene<br />
Erholung<br />
1 Vorwiegend landwirtschaftlich<br />
genutzter Teilraum ohne bzw.<br />
nur mit gering ausgebil-deten<br />
gliedernden Strukturen nördlich<br />
bzw. nordwestlich der Ortslage<br />
<strong>Hofbieber</strong><br />
2 Vorwiegend landwirtschaftlich<br />
geprägter Teilraum mit stärkerer<br />
Strukturierung und ausgebildeter<br />
Topographie südlich bzw.<br />
südwestlich der Ortslage<br />
<strong>Hofbieber</strong><br />
3 Durch Wald geprägter<br />
Teilraum mit stärker ausgebildeter<br />
Topographie um die<br />
Ortslagen Schackau, Elters und<br />
Kleinsassen<br />
gering mittel mittel gering - mittel<br />
hoch mittel mittel mittel - hoch<br />
hoch hoch mittel hoch
<strong>Landschaftsplan</strong> <strong>Hofbieber</strong> Seite - 88 -<br />
-Bewertung-<br />
Landschaftsraum Vielfalt Eigenart Naturnähe Eignung f. die<br />
landschaftsbezogene<br />
Erholung<br />
4 Landwirtschaftlich geprägter<br />
Teilraum mit hohem Grünlandanteil<br />
und stark ausgebildeter<br />
Topographie im Nordosten des<br />
<strong>Gemeinde</strong>gebietes<br />
5 Kleinstrukturiertes Nutzungsmosaik<br />
mit hohem Waldanteil<br />
und stark ausgeprägter<br />
Topographie südöstlich der<br />
Ortslage Kleinsassen<br />
hoch mittel mittel mittel - hoch<br />
sehr hoch sehr hoch hoch hoch - sehr<br />
hoch<br />
Landschaftstypische und landschaftsbedeutsame Strukturen<br />
Innerhalb des <strong>Gemeinde</strong>gebietes <strong>Hofbieber</strong> lassen sich Strukturen und Elemente<br />
beschreiben, die aufgrund ihrer Ausprägung, ihrer Erscheinung und / oder Dimension<br />
als "typisch" für den hier betrachteten Landschaftsraum zu bezeichnen sind. Die<br />
verschiedenen Elemente und Strukturen sind für ein unverwechselbares Landschaftsbild<br />
von hoher Bedeutung und prägen damit den Charakter des hier betrachteten<br />
<strong>Gemeinde</strong>gebietes.<br />
Im <strong>Landschaftsplan</strong> sind im einzelnen folgende landschaftsbedeutsamen und<br />
- prägenden Strukturen und Elemente dargestellt:<br />
• Ausgedehnte, zusammenhängende Waldflächen,<br />
z.T. mit einer besonderen Widmung und Kennzeichnung<br />
als Erholungswald südöstlich der Ortslagen<br />
<strong>Hofbieber</strong> und Langenbieber, im Bereich der<br />
Milseburg sowie nördlich der Ortslage Obernüst.<br />
• Bachtäler und Auenbereiche, hier vor allem der<br />
Bieber, Nässe und Nüst.<br />
• Gehölzstrukturen in den unterschiedlichsten<br />
Erscheinungsformen (Hecken, Einzelbäume,<br />
Baumreihen, ...), vor allem im östlichen Teil des<br />
<strong>Gemeinde</strong>gebietes.<br />
• Kuppen und Erhebungen innerhalb des gesamten<br />
<strong>Gemeinde</strong>gebietes als Ausdruck der besonderen<br />
topographischen Situation des hier betrachteten<br />
Landschaftsraumes.<br />
• Geologische Sonderstandorte wie Felsen, Blockschutthalden<br />
im Bereich und im unmittelbaren<br />
Umfeld der Milseburg.<br />
ABB.-NR.: 42. „Viehweide vor der<br />
Milseburg”<br />
• Naturdenkmale, Bodendenkmale und Kulturdenkmale punktuell im gesamten <strong>Gemeinde</strong>gebiet,<br />
verstärkt jedoch südöstlich der Ortslage <strong>Hofbieber</strong>, zwischen <strong>Hofbieber</strong>, Elters und<br />
Schackau sowie im südöstlichen Bereich des <strong>Gemeinde</strong>gebietes, südöstlich der Ortslage<br />
Kleinsassen im Bereich und Umfeld der Milseburg.
<strong>Landschaftsplan</strong> <strong>Hofbieber</strong> Seite - 89 -<br />
-Bewertung-<br />
Als landschaftsprägende bauliche Anlagen innerhalb des <strong>Gemeinde</strong>gebietes <strong>Hofbieber</strong><br />
sind zu nennen:<br />
• Kirche in der Ortslage <strong>Hofbieber</strong><br />
• Schloss Bieberstein<br />
• Anlagen der Fohlenweide<br />
Erschließung der Erholungslandschaft<br />
Um Natur und Landschaft erleben zu können, müssen sie zugänglich, d.h. betretbar und<br />
erschlossen sein. Darüber hinaus ist es erforderlich, dass sie erreichbar ist.<br />
Die Erschliessung der Erholungslandschaft, dargestellt in Form der verschiedensten<br />
Erschließungseinrichtungen und -anlagen, sowie Angebote für eine landschaftsgebundene<br />
Freizeit- und Erholungsnutzung, stellt den Gradmesser für die Nutzbarkeit<br />
einer Landschaft als Erholungsraum dar, trifft damit auch Aussagen über die<br />
nutzerorientierte Attraktivität einer Landschaft.<br />
Im <strong>Landschaftsplan</strong> sind im einzelnen folgende Erschließungseinrichtungen und<br />
-anlagen dargestellt:<br />
• Wanderwege<br />
• Wanderparkplätze<br />
• Schutzhütten,<br />
• Grillplätze<br />
• Sportplätze<br />
• Golfplatz <strong>Hofbieber</strong><br />
• Spielplätze<br />
• Zeltplätze<br />
• Schwimmbad Langenbieber<br />
• Naturlehrpfad<br />
• Trimm - dich - Pfad
<strong>Landschaftsplan</strong> <strong>Hofbieber</strong> Seite - 90 -<br />
-Bewertung-<br />
Belastungen, Beeinträchtigungen und Konflikte<br />
Als Belastungen und Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes und der<br />
landschaftsbezogenen Erholungsnutzung wirken sich vor allem aus:<br />
• Verkehr, insbesondere im Bereich der klassifizierten Straßen, hier vor allem durch den<br />
Hochrhönring der L 3330 im Umfeld Kleinsassens und der Milseburg sowie die stark<br />
frequentierte L 3174 Niederbieber – <strong>Hofbieber</strong> – Schwarzbach.<br />
• Freileitungen westlich der Ortslagen Wiesen, Traisbach und Allmus<br />
• Landwirtschaftliche Intensivnutzungen in den Auenbereichen und Bachtälern der Bieber<br />
und des Traisbaches mit seinen verschiedenen Zuflüssen<br />
• Potentieller Lagerstättenabbau südwestlich der Ortslage <strong>Hofbieber</strong><br />
• Erddeponien südwestlich Wiesen und nordwestlich <strong>Hofbieber</strong> sowie im Bereich des<br />
Schnurberges<br />
• Nutzungsein- und beschränkungen, wie z.B. Betretungsverbote, Einzäunungen im Bereich<br />
der Naturschutzgebiete Stellberg, Milseburg und Bieberstein.<br />
• Standortfremde Gehölze punktuell innerhalb des gesamten <strong>Gemeinde</strong>gebietes, großflächig<br />
im Bereich des Golfplatzes <strong>Hofbieber</strong>.<br />
• mangelhafte u./o. fehlende Eingrünungen ...<br />
... am westl. und östl. Ortsrand Schwarzbach,<br />
... am nordwestl. Ortsrand Langenberg,<br />
... am östl. Ortsrand Rödergrund,<br />
... am südl und südöstl. Ortsrand Traisbach,<br />
... am nördlichen Ortsrand Wiesen,<br />
... am nördlichen Ortsrand Mittelberg,<br />
... am nördl. und östl. Ortsrand Niederbieber,<br />
... am nördl. Ortsrand Langenbieber,<br />
... am nördl., südl. und südwestl. Ortsrand <strong>Hofbieber</strong>,<br />
... am südwestl. Ortsrand Elters.
<strong>Landschaftsplan</strong> <strong>Hofbieber</strong> Seite - 91 -<br />
-Leitbilder und Entwicklungsziele-<br />
5 Leitbilder und Entwicklungsziele<br />
Entsprechend dem gesetzlichen Auftrag durch das Hessische Naturschutzgesetz legen<br />
die Landschaftspläne für die verschiedenen Naturräume des Planungsgebietes Leitbilder<br />
und alle Massnahmen fest, die notwendig sind, um das jeweilige Leitbild zu<br />
verwirklichen.<br />
In den zu erarbeitenden Leitbildern sind die Ziele des Naturschutzes und der<br />
Landschaftspflege quantitativ und qualitativ für den Planungsraum darzustellen.<br />
Leitbilder sind dabei nicht-flächenscharfe, allgemeine und bildhafte Zielvorgaben. Sie<br />
geben umwelt- und naturschutzpolitisch bzw. naturschutzfachlich übergeordnete und<br />
allgemein formulierte Absichten und Vorstellungen eines zukünftigen Zustandes von<br />
Natur und Landschaft wieder.<br />
Der Zeitraum von Leitbildern beläuft sich auf ca. 25 bis 50 Jahre. Sie entsprechen damit<br />
einer eher möglichen, gewünschten Entwicklung in Form von Zukunftsvisionen als der<br />
gegenwärtigen Realität.<br />
ABB.-NR.: 43. „Überblick: Leitbilder und Entwicklungsziele”
<strong>Landschaftsplan</strong> <strong>Hofbieber</strong> Seite - 92 -<br />
-Leitbilder und Entwicklungsziele-<br />
Im einzelnen lassen sich für das <strong>Gemeinde</strong>gebiet <strong>Hofbieber</strong> folgende Leitbilder und<br />
Entwicklungsziele formulieren:<br />
TABELLE-NR. 22: „LEITBILDER UND ENTWICKLUNGSZIELE“<br />
Für den Landschaftsraum ... das Leitbild und Entwicklungsziel ...<br />
� Offene Landschaft<br />
Die charakteristische Kulturlandschaft <strong>Hofbieber</strong>s soll<br />
erhalten und unter Berücksichtigung der Funktionen der<br />
Schutzgüter Boden, Wasser, Klima, Arten und Biotope,<br />
Landschaftsbild und Erholungswert entwickelt werden.<br />
Die natürlichen Ressourcen sollen schonend genutzt<br />
werden.<br />
�� Landschaftsraum <strong>Hofbieber</strong> - ackerbauliche Nutzung dominierend,<br />
- Biotopstrukturen, Vernetzungselemente und<br />
landschaftsgliedernde Elemente entlang von Wegen,<br />
Gräben und Grundstücksgrenzen,<br />
- Sonderstandorte innerhalb der Ackerflächen,<br />
insbesondere Grünlandstrukturen, Säume,<br />
Sukzessionsflächen und flächige Gehölzbestände<br />
�� Landschaftsraum Elters - ausgewogenes Verhältnis zwischen ackerbaulicher<br />
Nutzung und Grünlandnutzung,<br />
- Biotopstrukturen, Vernetzungselemente und<br />
landschaftsgliedernde Elemente entlang von Wegen,<br />
Gräben und Grundstücksgrenzen,<br />
- extensiv genutzte Grünlandbereiche, vor allem auf<br />
Extremstandorten,<br />
- Sonderstandorte wie Felsstandorte, Rohböden,<br />
Sukzessionsflächen und flächige Gehölzbestände<br />
�� Landschaftsraum Schwarzbach - ausgewogenes Verhältnis zwischen ackerbaulicher<br />
Nutzung und Grünlandnutzung,<br />
- Biotopstrukturen, Vernetzungsstrukturen und<br />
landschaftsgliedernde Elemente entlang von Wegen,<br />
Gräben und Grundstücksgrenzen,<br />
- extensiv genutzte Grünlandbereiche, vor allem auf<br />
Extremstandorten,<br />
- Sonderstandorte wie Felsstandorte, Rohböden,<br />
Sukzessionsflächen und flächige Gehölzbestände<br />
�� Landschaftsraum Obernüst - Grünlandnutzung mit einem Anteil extensiver<br />
Grünlandnutzung dominierend,<br />
- Biotop- und Vernetzungsstrukturen entlang von
<strong>Landschaftsplan</strong> <strong>Hofbieber</strong> Seite - 93 -<br />
-Leitbilder und Entwicklungsziele-<br />
Für den Landschaftsraum ... das Leitbild und Entwicklungsziel ...<br />
Wegen, Gräben und Grundstücksgrenzen,<br />
- ausreichend dimensionierte Pufferzonen gegenüber<br />
Beeinträchtigungen,<br />
- Sonderstandorte, vor allem Magerrasen<br />
�� Landschaftsraum Kleinsassen - Grünlandnutzung mit einem Anteil extensiver<br />
Grünlandnutzung dominierend,<br />
� Fließgewässer und ihre<br />
Auenbereiche<br />
- Biotop- und Vernetzungsstrukturen entlang von<br />
Wegen, Gräben und Grundstücksgrenzen,<br />
- ausreichend dimensionierte Pufferzonen gegenüber<br />
Beeinträchtigungen,<br />
- Sonderstandorte, vor allem Magerrasen<br />
Fließgewässer sollen als wichtiges Vernetzungselement<br />
der Landschaft naturnah erhalten und entwickelt werden.<br />
Die Bedeutung der Bachauen als Lebensraum für<br />
Pflanzen und Tiere sowie die Funktionen im<br />
Naturhaushalt sollen erhalten und verbessert werden.<br />
�� Fließgewässer Bieber - Vielfalt und Strukturreichtum des Gewässers u.<br />
der Auenbereiche,<br />
- sehr gute bis gute Gewässerqualität und - güte,<br />
- natürliche Gewässerdynamik, gewässertypische<br />
Eigendynamik,<br />
- naturnaher Zustand von Ufer - und Auenbereich,<br />
- ausreichend dimensionierte Uferrandstreifen und<br />
Retentionsräume,<br />
- offene biologische Durchgängigkeit,<br />
- extensive Grünlandnutzung in den Auenbereichen,<br />
- gewässerbegleitende Gehölzstrukturen,<br />
- Sonderstandorte ( Feucht- und Nassbereiche, Auwälder<br />
... ), Bereiche ohne Nutzung<br />
�� Fließgewässer Nässe - Vielfalt und Strukturreichtum des Gewässers u.<br />
Auenbereiche,<br />
- sehr gute bis gute Gewässerqualität und -güte,<br />
- natürliche Gewässerdynamik, gewässertypische<br />
Eigendynamik,<br />
- naturnaher Zustand von Ufer - und Auenbereich,<br />
- ausreichend dimensionierte Uferrandstreifen und
<strong>Landschaftsplan</strong> <strong>Hofbieber</strong> Seite - 94 -<br />
-Leitbilder und Entwicklungsziele-<br />
Für den Landschaftsraum ... das Leitbild und Entwicklungsziel ...<br />
Retentionsräume,<br />
- offene biologische Durchgängigkeit,<br />
- extensive Grünlandnutzung in den Auenbereichen<br />
- gewässerbegleitende Gehölzstrukturen,<br />
- Sonderstandorte ( Feucht- und Nassbereiche, Auwälder<br />
... ), Bereiche ohne Nutzung<br />
�� Fließgewässer Nüst - Vielfalt und Strukturreichtum des Gewässers u.<br />
� Siedlungen<br />
Auenbereiche,<br />
- sehr gute bis gute Gewässerqualität und - güte,<br />
- natürliche Gewässerdynamik, gewässertypische<br />
Eigendynamik,<br />
- naturnaher Zustand von Ufer - und Auenbereich,<br />
- ausreichend dimensionierte Uferrandstreifen und<br />
Retentionsräume,<br />
- offene biologische Durchgängigkeit,<br />
- extensive Grünlandnutzung in den Auenbereichen<br />
- gewässerbegleitende Gehölzstrukturen,<br />
- Sonderstandorte ( Feucht- und Nassbereiche, Auwälder<br />
... ), Bereiche ohne Nutzung<br />
Siedlungen sollen in Einklang mit den Funktionen des<br />
Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes entwickelt<br />
werden.<br />
�� Ortskerne - Kleinräumige Nutzungs- und Vegetationsstrukturen,<br />
- alter Baumbestand,<br />
- ausgewogenes Verhältnis zwischen versiegelten und<br />
unversiegelten Flächen,<br />
- vielfältig strukturierte innerörtliche Grün- und<br />
Freiflächen<br />
�� erweiterte Ortskerne - Vernetzung mit der freien Landschaft,<br />
- Strukturreiche Übergänge Siedlung - freie Landschaft,<br />
Siedlungsränder,<br />
- Mögliche Erholungs- und Freizeitnutzungen im<br />
Umfeld,<br />
- Zugänglichkeit der Landschaft,<br />
- Markante und charakteristische Ortseingänge mit
<strong>Landschaftsplan</strong> <strong>Hofbieber</strong> Seite - 95 -<br />
-Leitbilder und Entwicklungsziele-<br />
Für den Landschaftsraum ... das Leitbild und Entwicklungsziel ...<br />
hohem Wiedererkennungswert<br />
�� Neubaugebiete - Landschafts- u. regionaltypische typische Bauweisen<br />
und Strukturen,<br />
� Zusammenhängende<br />
Wälder<br />
- vielfältig strukturierte Freiflächen und - räume,<br />
- landschaftstypische Baumpflanzungen,<br />
- maßstabsgerechte Straßenraumgestaltung,<br />
- vielfältige Lebensräume für Pflanzen und Tiere<br />
Wälder sollen in ihrer Substanz und ihren Funktionen im<br />
Naturhaushalt sowie als Lebensraum für Tiere und<br />
Pflanzen erhalten und im Sinne der nachhaltigen<br />
Entwicklung naturnah bewirtschaftet werden und wo<br />
erforderlich verbessert und in ausgewählten Bereichen<br />
erweitert werden.<br />
�� Wälder - artenreicher, standortheimischer, ungleichaltriger und<br />
reich strukturierter Laub- oder Mischwald,<br />
- Intensitätsabgestufte Nutzung vom Totalreservat zum<br />
Wirtschaftswald,<br />
- Laub- und Mischwaldbestände unterschiedlicher<br />
Altersphasen,<br />
- extensive, naturnahe Nutzung und Bewirtschaftung<br />
entspr. vorherrschender Standortgegebenheiten,<br />
- Sonderstandorte, historisch entstandene<br />
Waldstrukturen, Waldränder
<strong>Landschaftsplan</strong> <strong>Hofbieber</strong> Seite - 96 -<br />
-Entwicklung und Massnahmen-<br />
6 Entwicklung und Massnahmen<br />
6.1 Allgemeine Ziele und Grundsätze<br />
Unter Berücksichtigung unterschiedlichster und vielfältigster Nutzungsansprüche an<br />
Natur und Landschaft lassen sich folgende allgemeine Ziele definieren:<br />
�<br />
�<br />
�<br />
Resourcenverträgliche und nachhaltige Flächennutzungen unter<br />
Schonung des Naturhaushaltes (Boden, Wasser, Luft):<br />
Einsatz von Dünge- / Pflanzenschutzmitteln nach guter fachlicher<br />
Praxis, Vermeidung von Schadstoffeinträgen<br />
Flächen mit besonderer Bedeutung für<br />
Naturschutz und Landschaftspflege,<br />
Landschaftshaushalt, Landschaftsbild<br />
• Naturschutzgebiete (§ 12 HENatG)<br />
• Naturdenkmal (§ 14 HENatG)<br />
• Gesch. Landschaftsbest. (§ 15 HENatG)<br />
• Biotopverbundflächen (§ 1b HENatG)<br />
• Ges. geschützte Biotope (§ 15d HENatG)<br />
• Vogelschutzgebiete (§ 20a HENatG)<br />
• FFH-Gebiete (§ 20b HENatG)<br />
• Vertragsnaturschutz (z.B. nach HELP)<br />
• Kompensationsflächen (§§ 5, 6 HENatG)<br />
� Naturschutzvorrang:<br />
angepasste extensive Nutzung / Pflege<br />
bzw. Nutzungsaufgabe / Prozessschutz<br />
Flächen mit besonderer Bedeutung für<br />
Landschaftshaushalt, Landschaftsbild<br />
• Landschaftsschutzgebiete (§ 13 HENatG)<br />
• Wasserschutzgebiete (WHG, HWG)<br />
� Flächen mittlerer Standorte mit mittlerer<br />
Nutzungsintensität<br />
Flächen intensiver Nutzung<br />
•<br />
ABB.-NR.: 44. „Entwicklung und Massnahmen: allgemeine Ziele und Grundsätze”<br />
• Standortgerechte reich strukturierte<br />
Laubmischwälder und Waldränder,<br />
z.T. auf Sonderstandorten<br />
• Feuchtwiesen, Quellsümpfe,<br />
Feuchtbrachen, Röhrichte<br />
• Magerrasen, nährstoffarmes extensiv<br />
genutztes Grünland<br />
• Äcker mit Wildkrautanteilen<br />
• Naturnahe Fließgewässer<br />
• Naturnahe Stillgewässer mit<br />
Uferzonen<br />
• Feldgehölze, Hecken, Ufergehölze<br />
• Laubbäume, Streuobst<br />
• Feldraine, Krautsäume, Wegränder<br />
• Offen gelassene Steinbrüche<br />
• Felswände, Blockschutthalden<br />
• Mischwälder<br />
• Grünland mittlerer Nutzungsintensität<br />
• Ackerbrachen und –einsaaten<br />
• Beeinträchtigte Fließ- / Stehgewässer<br />
• Beeinträchtigte Stillgewässer<br />
• Siedlungen mit mäßigem<br />
Versiegelungsgrad, vielfältigen<br />
Grünflächen, Gehölzstrukturen und<br />
Gärten<br />
Nadelholzmonokulturen<br />
• Grünland, intensiv genutzt<br />
• Ackerflächen, intensiv genutzt<br />
• Verbaute Fließgewässer<br />
• Verbaute Stillgewässer<br />
• Siedlungen mit hohem<br />
Versiegelungsgrad, geringen Anteilen<br />
an Grünflächen, Gehölzstrukturen<br />
und Gärten<br />
• Strassen und sonstige Verkehrswege<br />
• (Erd-)Deponien
<strong>Landschaftsplan</strong> <strong>Hofbieber</strong> Seite - 97 -<br />
-Entwicklung und Massnahmen-<br />
Für die einzelnen Schutzgüter bedeutet dies ...<br />
6.1.1 Schutzgut Arten und Biotope<br />
Die standortheimischen Tier- und Pflanzenarten, einschl. der lokalen oder<br />
standörtlichen Rassen u. Varianten, sind zu erhalten. Ein Aussterben von Arten ist zu<br />
verhindern. Naturnahe Lebensräume sind dabei zu erhalten, zu pflegen und zu<br />
entwickeln. Die naturschutzfachlich wertvollsten Flächen sind als Schutzgebiete in<br />
ausreichender Flächengröße auszuweisen. Zur Sicherung des genetischen Ausgleichs<br />
zwischen den Schutzgebieten sind Verbundelemente zu schaffen. Ökologisch wertvolle<br />
Bereiche sind durch ausreichende Pufferzonen gegenüber intensiven Nutzungen der<br />
Landschaft zu schützen. Auch auf den intensiv genutzten Flächen ist eine<br />
Mindestqualität als Lebensraum für Pflanzen und Tiere zu sichern und ggfs.<br />
herzustellen.<br />
6.1.2 Schutzgut Boden<br />
Die Böden des <strong>Gemeinde</strong>gebietes sind grundsätzlich sorgsam und sparsam zu nutzen.<br />
Die uneingeschränkte Versickerungsfähigkeit der Böden ist zu erhalten, wieder<br />
herzustellen und zu verbessern. Wertvolle Böden sind in besonderer Weise zu erhalten<br />
und zu schützen. Schadstoffbelastete Böden sind zu sanieren, darüber hinaus sind<br />
Böden vor Schadstoffeinträgen zu schützen.<br />
6.1.3 Schutzgut Wasser<br />
Die eigene Trinkwasserversorgung der <strong>Gemeinde</strong> <strong>Hofbieber</strong> ist auch langfristig<br />
innerhalb des <strong>Gemeinde</strong>gebietes sicherzustellen. Eine extensive Nutzung in den<br />
Trinkwasserschutzgebieten bzw. im Bereich des gesamten Wassereinzugsgebietes ist<br />
anzustreben. Belastungs- und Beeinträchtigungspotentiale in den Wassereinzugsgebieten<br />
sind zu beseitigen und zu vermeiden. Grundsätzlich ist der Wasserverbrauch,<br />
insbesondere in den Siedlungsbereichen, durch geeignete Massnahmen zu reduzieren.<br />
Die natürlichen Retentionsräume sind zu erhalten und weiter zu entwickeln. Die<br />
Gewässerstruktur ist zu verbessern. Eingriffe in die Fließgewässerdynamik sind zu<br />
vermeiden. Quell-, Feucht- und Auenbereiche sind in ihrer besonderen Standortsituation<br />
zu erhalten und entspr. zu nutzen.
<strong>Landschaftsplan</strong> <strong>Hofbieber</strong> Seite - 98 -<br />
-Entwicklung und Massnahmen-<br />
6.1.4 Schutzgut Klima<br />
Die Auenbereiche und Bachtäler sind als kleinklimatische Strömungs- und<br />
Ventilationsbahnen von Bebauung, Gehölzriegeln und Aufforstungen freizuhalten.<br />
Bestehende Wald-, aber auch kleinere Gehölzflächen sind als kleinklimatische<br />
Ausgleichsräume zu erhalten. Flächen zur Kaltluftbildung sind unter besonderer<br />
Berücksichtigung ihrer Wohlfahrtswirkungen auf besiedelte und bebaute Bereiche zu<br />
erhalten und zu entwickeln. Die Belastungen und Beeinträchtigungen kleinklimatischer<br />
Wirkungen sind zu vermeiden und ggfs. zu beseitigen.<br />
6.1.5 Schutzgut Landschaftsbild und Erholungswert<br />
Natur- und Landschaftserleben<br />
Die kleinstrukturierte Kulturlandschaft ist unter besonderer Berücksichtigung des<br />
Leitbildes des Biosphärenreservates "Land der offenen Fernen" zu erhalten. Attraktive<br />
und interessante Landschaftselemente sind zu erhalten und zu entwickeln.<br />
Beeinträchtigungen und Belastungen des Landschaftsbildes sind zu vermeiden und ggfs.<br />
zu beseitigen.<br />
Erholungswert der Landschaft<br />
Anzustreben ist für das <strong>Gemeinde</strong>gebiet <strong>Hofbieber</strong> eine naturnahe Erholungsnutzung.<br />
Hierbei ist die vorhandene naturräumliche Ausstattung in besonderer Weise zu nutzen.<br />
Durch gezielte Informations-, Lenkungs- und Verlagerungsmassnahmen sind<br />
Belastungen und Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes und Landschaftsbildes zu<br />
beseitigen und zu vermeiden.
<strong>Landschaftsplan</strong> <strong>Hofbieber</strong> Seite - 99 -<br />
-Entwicklung und Massnahmen-<br />
6.2 Schutzgebiete, Objekte und Flächen rechtlicher Bindung<br />
ABB.-NR.: 45. „Überblick: Entwicklung: Schutzgebiete, Objekte und Flächen rechtlicher Bindung”<br />
6.2.1 Naturschutzgebiete<br />
Gem. § 12 HENatG sind "Naturschutzgebiete rechtsverbindlich festgesetzte Gebiete, in<br />
denen ein besonderer Schutz von Natur und Landschaft in ihrer Ganzheit oder in<br />
einzelnen Teilen<br />
1. zur Erhaltung von Lebensgemeinschaften oder Lebensstätten bestimmter wildwachsender Pflanzenoder<br />
wildlebenden Tierarten,<br />
2. aus wissenschaftlichen, naturgeschichtlichen oder landeskundlichen Gründen oder,<br />
3. wegen ihrer Seltenheit, besonderen Eigenart oder hervorragenden Schönheit<br />
erforderlich ist.<br />
Alle Handlungen, die zu einer Zerstörung, Beschädigung oder Veränderung des<br />
Naturschutzgebietes oder seiner Bestandteile oder zu einer nachhaltigen Störung führen<br />
können, sind [...] verboten".
<strong>Landschaftsplan</strong> <strong>Hofbieber</strong> Seite - 100 -<br />
-Entwicklung und Massnahmen-<br />
Innerhalb des <strong>Gemeinde</strong>gebietes <strong>Hofbieber</strong> sind folgende Naturschutzgebiete (60,9 ha)<br />
ausgewiesen:<br />
• NSG Stellberg (ca. 12,1 ha)<br />
• NSG Milseburg (ca. 43,9 ha)<br />
• NSG Bieberstein (ca. 4,9 ha)<br />
Zur Ausweisung eines weiteren Naturschutzgebietes wird der Bereich „Liedenküppel“<br />
(ca. 15 ha) nordwestlich der Milseburg vorgeschlagen. Der genannte Hang- und<br />
Kuppenbereich zeichnet sich durch eine naturnahe Waldbestockung aus.<br />
6.2.2 Landschaftsschutzgebiete<br />
Nach § 13 HENatG sind "Landschaftsschutzgebiete rechtsverbindlich festgesetzte<br />
Gebiete, in denen ein besonderer Schutz von Natur und Landschaft<br />
1. zur Erhaltung oder Wiederherstellung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes oder der<br />
Nutzungsfähigkeit der Naturgüter,<br />
2. wegen der Vielfalt, Eigenart oder Schönheit des Landschaftsbildes,<br />
3. wegen ihrer besonderen Bedeutung für die Erholung<br />
erforderlich ist.<br />
In einem Landschaftsschutzgebiet sind [...] alle Handlungen verboten, die den Charakter<br />
des Gebietes verändern, das Landschaftsbild beeinträchtigen oder dem besonderen<br />
Schutzzweck zuwiderlaufen".<br />
Als Landschaftsschutzgebiet "Hessische Rhön" (ca. 5.642 ha) ausgewiesen ist der<br />
gesamte östliche Teil des <strong>Gemeinde</strong>gebietes, gleichzeitig als Bestandteil des<br />
Naturparks. Darüber hinaus ist der Auenbereich der Haune (ca. 34 ha) als<br />
Landschaftsschutzgebiet ausgewiesen.<br />
Zur weiteren Ausweisung als Landschaftsschutzgebiet werden die Auenbereiche der<br />
Nüst, der Nässe und der Bieber vorgeschlagen.<br />
6.2.3 Naturdenkmale<br />
Gemäß § 14 HENatG sind "Naturdenkmale rechtsverbindlich festgesetzte<br />
Einzelschöpfungen der Natur, deren besonderer Schutz<br />
1. aus wissenschaftlichen, naturgeschichtlichen oder landeskundlichen Gründen oder<br />
2. wegen ihrer Seltenheit, Eigenart oder Schönheit<br />
erforderlich ist.
<strong>Landschaftsplan</strong> <strong>Hofbieber</strong> Seite - 101 -<br />
-Entwicklung und Massnahmen-<br />
Die Beseitigung des Naturdenkmals sowie alle Handlungen, die zu einer Zerstörung,<br />
Beschädigung, Veränderung oder nachhaltigen Störung des Naturdenkmals oder seiner<br />
geschützten Umgebung führen können, sind [...] verboten". Innerhalb des <strong>Gemeinde</strong>gebietes<br />
<strong>Hofbieber</strong> sind verschiedene Naturdenkmale ausgewiesen. Es handelt sich hier<br />
vor allem um alte markante Einzelbäume sowie um geologisch besondere Formationen.<br />
Weitere Neuausweisungen sind zur Zeit nicht vorgesehen.<br />
6.2.4 Schutz bestimmter Lebensräume und Landschaftsbestandteile (§ 15 d<br />
HENatG)<br />
Nach § 15 d HENatG ist die Zerstörung oder eine sonstige erhebliche oder nachhaltige<br />
Beeinträchtigung folgender Biotope verboten:<br />
• Natürliche oder naturnahe Bereiche fließender und stehender Binnengewässer einschließlich<br />
ihrer Ufer und der dazugehörigen uferbegleitenden natürlichen oder naturnahen Vegetation<br />
sowie ihrer natürlichen oder naturnahen Verlandungsbereiche, Altarme und regelmäßig<br />
überschwemmten Bereiche,<br />
• Sümpfe,<br />
• Röhrichte,<br />
• seggen- und binsenreiche Nasswiesen,<br />
• Quellbereiche,<br />
• offene natürliche Block-, Schutt- und Geröllhalden,<br />
• Wacholderheiden,<br />
• Borstgrasrasen,<br />
• Trockenrasen,<br />
• Wälder und Gebüsche trockenwarmer Standorte,<br />
• Bruch-, Sumpf- und Auwälder,<br />
• Schlucht-, Blockhalden- und Hangschuttwälder,<br />
• offene Felsbildungen,<br />
• Alleen<br />
sowie darüberhinaus im Außenbereich:<br />
• Trockenmauern,<br />
• Feldgehölze,<br />
• Streuobstbestände,<br />
• landschaftsprägende Einzelbäume.<br />
Die o.a. Biotoptypen sind im <strong>Landschaftsplan</strong> gekennzeichnet. Im <strong>Gemeinde</strong>gebiet<br />
<strong>Hofbieber</strong> handelt es sich hier vor allem um naturnahe Fließgewässerbereiche,<br />
kleinflächige Magerrasen- und Feuchtwiesenbestände sowie um Wald- und<br />
Gehölzbestände in unterschiedlicher Ausprägung.
<strong>Landschaftsplan</strong> <strong>Hofbieber</strong> Seite - 102 -<br />
-Entwicklung und Massnahmen-<br />
6.2.5 FFH- und Vogelschutzgebiete<br />
Gemäß § 20 b HENatG werden Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung nach<br />
Maßgabe des Art. 4 Abs. 4 der FFH-Richtlinie entsprechend den jeweiligen<br />
Erhaltungszielen von der zuständigen Behörde zu geschützten Teilen von Natur und<br />
Landschaft im Sinne von § 11 erklärt. Die Schutzerklärung bestimmt den Schutzzweck<br />
entsprechend den jeweiligen Erhaltungszielen und die erforderlichen Gebietsbegrenzungen.<br />
Es soll dargestellt werden, ob prioritäre Biotope oder prioritäre Arten zu<br />
schützen sind. Durch geeignete Gebote und Verbote sowie Pflege- und<br />
EntwicklungsMassnahmen ist sicherzustellen, dass den Anforderungen des Art. 6 der<br />
FFH-Richtlinie entsprochen wird.<br />
Zur Meldung als FFH-Gebiet gemäß Richtlinie zur Erhaltung der natürlichen<br />
Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (FFH - Richtlinie vom<br />
21.05.1992) sind innerhalb des <strong>Gemeinde</strong>gebietes neben der Milseburg (ca. 43,9 ha) ,<br />
auch die Hessenliede und der Kugelberg bei <strong>Hofbieber</strong> (ca. 112 ha), der Liedenküppel<br />
(ca. 22 ha) in unmittelbarer Nähe der Milseburg sowie der Stellberg bei Wolferts (ca.<br />
12,1 ha) vorgesehen, insgesamt also ca. 190 ha.<br />
Im Rahmen des Meldeverfahrens werden durch die Oberen Naturschutzbehörden<br />
Datenerhebungen durchgeführt sowie Erhaltungsziele für die Gebiete formuliert. Dabei<br />
gelten grundsätzlich der günstige Erhaltungszustand der Gebiete sowie Bestandsschutz<br />
für bestehende Nutzungen aber auch das sog. Verschlechterungsverbot.<br />
Gemäß § 20 a HENatg sind Europäische Vogelschutzgebiete , entsprechend den<br />
jeweiligen Erhaltungszielen, zu geschützten Teilen von Natur und Landschaft im Sinne<br />
von § 11 zu erklären. Die Schutzerklärung bestimmt den Schutzzweck auf Grund der<br />
für die Inschutznahme maßgeblichen Arten des Anhanges I und der Zugvogelarten im<br />
Sinne des Art. 4 Abs. 2 der Vogelschutz-Richtlinie und die erforderlichen Gebietsbegrenzungen.<br />
Durch geeignete Gebote und Verbote sowie Pflege- und Entwicklungsmassnahmen<br />
ist sicherzustellen, dass den Anforderungen der Vogelschutzrichtlinie<br />
Rechnung getragen wird.<br />
Als Vogelschutzgebiet gemäß Richtlinie über die Erhaltung der wildlebenden<br />
Vogelarten (Vogelschutz-Richtlinie vom 2.4.1979) ist das gesamte östliche<br />
<strong>Gemeinde</strong>gebiet östlich der Linie Schwarzbach - Elters - Schackau - Kleinsassen<br />
(ca. 3.687 ha) dargestellt.<br />
6.2.6 Biosphärenreservat<br />
Biosphärenreservate sind nach § 15 b HENatG von der UNESCO anerkannte<br />
großflächige, überwiegend geschützte Natur- und Kulturlandschaften. Sie dienen<br />
1. der Verbesserung der Kenntnisse über den Naturhaushalt, als Beispielflächen für langfristige<br />
Umweltbeobachtung und als Grundlage für ökologische Forschung in vom Menschen veränderten<br />
Ökosystemen,<br />
2. in beispielhafter Weise einem ausgewogenen Nebeneinander des menschlichen Wirtschaftens und der<br />
natürlichen Entwicklung,<br />
3. der Förderung und Erhaltung gebietstypischer Landnutzungsmethoden und deren Umsetzung für den<br />
nachhaltigen Schutz aller Lebensformen,
<strong>Landschaftsplan</strong> <strong>Hofbieber</strong> Seite - 103 -<br />
-Entwicklung und Massnahmen-<br />
4. der Erziehung, Bildung und Öffentlichkeitsarbeit mit dem Ziel, umwelt- und naturverträgliches<br />
Verhalten zu fördern.<br />
Biosphärenreservate sind gegliedert in:<br />
1. Kernzonen, die überwiegend Naturschutzgebiet oder Nationalpark sein müssen,<br />
2. Pufferzone, die einer besonderen Pflege und Entwicklungsplanung unterliegen und die sich innerhalb<br />
eines Landschaftsschutzgebietes befinden muß,<br />
3. Übergangszonen harmonischer Kulturlandschaften, die überwiegend Landschaftsschutzgebiet sein<br />
müssen".<br />
Der überwiegende Teil des <strong>Gemeinde</strong>gebietes liegt innerhalb des Biosphärenreservates<br />
Rhön, wobei die Entwicklungs- und Übergangszone hier den größten Flächenanteil<br />
einnimmt. Eine Kernzone des Biosphärenreservates befindet sich am Bubenbader Stein.<br />
Pflegezonen sind für die Bereiche Milseburg und Boxberg ausgewiesen.<br />
6.2.7 Flächen zur Durchführung von Kompensationsmassnahmen<br />
Innerhalb des <strong>Gemeinde</strong>gebietes sind folgende Massnahmen als Kompensationsmassnahmen<br />
für Eingriffe in den Naturhaushalt und das Landschaftsbild gemäß §§ 5<br />
und 6 HENatG ausgeführt und umgesetzt worden. Hierbei handelt es sich sowohl um<br />
Massnahmen im Rahmen der kommunalen Bauleitplanung, als auch um private und<br />
öffentliche Ausgleichsmassnahmen für sonstige Vorhaben.<br />
TABELLE-NR. 23: „FLÄCHEN MIT RECHTLICHER BINDUNG: KOMPENSATIONSMASSNAHMEN“<br />
Lfd.-Nr. Gemarkung Massnahme Grösse,<br />
Stückzahl<br />
A - 1 Langenbieber Streuobstwiese 750 m 2<br />
A – 2 Langenbieber Obstbaumreihe 23 St.<br />
A – 3 Langenbieber Umwandlung Acker in Wiese 14.000 m 2<br />
A – 4 Obernüst Streuobstwiese 1.400 m 2<br />
A – 5 Kleinsassen Streuobstwiese 76 St.<br />
A – 6 Schwarzbach Streuobstwiese 1.150 m 2<br />
A – 7 Schwarzbach Aufforstung 4.000 m 2<br />
A – 8 Obernüst Umwandlung Acker in Wiese 7.500 m 2<br />
A – 9 Langenbieber Sukzession 17.900 m 2<br />
A – 10 Niederbieber Streuobstwiese 2.500 m 2<br />
A – 11 Niederbieber Streuobstwiese 22 St.<br />
A – 12 Elters Streuobstwiese 1.000 m 2<br />
A – 13 Obernüst Aufforstung 1.000 m 2<br />
A – 15 Schwarzbach Feldgehölz 600 m 2<br />
A – 16 Niederbieber Streuobstwiese 1.100 m 2
<strong>Landschaftsplan</strong> <strong>Hofbieber</strong> Seite - 104 -<br />
-Entwicklung und Massnahmen-<br />
Lfd.-Nr. Gemarkung Massnahme Grösse,<br />
Stückzahl<br />
A – 17 <strong>Hofbieber</strong> Anpflanzung von Jungerlen 300 St.<br />
A – 18 Elters Umwandlung Acker in Wiese 5.800 m 2<br />
A – 19 Langenbieber Brachfläche 1.900 m 2<br />
A – 20 Kleinsassen Umwandlung Acker in Wiese 5.184 m 2<br />
A – 21 Mahlerts Obstbaumreihe 20 St.<br />
A – 22 Schwarzbach Brachfläche 3.100 m 2<br />
A – 23 Elters Streuobstwiese 2.600 m 2<br />
A – 24 Obernüst Umwandlung Acker in Wiese 12.479 m 2<br />
A – 25 Schwarzbach Aufforstung 2.600 m 2<br />
A – 26 Wittges Feldgehölz 1.000 m 2<br />
A – 27 Rödergrund Brache<br />
B – 3 Kleinsassen Streuobstwiese 2.100 m 2<br />
B – 5 Elters Nutzungsextensivierung<br />
C – 1 Wittges Sukzession 9.730 m 2<br />
C – 2 Mahlerts Sukzession 3.670 m 2<br />
C – 3 <strong>Hofbieber</strong> Sukzession 10.000 m 2<br />
C – 4 Niederbieber Entsiegelung<br />
D – 4 Elters Sukzession, Heckenpflanzung, Umwandlung<br />
Acker in Wiese<br />
D – 8 Langenbieber Wiesenbrache 5.321 m 2<br />
Zukünftige Kompensationsmassnahmen sind insbesondere dem Kapitel 6.3 zu<br />
entnehmen.<br />
6.2.8 Flächen mit vertraglichen Bindungen<br />
Im <strong>Landschaftsplan</strong> sind die Flächen dargestellt, die aufgrund vertraglicher Bindungen<br />
unter besonderen naturschutzfachlichen Aspekten genutzt, unterhalten und / oder<br />
gepflegt werden. Hierbei handelt es sich ausschließlich um vertragliche Bindungen nach<br />
dem Hess. Landschaftspflegeprogramm.<br />
Das Hess. Landschaftspflegeprogramm HELP fördert vor allem ...<br />
• nicht mehr bewirtschaftete Trocken - und Feuchtstandorte erstmalig zu entbuschen,<br />
• Ackerflächen in Grünland umzuwandeln,<br />
• ein- bis zweischürige Wiesennutzungen unter Einschränkung bzw. Verzicht auf Düngung<br />
und chem. Pflanzenschutz,
<strong>Landschaftsplan</strong> <strong>Hofbieber</strong> Seite - 105 -<br />
-Entwicklung und Massnahmen-<br />
• eine extensive Bewirtschaftung von Grünland in Form von ein- bis zweischüriger<br />
Mähweiden unter Einschränkung bzw. Verzicht auf Düngung und chem. Pflanzenschutz,<br />
• Pflege aufgegebener Grünlandflächen.<br />
6.2.9 Biotopverbund<br />
Gemäß Aussage des hessischen Naturschutzgesetzes dient der Biotopverbund der<br />
nachhaltigen Sicherung von heimischen Tier- und Pflanzenarten und deren<br />
Populationen einschließlich ihrer Lebensräume und Lebensgemeinschaften sowie der<br />
Bewahrung, Wiederherstellung und Entwicklung funktionsfähiger ökologischer<br />
Wechselbeziehungen. Der Biotopverbund besteht aus Kernflächen, Verbindungsflächen<br />
und Verbindungselementen. Teile des Biotopverbundes können dabei gesetzlich<br />
geschützte Biotope nach § 15d, Naturschutzgebiete, Gebiete im Sinne der §§ 20a und<br />
20b sowie Biosphärenreservate oder Teile dieser Gebiete, weitere Flächen und<br />
Elemente, einschließlich Teile von Landschaftsschutzgebieten und Naturparken sein.<br />
Nach Zeltner (1995) muss der Biotopverbund im umfassenden Sinne verstanden werden<br />
und darf nicht nur den räumlichen Verbund der letzten naturnahen Restflächen<br />
beinhalten. Der Begriff Biotopverbund steht als Synonym für die Wiederherstellung<br />
komplexer ökologischer Beziehungsgefüge in der Gesamtlandschaft und damit für die<br />
Wiederherstellung der Systemeigenschaften von Natur- und Landschaft.<br />
Der Landschaftsrahmenplan Nordhessen (1999) nennt vor allem folgende Massnahmen<br />
beim Aufbau von Biotopverbundsystemen zum Zwecke des Arten- und Biotopschutzes:<br />
• Erhaltung des Bestandes aller ökologisch bedeutsamen Lebensräume,<br />
• Sicherung eines ausreichenden Bestandes an Minimalarealen ökologisch bedeutsamer<br />
Lebensräume,<br />
• Entwicklung, vor allem Erweiterung der Biotopbestände, Einbindung der Kernflächen in<br />
großräumige naturraumtypische Biotopkomplexe, Schaffung von Pufferzonen im<br />
Grenzbereich zu intensiv genutzten Flächen,<br />
• Aufbau von Trittstein- und linear entwickelten Korridorbiotopen,<br />
• Erhaltung landwirtschaftlicher Betriebe zur Gewährleistung der Flächenbewirtschaftung,<br />
• Erhalt und Förderung historischer Nutzungsformen.<br />
Ein Biotopverbundsystem für das <strong>Gemeinde</strong>gebiet <strong>Hofbieber</strong> differenziert zunächst<br />
Kernflächen aus naturschutzfachlich besonders wertvollen Bereichen. Ergänzt werden<br />
die Kernflächen durch die Darstellung von Puffer- und Verbindungsflächen sowie<br />
–elementen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung des Biotopverbundes.<br />
Innerhalb des <strong>Gemeinde</strong>gebietes lassen sich folgende Kern- und Verbindungsflächen<br />
differenzieren:
<strong>Landschaftsplan</strong> <strong>Hofbieber</strong> Seite - 106 -<br />
-Entwicklung und Massnahmen-<br />
TABELLE-NR. 24: „BIOTOPVERBUND, KERN- UND VERBINDUNGSFLÄCHEN“<br />
Nr. Betr.<br />
Biotopkomplex<br />
1 Milseburg,<br />
Stellberg und<br />
oberes Biebertal<br />
2 Talauen der Bieber<br />
mit Goldbach und<br />
Traisbach<br />
3 Talauen Riegelund<br />
Igelbach<br />
Biotoptypen Kernflächen Biotoptypen<br />
Verbindungsflächen<br />
Hainsimsen-Buchenwälder, Hainsimsen-Zahnwurz-<br />
Buchenw., Orchideen-B., Sommerlinden-<br />
Bergulmen-Blockschuttwald, Traubeneichen-<br />
Trockenwald, Frauenfarn-Hainsimsen-Buchenwald<br />
Felsbildungen und Blockschutthalden /<br />
Lesesteinwälle an Milseburg, Bubenbader Stein und<br />
Stellberg, Quellgebiet und oberes Bachtal mit<br />
reichhaltigen Feld- / Ufer- und Einzelgehölzen,<br />
Borstgrasrasen, Goldhaferwiesen,<br />
Extensivgrünländer, feuchte Hochstaudenfluren<br />
sonstige Buchen- /<br />
Misch- und<br />
Nadelwälder, div.<br />
Grünländer, Äcker,<br />
Ortslage, Parkplätze,<br />
Bieberweiher<br />
201 ha 503 ha<br />
Bachlauf der Bieber mit zahlreichen Seitenbächen<br />
und Grabenzuflüssen, in weiten Teilen gesäumt<br />
durch Ufergaleriewald, Amphibientümpel<br />
(Fohlenweide + nördlich Allmus), Hecken- / Feldund<br />
Einzelgehölze, Feuchtwiesenreste,<br />
Extensivgrünländer, Feuchte Hochstaudenflur (Im<br />
Loels), Kalkschotterhang<br />
div. Grünländer,<br />
Äcker, div. Laub- /<br />
Mischwälder,<br />
Fischteiche, Ortslagen,<br />
Kläranlagen,<br />
Schwimmbad<br />
60 ha 453 ha<br />
Enger Bachtalkomplex mit Feucht- und<br />
Extensivgrünländern, Amphibientümpel und<br />
Quellen, Ufer- / Feldgehölze, Erlenbruchwaldrest<br />
div. Grünländer,<br />
Laubmisch- /<br />
Nadelwälder,<br />
Fischteiche<br />
11 ha 33 ha<br />
4 Talaue der Haune Fließgewässerabschnitt mit Ufergehölzsaum,<br />
Feucht- und Extensivgrünländer<br />
div. Grünländer,<br />
Entwässerungsgräben<br />
7,5 ha 9,5 ha<br />
5 Talaue der Nässe Fließgewässerkomplex der Nässe (Luße) mit<br />
Quellgebiet und einigen Seitenzuflüssen.<br />
Überwiegend mit Ufergehölzsaum,<br />
Extensivgrünländern (z.T. mit artenreichen<br />
Magersäumen), Feuchtgrünland nördl. Egelmes und<br />
westl. Schwarzes Kreuz, naturnahe Teiche bei<br />
Wittges, Erlenbruchwaldreste westlich Schwarzes<br />
Kreuz, Feld- / Einzelgehölze, offener Steinbruch,<br />
Amphibientümpel im Wald<br />
6 Talauen der Nüst<br />
mit Birkenbach,<br />
Schwarzbach und<br />
Grubenwasser<br />
Fischteiche, div.<br />
Grünländer, Äcker<br />
31 ha 313 ha<br />
Fließgewässerkomplex mit Teilbereichen und<br />
Schwerpunkten:<br />
Obergruben/Grubenwasser +<br />
Langenberg/Hausarmen: großflächige<br />
Extensivgrünländer, Feuchtwiesenreste,<br />
Goldhaferwiese, Basaltmagerrasen am Kleinen<br />
Gruben, kleinflächig Sandmagerrasen, Ufer- / Feldund<br />
Einzelgehölze<br />
bei Mahlerts und am Oberdörnbachshof:<br />
Feuchtwiesenreste, feuchte Hochstaudenfluren,<br />
Ufer- / Feld- und Einzelgehölze<br />
am oberen Schwarzbach: Laubwaldkomplex,<br />
Extensivgrünländer, Ufer- / Feld- und Einzelgehölze<br />
div. Grünländer,<br />
Äcker, sonstige<br />
Laubmisch- /<br />
Nadelwälder
<strong>Landschaftsplan</strong> <strong>Hofbieber</strong> Seite - 107 -<br />
-Entwicklung und Massnahmen-<br />
Nr. Betr.<br />
Biotopkomplex<br />
7 Hozzelberg /<br />
Nüster-Berg<br />
8 Lothar-Mai-Hütte<br />
mit Bomberg<br />
9 Kleiner<br />
Ziegenkopf,<br />
Hohlstein und<br />
Schackenberg mit<br />
Mambachtal<br />
10 Schröcksküppel<br />
und Ulrichshauk<br />
11 Kirschberg und<br />
Schweinsberg<br />
12 Hessenliede und<br />
Bieberstein<br />
13 Hofberg und<br />
Schnurberg<br />
Biotoptypen Kernflächen Biotoptypen<br />
Verbindungsflächen<br />
am Birkenbach / Gickershauk: feuchte<br />
Hochstaudenfluren, Waldkomplex<br />
am Schwarzehauk: Feuchtgrünland, feuchte<br />
Hochstaudenfluren, Amphibientümpel,<br />
Waldkomplex (Bergseggen-Perlgras-Buchenwald,<br />
Traubeneichen-Hainbuchenwald)<br />
75 ha 246 ha<br />
Buchenwaldgesellschaften, Goldhaferwiesen,<br />
Extensivgrünländer, Kalkmagerrasen, ausgeprägte<br />
Krautsäume und Wegesränder, Feld- / Einzelgehölze<br />
div. Grünländer,<br />
Äcker, sonstige<br />
Laubmischwälder<br />
141 ha 117 ha<br />
Extensivgrünländer (z.T. als strukturreiche<br />
Huteweide), Feuchtgrünland, Borstgrasrasen (z.T.<br />
ruderalisiert), Grabenlauf mit Ufergehölzen,<br />
Streuobst, Hecken- / Einzelgehölze<br />
div. Grünländer<br />
6,5 ha 42,5 ha<br />
Stark reliefierte Waldbereiche<br />
(Buchenwaldgesellschaften, z.B.: Zahnwurz-B.,<br />
Platterbsen-B., z.T. Edellaubholz-Blockschuttwald,<br />
Traubenkirschen-Erlen-Eschenwald) und<br />
Kuppenlagen mit engem Bachtal, Goldhaferwiesen,<br />
Extensivgrünländern (z.T. mit Quellsümpfen), Ufer-,<br />
Hecken- und Einzelgehölze, Streuobstbestände,<br />
ausgeprägte Krautsäume, Kalksteinbruch<br />
Exponierte Felskuppen mit Basaltmagerrasen,<br />
Extensivgrünländern, Trockenbrachen,<br />
Laubwäldern, Feld- / Einzelgehölze<br />
div. Grünländer,<br />
Äcker, Fischteiche<br />
172 ha 189 ha<br />
div. Grünländer,<br />
Äcker<br />
11 ha 29 ha<br />
Exponierte Felskuppen mit Basaltmagerrasen,<br />
Extensivgrünländern (z.T. als reich strukturierte<br />
Huteweiden), Kalksteinbruch, Feld- / Einzelgehölze<br />
div. Grünländer,<br />
Äcker, Wälder<br />
12 ha 25 ha<br />
Orchideen-Buchenwald, Platterbsen-Buchenwald,<br />
Sommerlinden-Bergulmen-Blockschuttwald,<br />
Perlgras-Buchenwald,<br />
Kalkmagerrasen, Extensivgrünländer,<br />
Trockenbrachen und –säume, Hecken- und<br />
Einzelgehölze<br />
sonstige Laubmischund<br />
Nadelwälder, div.<br />
Grünländer, Äcker<br />
86 ha 40 ha<br />
Kalkmagerrasen, Kalksteinbruch (z.T. in<br />
Verfüllung), Extensivgrünländer, Feld- und<br />
Einzelgehölze<br />
div. Grünland, Äcker,<br />
Mischwald,<br />
Laubwaldaufforstung<br />
und Golfplatz<br />
10 ha 100 ha<br />
Summen 824 ha 2.100 ha<br />
alle Flächenangaben in ca. ha, Erfassungsgenauigkeit 1:10.000
<strong>Landschaftsplan</strong> <strong>Hofbieber</strong> Seite - 108 -<br />
-Entwicklung und Massnahmen-<br />
Einzelne Massnahmen zur Entwicklung der Biotopverbundflächen sind der<br />
Beschreibung der Massnahmen im Kap. 6.3 zu entnehmen.<br />
6.2.10 Hinweise zum Arten- und Biotopschutz<br />
Für das Gebiet der <strong>Gemeinde</strong> <strong>Hofbieber</strong> werden dargestellt (vgl. auch Kap. 4.4):<br />
• Faunistisch bedeutsame Bereiche (u.a. Avifauna, Amphibien, Fledermäuse),<br />
• Floristisch bedeutsame Bereiche,<br />
• Vorkommen seltener bzw. Rote-Liste-Pflanzenarten,<br />
• Vorkommen seltener bzw. Rote-Liste-Tierarten.<br />
6.2.11 Sonstige Darstellungen<br />
6.2.11.1 Darstellungen gemäß Forstgesetz<br />
Ein in der <strong>Gemeinde</strong> befindlicher Schutzwald wird dargestellt.<br />
6.2.11.2 Darstellungen gemäß Denkmalschutzgesetz<br />
Innerhalb des <strong>Gemeinde</strong>gebietes sind verschiedene Bodendenkmale ausgewiesen.<br />
6.2.11.3 Darstellungen nach Hess. Wassergesetz<br />
Innerhalb des <strong>Gemeinde</strong>gebietes sind folgende Wasserschutzgebiete ausgewiesen:<br />
• südlich der Ortslagen Wiesen u. Niederbieber,<br />
• südlich der Ortslage Langenbieber,<br />
• Bereich Milseburg,<br />
• südöstlich der Ortslage Schackau,<br />
• nördlich, südwestlich u. südöstlich der Ortslage Elters.<br />
Entlang der Fließgewässer ist außerhalb der Ortslagen ein Uferschutzstreifen von 10 m,<br />
innerhalb der Ortslagen von 5 m einzuhalten.
<strong>Landschaftsplan</strong> <strong>Hofbieber</strong> Seite - 109 -<br />
-Entwicklung und Massnahmen-<br />
6.3 Landschaftspflegerische Massnahmen<br />
ABB.-NR.: 46. „Überblick: Entwicklung: Landschaftspflegerische Massnahmen”
<strong>Landschaftsplan</strong> <strong>Hofbieber</strong> Seite - 110 -<br />
-Entwicklung und Massnahmen-<br />
6.3.1 Erhalt, Pflege und Entwicklung naturschutzfachlich wertvoller Flächen und<br />
Bereiche<br />
Die naturschutzfachlich als wertvoll und schutzwürdig bewerteten Flächen und<br />
Bereiche innerhalb des <strong>Gemeinde</strong>gebietes sind durch gezielte Pflegemassnahmen zu<br />
erhalten, zu schützen und zu entwickeln.<br />
6.3.1.1 Flächenhafte Biotoptypen u./o. Strukturen<br />
naturnahe, artenreiche Laubwälder:<br />
Nachhaltige und naturnahe Nutzung und Bewirtschaftung von artenreichen<br />
Laubwaldbeständen unter besonderer Beachtung der vorherrschenden Standortgegebenheiten.<br />
TABELLE-NR. 25: „ENTWICKLUNGSFLÄCHEN: BESONDERE LAUBWALDBEREICHE“<br />
Einzelbiotop-Nr. Lage<br />
001 Milseburg / Liedenküppel<br />
002 Stellberg<br />
003 Bubenbader Stein<br />
004 Schackenberg / Ziegenkopf<br />
005 Wadberg<br />
006 Hohlstein / Fuchsstein<br />
007 Hessenliede / Kugelberg / Bieberstein<br />
008 Sandberg<br />
009 Bomberg<br />
010 Großer Grubenhauck<br />
011 Schwarzehauk / Gickershauk<br />
012 Nüster-Berg / Hozzel-Berg / Boxberg<br />
Summe: 13<br />
Erlenbruchwald und Erlenbruch-Hutewald:<br />
Nachhaltige und naturnahe Nutzung und Bewirtschaftung von Laubwaldbeständen unter<br />
besonderer Beachtung der vorherrschenden Standortgegebenheiten und Vermeidung<br />
von Bodenverdichtungen.<br />
TABELLE-NR. 26: „ENTWICKLUNGSFLÄCHEN: ERLENBRUCHWALD UND ERLENBRUCH-HUTEWALD“<br />
Einzelbiotop-Nr. Lage Größe<br />
100 Östlicher Zulauf der Nässe südwestlich vom Schwarzen Kreuz 850 m 2<br />
101 Östlicher Zulauf der Nässe südwestlich vom Schwarzen Kreuz 1.325 m 2<br />
102 Oberlauf des Riegel-Bachs südöstlich vom FA Thiergarten 2.825 m 2
<strong>Landschaftsplan</strong> <strong>Hofbieber</strong> Seite - 111 -<br />
-Entwicklung und Massnahmen-<br />
Einzelbiotop-Nr. Lage Größe<br />
103 Riegelbach 1.125 m 2<br />
104 Oberlauf der Bieber südöstlich Kleinsassen 6.425 m 2<br />
105 Seithang am Oberlauf der Bieber südlich Kleinsassen 2.500 m 2<br />
106, Hute Östlich Danzwiesen (Hutewald) 17.500 m 2<br />
107, Hute Östlich Danzwiesen (Hutewald) 4.350 m 2<br />
108 Nässe nördlich Egelmes 375 m 2<br />
Summe: 9 37.275 m 2<br />
Grünland feuchter bis nasser Standorte:<br />
Extensive Nutzung auf feuchten Grünlandstandorten durch standortangepasste Mahd<br />
u./o. Beweidung und Vermeidung von Bodenverdichtungen.<br />
TABELLE-NR. 27: „ENTWICKLUNGSFLÄCHEN: GRÜNLAND FEUCHTER BIS NASSER STANDORTE“<br />
Einzelbiotop-Nr. Lage Größe<br />
200 Graben südwestlich Boxberg 1.225 m 2<br />
201 Nüst südlich Wallings 800 m 2<br />
202 Nordöstlich Oberdörnbachshof 5.250 m 2<br />
203 Zufluß zur Nüst nördlich Mahlerts 3.250 m 2<br />
204 Nüst nordwestlich Mahlerts 3.050 m 2<br />
205 Nüst südlich Mahlerts 1.975 m 2<br />
206 Nässe nördlich L 3258 1.900 m 2<br />
207 Im Loels nördlich Allmus 6.950 m 2<br />
208 Im Loels nördlich Allmus 2.350 m 2<br />
209 Nordwestlich Traisbach 1.500 m 2<br />
210 Westlich Traisbach 900 m 2<br />
211 Nässe nördlich Egelmes 3.050 m 2<br />
212 Nässe westlich Egelmes 4.000 m 2<br />
213 Hang nördlich Obergruben 1.250 m 2<br />
214 Grubenwasser nordöstlich Obergruben 350 m 2<br />
215 Grubenwasser nordöstlich Obergruben 1.350 m 2<br />
216 Grubenwasser nordöstlich Obergruben 6.200 m 2<br />
217 Goldbach in Bieberaue südwestlich Niederbieber 3.250 m 2<br />
!!!<br />
(2 Teilfl.)<br />
218 Oberhalb Nässe östlich Elters 1.650 m 2<br />
219 Nördlich K29 östlich Elters 2.100 m 2<br />
220 Südlich K29 östlich Elters 1.800 m 2<br />
(6 Teilfl.)
<strong>Landschaftsplan</strong> <strong>Hofbieber</strong> Seite - 112 -<br />
-Entwicklung und Massnahmen-<br />
Einzelbiotop-Nr. Lage Größe<br />
221 Östlich Steens 1.800 m 2<br />
222 Nordwestlich Goldbachshof 1.600 m 2<br />
(2 Teilfl.)<br />
223 Goldbach östlich Goldbachshof 7.350 m 2<br />
224 Goldbach östlich Goldbachshof 15.400 m 2<br />
225 Riegelbach 6.000 m 2<br />
226 Riegelbach 11.350 m 2<br />
227 Riegelbach 400 m 2<br />
228 Riegelbach 750 m 2<br />
229 Graben nördlich FA Thiergarten 750 m 2<br />
230 Östlich Kleinsassen 925 m 2<br />
231 Hang östlich Danzwiesen 1.650 m 2<br />
232 Südöstlich Danzwiesen 500 m 2<br />
233 Südöstlich Danzwiesen 300 m 2<br />
234 Südöstlich Danzwiesen 650 m 2<br />
235 Südöstlich Danzwiesen 1.650 m 2<br />
236 Bieber südöstlich Kleinsassen 1.350 m 2<br />
237 Bieber südöstlich Kleinsassen 775 m 2<br />
238 Bieber südöstlich Kleinsassen 2.650 m 2<br />
239 Bieber südöstlich Kleinsassen 300 m 2<br />
240 Bieber südöstlich Kleinsassen 1.650 m 2<br />
241 Südöstlich Milseburg 1.000 m 2<br />
242 Südöstlich Milseburg 530 m 2<br />
243 Waldwiese südwestlich oberer Bieberlauf 600 m 2<br />
(3 Teilfl.)<br />
244 An L 3330 westlich Kleinsassen 530 m 2<br />
245 Südwestlich Mahlerts 675 m 2<br />
246 Südöstlich Kleinsassen 600 m 2<br />
247 Bieberaue östlich K 21 550 m 2<br />
248 Nordwestlich Schackau an Bahndamm 150 m 2<br />
249 Südwestlich Elters 250 m 2<br />
250 Hang östlich Danzwiesen 350 m 2<br />
251 Südöstlich Kleinsassen 1.225 m 2<br />
252 Nördlich FA Thiergarten 400 m 2<br />
253 250 m 2<br />
Summe: 63 119.060<br />
m 2
<strong>Landschaftsplan</strong> <strong>Hofbieber</strong> Seite - 113 -<br />
-Entwicklung und Massnahmen-<br />
feuchte Hochstaudenflur:<br />
Offenhalten von Brachflächen auf feuchten Standorten, ggf. Durchführung von<br />
abschnittsweisen Entbuschungsmassnahmen unter Beachtung der Standortverhältnisse.<br />
Auf ausgewählter Fläche mit besonderem Arteninventar (Nr. 306) periodische Mahd,<br />
ggf. mit Spezialmaschinen unter besonderer Beachtung der Standortverhältnisse und<br />
Vermeidung von Bodenverdichtungen.<br />
TABELLE-NR. 28: „ENTWICKLUNGSFLÄCHEN: FEUCHTE HOCHSTAUDENFLUR“<br />
Einzelbiotop-Nr. Lage Größe<br />
300 Bei Amphibientümpeln nordöstlich Schwarzehauk 7.250 m 2<br />
(2 Teilfl.)<br />
301 Bei Amphibientümpel südöstlich Schwarzehauk 2.650 m 2<br />
302 Nüst nordwestlich Mahlerts 1.575 m 2<br />
303 Bei Fischteichen am oberen Birkenbach 1.575 m 2<br />
304 Nordöstlich Fohlenweide 5.250 m 2<br />
305 Östlich Fohlenweide 7.950 m 2<br />
306 Östlich Danzwiesen 6.450 m 2<br />
307 Nordwestlich Öchenbach (Röhricht) 4.250 m 2<br />
308 Oberlauf der Bieber südlich von Kleinsassen 3.375 m 2<br />
309 Ufersaum am Goldbach 2.500 m 2<br />
310 Bieber nördlich Kleinsassen 625 m 2<br />
311 Südöstlich Allmus (Röhricht) 300 m 2<br />
312 Nässe nördlich Egelmes 700 m 2<br />
313 Nässe nördlich Egelmes 1.775 m 2<br />
314 Nässezufluss 475 m 2<br />
315 Nässezufluss 650 m 2<br />
316 Südwestlich Mahlerts 1.100 m 2<br />
317 Südöstlich Mahlerts 2.775 m 2<br />
318 Weihers-Mühle 1.425 m 2<br />
319 Südwestlich Weihershof an Teich neben K 25 900 m 2<br />
320 An Teich Fohlenweide 775 m 2<br />
321 Südöstlich Schackau 1.400 m 2<br />
Summe: 23 55.725 m 2<br />
!!!
<strong>Landschaftsplan</strong> <strong>Hofbieber</strong> Seite - 114 -<br />
-Entwicklung und Massnahmen-<br />
Goldhaferwiese:<br />
Extensive Nutzung mittlerer Grünlandstandorte durch standortangepasste Mahd u. / o.<br />
Beweidung.<br />
TABELLE-NR. 29: „ENTWICKLUNGSFLÄCHEN: GOLDHAFERWIESE“<br />
Einzelbiotop-Nr. Lage Größe<br />
400 Nordwestlich Boxberg 53.900 m 2<br />
401 Nordwestlich Boxberg 5.250 m 2<br />
402 Nordöstlich Wallings am Hozzelberg 3.350 m 2<br />
403 Nordöstlich Wallings 3.350 m 2<br />
404 Nordöstlich Wallings am Nüster-Berg 14.425 m 2<br />
405 Nordöstlich Wallings am Nüster-Berg 2.200 m 2<br />
406 Nordöstlich Wallings am Nüster-Berg 19.650 m 2<br />
407 Nördlich Wallings 16.050 m 2<br />
408 Südwestlich Schwarzbach zw. Schröcksküppel u. Ulrichshauk 2.100 m 2<br />
409 Grubenwasser nordöstlich Obergruben 3.100 m 2<br />
410 Nördlich Danzwiesen und L3379 8.500 m 2<br />
411 Nördlich Danzwiesen und L3379 2.100 m 2<br />
412 Nordwestlich Danzwiesen und nördlich Milseburg 9.950 m 2<br />
413 Nördlich Danzwiesen 525 m 2<br />
414 Nördlich Danzwiesen 4.500 m 2<br />
415 Östlich Danzwiesen 28.575 m 2<br />
416 Östlich Danzwiesen 3.250 m 2<br />
417 Östlich Danzwiesen 1.675 m 2<br />
418 Östlich Danzwiesen 6.725 m 2<br />
419 Östlich Danzwiesen 13.225 m 2<br />
420 Südöstlich Danzwiesen 12.400 m 2<br />
421 Südlich Danzwiesen 42.075 m 2<br />
422 Südlich Danzwiesen 12.950 m 2<br />
423 Südlich Danzwiesen 12.325 m 2<br />
424 Südwestlich Danzwiesen an NSG „Milseburg“ 26.100 m 2<br />
425 Südwestlich Danzwiesen an NSG „Milseburg“ 18.450 m 2<br />
426 Waldwiese südlich Milseburg 9.100 m 2<br />
427 Osthang im oberen Biebertal südöstlich Kleinsassen 9.850 m 2<br />
428 Nordöstlich Öchenbach und nordwestlich NSG „Stellberg“ 5.250 m 2<br />
429 Hang östlich Danzwiesen 725 m 2<br />
430 Hang östlich Danzwiesen 1.350 m 2<br />
Summe: 31 352.975<br />
m 2
<strong>Landschaftsplan</strong> <strong>Hofbieber</strong> Seite - 115 -<br />
-Entwicklung und Massnahmen-<br />
Magerrasen auf Kalkgestein:<br />
Extensive Nutzung auf trockenen Grünlandstandorten durch Schaf- / Ziegenbeweidung;<br />
alternativ maschinelle Offenhaltung / Pflege.<br />
TABELLE-NR. 30: „ENTWICKLUNGSFLÄCHEN: MAGERRASEN AUF KALKGESTEIN“<br />
Einzelbiotop-Nr. Lage Größe<br />
500 Westlich Boxberg 16.625 m 2<br />
501 Südöstlich <strong>Hofbieber</strong>, westlich Hessenliede 2.975 m 2<br />
502 Südöstlich <strong>Hofbieber</strong>, westlich Hessenliede 3.750 m 2<br />
503 Nordwestlicher Schnurberg 2.725 m 2<br />
504 Westlicher Schnurberg 1.750 m 2<br />
505 Waldwiese im oberen Mambachtal 30 m 2<br />
506 Nordöstlich Öchenbach 4.000 m 2<br />
Summe: 7 31.855 m 2<br />
Magerrasen auf Basaltgestein:<br />
Extensive Nutzung auf trockenen Grünlandstandorten durch Schaf- / Rinderbeweidung;<br />
alternativ maschinelle Offenhaltung / Pflege.<br />
TABELLE-NR. 31: „ENTWICKLUNGSFLÄCHEN: MAGERRASEN AUF BASALTGESTEIN“<br />
Einzelbiotop-Nr. Lage Größe<br />
600 Stöcksküppel nordwestlich Schwarzbach 2.425 m 2<br />
601 Schröcksküppel westlich Schwarzbach 1.675 m 2<br />
602 Ulrichshauk südwestlich Schwarzbach 6.925 m 2<br />
603 Ulrichshauk südwestlich Schwarzbach 5.300 m 2<br />
604 Kirchberg südlich Langenberg 9.550 m 2<br />
605 Kleiner Gruben südlich Obergruben 6.100 m 2<br />
Summe: 6 31.975 m 2<br />
Borstgrasrasen:<br />
Extensive Nutzung auf trockenen Grünlandstandorten durch Schaf- / Rinderbeweidung;<br />
alternativ maschinelle Offenhaltung / Pflege.<br />
TABELLE-NR. 32: „ENTWICKLUNGSFLÄCHEN: BORSTGRASRASEN“<br />
Einzelbiotop-Nr. Lage Größe<br />
700 Osthang der Milseburg 20.175 m 2<br />
701 Osthang der Milseburg 7.925 m 2<br />
702 Hang östlich Danzwiesen 1.900 m 2
<strong>Landschaftsplan</strong> <strong>Hofbieber</strong> Seite - 116 -<br />
-Entwicklung und Massnahmen-<br />
Einzelbiotop-Nr. Lage Größe<br />
703 Osthang im Oberlauf der Bieber südlich Kleinsassen 5.150 m 2<br />
704 Östlich Öchenbach 450 m 2<br />
705 Östlich Öchenbach 850 m 2<br />
706 Östlich Öchenbach 400 m 2<br />
707 Östlich Steens nahe Parkplatz 800 m 2<br />
Summe: 8 37.650 m 2<br />
Trockene Hochstaudenflur:<br />
Offenhalten von Brachflächen auf trockenen Standorten, ggf. Durchführung von<br />
abschnittsweisen Entbuschungsmassnahmen, periodische Mahd auf ausgewählten<br />
Standorten.<br />
TABELLE-NR. 33: „ENTWICKLUNGSFLÄCHEN: TROCKENE HOCHSTAUDENFLUR“<br />
Einzelbiotop-Nr. Lage Größe<br />
800 Farrod 1.900 m 2<br />
801 Nördlich Traisbach 1.500 m 2<br />
802 Steinbruch Langenberg 2.075 m 2<br />
803 Östlich <strong>Hofbieber</strong>, nordöstlich Hessenliede 18.150 m 2<br />
804 Östlich Niederbieber 1.925 m 2<br />
805 Waldwiese nördlich Oberbernhardser Höhe 3.500 m 2<br />
806 Östlich Kleinsassen in Kurve L 3379 2.675 m 2<br />
807 Nordwestlich Danzwiesen und südlich L 3379 950 m 2<br />
808 Westlich Danzwiesen 1.275 m 2<br />
809 Nördlich Obergruben 1.075 m 2<br />
810 Weihers-Mühle 650 m 2<br />
811 Nordwestlich <strong>Hofbieber</strong>, Hofberg 725 m 2<br />
812 Westlich <strong>Hofbieber</strong> südlich Hofberg 1.000 m 2<br />
813 Westlich Traisbach 1.775 m 2<br />
814 Südwestlich Steens 900 m 2<br />
815 Östlich Steens nahe Parkplatz 475 m 2<br />
816 Östlich Steens nahe Parkplatz 800 m 2<br />
Summe: 17 41.350 m 2
<strong>Landschaftsplan</strong> <strong>Hofbieber</strong> Seite - 117 -<br />
-Entwicklung und Massnahmen-<br />
Extensivgrünland:<br />
Extensive Nutzung mittlerer Grünlandstandorte durch standortangepasste Mahd u. / o.<br />
Beweidung.<br />
TABELLE-NR. 34: „ENTWICKLUNGSFLÄCHEN: SONSTIGES EXTENSIVGRÜNLAND“<br />
Einzelbiotop-Nr. Lage Größe<br />
900 Nordöstlich Boxberg 14.550 m 2<br />
901 Nordöstlich Boxberg 14.700 m 2<br />
902 Nordöstlich Boxberg 12.825 m 2<br />
903 Nördlich Boxberg 11.825 m 2<br />
904 Nördlich Boxberg 1.200 m 2<br />
905 Nördlich Boxberg 4.675 m 2<br />
906 Nördlich Boxberg 8.250 m 2<br />
907 Nördlich Boxberg 23.500 m 2<br />
908 Südöstlich Boxberg 3.750 m 2<br />
909 Südlich Boxberg 5.375 m 2<br />
910 Westlich Boxberg 30.200 m 2<br />
911 Nordöstlich Obernüst 8.325 m 2<br />
912 Nordöstlich Obernüst 17.450 m 2<br />
913 Nördlich Obernüst 10.550 m 2<br />
914 Nordwestlich Obernüst 15.050 m 2<br />
915 Nördlich Obernüst 39.825 m 2<br />
916 Nördlich Obernüst 20.425 m 2<br />
917 Nördlich Obernüst am Nüster-Berg 8.375 m 2<br />
918 Nördlich Obernüst am Nüster-Berg 3.625 m 2<br />
919 Nordöstlich Wallings 4.750 m 2<br />
920 Östlich Wallings 62.200 m 2<br />
921 Östlich Wallings 3.700 m 2<br />
922 Südöstlich Wallings 12.975 m 2<br />
923 Steinhauk südlich Obernüst 5.925 m 2<br />
924 Unter-Dörnbachshof 8.350 m 2<br />
925 Östlich Mahlerts 12.700 m 2<br />
926 Nordöstlich Mahlerts 6.925 m 2<br />
927 Nordöstlich Mahlerts 30.100 m 2<br />
928 Nördlich Mahlerts 3.150 m 2<br />
929 Nordöstlich Schwarzbach südlich L 3174 13.225 m 2<br />
930 Westlich Schwarzbach 8.450 m 2<br />
931 Westlich Schwarzbach 16.600 m 2<br />
932 Westlich Schwarzbach südlich Schröcksküppel 10.050 m 2
<strong>Landschaftsplan</strong> <strong>Hofbieber</strong> Seite - 118 -<br />
-Entwicklung und Massnahmen-<br />
Einzelbiotop-Nr. Lage Größe<br />
933 Westlich Schwarzbach südlich Schröcksküppel 7.200 m 2<br />
934 Nässe südlich L 3258 8.950 m 2<br />
935 Nässe nördlich L 3258 5.150 m 2<br />
936 Nässe nördlich L 3258 6.675 m 2<br />
937 Nässe nördlich L 3258 10.475 m 2<br />
938 Nördlich <strong>Hofbieber</strong> 11.700 m 2<br />
939 Waldwiese nördlich <strong>Hofbieber</strong> 9.675 m 2<br />
940 Waldwiese nördlich Allmus 1.900 m 2<br />
941 Nördlich Allmus 4.000 m 2<br />
942 Nordwestlich Traisbach 900 m 2<br />
943 Nordwestlich Traisbach 10.525 m 2<br />
944 Nordwestlich Traisbach 8.275 m 2<br />
945 Nördlich Traisbach 2.500 m 2<br />
946 Nordöstlich Traisbach 31.750 m 2<br />
947 Nördlich <strong>Hofbieber</strong> + L 3174 8.450 m 2<br />
948 Nördlich <strong>Hofbieber</strong> + L 3174 1.475 m 2<br />
949 Nördlich Egelmes 11.825 m 2<br />
950 Westlich Rödergrund 3.300 m 2<br />
951 Westlich Rödergrund 3.350 m 2<br />
952 Westlich Rödergrund 16.550 m 2<br />
953 Östlich Egelmes 13.425 m 2<br />
954 Nordöstlich Rödergrund 19.800 m 2<br />
955 Ulrichshauk südwestlich Schwarzbach 4.775 m 2<br />
956 Ulrichshauk südwestlich Schwarzbach 2.225 m 2<br />
957 Südöstlich Schwarzbach 27.225 m 2<br />
958 Südöstlich Schwarzbach 6.600 m 2<br />
959 Nordöstlich Langenberg 4.250 m 2<br />
960 Nordöstlich Langenberg 3.575 m 2<br />
961 Südwestlich Mahlerts 3.900 m 2<br />
962 Südwestlich Mahlerts 34.025 m 2<br />
963 Nordhang Grubenwasser nordöstlich Obergruben 7.125 m 2<br />
964 Nordhang Grubenwasser nordöstlich Obergruben 19.400 m 2<br />
965 Grubenwasser nordöstlich Obergruben 2.850 m 2<br />
966 Nordhang Grubenwasser nordöstlich Obergruben 20.375 m 2<br />
967 Nordhang Grubenwasser nordlich Obergruben 9.125 m 2<br />
968 Grubenwasser nordlich Obergruben 4.475 m 2<br />
969 Grubenwasser nordöstlich Obergruben 14.150 m 2<br />
970 Nordöstlich Obergruben nördlich K40 20.200 m 2
<strong>Landschaftsplan</strong> <strong>Hofbieber</strong> Seite - 119 -<br />
-Entwicklung und Massnahmen-<br />
Einzelbiotop-Nr. Lage Größe<br />
971 Östlich Obergruben südlich K 40 6.600 m 2<br />
972 Östlich Obergruben südlich K 40 13.325 m 2<br />
973 Nordöstlich Obergruben 9.200 m 2<br />
974 Nordöstlich Obergruben 3.225 m 2<br />
975 Nördlich Obergruben 10.975 m 2<br />
976 Westlich Obergruben 3.700 m 2<br />
977 Westlich Obergruben 4.775 m 2<br />
978 Südwestlich Obergruben 8.375 m 2<br />
979 Südwestlich Obergruben 5.100 m 2<br />
980 Südwestlich Obergruben 17.250 m 2<br />
981 Südwestlich Obergruben nördlich Kleiner Gruben 2.925 m 2<br />
982 Südlich Obergruben 7.325 m 2<br />
983 Südlich Obergruben 23.575 m 2<br />
984 Südlich Obergruben 18.500 m 2<br />
985 Südöstlich Obergruben 10.000 m 2<br />
986 Südöstlich Langenberg 4.700 m 2<br />
987 Südöstlich Langenberg am Kirchberg 2.575 m 2<br />
988 Südlich Langenberg 6.025 m 2<br />
989 Südöstlich Langenberg 2.000 m 2<br />
990 Südlich Langenberg 1.575 m 2<br />
991 Am Schweinsberg südlich Langenberg 24.300 m 2<br />
992 Am Schweinsberg südlich Langenberg 56.225 m 2<br />
993 Südlich Hahnershof 9.275 m 2<br />
994 Schweinsbach nordöstlich Wittges 44.175 m 2<br />
995 Schweinsbach nordöstlich Wittges 17.825 m 2<br />
996 Nässe westlich Wittges 5.175 m 2<br />
997 Nässe westlich Wittges 24.050 m 2<br />
998 Nordöstlich <strong>Hofbieber</strong> nördlich L 3174 10.250 m 2<br />
999 Nordöstlich <strong>Hofbieber</strong> südlich L 3174 9.500 m 2<br />
1000 Östlich <strong>Hofbieber</strong> nördlich Hessenliede 1.300 m 2<br />
1001 Östlich <strong>Hofbieber</strong> nördlich Hessenliede 5.675 m 2<br />
1002 Östlich <strong>Hofbieber</strong> nördlich Hessenliede 16.125 m 2<br />
1003 Östlich <strong>Hofbieber</strong> nördlich Hessenliede 18.200 m 2<br />
1004 Östlich <strong>Hofbieber</strong> nördlich Hessenliede 3.575 m 2<br />
1005 Östlich <strong>Hofbieber</strong> nördlich Hessenliede 4.900 m 2<br />
1006 Nordwestlich <strong>Hofbieber</strong> nördlich Hofberg 31.950 m 2<br />
1007 Südwestlich Allmus an K 11 1.575 m 2<br />
1008 Südöstlich Traisbach 12.325 m 2
<strong>Landschaftsplan</strong> <strong>Hofbieber</strong> Seite - 120 -<br />
-Entwicklung und Massnahmen-<br />
Einzelbiotop-Nr. Lage Größe<br />
1009 An Traisbach zwischen Wiesen und Mittelberg 8.675 m 2<br />
1010 Haune südwestlich Wiesen 31.900 m 2<br />
1011 Haune südwestlich Wiesen 9.300 m 2<br />
1012 Haune südwestlich Wiesen 15.875 m 2<br />
1013 Nordwestlich Schnurberg 5.600 m 2<br />
1014 Schnurberg 7.075 m 2<br />
1015 Bieber westlich Langenbieber 5.775 m 2<br />
1016 Südlich <strong>Hofbieber</strong> 17.575 m 2<br />
1017 Südöstlich <strong>Hofbieber</strong> westlich Hessenliede 2.550 m 2<br />
1018 Südöstlich <strong>Hofbieber</strong> südwestlich Hessenliede 2.550 m 2<br />
1019 Südöstlich <strong>Hofbieber</strong> südwestlich Hessenliede 6.675 m 2<br />
1020 Nordöstlich Langenbieber westlich Bieberstein 26.325 m 2<br />
1021 Östlich Langenbieber an K 21 5.525 m 2<br />
1022 Östlich Langenbieber an K 21 3.025 m 2<br />
1023 Südlich Elters westlich Steinbruch 4.500 m 2<br />
1024 Nordöstlich Elters 2.450 m 2<br />
1025 Östlich Elters 15.850 m 2<br />
1026 Östlich Elters 1.075 m 2<br />
1027 Östlich Elters nördlich K 29 12.700 m 2<br />
1028 Östlich Elters südlich K 29 3.450 m 2<br />
1029 Westlich Steens östlich Fuchsstein 6.350 m 2<br />
1030 Westlich Steens östlich Fuchsstein 2.875 m 2<br />
1031 Östlich Steens südwestlich Bomberg 6.350 m 2<br />
1032 Südöstlich Steens 7.275 m 2<br />
1033 Südöstlich Steens nordöstlich Lothar-Mai-Hütte 31.500 m 2<br />
1034 Südwestlich Steens und Lothar-Mai-Hütte 675 m 2<br />
1035 Südöstlich Steens 1.250 m 2<br />
1036 Südöstlich Steens 6.550 m 2<br />
1037 Nordwestlich Goldbachshof 2.600 m 2<br />
1038 Westlich Schackau 5.250 m 2<br />
1039 Westlich Schackau 2.050 m 2<br />
1040 Südwestlich Schackau 26.025 m 2<br />
1041 Südwestlich Schackau 1.175 m 2<br />
1042 Südlich Schackau 5.550 m 2<br />
1043 Östlich Schackau 4.875 m 2<br />
1044 Südöstlich Schackau 4.525 m 2<br />
1045 Östlich Schackau im Mambachtal 1.275 m 2<br />
1046 Östlich Schackau im Mambachtal 10.100 m 2
<strong>Landschaftsplan</strong> <strong>Hofbieber</strong> Seite - 121 -<br />
-Entwicklung und Massnahmen-<br />
Einzelbiotop-Nr. Lage Größe<br />
1047 Nordöstlich Kleinsassen 25.500 m 2<br />
1048 Nordöstlich Kleinsassen 9.775 m 2<br />
1049 Nordöstlich Kleinsassen 4.900 m 2<br />
1050 Nordöstlich Kleinsassen 1.450 m 2<br />
1051 Nordöstlicher Ortsrand Kleinsassen 6.875 m 2<br />
1052 Bieber nordwestlich Kleinsassen 9.700 m 2<br />
1053 Östlich FA Thiergarten 6.700 m 2<br />
1054 Südlich Langenbieber 1.250 m 2<br />
1055 Waldwiese am Riegelbach 13.425 m 2<br />
1056 Igelbach 9.050 m 2<br />
1057 Igelbach 11.725 m 2<br />
1058 Igelbach 500 m 2<br />
1059 Nordöstlich Öchenbach 11.950 m 2<br />
1060 Östlich Öchenbach 650 m 2<br />
1061 Nordöstlich Öchenbach 29.350 m 2<br />
1062 Südlich Vorderstellberg 14.050 m 2<br />
1063 Westlich Kleinsassen 11.400 m 2<br />
1064 Südwestlich Kleinsassen 10.550 m 2<br />
1065 Südlich Kleinsassen 12.550 m 2<br />
1066 Südlich Kleinsassen nördlich Hauenstein 8.775 m 2<br />
1067 Südlich Kleinsassen nördlich Hauenstein 27.250 m 2<br />
1068 Südlich Kleinsassen östlich Medenstein 9.050 m 2<br />
1069 Südlich Kleinsassen östlich Medenstein 3.650 m 2<br />
1070 Östlich Kleinsassen 6.550 m 2<br />
1071 Südöstlich Kleinsassen 13.350 m 2<br />
1072 Südöstlich Kleinsassen westlich Milseburg 8.850 m 2<br />
1073 Südlich Kleinsassen nördlich Hauenstein 25.075 m 2<br />
1074 Bieber südlich Kleinsassen 23.625 m 2<br />
1075 Bieber südlich Kleinsassen 1.100 m 2<br />
1076 Südlich Kleinsassen östlich Hauenstein 14.525 m 2<br />
1077 Südlich Kleinsassen und Hauenstein 2.800 m 2<br />
1078 Westlich Hinterstellberg 2.600 m 2<br />
1079 Westlich Hinterstellberg 1.075 m 2<br />
1080 Östlich Grabenhof 3.425 m 2<br />
1081 Waldwiese südlich Kleinsassen 9.675 m 2<br />
1082 Südlich Kleinsassen östlich Hauenstein 12.075 m 2<br />
1083 Oberes Biebertal südöstlich Kleinsassen 5.275 m 2<br />
1084 Oberes Biebertal südwestlich Milseburg 1.950 m 2
<strong>Landschaftsplan</strong> <strong>Hofbieber</strong> Seite - 122 -<br />
-Entwicklung und Massnahmen-<br />
Einzelbiotop-Nr. Lage Größe<br />
1085 Oberes Biebertal südwestlich Milseburg 6.850 m 2<br />
1086 Oberes Biebertal südwestlich Milseburg 12.475 m 2<br />
1087 Oberes Biebertal südlich Milseburg 23.350 m 2<br />
1088 Oberes Biebertal südlich Milseburg 17.875 m 2<br />
1089 Oberes Biebertal südlich Milseburg 21.600 m 2<br />
1090 Waldwiese im oberen Biebertal östlich Bieberweiher 2.725 m 2<br />
1091 Südwestlich Danzwiesen 34.350 m 2<br />
1092 Südwestlich Danzwiesen 26.100 m 2<br />
1093 Südwestlich Danzwiesen 12.325 m 2<br />
1094 Südöstlich Danzwiesen 4.625 m 2<br />
1095 Östlich Danzwiesen 1.550 m 2<br />
1096 Nordwestlich Danzwiesen 975 m 2<br />
1097 Nordwestlich Danzwiesen im NSG „Milseburg“ 8.775 m 2<br />
1098 Nordwestlich Danzwiesen 7.350 m 2<br />
1099 Nordwestlich Danzwiesen südlich L 3379 8.800 m 2<br />
1100 Nordwestlich Danzwiesen nördlich Liedenküppel 8.950 m 2<br />
1101 Südlich Schwarzbach 1.025 m 2<br />
1102 Südlich Schwarzbach 375 m 2<br />
1103 Grubenwasser östlich Obergruben 275 m 2<br />
1104 Grubenwasser östlich Obergruben 900 m 2<br />
1105 Westlich Traisbach 2.075 m 2<br />
1106 Nördlich Schackau 3.075 m 2<br />
1107 Oberes Biebertal südöstlich Kleinsassen 9.075m 2<br />
Summe: 208 2.196.025<br />
m 2<br />
Steinbruch, offen:<br />
Offenhalten von Steilwänden und Abbruchkanten in nicht mehr genutzten Steinbrüchen.<br />
TABELLE-NR. 35: „ENTWICKLUNGSFLÄCHEN: STEINBRUCH, OFFEN“<br />
Einzelbiotop-Nr. Lage Größe<br />
1200 Basalt, Phonolith: westl. Schwarzbach östlich Schwarzes Kreuz 1.700 m 2<br />
1201 Kalk: südlich Langenberg 3.425 m 2<br />
1202 Basalt, Phonolith: Sandberg 1.875 m 2<br />
1203 Kalk: nördlich Schackau nördlich L 3330 2.625 m 2<br />
1204 Kalk: südlich Elters 1.700 m 2<br />
1205 Kalk: Schnurberg südwestlich <strong>Hofbieber</strong> 7.350 m 2<br />
Summe: 6 18.675 m 2
<strong>Landschaftsplan</strong> <strong>Hofbieber</strong> Seite - 123 -<br />
-Entwicklung und Massnahmen-<br />
Stillgewässer, naturnah:<br />
Erhalt naturnaher Strukturen an Stillgewässern. Offenhaltung und Beseitigung<br />
unerwünschten Gehölzaufwuchses, ggf. Verzicht auf Nutzung.<br />
TABELLE-NR. 36: „ENTWICKLUNGSFLÄCHEN: STILLGEWÄSSER, NATURNAH“<br />
Einzelbiotop-Nr. Lage Größe<br />
1300 Nordöstlich Schwarzehauk 1.100 m 2<br />
1301 Nordöstlich Schwarzehauk 1.125 m 2<br />
1302 Östlich Schwarzehauk 425 m 2<br />
1303 Nordwestlich Allmus 6.925 m 2<br />
1304 Nordwestlich Allmus 950 m 2<br />
1305 Nässezufluss vom Schwarzen Kreuz 700 m 2<br />
1306 Nässezufluss vom Schwarzen Kreuz 1.175 m 2<br />
1307 Östlich Schwarzes Kreuz 400 m 2<br />
1308 Südwestlich Mahlerts 1.200 m 2<br />
1309 Nüst nordwestlich Mahlerts 675 m 2<br />
1310 Südöstlich Mahlerts 550 m 2<br />
1311 Oberlauf der Nässe östlich Elters 575 m 2<br />
1312 Wald südöstlich Elters 1.075 m 2<br />
1313 Westlich Wittges 4.375 m 2<br />
1314 Südwestlich Weihershof an K 25 3.075 m 2<br />
1315 Weihershof 2.800 m 2<br />
1316 Östlich Goldbachshof 1.350 m 2<br />
1317 Wächtersgraben südöstlich Langenbieber 850 m 2<br />
1318 Fohlenweide, Nordteich 6.500 m 2<br />
1319 Fohlenweide, Naturlehrpfad 1.775 m 2<br />
(5 Teilfl.)<br />
1320 Östlich Fohlenweide 1.200 m 2<br />
1321 Östlich Fohlenweide 1.025 m 2<br />
1322 Nordwestlich Karhof 300 m 2<br />
1323 Südwestlich Schackau benachbart zu div. Fischteichen 275 m 2<br />
1324 Riegelbach westlich FA Thiergarten 1.000 m 2<br />
1325 Riegelbach westlich FA Thiergarten 1.700 m 2<br />
1326 Riegelbach westlich FA Thiergarten 700 m 2<br />
1327 Riegelbach nordwestlich FA Thiergarten 1.375 m 2<br />
Summe: 32 45.175 m 2
<strong>Landschaftsplan</strong> <strong>Hofbieber</strong> Seite - 124 -<br />
-Entwicklung und Massnahmen-<br />
TABELLE-NR. 37: „ENTWICKLUNGSFLÄCHEN: ZUSAMMENFASSUNG“<br />
Biotoptyp / Nutzung Gesamtfläche<br />
in ca. ha<br />
Anzahl der<br />
Flächen<br />
Durchschnittsgröße<br />
in ca. ha<br />
keine Pflegemassnahmen,<br />
ggf.<br />
Prozessschutz<br />
Besondere Laubwaldbereiche * 13 �<br />
Erlenbruchwald und<br />
Erlenhutewald<br />
Summe Waldflächen<br />
3,73 9 0,41 �<br />
Offenhalten, ggf.<br />
Zurückdrängen<br />
von Gehölzen<br />
extensive<br />
Grünlandnutzung<br />
Landschaftspflege<br />
**<br />
Feuchte Hochstaudenflur 5,57 23 0,24 � � ***<br />
Trockene Hochstaudenflur 4,14 17 0,24 �<br />
Summe Brachflächen 9,71<br />
Grünland extensiver Nutzung 219,60 208 1,06 �<br />
Feuchtgrünland 11,92 63 0,19 � �<br />
Goldhaferwiese 35,30 31 1,14 � ( � )<br />
Kalkmagerrasen 3,19 7 0,46 �<br />
Basaltmagerrasen 3,20 6 0,53 �<br />
Borstgrasrasen 3,77 8 0,47 �<br />
Summe Grünlandflächen 276,98<br />
Steinbruch, offen 1,87 6 0,31 �<br />
Summe Steinbrüche 1,87<br />
Stillgewässer, naturnah 4,52 32 0,14 �<br />
Summe Stillgewässerflächen 4,52<br />
* = sonstige Waldflächen sind nicht quantifiziert ** = unter Beachtung u.a. der Bodenverhältnisse und Vorkommen von Pflanzen- und Tierarten:<br />
Mahd (Traktor / Spezialgerät) bzw. standortangepasste Beweidung mit entspr. Beweidungszeiten<br />
*** = östlich von Danzwiesen
<strong>Landschaftsplan</strong> <strong>Hofbieber</strong> Seite - 125 -<br />
-Entwicklung und Massnahmen-<br />
6.3.1.2 Linienhafte Biotoptypen u./o. Strukturen<br />
Lineare Gehölzbestände<br />
Gehölzbestände, vor allem Hecken und Ufergehölze trocken-frischer bis feucht-nasser<br />
Standorte, die sich durch linienhafte Ausprägungen charakterisieren lassen sind durch<br />
fachgerechte Pflegemassnahmen zu erhalten. Hierzu zählt u.a. ein artgerechter<br />
Gehölzschnitt, ggf. auch ein abschnittsweises „auf-den-Stock-setzen“.<br />
Lineare Krautsäume<br />
Kraut- und Staudensäume, vor allem in Verbindung mit Hecken- und Ufergehölzen<br />
sowie entlang von Wegen, Gewässern und Grundstücksgrenzen, sind durch<br />
fachgerechte Pflegemassnahmen zu erhalten. Hierzu zählt die Entwicklung mehrjähriger<br />
Bestände, die abschnittsweise zu mähen oder zu mulchen sind.<br />
6.3.1.3 Punktuelle Biotoptypen u./o. Strukturen<br />
Punktuelle Gehölzbestände<br />
Gehölzbestände, hier vor allem Laub- und Obstbäume im Einzelstand, in der Gruppe<br />
oder als Baumreihe, ggf. auch als Allee, sind durch fachgerechte Pflegemassnahmen zu<br />
erhalten. Hierzu zählt u.a. der artgerechte Gehölzschnitt, Kronenpflege an Obstgehölzen<br />
sowie ggf. habitus- und artgerechte Verkehrssicherungsmassnahmen an Bäumen.<br />
Sonstige kleinräumige Biotope und Strukturen<br />
Kleinräumige Biotope und Strukturen, wie Steinwände, Gesteinsbiotope,<br />
Reliefausprägungen und Quellen sind vor allem durch Schutz- und Sicherungsmassnahmen<br />
zu erhalten.
<strong>Landschaftsplan</strong> <strong>Hofbieber</strong> Seite - 126 -<br />
-Entwicklung und Massnahmen-<br />
6.3.2 Neuanlagen und Nutzungsänderungen<br />
6.3.2.1 Waldneuanlage<br />
Die innerhalb des <strong>Gemeinde</strong>gebietes <strong>Hofbieber</strong> gemäß Regionalplan Nordhessen 2000<br />
vorgesehenen Aufforstungsflächen wurden einer landschaftsplanerischen und<br />
landwirtschaftlichen Bewertung unterzogen, wobei Flächen nicht für eine Aufforstung<br />
vorzusehen sind, wenn ...<br />
... naturschutzfachlich wertvolle Biotopstrukturen und -elemente betroffen werden,<br />
... eine Beeinträchtigung des kulturhistorisch gewachsenen Landschaftsbildes<br />
zu erwarten ist,<br />
... landwirtschaftlich nutzbare Flächen in Anspruch genommen werden oder die weitere<br />
landwirtschaftliche Nutzung erschwert wird.<br />
TABELLE-NR. 38: „GEPLANTE AUFFORSTUNGSFLÄCHEN“<br />
Gepl. Aufforstungsfläche<br />
gem. Flächennutzungsplan<br />
aus landschaftsplanerischer Sicht<br />
...<br />
aus landwirtschaftlicher Sicht<br />
...<br />
akzeptabel problematisch akzeptabel problematisch<br />
nördlich Traisbach Teilflächen Teilflächen �<br />
nordwestlich Wiesen � �<br />
nördlich Allmus � �<br />
östlich Allmus ( Farrod ) Teilflächen � �<br />
südwestlich Rödergrund Teilflächen Teilflächen �<br />
südöstlich Rödergrund � �<br />
nördlich Rödergrund � �<br />
östlich Wittges � �<br />
zwischen Niederbieber und<br />
<strong>Hofbieber</strong><br />
Teilflächen Teilflächen �<br />
südlich Wiesen � �<br />
südlich Niederbieber � �<br />
südlich Langenbieber � �<br />
südöstlich Elters � �<br />
südwestlich Elters � �<br />
südwestlich Steens � �<br />
östlich Kleinsassen � �
<strong>Landschaftsplan</strong> <strong>Hofbieber</strong> Seite - 127 -<br />
-Entwicklung und Massnahmen-<br />
6.3.2.2 Anpflanzung standortgerechter Gehölze<br />
Innerhalb des <strong>Gemeinde</strong>gebietes <strong>Hofbieber</strong> werden folgende Neu - Anpflanzungen mit<br />
standortgerechten Gehölzen empfohlen:<br />
TABELLE-NR. 39: „ANPFLANZUNG STANDORTGERECHTER GEHÖLZE“<br />
Lfd.-<br />
Nr.<br />
Lage Gepl. Massnahme<br />
P - 1 entlang der L 3174, zwischen Obernüst und<br />
Nüsterrasen<br />
P - 2 entlang der L 3258 von Ortsrand <strong>Hofbieber</strong><br />
(Abzw. L 3174) in Richtung Morles<br />
P - 3 im Bereich der K 4 im Ortseingangsbereich<br />
Traisbach<br />
P - 4 entlang der K 4 zwischen Traisbach und<br />
Allmus<br />
P - 5 entlang der L 3330 zwischen Wolferts und<br />
Kleinsassen<br />
6.3.2.3 Nutzungsänderungen<br />
Pflanzung straßenbegleitender Laubbäume,<br />
ggfs. beidseitig als Allee<br />
abschnittweise Pflanzung standortgerechter<br />
Obstbäume<br />
Pflanzung markanter Laubbäume zur<br />
Markierung der Ortseingangssituation<br />
Pflanzung straßenbegleitender Laubbäume,<br />
ggfs. beidseitig als Allee<br />
abschnittweise Pflanzung straßenbegleitender<br />
Laubbäume<br />
Innerhalb der Fließgewässer - Auenbereiche wird eine Änderung der Nutzungsform<br />
empfohlen. Bisher intensiv genutzte Ackerflächen sollten zukünftig als Dauergrünland<br />
genutzt werden. Hierbei handelt es sich um Ackerflächen westlich Allmus, westlich<br />
Niederbieber, südlich Weihershof, südwestlich Elters, hier südlich der K 29.<br />
Nach Abstimmung mit den Ortslandwirten wurden die betroffenen Flächen auf die<br />
unmittelbaren Uferbereiche in ca. 10 – 20 m Ausdehnung reduziert.<br />
TABELLE-NR. 40: „NUTZUNGSÄNDERUNGEN: ACKER IN GRÜNLAND IN BACHAUEN“<br />
Lfd.-<br />
Nr.<br />
Lage Größe<br />
U 1 Westlich Obernüst 1.775 m 2<br />
U 2 Nordwestlich Mahlerts 2.750 m 2<br />
U 3 Oberes Birkenbachtal 450 m 2<br />
U 4 Südlich Weihershof 1.850 m 2<br />
U 5 Südlich Weihershof 4.600 m 2<br />
U 6 Südlich Weihershof 9.350 m 2<br />
U 7 Südlich Weihershof 5.450 m 2<br />
U 8 Südlich Weihershof 2.350 m 2<br />
U 9 Südlich Weihershof 2.875 m 2<br />
U 10 Südlich Weihershof 5.500 m 2<br />
U 11 Südlich Weihershof 3.350 m 2
<strong>Landschaftsplan</strong> <strong>Hofbieber</strong> Seite - 128 -<br />
-Entwicklung und Massnahmen-<br />
Lfd.-<br />
Nr.<br />
Lage Größe<br />
U 12 Nördlich Egelmes 2.600 m 2<br />
U 13 Westlich Rödergrund 800 m 2<br />
U 14 Südlich Rödergrund 1.650 m 2<br />
U 15 Nördlich Egelmes 2.750 m 2<br />
U 16 Südwestlich Egelmes 3.400 m 2<br />
U 17 Südwestlich Egelmes 3.825 m 2<br />
U 18 Südöstlich Bieberstein 2.750 m 2<br />
U 19 Südöstlich Bieberstein 3.350 m 2<br />
U 20 Südöstlich Langenbieber 450 m 2<br />
U 21 Östlich Niederbieber 4.275 m 2<br />
U 22 Östlich Niederbieber 6.350 m 2<br />
U 23 Östlich Niederbieber 500 m 2<br />
U 24 Östlich Niederbieber 700 m 2<br />
U 25 Nordöstlich Niederbieber 1.100 m 2<br />
U 26 Nordöstlich Niederbieber 2.475 m 2<br />
U 27 Nordöstlich Niederbieber 500 m 2<br />
U 28 Nordöstlich Niederbieber 400 m 2<br />
U 29 Nordwestlich Niederbieber 1.975 m 2<br />
U 30 Nordwestlich Niederbieber 8.750 m 2<br />
U 31 Nordwestlich Wiesen 800 m 2<br />
U 32 Östlich Traisbach 3.650 m 2<br />
U 33 Östlich Traisbach 16.350 m 2<br />
U 34 Östlich Traisbach 200 m 2<br />
U 35 Westlich Traisbach 1.250 m 2<br />
U 36 Westlich Allmus 1.200 m 2<br />
U 37 Westlich Allmus 9.000 m 2<br />
U 38 Westlich Allmus 1.250 m 2<br />
U 39 Westlich Allmus 10.100 m 2<br />
U 40 Östlich Allmus 1.000 m 2<br />
U 41 Östlich Allmus 4.000 m 2<br />
U 42 Nordwestlich Allmus 4.100 m 2<br />
U 43 Nordwestlich Allmus 8.900 m 2<br />
U 44 Nordwestlich Allmus 2.200 m 2<br />
U 45 Nördlich Allmus 3.950 m 2<br />
U 46 Nördlich Allmus 650 m 2<br />
Summe: 157.500<br />
m 2
<strong>Landschaftsplan</strong> <strong>Hofbieber</strong> Seite - 129 -<br />
-Entwicklung und Massnahmen-<br />
Darüber hinaus sollten die ausgedehnten Ackerflächen innerhalb des ausgewiesenen<br />
Wasserschutzgebietes Wittges, hier östlich und westlich der K 28, in Dauergrünland<br />
umgewandelt werden.<br />
TABELLE-NR. 41: „NUTZUNGSÄNDERUNGEN: ACKER IN GRÜNLAND IM WASSERSCHUTZGEBIET WITTGES“<br />
Lfd.-<br />
Nr.<br />
Lage Größe<br />
U 47 Nördlich der K 27 (1 Teilbereich) 5.600 m 2<br />
U 48 Südlich der K 27 und nordwestlich der K 28 (6 Teilbereiche) 65.375 m 2<br />
U 49 Östlich der K 28 (4 Teilbereiche) 52.875 m 2<br />
Summe: 123.850<br />
m 2<br />
Angrenzend an sensible Biotopbereiche sollten Ackerflächen in Grünland umgewandelt<br />
werden.<br />
TABELLE-NR. 42: „NUTZUNGSÄNDERUNGEN: ACKER ANGRENZEND AN SENSIBLE BIOTOPBEREICHE“<br />
Lfd.-<br />
Nr.<br />
Lage Größe<br />
U 50 Nordöstlich Boxberg 9.900 m 2<br />
U 51 Nordöstlich Boxberg 10.000 m 2<br />
U 52 Hessenlieder südwestlich <strong>Hofbieber</strong> 750 m 2<br />
U 53 Östlich Öchenbach 10.600 m 2<br />
U 54 Östlich Danzwiesen 7.575 m 2<br />
Summe: 38.825 m 2
<strong>Landschaftsplan</strong> <strong>Hofbieber</strong> Seite - 130 -<br />
-Entwicklung und Massnahmen-<br />
6.3.3 Beseitigung und Minimierung von Beeinträchtigungen des<br />
Naturhaushaltes und Landschaftsbildes<br />
Nachfolgend werden bestehende Belastungen und Beeinträchtigungen des<br />
Naturhaushaltes und Landschaftsbildes innerhalb des Genmeindegebietes <strong>Hofbieber</strong><br />
benannt und Massnahmen zur Beseitigung oder aber Minmierung aufgezeigt:<br />
6.3.3.1 Altlasten, Altlastenverdachtsflächen<br />
Die Verdachtsflächen für evtl. Altlasten sind auf deren Inhalte zu untersuchen und zu<br />
überprüfen, ggfs. zu beseitigen und die betroffenen Flächen anschließend zu<br />
rekultivieren bzw. zu renaturieren:<br />
TABELLE-NR. 43: „ALTLASTEN, ALTLASTENVERDACHTSFLÄCHEN“<br />
Lfd. Nr. Lage der Verdachtsfläche<br />
A - 1 nördlich Boxberg<br />
A - 2 südlich Obernüst<br />
A - 3 östlich Schwarzbach<br />
A - 4 östlich Langenberg<br />
A - 5 südlich Gickershauk<br />
A - 6 nördlich Traisbach<br />
A - 7 westlich Kleinsassen<br />
A - 8 südl. Elters<br />
6.3.3.2 Erosion<br />
In den nachfolgend genanten Bereichen werden Massnahmen empfohlen, die die hier<br />
bestehenden Erosionsgefährdungen mindern und ggfs. bestehende Erosionserscheinungen<br />
beseitigen, hier vor allem<br />
• eine hangparallele Bewirtschaftung,<br />
• möglichst vielseitige Fruchtfolgen mit Zwischenfruchtanbau,<br />
• eine Verbesserung der Bodenstruktur hinsichtlich Humus- und Basengehalt,<br />
• die Beseitigung und Vermeidung von Bodenverdichtungen,<br />
• eine Begrenzung der Hanglängen,<br />
• eine Gliederung der gefährdeten und betroffenen Flächen durch die Anlage von<br />
Gehölzstreifen, Rainen und Gräben.
<strong>Landschaftsplan</strong> <strong>Hofbieber</strong> Seite - 131 -<br />
-Entwicklung und Massnahmen-<br />
TABELLE-NR. 44: „POT. EROSIONSGEFÄHRDUNGEN“<br />
Lfd. Nr. Betr. Flächen<br />
E - 1 Mitteldörmbachshof<br />
E - 2 nordwestlich Schwarzbach<br />
E - 3 östlich Schwarzbach<br />
E - 4 südwestlich Rödergrund<br />
E - 5 nördlich Elters<br />
E - 6 südlich Wiesen<br />
E - 7 südlich Niederbieber, südwestlich Langenbieber<br />
E - 8 nördlich Wittges<br />
E - 9 nördlich Egelmes in Nässeaue<br />
E - 10 nördlich Allmus<br />
6.3.3.3 Deponien<br />
Bei den innerhalb des <strong>Gemeinde</strong>gebietes <strong>Hofbieber</strong> vorhandenen Deponien handelt es<br />
sich um Lagerungen von unbelastetem Erdaushub.<br />
Die betr. Flächen sind nach Beendigung der Lagerungstätigkeit zu renaturieren und<br />
einer Folgenutzung zuzuführen.<br />
TABELLE-NR. 45: „DEPONIEN“<br />
Lage Gepl. Folgenutzung, Rekultivierungsziel Gepl. Massnahme<br />
südlich Wiesen Landwirtschaft - Verfüllung unter Berücksichtigung von<br />
Schnurberg<br />
nordwestlich<br />
Langenbieber<br />
nordwestlich<br />
<strong>Hofbieber</strong><br />
Topographie und Exposition,<br />
- Bodenverbessernde Massnahmen zur<br />
landwirtschaftlichen Nutzung<br />
Landwirtschaft, Naturschutz - Verfüllung unter Berücksichtigung von<br />
Topographie und Exposition,<br />
Beibehaltung von Steilwandrelikten und<br />
anderen Biotopstrukturen eines<br />
Steinbruches<br />
- Bodenverbessernde Massnahmen zur<br />
landwirtschaftlichen Nutzung<br />
Landwirtschaft - Verfüllung unter Berücksichtigung von<br />
Topographie und Exposition<br />
- Bodenverbessernde Massnahmen zur<br />
landwirtschaftlichen Nutzung
<strong>Landschaftsplan</strong> <strong>Hofbieber</strong> Seite - 132 -<br />
-Entwicklung und Massnahmen-<br />
6.3.3.4 Gewässerverbau<br />
Zur Schaffung und Wiederherstellung der Vielfältigkeit und des Strukturreichtums<br />
sowie der offenen biologischen Durchgängigkeit der Fließgewässer innerhalb des<br />
<strong>Gemeinde</strong>gebietes werden RückbauMassnahmen an folgenden Gewässern<br />
vorgeschlagen:<br />
TABELLE-NR. 46: „GEWÄSSERVERBAU“<br />
Lfd. Nr. Lage Gepl. Massnahme<br />
G - 1 Traisbachzulauf südwestlich der<br />
Ortslage Traisbach<br />
Gewässeröffnung, Beseitigung der bestehenden<br />
Verrohrung, Renaturierung der Linienführung<br />
G - 2 Traisbach, Oberlauf Beseitigung des Querbauwerkes<br />
G - 3 Traisbachzulauf, östlich der<br />
Ortslage Allmus<br />
G - 4 Bieberzulauf, nördlich der<br />
Ortslage Niederbieber<br />
Renaturierung der Linienführung, Beseitigung des<br />
Querbauwerkes<br />
Renaturierung der Linienführung, Beseitigung des<br />
Querbauwerkes<br />
G - 5 Bieber, östl. Wiesen Beseitigung des Querbauwerkes<br />
G - 6 Bieber, östl. Niederbieber Gewässeröffnung, Beseitigung der besteh. Verrohrung<br />
G - 7 Bieber, Ortslage Langenbieber Beseitigung des Querbauwerkes<br />
G - 8 Bieber, Ortslage Kleinsassen Gewässeröffnung, Beseitigung der besteh. Verrohrung<br />
G - 9 Bieberzulauf Richtung Grabenhof Beseitigung des Querbauwerkes<br />
G - 10 Mambach, südlich Ortslage<br />
Schackau<br />
Gewässeröffnung, Beseitigung der bestehenden<br />
Verrohrung<br />
G - 11 Mambach, Oberlauf Beseitigung des Querbauwerkes<br />
G - 12 Igelbach Beseitigung des Querbauwerkes<br />
G - 13 Bieberzulauf, Fohlenweide Gewässeröffnung, Beseitigung der bestehenden<br />
Verrohrung, Beseitigung der Querbauwerke<br />
G - 14 Nässe, Oberlauf Beseitigung des Querbauwerkes, Renaturierung des<br />
begradigten Gewässerverlaufes<br />
G - 15 Nässezulauf, Ortslage Elters Gewässeröffnung, Beseitigung der bestehenden<br />
Verrohrung<br />
G - 16 Nässe, zwischen Weihershof und<br />
Wittges<br />
Beseitigung des Querbauwerkes<br />
G - 17 Nässezulauf, südlich Rödergrund Beseitigung des Querbauwerkes<br />
G - 18 Schweinsbach, Oberlauf Gewässeröffnung, Beseitigung der bestehenden<br />
Verrohrung<br />
G - 19 Birkenbach, Oberlauf Beseitigung des Querbauwerkes<br />
G - 20 Birkenbach, Mittellauf Beseitigung des Querbauwerkes<br />
G - 21 Schwarzbach, Ortslage<br />
Schwarzbach, südl. der Ortslage<br />
Gewässeröffnung, Beseitigung der bestehenden<br />
Verrohrung<br />
G - 22 Nüstzulauf, Hausarmen Renaturierung der Linienführung<br />
G - 23 Grubenwasser, Ortslage<br />
Obergruben<br />
G - 24 Schwarzbach, nördlich Ortslage<br />
Schwarzbach<br />
Gewässeröffnung, Beseitigung der bestehenden<br />
Verrohrung<br />
Beseitigung des Querbauwerks
<strong>Landschaftsplan</strong> <strong>Hofbieber</strong> Seite - 133 -<br />
-Entwicklung und Massnahmen-<br />
Lfd. Nr. Lage Gepl. Massnahme<br />
G - 25 Nässe, südlich Ortslage Wittges Beseitigung des Querbauwerks<br />
G - 26 Traisbachzulauf, Ortslage Allmus Gewässeröffnung, Beseitigung der bestehenden<br />
Verrohrung<br />
G - 27 Traisbachzulauf am Sportplatz<br />
zwischen Traisbach und Wiesen<br />
G - 28 Bieber und Zuläufe in<br />
Niederbieber um am Ortsrand von<br />
Niederbieber<br />
G - 29 Bieber unterhalb der<br />
Hählingsmühle<br />
Veränderung der Linienführung, Gewässeröffnung,<br />
Beseitigung der bestehenden Verrohrung<br />
Beseitigung der Querbauwerke<br />
Beseitigung des Querbauwerks<br />
G - 30 Goldbach am Goldbachshof Gewässeröffnung, Renaturierung der Linienführung<br />
G - 31 Bieberzuflüsse nördlich von<br />
Schackau<br />
Beseitigung der Querbauwerke<br />
G - 32 Bieber südlich von Kleinsassen Beseitigung des Querbauwerks<br />
6.3.3.5 Gewässergüte<br />
Zur Verbesserung der Wasserqualität der Fließgewässer sind in folgenden Bereichen die<br />
Abwassereinleitungen zu vermeiden:<br />
TABELLE-NR. 47: „GEWÄSSERGÜTE“<br />
Lfd. Nr. Lage<br />
G - 33 Grubenwasser, Ortslage Obergruben<br />
G - 34 Nüstzulauf, Ortslage Langenberg<br />
G - 35 Traisbachzulauf, östlich der Ortslage Allmus<br />
6.3.3.6 Aufforstung in sensiblen Bereichen<br />
Eine Aufforstung südöstlich der Ortslage Kleinsassen sollte aufgrund des hier bestehen<br />
sensiblen Bereiches (Borstgrasrasenrest) entfernt werden.<br />
6.3.3.7 Intensive Weidenutzung<br />
Auf nachfolgenden Flächen wird eine intensive Weidenutzung mit einer teilweisen<br />
Zerstörung und Beseitigung der Vegetationsdecke betrieben. Der <strong>Landschaftsplan</strong><br />
empfiehlt die betroffenen Flächen zu sanieren, insbesondere die vollständige<br />
Vegetationsdecke durch Ansaat wieder herzustellen und die Weidenutzung an die<br />
standörtlichen Gegebenheiten anzupassen. Eine Übernutzung sollte zukünftig<br />
vermieden werden. Für die Bereiche Hessenliede und Milseburg sind Extensivierungen<br />
vorzunehmen.
<strong>Landschaftsplan</strong> <strong>Hofbieber</strong> Seite - 134 -<br />
-Entwicklung und Massnahmen-<br />
TABELLE-NR. 48: „INTENSIVE WEIDENUTZUNG“<br />
Lfd. Nr. Lage<br />
W - 1 Bereich Öchenbach<br />
W - 2 Bereich Martesgrund, südlich Elters<br />
W - 3 Bereich Rasenmühle, westlich Niederbieber<br />
W - 4 Bereich südlich Ortslage Schwarzbach<br />
W - 5 Bereich Oberdörnbachshof<br />
W - 6 Bereich Hessenliede<br />
W - 7 Bereich Milseburg<br />
W - 8 Nordwestlich Rödergrund<br />
6.3.3.8 Intensive Mahdnutzung<br />
Auf nachfolgenden Flächen wird eine intensive Mahdnutzung betrieben. Der<br />
<strong>Landschaftsplan</strong> empfiehlt, die Nutzung auf den betroffenen Flächen unter<br />
Berücksichtigung des angestrebten Vegetationsbildes zu extensivieren.<br />
TABELLE-NR. 49: „INTENSIVE MAHDNUTZUNG“<br />
Lfd. Nr. Lage<br />
M - 1 Milseburg<br />
M - 2 Schackenbergshof südöstlich Schackau<br />
M - 3 nördlich Obergruben<br />
M - 4 nördlich Egelmes in Nässeaue<br />
6.3.3.9 nicht standortgerechte Gehölze<br />
Nicht standortgerechte Gehölze, hier vor allem Nadelgehölze, sollten durch<br />
standortgerechte Gehölze ersetzt werden. Im unmittelbaren Uferbereich der<br />
Fließgewässer wird die Anpflanzung von Erlen empfohlen, wobei einzelne<br />
Uferabschnitte dabei auch von Gehölzpflanzungen freizuhalten sind.<br />
TABELLE-NR. 50: „NICHT STANDORTGERECHTE GEHÖLZE“<br />
Lfd. Nr. Lage<br />
F - 1 Schwarzbach, nördlich der Ortslage Schwarzbach<br />
F - 2 Birkenbach<br />
F - 3 Nüstzulauf, nordöstlich der Ortslage Langenberg<br />
F - 4 Nässe, nördlich Ortslage Egelmes<br />
F - 5 Schweinsbach, östl. der Ortslage Wittges<br />
F - 6 Riegelbach
<strong>Landschaftsplan</strong> <strong>Hofbieber</strong> Seite - 135 -<br />
-Entwicklung und Massnahmen-<br />
Lfd. Nr. Lage<br />
F - 7 Goldbach, Oberlauf<br />
F - 8 Bieber, südlich der Ortslage Kleinsassen<br />
F - 9 Traisbachzulauf, Ortsrand Allmus<br />
F - 10 Traisbachzulauf östlich der Ortslage bis K 11<br />
6.3.3.10 Verkehrsweg innerhalb von Amphibien-Lebensräumen<br />
An folgenden Verkehrswegen wird die Durchführung von<br />
Amphibienschutzmassnahmen empfohlen:<br />
• L 3379 im Bereich Thiergarten<br />
• L 3258 Richtung Armenhof<br />
• K 21 im Bereich Fohlenweide<br />
6.3.3.11 Sonstige Belastungen und Beeinträchtigungen<br />
• K 25 und K 26 im Bereich<br />
Weihershof / Bieberstein<br />
Im Bereich des Stellberges sowie am Nüster Berg nördlich der Ortslage Obernüst, ist<br />
die Wegeführung (Beschilderung) der hier vorh. Wanderwege zu überprüfen. Ggfs. ist<br />
eine alternative Wegeführung außerhalb der sensiblen Biotopstrukuren auszuschildern.<br />
Nördlich der Ortslage Steens ist die Einzäunung eines sensiblen Biotopbereiches<br />
zurückzubauen bzw. zu beseitigen.
<strong>Landschaftsplan</strong> <strong>Hofbieber</strong> Seite - 136 -<br />
-Entwicklung und Massnahmen-<br />
6.3.4 Allgemeine Handlungsempfehlungen<br />
6.3.4.1 Ortsrandgestaltung<br />
Für nachfolgend benannte Ortslagen wird in Teilbereichen eine Gestaltung des<br />
Ortsrandes empfohlen, wobei es sich hier sowohl um bereits bestehende Bebauung am<br />
Ortsrand als auch um geplante Siedlungsflächenerweiterungen handelt:<br />
TABELLE-NR. 51: „ORTSRANDGESTALTUNG“<br />
Lfd. Nr. Lage Gepl. Massnahme<br />
O - 1 nördl. Ortslage Schwarzbach Heckenpflanzung zur Begrenzung der gepl.<br />
Siedlungsflächenerweiterung und Übergang zur freien<br />
Landschaft<br />
O - 2 westl. Ortslage Schwarzbach Anlage einer Streuobstwiese zur Begrenzung der gepl.<br />
Siedlungsflächenerweiterung und Übergang zur freien<br />
Landschaft<br />
O - 3 östl. bzw. südöstl. Ortslage<br />
Schwarzbach<br />
Heckenpflanzung zur Begrenzung der gepl.<br />
Siedlungsflächenerweiterung und Übergang zur freien<br />
Landschaft<br />
O - 4 östl. der Ortslage Egelmes Ergänzung vorh. Gehölzstrukturen, Eingrünung vorh.<br />
Bebauung<br />
O - 5 westl. Ortslage Rödergrund Anlage einer Streuobstwiese zur Begrenzung der gepl.<br />
Siedlungsflächenerweiterung und Übergang zur freien<br />
Landschaft<br />
O - 6 östl. Ortslage Rödergrund Ergänzung vorh. Gehölzstrukturen, Eingrünung vorh.<br />
Bebauung<br />
O - 7 nördl. Ortslage Allmus Heckenpflanzung zur Begrenzung der gepl.<br />
Siedlungsflächenerweiterung und Übergang zur freien<br />
Landschaft<br />
O - 8 östl. Ortslage Allmus Heckenpflanzung zur Begrenzung der gepl.<br />
Siedlungsflächenerweiterung und Übergang zur freien<br />
Landschaft<br />
O - 9 südlich Ortslage Allmus Anlage einer Streuobstwiese zur Begrenzung der gepl.<br />
Siedlungsflächenerweiterung und Übergang zur freien<br />
Landschaft<br />
O - 10 westlich Ortslage Allmus Anlage einer Streuobstwiese zur Begrenzung der gepl.<br />
Siedlungsflächenerweiterung und Übergang zur freien<br />
Landschaft<br />
O - 11 nördlich Ortslage <strong>Hofbieber</strong> Heckenpflanzung zur Begrenzung der gepl.<br />
Siedlungsflächenerweiterung und Übergang zur freien<br />
Landschaft<br />
O - 12 westlich Ortslage <strong>Hofbieber</strong> Ergänzung vorh. Gehölzstrukturen, Eingrünung vorh.<br />
Bebauung<br />
O - 13 südlich bzw. südöstlich Ortslage<br />
<strong>Hofbieber</strong><br />
Anlage einer Streuobstwiese zur Begrenzung der gepl.<br />
Siedlungsflächenerweiterung und Übergang zur freien<br />
Landschaft<br />
O - 14 nördlich Ortslage Langenbieber Heckenpflanzung zur Begrenzung der gepl.<br />
Siedlungsflächenerweiterung und Übergang zur freien<br />
Landschaft
<strong>Landschaftsplan</strong> <strong>Hofbieber</strong> Seite - 137 -<br />
-Entwicklung und Massnahmen-<br />
Lfd. Nr. Lage Gepl. Massnahme<br />
O - 15 östlich Ortslage Langenbieber Ergänzung vorh. Gehölzstrukturen, Eingrünung vorh.<br />
Bebauung<br />
O - 16 südlich Ortslage Langenbieber Ergänzung vorh. Gehölzstrukturen, Eingrünung vorh.<br />
Bebauung<br />
O - 17 westlich Ortslage Niederbieber Anlage einer Streuobstwiese zur Begrenzung der gepl.<br />
Siedlungsflächenerweiterung und Übergang zur freien<br />
Landschaft<br />
O - 18 nördl. Ortslage Niederbieber Heckenpflanzung zur Begrenzung der gepl.<br />
Siedlungsflächenerweiterung und Übergang zur freien<br />
Landschaft<br />
O - 19 östlich Ortslage Niederbieber Ergänzung vorh. Gehölzstrukturen, Eingrünung vorh.<br />
Bebauung<br />
O - 20 nördl. Ortslage Wiesen Heckenpflanzung zur Begrenzung der gepl.<br />
Siedlungsflächenerweiterung und Übergang zur freien<br />
Landschaft<br />
O - 21 östl. Ortslage Wiesen Ergänzung vorh. Gehölzstrukturen, Eingrünung vorh.<br />
Bebauung<br />
O - 22 westlich Ortslage Wiesen Ergänzung vorh. Gehölzstrukturen, Eingrünung vorh.<br />
Bebauung<br />
O - 23 nördl. Ortslage Kleinsassen Heckenpflanzung zur Begrenzung der gepl.<br />
Siedlungsflächenerweiterung und Übergang zur freien<br />
Landschaft<br />
O - 24 nordwestl., westl. und südwestl.<br />
Ortslage Langenberg<br />
Ergänzung vorh. Gehölzstrukturen, Eingrünung vorh.<br />
Bebauung<br />
O - 25 südl. Ortslage Wallings Anlage einer Streuobstwiese zur Begrenzung der gepl.<br />
Siedlungsflächenerweiterung und Übergang zur freien<br />
Landschaft<br />
O - 26 östl. Ortslage Obernüst Heckenpflanzung zur Begrenzung der gepl.<br />
Siedlungsflächenerweiterung und Übergang zur freien<br />
Landschaft<br />
O - 27 westl. Ortslage Elters Anlage einer Streuobstwiese zur Begrenzung der gepl.<br />
Siedlungsflächenerweiterung und Übergang zur freien<br />
Landschaft<br />
O - 28 südl. Ortslage Elters Anlage einer Streuobstwiese zur Begrenzung der gepl.<br />
Siedlungsflächenerweiterung und Übergang zur freien<br />
Landschaft<br />
O - 29 südöstl. Ortslage Elters Anlage einer Streuobstwiese zur Begrenzung der gepl.<br />
Siedlungsflächenerweiterung und Übergang zur freien<br />
Landschaft<br />
O - 30 südöstl. Weihershof Anlage einer Streuobstwiese zur Begrenzung der gepl.<br />
Siedlungsflächenerweiterung und Übergang zur freien<br />
Landschaft<br />
O - 31 nordöstlich Ortslage Wittges Heckenpflanzung zur Begrenzung der gepl.<br />
Siedlungsflächenerweiterung und Übergang zur freien<br />
Landschaft<br />
O - 32 südwestlich Ortslage Wittges Ergänzung vorh. Gehölzstrukturen, Eingrünung vorh.<br />
Bebauung
<strong>Landschaftsplan</strong> <strong>Hofbieber</strong> Seite - 138 -<br />
-Entwicklung und Massnahmen-<br />
6.3.4.2 Grünordnerische Massnahmen<br />
Innerhalb der gepl. Siedlungsflächenerweiterungen wird die Durchführung<br />
umfangreicher Massnahmen der Grünordnung und Landschaftspflege empfohlen. So<br />
u.a.<br />
• eine funktionsgerecht und gestalterisch hochwertige Straßenraumgestaltung,<br />
• Pflanzung standortgerechter Laubbäume,<br />
• Durchgrünung privater Grundstücksflächen,<br />
• Pflanzung von Haus- und Hofbäumen,<br />
• Einfriedung durch standortgerechte Hecken,<br />
• Schaffung kleinräumig strukturierter Lebensräume,<br />
• Fassaden- und Dachbegrünung,<br />
• Minimierung und Ausgleich von Flächenversiegelungen.<br />
Die Massnahmen sind im Rahmen der Bauleitplanung durch einen qualifizierten<br />
Grünordnungsplan planerisch vorzubereiten:<br />
TABELLE-NR. 52: „GRÜNORDNERISCHE MASSNAHMEN“<br />
Lfd. Nr. Lage<br />
GO - 1 nordwestl. Ortslage Schwarzbach<br />
GO - 2 westl. Ortslage Schwarzbach<br />
GO - 3 östl. Ortslage Schwarzbach<br />
GO - 4 nördl. Ortslage Rödergrund<br />
GO - 5 nördl. Ortslage Allmus<br />
GO - 6 westlich Ortslage Allmus<br />
GO - 7 nördlich Ortslage <strong>Hofbieber</strong><br />
GO - 8 südlich bzw. südöstlich Ortslage <strong>Hofbieber</strong><br />
GO - 9 nördlich Ortslage Langenbieber<br />
GO - 10 westlich Ortslage Niederbieber<br />
GO - 11 nördl. Ortslage Niederbieber<br />
GO - 12 nördl. Ortslage Wiesen<br />
GO - 13 nördl. Ortslage Kleinsassen<br />
GO - 14 nordöstl. Ortslage Obernüst<br />
GO - 15 südwestl. Ortslage Elters<br />
GO - 16 südöstl. Ortslage Elters<br />
GO - 17 nordöstlich Ortslage Wittges
<strong>Landschaftsplan</strong> <strong>Hofbieber</strong> Seite - 139 -<br />
-Entwicklung und Massnahmen-<br />
6.3.4.3 Bereich mit besonderer Berücksichtigung klimatischer Zusammenhänge<br />
In den Auenbereichen der Bieber, Nüst und Nässe sind kleinklimatische<br />
Zusammenhänge bei allen weiteren Vorhaben und Planungen in besonderer Weise zu<br />
berücksichtigen. So sind weitere Flächenversiegelungen und Bebauungen hier zu<br />
vermeiden, wobei vor allem bauliche Anlagen, die quer zur Fließrichtung errichtet<br />
werden sollen, grundsätzlich abzulehnen sind. Auch Pflanzungen, die quer zur<br />
Fließrichtung angelegt werden, wirken sich als Barriere aus und sind somit hier zu<br />
vermeiden.<br />
6.3.4.4 Bereich mit besonderer Berücksichtigung des Landschaftsbildes und der<br />
Landschaftsgestaltung<br />
In nachfolgenden Bereichen sind alle geplanten Vorhaben unter besonderer<br />
Berücksichtigung des Landschaftsbildes und der Landschaftsgestaltung durchzuführen.<br />
Die Kuppen- und exponierten Lagen sind zu erhalten und weitgehend von Bebauung<br />
freizuhalten:<br />
• Landschaftsraum Milseburg<br />
• Landschaftsraum nördlich der Linie Wallings, Obernüst, Boxberg<br />
• Landschaftsraum Kirschberg, südlich Langenberg<br />
• Landschaftsraum Kohlberg, nordöstlich<br />
• Landschaftsraum Schackenbergshof, südöstlich Schackau<br />
• Landschaftsraum Melmesberg, nordöstlich Egelmes
<strong>Landschaftsplan</strong> <strong>Hofbieber</strong> Seite - 140 -<br />
-Entwicklung und Massnahmen-<br />
6.4 <strong>Landschaftsplan</strong>erische Hinweise<br />
6.4.1 ... zur Waldbewirtschaftung<br />
Den Wäldern im <strong>Gemeinde</strong>gebiet <strong>Hofbieber</strong> ist eine hohe Bedeutung für die<br />
Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes und als Träger wichtiger Wohlfahrtsfunktionen<br />
zuzumessen, so u.a.:<br />
• Bodenschutz auf erosionsgefährdeten Hanglagen,<br />
• klimatische Regenerations- und Schutzfunktionen für die Ortslagen,<br />
• Immissionsschutz,<br />
• Verzögerung bzw. Regulierung des Wasserabflusses,<br />
• besondere Bedeutung für die landschaftsbezogene, ruhige Erholung,<br />
• hoher Wert für den Arten- und Biotopschutz.<br />
Darüber hinaus besitzen die Waldflächen wegen des nachwachsenden Rohstoffes Holz<br />
eine wichtige Nutzfunktion für den Menschen.<br />
Auch die Flächenausdehnung der Waldflächen unterstreicht die Bedeutung der Wälder<br />
innerhalb des <strong>Gemeinde</strong>gebietes. So werden mit ca. 3.300 ha Fläche heute 39 % des<br />
<strong>Gemeinde</strong>gebietes forstwirtschaftlich genutzt.<br />
Um die o.a. vielfältigen Funktionen und Aufgaben des Waldes zu erhalten und<br />
langfristig zu gewährleisten, sollten folgende Grundsätze in der Bewirtschaftung der<br />
Waldflächen zur "Naturgemäßen Waldwirtschaft" berücksichtigt werden (VGL. LRP<br />
NORDHESSEN, 1999):<br />
• Aufbau eines standortheimischen, artenreichen, ungleichaltrigen und reich strukturierten<br />
Laub- oder Mischwaldes,<br />
• Gewährleistung der natürlichen Waldentwicklung auf Einzelflächen (Prozeßschutz),<br />
• Sicherung und Entwicklung der Lebensräume der potentiellen natürlichen Fauna und Flora,<br />
• gleichzeitige Erfüllung aller Nutz-, Schutz und Erholungsfunktionen des Waldes auf ganzer<br />
Fläche (außerhalb von Schutzgebieten),<br />
• Ausnutzung der Naturkräfte bei Begründung und Pflege des Waldes,<br />
• Förderung der Selbstregulationskräfte des Waldes durch eine artenreiche<br />
Lebensgemeinschaft,<br />
• Gewährleistung des Individuenaustausches durch Waldvernetzung,<br />
• Erhalt und Pflege der natürlich gebildeten oder durch historische Nutzung entstandenen<br />
Waldstrukturen und Sonderstandorte,<br />
• Zulassen der natürl. Sukzession bis zum Wald, auf Flächen nach Nutzungsaufgabe und<br />
wenn kein anderer Schutzgrund dem entgegensteht.
<strong>Landschaftsplan</strong> <strong>Hofbieber</strong> Seite - 141 -<br />
-Entwicklung und Massnahmen-<br />
Die Aussagen in den Darstellungen des <strong>Landschaftsplan</strong>es für die verschiedenen<br />
Waldflächen innerhalb des <strong>Gemeinde</strong>gebietes können nur als grundsätzliche Aussagen<br />
in Form landschaftsplanerischer Anregungen zur Waldbewirtschaftung als<br />
Zielsetzungen und Entwicklungsvorstellungen der <strong>Gemeinde</strong> <strong>Hofbieber</strong> formuliert<br />
werden. Einzelheiten zur Waldbewirtschaftung, insbesondere zur Festlegung und<br />
Umsetzung konkreter Massnahmen, werden in forstlichen Fachplanungen geregelt und<br />
liegen nicht im Einflußbereich kommunaler Entscheidungsbefugnisse. Die<br />
Formulierung von Anregungen zur Waldbewirtschaftung aus landschaftsplanerischer<br />
Sicht soll vor allem auch zur Umsetzung der Leitbildvorstellungen für das<br />
<strong>Gemeinde</strong>gebiet <strong>Hofbieber</strong> beitragen.<br />
Im einzelnen lassen sich die im <strong>Landschaftsplan</strong> dargestellten Anregungen wie folgt<br />
differenzieren:<br />
Nadelholzwälder bzw. Mischwälder mit überwiegenden Anteilen von Nadelhölzern<br />
Die z.Zt. bestehenden Nadelholzwälder bzw. Mischwälder mit überwiegendem Anteil<br />
von Nadelhölzern sind langfristig in standortgerechte Mischbestände mit hohem<br />
Laubholzanteil zu entwickeln, so u.a. durch:<br />
• Berücksichtigung standörtlicher Gegebenheiten beim Neuaufbau von Waldbeständen,<br />
• Orientierung der Baumartenwahl an der pnV,<br />
• sukzessive Umwandlung standortfremder Bestände in standortgerechte Mischbestände mit<br />
hohem Laubholzanteil,<br />
• Flächenräumung zur Bestandsbegründung nur in Ausnahmefällen.<br />
Laubholzwälder bzw. Mischwälder mit überwiegenden Anteilen von Laubhölzern<br />
Die Laubholzwälder bzw. Mischwälder mit überwiegendem Anteil von Laubhölzern<br />
sind zu erhalten und zu pflegen, in Teilbereichen zu entwickeln, so u.a. durch:<br />
• Pflege und Nutzung einzelbaumbezogen, nicht flächenhaft,<br />
• Sukzession in ausgewählten Teilbereichen,<br />
• Förderung der Misch- und Nebenbaumarten,<br />
• rechtzeitige und starke Auslesedurchforstung,<br />
• Naturverjüngung vor Saat und Pflanzung,<br />
• Pflege und Erhalt der Waldinnen- und Waldaußenränder,<br />
• waldverträglicher Einsatz von Forsttechnik,<br />
• Einsatz mechanischer und biologischer Pflanzenschutzverfahren vor chem. Pflanzenschutz,
<strong>Landschaftsplan</strong> <strong>Hofbieber</strong> Seite - 142 -<br />
-Entwicklung und Massnahmen-<br />
Naturnahe Laubwälder<br />
Bei den naturnahen Laubwäldern innerhalb des <strong>Gemeinde</strong>gebietes <strong>Hofbieber</strong> handelt es<br />
sich um die Bereiche Milseburg / Liedenküppel, Stellberg, Bubenbader Stein,<br />
Schackenberg / Ziegenkopf, Wadberg, Hohlstein / Fuchsstein, Hessenliede / Kugelberg<br />
/ Bieberstein, Sandberg, Bomberg,Großer Grubenhauck, Schwarzehauk / Gickershauk,<br />
Nüster-Berg / Hozzel-Berg / Boxberg.<br />
Die o.a. naturnahen Laubwälder sind zu erhalten und durch geeignete Massnahmen der<br />
Bewirtschaftung zu schützen, so u.a. durch:<br />
• Überprüfung der bestehenden Wegenetze, ggfs. auch Rückbau bzw. Stillegung von Teilen<br />
des Wegenetzes,<br />
• Pflege und Förderung seltener Baum- und Straucharten,<br />
• Berücksichtigung von seltenen Pflanzenarten in der Krautschicht sowie empfindlichen<br />
Waldbewohnern auf Horst- und in Höhlenbäumen,<br />
• Ausweisung von Schutzgebieten und - flächen als Minimalareale,<br />
• Vernetzung naturnaher Waldbestände durch Erhalt, Pflege und Neuanlage von Hecken und<br />
Feldgehölzen in der Feldflur,<br />
• Belassen eines dynamischen Anteils von liegendem und stehendem Totholz,<br />
• Erhalt von Sonderbiotopen,<br />
• Erhalt und Pflege historischer Waldnutzungsformen.<br />
6.4.2 ... zur landschaftsgebundenen Freizeit- und Erholungsnutzung<br />
Aufgrund der naturräumlichen Ausstattung spielt die landschaftsgebundene Freizeitund<br />
Erholungsnutzung innerhalb des <strong>Gemeinde</strong>gebietes <strong>Hofbieber</strong> eine herausragende<br />
Rolle. In Anlehnung an die Grundsätze und Zielvorstellungen des Biosphärenreservates<br />
Rhön soll der Landschaftsraum <strong>Hofbieber</strong> der Erholung dienen. Anzustreben sind dabei<br />
Erholungsformen, die die Ökosysteme möglichst wenig belasten und die Erholungsqualitäten<br />
der Landschaft erhalten, wobei innerhalb des <strong>Gemeinde</strong>gebietes <strong>Hofbieber</strong><br />
die individuellen landschaftlichen Eigenschaften und Qualitäten zu bewahren und zu<br />
pflegen sind. Gezielte Informations-, Lenkungs- und Verlagerungsmassnahmen sind zur<br />
Vermeidung von Konflikten durch Ausflugsverkehr und umweltbeeinträchtigende<br />
Freizeitaktivitäten durchzuführen.<br />
Eine Verbesserung des Erlebniswertes der Landschaft hat für das <strong>Gemeinde</strong>gebiet<br />
aufgrund der naturräumlichen Ausstattung nur eine untergeordnete Bedeutung, wobei<br />
vor allen folgende Hinweise zu berücksichtigen sind:<br />
Das grundsätzliche Leitbild des Biospärenreservates "Land der offenen Fernen" ist auf<br />
das <strong>Gemeinde</strong>gebiet <strong>Hofbieber</strong> übertragbar. Auch für <strong>Hofbieber</strong> ist die kleinbäuerlich<br />
geprägte Kulturlandschaft charakteristisch. Eine Aufforstung großräumiger Bereiche<br />
sollte deshalb vermieden werden. Attraktive Vegetationsbilder und Landschaftselemente<br />
sollten erhalten und weiter entwickelt werden. Schwerpunkte innerhalb des<br />
<strong>Gemeinde</strong>gebietes sind hier die naturnahen Wälder (z.T. auf Sonderstandorten, wie z.B.
<strong>Landschaftsplan</strong> <strong>Hofbieber</strong> Seite - 143 -<br />
-Entwicklung und Massnahmen-<br />
Blockschutthänge), natürliche Felsbildungen, Bachauen der Fließgewässer sowie<br />
extensiv genutzte Grünlandbereiche in Durchmischung mit linearen und punktuellen<br />
Gehölzelementen.<br />
Grundsätzlich tragen alle bisher beschriebenen Massnahmen der Grünordnung und<br />
Landschaftspflege dazu bei, die Voraussetzungen und Möglichkeiten der<br />
landschaftsgebundenen Freizeit- und Erholungsnutzung zu erhalten und zu verbessern,<br />
wobei die Möglichkeiten zur Verbesserung vorwiegend im westlichen Teil, die zur<br />
Erhaltung der Situation im östlichen Teil des <strong>Gemeinde</strong>gebietes liegen.<br />
Aufbauend auf die o.a. Grundsatzüberlegungen formuliert der <strong>Landschaftsplan</strong> folgende<br />
Handlungsempfehlungen zur landschaftsgebundenen Freizeit- und Erholungsnutzung<br />
innerhalb des <strong>Gemeinde</strong>gebietes <strong>Hofbieber</strong>:<br />
• naturschutzfachlich wertvolle Landschaftsräume sind von Erholungs- und<br />
Freizeitnutzungen freizuhalten. Puffer- und nutzungsabgestufte Übergangszonen sind<br />
einzurichten.<br />
• die siedlungsfernen, ruhigen, wenig zerschnittenen und hinsichtlich des Erlebniswertes<br />
besonders wertvollen Landschaftsräume sind zukünftig nur im Rahmen von ruhigen, naturund<br />
landschaftsbezogenen Freizeit- und Erholungsaktivitäten zu nutzen.<br />
• der infrastrukturelle Aufwand ist so gering wie möglich zu halten. Neue Erholungs- und<br />
Infrastruktureinrichtungen sind nicht erforderlich.<br />
• neue Wanderwege sind nicht auszubauen, da das vorhandene Wegenetz als ausreichend<br />
anzusehen ist. Eine verbesserte Beschilderung ist durchzuführen, wobei insbesondere eine<br />
Vereinheitlichung der Beschilderung anzustreben ist.<br />
• intensive Freizeit- und Erholungseinrichtungen mit hohem Besucherdruck sind nicht<br />
erwünscht.<br />
Unter Berücksichtigung der o.a. Grundsätze und Zielvorstellungen sind die Massnahmen<br />
zur landschaftsgebundenen Freizeit- und Erholungsnutzung innerhalb des<br />
<strong>Gemeinde</strong>gebietes <strong>Hofbieber</strong> wie folgt zu differenzieren:<br />
1. In den Teilbereichen des <strong>Gemeinde</strong>gebietes mit Defiziten zur landschaftsgebundenen<br />
Freizeit- und Erholungsnutzung sind Massnahmen zu treffen, diese<br />
bisherigen Defizite zu beseitigen. Hier handelt es sich überwiegend um die<br />
Landschaftsräume im westlichen Teil des <strong>Gemeinde</strong>gebietes, vorwiegend westlich<br />
der Ortslage <strong>Hofbieber</strong>.<br />
Das Landschaftsbild und die Biotopstruktur ist hier durch gezielte Massnahmen,<br />
wie sie in Kapitel 6.3 beschrieben werden, zu verbessern und aufzuwerten. Hierzu<br />
zählen insbesondere die vorgesehenen Massnahmen der Ortsrand- und Ortseingangsgestaltung<br />
sowie die verschiedenen Pflanz- und sonstigen Entwicklungsmassnahmen.<br />
Darüber hinaus ist die Beschilderung von Wanderwegen, verbunden<br />
mit der Entwicklung eines einheitlichen Beschilderungskonzeptes zu vervollständigen<br />
sowie die Einrichtungen und Anlagen der Erholungsinfrastruktur zu<br />
ergänzen.
<strong>Landschaftsplan</strong> <strong>Hofbieber</strong> Seite - 144 -<br />
-Entwicklung und Massnahmen-<br />
Insgesamt ist der Bereich des westlichen <strong>Gemeinde</strong>gebietes stärker in die lokalen,<br />
regionalen und ggfs. auch überregionalen Fremdenverkehrs- und Tourismuskonzepte<br />
einzubinden, vor allem auch zur Ergänzung und Entlastung der stark<br />
frequentierten Schwerpunkträume.<br />
2. In den Schwerpunkträumen der landschaftsgebundenen Freizeit- und Erholungsnutzung<br />
sind vor allem Massnahmen dahingehend zu treffen, eine Überlastung zu<br />
vermeiden und irreparable Schäden für den Naturhaushalt und das Landschaftsbild<br />
zu verhindern. Bei den Schwerpunkträumen der landschaftsgebundenen Freizeitund<br />
Erholungsnutzung handelt es sich um Bereiche innerhalb des <strong>Gemeinde</strong>gebietes,<br />
die sich u.a. aufgrund naturräumlicher Ausstattung, kulturhistorischer<br />
Bedeutung, Vorhandensein von Anlagen und Einrichtungen zur Freizeitnutzung<br />
sowie günstiger Erschließung besonders für die Freizeit- und Erholungsnutzung<br />
eignen. Zu nennen sind hier:<br />
• Bereiche um die Milseburg,<br />
• die Anlagen und Einrichtungen der Fohlenweide,<br />
• der Golfplatz <strong>Hofbieber</strong>,<br />
• der Milseburgradweg.<br />
In den oben angeführten Bereichen sollte den Ansprüchen der<br />
landschaftsgebundenen Freizeit- und Erholungsnutzung Vorrang vor anderen<br />
Nutzungsinteressen unter Berücksichtigung von Naturhaushalt und Landschaftsbild<br />
eingeräumt wird. Ziel ist hier eine nachhaltige natur- und umweltverträgliche<br />
Freizeit- und Erholungsnutzung.
<strong>Landschaftsplan</strong> <strong>Hofbieber</strong> Seite - 145 -<br />
-Entwicklung und Massnahmen-<br />
TABELLE-NR. 53: „SCHWERPUNKTRÄUME DER LANDSCHAFTSGEBUNDENEN FREIZEIT- UND ERHOLUNGSNUTZUNG“<br />
Betr. Gebiet Beschreibung Bedeutung für die<br />
landschaftsgebundene Freizeitund<br />
Erholungsnutzung<br />
Milseburg geologische Formation (Milseburg)<br />
mit entspr. ausgebildeten<br />
Vegetationsstrukturen,<br />
Wanderwege, prähistorischer<br />
Wanderpfad, Information und<br />
einfache Gastronomie, Kapelle<br />
und Gedenkstätte<br />
Fohlenweide öffentliche und private Freizeiteinrichtungen<br />
und –anlagen<br />
(Wanderwege, Lehrpfad, Reit-,<br />
Sport- und Spielanlagen, Teiche,<br />
...) mit entspr. Hotelgastronomie<br />
Golfplatz intensiv genutzte Sportanlage mit<br />
entspr. infrastrukturellen<br />
Einrichtungen (Parkplätze,<br />
Gebäude, ...) im Umfeld<br />
Milseburgradweg asphaltierter Radweg auf ehem.<br />
Bahntrasse mit entspr.<br />
trassenbegleitenden<br />
infrastrukturellen Einrichtungen<br />
(Parkplätze, Rast- und<br />
Ruhebereiche, Schutzhütten, ...)<br />
überregionale Bedeutung als<br />
Wandergebiet und Ausflugsziel<br />
innerhalb des Naturparks Hess.<br />
Rhön und des Biosphärenreservates,<br />
Veranstaltungsort,<br />
hohe kulturhistorische Bedeutung<br />
mit Gedenkstätte und Kapelle,<br />
Wanderparkplätze<br />
überregionale Bedeutung für den<br />
Fremdenverkehr und Tourismus,<br />
stark genutzte Anlagen und<br />
Einrichtungen, wichtiger<br />
Veranstaltungsort<br />
überregionale Bedeutung für den<br />
Golfsport<br />
überregionale Bedeutung für den<br />
Tourismus und Fremdenverkehr<br />
als wichtige und alternative<br />
Erschließung der Rhön,<br />
Bedeutung als Sportanlage<br />
(Radfahrer, Skater, ...)<br />
Konfliktschwerpunkte,<br />
Eingriffe in Natur und<br />
Landschaft<br />
naturschutzfachliche Konflikte,<br />
hoher Schutzstatus als Naturschutzgebiet,<br />
stark frequentierte<br />
Wanderwege innerhalb sensibler<br />
Bereiche, starke Nutzung durch<br />
„Extremsportler“ (Mountainbiking,<br />
...), Ansprüche der<br />
archäologischen Forschung<br />
temporär naturschutzfachliche<br />
Konflikte starken Nutzungen<br />
(Veranstaltungen) und<br />
besonderen Zeiträumen<br />
(Amphibien-Laichzeiten, ...)<br />
naturschutzfachliche Konflikte,<br />
Eingriffe in naturschutzfachlich<br />
hochwertige Biotopstrukturen,<br />
Vernichtung und Beeinträchtigung<br />
naturschutzfachlich hochwertiger<br />
Lebensräume<br />
(Milseburg, ...)<br />
Störungswirkungen durch die<br />
Benutzer des Radweges<br />
Massnahmen im Rahmen der<br />
<strong>Landschaftsplan</strong>ung<br />
Lenkung (Freihalten sensibler<br />
Bereiche von Freizeitnutzungen<br />
jeglicher Art entsprechend den<br />
Geboten und Verboten der NSG-<br />
Verordnung), Vermeidung von<br />
Extremsportarten, Information<br />
Detailplanung erforderlich<br />
Lenkung (zeitweise Sperrung<br />
sensibler Bereiche, z.B. während<br />
der Amphibienwanderung),<br />
Information<br />
Berücksichtigung landschaftsplanerischer<br />
Aspekte im<br />
Rahmen der Pflege- und Unterhaltungsarbeiten,<br />
Pflanzung<br />
standortgerechter Gehölze<br />
Konfliktlösungen im Rahmen<br />
der Umsetzung:<br />
Nutzungsauflagen (z.B. fledermausverträgliche<br />
Beleuchtung<br />
im Milseburgtunnel), zeitweise<br />
Sperrung sensibler Bereiche<br />
(Milseburgtunnel)
<strong>Landschaftsplan</strong> <strong>Hofbieber</strong> Seite - 146 -<br />
-Entwicklung und Massnahmen-<br />
3. Die Landschaftsräume und Teilbereiche des <strong>Gemeinde</strong>gebietes <strong>Hofbieber</strong>, die<br />
aufgrund ihrer Biotopstrukturen sowie des hier vorhandenen Arteninventars eine<br />
überragende naturschutzfachliche Bedeutung aufweisen, sollten von Freizeit- und<br />
Erholungsaktivitäten grundsätzlich freigehalten werden. Hierbei handelt es sich um<br />
die störungsempfindlichen Waldbereiche:<br />
• am Stellberg,<br />
• am Hohlstein / Fuchsstein,<br />
• am Nüster-Berg / Hozzelberg.<br />
In den genannten Teilbereichen sind Wege sowie infrastrukturelle Einrichtungen<br />
und Anlagen der Freizeit- und Erholungsnutzung langfristig zurück zu bauen und<br />
zu beseitigen. Naturschutzfachliche Aspekte sollten vorrangig gegenüber Freizeitund<br />
Erholungsansprüchen behandelt werden. Die Beschilderung und allgemeine<br />
Information zur Wegeführung sollte unter Berücksichtigung der Sensibilität der o.a.<br />
Bereiche und unter Beachtung entsprechender “Tabu – und Pufferzonen“<br />
Ansprüche der Freizeit- und Erholungsnutzung lenken.<br />
In weiteren Bereichen sind die Ansprüche der Freizeit- und Erholungsnutzung mit<br />
den Belangen von Natur und Landschaft in Einklang zu bringen, wobei<br />
infrastrukturelle Einrichtungen und Anlagen ggf. zu überprüfen sind.<br />
Zu nennen sind hier:<br />
• die Hessenliede,<br />
• das Mambachtal.<br />
6.4.3 ... zur Siedlungsentwicklung<br />
Entsprechend den formulierten Leitbildern sind die Ortskerne, erweiteten Ortskerne und<br />
Neubaugebiete des <strong>Gemeinde</strong>gebietes zukünftig zu entwickeln. Das bedeutet für<br />
zukünftige Maßnahmen der Siedlungsentwicklung vor allem:<br />
• Erhalt und Weiterentwicklung historisch gewachsener Siedlungsstrukturen,<br />
• Berücksichtigung von Maßstäblichkeit der Siedlungsentwicklung,<br />
• Beachtung landschaftlicher Standortbedingungen,<br />
• Erhalt und Entwicklung historischer Ortskerne und wichtiger kulturhistorischer<br />
Siedlungselemente,<br />
• Schließung innerörtlicher Baulücken vor über den Ortsrand hinausgehenden<br />
Neuausweisungen,<br />
• Vermeidung einer ungeordneten, nicht zusammenhängenden Siedlungsflächenentwicklung,<br />
• organische Einordnung und Abgrenzung neu geplanter Siedlungsflächen unter Beachtung<br />
von Topographie und natürlicher Begrenzungselemente sowie gewachsener<br />
Siedlungsformen,
<strong>Landschaftsplan</strong> <strong>Hofbieber</strong> Seite - 147 -<br />
-Entwicklung und Massnahmen-<br />
• Anpassung der Baustrukturen und Bauformen hinsichtlich Maßstab, Materialwahl und Wahl<br />
der Dachform an ortstypische Baustrukturen,<br />
• Erhalt und Neugestaltung harmonischer Ortsränder,<br />
• Erhalt und Gestaltung ortsbildprägender Freiflächen in den Ortskernen, erweiterten<br />
Ortskernen und Neubaugebieten.<br />
Der Siedlungsflächenbedarf der <strong>Gemeinde</strong> <strong>Hofbieber</strong> wird mittelfristig durch die<br />
Darstellungen des Flächennutzungsplanes von 1999 in Verbindung mit den Vorgaben<br />
des Regionalen Raumordnungsplanes von 2000 gedeckt.<br />
Im Rahmen des vorliegenden <strong>Landschaftsplan</strong>es werden landschaftsverträgliche<br />
Möglichkeiten der Siedlungsentwicklung, die langfristig über die Aussagen des<br />
Flächennutzungsplanes hinausgehen, bewertet. Aufgrund der Langfristigkeit der<br />
getroffenen Aussagen werden hier jedoch keine parzellenscharfen Aussagen und<br />
konkrete Flächengrößen und -dimensionen beschrieben, sondern mögliche<br />
Entwicklungsrichtungen aufgezeigt. Gleichzeitig werden Landschaftsräume und<br />
-bereiche definiert, die auch langfristig von Bebauung freizuhalten und von zukünftigen<br />
Siedlungsflächenerweiterungen auszunehmen sind.<br />
Ausgehend von den Überlegungen, dass alle Siedlungserweiterungen mit Eingriffen in<br />
Natur und Landschaft verbunden sind sowie Siedlungsentwicklungen immer mit<br />
anderen flächenbeanspruchenden Nutzungen, insbesondere mit Ansprüchen der<br />
Landwirtschaft und des Naturschutzes, in Konkurrenz stehen, wurden zur Bewertung<br />
zukünftiger Siedlungsentwicklungen der <strong>Gemeinde</strong> <strong>Hofbieber</strong> folgende<br />
Bewertungskriterien zu Grunde gelegt:<br />
- Potentielle Auswirkungen auf Wasser und Boden<br />
Versiegelte und überbaute Flächen werden dem Boden- und Wasserhaushalt vollständig<br />
entzogen. Die Bodenstruktur wird irreversibel geschädigt. Der Verlust an<br />
Infiltrationsflächen führt zu einer Behinderung der Grundwasserneubildung und<br />
Beschleunigung des Oberflächenabflusses.<br />
Zukünftige Siedlungsentwicklungen erfolgen dort, wo die Auswirkungen auf den<br />
Boden- und Wasserhaushalt möglichst gering sind. Schutzgebiete zum Schutz von<br />
Wasser und Boden, Retentionsräume von Fließgewässern, Bereiche mit besonderen<br />
Empfindlichkeiten des Wasser- und Bodenhaushaltes sowie Vorrangflächen für die<br />
Landwirtschaft werden von Bebauung und weiterer Siedlungsflächenentwicklung<br />
freigehalten.<br />
- Potentielle Auswirkungen auf das Lokal- und Kleinklima<br />
Eine Bebauung von Freiflächen wirkt sich auf das Lokal- bzw. Kleinklima durch eine<br />
potentielle Behinderung des Luftaustausches durch eine Beeinträchtigung und<br />
Behinderung evtl. Leitbahnen, ggfs. dem Verlust kaltluftproduzierender Flächen,<br />
Veränderungen von Strömungs- und Windverhältnissen und evtl. kleinräumigen<br />
Temperaturerhöhungen aus.
<strong>Landschaftsplan</strong> <strong>Hofbieber</strong> Seite - 148 -<br />
-Entwicklung und Massnahmen-<br />
Potentielle Kaltluftabflußbahnen werden somit von weiterer Siedlungsentwicklung<br />
ausgenommen. Darüber hinaus werden Flächen mit einer besonderen Bedeutung für die<br />
Kaltluftentstehung von einer weiteren Bebauung freigehalten. Auch größere<br />
zusammenhängende Gehölzbestände mit lokal- und kleinklimatisch ausgleichenden<br />
Wirkungen stehen für eine zukünftige Siedlungsflächenerweiterung nicht zur<br />
Verfügung.<br />
- Potentielle Auswirkungen auf das Landschaftsbild<br />
Da jede Siedlungserweiterung und Neubebauung mit der Inanspruchnahme von Fläche<br />
verbunden ist, kommt es zu einer vollständigen Veränderung des bisherigen<br />
Vegetations- und Landschaftsbildes. Bestehende, gewachsene Ortsränder werden<br />
aufgelöst und übersprungen. Die bebaute Ortslage wird in die freie Landschaft<br />
geschoben.<br />
Zukünftige Siedlungsflächenerweiterungen berücksichtigen bestehende, gewachsene<br />
und besonders ausgeprägte Ortsrandsituationen. Exponierte Standorte werden von<br />
Bebauung freigehalten. Die Integrationsmöglichkeit der geplanten Bebauung in die<br />
umgebende Landschaft ist dabei Maßstab einer möglichen Siedlungsflächenerweiterung.<br />
- Potentielle Auswirkungen auf die Lebensbedingungen der Tier- und Pflanzenwelt<br />
Die Erweiterung von Siedlungsflächen ist mit einer Beeinträchtigung, vorwiegend sogar<br />
Zerstörung von bestehenden Biotopstrukturen und -elementen verbunden. Biotope<br />
werden direkt vernichtet und / oder durch Sekundärwirkungen in Form von Nutzungsintensivierungen<br />
irreversibel beeinträchtigt.<br />
So werden Schutzgebiete und -objekte sowie naturschutzfachlich wertvolle und<br />
bedeutsame Biotopstrukturen von einer weiteren Bebauung durch Siedlungsflächenerweiterung<br />
ausgenommen. Darüber hinaus finden erforderliche Pufferzonen und<br />
- bereiche zu wertvollen Lebensräumen und - strukturen sowie Entwicklungsmöglichkeiten<br />
dieser Lebensräume bei der zukünftigen Siedlungsentwicklung<br />
Berücksichtigung. Auch Elemente des Biotopverbundes werden in die Bewertung<br />
möglicher Siedlungsentwicklungen einbezogen.<br />
Unter Berücksichtigung der o.a. Bewertungskriterien lassen sich die langfristigen<br />
Entwicklungsmöglichkeiten der einzelnen Ortsteile innerhalb des <strong>Gemeinde</strong>gebietes<br />
<strong>Hofbieber</strong> hinsichtlich einer natur- und landschaftsverträglichen Siedlungserweiterung<br />
wie folgt beschreiben:
<strong>Landschaftsplan</strong> <strong>Hofbieber</strong> Seite - 149 -<br />
-Entwicklung und Massnahmen-<br />
TABELLE-NR. 54: „SIEDLUNGSFLÄCHENERWEITERUNGEN“<br />
Betr. Ortsteil mögliche Siedlungsflächenerweiterung<br />
...<br />
Allmus • nordwestlich der Ortslage<br />
• südwestlich der Ortslage<br />
Boxberg • südwestlich der Ortslage<br />
• nordöstlich der Ortslage<br />
von Bebauung freizuhalten ...<br />
• Auenbereich am östl. Ortsrand,<br />
nördlich der Kreisstrasse,<br />
• Auenbereich am westlichen Ortsrand<br />
• gut ausgeprägte Ortsrandbereiche<br />
westlich, südlich und östlich der<br />
Ortslage<br />
Danzwiesen • südlich der Ortslage • gut ausgeprägte Ortsrandbereiche<br />
westl., östl. u. nördl. der Ortslage<br />
Egelmes • Einzelflächen innerhalb der<br />
Ortslage<br />
• Auenbereiche<br />
• exponierte Hanglagen<br />
Elters • südlich der Ortslage • Auenbereiche<br />
• gut ausgeprägte Ortsrandbereiche<br />
nördl. u. östl. der Ortslage Elters<br />
<strong>Hofbieber</strong> • westlich der Ortslage • Feldgehölz am nordwestl. Ortsrand<br />
Kleinsassen • südöstlich der Ortslage<br />
• südwestlich der Ortslage<br />
Langenberg • südwestlich der Ortslage<br />
• westlich der Ortslage<br />
• nordwestlich der Ortslage<br />
• Buchenrestwald im Sandgebiet<br />
• Buchenrestwald am östlichen Ortsrand<br />
• südöstl. Ortsrand Richtung Hessenliede<br />
• gesamter Talraum sensibel<br />
• Auenbereich der Bieber nördlich und<br />
südlich der Ortslage<br />
• gut ausgeprägte Ortsränder westlich<br />
und östlich der Ortslage<br />
• Hanglage südöstl. der Ortslage<br />
Langenbieber • nördlich der Ortslage • Auenbereich der Bieber<br />
• Waldbestand südl. der Bahntrasse<br />
• Obstwiesen am südwestl. Ortsrand<br />
Mahlerts • östlich der Ortslage • Talauen der Fließgewässer<br />
Mittelberg • nördlich der Ortslage • Auenbereiche<br />
Niederbieber • nordwestlich der Ortslage<br />
• nordöstlich der Ortslage<br />
• östlich der Ortslage<br />
Obergruben • Einzelflächen innerhalb der<br />
Ortslage<br />
• Auenbereiche westl. und südöstl. der<br />
Ortslage<br />
• Hanglagen westl. der Ortslage<br />
• Auenbereiche
<strong>Landschaftsplan</strong> <strong>Hofbieber</strong> Seite - 150 -<br />
-Entwicklung und Massnahmen-<br />
Betr. Ortsteil mögliche Siedlungsflächenerweiterung<br />
...<br />
Obernüst • nordöstlich der Ortslage<br />
• nordwestlich der Ortslage<br />
Rödergrund • Einzelflächen innerhalb der<br />
Ortslage<br />
Schackau • Einzelflächen innerhalb der<br />
Ortslage<br />
Schwarzbach • nördlich der Ortslage<br />
• südöstlich der Ortslage<br />
von Bebauung freizuhalten ...<br />
• Hanglage am südl. Ortsrand<br />
• Auenbereich<br />
• Auenbereiche<br />
• Talaue<br />
• Steilhänge westl. und östlich der<br />
Ortslage<br />
• gut ausgeprägter Ortsrand nordöstl. der<br />
Ortslage,<br />
• exponierte Standorte westlich und<br />
südlich der Ortslage<br />
Steens • südlich der Ortslage • gut ausgeprägte Ortsrandbereiche<br />
nordöstl. u. südwestl. der Ortslage<br />
Steens<br />
Traisbach • nördlich der Ortslage<br />
• nordwestlich der Ortslage<br />
• südöstlich der Ortslage<br />
Wallings • Einzelflächen innerhalb der<br />
Ortslage<br />
Wiesen • nordöstlich der Ortslage<br />
• nordwestlich der Ortslage<br />
Wittges • Einzelflächen innerhalb der<br />
Ortslage<br />
• Auenbereiche östl. u. südwestl. der<br />
Ortslage<br />
• Auenbereich<br />
• gut ausgeprägte Ortsrandbereiche<br />
• hochwertige Biotopstrukturen<br />
• Auenbereiche<br />
• gut ausgeprägter Ortsrand nördl. der<br />
Ortslage<br />
• Auenbereich<br />
• exponierte Hanglage östl. der Ortslage
<strong>Landschaftsplan</strong> <strong>Hofbieber</strong> Seite - 151 -<br />
-Entwicklung und Massnahmen-<br />
Bei der zukünftigen Erweiterung von Siedlungsflächen sollten im Rahmen einer<br />
Neubebauung und Erschliessung von Siedlungsflächen folgende Grundsätze<br />
Berücksichtigung finden:<br />
... zum Schutz von Wasser und Boden:<br />
• Minimierung der Flächenversiegelung,<br />
• Förderung wasserdurchlässiger Oberflächen,<br />
• Massnahmen zur Regenwasserbewirtschaftung.<br />
... zum Schutz des Lokal- und Kleinklimas:<br />
• Beschränkung der Flächenversiegelung,<br />
• Landschaftsgerechte und maßstäbliche Gestaltung der Baukörper,<br />
• Maßnahmen der Be-, Ein- und Durchgrünung zur Schaffung günstiger kleinklimatischer<br />
Strukturen.<br />
... zum Schutz des Landschaftsbildes:<br />
• Auswahl standortangepasster Bauweisen und Materialien,<br />
• zurückhaltender und sensibler Einsatz von Farben und Formen,<br />
• Maßnahmen der Be-, Ein- und Durchgrünung zur Einbindung der Bebauung in die<br />
umgebende Landschaft.<br />
... Schutz der Lebensbedingungen der Pflanzen- und Tierwelt<br />
• Eingriffsminimierung durch Erhalt und Integration vorhandener Gehölz- und<br />
Vegetationsstrukturen,<br />
• Schaffung neuer Biotopstrukturen,<br />
Die beschriebenen Grundsätze sind durch geeignete Festsetzungen in die verbindliche<br />
Bauleitplanung (Bebauungsplan) zu integrieren. Darüber hinaus kann durch gezielte<br />
Aufklärung und Information im Rahmen einer engagierten Öffentlichkeitsarbeit das<br />
Bewußtsein für die Probleme von Bebauung und Siedlungserweiterung geschärft<br />
werden. Nicht zuletzt tragen sinnvoll eingesetzte Fördermassnahmen zu einer<br />
landschaftsverträglichen Siedlungsentwicklung bei.
<strong>Landschaftsplan</strong> <strong>Hofbieber</strong> Seite - 152 -<br />
-Umsetzungshinweise-<br />
7 Umsetzungshinweise<br />
Der <strong>Landschaftsplan</strong> zeigt zahlreiche Massnahmen und Handlungsansätze des Naturschutzes,<br />
der Landschaftspflege und der Grünordnung innerhalb des <strong>Gemeinde</strong>gebietes<br />
auf, wobei im <strong>Landschaftsplan</strong> dargestellt wird, wo innerhalb des <strong>Gemeinde</strong>gebietes<br />
unter Beachtung der örtlichen und überörtlichen Gegebenheiten welche Massnahmen<br />
zum Erhalt und zur Entwicklung von Natur und Landschaft zu treffen sind.<br />
Der <strong>Landschaftsplan</strong> kann dabei vor allem:<br />
• Handlungsempfehlung und Leitfaden für kommunale Planungen und Entscheidungen,<br />
• integraler Bestandteil der vorbereitenden Bauleitplanung (Flächennutzungsplan),<br />
• Grundlage der verbindlichen Bauleitplanung (Bebauungsplan),<br />
• Grundlage naturschutzfachlicher Überlegungen,<br />
• Information zu Planungen anderer Fachdisziplinen,<br />
• Grundlage für den Einsatz von Fördermitteln,<br />
sein.<br />
Festzustellen ist hierbei, dass bei der Umsetzung von Massnahmen immer das jeweilige<br />
Eigentum und / oder das Nutzungsverhältnis der Betroffenen zu beachten ist. Der<br />
vorliegende <strong>Landschaftsplan</strong> sollte hierbei als Impulsgeber angesehen werden, dessen<br />
Aussagen durch ein Umsetzungskonzept (z.B. für einzelne Massnahmengruppen) sowie<br />
mit der Koordinierung der jeweiligen Akteure aufgegriffen werden sollten.<br />
Für die Umsetzung sollten im einzelnen folgende Grundsätze gelten:<br />
• Landschaftspflegerische Massnahmen:<br />
Prioritär sind die besonders seltenen und kleinflächigen Biotoptypen der Magerrasen und<br />
Feuchtwiesen / Hochstaudenfluren zu sichern. Weiterhin soll das Augenmerk den weiteren<br />
extensiv genutzten Grünländern sowie den naturnahen Laubwäldern gelten.<br />
Zur Erhaltung und Entwicklung der exklusiven Magerrasengesellschaften oder<br />
Feuchtwiesen bzw. Feuchtbrachen sowie sonstigen selten vorkommenden Biotoptypen ist<br />
die öffentliche Hand als Eigentümer anzustreben.<br />
Fördermassnahmen für ggf. Flächenkäufe und / oder Nutzungs- / Pflegemassnahmen im<br />
Rahmen der Möglichkeiten, z.B. im Rahmen des Hess. Landschaftspflegeprogramm, auch<br />
i.V. mit Natura2000, sollen von den Betroffenen (Eigentümer, Nutzer, <strong>Gemeinde</strong><br />
<strong>Hofbieber</strong>, Fachbehörden) in Anspruch genommen werden.<br />
Entwicklungsmassnahmen und Verbesserungen sollten parallel in Abstimmung der<br />
verschiedenen Beteiligten und unter Ausnutzung der Fördermöglichkeiten umgesetzt<br />
werden.
<strong>Landschaftsplan</strong> <strong>Hofbieber</strong> Seite - 153 -<br />
-Umsetzungshinweise-<br />
• Artenschutzmassnahmen:<br />
Die Sicherung und Verbesserung des Schutzes von Biozönosen ist fortzuführen. Da durch<br />
den Schutz von flächenhaften Biotopen (sowohl auf Magerrasen/Feuchtwiesen als auch im<br />
Wald) auch Artenschutz betrieben wird, bestehen oftmals Wechselwirkungen in den<br />
Lebensgemeinschaften. In Ergänzung zu flächenhaften Schutzbemühungen sind auch<br />
punktuelle Massnahmen (wie z.B. der Schutz von Horstbäumen) durchzuführen.<br />
Durch die Konzentration auf sog. Zielarten (wie z.B. den Schwarzstorch) sind<br />
Mitnahmeeffekte für Begleitarten in Lebensräumen und Lebensraumkomplexen zu<br />
beschreiben. Für die Umsetzung und Koordinierung von Artenschutzmassnahmen ist das<br />
Projekt „Zoologischer Artenschutz im Biosphärenreservat Rhön“ zu beachten.<br />
• Landwirtschaft:<br />
Die Landwirtschaft trägt mit zur Gestaltung der Landschaft bei, wobei in den Nutzungen<br />
die Grundsätze der „guten fachlichen Praxis“ und der Nachhaltigkeit für die Faktoren<br />
Boden, Wasser und Luft zu beachten sind. Auf die Produktion mit entsprechenden<br />
Gütesiegeln, auch die des sog. „Ökolandbaus“, wird hingewiesen. Die Verzahnung von<br />
lokalen / regionalen Erzeugungs- und Vertriebsstrukturen (Hofläden, Bauernmärkte,<br />
Belieferung der Gastronomie, ...) wird grundsätzlich begrüßt.<br />
• Tourismus und Gastronomie:<br />
Für die Belange von Natur und Landschaft lassen sich durch das Zusammenwirken von<br />
Tourismus, Gastronomie und z.B. Umweltbildung Synergieeffekte erzielen.<br />
Hierbei kann durch touristische Angebotspakete (Exkursionen, Tagesprogramm,<br />
Gastronomie) entsprechende Wertschöpfung betrieben werden, welche durch die<br />
Verwendung heimischer Produkte wiederum dem jeweiligen Erzeuger zugute kommt. Auf<br />
Initiativen wie z.B. „Rhöner Charme“ und „Rhöner Weideochsen“ wird hingewiesen.<br />
• Verwertung von Biomasse aus z.B. Gehölzaufwuchs:<br />
Die Prüfung, ob das z.B. in der Pflege von Hecken und Feldgehölzen sowie sonstigen<br />
Gehölzen (Laub- und Obstbäume, Forstpflege) anfallende Schnittgut energetisch als sog.<br />
Holzhackschnitzel verwertet werden kann, wird vorgeschlagen. Ggf. könnten in einem<br />
Biomasseheizkraftwerk auch weitere Grüngutmassen verwertet werden.
<strong>Landschaftsplan</strong> <strong>Hofbieber</strong> Seite - 155 -<br />
-Umsetzungshinweise-<br />
TABELLE-NR. 55: „BEDEUTUNG UND UMSETZUNG VON AUSSAGEN UND DARSTELLUNGEN IM LANDSCHAFTSPLAN“<br />
Aussagen und Darstellungen im <strong>Landschaftsplan</strong> Bedeutung und Umsetzung<br />
Planungskategorie Ausgangssituation<br />
Flächen mit rechtlichen<br />
Bindungen für Naturschutz<br />
und Landschaftspflege<br />
• Naturschutzgebiet<br />
• Landschaftsschutzgebiet<br />
• Naturdenkmal<br />
• Geschützter Landschaftsbestandteil<br />
• Biosphärenreservat<br />
• §15d Biotope (... Teiche, Tümpel,<br />
Quellbereiche, Röhrichte, naturnahe<br />
Bachabschnitte, Trockenrasen, Alleen,<br />
Feld- und Ufergehölze, Hohlwege,<br />
Trockenmauern, Einzelbäume, Hecken,<br />
Feucht- und Nasswiesen,<br />
Streuobstbestände, ...)<br />
• Flora-Fauna-Habitat-Gebiet (FFH)<br />
• Vogelschutzgebiet<br />
Planungsaussagen und potentielle<br />
Maßnahmen<br />
• Erhalt, Sicherung und Unterhaltung gemäß<br />
Verordnung, z.B. durch<br />
Bewirtschaftungsauflagen und<br />
Pflegekonzepte, Vertragsnaturschutz<br />
• Korrektur / Neuabgrenzung,<br />
Innenabgrenzung<br />
• Neuvorschlag<br />
• Naturpark • Erhalt, Sicherung und Unterhaltung gemäß<br />
Verordnung<br />
• Wasserschutzgebiet • Erhalt, Sicherung und Unterhaltung gemäß<br />
Verordnung<br />
• Korrektur / Neuabgrenzung<br />
• Neuabgrenzung<br />
• Bodendenkmal • Erhalt, Sicherung und Unterhaltung gemäß<br />
Verordnung<br />
Bedeutung<br />
Rechtsverbindlich<br />
durch Hess.<br />
Naturschutzgesetz<br />
Rechtsverbindlich<br />
durch Hess.<br />
Forstgesetz<br />
Rechtsverbindlich<br />
durch Hess.<br />
Wassergesetz<br />
Rechtsverbindlich<br />
durch Hess. Denkmalschutzgesetz<br />
Grundlagen der<br />
Umsetzung<br />
• Verbote<br />
• Gebote<br />
• Verbote<br />
• Gebote<br />
• Verbote<br />
• Gebote<br />
• Verbote<br />
• Gebote<br />
Umsetzung durch ...<br />
• Fachbehörde<br />
• <strong>Gemeinde</strong> <strong>Hofbieber</strong><br />
• Grundstückseigentümer<br />
• Grundstücksnutzer<br />
• Fachbehörde<br />
• <strong>Gemeinde</strong> <strong>Hofbieber</strong><br />
• Grundstückseigentümer<br />
• Grundstücksnutzer<br />
• Fachbehörde<br />
• <strong>Gemeinde</strong> <strong>Hofbieber</strong><br />
• Grundstückseigentümer<br />
• Grundstücksnutzer<br />
• Fachbehörde<br />
• <strong>Gemeinde</strong> <strong>Hofbieber</strong><br />
• Grundstückseigentümer<br />
• Grundstücksnutzer
<strong>Landschaftsplan</strong> <strong>Hofbieber</strong> Seite - 156 -<br />
-Umsetzungshinweise-<br />
Aussagen und Darstellungen im <strong>Landschaftsplan</strong> Bedeutung und Umsetzung<br />
Planungskategorie Ausgangssituation<br />
Biotopverbund,<br />
Biotopentwicklungsflächen<br />
• Fliessgewässerstrukturen, einschließlich<br />
Ufer- und Saumbereiche<br />
• Stillgewässer und Quellen, einschließlich<br />
Saumbereiche und Röhrichte<br />
• Frisch- und Feuchtwiesen<br />
• Mager- / Trockenrasen<br />
• Periodisch genutzte / gepflegte feuchte<br />
Hochstaudenfluren<br />
• Lineare und punktuelle standort-gerechte<br />
Gehölzstrukturen<br />
Planungsaussagen und potentielle<br />
Maßnahmen<br />
• Erhalt und Sicherung des Bestandes<br />
• Verbesserung naturferner Ausprägungen<br />
• Erhalt und Sicherung des Bestandes<br />
• Verbindung und Verbesserung in<br />
Teilbereichen<br />
• Erhalt und Sicherung des vorhandenen<br />
Extensiv-Grünlandes durch angepasste<br />
Mahd- / Weidenutzung oder –pflege<br />
• Verbesserung durch Nutzungsänderung auf<br />
ausgewählten Standorten<br />
• Erhalt und Sicherung, auf ausgewählten<br />
Standorten durch angepasste<br />
Pflegemassnahmen<br />
• Erhalt und Sicherung, Pflege<br />
• Verbindung und Ergänzung in<br />
Teilbereichen durch Neupflanzung von<br />
Obst- / Laubgehölzen, Neuanlage von<br />
flächenhaften Gehölzstrukturen<br />
• Wald • Erhalt und Sicherung von naturnahen<br />
standortgerechten<br />
Laubmischwaldgesellschaften<br />
• Verbesserung von nicht standortgerechten<br />
Beständen<br />
• Waldrandgestaltung<br />
• Sonderstandorte (Fels, ...) • Erhalt und Sicherung des Bestandes<br />
• Verbindung, Ergänzung und Verbesserung<br />
durch z.B. Neuanlage von Lesesteinhaufen<br />
Bedeutung<br />
Empfehlung, landschaftsplanerisch<br />
erwünscht<br />
Grundlagen der<br />
Umsetzung<br />
• Vereinbarungen<br />
• Vertragliche<br />
Regelungen<br />
-Grunderwerb<br />
• Fördermassnahmen,<br />
z.B.:<br />
- Hess. Landschaftspflegeprogramm<br />
- Projekte nach der<br />
Ausgleichsabgabenverordnung<br />
- Programm<br />
„Naturnahe Gewässer“<br />
-<br />
-<br />
Umsetzung durch ...<br />
• Fachbehörde<br />
• <strong>Gemeinde</strong> <strong>Hofbieber</strong><br />
• Grundstückseigentümer<br />
• Grundstücksnutzer<br />
• Verband (ehrenamtlicher<br />
Naturschutz)
<strong>Landschaftsplan</strong> <strong>Hofbieber</strong> Seite - 157 -<br />
-Umsetzungshinweise-<br />
Aussagen und Darstellungen im <strong>Landschaftsplan</strong> Bedeutung und Umsetzung<br />
Planungskategorie Ausgangssituation<br />
Flächen für<br />
naturschutzrechtliche<br />
Ausgleichs- und<br />
Ersatzmassnahmen<br />
• Land- und forstwirtschaftlich genutzte<br />
Flächen<br />
Planungsaussagen und potentielle<br />
Maßnahmen<br />
• Verbesserung bestehender<br />
Biotopstrukturen, z.B. Pflegemassnahmen,<br />
Ergänzungspflanzungen, ...<br />
• Neuanlage von Biotopstrukturen<br />
Pflegeflächen • Frisch- und Feuchtwiesen • Erhalt und Sicherstellung der bisherigen<br />
Nutzung und Bewirtschaftung<br />
Flächen für die Neuanlage<br />
von Wald<br />
• Mager- / Trockenrasen<br />
• Periodisch genutzte / gepflegte feuchte<br />
Hochstaudenfluren<br />
• Lineare und punktuelle standort-gerechte<br />
Gehölzstrukturen<br />
• Kleinräumige Talabschnitte<br />
• Landwirtschaftlich genutzte Flächen<br />
• Ggf. Deponieflächen<br />
• Änderung der bisherigen Nutzung,<br />
Nutzungs- und Bewirtschaftungsauflagen<br />
• Einmalige / periodische<br />
Sondermassnahmen<br />
• Festlegung von Entwicklungs- und<br />
Bestandszielen<br />
Bedeutung<br />
Empfehlung, landschaftsplanerisch<br />
erwünscht<br />
Empfehlung, landschaftsplanerisch<br />
erwünscht<br />
Empfehlung, landschaftsplanerisch<br />
erwünscht<br />
Grundlagen der<br />
Umsetzung<br />
• Darstellungen und<br />
Festsetzungen in<br />
der Bauleitplanung<br />
• Vereinbarungen<br />
• Vertragliche<br />
Regelungen<br />
• Vereinbarungen<br />
• Vertragliche<br />
Regelungen<br />
• Fördermassnahmen,<br />
z.B.:<br />
- Hess. Landschaftspflegeprogramm<br />
- Projekte nach der<br />
Ausgleichsabgabenverordnung<br />
-<br />
-<br />
• Darstellungen und<br />
Festsetzungen in<br />
der Bauleitplanung<br />
• Vereinbarungen<br />
• Vertragliche<br />
Regelungen<br />
• Rekultivierungsauflagen<br />
Umsetzung durch ...<br />
• <strong>Gemeinde</strong> <strong>Hofbieber</strong><br />
• Fachbehörden<br />
• Grundstückseigentümer<br />
• Grundstücksnutzer<br />
• Fachbehörden<br />
• <strong>Gemeinde</strong> <strong>Hofbieber</strong><br />
• Grundstückseigentümer<br />
• Grundstücksnutzer<br />
• Verband (ehrenamtlicher<br />
Naturschutz)<br />
• <strong>Gemeinde</strong> <strong>Hofbieber</strong><br />
• Fachbehörden<br />
• Grundstückseigentümer<br />
• Grundstücksnutzer
<strong>Landschaftsplan</strong> <strong>Hofbieber</strong> Seite - 158 -<br />
-Umsetzungshinweise-<br />
Aussagen und Darstellungen im <strong>Landschaftsplan</strong> Bedeutung und Umsetzung<br />
Planungskategorie Ausgangssituation<br />
Beeinträchtigte und belastete<br />
Flächen<br />
Schutz- und<br />
Entwicklungsflächen in<br />
Siedlungen<br />
Planungsaussagen und potentielle<br />
Maßnahmen<br />
• durch Altlasten gefährdete Flächen • Beseitigung der Beeinträchtigung<br />
• Erosionsgefährdete Flächen<br />
• Flächen der Rohstoffgewinnung und<br />
–verarbeitung (Lagerstätten, Deponien)<br />
• Gewässerverrohrung, -verbau<br />
• Gewässerverschmutzung<br />
• Intensive Weide- und Mahdnutzung<br />
• Gehölzbestände<br />
• Öffentliche Grünflächen<br />
• Private Grünflächen<br />
• Ortseingänge, Ortsränder<br />
• Minderung und Minimierung der<br />
Belastungswirkungen, z.B. durch<br />
Nutzungsänderungen, Pflanzmassnahmen,<br />
sonstige Schutzmassnahmen, ...<br />
• Erhalt und Sicherung des Bestandes<br />
• Ergänzung und Optimierung von Grünund<br />
Freiraumstrukturen<br />
• Neuanlage von Gehölzbeständen<br />
• Gestaltung von Freiflächen<br />
• Ortsrand- und Ortseingangsgestaltung<br />
• Siedlungsflächenentwicklung,<br />
langfristig<br />
• Siedlungsflächenbegrenzung<br />
Bedeutung<br />
Allgemeine<br />
Rechtsvorgaben<br />
(BIMSchG, Bodenschutzgesetz,<br />
ROG,<br />
BauGB, ...)<br />
Empfehlung, landschaftsplanerisch<br />
erwünscht<br />
Empfehlung, landschaftsplanerisch<br />
erwünscht<br />
Grundlagen der<br />
Umsetzung<br />
• Hinweise,<br />
Anregungen<br />
• Informationsaustausch<br />
• Verbote / Gebote<br />
• Vereinbarungen<br />
• Vertragliche<br />
Regelungen<br />
• Fördermassnahmen,<br />
z.B.:<br />
- Projekte nach der<br />
Ausgleichsabgabenverordnung<br />
- Programm „Naturnahe<br />
Gewässer“<br />
-<br />
• Darstellungen und<br />
Festsetzungen in<br />
der Bauleitplanung<br />
• Satzungen<br />
Umsetzung durch ...<br />
• Fachbehörde<br />
• <strong>Gemeinde</strong> <strong>Hofbieber</strong><br />
• Grundstückseigentümer<br />
• Grundstücksnutzer<br />
• Verursacher<br />
• <strong>Gemeinde</strong> <strong>Hofbieber</strong><br />
• Fachbehörden<br />
• Grundstückseigentümer<br />
• Grundstücksnutzer
<strong>Landschaftsplan</strong> <strong>Hofbieber</strong> Seite - 159 -<br />
-Umsetzungshinweise-<br />
Aussagen und Darstellungen im <strong>Landschaftsplan</strong> Bedeutung und Umsetzung<br />
Planungskategorie Ausgangssituation<br />
Freizuhaltende Flächen<br />
Flächen für Freizeit und<br />
Erholung<br />
• Klimatisch bedeutsame Bereiche<br />
(Bachauen, Talräume, ...)<br />
• Landschaftsgestalterisch bedeutsame<br />
Bereiche (exponierte Kuppen und Hänge,<br />
Siedlungsränder, ...)<br />
• Flächen und Einrichtungen für<br />
landschaftsgebundene Freizeit- und<br />
Erholungsaktivitäten<br />
• Radwanderwege und Wanderwege<br />
Planungsaussagen und potentielle<br />
Maßnahmen<br />
• Erhalt und Sicherung<br />
• Beseitigung von Funktionsstörungen und -<br />
beeinträchtigungen<br />
• Erhalt und Sicherung<br />
• Ausbau und Ergänzung funktionsgerechter<br />
und landschaftsangepasster Infrastruktur<br />
(Beschilderung, Information, Umweltbildung,<br />
...)<br />
Bedeutung<br />
Empfehlung, landschaftsplanerisch<br />
erwünscht<br />
Empfehlung, landschaftsplanerisch<br />
erwünscht<br />
Grundlagen der<br />
Umsetzung<br />
• Darstellungen und<br />
Festsetzungen in<br />
der Bauleitplanung<br />
• Darstellungen und<br />
Festsetzungen in<br />
der Bauleitplanung<br />
Umsetzung durch ...<br />
• <strong>Gemeinde</strong> <strong>Hofbieber</strong><br />
• Fachbehörden<br />
• <strong>Gemeinde</strong> <strong>Hofbieber</strong><br />
• Fachbehörden<br />
• Grundstückseigentümer<br />
• Grundstücksnutzer<br />
• Betreiber
<strong>Landschaftsplan</strong> <strong>Hofbieber</strong> Seite - 160 -<br />
-Literaturverzeichnis-<br />
8 Literaturverzeichnis<br />
ALTMOOS, M. (1997): Ziele und Handlungsrahmen für regionalen zoologischen Artenschutz –<br />
Modellregion Biosphärenreservat Rhön, Hrsg. Hess. Gesellschaft f. Ornithologie und Naturschutz<br />
(HGON), Echzell<br />
ALTMOOS, M. (1998): Maßnahmenkonzept und Praxisanschub für zoologischen Artenschutz im<br />
Biosphärenreservat Rhön, hessischer Teil, unveröff., Hess. Gesellschaft f. Ornithologie und<br />
Naturschutz (HGON), Echzell<br />
ALTMOOS, M. (1999): Der Schwarzstorch (Ciconia nigra) im Biosphärenreservat Rhön: Beispiel für die<br />
Umsetzung von Artenschutz in Regionen und ihren Wirtschaftswäldern, in: Vogel und Umwelt,<br />
Zeitschrift für Vogelkunde und Naturschutz in Hessen 10: S. 131 ff.<br />
ARENS, R. & NEFF, R. (1997): Versuche zur Erhaltung von Extensivgrünland, Bundesamt für<br />
Naturschutz, Bonn – Bad Godesberg<br />
BARTH, U., GREGOR, T., LUTZ, P., NIEDERBICHLER, PUSCH, J., A. & I. WAGNER (2000): Zur Bedeutung<br />
extensiv beweideter Nassstandorte für hochgradig bestandsbedrohte Blütenpflanzen und Moose,<br />
in: Natur und Landschaft, 75. Jg. (2000) Heft 7, S. 292 ff.<br />
BARTHEL, P.H., JUNGMANN, W.W. & MIOTK, P. (1988): Natur aus zweiter Hand – Neues Leben an<br />
Bahndamm und Kiesgrube, Westermann-Verlag, Braunschweig<br />
BASTIAN, O. & SCHREIBER, K.-F. (1999): Analyse und ökologische Bewertung der Landschaft, 2. Aufl.,<br />
Heidelberg, Berlin<br />
BAUMANN, H. & KÜNKELE, S. (1988): Die Orchideen Europas, Franckh, Stuttgart<br />
BEIRAT FÜR NATURSCHUTZ UND LANDSCHAFTSPFLEGE BEIM BUNDESMINISTERIUM FÜR UMWELT,<br />
NATURSCHUTZ UND REAKTORSICHERHEIT (1997): Zur Akzeptanz und Durchsetzbarkeit des<br />
Naturschutzes, in: ERDMANN, K.-H. & SPANDAU, L. (1997): Naturschutz in Deutschland:<br />
Strategien, Lösungen, Perspektiven; Ulmer-Verlag, Stuttgart<br />
BELLMANN, H. (1993): Heuschrecken, beobachten – bestimmen, 2. Aufl., Naturbuch-Verlag, Augsburg<br />
BELLMANN, H. (1993): Libellen, beobachten – bestimmen, Naturbuch-Verlag, Augsburg<br />
BLAB, J. (1993): Grundlagen des Biotopschutzes für Tiere, in: Bundesforschungsanstalt für Naturschutz<br />
und Landschaftspflege (Hrsg.); Schriftenreihe für Landschaftspflege und Naturschutz, Heft 24,<br />
Bonn-Bad Godesberg<br />
BOCKHOLT, R. & FURHMANN, U., BRIEMLE, G. (1996): Anleitung zur korrekten Einschätzung von<br />
Intensitätsstufen der Grünlandnutzung, in: Natur und Landschaft, 71. Jg. (1996) Heft 6, S. 249 ff.<br />
BOHN, U. (1996): Vegetationskarte der Bundesrepublik Deutschland 1 : 200 000 –Potentielle natürliche<br />
Vegetation– Blatt CC 5518 Fulda einschl. Vegetationskarte der Hohen Rhön 1 : 50 000<br />
– Potentielle natürliche Vegetation– mit Aufdruck der „botanisch besonders wervollen Gebiete“,<br />
2. Aufl., Schr.Reihe Vegetationskde. 15, Bundesamt für Naturschutz, Bonn-Bad Godesberg<br />
BONEWITZ, M. (1994): Kampfplatz Naturschutz, vgs, Köln<br />
BORNHOLDT, G., BRENNER, U., HAMM, S., KRESS, J.C., LOTZ, A. & MALTEN, A. (1997): Zoologische<br />
Untersuchungen zur Grünlandpflege am Beispiel von Borstgrasrasen und Goldhaferwiesen in der<br />
Hohen Rhön, in: Natur und Landschaft, 72. Jg. (1997) Heft 6, S. 275 ff.<br />
BORNHOLDT, G., BRAUN, H., KRESS, J.C. & KOLB, K.-H. (2000): Modellhafte Durchführung von<br />
Erfolgskontrollen im abgeschlossenen Naturschutzgroßprojekt „Hohe Rhön / Lange Rhön“,<br />
Bundesamt für Naturschutz, Bonn – Bad Godesberg<br />
BREHM, DR. J., NECKERMANN, J. & ACHTERHOLT, B. (1988): Naturschutzgebiet „Milseburg“:<br />
Pflegeplan, unveröff. Manuskript im Auftrag des Regierungspräsidiums Kassel, Obere<br />
Naturschutzbehörde<br />
BRIEMLE, G. & ELLENBERG, H. (1994): Zur Mahdverträglichkeit von Grünlandpflanzen –<br />
Möglichkeiten der praktischen Anwendung von Zeigerwerten, in: Natur und Landschaft, 69. Jg.<br />
(1994) Heft 4, S. 139 ff.
<strong>Landschaftsplan</strong> <strong>Hofbieber</strong> Seite - 161 -<br />
-Literaturverzeichnis-<br />
BRIEMLE, G., EICKHOFF, D. & WOLF, R. (1991): Mindestpflege und Mindestnutzung unterschiedlicher<br />
Grünlandtypen aus landschaftsökologischer und landeskultureller Sicht – Praktische Anleitung<br />
zur Erkennung, Nutzung und Pflege von Grünlandgesellschaften, Beih. Veröff. Naturschutz<br />
Landschaftspflege Bad.-Württ., Karlsruhe<br />
BRUUN, DELIN, SVENSSON (1991): Der Kosmos-Vogelführer - Die Vögel Deutschlands und Europas,<br />
Übers. und bearb. von P.H. Barthel, 9. Aufl., Franckh-Kosmos, Stuttgart<br />
BÜCHTER, C. (2000): Anforderungen des Naturschutzes an die <strong>Landschaftsplan</strong>ung, in: Natur und<br />
Landschaft, 75. Jg. (2000) Heft 6, S. 237 ff.<br />
CHINERY, M. (1984): Insekten Mitteleuropas - ein Taschenbuch für Zoologen und Naturfreunde,<br />
Übers. u. bearb. von I. Jung u. D. Jung, 3. Aufl., Parey-Verlag, Hamburg, Berlin<br />
DIETZ, M. (2003): Fledermäuse im Milseburgtunnel, Fuldaer Zeitung vom Januar 2003<br />
ECKSTEIN, R. (1998): Tierart- und Literaturdatenbank, in: ALTMOOS, M. (1998): Maßnahmenkonzept<br />
und Praxisanschub für zoologischen Artenschutz im Biosphärenreservat Rhön, hessischer Teil,<br />
unveröff., Hess. Gesellschaft f. Ornithologie und Naturschutz (HGON), Echzell<br />
ELSÄßER, M. (2000): Wirkungen extensiver und intensiver Weidenutzungsformen auf die Entwicklung<br />
und Verwertbarkeit von Grünlandaufwüchsen, in: Natur und Landschaft, 75. Jg. (2000) Heft 9/10,<br />
S. 357 ff.<br />
ERDMANN, K.-H. & SPANDAU, L. (1997): Naturschutz in Deutschland: Strategien, Lösungen,<br />
Perspektiven; Ulmer-Verlag, Stuttgart<br />
DÖRHÖFER, G., JOSOPAIT, V. (1980): Eine Methode zur flächendifferenzierten Ermittlung der<br />
Grundwasserneubildungsrate, Geologisches Jahrbuch Heft 27<br />
FINCK, P. & HAUKE, U., SCHRÖDER, E. (1993): Zur Problematik der Formulierung regionaler<br />
Landschafts-Leitbilder aus naturschutzfachlicher Sicht, in: Natur und Landschaft, 68 Jg. (1993)<br />
Heft 12, S. 603 ff.<br />
GAREIS-GRAHMANN, F. (1993): Landschaftsbild und Umweltverträglichkeitsprüfung, Beiträge zur<br />
Umweltgestaltung, Band 13<br />
GELBRICH, H. & UPPENBRINK, M. (1998): <strong>Landschaftsplan</strong>ung ist zukunftsorientiert, in: Natur und<br />
Landschaft, 73. Jg. (1998) Heft 4, S. 181 ff.<br />
GREGOR, T. (1991): Lebensraum Magerrasen; Botanische Vereinigung für Naturschutz in Hessen e.V.<br />
und Naturschutz-Zentrum Hessen e.V. (Hrsg.)<br />
GRUBER, U. (1994): Amphibien und Reptilien - Kosmos Naturführer, Franckh-Kosmos, Stuttgart<br />
GRUEHN, D. (1992): Der <strong>Landschaftsplan</strong> - Modellhafte Anwendung am Beispiel der <strong>Gemeinde</strong><br />
Feldatal / Hessen, Schriftenreihe des FB Landschaftsentwicklung der TU Berlin, Sonderheft S7,<br />
Berlin<br />
GRUEHN, D. & KENNEWEG, H. (1998): Berücksichtigung der Belange von Naturschutz und<br />
Landschaftspflege in der Flächennutzungsplanung, Bundesamt für Naturschutz, Bonn – Bad<br />
Godesberg<br />
HARTHUN, M. & SCHMIDT, D. (1999): Vom Todesstreifen zur Lebensader - Eine Bilanzierung des<br />
Projektes „Grünes Band“, in: Jahrbuch Naturschutz in Hessen 4: 69-80, Zierenberg<br />
HEILAND, S. (2000): Sozialwissenschaftliche Dimensionen des Naturschutzes – Zur Bedeutung<br />
individueller und gesellschaftlicher Prozesse für die Naturschutzpraxis, in: Natur und Landschaft,<br />
75. Jg. (2000) Heft 6, S. 242 ff.<br />
HEINRICH, C. (1993): Leitlinien „Naturschutz im Wald“, Hrsg. Naturschutzbund Deutschland (NABU),<br />
Landesverband Hessen e.V., Wetzlar<br />
HERZIG, L. (2001): Fledermausdaten für den <strong>Landschaftsplan</strong> der <strong>Gemeinde</strong> <strong>Hofbieber</strong>, schriftl.<br />
Mitteilung; Fulda<br />
HESSISCHE GESELLSCHAFT FÜR ORNITHOLOGIE UND NATURSCHUTZ (HGON) (1996): Tagungsband<br />
5 Jahre Biosphärenreservat Rhön – Artenschutz was nun?, Echzell<br />
HESSISCHES LANDESAMT FUER UMWELT UND GEOLOGIE (2000): Biologischer Gewässerzustand<br />
HESSISCHES MINISTERIUM D. INNERN U.F. LANDWIRTSCHAFT, FORSTEN U. NATURSCHUTZ ( 1995):<br />
Vogel und Umwelt – Zeitschrift für Vogelkunde und Naturschutz in Hessen, Band 8, Sonderheft<br />
Rotmilan, Wiesbaden
<strong>Landschaftsplan</strong> <strong>Hofbieber</strong> Seite - 162 -<br />
-Literaturverzeichnis-<br />
HESSISCHES MINISTERIUM DES INNERN UND FÜR LANDWIRTSCHAFT, FORSTEN UND NATURSCHUTZ<br />
(1998): Empfehlungen zur Biotop- und Nutzungstypenkartierung, Materialien für den<br />
<strong>Landschaftsplan</strong>, Wiesbaden<br />
HESSISCHES MINISTERIUM FÜR LANDESENTWICKLUNG, WOHNEN, LANDWIRTSCHAFT, FORSTEN UND<br />
NATURSCHUTZ (1994): Hessische Biotopkartierung (HB) Kartieranleitung; 2. ergänzte Fassung;<br />
Wiesbaden<br />
HESSISCHES MINISTERIUM FÜR UMWELT, LANDWIRTSCHAFT UND FORSTEN (1999): Hessische<br />
Biotopkartierung (HB) Anwenderorientierte Erläuterungen zur Kartiermethodik; 1. Fassung;<br />
Wiesbaden<br />
HESS. MINISTERIUM FÜR UMWELT, LANDWIRTSCHAFT UND FORSTEN (1999): Gewässerstrukturgüte in<br />
Hessen<br />
HORMANN, M. & RICHARZ, K. (1996): Schutzstrategien und Bestandsentwicklung des Schwarzstorchs<br />
(Ciconia nigra) in Hessen und Rheinland-Pflanz – Ergebnisse einer Fachtagung, in: Vogel und<br />
Umwelt, Zeitschrift für Vogelkunde und Naturschutz in Hessen, Band 8, Heft 6, 1996<br />
JEDICKE, E. & FREY, W, HUNDSDORFER, M., STEINBACH, E. (1993): Praktische Landschaftspflege:<br />
Grundlagen und Maßnahmen, Ulmer-Verlag, Stuttgart<br />
JEDICKE, E. (1992): Die Amphibien Hessens, Hrsg. i. Zus. m.d. Hessischen Ministerium f.<br />
Landesentwicklung, Wohnen, Landwirtschaft, Forsten und Naturschutz; Ulmer-Verlag, Stuttgart<br />
JEDICKE, E. (1994b): Biotopschutz in der <strong>Gemeinde</strong>, Neumann-Verlag, Radebeul<br />
JEDICKE, E. (1994a): Biotopverbund: Grundlagen und Massnahmen einer neuen Naturschutzstrategie, 2.<br />
Aufl., Ulmer-Verlag, Stuttgart<br />
KAULE, G. (1991): Arten- und Biotopschutz; Stuttgart<br />
KIEMSTEDT, H. & SCHARPF, H. (1989): Erholungsvorsorge im Rahmen der <strong>Landschaftsplan</strong>ung<br />
KIEMSTEDT, PROF. DR. H. (1993): <strong>Landschaftsplan</strong>ung – Inhalte und Verfahrensweisen, Hrsg. Der<br />
Bundesminister für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit – Referat <strong>Landschaftsplan</strong>ung –,<br />
Bonn<br />
KLAUSING, DR. O. (1988): Die Naturräume Hessens mit Karte 1:200.000; Schriftenreihe der Hessischen<br />
Landesanstalt für Umwelt, Wiesbaden<br />
KLEIN, M., RIECKEN, U. & SCHRÖDER, E. (1997): Begriffsdefinitionen im Spannungsfeld zwischen<br />
Naturschutz und Landwirtschaft – Vorschläge zur Diskussion, in: Naturschutz und<br />
<strong>Landschaftsplan</strong>ung 29, (8), 1997, S. 229 ff.<br />
KOCH, M. (1991): Wir bestimmen Schmetterlinge, 3. Aufl., 792 S., Neumann-Verlag, Radebeul<br />
KORNPROBST, M. (1994): Lebensraumtyp Streuobst – Landschaftspflegekonzept Bayern, Band II.5,<br />
Hrsg. Bay. Staatsmin. f. Landesentwicklung und Umweltfragen und Bay. Akademie f.<br />
Naturschutz und Landschaftspflege<br />
KUNZE, K., VON HAAREN, C., KNICKREHM, B. & REDSLOB, M. (2002): Interaktiver <strong>Landschaftsplan</strong>,<br />
Bundesamt für Naturschutz, Bonn – Bad Godesberg<br />
KÜPFER, C. (1997): Ökonomisch tragfähige und ressourcenschonende Formen der Landbewirtschaftung<br />
– Teil A: Planungen für die nachhaltige Entwicklung von Agrarräumen, in: Naturschutz und<br />
<strong>Landschaftsplan</strong>ung 29, (5), 1997, S. 146 ff.<br />
LESER, H. (1991): Landschaftsökologie: Ansatz, Modelle, Methodik, Anwendung, 3. Aufl., Ulmer-<br />
Verlag, Stuttgart<br />
LICHT, T. (1993): Verinselung von Waldwiesentälern für Heuschrecken und Laufkäfer durch<br />
Fichtenquerriegel, in: Natur und Landschaft, 68. Jg. (1993) Heft 3, S. 115 ff.<br />
LUDWIG, H.W. (1993): Tiere in Bach, Fluß, Tümpel, See: Merkmale, Biologie, Lebensraum,<br />
Gefährdung, 2. Aufl., BLV Verlagsgesellschaft, München<br />
MAERTENS, T., WAHLERT, M. & LUTZ, J. (1990): Landschaftspflege auf gefährdeten<br />
Grünlandstandorten, Schriftenreihe angew. Naturschutz 9: 1-167<br />
MARKS, R., MÜLLER,J., LESER, H., KLINK, H.J., (1989): Anleitung zur Bewertung des<br />
Leistungsvermögens des Landschaftshaushaltes, Forschungen zur deutschen Landeskunde, Band<br />
229
<strong>Landschaftsplan</strong> <strong>Hofbieber</strong> Seite - 163 -<br />
-Literaturverzeichnis-<br />
MASCH, E. (1994): Feuchtgrünland-Bewirtschaftung und Wiesenbrüterschutz – Ein Beitrag aus der<br />
Sicht landwirtschaftlicher Tierhaltung, in: Naturschutz und <strong>Landschaftsplan</strong>ung 26, (4), 1994, S.<br />
138 ff.<br />
MEBS, T. (1987): Eulen und Käuze, 6. Aufl., Franckh-Kosmos, Stuttgart<br />
NABU AK AMPHIBIENSCHUTZ IM LKRS. FULDA (1999): Amphibienschutz an Straßen im Landkreis<br />
Fulda<br />
NIEDERSÄCHSISCHES LANDESAMT FÜR ÖKOLOGIE (HRSG.), (1999): Schutzgut Klima / Luft in der<br />
<strong>Landschaftsplan</strong>ung<br />
NITSCHE, L. (1999): Grünlandnutzung unter den Gesichtspunkten der Kulturlandschaftspflege, des<br />
Arten- und Biotopschutzes und des Biotopverbundes, in: Jahrbuch Naturschutz in Hessen 4: 61-<br />
69, Zierenberg<br />
NITSCHE, S. & L. (1994): Extensive Grünlandnutzung, Neumann-Verlag, Radebeul<br />
OPPERMANN, R. & LUICK, R. (1999): Extensive Beweidung und Naturschutz – Charakterisierung einer<br />
dynamischen und naturverträglichen Landnutzung, in: Natur und Landschaft, 74. Jg. (1999) Heft<br />
10, S. 411 ff.<br />
OTT, E. (1999): Mensch und Natur in Einklang bringen! - Regionale Entwicklungen in acht Jahren<br />
Biosphärenreservat Rhön, in: Jahrbuch Naturschutz in Hessen 4: 84-91, Zierenberg<br />
PLACHTER, H. (1991): Naturschutz, G. Fischer-Verlag, Stuttgart<br />
PLANUNGSBÜRO GREBE (1995): Biosphärenreservat Rhön, Rahmenkonzept für Schutz, Pflege und<br />
Entwicklung; Bayerisches Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen,<br />
München; Hessisches Ministerium für Landesentwicklung, Wohnen, Landwirtschaft, Forsten und<br />
Naturschutz, Wiesbaden; Thüringer Ministerium für Umwelt und Landesplanung, Erfurt;<br />
Neumann-Verlag, Radebeul<br />
PLANUNGSBÜRO HORST HENNING (1988): <strong>Landschaftsplan</strong> <strong>Hofbieber</strong>; Fulda<br />
PLANUNGSBÜRO HORST HENNING (1998): Flächennutzungsplan der <strong>Gemeinde</strong> <strong>Hofbieber</strong>, Erläuterungsbericht;<br />
Fulda<br />
RAEHSE, S. (1996): Veränderungen in der Kulturlandschaft – Lebensraum Grünland: Ergebnisse einer<br />
vegetationskundlichen Untersuchung exemplarisch ausgewählter Grünlandregionen Mittel- und<br />
Nordhessens – Begleitstudie zum Hessischen Ökowiesenprogramm, Hess. Ministerium d. Innern<br />
u.f. Landwirtschaft, Forsten und Naturschutz<br />
REGIERUNGSPRÄSIDIUM KASSEL, OBERE NATURSCHUTZBEHÖRDE (1999): Landschaftsrahmenplan<br />
Nordhessen 1999 (Entwurf); Kassel<br />
RIECKEN, U., FINCK, P. & SCHRÖDER, E. (2001): Tagungsbericht zum Workshop „Großflächige<br />
halboffene Weidesysteme als Alternative zu traditionellen Formen der Landschaftspflege“, in:<br />
Natur und Landschaft, 76 Jg. (2001) Heft 3<br />
RIECKEN, U., RIES, U., SSYMANK, A. (1994): Rote Liste der gefährdeten Biotoptypen der<br />
Bundesrepublik Deutschland, Schriftenreihe für Landschaftspflege und Naturschutz; Heft 41;<br />
Hrsg.: BfN; Bonn<br />
RÖSER, B. (1995): Saum- und Kleinbiotope: ökologische Funktion, wirtschaftliche Bedeutung und<br />
Schutzwürdigkeit in Agrarlandschaften, 3. Aufl., ecomed-verlagsgesellschaft, Landsberg<br />
RÖSLER, M. (1992): Erhaltung und Förderung von Streuobstwiesen: Analyse und Konzept -<br />
Modellstudie dargestellt am Beispiel der <strong>Gemeinde</strong> Boll, Diplomarbeit im Studiengang<br />
<strong>Landschaftsplan</strong>ung an der TU Berlin, Hrsg. <strong>Gemeinde</strong> Boll<br />
ROTHMALER, W. (1995): Exkursionsflora von Deutschland, Bd. 3 Gefäßpflanzen: Atlasband, 9.<br />
Auflage, Hrsg. Von E.J. Jäger u. K. Werner; Jena, Stuttgart, G. Fischer-Verlag<br />
RUNGE, F. (1994): Die Pflanzengesellschaften Europas – Eine kleine Übersicht, 12./13. Aufl.,<br />
Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster<br />
SCHAUER, T. & CASPARI, C. (1993): Der große BLV Pflanzenführer: über 1500 Blütenpflanzen<br />
Deutschlands und der Nachbarländer, 6. Aufl., BLV-Verlag, München<br />
SCHEFFER, F. & SCHACHTSCHABEL, P. (1992): Lehrbuch der Bodenkunde, 13. Aufl., Stuttgart<br />
SCHUMACHER, W. (1997): Naturschutz in agrarisch geprägten Landschaften, in: ERDMANN, K.H. &<br />
SPANDAU, L. (1997): Naturschutz in Deutschland: Strategien, Lösungen, Perspektiven; Ulmer-<br />
Verlag, Stuttgart
<strong>Landschaftsplan</strong> <strong>Hofbieber</strong> Seite - 164 -<br />
-Literaturverzeichnis-<br />
SCHWAHN, C. & BORSTEL, U. (1997): Möglichkeiten des Zusammenwirkens von Naturschutz und<br />
Landwirtschaft bei der Erhaltung montanen Grünlands, in: Natur und Landschaft, 72. Jg. (1997)<br />
Heft 6, S. 267 ff.<br />
SSYMANK, A., HAUKE, U., RÜCKRIEM, C. & SCHRÖDER, E. (1998): Das europäische<br />
Schutzgebietssystem NATURA 2000, BfN-Handbuch zur Umsetzung der Fauna-Flora-Habitat-<br />
Richtlinie (92/43/EWG) und der Vogelschutzrichtlinie (79/409/EWG), Schriftenreihe für<br />
Landschaftspflege und Naturschutz, Bundesamt für Naturschutz, Bonn-Bad Godesberg<br />
STROBEL, CH. & HÖLZEL, N. (1994): Lebensraumtyp Feuchtwiesen – Landschaftspflegekonzept<br />
Bayern, Band II.6, Hrsg. Bay. Staatsmin. f. Landesentwicklung und Umweltfragen und Bay.<br />
Akademie f. Naturschutz und Landschaftspflege, München<br />
VERLAG PARZELLER (1999): Die Milseburg, 2. Auflage, Verlag Parzeller, Fulda<br />
Gesetze, Verordnungen, Richtlinien und Erlasse<br />
BAUGESETZBUCH (BauGB)<br />
BEGRIFFSDEFINITION DAUERGRÜNLAND, Hess. Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Forsten<br />
FLURBEREINIGUNGSGESETZ (FlurbG)<br />
GESETZ ÜBER DIE GEMEINSCHAFTSAUFGABE „VERBESSERUNG DER AGRARSTRUKTUR UND DES<br />
KÜSTENSCHUTZES“ (GAK-Gesetz)<br />
GESETZ ÜBER NATURSCHUTZ UND LANDSCHAFTSPFLEGE (Bundesnaturschutzgesetz – BnatSchG)<br />
GESETZ ZUM SCHUTZ DES BODENS (Bundes-Bodenschutzgesetz – BbodSchG)<br />
GESETZ ZUR ORDNUNG DES WASSERHAUSHALTS (Wasserhaushaltsgesetz – WHG)<br />
HESSISCHES GESETZ ÜBER NATURSCHUTZ UND LANDSCHAFTSPFLEGE (Hessisches Naturschutzgesetz –<br />
HENatG)<br />
HESSISCHES WASSERGESETZ (HWG)<br />
LANDSCHAFTSPLANVERORDNUNG (LplanVO)<br />
NATURSCHUTZRECHTLICHE BEHANDLUNG STILLGELEGTER ACKERFLÄCHEN<br />
RICHTLINIE ZUR „FÖRDERUNG VON MAßNAHMEN, DIE DER WIEDERHERSTELLUNG NATURNAHER<br />
GEWÄSSER EINSCHLIEßLICH IHRER UFER UND AUEN DIENEN“<br />
RICHTLINIEN FÜR DIE FÖRDERUNG DES ERWERBS VON UFERRANDSTREIFEN UND DER MAßNAHMEN IM<br />
RAHMEN DES PROGRAMMES „NATURNAHE GEWÄSSER“<br />
VERORDNUNG ÜBER DIE GRUNDSÄTZE DER GUTEN FACHLICHEN PRAXIS BEIM DÜNGEN<br />
(Düngeverordnung)<br />
VERORDNUNG ÜBER TRINKWASSER UND ÜBER WASSER FÜR LEBENSMITTELBETRIEBE (TrinkwV)
<strong>Landschaftsplan</strong> <strong>Hofbieber</strong> Seite - 165 -<br />
-Anhänge-<br />
Plan- und Kartenmaterial<br />
Karte 1: Planungsvorgaben<br />
Karte 2: Biotoptypen und Nutzungen<br />
Karte 3: Schutzgut Boden<br />
Karte 4: Schutzgut Grundwasser<br />
Karte 5: Schutzgut Oberflächengewässer<br />
Karte 6: Schutzgut Klima<br />
Karte 7: Schutzgut Biotope und Arten<br />
Karte 8: Schutzgut Landschaftsbild und Erholungswert<br />
Karte 9: Leitbild<br />
Karte 10a: Entwicklung - Schutzgebiete, Objekte und Flächen rechtlicher Bindung<br />
Karte 10b: Entwicklung - Landschaftspflegerische Massnahmen