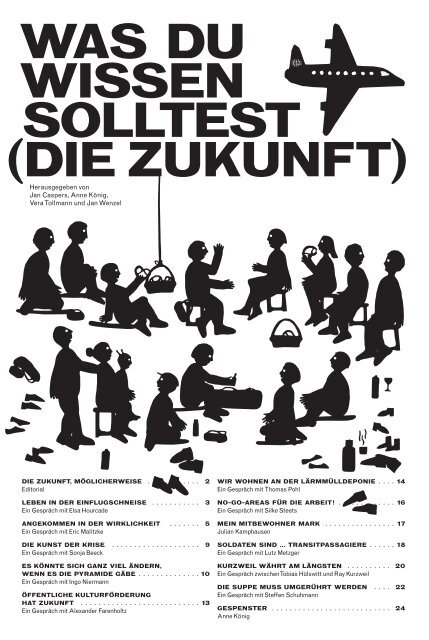Herausgegeben von Jan Caspers, Anne König, Vera Tollmann und ...
Herausgegeben von Jan Caspers, Anne König, Vera Tollmann und ...
Herausgegeben von Jan Caspers, Anne König, Vera Tollmann und ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
WAS DU<br />
WISSEN<br />
SOLLTEST<br />
(DIE ZUKUNFT)<br />
<strong>Herausgegeben</strong> <strong>von</strong><br />
<strong>Jan</strong> <strong>Caspers</strong>, <strong>Anne</strong> <strong>König</strong>,<br />
<strong>Vera</strong> <strong>Tollmann</strong> <strong>und</strong> <strong>Jan</strong> Wenzel<br />
DIE ZUKUNFT, MÖGLICHERWEISE . . . . . . . . . . . . 2<br />
Editorial<br />
LEBEN IN DER EINFLUGSCHNEISE . . . . . . . . . . . 3<br />
Ein Gespräch mit Elsa Hourcade<br />
ANGEKOMMEN IN DER WIRKLICHKEIT . . . . . . . 5<br />
Ein Gespräch mit Eric Malitzke<br />
DIE KUNST DER KRISE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9<br />
Ein Gespräch mit Sonja Beeck<br />
ES KÖNNTE SICH GANZ VIEL ÄNDERN,<br />
WENN ES DIE PYRAMIDE GÄBE . . . . . . . . . . . . . . 10<br />
Ein Gespräch mit Ingo Niermann<br />
ÖFFENTLICHE KULTURFÖRDERUNG<br />
HAT ZUKUNFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13<br />
Ein Gespräch mit Alexander Farenholtz<br />
WIR WOHNEN AN DER LÄRMMÜLLDEPONIE . . . . 14<br />
Ein Gespräch mit Thomas Pohl<br />
NO-GO-AREAS FÜR DIE ARBEIT! . . . . . . . . . . . . . 16<br />
Ein Gespräch mit Silke Steets<br />
MEIN MITBEWOHNER MARK . . . . . . . . . . . . . . . . 17<br />
Julian Kamphausen<br />
SOLDATEN SIND ... TRANSITPASSAGIERE . . . . . . 18<br />
Ein Gespräch mit Lutz Metzger<br />
KURZWEIL WÄHRT AM LÄNGSTEN . . . . . . . . . . 20<br />
Ein Gespräch zwischen Tobias Hülswitt <strong>und</strong> Ray Kurzweil<br />
DIE SUPPE MUSS UMGERÜHRT WERDEN . . . . 22<br />
Ein Gespräch mit Steffen Schuhmann<br />
GESPENSTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24<br />
<strong>Anne</strong> <strong>König</strong>
WAS DU WISSEN SOLLTEST (DIE ZUKUNFT)<br />
DIE ZUKUNFT,<br />
MÖGLICHERWEISE<br />
Editorial<br />
Schaut man sich derzeit im Feld der<br />
zeitgenössischen Kunst um, entsteht leicht<br />
der Eindruck, die ZUKUNFT sei das<br />
Thema der St<strong>und</strong>e. In erstaunlich vielen<br />
künstlerischen Arbeiten, Ausstellungsprojekten<br />
<strong>und</strong> Festivalankündigungen<br />
geistert der Begriff des Zukünftigen herum.<br />
Auffällig an der zu beobachtenden Häufung<br />
ist vor allem, dass das aktuelle Interesse<br />
an Zukunft unter neuen Vorzeichen zu<br />
stehen scheint. Denn es ist nicht mehr die<br />
Suche nach dem Utopia, die die Künstlerinnen<br />
<strong>und</strong> Künstler umtreibt, vielmehr<br />
versuchen sie in ihren Arbeiten nachzuvollziehen,<br />
in welchem Maße auch die<br />
noch vor uns liegende Zeit bereits als<br />
Ressource der Gegenwart aufgefasst wird.<br />
So untersucht zum Beispiel Katya Sander<br />
in ihrer Videoinstallation ›Darstellungen<br />
der Zukunft‹ (2008) die Mechanismen<br />
kapitalistischer Zukunftssteuerung,<br />
während sich die Autoren Paul Plamper<br />
<strong>und</strong> Julian Kamphausen in ihrem Hörspiel<br />
›Die Unmöglichen‹ (2008) mit der Pränataldiagnostik<br />
beschäftigen. Hier geht es<br />
darum, wie die Zukunft durch Techniken<br />
der Vorhersage, der Kontrolle <strong>und</strong> des Ausschlusses<br />
an der kurzen Leine der Ge genwart<br />
gehalten wird. Fast schon wie eine<br />
Revolte gegen solche Formen <strong>von</strong> Zukunfts-<br />
Besetzung wirkt dabei der Titel einer<br />
neuen Arbeit des britischen Künstlers Liam<br />
Gillick: »The future always acts differently<br />
– Die Zukunft verhält sich immer anders«.<br />
›Diskursdorf – Die Zukunft‹ überschrie<br />
ben Cora Hegewald <strong>und</strong> Benjamin<br />
Foerster-Baldenius einen dreitägigen Workshop,<br />
den das Thalia-Theater Halle im<br />
April in Kursdorf veranstaltete. Eingeladen<br />
waren 27 Referentinnen <strong>und</strong> Referenten,<br />
um über die Zukunft zu sprechen: Es ging<br />
in den drei Tagen um Utopien <strong>von</strong> Gestern,<br />
Zukunftsforen, Thinktanks <strong>und</strong> Science<br />
Fiction, um die Zukunft der Region <strong>und</strong> die<br />
des Flughafens, um die Zukunft der Biogenetik,<br />
der Theaterfestivals, der Stadt entwicklung,<br />
der Kulturförderung, der Mobilität<br />
<strong>und</strong> der Sprache – ein wahres Potpourri<br />
der Potentiale. Die beiden Workshop-<br />
Kuratoren hatten uns gefragt, ob wir ihre<br />
Arbeit dokumentierend begleiten würden. –<br />
Zwölf Minuten dauert die Zugfahrt<br />
<strong>von</strong> Leipzig oder Halle aus zum Flughafen.<br />
Hatte man sich hier vor einigen Jahren verplant<br />
oder würden die besseren Tage<br />
dieses Flughafens erst in der Zukunft beginnen?<br />
Durch die voll verglaste Fensterfront<br />
der gespenstisch leeren Mall sahen wir<br />
Kursdorf zum ersten Mal. Die Straße zum<br />
Dorf führt an einem Roll feld vorbei, auf<br />
dem jeden Tag Maschinen einer unbekannten<br />
Fluglinie auf ihren Abfl ug warten.<br />
Kursdorf war ein merk würdiger Ort. Eingeschlossen<br />
<strong>von</strong> Verkehrs infra struk turen –<br />
Autobahn, ICE-Trasse <strong>und</strong> Roll fel der –<br />
schien das Dorf selbst wie abgeschnitten<br />
<strong>von</strong> der Gegenwart. Die Mehrzahl der<br />
Häuser <strong>und</strong> Stallungen standen leer, obwohl<br />
alles bestens gepfl egt <strong>und</strong> erhalten<br />
wirkte, als wären die Bewohner plötzlich<br />
verschw<strong>und</strong>en. Hier <strong>und</strong> da gab es noch<br />
Anzeichen <strong>von</strong> Leben, aber es überwog der<br />
menschenleere Eindruck, den wir schon<br />
vom Flughafen kannten. Für den Workshop<br />
hatte man einige Gebäude temporär wieder<br />
nutzbar gemacht. Der April brachte Regen<br />
<strong>und</strong> Kälte. Nur in der mit einem Heizgebläse<br />
gewärmten winzigen Dorfkirche<br />
war es gelungen, eine angenehme Situation<br />
für die Gäste zu schaffen; im Gasthof <strong>und</strong><br />
in der Scheune musste man sich in eine<br />
der reichlich vorhandenen Leihdecken<br />
wickeln, um nicht zu sehr zu frieren.<br />
Was war das nur für ein Ort, um über die<br />
Zukunft zu sprechen? Drei Tage lang<br />
hörten wir zu, beobachteten, diskutierten<br />
<strong>und</strong> spazierten durch das Dorf <strong>und</strong> den<br />
Flughafen. Vieles blieb uns unklar.<br />
Wir erlebten Gesprächsformate, deren Sinn<br />
wir nicht verstanden. Wir hörten Beiträge,<br />
deren Bedeutung wir nicht begriffen.<br />
Wir sahen Flugzeuge vorbei rollen, deren<br />
Firmenzeichen wir nicht kannten. Nach<br />
den drei Tagen hatten wir vor allem<br />
Fragen. Aber gerade diese Fragen erwiesen<br />
sich als die beste Gr<strong>und</strong>lage für unsere<br />
weitere Arbeit. Sie führten uns zurück zu<br />
Referenten, mit denen wir dann ausführlichere<br />
Gespräche führten. Und sie führten<br />
uns zu Menschen, die sich intensiv mit<br />
dem Flughafen <strong>und</strong> seinem Beitrag für die<br />
Region befasst hatten.<br />
Erst mit der Zeit erhielten die Eindrücke<br />
der Diskursdorf-Tage so eine<br />
Ordnung. Es gab Themen, die wir aufgeschnappt<br />
hatten <strong>und</strong> nun intensiv<br />
weiterverfolgten, <strong>und</strong> es gab Lücken –<br />
Unartikuliertes, Vages, Ausgespartes – die<br />
uns erst im Nachhinein auffi elen. Und<br />
zunehmend hatten wir das Gefühl: Gerade<br />
in diesen Lücken stecken die Fragen<br />
der Zukunft.<br />
In dieser Zeitung, die im Laufe <strong>von</strong><br />
zwei Monaten entstand, überlagern sich<br />
verschiedene Themenstränge: Anfangs<br />
interessierten wir uns vor allem für<br />
individuelle Umgangsweisen mit Zukunft.<br />
Mit Silke Steets schrieben wir uns E-Mails<br />
über Deadline-Karten, Steffen Schuhmann<br />
machte uns die Bedeutung klar, die<br />
längerfristige Zeithorizonte nach wie vor<br />
besitzen. Wir wollten <strong>von</strong> unseren<br />
Gesprächspartnern wissen, ob fl exible <strong>und</strong><br />
kurzfristige Umgangsweisen mit Zeit solche<br />
längerfristigen Zeithorizonte, die ja den<br />
Begriff Zukunft eigentlich ausmachen,<br />
nicht längst entwertet haben <strong>und</strong> wie stark<br />
das permanente Nebeneinander unterschied<br />
licher Optionen <strong>und</strong> daraus erwachsende<br />
Ad-hoc-Strategien für sie handlungsleitend<br />
sind.<br />
Als wir bereits mitten in der redaktionellen<br />
Arbeit steckten, entschieden wir uns<br />
selbst, unsere Aufmerksamkeit ad hoc auf<br />
ein anderes Thema zu lenken: Das Bild der<br />
Flugzeuge mit dem Weltnetz als Logo, die<br />
wir in Kursdorf gesehen hatten, waren uns<br />
nicht aus dem Kopf gegangen.<br />
Wir hatten im Internet recherchiert; es<br />
handelte sich um World Airways, eine<br />
private Fluggesellschaft, die amerikanische<br />
Soldaten in die Krisengebiete im Irak <strong>und</strong><br />
in Afghanistan fl iegt – mit Tankstopp auf<br />
dem Flughafen Leipzig / Halle.<br />
Wir recherchierten weiter <strong>und</strong> führten<br />
Interviews: Mit dem Geschäftsführer des<br />
Flughafens Leipzig / Halle, Eric Malitzke,<br />
ebenso wie mit seinen Kritikern. Thomas<br />
Pohl <strong>von</strong> der Interessengemeinschaft<br />
Nachtfl ugverbot berichtete, dass, seit das<br />
B<strong>und</strong>esverwaltungsgericht 2006 die<br />
Nachtfl üge <strong>von</strong> Passagiermaschinen am<br />
Flughafen Leipzig / Halle untersagt hat, die<br />
amerikanischen Truppentransporte nachts<br />
wie Militärfl üge behandelt, tagsüber aber<br />
als zivile Transporte deklariert werden.<br />
Wir sahen bereits die St<strong>und</strong>e des<br />
Theaters gekommen, dessen gesellschaft liche<br />
Funk tion ja auch <strong>und</strong> besonders in der<br />
2<br />
Bear beitung <strong>von</strong> Widersprüchen auf offener<br />
Bühne besteht. Allerdings bringt wohl kein<br />
noch so spielerisches Gesprächsformat<br />
derart polarisierte Protagonisten an einen<br />
Tisch. Vielleicht ist es einem Medium wie<br />
der Zeitung – in ihrer Unmittelbarkeit<br />
praktisch die publizistische Entsprechung<br />
des Theaters – vorbehalten, den aktuellen<br />
Konfl ikt r<strong>und</strong> um den Flughafen Leipzig /<br />
Halle darzustellen. Je mehr sich unsere<br />
Recherchen konkretisierten, um so deut licher<br />
kamen die Signale <strong>von</strong> Seiten des Flughafens,<br />
dass auf seinem Gelände be stimmte<br />
Themen ein absolutes Tabu dar stel len<br />
<strong>und</strong> auch für die Kunst unausge sprochen<br />
bleiben müssen.<br />
Zugegeben, anfangs hegten wir<br />
Zweifel daran, ob ein halb verlassenes Dorf<br />
mitten auf dem Flughafengelände der<br />
richtige Ort sei, um über die Zukunft<br />
nachzudenken. In der Zwischenzeit haben<br />
wir unsere Meinung geändert. ›Diskursdorf‹<br />
funktio nierte wie ein Lackmustest für den<br />
öffent lichen Raum. Auf dem Flughafen<br />
war unter den gegebenen Umständen ein<br />
solches Unterfangen vielleicht <strong>von</strong> vornherein<br />
zum Scheitern verurteilt.<br />
Denn an diesem Ort wird die Zukunft<br />
durch Kon trolle <strong>und</strong> Ausschluss ans Gängelband<br />
gelegt. Kunst kann hier allenfalls als<br />
Camoufl age fungieren. Vom nahen Kursdorf<br />
aus wird deutlich, dass dieser Umgang<br />
mit der Zukunft eine Illusion darstellt.<br />
Denn auch für den Flughafen Leipzig/<br />
Halle gilt: »The future always acts<br />
differently – Die Zukunft verhält sich<br />
immer anders«.<br />
Impressum<br />
›Was Du wissen solltest (Die Zukunft)‹<br />
entstand als künstlerische Arbeit zum dreitägigen<br />
Symposium ›Diskursdorf –<br />
Die Zukunft‹ (11./12. <strong>und</strong> 19. April 2008).<br />
›Diskursdorf‹ ist Teil <strong>von</strong> ›AusFlugHafenSicht‹<br />
– ein temporärer Landschaftsgarten<br />
des Thalia Theater Halle, unterstützt durch<br />
›Theater der Welt 2008‹. Künstlerische<br />
Leitung: Benjamin Foerster-Baldenius <strong>und</strong><br />
Cora Hegewald.<br />
Die hier abgedruckten Beiträge geben nicht<br />
unbedingt die Meinung der <strong>Vera</strong>nstalter wieder.<br />
Herausgeber: <strong>Jan</strong> <strong>Caspers</strong>, <strong>Anne</strong> <strong>König</strong>,<br />
<strong>Vera</strong> <strong>Tollmann</strong>, <strong>Jan</strong> Wenzel<br />
Gestaltung: Ina Kwon, Helmut Völter<br />
Scherenschnitt: <strong>Jan</strong> <strong>Caspers</strong><br />
Lektorat: Wiebke Helms<br />
Druck: Union Druckerei Nohra bei Weimar<br />
Creative Commons Licence: by-nc-sa.<br />
Für alle Texte <strong>und</strong> Bilder gilt: Der Name des<br />
Urhebers muss genannt werden. Eine kommerzielle<br />
Nutzung ist nicht gestattet. Wenn ein<br />
Text bearbeitet wurde, muss das neu entstandene<br />
Werk unter einer Lizenz mit vergleichbaren<br />
Bedingungen weitergegeben werden.<br />
Alle Texte auf www.spectormag.net.<br />
Kontakt: spector@spectormag.net<br />
Dank an: Uwe Bautz, Sonja Beeck,<br />
Alexander Farenholtz,<br />
Benjamin Foerster-Baldenius, Cora Hegewald,<br />
Elsa Hourcade, Tobias Hülswitt, Thomas Irmer,<br />
Julian Kamphausen, Eric Malitzke,<br />
Lutz Metzger, Ingo Niermann, Thomas Pohl,<br />
Claudia Rast, Steffen Schuhmann,<br />
Stefan Shankland, Ria Staude, Silke Steets,<br />
Christian Tschirner, Kai Wenzel
WAS DU WISSEN SOLLTEST (DIE PERIPHERIE)<br />
LEBEN IN DER<br />
EINFLUGSCHNEISE<br />
Ein Gespräch mit der französischen<br />
Schauspielerin Elsa Hourcade,<br />
die Fragen stellten<br />
<strong>Jan</strong> <strong>Caspers</strong> <strong>und</strong> <strong>Anne</strong> <strong>König</strong><br />
Wie hast Du Gonesse bei Deinem ersten<br />
Besuch erlebt?<br />
Als ich das erste Mal nach Gonesse gefahren bin, sprach mich<br />
ein Mann auf der Straße an. »Du bist eine Fremde.« Ich blickte<br />
an mir herab. »Sehen Sie das an meiner Kleidung?« Er lachte.<br />
»Nein, Sie haben ständig ihren Kopf im Nacken <strong>und</strong> schauen<br />
nach jedem Flugzeug am Himmel. Das tun hier nur Fremde.«<br />
Und wirklich, nach einer Weile hörst du die Flugzeuge<br />
nicht mehr. Keiner hört sie mehr. Man kann sie fühlen, es fällt<br />
schwer, sich zu konzentrieren, wenn man mit den Leuten redet.<br />
Der Lärm ist nämlich nicht nur da, wenn die Flugzeuge direkt<br />
über dir sind, du hörst sie auch kommen <strong>und</strong> du hörst sie noch,<br />
wenn sie längst über dich hinweg geflogen sind. Es ist eine<br />
permanente Geräuschkulisse. Für mich war das wirklich eine<br />
körperliche Erfahrung. Im Maßstab der Menschheitsgeschichte<br />
passen wir uns an alle möglichen Umweltbedingungen an.<br />
Wie sich dieser Lärm auf die Ges<strong>und</strong>heit auswirkt? Sicherlich<br />
irgendwie, aber niemand hat das hier untersucht.<br />
Er ist bestimmt schädlich für das Gehirn <strong>und</strong> für das Gehör,<br />
das ist sicher. Man hat Konzentrationsprobleme, es gibt Schlaflosig<br />
keit. Tatsache ist auf jeden Fall, dass wir uns daran ge wöhnen<br />
können, so wie wir uns überhaupt an sehr viel gewöhnen<br />
können.<br />
Gibt es überhaupt keinen Protest gegen den<br />
Fluglärm?<br />
Ich glaube, der letzte organisierte Protest ist acht Jahre her.<br />
Natürlich klagen die Leute, wenn du sie danach fragst, aber andererseits<br />
vergessen sie es sofort wieder, weil sie so daran<br />
gewöhnt sind. Ich habe nie eine Beschwerde gehört, bis wir bei<br />
unseren Filmarbeiten mit Einwohnern <strong>von</strong> Saint-Blin eine<br />
Sequenz fünfzehn mal drehen mussten, immer in den Pausen<br />
zwischen zwei Überflügen.<br />
Du arbeitest gemeinsam mit der Künstlerin<br />
Sandrine Vivier. Sie ist vor Dir nach Gonesse<br />
gekommen. Sie wuchs in einer wohlhabenden<br />
Familie im Süden Frankreichs auf.<br />
Wie kam sie in ein Pariser Banlieue?<br />
Sandrine hatte gehört, dass ein kleines Filmfestival Video künstler<br />
suchte, die das Leben in einer Reihe <strong>von</strong> Vorstädten –<br />
Gonesse, Sarcelle, Saint-Denis, Pierrefitte – dokumentieren<br />
sollten. Sie bewarb sich <strong>und</strong> wurde angenommen, weil sie die<br />
einzige Künstlerin war, die vor schlug, für ein halbes Jahr<br />
dort hinzuziehen. Die anderen Künstler wohnten meist in Paris<br />
<strong>und</strong> wollten in diese Vorstädte pendeln. Sie schlug vor, ihre<br />
Sachen zu packen <strong>und</strong> einfach dort hinzuziehen.<br />
Und warum entschied sie sich dann, endgültig<br />
in Gonesse zu bleiben?<br />
Sie hatte das Gefühl, auch nach dem halben Jahr die Bewohner<br />
der Hochhaussiedlung Saint-Blin, mit denen sie arbeitete,<br />
nicht wirklich kennengelernt zu haben. Sie bat die Stadtverwaltung,<br />
ihren Aufenthalt zu verlängern, damit sie ihren ersten<br />
Film, ›Lost en Gonesse‹, fertig stellen könne. Und irgendwann<br />
fasste sie den Entschluss, sich dauerhaft niederzulassen.<br />
Sie hat mir einmal erklärt, dass das wie ein künstlerisches Experiment<br />
für sie sei, Wohnen <strong>und</strong> Arbeiten im ›Wilden Wes ten‹<br />
miteinander zu verknüpfen. Außerdem lernte sie jemanden<br />
kennen <strong>und</strong> verliebte sich.<br />
Die Menschen akzeptierten sie?<br />
Anfangs war es schwierig. Sie war immer mit ihrer Videokame<br />
ra unterwegs <strong>und</strong> wurde <strong>von</strong> vielen für eine Polizistin in<br />
Zivil gehalten. Man konnte sie einfach nicht in die gewohnten<br />
sozialen Muster einordnen: Sie war unverheiratet, hatte<br />
keine Verwandten in Saint-Blin, <strong>und</strong> sie ging keinem erkennbaren<br />
Beruf nach. Es wurde alles Mögliche über sie gesagt, die<br />
Leute hatten die abenteuerlichsten Theorien. Nachdem man sie<br />
zuerst für eine Polizistin hielt, glaubte man später, sie müsse<br />
sich sicher vor der Polizei verstecken. Als ich begann, mit<br />
ihr zu arbeiten, schien alles klar: Wir sind ein lesbisches Paar.<br />
Aber im Laufe der Zeit hat sich ein Vertrauensverhältnis<br />
aufgebaut, so dass Sandrine <strong>und</strong> ich heute sehr gut mit den<br />
Menschen dort zusammen leben <strong>und</strong> arbeiten <strong>und</strong> <strong>von</strong> ihnen<br />
akzeptiert werden.<br />
Gonesse ist ein Vorort im Nordwesten<br />
<strong>von</strong> Paris, der direkt in der Ein flugschneise<br />
des Flughafens Charles-de-<br />
Gaulles liegt. Zwischen 8 Uhr morgens<br />
<strong>und</strong> 20 Uhr abends fl iegen im Zwei-<br />
bis Dreiminutentakt Flug zeuge über die<br />
Häuser. Gonesse hat etwa 25.000 Einwohner<br />
<strong>und</strong> besteht aus zwei Teilen:<br />
Es gibt einem kleinen Altstadt kern mit<br />
einer Kirche <strong>und</strong> einem his to rischen<br />
Krankenhaus. Außen stehende verbinden<br />
mit Gonesse vor allem das Hochhaus<br />
viertel Saint-Blin, ein Monu ment<br />
Wo habt Ihr Euch kennengelernt?<br />
Wir haben uns bei dem Seminar einer Kulturstiftung getroffen,<br />
wo man über die Arbeit in den Banlieues sprach. Streitschlichtung<br />
<strong>und</strong> Banlieues, das war damals so eine Obsession.<br />
Ich arbeitete gerade an einem Theaterprojekt mit Banlieue-<br />
Bewohnern im Süden <strong>von</strong> Paris. Mir gefiel sehr gut, wie<br />
Sandrine ihre Arbeit beschrieb, <strong>und</strong> wir kamen ins Gespräch.<br />
Ein paar Wochen später rief sie mich an <strong>und</strong> sagte: »Okay,<br />
ich habe einen Vorschlag <strong>von</strong> einem Geschichtslehrer an einer<br />
Schule in Gonesse.« Er hatte eine sehr schwierige Klasse <strong>und</strong><br />
wollte den üblichen Lehrplan aufgeben <strong>und</strong> mit den Schülern<br />
an einem konkreten Projekt arbeiten, in dem sie sich mit<br />
Geschichte beschäftigen würden, aber auf eine persönlichere,<br />
künstlerische Art. Das war unser erstes gemeinsames Projekt.<br />
Es folgten viele, viele weitere.<br />
Als die Sozialwohnungen in Gonesse gebaut<br />
wurden, war da der Flughafen schon in<br />
Planung?<br />
Die Bauarbeiten für den Flughafen fingen 1966 an <strong>und</strong> das erste<br />
Terminal wurde 1974 eröffnet. Zehn Jahre zuvor war in Saint<br />
Blin der erste Block mit 594 Sozialwohnungen errichtet worden.<br />
Man wusste damals aber schon, dass in unmittelbarer Nähe ein<br />
Flughafen gebaut werden würde; die Flughafengesellschaft <strong>von</strong><br />
Orly hatte das Land bereits gekauft <strong>und</strong> die Planung auch<br />
schon begonnen. Trotzdem ist die Schalldämmung der Gebäude<br />
erbärmlich, vor allem die Fenster. Man kann die Nachbarn hören<br />
<strong>und</strong> natürlich die Flugzeuge. Die Scheiben vibrieren richtig<br />
vom Lärm, es wird aber nichts gemacht. Ansonsten sind<br />
die Wohnungen nicht schlecht, es sind zumeist Drei- oder Vierraumwohnungen.<br />
Aber der Lärm ist zum Verrücktwerden.<br />
Ist Saint-Blin eine reine Migrantensiedlung?<br />
Es wohnen da kaum Menschen, die aus Frankreich stammen.<br />
Man sieht das an den Briefkastenschildern. Es gibt kaum<br />
so typisch französische Nachnamen wie DuPont oder Durand.<br />
In meiner Kindheit, als ich in einem Vorort <strong>von</strong> Paris aufwuchs,<br />
war dort die Bevölkerung noch sehr gemischt. Bei uns haben<br />
Kinder verschiedenster Herkunft miteinander gespielt.<br />
In Orten wie Saint-Blin gibt es heute so viele Migranten, dass<br />
sie eine abgeschlossene Gemeinschaft bilden. Vor allem die<br />
älteren Menschen kommen fast ohne Französisch aus, weil sich<br />
ihr ganzes Leben im Banlieue abspielt.<br />
Mit welchen Erwartungen kommen die<br />
Migranten in Gonesse an <strong>und</strong> wie gestaltet sich<br />
dann ihr Leben?<br />
Bei der älteren Generation ist es kompliziert. Sie sind nach<br />
Frankreich gekommen, um dort Geld zu verdienen, <strong>und</strong> wollten<br />
dann wieder in ihre Heimat zurückkehren. Obwohl die meisten<br />
<strong>von</strong> ihnen in Gonesse unter sehr ärmlichen Bedingungen<br />
leben, schicken sie regelmäßig Geld nach Algerien, um dort ein<br />
Haus zu bauen. Ich hatte auch gedacht, dass sie irgend wann in<br />
Rente gehen <strong>und</strong> dann zurückkehren, aber sie bleiben. Es ist<br />
einfach zu kompliziert. Vor allem gibt es auch ein Gefühl der<br />
Scham, weil die Verwandten in der alten Heimat da<strong>von</strong> ausgehen,<br />
dass alle, die nach Frankreich gegangen sind <strong>und</strong> sogar<br />
in Paris wohnen, reich sein müssen. Sie sehen den Eiffelturm<br />
<strong>und</strong> sonst nichts. Dass die meisten Bewohner <strong>von</strong> Gonesse so<br />
gut wie nie nach Paris hineinfahren, können sie nicht begreifen.<br />
Und die Ausgewanderten belassen sie in diesem Glauben,<br />
um nicht bloßgestellt zu werden. Ihr Traum ist zur Lebenslüge<br />
geworden. Nur langsam gestehen sie sich <strong>und</strong> ihren Kindern<br />
ein, dass sie wohl nie mehr in ihre Heimat länder zurückkehren<br />
werden. Die meisten können sich nicht einmal leisten, in<br />
der alten Heimat beerdigt zu werden, obwohl ihnen das überaus<br />
wichtig ist. Sie werden im musli mi schen Friedhof in Gonesse<br />
begraben. Die jungen Menschen sagen, dass sie irgendwann<br />
aus Gonesse wegziehen wollen. Ich bin mir aber nicht<br />
sicher, ob sie das wirklich tun werden. Die meisten brechen<br />
schon früh die Schule ab. Sie finden keine Arbeit. In Gonesse<br />
können sie trotzdem durchkommen, sie bauen eine alternative<br />
Wirtschaft auf <strong>und</strong> fühlen sich vor allem sicher. Es ist ihre<br />
Heimat. Viele kommen aus muslimischen Familien mit einem<br />
starken Zusammenhalt. Es ist nicht leicht für sie, wegzugehen.<br />
des sozialen Wohnungs baus der<br />
sechziger Jahre. Heute leben in den<br />
Hochhäusern vor allem nordafrikanische<br />
Migranten. Manche <strong>von</strong> ihnen<br />
wohnen ihr ganzes Leben dort <strong>und</strong><br />
verlassen die neue Heimat nur selten.<br />
Die französische Schau spielerin<br />
Elsa Hourcade wuchs selbst in einem<br />
Banlieue <strong>von</strong> Paris auf <strong>und</strong> begann<br />
vor fünf Jahren, gemeinsam mit<br />
der bildenden Künsterlin Sandrine<br />
Vivier mit den Menschen in Gonesse<br />
zu arbeiten.<br />
Gonesse ist wirklich <strong>von</strong> Paris abgeschlossen?<br />
Es gibt die Péripherique, eine Ringautobahn. Sie umgibt Paris<br />
wie ein Burggraben. Die Péripherique ist wie eine Grenze.<br />
Es gibt zwar einen Vorortzug, mit dem man nach Paris hineinfahren<br />
kann. Die eigentliche Grenze ist aber anderer Natur:<br />
Die Menschen können sich einfach nicht vorstellen, warum sie<br />
nach Paris fahren sollten. Manche haben dort Verwandte,<br />
manchmal fahren Jugendliche einfach so in die Stadt, aber das<br />
sind ganz große Ausnahmen. Die meisten Leute, die ich in<br />
Gonesse kenne, fahren nie nach Paris hinein. Ihr gesamtes<br />
Leben spielt sich im Banlieue ab. Dieser Umstand wird <strong>von</strong> der<br />
Politik noch gefördert, da die Banlieue-Bewohner ohnehin als<br />
überflüssige Menschen betrachtet werden, die in der Stadt<br />
nicht gerne gesehen sind. Ich will die Schuld aber nicht allein<br />
auf die Politiker laden. Es gibt auch einen Mangel an Selbstbewusstsein<br />
<strong>und</strong> kultureller Offenheit bei den Menschen<br />
in Saint-Blin, die dazu führt, dass sie sich mehr nach innen wenden.<br />
Beides muss im Zusammenhang gesehen werden: Den<br />
Menschen fehlt der Wille, ihr Ghetto zu verlassen, <strong>und</strong><br />
gleichzeitig sind die Bahnhöfe <strong>und</strong> Züge, die sie dazu benutzen<br />
müssten, immer voller Polizisten.<br />
Protestieren die Menschen gegen ihre<br />
Situation?<br />
In den 80er Jahren wurden Polizeiautos, die nach Saint-Blin<br />
kamen, <strong>von</strong> den Hochhäusern aus mit Steinen <strong>und</strong> sogar Waschmaschinen<br />
beworfen. Es war so etwas wie eine gesetz lose<br />
Zone, was den Ort für Menschen ohne gültige Papiere,<br />
aber auch für Kriminelle attraktiv machte. Seitdem hat sich die<br />
Situation verbessert, aber der schlechte Ruf ist geblieben.<br />
Hat es auch Ausgangssperren gegeben?<br />
Eine Ausgangssperre hat es nur in Krisenzeiten gegeben.<br />
Es gibt da Sondergesetze, da kann man das machen. 2005, aber<br />
auch letztes Jahr, als die Unruhen wieder ausbrachen, wurde<br />
so ein Gesetz angewendet. Es ist besonders zugeschnitten auf<br />
Jugendliche unter 18. Aber es gibt auch ein Gesetz, das<br />
Versammlungen <strong>von</strong> jungen Leuten verbietet. Mehr als drei<br />
Leute dürfen im öffentlichen Raum nicht länger als eine halbe<br />
St<strong>und</strong>e ohne triftigen Gr<strong>und</strong> zusammenstehen. Die Polizei kann<br />
jederzeit die Personalien feststellen. Sie denken sich immer<br />
wieder neue Gründe aus, warum sie die Papiere kontrollieren.<br />
Es ist schon absurd. Sie können nicht einfach sagen, ich<br />
kontrolliere ihn, weil er schwarzer Hautfarbe ist oder arabisch<br />
aussieht, sie müssen sich irgendeinen Gr<strong>und</strong> ausdenken.<br />
Kann man die Bewohner <strong>von</strong> Banlieues wie<br />
Gonesse nur an der Hautfarbe erkennen oder<br />
auch an ihrer Sprache?<br />
Es gibt einen sehr starken Banlieuedialekt, eine Mischung aus<br />
arabischen <strong>und</strong> Romaakzenten, mit eigenem Wortschatz <strong>und</strong><br />
einer eigentümlichen Art der Wortverkehrung. Verlan heißt das,<br />
<strong>von</strong> ›parler en verlan‹, das heißt umgedreht ›à l’envers‹, im<br />
Gegenteil. Das Verlan kann hochkompliziert sein; ich verstehe<br />
es oft selbst nicht, obwohl ich viel mit Jugendlichen arbeite.<br />
Ich habe ja selbst als Kind den Dialekt gesprochen, aber heute<br />
bin ich zu alt, die Jugendlichen sprechen zu schnell <strong>und</strong> denken<br />
sich ständig neue Worte aus. In meiner Jugend war dieser<br />
Dialekt wirklich nur in den Pariser Banlieues zu hören, aber vor<br />
allem durch Reality TV-Sendungen hat er sich über ganz Frankreich<br />
ausgebreitet. Berühmte Fußballspieler wie Zinédine<br />
Zidane, die aus den Banlieues stammen, sprechen so.<br />
Und heute machen das alle nach. Das ist fast schon unheimlich,<br />
wie schnell das passiert ist. Eine ganze soziale Schicht<br />
benutzt diesen Dialekt, um sich zu identifizieren, um zu<br />
zeigen, dass man aus dem Ghetto kommt. Deshalb machen<br />
selbst die Kinder der Reichen in Paris diesen Dialekt nach.<br />
Man will sich heute eben mehr mit Gangsta-Rappern identi fizieren<br />
als mit Proust oder Deleuze.<br />
3
WAS DU WISSEN SOLLTEST (DIE WIRTSCHAFT)<br />
ANGEKOMMEN<br />
IN DER WIRKLICHKEIT<br />
Ein Gespräch mit Eric Malitzke,<br />
Geschäftsführer der<br />
Flughafen Leipzig / Halle GmbH,<br />
die Fragen stellten<br />
<strong>Jan</strong> <strong>Caspers</strong> <strong>und</strong> <strong>Anne</strong> <strong>König</strong><br />
Während des internationalen Festivals<br />
›Theater der Welt‹ im Juni wird das Flughafenge<br />
lände <strong>und</strong> die kleine, halbverwaiste Ortschaft<br />
Kursdorf für kurze Zeit auch zu einer<br />
Bühne für das Theater. Was hat Sie bewogen,<br />
dem Thalia-Theater Halle, das sich zuletzt<br />
vor allem mit ortsspezifi sch ausgerichteten<br />
Thea terformen einen Namen gemacht hat, den<br />
Flughafen als temporäre Spielstätte zu öffnen?<br />
Ein Flughafen ist in der heutigen Zeit mehr als nur<br />
Verkehrsinfrastruktur. Sicher, erstmal ist er so etwas wie<br />
eine Autobahn oder ein Bahnhof oder ein Hafen. Aber ein<br />
Flughafen ist mehr. Seine Funktion ist in der Region weithin<br />
spürbar. Er ist ein Ausfl ugsziel, ein Treffpunkt;<br />
hier fi nden Konferenzen statt. Ich denke, dass der Flughafen<br />
Leipzig / Halle mehr <strong>und</strong> mehr ein struktur gebendes<br />
Element für die Region werden wird, gerade was das<br />
Thema Logistik angeht. Damit verb<strong>und</strong>en ist immer auch<br />
eine gesellschaftliche Rolle <strong>und</strong> die geht über die rein kommerzielle<br />
Funktion <strong>und</strong> über Sachzwänge hinaus. Deshalb<br />
fi nde ich, hat auch Kunst Platz am Flughafen.<br />
Sie selbst sind seit fünf Jahren hier tätig. Ich<br />
habe gelesen, Sie sind der jüngste Flughafengeschäftsführer<br />
in Deutschland. Ihre Karriere<br />
hier begann zu einem Zeitpunkt, als auch<br />
der Flughafen durchgestartet ist. Wie empfi nden<br />
Sie diese Zeit?<br />
Ja, möglicherweise bin ich immer noch der jüngste Flughafengeschäftsführer,<br />
aber das wird ja irgendwann auch<br />
anders sein. – Alles in allem bin ich dankbar für die<br />
Möglichkeit, hier diesen Job zu machen. Leipzig ist eine<br />
tolle Stadt, die Aufgabe ist interessant <strong>und</strong> ich bin in den<br />
vergangenen fünf Jahren reicher geworden: reicher an<br />
Wissen, reicher an neuen Fre<strong>und</strong>en, reicher an der<br />
Erfahrung, weggegangen zu sein <strong>und</strong> woanders zu leben.<br />
Und das ist ja das Wesentliche.<br />
War es für die Entwicklung des Flughafens ein<br />
Vorteil, dass man die Aufgabe nicht an einen<br />
›alten Fuchs‹ übergeben hat, der vielleicht<br />
stärker in eingefahrenen Bahnen denkt <strong>und</strong><br />
handelt, sondern an jemanden, der – wie Sie –<br />
gerade erst an den Start ging?<br />
Oft ist es gut, wenn die Dinge sich ergänzen. Für einen<br />
Neuanfang ist es sicher nicht schlecht, jemanden zu haben,<br />
der schon andere Neuanfänge miterlebt hat. Ich verfügte<br />
nicht über diesen Erfahrungsschatz, aber ich hatte einige<br />
›alte Füchse‹ hier in der Mannschaft.<br />
Entsteht in einer solchen Umbruchsituation<br />
ein stärkerer Teamgeist, als man ihn auf einem<br />
großen <strong>und</strong> eingefahrenen Flughafen wie zum<br />
Beispiel dem Frankfurter Fraport fi ndet?<br />
Da<strong>von</strong> bin ich überzeugt. Wir sind eine kleine Mannschaft<br />
hier, die wirklich – gemessen an Vergleichsprojekten in der<br />
B<strong>und</strong>esrepublik – fast Unmögliches möglich gemacht hat,<br />
ein kleines Team, das tatsächlich bis nahezu zum Umfallen<br />
arbeitet. Wo man manchen hin <strong>und</strong> wieder vor sich selbst<br />
schützen muss, auch mal einen Schritt zurückzumachen.<br />
Aber das alles ohne Druck, da alle begeistert sind <strong>von</strong><br />
der Erkenntnis, was sich alles bewegen lässt. Letztes Jahr<br />
bin ich mit einem Teil meiner Führungsmannschaft einfach<br />
mal auf die Besucherterrasse hinauf <strong>und</strong> habe gesagt:<br />
»Guckt mal da rüber. Vor zwei Jahren war da nur Wald.<br />
Da war keine neue Start- <strong>und</strong> Landebahn, kein DHL-<br />
Gebäude, kein Flugzeughangar, da war nichts. Was man<br />
in so kurzer Zeit alles bewegen kann.« Das schweißt in der<br />
Tat zusammen, da<strong>von</strong> bin ich überzeugt.<br />
Wie viele Mitarbeiter haben Sie?<br />
Es sind um die 360 Mitarbeiter. Das ist eine ganz schlanke<br />
Besetzung.<br />
Als Geschäftsführer der Flughafen<br />
Leipzig / Halle GmbH zieht Eric Malitzke<br />
Lob <strong>und</strong> Kritik gleichermaßen auf sich.<br />
Anlässlich der Einweihung des DHL-<br />
Frachtdrehkreuzes überschrieb die<br />
Süddeutsche Zeitung ein Porträt über<br />
den 34-jährigen mit: »Der Überfl ieger«.<br />
Und Ralph Beisel, Hauptgeschäftsführer<br />
der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsfl<br />
ughäfen, rühmt der Jung manager<br />
als das »größte Talent der Branche«.<br />
Auf gewachsen ist Eric Malitzke im<br />
hessischen Kelsterbach, einem Ort in<br />
der Einfl ugschneise des Frankfurter<br />
Wie viele Mitarbeiter haben Flughäfen <strong>von</strong><br />
vergleichbarer Größe?<br />
Schwierig zu sagen. – Wir haben hier inzwischen eine<br />
Verkehrs infrastruktur, die <strong>von</strong> ihrer Dimensionierung <strong>und</strong><br />
<strong>von</strong> den Potentialen her zu einer der ganz großen gehört,<br />
aber seit wir als kleiner Flughafen in das Rennen um das<br />
Thema Logistik eingestiegen sind, haben wir nur 50 Leute<br />
mehr eingestellt, während sich unsere Kapazitäten nahezu<br />
verdoppelt haben <strong>und</strong> sich auch das Geschäftsvolumen<br />
nahe zu verdoppelt hat. Das ist ein guter Maßstab um zu<br />
verdeutlichen, dass das Ganze fast mit der gleichen Rumpfmannschaft<br />
bewältigt wird, wie zu den Zeiten als wir ausschließ<br />
lich ein kleiner Passagierfl ughafen waren.<br />
Sie sagen Ihr Geschäftsvolumen hat sich<br />
nahe zu verdoppelt. Wie ist es bei den Passagierzahlen?<br />
Lassen Sie mich zur Beantwortung dieser Frage etwas<br />
ausholen: Ein Flughafen kann zweierlei Funktion erfüllen.<br />
Er kann das Ein- <strong>und</strong> Ausfallstor für eine Region sein, oder<br />
er kann als Drehscheibe fungieren. Im ersten Fall nährt<br />
er sich aus dem Potential einer Region – also dem Quellmarkt<br />
<strong>und</strong> dem Zielmarkt dieser Region; im zweiten Fall,<br />
als Drehscheibe, hat das, was auf dem Flughafen umgeschlagen<br />
wird, nichts mit der wirtschaftlichen Stärke der<br />
Region zu tun. Im Bereich des Passagierverkehrs sind <strong>und</strong><br />
werden wir immer Ein- <strong>und</strong> Ausfallstor für die Region<br />
bleiben. Das heißt, das Wachstum <strong>und</strong> die Potentiale sind<br />
determiniert über Effekte in der wirtschaftlichen Entwicklung<br />
der Region. Stichworte: Entwicklung des Pro-<br />
Kopf-Einkom mens; Entwicklung der Arbeitslosigkeit; wie<br />
viele Unter nehmen generieren Geschäftsreiseverkehr –<br />
das ist immer das stabile Rückgrad <strong>von</strong> Passierver bindungen<br />
– <strong>und</strong> wie attraktiv wird die Region als In-Coming-<br />
Ziel, wie viele Touristen zieht man im Wochenend- <strong>und</strong><br />
Städte touris musbereich an. Das sind die<br />
Rahmenbedingungen, unter denen sich der Flughafen als<br />
Passagierfl ughafen ent wickelt <strong>und</strong> da sehe ich geringe<br />
Wachstumspotentiale. Im Frachtverkehr dagegen sind wir<br />
als Flughafen Drehkreuz, das heißt, die Volumina <strong>und</strong> die<br />
Entwicklung werden nicht durch die wirtschaftliche<br />
Entwicklung der Region bestimmt, sondern durch die<br />
Weltkonjunktur. Als Drehkreuz werden wir schon 2009 in<br />
der Champions League der europäischen Frachtfl ughäfen<br />
angekommen sein. Denn uns ist es gelungen, hier einen<br />
Markt zu akquirieren, der nicht im kausalen Zusammenhang<br />
mit dieser Region steht, sondern der Verkehre<br />
bündelt, die aus Europa <strong>und</strong> der ganzen Welt kommen <strong>und</strong><br />
dorthin dann auch wieder weitergeschickt werden.<br />
Wie macht man einen Flughafen für den Logistikmarkt<br />
attraktiv? Ich nehme an, es hat einen<br />
harten Wettbewerb darum gegeben, wo DHL<br />
sein neues Frachtdrehkreuz bauen wird. Was<br />
sind die Standortvorteile ihres Flughafens?<br />
Der ausschlaggebende Punkt dafür, dass sich DHL<br />
letztlich für den Flughafen Leipzig/ Halle entschieden hat,<br />
war sicher die hervorragende Luftverkehrsinfrastruktur,<br />
die wir hier anbieten können. Hinzu kommt das Autobahnnetz,<br />
die A9 <strong>und</strong> die A14 haben jeweils einen eigenen<br />
Autobahnanschluss zum Flughafen sowie die Möglichkeit,<br />
Luftfracht mit dem Zug weiterzutransportieren. Man<br />
nennt das auch trimodale Verkehrsanbindung: Luft –<br />
Straße – Schiene. Wichtig war natürlich auch, dass hier<br />
viele qualifi zierte Arbeitskräfte zur Verfügung stehen<br />
<strong>und</strong> schlussendlich haben wir auch, was die Wirtschaftlichkeit<br />
angeht, ein angemessenes Angebot gemacht.<br />
Damit meinen Sie den uneingeschränkten<br />
Nachtfl ug?<br />
Nein, damit meine ich die Konditionen. Es muss ja wettbewerbsfähig<br />
sein. Das heißt, es geht bei solchen<br />
Flughafens. Von klein auf haben ihn<br />
Flug zeuge fasziniert. Als er 2003<br />
Geschäftsführer des Flughafens Leipzig /<br />
Halle wurde, »dümpelte« – wie die<br />
Süddeutsche Zeitung schreibt – »der in<br />
den neunziger Jahren mit einer<br />
Milliarde Euro modernisierte sächsische<br />
Regional fl ughafen wirtschaftlich vor<br />
sich hin.« Eric Malitzke hat erreicht,<br />
dass er in diesem Jahr zum drittgrößten<br />
deutschen Luftfrachtfl ughafen aufsteigt.<br />
Dass ein solcher Entwicklungssprung<br />
auch Kon fl ikte mit sich bringt, weiß<br />
der Flughafenchef.<br />
Entscheidungen immer auch um Wirtschaftlichkeit. Das<br />
Nacht fl ug thema ist da eine unabdingbare Voraussetzung,<br />
ohne die auch das beste wirtschaftliche Angebot nicht halten<br />
würde. Denn wenn es ein Nachtfl ugverbot gibt, dann<br />
ist DHL wieder weg <strong>und</strong> somit auch ein paar tausend Jobs.<br />
Wie bei jedem Unternehmen stellt sich sicher<br />
auch bei Ihnen die Frage nach der Wirtschaftlichkeit<br />
– auch wenn bei Verkehrsinfra -<br />
strukturen wie der Bahn anhaltend darüber<br />
diskutiert wird, ob Wirtschaftlichkeit das wichtigste<br />
Kriterium sein darf. Ziehen die Eigentümer<br />
des Flughafens, also zum Beispiel<br />
das Land Sachsen, bereits Gewinne aus ihrem<br />
Engagement oder ist der Flughafen für seine<br />
Gesellschafter ein einkalkuliertes Zuschussgeschäft,<br />
weil die Infrastruktur selbst<br />
schon ein Gewinn ist?<br />
Zunächst – ich halte es für durchaus hinterfragenswert,<br />
ob der Staat sich aus kurzfristigen haushalterischen Überlegungen<br />
aus seiner staatlichen Fürsorgepfl icht für<br />
Verkehrsinfrastrukturen zurückziehen sollte. Für mich ist<br />
das Thema der Bahnprivatisierung ein heikles Thema.<br />
Jedem ist klar, dass die B<strong>und</strong>esrepublik im Wettbewerb<br />
um die Ansiedlung <strong>von</strong> Unternehmen den Vorteil hat, dass<br />
sie über hervorragende Verkehrsinfrastrukturen verfügt.<br />
Verkehrsinfrastrukturen wie zum Beispiel Flughäfen,<br />
deren Planung <strong>und</strong> Bau oft ein bis zwei Jahrzehnte dauert,<br />
sind eine langfristige, strategische Angelegenheit. Diese<br />
mit kurzfristigen Kapitalinteressen zu vermengen, sehe<br />
ich persönlich kritisch. Nun sind Flughäfen im Gegensatz<br />
zu anderen Verkehrsträgern als privatwirtschaftliche<br />
Unternehmen organisiert. Das ist auch der einzige Gr<strong>und</strong><br />
dafür, weshalb nach ihrer Wirtschaftlichkeit gefragt wird.<br />
Dabei darf man die volkswirtschaftlichen Effekte nicht<br />
übersehen, die unbestritten sind. Das heißt, der Segen für<br />
die Gesellschafter ist erstmal, dass der Flughafen<br />
Leipzig / Halle eine der größten Arbeitsstätten Ostdeut schlands<br />
ist. Irgendwann in diesem Jahr werden hier auf<br />
dem Gelände des Flughafens 4.500 Mitarbeiter tätig sein.<br />
Und der betriebswirtschaftliche Effekt ist zumindest so,<br />
dass es kein Zuschussgeschäft mehr ist, dass das operative<br />
Geschäft sich trägt <strong>und</strong> dass es auch mit DHL besser wird.<br />
Sicher, wenn wir nach den Statuten des HGB am Ende<br />
des Jahres die Bücher aufstellen müssen, stehen da keine<br />
schwarzen Zahlen, aber das ist den Abschreibungsregeln<br />
einer so großen, neuen Infrastruktur geschuldet.<br />
Während der Workshop-Tage in Kursdorf sind<br />
mir Flugzeuge aufgefallen, die eine schematische<br />
Darstellung des Globusnetzes auf dem<br />
Heckfl ügel hatten. Dass es das Logo der Fluggesellschaft<br />
World Airways ist, habe ich<br />
mir dann sagen lassen. Die Fluggesellschaft<br />
transportiert mit Zwischenstopp in Leipzig<br />
amerikanische Soldaten in die Kriegsgebiete<br />
im Irak <strong>und</strong> in Afghanistan. Das heißt, dass<br />
der Flughafen auch für militärische Zwecke<br />
genutzt wird. Wird dabei nicht die rechtliche<br />
Unterscheidung <strong>von</strong> Zivilem <strong>und</strong> Militärischem<br />
aufgeweicht?<br />
Das ist eine vielschichtige Betrachtung. Rein formal<br />
handelt es sich nicht um militärische Verkehre, weil wir es<br />
mit zivilen Fluggesellschaften zu tun haben. Faktisch<br />
fl iegen diese Fluggesellschaften zum Teil im Auftrag der<br />
Militärs, das ist richtig.<br />
Jetzt gibt es eine rechtliche Diskussion – die ist unstrittig<br />
zugunsten des Flughafens zu entscheiden –, weil wir<br />
Verträge mit zivilen Fluggesellschaften haben, die eigene<br />
kommerzielle Entscheidungen treffen. Wir haben keinen<br />
Vertrag mit dem Militär. Und dann gibt es eine moralische<br />
Diskussion, die – sagen wir mal – ausgiebig in der<br />
5
WAS DU WISSEN SOLLTEST (DIE WIRTSCHAFT)<br />
Öffentlichkeit geführt wird. Bei dieser Diskussion muss<br />
ich mich fragen, warum wird sie geführt? Das Problem ist<br />
doch: Wann immer sie in unserer Gesellschaft etwas<br />
verändern wollen oder müssen, was unstrittig auch Effekte<br />
auf Nachbarschaften hat, fi nden sie eine Opposition.<br />
Das ist normal. Wir befi nden uns in einem System, in dem<br />
sie, wenn sie sich für irgendetwas entscheiden, zwangsläufi<br />
g immer auch zu etwas anderem Nein sagen müssen.<br />
Das ist so. Und unsere Gegner haben festgestellt, dass<br />
sie es unheimlich schwer haben, auch medial. Denn es geht<br />
ja auch um mediale Aufmerksamkeit bei den Flughafengegnern.<br />
Sie haben es schwer, gegen DHL <strong>und</strong> die nach weislich<br />
jetzt schon über zweitausend geschaffenen Jobs anzukommen.<br />
Und da kommt dann das Thema Militär, denn<br />
wenn sie in ihrer Argumentation verkaufen, die Moral auf<br />
ihrer Seite zu haben, dann machen sie es ihrem Gegner<br />
schwer zu argumentieren. Denn wer die Moral auf seiner<br />
Seite hat, hat natürlich Recht.<br />
Nun will ich den moralischen Aspekt nicht aussparen –<br />
aber auf der anderen Seite steht immer die Situation, dass<br />
man, wie ich zum Beispiel, <strong>Vera</strong>ntwortung zu tragen hat<br />
hier in der Region. Da kommt dann eine zivile Airline <strong>und</strong><br />
sagt, passen sie mal auf, wir machen das <strong>und</strong> das Geschäft<br />
<strong>und</strong> wir würden hier gern hinkommen. Am Verhandlungstisch<br />
sitzt dann beispielweise auch der Leiter einer<br />
Betriebsküche, die die Bordverpfl egung für Flugzeuge<br />
herstellt, <strong>und</strong> der sagt: »Malitzke, wir wollten unsere<br />
Betriebsküche hier zumachen, aber wenn wir die kriegen,<br />
dann können wir 65 Jobs retten.« So, dann sind sie also<br />
am überlegen, was machst du jetzt? Soll ich jetzt diesen<br />
zivilen Airlines sagen, hier nicht, ich mag euren Auftraggeber<br />
nicht, <strong>und</strong> das was die amerikanische Administration<br />
macht, halte ich moralisch für mindestens<br />
bedenklich? Mit dem Wissen um diese 65 Arbeitsplätze<br />
muss ich Ihnen ehrlich sagen, bin ich Überzeugungstäter,<br />
auf diesen K<strong>und</strong>en will ich nicht verzichten. Auch weil<br />
ich nicht glaube, dass sich eine US-amerikanische Administration<br />
beeindrucken lässt, wenn ich erkläre, dass<br />
ich das für fragwürdig halte. — Was ich tue.<br />
Aber es geht darum, abzuwägen, wie viel Idealismus kann<br />
ich, ohne dass das Unternehmen hier <strong>und</strong> auch Teile<br />
der wirtschaftlichen Entwicklung in der Region Schaden<br />
nehmen, zu meiner Handlungsmaxime, <strong>und</strong> zwar<br />
zu meiner ausschließlichen Handlungsmaxime, machen.<br />
Inzwischen ist es so, dass die besagte Betriebsküche<br />
130 Leute beschäftigt, dass wir selbst in unserem Abfertigungsbereich<br />
etliche Leute eingestellt haben, zwei Einzelhändler<br />
hier noch in dem Bereich tätig sind, wo die Soldaten<br />
sich aufhalten. Ich würde sagen, da hängen<br />
inzwischen gut <strong>und</strong> gerne 200 Jobs daran. – So, das ist<br />
meine Antwort auf den moralischen Teil der Diskussion.<br />
Und es gibt noch eine andere Antwort: Dass das, was hier<br />
stattfi ndet, auch überall sonst stattfi ndet. An zig deutschen<br />
<strong>und</strong> europäischen Zivilfl ughäfen. Und da regt<br />
sich keiner auf.<br />
Ich weiß <strong>von</strong> keinem Flughafen in Deut schland,<br />
wo das auch passiert.<br />
Das passiert in Köln / Bonn, in Frankfurt-Hahn, also an<br />
jedem Flughafen. – Das mag verwegen klingen, aber<br />
machen Sie sich einmal Folgendes klar: Dieser Flughafen<br />
ist weithin sichtbar in der Landschaft, wenn diese Flüge<br />
wirklich rechtlich ein Problem darstellen würden, können<br />
sie da<strong>von</strong> ausgehen, dass ich das nicht machen könnte.<br />
Da hätte sich längst jemand gef<strong>und</strong>en, der sagen würde:<br />
»Herr Malitzke, is’ nicht!« – Ich habe keinen Vertrag mit<br />
dem Militär, <strong>und</strong> selbst wenn ich das hätte, das würde<br />
nicht gegen die Statuten eines zivilen Verkehrsfl ughafens<br />
verstoßen. Daran ist rechtlich, so sehr das auch immer<br />
wieder behauptet wird, nichts auszusetzen. Juristisch<br />
ist es völlig unbedenklich. Das Thema ist ein moralisches<br />
Thema, aber das lässt sich nun schwer objektiv erklären.<br />
– Sehen Sie, es kann auch sein, dass auf einem Flieger<br />
einer der uns wohlbekannten Passagier-Airlines ein<br />
Asylant sitzt, der abgeschoben wird, der dahin zurückgebracht<br />
wird, wo ihm vielleicht die Todesstrafe droht.<br />
Das ist moralisch vielleicht auch bedenklich.<br />
Sie wollen sagen, es fi ndet trotzdem statt.<br />
Da sind Begleitbeamte dabei, der Flug wird<br />
ganz normal im Reisebüro gebucht, <strong>und</strong><br />
die Beamten kommen dann hier vorbei, <strong>und</strong><br />
Sie würden das nur mitkriegen, –<br />
Ich kriege das überhaupt nicht mit –<br />
– denn die steigen wie ganz normale Passagiere<br />
ein. Es ist möglich, dass das hier<br />
auf ihrem Flughafen passiert, so wie es in<br />
Berlin <strong>und</strong> Frankfurt / Main auch passiert.<br />
Das ist richtig.<br />
Die amerikanischen Soldaten, die hier<br />
zwischen landen, werden ja als Transit passagiere<br />
gezählt. Wenn man auf die Statistik<br />
schaut, dann hat sich ihre Zahl in der letzten<br />
Zeit sehr stark entwickelt. Für den Flughafen<br />
ist das, wie sie sagen, positiv. Auch was<br />
die Passagierzahlen betrifft …<br />
Die statistischen Effekte sind mir völlig gleich. Glauben sie<br />
mir, ich würde diese Flüge am liebsten aus der Statistik<br />
raus lassen, denn jeder sagt, das sind gar keine echten<br />
Passagiere. Ich habe aber laut den Statuten des statistischen<br />
B<strong>und</strong>esamtes überhaupt nicht die Möglichkeiten,<br />
sie herauszulassen.<br />
Im Moment gibt es in der Öffentlichkeit einigen<br />
Unmut über den Flughafen. Der Knackpunkt<br />
sind vor allem die Nachtfl üge, die jetzt,<br />
wo DHL seinen Betrieb aufgenommen hat,<br />
deutlich zunehmen. Auf welche Weise verfolgt<br />
der Flughafen, wie sich seine betriebliche<br />
Entwicklung auf das direkte Umfeld auswirkt?<br />
Wie reagieren Sie auf die Beschwerden?<br />
Und welche Spielräume bestehen eigentlich,<br />
um auf sie zu reagieren?<br />
Als wir den Antrag für die Entwicklung des Flughafens zu<br />
einem Frachtdrehkreuz gestellt haben, haben wir <strong>von</strong><br />
Anfang an gesagt, Frachtfl üge bedeuten Nachtfl üge. Wir<br />
sind insbesondere <strong>von</strong> einem überproportionalen<br />
Wachstum zur Nachtzeit ausgegangen, <strong>und</strong> das haben wir<br />
öffentlich <strong>von</strong> Anfang an auch bek<strong>und</strong>et. Die Prognosen,<br />
die wir abgegeben haben, bildeten die Gr<strong>und</strong>lage für<br />
die Berechnung <strong>von</strong> Schallschutzmaßnahmen. Denn wir<br />
haben auch gesagt, es wird ein passives Schallschutzprogramm<br />
geben, um so gut wie möglich zu kompensieren,<br />
was an Schall emittiert werden wird. Da ist der Flughafen<br />
seinerseits in der Pfl icht, <strong>und</strong> der kommt er auch nach.<br />
Denn die Betroffenheiten sind unstrittig. Aber neben<br />
dieser Erkenntnis <strong>und</strong> dem Anerkennen <strong>von</strong> Betroffenheiten<br />
ist es so, wie es <strong>von</strong> den Flughafengegnern<br />
artikuliert wird, teilweise recht fragwürdig. Plötzlich sind<br />
alle überrascht, dass da Flugverkehr stattfi ndet. Die<br />
Start- <strong>und</strong> Landebahn Nord, die im Jahr 2000 in Betrieb<br />
gegangen ist, ist im Jahr 1997 durch ein Planfeststellungsverfahren<br />
gegangen <strong>und</strong> zwar mit einer Prognose <strong>von</strong><br />
130.000 Flugbewegungen pro Jahr ohne irgendwelche<br />
Einschränkungen. Heute sind wir bei zirka 65.000 Bewegungen<br />
angelangt. Das heißt, wir sind also noch nicht mal<br />
bei dem, was für die Nordbahn prognostiziert wurde<br />
ohne Nachtbeschränkung. Und jetzt fragt jeder, wie das<br />
stattfi nden kann <strong>und</strong> ob das überhaupt rechtmäßig ist,<br />
dass nachts Flugzeuge fl iegen. – Ja, natürlich. Klar!<br />
Natürlich sind wir uns bewusst, dass es wie bei jeder wirtschaftlichen<br />
Entwicklung auch Effekte gibt, die nachteilig<br />
sind für die Betroffenen. Jede Form der wirtschaftlichen<br />
Entwicklung in einem gesellschaftlichen Zusammenleben<br />
hat Effekte, auch negative Effekte, bei einem Flughafen<br />
ist es Fluglärm. Aber wir haben noch lange nicht das<br />
erreicht, was wir 1997 kommuniziert haben bei dem Bau<br />
der Start- <strong>und</strong> Landebahn Nord. Und wir haben seit<br />
dem ich hier bin – seit 2003 – sowohl im förmlichen Planungsprozess<br />
als auch in inzwischen über 70 freiwilligen<br />
Informationsveranstaltungen öffentlich gesagt, es geht<br />
um Frachtfl üge, es geht um Nachtfl üge! Und die Entwicklung<br />
zu einem Frachtdrehkreuz, wie wir es beantragt<br />
haben, wollen wir auch so fortführen. Und dieses Zugeständnis<br />
an den Flughafen, dass man sagt: »Wir wissen,<br />
der Flughafen ist wichtig, <strong>und</strong> er soll sich auch entwickeln,<br />
aber ohne Nachtfl ug«, das kann sich jeder schenken.<br />
Seit der Absichtserklärung der Deutschen Post im Jahre<br />
2004, dass Leipzig zum Drehkreuz für DHL werden<br />
soll, redet ganz Mitteldeutschland da<strong>von</strong>, Logistikregion<br />
werden zu wollen. Ich glaube, es gibt nicht mehr so<br />
viele Chancen, die diese Region im Moment greifbar hat,<br />
um den Menschen, die hier leben <strong>und</strong> leben bleiben<br />
wollen, maß gebliche wirtschaftliche Entwicklungen bieten<br />
zu können. Und wenn wir das wollen, braucht es den<br />
Flughafen, <strong>und</strong> wenn wir den Flughafen wollen, braucht<br />
es Nachtfl üge. Das ist <strong>und</strong> bleibt ein unaufl ösbarer<br />
Zielkonfl ikt!<br />
Wie viele Arbeitsplätze sollen denn hier<br />
entstehen?<br />
Als ich 2003 kam, waren auf dem Flughafen <strong>und</strong> in dessen<br />
Umfeld ungefähr 1.500 Leute beschäftigt. Aktuell sind<br />
es zirka 4.300. DHL hat selbst schon 2.200 Leute<br />
eingestellt <strong>und</strong> hält an Planungen fest, bis 2012 3.500 Jobs<br />
schaffen zu wollen. Inzwischen hat beispielsweise auch<br />
Lufthansa Cargo angekündigt, hierher zu kommen <strong>und</strong><br />
hier 1.000 neue Jobs zu schaffen. Es gibt also die Nachfolgeeffekte,<br />
die wir uns erhofft haben.<br />
Was für Arbeitsplätze entstehen hier?<br />
Ich habe eine leise Ahnung, worauf Sie hinauswollen. —<br />
Heute ist ein Artikel in der Leipziger Volkszeitung,<br />
da wurden zwei Beschäftigte <strong>von</strong> DHL interviewt. Ich sage<br />
Ihnen ehrlich, ich halte die Diskussion um unterbezahlte,<br />
geknechtete Menschen für verlogen. Wir haben in diesem<br />
Land Vertragsfreiheit, <strong>und</strong> ich kenne keinen Fall, in<br />
6
WAS DU WISSEN SOLLTEST (DIE WIRTSCHAFT)<br />
dem irgendjemand mit der Pistole gezwungen wurde, einen<br />
Arbeitsvertrag zu unterschreiben. Ist mir nicht bekannt.<br />
Das heißt, es muss Konditionen geben in einem ganz<br />
normalen Markt <strong>von</strong> Angebot <strong>und</strong> Nachfrage, wo sich<br />
Menschen dazu bewegen, einen Arbeitsvertrag zu unterschreiben,<br />
das mal vorab.<br />
DHL selbst bezahlt für Jobs, die die geringste Form der<br />
Qualifi zierung benötigen, ein Eingangsgehalt <strong>von</strong> 7,50 Euro<br />
die St<strong>und</strong>e. Das ist immer die einzige Zahl, die genannt<br />
wird. Und dazu wird dann immer erklärt, das sind 1-Euro-<br />
Jobber, das sind nur Teilzeitjobs <strong>und</strong> was nicht noch alles.<br />
Also: DHL hat einen Tarifvertrag mit ver.di, die zahlen<br />
über den Tarif des Postzustellergewerbes <strong>und</strong> stellen<br />
nur unbefristete Arbeitsverträge aus. Tatsächlich haben<br />
sie einen großen Teil Teilzeitverträge ausgeschrieben,<br />
ab 22 St<strong>und</strong>en, aber alles unter 40 St<strong>und</strong>en wird als Teilzeit<br />
beschäftigung bezeichnet, das heißt, auch jemand, der<br />
38,5 St<strong>und</strong>en arbeitet, ist teilzeitbeschäftigt. Es gibt da<br />
keine Differenzierung. Mittlerweile ist es so, dass ein<br />
Großteil derer, die mit 22 St<strong>und</strong>en angefangen haben, bei<br />
nahezu 40 St<strong>und</strong>en angekommen sind, allein, weil der<br />
Betrieb so gut läuft. Hinzu kommt: Ein großer Teil der<br />
Leute, die dort anfangen, kommen aus der Arbeitslosigkeit<br />
<strong>und</strong> sind fünfzig Jahre <strong>und</strong> älter. Unsere Gegner haben<br />
es erfolgreich geschafft, immer wieder zu proklamieren,<br />
dass es geknechtete 1-Euro-Jobber sind, aber das<br />
ist wirklich nicht der Fall.<br />
Wenn man zwischen fünfzig <strong>und</strong> sechzig Jahre<br />
alt ist, sind die Chancen auf dem Arbeitsmarkt<br />
nicht mehr so groß. Da sitzt dann die Pistole,<br />
<strong>von</strong> der Sie erst sprachen, im eigenen<br />
Portemonnaie …<br />
Und welche Chancen hatten die Leute vor DHL?<br />
Das will ich gar nicht zur Diskussion stellen,<br />
ich sage nur, welche individuellen Zwänge auch<br />
dahinter stehen, bei der Entscheidung für<br />
einen bestimmten Job.<br />
Ja, das ist richtig. Sie werden Mühe haben, zu vergleichbaren<br />
Löhnen in einer Region wie München Leute zu<br />
bekommen. Aber da haben sie Vollbeschäftigung. Das muss<br />
man einfach anerkennen. – Und deshalb, ich schätze die<br />
kritische Redakteurszunft sehr, aber man muss schon<br />
ein bisschen aufpassen, sich nicht immer einseitig auf die<br />
Seite der Entrechteten <strong>und</strong> Entmachteten zu stellen.<br />
Immer diese Frage: Na, was sind denn das für Jobs? Das<br />
sind doch gar keine richtigen Jobs. – Doch das sind richtige<br />
Jobs! In dieser Region mangelt es doch nicht an Ingenieursstellen,<br />
sondern an Jobs für Leute, die überhaupt erst<br />
einmal wieder in den Arbeitsmarkt integriert werden müssen.<br />
Deshalb ist DHL für mich in der Region ein ganz<br />
wichtiger Arbeitgeber, heute <strong>und</strong> in der Zukunft.<br />
Sie haben im Laufe unseres Gesprächs schon<br />
mehrfach <strong>von</strong> den Gegnern des Flughafens<br />
gesprochen. Es gibt Gegenwind, das ist in der<br />
letzten Zeit deutlich zu spüren. Was ist in einer<br />
solchen Situation die Vision, an der Sie<br />
festhalten, die Sie motiviert? Welche Rolle soll<br />
der Flughafen in Zukunft spielen, <strong>und</strong> wie wird<br />
sich Ihrer Meinung nach die Region durch den<br />
Flughafen verändern, nicht nur innerhalb der<br />
nächsten fünf Jahre, sondern langfristig?<br />
Meine Vision ist es, dass es mit der Logistik gelingt, einen<br />
Wirtschaftszweig zu etablieren, der hier Tausende <strong>von</strong><br />
Jobs schaffen wird, <strong>und</strong> dass der Flughafen Leipzig / Halle<br />
dessen Nukleus ist. Irgendwann wird es, wie wir alle<br />
wissen, die Transfermittel aus dem Westen, die Förder programme,<br />
etc pp. nicht mehr geben. Das heißt, wenn es<br />
uns in den nächsten Jahren nicht gelingt, mehr <strong>und</strong> mehr<br />
eigenständige Branchen zu etablieren, die Menschen<br />
<strong>und</strong> Familien in Lohn <strong>und</strong> Brot zu bringen, wird es uns<br />
nach dem Auslaufen bestimmter Förderprogramme noch<br />
weit aus weniger gelingen. Meine Vision ist, dass der<br />
Flughafen dazu beiträgt, aus der Region Leipzig/ Halle eine<br />
Wachs tums region deutlichen Ranges zu machen, dass<br />
es gelingt, jungen Leuten hier eine Perspektive zu bieten,<br />
<strong>und</strong> dass auch eine Menge <strong>von</strong> Heimkehrern hier<br />
anheuert, Leute, die aus dem Westen zurückkommen,<br />
weil sie plötzlich die qualifi zierten Jobs hier fi nden, die es<br />
vorher nicht gab. Ich wünsche mir, dass der Flughafen<br />
auch zum Vermarkter dieser Region als Logistikregion<br />
wird <strong>und</strong> dass er selbst als Arbeitsstätte, spätestens<br />
in zehn Jahren, eine Schallmauer <strong>von</strong> 10.000 Jobs durchbricht.<br />
Das ist mein Wunsch.<br />
Das wäre jetzt ein gutes Schlusswort –<br />
Wenn jetzt nicht noch zwei, drei Fragen wären.<br />
Genau. Ich habe gleich noch eine: Und zwar<br />
würde ich gern noch einmal auf die amerikanischen<br />
Truppentransporte zurückkommen,<br />
die über den Flughafen Leipzig / Halle <strong>von</strong><br />
zivilen Luftfahrtunternehmen abgewickelt<br />
werden. Diese Flüge machen ja nicht nur ein<br />
oder zwei Prozent der Passagierbewegungen<br />
aus, sondern sind, wie Sie sagten, für<br />
den Flughafen ein wichtiger K<strong>und</strong>e, der<br />
Arbeitsplätze sichert. Warum gehen Sie mit<br />
diesem Akquise-Erfolg nicht ähnlich wie<br />
bei DHL an die Öffentlichkeit? Oder anders<br />
gefragt, sehen Sie eine konkrete Gefahr, durch<br />
diesen K<strong>und</strong>en ins Zielvisier des inter na tionalen<br />
Terrorismus zu kommen, <strong>und</strong> scheuen<br />
deshalb die Öffentlichkeit, wie es <strong>von</strong><br />
Kritikern dieser Flüge behauptet wird?<br />
Ich habe schon beschrieben, wie schwer es ist, gegen Leute<br />
zu argumentieren, die behaupten, die Moral auf ihrer<br />
Seite zu haben. Daneben gibt es noch ein zweites Thema,<br />
nämlich die schönen Ängste. Und das wird natürlich auch<br />
bewusst in einem Zusammenhang gemacht. Natürlich<br />
müssen wir anerkennen, dass der B<strong>und</strong>esinnenminister<br />
schon seit Jahren erklärt, dass auch die B<strong>und</strong>esrepublik<br />
ein Ziel für Anschläge sein kann, dass es ein Gefährdungspotential<br />
gibt. Europa insgesamt ist ein potentielles Ziel<br />
für medienwirksame Attentate. Aber ganz ehrlich, wie mit<br />
einem solchen Thema umgegangen wird, ist bisweilen<br />
regelrecht unanständig – es werden bewusst Ängste in der<br />
Bevölkerung geschürt.<br />
Für den Flughafen Leipzig / Halle ist es so: Ein Flughafen<br />
ist ein Sicherheitsbereich, per Defi nition. Was hier<br />
stattfi ndet, fi ndet in einem separaten Terminal statt, in<br />
beträchtlicher Entfernung zu allem anderen kommerziellen<br />
Verkehr. Das hier ist kein Militärstützpunkt,<br />
sondern hier fl iegen zivile Airlines, die Militärpersonal an<br />
Bord haben, das hier lediglich umsteigt. Die übrigen in<br />
Anspruch genommenen Dienstleistungen, wie beispielsweise<br />
Betankung, werden <strong>von</strong> am Flughafen ansässigen<br />
Firmen erbracht – wie für alle anderen Airlines auch.<br />
Die Sicherheitsmaßnahmen, so wie sie an einem Flughafen<br />
notwendig sind, werden hier eingehalten, Und natürlich<br />
gibt es im Luftverkehr insgesamt eine hohe Wahrnehmung<br />
<strong>von</strong> Gefährdungspotentialen. Wenn es darum geht, wie<br />
freizügig wir über bestimmte Themen berichten –<br />
weil sie sagten, DHL wird doch auch lauthals proklamiert,<br />
welche Erfolge das sind <strong>und</strong> was dahinter steckt –,<br />
dann komme ich wieder zu dem Thema, der Flughafen<br />
Leipzig / Halle ist ein privatrechtlich organisiertes<br />
Unternehmen <strong>und</strong> in dieser Eigenschaft auch Vertragspartner<br />
seiner K<strong>und</strong>en. Wir sind nicht diejenigen, die<br />
gegen den Willen der K<strong>und</strong>en irgendwelche Daten Preis<br />
geben. Ich erkläre auch nicht, wie viele Passagiere die<br />
Air France zwischen Leipzig <strong>und</strong> Paris Charles de Gaulles<br />
fl iegt. Sondern das muss die Air France schon selbst<br />
kommunizieren. Wenn die das getan hat, dann plappere<br />
ich das möglicherweise nach, aber gr<strong>und</strong>sätzlich ist es so,<br />
dass wir nicht diejenigen sind, die mit den Zahlen oder<br />
den Fakten der K<strong>und</strong>en hausieren gehen.<br />
Das ist sozusagen eine Frage der Diskretion.<br />
Das sind individuelle Vertragsvereinbarungen, <strong>und</strong> es ist<br />
immer noch nicht so, dass ich ein Einsehen habe, diese<br />
Vertragsgr<strong>und</strong>lagen offen zu legen. Oder bestimmte Zahlen<br />
<strong>und</strong> Daten, denn die können leicht unter den Konkurrenzschutz<br />
fallen. Sie müssen bedenken, auch diese zivilen<br />
Airlines stehen im Wettbewerb zu anderen zivilen Airlines,<br />
die dasselbe Geschäft betreiben, <strong>und</strong> auch wir als<br />
Flughafen stehen in Konkurrenz zu anderen Flughäfen.<br />
Um unser Gespräch abzur<strong>und</strong>en, würde ich<br />
gern noch einmal auf das Theater zurückzukommen<br />
–<br />
Ach richtig, wir kommen ja eigentlich vom Theater.<br />
Es gibt ja eine ganze Reihe <strong>von</strong> <strong>Vera</strong>nstaltungen.<br />
Sie haben anfangs beschrieben, dass<br />
der Flughafen für die Region auch strukturgebend<br />
wirksam sein will. Sehen sie die Patenschaften<br />
mit Stadttheatern <strong>und</strong> Fechtclubs<br />
als Teil dieser Philosophie?<br />
Ganz klar. – Die langweilige Antwort für einen Interviewer<br />
wäre jetzt: Exakt. Aber vielleicht sollte ich doch etwas<br />
ausführlicher werden: Ja, der Flughafen macht das nicht<br />
erst seit dem Projekt des Thalia-Theaters – auf das ich<br />
mich sehr freue –, sondern wir hatten hier zum Beispiel<br />
auch internationale Fechtturniere. Natürlich haben wir als<br />
Flughafen auch einen Tag der offenen Tür, <strong>und</strong> zu Weihnach<br />
ten spielt beispielsweise das große Orchester der B<strong>und</strong>es<br />
polizei hier am Terminal. Also dieser Flughafen kann,<br />
um der Funktion, die er für die Region spielt, Ausdruck<br />
zu ver leihen, für alles andere mitgenutzt werden – solange<br />
der ursprüngliche Zweck damit nicht in Frage gestellt<br />
oder behindert wird.<br />
7
WAS DU WISSEN SOLLTEST (DIE STADT)<br />
DIE KUNST DER KRISE<br />
Ein Gespräch mit der Stadtplanerin<br />
Sonja Beeck,<br />
die Fragen stellte <strong>Jan</strong> Wenzel<br />
— In der Broschüre, die das Bauhaus Dessau zur<br />
IBA Stadtumbau 2010 in Sachsen-Anhalt herausgegeben<br />
hat, heißt es: Eines der Ziele sei, die Städte zukunftsfähig<br />
zu machen. Was ist dafür notwendig? Oder anders gefragt:<br />
Gibt es gegenwärtig eine Angst vor der Zukunft?<br />
— Angst ist vielleicht übertrieben. Aber es gibt ein Unwohlsein,<br />
was die Zukunft angeht. Wir haben bisher wenig Erfahrung<br />
damit, was ein Weniger bedeuten kann. Was Wachsen heißt,<br />
wissen die Stadtplaner. Das ist etwas, was wir jahrzehntelang<br />
eingeübt haben. Das Schrumpfen einer Stadt ist ein unkontrollierter<br />
Prozess <strong>und</strong> es fällt nach wie vor schwer, darin eine<br />
Chance zu sehen. Es ist gewagt, <strong>von</strong> dem Weniger als Chance<br />
zu sprechen. So weit sind wir überhaupt nicht. – Weniger ist<br />
erst einmal weniger <strong>und</strong> langsamer ist langsamer. Und dieses<br />
Weniger ist auch nicht generell eine gute Botschaft. Die Städte<br />
verlieren an Kraft. Das ist vollkommen klar. Dennoch glaube<br />
ich, dass man sich als Stadt auf einem geringeren Niveau sehr<br />
gut stabilisieren kann, vielleicht sogar qualitativ wachsen.<br />
Das sollte das Ziel der gemeinsamen Anstrengung sein. Das<br />
ist, was wir mit Zukunftsfähig-Machen meinen. Wir arbeiten<br />
intensiv mit den Verwaltungen, mit der örtlichen Politik <strong>und</strong><br />
auch mit den Bürgern <strong>und</strong> versuchen, Hilfestellungen zu geben.<br />
— Wie gehen Sie dabei vor?<br />
— Einerseits werden große Visionen entwickelt, damit eine<br />
Stadt so wie hier in Dessau einen eigenen Schrumpfungspfad<br />
einschlägt. Die Stadt Dessau zerlegt einen viel zu großen<br />
Stadtkörper in einzelne urbane Inseln <strong>und</strong> dazwischen werden<br />
Landschaftszonen ausgewiesen. Das ist ein ganz neues,<br />
großes, radikales <strong>und</strong> komplexes Bild der Stadt. Bis das umgesetzt<br />
ist, dauert es noch dreißig Jahre. Da geht die Stadt jetzt<br />
energisch vor das Schritt für Schritt zu tun. In anderen Städten<br />
sind es vielleicht die kleinen Strategien, die man gemeinsam<br />
entwickelt. Interessant ist zum Beispiel unsere Zusam men arbeit<br />
mit den homöopathischen Ärzten in Köthen.<br />
— Können Sie mir erzählen, was sie gemeinsam<br />
ausprobiert haben?<br />
— Köthen ist die Stadt, in der Samuel Hahnemann, der Erfinder<br />
der Homöopathie, lange Zeit gewirkt hat. Köthen ist auch eine<br />
schöne Residenzstadt mit einer schönen Bausubstanz <strong>und</strong> einer<br />
intakten Innenstadt. Sie verströmt eine kulturell niveauvolle<br />
Atmosphäre mit dem intensiven Bemühen um die Musik<br />
<strong>von</strong> Bach. Köthen erscheint heiler <strong>und</strong> heiterer als viele andere<br />
Städte mit den gleichen Problemen. Ich weiss nicht genau wie<br />
ich das beschreiben soll. Den Köthenern ist seit langem klar,<br />
dass die große industrielle Zukunft nicht ihr wirtschaftliches<br />
Standbein sein wird. Und so findet Stück für Stück eine Öffnung<br />
in Richtung Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Wissensgesellschaft statt.<br />
Gerade im Ausland wird die kleine Stadt in Sachsen-An halt als<br />
die Wiege der Homöopathie bezeichnet. Es lag große Aufmerksamkeit<br />
darauf, die Homöopathie wieder in diesem Ort<br />
heimisch werden zu lassen. Da gibt es dann ganz praktische<br />
Bausteine, wie den Aufbau einer Akademie für Homöopathie,<br />
an der man einen Mastersstudiengang an bieten möchte,<br />
die europäische Zentralbibliothek für Homöo pa thie zieht nach<br />
Köthen, es finden Kongresse homöopa thi scher Ärzte statt,<br />
so dass die Besucherzahlen steigen. Aus dieser Situation<br />
heraus entstand vor vier Jahren die Idee, mit den homöopathischen<br />
Ärzten eine Arbeitsgruppe zu gründen <strong>und</strong> zu überlegen,<br />
was wir Stadtplaner <strong>von</strong> der Homöopathie lernen könnten.<br />
Die Gruppe besteht aus den <strong>Vera</strong>ntwortlichen der Bauverwaltung,<br />
der örtlichen Wohnungsgesellschaft, Experten des<br />
IBA Büros <strong>und</strong> homöopatischen Ärzten aus ganz Deutschland.<br />
Anfangs haben uns alle für verrückt gehalten.<br />
— Was haben Sie gemeinsam unternommen?<br />
— Wir haben sehr problematische Situationen in der Stadt<br />
identi fiziert. Eine wesentliche Frage war, was macht man mit<br />
Gebieten, in denen kein Nutzungsdruck mehr herrscht, die man<br />
aber trotzdem nicht komplett liegen lassen kann. Wir haben uns<br />
solche Gebiete nach der Anamnesetechnik der Homöopathen<br />
angeschaut <strong>und</strong> versucht, die Bürger anders zu befragen.<br />
Wir wollten <strong>von</strong> ihnen wissen, wie sie selbst die Veränderungen<br />
beschreiben <strong>und</strong> wie sie diese Veränderungen empfinden.<br />
Das hört sich esoterisch an, aber es waren sehr interessante<br />
Beobach tungen, <strong>von</strong> denen uns die Anwohner berichtetet<br />
haben. Zum Beispiel gibt es in Köthen die Ludwigstraße, die<br />
eine deprimierende Atmosphäre ausstrahlt. Sie liegt am Rande<br />
der Innenstadt <strong>und</strong> hat ein gründerzeitliche Struktur. Während<br />
der DDR-Zeit ist der Stuck <strong>von</strong> den Häusern entfernt worden.<br />
Ungefähr ein Drittel der unsanierten <strong>und</strong> leer stehenden<br />
Häuser gehören der Köthener Wohnungsgesel lschaft. Sie<br />
wirken in ihren braun-grauen Fassaden trostlos. Ihr Abriss ist<br />
beschlossen, obwohl die gute Lage der Ludwigstraße dagegen<br />
spricht <strong>und</strong> jedem das Herz blutet aus der geschlossenen<br />
Bebauung die ›Zahnlücken‹ herauszureißen. Die Straße zeigt<br />
eine soziale Gemengelage aus sozial schwierigen Milieus <strong>und</strong><br />
Hausbesitzern <strong>und</strong> Bewohnern, die seit je her in der Ludwig<br />
straße wohnen. Die städtebauliche Anamnese, die einem<br />
Erstgespräch mit einem homöopathischen Arzt ähnelt, ist ein<br />
ganz wichtiger Baustein. Als nächstes folgt aufgr<strong>und</strong> der<br />
Analyse die Impulssetzung nach einem Ähnlichkeitsprinzip.<br />
Ob Krisen für eine Stadt heilsam sein<br />
können, wird momentan in der<br />
Kleinstadt Köthen untersucht. Sie ist<br />
eine <strong>von</strong> siebzehn Städten in Sachsen-<br />
Anhalt, die an der ›Internationalen<br />
Bauausstellung Stadtumbau 2010‹<br />
beteiligt sind. Unter Laborbedingungen<br />
Die Frage lautet, wie man mittels einer Reiztherapie auch im<br />
städtischen Bereich einen Impuls setzen kann, der dem<br />
Ausgangspunkt ähnelt, aber trotzdem unschädlich ist <strong>und</strong><br />
etwas anderes in Gang bringt.<br />
— Wie haben Sie das in der Ludwigstraße gemacht?<br />
— An einem Abend im Dezember haben wir die<br />
Straßenbeleuchtung für 25 Minuten ausgeschaltet, danach die<br />
›Abrisskandidaten‹ mit Theaterscheinwerfern angestrahlt <strong>und</strong><br />
dann die Anwohner zu einer Versammlung im Hotel auf der<br />
Ecke eingeladen. Hier konnten wir nur die schlechte Nachricht<br />
des geplanten Abrisses überbringen. Diese Geste – das Licht<br />
geht aus – hat natürlich viel Betroffenheit bei den Bürgern<br />
freigesetzt. Zwei St<strong>und</strong>en lang sind sie uns sehr lautstark an gegangen,<br />
weil wir ihnen mitteilen mussten, dass viele Häuser in<br />
der Straße abgerissen werden müssen, aber wir trotzdem<br />
keinen Plan dafür haben, wie die Zukunft der Straße aussieht.<br />
Der Planer hat keinen Plan. Das verunsichert, war aber seriös,<br />
denn es gibt Gebiete in der Stadt, die keinerlei Nutzungsdruck<br />
erwarten. Erst nach zwei St<strong>und</strong>en drehte sich die angespannte<br />
Situation <strong>und</strong> der erste Nachbar fragte: »Was würde denn<br />
ein Gr<strong>und</strong>stück kosten, wenn ich es kaufen würde?« Er sagte, er<br />
habe durchaus Interesse seine Eltern auf dem Nach bar gr<strong>und</strong>stück<br />
unterzubringen. Wir würden gern eine Solaranlage bauen,<br />
sagten die Nächsten. Und so kam dann Stück für Stück Bewegung<br />
in die Straße, indem die Nachbarn ange fangen haben,<br />
mit der Wohnungsbaugesellschaft als Eigen tümerin ins Gespräch<br />
zu kommen. Die Frage, die wir uns dabei ständig gestellt<br />
haben, ist, wie beobachtet man solche Prozesse? Wie notiert<br />
man sie <strong>und</strong> aus welchen Dingen zieht man die richtigen<br />
Schlüsse? Es ist wichtig, dass wir lernen, Prozesse anders<br />
zu betrachten, zu bewerten <strong>und</strong> diese Erfahrungen in ganz ausführlichen<br />
Protokollen aufzuschreiben: Wer hat was gesagt,<br />
was ist auffällig gewesen an den Aussagen oder an der räumlichen<br />
Situation – das sind wirklich lange Protokolle.<br />
— Eine permanente Rekapitulation –<br />
— Eine permanente Verlaufsbeobachtung dieser Situation.<br />
Was relativ aufwändig ist <strong>und</strong> was wir als Planer auch nicht<br />
gewohnt sind.<br />
— Warum machen Sie das?<br />
— Damit man weiß, wann man welche Entscheidungen<br />
getroffen hat. Das hat für die akute Situation nicht sofort einen<br />
Mehrwert, aber wir erhoffen uns <strong>von</strong> diese sorgfältigen<br />
Dokumentationen, dass man in einer anderen Situation noch<br />
einmal auf das Beispiel Ludwigstraße zurückgreifen kann.<br />
Daran arbeiten wir in Köthen.<br />
— Wenn man sich die Homöopathie als Metapher<br />
anschaut, wo lägen dann die Schnittpunkte zur Planung?<br />
— Wie schon gesagt: In der Anamnese, Analyse <strong>und</strong> in der<br />
Impulssetzung nach einem Ähnlichkeitsprinzip, eben auch<br />
durch das Erzeugen <strong>von</strong> Störungen <strong>und</strong> Kunstkrankheiten <strong>und</strong><br />
in der sorgfältigen Prozessbeobachtung, <strong>und</strong> vor allem im<br />
Vertrauen in Prozesse. Der homöopathische Arzt hat ein tiefes<br />
Vertrauen, dass aus dem Prozess etwas entstehen wird <strong>und</strong><br />
er hat eine f<strong>und</strong>ierte Routine, Prozesse zu strukturieren.<br />
Der Patient wird nach Ende der Behandlung nie wieder an demselben<br />
Punkt sein wie vorher – es gibt keine Stagnation. Das<br />
ist, glaube ich, die große Anleihe, die man bei den homöopathischen<br />
Ärzten machen kann.<br />
— Weil sie keinen Idealzustand im Auge haben?<br />
— Ja, weil es in der Homöopathie keine Definition <strong>von</strong><br />
Ges<strong>und</strong>heit gibt. Ges<strong>und</strong> ist der, der sich ges<strong>und</strong> fühlt, selbst<br />
wenn er objektiv ein Leiden hat. Jemand kann einen gebrochenen<br />
Arm haben, sich aber trotzdem fit <strong>und</strong> munter fühlen. Das<br />
ist dann nicht das Problem. Denn es gibt ein subjektives<br />
Empfinden <strong>von</strong> Ges<strong>und</strong>heit jenseits der objektiven Diagnose.<br />
— Wie versteht Homöopathie das Objekt, das sie bearbeitet<br />
– also den Kranken, den Patienten, im Unterschied<br />
zu einem Schulmediziner?<br />
— Ich denke, Homöopathie verfolgt einen genuin subjektiven<br />
Ansatz, auch wenn objektive Laborwerte mit einbezogen<br />
werden. Aber einen menschlichen Körper anhand <strong>von</strong> Werten<br />
objektiv durchzuchecken, das ist nur die eine Ebene der<br />
Betrachtung. Wirklich entscheidend ist das subjektive Empfinden<br />
<strong>und</strong> die Person, <strong>und</strong> beides ist schwer auf eine Stadt<br />
übertragbar.<br />
— Was steht dem entgegen?<br />
— Ein städtischer Organismus ist natürlich multipolar. Ein Arzt-<br />
Patientenverhältnis hingegen ist eine simple bipolare Situa tion.<br />
Man kann bestimmte Metaphern herausnehmen, aber gr<strong>und</strong>sätzlich<br />
kann man solche Dinge nicht 1:1 übertragen.<br />
— Ich bin gespannt, wie es mit der Ludwigstraße weitergegangen<br />
ist?<br />
— In der Ludwigstraße sind drei Häuser abgerissen worden,<br />
für vier Häuser hat sich ein Nachbar gef<strong>und</strong>en. Es werden noch<br />
weitere abgerissen werden. Mittlerweile arbeiten wir eher<br />
an dem sozialen Gefüge der Straße. Eine auffällige Aussage<br />
bei der letzten Anamnese war, dass es keine schönen<br />
Menschen in der Ludwigstraße gebe, dass es alles so grau <strong>und</strong><br />
trist sei. Im Moment nimmt eine Fotografin die Menschen in der<br />
Ludwigstraße auf. Im Juni wird es eine Fotoausstellung geben,<br />
erforscht das Bauhaus Dessau dort<br />
wie Städte zukunftsfähig gemacht<br />
werden können. Sonja Beeck ist<br />
daran beteiligt, neue Werk zeuge der<br />
Stadtentwicklung zu erpro ben.<br />
Kommunikation ist dabei oft wichtiger<br />
als architektonische Neuerungen.<br />
um zu schauen, was das eigentlich für ein Begriff <strong>von</strong> Schönheit<br />
ist, den die Anwohner vermissen, denn das soziale Gefälle<br />
ist sehr groß. Mit solchen Interventionen machen wir<br />
Schritt für Schritt weiter.<br />
— Könnte man das Prinzip, das sie verfolgen auch mit<br />
›Do-Little‹ umschreiben – also wenig zu tun <strong>und</strong> nicht mit<br />
der großen Planerkeule auf eine Situation los zu gehen?<br />
— Ja sicher, das ist eine ganz wichtiger Punkt, auch weil<br />
Förder mittel endlich sind. Man hat mit Fördermitteln schon<br />
vielen Städten geschadet. Und irgendwie ist es sehr wichtig,<br />
dass man mit wenig Geld <strong>und</strong> kleinen Schritten auskommt.<br />
Das soll kein Plädoyer dafür sein, dass wenig Geld wünschenswert<br />
ist. Andererseits garantiert viel Geld nicht eine nachhaltige<br />
Entwicklung. Manchmal ist es wichtig, dass man mit den<br />
kleinen Schritten vorwärts kommt, einen Lernprozess erfährt<br />
<strong>und</strong> weiß, wie man miteinander <strong>und</strong> mit der Entwicklung einer<br />
Stadt besser umgeht. Das braucht andere Quellen als<br />
Geld. In Köthen bedanken wir uns für das Engagement der<br />
hömöopahischen Ärtzte.<br />
— Wird Kommunikation inzwischen für die Stadt entwicklung<br />
wichtiger als bauliche Veränderungen?<br />
— Ich würde sagen: Ja, weil es überhaupt keine Notwendigkeit<br />
gibt, viel zu bauen. Wichtiger ist die Gestaltung einer Vorstellung<br />
<strong>von</strong> Zukunft: Welche Pläne, welche Ziele hat man, was<br />
ist einem wichtig, was will man erhalten, was kann wegfallen.<br />
Solche Fragen sind wichtig, <strong>und</strong> darüber muss man reden.<br />
In den schrumpfenden Regionen heißt Bauen vor allem, Dinge<br />
zu ergänzen, Dinge auch einmal auszuwechseln, die nicht<br />
mehr tauglich sind <strong>und</strong> für eine wirklich gute neue Idee einen<br />
neuen Raum zu schaffen. Aber im Gr<strong>und</strong>e gibt es Hväuser<br />
<strong>und</strong> Bausubstanz genug.<br />
— Sie sprechen <strong>von</strong> Stadtplanung als offenem Prozess –<br />
trotzdem die Frage, wie wichtig sind dafür auch langfristige<br />
Zeitperspektiven?<br />
— Ich glaube, es ist immer richtig, langfristige Ziele zu verfolgen,<br />
weil man entsprechend Entscheidungen in eine bestimmte<br />
kohärente Ordnung bringen kann. Das verkürzt die Irrtümer<br />
<strong>und</strong> die Fehlerfrequenzen. Deshalb ist jede Stadt, die langfristige<br />
Ziele formulieren kann, einen großen Schritt weiter.<br />
Gleich zeitig ist es schwierig, solche Ziele zu benennen, damit<br />
wird sehr viel Scharlatanerie betrieben. Ich bin der Über zeugung,<br />
dass Städte wie Charaktere sind <strong>und</strong> dass es immer <strong>von</strong><br />
der konkreten Konstellation der lokalen Akteure abhängt, ob<br />
sie ihre Ziele härter oder weicher fassen.<br />
Der nächste Punkt ist natürlich, dass innerhalb einer städtischen<br />
Gemeinschaft gern unterschiedliche Ziele gesehen<br />
werden. Das ist eine Frage der Verhandlung vor Ort; welche<br />
Ziele mit welcher Konsequenz nach vorn geschossen werden.<br />
Für die einen ist ökologischer Umbau das Ziel, für andere<br />
die Vollbeschäftigung <strong>und</strong> für wieder andere ein gut funktionierendes<br />
soziales Netz, geringe Neben kos ten für jeden Bürger<br />
<strong>und</strong> wirtschaftliche Prosperität. Es gibt ein Set <strong>von</strong> Entwicklungs<br />
zielen, die eine Stadt in ver schie denen Wertigkeiten<br />
aufbauen kann.<br />
— Welche Rolle spielt Kultur in diesen Umbauprozessen?<br />
Hilft sie kurzfristig dabei eine Identität zu markieren oder<br />
ist es mehr?<br />
— Künstlerische Prozesse haben oft die Funktion, einer<br />
Gemein schaft oder einer Situation einen Spiegel vor zu halten,<br />
Dinge zu überhöhen, oder überhaupt einer Situation einen<br />
Reflektionsraum zu geben. Oft ist es ein Gewinn, die eigene<br />
Situation spielerisch oder ernst, bildhaft oder in einer Aktion zu<br />
überhöhen, <strong>und</strong> dann eine Diskussion anzuzetteln. Darin liegt<br />
die große Rolle <strong>von</strong> Kunst <strong>und</strong> Kultur in diesen Zeiten –<br />
eine ganz wichtige Rolle. Weil: Kultur darf das tun, was ein<br />
Stadtrat manch mal nicht entscheiden oder auch nicht so sagen<br />
kann. Sie schmeißt einfach den Stein nach vorn. Was dann im<br />
Verfahren oder im Gesetz herauskommt, ist eine andere Sache.<br />
— Ist das, um auf die Metapher der Homöopathie zurückzukommen,<br />
auch eine Art Parallelreiz? Dass im Bereich<br />
der Kunst das Überraschende eher möglich ist, etwas, was<br />
an anderer Stelle aber eigentlich nötig wäre?<br />
— Ja, das kann man so sagen. In der Homöopathie gibt es<br />
direkte Äquivalente zur Provokation in der Kunst. Künstler<br />
dürfen auch etwas Provozierendes machen <strong>und</strong> dadurch etwas<br />
anregen. Das darf Planung nicht. Planung darf nicht provozieren<br />
<strong>und</strong> sie soll Krisen vermeiden. Kunst hin gegen darf<br />
provozieren <strong>und</strong> eine Krise erzeugen. Genau das tun die<br />
Homöopathen auch. Das wäre auch für Planer eine wichtige<br />
Technik, die Störung <strong>und</strong> die Krise als kreatives Moment<br />
einzubeziehen. Aber das ist in unseren Verfahren noch nicht<br />
möglich. Man kann keinen Auftrag vergeben an eine Gruppe<br />
<strong>von</strong> Planern, eine kurzfristige Krise auszulösen.<br />
— Warum kann man das nicht?<br />
— Weil es dem Selbstverständnis <strong>von</strong> Politik <strong>und</strong> Planung<br />
widerspricht. Im öffentlichen Sektor geht es schon um die<br />
Wahrnehmung <strong>von</strong> <strong>Vera</strong>ntwortung <strong>und</strong> den Schutz der Bevölkerung.<br />
Daher muss man Umwege nehmen über Experimente<br />
<strong>und</strong> Kultur. Manchmal würde ich es mir wünschen, aber<br />
die Krisen entstehen auch <strong>von</strong> selber.<br />
9
WAS DU WISSEN SOLLTEST (DIE GLOBALISIERUNG) 10<br />
ES KÖNNTE SICH<br />
GANZ VIEL ÄNDERN,<br />
WENN ES DIE<br />
PYRAMIDE GÄBE<br />
Ein Gespräch mit dem Autor<br />
Ingo Niermann, die Fragen stellte<br />
<strong>Vera</strong> <strong>Tollmann</strong><br />
In Umbauland entwickelst Du die Idee einer Pyramide,<br />
die als globale Begräbnisstätte zum Beispiel<br />
in Sachsen-Anhalt entstehen könnte. Was hat<br />
ein kulturgeschichtlich bedeutendes Bauwerk wie<br />
eine Pyramide mit der Zukunft zu tun? Ist es nicht<br />
eher ein folkloristischer Gedanke, heute eine<br />
Pyramide zu bauen?<br />
Mich interessieren Pyramiden eigentlich gar nicht, weder das<br />
esoterisch Aufgeladene an ihnen, noch ihre strenge Form.<br />
Es ist einfach eine sehr stabile Bauform. Vor allem, wenn man<br />
etwas baut, was keine feste Zielgröße hat, was immer weiter<br />
wachsen soll. Ein Quader, der sich immer weiter vergrößert, ist<br />
viel komplizierter <strong>und</strong> nicht so stabil. Darum die Pyramide.<br />
Die Pyramide ist wie ein abstrakter Berg. Dass sie eine antike<br />
Konnotation hat, damit kann man spielen <strong>und</strong> muss es auch<br />
tun, aber das war nicht der Gr<strong>und</strong>, sich für diese Form zu entscheiden.<br />
Wir haben im Verein ganz am Anfang darüber gesprochen,<br />
ob man nicht eine zeitgemäßere Form finden müsse,<br />
etwa die einer Hyperbel. Ich fand den Vorschlag zu willkürlich.<br />
Die Pyramide hingegen hat <strong>von</strong> Anfang an ihre Form, du kannst<br />
schon mit fünf Steinen eine bauen.<br />
Bei dem internationalen Architekturwettbewerb,<br />
den Ihr für den Bau der Friedhofspyramide ausgeschrieben<br />
hattet, fällt auf, dass drei <strong>von</strong> vier<br />
Büros in Asien beheimatet sind. Hat diese<br />
Wahl damit zu tun, dass Japan der Inbegriff für<br />
eine vergangene Zukunft <strong>und</strong> China der für die<br />
kommende ist?<br />
Das war eigentlich Zufall. Ich kenne mich mit Architektur gar<br />
nicht so gut aus. Dann hatten wir die Idee, dass Rem Kolhaas<br />
den Jury-Vorsitz machen könnte <strong>und</strong> auch nach Architekten<br />
sucht. Seine Auswahl haben wir dann zusammen besprochen.<br />
Wir haben auch andere Leute aus der Jury gefragt wie Stefano<br />
Boeri <strong>und</strong> das Architekturbüro Atelier Bow-Wow aus Tokio<br />
<strong>und</strong> MADA s.p.a.m. aus Shanghai tauchten auf. Ai Weiwei<br />
kannte ich bereits aus meiner Zeit in Peking. Eigent lich hatten<br />
wir noch ein Büro aus Miami eingeladen, Arqui tectonica,<br />
das aber abgesagt hat, weil ihnen unser Vorhaben zu heikel war.<br />
Deren Arbeit kann man als seltsames Spät-Memphis [Anm.<br />
postmodernes Mailänder Designerkollektiv der 1980er Jahre]<br />
beschreiben. Koolhaas’ Idee war es, vor allem alte Architekten<br />
einzuladen. Das hat aber nicht geklappt.<br />
Alte Leute, weil sie dem Tod näher sind?<br />
Ja. Ungers ist dann gestorben, der war schwer krank. Bei ihm<br />
war es ein bisschen zu nah am Tod gefragt. Laurinda Spear <strong>von</strong><br />
Arquitectonica ist auch schon älter, <strong>und</strong> sie hat anfangs sofort<br />
ja gesagt. Erst später haben wir darüber nachgedacht, dass<br />
Japan <strong>und</strong> China tatsächlich strategisch günstige Länder<br />
wären. Japan hat eine Kremierungsrate <strong>von</strong> 100 Prozent, <strong>und</strong> in<br />
China gibt es anscheinend sogar eine Kremierungspflicht;<br />
Von Ingo Niermann erschien 2003 der<br />
Proto kollband ›Minusvisionen. Unter nehmer<br />
ohne Geld‹, in dem Gespräche mit<br />
gescheiterten Unternehmensgründern<br />
ver sammelt sind. Mit einem der »Unternehmer<br />
ohne Geld«, dem Wirt schafts wissenschaftler<br />
Jens Thiel aus Erfurt, denkt<br />
Ingo Niermann heute darüber nach,<br />
eine Pyramide in Sachsen-Anhalt zu<br />
bauen. Entgegen gängiger Zukunfts vorstel<br />
lungen <strong>von</strong> einem län ge ren <strong>und</strong><br />
techno ideren Leben planen die beiden<br />
ein kollektives Grab für Angehö rige aller<br />
Religionen. Investoren gibt es bisher<br />
keine, die Kulturstiftung des B<strong>und</strong>es hat<br />
die Entwicklungsphase finanziert. In<br />
seinem Buch ›Umbauland‹ (2007) stellt<br />
also auch 100 Prozent. Als ein möglicher Standort, wenn er<br />
denn nicht in Deutschland wäre, tauchte plötzlich Miami auf,<br />
weil: tolles Klima, ohnehin schon Touristenziel <strong>und</strong> viele alte<br />
Leute. Dort gibt es ein liberales Bestattungsrecht, das private<br />
Friedhöfe erlaubt. Dabei gibt es schon ziemlich viele<br />
Möglichkeiten in Amerika: die Asche einfach ausstreuen, die<br />
Asche mit nach Hause nehmen. Bei uns soll es eine Mischform<br />
aus anonymer <strong>und</strong> persönlicher Bestattung geben, denn<br />
man wird Teil dieser Pyramide, aber darin lokalisierbar sein.<br />
Man ist nicht irgendwo.<br />
Müssen Zukunftsentwürfe heute pragmatisch<br />
ausfallen?<br />
Nach pragmatischen Lösungen wird immer gesucht, das ist<br />
nichts besonderes. Auch innerhalb einer radikalen Revolution<br />
geht es sehr bald darum, Lösungen zu finden, wie man konkret<br />
mit einer Situation verfährt <strong>und</strong> sie nicht einfach sich selbst<br />
überlässt. Wie sich das Marx noch in einem Hegelianischen<br />
Geschichtsmodell gedacht hat, dass nur ein bestimmter<br />
Stand der Produktionsmittel erreicht sein müsse <strong>und</strong> dann<br />
laufe alles <strong>von</strong> selber. Dabei hat er sich kaum Gedan ken<br />
darüber gemacht, wie seine Zielgesellschaft aussehen könnte.<br />
Die Vorschläge in ›Umbauland‹ unterscheiden sich <strong>von</strong> anderen<br />
pragmatischen Ansätzen darin, dass ich versucht habe,<br />
pragmatisch als billig zu denken, als kostengünstige Lösung.<br />
Denn ich habe in Deutschland beobachtet, dass die großen<br />
politischen Debatten eigentlich immer Umverteilungsdebatten<br />
sind. Entweder <strong>von</strong> reich nach arm oder erst mal zu reich hin<br />
mit der Idee, dass das Geld irgendwann zu den Armen<br />
runtersackt; also erst mal Steuererleichterung für die Reichen<br />
schaffen <strong>und</strong> dann profitieren irgendwann die Armen da<strong>von</strong>.<br />
Oder aber man gibt es den Armen, die geben ganz viel Geld aus<br />
<strong>und</strong> dann profitieren auch die Reichen da<strong>von</strong>. Das sind die<br />
zwei wesentlichen Modelle, mit denen die ganze Zeit hin <strong>und</strong><br />
her argumentiert wird. Gleichzeitig merkt man aber, dass durch<br />
die Globalisierung <strong>und</strong> dadurch, dass die Steuerrate schon<br />
einen bestimmten Prozentsatz erreicht hat, gar nicht mehr viel<br />
Spiel da ist, Geld hin- <strong>und</strong> her zu schieben.<br />
Die Große Pyramide, eine prototypische Grabstätte<br />
für alle, ist auch als wirtschaftliches Triebwerk<br />
für die Region gedacht, in der sie gebaut wird.<br />
Warum interessierst Du Dich überhaupt dafür,<br />
über Deutschland als Wirtschaftsstandort nachzudenken?<br />
Mich hat die wirtschaftliche <strong>und</strong> politische Zukunft <strong>von</strong><br />
Deutschland nie besonders interessiert. Ich hatte nie patriotische<br />
Gefühle, aus denen heraus ich mich um Deutschland<br />
kümmern müsste. Ich fand nur diese Debatten langweilig.<br />
Und dann habe ich angefangen, mit Fre<strong>und</strong>en rumzuspinnen.<br />
Für mich war es wie ein Rätsel, das man lösen will; das kann<br />
einfach nicht alles sein, was man denken kann. Der andere<br />
er diese zusammen mit neun weiteren<br />
»deutschen Visionen« vor. Niermann hat<br />
viele Ideen für die Zukunft, fühlt sich<br />
deswegen selbst aber nicht besser auf sie<br />
vorbereitet. — Das Gespräch findet in<br />
seiner Pankower Woh nung statt. Dort ist<br />
es so ruhig wie kaum an einem anderen<br />
Ort in Berlin – für ihn aber könnte es noch<br />
ruhiger sein. Durch das große Fenster<br />
im Berliner Zimmer sieht man die S-Bahn-<br />
Gleise <strong>und</strong> den alten Mauer streifen.<br />
Niermann stellt chinesischen Grüntee<br />
auf den Tisch <strong>und</strong> gibt mir sein gerade erschienenes<br />
Buch ›China ruft dich‹.<br />
Es enthält ausführ liche Interviews mit in<br />
Peking lebenden Chi ne sen <strong>und</strong> Aus ländern<br />
über deren Leben.<br />
Ansatz in dieser Marx’schen Linie ist, zu sagen, man brauche<br />
erst mal einen anderen technischen Stand <strong>und</strong> dann löse sich<br />
alles <strong>von</strong> selbst. Man investiert in Forschung, muss warten <strong>und</strong><br />
dann wird es schon. Ich dachte aber, ob man nicht auch für<br />
die jetzige Gesellschaft Lösungen finden kann. Darum heißt<br />
das Buch ›Umbauland‹: Ich sehe die Gesellschaft wie ein Haus,<br />
das man schon hat <strong>und</strong> aus dem man versucht, mit wenigen<br />
Mitteln was anderes zu machen. Das ist ein neuer Pragmatismus.<br />
Ein Pragmatismus, der sonst nicht ungewöhnlich ist.<br />
Dass man an etwas Existierendes anknüpft?<br />
Ja, man knüpft immer an etwas an. Pragmatismus aber auch,<br />
weil man einen Dreh sucht, um unter den großen Debatten<br />
durchzutauchen.<br />
Wie ernst meinst Du es mit einem neuen Wirtschaftsmodell<br />
für Deutschland? Ist die Pyramide<br />
Parodie oder Masterplan?<br />
Normalerweise werden Bücher zu der Frage, wie das Land<br />
geändert werden kann, ganz anders. Die gehen <strong>von</strong> nur einer<br />
Idee aus <strong>und</strong> sind 250 bis 300 Seiten dick. Der Autor muss mit<br />
einem bestimmten missionarischen Gestus auftreten, <strong>und</strong><br />
der geht mir komplett ab. Ich finde die Ideen wirklich gut, aber<br />
wollte gleich einen Haufen hinwerfen. Hier habt ihr gleich<br />
zehn, <strong>und</strong> dafür braucht man auch nur siebzig Seiten.<br />
Würdet Ihr bei dem Pyramiden-Projekt bei einer<br />
möglichen Realisierung denn als Unter nehmer<br />
auftreten oder gebt Ihr das Projekt an diesem<br />
Punkt ab?<br />
Ich komme ja eigentlich <strong>von</strong> der Literatur her <strong>und</strong> deswegen<br />
ist das Nachdenken über Zukunft für mich eine andere Form <strong>von</strong><br />
Fiktion. Man hat plötzlich diese Möglichkeit, dass sie doch<br />
Wirklichkeit werden könnte. Aber es muss nicht sein. Ich war<br />
mit der Pyramide in jedem Stadium sehr glücklich. Schon<br />
in dem Moment, als ich sie mir ausgedacht habe, war ich sehr<br />
glück lich. Auch als klar war, dass man einen Verein gründen<br />
<strong>und</strong> alles mal versuchen kann. Wir haben die Pyramide auf<br />
Dessau als möglichen Standort hin gedacht. Zuerst sagten sie,<br />
kommt doch mal her. Dann schien sich die Neugier wieder umzukehren.<br />
Jetzt gibt es ein stärkeres politisches Interesse.<br />
Wir haben die Pyramide im Bauhaus Dessau vorgestellt, mit<br />
Unterstützung der Grünen, <strong>und</strong> dann standen auch Leute<br />
<strong>von</strong> der FDP <strong>und</strong> der Linken auf <strong>und</strong> sagten, wir wollen die<br />
Pyramide. Das war ein toller Moment. Alle Ideen in ›Umbauland‹<br />
sind so abgefasst, dass ich nichts dagegen hätte, wenn<br />
sie realisiert würden. Aber ich selber kann es nicht leisten.<br />
Du willst damit kein Geld verdienen?<br />
Ich kann vielleicht eine Beteiligung halten, aber ich kann nicht<br />
Bauherr werden, das geht überhaupt nicht. Das ist für Jens<br />
[Thiel], mit dem ich zusammenarbeite, anders. Jens ist Ökonom<br />
<strong>und</strong> hat sich im letzten Jahr wahnsinnig in die Detailfragen
WAS DU WISSEN SOLLTEST (DIE GLOBALISIERUNG) 11<br />
reingekniet. Ihn habe ich schon für das ›Minusvisionen‹-Buch<br />
interviewt. Darin geht es um Unternehmer, die nicht vorrangig<br />
durch monetäre Interessen getrieben werden, sondern<br />
bei denen die unternehmerische Idee im Vordergr<strong>und</strong> steht.<br />
Die Pyramide ist eine tolle Idee, aber ich kann überhaupt nicht<br />
einschätzen, wie das Ganze ausgeht. Noch wurde keine<br />
Gesellschaft gegründet <strong>und</strong> wurden keine Investoren angesprochen.<br />
Dabei geht es darum, dass man am Anfang ein paar<br />
Millionen hat, um ein F<strong>und</strong>ament zu bauen <strong>und</strong> das gr<strong>und</strong>legende<br />
Marketing hinzubekommen. Man kann sich aber auch<br />
vorstellen, <strong>und</strong> das finde ich noch schöner, auf einem ebenen<br />
felsigen Untergr<strong>und</strong> einfach loszulegen. Dann braucht man<br />
am Anfang kaum Geld. Es reicht, wenn ein Feldweg zur<br />
Pyramide hinführt. In Deutschland ist das aber wegen der<br />
strengen Bauvorschriften nicht möglich.<br />
Wo ordnest Du Euer Pyramidenvorhaben etwa<br />
zwischen der kasachischen, <strong>von</strong> Norman Foster<br />
entworfenen Friedenspyramide in Astana <strong>und</strong><br />
der japanischen Utopie einer Unterwasserpyramide,<br />
der sogenannten X-Seed 4000, ein?<br />
Wollt Ihr beides sein, Machtdemonstration <strong>und</strong><br />
Schutzbunker?<br />
Diese Unterwasserpyramide kenne ich gar nicht. Ich kenne nur<br />
die Idee zum größten Bauwerk, das aussieht wie ein riesiger<br />
Berg aufeinandergestapelter Kästen.<br />
Das Pyramidenprojekt X-Seed 4000 lässt sich<br />
vielleicht mit der Biosphere II vergleichen, inklusive<br />
Friedhof.<br />
Wie gesagt, ich kenne nur die Vision für eine Pyramide vor<br />
Tokio, die Shimizu Mega City Pyramid – ich glaube, auf einer<br />
künstlichen Insel, die gleichzeitig als Wetterwall fungieren soll.<br />
Auf der Insel könnten dann 750.000 Menschen wohnen <strong>und</strong><br />
800.000 arbeiten. Das ist aber sehr spekulativ. Und das Tolle an<br />
der Großen Pyramde ist, mal ein großes Bauwerk zu errichten,<br />
in das man nicht reingehen kann.<br />
Selbst in die Chinesische Mauer kann man<br />
reingehen ...<br />
Ja, kann man da rein? An einigen Stellen vielleicht. Aber gut,<br />
die Große Mauer ist auch schon älter. Heute bedeutet<br />
Monumente zu errichten, nur Fassaden zu bauen. Innendrin<br />
findet man dann das Übliche vor, Büros <strong>und</strong> Wohnräume.<br />
Lauter Landmarks hat man gebaut, die aussehen wie Skulpturen.<br />
Man könnte denken, Architekten sind eigentlich die<br />
modernen Bildhauer, die das machen, was Künstler sich heute<br />
nicht mehr trauen. In der Kunst würde man denken, was ist<br />
denn das für ein Kitsch. Aber in der Architektur lebt das bunt<br />
<strong>und</strong> munter fort. Man macht da weiter, wo Henry Moore aufgehört<br />
hat. Das Monumentale besteht nur noch aus der Fas sade<br />
<strong>und</strong> Büros, Büros, Büros. Die Gestaltung der Innenräume<br />
ist im Vergleich zum Außen immer recht bescheiden.<br />
Was denkst Du, warum diese Form der Architektur<br />
gut funktioniert, warum gerade da<strong>von</strong> jetzt viel<br />
gebaut wird?<br />
Weil es kapitalistisch wertvoll ist?<br />
Klar, es ist ein Geschäftsmodell. Eine unverwechselbare Verpackung<br />
soll den verwechselbaren Inhalt aufwerten. Eigent lich<br />
ganz einfach nachzuvollziehen. Aber was es nicht mehr gibt:<br />
dass man etwas irgendwo hinsetzt, das nur massiv <strong>und</strong><br />
groß ist. Selbst durch das Berliner Holocaust-Mahnmal kann<br />
man wandeln.<br />
Neulich sagte der amerikanische Erfinder<br />
Ray Kurzweil in einem Interview, dass es bei allem<br />
Neuen einzig auf das richtige Timing ankäme.<br />
Denkst Du, jetzt ist der richtige Zeitpunkt für Euer<br />
Bauvorhaben?<br />
Das kann man ja nie so genau wissen. Vielleicht braucht es<br />
noch zwanzig, dreißig Jahre. Gr<strong>und</strong>sätzlich, glaube ich, ist das<br />
Timing gut, weil momentan ein neues Nachdenken über Bestattungsformen<br />
stattfindet. Bisher gibt es da nur den Friedwald,<br />
das Ausstreuen <strong>von</strong> Asche oder die Option, die Urne<br />
einfach mit nach Hause zu nehmen. Diese Konzepte schließen<br />
immer noch an das bürgerliche Verdrängen des Todes an.<br />
Der Fried wald ist irgendwo außerhalb, weit weg <strong>und</strong> einfach<br />
ein Wald. Wenn man die Asche mit nach Hause nimmt, hat man<br />
vielleicht privat ein Andenken, aber im öffentlichen Raum<br />
ist es weg. Dass man im öffentlichen Raum mit Tod konfrontiert<br />
wird, ist lange her. Um 1800 herum wurden die Friedhöfe raus<br />
geschafft aus dem Stadtzentrum, weil die Städte so sehr gewachsen<br />
waren. Seitdem wird der Tod verdrängt, durch Altenheime<br />
sogar die Zeit vor dem Tod. Genau das würde die<br />
Pyramide ändern. Darum wäre sie nicht nur, wenn sie funktionieren<br />
würde, ein interessantes Geschäftsmodell – Tourismus<br />
<strong>und</strong> damit einer Region den Aufschwung bringend <strong>und</strong> so<br />
weiter. Du musst Dir vorstellen, dass um die Pyramide herum<br />
ganz viele Leute trauern würden, sie wäre ein lauter Ort, wo<br />
man nicht mit dem Tod alleine ist. Als meine Oma gestorben ist,<br />
ging es darum, dass man sich zusammenreißt. Die direkten<br />
Hinterbliebenen gelten als tapfer, wenn sie nicht weinen.<br />
Das ist doch fürchterlich. Warum soll man nicht weinen <strong>und</strong><br />
auch mit ganz vielen anderen Menschen weinen, gleichzeitig<br />
<strong>und</strong> kreuz <strong>und</strong> quer? Ich sehe keinen Gr<strong>und</strong>, warum es immer<br />
nur diese eine Horde aus Angehörigen sein soll, die sich<br />
für drei St<strong>und</strong>en trifft. Nach der Beerdigung gibt es keinerlei<br />
kollektive Trauer mehr. Ich glaube, es könnte sich ganz viel<br />
ändern, wenn es die Pyramide gäbe.<br />
Dass man also etwas aus der muslimischen<br />
Kultur lernt?<br />
Ich glaube, auch in Deutschland war das früher anders. Im<br />
Alten Rom <strong>und</strong> Griechenland bestellte man Klageweiber, die<br />
ganz besonders exaltiert Trauer zeigten, wie eine Hebamme<br />
für den Tod. Früher hat man eine bestimmte Zeit lang Schwarz<br />
getragen. Es ist auf jeden Fall höchste Zeit für die Pyramide,<br />
<strong>und</strong> es haben sich auch schon Leute aus über sechzig Ländern<br />
auf unserer Website angemeldet. Ich dachte zuerst, dass<br />
viel mehr Vorbehalte kommen. Und vereinzelt kamen die auch:<br />
Monumentalarchitektur, das gab es doch in Deutschland zuletzt<br />
bei den Nazis, <strong>und</strong> da gab es auch ganz viele Tote. Es sei ein<br />
Zusammendenken <strong>von</strong> überhaupt nicht monumentalen Massengräbern<br />
in Nazideutschland, wo Tote in die Gruben gekippt<br />
wurden, <strong>und</strong> <strong>von</strong> Germania-Träumen.<br />
In letzter Zeit scheinst Du Dir sehr universa lis tische<br />
Gedanken zu machen. In dem Reisebuch<br />
Metan schreibst Du zusammen mit Christian<br />
Kracht die Menschheitsgeschichte neu, wie es im<br />
Klappentext heißt, <strong>und</strong> die geplante Große<br />
Pyramide soll in Sachsen-Anhalt als Denkmal zu<br />
Ehren der Menschheit entstehen. Worin liegt für<br />
dich der Vorteil einer so umfassenden Herangehens<br />
weise?<br />
Ich habe Philosophie studiert <strong>und</strong> mein erster Roman, ›Der<br />
Effekt‹, – am zweiten schreibe ich immer noch – ist Philosophie<br />
mit anderen Mitteln. In dem Roman habe ich alles unbestimmt<br />
gelassen, ich habe der Stadt keinen Namen gegeben.<br />
Es ist eine protomoderne Stadt. Jahre später, in Peking hatte<br />
ich das Gefühl, das ist eigentlich die Stadt, die ich damals<br />
beschrieben habe. Insofern war es schon etwas in die Zukunft<br />
gedacht. Allgemeine Fragen beschäftigen mich einfach.<br />
Einerseits will ich alles verstehen, dann folge ich einzelnen<br />
Geschichten, wie auch in meinem Chinabuch.<br />
Ich versuche beides zu maxi mieren, was schon ein bisschen<br />
verwegen ist.<br />
Soll die Pyramide eine Touristenattraktion werden?<br />
Wie viel hat die Pyramide mit Disneyland zu tun?<br />
Als Attraktion verstehe ich sie auf jeden Fall. Das Radikale<br />
besteht nicht darin, dass wir aus dem Tod Disneyland machen,<br />
sondern eine Themenstadt gründen wollen, die auch ohne<br />
Casinos <strong>und</strong> Achterbahn funktioniert. Dadurch wird natürlich<br />
diese Stadt ganz anders. Gerade beschäftige ich mich mit<br />
Dubai. Ich kann mir vorstellen, dass die Stadt Dubai noch in<br />
was ganz anderes kippen kann. Die Idee bei Dubai ist, auf<br />
die vielen Änderungen noch weitere drauf zu setzen. Für viele<br />
ist Dubai ein sehr langweiliger Ort. Und das ist er auch erst<br />
mal. Es ist immer noch eine Kleinstadt.<br />
Findest Du den Gedanken attraktiv aus Dubai<br />
einen interessanten Ort zu machen?<br />
In Dubai gibt es eine gigantische Immobilienblase, <strong>von</strong> der<br />
niemand weiß, wie sie eigentlich gefüllt werden soll. Es werden<br />
unglaublich viele Häuser gebaut, aber niemand weiß, wer da<br />
eigentlich rein soll. Das finde ich interessant an Dubai, es wird<br />
so weit wie möglich getrieben. Die wissen ganz genau, dass<br />
es eine Blase ist. Die Häuser wechseln unheimlich schnell den<br />
Besitzer, aber bleiben leer. Der neue Besitzer verkauft es<br />
wieder für 20, 30 oder 40 Prozent mehr. Ich bin gespannt, wie<br />
sich die internationale Immobilienkrise auf diese Vorgänge<br />
auswirkt. Es gibt auch Regionen, wo es nicht so ist. In London<br />
City merkt man <strong>von</strong> der Immobilienkrise gar nichts. Da geht es<br />
einfach weiter. Was die in Dubai versuchen, <strong>und</strong> das ist das<br />
Interessante, die sagen: Klar wird es irgendwann einen Crash<br />
geben, aber dann ist alles schon gebaut. Dann steht man<br />
plötzlich da <strong>und</strong> muss sich überlegen, was man mit all dem<br />
Zeug macht, so wie es jetzt aussieht. An dem Punkt setzt mein<br />
nächstes Buch mit sehr fantastischen Ideen an.<br />
Und wie geht es jetzt mit der Pyramide weiter?<br />
Es wird einen Businessplan geben, den man Investoren zeigen<br />
kann. Das ist die eine Sache. Und die andere ist, konkret<br />
mit interessierten Orten zu sprechen, erst einmal vor allem<br />
mit Dessau.<br />
Wie wichtig ist Dir persönlich Zukunft als Vorstellungsperspektive?<br />
Findest du es wichtig, dass<br />
man Pläne für die Zukunft macht?<br />
Ich finde es sehr, sehr spannend an die Zukunft zu denken.<br />
Wir leben wirklich in einer Zeit massiver Unterschiede,<br />
für jeden Ort auf der Welt bedeutet Zukunft was ganz anders.<br />
Man kann nicht mehr sagen – wie man es lange Zeit gedacht<br />
hat –, wir, der Westen sei für viele Regionen die Zukunft. Aber<br />
es muss auch nicht sein, dass andere Regionen Mitteleuropa<br />
einfach überholen – was sie in vielerlei Hinsicht tatsächlich<br />
tun. Die eine Zukunft, wie man sie sich das 20. Jahrh<strong>und</strong>ert<br />
hindurch vorgestellt hat – Hochhäuser, fliegende Autos <strong>und</strong> so<br />
weiter –, gibt es nicht mehr. Deswegen war es mir bei ›Umbauland‹<br />
wichtig, dass die Ideen überhaupt nichts mit neueren<br />
technischen Errungenschaften zu tun haben. Jetzt erlebt man<br />
eine neue Hungerkatastrophe. Die letzten zwanzig Jahre lang<br />
ging es immer darum, dass es ein Umverteilungsproblem<br />
sei. Eigentlich würde genug produziert, aber das Problem sei,<br />
dass nicht alle Leute genug Geld haben, um sich etwas zu<br />
kaufen. Und jetzt merkt man plötzlich, dass man an eine Grenze<br />
kommt. Beim Öl ist man ja schon an der Grenze angekommen.<br />
Auf einmal kann die Zukunft in allen möglichen Dingen<br />
bestehen. Früher bestand die Zukunft zum Beispiel in synthetischer<br />
Nahrung. Es kann plötzlich auch eine ganz neue Vegetarier-<br />
oder Veganer-Bewegung entstehen als die einzige<br />
Chance, wie alle noch genug zu essen hätten. Auch die chinesische<br />
Ein-Kind-Politik kann eine ganz andere Bedeutung<br />
bekommen. Zwangsmaßnahmen können aus einem Weltinteresse<br />
wieder aktuell werden. Genau wie es darum geht, eine<br />
Vereinbarung gegen den Klimawandel zu finden, könnte es<br />
auch ein Weltnahrungsabkommen geben: Wie viel Fleisch darf<br />
jeder Mensch essen? Müssen Länder mit hohem Fleischkonsum<br />
in Zukunft Strafe zahlen?<br />
Joseph Vogl spricht da<strong>von</strong>, dass im 20. Jahrh<strong>und</strong>ert<br />
ein Gefühl für die Gleichzeitigkeit möglicher,<br />
paralleler Leben entstanden ist. Kleinste Abweichungen,<br />
winzige Alternativen können größtmögliche<br />
Divergenzen erzeugen. Wie lange planst<br />
Du Dein Leben voraus? Weißt Du, was Du in einem<br />
halben Jahr machen wirst <strong>und</strong> wie stellst Du Dir<br />
Dein Leben in fünf Jahren vor?<br />
Irgendwie verdammt wenig eigentlich. [lacht] Im Vergleich dazu,<br />
wie viel Gedanken ich mir über die Zukunft mache! Ich habe<br />
manchmal das Gefühl, ich lebe selbst parallel zur Welt. Ich lebe<br />
in einer Postadoleszenzphase, die bald zwanzig Jahre andauert<br />
<strong>und</strong> irgendwann folgt das Alter. Für andere Leute kann sich<br />
diese Zeit strukturieren, indem sie Kinder bekommen, eine<br />
feste Anstellung haben oder in einem bestimmten Karrierelevel<br />
ankommen. All das gibt es in meinem Leben nicht. Ich habe<br />
erreicht, vom Schreiben irgendwie leben zu können, mein Einkom<br />
men setzt sich aber jedes Jahr anders zusammen. Normaler<br />
weise gibt es diese Schriftstelleridee, dass man ein Buch<br />
nach dem anderen schreibt, dann schließt man einen Vertrag ab<br />
<strong>und</strong> erhält einen Vorschuss für das nächste Buch. Das Ziel ist,<br />
dass man sich soweit etabliert, dass dem eigenen Schreibtempo<br />
entsprechend Geld reinkommt. Eine zeitlang kann man<br />
das noch mit Stipendien auffüllen, aber irgendwann kommt man<br />
über die Grenze. Spätestens mit vierzig muss es dann funktionieren.<br />
Aber das gibt es nicht mehr, so eine Peter-Handke-<br />
Karriere. Man kann sich darauf nicht verlassen, selbst wenn du<br />
einen Bestseller schreibst. Ich finde das keine blöde Entwicklung,<br />
denn sonst kann es auch schrecklich langweilig sein.
WAS DU WISSEN SOLLTEST (DIE VERANTWORTUNG)<br />
ÖFFENTLICHE<br />
KULTURFÖRDERUNG<br />
HAT ZUKUNFT<br />
Ein Gespräch mit Alexander Farenholtz,<br />
Vorstand <strong>und</strong> Verwaltungsdirektor der<br />
Kulturstiftung des B<strong>und</strong>es,<br />
die Fragen stellte <strong>Jan</strong> Wenzel<br />
Bei dem Workshop in Kursdorf gab es während<br />
des Panels ›Die Zukunft der Arbeit‹<br />
eine Situation, in der Sie außergewöhnlich<br />
leidenschaftlich reagiert haben. Benjamin<br />
Foerster-Baldenius sprach im Zusammen -<br />
hang mit dem Flughafen da<strong>von</strong>, dass es viel<br />
unkomplizierter sei, mit privaten Unternehmen<br />
ein Kunstprojekt zu stemmen, als<br />
mit Hilfe der öffentlichen Hand. Warum hat<br />
Sie diese Aussage zu Widerspruch gereizt?<br />
Gr<strong>und</strong>sätzlich mag es ja richtig sein, dass<br />
vieles mit privater Unterstützung einfacher<br />
geht. Aber eine Betrachtung der Kulturförderung<br />
zu verkürzen auf die Kompliziertheiten,<br />
die mit öffentlicher Förderung<br />
verb<strong>und</strong>en sind, fi nde ich nicht sachgerecht.<br />
Denn die Zahl derjenigen, die die<br />
Chance haben, <strong>von</strong> einem Unternehmen<br />
oder einer Privatperson Geld zu bekommen,<br />
ist verschwindend gering, wenn man<br />
es mit dem vergleicht, was durch öffentliche<br />
Mittel an Förderung für Kulturprojekte<br />
ausgegeben wird. Im Hinblick auf<br />
die Abwicklung ist es sicher einfacher,<br />
einen privaten Partner zu haben, der eine<br />
Gr<strong>und</strong>sympathie für ein bestimmtes<br />
Projekt hat <strong>und</strong> der großzügig sein kann,<br />
weil es sein eigenes Geld ist. Ich empfehle<br />
jedem, der an private Gelder herankommt,<br />
diese Chance zu nutzen – schon um die<br />
öffentlichen Mittel zugunsten derjenigen zu<br />
schonen, die diese Möglichkeit nicht haben.<br />
Bei öffentlichen Förderungen mag das<br />
komplizierter sein, aber da handelt es sich<br />
auch um Steuergelder, die wir alle unter<br />
Nöten aufbringen müssen. Im Umgang mit<br />
diesen Geldern gibt es eine hohe<br />
<strong>Vera</strong>ntwortung, das liegt auf der Hand.<br />
Bei öffentlicher Kulturförderung ist der<br />
Aufwand bei der Verwaltung <strong>und</strong><br />
Abrechnung der Gelder recht hoch – aber<br />
gibt es nicht auch bei privater Förderung<br />
Erwartungen an diejenigen, denen Geld zur<br />
Verfügung gestellt wird?<br />
Ehrlich gesagt, nicht nur Erwartungen,<br />
sondern manchmal regelrecht Besetzungen.<br />
Ich fi nde, es macht nach wie vor einen<br />
Unterschied, ob eine öffentliche <strong>Vera</strong>nstaltung<br />
durch irgendeinen Firmennamen<br />
markiert ist oder durch öffentliche Mittel<br />
fi nanziert wird <strong>und</strong> dann dort steht:<br />
Finanziert durch das Land Baden-Württemb<br />
erg oder das Land Sachsen-Anhalt<br />
oder die Kulturstiftung des B<strong>und</strong>es eben.<br />
Vor kurzem hatte ich ein Gespräch mit<br />
einem Vertreter eines wichtigen Museums<br />
in München, einer Stadt, wo man noch<br />
verhältnismäßig schnell an private Mittel<br />
herankommt. Er sagte, es ist in der<br />
Tat komplizierter, mit der öffentlichen<br />
Hand Fördermittel abzurechnen, aber sie<br />
ziehen diese Möglichkeit trotzdem vor,<br />
um die Privatisierung kultureller Angebote<br />
nicht noch zu beschleunigen.<br />
Der Workshop in Kursdorf kreiste um das<br />
Thema Zukunft. Was denken Sie, wie wird<br />
sich die gesellschaftliche Stellung <strong>von</strong><br />
Kultur verändern, wenn die Privatisierung<br />
kultureller Angebote fortschreitet? Wo sehen<br />
Sie die Chancen, aber auch die Risiken eines<br />
verstärkten kulturellen Engagements<br />
privater Unternehmen?<br />
Was sich verändert, ist der Stellenwert <strong>von</strong><br />
bürgerschaftlicher <strong>Vera</strong>ntwortung für<br />
Kultur, aber auch für Soziales oder Sport.<br />
Die Frage ist, gibt es jenseits der staatlichen<br />
Fürsorge – also der staatlichen<br />
<strong>Vera</strong>ntwortung – für bestimmte Aufgaben<br />
auch so etwas wie eine bürgerschaftliche<br />
Verpfl ichtung, die aus der Sozialgeb<strong>und</strong>enheit<br />
des Eigentums erwächst?<br />
Auf mich wirkt diese Vorstellung immer<br />
etwas romantisch. Aber ich will gar nicht<br />
bestrei ten, dass die Kultur in unserer<br />
Gesellschaft durch solche vorkapitalis tischen<br />
oder früh kapitalistischen Haltungen<br />
mit geprägt ist ...<br />
Sie meinen Mäzenatentum?<br />
Macht es einen Unterschied, ob eine<br />
Kulturveranstaltung <strong>von</strong> der öffent li chen<br />
Hand oder <strong>von</strong> privaten Sponsoren<br />
gefördert wird? Alexander Farenholtz<br />
ist ein ausgewiesener Spezialist,<br />
wenn es um die wirtschaft liche Seite<br />
<strong>von</strong> Kultur geht. Anfang der neunziger<br />
Jahre war er als Geschäftsführer<br />
für das Bestehen der documenta IX<br />
Was Mäzenatentum geleistet hat <strong>und</strong> noch<br />
leistet, basiert ja in gewisser Weise auf<br />
dem Gutdünken desjenigen, der privilegiert<br />
ist. Die Vorstellung, dass aus Privilegien<br />
auch Pfl ichten erwachsen, will ich dabei<br />
gar nicht diskreditieren, das ist ja durchaus<br />
wünschenswert. Persönlich neige ich aber<br />
mehr der Vorstellung zu, dass es bestimmte<br />
Ansprüche der Bürgerinnen <strong>und</strong> Bürger<br />
gegenüber ihrem Staat gibt – wozu auch<br />
der Anspruch auf Kultur gehört.<br />
An sprüche, die sich die Bürger erstritten<br />
haben <strong>und</strong> immer neu erstreiten müssen.<br />
Aber deshalb arbeite ich wahrscheinlich<br />
auch bei der Kulturstiftung des B<strong>und</strong>es <strong>und</strong><br />
nicht bei irgendeiner privaten Stiftung.<br />
Mir hat auf einer privaten Englandreise die<br />
Haltung eines älteren britischen Ehe paares<br />
gefallen, die sich über die aus unerfi ndlichen<br />
Gründen geschlossenen Tore eines<br />
Schlossmuseums irgendwo auf dem Lande<br />
mit dem Ausruf empörten: »It belongs to<br />
the Nation!«, womit sie offen k<strong>und</strong>ig<br />
sich selber auch ganz persön lich meinten.<br />
Das korrespondiert übrigens mit dem<br />
verbreiteten ehrenamtlichen Engage ment<br />
vieler Briten im kulturellen Bereich.<br />
Oft ist die Frage, wie gestaltet sich das<br />
Verhältnis zwischen demjenigen, der Geld<br />
gibt <strong>und</strong> demjenigen, der es in Anspruch<br />
nimmt. Welche Prinzipien wären für Sie da<br />
besonders wichtig?<br />
Die Kulturstiftung des B<strong>und</strong>es unter scheidet<br />
sich <strong>von</strong> anderen staatlichen Förderungen<br />
unter anderem dadurch, dass wir<br />
häufi g auch an inhaltlichen Debatten<br />
teilnehmen. Sei es, dass wir Projekte selber<br />
entwickeln, sei es, dass wir im Zuge der<br />
Realisierung gefragt werden, weil man bei<br />
uns einen gewissen Sachverstand<br />
vermutet.<br />
So etwas ist auf der einen Seite außerordent<br />
lich erfreulich – so verstehen wir uns<br />
auch, als Partner, deswegen gibt es bei<br />
uns auch keine Zuwendungsbescheide,<br />
sondern es gibt Verträge auf gleicher Augenhöhe<br />
– auf der anderen Seite ist natürlich<br />
die Einfl ussnahme desjenigen, der über<br />
das Geld verfügt, immer ein zweischnei diges<br />
Schwert. Man muss da sehr stark<br />
acht geben, dass man den Umstand,<br />
derjenige zu sein, der das Geld hat, nicht<br />
dazu missbraucht, Positionen, die der<br />
Partner <strong>von</strong> sich aus nicht vertreten würde,<br />
durchzusetzen.<br />
Ich finde die Selbstbeschränkung, <strong>von</strong> der<br />
Sie sprechen, sehr wichtig. Machen Sie eine<br />
solche Haltung auch öffentlich?<br />
Nein, als Haltung thematisieren wir das<br />
nicht. Worauf wir aufmerksam machen, ist,<br />
dass durch uns öffentliche Mittel zur<br />
Förderung <strong>von</strong> Kultur eingesetzt werden.<br />
Damit das auch in Zukunft so bleibt, ist es<br />
meiner Meinung nach wichtig, sichtbar<br />
zu machen, wo überall öffentliche Mittel<br />
Ver wendung fi nden. Der Zweck ist natürlich<br />
auch, die Proportionen zwischen<br />
den öffentlichen Beiträgen, <strong>und</strong> den verhältnismäßig<br />
geringen privaten Mitteln,<br />
die in die Kultur fl ießen, deutlich zu<br />
machen. Das ist politisch enorm wichtig,<br />
auch weil wir dafür streiten müssen, dass<br />
der öffentliche Anteil in Zukunft nicht<br />
geringer wird.<br />
In den Gesprächen, die wir für die Dokumentation<br />
des Diskursdorf-Workshops führen,<br />
interessiert uns immer auch, welchen<br />
Stellenwert die Zukunft als Zeithorizont für<br />
den Einzelnen hat, wie weit man vorausplant<br />
<strong>und</strong> wie stark man das eigene Leben<br />
<strong>von</strong> Unwägbarkeiten <strong>und</strong> überraschenden<br />
Wendungen durchzogen sieht. Wie ist das<br />
bei Ihnen?<br />
Mein bisheriges berufl iches Leben hat sich<br />
sehr stark in Zeiträume <strong>von</strong> fünf Jahren<br />
unterteilt. Meist habe ich fünf Jahre lang<br />
eine Aufgabe gemacht <strong>und</strong> bin dann<br />
zu etwas anderem gewechselt. Das ist<br />
eigentlich seit meinem Studium so. Nach<br />
drei bis vier Jahren setzt eine innere<br />
Unruhe ein, <strong>und</strong> ich sage mir, jetzt ist es<br />
Zeit, mir etwas Neues auszudenken.<br />
Das ändert sich, je älter man wird <strong>und</strong><br />
sieht, dass nicht mehr so viele Fünfjahre szyklen<br />
zu erwarten sind. – Wenn man<br />
länger als drei oder vier Jahre in einer Position<br />
arbeitet, lernt man aber etwas, was<br />
sich bei kürzeren Zeiträumen in der Regel<br />
vermeiden lässt, nämlich, dass einem<br />
Fehler, die man gemacht hat, irgendwann<br />
wieder begegnen. Das ist ein sehr<br />
gutes Korrektiv.<br />
Vor einigen Wochen habe ich ein Interview<br />
mit dem Philosophen Ludger Heidbrink über<br />
die kulturelle Dimension des Klimawandels<br />
geführt. Heidbrink äußerte die Hypothese,<br />
dass uns das Imaginations potential für die<br />
Zukunft abhanden ge kom men sei.<br />
Gleichzeitig kann man im kulturellen Feld<br />
in den letzten Monaten ein wachsendes<br />
In teresse am Thema Zukunft entdecken.<br />
Was ist Ihre Meinung, wie wichtig<br />
ist es, gesellschaftliche Zukunftsbilder zu<br />
formulieren, sie spielerisch zu erproben<br />
oder kritisch zu testen?<br />
So allgemein lässt sich das schwer beantworten.<br />
Da kommt man schnell zu Plattitüden.<br />
Damit kann ich eigentlich immer<br />
weniger anfangen. – Aber ich gebe<br />
Ihnen ein Beispiel, weil es eine Diskussion<br />
13<br />
verantwortlich, ab 1997 hat er als Leiter<br />
des Kulturprogramms <strong>und</strong> Gesamtprokurist<br />
auf die Expo 2000 in Hannover<br />
zugearbeitet. Dabei nahm seine Karriere<br />
ihren Anfang in der Politik. Seit 2002<br />
bestimmt er als Vor stand <strong>und</strong> Verwaltungsdirektor<br />
die Ge schicke der Kulturstiftung<br />
des B<strong>und</strong>es maßgeblich mit.<br />
widerspiegelt, die wir heute in unserem<br />
Team geführt haben. Da war die Frage,<br />
ob wir als Stiftung nicht stärker im Internet<br />
kommunikativ vertreten sein sollten –<br />
zum Beispiel in Form eines Blogs.<br />
Die Gefahr könnte sein, dass wir uns ansons<br />
ten abkoppeln <strong>von</strong> einer jungen Generation<br />
<strong>von</strong> Akteuren, für die das Alltag ist.<br />
Ich habe mir die Frage gestellt, ob man<br />
einen solchen Trend ohne Weiteres<br />
übernehmen muss, oder ob nicht vielmehr<br />
der Anspruch sein müsste, Kom mu ni kationsformate<br />
zu fi nden, die eine persönliche<br />
Begegnung wieder verstärken.<br />
Wir haben dann als Ergebnis dieser Diskussion<br />
überlegt, vielleicht könnte ein Charakteristikum<br />
der Blogs der Kultur stiftung<br />
des B<strong>und</strong>es sein, dass sie immer in irgendeiner<br />
Form mit tatsächlichen Begeg nungen<br />
– mit abschließenden, beglei tenden oder<br />
solchen, die man gerade be ginnt – verknüpft<br />
sein könnten. Die Vorstellung, dass<br />
uns jetzt lauter Leute irgendwie anmorsen<br />
auf diesen Blogs <strong>und</strong> dass das im Gr<strong>und</strong>e<br />
genommen ohne jede Reaktion bleibt,<br />
kam mir vor wie ein Beichtstuhl, wo<br />
irgendjemand vor sich hin blubbert, aber<br />
es passiert nichts, außer, dass er sich selber<br />
erleichtert fühlt. Und die Funktion, die<br />
müssen wir nicht übernehmen. Ich weiß<br />
nicht, wie sehen Sie das?<br />
Aus meiner Perspektive als Künstler <strong>und</strong><br />
Publizist können Blogs relevant sein sowohl<br />
als Ergänzung, aber auch als ernst zu<br />
nehmendes Korrektiv <strong>und</strong> Gegenbild zu den<br />
so genannten alten Medien, beispielsweise<br />
den Tageszeitungen. Das hat sich neulich im<br />
Zusammenhang mit dem Tibet-China-<br />
Konflikt wieder bewiesen. Auch der Perlentaucher,<br />
dessen englischsprachige Ausgabe<br />
›signandsight‹ die Kulturstiftung des Bu n -<br />
des gefördert hat, berücksichtigt in seiner<br />
Feuilleton-Auslese seit einiger Zeit Blog-<br />
Beiträge. Denn es gibt viele Blogs neben den<br />
privatistischen Beichtstühlen, <strong>von</strong> denen Sie<br />
sprechen, die ähnlich wie ein Feuilleton<br />
Kultur <strong>und</strong> Gesellschaft reflek tie ren.<br />
Nur ist es nicht so einfach, genau diese Blogs<br />
zu finden. Wenn die Kultur stif tung des<br />
B<strong>und</strong>es einen Blog einrichten würde, dann<br />
könnten darin wissenswerte Informationen<br />
in Bezug auf die Entwicklung der Förderpolitik<br />
zu lesen sein, denn darin kennt<br />
sich Ihre Stiftung aus. Außerdem könnten<br />
Sie das Entstehen programmatischer<br />
Förderschwerpunkte dort transparent<br />
machen, indem Sie etwa einzelne Rechercheschritte<br />
veröffentlichen oder die Relevanz<br />
einzelner Themen diskutieren. Das sind sehr<br />
spontane Ideen. – In den meisten Fällen<br />
wird ein Blog <strong>von</strong> einem Autor oder einer<br />
Autorin <strong>und</strong> deren jeweiligen Interessen <strong>und</strong><br />
Meinung belebt. Es wäre interessant zu<br />
sehen, wie sich ein solches Prinzip auf eine<br />
Institution übertragen lässt.
WAS DU WISSEN SOLLTEST (DIE DEMOKRATIE) 14<br />
»WIR WOHNEN AN DER<br />
LÄRMMÜLLDEPONIE«<br />
Ein Gespräch mit Thomas Pohl,<br />
Vorstandsmitglied der IG Nachtfl<br />
ugverbot Leipzig/ Halle e.V.,<br />
die Fragen stellten <strong>Jan</strong> <strong>Caspers</strong><br />
<strong>und</strong> <strong>Jan</strong> Wenzel.<br />
— War die Nordbahn des Flughafens schon in Planung als<br />
sie 1996 ihr Haus in Rackwitz bauten?<br />
— Ja, es gab bereits eine Grobplanung. Nur, dass die Bürger<br />
darüber nichts erfahren haben. Im Gegenteil, der Bürgermeister<br />
der Gemeinde Rackwitz als Verkäufer des Gr<strong>und</strong>stücks,<br />
hatte uns versichert, dass es keine Absichten zum Ausbau des<br />
Flughafens gibt. Da er als Bürgermeister automatisch in<br />
der Fluglärmkommission des Flughafens Mitglied war, wusste<br />
er <strong>von</strong> den Ausbauplänen <strong>und</strong> hat uns im Prinzip belogen.<br />
Auch auf Nachfragen der Gr<strong>und</strong>stücksinteressenten kamen<br />
<strong>von</strong> ihm immer wieder abwiegelnde Äußerungen. Den Satz,<br />
»das Lauteste, was Sie hier hören werden, ist das Rauschen<br />
der Pappeln«, haben viele <strong>von</strong> uns noch im Ohr. Als die<br />
Nordbahn dann im Jahr 2000 in Betrieb ging, habe ich das erste<br />
Mal begriffen, was Fluglärm ist. Vorher dachte ich, okay, das<br />
wird nicht schlimmer sein, als wenn ein großer LKW die Straße<br />
entlangfährt, außerdem will man ja der wirtschaftlichen<br />
Entwicklung des Flughafens nicht entgegenstehen. Ich habe<br />
mich damals auch noch nicht an den Protesten beteiligt, denn<br />
ich dachte: Das wird schon nicht so schlimm.<br />
— Herr Pohl, wie würden Sie Fluglärm beschreiben?<br />
— Fluglärm ist der schädlichste Lärm aller Verkehrsträger. Sie<br />
hören aus der Entfernung ein Dröhnen, so eine Art Grollen,<br />
<strong>und</strong> denken, ist das jetzt der Beginn eines starken Gewitters?<br />
Aber das Geräusch wird immer stärker, immer stärker, <strong>und</strong><br />
dann denken Sie, das Ding muss doch jetzt bald mal über dem<br />
Haus sein. Wenn wir dann endlich überflogen worden sind,<br />
dauert es noch etwa eine Minute bis der Lärm verschw<strong>und</strong>en<br />
ist, dann kommt aber schon das nächste Flugzeug, das<br />
Ganze geht <strong>von</strong> Neuem los. Bei uns im Wohngebiet gibt es<br />
in 300 Meter Höhe Überflüge mit teils über 90 dB(A).<br />
Dabei soll man normalerweise ab 80 dB(A) einen Hörschutz<br />
tragen. Das Dröhnen ist manchmal so stark, dass die Wände<br />
wackeln <strong>und</strong> die Heizkörper im Haus anfangen zu vibrieren.<br />
Auch, weil da alte, zu Frachtmaschinen umgebaute, ausrangierte<br />
Passagierflugzeuge landen. Da helfen keine Lärmschutz<br />
fenster!<br />
— Seit wann haben Sie die Probleme mit dem Fluglärm?<br />
— Im Prinzip seit der Inbetriebnahme der Nordbahn im Jahr<br />
2000. Wobei die Anzahl der Flüge, <strong>und</strong> damit auch der Fluglärm,<br />
in den letzten Jahren stark angestiegen ist. Darunter fällt<br />
nicht nur der unerträgliche Überfluglärm, sondern auch der<br />
Bo den lärm. Der ist vor allem im Leipziger Westen, in Lützschena,<br />
in Stahmeln, in Wahren stark. Dort wurde im Frühjahr dieses<br />
Jahres auch die Südabkurvung wieder in Betrieb genommen.<br />
Unter den Einflugschneisen, die in der Nacht beflogen wer -<br />
den, sind es ungefähr 100.000 Menschen, die in jeder Nacht um<br />
ihren Schlaf gebracht werden. Hier darf nachts uneingeschränkt<br />
alles fliegen, was in Europa auch gerade noch so zugelassen<br />
ist. Das ist einmalig auf europäischen Zivilflughäfen. Sie finden<br />
keinen vergleichbaren Flughafen, wo nachts ganz offiziell soviel<br />
Lärm erlaubt ist. Nach dem Urteil des B<strong>und</strong>esverwaltungsgerichtes<br />
hat das Regierungspräsidium Leipzig als so genannten<br />
Ausgleich für die Bevölkerung Passagiermaschinen in der<br />
Nacht <strong>von</strong> 23.30 bis 5.30 Uhr verboten. Das war das kleinste<br />
Übel. Aber ohne die Anwohnerproteste wäre selbst das nicht<br />
passiert. Condor <strong>und</strong> Air Berlin haben dagegen sofort Klage<br />
eingereicht. Dazu gab es schon ein Eilverfahren, das die beiden<br />
Fluggesellschaften vor dem B<strong>und</strong>esverwaltungsgericht verloren<br />
haben. Das Hauptsacheverfahren findet voraussichtlich<br />
am 15. Juli 2008 in Leipzig statt.<br />
— Sie haben vor kurzem auf einer Demonstration vor<br />
der Leipziger Nikolaikirche den Flughafen als »Lärmmülldeponie<br />
Europas« bezeichnet. Liegt in den fehlenden<br />
Nacht flugauflagen nicht ein Standortvorteil, der dem<br />
Flughafen Wettbewerbsvorteile bringt?<br />
— Auf jeden Fall ist das ein Standortvorteil für den Flughafen,<br />
dass keine Rücksicht auf die Belange der Anwohner genommen<br />
werden muss. Für die Menschen in der Region ist das der<br />
Super-Gau. Es gibt schon einige Anwohner, die sich in ärztliche<br />
Behandlung begeben haben, weil sie durch permanenten<br />
Schlaf mangel unter Bluthochdruck leiden. Nur in der Nacht<br />
<strong>von</strong> Sonnabend auf Sonntag können wir relativ gut durchschlafen,<br />
spätestens in der Nacht <strong>von</strong> Sonntag auf Montag ist<br />
Thomas Pohl engagiert sich in der IG<br />
Nachtfl ugverbot Leipzig/Halle e.V. –<br />
einem Verein mit 330 Mitgliedern <strong>und</strong><br />
einigen zehntausend Sympathisanten.<br />
Er hat triftige Gründe. Denn das<br />
Fertighaus, das er sich 1996 mit seiner<br />
Familie in Rackwitz bei Leipzig gebaut<br />
hat, steht inzwischen direkt in der<br />
Einfl ugschneise der Nordbahn des<br />
Flughafens.<br />
der Fluglärm so stark, da schlafen wir erst schlecht ein, <strong>und</strong><br />
spätestens dann um 3.00 Uhr ist die Nacht für uns zu Ende.<br />
Im Minutentakt donnern dann die Frachtmaschinen über unser<br />
Wohngebiet, dann liegen wir im Bett <strong>und</strong> zählen die Flieger bis<br />
zum Weckerklingeln. Und das geht dann die ganze Woche so.<br />
Der Flughafen sagt, das müsst ihr hinnehmen, weil Arbeitsplätze<br />
geschaffen werden. In den Zeitungen liest man, dass bei<br />
DHL 3.500 Arbeitsplätze entstehen sollen. Weitere 10.000<br />
sollen wohl im Umfeld geschaffen werden. Auch die Zahl <strong>von</strong><br />
100.000 Arbeitsplätzen wurde schon genannt. Über Sinn oder<br />
Unsinn solcher Prognosen wird nicht diskutiert.<br />
Wir gehen da<strong>von</strong> aus, dass es bei diesem hohen Automati sierungs<br />
grad nicht mehr als 1.600 Vollzeitarbeitsplätze werden.<br />
Erst werden hier Millionensubventionen für die Ansiedlung<br />
abgefasst <strong>und</strong> dann zieht man bei Protesten weiter. Dann geht<br />
das Spiel <strong>von</strong> vorn los. In Brüssel wurden bei der Verlage rung<br />
des Drehkreuzes über 1.500 Menschen in Vollzeit entlassen,<br />
in Köln/Bonn hat sich DHL zurückgezogen, <strong>und</strong> auch in Berlin<br />
wurden Menschen entlassen. Ganz aktuell berichtet DHL<br />
über die Schließung seines Drehkreuzes im amerika nischen<br />
Wilmington, dort stehen 4.000 Arbeitnehmer vor dem Aus.<br />
Es werden vielmehr Menschen entlassen, als nun eingestellt<br />
werden. Aber da<strong>von</strong> hören sie bei all dem Jubel, den die Presse<br />
verbreitet, nichts.<br />
— Sehen Sie im Flughafen ein Beispiel wirtschaftlicher<br />
Deregulierung?<br />
— Das könnte man so sehen. Denn den Rechtsrahmen für den<br />
Flughafen gibt das Regierungspräsidium in einem so genannten<br />
Planfeststellungsbeschluss vor. Dieser Planfeststellungsbeschluss<br />
ist schon einmal geändert <strong>und</strong> einmal ergänzt<br />
worden – der gesetzliche Rahmen wird dabei maximal aus genutzt.<br />
In der EU dürfen Flugzeuge der Chapter-3- <strong>und</strong> der<br />
Chapter-4-Kategorie fliegen. Aber man muss auch wissen, je<br />
größer das Flugzeug ist <strong>und</strong> je mehr Fracht es transportieren<br />
kann, umso lauter darf es auch in absoluten Werten sein.<br />
So ist beispielsweise eine MD 11 in der Chapter-4-Kategorie,<br />
das heißt, sie ist in der leisesten Kategorie eingestuft, aber<br />
auf gr<strong>und</strong> ihrer Größe ist es das mit Abstand lauteste Flugzeug<br />
überhaupt. Jeder Flughafenbetreiber tut gut daran, mit den<br />
Anwohnern einen Kompromiss zu suchen. Der Flughafenchef<br />
hier ist daran überhaupt nicht interessiert. Er ist kompromisslos<br />
<strong>und</strong> spricht ständig nur <strong>von</strong> einem »Zielkonflikt«, der<br />
2004 hatte DHL entschieden, sein Frachtdrehkreuz<br />
<strong>von</strong> Brüssel nach Leipzig zu<br />
verlagern. In der belgischen Hauptstadt<br />
war aufgr<strong>und</strong> <strong>von</strong> Anwohnerprotesten<br />
eine Ausweitung des Nachtfl ugverkehrs<br />
politisch nicht druchsetzbar. Seit DHL<br />
im April dieses Jahres den Betrieb seines<br />
neuen Drehkreuzes in Leipzig aufgenommen<br />
hat, schlafen Thomas Pohl <strong>und</strong><br />
seine Familie schlechter.<br />
nicht zu lösen sei <strong>und</strong> damit hat sich die Sache für ihn erledigt.<br />
Schlimm genug, dass man ein Luftfrachtdrehkreuz mitten<br />
in eine dicht besiedelte Region, wie es Leipzig/ Halle ist, implantiert<br />
hat, das war auch keine wirtschaftliche Entscheidung, es<br />
war ganz klar eine politische Entscheidung.<br />
Und als ob der Lärm, der <strong>von</strong> diesem Frachtdrehkreuz ausgeht,<br />
nicht schon genug ist, nein, man installiert auch gleich noch<br />
eine Militärdrehscheibe, mit all dem zusätzlichen Fluglärm.<br />
Diese Militärflüge waren nicht Gegenstand des Planfeststellungsbeschlusses.<br />
Das Regierungspräsidium wäre norma lerweise<br />
jetzt in der Pflicht, die harten Vorgaben der B<strong>und</strong>esver<br />
waltungsrichter umzusetzen <strong>und</strong> die Anwohner vor weitergehendem<br />
Lärm zu schützen. Das machen sie aber nicht,<br />
sie sagen, ihnen seien die Hände geb<strong>und</strong>en. Das ist doch eine<br />
Farce.<br />
— Vereinfacht gesagt, der Freistaat müsste jetzt gegen<br />
sich selbst entscheiden.<br />
— Ja. – Meiner Meinung nach war das Verfahren <strong>von</strong> Anfang<br />
auf Konfrontation angelegt. Wahrscheinlich hat die Lan desregierung<br />
in Sachsen gedacht, im Osten geht alles, da klagt<br />
schon niemand, wenn sie mit dem Totschlagargument<br />
Arbeitsplätze kommt. Aber da hat sich die Politik gründlich ver -<br />
spekuliert. Bereits im Jahr 2002 hat der Europäische Gerichtshof<br />
für Menschenrechte in Straßburg nach Anwohner klagen<br />
für London-Heathrow die bis dato stattfindenden 17 Nachtflüge<br />
als Menschenrechtsverletzung verurteilt. Darauf hin durfte<br />
nachts nicht mehr über Heathrow geflogen werden.<br />
Hier in Leip zig fliegt allein schon DHL mit etwa 60 Frachtmaschinen<br />
in jeder Nacht. Dazu kommen dann noch die Flüge<br />
<strong>von</strong> LufthansaCargo mit ihren lauten MD 11 <strong>und</strong> die schon erwähnten<br />
Truppentransporte. Außerdem wurde am Flughafen<br />
eine Wartungsbasis gebaut, um eines der größten Frachtflug -<br />
zeuge der Welt, die Antonov 124-100, zu jeder Tages- <strong>und</strong><br />
Nachtzeit warten zu können. Eingesetzt wird sie überwiegend<br />
für das (vorläufige) NATO-Militärprojekt SALIS (Strategic<br />
Airlift Interim Solution). Bei Anforderung darf der russische<br />
Großraumtransporter zu jeder Tages- <strong>und</strong> Nachtzeit in internationale<br />
Kriegseinsätze fliegen. Beauftragt mit den Transpor ten<br />
im geschätzten Umfang <strong>von</strong> 1,2 Milliarden Euro, ist das<br />
›zivile‹ Unternehmen Ruslan Salis GmbH, ein Tochterunternehmen<br />
einer russischen Firma mit Sitz am Flughafen Leipzig/<br />
Halle. Sechzehn NATO-Mitglieder können Aufträge vergeben,
WAS DU WISSEN SOLLTEST (DIE DEMOKRATIE) 15<br />
die dann innerhalb <strong>von</strong> 72 St<strong>und</strong>en abgewickelt werden.<br />
Herr Malitzke, der Geschäftsführer des Flughafens, sprach vor<br />
kurzem da<strong>von</strong>, in wenigen Jahren könnte sich die Anzahl der<br />
Nachtflüge verdoppeln. – Das ist reiner Sarkasmus gegenüber<br />
den Anwohnern. Wir schätzen, dass hier jetzt schon jede<br />
Nacht mindestens 75 Flugzeuge über unsere Köpfe donnern.<br />
Der Flughafen hat eine Kapazität pro Bahn <strong>von</strong> ungefähr<br />
40 Flugzeugen in der St<strong>und</strong>e. Das heißt, 80 Flugzeuge auf beiden<br />
Bahnen wären eine Vollauslastung pro St<strong>und</strong>e. Da können<br />
Sie sich vorstellen, wie viele Flugzeuge hier pro Nacht zwischen<br />
22.00 <strong>und</strong> 6.00 Uhr künftig noch starten <strong>und</strong> landen<br />
könnten. Der Lärm heute ist erst der Anfang. Denn es gibt im<br />
Planfeststellungsbeschluss keine Kontingentierung.<br />
— Sie weisen auf Ihrer Homepage auf ein Verfahren hin,<br />
das der EU-Wettbewerbskommissar seit 2006 gegen den<br />
Leipziger Flughafen führt. Warum?<br />
— Das Verfahren betrifft die staatlichen Beihilfen an den<br />
Flughafen beziehungsweise an DHL. Es geht darum, dass sie<br />
als nicht rechtskonform angesehen werden, weil DHL<br />
schon 28 % direkte Subventionen für ihre Investition am Flughafen<br />
bekommen hat, womit die maximale Förderung ausgeschöpft<br />
ist, die an ein Wirtschaftsunternehmen gehen kann.<br />
70,8 Millionen Euro, bezahlt vom Freistaat Sachsen. Beim Bau<br />
der Südbahn geht man da<strong>von</strong> aus, dass sie nur für DHL gebaut<br />
worden ist, damit DHL uneingeschränkt fliegen kann. Der<br />
Bau der Südbahn war eine Gr<strong>und</strong>vorausetzung für die Zusage<br />
<strong>von</strong> DHL, sich hier anzusiedeln. Die interkontinental-taugliche<br />
Nordbahn hatte gerade mal eine Auslastung <strong>von</strong> 25 %. Das<br />
ist der EU-Kommission zu Recht ein Dorn im Auge, daher<br />
finden derzeit immer noch Ermittlungen statt. Außerdem sind<br />
die Mieten, die DHL für die Infrastruktur des Flughafens bezahlen<br />
muss, nicht marktüblich, sie liegen weit darunter. Hinzu<br />
kommen vergleichsweise niedrige Start- <strong>und</strong> Landeentgelte.<br />
Je mehr DHL-Flugzeuge fliegen, umso billiger wird es für jedes<br />
einzelne Flugzeug. DHL wird <strong>von</strong> den meisten Lokalpolitikern<br />
als ein Leuchtturm bezeichnet, auf den die Region nicht verzich<br />
ten kann. Es heißt, das DHL-Luftfrachtdrehkreuz wird<br />
ge braucht, damit der Flughafen wirtschaftlich arbeiten kann.<br />
Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Seit Jahren zahlen<br />
die Anteil seigner etwa 37 Millionen Euro Steuergelder im Jahr<br />
für die Verluste des hochdefizitären Flughafens. Die EU geht<br />
da<strong>von</strong> aus, dass aufgr<strong>und</strong> der mit DHL abgeschlossenen<br />
Verträge die Verluste des Flughafens weiter steigen werden.<br />
Der Flug ha fen kann so nicht wirtschaftlich betrieben werden.<br />
Die Verein ba rung mit DHL nennt außerdem namentlich<br />
Frachtunterneh men, die sich nicht am Vorfeld niederlassen<br />
dürfen. Auch das ist ein Verstoß gegen den Wettbewerb<br />
in der EU.<br />
— Was ist Ihre Interpretation, warum schließt ein Unter nehmen<br />
solche Vereinbarungen?<br />
— Man will auf Teufel komm raus DHL an sich binden. Als Un -<br />
ter nehmen wäre ich auch froh, wenn man mir für die näch sten<br />
30 Jahre den Ausschluss jeglicher Nachtflugbeschrän kungen<br />
vertraglich garantieren würde. Sollte es im Laufe <strong>von</strong> drei<br />
Jahrzehnten irgendeine gesetzliche Beschränkung für die<br />
Nacht geben, kostet das den Freistaat Sachsen 500 Mio. Euro.<br />
Eine halbe Milliarde Euro, ein Wahnsinn! Der Flughafen wird<br />
<strong>von</strong> der Mitteldeutschen Flughafen AG betrieben, die auch den<br />
Flughafen Dresden betreibt. Den größten Anteil am Unternehmen<br />
hat mit über 73 % das Land Sachsen. Sachsen-Anhalt,<br />
Leipzig <strong>und</strong> Dresden halten geringere Anteile. Die Stadt Halle<br />
besitzt seit Mai 2008 nur noch einen symbolischen Anteil<br />
<strong>von</strong> 0,2 %. Private Anteilseigner gibt es nicht. Die wären bei<br />
den hohen Verlusten des Flughafens schon lange pleite!<br />
— Sie leisten als Verein sehr viel Recherchearbeit,veröffent<br />
lichen Zahlen über Flugbewegungen <strong>und</strong> Angaben zu<br />
dem laufenden EU-Verfahren. Ist es für Sie als Bürger<br />
schwierig, an dieses Material heranzukommen?<br />
— Wir investieren in die Recherchearbeit sehr viel Zeit. Aber<br />
nur so kann man die Verstrickung <strong>von</strong> Wirtschaft <strong>und</strong> Politik<br />
aufdecken. Wir staunen immer wieder über die Skrupellosigkeit<br />
der Lobbyisten. Wie am Flughafen ohne Aufklärung der Bevöl<br />
kerung Fäden gesponnen werden, erschreckt uns seit langem.<br />
Deshalb ist die Klage der Anwohner nur allzu verständlich,<br />
sonst käme wahrscheinlich nichts da<strong>von</strong> ans Tageslicht. Der<br />
Flughafen hält sich mit Informationen komplett zurück, alles sei<br />
Betriebsgeheimnis, heißt es lapidar. Selbst die Passagierstatis<br />
tik ist nicht transparent. Angaben darüber, wo die Passagiere<br />
herkommen <strong>und</strong> wo sie hingeflogen sind <strong>und</strong> um was für<br />
Transitpassagiere es sich hier handelt – alles Fehlanzeige. Der<br />
Flughafen Leipzig/Halle hat nach unserem Kenntnisstand fast<br />
ausschließlich amerikanische US-Soldaten als Transitpassa<br />
giere. Die Flugzeuge machen hier eine Zwischenlandung, um<br />
neu aufgetankt zu werden. Außerdem werden die Soldaten<br />
mit Lebensmitteln versorgt. Weiter geht es dann in die Kriegsgebiete.<br />
Wenn zum Beispiel für März 2008 46.393 Transit pas -<br />
sa giere in der uns vorliegenden Statistik bei insgesamt<br />
179.520 Passagieren genannt werden, können Sie da<strong>von</strong> ausge<br />
hen, dass es sich bei den Transitpassagieren um US-Soldaten<br />
handelt, die auf dem Weg in den Irak oder nach Afghanistan<br />
hier zwischenlanden. Jeder 4. Passagier in der offiziellen<br />
Passagierstatistik ist mittlerweile ein US-Soldat.<br />
— Der Begriff Frachtdrehkreuz ist bekannt. Was ist ein<br />
Militär drehkreuz?<br />
— Georg Milbradt, der damalige Ministerpräsident, hatte sich<br />
massiv dafür eingesetzt, dass Leipzig/ Halle das Frachtdreh -<br />
kreuz bekommt. Die Vision eines Interkontinentalflughafens, wie<br />
sie Anfang der neunziger Jahre bestand, war wie eine Seifenblase<br />
zerplatzt. Angesichts der derzeitigen Entwicklung am<br />
Flughafen bekommt das Wort ›Interkontinental‹ eine ganz neue<br />
Bedeutung. Vor allem für den Transport <strong>von</strong> Paketen <strong>und</strong><br />
US-Soldaten werden die Interkontinentalverbindungen genutzt.<br />
Ob das wirklich im öffentlichen Interesse liegt?<br />
In der Zeit, als die Ansiedlung <strong>von</strong> DHL in greifbare Nähe<br />
rückte, wurden auch schon Fäden mit dem amerikanischen Verteidigungsministerium<br />
gesponnen, um diesen Flughafen mit<br />
seiner 24-stündigen uneingeschränkten Betriebserlaubnis auch<br />
vom US-Militär nutzen zu können. Dass der Flughafen nicht<br />
nur Frachtdrehkreuz, sondern auch Militärdrehkreuz geworden<br />
ist, wird vom Flughafen <strong>und</strong> <strong>von</strong> der Politik vehement bestritten.<br />
Die US-Truppentransporte, die <strong>von</strong> Privatunternehmen durchgeführt<br />
werden, sind funktional betrachtet Militärflüge.<br />
Sie werden vom Air Mobility Command (Hauptkommando der<br />
US-amerikanischen Luftwaffe) geplant, also <strong>von</strong> einem Teil<br />
des amerikanischen Verteidigungsministeriums. Die GIs werden<br />
mit einem Zwischenstopp auf dem Flughafen Leipzig/ Halle,<br />
der zum Auftanken gebraucht wird, in den Irak oder nach<br />
Afghanistan geflogen oder kommen <strong>von</strong> da. Wir haben viele<br />
Fotos da<strong>von</strong> gemacht. Und in diese Kriesengebiete wird vom<br />
Flughafen aus auch übergroßes Militärgerät geflogen, zum<br />
Beispiel Panzer, Hubschrauber <strong>und</strong> andere Waffen. Das geht alles<br />
über den Flughafen Leipzig/Halle – aber als Bürger erfährt<br />
man darüber offiziell nichts. Wir haben Anfragen an den<br />
sächsischen Landtag gestellt, an die B<strong>und</strong>esregierung <strong>und</strong> uns<br />
wurde immer wieder versichert, es fänden keine Flüge zu militärischen<br />
Zwecken statt. Der Flughafen wird angeblich nicht militärisch<br />
genutzt. Die Soldatentransporte sind zivile Flüge,<br />
die mit zivilen Fluggesellschaften <strong>und</strong> zivilem Personal die<br />
Amerikaner in den Urlaub fliegen. Wenn das wirklich Urlaubsflüge<br />
wären, dann wären sie als Passagierflüge nachts nach<br />
dem Beschluss des Regierungspräsidiums eigentlich verboten.<br />
Da sind es dann doch auf einmal wieder militärische Anforderungsverkehre.<br />
Je nachdem, wie es gerade gebraucht wird.<br />
— Soldaten werden <strong>von</strong> zivilen Fluggesellschaften<br />
transportiert, was dann gleich keine militärische Bewegung<br />
mehr sein soll – an diesem Punkt wird ja auch eine<br />
elementare rechtliche Unterscheidung ausgehebelt: die<br />
zwischen Zivilem <strong>und</strong> Militärischem. Das ist eine juridische<br />
Unterscheidung, die über Jahrh<strong>und</strong>erte gewachsen ist,<br />
die hier aufs Spiel gesetzt wird.<br />
— Ja, die Bezeichnung Militärflüge hat man gründlich vermieden,<br />
um die Bevölkerung nicht zu beunruhigen. Diese Flugbewegungen<br />
sind natürlich in dem Lärmschutzkonzept, das<br />
vom Regierungspräsidium als bestes Lärmschutzkonzept der<br />
Welt bezeichnet wurde, nicht erfasst. Der damals zugr<strong>und</strong>e<br />
gelegte Flugzeugmix verschiebt sich immer mehr in Richtung<br />
lauter Militärflugzeuge. DHL rühmt sich ja, mit relativ leisen<br />
Flugzeugen zu fliegen, aber für ihre Subunternehmer, osteuropäische<br />
Gesellschaften aus Polen oder Russland, fühlen sie<br />
sich nicht verantwortlich. Die fliegen teilweise mit Turbopropmaschinen,<br />
die mehr als 40 Jahre auf dem Buckel haben.<br />
— Wo fanden die Zwischenstopps, die für die amerikanischen<br />
Truppentransporte nötig sind, statt, bevor sie über<br />
den hiesigen Flughafen abgewickelt wurden?<br />
— In Shannon in Irland. Dort gibt es einen großen Militärflug<br />
platz, wo weit <strong>und</strong> breit kein Mensch wohnt. Trotzdem kam<br />
es in Shannon aufgr<strong>und</strong> <strong>von</strong> Bürgerprotesten zu einer<br />
Nachtflug einschränkung, was dem Militär nicht gepasst hat.<br />
Sollten wir mit unserer Klage nach Nachtflugeinschränkungen<br />
keinen Erfolg haben, werden wir schon im Jahr 2009 den<br />
eine millionsten US-Soldaten pro Jahr am Flughafen Leipzig/<br />
Halle begrüßen können.<br />
— Sie stellen die Rechtmäßigkeit diese Flüge auch in<br />
Frage?<br />
— Ja, es ist ein Klagepunkt. Die Entscheidung dazu soll am<br />
15. Juli fallen. Aber vielleicht wird das B<strong>und</strong>esverwaltungsgericht<br />
nicht die letzte Instanz für uns sein. Es gibt dann noch<br />
die Möglichkeit, dass wir uns an das B<strong>und</strong>esverfassungs -<br />
gericht <strong>und</strong> an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte<br />
in Straßburg wenden.<br />
— Was ist für Sie der Gr<strong>und</strong>, diese Flüge in Frage zu<br />
stellen?<br />
— Diese Flüge verstoßen gegen das Völkerrecht. Der Flug ha fen<br />
verdient mit diesen Unterstützungsleistungen schmut ziges<br />
Geld, er verdient an Kriegen mit. Primär sind es aber auch ges<strong>und</strong>heitliche<br />
Aspekte für die Anwohner. Es gibt mehrere große,<br />
europaweite Studien, die eindeutig nach gewiesen haben, dass<br />
ein großer Teil der Bevölkerung bei ständig ausgesetztem<br />
Fluglärm unter Bluthochdruck, Immun schwäche oder Krebs<br />
leidet. Sogar die Menschen, die gut schlafen, weil sie vielleicht<br />
Lärmschutzfenster oder einen festen Schlaf haben, bekommen<br />
oft im Schlaf erhöhten Blutdruck bei Lärmereignissen. Auf<br />
Dauer wächst dadurch das Herzinfarktrisiko. Ich kenne einige,<br />
die jetzt schon Medikamente einnehmen, um den Lärm irgendwie<br />
auszuhalten. Der Mensch braucht den Schlaf wie das Essen<br />
<strong>und</strong> das Trinken. Dieser nächtliche Fluglärm macht die Menschen<br />
auf Dauer krank <strong>und</strong> das wird vorsätzlich <strong>von</strong> den <strong>Vera</strong>ntwort<br />
lichen geduldet.<br />
— Der Flughafen gilt als Motor für die wirtschaftliche<br />
Ent wicklung der Region. Wie schätzen Sie die gesellschaftliche<br />
<strong>Vera</strong>ntwortung dieses Unternehmens ein?<br />
— Das Unternehmen hat eine sehr hohe gesellschaftliche <strong>Vera</strong>ntwortung.<br />
Es überzieht die Region schließlich jede Nacht mit<br />
einem riesigen Lärmteppich. Der ist nach Lesart des Regierungs<br />
präsidium 44 km lang <strong>und</strong> über 6 km breit. Auch die<br />
Luft wird durch die vielen Flüge nicht besser. DHL unterstützt<br />
finanziell die Kultur, den Sport <strong>und</strong> die Jugendarbeit. Das<br />
muss man unumw<strong>und</strong>en zugeben. Auch Gemeinden haben<br />
schon Schecks erhalten. Früher hat die Öffentlichkeitsabteilung<br />
des Flughafens die Zeitung ›Towerblick‹ für die Anwohner<br />
heraus gebracht. Aber diese Propaganda hat abgenommen, wir<br />
kriegen den ›Towerblick‹ seit dem vergangenen Jahr nicht mehr.<br />
— Was hat sie am ›Towerblick‹ gestört?<br />
— In seiner Zeitung pries der Flughafen unter anderem sein<br />
überragendes Lärmschutzkonzept. Niemand müsse sich wegen<br />
des Lärms Gedanken machen, jeder könne weiterhin ruhig<br />
schlafen. Dann frage ich mich, warum sich im Umfeld<br />
mittlerweile an die 20 Bürgerinitiativen gegen den Flug- <strong>und</strong><br />
Bodenlärm gebildet haben?<br />
Der Flughafen hat in der Öffentlichkeit sein positives Image<br />
mehr <strong>und</strong> mehr verloren, auch durch die vielen Proteste<br />
in der letzten Zeit. Die nächste Demo ist schon geplant. Deswegen<br />
werden jetzt Marathonläufe am Flughafen veranstal tet,<br />
Volleyballturniere durchgeführt; man holt Sport <strong>und</strong> Kultur<br />
an den Flughafen, damit auch etwas Positives über ihn berichtet<br />
wird. Aber dadurch werden die Probleme der Anwohner <strong>und</strong><br />
des Flughafens nicht geringer. Leipzig ist die Stadt der<br />
friedlichen Revolution; die B<strong>und</strong>esrepublik hält sich offiziell<br />
aus dem Irakkrieg heraus, <strong>und</strong> auf dem Flughafen werden völkerrechtswidrige<br />
Unterstützungsleistungen geduldet. Das<br />
ist schon ein Widerspruch, den sich die Bewohner der Städte<br />
Leipzig <strong>und</strong> Halle nicht gefallen lassen. Deshalb ist unser<br />
großes Ziel, im laufenden Verfahren vor dem B<strong>und</strong>esverwaltungs<br />
gericht auch die Militärflüge schnellstmöglich zu verhindern.<br />
Ich denke, wir haben da sehr gute Chancen.
WAS DU WISSEN SOLLTEST (DIE ZEIT)<br />
NO-GO-AREAS<br />
FÜR DIE ARBEIT!<br />
Ein E-Mail-Interview mit der<br />
Soziologin Silke Steets,<br />
die Fragen stellte <strong>Jan</strong> Wenzel<br />
Ich würde mich gern mit Dir darüber<br />
austauschen, wie wichtig Zukunft für Dich<br />
ist. Teilst Du meine Beobachtung, dass die<br />
Zeitperspektive, die sich mit dem Begriff<br />
Zukunft verbindet, für die Organisation des<br />
eigenen Lebens heute kaum noch eine<br />
Bedeutung hat, weil wir alle mehr <strong>und</strong> mehr<br />
ad hoc, aus der Situation heraus handeln?<br />
Wir sind zukunftsblind. Allerdings nicht,<br />
weil wir Angst vor der Zukunft verspüren,<br />
sondern aus einem Wissen heraus, wie<br />
ungewiss <strong>und</strong> voller ungeahnter Möglich -<br />
keiten – im Guten wie im Schlechten – die<br />
Zukunft ist.<br />
Wie wichtig ist für mich ein Nach denken<br />
über die Zukunft? Wenn ich mal ganz<br />
untheoretisch, das heißt spontan, auf<br />
mein eigenes Leben blicke, dann überwiegt<br />
der Eindruck, dass mir die wirklich entscheidenden<br />
Dinge tatsächlich zufällig passiert<br />
sind. Ich hatte nie einen fest gefügten<br />
Lebens- oder gar Karriereplan, der<br />
mich auf sicherem Weg durch Schule <strong>und</strong><br />
Studium in den Beruf geführt hätte.<br />
Das heißt nicht, dass es nie Ziele gab,<br />
aber diese waren hinsichtlich ihres zeit lichen<br />
Horizonts immer klar als Begrenzung<br />
eines Abschnitts (Projekts) defi niert, was<br />
ich immer als Entlastung empf<strong>und</strong>en habe.<br />
Irgendwie wollte ich eben das Abi schaffen,<br />
habe mich dann – weil der SPIEGEL im<br />
Sommer 1993 eine Studie über frustrierte<br />
Lehrer veröffentlichte – in letzter Sek<strong>und</strong>e<br />
gegen ein Lehramts- <strong>und</strong> für ein Soziologiestudium<br />
entschieden (mit dem man ja<br />
alles <strong>und</strong> nichts werden kann), habe 1999<br />
mein Diplom gemacht, bin dann eigent lich<br />
über private Umwege <strong>und</strong> weil ich nach<br />
dem Diplom nichts Besseres zu tun hatte,<br />
am Bauhaus in Dessau gelandet, wo ich im<br />
Bauhaus-Kolleg zur Stadt- <strong>und</strong> Raumsoziologin<br />
wurde. In dieser Zeit erschien<br />
gerade das Buch Raumsoziologie <strong>von</strong><br />
Martina Löw. Ein Fre<strong>und</strong> <strong>von</strong> mir stellte<br />
den Kontakt zu ihr her, wir trafen uns in<br />
Berlin, <strong>und</strong> sie wurde meine Doktormutter<br />
<strong>und</strong> kurze Zeit später meine Chefi n an<br />
der TU Darmstadt, wohin sie als Professorin<br />
berufen worden war. Viele Wendepunkte<br />
in dieser kurzen Lebensskizze würde ich<br />
tatsächlich dem Lola-rennt-Prinzip folgend<br />
als Zufall charakterisieren, weshalb ich<br />
mich gerne (<strong>und</strong> oft sehr konsequent)<br />
einem Nachdenken über die eigene Zukunft<br />
verweigere. Kommt eh wie’s kommt <strong>und</strong><br />
lief ja auch bislang alles ganz gut.<br />
Als Soziologin weiß ich, dass man<br />
das, was ich da gerade aufgeschrieben<br />
habe, als »Biographisierung« bezeichnet.<br />
Damit ist das Ins-Verhältnis-Setzen lebensgeschichtlicher<br />
Vergangenheit, Gegen -<br />
wart <strong>und</strong> Zukunft gemeint, also die<br />
Kon struktion einer eigenen Geschichtlich -<br />
keit. Der Soziologe Gunter Weidenhaus hat<br />
das em pirisch untersucht, indem er sich<br />
<strong>von</strong> verschiedenen Menschen deren Leben<br />
hat erzählen lassen. Er unterscheidet<br />
drei »Modi der Biographisierung«, den<br />
»linearen«, den »zyklischen« <strong>und</strong> den<br />
»blasenhaften« Modus. Lineare Biographisierungen<br />
folgen einer starken logischen<br />
Verknüpfung zwischen Vergangenheit,<br />
Gegenwart <strong>und</strong> Zukunft. Die Zukunft<br />
ist deshalb wichtig, weil sie planend angeeignet<br />
wird. Zyklische Formen der<br />
Biographisierung zerstören die Zukunft,<br />
indem sie eine sich täglich wiederholende<br />
Gegenwart in die Zukunft ausdehnen.<br />
Der blasenhafte Modus entspricht wohl am<br />
ehesten dem, was ich für mein Leben<br />
gerade erzählt habe.<br />
Creative Industries – hinter diesem<br />
Schlagwort verbergen sich die Initiatoren<br />
<strong>von</strong> lokalen Filmprojekten, die Betreiber<br />
<strong>von</strong> Clubs oder auch freie Architektinnen,<br />
Autoren <strong>und</strong> Künstlerinnen. Als<br />
Soziologin ist Silke Steets oft selbst Teil<br />
der Phänomene, die sie theoretisch<br />
Man denkt in zeitlich begrenzten Projekten<br />
(Zeitblasen). Vergangenheit, Gegenwart<br />
<strong>und</strong> Zukunft sind eigenständige lebens geschichtliche<br />
Zeiten, die nicht logisch auf -<br />
einander aufbauen <strong>und</strong> eher unverb<strong>und</strong>en<br />
nebeneinander stehen. Die Zukunft bleibt<br />
kontingent, damit aber auch offen.<br />
Die Unsicherheit, die eine solche Situation<br />
zwangsläufi g erzeugt, wird – so schreibt<br />
Weidenhaus – <strong>von</strong> den Leuten, die in Zeitblasen<br />
leben, durch eine Verdrängung<br />
des Nachdenkens über die Zukunft bewältigt.<br />
Für unsere Generation scheint mir<br />
dies recht typisch zu sein.<br />
Dass man die Zukunft auf sich zukommen<br />
lässt, keinen Lebensplan mehr hat, kann<br />
einen riesigen Gewinn an Möglichkeiten<br />
bedeuten. Individuell scheint mir das sehr<br />
plausibel. Trotzdem die Frage: Lässt<br />
sich eine individuelle, <strong>von</strong> Brüchen markierte<br />
Alltagserfahrung noch mit einem<br />
langfristigen, kollektiven Denken verbinden?<br />
Oder anders: Alexander Kluge spricht in<br />
›Die Maßverhältnisse des Politischen.<br />
Vorschläge zum Unterscheidungsvermögen‹<br />
da<strong>von</strong>, dass alle Prozesse, die Gemein -<br />
wesen <strong>und</strong> gesellschaftlichen Reichtum herstellen,<br />
lange Fristen haben. Welche Formen<br />
der Organisation wären geeignet, um trotz<br />
des kurzen Zeithorizontes, in dem man das<br />
eigene Leben organisiert, die langen Zeitmaße,<br />
durch die gesellschaftliche Prozesse<br />
charakterisiert sind, weiterhin mitgestalten<br />
zu können?<br />
Um den eigenen, <strong>von</strong> Brüchen markier<br />
ten, persönlichen Zeithorizont mit einer<br />
längerfristigen Gestaltung gesellschaftlicher<br />
Prozesse zu verknüpfen, bedarf es<br />
aus meiner Sicht einer Veränderung auf der<br />
Ebene der ERFAHRUNG. Die zielorientier -<br />
ten Entwicklungsperspektiven <strong>und</strong> ›großen<br />
Erzählungen‹ der Moderne (die mit linearen<br />
Biographisierungsmodi korrespon dieren)<br />
sind obsolet geworden, <strong>und</strong> ich fi nde, es<br />
lohnt sich aufgr<strong>und</strong> ihrer Determi niertheit<br />
<strong>und</strong> der Absolutheit ihres An spruchs auch<br />
nicht, um sie zu trauern. Mit dem Verlust<br />
der ›großen Erzählungen‹ ist nämlich<br />
eins entstanden: eine ›offene‹ Zukunft <strong>und</strong><br />
damit die erste Voraussetzung dafür, um<br />
überhaupt sinnvoll politisch han deln<br />
zu können. Das Problem ist nur, dass wir<br />
offensichtlich nicht mehr so recht wissen,<br />
wohin wir wollen (<strong>und</strong> woher wir kommen),<br />
dass uns also die ERFAHRUNG einer<br />
längerfristigen Zeitperspektive zu fehlen<br />
scheint.<br />
Für den Raum hat Fredric Jameson<br />
1984 diesen Verlust <strong>von</strong> Erfahrung sehr<br />
anschaulich erklärt, <strong>und</strong> zwar am Beispiel<br />
des Bonaventure Hotels im Zentrum <strong>von</strong><br />
L.A., das für Jameson zum Sinnbild dessen<br />
wird, was er den »postmodernen Hyperraum«<br />
nennt. Er beschreibt das mit Glas fassaden<br />
ummantelte Hotel als »totalen«<br />
Raum, als in sich vollständige Miniaturstadt,<br />
die die (echte) Stadt außerhalb des<br />
Gebäudes zum Bild <strong>von</strong> sich selbst mache.<br />
Im Inneren inspiriere das Hotel die Besucher,<br />
den körperlich erfahrbaren Durchgang<br />
durch das Gebäude als Erzählung,<br />
als Fiktion zu erleben. Diese Raumerfahrung<br />
werde durch die zahlreichen Rolltrep -<br />
pen <strong>und</strong> verglasten Fahrstühle des Gebäudes<br />
unterstützt. Allerdings fehle den<br />
»postmodernen Subjekten« (noch) der ent -<br />
sprechende Wahrnehmungsapparat, um<br />
sich in diesem Raum zurechtzufi nden.<br />
Die Distanz zwischen wahrnehmendem<br />
Subjekt <strong>und</strong> wahrgenommenem Objekt,<br />
die notwendig ist für das Erfassen<br />
<strong>von</strong> Perspektive <strong>und</strong> Volumen, gehe im<br />
Bonaventure Hotel verloren. Man stehe<br />
buchstäblich ›bis zum Hals‹ in diesem<br />
Hyperraum. Jamesons These lautet deshalb,<br />
»dass es dem postmodernen Hyperraum<br />
gelungen ist, die Fähigkeit des<br />
individuellen menschlichen Körpers zu über-<br />
schreiten, sich selbst zu lokalisieren, seine<br />
unmittelbare Umgebung durch die Wahrnehmung<br />
zu strukturieren <strong>und</strong> kog ni tiv<br />
seine Position in einer vermeß baren äuße-<br />
ren Welt durch Wahrnehmung <strong>und</strong> Erkenntnis<br />
zu bestimmen«. Der neue Raum<br />
kann nur in Bewegung darge stellt <strong>und</strong><br />
erfahren werden. Jameson überträgt dies<br />
nun auf die Situation der postmo der nen<br />
Subjekte, welche er als Dilemma bezeich -<br />
net, das in der »Unfähigkeit unseres<br />
Bewußtseins« besteht, »das große, globale,<br />
multinationale <strong>und</strong> dezentrierte Kommunikationsgefl<br />
echt zu begreifen, in dem wir<br />
als individuelle Subjekte gefangen sind«.<br />
Notwendig sei deshalb eine Ȁsthetik nach<br />
dem Muster der Kartographie«. Diese<br />
müsse die kognitiven <strong>und</strong> pädagogischen<br />
Dimensionen der politischen Kunst <strong>und</strong><br />
Kultur in den Vordergr<strong>und</strong> rücken.<br />
Mit anderen Worten: Um im Spätkapitalis<br />
mus Kritik zu üben bzw. um politisch<br />
handeln zu können, muss man wissen, wo<br />
man steht. Etwas Ähnliches müsste man<br />
aus meiner Sicht mit der Dimension der<br />
Zeit, die ja ähnlich wie der Raum nur noch<br />
fragmentiert wahrgenommen wird,<br />
machen. Eine Ȁsthetik nach dem Muster<br />
der Kartographie« wäre dann eine, die<br />
die Verwobenheit <strong>von</strong> Vergangenheit, Gegen<br />
wart <strong>und</strong> Zukunft wieder ERFAHRBAR<br />
macht.<br />
Gr<strong>und</strong>sätzlich finde ich die Idee,<br />
Fredric Jamesons Idee der Kartographie<br />
analog zur Analyse des zeitgenössischen<br />
Raums auch auf den Aspekt der Zeit anzuwenden,<br />
sehr überzeugend. Da dabei<br />
imaginäre Karten entstünden, würde mich<br />
interessieren, ob Du mir ein oder zwei dieser<br />
Zeitkarten beschreiben könntest? Wie würde<br />
ein Atlas für solche Zeitkartographien<br />
aussehen? – Ich stelle mir zum Beispiel ein<br />
Kapitel mit Deadline-Karten vor, die die<br />
unübersichtliche Landschaft der zu knapp<br />
gewordenen Zeit <strong>und</strong> die Vielzahl der<br />
individuellen Strategien, sich in dieser verbauten<br />
Landschaft zu bewegen, visualisieren<br />
<strong>und</strong> damit kollektiv erfahrbar machen<br />
könnten. Wäre das denkbar?<br />
Die Idee der Deadline-Karten könnte<br />
in der Tat sehr erhellend sein, denn der<br />
individuelle Umgang mit der Fragmentiertheit<br />
<strong>und</strong> Knappheit der Zeit ist sehr unter<br />
schiedlich, wenngleich das Phänomen<br />
<strong>von</strong> verschiedenen Menschen ähnlich<br />
wahr genommen wird. Mir kommt die Zeit<br />
manch mal vor wie eine Decke, an der man<br />
an allen (Projekt-)Ecken <strong>und</strong> Enden versucht<br />
zu ziehen, nur um zu der schlichten<br />
Einsicht zu gelangen, dass die Decke<br />
einfach zu klein ist <strong>und</strong> man durch das<br />
Ziehen in eine Richtung an der anderen<br />
Ecke kalte Füße bekommt.<br />
Eine Form mit der zu kurzen, zerstückelten<br />
Zeit umzugehen ist das vielbe<br />
schworene Multitasking, also das<br />
gleich zei tige Arbeiten an unterschiedlichen<br />
Din gen. Karten, die die Komplexität des<br />
Parallel arbeitens, somit all die Anfänge<br />
<strong>und</strong> Enden <strong>und</strong> Verwobenheiten <strong>von</strong> Projekten<br />
<strong>und</strong> Aufgaben zeigen, könnten ge rade<br />
die Er fahrung, dass alles ein Anfang<br />
<strong>und</strong> ein Ende hat, verdeutlichen. Denn das<br />
ist es, was beim Multitasking oft verloren<br />
16<br />
refl ektiert. So wie in ihren aktuellen Buch<br />
›Wir sind die Stadt. Kulturelle Netzwerke<br />
<strong>und</strong> die Konstituion städtischer<br />
Räume in Leipzig‹, in dem sie beschreibt<br />
wie sich das kulturelle Selbstverständnis<br />
der ostdeutschen Großstadt im letzten<br />
Jahrzehnt gewandelt hat.<br />
geht: Weil man nie wirklich fertig ist, ist<br />
die Erfahrung da<strong>von</strong>, etwas abzuschließen,<br />
sehr ephemer geworden. Deadline-Karten<br />
könnten genau diese Endpunkte markieren<br />
<strong>und</strong> damit in Wert setzen.<br />
Eine andere Form des Umgangs<br />
mit Zeitknappheit ist die Entwicklung <strong>von</strong><br />
Zeit routinen. Der Soziologe Anthony<br />
Giddens sagt, dass Routinen im Alltag so<br />
etwas wie ›Seinsgewissheit‹ schaffen. Sie<br />
funktio nie ren als Strukturen, über die wir<br />
nicht mehr jeden Tag neu nachdenken<br />
müssen (was ja auch Zeit kostet), die uns<br />
natürlich auch manchmal einengen, die<br />
da durch aber an anderer Stelle Energien<br />
freisetzen können. Wenn ich mich jeden<br />
Mit tag mit einem Kollegen zum Essen<br />
ver ab rede, dann habe ich jeden Mittag tatsächlich<br />
eine St<strong>und</strong>e, in der ich nicht vor<br />
dem Computer sitze. Dann sind meine<br />
Augen erholt <strong>und</strong> der Magen gefüllt <strong>und</strong><br />
danach geht alles vielleicht viel schneller.<br />
Kinder sind auch ein guter Taktgeber<br />
für Zeitroutinen. Man darf nur nicht gegen<br />
sie (also die Zeitroutinen <strong>und</strong> natürlich<br />
auch nicht gegen die Kinder) arbeiten,<br />
man sollte sie vielmehr als Ermöglichungsstruk<br />
tur begreifen. Routine-Karten<br />
könn ten Zeitinseln abbilden, sowas wie<br />
No-Go-Areas für die Arbeit.<br />
Und dann fällt mir zu guter Letzt<br />
noch eine Zeitstrategie ein, die man mit<br />
Tocotronic vielleicht am besten als Kapitulation<br />
bezeichnen könnte, das heißt auf<br />
unser Thema bezogen als Verweigerung der<br />
Effi zienzsteigerung der Zeit. Denn sowohl<br />
Multitasking als auch Routinen als<br />
auch Deadline-Karten sind Strategien des<br />
Umgangs mit einer extern vorgegebenen<br />
(<strong>und</strong> damit auch gr<strong>und</strong>sätzlich akzeptier<br />
ten) Struktur. In der Geschichte der<br />
Kartographie gibt es Karten, deren Zweck<br />
nichts anderes war als die Instrumentalisierung<br />
des Raums. Man denke an die<br />
Karten der Landvermesser <strong>und</strong> Seefahrer,<br />
die ihr Wissen über den Raum zur Vermarktung<br />
bzw. Kolonialisierung des Raums<br />
verwendet haben. Effi zienzverweigerungsarten<br />
müssten ähnlich der Karten, die<br />
zum Beispiel Guy Debord <strong>von</strong> Paris<br />
gezeichnet hat, die gefühlten, die direkt<br />
auch körperlich <strong>und</strong> emotional erfahrenen,<br />
die qualitative Zeiteinheiten zeigen, in<br />
einen Zusammenhang bringen <strong>und</strong> damit<br />
als relevant <strong>und</strong> wichtig markieren. Ich<br />
stelle mir vor, dass man darauf Tätigkeiten<br />
abbildet, in denen man gemeinhin gerne<br />
die Zeit vergisst, was natürlich individuell<br />
sehr unterschiedlich ist, was zum Beispiel<br />
ein Frühstück mit der Lieblingszeitung<br />
sein könnte, Spielen mit Kindern,<br />
das Treffen mit alten Fre<strong>und</strong>en, der Besuch<br />
einer Ausstellung, die Fahrt mit einem<br />
Boot, (Tag-)Träume, ein Spaziergang, die<br />
Zigarette (oder zwei) vorm Schlafengehen<br />
etc. Vielleicht könnte man auch Lange -<br />
weile kartieren, das könnte doch eine wirk -<br />
lich spannende Karte werden ...
WAS DU WISSEN SOLLTEST (DIE KONTROLLE)<br />
MEIN MITBEWOHNER<br />
MARK<br />
Julian Kamphausen<br />
2<br />
3<br />
4<br />
1<br />
6<br />
1<br />
Mein ehemaliger Mitbewohner Mark arbeitet<br />
jetzt bei einer amerikanischen Firma:<br />
›ReproGenetics Institute‹.<br />
Die Firma expandiert im Moment stark.<br />
Sie ist Vorreiter bei einer neuen Diagnosetechnik:<br />
Präimplantationsdiagnose.<br />
5<br />
2<br />
Bei der Präimplantationsdiagnose entnimmt<br />
man Embryonen, die durch künst liche Befruchtung<br />
erzeugt wurden, je eine Stammzelle.<br />
3<br />
Dieser Stammzelle werden dann die Chromosomen<br />
entnommen, um die komplette DNA<br />
des möglichen Menschen zu entschlüsseln.<br />
4<br />
Auf der DNA sucht man nach Mutationen die<br />
später zu Behinderungen oder Krankheiten<br />
führen. Hier sieht man zum Beispiel links das<br />
Brustkrebs-Gen <strong>und</strong> auf Chromosom 14 das<br />
Alzheimer-Gen.<br />
8<br />
5<br />
So sieht es dann komplizierter aus.<br />
Mittlerweile können 7000 Mutationen erkannt<br />
werden, die zu späteren Erkrankungen <strong>und</strong><br />
Behinderungen führen. Auf diese Weise<br />
können dann garantiert ges<strong>und</strong>e Embryonen<br />
eingepflanzt werden.<br />
6<br />
Die Nachfrage nach dieser Methode ist so<br />
hoch, dass die Firma inzwischen acht Kliniken<br />
weltweit betreibt, die diese Methode anbieten.<br />
Hier ist die Filiale in Larnaca auf Zypern<br />
zu sehen.<br />
7<br />
§ 1 Mißbräuchliche Anwendung <strong>von</strong><br />
Fortpfl anzungstechniken<br />
(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit<br />
Geldstrafe wird bestraft, wer<br />
1. auf eine Frau eine fremde unbefruchtete Eizelle<br />
überträgt,<br />
2. es unternimmt, eine Eizelle zu einem anderen<br />
Zweck künstlich zu befruchten, als eine<br />
Schwangerschaft der Frau herbeizuführen, <strong>von</strong><br />
der die Eizelle stammt,<br />
3. es unternimmt, innerhalb eines Zyklus mehr als<br />
drei Embryonen auf eine Frau zu übertragen,<br />
4. es unternimmt, durch intratubaren<br />
Gametentransfer innerhalb eines Zyklus mehr<br />
als drei Eizellen zu befruchten,<br />
5. es unternimmt, mehr Eizellen einer Frau zu<br />
befruchten, als ihr innerhalb eines Zyklus<br />
übertragen werden sollen,<br />
6. einer Frau einen Embryo vor Abschluß seiner<br />
Einnistung in der Gebärmutter entnimmt, um<br />
diesen auf eine andere Frau zu übertragen oder<br />
ihn für einen nicht seiner Erhaltung dienenden<br />
Zweck zu verwenden, oder<br />
7. es unternimmt, bei einer Frau, welche bereit ist,<br />
ihr Kind nach der Geburt Dritten auf Dauer zu<br />
überlassen (Ersatzmutter), eine künstliche<br />
Befruchtung durchzuführen oder auf sie einen<br />
menschlichen Embryo zu übertragen.<br />
(2) Ebenso wird bestraft, wer<br />
1. künstlich bewirkt, daß eine menschliche<br />
Samenzelle in eine menschliche Eizelle<br />
eindringt, oder<br />
2. eine menschliche Samenzelle in eine<br />
menschliche Eizelle künstlich verbringt,<br />
ohne eine Schwangerschaft der Frau<br />
herbeiführen zu wollen, <strong>von</strong> der die Eizelle<br />
stammt.<br />
(3) Nicht bestraft werden<br />
1. in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1, 2 <strong>und</strong> 6 die<br />
Frau, <strong>von</strong> der die Eizelle oder der Embryo<br />
stammt, sowie die Frau, auf die die Eizelle<br />
übertragen wird oder der Embryo übertragen<br />
werden soll, <strong>und</strong><br />
2. in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 7 die<br />
Ersatzmutter sowie die Person, die das Kind auf<br />
Dauer bei sich aufnehmen will.<br />
(4) In den Fällen des Absatzes 1 Nr. 6 <strong>und</strong> des<br />
Absatzes 2 ist der Versuch strafbar.<br />
17<br />
7<br />
In Deutschland ist die Nachfrage zwar sehr<br />
groß, aber die Methode ist durch das deutsche<br />
Embryonenschutzgesetz verboten.<br />
8<br />
Daher plant das ›ReproGenetics Institute‹ in<br />
Deutschland eine Vorklinik zu gründen, in der<br />
die ersten Behandlungsschritte (Hormonbehandlung,<br />
Samenspende, Ei-Entnahme <strong>und</strong><br />
künstliche Befruchtung) durchgeführt werden.<br />
Dann fliegt die potentielle Mutter für nur drei<br />
Tage nach Zypern, wo die eigentliche Analyse<br />
<strong>und</strong> das Einpflanzen vorgenommen werden.<br />
Deswegen wird ein Standort in Flug hafennähe<br />
bevorzugt. Im Gespräch sind der Flughafen<br />
Lübeck <strong>und</strong> der Flughafen Leipzig/ Halle, wobei<br />
letzterer favorisiert wird, wegen seiner Nähe<br />
zu Polen, wo auch eine hohe Nachfrage durch<br />
eine ähnliche Gesetzes lage gebremst wird.<br />
Mark hat mir erzählt, dass die häufigen<br />
Kindstötungen in den neuen B<strong>und</strong>esländern<br />
in der amerikanischen Presse Aufmerksamkeit<br />
erregt haben. Und die Projektmanager vom<br />
›ReproGenetics Institute‹ gehen da<strong>von</strong> aus,<br />
dass die Gestaltungsmöglichkeit <strong>und</strong><br />
Sicherheit, die die Präimplantationsdiagnose<br />
Paaren mit Kinderwunsch bietet, hier vielleicht<br />
Zuversicht <strong>und</strong> Angstfreiheit bieten könnte.
WAS DU WISSEN SOLLTEST (DER KRIEG) 18<br />
»SOLDATEN SIND …<br />
TRANSITPASSAGIERE«<br />
Ein Gespräch mit Lutz Metzger,<br />
Mitglied der Aktionsgemeinschaft<br />
Flughafen NATO-FREI,<br />
die Fragen stellten <strong>Anne</strong> <strong>König</strong><br />
<strong>und</strong> <strong>Jan</strong> <strong>Caspers</strong><br />
Wie haben die Anwohner reagiert, als<br />
Sie Ihnen <strong>von</strong> der geplanten militärischen<br />
Nutzung des Flughafens berichteten?<br />
Als ich ab März 2006 zum Beispiel in<br />
Schkopau, Hohenheida <strong>und</strong> in anderen<br />
Sä len der Flughafenumgebung auftrat,<br />
waren viele der Anwohner verblüfft, wenn<br />
ich ihnen <strong>von</strong> den Plänen zur militärischen<br />
Nutzung des Flughafens berichtet<br />
habe. Viele konnten es gar nicht glauben.<br />
Inzwischen sind sie geläutert. Es dröhnt<br />
<strong>und</strong> brummt über ihren Köpfen, vor<br />
allem nachts wird es immer heftiger. Die<br />
Leute suchen sehr verärgert nach Aus -<br />
wegen. Wenn ich ihnen jetzt sage, das ist<br />
aber nicht nur die NATO, die über<br />
Leipzig Militärfrachten fl iegen lässt, dann<br />
erschrecke ich sie nur wieder. Viele Bürger,<br />
die gegen den Fluglärm demonstrieren,<br />
wollen schon nicht mehr hören,<br />
wie schlimm es noch werden könnte.<br />
Inzwischen hat auch die sächsische Landesregierung<br />
die militärische Nutzung des<br />
Flughafens Leipzig/ Halle offiziell eingeräumt.<br />
Wie wird der Flughafen konkret<br />
militärisch genutzt?<br />
Man müsste verschiedene Aspekte nennen:<br />
Seit 2006 betreibt die russische Volga-<br />
Dnepr-Gruppe <strong>und</strong> die ukrainische Antonov<br />
Airlines am Flughafen Leipzig/ Halle die<br />
Ruslan SALIS GmbH. Mehrere Antonov<br />
An-124-100 Maschinen stehen hier bereit,<br />
um jederzeit Militärfracht an jeden<br />
Krisenherd der Welt fl iegen zu können. Die<br />
Stationierung, die Leipzig zum bedeutendsten<br />
europäischen Drehkreuz für Groß -<br />
waf fen werden lässt, verfolge auch »humanitäre<br />
Ziele«, heißt es <strong>von</strong>seiten der Dresdner<br />
Staatskanzlei dazu. Ich habe auch<br />
nichts gegen Starts <strong>und</strong> Landungen <strong>von</strong><br />
Antonov-Maschinen vorzubringen, wenn<br />
diese wahrhaft Frieden schaffend,<br />
zur Katastrophenhilfe oder auch nur<br />
kom mer ziell genutzt werden. Wir haben<br />
logistisch, fi nanziell <strong>und</strong> technologisch<br />
gesehen alle Möglichkeiten, weltweit<br />
zu helfen, aber wir tun es nicht genügend.<br />
Der Militär bereich dagegen wird ständig<br />
weiter aus gebaut.<br />
Nicht nur Ruslan SALIS, auch DHL ist<br />
inzwischen auf diesem Sektor tätig. Dabei<br />
ist die Posttochter nicht nur für die<br />
Feld post der deutschen Soldaten im Auslands<br />
einsatz zuständig; die B<strong>und</strong>eswehr<br />
ist gerade im Begriff, ihre gesamten<br />
Logistik aufgaben an Schenker <strong>und</strong> DHL<br />
zu über tragen.<br />
Und ein dritter Aspekt sollte nicht vergessen<br />
werden – auch wenn der Flughafen<br />
argumentiert, dass es sich dabei um keine<br />
militärischen Flüge handelt: In Leipzig/<br />
Halle landen täglich amerikanische GIs<br />
zwischen, die auf dem Weg in den Irak <strong>und</strong><br />
nach Afghanistan sind oder <strong>von</strong> dort in<br />
die USA zurück transportiert werden. In<br />
Zivilmaschinen, das ist richtig, aber eben<br />
in Zivilmaschinen, mit denen eine eindeutig<br />
militärische Aufgabe erfüllt wird,<br />
die des Truppentransports.<br />
Können Sie die Aktivitäten der Ruslan<br />
SALIS GmbH genauer beschreiben?<br />
Die Ruslan SALIS GmbH ist eine private<br />
Firma, die im Auftrag der NATO <strong>und</strong> der<br />
EU für das Projekt SALIS (Strategic Airlift<br />
Interim Solution) arbeitet. Entgegen den<br />
Beschwichtigungen der NATO, nur temporäre<br />
Transportengpässe überbrücken<br />
zu wollen, weisen alle Anzeichen darauf<br />
hin, dass das Projekt SALIS dauerhaft ausgebaut<br />
<strong>und</strong> noch erweitert werden soll.<br />
Die Ruslan SALIS-Halle, die das russischukrainische<br />
Unternehmen am Flughafen<br />
Leipzig/ Halle unterhält, ist nicht besonders<br />
groß, sie ist die alte Wartungshalle des<br />
Flughafens. Vor ihr haben bis zu zehn<br />
Antonov-Maschinen Platz. Wohlgemerkt:<br />
Bei diesem Flugzeug handelt es sich<br />
um eines der größten Transportfl ugzeuge<br />
der Welt. Es kann bis zu 120 Tonnen Mate<br />
rial laden <strong>und</strong> ist den Konkurrenz modellen<br />
<strong>von</strong> Boeing weit überlegen.<br />
Wohin gehen solche Flüge?<br />
Die Aktionsgemeinschaft »Flughafen<br />
NATO-FREI« wurde im März 2006 in<br />
Leipzig gegründet. Die Gruppe protestiert<br />
gegen die militärische Nutzung des<br />
Flughafens Leipzig/Halle. Lutz Metzger<br />
ist bekennender Pazifi st, er arbeitet als<br />
Deeskalationstrainer <strong>und</strong> engagiert sich<br />
gegen Gewalt <strong>und</strong> Rassismus. Schon vor<br />
der Gründung der Aktionsgemeinschaft<br />
war er in den Vororten <strong>von</strong> Leipzig<br />
Die Waffen, die mit den Antonov-Maschinen<br />
transportiert werden, sind zum<br />
Beispiel für die riesigen US-Stützpunkte in<br />
Katar oder in Bahrein bestimmt, aber<br />
auch für die vier großen US-Luftstützpunkte<br />
im Irak. Aber das Bestimmungsziel<br />
der Transporte kann genauso gut Temez<br />
in Usbe kistan, Kabul in Afghanistan<br />
oder die US-Basis Ircelik in der Türkei<br />
sein.<br />
Können Sie ein Beispiel nennen, was da<br />
transportiert wird?<br />
Logistisch war es zum Beispiel in diesem<br />
Jahr kein Problem, als die kanadische<br />
Afghanistan-Truppe <strong>von</strong> der B<strong>und</strong>eswehr<br />
unentgeltlich 20 Kampf- <strong>und</strong> zwei<br />
Bergepanzer vom Typ Leopard 2A6M<br />
erhielt, diese Panzer nach Kabul zu transportieren.<br />
Das Rüstungsunternehmen Krauss-Maffei<br />
Wegmann lieferte bereits am 2. August<br />
2007 den ersten Leopard 2A6M CAN mit<br />
einer Antonov 124-100, stationiert in<br />
Leipzig/Halle, an die kanadischen Streitkräfte.<br />
Das Problem dabei war: Bisher war<br />
es Konsens für alle B<strong>und</strong>esregierungen,<br />
keine Rüstungsgüter in Spannungsgebiete<br />
zu exportieren. Der B<strong>und</strong>essicherheitsrat<br />
– ein geheim tagender Unterausschuss des<br />
Kabinetts – hat über jeden Ausfuhr -<br />
antrag zu befi nden. In diesem Gremium<br />
sitzen die Kanzlerin, die Minister für Ver -<br />
tei digung, des Äußeren, Inneren, der<br />
Wirt schaft <strong>und</strong> Finanzen sowie der Generalinspekteur<br />
der B<strong>und</strong>eswehr. Der B<strong>und</strong>essicherheitsrat<br />
entschied, dass die zwanzig<br />
Leo 2-Panzer an die Kanadier nur ver<br />
mietet werden, was ein Schlupfl och darstellt,<br />
um die Exportrestriktion zu umge<br />
hen, weil die Regierung der Meinung ist:<br />
Leasing stellt kein Exportgeschäft dar.<br />
Welchen Umfang haben die Aktivitäten der<br />
Ruslan SALIS?<br />
Im Jahr 2006 wurden zum Beispiel<br />
220 Flü ge durchgeführt <strong>und</strong> 13.500 Tonnen<br />
transportiert. Dabei erwirtschaftete das<br />
Unternehmen einen Gewinn <strong>von</strong><br />
70.2 Mil lion US-Dollar. Neben den bereits<br />
genannten Fluggesellschaften fl iegen<br />
aber auch andere Antonov-124 oder Boing-<br />
747-Maschinen unter Firmierungen wie<br />
AirBridgeCargo oder Polet Airlines<br />
Company schwerstes Kriegsgerät über<br />
Leipzig/ Halle, zum Beispiel in den<br />
Mittleren Osten.<br />
Welcher Zusammenhang besteht zwischen<br />
den unternehmerischen Aktivitäten <strong>von</strong><br />
Ruslan SALIS <strong>und</strong> der Flughafen Leipzig/<br />
Halle GmbH?<br />
Ob nun Panzer, gepanzerte LKWs oder wie<br />
zur Zeit Transport- <strong>und</strong> Kampfhubschrauber<br />
vom Typ Mi-17 transportiert werden,<br />
es handelt sich bei diesen Transfers immer<br />
auch um Transportkapazitäten. Die Flughafengesellschaft<br />
erwirtschaftet ihren<br />
Gewinn durch Landeentgelte <strong>und</strong> durch<br />
Gebühren für die Nutzung ihrer Rollbahnen<br />
<strong>und</strong> Immobilien. Der Flughafen profi<br />
tiert also direkt <strong>von</strong> den Militärtransporten.<br />
Wahrscheinlich ist es für den Flughafen<br />
der einfachste Weg, schwarze Zahlen<br />
zu schreiben.<br />
Sie erwähnten die Transporte <strong>von</strong> amerikanischen<br />
Militärangehörigen durch zivile<br />
Fluggesellschaften. Wie viele GIs landen auf<br />
dem Flughafen Leipzig/Halle zwischen?<br />
Nur einmal, Anfang 2007, hat die Flughafen<br />
GmbH den genauen Anteil <strong>von</strong> militärischem<br />
Personal an den Transitpassagieren<br />
unterwegs, um Anwohner <strong>und</strong> Mitglieder<br />
der IG Nachtfl ugverbot über die voraussichtliche<br />
militärische Nutzung des<br />
Flughafens zu informieren. Dafür hatte er<br />
öffentlich zugängliches Material <strong>von</strong> der<br />
B<strong>und</strong>eswehr eingesehen, in dem Investitions-<br />
<strong>und</strong> militärische Nutzungspläne für<br />
den südwestlichen Teil des Flughafens<br />
bereits vereinbart waren.<br />
in einer Pressemitteilung veröffentlicht.<br />
2006 waren es demnach 240.000 Soldaten,<br />
die hier zwischenlandeten. Seitdem<br />
wurden keine weiteren offi ziellen Zahlen<br />
he raus gegeben.<br />
Wie erhalten Sie dann Angaben über den<br />
Umfang dieser Transporte, gibt es ein Gesetz,<br />
damit man solche Informationen als<br />
Bürger bekommt?<br />
Es gibt das B<strong>und</strong>esinformationsgesetz,<br />
das jedem Bürger das Recht gibt, nachzufra<br />
gen <strong>und</strong> Antworten zu bekommen.<br />
Wir haben auch in der sächsischen Staatskanz<br />
lei Leute in Amt <strong>und</strong> Würden, die<br />
darauf achten, dass unseren Bürgerrechten<br />
entsprochen wird. Nur ist die Flughafengesellschaft<br />
zur Zeit überhaupt nicht<br />
angetan, irgendetwas zu beantworten.<br />
Man verschanzt sich dort hinter Anordnungen<br />
der deutschen Flugsicherung, das sei<br />
alles einfach Transit. Um zu erfahren,<br />
wie viele amerikanische Soldaten auf<br />
dem Flughafen zwischenlanden, kann ich<br />
natürlich sagen: Okay, ich schaue<br />
mir die Transitzahlen an. Die Zahl der
WAS DU WISSEN SOLLTEST (DER KRIEG) 19<br />
Transitreisenden auf dem Flughafen<br />
Leipzig/ Halle ist derzeit fast dreimal so<br />
hoch wie auf dem größten deutschen<br />
Pa ssa gierfl ughafen in Frankfurt/Main,<br />
ob wohl hier kaum jemand umsteigt.<br />
Was passiert auf dem Flughafen genau, wenn<br />
eine Maschine mit GIs zwischenlandet?<br />
Die GIs steigen aus, weil das Flugzeug aufgetankt<br />
wird. Dann werden sie in Bussen<br />
zum Terminal A gefahren <strong>und</strong> bleiben so im<br />
Transitbereich. Zwischen den Angestellten,<br />
auch den Sicherheitskräften, <strong>und</strong> den<br />
GIs fi nden keine Gespräche statt. Das ist<br />
wohl auch gar nicht erwünscht.<br />
Hat Ihre Gruppe Kontakte zu amerikanischen<br />
GIs?<br />
Wir haben Kontakt zu einigen Dissidenten,<br />
die in Deutschland leben. Über ein Netzwerk<br />
<strong>von</strong> europäischen Friedensorganisationen<br />
ist es möglich, Informationen<br />
über Beratungsstellen <strong>und</strong> dergleichen an<br />
die US-SoldatInnen <strong>und</strong> ihre Familien<br />
zu verteilen. Erwähnen kann ich hier die<br />
guten Kontakte zu den auch in Deutschland<br />
tätigen Friedensgruppen Munich<br />
American Peace Committee (MAPC) oder<br />
American Voices Abroad (AVA) Military<br />
Project.<br />
Wer hat außerdem noch Kontakt zu<br />
den GIs?<br />
Neulich habe ich erfahren, dass eine Notärztin<br />
zum Flughafen geholt wurde, weil<br />
einige GIs im Flugzeug kollabiert waren.<br />
Da kommen junge Frauen <strong>und</strong> Män -<br />
ner trau matisiert aus Einsätzen wieder.<br />
Sie sind nur noch schwer zu transportieren.<br />
Bei Halle wird jetzt ein Krankenhaus<br />
eingerichtet, das mit Hubschraubern<br />
vom Flughafen aus schnell erreichbar<br />
ist, um Verw<strong>und</strong>ete, aber vor allem auch<br />
seelisch strapazierte Menschen medizinisch<br />
zu versorgen. Auch auf diese Weise<br />
wird der Krieg hier in unserer Region<br />
alltägliche Realität.<br />
2003, in der Zeit, als die völkerrechtswidrige<br />
Invasion im Irak begann, gab es in<br />
Leipzig wie in vielen anderen Städten große<br />
Protestdemonstrationen. Bis zu 30.000 Bürgerinnen<br />
<strong>und</strong> Bürger waren Montag für<br />
Montag auf der Straße, um friedlich gegen<br />
den Krieg zu demonstrieren. Uns würde<br />
interessieren, wie die Leipziger Lokalpolitiker<br />
auf die jetzigen Truppentransporte reagiert<br />
haben?<br />
Der Oberbürgermeister der Stadt Leipzig,<br />
Burkhard Jung, sitzt im Aufsichtsrat des<br />
Flughafenkonsortiums <strong>und</strong> hat dort der<br />
extraterritorialen Benutzung durch das<br />
US-Militär ausdrücklich zugestimmt, weil<br />
die Amerikaner sehr gut zahlen. Als ihn<br />
am 29. Februar diesen Jahres ein Friedensforscher<br />
auf einer öffentlichen <strong>Vera</strong>nstaltung<br />
in Leipzig darauf ansprach <strong>und</strong><br />
fragte, ob er sich als Oberbürgermeister<br />
<strong>von</strong> Leipzig damit nicht zum Komplizen für<br />
möglicherweise ganz andere Transportinhalte<br />
mache, antwortete Burkhard Jung,<br />
er wolle ganz bewusst nicht wissen, was<br />
da transportiert <strong>und</strong> zwischengelandet<br />
werde. Eben weil, wie er wiederholte, die<br />
Bezahlung sehr gut sei <strong>und</strong> das Ganze ein<br />
lukratives Geschäft darstellen würde.<br />
Bei der <strong>Vera</strong>nstaltung in Kursdorf hatte<br />
ich den technischen Leiter des Flughafens<br />
darauf angesprochen, wie groß der<br />
Um fang militärischer Transporte ist.<br />
Da meinte er, es gäbe keine militärischen<br />
Transporte, weil die alle mit Privatmaschinen<br />
fliegen.<br />
World Airways, North American Airlines<br />
<strong>und</strong> die ATA-Group sind einige <strong>von</strong> vielen<br />
amerikanischen Fluglinien, die vom<br />
Pen tagon ihre Aufträge bekommen <strong>und</strong><br />
damit ihre Gewinne machen – teilweise<br />
schon seit dem Koreakrieg. In den<br />
neunziger Jah ren haben die Vereinigten<br />
Staaten ihre Ressourcen <strong>und</strong> Streitkräfte<br />
umgelagert. Zum Beispiel konnte<br />
George Bush senior seine Streitkräfte<br />
nicht kostengünstig in den Nahen Osten<br />
verlagern, er musste sie damals schon nach<br />
wenigen Monaten wieder aus dem Irak<br />
abziehen, denn dieser Krieg war fi nanziell,<br />
technologisch <strong>und</strong> logistisch nicht mehr<br />
tragbar. George Bush junior hat dann diese<br />
privaten Wirtschaftsunternehmungen<br />
– nach der ideologischen Wirtschaftstheorie<br />
der Chicagoer Schule <strong>und</strong> ihrem<br />
neolibe ralen Vordenker, Milton Friedman –<br />
zugelassen. Donald Rumsfeld, der vorletzte<br />
US-Verteidigungsminister, hat bei<br />
Friedman studiert. Man kann sagen,<br />
er hat seine Ideen sogar radikalisiert, denn<br />
in seiner Amtzeit begann Rumsfeld, dem<br />
Staat die Kontrolle über das Militär<br />
zu entziehen <strong>und</strong> militärische Aufgaben<br />
mehr <strong>und</strong> mehr in Privatunternehmen<br />
auszulagern. Man darf nicht vergessen:<br />
Im Irak, dem Flugziel der meisten<br />
›Transitpassagiere‹, wurde die Infrastruk -<br />
tur komplett zerstört, um sie dann privatwirtschaftlich<br />
neu aufzubauen. Das<br />
al les sind Zeichen eines neuen globalen<br />
Wirtschaftens, das wir auch hier in Leipzig<br />
spüren können.<br />
Die Privatisierung des Militärischen, ist<br />
das eine Entwicklung die sich vor allem auf<br />
Amerika beschränkt?<br />
Nein, ganz <strong>und</strong> gar nicht. Das ist eine<br />
Praxis, die inzwischen weltweit Schule<br />
macht: Auch in Deutschland soll die<br />
gesamte Basislogistik der B<strong>und</strong>eswehr,<br />
also die Lagerhaltung sowie der Transport<br />
auch <strong>von</strong> Waffen <strong>und</strong> Munition, <strong>von</strong> DHL<br />
<strong>und</strong> Schenker übernommen haben.<br />
Allein der erste Auftrag hat nach Branchenschätzungen<br />
einen Wert <strong>von</strong> 800 Millionen<br />
Euro. Die Logistik der B<strong>und</strong>eswehr<br />
wird auf insgesamt drei Milliarden Euro<br />
geschätzt.<br />
Welche Konsequenzen hat eine solche Privatisierung<br />
des Militärischen für die über<br />
Jahrh<strong>und</strong>erte gewachsene rechtliche Unterscheidung<br />
<strong>von</strong> Zivilem <strong>und</strong> Militärischem?<br />
Ich kann Ihnen sagen, welche rechtlichen<br />
Gr<strong>und</strong>lagen den gesellschaftlichen <strong>Vera</strong>ntwortungsträgern<br />
gr<strong>und</strong>sätzlich<br />
<strong>und</strong> gr<strong>und</strong>gesetzlich verbieten, aus unserem<br />
zi vil genutzten Interkontinentalfl<br />
ughafen einen global agierenden Interventionshub<br />
zu machen.<br />
Das beginnt bei den Genfer Konventionen,<br />
auch Genfer Abkommen genannt: das<br />
sind zwischenstaatliche Abkommen <strong>und</strong><br />
eine wichtige Komponente des humanitären<br />
Völkerrechts. Sie enthalten für den<br />
Fall eines Krieges beziehungsweise<br />
eines internationalen oder nicht-internationalen<br />
bewaffneten Konfl ikts Regeln für<br />
den Schutz <strong>von</strong> Personen, die nicht an den<br />
Kampfhandlungen teilnehmen. Das<br />
Völkerstrafgesetzbuch (VStGB) regelt in<br />
Deutschland die Folgen der Straftaten<br />
gegen das Völkerrecht. Von der UN-Charta<br />
brauchen wir da gar nicht zu reden. Es ist<br />
Artikel 26 des Gr<strong>und</strong>gesetzes, der hier<br />
gr<strong>und</strong>sätzlich missachtet wird. Darin steht:<br />
»Handlungen, die geeignet sind <strong>und</strong> in<br />
der Absicht vorgenommen werden,<br />
das friedliche Zusammenleben der Völker<br />
zu stören, insbesondere die Führung<br />
eines Angriffskrieges vorzubereiten,<br />
sind verfassungswidrig.«<br />
Ihre Gruppe setzt sich intensiv mit der<br />
militärischen Nutzung des Flughafens auseinander.<br />
Wie geht der Flughafen mit dieser<br />
Kritik um?<br />
Die Sicherheitskonzepte am Flughafen sind<br />
sehr resolut. Wenn wir am Flughafen ankommen,<br />
ist es wieder <strong>und</strong> wieder vorgekom<br />
men, dass die Sicherheitskräfte schon<br />
da stehen <strong>und</strong> sagen: »Wir dachten, Sie<br />
kommen gar nicht, Herr Metzger.« Mit<br />
Handschlag werde ich begrüßt. Seitdem<br />
wir den Tornado beschmiert haben,<br />
sind sie sauer auf mich. Sollen sie<br />
auch sein. Nur macht das die weitere<br />
Arbeit nicht einfacher.<br />
Was haben Sie mit dem Tornado gemacht?<br />
Zur Eröffnung der Südbahn gab es ein<br />
Volks fest mit Flugschau. Dort standen<br />
Antonov-Maschinen, Aufklärungsfl ugzeuge<br />
AWACS <strong>und</strong> ein B<strong>und</strong>eswehr-Tornado –<br />
nun, nicht eine <strong>von</strong> den sechs Maschinen,<br />
die in Afghanistan waren, aber ein<br />
seriengleiches Flugzeug – <strong>und</strong> alle, auch<br />
Mütter mit ihren Kindern, durften das<br />
kleine Treppchen hochsteigen <strong>und</strong> in den<br />
Tornado krabbeln. Wir sind als Frie densgruppe<br />
hingegangen <strong>und</strong> haben den<br />
Tornado mit Ketchup bespritzt. Unser<br />
Er folg war, dass danach sofort die Flugschau<br />
weiträumig abgesperrt wurde.<br />
Welche anderen Mittel setzen Sie zum<br />
Protest ein?<br />
Wir gehen mit Transparenten zum Flughafen,<br />
auf denen steht »Nein, zur Militärisierung<br />
unseres Flughafens« oder<br />
»Nein zum Kriegsfl ughafen«. Wenn die GIs<br />
kom men, steht »Sir, no Sir« – ein alter<br />
Slogan kritischer amerikanischer Soldaten,<br />
noch aus dem Vietnamkrieg – sowie die<br />
Telefonnummer einer Rechtsberatung für<br />
amerikanische Soldaten drauf. Wir versuchen<br />
auch, die Touristen, die zum Checkin<br />
gehen, aufzuklären. »Hallo, wenn du<br />
dich jetzt in die Maschine setzt, lies doch<br />
mal, was hier am Flughafen los ist.«<br />
Können Sie dort ohne weiteres Flugblätter<br />
verteilen?<br />
Wenn wir uns anmelden, dann dürfen<br />
wir gar nichts. Wenn die S-Bahn einfährt,<br />
dann stehen schon zehn Beamte <strong>von</strong> der<br />
Bun des polizei dort. Wir kommen uns<br />
vor wie Hooligans vor einem Fußballspiel.<br />
Dann werden wir <strong>von</strong> zirka 20 Sicherheits<br />
kräften mit Schlips <strong>und</strong> Jackett durch<br />
den ganzen Terminal B geführt. Man<br />
kommt sich schon fast wie eine Re gierungsdelegation<br />
vor. Wir können nur unangemeldete<br />
Aktionen starten, aber über die<br />
kann ich natürlich nicht reden. Was<br />
ich aber sagen kann: Bei allen Aktionen<br />
der »AG Flughafen NATO-FREI« ist<br />
das Ziel, den Gedanken der Rüstungskonversion<br />
wieder in die Bevölkerung zu tragen.<br />
Wir erleben hier in Leipzig gerade die politisch<br />
gewollte Inversion, die schleichende<br />
Militarisierung unseres Alltags.
WAS DU WISSEN SOLLTEST (DAS WÜNSCHEN) 20<br />
KURZWEIL<br />
WÄHRT AM LÄNGSTEN<br />
Der Berliner Autor Tobias Hülswitt<br />
trifft den amerikanischen<br />
Zukunftsforscher Ray Kurzweil<br />
Ovid beendete seine Metamorphosen mit den<br />
Versen: »Die Menschen werden mich lesen,<br />
<strong>und</strong> im Gedächtnis aller Zeiten / Werde ich […]<br />
leben.« Wie klingt das für Sie?<br />
Bis vor kurzem hatten wir keine Möglichkeit, die scheinbare<br />
Zwangsläufi gkeit <strong>von</strong> körperlichem Verfall <strong>und</strong><br />
Tod auf zuheben. Unser Bewusstsein kommt uns jedoch<br />
nicht vergänglich vor, sondern scheint dauerhaft. Trotzdem<br />
müssen wir beobachten, dass Menschen sterben. Also<br />
haben wir verschiedene Theorien entwickelt, warum sie,<br />
auch wenn ihr Leben zeitlich begrenzt scheint, in Wahrheit<br />
ewig leben: durch Wiedergeburt, in einem ewigen Leben<br />
im Himmel oder im Gedächtnis der Nachfahren. Und wir<br />
erdenken philosophische Gründe, warum der Tod etwas<br />
Positives <strong>und</strong> Befreiendes ist <strong>und</strong> es nicht gut wäre,<br />
das Leben ins Unendliche zu verlängern. Die Ver drän gung<br />
der Tatsache, dass der Tod eine unermesslich schreckenerregende<br />
Vorstellung ist – ganz zu schweigen <strong>von</strong> dem<br />
Leiden, das damit einhergeht –, ist weit verbreitet.<br />
Wir hängen an unseren Rationalisierungen, die es uns<br />
erlau ben, im Angesicht der heraufziehenden Tragödie<br />
weiter zumachen. Solange wir keine Alternative hatten,<br />
war das vernünftig. Heute haben wir allerdings eine Alterna<br />
tive. Auch wenn wir die nötigen Mittel noch nicht zur<br />
Hand haben, besitzen wir doch das Wissen, wie wir<br />
bis zu dem Zeitpunkt leben können, an dem sie zur Verfügung<br />
stehen werden. Mit dem heutigen Wissen können<br />
selbst Angehörige meiner Generation in fünfzehn Jahren<br />
noch bei guter Verfassung sein. Dann wird es möglich<br />
sein, unser biologisches Programm durch Biotechnologie zu<br />
modifi zieren, was uns lange genug leben lassen wird, bis<br />
uns die Nanotechnologie befähigt, ewig zu leben.<br />
War die Angst vor dem Tod der Ausgangspunkt<br />
Ihrer Arbeit?<br />
Nein. Mein Denken besitzt zwei Ursprünge. Ich bin Erfi nder,<br />
<strong>und</strong> meine Produkte sollen das richtige Timing haben.<br />
Die meisten Erfi nder scheitern nicht, weil ihre Ideen<br />
schlecht sind, sondern weil ihr Timing falsch ist. Deshalb<br />
untersuchte ich technologische Trends <strong>und</strong> sah, dass<br />
die Entwicklungen der Rechnerleistung <strong>und</strong> der Leistungsfähigkeit<br />
<strong>von</strong> Kommunikationstechnologien vorhersagbar<br />
sind. Ich arbeite heute mit zehn Leuten, die Daten aus verschiedenen<br />
Feldern zusammentragen, anhand deren wir<br />
mathematische Modelle entwickeln. Diese ermöglichen<br />
uns genaue Prognosen. Auf diese Weise haben wir zuletzt<br />
eine taschenformatgroße Lesemaschine für Blinde<br />
entwickelt. 2002 errechneten wir, dass die dafür benötigte<br />
Technik 2006 – in der richtigen Größe, mit der richtigen<br />
Leistungsstärke <strong>und</strong> zum richtigen Preis – zur Verfügung<br />
stehen würde. Also begannen wir die Entwicklung 2002,<br />
um 2006 mit dem Produkt fertig zu sein. Mit denselben<br />
mathematischen Modellen kann man nun nicht nur<br />
fünf oder zehn, sondern zwanzig, dreißig Jahre vorausschauen.<br />
Wegen der explosiven Natur, der exponentiellen<br />
Beschleunigung technischer Entwicklung <strong>und</strong> weil<br />
Informationstechnologien dieser Beschleunigung unterliegen,<br />
kam ich zu dem Schluss, dass 2045 die Singularität<br />
stattfi nden wird: Das Ereignis also, hinter das wir <strong>von</strong><br />
Ray Kurzweil ist als Computerwissenschaftler,<br />
Autor <strong>und</strong> Unternehmer<br />
weltweit bekannt. Seit über vier Jahrzehnten<br />
arbeitet er – auch im Selbstversuch<br />
– an der Idee, das menschliche<br />
Leben durch computerbasierte<br />
Methoden <strong>und</strong> Programme zu verlängern.<br />
Bevor er seine Firma Kurzweil<br />
Music Systems für elektronische Musikinstrumente<br />
gründete, hatte er bereits<br />
auf Wunsch <strong>von</strong> Stevie Wonder eine<br />
Lesemaschine für Blinde erfun den.<br />
Ray Kurzweil wurde 1948 als Sohn einer<br />
jüdischen Migrantenfamilie in<br />
New York geboren <strong>und</strong> studierte am<br />
heute nicht weiter in die Zukunft schauen können, da dann<br />
artifi zielle Intelligenz die menschliche überholen wird.<br />
Sie erwähnten einen zweiten Urspung ihres<br />
Denkens.<br />
Der liegt darin, dass ich an Diabetes Typ II er krankte, als<br />
ich fünf<strong>und</strong>dreißig war. Die her köm mliche<br />
Herangehensweise machte es schlim mer. Also ging ich das<br />
Problem als Ingenieur <strong>und</strong> Wissenschaftler an. Ich<br />
sammelte Informationen <strong>und</strong> heilte so meinen Diabetes<br />
durch Nahrungsergänzungsmittel <strong>und</strong> Umstellungen<br />
im Lebensstil; heute bin ich völlig symp tomfrei. Damals<br />
begriff ich, dass man Ges<strong>und</strong>heitsprobleme mit der<br />
richtigen Kombination <strong>von</strong> Ideen überwinden kann. Und<br />
wenn es mit Diabetes möglich ist, dann kann man, zumindest<br />
ich, das mit jeder Krankheit tun.<br />
Schließlich bekam ich ein weiteres Ges<strong>und</strong>heitsproblem:<br />
das sogenannte mittlere Alter, diese Beschleunigung des<br />
Alterns <strong>von</strong> Menschen um die fünfzig. Ich glaube, ich habe<br />
auch diese Herausforderung gemeistert. Bei bestimmten<br />
Alterstests kommt bei mir vierzig heraus, obwohl ich<br />
sechzig bin. Ich messe regelmäßig sechzig verschiedene<br />
Blutwerte, zudem mein Gedächtnis, die Reaktionszeit <strong>und</strong><br />
das Tastempfi nden. In fünfzehn Jahren, wenn ich<br />
chronologisch 75 Jahre alt bin, möchte ich biologisch 38<br />
sein. Dann werden wir unsere Biochemie neu programmieren<br />
können, <strong>und</strong> später kommen die Nanobots, winzige<br />
Roboter, die wir in unseren Blutkreislauf einspeisen.<br />
Werden wir durch die Verbindung <strong>von</strong> Mensch<br />
<strong>und</strong> künstlicher Intelligenz fähig sein, unser<br />
Wissen <strong>und</strong> sogar persönliches Erleben kabellos<br />
direkt <strong>von</strong> Hirn zu Hirn zu übertragen?<br />
Unser Körper scheint eine festgelegte physische Form zu<br />
besitzen. Unsere Gehirne sind in einem Schädel ein gesperrt<br />
<strong>und</strong> überlappen nicht physisch mit anderen<br />
Gehirnen. Daher pfl egen wir die Vorstellung der einzigartigen<br />
Identität jedes einzelnen Individuums. Computer<br />
sind anders. Man könnte eine Million <strong>von</strong> ihnen nehmen<br />
<strong>und</strong> einen einzigen Prozessor daraus machen, <strong>und</strong> danach<br />
könnten es wieder eine Million Computer werden.<br />
Sprich: Computer können sich mitsamt ihrer Identität <strong>und</strong><br />
all ihrer Software problemlos mit anderen Computern<br />
verbinden <strong>und</strong> sich wieder isolieren. Die Identität eines<br />
Computers beruht auf seiner Software. Wenn Ihr Notebook<br />
stirbt, können Sie die Software einfach <strong>von</strong> einem Back-up<br />
auf einen anderen Computer spielen, <strong>und</strong> Ihr Notebook<br />
ist wieder am Leben.<br />
In Bezug auf uns selbst leben wir mit der Vorstellung,<br />
dass die Software sterben muss, wenn die Hardware<br />
kaputtgeht – denn das ist der Tod: Unsere Hardware geht<br />
kaputt. Bei Computern haben wir diese Erwartung nicht.<br />
Indem wir also unsere Biologie immer mehr ablegen <strong>und</strong><br />
computerähnlicher werden <strong>und</strong> uns mit unseren<br />
Computern verbinden, bis schließlich der Computeranteil<br />
unserer Intelligenz eine Milliarde mal leistungsstärker<br />
sein wird als ihr biologischer Anteil, werden wir dieselben<br />
Fähigkeiten besitzen. Wir werden unsere Intelligenz<br />
verschmelzen <strong>und</strong> uns wieder trennen können, genauso,<br />
wie es Computer heute tun. Wenn wir tiefer in das<br />
Massachusetts Institute of Technology.<br />
Vieles <strong>von</strong> dem, was Kurzweil in seinen<br />
Büchern, etwa 1990 in ›The Age of<br />
Intelligent Machines‹, prophezeit, ist<br />
heute längst Alltag: Computer schla gen<br />
Schachgroßmeister, das Internet durchdringt<br />
unser Leben. — Für das Gespräch<br />
in seinem Büro in einem Vorort <strong>von</strong><br />
Boston nimmt sich Ray Kurzweil so viel<br />
Zeit, als habe er da<strong>von</strong> im Überfl uss.<br />
Auf seinem Schreibtisch stehen die gesammelten<br />
Abenteuer des Science-<br />
Fiction-Helden Tom Swift Jr., die er als<br />
Junge verschlungen hat.<br />
Bewusstsein eines anderen Menschen eindringen können,<br />
indem wir unser Denken mit seinem auf intimste Weise,<br />
mit Hilfe nichtbiologischer Intelligenz, verbinden,<br />
so wird sich das sehr positiv auf das Mitgefühl <strong>und</strong> das<br />
gegenseitige Verständnis auswirken.<br />
Gibt es nicht heute bereits Möglichkeiten,<br />
unsere Empathiefähigkeit zu steigern, zum<br />
Beispiel – idealerweise weltanschauungsneutrale<br />
– Formen der Meditation oder ganz<br />
einfach das Gespräch? Warum sollten wir,<br />
die wir solche Möglichkeiten heute nicht<br />
nutzen, in der Zukunft, die Sie beschreiben,<br />
darin besser werden?<br />
Wir teilen Wissen <strong>und</strong> Ideen auch heute durch Sprache<br />
<strong>und</strong> sind in der Lage, mit anderen Menschen mitzuempfi<br />
nden. Und wir haben die Gehirnstrukturen, die<br />
Neuronen <strong>und</strong> Spindelzellen, die uns das Mitfühlen <strong>und</strong><br />
Miterleben bis zu einem gewissen Grad ermöglichen,<br />
im Gehirn ausgemacht. Und wir besitzen bereits eine<br />
gewisse Fähigkeit, unser Denken zu denkenden Entitäten<br />
zu verbinden, die aus vielen verschiedenen Menschen<br />
bestehen. Kommunikationstechnologien wie das Internet<br />
erlauben es uns, weltumspannend zu kommunizieren<br />
<strong>und</strong> Gemeinschaften zu schaffen, die vor einigen<br />
Jahrzehnten noch nicht existierten. Dies sind zutiefst<br />
demokratisierende Technologien.<br />
Um den Alterungsprozess zu verlangsamen,<br />
nehmen Sie 250 Nahrungsergänzungspillen<br />
pro Tag.<br />
Ich bin mittlerweile auf zweih<strong>und</strong>ert, durch Effi zienzsteigerung.<br />
Ich nehme allerdings nicht einfach willkürlich<br />
irgendwelche Mittel, geleitet <strong>von</strong> Aberglaube oder vagen<br />
Ahnungen. Mein Programm ist sehr konservativ, auch<br />
wenn es aggressiv wirken mag. Es stehen wissenschaft liche<br />
Beweise hinter allem, was ich tue <strong>und</strong> empfehle. Wenn<br />
etwas zu Recht umstritten ist, wie menschliche Wachstumshormone,<br />
dann nehme <strong>und</strong> empfehle ich es nicht. Und<br />
mit Mitteln, über deren Wirkungen wir nicht genug<br />
wissen, experimentiere ich nicht. Außerdem führe ich, wie<br />
gesagt, regelmäßig zahlreiche Tests durch, um zu sehen,<br />
wie es mir geht. Ich mache das seit zwanzig Jahren, <strong>und</strong> es<br />
geht mir sehr gut. Mein Cholesterinspiegel, der vor<br />
25 Jahren bei 2,80 lag, liegt heute bei 1,30, <strong>und</strong> ich könnte<br />
viele andere Werte aufzählen, die ideal eingestellt sind.<br />
Mein Hormonspiegel entspricht einem Dreißig- oder<br />
Vierzigjährigen, <strong>und</strong> ich bin sechzig. Ich schlafe gut, <strong>und</strong><br />
ich bin immer noch sehr produktiv.<br />
Wann nehmen Sie all diese Pillen?<br />
Über den ganzen Tag verteilt.<br />
Denken Sie manchmal, der Tod könnte eine<br />
interessante Erfahrung sein, die Sie verpassen<br />
werden?<br />
(Überlegt lange) Na ja – man kann kaum wissen, wie diese<br />
Erfahrung sein wird.<br />
Ich kenne sogar Leute, die sagen, es wird eine<br />
grandiose Erfahrung.
WAS DU WISSEN SOLLTEST (DAS WÜNSCHEN) 21<br />
(Lacht) Und dann, was passiert danach? Es gibt ja<br />
Menschen, die in diesen Prozess eingetreten sind, die für<br />
klinisch tot erklärt worden <strong>und</strong> zurückgekommen sind.<br />
Sie haben nichts Transzendentales zu berichten. Wenn es<br />
dort schöne Prozesse gibt, dann werden wir sie erfahrbar<br />
machen können, ohne zu sterben. Wir müssten nur<br />
herausfi nden, was für Prozesse das wären. Ich denke, die<br />
Einstellung der Leute, die Sie erwähnt haben, ist nur eine<br />
weitere Rationalisierung, um sich einzureden, dass der Tod<br />
etwas Gutes ist, um nicht der Tatsache ins Auge zu sehen,<br />
dass er in Wahrheit eine furchtbare Tragödie ist.<br />
Warum werden radikale Lebensverlängerungs<br />
maßnahmen in Amerika früher auf Akzeptanz<br />
stoßen als in Europa?<br />
Das ist eine gute Frage. Der Widerstand gegen gentechnisch<br />
veränderte Organismen ist in Europa ebenfalls<br />
stärker als in den USA. Vielleicht ist für Europa die eigene<br />
Geschichte wertvoller, was zu einer Angst vor dem Wandel<br />
führen kann. Die Vereinigten Staaten haben den Geist<br />
der Grenzüberschreitung. Es gab im 19. Jahrh<strong>und</strong>ert die<br />
geographische Grenze im Sinne der offenk<strong>und</strong>igen<br />
Bestimmung des ›Manifest Destiny‹, in der sie ihr Staatsgebiet<br />
ausweiteten, <strong>und</strong> es gab auch immer einen Drang,<br />
die Grenzen der Vergangenheit aufzubrechen, in den<br />
Weltraum zu steigen, <strong>und</strong> auch das Risikokapital wurde<br />
in den USA erf<strong>und</strong>en …<br />
Im Großen <strong>und</strong> Ganzen hat sich die ganze Welt an diesem<br />
Vorbild orientiert, der Gr<strong>und</strong>satz des Unternehmertums<br />
<strong>und</strong> Risikokapitals ist keine ausschließlich amerikanische<br />
Erscheinung mehr, aber er hat hier seinen Ursprung.<br />
Es gibt diesen amerikanischen Drang zur Überwindung<br />
<strong>von</strong> alten Grenzen, <strong>von</strong> alten Beschränkungen. Unsere<br />
begrenzte Lebenszeit ist eine große Beschränkung. Es ist<br />
wirklich ziemlich tragisch. Ich meine, gerade dann, wenn<br />
den Menschen etwas gelingt <strong>und</strong> sie endlich herausgef<strong>und</strong>en<br />
haben, wie sie ihren Beitrag zur Kunst oder zur<br />
Wissenschaft leisten oder gute Beziehungen führen<br />
können, müssen sie sterben. Wir könnten aus der Weisheit<br />
der Menschen einen echten Nutzen ziehen. Und diese<br />
Vorstellung, es gäbe nur begrenzte Ressourcen <strong>und</strong> dass<br />
die ganze Energie <strong>und</strong> das Wasser für so viele Menschen<br />
nicht ausreichen würde, ist unsinnig. Die neuen Technologien<br />
werden eine unglaubliche Steigerung der Roh -<br />
stoffquellen herbeiführen. Allein im Sonnenlicht steht uns<br />
zehntausendmal mehr Energie zur Verfügung als wir<br />
heute verbrauchen. Es gibt ausreichend Rohstoffe, wenn<br />
wir erst einmal Dinge wie die Nanotechnologie anwenden.<br />
Also, in Europa gibt es starke technologiefeindliche<br />
Strömungen <strong>und</strong> vielleicht auch einen engeren Bezug zu<br />
dieser überlieferten Herleitung, der Tod sei etwas Gutes,<br />
weil er dem Leben eine Bedeutung verleihe.<br />
Sie meinen, weil die Amerikaner die Alte Welt<br />
hinter sich gelassen haben, ist es für sie<br />
auch einfacher, alte Vorstellungen hinter sich<br />
zu lassen?<br />
In der Tat, <strong>und</strong> die Vereinigten Staaten sind die Völker<br />
der Welt, wissen Sie, es gibt Europäer in Amerika, aber<br />
eben auch Afrikaner oder Chinesen. Wir haben alle Völker<br />
der Welt versammelt, weshalb es keine übermäßige<br />
Bindung an eine bestimmte Kultur gibt. Es gibt so eine<br />
Art neue Weltkultur. Und eine neue Weltkultur kommt<br />
überall auf der Welt zum Vorschein, weil das Internet die<br />
ganze Welt verbindet, aber in den Vereinigten Staaten<br />
hatten wir die Völker der Welt <strong>von</strong> Anfang an versammelt.<br />
Zu Beginn unseres Gesprächs habe ich aus<br />
Ovids Metamorphosen zitiert. Ich möchte gerne<br />
noch einmal auf die Rolle der Erzählung<br />
zurückkommen. Menschen, denen Geschichten<br />
im aristotelischen Sinne erzählt werden,<br />
glauben in der Regel daran, selbst ein geschlossenes<br />
Wesen mit einem wahren inneren Selbst<br />
zu sein. Das wahre innere Selbst ist jedoch –<br />
genauso wie eine übergeordnete aristotelische<br />
Dramaturgie – ein metaphysisches Konzept.<br />
Diese Vorstellungen verursachen eine permanent<br />
verzerrte Weltsicht. Wenn man nun<br />
Youtube als eine Erzählung betrachtet, ist das<br />
anders. Es gibt kein wahres inneres Selbst;<br />
wenn alle ›Szenen‹ oder Erzähleinheiten<br />
weggenommen werden, bleibt nichts übrig.<br />
Alles ist ersetzbar. Ist das die Erzählung der<br />
Zukunft?<br />
Bei einer näheren Betrachtung <strong>von</strong> Erscheinungen wie<br />
Youtube oder Blogs wird deutlich, dass diese sich aus<br />
der Weisheit der Massen nähren, die nicht zentral geleitet<br />
wird wie ein aristotelischer Erzählentwurf. Sie sind<br />
vielmehr selbstorganisierend, tragen aber am Ende dennoch<br />
ein hohes Maß an Weisheit in sich. Ein einzelner Blog<br />
für sich mag nur eine Aneinanderreihung kleiner Lichter<br />
sein, aber die Blogosphäre als Ganzes versteht es, die<br />
Wahrheit einer Situation äußerst wirkungsvoll offen zulegen.<br />
Google greift nicht auf einen eigenen Karteikasten<br />
zurück, um zu entscheiden, welcher Link erscheint, wenn<br />
du nach einem Elefanten suchst – es ist ein selbstorganisierendes<br />
System, das auf den Entschei dungen <strong>von</strong><br />
Millionen Menschen beruht. Es zapft in der Tat die<br />
Weisheit der Massen an. Und so ermöglichen uns diese<br />
neuen Technologien, aus der Gesamtheit unserer Geister<br />
einen Übergeist zu schaffen, der selbst den hellsten Geist<br />
zu übertreffen vermag. Der Unterschied zwischen<br />
einzelnen Menschen ist nicht so groß, aber wenn du wirklich<br />
Millionen <strong>und</strong> Abermillionen <strong>von</strong> Menschen anzapfen<br />
kannst, führt das zu Einsichten, die anders niemals<br />
möglich wären. Geschichtenerzählen hat seine Grenzen,<br />
wie man am Beispiel <strong>von</strong> Hollywood sehen kann, wo es ein<br />
ganz bestimmtes Muster gibt, das zum Beispiel am Ende<br />
die Liebe siegt, <strong>und</strong> bestimmte Regeln, so dass du schon<br />
erkennen kannst, wie die Geschichte ausgehen wird,<br />
auf der Gr<strong>und</strong>lage dieser alles bestimmenden Muster.<br />
Das wirkliche Leben ist meistens unordentlicher. Obwohl<br />
die Menschen eine Vorstellung <strong>von</strong> der Geschichte ihres<br />
eigenen Lebens haben, wobei sie darüber häufi g die eigentliche<br />
Komplexität ihres Lebens übersehen. Ich glaube,<br />
wir können zu tieferen Einsichten gelangen, indem wir uns<br />
mit der ungeordneten Wirklichkeit beschäftigen. Es gibt<br />
einen Inhalt, der über irgendwelche Filmchen auf Youtube<br />
<strong>und</strong> den Inhalt <strong>von</strong> Blogs hinaus geht, der aus gegenseitiger<br />
Interaktion besteht <strong>und</strong> selbstorganisierend ist,<br />
<strong>und</strong> dieser Inhalt führt zu tiefen Einsichten.
WAS DU WISSEN SOLLTEST (DAS GESTALTEN) 22<br />
» DIE SUPPE MUSS<br />
UMGERÜHRT WERDEN «<br />
Ein E-Mail-Interview mit<br />
Steffen Schuhmann,<br />
die Fragen stellte <strong>Vera</strong> <strong>Tollmann</strong><br />
— Wie wichtig ist so etwas wie Zukunft heute eigentlich<br />
noch? Ähnelt unser Leben nicht dem <strong>von</strong> ›Lola rennt‹? –<br />
Jeder Tag bringt h<strong>und</strong>erte Situationen, aus denen sich erst<br />
die Richtung des nächsten Tages ergibt. Ist dabei ein<br />
Zeithorizont, wie er einmal mit dem Wort Zukunft<br />
umschrieben wurde, nicht längst aus dem Blick geraten?<br />
— Mir nicht.<br />
— Auch weil wir mehr <strong>und</strong> mehr dazu übergegangen sind,<br />
ad hoc zu entscheiden.<br />
— Ich versuche ad hoc zu vermeiden – das bringt auf lange<br />
Sicht (Zukunft!) nichts.<br />
— Wie wichtig ist für Dich ein Nachdenken über die<br />
Zukunft?<br />
— Zukunft beschäftigt mich ganz gewaltig. Ich arbeite in einem<br />
Kollektiv <strong>von</strong> Designern. Wir sind überzeugt, dass unser Tun<br />
<strong>und</strong> Lassen unter anderem auch eine politische Dimension<br />
hat – <strong>und</strong> Politik heißt Zukunft verhandeln. Unsere Maxime ist:<br />
Wir arbeiten an Entwürfen für eine bessere Welt. Viel mehr<br />
Zukunftsmusik geht nicht, oder?<br />
— Wie stellt Ihr Euch denn die bessere Welt vor? Wie sehen<br />
Eure Entwürfe aus? Orientiert Ihr Euch dabei an<br />
den Visionen der Moderne oder woran knüpft Ihr an?<br />
— Die Moderne – nett. Sie hat ein so positives Menschenbild.<br />
Das ist mir sympathisch. Anknüpfen möchte ich aber lieber am<br />
Konkreten, an einem Gespräch vor einem Dorfkiosk, an eine<br />
Randnotiz in der Zeitung, an Fragen <strong>von</strong> Leuten, die uns bitten,<br />
sie zu unterstützen. Aus drei Problemen lässt sich eine Lösung<br />
machen. Wir haben zum Beispiel aus Leerstand, fehlendem<br />
Austausch zwischen Studenten <strong>und</strong> mangelndem kulturellen<br />
Angebot in Frankfurt/Oder das ›verbuendungshaus fforst‹<br />
entwickelt – ein selbstverwaltetes, internationales Studentenwohnheim<br />
an der Oder. Darauf kann man nun trefflich seine<br />
jeweilige Vision einer besseren Welt projizieren. Vielleicht<br />
ist es sogar ein Beitrag zum Klimaschutz, indem es Ressourcen<br />
schont. Jeder darf sich da was wünschen … Fakt ist aber:<br />
Es reagiert auf einen konkreten Bedarf. Wohnheimplätze zu<br />
polnischen Preisen in der Frankfurter Innenstadt gab es bisher<br />
nicht. – Unsere Entwürfe sind keine Masterpläne. Sie sind<br />
Beispiele. Sie sind pragmatisch, sie sind realisierbar, sie laden<br />
ein, sie nachzumachen.<br />
— Ist das Beispiel Frankfurt/ Oder prototypisch für Eure<br />
Arbeitsweise?<br />
— Was dort geklappt hat – mit den Möglichkeiten visueller<br />
Kommunikation <strong>und</strong> dem Vermitteln <strong>von</strong> konkretem Wissen,<br />
eine langlebige Struktur zu etablieren –, ist für uns zumindest<br />
ein Maßstab für vergleichbare Projekte.<br />
— In ihrem Buch ›Wir nennen es Arbeit – die digitale<br />
Bohème oder intelligentes Leben jenseits der Festanstellung‹<br />
proklamieren Holm Friebe <strong>und</strong> Sascha Lobo, dass die<br />
Zukunft in der flexiblen selbstständigen <strong>und</strong> digitalen<br />
Arbeit liegt, sie lebten bereits deren Prototyp. Wie stehst Du<br />
zu diesem zukunftsoptimistischen Konzept?<br />
— Ich habe in den letzten Jahren kein ärgerlicheres Buch<br />
gelesen als ›Wir nennen es Arbeit‹. Die ZIA [Zentrale<br />
Als Reaktion auf den ›Aufstand der<br />
Anständigen‹ im Herbst 2000 fand sich<br />
an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee<br />
eine Arbeitsgruppe junger Kommunikationsdesigner<br />
zusammen, die mit<br />
›Anschlaege gegen Rechts?‹ das erste<br />
Projekt erarbeitete, das unter<br />
www.anschlaege.de veröffentlicht wurde.<br />
In Berlin Hellersdorf bezogen die drei<br />
Gestalter – Axel Watzke, Christian Lagé<br />
<strong>und</strong> Steffen Schuhmann – 2003 für<br />
Intelligenz-Agentur] ist ein gutes Beispiel für erfolgreiche<br />
Kreative. Für ihren kollektiven Ansatz, ihre vorzeigbaren Erfolge<br />
ver dienen sie allen Respekt. Aber es ist völlig größen wahnsinnig,<br />
dieses Modell zu verallgemeinern (insbesondere über<br />
die eigene Branche hinaus) <strong>und</strong> sich selbst zur Avantgarde zu<br />
krönen. Ein Modell für die Kastanienallee ist kein Modell.<br />
Ich zum Beispiel arbeite in Lichtenberg. Und andere sind ar beitslos<br />
in Zittau oder Bremerhaven.<br />
— Was denkst Du, wie Du in Zukunft Geld verdienen wirst?<br />
— Bisher verdiene ich mein Geld mit Gestaltung. Da mir<br />
das Freude macht, möchte ich dieses Modell in die Zukunft<br />
verlängern.<br />
— Du hast in Berlin an der Publikation ›Plan B. Kultur<br />
wirtschaft in Berlin‹ mitgearbeitet, die sich mit dem<br />
kulturellen Bereich als Arbeitsfeld beschäftigt. Zu welchem<br />
Ergebnis seid Ihr dabei gekommen?<br />
— Das Buch hat über 400 Seiten <strong>und</strong> arbeitet nicht auf ein<br />
finales Statement, sondern auf eine ganze Bandbreite <strong>von</strong> Standpunkten<br />
<strong>und</strong> Äußerungen hin – es streut eine ganze Reihe<br />
Zweifel, Scherze <strong>und</strong> Vorschläge in die Kulturwirtschaftsdebatte.<br />
Zum Beispiel: Sind Selbstständige, die weniger als ein<br />
Busfahrer verdienen, eigentlich Unternehmer? Was kostet<br />
Kreativität? Wie kann man sich ökonomisch organisieren, um<br />
tatsächlich vorwärts zu kommen? Hat Berlin wirklich Interesse<br />
an einer Entwicklung <strong>von</strong> Kreativwirtschaft, oder braucht die<br />
Stadt die Kreativen nur als Hefe im Immobilienmarkt?<br />
— Neulich lautete ein Vorschlag einer Münchner Konferenz<br />
zur Zukunft der Städte, dass man als Reaktion auf<br />
die globale Erderwärmung Reihen <strong>von</strong> Häusern abreißen<br />
könnte, um Lüftungsschneisen zu generieren. Im Zu sammenhang<br />
mit Eurem ›Dostoprimetschatjelnosti‹-Projekt<br />
wurdet Ihr bestimmt oft gefragt, wie die Städte der Zukunft<br />
aussehen könnten?<br />
— Klar. Aber bei ›Dostoprimetschatjelnosti‹ ging es weniger<br />
um eine Zukunftsversion für Städte im Allgemeinen. Es<br />
ging darum, das Potential <strong>von</strong> Plattenbauten zu untersuchen<br />
<strong>und</strong> in der Folge, dem medial vorbereiteten Massenabriss<br />
dieser Häuser zur Mietpreisstabilisierung in den Arm zu fallen.<br />
— Was sind denn für Dich urbane Zukunftsvisionen, <strong>und</strong><br />
was könnte das Baumaterial der Zukunft sein?<br />
— Stärkere Besteuerung <strong>von</strong> Erbe <strong>und</strong> Kapitalerträgen. Zerschlagung<br />
<strong>von</strong> Monopolen. Die Suppe muss umgerührt werden.<br />
Chancengleichheit ist das ›Baumaterial‹. Der Rest ist – zugespitzt<br />
– Kosmetik an der Stadt. Was nicht heißt, dass man damit<br />
nichts erreichen kann.<br />
— Was könnte das konkret heißen oder wie stellst Du Dir<br />
die Umsetzung vor? Sozialistische Prinzipien in unsere<br />
neoliberale Marktwirtschaft unterzubringen? Oder denkst<br />
Du an die Revolution?<br />
— Wenn eine Bürogemeinschaft einen gemeinsamen Kopierer<br />
hat, könnte man dies als einen Schritt hin zur Vergesel lschaftung<br />
<strong>von</strong> Produktionsmitteln deuten. Dieselbe Bürogemeinschaft<br />
beschäftigt jedoch unter Umständen auch ein<br />
halbes Dutzend unbezahlter Praktikanten. Was ist das nun?<br />
mehrere Wochen mit dem Titel<br />
›Dostoprime tschatjel nosti‹ [russ. Sehenswürdig<br />
keiten] einen zum Abriss<br />
bestimmten Platten bau <strong>und</strong> luden dazu<br />
inter nationale Künstler <strong>und</strong><br />
Künstlerinnen ein. Die seit Bestehen<br />
<strong>von</strong> anschlaege.de realisierten Projekte<br />
haben eines gemein sam: Sie greifen<br />
mit den Mitteln <strong>von</strong> Gestaltung direkt<br />
in gesellschaftliche Situationen <strong>und</strong><br />
politische Debatten ein.<br />
Sozialistisch? Neoliberal? – Meiner Meinung nach, kommen wir<br />
nicht viel weiter, wenn wir <strong>von</strong> ›sozialistischen Prinzipien‹, ›neoliberaler<br />
Marktwirtschaft‹ oder ›Revolution‹ reden, weil diese<br />
Begriffe nicht mehr durchschlagen, nicht mehr kon kret verwendet<br />
<strong>und</strong> verstanden werden. Steuerrecht (darin steckt ja mit<br />
etwas Phantasie das Verb ›steuern‹) dagegen ist sehr konkret.<br />
Ein Kartellamt ist auch nichts Abstraktes. Wir haben sogar eine<br />
Verfassung, in der die Sozialbindung des Eigentums verankert<br />
ist. Eine Struktur ist also im Gr<strong>und</strong>e angelegt – es gilt ihre<br />
Möglichkeiten auszureizen. Die Verfassung wörtlich zu nehmen,<br />
ist nicht revolutionär. Allerdings wurde 1989 in der DDR an fangs<br />
auch nur eingefordert, was in der Verfassung verbrieft war.<br />
— Die funktional geordnete Stadt der Moderne hat ausgedient,<br />
weil ja auch das eigene Leben nicht mehr funktional<br />
geordnet ist. Alexander Mitscherlich meinte schon Anfang<br />
der siebziger Jahre, dass die Funktionstrennung viel<br />
zu viel Zeit kosten würde. Am besten wäre heute ein Arbeits-<br />
<strong>und</strong> Wohnhaus mit Kindergarten direkt gegenüber. –<br />
Seid Ihr nicht sogar mit Euren Büros in einen ehemaligen<br />
Kindergarten eingezogen?<br />
— Das Schöne an der Stadt der Moderne ist doch, dass sie ein<br />
utopisches Potential hat. Dass sie dienen möchte, nicht beherrschen.<br />
Unser Atelier befindet sich in einem ehemaligen<br />
Kindergarten in Berlin-Lichtenberg. Wir sitzen in einer Mustersiedlung<br />
aus den sechziger <strong>und</strong> siebziger Jahren. Die kann man<br />
sehr gut nutzen. Man muss nur die Möglichkeiten der vorhandenen<br />
Räume entdecken. Unsere Erfahrung dabei: Diese<br />
Räume lassen viel zu. Gerade ein gemeinsames, interdiszi plinäres<br />
Arbeiten ist hier viel leichter als in den Ladenlokalen<br />
der Gründerzeitstadt. Und die soziale Infrastruktur (Kindergärten!)<br />
ist in diesen Gegenden sehr gut ausgebaut. Die<br />
Trennung <strong>von</strong> Wohn- <strong>und</strong> Arbeitsort ist wichtig. Sie ermöglicht<br />
Feierabend, Freizeit, Regeneration, soziale Kontakte,<br />
auch über das eigene Milieu hinaus (das ist das Problem bei<br />
Holm Friebe), Bildung.
WAS DU WISSEN SOLLTEST (DIE ATMOSPHÄRE)<br />
GESPENSTER<br />
<strong>Anne</strong> <strong>König</strong><br />
Kursdorf, den 11. April 2008<br />
Es ist schwierig, im Dorf eine Kochplatte zu<br />
finden, die noch funktioniert. Ein Mann<br />
hat mich mit einem vielsagenden Blick in die<br />
Sechs verwiesen. Ich schiebe meinen Kinderwagen<br />
die Dorfstraße entlang. Bei den<br />
meisten Häusern sind die Rollläden heruntergelassen.<br />
Ob sie noch bewohnt sind, kann<br />
man nicht genau erkennen. Hinter den Eigenheimen<br />
auf der rechten Straßenseite steht eine<br />
hohe rote Mauer, die Grenze zum Flughafen.<br />
Während ich durchs Dorf laufe, fährt im<br />
Schritttempo hinter der Mauer ein Flugzeug,<br />
<strong>von</strong> dem man nur den oberen Teil sieht.<br />
Wie eine Haifischflosse schiebt es sich über<br />
dem Mauerrand <strong>und</strong> den Dächern der Häuser<br />
entlang. An dem Heckflügel ist als Logo<br />
ein schematisierter Globus angebracht. Diese<br />
Fluglinie habe ich noch nie gesehen. Ihren<br />
Namen kann ich nicht lesen, er wird <strong>von</strong> der<br />
Mauer verdeckt.<br />
Haus Sechs steht am Rande des<br />
Dorfes. Es ist ein verlassenes Eigenheim mit<br />
einem veralgten Tümpel im Garten. Hinterm<br />
Zaun gackern ein paar Hühner. Wer die<br />
hier wohl versorgt? In Kursdorf wohnten bis<br />
vor wenigen Jahren noch 300 Menschen. Jetzt<br />
sind es nur noch 50. Mit dem Ausbau das<br />
Flughafens Leipzig/ Halle verschlechterte sich<br />
die Wohnsituation für die Kursdorfer erheblich.<br />
Denn der kleine Ort mit einer Feldsteinkirche<br />
aus dem 14. Jahrh<strong>und</strong>ert lag plötzlich<br />
direkt zwischen den Rollfeldern. Die Flughafen<br />
GmbH bot den Bewohnern neue<br />
Gr<strong>und</strong>stücke im Nachbarort an <strong>und</strong> kaufte die<br />
Häuser <strong>von</strong> den Leuten ab, die gern umziehen<br />
wollten. Jetzt stehen die meisten Eigenheime<br />
schon leer.<br />
Hier haben alle Häuser einen Teich,<br />
sagt die Assistentin, die mir fre<strong>und</strong>lich die<br />
Tür <strong>von</strong> Haus Sechs aufschließt. Ein weiß gefliester<br />
Flur mit kleiner Treppe führt ins Haus.<br />
Ich stelle meinen Kinderwagen ab <strong>und</strong> nehme<br />
meine Tochter heraus. In der Küche befindet<br />
sich eine kleine Kochstelle. Zwei Herdplatten<br />
stehen auf übereinander gestapelten<br />
roten Getränkekisten. Leere Marmeladengläser<br />
<strong>und</strong> Weinflaschen sind an die Fußbodenleiste<br />
geschoben. In der Mitte des Raums ist ein alter<br />
Tisch mit Sitzgelegenheiten aus roten<br />
Getränke kisten. Ein universelles Möbel, aber<br />
mit unbequemer Sitzfläche. War nicht <strong>von</strong><br />
Stühlen die Rede? Ich schiebe eine herumliegende<br />
Zeitung unter. Das Geschirr wird im<br />
Bad gespült – die einzige Stelle im Haus,<br />
wo noch Wasser fließt. Das größte Zimmer in<br />
der unteren Etage ist mit roter Teppichware<br />
ausgelegt, neben dem Kamin liegen ein paar<br />
Holzscheite – so, als hätten sie die früheren<br />
Besitzer dort liegen gelassen. Oder haben<br />
die neuen Bewohner schon kalte Füße bekommen<br />
<strong>und</strong> sich an den sorgsam aufge schichteten<br />
Holzscheiten im Garten bedient, um das<br />
ausgekühlte Haus zu beheizen? Was wäre,<br />
wenn plötzlich die früheren Besitzer in der Tür<br />
stünden? Und was ist eigentlich mit den<br />
Hühnern im Garten? Diese Gedanken kämpfe<br />
ich gleich in mir nieder, weil ich hier nichts<br />
zu suchen habe – außer einer funktionierenden<br />
Kochplatte. Ich kratze aus einem Topf die<br />
festgeklebten Essenreste vom Vortag <strong>und</strong><br />
spüle ihn im Bad aus. Mit dem Geschirrhandtuch<br />
wische ich das Gefäß mehrmals ab,<br />
aber es trocknet nicht. Der Handtuchstoff<br />
fühlt sich neu an, als ob er noch nicht<br />
gewaschen wurde. Ich stelle den feuchten Topf<br />
auf den Ofen. Auf der heißen Herdplatte<br />
zischen die Wassertröpfchen. Der Gemüsebrei<br />
benötigt mindestens eine Viertelst<strong>und</strong>e, bis<br />
er im Wasserbad erwärmt ist. Ich breite meine<br />
Jacke auf dem Fußboden aus <strong>und</strong> lege mein<br />
Kind darauf. Es weint. Babys sind erbarmungs -<br />
los. Wenn ihnen eine Atmosphäre nicht gefällt,<br />
schreien sie solange, bis man geht.<br />
Meist fluchtartig. Ich kann hier nicht sofort<br />
verschwin den, sondern muss warten, bis<br />
das Essen warm ist. Ich nehme sie wieder auf<br />
den Arm, sie beruhigt sich. Ich schaue<br />
mich etwas um.<br />
Die universellen roten Getränkekisten<br />
bilden den Unterbau für mehrere Betten, die<br />
im ehemaligen Wohnzimmer stehen. Die weiß<br />
bezogenen Kissen <strong>und</strong> Decken sind über ein-<br />
Oben: Filmstill aus ›Die innere Sicherheit‹<br />
(2001) <strong>von</strong> Christian Petzold<br />
Unten: Kursdorf 2008, Foto <strong>Jan</strong> Wenzel<br />
ander geworfen. Daneben liegen große<br />
blaue Ikea-Tüten, aus denen Schuhe, Bücher,<br />
Stadtpläne <strong>und</strong> Anziehsachen herausschauen.<br />
Dieses Interieur hat etwas Improvisiertes,<br />
aber nicht wie beim Zelten auf dem Campingplatz<br />
oder in einer Berghütte, wo man sich<br />
freiwillig mit Wasser aus der Regentonne<br />
wäscht <strong>und</strong> auf ein Plumpsklo geht, weil es<br />
ja romantisch ist, auch mal so ganz einfach zu<br />
leben. Nein, in diesem Haus herrscht eine<br />
erzwungene, unfreiwillige Improvisation – an<br />
den Geschirrtüchern kleben noch die<br />
Preisschilder, die Bettwäsche kommt direkt<br />
aus der Verpackung, das Mobiliar besteht aus<br />
praktischen Getränkekisten, die man rasch<br />
wieder ihrer ursprünglichen Verwendung<br />
zuführen kann. Die Gegenstände hier scheinen<br />
nur für einen vorübergehenden Zweck an geschafft<br />
worden zu sein, für eine kurze<br />
Zwischen zeit, um sie dann schnell wieder zu<br />
entsorgen. Das Haus gleicht einem Lager,<br />
das sich über zwei Etagen breit gemacht hat.<br />
Mir fällt eine Filmsequenz aus<br />
›Die innere Sicherheit‹ <strong>von</strong> Christian Petzold<br />
ein, die Stelle, als die halbwüchsige Tochter<br />
den letzten bewohnbaren Unterschlupf für ihre<br />
Familie findet. Die Eltern sind seit Jahren auf<br />
der Flucht, haben kein Geld mehr <strong>und</strong> stehen<br />
kurz vor dem endgültigen Aus. Die fünfzehnjährige<br />
Jeanne hat sich an der portugiesischen<br />
Küste in Heinrich, einen deutschen Surfer,<br />
verliebt. Er erzählt ihr <strong>von</strong> der Villa Stahl<br />
in Hamburg – einem leer stehenden Haus mit<br />
Swimming Pool mitten im Wald. Die Villa wird<br />
zum letzten Zufluchtsort für die Familie.<br />
In der Nacht beobachten die drei vom Auto<br />
aus, wie sicher die Gegend ist. Der Vater hat<br />
einen Plan der benachbarten Häuser gezeichnet<br />
<strong>und</strong> notiert, in welchen Fenstern das<br />
Licht ausgeht. Als alles dunkel ist, betreten<br />
die drei die Villa. Der Vater bricht die Glastür<br />
<strong>von</strong> der <strong>Vera</strong>nda mit einem Brecheisen auf, die<br />
Tochter hält die Taschenlampe. Er prüft den<br />
Sicherungskasten <strong>und</strong> schaltet den Strom ein.<br />
Sie laufen durch das verlassene Haus <strong>und</strong><br />
inspizieren die Räume, die spärlich ein gerichtet<br />
sind. Betten <strong>und</strong> Sessel sind mit weißen<br />
Bettlaken verhängt. Im Flur stehen braune<br />
Ledersessel, die der Platz für das 24-stündige<br />
Wache-Halten werden. Die Familie schlägt ihr<br />
Lager in der Villa auf. Für wie lang, das ist<br />
ungewiss. Der Vater versteckt das Auto.<br />
Das Haus ist ein Transitraum mit funktionstüchtigem<br />
Fluchtweg <strong>und</strong> Notausgang.<br />
Ich rühre den Gemüsebrei mit einem<br />
Löffel um. Beim Blick aus dem Fenster sehe<br />
ich den leer stehenden griechischen Gasthof,<br />
der gleich neben dem Rollfeld vis-á-vis<br />
<strong>von</strong> Haus Sechs steht – nur ein brachliegendes<br />
Feld trennt die beiden Gebäude. Wer wohnt in<br />
diesem Dorf noch, wo alle Häuser verlassen<br />
wirken <strong>und</strong> man nicht weiß, ob die Rollläden<br />
herunter gelassen sind, weil niemand mehr da<br />
ist oder gerade, weil doch noch jemand da<br />
ist? Haben sich die letzten Kursdorfer hinter<br />
ihren fest verschlossenen Toren <strong>und</strong> Fenstern<br />
24<br />
verschanzt, um im Gesamtbild des Ortes<br />
nicht aufzufallen? Sind es ein paar Alte,<br />
die der Lärm <strong>und</strong> das Kerosin in der Luft nicht<br />
vertreiben konnten? Wer würde freiwillig<br />
hierher ziehen, wo die Flugzeuge bedrohlich<br />
nah vor dem Wohnzimmerfenster entlang<br />
rollen <strong>und</strong> das Dröhnen der Motoren das<br />
veralgte Wasser im Tümpel erzittern lässt? Ein<br />
Ort, an dem man sich nicht länger niederlassen<br />
möchte. Ein Transitraum für diejenigen,<br />
die immer schnell die Zelte ab brechen müssen.<br />
Der Flughafen vor der Haus tür als ideale<br />
Fluchtmöglichkeit?<br />
Aus Vorsicht wird allein Jeanne zum<br />
Einkaufen in die Stadt geschickt. Sie ist<br />
unverdächtig, deshalb muss sie die Familie<br />
versorgen. Die Fünfzehnjährige, die in ihrem<br />
Leben nie eine richtige Schule besucht hat,<br />
nutzt die täglichen Einkäufe, um Gleichaltrigen<br />
zu begegnen. Mit Plastiktüten bepackt streift<br />
sie durch Musikläden <strong>und</strong> Modegeschäfte<br />
<strong>und</strong> rennt erschrocken da<strong>von</strong>, als eine<br />
Alarmanlage anspringt, weil sie CDs geklaut<br />
hat. Sie schaut sich um, ob ihr jemand gefolgt<br />
ist. Ohne weitere Zwischenfälle bringt sie das<br />
Diebesgut <strong>und</strong> die Einkäufe in die Villa.<br />
Sie geht nicht durch den Vordereingang ins<br />
Haus, sondern klettert <strong>von</strong> einem Waldweg<br />
aus über den Zaun ins Gr<strong>und</strong>stück. Die<br />
Nachbarn haben noch nichts <strong>von</strong> den heimlichen<br />
Bewohnern bemerkt.<br />
Der Gemüsebrei ist endlich warm.<br />
Ich schütte das Glas in einen Teller <strong>und</strong> verbrenne<br />
mir die Finger. Als ich mich mit meiner<br />
Tochter auf einer der roten Sitzkisten in<br />
der Küche niedergelassen habe, klappt plötzlich<br />
die Haustür. Ich schrecke zusammen.<br />
Eine Stimme ruft vom Treppenhaus: »Bei Euch<br />
ist alles klar? Bleibt mal schön im Warmen.«<br />
Energische Schritte stapfen die Treppe hoch.<br />
Nach zwei Minuten geht die Klospülung.<br />
Gleich wird sie vor mir stehen, denke ich.<br />
Jeanne trifft in Hamburg Heinrich, den<br />
Surfer <strong>von</strong> der portugiesischen Küste, wieder.<br />
Er wohnt in einem Jugendheim unweit der<br />
Villa Stahl. Das jahrelange Versteckspiel fliegt<br />
auf, als Jeanne ihm gesteht, dass ihre<br />
Familie keiner Sekte angehört, sondern im<br />
Untergr<strong>und</strong> lebt.<br />
Die junge Frau trägt einen kurzen<br />
Rock <strong>und</strong> schwarze Lederstiefel. Sie<br />
wirkt etwas über dreht. Entrüstet erzählt sie<br />
mir, dass die letzte Nacht die schlimmste in<br />
ihrem Leben gewesen ist. Kein Auge habe sie<br />
vor Kälte zuge macht. Wirklich, es sei die<br />
schlimmste Nacht gewesen. Die Schlimmste,<br />
wiederhole ich. Das kommt vor. Ich frage,<br />
was sie hier macht. Sie hilft dem Koch beim<br />
Catering, aber eigentlich ist sie Schauspielerin.<br />
Meine Tochter reagiert auf die fremde<br />
Frau gereizt, sie zappelt auf meinem Schoß<br />
herum <strong>und</strong> isst ihren Gemüsebrei nicht.<br />
Ich rede ihr gut zu: Einen Löffel für Luise,<br />
einen für die bunte Wiese, einen für den<br />
Osterhas’, der auf dieser Wiese saß, einen<br />
Löffel für den Hans, einen für den<br />
Katzenschwanz, einen für die kleine Maus,<br />
einen für das große Haus ...