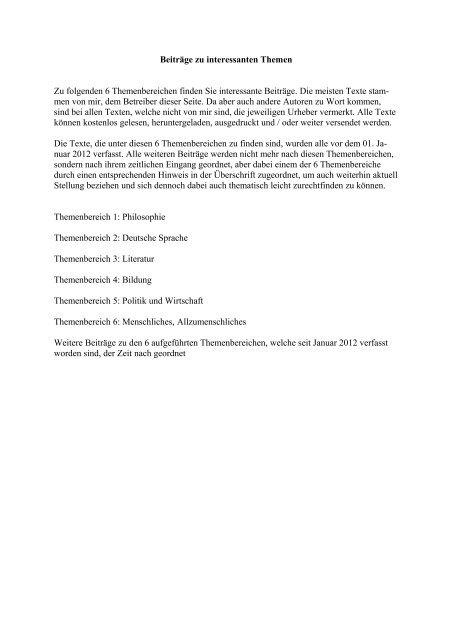Gesamttext als PDF-Datei - Dr. Bottke
Gesamttext als PDF-Datei - Dr. Bottke
Gesamttext als PDF-Datei - Dr. Bottke
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Beiträge zu interessanten Themen<br />
Zu folgenden 6 Themenbereichen finden Sie interessante Beiträge. Die meisten Texte stammen<br />
von mir, dem Betreiber dieser Seite. Da aber auch andere Autoren zu Wort kommen,<br />
sind bei allen Texten, welche nicht von mir sind, die jeweiligen Urheber vermerkt. Alle Texte<br />
können kostenlos gelesen, heruntergeladen, ausgedruckt und / oder weiter versendet werden.<br />
Die Texte, die unter diesen 6 Themenbereichen zu finden sind, wurden alle vor dem 01. Januar<br />
2012 verfasst. Alle weiteren Beiträge werden nicht mehr nach diesen Themenbereichen,<br />
sondern nach ihrem zeitlichen Eingang geordnet, aber dabei einem der 6 Themenbereiche<br />
durch einen entsprechenden Hinweis in der Überschrift zugeordnet, um auch weiterhin aktuell<br />
Stellung beziehen und sich dennoch dabei auch thematisch leicht zurechtfinden zu können.<br />
Themenbereich 1: Philosophie<br />
Themenbereich 2: Deutsche Sprache<br />
Themenbereich 3: Literatur<br />
Themenbereich 4: Bildung<br />
Themenbereich 5: Politik und Wirtschaft<br />
Themenbereich 6: Menschliches, Allzumenschliches<br />
Weitere Beiträge zu den 6 aufgeführten Themenbereichen, welche seit Januar 2012 verfasst<br />
worden sind, der Zeit nach geordnet
1. Philosophie<br />
Inhaltsverzeichnis<br />
1.1. Einleitung<br />
1.2. Grundsätzliche Fragen der Menschheitsgeschichte<br />
1.3. Grundlagen und Grenzen menschlichen Denkens<br />
1.4. Wertungen in der Wissenschaft<br />
1.5. Willensfreiheit<br />
1.6. Sinnlosigkeit nein danke<br />
2. Deutsche Sprache<br />
2.1. Einleitung<br />
2.2. Fiktiver Trialog zur Deutschen Sprache<br />
2.3. Artikel aus den ‚Sprachnachrichten’ des ‚Verein Deutsche Sprache e.V. (VDS)’<br />
2.3.1. „Liebe Sprachfreunde“, von Walter Krämer, Bundesvorsitzender des VDS;<br />
Ausgaben Juni 2008, Nummer 38, Seite 2<br />
2.3.2. „Die Störanfälligkeit wächst“, von Hartmut Heuermann, Ausgabe Juni 2008,<br />
Nummer 38, Seite 5<br />
2.3.3. „Imponierende Wissenschaft“, von Oliver Baer, Ausgabe Juni 2008, Nummer 38,<br />
Seite 9<br />
2.3.4. „Denglisch kostet bares Geld“, von Rainer Pogarell, Ausgabe Juni 2008,<br />
Nummer 38, Seite 17<br />
2.3.5. „Für die Gleichstellung der deutschen Sprache in der EU“, von Gerd Schrammen,<br />
Ausgabe Juni 2008, Nummer 38, Seite 25<br />
2.3.6. „Deutsch ins Grundgesetz“, von Walter Krämer, Bundesvorsitzender des VDS,<br />
Ausgabe Oktober 2008, Titelseite<br />
2.3.7. „Liebe Sprachfreunde“, von Walter Krämer, Bundesvorsitzender des VDS,<br />
Ausgabe Oktober 2008, Seite 2<br />
2.3.8. „Anpassung <strong>als</strong> Identitätsverlust“, von Walter Krämer, Bundesvorsitzender des VDS,<br />
Aushabe Dezember 2008, Seite 12<br />
2.4. Weitere Beiträge zum Thema<br />
2.4.1. Der ‚Pageturner’, von Julia Dorndorf<br />
2.4.2. ‚Kaffee to go’, von Julia Dorndorf<br />
3. Literatur<br />
3.1. Einleitung<br />
3.2. Herodot und Thukydides<br />
3.3. Johann Wolfgang von Goethe, von Marco Schäfer<br />
3.4. Thomas Mann, von Marco Schäfer<br />
3.5. Franz Kafka, von Marco Schäfer
4. Bildung<br />
4.1. Einleitung<br />
4.2. Einige Gedanken zum deutschen Schulsystem<br />
4.3. Zumeist ein Trauerspiel: Wie Politiker(innen), Parteien sowie deren Jugendorgani<br />
sationen und die Parteistiftungen auf konstruktive Vorschläge und Initiativen zum<br />
Thema ‚Bildung’ reagieren<br />
4.3.1. Bildungsportal<br />
4.3.2. Bildungsinitiative ‚Dummheit-nein-danke’<br />
4.3.3. Unentbehrliche Grundlagen im Fach Mathematik: Wie sich Politiker(innen) einer sehr<br />
sinnvollen Initiative verweigern<br />
4.3.4. Ein offener Brief von enttäuschten Schülern an verantwortliche Politikerinnen<br />
5. Politik und Wirtschaft<br />
5.1. Einleitung<br />
5.2. Demokratie – die einzig legitime Staatsverfassung<br />
5.3. Deutscher Föderalismus – Wie eine gute Idee sehr schlecht umgesetzt wird<br />
5.4. Europäische Union<br />
5.5. Eurokrise I<br />
5.6. Eurokrise II<br />
5.7. Eurokrise III<br />
5.8. Kreditkrise für Dummies, von einem anonymen Verfasser<br />
5.9. Fünf Populäre Irrtümer über die Wirtschaft<br />
5.9.1. Irrtum 1<br />
5.9.2. Irrtum 2<br />
5.9.3. Irrtum 3<br />
5.9.4. Irrtum 4<br />
5.9.5. Irrtum 5<br />
5.9.6. Reaktionen der im Bundestag vertretenen Parteien, des DGB, des Verbandes der<br />
Familienunternehmer sowie des Bundes der Steuerzahler auf eine Anfrage von<br />
Schülerinnen und Schülern im Rahmen der von mir organisierten Wirtschaftsarbeitgemeinschaften<br />
zum Thema des ersten Irrtums (s.o.) im Jahre 2008<br />
5.10. Anzustrebende Wirtschaftsordnung: Soziale und ökologische Marktwirtschaft<br />
5.11. Freiheit und Verantwortung<br />
5.12. Wie sich Deutschland und Europa von der Zukunft verabschieden<br />
5.13. Umsatzbasierte Unternehmenssteuer – Ein Befreiungsschlag aus dem Steuerdickicht
6. Menschliches, Allzumenschliches<br />
6.1. Einleitung<br />
6.2. Schule<br />
6.2.1. Die engagierte Lehrerin<br />
6.2.2. Der selbstkritische Lehrer<br />
6.2.3. Der jammernde Lehrer<br />
6.2.4. Die müde Masse<br />
6.2.5. Ein wirklich böser Lehrer<br />
6.2.6. Die überengagierten Eltern<br />
6.2.7. Der abwimmelnde Lehrer<br />
6.3. Hochschule<br />
6.3.1. Der ewige Student<br />
6.3.2. Der schmierige BWL-Student, von Marco Schäfer<br />
6.3.3. Das Jurahäschen, von Marco Schäfer<br />
6.4. Wohngemeinschaft<br />
6.4.1. Der still Leidende<br />
6.4.2. Der gute Geist<br />
6.4.3. Der Kotzbrocken<br />
6.5. Arbeitsplatz<br />
6.5.1. Der vorbildliche Chef<br />
6.5.2. Der Chef <strong>als</strong> Diktator<br />
6.5.3. Der fleißige, unauffällige und ordentliche Mitarbeiter<br />
6.5.4. Die Klatschtante<br />
7. Weitere Beiträge zu den 6 aufgeführten Themenbereichen, welche seit Januar 2012<br />
verfasst worden sind, der Zeit nach geordnet<br />
7.1.
1. Philosophie:<br />
1.1. Einleitung:<br />
Hier werden einige meiner Überlegungen zu den Grundlagen und Grenzen menschlicher Erkenntnis<br />
wiedergegeben. Alle Interessierte sind eingeladen mitzudiskutieren. Insbesondere die<br />
Professorenschaft sei ganz im sokratischen Sinne hierzu aufgerufen. Vielleicht kommen alle<br />
Beteiligten ja zu wirklich wegweisenden Erkenntnissen, indem sie sich gegenseitig klug<br />
reden. Ich beanspruche mit meinen Thesen keineswegs alles besser zu wissen <strong>als</strong> andere,<br />
sondern lasse mich gerne eines Besseren belehren. Mein Motto und das damit das dieser<br />
Internetseite lautet:<br />
Ich habe eine Meinung, begründe dieses und stelle sie dann zur Diskussion.<br />
Es sollen nur Argumente und nicht Titel oder Berühmtheit gelten! Also – liebe Professoren,<br />
insbesondere der Philosophie – habt weder Scheu noch gar Angst, Stellung zu beziehen. Seid<br />
wie Sokrates: Geht auf die Menschen zu, beteiligt Euch am aufklärerischen Diskurs und verschanzt<br />
Euch nicht in einem Elfenbeinturm!
1.2. Grundsätzliche Fragen der Menschheitsgeschichte:<br />
Grundsätzliche Fragen der Menschheitsgeschichte:<br />
1. Können wir Menschen überhaupt etwas absolut sicher wissen?<br />
2. Wenn ja, was?<br />
3. Wo liegen die Grenzen unserer Vernunft?<br />
4. Gibt es für unsere rationale Vernunft unauflösliche Widersprüche?<br />
5. Können wir diese unauflöslichen Widersprüche für unsere rationale Vernunft akzeptabel<br />
machen?<br />
6. Gibt es ‚Wahrheit’ für uns Menschen?<br />
7. Wenn es sie nicht gibt, können wir dann überhaupt eine Meinung oder These oder<br />
Theorie einer anderen vorziehen?<br />
8. Ist dann nicht alles gleich richtig oder f<strong>als</strong>ch?<br />
9. Gibt es eine rational begründete Grundlage menschlichen Denkens und darauf aufbauenden<br />
Wissens, selbst wenn sich herausstellen sollte, daß es unauflösliche Widersprüche<br />
sowie keine absolut sichere Grundlage menschlichen Wissens gibt?<br />
10. Gibt es Freiheit für uns Menschen?<br />
11. Gibt es Moral für uns Menschen?<br />
12. Wenn ja, gibt es einen rational begründbaren Maßstab für moralisches Handeln, der<br />
für alle freiheitsbegabten Vernunftwesen und damit auch für uns Menschen gilt?<br />
13. Können wir Menschen diesen Maßstab unabhängig von der Empirie gewinnen?<br />
14. Oder können wir Menschen immer nur aus der Empirie heraus Erkenntnisse gewinnen?<br />
15. Können wir Menschen überhaupt von einem Sein auf ein Sollen schließen?<br />
16. Wäre in einem solchen Fall die Frage nach dem ‚Sollen’ und damit der Moral für uns<br />
Menschen nicht hinfällig, weil dann Sein und Sollen eh Ein und Dasselbe für uns<br />
wären?<br />
17. Gibt es einen Sinn des Lebens für uns Menschen?<br />
18. Wenn ja, worin besteht er?<br />
19. Kann die Sinnfrage letztlich befriedigend ohne den Glauben an einen, absoluten, allwissenden,<br />
allmächtigen und gerechten Gott, der uns in Liebe geschaffen und auf ewig<br />
in Güte zugetan ist, beantwortet werden?<br />
20. Können wir für unsere rationale Vernunft die Allwissenheit und die Allmächtigkeit<br />
Gottes mit der Freiheit für uns Menschen in einen akzeptablen Einklang bringen?<br />
Diese Fragen bewegen die Menschheits- und damit Philosophiegeschichte, schon sehr lange.<br />
Auch ich habe mir diese Fragen immer wieder gestellt und bei den großen Denkern und<br />
Dichtern nach Antworten gesucht. Auf dieser Suche sind mir viele sehr wertvolle Schätze<br />
zuteil geworden. Dafür möchte ich diesen Menschen an dieser Stelle meinen tief empfundenen<br />
Dank abstatten. Ohne sie und ihre genialen Gedanken, niedergelegt in großenartigen<br />
Werken, wäre ich nicht der, der ich heute bin. Trotzdem fand ich auf die oben gegebenen<br />
Fragen – insbesondere wenn man alle 20 zusammennimmt – zunächst keine für mich befriedigenden<br />
Antworten.<br />
So war ich gezwungen, selbst Antworten zu suchen. Ich fand sie schließlich, indem ich – aufbauend<br />
auf den großartigen Leistungen jener großen Denker und Dichter, mit denen ich mich<br />
beschäftigt hatte – an einigen entscheidenden Stellen gewissermaßen Schlußsteine in das<br />
Theoriegebäude einfügte. Dies mag zunächst einmal furchtbar anmaßend klingen. Aber ich<br />
behaupte, daß dem nicht so ist, sondern daß ich diesem selbst gestellten Anspruch gerecht geworden<br />
bin. Aber vielleicht täusche ich mich ja. Daher stelle ich meine Thesen zur Diskussion
und fordere geradezu jeden auf, mich zu widerlegen bzw. an der ein oder anderen Stelle zu<br />
korrigieren; Ergänzungen können ohnehin immer erfolgen, da kein Mensch im Ernst von sich<br />
behaupten kann, er hätte alles Erwähnenswerte selber bereits zum Ausdruck gebracht.<br />
Grundsätzlich verfahre ich <strong>als</strong>o bei all meinen öffentlich geäußerten Ansichten nach folgendem<br />
Prinzip:<br />
Ich habe eine Meinung, begründe diese und stelle sie dann zur Diskussion.<br />
Die ersten neun Fragen beschäftigen sich mit theoretischen Problemen, <strong>als</strong>o kurz zusammengefaßt<br />
mit der Frage: Was kann ich wissen? Oder: Kann ich <strong>als</strong> Mensch überhaupt irgendetwas<br />
wissen? Die Beantwortung dieser Frage(n) ist unter anderem für jegliche Wissenschaft<br />
unabdingbar, weil ansonsten kein Kriterium vorläge, um eine Theorie einer anderen vorzuziehen<br />
und damit jede Meinung – und sei sie nach allgemeiner Auffassung noch so absurd –<br />
gleich wahr bzw. f<strong>als</strong>ch wäre. Schon Aristoteles hielt den Skeptikern seiner Zeit vor, daß, wer<br />
die Existenz von Wahrheit überhaupt leugne, selber davon ausgehe, daß seine Aussage – <strong>als</strong>o<br />
die Leugnung von Wahrheit – wahr sei und sich damit selber widerspreche. Also, gibt es nun<br />
eine Wahrheit, gibt es irgendetwas, dessen wir Menschen absolut sicher sein können? Wann<br />
können wir sicher sein, daß wir in irgendeinem Fall uns ganz sicher nicht täuschen? Und<br />
warum sollten wir gerade in diesem ausgewählten Fall wirklich sicher sein können? Beim<br />
Versuch letzte Wahrheiten zu finden, sind die Menschen bisher immer gescheitert. Wir verstricken<br />
uns und unsere Vernunft bei solchen Versuchen immer zwingend in unauflösliche<br />
Widersprüche. Und dies wird auch zukünftig so bleiben, so meine Überzeugung. Dennoch<br />
meine ich einen Weg gefunden zu haben, der es ermöglicht, diese Widersprüche für unsere<br />
Vernunft akzeptabel zu machen und zugleich ein sinnvolles, pragmatisches Fundament zu<br />
legen, auf welchem wir vernünftigerweise aufbauen können, damit wir nicht dem Relativismus,<br />
der Beliebigkeit anheimfallen, ohne dabei in der Methode dogmatisch zu sein. Dieses<br />
Fundament ermöglicht es uns mit den Mitteln unserer Vernunft eine Theorie einer anderen<br />
aufgrund besserer Argumente vorzuziehen. Die Wissenschaften verfahren heute implizit in<br />
den meisten Fällen danach, sind sich aber bisher über das Fundament, auf dem sie letztlich<br />
stehen, nicht hinreichend bewußt geworden. Dies hat dann auch den ein oder anderen Fehler<br />
bzw. manche Unzulänglichkeit im Theoriegebäude zur Folge.<br />
Meine Auseinandersetzung mit den ersten neun Fragen einschließlich meines pragmatischen<br />
Lösungsansatzes kann man kostenlos auf dieser Seite unter dem nachfolgenden Punkt 1.3.<br />
‚Grundlagen und Grenzen menschlicher Erkenntnis’ nachlesen. Dort beschäftige ich mich<br />
auch am Schluß der Ausführungen mit modernen wissenschaftstheoretischen Theorien sowie<br />
deren Unzulänglichkeiten und lege dar, inwiefern mein Lösungsvorschlag besser geeignet ist,<br />
die Grundlagen und Grenzen menschlichen Denkens aufzuzeigen.<br />
Die Fragen 10 bis 20 beschäftigen sich mit ‚Freiheit’, ‚Moral’, dem ‚Sinn des Lebens’ und mit<br />
‚Gott’. Aufbauend auf den Erkenntnissen zu den ersten neun Fragen habe ich hier für mich<br />
befriedigende, wenn auch selbstverständlich keine absolut wahren Antworten gefunden, ohne<br />
dennoch auch hier einem Relativismus oder einer Beliebigkeit anheimzufallen. So begründe<br />
ich beispielsweise, wie man sehr wohl moralische Normen rational begründen und entsprechende<br />
Maßstäbe entwickeln kann, ohne daß sie allerdings absolut oder, wie Kant es ausdrückt,<br />
‚kategorisch’ gelten. Obwohl ich Kants Imperativ <strong>als</strong> außerordentlich brauchbaren<br />
Maßstab für moralisches Handeln ansehe, so kann er nicht absolut oder ‚kategorisch’ gelten,<br />
weil jener Maßstab letztlich doch auch nur aus der Empirie heraus entstanden ist, wie ich<br />
zeigen kann. Dennoch trotzt er wirksam der moralischen Beliebigkeit, vor welcher Kant ihn<br />
nur meinen schützen zu können, indem er versuchte, diesen unabhängig von allem empiri-
schen Sein zu entwickeln. Infolgedessen muß der Königsberger auch konsequenterweise<br />
davon ausgehen, daß es prinzipiell in jeder möglichen Situation eine eindeutig moralisch<br />
richtige Handlungsmaxime für uns Menschen gibt; natürlich unabhängig davon, ob wir jene<br />
Maxime dann auch befolgen. Ich zeige hingegen, daß Kant diesem Anspruch nicht gerecht<br />
wird und es <strong>als</strong> Mensch auch grundsätzlich nicht kann. Dennoch begründe ich, wie man<br />
seinen Imperativ <strong>als</strong> universellen Moralmaßstab verwenden kann, welcher aber weder<br />
‚kategorisch’ gilt noch uns immer eine eindeutige Handlungsmaxime in jeder möglichen<br />
Situation bietet und dennoch wirksam dem Relativismus und der Beliebigkeit – wie oben<br />
bereits erwähnt – trotzt.<br />
Schließlich habe ich – zumindest für mich selbst – einigermaßen zufriedenstellend die Fragen<br />
nach dem Sinn des Lebens und nach Gott beantwortet, wobei ich gleich anmerken möchte,<br />
daß ich hier selbstverständlich keine letzten, unbezweifelbaren Antworten gebe und geben<br />
will. Das wäre die größt mögliche Anmaßung eines Menschen: Es wäre Hybris, die ich zutiefst<br />
verabscheue. Ob und inwieweit anderen Menschen meine Überlegungen bei ihrer<br />
Sinnsuche helfen können, müssen sie jeweils für sich selbst entscheiden. Mir jedenfalls hat<br />
nicht zuletzt auch – wenngleich nicht nur – meine rationale Vernunft sehr geholfen, für mich<br />
befriedigende Antworten herauszuarbeiten und zum christlichen Glauben zu finden. Dabei<br />
war es für mich unter anderem sehr wichtig, eine zentrale Frage der Theologie für meine<br />
rationale Vernunft akzeptabel zu beantworten: Wie kann ich die Allwissenheit und Allmacht<br />
Gottes mit meiner eigenen Freiheit in einen akzeptablen Einklang bringen. Denn nur durch<br />
die Freiheit bin ich in der Lage, selber zu entscheiden, was ich tue. Und erst dadurch bin ich<br />
auch dafür moralisch verantwortlich zu machen. Erst dadurch werde ich ein Wesen mit<br />
eigener Würde. Aber wie bringe ich das mit Gottes Allmacht und Allwissenheit in einen für<br />
meine rationale Vernunft akzeptablen Einklang? Denn wenn Gott alles weiß, weiß er auch,<br />
was ich zukünftig tun werde. Und wie ist dann meine Freiheit, meine moralische Eigenverantwortlichkeit<br />
und damit meine Würde überhaupt denkbar? Auch hierauf meine ich eine<br />
rational akzeptable Antwort gegeben zu haben, die Gottes Allwissenheit und Allmacht mit<br />
unserer Freiheit in Einklang bringt.<br />
Sowohl die Auseinandersetzung mit den ersten neun Fragen <strong>als</strong> auch mit den darauffolgenden<br />
sowie noch einiges mehr ist in meinem Buch ‚Der Mensch – Eine kritische Auseinandersetzung<br />
mit und selbst’ nachzulesen.<br />
Wer Kontakt mit mir aufnehmen möchte, weil ihn sowohl die Fragen <strong>als</strong> auch meine Antworten<br />
zu jenen interessieren, kann mich am besten unter folgender E-Postadresse erreichen:<br />
info@drbottke.de
1.3. Grundlagen und Grenzen menschlichen Denkens:<br />
Unser Denken verstrickt sich notwendig in Widersprüche, es ist in sich zerspalten und bildet<br />
doch zugleich immer eine Einheit, die letztlich rational nicht verständlich ist. Nachfolgend<br />
sollen einige der Widersprüche, die im Verlauf der Philosophiegeschichte diskutiert worden<br />
sind, kritisch erörtert werden, um schließlich einige ‚pragmatische Setzungen’, <strong>als</strong> unabdingbare<br />
Grundlage all unseren Denkens, herauszuarbeiten.<br />
1. Der Raumbegriff:<br />
Alles Wahrnehmbare besitzt eine Grenze, sonst wäre es für uns weder anschaulich erkennbar<br />
noch denkbar. Denn etwas, das wir uns körperlich, d.h. dreidimensional, vorstellen, ist notwendig<br />
begrenzt und damit auch endlich. Wenn wir uns nun immer größere Räume vorstellen,<br />
dann begegnet uns die Frage nach einem größtmöglichen Raum, da wir jeden noch so großen<br />
Raum nur <strong>als</strong> endlich und damit begrenzt denken können und dennoch jeden noch so groß<br />
gedachten Raum wiederum <strong>als</strong> von einem noch größeren umgeben uns vorstellen müssen.<br />
Diese Reihe nimmt prinzipiell kein Ende, ist <strong>als</strong>o unendlich; 1 dies können wir uns jedoch<br />
nicht vorstellen. Wir verwenden den Begriff der Unendlichkeit notwendig, er ist in unserem<br />
Denken angelegt, ohne daß wir ihn wirklich verstehen könnten.<br />
Genauso wenig wie wir uns einen größten Raum vorzustellen vermögen, sind wir in der Lage,<br />
einen kleinstmöglichen zu denken. Jedes körperlich ausgedehnte Ding ist grundsätzlich – zumindest<br />
theoretisch – teilbar, denn dies ist eine der Räumlichkeit notwendig anhaftende Eigenschaft.<br />
Somit ist alles Körperliche etwas Zusammengesetztes. Ein solches Ganzes stellt<br />
<strong>als</strong>o die Summe seiner Teile dar. Ein letztes, kleinstes, unteilbares Teilchen, aus dem das Körperliche<br />
zusammengesetzt sein müßte, können wir uns aber nicht vorstellen, weil es keine<br />
räumliche Ausdehnung besitzen dürfte und somit seine Körperlichkeit einbüßte. Ein kleinstes,<br />
theoretisch nicht mehr teilbares Etwas wäre damit notwendig nicht mehr dreidimensional, es<br />
hätte keine räumliche Ausdehnung und könnte damit nicht mehr <strong>als</strong> ein Teil des Ganzen gelten,<br />
weil ihm eben jegliche Körperlichkeit abginge, so daß noch so viele ‚Unkörperliche’ niem<strong>als</strong><br />
etwas Körperliches nach unserem Vorstellungsvermögen bilden könnten. Infolgedessen<br />
besitzt ein Ding entweder eine räumliche Ausdehnung, dann ist es teilbar, oder aber es ist unteilbar<br />
und verliert seinen dreidimensionalen Charakter, wodurch es nicht mehr ein Teil des<br />
Ganzen sein kann. 2<br />
Zur Unendlichkeitsproblematik sollen noch folgende Beispiele zur Veranschaulichung dargestellt<br />
werden. Stellen wir uns einen Zahlenstrahl vor. Ausgehend von Null ist eine unendliche<br />
Fortführung sowohl in positiver <strong>als</strong> auch in negativer Richtung zu konstatieren, weil man eine<br />
beliebige Zahl durch Addition vergrößern kann. Somit ist ein Zahlenstrahl grundsätzlich von<br />
Null beginnend in beide Richtungen <strong>als</strong> unendlich anzusehen. Etwas größeres <strong>als</strong> das Unendliche<br />
ist nicht denkbar. Nun stellt sich unserer Vernunft jedoch das Problem, daß der unendlich<br />
lange Zahlenstrahl in positiver Richtung nicht <strong>als</strong> genauso lang gedacht werden kann, wie<br />
die Länge beider, d.h. sowohl derjenige in positiver <strong>als</strong> auch negativer Richtung, welcher<br />
ebenfalls unendlich lang ist. Somit müßte eine Verdoppelung der Unendlichkeit gedacht werden.<br />
Dies beinhaltet aber notwendig einen Widerspruch zu der Behauptung, daß das Unendliche<br />
das größtmögliche Denkbare ist. Entsprechendes gilt für die Menge der rationalen<br />
Zahlen zwischen zwei ganzen Zahlen, die unendlich groß ist, wie z.B. zwischen 1 und 2.<br />
Ebenso unendlich ist diese Menge aber auch zwischen 1 und 3, obwohl ganz offensichtlich<br />
1 vgl. hierzu: Aristoteles, Physik, 3, 4 und 6; ich führe hier und im folgenden einige Aristoteles – Stellen auf,<br />
weil sie für mich eine wichtige intellektuelle Anregung bedeuteten, wobei ich allerdings dem antiken Autor nicht<br />
in seiner Einschätzung zu folgen vermag, daß jene Aporien auflösbar seien, wie jener dies an mehreren Stellen,<br />
sowohl in der Physik <strong>als</strong> auch Metaphysik, behauptet.<br />
2 vgl. hierzu: ebenda, 3, 7 sowie Platon, Parmenides Dialog
die Menge der rationalen Zahlen hinsichtlich des letzteren Beispiels <strong>als</strong> größer 3 gedacht werden<br />
muß, <strong>als</strong> bei ersterem. Dies läßt sich logisch wie folgt eindeutig belegen: Die Menge der<br />
rationalen Zahlen zwischen 1 und 3 enthält alle rationalen Zahlen zwischen 1 und 2 und darüber<br />
hinaus aber eben noch jene zwischen 2 und 3, welche offensichtlich nicht in der Menge<br />
zwischen 1 und 2 enthalten sein können, so daß die Menge der rationalen Zahlen zwischen 1<br />
und 3 auf jeden Fall größer sein muß <strong>als</strong> diejenige zwischen 1 und 2, weil sie alle Zahlenwerte<br />
jener enthält, aber eben noch weitere. Andererseits widerspricht dies der Aussage, daß das<br />
Unendliche das größtmögliche Denkbare für uns ist, wie oben bereits erwähnt. Denn was<br />
sollte auch größer <strong>als</strong> das Unendliche sein? In der Mathematik beweist man die Gleichmächtigkeit<br />
4 zweier unendlicher Mengen durch das Aufzeigen einer Bijektion 5 zwischen beiden, so<br />
daß z.B. die Menge aller natürlichen Zahlen gleichmächtig im Vergleich zu jener der geraden<br />
natürlichen Zahlen ist:<br />
Definition: V2 sei die Menge der geraden natürlichen Zahlen<br />
Satz: V2 ist gleichmächtig wie /N<br />
Beweis: Sei b(n) = 2n eine Abbildung von /N nach V2.<br />
b ist bijektiv, da 1. ∀ Paare n1, n2 ∈ /N mit n1 ≠ n2 gilt: 2n1 ≠ 2n2,<br />
<strong>als</strong>o b(n1) ≠ b(n2), folglich ist b injektiv<br />
2. ∀ Paare m1, m2 ∈ V2 mit m1 ≠ m2 gilt:<br />
b -1 (m1) = m1 und b -1 (m2) = m2 mit b -1 (m1) ≠ b -1 (m2),<br />
2 2<br />
folglich ist b surjektiv<br />
q.e.d. 6<br />
Wir haben <strong>als</strong>o zwei logisch 7 gültige Beweise 8 zur Unendlichkeitsproblematik mit sich widersprechenden<br />
Ergebnissen. Dieser Widerspruch ist für unsere Vernunft schlechterdings unauflösbar,<br />
obwohl wir dennoch den für uns letztlich unverstehbaren Begriff der Unendlichkeit<br />
allein schon deshalb verwenden müssen, um zu wissen, was Endlichkeit bedeutet.<br />
2. Der Zeitbegriff:<br />
3 Als ‚größer’ stellen wir uns nach unserer Vernunft etwas vor, welches alles von etwas anderem beinhaltet und<br />
darüber hinaus noch mehr, da ersteres alles von letzterem in sich vereinigt und eben noch etwas mehr umfaßt, so<br />
daß es nicht gleich groß im Vergleich zu jenem ist, sondern größer sein muß.<br />
4 Zum mathematischen Begriff der ‚Mächtigkeit’ siehe: Brockhaus. Die Enzyklopädie in vierundzwanzig Bänden.<br />
Zwanzigste, überarbeitete Auflage. Leipzig Mannheim 1996. <strong>Dr</strong>eizehnter Band, S. 709, s.v. Mächtigkeit;<br />
vgl. hierzu auch folgende Internetadresse: de.wikipedia.org/M%E4chtigkeit<br />
5 Eine Bijektion liegt genau dann vor, wenn eine Abbildung sowohl surjektiv <strong>als</strong> auch injektiv, <strong>als</strong>o umkehrbar<br />
eindeutig bzw. eineindeutig ist. Somit werden zwei Mengen <strong>als</strong> gleichmächtig oder äquivalent bezeichnet‚ wenn<br />
es eine bijektive Abbildung von der einen auf die andere gibt. Zu diesem Begriff habe ich eingesehen: B. Huppert:<br />
Lineare Algebra I. Vorlesungsskript zum Wintersemester 1990 des Fachbereiches Mathematik der Johannes<br />
Gutenberg Universität Mainz, S. 14 – 15. Darüber hinaus finden sich im Internet z.B. auf den entsprechenden<br />
Seiten der Universitäten zu diesem Begriff weitere wissenschaftliche Erläuterungen. Vgl. hierzu auch: Brockhaus,<br />
dritter Band, S. 312, s.v. Bijektion sowie Brockhaus, erster Band, S. 19, s.v. Abbildung<br />
6 Dieser mathematische Beweis wurde von einem Mitarbeiter meines Institutes – Herrn Ralph Unverzagt –<br />
formuliert.<br />
7 Die Mathematik stellt nur einen Teilbereich der Logik dar. In der Mathematik, so wie sie von den Fachvertretern<br />
eingegrenzt wird, tritt obiger Widerspruch nicht auf, da sie dieses Problem in seiner ganzen Dimension<br />
für unsere Vernunft schlicht ignorieren, indem sie eine durchaus für mathematische Probleme sinnvolle Operationalisierung<br />
des Unendlichkeitsbegriffes vornehmen. Dadurch wird allerdings noch keineswegs der für unsere<br />
Vernunft zwingende und logisch eindeutig belegbare Widerspruch ausgeräumt.<br />
8 Der zuerst aufgeführte Beweis, daß die Menge der rationalen Zahlen zwischen 1 und 3 größer sein muß <strong>als</strong><br />
zwischen 1 und 2 unter der in Anmerkung 3 vorausgesetzten Definition von ‚größer’, ist, aufgrund der besseren<br />
Verständlichkeit, nicht in der Form eines formallogischen Kalküls dargelegt worden, ohne daß hierdurch irgendeine<br />
Einschränkung hinsichtlich der eindeutigen Gültigkeit der Beweisführung eintritt.
Jedes innerliche wie äußerliche Erleben verläuft in der Zeit, einem unaufhörlichen Nacheinander.<br />
Wenn wir uns den Verlauf allen Erlebens auf einem Zeitstrahl verdeutlichen, treten sofort<br />
zwei unauflösliche Probleme auf: Einerseits ist der Zeitstrahl weder in Richtung auf die<br />
Vergangenheit noch in Richtung auf die Zukunft <strong>als</strong> begrenzt denkbar, womit wieder das Problem<br />
der Unendlichkeit auftritt. Andererseits können wir uns die Gegenwart, das Jetzt, nicht<br />
<strong>als</strong> zeitlich ausgedehnt denken, sondern nur <strong>als</strong> Trennlinie zwischen Vergangenheit und Zukunft.<br />
Denn wenn die Gegenwart eine zeitliche Ausdehnung besäße, könnte sie wiederum in<br />
Vergangenheit und Zukunft aufgeteilt werden und stellte damit keine Trennlinie zwischen<br />
beiden dar. 9 Somit kann ein Ereignis entweder nur gewesen sein oder es wird erst in der Zukunft<br />
sein, aber es ist nie, da die Gegenwart keine zeitliche Ausdehnung zuläßt. Obgleich wir<br />
einerseits der Gegenwart keine Ausdehnung zubilligen können, müssen wir andererseits zugleich<br />
dennoch ein Sein auch <strong>als</strong> gegenwärtig, <strong>als</strong>o im Jetzt befindlich, notwendig denken,<br />
denn sonst wäre es für uns nicht existent, da auch dasjenige, welches in der Vergangenheit<br />
einmal war, <strong>als</strong> irgendwann einmal gegenwärtig gedacht werden muß. Die Gegenwart<br />
schmilzt somit auf eine unendlich kleine Größe ohne zeitliche Ausdehnung zusammen und<br />
muß dennoch, im Widerspruch dazu, <strong>als</strong> ausgedehnt gedacht werden, um überhaupt ein Sein,<br />
welches nicht anders <strong>als</strong> in der Zeit gedacht werden kann, konstituieren zu können.<br />
Alles Sein ist geworden, d.h. es ist irgendwann in der Vergangenheit entstanden. Entstehen<br />
bedeutet jedoch nichts anderes, <strong>als</strong> daß aus einem Etwas ein anderes Etwas wird, aus einem A<br />
ein Nicht-A. Solange das A ein A und kein Nicht-A ist, hat <strong>als</strong>o das Werden vom A zum<br />
Nicht-A noch nicht stattgefunden. Sobald aber aus dem A das Nicht-A geworden ist, muß das<br />
Werden schon abgeschlossen sein. 10 Infolgedessen muß das Werden, wie die Gegenwart, <strong>als</strong><br />
unendlich klein gedacht werden und ist damit für uns nicht vorstellbar.<br />
9 vgl. hierzu: Aristoteles, Physik, 6, 3<br />
10 vgl. hierzu: ebenda, 6, 5
3. Raum – Zeit – Problematik:<br />
Aus dem bisher Dargestellten ergeben sich gravierende Probleme hinsichtlich von Raum und<br />
Zeit, welche bereits in der Antike eingehend diskutiert worden sind. Daher sollen nachfolgend<br />
zunächst zwei sich widersprechende naturphilospohische Lehren kurz vorgestellt werden: die<br />
Eleaten und Heraklit:<br />
Der Name der Schule ersteren leitet sich nach dem Ort ihrer Tätigkeit, dem an der italienischen<br />
Westküste gelegenen Ort Elea, her. Als Begründer der eleatischen Schule gilt Xenophanes,<br />
welcher um 570 v.Chr. geboren wurde. Er zog <strong>als</strong> fahrender Dichter und Sänger<br />
durch die Lande und verbreitete in lyrischer Form seine philosophischen Gedanken. Die<br />
althergebrachte Religion der Griechen mit ihren zahlreichen Anthropomorphismen, wie sie<br />
z.B. von Homer und Hesiod überliefert sind, lehnte er scharf ab und machte sich mit beißendem<br />
Spott darüber lustig. Demgegenüber glaubte er an nur einen einzigen, höchsten und besten<br />
Gott (Monotheismus), welcher der Urgrund für alles Seiende sei und in dem das Wesen<br />
alles Seienden zusammenfließe. Im Unterschied zu den Milesiern, welche den Urgrund der<br />
Dinge <strong>als</strong> selbstbewegt ansahen, strich er dieses Postulat und sah Gott <strong>als</strong> unbeweglich und in<br />
allen seinen Teilen <strong>als</strong> vollkommen gleichartig an. Mit seiner Gleichsetzung des höchsten<br />
Wesens mit der Einheit des Weltganzen ist er der geistige Vater von einem ewigen, unveränderlichen<br />
Sein, dem letztlich nur wirkliche Realität zukommt, im Gegensatz zur Vielheit<br />
der empirischen Erscheinungen. Der bedeutendste Denker dieser Schule war der um 525<br />
v.Chr. in Elea geborene Parmenides. Daß es ein Sein gibt (e)/sti ga/r ei)/nai), ist für ihn ein<br />
begriffliches Postulat von so zwingender Evidenz, daß sie keines Beweises bedarf. Im Umkehrschluß<br />
stellt er fest, daß es das Nichtsein weder geben noch daß es gedacht werden könne,<br />
denn wenn man etwas denkt, muß es auch sein, sonst kann man es gar nicht erst denken. Somit<br />
sind Sein und Denken völlig identisch. Für Parmenides ist Raumerfüllendes (to ple/on),<br />
<strong>als</strong>o Körperlichkeit, gleichbedeutend mit Sein. Infolgedessen kann es auch keinen leeren<br />
Raum (to ke/non) geben: es existiert nur ein einheitliches, ewiges, ungewordenes, unvergängliches,<br />
unbewegliches, unterschiedsloses Sein in Form eines wohlgerundeten Weltkörpers<br />
in Kugelgestalt. Die bewegliche, vom Streit zerrissene Welt, wo es Geburt und Tod,<br />
Anfang und Ende der Einzeldinge in der Zeit gibt, sind nichts <strong>als</strong> bloßer trügerischer Schein,<br />
bloße Meinung (do/ca). Das Vergängliche ist das, was einst nicht war und einmal nicht mehr<br />
sein wird und ist damit nicht wirklich existent: ein Werden und Vergehen kann nicht vernünftig<br />
gedacht werden. Bewegung setzt den leeren Raum voraus, in welchem das Sein seine Ortsveränderung<br />
erleidet; da es diesen nicht geben kann, gibt es eben auch keine Bewegung. Die<br />
Metaphysik der Eleaten duldet damit keine Physik! Die von uns wahrnehmbare Welt wird<br />
radikal negiert, weil sie mit der Theorie nicht übereinstimmt. Zenon, geboren um 490 v.Chr.,<br />
war der berühmteste Schüler des Parmenides und sah seine Hauptaufgabe in der Abwehr der<br />
Angriffe auf die eleatische Schule. Seine Argumente, daß es logisch gesehen keine Bewegung<br />
geben könne, waren sehr durchdacht und schärften den kritischen Blick gegenüber allem, was<br />
auf den ersten Anschein hin einleuchtend und selbstverständlich erscheint.<br />
Heraklit wurde um 540 v.Chr. geboren und lebte im kleinasiatischen Ephesos. Er war ein<br />
Einzelgänger mit aristokratischer Gesinnung und ein Verächter der Masse. Die wenigen von<br />
ihm erhaltenen Fragmente sind u.a. aufgrund ihrer aphoristischen Kürze sehr dunkel und vieldeutig.<br />
Wie seine Vorgänger geht auch er davon aus, daß es hinter der beobachtbaren Vielheit<br />
etwas Einheitliches, welches dieser zugrunde liegt, geben muß. Im Gegensatz zu den Eleaten<br />
leugnet er aber nicht die Vielheit und die Bewegung, das beständige Werden und Vergehen<br />
der Dinge, sondern versteht dies <strong>als</strong> Ausdruck einer in der Welt obwaltenden göttlichen Vernunft,<br />
die er mit dem Namen ‚Logos’ (lo/goj) bezeichnet. Der dauernde Fluß des Werdens<br />
und Vergehens (pa/nta r(ei=) ist das Wesen aller Dinge, <strong>als</strong>o weder ein Urstoff der Milesier<br />
noch ein unveränderliches Sein der Eleaten, d.h. es gibt nur das Geschehen, das Werden<br />
selbst. Die ständige Veränderung allen Seins erfolgt jedoch keineswegs willkürlich, sondern
nach einem ewigen Gesetz, nach welchem alles einem polaren Zusammenspiel widerstreitender<br />
Kräfte entspringt. Durch diesen Kampf (po/lemoj) der Gegensätze erst entsteht die<br />
beobachtbare Welt und ist damit Ausdruck einer göttlichen Ordnung. Kein Einzelding hat<br />
Bestand, nur der lo/goj, nach dem alles gestaltet wird, ist das Bleibende. In diesem Kampf<br />
der Gegensätze liegt <strong>als</strong>o das Wesen aller Dinge, so daß er die Vorstellung vom Ende allen<br />
Kampfes, den ewigen Frieden ablehnt, weil dieser das Ende aller schöpferischen Kraft bedeuten<br />
würde und dem Tod gleichkäme. Diese Erfahrung können wir auch im alltäglichen<br />
Leben machen, denn erst durch die Krankheit wissen wir z.B. die Gesundheit zu schätzen.<br />
Kennten wir die Krankheit gar nicht, wüssten wir auch nichts von der Gesundheit. Dieses<br />
Gesetz des Wechsels schafft die kosmische Harmonie, welche sich allerdings dem schlichten<br />
Beobachter, so Heraklit, nicht so einfach erschließt, da er nur viele einzelne Dinge wahllos<br />
entstehen und vergehen sieht, ohne das dahinter liegende Urgesetz zu erkennen. Alles, was für<br />
kürzere oder längere Zeit zu sein scheint, ist das Produkt entgegengesetzter Bewegungen und<br />
Kräfte, die sich in ihrer Wirkung das Gleichgewicht halten (e)nantiotropi/a). So ist jeden<br />
Augenblick das Universum eine in sich gespaltene und wieder in sich zurückgehende Einheit<br />
(e(/n diafero/menon e(aut%=) – ein Streit, der seine Versöhnung, ein Mangel, der seine Sättigung<br />
findet: das Werden stellt die Einheit der Gegensätze her; somit existiert eine Einheit in<br />
der Vielheit und eine Vielheit in der Einheit. Als Bild für diese Urenergie verwendet Heraklit<br />
das Feuer, welches durch sein Auflodern und Verlöschen seine Vorstellungen am besten verdeutlicht.<br />
Der Mensch partizipiert durch seine ihm innewohnende Vernunft an diesem Weltlogos.<br />
Zitate: „Wir können nicht zweimal in denselben Fluß springen.“<br />
„Der Krieg ist aller Dinge Vater, aller Dinge König.“<br />
Mit seiner Lehre vom Zusammenwirken der Gegensätze schuf er ein erstes Modell der dialektischen<br />
Entwicklungslehre, welche bis heute unser Denken maßgeblich mit beeinflußt: insbesondere<br />
Hegel, Marx, Nietzsche und Darwin.<br />
Nach diesem kurzen Exkurs zu diesen beiden Denkschulen wenden wir uns nun den sich daraus<br />
ergebenden Problemen für unsere Vernunft in bezug auf die Raum – Zeit – Problematik<br />
zu, indem wir uns das von Zenon entwickelte Paradoxon des ‚ruhenden Pfeils’ näher zu Gemüte<br />
führen: Ein fliegender Pfeil, in jedem Einzelmoment betrachtet, befindet sich an einer<br />
bestimmten Stelle im Raum, wo er infolge seines Dortseins ruhen muß, da er sonst nicht dort,<br />
sondern woanders wäre. Wenn er aber in jedem einzelnen Zeitpunkt des Fluges ruht, so ruht<br />
er auch im ganzen. Auf dieses Paradoxon antwortete Aristoteles, daß man die Zeit nicht in<br />
einzelne Stücke zerteilen dürfe, sondern sie <strong>als</strong> ein dauernd fließendes Kontinuum begreifen<br />
müsse 11 . Doch damit ist das hier aufgeführte Raum – Zeit – Problem keineswegs für unsere<br />
Vernunft gelöst, da wir durch diese genötigt sind, ein sich bewegendes Sein <strong>als</strong> einerseits<br />
raum – zeitlich fixiert, d.h. zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem bestimmten Ort befindlich,<br />
<strong>als</strong>o ruhend und andererseits dennoch auch in diesem Punkt <strong>als</strong> bewegt ansehen<br />
müssen. 12 Wir können uns weder die ununterbrochene Bewegung noch die raum – zeitliche<br />
Fixierung bei einem bewegten Gegenstand <strong>als</strong> eine dem Sein notwendig inhärente Eigenschaft<br />
im Kontinuum des Zeitflusses wegdenken, obgleich dies in sich widersprüchlich ist.<br />
Eleatisches Sein und heraklitisches Werden lassen sich für unsere Vernunft nicht in Einklang<br />
bringen, obwohl wir beides immer gemeinsam zwingend mitdenken müssen und keines völlig<br />
ignorieren können.<br />
11 ebenda, 6, 2 und 9; sowohl die Argumentation Zenons <strong>als</strong> auch die Widerlegung von Aristoteles finden wir<br />
durch diese Stellen belegt.<br />
12 Es soll allerdings sofort klar gestellt werden, daß mit der Entwicklung der Infinitesimalrechnung durch Leibniz<br />
und Newton das aufgeführte Paradoxon mathematisch durchaus lösbar ist. Aber es bleibt dennoch letztlich für<br />
unsere Vernunft unverständlich, da wir uns von der Unendlichkeit keine Vorstellung machen können (s.o.) und<br />
nur dieser, in unserem Denken angelegte Widerspruch, ist hier Gegenstand meiner Erörterung.
4. Aristoteles und die Seinsproblematik:<br />
Alle Versuche der Metaphysik seit Aristoteles 13 <strong>als</strong> einer Wissenschaft vom ‚Seienden <strong>als</strong><br />
Seiendem’ bzw. dem ‚Seienden <strong>als</strong> solchem’ 14 zielten darauf ab, das Wesen 15 der Dinge in der<br />
Weise zu ergründen, daß das Sein 16 für uns Menschen rational widerspruchsfrei begreifbar<br />
sein würde. Bei allem, was wir uns vorstellen, müssen wir immer zunächst ein Sein des Vorzustellenden<br />
voraussetzen, welches in der Alltagssprache häufig durch die ‚ist – Kopula’ zum<br />
Ausdruck kommt, d.h. wenn man sagt: „Dieser Mensch ist groß.“, dann impliziert dies notwendig<br />
schon sein Dasein, ohne daß wir dies gesondert betonen müßten. Allen Seienden ist<br />
demnach, bei aller individuellen Verschiedenheit, das Dasein gemeinsam, es liegt ihnen notwendig<br />
zugrunde, bzw. wir können es uns nur so mit unserer Vernunft vorstellen. Ihre jeweilige<br />
‚Washeit’, d.h. das, was sie zu einem bestimmten Etwas macht, müssen wir in ihrem<br />
Wesen, worin sie sich eben von den anderen Dingen unterscheiden, suchen. Dieses Wesen<br />
müssen wir <strong>als</strong> solches erkennen, wenn wir einen bestimmten Menschen <strong>als</strong> jenen wieder<br />
identifizieren wollen, obwohl wir ihn beispielsweise aus einer anderen Perspektive betrachten<br />
und damit nicht ein identisches Bild im Vergleich zum vorherigen wahrnehmen. Bei Aristoteles<br />
finden wir dafür folgende Wortschöpfung: „to/ ti/ h)=n to\ tw?= e(ka/stw? ei)=nai“ 17 oder in<br />
abgekürzter Form: „to/ ti/ h)=n ei)=nai“. Das Imperfekt h)=n betont hier die zeitlose Dauer der<br />
jeweils auszumachenden Wesenheit eines Dinges, denn ohne sie könnten wir es <strong>als</strong> solches<br />
infolge seiner Veränderungen im Zeitablauf gar nicht mehr wiedererkennen. Der substantivierte<br />
Infinitiv von ei)=nai verbindet sich bei Aristoteles häufig mit einem Dativus possessivus,<br />
welcher das Eigentümliche, das Sosein des bezeichneten Gegenstandes verdeutlichen<br />
soll. 18 Der antike Autor sieht die genuine Aufgabe der Metaphysik in der Auseinandersetzung<br />
mit dem Begriff der Wesenheiten selbst, wobei aber nicht die jeweilige ‚Washeit’ einzelner<br />
Objekte Gegenstand ihrer Untersuchung ist, da dies den Einzelwissenschaften mit den entsprechenden<br />
induktiven Methoden vorbehalten bleibt. Dagegen beschäftigt sich die Metaphysik<br />
mit denen allen Dingen inhärenten Wesenheiten <strong>als</strong> Wesenheiten. Die von ihm z.T.<br />
äußerst scharfsinnigen Ausführungen sollen hier nicht weiter thematisiert werden; sie sind im<br />
wesentlichen in der Metaphysik aber auch in den Analytiken und der Hermeneutik nachzulesen.<br />
Trotz aller Bemühungen von der Antike bis heute bleiben wesentliche Aspekte der Seinsproblematik<br />
für unsere Vernunft unauflösbar. Obwohl wir in der Tat gezwungen sind, allen<br />
Dingen ein Sein zuzusprechen, können wir es, wie oben dargelegt, nicht im Kontinuum des<br />
Zeitflusses, so wie wir ihn uns vorstellen, fixieren, denn ein Sein ist für uns nur in der Zeit<br />
denkbar. Das Sein, <strong>als</strong> etwas allem Zukommendem, kann selbst nur <strong>als</strong> Grenzbegriff benutzt<br />
werden, aber niem<strong>als</strong> ein Gegenstand weiterer wissenschaftlicher Untersuchungen sein, eben<br />
weil es von nichts anderem mehr ableitbar ist und keine spezifischen Eigenschaften besitzt; es<br />
läßt sich nicht beschreiben und muß dennoch einfach vorausgesetzt werden! Die Behauptung,<br />
aus dem Sein sei das Wesen der Dinge herleitbar, ist eine wenig weiterführende Aussage, da<br />
13 Fragen nach dem Sein werden zwar schon von einigen Vorsokratikern und insbesondere von Platon erörtert,<br />
aber erst seit Aristoteles kann man von einer rational – logischen Auseinandersetzung mit der Seinsproblematik<br />
sprechen.<br />
14 Aristoteles nennt es ‚to\ o)\n h?(= o)/n’.<br />
15 Aristoteles benutzt die substantivierte Form des weiblichen Partizips von ‚ei)=nai’, nämlich ‚ou)si/a’, worunter<br />
er etwas versteht, das allem Seienden zugrunde liegt und von nichts weiterem mehr abgeleitet werden kann; vgl.<br />
zu diesem Begriff auch: Thesaurus Graecae Linguae, Bd. V, s.v. ou)si/a, 2.419 sowie zum lateinischen Begriff<br />
‚essentia’: Thesaurus Linguae Latinae, Bd. V, 2, s.v. essentia, 862 – 864<br />
16 Zur Etymologie des Wortes ‚Sein’ vgl.: Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm, Bd. 16, s.v.<br />
Sein, 228 – 336<br />
17 Übersetzung: „Was war das für jedes Einzelding wesensmäßige Sein?“<br />
18 So z.B.: Aristoteles, Metaphysik 4, 4; 1007, a: „...× to\ ga\r a)nJrw/pw? kai\ ei)=nai to\ mh\ a)nJrw/pw?<br />
ei)=nai…”; deutsche Übersetzung: „...: das dem Menschen wesensmäßige Sein und das dem Menschen nicht<br />
wesensmäßige Sein ...“
zum einen zwar allen Dingen ihre Seinsqualität gemein ist, aber eine weiterführende Feststellung,<br />
infolge der nicht weiteren Bestimmbarkeit von Sein, nicht getroffen werden kann. Wenn<br />
wir ein Ding <strong>als</strong> solches in seiner Individualität identifizieren und damit auch in der Lage<br />
sind, es aus anderer Perspektive wiederzuerkennen, setzt dies die Konstruierung von Wesensmerkmalen<br />
durch unseren Verstand voraus, d.h. wir entwickeln ein Bild vor unserem geistigen<br />
Auge, welches nur für uns wesentliche Charaktermerkmale beinhaltet, so daß wir unabhängig<br />
von nicht wesentlichen Veränderungen zur Reidentifizierung imstande sind. Dabei<br />
gibt es allen Menschen gemeinsame Erkenntniskategorien (s.u. die Ausführungen zu Immanuel<br />
Kant), andere, die historisch / kulturell bedingt sind und schließlich einige, die im einzelnen<br />
Menschen liegen. Es ist die wichtige und umfangreiche Aufgabe vieler unterschiedlicher<br />
Fächer, die Detailforschung auf den genannten Gebieten voranzutreiben und kann daher hier<br />
nicht weiter verfolgt werden. Wenn <strong>als</strong>o allem Denken von oder über etwas immer zugleich<br />
ein Sein sowie ein Sosein inhärent ist, so kann auch die formale Logik nicht <strong>als</strong><br />
davon losgelöst angesehen werden, d.h. auch sie muß empirisch betrachtet werden.<br />
Nichts kann für unsere Vernunft ausschließlich formal aufgefaßt werden, es ist immer<br />
auch ein für uns identifizierbares Sein mitzudenken, obgleich dieses Sein <strong>als</strong> in der Zeit<br />
befindlich nicht widerspruchsfrei vorstellbar ist (s.o.)!<br />
Alle hierüber hinausgehenden metaphysischen Versuche, das ‚Seiende <strong>als</strong> Seiendes’ oder das<br />
Wesen der Dinge zu ergründen, müssen notwendig an unseren begrenzten menschlichen<br />
Möglichkeiten scheitern, da bestimmte Widersprüche unauflösbar in unserer Natur angelegt<br />
sind, wie dies bereits oben dargelegt wurde und in den folgenden Abschnitten noch zu zeigen<br />
sein wird.<br />
5. Ursache – Wirkung – Problematik:<br />
Wenn wir versuchen, etwas zu verstehen, suchen wir nach Bedingungen bzw. Ursachen, die<br />
ein bestimmtes Phänomen bedingt bzw. verursacht haben. Beim weiteren Fortschreiten auf<br />
dieser Suche begegnet uns notwendig die Frage nach dem Unbedingten, welches aber wiederum<br />
für uns nicht verstehbar sein kann, da ja alles Verstehen nur durch die Angabe von Bedingungen<br />
möglich ist, aber dem Unbedingten ex definitione keine Bedingungen zugrunde<br />
liegen können, da es ansonsten bedingt und nicht unbedingt wäre. Damit ist die Grundlage des<br />
Verständnisprozesses, <strong>als</strong>o das Unbedingte, für uns nicht verständlich, ohne daß unsere Vernunft<br />
eine befriedigende Antwort auf jene sie beschäftigende Frage finden kann.
6. Freiheitsproblematik:<br />
Die Ursache – Wirkung – Problematik begegnet uns ebenfalls beim Verständnis von Freiheit.<br />
Wenn man dem Menschen zubilligt, Spielräume freien Entscheidens zu besitzen, muß man<br />
ihn zumindest teilweise aus dem Bedingungsgefüge von Ursache und Wirkung entlassen, weil<br />
ansonsten alles Handeln infolge der diesem zugrunde liegenden Ursachen vollkommen determiniert<br />
wäre. Freiheit wäre somit ein rein negativer Begriff, nicht im Sinne einer Wertung<br />
von gut oder schlecht, sondern insofern, <strong>als</strong> daß er lediglich etwas Indeterminiertes bezeichnete.<br />
Wir empfinden in uns ein Gefühl von Freiheit, und es gehört zu unserem Selbstverständnis,<br />
über einen freien Willen zu verfügen, weil ansonsten alle Überlegungen über zukünftiges<br />
Handeln sinnlos wären, da ja alles gesetzmäßig vorgegeben wäre, ohne daß es überhaupt<br />
einen Entscheidungsspielraum für uns gäbe. Aber diesen freien Willen können wir niem<strong>als</strong><br />
rational verstehen, denn, wenn wir versuchen uns einen freien Willen vorzustellen, geraten<br />
wir auch deshalb schon in Widersprüche, weil alle inneren Motive auch wieder <strong>als</strong> Ursachen<br />
für Handlungen zu verstehen sind und eine Freiheit, die völlig losgelöst von allen unseren<br />
inneren Gegebenheiten existierte, nichts mehr mit uns selbst zu tun hätte. Sobald wir versuchen,<br />
etwas zu verstehen, halten wir Ausschau nach Bedingungen, ob es nun äußere oder<br />
innere sind. Verstehen wir ein Phänomen, dann kennen wir alle Ursachen, die zu ihm notwendig<br />
geführt haben; wenn dem nicht so ist, haben wir das besagte Phänomen noch nicht<br />
völlig verstanden und müssen weiter suchen. Egal wie klein wir uns den nicht determinierten<br />
Spielraum freien Handelns in einer bestimmten Situation auch vorstellen mögen, in einer Situation<br />
<strong>als</strong>o, in der wir wirklich auch meinen, jenen Spielraum zu besitzen, so dürfte dieser in<br />
keiner Weise dem Bedingungsgefüge von Ursache und Wirkung unterworfen sein, da er ja<br />
sonst bedingt und nicht frei wäre. Dies gilt in gleicher Weise für äußere und innere Ursachen,<br />
wie Gefühle oder rationale Erwägungen, die zu einer bestimmten Handlung geführt haben.<br />
Etwas, das aber von nichts verursacht ist, können wir uns nicht vorstellen, weil eine Vorstellung<br />
immer auch die Möglichkeit der Angabe von Bedingungen impliziert. Infolgedessen<br />
bleibt es für uns allein aus diesem Grund letztlich immer unverständlich, wie der Mensch<br />
durch freie Entscheidungen den Lauf der Dinge ändern können sollte, da Verstehen für uns ja<br />
immer an die Angabe von Bedingungen gebunden ist. Allerdings läßt sich auch das Gegenteil,<br />
d.h. daß es keine Freiheit gibt, nicht beweisen. Denn wie sollte ein solcher Beweis aussehen?<br />
Einer bestimmten Handlung sieht man nicht an, ob sie vollständig unfrei war oder nicht; man<br />
nimmt nur sie, aber nicht eine möglicherweise freie Entscheidung, welche ihr zugrunde gelegen<br />
haben mag, wahr. Wir haben <strong>als</strong> Menschen keinerlei Möglichkeit, die Nichtexistenz des<br />
Grenzbegriffes ‚Freiheit’ zu beweisen, weil unser Denk- und Erkenntnisapparat keine entsprechenden<br />
Fähigkeiten bereithält. Denn einerseits läßt sich empirisch die Nichtexistenz von<br />
irgend etwas niem<strong>als</strong> sicher feststellen, da wir allenfalls ein bisheriges Nichtbeobachten des in<br />
Rede stehenden Etwas wissenschaftlich korrekt aussagen können, welches aber in Zukunft<br />
dennoch vielleicht einmal <strong>als</strong> existent nachgewiesen wird. Andererseits ist es für unsere Vernunft<br />
schlechterdings unmöglich, über etwas wie die Freiheit sicheres aussagen bzw. beweisen<br />
zu können, weil wir dafür Gründe – <strong>als</strong>o Bedingungen – angeben müßten. Die Freiheit <strong>als</strong><br />
etwas Unbedingtem entzieht sich aber ex definitione genau diesem Bedingungsgefüge, in welchem<br />
unsere Vernunft beim Verstehen von Phänomenen notwendig gefangen bleibt, so daß<br />
sie allein dadurch niem<strong>als</strong> zwingende Aussagen über die Freiheit zu treffen vermag.<br />
Wir besitzen lediglich dieses unausrottbare Gefühl von Freiheit in uns und müssen uns auch<br />
allein schon deshalb grundsätzlich die Möglichkeit von Freiheit zugestehen, weil davon<br />
unsere ganz besondere Würde abhängt. Besäßen wir keine Freiheit, wäre all unser Handeln<br />
vorherbestimmt. Wir glichen einer Maschine, welche keine eigenen Entscheidungen treffen<br />
könnte und somit auch keinerlei Verantwortung für ihr Handeln zu übernehmen hätte. Damit<br />
entbehrten Moral und Recht jeder Grundlage. Da wir die Existenz von Freiheit weder be-<br />
noch widerlegen können, macht es aus den vorgebrachten Gründen durchaus Sinn, sie für uns
Menschen zu reklamieren, ohne damit aber die oben gezogenen prinzipiellen Grenzen zu<br />
überschreiten.<br />
Wir müssen nun noch sehen, ob Freiheit wirklich nur <strong>als</strong> negativer Begriff zu denken ist,<br />
ohne dabei jedoch den oben erwähnten Widerspruch, der sich aus dem Gegensatzpaar ‚Determination<br />
– Indetermination’ und dem damit zusammenhängenden Verständnisproblem hinsichtlich<br />
der Angabe von hinreichenden Bedingungen zur Erklärung eines Phänomens ergibt,<br />
vergessen machen zu wollen. Diese Problematik ist prinzipiell für unsere Vernunft nicht lösbar!<br />
Ich möchte nachfolgend nur zeigen, inwieweit sich trotz dieser grundsätzlichen Grenzen<br />
für uns ein Begriff von Freiheit entwickeln läßt, welcher ein besseres Verständnis für ein<br />
humanes ‚Ich’ mit seiner ganz besonderen Würde ermöglicht und damit auf Selbstverantwortung<br />
sowie Freiheit fußt. Da rein negative Begriffe für uns nicht verständlich sein können,<br />
obgleich wir solche dennoch notwendig benutzen müssen (s.o. und s.u.), versuche ich nun,<br />
Freiheit auch positiv zu erfassen. Wenn wir meinen, etwas frei und selbstverantwortlich entscheiden<br />
zu können, darf einer solchen Entscheidung nichts anhaften, was wir nicht selber<br />
wollen! Kein äußerer oder innerer Zwang darf uns zu einer Handlung, für die wir meinen, uns<br />
frei entschieden zu haben, führen, denn sonst besäßen wir dieses Gefühl der Freiheit nicht.<br />
Desweiteren muß diese Entscheidung aber etwas mit uns selbst zu tun haben, d.h. wir müssen<br />
sie innerlich bejahen. Dies versuchen wir dadurch zu gewährleisten, daß wir bei vielen, wenn<br />
auch nicht allen freien Entscheidungen vorher Überlegungen anstellen, warum wir jenes und<br />
nichts anderes wollen. Dieses Nachdenken wiederum wird durch die uns umgebende Umwelt<br />
maßgeblich beeinflußt und zwar durchgängig, so daß ein dauernder Kommunikationsprozeß<br />
zwischen dem ‚Ich’ und allem ‚Nicht – Ich’ stattfindet. Erst aufgrund dessen meinen wir,<br />
sinnvolle Abwägungen anstellen und daraufhin Entscheidungen treffen zu können sowie diese<br />
auch innerlich <strong>als</strong> eigene anzuerkennen, im Gegensatz z.B. zu inneren Zwängen, die einem<br />
nicht das Gefühl von Freiheit zu vermitteln vermögen, auch wenn sie aus uns selbst heraus<br />
erfolgen. Wenn wir etwas <strong>als</strong> eigene Entscheidung billigen wollen, suchen wir <strong>als</strong>o nach<br />
Gründen, warum wir es sollen wollen. Dabei geraten wir notwendig in den oben schon benannten<br />
Zirkel der ‚Ursache – Wirkung – Problematik’, welcher für uns unauflösbar bleibt.<br />
Wenn wir dies nun akzeptieren, da wir auch gar nicht anders können, so ist eine frei getroffene<br />
Entscheidung deshalb frei, weil in uns ein Vorgang stattgefunden hat, der zwar durch<br />
Nachdenken vorbereitet worden war, aber an dessen Ende eine Billigung durch uns selbst<br />
ohne weitere Angabe von Gründen erfolgt ist. Diese Billigung ist kausal nicht weiter hinterfragbar,<br />
denn nach allem Sammeln von Gründen, die für und wider eine Handlung sprechen,<br />
muß irgendwann eine Entscheidung stehen, die wir dann <strong>als</strong> unsere eigene anerkennen. Bei<br />
allen Willensäußerungen, welchen keine rationalen Überlegungen vorangehen und für die<br />
keine besonderen Gründe auszumachen sind, wie z.B. willkürlich in einem Moment die Hand<br />
heben zu können, ohne irgend etwas damit zu bezwecken, ist dieser Zusammenhang ganz<br />
augenfällig, vorausgesetzt wir wollten es bewußt so! Diese Vorstellung von Billigung ist<br />
deshalb für uns letztlich nicht verständlich, weil sich eben keine Gründe dafür vorbringen<br />
lassen, da vorausgegangene Überlegungen eines Für und Wider zwar erfolgt sein mögen, aber<br />
die Billigung selbst nicht einer mechanischen Rechenoperation entsprungen sein kann, wenn<br />
sie frei sein soll. Der Bereich, in welchem eine solche Bejahung stattfindet, ist daher rational<br />
nicht nachvollziehbar. Damit bleibt der Begriff der Freiheit weiterhin problematisch. Dennoch<br />
können wir abschließend konstatieren, daß dem Begriff der Freiheit, neben seiner negativen<br />
Bedeutung <strong>als</strong> Gegensatz zu demjenigen der Determination, für uns nur insofern eine positive<br />
Bedeutung zukommen kann, <strong>als</strong> daß er etwas ausdrückt, welches aus uns selbst bewußt entsprungen<br />
sein muß, ohne daß wir das Gefühl haben, bei unserem Wollen fremdbestimmt zu<br />
sein und wir daher bei einer freien Willensentscheidung eine Billigung durch uns voraussetzen<br />
müssen. 19<br />
19 In diesem Zusammenhang möchte ich ein Buch von Peter Bieri erwähnen: Das Handwerk der Freiheit. Über<br />
die Entdeckung des eigenen Willens. München Wien 2001. Dort behandelt er die oben erörterte Problematik sehr
7. Wahrheitsproblematik:<br />
Wenn wir uns die Frage nach der Wahrheit stellen, geraten wir sofort in Schwierigkeiten,<br />
insbesondere wenn wir uns noch einmal das oben Aufgeführte mit seinen ganzen Widersprüchen<br />
vor Augen führen. Wenn <strong>als</strong> Folge hiervon jedoch Wahrheit geleugnet wird, so ist<br />
auch dies in sich widersprüchlich, denn die Leugnung von Wahrheit beansprucht ja selbst<br />
schon wieder wahr zu sein: „Der nämlich, der alles für wahr erklärt, der erklärt damit auch die<br />
der seinen entgegenstehende Behauptung für wahr, <strong>als</strong>o seine eigene für nicht wahr (da jene<br />
des Gegners seine eigene nicht für wahr erklärt); wer aber alles für f<strong>als</strong>ch hält, der hält auch<br />
seine eigene Behauptung für f<strong>als</strong>ch.“ 20 Einerseits kommt unser Denken ohne den Wahrheitsbegriff<br />
nicht aus, denn jegliches Denken beruht auf Festlegungen, die für sich ein Wahrsein<br />
beanspruchen müssen, und andererseits sind wir nicht in der Lage, wirklich festzulegen, was<br />
letztlich wahr ist. Das sokratische ‚Ich weiß, daß ich nichts weiß’ beschreibt diesen Widerspruch<br />
sehr prägnant, und Platon ließ viele seiner Dialoge in der Aporie enden.<br />
Augustinus sah im Zweifel, der Ungewißheit eine Grundtatsache unseres Seins, denn daran,<br />
daß wir zweifeln, können wir nicht zweifeln. Ebenso fand Descartes in dem Satz ‚Cogito ergo<br />
sum’ eine angeblich letzte, unbezweifelbare Gewißheit, die ihm <strong>als</strong> Ausgangspunkt einer<br />
rationalen und widerspruchsfreien Philosophie dienen sollte, ohne diesen Anspruch natürlich<br />
einlösen zu können. Desweiteren setzt der Begriff des Zweifelns auch den der Wahrheit voraus,<br />
da man nur an etwas zweifeln kann, wenn man annimmt, daß es nicht wahr sei und somit<br />
die Vorstellung von Wahrheit notwendig mitdenken muß, ohne damit das Wahrheitsproblem<br />
zu lösen und aufzeigen zu können, was letztlich wahr ist.<br />
Ein weiteres Problem der Wahrheitserkenntnis soll kurz erläutert werden. In der Philosophiegeschichte<br />
ist von der Antike bis zur Neuzeit häufig die Mathematik <strong>als</strong> bestes Beispiel für<br />
unbezweifelbare Erkenntnisse angesehen worden, z.B. 3 x 5 = 15. Ob das errechnete Ergebnis<br />
jedoch richtig ist, muß durch Menschen überprüft werden, indem sie nachrechnen, ob es<br />
stimmt oder nicht. Da man jedoch niem<strong>als</strong> sicher sein kann, daß sich jemand verrechnet,<br />
bleibt eine gewisse Unsicherheit auch dort notwendig bestehen, weil auch sehr viele Menschen<br />
sich verrechnen können. Denn alle Ergebnisse jeder Wissenschaft beruhen auf menschlichem<br />
Denken, welches niem<strong>als</strong> sicher Fehlerfreiheit für sich reklamieren kann. Und dies<br />
gilt selbstverständlich auch für Mathematik und Logik!<br />
ausführlich und allgemeinverständlich, wofür ihm sehr zu danken ist. Er breitet dabei viele Argumentationsstränge,<br />
welche die Fragen der Freiheit und ihres Verständnisses für uns berühren, aus und kommt ebenfalls zu<br />
dem Ergebnis, daß eine freie Willensäußerung nur dann <strong>als</strong> solche zu charakterisieren sei, wenn sie durch uns<br />
bewußt gebilligt worden sei. Auch meint er, daß diese Billigung durch einen Kommunikationsprozeß mit der<br />
Umwelt beeinflußt werde und ein Vorgang des Aneignens durch uns erfolge. Daraus entwickelt er den Begriff<br />
einer ‚angeeigneten bzw. bedingten Freiheit’. Allerdings vernachlässigt er bei der Erklärung dieser Freiheitsvorstellung<br />
im dritten Teil seines Buches die von mir oben erwähnten Widersprüche, welche dem Begriff der<br />
Freiheit notwendig inhärent sind, so daß er die letztlich rationale Unverständlichkeit des Vorgangs der Billigung<br />
nicht hinreichend deutlich werden läßt.<br />
20 Aristoteles, Metaphysik 4, 8; 1012 b, 15,: „o( me\n pa/nta a)lhJh= le/gwn kai\ to\n e)nanti/on e(autou=<br />
lo/gon a)lhJh= poiei=, w(/ste to\n au(tou= ou)k a)lhJh= (o( ga\r e)nanti/oj ou)/ fhsin au)to\n a)lhJh=), o( de\<br />
pa/nta yeudh= kai\ au)to\j e(auto/n.“ Im obigen Abschnitt findet sich meine deutsche Übersetzung des<br />
zitierten griechischen Textes. Hierbei möchte ich darauf hinweisen, daß Übersetzungen immer auch Interpretationen<br />
darstellen, weil jede Sprache das Resultat ihrer eigenen Geschichte ist. Die griechischen Wörter<br />
‚a)lh/Jeia’ bzw. ‚a)lhJh/j’ übersetzen wir im Deutschen i.d.R. mit ‚Wahrheit’ bzw. ‚wahr’, obgleich sie wörtlich<br />
das ‚Nichtverborgene’ bzw. ‚nichtverborgen’ bedeuten. Infolgedessen muß man für eine wissenschaftlich<br />
seriöse Auseinandersetzung über entsprechende sprachliche Kenntnisse verfügen, ohne allerdings unbedingt jede<br />
Vokabel oder jedes grammatikalische Detail zu kennen; aber man hat auf jeden Fall über notwendige Grundkenntnisse<br />
zu verfügen, die für die zu erörternden Fragen hinreichend sein müssen! Falls man nicht über solche<br />
Kenntnisse verfügt, so kann es dennoch sehr sinnvoll sein, sich die aufgeführten Gedanken zu Gemüte zu führen,<br />
um seinen eigenen Horizont so weit zu erweitern, wie es einem eben möglich ist.
8. Immanuel Kant: Möglichkeiten und Grenzen menschlichen Verständnisses:<br />
Nachfolgend soll eine kurze Auseinandersetzung mit Immanuel Kant erfolgen, weil er, neben<br />
den alten Griechen, zu den größten Philosophen der Menschheitsgeschichte gehört. Obgleich<br />
ich einigen seiner zentralen Thesen mittlerweile sehr kritisch gegenüberstehe, so verdanke ich<br />
ihm dennoch außerordentlich viel und meiner Bewunderung für sein Werk sollen alle vorzubringenden<br />
Kritikpunkte keinen Abbruch tun, weil auch und zum Teil gerade aus Irrtümern<br />
weiterführende Einsichten erwachsen können.<br />
Kants kritische Philosophie setzt sich im theoretischen Teil mit dem Problem menschlicher<br />
Erkenntnis, <strong>als</strong>o der Frage „Was kann ich wissen“ und im praktischen mit der Moral, <strong>als</strong>o der<br />
Frage „Was soll ich tun“ 21 , auseinander; beides Topoi der gesamten Philosophiegeschichte. 22<br />
Zum zuerst genannten Problembereich formulierte Locke, die scholastische Position aufnehmend,<br />
folgendes: „Nihil est in intellectu quod non fuerit in sensu“, worauf Leibniz trocken<br />
erwiderte: „Nisi intellectus ipse.“ 23 . Dieser Disput zweier Vorgänger Kants beleuchtet kurz<br />
und prägnant einen wesentlichen Ausgangspunkt seiner Philosophie, nämlich die Frage, welchen<br />
Anteil die menschliche Vernunft an der Erkenntnis hat, ob sie sich zur Außenwelt nur<br />
passiv und unfrei verhält oder selbst etwas und wenn ja, was genau in diesen Prozeß miteinbringt.<br />
Kant vertritt die Auffassung, daß der menschliche Verstand nicht passiv oder nur<br />
marginal an der Erkenntnis beteiligt sei, sondern sie geradezu konstituiere; dies nennt er, in<br />
Anlehnung an die Kosmologie, die ‚kopernikanische Wende’, welche seine Thesen für die<br />
Philosophie beanspruchen könnten. Wenn, wie die englischen Empiristen Locke und Hume<br />
behaupten, nichts im Verstande sei, was nicht vorher in den Sinnen gewesen wäre, verhielte er<br />
sich lediglich passiv, und alle menschliche Erkenntnis stammte aus der Erfahrung. Infolgedessen<br />
existieren nach Hume nur aus der äußeren und inneren Wahrnehmung stammende Eindrücke<br />
(impressions) sowie Vorstellungen (ideas), welche Nachbilder bzw. Erinnerungen der<br />
ersteren seien. Komplexe Vorstellungen, wie z.B. wissenschaftliche Theorien, entstünden<br />
demnach durch die verschiedensten Kombinationen aus Eindrücken und Vorstellungen.<br />
Außer diesem gebe es nichts, weder so etwas wie Substanz und damit eine Seele oder ein bleibendes<br />
‚Ich’, noch Kausalität, da wir immer nur ein Nacheinander in der Zeit und kein Wegeneinander<br />
wahrnähmen. Wenn wir trotzdem so etwas wie Substanz oder Kausalität dächten,<br />
so geschehe dies aufgrund von Gewöhnung, die eine dahingehende psychische Nötigung darstelle.<br />
Eine Gegenposition hierzu vertraten Rationalisten wie Descartes oder Leibniz, welche<br />
dem Verstand die Gewinnung wahrer Erkenntnisse aus sich selbst heraus mittels korrekten<br />
logischen Denkens und damit auch die Möglichkeit richtiger Aussagen sowohl über die wahrnehmbare<br />
Außenwelt <strong>als</strong> auch darüber hinaus im metaphysischen Bereich zusprachen, ohne<br />
allerdings vorher eine kritische Prüfung des Verstandes und seiner Möglichkeiten sowie<br />
Grenzen vorzunehmen, wodurch dieser Rationalismus in seiner Methode dogmatisch war.<br />
Kant nimmt nun beide Positionen auf und geht über sie hinaus. Die Erfahrung sei demnach<br />
etwas Zusammengesetztes und zwar bestehend aus den äußeren Eindrücken und dem, was wir<br />
durch unseren Verstand selbst hinzufügten. Obgleich alle Erkenntnis mit der Erfahrung anfange,<br />
da unsere Sinne durch äußere Reize zunächst affiziert werden müßten und diese somit jenen<br />
zeitlich immer vorausgingen, bedeute dies aber keineswegs, daß auch alle Erkenntnis aus<br />
der Erfahrung stamme. Denn die in uns befindliche Funktionsweise des Verstandes sei vor<br />
aller Erfahrung in uns angelegt, sie stamme nicht aus jener. Kants Transzendentalphilosophie<br />
<strong>als</strong> einer nicht empirischen Wissenschaft nicht empirischer Bedingungen empirischer Erkenntnisse<br />
beschäftigt sich <strong>als</strong>o mit reinen, d.h. vor aller Erfahrung liegenden Erkenntnissen.<br />
Mithilfe unserer Verstandeskategorien erzeugten wir selbst die Welt, die wir wahrnehmen,<br />
21 beide Zitate aus: Immanuel Kant: Kritik der reinen Vernunft. Hg. W. Weischedel. Sonderausgabe Wissenschaftliche<br />
Buchgesellschaft Bd. 4 Darmstadt 1983. S. 677<br />
22 vgl. hierzu: Immanuel Kant: Kritik der Urteilskraft. Hg. W. Weischedel. Sonderausgabe Wissenschaftliche<br />
Buchgesellschaft Bd. 8 Darmstadt 1983. S. 173 und 242 (erste und zweite Fassung)<br />
23 Beide Zitate nach: Wilhelm Windelband: Lehrbuch der Geschichte der Philosophie. Tübingen 17 1980. S. 398
indem wir das uns von außen gegebene Material entsprechend dieser Kategorien verarbeiteten,<br />
so daß beispielsweise Raum und Zeit oder die Kausalität in uns angelegt seien und wir<br />
infolgedessen valide Aussagen über die uns umgebende Umwelt treffen könnten, da jene<br />
insoweit ja durch uns selbst erzeugt worden sei. Allerdings, so betont Kant einschränkend,<br />
könnten wir über die ‚Dinge an sich’, <strong>als</strong>o wie sie unabhängig von unserer Erfahrung seien,<br />
nichts aussagen. Gleichwohl existierten diese Dinge an sich, und die Welt sei somit nicht nur<br />
ein Produkt unseres Geistes, wie der Idealismus behauptet. Unser Verstand benötige das von<br />
den Sinnen schon verarbeitete Material und forme es weiter, wodurch dann gesicherte Erkenntnisse<br />
entstünden, d.h. daß Begriffe ohne Anschauungen leer seien und damit jeglicher<br />
metaphysischen Spekulation der Boden einer gesicherten Erkenntnis entzogen sei, da man nur<br />
mithilfe reiner Verstandeserkenntnis, ohne sie an der empirischen Realität, so wie sie uns<br />
durch die Sinne gegeben sei, zu prüfen, alle möglichen Denkgebäude errichten könne, welche<br />
aber damit keinerlei Anspruch auf Wahrheit erheben könnten. Andererseits seien Anschauungen<br />
ohne Begriffe blind, weil erst durch die Tätigkeit des Verstandes und seiner Kategorien<br />
wie z.B. der Kausalität ein für uns verständliches Bild der Außenwelt entstehe. Hier sollten<br />
nur kurz einige wesentliche Eckpunkte von Kants theoretischer Philosophie angesprochen<br />
werden, um sich nachfolgend mit Problemen, welche sich daraus ergeben, auseinanderzusetzen,<br />
wobei entsprechende Kenntnisse hier vorausgesetzt sind.<br />
Der Begriff des ‚Dinges an sich’, auch wenn er nur <strong>als</strong> Grenzbegriff dient, ist in sich widersprüchlich,<br />
weil er einen Kaus<strong>als</strong>chluß von der Welt außerhalb unseres Verstandes auf die uns<br />
erscheinende Welt darstellt, mithin eine Anwendung einer nur für unser Denken gültigen Kategorie<br />
außerhalb ihres von Kant vorgegebenen Wirkungsbereiches. Wir sind grundsätzlich<br />
nicht in der Lage zu beweisen, ob es überhaupt eine Welt außerhalb unserer Vorstellungen<br />
gibt oder nicht, obwohl wir uns der Existenz einer solchen dennoch gefühlsmäßig ganz sicher<br />
sind. Der Versuch, durch die Konstruierung des ‚Dinges an sich’, eine Ursache für das weltliche<br />
Bedingungsgefüge außerhalb desselben mit Hilfe unseres Verstandes rational verständlich<br />
herauszuarbeiten, ist notwendig zum Scheitern verurteilt, weil ein solcher Versuch die<br />
Grenzen unserer Möglichkeiten überschreitet. Obwohl Kant auch keineswegs behauptete, man<br />
könne die Existenz eines ‚Dinges an sich’ beweisen, so setzt er bei seiner Philosophie dies jedoch<br />
voraus, indem er beispielsweise vielfach betont, daß die ‚Welt an sich’ keinesfalls so<br />
beschaffen sei, wie wir sie wahrnähmen bzw. für uns selbst konstruierten. Man muß sich hier<br />
ganz einfach die Frage stellen, warum die Welt an sich denn nicht so sein soll, wie wir sie<br />
wahrnehmen, ohne damit zu behaupten, daß sie so sei, aber dennoch zumindest die Möglichkeit<br />
einer solchen Annahme zu konstatieren. Obwohl wir durch die moderne Physik sowie<br />
unter Zuhilfenahme neuester Technik heute z.T. sogar sehr anschaulich darlegen können, daß<br />
die Welt, die wir wahrnehmen, nicht so ist, wie wir sie nur mithilfe unserer Sinne wahrnehmen,<br />
so ist doch auch letztlich dies nur wieder ein Konstrukt durch uns selbst, dessen Wahrheit<br />
ebenfalls letztlich nicht beweisbar ist und damit die Welt doch wieder so sein könnte, wie<br />
wir sie durch die Sinne wahrnehmen. Um jeglichem Mißverständinis vorzubeugen möchte ich<br />
allerdings betonen, daß ich mich natürlich keineswegs gegen die neuen naturwissenschaftlichen<br />
Erkenntnisse wende, sondern sie im Gegenteil für außerordentlich nützlich halte und<br />
deren Einbeziehung für die Erklärung der Welt, so weit wir sie eben mit unseren Sinnen einschließlich<br />
aller technischen Hilfsmittel und unserer Vernunft erkennen können, nachdrücklich<br />
einfordere. Dennoch bleibt die oben dargelegte Problematik bestehen, daß letzte Gewißheit<br />
– in welcher Frage auch immer – für uns Menschen unerreichbar bleibt und somit auch<br />
die Behauptung, die Welt an sich sei auf gar keinen Fall so, wie wir sie wahrnehmen, keinen<br />
absoluten Wahrheitsanspruch erheben kann. Daher sollten wir uns meiner Meinung nach<br />
darauf beschränken, in dieser Frage einfach keine sinnvollen Aussagen treffen zu können und<br />
stattdessen die Welt mit den uns gegebenen Möglichkeiten zu interpretieren. Dabei sollten wir<br />
uns aber mit Kant immer bewußt machen, daß es sich eben um eine von uns selbst zumindest
mit geschaffene Welt handelt, um dadurch nicht einem unkritischen, naiven Dogmatismus anheimzufallen.<br />
Ebenso problematisch in der Kantischen Philosophie ist die Frage, wie man <strong>als</strong> Mensch zu<br />
einer reinen Erkenntnis gelangen können soll, da auch die sog. nicht empirischen Bedingungen<br />
für uns immer empirisch gegeben sind. Wenn wir uns Gedanken über Raum, Zeit oder<br />
Kausalität sowie deren Herkunft und Stellung im Rahmen unseres Erkenntnisprozesses machen,<br />
so kann dies nur empirisch geschehen, sonst wären es nicht unsere Gedanken. Infolgedessen<br />
gibt es für uns keine reine Erkenntnis; sie ist letztlich für uns nicht einmal vorstellbar.<br />
Wir sind lediglich in der Lage, verschiedene Funktionsweisen unserer Anschauung sowie unseres<br />
Denkens zu erkennen, wobei wir zu dieser Erkenntnis aber nur immer durch die Empirie<br />
gelangen können: Wir denken so wie wir denken, weil wir nur so denken können, und dies erkennen<br />
wir durch unser Denken und niem<strong>als</strong> anders. Diesem Zirkel können wir nicht entfliehen.<br />
Darüber hinaus bleiben alle in den vorigen Abschnitten aufgeführten und für uns unauflösbaren<br />
Widersprüche innerhalb unserer Erkenntniskategorien weiterhin bestehen.<br />
In seiner praktischen Philosophie behauptet der Königsberger, daß der Mensch einerseits ein<br />
Teil der Sinnenwelt sei, in welcher alles durch physikalische Gesetze (Newtons Physik) determiniert<br />
sei, andererseits aber auch einem Reich der Freiheit angehöre, das <strong>als</strong> getrennt von<br />
der empirischen gedacht werden müsse, weil es sonst nicht <strong>als</strong> frei betrachtet werden könne.<br />
Kant gibt selber zu, daß die Verbindung dieser beiden Welten im Menschen für uns letztlich<br />
unerklärlich bleibe. Meiner Meinung nach ist sie aber nicht nur unerklärlich, sondern sogar<br />
widersprüchlich, und dieser Widerspruch bleibt unauflöslich (s.o. und s.u.). Es ist nicht einzusehen,<br />
wie die Freiheit in einer determinierten empirischen Welt praktisch, d.h. wie sie<br />
durch unsere Handlungen in einer an sich doch gesetzmäßig bestimmten Welt wirksam werden<br />
sollte, denn dies kann wiederum nur geschehen, wenn die empirische Welt nicht determiniert<br />
wäre. Dies wiederum kollidiert z.B. mit der Kategorie der Kausalität, mit deren Hilfe wir<br />
nach Kant die empirische Welt selbst konstruieren. 24 Desweiteren erörtert Kant die in dem<br />
Begriff der Freiheit selbst liegenden und für uns unauflöslichen Widersprüche (s.o.) nicht<br />
näher. Dennoch meint er im kategorischen Imperativ ein allgemeingültiges, auf der Freiheit<br />
basierendes Moralprinzip für alle vernünftigen Wesen gefunden zu haben, welches aufgrund<br />
seiner reinen Formalität diesen Anspruch einzulösen vermöge, da es nicht aus der Erfahrung<br />
gewonnen sei. Daß dies ein Denkfehler Kants war, ergibt sich aus dem oben bereits Dargestellten,<br />
weil wir alle Erkenntnis nur empirisch gewinnen können und etwas rein Formales<br />
durch unsere Vernunft nicht gedacht werden kann. Ebensowenig sind wir in der Lage, etwas<br />
<strong>als</strong> unumstößlich richtig zu bezeichnen, allein schon deshalb, weil wir uns <strong>als</strong> Menschen<br />
immer täuschen können (s.o.).<br />
Trotz der vorgebrachten Kritikpunkte bleibt es das große Verdienst von Kant, den aufrichtigen<br />
Versuch unternommen zu haben, gegen einen radikalen Skeptizismus bzw. Relativismus<br />
Stellung sowohl in theoretischer <strong>als</strong> auch in praktischer Hinsicht bezogen und gleichzeitig<br />
unser Erkenntnisvermögen kritisch durchleuchtet zu haben. Das, was Sokrates gefühlsmäßig<br />
postulierte, nämlich daß es eine allgemeingültige Wahrheit gebe, auch wenn er sie in seinem<br />
Leben nicht gefunden habe, versuchte Kant rational zu ergründen und meinte es in seiner<br />
Transzendentalphilosophie zumindest im Hinblick auf die Funktionsweisen und Grenzen<br />
menschlicher Erkenntnis <strong>als</strong> auch hinsichtlich der Moral gefunden zu haben. Obgleich er diesem<br />
Anspruch nach dem oben Erörterten nicht ganz gerecht wurde, so können die Erkenntnisse<br />
seiner theoretischen wie praktischen Philosophie <strong>als</strong> bahnbrechende Fortschritte in der<br />
menschlichen Geistesgeschichte bezeichnet werden!<br />
24 In der modernen Physik existiert die strenge Kausalität wie bei Newton nicht mehr, so daß wir heute eine derart<br />
schroffe Gegenüberstellung der zwei Welten von empirischer Determination und ideeller Freiheit allein schon<br />
deshalb nicht mehr vornehmen müssen, um dadurch eine Physik der völligen Kausalität und Berechenbarkeit zu<br />
ermöglichen, ohne gleichzeitig jegliche Möglichkeit von Freiheit für uns aufzugeben.
9. Anerkennung der Grenzen menschlicher Möglichkeiten und die Entwicklung pragmatischer<br />
Setzungen:<br />
Die oben erörterten Widersprüche können trotz aller Versuche dennoch prinzipiell nicht von<br />
der menschlichen Vernunft aufgelöst werden. Eigentlich dürften wir uns mit dieser Feststellung<br />
nicht abfinden, weil ein zentrales Denkprinzip dem diametral entgegensteht, nämlich der<br />
Satz vom zu vermeidenden Widerspruch, wonach man von dem Einen nicht das Eine und sein<br />
Gegenteil zugleich behaupten darf. Wir müßten demnach anders denken und können es dennoch<br />
nicht, wir suchen nach Auflösung und wissen, daß wir sie nicht finden werden. Alle Bemühungen<br />
der Philosophie, diesem Dilemma zu entkommen, waren und sind notwendig zum<br />
Scheitern verurteilt, weil unsere Vernunft so widersprüchlich angelegt ist. Auch wenn es wenig<br />
Trost spendet, so zeigen sich z. B. einige dieser Probleme auch in der modernen Physik,<br />
deren große Entdecker teilweise in schiere Verzweifelung gerieten, weil ihre Ergebnisse einfach<br />
nicht in einen mit unserem Denken widerspruchsfreien Einklang zu bringen sind und sich<br />
der Begriff der Materie auch in der Physik, ebenso wie in der Philosophie, <strong>als</strong> höchst problematisch<br />
erwiesen hat, weil beispielsweise ein Teilchen mal <strong>als</strong> Körper mal <strong>als</strong> im Raum ausgedehnte<br />
Welle erscheint, abhängig von den Beobachtungsbedingungen, oder daß der Aufenthaltsort<br />
eines Elektrons nicht genau im Raum – Zeitgefüge bestimmbar ist und somit nur Aufenthaltswahrscheinlichkeiten<br />
angegeben werden können, sowie schließlich daß unser Raum<br />
nicht dreidimensional ist, obwohl wir uns dies niem<strong>als</strong> werden wirklich vorstellen können. 25<br />
Was sollen wir <strong>als</strong>o tun, um eine Grundlage zu finden, auf der sinnvoll aufzubauen ist? Nach<br />
allen vergeblichen Bemühungen der Geistesgeschichte, die genannten Probleme einer Lösung<br />
zuzuführen und der Einsicht, daß sie für uns Menschen schlechterdings unlösbar sind und<br />
bleiben, müssen wir wohl oder übel damit leben. Denn auch die eben aufgestellte Behauptung,<br />
daß diese Probleme unlösbar seien, beansprucht ja wieder wahr zu sein. Aus diesem<br />
Zirkel gibt es kein Entrinnen. Dies müssen wir einfach akzeptieren, ohne uns jem<strong>als</strong> damit<br />
wirklich zufrieden geben zu können; auch dies ein notwendiger Zwiespalt, ein Widerspruch.<br />
Dennoch sehen wir, daß die Menschheit damit leben kann, weil sie damit leben muß! Hier<br />
erscheint es mir angebracht zu sein, Heraklit heranzuziehen. Dieser ging davon aus, daß die<br />
Welt aus einem unablässigen Kampf von Gegensätzen, <strong>als</strong>o sich widerstreitender Kräfte, hervorgehe<br />
und dies selbstverständlich auch unser Erkenntnisvermögen bestimme: denn z.B. erst<br />
durch die Krankheit wüßten wir, was Gesundheit bedeute. Somit impliziert Erkenntnis notwendig<br />
Abgrenzung und z.T. sogar die – zumindest gedankliche Konstruierung – von Gegensatzpaaren:<br />
Endlichkeit, räumlich oder zeitlich, ist für uns erst verständlich, wenn wir den<br />
Begriff der Unendlichkeit formulieren; gleiches gilt z.B. für das Gegensatzpaar Determination<br />
und Indetermination. Somit verwenden wir Begriffe notwendig in unserem Denken, ohne daß<br />
wir sie letztlich verstehen können. Einen in diesem Zusammenhang interessanten Ansatz vertrat<br />
der Neukantianer Hans Vaihinger. Er begründete den sog. ‚Fiktionalismus’, indem er dabei<br />
die regulativen Ideen Kants weiterverarbeitete. 26 Demnach verwendeten wir Hilfsbegriffe<br />
in unserem Denken, welche entweder nicht beweisbar oder sogar in sich widersprüchlich<br />
seien, wie z.B. den der Freiheit. Dennoch erwiesen uns diese ‚Als – ob – Begriffe’ wertvolle<br />
Dienste im Alltag, ja sie seien teilweise sogar notwendig zu denken. Die Rechtfertigung ihrer<br />
Benutzung liege <strong>als</strong>o allein in ihrer praktischen Tauglichkeit, welche sie für uns im ‚Kampf<br />
ums Dasein’ beweisen müßten. Sie bestünden <strong>als</strong>o nicht um ihrer selbst willen, sondern seien<br />
nur Mittel zum Zweck. Erst wenn sie einer philosophischen Reflexion unterzogen würden,<br />
25 Einige bedeutende Physiker sollen hier genannt sein: Niels Bohr, Albert Einstein, Werner Heisenberg, Max<br />
Planck, Erwin Schrödinger. In diesem Zusammenhang möchte ich zwei Bücher erwähnen, welche versuchen,<br />
moderne physikalische Erkenntnisse auch für den Nicht – Physiker verständlich darzulegen: Ernst Peter Fischer:<br />
Werner Heisenberg. Das selbstvergessene Genie. München 2001 sowie Gert – Ludwig Ingold: Quantentheorie.<br />
Grundlagen der modernen Physik. München 2002.<br />
26 Hans Vaihinger: Die Philosophie des Als – Ob. System der theoretischen, praktischen und religiösen Fiktionen<br />
der Menschheit. Halle a. d. Saale 1911
erwiesen sie sich <strong>als</strong> in höchstem Maße problematisch. Infolgedessen entwickelte Vaihinger<br />
einen ganz anderen Begriff von ‚Wahrheit’: wahr sei demnach alles, was wir richtig vorauszusagen<br />
vermöchten, indem wir uns aufgrund von Theorien und empirischer Beobachtungen<br />
ein zutreffendes Bild von der Zukunft machten. Jede Überlegung, die dies zu leisten vermöge,<br />
habe somit <strong>als</strong> wahr zu gelten, zumindest so lange sie nicht durch die Erfahrung widerlegt<br />
würde. Wahrheit sei demnach nichts anderes <strong>als</strong> Nützlichkeit; einen anderen‚ objektiven Maßstab<br />
gebe es nicht. Indem Vaihinger jedoch behauptet, daß diese Aussage wahr sei, unterliegt<br />
er dem in Abschnitt 7. erläuterten Widerspruch. Aber abgesehen davon erscheint mir sein<br />
Ansatz hinsichtlich der Nützlichkeit bzw. sogar Notwendigkeit solcher ‚Als – ob – Begriffe’<br />
insofern weiterführend zu sein, <strong>als</strong> daß wir gar nicht umhin können, sie in unserem Leben zu<br />
verwenden, wobei hier ihre entwicklungsgeschichtliche Genese von Vaihinger herangezogen<br />
wird, um ihre Tauglichkeit während des Evolutionsprozesses <strong>als</strong> plausible Begründung ihrer<br />
Verwendung in der Gegenwart zu postulieren. Allerdings möchte ich hier dennoch anfügen,<br />
daß wir trotz solcher Nützlichkeitserwägungen einen Wahrheitsanspruch in uns selbst vorfinden<br />
– rational wie auch emotional – welcher nicht allein mit der Tauglichkeit von Überlegungen<br />
zu befriedigen ist, so daß wir zwar durch Vaihingers Denkansatz eine weitere kritische<br />
Läuterung zu erfahren vermögen, aber letztlich dennoch keine Lösung der angesprochenen<br />
Probleme ausmachen können, weil dies die prinzipiellen Grenzen unserer Möglichkeiten<br />
<strong>als</strong> Menschen (s.o.) eben nicht erlauben.<br />
Trotz aller radikalen und unauflöslichen Widersprüche, kommen wir <strong>als</strong> Menschen gar nicht<br />
umhin, einige pragmatische Setzungen vorzunehmen, auch wenn sie sich widersprechen, wie<br />
z.B. daß es Freiheit für uns gibt, obwohl Verstehen bedeutet, hinreichende Bedingungen für<br />
ein Phänomen anzugeben, die dieses notwendig bestimmt haben, oder daß wir den Begriff<br />
Wahrheit verwenden, ohne letztlich sagen zu können, was wirklich wahr ist; das gleiche gilt<br />
für die anderen oben aufgeführten Widersprüche sowie alle weiteren, die sich entweder aus<br />
diesen ergeben oder hier nicht aufgeführt worden sind.<br />
Nach einer Auseinandersetzung mit der menschlichen Geistesgeschichte und ihrer kritischen<br />
Würdigung ist eine solche Setzung aber nicht dogmatisch, sondern aufgeklärt, eine ‚gelehrte<br />
Unwissenheit’, um mit Nicolaus Cusanus zu sprechen, welcher das menschliche Nichtwissen<br />
in bezug auf Gott und seine Eigenschaften konstatierte, <strong>als</strong>o ein Nichtwissen hinsichtlich<br />
letzter Fragen. Dennoch dürfen wir nicht derart verzagen, daß wir apathisch alles hinnehmen,<br />
nur weil uns keine unbezweifelbar wahren Antworten zuteil werden können. Stattdessen<br />
müssen wir uns auf unsere Fähigkeiten besinnen und dementsprechend zuversichtlich ans<br />
Werk gehen.<br />
Nachfolgend sollen kurz einige wesentliche Setzungen aufgeführt werden, die nicht willkürlich<br />
getroffen worden sind, sondern sich aus dem bisher Aufgeführten <strong>als</strong> sinnvoll herauskristallisiert<br />
haben, wobei aber betont werden muß, daß damit die grundsätzlich oben dargelegten<br />
Grenzen menschlichen Wissens nicht <strong>als</strong> gelöst zu betrachten sind und das Wissen um<br />
unser Nichtwissen – ebenfalls ein Widerspruch – <strong>als</strong> ständige Mahnung gegen jegliche Hybris<br />
im Gedächtnis zu behalten ist:<br />
1. die Gewißheit der eigenen Existenz, welche notwendig die Annahme eines Wahrheitsbegriffes<br />
sowie damit die Idee des zu vermeidenden Widerspruches impliziert; denn<br />
wenn ich sage, daß ich bin, gehe ich davon aus, daß es wahr ist; weiterhin muß ich<br />
dann annehmen, daß ich nicht gleichzeitig existiere und nicht existiere;<br />
2. die Wahrnehmung der Welt <strong>als</strong> räumlich dreidimensional;<br />
3. die Wahrnehmung der Phänomene im kontinuierlichen zeitlichen Nacheinander;<br />
4. der Prozeß des Verstehens muß <strong>als</strong> abhängig von der Angabe hinreichender Bedingungen<br />
angenommen werden;<br />
5. die Gewißheit der Möglichkeit freien Handelns und Entscheidens.<br />
Über die hier aufgeführten Grundlagen und Grenzen menschlicher Erkenntnisfähigkeit hinaus<br />
ist weitere Philosophie nicht sinnvoll zu betreiben. Die erörterten Widersprüche sind schlech-
terdings für die menschliche Vernunft nicht auflösbar, und die daraus folgenden pragmatischen<br />
Setzungen sind, trotz der auch notwendig darin enthaltenen Widersprüche, zwingend<br />
vorzunehmen, da wir letztlich uns selbst ohne diese Setzungen nicht denken könnten sowie<br />
auch jede Kommunikation mit anderen völlig ausgeschlossen wäre.<br />
Infolgedessen sind die oben diskutierten Probleme, welche die Philosophie seit jeher beschäftigten,<br />
durch die von mir in diesem Kapitel aufgeführten Argumente so weit geklärt<br />
worden, wie dies für Menschen eben möglich ist.<br />
Die nachfolgenden Erörterungen sollen nochm<strong>als</strong> die zentralen Punkte meiner Auffassung zu<br />
diesem Themenkomplex verdeutlichen, wobei die kritische Auseinandersetzung mit einigen,<br />
vornehmlich moderneren (20. Jahrhundert) philosophischen Theorien diesem Ziel dienen soll.<br />
Allerdings darf der Leser an dieser Stelle von mir keine Werksexegesen mit entsprechenden<br />
Textbelegen einschließlich der relevanten Sekundärliteratur erwarten, weil dies mein Zeitbudget<br />
nicht zuläßt. Es geht mir einzig und allein um die Verdeutlichung der Schlüssigkeit und<br />
Sinnhaftigkeit meiner Thesen.<br />
Zunächst schauen wir uns das Problem der Gleichheit bzw. Identität an, welches u.a. Gottlob<br />
Frege 27 sehr beschäftigte. Nehmen wir folgendes Beispiel: 3 + 4 = 7. Obgleich nach den arithmetischen<br />
Regeln drei plus vier sieben ergeben, so ist die linke Seite des Termes aber offensichtlich<br />
nicht identisch mit der rechten. Das Auflösen von Termen ist ebenfalls ein gutes Beispiel<br />
dafür, wie wir mit Hilfe analytischer Verfahren unsere Erkenntnis erweitern, und zwar<br />
einfach indem wir durch Rechnen bzw. Auflösen neue Zusammenhänge erschließen können.<br />
Somit sind Gleichheitszeichen im Gegensatz zu Äußerungen von Wittgenstein 28 sowohl in der<br />
Logik <strong>als</strong> auch Mathematik erkenntniserweiternd und unbedingt notwendig, womit Frege in<br />
diesem Punkt zuzustimmen ist. Er benutzte u.a. das Beispiel vom Morgenstern, welcher<br />
gleich dem Abendstern sei, was nichts weiter aussagen soll, <strong>als</strong> daß es sich bei dem hellen<br />
Himmelskörper am Abendhimmel um den gleichen handelt, wie um den ebenfalls hellen am<br />
Morgenhimmel. Obwohl es zwei verschiedene Wörter sind, bezeichnen sie den gleichen Gegenstand,<br />
der nur aus verschiedenen Zeitperspektiven beobachtet wird; es liegt <strong>als</strong>o eine<br />
Gleichheit im Hinblick auf ein bestimmtes Merkmal vor und keine vollkommene Identität.<br />
Dennoch sind solche Gleichheitsaussagen offensichtlich sinnvoll. Vertiefen wir die Gleichheitsproblematik<br />
noch ein wenig, indem wir einen auf den ersten Blick eindeutigen Fall von<br />
Identität betrachten: a = a. Dieser Ausdruck scheint ebenso wahr wie trivial zu sein. Aber<br />
auch hier ist keine absolute Identität gegeben, da sich das linke a an einem anderen Ort <strong>als</strong> das<br />
rechte befindet bzw. beim Sprechen zuerst ein a zum Zeitpunkt x1 ertönt und das zweite a zum<br />
Zeitpunkt x2. Das gleiche Problem beschreibt der Heraklit zugeschriebene Ausspruch, man<br />
könne nicht zweimal in denselben Fluß steigen, weil sowohl der Fluß <strong>als</strong> auch man selbst<br />
nicht <strong>als</strong> völlig identisch mit dem Zustand zuvor angesehen werden könnten. Damit begegnet<br />
uns auch wieder die prinzipielle logische Unvereinbarkeit von eleatischem Sein und heraklitischem<br />
Werden, in welchem unsere Vernunft zwingend gefangen ist. Gleichheit oder Identität<br />
ist eine notwendige Konstruktion des menschlichen Geistes, um die Welt für uns erfahrbar<br />
zu machen, auch wenn wir sie logisch niem<strong>als</strong> mit einem dauernden Prozeß des Werdens,<br />
der ebenso notwendig für die Möglichkeit einer Weltbetrachtung durch uns ist, widerspruchsfrei<br />
in Einklang zu bringen vermögen. Daher sind wir bei Identitätsfeststellungen darauf verwiesen,<br />
sie hinsichtlich bestimmter Merkmale, die wir möglichst genau definieren müssen,<br />
vorzunehmen. So können wir <strong>als</strong>o durchaus aufgrund von Beobachtungen feststellen, daß es<br />
27 Gottlob Frege: Begriffsschrift. Jena 1879; ders.: Die Grundlagen der Arithmetik. Jena 1884; ders.: Die Grundgesetze<br />
der Arithmetik. Jena Bd.1 1893 Bd.2 1903; ders.: Aufsatzserie von 1891 bis 1892: Funktion und Begriff<br />
1891, Über Sinn und Bedeutung 1892 sowie Begriff und Gegenstand 1892. Spätere Schriften zu logischen Untersuchungen:<br />
ders.: Der Gedanke. Jena 1918; ders.: Die Verneinung. Jena 1919; ders.: Gedankengefüge. Jena<br />
1923.<br />
28 Ludwig Wittgenstein: Tractatus Logico-Philosophicus. 1921 bzw.1922; in seinem 1953 posthum erschienenen<br />
Spätwerk ‚Philosophische Untersuchungen’ findet seine teilweise radikale philosophische Neuorientierung Ende<br />
der 1920er sowie Anfang der 1930er Jahre ihren literarischen Niederschlag.
sich beim Morgen- und Abendstern um den gleichen Himmelskörper handelt, wobei auch<br />
wieder die Einschränkung zu machen ist, daß es sich letztlich natürlich insofern nicht um denselben<br />
handelt, <strong>als</strong> daß sich jener in der Zeit zwischen dem Morgen und dem Abend wieder in<br />
mehrfacher Weise (s.o.) verändert hat. Das prinzipielle Problem der Identität kann <strong>als</strong>o zwingend<br />
nicht durch unsere Vernunft gelöst werden, und gleichzeitig müssen wir diesen Begriff<br />
verwenden, um uns in dieser Welt zurechtzufinden. Infolgedessen ist das Identitätspostulat <strong>als</strong><br />
eine notwendige pragmatische Setzung durch uns gerechtfertigt, denn falls dies jemand leugnen<br />
sollte, wie wollte er diese Leugnung überhaupt formulieren, ohne gleichzeitig die Identität<br />
hinsichtlich der Bedeutung seiner Worte vorauszusetzen, damit seine Leugnungsthese<br />
überhaupt zustande kommen sowie kommuniziert und damit durch andere überprüft werden<br />
kann. Das Identitätspostulat <strong>als</strong> Bestandteil des Postulates vom zu vermeidenden Widerspruch<br />
kann trotz seiner in letzter Konsequenz logischen Widersprüchlichkeit rational nicht bestritten<br />
werden, da eine derart ablehnende These genau jenes Postulat zunächst einmal selber verwenden<br />
muß.<br />
Nun wende ich mich dem von Popper 29 begründeten kritischen Rationalismus zu, nach welchem<br />
induktive Aussagen niem<strong>als</strong> verifiziert, sondern allenfalls f<strong>als</strong>ifiziert werden könnten,<br />
da noch so viele Beobachtungen vom Typ für alle a gilt Eigenschaft x oder immer wenn a<br />
dann b <strong>als</strong> absolut sicher anzusehen sind. Denn wir schauen dabei in die Vergangenheit und<br />
schließen daraus, daß es sich auch in Zukunft zwingend so wiederholen werde. Dafür gibt es<br />
allerdings keine Gewähr, wie schon Hume erkannte. Empirische Aussagen ließen sich nach<br />
Popper <strong>als</strong>o lediglich f<strong>als</strong>ifizieren, d.h. daß ein Gegenbeispiel genüge, um eine Allaussage zu<br />
widerlegen. In späteren Jahren ergänzte er seine Theorie dahingehend, daß sich auch eine F<strong>als</strong>ifikation<br />
selbst <strong>als</strong> fehlerhaft erweisen könne, wodurch eine absolut gültige F<strong>als</strong>ifikation<br />
letztlich doch nicht möglich sei. 30 An diesem Punkt möchte ich ansetzen, da genau hier die<br />
von mir zuvor bereits mehrfach angesprochene grundsätzliche Problematik wieder sichtbar<br />
wird, daß wir einerseits niem<strong>als</strong> absolut sichere Thesen aufzustellen vermögen, da wir uns<br />
immer täuschen können und daß andererseits dies eine in sich widersprüchliche Aussage ist,<br />
weil sie wiederum beansprucht wahr zu sein und gleichzeitig impliziert, daß es genau diese<br />
Wahrheit nicht gibt. Wir bleiben notwendig in diesem Zirkel gefangen. Popper mußte sich<br />
aber noch der Frage stellen, wann und warum wir eine Theorie einer anderen vorziehen<br />
sollten, wenn wir noch nicht einmal eine höhere Eintrittswahrscheinlichkeit für eine angeben<br />
könnten. Denn ich kann noch so viele weiße Schwäne finden, ohne damit auch nur eine<br />
höhere Wahrscheinlichkeit angeben zu können, daß auch in Zukunft nur weiße Schwäne zu<br />
finden seien; in diesem Fall wissen wir natürlich, daß es auch schwarze Schwäne gibt. Popper<br />
vertritt daher die Auffassung, daß wir eine Theorie, deren Aussagen sich bisher immer<br />
bewahrheitet hätten und die somit noch nicht f<strong>als</strong>ifiziert worden sei, deshalb in der Praxis<br />
weiter Anwendung finden solle; er nennt dies Bewährung. Man solle allerdings in der Folgezeit<br />
immer wieder versuchen, eine bisher bewährte Theorie zu widerlegen, um möglichen<br />
Fehlern auf die Spur zu kommen. Seine Theorie lehnt sich daher in einigen Punkten an die<br />
von mir in oben erörterten Thesen von Vaihinger an. Ein prinzipielles Problem bleibt jedoch<br />
bestehen: Welche rationalen Gründe kann es geben, damit wir eine Theorie einer anderen<br />
vorziehen sollten, wenn nicht einmal eine höhere Wahrscheinlichkeit für eine von beiden<br />
spricht? Denn letztlich führt uns auch der Terminus ‚Bewährung’ hier nicht weiter. In der<br />
Folgezeit verwarfen einige Vertreter des kritischen Rationalismus auch diesen Begriff und<br />
erklärten, daß es keine rationalen Gründe für die Rechtfertigung irgendwelcher Aussagen<br />
gebe und Rationalität mit Offenheit für Kritik gleichzusetzen sei. 31 Indem sie aber dies postu-<br />
29 Karl Raimund Popper: Logik der Forschung. Wien 1934; ders.: The Open Society and Its Enemies. 1945 (auf<br />
Deutsch: Die offene Gesellschaft und ihre Feinde); ders.: The Poverty of Historicism. 1957 (auf Deutsch: Das<br />
Elend der Historizismus)<br />
30 Vgl. hierzu ders.: Postskript zur Logik XXII ff.<br />
31 Vgl. hierzu: William Warren Bartley III: Flucht ins Engagement. Tübingen 1987; David Miller: Critical<br />
Rationalism: A Restatement and Defence. Chicago 1994
lieren, begeben sie sich in den von mir schon mehrfach dargestellten Zirkel, daß diese Behauptung<br />
einen Wahrheitsanspruch für die Richtigkeit ihrer selbst impliziert und gleichzeitig<br />
jegliche Wahrheitsmöglichkeit leugnet (vgl. hierzu 7. Wahrheitsproblematik insbesondere die<br />
von mir zitierte Aristotelesstelle). Im weiteren Verlauf der philosophischen Diskussion stellte<br />
sich zudem heraus, daß sich Existenzaussagen, im Gegensatz zu Gesetzes- d.h. Allaussagen,<br />
letztlich nicht f<strong>als</strong>ifizieren lassen, da man ja nie mit Gewißheit davon ausgehen kann, ob<br />
etwas, dessen Existenz einfach postuliert wird, ohne gleichzeitig seine Existenz nachweisen<br />
zu können, nicht dennoch irgendwo im Universum existiert. Die einzig vernünftige Vorgehensweise<br />
ist folgende: Wir müssen uns einerseits die prinzipiell unauflösbaren Widersprüche<br />
in unserem Denken eingestehen und andererseits die in den pragmatischen Setzungen<br />
getroffenen Aussagen <strong>als</strong> Grundlagen anerkennen. Bezogen auf die oben dargelegte<br />
Problemstellung heißt dies, daß wir mit absoluter Sicherheit zwar keine Theorie irgendeiner<br />
anderen vorziehen können, wobei dies in gleicher Weise für die F<strong>als</strong>ifikation einer Theorie<br />
gilt, da ja auch die F<strong>als</strong>ifikationsaussage den oben erwähnten Wahrheitsanspruch für sich<br />
selbst notwendig beansprucht, aber andererseits insbesondere die 1., 3. und 4. pragmatische<br />
Setzung <strong>als</strong> Basis für die Entwicklung von Kriterien der Bevorzugung einer Theorie heranzuziehen<br />
sind. Denn jeder Versuch, die erwähnten Setzungen zu widerlegen, ist prinzipiell<br />
zum Scheitern verurteilt, weil für die Möglichkeit eines solchen Versuches zunächst<br />
wiederum diese Setzungen Anwendung finden müßten. Die von mir weiter unten in Kapitel<br />
3.1. kurz erörterten Grundregeln zur Erlangung wissenschaftlicher Theorien, welche auf<br />
diesem Kapitel aufbauen, stellen eine rational gut begründete Basis dar.<br />
Ich hoffe, meine Position durch die Auseinandersetzung mit einigen moderneren Theorien<br />
verdeutlicht zu haben. Es sollte klar geworden sein, daß die immer wieder gewälzten Fragen<br />
in diesem Bereich für uns Menschen zu keiner anderen rational sinnvollen Lösung gelangen<br />
können, <strong>als</strong> derjenigen, welche ich dargelegt habe. Dabei kommt es mir ein wenig wie in dem<br />
Märchen ‚Des Kaisers neue Kleider’ vor, wo ein Junge feststellt, daß der Kaiser eigentlich<br />
nackt sei. Es wird bis heute teilweise mit viel Scharfsinn versucht, Probleme zu lösen, die<br />
letztlich nicht zu lösen sind oder man gleitet in einen Relativismus ab, der nicht minder widersprüchlich<br />
und genauso wenig weiterführend ist. Die von mir hier formulierten Thesen sollten<br />
auf den Leser nicht anmaßend wirken, da es mir nicht um die eigene Eitelkeit ging, sondern<br />
nur um rationale Bestimmungen der Grenzen und Möglichkeiten menschlichen Denkens.<br />
Dabei kam es mir teilweise eben so wie in dem oben erwähnten Märchen vor, da es mich<br />
doch sehr wunderte, daß bis heute einige offensichtliche Sachverhalte bei einer Reihe von<br />
berühmten Fachvertretern nicht richtig erkannt worden sind. Dies läßt sich meiner Meinung<br />
nach wohl am ehesten psychologisch erklären, weil der Mensch nach absoluter Wahrheit<br />
sucht, d.h. zumindest nach einigen wenigen Punkten, wo er sich wirklich völlig sicher sein<br />
kann und dann aber genau von diesem Streben so überwältigt wird, daß er an manchen Stellen<br />
das klare Denken zugunsten seines so heiß begehrten Zieles aufgibt und entweder vermeintlich<br />
absolut sichere Erkenntnisse meint gefunden zu haben, oder aber, infolge erfolgloser<br />
Suche nach jenen, in einen Relativismus bzw. Skeptizismus abgleitet, welcher genauso unsinnig<br />
ist, wie oben gezeigt werden konnte.<br />
Eine Suche nach Erkenntnissen über das oben Aufgeführte hinaus ist meiner Meinung nach<br />
sinnlose Zeitverschwendung, wobei allerdings eine Auseinandersetzung mit der Philosophiegeschichte<br />
und ihren Autoren natürlich sehr zu empfehlen ist, um den Weg, welcher zu den<br />
von mir hier begründeten Ergebnissen geführt hat, kennen zu lernen. Die Aufgabe der philosophischen<br />
Forschung kann heute daher ‚nur’ darin bestehen, von dieser Grundlage ausgehend,<br />
Themen zu behandeln, die insbesondere praktische Probleme wie z.B. Moral, Recht,<br />
Wirtschaft oder Politik betreffen, d.h. hier Antworten zu geben versuchen bzw. mit vorzubereiten<br />
und dabei eine geistige Tiefe durch die Auseinandersetzung mit der Geistesgeschichte<br />
einzubringen, welche eine gute Hilfe ist, um über die Tagesaktualität hinaus zu
licken und längere Entwicklungslinien, einschließlich der vorgekommenen Irrtümer, besser<br />
zu erkennen.<br />
„Wer nicht von dreitausend Jahren<br />
Sich weiß Rechenschaft zu geben,<br />
Bleib im Dunkeln unerfahren,<br />
Mag von Tag zu Tage leben.“<br />
(Johann Wolfgang von Goethe, West-östlicher Divan)<br />
Exkurs: Einige weitere Überlegungen:<br />
Inwiefern die Spannung zwischen dem Streben nach Fehlerfreiheit, absoluter Perfektion<br />
einerseits und der Fehlerhaftigkeit, Ungenauigkeit andererseits erst Entwicklung, Leben und<br />
dessen evolutionäre Weiterentwicklung ermöglicht, zeigt sich auch eindrucksvoll bei der<br />
Kopie genetischer Erbinformationen, welche fast unzählige Male in jedem Lebewesen, jeder<br />
Zelle stattfindet, solange dort Leben st. Zum einen muß dieser Kopiervorgang möglichst<br />
fehlerfrei ablaufen, damit die Weitergabe essentieller Informationen und damit weiteres<br />
Leben dieses Wesens überhaupt erst gewährleistet ist. Zum anderen aber treten dort immer<br />
wieder kleine Ungenauigkeiten, sprich Kopierfehler auf, die zu Mutationen führen, welche<br />
zwar das Lebewesen schädigen oder sogar töten, aber auch Weiterentwicklungen herbeiführen<br />
können, ja diese Weiterentwicklungen überhaupt erst ermöglichen. Denn schließlich kann<br />
durch die exakte Wiederholung des immer Gleichen keine Entwicklung, kein Fortschritt<br />
eintreten. Einerseits strebt das Leben (und damit die Weitergabe von Erbinformationen) nach<br />
Perfektion, nach Fehlerfreiheit. Andererseits wird Entwicklung zu Höherem, die Anpassung<br />
an geänderte Umweltbedingungen erst durch das Auftreten von Ungenauigkeiten, Fehlern<br />
ermöglicht.<br />
Auch hier haben wir <strong>als</strong>o wieder feststellen können, inwieweit das ganze Leben – nicht nur<br />
unser zwischenmenschlicher Alltag – durch die Spannung zwischen Perfektion und Chaos,<br />
zwischen Fehlerfreiheit und der Unausweichlichkeit von Fehlern bestimmt, ja überhaupt erst<br />
ermöglicht wird. Wir streben danach, und müssen es zumeist auch, keine Fehler zu machen,<br />
weil ansonsten nichts mehr vorhersagbar, berechenbar und damit für uns handhabbar wäre.<br />
Andererseits müssen wir feststellen, daß die Erreichung dieses Zieles für uns nicht nur unmöglich<br />
ist und bleibt, sondern wir auch letztlich gar nicht hoffen dürfen, dieses Ziel im<br />
Diesseits zu erreichen, weil erst durch Ungenauigkeiten, Fehler eine Entwicklung – zum<br />
Guten wie zum Bösen – und damit Leben überhaupt erst möglich wird und ist. Dennoch<br />
müssen wir zugleich die völlige Unberechenbarkeit, das Chaos zu vermeiden suchen, indem<br />
wir das Richtige, das Fehlerfreie anstreben:<br />
Wir streben <strong>als</strong>o nach etwas und müssen dies sogar, das wir niem<strong>als</strong> werden erreichen<br />
können, und es nicht einmal erreichen wollen können. Die dadurch erzeugte Spannung<br />
macht letztlich das diesseitige Leben aus!
1.4. Wertungen in der Wissenschaft:<br />
Können, dürfen oder müssen Geistes-, Gesellschafts- und Sprachwissenschaften auch<br />
moralische Wertungen vornehmen?<br />
Die genannten Wissenschaften müssen zunächst natürlich – wie alle anderen Wissenschaften<br />
auch – Phänomene korrekt beschreiben und untersuchen, was zu diesen Phänomenen geführt<br />
hat und welche Entwicklungen unter der Annahme bestimmter Vorraussetzungen zu erwarten<br />
sind. Bei all diesem verbieten sich normative Wertsetzungen. Die einzige – zumindest teilweise<br />
unvermeidbare Wertsetzung – besteht in der Auswahl der Themen bzw. zu untersuchenden<br />
Szenarien. Denn zunächst gilt es, möglichst objektiv Sachverhalte zu beschreiben, zu<br />
untersuchen, zu analysieren und daraufhin Prognosen für die Zukunft unter der Angabe genau<br />
definierter Rahmenbedingungen zu erstellen. Hinsichtlich der Empirie ist die intersubjektive<br />
Nachprüfbarkeit zu gewährleisten, damit jeder feststellen kann, dass die behaupteten empirischen<br />
Fakten auch stimmen – oder eben nicht. Darüber hinaus müssen die Schlüsse, die aus<br />
diesen empirischen Fakten gezogen werden, logisch eindeutig folgerichtig belegbar sein, um<br />
wissenschaftlichen Standards zu entsprechen. Beide – empirische Nachprüfbarkeit und logische<br />
Stringenz – müssen immer zwingend gegeben sein, damit eine Aussage oder Theorie<br />
ernstzunehmend diskutiert werden können. Es handelt sich bei dem oben Dargelegten <strong>als</strong>o um<br />
notwendig zu erfüllende Bedingungen für eine wissenschaftliche Auseinandersetzung.<br />
Wir konnten <strong>als</strong>o feststellen, welche Kriterien an wissenschaftliche Aussagen zwingend anzulegen<br />
sind. Wie sieht es hinsichtlich dieser Kriterien aber mit normativen Wertsetzungen aus?<br />
Kann man rational solche Wertsetzungen begründen oder ist dies nicht möglich?<br />
Nehmen wir einmal an, dass dies nicht möglich ist. Was hätte dies zur Folge? Die Vergasung<br />
der Juden während der Naziherrschaft in Deutschland könnte unter rationalen Gesichtspunkten<br />
nicht bewertet werden. Es existierten mithin keine vernünftigen Kriterien dafür, diese Tat<br />
zu verurteilen oder gut zu heißen. Es war eben so, wie es war. Die Wissenschaft kann dies nur<br />
achselzuckend zur Kenntnis nehmen und beschreiben, was zu dieser Tat geführt hat. Aber<br />
rationale Gründe zur moralischen Verurteilung ließen sich nicht liefern. Auch die Sprache, die<br />
solche Taten rechtfertigt, wäre nicht zu verurteilen. Wenn jemand öffentlich sagt, dass ein Ort<br />
‚judenrein’ sei, so gäbe es keinen rational begründbaren Maßstab dies zu verurteilen.<br />
Ich kann mich mit einer solchen Geisteshaltung, die derartiges unter dem Denkmantel der<br />
Wissenschaftlichkeit postuliert, ganz und gar nicht abfinden und halte eine solche Haltung<br />
weder für rational noch gar für moralisch rechtfertigbar. Ich will dies nachfolgend begründen.<br />
Alles menschliche Denken – einschließlich der wissenschaftlichen Ratio – beruht letztlich auf<br />
Grundlagen, welche wir mithilfe eben jenes Denkens bzw. logischer Ratio nicht hinreichend<br />
erklären können. Es handelt sich dabei um Fragen wie diejenige nach der ersten Ursache.<br />
Wenn wir versuchen, empirische Sachverhalte zu erklären, dann suchen wir immer nach<br />
Ursachen, die zu jenem Sachverhalt geführt haben. Unser Verstehen basiert mithin auf dem<br />
Kausalprinzip, dem ‚Ursache-Wirkung-Schema’. Anders können wir uns empirische Phänomene<br />
nicht erklären. Beim Fortschreiten im Rahmen dieser Suche stoßen wir immer zwingend<br />
irgendwann auf die Frage nach der ersten Ursache, welche selber ex definitione nicht von<br />
einer anderen Ursache bedingt worden sein kann. Diese zwingend für unsere Vernunft anzunehmende<br />
erste Ursache bleibt aber notwendig für uns unverständlich, weil wir ja eben nur<br />
Dinge verstehen können, deren Ursachen, die zu jenem Ding, Sachverhalt bzw. Phänomen<br />
geführt haben, herausfinden konnten. Wir können uns die Welt nicht anders <strong>als</strong> (auch) mithilfe<br />
des ‚Ursache-Wirkung-Schemas’ erschließen, ohne dabei weder die eigentlich diesem<br />
Schema logisch zwingend inhärente erste Ursache verstandesmäßig zu verstehen noch gar
empirisch nachzuweisen. Ähnliches gilt für die Logik, welche auch für uns unauflösliche<br />
Widersprüche bereithält, insbesondere wenn es um Fragen der Unendlichkeit geht. Ausführlichere<br />
Erläuterungen dazu findet man hier unter dem Unterpunkt ‚Grenzen und Grundlagen<br />
menschlichen Denkens’.<br />
Ich will mit diesen kurzen Ausführungen nur darauf hinweisen, dass selbst die rationale<br />
Wissenschaft auf Grundlagen ruht, die selber nicht mehr rational erklärt werden können,<br />
sondern einfach aus pragmatischen Gründen vorausgesetzt werden müssen, damit Wissenschaft<br />
überhaupt erst möglich wird. Eben solche Setzungen können wir mit Fug und Recht<br />
auch für die Moral vornehmen und müssen dies auch, wenn wir im Menschen ein mit Würde<br />
behaftetes Wesen sehen wollen: Menschen sind freiheitsbegabte Vernunftwesen. Wir sind<br />
prinzipiell dazu begabt, freie Entscheidungen zu treffen, wobei der jeweils individuelle Spielraum<br />
natürlich sehr unterschiedlich situationsabhängig bemessen ist. Besäßen wir überhaupt<br />
keine Freiheit, so glichen wir einer Maschine, die nach einem bestimmten Programm funktioniert,<br />
ohne selbst Einfluss auf diesen Prozess zu haben sowie sich ihrer selbst bewusst zu<br />
sein. Kein Mensch kann im Ernst eine solche Selbsteinschätzung für sich vornehmen. Wir<br />
können uns nur <strong>als</strong> freiheitsbegabt begreifen oder gar nicht. Ob es Freiheit <strong>als</strong> solche<br />
wirklich gibt, kann mithilfe menschlicher Möglichkeiten weder wissenschaftlich bewiesen<br />
noch widerlegt werden. Nähere Erläuterungen hierzu finden sich u.a. unter dem oben schon<br />
genannten Unterpunkt ‚Grenzen und Grundlagen menschlichen Denkens’.<br />
Zur eigenen Entscheidungsfreiheit tritt die Vernunft hinzu. Erst sie ermöglicht uns, Gründe zu<br />
suchen und zu finden, warum wir das eine tun oder lassen sollen. Erst hierdurch sind wir in<br />
der Lage, sowohl für uns selbst <strong>als</strong> auch in der Kommunikation mit anderen, unser jeweiliges<br />
Handeln – mal mehr, mal weniger – verständlich zu machen. Als freiheitsbegabte Vernunftwesen<br />
sind wir im Rahmen unserer jeweiligen tatsächlichen Freiheitsspielräume aber auch<br />
moralisch für unser Handeln verantwortlich zu machen.<br />
Alle Menschen besitzen demnach <strong>als</strong> freiheitsbegabte Vernunftwesen die gleiche Würde, die<br />
es zu achten gilt. Und hierauf baut der Kantische Moralmaßstab auf: „Handele so, dass die<br />
Maxime Deines Willens jederzeit zugleich <strong>als</strong> Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten<br />
könne.“ Dieser Kantische Imperativ liefert einen rationalen Moralmaßstab, weil er die gleichberechtigte<br />
Kompatibilisierung der freien Entfaltung der eigenen Persönlichkeit mit dem<br />
gleichen Streben aller anderen ebenfalls freiheitsbegabten Vernunftwesen nach einem allgemeinen<br />
Prinzip für alle solche Wesen einfordert. Jeder Mensch hat <strong>als</strong>o <strong>als</strong> freiheitsbegabtes<br />
Vernunftwesen das Recht, so zu leben, wie er es für richtig hält, solange er dabei das gleiche<br />
Recht aller anderen Menschen dazu durch sein eigenes Handeln nicht ungebührlich einschränkt,<br />
wobei die Ungebührlichkeit beispielsweise darin bestehen könnte, dass ich Menschen<br />
mit einer anderen Hautfarbe <strong>als</strong> meiner eigenen weniger Rechte zubillige. Somit bietet<br />
dieser Moralmaßstab eben auch eine rationale Möglichkeit, moralische Wertsetzungen vorzunehmen,<br />
die damit keineswegs willkürlich sind. Ja, ich bin geradezu moralisch aufgerufen,<br />
solche Wertsetzungen vorzunehmen, wenn ich von der Voraussetzung ausgehe, dass allen<br />
Menschen <strong>als</strong> freiheitsbegabten Vernunftwesen die gleiche Würde zukommt.<br />
Infolgedessen sind auch die Geistes-, Gesellschafts- und Sprachwissenschaften neben der<br />
rationalen Beschreibung und Analyse von Phänomenen sowie der Erstellung von Prognosen<br />
für die Zukunft dazu aufgerufen, normative Wertsetzungen wissenschaftlich zu begründen. So<br />
kann und soll die Politikwissenschaft selbstverständlich auch mit ihrem rationalen wissenschaftlichen<br />
Sachverstand dazu beitragen zu begründen, warum Demokratie, Rechtsstaat und<br />
Pressefreiheit in und von einem Staat unter anderem auch durch bestimmte konstitutionelle<br />
Regelungen zu schützen und zu befördern sind. Es ist – um bei diesem Beispiel zu bleiben –
eben nicht beliebig, ob ein Staat die Würde seiner Bürger schützt oder sie mit Füßen tritt und<br />
zwar auch und gerade nicht unter rationalen Gesichtspunkten. Es ist mithin alles andere <strong>als</strong><br />
unwissenschaftlich, derartige Normsetzungen vorzunehmen, solange sie rational begründet<br />
werden, wobei die Grundlage jener Rationalität die Würde des Menschen <strong>als</strong> freiheitsbegabtes<br />
Vernunftwesen sein muss, wie oben gezeigt werden konnte! Denn es gibt keinen rationalen<br />
Grund, warum zum Beispiel Menschen mit schwarzer Hautfarbe weniger Rechte haben<br />
sollten <strong>als</strong> jene mit einer weißen. Wenn einige ‚Wissenschaftler’ in den hier in Rede stehenden<br />
Wissenschaften behaupten sollten, es sei nicht wissenschaftlich und damit rational nicht<br />
möglich, derartige Normsetzungen zu begründen, so konnte dies hier eindeutig widerlegt<br />
werden. Solche Normsetzungen sind prinzipiell genauso gut rational mithilfe unserer Vernunft<br />
zu begründen wie alle anderen Sachverhalte in der Wissenschaft auch.<br />
Zudem sind die hier in Rede stehenden Wissenschaften aber auch verpflichtet, solche Normsetzungen<br />
rational zu begründen und sich nicht davor zu drücken! Es gehört mit zu ihrem<br />
Aufgabenfeld. Ich will nachfolgend zwei Gründe dafür aufführen und kurz erläutern:<br />
1. Die Meinungs- und Presse- bzw. Publizitätsfreiheit sowie ein diskriminierungsfreier Zugang<br />
zu allen wissenschaftlichen Institutionen ist keineswegs eine willkürlich Normsetzung,<br />
sondern sie ist sowohl aus moralischen Gründen zu wollen (s.o.), aber darüber hinaus auch<br />
deshalb, weil erst dadurch Wissenschaft möglich wird. Denn nur wenn alle Thesen von allen<br />
diskriminierungsfrei und offen diskutiert werden können, kann man beispielsweise dem<br />
wissenschaftlichen Postulat der intersubjektiven Nachprüfbarkeit gerecht werden. Und dieses<br />
wird ja selbst von jenen ‚Wissenschaftlern’ eingefordert, die Normsetzungen <strong>als</strong> unwissenschaftlich<br />
ablehnen. Und dass für die Verwirklichung dieser Norm bestimmte staatliche Regelungen<br />
erforderlich sind, kann vernünftigerweise ebenfalls nicht bestritten werden. Wenn es<br />
wissenschaftlich <strong>als</strong>o möglich ist, Normsetzungen rational zu begründen und die Verwirklichung<br />
bestimmter Normen sogar für den wissenschaftlichen Betrieb zwingend gegeben sein<br />
muss, dann ist die Wissenschaft allein schon aus Selbsterhaltungsgründen dazu aufgerufen,<br />
diese Normen wissenschaftlich zu begründen. Wenn die Wissenschaft dies nicht kann oder<br />
nicht will, führt sie sich selbst ad absurdum. Und gerade beispielsweise die Politikwissenschaft<br />
darf sich daher nicht nur auf die Beschreibung von staatlichem Handeln beschränken,<br />
sondern muss auch wissenschaftlich begründen, warum Demokratie, Rechtsstaatlichkeit<br />
sowie Presse- und Meinungsfreiheit anzustreben und gemäß der jeweiligen historischen<br />
Situation möglichst optimal umzusetzen sind.<br />
2. Die hier in Rede stehenden Wissenschaften werden in Deutschland wie in anderen Ländern<br />
ganz wesentlich aus Steuergeldern finanziert. Damit haben sie auch eine Verantwortung gegenüber<br />
dem Gemeinwesen, welches ihre Tätigkeit erst ermöglicht. Es sind die Bürger, die<br />
mit ihren Steuern die Wissenschaftler und ihre materielle Ausstattung finanzieren und hierdurch<br />
ihr Forschen und Lehren erst ganz wesentlich ermöglichen. Daher haben die Wissenschaftler<br />
sowohl moralisch <strong>als</strong> auch aus eigenen Existenzgründen heraus eine rational gut begründbare<br />
Verpflichtung, bestimmte Normsetzungen im Rahmen ihrer wissenschaftlichen<br />
Tätigkeit vorzunehmen und zwar <strong>als</strong> Forscher wie <strong>als</strong> Lehrende, die unsere Jugend ausbilden.<br />
Denn ohne die Mittel aus diesem Gemeinweisen gäbe es diese Wissenschaft gar nicht bzw.<br />
bei weitem nicht in diesem Umfang.<br />
Abschließend bleibt festzuhalten, dass es zum Aufgabenfeld der hier in Rede stehenden<br />
Wissenschaften gehört, Normsetzungen rational zu begründen und zwar sowohl aus<br />
moralischen wie aus wissenschaftlichen Gründen. Falls sich ‚Wissenschaftler’ dem<br />
entziehen, fehlt es ihnen sowohl an Wissenschaftlichkeit <strong>als</strong> auch an moralischer Verantwortung!
1.5. Willensfreiheit:<br />
Peter Biere belegt in einem Spiegelartikel, wie unsinnig die Behauptung mancher Hirnforscher<br />
und Psychologen ist, man könne beweisen, dass es keine Willensfreiheit gäbe (Peter<br />
Bieri: Unser Wille ist frei, in: Der Spiegel, 2/2005, S. 124 f.). Ich schließe mich seinen dort<br />
gemachten Ausführungen im wesentlichen an und möchte hier nur einige Ergänzungen vornehmen,<br />
wobei ich zunächst unter anderem auf den oben genannten Artikel zurückgreife.<br />
Freiheit bedeutet nach Bieri, dass Urteilen und Wollen zusammenfallen: „Unser Wille ist frei,<br />
wenn er sich unserem Urteil darüber fügt, was zu wollen richtig ist.“ Wie der Autor in seinem<br />
sehr lesenswerten Buch ‚Handwerk der Freiheit’ ausführt, fühlen wir uns immer dann frei,<br />
wenn wir uns aus freiem Entschluss eine bestimmte Handlung vornehmen, und sie nicht aus<br />
äußeren oder inneren Zwängen heraus erfolgt. Bieri verwendet dafür den Begriff ‚Billigung’.<br />
Wenn wir uns <strong>als</strong>o für eine solche Handlung nach eigenem Empfinden frei entschlossen<br />
haben, dann billigen wir diese Handlung, so dass unser Urteilen mit unserem Wollen zusammenfällt.<br />
Diesen Vorgang der Billigung kann man aber nicht mit physikalisch-chemischen<br />
Methoden messen. In dem oben erwähnten Spiegelartikel zeigt er diesen Sachverhalt sehr<br />
anschaulich am Beispiel eines Gemäldes: Es ist in Öl gemalt und wiegt 30 Kilogramm. Wir<br />
können es mithilfe noch so ausgefeilter physikalisch-chemischer Methoden untersuchen und<br />
dabei alles Mögliche herausfinden, nur nichts hinsichtlich seiner Schönheit oder Ausdruckskraft.<br />
Derartige Qualitäten eines Bildes lassen sich mit solchen Methoden nicht auffinden.<br />
Heißt dies nun, dass es diese Qualitäten gar nicht gibt? Natürlich nicht! In dem genannten<br />
Artikel zeigt Bieri, dass diejenigen, die meinen, durch physikalische Messungen der Hirnströme<br />
beweisen zu können, es gäbe keine Willensfreiheit, einen kardinalen Kategoriefehler<br />
begehen, indem sie mit einer unzulänglichen Untersuchungsmethode etwas aufzuzeigen zu<br />
versuchen, das diese Methode gar nicht in der Lage ist zu zeigen. Wir können aus verschiedenen<br />
Perspektiven ein Phänomen betrachten und analysieren, ohne dass dabei die eine Perspektive<br />
wahrer <strong>als</strong> die andere ist. So intensiv ich das oben erwähnte Gemälde auch mit physikalisch-chemischen<br />
Methoden untersuche, ich werde dabei nichts über dessen Ausdruckskraft<br />
und Schönheit in Erfahrung bringen können, weil diese Methode dazu gar nicht in der Lage<br />
ist. Dann aber den Schluss daraus zu ziehen, dass es so etwas wie Schönheit oder Ausdruckskraft<br />
gar nicht gäbe, weil ich es mit naturwissenschaftlichen Verfahren nicht messen kann, ist<br />
offensichtlich unzulässig. Man wundert sich darüber, welch primitive Fehler von machen, die<br />
sich ‚Wissenschaftler’ schimpfen, doch begangen werden!<br />
Nachfolgend möchte ich noch einige weitere grundsätzliche Überlegungen zu den Grundlagen<br />
und Grenzen menschlichen Denkens darlegen und dann noch einmal auf den Freiheitsbegriff<br />
eingehen.<br />
Wenn wir versuchen, empirische Sachverhalte zu erklären, dann suchen wir immer nach<br />
Ursachen, die zu jenem Sachverhalt geführt haben. Unser Verstehen basiert mithin auf dem<br />
Kausalprinzip, dem ‚Ursache-Wirkung-Schema’. Anders können wir uns empirische Phänomene<br />
nicht erklären. Beim Fortschreiten im Rahmen dieser Suche stoßen wir immer zwingend<br />
irgendwann auf die Frage nach der ersten Ursache, welche selber ex definitione nicht von<br />
einer anderen Ursache bedingt worden sein kann. Diese zwingend für unsere Vernunft anzunehmende<br />
erste Ursache bleibt aber notwendig für uns unverständlich, weil wir ja eben nur<br />
Dinge verstehen können, deren Ursachen, die zu jenem Ding, Sachverhalt bzw. Phänomen<br />
geführt haben, herausfinden konnten. Wir können uns die Welt nicht anders <strong>als</strong> (auch) mithilfe<br />
des ‚Ursache-Wirkung-Schemas’ erschließen, ohne dabei weder die eigentlich diesem<br />
Schema logisch zwingend inhärente erste Ursache verstandesmäßig zu verstehen noch gar<br />
empirisch nachzuweisen. Somit können wir zwingend niem<strong>als</strong> aufzeigen – weder empirisch<br />
noch mithilfe unseres logischen Verstandes – ob es diese erste Ursache gibt oder nicht und
wie sie konkret beschaffen ist. Es ist allein schon deshalb ausgeschlossen, weil unsere<br />
Vernunft nach dem ‚Ursache-Wirkung-Schema’ funktioniert, uns dieses Schema selber in<br />
letzter Konsequenz zu einem für unsere Vernunft unauflöslichen Widerspruch führt: Dieses<br />
Schema setzt eine erste Ursache voraus, die selber ex definitione von nichts anderem mehr<br />
verursacht worden sein kann. Aber etwas, das von nichts verursacht worden ist, bleibt notwendig<br />
für uns unverständlich.<br />
Genauso wenig wie wir die Existenz bzw. Nichtexistenz dieser ersten Ursache logisch beweisen<br />
oder gar empirisch belegen können, sind wir in der Lage, dies hinsichtlich der Freiheit<br />
zu tun. Denn nur weil wir etwas bisher mit naturwissenschaftlichen Methoden haben nicht<br />
messen können, heißt dies ja keineswegs, dass es dieses Etwas gar nicht gibt. Darüber hinaus<br />
entzieht sich die Freiheit insofern der wissenschaftlichen Nachweisbarkeit, <strong>als</strong> dass sie ex<br />
definitione außerhalb des ‚Ursache-Wirkung-Schemas’ liegt.<br />
Da sich die Existenz von Freiheit weder beweisen noch widerlegen lässt, ist es dann überhaupt<br />
sinnvoll, ihre Existenz für uns <strong>als</strong> pragmatische Setzung anzunehmen? Ich meine: Ja,<br />
auf jeden Fall. Stellen wir uns vor, alle unsere Handlungen wären durch unsere Gene, durch<br />
unsere Sozialisation völlig vorherbestimmt, ohne dass wir auch nur im geringsten die Möglichkeit<br />
besäßen, selbst zu entscheiden, was wir tun oder lassen sollen, dann glichen wir einer<br />
Maschine: Wir funktionierten nach einem vorgegebenen Programm und wären damit natürlich<br />
auch nicht für unsere Handlungen verantwortlich zu machen. Wir wären damit vollkommen<br />
fremd bestimmt. Folglich besäßen wir auch keine Würde. Kein Mensch kann im Ernst<br />
eine solche Selbsteinschätzung für sich vornehmen. Wir können uns nur <strong>als</strong> freiheitsbegabt<br />
begreifen oder gar nicht.<br />
Zur eigenen Entscheidungsfreiheit tritt die Vernunft hinzu. Erst sie ermöglicht uns, Gründe zu<br />
suchen und zu finden, warum wir das eine tun oder lassen sollen. Erst hierdurch sind wir in<br />
der Lage, sowohl für uns selbst <strong>als</strong> auch in der Kommunikation mit anderen, unser jeweiliges<br />
Handeln – mal mehr, mal weniger – verständlich zu machen. Als freiheitsbegabte Vernunftwesen<br />
sind wir im Rahmen unserer jeweiligen tatsächlichen Freiheitsspielräume moralisch für<br />
unser Handeln verantwortlich zu machen.<br />
Wir Menschen können uns demnach nur <strong>als</strong> freiheitsbegabte Vernunftwesen begreifen oder<br />
eben gar nicht. Wer dies bestreitet, bestreitet unsere Würde, das was uns letztlich zum<br />
Menschen macht und das nur, weil man es nicht mit naturwissenschaftlichen Methoden<br />
messen kann. Darüber hinaus wird sich jeder redlich arbeitende Naturwissenschaftler niem<strong>als</strong><br />
zu der Behauptung versteigen, dass nur, weil etwas bisher nicht gemessen werden konnte,<br />
auch nicht existiert. Aber, wie bereits mehrfach ausgeführt, kann ein solch empirischer Beweis<br />
der Existenz bzw. Nichtexistenz von Freiheit genauso wenig erfolgen wie derjenige<br />
Gottes – und zwar prinzipiell nicht. Wer meint, dies zu können, macht sich der Hybris schuldig,<br />
er überhebt sich über das menschliche Maß hinaus und erklärt sich quasi selbst zu Gott.<br />
Weitere ausführlichere Darlegungen finden sich hier unter dem Unterpunkt ‚Grenzen und<br />
Grundlagen menschlichen Denkens’ und dort insbesondere im Absatz 2.6. Freiheitsproblematik.
1.6. Sinnlosigkeit nein danke:<br />
Der alltäglichen Sinnlosigkeit durch gute Taten entfliehen<br />
Wer will schon sinnlos sein Leben verbringen und sich am Ende fragen müssen: War das<br />
etwa schon alles?! Wohl niemand. Aber fragt Euch doch einmal selbst: Wie läuft Euer Leben<br />
denn so ab? Seid Ihr wirklich zufrieden damit? Wisst Ihr überhaupt, was Ihr selbst für sinnvoll<br />
haltet? Oder hechelt Ihr nur von Termin zu Termin, arbeitet fast rund um die Uhr, fühlt<br />
Euch wie in einem Hamsterrad, in welchem man läuft und läuft und läuft, ohne jem<strong>als</strong> vorwärts<br />
zu kommen? Wenn ich keinen tieferen Sinn in meinem Leben erkenne, dann drohe ich<br />
einer sinnlosen Leere zu verfallen, im Nirgendwo fremdbestimmt umherzuirren, gleich einem<br />
hilflosen Dahintreiben in einem unendlichen Ozean ohne Aussicht, jem<strong>als</strong> ein rettendes Ufer<br />
zu erreichen und letztlich einfach unterzugehen. Versucht Ihr das Gefühl und die Folgen einer<br />
solchen Sinnlosigkeit durch das Nichtnachdenken über diese eigentlich so bedeutsame Frage<br />
zu ignorieren? Dienen Euch Partys und andere mehr oder weniger unverbindliche Anlässe <strong>als</strong><br />
willkommene Ablenkung, sich dieser Frage nicht ernsthaft zu stellen? Oder betäubt Ihr das<br />
manchmal aufkeimende Gefühl der Sinnlosigkeit durch Konsum von Alkohol und oberflächlicher<br />
Fernsehunterhaltung? Also nochm<strong>als</strong>: Soll das wirklich schon alles sein?! Ich bin der<br />
festen Überzeugung: Nein, das darf und das muss nicht alles sein! Ich jedenfalls habe<br />
meinen Sinn im Leben gefunden und bin sehr zufrieden, in manchen Augenblicken sogar<br />
glücklich, trotz aller Schwierigkeiten und Rückschläge, die selbstverständlich auch mir bisher<br />
widerfahren sind und es zukünftig weiterhin werden. Ich mache mir dabei allerdings immer<br />
wieder bewusst, dass es sich bei dieser Sinnfindung nicht um einen einmaligen Akt handelt<br />
und sich damit alles gewissermaßen erledigt hat. Nein, es ist ein bis ans Lebensende zu beschreitender<br />
Weg mit immer neu zu meisternden Herausforderungen. Nur sollte man eben<br />
schauen, dass man den für sich selbst richtigen gefunden hat. Auf dieser Seite will ich hierzu<br />
einige meiner Gedanken vorstellen. Vielleicht hilft es dem ein oder anderen bei seiner eigenen<br />
Sinnsuche. Das Nachdenken darüber, das ich hiermit befördern will, ist Teil meiner Sinnstiftung.<br />
Dennoch muss natürlich jeder Mensch seinen eigenen Weg finden. Aber um diesen Weg<br />
überhaupt erst beschreiten zu können, ist es erforderlich, sich auf jenen erst einmal ernsthaft<br />
zu begeben und nicht durch Verdrängung oder Nichtachtung zu meiden. Auch diejenigen, die<br />
meinen, im Großen und Ganzen den richtigen Weg für sich bereits gefunden zu haben,<br />
können hier vielleicht die ein oder andere zusätzliche Anregung finden, um ihr eigenes wie<br />
das Leben anderer Menschen zu bereichern. Schließlich kann niemand – ich selbst natürlich<br />
eingeschlossen – davon ausgehen, schon immer ganz allein alles Sinnvolle selber herausgefunden<br />
zu haben. Daher lohnt es sich aus meiner Sicht weiter zu lesen, nicht jetzt schon aufzugeben<br />
und einfach wegzuklicken. Also, auf geht’s!<br />
Nichts ist meiner Meinung nach so sinnstiftend, wie gute Dinge zu vollbringen. Es muss, ja es<br />
kann sich dabei zumeist nicht um Heldentaten handeln. Gerade die vielen Möglichkeiten im<br />
Alltag Gutes zu tun, sollen hier im Vordergrund stehen. Wer kennt nicht das befriedigende, ja<br />
teilweise sogar Glück bringende Gefühl, sich oder anderen etwas Gutes getan, etwas Sinnvolles<br />
geleistet zu haben?! Was ist aber ‚gut’ und damit letztlich sinnvoll? Ich meine, alles<br />
was der Würde des Menschen zuträglich ist.<br />
Aber worin besteht die Würde des Menschen und wie achte und befördere ich sie am besten<br />
und fühle mich dadurch auch wirklich zufriedener? Meiner Meinung nach ruht die menschliche<br />
Würde ganz entscheidend auf drei Säulen: Freiheit, Vernunft sowie Mitgefühl und<br />
Liebe.
Zur Freiheit:<br />
Nur weil wir zumindest teilweise frei sind, unterscheiden wir uns beispielsweise von einer<br />
Maschine, bei der alles nach einem vorher festgelegten Programm abläuft. Sie selber besitzt<br />
keine Möglichkeit, aus eigenem Entschluss davon abzuweichen. Sie hat sozusagen nicht die<br />
Möglichkeit, sich aus dem oben beschriebenen Hamsterrad zu befreien. Ja, sie kann nicht einmal<br />
merken, dass sie so ist, wie sie ist. Erst durch das Gefühl von Freiheit, können wir uns <strong>als</strong><br />
Menschen überhaupt wahrnehmen, uns <strong>als</strong> nicht ausschließlich fremdbestimmt empfinden<br />
und somit ein wahres Ich-Gefühl entwickeln.<br />
Zur Vernunft:<br />
Durch die Vernunft wiederum sind wir in der Lage, unsere Freiheit sinnvoll zu nutzen, weil<br />
wir mit ihrer Hilfe nicht nur willkürlich mal das eine, mal das andere tun; gewissermaßen<br />
ohne Sinn und Verstand. Die Vernunft ermöglicht uns beispielsweise Planungen oder Abwägungen<br />
vorzunehmen, was für uns selbst, aber auch für andere nachhaltig von Nutzen sein<br />
kann.<br />
Zu Mitgefühl und Liebe:<br />
Das Mitfühlen mit dem Schicksal anderer Menschen – sei es im Glück oder Unglück – ist zutiefst<br />
menschlich, und jeder kennt es. Wir können uns mit anderen über ihr Glück freuen und<br />
zusammen mit ihnen über ihr Unglück trauern. Wir können sowohl Mitgefühl schenken <strong>als</strong><br />
auch empfangen. Und wer will dies letztlich wirklich missen? Wohl kaum jemand. Wir<br />
wollen selber lieben und geliebt werden. Nur um wirklich andere lieben zu können, müssen<br />
wir zunächst auch uns selbst lieben, denn nicht umsonst heißt es: Liebe Deinen Nächsten wie<br />
Dich selbst.<br />
Demnach sind alle Menschen aufgerufen, sowohl ihre eigene Würde <strong>als</strong> auch die anderer<br />
Menschen zu achten und zu befördern und dadurch selbst einen tieferen Sinn im Leben zu<br />
finden und anderen bei ihrer Sinnfindung behilflich zu sein.<br />
Ein Sinnspruch könnte lauten:<br />
Tue Gutes auch im Kleinen, im Alltag und mache es Dir selbst bewusst, auf dass Du dadurch<br />
bei Deiner Sinnsuche erfolgreich bist. Erwarte nicht zuviel, auf dass Du nicht enttäuscht wirst.<br />
Bemühe Dich um Ehrlichkeit vor allem Dir selbst gegenüber, insbesondere hinsichtlich der<br />
Moralität der eigenen Handlungen. Bedenke, dass Deine Zeit auf Erden begrenzt ist und die<br />
Tatsache, dass Du etwas getan oder unterlassen hast, ewigen Bestand hat, im Gegensatz zum<br />
Ergebnis Deines Handelns. Vergiss dabei dennoch nicht, auch Dein eigenes Wohlbefinden <strong>als</strong><br />
ein mit Würde ausgestattetes, freiheitsbegabtes Vernunftwesen zu befördern. Achte andere<br />
Menschen ebenfalls <strong>als</strong> solche Wesen und benutze sie nicht bloß <strong>als</strong> Mittel, sondern immer<br />
auch <strong>als</strong> Zweck an sich selbst. Glaube an einen guten, barmherzigen Gott, der uns im endlichen<br />
Diesseits wie im unendlichen Jenseits in Liebe zugetan ist. Er hat uns mit Freiheit und<br />
damit Verantwortung und Würde ausgestattet, auf dass wir im irdischen Leben möglichst viel<br />
Gutes tun sollen. Bedenke, dass Du spätestens am Ende Deines Lebens nicht nur Dir selbst,<br />
sondern auch Gott gegenüber Rechenschaft ablegen musst und er das für Dich Gerechte gemäß<br />
Deiner irdischen Taten bereithalten wird. Sorge Dich in diesem Bewusstsein um Deine<br />
eigene Würde wie um diejenige Deiner Mitmenschen durch moralisch gute Taten nach<br />
Kräften. So findest Du hoffentlich, was Du suchst: Ein sinnerfülltes Leben.<br />
Um besser verstehen zu können, wie ich meinen Sinn im Leben gefunden habe und hoffe, ihn<br />
auch weiterhin zu finden, stelle ich mich in einer Kurzbiographie (s.u.) vor und biete zudem<br />
einige grundsätzliche Überlegungen zu diesem Thema zur Lektüre an. (s.u.) An dieser Stelle<br />
möchte ich ausdrücklich alle herzlich zur Mitwirkung an meinen ehrenamtlichen Projekten<br />
einladen, welche sich mit entsprechenden Links in meiner Kurzbiographie finden.
Kurzbiographie:<br />
Ich wuchs in einer Mannesmann – Arbeitersiedlung in Ratingen bei Düsseldorf auf. Nach<br />
dem Abitur absolvierte ich zunächst eine Ausbildung zum Industriekaufmann bei einem<br />
mittelständischen Industriebetrieb in Düsseldorf. Danach studierte ich an den Universitäten<br />
Duisburg, Frankfurt am Main und Mainz die Fächer Geschichte, Philosophie, Wirtschaftswissenschaften<br />
und Politik. Nach dem Magisterabschluss promovierte ich zu dem althistorischen<br />
wie ökonomischen Thema ‚Römische Mietshäuser’ und beschäftigte mich dabei mit<br />
den im antiken Rom anzutreffenden Wohnverhältnissen und deren bautechnischen sowie<br />
ökonomischen Ursachen.<br />
Aufgrund dieses von Beginn an interdisziplinär angelegten Studiums konnte ich die Vorzüge<br />
der damit verbundenen Erweiterung des eigenen intellektuellen Horizontes erkennen, obwohl<br />
der Arbeitsaufwand doch erheblich war, weil beispielsweise das Erlernen des Altgriechischen<br />
viel Zeit und Disziplin erforderte oder aber die mathematischen Grundlagen für das Verständnis<br />
ökonomischer Modelle erst einmal erarbeitet sein wollten.<br />
Da ich mein Studium selbst finanzieren musste, weil mein Vater bereits zwei Jahre vor<br />
meinem Abitur verstorben war und ich nicht auf das staatliche Bafög zurückgreifen wollte,<br />
machte ich mich schon zu Beginn des Studiums selbständig und gründete mit zwei Kommilitonen<br />
eine kleine Baufirma. Doch nach einiger Zeit kam ich zu dem Ergebnis, dass das Studium,<br />
so wie ich es mir vorstellte, mit der Firma nicht sinnvoll zu vereinbaren war, so dass ich<br />
sie meinen Gesellschaftern überließ und mich voll und ganz der Universität widmen konnte,<br />
da ich nun über genügend finanzielle Mittel verfügte.<br />
Während des Promotionsstudiums (1994 – 1999) arbeitete ich allerdings zwischen 1995 und<br />
1998 zeitweise <strong>als</strong> Privatdozent bei einer in Koblenz ansässigen Personalentwicklungsfirma,<br />
sowohl um meine Rücklagen nicht ganz aufzubrauchen, aber auch damit ich mehr über den<br />
Bereich der Erwachsenenbildung in Erfahrung bringen konnte. Gleichzeitig gründete ich mit<br />
einem ehemaligen Kommilitonen Ende 1996 in Mainz ein privates Lehrinstitut – die Schülerförderung<br />
Rhein-Main –, welches ich von 1999 bis Mitte 2012 alleine führte.<br />
Darüber hinaus habe ich einen Vertrieb für elektronische Bücher im Herbst 2009 eröffnet, auf<br />
welchem zurzeit zehn von mir verfasste Titel zum Thema ‚Bildung’ käuflich zu erwerben<br />
sind. Einige E-Bücher dienen auch <strong>als</strong> Lehrbücher an Hochschulen. Neben diesen Büchern<br />
biete ich Schulungen und Beratungen in vielen Fachbereichen für Schulen und Unternehmen<br />
an. Außerdem habe ich im Auftrag der IHK Seminare für Auszubildende konzeptioniert und<br />
führe sie teilweise auch selbst bei namhaften Unternehmen wie Michelin oder KHS durch.<br />
Die Internetadresse lautet: www.drbottke-e-buchvertrieb.de<br />
Seit November 2007 bin ich ehrenamtlich im ‚Verein Deutsche Sprache e.V. (VDS)’ für die<br />
Region 55… im Regionalvorstand tätig. Mehrm<strong>als</strong> organisierte ich den Buchstabierwettbewerb,<br />
der unter der Schirmherrschaft des VDS steht: www.Buchstabierwettbewerb.de<br />
Schließlich versuche ich mithilfe einer im Frühjahr 2010 von mir ins Leben gerufenen Initiative<br />
zusammen mit anderen Engagierten, insbesondere junge Menschen für das Thema ‚Bildung’<br />
zu gewinnen und zum Mitmachen zu bewegen: www.dummheit-nein-danke.de
Grundsätzliche Überlegungen für ein sinnerfülltes Leben<br />
Viele Menschen leben gerade auch heutzutage einfach nur so vor sich, erledigen täglich im<br />
Beruf wie privat dies oder jenes, lassen sich durch alles Mögliche die Zeit vertreiben und<br />
stellen irgendwann erschrocken fest: War das schon alles?! Spätestens dann wird ihnen so<br />
langsam ihre Verlorenheit in der alltäglichen Sinnlosigkeit bewusst. Sie sind einfach nur so da<br />
auf dieser Erde. Aber warum eigentlich? Was bleibt von uns? Nichts weiter <strong>als</strong> auseinander<br />
fallende Atome?! Befällt nicht so manch einen die Befürchtung, nur ziel- und damit orientierungslos<br />
in einem sinnlos erscheinenden Dasein umherzuirren. Verdrängen und betäuben wir<br />
dieses Gefühl nicht allzu oft: Beispielsweise durch unsere fast ausschließliche Konzentration<br />
auf die Arbeit, die Karriere, Geld, Status, Bewunderung und Applaus von anderen, oder aber<br />
im Gegenteil lassen wir uns hängen, treiben nur so in den Tag hinein, konsumieren Alkohol,<br />
seichte Fernsehunterhaltung und dergleichen? Soll das wirklich schon alles gewesen sein?<br />
Nein, das wird im Ernst wohl niemand behaupten wollen.<br />
Nachfolgend sollen einige Gedanken zunächst in neun Punkten kurz benannt und danach etwas<br />
ausführlicher erläutert werden, die ich für mich <strong>als</strong> sinnstiftend herausgefunden habe.<br />
Manchem mögen sie ganz konkret helfen, anderen lediglich zur Inspiration dienen, wieder<br />
andere empfinden zumindest in einigen Punkten ganz anders. Jeder muss letztlich seinen ganz<br />
eigenen Weg finden, beschreiten und sich dafür auch verantworten.<br />
Zunächst nun die Auflistung der neun Punkte:<br />
1. Als freiheitsbegabte Vernunftwesen besitzen alle Menschen eine zu achtende Würde.<br />
2. Wir Menschen sind prinzipiell in der Lage, frei zu entscheiden. Erst dadurch unterscheiden<br />
wir uns beispielsweise von Maschinen, die einfach nur nach einem vorgegebenen<br />
Programm funktionieren.<br />
3. Daher sind wir – wenn auch in unterschiedlichem Ausmaß – prinzipiell darum bemüht,<br />
unseren Freiheitsspielraum zu erhöhen. Erst durch diesen können wir selbstbestimmt<br />
unser eigenes Leben leben und es <strong>als</strong> solches auch empfinden.<br />
4. Bei unserer Selbstverwirklichung müssen wir aber auch immer darauf achten, allen<br />
anderen Mitmenschen das gleiche Recht zur Selbstverwirklichung einzuräumen.<br />
Moralisch sind wir <strong>als</strong>o dazu aufgerufen, unsere eigene Würde wie die aller anderer<br />
Menschen in gleicher Weise zu achten und zu schützen.<br />
5. Indem wir moralisch Gutes tun und uns dessen auch selbst vergewissern, können wir<br />
einen tieferen Sinn im Leben finden.<br />
6. Nur durch die Endlichkeit unseres irdischen Daseins, unser Bewusstsein über unseren<br />
eigenen Tod erwächst in uns eine Wertschätzung des Guten und Schönen wie der<br />
<strong>Dr</strong>amatik und Tragödie unseres Lebens: Ohne unser Wissen um unseren irdischen Tod<br />
wäre alles einfach nur belanglos.<br />
7. Durch die Bewältigung von Herausforderungen im Alltag erzielen wir das Gefühl<br />
einer Befriedigung in uns. Je mehr und / oder länger wir uns dafür anstrengen<br />
mussten, desto tiefer und anhaltender empfinden wir diese Befriedigung.<br />
8. Die Ergebnisse all unserer Handlungen sind vergänglich: Kinder, die wir groß gezogen<br />
haben, werden auch irgendwann sterben, sowie deren Kindeskinder, selbst die<br />
großartigsten Bauwerke werden dereinst zu Staub zerfallen. Einzig die Tatsache, dass<br />
wir etwas getan oder unterlassen haben, bleibt ewig: Wenn wir etwas moralisch Gutes<br />
oder auch Schlechtes getan haben, bleibt die Tatsache, dass wir es getan haben, ewig<br />
<strong>als</strong> solche bestehen. Nichts können wir rückgängig machen. Nur in Zukunft können
wir im Bewusstsein dessen Gutes tun, uns es selbst dies klar machen und darin eine<br />
Sinnstiftung erfahren.<br />
9. Erst der Glaube an einen guten, barmherzigen Gott, der uns in diese Welt <strong>als</strong> freiheitsbegabte<br />
Vernunftwesen mit eigener Verantwortung entlassen hat und uns auf ewig in<br />
Liebe im endlichen Diesseits wie im unendlichen Jenseits zugetan ist, erfahren wir die<br />
letzte und höchste Stufe der Sinnstiftung.<br />
Erläuterung der neun Punkte<br />
Worin besteht der Sinn des Lebens? Eine, wenn nicht die zentrale Frage für uns Menschen!<br />
Zunächst ist man versucht zu sagen, dass es hierauf keine für alle gleiche Antwort gibt. Dies<br />
mag, bezogen auf die konkrete Ausgestaltung im Leben eines jeden, richtig sein, aber vielleicht<br />
lassen sich dennoch Gemeinsamkeiten für alle Menschen herausarbeiten.<br />
Wenn wir voraussetzen, dass alle Menschen freiheitsbegabte Vernunftwesen sind und danach<br />
streben, ihre Freiheit mit Hilfe ihrer Vernunft zu nutzen, dann können wir hier einen Ausgangspunkt<br />
zur Beantwortung der Sinnfrage ausmachen. Denn ohne Freiheit stellte sich diese<br />
zentrale Frage erst gar nicht, weil alles vorausbestimmt wäre und einem mechanistischen Uhrwerk<br />
gleich abliefe: Alles wäre so wie es ist, weil es notwendig so sein müsste und auch in<br />
Zukunft würde sich daran nichts ändern können. Wir nehmen in uns aber nicht nur ein Gefühl<br />
der Freiheit wahr, sondern versuchen auch von ihr Gebrauch zu machen, weil wir uns eben<br />
erst dadurch von einer fremdbestimmten Maschine unterscheiden. Somit gilt für jeden Menschen,<br />
dass er danach strebt, frei zu sein, d.h. möglichst viel selbst bestimmen zu können und<br />
dabei nicht durch äußere Umstände eingeschränkt zu sein. Die Vorstellung einer völligen<br />
Unfreiheit ist für uns letztlich schier unerträglich. Der Mensch muss <strong>als</strong>o die Umwelt nach<br />
seinen Vorstellungen verändern können, da nur so Freiheit wirksam werden kann. Allein<br />
diese Gestaltungsmöglichkeit besitzt einen Eigenwert für uns, denn ohne sie wären wir – wie<br />
bereits erwähnt – Maschinen und keine Menschen mit einer besonderen Würde. Worin der<br />
jeweilige Freiheitsspielraum besteht und wie groß er ist, hängt natürlich immer von der konkreten<br />
Lebenssituation ab: Von den äußeren Umständen oder eigenen Wünschen, worauf wir<br />
unser Streben nach Freiheit richten und mit welcher Intensität wir dies tun. Jeder Mensch<br />
muss sich seine eigenen Entscheidungsspielräume schaffen und schaffen können, ohne dabei<br />
dem gleichen Streben anderer einen ungebührlichen Abbruch zu tun, d.h. wir müssen bei<br />
unserer Selbstverwirklichung immer darauf achten, dass andere das gleiche Recht dazu haben.<br />
Die oben gestellte Frage lässt sich demnach nicht inhaltlich gleich für alle Menschen beantworten,<br />
sondern nur insofern, <strong>als</strong> dass das Streben nach Freiheit die Grundlage für ein Leben<br />
mit Sinn darstellt. Worauf sich dieses Streben jeweils konkret richtet, liegt, abgesehen von<br />
den Einschränkungen der Umwelt, an jedem selbst. Eine humane Gesellschaft muss <strong>als</strong>o zum<br />
Ziel haben, den Menschen ein möglichst selbstbestimmtes, aber damit auch selbstverantwortliches<br />
Leben durch die Schaffung entsprechender Rahmenbedingungen zu ermöglichen.<br />
Im Rahmen seines Freiheitsspielraumes ist jeder Mensch infolgedessen selbst verantwortlich<br />
für sein Dasein und zwar auch hinsichtlich der eigenen Sinngebung. Niemand kann und darf<br />
sie ihm abnehmen, denn dadurch verlöre er ja gerade das, was ihn <strong>als</strong> freiheitsbegabtes Wesen<br />
auszeichnet. Kein Mensch kann dieser zentralen Problematik letztlich ausweichen, da durch<br />
das Wissen um die eigene Vergänglichkeit, den Tod, sich uns die Existenzfrage unabweisbar<br />
aufzwingt: Sie durchdringt unser ganzes Dasein, ja sie ist geradezu konstitutiv für jenes. Denn<br />
wenn wir davon ausgehen dürften, dass wir ewig lebten, besäße nichts wirklich eine Bedeutung<br />
und damit einen Wert für uns, alles könnte ja irgendwann später noch Beachtung finden,<br />
bearbeitet, durchdacht oder erledigt werden. Desweiteren könnte uns nichts existentiell
Bedrohliches zustoßen, so dass wir um die Einzigartigkeit unserer selbst einschließlich der<br />
damit verbundenen Würde gar nicht wissen könnten, weil sie überhaupt nicht vorhanden<br />
wäre, jedenfalls wenn wir von unseren jetzigen intellektuellen Möglichkeiten ausgehend eine<br />
unendliche Dauer unseres irdischen Daseins unterstellten. Somit ist der Tod eine notwendige<br />
Bedingung, um die Existenz- und damit die Sinnfrage überhaupt stellen und die <strong>Dr</strong>amatik des<br />
irdischen Lebens, mit ihren schönen wie schrecklichen Seiten, würdigen zu können. Indem<br />
wir uns bewusst mit der Todesproblematik auseinandersetzen, gewinnen wir die Möglichkeit,<br />
aber keinesfalls die Sicherheit, ein sinnerfülltes Leben zu führen.<br />
Abschließend soll in diesem Zusammenhang noch angemerkt werden, dass wir auch durch<br />
folgende Erkenntnis Zuversicht finden können: Alles von uns Geschaffene mag vergänglich<br />
sein, aber die Tatsache, dass wir es geschaffen haben, bleibt unvergänglich. Diese eigentlich<br />
doch so banale Einsicht scheint allerdings vielen, nach dauerhaftem Ruhm strebenden Menschen,<br />
bisher nicht hinreichend klar gewesen zu sein. Denn sie versuchten zumeist stets, dass<br />
ihre Werke die Zeiten überdauerten bzw. dass sie von nachkommenden Generationen noch<br />
verehrt werden würden, um wenigstens dadurch in gewisser Weise über ihr irdisches Dasein<br />
hinaus ‚weiterzuleben’. Nicht zuletzt dieses Streben nach angeblich ‚unvergänglichem Ruhm’<br />
spornte Menschen zu Höchstleistungen an, die leider häufig negative oder gar schreckliche<br />
Folgen zeitigten. Daher sollte man sich meiner Meinung nach darauf besinnen, moralisch zu<br />
handeln und infolgedessen einen Verdienst erringen, der <strong>als</strong> solcher unvergänglich und zugleich<br />
gut ist, denn Berühmtheit allein bedeutet in diesem Sinne gar nichts!<br />
Das Streben vieler Menschen nach Ruhm bzw. öffentlicher Anerkennung wird dann problematisch,<br />
wenn eine innere Leere, ein Sinnvakuum, damit verdrängt werden soll, so dass man<br />
nur dann glaubt, einen Wert und somit eine ganz eigene Würde zu besitzen, solange einem der<br />
Beifall des Publikums zuteil wird. Eine derart oberflächliche und vor allem fremdbestimmte<br />
Sinngebung ist letztlich überhaupt keine. Man ist einer ständigen Unruhe und Unsicherheit<br />
ausgeliefert und giert wie ein Süchtiger geradezu nach Anerkennung, sei es im Beruf oder im<br />
Privatleben durch Zurschaustellung der eigenen Konsummöglichkeiten in Form von Statussymbolen<br />
wie Reisen, Autos oder Markenkleidung. Ich wende mich hier nicht gegen den<br />
durchaus berechtigten Stolz auf eine eigene Leistung, die sich auch in solchen Symbolen<br />
widerspiegeln kann, sondern dass ihnen eine zu große Bedeutung bei der Suche nach dem<br />
eigenen Wert <strong>als</strong> Person zugemessen wird, wenn auch zum Teil wahrscheinlich unbewusst.<br />
Viele fallen daher in ein tiefes Loch, wenn diese Form der Anerkennung ausbleibt oder man<br />
feststellen muss, dass man die Sinnfrage genau daran festgemacht hat und seinem Leben<br />
keinen Sinn darüber hinaus zu geben vermag. Auch diejenigen, die vielleicht nicht so sehr<br />
nach Beifall heischen, betäuben das Gefühl der inneren Leere durch Konsum. Es muss immer<br />
etwas neues, noch Ausgefalleneres sein. Die Reizdosis ist ständig zu steigern, um nicht der<br />
Langeweile anheimzufallen. Ein Moment der Ruhe, ein Zurückgeworfensein auf sich selbst<br />
wird dann <strong>als</strong> existenzielle Bedrohung empfunden, der man sich durch die Flucht in den Konsumrausch<br />
oder andere Oberflächlichkeiten zu entziehen versucht, nur um dieser so entsetzlich<br />
aufdringlichen Stille nicht ausgeliefert zu sein. Aber die Verlockungen sind natürlich<br />
auch sehr groß, und Möglichkeiten der kurzweiligen Zerstreuung drängen sich einem geradezu<br />
auf, so dass es leicht fällt, sich in diesem Rausch ziellos weitertreiben zu lassen, aus dem<br />
Fluss Lethe zu trinken, um alles irdische Leid zu vergessen und sich einer Illusion des ewigen,<br />
sorglosen Frühlings im Elysium hinzugeben. Das Erwachen ist dann aber umso ernüchternder.<br />
Wenn man z.B. über seine Verhältnisse gelebt hat und nun nicht mehr so viel konsumieren<br />
kann wie bisher, dann ist die Bitternis groß, wobei viele versucht sind, lieber die Schuld bei<br />
anderen suchen, anstatt sich selber kritische Fragen zu stellen. Dies war man ja auch bisher<br />
nicht gewohnt, sondern entzog sich dem durch die Flucht ins Sorglos-Unverbindliche, man<br />
betäubte erfolgreich alle Warnsignale und steht nun mit leeren Händen da. Ich will hier gar
nicht prinzipiell jegliches, auch oberflächliche Konsumvergnügen verdammen, sondern ich<br />
warne nur eindringlich vor der eigenen Auslieferung daran, so dass man wie ein Süchtiger<br />
solchem fremdbestimmten Vergnügen hingegeben ist und nur sehr eingeschränkt noch <strong>als</strong><br />
Autor seines Lebens gelten kann. Dadurch büßt man letztlich auch einen Großteil seiner<br />
Würde ein. Man soll durchaus genießen, aber dennoch nicht dem Genuss völlig anheimfallen,<br />
auf dass man von ihm beherrscht wird.<br />
Ich plädiere daher an dieser Stelle für ein möglichst selbstbestimmtes Leben, in welchem man<br />
sich Freiheitsspielräume erarbeiten soll, ohne anderen, die das gleiche Recht dazu haben,<br />
einen ungebührlichen Abbruch darin zu tun und dabei Werke zu vollbringen, die nach Möglichkeit<br />
auch einen moralischen Wert besitzen, wobei die Tat <strong>als</strong> solche, nicht aber das Werk<br />
selbst, unvergänglich bleibt. Sich einer solchen Lebenshaltung vergewissernd sollte man mit<br />
anderen in der Gesellschaft für sich selbst wie für zukünftige Generationen eine lebenswerte<br />
Grundlage schaffen. Im Bewusstsein diesem Ziel nachzustreben, kann man dann eine tiefere<br />
und womöglich auch dauerhaftere Sinngebung erlangen, weil man eben nicht ausschließlich<br />
oder doch in sehr hohem Maß oberflächlichem Konsum nachjagt. Um es nochm<strong>als</strong> klar zu<br />
stellen: Ich wende mich keineswegs grundsätzlich gegen jede kurzweilige Unterhaltung,<br />
sondern nur gegen die eigene Auslieferung an sie. Wenn man in dem von mir hier angesprochenen<br />
Sinne zu sich selbst <strong>als</strong> einem freiheitsbegabten Vernunftwesen steht und der Sinnfrage<br />
bewusst stellt, dann besteht überhaupt kein Problem in der zeitweisen Hingabe an den angenehmen<br />
Konsum ohne allzu tiefes Grübeln. Ganz im Gegenteil: Auch der Genuss soll zu<br />
seinem Recht kommen, aber wie bei allem macht die Dosis das Gift!<br />
Nachfolgend möchte ich noch einmal einige anfangs aufgeführte grundsätzliche Aspekte mit<br />
ganz konkreten Alltagssituationen in einen Zusammenhang bringen. Da wir die Möglichkeit<br />
freien, selbst bestimmten Handelns <strong>als</strong> freiheitsbegabte Vernunftwesen besitzen, müssen wir<br />
bei der Suche nach einem sinnerfüllten Leben danach Ausschau halten, worauf wir unser Streben<br />
und Handeln richten. Dabei sollten wir uns klar machen, dass die Ergebnisse unseres Bemühens<br />
letztlich immer der Vergänglichkeit anheim gegeben sind und nur die Bemühung <strong>als</strong><br />
solche ewigen Bestand hat: Der Weg ist <strong>als</strong>o das Ziel. Es stellt sich dabei allerdings die Frage,<br />
welchen konkreten Weg ich einschlagen soll.<br />
Kommen wir nun zu konkreten Alltagssituationen: Wir können Befriedigung sehr häufig dadurch<br />
erfahren, dass wir einen empfundenen Mangel beseitigen, sei es im Berufsleben oder in<br />
der Freizeit beim Sport, bei der Gartenarbeit oder irgendwo anders. Unter ‚Mangel’ verstehe<br />
ich hier ganz allgemein einen subjektiv empfundenen Zustand, welchen wir aus irgendeinem<br />
Grund ändern wollen bzw. sogar müssen, z.B. weil wir einen Auftrag von außen erhalten<br />
haben, sei es vom Chef oder einem Kunden oder aufgrund irgendeiner anderen äußeren Einflussnahme.<br />
Wenn wir nun diese Herausforderung nach eigenem Empfinden erfolgreich bestanden<br />
haben, erzeugt dies eine innere Befriedigung in uns, und zwar prinzipiell gleichgültig,<br />
ob wir uns jene Herausforderung selbst gestellt haben oder sie von außen an uns herangetragen<br />
worden ist. Das Ausmaß der Befriedigung hängt viel mehr von unserem Empfinden ab,<br />
wie groß die bestandene Herausforderung und die dafür notwendige eigene Leistung zu deren<br />
Bewältigung gewesen war. Heißt dies nun, dass wir uns einfach nur selbst die größten<br />
Herausforderungen suchen müssen, und schon haben wir ein sinnerfülltes Leben? Nein, so<br />
einfach ist es natürlich nicht! Zunächst einmal können wir – wie oben bereits erwähnt –<br />
durchaus durch die Bewältigung von außen kommender Herausforderungen eine Befriedigung<br />
und damit Sinnstiftung erfahren. Häufig können wir uns diese Herausforderungen jedoch<br />
kaum oder gar nicht aussuchen und müssen dann zusehen, wie wir mit jenen zurechtkommen.<br />
Aber sowohl in einer solchen Situation <strong>als</strong> auch in einer selbst gewählten kommt es bei der<br />
eigenen Sinnsuche darauf an, auf welche Art wir sie bewältigen. Wir sollten zunächst einmal
danach Ausschau halten, wie wir unseren Freiheitsspielraum und damit die selbst bestimmten<br />
Handlungsmöglichkeiten erweitern können. Denn nur so sind wir in der Lage, uns <strong>als</strong> Autor<br />
unserer Handlungen zu verstehen und emotional zu empfinden. Bei der Bewältigung von<br />
außen an uns hergetragener Herausforderungen können wir <strong>als</strong>o auch durch die Art, wie wir<br />
diesen begegnen, einiges selbst bestimmen und sind dabei keineswegs zwingend ausschließlich<br />
fremdbestimmt. Bei selbst gewählten Herausforderungen besitzen wir naturgemäß zunächst<br />
einmal den größten Freiheitsspielraum, da wir dann nicht nur die Art, wie wir die<br />
Herausforderung angehen, sondern uns jene ebenfalls selbst ausgesucht haben. In den allermeisten<br />
alltäglichen Fällen sind wir mit Mischformen konfrontiert, z.B. wenn wir uns für den<br />
Kauf eines Hauses mit Garten frei entschieden haben, folgen damit wieder weitere Herausforderungen,<br />
die wir nicht mehr alle völlig selbst bestimmen können, man denke an die Pflege<br />
des Hauses und des Gartens. Allerdings bleibt es uns weitgehend freigestellt, wie beispielsweise<br />
der Garten unserer Meinung nach aussehen soll bzw. wieviel Zeit wir dann bereit sind,<br />
dafür zu investieren. An diesem Beispiel sollte nur einmal kurz aufgezeigt werden, dass wir<br />
meistens selbst bei zuvor – zumindest relativ – frei gewählten Entscheidungen dennoch wiederum<br />
<strong>als</strong> Folge jener mit von außen kommenden Herausforderungen konfrontiert werden.<br />
Trotzdem sind wir in den meisten Fälle in der Lage, einen Teil unserer Handlungen selbst zu<br />
bestimmen – sei es im Hinblick auf die Auswahl von Herausforderungen oder in bezug auf<br />
die Art der Bewältigung jener – und damit uns selbst <strong>als</strong> Autor solcher Handlungen anzusehen<br />
bzw. so auch subjektiv zu empfinden. Das Ausmaß der Befriedigung, die wir nach bestandener<br />
Herausforderung empfinden, hängt nicht nur, aber dennoch sehr stark davon ab, wie groß<br />
die eigene Mühe war, welche wir für eine erfolgreiche Bewältigung haben aufbringen<br />
müssen. Häufig, wenn auch keineswegs immer, hängt dies mit dem Ausmaß des zuvor empfundenen<br />
Mangels zusammen. Ein passendes Beispiel hierfür liefert der Sport: Nach einem<br />
Waldlauf, welchen man vielleicht sogar noch mit eigener Bestzeit absolviert hat, fühlt man<br />
sich nach dieser großen Anstrengung sehr befriedigt, und auch das Stillen des Durstes empfinden<br />
wir dann <strong>als</strong> außerordentlich wohltuend. Als ein Zwischenergebnis lässt sich folgendes<br />
festhalten: Je freier und damit selbst bestimmter die Auswahl der Herausforderung ist und je<br />
größer die vorher aufgewandte Mühe zu ihrer Bewältigung war, desto tiefer ist die danach<br />
empfundene Befriedigung; zumindest ist dies in den allermeisten Fällen so, denn Ausnahmen<br />
bestätigen auch hier die Regel. Eine nicht bestandene Herausforderung wird häufig zum<br />
Gegenteil führen, zur Frustration. Dieses Gefühl verstärkt sich naturgemäß, wenn solches<br />
Nichtbestehen wiederholt auftritt. Daher ist das Bestehen einer Herausforderung ein sehr<br />
wichtiger Aspekt hinsichtlich der eigenen Zufriedenheit, auch wenn man sicherlich teilweise<br />
auch durch Niederlagen angespornt werden kann. Nur letztlich sind wir selbstverständlich<br />
immer bestrebt, die uns begegnenden Herausforderungen möglichst erfolgreich zu meistern,<br />
so dass man versuchen sollte, ein richtiges Maß beim Auswählen des Schwierigkeitsgrades zu<br />
finden, <strong>als</strong>o weder die Latte zu hoch zu legen, wodurch ein Scheitern wahrscheinlich wird<br />
oder aber auch zu niedrig, wodurch die Befriedigung kaum oder gar nicht eintritt. Dabei gilt<br />
es ebenfalls zu beachten, dass zumindest die selbst gewählten Herausforderungen ein möglichst<br />
aktives Tun unsererseits beinhalten, d.h. in bezug auf den Körper, dass wir nicht nur<br />
passiv im Sessel sitzen, sondern unseren Hintern hoch kriegen und uns bewegen, auf dass wir<br />
es uns nach dieser Anstrengung wieder bequem machen können. Ähnliches gilt für unseren<br />
Verstand. Auch diesen sollten wir fordern, indem wir ihn nicht zu einseitig und oberflächlich<br />
nutzen, sondern die Kreativität sowie Tiefe unseres Denkens befördern. Wer sich immer nur<br />
passiv mit obendrein seichter Kost berieseln lässt oder die Zeit vornehmlich mit derartigen<br />
Computerspielen verbringt, bei denen nur kurzweilige wie einseitige Erfolgserlebnisse in<br />
einer rasenden Bilderflut zu erzielen sind, wird damit sicherlich keinen Beitrag für die eigene<br />
tiefe wie nachhaltige Sinnsuche leisten, da ein solches Verhalten in weiten Teilen gerade eben<br />
nicht dem entspricht, was wir diesbezüglich bereits herausgefunden haben.
Bei dieser Suche ist das eben Dargelegte sicherlich sehr wichtig, aber es bedarf für ein wirklich<br />
sinnerfülltes Leben noch mehr. Ganz entscheidend für das oben Ausgeführte ist der moralische<br />
Aspekt unserer Zielsetzungen und Handlungen! Wir haben in diesem Abschnitt<br />
schon erfahren können, dass das einzig Unvergängliche, dessen wir uns auch rational ganz<br />
sicher sein können, die Tatsache einer Handlung sowie die zu ihr geführte Motivation ist. Die<br />
Ergebnisse all unserer Bemühungen sind, wie wir selbst <strong>als</strong> irdische Wesen, vergänglich. Bei<br />
der selbstkritischen Bewertung unserer Handlungen und insbesondere der jeweiligen Motivation<br />
zu jenen in moralischer Hinsicht stoßen wir dann auf den Kern der Sinnfrage. Als freiheitsbegabte<br />
Vernunftwesen suchen wir zum einen immer nach einem möglichst großen<br />
Freiheitsspielraum für uns selbst, aber dabei müssen wir unter moralischen Gesichtspunkten<br />
immer dasselbe Recht aller anderen eben solcher Wesen beachten, d.h. die gleichberechtigte<br />
Kompatibilisierung der Freiheitsansprüche aller Menschen untereinander. Indem wir uns nach<br />
bestem Wissen darum bemühen, in diesem Sinne moralisch zu handeln und uns dies auch<br />
selbst bewusst machen, können wir eine tiefgehende Sinnstiftung erfahren. Dabei sollen und<br />
dürfen wir unser eigenes Wohlbefinden durchaus befördern. Nur müssen wir unter moralischen<br />
Gesichtspunkten bei diesem Streben nach der Befriedigung eigener Bedürfnisse darauf<br />
achten, nicht das gleiche Recht anderer Mitmenschen dabei ungebührlich einzuschränken. Darüber<br />
hinaus sollten wir aktiv mithelfen dafür Sorge zu tragen, dass die menschliche Gemeinschaft,<br />
in der wir leben und auf die wir in aller Regel selber in hohem Maße nicht nur im Hinblick<br />
auf unser Überleben, sondern zumeist ebenso hinsichtlich unserer Selbstverwirklichung<br />
<strong>als</strong> gesellige, auf Gemeinschaft mit anderen angelegte Wesen angewiesen sind, sich gedeihlich<br />
entwickelt. Was kann es letztlich Befriedigenderes oder Sinnstiftenderes geben, <strong>als</strong> bei<br />
der Verwirklichung von moralisch Gutem aktiv mitzuhelfen? Wenn man sich nach Kräften<br />
anstrengt, hat man eigentlich schon Erfolg gehabt und seine moralische Pflicht getan. Durch<br />
positive Rückmeldungen der Mitmenschen kann man darüber hinaus häufig Dankbarkeit und<br />
Anerkennung erfahren, die <strong>als</strong> eine erfolgreich bestandene Herausforderung im oben genannten<br />
Sinne zur Befriedigung beitragen kann. Leider sind solche guten Handlungen in der Praxis<br />
oft gar nicht so leicht zu erkennen und / oder umzusetzen, allein manchmal schon deshalb,<br />
weil die Mitmenschen dasjenige, was man ihnen Gutes angedeihen lassen möchte, nicht <strong>als</strong><br />
solches erkennen, sei es, weil man tatsächlich einfach f<strong>als</strong>ch liegt, in seinem Bestreben Gutes<br />
zu tun, sei es, dass die Adressaten es selber f<strong>als</strong>ch einschätzen und / oder mangels eigenen<br />
guten Willens nicht wahrhaben wollen. In der alltäglichen Realität werden wir es zumeist mit<br />
unterschiedlichen Mischungen zu tun haben. Dennoch sollten wir uns in dieser Hinsicht nicht<br />
entmutigen lassen, sondern uns immer strebend bemühen.<br />
Letztlich werden wir dieses sinnerfüllte Leben aber erst dann finden, wenn wir den Glauben<br />
an einen guten, barmherzigen Gott finden, der uns <strong>als</strong> freie und damit mündige Wesen geschaffen<br />
hat und uns in Liebe im endlichen Diesseits wie im unendlichen Jenseits zugetan ist.<br />
Nehmen wir einmal an, es gäbe keinen allmächtigen und barmherzigen Gott, der uns mit der<br />
Welt geschaffen hat und uns auf ewig liebt. Warum sollten wir beispielsweise Trost, Zuversicht<br />
und damit Sinnstiftung für unser begrenztes irdisches Leben dadurch gewinnen können,<br />
dass die Tatsache, dass wir etwas moralisch Gutes entsprechend der oben kurz dargelegten<br />
Kriterien vollbracht haben, unauslöschbar ist und somit zwar das Ergebnis einer solch guten<br />
Tat vergänglich ist, aber das Faktum des Handelns unvergänglich <strong>als</strong> solches bestehen bleibt?<br />
Ohne die Annahme des allmächtigen und barmherzigen Gottes könnte man sich doch fragen,<br />
wieso ich nicht nur an mich selbst und meinen Vorteil denken sollte, um dadurch das größtmögliche<br />
Maß an Glück in meinem irdisch begrenzten Leben zu finden. Dies schlösse freilich<br />
nicht aus, anderen auch etwas Gutes zu tun, aber eben letztlich nur aus eigensüchtigen Motiven<br />
heraus. Der Sinn des Lebens beschränkte sich dann letztlich doch nur immer wieder auf<br />
die Erreichung der größt möglichen eigenen Glückseligkeit in unserem zeitlich begrenzten<br />
Dasein auf dieser Erde. Selbst die eigene Bewusstmachung der unauslöschlichen Faktizität
egangener Handlungen änderte insofern daran nichts, <strong>als</strong> dass wir uns fragen müssten, was<br />
wir durch diesen Ewigkeitsgedanken letztlich im Hinblick auf die Sinnfrage gewonnen hätten.<br />
Die Antwort kann nur lauten: Gar nichts! Wir wären – unter Annahme der heutigen naturwissenschaftlichen<br />
Erkenntnislage – nichts weiter <strong>als</strong> eine komplex organisierte Einheit von<br />
Atomen, die mit anderen mehr oder minder komplexen Einheiten für eine bestimmte Zeit<br />
interagiert und sich dann wieder in ihre Bestandteile – die Atome – zerlegt. Und das war es<br />
dann. Was hätten wir <strong>als</strong>o durch den Gedanken gewonnen, dass die Tatsache der Durchführung<br />
irgendeiner, wie auch immer moralisch zu bewertenden Handlung, unvergänglich wäre?<br />
Die Antwort lautet wiederum: Gar nichts! Analog zu den Grundlagen und Grenzen unserer<br />
menschlichen Erkenntnisfähigkeit stoßen wir auch bei der Sinnfrage auf das Letzte, Absolute,<br />
unbedingt Gute und Barmherzige, auf Gott, dessen Dasein vor und in aller Zeit auf ewig wir<br />
gezwungen sind für uns anzunehmen, wollen wir Sinnstiftung in letzter Konsequenz erreichen.<br />
Nur so entrinnen wir der Vorstellung, zufälliges materielles Produkt physikalisch,<br />
chemisch, biologisch ablaufender Prozesse im Rahmen der Evolution zu sein, verloren in<br />
einem sinnlosen Universum, das stupide nach Gesetzen funktioniert, die Würde und Moral<br />
nicht kennen. Das Stärkere setzt sich solange durch, <strong>als</strong> dass es das Stärkere im Kampf ums<br />
Werden und Sein ist, bis es selbst zum Schwächeren wird und verschwindet. Erst durch die<br />
Annahme des Daseins des allmächtigen und barmherzigen Gottes und der Aufgehobenheit<br />
durch und in ihm finden wir einen Weg aus dieser sinnlosen in eine sinnstiftende Welt. Erst<br />
dann ergibt alles vorher Geschriebene einen letztlich wirklichen Sinn für uns. Es fehlte bis zu<br />
dieser Einsicht – bildlich gesprochen – das Fundament, auf dem alles ruht.<br />
Diese Erläuterung ist nur ein Ausschnitt meiner Überlegungen zu diesem Thema. Wer mehr<br />
hierüber, insbesondere zur Frage des Glaubens an Gott, sowie vieles Weitere erfahren möchte,<br />
kann dies in meinem Buch ‚Der Mensch – Eine kritische Auseinander mit uns selbst’ nachlesen.<br />
Erhältlich ist dieses Buch über meinen E-Buchvertrieb:<br />
www.drbottke-e-buchvertrieb.de
2. Deutsche Sprache:<br />
2.1. Einleitung:<br />
Wir behandeln hier das Thema ‚Deutsche Sprache‘, weil wir in ihr ein Kulturgut ersten<br />
Ranges sehen. Die deutsche Sprache dient zunächst <strong>als</strong> Kommunikationsmittel, um Gedanken<br />
zu formulieren, Thesen zu begründen oder zu widerlegen und Informationen zur Verfügung<br />
zu stellen. Doch Sprache ist natürlich noch sehr viel mehr: So dient sie beispielsweise der<br />
Identifikationsstiftung innerhalb einer Gesellschaft oder Kulturgemeinschaft, vermittelt ein<br />
Gefühl von Geborgenheit und Heimat oder verleiht den unterschiedlichsten Gefühle in Werken<br />
der Weltliteratur einen eindrucksvollen Ausdruck. Jede große Kultursprache verfügt über<br />
ihre ganz eigenen, unverwechselbaren wie reichhaltigen Ausdrucksmöglichkeiten. Keine kann<br />
daher die andere ersetzen.<br />
Allein diese kurze Einführung zeigt, wie wichtig der Erhalt und die Pflege einer bedeutenden<br />
Kultursprache sind. Leider wird die deutsche Sprache – insbesondere von vielen Deutschen<br />
selbst – misshandelt. Gerade Teile der gesellschaftlichen Eliten zeigen bedauerlicherweise<br />
häufig eine nicht zu akzeptierende Ignoranz gegenüber der Bedeutung der eigenen Muttersprache,<br />
so beispielsweise in der Wirtschafts- und Finanzwelt oder Wissenschaft. Viele bedenken<br />
dabei gar nicht, welchen Schaden sie damit der eigenen Gesellschaft, aber auch ihrem<br />
Unternehmen bzw. ihrer Hochschule und damit letztendlich sich selbst zufügen.<br />
Ich selber bin aktives Mitglied im ‚Verein Deutsche Sprache e.V. (VDS)‘, weil dieser gemeinnützige<br />
Verein sich in vorbildlicher Weise für das Kulturgut ‚Deutsche Sprache‘ einsetzt.<br />
An dieser Stelle soll ausdrücklich klargestellt werden, dass wir uns zwar mit Nachdruck für<br />
die deutsche Sprache einsetzen, ohne jedoch andere, großartige Kultursprachen herabzusetzen.<br />
Keine Sprache kann eine andere ersetzen. Jede hält ihre ganz eigenen Ausdrucksmöglichkeiten<br />
bereit und dient damit der kulturellen Vielfalt, die es zu erhalten gilt.<br />
Da dieses Thema – zumindest teilweise – hoch umstritten ist, soll es hier diskutiert werden. Es<br />
werden Beiträge aus der vom VDS herausgegebenen Zeitschrift – den ‚Sprachnachrichten’ –<br />
sowie von anderen, einschließlich mir selbst, <strong>als</strong> Diskussionsgrundlagen vorgestellt. Nun sind<br />
alle zu einer sachlich-argumentativen Diskussion eingeladen, sei es, dass sie die hier geäußerten<br />
Befürchtungen teilen, ihren Sorgen sowie ihren Vorschlägen zur Verbesserung der derzeitigen<br />
Situation Ausdruck verleihen möchten, sei es, dass sie eine ganz andere Auffassung<br />
vertreten.<br />
Es folgen <strong>als</strong> erstes ein von mir verfasster, fiktiver Trialog, dann Artikel aus den Sprachnachrichten<br />
und schließlich weitere Beiträge.
2.2. Fiktiver Trialog zur Deutschen Sprache:<br />
Gespräche im Wartezimmer: Über Sprache und Kultur sowie Solidarität<br />
Im Wartezimmer der Ärztin K. für traditionelle chinesische Medizin trifft Bürger B. auf den<br />
Linguisten L. und den Vorstandsvorsitzenden C. einer mittelgroßen Aktiengesellschaft.<br />
Bürger B. ist allerdings nicht <strong>als</strong> Patient gekommen, sondern nur weil er ein persönlich guter<br />
Bekannter der Ärztin ist und ihr lediglich einen spontanen Besuch abstatten wollte.<br />
Bürger B.: Guten Tag die Herren.<br />
Beide grüßen freundlich zurück. Ärztin K. hört, daß Herr B. sie überraschend besucht und tritt<br />
kurz ins Wartezimmer.<br />
Ärztin K.: Hallo Herr B.. Welch eine Überraschung, daß Sie mich besuchen. Wie geht es<br />
Ihnen?<br />
Bürger B.: Danke. Mir geht es gut. Aber ich sehe, Sie haben gerade viel zu tun. Ich will Sie<br />
nicht stören. Ich kann ja später noch einmal vorbeischauen.<br />
Ärztin K.: Ja, im Augenblick habe ich wirklich wenig Zeit. Aber vielleicht wollen Sie hier<br />
warten. Sie können sich ja mit dem Linguisten L., der gerade promoviert hat und Herrn C.,<br />
einem Vorstandsvorsitzendem einer Mobilfunkfirma etwas unterhalten.<br />
An die Herren gewandt:<br />
Ärztin K.: Natürlich nur, wenn es Ihnen recht ist.<br />
Herr C.: Selbstverständlich. Sehr gerne sogar.<br />
Herr L.: Auch ich habe nichts dagegen einzuwenden.<br />
Bürger B.: Sehr schön. Wenn ich mich kurz vorstellen darf: Ich bin selbständig und betreibe<br />
ein privates Lehrinstitut, in welchem vor allem Schüler aber auch Erwachsene in den verschiedensten<br />
Fächern unterrichtet werden.<br />
Herr C.: Sehr interessant. Und woher kennen Sie die Ärztin K.?<br />
Bürger B.: Ich habe sie über eine Freundin kennengelernt.<br />
Herr L.: Bei mir war es ähnlich; eine gute Bekannte hat mir Frau K. ans Herz gelegt.<br />
Herr C.: Mir ist die Ärztin K. ebenfalls von einem Bekannten weiterempfohlen worden, der<br />
ihre Heilkünste sehr zu loben wußte. Ich habe Probleme mit dem Magen. Wahrscheinlich<br />
etwas zu viel Streß. Nun ja, in meiner Position hat man eben viel um die Ohren, ganz zu<br />
schweigen von der Verantwortung für die zahlreichen Mitarbeiter und natürlich die Aktionäre.<br />
Bürger B.: Wie versuchen Sie mit dem ganzen Streß auf Dauer zurecht zu kommen?
Herr C.: Das ist in der Tat gar nicht so einfach. Da ich damit allerdings keineswegs allein<br />
konfrontiert bin, sondern dies viele Führungskräfte im höheren bis mittleren Management<br />
betrifft, haben wir uns in unserem Unternehmen einiges einfallen lassen, damit unsere Mitarbeiter<br />
Streß abbauen können und motiviert bleiben. Hierdurch wollen wir dem ‚Burn – out –<br />
Syndrom’ begegnen, von dem immer wieder zu hören ist. Besonders gut gefallen mir in<br />
diesem Zusammenhang spezielle ‚Out – door – events’ bei denen man sich im ‚Team’ in der<br />
Natur bewähren muß. Es sind Aufgaben verschiedenster Art zu bewältigen, die natürlich<br />
vorher nicht bekannt sind. ‚Teamwork’ ist dabei sehr wichtig; und dies ist auch im täglichen<br />
Geschäft überaus entscheidend. Darüber hinaus wird die ‚Corporate – Identity’ in unserem<br />
Unternehmen gestärkt: Man ist Teil des ‚Teams’ wie man Teil unserer ‚Company’ ist. Das<br />
schweißt zusammen. Besonders gut hat mir bei der letzten Veranstaltung vor ein paar Wochen<br />
eine ‚Challenge’ gefallen, wo wir uns bei starkem Regen durch zum Teil tiefen Morast haben<br />
durchkämpfen müssen. Das hatte was Animalisches. Danach fühlt man sich wie neugeboren.<br />
Einfach ‚back to the roots’.<br />
Bürger B.: Körperliche Betätigung ist sicherlich besonders für Menschen, die eine solche im<br />
Berufsalltag nicht vorfinden, etwas Erstrebenswertes, gar Befreiendes. Ich zum Beispiel fahre<br />
gerne mit dem Fahrrad durch die Natur oder gehe spazieren. Mir ist allerdings bei Ihren Ausführungen<br />
aufgefallen, daß Sie viele englische Wörter in einem deutschen Gespräch gebraucht<br />
haben. Hat das einen bestimmten Grund?<br />
Herr C.: Das habe ich überhaupt nicht bemerkt. Aber Englisch ist ja die Weltsprache<br />
schlechthin. Gerade in der Wirtschaft spricht man ja praktisch nur noch Englisch oder verwendet<br />
zumindest englische Fachbegriffe. Gerade wir <strong>als</strong> internationale ‚Company’ haben<br />
selbstverständlich auch in unserer deutschen Zentrale alle Geschäftsbereiche, Abteilungen, bis<br />
hin zu den einzelnen Positionen mit englischen Namen belegt. Deutsch ist etwas für zu Hause<br />
im privaten Gespräch. Das Englische hingegen für alles andere, insbesondere das Geschäftsleben.<br />
Da führt kein Weg dran vorbei. Je früher man das begreift, umso besser. Diese Meinung<br />
teilen auch viele führende Politiker, so unter anderem der baden – württembergische<br />
Ministerpräsident Herr Oe..<br />
Bürger B.: Und was wird dann aus der klassischen deutschen Literatur oder der Philosophie<br />
im Land der ‚Dichter und Denker’?<br />
Herr C.: Na ja, Literatur und Philosophie von mir aus auch noch. Aber das ist doch nicht<br />
wirklich wichtig. Zumindest in der Literatur gibt es zur Zerstreuung nun wahrlich genug auch<br />
auf Englisch.<br />
Bürger B.: Literatur ist nach Ihrer Meinung nur zur Zerstreuung gut?<br />
Herr C.: Ja, wozu denn sonst noch? Irgendwelche Lebensweisheiten von vor ein paar hundert<br />
Jahren sind doch auf die heutige Situation kaum oder gar nicht mehr anwendbar. Wir leben<br />
doch in einer völlig anderen Welt. Wir müssen im Hier und Jetzt zurecht kommen.<br />
Bürger B.: Aber das Hier und Jetzt hat doch eine Geschichte, nicht wahr?<br />
Herr C.: Wie meinen Sie das?<br />
Bürger B.: Wir sind doch nicht einfach im Hier und Jetzt. Es gibt immer eine Vergangenheit,<br />
welche die Gegenwart bestimmt. Denn alles Gegenwärtige hat eine Geschichte, die es zu dem<br />
gemacht hat, was es ist. Oder etwa nicht?
Herr C.: Natürlich.<br />
Bürger B.: Wenn wir <strong>als</strong>o das Hier und Jetzt verstehen wollen, müssen wir in die Vergangenheit<br />
schauen. Erst so sind wir in der Lage, die Gegenwart zu verstehen und sinnvoll Pläne für<br />
die Zukunft zu schmieden.<br />
Herr C.: So allgemein wie Sie das hier sagen, stimmt das wohl. Aber was hat das mit dem zunehmenden<br />
Gebrauch des Englischen in Deutschland zu tun? Englisch ist doch ebenfalls eine<br />
Kultursprache von Rang und mit Geschichte, oder etwa nicht?<br />
Bürger B.: Selbstverständlich ist Englisch eine solche Sprache. Daher denke ich, daß es auf<br />
jeden Fall sinnvoll ist, Englisch zu lernen. Worum es mir geht, ist aber folgender Umstand:<br />
Wir vermischen bei uns in zunehmendem Maße Deutsch mit Englisch zu einem teilweise<br />
furchtbaren sogenannten ‚Denglisch’, d.h. wir sprechen und schreiben dann weder Deutsch<br />
noch Englisch. Ich will das an folgendem Beispiel ein wenig verdeutlichen: Man benutzt<br />
heute leider sehr oft den Begriff ‚hand out’, wenn man ein Thesenpapier an Teilnehmer eines<br />
Seminars austeilt. Dieses englische Wort ist in einem auf Deutsch gehaltenen Vortrag nicht<br />
nur völlig überflüssig, weil es eben ein deutsches Wort dafür gibt, sondern sogar noch viel<br />
ungenauer. Denn bei einem ‚hand out’ könnte es sich ja beispielsweise auch um belegte<br />
Schnittchen handeln, die man verteilt. Dem gegenüber ist der deutsche Begriff viel treffender.<br />
Oder sehen Sie das anders?<br />
Herr C.: Nun gut, in diesem Fall mag das so sein. Was meinen Sie eigentlich dazu, Herr L.?<br />
Sie haben bisher noch gar nichts gesagt.<br />
Herr L.: Nun ja, ich höre gerne erst einmal zu und analysiere das Gesagte nach wissenschaftlichen<br />
Kriterien.<br />
Herr C.: Schön und gut. Aber nun heraus mit der Sprache: Wie stehen Sie zu den Thesen von<br />
Herrn B.. Sie haben doch in Linguistik gerade promoviert und müßten sich mit der Materie<br />
auskennen.<br />
Herr L.: Gewiß doch. Ich denke, daß Sie – Herr B. – das Verständigungsproblem weit übertreiben.<br />
Denn in besagtem Beispiel würde allen Beteiligten völlig klar sein, daß es sich um ein<br />
Thesenpapier und nicht um belegte Schnittchen handelt, da Sprache immer im jeweiligen<br />
Kontext zu sehen ist.<br />
Herr C.: Na da sehen Sie es, Herr B.! In der Praxis bestehen die von ihnen konstruierten<br />
Probleme in der Weise gar nicht.<br />
Bürger B.: Das von mir aufgeführte Beispiel sollte ein prinzipielles Problem nur veranschaulichen,<br />
selbst wenn zugegebenermaßen niemand in der besagten Situation auf den<br />
Gedanken käme, daß nun belegt Schnittchen ausgeteilt werden würden. Ich will daher versuchen<br />
zu verdeutlichen, worauf es mir ankam: Wenn ich ein Thesenpapier in einem auf<br />
Deutsch gehaltenen Vortrag verteile, ist jener Begriff dem ‚hand out’ vorzuziehen, weil es<br />
sich erstens um ein deutsches Wort handelt, welches zudem zweitens den Sachverhalt genauer<br />
trifft. Es gibt doch überhaupt keinen vernünftigen Grund für den Gebrauch dieses englischen<br />
Begriffes.<br />
Herr L.: Mag sein, daß es keinen zwingenden Grund dafür gibt. Aber der Verständigung<br />
schadet es auch nicht. Im übrigen dient Sprache keineswegs nur der bloßen Verständigung,
sondern man versucht mithilfe bestimmter Sprachcodes beispielsweise Gruppenidentifikationen<br />
herzustellen.<br />
Bürger B.: Dem zuletzt Gesagten hinsichtlich der Identifikationsbedeutung mit und durch<br />
Sprache kann ich mich voll und ganz anschließen. An dem obigen Beispiel wird dies doch<br />
auch deutlich. Gäben wir das Deutsche in der Weise, wie es Herr C. sagte, auf, so verlören<br />
wir damit eine treffendere Ausdrucksmöglichkeit. Daher bedeutet die weitgehende Aufgabe<br />
einer Kultursprache wie des Deutschen einen ungeheueren Verlust von sprachlichen Differenzierungs-<br />
und damit letztlich von Denkmöglichkeiten. Gerade die Wissenschaft, die ja<br />
bekanntermaßen eine ganz entscheidende Grundlage unseres materiellen Wohlstandes darstellt,<br />
lebt vom Ideenreichtum sowie verschiedener, miteinander konkurrierender Herangehensweisen<br />
an ein Problem. Wenn man dies durch den generellen Gebrauch nur einer<br />
Sprache einschränkt, gibt man zugleich sehr viel mehr auf, <strong>als</strong> man auf den ersten Blick vielleicht<br />
meint. Sprache und Denken sind auf das Engste miteinander verknüpft. Sprache ist<br />
gewissermaßen geronnene Kultur. Sie ist in der Tat viel mehr <strong>als</strong> simple Informationsübermittlung<br />
und sogar noch mehr <strong>als</strong> ein Identifikationsinstrument.<br />
Herr L.: Aber gerade in der Wissenschaft dominiert – ähnlich wie in der Wirtschaft – doch<br />
immer mehr das Englische. Dies hat unter anderem den Vorteil, daß man sich auf internationaler<br />
Ebene viel leichter verständigen kann.<br />
Herr C.: Na sehen Sie, Herr B.! Genau was ich sage.<br />
Bürger B.: Auf internationalen Kongressen ist dies sicherlich sinnvoll. Aber es kommt, wie<br />
bei allem, auf das Maß an. Wenn man auch in Deutschland teilweise wissenschaftlich nur<br />
noch auf Englisch publiziert und gar nicht mehr auf Deutsch, dann gibt man letztlich eine<br />
Kultursprache mit all ihren spezifischen Differenzierungsmöglichkeiten auf und verliert auf<br />
mittlere bis lange Sicht sehr viel dadurch, so wie ich es eben erwähnte. Denn auch für Engländer<br />
oder Amerikaner kann es durchaus sinnvoll sein, ein wenig die deutsche Sprache<br />
kennenzulernen, um ihren intellektuellen Horizont zu erweitern.<br />
Herr L.: Aber es existieren doch hunderte wenn nicht gar tausende Sprachen. Die kann doch<br />
kein Mensch lernen.<br />
Herr C.: Genauso ist es!<br />
Bürger B.: Natürlich kann man bei weitem nicht alle lernen. Es geht mir darum, daß nicht nur<br />
eine Sprache alles dominiert. Auch hier ist das Maß entscheidend. Welche Bedeutung eine<br />
Sprache hat, hängt von vielen Faktoren ab, so zum Beispiel wie viele Menschen sie <strong>als</strong><br />
Muttersprache sprechen, welche kulturell – historische Bedeutung sie hatte und hat, welche<br />
wirtschaftliche sowie politische Bedeutung das oder die Länder auf der Welt haben, in denen<br />
eine Sprache beheimatet ist. Wenn wir nun freiwillig eine nach diesen Kriterien so bedeutende<br />
Sprache wie das Deutsche vernachlässigen oder teilweise sogar aufgeben, dann ist der<br />
Verlust für die ganze Menschheit bedeutend und für uns selbst ganz immens.<br />
Herr L. runzelt die Stirn, will aber erst einmal abwarten und Herrn C. das Gespräch mit<br />
Bürger B. überlassen.<br />
Herr C.: Wie meinen Sie das?<br />
Bürger B.: In welcher Sprache träumen Sie?
Herr C.: In Deutsch.<br />
Bürger B.: In welcher Sprache sprechen Sie zu Hause mit Ihrer Familie?<br />
Herr C.: Natürlich auch in Deutsch.<br />
Bürger B.: Und wenn Sie sich Gefühle gedanklich vergegenwärtigen wollen, geschieht dies<br />
sicherlich ebenfalls in Ihrer Muttersprache Deutsch, nicht wahr?<br />
Herr C.: Gewiß doch.<br />
Bürger B.: Sie sehen allein schon anhand dieser alltäglichen Beispiele, wie viel mehr <strong>als</strong><br />
lediglich simple Informationsübermittlung Sprache für den Menschen bedeutet. Sie ist<br />
geistige und vor allem gefühlsmäßige Heimat, in welcher wir zu uns selbst finden können.<br />
Wir verbringen so viel Zeit in und mit ihr, daß uns eine andere Sprache, die wir zum Beispiel<br />
nur im Geschäftsleben verwenden, niem<strong>als</strong> so vertraut sein kann, wie eben die Muttersprache.<br />
Sie bleibt uns immer zumindest ein wenig fremd. Deshalb nennen wir sie ja nicht zuletzt auch<br />
Fremdsprache, oder etwa nicht?<br />
Herr C.: Na gut, von mir aus.<br />
Bürger B.: Stellen wir uns nun irgendeine Firma in Deutschland vor, in der teilweise nur Englisch<br />
gesprochen wird, vornehmlich im mittleren und höheren Führungsbereich. Ansonsten<br />
wird Deutsch zwar nicht völlig abgeschafft, aber es werden viele englische Begriffe verwandt.<br />
Herr C.: Das ist heute bei den meisten größeren Unternehmen durchaus üblich.<br />
Bürger B.: Genau davon las ich schon des öfteren, aber Sie werden sich hinsichtlich dieser<br />
Praxis gewiß viel besser auskennen <strong>als</strong> ich.<br />
Herr C.: Sicherlich.<br />
Bürger B.: Gut. Treten hierdurch nicht bedeutende Verständigungsprobleme auf?<br />
Herr C.: Wieso?<br />
Bürger B.: Wenn sich beispielsweise der Werksmeister mit einem Ingenieur der Entwicklungsabteilung<br />
über ein Konstruktionsproblem auseinandersetzen will und selber bisher erst<br />
mühsam einige neue Begriffe auf Englisch gelernt hat, welche ihm dennoch nicht sicher von<br />
den Lippen gehen, wohingegen der Ingenieur alle seine Planungen ausschließlich in englischer<br />
Sprache formuliert, liegen dann gravierende Verständigungsprobleme nicht auf der<br />
Hand? Denn der Ingenieur muß nun alles wieder zurück ins Deutsche übersetzen, um sich<br />
seinem Gegenüber sinnvoll mitteilen zu können. Manchmal rutscht ihm dann doch wieder ein<br />
englischer Fachbegriff heraus und der Werksmeister muß nachfragen oder unterläßt es gar aus<br />
Scham. Könnten hierdurch nicht schwerwiegende Fehler verursacht werden?<br />
Herr C.: Schon möglich.<br />
Bürger B.: Wenden wir uns nun der sogenannten ‚Marketingabteilung’ zu. Gerade in der<br />
Werbung finden sich englische Begriffe zuhauf bei uns. Dies liegt wahrscheinlich ganz
wesentlich daran, daß in diesen Abteilungen äußerst viele englische Wörter benutzt werden.<br />
Welche Aufgabe hat denn eigentlich die Werbung?<br />
Herr C.: Na was wohl? Produkte im Markt bekannt zu machen, die Kunden von den Vorzügen<br />
jener zu überzeugen und sie schließlich zum Kauf zu animieren. Was denn sonst?<br />
Bürger B.: Genau so dachte ich mir das auch. Aber kennen Sie denn nicht viele neuere<br />
Studien, die sich gerade mit der Problematik der Werbung auf Englisch auseinandersetzen?<br />
Herr C.: Von welchen sprechen Sie?<br />
Bürger B.: Nun ja zum Beispiel von jener des Umfrageinstitutes A., das Sie sicherlich kennen<br />
werden.<br />
Herr C.: Selbstverständlich ist mir jenes Institut gut bekannt.<br />
Bürger B.: Fein. Also die Studie, die ich meine, belegt, daß viele Konsumenten, die gerade<br />
durch die englische Werbung angesprochen werden sollten, jene überhaupt gar nicht verstanden<br />
haben und sich teilweise sogar abgestoßen fühlten. Kann das der Sinn von Werbung<br />
sein?<br />
Herr C.: Natürlich nicht!<br />
Bürger B.: Aber warum entwerfen Menschen aus den Werbeabteilungen oder ‚Marketingfirmen’<br />
solche Werbung? Kann es nicht in erheblichem Maße daran liegen, daß sie selbst sehr<br />
viel nur noch auf Englisch abhandeln?<br />
Herr C.: Vielleicht.<br />
Bürger B.: Sie sehen <strong>als</strong>o auch an diesem Beispiel wie schädlich es sein kann, sich nur auf das<br />
Englische zu beschränken.<br />
Herr C.: Mag sein. Trotzdem ist die Entwicklung hin zum Englischen wohl kaum aufzuhalten.<br />
Da muß man sich eben anpassen.<br />
Bürger B.: Aber wieso denn. Gerade anhand der besprochenen Beispiele wird doch ganz deutlich,<br />
daß ein Unternehmen in Deutschland besser daran täte, dieser Entwicklung eben nicht<br />
einfach zu folgen. Oder täusche ich mich da?<br />
Herr C.: Von mir aus mag das in den von Ihnen genannten Beispielen so sein.<br />
Herr L.: Wenn die Kunden der Werbeagenturen dies erkennen, dann steuern sie eben um.<br />
Dies ist in letzter Zeit auch mehrfach geschehen. So löst sich das Problem von selbst.<br />
Bürger B.: Es ist zutreffend, daß Firmen darauf in der von Ihnen geschilderten Weise reagiert<br />
haben. Aber mußte es erst zu solchen Fehlentwicklungen kommen? Ich meine: Nein. Der<br />
Grund, daß es dazu dennoch kam, liegt an dem von mir vorhin Aufgeführten. Wenn man in<br />
seinem Tagesablauf in Deutschland nur noch Englisch spricht und schreibt, erhöht dies die<br />
Gefahr am Kunden in diesem Land vorbei zu denken.
Herr L.: Es mag sein, daß das von Ihnen soeben Vorgebrachte eine Rolle dabei gespielt hat.<br />
Aber ich sehe darin nach wie vor nicht eine wirklich ernsthafte Bedrohung. Abgesehen davon<br />
dient die Sprache nicht nur der Informationsübermittlung, sondern sie wird u.a. darüber hinaus<br />
auch <strong>als</strong> Identifikationsinstrument genutzt. So verwenden beispielsweise Jugendgruppen<br />
ganz bestimmte Ausdrücke, um sich von anderen abzugrenzen, insbesondere von der Erwachsenenwelt.<br />
Ebenfalls bieten heute Medien wie das Internet zahlreiche Ausdrucksmöglichkeiten<br />
für viel mehr Menschen <strong>als</strong> früher. Dadurch entsteht eine buntere Vielfalt, die Ausdruck<br />
einer demokratischen Gesellschaft ist. Das halte ich eher für einen Vor- <strong>als</strong> Nachteil.<br />
Herr C.: Da sehen Sie es, Herr B.: Die von Ihnen dargelegten Probleme existieren in Wirklichkeit<br />
gar nicht!<br />
Bürger B.: Das sehe ich anders. Zunächst muß festgehalten werden, daß bisher noch kein<br />
stichhaltiges Argument gegen meine vorhin formulierten Thesen vorgebracht worden ist.<br />
Aber nun will ich mich dem eben von Herrn L. Gesagten zuwenden. Zunächst gehe ich auf<br />
die Vielfalt ein: Quantität bedeutet nicht immer zugleich Qualität.<br />
Herr L.: Wollen Sie etwa eine Qualitätsprüfung für öffentliche Äußerungen einführen?<br />
Bürger B.: Nein, auf gar keinen Fall! Selbstverständlich dürfen auch die dümmsten Dinge<br />
öffentlich gesagt oder sonst wie dargeboten werden, soweit sie den gesetzlichen Rahmen nicht<br />
verletzen; ich denke z.B. an persönliche Beleidigungen oder Rufmord. Ich bin in der Hinsicht<br />
ein sehr liberal eingestellter Mensch. Nichtsdestotrotz sollten wir uns der Bewertung von<br />
Äußerungen nicht entziehen, oder sehen Sie das anders Herr L.?<br />
Herr L.: Nein, natürlich nicht.<br />
Bürger B.: Sehr schön. Wir können <strong>als</strong>o übereinstimmend festhalten, daß Vielfalt im oben<br />
skizzierten Rahmen selbstverständlich unabhängig von der Qualität der jeweiligen Darbietungen<br />
zwar erlaubt, aber nicht unbedingt vernünftig sein muß, nicht wahr?<br />
Herr L.: Von mir aus. Aber wer soll die Qualität denn bewerten? Soll etwa nur das gut sein,<br />
was Sie dafür halten?<br />
Bürger B.: Es kommt zunächst einmal nicht darauf an, wer etwas sagt, sondern was und wie<br />
er es begründet. Daher war Ihre letzte Äußerung unsachlich. Nur Argumente sollten in einem<br />
rationalen Diskurs <strong>als</strong> Qualitätsmaßstab gelten. Können wir uns darauf verständigen?<br />
Herr L. wirkt etwas verlegen, weil ihm bewußt wird, wie dumm und unangebracht sein letzter<br />
Einwand war. Er nickt kurz Bürger B. zu, der daraufhin fortfährt.<br />
Bürger B.: Gut. Ich begrüße <strong>als</strong> Demokrat selbstverständlich alle Möglichkeiten der freien<br />
Meinungsäußerung und trete hiermit nachdrücklich für deren Erhalt oder sogar Ausbau ein.<br />
Das enthebt uns alle aber nicht der Bewertung dessen, was geäußert wird. Wenn beispielsweise<br />
irgendwelcher astrologischer oder sonst welcher esoterischer Unsinn, der nachweislich<br />
einer wissenschaftlichen Nachprüfung nicht standhält, verbreitet wird, so muß man solches<br />
dann eben auch <strong>als</strong> das, was es ist, qualifizieren und darf es nicht einfach bei einer Beschreibung<br />
der Tatsache <strong>als</strong> solcher belassen. Noch deutlicher trifft dies auf politische Wirrköpfe<br />
zu, welche die Demokratie <strong>als</strong> solche infrage stellen. Man hat die Pflicht <strong>als</strong> vernünftiges<br />
Individuum, dem mit Argumenten entgegenzutreten. Denn wer sich nur auf die Position des<br />
neutral Beschreibenden zurückzieht, ignoriert sowohl seine Pflichten <strong>als</strong> Bürger eines Ge-
meinwesens <strong>als</strong> auch diejenigen eines vernunftbegabten Wesens. Sie sehen <strong>als</strong>o, Herr L., daß<br />
zwar die Möglichkeit von Meinungsvielfalt zu begrüßen ist. Damit ist aber noch nichts über<br />
die jeweilige Qualität einer Äußerung gesagt. Die schlichte Feststellung, daß das Internet<br />
vielen ein Forum ihrer Ideen und Ansichten bietet, bedeutet <strong>als</strong>o nicht, daß alles, was dort zu<br />
finden auch hilfreich und vernünftig ist, unbeschadet der prinzipiell zu begrüßenden Tatsache<br />
der Möglichkeit einer freien Meinungsäußerung. Oder sehen Sie das anders, Herr L.?<br />
Herr L.: Nein, dem will ich auch gar nicht widersprechen. Aber ich sprach vorhin davon, daß<br />
sich Sprache eben keineswegs auf bloße Informationsübermittlung reduzieren lasse, sondern<br />
darüber hinaus u.a. der Gruppenidentifikation diene.<br />
Bürger B.: Da stimme ich mit Ihnen überein. Ich wollte sowieso darauf eingehen. Wenn<br />
Sprache <strong>als</strong>o ebenfalls der Identifikation von Gruppen dient, dann gilt dies doch notwendig<br />
ebenso für Nationen. Denn Demokratie bedeutet ‚Volksherrschaft’. Es muß <strong>als</strong>o ein Volk sich<br />
<strong>als</strong> solches verstehen, um eine gedeihliche Gemeinschaft zu bilden. Neben der Informationsübermittlung,<br />
die selbstverständlich unbedingt notwendig für das Zustandekommen einer Verständigung<br />
ist, kommt der Sprache darüber hinaus eben auch genau diese gemeinschaftsbildende<br />
Funktion zu. Dabei spielen Geschichte und Kultur eine entscheidende Rolle.<br />
Nun mischt sich Herr C. wieder in die Diskussion ein, da er sich nur sehr ungern auf die Rolle<br />
eines bloßen Zuhörers beschränkt sieht. Herr L. ist hingegen im Moment durchaus erleichtert,<br />
daß Herr C. das Wort ergreift.<br />
Herr C.: Erklären Sie mir, was Sie mit damit genau meinen.<br />
Bürger B.: Gerne. Fühlen Sie sich <strong>als</strong> Deutscher?<br />
Herr C.: Sicher.<br />
Bürger B.: Warum?<br />
Herr C.: Ich bin hier geboren und aufgewachsen. Meine Familie und ich leben hier. Nicht<br />
zuletzt haben wir alle einen deutschen Paß und sind damit deutsche Staatsbürger.<br />
Bürger B.: Das bedeutet aber wohl auch, daß Sie von Kindes Beinen an sehr stark von der<br />
deutschen Kultur, ihren Sitten, Gebräuchen und Traditionen geprägt worden sind, wobei dies<br />
in deutscher Sprache geschehen ist. Oder etwa nicht?<br />
Herr C.: Natürlich.<br />
Bürger B.: Die jeweilige Kultur, in welcher man aufwächst, ist aber doch nicht gleichzeitig<br />
mit der Geburt des einzelnen ebenfalls erst auf die Welt gekommen, nicht wahr?<br />
Herr C.: Wie genau meinen Sie das?<br />
Bürger B.: Wir haben doch vorhin im Gespräch schon geklärt, daß das Hier und Jetzt nicht<br />
einfach so da ist, sondern eine Geschichte haben muß. Daher sind Sitten, Gebräuche, Traditionen<br />
sowie nicht zuletzt die Sprache Produkte einer langen Entwicklungsgeschichte, welche<br />
unser Denken und Fühlen während unseres Heranwachsens und später im Leben prägen. Ist es<br />
nicht so?
Herr C.: Ja schon.<br />
Bürger B.: Je genauer man diese Geschichte kennt, um so mehr ist man in der Lage, sie auch<br />
für sich selbst zu interpretieren , indem man sich viel bewußter darüber wird, woher man<br />
kommt und warum man so fühlt und denkt, wie man es eben tut. Durch den wohl reflektierten<br />
Umgang mit Geschichte lernt man <strong>als</strong>o nicht zuletzt sich selbst viel besser kennen. Durch das<br />
Wissen um seine eigenen Wurzeln, seine Herkunft erlangt man überhaupt erst einen kritisch<br />
reflektierten Standpunkt, von dem aus man dann einen vernünftig durchdachten Standpunkt<br />
einnehmen kann, ohne weder in Dogmatismus zu verfallen oder aber, im Gegenteil dazu, wie<br />
ein Blatt im Wind – den Moden des Augenblicks ausgeliefert – mal hierhin, mal dorthin geweht<br />
zu werden und sich in Beliebigkeit verliert. Ohne das Finden eines solchen Standpunktes<br />
laufen wir Gefahr, nur noch Getriebene zu sein, nicht fähig, wirklich selbstbestimmt leben zu<br />
können, bar jeglicher Erinnerung, verloren und selbstvergessen im Strom Lethe treibend. Dies<br />
wußte schon Goethe vor ungefähr zweihundert Jahren wie folgt auszudrücken:<br />
„Wer nicht von dreitausend Jahren<br />
Sich weiß Rechenschaft zu geben,<br />
Bleib im Dunkeln unerfahren,<br />
Mag von Tag zu Tage leben.“<br />
Dieses Leben nur von Tag zu Tag ziemt vielleicht dem Vieh auf der Weide, das unreflektiert sein<br />
Graß frißt und verdaut, aber dem Menschen ist es doch wohl kaum angemessen, nicht wahr?<br />
Herr C.: Das war mir jetzt irgendwie viel zu philosophisch. Und mit dem Vieh laß ich mich nun<br />
wirklich nicht auf eine Stufe stellen.<br />
Bürger B.: Ich wollte Sie auf keine Stufe mit dem Vieh stellen. Es stellt sich mir nur die Frage,<br />
inwieweit Sie das selber durch Ihr Verhalten tun.<br />
Herr C.: Also ich darf doch wohl sehr bitten. Nun werden Sie nicht unverschämt.<br />
Bürger B.: Mir liegt wirklich nichts daran, Sie zu beleidigen. Nur versuchen wir doch einmal gemeinsam<br />
herauszufinden, ob die von mir vorgebrachten Argumente stimmen oder nicht. Ich<br />
hoffe, Sie haben keine Angst vor einem solchen Gespräch?<br />
Herr C.: Ich und Angst vor einem Gespräch? Keineswegs!<br />
Bürger B.: Sehr schön. Was meinten Sie eben mit der Bemerkung, daß meine Ausführungen viel<br />
zu philosophisch seien?<br />
Herr C.: Na ja, irgendwie zu abgehoben.<br />
Bürger B.: Was immer Sie damit meinen mögen. Aber sind meine Äußerungen Ihrer Meinung<br />
nach an irgendeiner Stelle nicht zutreffend?<br />
Herr C.: Wenn Sie das so allgemein sehen, kann ich im Moment nichts dagegen ins Feld führen.<br />
Bürger B.: Also stimmt es nun, was ich gesagt habe oder nicht?<br />
Herr C.: Wenn Sie mich so fragen, kann ich dem von Ihnen Gesagten nicht widersprechen.
Bürger B.: Solange keine Argumente gegen eine wohl begründete These sprechen, sollten wir sie<br />
doch für brauchbar ansehen und auf ihr weiter aufbauen. Zumindest solange sie nicht widerlegt<br />
oder aber zum Beispiel durch Ergänzungen verbessert wird, nicht wahr?<br />
Herr C.: Von mir aus.<br />
Bürger B.: Gut. Für den Zusammenhalt einer Gesellschaft sind doch gemeinsame Werte ganz<br />
entscheidend?<br />
Herr C.: Welche meinen Sie genau?<br />
Bürger B.: Wenn ich das am Beispiel Deutschlands festmache, dann denke ich an Demokratie,<br />
Rechtsstaat, Solidarität mit unverschuldet in Not geratenen Menschen und Freiheit verbunden<br />
mit Selbstverantwortung für das eigene Handeln. Darauf gründet nach meinem Verständnis die<br />
Menschenwürde bzw. läßt sie erst real werden.<br />
Herr C.: Alles, was Sie sagen, stimmt wohl, aber das gilt doch nicht nur für Deutschland.<br />
Bürger B.: Nein, natürlich nicht. Dies sind historisch gesehen spezifisch europäische Werte,<br />
wobei einzelne dieser Werte selbstverständlich auch in anderen Kulturen anzutreffen sind. Und<br />
Deutschland ist ein Teil dieser europäischen Kultur. Obgleich <strong>als</strong>o unser europäisches Verständnis<br />
von Menschenwürde entscheidend durch antike Philosophie, Christentum und Aufklärung<br />
geprägt worden ist, so gibt es zwischen den nationalen Kulturen – trotz dieser gemeinsamen<br />
Grundlage – auch Unterschiede, die nicht zuletzt durch die verschiedenen Sprachen ihren Ausdruck<br />
finden.<br />
Herr C.: Schön und gut. Aber was sagt uns das jetzt?<br />
Bürger B.: Ich fragte Sie doch vorhin, ob Sie sich <strong>als</strong> Deutscher fühlten?<br />
Herr C.: So ist es.<br />
Bürger B.: Sie bejahten die Frage. Und im Verlauf des Gesprächs konnten wir zumindest ein wenig<br />
klären, was darunter zu verstehen ist, sich <strong>als</strong> Deutscher zu fühlen und zwar indem wir einen<br />
Blick zurück auf die Geschichte warfen, nicht wahr?<br />
Herr C.: Von mir aus.<br />
Bürger B.: Somit bedeutet der kulturelle Ort, an dem wir aufgewachsen sind, Heimat für uns.<br />
Wir leben nicht zuletzt auch von vielen Erinnerungen aus dieser Zeit, die uns ganz entscheidend<br />
geprägt und damit zu dem gemacht haben, was wir sind. Bei der Identitätssuche – <strong>als</strong>o bei der<br />
Suche nach unseren eigenen Wurzeln – sind wir auf diese historische Besinnung angewiesen, um<br />
uns überhaupt unserer selbst bewußt zu werden. Ohne unsere Geschichte sind wir nicht wir<br />
selbst.<br />
Herr C.: Gut. Das stimmt wohl. Aber ich kann doch meine Heimat wechseln und woanders eine<br />
neue finden?<br />
Bürger B.: Gewiß. Aber die alte bleibt immer ein Teil von Ihnen.<br />
Herr C.: Das ist nicht zu leugnen.
Bürger B.: Schauen wir uns nun nochm<strong>als</strong> die Frage nach den Werten, die eine Gesellschaft wie<br />
die unsrige zusammenhalten, näher an. Nehmen wir beispielsweise den Wert der Solidarität mit<br />
unverschuldet in Not geratenen Menschen: Wenn dieser Wert völlig wegbricht, kann dann eine<br />
Gesellschaft überhaupt noch weiter existieren?<br />
Herr C.: Wohl kaum.<br />
Bürger B.: Das sehe ich auch so. Jedenfalls kann ich mir das nur sehr schwer vorstellen. Und<br />
leben wollte ich in einer solchen auf keinen Fall.<br />
Herr C.: Ich ebenfalls nicht. Allein wenn man einmal an die dann wohl extrem hohe Kriminalität<br />
denkt. Sehr viele Menschen, die nicht genug zum Überleben hätten, würden andere berauben.<br />
Man wäre seines Eigentums nicht mehr sicher. Mord und Totschlag griffen wohl verstärkt um<br />
sich.<br />
Bürger B.: Dies wird wahrscheinlich eines der Resultate sein, das in einer derartigen ‚Gesellschaft’<br />
– wenn man von einer solchen dann überhaupt noch sprechen kann – zu beobachten<br />
wäre.<br />
Herr C.: Mit Sicherheit!<br />
Bürger B.: Wenn wir unsere Welt, wie sie zur Zeit ist, nun einmal genauer betrachten, dann<br />
können wir leicht feststellen, daß das Ausmaß der geleisteten Solidarität, bezogen auf staatliche<br />
Leistungen, aus unterschiedlichen Gründen sehr verschieden ist, nicht wahr?<br />
Herr C.: Sicher doch. Viele Länder sind wirtschaftlich überhaupt gar nicht in der Lage dazu, vor<br />
allem, wenn Sie sich mal Afrika anschauen.<br />
Bürger B.: So ist es wohl. Wir hier in Deutschland beispielsweise leben auf einem sehr hohen<br />
materiellen Niveau. Wir können und wollen uns – zumindest im Moment noch – ein hohes Maß<br />
an staatlich garantierter Solidarität leisten.<br />
Herr C.: Dafür zahle ich auch eine Menge Steuern!<br />
Bürger B.: Das ist gewiß sehr lobenswert. Denn ohne die vielen gutverdienenden Menschen in<br />
diesem Land wären schließlich unsere Sozi<strong>als</strong>ysteme nicht überlebensfähig.<br />
Herr C.: Ganz genau! So etwas höre ich viel zu selten!<br />
Bürger B.: Das mag schon sein. Fahren wir nun weiter fort und rufen uns noch einmal ins Gedächtnis,<br />
warum es diese Solidarität bei uns gibt: Zunächst sind wir – jedenfalls im Augeblick<br />
noch – wirtschaftlich dazu in der Lage. Desweiteren wollen wir jene gewährleisten, sowohl aus<br />
moralischem Empfinden heraus <strong>als</strong> auch um der Sicherheit willen, oder sehen Sie das anders?<br />
Herr C.: Nein. Genauso so wird es sein.<br />
Bürger B.: Warum leisten wir diese Solidarität denn vornehmlich nur gegenüber den deutschen<br />
Bürgern?<br />
Herr C.: Aber wieso sagen Sie denn so etwas? Wir sind doch bekanntermaßen Spendenweltmeister!
Bürger B.: Das mag schon stimmen. Aber dennoch leisten wir – wenn man sich die Zahlen vor<br />
Augen führt – die ganz überwiegende Solidarität mit unseren Mitbürgern. Verglichen damit ist<br />
die internationale Solidarität sehr gering, trotz Privatspenden, Entwicklungshilfe und dergleichen<br />
mehr.<br />
Herr C.: Gut, wenn Sie das so sehen, sicherlich. Aber wir können ja schließlich nicht die ganze<br />
Welt beglücken.<br />
Bürger B.: Wohl kaum. Aber führen wir den Gedanken noch ein wenig weiter fort. Wenn<br />
jemand nun die Frage stellte, warum die staatliche Solidarität anstatt vor allem national, nicht<br />
stattdessen weltweit organisiert werden sollte, so daß die Abgaben der Wohlhabenden auf dem<br />
gesamten Globus gleichmäßig an die Bedürftigen verteilt werden würden. Wie reagierten auf<br />
einen solchen Vorschlag wohl beispielsweise die Bürger in Deutschland?<br />
Herr C.: Na wie wohl, natürlich ablehnend. Wir können doch nicht alle auf diesem Globus<br />
durchfüttern!<br />
Bürger B.: Der andere könnte nun aber einwenden, daß dies ja auch keineswegs der Fall wäre, da<br />
die Wohlhabenden aller Länder zu dieser Solidarität herangezogen würden.<br />
Herr C.: Von mir aus. Aber dann müßten diese Wohlhabenden so viel zahlen, daß sie selber<br />
kaum noch etwas für sich übrig behalten könnten.<br />
Bürger B.: Dem könnte jener mit dem Argument entgegentreten, daß man sich darauf verständigte,<br />
die Wohlhabenden nicht mehr <strong>als</strong> bisher zu belasten und die Summe, die dabei zustande<br />
käme, eben weltweit zu verteilen.<br />
Herr C.: Gut. Wenn ich nicht mehr zahlen müßte. Von mir aus.<br />
Bürger B.: Glauben Sie denn, daß es dafür in Deutschland eine Mehrheit gäbe?<br />
Herr C.: Natürlich nicht! Dadurch würden ja die Empfänger staatlicher Leistungen viel weniger<br />
<strong>als</strong> zurzeit erhalten, weil die Bedürftigkeit in den meisten Ländern höher oder sogar wesentlich<br />
höher <strong>als</strong> in Deutschland ist.<br />
Bürger B.: Das ist in der Tat so. Nun frage ich aber nochm<strong>als</strong> Sie selbst, ob Sie wirklich <strong>als</strong><br />
Wohlhabender der weltweiten Verteilung zustimmen würden, auch wenn sie nicht mehr zahlen<br />
müßten? Erinnern Sie sich denn nicht mehr an das von Ihnen kurz zuvor Gesagte?<br />
Herr C.: Was meinen Sie?<br />
Bürger B.: Sie vertraten eben doch die Auffassung, daß bei keiner oder zumindest deutlich<br />
verminderter Solidarität eine Gesellschaft Gefahr läuft, ihren Zusammenhalt zu verlieren und<br />
dadurch nicht zuletzt die Kriminalität stiege, wovon dann eben auch die Wohlhabenden sehr<br />
negativ betroffen werden würden, nicht wahr?<br />
Herr C.: Ich erinnere mich.<br />
Bürger B.: Also würden Sie letztlich einem solchen Vorschlag der weltweit organisierten Solidarität<br />
wohl Ihre Zustimmung verweigern, oder sehe ich das f<strong>als</strong>ch?
Herr C.: Wenn ich so darüber nachdenke, haben Sie wohl recht. Man fühlt sich ja auch seinen<br />
Landsleuten schon irgendwie näher <strong>als</strong> anderen.<br />
Bürger B.: Genau so denken wahrscheinlich fast alle Menschen auf dieser Erde. Woher kommt<br />
wohl diese Geisteshaltung?<br />
Herr C.: Ja, so genau weiß ich das nicht. Was meinen Sie denn?<br />
Bürger B.: Wir kommen nun wieder auf den Anfang unseres Gespräches zurück.<br />
Herr C.: Wieso?<br />
Bürger B.: Ich meine die gemeinsame Geschichte, welche die Bevölkerung eines Nation<strong>als</strong>taates<br />
miteinander teilt. Zumindest wenn dieser Staat eine solche hat und beispielsweise nicht ein willkürliches<br />
Kunstprodukt ist, wie wir dies beispielsweise heute in Afrika feststellen müssen, wo<br />
die Ländergrenzen von den ehemaligen Kolonialmächten ohne Rücksicht auf die ansässige Bevölkerung<br />
gezogen worden sind. Hierin liegt eine wichtige Ursache vieler Spannungen und Konflikte,<br />
eben weil man der Geschichte keine Beachtung geschenkt hat.<br />
Herr C.: Das mag so sein. Aber was hat das alles mit uns und vor allem mit dem Ihrer Meinung<br />
nach zu häufigen Gebrauch des Englischen in Deutschland zu tun?<br />
Bürger B.: Ist Ihnen das denn wirklich noch nicht klar geworden?<br />
Herr C.: Nein! Nun sagen Sie schon, wie Sie das meinen!<br />
Bürger B.: Es ist doch aus dem bisher Gesagten deutlich geworden, wie wichtig der Zusammenhalt<br />
unter den Mitgliedern einer Gesellschaft ist, nicht wahr?<br />
Herr C.: Sicher.<br />
Bürger B.: Ein derartiges Zusammengehörigkeitsgefühl ist ganz entscheidend für die Motivation,<br />
Solidarität zu üben. Denn Sie sagten eben selber, daß Ihnen die eigenen Landsleute gefühlsmäßig<br />
näher stünden <strong>als</strong> andere.<br />
Herr C.: Ja.<br />
Bürger B.: Und dieses Zusammengehörigkeitsgefühl findet seine entscheidende Grundlage in der<br />
gemeinsamen Geschichte, in welcher Werte, Traditionen und Gebräuche sich entwickelt haben,<br />
um dann weitergegeben zu werden. Oder etwa nicht?<br />
Herr C.: So wird es wohl sein.<br />
Bürger B.: Ganz entscheidend geprägt wird die Kultur durch die Sprache: Durch sie entsteht sie<br />
erst ganz wesentlich und wird weitergegeben. Poetisch kann man es auch wie folgt ausdrücken:<br />
Die Sprache ist die Seele eines Volkes.<br />
Herr C.: Nun ja, dem kann ich nicht widersprechen. Jetzt wird mir klar, worauf Sie hinaus<br />
wollen: Die Sprache <strong>als</strong> entscheidender Kulturträger, die Grundlage jeder stabilen Gesellschaft.
Bürger B.: Ganz genau. Mich freut, daß Sie nun anscheinend verstanden haben, worauf ich die<br />
ganze Zeit hinaus wollte.<br />
Herr C.: Gut und schön. Aber dann erklären Sie mir doch, warum gerade die jungen Menschen<br />
das Englische so sehr bevorzugen? Das kann doch nicht alles an den ‚bösen’ Werbemenschen<br />
oder den Managern liegen.<br />
Bürger B.: Alles wohl nicht. Aber einiges doch wohl. Sie kennen sicher das Sprichwort: „Der<br />
Fisch stinkt vom Kopf her.“ Damit will ich sagen, daß den Eliten eines Landes, seien sie in der<br />
Wirtschaft, der Wissenschaft, den Medien oder der Politik, eine entscheidende Rolle zukommt,<br />
weil sie neben ihrer konkreten gestalterischen Macht in ihrem engeren Umfeld auch eine Vorbildfunktion<br />
innehaben. Sie können sich da nicht aus der Verantwortung stehlen. Sie sollten sich<br />
zunächst einmal die hier besprochenen Zusammenhänge vor Augen führen, um dann ihr Verhalten<br />
entsprechend zu ändern, oder sehen Sie das anders?<br />
Herr C.: Meinetwegen. Aber das ist doch nicht allein der Grund für das Vordringen des Englischen<br />
in unseren Alltag.<br />
Bürger B.: Darin stimme ich mit Ihnen durchaus überein. Mir war es dennoch wichtig, die Verantwortung<br />
der Eliten nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. Nun wenden wir uns <strong>als</strong>o den<br />
vielen jungen Menschen zu, die derart sorglos mit ihrer Muttersprache umgehen. Neben der<br />
Rolle der Vorbilder ist ein wichtiger Grund wohl die Gedankenlosigkeit der meisten, die einfach<br />
nur nachplappern, was sie im Alltag hören oder lesen.<br />
Herr C.: Das mag wohl so sein. Trotzdem tragen sie für ihr Verhalten doch auch ein gewisses<br />
Maß an Eigenverantwortung, oder sehen Sie das anders?<br />
Bürger B.: Nein, das sehe ich ganz genauso. Denn unreflektiertes Nachplappern und das naive<br />
Nachäffen aktueller Moden, ohne sich eigene Gedanken über sein Tun zu machen, kann man<br />
nicht einfach ausschließlich auf f<strong>als</strong>che Vorbilder abschieben. Das Verhalten so vieler Menschen<br />
hinsichtlich des Gebrauches der eigenen Sprache in Deutschland werte ich durchaus drastisch <strong>als</strong><br />
Verrat an der eigenen Kultur und damit letztlich an sich selbst, weil man ja ebenfalls seine<br />
eigenen Wurzeln ein Stück weit verleugnet. Wenn man derart geringschätzig mit der eigenen<br />
Sprache und Geschichte umgeht, darf man sich nicht wundern, wenn andere einem selbst und<br />
seiner Kultur wenig abgewinnen können, ja sie vielleicht sogar verachten. Wie soll eine Gesellschaft,<br />
die in zunehmendem Maße immerfort die eigenen Grundlagen mißachtet und sich einer<br />
solch gravierenden Selbstvergessenheit hingibt, weiter existieren? Sie wird durch gedankenlose<br />
Selbstzerstörung untergehen.<br />
Herr C.: Das sind aber starke Worte. Meinen Sie nicht, daß Sie da übertreiben?<br />
Bürger B.: Das mag vielleicht sein. Ich hoffe zumindest auf ein schrittweises Umdenken und<br />
zwar bei allen. Ansonsten habe ich allerdings wenig Hoffnung für unsere deutsche Kultur. Und<br />
dies wird unweigerlich den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft stark beeinträchtigen und<br />
schließlich womöglich ganz zerstören. Wollen Sie nach unserem Gespräch nicht auch selbst<br />
Konsequenzen ziehen, zum Beispiel in dem Unternehmen, dem Sie vorstehen?<br />
Herr C.: Wie stellen Sie sich das vor? Nur aufgrund irgendwelcher philosophisch abgehobener<br />
Gedanken kann ich doch nicht alles umkrempeln!
Bürger B.: Aber wir haben doch vorhin festgestellt, daß die bisher entwickelten Thesen in sich<br />
schlüssig sind und daher solange unser Handeln vernünftigerweise bestimmen sollten, bis sie<br />
entweder widerlegt oder durch bessere ersetzt werden, oder sehen Sie das anders?<br />
Herr C.: Ach wissen Sie, ich habe im Moment zwar keine Gegenargumente gegen Ihre Ausführungen,<br />
aber trotzdem werde ich nichts ändern! Solche Gedankenspiele mögen manchmal<br />
ganz unterhaltend sein. Deshalb muß man ja nicht gleich alles anders machen.<br />
Bürger B.: Wie Sie sich denken können, stimme ich damit überhaupt nicht überein. Ich will aber<br />
nicht missionieren. Wenn Sie sich Argumenten verschließen wollen, ist das Ihre Sache. Schade,<br />
daß wir hier wohl nicht weiterkommen. Und wie stehen Sie zu dem Gesagten, Herr L.? Sie<br />
haben sich die ganze Zeit völlig zurückgehalten.<br />
Herr L.: Ich habe interessiert zugehört. Mich, <strong>als</strong> Linguist, interessiert mehr, wie Sprachen<br />
beschaffen sind und wie sie sich entwickeln. Wertungen sind eher nicht meine Sache. Etwas<br />
möchte ich gegen Ihre Ausführungen aber dennoch anbringen: Kultur und Sprache sind nichts<br />
für immer fest Gefügtes, sondern ständig Veränderungen unterworfen, so daß mir Ihre Sicht der<br />
Dinge <strong>als</strong> zu statisch vorkommt. Kultur und Sprache befinden sich im Fluß und sollten nicht –<br />
wie Sie es an einer Stelle ausdrückten – etwas Geronnenes sein.<br />
Bürger B.: Natürlich unterliegen Sprache wie Kultur einem ständigen Veränderungsprozeß. Die<br />
Frage ist nur, in welche Richtung und in welchem Ausmaß sie sich verändern. Wenn ich von<br />
Sprache <strong>als</strong> geronnener Kultur spreche, so meine ich im Grunde das Gleiche wie der vorhin von<br />
mir zitierte Goethe, welcher die Sprache <strong>als</strong> Seele eines Volkes bezeichnete. Obwohl sich<br />
Sprache und Kultur ständig wandeln und gegenseitig beeinflussen, so haben wir es in der<br />
jeweiligen Gegenwart immer mit etwas Vorhandenem zu tun, welches wir zunächst <strong>als</strong> Gegebenes<br />
betrachten müssen. Denn auch etwas sich Wandelndes existiert für unsere Vernunft erst<br />
einmal. Denn wir können <strong>als</strong> Menschen nicht etwas begreifen, das nicht ist. Andererseits<br />
wandelt sich die Welt andauernd. Beides zusammen sind wir nicht in der Lage völlig miteinander<br />
zu vereinbaren. Wir befinden uns immer in einem Spannungsverhältnis zwischen<br />
eleatischem Sein und heraklitischem Werden.<br />
Herr L.: Das war mir jetzt viel zu philosophisch.<br />
Herr C.: Mir geht es genauso.<br />
Bürger B.: Nun gut. Dann versuche ich es für Sie verständlicher zu erklären. Die eleatische wie<br />
die heraklitische Philosophie stammen beide aus der vorsokratischen Epoche im alten Griechenland.<br />
Erstere konstatierte, daß es in Wahrheit nur ein unveränderliches Sein gebe und alle Bewegung<br />
nur Täuschung sei, wohingegen Heraklit davon ausging, daß sich alles Sein im ständigen<br />
Wandel befinde und es nichts Beständiges außer eben diesen Wandel gebe, welcher aber<br />
gesetzmäßig ablaufe.<br />
Herr L.: Da scheint mir Heraklit aber eher die Wahrheit getroffen zu haben.<br />
Herr C.: Ja, genau!<br />
Bürger B.: Nun ja, ich denke beide Positionen haben etwas für sich, auch wenn sie sich diametral<br />
entgegenzustehen scheinen. Denn, wie eben schon ausgeführt, müssen wir <strong>als</strong> Menschen neben<br />
dem Wandel auch ein Sein mitdenken. Schauen wir uns einmal die Begriffe Vergangenheit,<br />
Gegenwart und Zukunft an: Erstere umfaßt alles, was vor dem Jetzt einmal war, letztere alles,
was sein wird. Die Gegenwart schrumpft dann aber zu einer unendlich kleinen Größe zusammen,<br />
d.h. beispielsweise daß wir waren und womöglich sein werden, aber niem<strong>als</strong> sind! Dennoch<br />
gehen wir selbstverständlich davon aus, daß wir existieren. Nur unser logischer Verstand<br />
verfängt sich hier in Widersprüche, aus denen er nicht herausfindet. Was ich damit zeigen wollte,<br />
ist das oben beschriebene Dilemma für unsere Vernunft. So viel zum grundsätzlich Philosophischen,<br />
das ich hier natürlich nur sehr grob andeuten konnte. Nun noch einmal zurück zu<br />
unserem Thema: Obwohl Sprache einer ständigen Veränderung unterworfen ist, so ist sie für uns<br />
immer auch etwas gerade Seiendes mit ganz spezifischen Eigenschaften. Dies muß auch so sein,<br />
da wir uns ansonsten überhaupt gar nicht verständigen könnten. Wenn z.B. ein Tisch im nächsten<br />
Moment etwas völlig anderes bedeutete <strong>als</strong> bisher, wäre jegliche Verständigung unmöglich. Das<br />
gleiche gilt für die identitätsstiftende Bedeutung der Sprache, wie Sie es vorhin einmal ausführten,<br />
Herr L.: Sie kann nur diese Funktion innehaben, wenn sie zumindest für eine gewisse<br />
Zeit für die Gruppe, für die sie eben jene Funktion neben der bloßen Verständigung hat, etwas<br />
Beständiges besitzt. Ansonsten bestünde die Möglichkeit einer derartigen Funktion der Sprache<br />
gar nicht, oder sehen Sie das anders?<br />
Herr L.: Nun gut, das mag so sein. Aber sind Sie denn, um noch einmal ganz konkret zu werden,<br />
grundsätzlich gegen die Verwendung von Anglizismen im Deutschen?<br />
Bürger B.: Nein, natürlich nicht! Es geht mir nur darum, ob in einem bestimmten Fall ein Wort<br />
aus einer anderen Sprache eine wirkliche Bereicherung darstellt oder nicht. Wenn ersteres der<br />
Fall ist, heiße ich es natürlich gut. Aber wir haben im Laufe unserer Diskussion einige Beispiele<br />
kennengelernt, bei denen dies nicht der Fall war, sondern ganz im Gegenteil, die englischen<br />
Bezeichnungen viel ungenauer waren. Ein weitere Aspekt kommt hinzu: Das Maß der Übernahme<br />
von Worten aus dem Englischen. Wenn unsere deutsche Sprache in kurzer Zeit mit zu<br />
vielen Worten aus dem Englischen geradezu überflutet wird, dann verlieren wir ein Stück weit<br />
unser Identitätsgefühl, denn die Fülle solcher Begriffe kann nicht mehr wirklich integriert<br />
werden. Sie bilden dann zu viele Fremdkörper die eine Sprache dann sogar zersetzen können.<br />
Wie bei allem gilt es, das richtige Maß anzustreben und Übertreibungen zu vermeiden. Denn<br />
ansonsten geht jene identitätsstiftende Wirkung der Sprache verloren. Wir verkaufen dann – um<br />
noch einmal Goethe aufzugreifen – unsere Seele. Und daß es hinreichend Beispiele für derartige<br />
Übertreibungen und Fehlentwicklungen in Deutschland gibt, habe ich in unserer Diskussion<br />
hinreichend deutlich machen können einschließlich einiger ganz konkreter Probleme die sich<br />
bereits daraus ergeben haben sowie welcher, die sich anbahnen. Und, soweit ich mich erinnere,<br />
konnten Sie dies bisher nicht argumentativ entkräften.<br />
Herr L.: Nun ja, wie auch immer. Ich beschränke mich doch lieber auf die wissenschaftliche<br />
Beobachtung der Vorgänge um die Sprache und halte mich mit Wertungen zurück.<br />
Herr C.: Ich bin für die unternehmerische Praxis zuständig und kümmere mich nicht um<br />
irgendwelche philosophische Spekulationen.<br />
Bürger B.: Das ist Ihre Entscheidung. Aber Sie vergessen dabei Ihre Verpflichtungen gegenüber<br />
unserem Gemeinwesen hinsichtlich der kulturellen Grundlagen. Denn die Wirtschaft lebt von<br />
Voraussetzungen, die sie selber nicht alleine schaffen kann. Und Ihnen <strong>als</strong> Linguist muß ich vorhalten,<br />
daß Sie sich ganz besonders aus der Verantwortung stehlen und versuchen, dies pseudowissenschaftlich<br />
zu bemänteln. Sicher muß man zunächst einmal möglichst objektiv einen Sachverhalt<br />
beobachten. Aber danach kann und muß man werten, auch in wissenschaftlicher Hinsicht,<br />
aber noch viel mehr <strong>als</strong> Mensch und Bürger einer Gesellschaft, für die man schließlich<br />
Verantwortung trägt. Und gerade Sie <strong>als</strong> Wissenschaftler werden von dieser Gemeinschaft über
Steuern bezahlt. Sie müssen sich dann schon in mehrfacher Hinsicht fragen lassen, was Sie<br />
zurückgeben.<br />
Herr L. und Herr C. sind zunächst sprachlos ob der harschen Vorwürfe von Herrn B., weil Ihnen<br />
spontan keine vernünftige Erwiderung einfällt. Zugleich wächst Ihr Zorn auf Bürger B., obwohl<br />
er Ihnen nur den Spiegel vorgehalten hat. Aber wie so oft wird der Überbringer schlechter Nachrichten<br />
mit dem Verursacher derselben gleichgesetzt. Als Herr C. dann doch seinem Unmut<br />
freien Lauf lassen will, versucht Herr L. seinen eigenen zu unterdrücken, um sich nach außen hin<br />
keine Blöße zu geben. Plötzlich fällt ihm aber ein Detail aus der Gesprächsführung von Bürger<br />
B. ein, mit dem er hofft, ihn vorführen zu können; <strong>als</strong> Genugtuung gewissermaßen:<br />
Herr L.: Herr B., Sie sprachen sich so entschieden gegen den Gebrauch von Anglizismen aus,<br />
nicht wahr?<br />
Bürger B.: Gegen den unangebrachten wie übertriebenen Gebrauch, um genau zu sein.<br />
Herr L.: Gewiß. Aber doch wohl auch gegen den überflüssigen, oder irre ich mich?<br />
Bürger B.: Nein, Sie irren sich nicht. Aber worauf wollen Sie hinaus?<br />
Herr L.: Mir ist aufgefallen, daß Sie einige Male folgende Formulierung verwendeten: ‚Ich<br />
denke, daß …’. Ich weiß nicht, ob Sie es wissen, aber auch dies ist gewissermaßen eigentlich ein<br />
überflüssiger Anglizismus, da wir im Deutschen besser sagen: ‚Ich meine, daß …’ oder ‚Ich<br />
glaube, daß …’. So weit ich weiß, resultiert diese Formulierung aus schlechten Übersetzungen<br />
aus dem Englischen ins Deutsche, welche sich mittlerweile bei uns eingebürgert hat. Ich will<br />
damit zum Ausdruck bringen, daß Sie selber Ihrem Anspruch dann doch wohl nicht ganz gerecht<br />
geworden sind, nicht wahr?<br />
Herr C. kann sich nun nicht mehr zurückhalten:<br />
Herr C.: Ha! Da sehen Sie es! Klug daherschwätzen, aber dann selber den hehren Ansprüchen<br />
nicht gerecht werden!<br />
Bürger B.: Wenn ich darüber nachdenke, haben Sie, Herr L., mit Ihrem Einwand wohl recht.<br />
Herr C.: Zumindest geben Sie es zu. Also können wir Ihr ganzes Gerede wohl damit <strong>als</strong> erledigt<br />
betrachten.<br />
Bürger B.: Nein, das nun wiederum nicht. Ganz im Gegenteil sogar. Dieses Beispiel stützt eher<br />
meine vorhergehende Argumentation.<br />
Herr C.: Unsinn! Sie sind nur ein schlechter Verlierer. Aus der Nummer kommen Sie mir nicht<br />
mehr heraus.<br />
Bürger B.: Warten wir es doch erst einmal ab. Es stimmt wohl, daß diese Formulierung aus eher<br />
mäßigen bis schlechten Übersetzung aus dem Englischen ins Deutsche stammt und sich hier<br />
stark eingebürgert hat, ohne daß es die meisten von uns gemerkt hätten, mich selbst eingeschlossen.<br />
Obwohl ich mich immer wieder gegen die unüberlegte, überflüssige oder gar schädliche<br />
Übernahme von Anglizismen wende und dies auch stichhaltig begründet habe, so können<br />
mir natürlich trotzdem manchmal auch selber solche Fehler passieren. Das ändert dann aber<br />
nichts an der Schlüssigkeit meiner Argumentation. Ich versuche selbstverständlich den von mir
aufgestellten Idealen gerecht zu werden, aber kein Mensch ist schließlich fehlerfrei. Wenn man<br />
Fehler begeht und dies merkt, so muß man sie nur unumwunden sich selbst und anderen gegenüber<br />
der Redlichkeit halber eingestehen. Und damit habe ich, wie Sie feststellen konnten, kein<br />
Problem. Ich gebe zu, daß ich mir bei der besagten Formulierung über deren Herkunft vorher<br />
keine hinreichenden Gedanken gemacht habe. Darüber hinaus wandte ich mich in unserem Gespräch<br />
ja auch keineswegs gegen jegliche Übernahme aus dem Englischen, ganz im Gegenteil.<br />
Ob die Formulierung ‚Ich denke, daß’ anstellen von ‚Ich meine, daß?’ eine Bereicherung darstellt,<br />
kann durchaus bezweifelt werden. Gerade an diesem Beispiel können Sie aber auch erkennen,<br />
daß ich mit meinen bisherigen Ausführungen in unserem Gespräch recht hatte. Denn es<br />
zeigt sich, wie selbst Menschen wie mir, die nun wirklich nicht für die unbegrenzte Flut überflüssiger<br />
Anglizismen Partei ergreifen oder auch nur dem Ganzen passiv, achselzuckend gegenüberstehen,<br />
Derartiges passieren kann. Meine Befürchtungen hinsichtlich des Zustandes und insbesondere<br />
der Zukunft unserer schönen Muttersprache werden durch meinen Lapsus geradezu<br />
bestätigt, wie Sie unschwer erkennen können.<br />
Herr C. und Herr L. merken, daß Sie sich mit ihren vorschnellen Triumphgefühlen offensichtlich<br />
vollkommen getäuscht haben. Vor allem ärgert beide, wie bereitwillig Bürger B. eigene Fehler<br />
eingesteht. Dies entspricht so gar nicht ihrem Wesen, aber sie verdrängen es, vor allem sich<br />
selbst gegenüber. So kann aus Neid gegenüber einem aufrichtigen Menschen schnell Abneigung<br />
oder gar Haß werden. Dies wollen sie sich aber natürlich ebenfalls nicht eingestehen und schon<br />
gar nicht nach außen hin zeigen. Daher versucht Herr L. das Gespräch ohne allzu großen Gesichtsverlust<br />
zu beenden:<br />
Herr L.: Wissen Sie, Herr B., ich bin der Meinung, daß wir unser Gespräch jetzt besser nicht<br />
weiter fortführen sollten. Herr C. und ich sehen die Dinge nun mal anders <strong>als</strong> Sie, und wir stehen<br />
damit offenkundig nicht allein in diesem Lande.<br />
Herr C.: Genau, so ist es! Sie sprechen mir aus der Seele, Herr L.!<br />
In diesem Augenblick tritt Ärztin K. ins Wartezimmer und wendet sich zunächst Herrn L. zu.<br />
Ärztin K.: Herr L., ich habe Ihre Kräutermischung fertig gemacht. Sie müssen täglich zwei Aufgüsse<br />
davon trinken. Sie sollten sich zudem nicht so einseitig ernähren, damit schaden Sie sich<br />
auf Dauer zu sehr, und dann helfen auch meine Kräuter nicht mehr viel.<br />
Herr L.: Vielen Dank für die Kräuter und Ihren Ratschlag. Ich werde mich bemühen, dies zu<br />
beherzigen.<br />
Herr L. verabschiedet sich und verläßt die Praxis. Daraufhin bittet Ärztin K. Herrn C., sich ins<br />
Behandlungszimmer 2 zu begeben, da sie mit ihm noch etwas ausführlicher über seinen Gesundheitszustand<br />
sprechen möchte. Herr C. geht wortlos an Bürger B. vorbei in das ihm zugewiesene<br />
Zimmer. Daraufhin wendet sie sich an Bürger B.<br />
Ärztin K.: Ich glaube, es ist besser, wenn wir uns heute Abend bei einem Tee in Ruhe unterhalten.<br />
Bürger B.: Selbstverständlich. Ich komme gerne in drei Stunden nochm<strong>als</strong> wieder, wenn Sie<br />
mehr Zeit haben. Wäre es Ihnen recht so?<br />
Ärztin K.: Es freut mich, daß Sie so verständnisvoll sind.<br />
Bürger B. verabschiedet sich und verläßt daraufhin die Praxis.
2.3.<br />
Artikel aus den ‚Sprachnachrichten’ des ‚Verein Deutsche Sprache e.V. (VDS)’:<br />
2.3.1. „Liebe Sprachfreunde“, von Walter Krämer, Bundesvorsitzender des VDS; Ausgaben<br />
Juni 2008, Nummer 38, Seite 2:<br />
Liebe Sprachfreunde,<br />
es wird Sommer und damit Zeit für die Wahl des Sprachpanschers des Jahres. Damit zeichnen<br />
wir unter großer Teilnahme der Medien seit zehn Jahren Personen aus, die in besonders augenfälliger<br />
Weise die deutsche Sprache mit Füßen treten. Auch in diesem Sommer haben wir<br />
wieder fünf würdige Kandidaten ausgesucht. Einer ist etwa Ann Kathrin Linsenhoff, die<br />
Vorsitzende der Deutschen Sporthilfe, die gerade in Berlin eine Hall of Fame für verdiente<br />
deutsche Sportler eingerichtet hat. Ein passender Sieger wäre auch Klaus Wowereit, der Regierende<br />
Bürgermeister dieser Stadt. Mit seinem Werbespruch Be Berlin hat er der ganzen<br />
Welt erneut gezeigt, was die Londoner Times schon vor 40 Jahren wußte: dass die Deutschen<br />
in ihrer typischen linguistic submissiveness (sprachliche Unterwürfigkeit) nicht in der Lage<br />
seien, eigene Werte und Traditionen in ihrer eigenen Sprache zu vermitteln. Wäre ein Spruch<br />
Be Barcelona denkbar? Oder Be Beijing? Natürlich nicht. In China oder Spanien würde man<br />
niem<strong>als</strong> so wie in Berlin Weltoffenheit mit Unterwürfigkeit verwechseln; da hat man noch<br />
Respekt vor der eigenen Heimat und Kultur. Auch die anderen Kandidaten hätten den Titel<br />
verdient. Bitte kreuzen Sie auf dem beiliegenden Stimmzettel Ihren Favoriten an, und<br />
schicken oder faxen Sie uns das Blatt bis zum 29. August zurück. Ein weiteres großes Ereignis<br />
des Jahres 2008 ist die Verleihung unseres Kulturpreises Deutsche Sprache – wie immer<br />
in der schönen Residenzstadt Kassel. Bitte merken Sie sich den 1. November schon einmal<br />
vor. Und dann will dieses Heft der Sprachnachrichten Ihren Blick auf einen Umstand lenken,<br />
der über den nur allzu berechtigten Klagen über die modische Verhunzung unserer schönen<br />
deutschen Sprache oft vergessen wird: dass die Sprache nicht nur ein Mittel der Verständigung<br />
und ein Kulturgut, sondern auch ein Produktionsfaktor ist, um mal einen Fachausdruck<br />
aus den Wirtschaftswissenschaften zu gebrauchen. Wie wir unsere Gedanken in Worte<br />
fassen, wie wir über Sprache mit unserer Umwelt in Verbindung treten, ist mehr <strong>als</strong> nur ein<br />
Pausenthema für Deutschlehrer; es geht viel mehr, <strong>als</strong> die meisten glauben, auch die Wissenschaft<br />
und die Wirtschaft an. Wenn deutsche Muttersprachler sich überreden lassen, in einer<br />
fremden Sprache zu verhandeln oder Wissenschaft zu treiben, bleiben sie wie ein rechtsfüßiger<br />
Mittelstürmer, den man zwingt, mit links zu schießen, allein schon deshalb oft nur<br />
zweiter Sieger. Nicht jeder beherrscht eine fremde Sprache so wie Marica Bodrožič. Auch in<br />
weiteren Ausgaben dieser Zeitung werden wir diesen oft vernachlässigten Aspekt der<br />
deutschen Sprachverleugnung zur Sprache bringen. Vorerst wünsche ich Ihnen viel Erbauung<br />
beim Lesen der aktuellen Ausgabe und eine sonnige und erholsame Sommerzeit.<br />
Ihr<br />
Walter Krämer
2.3.2. „Die Störanfälligkeit wächst“, von Hartmut Heuermann, Ausgabe Juni 2008, Nummer<br />
38, Seite 5:<br />
Die Störanfälligkeit wächst. Warum deutsche Wissenschaftler (meistens) schlechtes<br />
Englisch sprechen<br />
Der Sachverhalt ist klar, die Argumente sind bekannt: Englisch steht unangefochten an der<br />
Spitze der Weltsprachen. Englisch genießt das höchste Prestige unter seinen Konkurrenten.<br />
Englisch zu lernen gilt <strong>als</strong> weltbürgerliche Pf licht. Englisch ist das erkorene Medium für<br />
grenzüberschreitende Kommunikation. Der Sprachwissenschaftler Claus Gnutzmann stellt<br />
fest: „Nie zuvor hat es in der Geschichte der Menschheit eine Sprache gegeben, die wie das<br />
Englische über eine solche Verbreitung verfügt, von so vielen Menschen gesprochen und in<br />
so vielfältigen Verwendungen gebraucht wird. Es gibt heute kein Land auf der Erde, in dem<br />
nicht mit Hilfe des Englischen kommuniziert wird, und es ist wohl kaum eine Situation<br />
denkbar, in der das Englische nicht auch <strong>als</strong> internationale Sprache gebraucht wird.“<br />
Da in der heutigen Welt allenthalben der Internationalismus herrscht und die Wissenschaft<br />
einer seiner Motoren ist, folgt, dass Wissenschaftler, wollen sie auf internationalem Parkett<br />
bestehen, auf Englisch publizieren. Es folgt weiter, dass sie bei Kongressen Englisch parlieren<br />
und – wenn sie schon mal dabei sind – auch ihre Vorlesungen zuhause auf Englisch halten.<br />
All dies mit dem stillschweigenden Anspruch, dass sie das Medium in Wort und Schrift<br />
beherrschen. Denn: Englisch hat man zu können. „Punctum!“<br />
Einem deutschen Wissenschaftler die Gewissensfrage zu stellen, ob er es wirklich kann, oder<br />
ihm gar die Kompetenz dafür abzusprechen, käme einer Majestätsbeleidigung gleich (obwohl<br />
es keinerlei empirische Belege zur Stützung des verbreiteten Anspruchs gibt). Nur wenige<br />
sind mit englischer Sprachkompetenz gesegnet Bei Lichte besehen, psycholinguistisch betrachtet,<br />
basiert der Anspruch auf einer Unterstellung, die nicht realistisch ist. Es wird mit<br />
ungedeckten Schecks gehandelt. Gibt es in Deutschland zweifellos auch Wissenschaftler, die<br />
das Medium in Wort und Schrift beherrschen, da sie bilingual aufgewachsen sind oder Jahre<br />
im englischsprachigen Ausland tätig waren oder exzeptionell talentiert sind, so gilt dies für<br />
die Mehrheit nicht. Diese arbeitet eher mit der fehlerhaften Gleichung Schulenglisch +<br />
Fachvokabular = Wissenschaftsenglisch.<br />
Weder sind sie mit englischer Sprachkompetenz <strong>als</strong> Gottesgabe gesegnet, noch sind sie in die<br />
fremde Sprache wirklich eingetaucht. Es sind eher gemeine Sterbliche, für die das Erlernen<br />
einer zweiten (und jeder weiteren) Sprache einen langwierigen, diffizilen, störanfälligen Prozess<br />
darstellt – ein Prozess, den sie nicht allein deshalb elegant meistern, weil sie Wissenschaftler<br />
sind. Für Linguisten, die sich mit Spracherwerbsproblemen befassen, liegen die<br />
Gründe klar zutage. Es sind im Wesentlichen drei:<br />
1. Der größte Stolperstein auf dem Weg zu fremdsprachlicher Kompetenz ist die Interferenz.<br />
Sie bezeichnet das Phänomen, wonach ein mit der Muttersprache etabliertes, in den beiden<br />
Sprachenzentren des Gehirns verankertes Sprachsystem die Tendenz hat, sich gegen ein<br />
neues, „fremdes“ System zu wehren. Die Subsysteme der Muttersprache (das phonologische,<br />
das semantische und morpho-syntaktische) streben infolge einer spezifischen neuronalen<br />
Vernetzung danach, sich gegen den „Eindringling“ zu behaupten. Man könnte diesbezüglich<br />
fast von psycholinguistischer Fremdenfeindlichkeit sprechen. Jedenfalls ist das Resultat ein<br />
Substitutionsdruck, den die alten auf die neuen Strukturen ausüben und den Spracherwerb<br />
stören. Auch wenn es den neuen Strukturen halbwegs gelingt, sich zu etablieren, schimmern<br />
(meist noch jahrelang) die alten Strukturen durch und verraten die Verknüpfungsregeln und<br />
Muster der ersten Sprache. Die Störungen sind für Sprachkundige <strong>als</strong> typische Fehler wahrnehmbar,<br />
die sich <strong>als</strong> Normverletzungen (stockender Sprachfluss, schlechte Aussprache,<br />
verunstaltete Grammatik und unidiomatischer Wortgebrauch) kundtun.
2. Ein weiteres Problem betrifft die vier unterschiedlichen Fertigkeiten im Sprachgebrauch:<br />
hören und lesen auf der einen (der passiven) Seite, gegenüber sprechen und schreiben auf der<br />
anderen (der aktiven) Seite. Unter Anglisten sind sie bekannt <strong>als</strong> „the four skills“. Die ersten<br />
beiden involvieren die Rezeptivität des Sprechers, seine Dekodierfähigkeit, die zweiten seine<br />
Produktivität, die Enkodierfähigkeit. Dabei ist klar, dass die rezeptiven Fertigkeiten, da sie<br />
gegebene fremde Leistungen verarbeiten, leichter zu erwerben sind <strong>als</strong> die produktiven, die<br />
Eigenleistungen erfordern. Englischsprachige Äußerungen aufzufassen und Fachtexte zu verstehen,<br />
bereitet deutschen Wissenschaftlern in der Regel denn auch kaum Schwierigkeiten;<br />
die Probleme tauchen bei der Enkodierung, dem eigenen Verbalisieren und Formulieren, auf.<br />
Denn der Wechsel verlangt einen qualitativen Sprung, der unterschiedliche neuronale Prozesse<br />
ins Spiel bringt und höhere Konzentrationsleistungen erfordert. Die Störanfälligkeit<br />
wächst, das Niveau sinkt. Hochkomplexe Sachverhalte lassen sich eben nicht gut in defizitäre<br />
Sprachstrukturen quetschen.<br />
3. Zwischen den Zeichen einer Sprache und dem von ihnen Bezeichneten bestehen im Kopf<br />
eines Sprechers enge, relativ stabile Beziehungen kognitiver wie auch affektiver Art. Demzufolge<br />
bilden sich im Umgang mit der Muttersprache charakteristische Gewohnheiten (Habitualisierungen)<br />
aus, die nicht nur die rezeptiven und produktiven Fertigkeiten im engeren<br />
Sinne, sondern auch die Denkweisen im jeweiligen Weltbild im weiteren Sinne betreffen.<br />
Sprachliche Äußerungen haben Korrelate in der Weltsicht des Sprechers, bei Wissenschaftlern<br />
eben die spezifischen Inhalte und Strukturen ihres Faches. Die muttersprachlich eingefahrenen<br />
Denkgewohnheiten zu suspendieren und andere (vorübergehend) an ihre Stelle zu<br />
setzen, ist nicht „natürlich“. Denn das wissenschaftliche Weltbild ist ein stark sprachlich oder<br />
semiotisch vermitteltes Weltbild, das man ohne Qualitätsverlust nicht von der gewohnten<br />
Vermittlung abkoppeln kann. Hier können sprachpsychologische „Loyalitätskonflikte“ beim<br />
Wechsel von einem zum anderen Medium auftreten, die ebenfalls einer souveränen Sprachbeherrschung<br />
entgegenwirken. Dies sind die Ursachen jener „Unbeholfenheit“, welche die Autoren<br />
der „Sieben Thesen zur deutschen Sprache in der Wissenschaft“ beim Gebrauch von<br />
Englisch hierzulande kritisieren. Und dies ist der Hintergrund der spitzen Bemerkung von<br />
Ekkehard König: „The language of good science is bad English.“<br />
Der Verfasser ist Professor für Amerikanistik i. R. an der Technischen Universität<br />
Braunschweig
2.3.3. „Imponierende Wissenschaft“, von Oliver Baer, Ausgabe Juni 2008, Nummer 38,<br />
Seite 9:<br />
Die Welt wird nicht verständlicher, wenn wir sie auf Englisch erklären.<br />
Die Finanzwelt ist gänzlich aus den Fugen geraten, ihre Sprache ist Englisch: eine zufällige<br />
Übereinstimmung oder ursächliche Verknüpfung? Könnte es sein, daß Englisch unserer geistigen,<br />
ethischen und wirtschaftlichen Gesundheit schadet? Immerhin verdrängt Englisch, oder<br />
eine Variante davon, <strong>als</strong> Konzernsprache das Deutsche, und in der Wissenschaft sind die<br />
Messen bereits gesungen: Wessen Bericht nicht auf Englisch gedruckt wird, der gilt nichts.<br />
Armselige Gedanken gebären keine starke Sprache, und sprachliche Dürftigkeit behindert das<br />
Denken. Dennoch wird verbissen das Recht beansprucht, Englisch zu sprechen, sobald es<br />
wichtig wird. Dieser Krampf erstreckt sich von der kleinsten Fachhochschule zu den Eliteuniversitäten,<br />
von Greenpeace zum Auswärtigen Amt, vom Marketing zu den Ingenieuren.<br />
Welche Denkweise dem zugrunde liegt, beleuchtet ein Beitrag in der Financial Times. Da<br />
wird Porsche vorgeworfen, man entwickle seine Autos auf Deutsch, obwohl der wichtigste,<br />
der amerikanische Markt, Englisch spricht. Die Mühe zu erläutern, was das eine mit dem<br />
anderen zu tun habe, erspart sich das Blatt. Sicher kann man auf Englisch einen komplizierten<br />
Gedanken so gut führen wie in jeder anderen entwickelten Sprache. Ebenso stimmt, daß die<br />
glatte Beliebigkeit des Globalenglischen eine notwendige Eigenschaft der Weltsprache ist. Sie<br />
kommt teuer, denn im selben Maße fehlt der Weltsprache das Gegenteil, die kantige Gewissenhaftigkeit<br />
der deutschen Sprache. Zwei <strong>Dr</strong>ittel der Englischkundigen weltweit sind<br />
keine englischen Muttersprachler; was sie der Sprache antun, bleibt der deutschen erspart.<br />
Engländer gelangen dennoch zum selben Ergebnis wie Deutsche, denn ihnen stehen die<br />
Nuancen, Idiome, Analogien ihrer vertrauten Sprache zur Verfügung. Den Fremdsprachlern<br />
im Englischen, den Deutschen, fehlen sie. Die willkommene Glätte des Global englischen hat<br />
einen weiteren Nachteil: Sie verführt zum Mißbrauch. Wer in wohlklingenden Worten nichts<br />
sagen möchte, bleibt auf Englisch länger unertappt <strong>als</strong> auf Deutsch, da schaltet man nach wenigen<br />
Sätzen bereits ab. Auffällig hemmungslos gefällt sich die Finanzbranche in Formulierungen,<br />
die keiner verstehen soll.<br />
Ihre virtuelle Sprache bedeutet wenig, füllt aber den Äther mit einem Grundrauschen, das<br />
Dissonanzen unterdrückt, Komplexität verdrängt, Unterscheidungen in Grauzonen auf löst.<br />
Daran gewöhnt man sich, dem verfällt man wie einer <strong>Dr</strong>oge. Im Licht der Skandalwelle<br />
möchte man der Bankaufsicht raten, dieser Frage nachzugehen. Autofahren im Suff ist<br />
schließlich auch nicht erlaubt. Daß auch unter Gebildeten das Werbe- und Wirtschafts-<br />
Wischiwaschi nicht flächendeckend verpönt ist, haben die Universitäten mit zu verantworten.<br />
Sie setzen Maßstäbe, sie verlangen sogar, daß sich Akademie einer fremden Sprache bedient,<br />
noch dazu einer, die auf hohem Niveau besonders schwer zu beherrschen ist. Daran gestalten<br />
sie mit wie die Passagiere eines Zuges am Fahrplan. In ihren Berichten häufen sich sinnentstellende<br />
Fehler, und auf Symposien blamieren sie die Wissenschaft. Selbst an der Quelle<br />
dieses Übels, dem <strong>Dr</strong>uck zur Veröffentlichung in zitierfähigen, <strong>als</strong>o englischen Publikationen,<br />
unterbleibt Kritik an der sprachlichen Dürftigkeit ihrer Produkte. Wissenschaftliches Niveau<br />
erreicht man so nicht.<br />
Derart in die Irre geführt, finden die Absolventen in die Praxis hinaus. Ausgestattet mit einem<br />
höheren Globalesisch (aber minderen Englisch) bringen sie kaum den Mut auf, mit muttersprachlicher<br />
Denkschärfe so etwas wie die strukturierten Bankprodukte zu hinterfragen. Damit<br />
nichts schief geht, verharren sie in ihrem abgehobenen Jargon, der alle Zweifel vernebelt.<br />
Erkenntnistiefe wird ersetzt durch das Gruppenerlebnis, irgendwie cool und sexy unter<br />
Gleichgesinnten zu sein. Anzulasten wäre der englischen Sprache die Eignung für diesen<br />
Mumpitz nur, wenn Sprache ein lebendiger Organismus wäre, den man notfalls in Beugehaft<br />
nimmt. Aber Sprache bestraft man sowenig wie Kräuter im Garten.
Die Wissenschafts- wie auch die Wirtschaftssprache müssen der Zusammenarbeit dienen, der<br />
Fehlerkorrektur, der Verläßlichkeit, der Genauigkeit. Beide Begründungen, der Muttersprache<br />
ein fragwürdiges Englisch vorzuziehen, stammen aus der zweiten Reihe: Englisch sei zeitgemäß<br />
und Englisch sei schon da. Sie schmecken wie die Semmeln vom Vortag, sobald sich<br />
herumspricht, daß sich alle Muttersprachler, bis auf die Angelsachsen, unter Wert verkaufen.<br />
Den Beweis, daß sich Deutsch <strong>als</strong> Wissenschaftssprache eignet, brauchen wir nicht zu führen.<br />
Auch die Wirtschaft hat das Makelzeichen Made in Germany zum Gütezeichen gewandelt, <strong>als</strong><br />
Englischkenntnis noch nicht <strong>als</strong> Wettbewerbsvorteil galt. Verwenden wir daher unsere<br />
Muttersprache, beherzt und ohne Komplexe! Sie war auch die Sprache der Göttinger Professoren,<br />
zu deren Füßen alle Welt saß. Denken und arbeiten wir in Wissenschaft und Wirtschaft<br />
ausschließlich in der Muttersprache und lassen ihr Ergebnis dann ins Englische übertragen<br />
– von Experten, die der Sprache kundig sind! Das wird Dolmetscher und Übersetzer<br />
kosten, aber wir würden auch in China nicht ohne sie auftreten.<br />
Auf diesen scheinbaren Umweg zu verzichten, wäre noch teurer. Wir investieren in Dolmetscher<br />
und Übersetzer, um das Wissen, das in der Vielfalt der Muttersprachen steckt, zu nutzen<br />
und zu mehren. Wissen, das sonst verloren ginge. Der Verzicht darauf wäre kaum rückgängig<br />
zu machen. Ihn zu verhindern, zählt sicher mehr, <strong>als</strong> den Kollegen mit Englisch zu imponieren.
2.3.4. „Denglisch kostet bares Geld“, von Rainer Pogarell, Ausgabe Juni 2008, Nummer 38,<br />
Seite 17:<br />
Auch wenn man sich über die vielen Anglizismen in der Sprache der Manager und Consulter<br />
ärgert, man sollte nicht vergessen, daß die meisten ein Produkt der puren Not sind. Ständig<br />
werden Führungskräfte und externe Berater genötigt, vollkommen neue und umwälzende<br />
Konzepte, Strategien und Produkte zu präsentieren.<br />
Woher sollen sie diese aber nehmen? Von der bekannten Marketingagentur verlangt ein Weltkonzern,<br />
den Vertrieb von allen alten Zöpfen zu befreien und ein innovatives, noch nie da<br />
gewesenes Vertriebskonzept vorzulegen. Die Agentur grübelt lange und intensiv herum und<br />
kommt so auf folgende Neuerung: Jeder große Kunde bekommt einen einzigen Großkundenbetreuer<br />
zugewiesen, der sich um alle Belange des Abnehmers kümmert. Zudem soll es<br />
bei der Betreuung etwas lustiger zugehen. Dem Kunden werden künftig Karten für den<br />
örtlichen Bundesliga-Verein sowie Hubschrauberflüge angeboten. Kurz vor der Abgabe<br />
kommen die ersten Zweifel.<br />
„Großkundenbetreuer“ hatte der Konzern bereits in den 60er-Jahren, bloß nannten sich diese<br />
dam<strong>als</strong> „Hauptrepräsentanten“. Bundesliga-Karten gab es eigentlich auch schon immer,<br />
zudem nahm der Vertriebschef gerne einmal einen Großkunden in seinem Learjet mit. Also<br />
macht der Dienstleister aus der Not einige Anglizismen: One face to the customer heißt nun<br />
das Gesamtprojekt, die ehemaligen Kundenbetreuer bekommen jetzt den Titel Key-Accounter.<br />
Der lustige Teil des Programms heißt Stop boring sales, die Bundesliga-Besuche werden <strong>als</strong><br />
Soccer and wine angeboten, weil es in der VIP-Lounge natürlich immer einen guten Tropfen<br />
gibt.<br />
Der Konzern ist begeistert und läßt sofort sämtliche Visitenkarten seiner Repräsentanten neu<br />
drucken. Die Agentur ist zunächst noch etwas ängstlich. Man fürchtet die Entdeckung des<br />
nackten Kaisers. Doch die bleibt aus, der Trick hat funktioniert. Also tauft sie sich bei<br />
nächster Gelegenheit selbst um. Aus der „Agentur für Absatz und Werbung“ wird nun die<br />
Sales promotion consulting, die fortan die deutsche Wirtschaft mit englischen und denglischen<br />
Begriffen versorgt.<br />
So oder sehr ähnlich dürften die meisten Anglizismen in die deutsche Wirtschaft gelangt sein.<br />
Anders sind die meisten sprachlichen Eseleien einfach nicht zu erklären. Ob aus einer Firmenzentrale<br />
ein Headquarter wird, eine Weiterbildung sich nun Academy nennt, der Geschäftsbereich<br />
zu einer Line of business mutiert oder ob das Bestreben des Unternehmens auf<br />
Customer satisfaction und Shareholder-Value statt auf Kundenzufriedenheit und Gewinn gerichtet<br />
ist, rationale oder gar zwingende Gründe für die Umbenennung sind auch auf Nachfrage<br />
nicht zu ermitteln. Man hat nichts zu sagen, <strong>als</strong>o sagt man es auf Englisch.<br />
Allerdings ist die Zeit, in der jeder Anglizismus bedenkenlos und unübersetzt in der Wirtschaft<br />
begeistert aufgenommen wurde, vorbei. Möglicherweise sind dafür die verbesserten<br />
Englischkenntnisse der Manager verantwortlich. Man kann ihnen nicht mehr jeden Humbug<br />
verkaufen, wenn er nur englisch genug klingt. Dazu hat man ja auch ein sehr hohes Lehrgeld<br />
bezahlt, die Anglisierung hat sich für niemanden gelohnt.<br />
Im Gegenteil, sie kostet. Gemeint sind keineswegs die Kosten für neue Firmenschilder und<br />
Visitenkarten. Gemeint ist der enorme Imageverlust, den deutsche Unternehmen mit englischen<br />
Namen und Produkten erleiden. Deutschland gehört zu den ganz großen Exportmächten<br />
der Welt, nicht selten belegt das Land sogar den ersten Platz. Wie ist das möglich? Ganz<br />
sicher sind für diesen Erfolg die unzähligen positiven Vorurteile verantwortlich, die man weltweit<br />
mit Deutschland verbindet.<br />
Spitzentechnologie, Zuverlässigkeit und Solidität gehören zum Beispiel dazu, Vorurteile, die<br />
einen Konzern auch dann tragen können, wenn seine Technologie eine Weile nicht Spitze ist.<br />
Wie aber sollen sich diese Vorurteile entfalten, wenn dem ausländischen Betrachter überall<br />
englische Produktnamen und Abteilungsbezeichnungen begegnen? Ein richtig gutes Auto
kommt für den Weltmarkt immer noch aus Deutschland, auch wenn eventuell andere Nationen<br />
schon gleichwertige oder bessere Fahrzeuge bauen. Ein deutscher Wagen vermittelt<br />
einfach ein besseres Gefühl. Dieses Gefühl wird aber angekratzt, wenn sich das Produkt aus<br />
Stuttgart oder München nicht deutschsprachig präsentiert.<br />
Allein der sprachliche Ausrutscher der Daimler Benz AG, die ihre große Erfindung nicht<br />
„Prallkissen“, sondern Airbag nannte, dürfte die deutsche Automobilwirtschaft Milliarden<br />
gekostet haben, denn weltweit glaubt der Normalbürger, es handele sich um eine amerikanische<br />
Erfindung. Airbag war <strong>als</strong>o ein ganz besonders teurer Anglizismus, aber letztlich trägt<br />
jede einzelne sprachliche Posse zur Imageverschlechterung bei.<br />
Reiner Pogarell ist Leiter des Instituts für Betriebslinguistik in Paderborn.
2.3.5. „Für die Gleichstellung der deutschen Sprache in der EU“, von Gerd Schrammen,<br />
Ausgabe Juni 2008, Nummer 38, Seite 25:<br />
Am 10. April überreichte Hessens Europaminister Volker Hoff dem EU-Sprachenkommissar<br />
Leonard Orban eine Erklärung zur Benachteiligung von Deutsch auf europäischer Ebene mit<br />
der Forderung, diese Benachteiligung zu beenden.<br />
„Ich freue mich sehr darüber“, erklärte Hoff bei der Übergabe, „dass diese hessische Initiative<br />
mittlerweile von 18 europäischen Regionen und rund 50 Europaabgeordneten aus sechs verschiedenen<br />
EU-Mitgliedsstaaten getragen wird. EU-weit sprechen fast 100 Millionen Menschen<br />
Deutsch <strong>als</strong> Muttersprache; keine Sprache ist in der EU so weit verbreitet. Wenn es die<br />
Kommission <strong>als</strong>o ernst meint mit ihren Plänen für ein ‚Europa der Bürger‘, dann darf sie die<br />
deutsche Sprache nicht weiter benachteiligen, indem sie beispielsweise Dokumente oder Internetseiten<br />
nur auf Englisch und Französisch, nicht aber auf Deutsch publiziert. Wenn sie<br />
wirklich will, dass die Bürgerinnen und Bürger aktiv am politischen Leben Europas teilnehmen<br />
und sich für die Ziele der EU engagieren, dann muss sie ihnen die nötigen Informationen<br />
auch in ihrer Sprache zur Verfügung stellen.<br />
Breite Unterstützung – auch von Nachbarländern<br />
Neben Hessen haben die Bundesländer Bayern, Saarland, Sachsen und Sachsen-Anhalt sowie<br />
die Freie und Hansestadt Hamburg die Erklärung unterzeichnet. Ferner die österreichischen<br />
Länder Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg, Steiermark, Tirol<br />
und Vorarlberg. Auch die Autonome Provinz Bozen-Südtirol in Italien, die Deutschsprachige<br />
Gemeinschaft Belgiens, die rumänischen Kreise Hermannstadt/Sibiu und Timis sowie rund 50<br />
Mitglieder der Fraktionen der Christdemokraten, Sozialdemokraten, Liberalen und Grünen im<br />
Europäischen Parlament setzten ihre Unterschrift unter das Dokument.<br />
Volker Hoff betonte und zeigte sich erfreut darüber, dass seine Aktion nicht nur von<br />
deutschen<br />
Politikern ausgehe. Vielmehr werde die Forderung nach mehr Deutsch in der EU zum ersten<br />
Mal auch von ausländischen Politikern und Institutionen unterstützt. Hinter der Forderung<br />
nach Gleichberechtigung für Deutsch neben Englisch und Französisch stehen Bundestagspräsident<br />
Norbert Lammert (CDU) und Außenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD). Zustimmung<br />
findet sie auch bei einer größeren Zahl von Europapolitikern wie Michael Gahler,<br />
Ingeborg Grasle, Andreas Krautscheid, Wolf Klinz und anderen. Außerhalb der Politik begrüßte<br />
der Vorsitzende der Gesellschaft für deutsche Sprache, Rudolf Hoberg, die Initiative.<br />
Clemens-August Krapp, Bundesvorsitzender des Verbandes der Katholiken in Wirtschaft und<br />
Verwaltung, zeigte sich ebenfalls zufrieden. „Wer die Sprachenvielfalt ignoriert, grenzt aus<br />
und benachteiligt“, sagte er.<br />
Bayern stößt nach: 5-Punkte Programm<br />
Anfang Mai hat der CSU-Politiker und bayrische Europaminister Markus Söder eine weitere<br />
Lanze für mehr Deutsch in der EU gebrochen: „Wir erwarten vom nächsten Präsidenten der<br />
EU-Kommission, dass er sich um die deutsche Sprache in der EU genauso kümmert, wie um<br />
CO2-Grenzwerte,“ erklärte er in einem Interview mit der Welt.<br />
Söder kündigte an, ein 5-Punkte-Programm zur Stärkung des Deutschen vorzulegen. Eine<br />
seiner Forderungen: Alle Beamten müssen spätestens nach der ersten Beförderung in allen<br />
drei Amtssprachen arbeitsfähig sein – <strong>als</strong>o auch in Deutsch.<br />
Der Minister verwies auf die bekannten wirtschaftlichen Nachteile für deutsche Unternehmen<br />
und forderte sprachliche Chancengleichheit. In Osteuropa sei Deutsch die Fremdsprache<br />
Nummer zwei. Dieser Vorteil ginge der deutschen Wirtschaft verloren, wenn die deutsche<br />
Sprache in der EU hintangesetzt wird.
Wie andere vor ihm ermahnte auch Söder die deutschsprachigen Vertreter in der EU, sie<br />
sollten selbst mehr Deutsch sprechen.<br />
Nicht hinnehmbare Benachteiligung<br />
Mit seinen 100 Millionen Sprechern liegt Deutsch <strong>als</strong> Muttersprache in Europa weit vor<br />
Englisch und Französisch und <strong>als</strong> Fremdsprache hinter Englisch an zweiter Stelle. Die Aufwertung<br />
von Deutsch <strong>als</strong> EU-Sprache ist deshalb eine Selbstverständlichkeit, die eigentlich<br />
keine weiteren Begründungen braucht. Ganz zu schweigen davon, dass Deutschland <strong>als</strong> der<br />
größte Nettozahler das meiste Geld in den EU-Haushalt einbringt. Hoff erinnerte jedoch daran:<br />
„Wir müssen, was die deutsche Sprache betrifft, selbstbewusster auftreten.“ Die Unterstellung<br />
von Deutschtümelei wies er zurück.<br />
Mehr deutsche Sprache in der EU bedeutet mehr sprachliche und kulturelle Vielfalt. Auch<br />
mehr Bürgernahe für alle, die Deutsch sprechen. Und weniger Benachteiligung bei Ausschreibungen<br />
oder Anträgen auf Fördergelder. Vor allem mittelständische deutsche Unternehmen<br />
sind da im Hintertreffen, wenn die maßgeblichen Texte nicht auf Deutsch, sondern<br />
nur in einer fremden Sprache vorliegen. Bei Hilfsprogrammen für die dritte Welt haben die<br />
Firmen oder Verbände lediglich die Wahl zwischen Englisch, Französisch, Portugiesisch und<br />
Spanisch – „vier Koloni<strong>als</strong>prachen“, wie MdEP Michael Gahler es nannte.<br />
Die Stellung der deutschen Sprache innerhalb der EU – linguistisch: ihr Status – entspricht<br />
nicht ihrer tatsächlichen Bedeutung. Aber Sprachenkommissar Leonard Orban, ein Ingenieur<br />
aus Rumänien, ist auf diesem Ohr taub. „Wir sehen nicht, dass Deutsch in irgendeiner Form<br />
diskriminiert wird,“ sagte er zu der Erklärung, die Volker Hoff ihm übergeben hatte. Er unterschlägt<br />
dabei, dass lediglich die allerwichtigsten Dokumente der europäischen Politik ins<br />
Deutsche übersetzt werden. Alles andere gibt es nur in englischer oder französischer Fassung.<br />
Orban ist EU-Kommissar für Sprachenvielfalt. Er erklärt gern, dass die Bürger Europas neben<br />
ihrer Muttersprache noch zwei fremde sprechen sollten. Das ist in Ordnung. Wieso er jedoch<br />
die Diskriminierung der deutschen Sprache in der EU leugnet, bleibt sein Geheimnis.
2.3.6. „Deutsch ins Grundgesetz“, von Walter Krämer, Bundesvorsitzender des VDS,<br />
Ausgabe Oktober 2008, Nummer 39, Titelseite:<br />
Unser Grundgesetz schützt viele Dinge, die uns wichtig sind: die Ehe, die Familie, die Unverletzlichkeit<br />
der Wohnung, die Presse- und Versammlungsfreiheit. Oder es klärt Streitfälle: Die<br />
Bundeshauptstadt ist Berlin, die Bundesflagge hat die Farben schwarz/rot/gold. Warum dann<br />
nicht auch ein Zusatz ins Grundgesetz: Die Sprache der Bundesrepublik Deutschland ist<br />
Deutsch?<br />
Die Standard-Antwort der politisch Korrekten hierzulande ist: Selbstverständlichkeiten bedürfen<br />
keiner Gesetze. Dann wäre <strong>als</strong>o der Schutz von Ehe und Familie nicht selbstverständlich?<br />
Anderswo sieht man das anders. Insgesamt siebzehn der siebenundzwanzig EU-Mitgliedstaaten<br />
haben in ihrer Verfassung einen Passus zur Landessprache. Und viele der anderen, die<br />
noch keinen haben, denken darüber nach. In Österreich, in Liechtenstein und in der Schweiz<br />
hat Deutsch <strong>als</strong> Landessprache Verfassungsrang. Nur in Deutschland selber nicht.<br />
Im Juli dieses Jahres hat daher der Verein Deutsche Sprache gemeinsam mit dem Verein für<br />
deutsche Kulturbeziehungen im Ausland, eine Initiative gestartet, diesen Passus in das Grundgesetz<br />
aufzunehmen. Viele Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, auch viele Politiker von<br />
links bis rechts, unterstützen das Bestreben.<br />
Dann wäre es vielleicht nicht mehr ohne Weiteres möglich, dass Arbeitnehmer in Deutschland<br />
gegen ihren Willen gezwungen werden können, mit ihren Arbeitskollegen Englisch zu reden,<br />
oder Studierende an deutschen Hochschulen mit englischsprachigen Vorlesungen zwangsgefüttert<br />
werden. „Sie werden verstehen,“ schreiben Physik-Studenten einer großen deutschen<br />
Universität in einem Hilferuf an den VDS, „dass wir es für didaktisch sehr ungeschickt halten,<br />
fachlich komplizierte Inhalte an einer deutschen Universität vor größtenteils deutschem Publikum<br />
von deutschen Dozenten in einer Fremdsprache vermitteln lassen zu wollen, zumal es<br />
mit den sprachlichen Fähigkeiten vieler Naturwissenschaftler bereits im Deutschen nicht zum<br />
besten steht.“<br />
An dieser Fakultät werden die Vorlesungen in dem neuen Master-Studiengang Physik ausschließlich<br />
in Englisch angeboten, gegen den ausdrücklichen Willen der Studierenden.<br />
„Unsere traditionsreiche Universität, einst Hort humboldtschen Geistes und umfassender<br />
Menschenbildung, droht unter dem Diktat destruktiver Zeitgeistknechte zu einer geistig<br />
verflachten, ökonomisierten anglisierten Humankapitalfabrik degradiert zu werden,“<br />
schreiben sie. „Wir haben alle uns selbst zu Gebote stehenden Mittel ausgeschöpft, ohne dass<br />
uns Gehör geschenkt wurde.“<br />
Vielleicht hätten sie Gehör gefunden, wäre Deutsch <strong>als</strong> Landessprache auch im Grundgesetz<br />
verankert?<br />
Die letzte der 52 Änderungen des Grundgesetzes gab es am 28. August 2006: die sogenannte<br />
„Föderalismusreform“. Sie erklärte die soziale Wohnraumförderung, den Strafvollzug und<br />
den Ladenschluss zur Ländersache, reduzierte dafür aber die Zahl der Bundesgesetze, die der<br />
Zustimmung des Bundesrates bedürfen, und erklärte die Atomenergie, die Terrorabwehr, das<br />
Meldewesen und den Schutz deutschen Kulturgutes gegen Abwanderung ins Ausland zur<br />
Bundessache.<br />
Dass deutsche Kulturgüter nicht ins Ausland abwandern, ist unseren Parlamentariern <strong>als</strong>o eine<br />
Änderung des Grundgesetzes wert. Dass unser höchstes Kulturgut überhaupt, die deutsche<br />
Sprache, nicht im Inland ausgehungert wird, sollte ihnen nicht weniger bedeutsam sein.
2.3.7. „Liebe Sprachfreunde“, von Walter Krämer, Bundesvorsitzender des VDS, Ausgabe<br />
Oktober 2008, Nummer 39, Seite 2:<br />
Liebe Sprachfreunde,<br />
in diesem Sommer haben Sie mit großem Abstand Klaus Wowereit, den Regierenden Bürgermeister<br />
von Berlin, zum Sprachpanscher des Jahres 2008 gewählt. Und das zu Recht. Wowereit<br />
steht einer Kommune vor, die im Ausland damit wirbt – und sich nicht etwa dafür schämt<br />
– die am meisten amerikanisierte Stadt Deutschlands zu sein, und da ist es nur folgerichtig,<br />
dass der neue Werbespruch für unsere Hauptstadt – be Berlin! - auch amerikanisch ist.<br />
Warum beantragt Wowereit nicht gleich die Aufnahme Berlins <strong>als</strong> 52. amerikanischer<br />
Bundesstaat?<br />
Diese galoppierende Amerikanisierung unserer Sprache und Kultur zeigt sich auch in der<br />
Zweitplatzierten unseres Wettbewerbs, der Vorsitzenden der Stiftung Deutsche Sporthilfe,<br />
Karin Linsenhoff. Um verdiente deutsche Sportler auszuzeichnen, fiel dieser ehrenwerten<br />
Gesellschaft nichts besseres ein, <strong>als</strong> auch im Namen eine Einrichtung zu kopieren, die es seit<br />
1901 im amerikanischen New York für verdiente US-Bürger und in anderen amerikanischen<br />
Städten speziell für Sportler gibt, die sogenannte „Hall of Fame“. Jetzt müssen wir nur noch<br />
darauf warten, dass dort ein Denkmal von Francis Beckenbauer steht.<br />
Und wenn schon, höre ich jetzt wieder die Abwieglerfraktion: Das ist vielleicht hässlich oder<br />
ärgerlich, aber wir haben ja weiß Gott in Deutschland größere Probleme.<br />
F<strong>als</strong>ch. Genau dieses mangelnde Selbstvertrauen, der verbreitete Irrglaube, am amerikanischen<br />
Wesen werde die Welt genesen, ist eines unserer größten Probleme, ist vielleicht unser<br />
größter Standortnachteil in Deutschland überhaupt. Durch das gedankenlose Nachäffen<br />
angelsächsischer Sitten und Gebräuche ruinieren wir das deutsche Hochschulwesen, das gerade<br />
die humboldtschen Ideale und den weltweit respektierten deutschen Diplomingenieur<br />
zugunsten billiger Micky-Maus-Grade über Bord geworfen hat, und die deutsche Wirtschaft<br />
gleichermaßen. So wage ich etwa zu behaupten, dass ein großer Teil der über 30 Milliarden<br />
Euro, die Daimler-Chrysler seit der Abschaffung von Deutsch und der Einführung von<br />
Englisch <strong>als</strong> Firmensprache in den Sand gesetzt hat – das ist mehr <strong>als</strong> das jährliche Sozialprodukt<br />
von Luxemburg – auf eben diese Firmensprache zurückzuführen ist. In der Sprache<br />
BSE (Bad Simple Englisch) kann man weder klare noch innovative Gedanken fassen, indem<br />
wir uns diese moderne Billigsprache überstülpen lassen, werden wir zu Sklaven einer angelsächsischen<br />
Denkweise und Weltansicht und geben unsere eigenen komparativen Vorteile, die<br />
wir in Deutschland immer noch besitzen, ohne Gegenleistung und unter großen Kosten auf.<br />
In Amerika sagt man dazu auch Stupid German Money. Hier findet eine beträchtliche transatlantische<br />
Vermögensübertragung statt, und zwar von Ost nach West. Jetzt könnte man<br />
sagen: Gut, wir zahlen nur den Marshall-Plan zurück, aber ich persönlich hätte das Geld doch<br />
lieber hier bei uns.<br />
Und wenn Sie bis jetzt immer noch nicht wussten, warum die deutsche Sprache ins<br />
Grundgesetz gehört – jetzt hätten Sie ein Argument.<br />
Mit nachdenklichen Grüßen,<br />
Ihr Walter Krämer
2.3.8. „Anpassung <strong>als</strong> Identitätsverlust“, von Walter Krämer, Bundesvorsitzender des VDS,<br />
Aushabe Dezember 2008, Nummer 40, Seite 12:<br />
Ein wichtiger Kollater<strong>als</strong>chaden des Bolognaprozesses wird gern übersehen: Der Untergang<br />
von Deutsch <strong>als</strong> Wissenschaftssprache. Ginge es nach dem Willen deutscher Kultusbürokraten,<br />
fänden akademische Lehre und Forschung in Deutschland bald nur noch auf Englisch<br />
statt. Auch viele Hochschullehrer glauben, dass man Spitzenwissenschaft heute nur noch auf<br />
Englisch betreiben könne oder solle. „Professoren muss es an deutschen Hochschulen freigestellt<br />
sein, in Englisch zu unterrichten. In jedem Fach sollte es (mit sinnvollen Ausnahmen,<br />
zum Beispiel Literatur- / Sprachwissenschaften) einen durchgängig englischen Lehrplan geben.<br />
Deutschland profitiert vom Input der weltweit besten Studenten, die zudem ihr Leben<br />
lang Deutschland verbunden bleiben.“<br />
Das fordern etwa 76 deutsche Auslandwissenschaftler schon 2005 in dem Magazin Karriere.<br />
Nun ist hier vorsichtig noch von „freigestellt“ die Rede. Aber es ist klar, dass daraus bald eine<br />
Verpflichtung zu werden habe.<br />
Diese Kollegen irren. Richtig ist: Deutsch <strong>als</strong> internationale Wissenschaftssprache hat in<br />
den meisten Fächern keine Zukunft. Die Zeiten, da japanische Mediziner ihre Dissertationen<br />
auf Deutsch publizierten oder Russen und Franzosen auf Mathematikerkongressen<br />
Deutsch miteinander redeten, sind vorbei. Daraus folgt aber keinesfalls, dass Spitzenforschung<br />
ausschließlich in englischer Sprache betrieben werden müsse. Denn diese Befürworter<br />
des Englischen <strong>als</strong> alleiniger Wissenschaftssprache verwechseln die Rolle von Deutsch <strong>als</strong><br />
internationaler mit der <strong>als</strong> nationaler Wissenschaftssprache, <strong>als</strong> Medium, in dem Forscher<br />
denken, grübeln, Ideen entwickeln, Hypothesen formulieren, Querverbindungen herstellen,<br />
Gedankenblitze zünden lassen. Es geht hier um das Werkzeug, den Geburtshelfer, der<br />
Theorien und Ideen überhaupt erlaubt, das Chaos unserer Gehirnzellen in Richtung Umwelt<br />
zu verlassen. Und hier richtet die moderne Ersatz-Wissenschaftssprache „Simpel-Englisch“<br />
riesengroßen Schaden an.<br />
Ich empfehle allen Kollegen, die auf internationalen Konferenzen auf Englisch daherstottern<br />
müssen und allein schon deshalb allen englischen Muttersprachlern immer unterlegen sind,<br />
die Lektüre des zeitlosen Aufsatzes „Über die allmähliche Verfertigung der Gedanken beim<br />
Reden“ von Heinrich von Kleist: „Wenn du etwas wissen willst“, fängt dieser Aufsatz an,<br />
„und es durch Meditation nicht finden kannst, so rate ich dir, mein lieber, sinnreicher Freund,<br />
mit dem nächsten Bekannten, der dir aufstößt, darüber zu sprechen.“ Denn durch das<br />
Sprechen, so Kleist, werden unsere Gehirnzellen quasi aufgemischt, beflügelt, zu Höchstleistungen<br />
angetrieben – das Sprechen <strong>als</strong> Türöffner für das Denken. „Der Franzose sagt:<br />
l’appétit vient en mangeant, und dieser Erfahrungssatz bleibt wahr, wenn man ihn parodiert,<br />
und sagt, l’idee vient en parlant.“<br />
Sprache, so würde Kleist vermutlich heute formulieren, ist nämlich mehr <strong>als</strong> eine Benutzeroberfläche,<br />
mit der unser Denken mit der Umwelt in Verbindung tritt, Sprache ist einer der<br />
Motoren dieses Denkens selbst. Wenn man aber nicht nur das Vermitteln, sondern auch das<br />
Entstehen von Gedanken einer Pidgin-Sprache überantwortet, ähnlich der, die vielen<br />
deutschen Wissenschaftlern heute zum Erfassen unserer Welt <strong>als</strong> ausreichend erscheint, ist<br />
hochkarätige Forschung nicht mehr möglich. „Jeder Mensch denkt in seiner eigenen Sprache<br />
mit den ihr eigenen Nuancen“, so der weltweit wohl bekannteste Computerexperte, Joseph<br />
Weizenbaum vom MIT (Massachusetts Institute of Technology). „Die Sucht vieler Deutscher<br />
nach englischen Sprachbrocken erzeugt dagegen Spracharmut, Sprachgulasch. Ideen können<br />
so nicht entstehen.“ Man kann <strong>als</strong>o das Hauptargument der Befürworter des Englischen <strong>als</strong><br />
allgemeiner und alleiniger Wissenschaftssprache auch in den Ländern außerhalb des englischen<br />
Sprachgebietes geradezu umkehren, die meinen, erst müsse die deutsche Wissenschaft<br />
besser werden, dann ginge es auch der deutschen Sprache besser. In Wahrheit verhält es sich
genau umgekehrt: Erst muss die deutsche Sprache besser werden, erst müssen wir wieder<br />
üben, überhaupt kreativ und innovativ zu denken, dann steigt auch die Qualität der deutschen<br />
Wissenschaft. Denn kreatives Denken, um das nochm<strong>als</strong> zu betonen, gelingt den meisten<br />
Menschen nur in ihrer Muttersprache, und wenn diese Muttersprache ganze Lebens- und<br />
Wissensbereiche aus dem Weltbild ausblendet, ist in dieser Muttersprache eben kein Erfassen<br />
dieser Welt mehr möglich.<br />
Wenn man dann eine Erkenntnis in der Muttersprache geboren hat, spricht nichts dagegen, ja<br />
ist es sogar angezeigt, sie dem weltweiten Publikum in einer wie auch immer gewählten<br />
lingua franca mitzuteilen, wie das unseren französischen Freunden seit langem mit viel Erfolg<br />
gelingt, zumindest in den Fächern, die ich selbst verfolge. Denn ökonomische und ökonometrische<br />
Forschung findet in Frankreich auf Französisch statt. Die Terminologie ist umfassend<br />
und reich, fördert kreatives Denken und lässt unsere französischen Kollegen nahezu alles, was<br />
sie denken können oder wollen, zunächst einmal auf Französisch denken. Und erst dann wird<br />
das Ergebnis auf die bekannte etwas holprige Art und Weise ins Englische übertragen und<br />
einem weltweiten Publikum bekannt gemacht. Und das mit großem Erfolg. Laut Zählung von<br />
2006 (siehe „Report of the Secretary“, Econometrica 75, 2007, S. 291–297) hat die<br />
Econometric Society 186 Mitglieder in Frankreich, davon 30 „Fellows“. Das sind durch<br />
herausragende wissenschaftliche Leistungen aufgefallene Mitglieder, die per Zuwahl in<br />
diesen erlesenen Kreis der führenden Ökonomen dieser Erde aufgenommen werden. In<br />
Deutschland gibt es 380 Mitglieder, aber nur 9 Fellows. Ich lese das so, dass die Deutschen<br />
zwar fleißiger sind, aber weniger Spitzenforschung produzieren und dass die von Weizenbaum<br />
so genannte „Sucht vieler Deutscher nach englischen Sprachbrocken“ einer kreativen<br />
Wissenschaft im Wege steht. Und in der Tat: Wenn man sich das oft unverdauliche Kauderwelsch<br />
anhört, mit dem sich manche Kollegen etwa auf der Jahrestagung des Vereins für<br />
Socialpolitik verständigen zu müssen glauben, fällt es nicht leicht, dahinter irgendwelche<br />
nennenswerten Beiträge zur Forschung zu vermuten.<br />
„Sprachlichkeit ist Teil des Wissensgeschehens selbst, und der Sprache kommt eine eigenständige<br />
gnoseologische Funktion bei der Wissensgewinnung zu“, schreibt Konrad Ehlich,<br />
der Vorsitzende des Deutschen Germanistenverbandes, in einem Aufsatz „Deutsch <strong>als</strong><br />
Wissenschaftssprache für das 21. Jahrhundert“. Deshalb, und nicht weil die deutsche Sprache<br />
per se so erhaltens- und bewundernswürdig wäre (was zutreffen mag oder auch nicht, mein<br />
Argument aber nicht berührt), ist eine flexible, geschmeidige, anpassungsfähige und innovative<br />
Muttersprache für kreative Forschung unerlässlich. Nicht umsonst fiel die Explosion der<br />
wissenschaftlichen Erkenntnis nach der Renaissance mit dem Niedergang des Lateinischen <strong>als</strong><br />
nationaler Denksprache zusammen. Galileo dachte italienisch, Kepler oder Leibniz deutsch,<br />
und Newton vermutlich englisch. Erst das Ergebnis ihres Denkens publizierten dann alle auf<br />
Latein.<br />
Deshalb geht auch das oft gehörte Argument, muttersprachliche Fachsprachen wären für<br />
Nichtfachleute unverständlich und deshalb könne man auch gleich in einer fremden Sprache<br />
Wissenschaft betreiben, am eigentlichen Problem vorbei. Denn mit dem Funktionieren der<br />
Denkfabrik „Gehirn“ hat das alles nichts zu tun. Es geht nicht allein und noch nicht einmal<br />
in erster Linie darum, dass das breite Publikum eine Idee versteht, sondern darum, dass<br />
der Ideenproduzent sie selbst versteht. Und das ist eben in einer Pidgin-Sprache namens<br />
BSE nur sehr schwer möglich.<br />
Das Vordringen von Englisch im internen deutschen Wissenschaftsbetrieb ist <strong>als</strong>o keine Hilfe,<br />
sondern eine Bremse für den wissenschaftlichen Fortschritt hierzulande. Wir zementieren<br />
damit die Zweitklassigkeit der deutschen Forschung auf allen Gebieten und machen uns auf<br />
ewig zu Anhängseln und Sklaven eines fremden, amerikanisch dominierten internationalen<br />
Kommunikations- und Wertesystems, wir machen uns zu Bürgern zweiter Klasse in unserem<br />
eigenen Wissenschaftsbetrieb.
2.4.<br />
2.4.1.<br />
Weitere Beiträge zum Thema:<br />
Der ‚Pageturner’:<br />
Ein Schüler zeigt mir sein neues Buch. „Das ist echt total spannend“, meint er. Ich bin verwundert,<br />
<strong>als</strong> ich den Klappentext lese. „Ein actionreicher Pageturner mit Titanic-Feeling –<br />
Spannung pur.“ steht dort. (Im folgenden findet sich ein Link zum Pressetext des Buchs, wo<br />
auch vom Pageturner die Rede ist: http://www.dtv.de/_pdf/waschzettel/71303.pdf). Der<br />
Verlag empfiehlt seinen „Pageturner“ Lesern ab 14 Jahren. Ich frage mich, ob diese Klientel<br />
weiß, was unter einem „Pageturner“ zu verstehen sei.<br />
Um der Frage nachzugehen, starte ich eine kleine Umfrage. Ich zeige Schülern im Alter<br />
zwischen 14 und 18 Jahren Titelbild und Umschlagseite des besagten Buchs und frage, ob sie<br />
wüssten, was man unter einem „Pageturner“ verstehe. Ein Schüler findet nach einigem Überlegen<br />
die richtige Antwort. Alle anderen können mit dem Begriff jedoch gar nichts anfangen.<br />
Ich versuche zu helfen, indem ich empfehle, den Begriff zu übersetzen. Schlagen die Schüler<br />
„Seitendreher“ oder „Seitenumwandler“ vor, gebe ich einen weiteren Hinweis. Im Englischen<br />
sage man „to turn over“ zum Umblättern von Buchseiten. Da sich „Pageturner“ auf ein Buch<br />
beziehe, wäre die wortwörtliche Übersetzung <strong>als</strong>o das ziemlich seltsam klingende deutsche<br />
Wort „Seitenumblätterer“. Darunter können sich viele wieder gar nichts vorstellen. Einige<br />
glauben jedoch, es sei damit ein derart langweiliges Buch gemeint, dass man die Seiten so<br />
schnell wie möglich umblättern wolle.<br />
Ich dehne die Umfrage auf Lehrkräfte aus. Hier bekomme ich folgende Angebote: Der Inhalt<br />
dieses Buchs sei wahrscheinlich „anturnend“. Andere wiederholen die Schülermeinung, es<br />
handele sich um ein Buch, das man nur oberflächlich lesen und durchblättern müsse. Einige<br />
kennen das Wort zwar nicht, können sich aber seine richtige Bedeutung herleiten. Der Begriff<br />
wird im Englischen für ein spannendes Buch verwendet. Dieses Buch wird von seinen Lesern<br />
derart verschlungen, dass man seine Seiten aufgrund des schnellen Leseflusses ständig umblättert.<br />
Aber wie kam der Begriff bei vielen deutschsprachigen Lesern an? Nicht <strong>als</strong> so spannend,<br />
dass man beim Lesen schnell umblättern muss, sondern <strong>als</strong> so langweilig, dass man das Buch<br />
nur überfliegt – so verstanden nicht wenige Schüler und Lehrkräfte den „Pageturner“. Außer<br />
der Bedeutung wollte ich von den Befragten noch wissen, ob sie den Begriff „Pageturner“ <strong>als</strong><br />
Werbung für dieses Buch geeignet fänden. Keiner der Befragten hielt den Begriff für geeignet.<br />
Alle, selbst diejenigen, die ihn sinngemäß übersetzt hatten, begründeten ihre Ablehnung<br />
damit, dass die Zielgruppe „Pageturner“ entweder gar nicht verstehen oder missverstehen<br />
könne. Selbst der Autor dieses Blogs http://immernurnoergeln.wordpress.com/about/, der den<br />
Anliegen des VDS (www.vds-ev.de) sehr kritisch gegenübersteht, sprach sich aus den oben<br />
genannten Gründen gegen die Verwendung des Anglizismus „Pageturner“ aus.<br />
Von Julia Dorndorf
2.4.2: ‚Kaffee to go’:<br />
Mittlerweile sieht man es fast überall: Kaffee to go. Natürlich gibt es auch andere Sachen die<br />
„to go" sind. Aber was denkt wohl ein Muttersprachler des Englischen, wenn er so einen Hinweis<br />
sieht? Wahrscheinlich wird er nicht wissen, was das sein soll, denn etwas „zum Mitnehmen"<br />
heißt im Englischen „to take away". Eine weitere skurrile Schöpfung ist „Back-<br />
Factory". Mir ist schleierhaft, was sich der Gründer des Unternehmens bei der Namensgebung<br />
gedacht hat. Vermutlich gar nichts. Der englische Begriff „back" heißt zu deutsch „Rücken"<br />
und eine „Rückenfabrik" würde ich nun wirklich nicht mit Backwaren assoziieren wollen.<br />
Leider wird man diese pseudo-englischen Ausdrücke aus unserem Alltag wohl nicht mehr<br />
wieder verschwinden sehen. Ich hoffe aber, dass in Zukunft nicht noch mehr solcher<br />
merkwürdigen Schöpfungen entstehen.<br />
Von Julia Dorndorf
3. Literatur:<br />
3.1. Einleitung:<br />
Literatur im Gegensatz zur Geschichtsschreibung legt ihren Schwerpunkt auf die Fiktion anstatt<br />
auf nachprüfbare Fakten. Besondere Schicksale werden in der Literatur exemplarisch erzählt<br />
und erhalten dadurch eine allgemeine Bedeutung. Ob sich die Ereignisse so zugetragen<br />
haben, tritt hinter der Frage zurück, ob die dargestellten Handlungen der Figuren wahrscheinlich<br />
sind. In großer Literatur werden <strong>als</strong>o menschliche Verhaltensweisen exemplarisch dargestellt.<br />
Wer sich mit Literatur beschäftigt, fördert sein Vermögen, Motivationen von Handlungen einzelner<br />
Menschen und Menschengruppen besser zu verstehen. Wer eine Ahnung davon hat,<br />
wie Menschen aus welchen Gründen heraus handeln, der findet sich auch in der realen Welt<br />
besser zurecht. Der gebildete Leser wird sich kein f<strong>als</strong>ches Bild vom Menschen machen, sondern<br />
ein realistisches. Er wird den Menschen weder <strong>als</strong> ausschließlich schlecht noch <strong>als</strong> ausschließlich<br />
gut erfahren, denn die Literatur lehrt, dass die Welt nicht in ein simples Gut oder<br />
Böse eingeteilt werden kann. Sie zeigt vielmehr den Menschen mit seinen Stärken und<br />
Schwächen, wozu er fähig ist und wozu er fähig wäre.<br />
Über diese Eigenschaft der Literatur hinaus lernt man durch das Lesen von literarischen<br />
Schätzen der eigenen und fremden Kultur sich selbst und einander besser kennen, denn obwohl<br />
in der Literatur nicht die faktische Geschichte wiedergegeben wird, so doch ein kulturelles<br />
Gedächtnis in Form von exemplarischen Schicksalen, in denen sich auch größere Zeitläufe<br />
spiegeln. Indem man in der Auseinandersetzung mit der Literatur erkennt, wie fruchtbar<br />
ihr Austausch über Sprachgrenzen hinweg war und ist, lernt man neben der eigenen auch<br />
fremde Kulturen wertschätzen.<br />
In der Regel wird man sich aber in der Literatur besser zurechtfinden, die man problemlos im<br />
Original lesen kann, denn in der Origin<strong>als</strong>prache sind die Nuancen des Sprachkunstwerks besser<br />
bewahrt <strong>als</strong> in jeder Übersetzung. Weil Sprache <strong>als</strong> das Material der Literatur in ihr auf<br />
mannigfache Weise aufgegriffen und gestaltet wird, sensibilisiert das Lesen von Literatur<br />
auch für den Ausdrucksreichtum der Sprache. Diese Sensibilisierung der Sprache gegenüber<br />
darf nicht unterschätzt werden. Wer bewusster formuliert, denkt genauer und umgekehrt.<br />
Damit ist man weniger anfällig für verführerische Phrasen, hinter denen sich gefährliches<br />
Gedankengut verbergen kann.<br />
Angesichts einer Flut von Informationen und einem Alltag, der oft <strong>als</strong> abgehetzt empfunden<br />
wird, findet der Leser in der Lektüre Ausgleich sowie die oben beschriebene Orientierung.<br />
Nach und nach bildet sich der Leser durch seine Lektüre einen Kanon, der ihm kulturelle Vergleiche<br />
gestattet und zu einer tiefergehenden Geschmacksbildung führt. Wer derart in der<br />
Kultur wurzelt, wird nicht jeder schnelllebigen Mode hinterherhecheln.<br />
Wie jede Kunstform so braucht auch die Literatur Rezipienten, die sie aufnehmen, deuten und<br />
aufgreifen. Auf diese Weise bewahren die Rezipienten das oben beschriebene kulturelle Gedächtnis<br />
der Menschheit. Wer dieses Gedächtnis meint mit Geringschätzung strafen zu können,<br />
der darf sich nicht wundern, dass ihm die oben beschriebene Orientierung verwehrt<br />
bleibt:<br />
„Wer nicht von dreitausend Jahren<br />
Sich weiß Rechenschaft zu geben,<br />
Bleib im Dunkeln unerfahren,<br />
Mag von Tag zu Tage leben.”<br />
Von Marco Schäfer<br />
(Johann Wolfgang von Goethe, West-östlicher Diwan)
3.2. Herodot und Thukydides: Herrscher, Untertanen und Bürger in der Antike:<br />
Die beiden bekanntesten Historiker dieser Zeit waren Herodot und Thukydides. Ersterer<br />
schrieb u.a. über die Kriege der Griechen gegen die Perser und letzterer über den großen<br />
Krieg der Griechen untereinander. Dabei beschreiben diese Zeitzeugen außerordentlich anschaulich<br />
und unterhaltsam, wie sich Menschen in den verschiedensten Situationen verhalten<br />
haben. Vieles von dem ist auch auf unsere Zeit sehr gut übertragbar, weil die Menschen im<br />
wesentlichen gleich geblieben sind: Mut und Feigheit, Treue und Verrat, Vernunft und<br />
Dummheit sind Konstanten menschlichen Daseins bis heute. Daher werden viele überrascht<br />
sein, mit welch tiefgründigen, aber dennoch sehr verständlichen Worten jene Autoren<br />
menschliches Verhalten in vielen seiner Facetten abgebildet haben, das zudem noch bis auf<br />
den heutigen Tag höchst aktuell ist.<br />
Herodot (1, 30 - 33): Solon-Kroisos-Logos:<br />
Geld und Macht allein machen nicht glücklich<br />
Gerade um der Gesetze willen sowie um die Welt zu sehen, war Solon außer Landes gegangen<br />
und zu Amasis nach Ägypten gekommen. Er gelangte auch nach Sardes zu Kroisos. Nach<br />
seiner Ankunft ließ ihn Kroisos im Palast gastlich aufnehmen. Am dritten oder vierten Tage<br />
mussten ihn Diener auf Kroisos’ Geheiß in die Schatzkammer führen und alle die großen und<br />
reichen Schätze des Königs zeigen. Als er alles gesehen und nach Wunsch betrachtet hatte,<br />
fragte ihn Kroisos: ,,Gastfreund aus Athen, verschiedene Kunde über Dich ist zu uns gedrungen,<br />
über deine Weisheit und deine Reisen. Man hat uns erzählt, Du habest <strong>als</strong> Freund der<br />
Weisheit, und um die Welt kennenzulernen, viele Länder der Erde besucht. Nun möchte ich<br />
Dich doch gern fragen, ob du schon einen Menschen gefunden hast, der am glücklichsten auf<br />
Erden ist.“ Er erkundigte sich danach, weil er meinte, selbst der glücklichste Mensch auf<br />
Erden zu sein. Solon jedoch wollte ihm nicht schmeicheln, sondern die ganze Wahrheit sagen.<br />
Er sprach daher: „Ja, König, Tellos aus Athen!" Kroisos staunte über das Wort und fragte gespannt:<br />
,,In welcher Hinsicht, meinst Du, sei Tellos der glücklichste?" Solon antwortete:<br />
,,Tellos lebte in einer blühenden Stadt, hatte treffliche, wackere Söhne und sah, wie ihnen<br />
allen Kinder geboren wurden und wie diese alle am Leben blieben. Er war nach unseren<br />
heimischen Begriffen glücklich, und ein herrlicher Tod krönte sein Leben. In einer Schlacht<br />
zwischen Athenern und ihren Nachbarn in Eleusis brachte er durch sein Eingreifen die Feinde<br />
zum Weichen und starb den Heldentod. Die Athener begruben ihn auf Staatskosten an der<br />
Stelle, wo er gefallen war, und ehrten ihn sehr."<br />
Als Solon den Kroisos durch die Geschichte von Tellos, indem er so viel Gutes über ihn<br />
sagte, noch wissbegieriger gemacht hatte, fragte der König weiter, wen er denn für den Zweitglücklichsten<br />
halte. Er hoffte doch, wenigstens die zweite Stelle in der Glückseligkeit zu erhalten.<br />
Aber Solon sagte: ,,Kleobis und Biton. Diese beiden Brüder - sie stammten aus Argos<br />
- hatten ein gutes Auskommen und waren körperlich sehr stark. Beide wurden gleichzeitig<br />
Sieger in Wettkämpfen. Man erzählt folgende Geschichte von ihnen: Auf einem Herafest in<br />
Argos musste ihre Mutter auf jeden Fall in einem Fahrzeug in den Tempel gefahren werden.<br />
Die Stiere aber waren nicht rechtzeitig vom Felde zur Stelle. Die Zeit drängte. Da traten die<br />
jungen Männer selbst unter das Joch und zogen den Wagen, in dem ihre Mutter saß. Sie liefen<br />
45 Stadien und kamen zum Tempel. Nach dieser Tat, die das ganze versammelte Volk gesehen<br />
hatte, wurde ihnen der schönste Tod zuteil. An ihnen offenbarte Gott, dass der Tod für<br />
den Menschen besser sei <strong>als</strong> das Leben. Die umstehende Menge der Argeier lobte die Kraft<br />
der jungen Männer. Die Frauen aus Argos aber priesen ihre Mutter, daß sie solche Kinder geboren<br />
habe. Hocherfreut über die Tat und den Ruhm ihrer Söhne, trat die Mutter vor das
Götterbild und betete, die Göttin möge ihren Kindern Kleobis und Biton, die ihre Mutter so<br />
hoch geehrt hätten, das Schönste verleihen, was ein Mensch erlangen kann. Als sie nach<br />
diesem Gebet geopfert und am Mahl teilgenommen hatten, schliefen die Jünglinge unmittelbar<br />
im Tempelbezirk ein und wachten nicht mehr auf. Sie fanden dieses Ende. Die Argeier<br />
ließen Standbilder von ihnen machen und stellten sie in Delphi auf <strong>als</strong> Bilder edler und<br />
wackerer Männer.“<br />
Ihnen <strong>als</strong>o gab Solon die zweite Stelle in der Glückseligkeit, Kroisos aber rief aufgeregt:<br />
,,Gastfreund aus Athen, und mein Glück erachtest Du so tief, dass Du mich gar unter diese<br />
einfachen stellst?" Solon erwiderte: ,,Lieber Kroisos, wo ich doch weiß, dass das ganze<br />
göttliche Walten neidisch und unbeständig ist, fragst Du mich nach menschlichen Dingen. ...<br />
Mir erscheinst Du gewiss sehr reich und ein König über viele Menschen. Aber das, wonach<br />
Du mich fragst, kann ich Dir nicht eher beantworten, <strong>als</strong> bis ich erfahren, dass Du dein Leben<br />
auch glücklich beendet hast. Denn der Reiche ist nicht glücklicher <strong>als</strong> einer, der gerade für<br />
einen Tag genug zum Leben hat, wenn er seinen ganzen Reichtum bis an sein glückliches<br />
Lebensende genießen darf. Viele sehr reiche Menschen sind unglücklich; viele, die nur mäßig<br />
viel zum Leben besitzen, sind glücklich. Der unglückliche Reiche hat nur in zwei Stücken<br />
etwas dem Glücklichen voraus, dieser aber vieles vor Reichen und Unglücklichen. Der Reiche<br />
kann seine Gelüste befriedigen und schwere Schicks<strong>als</strong>schläge einfacher tragen. Der andere<br />
aber hat folgendes mehr <strong>als</strong> jener: zwar wird er, weil er nicht reich ist, mit seinen Wünschen<br />
und Schicks<strong>als</strong>schlägen nicht in gleicher Weise fertig wie jener. Aber sein guter Stern hält sie<br />
von ihm fern. Er ist unversehrt, gesund, ohne Leid, glücklich mit seinen Kindern und wohlgestaltet.<br />
Wenn er dann noch einen schönen Tod hat, dann ist er eben der, nach dem Du suchst,<br />
ein Mensch, der wahrhaft glücklich zu nennen ist. Vor dem Tode aber muss man sich im<br />
Urteil zurückhalten und darf niemanden glücklich nennen, sondern nur vom Schicksal begünstigt.<br />
Dass aber alles das, was zur Glückseligkeit gehört, bei einem Menschen zusammentrifft,<br />
ist unmöglich. Auch ein Land besitzt nicht alles, was es braucht; vielmehr hat es das<br />
eine und entbehrt das andere. Das beste Land ist das, das am meisten besitzt. So erfüllt auch<br />
der Mensch <strong>als</strong> Einzelwesen sich nicht selbst. Das eine hat er, etwas anderes entbehrt er. Der<br />
Mensch aber, der das meiste seines Bedarfes besitzt und in diesem Besitze lebt und glücklich<br />
sein Leben beendet, der, König, verdient nach Meinung den Namen eines Glücklichen. Überall<br />
muss man auf das Ende und den Ausgang sehen. Vielen schon winkte die Gottheit mit<br />
Glück und stürzte sie dann ins tiefste Elend.“ So sprach er und schmeichelte Kroisos nicht.<br />
Dieser ließ ihn ohne eines weiteren Wortes zu würdigen, von sich gehen. Kroisos hielt ihn<br />
sogar für einen großen Toren, weil er das Glück der Gegenwart nicht gelten ließ und immer<br />
nur auf das Ende hinwies.<br />
Wer gut arbeitet, soll auch gut feiern<br />
Herodot (2, 173): Pharao Amasis über seinen Herrschaftsstil:<br />
Seine Tageseinteilung hatte er so geordnet: Vom frühen Morgen bis zur Mittagsstunde erfüllte<br />
er die anfallenden Arbeiten mit großem Eifer; von da ab aber zechte er, scherzte mit seinen<br />
Tischgenossen, war leichtfertig und lustig. Seine Freunde ärgerten sich darüber; sie wollten<br />
ihm den Kopf zurechtsetzen und sagten: „König, Du hältst dich nicht wie Du sollst, wenn Du<br />
Dich arger Leichtfertigkeit hingibst. Du müsstest ernst auf erhabenem Thron sitzen und den<br />
ganzen Tag über schaffen. Dann würden die Ägypter merken, dass ein wirklich großer Mann<br />
über sie herrscht, und Du stündest in besserem Ruf. So aber lebst Du durchaus nicht wie ein<br />
König." Darauf antwortete Amasis: ,,Den Bogen spannt man nur, wenn man ihn braucht; hat<br />
man ihn benutzt, entspannt man ihn wieder. Hielte man ihn dauernd in Spannung, würde er<br />
zerbrechen; und wenn man ihn bräuchte, wäre er nutzlos. So ist es auch mit des Menschen
Art. Wenn er immer nur ernst und fleißig ist und Scherz und Spaß keinen Raum gönnt, dann<br />
wird er, ohne es zu merken, ganz toll oder völlig erschöpft. Weil ich das weiß, lasse ich jedem<br />
seinen Teil zukommen." Diese Antwort gab er seinen Freunden.<br />
Andere Länder, andere Sitten<br />
Herodot (3, 38): Über den Respekt gegenüber fremdartigen Kulturen:<br />
Wenn man alle Völker der Erde aufforderte, sich unter all den verschiedenen Sitten die trefflichsten<br />
auszuwählen, so würde jedes nach genauer Untersuchung doch die eigenen allen anderen<br />
vorziehen. So sehr ist jedes Volk davon überzeugt, dass seine Lebensformen die besten<br />
sind. Es ist <strong>als</strong>o ganz natürlich, dass nur ein Wahnsinniger über so etwas (gemeint sind ihm<br />
fremde Sitten) spotten kann. Dass alle Völker so in Sitten und Bräuchen denken, zeigt unter<br />
genügend anderen folgendes Beispiel: Als Dareios König war, ließ er einmal alle Griechen<br />
seiner Umgebung zu sich rufen und fragte sie, um welchen Lohn sie bereit wären, die Leichen<br />
ihrer Väter zu verspeisen. Die aber antworteten, sie würden das um keinen Preis tun. Darauf<br />
rief Dareios die indischen Kalatier, die die Leichen der Eltern essen, und fragte sie in<br />
Anwesenheit der Griechen - durch einen Übersetzer erfuhren sie, was er sagte - um welchen<br />
Preis sie ihre verstorbenen Eltern verbrennen möchten. Sie schrien laut auf und baten ihn<br />
inständig, solch gottlose Worte zu lassen. So steht es mit den Sitten der Völker, und Pindar<br />
hat meiner Meinung nach recht, wenn er sagt, die Sitte sei aller Wesen König.<br />
Wer soll herrschen?<br />
Herodot (3, 80 - 82): Diskussion verschiedener Verfassungstypen bei den Persern:<br />
Otanes riet, die Regierungsgewalt in die Hände der Gesamtheit der Perser zu legen; er sagte<br />
folgendes: „Mir scheint, ein einzelner von uns darf nicht Alleinherrscher werden; das ist nicht<br />
erfreulich und gut für uns. Ihr seht alle, wie weit der Frevelmut des Kambyses gegangen ist.<br />
Auch unter dem Übermut des Magers hattet ihr zu leiden. Wie kann die Alleinherrschaft eine<br />
wohlgeordnete Einrichtung sein, wenn es darin dem König erlaubt ist, ohne Verantwortlichkeit<br />
zu tun, was er will. Auch wenn man den Allerbesten zu dieser Stellung erhebt, würde er<br />
seiner früheren Gesinnung untreu werden. Selbstüberhebung befällt ihn aus der Fülle von<br />
Macht und Reichtum, und Neid ist dem Menschen von Anfang schon angeboren. Mit diesen<br />
Eigenschaften besitzt er aber auch schon alle anderen Laster. Aus Selbstüberhebung und Neid<br />
begeht er viele Torheiten. Freilich sollte gerade ein Alleinherrscher ohne alle Missgunst sein;<br />
besitzt er doch alle Güter. Aber seinen Mitbürgern gegenüber zeigt er sich <strong>als</strong> das Gegenteil.<br />
Er beneidet die Besten um ihr bloßes Dasein und Leben, er freut sich über die schlechtesten<br />
Bürger und ist gern bereit, auf Verleumdungen zu hören. Und was am allerwenigsten zusammenpasst:<br />
Wenn man ihn in maßvoller Weise bewundert, ärgert er sich, dass man ihm nicht<br />
ehrerbietig genug begegnet; erweist man ihm aber höchste Achtung, dann ärgert er sich, dass<br />
man ihm schmeichelt. Das Schlimmste aber sage ich jetzt erst: Er rührt an den altüberlieferten<br />
Ordnungen, er vergewaltigt Frauen und tötet ohne Richterspruch. Wenn dagegen die Menge<br />
herrscht, hat dieses Regiment zunächst den allerschönsten Namen: Gleichheit vor dem Gesetz.<br />
Außerdem aber ist sie von allen den Fehlern frei, die die Alleinherrschaft aufweist. Sie besetzt<br />
die Ämter durch das Los, die Verwalter der Ämter sind verantwortlich; alle Beschlüsse werden<br />
der Gesamtheit vorgelegt. So meine ich <strong>als</strong>o: Wir schaffen die Alleinherrschaft ab und<br />
geben der Menge die Macht; denn auf der Masse des Volkes ruht der ganze Staat!"
Das war der Antrag des Otanes. Megabyzos aber empfahl, die Macht einer beschränkten Zahl<br />
zu geben, und sagte. ,,Was Otanes über die Abschaffung des Königtums sagt, ist auch meine<br />
Meinung. Wenn er aber rät, die Menge zum Herrscher zu machen, dann hat er damit nicht das<br />
Rechte getroffen. Es gibt nichts Unvernünftigeres und Hochmütigeres <strong>als</strong> die blinde Masse.<br />
Es ist aber unerträglich, dem Übermut eines Alleinherrschers zu entfliehen und in die Selbstüberhebung<br />
einer zügellosen Masse hineinzugeraten. Jener weiß doch wenigstens, was er tut;<br />
die breite Masse aber handelt ohne Einsicht. Woher auch sollte dem Volke Vernunft kommen?<br />
Es hat das Gute weder gesehen noch von sich aus; vielmehr stürzt es sich ohne Verstand<br />
einem Bergstrom gleich auf die Staatslenkung und treibt sie voran. Nur wer den Persern<br />
Böses gönnt, ziehe das Volk zur Regierung heran. Wir sollten die Regierung aus den besten<br />
Männern bilden, denen wir die Macht übertragen; zu diesen gehören wir auch selbst. Die<br />
besten Männer werden billigerweise auch die besten Entschlüsse fassen." Diese Meinung trug<br />
Megabyzos vor.<br />
Als dritter äußerte sich Dareios und sagte: „Die Meinung des Megabyzos über die Masse<br />
billige ich, nicht aber, was er über die Oligarchie sagt. <strong>Dr</strong>ei Verfassungen sind möglich.<br />
Nehmen wir sie alle in ihrer vollkommensten Form an, <strong>als</strong>o die vollkommenste Demokratie,<br />
die vollkommenste Oligarchie und die vollkommenste Monarchie, so überragt die letzte die<br />
anderen beiden, wie ich behaupte, bei weitem. Es gibt offenbar nichts Besseres <strong>als</strong> die Einzelregierung<br />
des besten Mannes. Bei dieser Gesinnung wird er ohne Tadel für sein Volk sorgen.<br />
Beschlüsse gegen Volksfeinde werden am besten geheimgehalten. In einer Oligarchie dagegen<br />
entstehen oft heftige persönliche Feindschaften, wenn viele ihre Tüchtigkeit vor der Gesamtheit<br />
unter Beweis stellen wollen. Jeder bemüht sich, an der Spitze zu sein und seine<br />
Meinung durchzusetzen. So geraten sie untereinander in arge Feindschaft. Daraus entstehen<br />
Parteiwirren, es kommt zum Mord. Schließlich führt das alles wieder hinaus auf die Monarchie;<br />
und sieht man, um wieviel sie doch die beste Staatsform ist. Wenn aber das Volk<br />
herrscht, dann bleibt es nicht aus, dass Gemeinheit auftritt. Kommt aber diese in der Gemeinschaft<br />
auf, dann entstehen zwar keine Feindschaften unter den Schlechten, wohl aber starke<br />
Freundschaften; denn die, die das Gemeinwesen schädigen, tun es gemeinsam und stecken<br />
ihre Köpfe zusammen. Das geht so lange, bis ein Führer des Volkes ihrem Treiben ein Ende<br />
setzt. Dafür preist ihn das Volk, und der Gepriesene erscheint wieder <strong>als</strong> Alleinherrscher. Hier<br />
zeigt sich auch an ihm wieder, dass die Monarchie die beste Verfassung ist. Um alles kurz<br />
zusammenzufassen: Wie ist denn das Perserreich frei geworden? Wer hat ihm die Freiheit<br />
gegeben? Das Volk, die Oligarchie oder die Monarchie? Ich habe <strong>als</strong>o die Überzeugung: Wir<br />
haben durch einen Mann die Freiheit bekommen; an ihr müssen wir festhalten. Überhaupt<br />
sollten wir die altüberlieferte Verfassung, die so gut ist, nicht abschaffen; das ist immer von<br />
Übel."<br />
Stärke durch Demokratie<br />
Herodot (5, 78): Herodots Meinung über die Demokratie:<br />
Die Athener waren stark geworden. Das bürgerliche Recht des freien Wortes für alle ist eben<br />
in jeder Hinsicht, wie es sich zeigt, etwas Wertvolles. Denn <strong>als</strong> die Athener von Tyrannen beherrscht<br />
wurden, waren sie keinem einzigen ihrer Nachbarn im Kriege überlegen; jetzt aber,<br />
wo sie frei von Tyrannen waren, standen sie weitaus an der Spitze. Daraus ersieht man, daß<br />
sie <strong>als</strong> Untertanen, wo sie sich für ihren Gebieter mühten, sich absichtlich feige und träge<br />
zeigten, während jetzt nach ihrer Befreiung ein jeder eifrig für sich selbst schaffte.
Zuviel Macht in einer Hand verführt zum Missbrauch<br />
Herodot (5, 92): Über die Tyrannenherrschaft der Kypseliden in Korinth:<br />
Als Kypselos Tyrann geworden war, benahm er sich folgendermaßen: Er verbannte eine<br />
Menge Korinther, raubte vielen das Vermögen und weitaus den meisten das Leben. Nach<br />
dreißigjähriger Herrschaft starb er eines ruhigen Todes. Ihm folgte sein Sohn Periandros auf<br />
den Thron. Er zeigte sich anfangs milder <strong>als</strong> sein Vater. Als er aber durch Boten mit Thrasybulos,<br />
dem Tyrannen von Milet, in Verkehr getreten war, wurde er noch weit blutgieriger <strong>als</strong><br />
Kypselos. Er schickte nämlich einen Boten zu Thrasybulos und ließ ihn fragen, wie er seine<br />
Sache am sichersten einrichten und dabei die Stadt am besten verwalten könne. Thrasybulos<br />
führte den Boten des Periandros aus der Stadt, betrat ein Saatfeld und durchschritt es, während<br />
er den Boten wiederholt nach dem Zweck seines Kommens aus Korinth befragte. Dabei<br />
riß er immer wieder eine Ähre ab, die er über die anderen herausragen sah, und warf sie dann<br />
fort, bis er schließlich den schönsten und dichtesten Teil des Feldes mit diesem Tun entstellt<br />
hatte. Nachdem er das Feld durchschritten, entließ er den Boten, ohne ihm weiter eine Antwort<br />
zu geben. Als dieser nach Korinth zurückkehrte, wollte Periandros begierig den Rat des<br />
Thrasybulos erfahren. Der Bote aber erwiderte, er habe keinen Rat erhalten, wundere sich<br />
aber, was das für ein Mann sei, zu dem ihn Periandros geschickt habe; der sei ja verrückt und<br />
schädige sein eigenes Land. Dabei erzählte er, was er bei Thrasybulos erlebt hatte.<br />
Periandros aber verstand sein Tun und erriet, dass Thrasybulos ihm nahelege, die hervorragenden<br />
Bürger zu ermorden. So zeigte er offen all sein Wüten gegen seine Mitbürger. Was<br />
Kypselos noch versäumt hatte bei Hinrichtung und Verbannung, holte er nach.<br />
Herodot (7, 102 - 103): Demaratos – Logos:<br />
Mut für die Freiheit<br />
Als Demaratos dies hörte, sagte er: ,,König, da Du durchaus willst, dass ich dir die volle<br />
Wahrheit sage, so dass sich nachher nicht etwas <strong>als</strong> Lüge herausstellt, so höre: In Griechenland<br />
ist die Armut von jeher zu Hause; die mannhafte Haltung aber ist anerzogen durch Weisheit<br />
und strenges Gesetz. Durch sie schützt sich Griechenland gegen Armut und Knechtschaft.<br />
Ich muss alle Griechenstämme loben, die im dorischen Gebiet ringsum wohnen, will aber<br />
nicht von allen folgendes sagen, sondern von den Lakedaimoniern allein; sie werden fürs erste<br />
dein Anerbieten niem<strong>als</strong> annehmen, das über Griechenland Sklaverei bringt. Dann werden sie<br />
sich dir im Kampf stellen, selbst wenn alle übrigen Griechen auf deine Seite träten. Frage<br />
nicht, ob sie zahlenmäßig stark genug dazu sind! Sie werden kämpfen, mögen tausend Mann<br />
ausgezogen sein oder weniger oder mehr."<br />
Als Xerxes das hörte, lachte er laut auf und sprach: ,,Demaratos, was sagst Du da? Tausend<br />
Mann sollen gegen ein so großes Heer streiten? Sag doch: du warst ja, wie Du sagst, selbst<br />
dieses Volkes König. Wolltest Du zum Beispiel es mit zehn Mann aufnehmen? Und doch,<br />
wenn euer Staatsaufbau ganz so ist, wie du es beschreibst, dann müsstest Du <strong>als</strong> ihr König<br />
nach eurer Sitte gegen doppelt so viele Männer bestehen. Denn wenn jeder von ihnen zehn<br />
Männern meines Heeres gewachsen wäre, dann verlange ich, dass Du mit zwanzig fertig<br />
wirst. Nur so hat deine Behauptung ihre Richtigkeit. Wenn aber Leute von der Art und Größe<br />
wie Du und die anderen Griechen, die mit mir ins Gespräch kommen, sich derart rühmen, so<br />
sieh zu, dass nicht solche Reden offenbar nur Prahlerei sind. Lass uns doch einmal dies mit<br />
aller Wahrscheinlichkeit betrachten: Wie könnten 1.000, 10.000 oder 50.000, die alle gleich<br />
frei sind und nicht dem Befehl eines einzigen gehorchen, einem so großen Heer
widerstehen? ... Hätten sie nach unserer Art einen einzigen Gebieter, würden sie sich<br />
vielleicht aus Furcht vor ihm über ihre Natur hinaus tapfer zeigen und unter Geißelhieben<br />
vielleicht trotz ihrer kleineren Zahl auch einen überlegenen Gegner angreifen. Aber ihrem<br />
eigenen Belieben überlassen, tun sie sicherlich nichts von alledem. Ich selbst glaube sogar,<br />
dass die Griechen schwerlich gegen die Perser allein kämpfen würden, selbst wenn sie ebenso<br />
stark an Zahl wären. Was Du von den Griechen behauptest, das gilt nur für uns Perser, und<br />
auch da nicht häufig, sondern ganz selten. Es gibt nämlich unter meinen Lanzenträgern ein<br />
paar, die es mit drei Griechen zugleich aufnehmen. Weil Du sie nicht kennst, deswegen redest<br />
du soviel Unsinn.“<br />
Freiheit <strong>als</strong> Voraussetzung für Würde<br />
Herodot (7, 135 - 136): Freiheitsliebe der Spartaner:<br />
Man muss den Mut dieser Männer bewundern und nicht weniger die Worte, die sie gesprochen<br />
haben. Auf der Reise nach Susa kamen sie zu Hydarnes. Er war ein Perser von<br />
Geburt und Feldherr über alles Volk an Asiens Küste. Der nahm sie gastfreundlich auf und<br />
bewirtete sie. Während des Essens fragte er sie: „Männer aus Lakedaimon, warum sträubt Ihr<br />
euch, Freunde des Königs zu werden? Ihr seht doch an mir und meiner Geltung, wie der<br />
König es versteht, wackere Männer zu ehren. Ihr geltet bei ihm <strong>als</strong> tapfere Leute. Wenn auch<br />
Ihr euch <strong>als</strong>o dem König ergäbet, dann könnte jeder von Euch griechisches Land beherrschen,<br />
das der König euch geben würde." Darauf antworteten sie folgendes: „ Hydarnes, Dein Rat an<br />
uns geht nicht von der gleichen Erfahrung aus; das eine nur hast Du erprobt und rätst es uns,<br />
das andere aber kennst du nicht. Du verstehst das eine: Sklave zu sein; von der Freiheit aber<br />
hast Du noch nicht erfahren, ob sie süß ist oder nicht. Hättest Du sie gekostet, Du würdest uns<br />
raten, nicht nur mit der Lanze, sondern auch mit Beilen um sie zu kämpfen.“ So antworteten<br />
sie dem Hydarnes. Als sie von dort nach Susa gelangten und dem König vor die Augen traten,<br />
weigerten sie sich, vor ihm niederzufallen und ihn fußfällig zu verehren.<br />
Menschliches Verhalten in lebensbedrohlichen Krisen<br />
Thukydides (2, 47 - 53): Über den Pest - Ausbruch in Athen während des Peloponnesischen<br />
Krieges:<br />
So wurden die Toten beigesetzt in diesem Winter, und mit seinem Ende war das erste Jahr<br />
dieses Krieges abgelaufen. Gleich mit Beginn des Sommers fielen die Peloponnesier und ihre<br />
Verbündeten mit zwei <strong>Dr</strong>itteln ihrer Macht, wie das erstemal, in Attika ein, geführt von<br />
Archidamos, Zeuxidamos' Sohn, König von Sparta, lagerten sich und verwüsteten das Land.<br />
Sie waren noch nicht viele Tage in Attika, <strong>als</strong> in Athen zum ersten Male die Seuche (Pest)<br />
ausbrach. Es hieß, sie habe schon vorher mancherorts eingeschlagen, bei Lemnos und anderwärts,<br />
doch nirgends wurde eine solche Pest, ein solches Hinsterben der Menschen berichtet.<br />
Nicht nur die Ärzte waren mit ihrer Behandlung zunächst machtlos gegen die unbekannte<br />
Krankheit, ja, da sie am meisten damit zu tun hatten, starben sie am ehesten selbst, aber auch<br />
jede andere menschliche Kunst versagte: alle Bittgänge zu den Tempeln, Weissagungen und<br />
was sie dergleichen anwandten, half alles nichts, und schließlich ließen sie davon ab und ergaben<br />
sich in ihr Unglück. Sie (die Seuche) begann zuerst, so heißt es, in Äthiopien oberhalb<br />
Ägyptens und stieg dann nieder nach Ägypten, Libyen und in weite Teile von des Großkönigs<br />
Land. In die Stadt Athen brach sie plötzlich ein und ergriff zunächst die Menschen im Piräus,<br />
weshalb auch die Meinung aufkam, die Peloponnesier hätten Gift in die Brunnen geworfen
(denn Quellwasser gab es dort dam<strong>als</strong> noch nicht). Später gelangte sie auch in die obere Stadt,<br />
und da starben die Menschen nun erst recht dahin. Mag nun jeder darüber sagen, Arzt oder<br />
Laie, was seiner Meinung nach wahrscheinlich der Ursprung davon war und welchen Ursachen<br />
er eine Wirkung bis in solche Tiefe zutraut; ich will nur schildern, wie es war; nur die<br />
Merkmale, an denen man sie am ehesten wiedererkennen könnte, um dann Bescheid zu<br />
wissen, wenn sie je noch einmal hereinbrechen sollte, die will ich darstellen, der ich selbst<br />
krank war und selbst andere leiden sah. Es war jenes Jahr, wie allgemein festgestellt wurde, in<br />
bezug auf die anderen Krankheiten grade besonders gesund. Wer schon vorher ein Leiden<br />
hatte, dem ging es immer über in dieses, die andern aber befiel ohne irgendeinen Grund<br />
plötzlich aus heiler Haut zuerst eine starke Hitze im Kopf und Rötung und Entzündung der<br />
Augen, und innen war sogleich alles, Schlund und Zunge, blutigrot, und der Atem, der<br />
herauskam, war sonderbar und übelriechend. Dann entwickelte sich daraus ein Niesen und<br />
Heiserkeit, und ziemlich rasch stieg danach das Leiden in die Brust nieder mit starkem<br />
Husten. Wenn es sich sodann auf den Magen warf, drehte es ihn um, es folgten Entleerungen<br />
der Galle auf all die Arten, für die die Ärzte Namen haben, und zwar unter großen Qualen,<br />
und die meisten bekamen dann ein leeres Schlucken, verbunden mit einem heftigen Krampf,<br />
der bei einigen <strong>als</strong>bald nachließ, bei anderen auch erst viel später. Wenn man von außen<br />
anfasste, war der Körper nicht besonders heiß, noch auch bleich, sondern leicht gerötet, blutunterlaufen<br />
und bedeckt von einem dichten Flor kleiner Blasen und Geschwüre; aber innerlich<br />
war die Glut so stark, dass man selbst die allerdünnsten Kleider abwarf und es nicht anders<br />
aushielt <strong>als</strong> nackt und sich am liebsten in kaltes Wasser gestürzt hätte. Viele von denen,<br />
die keine Pflege hatten, taten das auch und zwar in die Brunnen infolge des unstillbaren<br />
Durstes. Es war kein Unterschied, ob man viel oder weniger trank. Und die ganze Zeit quälte<br />
man sich in der hilflosen Unrast und Schlaflosigkeit. Solange die Krankheit auf ihrer Höhe<br />
stand, fiel auch der Körper nicht zusammen, sondern widerstand den Schmerzen über Erwarten.<br />
Entweder gingen daher die meisten am neunten oder siebten Tag zugrunde an der inneren<br />
Hitze, ohne ganz entkräftet zu sein, oder sie kamen darüber weg, und dann stieg das Leiden<br />
tiefer hinab in die Bauchhöhle und bewirkte dort starke Blähungen, wozu noch ein wässriger<br />
Durchfall auftrat, so dass die meisten später an diesem starben, vor Erschöpfung. Denn das<br />
Übel durchlief von oben her, vom Kopfe, wo es sich zuerst festsetzte, den ganzen Körper, und<br />
hatte einer das Schlimmste überstanden, so zeigte sich das am Befall seiner Gliedmaßen: denn<br />
nun schlug es sich auf Schamteile, Finger und Zehen, und viele entrannen mit deren Verlust,<br />
manche auch mit dem der Augen. Andere hatten beim ersten Aufstehen rein alle Erinnerung<br />
verloren und kannten sich selbst und ihre Angehörigen nicht mehr. Denn die unfaßbare Natur<br />
der Krankheit überfiel jeden mit einer Wucht über Menschenmaß, und insbesondere war dies<br />
ein klares Zeichen, dass sie etwas anderes war <strong>als</strong> alles Herkömmliche: die Vögel nämlich<br />
und die Tiere, die an Leichen gehen, rührten entweder die vielen Unbegrabenen nicht an, oder<br />
sie fraßen und gingen dann ein. Zum Beweis: es wurde ein deutliches Schwinden solcher<br />
Vögel beobachtet; man sah sie weder sonst noch bei irgendeinem Fraß, wogegen die Hunde<br />
Spürsinn zeigten für die Wirkungen wegen der Lebensgemeinschaft mit den Menschen.<br />
So <strong>als</strong>o war diese Seuche, von mancher Besonderheit abgesehen, worin der eine sie vielleicht<br />
etwas anders erfuhr <strong>als</strong> ein anderer, aber doch in ihrer Gesamtform. Sonst litt man zu jener<br />
Zeit an keiner von den gewöhnlichen Krankheiten, wenn aber doch eine vorkam, so endete sie<br />
immer in jene. Die einen starben, wenn man sie liegen ließ, die anderen auch bei der besten<br />
Pflege. Und ein sicheres Heilmittel wurde eigentlich nicht gefunden, das man zur Hilfe hätte<br />
anwenden müssen - was dem einen genützt hatte, das schadete einem andern - auch erwies<br />
sich keine Art von Körper nach seiner Kraft oder Schwäche <strong>als</strong> gefeit dagegen, sondern alle<br />
raffte es weg, auch die noch so gesund gelebt hatten. Das Allerärgste an dem Übel war die<br />
Mutlosigkeit, sobald sich einer krank fühlte (denn sie überließen sich sofort der Verzweiflung,<br />
so dass sie sich innerlich viel zu schnell selbst aufgaben und keinen Widerstand leisteten), und<br />
dann, dass sie bei der Pflege einer am anderen sich ansteckten und wie die Schafe hinsanken;
daher kam hauptsächlich das große Sterben. Wenn sie nämlich in der Angst einander mieden,<br />
so verdarben sie in der Einsamkeit, und manches Haus wurde leer, da keiner zu pflegen kam;<br />
gingen sie aber hin, so holten sie sich den Tod, grad die, die Charakter zeigen wollten - diese<br />
hätten sich geschämt, sich zu schonen, und besuchten ihre Freunde; wurden doch schließlich<br />
sogar die Verwandten stumpf gegen den Jammer der Verscheidenden, vor der Übergewalt des<br />
Leides. Am meisten hatten immer noch die Geretteten Mitleid mit den Sterbenden und Leidenden,<br />
weil sie alles voraus wussten und selbst nichts zu fürchten hatten; denn zweimal<br />
packte es den gleichen nicht, wenigstens nicht tödlich. Diese wurden glücklich gepriesen von<br />
den anderen und hatten auch selbst seit der Überfreude dieses Tages eine hoffnungsvolle<br />
Leichtigkeit für alle Zukunft, <strong>als</strong> könne sie keine andere Krankheit je mehr umbringen.<br />
Zu all dieser Not kam noch <strong>als</strong> größte <strong>Dr</strong>angsal das Zusammenziehen von den Feldern in die<br />
Stadt, zumal für die Neugekommenen. Denn ohne Häuser, in stickigen Hütten wohnend in der<br />
Reife des Jahres, erlagen sie der Seuche ohne jede Ordnung: die Leichen lagen übereinander,<br />
sterbend wälzten sie sich auf den Straßen und halbtot um alle Brunnen, lechzend nach<br />
Wasser. Die Heiligtümer, in denen sie sich eingerichtet hatten, lagen voller Leichen der an<br />
geweihtem Ort Gestorbenen; denn die Menschen, völlig überwältigt vom Leid und ratlos, was<br />
aus ihnen werden sollte, wurden gleichgültig gegen Heiliges und Erlaubtes ohne Unterschied.<br />
Alle Bräuche verwirrten sich, die sie sonst bei der Bestattung beobachteten; jeder begrub, wie<br />
er konnte. Viele vergaßen alle Scham bei der Beisetzung, aus Mangel am Nötigsten, nachdem<br />
ihnen schon so viele vorher gestorben waren: sie legten ihren Leichnam auf einen fremden<br />
Scheiterhaufen und zündeten ihn schnell an, bevor die wiederkamen, die ihn geschichtet<br />
hatten, andere warfen auf eine schon brennende Leiche die, die sie brachten, oben darüber und<br />
gingen wieder. Überhaupt kam in der Stadt die Sittenlosigkeit erst mit dieser Seuche richtig<br />
auf. Denn mancher wagte jetzt leichter seinem Gelüst zu folgen, das er bisher unterdrückte, da<br />
man in so enger Kehr die Reichen, plötzlich Sterbenden, tauschen sah mit den früher Besitzlosen,<br />
die miteins deren Gut zu eigen hatten, so dass sie sich im Recht fühlten, rasch jedem<br />
Genuss zu frönen und zu schwelgen, da Leib und Geld ja gleicherweise nur für den einen Tag<br />
seien. Sich vorauszuquälen um ein erwähltes Ziel war keiner mehr willig bei der Ungewissheit,<br />
ob man nicht, eh man es erreiche, umgekommen sei; aber alle Lust im Augenblick und<br />
was gleichviel woher, dafür Gewinn versprach, das hieß nun ehrenvoll und brauchbar. Da war<br />
keine Schranke mehr, nicht Götterfurcht, nicht Menschengesetz; für jenes kamen sie zum<br />
Schluss, es sei gleich, fromm zu sein oder nicht, nachdem sie ohne Unterschied so viele hinsterben<br />
sahen, und für seine Vergehen gedachte keiner den Prozess noch zu erleben und die<br />
entsprechende Strafe zu zahlen; viel schwerer hänge die über ihnen, zu der sie bereits verurteilt<br />
seien, und bevor die auf sie niederfalle, sei es nur recht, vom Leben noch etwas zu<br />
genießen.
3.3. Johann Wolfgang von Goethe:<br />
Die Legenden über einen Gelehrten namens Faust erlangten durch ein Volksbuch aus dem 16.<br />
Jahrhundert ernorme Bekanntheit und verbreiteten sich in ganz Europa. Bereits vor Goethe,<br />
aber auch zu seinen Lebzeiten wurde der Stoff häufig adaptiert, d.h. viele Schriftsteller ließen<br />
sich durch die Vorlage zu eigenen Werken inspirieren. Offensichtlich beflügelte die Geschichte<br />
eines Gelehrten, der die Begrenztheit seines Wissens überwinden will, indem er<br />
einen Pakt mit dem Teufel schließt, die Phantasie der Schriftsteller.<br />
Auch Goethe <strong>als</strong> umfassend gebildeter Schriftsteller konnte sich dieser Faszination nicht<br />
entziehen. Der Fauststoff bewegte ihn bereits während seiner Studienjahre. Eine erste Version<br />
seines <strong>Dr</strong>amas Faust verfasste er während der Phase des ‚Sturm und <strong>Dr</strong>ang‘ in den 1770er<br />
Jahren. Diese erste Version schrieb er im Laufe der Zeit um und erweiterte sie, bis er 1806<br />
„Faust, der Tragödie erster Teil” veröffentlichte. Kurz vor seinem Tode stellte Goethe „Faust,<br />
der Tragödie zweiter Teil” fertig. Das Werk erschien posthum 1832.<br />
Nur wenige Menschen bringen es fertig, sich aus freien Stücken über einen derart langen<br />
Zeitraum für etwas zu begeistern und zu motivieren, das sie <strong>als</strong> sinnstiftende Lebensaufgabe<br />
begreifen. Von diesen Wenigen gibt es noch wenigere, die mit einer derartigen Sprachbegabung<br />
versehen sind wie Goethe. Und von diesen Wenigen wiederum sind es noch wenigere,<br />
denen vergleichbare Bildung und Wissbegier eigen ist. Diese Umstände bilden wichtige Berührungspunkte<br />
des Fauststoffs mit dem Leben Goethes.<br />
Einem hochbegabten und äußerst produktiven Schriftsteller wie Goethe war das Streben nach<br />
Vollendung alles andere <strong>als</strong> fremd. Um sie zu erreichen, schreckte er nicht vor der ein oder<br />
anderen Rücksichtslosigkeit gegen sich selbst und andere zurück. Gerade in dieser Charaktereigenschaft<br />
offenbart sich das sprichwörtlich gewordene faustische Wesen, welches zuweilen<br />
das Höchste um den Preis des Niederen zu erreichen trachtet. In einem noch umfassenderen<br />
Sinne erkennt man das Streben nach Vollendung darin, dass Goethe ein Werk hinterlassen<br />
wollte, wie es die Welt noch nicht gesehen hatte.<br />
Wäre der Faust aber nur eine verlängerte Biographie Goethes, er wäre heute kaum einer Erwähnung<br />
wert. „Der Faust ist die gewaltigste Dichtung in unserer Sprache.”, schreibt Dietrich<br />
Schwanitz in seinem Buch: „Bildung. Alles, was man wissen muss.” Vieles rechtfertigt dieses<br />
Urteil. Die Sprache des Faust bringt in einem eingängigen, zeitlosen, aber stets kunstvollen<br />
Deutsch durchdringende Einsichten zum Ausdruck. Davon zeugen die vielen berühmt gewordenen<br />
Faustzitate. Doch auch inhaltlich besticht das Werk. Faust erzählt die Krise eines Gelehrten,<br />
aber auch die Überwindung derselben durch die Einsicht in die eigene Begrenztheit,<br />
die nicht zur Resignation, sondern zur Zufriedenheit führt.<br />
Goethe zeichnet im ersten Teil einen ungenügsamen Faust, der weder mit seinen Forschungen<br />
noch mit seinem Privatleben zufrieden ist. Diese Situation nutzt Mephistopheles aus und<br />
bietet ihm einen Pakt an. Mephistopheles verspricht Faust, seinen Selbstzweifeln abzuhelfen<br />
und ihn zufrieden zu stellen, wenn dieser ihm seine Seele verpfändet. Sobald Faust zum<br />
Augenblicke sagen soll, „Verweile doch, du bist so schön”, darf der Teufel sich seiner Seele<br />
bemächtigen. Im Kontrast zu dieser düsteren Verbindung steht im ersten Teil der Tragödie die<br />
unschuldige junge Frau namens Gretchen, in die sich Faust verliebt. Faust bedient sich bei<br />
seinem Werben um Gretchen der diabolischen Hilfe. Dies hat tragische Folgen. Gretchen<br />
verliert ihre Unschuld, Faust tötet ihren Bruder, und das im Grunde herzensgute Mädchen<br />
wird zur Kindsmörderin.<br />
Im zweiten Teil erleben wir Faust <strong>als</strong> Machthaber, der mit der Zeit lernt, von Mephistopheles<br />
unabhängiger zu werden, indem er sich seine Kenntnisse über die Natur und den Menschen<br />
zunutze macht. Somit emanzipiert sich Faust Schritt für Schritt von Mephistopheles, indem er<br />
sich von fremder Leitung und Einflüsterung frei macht und sich bei seinem Wirken auf seine<br />
eigenen Fähigkeiten besinnt. So lernt Faust, sich selbst zu akzeptieren und sein Streben auf<br />
realistische Ziele zu richten. Faust verleiht ganz am Ende diesem Gefühl Ausdruck. Bereits
erblindet, hört er das Geräusch von Arbeitern. Er glaubt, dass diese im Begriff seien, nach<br />
seinen Plänen einen Küstenstreifen <strong>als</strong> Bauland zu erschließen. In Wahrheit jedoch schaufeln<br />
sie sein Grab. Faust erschaut das Prinzip des Lebens, das für ihn darin besteht, tagtäglich um<br />
die Freiheit zu ringen, die man erst in diesem Kampf um sie erwerben könne. Dieses Prinzip<br />
lehrt ihn die Demut vor seinem irdischen Dasein und lässt ihn nicht mehr resignieren. Vielmehr<br />
ist er beseelt, weil er nun weder das Unmögliche erstrebt noch sich dem haltlosen<br />
Müßiggang überlässt. Dieses Prinzip gefunden, sieht er sich selbst im Angesicht des Höchsten<br />
und sein Leben in den Dienst der Guten Sache gestellt und überwindet damit auch die Angst<br />
der eigenen Endlichkeit, denn diese fügt sich ein in die Ewigkeit, ist eine Spur in ihr, die nicht<br />
vergehen wird. Es ist ein Vorgefühl auf die Unendlichkeit und das Glück, das Prinzip des<br />
Schönen, Guten und Wahren erblickt zu haben, was ihn zu dem Ausspruch bringt, dass er im<br />
Vorgefühl solchen Glücks sagen könnte: „Verweile doch, du bist so schön.”<br />
Obwohl Faust den Konjunktiv seinem Ausspruch voranstellt, sieht der Teufel den Vertrag<br />
erfüllt und will seine Seele holen. Doch die Engel erretten Faustens Seele. Sie begründen die<br />
Errettung von Faustens Seele mit den Worten: „Wer stetig strebend sich bemüht, den können<br />
wir erlösen.”<br />
Diese knappe Zusammenfassung kann nur einen unzulänglichen Eindruck von diesem Werk<br />
geben. Faust lotet das Höchste und das Tiefste der menschlichen Existenz aus. Die niederen<br />
Instinkte, der pure Egoismus spielen im Faust ebenso eine Rolle wie das Streben nach dem<br />
Edlen, Schönen und Guten. Entfaltet wird dieser Kampf von den zwei Seelen in einer Brust<br />
vor dem Hintergrund der europäischen Geistesgeschichte. Goethe war der Ansicht, dass alles<br />
Gescheite bereits gedacht worden sei und die Aufgabe der Dichter und Denker darin bestehe,<br />
es variierend noch einmal auszudrücken. Im Faust hat Goethe vieles Geistreiche noch einmal<br />
gedacht und in Literatur verwandelt.<br />
Wer mehr erfahren möchte, der nehme am besten eine kommentierte Ausgabe von Goethes<br />
Faust zur Hand und lese. Es lohnt sich.<br />
Von Marco Schäfer
3.4. Thomas Mann:<br />
Thomas Mann war ein Schriftsteller, der früh erwachsen werden musste. Der Tod seines<br />
Vaters fiel in seine Jugendzeit. Daraufhin erlebte die Familie den Verkauf des väterlichen<br />
Geschäftes. Es müssen diese Erfahrungen und die Selbsterkenntnis, dass er nicht zum Kaufmann<br />
geboren war, sondern eher die musischen Begabungen seiner Mutter geerbt hatte,<br />
gewesen sein, die, verbunden mit einem unbändigen Ehrgeiz und Arbeitseifer, den 22jährigen<br />
veranlassten, den mehrere hundert Seiten umfassenden Roman „Die Buddenbrooks”<br />
zu schreiben, für den er im Jahre 1929 mit dem Nobelpreis für Literatur ausgezeichnet wurde.<br />
Bei Buddenbrooks handelt es sich, wie der Untertitel verrät, um den Verfall einer Familie.<br />
Der Roman erzählt über vier Generationen hinweg vom Leben einer Lübecker Kaufmannsfamilie.<br />
Johann Buddenbrook, der Ältere, steht noch für den ungebrochenen Aufstiegswillen des aufstrebenden<br />
Bürgertums. Sein Sohn Jean Buddenbrook, auch Konsul Buddenbrook genannt, ist<br />
bereits gespaltener in seiner teilweise verstiegenen Religiosität und Naivität gegenüber seiner<br />
Umwelt. Auch hat er nicht immer den Überblick über die Finanzen seines Unternehmens.<br />
Sein Sohn Thomas Buddenbrook übernimmt zwar die Geschäfte nach dem Tod des Vaters mit<br />
Disziplin und Zuversicht und schafft es dadurch gute Umsätze zu machen, aber er heiratet<br />
eine holländische Künstlerin, die ihm einen schwächlichen Sohn schenkt. Außerdem gelingt<br />
es ihm nach und nach immer weniger seine todessüchtigen Gedanken aus seinem Kopf zu<br />
vertreiben.<br />
Sein Bruder Christian ist ein Bohemien und Müßiggänger, den der Bruder nur loswird, indem<br />
er ihm sein Erbe ausbezahlt. Die Schwester Tony ist ein einfältiges Ding, das zweimal den<br />
f<strong>als</strong>chen Mann heiratet. Nachdem Thomas Buddenbrook an einem Schlaganfall stirbt, bleibt<br />
nur noch sein Sohn Hanno Buddenbrook, der den Namen weitervererben könnte. Doch der<br />
letzte männliche Nachfahre der Buddenbrooks stirbt im jugendlichen Alter. Zeitgleich mit<br />
dem Niedergang der Familie Buddenbrook vollzieht sich der Aufstieg der konkurrierenden<br />
und rücksichtslosen Familie Hagenström.<br />
Liest man eine Zusammenfassung dieser Geschichte, so wird man sich vielleicht fragen,<br />
worin das besondere dieses Romans bestehe. Thomas Mann war dies selbst nach eigenen<br />
Aussagen zunächst nicht klar, weil er nur über das geschrieben hatte, was er aus eigener<br />
Anschauung kannte, natürlich nicht ohne es stark zu fiktionalisieren. Für diese realistische<br />
Verfahrensweise mag auch sprechen, dass nach dem Erfolg des Romans in Lübeck Listen<br />
kursierten, mit deren Hilfe die fiktiven Figuren des Romans ihren tatsächlichen Vorbildern<br />
zugeordnet werden konnten.<br />
Sind die Buddenbrooks <strong>als</strong>o nur ein historischer Roman mit Lokalkolorit. Nein, das Buch ist<br />
einer der ersten deutschen Romane von Weltrang. In ihr wird die Befindlichkeit einer<br />
deutschen Kaufmannsfamilie im Deutschland des 19. Jahrhunderts exemplarisch erzählt. Die<br />
Virtuosität, mit der dies geschieht, verblüfft angesichts der jungen Jahre des Autors. Thomas<br />
Mann zeichnet ein präzises Sittenbild, indem er den Figuren Vielstimmigkeit verleiht. So<br />
spricht zum Beispiel die Konsulin Buddenbrook Niederdeutsch, gespickt mit französischen<br />
Floskeln, um ihre guten Sitten zu bezeugen. Eine weitere in seinem späteren Werk immer<br />
wieder anzufindende literarische Technik verwendet Thomas Mann bereits in den Buddenbrooks.<br />
Er setzt Leitmotive ein, die er über den gesamten Roman hinweg anklingen lässt. Somit<br />
werden die einzelnen Szenen und Charaktere auf scheinbar natürliche Weise miteinander<br />
verknüpft. Ein weiteres Stilmittel, das Thomas Mann sein Leben lang beibehalten wird, findet<br />
in seinem ersten Roman bereits Eingang, es ist die Ironie. Der Erzähler verfährt nicht wie ein<br />
Richter mit seinen Figuren, denen er ihre Verfehlungen vorhält, sondern schildert deren<br />
Schwächen mit feiner Ironie.<br />
Von Marco Schäfer
3.5. Franz Kafka:<br />
Franz Kafka war im Gegensatz zu beispielsweise Thomas Mann ein Schriftsteller, der einer<br />
geregelten Tätigkeit nachging, solange sein Gesundheitszustand dies zuließ, denn der Schriftsteller<br />
litt an der zu Beginn des 20. Jahrhunderts noch unheilbaren Krankheit Tuberkulose.<br />
Als Angestellter einer Versicherung in Prag ging er tagsüber seinem Beruf nach und schrieb<br />
häufig nachts.<br />
Kafka war im Gegensatz zu Thomas Mann kein realistischer Autor, aber trotzdem entstand<br />
sein Werk, insbesondere der Prozess, in der Auseinandersetzung mit der Lebenswirklichkeit<br />
seiner Zeit. Im Prozess schreibt Kafka über eine sich verselbstständigende Bürokratie, in welcher<br />
der Mensch aufgerieben wird. Der Prozess beginnt mit folgendem berühmt gewordenen<br />
Satz: „Jemand musste Josef K. verleumdet haben, denn ohne dass er etwas Böses getan hätte,<br />
wurde er eines Morgens verhaftet.” Dieser erste Satz nimmt bereits jene Verstörung vorweg,<br />
die den Roman durchzieht. Josef K. ist sicher, unschuldig zu sein und dies auch beweisen zu<br />
können, wird aber immer wieder verunsichert. Selbst der Leser kann nicht entscheiden, ob<br />
sich die Hauptfigur tatsächlich etwas zu Schulden kommen lassen hat oder nicht. Jedenfalls<br />
scheint sich ein Netz von Verdächtigungen um Josef K. zu schließen, das ihn selbst an seiner<br />
Unschuld zweifeln lässt. Die Paranoia wird noch dadurch verstärkt, dass er Vorladungen erhält<br />
und <strong>als</strong> Angeklagter behandelt wird, aber wieder gehen, ja sogar seinen Beruf weiterhin<br />
ausüben darf. Kein einziges Mal wird offen ausgesprochen, was der Angeklagte sich habe zu<br />
Schulden kommen lassen.<br />
Kafka hat mit seinem Werk eine Parabel auf eine entmenschlichte Bürokratie geschrieben, die<br />
willkürlich zuschlägt. Wenn wir von einer anonymen Bürokratie sprechen, so nennen wir sie,<br />
wenn sie besonders krasse Auswüchse annimmt in Anlehnung an den berühmten Autoren<br />
‚kafkaesk‘. Vergleichen wir die Stimmung dieses Romans mit den Aufzeichnungen von politisch<br />
verfolgten Autoren des 20. Jahrhunderts, so finden wir in dem Roman bereits eine beklemmende<br />
Vorwegnahme. Die Welt wirkt normal, ist aber für den Verfolgten aus den Fugen<br />
geraten.<br />
Wer mehr über diese zugegebenermaßen düstere Stimmung erfahren will, der lese „Der<br />
Prozess”.<br />
Von Marco Schäfer
4. Bildung:<br />
4.1. Einleitung:<br />
Was ist Bildung?<br />
Mit dieser Frage sollte sich jeder irgendwann einmal auseinandersetzen. Daher sollen nachfolgend<br />
einige Überlegungen angestellt werden, was wir uns unter dem Begriff ‚Bildung‘ vorstellen.<br />
Aber schon an dieser Stelle sei betont, dass wir nicht beanspruchen, in dieser – wie<br />
auch in anderen Fragen – die Weisheit für uns sozusagen ‚gepachtet zu haben‘, um es einmal<br />
umgangssprachlich auszudrücken. Dennoch meinen wir, einen wichtigen Beitrag zu diesem<br />
so zentralen Thema liefern zu können, welcher wohlbegründet ist. Wir laden zudem alle<br />
Interessierten herzlich ein, uns Verbesserungsvorschläge zu unterbreiten. Wir sind immer<br />
gerne bereit dazuzulernen.<br />
Nun aber zur Frage ‚Was ist Bildung?‘. Es soll hier ein sehr berühmtes Zitat von Immanuel<br />
Kant am Anfang stehen:<br />
Es geht dabei um die Frage ‚Was ist Aufklärung?‘<br />
„Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit”.<br />
Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu<br />
bedienen. Selbstverschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn die Ursache derselben nicht im<br />
Mangel des Verstandes, sondern der Entschließung und des Mutes liegt, sich seiner ohne<br />
Leitung eines anderen zu bedienen. Sapere Aude! Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes<br />
zu bedienen! ist <strong>als</strong>o der Wahlspruch der Aufklärung.“<br />
Diese grandiosen Sätze von einem der größten Philosophen der Menschheitsgeschichte stehen<br />
mit Bedacht am Anfang dieser Erörterungen, weil sie in ihrer Tiefe wie Prägnanz zu diesem<br />
Thema unübertroffen sind! Das Wort ‚Aufklärung‘ – so wie es Kant erläutert hat – deckt<br />
vieles von dem ab, das wir in unserem Projekt ‚Bildung‘ in die Tat umzusetzen versuchen.<br />
Kant weist die Leser seiner Worte zunächst einmal darauf hin, dass der Mensch prinzipiell<br />
dazu in der Lage ist, einen selbständigen Gebrauch von seinem Verstande zu machen, aber<br />
aus der historischen Perspektive heraus gesehen, viele Menschen eben dies in viel zu geringem<br />
Ausmaße tun und dies ganz wesentlich an ihrer eigenen Trägheit liegt. Es ist ja auch viel<br />
bequemer, schon alles vorgefertigt serviert zu bekommen, <strong>als</strong> sich selber Mühe zu geben.<br />
Doch diese Bequemlichkeit hat einen hohen Preis: Die Selbstentmündigung! Daher verbindet<br />
Kant seine Erklärung des in Rede stehenden Begriffes ‚Aufklärung‘ mit der besagten<br />
Aufforderung, den Mut zu haben, sich seines Verstandes selbständig zu bedienen.<br />
Dieser Aufforderung schließen wir uns – <strong>als</strong> Betreiber dieses Port<strong>als</strong> ‚Bildung‘ – nur allzu<br />
gerne an und hoffen auf eine rege Beteiligung an unserem Projekt. Denn Bildung beginnt mit<br />
dem Willen, sich seines Verstandes selber zu bedienen. Zunächst ist <strong>als</strong>o die eigene Trägheit<br />
zu überwinden. Warum führt aber eine solche Trägheit, eine solche Bequemlichkeit zur vorhin<br />
bereits formulierten Selbstentmündigung? Ganz einfach: Wenn ich andere für mich denken<br />
lasse, weil ich selbst in vielen Fällen zu faul bin, mir die Welt mit meinen eigenen Möglichkeiten<br />
selbständig zu erschließen, dann tun dies eben andere für mich. Und indem ich<br />
mich immer stärker daran gewöhne, verliere ich mehr und mehr die Möglichkeit, mir ein<br />
eigenes Bild von der Welt machen zu können. Ich werde Schritt für Schritt abhängiger von<br />
jenen, die für mich denken, da ich selber diese Fähigkeit mangels Übung immer mehr verliere.<br />
Denn der Verstand bedarf, genauso wie der Körper, eines regelmäßigen Trainings, um<br />
fit zu bleiben. Je mehr ich meine Fähigkeiten verliere, desto höher wird meine Abhängigkeit<br />
von anderen, bis ich dann kaum oder gar nicht mehr in der Lage bin, ein selbstbestimmtes
Leben zu führen. Daher ist der erste, unbedingt erforderliche Schritt zur Bildung der Wille<br />
dazu. Ich muss mich dazu entschließen, meinen Verstand regelmäßig selbständig zu nutzen,<br />
ihn zu hegen und zu pflegen. Obwohl dies teilweise durchaus mit Anstrengung verbunden ist,<br />
so wird man dafür reichlich belohnt werden, indem man feststellt, welch großes Universum<br />
sich einem mit entsprechender Bildung erschließt. Man begibt sich durch die Aneignung von<br />
Bildung auf eine Reise, auf welcher man auf so viel Neues und Interessantes stößt, wie man<br />
es sich vorher nicht einmal erträumt hat. Die Welt erscheint uns viel reichhaltiger, weil wir<br />
ohne entsprechende Bildung einfach vieles gar nicht wahrnehmen bzw. überhaupt erst gar<br />
nicht wahrnehmen können. Daher möchten wir allen Menschen nur zurufen: Macht eigenständigen<br />
Gebrauch von Eurem Verstand. Lasst Euch nicht hängen, strengt Euch an, und Ihr<br />
werdet für diese Anstrengung reich belohnt werden. Habt keine Angst, denn Bildung tut<br />
nicht weh!<br />
Die Beantwortung der Frage ‚Was ist Bildung?‘ hängt <strong>als</strong>o zunächst einmal mit dem Willen<br />
eines jeden zusammen, von seinem Verstand einen eigenständigen Gebrauch zu machen.<br />
Denn dieser Wille zur Selbstaufklärung ist die wichtigste Voraussetzung für Bildung, wie<br />
wir sie hier verstanden wissen wollen. Es ist diese bejahende Haltung, sich Bildung aneignen<br />
zu wollen, verbunden mit der Erkenntnis, dass man nur so ein möglichst selbstbestimmtes<br />
Leben führen kann, die am Anfang unserer Überlegungen hier so ausdrücklich in den Vordergrund<br />
gerückt wird.<br />
Ist Bildung gleich Wissen? Nicht nur, aber auch! Wissen kann man viel, aber was ist wirklich<br />
wichtig – für mich und unsere Welt? Mit dem Eintritt durch dieses Portal ist bereits ein erster<br />
Schritt getan, denn hier werden Wege aufgezeigt, Wichtiges von weniger Wichtigem oder gar<br />
Unwichtigem zu unterscheiden. Wer diesen Pfaden weiter folgt, der wird über Wissen zu Einblicken<br />
in die Bildung gelangen. Bildung ist einerseits mehr <strong>als</strong> Wissen und andererseits weniger<br />
<strong>als</strong> Wissen. Weniger <strong>als</strong> Wissen, weil vieles nicht wissenswert ist. Mehr <strong>als</strong> Wissen, gerade<br />
weil Bildung lehrt, was wirklich wichtig ist. Dennoch erreicht man ohne entsprechende<br />
Wissensgrundlagen niem<strong>als</strong> Bildung. In diesem Portal findet man einige dieser Grundlagen.<br />
Indem man die Angebote dieser Seite nutzt, lernt man Vorgehensweisen und Begründungen<br />
kennen und anwenden, um sich im Informationsdschungel – einem verwirrenden Überangebot<br />
von angeblich Wissenswertem – orientieren zu können.<br />
Etwas ganz Entscheidendes, das uns Bildung <strong>als</strong>o erst ermöglicht, ist die eigenständige und<br />
damit selbstbestimmte Orientierung in dieser Welt, auf dass wir sie nach eigenen Plänen erkunden,<br />
uns Ziele setzen und diese – zumindest teilweise – auch wirklich erreichen, weil wir<br />
in der Lage sind, unsere Zielvorstellungen mit den dafür notwendigen Mitteln in einen vernünftigen<br />
Einklang zu bringen. Damit wir uns erfolgreich in dieser Welt bewegen können,<br />
d.h. in einem möglichst hohen Maße unsere selbst gesteckten Ziele auch wirklich erreichen,<br />
bedarf es einer dementsprechenden Bildung. Denn erst sie befähigt uns – wie oben bereits<br />
ausgeführt – Wichtiges von weniger Wichtigem oder gar Unwichtigem zu unterscheiden,<br />
damit wir uns beispielsweise keine unrealistischen Ziele setzen, weil wir unsere eigenen<br />
Möglichkeiten f<strong>als</strong>ch eingeschätzt haben, so dass uns durch fehlende Kenntnisse von vornherein<br />
viele Wege verschlossen bleiben. Nun wollen wir uns einigen konkreten Wissensbereichen<br />
zuwenden, die für die angesprochene Orientierung von entscheidender Bedeutung<br />
sind:<br />
Heute bestimmen maßgeblich zwei große Wissensbereiche unsere Welt: Das sind zum einen<br />
Naturwissenschaften und Technik sowie zum anderen die Wirtschaftswissenschaften. Beide<br />
bedienen sich bei der Konstruktion ihrer Modellvorstellungen der Mathematik, die somit gewissermaßen<br />
zu beiden Blöcken dazugehört. Niemand Ernstzunehmender wird die Relevanz<br />
dieser Bereiche bestreiten, so dass eine nähere Begründung, warum diese hier aufgeführt werden,<br />
nicht erfolgen muss. Doch Bildung beschränkt sich keineswegs nur hierauf! Ebenfalls<br />
sind beispielsweise Sprachen und ihre Pflege, Literatur, Geschichte oder Philosophie von<br />
entscheidender Bedeutung, um sich orientieren und anderen mitteilen zu können. Gerade
geisteswissenschaftliche Erkenntnisse vermögen den intellektuellen Horizont entscheidend zu<br />
erweitern und können einseitigem wie kurzsichtigem Denken erfolgreich entgegenwirken. Es<br />
mangelt leider bei vielen am Verständnis dafür, wie wichtig z.B. Kenntnisse auf Gebieten wie<br />
Geschichte, Philosophie, Latein oder Altgriechisch sind. Sie werden meist nur <strong>als</strong> unsinniger<br />
Ballast angesehen, vielleicht auch deshalb, weil die meisten mit solchem Bildungsgut kaum<br />
noch in Berührung gekommen sind und daher dessen Wert, aufgrund dieses intellektuellen<br />
Defizits, gar nicht mehr erkennen können. Gerade das sehr mangelhafte historische Wissen<br />
führt mit zu dem sehr häufig kurzfristig ausgerichteten Denken und zwar nicht nur in der Politik.<br />
Aber allein die Geschichte ermöglicht uns eine Orientierung, und jeder, der ohne sie auf<br />
die Zukunft blickt, ist wie ein Blatt im Wind, das von den Zufällen und Moden des Tages mal<br />
in die eine, mal in die andere Richtung getrieben wird, ohne überlegt und selbstbewusst einen<br />
eigenen Standpunkt einzunehmen. Denn nur wer weiß, wo er herkommt, findet einen guten<br />
Weg in die Zukunft. Diese Herkunft und das eigene Wissen um sie helfen ganz entscheidend<br />
bei der eigenen Identitätsfindung, die dann auf einem soliden Fundament ruht und nicht ziellos<br />
von Ereignis zu Ereignis flüchtet, ohne Halt zu finden. Eine so verstandene Bildung beschränkt<br />
sich keineswegs auf das sture Einpauken von Stoffmengen, sondern ist sinnstiftend<br />
aufgrund ihrer rational reflektierten sowie emotional engagierten Hinwendung zur eigenen<br />
Kultur und ihren Wurzeln.<br />
Man könnte hierzu noch sehr viel mehr schreiben und natürlich auch noch andere Gebiete wie<br />
Kunst oder Musik erörtern. Doch wir wollen es bei diesen Ausführungen der gebotenen Kürze<br />
halber belassen.<br />
Nun kommen wir noch darauf zu sprechen, auf welche Weise man sich denn Bildung aneignen<br />
kann und soll. Zunächst einmal gehört das Lesen und auch teilweise Auswendiglernen<br />
von Grundlegendem dazu. Wenn ich eine Sprache lernen will, muss ich die Vokabeln und die<br />
Grundlagen der Grammatik lernen, sonst klappt es nicht. Ebenfalls muss ich Texte in dieser<br />
Sprache lesen und mich in ihr mit anderen unterhalten, um sie wirklich zu beherrschen. Neben<br />
dem Auswendiglernen kommt <strong>als</strong>o die praktische Anwendung hinzu. Das gilt natürlich nicht<br />
nur für Sprachen, sondern genauso z.B. für die Mathematik, weil ich nach dem ersten Verstehen<br />
einer Formel nur durch das Lösen vieler verschiedener Aufgaben mehr Sicherheit und<br />
teilweise auch neue Erkenntnisse gewinne. Ebenfalls lerne ich viel mehr über das Thema<br />
‚Wirtschaft‘, wenn ich über das unverzichtbare Studium von Theorien hinaus mit anderen diskutiere.<br />
Ich muss dann meine Meinung mit Fakten und Argumenten begründen, will ich von<br />
den anderen Diskussionsteilnehmern ernst genommen werden. Aber gerade hierdurch lerne<br />
ich nicht nur sehr viel besser, mir die wirtschaftlichen Theorien und Zusammenhänge einzuprägen,<br />
sondern eben darüber hinaus das angesprochene Diskutieren, das Formulieren der<br />
eigenen Überzeugungen und die Akzeptanz einer Widerlegung der eigenen Meinung durch<br />
bessere Argumente meiner Mitdiskutanten.<br />
Manch einer wird an dieser Stelle vielleicht geradezu vor Erfurcht erstarren und sich selber<br />
sagen: Das kann ich doch gar nicht alles lernen, alles beherrschen. Und daraufhin mag er an<br />
dieser Stelle dann doch den Mut verlieren, sich seines eigenen Verstandes ohne Leitung eines<br />
anderen zu bedienen, weil ihm die Hürden dafür <strong>als</strong> viel zu hoch erscheinen mögen. Doch hier<br />
können wir Entwarnung geben: Es ist weder möglich noch erforderlich in allen genannten Gebieten<br />
Spezialkenntnisse zu besitzen. Denn gerade Bildung bedeutet, zwischen wirklich<br />
Wichtigem, weniger Wichtigem oder gar Unwichtigem unterscheiden zu können. Für jeden<br />
Beruf gibt es natürlich ein dazugehöriges Spezialwissen, welches nur die dort Tätigen<br />
beherrschen müssen. Das kann man von allen anderen nicht erwarten, allein schon weil es<br />
schlicht unmöglich wäre. Dennoch gibt es einige Grundlagen, die man über das eigene berufliche<br />
Fachgebiet hinaus beherrschen muss, um sich in der oben erläuterten Weise in der Welt<br />
möglichst selbstbestimmt orientieren und bewegen zu können. Und über je mehr Bildung man<br />
in diesem Sinne verfügt, desto eher gelingt es, ein derart selbstbestimmtes Leben zu führen.
4.2. Einige Gedanken zum deutschen Schulsystem:<br />
Anmerkungen zu unserem Schulsystem<br />
Die Bildung 32 der Bürger einer Gesellschaft stellt einen ganz entscheidenden Faktor für das<br />
Funktionieren einer Demokratie sowie einer freien, marktwirtschaftlich orientierten Ökonomie<br />
dar. Dieses Faktum muss am Anfang in aller Deutlichkeit zum Ausdruck gebracht werden!<br />
Wie sieht es nun damit in Deutschland aus? Nicht erst seit der PISA – Studie war allen, die es<br />
wissen wollten, klar, dass es mit unserer Schulausbildung nicht zum Besten steht. Aufgrund<br />
meiner beruflichen Tätigkeit im privaten Unterrichtswesen kann ich viele Klagen von Eltern,<br />
Lehrkräften an Schulen, Professoren und Unternehmern nur bestätigen, welche sich über vielfältige<br />
Bildungsrückstände beklagen: Es mangelt häufig an elementarstem Textverständnis,<br />
der Fähigkeit, eigenen Gedanken eine schriftlich akzeptable Form zu geben sowie daran, die<br />
Grammatik des Deutschen oder diejenige einer zu erlernenden Fremdsprache zu memorieren<br />
und selbständig anzuwenden. Darüber hinaus fehlt vielen Schülern ein mathematisch-naturwissenschaftliches<br />
Grundverständnis ebenso wie eine auch nur rudimentär ausgebildete historische<br />
oder politische Allgemeinbildung. An dieser Stelle sollen einige Beispiele aufgeführt<br />
werden, die bei Haupt- und Re<strong>als</strong>chülern fast durchgängig und bei Gymnasiasten noch durchaus<br />
häufig anzutreffen sind: 33<br />
1. die Unterscheidung zwischen Aktiv und Passiv fällt vielen sehr schwer,<br />
2. der korrekte Gebrauch der Konjunktive im Deutschen ist bei fast allen Schülern<br />
jeden Schultyps so gut wie gar nicht anzutreffen,<br />
3. selbst in der zehnten Klasse können die meisten Re<strong>als</strong>chüler den Inhalt einfacher<br />
literarischer Texte nicht zusammenfassen, geschweige denn auch nur ansatzweise<br />
interpretieren; es ist ein immenses Defizit beim verstehenden Umgang mit Texten<br />
zu beklagen,<br />
4. ebenfalls beherrschen fast alle Re<strong>als</strong>chüler in der zehnten Klasse nicht einmal<br />
halbwegs die korrekte Bildung und den Gebrauch der Tempora im Englischen,<br />
wobei vielen, auch nach mehrmaligem Erklären, grammatikalische Zusammenhänge<br />
nicht dauerhaft zu vermitteln sind,<br />
5. einfachste mathematische Grundlagen sind sehr vielen Schülern ein ‚Buch mit sieben<br />
Siegeln’, so dass z.B. die Regeln der Bruchrechnung nicht bekannt sind, das<br />
Auflösen einfachster Terme nicht eigenständig bewältigt wird oder gelernte Regeln<br />
gar selbständig auf etwas andere Aufgabentypen übertragen werden können;<br />
6. die historisch-politische Allgemeinbildung muss für alle Schultypen in den höheren<br />
Klassen <strong>als</strong> vollkommen katastrophal bezeichnet werden, wobei eine solche<br />
gerade für eine demokratische Gesellschaft von ganz entscheidender Bedeutung<br />
ist; so wissen die meisten so gut wie gar nichts über die europäische Antike oder<br />
das Mittelalter und selbst so wichtige neuzeitliche Themen der deutschen Geschichte<br />
wie beispielsweise die Revolution von 1848 sind völlig unbekannt; hinsichtlich<br />
der politischen Allgemeinbildung mangelt es fast allen Schülern an<br />
elementarsten Grundkenntnissen, so dass sie weder Personen wie Adenauer oder<br />
Brandt richtig einzuordnen noch die parteipolitische Zusammensetzung der<br />
Bundes- oder gar der Landesregierungen zu benennen vermögen; desweiteren<br />
werden politisch relevante Themen und die Stellung der Parteien dazu i.d.R.<br />
überhaupt gar nicht zur Kenntnis genommen, wodurch bei fast keinem großen<br />
32 Unter Bildung ist, neben einer gewissen Wissensbasis, der eigenständige Umgang mit jener sowie eine damit<br />
einhergehende Fähigkeit der selbständigen Weltinterpretation im kantisch-aufklärerischen Sinne zu verstehen.<br />
(Vgl. auf diesem Portal: ‚Über unser Projekt’, Unterpunkt ‚Bildung’)<br />
33 Diese Aussage basiert auf meiner persönlichen Erfahrung, den Berichten von Unternehmern, Professoren<br />
sowie in meinem Institut arbeitenden Lehrkräften, welche z.T. auch an staatlichen Schulen tätig sind.
gesellschaftlichen Problem auch nur der Hauch einer Ahnung bei den meisten<br />
anzutreffen ist.<br />
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass fast alle Haupt- und Re<strong>als</strong>chüler sowie viele<br />
Gymnasiasten nach all meinen Erfahrungen ganz erhebliche Wissenslücken in zentralen<br />
Bildungsbereichen aufweisen und zudem das abstrakt-logische Denkvermögen völlig unzureichend<br />
ausgebildet ist.<br />
Die Hauptschulen sind insbesondere in Großstädten zumeist nur noch Restschulen für sehr<br />
leistungsschwache Schüler 34 , welche den Leistungsanforderungen im heutigen Berufsleben<br />
i.d.R. nicht mehr gewachsen sind. Aber auch sehr viele Re<strong>als</strong>chüler weisen so gravierende<br />
Bildungs- wie Verständnisrückstände auf, dass sie kaum noch für moderne Büroberufe geeignet<br />
sind. Selbst die theoretischen Anforderungen im Handwerk oder zur Facharbeiterausbildung<br />
stellen für viele eine unüberwindliche Hürde dar. Schließlich weisen auch die Gymnasiasten<br />
viele Schwächen in den genannten Bereichen auf, wobei hier allerdings angemerkt<br />
werden muss, dass es neben vielen schlechten und mittelmäßigen auch gute Gymnasien gibt,<br />
wo das Niveau im allgemeinen akzeptabel oder sogar gut ist. Die Integrierten Gesamtschulen<br />
sind leider häufig nur etwas bessere Hauptschulen und das dort mögliche Abitur ist vom<br />
Niveau her nicht befriedigend. Diese Schulform kann so, wie sie zurzeit in Deutschland vielfach<br />
umgesetzt wird, nicht <strong>als</strong> ein wirklich gelungenes Experiment bezeichnet werden. Damit<br />
möchte ich allerdings nicht behaupten, dass die Grundidee einer Gesamtschule in jedem Fall<br />
schlecht ist. Es kommt darauf an, wie sie konkret umgesetzt wird. Dies beweisen einige Gesamtschulen,<br />
die ich selber etwas näher kennengelernt habe. Dort trifft man auf engagierte<br />
Schulleitungen wie Lehrkräfte, die sich wirklich bemühen, Schüler entsprechend ihrer individuellen<br />
Fähigkeiten zu fördern und dabei vielfältige, lobenswerte Projekte ins Leben rufen<br />
oder begleiten. Dies gilt natürlich ebenso für Schulleitungen und Lehrkräfte der anderen<br />
Schulformen. Leider findet man aber auch viele Negativbeispiele von unmotivierten Lehrerinnen<br />
und Lehrern ebenfalls in allen Schulformen, wodurch das Ansehen des Lehrerberufes<br />
insgesamt in Deutschland erheblichen Schaden erlitten hat.<br />
Neben den bisher aufgeführten Schwächen kommt noch die Uneinheitlichkeit der jeweiligen<br />
Abschlüsse hinzu, d.h. dass das Abitur bzw. die Abschlussnote nur wenig Aussagekraft<br />
besitzt, weil das Niveau nicht nur zwischen den Bundesländern, sondern sehr viel mehr<br />
zwischen den einzelnen Schulen variiert. Diese Defizite setzen sich naturgemäß auf den<br />
Universitäten fort, wo von den Professoren häufig völlig zu Recht eine mangelnde Studierfähigkeit<br />
der Studenten beklagt wird. Dies musste ich schon während meines Studiums feststellen<br />
und zeigt sich heute in noch weit größerem Ausmaß bei vielen Lehrkräften, die sich<br />
bei meinem Institut bewerben. In einer Reihe von Studienfächern wird darauf leider mit einer<br />
z.T. drastischen Herabsetzung der wissenschaftlichen Standards reagiert, so dass man z.B.<br />
Germanistik ohne Lateinkenntnisse studieren kann, in Fächern wie Soziologie, Pädagogik<br />
oder Politik antike Autoren ohne jedwede Griechischkenntnisse behandelt und Hausarbeiten<br />
teilweise ohne wissenschaftlichen Anmerkungsapparat abgefasst werden. Die Liste der Versäumnisse<br />
ließe sich problemlos fortsetzen, wobei neben den genannten Fächern insbesondere<br />
in den Sprachwissenschaften das abstrakt-logische Denkvermögen bei vielen sehr zu<br />
wünschen übrig lässt. Eine obligatorische Einführung in die Grundstrukturen der formalen<br />
Logik für alle Studenten mit einer entsprechenden Prüfung nach dem ersten Semester könnte<br />
hier viel bewirken.<br />
Aufgrund der aufgeführten Mängel in unserem Schulsystem, welche naturgemäß auch auf die<br />
Hochschulen auswirken, hilft allein mehr Geld in das System zu geben kaum weiter. Nur bei<br />
gleichzeitig erfolgenden grundlegenden Reformen können die durchaus notwendigen zusätz-<br />
34 Die Gründe des Zurückbleibens der Schüler sind vielfältig, wobei häufig ein Migrationshintergrund verbunden<br />
mit mangelnder Integration der Eltern in unsere Gesellschaft anzutreffen ist oder aber zerrüttete Familienverhältnisse<br />
vorliegen. Darüber hinaus können sicherlich noch weitere Gründe aufgeführt werden. Wie auch immer,<br />
die Kinder aus solchen Elternhäusern sind leider extrem benachteiligt.
lichen Finanzmittel auch wirklich greifen. Nachfolgend will ich nun einige dringend vorzunehmende<br />
Korrekturen vorschlagen:<br />
1. Jedes Halbjahr müssten bundesweit in jedem Fach, jeden Schultyps sowie jeder<br />
Jahrgangsstufe gleiche Prüfungen für alle durchgeführt werden, um wirklich vergleichbare<br />
Bildungsstandards zu ermöglichen. Im föderalistischen System sollte<br />
dabei der Weg, wie man die erstrebten Leistungsniveaus erreicht, den Ländern<br />
bzw. sogar den Schulen überlassen bleiben. Dies wäre ein wirklich sinnvoller<br />
Wettbewerb im Gegensatz zur heutigen Situation, wo eine Note an sich fast gar<br />
keine Aussagekraft mehr besitzt und deshalb z.B. die Unternehmen umfangreiche<br />
Einstellungstests vornehmen. In einem solchen Wettbewerb kristallisierte sich<br />
dann sehr schnell heraus, wer, mit welchen Mitteln, welche Erfolge erzielt, so dass<br />
unverbesserlichen Bildungsideologen, die unser Bildungssystem infolge des weitgehenden<br />
Leistungsverzichts so sehr heruntergewirtschaftet haben, jegliche Legitimationsgrundlage<br />
entzogen werden würde.<br />
2. Bei der inhaltlichen Ausgestaltung der bundesweit gültigen Bildungsstandards<br />
müssen für die Schüler zu erreichende Kernkompetenzen in den Fächern Deutsch,<br />
Fremdsprachen, Mathematik, Naturwissenschaften, Geographie und Geschichte<br />
festgelegt werden, welche zum Teil deutlich über dem jetzigen Niveau zu liegen<br />
haben, wobei natürlich nur eine sukzessive Erhöhung realisierbar ist. Es ist hierbei<br />
darauf zu achten, dass, neben einem auf jeden Fall zu erlernenden Faktenwissen,<br />
insbesondere problemorientiertes, selbständiges Lösen von Aufgaben eingeübt und<br />
in diesem Zusammenhang logisch-abstraktes Denken gefördert wird, welches nicht<br />
nur im mathematisch-naturwissenschaftlichen Bereich, sondern ebenso beim verstehenden<br />
Umgang mit Texten von entscheidender Bedeutung ist. Darüber hinaus<br />
sind die Fähigkeiten im sprachlichen Ausdruck deutlich zu verbessern.<br />
3. Eine Ganztagesbetreuung der Schüler, <strong>als</strong> fakultatives Angebot, ist sowohl aus<br />
schulischen <strong>als</strong> auch gesamtgesellschaftlichen Gründen, wie der besseren Vereinbarkeit<br />
von Familie und Beruf, zu etablieren. Außerdem sind die vielen Ferienzeiten<br />
einzuschränken: Es sollten wie bisher sechs Wochen Sommerferien und<br />
knapp drei Wochen Weihnachtsferien beibehalten werden. Alle anderen sind ersatzlos<br />
zu streichen. So gäbe es mehr dringend notwendige Unterrichtszeit, und<br />
zudem würde das Schulhalbjahr nicht so oft unterbrochen, wodurch der Lernfluss<br />
merklich gestört wird. Eine diesbezügliche Privilegierung der zumeist auch noch<br />
beamteten Lehrer ist in keiner Weise gerechtfertigt!<br />
4. Der auch im Jahr 2009 noch vorherrschende Beamtenstatus bei Lehrern, insbesondere<br />
in den alten Bundesländern, ist abzuschaffen. Stattdessen soll für Lehrer das<br />
gleiche wie für viele andere Beschäftigte in der freien Wirtschaft gelten, nämlich<br />
dass sie nach Leistung bezahlt werden und bei nachgewiesenem Versagen natürlich<br />
auch kündbar sind. Die Leistungskontrolle erfolgt über die selbstverständlich<br />
schulextern organisierten zentralen staatlichen Prüfungen, die für alle Schüler<br />
gleich sind, so dass dann leicht festzustellen ist, wie gut die Schüler in einer Klasse<br />
abgeschnitten haben. Dies wirkt sich dann entsprechend auf die Bezahlung des für<br />
das Fach verantwortlichen Lehrers aus. Allerdings muss natürlich bei einem solchen<br />
Verfahren darauf geachtet werden, aus welchen sozialen Milieus die Schüler<br />
kommen, damit es gerecht zugeht. So hielte ich es für sinnvoll, wenn in einer<br />
Klasse, in welcher ein Großteil der Schüler aus einem sozial benachteiligten Viertel<br />
stammt, weil beispielsweise viele einen Migrationshintergrund aufweisen,<br />
einem Lehrer nur halb soviel Schüler <strong>als</strong> üblich zugeteilt oder andere Hilfestellungen<br />
gewährt werden würden. Außerdem kann man in solchen Fällen die leistungsbezogene<br />
Entlohnung an Verbesserungen der Schüler ausrichten; hier sind<br />
viele, auch für die betroffenen Lehrkräfte, gerechte Lösungen vorstellbar. In
diesem Zusammenhang möchte ich betonen, dass durch derartige Reformen für<br />
engagierte Lehrer durchaus deutliche Gehaltsverbesserungen denkbar sind. Eine<br />
solche Vorgehensweise wäre viel gerechter im Vergleich zur derzeitigen Situation<br />
in Deutschland: Alle Lehrkräfte einer Gehaltsstufe an staatlichen Schulen erhalten<br />
zurzeit die gleiche Entlohnung unabhängig von ihrer Leistung. Zudem sind selbst<br />
die angestellten Lehrkräfte praktisch unkündbar. Da muss man sich nicht wundern,<br />
dass einige – ich betone ausdrücklich einige – es sich bequem machen und einen<br />
dementsprechend schlechten Unterricht zum Schaden der Schüler durchführen.<br />
Ebenfalls werden dann häufig alle Lehrkräfte in der öffentlichen Diskussion in<br />
einen Topf geworfen und beispielsweise <strong>als</strong> ‚faule Säcke’ beschimpft. Damit tut<br />
man den vielen engagierten Lehrerinnen und Lehrern allerdings unrecht. Infolgedessen<br />
läge eine leistungsbezogene Entlohnung gepaart mit externer Kontrolle und<br />
Transparenz sowie entsprechender öffentlicher Anerkennung engagierter Lehrkräfte<br />
sowohl ganz in deren Interesse <strong>als</strong> auch natürlich insbesondere in demjenigen<br />
der Schüler.<br />
5. Zum hier diskutierten Bildungsbereich gehört aber auch der vorschulische im Kindergarten.<br />
Hier sollten die Kleinen auf jeden Fall gelernt haben, richtig deutsch zu<br />
sprechen, damit sie dann in der Grundschule dem Unterricht wirklich folgen<br />
können. Darüber hinaus sind viele sinnvolle pädagogische Konzepte denkbar,<br />
welche die Neugier der Kinder zur selbständigen, intellektuellen Erfassung und<br />
Interpretation ihrer Umwelt fördern.<br />
Falls diese Reformen umgesetzt werden würden, wären wir schon einen sehr großen Schritt<br />
weiter. Nur durch eine hohe Qualität auch und gerade in der Bildung ist ein Hochlohnland wie<br />
Deutschland international konkurrenzfähig. Wenn hier nicht radikal umgesteuert wird, sägen<br />
wir weiter an dem Ast, auf dem wir sitzen. Der Wohlstand eines rohstoffarmen Landes wie<br />
dem unseren lässt sich nur mithilfe weit überdurchschnittlicher Bildung aufrechterhalten, und<br />
dies ist ausschließlich durch entsprechende Leistung erreichbar. Das muss allen klar sein, sowohl<br />
den Finanz- <strong>als</strong> auch Bildungspolitikern wie den Studenten, Schülern und Eltern. Bei<br />
alldem soll hier nochm<strong>als</strong> die heilsame Wirkung des Wettbewerbsprinzips hervorgehoben<br />
werden, denn nur hierdurch sind wünschenswerte Leistungen zu erzielen, die letztlich nicht<br />
nur dem Einzelnen, sondern der gesamten Gesellschaft zugute kommen. An dieser Stelle<br />
möchte ich aber ausdrücklich betonen, dass Bildung keineswegs auf technisch-ökonomisch<br />
verwertbares Wissen – so wichtig es auch ist – reduziert werden darf. Gerade geisteswissenschaftliche<br />
Erkenntnisse vermögen den intellektuellen Horizont entscheidend zu erweitern<br />
und können einseitigem wie kurzsichtigem Denken wirkungsvoll entgegenwirken. Es mangelt<br />
bei vielen am Verständnis dafür, wie wichtig z.B. Kenntnisse auf Gebieten wie Geschichte,<br />
Philosophie, Latein oder Altgriechisch sind. Sie werden meist nur <strong>als</strong> unsinniger Ballast angesehen,<br />
vielleicht auch deshalb, weil die meisten mit solchem Bildungsgut kaum noch in<br />
Berührung gekommen sind und daher dessen Wert, aufgrund dieses intellektuellen Defizits,<br />
gar nicht mehr erkennen können. Gerade das sehr mangelhafte historische Wissen führt mit zu<br />
dem sehr häufig kurzfristig ausgerichteten Denken und zwar nicht nur in der Politik. Aber<br />
allein die Geschichte ermöglicht uns eine Orientierung, und jeder, der ohne sie auf die Zukunft<br />
blickt, ist wie ein Blatt im Wind, das von den Zufällen und Moden des Tages mal in die<br />
eine, mal in die andere Richtung getrieben wird, ohne überlegt und selbstbewusst einen eigenen<br />
Standpunkt einzunehmen. Denn nur wer weiß, wo er herkommt, findet einen guten Weg<br />
in die Zukunft. Diese Herkunft und das eigene Wissen um sie helfen ganz entscheidend bei<br />
der eigenen Identitätsfindung, die sich dann auf einem soliden Fundament befindet und nicht<br />
ziellos von Ereignis zu Ereignis flüchtet, ohne Halt zu finden. Eine so verstandene Bildung<br />
beschränkt sich keineswegs auf das sture Einpauken von Stoffmengen, sondern ist<br />
sinnstiftend aufgrund ihrer rational reflektierten sowie emotional engagierten Hinwendung zur
eigenen Kultur und ihren Wurzeln. Aber gerade hier sind in Deutschland immense Defizite<br />
bei den meisten Schülern, Auszubildenden und Studenten auszumachen. Dies zeigt sich nicht<br />
zuletzt am gleichgültigen Umgang mit der eigenen Muttersprache. Es liegt beispielsweise im<br />
Trend, unreflektiert Anglizismen zu verwenden und zwar sehr häufig an Stellen, wo sie<br />
überhaupt keinen Sinn ergeben. Die Identifikation mit dem eigenen Land, seiner Geschichte<br />
und Kultur stellt einen ganz entscheidenden Faktor bei der Schaffung der notwendigen<br />
Solidarität innerhalb einer Gesellschaft dar, ohne welche sie auf Dauer nicht zu überleben<br />
vermag. Sie ist der vielzitierte unverzichtbare Kitt zur langfristigen Erhaltung eines jeden<br />
zivilisierten Staates, welcher eben nicht durch schiere Macht despotisch seine Untertanen<br />
zusammenhält, sondern auf einer moralisch legitimen Kulturvorstellung basiert, die von den<br />
ihn konstituierenden Staatsbürgern mit Herz und Verstand aus freiem Entschluss geteilt wird.<br />
Am Schluss dieses Abschnitts möchte ich noch kurz auf die Verantwortung jedes Einzelnen<br />
für seine eigene Bildung eingehen. Obgleich natürlich dem staatlichen Bildungssystem eine<br />
entscheidende Rolle in allen Fragen der Bildung zufällt, so muss sich jeder auch aus eigenem<br />
Willen heraus dieser Herausforderung stellen. Inwieweit jemand beschließt, sich Bildung anzueignen,<br />
hängt in erster Linie von ihm selbst ab. Wer <strong>als</strong>o meint, diese Verantwortung ausschließlich<br />
auf die Gesellschaft abwälzen zu können, begeht einen schweren Fehler und zwar<br />
nicht nur hinsichtlich seiner moralischen Verpflichtung eben jener Gesellschaft, sondern auch<br />
sich selbst gegenüber. Es ist historisch bis in die Gegenwart hin erwiesen, dass diejenigen, die<br />
sich dieser Herausforderung engagiert gestellt und die entsprechenden Konsequenzen für sich<br />
gezogen sowie einen dementsprechenden Aufstiegswillen bewiesen haben, zu den Gewinnern<br />
zählen und die anderen eben zu den Verlierern. Dies sei allen ‚Gutmenschen’ ins Stammbuch<br />
geschrieben, die mit f<strong>als</strong>chem Verständnis für die ach so schwierige Lage der zu Betreuenden<br />
bevormundenden Maßnahmen das Wort reden, anstatt Eigeninitiative einzufordern. Mit ihrem<br />
selbstgerechten und völlig verfehlten ‚Gutmenschentum’ erzeugen sie immensen Schaden und<br />
zwar sowohl für die Adressaten ihres vermeintlichen Verständnisses <strong>als</strong> auch für die Gesellschaft<br />
<strong>als</strong> Ganzes. Wir können unser derzeitiges Wohlstandsniveau nur durch entsprechende<br />
Leistung erhalten und durch sonst gar nichts! Wer die dafür notwendige Leistungsbereitschaft<br />
durch ideologisch motivierte Propaganda untergräbt, verhält sich zutiefst<br />
unmoralisch und schadet auf unverantwortliche Weise dem gesamten Gemeinwesen.<br />
Niemand darf aus seiner Eigenverantwortung hinsichtlich des eigenen Aufstiegswillens,<br />
gegründet auf Bildung, entlassen werden!
4.3. Zumeist ein Trauerspiel: Wie Politiker(innen), Parteien sowie deren Jugendorganisa-<br />
tionen und die Parteistiftungen auf konstruktive Vorschläge und Initiativen zum Thema<br />
‚Bildung’ reagieren:<br />
Die Politiker und natürlich auch Politikerinnen betonen in ihren Sonntagsreden unter anderem<br />
immer wieder folgende drei Punkte:<br />
1. Bildung, Bildung und nochm<strong>als</strong> Bildung: Davon hängt die Zukunft unseres Landes ab<br />
2. Die Bürger – insbesondere auch junge Menschen – sollten sich an der politische Diskussion<br />
beteiligen, denn nur dadurch entsteht eine lebendige Demokratie.<br />
3. Ehrenamtliches Engagement ist sehr wichtig für unsere Gesellschaft.<br />
Diese oft gehörten Worte im Ohr dachten wir – neben mir engagieren sich auch andere Menschen<br />
(vor allem Schüler und Studenten) in den von mir ins Leben gerufenen Aktivitäten –<br />
auf offene Türen zu stoßen, weil all unsere Projekte zumindest zwei jener drei Punkte abdecken.<br />
Anfangs gestaltet sich auch alles einigermaßen positiv: Bundes- wie Landtagsabgeordnete<br />
verschiedener Parteien empfingen uns in ihren Sprechstunden und hörten freundlich<br />
zu. Uns antworteten sogar auf eine Frage zur Vermögenssteuer – wenn auch erst nach einigem<br />
Nachfragen und im Ablauf eines halben Jahres – alle Bundestagsfraktionen. Aber <strong>als</strong> wir den<br />
Dialog mit den Parteien, deren Jugendorganisationen sowie den parteinahen Stiftungen ernsthaft<br />
aufnehmen wollten, blockten alle, wirklich alle Parteien und deren Vertreter ab. Sie<br />
hatten und haben bis heute kein wirkliches Interesse sich mit Bürgern konstruktiv über politische<br />
Fragen auszutauschen. Die Bekundungen in ihren Sonntagsreden haben sich nicht nur<br />
einmal <strong>als</strong> hohl und verlogen erwiesen! Leider!! Aber lesen Sie selbst, was sich wirklich so<br />
zugetragen hat, wie es auf dieser Seite beschrieben wird. Das alles kann ich anhand von E-<br />
Mails mit Inhalt und Datum beweisen. Die Politiker können sich dabei nicht mehr herausreden!<br />
Der interessierte Leser in sollte dabei die Mühe nicht scheuen, auch eine E-Mail von<br />
ein paar Seiten Länge zu lesen. Denn erst dadurch erschließt sich der ganze Skandal.<br />
Aber zunächst der positive Beginn unserer Aktionen:<br />
Im Jahr 2008 organisierte ich ehrenamtlich ‚Wirtschaftsarbeitsgemeinschaften’. Dort können<br />
sich Schülerinnen und Schüler mit Themen aus der Wirtschaft beschäftigen. Der Ablauf ist im<br />
Prinzip folgender: Ich erkläre etwas aus diesem Bereich und beziehe damit zugleich Position,<br />
d.h. dass ich meine Meinung darlege und begründe sowie anschließend zur Diskussion stelle.<br />
In diese Diskussion wollten wir auch die politischen Parteien, die Gewerkschaften, Unternehmensverbände<br />
sowie den Bund der Steuerzahler mit einbeziehen, um ganze verschiedene<br />
Auffassungen einschließlich deren Begründungen miteinander vergleichen zu können. So<br />
stelle ich mir einen aufgeklärten demokratischen Diskurs vor. Nachdem ich den Schülern<br />
meine Position zur ‚Vermögenssteuer’ dargelegt hatte (s.u. Punkt 5.9.1. Irrtum 1) schrieben<br />
wir <strong>als</strong>o alle Bundestagsfraktionen, den DGB, den Verband der Familienunternehmer sowie<br />
den Bund der Steuerzahler zu dieser Frage an und baten um eine Stellungnahme. Als erstes<br />
antworteten der Verband der Familienunternehmer sowie der Bunde der Steuerzahler. Wir<br />
erhielten – wenn auch teilweise erst nach mehrmaligem Nachhaken – schließlich auch eine<br />
Antwort vom DGB sowie aus allen Fraktionen der im Bundestag vertretenen Parteien. Dies<br />
alles ist hier unter dem Punkt 5.9.6. nachzulesen.<br />
Nun regten wir an, dass man zukünftig in ganz verschiedenen Punkten die Bildung – insbesondere<br />
von jungen Menschen – betreffend mit den Parteien, deren Jugendorganisationen<br />
sowie den parteinahen Stiftungen konstruktiv zusammenarbeiten könne, ganz so wie sich die<br />
Parteien in ihren offiziellen Verlautbarungen immer wieder vernehmen lassen. Auch die
zuvor angeschriebenen Bundestagsabgeordneten baten wir dabei um ihre Mithilfe. Schließlich<br />
müsste es ja im ganz ureigenen Interesse der Parteien liegen, junge Menschen bei diesem<br />
guten Anliegen zu unterstützen, weil sie so ihre Glaubwürdigkeit unter Beweis stellen und<br />
dadurch vielleicht sogar neue Mitglieder gewinnen könnten. Zumindest aber würden sie junge<br />
Menschen für unsere Demokratie gewinnen!<br />
Die Wirklichkeit war und ist leider eine große Enttäuschung, jedenfalls zumeist. Das frustriert<br />
nicht nur mich, sondern mindestens genauso Schüler wie Studenten. Aber lesen Sie selbst,<br />
was sich zugetragen hat.
4.3.1.<br />
Bildungsportal:<br />
Auf meinem Bildungsportal ging es unter anderem auch darum, dass vor allem junge Menschen<br />
über ganz unterschiedliche politische Fragen mit Vertretern der politischen Parteien,<br />
deren Jugendorganisationen sowie den parteinahen Stiftungen auf lokaler, regionaler oder gar<br />
Bundesebene diskutieren. Das Motto lautet:<br />
Ich habe eine Meinung, begründe diese und stelle sie dann zur Diskussion.<br />
Wir schrieben <strong>als</strong>o alle im Bundestag vertretenen Parteien, deren Jugendorganisationen sowie<br />
die parteinahen Stiftungen an. Zudem telefonierten wir und führten persönliche Gespräche.<br />
Die Reaktion der Politiker bestätigt alle negativen (Vor)Urteile über jene. Leider!<br />
Nachfolgend zunächst unser Anschreiben, das alle oben Erwähnten erhielten:<br />
Schülerförderung Rhein-Main, Inh.: <strong>Dr</strong>. Hans-Dieter <strong>Bottke</strong> Große Bleiche 34-36, 55116 Mainz<br />
E-Post: info@drbottke-bildung.de Internet: www.drbottke-bildung.de<br />
An<br />
Parteien, deren Jugendorganisationen bzw. Stiftungen<br />
Betr.: Bildungsportal<br />
Sehr geehrte Damen und Herren,<br />
die Parteien beklagen häufig das geringe Interesse, insbesondere von Jugendlichen, an der<br />
Politik und rufen immer wieder zu stärkerem Engagement auf: Demokratie lebt vom Mitmachen!<br />
Dies meinen wir auch. Daher laden wir alle demokratischen Parteien, deren Jugendorganisationen<br />
sowie die parteinahen Stiftungen zur Mitwirkung an unserem Portal ganz herzlich<br />
ein.<br />
Wir hoffen und gehen auch davon aus, dass auch Ihre Partei / Jugendorganisation / Stiftung<br />
den eigenen Worten entsprechende Taten folgen lässt und aktiv unser ehrenamtliches Engagement,<br />
welches Bildung und Politik miteinander verbindet, durch aktive Mitarbeit<br />
unterstützen wird. Denn Glaubwürdigkeit gewinnt man nur, indem Handeln und Reden<br />
übereinstimmen.<br />
Unser Bildungsportal basiert auf folgenden Überlegungen:<br />
1. Bildung ist die zentrale Frage für die Zukunft unserer Gesellschaft – denn Bildung<br />
beeinflusst wesentlich die persönliche Entwicklung des Einzelnen und ist äußerst<br />
hilfreich für gesellschaftliches Engagement.<br />
2. Bildung bedeutet für uns bei weitem nicht nur passive Wissensaufnahme, sondern<br />
aktive Mitwirkung verstanden <strong>als</strong> interaktiven Prozess.<br />
3. Wir haben eine Meinung, begründen sie und laden alle Demokraten zur Diskussion<br />
ein.<br />
Wir schlagen Ihnen daher konkret vor, sich an unserem Diskussionsforum / Forum mit<br />
eigenen Beiträgen zu beteiligen. Darüber hinaus stellen wir auch gerne Projekte Ihrer Partei /<br />
Jugendorganisation / Stiftung, die sich mit dem Thema ‚Bildung’ beschäftigen, auf unserer<br />
Seite vor bzw. richten einen Link dazu ein.
Im Anhang befinden sich ganz konkrete Fragen, zu denen wir gerne eine Stellungnahme von<br />
Ihnen hätten, um einen vernunftgeleiteten Diskussionsprozess in Gang zu setzen. Wir werden<br />
Ihre Antworten in diesem Portal veröffentlichen, so dass alle Interessierten ihre Positionen<br />
und Argumentationen nachlesen und natürlich auch kommentieren können. Letzteres ist aber<br />
nur per E-Post möglich, damit wir vor dem Einstellen der Beiträge diese prüfen können.<br />
Weitere Möglichkeiten zur Nutzung und Mitwirkung sowie Gründe dafür, sich an unserem<br />
Projekt zu beteiligen, finden Sie kurz zusammengefasst auf unserer Startseite, u.a. unter dem<br />
Punkt ‚Über das Portal’.<br />
Wir würden uns sehr freuen, bald von Ihnen zu hören. Für eventuelle Rückfragen oder Anregungen<br />
stehen wir Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung.<br />
Mit freundlichen Grüße<br />
i.A. Eva Kriegel<br />
Die Reaktion der Angeschriebenen<br />
Niemand, wirklich niemand der Angeschriebenen wollte sich an diesem sinnvollen Projekt<br />
beteiligen!! Von den meisten erhielten wir – trotz Nachfragens – überhaupt keine Antwort.<br />
Von denen, die sehr, sehr kurz antworteten, erhielten wir gute Wünsche – so auch von der<br />
Bundesbildungsministerin Frau Annette Schavan – aber an einer Mitwirkung sei man nicht<br />
interessiert. Auf unsere Nachfrage, ob es denn viele solcher oder ähnlicher Projekte gebe, an<br />
denen sich die Parteien schon beteiligten und wir zumindest dann mit diesen und den Parteien<br />
zusammenarbeiten könnten, erhielten wir gar keine Antwort mehr.<br />
Wir finden das Verhalten der Politiker skandalös. Sie fordern bei fast jeder Gelegenheit, dass<br />
sich die Bürger doch konstruktiv in die politische Debatte einbringen sollen. Man würde sich<br />
darüber sehr freuen und gerne das offene, sachliche Gespräch mit dem interessierten Bürger<br />
suchen. Wir verließen uns genau darauf und mussten erfahren, dass keine, wirklich keine der<br />
im Bundestag vertretenen Parteien ein Interesse zeigte, sich an das zu halten, was sie uns<br />
immer wieder versichern.<br />
Man kommt muss so den Eindruck gewinnen, dass die Parteien unsere Stimmen bei den<br />
Wahlen gerne haben möchten, unser Steuergeld für ihre Organisationen ebenfalls gerne<br />
nehmen und Posten in vielen Bereichen der Gesellschaft mit ihren Parteifreunden besetzten,<br />
aber das konstruktive Gespräch, die ehrliche Diskussion mit dem Bürger ablehnen. Ihre<br />
wohlklingenden Sonntagsreden sind hohl und verlogen!
4.3.2. Bildungsinitiative ‚Dummheit-nein-danke’:<br />
Die von mir ins Leben gerufene Bildungsinitiative – www.dummheit-nein-danke.de – ist ein<br />
ehrenamtliches Engagement aller daran Beteiligten. Auf der Seite kann man in gebotener<br />
Kürze alles Wissenswerte nachlesen. Es geht unter anderem auch darum, dass Schüler anderen<br />
Schülern helfen und mit untereinander mit meiner Unterstützung über verschiedene<br />
Themen diskutieren und / oder Aktionen starten. Diesbezüglich schrieben wir alle im Landtag<br />
von Rheinland-Pfalz vertretenen Parteien an und / oder telefonierten mit Politikern und Vertretern<br />
deren Jugendorganisationen. Niemand, wirklich niemand ging auf unser Angebot<br />
einer Mitwirkung ernsthaft ein! Die Damen und Herren Politiker und Politikerinnen reden<br />
zwar immer von Bildung, Bildung und nochm<strong>als</strong> Bildung sowie von ehrenamtlichem bürgerlichem<br />
Engagement. Aber wenn man sie beim Wort nimmt, erweisen sich ihre Worte <strong>als</strong> hohl<br />
und verlogen!!<br />
Beispielhaft hierfür ist die Reaktion der SPD-Landtagabgeordneten Frau Brede-Hoffmann.<br />
Zunächst meine E-Mail an die Politikerin (vom 23.06.2010):<br />
Sehr geehrte Frau Brede-Hoffmann,<br />
gerade eben rief mich Frau Künzer an und teilte mir mit, dass Sie meine neue Initiative sehr<br />
gut fänden, aber ich Ihnen noch einmal konkreter erläutern solle, in welcher Form Sie diese<br />
Initiative unterstützen könnten. Ihr Parteifreund - Herr <strong>Dr</strong>. Getahun - engagiert sich bereits in<br />
vorbildlicher Weise für diese Initiative und hofft, dass sich möglichst viele aus der SPD<br />
ebenfalls daran beteiligen. Ihnen möchte ich folgendes ganz konkret vorschlagen:<br />
1. Ich nehme Sie in die Liste derjenigen auf, welche die auf der Seite - www.dummheit-neindanke.de<br />
- vorgestellten Projekte ideell mit ihrem Namen öffentlich unterstützen. Dafür<br />
benötige ich lediglich Ihr Einverständnis, das Sie mir auch einfach per Mail zukommen lassen<br />
können.<br />
2. Sie stimmen auf der Seite oben rechts ab und informieren Bekannte / Parteifreunde usw.<br />
kurz über diese Seite und tun auch dabei Ihre Unterstützung kundt.<br />
3. Wir wenden uns gemeinsam an Mainzer Schulen, um für das Projekt zu werben.<br />
Nachfolgend möchte ich Ihnen nochm<strong>als</strong> kurz zusammengefasst einiges zu dieser Bildungsinitiative<br />
erläutern:<br />
Es u.a. darum, dass Schüler anderen Schülern wichtigen Schulstoff erklären, wobei dies von<br />
mir und meinen Lehrkräften begleitet wird und zwar kostenlos. Am kommenden Montag<br />
beispielsweise stellen Schüler der 8. bzw. 9. Klasse (u.a. Gymnasiasten des Rama und des<br />
Willigis Gymnasiums) Schülern der gleichen Klassenstufe der IGS-Bretzenheim kompliziertere<br />
<strong>Dr</strong>eisatzaufgaben vor, an denen unvorbereitet erfahrungsgemäß die meisten<br />
Abiturienten scheitern. Ich habe den Schülern, welche den anderen dies erklären sollen,<br />
natürlich vorher den Stoff und die Art und Weise der Vermittlung eingehend erklärt.<br />
Unter anderem folgende Ziele sollen damit erreicht werden:<br />
1. Die Schüler, die anderen etwas erklären, eignen sich zunächst selber den Stoff viel genauer<br />
an.
2. Durch das Erklären des Stoffes verbessern sie ihre verbale Ausdrucksfähigkeit.<br />
3. Sie zeigen soziales Engagement, indem sie ihr Wissen nicht für sich behalten, sondern es<br />
ihren Mitschülern weitergeben.<br />
4. Sie erwerben Anerkennung auch bei ihren Mitschülern.<br />
5. Das Lernen verbunden mit dem Erwerb von grundlegendem Wissen und wichtigen Fähigkeiten<br />
erfährt bei allen beteiligten Schülern eine entscheidende Aufwertung und gilt nicht<br />
länger <strong>als</strong> 'uncool'<br />
6. Der fortschreitenden sozialen Segregation wird entgegengewirkt, indem Schüler aus unterschiedlichen<br />
Milieus einander in konstruktiver Weise begegnen und so viel besser die Lebenswirklichkeit<br />
der anderen kennenlernen.<br />
Auf der Seite - www.dummheit-nein-danke.de - können Sie alles weitere noch einmal nachlesen.<br />
Ich würde es sehr begrüßen, wenn ich sie für eine Mitwirkung in Form der drei oben unterbreiteten<br />
Vorschläge gewinnen könnte. Für ein persönliches Gespräch stehe ich Ihnen gerne<br />
zur Verfügung.<br />
Mit freundlichen Grüßen<br />
<strong>Dr</strong>. Hans-Dieter <strong>Bottke</strong><br />
Sehr geehrter Herr <strong>Dr</strong>. <strong>Bottke</strong>,<br />
Antwort von Frau Ulla Brede-Hoffmann kurze Zeit später:<br />
wir hatten ja schon ein Gespräch miteinander geführt.<br />
Ich finde Ihre Ideen sehr interessant.<br />
Allerdings möchte ich AUF KEINEN FALL in einem Unterstützer-Kreis geführt werden. Es<br />
wäre völlig inakzeptabel, wenn ich <strong>als</strong> bildungspolitische Sprecherin meiner Fraktion mich<br />
für Initiativen <strong>als</strong> Unterstützerin zur Verfügung stelle, die sich weiter entwickelt, ohne dass<br />
ich diese Weiterentwicklung begleiten/mitgestalten/kontrollieren kann. Ich kann es u.a. nicht<br />
aus Zeitgründen.<br />
Außerdem hätten dann viele andere aktive Menschen in Rheinland-Pfalz ebenfalls Anspruch<br />
darauf, dass ich mich <strong>als</strong> Unterstützerin für deren Aktivitäten zur Verfügung stelle. Da fehlt<br />
mir Kraft und Zeit, um das entsprechend begleiten, kommentieren und kontrollieren zu<br />
können! All zu schnell unterstützt man Dinge, die man eigentlich selbst nie fordern oder<br />
entwickeln würde.<br />
Daher <strong>als</strong>o ein klares NEIN zu Ihrem ersten Vorschlag.<br />
Auch zu Vorschlag 2 leider ein klares NEIN aus den gleichen genannten Gründen. Das<br />
müssen Sie schon selbst machen!<br />
Auch die Weiterempfehlung an Mainzer Schulen muss ich schon Ihrer Initiative überlassen.<br />
ich möchte Schulen nicht unter <strong>Dr</strong>uck setzen.<br />
Dennoch werde ich Ihre Seite mit Interesse betrachten.<br />
Danke für Ihre Hinweise darauf.<br />
Mit freundlichen Grüßen<br />
Ulla Brede-Hoffmann
Bewertung der Antwort von Frau Brede-Hoffmann:<br />
Die groß geschriebenen Hervorhebungen stammen von Frau Brede-Hoffmann. Damit betont<br />
sie ihre Ablehnung sehr deutlich. Sie schreibt, sie könne diese sinnvolle Initiative nicht einmal<br />
ideell unterstützen, da sie die Entwicklung jener nicht kontrollieren könne. Dann müsste sie<br />
jedem ehrenamtlichen Engagement außerhalb ihrer Partei die Unterstützung versagen. Das<br />
macht das Misstrauen gegenüber uns Bürgern nur allzu deutlich. Selbst die kleinste Form der<br />
Unterstützung – die rechtlich völlig unverbindlich Aufnahme in die Unterstützungsliste dieses<br />
Projektes – verweigerte sie.<br />
Erst recht einer Weiterempfehlung an die Schulen versagte sie sich. Dabei wissen wir alle,<br />
dass vieles alles andere <strong>als</strong> gut läuft an den Schulen. Ein ehrenamtliches Engagement, bei<br />
welchem Schüler angeleitet werden anderen zu helfen, müsste doch jedem Politiker willkommen<br />
sein. Frau Brede-Hoffmann hingegen ‚betrachtet lediglich mit Interesse die Seite’, wie<br />
sie sich ausdrückt. Das ist das Äußerste, was wir von solchen Politikerinnen erwarten können:<br />
Ein interessiertes Betrachten der Bürger und ihrer sinnvollen Aktivitäten. Mehr ist nicht drin!!<br />
Viele Politiker der anderen Parteien aus Rheinland-Pfalz, die ebenfalls zu dieser Initiative angeschrieben<br />
/ angesprochen worden sind, antworteten auf diese Einladung zur Mitwirkung<br />
erst gar nicht. Die politischen Parteien und deren Vertreter entlarven sich durch dieses Verhalten<br />
selbst <strong>als</strong> Menschen, die anders, und zwar ganz anders handeln <strong>als</strong> sie reden. Hier<br />
ist der Beweis schwarz auf weiß nachzulesen! Wahrhaft ein Trauerspiel.
4.3.3. Unentbehrliche Grundlagen im Fach Mathematik: Wie sich Politiker(innen) einer sehr<br />
sinnvollen Initiative verweigern:<br />
Immer mehr Unternehmen klagen darüber, dass es zunehmend schwerer werde, freie Lehrstellen<br />
zu besetzen, weil die Bewerber – und zwar sowohl Schulabgänger mit mittlerer Reife<br />
<strong>als</strong> auch Abiturienten – nicht über notwendige Grundkenntnisse und -fähigkeiten, insbesondere<br />
im Fach Mathematik, verfügen. In Zukunft wird sich dieses Problem aufgrund des demographischen<br />
Wandels (immer weniger junge und immer mehr alte Menschen) noch erheblich<br />
verschärfen. Daher muss alles unternommen werden, die wenigen jungen Menschen so<br />
gut wie möglich zu bilden und für das Berufsleben zu vorzubereiten.<br />
Ich habe im Rahmen meiner langjährigen Tätigkeit <strong>als</strong> selbständiger Unternehmer im Bildungsbereich<br />
didaktisch-pädagogische Konzepte unter anderem für das Fach Mathematik<br />
entwickelt, die sich in der Praxis vielfach <strong>als</strong> sehr erfolgreich erwiesen haben: Selbst Neuntklässler<br />
einer Re<strong>als</strong>chule konnten praxisrelevante Aufgaben mithilfe meiner Methoden nach<br />
relativ kurzer Zeit lösen, an denen selbst fast alle Abiturienten scheitern, wie zahlreiche Tests<br />
immer wieder ergeben haben! Einige Schüler, die meine Methoden kennengelernt haben,<br />
waren so begeistert davon, dass sie ihre positiven Erfahrungen im Internet veröffentlichten<br />
(<strong>als</strong> eigne Seite, bei Youtube oder facebook). Ebenfalls hat mich die IHK Koblenz, Geschäftsstelle<br />
Bad Kreuznach mit der Konzeptionierung sowie Durchführung des Seminars ‚Fit in die<br />
Lehre – Mathematik’ beauftragt. Dieses Angebot nutzen unter andere namhafte Firmen wie<br />
Michelin oder KHS.<br />
Aufgrund all dieser positiven Erfahrungen wollte ich zusammen mit Schülern versuchen, dass<br />
diese nachweislich erfolgreichen Methoden in den Schulen flächendeckend zur Anwendung<br />
gelangen und wandte mich vor der Landtagswahl 2011 in Rheinland-Pfalz an die Parteien<br />
(SPD, CDU, FDP und Grüne), um mit ihnen zusammen an der derzeitig misslichen Lage an<br />
den Schulen etwas zu ändern. In diesem Zusammenhang wies ich unter anderem auch<br />
nochm<strong>als</strong> auf meine ehrenamtliche Bildungsinitiative ‚Dummheit-nein-danke’ hin (s.o.).<br />
Eigentlich müssten alle – wenn man ihren öffentlichen Verlautbarungen Glauben schenken<br />
will – doch ein großes Interesse an solch konstruktiven Vorschlägen haben, die zudem von<br />
der IHK wie namhaften Firmen unterstützt werden. Außerdem wollte ich zu keinem<br />
Zeitpunkt Steuergelder aus der Landeskasse: Meine Vorschläge kosten das Land kein<br />
Geld!<br />
Dennoch verweigerten sich die genannten Parteien aller guten Vorschläge. Unfassbar! Nach<br />
der Wahl hielten die Grünen – wenn auch erst nach einigen Monaten – lediglich ihre Zusage<br />
ein, Schüler und mich im Landtag zu empfangen, um dort unsere Vorschläge zu unterbreiten.<br />
Letztlich trafen wir auch hier wieder nur auf destruktive Ablehnung.<br />
Nachfolgend können Sie zunächst meine Sicht der Dinge nachlesen und dann einen Kommentar<br />
der Schüler, die Sie in einer offenen Mail an die Abgeordneten schickten.
Mein Erlebnisbericht aus dem Mainzer Landtag und die Konsequenzen, die ich daraus<br />
ziehe<br />
Am 21. September 2011 war ich zusammen mit einer Schülerin und zwei Schülern eines<br />
Mainzer Gymnasiums (alle 10. Klasse) zu einem Gespräch mit zwei Politikerinnen der<br />
Grünen im Landtag von Rheinland-Pfalz verabredet; beide Damen sind Abgeordnete des<br />
Landtages und ausgebildete Lehrerinnen (Fächer: eine Philosophie und Deutsch, die andere<br />
Pädagogik und Geographie).<br />
Es ging um folgendes: Immer mehr Unternehmen beklagen seit Jahren, dass viele Bewerber<br />
gerade auch im Fach Mathematik nicht über die erforderlichen Fähigkeiten zur Aufnahme<br />
einer Lehrstelle verfügen. Sie beherrschen häufig nicht den Stoff, den sie eigentlich laut<br />
Lehrplan beherrschen müssten. Um es noch einmal zu betonen: Diese Situation ist seit vielen<br />
Jahren bekannt und in zahlreichen Medien immer wieder ein Thema, so dass niemand im<br />
Ernst behaupten kann, er wüsste dies nicht. Ich wollte nun zusammen mit den oben erwähnten<br />
Schülern einen konstruktiven Vorschlag unterbreiten, wie die beschriebene Situation im Bereich<br />
Mathematik zügig und deutlich verbessert werden kann. Wir – die Schüler und ich –<br />
hofften, dass die Landespolitikerinnen das gleiche Interesse haben müssten.<br />
Nach der freundlichen Begrüßung durch die beiden Politikerinnen begann ich damit, kurz die<br />
Defizite vieler Schulabgänger zu skizzieren und gab einige Presseberichte dazu weiter.<br />
Größtenteils stimmten beide Politikerinnen der beschriebenen misslichen Situation zu, wobei<br />
eine von beiden einwandte, dass es vielleicht doch nicht gar so schlimm sei. Dem widersprach<br />
nicht nur ich sofort, sondern auch alle anwesenden Schüler bestätigten meine Position aus<br />
eigener Erfahrung.<br />
Was hatte ich <strong>als</strong>o <strong>als</strong> Verbesserung anzubieten? Als selbständiger Unternehmer im Bildungsbereich<br />
beschäftige ich mich seit vielen Jahren unter anderem auch mit der hier in Rede<br />
stehenden Problematik. Im Laufe der Zeit entwickelte ich eine Methode, wie selbst Hauptschüler<br />
in relativ kurzer Zeit Rechenaufgaben schnell und sicher bewältigen können, an denen<br />
selbst die meisten Abiturienten scheitern. Hier eine Beispielaufgabe:<br />
Zur Reinigung einer Werkstattfläche von 540 qm wurden bisher 3 Arbeiter je 5 Stunden beschäftigt.<br />
Um wieviel Prozent ist die Produktivität je Arbeitsstunde gestiegen, wenn nach<br />
Vergrößerung der Werkstattfläche auf 680 qm durch den Einsatz verbesserter Geräte die<br />
Reinigung von 4 Arbeitern in 4 Stunden erledigt werden kann?<br />
Ich schrieb ein E-Buch, in welchem auch derartige Aufgaben behandelt und deren Lösung für<br />
Schüler verständlich erklärt werden. Daher hat mich die Industrie- und Handelskammer<br />
Koblenz, Geschäftsstelle Bad Kreuznach, deren Mitglied ich bin, beauftragt, das Seminar ‚Fit<br />
in die Lehre – Mathematik’ inhaltlich zu konzeptionieren und durchzuführen. Sowohl das<br />
Seminar <strong>als</strong> auch mein E-Buch <strong>als</strong> Lerngrundlage werden von der IHK gesponsert. Eigentlich<br />
sollte es an Schulen in den 9. und 10. Klassen stattfinden, doch das gelang leider nicht, da ich<br />
bei den Schulen auf keine ausreichende Gegenliebe stieß. Allerdings fanden sich Firmen schon<br />
nach kurzer Zeit bereit, dieses Angebot wahrzunehmen, um ihre Auszubildenden im Fach<br />
Mathematik nachschulen zu lassen, obwohl der dort behandelte Stoff eigentlich bis zur 10.<br />
Klasse in der Schule vermittelt werden müsste. Nur, was nützt es den Unternehmen, wenn die<br />
Realität anders aussieht und sie zusehen müssen, dass ihre Auszubildenden diesen Stoff beherrschen!<br />
Die Nachfrage der Firmen nach diesem Seminar – darunter namhafte wie Michelin<br />
oder KHS – war in diesem Jahr so groß, dass schon Ende August die Mittel der IHK ausge-
schöpft waren. Bedarf besteht <strong>als</strong>o offensichtlich! Über all dies informierte ich die Abgeordneten<br />
schon im Vorfeld unseres Treffens und nochm<strong>als</strong> bei unserer Begegnung im Landtag.<br />
Nun, wie ging es weiter. Einer der Schüler zeigte den beiden Politikerinnen den Lösungsweg,<br />
den er von mir gelernt hatte. Zuvor tat er dasselbe in seiner Klasse. Er wie seine beiden Mitschüler<br />
bestätigten, dass niemand aus ihrer Klasse (10. Klasse Gymnasium!) vor der Kenntnis<br />
meines Lösungsweges in der Lage gewesen sei, derartige Aufgaben zu lösen. Das entspricht<br />
auch meinen Erfahrungen seit vielen Jahren. Aber immer wenn ich Schülern dann meinen<br />
Rechenweg erkläre, sind sie erstaunt, wie schnell und sicher sie solche Aufgaben lösen können.<br />
Als Zwischenergebnis lässt sich <strong>als</strong>o festhalten: Es gibt ein gravierendes Problem im Bereich<br />
Mathematik und es gibt eine bereits vielfach erfolgreich erprobte Lösung. Was spricht<br />
dagegen, diese an Schulen zu etablieren? Eigentlich gar nichts, meinten auch die Schüler.<br />
Und maßgeblich verantwortlich für die Schulen sind nun einmal die Landespolitiker.<br />
Doch wie reagierten die beiden Politikerinnen?<br />
Zunächst bedauerten sie, dass Textaufgaben (s.o.) nicht hinreichend von den Mathematiklehrkräften<br />
an den Schulen behandelt würden. Außerdem gebe es viele Mathe-Lehrer, die den<br />
Stoff nicht gut erklären könnten und dadurch die Schüler überforderten. Ein Schuldiger war<br />
<strong>als</strong>o schon ausgemacht: Die Mathe-Lehrer.<br />
Dann kamen die Unternehmen dran: Die Anforderungen an die Auszubildenden seien in den<br />
letzten Jahren gestiegen, so dass doch die Unternehmen aufgefordert seien, selbst einiges für<br />
die Ausbildungsfähigkeit der jungen Leute zu tun. Daher sollten ruhig die IHK sowie die<br />
Firmen weiter Geld dafür investieren. Auf meinen Hinweis, dass es sich doch eigentlich um<br />
Schulstoff handele, den die Schüler weitgehend nicht beherrschten und der in dem oben besagten<br />
Seminar aufgearbeitet würde, bewirkte keine Änderung der Auffassung der beiden<br />
Politikerinnen.<br />
Daraufhin betonte ich wiederholt, dass es mir nicht um Schuldzuweisungen ginge, sondern um<br />
die Lösung des Problems. Die Erwiderung der beiden Damen bestand darin, dass man vielleicht<br />
ein paar Änderungen im Studienseminar bei der Ausbildung der Lehrkräfte in Betracht ziehen<br />
könnte. Im Klartext heißt dies nichts anderes, <strong>als</strong> dass sich auf absehbare Zeit an der Situation<br />
gar nichts ändert. Ich schlug nun vor, dass einige Klassen von mir eine Woche betreut werden<br />
und andere Klassen in derselben Zeitspanne nach den Vorschlägen der beiden Politikerinnen<br />
unterrichtet werden würden. Dann werde man noch kurzer Zeit sehr schnell feststellen, wer erfolgreich<br />
war und wer nicht. Doch dann kam der unvermeidliche Politikerklassiker: Man sei<br />
dafür eigentlich gar nicht zuständig! Es stehe mir ja frei, selber Schulen anzusprechen. Dass<br />
ich dies bereits mehrfach getan hatte – auch zusammen mit der IHK – und dies leider kaum<br />
Erfolge zeitigte, wie am Beginn unseres Gesprächs bereits erwähnt, führte zu keiner Umstimmung<br />
der beiden Politikerinnen. Ganz im Gegenteil, zweifelten sie zunehmend daran, dass<br />
mein Vorgehen wirklich so erfolgreich sei. Würden denn wirklich alle Schüler nach kurzer Zeit<br />
Aufgaben wie die oben aufgeführte nach meinem System lösen können? Nein, nicht alle, aber<br />
sehr viel mehr <strong>als</strong> vorher! Und dass sei doch eine wesentliche Verbesserung zu jetzigen Situation,<br />
erwiderte ich. Und nochm<strong>als</strong> schlug ich vor, mein System zu testen und es bei positivem<br />
Ausgang landesweit zu etablieren, damit alle Schüler gleichermaßen davon profitieren könnten.<br />
Ein Schüler warf, mich unterstützend, ein, dass doch auch den Politikerinnen daran gelegen<br />
sein müsse, dass möglichst viele Schüler in die Lage versetzt werden sollten, den Stoff zur<br />
Aufnahme einer Lehrstelle beim Schulabschluss zu beherrschen, um überhaupt erst über eine<br />
gute Startchance in die Berufswelt zu verfügen. Daraufhin fragte ich die Politikerinnen noch-
m<strong>als</strong>, was dagegen spräche mit Unterstützung der Politik mein System an Schulen auszuprobieren,<br />
um zu sehen, ob sich dann nach kurzer Zeit deutliche Verbesserungen einstellten. Sie<br />
blieben jedoch bei ihrer Haltung, dass ich es ja selbst versuchen solle, sie zunächst einmal nicht<br />
zuständig seien und überhaupt die ganze Angelegenheit diskutiert werden müsse. Daraufhin lud<br />
ich sie und alle interessierten Parteifreunde zu einer öffentlichen Diskussion mit Schülern,<br />
Eltern und Vertretern aus der Wirtschaft sowie natürlich mir selbst ein. Aber auch hieran<br />
wollten sie sich nicht beteiligen.<br />
Ich könnte an dieser Stelle noch einige weitere Vorschläge von mir aus diesem Gespräch ausbreiten,<br />
die alle keine positive Aufnahme durch die Politikerinnen fanden, aber ich will es bei<br />
den bisherigen Beispielen belassen, um den Leser nicht mit den immer gleichen Geschichten zu<br />
langweilen. Nach einer Stunde war das Gespräch – wie vorher verabredet – zu Ende, ohne dass<br />
irgendetwas Greifbares herausgekommen wäre. Ich konnte und kann mich des Eindruckes nicht<br />
erwehren, dass die Politikerinnen alles daran setzten, dass es genauso endete. Anstatt zu sagen:<br />
Prima, lasst uns das Ganze doch einmal ausprobieren. Wir unterstützen das. Aber nein!<br />
Sie reagierten wie alle Politiker, freundlich, aber letztlich dennoch abweisend!<br />
Ich befragte nach dem Gespräch die Schüler nach ihrem Eindruck. Die erste Antwort lautete<br />
spontan: Alle negativen Vorurteile über Politiker seien bestätigt worden. Warum lehnten<br />
sie denn jeden Versuch einer Verbesserung ab? Warum stellten sie sich nicht einem Wettbewerb<br />
der Ideen mit mir? Ein Schüler meinte schließlich, dass es wohl daran liege, dass sich<br />
dann herausstellen könnte, dass die bisherige Schulpolitik doch nicht so gut war, wie man uns<br />
immer weismachen will und dass es andere besser könnten, <strong>als</strong> die derzeitigen Politiker. Da<br />
scheint mir einiges dran zu sein.<br />
Ein weiterer Kritikpunkt der Schüler lautete, dass die Politikerinnen allen möglichen<br />
anderen die Schuld für die Probleme zuschoben, aber irgendeine eigene Verantwortung<br />
mit keinem Wort auch nur erwähnten, und dass dies ja typisch für Politiker sei.<br />
Abschließend muss ich <strong>als</strong> ernüchterndes Fazit des Gespräches folgende Punkte festhalten:<br />
1. Es gibt große Probleme im Bereich Mathematik bei sehr vielen Schulabgängern, das<br />
von Unternehmen, Schülern, Eltern und in den Medien immer wieder beklagt wird.<br />
2. Ich behaupte, dass mithilfe meiner Angebote dieses Problem deutlich verringert werden<br />
kann und bin zur Beweisführung jederzeit bereit. Dass meine Behauptung nicht aus der Luft<br />
gegriffen ist, belegen die von der IHK gesponserten Seminare.<br />
3. Alle konstruktiven Versuche von mir zusammen mit den verantwortlichen Politikern die<br />
Lage schnell zu verbessern, stoßen auf freundliche Ablehnung in der politischen Klasse. Hier<br />
muss erwähnt werden, dass ich natürlich schon seit einiger Zeit auch die anderen Parteien<br />
diesbezüglich angesprochen habe. Immer wieder das Gleiche!<br />
4. Die Schuld für die derzeitig schlechte Situation bzw. die Verantwortung für die Lösung<br />
der Probleme wird von den Politkern allen anderen zugeschoben – beispielsweise Lehrern oder<br />
Unternehmern – nur bei sich selbst suchen sie nicht! Der Splitter im Auge des anderen ist für<br />
sie viel deutlicher sichtbar, <strong>als</strong> der Balken im eigenen!<br />
5. Denn wer trägt eigentlich die Hauptverantwortung für die genannte Misere: die Landespolitik.<br />
Schließlich ist sie zuständig für die Schulen.<br />
6. Eine weitere beliebte Strategie von Politikern ist die Leugnung offensichtlicher Probleme;<br />
auch wenn in diesem Gespräch diese Strategie kaum verfolgt wurde.<br />
7. Dafür wurde von ihnen der andere Klassiker bemüht: Man sei nicht zuständig. Wenn<br />
Bürger von außen mit konstruktiven Vorschlägen kommen und einem Politiker die inhaltlichen<br />
Einwände dagegen ausgehen, kommt dieser unvermeidliche Klassiker. Franz Kafka lässt<br />
grüßen!
Die Schüler und ich mussten einsehen, dass man positive Veränderungen nicht mit,<br />
sondern nur ohne bzw. sogar gegen die verantwortlichen Politiker erreichen kann. Und<br />
das gilt gleichermaßen für Regierungs- wie Oppositionspolitiker. Die Politiker, die selber<br />
nachweislich bisher nicht in der Lage waren, besagtes Problem in den Griff zu bekommen,<br />
weisen Bürger, die genau dabei Erfolge zu verweisen haben, ab. Nicht einmal der Test zur<br />
Überprüfung des neuen Systems findet ernsthafte Unterstützung, obwohl es sich schon mehrfach<br />
bewährt hat. So bleibt alles, wie es ist. Ich sage hiermit voraus, dass auch weiterhin ein<br />
Großteil der Schüler obige Aufgaben nicht wird lösen können, wenn es nach unseren Politikern<br />
geht. Wahrhaft ein Trauerspiel!<br />
Wir Bürger müssen leider ohne oder gar gegen diese Politiker Verbesserungen herbeiführen!<br />
Dafür müssen wir zunächst einmal eine möglichst große öffentliche Aufmerksamkeit erringen.<br />
Hierfür möchte ich kurz ein paar Vorschläge unterbreiten:<br />
1. Im Internet auf allen möglichen Wegen (eigene Seiten, gegenseitige Verlinkung der<br />
Seiten, Blogs, soziale Netzwerke usw.) oben beschrieben Sachverhalt bekannt machen und<br />
darüber mit Freunden im Netz diskutieren.<br />
2. Per Mails / Rundmails möglichst viele andere Menschen informieren und / oder Links<br />
zu oben genannten Internetseiten / Blogs weiterleiten.<br />
3. Im persönlichen Gespräch darüber mit allen interessierten Menschen diskutieren.<br />
4. Die Medien immer wieder ansprechen, darüber zu berichten.<br />
Kurz zu meiner Person: Ich heiße Hans-Dieter <strong>Bottke</strong> und bin seit vielen Jahren selbständiger<br />
Unternehmer im Bildungsbereich. Von mir findet man mehrere Seiten im Netz, auf denen sich<br />
jeder über meine Aktivitäten erkundigen kann. Nachfolgend drei meiner Seiten:<br />
www.drbottke.de oder www.dummheit-nein-danke.de<br />
Wer mit mir Kontakt aufnehmen möchte, schreibt am besten an folgende Adresse:<br />
info@drbottke.de
4.3.4. Ein offener Brief von enttäuschten Schülern an verantwortliche Politikerinnen:<br />
Nachfolgend nun die E-Mail der enttäuschten Schüler, die am Gespräch im Landtag<br />
teilgenommen hatten, an die beiden Politikerinnen<br />
Sehr geehrte Frau Bröskamp, sehr geehrte Frau Ratter,<br />
wir möchten Ihnen mit diesem Schreiben eine Rückmeldung zu unserem Gespräch im<br />
Landtag vom 21.09.2011 zusammen mit Herrn <strong>Dr</strong>. <strong>Bottke</strong> geben. Es ging um Probleme in<br />
Mathematik und dabei um Aufgaben, die eigentlich alle Zehntklässler wie wir lösen können<br />
müssten, es aber in Wirklichkeit nicht können. Erst <strong>als</strong> wir das System von Herrn <strong>Dr</strong>. <strong>Bottke</strong><br />
kennengelernt hatten, waren wir dazu in der Lage und zwar sehr, sehr schnell. Diese Art von<br />
Rechenaufgaben erwarten alle Auszubildenden, können aber selbst von Gymnasiasten der 10.<br />
Klasse wie wir in der Regel nicht gelöst werden. Wir waren im Vorfeld des Treffens sehr<br />
gespannt, wie Sie <strong>als</strong> Abgeordnete auf die überzeugenden Vorschläge von Herrn <strong>Dr</strong>. <strong>Bottke</strong><br />
reagieren würden. Wir hofften, dass Sie sich dafür einsetzen würden, dass sich schnell<br />
etwas verbessert. Nun aber sind wir sehr enttäuscht von Ihnen und finden alle negativen<br />
Vorurteile über Politiker bestätigt.<br />
1. Sie schieben die Verantwortung für die Probleme sowie deren Lösung auf andere, ohne<br />
selber auch nur einen Vorschlag zu machen, wie es wirklich besser werden könnte.<br />
2. Sie sind nicht einmal bereit, das Ausprobieren des Systems von Herrn <strong>Dr</strong>. <strong>Bottke</strong> in<br />
Schulen aktiv zu unterstützen, um zu sehen, wie gut es funktioniert.<br />
3. Sie sind außerdem nicht bereit, den von Herrn <strong>Dr</strong>. <strong>Bottke</strong> angebotenen Wettbewerb anzunehmen:<br />
Er betreut eine Woche eine Klasse und andere werden nach Ihren Ideen unterrichtet,<br />
um dann zu sehen, wer erfolgreicher war.<br />
4. Sie wollten weder an einer von Herrn <strong>Dr</strong>. <strong>Bottke</strong> vorgeschlagenen öffentlichen Diskussion<br />
über das Thema teilnehmen, noch einen von uns angestrebten Wettbewerb aktiv unterstützen.<br />
5. Wir hatten den Eindruck, dass Sie alles darangesetzt haben, dass gute Vorschläge nicht umgesetzt<br />
werden.<br />
Anstatt immer nur zu sagen, was nicht geht, warum alle anderen was machen sollen und Sie<br />
selber eigentlich nicht zuständig sind, hätten Sie doch einfach nur sagen können: „Super. Eine<br />
gute neue Idee. Schauen wir einmal, was wir zusammen unternehmen können, damit es besser<br />
wird.“<br />
Sie aber taten genau das Gegenteil! Warum haben Sie die vielen guten Vorschläge von Herrn<br />
<strong>Dr</strong>. <strong>Bottke</strong> abgewehrt? Er hat immer wieder betont, dass er jederzeit bereit sei, zu beweisen,<br />
dass seine Vorschläge eine deutliche Verbesserung bewirken. Und wir haben Ihnen auch bestätigt,<br />
dass wir erst durch das System von Herrn <strong>Dr</strong>. <strong>Bottke</strong> große Fortschritte sehr schnell<br />
machen konnten.<br />
Wir haben kein Verständnis für Ihre Haltung und müssen einsehen, dass sich nichts verbessern<br />
wird, wenn es nur nach Ihnen geht. Wir wollen uns damit aber nicht einfach abfinden,<br />
sondern werden unsere Meinung über dieses Gespräch nicht für uns behalten.<br />
Mit enttäuschten Grüßen<br />
Josephine, Vincent und Alexander
5. Politik und Wirtschaft:<br />
5.1. Einleitung:<br />
Politik und Wirtschaft hängen heutzutage derart eng miteinander verflochten, dass wir sie hier<br />
zusammen abhandeln wollen. Wie auch bei den anderen Themenbereichen werden Positionen<br />
zu verschiedenen Fragen bezogen, begründet und zur Diskussion gestellt. Hierbei ist es uns<br />
sogar gelungen, Stellungnahmen von Spitzenpolitikern aus allen Bundestagsfraktionen, vom<br />
DGB, dem Verband der Familienunternehmer sowie dem Bund der Steuerzahler zum Thema<br />
‚Vermögenssteuer’ zu erhalten, um dann mit ihnen darüber zu diskutieren.<br />
Unser Motto – welches für diese Seite insgesamt gilt – lautet:<br />
Ich habe eine Meinung, begründe diese und stelle sie zur Diskussion.<br />
Kein Mensch kann schließlich für sich in Anspruch nehmen, die absolute Wahrheit zu kennen<br />
und sich daher auch nicht irren zu können. Zudem ist für eine vernunftgeleitet Diskussion entscheidend,<br />
dass man sich mit den vorgebrachten Argumenten wirklich sorgfältig auseinandersetzt<br />
und nicht jemanden vorschnell in eine Schublade, in ‚Freund oder Feind’ einsortiert.<br />
Leider ist es auch mir schon einige Male passiert, dass Leute mich beispielsweise in die<br />
Schublade ‚Marktradikaler’ geworfen haben, obwohl dies sachlich nachweislich f<strong>als</strong>ch ist,<br />
weil ich kein Radikaler, auch kein Marktradikaler bin. Dies kann man leicht feststellen, wenn<br />
man meine Texte liest. Aber manchen Zeitgenossen fehlt leider zu einer vernünftigen Diskussion<br />
die dafür nötige Mühe, sich mit Argumenten gewissenhaft auseinanderzusetzen. Teilweise<br />
fehlt ihnen auch die entsprechende Bildung auf dem zu diskutierenden Gebiet. Das hält<br />
jene Subjekte natürlich keineswegs davon ab, mit unerschütterlicher Gewissheit ihre Meinung<br />
herauszuposaunen und alle Gegenmeinungen wahlweise <strong>als</strong> dumm, marktradikal, europafeindlich,<br />
undemokratisch oder sonst wie zu bezeichnen. Ihre Meinung ist die richtige, das<br />
steht für sie fest!<br />
Mit solchen Menschen wollen wir hier nicht weiter unsere Zeit verschwenden. All jene hingegen,<br />
die wie wir, sich gerne auch mit vernünftigen Argumenten widerlegen und / oder ihre<br />
Ausführungen zu einem Thema ergänzen lassen, sind zu einer sachlichen Diskussion herzlich<br />
eingeladen.
5.2. Demokratie – die einzig legitime Staatsverfassung:<br />
Aufgrund des oben entworfenen Menschenbildes ist die einzig vernünftig zu wollende und<br />
legitime Verfassung der demokratische Rechtsstaat <strong>als</strong> einer Vereinigung grundsätzlich<br />
gleichberechtigter und mit Freiheit ausgestatteter Individuen unter Rechtsgesetzen.<br />
Ich werde Kants Rechtsstaatstheorie <strong>als</strong> Basis für die weiteren Erörterungen heranziehen, wobei<br />
hier nur kurz angemerkt sein soll, daß seine „politische Philosophie ... der Ausdruck von<br />
tief im System der Transzendentalphilosophie verankerten Postulaten“ 35 ist. Trotz einiger,<br />
wenn auch z.T. wesentlicher, Kritikpunkte an Kants Philosophie, wie sie oben bereits vorgebracht<br />
worden sind, können viele Kernaussagen seiner Staatslehre weiterhin äußerst hilfreiche<br />
Dienste leisten.<br />
Kants Moralphilosophie <strong>als</strong> Grundlage seiner Rechts- und Staatsphilosophie<br />
Der einzelne Mensch <strong>als</strong> autonome, sich selbst verantwortliche, sittliche Persönlichkeit erfährt<br />
bei Kant eine ungeheure Aufwertung. Da die Grundlage der Moral in jedem Einzelnen selbst<br />
liegt, ist das Individuum <strong>als</strong> vernünftiger Selbstgesetzgeber frei und sind alle Vernunftwesen<br />
<strong>als</strong> Vernunftwesen untereinander moralisch gleichwertig. Gleichheit und Freiheit sind hier<br />
nicht <strong>als</strong> willkürliche, inhaltliche Werte zu begreifen, sondern <strong>als</strong> transzendentale Bedingungen<br />
für Moral und Recht überhaupt.<br />
Dies hat eine Emanzipation des Individuums gegenüber gesellschaftlichen wie politischen<br />
Institutionen mit der Betonung des Eigenwertes jedes Menschen zur Folge und ist damit<br />
wiederum grundlegend für Kants Rechts- und Staatsverständnis. Recht und Staat sind nach<br />
ihm zwar notwendig für das gesittete Zusammenleben der Menschen, aber eben sekundär, d.h.<br />
abgeleitet von den allgemeinen Eigenschaften und Bedürfnissen der einzelnen Menschen <strong>als</strong><br />
mit Freiheit begabter Vernunftwesen. Die konkreten Inhalte von Recht und Verfassung sind<br />
daher nicht mit Hilfe inhaltlich tradierter Vorgaben zu rechtfertigen, sondern nur durch die<br />
formalen Bedingungen ihres Zustandekommens. Somit können „weder die Richtigkeit des<br />
Rechts noch die Legitimität von Herrschaft ... durch vorgegebene inhaltliche Gerechtigkeitsprinzipien<br />
garantiert sein, sondern hängen von der Art der (demokratischen) Verfahren ab, in<br />
denen sie gesetzt bzw. eingesetzt werden.“ 36 Analog zum kategorischen Imperativ, <strong>als</strong> formalem<br />
moralischen Prüfungsmaßstab, ist das „Recht ... <strong>als</strong>o der Inbegriff der Bedingungen, unter<br />
denen die Willkür des einen mit der Willkür des anderen nach allgemeinem Gesetze der Freiheit<br />
zusammen vereinigt werden kann.“ 37<br />
35 Zwi Batscha (Hg.): Materialien zu Kants Rechtsstaatsphilosophie. Frankfurt / M. 1976, S. 27<br />
36 Ingeborg Maus: Zur Theorie der Institutionalisierung bei Kant, in: Gerhard Göhler u.a. (Hg.): Politische<br />
Institutionen im gesellschaftlichen Umbruch. Ideengeschichtliche Beiträge zu Theorie politischer Institutionen.<br />
Opladen 1990. S. 359; vgl. von derselben Autorin hierzu auch: Zur Aufklärung der Demokratietheorie. Rechts-<br />
und demokratietheoretische Überlegungen im Anschluß an Kant. Frankfurt am Main 1992.<br />
37 Kant: MdS. S. 337
Grundzüge von Kants Rechtsstaatsphilosophie<br />
Die Aufgabe des Staates besteht in der Durchsetzung und Garantie des Rechts durch Gesetze,<br />
d.i. die Rechtsstaatlichkeit: „Ein Staat ist die Vereinigung einer Menge von Menschen unter<br />
Rechtsgesetzen." 38 Die Konstituierung von Recht und Staat muß vom Menschen aus reinen<br />
Vernunftgründen gewollt werden, weil nur diese eine Kompatibilisierung der Willkür jedes<br />
Einzelnen unter einem allgemeinen Gesetz erst möglich macht, im Unterschied zum anarchisch<br />
– vorstaatlichen Naturzustand 39 , wo zwar nicht zwangsläufig „Ungerechtigkeit“ 40 aber<br />
„Rechtlosigkeit“ 41 herrscht und kein Besitzstand, einschließlich des Lebensnotwendigen, gesichert,<br />
d.h.„provisorisch“ 42 , ist. Als Mittel zur Durchsetzung des Rechts muß es „öffentlich<br />
gesetzlichen Zwang“ 43 geben, da nur das Gewaltmonopol des Staates den einzelnen Menschen<br />
vor der, zumindest potentiell, willkürlichen Gewalt eines anderen bei einer Interessenkollision<br />
schützen kann, d.i. „tätige Unrechtsabwehr“. 44 Das Mittel – Gewaltmonopol des Staates – darf<br />
jedoch nicht zum Selbstzweck verkommen, weil ansonsten der ursprüngliche Zweck, nämlich<br />
die gesicherte Freiheit und Gleichheit von autonomen, sittlichen Persönlichkeiten nicht mehr<br />
gewährleistet wäre. Folglich dürfen die vernünftig zu wollende Ursache und das konkrete<br />
Sein des Staates nicht gegeneinander stehen.<br />
Dieses Rechts- und Staatsideal kann nicht auf historisch unreflektierten inhaltlichen Vorgaben<br />
ruhen, sondern nur auf den formalen Bedingungen von Freiheit und Gleichheit, da sich diese<br />
aus der Natur des Menschen <strong>als</strong> Vernunftwesen, d.i. im praktischen Sinne <strong>als</strong> autonome, sittliche<br />
Persönlichkeit, ergeben. Somit ist die einzig legitime Verfassung die Republik, da nur<br />
durch sie die gleichberechtigte und freie Mitwirkung der von den zu beschließenden Gesetzen<br />
Betroffenen erst möglich wird und dadurch kein Unrecht im formalen Sinne, d.h. bezogen<br />
auf die rechtmäßige Genese von Gesetzen, entstehen kann, solange die gleichberechtigte und<br />
freie Mitwirkung in vollem Umfang gewährleistet ist: „Die gesetzgebende Gewalt kann nur<br />
dem vereinigten Willen des Volkes zukommen. Denn, da von ihr alles Recht ausgehen soll, so<br />
muß sie durch ihr Gesetz schlechterdings niemand unrecht tun können.“ 45<br />
Kants Rechtsstaatstheorie beruht, analog zur Moralphilosophie, nicht auf inhaltlichen Tugend-<br />
bzw. Gerechtigkeitsprinzipien. Durch den Rechtsstaat kann und muß die Würde des Menschen<br />
gesichert werden, indem die Willensautonomie jedes Einzelnen einschließlich des<br />
individuellen Strebens nach Glückseligkeit anerkannt sowie die Kompatibilisierung dieses<br />
Menschenrechtes aller Betroffenen untereinander gewährleistet wird: „Niemand kann mich<br />
zwingen auf seine Art (wie er sich das Wohlsein anderer denkt), glücklich zu sein, sondern<br />
ein jeder darf seine Glückseligkeit auf dem Wege suchen, welcher ihm selber gut dünkt, wenn<br />
er nur der Freiheit anderer, einem ähnlichen Zwecke nachzustreben, die mit der Freiheit von<br />
jedermann nach einem möglichen allgemeinen Gesetze zusammen bestehen kann, (d.i. diesem<br />
Rechte des anderen) nicht Abbruch tut.“ 46 Da infolge dieser Willensautonomie konkrete material<br />
– inhaltliche Vorgaben die fundamentale Freiheit des Menschen in unerlaubter Weise<br />
einschränken würden, kann die Legitimation von Gesetzen nur „auf der Struktur des demokratischen<br />
Gesetzgebungsprozesses selber“ 47 beruhen. Somit sind die formalen Bedingungen<br />
38 ebenda, S. 431<br />
39 Der Naturzustand darf hier nicht <strong>als</strong> historische Tatsache aufgefaßt werden, sondern ist <strong>als</strong> Gedankenmodell zu<br />
verstehen.<br />
40 ebenda, S. 430<br />
41 ebenda, S. 430<br />
42 ebenda, S. 431; vgl. hierzu auch Thomas Hobbes und John Locke<br />
43 ebenda, S. 430<br />
44 Wolfgang Kersting: Sittengesetz und Rechtsgesetz – Die Begründung des Rechts bei Kant und den frühen<br />
Kantianern, in: R. Brandt (Hg.): Die Rechtsphilosophie der Aufklärung. Berlin New York 1982. S. 163<br />
45 Kant, MdS, S. 432<br />
46 Immanuel Kant: Über den Gemeinspruch: Das mag in der Theorie richtig sein, taugt aber nicht für die Praxis.<br />
Hg. W. Weischedel. Sonderausgabe Wissenschaftliche Buchgesellschaft Bd. 9 Darmstadt 1983. S. 145<br />
47 Maus, Institutionalisierung bei Kant, S. 373
des Zustandekommens von Gesetzen der einzig legitime juristische Rechtfertigungsmaßstab<br />
für jene: „Denn das ist der Probierstein der Rechtsmäßigkeit eines jeden öffentlichen Gesetzes.“<br />
48 Aus dem bisher Aufgeführten leitet sich auch das unveräußerliche Recht auf die<br />
gleichberechtigte und freie Mitwirkung aller Betroffenen am Gesetzgebungsprozeß ab, weil<br />
ansonsten der Würde des Menschen Abbruch getan würde (s.o.): „Das Recht der obersten<br />
Gesetzgebung im gemeinen Wesen ist kein veräußerliches, sondern das allerpersönlichste<br />
Recht. Wer es hat, kann nur durch den Gesamtwillen des Volkes über das Volk, aber nicht<br />
über den Gesamtwillen selbst, der der Urgrund aller öffentlichen Verträge ist, disponieren.<br />
Ein Vertrag, der das Volk verpflichtete, seine Gewalt wiederum zurückzugeben, würde demselben<br />
nicht <strong>als</strong> gesetzgebende Macht zustehen ...“. 49 Aus Kants Rechtsstaatskonstruktion<br />
folgt desweiteren, daß ein Staat oder eine Regierung sich nicht auf der Grundlage der Glücksbeförderung<br />
der Untertanen legitimieren darf und kann, weil dies eine „väterliche Regierung“<br />
50 wäre, die die Menschen wie „unmündige Kinder“ 51 behandeln würde und der „größte<br />
denkbare Despotismus“ 52 wäre. Daraus ergibt sich, daß der Staat, um eines noch so hehren<br />
Zieles willen, keinesfalls „die Freiheitssicherung zugunsten der Glücksbeförderung“ 53 aufgeben<br />
darf.<br />
Die Sicherung der republikanisch – demokratischen Freiheitsrechte ist nach Kant nicht von<br />
der formalen Struktur des Staates zu trennen, d.i. die strikte Gewaltenteilung von Legislative,<br />
Exekutive und Judikative, da eine „Regierung, die zugleich gesetzgebend wäre, würde<br />
despotisch zu nennen sein ...“. 54 Denn nur durch die Herrschaft allgemeiner Gesetze, welche<br />
wiederum nur durch ihre demokratische „Genese“ 55 legitimiert sind, kann der Rechtsstaat<br />
seinem vernünftig zu wollenden Ursprung gerecht werden, „d.i. sich selbst nach Freiheitsgesetzen“<br />
56 bilden und erhalten. In diesem Zusammenhang ist auch die von Kant vorgenommene<br />
Unterscheidung von Dekreten und Gesetzen wichtig. Dekrete sind nur „Entscheidungen in<br />
einem besonderen Fall“ 57 , müssen sich dabei im Rahmen der Gesetze bewegen und dürfen<br />
diese keinesfalls aushöhlen oder gar ersetzen, weil dies den Grundsätzen der Gewaltenteilung<br />
und damit des Rechtsstaates zuwider liefe. Denn Dekrete dürfen der Exekutive ausschließlich<br />
zur Umsetzung der Gesetze im Einzelfall dienen. Sobald sie Gesetzesfunktionen übernähmen,<br />
hätte sich die Exekutive eine Kompetenz zu eigen gemacht, die nur dem einzig legitimen Gesetzgeber,<br />
d.i. das Volk, zukommt und wäre damit nicht hinreichend von jenem zu kontrollieren.<br />
Darüber hinaus würden Dekrete mit Gesetzesfunktion die Freiheit des Einzelnen insofern<br />
fundamental aushöhlen, <strong>als</strong> sie mit Wissen um den besonderen Fall erlassen werden, im<br />
Gegensatz zu Gesetzen, welche ja vorher, d.h. ohne Wissen des zukünftig eintretenden Einzelfalles,<br />
beschlossen und dann erst rechtskräftig werden.<br />
Die hier kurz dargestellten Kernaussagen der Rechts- und Staatsphilosophie Immanuel Kants<br />
können nach wie vor <strong>als</strong> äußerst hilfreiche rationale Basis zur Begründung des demokratischen<br />
Rechtsstaates herangezogen werden, wofür dem großen Königsberger Dank zu zollen<br />
ist.<br />
48 Kant, Gemeinspruch, S. 153<br />
49 Kant, MdS, S. 465; Hervorhebungen durch H. – D. <strong>Bottke</strong><br />
50 Kant, Gemeinspruch, S. 145<br />
51 ebenda, S. 146<br />
52 ebenda, S. 146<br />
53 3 Otfried Höffe: Immanuel Kant. München 1992. S. 214<br />
54 Kant, MdS, S. 435<br />
55 Maus, Institutionalisierung bei Kant, S. 373<br />
56 Kant, MdS, S. 437<br />
57 ebenda, S. 435
Direkte Demokratie <strong>als</strong> Voraussetzung von Demokratie überhaupt<br />
Weitergehende, aus dem bisher Dargelegten logisch zwingende Folgerungen hinsichtlich<br />
direktdemokratischer Mitwirkungsrechte des Volkes sollen nun erörtert werden.<br />
Demokratie heißt, aus dem Griechischen übersetzt, nichts anderes <strong>als</strong> Volksherrschaft. Das<br />
Volk besteht aus mit Freiheit begabten Vernunftwesen, die hinsichtlich ihrer prinzipiellen<br />
Möglichkeit freien Handelns gleich sind, ungeachtet aller Unterschiede, welche das Ausmaß<br />
der Freiheit im besonderen Fall anbelangt. Darauf gründet die besondere Würde des Menschen,<br />
welche in ihrem Kern nicht angetastet werden darf! Jeder ist somit befugt, sein Leben<br />
nach eigenen Maximen einzurichten und dabei seiner individuellen Glückseligkeit, wie er sie<br />
sich denkt, nachzustreben und dabei nur zu beachten hat, wie seine Willkür mit der aller anderen<br />
nach allgemeinen und für alle gleichen Freiheitsregeln zu vereinbaren ist. Da zur Sicherung<br />
dieser Freiheitsrechte die Einrichtung eines Rechtsstaates vernünftig zu wollen ist und<br />
die Gesetze, die in ihm erlassen werden, einschließlich der ihn konstituierenden Verfassung,<br />
nur durch die gleichberechtigte Mitwirkung aller Mitglieder <strong>als</strong> freier und damit in ihrer<br />
Würde gleicher Vernunftwesen legitimiert werden können, kommt allen Staatsbürgern in<br />
ihrer Gesamtheit das unveräußerliche Recht zu, jederzeit zu jeder Frage, die das Staatswesen<br />
betrifft, verbindlich abzustimmen. Es ist natürlich legitim Vertreter zu wählen, die<br />
dann im Namen des Volkes Gesetze erlassen, allein weil es kaum praktikabel wäre, zu jedem<br />
Gesetz immer eine Volksabstimmung abzuhalten. Dennoch muß die Möglichkeit garantiert<br />
sein, daß das Volk, wenn es dies wünscht, zu jedem Zeitpunkt und zu jeder Thematik direkt<br />
abstimmen und damit letztgültig <strong>als</strong> oberster Souverän entscheiden kann! Es ist nicht akzeptabel,<br />
daß Parteienvertreter, Richter oder sonstige, z.T. selbst ernannte Experten dieses<br />
Recht einschränken, wie dies z.B. zurzeit in der Bundesrepublik Deutschland geschieht. Wer<br />
gibt irgendjemandem das Recht zu bestimmen, daß über gewisse Fragen das Volk in seiner<br />
Gesamtheit nicht abstimmen darf? Woher meinen diese Menschen ihre Legitimität, so etwas<br />
entscheiden zu dürfen, herzunehmen, wenn doch alle Menschen in ihrer Würde <strong>als</strong> freiheitsbegabte<br />
Vernunftwesen gleich sind und niemand für sich eine privilegierte Stellung hinsichtlich<br />
der Entscheidungen beanspruchen darf, welche das Staatswesen, <strong>als</strong> einer gleichberechtigten<br />
Vereinigung aller Staatsbürger, betreffen? Wenn jemand oder eine Gruppe von<br />
Staatsbürgern behauptet, sie besäßen das Recht zu entscheiden, ob oder worüber das Volk<br />
direkt zu entscheiden habe, dann stellt sich doch die Frage, woher sie sich dieses Recht nehmen.<br />
Die Abgeordneten des Bundestages sind zwar demokratisch gewählte Vertreter des<br />
Volkes, aber nicht das Volk! Sie haben nicht das Recht festzulegen, daß das Volk sich nicht<br />
selbst eine Verfassung geben darf. Nur die Staatsbürger in ihrer Gesamtheit sind der oberste<br />
Souverän und niemand sonst. Es stellt eine ungeheuerliche Anmaßung dar, den Anspruch<br />
einer besonderen, höheren Menschenwürde für sich selbst zu reklamieren und dem Rest des<br />
Volkes eine geringere zuzumuten! Die gewählten Abgeordneten können nicht das Recht für<br />
sich beanspruchen, in Fragen direkter Demokratie <strong>als</strong> Stellvertreter für das gesamte Volk zu<br />
entscheiden, allein schon deshalb nicht, weil die Bürger bei der Wahl jener Abgeordneten gar<br />
nicht über diese Frage abstimmen konnten, da nur die Parteien und ihre Kandidaten zur Wahl<br />
standen, wodurch der oberste und einzig legitime Souverän in dieser Frage überhaupt gar<br />
nicht zu Wort kommen konnte und kann. Darüber hinaus ist kein Verfassungsgeber, der<br />
immer nur in einer konkreten historischen Situation für das zu dieser Zeit existierende Gemeinwesen<br />
zu befinden hat, befugt, nachfolgenden Generationen vorzuschreiben, welche Regelungen<br />
für sie sinnvoll sind, weil dies ihrer Entmündigung gleichkäme! Somit kann auch<br />
das Volk mit Mehrheit weder für sich noch gar für zukünftige Generationen legitim beschließen,<br />
sich selbst zu entmündigen und damit einen Teil seiner Würde aufzugeben, wie es<br />
schon Kant sehr prägnant formuliert hat. 58<br />
58 vgl. oben: Kant, MdS, S. 465
Neben den aufgeführten grundsätzlichen Argumenten sprechen auch praktische Erwägungen<br />
für die Einführung direktdemokratischer Mitwirkungsrechte:<br />
1. direkte Bürgerbeteiligung führt über die aktive Auseinandersetzung mit wichtigen<br />
Problemen des Gemeinwesens zu einer höheren Identifikation mit demselben;<br />
2. aufgrund der Möglichkeit, Entscheidungen direkt herbeiführen zu können, wird auch<br />
das Interesse, sich inhaltlich kundig zu machen, befördert;<br />
3. dadurch steigt tendenziell auch die Fachkompetenz vieler Bürger, weil eine solche<br />
direkte Beteiligung einen entsprechenden Lernprozeß befördern würde;<br />
4. somit wird ebenfalls der Verselbständigung kleiner Eliten, mit den Bürgern <strong>als</strong> bloßen<br />
Zuschauern, entgegengewirkt;<br />
5. öffentliche Sachdiskussionen könnten jenseits parteipolitischer Machtkalküle und der<br />
daraus resultierenden Verhärtungen stattfinden;<br />
6. auch schmerzhafte Reformen, so sie denn durch das Volk beschlossen würden, wären<br />
aufgrund ihrer hohen Legitimation schneller durchzusetzen und besäßen eine weit<br />
höhere Akzeptanz im Volke, da es jene ja mit Mehrheit selber beschlossen hätte.<br />
Ein häufig anzutreffender Einwand von Gegnern direktdemokratischer Entscheidungsbefugnisse<br />
bezieht sich auf die unzureichende Sachkompetenz der Bürger bei komplizierten Sachverhalten<br />
oder bemängelt, daß viele Fragen nicht einfach mit ‚Ja’ oder ‚Nein’ zu beantworten<br />
seien. Daher könne nur die repräsentative Form der Demokratie mit einem hauptberuflichen<br />
Parlament die wichtigen Entscheidungen treffen. Doch hier stellt sich zugleich die Frage nach<br />
der sog. ‚Kompetenz Kompetenz’, d.h. wer, außer das gesamte Volk in seiner Mehrheit, soll<br />
darüber befinden, wer was zu entscheiden hat. Sobald man dem Volk diese Letztentscheidungskompetenz<br />
nimmt, transferiert man sie zwingend an jemand anderen, der dieses Recht<br />
wahrnimmt; dies können Politiker oder Gerichte sein oder, wie bei uns, eine Mischung aus<br />
beidem. Nur wenn man so vorgeht, ist dies eben nicht demokratisch, sondern eine selbsternannte<br />
Expertokratie maßt sich moralisch illegitimerweise diese Kompetenz an. Ich wende<br />
mich hierbei jedoch keineswegs gegen ein parlamentarisches System, weil mir durchaus bewußt<br />
ist, daß die meisten Entscheidungen aus vielerlei praktischen Gründen im Parlament<br />
vorbereitet und getroffen werden müssen. Aber in einer Demokratie muß das Letztentscheidungsrecht<br />
beim Souverän, <strong>als</strong>o dem Volk, liegen. Dies gilt auch hinsichtlich des Problems,<br />
ob man eine bestimmte Thematik auf eine ‚Ja-Nein-Entscheidung’ reduzieren kann oder<br />
nicht. Denn man sollte den mündigen Bürgern in einer Demokratie durchaus zutrauen, so weit<br />
differenzieren zu können, daß sie eine unangebrachte Verkürzung einer Problematik erkennen<br />
können. Darüber hinaus fordern Stimmabgaben bei Parlamentswahlen dem Bürger eher noch<br />
mehr ab, <strong>als</strong> Voten bei einem Volksentscheid, da bei ersteren weit mehr Aspekte zu beachten<br />
sind, soll die Entscheidung zumindest auch durch rationale Erwägungen maßgeblich mitgeprägt<br />
sein, wie z.B.:<br />
- der Vergleich und die Bewertung einer Reihe verschiedener Programmpunkte<br />
der Parteien, die so komplizierte Bereiche wie das Steuerrecht, den Staatshaushalt<br />
oder die Außenpolitik zum Inhalt haben,<br />
- die Beurteilung der fachlichen Kompetenz der Bewerber für ein Mandat,<br />
- die Bewertung der moralischen Glaubwürdigkeit der Politiker, d.h. ob und<br />
inwieweit sie gemachte Versprechen auch einhalten werden.<br />
Wenn man dem Bürger diese Kompetenz bei Wahlen zubilligt, ist es inkonsequent, ihm diese<br />
bei Volksentscheidungen nicht zutrauen zu wollen. Wer die Menschen eines Landes für zu<br />
unmündig erachtet Sachentscheidungen fällen zu können, der muß dann folgerichtig auch<br />
ganz die Demokratie verwerfen und einen anderen Souverän <strong>als</strong> das Volk benennen. Es ist<br />
zwar immer durchaus möglich, daß Menschen, auch in ihrer Mehrheit, Fehler begehen. Doch<br />
dies gilt für alle, <strong>als</strong>o ebenso für Parlamentarier. Falls sich die Bürger bei einem nach ihrer<br />
Auffassung für sie zu komplizierten Sachverhalt überfordert fühlen, können sie die Entscheidung<br />
natürlich ihren Vertretern überlassen und müßten sich dann eben in einer anstehenden
Abstimmung entsprechend entscheiden. Die Möglichkeit direktdemokratischer Entscheidungsverfahren<br />
bedeutet ja keineswegs, daß das Volk immer über alles selbst direkt zu befinden<br />
hat. Bei ihm <strong>als</strong> Souverän liegt lediglich die oben schon erörterte Letztentscheidungskompetenz.<br />
Das Volk muß demnach auf allen drei staatlichen Ebenen – Kommunen, Länder, Bund – befugt<br />
sein, direkt Entscheidungen durch Abstimmungen herbeizuführen und zwar ohne jede<br />
thematische Einschränkung! Im Rahmen direkter Demokratie ist zwischen dem Referendum<br />
über ein parlamentarisches Gesetz bzw. einen Gesetzesvorschlag und ein aus dem Volk selbst<br />
stammendes Gesetz zu unterscheiden. Bei ersterem kann das Volk nur durch die Abstimmung<br />
entscheiden, ob ein bestimmtes Gesetz, so wie es formuliert worden ist, in Kraft treten soll<br />
oder nicht. Ein solches Referendum kann durch die parlamentarische Opposition, die Regierungsfraktionen<br />
oder die Regierung selbst Obgleich das Referendum ein wichtiges Instrument<br />
direkter Bürgerbeteiligung darstellt, so genügt dies allein demokratischen Ansprüchen nicht,<br />
da nur über parlamentarische Gesetze bzw. Gesetzesvorschläge abgestimmt werden kann.<br />
Wenn allerdings keine der im parlamentarischen Verfahren zustande gekommenen Vorschläge<br />
einer Mehrheit im Volke zusagt, so muß der oberste Souverän die Möglichkeit haben, selber<br />
eigene Überlegungen einzubringen und zur Abstimmung zu stellen. Dies geschieht durch<br />
die Volksinitiative, das Volksbegehren und schließlich die Volksabstimmung. Für Volksinitiative<br />
wie Volksbegehren schlage ich ein Quorum von 5% der Wahlberechtigten vor, damit<br />
nur bei entsprechendem öffentlichem Interesse das Verfahren eingeleitet wird, wobei zur<br />
Niederlegung der nötigen Unterschriften Einrichtungen in den Rathäusern zu schaffen sind<br />
und ein Zeitraum von drei Monaten für deren Sammeln anzusetzen ist. Um Querulanten, welche<br />
nur unnötige Kosten verursachen, von ihrem Tun abzuhalten, könnte man für die Verwaltungskosten<br />
einen Vorschuß verlangen, der beispielsweise nur dann zurückerstattet wird,<br />
wenn sich mindestens 1% der jeweils wahlberechtigten Bevölkerung in die Unterschriftenlisten<br />
einträgt. Desweiteren wäre es wahrscheinlich sinnvoll, einen festen Termin im Jahr für<br />
Volksabstimmungen vorzusehen.<br />
In einer Demokratie müssen Fragen, welche die Verfassung betreffen – sei es die Verabschiedung<br />
der Verfassung oder seien es Änderungen einer bereits bestehenden – obligatorisch<br />
durch das Volk direkt entschieden werden. Bei Volksentscheiden in Verfassungsfragen sollte<br />
meiner Meinung nach ein Zustimmungsquorum von 50% plus eine Stimme gelten, d.h. daß<br />
sich eine absolute Mehrheit des Volkes z.B. für die Änderung eines Artikels in der Verfassung<br />
aussprechen muß, damit sie in Kraft treten kann. Bei einfachen Gesetzen sollte das<br />
Quorum entsprechend niedriger liegen, und zwar zwischen 20% und 25%. Normale Gesetze,<br />
<strong>als</strong>o diejenigen, welche keinen Verfassungsrang genießen, dürfen zumindest innerhalb von<br />
fünf Jahren nur durch das Volk in direkter Abstimmung geändert werden und nicht durch das<br />
Parlament, da hierdurch ein Volksentscheid zu einer Farce verkommen kann, wie dies bei der<br />
Volksabstimmung in Schleswig – Holstein zur neuen Rechtschreibung erfolgte. Im Jahre<br />
1998 hatte sich die Bevölkerung im nördlichsten Bundesland in einem Volksentscheid gegen<br />
die Einführung der neuen Rechtschreibregeln gewandt. Aber schon im Sommer des darauf<br />
folgenden Jahres beschloß der Landtag, dieses ‚Volksgesetz’ wieder aufzuheben und überging<br />
damit arrogant und völlig undemokratisch den Willen des eigentlichen Souveräns. Mit solchen<br />
Machenschaften entfremdet man die Bürger von unserer Parteiendemokratie nur noch<br />
mehr. Die von vielen Politikern ansonsten wohlfeil vorgebrachten Klagen über mangelndes<br />
demokratisches Engagement der Menschen in unserem Lande entlarven sich durch solches<br />
Vorgehen <strong>als</strong> perfide Heuchelei!<br />
Daß direktdemokratische Elemente mit parlamentarischer Demokratie vereinbar sind und in<br />
der Praxis funktionieren können, beweißt das Beispiel der Schweiz, die uns kulturell nicht so<br />
fern steht. Auch wenn sie im Vergleich zu Deutschland ein kleineres Gemeinwesen darstellt,<br />
so handelt es sich bei ihr ebenfalls – mit mehreren Millionen Einwohnern – um ein großes,
modernes Staatswesen von so erheblicher Größe, daß ein prinzipieller Vergleich in der hier<br />
diskutierten Fragestellung vollkommen zulässig ist.<br />
Trotz der dargestellten positiven praktischen Auswirkungen, die durch direktdemokratische<br />
Beteiligungsmöglichkeiten erzielt werden könnten, möchte ich diesbezüglich allerdings auch<br />
nicht zu optimistisch sein, da es natürlich, genauso wenig wie im parlamentarischen Prozedere,<br />
eine Garantie für sachlich sinnvolle Entscheidungen gibt, wobei es wiederum schwierig<br />
ist, festzulegen, was denn eigentlich sinnvoll oder gut ist. Ich glaube auch keineswegs, daß die<br />
Mehrheitsmeinung immer mit meiner eigenen zusammenfällt oder daß durch Volksentscheide<br />
Probleme, wie z.B. die Arbeitslosigkeit, in jedem Fall gelöst werden würden. Aber selbst<br />
wenn das Volk mit Mehrheit Entscheidungen treffen sollte, die einige Probleme sogar noch<br />
verschärften, was nicht auszuschließen ist, so müßte es dafür auch die Verantwortung tragen<br />
und könnte niemanden sonst zum Schuldigen erklären. Eine solch bequeme Haltung wird viel<br />
eher durch unser jetziges, allein repräsentatives System auf Bundesebene befördert. Das Volk<br />
besitzt bei direktdemokratischen Entscheidungen die Möglichkeit, aus Fehlern zu lernen, wobei<br />
hier angemerkt sein soll, daß infolge der weitreichenden technischen Potentiale unserer<br />
modernen Zivilisation kaum oder nicht revidierbare Fehlentwicklungen eingeleitet werden<br />
können. Dieser Tatbestand spricht aber nicht gegen, sondern eher für mehr Demokratie, da<br />
auch Abgeordnete in ihrer Mehrheit irren können. Eine Gewährleistung für verantwortungsvolle<br />
Entscheidungen – auch im Hinblick auf zukünftige Generationen – gibt es bei keinem<br />
Verfassungssystem, weil wir es eben mit fehlbaren Menschen zu tun haben! Die Mehrheit<br />
kann <strong>als</strong>o auch Gesetze beschließen, die beispielsweise eine Minderheit stärker belasten: z.B.<br />
sehr hohe Steuern für Vermögende. Die betroffene Gruppe hat dann natürlich das Recht, diese<br />
Entscheidung nicht für gut zu halten und Konsequenzen daraus zu ziehen, indem sie selbst<br />
bzw. ihr Vermögen das Land verläßt oder viele wirtschaftliche Leistungsträger eben nicht<br />
mehr so viel im Land investieren. Ihre Argumente kann diese Gruppe von Staatsbürgern mit<br />
aller Schärfe in die Öffentlichkeit tragen, auch wenn das Volk in seiner Mehrheit anders beschlossen<br />
hat. Die freie Meinungsäußerung ist, <strong>als</strong> konstituierendes Element der Demokratie<br />
und Bestandteil der unantastbaren Würde jedes Menschen, für niemanden disponibel! Alle<br />
Entscheidungen einer Mehrheit, welche die Menschenwürde, die sich aus den Ausführungen<br />
auch der vorangegangenen Kapitel ergeben, einer Minderheit antasten, sind nicht legitim,<br />
trotz einer möglicherweise demokratisch erzielten Mehrheit. Das Problem besteht aber immer<br />
darin, wer das Recht hat, eine solche Feststellung zu treffen. Hierauf gibt es keine letztlich<br />
befriedigende Antwort, weil sowohl die Mehrheit eines Volkes <strong>als</strong> auch eine der Parlamentarier<br />
sowie die eines Richtergremiums irren können. Irrtümer lassen sich eben niem<strong>als</strong> völlig<br />
ausschließen. Um die Wahrscheinlichkeit ihres Eintretens zu vermindern, gilt weiterhin der<br />
Wahlspruch der Aufklärung, formuliert durch Immanuel Kant: „Aufklärung ist der Ausgang<br />
des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen,<br />
sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Selbstverschuldet ist<br />
diese Unmündigkeit, wenn die Ursache derselben nicht am Mangel des Verstandes, sondern<br />
der Entschließung und des Mutes liegt, sich seiner ohne Leitung eines anderen zu bedienen.<br />
Sapere aude! Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen! ist <strong>als</strong>o der Wahlspruch<br />
der Aufklärung.“ 59<br />
Nachfolgend möchte ich noch die Frage nach dem einen Staat konstituierenden Volk diskutieren<br />
und welche Voraussetzungen dafür gegeben sein müssen, damit Demokratie praktiziert<br />
werden kann. Neben der Meinungsfreiheit <strong>als</strong> einer notwendigen Bedingung für einen freien<br />
Diskurs ist auch die gemeinsame Sprache zu nennen, da ohne diese eine gleichberechtigte<br />
Kommunikation gar nicht erst stattfindet. Dieses Problem stellt sich in vielen westlichen<br />
Industrieländern, in denen erhebliche Minderheiten mit Migrationshintergrund leben und<br />
nicht über ausreichende oder sogar keinerlei Sprachkenntnisse des betreffenden Landes ver-<br />
59 Immanuel Kant: Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung? Hg. W. Weischedel. Sonderausgabe Wissenschaftliche<br />
Buchgesellschaft Bd. 9 Darmstadt 1983. S. 53
fügen. Ihre – zunächst sprachliche – Integration ist dringend erforderlich und verlangt von der<br />
einheimischen Gesellschaft, die Einwanderer <strong>als</strong> Mitbürger willkommen zu heißen und dabei<br />
keine rassistischen oder sonstigen Vorurteile gegenüber jenen Neubürgern an den Tag zu<br />
legen. Aber auch die Migranten haben Pflichten! Sie müssen sich in die Gesellschaft aktiv<br />
integrieren wollen, d.h. zunächst möglichst schnell die Sprache zu erlernen, aber ebenso gewisse<br />
Umgangsformen zu beachten, allein schon um ein gedeihliches Miteinander zu befördern.<br />
Denn, wenn ich in ein anderes Land auswandere, kann ich nicht von der dortigen Bevölkerung<br />
erwarten, daß sie sich im wesentlichen mir anpaßt. Dies spricht allerdings nicht gegen<br />
vielfältige kulturelle Bereicherungen durch Einwanderer, solange sie in Art und Ausmaß die<br />
Gesellschaft nicht überfordern. Daß sich alle Bewohner eines Landes an die geltenden Gesetze<br />
zu halten haben, ist eine schlichte Selbstverständlichkeit. Somit ist <strong>als</strong> Ideal anzustreben,<br />
daß alle in einem Land dauerhaft wohnenden Menschen Staatsbürger mit gleichen Rechten<br />
und Pflichten sind und damit das den Staat konstituierende Volk ausmachen. Große, nicht<br />
integrierte Minderheiten gefährden letztlich die Demokratie selbst und können sogar staatszerstörend<br />
wirken! Die hier angesprochenen kulturellen Aspekte sind für das Funktionieren<br />
einer Demokratie außerordentlich wichtig, weil gerade das Gefühl der Bürger einer gemeinsamen<br />
Kultur und ihren Werten anzugehören eine enorme Bedeutung für eine positive Identifikation<br />
mit dem Gemeinwesen besitzt, die unbedingt zu erhalten und zu fördern ist. In diesem<br />
Zusammenhang muß dringend vor einem naiven ‚Multikulti’ – Gefasel gewarnt werden,<br />
welches letztlich nur die eigenen kulturellen Wurzeln vernichtet und den Weiterbestand einer<br />
Kulturnation wie der unsrigen bedroht. Denn eine Nation, die sich derart selbst aufgäbe, wäre<br />
langfristig nicht zu retten. Dies bedeutet aber keineswegs, um es nochm<strong>als</strong> ausdrücklich<br />
hervorzuheben, sich anderen kulturellen Einflüssen zu verschließen, sondern lediglich, daß<br />
solche Einflüsse mit Hilfe der eigenen historischen Traditionen selbstbewußt, aber ohne Überheblichkeit<br />
interpretiert werden und somit zu einer Bereicherung der eigenen Kultur führen<br />
sollten. Dadurch würde Offenheit für eine notwendige gesellschaftliche Dynamik mit dem<br />
unbedingt notwendigen Gemeinschaftsgefühl in Einklang gebracht werden. Gerade die von<br />
mir in diesem Buch vertretenen freiheitlich-demokratischen Werte dürfen nicht nur <strong>als</strong> theoretische<br />
Konstrukte existieren, sondern müssen auch gelebt werden, wie dies in unseren westlichen<br />
Gesellschaften noch am ehesten, trotz aller auch von mir zum Teil scharf kritisierter<br />
Schwächen, geschieht. Infolgedessen müssen diese Werte offensiv gerade nach innen vertreten<br />
werden. Leider ist dies hier in Deutschland lange Zeit nicht in ausreichendem Maße<br />
geschehen, weil einige Toleranz mit Beliebigkeit sowie kultureller Selbstaufgabe verwechselt<br />
haben!<br />
Die Argumente, die für direkte Demokratie sprechen, ausgehend von den genannten Voraussetzungen<br />
von Freiheit und Gleichheit, sind logisch zwingend einschließlich aller damit verbundenen<br />
moralischen Implikationen, welche die Würde des Einzelnen betreffen. Daher rührt<br />
auch mein sehr deutliches Eintreten für eine diesen Grundsätzen entsprechende Verfassung.<br />
Allerdings ist mir dabei durchaus bewußt, daß die praktische Realisierung eines solchen Verfassungstyps<br />
an historisch – kulturelle Voraussetzungen gebunden ist, da leider keineswegs<br />
alle oder auch nur die meisten Menschen auf der Welt, weder heute noch gar in der Vergangenheit,<br />
die dafür nötigen moralischen Werte teilen sowie gewisse intellektuelle Mindestanforderungen<br />
erfüllen, auch infolge ihrer historisch – kulturellen Prägung. Obgleich undemokratische<br />
Einstellungen eindeutig unmoralisch sind und man daher eine Demokratie zwar mit<br />
gutem Recht fordern kann, so wird man sie allerdings ohne die erforderliche Mitwirkung der<br />
Menschen nicht umsetzen können. Wenn sich <strong>als</strong>o der eigentliche Souverän seiner Verantwortung<br />
nicht stellt oder sie sogar bewußt verletzt, indem er entweder mit Mehrheit seine Entmündigung<br />
beschließt, die freie Meinungsäußerung verhindert oder überhaupt Minderheiten<br />
durch Mehrheitsbeschlüsse von einer gleichberechtigten Partizipation am Gemeinwesen aus-
schließt 60 , dann läßt sich die einzig legitime Staatsverfassung eben leider nicht in die Praxis<br />
umsetzen. Guten Demokraten bleibt in diesem Fall nichts anderes übrig, <strong>als</strong> beharrlich für die<br />
Demokratie und ihre Vorzüge zu werben. Es kann daher durchaus erforderlich sein, sich dem<br />
Ziel einer vollständigen Demokratie schrittweise zu nähern. Wann, wem, welche Rechte zugebilligt<br />
werden sollen und von wem diese Entscheidungen im Einzelfall zu treffen sind, ist<br />
schwerlich allgemeingültig zu beantworten und muß in der jeweiligen historischen Situation<br />
verantwortlich abgewogen werden. Mir ist die Problematik dieser Aussage durchaus bewußt,<br />
aber es gibt hierauf wohl keine eindeutigere Antwort. Als ein Beispiel kann man den Kosovo<br />
heranziehen, wo, wenn auch erst sehr spät bzw. für viele Opfer zu spät, der Westen (EU,<br />
USA) seit ein paar Jahren versucht, Grundlagen für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit zu<br />
schaffen und sogar Volksgruppen mit Gewalt daran hindern muß, sich gegenseitig zu massakrieren.<br />
Hier übernimmt ein Gruppe von Staaten die Rolle desjenigen, der zurzeit die oberste<br />
Souveränität innehat, um das Schlimmste zu verhüten.<br />
Nun komme ich nochm<strong>als</strong> zum Abschluß dieses Kapitels auf Deutschland zu sprechen:<br />
Inwieweit entspricht die deutsche Bevölkerung des Jahres 2008 in ihrer Gesamtheit den Anforderungen<br />
einer wirklichen Demokratie? Ich versuche nachfolgend diese Frage nach bestem<br />
Wissen zu beantworten, wobei ich mir natürlich darüber bewußt bin, wie leicht dies <strong>als</strong> anmaßend<br />
empfunden werden kann. Dennoch gehe ich dieses Wagnis ein.<br />
Zunächst einmal glaube ich aufgrund der Erfahrungen seit dem Entstehen der westdeutschen<br />
Bundesrepublik nach dem Zweiten Weltkrieg sowie nach der friedlichen und demokratischen<br />
Revolution im Osten Deutschlands in den Jahren 1989 / 90 an eine entsprechende Reife des<br />
deutschen Volkes, so daß zumindest die wesentlichen Grundvoraussetzungen für gleichberechtigte<br />
und freie Wahlen bzw. direktdemokratische Abstimmungen in unserem Land einigermaßen<br />
fest verankert sind. Es ist <strong>als</strong>o nicht davon auszugehen, daß unser Volk in seiner<br />
Mehrheit wesentliche Bestandteile einer Demokratie wie die Rede- und Pressefreiheit in<br />
ihrem Kern bedrohen, den Rechtsstaat abschaffen oder Beschlüsse fassen würde, die zu<br />
bürgerkriegsähnlichen Zuständen, wie sie im ehemaligen Jugoslawien in den 1990er Jahren<br />
leider anzutreffen waren, führten. Obgleich dies aus unserer heutigen Sicht in Deutschland<br />
eigentlich eine Selbstverständlichkeit ist, so sollte dies dennoch an dieser Stelle erwähnt werden.<br />
Diese wesentlichen Grundprinzipien einer demokratischen Staatsordnung werden <strong>als</strong>o<br />
nach meiner festen Überzeugung nicht nur von irgendeiner kleinen Elite, sondern von der<br />
übergroßen Mehrheit hierzulande geteilt und im Alltag auch gelebt. Allerdings bereiten mir<br />
die seit Jahren zunehmende Gewalt und Propaganda von rechtsradikalen Gruppierungen<br />
sowie dergleichen durch kriminelle, schlecht bzw. gar nicht integrierte Migranten, die sich<br />
teilweise in Banden zusammenschließen, große Sorgen. Auch wenn es sich um relativ kleine<br />
Minderheiten handelt, so führen solche Machenschaften zu erheblichen Verunsicherungen in<br />
weiten Teilen der Bevölkerung, wobei sogar schon Stadtteile oder ganze ländliche Regionen<br />
von solchen Gruppen so weit eingeschüchtert oder sogar fast schon terrorisiert werden, daß<br />
viele Menschen – insbesondere auf die es diese Kriminellen vor allem abgesehen haben – sich<br />
kaum noch trauen, gegen sie öffentlich Stellung zu beziehen. Hier hat der Rechtsstaat aus<br />
meiner Sicht durch viel zu große Laschheit und f<strong>als</strong>ch verstandene Toleranz in Teilen versagt.<br />
Ich würde mir wünschen, daß gegen solche Personen oder Gruppen, die unsere freiheitlich –<br />
demokratischen Werte so schamlos mit Füßen treten (leider teilweise im wahrsten Sinne des<br />
Wortes), in Zukunft viel konsequenter und mit aller Härte vorgegangen und diesem Treiben<br />
durch die dazu legitimierten Staatsorgane rigoros ein Ende bereitet wird. Bei diesen, vor allem<br />
jugendlichen, gewaltbereiten Menschen handelt es sich sehr häufig um jene, die man <strong>als</strong> ‚Modernisierungsverlierer’<br />
bezeichnen könnte, jene <strong>als</strong>o, die beispielsweise den heutigen Anforderungen<br />
auf dem Arbeitsmarkt nicht oder kaum gewachsen sind und ihr Minderwertigkeits-<br />
60 Derartige Beschlüsse sind sowohl eindeutig unmoralisch <strong>als</strong> auch insofern juristisch illegitim, wenn man die in<br />
den vorigen Kapiteln dargelegten Grundlagen der Menschenwürde und die daraus zwingend resultierenden<br />
Rechtsgrundsätze, denen jedes legitime positive Recht entsprechen muß, zugrunde legt.
gefühl dann mit Ideologie und Gewalt zu kompensieren trachten. Obwohl man natürlich versuchen<br />
soll, sie aus solcher Perspektivlosigkeit herauszuführen, so muß man ihnen zunächst<br />
einmal mit unmißverständlicher Härte klarmachen, daß sie selbst den ersten Schritt tun und<br />
von der Gewalt ablassen müssen, da sie ansonsten so lange weggesperrt werden, bis sie dies<br />
verstanden haben. Ich will es an dieser Stelle bei diesem kurzen Exkurs belassen. 61 Es sollte<br />
hier nur verdeutlicht werden, daß durch die Taten auch relativ kleiner Minderheiten Prinzipien<br />
eines freiheitlich – demokratischen Gemeinwesens erheblich unterminiert werden können und<br />
am besten schon den Anfängen entschlossen begegnet werden sollte, nicht zuletzt damit das<br />
Vertrauen in eine Demokratie <strong>als</strong> solche keinen großen Schaden nimmt; denn darum geht es<br />
ja in diesem Abschnitt. Wenn der deutsche Staat in Zukunft in dem genannten Sinne die<br />
Herausforderung überall im Lande annähme, dann wäre diesem Spuk schnell ein Ende bereitet.<br />
Hinsichtlich des gerade Aufgeführten fände sich wohl leicht eine breite Mehrheit in<br />
unserem Volke, weil die allermeisten eben ein friedliches, freies, demokratisches und möglichst<br />
sicheres Gemeinwesen wünschen.<br />
Diesem positiven Urteil hinsichtlich der demokratischen Gesinnung der großen Mehrheit hierzulande<br />
muß aber leider nun auch Kritik folgen. Um sich sinnvoll an Entscheidungen beteiligen<br />
zu können, ist ein Mindestmaß an Informationen vonnöten. Zunächst einmal muß man<br />
natürlich über die Grundlagen unserer Verfassung, der wichtigsten Staatsorgane sowie deren<br />
führende Vertreter informiert sein. Ebenfalls ist es erforderlich, über die wichtigsten Programmpunkte<br />
der zur Wahl stehenden Parteien 62 sowie deren jeweilige Vorschläge zur Lösung<br />
der gerade anstehenden, wesentlichen politischen Probleme Bescheid wissen, um überhaupt<br />
eine Wahl nach vernünftigen Kriterien treffen zu können. Aber selbst diese Mindestanforderungen<br />
überfordern viele Menschen, insbesondere junge Leute. Es geht ein Riß durch<br />
die Gesellschaft: ein kleiner, wohl informierter Teil steht einem viel größeren, kaum oder gar<br />
nicht informierten gegenüber. Selbst wenn man sich durch mehr direkte Bürgerbeteiligung<br />
eine stärkere Anteilnahme am politischen Geschehen versprechen sollte, so muß dies jeden<br />
Demokraten sehr bedenklich stimmen. An dieser Stelle will ich ausdrücklich betonen, daß<br />
jeder in einer Demokratie Verantwortung für dieselbe trägt und moralisch dazu verpflichtet<br />
ist, sich wenigsten über die wichtigsten Fragen, welche unser Gemeinwesen betreffen sowie<br />
die Haltung der Parteien zu jenen, kundig zu machen. Information ist eben auch eine Holschuld,<br />
d.h. man ist selber gefordert, sie sich zu besorgen! Und dies ist in Deutschland in bezug<br />
auf diese grundlegenden Sachverhalte nun wirklich nicht schwierig; man denke an die<br />
Vielzahl von soliden bis hervorragenden Tageszeitungen, das Internet, Radio- und Fernsehsender<br />
sowie die Inforationsangebote der Parteien. Viele ziehen es jedoch vor, sich nur zu<br />
beklagen und auf ‚die Politik’ zu schimpfen, ohne selber auch nur ein wenig eigenes Engagement<br />
an den Tag zu legen. Eine solche Haltung ist verderblich und eines Demokraten<br />
unwürdig!<br />
Neben diesen Mindestanforderungen sind aber auch auf naturwissenschaftlichem sowie ökonomischem<br />
Gebiet einige Grundkenntnisse 63 erforderlich, um politischen Debatten zu folgen,<br />
sich selber einzumischen und dann bei der Wahl auch wirklich nach vernünftigen Kriterien<br />
eine Entscheidung zwischen den Parteien treffen zu können. Auch hier sind die Informationen<br />
leicht zu erhalten; ich verweise auf die eben bereits erwähnten Medien. Wenn man Umfragen<br />
Glauben schenken will, die dergleichen getestet haben, so bietet sich ein sehr düsteres Bild.<br />
Aus eigener Erfahrung einschließlich der vielfältigen beruflichen Kontakte im Rahmen der<br />
Leitung meines privaten Lehrinstitutes muß ich dies leider nur voll und ganz bestätigen: Ein<br />
gut informierter kleiner Teil steht einem viel größeren, desinteressierten gegenüber. Eine vernunftgeleitete<br />
öffentliche politische Debatte beschränkt sich infolgedessen auf jenen kleinen<br />
61 Vgl. hierzu die Ausführungen in Kapitel 11.<br />
62 Hiermit sind natürlich nicht alle möglichen Splitterparteien gemeint, sondern nur diejenigen, die im politischen<br />
Kräftespiel eine Rolle spielen; es handelt sich auf jeden Fall um die im Bundestag vertretenen Parteien.<br />
63 Hierunter verstehe ich nur einige grundlegende Kenntnisse, so beispielsweise wesentliche Wirkmechanismen<br />
unseres Wirtschaftssystems.
Kreis, während die übrigen sich weitgehend heraushalten oder noch schlimmer irgendwelchen<br />
Demagogen nachlaufen; seien sie nun weit links oder noch schlimmer rechtsradikal. Ganz besonders<br />
bedenklich wird es, wenn im Volk bei repräsentativen Umfragen große Mehrheiten<br />
für Positionen zustande kommen, die selbst rechtsstaatliche Grundprinzipien verletzen.<br />
Diese Defizite sind leider nicht nur in Deutschland, sondern in fast allen westlichen Nationen<br />
64 zu beobachten und stimmen mich sehr skeptisch. Am Anfang dieses Abschnitts findet<br />
sich mein vehementes Eintreten für die Demokratie einschließlich direktdemokratischer Elemente,<br />
allein schon weil sich nur eine solche Verfassungsform vernünftig moralisch legitimieren<br />
läßt. Auf der anderen Seite muß ich leider feststellen, daß viele Bürger ihren Pflichten,<br />
welche für die praktische Verwirklichung einer solchen Verfassung erforderlich sind, in wesentlichen<br />
Teilen nicht nachkommen. Dies gilt im Prinzip gleichermaßen für eine rein repräsentative<br />
Demokratie wie für eine mit direktdemokratischen Elementen. Man könnte vielleicht<br />
annehmen, daß die Wahl von Volksvertretern eine Art ‚Filter’ darstellt, durch den die<br />
unvernünftigsten Entwicklungen aufgehalten werden würden. Aber gerade die deutsche Geschichte<br />
lehrt uns, daß dies keineswegs immer so sein muß, da schließlich Hitler nicht zuletzt<br />
auch durch den großen Zuspruch seiner Partei bei Parlamentswahlen an die Macht gelangen<br />
konnte; zumindest wäre er ohne jene Wahlerfolge nicht Reichskanzler geworden, selbst wenn<br />
noch einiges mehr für seine Machtergreifung hinzukommen mußte.<br />
Mein Fazit hinsichtlich der demokratischen Reife des deutschen Volkes fällt wie folgt aus:<br />
Im Moment sehe ich keine akute Gefahr hinsichtlich der grundsätzlichen Akzeptanz demokratischer<br />
Spielregeln. Sie sind immer noch in weiten Teilen fest verankert, trotz mancher Randerscheinungen,<br />
die man jedoch sehr genau im Auge behalten bzw. schon im Ansatz konsequent<br />
bekämpfen muß. Die gravierenden Defizite bei vielen Menschen in diesem Lande in bezug<br />
auf wesentliche Informationen, welche für das Verfolgen politischer Debatte sowie für<br />
Wahlentscheidungen notwendig sind, stimmt mich sehr bedenklich. Dies gilt allerdings gleichermaßen<br />
für eine rein repräsentative Demokratie wie für eine mit direktdemokratischen<br />
Elementen. Daher plädiere ich für die Einführung letzterer, zum einen aus den anfangs erwähnten<br />
prinzipiellen Gründen und zum anderen wegen einer, wenn auch nur sehr begrenzten,<br />
Hoffnung auf eine dann stärkere Partizipation größerer Teile unseres Volkes an einem<br />
vernunftgeleiteten demokratischen Prozeß. Umfragen ergeben immer wieder, daß eine große<br />
Mehrheit sich eine direkte Einflußnahme auf politische Entscheidungen durch Volksabstimmungen<br />
wünscht. Nur muß ich vielen aus dieser Mehrheit vorhalten, daß aufgrund ihres bisher<br />
gezeigten Verhaltens sie die Erfüllung ihres Wunsches kaum verdient haben. Dennoch<br />
will ich nicht zu jenen zählen, die ihnen die Möglichkeit zur Besserung von vornherein verweigern.<br />
Insbesondere wären sie dann wirklich selbst verantwortlich und könnten dann ihre<br />
eigenen Versäumnisse nicht mehr anderen in die Schuhe schieben. Wenn sie <strong>als</strong>o beispielsweise<br />
im steuerlichen Bereich Entscheidungen treffen sollten, die zu einer verstärkten Abwanderung<br />
von Leistungsträgern führten, dann müssten sie eben auch völlig zu Recht die<br />
Suppe auslöffeln, die sich in ihrer Mehrheit selbst eingebrockt hätten. Mitleid können sie dann<br />
nicht erwarten und hätten es auch gar nicht verdient! Andererseits hätten sie ja auch die Möglichkeit,<br />
aus solchen Fehlern zu lernen und Entscheidungen zu korrigieren, wobei einmal verspieltes<br />
Vertrauen allerdings nur schwer wiederzugewinnen ist.<br />
Nachfolgendes Zitat von Thomas von Aquin soll am Schluß dieser Ausführungen stehen.<br />
Auch wenn es aus einer anderen Zeit und einem anderen Zusammenhang stammt, so kann es<br />
auf das eben erörterte Thema ebenfalls Anwendung in dem Sinne finden, <strong>als</strong> daß es zugleich<br />
die Rechte wie Pflichten eines jeden Bürgers prägnant zum Ausdruck bringt:<br />
„Quod omnes tangit, ab omnibus tractari et approbari debet.”<br />
64 Trotz dieser harschen, aber dennoch gerechtfertigten Kritik – die Schweiz bildet hier, zumindest teilweise, eine<br />
rühmliche Ausnahme – hinsichtlich vieler Länder unseres Kulturkreises sind die Völker hier dennoch mit demokratischen<br />
Grundwerten am ehesten vertraut. Dies muß aber nicht immer so bleiben!
5.3. Deutscher Föderalismus – Wie eine gute Idee sehr schlecht umgesetzt wird:<br />
Der Föderalismus bietet, insbesondere für größere Länder, vor allem zwei Vorteile, wenn er<br />
richtig konzipiert ist. Er fördert effizientes Handeln:<br />
1. durch den Wettbewerb der einzelnen Gliedstaaten untereinander,<br />
2. durch Dezentralisierung verbunden mit einer größeren Bürgernähe.<br />
Leider müssen wir hier in Deutschland bei der Umsetzung einer an sich guten Idee sehr viele<br />
Schwächen konstatieren, die durch Verkrustungen, Ineffizienzen oder häufig nicht klar abgegrenzter<br />
Kompetenz- und Verantwortungsbereiche zwischen Bund, Ländern und Gemeinden<br />
verursacht werden, so daß dringend durchgreifende Reformen erfolgen müssen. Ich möchte<br />
hier nur kurz einige Verbesserungsvorschläge unterbreiten, welche zum Teil genauso oder<br />
zumindest in ähnlicher Weise schon seit langem sowohl in der politikwissenschaftlichen<br />
Fachwelt <strong>als</strong> auch in zahlreichen öffentlichen Medien diskutiert worden sind.<br />
Um einen sinnvollen Wettbewerb zwischen den Ländern zu ermöglichen, müssen zumindest<br />
folgende zwei Bedingungen erfüllt sein:<br />
2. aus sich heraus lebensfähige Gliedstaaten,<br />
3. klare Kompetenz- und damit Verantwortungszuweisungen.<br />
Die Schaffung aus sich heraus lebensfähiger Länder erfordert eine Neugliederung des Bundesgebietes.<br />
Ich schlage hierfür folgende Neustrukturierung vor:<br />
1. Nordrheinwestfalen (wie bisher),<br />
2. Bayern (wie bisher),<br />
3. Baden – Württemberg (wie bisher),<br />
4. Rheinland – Hessen (Saarland, Rheinland – Pfalz und Hessen),<br />
5. Sachsen – Thüringen (Sachsen, Thüringen und die südlichen Teile Sachsen – Anhalts),<br />
6. Niedersachsen (Niedersachsen, Bremen, Hamburg und Schleswig – Holstein),<br />
7. Brandenburg (Brandenburg, Berlin, Mecklenburg – Vorpommern und die nördlichen<br />
Teile von Sachsen – Anhalt).<br />
Es sind durchaus noch andere sinnvolle Varianten denkbar, solange sie wirklich lebensfähige<br />
Gemeinwesen konstituieren, wobei dieser Vorschlag zur besseren Durchsetzung teilweise<br />
gewachsene Strukturen berücksichtigt. Zur Legitimation der Durchführung bedarf es einer<br />
bundesweiten Volksabstimmung, weil das gesamte Bundesgebiet in Länder aufgeteilt wird<br />
und der oberste Souverän das Bundesvolk in seiner Gesamtheit ist. In Kapitel 6 wurde im<br />
Rahmen der Erörterungen zur Staatsverfassung auch die Notwendigkeit direktdemokratischer<br />
Elemente diskutiert, wobei die Frage nach dem deutschen Staatsvolk nicht gestellt sondern<br />
vorausgesetzt worden ist, daß alle Menschen mit deutschem Pass jenes konstituieren, so daß<br />
<strong>als</strong> oberster Souverän nur das gesamte Volk gelten kann und nicht etwa ein Landesvolk.<br />
Wenn man allerdings eine andere Voraussetzung wählt, wie z.B. daß erst in Abstimmungen<br />
der einzelnen Bundesländer oder gar Regionen ermittelt werden sollte, ob man sich zum Gesamtgemeinwesen<br />
‚Deutschland’ <strong>als</strong> einem nicht eigenständigen Teil verstehen mag oder lieber<br />
seinen ‚Kleinstaat’ <strong>als</strong> obersten Souverän ansieht und nur einen lockeren Verbund anstrebt,<br />
dann ergeben sich natürlich auch andere Legitimationsgrundlagen einschließlich eines<br />
zu erfolgenden Abstimmungsprozederes. Man muß sich dann aber fragen, ob in einem solchen<br />
Fall Deutschland <strong>als</strong> Ganzes vom Volk in seiner überwiegenden Mehrheit überhaupt<br />
noch gewollt werden würde sowie daß durch eine Kleinstaaterei höchstwahrscheinlich alle<br />
erheblich zu leiden hätten und zwar sowohl aus ökonomischen <strong>als</strong> auch außenpolitischen<br />
Gründen, da man dann viel eher nur Objekt fremder Akteure zu werden drohte! Ich schlage<br />
daher in diesem Zusammenhang vor, das jetzige Staatsvolk von Deutschland <strong>als</strong> obersten<br />
Souverän anzuerkennen, soweit nicht erhebliche Proteste dagegen, wie beispielsweise im<br />
ehemaligen Jugoslawien, aufkommen sollten.<br />
Nach der Klärung dieser grundsätzlichen Frage soll nun noch auf einige wesentliche Vorteile<br />
einer wie oben vorgeschlagenen Neugliederung eingegangen werden. Nachfolgend verwende
ich Zahlenwerte aus der vom Bund der Steuerzahler herausgegebenen Monatsschrift ‚Der<br />
Steuerzahler’ aus dem Juli 2003, wo auf Seite 134 dankenswerter Weise dieses Thema aufgegriffen<br />
und mit guten Argumenten, die ich in weiten Teilen ebenfalls schon immer vertreten<br />
habe, abgehandelt wird:<br />
- wir haben derzeit 16 Länder mit 16 Regierungschefs und ca. 150 Ministern,<br />
- in den Landtagen sitzen 1.628 Abgeordnete zuzüglich des gesamten untergeordneten<br />
Person<strong>als</strong>, welches diese Zahl um ein Vielfaches übertrifft einschließlich<br />
aller damit verbundenen Versorgungsansprüche,<br />
- allein für diese politische Führung gaben die Bundesländer insgesamt im Jahr<br />
2002 16,68 Milliarden Euro aus; diese Summe ließe sich bei einer Neugliederung<br />
mindestens halbieren, so daß hier ein Einsparpotential in Höhe von über 8<br />
Milliarden Euro pro Jahr zu erzielen wäre,<br />
- im oben erwähnten Heft ‚Der Steuerzahler’ wird zurecht folgendes vermerkt:<br />
„Absurd ist, daß es sogar Bundesergänzungszuweisungen für überproportional<br />
hohe Kosten der politischen Führung 65 gibt, diese betrugen im Jahr 2002<br />
immerhin 800 Millionen Euro.“; dem ist nichts hinzuzufügen,<br />
- das System des Länderfinanzausgleiches, nach welchem ärmere Länder von<br />
reicheren Ländern sowie dem Bund unterstützt werden, erreichte im Jahre<br />
2001 eine Höhe von 7,6 Milliarden Euro.<br />
Diese Zahlen allein schon verdeutlichen die Notwendigkeit einer Neugliederung und sollten<br />
auch bei einer Volksabstimmung entsprechend in ganz Deutschland publik gemacht werden,<br />
damit niemand an der Sinnhaftigkeit der hier unterbreiteten Vorschläge zweifeln kann. Darüber<br />
hinaus müssen aber viele Verwaltungsvereinfachungen, die infolge einer solchen Neugliederung<br />
zu erwarten sind, in Rechnung gestellt werden, deren Einsparpotential ebenfalls im<br />
Milliardenbereich liegen dürfte!<br />
Desweiteren ist eine Beendigung der bisherigen Kompetenzvermischungen herbeizuführen.<br />
Im Laufe der Zeit sind immer mehr Mischfinanzierungen zwischen Bund, Ländern und Gemeinden<br />
geschaffen worden, welche aber letztlich eine Beschneidung der Landes- bzw. Gemeindeverantwortlichkeiten<br />
notwendig zur Folge hatten, weil der Bund Mitspracherechte im<br />
Gegenzug für sein finanzielles Engagement forderte. Die Länder sollten durch ihre Mitwirkung<br />
im Bundesrat entschädigt werden. Allerdings muß man sich hierbei klar machen, daß es<br />
sich beim Bundesrat um ein Bundesorgan handelt, wo Regierungsvertreter der Länder an der<br />
Bundesgesetzgebung mitwirken und somit von einer wirklichen Kompensation für die genuine<br />
Landesgesetzgebung nicht gesprochen werden kann! Die daraus resultierende Kompetenzverflechtung<br />
mit den vielfältigen Einspruchsmöglichkeiten der Ländervertreter hinsichtlich<br />
der Bundesgesetzgebung trägt ganz erheblich zu den vielfach zu Recht beklagten Politikblockaden<br />
bei. Auch wenn bei der Föderalismusreform der großen Koalition einige Punkte<br />
angegangen worden sind, so stellt dies nur einen minimalen Fortschritt im Hinblick auf das<br />
eigentlich Notwendige dar.<br />
Am Beispiel der Problematik von Mischfinanzierungen sollen negative Folgen von nicht klar<br />
abgegrenzten Verantwortungsbereichen verdeutlicht werden. Hierbei stütze ich mich im wesentlichen<br />
auf eine äußerst verdienstvolle Stellungnahme vom Karl – Bräuer – Institut des<br />
Bundes der Steuerzahler. 66 Zunächst sollen wichtige Mischfinanzierungsbereiche mit ihren<br />
ungefähren Finanzvolumina aus dem Jahre 2000 aufgeführt werden:<br />
1. Gemeinschaftsaufgaben zwischen Bund und Ländern nach den Grundgesetzartikeln<br />
91a und 91b, Investitionshilfen des Bundes nach Grundgesetzartikel 104a Absatz a<br />
sowie sog. ungeschriebene Zuständigkeiten wie z.B. die Ergänzungszuweisungen für<br />
65 Gemeint sind hier die Kosten, die bei kleinen Bundesländern naturgemäß überproportional hoch sind.<br />
66 Stellungnahme Nr. 28: Abbau von Mischfinanzierungen. Wichtiger Beitrag zu rationaler Finanzpolitik, zu<br />
Einsparungen und Entlastungen. Wiesbaden 2001. Ich selbst bin Mitglied im Bund der Steuerzahler und fördere<br />
durch meinen Mitgliedsbeitrag sowie Spenden sehr gerne derart für unser Gemeinwesen wichtige Arbeiten.
überdurchschnittliche Politik- und Verwaltungskosten kleinerer Länder (s.o.); gesamtes<br />
Finanzvolumen einschließlich der Finanzierungsanteile der Länder: ca. 45<br />
Milliarden Euro,<br />
2. Mischfinanzierungen in Form von Zuweisungen für bestimmte Zwecke in Höhe von<br />
mindestens 20 Milliarden Euro,<br />
3. eine Vielzahl von Steuervergünstigungen, worunter seit 1996 auch das Kindergeld gezählt<br />
wird und zwar <strong>als</strong> Steuervergünstigung zu Lasten der Einkommensteuer; Finanzvolumen:<br />
ca. 50 Milliarden Euro,<br />
4. Mischfinanzierungen zwischen Deutschland und der EU: ca. 5 Milliarden Euro.<br />
Insgesamt belief sich <strong>als</strong>o das Volumen im Jahre 2000 auf ungefähr 120 Milliarden Euro, wodurch<br />
die erhebliche Größenordnung verdeutlicht werden soll. Es geht hier zunächst nicht darum,<br />
die Sinnhaftigkeit der verausgabten Mittel zu diskutieren, auch wenn dies in einigen<br />
Fällen sicherlich überlegenswert wäre 67 , sondern um die allen Mischfinanzierungen innewohnende<br />
erhebliche Effizienzproblematik hinsichtlich des Mitteleinsatzes zur Erreichung<br />
eines vorgegebenen Zieles einschließlich des Einsparpotentiales bei einer rationaleren Verwendung<br />
der Gelder infolge einer radikalen Entwirrung des hochkomplexen Finanzierungsgeflechtes<br />
zwischen den verschiedenen Gebietskörperschaften. Folgende Mängel der Mischfinanzierung<br />
sollen nachfolgend kurz aufgezählt und begründet werden:<br />
1. durch eine gespaltene Kosten – Nutzen – Betrachtung kalkuliert die mittelempfangende<br />
Stelle nur den eigenen Betrag zur Realisierung eines Projektes und vernachlässigt<br />
in der Regel die Gesamtkosten, weil sie dafür auch nicht aufzukommen hat, so<br />
daß systemimmanente Überforderungen der öffentlichen Haushalte in solchen Finanzierungen<br />
zwingend angelegt sind; dies erläutert Wolfram Engels treffend mit folgendem<br />
Beispiel: „Wenn eine Gemeinde zum Bau einer Straße öffentliche Zuschüsse des<br />
Landes und des Bundes erhält, sagen wir 70 Prozent, und die Straße 10 Millionen DM<br />
kostet, dann heißt das vom Standpunkt der Gemeinde, daß die Gemeinde nur 3 Millionen<br />
DM aufbringen muß, um eine Straße von 10 Millionen zu bauen. Wenn die Straße<br />
der Gemeinde keine 10 Millionen DM, sondern sagen wir nur 5 Millionen DM wert<br />
ist, dann wird diese Straße gebaut. Denn vom Standpunkt der Gemeindeväter ist der<br />
Bau dieser Straße rentabel. Die Kosten für die Gemeinde betragen 3 Millionen DM.<br />
Und der Wert für die Gemeinde ist 5 Millionen DM. Die Kosten für die Gesamtheit<br />
aller sind aber 10 Millionen DM. Eigentlich dürfte sie nicht gebaut werden. Aber in<br />
diesem System muß sie gebaut werden, und zwar genau dann, wenn die Bürgermeister<br />
und Gemeindeväter die Interessen ihrer Bürger richtig vertreten ... Aber die Gesamtheit<br />
aller zahlt 10 Millionen DM. So finanzieren die Mainzer die Schwimmhalle in<br />
Kiel und die Kieler die Straßen in Mainz, und alle geben sie mehr Geld aus, <strong>als</strong> sie<br />
ausgeben würden, wenn sie diese öffentlichen Güter selber bezahlen müßten. Wir<br />
haben ein System der Ausbeutung aller durch alle geschaffen. Das heißt, jeder einzelne<br />
handelt richtig in seiner Situation und in seiner Interessenlage und für die Bürger,<br />
die er vertritt. Aber alle zusammen beuten sich gegenseitig aus. Nicht der Vorwurf<br />
gegen die Gemeindeväter, nicht der Vorwurf gegen die Bürgermeister, nicht der<br />
Vorwurf gegen die Landesminister, der Vorwurf ist gegen die Fehlkonstruktion des<br />
Systems zu richten.“ 68 ; allerdings möchte ich hier anmerken, daß für das System wiederum<br />
die Politiker auf Landes- und Bundesebene verantwortlich zu machen sind,<br />
denn sie haben es geschaffen und könnten, ja müßten, es ändern;<br />
2. es entstehen erhebliche Prioritätsverzerrungen, weil die mittelempfangende Stelle eher<br />
denjenigen Projekten Vorrang einräumt, welche durch andere mitfinanziert werden,<br />
weil für sie dann nicht die ganzen Kosten anfallen, so daß eine rationale Aufgabenpla-<br />
67 Zu dieser Problematik vgl. weiter unten Abschnitt 10.2.: Steuern, Subventionen und Investitionen.<br />
68 Wolfram Engels: Den Staat erneuern – den Markt retten, in: Bundesverband Junger Unternehmer (Hrsg.),<br />
Staatsreform statt Wirtschaftslenkung. Bonn 1981, S. 47
nung zumindest beeinträchtigt wird und nicht unbedingt die Vorhaben zuerst verwirklicht<br />
werden, die ohne diese Verzerrungen Vorrang genössen; so bemängelte beispielsweise<br />
der Hessische Rechnungshof, daß Kommunen gebotene Instandhaltungsarbeiten<br />
an Straßenbrücken nicht vorgenommen hätten, so daß später sehr viel teurere Erneuerungsarbeiten<br />
anstanden, wobei das Verhalten der Gemeinden aus ihrer Sicht durchaus<br />
rational war, da Erneuerungsarbeiten im Gegensatz zu Instandhaltungsarbeiten<br />
vom Land bezuschußt werden 69 ; es ließe sich problemlos eine lange Liste derartiger<br />
systembedingter Absurditäten erstellen,<br />
3. infolge der Zusammenarbeit von Fachleuten der Exekutive unterschiedlicher Gebietskörperschaften<br />
werden tendenziell die aufwendigsten Lösungen favorisiert, da keiner<br />
der Beteiligten die Gesamtkosten, sondern nur den eigenen Finanzierungsanteil bei<br />
seinen Überlegungen berücksichtigt,<br />
4. es entstehen Verkrustungen durch multilaterale Planungen zwischen dem Bund und<br />
mehreren oder gar allen Ländern, da gemeinsame Positionen nur unter großem Aufwand<br />
zu finden sind und einmal erreichte Kompromisse, auch wenn sie erhebliche Ineffizienzen<br />
beinhalten, kaum abgeändert werden können, so daß Ausgabenkürzungen<br />
zumeist nicht oder nur mit großen zeitlichen Verzögerungen politisch durchzusetzen<br />
sind,<br />
5. Mischfinanzierungen ziehen in der Regel Doppel- oder gar Mehrfacharbeiten mit all<br />
den damit verbundenen Kosten wie Personalaufwendungen oder zeitliche Verzögerungen,<br />
welche in ihren Auswirkungen nicht unterschätzt werden dürfen, nach sich, weil<br />
auf jeder der beteiligten Ebenen eigenständig geplant wird und daraufhin diese Planungen<br />
wieder untereinander zu koordinieren sind,<br />
6. aufgrund der Vielzahl der Beteiligten treten erhebliche Mängel bei der Kontrolle infolge<br />
geteilter oder gar unklarer Verantwortlichkeiten auf,<br />
7. schließlich sind die Gefahren politischer wie staatsrechtlicher Natur nicht zu vernachlässigen,<br />
weil klare Kompetenzzuweisungen kaum mehr möglich sind und daher eine<br />
demokratische Kontrolle der Exekutive durch die Legislative oder bei Wahlen durch<br />
das Volk erheblich beeinträchtigt wird und damit ein Kernbereich der demokratischen<br />
Grundordnung systematisch unterminiert wird!<br />
Anstatt solcher, nicht zu rechtfertigender Finanzverflechtungen sollte die Verantwortung zur<br />
Durchführung von Projekten eindeutig einer Ebene einschließlich der notwendigen Mittel zugeordnet<br />
werden, so daß sie auch alleine die Verantwortung dafür zu tragen hat, z.B. indem<br />
die Länder die bisherigen Gelder für den Hochschulbau vom Bund bekommen und dann<br />
selbstverantwortlich damit zurecht kommen müssen. Das Prinzip der Subsidiarität, d.h. daß<br />
immer zunächst die untere und am Bürger nähere Ebene selbstverantwortlich Aufgaben so<br />
weit wie möglich erfüllt, bevor eine übergeordnete Ebene tätig wird, weil sie die Probleme<br />
vor Ort am besten kennt, wird von vielen deutschen Politikern zurecht in bezug auf die EU<br />
gefordert, aber bei der entsprechenden Umsetzung im eigenen Land versagen sie kläglich,<br />
nicht zuletzt aus egoistischen Machtkalkülen. Abschließend möchte ich aus dem vom Bund<br />
der Steuerzahler herausgegebenen Monatsheft ‚Der Steuerzahler’ vom Juni 2003 eine Passage,<br />
die auf Seite 115 nachzulesen ist, zitieren, welche selbst wiederum aus einem Untersuchungsbericht<br />
des Bundesrechnungshofes zu den ‚Finanzbeziehungen zwischen Bund und<br />
Ländern’ stammt, worin die Erkenntnisse hinsichtlich der negativen Folgen von Mischfinanzierungen<br />
zusammengefaßt werden: „So fördern Mischfinanzierungen Verteilungs- und<br />
Subventionswettläufe zwischen den Ländern, verhindern klare Aufgabenteilungen zwischen<br />
Bund und Ländern und entsprechen nicht dem Subsidiaritätsprinzip. Mischfinanzierungen<br />
führen zur Teilung von Verantwortlichkeiten und damit zu insgesamt weniger Verantwortung.<br />
Die Finanzplanung bei den beteiligten Gebietskörperschaften wird vorab festgelegt, da zu<br />
erwartende Zuschüsse Prioritätsentscheidungen hinsichtlich der Ressourcenverwendung<br />
69 Vgl. Hessischer Rechnungshof: Bemerkungen. Wiesbaden 1999, S. 144 ff
überlagern können. Mischfinanzierungen lösen Mitnahmeeffekte aus, bewirken gegenseitige<br />
Abhängigkeiten und können damit zu starren Strukturen und ineffizientem Mitteleinsatz<br />
führen, wobei das Wirtschaftlichkeitsgebot nicht immer hinreichend beachtet wird. Die Parlamente<br />
und Finanzressorts werden bei der Haushaltsaufstellung faktisch eingeengt, insbesondere<br />
weil sie Komplementärmittel bereitstellen müssen, damit Leistungen von anderen<br />
Mittelgebern nicht unterbleiben.“ Und weiter heißt es: „ Mischfinanzierungen verursachen<br />
durch die Befassung mehrerer Gebietskörperschaften mit den selben Sachverhalten erheblichen<br />
Verwaltungsaufwand. Dabei erweisen sich die Verfahren nicht <strong>als</strong> besonders sachgerecht,<br />
da die Mittelverteilung oft nach starren Verfahren erfolgt, die nur wenigen Änderungen<br />
unterliegen und gewandelten Bedarfslagen nur schwer angepaßt werden können.“ ...<br />
„Nach Auffassung des Bundesbeauftragten für die Wirtschaftlichkeit der Verwaltung sollte<br />
das Geflecht gegenseitiger inhaltlicher Abhängigkeiten, politischer Vorfestlegungen und<br />
ineinander greifender Kofinanzierungen <strong>als</strong> Folge des derzeit rechtlich vorbestimmten und<br />
praktisch geübten Systems der Mischfinanzierung zwischen Bund und Ländern (...) grundsätzlich<br />
aufgegeben, jedenfalls aber entwirrt werden. Auch bei im wesentlichen gleich bleibenden<br />
Mitteleinsätzen würde dies bei allen Beteiligten in Bund und Ländern direkt zu einem<br />
wirtschaftlichen Ressourceneinsatz und damit zu mittelbaren Einsparmöglichkeiten führen.“<br />
Falls alle in diesem Abschnitt aufgeführten Reformvorschläge umgesetzt würden, hätte dies<br />
bei einer besseren Versorgung der Bürger durch effizientere Verfahren auch noch erhebliche<br />
Einsparungen mittelfristig zur Folge, wobei ich von einem jährlichen Einsparvolumen in<br />
Höhe von mindestens 20 Milliarden Euro ausgehe! 70<br />
Meiner Meinung nach könnte der derzeitige skandalöse Zustand am besten durch einen bundesweiten<br />
Volksentscheid grundlegend geändert werden, da man nur die schon vorhandenen<br />
wissenschaftlich untermauerten Vorschläge, wie z.B. die von mir oben erwähnte Stellungnahme<br />
des Karl – Bräuer – Institutes, zur Abstimmung stellen müßte: es würde zumindest für<br />
eine grundlegende Entflechtung der Finanzbeziehungen eine überwältigende Mehrheit geben,<br />
denn nur einige Bürokraten und Machttaktierer aus den Parteien, die einen Teil ihrer Pfründe 71<br />
einbüßten, wären die Verlierer einer solchen Änderung. Ich habe daher wenig Hoffnung, daß<br />
allein gut begründete Vorschläge verbunden mit einem moralischen Appell an die verantwortlichen<br />
Landes- und Bundespolitiker etwas ändern würde, weil dieser Zustand mit all<br />
seiner Problematik nicht erst seit gestern bekannt ist, wie die oben zitierten Ausführungen von<br />
Wolfram Engels aus dem Jahre 1981 beweisen. Ohne massiven <strong>Dr</strong>uck wird die Mehrheit der<br />
jetzt an der Macht sitzenden Subjekte sich wohl kaum zu notwendigen Reformschritten<br />
durchringen! Solcher <strong>Dr</strong>uck kann z.B. auch durch ökonomische Fakten erzeugt werden, indem<br />
einfach immer mehr Menschen diesem Staat ihre Gefolgschaft teilweise oder ganz aufkündigen,<br />
sie oder ihr Geld das Land verlassen, Investitionen nicht mehr getätigt werden, die<br />
Schwarzarbeit zunimmt etc., so daß einfach die Einnahmen der öffentlichen Kassen so drastisch<br />
einbrechen würden, daß dann auch die verantwortlichen Politiker zu durchgreifendem<br />
Handeln aus Eigeninteresse gezwungen wären, da bei einem völligen Kollaps des Systems<br />
auch ihre Besitzstände nicht mehr gewahrt werden könnten. Solange dieser <strong>Dr</strong>uck aber nicht<br />
in ausreichendem Maß vorhanden ist, bleibt leider – trotz winziger Reformschritte – wahrscheinlich<br />
alles im wesentlichen, wie es ist.<br />
70 Diese Größenordnung ist eher vorsichtig angesetzt und addiert sich zum einen aus den direkten Einsparungen<br />
bei der politischen Führung in Höhe von ca. 8 Milliarden Euro infolge einer Neugliederung des Bundesgebietes<br />
und einem 10%igen Effizienzgewinn durch die Vermeidung von Mischfinanzierungen. Auf längere Sicht sind<br />
aber noch größere Einsparungen wahrscheinlich!<br />
71 Diese Pfründe bestehen u.a. darin, daß man durch Mischfinanzierungen Macht auf andere ausüben sowie<br />
Posten in der Bürokratie für verdiente Parteigänger schaffen kann etc. und damit seine eigene Machtposition<br />
sichert.
Gespräch im Zug: Über die Eingeborenen von Absurdistan<br />
Bürger B. trifft überraschend auf einer Zugfahrt seinen Bekannten Robin P., der viel in der<br />
Welt herumreist und somit immer Interessantes zu erzählen weiß.<br />
Bürger B.: Hallo Robin, das ist ja ein Zufall, daß wir uns hier begegnen.<br />
Robin P.: Ja, ganz recht. Wie geht es Dir?<br />
Bürger B.: Prima. Und selbst?<br />
Robin P.: Eigentlich ganz gut. Ich bin nur ein wenig erschöpft von dem langen Flug und muß<br />
erst einmal richtig ausschlafen.<br />
Bürger B.: Wo bist Du die letzte Zeit eigentlich gewesen?<br />
Robin P.: Ich komme gerade aus Absurdistan zurück. Es liegt ungefähr zehn Flugstunden von<br />
Frankfurt entfernt. Ein wirklich absonderliches Land.<br />
Bürger B.: Das hört sich interessant an. Erzähl schon, was für Erfahrungen und Eindrücke Du<br />
dort hast sammeln können.<br />
Robin P.: Oh, da gibt es wirklich viel Erstaunliches zu berichten. Die Eingeborenen haben<br />
zum Teil wahrlich verrückte Angewohnheiten, die ihnen zwar selber schaden, welche sie aber<br />
dennoch ganz konsequent beibehalten.<br />
Bürger B.: Jetzt bin ich aber gespannt.<br />
Robin P.: Also schön. Zunächst ein paar Worte zu Absurdistan: Das ganze Land, welches ungefähr<br />
halb so groß wie Deutschland ist und über annähernd 30 Millionen Einwohner verfügt,<br />
ist in zehn Grafschaften unterteilt, vergleichbar unseren Bundesländern. Deren Größe variiert<br />
sehr stark, und die Grenzen stammen noch aus der Kolonialzeit. Sowohl auf Grafschafts- wie<br />
Landesebene hat sich ein parlamentarisch-demokratisches System mit verschiedenen Parteien<br />
etabliert. Es herrscht Frieden und ein wenig Wohlstand für alle.<br />
Bürger B.: Das hört sich doch alles sehr gut an.<br />
Robin P.: Stimmt. Nur es könnte den Eingeborenen dort noch sehr viel besser gehen, wenn sie<br />
einige Verrücktheiten einfach beseitigten.<br />
Bürger B.: An welche denkst Du?<br />
Robin P.: Zunächst fällt mir dabei die Aufgliederung des Landes in Grafschaften sowie die jeweiligen<br />
Zuständigkeiten der beiden Ebenen ein: Für das Schulwesen, die Eisenbahn und die<br />
regionalen Straßen sind die Grafschaften zuständig, während die landesweiten Straßen, die<br />
Wasserwege, die Außen- und Verteidigungspolitik allein der Landesverantwortung unterliegen.<br />
Hochschulen, das Justizwesen, die Wirtschaftsförderung und vieles mehr unterliegen<br />
einer äußerst kompliziert gestalteten gemeinsamen Zuständigkeit, die ein Außenstehender<br />
wohl nie ganz verstehen wird.
Bürger B.: Mir scheint, daß daraus schwerwiegende Probleme erwachsen können.<br />
Robin P.: Nicht nur können! Sie sind tagtäglich anzutreffen. Ich beginne mit folgendem Beispiel:<br />
Da die Eisenbahnen in die Zuständigkeit der jeweiligen Grafschaft fallen und jene Grafschaftseinteilung<br />
aus der Kolonialzeit mit verschiedenen Kolonialmächten und daher unterschiedlichen<br />
Spurbreiten stammt, müssen an den Grafschaftsgrenzen Waren umgeladen werden<br />
und die Passagiere umsteigen. Das kostet Zeit, Geld und Nerven.<br />
Bürger B.: Ja, aber warum haben die Eingeborenen von Absurdistan das nicht längst vereinheitlicht?<br />
Die Kolonialzeit ist doch seit fast fünfzig Jahren vorüber!<br />
Robin P.: So ist es. Aber keine Grafschaft will eigene Kompetenzen an die Landesebene abgeben,<br />
geschweige denn an eine andere Grafschaft. Und deshalb bleibt alles so, wie es seit<br />
jener Kolonialzeit war. Aber das ist noch längst nicht alles.<br />
Bürger B.: Wirklich nicht?<br />
Robin P.: Nein. Du kannst Dir denken, daß die Kosten für ein solch ineffizientes System<br />
enorm hoch sind, so daß die Eisenbahn im Vergleich zum Auto eigentlich viel zu teuer ist.<br />
Um die Weiterexistenz der Eisenbahn zu sichern, muß sie aus Steuermitteln stark subventioniert<br />
werden.<br />
Bürger B.: Und das akzeptieren die Eingeborenen einfach so?<br />
Robin P.: Die allermeisten schon. Es war halt immer schon so. Doch es kommt noch besser.<br />
Bürger B.: Kann es zu so viel Dummheit denn noch eine Steigerung geben?<br />
Robin P.: Oh ja. Einige sehr kleine Grafschaften sind nicht in der Lage, die Subventionen<br />
selbst vollständig aufzubringen. Daher erhalten sie aus einem Fonds, der vom Land und den<br />
Grafschaften gemeinsam finanziert und verwaltet wird, Zuweisungen. Diese Mittel dienen<br />
nicht nur zur Subventionierung des Schienenwesens, sondern sogar der Bezuschußung der<br />
politischen Verwaltung, d.h. die kleinen Grafschaften leisten sich eine Regierung, die sie sich<br />
eigentlich gar nicht leisten könnten und erhalten dafür von den anderen, größeren Grafschaften<br />
und vom Land das erforderliche Geld, welches sie selbst nicht haben.<br />
Bürger B.: Und die Eingeborenen der größeren Grafschaften lassen sich das einfach gefallen?<br />
Robin P.: In der Tat. Es hat vor einigen Jahren von der politischen Elite, die ansonsten äußerst<br />
eifersüchtig auf ihre Zuständigkeiten und Pfründe achtet, den vernünftigen Versuch gegeben,<br />
zwei kleinere Grafschaften zusammenzuführen. Doch dies scheiterte in einer Volksabstimmung<br />
in den betroffenen Grafschaften.<br />
Bürger B.: Das gibt es doch nicht.<br />
Robin P.: Ganz genauso hat es sich zugetragen, und die Eingeborenen der größeren Grafschaften<br />
nahmen es gleichgültig mit einem Schulterzucken hin, wie mir mein Bekannter aus<br />
Absurdistan versicherte.<br />
Bürger B.: Der Schwachsinn scheint dort Methode zu haben.
Robin P.: So sehe ich das auch. Und dafür gibt es auch zahlreiche weitere Beispiele.<br />
Bürger B.: Nenn mir doch bitte einige.<br />
Robin P.: Gerne. Ich erwähnte vorhin, daß die regionalen Straßen Angelegenheit der Grafschaften<br />
seien. Die Brücken allerdings werden geplant, gebaut, verwaltet, gewartet und finanziert<br />
gemeinsam von der betroffenen Grafschaft, dem Land sowie einer Kommission, die aus<br />
allen Grafschaften nach einem komplizierten Proporzsystem gebildet wird. Wenn <strong>als</strong>o z.B.<br />
eine Grafschaft eine Brücke neu errichten will, muß sie zunächst einen Antrag beim Land und<br />
bei der Kommission einreichen. Daraufhin stellen alle drei – <strong>als</strong>o die Grafschaft, das Land sowie<br />
die Kommission – eigene Planungen an. Diese müssen dann in gemeinsamen Sitzungen<br />
immer wieder aufeinander abgestimmt werden. Jede beteiligte Planungsabteilung vertritt ihre<br />
eigenen Auffassungen und versucht sie natürlich auch durchzusetzen. Bis dann ein Kompromiß<br />
gefunden ist, vergeht nicht nur viel Zeit, sondern das Ergebnis ist häufig ebenfalls nicht<br />
das vernünftigste. Ein einmal mühsam gefundener gemeinsamer Beschluß wird daher selbst<br />
dann nicht mehr in Frage gestellt, wenn sich mittlerweile herausgestellt hat, daß die Brücke<br />
eigentlich besser an einem anderen Standort gebaut werden sollte, weil alle Beteiligten für<br />
einen erneuten Verhandlungsmarathon viel zu erschöpft sind.<br />
Bürger B.: Es ist wirklich erstaunlich, mit welcher Zähigkeit die Eingeborenen an solch unvernünftigen<br />
Ritualen festhalten.<br />
Robin P.: Ja, das habe ich meinem dort beheimateten Bekannten auch gesagt. Dabei nannte er<br />
mir eine in der öffentlichen Debatte häufig vorgebrachte Begründung für das so komplizierte<br />
Staatsgefüge in Absurdistan, die so unsinnig ist, daß ich es erst nicht glauben wollte.<br />
Bürger B.: Du machst mich neugierig.<br />
Robin P.: Die Befürworter dieses Systems verwiesen allen Ernstes auf die Arbeitsplätze, die<br />
hierdurch gesichert würden.<br />
Bürger B.: Das kann doch nicht wahr sein.<br />
Robin P.: Aber ja doch. Ihm selbst war natürlich der Unsinn einer solchen Pseudobegründung<br />
klar. Genauso könnte man schließlich behaupten, daß beispielsweise in einem Unternehmen<br />
die Computertastaturen nur über den halben Buchstabensatz verfügen, so daß sich beim<br />
Schreiben einer Mitteilung immer mindestens zwei Mitarbeiter untereinander abstimmen<br />
müßten, weil der eine ja nur immer die Buchstaben eingeben könnte, die auf seiner Tastatur<br />
vorhanden sind, um dann die <strong>Datei</strong> abzuspeichern und sie seinem Kollegen mit den restlichen<br />
Buchstaben zur Fertigstellung zu übergeben. Mit einem derart unrationellen Vorgehen könnte<br />
man wahrlich viele zusätzliche Arbeitsplätze schaffen, die allerdings nicht lange am Markt<br />
Bestand haben würden.<br />
Bürger B.: Du hast es auf den Punkt gebracht. Es ist dennoch ein weit verbreiteter Irrglaube,<br />
Unternehmen oder gar der Staat sollte zunächst einmal möglichst viele Arbeitsplätze schaffen.<br />
An dem von Dir vorgebrachten Beispiel wird schnell klar, daß man stets bestrebt sein muß,<br />
rationell zu arbeiten, d.h. mit möglichst wenig Mitteleinsatz möglichst viel zu erzeugen. Falls<br />
nur einfach Arbeitsstellen ohne Rücksicht auf ihre Effizienz eingerichtet werden sollten,<br />
könnte man einfach die Benutzung von Rädern untersagen: Es führen weder Züge noch<br />
Autos. Alles müßte von Menschen oder von Lasttieren, die ebenfalls von Menschen geführt<br />
werden müßten, transportiert werden.
Robin P.: Ja, es stimmt, was Du sagst. Mir wird jetzt auch klar, daß nicht nur die Leute in Absurdistan<br />
solch verrückte Argumente anführen, sondern sie ebenfalls bei uns zu vernehmen<br />
sind.<br />
Bürger B.: So ist es. Aber wir vergaßen bisher noch eine weitere mögliche Ineffizienz, die<br />
einem solchen System innewohnt, zu erwähnen.<br />
Robin P.: An welche denkst Du?<br />
Bürger B.: Ich weiß zwar nicht genau, wie es in Absurdistan tatsächlich aussieht, aber ich<br />
könnte mir gut folgendes vorstellen: Wenn eine Grafschaft eine neue Brücke plant, kalkuliert<br />
sie zunächst einmal nur die Kosten, die sie selbst für jene aufzubringen hätte und nicht die<br />
Gesamtkosten, welche neben ihrem eigenen Beitrag, infolge der Mischfinanzierung, ebenfalls<br />
aus Mitteln des Landes sowie der Kommission zu begleichen wären, nicht wahr?<br />
Robin P.: Ja, so verhält es sich. Aber wo siehst Du ein Problem dabei?<br />
Bürger B.: Ganz einfach. Bei der Planung einer Brücke durch die Grafschaft werden von ihr<br />
Kosten und Nutzen gegenübergestellt, wobei sie natürlich nur den eigenen Kostenanteil im<br />
Blick hat und eben nicht die Gesamtkosten. Infolgedessen besteht die große Gefahr, daß<br />
hinsichtlich der Gesamtkosten die Brücke viel zu wenig Nutzen bringt, weil die Grafschaft<br />
eben nur die eigenen Kosten dem erwarteten Nutzen gegenüberstellt. Somit werden in einem<br />
derart aufgebauten Staatswesen tendenziell viel zu viele Brücken in bezug auf ihren Nutzen<br />
errichtet, so daß Kosten und Nutzen in keinem angemessenen Verhältnis zueinander stehen.<br />
Kurz gesagt: Es wird Geld verschwendet, weil es im System so angelegt ist, und die Bürger<br />
müssen das Ganze durch zu hohe Steuern letztlich bezahlen.<br />
Robin P.: Jetzt verstehe ich, wie Du das gemeint hast. Und wenn ich mich recht besinne,<br />
stehen dort wirklich an Stellen aufwendige Brückenkonstruktionen, die kaum genutzt werden,<br />
weil sie fernab der eigentlichen Hauptverbindungswege liegen. Mein Bekannter bestätigte<br />
mir, daß es einige wenige Einwände von Bürgern zumindest gegen derartig aufwendige Bauweisen<br />
gegeben habe.<br />
Bürger B.: Und was ist aus diesen Einwänden geworden?<br />
Robin P.: Sie sind überhaupt nicht berücksichtigt worden.<br />
Bürger B.: Das habe ich mir gleich gedacht. Es liegt halt im wesentlichen an diesem unsinnigen<br />
System der Mischfinanzierung verbunden mit komplizierten wie unklaren Verantwortlichkeiten:<br />
Niemand hat das Ganze hinreichend im Blick, weil er dafür eben nicht verantwortlich<br />
ist. Nur dem kleinen, eigenen Bereich wendet er seine Aufmerksamkeit zu.<br />
Robin P.: Mir wird die Unsinnigkeit immer klarer. Aber hier in Deutschland haben wir doch<br />
ein ganz ähnliches System, oder irre ich mich?<br />
Bürger B.: Nein, keineswegs. Auch bei uns hat dieser Wahnsinn Methode. Aber erzähl mir<br />
bitte noch ein wenig mehr über Absurdistan.<br />
Robin P.: In Ordnung. Ich wende mich nun dem Schulwesen zu: Die Zuständigkeit hierfür<br />
liegt, wie ich vorhin schon sagte, bei den Grafschaften. Jede erstellt zunächst ihre eigenen<br />
Lehrpläne, setzt die Klassengrößen und die Prüfungsstandards fest. Um die Unterschiede
zwischen den Grafschaften nicht allzu groß werden zu lassen, bilden alle zehn Schulminister<br />
eine Kommission, in der die jeweiligen Unterschiede deutlich hervortreten. Daraufhin wird<br />
versucht, diese wieder ein wenig abzumildern. Doch dies gelingt nur äußerst unvollkommen,<br />
da jede Grafschaft auf ihre Eigenständigkeit penibel bedacht ist. Die Eltern von Schulkindern<br />
leiden insbesondere beim Umzug von der einen zur anderen Grafschaft sehr darunter, weil<br />
viel Lernstoff in kurzer Zeit nachzuholen ist.<br />
Bürger B.: Das ist eine Unverschämtheit gegenüber den Eltern und vor allem den Kindern!<br />
Robin P.: Das sehe ich genauso, und es ist den verantwortlichen Ministern mit der Zeit wohl<br />
auch klar geworden. Allerdings haben sie natürlich nicht ihr Vorgehen grundsätzlich geändert,<br />
sondern lediglich versucht, den Unsinn für die Betroffenen erträglicher zu machen.<br />
Bürger B.: Erzähl schon, was den Verantwortlichen in Absurdistan eingefallen ist.<br />
Robin P.: Gerne. Sie haben spezielle Fördergruppen in den Schulen für Kinder von neu Zugezogenen<br />
eingerichtet, damit sie den entsprechenden Lernstoff schneller nachholen können.<br />
Bürger B.: Wenn ich es richtig verstehe: Sie halten prinzipiell an dem Schwachsinn fest und<br />
versuchen, durch diese Maßnahme, die natürlich infolge zusätzlicher Lehrerstellen und Schulräume<br />
entsprechend hohe Kosten verursacht, die negativen Folgen für die Betroffenen ein wenig<br />
verkraftbarer zu machen. Die Eingeborenen zahlen <strong>als</strong>o dafür die doppelt Zeche: Erstens<br />
weil sie und ihre Kinder unter der Belastung zu leiden haben und zweitens weil sie durch<br />
höhere Steuern für die zusätzlichen Lehrer und Schulräume aufkommen müssen.<br />
Robin P.: So ist es.<br />
Bürger B.: Warum wehren sich die Eingeborenen von Absurdistan denn nicht dagegen?<br />
Robin P.: Ich weiß es wirklich nicht. Sie nehmen es anscheinend einfach so hin.<br />
Bürger B.: Das ist wahrlich erstaunlich. Aber wenn ich es so recht bedenke, sind die Zustände<br />
hier in Deutschland ganz ähnlich, bis auf die unterschiedlichen Spurbreiten der Eisenbahn.<br />
Und die meisten Bürger verhalten sich demgegenüber wie die Eingeborenen von Absurdistan.<br />
Robin P.: Stimmt. Wir sollten die Eingeborenen dort nicht mit allzu viel Häme ob ihrer Dummheit<br />
und geistigen Rückständigkeit überschütten, solange es bei uns selbst kaum besser aussieht.<br />
Bürger B.: Damit hast Du wahrscheinlich recht. Wir sollten zunächst einmal vor der eigenen<br />
Haustüre kehren.<br />
Robin P.: So ist es. Was könnte man Deiner Meinung nach unternehmen, um die Mißstände in<br />
Deutschland zu bekämpfen?<br />
Bürger B.: Wahrscheinlich wenig. Aber man sollte den Mut nicht ganz aufgeben und immer<br />
wieder durch Argumente versuchen, wenigstens etwas zu bewegen und sei es nur der Moral<br />
halber, daß man eben sein bestes gibt, ohne zu wissen, wie viel es letztlich fruchtet.<br />
Robin P.: Das hört sich aber wenig zuversichtlich an.
Bürger B.: Sicher. Nur sollte man sich keinen Illusionen hingeben. Falls jedoch immer mehr<br />
Menschen in diesem Lande ihre demokratischen Bürgerpflichten ernster nähmen und sich mit<br />
vernünftigen Argumenten in die Politik einmischten, dann würde sich schon vieles ändern.<br />
Aber zunächst müßten sie sich erst einmal gründlich informieren, z.B. über wirtschaftliche<br />
Zusammenhänge, um sich überhaupt erst ein rational begründetes Urteil bilden zu können.<br />
Der von Immanuel Kant sehr schön formulierte Wahlspruch der Aufklärung hat nichts an<br />
Aktualität verloren.<br />
Robin P.: Wie lautet jener eigentlich genau?<br />
Bürger B.: Kant brachte es mit folgenden Worten auf den Punkt: „Aufklärung ist der Ausgang<br />
des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. ‚Unmündigkeit’ ist das Unvermögen,<br />
sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. ‚Selbstverschuldet’<br />
ist diese Unmündigkeit, wenn die Ursache derselben nicht am Mangel des Verstandes, sondern<br />
der Entschließung und des Mutes liegt, sich seiner ohne Leitung eines anderen zu bedienen.<br />
Sapere aude! Habe Mut, dich deines Verstandes zu bedienen! Ist <strong>als</strong>o der Wahlspruch<br />
der Aufklärung.<br />
Robin P.: Das hört sich wirklich sehr gut an.<br />
Bürger B.: Das sehe ich genauso. Und die meisten Menschen könnten viel mehr diesem Ideal<br />
gerecht werden, wenn sie nur wollten. Aber die meisten, gerade auch hier in Deutschland,<br />
sind anscheinend viel zu bequem dafür und hängen entweder leicht eingängigen Vorstellungen<br />
an oder interessieren sich erst gar nicht für politische wie wirtschaftliche Fragen. Diese<br />
selbstverschuldete Unmündigkeit trägt dann natürlich maßgeblich dazu bei, sich nicht einzumischen,<br />
weil man vieles nicht versteht. Es ist ja auch viel einfacher, auf ‚die da oben’ zu<br />
schimpfen, <strong>als</strong> selber etwas zur Verbesserung beizutragen.<br />
Robin P.: Das ist eine wirklich herbe Kritik, aber mir scheint, daß sie durchaus ihre Berechtigung<br />
hat, da wir schließlich in einer Demokratie mit weitgehender Meinungsfreiheit und vielfältigem<br />
Zugang zu Informationen leben. Der Aufklärung und Einmischung steht, wie Du es<br />
eben erwähntest, die Trägheit der meisten Leute entgegen und sonst nichts.<br />
Bürger B.: So verhält es sich wohl. Gleich sind wir am Ziel unserer Zugfahrt und müssen aussteigen.<br />
Es war ein sehr interessantes Gespräch mit Dir. Hoffentlich sehen wir uns demnächst<br />
einmal wieder.<br />
Robin P.: Ganz bestimmt. Ich bleibe nämlich für die nächsten Monate in Deutschland.<br />
Kurz darauf verabschieden sich beide.
5.4. Europäische Union:<br />
In diesem Beitrag wende ich mich der Europäischen Union zu, welche schon mehr <strong>als</strong> nur<br />
einen Völkerbund im Kleinen darstellt, weil die ihr angehörenden Nation<strong>als</strong>taaten bedeutende<br />
Bereiche ihrer Souveränität an diese Organisation abgegeben haben. Ein sehr großer historischer<br />
Fortschritt ist die Schaffung einer stabilen Friedenszone von früher sich bekriegenden<br />
Staaten, so daß sich in meiner Generation wohl kaum jemand mehr ernsthaft vorstellen kann,<br />
gegen Länder wie Polen oder Frankreich Krieg zu führen. Ebenfalls empfindet eine große<br />
Mehrheit der Bevölkerung in allen Mitgliedstaaten die Freizügigkeit, die sich nicht nur auf<br />
das Reisen beschränkt, mit ihren vielfältigen wirtschaftlichen und kulturellen Verflechtungen<br />
<strong>als</strong> im wesentlichen sehr positiv. Kein vernünftiger Mensch wird hierauf verzichten wollen.<br />
Wie begrüßenswert auch immer alle Fortschritte sind, so muß doch einiges kritisiert werden.<br />
Zunächst ist hierbei an mehreren Stellen ein erhebliches Demokratiedefizit auszumachen.<br />
Weder die verschiedenen europäischen Räte, besetzt mit Vertretern der Exekutive der Nation<strong>als</strong>taaten,<br />
noch die Kommission sind hinreichend demokratisch legitimiert. Erstere sollten<br />
<strong>als</strong> Regierungsvertreter keine Gesetzgebungskompetenz besitzen, da dies die Gewaltenteilung<br />
aufhebt. Die Zusammensetzung letzterer wird maßgeblich durch eben diese Vertreter bestimmt,<br />
auch wenn das Europäische Parlament zustimmen muß. In der politischen Praxis<br />
werden so sehr häufig weitreichende Entscheidungen getroffen, welche das Leben der Menschen<br />
in der Europäischen Union stark beeinflussen, ohne daß ein hinreichender öffentlicher<br />
Diskussionsprozeß stattgefunden hat. Desweiteren werden die Befugnisse der nationalen Parlamente<br />
dadurch in unerträglicher Weise eingeschränkt, so daß die Bürger durch die Wahl<br />
ihrer Abgeordneten kaum oder gar keinen Einfluß mehr auf wichtige Politikfelder nehmen<br />
können. Dieser Zustand ist völlig inakzeptabel! Aber auch das Europäische Parlament ist kein<br />
Hort der Demokratie. Ein elementarer demokratischer Grundsatz wird allein schon bei der<br />
Wahl der Abgeordneten sträflich mißachtet, nämlich daß die Stimme jedes Wahlbürgers<br />
gleiches Gewicht besitzen muß. Dies ist aber nicht der Fall, da für die Wahl eines Abgeordneten<br />
aus einem kleineren Mitgliedsland viel weniger Voten <strong>als</strong> in einem größeren erforderlich<br />
sind. Ein weiteres demokratisches Defizit stellt die fehlende europäische politische<br />
Öffentlichkeit dar. Notwendige Diskussionsprozesse können schon allein wegen der Sprachbarrieren<br />
nicht gesamteuropäisch stattfinden. Trotz vielfältiger gemeinsamer kultureller Wurzeln<br />
gibt es dennoch kein ‚europäisches Volk’ und damit keinen legitimen Souverän, wobei<br />
die verschiedenen Muttersprachen nur ein, wenn auch sehr wichtiger Ausdruck der verschiedenen<br />
Nationalkulturen sind. Solange es aber ein die Demokratie legitimierendes Staatsvolk<br />
nicht gibt, weil die meisten Menschen in Europa dies zurzeit nicht wollen, existiert überhaupt<br />
keine Grundlage für demokratische Entscheidungen! Infolgedessen kann es vorerst keine<br />
‚Vereinigten Staaten von Europa’ geben, sondern es müssen Regelungen gefunden werden,<br />
welche die bisherigen Nation<strong>als</strong>taaten mit Kernkompetenzen weiterbestehen lassen, so daß<br />
man eher ein ‚Europa der Vaterländer’ anstreben sollte. Viele Bürger, welche die Fortschritte<br />
Europas durchaus zu schätzen wissen, fühlen sich durch intransparente und undemokratische<br />
Entscheidungen entmündigt sowie ohnmächtig, sich durch Wahlen und Abstimmungen dagegen<br />
wehren zu können. Dies ist möglichst zügig grundlegend zu ändern und zwar sowohl aus<br />
prinzipiellen, die Menschenwürde betreffenden Gründen, <strong>als</strong> auch um der Erhaltung dieser<br />
Gemeinschaft selbst willen, da bei einer zu großen Frustration der Bürger unter Umständen<br />
viele positive Errungenschaften ebenfalls Schaden nähmen.<br />
Die Volksabstimmungen in Frankreich und den Niederlanden zur Verfassung der Europäischen<br />
Union im Jahr 2005 haben die eben aufgeführten Bedenken eindrucksvoll bestätigt: Der<br />
Verfassungsentwurf ist mehrheitlich in beiden Ländern abgelehnt worden, obwohl ihn die politische<br />
Klasse fast einhellig befürwortet und für dessen Zustimmung vehement geworben hat.<br />
In vielen, wenn nicht gar in allen Mitgliedsländern der Europäischen Union herrscht bei der<br />
weit überwiegenden Mehrheit der Bevölkerung ein Bewußtsein vor, welches im Nation<strong>als</strong>taat
die entscheidende Institution der demokratischen Legitimation sieht und eben nicht in Europa<br />
<strong>als</strong> Ganzem. Es gibt kein europäisches Staatsvolk, solange die allermeisten Menschen dies<br />
nicht wollen, und sie wollen es zurzeit nicht! Sie verstehen sich zunächst einmal <strong>als</strong> Bürger<br />
eines bestimmten Landes und dann erst <strong>als</strong> Europäer. Infolgedessen müssen die wesentlichen<br />
Entscheidungen, die das Zusammenleben in einem Land regeln, dort durch demokratische<br />
Verfahren getroffen werden, um Legitimität beanspruchen zu können. Dem stehen selbstverständlich<br />
gesamteuropäische Abkommen nicht prinzipiell entgegen, wie beispielsweise ein<br />
gemeinsamer Markt verbunden mit Reise- und Niederlassungsfreiheit. Nur muß jedes Land<br />
eben für sich demokratisch entscheiden, wie weit die Integration für dasselbe gehen soll. Ich<br />
wende mich hiermit <strong>als</strong>o keineswegs grundsätzlich gegen verstärkte Integrationsschritte, sondern<br />
nur gegen von politischen Eliten ohne Zustimmung der davon Betroffenen verordnete.<br />
Es ist daher prinzipiell möglich, wenn es dem Willen der Mehrheit der Menschen in einigen<br />
Ländern entspricht, verstärkt Kompetenzen an eine supranationale Institution abzugeben und<br />
diese dann natürlich einer gemeinsamen demokratischen Kontrolle unterliegt. Dabei kann es<br />
durchaus zu einem staatsähnlichen Gebilde kommen, wodurch wesentliche, ursprünglich<br />
nationale Kompetenzen, auf die neue Ebene übertragen werden. Aber genau dies wollen die<br />
Menschen in Europa eben im Augenblick so nicht. Für sie stellt weiterhin der Nation<strong>als</strong>taat<br />
die wesentliche Bezugsgröße und Identifikationsquelle dar. Und genau darin gründet im wesentlichen<br />
die Ablehnung in den beiden genannten Ländern. Obgleich in dem zur Abstimmung<br />
vorgelegten Verfassungsentwurf sogar Volksabstimmungen auf europäischer Ebene<br />
vorgesehen waren, ist dies unter den genannten Voraussetzungen insofern kein demokratischer<br />
Gewinn, <strong>als</strong> daß im Verständnis der Bevölkerungen der einzelnen Länder kein entsprechendes<br />
Zusammengehörigkeitsgefühl in einem Maße existiert, welches eine hinreichende<br />
Basis für die Legitimation einer derartigen Abstimmung abgibt, weil die Menschen sich<br />
nicht in erster Linie <strong>als</strong> Europäer verstehen wollen, sondern <strong>als</strong> Franzosen, Briten oder<br />
Deutsche. Wenn die politischen Akteure trotz alledem so weiter machen sollten wie bisher<br />
und dabei den Mehrheitswillen ignorieren, laufen sie Gefahr, viele positive sowie von den<br />
meisten Menschen bisher sehr geschätzte Errungenschaften der Europäischen Union zu<br />
gefährden, weil auch sie dann eine Ablehnung infolge einer verstärkt um sich greifenden<br />
Europaskepsis erfahren könnten. Meine Hoffnung besteht darin, daß zum einen immer mehr<br />
Politiker zu der Überzeugung gelangen, daß man ohne oder gegen das eigene Volk dauerhaft<br />
keine erfolgreiche und schon gar nicht legitime Politik betreiben kann bzw. darf und zum<br />
anderen, daß die Menschen immer stärker ihre demokratischen Rechte einfordern.
5.5. Eurokrise I:<br />
Eurokrise: Die f<strong>als</strong>chen Versprechungen der Politik<br />
Die derzeitige Eurokrise dürfte eigentlich niemanden, der sich mit dem Thema ernsthaft beschäftigt<br />
hat, überraschen: Die Konstruktion des Euro, nach welcher es eine gemeinsame<br />
Zentralbank und damit gemeinsame Geld- sowie Zinspolitik für alle 17 Teilnehmerländer aber<br />
keine gemeinsame Fiskal-, Steuer- und Wirtschaftspolitik gibt, musste insbesondere bei sich<br />
ganz unterschiedlich wirtschaftlich entwickelnden Ländern zu Ungleichgewichten führen.<br />
Diese ziehen erhebliche Probleme nach sich, die wir heute – im September 2011 – in aller<br />
Schärfe zu spüren bekommen. Warnungen davor hat es hinreichend gegeben, aber verantwortliche<br />
Politiker – allen voran einer der Väter des Euro Helmut Kohl – haben diese arrogant in<br />
den Wind geschlagen und tun es auch heute noch!<br />
In meinem Beitrag ‚Europäische Union’ habe ich aber nicht nur den engeren ökonomischen<br />
Zusammenhang beleuchtet, sondern betont, dass Probleme auf europäischer Ebene letztlich<br />
vor allem welche der demokratischen Legitimation sind und waren. Dies wird durch das derzeitige<br />
Agieren der verantwortlichen Politiker sogar immer weiter vergrößert.<br />
Nachfolgend werde ich meine Position am Beispiel der deutschen Politik begründen. Zunächst<br />
einmal ist der Euro in Deutschland – trotz aller Warnungen, wie oben bereits ausgeführt<br />
– von allen großen Parteien gutgeheißen und durchgesetzt worden, ohne das deutsche<br />
Volk in einer Volksabstimmung darüber abstimmen zu lassen. Alle Meinungsumfragen ergaben<br />
in den 1990er Jahren eine klare Ablehnung der deutschen Bevölkerung gegen die Abschaffung<br />
der Deutschen Mark und die Einführung der neuen Währung ‚Euro’. Dies ist aus<br />
demokratischer Sicht ein Skandal, aber darum scherte sich die Machtelite in diesem Land<br />
natürlich überhaupt nicht und tut es auch heute nicht!<br />
Die Politiker versprachen dem deutschen Volk, dass diese Währungsunion keinesfalls eine<br />
Transferunion sei und werden dürfe und hielten dies sogar vertraglich fest: Es ist demnach<br />
ausdrücklich verboten, dass ein Land für die Schulden eines anderen haftet, <strong>als</strong>o beispielsweise<br />
der deutsche Steuerzahler für griechische Schulden. Und wie sieht es heute aus? Wir<br />
deutschen Steuerzahler haften nun doch. Die Politik bricht hiermit nicht nur ein Wahlversprechen<br />
– so, wie es schon allzu häufig geschehen ist. Nein, sie bricht rechtsgültige Verträge!<br />
Man stelle sich vor, wir normalen Bürger würden uns erdreisten, einfach einmal Verträge<br />
zu brechen. Wir müssten zurecht juristische Konsequenzen fürchten. Nicht so natürlich<br />
die Politiker. Sie machen, was sie wollen: Sie brechen Versprechen gegenüber uns Wählern,<br />
sie brechen rechtsgültige Verträge und sie denken nicht im Traum daran, uns selbst darüber<br />
direkt abstimmen zu lassen, wie es weitergehen soll. Stattdessen rufen sie uns auf, gerade<br />
ihnen, die uns belogen und betrogen haben, doch die wichtigen Entscheidungen in dieser<br />
Frage zu überlassen. Eine kaum zu überbietende <strong>Dr</strong>eistigkeit!<br />
Aber auch die Europäische Zentralbank unter der Führung des Franzosen Herrn Trichet bricht<br />
die Regeln, indem sie kräftig Staatsanleihen der Krisenländer kauft. Auch dies ist aus guten<br />
Gründen – nämlich wegen der Inflationsgefahr, die damit verbunden ist – verboten. Zu Zeiten<br />
der Deutschen Mark unter der Aufsicht der Deutschen Bundesbank wäre an so etwas niem<strong>als</strong><br />
auch nur zu denken gewesen. Aber in anderen Ländern gab und gibt es eben andere Traditionen.<br />
Und diese haben sich augenscheinlich gegen die gut begründeten Bedenken der<br />
deutschen Sicht im Zentralbankrat der Europäischen Zentralbank durchgesetzt. In diesem<br />
Zusammenhang muss unbedingt auf eine weitere Fehlkonstruktion der Europäischen Zentralbank<br />
hingewiesen werden: Deutschland hat nach den Verträgen das gleiche Stimmgewicht im
entscheidenden Zentralbankrat wie jedes andere Land, das Mitglied im Euroraum ist, <strong>als</strong>o<br />
beispielsweise Malta oder Zypern! Deutschland hingegen muss entsprechend seiner Wirtschaftskraft<br />
und Bevölkerungsgröße (beides hängt miteinander zusammen) die größten Einlagen<br />
in dieser Zentralbank hinterlegen und haftet auch für einen viel größeren Anteil <strong>als</strong> andere<br />
Länder, ohne dass dem in der Gewichtung des Stimmrechtes Rechnung getragen wird.<br />
Dies ist ein weiteres Beispiel dafür, wie deutsche Interessen von verantwortlichen<br />
deutschen Politikern verraten worden sind, ohne dass der ernsthafte Versuch gemacht<br />
worden ist, den deutschen Bürgern diesen Sachverhalt zu erklären, geschweige denn direkt<br />
das Volk darüber abstimmen zu lassen. Dies verringert völlig zurecht in nicht unerheblichem<br />
Maße das Vertrauen vieler Deutscher in den Euro zusätzlich!<br />
Nun erzählen uns viele Politiker, wie stark gerade doch wir Deutschen vom Euro wirtschaftlich<br />
profitieren würden. Sie zählen dabei immer wieder alle (angeblichen) Vorteile auf, ohne<br />
aber auch die andere Seite – die Risiken und Kosten – gebührend zu erwähnen. Ich will mir<br />
diese Einseitigkeit nicht zu eigen machen und beginne daher mit unbestreitbaren wirtschaftlichen<br />
Vorteilen des Euro gerade für uns Deutsche. Zunächst einmal fallen die Kosten, die mit<br />
der Umrechnung und dem Umtausch in verschiedene Währungen verbunden sind, innerhalb<br />
der Eurozone weg. Ebenfalls gibt es gerade für unsere exportorientierte deutsche Wirtschaft<br />
kein Wechselkursrisiko innerhalb der Eurozone. Deutsche Exporteure müssen <strong>als</strong>o nicht befürchten,<br />
dass aufgrund einer Aufwertung der heimischen Währung gegenüber derjenigen des<br />
Exportlandes die Produkte teurer und damit schwerer verkäuflich werden bzw. der ursprünglich<br />
kalkulierte Gewinn sich verringert. In diesem Zusammenhang steigt zudem noch die<br />
Planungssicherheit. Beim besagten Wechselkursrisiko handelt es sich eben um ein Risiko, das<br />
in der Wirklichkeit kaum oder sogar überhaupt nicht ins Gewicht fallen muss, sondern eben<br />
nur kann. Viele Eurobefürworter behaupten nun einfach, dass Deutschland <strong>als</strong> größte Exportnation<br />
in der Eurozone nun dadurch sehr profitiert habe. Aber das stimmt so überhaupt gar<br />
nicht: Vor der Einführung des Euro waren unsere Exporte in die Länder der heutigen Eurozone<br />
höher, <strong>als</strong> sie es heute sind! Das bedeutet, dass wir trotz Euro nicht mehr, sondern sogar<br />
deutlich weniger prozentual in die Länder der Eurozone exportieren. In die anderen Länder,<br />
die den Euro nicht haben und gegenüber denen für uns weiterhin das besagte Wechselkursrisiko<br />
besteht, verkaufen wir mehr Waren und Dienstleistungen. So einfach, wie es uns viele<br />
Politiker weismachen wollen, ist es <strong>als</strong>o keineswegs. Denn wie viel und wie profitabel sich<br />
Exporte gestalten, hängt bei weitem nicht nur vom Wechselkurs ab!<br />
Zudem verschweigen uns viele Eurobefürworter in der Politik noch die Vorteile, die uns eine<br />
stärkere Deutsche Mark gebracht hätte. Denn die Aufwertung einer Währung hat für ein Land<br />
keineswegs ausschließlich negative Folgen, die durch die Verteuerung der Exporte eintreten.<br />
Zunächst einmal werden die Importe, so beispielsweise Rohstoffe wie Erdöl, billiger. Durch<br />
eine solche Verbilligung werden viele Produkte sowohl für den deutschen Kunden im Inland<br />
<strong>als</strong> auch die für den Export vorgesehenen Güter billiger. Denn ihre Herstellungskosten verringern<br />
sich dadurch ja auch. Ebenfalls wären Reisen und Einkäufe für deutsche Privatleute im<br />
Ausland preisgünstiger, weil unser Geld eben mehr wert wäre.<br />
Dass Deutschland <strong>als</strong>o keineswegs einfach nur <strong>als</strong> großer wirtschaftlicher Gewinner des Euro<br />
zu betrachten ist, belegt zu dem bereits Dargelegtem noch folgender Aspekt: Gerade in den<br />
ersten Jahren nach der Einführung des Euro ist viel Kapital von Deutschland weg hin zu den<br />
anderen Euroländern geflossen, weil viele annahmen, dass man dort mit der neuen Währung<br />
genauso sicher sein Geld investieren könne wie zuvor in Deutschland. Dies hat unsere Wirtschaftskraft<br />
nachweislich spürbar geschwächt. Erst in den letzten Jahren im Zuge der Krise ist<br />
vieles davon wieder zurück nach Deutschland geflossen.
Wir können anhand dessen wieder einmal sehen, dass man den vollmundigen Verlautbarungen<br />
vieler Politiker nicht vertrauen kann! Die Vertrauenskrise in den Euro ist ganz erheblich<br />
von den politisch Verantwortlichen verursacht worden. Die Eurokrise wird immer mehr auch<br />
zu einer grundlegenden Vertrauenskrise in die politisch Verantwortlichen, weil wir Bürger<br />
weder auf die fachliche Kompetenz jener Politiker noch auf deren moralische Integrität vertrauen<br />
können. Sie halten uns gegebene Versprechungen einfach nicht ein und brechen<br />
sogar rechtsgültige Verträge und beides mit voller Absicht! Das zerstört auf Dauer die<br />
Fundamente der Demokratie in Deutschland und in ganz Europa! Denn auf Lug und<br />
Betrug lässt sich meiner Meinung nach kein Gemeinwesen auf Dauer errichten bzw.<br />
erhalten, und das soll es aus moralischen Gründen auch gar nicht!!
5.6. Eurokrise II:<br />
Hilfspakete, Rettungsschirme, Eurobonds: Marsch in die Schuldenunion und Sprengsätze<br />
für die europäischen Demokratien<br />
Hilfspakete und Rettungsschirme für überschuldete Euroländer wie beispielsweise Griechenland<br />
sowie in der Diskussion stehende Eurobonds bedeuten einen beschleunigten Marsch in<br />
die Schuldenunion und stellen Sprengsätze für die europäischen Demokratien dar.<br />
Beginnen wir mit den Hilfspakten und Rettungsschirmen, von denen bereits einige beschlossen<br />
worden und weitere in Planung sind; so der Stand Anfang September 2011. Mithilfe der<br />
genannten Maßnahmen sind überschuldete Länder bis jetzt vor der Staatsinsolvenz, <strong>als</strong>o der<br />
Zahlungsunfähigkeit bewahrt worden. Sie waren auf diese Hilfe von Staaten wie vor allem<br />
Deutschland angewiesen, weil ihnen kein privater Gläubiger mehr zu bezahlbaren Konditionen<br />
Geld leihen wollte. Aber genau dieses Geld brauchten jene überschuldeten Länder<br />
dringend, um ihren Zahlungsverpflichtungen im In- wie Ausland nachkommen zu können.<br />
Denn ihre Einnahmen aus Steuern und Abgaben reichen dafür bei weitem nicht aus. Diese<br />
Länder sind nämlich nach Meinung von privaten Investoren wie beispielsweise Lebensversicherungen<br />
nicht mehr in der Lage, Zins- und Tilgungszahlungen bestehender Kredite aus<br />
eigener Kraft auch in Zukunft sicherzustellen. Diese Länder – außer Irland alles von Deutschland<br />
aus südlich gelegene Staaten – haben insbesondere nach der Euroeinführung die dadurch<br />
niedrigeren Zinsen nicht dazu genutzt, ihre bisherigen Schulden abzubauen und besser zu<br />
wirtschaften, sondern die Politiker dieser Länder haben – ganz im Gegenteil – diesen Zinsvorteil<br />
dazu genutzt, noch mehr Schulden anzuhäufen, um ihrer Bevölkerung Wahlgeschenke auf<br />
Pump zu bieten. Und die Wähler in diesen Ländern haben dies dankbar angenommen. Dass<br />
sie diesen Zinsvorteil vor allem Deutschland zu verdanken haben, wurde und wird auch heute<br />
noch häufig ausgeblendet. Denn im wesentlichen war und ist die Stärke des Euro an Deutschland<br />
gebunden. Aber nun ist die Party vorbei und das Vertrauen der Märkte in viele Euroländer,<br />
gerade im Süden Europas, leichtfertig verspielt. Aber erst auf <strong>Dr</strong>uck der oft zu unrecht<br />
gescholtenen Märkte finden sich nun jene Länder – einige mehr, andere weniger – zu Korrekturen<br />
bereit, weil sie schlicht keine andere Wahl haben. Denn ansonsten können sie zukünftig<br />
weder im Ausland dringend benötigte Waren mangels Zahlungsfähigkeit kaufen, noch die Gehälter<br />
ihrer Staatsbediensteten oder beispielsweise die Renten auszahlen. Sie könnten es jetzt<br />
schon nicht, wenn nicht wir deutschen Steuerzahler ihnen mit Hilfspaketen und Rettungsschirmen<br />
unter die Armen gegriffen hätten. Aber das heißt letztlich nichts anderes, <strong>als</strong> dass<br />
wir auf Wohlstand verzichten müssen, weil andere über ihre Verhältnisse gelebt haben. Und<br />
indem wir diese Politik durch immer größere Hilfspakete und Rettungsschirme fortsetzen,<br />
nehmen wir auch den <strong>Dr</strong>uck ein wenig weg, der diese Länder veranlasst, wirklich durchgreifende<br />
Strukturreformen umzusetzen. Die Deutschen zahlen ja, sagt man sich nicht ganz zu<br />
unrecht! Bei uns in Deutschland fehlt hingegen das Geld für Schulen, Kindertagesstätten und<br />
dergleichen, aber für diese Länder gehen wir mit unglaublichen hunderten von Milliarden in<br />
die Haftung. Und wer von den politisch Verantwortlichen uns weismachen will, dass wir<br />
am Ende nicht kräftig werden zahlen müssen, ist entweder unglaublich naiv, sprich<br />
fachlich völlig inkompetent oder belügt uns schamlos!<br />
Wer den <strong>Dr</strong>uck der Märkte von den nicht solide wirtschaftenden Ländern wegnimmt, provoziert<br />
jene nur, weiterhin die wirtschaftlich notwendigen Strukturanpassungen nicht vorzunehmen.<br />
Denn sowohl ihre Staatsapparate <strong>als</strong> auch ihre Wirtschaft sind – wenn auch in unterschiedlichem<br />
Ausmaß – international nicht hinreichend wettbewerbsfähig. Griechenland ist<br />
hierbei ein besonders krasses Beispiel.<br />
Eurobonds – <strong>als</strong>o Schuldverschreibungen, für die alle Eurostaaten gemeinsam bürgen – sind<br />
genau das f<strong>als</strong>che Signal an die unsolide wirtschaftenden Staaten, da sie diese nur dazu ver-
leiten, sich weiter übermäßig zu niedrigen Zinsen zu verschulden, weil ja Länder wie<br />
Deutschland mit ihrer – bisher noch – guten Bonität für sie mit bürgen. Dennoch kämen bei<br />
der Einführung dieser Eurobonds sofort schon erhebliche Kosten auf uns Deutsche zu, weil<br />
die Zinsen für unsere eigenen Schulden ansteigen würden. Denn unsere Bonität würde natürlich<br />
darunter leidern, wenn wir immer mehr für andere mit unzähligen Milliarden ins Obligo<br />
gingen. Und das höhere Risiko schlägt sich dann in dementsprechend höheren Zinsen für uns<br />
nieder, da auch wir immer noch neue Schulden machen. Laut Berechnungen des ifo-Institutes<br />
handelt es sich dabei um Mehrbelastungen für den deutschen Steuerzahler in Höhe zweistelliger<br />
Milliardenbeträge – und das Jahr für Jahr, ohne dass ein Ende absehbar ist!<br />
Länder wie Griechenland oder Portugal werden auf absehbare Zeit nicht eine auch nur annähernd<br />
so effiziente und konkurrenzfähige Wirtschaft wie Deutschland entwickeln können.<br />
Darüber hinaus deutet nicht allzu viel darauf hin, dass die südlichen Länder des Euroraums<br />
und deren Völker harte Anpassungsmaßnahmen – so beispielsweise das Senken von Löhnen<br />
und anderen Preisen, um international wettbewerbsfähig zu werden – durchführen wollen. In<br />
einem gemeinsamen Währungsraum fehlt ihnen dann aber die Möglichkeit einer Anpassung<br />
über die Abwertung der eigenen Währung. Solche Abwertungen der Währung waren bis zur<br />
Euroeinführung gängige Praxis in jenen Ländern. Und dann sollten sie sich auf einmal eine<br />
deutsche Stabilitätskultur zu eigen machen. Das musste scheitern, wie wir heute wissen.<br />
Trotz der im Vergleich zu den hoch verschuldeten Euroländern deutlich besseren Situation in<br />
Deutschland haben auch wir ein massives Schuldenproblem: Wenn Deutschland ab sofort<br />
keine neuen Schulden mehr aufnehmen müsste und täglich ein Million Euro Schulden zurückzahlte,<br />
so würde es 5.408 Jahre dauern, bis alles abbezahlt wäre; bei einer Rückzahlung<br />
von einer Million Euro pro Stunde wären es immer noch 225 Jahre! Dies kann man im<br />
‚Steuerzahler’, Ausgabe September 2011 auf den Seiten 4 und 5 nachlesen; der Steuerzahler<br />
wird vom ‚Bund der Steuerzahler’ herausgegeben. Wir sind <strong>als</strong>o der Einäugige unter den<br />
Blinden. Uns in Deutschland geht es zwar im Vergleich zu Ländern wie Griechenland oder<br />
Portugal noch vergleichsweise gut, aber auch unser derzeitiges Schuldenproblem ist sehr<br />
bedrohlich. Und wenn wir nun noch für immer mehr Schulden anderer Länder einstehen<br />
müssen, wird sich diese Situation noch deutlich verschärfen und vielleicht stehen wir dann<br />
auch irgendwann vor der Pleite.<br />
Die bisherige Politik der Hilfspakete und Rettungsschirme ist aber nicht nur aus ökonomischer<br />
Sicht äußerst fragwürdig, sondern untergräbt auch die Demokratien in Europa und zwar<br />
sowohl in den Geber- bzw. Garantieländern wie Deutschland, <strong>als</strong> auch in den Nehmerländern<br />
wie Griechenland.<br />
Beginnen wir mit Deutschland: Der größte Teil der politischen Elite dieses Landes gibt bereitwillig<br />
Garantien und letztlich auch Geld an andere Länder und zwar unser Geld, das Geld<br />
der Bürger und Steuerzahler! Die Meinungsumfragen ergaben, dass gut <strong>Dr</strong>eiviertel der Bevölkerung<br />
diese Politik ablehnen. Aber was heißt das schon, wenn die politische Elite es anders<br />
will! Wir haben keine Möglichkeit, direkt darüber abzustimmen, ob wir diese Garantien geben<br />
wollen oder eben nicht. Darüber hinaus können unsere Volksvertreter sowie die Bundesregierung<br />
nur sehr eingeschränkt – wenn überhaupt – sicherstellen, dass in den Nehmerländern<br />
auch wirklich im Sinne der Geber mit den zur Verfügung gestellten Mitteln umgegangen<br />
wird. In Deutschland selbst hat der Bundestag sehr viel größere, direktere und wirksamere<br />
Möglichkeiten, die sachgerechte Verwendung von Haushaltsmitteln zu gewährleisten.<br />
Nun zu Nehmerländern wie Griechenland: Wenn die Regierung versucht, die von außen, d.h.<br />
maßgeblich von Geberländern wie Deutschland geforderten Maßnahmen umzusetzen, stößt<br />
sie auf große Widerstände in der eigenen Bevölkerung. Diese Bevölkerung gewinnt zunehmend<br />
den Eindruck, dass sie mit ihrer Wahlstimme sowieso nichts mehr bewirken kann, weil<br />
andere ihnen vorschreiben, wie sie wirtschaften und ihren Staat organisieren müssen. Dabei
verdrängen allerdings viele von ihnen, dass sie mit der unverantwortlichen Ausgabenpolitik in<br />
den vergangenen Jahren sich selbst in diese missliche Lage gebracht haben und zwar auch das<br />
einfache Wahlvolk, das so gerne die Politiker gewählt hat, die am meisten Wohltaten versprochen<br />
haben. Wie auch immer, Vorgaben von außen werden immer <strong>als</strong> Fremdbestimmung<br />
empfunden und führen entweder zu massivem Protest oder Lethargie, nicht aber zu konstruktivem<br />
Mitwirken im demokratischen Gemeinwesen.<br />
Man kann festhalten, dass sowohl in den Geber- <strong>als</strong> auch Nehmerländern das Vertrauen in die<br />
Demokratien durch die oben beschriebenen Maßnahmen der verantwortlichen Politiker untergraben<br />
wird. Besser wäre es, wenn jedes Land über seine Lebensweise und damit seine<br />
Zukunft selbstverantwortlich entscheidet, aber damit auch die Konsequenzen für sein<br />
Handeln trägt und eigene Fehler nicht von anderen bezahlen lässt! Warum sollten die<br />
Griechen auch so leben und wirtschaften wie wir Deutschen? Ich möchte ihnen auch gar nicht<br />
<strong>als</strong> deutscher Oberlehrer sagen, was sie zu tun oder zu lassen haben. Sie sollen über ihre<br />
eigene Lebensweise selbst entscheiden und dann selbstverständlich auch für die Folgen ihres<br />
Handelns einstehen.<br />
Und hier genau liegt der schon mehrfach von mir beschriebene grundsätzliche Konstruktionsfehler<br />
der gemeinsamen Währung: Sie besitzt keine demokratische Legitimation, weil es kein<br />
europäisches Volk mit entsprechendem Identitäts- und Solidaritätsgefühl einschließlich einer<br />
gemeinsamen Sprache und Kultur gibt. Trotz aller europäischer Gemeinsamkeiten sind es<br />
letztlich doch die Nationen, die Nation<strong>als</strong>taaten, die Identität und damit ein hohes Maß an<br />
Solidarität bieten. Wenn nun einige, aber keineswegs alle Ökonomen fordern, dass man <strong>als</strong><br />
Konsequenz aus der gegenwärtigen Eurokrise eine stärkere Verlagerung von Kompetenzen<br />
auf europäische Ebene in Angriff nehmen müsse, ignorieren sie das ganz erhebliche demokratische<br />
Legitimitätsproblem, das dadurch entstünde. Solange es kein europäisches Volk mit<br />
entsprechender Identifikation aller Menschen in Europa einschließlich hinreichend gemeinsamer<br />
kultureller Werte sowie Lebensweisen gibt, bleibt die entscheidende Legitimationsquelle<br />
der Nation<strong>als</strong>taat, trotz vieler Gemeinsamkeiten der europäischen Völker.<br />
Ökonomische Modelle taugen <strong>als</strong> Hilfe zur Diagnose wie anschließender Vorschläge zur<br />
Therapie, nur dann, wenn sie die kulturellen Gegebenheiten eingehend in alle Überlegungen<br />
miteinbeziehen. Dabei spielt gerade in Europa die demokratische Legitimation<br />
eine entscheidende Rolle!<br />
Neben einigen Ökonomen fordern vor allem viele Politiker in Europa eine verstärkte Übertragung<br />
von Machtbefugnissen weg von den Nation<strong>als</strong>taaten hinauf zur europäischen Ebene.<br />
Gerade ihnen <strong>als</strong> gewählte Politiker sollten die damit verbundenen demokratischen Legitimationsprobleme<br />
eigentlich bewusst sein. In meinen obigen Ausführung sowie ausführlicher<br />
in meinem Beitrag ‚Europäische Union’ habe ich diese eingehend erläutert und schon vor<br />
Jahren auf die damit verbundenen Gefahren hingewiesen. Die politische Elite – unter dieser<br />
ganz maßgeblich der ehemalige Bundeskanzler Helmut Kohl – hat darauf überhaupt keine<br />
Rücksicht genommen, sondern meinte gegen die Mehrheitsmeinung des Volkes einfach die<br />
europäische Integration so voranzutreiben, wie sie es für richtig hielt. So wurde der Euro –<br />
gegen alle berechtigten Warnungen und gegen die Mehrheit des deutschen Volkes – einfach<br />
eingeführt. Eine der Begründungen lautete dabei, dass man durch die gemeinsame Währung<br />
die politische Integration vorantreiben könne. Nun geschieht aber das genaue Gegenteil: Der<br />
Euro und die mit diesem verbundenen Rettungsmaßnahmen drohen eher zum Spaltpilz<br />
Europas zu werden, wodurch auch viele eindeutig positive Aspekte der europäischen Zusammenarbeit<br />
erheblichen Schaden nehmen könnten. Ganz maßgeblich durch die f<strong>als</strong>che<br />
Politik der letzten Jahrzehnte sind wir nun in eine Situation gekommen, in welcher die Lage<br />
so verfahren ist, dass es keinen leichten Ausweg mehr gibt. Und nun sollen wir ausgerechnet<br />
der politischen Elite Vertrauen bei der Lösung der Probleme schenken? Ich tue<br />
es jedenfalls nicht!
5.7. Eurokrise III:<br />
Warum überhaupt noch zur Wahl gehen?!<br />
Warum sollte man in Deutschland überhaupt noch zur Wahl gehen? Ich weiß natürlich, dass<br />
sich sofort viele gute, vernünftige Gründe dafür aufführen ließen, warum man unbedingt auch<br />
in Deutschland von seinem Wahlrecht Gebrauch machen sollte. Aber ich will hier einmal den<br />
Advocatus Diaboli geben und zwar am Beispiel der Euro-Krise.<br />
Wenn ich mich an einer Wahl beteilige, will ich durch meine Stimmabgabe den politischen<br />
Prozess in meinem Land mitbestimmen. In Deutschland habe ich auf der die meisten wichtigen<br />
Fragen entscheidenden Bundesebene nur die Möglichkeit, alle vier Jahre meine zwei<br />
Kreuzchen zu machen, eines für den Abgeordneten und das andere, weit wichtigere für die<br />
Partei. Ich kann mich faktisch nur zwischen einigen Parteien und denen von ihnen aufgestellten<br />
Kandidaten entscheiden. Weder habe ich Einfluss auf die Personen noch die Inhalte, die<br />
zur Wahl stehen. Sobald ich mich für eine Partei entschieden habe, wähle ich – ob ich will<br />
oder nicht – immer das ganze Programmpaket, auch wenn ich vielleicht vieles davon überhaupt<br />
nicht richtig finde. Ich wähle halt diese Partei, weil sie meinen Vorstellungen noch am<br />
nächsten kommt im Vergleich mit den anderen. Also gut, man muss eben Kompromisse<br />
machen. Aber ich muss mich doch dann wenigstens auf die Versprechungen der Parteien verlassen<br />
können. Sonst könnte ich ja einfach blind irgendwo auf dem Wahlzettel mein Kreuzchen<br />
machen, oder gar nicht erst zur Wahl gehen. Denn ich würde ja letztlich überhaupt nichts<br />
in meinem Sinne im politischen Prozess bewirken können, weil die Parteien und deren Kandidaten,<br />
erst einmal gewählt, das machten, was sie wollten und nicht das, wofür sie von den<br />
Wählern ihre Stimme erhalten hätten. Und wie sieht es in der Realität aus? Selbstverständlich<br />
werden Wahlversprechen der Parteien immer wieder in eklatanter Weise gebrochen, wodurch<br />
die Wahlen zur bloßen Farce zu verkommen drohen. Die Wähler sollen schön brav die Parteien<br />
und ihre Kandidaten wählen und dann gefälligst den Parlamentarien das politische Geschäft<br />
überlassen. Sie verstehen schließlich auch viel mehr davon, <strong>als</strong> der normale Bürger,<br />
Steuerzahler und Wähler. Diesen Eindruck jedenfalls gewinnen viele Menschen in Deutschland,<br />
und auch mir geht es so. Wenden wir uns nun der Euro-Krise <strong>als</strong> einem Beispiel für das<br />
eben Geschriebene zu. Die verantwortlichen Politiker in Deutschland versprachen uns immer<br />
und immer wieder, dass es mit der Einführung des Euros keine Transferunion geben werde,<br />
<strong>als</strong>o dass ein Land für die Schulden eines anderen einsteht. Und dies hielt man sogar rechtsverbindlich<br />
vertraglich fest! Nun müssen wir feststellen, dass weder das politische Versprechen<br />
noch ein rechtsverbindlicher Vertrag eingehalten wird. Und dieser Rechtsbruch hat<br />
zudem keinerlei Konsequenzen für die Rechtsbrecher. Man stelle sich vor, wir normalen<br />
Bürger würden einfach einmal das Recht brechen, beispielsweise einfach keine Steuern mehr<br />
zahlen, weil wir das Geld lieber für etwas anderes ausgeben wollten: Wir würden sofort<br />
juristisch zur Verantwortung gezogen und bestraft werden!<br />
Darüber hinaus vermitteln uns die meisten Politiker in der Euro-Krise auch nicht gerade<br />
Fachkompetenz. Die meisten Ökonomen haben schon im Vorfeld der Euro-Einführung davor<br />
gewarnt, dass die Einführung einer gemeinsamen Währung mit einer einheitlichen Geld- und<br />
Zinspolitik durch eine gemeinsame Zentralbank bei ganz verschieden entwickelten Volkswirtschaften<br />
ohne eine politische Union einschließlich einer Transferunion auf Dauer nicht<br />
funktionieren könnte. Aber das ignorierten die verantwortlichen Politikern – an der Spitze der<br />
damalige Bundeskanzler Helmut Kohl – arrogant. Sie wussten zudem natürlich auch, dass die<br />
Menschen in Deutschland den Euro in ihrer großen Mehrheit nicht wollten und erst recht eine<br />
wie oben beschriebene politische Union entschieden ablehnten. Aber unsere politische Elite<br />
hat selbstverständlich zu keinem Zeitpunkt auch nur daran gedacht, das Volk über eine so<br />
grundlegende Frage direkt abstimmen zu lassen. Sie meinten ja, alles besser zu wissen! Heute
sehen wir, dass sie es eben weder dam<strong>als</strong> noch heute wirklich besser wussten bzw. wissen.<br />
Dennoch klammern sie sich mit aller Macht an die Macht und überlassen die Entscheidung<br />
über derart grundlegende Fragen nicht dem Volk, dem eigentlichen Souverän in einer<br />
Demokratie!<br />
Also noch einmal: Warum sollen wir überhaupt noch wählen gehen? Die Politiker machen,<br />
was sie wollen. Und nicht einmal das Argument, dass sie doch fachkompetent seien, kann ein<br />
Großteil der politischen Elite für sich beanspruchen. Dennoch beharrt diese politische Elite<br />
zäh auf ihrem Entscheidungsmonopol. Wir Bürger dürfen auf Bundesebene lediglich alle vier<br />
Jahre unsere Kreuzchen machen. Und selbst diese sind kaum bis gar nichts mehr wert, weil<br />
nach der Wahl in zentralen Punkten etwas anderes gemacht wird, <strong>als</strong> vor der Wahl den<br />
Wählern versprochen worden ist. Und neuerdings halten sich Politiker nicht einmal an rechtsgültige<br />
Verträge und biegen sich das Recht so zurecht, wie sie es gerne haben wollen. Zudem<br />
verlieren die von uns gewählten Bundestagsabgeordneten immer mehr Kompetenzen an die<br />
Europäische Union. Und die dortigen Behörden und Institutionen erwecken selbst beim<br />
naivsten Menschen nicht den Eindruck, dass sie einer auch nur annähernd akzeptablen demokratischen<br />
Legitimation und Kontrolle unterliegen.<br />
Um noch einmal auf die Euro-Krise zurückzukommen: Welche Wahl hatten wir denn vor der<br />
Einführung des Euro? Obwohl die große Mehrheit in Deutschland gegen diese neue Währung<br />
war, waren alle im Bundestag vertretenen Parteien dafür. Wen hätten die vielen Wähler, die<br />
gegen den Euro waren, denn mit einiger Aussicht auf Erfolg wählen sollen, wenn die gesamte<br />
politische Elite des Landes für den Euro war? Wir hatten <strong>als</strong>o in einem zentralen Punkt überhaupt<br />
keine Wahl! Und heute dürfen wir <strong>als</strong> Bürger und Steuerzahler die Zeche zahlen, die<br />
uns diese Politiker eingebrockt haben. Und natürlich können wir auch weiterhin nicht selber<br />
über solch entscheidende Fragen direkt abstimmen. Zudem vermitteln uns die Politiker auch<br />
nicht den Eindruck der nötigen Fachkompetenz. Dennoch haben wir auch weiterhin keine<br />
wirkliche Wahl, da (fast) alle aus der politischen Elite die gleiche Richtung in dieser Frage<br />
verfolgen.<br />
Mir tut es letztlich in der Seele weh, gerade in dieser Frage den Advocatus Diaboli zu geben<br />
und Argumente gegen die Sinnhaftigkeit der Teilnahme an Wahlen aufzuführen. Aber leider<br />
sehe ich mich aufgrund der arroganten und bürgerfernen Handlungsweise der politischen Elite<br />
in Deutschland dazu gezwungen, wobei das Agieren vieler Politiker in der Eurokrise den<br />
letzten Anstoß dazu geliefert hat und sich nicht abzeichnet, dass sich an der undemokratischen<br />
und bürgerfernen Haltung etwas Grundlegendes ändern wird, wenn es nach der politischen<br />
Klasse in diesem Land geht. Wir Bürger müssen uns mit legitimen Mitteln zur Wehr setzen.<br />
Und das erste, das wir tun müssen, ist meiner Meinung nach ungeschönt die Dinge beim<br />
Namen zu nennen, zu argumentieren und öffentlich zu diskutieren. So können wir Bürger mit<br />
wohl begründeten Argumenten in die politische Debatte eingreifen und vielleicht auf Dauer ja<br />
doch etwas bewegen. Das ist zumindest meine Hoffnung – auch wenn ich zugeben muss, dass<br />
diese Hoffnung im Moment nur sehr, sehr klein ist. Aber auch die kleinste Flamme mag dereinst<br />
einmal hell leuchten. Wer weiß?!
5.8. Kreditkrise für Dummies:<br />
Kreditkrise für Dummies von einem anonymen Verfasser, der nachfolgenden Text ins<br />
Internet gestellt hat:<br />
Die Ursachen und Wirkungen der Kreditkrise sind schwer zu verstehen. Hier nun endlich ein<br />
Erklärungsmodell zur Finanzkrise, das jeder versteht.<br />
Mandy besitzt eine Bar in Berlin-Kreuzberg. Um den Umsatz zu steigern, beschließt sie, die<br />
Getränke der Stammkundschaft (hauptsächlich alkoholkranke Hartz-IV-Empfänger) auf den<br />
Deckel zu nehmen, ihnen <strong>als</strong>o Kredit zu gewähren. Das spricht sich in Kreuzberg schnell<br />
herum und immer mehr Kundschaft desselben Segments drängt sich in Mandy's Bar.<br />
Da die Kunden sich um die Bezahlung keine Sorgen machen müssen, erhöht Mandy<br />
sukzessive die Preise für den Alkohol und erhöht damit auch massiv ihren Umsatz. Der junge<br />
und dynamische Kundenberater der lokalen Bank bemerkt Mandy's Erfolg und bietet ihr zur<br />
Liquiditätssicherung eine unbegrenzte Kreditlinie an. Um die Deckung macht er sich keinerlei<br />
Sorgen, er hat ja die Schulden der Trinker <strong>als</strong> Deckung.<br />
Zur Refinanzierung transformieren top ausgebildete Investmentbanker die Bierdeckel in<br />
verbriefte Schuldverschreibungen mit den Bezeichnungen SUFFBOND®, ALKBOND® .<br />
Diese Papiere laufen unter der modernen Bezeichnung SPA Super Prima Anleihen und<br />
werden bei einer usbekischen Online-Versicherung per Email abgesichert. Daraufhin werden<br />
sie von mehreren Rating-Agenturen (gegen lebenslanges Freibier in Mandy's Bar) mit<br />
ausgezeichneten Bewertungen versehen.<br />
Niemand versteht zwar, was die Abkürzungen dieser Produkte bedeuten oder was genau diese<br />
Papiere beinhalten, aber dank steigender Kurse und hoher Renditen werden diese Konstrukte<br />
ein Renner für institutionelle Investoren. Vorstände und Investmentspezialisten der Bank<br />
erhalten Boni im dreistelligen Millionenbereich.<br />
Eines Tages, obwohl die Kurse immer noch steigen, stellt ein Risk Manager (der inzwischen<br />
wegen seiner negativen Grundeinstellung selbstverständlich entlassen wurde) fest, dass es an<br />
der Zeit sei, die ältesten Deckel von Mandy's Kunden langsam fällig zu stellen.<br />
Überraschenderweise können weder die ersten noch die nächsten Hartz-IV-Empfänger ihre<br />
Schulden, von denen viele inzwischen ein Vielfaches ihres Jahreseinkommens betragen,<br />
bezahlen. Solange man auch nachforscht, es kommen so gut wie keine Tilgungen ins Haus.<br />
Mandy macht Konkurs. SUFFBOND® und ALKBOND® verlieren 95%, KOTZBOND® hält<br />
sich besser und stabilisiert sich bei einem Kurswert von 20%.<br />
Die Lieferanten hatten Mandy extrem lange Zahlungsfristen gewährt und zudem selbst in die<br />
Super Prima Anleihen investiert. Der Wein- und der Schnapslieferant gehen Konkurs, der<br />
Bierlieferant wird dank massiver staatlicher Zuschüsse von einer ausländischen<br />
Investorengruppe übernommen. Die Bank wird durch Steuergelder gerettet. Der Bankvorstand<br />
verzichtet für das abgelaufene Geschäftsjahr auf den Bonus.
5.9. Fünf Populäre Irrtümer über die Wirtschaft:<br />
5.9.1. Irrtum 1:<br />
Eine Vermögenssteuer ist gerecht, belastet nur die Reichen und hilft den Armen<br />
Zunächst erscheint es vielen sehr einleuchtend zu sein, dass die Wohlhabenden durch eine<br />
Vermögenssteuer zur Kasse gebeten werden sollen, damit beispielsweise mehr für die Bildung<br />
ausgegeben werden kann. Obendrein hört es sich gerecht an, wenn die Reichen mehr<br />
abgeben <strong>als</strong> bisher. Wir wollen nun einmal nachstehenden Dialog mitverfolgen, um zu sehen,<br />
wie es sich mit einer Vermögenssteuer wirklich verhält:<br />
Der Politiker Oskar L. liest im Rahmen einer Buchvorstellung einige Passagen aus seinem neuen<br />
Werk vor. Im Unterschied zu seinen sonstigen öffentlichen Auftritten, bei denen aufgrund der<br />
Berühmtheit des Autors viel Medienandrang herrscht, hat er allerdings dieses Mal auf einem<br />
kleinen Zuhörerkreis bestanden, weil er den persönlichen Kontakt zu ganz normalen Menschen<br />
pflegen wollte, um direkt deren Meinung ungefiltert erfahren zu können.<br />
Oskar L.: Ich habe mich auf diesen Abend schon seit längerem sehr gefreut und hoffe, Sie werden,<br />
nach den aus meinem neuen Buch vorgelesenen Stellen, in einen regen Gedankenaustausch<br />
mit mir eintreten. Dabei nehme ich gerne Anregungen aus Ihrem Alltag für mögliche neue Buchprojekte<br />
von mir auf.<br />
Beifall im Publikum. Oskar L. liest vor: Inhalt seiner Lesung sind die Themen Gerechtigkeit und<br />
Solidarität und wie man sie am besten mit Hilfe von Lohn- sowie Steuerpolitik in die Tat umsetzen<br />
müsste. Dabei kritisiert er heftig die Politik der Bundesregierung, die Vorstellungen konkurrierender<br />
Parteien sowie die Arbeitgeberverbände, wofür er häufig stürmischen Beifall im<br />
Publikum erntet, dem er aus der Seele zu sprechen scheint. Es sind meist einfache Leute, die zum<br />
Teil arbeitslos sind oder nur wenig Einkommen erzielen, sei es im Beruf oder durch die Rente.<br />
Sie fühlen sich der neuen wirtschaftlichen Entwicklung namens ‚Globalisierung’ hilflos ausgeliefert<br />
und sehen in Oskar L. jemanden, der sie ernst nimmt, sie nicht vergessen hat und ihrer<br />
Angst wie ihren Sehnsüchten eine öffentlich wahrnehmbare Stimme verleiht. Kurz gesagt: Er<br />
bietet ihnen eine geistige und vor allem emotionale Heimat.<br />
Seine Thesen besagen im wesentlichen, dass die Löhne der Gering- und Normalverdienenden<br />
erhöht werden müssten und zwar sowohl um der Gerechtigkeit <strong>als</strong> auch der wirtschaftlichen<br />
Logik willen, weil schließlich nur Leute, die genug verdienten, letztlich die Produkte der Unternehmen<br />
kaufen könnten: Denn ohne Konsumenten kein Absatz der von den Firmen hergestellten<br />
Waren, so sein Credo. Darüber hinaus sollten beispielsweise die Reichen durch die Einführung<br />
einer Vermögenssteuer deutlich mehr an den Staat abführen <strong>als</strong> bisher.<br />
Rentner R. mischt sich in die Diskussion ein:<br />
Rentner R.: Herr L., Sie sprachen mir voll und ganz aus dem Herzen. Insbesondere finde ich es<br />
vorbildlich von Ihnen, dass Sie <strong>als</strong> jemand, der recht viel verdient, etwas mehr abgeben wollen,<br />
um die Ärmeren in dieser Gesellschaft stärker zu unterstützen. Sie zeigen nicht nur auf die anderen,<br />
sondern beginnen bei sich selbst. Dafür möchte ich Ihnen zunächst meinen tief empfundenen<br />
Dank aussprechen.<br />
Starker Beifall im Publikum.
Oskar L.: Ich danke Ihnen sehr für die lobenden Worte. In der Tat ist für mich Solidarität ein<br />
ganz entscheidender Wert, den ich eben nicht, wie viele Menschen, nur von den anderen einfordere,<br />
sondern zunächst einmal bei mir selbst beginne.<br />
Wiederum starker Beifall im Publikum.<br />
Rentner R.: Ich muss Ihnen unbedingt von einer Begegnung mit einem Menschen, den ich zufällig<br />
auf dem Bahnhof getroffen hatte, berichten und hoffe, dass Sie mir weiterhelfen können.<br />
Nachdem wir zwanglos ins Gespräch gekommen waren, besprachen wir schon nach relativ<br />
kurzer Zeit wirtschaftliche Themen, wobei Fragen nach Gerechtigkeit und Solidarität eine entscheidende<br />
Rolle zufiel. Ich komme halt einigermaßen über die Runden. In fast allen Punkten<br />
vertrat er dabei allerdings eine völlig andere Meinung <strong>als</strong> Sie und argumentierte derart, dass ich<br />
ihm letztlich nicht widersprechen konnte. Mir fehlten einfach die Gegenargumente. Vielleicht<br />
können Sie mir jetzt weiterhelfen.<br />
Oskar L:: Wer war denn dieser Mensch? Womöglich irgendein Verbandsvertreter aus der Wirtschaft?<br />
Rentner R.: Nein, keineswegs. So weit ich das verstanden habe, ist er ein Kleinunternehmer im<br />
Bildungsbereich, der wohl auch nicht zu den Reichen dieser Gesellschaft zählt.<br />
Oskar L.: Na schön. Was hat er denn gesagt?<br />
Rentner R.: Also gut. Ich will versuchen, es möglichst genau wiederzugeben. Als erstes fällt mir<br />
das Thema Vermögenssteuer ein: Er hielt sie sowohl aus wirtschaftlicher Sicht <strong>als</strong> auch aus<br />
Gründen der Gerechtigkeit für unsinnig.<br />
Oskar L.: Wahrscheinlich war er wohl doch vermögender, <strong>als</strong> er sich gab!<br />
Rentner R.: Das glaube ich nicht. Er machte auf mich keinesfalls einen solchen Eindruck. Aber<br />
unabhängig davon sollten wir uns seine Meinung genauer anhören, um zu sehen, wie wir ihn<br />
vielleicht widerlegen können.<br />
Oskar L.: Na schön. Dann legen Sie mal los.<br />
Rentner R.: Ich beginne mit der Gerechtigkeitsfrage. Er vertrat die Auffassung, die Vermögenssteuer<br />
sei ungerecht und verdeutlichte dies mit Hilfe des folgenden Beispiels:<br />
Stellen wir uns zwei einigermaßen gut verdienende Menschen vor: Beide zahlen zunächst einmal<br />
gleichermaßen Einkommenssteuer. Von dem danach übrig gebliebenen Geld spart der eine von<br />
ihnen einen erheblichen Teil, während der andere alles ausgibt, vor allem indem er regelmäßig<br />
seinen Urlaub an teuren, exotischen Orten verbringt. Der Sparsame zahlt neben der Steuer auf<br />
seine Arbeitseinkünfte bald zusätzlich noch eine Steuer auf seine Zinserträge, die der Globetrotter<br />
natürlich nicht zahlt. Nach einigen Jahren hat der Sparer soviel Vermögen angesammelt,<br />
dass er dann auch noch auf dieses eine Steuer entrichten muss, d.h. neben seiner Einkommens-<br />
und Zinssteuer muss er noch eine zusätzliche Abgabe auf sein angespartes und schon zweimal<br />
versteuertes Vermögen leisten, wohingegen der andere diese Steuerbelastung nicht zu tragen hat<br />
und stattdessen sein Geld im Ausland ausgibt. So geht das Jahr für Jahr. Als schließlich beide alt<br />
und gebrechlich geworden sind und in einem Pflegeheim untergebracht werden müssen, zahlt der<br />
Sparsame den Teil der Kosten, die nicht durch die Pflegeversicherung abgedeckt werden, aus<br />
seinem zuvor gesparten Vermögen. Der andere hingegen ist auf die Unterstützung des Staates,
<strong>als</strong>o der Steuerzahler angewiesen. Ist dies nicht ungerecht, wenn der Sparer viel mehr Steuern<br />
zahlt und am Ende auch noch aus dem von ihm mehrfach versteuerten Vermögen einen Teil der<br />
Heimkosten begleichen muss, während der Lebemann, der alles auf seinen Reisen verjubelte,<br />
auch noch jene Kosten durch die Solidargemeinschaft erstattet bekommt?<br />
Das Publikum im Raum ist ganz still und nachdenklich geworden.<br />
Oskar L.: Mag sein, dass eine Vermögenssteuer in einem solchen Fall vielleicht nicht sonderlich<br />
gerecht wäre. Aber man muss den Staat doch mit genügend Mitteln ausstatten, um Gerechtigkeit<br />
üben zu können, und dafür müssen die Reicheren nun einmal mehr zahlen!<br />
Rentner R.: Etwas Ähnliches habe ich ihm auch entgegengehalten.<br />
Oskar L.: Und wie hat er geantwortet?<br />
Rentner R.: Dem hat er ohne weiteres auch zugestimmt. Nur meinte er, dass die Vermögenssteuer<br />
dafür eben ungerecht sei. Man müsse stattdessen den sozialen Ausgleich über die Einkommenssteuer<br />
realisieren.<br />
Oskar L.: Für einen solchen Ausgleich durch die Einkommenssteuer bin ich natürlich ebenfalls.<br />
Zusätzlich sollte man aber noch die Vermögenssteuer erheben, selbst wenn sie in Einzelfällen<br />
vielleicht nicht hundertprozentig gerecht sein sollte.<br />
Rentner R.: Ja genau. Das erwiderte ich ihm auch. Aber dann fragte er mich, ob denn nicht durch<br />
das aufgeführte Beispiel die prinzipielle Ungerechtigkeit einer Vermögenssteuer dargelegt worden<br />
sei, weil sie beispielsweise zum dritten Mal die Früchte der Arbeit eines fleißigen Sparers<br />
besteuere: zuerst nämlich treffe ihn die Einkommenssteuer, dann die Steuer aus den Zinserträgen<br />
und schließlich zuletzt noch eine Vermögenssteuer, die nur die Tatsache besteuere, dass einem<br />
etwas gehört, welches vorher bereits zweimal der Steuer unterworfen gewesen ist. Darauf konnte<br />
ich ihm nun nichts mehr entgegnen.<br />
Im Publikum herrscht Stille. Nach einer kurzen Pause ergreift Oskar L. das Wort:<br />
Oskar L.: Von mir aus mag Ihr Gesprächspartner das so sehen, wie Sie es dargestellt haben. Ich<br />
bin eben anderer Meinung!<br />
Im Publikum herrscht weiterhin Stille. Man bemerkt dort mit einigem Unwohlsein, dass Oskar L.<br />
keine Gegenargumente vorzuweisen hat, obwohl man gefühlsmäßig seine Meinung in diesem<br />
Kreise eigentlich teilt. Oskar L. geht nun auf die angeblich ökonomische Unsinnigkeit einer<br />
Vermögenssteuer ein:<br />
Oskar L.: Ihr Gesprächspartner sprach doch auch davon, dass eine Vermögenssteuer ebenfalls<br />
aus wirtschaftlicher Sicht nicht anzuraten sei, nicht wahr?<br />
Rentner R.: Ja, genau das sagte er.<br />
Oskar L.: Nun, in diesem Punkt können wir ihn wohl leicht widerlegen!<br />
Rentner R.: Prima. Darauf bin ich jetzt sehr gespannt.<br />
Oskar L.: Nehmen wir das Beispiel USA: Dort wird eine Vermögenssteuer erhoben und die<br />
Wirtschaft wächst deutlich stärker <strong>als</strong> hier in Deutschland, wo die Reichen von einer solchen
Steuer nicht betroffen sind. Das ist doch wohl ein klarer Beweis für die Wirtschaftsverträglichkeit<br />
einer Vermögenssteuer!<br />
Rentner R.: Genau dieses Beispiel führte auch ich in unserem Gespräch an, weil ich kurz zuvor<br />
in einer Zeitung gelesen hatte, dass es in den USA eine solche Steuer gebe und es ja allgemein<br />
bekannt sein dürfte, dass dort die Wirtschaft schneller wächst <strong>als</strong> bei uns.<br />
Oskar L.: Na sehen Sie, manchmal ist es gar nicht so schwer wie es zunächst scheint, jemanden,<br />
der herumtheoretisiert, mit einfachen Beispielen aus der Praxis zu widerlegen!<br />
Rentner R.: Das dachte ich anfangs auch. Aber dann argumentierte er ungefähr wie folgt: Dieses<br />
Beispiel für sich genommen beweise noch keineswegs, dass eine Vermögenssteuer nicht doch<br />
aus ökonomischer Sicht unsinnig sei.<br />
Oskar L.: Aber was redet er denn da? Das ist Unfug!<br />
Rentner R.: Genauso dachte auch ich. Vielleicht können wir kurz den Dialog, welchen ich mit<br />
ihm führte, hier ein wenig nachspielen, indem ich versuche, seine Argumente aufzuführen und<br />
Sie jene zu widerlegen. Dann können wir wahrscheinlich genau den Punkt herausfinden, an dem<br />
er irrte.<br />
Oskar L.: Diesen Punkt werden wir wohl schnell finden!<br />
Rentner R.: Sehr schön. Dann beginne ich jetzt mit der mir ungewohnten Rolle: Eine entscheidende<br />
Grundlage unseres Wohlstandes bildet doch wohl die hohe Produktivität der Wirtschaft,<br />
nicht wahr?<br />
Oskar L.: Selbstverständlich.<br />
Rentner R.: Hohe Produktivität heißt nichts anderes, <strong>als</strong> dass pro Arbeitsstunde viel hergestellt<br />
wird.<br />
Oskar L.: Natürlich.<br />
Rentner R.: Pro Arbeitsstunde kann aber nur dann viel produziert werden, wenn die technischen<br />
Hilfsmittel – wie zum Beispiel leistungsstarke Maschinen – am Arbeitsplatz zum Einsatz<br />
kommen.<br />
Oskar L.: Das ist doch alles völlig klar.<br />
Rentner R.: Schön. Eine derart gute Ausstattung eines Unternehmens ist dann wohl auch die unbedingte<br />
Voraussetzung für seine hohe Produktivität, oder etwa nicht?<br />
Oskar L.: Aber was Sie hier sagen, ist doch ganz selbstverständlich. Wann kam denn Ihr Gesprächspartner<br />
endlich auf den Punkt?<br />
Rentner R.: Warten Sie es ab, gleich sind wir soweit: Diese Ausstattung bezeichnet man auch <strong>als</strong><br />
das Kapital des Unternehmens.<br />
Oskar L.: So ist es.
Rentner R.: Somit ist eine hohe Kapitalausstattung die Voraussetzung einer hohen Produktivität.<br />
Oskar L.: Das versteht sich von selbst.<br />
Rentner R.: Fein. Dieses Kapital ist nichts anderes <strong>als</strong> das Vermögen des Unternehmens.<br />
Oskar L.: Sicher.<br />
Rentner R.: Eine Vermögenssteuer verteuert <strong>als</strong>o den Faktor Kapital, weil der Unternehmer, je<br />
mehr Maschinen er hat, umso mehr Steuern zahlen muss.<br />
Oskar L.: Von mir aus.<br />
Rentner R.: Infolgedessen führt eine Vermögenssteuer durch die Verteuerung des Faktors Kapital<br />
zu einer geringeren Nachfrage nach diesem Faktor, <strong>als</strong> ohne eine solche Steuer. Dadurch ist<br />
das Unternehmen dann weniger produktiv, weil nicht so viele Maschinen oder billigere und<br />
damit leistungsschwächere zum Einsatz kommen. Das Unternehmen produziert demnach weniger<br />
Güter oder qualitativ schlechtere und erwirtschaftet nicht so viel Umsatz und Gewinn, so<br />
dass es bei niedrigerer Produktivität schließlich auch den Arbeitern nur geringere Löhne wird<br />
auszahlen können. So ungefähr legte er mir den Sachverhalt auseinander.<br />
Völlige Stille im Publikum. Oskar L. blickt kurz verlegen um sich. Die Blicke fallen nun auf ihn.<br />
Da fällt ihm plötzlich wieder das Beispiel mit den USA ein:<br />
Oskar L.: Das klingt ja alles sehr schön, aber das Beispiel USA widerspricht dem doch ganz<br />
offensichtlich!<br />
Rentner R.: Eben nicht.<br />
Oskar L.: Ja, aber warum denn nicht?<br />
Rentner R.: Die USA erwirtschaften nicht wegen, sondern trotz der Vermögenssteuer so viel.<br />
Oskar L.: Was soll denn das nun wieder bedeuten? In den USA wird die Vermögenssteuer erhoben<br />
aber nicht in Deutschland! Und dort ist das Wirtschaftswachstum größer <strong>als</strong> bei uns.<br />
Rentner R.: Das mag wohl so sein. Dennoch widerlegt dies nicht die vorher aufgeführte Argumentation<br />
gegen eine Vermögenssteuer, weil sie nicht allein das Wirtschaftsgeschehen bestimmt.<br />
Oskar L.: Natürlich nicht.<br />
Rentner R.: Da ich meinem Gesprächspartner ähnlich entgegnete wie Sie mir Herr L., versuchte<br />
er mir seinen Gedankengang mit Hilfe eines einfachen Beispiels zu verdeutlichen:<br />
Churchill soll einmal in schon weit fortgeschrittenem Alter einem Journalisten, der ihn danach<br />
fragte, was er denn seinen Lesern empfehlen könne, damit sie ebenfalls so alt würden wie er,<br />
geantwortet haben: Zigarren rauchen, Whiskey trinken und keinen Sport treiben.<br />
Oskar L.: Dieses Zitat kenne ich. Aber was soll das in diesem Zusammenhang bedeuten?<br />
Rentner R.: Es ist sowohl eine Tatsache, dass Churchill relativ alt geworden ist, <strong>als</strong> auch dass er<br />
Zigarren rauchte, viel Whisky trank und wenig Sport trieb. Aber würden wir deshalb behaupten,<br />
dass dies für die Gesundheit förderlich sei?
Oskar L.: Keineswegs natürlich!<br />
Rentner R.: Genau so verhält es sich mit dem Beispiel der USA und der Vermögenssteuer.<br />
Oskar L.: Wie das denn?<br />
Rentner R.: Es gibt anscheinend viele ökonomische Rahmenbedingungen, die in den USA besser<br />
<strong>als</strong> in Deutschland sind, sonst hätten sie schließlich kein höheres Wachstum im Vergleich zu uns.<br />
Die wirtschaftlich nicht sehr förderliche Vermögenssteuer fällt daher bei diesem Vergleich nicht<br />
so sehr ins Gewicht. Würde sie allerdings in den USA ebenfalls nicht erhoben, so wäre das Wirtschaftswachstum<br />
noch höher, <strong>als</strong> es jetzt schon ohnehin ist. Wenn wir nun wieder auf das Beispiel<br />
mit Churchill zurückkommen, können wir ebenfalls mit gutem Recht wohl sagen, dass er<br />
nicht wegen, sondern viel mehr trotz seiner zum Teil sehr ungesunden Lebensweise so alt geworden<br />
ist, weil er von Natur aus eben sehr gesund war. Er hätte bei einem gesünderen Lebenswandel<br />
wohl durchaus noch älter werden können. Ungefähr in der Weise argumentierte mein<br />
Gesprächspartner.<br />
Völlige Stille im Publikum. Oskar L. ist sichtlich genervt, will aber nicht so schnell kleinbeigeben<br />
und macht einen neuen Vorschlag zur Vermögenssteuer:<br />
Oskar L.: Nun gut. Das mag ja alles so sein, wie Sie sagen. Dann nehmen wir eben die Unternehmen<br />
von der Vermögenssteuer aus und wenden Sie nur auf Privatvermögen an.<br />
Rentner R.: Das schien mir ebenfalls eine gute Idee zu sein, und ich führte dieses Argument in<br />
unser Gespräch ein.<br />
Oskar L.: Und was erwiderte er darauf? Da fiel ihm in wirtschaftlicher Hinsicht wohl nicht mehr<br />
viel ein, nicht wahr?<br />
Rentner R.: Das dachte ich auch. Aber dann behauptete er, dass auch durch eine derartige Vermögenssteuer<br />
die Produktivität der Unternehmen beeinträchtigt werden würde.<br />
Oskar L.: Aber das ist doch offensichtlicher Unfug!<br />
Rentner R.: Warten Sie es ab. Wenn auf hohe Privatvermögen eine Vermögenssteuer erhoben<br />
wird, wirkt sich das doch auf das Sparverhalten derjenigen aus, die davon betroffen sind, oder<br />
etwa nicht?<br />
Oskar L.: Vielleicht.<br />
Rentner R.: Es wird auf jeden Fall weniger lukrativ für sie, in Deutschland ihr Geld anzulegen,<br />
da sie ja durch eine solche Steuer eine zusätzliche Belastung erführen.<br />
Oskar L.: Von mir aus.<br />
Rentner R.: Wenn ein vermögender Privatmann nun überlegt, ob er sich Aktien einer deutschen<br />
Gesellschaft zulegen oder besser im Ausland sein Geld anlegen soll, so spielt die Vermögenssteuer<br />
sicherlich auch eine Rolle, nicht wahr?<br />
Oskar L.: Meinetwegen.
Rentner R.: Wenn nun viele vermögende Privatanleger so denken und daher weniger oder sogar<br />
gar kein Geld mehr in Deutschland anlegen, dann wird es für die Unternehmen schwieriger und<br />
damit teurer, an Kapital zu kommen. Das beschränkt sich keinesfalls nur auf Aktien, die sie über<br />
die Börse verkaufen, sondern beispielsweise auch auf Kredite von Banken, die sie für Investitionen<br />
benötigen, um neue Maschinen zu kaufen und ihre Produktivität zu steigern. Denn die<br />
Banken können schließlich nur das Geld verleihen, welches zuvor von anderen gespart, d.h. bei<br />
ihnen gegen Zins hinterlegt worden ist. Wenn es für die Sparer weniger lukrativ ist zu sparen,<br />
werden sie dies auch weniger tun, wodurch dann der Preis für geliehenes Geld steigt. Somit<br />
erhöhen sich Kreditzinsen, und Investitionen in neue Maschinen werden dadurch für die Unternehmen<br />
entsprechend teurer. Es wird weniger investiert, die Produktivität und damit die Löhne<br />
sind niedriger, <strong>als</strong> sie ohne die Vermögenssteuer wären. Nachdem mein Gesprächspartner alles<br />
dies angeführt hatte, war ich gezwungen, ihm voll und ganz zuzustimmen, obwohl mir nicht<br />
wohl dabei war. Deshalb hoffte ich, dass Sie, Herr L., mir helfen könnten. Aber wie ich sehe,<br />
wissen auch Sie nichts rechtes zu entgegnen, oder fällt Ihnen vielleicht doch noch etwas ein?<br />
Wiederum völlige Stille und Nachdenklichkeit im Publikum. Oskar L. ringt sichtlich um<br />
Fassung und weiß im Moment nichts Sinnvolles zu sagen. Rentner R. tut Herr L., den er bis<br />
jetzt so bewundert hatte, ein wenig leid. Dennoch beschleichen ihn nagende Zweifel, ob Herr<br />
L. nicht auch bei vielen anderen seiner Thesen f<strong>als</strong>ch liegen könnte und letztlich nur jenen<br />
schadet, denen er doch eigentlich zu helfen vorgibt.<br />
An diesem Beispiel können wir nun sehr gut nachvollziehen, wie leicht sich ein solch populärer<br />
Irrtum widerlegen lässt, wenn man einmal genauer nachdenkt. Zusammenfassend soll<br />
noch einmal kurz festgehalten werden, was gegen eine Vermögenssteuer spricht:<br />
1. Sie ist ungerecht, weil sie den Sparer mehrfach besteuert und er auch noch im Alter<br />
oder bei einer Krankheit von seinem angesparten Vermögen alle Kosten dafür selbst<br />
tragen muss, wohingegen der Lebemann im Vergleich mit ihm weniger Steuern<br />
gezahlt hat und obendrein noch vom Staat im Alter oder bei Krankheit eine höhere<br />
Unterstützung <strong>als</strong> der Sparer erfährt.<br />
2. Sie ist wirtschaftlich unsinnig, weil sie den Produktionsfaktor Kapital verteuert und<br />
dadurch eine Volkswirtschaft über weniger leistungsfähige Maschinen und sonstige<br />
Produktionsgüter verfügt <strong>als</strong> ohne diese Steuer. Infolge der geringeren Produktivität<br />
der Unternehmen können auch die dort beschäftigten Arbeitnehmer nicht so gut bezahlt<br />
werden, weil sie ja auch mit weniger leistungsfähigen Arbeitsgeräten nicht so<br />
produktiv sein können. Somit trifft eine Vermögenssteuer auch die normalen Arbeitnehmer,<br />
weil sie weniger verdienen <strong>als</strong> ohne eine derartige Steuer, obwohl sie diese<br />
gar nicht direkt an den Staat abführen.
5.9.2. Irrtum 2:<br />
Eine gerechte Entlohnung muss sich nach der Schwere der Arbeit richten<br />
Wer hart arbeitet – ob nun körperlich oder geistig – soll demnach auch dafür gut bezahlt werden.<br />
Diese These entspricht dem Gerechtigkeitsempfinden vieler Menschen, da derjenige, der<br />
schwer schuftet, auch seinen gerechten Lohn erhalten soll. Aber kann dies wirklich einen<br />
brauchbaren Maßstab für die Höhe der Entlohnung abgeben? Schauen wir uns hierzu einmal<br />
ein paar Beispiele etwas genauer an:<br />
Beispiel 1:<br />
Angenommen ein Vermieter würde die Mietwohnung seines Mieters zwar mit sehr viel Mühe<br />
renovieren, aber, da er kein gelernter Handwerker ist, gelingt ihm das nicht so gut. Infolgedessen<br />
ist die Wohnung zugig, an einigen Stellen feucht und die Tapeten lösen sich teilweise<br />
von den Wänden. Wäre der Mieter bereit, für die Mühe des Vermieters viel Geld zu zahlen?<br />
Natürlich nicht!<br />
Beispiel 2:<br />
Deutsche Arbeiter stellen mit sehr viel Mühe Sportschuhe her. Das gleiche tun ihre chinesischen<br />
Kollegen ebenfalls und zwar in der gleichen Qualität – allerdings wesentlich billiger.<br />
Welche Schuhe würden wohl die deutschen Konsumenten kaufen: Die teuren deutschen oder<br />
die gleich guten, aber viel billigeren aus China? In der Regel wohl letztere.<br />
Beispiel 3:<br />
Ein Maler malt mit großer Mühe und viel Zeitaufwand seine Bilder. Dann stellt er sie in der<br />
Fußgängerzone aus, um sie zu verkaufen. Wir kommen zufällig dort vorbei, schauen sie uns<br />
genauer an, aber sie gefallen uns nicht. Daher sehen wir von einem Kauf ab. Daraufhin beschimpft<br />
uns der Maler, weil wir seine mit so viel Mühe gemalten Bilder verschmähen und<br />
fragt uns vorwurfsvoll, wovon er denn leben solle, wenn wir nicht seine Bilder kauften? Ein<br />
solches Verhalten empfänden wir mit Fug und Recht <strong>als</strong> befremdlich und unangemessen.<br />
Beispiel 4:<br />
Ein Konditormeister backt eine schmackhafte Torte und verkauft sie stückweise an seinem<br />
Stand beim Stadtfest. Auch wir haben schon zwei große Stücke gegessen, weil sie uns so gut<br />
mundeten. Es ist aber noch einiges von der Torte übrig geblieben. Doch ein weiteres Stück<br />
können wir nun wirklich nicht mehr essen, weil wir satt sind. Dann wird der Konditor böse<br />
auf uns, weil er nicht alle seine schönen Tortenstücke hat verkaufen können, so dass er nicht<br />
den erhofften Erlös erzielt. Würden wir dennoch, nur um die Mühe des Meisters zu belohnen,<br />
ein weiteres Stück Torte herunterwürgen? Wohl kaum.<br />
Obgleich dies vier verschiedene Phantasiebeispiele sind, haben sie jedoch etwas gemeinsam,<br />
womit sich der oben aufgeführte Irrtum leicht erklären lässt: Bei unseren Kaufentscheidungen<br />
wägen wir den Nutzen, den uns ein bestimmtes Gut zu einer bestimmten Zeit bietet mit dem<br />
dafür geforderten Preis ab. Danach entscheiden wir, ob wir es kaufen oder nicht. Die Mühe,<br />
die der Hersteller darauf verwandte, interessiert uns nicht, sondern nur das Preis-Leistungsverhältnis!<br />
Ob jemand für die Befriedigung eines unserer Bedürfnisse hart schuften musste<br />
oder es ihm leicht fiel, ist uns <strong>als</strong>o in aller Regel ziemlich gleichgültig. Unsere Bedürfnisse<br />
ändern sich zudem ständig, so beispielsweise wenn wir satt sind, möchten wir nichts mehr<br />
von der vorher so sehr geliebten Torte essen. Ob jemand ein bestimmtes Produkt, eine<br />
Dienstleistung oder seine Arbeitskraft am Markt verkaufen kann, hängt letztlich ausschließlich<br />
davon ab, ob es dafür auch Abnehmer gibt, die aufgrund ihrer eigenen Nutzeneinschät-
zungen bereit sind, den geforderten Preis dafür zu entrichten. Ansonsten findet das eigene<br />
Angebot eben keinen Abnehmer. Denn warum sollte jemand etwas kaufen, das er entweder<br />
überhaupt gar nicht braucht oder es ihm zu teuer erscheint oder er ein aus seiner Sicht<br />
qualitativ gleichwertiges, aber billigeres Produkt bei einem anderen Anbieter erstehen kann?<br />
Genau dieser Sachverhalt ist für die Höhe der Entlohnung einer Arbeitskraft entscheidend und<br />
nicht die Schwere der Arbeit. Und das ist auch gut so, weil andernfalls nicht die Güter am<br />
Markt zu finden wären, welche die Kunden haben wollen, sondern alles mögliche, das aber<br />
dann keine Abnehmer finden würde. Eine Wirtschaft, in der es so zuginge, bräche sehr schnell<br />
in sich zusammen.<br />
Wem das alles zu hart klingen mag, der werfe nochm<strong>als</strong> einen Blick auf die genannten Beispiele<br />
und reflektiere anschließend sein eigenes Kaufverhalten. Denn dies ist mitverantwortlich<br />
für die Höhe der Entlohnung von Arbeitnehmern, da Arbeitgeber ihre Mitarbeiter nur in<br />
der Höhe entlohnen können, inwieweit ihre Produkte am Markt Abnehmer finden. Für die<br />
Kunden zählen dabei letztlich fast ausschließlich Preis und Qualität der angebotenen Waren<br />
und nicht die Mühe, die zuvor auf ihre Herstellung verwandt worden ist. Das ist die Sicht der<br />
Nachfrager von Waren, die der Anbieter, will er erfolgreich am Marktgeschehen teilnehmen,<br />
stets im Blick haben muss. Denn nur dann zahlt sich die eigene Anstrengung letztlich auch<br />
aus. Für den Anbieter spielt natürlich die Mühe, die er auf die Herstellung eines Gutes verwendet,<br />
eine große Rolle und er muss sich somit immer darüber Rechenschaft ablegen, ob<br />
sich seine Arbeit lohnen wird. Schließlich verdient er dadurch seinen Lebensunterhalt. Nur<br />
am Markt wird nicht seine Mühe, sondern das Ergebnis seiner Mühe entsprechend von<br />
Angebot und Nachfrage entlohnt.
5.9.3. Irrtum 3:<br />
In Deutschland findet eine Umverteilung von unten nach oben statt<br />
Eine immer wieder zu hörende Behauptung. Unter Umverteilung versteht man in diesem<br />
Zusammenhang gemeinhin die staatlich erzwungene durch Steuern und Sozialabgaben, aber<br />
nicht die freiwillige durch Spenden oder ähnliches. Letztere macht darüber hinaus auch nur<br />
einen winzigen Bruchteil im Vergleich zur ersteren aus.<br />
Werfen wir zunächst einfach einmal unseren Blick auf folgendes Schaubild zur Einkommenssteuer<br />
aus dem Jahre 2001, basierend auf Daten des Statistischen Bundesamtes:<br />
Schaubild:
Man kann sofort erkennen, dass gerade die Besserverdienenden einen ganz erheblichen Teil<br />
der Einkommenssteuerlast tragen und die unteren Einkommensschichten so gut wie gar nichts<br />
zur Einkommenssteuer beitragen. Schauen wir uns die Zahlen etwas genauer an:<br />
Die drei obersten Einkommensschichten stellen lediglich 1,7% der Gesamtbevölkerung aber<br />
zahlen 28,4% der gesamten Einkommenssteuer und die Höchstverdienenden unter diesen –<br />
<strong>als</strong>o diejenigen, die mehr <strong>als</strong> 500.000,-- € im Jahr verdienen – 11,2%, obwohl sie nur 0,1%<br />
der Gesamtbevölkerung ausmachen, d.h. ein Tausendstel aller Steuerzahler trägt mehr <strong>als</strong> ein<br />
Zehntel der Steuerlast und damit gut hundert Mal mehr, <strong>als</strong> es ihrem Bevölkerungsanteil entspricht.<br />
Mit anderen Worten: Diese Personengruppe mit den höchsten Einkommen zahlt über<br />
hundert Mal mehr <strong>als</strong> den Durchschnittswert, bezogen auf die Gesamtbevölkerung! Wenn das<br />
keine Umverteilung von oben nach unten ist?!<br />
Die unteren drei Einkommensschichten hingegen tragen nicht einmal 6% (5,8%) der hier betrachteten<br />
Steuer, obgleich sie fast die Hälfte der Steuerzahler ausmachen (48,5%). Somit<br />
zahlt die untere Hälfte der Einkommensbezieher so gut wie gar nichts in diesen Steuertopf<br />
ein! Auch für das Jahr 2006 können wir den Daten des Bundesfinanzministeriums ein nahezu<br />
identisches Bild hinsichtlich der Steuerzahlungen, gestaffelt nach Einkommensschichten, entnehmen:<br />
Die obere Hälfte zahlt 93,7% der Einkommenssteuern während die untere demnach<br />
lediglich 6,3% beiträgt; die oberen 15% der Einkommensbezieher leisten, wie schon 2001, ca.<br />
66% der gesamten Einkommenssteuerzahlungen. Von sozialer Schieflage in unserem Steuersystem<br />
zuungunsten der Geringverdiener oder der mangelnden solidarischen Leistung der<br />
Besserverdiener kann beim besten Willen nicht die Rede sein. Die Zahlen sprechen eine allzu<br />
deutliche Sprache.<br />
Die Einkommenssteuer macht ungefähr die Hälfte der Steuereinnahmen aus. Die andere<br />
Hälfte kommt aus den indirekten Steuern, wie der Mehrwertsteuer. Aber auch hier ist der<br />
Anteil der Gutverdiener wesentlich höher, weil sie mehr konsumieren. So kostet eine Oberklasselimousine<br />
ein Vielfaches eines Kleinwagens, wodurch natürlich auch eine entsprechend<br />
höhere Mehrwertsteuer fällig wird, die der Käufer einer solchen Luxuskarosse berappen muss.<br />
Der Staat verdient an seinem Luxus tüchtig mit!<br />
Die Tatsache, dass Gutverdienende so viel Steuern zahlen, liegt an unserem progressiv ausgestalteten<br />
Steuertarif, so dass der Steuersatz mit zunehmendem Einkommen steigt. An einem<br />
fiktiven Beispiel soll das Wirkprinzip eines solchen Tarifes mit einem steuerfreien Grundbetrag<br />
von 10.000,-- € verdeutlicht werden:<br />
Arbeitnehmer A verdient 30.000,-- € pro Jahr und hat einen durchschnittlichen Steuersatz von<br />
20% auf sein Einkommen, das über dem Freibetrag von 10.000,-- € liegt, so dass er 20.000,--<br />
€ mit diesem Satz zu versteuern hat. Folglich beträgt seine Steuerlast 4.000,-- €.<br />
Arbeitnehmer B hingegen erzielt ein Einkommen in Höhe von 100.000,-- € und hat somit<br />
einen deutlich höheren durchschnittlichen Steuersatz von 40%. Auch bei ihm ziehen wir den<br />
steuerfreien Grundbetrag von 10.000,-- € ab, so dass er 90.000,-- € mit 40% versteuern muss.<br />
Er hat dann 36.000,-- € an den Staat abzuführen und zahlt damit neunmal so viel wie Arbeitnehmer<br />
A, obwohl er nur gut dreimal so viel verdient!<br />
Wir können <strong>als</strong>o gerade am Beispiel unseres Steuersystems erkennen, dass genau das Gegenteil<br />
des obigen Irrtums stimmt: Anstatt einer Verteilung von unten nach oben haben wir tatsächlich<br />
eine von oben nach unten.
In diesem Zusammenhang soll eine Parabel zitiert werden, die im vom Bund der Steuerzahler<br />
herausgegebenen Monatszeitschrift ‚Der Steuerzahler’ in der Märzausgabe 2005 auf Seite 45<br />
abgedruckt worden ist. Der Bund der Steuerzahler weist darauf hin, dass diese Parabel im<br />
Internet ohne Angabe eines Autors zu finden war und diese – wie dort vorgefunden – veröffentlicht,<br />
um sie einem größeren Leserkreis zu präsentieren:<br />
So funktioniert unser Steuersystem – Eine Parabel<br />
Es waren einmal zehn Männer, die jeden Tag miteinander zum Essen gingen. Die Rechnung<br />
betrug zusammen jeden Tag genau 100 Euro. Die Gäste zahlten ihre Rechnung wie wir<br />
unsere Steuern: Die ärmsten vier Gäste zahlten nichts. Der Fünfte zahlte einen Euro. Der<br />
Sechste 3 Euro. Der Siebte 7 Euro. Der Achte 12 Euro. Der Neunte 18 Euro. Der Zehnte, der<br />
am meisten Geld hatte, zahlte 59 Euro.<br />
Das ging eine ganze Zeitlang gut. Jeden Tag kamen sie zum Essen und alle waren zufrieden,<br />
bis der Wirt Unruhe in das Arrangement brachte, indem er den Preis für das Essen um 20<br />
Euro reduzierte. Jetzt kostete das Essen für die zehn nur noch 80 Euro, aber die Gruppe<br />
wollte unbedingt beibehalten so zu bezahlen wie bisher. Dabei änderte sich für die ersten vier<br />
nichts. Sie aßen weiterhin kostenlos. Wie sah es aber mit den restlichen sechs aus? Wie<br />
konnten sie die 20 Euro Ersparnis so aufteilen, daß jeder etwas davon hatte? Die sechs<br />
stellten schnell fest, daß 20 Euro geteilt durch sechs 3,33 Euro ergibt. Aber wenn sie das von<br />
den einzelnen Teilen abziehen würden, bekämen der fünfte und sechste noch Geld dafür, daß<br />
sie zum Essen gehen.<br />
Also schlug der Wirt den Gästen vor, daß jeder ungefähr prozentual so viel weniger zahlen<br />
sollte, wie er insgesamt beisteuerte. Er begann für seine Gäste auszurechnen. Heraus kam<br />
folgendes: Der fünfte Gast, ebenso die ersten vier, zahlte ab sofort nichts mehr (100%<br />
Ersparnis). Der Sechste zahlte 2 Euro statt 3 Euro (33% Ersparnis). Der Siebte zahlte 5 statt<br />
7 Euro (28% Ersparnis). Der Achte zahlte 9 statt 12 Euro (25% Ersparnis). Der Neunte<br />
zahlte 14 statt 18 Euro (22% Ersparnis). Und der Zehnte (der Reichste) zahlte 49 statt 59<br />
Euro (16% Ersparnis).<br />
Jeder der sechs kam günstiger weg <strong>als</strong> vorher und die ersten vier aßen immer noch kostenlos.<br />
Aber <strong>als</strong> sie noch mal nachrechneten, war alles doch nicht so ideal wie sie dachten. „Ich hab’<br />
nur einen Euro von den 20 bekommen!“ sagte der sechste Gast und zeigte auf den zehnten<br />
Gast, den Reichen: „Aber er kriegt 10 Euro!“ „Stimmt!“ rief der Fünfte. „Ich hab’ nur einen<br />
Euro gespart und er spart sich zehnmal so viel wie ich.“ „Wie wahr!“ rief der Siebte.<br />
„Warum kriegt er 10 Euro zurück und ich nur 2? Alles kriegen mal wieder die Reichen!“<br />
„Moment mal,“ riefen da die ersten vier aus einem Munde. „Wir haben überhaupt nichts<br />
bekommen. Das System beutet die Ärmsten aus!“<br />
Und wie aus heiterem Himmel gingen die neun gemeinsam auf den Zehnten los und verprügelten<br />
ihn. Am nächsten Tag tauchte der zehnte Gast nicht mehr zum Essen auf. Also setzten<br />
die übrigen neun sich zusammen und aßen ohne ihn. Aber <strong>als</strong> sie die Rechnung bezahlen<br />
wollten, stellten sie fest, daß alle zusammen nicht genügend Geld hatten, um auch nur die<br />
Hälfte der Rechnung bezahlen zu können!<br />
Und so funktioniert unser Steuersystem: Die Menschen, die die höchsten Steuern zahlen,<br />
haben die größten Vorteile bei einer Steuererleichterung. Wenn sie aber zu viel zahlen<br />
müssen, kann es passieren, daß sie einfach nicht mehr am Tisch erscheinen. In der Schweiz<br />
und der Karibik gibt es auch ganz tolle Restaurants.
5.9.4. Irrtum 4:<br />
Die Aufgabe von Unternehmen ist es, Arbeitsplätze zu schaffen<br />
So oder so ähnlich schallt es einem immer wieder in Talkshows wie wohlfeilen Sonntagsreden<br />
entgegen. Doch deswegen muss es noch längst nicht stimmen.<br />
Was ist die eigentliche Aufgabe von Unternehmen? Die Bereitstellung von Gütern, die von<br />
den Menschen nachgefragt werden. Die Produkte der Firmen müssen die Kunden hinsichtlich<br />
ihrer Qualität sowie ihres Preises überzeugen, damit sie gekauft werden. Insbesondere um die<br />
Preise nicht in die Höhe schnellen zu lassen, darf es der Unternehmer nicht versäumen, möglichst<br />
kostensparend zu produzieren, da ansonsten seine Waren zu teuer werden würden und<br />
kaum Abnehmer fänden. Wenn er aber nur wenig verkauft, kann er auch seine Arbeiter nicht<br />
mehr entlohnen und muss sie schließlich entlassen. Um <strong>als</strong>o die Produktionskosten niedrig zu<br />
halten und trotzdem eine akzeptable Qualität zu erreichen, ist es erforderlich, sehr rationell zu<br />
produzieren, d.h. beispielsweise mit modernen Maschinen aber möglichst wenig (!) Arbeitnehmern<br />
möglichst viele Waren herzustellen, damit sie für möglichst viele Kunden auch erschwinglich<br />
sind. Denn erst dann werden sie auch gekauft werden. Mit dem Verkaufserlös<br />
kann der Unternehmer seine Mitarbeiter bezahlen oder sogar – wenn die Geschäfte gut laufen<br />
– seine Produktion ausweiten und unter Umständen noch weitere Leute einstellen.<br />
Zunächst einmal besteht <strong>als</strong>o die Aufgabe der Unternehmen darin, die Bevölkerung preisgünstig<br />
mit den benötigten Gütern zu versorgen. Um dies zu gewährleisten, muss der Unternehmer<br />
bestrebt sein, eben nicht vordringlich viele Arbeitsplätze zu schaffen, sondern – ganz<br />
im Gegenteil dazu – überlegen, wie er die gleiche Anzahl von Produkten in gleicher Qualität<br />
mit weniger Mitarbeitern herzustellen vermag. Da auch seine Konkurrenten so denken, entsteht<br />
Wettbewerb. Dies hat für die Kunden und damit für die ganze Gesellschaft den Vorteil,<br />
dass mehr Waren zu günstigeren Preisen angeboten werden und dadurch schließlich der<br />
Wohlstand für alle zunimmt.<br />
Man muss sich nur einmal vor Augen führen, was geschähe, wenn das Gegenteil der Fall<br />
wäre: Die Unternehmer würden dazu verpflichtet, keine Mitarbeiter mehr zu entlassen und<br />
jährlich sogar noch immer neue einzustellen und zwar unabhängig von den Verkaufserlösen:<br />
Entweder stünden viele nur nutzlos herum oder aber die modernen Maschinen würden durch<br />
Arbeiter ersetzt, so dass für die Herstellung der gleichen Anzahl von Gütern mehr Menschen<br />
benötigt werden würden. Bezogen auf die gesamte Wirtschaft eines Landes hätte das dramatische<br />
Folgen: Immer mehr Menschen würden immer weniger produzieren. Es gäbe viel<br />
weniger Güter für alle und Mangel oder gar Hunger wären an der Tagesordnung. Wenn man<br />
diesen Weg konsequent zu Ende ginge, landete man wieder in der Steinzeit! Ohne technischen<br />
Fortschritt ist eine derartig gute Versorgung mit Gütern, wie gegenwärtig bei uns in<br />
Deutschland, überhaupt gar nicht denkbar. Denn jener Fortschritt ist Ausdruck einer steigenden<br />
Arbeitsproduktivität, durch welche pro Kopf ständig mehr bzw. bessere Güter hergestellt<br />
werden. Erst infolgedessen kann dann auch mehr verteilt werden. Schließlich müssen alle für<br />
den Konsum zur Verfügung stehenden Waren zunächst einmal hergestellt werden. Und wenn<br />
die Menschen in einem Land eben weniger produzieren, dann nimmt in dem Maße zwingend<br />
auch der materielle Wohlstand bezogen auf die gesamte Gemeinschaft ab.<br />
Unternehmen tun <strong>als</strong>o auch im Interesse der gesamten Gesellschaft gut daran, nur so viele<br />
Arbeitsplätze zu schaffen, wie sie gerade benötigen, um die Kundenwünsche zu erfüllen und<br />
keineswegs mehr, weil ansonsten ihre Produkte zu teuer wären. Neue Arbeitsplätze entstehen<br />
am Markt ausschließlich in dem Maße, wie sich Käufer für die Waren der Firmen finden. Und<br />
die Kunden sind bekanntlich sehr wählerisch – insbesondere hinsichtlich des Preises! Daher<br />
muss der kluge Chef immer darauf achten, dass er seine Kosten im Griff hat und das heißt
nichts anderes, <strong>als</strong> dass er immer daran denken muss, wie er seine Produktion noch rationeller<br />
gestalten, <strong>als</strong>o mit weniger Mitarbeitern die gleiche Menge herstellen kann. Nur wenn aufgrund<br />
seiner vorausschauenden Unternehmensführung die Geschäfte entsprechend gut laufen,<br />
kann er <strong>als</strong> Folge davon dann sogar noch zusätzliche Arbeitsplätze schaffen, weil er eben viel<br />
mehr <strong>als</strong> zuvor am Markt absetzt. Neue Arbeitsplätze sind <strong>als</strong>o immer erst das Resultat,<br />
niem<strong>als</strong> aber das Ziel einer durchdachten Geschäftspolitik!
5.9.5. Irrtum 5:<br />
Globalisierung schadet unserer deutschen Wirtschaft, vernichtet Arbeitsplätze und ist<br />
mehr eine Bedrohung <strong>als</strong> ein Gewinn für die meisten von uns<br />
Häufig hört man in den Nachrichten, dass wieder einmal ein Betrieb seine Werkstore in<br />
Deutschland schließt und gleichzeitig eine neue Fabrik irgendwo im Osten eröffnet – sei es in<br />
Polen oder Rumänien oder ganz weit weg in Indien oder China. Der Unternehmer begründet<br />
dies mit den dort deutlich günstigeren Produktionskosten aufgrund der viel geringeren Löhne.<br />
Die deutschen Arbeitskräfte haben dann eben das Nachsehen und sind ihre Job los. Gegen<br />
diese Billigkonkurrenz haben sie keine Chance. Damit scheint für viele festzustehen, dass wir<br />
die Verlierer der Globalisierung sind. Es gibt daher nicht wenige, die sich eine stärkere Abschottung<br />
gegen die zunehmende internationale Konkurrenz wünschen. Dies mag auf den<br />
ersten Blick verständlich erscheinen, aber schauen wir nun genauer hin.<br />
Angenommen Deutschland würde sich vom Welthandel abkoppeln, um, nur noch auf sich<br />
allein gestellt, alles selber herzustellen, was hier gebraucht wird, ohne ausländische Billigkonkurrenz<br />
fürchten zu müssen. Es könnte gar nicht gelingen, weil uns zunächst Rohstoffe wie<br />
beispielsweise Öl fehlten. Alle Räder stünden still. Aber auch viele andere schöne Dinge des<br />
Alltags würden wir vermissen, so z. B. leckere Südfrüchte wie Bananen, die in unseren<br />
Breiten nicht wachsen. Wir können <strong>als</strong>o schnell erkennen, dass es so einfach nicht geht. Wir<br />
sind existenziell auf den internationalen Warenaustausch angewiesen und können uns gar<br />
nicht aus diesem verabschieden. Unsere Wirtschaft und damit unsere Gesellschaft würden<br />
sofort in sich zusammenbrechen.<br />
Infolge dieser Überlegungen mag einige das ungute Gefühl beschleichen, dass wir zwar auf<br />
den Welthandel angewiesen seien, aber dennoch geradezu schicksalhaft <strong>als</strong> Verlierer dastünden,<br />
ausgeliefert den anonymen Mächten der Globalisierung. Die Wirklichkeit ist dennoch<br />
eine ganz andere. Um zu verstehen, was Globalisierung eigentlich bedeutet und welche Vorteile<br />
sie für alle an ihr Beteiligten bietet, müssen wir die Funktionsweise der internationalen<br />
Arbeitsteilung etwas genauer betrachten.<br />
Beginnen wir mit einem Klassiker der Freihandelslehre: Adam Smith (1723 – 1790). Er trat<br />
dafür ein, alle Zölle oder sonstigen Einfuhrbeschränkungen, die den internationalen Handel<br />
behinderten, abzuschaffen und einen freien Handel zwischen den Nationen zuzulassen. Denn<br />
durch die dann stärker stattfindende internationale Arbeitsteilung profitieren alle, weil sich<br />
jedes Land auf die Herstellung derjenigen Güter konzentriert, die es besonders kostengünstig<br />
zu produzieren vermag, um sie dann allen anderen Ländern am Markt anzubieten und selber<br />
dort all diejenigen Waren erwirbt, die andere Länder billiger feilbieten, <strong>als</strong> man es selbst<br />
könnte. Diese These der sog. ‚Absoluten Kostenvorteile’ leuchtet eigentlich jedem sofort ein.<br />
Denn auch innerhalb eines Landes stellt schließlich niemand alles, was er braucht, selber her.<br />
An dieser Stelle passt wiederum der Vergleich mit der Steinzeit, wo die Sippe sich ganz allein<br />
versorgen musste. Ohne die Arbeitsteilung wäre unser heutiges Wohlstandsniveau völlig undenkbar!<br />
In diesem Zusammenhang soll nach Adam Smith ein weiterer Anhänger der Freihandelslehre<br />
Erwähnung finden: der französische Ökonom und Satiriker Frédéric Bastiat (1801 – 1850). Er<br />
verfasste die wunderschöne Parabel ‚Die Petition der Kerzenmacher’, welche bissig die Absurdität<br />
einer Ablehnung des freien Handels unter den Nationen aufzeigte:<br />
Die französischen Kerzenmacher verlangten in jener Petition, dass die Fenster zugemauert<br />
sowie alle weiteren Öffnungen, durch die Licht in die Häuser dringen konnte, geschlossen<br />
werden müssten. Dadurch stiege dann der Verbrauch von Kerzen, Öl sowie anderen Brennstoffen.<br />
Infolgedessen entstünden nicht nur bei den Kerzenmachern, sondern auch in weiteren<br />
Branchen Arbeitsplätze, so beispielsweise bei den Produzenten von Öllampen. Die ganze<br />
Volkswirtschaft profitierte durch höhere Löhne und mehr Beschäftigung von der Ab-
schließung aller Öffnungen, durch die das Sonnenlicht bisher habe eindringen können. Die<br />
Kerzenmacher seien zwar selbstverständlich für Wettbewerb, aber dieser müsse fair vonstatten<br />
gehen. Die Konkurrenz der Sonne hingegen sei eine unfaire, weil sie ihre lichtspendenden<br />
und wärmenden Strahlen immerfort zu dem extremen Dumpingpreis von Null anbiete.<br />
Ebenfalls besäßen die englischen Kerzenhersteller ungerechte Vorteile gegenüber ihren französischen<br />
Kollegen, da der Nebel in England ihren Absatz entscheidend fördere. Gegen<br />
solche unfaire Konkurrenz müsse man sich schützen!<br />
Diese Parabel kann auch heute noch <strong>als</strong> Lehrstück für alle Gegner einer internationalen<br />
Arbeitsteilung – heute mit Globalisierung betitelt – dienen.<br />
Damit noch nicht genug. Selbst wenn ein Land im Vergleich mit einem anderen alle Waren<br />
kostengünstiger herstellen könnte <strong>als</strong> jenes, aber bei einigen Produkten der Kostenunterschied<br />
geringer wäre, lohnte sich trotzdem für beide Länder die Arbeitsteilung. Diese Theorie der<br />
sog. ‚Komparativen Kostenvorteile’ entwickelte David Ricardo (1772 – 1832). Verdeutlichen<br />
wir uns seine These durch ein einfaches Beispiel:<br />
Angenommen Indien wie Deutschland produzieren Stahl und Farbe. Deutschland brauchte sowohl<br />
zur Herstellung von einer Tonne Stahl <strong>als</strong> auch für 15 Liter Farbe je 10 Arbeitsstunden,<br />
wohingegen Indien für eine Tonne Stahl 30 und für 15 Liter Farbe 20 Arbeitsstunden benötigte.<br />
Obwohl nach diesem Beispiel Deutschland beide Produkte bezogen auf die Arbeitszeit<br />
günstiger produzieren könnte, wäre es besser, sich auf die Herstellung von Stahl zu spezialisieren<br />
und die Farbe aus Indien zu beziehen, allein aufgrund der relativen bzw. komparativen<br />
Kostenvorteile. Dies kann man sich leicht durch folgende Rechnung klarmachen: Verfügten<br />
beide Länder über 40 Arbeitsstunden, so könnte Deutschland im Autarkiezustand beispielsweise<br />
3 Tonnen Stahl und 15 Liter Farbe produzieren, während es bei Indien lediglich eine<br />
Tonne Stahl und 7,5 Liter Farbe wären. Falls sich Deutschland aber allein auf die Produktion<br />
von Stahl konzentrierte, könnte es 4 Tonnen davon herstellen. Indien hingegen spezialisierte<br />
sich auf Farbe und würde demnach 30 Liter herstellen. Somit betrüge die Gesamtproduktion<br />
beider Länder an Stahl 4 Tonnen und die von Farbe 30 Liter, während im Autarkiezustand für<br />
beide zwar auch 4 Tonnen Stahl aber nur 22,5 Liter Farbe zur Verfügung stünden.<br />
Wir konnten durch die aufgeführten Beispiele eindeutig erkennen, dass der internationale<br />
Handel allen daran beteiligten Ländern zum Vorteil gereicht, wobei noch nicht einmal die<br />
unterschiedlichen Lohnniveaus berücksichtigt worden sind, welche den Nutzen einer internationalen<br />
Arbeitsteilung noch deutlich erhöhen können! Woher kommen dann die Widerstände<br />
gegen eine doch ganz offensichtlich sehr nutzbringende globale Arbeitsteilung? Die<br />
Skepsis oder gar Gegnerschaft vieler Menschen gegen die Globalisierung rührt vor allem<br />
daher, dass es in jedem Land zumeist anfangs auch Verlierer gibt, weil z.B. eine Branche ihre<br />
Produktion aufgrund der internationalen Konkurrenz zurückfahren oder gar gänzlich einstellen<br />
muss. Dies ist für die davon Betroffenen zunächst einmal nicht erfreulich, und sie protestieren<br />
dann vielleicht gegen die zunehmende Globalisierung. Insgesamt gesehen profitiert<br />
das Land trotz solcher Entlassungen aber vom internationalen Handel, wie es oben bereits<br />
bewiesen worden ist. Denn schließlich sinken dadurch die Preise derjenigen Produkte, die im<br />
Ausland billiger hergestellt werden können zum Wohle aller Konsumenten in diesem Land.<br />
Ein Beispiel soll diesen Zusammenhang verdeutlichen:<br />
Angenommen die Produktion von Teekesseln ist in einem Land zu teuer im Vergleich mit der<br />
ausländischen Konkurrenz geworden und wird deshalb eingestellt. Zwar werden dann die dort<br />
bisher beschäftigten Arbeitnehmer entlassen, aber alle Konsumenten sparen so beim Kauf<br />
eines Teekessels z.B. 10,-- €. Dieses Geld, das sie mehr in der Tasche haben, können sie dann<br />
für den Kauf von anderen Waren oder Dienstleistungen ausgeben, indem sie sich beispielsweise<br />
dafür einen zusätzlichen Restaurantbesuch leisten, was dem Wirt von Nutzen sein wird.<br />
Wenden wir uns nun noch einmal Deutschland zu. Wir sind nicht nur allein aufgrund unseres<br />
Mangels an eigenen Rohstoffen wie z.B. Öl auf die Globalisierung angewiesen, sondern profitieren<br />
sogar noch überproportional von ihr! Dies verdeutlicht am besten unser enormer
Exportüberschuss, der uns schon häufig den Titel des Exportweltmeisters einbrachte. Was<br />
bedeutet dies? Wir verkaufen mehr Waren ins Ausland, <strong>als</strong> wir von dort beziehen und verdienen<br />
somit eine ganze Menge Geld, obwohl einige Branchen Arbeitsplätze abbauen<br />
mussten. In der Summe aber fahren wir sehr gut mit dem Welthandel, ansonsten gäbe es diesen<br />
Exportüberschuss schließlich nicht. Darüber hinaus sind viele Waren durch die internationale<br />
Arbeitsteilung viel preisgünstiger für uns <strong>als</strong> ohne eine solche, man denke an Kleidung,<br />
die vielfach ausschließlich im Ausland hergestellt wird oder auch an Autos renommierter<br />
deutscher Hersteller, die viele Teile im Ausland fertigen lassen. Als Konsumenten freut uns<br />
dies, weil wir so mehr von unserem Geld kaufen können. Und dies wiederum kurbelt die<br />
Wirtschaft zum Wohle aller an und zwar nicht nur bei uns in Deutschland, sondern eben auch<br />
in den Ländern, die uns ihre Waren verkaufen.<br />
Gerade arme Staaten sind auf einen möglichst freien Handel angewiesen, um durch den Verkauf<br />
ihrer Produkte an die Reichen mehr zu verdienen und ihren Wohlstand zu heben. Daher<br />
ist es ein Gebot der Gerechtigkeit, den Welthandel auszubauen und Handelsschranken niederzureißen.<br />
Das ist weitaus besser <strong>als</strong> jede noch so gut gemeinte Entwicklungshilfe! Zurzeit<br />
herrscht teilweise eine absurde Situation: Auf der einen Seite geben die Länder der Europäischen<br />
Union Geld an hilfsbedürftige Länder, damit sie sich besser entwickeln können und auf<br />
der anderen schotten wir unsere Märkte gegen ihre Produkte ab, so dass sie ihre Waren hier<br />
nicht verkaufen können. Dem ganzen Irrsinn setzten wir dann noch die Krone auf, indem wir<br />
ihre Märkte beispielsweise mit subventionierten Lebensmitteln überschwemmen und die wirtschaftliche<br />
Existenz der Kleinbauern vernichten, für die zuvor aus Geldern der Entwicklungshilfe<br />
Brunnen gebohrt worden sind. Mit anderen Worten: Zuerst geben wir aus dem reichen<br />
Norden Geld an den ärmeren Süden, damit dort die Bauern höhere Ernteerträge erzielen<br />
können. Dann verhindern wir aber, dass sie ihre Waren bei uns verkaufen und zerstören zudem<br />
gänzlich die Lebensgrundlage der dortigen von uns aus Steuergeldern zuvor geförderten<br />
Landwirte, indem wir ihre Märkte mit ebenfalls aus Steuergeldern subventionierten Lebensmitteln<br />
überschwemmen, so dass die armen Landwirte im Süden ihre Produkte selbst im<br />
eigenen Land nicht mehr verkaufen können. Es wäre für alle ein Riesenfortschritt, wenn der<br />
ganze Irrsinn aufhörte: Wir im Norden könnten einige Waren preisgünstiger kaufen, sparten<br />
viel Geld für überflüssige Subventionen und müssten bald kaum noch Entwicklungshilfe<br />
leisten, weil eben auch die bisher armen Nationen im Süden mehr an uns verkaufen könnten<br />
und ihre Märkte durch unfaire, subventionierte Waren aus dem Norden nicht kaputt gemacht<br />
werden würden.<br />
Eigentlich verhält es sich ganz einfach mit der internationalen Arbeitsteilung: Wenn jedes<br />
Land das macht, was es am besten kann und dann die Früchte seiner Arbeit auf dem freien<br />
Markt anbietet, um sie dort zu verkaufen und seinerseits von den anderen die Güter günstig<br />
einkauft, die es selber nicht herstellt, dann kommt dies allen Beteiligten zugute. Entscheidend<br />
für den Erfolg einer solch international verflochtenen Wirtschaft sind allerdings für alle<br />
offene Märkte ohne Abschottungen oder Diskriminierungen welcher Art auch immer sowie<br />
ohne wettbewerbsverzerzerrende Subventionen oder Umweltdumping. Gerade letzteres<br />
müssen wir und insbesondere unsere Nachfahren teuer bezahlen. Daher kann der Wahlspruch<br />
nur heißen: Es lebe der freie, faire und gleichberechtigte Welthandel, es lebe die Globalisierung!
5.9.6. Reaktionen der im Bundestag vertretenen Parteien, des DGB, des Verbandes der Fami-<br />
lienunternehmer sowie des Bundes der Steuerzahler auf eine Anfrage von Schülerinnen und<br />
Schülern im Rahmen der von mir organisierten Wirtschaftsarbeitgemeinschaften zum Thema<br />
des ersten Irrtums (s.o.) im Jahre 2008:<br />
Hier nun zunächst unser Anschreiben, das an alle oben genannten Fraktionen und<br />
Institutionen abgesandt wurde:<br />
Sehr geehrte Damen und Herren,<br />
wir sind drei Jugendliche, die das kostenlose Angebot an einer Teilname der von der Schülerförderung<br />
Rhein-Main angebotenen Wirtschaftsarbeitsgemeinschaften mit Freude wahrgenommen<br />
haben.<br />
Zunächst möchten wir uns kurz vorstellen:<br />
Wir sind zwei Mädchen mit türkischem Migrationshintergrund, fühlen uns aber in Deutschland<br />
sehr gut integriert und ein deutscher Jugendlicher ohne Migrationshintergrund. Wir<br />
möchten uns für diese Gesellschaft sowohl zum Nutzen für die Allgemeinheit <strong>als</strong> auch für uns<br />
selbst engagieren: Ich bin Schülerin A, 17 Jahre alt, habe die deutsche Staatsbürgerschaft und<br />
besuche die 10. Klasse der ‚Anne Frank Re<strong>als</strong>chule’ in Mainz.<br />
Ich bin Schülerin B, 16 Jahre alt und besuche die 11. Klasse des ‚Carl von Ossietzky Gymnasiums’<br />
in Wiesbaden. Obwohl ich noch nicht die deutsche Staatsbürgerschaft besitze, fühle<br />
ich mich hier in Deutschland zuhause und gut integriert.<br />
Ich bin Schüler C, 17 Jahre alt und besuche die 12 Klasse des humanistischen Gymnasiums<br />
‚Rhabanus Maurus’ in Mainz. Wir drei interessieren uns für Politik und Wirtschaft, weil diese<br />
Bereiche für unser Leben von entscheidender Bedeutung sind. Insbesondere das Thema ‚Wirtschaft’<br />
ist unsere Meinung nach sehr wichtig, weil die Beschäftigung mit diesem eine notwendige<br />
Grundlage zum Verständnis unserer Welt von heute darstellt. Wir sind daher sehr dankbar,<br />
dass Herr <strong>Dr</strong>. <strong>Bottke</strong> <strong>als</strong> Leiter und Inhaber der Schülerförderung Rhein-Main uns dabei<br />
fachlich wie pädagogisch tatkräftig unterstützt.<br />
Ein wichtiger und zugleich interessanter Aspekt im Rahmen der Teilnahme an dieser Arbeitsgemeinschaft<br />
ist die Befragung von Institutionen und Parteien zu bestimmten wirtschaftlichen<br />
Themen. Wir bitten die Angeschriebenen darum, dass sie uns ihre Meinung zu der vorgebrachten<br />
Fragestellung mitteilen und diese natürlich auch möglichst gut begründen, damit wir<br />
danach die verschiedenen Stellungnahmen miteinander vergleichen und in der Gruppe diskutieren<br />
können. So lernt man am besten, einen eigenen Standpunkt, welcher nicht auf Vorurteilen<br />
sondern auf den besten Argumenten gründet, einzunehmen. Häufig wird in der öffentliche<br />
Debatte – und das leider nicht völlig zu unrecht – beklagt, dass sich viele Jugendliche<br />
nicht für solche an sich doch so wichtige Themen interessieren. Wir wollen dem hiermit entgegenwirken<br />
und hoffen dabei auf Ihre Unterstützung. Denn immer nur Klage zu führen, hilft<br />
nicht weiter. Man muss selbst aktiv werden, um etwas zu verändern!<br />
Nun kommen wir zu unserer konkreten Frage:<br />
Was halten Sie von einer Vermögenssteuer? Sind Sie dafür oder dagegen? Bitte begründen<br />
Sie Ihren Standpunkt.<br />
Wir hoffen, dass wir demnächst eine Antwort von Ihnen erhalten. Sie werden auf jeden Fall<br />
über die Stellungnahmen anderer von uns angeschriebener Institutionen bzw. Parteien sowie<br />
schließlich unserer eigenen Einschätzung informiert. Damit muss der Diskussionsprozess aber<br />
keineswegs abgeschlossen sein, da wir Ihnen natürlich immer die Möglichkeit einräumen, zu<br />
den Thesen anderer nochm<strong>als</strong> Stellung zu beziehen. Durch ein solches Vorgehen lernen wir<br />
<strong>als</strong> Schüler nicht nur mehr über das Fach ‚Wirtschaft’, sondern vor allem, wie man sich selbständig<br />
und vernünftig mit unterschiedlichen Sichtweisen sowie Argumentationen auseinandersetzt.<br />
Wir hoffen damit beispielgebend für andere Jugendliche zu sein und werden daher<br />
versuchen, Presse, Radio- sowie Fernsehsender für dieses Projekt zu gewinnen, indem wir sie
itten, darüber zu berichten. Vielleicht können Sie uns dabei ja auch behilflich sein. Nun sind<br />
wir auf Ihre Antwort gespannt.<br />
Mit freundlichen Grüßen<br />
Schülerin A, Schülerin B, Schüler C, <strong>Dr</strong>. Hans-Dieter <strong>Bottke</strong>
Nachfolgend nun die Reaktion des Bundes der Steuerzahler von Sven Ehling:<br />
Sehr geehrter Herr <strong>Dr</strong>. <strong>Bottke</strong>,<br />
nachfolgend finden Sie unsere Antwort auf die Frage über die Vermögensteuer. Ich freue<br />
mich, vom Fortgang zu hören,<br />
mit freundlichen Grüßen<br />
Sven Ehling<br />
Kurzfassung:<br />
Gesicherte Mängel und Nachteile der Vermögensteuer:<br />
In der Diskussion um die Wiedereinführung der Vermögensteuer werden entscheidende Mängel<br />
und Gefahren dieser Steuer ausgeblendet, obwohl sie seit Jahrzehnten bekannt sind und<br />
zum gesicherten Bestand finanzwissenschaftlicher Erkenntnis gehören.<br />
Fehlende Begründung der Vermögensteuer (S. 5 ff.)<br />
Die Vermögensteuer ist mit einer Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit nicht zu be-<br />
gründen. Denn die Aufgabe, den einzelnen nach seiner Leistungsfähigkeit zur Finanzierung<br />
allgemeiner Staatsaufgaben heranzuziehen, wird ja bereits von der Einkommensteuer erledigt,<br />
und zwar in sehr subtiler Weise, wenn auch sicherlich nicht fehlerfrei.<br />
Die Vermögensteuer lässt sich auch mit Konstruktionen einer besonderen Leistungsfähigkeit<br />
nicht rechtfertigen. Weder sind die Vermögenseinkünfte sicherer <strong>als</strong> andere Einkünfte, noch<br />
handelt es sich bei ihnen um mühelose oder etwa arbeitslose Einkünfte. Auch ist nicht einzu-<br />
sehen, dass Vermögensbesitz <strong>als</strong> solcher eine besondere Leistungsfähigkeit mit sich bringt,<br />
und wenn dies so wäre, würde diesem Aspekt bereits durch die Einkommensteuer sowie die<br />
Erbschaft- und Schenkungsteuer Rechnung getragen.<br />
Die Vermögensteuer ist ferner nicht <strong>als</strong> Kontrollsteuer zu begründen. Der Steuersünder, der<br />
mit Wissen und Willen steuerpflichtige Einkünfte in der Einkommensteuer-Erklärung nicht<br />
angibt, wird sich bei der Vermögensteuer dementsprechend verhalten. Ebenso versagt die<br />
Begründung der Vermögensteuer <strong>als</strong> Nachholsteuer. Hätte sie die Aufgabe, Lücken im Einkommensteuergesetz<br />
zu schließen, dürfte sie nicht das gesamte Vermögen erfassen. Auch<br />
erscheint es rationaler, falls Lücken im Einkommensteuergesetz bestehen, diese dort zu<br />
schließen, statt zu diesem Zweck eine neue oder eine zusätzliche Steuer zu erheben.<br />
Ungleichmäßig, kompliziert, verwaltungsaufwändig und ertragsunabhängig (S. 7 f.)<br />
Die Vermögensteuer ermangelt aber nicht nur einer überzeugenden Begründung, sie weist<br />
zudem eine Reihe schwerwiegender Mängel auf. Ursache dafür ist, dass die Vermögensteuer<br />
zwar die Erträge des Vermögens belasten soll, aber gar nicht nach deren Höhe, sondern nach<br />
dem Wert des Vermögens bemessen wird. Daraus resultieren schwer wiegende Bewertungsprobleme<br />
und –schwierigkeiten, die im Verlaufe mehrerer Jahrzehnte und trotz immenser<br />
Anstrengungen nicht wirklich gelöst werden konnten. Die vielfältigen Verbesserungsversuche<br />
haben stattdessen dazu geführt, dass die Vermögensteuer immer komplizierter und verwaltungsaufwändiger<br />
wurde. Im Jahre 1984 beliefen sich die Erhebungskosten bei Verwaltung<br />
und Steuerzahlern zusammen auf 32,3% des Aufkommens. Damit lag die Vermögensteuer bei<br />
den Erhebungskosten mit weitem Abstand an der Spitze aller Steuern.<br />
Aus der Anknüpfung an den Wert des Vermögens resultiert ferner die Ertragsunabhängigkeit<br />
der Vermögensteuer. Sie verursacht nahezu zwangsläufig Ungleichmäßigkeiten der<br />
Belastung zwischen Vermögen mit unterschiedlichen Erträgen. Sie kann zudem in Krisenzeiten<br />
nur allzu leicht zu Substanzeingriffen in Unternehmens- und anderes Vermögen führen,<br />
besitzt eine krisenverschärfende Tendenz und erschwert den Start neuer und die Fortführung<br />
in Umstellung befindlicher Unternehmen. Aber auch in konjunkturellen und geschäftlichen<br />
Normallagen behindert die Vermögensteuer Investitionen und wirkt sich so dämpfend<br />
auf das wirtschaftliche Wachstum und den Umfang der Beschäftigung aus.
Verfehlter Einsatz zum Zwecke der Umverteilung (S. 8 f.)<br />
Der Einsatz der Vermögensteuer zur Umverteilung ist verfehlt. Bei einer Steuerüberwälzung<br />
im Preis, die insbesondere den größeren Unternehmen eher gelingen dürfte, werden kleinere<br />
Unternehmen und Verbraucher belastet. Lässt der Markt die Steuerüberwälzung nicht zu,<br />
wirkt sich die Vermögensteuer <strong>als</strong> zusätzliche, ertragsunabhängige Abgabe nachteilig auf Er-<br />
trag, Investitionen und Bereitstellung von Arbeitsplätzen aus. Letztendlich werden von der<br />
Vermögensteuer <strong>als</strong>o gerade diejenigen belastet, die angeblich von ihrer Umverteilungswirkung<br />
profitieren sollen. Aber auch wegen ihres geringen Aufkommens und der<br />
fehlenden Zweckbindung ist die Vermögensteuer untauglich für eine spürbare Umverteilung<br />
mit steuerlichen Mitteln.<br />
Geringe fiskalische Ergiebigkeit (S. 10)<br />
Die Vermögensteuer besitzt nur eine geringe Ergiebigkeit. Mit einem Anteil von 1 v.H. des<br />
gesamten Steueraufkommens gehörte sie in den neunziger Jahren zu den fiskalisch unbedeutenden<br />
Steuern. Ihre Ergiebigkeit wird weiter geschmälert durch ihre hohen Verwaltungskos-<br />
ten und ihre wachstums- und beschäftigungshemmende Wirkung, die sich aufkommmensmindernd<br />
auf andere Steuern auswirkt.<br />
Ablehnung in Finanz- und Steuerrechtswissenschaft (S. 10 ff.)<br />
Das Fazit aus diesen gesicherten Mängeln und Nachteilen kann nur lauten, dass die Vermögenssteuer<br />
ein Fremdkörper in einem modernen Steuersystem ist und deshalb beseitigt werden<br />
sollte. Finanz- und Steuerrechtswissenschaft lehnen die Vermögensteuer ganz überwiegend<br />
ab.<br />
Verfassungskonforme Vermögensteuer praktisch ausgeschlossen (S. 13 ff.)<br />
Als ein erheblicher Nachteil der Vermögensteuer kommt hinzu, dass sie von Verfassungs wegen<br />
nur in engen Grenzen erhoben werden kann. Das Bundesverfassungsgericht hat festgelegt,<br />
dass die Vermögensarten nicht ungleich im Hinblick auf ihre Ertragsfähigkeit belastet<br />
werden dürfen (Gleichbehandlungsgrundsatz). Ferner darf die Vermögensteuer mit den<br />
sonstigen Steuerbelastungen zusammen nicht in den Vermögensstamm eingreifen (Substanzschutz.<br />
Damit scheidet eine Umverteilung durch Besteuerung der Vermögenssubstanz aus.<br />
Die Gesamtbelastung der Erträge darf sich höchstens in der Nähe einer hälftigen Teilung<br />
zwischen privater und öffentlicher Hand bewegen (Halbteilungsgrundsatz). Schließlich<br />
muss mit Hilfe persönlicher Freibeträge das übliche Gebrauchsvermögen von der<br />
Vermögenssteuer freigestellt werden. Aufgrund dieser Anforderungen ist eine verfassungskonforme<br />
Vermögenssteuer praktisch ausgeschlossen.<br />
Angebliche Vorteile einer neuen Vermögensteuer – nicht überzeugend (S. 19 ff.)<br />
Allerdings haben die Verfechter der Vermögensteuer eine Reihe von Behauptungen aufgestellt,<br />
die eine Wiedereinführung dieser Steuer in einem günstigen Licht erscheinen lassen<br />
sollen. Diese Behauptungen sind jedoch oberflächlich und können deshalb nicht überzeugen.<br />
Als Ausgleich für zu geringe Einkommensteuer weder tauglich noch erforderlich (S. 19 ff.)<br />
Die Vermögensteuer taugt nicht dazu, die angeblich zu geringe Belastung der „Reichen“ mit<br />
Einkommensteuer zu korrigieren. Soweit nämlich die geringe Einkommensteuerbelastung der<br />
„Reichen“ darauf zurückgeführt wird, dass Einkünfte nicht angegeben werden, kann die<br />
Vermögensteuer keinen Ausgleich schaffen. Denn wer Einkünfte verschweigt, wird auch das<br />
ihnen zu Grunde liegende Vermögen ebenfalls nicht angeben. Ehrliche Steuerzahler würden<br />
<strong>als</strong>o doppelt belastet, unehrliche Steuerzahler weiterhin gar nicht belastet.<br />
Die Vermögenssteuer braucht auch nicht erhoben zu werden, um die Inanspruchnahme so genannter<br />
Steuerschlupflöcher zu ahnden. Wer der Aufforderung des Gesetzgebers folgt und<br />
Teile seines Einkommens oder Vermögens für staatlich begünstigte Zwecke verwendet, ver-<br />
hält sich legal und gemäß den verfolgten Gesetzeszwecken. Für eine „Bestrafung“ dieser<br />
Steuerzahler mit Hilfe einer Vermögensteuer besteht deshalb kein Anlass.<br />
Die Vermögensteuer ist schließlich nicht erforderlich, um eine zu geringe Steuerbelastung<br />
der „starken Schultern“ auszugleichen. Das Bundesfinanzministerium selbst hat festgestellt,
dass die oberen 10% der Steuerzahler 53,5% des Aufkommens der Lohn- und Einkommens-<br />
teuer erbringen. Die oberen 50% der Steuerzahler leisten 91,3%, die unteren 50% hingegen<br />
8,7% des Aufkommens. Irreführend sind hingegen auffallend niedrige Steuerbelastungen der<br />
Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen. Diese Quoten werden aus Daten der<br />
Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung abgeleitet, die aber für diesen Zweck ungeeignet<br />
sind.<br />
Die Vermögensteuer muss schon gar nicht reaktiviert werden, weil ihr Abbau ein Steuergeschenk<br />
für die „Reichen“ gewesen wäre. Denn in Wirklichkeit hat der Gesetzgeber <strong>als</strong> Aus-<br />
gleich für die Nichterhebung der Vermögensteuer vor allem die Erbschaftsteuer und die<br />
Grunderwerbsteuer erhöht. Zudem war die Nichterhebung eine schon längst fällige Maßnahme<br />
zur Beseitigung ungerechtfertigter Doppel- und <strong>Dr</strong>eifachbelastungen sowie einer substanzgefährdenden<br />
Soll-Ertragsbesteuerung.<br />
Als Zusatz- und Sonderlast nicht überzeugend zu begründen (S. 24 ff.)<br />
Die Vermögensteuer kann nicht <strong>als</strong> Solidaritätsbeitrag verstanden werden, denn alle Steuern<br />
sollen der solidarischen Finanzierung von Gemeinlasten dienen. Zudem stünde ein Solidaritätsbeitrag<br />
zugunsten der Länder im Widerspruch zur Verfassung, die lediglich die <strong>als</strong> Solidaritätszuschlag<br />
bezeichnete Ergänzungsabgabe des Bundes zur Einkommen- und Körperschafts-<br />
teuer vorsieht. Verfehlt ist auch die Bezeichnung der Vermögensteuer <strong>als</strong> Verantwortungssteuer.<br />
Steuern sind voraussetzungslos geschuldete Geldleistungen. Eine Steuer,<br />
gegründet auf eine spezielle staatliche Verpflichtung einer Gruppe von Steuerzahlern zur<br />
Finanzierung von Schule und Bildung, würde das Steuerrecht und die Finanzverfassung<br />
sprengen. Wer die Vermögensteuer <strong>als</strong> Rückzahlung der „Reichen“ für die schulische<br />
Bildung betrachtet, übersieht dabei, dass schon die Eltern dieser „Reichen“ über Einkommensteuer<br />
und andere Steuern zur Finanzierung der staatlichen Bildungseinrichtungen beigetragen<br />
haben. Zudem profitiert der Staat vom „Reichtum“ der ehemaligen Schüler bereits über eine<br />
progressiv gestaltete Einkommensteuer. Schließlich wäre es unzutreffend, im staatlichen<br />
Bildungssystem die einzige und entscheidende Ursache privaten Reichtums zu sehen.<br />
Fiskalische Bedeutung der Vermögensbesteuerung im Ausland kein Maßstab (S. 26 ff.)<br />
Internationale Vergleiche der Vermögensbesteuerung können keinen Aufschluss darüber geben,<br />
ob überhaupt und wie im Einzelnen die vermögensabhängige Besteuerung in Deutschland<br />
ausgebaut werden sollte. So erheben noch nicht einmal alle Länder, die in diesen Ver-<br />
gleich einbezogen wurden, eine Vermögensteuer. An einem international vergleichsweise<br />
geringen Anteil der vermögensabhängigen Steuern wird ohnehin nur derjenige Anstoß nehmen,<br />
der prinzipiell – und nicht erst aufgrund internationaler Vergleiche – für eine verstärkte<br />
Besteuerung des Vermögens eintritt. Tatsächlich ist jedoch die Einkommensbesteuerung die<br />
gerechtere und auch modernere Form, jeden gemäß seiner Leistungsfähigkeit zur Finanzierung<br />
der allgemeinen öffentlichen Lasten heranzuziehen. Zudem entspricht der Verzicht auf<br />
die Vermögensteuer dem Ziel der Steuerharmonisierung in Europa. Von den 15 Mitgliedstaaten<br />
der EU erhebt keiner eine Vermögensteuer von Kapitalgesellschaften und nur fünf kennen<br />
eine Vermögensteuer von Privatpersonen.<br />
Einfache Bewertung und niedrige Erhebungskosten nicht in Sicht (S. 28 ff.)<br />
Skepsis ist gegenüber den Behauptungen angebracht, dass es geeignete Bewertungsverfahren<br />
zum Zwecke der Vermögensbesteuerung gibt. Die Vorschläge der Sachverständigenkommission<br />
Vermögensbesteuerung zur Bewertung des Grundbesitzes könnten zwar auf Verwaltungsseite<br />
die Bewertung in Teilbereichen vereinfachen und deshalb auch die Verwaltungs-<br />
kosten verringern. Den meisten Steuerzahlern dürften jedoch die vorgeschlagenen Bewertungsverfahren<br />
nicht weniger unverständlich sein <strong>als</strong> das alte Bewertungsrecht. Zudem dürf-<br />
ten die Befolgungskosten auf Seiten der Steuerzahler durch die Abwehr von Überbewertungen<br />
ansteigen, die sich nahezu zwangsläufig häufen würden, wenn die angestrebte verkehrswertnahe<br />
Bewertung verwirklicht würde. Zudem sind die Vorschläge der Sachverständigen-
kommission mit dem Risiko der Verfassungswidrigkeit belastet, denn sie verfehlen die Vorgaben<br />
des Bundesverfassungsgerichts zur Vermögensbewertung.<br />
Ob die Übernahme der Bedarfsbewertung für die Zwecke der Vermögensteuer eine Vereinfachung<br />
der Grundbesitz-Bewertung mit sich bringen würde, lässt sich erst beurteilen, wenn das<br />
Bundesverfassungsgericht über den Vorlagebeschluss des Bundesfinanzhofs entschieden hat,<br />
der die Bedarfsbewertung einschließlich der Grundstücksbewertung für verfassungswidrig<br />
erachtet. Im Hinblick auf die Bewertungskosten wäre von Vorteil, dass die Bedarfsbewertung<br />
die Zahl der Bewertungen im Vergleich zu den früher durchgeführten Hauptfeststellungen<br />
reduzieren würde. Wegen der Schwierigkeiten, diejenigen Fälle „herauszufischen“, in denen<br />
es einer Bewertung des Grundbesitzes bedarf, begegnet sie jedoch verfassungsrechtlichen<br />
Bedenken im Hinblick auf die Gleichmäßigkeit der Besteuerung.<br />
Gefahren für Investitionen und Arbeitsplätze (S. 36 ff.)<br />
Im Gegensatz zu anders lautenden Beteuerungen würde die Wiedererhebung der Vermögenssteuer<br />
erhebliche Mehrbelastungen zur Folge haben und wäre mit schwer wiegenden Gefahren<br />
für Investitionen und Arbeitsplätze verbunden. Der Schwerpunkt der Belastungsverschärfungen<br />
läge bei privaten Investoren, mittelständischen Unternehmen und Kapitalgesellschaften.<br />
Die Vermögensteuer würde die Fähigkeit und die Bereitschaft vermindern, Investitionen<br />
vorzunehmen. Soweit die Vermögen bereits in Grundstücken und Unternehmen gebunden<br />
sind, würde die neue Vermögensteuer deren Renditen verringern. Dies würde den <strong>Dr</strong>uck erhöhen,<br />
in vermögensteuerfreie Anlagen auszuweichen, und die Investitionstätigkeit in<br />
Deutschland mindern. Die wachstumshemmende Wirkung der Vermögensteuer würde letzt-<br />
endlich dazu führen, dass ihre Wiedereinführung kaum Mehreinnahmen in den öffentlichen<br />
Haushalten zur Folge hat und sich negativ auf die Beschäftigung auswirkt.<br />
Kein Beitrag zur Konsolidierung des Haushalts (S. 40 ff.)<br />
Die neue Vermögensteuer ist nicht der Königsweg zur Konsolidierung der Landeshaushalte.<br />
Selbst dann, wenn sich die Einnahmewartungen erfüllten, müsste von einem Einsatz der Vermögensteuer<br />
zur Haushaltskonsolidierung abgeraten werden. Denn Erhöhungen der Steuer-<br />
und Abgabenlast sind schon vom Ansatz her verfehlt und folgenschwer. Da die Abgaben-<br />
last in Deutschland zu hoch ist, muss die Konsolidierung auf der Ausgabenseite erfolgen, und<br />
zwar über eine Kürzung der konsumtiven Staatsausgaben und der Subventionen. Gegen diese<br />
Strategie verstoßen bereits die Abgabenvorhaben der Koalition. Die von ihnen ausgehenden<br />
konjunkturellen Bremsspuren dürfen nicht durch eine Wiedererhebung der Vermögensteuer<br />
noch vertieft werden.<br />
Die Einnahmeerwartungen beruhen zudem auf Schätzungen, die an statistisch zum Teil ungesicherte<br />
Daten der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung anknüpfen und von der wenig<br />
wahrscheinlichen Erfüllung weitgehender Voraussetzungen abhängen. Ferner müssen die<br />
Verwaltungskosten der Vermögensteuer sowie ihre dämpfenden Wirkungen auf das wirtschaftliche<br />
Wachstum und das Aufkommen anderer Steuern gegengerechnet werden. Schließlich<br />
wird die Eignung der Vermögensteuer zur Haushaltskonsolidierung vom Finanzausgleich<br />
geschmälert, der die Mehreinnahmen zum größten Teil in die ausgleichsberechtigten<br />
Bundesländer weiterleiten würde.<br />
Finanzierung von Schule und Bildung – ein durchschaubarer Vorwand (S. 44 ff.)<br />
Dass gerade die Vermögensteuer zur Finanzierung von Schule und Bildung mit wachstumspolitischer<br />
Fernwirkung eingesetzt werden soll, ist von der Sache her nicht geboten. Die Verbindung<br />
der Vermögensteuer mit der Bildungspolitik lässt sich indes politisch erklären, wenn<br />
man berücksichtigt, dass zu den Verfechtern der Vermögensteuer vor allem von der SPD regierte<br />
Länder mit erheblichen Haushaltsproblemen gehören. Was liegt für diese näher, <strong>als</strong><br />
die geplante Steuererhöhung mit der Aussicht auf zusätzliche Leistungen in dem Bereich zu<br />
verknüpfen, in dem die Länder noch aktiv werden können, die Rechnung dafür aber anderen<br />
<strong>als</strong> der eigenen Klientel zu präsentieren? Der Eindruck einer verkappten Finanzaktion wird
noch dadurch verstärkt, dass eine haushaltsrechtliche Bindung der Vermögensteuer für Bildungszwecke<br />
zugunsten einer (wirkungslosen) politischen Zweckbindung abgelehnt wurde.<br />
Vorteil Wettbewerbsföderalismus? (S. 46 f.)<br />
Trotz der Vorteile, die der Steuerwettbewerb dem Steuerzahler verspricht, sollte die Vermögensteuer<br />
nicht zu seiner Belebung wieder eingeführt werden, denn sie ist steuerpolitisch und<br />
steuersystematisch überholt sowie von zahlreichen schwer wiegenden Mängeln gekennzeichnet.<br />
Gegenstand des Steuerwettbewerbs sollten vielmehr nur Steuern sein, die Bestandteil<br />
eines modernen, an der Leistungsfähigkeit ausgerichteten Steuersystem sein können.<br />
Auch diejenigen Länder, die auf die Einführung der Vermögensteuer verzichteten, würden die<br />
wirtschafts- und finanzpolitischen Nachteile dieser Steuer über den Finanzausgleich spüren.<br />
Wiedereinführung kein verfassungsrechtliches Problem? (S. 47 ff.)<br />
Die Wiedereinführung der Vermögensteuer durch den Bund stößt auf verfassungsrechtliche<br />
Hindernisse. Die Mehrheit der Länder macht dem Bund die Gesetzgebungskompetenz für<br />
die Vermögensteuer streitig. Ohne die Zustimmung des Bundesrates ist jedoch eine Wiedereinführung<br />
der Vermögensteuer durch den Bund ausgeschlossen. Als weiteres Hindernis dürfte<br />
sich der Halbteilungsgrundsatz erweisen, an den der Gesetzgeber jedenfalls für die Ver-<br />
mögensteuer gebunden ist. Eine Vermögensteuer, die gerade die „Höchstvermögenden“ verschont,<br />
weil sie sonst mehr <strong>als</strong> die Hälfte der Erträge an den Fiskus abführen müssten, wollen<br />
die Vermögensteuer-Verfechter aber nicht einrichten.<br />
Ergänzung zur Abgeltungssteuer und zur Steueramnestie? (S. 51 ff.)<br />
Die Vermögensteuer wird schließlich nicht <strong>als</strong> Ergänzung der geplanten Abgeltungssteuer benötigt.<br />
Bei dieser handelt es sich nämlich nicht um eine Steuervergünstigung für „Reiche“, die<br />
mit Hilfe der Vermögensteuer ausgeglichen werden müsste. Tatsächlich wird mit der Abgeltungssteuer<br />
in Höhe von 20% - dies entspricht in etwa dem halben Spitzensteuersatz im<br />
Jahre 2005 - der besonderen Inflationsanfälligkeit der Zinseinkünfte Rechnung getragen,<br />
die, auf lange Sicht betrachtet, die Zinserträge zur Hälfte entwertet. Zudem ist von der Abgeltungssteuer<br />
eine erhebliche Vereinfachung der Besteuerung zu erwarten. Dass die Abgeltungssteuer<br />
wahrscheinlich Mindereinnahmen verursacht, sollte nicht ihre Ablehnung zur<br />
Folge haben, denn diese entstehen auch dadurch, dass mit ihr die inflationäre Überbesteuerung<br />
der Zinsen beendet wird, die über Jahrzehnte hinweg zu zusätzlichen und ungerechtfertigten<br />
Einnahmen bei der Einkommensteuer und ihren Annexsteuern geführt hat.<br />
Beseitigen statt Wiedereinführen! (S. 53 f.)<br />
Die jüngsten Erfahrungen lassen befürchten, dass die alte Vermögensteuer, so lange sie rechtlich<br />
gesehen noch besteht, immer wieder zu Forderungen Anlass geben wird, sie in einem<br />
neuen Gewande wieder einzuführen. Aber selbst die Aufhebung der Vermögensteuer durch<br />
Bundesgesetz würde nicht vor populistischen Wiederbelebungsversuchen schützen. Steuer-<br />
und finanzpolitisch erforderlich ist deshalb die Streichung der Vermögensteuer aus dem<br />
Katalog der verfassungsgesetzlich zulässigen Steuern (Art. 106 GG). Dabei handelt es sich<br />
um keine vermögensteuerspezifische Forderung. Vielmehr hat das Institut schon vor Jahren in<br />
seiner Schrift zu „Verfassungsgrenzen für Steuerstaat und Staatshaushalt“ gefordert, alte,<br />
nicht mehr erhobene Steuern aus dem Grundgesetz zu streichen.<br />
Ich dankte dem Bund der Steuerzahler für seine Stellungnahme und informierte ihn über<br />
diejenigen der anderen Angeschriebenen.
Nachfolgend nun die Reaktion des Verbandes der Familienunternehmer:<br />
Sehr geehrter Herr <strong>Dr</strong>. <strong>Bottke</strong>,<br />
Anbei erhalten Sie für die Wirtschaftsarbeitsgemeinschaft der Schülerförderung Rhein-Main<br />
den Standpunkt der Familienunternehmer zum Thema Vermögenssteuer. Auf weitere Positionen<br />
bin ich, sind wir, gespannt.<br />
Mit freundlichen Grüßen aus Berlin<br />
Stephan Einenckel Referent für Wirtschaftspolitik, politische Kontakte<br />
DIE FAMILIENUNTERNEHMER - ASU e.V. DIE JUNGEN UNTERNEHMER – BJU<br />
Wiederbelebung der Vermögenssteuer – ein Instrument für mehr Gerechtigkeit?<br />
Die Vermögenssteuer – worum geht es?<br />
Ihr werdet die Schwachen nicht stärken,<br />
indem ihr die Starken schwächt.<br />
Ihr werdet denen, die ihren Lebensunterhalt verdienen müssen, nicht helfen,<br />
indem Ihr die ruiniert, die sie bezahlen.<br />
Ihr werdet den Armen nicht helfen,<br />
wenn Ihr die Reichen ausmerzt.<br />
Abraham Lincoln,<br />
(US-Präsident, Kriegherr auf Seiten der Nordstaaten im Bürgerkrieg zur Beendigung der<br />
Sklaverei, kurz nach militärischem Sieg und Erreichen dieses Zieles Tod durch Attentat)<br />
Der Begriff – in politischer Hinsicht<br />
Immer wieder wird eine Wiedereinführung bzw. Wiederbelebung der Vermögensteuer<br />
gefordert, die seit 1997 aus verfassungsrechtlichen Gründen nicht mehr erhoben wurde.<br />
„Immer wieder“, d. h.: Immer wieder dann, wenn der Staat mal wieder unter Geldnot zu<br />
leiden vorgibt, oder auch, wenn Geld für einen vielleicht guten Zweck gesucht wird.<br />
„Immer wieder“ heißt aber auch: Immer wieder dann, wenn man einmal mehr entdeckt hat,<br />
dass es in unserem Land sehr vermögende Personen gibt. Und dass es Unterschiede gibt.<br />
Viele Menschen finden das nicht „gerecht“.<br />
Es gibt Gründe für eine Wiedereinführung der Vermögensteuer, und es gibt sehr gute Gründe<br />
dafür, diese Steuer nicht (wieder) zu erheben. Beide Gruppen von Überlegungen sollen kurz<br />
beleuchtet werden. Fair, aber auch mit Ergebnissen.<br />
Der naheliegendste Grund für die (Wieder-) Einführung einer Steuerart – wie zum Beispiel<br />
der „Vermögensteuer“ ist natürlich der, dass der Staat (mehr) Geld zum Ausgeben benötigt.<br />
Viele Politiker lieben es zu sagen, dass „unser Staat handlungsfähig bleiben muss“, und zwar<br />
um natürlich noch mehr gutes zu tun, z. B. für Gesundheit, Bildung, Kinder und Alte.<br />
Erstens: Es gibt es immer Gutes zu tun. Aber muss das und (kann das überhaupt) der Staat<br />
am Besten? Oder wollen Staat und Parteien sich nur über Geld, das sie den Bürgern nehmen,<br />
bei anderen Bürgern, die Geld und staatliche Leistungen erhalten, Sympathien kaufen?<br />
Zweitens: Hat der Staat denn zu wenig Geld, um den Job zu leisten, für den er da ist?<br />
Jedenfalls hat er eine Menge Mittel zur Verfügung. Allein der Bund hat 300 Mrd. Euro pro<br />
Jahr, die er ausgeben kann. Die Steuereinnahmen sind im letzten Jahr (2007) übrigens um<br />
weitere 50 Mrd. Euro gewachsen – wegen der besseren Konjunktur und Steuererhöhungen.<br />
Wie viel Geld braucht der Staat <strong>als</strong>o noch, so dass er schon wieder Steuern erhöhen muss? Ein<br />
anderer Grund ist, dass es Vermögende gibt, teilweise sogar wirklich richtig „Reiche“.<br />
Erstens: Das ist gut für uns alle. Denn wenn „Reiche“ bei uns leben und nicht nur in New<br />
York, London, Zürich oder auch in Dubai, dann geben sie hier, bei uns, ihr Geld aus. Und sie<br />
investieren im Zweifel auch eher hier bei uns. Dort wo einige sehr reich sind, sind alle mit<br />
ihnen auch etwas reicher. Wohlstand verteilt sich langsam von allein – auch ohne den Staat.
Übrigens entwickeln „Reiche“ auch neuartige, durchaus luxuriöse, Bedürfnisse. Dadurch<br />
entstehen dort, wo sie leben, neue Produkte, neues Produktwissen und auch Arbeitsplätze.<br />
Zweitens: Vermögende steuern schon viel bei – auch ohne eine Vermögensteuer. Sie tragen<br />
sowieso sehr viel zum Staatshaushalt bei (dazu gleich und dann mit ganz konkreten Zahlen).<br />
Das Vermögen von wenigen steht nicht in einem Gegensatz dazu, dass eine Gesellschaft auch<br />
sehr fürsorglich zu ihren Armen sein kann. Deutschland bringt jedes Jahr rund 700 Mrd. Euro<br />
für soziale Wohltaten auf. Und das liegt auch an den Vermögenden, die hier leben und die<br />
hier Arbeitsplätze schaffen und Steuern zahlen – sog. Ertragsteuern, <strong>als</strong>o solche Steuern, die<br />
aus einem laufendem Vermögenszuwachs für einen bestimmten Zeitraum bestritten werden.<br />
Zu den klassischen Beispielen gehören die Einkommens- oder die Gewerbesteuer. Ganz im<br />
Gegensatz dazu, ist die Vermögenssteuer eine sogenannte „Substanzsteuer“.<br />
„Substanzsteuer“ , das ist bereits ein fachlicher Begriff. Er muss hier erklärt werden:<br />
Der Begriff – in fachlicher Hinsicht<br />
Bei der Vermögenssteuer, wie man sie vor einigen Jahren in Deutschland noch kannte,<br />
handelt es sich um eine „Substanzsteuer“. Gezahlt wird die Steuer nicht aus einem aktuellen,<br />
einem laufenden Einkommen, sondern aus der „Substanz“ des in der Vergangenheit bereits<br />
verdienten Vermögens.<br />
Hier liegt aber bereits ein rechtliches und moralisches Gerechtigkeitsproblem: Wenn ein<br />
Bürger ein früheres Einkommen bereits versteuert hat, wieso soll und darf er dann auf dieses<br />
Einkommen in der Gegenwart und Zukunft – wieder und wieder – Steuern zahlen müssen?<br />
Darf der Staat das? Darf er nicht einmal sondern wiederkehrend immer wieder zugreifen?<br />
Viele Fachleute sagen: Wenn ein Bürger vermögend wird, weil er viel Geld verdient hat, dann<br />
darf die Gesellschaft (und der Staat) davon etwas abbekommen, um damit Dinge wie Sicherheit<br />
und Bildung zu finanzieren. Gut. Aber er darf davon nur einmal seinen Teil bekommen.<br />
Der Rest muss dann dem, der das Vermögen verdient hat, und seiner Familie bleiben. Der<br />
Staat darf nicht immer wieder, Jahr um Jahr, fordernd vor seiner Tür stehen.<br />
Nichts anderes aber macht ein Staat, der Vermögensteuer erhebt. Er kommt immer wieder.<br />
Und jetzt noch etwas Verfassungsrecht: Das Bundesverfassungsgericht hat 1995 die Erhebung<br />
der Vermögenssteuer für nicht vereinbar mit dem Grundgesetz erklärt. Es hat dabei auf der<br />
Grundlage des Gleichheitsgrundsatzes argumentiert: Für eine Ungleichbehandlung von<br />
Gruppen (z. B. von Gruppen von Steuerzahlern) muss ein guter sachlicher Grund vorliegen.<br />
Das war bei der alten Vermögensteuer mit all ihren Ausnahmen und Freistellungen nicht der<br />
Fall. Im Übrigen hat das Bundesverfassungsgericht, zuletzt Anfang 2006, festgestellt, dass<br />
auch der Steuergesetzgeber nicht beliebig Steuern erheben und auf Privatvermögen zugreifen<br />
darf. Privatleute und Unternehmen haben aus Art. 14 Grundgesetz einen Anspruch darauf,<br />
dass der Staat Ihnen nicht exzessiv Steuern auferlegt. Kaum einer in Deutschland weiß, dass<br />
unser Land damit der erste Staat in der Welt ist, bei dem es ein solches Grundrecht gibt, auf<br />
dass sich jeder Bürger berufen kann. Ein solches Freiheitsgrundrecht fehlte in der Verfassung<br />
der USA und auch in der Deklaration der Menschenrechte in Frankreich. Nur in Deutschland<br />
gibt es so etwas – seit Januar 2006. Darauf könnte man durchaus stolz sein.<br />
Und noch ein paar langfristig politische Argumente:<br />
Das Bundesverfassungsgericht hat gute Gründe, den staatlichen Zugriff auf privates Einkommen<br />
und Vermögen einzuschränken.<br />
Das private Eigentum steht unter dem Schutz des Grundgesetzes und ist einer der wichtigsten<br />
Pfeiler für das Funktionieren und Bestehen der sozialen Marktwirtschaft. Eine Steuer, wie sie<br />
die Vermögenssteuer war oder erhoben werden soll, kann zu einer schleichenden Enteignung<br />
privaten Vermögens unter den Bürgern beitragen.<br />
Solche Entwicklungen sind sehr gefährlich. Historiker wissen, dass das NS-Regime auch deshalb<br />
ermöglicht wurde, dass die Deutschen nach dem 1. Weltkrieg und der darauf folgenden<br />
Hyperinflation enteignet und vermögenslos und dadurch desorientiert und für Nazis und<br />
andere Propaganda - anfällig geworden waren.
Der Staat sollte gerade im Zeitalter der Überalterung und der ausgezehrten Rentensysteme<br />
den privaten Vermögensaufbau nicht behindern. Wer heute jung ist, kann sich nicht länger auf<br />
staatliche Rentenkassen verlassen. Er muss selbst etwas für sein Vermögen tun, damit ihn<br />
nicht Altersarmut trifft. Erspartes Vermögen tritt häufig in Ergänzung oder Ersatz zu staatlichen<br />
Leistungen, bspw. der Rentenzahlung oder Pflegegeld, auf. Warum soll oder besser:<br />
darf der Staat solch ein Beispiel privater Vorsorge durch eine Besteuerung konterkarieren?<br />
Vielfach wird auch das Prinzip der Verteilungsgerechtigkeit ins Feld geführt. Obere Einkommen<br />
sollen stärker belastetet werden und so den Ausgaben des Staates dienen. Das<br />
Problem an dieser Argumentation wird offenbar, schaut man sich die echten Zahlen an: Die<br />
oberen 10 Prozent der Einkommensteuerzahler schultern bereits über 50 Prozent des Einkommenssteueraufkommens.<br />
Die unteren 25 Prozent sind bereits heute praktisch einkommensteuerfrei<br />
gestellt. Sie tragen zum Einkommensteueraufkommen nichts bei.<br />
Es gibt keine irgendwie parasitären Besserverdiener. Vielmehr machen die schon sehr viel.<br />
Unsere Gesellschaft ist viel solidarischer <strong>als</strong> viele es wahrnehmen. Auch Dank der „Reichen“.<br />
Und die sollten auch langfristig nicht vertrieben werden: Die (neuerliche) Erhebung einer<br />
Vermögensteuer – zusätzlich zu der jüngst ja bereits eingeführten sog. „Reichensteuer“ –<br />
könnte dazu führen, dass Personen mit Vermögen oder auch nur deren Vermögen – gehen.<br />
Überall im Ausland begegnet man dieser Gruppe mit offenen Armen (Gründe siehe oben).<br />
Befund:<br />
Eine Vermögenssteuer ist ein nicht durchdachtes, f<strong>als</strong>che Effekte erreichendes und nicht einmal<br />
ein gerechtes oder moralisch eindeutiges Instrument eines Staates, der auf diese Weise<br />
zwei Dinge erreicht:<br />
Er versucht sich noch mehr Einnahmen zu verschaffen, und zwar bei denen, die er schon<br />
geschröpft hat, und die sowieso einen Großteil des Steueraufkommens schultern müssen, weil<br />
andere es nicht können. Der Staat bekommt den H<strong>als</strong> nicht voll.<br />
Der Staat spaltet mit einem Gesetz wie der sog. „Vermögensteuer“ die Bürgerschaft, indem er<br />
eine Gruppe ausgrenzt und das Aufkommen von Neidgefühlen gegen diese klar befördert.<br />
Eine geteilte Bürgerschaft ist im Handling leichter. Das erinnert an das bewährte Prinzip der<br />
römischen Kaiser: „Teile und herrsche!“. Der Staat will einer Minderheit noch mehr nehmen,<br />
um sich mit dem zusätzlichen Geld bei einer relativen Mehrheit in ein gutes Licht zu setzen.<br />
„Gerechtigkeit“ ist nicht Umverteilung. Wer Gerechtigkeit so platt und eng definiert, handelt<br />
wie eine Figur aus einem George-Orwell-Roman. Gerechtigkeit, inhaltsreicher verstanden und<br />
ohne Bezug darauf, dass der Staat mehr Mittel bekommen kann und diese gnädig zu verteilen,<br />
ist etwas, was gerade die jetzt junge Generation längst verstanden hat: Die Möglichkeit, sein<br />
Leben selbst in die Hand zu nehmen und sich selbst Sicherheiten zu verschaffen. Denn von<br />
den Vorgängergenerationen und dem Staat ist künftig immer weniger zu erwarten. Der<br />
„Staat“ ist die Fassade, hinter der die Vorgängergenerationen Schulden aufgetürmt haben, die<br />
das Leben der Nachgeborenen belasten werden. Der positive Gegenbegriff hierzu ist privates<br />
Vermögen, d.h. das Recht, selbst verdientes Geld für das eigene Leben und die eigene, die<br />
einzige) Altersvorsorge zu behalten. „Vermögen“ ist die Folge von persönlichem „Verdienst“,<br />
und von beidem sollte der Staat, der seit Jahrzehnten mehr Geld ausgibt <strong>als</strong> er einnimmt (egal<br />
wie viel er auch einnimmt), besser die Hände wegnehmen. „Vermögensbildung“ ist DIE<br />
Chance der Jugend, „Staat und Steuern“ sind die Altlasten vorangegangener Verschwendung.<br />
Ich dankte dem Verband der Familienunternehmer für seine Stellungnahme und informierte<br />
ihn über diejenigen der anderen Angeschriebenen.
Nachfolgend nun die Reaktion des DGB von Tanja Girke:<br />
Sehr geehrter <strong>Dr</strong>. <strong>Bottke</strong>,<br />
Ihre Frage nach unserem Standpunkt zu einer Vermögenssteuer, möchte ich Ihnen gerne<br />
beantworten.<br />
Der DGB steht für die (Wieder)Einführung der seit 1997 nicht mehr erhobenen Vermögenssteuer.<br />
Damit würden die zusätzlichen Finanzmittel erschlossen werden, die die öffentliche<br />
Hand dringend braucht, um notwendige Investitionen in Bildung und Ausbildung, Forschung<br />
und Entwicklung und in die Infrastruktur tätigen zu können.<br />
Die internationale Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft wird langfristig an den<br />
Schulen und Universitäten entschieden. Bildung, Wissenschaft und Forschung sind die entscheidenden<br />
Potenzialfaktoren für Wachstum, Innovation und Beschäftigung.<br />
Bundesweit wurden im Jahr vor der Kappung der Vermögenssteuer, 1996, rd. 4,6 Mrd. Euro,<br />
bei einem Steuersatz von 1% (Freibetrag 500.000 Euro) erhoben. Das Aufkommen von<br />
Rheinland-Pfalz betrug bei der letzten Erhebung 1997 rd. 225 Mio. Euro (ca. 5% am bundesdeutschen<br />
Gesamtaufkommen).<br />
Bei Reaktivierung der Vermögenssteuer auf Bundesebene, wäre ein Aufkommen von rd. 15,9<br />
Mrd. Euro zu erzielen. Innerhalb dieser Rechnung entfiele auf Rheinland-Pfalz ein Aufkommen<br />
von rd. 800 Mio. Euro pro Jahr. Bei einem Steuersatz für die Vermögenssteuer von 0,5%<br />
(Freibetrag 500.000 Euro) läge das Aufkommen bei 400 Mio. Euro im Jahr.<br />
Zwei <strong>Dr</strong>ittel der Bevölkerung verfügen über kein oder ein sehr geringes Vermögen. Andererseits<br />
verfügen die wohlhabensten 10% der Haushalte über mittlerweile fast 60% des gesamten<br />
Vermögens.<br />
So steigerten allein die 300 reichsten Deutschen im letzten Jahr ihr vermögen um 80 Mrd.<br />
Euro auf 475 Mrd. Euro.<br />
Gleichzeitig ist das Armutsrisiko in Deutschland in den letzten zehn Jahren von 12% auf 18%<br />
gestiegen. Für Kinder ist das Armutsrisiko von 15% in 2003 auf 26% im Jahr 2005 gestiegen.<br />
Weit mehr <strong>als</strong> 50% der Bundesbürger finden laut DGB-Verteilungsbericht 2008 die derzeitige<br />
Einkommensverteilung <strong>als</strong> ungerecht. Nur noch rd. 10% der Deutschen empfindet die Verteilung<br />
im Großen und Ganzen gerecht (siehe Literaturhinweis).<br />
Die Erhebung einer Vermögensteuer ist nicht – entgegen häufiger Darstellung – verfassungswidrig.<br />
Das Bundesverfassungsgericht hat mit seinem Urteil 1995 lediglich die damalige<br />
Praxis der Vermögensbesteuerung für unzulässig erklärt, weil die Bewertung von Grundvermögen<br />
und Geldvermögen unterschiedlich vollzogen wurde.<br />
Die (wieder)eingeführte Vermögensteuer muss deshalb die verfassungskonforme Bewertung<br />
der Vermögen gewährleisten. Eine (wieder)eingeführte Vermögensteuer erschließt nach Ansicht<br />
des DGB großen Chancen:<br />
Erstens können hierdurch die nötigen zusätzlichen Finanzmittel erschlossen werden, um in<br />
Bildung und Ausbildung zu investieren und dadurch die Arbeitslosigkeit zu bekämpfen und<br />
die internationale Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft zu steigern.<br />
Zweitens erschließt die Vermögensteuer zusätzliche Finanzmittel, ohne gleichzeitig die<br />
gesamtwirtschaftliche Nachfrage anderswo einzuschränken, wie dies z.B. bei Erhöhungen der<br />
Lohn- oder Umsatzsteuer der Fall wäre.<br />
<strong>Dr</strong>ittens kann die Vermögensteuer die sich in den letzten Jahren dramatisch verstärkte verteilungspolitische<br />
Schieflage korrigieren und damit einen Beitrag zur Wiederherstellung der<br />
sozialen Gerechtigkeit leisten.<br />
Die Vermögensteuer ist eine Landessteuer. Insofern sind zunächst die Länder aufgefordert,<br />
über eine Gesetzesinitiative die Vermögensteuer zu reaktivieren und den Bund aufzufordern,<br />
für eine einheitliche Regelung zu sorgen.<br />
Ich hoffe, ich konnte Ihre Frage hinlänglich beantworten.
Mit freundlichen Grüßen<br />
Tanja Girke<br />
Den DGB-Verteilungsbericht 2008 finden Sie im Internet unter:<br />
http://www.dgb.de/2008/04/04_verteilungsbericht.htm/<br />
Ich dankte dem DGB für seine Stellungnahme und informierte ihn über diejenigen der anderen<br />
Angeschriebenen. Außerdem wies ich auf meine Ausführungen zu dem hier diskutierten<br />
Thema hin, die eine andere <strong>als</strong> die des DGB ist. Wir luden den DGB zur Diskussion darüber<br />
ein, auch weil wir meinten die Argumente des DGB an entscheidenden Stellen widerlegt zu<br />
haben (siehe dazu Irrtum 1). Leider hat sich daraufhin der DGB – trotz mehrmaligen Nachfragens<br />
– nicht mehr bei uns gemeldet. Schade!
Nachfolgend nun die Reaktion der FDP Fraktion von Herrn <strong>Dr</strong>. Günter Hofmann,<br />
einem Mitarbeiter von Herrn <strong>Dr</strong>. Westerwelle:<br />
Sehr geehrte Schülerin A, sehr geehrte Schülerin B, sehr geehrter Schüler C,<br />
<strong>Dr</strong>. Westerwelle lässt Ihnen für Ihre Anfrage zur Position der FDP zur Vermögensteuer<br />
danken. Er hat mich gebeten, Ihnen zu antworten.<br />
Die Vermögensteuer wurde im früheren Bundesgebiet bis 1996 erhoben. Das Bundesverfassungsgericht<br />
hat entschieden, dass diese Steuer in der dam<strong>als</strong> erhobenen Fassung nicht mit<br />
dem Grundgesetz vereinbar ist. Die FDP ist gegen eine Wiedererhebung dieser Steuer.<br />
Die Vermögensteuer brachte zuletzt ein Aufkommen von etwa 4,5 Mrd. Euro, wobei etwa 1,5<br />
Mrd. Euro auf Privatvermögen und 3 Mrd. Euro auf Betriebsvermögen entfielen. Die Kosten<br />
für die Erhebung dieser Steuer (insbesondere die laufende Bewertung des gesamten Vermögens)<br />
betrugen zuletzt etwa 33 Prozent der Einnahmen. Zum Vergleich: Die Vollzugskosten<br />
der Lohnsteuer betrugen 6,2 Prozent, die der Einkommensteuer ca. 9 Prozent. Die Erhebung<br />
der Vermögensteuer war <strong>als</strong>o unwirtschaftlich.<br />
Die Vermögenssteuer ist eine Substanzsteuer, d.h. sie ist unabhängig davon zu entrichten, ob<br />
jemand Gewinne erzielt oder Verluste macht. Das gilt insbesondere für Unternehmen. In konjunkturell<br />
schwierigen Zeiten kann das eine Gefahr für Investitionen und Arbeitsplätze darstellen.<br />
Anerkannter Maßstab für die Besteuerung ist bei uns der Grundsatz der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit.<br />
Je höher die individuellen Einnahmen sind, desto höher (absolut und relativ)<br />
ist die Steuerbelastung. Mit diesem Grundsatz ist eine Substanzsteuer nicht vereinbar. Aus<br />
diesem Grund wurde übrigens auch Ende der 90er Jahre die Gewerbekapit<strong>als</strong>teuer - eine Substanzsteuer<br />
für Unternehmen - mit sehr großer parlamentarischer Mehrheit abgeschafft.<br />
Unzutreffend ist das Argument, große Vermögen würden nicht ausreichend am Steueraufkommen<br />
beteiligt. Der Beschluss, die Vermögensteuer nicht mehr zu erheben, ging einher mit<br />
einer Erhöhung der Erbschaft- und der Grunderwerbsteuer etwa in Höhe des Aufkommens der<br />
Vermögensteuer.<br />
Mit freundlichen Grüßen<br />
<strong>Dr</strong>. Günter Hofmann<br />
Referent für Steuer- und Finanzpolitik<br />
Ich dankte der FDP für ihre Stellungnahme und informierte sie über diejenigen der anderen<br />
Angeschriebenen.
Nachfolgend nun die Reaktion der Linken von <strong>Dr</strong>. Gregor Gysi sowie mein Schriftwechsel<br />
mit ihm und eine weitere Reaktion von Marco Schäfer, einem Studenten und<br />
damaligem Mitarbeiter von mir:<br />
Liebe Schülerin A, liebe Schülerin B, lieber Schüler C, sehr geehrter Herr <strong>Dr</strong>. Hans-Dieter<br />
<strong>Bottke</strong>,<br />
bitte haben Sie Verständnis dafür, dass ich Ihre Frage nur kurz beantworten kann. Ich bin für<br />
die Wiedererhebung der Vermögenssteuer. Jahrelang gab es dadurch wichtige Einnahmen der<br />
Bundesrepublik Deutschland. Hinzu kam, dass es dadurch eine gewisse Umverteilung gab,<br />
die heute besonders erforderlich ist, weil Armut und Reichtum gleichermaßen wachsen. Zu<br />
beachten ist auch Artikel 14 des Grundgesetzes, der besagt, dass Eigentum zugleich dem Allgemeinwohl<br />
dienen soll. Das geschieht, wenn man für große Vermögen auch eine angemessene<br />
Steuer bezahlt.<br />
Mit freundlichen Grüßen<br />
<strong>Dr</strong>. Gysi<br />
Sehr geehrter Herr <strong>Dr</strong>. Gysi,<br />
zunächst einmal möchte ich mich dafür bedanken, dass Sie uns <strong>als</strong> einer der beiden Fraktionsvorsitzenden<br />
geantwortet haben. Ebenfalls hatten wir Herrn Lafontaine angeschrieben, aber<br />
ich gehe davon aus, dass Ihre Antwort auch ganz in seinem Sinne erfolgt ist. Von den Fraktionen<br />
des Bundestages hat <strong>als</strong> erster Herr <strong>Dr</strong>. Westerwelle geantwortet und etwas später, aber<br />
dafür am ausführlichsten Herr <strong>Dr</strong>. Meister von der Unionsfraktion. Herr <strong>Dr</strong>. Struck ließ uns<br />
mitteilen, dass er sich aufgrund sehr vieler Anfragen leider nicht an unserem Projekt beteiligen<br />
könne. Daraufhin habe ich bei dem SPD Abgeordneten Körper aus meinem Wahlkreis<br />
nachgehakt und werde nun sehen, was sich daraus ergibt. Die Fraktion Bündnis90 / Die<br />
Grünen hat sich leider überhaupt nicht gemeldet. Von den angeschriebenen Verbänden haben<br />
der Bund der Steuerzahler, die Familienunternehmer und der DGB bisher geantwortet.<br />
Zunächst gehe ich kurz auf unsere Vorgehensweise ein: Wir besprechen - zumeist unter<br />
meiner fachlichen wie pädagogischen Anleitung - bestimmte ökonomische Fragestellungen.<br />
Dabei beschreibe ich zunächst einige mir bekannten Positionen zu dieser Frage und nehme<br />
anschließend eine eigene Stellung dazu ein, welche ich natürlich begründe. Ich weise die<br />
beteiligten Schüler auch ausdrücklich daraufhin, dass dies meine Meinung zu diesem Thema<br />
ist, wer diese mit mir teilt und wer eben eine andere Auffassung vertritt. In diesem Zusammenhang<br />
haben wir nun verschiedene Parteien und Institutionen angeschrieben, um Ihnen die<br />
Möglichkeit zu geben, Ihre jeweilige Sicht der Dinge zu erläutern, so dass sich die Schüler<br />
dann alle vorgebrachten Stellungnahmen mit ihren jeweiligen Begründungen zu Gemüte<br />
führen und sich anschließend eine eigene, wohl überlegte Meinung bilden können. Aber auch<br />
ich selbst bin immer offen für Argumente, unabhängig davon, ob sie meine bisherige Auffassung<br />
bestätigen oder nicht. Für mich zählt ausschließlich die Stichhaltigkeit der Argumente,<br />
so dass ich gerne bereit bin, dazu zu lernen und eigene, unrichtige Positionen zu korrigieren.<br />
In diesem Zusammenhang möchte ich darauf hinweisen, dass die Schüler in keinem<br />
Abhängigkeitsverhältnis zu mir stehen, da mein Institut Nachhilfe anbietet und selber keine<br />
Noten vergibt. Zudem sind die meisten Teilnehmer dieser Wirtschaftsarbeitsgemeinschaft<br />
nicht einmal Kunden meines Institutes; das von mir gemachte Angebot richtet sich kostenlos<br />
an alle Interessierten.<br />
Nun komme ich auf die Frage nach der Vermögenssteuer zu sprechen: Der DGB vertritt inhaltlich<br />
die gleiche Position wie Sie, wohingegen der Bund der Steuerzahler, die Familienunternehmer,<br />
die FDP und die Union eine andere Auffassung haben. Ich selbst wie auch die<br />
beteiligten Schüler sind gegen eine Vermögenssteuer und teilen daher die Position der zuletzt<br />
Genannten sowie ihrer Begründungen. Wenn Sie es wünschen, leite ich Ihnen diese Stellung-
nahmen gerne per E-Post weiter, um Ihnen die Gelegenheit zu geben, deren Argumente zu<br />
widerlegen oder aber Ihre eigene Meinung zu korrigieren.<br />
Ich selber habe u.a. zu dem Thema Vermögenssteuer einen eigenen, fiktiven Dialog verfasst,<br />
welcher meine Position zu dieser Frage in einer Weise erklären soll, welche auch der ökonomische<br />
Laie versteht. Aber, wie gesagt, vielleicht liege ich mit meiner Meinung ja doch nicht<br />
richtig. Als Mensch ist man eben nicht unfehlbar, so dass ich Sie durchaus ermuntern möchte,<br />
den Versuch einer Widerlegung meiner Sicht der Dinge zu unternehmen. In diesem Dialog,<br />
welchen ich Ihnen im Anhang dieser E-Post zusende, diskutiert der Rentner R. mit einem<br />
gewissen Oskar L. über die Vermögenssteuer. Wenn Sie die Argumente des Rentners R.<br />
stichhaltig widerlegen sollten, bin ich gerne bereit, meine bisherige Auffassung zu dem besagten<br />
Thema zu korrigieren. Ebenfalls werde ich selbstverständlich Ihren Widerlegungsversuch<br />
den Schülern der Wirtschaftsarbeitsgemeinschaft zur Kenntnis bringen und darüber mit diesen<br />
diskutieren.<br />
Abschließend möchte ich Sie nochm<strong>als</strong> ausdrücklich dazu ermuntern, sich an der Diskussion<br />
zu beteiligen und mich womöglich durch bessere Argumente zu widerlegen. Wenn Sie eine<br />
Zusendung der Stellungnahmen der anderen Angeschriebenen wünschen, teilen Sie mir dies<br />
bitte mit. Ich werde diese dann unverzüglich an Sie weiterleiten. Ich möchte Sie abschließend<br />
noch darauf aufmerksam machen, dass wir planen, diesen Diskurs in die Medien zu tragen. So<br />
haben alle Beteiligten die Möglichkeit, ihre Sicht der Dinge darzulegen.<br />
Mit freundlichen Grüßen<br />
<strong>Dr</strong>. <strong>Bottke</strong>, Schülerförderung Rhein-Main<br />
Sehr geehrter Herr <strong>Dr</strong>. <strong>Bottke</strong>,<br />
Ihre Nachricht vom 20. September hat mich erreicht. Die Stellungnahmen der Verbände und<br />
anderen Parteien kenne ich. Die Stellungnahme der Schülerinnen und Schüler würde mich<br />
allerdings interessieren.<br />
Mit freundlichen Grüßen<br />
<strong>Dr</strong>. Gysi<br />
Sehr geehrter <strong>Dr</strong>. Gysi,<br />
es freut mich, dass Sie an der Meinung der Schülerinnen und Schüler interessiert sind. In<br />
meinem letzten Anschreiben teilte ich Ihnen mit, dass sich die beteiligten Schülerinnen und<br />
Schüler unter meiner fachlichen wie pädagogischen Anleitung mit wirtschaftlichen Themen<br />
beschäftigen. In diesem Zusammenhang werden verschiedene Positionen mit den jeweiligen<br />
Begründungen den Teilnehmern vorgestellt und anschließend diskutiert. Schließlich bilden<br />
sich die Schülerinnen und Schüler eine eigene Meinung.<br />
Im Falle der Vermögenssteuer entschieden sie sich gegen die Erhebung dieser Steuer, da sie<br />
die vorgebrachten Argumente, welche gegen eine solche Steuerart sprechen, für stichhaltig<br />
hielten. Insofern haben sie keine eigene, schriftliche Stellungnahme verfasst, sondern teilten<br />
eben die vorgebrachten Argumente derjenigen, die sich gegen diese Steuer aussprachen und<br />
hielten die Ausführungen der anderen nicht für stichhaltig. Insbesondere gefiel ihnen der von<br />
mir verfasste fiktive Dialog sehr gut, welchen ich Ihnen nochm<strong>als</strong> mit dieser E-Post zusende.<br />
Sie schrieben in Ihrer Antwort an mich, dass Sie die Stellungnahmen der Verbände und anderer<br />
Parteien kennten. Obgleich ich natürlich davon ausgegangen bin, dass Sie, <strong>als</strong> einer der<br />
beiden Fraktionsvorsitzenden Ihrer Partei, über diese Informationen verfügen, so wäre es<br />
interessant, von Ihnen zu erfahren, wie Sie die aus Ihrer Sicht f<strong>als</strong>chen Positionen widerlegen<br />
wollen. In den Stellungnahmen der anderen Parteien und Verbände wurde jedenfalls auch auf<br />
die Argumente der Befürworter einer Vermögenssteuer eingegangen, welche dann nach<br />
unserer Auffassung stichhaltig widerlegt worden sind. Aber vielleicht haben Sie dennoch die<br />
besseren Argumente auf Ihrer Seite. Wenn dem so sein sollte, widerlegen Sie doch beispielsweise<br />
einfach die Einlassungen des Rentners R. in besagtem fiktivem Dialog. Wir würden
einen solchen Versuch mit großem Interesse lesen. Daher möchte ich Sie nochm<strong>als</strong> ausdrücklich<br />
zu einem solchen ermuntern. Eine derart offene, argumentative Vorgehensweise, in der<br />
nur die Stichhaltigkeit der Argumente zählt, ist unserer Meinung nach ein gutes Beispiel für<br />
gelebte Demokratie, zu der jeder Demokrat ganz herzlich eingeladen ist. Dabei sollten alle<br />
Diskursteilnehmer immer bereit sein, ihre eigene Position aufgrund besserer Argumente zu<br />
korrigieren.<br />
In der Hoffnung auf einen gelingenden Dialog verbleibe ich mit freundlichen Grüßen<br />
<strong>Dr</strong>. <strong>Bottke</strong>, Schülerförderung Rhein-Main<br />
Sehr geehrter Herr <strong>Dr</strong>. <strong>Bottke</strong>,<br />
vielen Dank für Ihre weitere Nachricht vom 25. September.<br />
Ich befürchte, dass Sie meinen Zeitfonds f<strong>als</strong>ch einschätzen. Ich habe Ihren Dialog deshalb an<br />
meine Stellvertreterin Frau <strong>Dr</strong>. Höll mit der Bitte weitergeleitet, Ihnen eine entsprechende<br />
Antwort zukommen zu lassen.<br />
Mit freundlichen Grüßen<br />
<strong>Dr</strong>. Gysi<br />
Sehr geehrter Herr <strong>Dr</strong>. Gysi,<br />
Sie schrieben mir vor ein paar Wochen, dass Sie aus Zeitgründen den von mir verfassten,<br />
fiktiven Dialog zum Thema 'Vermögenssteuer' an Ihre Stellvertreterin Frau <strong>Dr</strong>. Höll weitergeleitet<br />
hätten. Leider haben wir bisher von Ihr keine Antwort erhalten. Teilen Sie mir doch<br />
bitte mit, ob wir uns nun direkt diesbezüglich an Ihre Stellvertreterin wenden sollen oder Sie<br />
selbst noch einmal bei Ihr nachfragen. Den Schülern und mir geht es vor allem um einen<br />
vernunftgeleiteten Diskurs über wirtschaftliche Themen und darum, mit welchen Argumenten<br />
die verschiedenen Parteien und Verbände dabei auf das Diskussionsangebot von interessierten<br />
Bürgern eingehen. Falls der Dialog verloren gegangen sein sollte, finden Sie diesen nochm<strong>als</strong><br />
im Anhang dieser E-Post.<br />
Mit freundlichen Grüßen<br />
<strong>Dr</strong>. <strong>Bottke</strong>, Schülerförderung Rhein-Main<br />
Sehr geehrter Herr <strong>Dr</strong>. <strong>Bottke</strong>,<br />
Ihre Informationen vom 01.10.und vom 18.10., die Sie Herrn <strong>Dr</strong>. Gysi sandten, sind zu uns<br />
weitergeleitet worden. Durch die Überbelastung in der derzeitigen Situation (Frau Höll ist<br />
Mitglied des Finanzausschusses) kam es zur Verzögerung der Beantwortung der E-Mails.<br />
In der kommenden Woche werden Sie eine umfangreiche Antwort erhalten.<br />
Mit freundlichen Grüßen<br />
i. A. Lotte Obst<br />
Sekretariat<br />
Mein Name ist Marco Schäfer. Ich bin ein Mitarbeiter der Schülerförderung Rhein-Main und<br />
betreue Schüler der Wirtschaftsarbeitsgemeinschaften. Dieses Projekt steht unter der Leitung<br />
von Herrn <strong>Dr</strong>. <strong>Bottke</strong>.<br />
Sie haben richtig gelesen (s.o.). Die Partei Die Linke hat eine umfangreiche Antwort zugesagt,<br />
aber dieses Versprechen bisher nicht gehalten. Frau <strong>Dr</strong>. Höll ist der Bitte von Herrn <strong>Dr</strong>.<br />
Gysi nicht nachgekommen, auf diesen Dialog über die Vermögenssteuer (Link) einzugehen.<br />
(Dieser Text bildet die Diskussionsgrundlage in den Wirtschaftsarbeitsgemeinschaften.) Wir,<br />
die Schüler, Herr <strong>Dr</strong>. <strong>Bottke</strong> und ich finden es sehr schade, dass der Dialog von der Linken<br />
einfach abgebrochen worden ist. Wir halten es für ein f<strong>als</strong>ches Signal. Politiker fordern doch
Engagement von Schülern. Dann sollten sie sich nicht zurückziehen, wenn junge Menschen<br />
sich tatsächlich konstruktiv in den politischen Diskurs einbringen. Im vorliegenden Fall ist die<br />
Enttäuschung sogar noch größer. Wir haben eine Zusage erhalten, dass man auf die Argumente,<br />
die gegen eine Vermögenssteuer sprechen, näher eingehen werde. Diese Zusage ist nicht<br />
gehalten worden. Durch ihr Vorgehen riskiert die Partei Die Linke ihre Glaubwürdigkeit. Ist<br />
sie etwa nicht an einem demokratischen Diskurs interessiert, bei dem sich das bessere Argument<br />
durchsetzt? Hat die Partei Die Linke vielleicht gar keine stichhaltigen Argumente für<br />
ihre Position zur Vermögenssteuer? Wir wissen es nicht, aber laden die Partei Die Linke nach<br />
wie vor ein, auf die Argumente in diesem Dialog (Link) einzugehen. Die Schüler und wir<br />
warten noch auf die versprochene Antwort. Worauf wartet Die Linke?
Nachfolgend nun die Reaktion der CDU /CSU Fraktion vom Abgeordneten <strong>Dr</strong>. Michael<br />
Meister:<br />
Sehr geehrter Herr <strong>Dr</strong>. <strong>Bottke</strong>, sehr geehrte Schülerin A, sehr geehrte Schülerin B, sehr geehrter<br />
Schüler C,<br />
vielen Dank für Ihre e-mail vom 2. September 2008 zur Vermögensteuer. Gerne lege ich<br />
Ihnen meinen Standpunkt zur Vermögensteuer dar.<br />
In Deutschland wird die Vermögensteuer seit gut zehn Jahren nicht mehr erhoben. Hintergrund<br />
ist eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, die die Vermögensteuer in ihrer<br />
damaligen Form für verfassungswidrig erklärt hat. Der Gesetzgeber ist seitdem nicht mehr<br />
tätig geworden. Das Vermögensteuergesetz besteht damit noch fort, darf aber nicht angewendet<br />
werden.<br />
Seit dieser Entscheidung wurde wiederholt die Wiederbelebung der Vermögensteuer gefordert.<br />
Starke Schultern müssten einen größeren Beitrag zur Finanzierung des Gemeinwesens<br />
beitragen <strong>als</strong> bisher, lautet die gängige Begründung. Teilweise wird die Wiederbelebung damit<br />
gerechtfertigt, dass das Aufkommen für die Verbesserung des Bildungswesens eingesetzt<br />
werden könnte. Beide Argumente gehen fehl.<br />
Die Aussage „breite Schultern müssen stärker belastet werden“ ist grundsätzlich richtig. Dies<br />
ist jedoch schon heute der Fall wie etwa ein Blick auf die Einkommensteuer zeigt, die neben<br />
der Umsatzsteuer die wichtigste Einnahmequelle des Staates ist. Nach Angaben des Bundesfinanzministeriums<br />
zahlen 10% der Steuerpflichtigen mit hohen Einkünften mehr <strong>als</strong> 50% des<br />
Einkommensteueraufkommens. 5% der Steuerpflichtigen mit sehr hohen Einkünften zahlen<br />
41,4% des Einkommensteueraufkommens. Dagegen zahlen 50% der Steuerpflichtigen mit<br />
niedrigen Einkünften gerade einmal 8,3% des Einkommensteueraufkommens. Schon dieses<br />
Beispiel zeigt, dass die Wohlhabenden ihren Beitrag leisten.<br />
Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass fast zwei <strong>Dr</strong>ittel der Deutschen kein nennenswertes<br />
Vermögen haben, dagegen das oberste Zehntel der Bevölkerung fast 60% des Geld-<br />
und Sachvermögens hält. Erstens sagt dies nicht über das soziale Miteinander aus. In dem <strong>als</strong><br />
sehr sozial geltenden Schweden sind die Vermögen noch sehr viel stärker konzentriert. In<br />
Deutschland werden fast 50% des Bundesetats für Arbeit und Soziales ausgegeben. Zweitens:<br />
Wer die Steuerschraube überdreht, fördert die Abwanderung gut ausgebildeter Leistungsträger<br />
ins Ausland. Die Folge dieses „brain drain“ – des Verlustes an Geistes- und Leistungspotenti<strong>als</strong><br />
– werden Wachstumseinbußen und der Verlust von Arbeitsplätzen in Deutschland<br />
sein. Darunter leiden insbesondere die sozial Schwachen. Schon Abraham Lincoln hat erkannt:<br />
„Wir werden die Schwachen nicht stärken, indem wir die Starken schwächen.“<br />
Steuern decken den allgemeinen Finanzbedarf. Sie dienen grundsätzlich nicht der Finanzierung<br />
besonderer Aufgaben. Eine Zweckbindung des Steueraufkommens ist mit dem haushaltsrechtlichen<br />
Grundsatz der Gesamtdeckung unvereinbar, wonach alle Einnahmen <strong>als</strong><br />
Deckungsmittel für alle Ausgaben zu dienen haben. Die Verwendung des Vermögenssteueraufkommens<br />
für das Bildungswesen kann daher so nicht festgelegt werden. Darüber hinaus<br />
sprechen folgende Gründe gegen die Wiederbelebung der Vermögensteuer: Deutschland lebt<br />
vom Außenhandel in einer globalisierten Welt. Deshalb können die Rahmenbedingungen in<br />
Deutschland nicht von den Entwicklungen in anderen Staaten abgekoppelt werden. So gibt es<br />
innerhalb der Europäischen Union für Kapitalgesellschaften keine eigenständige Vermögenssteuer.<br />
Die nationalen Gesetzgeber bauen die ertragsunabhängigen Steuern mit Ausnahme der<br />
Grundsteuer ab, wie z.B. Luxemburg, Niederlande, Österreich. Sollte sich Deutschland von<br />
diesem internationalen Trend abkoppeln, hätten deutsche Unternehmen einen Standortnachteil<br />
zu verkraften.<br />
Die Berechnung der Steuer ist sowohl für die Betroffenen <strong>als</strong> auch für die Finanzverwaltung<br />
mit einem enorm hohen Aufwand verbunden. So müsste nach den Vorgaben des Bundesver-
fassungsgerichts der Grundbesitz neu bewertet werden. Um eine solche Aufgabe bewältigen<br />
zu können, wären mehrere Tausend neue Stellen in der Finanzverwaltung notwendig. In den<br />
Jahren, in denen die Vermögensteuer erhoben wurde, betrugen die Erhebungskosten knapp<br />
ein <strong>Dr</strong>ittel des Aufkommens der Vermögensteuer. Dies steht in keinem Verhältnis zum Aufkommen,<br />
das zuletzt etwa 4 Mrd. Euro betrug.<br />
Das mit der Nichterhebung der Vermögensteuer weggefallene Aufkommen wurde seinerzeit<br />
mit Erhöhung der Erbschaftsteuer und der Grunderwerbsteuer gegenfinanziert. Diese Steuern<br />
müssten bei Wiederbelebung der Vermögensteuer wieder gesenkt werden. Damit wäre jedoch<br />
nichts gewonnen außer einem Mehr an Bürokratie.<br />
Aus diesen Gründen bin ich klar gegen die Wiederbelebung der Vermögensteuer.<br />
Mit freundlichen Grüßen<br />
gez. <strong>Dr</strong>. Michael Meister MdB<br />
Ich dankte der CDU für ihre Stellungnahme und informierte sie über diejenigen der anderen<br />
Angeschriebenen.
Nachfolgend nun die Schreiben der beiden Fraktionsvorsitzenden der Grünen:<br />
Zunächst von einem Mitarbeiter von Renate Künast und danach von einem Mitarbeiter<br />
von Fritz Kuhn sowie meine Antwort:<br />
Liebe Schülerin A, Schülerin B, Schüler C,<br />
ich fürchte, eure Anfrage ist bislang unbeantwortet geblieben, wofür ich mich entschuldigen<br />
möchte.<br />
Eine Wiedereinführung der Vermögensteuer wurde bei uns in der Bundestagsfraktion bereits<br />
intensiv diskutiert. Dazu wurde in 2004 auch ein Gutachten beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung<br />
(DIW) in Auftrag geben. Die Untersuchungsergebnisse des DIW machten<br />
dabei deutlich: Mehr Transparenz und Einfachheit auf der einen Seite, mehr Gerechtigkeit auf<br />
der anderen Seite und schließlich Wachstums- und Beschäftigungsverträglichkeit stehen in<br />
unauflösbarer Konkurrenz zueinander, wenn man sich mit den konkreten Möglichkeiten einer<br />
Vermögensteuer befasst. Die Vermögensteuer stammt aus einer Zeit, in der die technischen<br />
Möglichkeiten noch keine effiziente Ertragsbesteuerung erlaubt haben. Die Zeiten haben sich<br />
geändert, der Anteil der Vermögensbesteuerung hat deutlich abgenommen, der Anteil der Ertragsbesteuerung<br />
hat deutlich zugenommen, diese Entwicklung ist in allen Industriestaaten zu<br />
beobachten. Die Untersuchungsergebnisse haben uns dazu veranlasst, die in der DIW-Studie<br />
herausgearbeiteten Zielkonflikte bei der Vermögensteuer dadurch aufzulösen, dass wir uns<br />
intensiver den möglichen Verbesserungen der Ertragsbesteuerung und sowie der Erbschaftssteuer<br />
zuwenden wollen. Ich hoffe, diese späte Antwort hilft noch weiter.<br />
Viel Erfolg & beste Grüße aus Berlin<br />
Andreas Rade<br />
Liebe Schüler der Schülerförderung Rhein-Main,<br />
vielen Dank für die E-mail vom August 2008, die ich im Namen von Herrn Kuhn beantworten<br />
darf. Zunächst bitte ich die späte Rückmeldung zu entschuldigen, welche der Tatsache geschuldet<br />
ist, dass wir in den letzten Wochen und Monaten vor allem mit der Beratung der Gesetze<br />
zur Stabilisierung der Finanzmärkte, des Haushalts 2009 sowie des Konjunkturprogramms<br />
befasst waren, welche wegen ihrer Komplexität sehr viel Zeit und Kapazitäten gebunden<br />
haben. Nun zur Beantwortung der Fragen: Was halten Sie von einer Vermögenssteuer?<br />
Sind Sie dafür oder dagegen? Bitte begründen Sie Ihren Standpunkt. Bündnis 90 / Die<br />
Grünen haben sich mehrfach für die Wiedereinführung der Vermögensteuer ausgesprochen,<br />
wenngleich diese Position nicht unumstritten ist. Die Vermögensteuer ist ebenso wie z.B. die<br />
Erbschaftsteuer eine Substanzsteuer. Da Vermögen in der Regel aus bereits versteuertem<br />
Einkommen gebildet wurde, bedarf es für die erneute Besteuerung des Vermögens einer<br />
besonderen Begründung. Im Falle der Erbschaftsteuer sehen wir den Gerechtigkeitsaspekt <strong>als</strong><br />
wichtige Begründung gegeben. Beim Erben erhält nicht derjenige das Vermögen, welcher<br />
dieses durch seine Arbeit erwirtschaftet hat. Vielmehr findet ein Vermögenszuwachs statt, der<br />
allein auf der familiären Herkunft gründet. Aus Gerechtigkeitsgründen sehen wir daher die<br />
Besteuerung insbesondere großer Erbschaften <strong>als</strong> notwendig an. Im Falle der Vermögensteuer<br />
kann man sich fragen, ob tatsächlich das gesamte Vermögen aus bereits versteuertem Einkommen<br />
gebildet wurde. Dies ist z.B. nicht der Fall, wenn das Vermögen allein deshalb<br />
wächst, weil die Immobilien- oder Aktienpreise steigen. Dies gilt aber auch, wenn das Vermögen<br />
aus unvollständig versteuertem Einkommen gebildet wurde. Dies ist z.B. der Fall,<br />
wenn unvollständig besteuerte Zins- und Dividendenzahlungen den Vermögenszuwachs<br />
begründen. Sind die Gründe für die Erhebung der Vermögensteuer gegeben, stellt sich die<br />
Frage, wie eine gleichmäßig gerechte Besteuerung des Vermögens aussehen kann. Für die<br />
Einführung müssen wichtige Grundbedingungen erfüllt sein. So muss die Besteuerung ver-
fassungskonform sein. Im Jahr 1997 hatte das Bundesverfassungsgericht die Steuer wegen<br />
Belastungsungerechtigkeiten gestoppt. Weiterhin muss sichergestellt sein, dass Betriebsvermögen<br />
geschont bleibt. Es hilft nicht, wenn z.B. ein Unternehmen welches zwar auf dem<br />
Papier einen hohen Wert besitzt aber nur vergleichsweise geringe Erträge abwirft, durch die<br />
Vermögensteuer belastet wird und dadurch Arbeitsplätze gefährdet werden. Vor dem Hintergrund<br />
dieser Fragen können wir uns die Wiedereinführung der Vermögensteuer zwar durchaus<br />
vorstellen. Jedoch haben wir erhebliche Zweifel, dass sämtliche Bedingungen zu unserer<br />
vollen Zufriedenheit erfüllt werden können. Ich wünsche weiterhin viel Erfolg und Spaß beim<br />
Lernen<br />
Mit freundlichen Grüßen<br />
i.A. Klaus Müller<br />
Sehr geehrter Herr Müller,<br />
ich, <strong>als</strong> Leiter der Schülerförderung Rhein-Main, antworte Ihnen erst jetzt auf Ihr Schreiben,<br />
da wir noch auf die Stellungnahme von Herrn Kuhn, bzw. seinem Referenten Herrn Müller,<br />
gewartet haben. Ich gehe davon aus, dass Sie seine Stellungnahme zu der gleichen Frage von<br />
ihm erhalten können. Nun zu Ihrer Stellungnahme: Zunächst freut es uns, dass Sie nach dem<br />
zweiten Anschreiben geantwortet haben. Den Schülern fiel es schwer, Ihre Argumentation<br />
nachuzvollziehen, so dass ich gezwungen war, Ihnen einiges zu erklären. Wenn ich es richtig<br />
verstanden habe, sind Sie gegen die Erhebung einer Vermögenssteuer. Ich selber bin ebenfalls<br />
dieser Meinung und habe dies den teilnehmenden Schülern gegenüber selbstverständlich auch<br />
begründet. Sie finden im Anhang zu dieser E-Post einen von mir verfassten fiktiven Dialog<br />
zwischen Oskar L. und Rentner R., in welchem ich versucht habe, meine Position zu diesem<br />
Thema auch für Laien verständlich darzulegen. Ich machte die Schüler darauf aufmerksam,<br />
dass es zu meiner Position sowohl zustimmende <strong>als</strong> auch gegenteilige Meinungen gebe. Die<br />
eingegangenen Stellungnahmen der Bundestagsfraktionen, von Wirtschaftsverbänden und<br />
dem DGB haben wir uns genauer angeschaut und diskutiert. Im Ergebnis überzeugten uns in<br />
dieser Frage diejenigen, welche sich gegen eine Vermögenssteuer aussprachen, weil wir deren<br />
Argumente für überzeugend hielten. Einige Gründe führten ja auch Sie in Ihrem Antwortschreiben<br />
auf. Die von mir ins Leben gerufenen Wirtschaftsarbeitsgemeinschaften, an denen<br />
sich Schüler kostenlos beteiligen können, haben nicht nur die Auseinandersetzung mit ökonomischen<br />
Themen zum Ziel, sondern mindestens genauso die demokratische Debattenkultur,<br />
indem verschiedene Meinungen vorgetragen und begründet werden, um danach zu entscheiden,<br />
wer die besseren Argumente vorbringt. Daher danke ich Ihnen ganz ausdrücklich für Ihr<br />
Antwortschreiben, auch wenn es etwas spät einging. Es geht mir vor allem darum, eine demokratische<br />
Debattenkultur jungen Menschen nahezubringen. In diesem Zusammenhang möchte<br />
ich Sie bitten, die Grünen in RLP bzw. Mainz von unserem Projekt in Kenntnis zu setzen,<br />
bzw. mir mitzuteilen, an wen wir uns wenden müssten. Denn das Klagen über die Politikverdrossenheit<br />
allein hilft nicht weiter. Man muss etwas tun! Und dies versuche ich mit meinen<br />
bescheidenen Mitteln <strong>als</strong> kleiner selbständiger Unternehmer im Bildungsbereich. Ich würde<br />
mich daher sehr um eine diesbezüglich weiterhelfende Antwort Ihrerseits freuen.<br />
Mit freundlichen Grüßen<br />
<strong>Dr</strong>. <strong>Bottke</strong>, Schülerförderung Rhein-Main<br />
Ich dankte den Grünen für ihre Stellungnahme und informierte sie über diejenigen der<br />
anderen Angeschriebenen.
Nachfolgend nun die Reaktion vom SPD-Abgeordneten Fritz Rudolf Körper:<br />
Sehr geehrter Herr <strong>Dr</strong>. <strong>Bottke</strong>,<br />
bei unserem letzten Gespräch hatte ich Ihnen zugesagt, Ihnen einige Gedanken zur Vermögenssteuer<br />
mitzuteilen. Leider komme ich erst jetzt dazu, Ihnen zu schreiben. Das Thema ist<br />
aktuell wieder in der Diskussion. Das ist nicht verwunderlich. Denn im Augenblick blicken<br />
viele Menschen mit Unsicherheit in ihre Zukunft. Ich habe immer eine pragmatische Politik<br />
verfolgt und bin eigentlich nie der Versuchung erlegen, populistische Forderungen aufzustellen.<br />
Da gilt mein Leitsatz: "Politik hat nichts damit zu tun, in der Zeitung zu stehen." Die<br />
Vermögensteuer mag durchaus populär sein. Denn es ist einfach, "die Reichen" zu mehr Abgaben<br />
heranziehen zu wollen. Hier stelle ich zuweilen die Frage, ab wann man denn nun ein<br />
reicher Mensch ist?<br />
Fakt ist, dass im Jahre 1995, in dem die letzte Statistik zum Aufkommen erhoben wurde, eine<br />
Million Haushalte diese Vermögensteuer zahlte. Das Bundesverfassungsgericht hat am 22.<br />
Juni 1995 beschlossen, dass die Vermögensteuer ab 1997 nicht mehr erhoben werden durfte.<br />
Grund war die unterschiedliche Bewertung von Grundvermögen und sonstigem Vermögen.<br />
Seitdem gab es immer wieder Forderung nach einer Wiedererhebung. Ich schließe eine Wiedererhebung<br />
in dieser Legislaturperiode aus. Denn selbst wenn der Bundesgesetzgeber eine<br />
Einigung erzielen würde, die Mehrheit im Bundesrat wäre nicht zu überzeugen, da diese zwar<br />
die Besteuerung von Vermögensübertragungen, nicht aber eine Vermögensteuer befürwortet.<br />
Nun denke ich <strong>als</strong> Politiker über die Dauer einer Legislaturperiode hinaus. Am 27. November<br />
2008 haben wir die Reform der Erbschaftsteuer beschlossen. Das wichtigste dabei ist, dass sie<br />
erhalten bleibt. Denn so bleiben den Bundesländern vier Milliarden Euro, die sie für gute Bildung,<br />
für Kinder und für eine gute Zukunft unseres Landes einsetzen können. Millionenerben<br />
werden auch in Zukunft Erbschaftsteuer zahlen müssen und Betriebe, die nachhaltig Arbeitsplätze<br />
erhalten, werden entlastet. Ein selbst genutztes Eigenheim wird nicht belastet. Das<br />
finde ich gerecht. Ein ganz wichtiger Erfolg ist es, dass sich künftig die Bewertung aller Vermögensarten<br />
einheitlich am wirklichen Wert orientiert. Das war übrigens unsere Forderung,<br />
bevor das Bundesverfassungsgericht dem Gesetzgeber das vorgegeben hat. Es war richtig zu<br />
kritisieren, dass sowohl das Betriebsvermögen <strong>als</strong> auch das Grundvermögen verglichen mit<br />
den anderen Einkunftsarten steuerlich viel zu niedrig bewertet wird. Die Erbschaftsteuer wird<br />
<strong>als</strong>o künftig eine ehrliche und gerechte Bemessungsgrundlage bekommen. Mit diesem Bewertungsrecht<br />
ist aber nicht zuletzt eine zwingende Voraussetzung für eine spätere mögliche<br />
Wiedererhebung der Vermögensteuer geschaffen worden. Denn künftig wird sich die Bewertung<br />
aller Vermögensarten an ihrem tatsächlichen Wert orientieren. Ich gehe deshalb davon<br />
aus, dass in der kommenden Legislaturperiode neu ernsthaft über die Vermögensteuer diskutiert<br />
werden wird. Denn eine Steuerreform halte ich dann für unausweichlich. Man wird dann<br />
entscheiden, ob eine Wiedererhebung nötig und gewünscht ist. Im Augenblick gilt es allerdings,<br />
Wachstum zu stärken, um Arbeitsplätze zu sichern. Mit Investitionen, die insbesondere<br />
auf kommunaler Ebene nötig sind, müssen wir den Konjunktureinbruch verhindern. Wir werden<br />
sehen müssen, wie sich die Lage in Deutschland entwickelt. Bis dahin halte ich Diskussionen<br />
über eine Vermögensteuer für nicht sinnvoll. Dies gilt auch für vorschnelle Forderungen<br />
zu einer Senkung der Mehrwertsteuer. Wichtig ist es derzeit, Anreize zu Investitionen zu<br />
fördern. Sie haben mir ein Papier zukommen lassen, in dem Sie sagen, die Vermögensteuer<br />
sei wirtschaftlich unsinnig und ungerecht. Ich teile diese Auffassung nicht, weil ich glaube,<br />
dass man über Steuern grundsätzlich differenziert diskutieren muss und möglichst ohne<br />
Emotionen. Festzuhalten bleibt, dass starke Schultern mehr tragen müssen <strong>als</strong> schwache. Ich<br />
wünsche Ihnen alles Gute für die kommenden Weihnachtsfeiertage und für das neue Jahr gute<br />
Ideen und viel Erfolg für Ihre Arbeit. Wir brauchen derzeit Mut und Vertrauen in Deutschland.<br />
Ich hoffe, dass Sie dies Ihren Schülerinnen und Schülern vermitteln können.<br />
Ich dankte der SPD für ihre Stellungnahme und informierte sie über diejenigen der anderen<br />
Angeschriebenen.
5.10.<br />
Anzustrebende Wirtschaftsordnung: Soziale und ökologische Marktwirtschaft:<br />
Eine anzustrebende Wirtschaftsordnung: Die soziale und ökologische Marktwirtschaft<br />
Der Staat hat zu gewährleisten, dass jeder Mensch sich frei entfalten können muss im Streben<br />
nach seiner eigenen Glückseligkeit und dies darin seine Grenze findet, dass er allen anderen in<br />
diesem Streben durch sein Handeln keinen ungebührlichen Abbruch tut, d.i. die Kompatibilisierung<br />
der individuellen Willkür aller Staatsbürger untereinander nach einem allgemeinen<br />
Gesetz der Freiheit und Gleichheit. Wenn ich <strong>als</strong>o dem Menschen Freiheit zubillige, kann ich<br />
ihn auch für sein Tun zur Verantwortung ziehen; natürlich nur innerhalb der Grenzen des tatsächlich<br />
jeweils vorhandenen Handlungsspielraumes. Somit ist die Gemeinschaft der Staatsbürger<br />
zwar verpflichtet, allen unverschuldet in Not geratenen Mitbürgern zu helfen, aber jene<br />
wiederum müssen alles ihnen Mögliche auch unternehmen, um der Gemeinschaft nicht weiter<br />
zur Last zu fallen. Falls ein Bürger eine solche Anstrengung unterließe, verlöre er jeglichen<br />
moralischen Anspruch auf Unterstützung, weil ein derartiges Verhalten eindeutig unmoralisch<br />
wäre und ganz offensichtlich dem Kantischen Imperativ widerspräche, da es niem<strong>als</strong> <strong>als</strong><br />
Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung dienen könnte. Es wäre der Gemeinschaft gegenüber<br />
völlig unsolidarisch und belastete alle ehrlichen Abgabenzahler ungebührlich, weil deren Freiheitsspielraum<br />
durch die dann höhere Zahllast in unerlaubter Weise eingeschränkt werden<br />
würde. Wenn aber jemand aus Gründen, die er nicht selbst zu verantworten hat, wie beispielsweise<br />
einer chronischen Erkrankung, auf Dauer nicht fähig ist, seinen Lebensunterhalt selbst<br />
zu bestreiten, hat die Gemeinschaft, solange es ihr irgendwie möglich ist, für ihn zu sorgen<br />
und seine Menschenwürde in gleicher Weise zu achten wie die aller anderen Mitbürger, da die<br />
Würde eines Menschen nicht von seiner ökonomischen Effizienz abhängig gemacht werden<br />
darf! Ein Problem, welches hierbei in der Praxis immer auftreten wird, ist die Feststellung, ob<br />
und inwieweit jemand seinen Pflichten gemäß der eigenen Möglichkeiten nachkommt und<br />
welche Unterstützungsansprüche legitim daraus ableitbar sind. Man muss daher Regelungen<br />
treffen, welche keinen zu großen bürokratischen Aufwand erfordern, um jedem Einzelfall<br />
völlig gerecht werden zu können, weil ansonsten die Funktionsfähigkeit des Ganzen gefährdet<br />
werden würde. Daher müssen Pauschalregelungen getroffen und entsprechende ökonomische<br />
Anreize geschaffen werden.<br />
Das vernünftig zu wollende Wirtschaftssystem bewegt sich <strong>als</strong>o in folgendem Spannungsfeld:<br />
Es muss einerseits den freien Entfaltungsspielraum jedes Individuums möglichst großzügig<br />
bemessen, um den Einzelnen nicht in seiner Freiheit einzuschränken, ihn damit zu entmündigen<br />
und seiner Würde zu berauben sowie andererseits darauf achten, dass durch die Einrichtung<br />
entsprechender staatlicher Institutionen diese Freiheit zur Entfaltung der eigenen Persönlichkeit<br />
jedem in gleicher Weise zukommt und sein rechtmäßig erworbenes Eigentum schützt.<br />
Darüber hinaus muss der Staat die Unterstützung unverschuldet in Not geratener Personen gewährleisten.<br />
In einem modernen Gemeinwesen bedeutet dies die Schaffung zahlreicher Institutionen<br />
wie Justiz, Polizei, Verwaltungen, großer Teile des Ausbildungswesens, Einrichtungen<br />
im Gesundheits- und Sozialbereich und einiges mehr, wobei, abgesehen von den hoheitlichen<br />
Kernbereichen wie Justiz, Polizei, Militär oder Regierungsebene, viele Leistungen<br />
durch private Dienstleister erbracht werden können, wenn der Staat die Rahmenbedingungen<br />
festlegt und überprüft, so dass in den genannten Bereichen eine Grundversorgung der Bürger<br />
immer garantiert ist. Dafür müssen Steuern und Abgaben von den Bürgern erhoben werden.<br />
Ihre Höhe bewegt sich in dem genannten Spannungsfeld, d.h. sie darf keinesfalls zu hoch<br />
sein, damit der Einzelne nicht seiner Freiheit und damit seiner Würde beraubt wird, aber sie<br />
muss hoch genug sein, um die Erfüllung der notwendigen Aufgaben – und nur dieser – zu<br />
gewährleisten. Eine genaue Höhe lässt sich nicht allgemeinverbindlich errechnen. Sie ist ab-
hängig von der jeweiligen historischen Situation, wobei die aufgeführten Aspekte dabei zu<br />
berücksichtigen sind.<br />
An dieser Stelle möchte ich nun folgenden Punkt beleuchten, nämlich, dass der Staat niem<strong>als</strong><br />
nur Rahmensetzer ist, <strong>als</strong>o die ‚Spielregeln’ des ökonomischen Handelns bestimmt und deren<br />
Einhaltung überwacht sowie nötigenfalls mit Zwangsmitteln durchsetzt, sondern immer auch<br />
selbst wirtschaftlicher Akteur ist und zwar allein schon deshalb, weil er zur Umsetzung der<br />
genannten Aufgaben <strong>als</strong> Nachfrager auf den Faktormärkten auftritt, <strong>als</strong>o z.B. Sachgüter wie<br />
Gebäude oder Fahrzeuge kaufen bzw. mieten sowie Arbeitskräfte einstellen muss. Allein aufgrund<br />
dessen beeinflusst er, je nachdem wie umfangreich dieser Apparat ist, merklich die<br />
Faktorpreise und damit das wirtschaftliche Geschehen. Zusätzlich ist er aber Anbieter von<br />
zahlreichen Gütern und Dienstleistungen. Neben den hoheitlichen Aufgaben im engeren Sinne<br />
wie Verwaltung, Justiz, Polizei und Militär tritt der Staat auch <strong>als</strong> Anbieter im Ausbildungs-<br />
und Gesundheitswesen auf, betätigt sich auf dem Feld weiterer Infrastrukturleistungen wie<br />
Verkehrswege oder diverse Versorgungsnetze (z.B. Wasserversorgung), engagiert sich im<br />
Wohnungsbau und subventioniert sehr viele Wirtschaftsbereiche wie die Landwirtschaft, den<br />
Schiffsbau oder die Kohleförderung. Diese Auflistung ist nur sehr grob gehalten und ließe<br />
sich problemlos fort- bzw. detaillierter zu den einzelnen Bereichen ausführen. In unterschiedlichem<br />
Ausmaß lässt sich dieser Sachverhalt für alle modernen Industrienationen konstatieren,<br />
so dass der Staatsanteil am Wirtschaftsleben meist um die 50% beträgt. Nun stellt sich in diesem<br />
Zusammenhang nochm<strong>als</strong> die Frage nach den notwendigen Aufgaben. Was und wieviel<br />
soll <strong>als</strong>o durch den Staat geleistet werden? Von der Beantwortung dieser Frage hängt einerseits<br />
entscheidend die Steuer- und Abgabenlast ab, aber andererseits verändert sich, abhängig<br />
von den Feldern, auf denen der Staat tätig wird sowie dem Ausmaß seines Handelns, auch die<br />
Konkurrenzsituation auf den Märkten, so dass privatwirtschaftliche Anbieter durch Staatskonkurrenz<br />
aus dem Marktgeschehen ausscheiden oder erst gar nicht <strong>als</strong> solche auftreten können.<br />
Darüber hinaus kann der Staat auch die gesamte Konjunktur durch sein Verhalten beeinflussen<br />
und zwar allein schon dadurch, dass er Nachfrage in erheblichem Umfang sowohl<br />
durch Investitionen wie auch im konsumptiven Bereich zu schaffen vermag. In der wirtschaftswissenschaftlichen<br />
Diskussion herrscht heute weitgehend Einvernehmen darüber, die<br />
Rolle des Staates <strong>als</strong> aktiven Akteur im Wirtschaftsleben zu begrenzen, weil privatwirtschaftliche<br />
Anbieter fast immer effizienter arbeiten, da sie der Härte des Wettbewerbs ausgesetzt<br />
sind und sich somit Ineffizienzen viel weniger erlauben können <strong>als</strong> der Staat, der <strong>als</strong><br />
Rahmensetzer und zugleich Mitspieler sich letztlich immer gegen private Konkurrenz wird<br />
durchsetzen können, so dass nicht genügend <strong>Dr</strong>uck zur Wirtschaftlichkeit vorhanden ist.<br />
Desweiteren ist der Staatsapparat zu groß und unbeweglich, um auf Veränderungen schnell<br />
reagieren zu können, wobei noch hinzukommt, dass für seine Beschäftigten zumeist kaum<br />
Anreize bestehen, ökonomisch sinnvoll zu agieren. Schließlich spielt auch der Freiheitsaspekt<br />
eine wesentliche Rolle. Wie wir oben bereits gesehen haben, basiert die Würde des Menschen<br />
auf seiner Freiheit, von der er möglichst viel Gebrauch machen können sollte, ohne allerdings<br />
anderen dieses gleiche Recht in ungebührlicher Weise einzuschränken. Ein zu hoher Staatsanteil<br />
am Wirtschaftsleben, verbunden mit einer umfassenden sozialen Fürsorge für seine<br />
Bürger, entwöhnt jene im Laufe der Zeit tendenziell selbst Verantwortung zu übernehmen,<br />
weil das süße Gift eines derart bevormundenden Gemeinwesens zu viele Mitbürger durch<br />
solche Fehlanreize davon abhält, eben jene Eigenverantwortung in wünschenswertem Umfang<br />
zu übernehmen, so dass sie im Laufe der Zeit infolge einer derartigen Sozialisation verstärkt<br />
Kompetenzen in dieser Hinsicht einbüßen, ein mentales Umsteuern immer schwieriger wird<br />
und letztlich die Gefahr sehr groß ist, ökonomisch auf Dauer sowohl im Vergleich zu anderen<br />
Ländern, die weniger fürsorgend und bevormundend sind, <strong>als</strong> auch absolut gesehen, abzusteigen,<br />
wodurch erhebliche Wohlstandseinbußen unausweichlich eintreten werden. Darüber<br />
hinaus muss der Staat zur Erfüllung solcher Wohltaten hohe Steuern erheben, die wiederum
die Leistungsträger, welche erst die Grundlagen für ein solches System schaffen, in ihrem Tun<br />
behindern oder gar völlig demotivieren, so dass der Ast, auf dem man sitzt, abgesägt wird!<br />
Dies alles ist bei der Beantwortung der Frage der notwendigen Staatsaufgaben sehr sorgfältig<br />
zu berücksichtigen, ohne dass damit zwar eine genau quantifizierbare Größe, die für alle<br />
Gemeinwesen zu allen Zeiten gültig wäre, angegeben werden könnte, aber dennoch eine<br />
handlungsleitende Richtschnur formuliert und schlüssig begründet worden ist.<br />
Obgleich oben festgestellt wurde, dass die überwiegende Mehrheit der Ökonomen für eine<br />
enge Begrenzung der Staatsaufgaben aus den aufgeführten Gründen plädiert, sind dennoch<br />
Unterschiede hinsichtlich der Art sowie Intensität staatlicher Interventionen in den Wirtschaftsablauf<br />
auszumachen. Dies beruht im wesentlichen darauf, inwieweit man das Marktgeschehen<br />
<strong>als</strong> in sich eher stabil ansieht, so dass es trotz kurzfristiger Ungleichgewichte von<br />
alleine zu einem Gleichgewicht tendiert oder eben nicht. Zwei Denkrichtungen markieren<br />
diese Unterschiede recht deutlich:<br />
1. eher keynesianisch ausgerichtete Ökonomen gehen davon aus, dass das Marktgeschehen<br />
eher instabil sei und durch kleinste Anstöße auch dauerhaft aus dem Gleichgewicht<br />
gebracht werden könne, so dass hieraus die Legitimation für eine aktive staatliche<br />
Beeinflussung der Konjunktur herzuleiten sei,<br />
2. die Monetaristen hingegen behaupten, dass dem keineswegs so sei und größere konjunkturelle<br />
Ausschläge hauptsächlich durch eine verfehlte Wirtschaftspolitik des<br />
Staates, insbesondere hinsichtlich einer f<strong>als</strong>chen, d.h. zu expansiven Geld- und<br />
Fiskalpolitik, zustande kämen.<br />
Mehrere historische Beispiele – so vor allem die große Weltwirtschaftskrise in den 1930er<br />
Jahren – haben gezeigt, dass das Marktgeschehen massiv und nachhaltig gestört war und die<br />
prozyklische Politik der agierenden Regierungen diese Situation noch verschärft hat. Keynes<br />
sah nun die Aufgabe des Staates darin, die sich negativ verstärkenden Effekte durch eine<br />
aktive Fiskalpolitik zu durchbrechen, indem der Staat Nachfrage schafft, die stark genug sein<br />
muss, um eine Umkehr, insbesondere beim Investitionsverhalten der Unternehmen, herbeizuführen.<br />
Denn Investitionen führen zum einen dazu, dass Arbeitsplätze geschaffen werden und<br />
dadurch die eingestellten Arbeitnehmer wieder vermehrt <strong>als</strong> Nachfrager auftreten, so dass die<br />
Unternehmen wieder mehr absetzen können. Zum anderen aber erhöhen Investitionen auch<br />
selber die Nachfrage, weil z.B. die Maschinen zur Herstellung von Konsumgütern oder anderen<br />
Investitionsgütern von den jeweils nachgeordneten Industrien zur Herstellung ihrer Produkte<br />
benötigt werden. Keynes ist bekanntlich von der Möglichkeit eines dauerhaften<br />
‚Gleichgewichts bei Unterbeschäftigung’ ausgegangen, wonach der Anstoß zu dem oben<br />
beschriebenen Umkehrprozess von sich gegenseitig positiv verstärkenden Effekten nicht vom<br />
Markt selber erfolgt. Allerdings konnte Evsey D. Domar bereits in einem Aufsatz von 1946<br />
nachweisen, dass das Keynessche Ungleichgewicht auf Dauer gar nicht weiterbestehen könne,<br />
da auch noch so geringe Nettoinvestitionen bei einer Unterauslastung der Produktionskapazitäten,<br />
wie von Keynes unterstellt, aus Unternehmersicht unsinnig wären und deshalb auch auf<br />
Dauer nicht erfolgen würden.<br />
Wenden wir uns noch einmal dem Doppelcharakter der Investitionen zu. Wenn Unternehmen<br />
davon ausgehen, dass die Nachfrage nach ihren Produkten steigt, so werden sie vermehrt<br />
investieren, um den steigenden Bedarf befriedigen zu können. Falls sich allerdings daraufhin<br />
erweisen sollte, dass überinvestiert worden ist, so müssen die Kosten reduziert werden. Dies<br />
führt zu geringerer Nachfrage auf den Faktormärkten, wodurch die Arbeitslosigkeit steigt und<br />
zwar allein schon deshalb, weil in der entsprechenden Investitionsgüterindustrie die Aufträge<br />
abnehmen. Je größer die konjunkturellen Ausschläge sind, desto größer sind auch die jeweils
sich verstärkenden Effekte. Wie groß die Ausschläge sind, hängt entscheidend davon ab, wie<br />
umfangreich und mit welcher zeitlichen Verzögerung die Unternehmen auf Nachfrageschwankungen<br />
reagieren. Dieser Zusammenhang lässt sich einfach mithilfe mathematischer<br />
Modelle beweisen. Hierdurch kann verdeutlicht werden, welche zentrale Bedeutung die<br />
Investitionen dabei einnehmen. Am besten wäre es demnach, ein möglichst gleichmäßiges<br />
Wachstum ohne größere Ausschläge anzustreben, um starke Ungleichgewichte, die wiederum<br />
zu sich negativ verstärkenden Effekten führen können, zu vermeiden. Allerdings lässt sich<br />
eine ideale Wachstumsrate für die wirtschaftliche Praxis kaum ermitteln, weil das Investitionsverhalten<br />
entscheidend von den Zukunftserwartungen der Unternehmen abhängt, und<br />
diese sind eben auch stark psychologisch bestimmt. Infolgedessen ist das Verhalten der<br />
Unternehmer ganz entscheidend dafür, ob bzw. wie gut Marktprozesse funktionieren, da sie,<br />
abgesehen vom Staat, über die Art und Höhe der Investitionen entscheiden und damit bestimmen,<br />
was und wieviel in einer Volkswirtschaft überhaupt produziert werden kann, wieviel<br />
rentable Arbeitsplätze entstehen und wieviel letztlich für soziale Aufgaben zur Verfügung<br />
steht. Die populäre aber f<strong>als</strong>che Vorstellung einiger ‚Schlaraffenland- oder Vulgärökonomen’,<br />
wonach einfach durch Lohnerhöhungen mit einer damit angeblich verbundenen höheren<br />
Kaufkraft die Wirtschaft angekurbelt werden könnte, ist in dieser Schlichtheit einfach unsinnig.<br />
Dies soll anhand des folgenden fiktiven Trialoges verdeutlicht werden:<br />
Die junge Gewerkschaftsaktivistin Frau D. unterhält sich angeregt auf dem Marktplatz am Rande<br />
eines Gemüsestandes mit dem Möbelverkäufer Herrn V. über die zu geringen Löhne und Gehälter<br />
in Deutschland. Bürger B., der gerade ein paar Einkäufe tätigt, bekommt ihr Gespräch mit<br />
und hört zunächst nur eine Weile zu. Doch dann mischt er sich ein und spricht die beiden an:<br />
Bürger B.: Guten Tag zusammen. Ich hörte gerade Ihrem angeregten Gespräch ein wenig zu und<br />
hätte da noch ein paar Fragen.<br />
Frau D.: Prima. Ich freue mich immer, wenn ich Menschen erreiche, um mich mit ihnen gegen<br />
Ungerechtigkeit und ökonomischen Unverstand gemeinsam zur Wehr zu setzen. Sie müssen<br />
wissen, dass ich aktiv in der Gewerkschaft mitarbeite. Dies hier ist Herr V., ein Verkäufer in<br />
dem großen Möbelhaus um die Ecke.<br />
Alle drei Gesprächspartner begrüßen sich kurz.<br />
Frau D.: Sie sagten eben, Sie hätten da ein paar Fragen. Legen Sie einfach los!<br />
Bürger B.: Sie sprachen vorhin davon, dass die Löhne und Gehälter in Deutschland vielfach zu<br />
niedrig seien.<br />
Frau D.: Ganz recht. Das ist zunächst sehr ungerecht gegenüber den vielen fleißigen Arbeitnehmern.<br />
Aber darüber hinaus ist es auch ökonomisch gesehen sehr dumm. Dies schadet unserer<br />
Wirtschaft, weil die niedrigen Einkünfte das dringend benötigte Wirtschaftswachstum nicht ermöglichen.<br />
Herr V. nickt zustimmend.<br />
Bürger B.: Und was schlagen Sie vor, damit unsere Wirtschaft wieder stärker wächst?<br />
Frau D.: Deutlich höhere Löhne und Gehälter natürlich!
Bürger B.: Sehr interessant. Sie sind <strong>als</strong>o der Meinung, dass die Einkommen der Arbeitnehmer<br />
zuerst deutlich erhöht werden müssten, damit danach die Wirtschaft richtig an Fahrt gewinnt,<br />
oder habe ich Sie da f<strong>als</strong>ch verstanden?<br />
Frau D.: Nein. Sie haben mich da völlig richtig verstanden.<br />
Bürger B.: Das klingt zu schön, um wahr zu sein. Könnten Sie mir das vielleicht ein wenig näher<br />
erklären?<br />
Frau D.: Selbstverständlich kann ich das. Und Sie werden gleich sehen, wie einfach die Zusammenhänge<br />
sind!<br />
Bürger B.: Jetzt bin sehr gespannt auf Ihre Ausführungen.<br />
Frau D.: Gut, dann will ich Sie darüber aufklären und Ihnen alles so erläutern, dass Sie es gut<br />
verstehen werden: Wenn die Arbeitnehmer in Deutschland so wenig verdienen, können sie<br />
natürlich auch nicht viel einkaufen, so dass die Binnennachfrage entsprechend schwach bleibt.<br />
Bürger B.: Und deshalb sollen die Arbeitgeber ihnen mehr Lohn oder Gehalt zahlen, damit sie<br />
mehr Waren einkaufen können.<br />
Frau D.: Ganz genau so verhält es sich. Sehen Sie, es ist doch gar nicht schwer zu verstehen.<br />
Wenn die Leute nicht genug Geld in der Tasche haben, können sie auch nicht viel für Einkäufe<br />
ausgeben. Die Unternehmer bleiben auf ihren Produkten sitzen, weil kaum jemand etwas kauft.<br />
Die Firmen machen weniger Umsatz und folglich weniger Gewinn. Es liegt <strong>als</strong>o eigentlich auch<br />
im Interesse der Unternehmen, die Löhne und Gehälter zu erhöhen.<br />
Herr V. nickt wiederum zustimmend.<br />
Bürger B.: Wenn sich das so verhält, wie Sie sagen, dann müssten die Unternehmer ja ziemlich<br />
dumm sein.<br />
Frau D.: Ja, so ist es. Sie sehen das Ganze halt sehr kurzfristig, weil sie eben nur die Lohnkosten<br />
betrachten und die Nachfrageseite völlig ignorieren. Letztlich schaden sie damit sowohl den<br />
Arbeitnehmern <strong>als</strong> auch sich selbst.<br />
Bürger B.: Also müssten die Unternehmen lediglich höhere Löhne und Gehälter <strong>als</strong> zurzeit<br />
zahlen und schon würde die Wirtschaft besser laufen, meinen Sie es so?<br />
Frau D.: Ja sicher, so meine ich es.<br />
Bürger B.: Mir scheint das etwas zu einfach zu sein.<br />
Frau D.: Nicht doch. Genau so verhält es sich! Oder können Sie das von mir Gesagte widerlegen?<br />
Bürger B.: Ich will es versuchen.<br />
Frau D.: Nur zu. Sie werden schnell feststellen, dass es vollkommen zwingend ist, was ich dargelegt<br />
habe. Wir wollen schließlich argumentieren und nicht einfach unbegründete Meinungen in<br />
die Welt setzen!
Bürger B.: In der Tat ist es auf jeden Fall erstrebenswert, nach den Regeln der Logik ein solches<br />
Gespräch zu führen und nicht auf unbegründeten Behauptungen zu bestehen, nur weil man recht<br />
behalten möchte.<br />
Frau D.: Sehr richtig! Also versuchen Sie, mich zu widerlegen. Wenn es Ihnen nicht gelingen<br />
sollte, gilt meine Darlegung <strong>als</strong> gerechtfertigt.<br />
Bürger B.: Einverstanden. Zumindest vorerst.<br />
Frau D.: Na schön, dann legen Sie mal los.<br />
Bürger B.: Gut, schauen wir <strong>als</strong>o, ob es sich so einfach verhält, wie Sie sagen. Herr V., Sie<br />
arbeiten doch im Möbelhaus um die Ecke <strong>als</strong> Verkäufer, wenn ich es richtig verstanden habe,<br />
nicht wahr?<br />
Herr V.: So ist es.<br />
Bürger B.: Nehmen wir <strong>als</strong>o das Unternehmen, in dem Sie arbeiten, <strong>als</strong> Beispiel, durch welches<br />
wir nachprüfen, ob die Zusammenhänge so sind, wie sie von Frau D. eben geschildert wurden.<br />
Herr V.: Sehr gerne.<br />
Frau D.: Ja, genau. Nehmen wir ein Beispiel aus der Praxis gleich hier um die Ecke.<br />
Bürger B.: Also gut. Angenommen der Arbeitgeber von Herrn V. erfüllte Ihre Forderung nach<br />
einer Gehaltserhöhung, beispielsweise um 500,-- € im Monat.<br />
Frau D.: So einfach geht das natürlich nicht. Wenn andere Möbelhäuser nicht ebenfalls die Entlohnung<br />
ihrer Mitarbeiter erhöhten, würden die Waren des Arbeitgebers von Herrn V. teurer <strong>als</strong><br />
diejenigen seiner Konkurrenten sein und er verlöre viele Kunden an jene.<br />
Bürger B.: Sie haben völlig recht, aber ich begann ja erst mit meinen Ausführungen. Wenn demnach<br />
alle Möbelhäuser ihren Mitarbeitern nun jeweils 500,-- € mehr im Monat zahlten und diese<br />
Mitarbeiter ihr gesamtes zusätzliches Einkommen nur bei ihrem jeweiligen Arbeitgeber ausgäben,<br />
<strong>als</strong>o davon nicht zum Beispiel ein neues Auto kauften oder irgendetwas anderes damit<br />
täten, was würde das für Folgen für die beteiligten Unternehmer haben?<br />
Frau D.: Die Unternehmer hätten ihren Umsatz deutlich gesteigert, so wie ich es vorhin sagte.<br />
Bürger B.: Dass sie in einem solchen Falle ihren Umsatz kurzfristig gesteigert hätten, stimmt<br />
natürlich, aber das ist nicht das Entscheidende.<br />
Frau D.: Wieso denn nicht?<br />
Bürger B.: Ganz einfach: Der Umsatz wäre zwar gestiegen, aber der Gewinn dementsprechend<br />
gesunken.<br />
Frau D.: Wie meinen Sie das?<br />
Bürger B.: Schauen wir uns einmal das Möbelhaus von Herrn V. für den genannten Fall näher<br />
an: Der Chef von Herrn V. zahlte ihm und all seinen Kollegen 500,-- € mehr im Monat und jene
kauften von ihren zusätzlichen Einkünften nur Produkte ihres Arbeitgebers. Das Resultat einer<br />
solchen Vorgehensweise wäre für den Unternehmer ein Desaster und letztlich natürlich auch für<br />
seine Mitarbeiter, wenn die Firma nach einiger Zeit pleite ginge und alle arbeitslos wären.<br />
Frau D.: Moment mal. Wieso wäre das ein Desaster, und warum würde die Firma pleite gehen?<br />
Bürger B.: Das liegt doch auf der Hand: Der Arbeitgeber von Herrn V. bekäme zwar die 500,-- €<br />
von all seinen Mitarbeitern wieder zurück, aber wäre um die an jene verkauften Möbelstücke und<br />
die Kosten, welche sie für Herstellung und Transport verursacht hätten, ärmer. Ein grandioses<br />
Verlustgeschäft, oder etwa nicht?<br />
Frau D.: Ihrer Argumentation kann ich noch nicht ganz folgen.<br />
Bürger B.: Nun, dann versuche ich es noch einmal. Die von Ihnen befürwortete sog. ‚Kaufkrafttheorie’<br />
besagt doch im Grunde nichts anderes, <strong>als</strong> dass die Leute nur mehr Geld in der Tasche<br />
haben müssen, um mehr Güter einkaufen zu können. Davon wiederum profitieren auch die<br />
Unternehmer, indem sie mehr Produkte verkaufen können. Durch mehr Geld für die Arbeitnehmer<br />
ist angeblich allen geholfen – so die Annahme. Nun spielen wir dies nochm<strong>als</strong> am Beispiel<br />
des Möbelhauses durch: Der Chef zahlt seinen Mitarbeitern 500,-- € mehr im Monat aus<br />
und letztere kaufen mit dem ganzen zusätzlichen Geld Möbel von ihrem Arbeitgeber. Die Folge<br />
für den Unternehmer bestünde dann offensichtlich darin, dass er das zuvor mehr ausgezahlte<br />
Geld an seine Mitarbeiter zwar wieder zurückbekommen hätte, aber um die von ihnen dafür erworbenen<br />
Möbel ärmer wäre: Ein ganz offensichtliches Verlustgeschäft für den Unternehmer!<br />
Frau D. ist sprachlos, und Herr V., der ihr vorher eifrig zugestimmt hatte, ist sehr nachdenklich<br />
geworden. Ihm wird allmählich klar, dass die Welt der Wirtschaft wohl doch nicht ganz so<br />
simpel funktioniert, wie es die Gewerkschaftsaktivistin darstellte. Bürger B. möchte allerdings<br />
noch etwas seinen Ausführungen hinzufügen:<br />
Bürger B.: Dies ist aber noch nicht alles.<br />
Herr V.: Was meinen Sie?<br />
Bürger B.: Wir vergaßen bei unserem Beispiel die Steuer- und Abgabenlast. Bei einer Lohnerhöhung<br />
von 500,-- € flösse an die Mitarbeiter ungefähr nur die Hälfte, wenn überhaupt. Folglich<br />
könnten sie nur für ca. 250,-- € mehr Waren einkaufen.<br />
Herr V.: Was sagen Sie nun dazu Frau D.?<br />
Frau D.: Im Augenblick weiß ich darauf nichts zu erwidern.<br />
Herr V.: Hat denn nun Herr B. recht oder nicht?<br />
Frau D.: Im Moment zumindest scheint es so. Was machen Sie eigentlich beruflich Herr B.?<br />
Bürger B.: Ich bin Unternehmer im Bildungsbereich.<br />
Frau D.: Dachte ich es mir doch. Dann ist es ja klar, dass Sie so reden.<br />
Bürger B.: Wie meinen Sie das?
Frau D.: Na ja, Sie vertreten halt Ihre Interessen <strong>als</strong> Arbeitgeber. Das versteht sich doch von<br />
selbst.<br />
Bürger B.: Ob ich nur meine Interessen wahrnehme oder nicht, ist doch für die Sachargumentation<br />
völlig unerheblich. Entscheidend ist die logische Folgerichtigkeit meiner Ausführungen. Das<br />
haben Sie selbst am Beginn unseres Gespräches betont, oder irre ich mich?<br />
Herr V.: Nein, genauso war es!<br />
Frau D.: Von mir aus. Aber ich habe dann doch noch eine Frage: Nach Ihrer Logik, Herr B.,<br />
dürften die Löhne dann gar nicht mehr steigen, nicht wahr?<br />
Bürger B.: Nein, keineswegs. Selbstverständlich können und sollen die Einkünfte der Beschäftigten<br />
steigen, aber nur dann, wenn sie entsprechend produktiver arbeiten. Denn der Hauptfehler<br />
der von Ihnen anfangs skizzierten sog. ‚Kaufkrafttheorie’ besteht darin, dass durch die Ausgabe<br />
von mehr Geld noch kein zusätzliches Gut – zum Beispiel ein Möbelstück – hergestellt worden<br />
ist. Es kann immer nur das verteilt werden, was zuvor erwirtschaftet worden ist. Waren entstehen<br />
schließlich nicht von selbst.<br />
Herr V.: Das leuchtet mir ein. Was sagen Sie dazu Frau D.?<br />
Frau D.: Darüber muss ich noch einmal näher nachdenken.<br />
Bürger B.: Einen Aspekt möchte ich in diesem Zusammenhang noch erwähnen, weil er mir sehr<br />
wichtig zu sein scheint.<br />
Herr V.: Und welcher ist das?<br />
Bürger B.: Wir dürfen nicht mehr nur national denken, sondern müssen uns weltweit umschauen.<br />
Andere Länder kaufen einerseits unsere Waren, aber andererseits verkaufen sie auch welche bei<br />
uns, oder wir machen nicht nur hier, sondern auch im Ausland Urlaub und geben dort Geld aus.<br />
Herr V.: Ja gewiss. Und das nennt man dann ‚Globalisierung’.<br />
Bürger B.: So ist es. Gerade Deutschland ist wie kaum ein anderes Land auf der Welt auf den<br />
Handel mit anderen angewiesen. Man schaue sich lediglich die Energieimporte an, ohne die hier<br />
fast alle Räder still stünden.<br />
Herr V.: Das ist wahr.<br />
Bürger B.: Wir müssen <strong>als</strong>o immer darauf achten, dass wir international konkurrenzfähig sind.<br />
Denn Sie sagten vorhin im Gespräch selbst, Frau D., dass nicht nur der Chef von Herrn V. die<br />
Löhne anheben dürfte, sondern seine Konkurrenten dasselbe tun müssten, damit die Kunden<br />
wegen der höheren Preise des Möbelhauses, in welchem Herr V. arbeitet, nicht einfach woanders<br />
einkauften, nicht wahr?<br />
Herr V.: Ja, genau. Ich erinnere mich. Das sagten Sie, Frau D..<br />
Frau D.: So war es wohl.
Bürger B.: Genauso verhält es sich im Prinzip weltweit. Da wir uns aus den genannten Gründen<br />
nicht abschotten können, müssen wir uns dem Wettbewerb stellen. Hohe Löhne sind nur dann<br />
und insoweit gerechtfertigt, wenn dahinter eine hohe Produktivität steckt: Entweder stellt ein<br />
Arbeiter mit Hilfe einer guten Maschine und seinem Können mehr oder qualitativ hochwertigere<br />
Produkte her, um gegenüber seinem geringer bezahlten Kollegen im Ausland bestehen zu<br />
können, oder er wird sehr bald seinen Arbeitsplatz verlieren, weil die Kunden weder in Deutschland<br />
noch anderswo die in ihren Augen zu teuren Waren kaufen werden.<br />
Herr V.: Genauso wird es sich wohl verhalten, oder sehen Sie das anders, Frau D.?<br />
Frau D.: Das mag so sein. Gefallen tut es mir trotzdem nicht!<br />
Herr V.: Ob es nun gut so ist, wie es ist, können wir jetzt nicht klären, weil ich wieder ins<br />
Geschäft zurück muss. Aber vielleicht wollen Sie sich ja noch ein wenig unterhalten?<br />
Frau D.: Nein, nein. Auch ich habe noch <strong>Dr</strong>ingendes zu erledigen. Vielleicht sehen wir uns ja<br />
irgendwann noch einmal.<br />
Alle drei verabschieden sich voneinander. Bürger B. ist immer wieder darüber erstaunt, mit<br />
welcher Selbstsicherheit Zeitgenossen etwas vorgeben zu wissen, und sich dann, bei etwas<br />
näherem Hinsehen, sehr leicht die Unhaltbarkeit ihrer vorgebrachten Thesen herausstellt.<br />
Dieser Trialog sollte die Unsinnigkeit der sog. ‚Kaufkrafttheorie’, welche leider so oft Eingang<br />
in die öffentliche Debatte findet, verdeutlichen. Es ist in der Tat zu schön, um wahr zu<br />
sein, dass eine einfache Erhöhung der Löhne und Gehälter zu mehr Wohlstand für alle führt.<br />
Allerdings soll an dieser Stelle keinesfalls der Eindruck erweckt werden, dass die Entgelte der<br />
Arbeitnehmer niem<strong>als</strong> steigen oder sogar immer weiter sinken sollten. Ihre Höhe richtet sich<br />
nach ihrer Produktivität, so dass ein gut qualifizierter und fleißiger Mitarbeiter, der zudem mit<br />
modernen, sehr leistungsfähigen Arbeitsgeräten Güter produziert, auch dementsprechend gut<br />
entlohnt werden kann und soll! Wenn aber das Einkommen des Arbeitnehmers zu hoch ausfällt,<br />
so dass die Kosten für den Unternehmer derart steigen, dass er seine Produkte am Markt<br />
nicht mehr verkaufen kann, weil sie zu teuer geworden sind, dann muss er Leute entlassen<br />
oder sogar seinen Betrieb schließen. Und damit ist letztlich niemandem gedient. Daher gilt für<br />
alle Arbeitnehmer folgendes: Die Höhe ihrer Entlohnung durch den Unternehmer muss sich<br />
an den Gegebenheiten des Marktes ausrichten. Falls sie zu hoch ausfällt, ist die zwingende<br />
Folge eine höhere Arbeitslosigkeit, weil der Unternehmer die über dem Marktpreis liegenden<br />
Kosten nicht auf seine Produkte umlegen kann und dann eben Entlassungen vornehmen oder<br />
sogar ganz schließen muss. Dies gilt es insbesondere in einer weltweit vernetzten Wirtschaft –<br />
‚Globalisierung’ genannt – in ganz besonderer Weise zu beachten!<br />
Wie in sich fehlerhaft diese sog. ‚Kaufkrafttheorie’ ist, wird allein schon dadurch deutlich,<br />
dass sie selbst in einem völlig abgeschotteten Markt nicht funktionieren würde, wie es das<br />
oben angeführte Beispiel mit dem Möbelhaus in ganz einfacher Form zum Ausdruck brachte:<br />
Wenn der Chef all seinen Angestellten 500,-- € mehr zahlte und jene diese gesamte zusätzliche<br />
Kaufkraft nur für den Einkauf bei ihrem Arbeitgeber nutzten, dann bekäme er zwar die<br />
an seine Arbeitnehmer ausgezahlte Lohnerhöhung vollständig wieder zurück, wäre aber um<br />
seine Möbel ärmer. Ein solches Verlustgeschäft überlebt kein Betrieb sehr lange!<br />
Die Höhe des Faktorpreises Arbeit muss sich <strong>als</strong>o immer an seiner Produktivität ausrichten,<br />
denn lediglich durch Lohnerhöhungen wird schließlich kein zusätzliches Gut produziert, d.h.<br />
nur weil ich mehr Geldscheine in der Tasche habe, existieren nicht mehr Güter, da sie ja<br />
zunächst erst einmal hergestellt werden müssen. Erst durch mehr und / oder produktivere
Arbeit ist eine Vermehrung der volkswirtschaftlichen Leistung möglich, wobei den Unternehmern<br />
durch ihre Investitionsentscheidungen eine entscheidende Rolle zufällt. Dabei ist der<br />
Preis für den Faktor Arbeitskraft genauso zu behandeln wie andere Faktorpreise, die sich<br />
aufgrund von Angebot und Nachfrage bilden, wodurch am ehesten eine möglichst effiziente<br />
Allokation der Produktionsfaktoren mit all ihren gesamtwirtschaftlich positiven Folgen<br />
gewährleistet wird. Die beste Strategie für Arbeitnehmer, den Wert ihrer Arbeitskraft zu<br />
erhalten bzw. zu erhöhen, besteht in einer möglichst hohen Qualifikation, welche sich aber<br />
dabei sehr stark an den jeweiligen Marktbedürfnissen auszurichten hat, da niemand von<br />
anderen eine Entlohnung für etwas verlangen kann, das er gar nicht benötigt! In einer sozialen<br />
Marktwirtschaft müssen soziale Ausgleichsmaßnahmen für weniger leistungsfähige Menschen<br />
durch die staatlichen Sozi<strong>als</strong>ysteme erfolgen, damit ihnen immer, bei entsprechender<br />
Kooperationsbereitschaft, ein Existenzminimum garantiert ist.<br />
Die Frage, inwieweit Marktprozesse letztlich eher instabil sind oder nicht und was sich daraus<br />
für Konsequenzen in bezug auf die Rolle des Staates ergeben, kann meiner Meinung nach<br />
nicht so einfach beantwortet werden. Es lässt sich weder eindeutig empirisch nachweisen<br />
noch logisch begründen, inwiefern Marktprozesse allein aufgrund des gegebenen institutionellen<br />
Handlungsrahmens in sich stabil sind oder nicht. Dies hängt neben dem Handlungsrahmen,<br />
dessen entscheidende Bedeutung hier in keiner Weise geleugnet werden soll, sehr<br />
stark von den Menschen in einer Gesellschaft und ihrer kulturellen Prägung ab, wobei<br />
wiederum der Rahmen selbst großen Einfluss auf die Sozialisation ausübt und zugleich aber<br />
auch Produkt derselben ist. Wir haben es hier <strong>als</strong>o mit sehr komplexen, sich gegenseitig<br />
beeinflussenden Bedingungen zu tun, die niem<strong>als</strong> vollständig durch mathematische Modelle<br />
zu erfassen sind. Dennoch sind solche Modelle sehr hilfreich zum teilweisen Verständnis der<br />
Probleme und der Entwicklung von Lösungsansätzen, solange man sich der oben angesprochenen<br />
Komplexität dabei immer bewusst ist. Infolgedessen kann weder die Position der<br />
Keynesianer noch die der Monetaristen in dieser Frage eine befriedigende Antwort bieten.<br />
Ich bin daher der Überzeugung, dass der Staat durch die Schaffung geeigneter Rahmenbedingungen<br />
einen möglichst sich selbst regulierenden Marktprozess ohne größere Ungleichgewichte<br />
gewährleisten sollte. Nur wenn wirklich große Störungen vorliegen, dürfte er, nach<br />
einer eingehenden Ursachenanalyse der Probleme, eingreifen, um die Wirtschaft aus sich<br />
negativ verstärkenden Effekten herauszuführen. Dabei muss allerdings immer beachtet<br />
werden, dass das Staatsengagement nicht auf Dauer angelegt sein darf, weil es ansonsten die<br />
Selbstheilungskräfte des Marktes unterminiert und damit letztlich das Abdriften in eine Planwirtschaft<br />
droht! Vor allem sollte der Staat nicht <strong>als</strong> Verstärker konjunktureller Schwankungen<br />
durch eine leider häufig anzutreffende Politik unkoordinierter Eingriffe sowohl hinsichtlich<br />
der Rahmensetzung <strong>als</strong> auch der direkten Interventionen ins Wirtschaftsleben auftreten,<br />
denn eine Verunsicherung der Marktakteure infolge von großen Planungsunsicherheiten sind<br />
mit die größten Übel, welche aber oft aus kurzfristig-opportunistischen Motiven heraus erfolgen.<br />
Darüber hinaus sollte die staatliche Bürokratie einschließlich aller damit verbundenen Regulierungen<br />
auf ein notwendiges Minimum beschränkt bleiben, um einerseits Kosten zu sparen<br />
und andererseits den Handlungsspielraum der Marktakteure nicht unnötig einzuschränken, da<br />
gerade eine hohe Wettbewerbsintensität effiziente Lösungen entscheidend befördert und damit<br />
die gesamtwirtschaftliche Leistung einer Volkswirtschaft deutlich erhöht. So kann beispielsweise<br />
durch ein einfaches und transparentes Steuersystem mittel- bis langfristig nicht<br />
nur ein beträchtliches Sparpotential durch den Wegfall überflüssiger Beamtenstellen realisiert,<br />
sondern infolgedessen auch entsprechende Bürokratie in den Unternehmen eingespart werden,<br />
wodurch diese ihre Ressourcen viel mehr auf den eigentlichen Betriebszweck konzentrieren
könnten und zusätzlich noch viele, den Wettbewerb verzerrende Ausnahmetatbestände wegfielen.<br />
Ebenso sind Zwangsmitgliedschaften wie z.B. in den deutschen Berufsgenossenschaften<br />
für Arbeitgeber unbedingt zu vermeiden, weil hier zur Absicherung von Unfallrisiken für<br />
Arbeitnehmer die Mitgliedschaft in einer dem Wettbewerb nicht unterliegenden Monopoleinrichtung<br />
– eben jenen Berufsgenossenschaften – vorgeschrieben ist, anstatt die durchaus notwendige<br />
Absicherung in Form einer Versicherungspflicht vorzunehmen und damit einen<br />
Wettbewerb verschiedener Versicherungsgesellschaften, wie beispielsweise bei der Kfz-<br />
Haftpflichtversicherung, zu ermöglichen. Denn Monopole führen regelmäßig zu höheren<br />
Kosten für die gesamte Volkswirtschaft, weil der durch ein solches Begünstigte keine Konkurrenz<br />
zu befürchten hat und sich Ineffizienzen leicht erlauben kann, da er diese Kosten<br />
einfach auf die Abnehmer seiner Leistung umlegt und zumeist noch einen zusätzlichen Gewinn<br />
in Form einer sog. Monopolistenrente einstreicht; all dies geschieht zum Schaden aller<br />
anderen Wirtschaftssubjekte. Deshalb sind insbesondere staatlich sanktionierte Monopole in<br />
aller Regel zu vermeiden!<br />
Somit bleibt festzuhalten, dass ein Wirtschaftssystem in der Praxis so konstruiert sein muss,<br />
dass es überhaupt seine primäre Aufgabe, nämlich die ökonomischen Voraussetzungen für die<br />
freie Entfaltung der Persönlichkeit zu schaffen bzw. zu optimieren, erfüllen kann, wobei auch<br />
auf seine Nachhaltigkeit hinsichtlich nachfolgender Generationen zu achten ist. Alle Überlegungen,<br />
die um eine Verteilung von staatlichen Wohltaten an die jetzt lebenden Mitbürger<br />
kreisen, sollten immer auch die zukünftige ökonomische Leistungskraft einer Volkswirtschaft<br />
im Blick haben. Insbesondere das hemmungslose Schuldenmachen der vergangenen<br />
Jahrzehnte in Deutschland und anderswo ist ein gravierender Verstoß gegen das Nachhaltigkeitsprinzip.<br />
Hierbei gerät nur allzu leicht in Vergessenheit, dass die Schulden von heute die<br />
Steuern von morgen nach sich ziehen, für die dann diejenigen einzustehen haben, die ohnehin<br />
schon das zukünftig noch viel marodere Sozi<strong>als</strong>ystem finanzieren müssen!<br />
Ebenfalls sind ökologische Fragen gewissenhaft zu berücksichtigen. Obgleich auch im Umweltschutz<br />
die Kräfte des Marktes genutzt werden sollten, so muss der Staat die Rahmenbedingungen<br />
festlegen, so beispielsweise Grenzwerte bei der Belastung von Gewässern oder der<br />
Luft durch Industrie sowie Privathaushalte (man denke an PKWs oder Wohnhäuser). Es muss<br />
gerade auch hier das Prinzip der Kostenwahrheit Eingang finden, so dass die Kosten einer<br />
Nutzung der Umwelt internalisiert, d.h. in die Kostenkalkulation mit einbezogen und nicht<br />
einfach nachfolgenden Generationen aufgebürdet werden dürfen. Die rechtlichen Grundlagen<br />
dafür sind vom Staat zu schaffen. Allerdings muss darauf geachtet werden, dass ein einzelner<br />
Nation<strong>als</strong>taat nicht zu weit vorprescht und dadurch nur Verlagerungen einer Branche ins<br />
Nachbarland bewirkt. Damit wäre nur der heimischen Industrie geschadet und der Umwelt<br />
nicht geholfen. Obwohl man sicherlich auch <strong>als</strong> einzelner Staat in manchen Bereichen eine<br />
Vorreiterrolle einnehmen kann, so darf man hier aber nicht übertreiben, weil dies sonst nur zu<br />
Verlagerungen der Produktion und nicht zu mehr Umweltschutz führt. Infolgedessen sind<br />
gerade im Umweltschutzbereich internationale Vereinbarungen besonders wichtig!<br />
Abschließend lässt sich <strong>als</strong>o festhalten, dass eine soziale Marktwirtschaft, der ökologischen<br />
sowie ökonomischen Nachhaltigkeit verpflichtet sowie eingebettet in ein demokratisches und<br />
rechtsstaatliches System wohl die beste Lösung darstellt. Gerade marktwirtschaftliche Elemente<br />
kommen der individuellen Persönlichkeitsentfaltung sehr entgegen und bieten die<br />
besten Anreize zu ökonomisch effizientem Handeln. Dabei ist natürlich einerseits darauf zu<br />
achten, dass wirtschaftliche Sichtweisen niem<strong>als</strong> alleine alle Entscheidungen bestimmen und<br />
andererseits, dass sie aber auch nicht vernachlässigt werden dürfen, um die gesamte Leistungskraft<br />
des Gemeinwesens nicht zu gefährden. Bei alldem muss eine nachhaltige Nutzung<br />
der Natur gewährleistet sein und Raubbau auf Kosten insbesondere nachfolgender Generationen<br />
unbedingt vermieden werden.
5.11. Freiheit und Verantwortung:<br />
Finanzkrise, Schuldenkrise, Sozi<strong>als</strong>taatskrise, Eurokrise: All diesen Krisen ist neben<br />
allen Unterschieden eine Ursache gemeinsam: Das Auseinanderfallen von Freiheit und<br />
Verantwortung<br />
Freiheit und Verantwortung gehören untrennbar zusammen. Jeder Mensch soll frei darüber<br />
entscheiden können, was er tut oder lässt, solange er allen anderen Menschen in diesem Bestreben<br />
keinen ungebührlichen Abbruch tut sowie natürlich für die Folgen seiner Entscheidung<br />
selber einsteht und diese nicht anderen einfach aufbürdet. Daher haben wir uns in<br />
Deutschland, Europa und der ganzen westlichen Welt für Demokratie und Rechtsstaat sowie<br />
einer marktwirtschaftlich geprägten Wirtschaftsordnung entschieden. Denn in diesem Rahmen<br />
können die oben beschriebenen Werte am besten auch praktisch zur Geltung gelangen.<br />
Doch leider sind in den letzten Jahrzehnten diese an sich guten Werte – Demokratie, Rechtsstaat<br />
und Marktwirtschaft – durch Fehlentscheidungen einiger weniger aus der Wirtschaftselite<br />
sowie dem Großteil der politischen Eliten untergraben worden. Allerdings muss hierbei<br />
auch sofort klar gestellt werden, dass insbesondere das Verhalten der politischen Elite häufig<br />
– aber keineswegs immer, wie bei der Einführung des Euro in Deutschland gegen die Mehrheitsmeinung<br />
der Bevölkerung – durch die Mehrheit der Wähler entscheidend befördert worden<br />
ist. Welche Fehler meine ich genau damit? Nachfolgend wende ich mich nacheinander<br />
den drei oben genanten Krisenherden zu, um aufzuzeigen, inwieweit sie dem Auseinanderfallen<br />
von Freiheit und Verantwortung geschuldet sind.<br />
Beginnen wir mit der Finanzkrise: Die letzte große, weltweite Finanzkrise, die ihren dramatischen<br />
Höhepunkt im Jahre 2008 mit der Pleite der amerikanischen Investmentbank<br />
‚Lehman Brothers’ verzeichnete, hatte unter anderem einen gravierenden Wirtschaftseinbruch<br />
sowie eine nachhaltige Verunsicherung der Märkte – nicht nur der Finanzmärkte – zur Folge,<br />
die bis heute nicht überwunden ist. Wie konnte es dazu kommen? An vielen Stellen in Politik<br />
und Wirtschaft – in bezug auf letztere vor allem von Banken und Fondsgesellschaften – sind<br />
krasse Fehlentscheidungen dafür verantwortlich zu machen. Einige davon sollen hier nur kurz<br />
genannt werden:<br />
1. Die expansive Geldpolitik der amerikanischen Notenbank verbunden mit einer extremen<br />
Niedrigzinspolitik, die maßgeblich mit zu der Immobilienblase in den USA beigetragen<br />
hat<br />
2. Die von der US-Regierung verfolgte Strategie, dass möglichst viele Amerikaner eine<br />
eigene Immobilie ihre eigene nennen sollten, auch wenn sie nicht über genügend<br />
Eigenkapital und / oder Einkommen verfügten, so dass sie auf billige Kredite angewiesen<br />
waren<br />
3. Die Banken, die ohne entsprechende Risikoprüfung Immobilienkredite an wenig solvente<br />
Kunden vergaben<br />
4. Die komplizierte Bündelung von vielen Krediten, die kaum noch jemand durchschaute<br />
und dennoch von den US-Ratingagenturen, die eng mit dem Banken- und Finanzsystem<br />
in den USA verzahnt sind, mit Bestnoten bewertet worden sind<br />
5. Der weltweite Verkauf dieser unseriösen Finanzprodukte, deren Wert sich nach dem<br />
Platzen der Blase erdrutschartig verringerte; der letzte Besitzer der Papiere war dann<br />
der Dumme<br />
6. Die ungenügende Bankenaufsicht in den USA und in Europa, hier vor allem in Irland<br />
7. Die ungezügelte Gier von Bankern und Anlegern nach hohen Renditen
Diese Auflistung nimmt für sich selbstverständlich keine Vollständigkeit in Anspruch, sondern<br />
sollte nur noch einmal einige wesentliche Ursachen der Krise ins Gedächtnis rufen. In<br />
Deutschland fielen insbesondere öffentliche Kreditinstitute auf die windigen Finanzprodukte<br />
herein, <strong>als</strong>o jene, in welchen sich viele Politiker in den Aufsichtsgremien finden! Die Krise<br />
nach dem eigentlich absehbaren Platzen der Blase mit der Pleite der oben bereits genannten<br />
Investmentbank hatte neben einem starken Wirtschaftseinbruch auch einen erheblichen Liquiditätsverlust<br />
im Bankensystem zur Folge. Um die Insolvenz weiterer, großer Banken und<br />
damit den völligen Zusammenbruch unseres gesamten Finanzsystems zu verhindern, sprangen<br />
neben den Notenbanken vor allem die Staaten mit Stützungsmaßnahmen ein, welche die Verschuldung<br />
erheblich in die Höhe trieben. Der normale Steuerzahler – <strong>als</strong>o Arbeitnehmer,<br />
Selbständige und Unternehmer – haftete und tut dies immer noch für Fehler, die er nicht zu<br />
verantworten hat. Weder die Politiker, die viele politische Rahmenbedingungen f<strong>als</strong>ch<br />
gesetzt oder in Aufsichtsgremien von öffentlichen Banken kläglich versagt hatten, noch<br />
gierige Finanzjongleure in Banken und Fondsgesellschaften werden für ihr Handeln zur<br />
Verantwortung gezogen! Wenn Banker für windige Finanzgeschäfte irrsinnig hohe Bonuszahlungen<br />
bekommen, dann aber im Falle von zum Teil milliardenschweren Fehlentscheidungen<br />
in der Regel kaum oder gar nicht in Haftung genommen werden, widerspricht dies<br />
allen marktwirtschaftlichen Grundsätzen. Viele kleine Mittelständler hingegen haften mit<br />
ihrem ganzen Vermögen für Entscheidungen, die sie tagtäglich treffen. In einer Marktwirtschaft,<br />
die diesen Namen auch verdient, gehen Risiko, Gewinn und Haftung immer<br />
Hand in Hand! Sobald aber jemand nur die Gewinne einstreichen, aber im Fall, dass es<br />
schief geht, nicht für sein Handeln haftbar gemacht werden kann, ist es nur eine Frage der<br />
Zeit, bis er zu hohe Risiken eingeht und dann Schiffbruch erleidet. Schließlich haftet ja nicht<br />
er, sondern irgendjemand anderes. Das eine solche Art des Wirtschaftens nicht nachhaltig sein<br />
kann, leuchtet wohl jedem unmittelbar ein. Es ist daher völlig inakzeptabel, dass der Steuerzahler<br />
für das oben beschriebene Fehlverhalten auch zukünftig in Haftung genommen wird<br />
und immer wieder Banken retten muss. Man muss das Finanzsystem so gestalten, dass die<br />
Haftung der Manager für ihr Tun spürbar erhöht wird und dass Banken pleite gehen können,<br />
ohne dass damit das ganze Wirtschaftssystem in den Abgrund gestürzt wird. Dafür müssen<br />
Großbanken auch zerschlagen bzw. in verschiedene, voneinander getrennte Geschäftsbereiche<br />
aufgeteilt werden. Hierzu gibt es bereits viele durchdachte Lösungsvorschläge, die teilweise<br />
auch schon in der Umsetzung sind.<br />
Wichtig bei all dem ist, dass mit der Freiheit der eigenen Entscheidung auch die Haftung für<br />
die Folgen dieser Entscheidung einhergeht und dass unbeherrschbar große Risiken durch entsprechende<br />
Rahmenbedingungen, die von der Politik formuliert und in der Praxis durchgesetzt<br />
werden müssen, vermieden werden. Denn nur so gehen Freiheit und Verantwortung<br />
Hand in Hand!<br />
Nun zur Schuldenkrise: Fast alle westlichen Industrieländer sind hoch verschuldet, manche<br />
wohl auch schon überschuldet. Wie ist es soweit gekommen? Ich werde dies nachfolgend am<br />
Beispiel Deutschlands kurz skizzieren. Seit den 1970er Jahren wuchsen die Staatsschulden<br />
beständig, weil die Einnahmen aus Steuern, Abgaben und weiteren Quellen stets geringer <strong>als</strong><br />
die Ausgaben waren. Es wurden dafür alle möglichen Gründe genannt: ein wirtschaftlicher<br />
Abschwung sollte durch staatliche Ausgabenprogramme aufgehalten werden, soziale Leistungen<br />
wurden verteilt, von denen fast jeder Bürger irgendwie profitierte, die Infrastruktur<br />
(z.B. Straßen, Schienen, Wasserwege) wurde ausgebaut, die deutsche Einheit musste finanziert<br />
und zuletzt die Banken gerettet werden. Unabhängig davon, inwieweit jede Geldausgabe<br />
in den oben genannten Bereichen sinnvoll war oder nicht, eines haben sie alle nachhaltig mit<br />
verursacht: eine immer stärker steigende Staatsverschuldung! Wenn Deutschland ab sofort<br />
keine neuen Schulden mehr aufnehmen müsste und täglich ein Million Euro Schulden zurückzahlte,<br />
so würde es 5.408 Jahre dauern, bis alles abbezahlt wäre; bei einer Rückzahlung
von einer Million Euro pro Stunde wären es immer noch 225 Jahre! Dies kann man im<br />
‚Steuerzahler’, Ausgabe September 2011 auf den Seiten 4 und 5 nachlesen; der ‚Steuerzahler’<br />
wird vom ‚Bund der Steuerzahler’ herausgegeben. Und die Wähler haben in ihrer Mehrheit<br />
auch immer wieder diejenigen Parteien und Politiker gewählt, die ihnen die meisten Wohltaten<br />
versprachen, ohne für eine entsprechende Finanzierung jener Ausgaben durch die derzeit<br />
lebende Generation zu sorgen. Allen Beteiligten – Wählern wie Gewählten – musste dabei<br />
aber klar gewesen sein, dass dies auf Kosten der nachfolgenden Generationen geschah und<br />
weiterhin geschieht. Denn sie müssen für Zins und Tilgung von Schulden aufkommen, die sie<br />
selber nicht gemacht haben. Die Generation der Schuldenmacher nahm sich hingegen die<br />
Freiheit, jene Schulden aufzunehmen, ohne selber die Zeche dafür zu bezahlen. Es ist ja auch<br />
viel einfacher den Schuldenberg den nachfolgenden Generationen zu überlassen und es<br />
sich selbst erst einmal gut gehen zu lassen! Auf diese Weise fielen und fallen auch weiterhin<br />
Freiheit und Verantwortung auseinander und das nicht nur in Deutschland, sondern in fast<br />
allen entwickelten Industrieländern.<br />
Nun zur Sozi<strong>als</strong>taatskrise: Neben der hohen Verschuldung existiert in vielen Industrieländern<br />
eine Krise der Sozi<strong>als</strong>ysteme, wenn auch in unterschiedlichem Ausmaß. Auch hierbei<br />
will ich mich mit dem deutschen Beispiel auseinandersetzen. Weitgehend unstrittig ist in<br />
unserem Land, dass es einen Sozi<strong>als</strong>taat geben muss, der die großen Lebensrisiken wie<br />
Krankheit oder Versorgung im Alter absichert oder sonst wie unverschuldet in Not geratenen<br />
Menschen ein menschwürdiges Existenzminimum garantiert. Außerdem sorgt der Staat zudem<br />
beispielsweise für die schulische Ausbildung der Kinder und Jugendlichen. Das und noch<br />
vieles mehr sind Aufgaben des Sozi<strong>als</strong>taates. Dadurch soll verhindert werden, dass Menschen<br />
ganz auf sich allein gestellt und völlig ungeschützt ausschließlich dem freien Marktgeschehen<br />
ausgesetzt sind. Allen soll ein menschenwürdiges Dasein garantiert werden. Diese Grundsätze<br />
einer sozialen Marktwirtschaft finden meine volle Unterstützung und zwar sowohl aus prinzipiell<br />
moralischen Gründen <strong>als</strong> auch aus jenen der gesellschaftlichen und damit ökonomischen<br />
Stabilität. Man muss bei allen Sozialtransfers allerdings zunächst darauf achten, dass sie so<br />
angelegt sind, dass sie Menschen einen Anreiz geben, soweit wie möglich für sich selbst sorgen<br />
zu können. Dies ist für sie selber und ihr Selbstwertgefühl besser <strong>als</strong> dauernd auf Hilfe<br />
angewiesen zu sein und entlastet natürlich auch diejenigen, die durch ihre Steuern und Abgaben<br />
erst die Grundlagen für jedes soziale Umverteilungssystem liefern. Es ist moralisch<br />
äußerst unsolidarisch, wenn Hilfeempfänger nicht wirklich alles in ihrer Macht stehende tun,<br />
um denjenigen, die sie mit ihrem Geld unterstützen, nicht weiter zur Last zu fallen. Desweiteren<br />
muss ein gerechter Sozi<strong>als</strong>taat so aufgebaut sein, dass er zukünftige Generationen<br />
nicht ungebührlich belastet.<br />
Beides wird in Deutschland seit Jahrzehnten jedoch in hohem Maße missachtet, wobei es<br />
sogar eine ganze Reihe von Ländern – unter anderem im Euroraum – gibt, die diese Prinzipien<br />
noch viel stärker verletzt haben <strong>als</strong> Deutschland (vgl. weiter unten: Eurokrise). Unsere<br />
Sozi<strong>als</strong>ysteme in Deutschland bieten leider – trotz aller Reformen – immer noch genügend<br />
Schlupflöcher für jene, die sich nicht hinreichend bemühen, selber für ihren Lebensunterhalt<br />
aufzukommen. Beispielsweise finden Firmen für einfachste Arbeiten teilweise keine Mitarbeiter,<br />
obwohl eigentlich genügend Arbeitslose offiziell vorhanden sind. Zudem wird in einigen<br />
Medien zu sehr die Sicht der Hilfeempfänger ins Zentrum der Berichterstattung gestellt,<br />
ohne in ausreichendem Maße zu erläutern, dass die Leistungsträger dieser Gesellschaft durch<br />
ihre Steuern und Abgaben sowohl die wirtschaftlichen Grundlagen schaffen <strong>als</strong> auch die erforderlichen<br />
Zahlungen für den Sozi<strong>als</strong>taat leisten. So zahlen die obersten 10% über 50% der<br />
Einkommenssteuer in Deutschland. Ohne diese Leistungsträger und ihre seit Jahrzehnten geübte<br />
Solidarität würde der Sozi<strong>als</strong>taat augenblicklich zusammenbrechen! Wir sollten gerade<br />
diesen Menschen viel mehr Respekt zollen <strong>als</strong> bisher. Denn sie handeln so, wie es sein<br />
sollte: Freiheit und Verantwortung gehen Hand in Hand! Dabei übernehmen sie nicht nur
Verantwortung für sich selbst, sondern auch für andere. So schafft ein mittelständischer Unternehmer<br />
nicht nur Arbeitsplätze, sondern sorgt dafür, dass er selbst wie auch seine Mitarbeiter<br />
Steuern und Abgaben zahlen, die erst den staatlichen Umverteilungsmechanismus ermöglichen.<br />
Und für ihre freien Entscheidungen haften diese Unternehmer sogar häufig mit ihrem<br />
gesamten Vermögen. Dies sollten sich all jene einmal genauer vor Augen führen, die immer<br />
noch mehr Solidarität – sprich mehr Geld – von diesen Leistungsträgern fordern. Es ist doch<br />
viel mehr so, dass diese Leistungsträger schon seit Jahrzehnten Solidarität üben, aber der Staat<br />
trotz alledem die ganze Zeit durchweg mehr verteilt, <strong>als</strong> er einnimmt – bis heute! Anstatt weniger<br />
auszugeben, sollen entweder den Leistungsträgern noch mehr abverlangt oder aber<br />
höhere Schulden auf Kosten der nachfolgenden Generationen gemacht werden.<br />
Und hier sind wir bei beim zweiten Aspekt: In Deutschland werden spätestens seit den 1960er<br />
Jahren bis heute ganz offensichtlich Lasten auf zukünftige Generationen abgewälzt. So werden<br />
beispielsweise die jungen Leute, die heute ins Berufsleben starten, einerseits viel geringere<br />
Renten erhalten, <strong>als</strong> die derzeitige Rentnergeneration und andererseits dennoch höhere Beiträge<br />
und / oder Steuern bezahlen müssen, wenn unser Sozi<strong>als</strong>taat nicht völlig kollabieren<br />
soll. Gleiches gilt – auch infolge des demographischen Wandels (immer mehr alte Menschen<br />
und immer weniger junge) für die Kranken- und Pflegeversicherung sowie die Beamtenpensionen.<br />
Die zukünftigen Lasten, welche sich aus den Ansprüchen der Sozialversicherungssystemen<br />
bzw. den Beamtenpensionen ergeben, nennt man auch ‚implizite Staatsverschuldung’<br />
im Unterschied zur expliziten, mit welcher ich mich oben bereits auseinandergesetzt<br />
habe. Und diese implizite Staatsverschuldung ist sogar zwei- bis dreimal so hoch wie die<br />
explizite! Und all dies hinterlassen wir einer immer kleiner werdenden jüngeren Generation.<br />
Dies ist ein trauriges Beispiel dafür, wie es sich eine Generation bedenkenlos auf<br />
Kosten ihrer Kinder hat gut gehen lassen: Man nahm und nimmt sich weiterhin diese Freiheit<br />
einfach heraus, ohne selber die Verantwortung zu übernehmen. Die meisten Politiker – nicht<br />
alle, so beispielsweise Professor Biedenkopf – und die Mehrheit der Wähler verschlossen<br />
die Augen vor dieser Problematik und wählte den für sie einfacheren Weg zu Lasten der<br />
nachfolgenden Generation.<br />
Schließlich zur Eurokrise: Der Euro ist von den verantwortlichen Politikern – in Deutschland<br />
vor allem Helmut Kohl – eingeführt worden, ohne dass in jedem der betroffenen Länder das<br />
Volk direkt über eine so grundlegende Frage abstimmen konnte. Gerade in Deutschland war<br />
nach allen Meinungsumfragen eine große Mehrheit gegen die Abschaffung der D-Mark und<br />
deren Ersetzung durch den Euro. Viele Ökonomen haben dam<strong>als</strong> auf die Konstruktionsschwächen<br />
des Euro hingewiesen, so beispielsweise dass sehr unterschiedliche Volkswirtschaften<br />
einer einheitlichen Geld- und Zinspolitik durch die Europäische Zentralbank (EZB)<br />
unterworfen sind, ohne eine politische Union mit einer für alle Euroländer abgestimmten<br />
Wirtschafts-, Fiskal- und Steuerpolitik sowie Transferleistungen von reicheren zu ärmeren<br />
Staaten der Eurozone zu schaffen, um entstehende Ungleichgewichte auszugleichen. Doch<br />
gerade eine solche Transferunion sollte es nach deutscher Auffassung nicht geben, weil man<br />
nicht zu unrecht befürchtete, dass dies nur zu Lasten des deutschen Steuerzahlers gehen<br />
würde. Und das ahnten auch die Bürger in unserem Land dam<strong>als</strong>, so dass die politische Elite<br />
uns hoch und heilig versprach, es werde keine Transferunion geben. Man schrieb dies sogar<br />
rechtsverbindlich in die Verträge zur Währungsunion! Heute wissen wir, dass weder die abgegebenen<br />
Versprechen, noch rechtsgültige Verträge eingehalten werden. Die verantwortlichen<br />
Politiker brechen einfach das Recht, ohne irgendwelche Konsequenzen fürchten<br />
zu müssen! Aber auch die EZB bricht das Recht, indem sie Staatsanleihen hoch verschuldeter<br />
Euroländer kauft, obwohl dies vertraglich ausdrücklich verboten ist. Dadurch erhöht sich<br />
nicht nur mittel- bis langfristig die Inflationsgefahr, sondern die EZB verliert auch einen Teil<br />
ihrer politischen Unabhängigkeit, weil sie von der Zahlungsfähigkeit bzw. Zahlungswilligkeit<br />
jener Schuldnerländer abhängig geworden ist.
Und für all das haftet vor allem der deutsche Steuerzahler: spätestens sobald die Bürgschaften<br />
für hoch verschuldete Länder wie Griechenland fällig werden oder die EZB höhere Einlagen<br />
benötigt. Gerade in den südlichen Ländern der Eurozone sind die durch die Einführung des<br />
Euro stark gesunkenen Zinsen nicht im wesentlichen dafür genutzt worden, die Verschuldung<br />
spürbar zurückzuführen. Stattdessen hat man lieber das Geld weiterhin mit vollen Händen für<br />
teure Wahlversprechen gegenüber der eigenen Bevölkerung ausgegeben. Und die Wähler in<br />
diesen Ländern hatten natürlich auch keinerlei Skrupel, diese Wahlgeschenke auf Pump anzunehmen.<br />
Nun aber ist das Wehklagen groß, und man fordert von Deutschland Solidarität ein.<br />
Der deutsche Steuerzahler soll wieder für alles einstehen, ohne dass er gefragt wird. Alle<br />
Meinungsumfragen ergeben eine deutliche Mehrheit gegen all die Hilfspakete und Rettungsschirme,<br />
aber direkt darüber abstimmen darf der deutsche Bürger nicht. Es reicht, wenn er<br />
zahlt. Wir sehen <strong>als</strong>o auch an diesem Beispiel, wohin es führt, wenn Freiheit und Verantwortung<br />
nicht Hand in Hand gehen.<br />
Aus allen vier Krisen kann man <strong>als</strong>o folgendes Fazit ziehen: Wenn Freiheit und Verantwortung<br />
nicht hinreichend miteinander verbunden sind und zwar durch einen gesetzlichen Rahmen,<br />
dessen Einhaltung auch wirklich durchgesetzt wird, dann kann man mit großer Wahrscheinlichkeit<br />
davon ausgehen, dass viele Menschen sich bedenkenlos die Freiheit nehmen,<br />
aber die Verantwortung für ihr Handeln auf andere schieben, sei es auf nachfolgende Generationen<br />
oder auf andere Bürger im eigenen Land oder auf jene in anderen Ländern. Der kurzsichtige<br />
Egoismus feiert Triumphe auf Kosten anderer und zwar unabhängig vom Geldbeutel:<br />
Reiche wie Arme nutzen Systeme aus, wenn sie nicht wirksam in die Schranken gewiesen<br />
werden und sie davon ausgehen müssen, dass sie für ihr Handeln auch zur Verantwortung<br />
gezogen werden. Wenn <strong>als</strong>o Freiheit und Verantwortung nicht eng miteinander auch durch<br />
institutionelle Rahmenbedingungen miteinander wirksam verkoppelt sind, lädt dies einerseits<br />
zum moralisch verwerflichen Missbrauch ein. Andererseits führt diese Entkoppelung mittel-<br />
bis langfristig auch zu wirtschaftlichen wie gesellschaftlichen Verwerfungen, die irgendwann<br />
die Menschen teuer zu stehen kommen. Es fragt sich nur, wer dann letztlich die Zeche wird<br />
zahlen müssen.
5.12.: Wie sich Deutschland und Europa von der Zukunft verabschieden:<br />
Deutschland und Europa sind nicht nur biologisch alternde Gesellschaften mit immer mehr<br />
alten und immer weniger jungen Menschen, sondern sie haben auch viel von jenem jugendlichen<br />
Elan verloren, dem sie ihren Aufstieg bis ins zwanzigste Jahrhundert hinein zu verdanken<br />
haben. Nach der fürchterlichen Selbstzerfleischung in den beiden Weltkriegen gelang<br />
zwar – auch unter der Mithilfe der USA – ein Aufstieg aus den Trümmern des letzten Krieges,<br />
aber dann setzte sich zunehmend eine satte Selbstzufriedenheit durch. Man dachte und denkt<br />
vor allem an soziale Absicherung, Arbeitszeitverkürzung und möglichst hohe Renten im<br />
Alter. In vielen Ländern Europas galten bis zur derzeitigen Krise sichere Posten beim Staat,<br />
die einem auch nicht allzuviel Arbeitseifer abverlangen, <strong>als</strong> sehr erstrebenswert.<br />
Was hatte dies zur Folge? Die Sozi<strong>als</strong>ysteme verschlingen immer mehr Mittel, die von<br />
immer weniger Steuerzahlern zu erwirtschaften sind. Zudem stieg die Staatsverschuldung<br />
in astronomische Höhen. Und nun, in der Krise, bemerken viele die ersten Folgen<br />
dieses bequemen Lebens auf Kosten der Zukunft, der jungen Menschen. Aber das ist erst der<br />
Anfang!<br />
Und wie sieht es dagegen in aufstrebenden Ländern wie China aus? Dort wird vielfach in die<br />
Zukunft investiert, so beispielsweise in die Raumfahrt, wo China, wenn es so weiter geht, in<br />
nicht allzu ferner Zukunft Europa den Rang ablaufen wird.<br />
In Europa und Deutschland hingegen sind die meisten Menschen viel stärker an sozialen<br />
Wohltaten interessiert, die an die jetzige Generation verteilt werden sollen. Wie würde wohl<br />
eine Volksabstimmung ausgehen, bei der es darum ginge, ob man um 5% die Renten oder die<br />
Investitionen in die Raumfahrt bzw. in andere zukunftsträchtige Gebiete erhöhen sollte? Ich<br />
befürchte zugunsten der zuerst genannten Alternative.<br />
Ähnliches kann man regelmäßig beim Thema ‚Steuern’ erleben: Die Reichen – in der Regel<br />
die Leistungsträger der Gesellschaft, die ohnehin einen weit überproportionalen Anteil insbesondere<br />
bei den direkten Steuern tragen – sollen mehr zahlen, damit noch mehr – insbesondere<br />
an sozialen Wohltaten – verteilt werden kann. Häufig wird zwar auch das Thema ‚Bildung’<br />
genannt. Aber dort würden viele zusätzliche Mittel einfach in ineffizienten Systemen<br />
spurlos versickern. Hierbei beziehe ich mich auf Deutschland, dessen Bildungslandschaft ich<br />
recht gut aus eigener Erfahrung kenne. Unter Punkt 4. auf dieser Seite kann man viel Skandalöses<br />
dazu nachlesen.<br />
Die Schuldenkrise in vielen Ländern der EU ist – bis vielleicht auf Griechenland – noch<br />
längst nicht auf ihrem Höhepunkt angelangt. Das Schlimmste steht uns noch bevor. Aber jetzt<br />
schon ‚betteln’ Vertreter des Eurorettungsfonds (EFSF) schon unter anderem in China um<br />
Milliarden. So weit ist es nun schon mit dem einst so stolzen – aber teilweise leider auch<br />
übermütigen – Europa gekommen.<br />
Aber am meisten Sorgen bereitet mir, dass sich viele Deutsche und Europäer mit unserem<br />
Abstieg bereits abgefunden haben, keinen Ehrgeiz mehr entwickeln, dem mit jugendlicher<br />
Kraft entgegenzutreten. Viel mehr interessiert sie nur ihre Rente oder dergleichen. Und selbst<br />
bei vielen jungen Menschen – beispielsweise Schülern und Auszubildenden – treffe ich häufig<br />
auf keinerlei Unbehagen darüber, dass viele chinesische Schüler in ihrem Alter viel bessere<br />
Leistungen vollbringen <strong>als</strong> sie. Es interessiert die meisten überhaupt nicht. Sie vergessen, dass<br />
diese jungen Chinesen und andere es sind, mit denen sie in der weltweiten Wirtschaft werden<br />
konkurrieren müssen. Mit einer solchen Geisteshaltung verspielen wir unsere Zukunft!
5.13. Umsatzbasierte Unternehmenssteuer – Ein Befreiungsschlag aus dem Steuerdickicht:<br />
Ich möchte nachfolgend meinen Vorschlag für eine umsatzbasierte anstatt gewinnbezogene<br />
Unternehmenssteuer erläutern, die sicherlich den meisten Lesern auf den ersten Blick sehr<br />
ungewöhnlich vorkommen mag. Dennoch halte ich eine derartige radikale Vereinfachung des<br />
Steuersystems für außerordentlich sinnvoll, selbst wenn dies eine Steuerzahlung von Unternehmen<br />
zur Folge hätte, welche keinen Gewinn erzielten oder sich sogar in der Verlustzone<br />
bewegten und zwar allein schon aus folgenden zwei Gründen:<br />
1. die radikale Vereinfachung des Steuersystems führte zu spürbaren Kostenentlastungen<br />
für die Unternehmen durch Einsparungen in der Verwaltung bzw. bei der Steuerberatung<br />
durch dafür bezahlte Dienstleister,<br />
2. auch wenn ein Unternehmen Verluste macht, nutzt es die staatliche Infrastruktur und<br />
sollte dafür ein Entgelt entrichten; Unternehmen, die diese Steuer nicht mehr tragen<br />
könnten, müssten eben aus dem Markt ausscheiden, denn nur diejenigen, welche in der<br />
Lage sind, die für alles Wirtschaften notwendige Infrastruktur mit zu finanzieren, dürften<br />
weiter am Marktgeschehen teilnehmen, da eben ohne jene Infrastruktur die Grundlagen<br />
des Wirtschaftens, wie beispielsweise die Rechtspflege, nicht existierten.<br />
Wenn man eine solche Steuer aufkommensneutral in bezug auf die durchschnittlichen jährlichen<br />
Steuererträge, die aus dem gesamten unternehmerischen Handeln der letzten zehn Jahre<br />
resultierten, ausgestaltet, dann dürfte sie zwischen einem und zwei Prozent des Umsatzes liegen.<br />
Es geht mir an dieser Stelle zunächst einmal um eine völlig neue Struktur unseres Unternehmenssteuerrechtes,<br />
das einem Befreiungsschlag gleichkäme. Inwiefern darüber hinaus<br />
noch Nettoentlastungen der Unternehmen anzustreben sind, soll an dieser Stelle nicht Gegenstand<br />
der Erörterung sein.<br />
Ich will an einem einfachen Beispiel zunächst einmal verdeutlichen, in welcher Höhe sich die<br />
Steuerlast für Unternehmen bewegen würde:<br />
1. ein Kleingewerbetreibender mit einem jährlichen Umsatz von 100.000,-- € zahlte bei<br />
einem Prozent auf den Umsatz 1.000,-- € und bei zwei Prozent 2.000,-- € Steuern im<br />
Jahr,<br />
2. ein kleiner Mittelständler mit einer Million Euro Umsatz im Jahr zahlte demnach<br />
10.000,-- € bzw. 20.000,-- €,<br />
3. ein mittelgroßer Mittelständler mit zehn Millionen Umsatz im Jahr zahlte 100.000,-- €<br />
bzw. 200.000,-- €.<br />
Innerhalb dieser vorgeschlagenen Bandbreite hätte der Staat die Möglichkeit, die gleichen<br />
Steuereinnahmen wie bisher zu erzielen. Viele kleine und mittelgroße Unternehmen müssten<br />
zum Teil deutlich weniger Steuern zahlen, wohingegen insbesondere einige große Unternehmen,<br />
welche alle Möglichkeiten zur legalen Steuergestaltung nutzen konnten und können,<br />
eben mehr Steuern abzuführen hätten. Jeder Unternehmer kann sich ja einmal selbst ausrechnen,<br />
wie er nach dem hier unterbreiteten Vorschlag abschneiden würde.<br />
Bei Einzelunternehmen sowie Personengesellschaften soll den persönlich haftenden Unternehmern<br />
nach Abzug dieser pauschalen Unternehmenssteuer alles zur freien Verfügung<br />
stehen, d.h. es liegt dann ganz bei ihnen, ob oder wieviel sie privat entnehmen und wieviel sie<br />
im Unternehmen investieren. Bei Kapitalgesellschaften sollte meiner Meinung nach wie folgt<br />
verfahren werden, wobei die prinzipielle Vorgehensweise anhand einer Aktiengesellschaft<br />
dargelegt wird: nach Abzug der Steuern sind darüber hinaus die ausgeschütteten Dividenden<br />
an die Aktionäre von diesen nach dem Einkommenssteuertarif zu besteuern. Falls sich herausstellen<br />
sollte, dass eine solche Dividendenbesteuerung zu hoch wäre – z.B. aus Gründen der
internationalen Wettbewerbsfähigkeit –, müsste ein niedrigerer Satz angesetzt werden. Eine in<br />
dieser Hinsicht unterschiedliche Behandlung von Personen- und Kapitalgesellschaften zugunsten<br />
ersterer scheint mir deshalb gerechtfertigt, weil der persönlich haftende Unternehmer<br />
ein viel höheres Risiko eingeht, da er unbeschränkt mit seinem ganzen Vermögen haftet. Bei<br />
diesen Unternehmern im ‚klassischen Sinne’ handelt es sich zumeist um kleinere mittelständische<br />
Betriebe, die in ihrer Region verhaftet sind und neben der Schaffung von Arbeitsplätzen<br />
vor Ort auch häufig weitere Verantwortung in ihrer Gemeinde übernehmen. Sie sind<br />
viel mehr auf den Standort Deutschland angewiesen und können nicht so leicht ins Ausland<br />
ausweichen, wodurch sie sich ebenfalls genötigt sehen, für eine gedeihliche Umgebung mit<br />
Sorge zu tragen, um selber wirtschaftlich zu überleben. Daher bin ich der Meinung, dass<br />
solche Unternehmensformen dieses Privileg auch und gerade wegen der daraus resultierenden<br />
Vorteile für unser Land verdient hätten. Denn solche Unternehmer schauen i.d.R. nicht nur<br />
auf den kurzfristigen Profit, sondern blicken längerfristig in die Zukunft und das letztlich zum<br />
Wohle aller.<br />
Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung sollten ausnahmslos der pauschalen Unternehmenssteuer<br />
unterliegen, wobei <strong>als</strong> Bemessungsgrundlage die Miete abzüglich der Kosten für<br />
Wasser, Abwasser, Müllentsorgung, Straßenreinigung, Hausstrom, Heizkosten sowie einer<br />
Verwaltungspauschale von 5% bezogen auf die gesamten Mieteinnahmen. Aufwendungen für<br />
die Instandhaltung, Abschreibungen jeglicher Art sowie Versicherungskosten sind nicht zu<br />
berücksichtigen. Aufgrund solcher Absetzungsmöglichkeiten waren die Steuererträge für ganz<br />
Deutschland in einigen Jahren sogar negativ! Hierdurch hätte einerseits der Staat eine sicher<br />
überschaubare Einnahmequelle und müsste nicht, wie es in der Vergangenheit teilweise der<br />
Fall war, noch draufzahlen. Andererseits könnte der Vermieter seine Steuerbelastung leicht<br />
ermitteln, damit sicher kalkulieren und seine Entscheidungen nach rein ökonomischen Gesichtspunkten<br />
treffen, ohne nach steuerlichen Abschreibungstatbeständen Ausschau zu halten.<br />
Dies würde eine wesentlich effizientere Allokation der Produktionsfaktoren auch im Immobilienbereich<br />
zur Folge haben sowie einer daraus resultierenden Wohlstandsoptimierung für die<br />
gesamte Gesellschaft.<br />
Wie eine pauschale Besteuerung bei Versicherungen und Banken, die genauso einfach, international<br />
konkurrenzfähig und ohne große Verzerrung der rein ökonomischen Kostenverhältnisse<br />
durch die Steuererhebung genau auszusehen hat, lasse ich hier bewusst offen, weil ich<br />
mir diesbezüglich momentan nicht sicher genug bin und gerne Vorschläge von Experten aufnehmen<br />
möchte. Es muss sich allerdings um eine ähnliche Art der Steuerfestsetzung wie oben<br />
beschrieben handeln, was sicherlich möglich ist.<br />
Eine solch radikale Vereinfachung des Steuersystems für Unternehmen würde geradezu eine<br />
revolutionäre Veränderung der Rahmenbedingungen bedeuten. Nach dem hier zur Diskussion<br />
stehenden Modell wären Investitionsentscheidungen der Unternehmen von der Steuererhebung<br />
fast völlig unbelastet, weil z.B. nicht mehr nach irgendwelchen Abschreibungstatbeständen<br />
Ausschau zu halten wäre, um die Steuerlast zu minimieren. Unternehmer hätten den<br />
Kopf frei, ausschließlich nach unternehmerisch sinnvollen Gesichtspunkten ihr Verhalten auszurichten,<br />
so dass eine viel effizientere Allokation der Produktionsfaktoren <strong>als</strong> zurzeit zu erwarten<br />
wäre, was der gesamten Volkswirtschaft und nicht nur dem einzelnen Unternehmer<br />
zugute käme. Zudem sparten sowohl der Staat <strong>als</strong> auch die Unternehmen eine Menge an dann<br />
überflüssiger Bürokratie ein. Man denke bei den Unternehmen an all die Ressourcen, die für<br />
steuerliche Fragen von der Gestaltung bis zur Dokumentation verbraucht werden und welche<br />
immensen Kosten dies verursacht. Das Gleiche gilt für die aufwendige staatliche Bürokratie.<br />
In diesem Zusammenhang muss unbedingt auch Wegfall der völlig anachronistischen Gewerbesteuer<br />
berücksichtigt werden. Da hier ein aufkommensneutraler Vorschlag unterbreitet<br />
wird, entstünden den öffentlichen Kassen keine Einnahmeeinbußen durch den Wegfall dieser<br />
Steuer.
Durch ein derart einfaches und überschaubares Unternehmenssteuersystem sparten <strong>als</strong>o sowohl<br />
Unternehmen wie auch der Staat allein durch den Wegfall überflüssiger Bürokratie viel<br />
Geld ein, ohne dass weniger Mittel für die öffentliche Hand zur Verfügung stünden. Darüber<br />
hinaus würden – wie oben bereits erwähnt – die Unternehmensführungen den Kopf ausschließlich<br />
frei haben für den eigentlichen Betriebszweck: nämlich der möglichst preiswerten<br />
wie qualitativ hochwertigen Herstellung von Gütern und Dienstleitungen, ohne bei allen<br />
Entscheidungen immer auch den Aspekt der Steuergestaltung berücksichtigen zu müssen.<br />
Ebenso wäre dieses Steuermodell international sowohl wegen seiner Einfachheit <strong>als</strong> auch<br />
seiner relativ niedrigen Gesamtbelastung für die Unternehmen außerordentlich konkurrenzfähig,<br />
so dass erheblich mehr ausländische Investoren <strong>als</strong> zurzeit hierzulande ihr Kapital anlegten,<br />
wodurch nicht zuletzt die dringend notwendigen Arbeitsplätze geschaffen werden<br />
würden. Selbst wenn es infolge dieses neuen Steuersystems in einigen wenigen Ausnahmefällen<br />
zu einer geringfügigen Verteuerung bei manchen Produkten kommen sollte, so würde<br />
dies gesamtwirtschaftlich durch die oben genannten Faktoren weit überkompensiert werden,<br />
und es träte eine spürbare Wohlstandsmehrung bezogen auf die gesamte Volkswirtschaft ein.<br />
Diejenigen Unternehmen, welche nicht imstande wären, ihren Beitrag für das Gemeinwesen<br />
zu leisten, dürften diese Aufwendungen nicht einfach den anderen Mitbewerbern sowie den<br />
Bürgern aufbürden und müssten dann eben aus dem Marktgeschehen ausscheiden. Schließlich<br />
trägt selbst jeder Bürger, zumindest über die indirekten Steuern, zur Finanzierung des Staates<br />
bei, wobei der Solidarität mit Menschen natürlich eine ganz andere Qualität zukommt, <strong>als</strong> die<br />
Sorge um das Weiterbestehen eines gewinnorientierten Unternehmens. Darüber hinaus ist es<br />
durchaus wünschenswert, dass weniger leistungsfähige Betriebe nicht mehr weiterbestehen<br />
und durch effizienter wirtschaftende ersetzt werden, weil insbesondere bei einer schrumpfenden<br />
und gleichzeitig älter werdenden Bevölkerung Wachstum nur durch Produktivitätssteigerungen<br />
zu erzielen ist.<br />
Gegen eine solch pauschale, umsatzbasierte Gewinnermittlung <strong>als</strong> Grundlage der Steuerlastberechnung<br />
für Unternehmen könnte man einwenden, dass damit das Prinzip der Leistungsfähigkeit<br />
bezogen auf den jeweiligen Einzelfall nicht hinreichende Beachtung fände und es<br />
somit ungerecht wäre. Wenn man sich allerdings den heutigen Zustand des Steuerrechtes mit<br />
seinen unzähligen Bestimmungen anschaut, in deren Folge sich viele Firmen – insbesondere<br />
einige Großkonzerne – ganz legal so arm rechnen können, dass sie kaum oder gar keine<br />
Steuern mehr zahlen, stellt sich das Gerechtigkeitsproblem viel eher <strong>als</strong> bei dem hier unterbreiteten<br />
Vorschlag, wonach eine solche Praxis definitiv ausgeschlossen wäre. Selbst falls das<br />
jetzige deutsche Unternehmenssteuerrecht vereinfacht, aber dennoch eine weitgehend einzelfallgerechte<br />
Gewinnermittlung angestrebt werden würde, müssten z.B. weiterhin komplizierte<br />
Abschreibungstabellen erstellt, viele Sondertatbestände genau definiert und umfangreiche<br />
Prüfungen vorgenommen werden. Und selbst dann bleibt das Problem der Ermittlung des ‚tatsächlichen’<br />
Gewinns, der ja <strong>als</strong> Grundlage des Leistungsfähigkeitsprinzips dient, bestehen,<br />
auch wenn das Regelwerk sehr ausführlich, aber damit notwendig äußerst kompliziert und<br />
folglich für die Unternehmen sehr kostspielig ist, ohne dabei jenes Leistungsfähigkeitsprinzip<br />
<strong>als</strong> Basis für die angestrebte Einzelfallgerechtigkeit in vielen Fällen auch nur annähernd zu<br />
erreichen, wie es das deutsche Beispiel sehr eindrucksvoll zeigt. Infolgedessen sollte man sich<br />
von diesem Irrweg vollständig verabschieden und stattdessen die hier dargelegte Pauschalregelung<br />
einführen.<br />
Ein weiterer Vorteil dieses Steuersystems bestünde in den sehr viel gleichmäßiger fließenden<br />
Steuereinnahmen für den Staat, wodurch eine wesentlich bessere Planungsgrundlage für alle<br />
Gebietskörperschaften gewährleistet wäre, da der Umsatz, auf welchem letztlich die Ermittlung<br />
der Steuerlast beruht, deutlich geringeren Schwankungen unterliegt, <strong>als</strong> es bei der bisherigen<br />
Berechnungsmethode der Fall ist, so dass die Aufstellung der öffentlichen Haushalte<br />
zurzeit mit ganz erheblichen Unsicherheiten belastet ist. Zudem könnten mithilfe des hier<br />
vorgeschlagenen Steuersystems die sog. ‚Steueroasen’, welche vornehmlich von großen,
international tätigen Konzernen sowie reichen Privatleuten gerne genutzt werden, um Steuern<br />
zu sparen, wirkungsvoll ausgetrocknet werden. Denn nach dem hier vorgeschlagenen System<br />
der umsatzbasierten Besteuerung im Land der Produktion bzw. Leistungserstellung könnten<br />
Gewinne nicht mehr in die genannten Steueroasen durch findige legale wie illegale Tricks<br />
verlagert werden, wodurch beispielsweise dem deutschen Fiskus jährlich viele Milliarden<br />
entgehen und zwar zum Schaden aller anderen Steuerzahler sowie Empfänger bzw. Nutznießer<br />
staatlicher Leistungen.<br />
Ebenfalls darf der enorme psychologische Effekt einer derart leicht überschaubaren Regelung<br />
des Steuerrechtes nicht unterschätzt werden. Um es noch einmal hervorzuheben:<br />
Unternehmer könnten nicht nur sehr schnell ihre Steuerlast für das vergangene Geschäftsjahr<br />
genau ermitteln, sondern fast ebenso problemlos relativ treffsichere Schätzungen für das<br />
laufende anstellen, ohne sich mit äußerst komplizierten Regelungen auseinanderzusetzen.<br />
Dies würde die Planung von Investitionen wesentlich erleichtern, allein schon weil man dabei<br />
nicht mehr immer die steuerlichen Aspekte im Hinterkopf behalten müsste. Gerade dieser<br />
Sachverhalt käme einem psychologischen Befreiungsschlag gleich, der weit über die rein<br />
berechenbaren Effizienzgewinne infolge erhöhter Planungssicherheit oder der kaum noch<br />
gegebenen Verzerrung betriebswirtschaftlicher Entscheidungen durch die Steuererhebung<br />
hinausging. Man müsste weder befürchten, alle Absetzmöglichkeiten nicht ausgeschöpft und<br />
damit Geld verschenkt zu haben, noch wären unangenehme Steuerprüfungen zu erwarten. Die<br />
eben aufgeführten Aspekte spielen bei vielen Selbständigen eine außerordentlich große Rolle,<br />
wodurch auch zum Teil völlig irrationale Handlungsweisen hervorgerufen werden, nur um<br />
Steuern zu sparen, so dass dann manchmal gravierende Fehlentscheidungen getroffen werden,<br />
welche sogar Arbeitsplätze in den Unternehmen gefährden. In diesem Zusammenhang darf<br />
ebenfalls das Signal einer derartigen Regelung verbunden mit einem akzeptablen und vor<br />
allem leicht verständlichen Steuersystem an ausländische Investoren nicht vernachlässigt<br />
werden, da jene leicht und sicher die steuerliche Belastungsgröße eines Engagements berechnen<br />
könnten. Auch hier spielt der psychologische Effekt eine wichtige Rolle, allein weil<br />
durch die Einfachheit eines solchen Systems viel Zeit bei den anzustellenden Überlegungen<br />
gespart werden würde und Entscheidungsträger aufgrund ihres häufig sehr engen Zeitbudgets<br />
sich eher einem Standort mit derartigen Rahmenbedingungen zuwendeten.<br />
Schließlich möchte ich noch das Signal, das von dem oben beschriebenen Steuermodell für<br />
die dringend notwendige Entbürokratisierung aller anderen öffentlichen Bereiche in unserem<br />
Land ausginge, ansprechen. Neben den ganz erheblichen Einsparungen bei den Staatsausgaben<br />
bedeutete eine durchgreifende Entbürokratisierung auch eine Entfesselung unseres mit<br />
vielen sinnlosen Regelungen geradezu eingemauerten Gemeinwesens, welches äußerst demotivierend<br />
insbesondere auf diejenigen wirkt, die im wahrsten Sinne des Wortes etwas<br />
unternehmen wollen. Wir benötigen dringend einen radikalen Mentalitätswandel in Deutschland<br />
hin zu mehr Flexibilität, Phantasie und Eigenverantwortung und weg von der alles lähmenden<br />
bürokratischen Fesselung unserer Gesellschaft. Dies kann aber nur gelingen, wenn<br />
vieles vereinfacht und pauschal geregelt wird, denn die damit verbundenen Chancen sind<br />
wesentlich höher zu veranschlagen, <strong>als</strong> die dann nicht mehr so genau erzielbare Einzelfallgerechtigkeit.<br />
Außerdem muss man noch in Betracht ziehen, dass viele der heute in der<br />
staatlichen Bürokratie Tätigen nicht mehr dort gebraucht würden und somit andere, für die<br />
Gesellschaft viel sinnvollere Arbeiten verrichten könnten. Wenn der Staat überflüssige Bürokratie<br />
beseitigt, hat er zudem mehr Ressourcen für notwendige Regulierungen übrig und verzettelt<br />
sich nicht. Die internationale Finanzkrise, welche im Jahr 2008 begann, zeigt dies eindrucksvoll:<br />
Der Staat muss sich auf die effektive Regulierung zentraler Bereiche konzentrieren,<br />
damit das Wirtschaftsleben möglichst reibungslos funktioniert. Aber er hat darauf zu<br />
achten, dass derartige Regulierungen auch wirklich gut kontrollierbar sind und dabei einerseits<br />
weder der unternehmerische Freiraum unnötig eingeschränkt wird, noch andererseits ein
systemgefährdender Wildwuchs, wie er im Rahmen der Finanzkrise sichtbar wurde, entstehen<br />
kann.<br />
Nach der Einführung eines derart einfach gestalteten Steuersystems bestünde für alle Seiten<br />
ein hohes Maß an Planungssicherheit sowohl für den Staat <strong>als</strong> auch für die Unternehmen,<br />
ohne komplizierte Steuergesetze einschließlich aller möglichen Umgehungstatbestände zu<br />
studieren. Der Vorteil liegt vor allem in der gleichmäßig niedrigen Grenzbelastung infolge des<br />
einheitlichen Tarifes, wodurch sich dann eben wirklich ‚Leistung lohnt’!<br />
Die für den Gesamtstaat erzielten Steuereinnahmen sollten unter den drei Ebenen – Bund,<br />
Länder und Gemeinden – so aufgeteilt werden, dass jede von ihnen auch die Aufgaben, die<br />
von ihr am besten zu erledigen sind, finanzieren können soll. Dabei muss darauf geachtet<br />
werden, dass z.B. die Länder und Kommunen ein Eigeninteresse besitzen, Unternehmen bei<br />
sich anzusiedeln. Um dies zu gewährleisten, müssen bei den zu entwickelnden Aufteilungsschlüsseln<br />
auch Leistungselemente miteinfließen, welche die Wirtschaftskraft der dort ansässigen<br />
Firmen in Rechnung stellen, so dass z.B. die Einnahmen eines Landes oder einer Gemeinde<br />
bei einer guten Ansiedelungspolitik für Unternehmen für einen regeren Zulauf sorgen<br />
und dies durch höhere Einnahmen belohnt wird.<br />
Abschließend sollen nochm<strong>als</strong> stichwortartig die wesentlichen Vorteile des hier vorgeschlagenen<br />
Unternehmenssteuerrechts aufgeführt werden:<br />
1. Kosteneinsparungen in den Unternehmen durch den Wegfall der Steuerbürokratie,<br />
2. Kosteneinsparungen in der staatlichen Steuerbürokratie,<br />
3. höhere Planungssicherheit sowie Überschaubarkeit für Unternehmen hinsichtlich der<br />
zu erwartenden Steuerbelastung,<br />
4. wesentlich größere Gleichmäßigkeit der Steuereinnahmen für die öffentliche Hand sowie<br />
eine damit verbundene höhere Planungssicherheit bei der Aufstellung der Haushalte,<br />
insbesondere für die Kommunen,<br />
5. wirkungsvolle Austrocknung der sog. Steueroasen,<br />
6. unternehmerisches Handeln richtet sich bei weitem nicht mehr so stark wie heute an<br />
steuerlichen Gestaltungsmöglichkeiten aus, sondern konzentriert sich viel mehr auf<br />
den eigentlichen Zweck des Unternehmens: die Erstellung von Gütern und Dienstleistungen<br />
zu einem möglichst günstigen Preis-Leistungs-Verhältnis, wodurch nicht<br />
nur das einzelne Unternehmen, sondern auch die gesamte Gesellschaft profitiert,<br />
7. ein solcher Schritt hätte erhebliche positive psychologische Effekte für eine weitergehende<br />
Abschaffung unnützer bürokratischer Regelungen in vielen anderen Bereichen<br />
zur Folge,<br />
8. schließlich wäre ein solches Steuersystem viel gerechter <strong>als</strong> das derzeitige in Deutschland.<br />
Wer mehr mit mir Kontakt aufnehmen möchte, kann dies am besten über folgende<br />
E-Postadresse:<br />
info@drbottke.de
6. Menschliches, Allzumenschliches:<br />
6.1. Einleitung:<br />
Menschen, wie sie waren, wie sie sind und wahrscheinlich immer sein werden, mit ihren<br />
unterschiedlichsten Eigenschaften:<br />
Liebenswertes, Vorbildliches, Marotten, Skurriles, Egoistisches, Rücksichtsloses, Böses und<br />
sehr Böses.<br />
Obgleich der Titel aus einem berühmten Werk von Friedrich Nietzsche hier <strong>als</strong> Überschrift<br />
für diese Rubrik herangezogen wird, so bedeutet dies keineswegs, dass nachfolgend eine Auseinandersetzung<br />
mit besagter Schrift erfolgt. Lediglich erschien uns dieser Titel für unser<br />
Vorhaben sehr passend zu sein. Denn nachfolgend sollen in kurzen wie treffenden Beispielen<br />
unterschiedlichste menschliche Verhaltensweisen, die häufig Rückschlüsse auf den wahren<br />
Charakter der Handelnden zulassen, dargestellt werden. Sie sollen neben der kurzweiligen<br />
Unterhaltung vor allem der Läuterung bzw. Selbstläuterung dienen, wobei letzteres wohl nur<br />
denjenigen gelingt, die nicht nur über andere, sondern auch über sich selbst lachen können.<br />
Bei schwerwiegenderen charakterlichen Mängeln bedarf es natürlich mehr, <strong>als</strong> eines bloßen<br />
Schmunzelns über sich selbst. Der einem hier vorgehaltene Spiegel in Form der dargebotenen<br />
Geschichten soll den guten Menschen in seinem Tun bestärken sowie den Übeltäter zur Besinnung<br />
und Umkehr bewegen. Wie oft das gelingt, muss hier offen bleiben. Aber einen Versuch<br />
ist es allemal wert. Zudem hilft es vielleicht dem oder anderen, gute Menschen zu erkennen<br />
und sich vor weniger guten in Acht zu nehmen.<br />
Teilweise werden in den kurzen Texten menschliche Verhaltensweisen und die Rückschlüsse<br />
auf deren jeweiligen Charakter sehr zugespitzt formuliert, um dem Leser eine leichte wie<br />
schnelle Orientierung zu ermöglichen. Falls jemand beispielsweise die ein oder andere Handlungsweise,<br />
die in diesen Geschichten zur Sprache gebracht wird, an sich selbst manchmal zu<br />
erkennen meint, heißt das noch nicht automatisch, dass er mit dem dort beschriebenen guten<br />
oder schlechten Menschen vollkommen gleichzusetzen wäre. Er sollte sich dann überlegen,<br />
wie oft er sich so, wie derjenige in der Geschichte Beschriebene, verhält, um daraufhin für<br />
sich selbst die entsprechenden Konsequenzen zu ziehen.<br />
Als Handlungsorte der Geschichten sind ausgewählt worden:<br />
Schule, Hochschule, Wohngemeinschaft und Arbeitsplatz<br />
Wir wählten <strong>als</strong> Handlungsorte diese vier, weil wir der Meinung sind, dass sich hier sehr<br />
häufig Allzumenschliches geradezu beispielhaft ereignet und so gut wie alle Menschen mit<br />
einem, mehreren oder allen Orten eigene, zum Teil sehr einprägsame Erfahrungen verbinden.<br />
Nun wünschen wir allen Lesern dieser Seite Erkenntnisgewinn, verbunden mit Freude beim<br />
Lesen. Vielleicht ist es in manchen Fällen durchaus angebracht, die ein oder andere Geschichte<br />
im Büro, in der Schule, der Uni oder WG auszuhängen und wo man mehr davon im Internet<br />
finden kann; unter anderem natürlich auf unserer Seite.
6.2. Schule:<br />
6.2.1. Die engagierte Lehrerin:<br />
So gut wie alle Menschen in Deutschland haben ihre ganz eigenen, vielfältigen Erfahrungen<br />
mit der Schule gemacht oder machen sie zurzeit noch, sei es direkt <strong>als</strong> Schüler, Eltern oder<br />
Lehrkräfte. Wir wollen nachfolgend Erfreuliches wie weniger Erfreuliches aus dem heutigen<br />
Schulalltag zum Besten geben und freuen uns über Zuschriften aus diesem Bereich, die Interessantes<br />
zu berichten wissen.<br />
Es gibt sie wirklich: engagierte Lehrerinnen und Lehrer. Hier soll stellvertretend für alle vorbildlichen<br />
Lehrkräfte das Beispiel einer Lehrerin stehen.<br />
Sie bemüht sich wirklich vielfältig um ihre Schüler, auf dass sie den Schulstoff nicht nur verstehen,<br />
sondern sogar noch – zumindest teilweise – Spaß beim Lernen haben. Als Deutschlehrerin<br />
hat sie in ihrer Freizeit eine Theater-AG ins Leben gerufen, um den Stoff einiger<br />
Werke der klassischen Literatur den Schülern möglichst lebensnah zu vermitteln. So spielen<br />
sie antike <strong>Dr</strong>amen oder Stücke aus der Epoche ‚Sturm und <strong>Dr</strong>ang‘ nicht nur nach, sondern<br />
übertragen die dort behandelten menschlichen Schicksale auf die heutige Zeit. Dieses aktive<br />
Aneignen bereitet den teilnehmenden Schülern große Freude. Leider beteiligen sich an solchen<br />
Projekten immer wieder dieselben: Es sind die aktiven, kreativen Schüler (Gegenteil:<br />
‚Die müde Masse‘, Artikel auf dieser Seite).<br />
Auch wenn sinnvolle Angebote von außerhalb an die Schule herangetragen werden, ist diese<br />
vorbildliche Lehrerin sofort dabei. So beim Buchstabierwettbewerb, der von ebenfalls engagierten<br />
Unternehmern organisiert wird. Sie versucht möglichst viele Schüler in ihren Klassen<br />
von einer Teilnahme zu überzeugen, sie spricht mit Kollegen, damit auch sie weitere Teilnehmer<br />
gewinnen.<br />
Doch leider stößt sie weder bei allen Schülern noch Lehrkräften auf die gewünschte Resonanz.<br />
Es sind halt immer wieder dieselben und zwar in beiden Gruppen, die sich aktiv einbringen<br />
oder aber jene, die träge alles abblocken (siehe: ‚Die müde Masse‘). Trotzdem gibt<br />
sie nicht auf, sondern versucht immer wieder ihr bestes zu geben und freut sich über jeden<br />
Erfolg.<br />
Ebenfalls honoriert sie, wenn sich Schüler wirklich ernsthaft bemühen. Sie spricht ihnen Mut<br />
zu, auch wenn es einmal nicht so klappen will und streicht die Fortschritte heraus, die sie<br />
machen, anstatt auf ihnen und ihren Fehlern herumzuhacken, sie gar vor der Klasse bloßzustellen<br />
(siehe: ‚Wirklich böse Lehrkräfte‘).<br />
Solche Vorbilder kann es nie genug geben. Danke und weiter so!
6.2.2. Der selbstkritische Lehrer:<br />
Lehrer wissen immer alles, vor allem alles besser, so ein gängiges (Vor)Urteil. Leider trifft<br />
dies nur allzu oft zu. Dennoch gibt es glücklicherweise auch andere. So soll nachfolgend von<br />
einem Lehrer die Rede sein, der auch einmal vor der Klasse offen eingesteht, von einem Themenbereich,<br />
den er gerade in der Klasse behandelt, selber nicht alles zu wissen.<br />
Es ging um die weltweite Finanzkrise im Jahre 2008. Die Schüler fragten ihren Lehrer nach<br />
den Gründen für das sich abzeichnende Desaster, wie das alles zusammenhänge, wer, wann<br />
was f<strong>als</strong>ch gemacht habe und wann die Krise vorbei sein würde. Das alles konnte der Lehrer<br />
natürlich nicht beantworten. All das hätte auch sonst kein Mensch beantworten können. Aber<br />
der Lehrer gab auch zu, dass er trotz seines Studiums einiges nicht wusste, das allerdings<br />
durchaus zu wissen möglich sei. So sagte er sich und den Schülern, dass man doch Sachverstand<br />
von außen an die Schule holen solle, um sich von einem Experten das ein oder andere<br />
besser erklären zu lassen. Gesagt getan. Es fand sich ein Bankkaufmann, der viel Interessantes<br />
vor der Klasse über Börsen und Banken zu berichten wusste. Es war dem Lehrer überhaupt<br />
nicht peinlich, einmal selbst die Schülerrolle wieder einzunehmen, sich zu melden und Fragen<br />
an den Fachmann zu stellen.<br />
Eine wirklich gute Erfahrung für Schüler wie Lehrer. Weiter so!
6.2.3. Der jammernde Lehrer:<br />
Jeder kennt das Bild des Klage führenden Lehrers. Dieser Typus verschweigt hartnäckig die<br />
Privilegien, die mit seinem Berufsstand einhergehen und betont anderen gegenüber stets,<br />
welche Marter seine Arbeit mit sich brächte. Besonders redselig wird dieser Typus, wenn er<br />
auf seinesgleichen trifft. Dann entsteht eine Art Wettbewerb um die Frage: Welcher Lehrer<br />
jammert am besten? Aus solchen Gesprächen zieht der jammernde Lehrer kurzfristig neue<br />
Energie, obwohl er für keine seiner Probleme einen Lösungsansatz erhalten hat. Für einen<br />
kurzen Augenblick hat er das Gefühl, dass sein Leben unter einem heroischen Motto steht:<br />
Lehrer haben’s schwer, aber nehmen’s leicht! Es gibt aber auch allzu viel, worüber ein Lehrer<br />
jammern kann.<br />
Die Schüler von heute machen einem den Alltag manchmal regelrecht zur Hölle, und die<br />
Eltern tun ihr übriges, um dem Gefühl Nahrung zu geben, von Gegnern umzingelt zu sein.<br />
Bleiben wir zunächst bei den Schülern. Sie müssen unterrichtet werden, aber das ist eine<br />
große Herausforderung, besonders in den höheren Klassen. Kaum einer macht sich eine Vorstellung<br />
davon, welche Stoffmenge ein Lehrer beherrschen muss. Lauscht man den Klagen<br />
könnte man den Eindruck gewinnen, dass selbst an die Bildung eines Professors geringere<br />
Anforderungen gestellt würden <strong>als</strong> an einen jammernden Lehrer. Trifft jedoch der jammernde<br />
Lehrer zufällig einmal auf jemanden, dem er intellektuell nicht gewachsen ist, dann gibt er<br />
sich ganz kleinlaut.<br />
In Wahrheit ist die fachliche Überforderung der Lehrer häufig hausgemacht. Wer ein Fach<br />
studiert, weil er Beamter werden will, der bringt es in der Regel niem<strong>als</strong> zu einer tiefergehenden<br />
Identifikation mit dem, was er lernt. Häufig wird nur das allernötigste gemacht. Später in<br />
der Schule rächt sich diese Haltung. Auf einmal steht man vor einer Klasse und sieht sich<br />
mitunter einer müden Masse gegenüber, in der man sich auf der Uni selbst allzu wohl gefühlt<br />
hat. Schnell kommt es zu Frustration, denn weil man sich immer nur für den Stoff der nächsten<br />
Prüfung interessiert hat, fehlt es an einem Gespür für fachliche Zusammenhänge. Wer<br />
hingegen für sein Fach brennt, der läuft viel weniger Gefahr, sich ausgebrannt zu fühlen. Als<br />
besonders ärgerlich erweisen sich die Schüler, die jenes tiefergehende Interesse an einem<br />
Fach mitbringen und den jammernden Lehrer mit seinem Nichtwissen konfrontieren. Ihnen<br />
gegenüber fühlt sich der Klagende besonders hilflos und versucht sie durch eine Mischung<br />
aus Autorität und guten Noten ruhigzustellen.<br />
Neben fachlicher Kompetenz fehlt es dem jammernden Lehrer oft noch an pädagogischen<br />
Fähigkeiten. Auch was das angeht, mag er bei Gleichgesinnten auf Verständnis stoßen, aber<br />
in Wahrheit ist er selbst schuld, denn niemand hat ihn gezwungen, einen Beruf zu ergreifen,<br />
der verlangt, größere Gruppen von Kindern und Jugendlichen führen zu können. Auch hier<br />
lockte der Beamtenstatus offensichtlich. Dass man ein Leben lang Kinder unterrichten müsste,<br />
wozu es gewisse Qualifikationen verlangt, hat man verdrängt, bis es zu den ersten Unterrichtssituationen<br />
kommt. Ein solcher Typus Lehrer kann sich nur mit übertriebener Autorität<br />
Respekt verschaffen oder lässt sich auf der Nase herumtanzen. In jedem Fall rechnet der<br />
Klagende die Tage bis zu seiner Frühpensionierung aus, wobei er Mittel und Wege ersinnt,<br />
wie man diesen Eintritt möglichst noch weiter nach vorne verschieben könnte. Bis dahin<br />
bleibt das Klagen im trauten Kreise.<br />
Wir haben noch nicht über die Eltern gesprochen. Die machen sich überhaupt keine Vorstellung<br />
von dem Lehrerberuf. Meistens arbeiten sie in der freien Wirtschaft und müssen Leistungen<br />
erbringen, die in der Regel ziemlich transparent nachzuvollziehen sind. Bei krassem Fehlverhalten<br />
können sie ihren Arbeitsplatz verlieren. Obwohl es bei immer mehr Arbeitnehmern<br />
mit dem Geld knapp ist, müssen sie für ihr Alter ansparen, weil ihnen, selbst wenn sie lange<br />
in die Rentenversicherung eingezahlt haben, nur eine verhältnismäßig bescheidene Rente<br />
bleibt. In der Tat, wer mit solchen Sorgen umgehen muss, macht sich wirklich keine Vorstellung<br />
von den Privilegien des Lehrerberufs.
Fazit: Jammernde Lehrer kann sich ein Land, das wie Deutschland so sehr auf die Bildung<br />
und die Vermittlung derselben angewiesen ist, nicht leisten. Sie verschlingen viel Geld und<br />
leisten verhältnismäßig wenig. Lehrer sollten ebenfalls nach Leistung bezahlt werden. Das<br />
wäre nur gerecht, denn der vorbildliche Lehrer würde dann aus dem langen Schatten treten,<br />
den die jammernde Fraktion auf ihn und seine engagierten Kollegen wirft.
6.2.4. Die müde Masse:<br />
Sie gibt es leider, die müde Masse. Viel zu viele träge Schüler wie Lehrkräfte, die nur das tun,<br />
was sie unbedingt tun müssen. Alles darüber Hinausgehende weisen sie zurück. Sie haben ja<br />
eh schon so viel um die Ohren. Bloß nicht noch mehr von dem, was auch nur ansatzweise<br />
nach Arbeit riecht! Nachfolgend ein soll an einem treffenden Beispiel diese Einstellung dargestellt<br />
werden. Es hat sich in Wirklichkeit genauso abgespielt!<br />
Von einem engagierten Unternehmer wurden kostenlose Informationsangebote zusammen mit<br />
einer Bank für Schulklassen angeboten. Dort sollten die Schüler einiges über das Bankwesen<br />
erfahren, wie man sich richtig bewirbt und was für Anforderungen die Unternehmen an Auszubildende<br />
stellen. Der Unternehmer dachte sich, dass dies doch Schüler wie Lehrer gleichermaßen<br />
interessieren müsste, da er diesen Versuch gerade in einer Zeit in Angriff nahm, <strong>als</strong><br />
dauernd in den Medien über einen Lehrstellenmangel geklagt worden ist. Zunächst wandte er<br />
sich an seine Hausbank, um diese Aktion gemeinsam zu organisieren. Der Bankdirektor war<br />
sofort einverstanden und erteilte ohne große Diskussion sein Einverständnis, die Räumlichkeiten<br />
sowie Personal der Bank zur Verfügung zu stellen. Daraufhin schrieb der Unternehmer<br />
frohgemut die Schulen in seiner Umgebung an, um sie zu einer Teilnahme einzuladen. Es<br />
waren über zehn Schulen. Was nun geschah, glaubt man kaum, aber genauso trug es sich zu.<br />
Bis auf zwei Schulen, lehnten alle übrigen ohne Angabe nachvollziehbarer Gründe einfach ab<br />
oder antworteten nicht einmal. Trotz telefonischer Nachfrage bei jenen, von denen er eine<br />
Absage bzw. keine Antwort erhalten hatte, blieben sie bei ihrer Verweigerungshaltung, ohne<br />
Nennung von Gründen. Aber wenigsten zwei Schulen hatte er für sein Projekt gewonnen.<br />
Doch er musste sich auch dort zunächst in Geduld üben. Wofür es bei der Bank nur eines<br />
kurzen Gespräches bedurfte, dazu brauchten die Schulen, die zugesagt hatten, über ein halbes<br />
Jahr. Erst dann konnte die erste Veranstaltung stattfinden. Danach gab es nur noch eine. Denn<br />
von jeder Schule nahmen aus allen neunten und zehnten Klassen nur jeweils ungefähr 20 Interessierte<br />
das Angebot an. Wie der Unternehmer von den engagierten Lehrkräften, die sich für<br />
dieses Projekt stark gemacht hatten, erfuhr, suchten fast alle der nicht teilnehmenden Schüler<br />
noch eine Lehrstelle. Unglaublich, aber wahr!<br />
In beiden Veranstaltungen hörten die Schüler aufmerksam zu und stellten auch einige Fragen.<br />
So weit, so gut. Jeweils am Ende der beiden Veranstaltungen unterbreitete der Unternehmer<br />
den anwesenden Schülern ein attraktives Angebot, welches er zuvor mit dem Bankdirektor,<br />
der ebenfalls persönlich jedesmal mit dabei war, abgesprochen hatte: Er bot den Schülern<br />
kostenlos die Teilnahme an den von ihm angebotenen Wirtschaftsarbeitsgemeinschaften an,<br />
in welchen sich die Schüler mit dem Thema ‚Wirtschaft‘ in interessanter Form auseinandersetzen<br />
könnten. So wollte er Politiker, Wirtschaftsverbände und Gewerkschaften in das<br />
Projekt miteinbeziehen. Der Bankdirektor versicherte den Schülern, dass eine Teilnahme an<br />
einem solchen Projekt die Chancen für eine erfolgreiche Bewerbung erheblich erhöhe, da sie<br />
ja von dem Unternehmer dafür eine Bestätigung erhielten. Bei seiner Bank, die jedes Jahr<br />
ausbilde, achte man jedenfalls auf solche Dinge. Darüber hinaus bot der Bankdirektor allen<br />
Schülern, die sich an diesen Arbeitsgemeinschaften beteiligen würden, ein gebührenfreies<br />
Konto mit einem kleinen Startkapital an. Die Schüler müssten <strong>als</strong>o nichts bezahlen, sondern<br />
bekämen obendrein für ihre Teilnahme noch Geld geschenkt! Und nun geschah das Unglaubliche:<br />
Obwohl mehrere Schüler gerade dabei waren, sich bei Banken um eine Lehrstelle zu<br />
bewerben, nahm niemand von ihnen dieses Angebot wahr. Lediglich ein Mädchen, welches<br />
weiter zur Schule gehen wollte, fand sich bereit, dieses großzügige Angebot anzunehmen.<br />
Dem Bankdirektor wie dem Unternehmer fehlten die Worte ob dieser Trägheit verbunden mit<br />
unverzeihlicher Dummheit!!<br />
Schließlich gelang es dem Unternehmer noch auf anderem Wege, weitere Schüler für sein<br />
Projekt der Wirtschaftsarbeitsgemeinschaften zu gewinnen. Diese wahre Geschichte über<br />
Schulen, Lehrkräfte und Schüler verdient es, verbreitet zu werden.
6.2.5. Ein wirklich böser Lehrer:<br />
Wirklich böse Lehrkräfte sind glücklicherweise eher selten an den Schulen anzutreffen, aber<br />
es gibt sie leider dennoch. Sie missbrauchen ihre Macht, insbesondere gegenüber schwächeren<br />
Schülern bzw. gegenüber Schülern, von deren Eltern sie aufgrund ihrer sozialen Stellung<br />
weniger effektive Gegenwehr zu erwarten haben. Nachfolgend soll beispielhaft von einem<br />
solchen Exemplar berichtet werden: einem Mathe-Lehrer.<br />
Ein Schüler der sechsten Klasse, welcher in der Grundschule immer sehr gut in Mathe war,<br />
hatte nun schon über ein Jahr besagten Mathe-Lehrer und stand zu Beginn der sechsten Klasse<br />
auf der Note 5. Bei einem Gespräch mit diesem Mathe-Lehrer erfuhr seine Mutter, dass ihr<br />
Sohn große Verständnisschwierigkeiten aufweise und sie doch überlegen solle, ihn von der<br />
Schule zu nehmen. Doch dies wollte die allein erziehende Mutter erst einmal nicht und<br />
wandte sich an ein Nachhilfeinstitut, um die Probleme in diesem Fach in den Griff zu bekommen.<br />
Sie entschied sich für den Einzelunterricht, bei dem der Schüler allein zusammen mit<br />
seinem Nachhilfelehrer übt. Sehr schnell bemerkte sein Nachhilfelehrer, dass der Schüler<br />
eigentlich ein sehr gutes mathematisches Verständnis an den Tag legte. Er konnte sich daher<br />
seine schlechte Note nicht erklären. Der Schüler berichtete, dass der Mathe-Lehrer bei Nachfragen<br />
im Unterricht nicht auf die Schüler einging, sondern mit seinem Unterricht einfach<br />
fortfuhr. Vor Klassenarbeiten sei er zudem immer sehr nervös, weil der Lehrer darin häufig<br />
noch nicht behandelten Stoff abfrage oder aber Aufgaben vorkämen, die nach seiner ausdrücklichen<br />
Versicherung gegenüber der Klasse nicht vorkommen würden. Da wurde der<br />
Nachhilfelehrer misstrauisch und übte mit seinem Schüler auch Dinge, die eigentlich erst<br />
später drankommen sollten sowie alle denkbaren Aufgaben aus dem gerade in der Schule<br />
durchgenommenen Stoffgebiet. Der Schüler merkte schnell, dass ihm Mathe eigentlich doch<br />
liege und stürzte sich mit immer mehr Begeisterung auf die Mathe-Aufgaben. Und siehe da,<br />
seine schriftlichen Noten verbesserten sich von einer 5 auf eine gute 2, die eigentlich eine 1<br />
hätte sein müssen. Aber der Lehrer suchte akribisch nach Möglichkeiten, dem Schüler diese<br />
Note nicht zu geben, indem er eine eigentlich gut lesbare Zahl <strong>als</strong> eine andere las oder andere<br />
Kleinigkeiten suchte, sie aber so gut wie gar nicht finden konnte. So musste besagter Mathe-<br />
Lehrer dem Schüler bei schriftlichen Arbeiten und Tests eine gute Note geben. Aber im<br />
Mündlichen gab er ihm weiterhin lediglich eine 4, obwohl der Schüler immer seine Hausaufgaben<br />
richtig erledigte und sich eifrig meldete, wie seine Klassenkameraden zu bestätigten<br />
wussten. Ebenfalls war er ein Schüler, der den Unterricht nicht durch Schwatzen störte oder<br />
unaufmerksam war. Dies entsprach auch der Einschätzung aller anderen Lehrerinnen und<br />
Lehrer, die er in den übrigen Fächern hatte. Als die Mutter den Mathe-Lehrer darauf bei<br />
einem Eltersprechtag ansprach, entgegnete er ihr in zuckersüßem Ton, dass ihr Sohn sich<br />
zwar schriftlich verbessert habe, aber eben nicht mündlich. Dies tue ihm wirklich leid. Beides<br />
war offensichtlich gelogen. Der Lehrer hatte es nicht verwinden können, dass eine Mutter, die<br />
obendrein nicht zu den Wohlhabenderen zählt, es gewagt hatte, ihm in seiner Einschätzung<br />
ihres Jungen zu widersprechen und damit offensichtlich sogar noch Recht hatte. Bis zum<br />
Ende der sechsten Klasse hat er den Schüler nicht einmal gelobt, sondern nur bei der kleinsten<br />
Kleinigkeit kritisiert, auch vor der ganzen Klasse. Aber das kam nicht oft vor, da der Lehrer<br />
trotz seiner intensiven Bemühungen kaum etwas Kritisierenswertes finden konnte. Der Junge<br />
gewann an Selbstbewusstsein und bekam in der siebten Klasse einen neuen Mathe-Lehrer, bei<br />
dem er nur noch sehr gute Noten schrieb.<br />
Leider gibt es böse Menschen in allen Berufen, die ihre Macht Schwächeren gegenüber missbrauchen.<br />
Selbstkritik ist ihnen fremd. Kritik von außen empfinden sie <strong>als</strong> eine Art ‚Majestätsbeleidigung’.<br />
Einzig und allein auf <strong>Dr</strong>uck von oben, von Stärkeren beugen sie sich willfährig,<br />
um dann aber ihren Frust nur umso ungehemmter an Unterlegenen auszulassen. Wie<br />
gesagt, diese Art von Menschen gibt es leider in allen Berufen.
6.2.6. Die überengagierten Eltern:<br />
Überfallsartig kommen sie in die Sprechstunde eines ahnungslosen Lehrers gestürmt, sparen<br />
sich die Begrüßung und verleihen sogleich lauth<strong>als</strong> ihrer Empörung über die ungerechte Behandlung<br />
ihres Sprösslings Ausdruck. Der Sohn wurde gezwungen, die Eltern zu begleiten. Er<br />
sitzt nun etwas beklommen da und wohnt einer Szenerie bei, die er nur allzu gut kennt und für<br />
die er sich sehr schämt. Seine Eltern sind der unumstößlichen Auffassung, dass ihr Kind zu<br />
Höherem berufen sei. Um sich selbst und auch ihrem Sohn, der im Gymnasium mittelmäßige<br />
Noten schreibt, zu beweisen, was sie selbst schon vor seiner Geburt wussten, nämlich dass er<br />
überdurchschnittlich intelligent sein werde, musste der Sohn etliche Tests über sich ergehen<br />
lassen. Diesem Prozedere haben die Eltern ihren Sprössling so lange unterzogen, bis sie ein<br />
Gutachten hatten, das ihren Vorstellungen entsprach, wobei hinzufügt werden muss, dass das<br />
Gutachten derart viele Fachbegriffe enthält, dass der Laie nicht recht daraus schlau wird. Mit<br />
anderen Worten: Das Gutachten eröffnet gewisse Interpretationsspielräume. Mit kämpferischer<br />
Laune und dem besagten Gutachten ausgestattet, sitzen die überengagierten Eltern nun<br />
in der Sprechstunde des ziemlich überrumpelt dreinschauenden Lehrers. Ihr Ziel ist es vor<br />
allen Dingen, dem Lehrer klar zu machen, dass ihr Sprössling bessere Noten verdient hätte,<br />
weil er nun einmal hochbegabt sei, Punkt. Ein vernünftiges Gespräch ist mit ihnen leider nicht<br />
möglich. Der Lehrer gibt zu verstehen, dass der Junge kein schlechter Schüler sei und sogar<br />
mit Fleiß und Einsatz noch besser werden könnte. Das alles wollen die Eltern nicht hören,<br />
weil sie sich vollkommen in die Vorstellung hineingesteigert haben, dass man im Gegensatz<br />
zu ihnen die vorhandene überdurchschnittliche Intelligenz ihres Kindes nicht erkennen wolle.<br />
So geht es ein wenig hin und her, wobei der Lehrer stets höflich bleibt, während die Eltern zu<br />
unsachlichen Bemerkungen übergehen. Schließlich kommen die Eltern zu dem Ergebnis, dass<br />
man mit diesem Lehrer einfach nicht reden könnte und wollen wutschnaubend wieder abziehen.<br />
Als der Sohn und der Lehrer sich höflich voneinander verabschieden wollen, zerrt die<br />
Mutter ihren Sprössling unsanft fort. Der Lehrer bleibt mit einem unguten Gefühl zurück.<br />
Sein Schüler tut ihm leid.
6.2.7. Der abwimmelnde Lehrer:<br />
Er hasst Elterngespräche und versucht sie so kurz wie möglich zu halten. Meistens gelingt<br />
ihm das auch. Heute haben sich zwei Elternteile in seine Sprechstunde verirrt, die zwar nicht<br />
viel Geld haben, aber denen die Bildung ihrer Tochter eine Herzensangelegenheit ist. Die<br />
Tochter hat zwar Probleme in der Schule, ist aber motiviert, stört nicht den Unterricht, erledigt<br />
ihre Aufgaben sorgfältig und möchte sich verbessern. Die Eltern ermutigen ihre Tochter<br />
in ihrem Engagement und helfen ihr mit ihren bescheidenen Mitteln so gut sie können. Sie<br />
suchen nun das Gespräch mit dem Lehrer, weil sie einige Auskünfte über die Mitarbeit ihrer<br />
Tochter wünschen. Außerdem wollen sie den Lehrer bitten, das Engagement ihrer Tochter zu<br />
fördern.<br />
Der abwimmelnde Lehrer erkennt sogleich, mit wem er es hier zu tun hat: gutmütige Eltern<br />
mit niedrigem Sozialprestige. Mit der Klientel hat er einfaches Spiel. Er versteht den Namen<br />
des Kindes nicht richtig, wirft aber einen bedeutungsvollen Blick in sein Notenbuch und beginnt<br />
einige Sätze über Schule und das Leben im allgemeinen abzusondern. Die Schülerin sei<br />
nicht zu schlecht, nicht zu gut und müsse noch manches lernen, so sein Fazit. Die Eltern<br />
wollen es genauer wissen und stellen konkretere Fragen nach ihrer Tochter. Der Lehrer<br />
weicht in alle Richtungen aus und wiederholt im wesentlichen das, was er vorher bereits von<br />
sich gegeben hatte. Die Eltern merken, dass sie so nicht weiterkommen und möchten nun auf<br />
die Förderung ihrer Tochter zu sprechen kommen. Damit haben sie dem Lehrer eine Steilvorlage<br />
geliefert, der nun auf Kollegen XY verweist, der eine entsprechende AG betreibe. Man<br />
könne sich gerne an ihn wenden. Leider sei nun die Zeit der Sprechstunde schon vorbei. Bei<br />
Bedarf könnten sie sich bei ihm melden, um einen neuen Termin zu vereinbaren.<br />
Die Eltern sind sehr enttäuscht, aber auch eingeschüchtert und haben Angst, dass sie ihrer<br />
Tochter schaden würden, wenn sie bei diesem Lehrer weiter insistierten. Missmutig verlassen<br />
sie die Sprechstunde. Der Lehrer bleibt mit einem triumphierenden Gefühl zurück.
6.3. Hochschule:<br />
Die Universitäten und Fachhochschulen sind ein wirklich interessanter Ort, an dem sich die<br />
unterschiedlichsten Charaktere tummeln. Auf dem Campus gibt es viele Begegnungsmöglichkeiten:<br />
so beispielsweise der Hörsaal, die Cafeteria, häufig auch Sport- und Schwimmhallen,<br />
die Sprechzimmer der Dozenten, AStA- und Fachschaftsräume oder Wohnheime. Es handelt<br />
sich hier wirklich um ein interessantes Biotop, auf dem viel gedeiht und zwar längst nicht nur<br />
in wissenschaftlicher Hinsicht. Wir wollen uns in den nachfolgenden auf das Menschliche<br />
konzentrieren.<br />
6.3.1. Der ewige Student:<br />
Ein gerne gebrauchtes Klischee, der ewige Student. Aber, wie so oft bei derartigen Klischees,<br />
liegt dem ein wahrer Kern zugrunde. Nachfolgend soll von einem eher liebenswerten Chaoten<br />
die Rede sein, der nichts wirklich auf die Reihe kriegt und trotzdem fest davon überzeugt ist,<br />
das richtige Leben zu leben. Ob dies wirklich so ist, soll hier dahingestellt bleiben.<br />
Seine genaue Semesterzahl lässt sich nicht so genau ermitteln, da er sich schon in unterschiedlichsten<br />
Fächern versucht hat. Lediglich dass sie zweistellig sein muss, steht zweifelsfrei fest.<br />
Neben Germanistik studiert er zurzeit auch Indologie, nachdem er vor einem Jahr ein Urlaubssemester<br />
in Indien verbracht hat. Vieles dort faszinierte ihn sofort, insbesondere diejenigen,<br />
die nach dem Motto lebten: ‚In der Ruhe liegt die Kraft‘. Ihm lag dieses eher Kontemplativ-meditative.<br />
Hektik ist nicht seine Sache. Man muss sich ja auch Zeit lassen, um die Dinge<br />
von Grund auf zu verstehen. Man benötigt eben viel Zeit, um sich in literarische Werke richtig<br />
hineinversetzen zu können. Allein schon, wenn die historischen Hintergründe, vor denen<br />
ein Autor sein Werk verfasste, in all ihren interessanten Details verstanden werden wollen.<br />
Dazu ist viel Zeit und Muße erforderlich. Die <strong>als</strong> Regelstudienzeit vorgesehene Semesteranzahl<br />
reicht dafür selbstredend keinesfalls aus. Schließlich sollte gerade ein sprach- wie<br />
geisteswissenschaftliches Studium auch vor allem der Persönlichkeitsbildung dienen und<br />
weniger, viel weniger zur Findung eines einträglichen Karrierejobs. Allein schon das Wort<br />
‚Karriere‘ ruft bei ihm innerlich heftige Abwehrreaktionen hervor. Ihn interessiert der<br />
schnöde Mammon nicht. Er lebt lieber bescheiden in seiner WG und diskutiert gerne existentielle<br />
Fragen mit seinen Mitbewohnern. Das Geldverdienen beschränkt er auf das unbedingt<br />
notwendige Minimum. Finanzielle Vorsorge ist ihm vollkommen fremd, er lebt, was das<br />
angeht von der Hand in den Mund und glaubt, das damit verbundene Risiko durch sein<br />
soziales Netzwerk beherrschbar zu halten. Denn durch die aufrichtige Hilfsbereitschaft, die<br />
keineswegs nur dem egoistischen Motiv besagter Absicherung entspringt, sondern wirklich<br />
von Herzen kommt, hat er sich viele Freunde geschaffen. Es entspricht auch viel er seiner<br />
Gesellschaftsvorstellung, dass sich die Menschen aus Mitgefühl gegenseitige helfen und<br />
unterstützen sollten, anstatt nur egoistisch für sich das Beste herauszuschlagen und dabei<br />
womöglich noch andere übers Ohr zu hauen. In seinem privaten Umfeld versucht er geduldig<br />
in Gesprächen, die Menschen von dieser Utopie zu überzeugen. Trotz aller aufrichtiger<br />
Hilfsbereitschaft seinerseits gegenüber anderen nimmt er es mit Terminabsprachen – nun ja<br />
sagen wir einmal – nicht immer ganz so genau. Manchmal dauert ein wichtiges Gespräch<br />
eben etwas länger, so dass er beim Umzug einer Bekannten erst gegen Mittag erscheint, <strong>als</strong><br />
die schweren Möbel schon von den übrigen Helfern in den fünften Stock des Altbaus ohne<br />
Aufzug gewuchtet worden sind. Er versucht sein Zuspätkommen dadurch wieder gut zu<br />
machen, dass er am nächsten Tag für alle ein wirklich ausgefallenes Mal zubereiten will,<br />
dessen Rezept er von seiner Reise aus Indien mitgebracht hat. Einschränkend fügt er kleinlaut<br />
hinzu, dass sie ihm lediglich für die Beschaffung der notwendigen Gemüse und dergleichen<br />
finanziell aushelfen müssten. Er versichert aber sofort, dafür auch das Abspülen ganz alleine<br />
zu übernehmen. Da die anderen ihn und seine Eigenheiten kennen und ihn im Grunde eigent-
lich auch mögen, willigen sie ein. So ist er nun mal. Wirklich vorausschauende oder gar<br />
exakte Planung ist ihm ein Graus. Da kommt einem ja jede Spontaneität abhanden. Nein, auch<br />
in seinem Zimmer in der WG deute nichts auf irgendwelche rational nachvollziehbaren<br />
Ordnungsprinzipien hin. Dennoch findet er – allerdings auch nur er – sich dort zurecht. Bis<br />
zum heutigen Tage lebt er kreativ in den Tag hinein, ohne dass sich ein Ende seines Studiums<br />
oder gar irgendeine Berufsperspektive abzeichnen würden. ‚Der Weg ist das Ziel‘, so sein<br />
Credo.<br />
Er mag ein wirklich liebenswerter Zeitgenosse sein, aber dauerhafte Verantwortung beispielsweise<br />
für eine Familie mit Frau und Kindern liegt ihm gar nicht. Und ob er auch in fortgeschrittenem<br />
Alter dieses Leben leben will bzw. kann, lässt sich an dieser Stelle nicht beantworten.
6.3.2. Der schmierige BWL-Student:<br />
Er studiert BWL, gelt seine Haare und stellt die Bücher in der Bibliothek stets dahin, wo er<br />
sie wieder finden kann. Ehrenamtliches Engagement ist seiner Meinung etwas für Verlierer.<br />
Deswegen lästert er über die Fachschaft, nimmt aber deren Angebot in Anspruch, wenn es<br />
ihm zum Vorteil gereicht.<br />
Er weiß, wie man sich gut verkaufen kann, lässt sich selbst aber nichts andrehen. Frauen erzählt<br />
er gerne, was sie hören wollen. Er will vor allem seinen Spaß haben und braucht für sein<br />
Ego auch einen Fundus an erotischen Errungenschaften. Gerne gibt er auch im Kreise seiner<br />
Kumpels intime Details seiner Affären preis und trägt dadurch zur allgemeinen Belustigung<br />
bei. Er weiß einfach, wo man mit welcher Masche am besten ankommt. Seinen Dozenten und<br />
Vorgesetzten gegenüber gibt er sich stets zuvorkommend. Seine Maxime ist, die Meinung<br />
seines Chefs vorauszuahnen, um sich ihr anzuschließen, bevor sie ausgesprochen worden ist.<br />
Eigenständiges Denken zählt ohnehin nicht zu seinen Stärken. Er glaubt, dass zu viel Bildung<br />
nur belastet. Wirklich wichtig ist für ihn nur das Wissen, das seinen Aufstieg zu ebnen verspricht.<br />
Was irgendwelche verschrobenen, ja teilweise geisteskranken Dichter und Denker<br />
sich irgendwann einmal ausgedacht haben, hält er für entbehrlichen Bildungsballast. Er ist<br />
stets am Hier und Jetzt orientiert, am Puls der Zeit sozusagen. Da er bisher mit dieser Einstellung<br />
immer auf die Füße gefallen ist, glaubt er von sich selbst, der geborene Chef zu sein.<br />
Sein Motto lautet: „Erfolg ist die Summe meiner Entscheidungen.” Seine künftigen Untergebenen<br />
dürfen sich diesen Satz schon einmal vormerken.<br />
Von Marco Schäfer
6.3.3. Das Jurahäschen:<br />
Sie studiert Jura, ist zielstrebig und hat einen weiten Ausschnitt. Die Sprechstunden ihrer<br />
männlichen Dozenten nimmt sie gerne wahr, denn ihr ist es wichtig, dass man sich auch<br />
menschlich näher kommt. Viele Dozenten sind auch gar nicht so unlocker, wie manche denken.<br />
Ihre Dozenten erlebt sie jedenfalls <strong>als</strong> sehr zuvorkommend und nett. Wie man in den<br />
Wald hineinruft, so schallt es eben hinaus. Mittlerweile ist besonders einer ihrer Professoren<br />
ihr gegenüber richtiggehend zu Scherzen aufgelegt. Das findet sie lustig und kommt dem<br />
Professor gerne lachend entgegen. Kleine Gefälligkeiten sind eigentlich eine Selbstverständlichkeit,<br />
wenn die Chemie stimmt. Daher erhält die zielstrebige Studentin im Gegensatz zu<br />
ihren Kommilitonen auch ein vorgefertigtes Skript der aktuellen Vorlesung. Von diesem<br />
kleinen Wettbewerbsvorteil brauchen die anderen nichts zu wissen, die ohnehin nur neidisch<br />
sind, weil sie so gut aussieht. Allerdings hasst sie es, wenn jemand ihre fachlichen Fähigkeiten<br />
kleinreden will, denn immerhin paart sich bei ihr Intelligenz mit gutem Aussehen. Hat sie<br />
mit Kommilitonen irgendeinen Konflikt, so sorgt sie dafür, dass bald über ihn oder sie<br />
Geschichten am gesamten Institut im Umlauf sind. Ihr ist gerade an einem guten Klima gelegen,<br />
das manche Miesmacher aber nur vergiften wollen, indem sie zum Beispiel Studenten<br />
wie sie, die sich nun einmal gut mit den Professoren verstehen, kritisieren. Solche Störenfriede<br />
erkennt sie sofort und weiß sich gegen sie angemessen zur Wehr zu setzen. Weil sie<br />
sich durchsetzen kann, schätzt sie sich selbst <strong>als</strong> sehr emanzipiert und fortschrittlich ein. Der<br />
Professor mit den lustigen Witzen ist übrigens ihr Doktorvater geworden.<br />
Von Marco Schäfer
6.4. Wohngemeinschaft:<br />
Fast jeder Student bzw. jede Studentin weiß Geschichten über das Leben in einer Wohngemeinschaft<br />
zu berichten, sei es, dass man sie selber erleben durfte (manchmal ein durchaus<br />
zweifelhaftes Vergnügen!), sei es, dass man haarklein erzählte Berichte anderer zu Ohren bekam,<br />
ob man nun wollte oder nicht. Aus diesem reichhaltigen Erfahrungsschatz sollen nun<br />
einige klassische Beispiele aufgeführt werden.<br />
6.4.1. Der still Leidende:<br />
Er tritt seiner Umwelt, insbesondere der weiblichen, zunächst einmal sehr zuvorkommend<br />
entgegen, hört geduldig zu und vollbringt scheinbar selbstlos kleinere Gefälligkeiten. Dies<br />
kommt natürlich gut an. Aber wehe, wenn ihm einmal nicht die seiner Meinung nach gebührende<br />
Aufmerksamkeit seiner Mitbewohnerinnen zuteil wird! Eine solch unverzeihliche Ignoranz<br />
seiner Person kann sich auf unterschiedlichste Weise ereignen: Sei es, dass man vergisst,<br />
ihn zu einem spontan geplanten Ausflug rechtzeitig einzuladen, sei es dass man es unterlassen<br />
hat, bei einem kleinen Anflug einer Erkältung ihn regelmäßig mit Kamillentee zu<br />
versorgen und dabei eine mitfühlende Mine ob seiner unaussprechlichen Leiden aufzusetzen<br />
oder in irgend einer anderen Weise ihm nicht hinreichende Beachtung schenkt. Nein, nicht<br />
dass er das schuldhafte Verhalten offen zur Sprache bringt. Nie und nimmer. Stattdessen zelebriert<br />
er sein Leiden, indem er beispielsweise seinen Mitbewohnerinnen mit traurig-verletztem<br />
Gesichtsausdruck entgegentritt und sie zeitweilig nur anschweigt oder lediglich schriftlich<br />
seiner Enttäuschung Ausdruck verleiht. Er erwartet nun von den Übeltäterinnen keineswegs<br />
nur eine Entschuldigung für ihr Fehlverhalten, sondern dass sie fortan immer sensibel<br />
auf seine Wünsche und Nöte geduldig eingehen, ihn mit seiner schweren Last ja nicht alleine<br />
lassen. Dennoch wird es seinen Mitbewohnerinnen selbst unter größten Anstrengungen niem<strong>als</strong><br />
dauerhaft gelingen, ihn zufriedenzustellen. Warum? Ganz einfach: Er will mit seinen<br />
egoistischen Wünschen immer im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zumindest seiner näheren<br />
Umgebung stehen. Und dies versucht er dadurch zu erreichen, indem er bestrebt ist, bei den<br />
anderen ein schlechtes Gewissen hervorzurufen, so dass ihre Gedanken ständig nur um ihn<br />
kreisen, ohne dass es so aussieht, <strong>als</strong> würde er sie dauernd dazu auffordern oder gar zwingen.<br />
Nein, er stellt es viel geschickter an, indem er sein stilles Leiden zur Schau stellt, welches<br />
natürlich von seiner ignoranten Umwelt wesentlich verursacht worden ist. Und das, obwohl er<br />
doch anfangs immer so einfühlsam, geduldig und hilfsbereit war. Hier schließt sich der Kreis.<br />
Dieses Verhalten ist nur Taktik, um daraufhin seine Mitbewohnerinnen Stück für Stück<br />
immer mehr für sich und seine Interessen ziemlich rücksichtslos einzunehmen, ohne dass es<br />
nach außen hin auf den ersten Blick so zu sein scheint. Eine wirklich raffinierte Vorgehensweise,<br />
die leider nur allzu oft zum Erfolg führt. Wenn sich eine Frau auf einen solchen Typen<br />
näher einlässt, wird sie niem<strong>als</strong> viel mehr <strong>als</strong> seine abhängige Dienerin sein können, zumeist<br />
ohne seine ausgeklügelte Strategie zu durchschauen. Sie sucht die Fehler ja zunächst bei sich<br />
selbst und lässt sich so auf eine sehr raffinierte Art und Weise ausbeuten.
6.4.2. Der gute Geist:<br />
In vielen WGs gibt es ihn bzw. sie: Den guten Geist der WG. Ob Mann oder Frau, hier ist beiderlei<br />
Geschlecht vertreten. Solch gute Geister zeichnen sich durch viele Vorzüge aus, von<br />
denen einige hier aufgeführt werden sollen und welche die übrigen Mitbewohner nur allzu<br />
gerne in Anspruch nehmen.<br />
Jener gute Geist füllt zur Neige gehende Vorräte an Kaffee, Tee, Brot und dergleichen rechtzeitig<br />
wieder auf. Denn die anderen kommen aus irgendwelchen wichtigen Gründen zumeist<br />
nicht dazu. So übernimmt der gute Geist dies. Dabei streckt er nicht selten auch noch das<br />
Haushaltsgeld für diesen unverzichtbaren Proviant vor, obwohl eigentlich ausgemacht ist,<br />
dass alle rechtzeitig ihren Obolus beizutragen haben. Auch das leidige Abspülen der Geschirrstapel,<br />
die sich in atemberaubender Geschwindigkeit irgendwie immer wieder sehr schnell<br />
auftürmen, bewältigt diese Seele von Mensch ohne Murren, weil es eben sonst keiner macht.<br />
Darüber hinaus hat der gute Geist immer ein Ohr für die Probleme oder Problemchen seiner<br />
Mitbewohner, die dies gerne weidlich ausnutzen, um von ihren großartigen Erfolgen oder<br />
ihren ach so schweren Sorgen, die sie drücken, zu berichten.<br />
Aber wehe, wenn sich der gute Geist einmal selbst mit einer Bitte an seine lieben Mitbewohner<br />
wendet und gar noch wagt zu erwähnen, was er bzw. sie alles bereits für die anderen getan<br />
hat. Dann sind sie beleidigt und halten ihm bzw. ihr vor, dass er bzw. sie das alles doch nicht<br />
hätte tun müssen. Er bzw. sie machte doch alles freiwillig!<br />
Die Moral von der Geschichte ist, dass man durchaus anderen gegenüber hilfsbereit sein<br />
sollte, aber sich dabei nicht ausbeuten lassen darf. Denn wie heißt es so weise: „Undank ist<br />
der Welten Lohn.” Leider trifft dieser Spruch nur allzu oft zu.
6.4.3. Der Kotzbrocken:<br />
Hierbei handelt es sich um eine Spezies, die – anders <strong>als</strong> der still Leidende (siehe Artikel auf<br />
dieser Seite) – allen Mitbewohnern ganz offensichtlich auf die Nerven geht und zwar entweder<br />
bis sie sich bedingungslos seiner Tyrannei beugen oder aber ihn herauswerfen. Nachfolgend<br />
soll von einem solchen Kotzbrocken berichtet werden, den die Mitbewohner schließlich<br />
vor die Tür gesetzt haben.<br />
Er war derjenige, der schon am längsten in der Vierer-WG wohnte: Zwei Mädels, ein Junge<br />
und eben er. Er meinte, dort das Kommando führen zu müssen, indem er entschied, wer, wann<br />
abzuspülen oder einzukaufen hatte. Auch das gemeinsame Kücheninventar sah er <strong>als</strong> sein persönliches<br />
Eigentum an, über das er nach Belieben meinte verfügen zu können. So entführte er<br />
regelmäßig die Kaffeemaschine in sein Zimmer, damit er sich nicht immer für die nächste<br />
Tasse in die Küche bemühen muss. Wenn ihn dann eine Mitbewohnerin daraufhin ansprach,<br />
reagierte er erst einmal überhaupt gar nicht. Erst wenn die Intervention ihrerseits zusammen<br />
mit dem anderen Mädel oder gar dem Jungen eindringlicher wurde, gab er sie widerwillig<br />
heraus. Wenn es dann am Abend zu Diskussionen über sein Verhalten kam, wusste er sich<br />
wortreich zu verteidigen und führte an, was er doch alles für die WG in der Vergangenheit<br />
geleistet habe. Vornehmlich berichtete er dabei über seine Verdienste in der Zeit, <strong>als</strong> noch<br />
niemand von den jetzigen Mitbewohnern hier wohnte. Nach einiger Zeit des unfruchtbaren<br />
Disputes waren die anderen so genervt, dass sie die Diskussion ohne Konsequenzen für den<br />
Kotzbrocken beendeten und irgendwie auf Einsicht und Besserung bei ihm hofften. Aber dem<br />
war natürlich nicht so. Denn der Kotzbrocken fühlte sich durch ihr Einlenken umso mehr<br />
darin bestärkt, weiter zu machen wie bisher. Als einmal die Mitbewohnerin, die erst seit<br />
kurzem WG-Mitglied war, ein paar Nägel von ihm haben wollte, um ein Regal in ihrem<br />
Zimmer zu befestigen, half er ihr zwar aus, vergas dabei aber nicht, jeden einzelnen Nagel<br />
genau abzuzählen und ihr gegenüber klarzustellen, dass sie beim nächsten Einkauf im Baumarkt<br />
genau jene Menge an Nägeln dieser Größe wieder zurückzugeben habe. Ihr fehlten in<br />
dem Moment einfach die Worte für eine passende Erwiderung. Sie war einfach nur sprachlos,<br />
nahm aber dennoch die benötigten Nägel an, um sie ihm am nächsten Tag, nach ihrem Besuch<br />
im Baumarkt, wieder zurückzugeben. Ein andermal musste wiederum diese Mitbewohnerin<br />
feststellen, dass nach ihrem zweiwöchigen Urlaub Geschirr- und Besteckteile aus ihrem<br />
Zimmer fehlten. Der Kotzbrocken hatte sich diese ungefragt unter den Nagel gerissen und<br />
weigerte sich frech, sie ihr wieder zurückzugeben. Erst nach wochenlangem Tauziehen rückte<br />
er die Sachen wieder heraus.<br />
Man könnte noch viele Geschichten erzählen, aber wir wollen es an dieser Stelle dabei bewenden<br />
lassen, da sich nun wohl jeder ein Bild von diesem Kotzbrocken machen kann. Man<br />
fragt sich nur, warum sich die anderen sein Verhalten auf Dauer gefallen lassen? Es ist wohl<br />
eine Mischung aus Gutmütigkeit und Vermeidung nerviger wie lang andauernder Streitereien.<br />
Aber weil gerade solche Typen genau darauf setzen, hilft nur der klare Schnitt. Die Mitbewohnerin,<br />
deren Erfahrungen wir gerade mitverfolgen durften, wollte nun endlich einen<br />
Schlussstrich ziehen und einigte sich mit den anderen darauf, diesen Kotzbrocken zum Auszug<br />
zu bewegen. Obgleich alle damit im Prinzip sofort einverstanden waren, knickten sie zunächst<br />
im persönlichen Gespräch mit dem Kotzbrocken ein, der sich nun lauth<strong>als</strong> über die ihm<br />
zuteil werdende Ungerechtigkeit beklagte. So siegte bei einigen vorerst das Mitleid mit ihm,<br />
und er erhielt eine letzte Chance. Aber, wie nicht anders zu erwarten war, änderte er sich<br />
nicht. Nun schwenkten alle auf die Linie der Mitbewohnerin ein und setzten ihn schließlich<br />
vor die Tür.<br />
Den Rat, den man ob dieser Geschichte allen geben möchte, ist derjenige nach der frühzeitigen<br />
Unnachgiebigkeit gegenüber solchen offensichtlichen Kotzbrocken, die andere immer<br />
so lange nerven und egoistisch ausnutzen werden, bis sie in die Schranken verwiesen werden.
6.5. Arbeitsplatz:<br />
Der Arbeitsplatz: Ein Ort vielfältiger menschlicher Begegnungen. Man trifft dort auf die unterschiedlichsten<br />
Typen von Menschen: Mal sympathisch mal weniger bis überhaupt nicht<br />
sympathisch. Vielleicht finden Sie sich und / oder andere – zumindest teilweise – in den beschriebenen<br />
Personen wieder. Wir wünschen Ihnen nun viel Freude beim Lesen der<br />
nachfolgenden kurzen Geschichten.<br />
6.5.1. Der vorbildliche Chef:<br />
Er kommt zumeist gut gelaunt in die Firma und grüßt freundlich all seine Mitarbeiter. Und<br />
wenn er einmal keine gute Laune hat, so lässt er es seine Untergebenen jedenfalls nicht<br />
spüren. Er hat ein offenes Ohr für neue Ideen seiner Leute wie für ihre Sorgen und Nöte. Er<br />
lässt keine Intrigen zu und fordert von allen einen offenen, aber freundlichen, respektvollen<br />
Umgang miteinander. Diesem Verhaltenskodex unterwirft er sich selbst natürlich ebenfalls.<br />
Er erteilt Lob für gute Leistungen und übt sachliche, aber keinesfalls persönlich verletzende<br />
Kritik, wenn etwas nicht so gut gelaufen ist. Er gibt gute Einfälle von anderen nicht <strong>als</strong> die<br />
eigenen aus, sondern sagt immer klar und deutlich, von wem sie sind, womit er sie zugleich<br />
entsprechend ihres Verdienstes lobt. Er spornt seine Mitarbeiter zu guten Leistungen an, aber<br />
versteht es, sie dabei nicht zu überfordern oder gar Unmögliches von ihnen zu verlangen.<br />
Seine realistischen Zielvorgaben formuliert er klar und deutlich, so dass keine Missverständnisse<br />
auftreten. Er hinterfragt seinen Führungsstil regelmäßig selbstkritisch und ist für sachliche<br />
Kritik seiner Angestellten ihm gegenüber immer offen. Denn nur so kann er eigene Fehler<br />
zum Wohle aller korrigieren. Ein so geführtes Unternehmen hat beste Voraussetzungen,<br />
am Markt erfolgreich zu sein, da hierfür gut motivierte Menschen, die einander helfen, von<br />
entscheidender Bedeutung sind. Das müsste eigentlich jedem Chef klar sein!<br />
Nun wird sich manch einer unter Umständen fragen, aus welchem Märchen die Beschreibung<br />
eines solchen Chefs entnommen worden ist. Es soll an dieser Stelle durchaus eingeräumt werden,<br />
dass solche Chefs in der Realität – sagen wir es einmal vorsichtig – nicht ganz so häufig<br />
anzutreffen sind. Aber es sollte hier einmal ein Idealbild gezeichnet werden, an dem sich<br />
Chefs orientieren können. Vielleicht kann man diese Beschreibung ja einmal im Büro aushängen,<br />
<strong>als</strong> Anregung sozusagen. Natürlich nur, wenn der Chef es erlaubt. Verweigert er dies,<br />
so möge man seine Schlüsse daraus ziehen.
6.5.2. Der Chef <strong>als</strong> Diktator:<br />
Er ist der festen Überzeugung, dass ihm das Chef-Sein in die Wiege gelegt worden ist. Er<br />
weiß immer, was richtig ist und vor allem wer recht hat: Er selbst natürlich! Er kennt keine<br />
Mitarbeiter, sondern nur Untergebene, die seine Befehle bedingungslos auszuführen haben.<br />
Jedwede Kritik an seinen Entscheidungen oder gar seiner Person empfindet er <strong>als</strong> Majestätsbeleidigung,<br />
die umgehend eine schwere Bestrafung vor aller Augen und Ohren nach sich<br />
zieht, auf dass so etwas niem<strong>als</strong> mehr vorkomme. Er erwartet es, von allen immer respektvoll<br />
gegrüßt zu werden, aber er erwidert solches Verhalten nicht in gleicher Weise. Nein, er bringt<br />
allenfalls ein kurzes ‚Tag‘ über die Lippen. Zumeist nickt er bloß ein wenig abfällig oder geht<br />
sogar völlig grußlos weiter, insbesondere wenn er schlechte Laune hat. Werden seine Zielvorgaben<br />
nicht erreicht, so liegt das natürlich nicht an ihm. Seine Mitarbeiter haben dann kläglich<br />
versagt. Und er lässt sie dies bei Besprechungen auch deutlich spüren. ‚Besprechung‘ ist hier<br />
wahrscheinlich kein so ganz passender Ausdruck. Denn von einem sachlichen Gespräch in<br />
gegenseitigem Respekt kann nicht die Rede sein: Er brüllt, seine Untergebenen lassen mit<br />
gesenktem Kopf alles über sich ergehen und hoffen auf ein möglichst baldiges Ende dieser<br />
Veranstaltung. Läuft es hingegen besser <strong>als</strong> erwartet, dann beansprucht er diesen Erfolg<br />
selbstredend für sich, und zwar für sich ganz allein. Schließlich ist es nur seinem – wie er es<br />
sieht – konsequenten Führungsstil zu verdanken. Denn nur deshalb würden schließlich seine<br />
Untergebenen auch wirklich fleißig arbeiten. Ohne ihn und seine diktatorische Vorgehensweise<br />
– so seine unumstößliche Meinung – brächten seine Untergebenen eh nichts zustande,<br />
sondern ließen alles schleifen.
6.5.3. Der fleißige, unauffällige und ordentliche Mitarbeiter:<br />
Für ihn gibt es im Büroalltag nur die pflichtgemäße Erledigung der ihm übertragenen Arbeiten.<br />
Darauf richtet er sein ganzes Bemühen. Obgleich er seine Kollegen immer freundlich<br />
grüßt, so entwickeln sich mit ihm nicht einmal in der Mittagspause längere Gespräche. Nein,<br />
sehr kommunikativ ist er nicht gerade. Während seiner Arbeitszeit sind für ihn private Unterhaltungen<br />
sowieso tabu. Er muss schließlich seine Arbeit gewissenhaft erledigen. Was er<br />
während der normalen Bürozeit nicht mehr schafft, nimmt er sich nach Hause mit. Sein Chef<br />
hat daher nie Grund zur Klage. Er erledigt alles ohne Widerspruch wunschgemäß. Der<br />
Kreativste ist er allerdings auch nicht. Allein schon seine äußere Erscheinung lässt darauf<br />
schließen: Er trägt den immer gleichen, korrekten, langweiligen Scheitel, Hosen, Hemden<br />
oder Anzüge, die er schon vor über zehn Jahren gekauft hat, welche schon zu dieser Zeit –<br />
sagen wir es einmal vorsichtig – nicht mehr die Modischsten waren. Auch hinsichtlich seiner<br />
Arbeit macht er nicht gerade mit neuen Ideen auf sich aufmerksam. Ihm ist sowieso das Eingefahrene,<br />
Bewährte am liebsten. Und natürlich Ordnung! Auch sie ist für ihn unverzichtbar.<br />
Sein Schreibtisch ist immer aufgeräumt, alles hat seinen Platz und ist dort sofort zu finden.<br />
Jede Unordnung ist ihm ein Graus. Dass einige Kollegen über ihn zeitweise Witze machen,<br />
stört ihn nicht, jedenfalls lässt er sich nichts anmerken. Er verschanzt sich dann nur umso<br />
mehr hinter seiner Arbeit.<br />
Ob solche Menschen wirklich mit ihrem Leben zufrieden sind, kann hier nicht geklärt werden.<br />
Obgleich man mit ihnen schwerlich in Kontakt kommt oder gar Freundschaften entwickeln<br />
kann, so tun sie einem nichts Böses. Sie erfüllen im Betrieb gewissenhaft ihre Aufgaben,<br />
gehen jedem Streit aus dem Wege, sägen an keinem Stuhl oder feilen gar an irgendwelchen<br />
Intrigen. Nein, sie sind harmlos und aus der Sicht der meisten Kollegen eben langweilig.
6.5.4. Die Klatschtante:<br />
Sie sieht in ihrer beruflichen Tätigkeit – neben dem Geldverdienen – vor allem die Möglichkeit,<br />
den neuesten Klatsch zu hören und sogleich allen anderen mitzuteilen. Die Büroarbeit ist<br />
lediglich ein notwendiges Übel, um ihrer eigentlichen Berufung nachzugehen. Von der unpassenden<br />
Krawatte des Chefs bis zur Affäre einer Kollegin mit einem jüngeren Kollegen: Dergleichen<br />
weckt sofort ihr Interesse. Sie scheut sich nie, ihre in Sekundenschnelle entwickelten<br />
Bewertungen der erspähten Sachverhalte anderen unverzüglich in aller Ausführlichkeit<br />
mitzuteilen. Zweifel, dass sie damit auch mal f<strong>als</strong>ch liegen und anderen Unrecht tun könnte,<br />
sind ihr völlig fremd. Wenn sie erst so richtig in Fahrt ist, nimmt ihr Redefluss kein Ende.<br />
Ihre Kreativität beim Ausmahlen kleinster, aber aus ihrer Sicht natürlich unverzichtbarer<br />
Details, kennt keine Grenzen. Ihre Lästereien finden nur dann ein abruptes Ende, wenn<br />
derjenige, über den sie gerade herzieht, sich nähert oder der Chef ins Büro tritt. Dann lächelt<br />
sie sofort mit ihrer durch lange Praxis eingeübten Unschuldsmine, um, nachdem diese<br />
unwillkommene Unterbrechung des doch so interessanten Gespräches wieder vorüber ist, nun<br />
wieder weiter zu tratschen. Dass ihr der Stoff für derartige Unterhaltungen ausgehen könnte,<br />
ist eine wahrlich abwegige Annahme. Denn irgendetwas fällt ihr an ihren Mitmenschen<br />
immer auf, über das es sich zu lästern lohnt. Da kennt sie weder Gnade noch Reue.<br />
Man nehme sich vor solchen Leuten in Acht und überlege sich sehr genau, was man ihnen<br />
anvertraut. Denn Vertrauliches spornt solche Klatschtanten erst recht dazu an, es möglichst<br />
schnell anderen weiter zu erzählen und sich dabei gar noch lustig über die Vertrauensseligkeit<br />
jener naiven Leute zu machen, die meinten, ihr etwas sehr Persönliches, nicht für andere<br />
Ohren bestimmtes erzählen zu können.
7. Weitere Beiträge zu den 6 aufgeführten Themenbereichen, welche seit Januar 2012 verfasst<br />
worden sind, der Zeit nach geordnet:<br />
7.1.