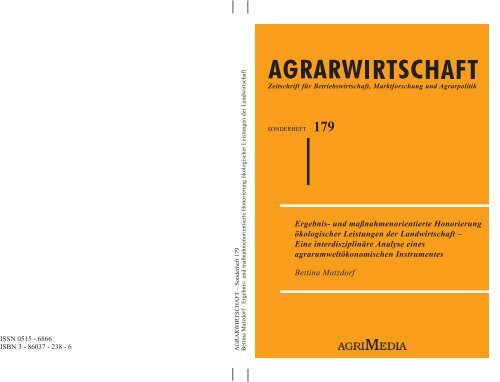0 8 - Zalf
0 8 - Zalf
0 8 - Zalf
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Die vorliegende Arbeit wurde am 26.08.2004 von der Agrar- und<br />
Ernährungswissenschaftlichen Fakultät der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel als<br />
Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades der Agrarwirtschaften angenommen.<br />
Tag der mündlichen Prüfung: 04.11.2004<br />
1. Berichterstatter: Prof. Dr.. Hartmut Roweck (Ökologie-Zentrum der CAU Kiel)<br />
2. Berichterstatter: Prof. Dr. Klaus Müller (Leibniz-Zentrum für Agrarlandschafts- und<br />
Landnutzungsforschung e.V., Müncheberg)<br />
3. Berichterstatter: Prof. Dr. R. Marggraf (Universität Göttingen)<br />
Gedruckt mit Genehmigung der Agrar- und Ernährungswissenschaftlichen Fakultät der<br />
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel.<br />
ISSN 0515 – 6866<br />
ISBN 3 – 86037 – 238-6<br />
2004<br />
Alle Rechte, auch die der auszugsweisen Veröffentlichung und fotomechanischer Wiedergabe<br />
bei Agrimedia GmbH<br />
Spithal 4 D-29468 Bergen/Dumme<br />
Telefon (058 45) 9881-0 Telefax (05845) 988111<br />
mail@agrimedia.com
Aus dem Institut für Wasserwirtschaft und Landschaftsökologie<br />
der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel<br />
Ergebnis- und maßnahmenorientierte Honorierung ökologischer Leistungen der<br />
Landwirtschaft – Eine interdisziplinäre Analyse eines<br />
agrarumweltökonomischen Instrumentes<br />
Dissertation zur Erlangung<br />
des Doktorgrades<br />
der Agrar- und Ernährungswissenschaftlichen Fakultät<br />
der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel<br />
vorgelegt von<br />
Bettina Matzdorf<br />
aus Schwedt/Oder<br />
Kiel, 26. August 2004
Danksagung<br />
Ich möchte an dieser Stelle all jenen danken, die mich in der Zeit dieser Arbeit fachlich und<br />
privat unterstützt haben und damit wesentlichen Anteil am Gelingen haben.<br />
Namentlich, an erster Stelle, meinem Doktorvater, Prof. Roweck, der mir diese Arbeit als<br />
Stipendiatin des Graduiertenkollegs ‚Integrative Umweltbewertung’ ermöglicht hat und mir<br />
durch seinen kritischen Blick auf alles Vereinfachende wesentliche Anregungen für diese<br />
Arbeit gegeben hat. Ich möchte ihm auch dafür danken, dass er das Interesse an dieser Arbeit<br />
nicht verloren hat, obwohl mit ihr weit weniger die ökologische Perspektive des Themas<br />
aufgegriffen wird als ursprünglich geplant.<br />
Prof. v. Alvensleben möchte ich für die fachlichen Anregungen in der ersten Phase dieser<br />
Arbeit danken. Das gleiche gilt für Prof. Fränzle, der mit seinem Disziplinen übergreifendem<br />
Wissen und Interesse der ‚Vater’ des Graduiertenkollegs war.<br />
Nicht zuletzt gilt mein Dank allen StipendiatInnen des Graduiertenkollegs für den<br />
konstruktiven Austausch und die gegenseitige Befruchtung der Themen, hierbei insbesondere<br />
Barbara Semleit und Simone Graf, die sich mit mir gemeinsam das Feld der Honorierung<br />
ökologischer Leistungen erschlossen haben.<br />
Wesentlichen Anteil an der Fertigstellung der Arbeit nach längerer Unterbrechung hat mein<br />
zweiter Betreuer, Prof. Müller. Ihm möchte ich besonders danken - für die fachliche aber auch<br />
menschliche Unterstützung. Insbesondere dafür mein Dank, dass er es mir ermöglicht hat,<br />
unter optimalen Rahmenbedingungen diese Arbeit zu beenden und kurzfristig die fachliche<br />
Betreuung der Arbeit übernommen hat. Der Blick des Volkswirtes auf die Arbeit war am<br />
Ende noch einmal sehr hilfreich.<br />
Ohne meine Kollegen am ZALF hätte ich diese Arbeit wohl kaum zum jetzigen Zeitpunkt<br />
fertig stellen können. Dafür an alle meinen Dank, insbesondere an Angelika, Kerstin und<br />
Gerlinde für die große Unterstützung. Christian Kersebaum möchte ich für die großzügige<br />
Erlaubnis zur Nutzung von Daten danken, Jörg Steidl und Joachim Kiesel für die fachliche<br />
Hilfestellung.<br />
Ebenfalls möchte ich den Mitarbeitern des LUA danken, die mir freundlicherweise Einblicke<br />
in den aktuellen Diskussionsstand der Arbeiten in den Bereichen Natura 2000-Gebiete,<br />
Wasserrahmenrichtlinie sowie Erfolgskontrolle des Vertragnaturschutzes gaben.<br />
Meiner Familie möchte ich für ihr Interesse und die jahrelange bedingungslose Unterstützung<br />
danken, insbesondere meiner Mutter, Christel Matzdorf. Ebenfalls für ihre Unterstützung auf<br />
den verschiedenen ‚Felder’ möchte ich meiner Freundin Vera danken.<br />
Jean danke ich für den stets optimistischen und humorvollen Blick auf alle Dinge und die<br />
viele Geduld.
I<br />
1 EINLEITUNG______________________________________________________________ 1<br />
2 PROBLEMSTELLUNG, AUFBAU UND METHODIK___________________________________ 3<br />
3 ÖKONOMISCHE INSTRUMENTE IM SYSTEM DER UMWELTPOLITISCHEN INSTRUMENTE_____ 8<br />
3.1 Ökonomische Instrumente _______________________________________________ 8<br />
3.1.1 Steuerung durch rationale Entscheidungen ________________________________ 8<br />
3.1.2 Pigou-Instrumente __________________________________________________ 11<br />
3.1.3 Baumol-Instrumente_________________________________________________ 14<br />
3.2 Anwendung des Verursacherprinzips bei ökonomischen Instrumenten _________ 16<br />
4 HONORIERUNG ÖKOLOGISCHER LEISTUNGEN DER LANDWIRTSCHAFT ________________ 21<br />
4.1 Charakterisierung des Instrumentes ______________________________________ 21<br />
4.2 Ergebnis- und maßnahmenorientierte Honorierung ökologischer Leistungen____ 30<br />
4.2.1 Unterscheidung der ergebnis- und maßnahmenorientierten Honorierung ________ 32<br />
4.2.2 Potentieller Effektivitäts- und Effizienzvorteil der ergebnisorientierten<br />
Honorierung _______________________________________________________ 34<br />
4.2.2.1 Ökologische Effektivität___________________________________________ 35<br />
4.2.2.2 Effizienz _______________________________________________________ 36<br />
4.2.2.3 Schlussfolgerungen_______________________________________________ 41<br />
4.2.3 Aktuelle Ansätze einer ergebnisorientierten Honorierung____________________ 42<br />
4.2.3.1 Schweizer Öko-Qualitätsverordnung (ÖQV) ___________________________ 43<br />
4.2.3.2 Agrar-Umweltprogramm MEKA II in Baden-Württemberg _______________ 44<br />
4.2.3.3 Einzelprojekte in Zusammenarbeit von Wissenschaft und Praxis ___________ 45<br />
4.2.3.4 Zusammenfassung und Schlussfolgerungen für diese Arbeit_______________ 46<br />
5 EIGENTUMSRECHTE ALS VORAUSSETZUNG FÜR DIE HONORIERUNG ÖKOLOGISCHER<br />
LEISTUNGEN ____________________________________________________________ 49<br />
5.1 Definition und Aufgabe von Eigentumsrechten _____________________________ 49<br />
5.2 Ökologische Güter als Ansatzstelle der Eigentumsrechte an individuellen und<br />
ökosystemaren Fähigkeiten _____________________________________________ 53<br />
5.3 Notwendigkeit der Schaffung und Durchsetzung von Eigentumsrechten bei<br />
Verknappung von ökologischen Gütern unter open access____________________ 59<br />
5.4 Notwendigkeit der Änderung von absoluten Eigentumsrechten durch staatliches<br />
Eingreifen ____________________________________________________________ 67<br />
5.4.1 Bounded rationality und irrationales Verhalten ____________________________ 68<br />
5.4.2 Hohe Transaktionskosten _____________________________________________ 72<br />
5.5 Unterscheidung der Schaffung und Änderung von absoluten Eigentumsrechten _ 75
5.6 Eigentumsbegründung und Distribution ___________________________________ 77<br />
5.6.1 Distribution in der Ökonomie __________________________________________ 77<br />
5.6.2 Distribution der Eigentumsrechte an ökologischen Gütern im deutschen Recht ___ 79<br />
5.6.2.1 Distributionskriterien______________________________________________ 79<br />
5.6.2.2 Typisierung von positiven ökonomischen Anreizen entsprechend der<br />
zugewiesenen Eigentumsrechte______________________________________ 87<br />
6 RATIONALISIERTE UMWELTZIELE ALS ANSATZSTELLE FÜR DIE HONORIERUNG<br />
ÖKOLOGISCHER LEISTUNGEN _______________________________________________ 90<br />
6.1 Definition und Bedeutung rationalisierter Umweltziele_______________________ 90<br />
6.2 Minimierungsstrategie als Alternative zur umweltzielorientierten Strategie _____ 95<br />
6.2.1 Abgrenzung der Minimierungsstrategie von der umweltzielorientierten Strategie _ 95<br />
6.2.2 Minimierungsstrategie – tatsächlich eine Alternative zur umweltzielorientierten<br />
Strategie?__________________________________________________________ 97<br />
6.3 Rationalisierung der Umweltziele durch Indikatoren _______________________ 107<br />
6.3.1 Einordnung der Indikatoren in bestehende Indikatorensysteme _______________ 107<br />
6.3.2 Validität – Sinn der Indikatoren _______________________________________ 113<br />
6.3.3 Zweck der Indikatoren ______________________________________________ 116<br />
6.3.4 Zweckgebundene Anforderungen ______________________________________ 117<br />
6.3.4.1 Raumäquivalenz ________________________________________________ 118<br />
6.3.4.2 Problemäquivalenz ______________________________________________ 122<br />
6.3.4.3 Zeitäquivalenz __________________________________________________ 124<br />
6.3.4.4 Normierbarkeit _________________________________________________ 127<br />
6.3.4.5 Formulier- und Kommunizierbarkeit ________________________________ 129<br />
6.3.4.6 Praktische Erhebbarkeit und Überprüfbarkeit __________________________ 131<br />
6.3.4.7 Anforderungsprofil im Überblick und Diskussion ______________________ 131<br />
6.3.5 Probleme der Indikatorenentwicklung und deren Konsequenzen______________ 133<br />
6.3.5.1 Problem der Komplexität und des nicht deterministischen Verhaltens<br />
ökologischer Systeme und das damit verbundene finanzielle Risiko ________ 134<br />
6.3.5.2 Problem der Normativität aufgrund der Ungewissheit ___________________ 143<br />
6.3.5.3 Problem der Diversität von Umweltzielen ____________________________ 148<br />
7 POSITIVE ÖKONOMISCHE ANREIZE IM RAHMEN DER AGRARUMWELTMAßNAHMEN UND<br />
DES ARTIKEL 16 DER VO (EG) 1257/1999 ____________________________________ 150<br />
7.1 Agrar-politische Rahmenbedingungen ___________________________________ 150<br />
7.1.1 Verhandlungen der World Trade Organisation____________________________ 150<br />
7.1.2 Europäische Rahmenbedingungen _____________________________________ 154<br />
7.1.2.1 Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) ___________________________________ 154<br />
7.1.2.2 Vorgaben und Förderflächenumfang im Rahmen der VO (EG) 1257/1999 ___ 160
III<br />
7.1.3 Nationale Rahmenbedingungen in Deutschland __________________________ 163<br />
7.1.3.1 Föderale Strukturen in Deutschland und deren Konsequenz ______________ 163<br />
7.1.3.2 Gemeinschaftsaufgabe ‚Verbesserung der Agrarstruktur und des<br />
Küstenschutzes’ (GAK) __________________________________________ 164<br />
7.1.4 Mittelfristige Weiterentwicklung der politischen Rahmenbedingungen ________ 167<br />
7.1.4.1 Mid-Term-Review-Reform________________________________________ 167<br />
7.1.4.2 Finanzielle Mittel für die Honorierung ökologischer Leistungen __________ 168<br />
7.1.4.3 Cross Compliance und Institutionenwandel ___________________________ 169<br />
7.1.5 Zusammenfassung und Schlussfolgerungen _____________________________ 173<br />
7.2 Aktuelle Agrarumweltmaßnahmen am Beispiel der deutschen<br />
Agrarumweltprogramme nach VO (EG) 1257/1999 ________________________ 174<br />
7.2.1 Überblick über aktuellen Anwendungsumfang ___________________________ 174<br />
7.2.2 Analyse der aktuellen Agrarumweltmaßnahmen __________________________ 177<br />
7.2.2.1 Ansatz und Methode _____________________________________________ 177<br />
7.2.2.2 Zahlungstyp – Honorierung oder Subvention__________________________ 177<br />
7.2.2.3 Preistyp – Kosten oder Nutzen _____________________________________ 184<br />
7.2.2.4 Strategietyp – Umweltzielorientierte Strategie oder Minimierungsstrategie __ 186<br />
7.2.2.5 Rationalisierungstyp – Top down- oder Bottom up-Prozess ______________ 192<br />
7.2.2.6 Indikatorentyp – Ergebnis- oder maßnahmenorientierte Honorierung_______ 195<br />
7.2.3 Zusammenfassung und Schlussfolgerungen _____________________________ 197<br />
7.3 Ausgleich ordnungsrechtlicher Auflagen in Natura 2000-Gebieten im Rahmen<br />
des Artikel 16 der VO (EG) 1257/1999 ___________________________________ 198<br />
7.3.1 Überblick über aktuellen Anwendungsumfang ___________________________ 198<br />
7.3.2 Analyse der aktuellen Artikel 16-Maßnahmen ___________________________ 202<br />
7.3.2.1 Ansatz und Methode _____________________________________________ 202<br />
7.3.2.2 Zahlungstyp – Honorierung oder Subvention__________________________ 202<br />
7.3.2.3 Preistyp – Kosten oder Nutzen _____________________________________ 205<br />
7.3.2.4 Strategietyp – Umweltzielorientierte Strategie oder Minimierungsstrategie __ 205<br />
7.3.2.5 Rationalisierungstyp – Top down- oder Bottom up-Prozess ______________ 206<br />
7.3.2.6 Indikatorentyp – Ergebnis- oder maßnahmenorientierte Honorierung_______ 209<br />
7.3.3 Zusammenfassung und Schlussfolgerungen _____________________________ 209<br />
8 BEISPIELE FÜR ERGEBNISORIENTIERTE HONORIERUNGSANSÄTZE __________________ 211<br />
8.1 Ergebnisorientierte Honorierung im Rahmen von Agrarumweltmaßnahmen<br />
zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie ______________________________ 211<br />
8.1.1 Rahmenbedingungen – Voraussetzungen für ergebnisorientierte Honorierung __ 211<br />
8.1.2 Bedeutung von Agrarumweltmaßnahmen für N-Immissionsminderung im Zuge der<br />
Umsetzung der WRRL ______________________________________________ 215
8.1.3 Modellierte Stickstoffimmissionen als Anknüpfung für eine ergebnisorientierte<br />
Honorierung am Beispiel des Landes Brandenburg ________________________ 217<br />
8.1.3.1 Standortverhältnisse und Bearbeitungsgebiete nach Wasserrahmenrichtlinie _ 217<br />
8.1.3.2 Methodik und Datengrundlage _____________________________________ 219<br />
8.1.3.3 Ermittlung der N-Immissionen _____________________________________ 229<br />
8.1.3.4 Honorierungsverfahren ___________________________________________ 239<br />
8.1.3.5 Diskussion und Ausblick__________________________________________ 243<br />
8.2 Ergebnisorientierte Honorierung im Rahmen von Artikel 16-Maßnahmen zur<br />
Umsetzung der FFH-Richtlinie__________________________________________ 245<br />
8.2.1 Rahmenbedingungen – Voraussetzungen für ergebnisorientierte Honorierung ___ 245<br />
8.2.1.1 Natura 2000-Netzwerk ___________________________________________ 245<br />
8.2.1.2 Rationalisierte Umweltziele _______________________________________ 249<br />
8.2.1.3 Gebietsabgrenzung ______________________________________________ 252<br />
8.2.1.4 Monitoring und Berichtspflicht _____________________________________ 253<br />
8.2.1.5 Verteilung der Eigentumsrechte und Auswahl geeigneter Instrumente ______ 254<br />
8.2.2 Bedeutung von Artikel 16-Maßnahmen im Zuge der Umsetzung der<br />
FFH-Richtlinie ____________________________________________________ 257<br />
8.2.3 Pflanzenarten von Grünlandlebensraumtypen als Anknüpfung für eine<br />
ergebnisorientierte Honorierung am Beispiel des Landes Brandenburg_________ 260<br />
8.2.3.1 Beschreibung der diskutierten Lebensraumtypen (LRT) _________________ 260<br />
8.2.3.2 Ableitung von Pflanzenarten als Indikatoren __________________________ 263<br />
8.2.3.3 Honorierungsverfahren ___________________________________________ 270<br />
8.2.3.4 Diskussion und Ausblick__________________________________________ 273<br />
9 ZUSAMMENFASSUNG _____________________________________________________ 275<br />
SUMMARY __________________________________________________________________ 282<br />
LITERATUR _________________________________________________________________ 289
Abbildungsverzeichnis<br />
V<br />
Abbildung 1: Verhaltenssteuerung umweltökonomischer Instrumente__________________________ 11<br />
Abbildung 2: Ökologische Leistungen der Landwirtschaft als gezielte Antwort auf Verknappung<br />
ökologischer Güter_______________________________________________________ 28<br />
Abbildung 3: Ökonomische Anreize der Umweltpolitik im Verhältnis zu Eigentumsrechten und dem<br />
Verursacherprinzip ______________________________________________________ 30<br />
Abbildung 4: Unterscheidung von ergebnis- und maßnahmenorientierter Honorierung ökologischer<br />
Leistungen _____________________________________________________________ 33<br />
Abbildung 5: Potentieller Effizienzvorteil der ergebnisorientierten gegenüber der<br />
maßnahmenorientierten Honorierung ökologischer Leistungen der Landwirtschaft ____ 42<br />
Abbildung 6: Ergebnisorientierte Honorierung im Rahmen des baden-württembergischen MEKA II und<br />
der Schweizer ÖQV______________________________________________________ 47<br />
Abbildung 7: Systematisierung verschiedener Eigentumsrechte und deren Beziehung zueinander ____ 50<br />
Abbildung 8: Stellung der Eigentumsrechte als ökonomische Institutionen im Prozess der Nachhaltigen<br />
Entwicklung____________________________________________________________ 53<br />
Abbildung 9: Ökologische Güter als Ansatzstelle für die Eigentumsrechte an individuellen und<br />
ökosystemaren Fähigkeiten ________________________________________________ 58<br />
Abbildung 10: Vergleich der Zugangsbeschränkung und der Nutzungsbeschränkung bei den<br />
unterschiedlichen Eigentumsinstitutionen _____________________________________ 63<br />
Abbildung 11: Zusammenhang zwischen ökologischen Gütern und Umweltproblemen in Abhängigkeit<br />
vom Zugang zu den Gütern und auftretender Rivalität ___________________________ 64<br />
Abbildung 12: Überführung des open access zu einem well-regulated access bei ökologischen Gütern<br />
durch die Schaffung von Eigentumsrechten ___________________________________ 66<br />
Abbildung 13: Möglichkeit einer effizienten Allokation einer artenreichen Wiese durch die Honorierung<br />
ökologischer Leistungen in Abhängigkeit der vorliegenden absoluten Eigentumsrechte _ 74<br />
Abbildung 14: Distributionsentscheidungen im Zuge der Verteilung der Eigentumsrechte an<br />
ökologischen Gütern nach deutschem Recht___________________________________ 83<br />
Abbildung 15: Typen der Zahlungen für ökologische Leistungen entsprechend der Eigentumsrechte<br />
und in Abhängigkeit der Allokationsform_____________________________________ 89<br />
Abbildung 16: Vorsorgestrategien der Umweltpolitik und deren mögliche Ansatzstellen für<br />
entsprechende Eigentumsrechte_____________________________________________ 96<br />
Abbildung 17: Abhängigkeit der rationalen Instrumentenwahl von der bounded rationality und den<br />
darauf aufbauenden Transaktionskosten der Präferenzermittlung__________________ 106<br />
Abbildung 18: Einordnung der Typen von Indikatoren einer ergebnis- und maßnahmenorientierten<br />
Honorierung in den Indikatorenrahmen der OECD_____________________________ 111<br />
Abbildung 19: Für die Durchsetzung von Ertragsrechten an individuellen und ökosystemaren Fähigkeiten<br />
werden Indikatoren benötigt, die die durch diese Fähigkeiten erzeugten ökologischen Güter<br />
für Transaktionen rationalisieren___________________________________________ 116<br />
Abbildung 20: Anforderungen an Agrarumweltindikatoren im Rahmen der Honorierung ökologischer<br />
Leistungen ____________________________________________________________ 132
VI<br />
Abbildung 21: Hauptprobleme bei der Entwicklung von Indikatoren als Ansatzstelle für die Honorierung<br />
ökologischer Leistungen _________________________________________________ 134<br />
Abbildung 22: Finanzielles Risiko unterschieden nach drei unterschiedlichen Formen der<br />
Kalkulierbarkeit _______________________________________________________ 136<br />
Abbildung 23: Modelle als Möglichkeit des Übertrages von nicht kalkulierbaren Risiken von<br />
Landwirten auf die Gesellschaft ___________________________________________ 139<br />
Abbildung 24: Idealisierte Darstellung der Normativität innerhalb des Prozesses der Entwicklung von<br />
Indikatoren für Umweltgüter _____________________________________________ 145<br />
Abbildung 25: Abstrahierte Abhängigkeit der normativen Ladung der Indikatoren von der Abweichung<br />
des Umweltziels von einem naturwissenschaftlich gefassten Phänomen ____________ 147<br />
Abbildung 26: Kategorisierung unterschiedlicher Einkommensbeihilfen nach dem Grad ihrer<br />
handelsverzerrenden Wirkung im Rahmen der WTO-Verhandlungen______________ 151<br />
Abbildung 27: Ausgaben der EU für das Haushaltsjahr 2003 ________________________________ 156<br />
Abbildung 28: Verteilung der Ausgaben des EAGFL ______________________________________ 156<br />
Abbildung 29: Aufteilung der Maßnahmen zur ländlichen Entwicklung auf die unterschiedlichen<br />
Planungsinstrumente am Beispiel der Ziel 1-Gebiete___________________________ 160<br />
Abbildung 30: Finanzierung der Agrarumweltmaßnahmen in Deutschland (bis zum Jahr 2004) _____ 165<br />
Abbildung 31: Geplante jährliche Finanzmittel für die Honorierung ökologischer Leistungen der<br />
Landwirtschaft in den Bundesländern im Planungszeitraum 2004-2006 ____________ 175<br />
Abbildung 32: Entwicklung der Agrarumweltmaßnahmen nach VO 2078/1992 von 1994-1999 _____ 176<br />
Abbildung 33: Typisierung der aktuellen Agrarumweltmaßnahmen als Subvention oder Honorierung<br />
auf der Grundlage der Verteilung der Eigentumsrechte _________________________ 184<br />
Abbildung 34: Typisierung der aktuellen Agrarumweltmaßnahmen im Hinblick auf die Art der<br />
Ermittlung des Preises___________________________________________________ 186<br />
Abbildung 35: Verhältnis von umweltzielorientierten Agrarumweltmaßnahmen zu<br />
Extensivierungsmaßnahmen in Brandenburg _________________________________ 188<br />
Abbildung 36: Anteil der erosionsmindernden Agrarumweltmaßnahmen in Brandenburg auf<br />
erosionsgefährdeten Flächen______________________________________________ 190<br />
Abbildung 37: Erosionsmindernde Agrarumweltmaßnahmen in Brandenburg in und außerhalb von<br />
erosionsgefährdeten Gebieten_____________________________________________ 190<br />
Abbildung 38: Typisierung der aktuellen Agrarumweltmaßnahmen im Hinblick auf ihren Zielbezug _ 192<br />
Abbildung 39: Bereitschaft von Brandenburger Landwirten zur aktiven Teilnahme an der<br />
Entwicklung von Agrarumweltmaßnahmen __________________________________ 194<br />
Abbildung 40: Typisierung der aktuellen Agrarumweltmaßnahmen im Hinblick auf die Art der<br />
Entwicklung der Indikatoren______________________________________________ 195<br />
Abbildung 41: Bereitschaft von Landwirten zur Teilnahme an ergebnisorientierter Honorierung ____ 196<br />
Abbildung 42: Typisierung der aktuellen Agrarumweltmaßnahmen als ergebnisorientierte oder<br />
maßnahmenorientierte Honorierung ________________________________________ 197<br />
Abbildung 43: Förderumfang von Artikel 16- und Agrarumweltmaßnahmen an der landwirtschaftlichen<br />
Nutzfläche in Natura 2000-Gebieten in Brandenburg __________________________ 200
VII<br />
Abbildung 44: Anwendung von Artikel 16-Maßnahmen in Deutschland ________________________ 201<br />
Abbildung 45: Typisierung der aktuellen Artikel 16-Maßnahmen als Subvention oder Honorierung auf<br />
der Grundlage der Verteilung der Eigentumsrechte ____________________________ 204<br />
Abbildung 46: Typisierung der aktuellen Artikel 16-Maßnahmen im Hinblick auf ihren Zielbezug ___ 205<br />
Abbildung 47: Typisierung der aktuellen Artikel 16-Maßnahmen im Hinblick auf den Prozess der<br />
Indikatorenentwicklung __________________________________________________ 208<br />
Abbildung 48: Typisierung der aktuellen Artikel 16-Maßnahmen als ergebnisorientierte oder<br />
maßnahmenorientierte ‚Honorierung’ _______________________________________ 209<br />
Abbildung 49: Eintragsvermindernde Agrarumweltmaßnahmen in Brandenburg innerhalb und<br />
außerhalb von sensiblen Gebieten für N-Immissionen ins Grundwasser ____________ 217<br />
Abbildung 50: Punktuelle und diffuse Eintragspfade und Prozesse in Flussgebieten Deutschlands____ 221<br />
Abbildung 51: Stickstoffeinträge nach Eintragspfaden _____________________________________ 222<br />
Abbildung 52: Stufen des landwirtschaftlichen N-Eintrages als Ansatzstelle für eine<br />
ergebnisorientierte Honorierung ___________________________________________ 223<br />
Abbildung 53: Potential an N-Immissionsverminderung in den drei Szenarien anhand der Verteilung<br />
der Fluren in den Potentialklassen__________________________________________ 233<br />
Abbildung 54: Verteilung der Potentialflächen für die Verminderung von N-Immissionen unter<br />
Szenario 1 ____________________________________________________________ 234<br />
Abbildung 55: Verteilung der Potentialflächen für die Verminderung von N-Immissionen unter<br />
Szenario 2 ____________________________________________________________ 234<br />
Abbildung 56: Verteilung der Potentialflächen für die Verminderung von N-Immissionen unter<br />
Szenario 3 ____________________________________________________________ 235<br />
Abbildung 57: N-Immissionsverminderung für drei Szenarien________________________________ 236<br />
Abbildung 58: Berücksichtigung der Retention und Verluste auf dem N-Eintragspfad im Rahmen der<br />
verwendeten Modelle bzw. Bewertungsansätze _______________________________ 237<br />
Abbildung 59: Vorschlag für eine ergebnisorientierte Honorierung der N-Immissionsverminderung für<br />
zwei Agrarumweltmaßnahmen unter Nutzung von zwei Optimierungsstrategien _____ 243<br />
Abbildung 60: Ermittelter Gesamtbestand von kulturbestimmten Lebensraumtypen in Deutschland __ 259<br />
Abbildung 61: Verfahren zur Ableitung der Indikatoren für eine ergebnisorientierte Honorierung für<br />
den Lebensraumtyp Brenndolden-Auenwiese _________________________________ 268<br />
Abbildung 62: Verfahren zur Ableitung der Indikatoren für eine ergebnisorientierte Honorierung für<br />
den Lebensraumtyp Magere Flachland-Mähwiese _____________________________ 269
Tabellenverzeichnis<br />
VIII<br />
Tabelle 1: Gegenüberstellung der Schaffung und Änderung von Eigentumsrechten an ökologischen<br />
Gütern __________________________________________________________________ 76<br />
Tabelle 2: Träger des Vertragsrisikos bei nicht problemäquivalenten Indikatoren im Rahmen der<br />
Honorierung _____________________________________________________________ 123<br />
Tabelle 3: Anzahl der Brutpaare und des Reproduktionserfolges des Großen Brachvogels auf Grünland<br />
in drei Brandenburger Vogelschutzgebieten ____________________________________ 126<br />
Tabelle 4: Träger des Vertragsrisikos bei nicht zeitäquivalenten Indikatoren im Rahmen der<br />
Honorierung _____________________________________________________________ 127<br />
Tabelle 5: Praktische Relevanz der Indikatorentypen im Rahmen der Honorierung unter Unsicherheit141<br />
Tabelle 6: Überblick über die verschiedenen Programme im Bereich ländlicher Entwicklung______ 160<br />
Tabelle 7: Modulationsbedingte Verschiebung der EU-Beihilfen von der ersten in die zweite Säule in<br />
Deutschland _____________________________________________________________ 169<br />
Tabelle 8: Prämienhöhe für ausgewählte Agrarumweltmaßnahmen in Brandenburg und Sachsen___ 185<br />
Tabelle 9: Entwicklung des geförderten Grünlandes nach Einführung der ergebnisorientierten<br />
Honorierung in Baden-Württemberg __________________________________________ 196<br />
Tabelle 10: Art und Anwendungsumfang von Artikel 16-Maßnahmen in Brandenburg ____________ 200<br />
Tabelle 11: Information und Beteiligung der Landwirte im Rahmen der Natura 2000-Gebietsmeldung 207<br />
Tabelle 12: Beschreibung der Relevanzklassen von landwirtschaftlichen Standorten für die<br />
N-Immissionen ins Grundwasser_____________________________________________ 227<br />
Tabelle 13: Beschreibung der Relevanzklassen von landwirtschaftlichen Standorten für die N-<br />
Immissionen in die Oberflächengewässer ______________________________________ 229<br />
Tabelle 14: Vorschlag für Gewichtungsfaktoren in Anlehnung an die geschätzten N-Immissionen in das<br />
Flusssystem _____________________________________________________________ 239<br />
Tabelle 15: Prämienkalkulation pro kg verminderter N-Immission für zwei Agrarumweltmaßnahmen 242<br />
Tabelle 16: Flächenumfang von drei kulturbestimmten Grünland-Lebensraumtypen in vier<br />
Bundesländern ___________________________________________________________ 260<br />
Tabelle 17: Art der Honorierung in Abhängigkeit von der Lebensraumqualität __________________ 271<br />
Tabelle 18: Ergebnisorientierte Honorierung im Rahmen von Artikel 16 für Brenndolden-Auenwiesen<br />
und Magere Flachland-Mähwiesen ___________________________________________ 272
Abkürzungsverzeichnis<br />
ABAG Allgemeinen Bodenabtragsgleichung<br />
AUM Agrarumweltmaßnahme<br />
AL Ackerland<br />
BB Brandenburg<br />
BBodSchG Bundes-Bodenschutzgesetz<br />
BE Berlin<br />
BImSchG Bundes-Immissionsschutzgesetz<br />
BetrPrämDurchfG Betriebsprämiendurchführungsgesetz<br />
BGH Bundesgerichtshof<br />
BGHZ Entscheidungen des Bundesgerichtshofes in Zivilsachen<br />
BMVEL Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft<br />
BNatSchG Bundesnaturschutzgesetz<br />
BP Brutpaare<br />
BVerfGE Bundesverfassungsgerichtsentscheidung<br />
BVerwG Bundesverwaltungsgericht<br />
BVerwGE Bundesverwaltungsgerichtsentscheidung<br />
BW Baden-Württemberg<br />
BY Bayern<br />
DirektZahlVerpflG Direktzahlungen-Verpflichtungengesetz<br />
D Deutschland<br />
DPSIR Driving Forces-Pressures-State-Impact-Responses<br />
DPSR Driving Forces-Pressures-State-Responses<br />
DüngeVO Düngeverordnung<br />
DüngeMG Düngemittelgesetz<br />
EAGFL Europäischer Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Landwirtschaft<br />
EFRE Europäischer Fonds für regionale Entwicklung<br />
EPLR Entwicklungsplan für den ländlichen Raum<br />
ESA Environmental Sensitive Areas<br />
EU Europäische Union<br />
EuGH Europäischer Gerichtshof<br />
EU-15 Mitgliedstaaten (15) der EU vor der EU-Osterweiterung<br />
EV Einigungsvertrag<br />
FAL Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft<br />
FFH Fauna-Flora-Habitat<br />
FIAF Finanzierungsinstrument für die Ausrichtung der Fischerei<br />
FN Fußnote<br />
GAP Gemeinsame Agrarpolitik<br />
GATT General Agreement on Tariffs and Trade<br />
GG Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland<br />
GL Grünland<br />
HB Bremen<br />
HE Hessen<br />
HH Hamburg<br />
i.e.S. im eigentlichen Sinne<br />
i.d.S. in diesem Sinne<br />
i.S.v. im Sinne von<br />
InVeKoS Integriertes Verwaltungs- und Kontrollsystem<br />
IOGB Integrierter Obst- und Gemüsebau<br />
IX
KULAP Kulturlandschaftsprogramm<br />
LANA Länderarbeitsgemeinschaft Naturschutz, Landschaftspflege und Erholung<br />
LAWA Länderarbeitsgemeinschaft Wasser<br />
LF Landwirtschaftliche Fläche<br />
LRT Lebensraumtyp<br />
LUA Landesumweltamt Brandenburg<br />
LVL Landesamt für Verbraucherschutz und Landwirtschaft des Landes Brandenburg (jetzt<br />
LVLF)<br />
MEKA Marktentlastungs- und Kulturlandschafts-Ausgleich<br />
MSL Markt- und standortangepasste Landwirtschaft<br />
MMK Mittelmaßstäbige landwirtschaftliche Standortkartierung<br />
MTR Mid-Term-Review<br />
MV Mecklenburg-Vorpommern<br />
NCO Non Commodity Outputs<br />
NföA Nationales Forum für ökologischen Ausgleich<br />
NI Niedersachsen<br />
NL Normative Ladung<br />
NNatSchG Niedersächsisches Naturschutzgesetz<br />
NW Nordrhein-Westfalen<br />
OECD Organisation for Economic Co-operation and Development<br />
ÖLN Ökologischer Leistungsnachweis<br />
OP Operationelles Programm<br />
ÖQV Öko-Qualitätsverordnung in der Schweiz<br />
PSR Pressure-State-Response-Ansatz<br />
PflSchG Gesetz zum Schutz der Kulturpflanzen<br />
RP Rheinland-Pfalz<br />
SAC Special Area of Conservation<br />
SH Schleswig-Holstein<br />
SL Saarland<br />
SN Sachsen<br />
SPA Special Protection Area<br />
ST Sachsen-Anhalt<br />
TH Thüringen<br />
TÜV Technischer Überwachungsverein<br />
UN/ECE Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für Europa<br />
UNCED United Nations Conference on Environment and Development<br />
UNDP Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen<br />
UPR Urheberpersönlichkeitsrecht<br />
VERMOST Vergleichsmethode Standort<br />
VO Verordnung<br />
WHG Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts<br />
WTO World Trade Organisation<br />
WRRL Wasserrahmenrichtlinie<br />
X
Einleitung 1<br />
1 Einleitung<br />
Die Honorierung ökologischer Leistungen der Landwirtschaft ist ein Instrument zur Lösung von<br />
Konflikten zwischen Landwirtschaft und Umweltschutz. Dabei ist das Verhältnis von einem<br />
bekannten Dualismus geprägt: Auf der einen Seite die seit Jahrzehnten beschriebenen<br />
schädlichen Umweltwirkungen der aktuellen Landwirtschaft, auf der anderen Seite positive<br />
Wirkungen, die sich jedoch fast ausschließlich auf traditionelle oder extensive Nutzungen<br />
beschränken (vgl. SRU 1985). Trotz dieser prinzipiellen Erkenntnis wesentlicher Wirkungen der<br />
Landwirtschaft auf die Umwelt scheint gerade dieser Bereich aus verschiedenen Gründen dafür<br />
prädestiniert zu sein, sich Entscheidungen zur Konfliktlösung zu entziehen. Juristisch<br />
gesprochen liegt das Problem weniger im fehlenden Wissen über den Regelungsgegenstand als<br />
im Fehlen von Lenkungswissen.<br />
Im Zuge der Produktion von Lenkungswissen stößt man unweigerlich auf Kernprobleme der<br />
Ökologie, der Ökonomie und der Rechtswissenschaft. Es seien hier einleitend für die Ökologie<br />
die Komplexität und nicht-lineares Verhalten ökologischer Systeme (vgl. Kap. 6.3.5.1), für die<br />
Ökonomie die Problematik der ökonomischen Eigentumsrechte (property rights) (vgl. Kap. 5)<br />
und damit eng verbunden für die Rechtswissenschaften die Eigentumsdogmatik (vgl. Kap. 5.6.1)<br />
aufgeführt. Nun setzt die Produktion von Lenkungswissen die Anwendung von Erkenntnissen in<br />
den oben umrissenen Gebieten voraus, was die Schwierigkeit dieses Unterfangens begründet.<br />
Die Bearbeitung von gesellschaftlichen Fragestellungen, wie die Lösung der Konflikte zwischen<br />
der aktuellen landwirtschaftlichen Nutzung und den damit verbundenen Umweltproblemen,<br />
bedarf in jedem Fall eines interdisziplinären Ansatzes. Auf der wissenschaftlichen Ebene führt<br />
dies bekanntermaßen zu Problemen: „Wer zu lang im Ausland lebt, kann schließlich heimatlos<br />
werden. Mit der fremden Sprache und Kultur wird er nie wirklich heimisch, aber zuhause findet<br />
er sich auch nicht mehr zurecht. Wer interdisziplinär arbeitet, steht in der gleichen Gefahr. Das<br />
fremde Fach nimmt ihn nicht wirklich ernst, das eigene Fach hält ihn für einen Fremdling“<br />
(Engel 2001: 4). Vielleicht habe ich hier als Planerin weniger Verlustängste, fehlt mir doch<br />
dieses ‚Heimatgefühl’ in einer Disziplin.<br />
Das Interesse am Wissenserwerb im Rahmen dieser Arbeit ist instrumentell. Wissen ist insoweit<br />
von Interesse, als es die Voraussetzung für Entscheidungen schafft oder verbessert. Darin wird<br />
deutlich, dass diese Arbeit methodisch eher juristischem Vorgehen entspricht.<br />
Ziel der Arbeit ist es, das theoretische Wissen der relevanten wissenschaftlichen Disziplinen im<br />
Hinblick auf das Instrument der Honorierung ökologischer Leistungen der Landwirtschaft
2 Kapitel 1<br />
innerhalb einer Arbeit zu diskutieren und damit eine integrative Auseinandersetzung zu<br />
ermöglichen. Der erkenntnistheoretischen Einsicht „Wer die Wirklichkeit ganz sehen will, sieht<br />
schließlich gar nichts mehr“ (Albert 1978) folgend, macht ein derartiger Ansatz nur im<br />
Zusammenhang mit der Lösung eines konkreten gesellschaftlichen Problems einen Sinn. Das<br />
hier zur Diskussion stehende gesellschaftliche Problem lautet: Wie kann unter den gegebenen<br />
gesellschaftlichen Rahmenbedingungen eine effektive und effiziente Honorierung ökologischer<br />
Leistungen der Landwirtschaft erfolgen und inwieweit unterscheiden sich dabei<br />
ergebnisorientierte von maßnahmenorientierten Honorierungsansätzen? Die gesellschaftlichen<br />
Rahmenbedingungen werden dabei als ein wandelbarer und sich wandelnder institutioneller<br />
Rahmen mit in die Betrachtungen einbezogen.<br />
Erst die interdisziplinäre und integrative Auseinandersetzung spannt das Problemnetz auf, das<br />
sich hinter den konkreten gesellschaftlichen Fragen verbirgt und zeigt, warum die praktische<br />
Ausgestaltung der Honorierung ökologischer Leistungen immer, jedoch graduell abnehmend,<br />
unbefriedigend sein wird. Zwei Beispiele für die mögliche aktuelle Anwendung einer<br />
ergebnisorientierten Honorierung ökologischer Leistungen sollen jedoch einen positiven<br />
Ausblick geben und aufzeigen, dass in jedem Fall Verbesserungspotential im Vergleich zu den<br />
derzeit eingesetzten Instrumenten besteht.
Problemstellung 3<br />
2 Problemstellung, Aufbau und Methodik<br />
Die Honorierung ökologischer Leistungen der Landwirtschaft ist ein ökonomisches Instrument,<br />
um dem Marktversagen im Bereich der ökologischen Güter, durch entsprechende Institutionen<br />
entgegenzuwirken. Ökonomischen, besser marktkonformen Instrumenten wird in einer liberalen<br />
Gesellschaft gegenüber dem Ordnungsrecht ein Vorrang zugebilligt und es spricht alles dafür,<br />
den Markt als Allokationsinstrument so weit wie möglich zu nutzen. Der Einsatz von<br />
marktkonformen Instrumenten (vgl. Kap. 3) zur Lösung der Probleme zwischen Landwirtschaft<br />
und Umweltschutz verlangt staatliches Eingreifen sowie die Schaffung und Durchsetzung von<br />
Institutionen, die öffentliche ökologische Güter für die positiven Mechanismen des Marktes<br />
zugänglich machen. In diesem Zusammenhang sind u.a. Erkenntnisse der Theorie der property<br />
rights (vgl. u.a. Brubaker 1995, Bromley 1997b) unter den gegebenen gesellschaftlichen<br />
Rahmenbedingungen auf den Sachverhalt anzuwenden (vgl. Kap. 5). Der Agrarbereich befindet<br />
sich aktuell aus institutionenökonomischer Sicht in einem Institutionenwandel. Die<br />
Schwierigkeiten einer effektiven und effizienten Ausgestaltung der Honorierung ökologischer<br />
Leistungen sind nur im Zusammenhang dieses komplexen Prozesses zu verstehen.<br />
Könnten öffentliche Güter den Marktmechanismen zugänglich gemacht werden, wäre allerdings<br />
schon viel getan. Generell liegen die Ursachen vieler Umweltprobleme tatsächlich darin, dass die<br />
Erkenntnisse der Ökonomie zu den natürlichen Ressourcen in der Praxis nicht angewendet<br />
werden und weniger darin, dass die „naive“ Neoklassik „dem Markt als unfehlbarem<br />
Allokationsinstrument blindlings“ vertraut (vgl. Hampicke 1999: 173). Wenn es um die Frage<br />
geht: ‚Wie kann eine effiziente Allokation von knappen Ressourcen aussehen? und nicht um die<br />
Frage: ‚Was bzw. welche sind die knappen Ressourcen?’, gibt es „größte methodische<br />
Verwandtschaft“ innerhalb der ökonomischen Strömungen (ebd.: 172), was einer Anwendung<br />
dieser Erkenntnisse sehr entgegenkommt.<br />
Es spricht viel dafür, dass die intensive Auseinandersetzung mit der Frage, ‚wie’ Instrumente für<br />
eine effiziente Allokation der öffentlichen ökologischen Güter im Zusammenhang mit der<br />
landwirtschaftlichen Nutzung ausgestaltet werden können, einen nicht unbeträchtlichen Beitrag<br />
zur Problemlösung bei Konflikten zwischen Landwirtschaft und Umweltschutz leisten kann.<br />
Erforderliche anwendungsbereite ökonomische Erkenntnisse sind verfügbar. „Der bedeutende<br />
Beitrag, den die Ökonomik durch den Einsatz marktwirtschaftlicher Instrumente des<br />
Umweltschutzes leisten kann, die zum Ziel des Naturerhalts mit hoher statischer und<br />
dynamischer Effizienz und mit einem geringen Maß an Eingriff in individuelle<br />
Entscheidungsfreiheit beitragen, sollte bei allen berechtigten praktischen und juristischen<br />
Bedenken stets im Auge behalten werden“ (Nutzinger 1999: 63).
4 Kapitel 2<br />
Diese Arbeit beschäftigt sich nur am Rande damit ‚was’ die knappen ökologischen Güter sind,<br />
die in Beziehung zu der Landwirtschaft stehen, sondern legt den Schwerpunkt darauf, welche<br />
Eigenschaften und Anforderungen diese Güter erfüllen müssen, um im Wirtschaftssystem<br />
Berücksichtigung zu finden – um eine effiziente Allokation über den Markt realisieren zu<br />
können. Diese Anforderungen aus ökonomischer Sicht werden vor dem Hintergrund<br />
ökosystemarer Erkenntnisse kritisch diskutiert und damit Möglichkeiten und Grenzen einer<br />
effizienten Honorierung ökologischer Leistungen über den Markt aufgezeigt.<br />
Diese Themeneingrenzung wird in dem Bewusstsein vorgenommen, dass durch die<br />
Nichtberücksichtigung der Frage nach dem ‚was die ökologischen Güter sind’, einer der<br />
wesentlichsten Problembereiche der Nachhaltigen Entwicklung ausgespart wird. Es sei an dieser<br />
Stelle auf die Ökologische Ökonomie verwiesen, die sich neben den Allokationsfragen auch mit<br />
der Entwicklung gesellschaftlicher Ziele bzw. ethischer Normen vor dem Hintergrund nicht<br />
substituierbarer natürlicher Ressourcen und fairer Distribution auseinandersetzt (vgl. z. B.<br />
Hampicke 1992, Daly 1992).<br />
Im Folgenden werden anhand von Fragen das Gesamtkonzept der Arbeit und der Aufbau der<br />
einzelnen Kapitel im Überblick dargestellt.<br />
Was sind ökonomische Instrumente und welche Vorteile versprechen sie? (Kapitel 3)<br />
Umweltökonomische Instrumente heben sich von den anderen umweltpolitischen Instrumenten<br />
dadurch ab, dass sie rationale Entscheidungen beeinflussen wollen. Rational handelnde<br />
Individuen sind die Grundannahme beim Einsatz ökonomischer Instrumente und bestimmen<br />
Möglichkeiten und Grenzen der Instrumente. Honorierungsinstrumente können danach<br />
unterschieden werden, an welcher ‚Optimierungsgröße’ sie ansetzen: An Gütern einer<br />
individuellen Nachfrage (im Sinne von Internalisierungsansätzen) oder an Umweltzielen (im<br />
Sinne von standardorientierten Ansätzen). Es wird gezeigt, dass beide Ansätze gerade im Lichte<br />
der Anwendung des Verursacherprinzips weniger Differenzen aufweisen als oftmals dargestellt<br />
wird. Beide Formen sind in dem dieser Arbeit zugrunde liegenden Honorierungsinstrument<br />
wieder zu finden.
Problemstellung 5<br />
Wodurch ist das Instrument der Honorierung ökologischer Leistungen charakterisiert und<br />
worin bestehen die Unterschiede zwischen der ergebnisorientierten und der<br />
maßnahmenorientierten Honorierung? (Kapitel 4)<br />
Die Honorierung ökologischer Leistungen ist ein seit Jahrzehnten bearbeitetes Thema.<br />
Dementsprechend viele Definitionen zu ‚ökologischen Leistungen’ und zum Instrument<br />
‚Honorierung ökologischer Leistung’ sind verfasst. Als Ausgangspunkt dieser Arbeit wird eine<br />
Charakterisierung des hier verwendeten Instrumentes der ‚Honorierung ökologischer<br />
Leistungen’ erarbeitet und eingehend beschrieben.<br />
Ökonomische Instrumente werden oft als ‚die’ Alternative zum defizitären oder auch nur<br />
‚ungeliebten’ Ordnungsrecht dargestellt. Die Begründung baut auf der Annahme auf, dass<br />
ökonomische Instrumente durch rationale Entscheidungen zur Effizienz führen. In der<br />
Argumentation für ökonomische Instrumente wird oftmals von einem ‚Idealmodell’ ausgegangen<br />
und dessen Eigenschaften werden auf das real vorliegende Instrument und die<br />
Rahmenbedingungen übertragen. Tatsächlich sind die aktuell angewendeten Instrumente, wie die<br />
Honorierung ökologischer Leistungen der Landwirtschaft im Rahmen der Agrarumwelt-<br />
programme, weit davon entfernt, dem ‚Idealmodell’ zu entsprechen. Kurz: Nicht überall wo<br />
‚Honorierung ökologischer Leistungen’ draufsteht, ist ein effizientes ökonomisches Instrument<br />
drin. Anhand des Vergleiches der ergebnisorientierten und der maßnahmenorientierten<br />
Honorierung werden wesentliche Kriterien eines effizienten Instrumentes diskutiert und Defizite<br />
der maßnahmenorientierten Honorierung aufgezeigt.<br />
Was sind die Voraussetzungen für den effizienten Einsatz der Honorierung ökologischer<br />
Leistungen und wodurch wird der Einsatz begrenzt? (Kapitel 5 und 6)<br />
Eine Honorierung ökologischer Leistungen ist lediglich dann möglich, wenn Eigentumsrechte an<br />
den ökologischen Gütern geschaffen sind. Man kann dies auch so formulieren: Mit dem<br />
Instrument der Honorierung ökologischer Leistungen muss es zur Schaffung und Durchsetzung<br />
von Eigentumsrechten kommen, um damit Umweltprobleme zu lösen. Aufbauend auf der<br />
Theorie der property rights wird unter Rückgriff auf die vorhandene Literatur das<br />
Umweltproblem als ein Problem fehlender oder ineffizienter Eigentumsrechte dargestellt. Die<br />
Schaffung und Durchsetzung von Eigentumsrechten erfüllt dabei den Zweck, eine effiziente<br />
Allokation ökologischer Güter zu ermöglichen. Dass die Distribution (Verteilung) der<br />
Eigentumsrechte jedoch nicht allein dem Diktat der Effizienz zu folgen hat, ist<br />
verfassungsrechtlich geregelt. Die aktuell herrschende Rechtsmeinung wird dargestellt und
6 Kapitel 2<br />
diskutiert. Ökonomische und juristische Anforderungen bestimmen somit den Rahmen für die<br />
Schaffung und Durchsetzung der Eigentumsrechte an ökologischen Gütern.<br />
Rationale Entscheidungen zur Lösung von Umweltproblemen bedürfen einer<br />
‚Optimierungsgröße’ und Handlungsalternativen. Umweltpolitische Ziele stellen diese<br />
Optimierungsgrößen für den Fall dar, dass individuelle Nachfrage aufgrund der besonderen<br />
Eigenschaften und Rahmenbedingungen bei ökologischen Gütern nicht bekundet wird. Ohne<br />
diese ‚Optimierungsgröße’ wie bei ‚Minimierungsstrategien’ ist der Einsatz von<br />
Honorierungsinstrumenten ökonomisch gesehen unsinnig.<br />
Problematisch bei der Optimierungsgröße ‚Umweltziel’ ist jedoch, dass die zu lösenden<br />
Umweltprobleme in Theorie und Praxis regelmäßig bereits als ziel-mittel-rational vorstrukturiert<br />
angenommen werden (Gawel 1999). Hierbei kann man vom ‚Rationalitätsdogma’ der<br />
ökonomischen Theorie sprechen (Gawel 1993: 574). Dabei wird bisher oft vernachlässigt, dass<br />
‚rationalisierte’ Umweltziele als Ansatzstellen für Eigentumsrechte und damit für<br />
Marktmechanismen in den wenigsten Fällen entwickelt sind. Tatsächlich wird die Möglichkeit<br />
der Schaffung von Eigentumsrechten und deren Durchsetzung mit Hilfe von effizienten<br />
ökonomischen Umweltinstrumenten entscheidend dadurch begrenzt, dass derartige rationalisierte<br />
Umweltziele, in dieser Arbeit als Indikatoren bezeichnet, nicht entwickelt sind und teilweise<br />
nicht entwickelt werden können.<br />
Kapitel 6 zeigt die Notwendigkeit von rationalisierten Umweltzielen und die Anforderungen an<br />
diese auf. Die Ableitung der Anforderungen erfolgt durch die Übertragung der Erkenntnisse aus<br />
der Indikatorenentwicklung auf den Sachverhalt auf der einen Seite und die Berücksichtigung<br />
wesentlicher politischer und juristischer Rahmenbedingungen der Honorierung ökologischer<br />
Leistungen auf der anderen Seite. Diese Anforderungen leiten über in die Probleme und Grenzen<br />
der Rationalisierung, deren wesentliche Ursache im Charakter ökologischer Güter bzw.<br />
ökologischer Systeme zu finden ist. Die Konsequenzen, die im Wesentlichen dem<br />
Problembereich des Umgangs mit Unsicherheit zuzuordnen sind, werden für die Honorierung<br />
ökologischer Leistungen analysiert.<br />
Wie und in welchem Umfang erfolgt aktuell die Honorierung ökologischer Leistungen der<br />
Landwirtschaft und inwieweit entsprechen diese Instrumente den theoretisch diskutierten<br />
Anforderungen? (Kapitel 7)<br />
Seit rund 10 Jahren werden in der Praxis in ganz Europa Zahlungen für umweltgerechtes<br />
Wirtschaften der Landwirte im Rahmen von Agrarumweltmaßnahmen getätigt. Eine
Problemstellung 7<br />
Verbesserung der Ausgestaltung dieser Instrumente wird seit längerem gefordert (u.a. Deblitz<br />
1999, Schramek et al. 1999a, COM 2000a). Unter welchen Rahmenbedingungen und in welchem<br />
Umfang aktuell diese Zahlungen erfolgen, gibt Aufschluss über die Bedeutung von<br />
Honorierungsinstrumenten. Analysiert wird, welchen Charakter diese Honorierungsinstrumente<br />
haben, inwieweit die innerhalb dieser Arbeit diskutierten Anforderungen an Effizienz<br />
berücksichtigt und wie die Eigentumsrechte verteilt sind. Auf der Grundlage der internationalen<br />
Rahmenbedingungen und der Ausgestaltung von Zahlungen für ökologische Leistungen der<br />
Landwirtschaft im Rahmen der Europäischen Verordnung VO (EG) 1257/1999 werden die<br />
aktuellen Honorierungsinstrumente analysiert.<br />
Kriterien dabei sind die Effizienzbetrachtungen (vgl. Kap. 4), die Verteilung der<br />
Eigentumsrechte (vgl. Kap. 5) sowie die in Kapitel 6 formulierten Anforderungen an<br />
Indikatoren, wobei hierbei der Zielbezug im Mittelpunkt steht. Die Analyse der aktuell<br />
angewendeten Honorierungsinstrumente erfolgt für die Agrarumweltprogramme in Deutschland<br />
sowie für die Umsetzung des Artikels 16 für Ausgleichszulagen in Natura 2000-Gebieten<br />
aufgrund von ordnungsrechtlichen Auflagen, als ein Sonderfall von Zahlungen.<br />
Wie kann eine ergebnisorientierte Honorierung ökologischer Leistungen unter den<br />
gegebenen Rahmenbedingungen umgesetzt werden? (Kapitel 8)<br />
Die OECD beklagt, dass zwar ein beeindruckender Fundus an Kenntnissen sowohl bezüglich der<br />
einschlägigen konzeptionellen Aspekte als auch im Hinblick auf die praktischen Möglichkeiten<br />
zur Verbesserung der Umweltergebnisse in der Landwirtschaft vorhanden ist, dieses Wissen aber<br />
in der Vergangenheit nicht in ausreichendem Maße angewendet und den Landwirten zugänglich<br />
gemacht wurde (OECD 1999b).<br />
Anhand von zwei konkreten Anwendungsgebieten für ergebnisorientierte Honorierung wird die<br />
theoretisch geführte Diskussion an praktischen Beispielen angewendet. Im Zuge von zwei<br />
hochaktuellen Problembereichen sollen Honorierungsinstrumente für ökologische Leistungen der<br />
Landwirtschaft einen entscheidenden Beitrag für die Lösung leisten: (i) Im Rahmen der<br />
Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie und (ii) im Zuge der Umsetzung des Natura 2000-<br />
Netzes. Eine ergebnisorientierte Honorierung ist aufgrund der Rahmenbedingungen in beiden<br />
Fällen möglich, und es kann damit der folgenden Aufforderung gefolgt werden: „In der<br />
gegebenen historischen Situation ist es geboten, kluge Kompromisse zu schließen und<br />
Institutionen zu schaffen, die rasch reale Fortschritte zeigen und den Weg für<br />
nachfrageorientierte Lösungen nicht zu verbauen, sondern ihn durch die Gewinnung von<br />
Erfahrungen für die Beteiligten „schmackhaft“ zu machen (Hampicke 2000a: 45).
8 Kapitel 3<br />
3 Ökonomische Instrumente im System der umweltpolitischen Instrumente<br />
3.1 Ökonomische Instrumente<br />
3.1.1 Steuerung durch rationale Entscheidungen<br />
Grundlegender Gedanke von ökonomischen Instrumenten ist das ökonomische<br />
Verhaltensmodell. Dieses geht von der Annahme individuell rationalen Verhaltens der<br />
Wirtschaftssubjekte aus und unterstellt dabei, dass diese ihre Entscheidungen an ihrem eigenen<br />
Vorteil ausrichten (Weck-Hannemann 1999: 68). Individuen bewerten den Nutzen und die<br />
Kosten alternativer Entscheidungen. Und sie entscheiden sich nach Abwägung der Vor- und<br />
Nachteile für jene Alternative, die ihnen den höchsten Nettonutzen verspricht. „Die Theorie<br />
rationalen Verhaltens beruht darauf, dass die Individuen einen Anreiz haben, sich für die beste<br />
aller möglichen Alternativen zu entscheiden, da sie die Folgen dieser Entscheidung – und damit<br />
auch die Folgen einer ‚falschen’ Entscheidung – in vollem Umfang selbst zu tragen haben“<br />
(ebd.: 76). Das Bild des homo oeconomicus ist entworfen. Aus der ökonomischen Perspektive ist<br />
menschliches Handeln „rationale Auswahl aus Alternativen“ durch Individuen (Kirchgässner<br />
1991: 12). Den Individuen wird dabei eigennutzorientiertes und in der Neoklassik ein vollständig<br />
unkooperatives Handeln unterstellt (Hampicke 1992). Menschliches Handeln ist planvoll und im<br />
Allgemeinen nicht sprunghaft oder chaotisch 1 .<br />
Der ‚ökonomische’ Rationalitätsansatz kann dem Konzept der instrumentellen Rationalität<br />
zugeordnet werden. Ihm zufolge ist ein Verhalten rational, wenn es im Hinblick auf bestimmte,<br />
als erwünscht ausgezeichnete Weltzustände als geeignetes Mittel gelten kann, diese Zustände<br />
herbeizuführen (Nida-Rümelin 1994: 3, Arni 1994: 31). Es kann auch von Ziel-Mittel-<br />
Rationalität gesprochen werden.<br />
Das instrumentelle ökonomische Rationalitätsverständnis betrachtet Wirtschaften als eine<br />
zweckrationale Disposition bzgl. knapper Ressourcen unter dem Walten des ökonomischen<br />
Prinzips (vgl. Gawel 1999: 241). Rationalität im allgemeinen ökonomischen Verständnis<br />
beschränkt sich auf die Frage nach den vernünftigen Mitteln zur Erreichung von Zielen. Von<br />
1 „Im Sinne der Hume’schen Tradition wird das menschliche Verhalten quasi-mechanisch erklärt: als die Resultate<br />
aus inneren Dispositionen und äußeren Anreizen. Eine gegebene Konstellation von Dispositionen und Anreizen<br />
bewirkt notwendig ein bestimmtes Handeln, was sich empirisch als die Wahrscheinlichkeit äußert, mit der ein<br />
bestimmtes Verhaltensresultat auftritt. Nicht ‚ich denke’, sondern ‚es’ denkt; das eigene Handeln ist weniger<br />
gewollt, sondern mehr bewirkt. Dagegen steht die Kant’sche Tradition, wonach der Mensch die Fähigkeit hat,<br />
aufgrund der von ihm selbst geschaffenen Erkenntnisse und regulativen Prinzipien in das Geschehen aktiv<br />
einzugreifen. Im Sinne dieser Tradition wird der Mensch als das ‚Theorien fabrizierende Tier’ aufgefasst. ... Die<br />
ökonomische Theorie menschlichen Verhaltens folgt eher der Kant’schen, die meisten psychologischen Ideen<br />
scheinen überwiegend der Hume’schen Tradition zu folgen“ (Meyer 1981), vgl. dazu auch Kapitel 5.4.1.
Ökonomische Instrumente 9<br />
dieser Zweckrationalität kann eine Rationalität unterschieden werden, bei der es um die<br />
vernünftigen Ziele im Sinne sittlicher Vernunft geht (Gorke & Ott 2003).<br />
Die Interpretation des Rationalitätskonzeptes ist weniger stringent als es auf den ersten Blick<br />
scheint 2 . Es sollen an dieser Stelle lediglich einige, für diese Arbeit wichtige Diskussionspunkte<br />
aufgegriffen werden. Kapitel 5.4.1 verdeutlicht die Bedeutung für das Thema der Honorierung<br />
ökologischer Leistungen.<br />
Es stellt sich die Frage, was die Kriterien der Rationalität sind. Misst sich die Rationalität an dem<br />
tatsächlichen Erreichen des Ziels (rational ist eine Entscheidung über die Mittel dann, wenn<br />
diese tatsächlich zum Ziel führt = objektive Rationalität 3 ) oder an der rationalen Auswahl<br />
vorhandener Alternativen? Das erstere ist unsinnig; „jedenfalls steht es in keinerlei<br />
Zusammenhang mit der Tradition des Vernunftbegriffs. Regellosigkeit ist vernunftwidrig – nicht<br />
das Subjekt, das sich auf sie nicht einstellen kann“ (Lübbe 1999: 18). Bei letzterem taucht das<br />
Problem auf, was als vorhandene Alternativen gezählt wird. Wird homo oeconomicus als ein<br />
vollständig informierter und immer blitzschnell entscheidender wandelnder Computer betrachtet<br />
(Kirchgässner 1991: 27)? In den neoklassischen Modellen ist dies der Fall. Werden derartige<br />
Modelle als Entscheidungshilfen bei der richtigen Wahl von Instrumenten eingesetzt bzw. sind<br />
Grundlage für die Zuweisung von Eigentumsrechten, erwachsen daraus Probleme. Diese<br />
Problematik wird in Kapitel 5.4.1 diskutiert.<br />
Für ökonomische Instrumente ist demnach charakteristisch, dass diese an den Adressaten keine<br />
Verhaltensanforderungen richten. Die Steuerung erfolgt durch eine Änderung der Restriktionen,<br />
unter denen der Adressat entscheidet. Diese Restriktionen werden durch finanzielle<br />
Anreizmechanismen verändert (Michaelis 1996). Finanzielle Anreizinstrumente sollen<br />
insbesondere zur Mobilisierung des Eigeninteresses der Normadressaten führen<br />
2 vgl. zu grundsätzlichen Problemen der Rationalitätskonzepte: z. B. Tietzel (1985); Popper (1995), vgl. zu<br />
Rationalitätskonzepten in der Ökonomie: z. B. Kirchgässner (1991); Gawel & Lübbe-Wolf (1999).<br />
3 Zur Beschreibung der „objektiven Rationalität“ soll ein Beispiel von Lübbe (1999: 17 f.) dienen. „Jemand möchte<br />
möglichst rasch mit dem Auto von Konstanz nach Zürich gelangen. Er kann entweder die Autobahn benutzen – das<br />
dauert etwa vierzig Minuten – oder die Landstraße. Dann dauert es eine Stunde. Objektiv rational verhält sich, wer<br />
die Autobahn benutzt – im Unterschied zu dem, der etwa in der irrigen Annahme, es gäbe zwischen Konstanz und<br />
Zürich gar keine Autobahn, über die Landstraße fährt. Was aber, wenn der Fahrer auf der Autobahn in einen<br />
plötzlichen, unfallbedingten Stau gerät, der ihn eine halbe Stunde kostet? Unter diesen Umständen wäre es besser<br />
gewesen, die Landstraße zu benutzen. Aber wir würden kaum sagen ‚Unter diesen Umständen wäre es rational<br />
gewesen, die Landstraße zu benutzen’. Das liegt daran, dass zum Zeitpunkt der Wahl der fraglichen Handlung auch<br />
der denkbar rationalste Autofahrer von jenen Umständen nichts wissen konnte. Dennoch wäre, falls die Umstände<br />
eintreten, die Fahrt über die Landstraße die objektiv rationale Handlung. ... Denn die bindet das Rationalitätsurteil<br />
an die Angepasstheit der Handlung an die tatsächlichen Umstände. Mit anderen Worten: sie prämiert den Erfolg,<br />
nicht den vernünftigen Plan.“
10 Kapitel 3<br />
(= „Ökonomisierung“ vgl. Gawel 1999: 243). Kennzeichnend sind demnach Alternativen und die<br />
Entscheidung unter dem Aspekt der Kosten. Ohne Alternativen gibt es kein ökonomisches<br />
Handeln.<br />
Das Recht hingegen will das Verhalten direkt beeinflussen, nicht die Entscheidung (Engel 2000).<br />
Im Ordnungsrecht erfolgt ein „einseitiger Verhaltensbefehl der klassischen Eingriffsverwaltung“<br />
(Kloepfer 1989: 98). Ökonomisch kann der ordnungsrechtliche Hebel als spezielle Form einer<br />
staatlichen Allokationspolitik beschrieben werden, die eine „systematische Verkürzung des<br />
individuellen Handlungs- und Möglichkeitsraumes“ anstrebt, „dessen Beschneidung nicht über<br />
preislich vermittelte Ressourcennutzungsbeschränkungen, sondern mit Hilfe unmittelbar in der<br />
Dimension der Handlungsvariable überbrachter Verhaltensbefehle gesteuert wird“ (Gawel 1994:<br />
96). Die Motive für die Verhaltensänderung können dabei sowohl extrinsisch als auch intrinsisch<br />
sein. Bei ersteren erfolgt die Verhaltensänderung durch Sanktionsandrohung, bei letzteren<br />
freiwillig.<br />
Kennzeichnend für ökonomische Instrumente ist daher indirekte, für das Ordnungsrecht direkte<br />
Verhaltenssteuerung. Neben den ordnungsrechtlichen und den ökonomischen Instrumenten gibt<br />
es noch die so genannten suasorischen Instrumente, die die Informationen und<br />
Wertvorstellungen des Entscheidungsträgers beeinflussen. In diesem Sinne erfolgt ebenfalls eine<br />
direkte Verhaltensänderung wie beim Ordnungsrecht, hierbei aber ausschließlich intrinsisch<br />
motiviert. Abbildung 1 verdeutlicht die Steuerungswirkung der drei beschriebenen Instrumente<br />
noch einmal. Selbstverständlich ist die Zuordnung eines konkreten Instrumentes unter einen der<br />
drei Typen nur bedingt möglich. So wird eine Wirkung des Rechtes mit dem Einfluss auf<br />
geänderte Wertvorstellungen (‚suasorisch’) begründet (Engel 2001). Auch der Übergang<br />
zwischen ordnungsrechtlichen und ökonomischen Instrumenten ist fließend. Bezieht z. B. die<br />
von einer Emissionsnorm betroffene Firma die Alternative der Normverletzung inklusive einer<br />
möglichen Sanktion in das Auswahlkalkül ein, so ist der Anreiz der Sanktion eher<br />
entscheidungsrelevant, als dass der ordnungsrechtliche Grenzwert das Verhalten steuert<br />
(Michaelis 1996, vgl. Gawel 1993).
Ökonomische Instrumente 11<br />
indirekt<br />
Steuerung von<br />
Entscheidungen<br />
Ökonomische<br />
Instrumente<br />
Abbildung 1: Verhaltenssteuerung umweltökonomischer Instrumente<br />
Die Honorierung ökologischer Leistungen baut als ökonomisches Instrument auf dem<br />
Rationalitätskonzept auf. Mit den positiven Anreizen sollen die Entscheidungen bzgl. der<br />
Alternativen beeinflusst werden. Es gibt auch bei den ökonomischen Instrumenten eine Vielzahl<br />
von möglichen Systematisierungen (u.a. Baumol & Oates 1988, Pearce & Turner 1990, Cansier<br />
1993, Michaelis 1996, vgl. auch für agrarumweltpolitische Instrumente Ewers & Hassel 2000).<br />
Eine systematische Gegenüberstellung der verschiedenen ökonomischen Instrumente (von<br />
Abgaben bis Zertifikaten) kann jedoch unterbleiben, steht im Mittelpunkt dieser Arbeit doch<br />
keine rationale Wahl oder Bewertung ökonomischer Instrumente, sondern die<br />
‚Binnenrationalisierung’ eines bestimmten ökonomischen Instrumentes – also dessen effizienter<br />
Einsatz und effiziente Ausgestaltung.<br />
Von Interesse für die Charakterisierung der Honorierung ökologischer Leistungen ist jedoch eine<br />
Typisierung im Hinblick auf den jeweiligen „allokationstheoretischen Anspruch“, der hinter den<br />
Instrumenten liegt (vgl. Hampicke 1996: 40).<br />
3.1.2 Pigou-Instrumente<br />
Steuerung<br />
intrinsischen und<br />
extrinsischen<br />
Verhaltens<br />
Ordnungsrechtliche<br />
Instrumente<br />
direkt<br />
Steuerung<br />
intrinsischen<br />
Verhaltens<br />
Suasorische<br />
Instrumente<br />
Mit Pigou-Instrumenten (Ansatz nach Pigou 1978) wird die vollständige Internalisierung von so<br />
genannten externen Effekten angestrebt, indem die Höhe des gestifteten Schadens/Nutzens<br />
möglichst genau erhoben und diese Summe seinem Verursacher in Rechnung gestellt wird
12 Kapitel 3<br />
(Hampicke 1996). Das Ziel von Pigou-Instrumenten ist es, private und soziale Kosten/Nutzen in<br />
Einklang zu bringen. Wirtschaftssubjekte sollen ihre Entscheidungen unter Berücksichtigung der<br />
gesamten Kosten und Nutzen ihrer Handlung treffen, also positive und negative externe Effekte<br />
in das private ökonomische Kalkül mit einbeziehen. Das Tragen der Verantwortung für die<br />
gesamten Folgen des eigenen Tuns ist auf privaten Märkten (ohne Externalitäten) stets gegeben<br />
(Hansjürgens 2001, vgl. Rationalitätsannahmen Kap. 3.1.1).<br />
Hervorzuheben ist, dass die Bewertung der externen Effekte in monetären Maßen ausschließlich<br />
den am Wirtschaftsprozess beteiligten Parteien obliegt. Es handelt sich also um ein streng<br />
individualistisches Konzept (Hampicke 1996).<br />
Im Idealfall (einer Welt ohne Transaktionskosten) können die externen Effekte durch<br />
individuelle Verhandlungen internalisiert werden (Coase 1960). Ein beliebtes Beispiel für private<br />
Verhandlungslösungen im Bereich der Landwirtschaft stellt der Bauer mit Mutterkuhhaltung<br />
neben einer Gaststätte dar. Die Gastwirtin hat aus Sicht ihrer Rentabilität ein Interesse an der sie<br />
umgebenden ‘Landschaftsidylle’ in Form einer grünen Wiese mit grasenden Kühen und Kälbern.<br />
Wenn die Rentabilität der Mutterkuhhaltung nicht mehr gewährleistet ist, hätte die Gastwirtin ein<br />
Interesse daran, den Landwirt für die ‘Landschaftsidylle’ zu bezahlen. Durch individuelle<br />
Verhandlungen könnte ein Preis für die ‘Landschaftsidylle’ vereinbart werden. Natürlich wird<br />
der Landwirt nur dann darauf eingehen, die ‘Landschaftsidylle’ zu produzieren, wenn der Preis,<br />
den er dafür erhält, ein rentables Wirtschaften zulässt. Ist die ‘Landschaftsidylle’ der Gastwirtin<br />
nicht so viel wert (ist das Gut ‘Landschaftsidylle’ also nicht knapp genug) wird der Landwirt die<br />
Mutterkuhhaltung aufgeben.<br />
An diesem Beispiel wird deutlich, dass so genannte ‚externe Effekte’ erst dann eine Rolle<br />
spielen, wenn die dadurch erzielten Nebenwirkungen (im obigen Fall die Landschaftsidylle)<br />
knapp sind. Von daher fragen sich Scheele & Isermeyer zu Recht: „wann überhaupt<br />
definitionsgemäß positive ‚externe Effekte’ vorliegen. Solange Nebenwirkungen produktiver<br />
Tätigkeiten in ausreichender Menge vorhanden oder einfach noch nicht Gegenstand<br />
ökonomischer Kalküle sind, haben sie einen Preis von 0,00 DM, womit der Betrag des ‚externen<br />
Effektes’ ebenfalls mit 0,00 DM anzusetzen wäre. Haben Kuppelprodukte hingegen einen Preis,<br />
sind sie also Gegenstand ökonomischer Kalküle, sind die Kriterien gängiger Definitionen<br />
‚externer Effekte’ nicht mehr erfüllt – es geht vielmehr um die zielgerichtete Nachfrage nach<br />
knappen Gütern, die im Rahmen zielgerichteter Wirtschaftsaktivitäten bereitgestellt werden“<br />
(Scheele & Isermeyer 1989: 105). Externe Effekte können weitaus besser mit Hilfe der Theorie<br />
der öffentlichen Güter und der Theorie der property rights erklärt werden. Betrachtet man die
Ökonomische Instrumente 13<br />
‘Landschaftsidylle’ von Anfang an als öffentliches Gut, so ist klar, dass dieses erst dann einen<br />
positiven Preis hat, wenn es knapp ist. Solange das Gut ‘Landschaftsidylle’ nicht knapp ist,<br />
liegen positive Wohlfahrtseffekte vor, für die kein Anspruch auf Zahlung besteht. Das Problem<br />
der externen Effekte ist das der knappen Güter, die aufgrund fehlender Institutionen nicht<br />
nachgefragt werden und für die keine Eigentumsrechte vorhanden sind (vgl. i.d.S.<br />
Schanzenbächer 1995), also nichts anderes als das der knappen öffentlichen Güter. Dies trifft<br />
ebenfalls auf die so genannten negativen externen Effekte als ‚schädigende Nebenwirkung’ zu.<br />
„Konkurrierende Verwendungen öffentlicher Umweltgüter sind die Ursachen für externe<br />
Effekte; externe Effekte sind eine Folge der nicht gelösten Konkurrenz von Verwendungen“<br />
(Siebert 1976: 7).<br />
„Welcher Aspekt der Umweltgüterbereitstellung auch immer betrachtet wird – überall zeigt sich,<br />
dass die Problemlösung im Bereich des Angebotes öffentlicher Güter, deren Erforderlichkeit im<br />
politischen Raum artikuliert wird, liegt“ (Scheele & Isermeyer 1989: 106). Pigou-Instrumente<br />
können demnach auch so definiert werden, dass mit ihrer Hilfe im Idealfall alle knappen<br />
öffentlichen Güter so in das wirtschaftliche Kalkül einbezogen werden, dass der Gesamtnutzen<br />
aller maximiert wird. Damit nimmt die Frage nach der Ermittlung der Knappheit öffentlicher<br />
Güter eine zentrale Stellung ein, da sich Marktpreise als Ausdruck der Knappheit lediglich in<br />
seltenen Fällen einstellen.<br />
Wenn sich, wie bei öffentlichen Gütern, keine Preise auf dem Markt bilden, kann dem z. B.<br />
durch Analysen zur Zahlungsbereitschaft begegnet werden. In den letzten Jahren kam es in<br />
dieser Hinsicht trotz immer noch relativ großen methodischen Problemen zu Fortschritten, so<br />
dass der Internalisierungsansatz wieder an Bedeutung gewonnen hat (Hampicke 1996). Generell<br />
ist die Problematik der Monetarisierung von ökologischen Gütern, also deren individuelle<br />
ökonomische Bewertung, jedoch die hauptsächliche Schranke für den Einsatz klassischer Pigou-<br />
Instrumente.<br />
Mit dem Internalisierungsansatz, also der Einbeziehung aller knappen öffentlichen Güter in das<br />
ökonomische Kalkül (und keinen sonstigen verzerrenden Umständen), kann die Ökonomie einen<br />
optimalen Zustand beschreiben. Die Frage nach gesellschaftlichen Zielen kann dieser Ansatz mit<br />
einem aus ökonomischer Sicht optimalen, allokativen Zustand, dem des Pareto-Optimums,<br />
beantworten (Hampicke 1996). Im Pareto-Optimum muss die Nutzenverteilung (Distribution)<br />
noch bestimmt werden. „Insofern liefert die Pareto-Theorie ein Effizienzkriterium (Pareto-<br />
Kriterium) bei noch offener Verteilung. Pareto-effiziente Konkurrenzgleichgewichte sind bei<br />
alternativen Verteilungen möglich. Eine soziale Bewertung ist nötig und möglich. Der Staat ist
14 Kapitel 3<br />
gefordert, dem Aspekt der sozialen Gerechtigkeit Rechnung zu tragen. Zudem kann eine faire<br />
(gerechte) Verteilung vom Markt allenfalls dann erwartet werden, wenn gleiche Startchancen,<br />
faire Spielregeln (Wettbewerb) und wirtschaftliche Stabilität gewährleistet sind (Bartmann<br />
1996). „Das Pareto-System besitzt einen Freiheitsgrad, der prinzipiell durch eine exogene<br />
(gesellschaftliche) Verteilungsentscheidung geschlossen werden muss“ (ebd. 1996: 25) (vgl.<br />
Kap. 5.6.2.1).<br />
3.1.3 Baumol-Instrumente<br />
Die hohen Anforderungen an die Monetarisierung öffentlicher Güter im Rahmen einer<br />
vollständigen Internalisierung führte zu einer scheinbar eleganten „dem Münchhausen-Prinzip<br />
allerdings nicht ganz unverdächtigen“ Art und Weise, sich aus der Affäre zu ziehen, indem die<br />
Zielfrage schlicht zu einer „außerökonomischen Entscheidung“ erklärt wurde (Ewers & Hassel<br />
2000: 33). Baumol und Oates (1971, 1988) entwickelten ein neues Instrument, den „Standard-<br />
Preis-Ansatz“, der keine Monetarisierung der externen Effekte bzw. öffentlicher Güter erfordert<br />
(Hampicke 1996). Der Standard-Preis-Ansatz geht von einem politisch vorgegebenen<br />
Umweltziel aus und beschränkt sich auf die Frage, wie man dieses Ziel kostenminimierend<br />
erreichen kann. „Anstatt sich um einen interdisziplinären Diskurs über Schutzgüter, Umweltziele<br />
und Trade-Off-Relationen bei der Zielbestimmung zu bemühen, wird quasi uneingeschränkt dem<br />
Primat anderer Disziplinen das Wort geredet“ (Ewers & Hassel 2000: 33 f.). Es wird in diesem<br />
Sinne „ein besonderer Neutralitätsanspruch“ verfolgt: „Man empfehle keine Ziele, sondern<br />
erhöhe Vernünftigkeit bei ihrer Verfolgung; man sage nicht, was wertvoll sei, sondern wie man<br />
das, was tatsächlich für wertvoll gehalten (‚präferiert’) wird, am besten erreiche“ (Lübbe 1999:<br />
15) 4 .<br />
Ein Baumol-Instrument kann z. B. wie folgt aussehen: Verursacht die Landwirtschaft zu viele<br />
Schäden durch hohen Stickstoffgebrauch, kann eine Abgabe pro Kilogramm Stickstoff<br />
(Stickstoffsteuer) erhoben werden. Diese Abgabe steht in keinem Zusammenhang zu dem<br />
monetären Wert des damit geschädigten öffentlichen Gutes (z. B. Schädigung der Gewässer<br />
4 “Zumindest heutige Anhänger einer dogmatisch erstarrten Art von ‘wertneutraler Wissenschaft’ könnten sich mit<br />
Rawls’/Ross’/Frankenas Deontologie mit Gewinn befassen. Die Letztgenannten messen der wertneutralen<br />
Zweckmäßigkeit ebenso wie Kant nur einen niederen Rang zu. Letzterer zu dem, wie er ihn nannte, ‚Imperativ der<br />
Geschicklichkeit’: ‚Ob der Zweck vernünftig oder gut sei, davon ist hier gar nicht die Frage, sondern nur was man<br />
tun müsse, um ihn zu erreichen. Die Vorschriften für den Arzt, um einen Mann auf gründliche Art gesund zu<br />
machen, und für einen Giftmischer, um ihn sicher zu töten, sind insofern von gleichem Wert, als eine jede dazu<br />
dient, ihre Absicht vollkommen zu bewirken’ (Kant 1961: 59)“ (Hampicke 1992: 49).
Ökonomische Instrumente 15<br />
durch Eutrophierung), sondern erfüllt eine Anreiz- und Lenkungsfunktion. Verhalten sich alle<br />
Emittenten in rationaler Weise und unterliegen sie alle demselben Abgabensatz, so sind die<br />
gesamten Emissionsvermeidungskosten in der Wirtschaft in Bezug auf den gesetzten Standard<br />
minimiert. Die Baumol-Lösung wäre effizient. „Die Wirksamkeit einer solchen Abgabe ist eine<br />
Funktion der jeweiligen Preiselastizitäten der Nachfrage nach Inanspruchnahme des Immissions-<br />
Belastungsspielraumes, so dass die Umsetzung der Maßnahmen eingehende Kenntnisse über die<br />
Reaktionsweisen der Angesprochenen voraussetzen sollte“ (Hampicke 1996: 42, vgl. auch Ewers<br />
& Hassel 2000). Im Hinblick auf die Berücksichtigung ökologischer Zusammenhänge ist<br />
hervorzuheben, dass in einem Gebiet mit gleichem Regelungsraum (z. B. Abgabesatz)<br />
substituierbare Bedingungen vorliegen müssen. Ist das umweltpolitische Ziel eine Verminderung<br />
der Emission von Stickstoff um 50 % im Abgabengebiet, so darf es für die Effektivität<br />
(ökologische Wirkung) keinen Unterschied machen, wo die Emission verringert wird. Die<br />
möglichen Allokationen müssen einander ‚ökologisch äquivalent’ sein und dies in räumlicher,<br />
zeitlicher und sachlicher Dimension (vgl. u.a. Michaelis 1996, SRU 1994, Huckestein 1993).<br />
Da es aber bei der Betrachtung von ökologischen Zusammenhängen aufgrund der Heterogenität<br />
gerade in vielen Fällen auf das ‚wo’, das ‚wann’ und das ‚wie’ ankommt, ist die<br />
Einsatzmöglichkeit von Baumol-Instrumenten jeweils kritisch zu prüfen. Sie sind effizient, wenn<br />
die Orte der geringsten Vermeidungskosten mit denen der höchsten ökologischen Effektivität<br />
übereinstimmen. Dieser Aspekt wird ausführlich im Kapitel zur räumlichen Äquivalenz erläutert<br />
(Kap. 6.3.4.1).<br />
Neben dem oben beschriebenen Problem der ‚ökologischen Äquivalenz’ ist die qualitativen und<br />
quantitativen Festlegung der Standards essentielle Voraussetzung für den effizienten Einsatz.<br />
Der Standard wird im politischen Raum festgelegt und hat im Gegensatz zum Pigou-Ansatz eine<br />
starke ‚kollektivistische’ Komponente (vgl. Hampicke 1996). Die Probleme, die mit dieser<br />
Standardfestlegung verknüpft sind, werden an späterer Stelle im Kapitel 6.3.5 vertieft behandelt.<br />
Der Ansatz nach Baumol & Oates (1971) wird bisher im politischen Raum überwiegend im<br />
Zusammenhang mit Abgaben diskutiert. Die Honorierung ökologischer Leistungen in politisch<br />
bestimmter Höhe ist jedoch eine folgerichtige Verallgemeinerung des von den Autoren<br />
vorgeschlagenen Standard-Preis-Ansatzes (vgl. SRU 1996).
16 Kapitel 3<br />
3.2 Anwendung des Verursacherprinzips bei ökonomischen Instrumenten<br />
Beim Einsatz aller umweltpolitischen Instrumente werden zumindest implizit Eigentumsrechte<br />
(property rights) verteilt (ausführlich Kap. 5). Eine umweltökonomische Diskussion kommt<br />
daher heutzutage nicht mehr ohne die Theorie der property rights aus. Eine zentrale Aussage der<br />
Theorie der property rights ist, dass sich alle Ökonomie letztlich nicht auf knappe Güter bezieht,<br />
sondern auf die Eigentumsrechte an diesen knappen Gütern (Lerch 1996: 64). Für den<br />
ökonomischen Wert eines knappen Gutes ist nicht die physische Beschaffenheit, sondern die<br />
damit verbundene Nutzungsmöglichkeit entscheidend (vgl. Demsetz 1967: 347). Bei der<br />
Anwendung des Verursacherprinzips im Rahmen der umweltökonomischen Instrumente wird die<br />
Bedeutung der Eigentumsrechte überdeutlich.<br />
Das Verursacherprinzip kann als Heuristik für eine am Ziel der Wohlfahrtsmaximierung<br />
orientierte Lenkung individueller Handlungen charakterisiert werden (Suchanek 2000: 67).<br />
Das Verursacherprinzip ist zweifellos jenes Prinzip, das am stärksten Eingang gefunden hat in<br />
die faktische Umweltpolitik (Suchanek 2000: 68). Es spielte bereits im ersten Umweltprogramm<br />
der Bundesregierung eine entscheidende Rolle (Bundesregierung 1971: 6) 5 . International wurde<br />
das Verursacherprinzip 1972 vom Rat der OECD als Teil eines Paktes von Leitsätzen<br />
angenommen, die sich auf die wirtschaftlichen Aspekte der Umweltpolitik in internationaler<br />
Sicht bezogen. 1974 wurde es vom Rat der OECD ausdrücklich bekräftigt als „Fundamentaler<br />
Grundsatz der Kostenzurechnung für die Verhütung und Bekämpfung von<br />
Umweltverschmutzung“, bevor es dann in der Einheitlichen Europäischen Akte (1987), im<br />
Vertrag von Maastricht (1992) und in der Erklärung von Rio (1992) auf breiter Basis verankert<br />
wurde. In den OECD-Leitsätzen von 1972 wird festgelegt, dass der Grundsatz, der bei der<br />
Zurechnung der Kosten für die Umweltschutzmaßnahmen angewendet wird und eine rationelle<br />
Verwendung der knappen Naturgüter fördert und Verzerrungen in den internationalen<br />
Handelsbeziehungen und Investitionen verhindern sollte, das so genannte Verursacherprinzip ist.<br />
Nach diesem Prinzip sollte der Verursacher die Kosten der Durchführung der vorerwähnten<br />
Maßnahmen, die vom Staat im Interesse einer annehmbaren Umwelt erschlossen werden, selbst<br />
tragen. Mit anderen Worten, die Kosten dieser Maßnahmen sollten sich in den Preisen der Güter<br />
und Dienstleistungen niederschlagen, die durch ihre Produktion und/oder ihren Verbrauch<br />
Umweltschäden hervorrufen. Diese Maßnahmen sollten nicht mit Subventionen verbunden sein,<br />
5 zur aktuellen Bedeutung als Leitprinzip der Umweltpolitik vgl. Artikel 34 Einigungsvertrag (EV) (i. V. m. Art. 45<br />
Abs. 2 EV) und Art. 130r Abs. 2 EG-Vertrag.
Ökonomische Instrumente 17<br />
die zu erheblichen Verzerrungen in den internationalen Handelsbeziehungen und Investitionen<br />
führen würden. Das Verursacherprinzip an sich folgt dem Grundsatz der Nichtsubventionierung<br />
und befürwortet eine Subventionierung nur in Ausnahmefällen (vor allen Dingen in<br />
Übergangsphasen zu strengeren Umweltauflagen) (OECD 1999c).<br />
Die Anwendung dieses Prinzips wird im umweltpolitischen Raum bis heute oftmals viel zu<br />
‚einfach’ interpretiert, denn die Frage, wer als Verursacher angesehen werden soll, ist nicht<br />
trivial. Coase (1960) wies auf die Symmetrie jedes Umweltnutzungskonfliktes hin, welche<br />
verbietet, unzweideutig einen ‚Verursacher’ und einen ‚Geschädigten’ zu identifizieren. Das<br />
Problem ist vielmehr „reziproker Natur“. So fügt ein Landwirt der Gesellschaft einen Schaden<br />
zu, indem er aufgrund der Stickstoffdüngung zu einer Eutrophierung der Gewässer beiträgt,<br />
andererseits verursacht der Staat auch dem Landwirt einen Schaden, wenn er die Unterlassung<br />
der Emission durchsetzt (vgl. Coase 1960: 69). Die Konsequenz daraus ist, „dass man um eine<br />
Entscheidung, was man als Ursache sehen und wen man für verantwortlich halten will, nicht<br />
herumkommt“ (Luhmann 1986/1990: 29).<br />
Ob der Landwirt durch Abgaben als Verursacher für die Schäden aufkommen oder aber der Staat<br />
den Landwirt für die Unterlassung entschädigen muss, hängt davon ab, wer die Eigentumsrechte<br />
am ökologischen Gut hat. Die Frage, nach welchen Kriterien diese Rechte verteilt werden sollen<br />
(Distribution), ist daher sehr grundsätzlicher Art und durchaus umstritten (vgl. Kap. 5.6).<br />
Die Anwendung des Verursacherprinzips bei Pigou-Instrumenten im Sinne der Internalisierung<br />
aller Kosten ist unstrittig, da das Verursacherprinzip weitgehend auf der Argumentationslinie<br />
von Pigou basiert (vgl. Hansmeyer & Schneider 1992).<br />
Wenn das Verursacherprinzip auf Baumol-Instrumente angewendet wird, verschwimmt die<br />
Grenze zwischen Pigou- und Baumol-Instrumenten. Baumol-Instrumente zielen nicht mehr nur<br />
auf den Anreiz und das Lenken eines bestimmten Verhaltens ab. Vielmehr werden die<br />
gesellschaftlichen Ziele wie knappe öffentliche Güter behandelt, mit dem Unterschied, dass diese<br />
nicht einer individuellen sondern einer kollektivistischen Nachfrage entsprechen. Das Problem,<br />
das bei dieser Interpretation auftritt, besteht neben der Zielentwicklung (Bildung der<br />
kollektivistischen Nachfrage nach knappen ökologischen Gütern) vor allen Dingen in der<br />
ökonomischen Bewertung. Für Baumol-Instrumente als ‚bloße’ Anreiz- oder<br />
Lenkungsinstrumente richtet sich die Höhe des Anreizes (ob positiv oder negativ) nach den<br />
Grenzkosten der Vermeidung oder der Produktion. Produzentenrenten bei positiven Anreizen<br />
werden als Mitnahmeeffekte bezeichnet und abgelehnt. Die aktuellen positiven Anreize für
18 Kapitel 3<br />
ökologische Leistungen der Landwirtschaft im Rahmen der Agrarumweltprogramme nach der<br />
VO (EG) 1257/1999 müssen sich z. B. an den Grenzkosten orientieren.<br />
„Die Beihilfen für die Agrarumweltverpflichtungen werden jährlich gewährt und anhand<br />
folgender Kriterien berechnet:<br />
• Einkommensverlust,<br />
• zusätzliche Kosten infolge der eingegangenen Verpflichtung und<br />
• die Notwendigkeit, einen Anreiz zu bieten“ (Artikel 24 Absatz 1 Satz 1<br />
VO (EG) 1257/1999).<br />
Die Durchführungsvorschriften zur Verordnung (EG) 1257/1999 führen zur Anreizkomponente<br />
aus: „Der Anreiz darf 20 % der aufgrund der Verpflichtung anfallenden Einkommensverluste<br />
und zusätzlicher Kosten nicht überschreiten, außer wenn bei einzelnen Verpflichtungen ein<br />
höherer Satz für unerlässlich gehalten wird, um die Wirksamkeit der betreffenden Maßnahmen<br />
sicherzustellen“ (Artikel 18 Satz 2 VO (EG) 1750/1999).<br />
Die Orientierung an den Grenzkosten erweist sich vor dem Hintergrund des effizienten Einsatzes<br />
öffentlicher Mittel als durchaus schlüssig.<br />
Wenn jedoch gesellschaftliche Umweltziele als kollektivistische Nachfrage angesehen werden,<br />
wäre gegen Produzentenrente nichts einzuwenden. Einer „Ökonomisierung“ im Sinne der<br />
„Mobilisierung des Eigeninteresses“ (Gawel 1999) würde eher Vorschub geleistet werden, die<br />
dynamische Effizienz kann erhöht werden. Umweltzielen jedoch diesen Stellenwert<br />
einzuräumen, bedeutet für viele Ökonomen „deren heilige Kuh“, die Konsumentensouveränität,<br />
zu schlachten. „Die Heilige Kuh der Konsumentensouveränität wird mit einem byzantinischen<br />
Rigorosum verteidigt, der bisweilen an den Panzer erinnert, mit dem sich Schizophrene gegen<br />
die vernünftigen Argumente ihrer Umgebung immunisieren“ (Hampicke 1998: 103).<br />
Bei aller Notwendigkeit zu kollektivistischen Entscheidungen im Zusammenhang mit<br />
ökologischen Gütern muss die berechtigte Kritik am Übergang zur Planwirtschaft bei der<br />
Erarbeitung derartiger Ansätze berücksichtigt werden 6 . „Das Hauptproblem besteht in der<br />
6 Eine kleine Anfrage der FDP an die Bundesregierung nach Presseveröffentlichungen zur Festlegung von Zielen<br />
und Indikatoren einer Nachhaltigen Entwicklung illustriert das Spannungsverhältnis dem wirtschaftlich zu<br />
berücksichtigende Umweltziele stets ausgesetzt sind: „Nach ‚Planzahlen’ für die Wirtschaftspolitik erkundigt sich<br />
die FDP-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (14/7186). Sie bezieht sich auf einen Pressebericht, wonach eine<br />
Staatssekretärsrunde unter Federführung des Bundeskanzleramtes 27 Schlüsselindikatoren und Ziele für eine
Ökonomische Instrumente 19<br />
Eröffnung eines breiten Spielraums für willkürliche staatliche Bewertungen, so dass ein hohes<br />
Maß an politischer Konsensfähigkeit und -willigkeit sowie Bewertungskompetenz der<br />
verantwortlichen Instanzen vorausgesetzt werden muss“ (SRU 1996: 91). Dass an einen<br />
derartigen politischen Prozess (und an den Willen von Politikern diesen Prozess durchzuführen)<br />
nicht zu hohe Erwartungen gestellt werden können, verdeutlichen Erkenntnisse der Politischen<br />
Ökonomie 7 .<br />
Die Aufteilung der Konsumenten- und Produzentenrente stellt in diesem Zusammenhang ein<br />
sehr ernstes Problem dar, da der Staat als einziger Nachfrager die Preise quasi festlegt 8 . Bereits<br />
bei der Aufteilung der durch Zahlungsbereitschaftsanalysen ermittelten monetären Werte in<br />
Produzenten- und Konsumentenrente weist Hampicke auf das Problem hin, dass „die<br />
Allgemeinheit, wenn sie eine Zahlungsbereitschaft für ein selbstloses Ziel, wie den Erhalt der<br />
Biodiversität, äußert, schon gegenüber dem Verdacht, die Anbieter könnten sich daran<br />
ungerechtfertigt bereichern, empfindlich reagieren“ würde (Hampicke 1996: 121). Dieses<br />
Problem verstärkt sich bei staatlich festgelegten Preisen, bei denen nicht auf derartige<br />
Erhebungen zurückgegriffen werden kann, eher noch.<br />
Werden gesellschaftliche Umweltziele als knappe öffentliche Güter behandelt, ist der einzige<br />
Unterschied zwischen Pigou- und Baumol-Instrumenten der der „Identifizierung“ und<br />
ökonomischen Bewertung von knappen öffentlichen Gütern. Pigou-Instrumente orientieren sich<br />
streng an dem methodologischen Individualismus, während Baumol-Instrumente den faktischen<br />
Schwierigkeiten Rechnung tragen, dass sich die Allokation ökologischer Güter, gerade vor dem<br />
Hintergrund der Nachhaltigen Entwicklung, oftmals unzureichend über individualistische<br />
Marktpreise regeln lässt und daher gesellschaftliche Umweltziele als kollektivistische Nachfrage<br />
anerkennt. Wenn gesellschaftliche Umweltziele von Seiten der Ökonomie als knappe<br />
ökologische Güter anerkannt werden, dann hat auch die Ökonomie mit dem Pareto-Optimum<br />
Nachhaltige Entwicklung formuliert habe. Die Abgeordneten wollen wissen, welcher konkrete Arbeitsauftrag dieser<br />
Staatssekretärsrunde zu Grunde lag, welche Schlüsselindikatoren mit welchen quantitativen Vorgaben im Einzelnen<br />
formuliert wurden und wie die Regierung diese Planindikatoren erreichen will. Auch die Haltung des<br />
Bundesfinanzministeriums und des Bundeswirtschaftsministeriums dazu interessiert die Fraktion“ .<br />
7 Die Neue Politische Ökonomie versucht auf der Basis des methodologischen Individualismus und des darauf<br />
aufbauenden Rationalitätskonzeptes politischer Prozesse zu analysieren (vgl. u.a. Endres & Finus 1997, Franke<br />
1996, Kirsch 1997, Zimmermann 2000).<br />
8 Selbstverständlich kann sich der Staat dabei indirekter und direkter Instrumente zur Erfassung von Präferenzen für<br />
öffentliche Güter bedienen wie Reisekostenansatz, Vermeidungskostenansatz, Hedonistischer Preisansatz,<br />
Contingent Valuation und Marktsimulationen, vgl. z. B. im Überblick Pommerehne & Roemer (1992); vgl. weiter<br />
Angaben in Kap. 4.1.
20 Kapitel 3<br />
wieder eine Antwort auf den idealen gesamtgesellschaftlichen Zielzustand. Der<br />
allokationstheoretische Anspruch der beiden Instrumente könnte sich annähern.<br />
Die Anwendung des Verursacherprinzips in der gesamten beschriebenen Breite spielt in der<br />
aktuellen Agrarpolitik eine entscheidende Rolle und ist gerade für die Honorierung ökologischer<br />
Leistungen der Landwirtschaft der entscheidende ‚Knackpunkt’. Die gesamten<br />
Agrarsubventionen stehen im Zuge der Marktliberalisierung auf dem Prüfstand. Die<br />
Argumentation der EU im Streit um die Beibehaltung bestimmter Förderungen der<br />
Landwirtschaft baut darauf auf, dass die Landwirtschaft nicht subventioniert wird, sondern dass<br />
sie für Leistungen bezahlt wird. Eine ökonomische Leistung ist jedoch an knappe Güter<br />
gebunden, wie Kapitel 4.1 näher erläutert. Der politische Druck durch die WTO-Verhandlungen<br />
spült die ungelösten Probleme zur Frage, was knappe ökologische Güter sind (Frage nach<br />
Umweltzielen!), wieder auf die Agenda der agrarpolitischen und ökonomischen Diskussion. Die<br />
intensiven Bemühungen zur Entwicklung von Umweltindikatoren spiegeln die Aktualität auf<br />
allen gesellschaftlichen Ebenen wider (global bis regional).<br />
Als entscheidender Punkt für die weiteren Betrachtungen kann zusammengefasst werden, dass<br />
nicht bei der Frage stehen geblieben werden kann, was knappe öffentliche Güter sind, sondern<br />
dass die Verfügungsrechte an diesen Gütern geklärt sein müssen, um das Instrument der<br />
Honorierung ökologischer Leistungen anwenden zu können. Unabhängig von der methodischen<br />
Nähe der jeweils konkreten Honorierung ökologischer Leistungen zu Pigou- oder Baumol-<br />
Instrumenten muss sich die Honorierung am Verursacherprinzip orientieren, um sich im Rahmen<br />
des internationalen Liberalisierungsdruckes vom Vorwurf der Subventionierung frei zu sprechen.
Honorierung ökologischer Leistungen als ökonomisches Instrument 21<br />
4 Honorierung ökologischer Leistungen der Landwirtschaft<br />
4.1 Charakterisierung des Instrumentes<br />
Wenn die ‚Honorierung ökologischer Leistungen’ als umweltökonomisches Instrument gefasst<br />
werden soll, so impliziert dies, dass der Begriff ‚ökologische Leistungen’ am Ende aus<br />
ökonomischer und juristischer Sicht operationalisiert sein muss. Die Honorierung stellt ein<br />
Mittel zur Beeinflussung ökonomischer Entscheidungen dar und das Recht (Ordnungsrecht) engt<br />
diesen Entscheidungsspielraum ein und setzt Rahmenbedingungen (ökonomische Regeln) für die<br />
Honorierungen.<br />
Im ökonomischen Verständnis ist eine Leistung eine Aktivität, welche Knappheit lindert, wann<br />
und wo immer diese auftaucht. Eine Leistung ist honorierungswürdig, wenn ökonomische<br />
Verfügungsrechte über das knappe Gut zugunsten des Leistungserbringers definiert sind,<br />
andernfalls muss er sie unentgolten liefern (Hampicke 1996: 72 ff) 9 .<br />
Um eine Aktivität als ökonomische Leistung zu identifizieren, ist demnach zu klären:<br />
1. Welches knappe Gut (einschließlich Dienstleistung) wird von der Aktivität beeinflusst?<br />
2. Hilft die Aktivität die Knappheit zu verringern?<br />
3. Besitzt der Leistungserbringer die ökonomischen Verfügungsrechte an dem knappen Gut<br />
(Frage der Honorierungswürdigkeit)?<br />
Diese drei Fragen als Ausgangspunkt nutzend, soll sich der ‚honorierungswürdigen ökologischen<br />
Leistung’ schrittweise genähert werden.<br />
‚Ökologische Leistung’ wird als Präzisierung des ökonomischen Leistungsbegriffs aufgefasst,<br />
indem das Gut, dessen Knappheit durch die Art der Leistung gelindert werden soll, zur<br />
Konkretisierung herangezogen wird.<br />
Dem Wortsinn nach handelt es sich um eine Verringerung der Knappheit eines ökologischen<br />
Gutes oder auch Umweltgutes 10 . Anthropozentrische, utilitaristische und instrumentelle<br />
Bewertungen von Umweltstrukturen führen zum ‚Extrahieren’ der Umweltgüter. Genau dieser<br />
9 Zu den vorhandenen Definitionen von ökologischen Leistungen der Landwirtschaft soll an dieser Stelle auf einige<br />
Literatur verwiesen werden: u.a. Pevetz 1990, Ahrens 1992, Heißenhuber et al. 1994, DAF 1995, Bromley 1997a,<br />
Deutscher Rat für Landespflege 2000.<br />
10 Es stellt damit einen Typus der so genannten NCO (non commodity-outputs) im Ansatz einer multifunktionalen<br />
Landwirtschaft dar. Behind multifunctionality is the idea that agriculture, in addition to producing food and fibre,<br />
produces a range of other non-commodity outputs such as environmental and rural amenities, and food security and<br />
contributes to rural viability (OECD 2001a, vgl. auch Wiggering et al. 2003).
22 Kapitel 4<br />
anthropozentrische, utilitaristische und instrumentelle Blick definiert ‚die’ ökologischen Güter<br />
(vgl. auch Kap. 6.1). Dabei ist es nicht entscheidend, ob es sich um naturbestimmte oder<br />
kulturbestimmte Umweltstrukturen handelt. Vielmehr machen die anthropozentrischen,<br />
utilitaristischen und instrumentellen Bewertungen deutlich, dass kulturhistorisch veränderte<br />
Umweltstrukturen nachgefragt werden.<br />
Der Einsatz zwei verschiedener Fähigkeiten führt zur Produktion ökologischer Güter:<br />
ökosystemare Fähigkeiten als Voraussetzung für die Produktion naturbestimmter<br />
Umweltstrukturen und der Einsatz individueller menschlicher Fähigkeiten für die Produktion<br />
kulturbestimmter Umweltstrukturen. Für kulturbestimmte Güter gilt dabei selbstverständlich,<br />
dass ökosystemare Fähigkeiten in jedem Fall Grundvoraussetzung sind. Bereits Kant 11 wies in<br />
seiner Eigentumsauffassung darauf hin, dass der Mensch allenfalls in seinen Träumen produktiv<br />
sei, „die äußeren Gegenstände der Willkür“ entspringen nicht der Arbeit oder dem Willen des<br />
Produzenten, sondern sind gegeben und können durch Arbeit lediglich modifiziert werden (vgl.<br />
Brandt 1974: 192 in Lerch 1999: 404).<br />
Die Abgrenzung zwischen öffentlichen Kulturgütern und kulturbestimmten ökologischen Gütern<br />
ist graduell. Sie kann sich im Wesentlichen an der Bedeutung der ökosystemaren Fähigkeiten im<br />
Zuge der Produktion der Güter orientieren. Verallgemeinert kann definiert werden: Wenn<br />
ökosystemare Fähigkeiten nur für die zu nutzende Ressource, aber nicht mehr für die eigentliche<br />
Herstellung der Güter notwendig sind, handelt es sich um Kulturgüter. Die individuellen<br />
Fähigkeiten bestimmen die Prozesse zur Herstellung der Güter. Sind jedoch für die Produktion<br />
sowohl individuelle als auch ökosystemare Fähigkeiten notwendig, handelt es sich um<br />
kulturbestimmte ökologische Güter. Beispiel für ein öffentliches Kulturgut sind alte, einer<br />
überholten landwirtschaftlichen Nutzung entstammende Tabakscheunen mit ästhetischem und<br />
kulturhistorischem Wert. Diese unterliegen als Kulturgut dem Denkmalschutz. Ebenfalls einer<br />
überholten landwirtschaftlichen Nutzung entstammende Brenndolden-Auenwiesen mit ihren<br />
seltenen Stromtalarten stellen kulturbestimmte ökologische Güter dar. Bei entsprechender<br />
Nachfrage unterliegen diese dem Naturschutz. Generell soll für kulturbestimmte ökologische<br />
Güter jedoch gelten, dass der Einsatz der menschlichen Fähigkeit sich auf das für die Produktion<br />
der ökologischen Güter minimal Notwendige beschränkt. Es geht also nicht um die Substitution<br />
ökosystemarer Fähigkeiten durch individuelle Fähigkeiten, sondern nur um die notwendige<br />
11 Die skizzierte Eigentumsauffassung Kants bezieht sich auf seine Überlegungen in „Metaphysische Anfangsgründe<br />
der Rechtslehre“ von 1797.
Honorierung ökologischer Leistungen als ökonomisches Instrument 23<br />
Ergänzung. Diese Prämisse baut auf das Bundesnaturschutzgesetz (§ 1 und 2 BNatSchG) auf, in<br />
dem der Erhaltung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes höchste Priorität eingeräumt wird.<br />
Es wird damit die „Strategie des Minimalen Eingreifens“ (Roweck 1993, 1995) auch bei<br />
kulturbestimmten Gütern verfolgt. Dieser Aspekt wird in Kapitel 5.2 aufgegriffen.<br />
Beim Einsatz von ökosystemaren Fähigkeiten wird anstatt von Produktion auch von<br />
Regeneration gesprochen. Allgemein bekannt sind so genannte regenerierbare Ressourcen.<br />
Tatsächlich findet hier jedoch nichts anderes statt als eine kostenlose (Re-)Produktion von<br />
ökologischen Gütern. Hierunter sind nicht etwa nur so genannte nachwachsende Rohstoffe zu<br />
verstehen, sondern z. B. auch ein knappes ökologisches Gut wie ‚nitratarmes Wasser’. So<br />
akkumulieren z. B. nährstoffreiche Überflutungsmoore mit ihren Großröhrichten aus Schilf,<br />
Rohrglanzgras oder Wasserschwaden aufgrund ihrer positiven Nährstoffbilanz nicht nur<br />
Kohlenstoff, sondern auch Stickstoff, unterbrechen bzw. beeinträchtigen also den<br />
Stickstoffkreislauf stark. Diese Bilanz kommt dadurch zustande, dass die Bildung organischer<br />
Substanz im Ergebnis der Photosynthese der Pflanzen in intakten Mooren größer ist als ihre<br />
Zersetzung. Bei einer Produktivität dieser Standorte, die mitteleuropäischen Laubwäldern<br />
vergleichbar ist (Succow & Jeschke 1990), kommt es so zur erheblichen Akkumulation 12 . Damit<br />
können diese ökologischen Systeme kostenlos aus ‚nitratreichem Wasser’ das knappe<br />
ökologische Gut ‚nitratarmes Wasser’ (in jedem Fall ‚nitratärmeres’) produzieren.<br />
Auch individuelle Fähigkeiten werden unter bestimmten Umständen kostenlos eingesetzt. Dies<br />
geschieht, wenn die Güter als Nebenprodukte oder auch Kuppelprodukte einer anderen für sich<br />
rentablen Tätigkeit entstehen. „Das Ausmaß des Nebeneffektes ‚Umweltgüterproduktion’ ist<br />
nicht Gegenstand betriebswirtschaftlicher Optimierungskalküle, denn solange die als Neben-<br />
effekt angebotene Menge an Umweltgütern die nachgefragte Menge übersteigt und der<br />
Umweltgüterpreis daher 0,00 DM beträgt, bleibt eine Mehr- oder Minderproduktion des<br />
Umweltgutes ohne Auswirkungen auf das Einkommen des Unternehmers“ (Scheele & Isermeyer<br />
1989: 88). Artenreiche Brenndolden-Auenwiesen sind Beispiel für ein Kuppelprodukt einer<br />
extensiven Grünlandnutzung vor 100 Jahren.<br />
Ökologische Güter sind vom Menschen als nützlich bewertete naturbestimmte oder<br />
kulturbestimmte Umweltstrukturen, die Bedürfnisse befriedigen (vgl. Abbildung 2). Was sind<br />
12 Es konnte ermittelt werden, dass im niedermoorreichen Schleswig-Holstein seit der letzten Eiszeit ca. 13-19<br />
Millionen Tonnen Stickstoff in Form von Niedermoortorfen langfristig den Kreisläufen entzogen wurden (vgl.<br />
Trepel 1996).
24 Kapitel 4<br />
jedoch knappe ökologische Güter? Knappheit an ökologischen Gütern liegt vor, wenn die<br />
Bedürfnisse der Individuen größer sind als ihre Bedürfnisbefriedigungsmöglichkeiten (vgl.<br />
Kobler 2000: 5).<br />
Im Allgemeinen ist ein knappes Gut durch eine Nachfrage gekennzeichnet, die sich bei<br />
funktionierenden Märkten durch einen positiven Preis äußert (Scheele & Isermeyer 1989). Bei<br />
ökologischen Gütern kommt es jedoch i.d.R. nicht zur Bildung von Märkten. Ökologischen<br />
Gütern werden Eigenschaften von öffentlichen Gütern zugesprochen, die den Tausch über den<br />
Markt verhindern.<br />
Öffentliche Güter können gemeinsam genossen werden (joint consumption) und zwar in der Art,<br />
dass damit kein physischer Konsum verbunden ist (grundlegend Samuelson 1954, 1969). Es<br />
besteht keine Rivalität im Konsum (nonrivalry). Nach Musgrave & Musgrave (1976) werden<br />
öffentliche Güter außerdem dadurch charakterisiert, dass kein Ausschluss vom Konsum möglich<br />
ist (nonexcludability). Letzteres Kriterium wird auch als open access bezeichnet (Bromley 1991,<br />
Ostrom 1998). Der open access ist dabei weniger eine Gütereigenschaft als vielmehr eine Frage<br />
der Transaktionskosten des Ausschlusses, also des technologisch oder institutionell möglichen<br />
(Blümel et al. 1986).<br />
Das Kriterium ‚nonrivalry’ trifft jedoch für eine Vielzahl von Nutzungen ökologischer Güter<br />
nicht zu. Tatsächlich würde es selbstverständlich nicht zur viel beschriebenen „tragedy of the<br />
commons“ 13 kommen, wenn keine Rivalität auftritt. Probleme und ‚Tragedies’ stellen ein<br />
Knappheitsproblem von Gütern im Zustand des ‚open access’ dar, deren Konsum durch<br />
Rivalität bestimmt ist. Umweltprobleme haben genau darin ihre Ursache.<br />
Die scheinbare ‚nonrivalry’ hat ihre Ursache bei ökologischen Gütern darin, dass es ohne<br />
ökonomische Anreize zum Einsatz sowohl von ökosystemaren als auch individuellen<br />
menschlichen Fähigkeiten kommt und ökologische Güter kostenlos (re)produziert werden.<br />
Der Verbrauch führt erst dann zur Verknappung von ökologischen Gütern, wenn die kostenlose<br />
(Re)Produktion geringer ist als der Verbrauch (die Nachfrage). Die wirtschaftliche Entwicklung<br />
führt zur Verknappung der ökologischen Güter wenn eine oder eine Kombination folgender<br />
Situation auftritt:<br />
13 vgl. dazu den vielzitierten Aufsatz von Hardin (1968)
Honorierung ökologischer Leistungen als ökonomisches Instrument 25<br />
• Die Nachfrage steigt und die ökosystemaren Fähigkeiten reichen nicht mehr aus, den<br />
Verbrauch durch (Re)Produktion zu ersetzen,<br />
• das Angebot nimmt durch Rückgang (Zerstörung) ökosystemarer Fähigkeiten ab und/oder<br />
• das Angebot nimmt durch Rückgang des Einsatzes an individuellen Fähigkeiten ab, da keine<br />
Koppelproduktion mehr vorliegt.<br />
In den ersten beiden Situationen stellen die Landwirte die bzw. einen Teil der Konsumenten dar,<br />
die ökologische Güter (über)nutzen bzw. ökosystemare Fähigkeiten zerstören (z. B. ökologische<br />
Güter ‚sauberes Grundwasser’ oder ‚artenreiches Kleingewässer’). In der dritten Situation stellen<br />
die Landwirte die Produzenten dar und sind verantwortlich für den Rückgang des Angebots.<br />
Da alle Nutzer Zugang zu den knappen ökologischen Gütern haben (open access als Kriterium<br />
der ökologischen Güter) entwickelt sich keine Marktnachfrage als Ausdruck der Knappheit<br />
dieser Güter (Ausnahme sind Verhandlungslösungen im Sinne von Coase, vgl. Kap 3.1.2). Die<br />
Nachfrage nach ökologischen Gütern muss daher weitgehend vom Staat ausgehen (Hampicke<br />
1996: 124).<br />
Dabei obliegt es der Wissenschaft, „durch aktive Aufdeckung der naturwissenschaftlichen und<br />
ökonomischen Zusammenhänge und durch aktive Aufklärung der Bevölkerung die Grundlagen<br />
für demokratische Entscheidungen zu verbessern und damit einen Beitrag zur<br />
Wohlfahrtssteigerung zu leisten“ (Scheele & Isermeyer 1989: 93).<br />
Tatsächlich stellt die ‚Identifikation’ von knappen ökologischen Gütern und ökosystemaren<br />
Fähigkeiten zur Produktion dieser Güter aufgrund der Komplexität ökologischer Systeme eines<br />
der Hauptprobleme für den Einsatz der Honorierung ökologischer Leistungen dar, wie Kapitel<br />
6.3.5 noch zeigen wird. So können z. B. „entstehende Knappheiten aufgrund unzureichender<br />
Informationen oft nicht bemerkt werden, weil Umwelt- und Gesundheitsschäden mit erheblicher<br />
Zeitverzögerung auftreten. In diesem Fall erweist sich ein Umweltgüterpreis von 0,00 DM im<br />
Nachhinein als zu niedrig“ (Scheele & Isermeyer 1989: 88). Knappheitsverhältnisse öffentlicher<br />
Güter ‚aufzudecken’ und dabei mit Blick auf eine Nachhaltige Entwicklung auch den<br />
‚Schwächsten’ (im Sinne der Möglichkeit ihrer Nachfrage), den künftigen Generationen,<br />
Gewicht zu verleihen, ist vor dem Hintergrund der „Nichtsubstituierbarkeit“ vieler Umweltgüter<br />
die größte Herausforderung unserer Zeit 14 .<br />
14 zum Problem der Berücksichtigung künftiger Generationen ausführlich Hampicke (1999)
26 Kapitel 4<br />
Dem Staat stehen idealtypischer Weise zwei Wege offen, knappe ökologische Güter zu<br />
identifizieren. Damit wird der Kreis zu den in Kapitel 3.1 beschriebenen zwei wesentlichen<br />
Typen von ökonomischen Instrumenten geschlossen:<br />
• der rein individualistische Weg im Sinne von Pigou, der mit einer Monetarisierung der<br />
ökologischen Güter und mit der Feststellung der Zahlungsbereitschaft der am<br />
Wirtschaftsprozess beteiligten Parteien verbunden ist (vgl. Kap. 3.1.2),<br />
• der kollektivistische Weg im Sinne der Entwicklung rationaler Ziele als ‚Stellvertreter’ für<br />
fehlende oder aus methodischen Gründen nicht zu erhebende individualistische Nachfrage<br />
und Festsetzung der Preise (vgl. Kap. 3.1.3).<br />
Trotz der Fortschritte der Monetarisierung von ökologischen Gütern 15 gibt es methodische 16 und<br />
sachliche Grenzen 17 .<br />
Knappe ökologische Güter müssen daher überwiegend indirekt als gesellschaftliche Umweltziele<br />
‚identifiziert’ werden. Gesellschaftliche Umweltziele als Ausdruck knapper ökologischer Güter<br />
sind Voraussetzung für ökonomisches Handeln zur Bewältigung der Umweltprobleme.<br />
Knappe ökologische Güter sind individuell oder gesellschaftlich als Umweltziele nachgefragte<br />
Umweltstrukturen (vgl. Abbildung 2a). Die Verknappung von ökologischen Gütern hat ihre<br />
Ursache in veränderten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, die zum Rückgang des Angebots<br />
und/oder zur Steigerung der Nachfrage führen. Da die ökologischen Güter durch so genannten<br />
open access gekennzeichnet sind, werden Angebot und Nachfrage nicht durch<br />
Marktmechanismen aufeinander eingestellt. Die Nachfrage ist ohne zielgerichtete Bereitstellung<br />
der ökologischen Güter nicht (mehr) zu befriedigen. Es kommt zur weiteren Verknappung der<br />
ökologischen Güter. Knappe ökologische Güter werden als Umweltprobleme bezeichnet.<br />
Wie oben beschrieben, besteht eine ökonomische Leistung darin, diese Knappheiten zu<br />
beseitigen. Dabei gibt es ausgehend von den Ursachen der Verknappung zwei ‚Schrauben’, an<br />
denen gedreht werden kann:<br />
15 Übersicht zu den unterschiedlichen Ansätzen z. B. Pommerehne & Roemer 1992; zur direkten Präferenzerfassung<br />
im Bereich Naturschutz durch Contingent Valuation z. B. Jakobsson & Dragun 1996, Degenhardt et al. 1998,<br />
Degenhardt & Gronemann 2000<br />
16 zu den methodischen Problemen z. B. Degenhardt & Gronemann 1998, Schneider 2001<br />
17 zu den sachlichen Grenzen z. B. Hampicke 1998, Seidl & Gowdy 1999, Schneider 2001
Honorierung ökologischer Leistungen als ökonomisches Instrument 27<br />
1. Die Nachfrage muss sich dem möglichen Angebot anpassen.<br />
2. Das Angebot muss entsprechend der Nachfrage erhöht werden.<br />
Zu 1.) Der begrenzende Faktor für die Angebotsseite der ökologischen Güter sind die<br />
ökosystemaren Fähigkeiten, die natürlicher Weise begrenzt sind. Die Überbeanspruchung dieser<br />
Fähigkeiten führt zur Verknappung der ökologischen Güter. Das Angebot kann aufgrund der<br />
‚natürlichen Begrenzung’ nicht beliebig entsprechend der Nachfrage erhöht werden. Eine<br />
‚ökologische Leistung’ besteht demnach darin, die Nutzung, also die Nachfrage, so zu<br />
begrenzen, dass die ökosystemaren Fähigkeiten wieder ausreichen, die verbleibende Nachfrage<br />
dauerhaft zu befriedigen.<br />
Zu 2.) Der Rückgang auf der Angebotsseite kann entsprechend den notwendigen Fähigkeiten zur<br />
Produktion der ökologischen Güter zwei Ursachen haben. Die ökosystemaren Fähigkeiten<br />
nehmen ab oder die individuellen Fähigkeiten werden nicht mehr in ausreichendem Maße<br />
eingesetzt (vgl. Abbildung 2b). Liegt die Ursache im Rückgang der ökosystemaren Fähigkeiten,<br />
kann eine Angebotserhöhung nur durch die Begrenzung der Nutzung ökosystemarer Fähigkeiten<br />
(verstanden als infrastrukturelle Umweltstrukturen und Prozesse) erreicht werden. Die<br />
Begrenzung der Nutzung muss derart gestaltet werden, dass die ökosystemaren Fähigkeiten<br />
wieder ausreichen, das orginär nachgefragte ökologische Gut zu produzieren. Liegt die Ursache<br />
für die Verknappung des ökologischen Gutes jedoch im Rückgang des Einsatzes individueller<br />
Fähigkeiten, würde die Umkehrung, das heißt der gezielte Einsatz dieser individuellen<br />
Fähigkeiten zur ‚Entknappung’ führen.<br />
Eine Ökologische Leistung besteht folglich darin (vgl. Abbildung 2c),<br />
• die Nachfrage nach ökologischen Gütern und notwendigen infrastrukturellen Gütern derart<br />
zu begrenzen, dass die ökosystemaren Fähigkeiten ausreichen, die Nachfrage dauerhaft zu<br />
befriedigen oder<br />
• individuelle Fähigkeiten gezielt zur Produktion ökologischer Güter und damit zur Erhöhung<br />
des Angebots einzusetzen.
28 Kapitel 4<br />
individuelle<br />
Fähigkeiten<br />
Ökologische Privat-/und<br />
Gemeingüter<br />
gezielter Einsatz<br />
individueller<br />
Fähigkeiten<br />
Knappe ökologische Güter<br />
Angebot nimmt ab<br />
Ökologische Leistungen<br />
Abbildung 2: Ökologische Leistungen der Landwirtschaft als gezielte Antwort auf Verknappung<br />
ökologischer Güter ( a) ‚Identifizierung’ ökologischer Güter b) Verknappung ökologischer Güter c) ökologische<br />
Leistungen als gezielte Antwort auf die Verknappung)<br />
Eine Honorierung dieser Leistung soll dann stattfinden, wenn der Leistungserbringer die<br />
Eigentumsrechte an den Fähigkeiten zur Produktion ökologischer Güter zugesprochen<br />
bekommen hat. Besitzt der Leistungserbringer die Eigentumsrechte nicht, muss die Leistung<br />
kostenlos erbracht werden. Die Zuteilung der Eigentumsrechte nimmt die zentrale Stellung bzgl.<br />
des Einsatzes der Honorierung ökologischer Leistungen der Landwirtschaft ein und wird<br />
ausführlich in Kapitel 5 behandelt.<br />
Nachfrage nimmt zu<br />
Öffentliche Ökologische Güter<br />
kulturbestimmte<br />
Umweltstrukturen<br />
(Kuppelprodukte)<br />
gezielter<br />
Nutzungsverzicht<br />
Änderung der sozioökonomischen<br />
Rahmenbedingungen<br />
naturbestimmte<br />
Umweltstrukturen<br />
ökosystemare<br />
Fähigkeiten<br />
Knappheit wird<br />
kompensiert durch<br />
ökologische Leistungen<br />
Knappheit durch<br />
Rückgang des Angebots<br />
oder<br />
Anstieg der Nachfrage<br />
wird nicht mehr<br />
kompensiert<br />
Knappheit wird<br />
kompensiert durch:<br />
individuelle Fähigkeit bei<br />
den Kuppelprodukten und<br />
ökosystemare Fähigkeit<br />
bei naturbestimmten<br />
Strukturen
Honorierung ökologischer Leistungen als ökonomisches Instrument 29<br />
Die Honorierung ökologischer Leistungen kann je nach Ausgestaltung sowohl den Charakter<br />
eines Pigou- als auch eines Baumol-Instruments haben sowie eine Mischform beider darstellen.<br />
Die Eigentumsrechte müssen jedoch bei Berücksichtigung des Verursacherprinzips bei allen<br />
umweltökonomischen Instrumenten, also auch bei ‚klassischen’ Baumol-Instrumenten, das<br />
Vorzeichen des Anreizes bestimmen (vgl. Kap. 3.2). In diesem Sinne spiegeln Anreize, deren<br />
Höhe zwar nicht aufgrund des monetären Wertes des knappen Umweltgutes ermittelt wurde,<br />
trotzdem die Verfügungsrechte an der Fähigkeit zur Produktion des knappen Umweltgutes<br />
wider. Positive Anreize sollten nur eingesetzt werden, wenn der Leistungserbringer über die<br />
Eigentumsrechte an den Fähigkeiten verfügt. Ist dies nicht der Fall, handelt es sich um<br />
Subventionen, die bei Berücksichtigung des Verursacherprinzips kategorisch von Honorierungen<br />
zu unterscheiden sind. Subventionen in diesem Verständnis sind „Staatsleistungen an Private,<br />
insbesondere Unternehmen, denen keine ‚ökonomische’ Gegenleistung entspricht“ (vgl.<br />
instrumentierte Ansätze der Subventionsdefinition bei Rodi 2000: 30 f., Andel 1998: 274). Die<br />
Honorierung und nicht die Subvention ist demnach das Spiegelbild der Abgabe (vgl. Abbildung<br />
3). Subventionen sind keine Instrumente zur Internalisierung von positiven Externalitäten (so<br />
z. B. in Weiland 1999, Thöne 2000), sondern reine Lenkungsinstrumente, die das<br />
Verursacherprinzip nicht berücksichtigen. Damit wird explizit nicht der Definition von<br />
Subventionen gefolgt, die diese wie Hansmeyer „als Geldzahlungen oder geldwerte Leistungen<br />
der öffentlichen Hand an Unternehmen ..., von denen anstelle einer marktwirtschaftlichen<br />
Gegenleistung bestimmte Verhaltensweisen gefordert oder erwartet werden, die dazu führen<br />
sollen, die marktwirtschaftlichen Allokations- und/oder Distributionsergebnisse nach politischen<br />
Zielen zu korrigieren“ (Hansmeyer 1977: 959). Nach dieser Definition könnten Zahlungen nicht<br />
entsprechend dem Verursacherprinzip differenziert betrachtet werden. Eine allgemein<br />
verbindliche Definition der ‚Subvention’ liegt allerdings weder im nationalen noch im<br />
internationalen Raum vor (vgl. Rodi 2000).<br />
Eine Unterscheidung von positiven Anreizen bzgl. der Verteilung der Eigentumsrechte ist jedoch<br />
der entscheidende Schritt, die Honorierung ökologischer Leistungen vom Verdacht der<br />
Subvention zu befreien. Die OECD mahnt immer wieder die Bedeutung der klaren Zuweisung<br />
der Eigentumsrechte als Unterscheidung zwischen Subventionen und Honorierungen an (OECD<br />
1999a). Auch das im Rahmen der Uruguay-Runde 1992 geschlossene Übereinkommen über die<br />
Landwirtschaft betont die Notwendigkeit von Transparenz und nachprüfbaren Kriterien, um<br />
Honorierungen von dem erforderlichen Abbau inländischer Stützungsmaßnahmen auszunehmen.<br />
Subventionen als Lenkungsinstrumente der Agrarumweltpolitik sollen nur in Ausnahmefällen<br />
zum Einsatz kommen und „in transparenter, zielgerichteter und befristeter Form“ umgesetzt<br />
werden (OECD 1999a: 30).
30 Kapitel 4<br />
Abbildung 3: Ökonomische Anreize der Umweltpolitik im Verhältnis zu Eigentumsrechten und dem<br />
Verursacherprinzip<br />
Für die Honorierung ökologischer Leistungen der Landwirtschaft kann abschließend formuliert<br />
werden:<br />
negative<br />
Anreize<br />
Eigentumsrechte nicht beim<br />
Anreizbezieher<br />
Die Honorierung ökologischer Leistungen der Landwirtschaft ist ein umweltökonomisches<br />
Instrument, mit dem Leistungen der Landwirtschaft zur Bereitstellung von individuell oder von<br />
der Gesellschaft als Umweltziele nachgefragten naturbestimmten und kulturbestimmten<br />
Umweltstrukturen honoriert werden, sofern der Landwirt über die entsprechenden<br />
Eigentumsrechte an den Fähigkeiten zur Produktion dieser Güter verfügt. Dabei kann eine<br />
Leistung erbracht werden durch:<br />
• Nutzungsverzicht derart, dass die ökosystemaren Fähigkeiten ausreichen, die<br />
naturbestimmten und kulturbestimmten Umweltstrukturen zu produzieren;<br />
• Einsatz individueller Fähigkeiten derart, dass die knappen kulturbestimmten<br />
Umweltstrukturen gezielt bereit gestellt werden.<br />
4.2 Ergebnis- und maßnahmenorientierte Honorierung ökologischer Leistungen<br />
Die Ökonomie befasst sich mit Maßnahmen zum Umgang mit Knappheiten. „Im Zustand der<br />
Knappheit muss man sich zwischen Alternativen entscheiden, man kann nie alles haben“<br />
(Hampicke 2000b: 4).<br />
positive<br />
Anreize<br />
Abgaben Subventionen Honorierung<br />
Eigentumsrechte beim<br />
Anreizbezieher<br />
Verursacherprinzip<br />
angewendet<br />
Verursacherprinzip<br />
nicht angewendet
Honorierung ökologischer Leistungen als ökonomisches Instrument 31<br />
Dass eine Verteilung (Allokation) knapper Güter durch den idealen Markt effizient möglich ist,<br />
ist nicht nur empirisch bewiesen, sondern auch der Grund für unser Wirtschaftssystem und soll<br />
an dieser Stelle als Axiom stehen.<br />
Die Forderung von Umweltökonomen, das Umweltordnungsrecht nach Möglichkeit durch<br />
ökonomische Instrumente zu ersetzen, zumindest jedoch zu ergänzen, und dadurch Raum für<br />
‚Marktkräfte’ zuzulassen, scheint daher nur konsequent.<br />
Dass viele die dem Markt unterstellte Steuerungswirkung keineswegs für all jenen Instrumenten<br />
gelten, die sich ökonomisch nennen, ist ebenfalls eine Tatsache, die leider in der öffentlichen<br />
politischen Diskussion oftmals unterzugehen scheint. Anders sind z. B. pauschale Rufe nach<br />
Vertragsnaturschutz an Stelle von Naturschutzordnungsrecht nicht zu verstehen. Abgesehen von<br />
der Frage der zugeteilten Verfügungsrechte kommt es wesentlich darauf an, ‚was’ die Verträge<br />
‚wie’ genau regeln bzw. ‚was’ unter den gegebenen Rahmenbedingungen ‚wie’ geregelt werden<br />
kann. Oftmals steckt hinter dem Ruf nach Vertragsnaturschutz weniger eine<br />
Allokationsbegründung (Effizienzsteigerung) als vielmehr eine Distributionsbegründung (vgl.<br />
Kap. 5.6).<br />
Grundgedanken, welche Eigenschaften ökonomische Instrumente besitzen sollten, um sich von<br />
dem regulativen Instrument ‚Ordnungsrecht’ abzugrenzen, fassen folgende Aussagen zu<br />
‚flexiblen Instrumenten’ zusammen: „Im Gegensatz zu regulativen Strategien steuert ein<br />
umweltpolitisches Instrument flexibel, sofern die zu regulierenden Einheiten mit einer<br />
spezifischen Regulierungsantwort auf die individuellen Umstände platziert werden können. Eine<br />
Lösung der öffentlichen Aufgabe ‚Schutz der Umwelt’ bzw. – wirtschaftswissenschaftlich<br />
gewendet – des Lenkungsproblems knapper Umweltgüter kann als flexibel gelten, sofern sie eine<br />
dezentrale Konfliktbewältigung vorsieht, d. h. Umstände des Einzelfalls (Präferenzen, Kosten)<br />
bei den Eingriffsvornahmen berücksichtigt. Aus der Sicht der Normadressaten ergeben sich bei<br />
flexibler Steuerung Freiheitsgrade individueller Normbefolgung. Ein wirtschaftspolitisches<br />
Instrument wirkt darüber hinaus anreizend, soweit der verwendete Allokationsmechanismus dem<br />
Normadressaten ein wirtschaftliches Eigeninteresse an der Verfolgung des staatlichen<br />
Steuerungszwecks vermittelt“ (Gawel 1994: 10).<br />
Eine nähere Betrachtung der beiden wesentlichen Vertragsgestaltungsmöglichkeiten der<br />
Honorierung ökologischer Leistungen verdeutlicht, dass sich aus ökonomischer Sicht bereits<br />
wesentliche Unterschiede aufgrund der ‚Ansatzstelle’ der Honorierung ergeben. Vor dem<br />
Hintergrund ihres Effizienzpotentials werden die ergebnis- und maßnahmenorientierte<br />
Honorierung ökologischer Leistungen näher beleuchtet. Aufgrund dieser Analyse ist eine
32 Kapitel 4<br />
Aussage möglich, welcher der beiden Varianten bei optimalen Ausgangsbedingungen der<br />
Vorrang zu geben ist.<br />
4.2.1 Unterscheidung der ergebnis- und maßnahmenorientierten Honorierung<br />
Es gibt prinzipiell zwei verschiedene Möglichkeiten der Honorierung ökologischer Leistungen<br />
der Landwirtschaft, die oftmals kategorisch gegenübergestellt werden, sich jedoch eher graduell<br />
unterscheiden:<br />
1. ergebnisorientierte Honorierung ökologischer Leistungen,<br />
2. maßnahmenorientierte Honorierung ökologischer Leistungen.<br />
Bei der ergebnisorientierten Honorierung wird die Zahlung direkt an das nachgefragte<br />
ökologische Gut geknüpft. Der Landwirt erhält z. B. eine Zahlung für eine ‚artenreiche<br />
Feuchtwiese’ oder positive Wirkungen auf das ökologische Gut (z. B. Verminderung von<br />
Immissionen, ausführlich in Kapitel 6.3.1). Bei der maßnahmenorientierten Honorierung wird<br />
die Zahlung an Maßnahmen geknüpft, die zur Produktion ökologischer Güter führen. Als<br />
Beispiel kann der Landwirt dafür bezahlt werden, dass er seine Wiese nicht düngt und nur<br />
einmal im Jahr, Ende Juni, mäht.<br />
Aus ökonomischer Sicht ist entscheidend, dass der Landwirt bei der ergebnisorientierten<br />
Honorierung Handlungsalternativen hat. Es ist ihm überlassen, wie er seine Wiese<br />
bewirtschaftet, entscheidend ist, dass die artenreiche Wiese produziert wird. Sein Augenmerk<br />
liegt damit auf dem Ergebnis seiner Arbeit.<br />
Bei der maßnahmenorientierten Honorierung wird dem Landwirt dagegen genau vorgegeben,<br />
welche Maßnahmen er durchzuführen hat. Er hat keine Handlungsalternativen. Der Anreiz der<br />
Zahlung beeinflusst lediglich eine Alternativentscheidung: die vorgegebene Maßnahme<br />
durchzuführen oder nicht 18 . Lediglich an dieser einen Stelle wirkt das ökonomische Prinzip, wird<br />
Entscheidung über ökonomische Anreize beeinflusst. Das Augenmerk des Landwirtes liegt nicht<br />
auf dem Ergebnis seiner Arbeit (vgl. Matzdorf 2004).<br />
18 Wie das Ordnungsrecht (vgl. Gawel 1999: 240, Gawel 1994) nimmt die maßnahmenorientierte Honorierung eine<br />
„Dichotomisierung des umweltallokativen Möglichkeitsraumes“ vor. Die maßnahmenorientierte Honorierung teilt<br />
den ‚Möglichkeitsraum’ in bezahlte und nicht bezahlte Umweltnutzungen. (Das Ordnungsrecht teilt den<br />
‚Möglichkeitsraum’ in erlaubte und nicht erlaubte Umweltnutzungen ein.)
Honorierung ökologischer Leistungen als ökonomisches Instrument 33<br />
Es wurde bereits erwähnt, dass diese beiden Honorierungsarten sich lediglich graduell<br />
unterscheiden. So kann die Produktion eines ökologischen Gutes lediglich eine<br />
Handlungsalternative zulassen. In diesem Fall wäre es vollkommen egal, ob die Zahlung an das<br />
Ergebnis oder die Handlung geknüpft ist (wenn sich beide gleich gut überprüfen lassen, vgl.<br />
unten).<br />
Die Handlungsalternativen sind jedoch das entscheidende ökonomische Kriterium, wie Kapitel<br />
4.2.2.2 zeigen wird. „Generell bedeutet die Zunahme des Spezifitätsgrades der Regulierung eine<br />
Quelle potentieller Ineffizienz durch Verkürzung von Freiheitsgraden“ (Gawel 2000: 120) 19 .<br />
Daher wird innerhalb dieser Arbeit die ergebnisorientierte Honorierung von der maßnahmen-<br />
orientierten Honorierung nicht allein anhand der Anknüpfstelle für die Zahlung, sondern auch<br />
auf der Grundlage der dem Landwirt zur Wahl stehenden Handlungsalternativen differenziert<br />
(vgl. Abbildung 4).<br />
Abbildung 4: Unterscheidung von ergebnis- und maßnahmenorientierter Honorierung ökologischer<br />
Leistungen (Quelle: Matzdorf 2004)<br />
Ergebnis- und maßnahmenorientierte Honorierung unterscheiden sich darüber hinaus in der<br />
Ermittlung des Preises für die Leistung.<br />
Bei der ergebnisorientierten Honorierung sollten sich Preise idealtypischer Weise am Wert des<br />
ökologischen Gutes orientieren. Mit der Produktion eines besonders hoch bewerteten<br />
19 „Das Ziel, in Bezug worauf eine äquivalente Allokation im Ermessen des Umweltnutzers verbleibe, gestattet<br />
nämlich bei überproportionaler Spezifizierung des Regulierungseingriffs kaum noch Variationen der Zielerfüllung;<br />
es werden so „limitationale Milieus” geschaffen, die keine Freiheitsgrade der Zielerfüllung mehr vorhalten“ (Gawel<br />
2000: 120). Zu „limitationale Milieus” vgl. auch Gawel (1994: 153 ff.).
34 Kapitel 4<br />
ökologischen Gutes kann der Landwirt bei geringen Kosten einen hohen Preis erzielen, es sind<br />
also Renteneinkommen möglich (vgl. Kap. 3.2).<br />
Maßnahmenorientierte Honorierung orientiert sich am Kostenprinzip. Dabei werden der<br />
Aufwand für die Produktionsfaktoren (Faktorkosten) oder der entgangene Nutzen durch<br />
Bewirtschaftungsauflagen (Kompensationskosten) berechnet (vgl. auch Kap. 3.2). In der gut<br />
nachvollziehbaren Kostenermittlung ist ein wesentlicher Grund dafür zu finden, dass aktuell die<br />
maßnahmenorientierte Honorierung überwiegt. Tatsächlich können durch derartige Preise jedoch<br />
falsche Anreize gesetzt werden, da sie in keiner Verbindung zum Wert des ökologischen Gutes<br />
stehen. Die Bemessung der Prämienhöhe an den Kosten führt darüber hinaus nicht unbedingt zu<br />
Anreizen, diese durch technischen Fortschritt zu senken, wenn damit gleichzeitig die<br />
Honorierung abnimmt.<br />
Es sei jedoch auch hier darauf hingewiesen, dass fließende Übergänge bei der Ermittlung des<br />
Preises für die Leistung (vgl. Kap. 4.1) bestehen können. Nicht zuletzt aufgrund der<br />
Schwierigkeit der Ermittlung bzw. Festlegung der Preise für die ökologischen Güter ist eine<br />
Verknüpfung der ergebnisorientierten Honorierung mit Preisen, die sich eher an den Kosten<br />
orientieren, ersatzweise vorstellbar (vgl. Bedeutung von Transaktionskosten Kap. 5.4.2.).<br />
4.2.2 Potentieller Effektivitäts- und Effizienzvorteil der ergebnisorientierten<br />
Honorierung<br />
Es soll im Folgenden ein Überblick über Effektivität und Effizienz der beiden<br />
Honorierungsansätze bei idealtypischem Charakter dargestellt werden. Dabei handelt es sich<br />
nicht um einen systematischen Vergleich aus ökonomischer Sicht. Ziel ist es vielmehr, die<br />
relative Vorzüglichkeit der ergebnisorientierten Honorierung im Hinblick auf ihr Effektivitäts-<br />
und Effizienzpotential zu verdeutlichen und damit die Begründung (und die Bedeutung) für die<br />
Suche nach ergebnisorientierten Honorierungsansätzen zu liefern.<br />
Die Beurteilungskriterien für den Vergleich der beiden umweltökonomischen Instrumente<br />
werden dabei in Anlehnung an die Klassifikation der OECD (1994b) unterteilt in Kriterien der<br />
ökologischen Effektivität (oder auch Treffsicherheit) und der ökonomischen Effizienz.
Honorierung ökologischer Leistungen als ökonomisches Instrument 35<br />
4.2.2.1 Ökologische Effektivität<br />
Ökologische Effektivität besagt, dass ein Instrument geeignet sein muss, das angestrebte<br />
umweltpolitische Ziel wirksam und präzise zu erreichen (statische Inzidenz) und im Zeitverlauf<br />
mindestens nicht zu unterschreiten oder sogar positiv fortzuschreiben (dynamische Inzidenz).<br />
„Wunsch und Wirklichkeit sollen nach erfolgtem Instrumenteinsatz in sachlicher, räumlicher und<br />
zeitlicher Hinsicht übereinstimmen“ (Ewers & Hassel 2000: 135).<br />
Die ökologische Effektivität ist bei der ergebnisorientierten Honorierung höher. Diese<br />
Erkenntnis ist trivial, da die Zahlung an das Ziel geknüpft ist bzw. an Wirkungen (Immissionen),<br />
die näher am Ziel sind (vgl. Kap. 6.3).<br />
Ganz und gar nicht trivial ist die Voraussetzung dafür. Das ‚Ergebnis’, an das die Zahlung<br />
geknüpft ist, muss das Ziel ‚präzise’ abbilden (statische Inzidenz). Ziel ist im Falle der<br />
ökologischen Güter jedoch nicht allein die effiziente Allokation des ‚ökologischen Gutes’ im<br />
Sinne der nachgefragten Umweltstruktur, sondern auch die Erhaltung der ökosystemaren<br />
Fähigkeiten (der Umweltprozesse), die zur Produktion des Gutes notwendig sind (vgl. Kap. 5.2).<br />
Der Erhalt der ökosystemaren Fähigkeit ist für eine anhaltende dynamische Inzidenz<br />
Voraussetzung. Das ‚Ergebnis’ muss demnach präzise ‚die’ Ziele abbilden. Diese triviale<br />
Forderung ist das Problem der ergebnisorientierten Honorierung (vgl. Kap. 6.3.2 und 6.3.5).<br />
Die ökologische Effektivität der maßnahmenorientierten Honorierung ist abhängig von der<br />
kausalen Beziehung von Ziel und Maßnahmen. In Anbetracht der Eigenschaften ökologischer<br />
Systeme ist jedoch ein Kausalnachweis für jede Maßnahme in absehbarer Zeit nicht zu führen<br />
(zum Problem des Kausalitätsnachweises z. B. Fränzle et al. 1993, Breckling et al. 1997,<br />
weiterführend Kap. 6.3.5.1). Von daher kann in der Regel die ökologische Effektivität der<br />
maßnahmenorientierten Honorierung nicht damit überprüft werden, dass die exakte<br />
Durchführung der Maßnahme überprüft wird, sondern die Maßnahmen müssen sich an den<br />
realen Umweltzuständen vor dem Hintergrund gesetzter Umweltziele prüfen lassen. Die<br />
Halbzeitbewertungen der Agrarumweltprogramme der EU-Staaten 20 berücksichtigen diesen<br />
Anspruch (COM 1999a, 2000b, 2002b) und heben sich dadurch von der bis dato gängigen<br />
Evaluierungspraxis ab (vgl. z. B. Zeddies & Doluschitz 1996, COM 1998).<br />
20 Bis zum Ende des Jahres 2003 fand in allen EU-Staaten die Halbzeitbewertung der Entwicklungspläne für den<br />
ländlichen Raum (EPLR) nach einem EU-weit einheitlichen methodischen Rahmen statt.
36 Kapitel 4<br />
4.2.2.2 Effizienz<br />
Bezüglich der Effizienz der beiden Honorierungsarten kann als Ausgangsthese formuliert<br />
werden, dass die ergebnisorientierte Honorierung ökologischer Leistungen effizienter ist als die<br />
maßnahmenorientierte Honorierung. „In der Tat spricht ökonomisch alles für eine<br />
leistungsgerechte Abgeltung. ... Jeder Marktteilnehmer wird für den durch die Nachfrage<br />
determinierten Wert seines Produktes bezahlt, nicht jedoch für die ihm entstandenen Kosten<br />
entschädigt“ (Hampicke 1996: 83, in gleicher Weise SRU 1994, 1996: 90 f.). Aufgrund der<br />
Bedeutung der Vorzugswürdigkeit der ergebnisorientierten Honorierung ökologischer<br />
Leistungen aus ökonomischer Sicht soll an dieser Stelle jedoch eine kurze ‚theoretische<br />
Diskussion’ wesentliche Vorteile skizzieren.<br />
Statische Effizienz liegt vor, wenn die gesellschaftlichen Ziele unter den gegebenen<br />
Rahmenbedingungen mit den geringst möglichen gesamtwirtschaftlichen Kosten erreicht werden<br />
(Michaelis 1996). Statische Effizienz ist erreicht, wenn z. B. alle Stickstoff emittierenden<br />
Landwirte die gleichen marginalen Vermeidungskosten haben. Würde es einen Landwirt geben,<br />
der Stickstoffemissionen zu geringeren Kosten vermeiden könnte, bestehen Möglichkeiten für<br />
Effizienzgewinne, indem bei insgesamt gleich bleibender Menge der Emittent mit<br />
vergleichsweise höheren Vermeidungskosten seine Aktivität ausdehnt, während sie ein Emittent<br />
mit geringeren Vermeidungskosten noch weiter zurücknimmt (vgl. Ewers & Hassel 2000).<br />
Dynamisch effizient ist ein Instrument, wenn es hinreichende Anreize gibt, Innovations-,<br />
Informations- und Motivationsvorteile gegenüber einer staatlichen Planungsinstanz zugunsten<br />
der Zielerreichung zu mobilisieren (Ewers & Hassel 2000: 137, vgl. Michaelis 1996, OECD<br />
1994b). Die Innovationswirkung von umweltökonomischen Instrumenten wird in der Literatur<br />
häufig als das wichtigste Kriterium überhaupt angesehen (vgl. z. B. Kneese & Schulze 1975,<br />
Faber & Stephan 1987) 21 . Gerade vor dem Hintergrund einer Nachhaltigen Entwicklung wird<br />
die Bedeutung der dynamischen Effizienz hervorgehoben (vgl. Lohmann 1999: 18).<br />
Ausgangspunkt der Betrachtungen soll die Unterscheidung der beiden Instrumente bzgl. der<br />
möglichen Handlungsalternativen sein. Aufgrund der Vorgaben der Mittel zur Erreichung des<br />
Umweltziels bei der maßnahmenorientierten Honorierung verschwindet der Vorteil des<br />
ökonomischen Instrumentes gegenüber ordnungsrechtlichen Normen. Der Markt ist dem Plan<br />
gerade deshalb überlegen, weil die Marktteilnehmer dezentral planen können (Engel 1998: 14).<br />
21 zur Bedeutung von Umweltinnovationen vgl. auch Klemmer et al. 1999
Honorierung ökologischer Leistungen als ökonomisches Instrument 37<br />
Vielmehr bestehen zwischen technikorientierten ordnungsrechtlichen Normen (Stichwort: ‚Stand<br />
der Technik’) und maßnahmenorientierter Honorierung große Übereinstimmungen. Die Kritik,<br />
die für individualisierte ordnungsrechtliche Technikvorgaben vorgebracht wird, gilt daher für<br />
maßnahmenorientierte Honorierung in gleicher Weise. „Bei Annahme einer asymmetrischen<br />
Informationsverteilung über die jeweils kostengünstige betriebliche Normerfüllungsalternative<br />
zwischen staatlichem Regulator (bzw. vollziehender Allokationsbehörde) und Umweltnutzer<br />
stehen individualisierte ordnungsrechtliche Technikvorgaben im Verdacht der Ineffizienz, da sie<br />
zieläquivalente, aber kostengünstigere Alternativen der Mittelwahl nicht zulassen oder<br />
behindern“ (Gawel 2000: 114 f.). Im Überblick können folgende Nachteile der<br />
maßnahmenorientierten Honorierung identifiziert werden:<br />
1. Maßnahmenorientierte Honorierung verhindert Eigeninteresse an der Suche und der<br />
Offenlegung von effizienteren Alternativen.<br />
Mögliche Effizienzgewinne einer kostengünstigeren Alternativlösung bleiben oftmals dauerhaft<br />
im Verborgenen, weil die durch maßnahmenorientierte Honorierung geprägte Situation erst gar<br />
nicht zu Such- und Aufdeckungsaktivitäten bei der Realisierung von<br />
Minimalkostenkombinationen anreizt (zur Kritik am Ordnungsrecht in diesem Sinne vgl. z. B.<br />
Gawel 2000: 119, Cansier 1993). Die Landwirte haben keine Veranlassung, sich Gedanken um<br />
effiziente Möglichkeiten der Zielerreichung zu machen, noch mehr, das Ziel der Maßnahme<br />
kann ausgeblendet werden bzw. wird ausgeblendet. Der Anreiz für die Suche nach der besten<br />
Alternative fehlt, da die Landwirte bei der maßnahmenorientierten Honorierung gerade nicht die<br />
Folgen (Umweltwirkungen) falscher Entscheidungen tragen. Damit fehlt ein wichtiger<br />
Grundbaustein des ökonomischen Verhaltensmodells und die Folge kann nur Effizienzverlust<br />
sein (vgl. Kap. 3.1).<br />
2. Maßnahmenorientierte Honorierung führt zur mangelnden dynamischen Anreizwirkung für<br />
Bearbeitungsinnovationen.<br />
Maßnahmenorientierte Honorierung im Sinne von Technikvorgaben kann keinen Ersatz für<br />
individuelle, kreative Lösungen eines Ergebnis bezogen definierten Knappheitskonflikts<br />
darstellen (vgl. i.d.S. Gawel 2000: 119); vor allem die dynamische Effizienz wird so behindert<br />
(z. B. Klemmer 1990, Endres 1994: 131 ff.). Dies ist besonders unter Berücksichtigung der<br />
großen Standortheterogenität und der dadurch notwendigen Unterschiede in der Bewirtschaftung<br />
zu betrachten. Landwirte kennen ihre Flächen besser als jede Behörde und können bei Zulassung<br />
von Freiheitsgraden gezielter einwirken. Bei Vorgabe der Maßnahmen kann dieses Potential<br />
nicht ausgeschöpft werden.
38 Kapitel 4<br />
3. Maßnahmenorientierte Honorierung verstärkt das Problem der Informationsasymmetrien.<br />
Bei der Honorierung ökologischer Leistung handelt es sich um eine vertragliche Beziehung<br />
zwischen Auftraggeber (Staat in Form von Verwaltung) und Auftragnehmer (Landwirt). Der<br />
Auftraggeber kann synonym auch als Principal, der Auftragnehmer als Agent bezeichnet werden.<br />
Bei der Honorierung ökologischer Leistung über Verträge liegt eine Principal-Agent-Beziehung<br />
vor: Mehrere Individuen kooperieren mit dem Ziel der individuellen Wohlfahrtssteigerung<br />
miteinander nach dem Schema von Leistung und Gegenleistung (vgl. z. B. Balks 1995, Richter<br />
& Furubotn 1996).<br />
Die an Honorierungsprogrammen teilnehmenden Landwirte besitzen regelmäßig sowohl vor als<br />
auch während der Programmteilnahme einen Wissensvorsprung gegenüber der auftraggebenden<br />
Verwaltung. Ein Wissensvorsprung vor Vertragsabschluss wird gemeinhin verborgene<br />
Information (hidden information) genannt, während sich ein Handlungsspielraum von<br />
Beauftragten in verborgenen Handlungen (hidden action) äußert (Meinhövel 1999: 13). Die<br />
Ungleichverteilung von Wissen über die Qualität, zuweilen auch Quantität von Gütern und<br />
Dienstleistungen beeinflusst den Vertragsabschluss: Der mehr Wissende besitzt verborgene<br />
Informationen (Meinhövel 1999: 14). Aufgrund der Informationsasymmetrie stellt sich die<br />
Frage, wie leistungsfähige Landwirte bei der Programmteilnahme ‚selektiert’ werden können<br />
und wie verhindert werden kann, dass die Landwirte während der Programmteilnahme gegen die<br />
Interessen des Auftraggebers handeln und sich opportunistisch (moral hazard-Gefahr) verhalten<br />
(Karl 1997: 398). „If the agent has differing preferences to the principal, then the agent faces an<br />
incentive to pursue his own interests. The principal finds it difficult to detect this because<br />
monitoring is costly” (Moyle 1998: 313 f.).<br />
„Das ökonomische Modell hat nur ein Instrument, um die Informationsverteilung zu ändern: Es<br />
muss an das Eigeninteresse dessen heran, der die Information besitzt“ (Engel 2001: 7). Nur wenn<br />
der Landwirt selbst ein Interesse daran hat, die Qualität seiner Leistung offen zu legen, wird das<br />
Problem der Informationsasymmetrie gemindert. Der Landwirt muss ein Eigeninteresse daran<br />
haben, den Zielen des Auftraggebers zu folgen (Rapp 1998, Weikard 1995, Hanf 1993).<br />
Lediglich bei der ergebnisorientierten Honorierung wird ein derartiges Eigeninteresse forciert.<br />
4. Maßnahmenorientierte Honorierung gewährleistet keine Kontinuität.<br />
Die Instrumente zur Honorierung ökologischer Leistungen sind dauerhaft, die<br />
Programmlaufzeiten jedoch kurzfristig angelegt. „Es ist kurios, dass ein Privathaushalt seinen<br />
Garten für 20 Jahre im Voraus einrichtet, dass beim Umgang mit der großen Landschaft jedoch<br />
von der Hand in den Mund gelebt wird“ (Hampicke 1995: 115). Sollen EU- und Bundesmittel in
Honorierung ökologischer Leistungen als ökonomisches Instrument 39<br />
Anspruch genommen werden, so beträgt die Vertragslaufzeit bis auf wenige Ausnahmen fünf<br />
Jahre. Landwirte wollen Planungssicherheit, ohne sich selbst über einen zu langen Zeitraum<br />
binden zu müssen. Von daher sind die meisten Landwirte mit Vertragszeiten von fünf Jahren<br />
durchaus zufrieden, wenn die Planungssicherheit über die fünf Jahre hinaus gegeben ist. Wenig<br />
Anreiz wird jedoch mit derart kurzen Laufzeiten im Hinblick auf den Aufbau eines<br />
„Reputationskapitals“ gegeben 22 (vgl. Hampicke 1995). Ergebnisorientierte Honorierung könnte<br />
Anreize zum Aufbau von Reputationskapital geben, da das Eigeninteresse an einer<br />
kontinuierlichen Teilnahme erweckt wird. Bei maßnahmenorientierter Honorierung besteht<br />
hingegen sogar die Gefahr, dass eine langfristige Teilnahme gerade konterkariert wird. So<br />
besteht bei Extensivierungsverträgen aus wirtschaftlicher Sicht geradezu ein Anreiz aus den<br />
Verträgen auszutreten, wenn diese ökologische Wirkung zeigen. Folgendes Beispiel soll dies<br />
verdeutlichen: Es werden Produktionseinbußen durch reduzierten Stickstoffeinsatz in den ersten<br />
Jahren der Extensivierung durch die ‚N-Nachlieferungsfähigkeit’ des Standortes abgeschwächt<br />
(z. B. Morard & Sanson 1995). Wenn dann die ‚N-Nachlieferungsfähigkeit’ nachlässt, besteht<br />
aus rein ökonomischer Sicht Anlass, wieder intensiv zu wirtschaften und den Standort<br />
‚aufzudüngen’. Es ist unschwer zu erkennen, dass dieses Verhalten konträr zur ökologischen<br />
Effektivität steht. Auch hier muss das Eigeninteresse an der Vertragsverlängerung – das<br />
Eigeninteresse an der ökologischen Effektivität – geweckt werden. Bei der ergebnisorientierten<br />
Honorierung investiert der Landwirt selbst in das Ergebnis, also in die ökologische Wirkung, hat<br />
demnach ein Interesse daran, Verträge zu verlängern, wenn und gerade weil sie Wirkung zeigen.<br />
5. Maßnahmenorientierte Honorierung bietet wenig Anreiz zu kooperativem Handeln.<br />
Gerade die Produktion von ökologischen Gütern bedarf in vielen Fällen kooperativen Handelns<br />
mehrerer Landwirte. Bei der maßnahmenorientierten Honorierung ist das Verhalten der anderen<br />
Landwirte für die einzelnen Wirtschaftsteilnehmer nicht relevant. Es besteht keine Veranlassung<br />
durch gemeinsames Handeln die Effizienz zu erhöhen. Anders ist es bei der ergebnisorientierten<br />
Honorierung. Ist das Ziel z. B. den Nährstoffeintrag in ein anliegendes Gewässer zu minimieren<br />
und die Zahlung wird an den Nährstoffgehalt des Gewässers geknüpft, so dürfte es dem<br />
Landwirt, der durch entsprechende Maßnahmen die Nährstoffimmission in das Gewässer senkt,<br />
nicht egal sein, wenn sein Nachbar ungestört weiterhin direkt bis an das Gewässer heranfährt und<br />
Dünger ausbringt und/oder keine Maßnahmen bzgl. der Bodenerosion unternimmt.<br />
22 „Nimmt ein Betrieb in nicht nur geringfügigem Umfang an Extensivierungsprogrammen teil, so müssen diese<br />
früher oder später die Betriebsorganisation beeinflussen. Irgendwann werden Entscheidungen fällig, welche<br />
dauerhaft binden. Gerade diesen kann man sich bei der heutigen Kurzfrist-Förderung nicht konstruktiv stellen, man<br />
kann sie nur immer wieder aufschieben“ (Hampicke 1995: 116).
40 Kapitel 4<br />
Wahrscheinlich wäre in solchem Fall, dass sich die Anrainer des Gewässers zusammenschließen<br />
und so wirtschaften, dass der ökologische Erfolg eintritt und sie dafür honoriert werden (vgl.<br />
Hampicke 1995, Frey & Blöchliger 1991). Hier wäre ein guter Ansatzpunkt für so genannte<br />
Naturschutzgenossenschaften (vgl. z. B. Hagedorn (Ed.) 2002).<br />
6. Maßnahmenorientierte Honorierung fördert die Eigenmotivation der Landwirte nicht –<br />
intrinsische Motivationen werden nicht gefördert.<br />
Die Zahlungen für Umweltleistungen werden von der Landwirtschaft zum überwiegenden Teil<br />
aktuell im Sinne von Ausgleichszahlungen für Ertragsausfall angesehen. Das Verständnis der<br />
Landwirte gegenüber dem Umweltschutz ist, dass Umweltschutz bzw. Naturschutz einer<br />
Produktion entgegensteht. Dem Selbstverständnis nach sind Landwirte jedoch Produzenten. Eine<br />
deutlichere Umorientierung hin zu einer Produktion von Umweltgütern könnte wesentlich zum<br />
Abbau von Vorbehalten gegenüber dem Naturschutz beitragen und so Ausgangspunkt für<br />
Effizienzsteigerung sein. Die für den Naturschutz erbrachten Leistungen würden als Produkte,<br />
den so genannten NCO (non commodity outputs), von den Landwirten verstanden werden<br />
können. Dieses Verständnis ist Voraussetzung für die Umsetzung des Konzeptes einer<br />
multifunktionalen Landwirtschaft 23 . Erfahrungen mit ergebnisorientierter Honorierung in der<br />
Schweiz bestätigen die positive Wirkung auf die Motivation: „Endlich wird auch mal ein<br />
Resultat belohnt, der Öko-Ausgleich bekommt einen neuen Sinn, es gibt eine Wertschätzung“<br />
(zitiert in Schiess-Bühler 2003: 86).<br />
7. Maßnahmenorientierte Honorierung verteilt Informationsdefizite bzgl. der Ungewissheit<br />
ökologischer Systeme einseitig zu Lasten der Gemeinschaft.<br />
Aufgrund der Komplexität von ökologischen Systemen haftet gezielten Eingriffen in<br />
ökologische Systeme in jedem Fall eine Unsicherheit an, ob die Eingriffe (Maßnahmen) auch<br />
wirklich zielführend sind. Bei der maßnahmenorientierten Honorierung trägt die Gesellschaft<br />
allein das Risiko, unter Umständen ihr Geld umsonst ausgegeben zu haben (ausführlich in Kap.<br />
6.3.5.1, vgl. auch Baur 1998). Zu beachten ist unter dem Aspekt der Risikoverteilung<br />
zweifelsohne, dass risikoaverse Landwirte ergebnisorientierte Verträge, die von unscharfen<br />
Beobachtungen ausgehen und damit mit einem Einkommensrisiko verbunden sind, nicht<br />
abschließen werden (Rapp 1998, Baur 2003). Die Gesellschaft als Nachfrager kann jedoch auch<br />
23 vgl. FN 10
Honorierung ökologischer Leistungen als ökonomisches Instrument 41<br />
bei ergebnisorientierter Honorierung das Risiko durch modellierte ‚Ergebnisse’ übernehmen und<br />
damit die Bereitschaft der Landwirte für Vertragsabschlüsse erhöhen (vgl. Kap. 6.3.5.1 und 8.1).<br />
Unter dem Aspekt der Risikoverteilung sind ergebnisorientierte Verträge prinzipiell für die<br />
Gesellschaft besonders dort interessant, wo der Staat aufgrund der Verfassung die<br />
Teilnahmebedingungen durch Hoheitsgewalt ändern kann. „Die Rechtsordnung ist freier gestellt.<br />
Sie kann die mangelnde Bereitschaft zur Preisgabe der Information mit staatlichem Zwang<br />
überspielen. ... Mit seiner Hoheitsgewalt kann der Staat die Teilnahmebedingung überspielen“<br />
(Engel 2001: 7). Derartige Hoheitsgewalt ist gerade im Verhältnis Landwirtschaft und<br />
Naturschutz an den Stellen von Interesse, an denen dem Staat die Option freigestellt ist, das Ziel<br />
durch Ordnungsrecht oder z. B. über Vertragsnaturschutz zu regeln. Für den gesamten Bereich<br />
der Erschwernis- oder Härteausgleichszahlungen kann das Argument der Risikoverteilung<br />
vorgebracht werden (vgl. Kap. 5.6).<br />
4.2.2.3 Schlussfolgerungen<br />
Unter idealen Bedingungen spricht alles für eine ergebnisorientierte Honorierung (vgl.<br />
Abbildung 5). Diese Art der Honorierung kommt der idealtypischen Charakteristik<br />
ökonomischer Instrumente am nächsten. Eine ergebnisorientierte Honorierung stellt jedoch hohe<br />
Anforderungen an die Vertragsgestaltung, insbesondere an die Operationalisierung bzw.<br />
Rationalisierung der Umweltziele bzw. ökologischen Güter. Daher werden Grenzen derartiger<br />
Vertragsgestaltung relativ schnell erreicht (vgl. z. B. Moyle 1998). Diese Grenzen werden vor<br />
allen Dingen durch die Eigenschaften ökologischer Systeme bestimmt. Die damit verbundenen<br />
Schwierigkeiten, die in Kapitel 6.3.5 verdeutlich werden, veranlassen zu differenzierten<br />
Betrachtungen bzgl. der Bewertung der ergebnis- und maßnahmenorientierten Honorierung<br />
ökologischer Leistungen der Landwirtschaft. Vor diesem Hintergrund kann der Aussage von<br />
Bohm & Russel (1985: 455) zur Instrumentenbewertung nur beigepflichtet werden: „No general<br />
statements can be made about the relative desirability of alternative policy instruments once we<br />
consider such practical complication as that location matters, that monitoring is costly, and that<br />
exogenous change occurs in technology, regional economies, and natural environmental<br />
systems.“
42 Kapitel 4<br />
Gesellschaftliche<br />
Risikoverteilung<br />
Verbesserung der<br />
intrinsischen Motivation<br />
Förderung kooperativen<br />
Handelns<br />
Abbildung 5: Potentieller Effizienzvorteil der ergebnisorientierten gegenüber der maßnahmenorientierten<br />
Honorierung ökologischer Leistungen der Landwirtschaft (Quelle: Matzdorf 2004)<br />
Als Ergebnis der Betrachtungen zum Effektivitäts- und Effizienzpotential kann jedoch<br />
Hampicke vollständig zugestimmt werden: „Zusammengefasst ist die Forderung nach leistungs-<br />
anstatt kostenorientierter Abgeltung leichter erhoben als erfüllt, dennoch ist diese Forderung als<br />
Leitbild voll zu unterstützen“ (Hampicke 1996: 85). Das Konzept sollte anhand der praktischen<br />
Anwendung auf die Möglichkeiten und Grenzen geprüft werden. Dabei kann auf teilweise<br />
jahrzehntelang gemachte Vorschläge aufgebaut werden (z. B. Knauer 1989) und erfolgreich<br />
stattfindende Praxisbeispiele können genutzt werden (vgl. Kap. 4.2.3).<br />
4.2.3 Aktuelle Ansätze einer ergebnisorientierten Honorierung<br />
Die Forderung nach ergebnisorientierter Honorierung wurde seit mehr als zehn Jahren für<br />
ökologische Leistungen der Landwirtschaft aufgestellt (vgl. z. B. Streit et al. 1989, Knauer 1992,<br />
SRU 1996, 2002b, Hampicke 1996, Agra-Europe 2002). Die praktische Anwendung von<br />
ergebnisorientierter Honorierung im Kontext der Förderung von Agrarumweltmaßnahmen ist<br />
jedoch verhalten (vgl. Kap. 7.3.2.6). Im Folgenden werden aktuelle Beispiele für die praktische<br />
Anwendung von ergebnisorientierter Honorierung kurz vorgestellt. Bei allen aktuell<br />
angewendeten Ansätzen handelt es um eine Honorierung ökologischer Leistungen für die<br />
Produktion biotischer Güter.<br />
Förderung des<br />
Eigeninteresses<br />
gegenüber der<br />
maßnahmenorientierten Honorierung<br />
ökologischer Leistungen<br />
Höheres<br />
Innovationspotential<br />
Förderung von<br />
Kontinuität<br />
Abbau von<br />
Informationsasymmetrie
Honorierung ökologischer Leistungen als ökonomisches Instrument 43<br />
4.2.3.1 Schweizer Öko-Qualitätsverordnung (ÖQV)<br />
In der Schweiz haben Zahlungen für eine umweltverträgliche Landwirtschaft seit vielen Jahren<br />
eine im europäischen Vergleich besondere Bedeutung. 1996 wurde per Volksentscheid das Ziel<br />
einer multifunktionalen, nachhaltigen Landwirtschaft in die Verfassung aufgenommen. Im<br />
Bereich der ergebnisorientierten Honorierung hat die Schweiz, nicht zuletzt aufgrund der guten<br />
Haushaltslage, verbunden mit der Möglichkeit, Lösungen unabhängig der ‚EU-<br />
Agrarsubventionsmaschinerie’ zu entwickeln, eine Vorreiterrolle. In einigen Kantonen wurden<br />
bereits Mitte der neunziger Jahre ergebnisorientierte Honorierungen entwickelt (vgl. Hartmann et<br />
al. 2003). Dabei stand von Anfang an die Förderung artenreichen Grünlandes im Fokus. Seit dem<br />
01.05.2001 unterstützt der Bund die Kantone im Rahmen Öko-Qualitätsverordnung (ÖQV) 24<br />
durch eine gezielte Förderung der natürlichen Artenvielfalt mit Finanzhilfen von 70-90 % für<br />
zusätzliche Direktzahlungen.<br />
Ergebnisorientiert honoriert werden die Qualität und die Vernetzung der im Rahmen des<br />
Ökologischen Leistungsnachweis (ÖLN) verpflichtenden ökologischen Ausgleichsflächen. In<br />
der Schweiz sind bereits seit mehreren Jahren alle Direktzahlungen (Flächenprämien) an<br />
bestimmte ökologische Leistungen geknüpft, werden demnach cross compliance-Maßnahmen<br />
angewendet (vgl. Kap. 7.1.4.3). Unter anderem müssen mindestens 7 % der landwirtschaftlichen<br />
Nutzflächen als so genannte ökologische Ausgleichsflächen genutzt werden 25 (Bundesamt für<br />
Landwirtschaft 1998, vgl. auch Gujer 2003). Diese Ausgleichsflächen sind verpflichtend für die<br />
Direktzahlungen, werden jedoch auch finanziell honoriert (Honorierung für die Quantität).<br />
Die Evaluierung zur Qualität der Flächen erbrachte jedoch, dass diese überwiegend artenarm und<br />
nicht genügend vernetzt sind und daher nach fast einem Jahrzehnt Ökoausgleich noch keine<br />
allgemeine Zunahme der Artenvielfalt festzustellen ist (Gujer 2003, Spiess et al. 2002, vgl. auch<br />
Bosshard 1999). Nur 7 % der als Ökoflächen angemeldeten Wiesen entsprechen extensiv<br />
bewirtschafteten, artenreichen Wiesen. Im Mittel erfüllen nur 25 % aller Wiesen im<br />
ökologischen Ausgleich die botanischen Minimalanforderungen betreffend ökologischer Qualität<br />
(Dreier et al. 2002).<br />
24 Die Verordnung über die regionale Förderung der Qualität und der Vernetzung von ökologischen<br />
Ausgleichsflächen in der Landwirtschaft, die Öko-Qualitätsverordnung (ÖQV), trat am 1. Mai 2001 in der Schweiz<br />
in Kraft.<br />
25 3,5 % der landwirtschaftlichen Fläche bei Spezialkulturen
44 Kapitel 4<br />
Vor diesem Hintergrund wurde 1998 das Ökoforum mit einer Machbarkeitsstudie beauftragt, die<br />
dann in die Erarbeitung von Qualitäts- und Vernetzungskriterien mündete 26 . Diese Kriterien<br />
bildeten die Grundlage für die Öko-Qualitätsverordnung (ÖQV), die seit 2001 angewendet wird.<br />
Die technischen Ausführungsbestimmungen zum Anhang 1 der ÖQV sind ausführlich in<br />
Oppermann und Gujer (Hrsg.) (2003: 186 ff.) dargestellt.<br />
Folgende Grundideen stehen hinter der Öko-Qualitätsverordnung (Spiess 2003):<br />
• regionale Zielformulierung,<br />
• regionale Mitverantwortung bei der Finanzierung,<br />
• Zielvorgaben an Stelle von Bewirtschaftungsauflagen,<br />
• Freiwilligkeit der Beteiligung und<br />
• Reversibilität der Maßnahmen.<br />
Als Grundsatz soll der Bund Finanzhilfen an die Kantone für Beiträge an die Landwirte<br />
gewähren für (i) Ökoflächen von besonderer biologischer und ökologischer Qualität und/oder (ii)<br />
die ökologisch sinnvolle Vernetzung von Ökoflächen. Anrechenbar an Finanzhilfe sind dabei<br />
maximal je 500 CHF (€ 333)/ha für biologische Qualität und Vernetzung sowie 20 CHF<br />
(€ 13.30) je Hochstamm-Feldobstbaum und Jahr.<br />
Die ergebnisorientierte Honorierung erfolgt aktuell für die biologische Qualität des Grünlandes<br />
(Ökoflächen). In Abbildung A-1 im Anhang sind die Indikatoren (Arten bzw. ‚Sammelarten’)<br />
und das Bewertungsschema für die Alpennordseite dargestellt.<br />
4.2.3.2 Agrar-Umweltprogramm MEKA II in Baden-Württemberg<br />
Im MEKA II-Programm werden die Landwirte für die Erhaltung und Entwicklung von<br />
artenreichen Wiesen und Weiden honoriert. Als Indikatoren wurden Pflanzenarten definiert, die<br />
den nachgefragten knappen Grünlandtyp widerspiegeln. Dazu wurde ein Katalog von 28 Arten<br />
erstellt, von denen mindestens 4 Arten im Rahmen der Erhebung vorkommen müssen. Der<br />
Kennartenkatalog ist speziell für Baden-Württemberg entwickelt worden und deckt alle<br />
Naturräume von der Rheinebene bis in den Hochschwarzwald und vom Odenwald bis zum<br />
Bodensee ab. Die Kennarten sind nach Standorten differenziert aufgeführt (trockene, frische,<br />
26 Methodik zur Festlegung der Standards vgl. UNA 2001, zum Test der Kontrollierbarkeit vgl. LBL 2000, einen<br />
Überblick zur Genese Pearson 2003
Honorierung ökologischer Leistungen als ökonomisches Instrument 45<br />
feuchte und nasse Standorte sowie Silikatmagerweiden 27 ). Die Erhebung ist standardisiert (vgl.<br />
S. 121). Bei den Wiesenarten handelt es sich um leicht erkennbare, dikotyle Arten. Zusätzlich zu<br />
einer Art Basisförderung für die Erhaltung des Grünlandes (je nach Viehbesatz und<br />
Hangneigung 130 bis 290 €/ha) bekommt der Landwirt für das Vorhandensein von mindestens 4<br />
Kennarten eine Prämie von 50 € /ha. Erste Erfahrungen zum MEKA II sind u.a. in Oppermann &<br />
Briemle (2002) und in Oppermann & Gujer (Hrsg. 2003) veröffentlicht. In Kapitel 7.2.2.6 ist der<br />
aktuelle Anwendungsumfang dargestellt.<br />
4.2.3.3 Einzelprojekte in Zusammenarbeit von Wissenschaft und Praxis<br />
Neben diesen zwei Beispielen für flächenrelevante Honorierung ökologischer Leistungen gab es<br />
in den letzten Jahren verstärkte Bemühungen, derartige Ansätze in Zusammenarbeit von<br />
Universitäten und Praxis zu entwickeln. Der Schwerpunkt liegt auch dabei auf der Honorierung<br />
für artenreiches Grünland. So ist die Entwicklung eines regionalisierten und ergebnisorientierten<br />
Honorierungskonzeptes für ökologische Leistungen der Landwirtschaft Ziel eines<br />
interdisziplinären Forschungsprojektes an der Universität Göttingen. Als Projektregion wurde<br />
der Landkreis Northeim in Südniedersachsen gewählt. Ziel ist es, am Beispiel dieser Region –<br />
zusammen mit lokalen Akteurinnen und Akteuren – ein praxistaugliches ergebnisorientiertes<br />
Honorierungssystem für ökologische Güter zu entwickeln, wobei die potentielle Übertragbarkeit<br />
des Konzeptes auch auf andere Regionen ein wichtiger Aspekt der Arbeit ist (Bertke et al. 2003).<br />
Dabei wird auch hier der Ansatz der Schweiz und von Baden-Württemberg aufgegriffen und die<br />
Honorierung an bestimmte Arten bzw. ‚Sammelarten’ geknüpft (Bertke et al. 2002).<br />
Ebenfalls im niedersächsischen Raum fand ein Forschungsprojekt zur Entwicklung und<br />
Erprobung ergebnisorientierter Honorierung für Grünland statt. Dabei wurde im Projektgebiet<br />
‚Fuhrberger Feld’ die Existenz bzw. Präsenz bestimmter Pflanzenarten als zu honorierendes<br />
Ergebnis (ökologische Leistung) herangezogen. Grundlage dafür war ein Katalog von<br />
Pflanzenarten feuchter sowie trockener bis frischer Standorte. Die Honorierung erfolgte<br />
gestaffelt je nach Anzahl der vorgefundenen Arten in Form eines Erfolgshonorars. Daneben<br />
wurde ein Sockelbetrag für besondere Aufwendungen (Erfassung der Kennarten, Fragebogen<br />
etc.) gezahlt (Brahms 2003).<br />
27 Katalog unter http://www.landwirtschaft-mlr.baden-wuerttemberg.de/mlr/Fachinfo/Ref_65/uebersicht.htm
46 Kapitel 4<br />
Die Landesverwaltung von Nordrhein-Westfalen versucht in Zusammenarbeit mit der<br />
Universität Bonn, die Möglichkeit der ergebnisorientierten Honorierung im Rahmen ihres<br />
Agrarumweltprogramms umzusetzen. Seit August 2001 untersuchen das Institut für Agrarpolitik,<br />
Marktforschung und Wirtschaftssoziologie, Abteilung Ressourcen- und Umweltökonomik sowie<br />
das Institut für Landwirtschaftliche Botanik, Abteilung Geobotanik und Naturschutz der<br />
Universität Bonn gemeinsam notwendige Rahmenbedingungen für eine erfolgreiche Aufnahme<br />
ergebnisorientierter Honorierungskomponenten in den nordrhein-westfälischen<br />
Vertragsnaturschutz. Im Mittelpunkt der Untersuchung steht exemplarisch das über<br />
Vertragsnaturschutz geförderte landwirtschaftlich nutzbare Grünland (vgl. zum Stand Henselt et<br />
al. 2003).<br />
Dem für das Grünland erfolgreich erprobten Ansatz folgend, schlagen Braband et al. (2003) auch<br />
im Bereich des Ackerbaus bei entsprechender Zielstellung vor, nicht allein die<br />
Extensivierungsmaßnahmen zu honorieren, sondern auch das Vorkommen bestimmter, aus<br />
Naturschutzsicht, wertvoller Pflanzenarten. Die Autoren erarbeiteten dazu eine Liste möglicher<br />
Pflanzenarten. Im Bereich Acker dürfte allerdings weitaus mehr als im Grünland das Problem<br />
bestehen, dass bei einer tatsächlichen Knüpfung der Honorierung an das Vorkommen bestimmter<br />
Pflanzenarten, diese bewusst durch die Landwirte ausgesät werden, die Indikatoren also nicht<br />
problemkompatibel sind (vgl. Kap. 6.3.4.2).<br />
4.2.3.4 Zusammenfassung und Schlussfolgerungen für diese Arbeit<br />
Die Praxisbeispiele aus den letzten Jahren zeigen, dass eine Anwendung ergebnisorientierter<br />
Honorierung selbst im größeren Rahmen (vgl. ÖQV und MEKA II) und eingebettet in die<br />
Europäische Agrarförderung (MEKA II) prinzipiell möglich ist. Das Vorgehen bisher ist in<br />
großen Teilen identisch. Die ergebnisorientierte Honorierung wird auf eine Grundförderung für<br />
Grünlanderhalt und Pflege (MEKA II über Agrarumweltmaßnahmen, ÖQV über<br />
Direktzahlungen und ökologische Ausgleichszahlung) als top-up für eine bestimmte Qualität des<br />
Grünlandes aufgesattelt (vgl. Abbildung 6). Die übrigen aktuell diskutierten Beispiele (vgl. Kap.<br />
4.2.3.3) greifen ebenfalls diesen Ansatz auf.
Honorierung ökologischer Leistungen als ökonomisches Instrument 47<br />
Förderung von artenreichem Grünland<br />
ÖQV<br />
Vorkommen<br />
bestimmter<br />
‚Grünlandarten’<br />
Cross compliance<br />
Regelungen für<br />
Direktzahlungen<br />
Ergebnisorientierte<br />
Honorierung<br />
Grundförderung<br />
MEKA II<br />
Vorkommen<br />
bestimmter<br />
‚Grünlandarten’<br />
Maßnahmenorientierte<br />
Agrarumweltmaßnahmen<br />
(Grünlandextensivierung)<br />
Abbildung 6: Ergebnisorientierte Honorierung im Rahmen des baden-württembergischen MEKA II und der<br />
Schweizer ÖQV<br />
Die bisherigen praktischen Erfahrungen mit dem ergebnisorientierten Honorierungsansatz sind<br />
positiv und zwar vor allen Dingen bzgl. der Verbesserung des Verständnisses der Landwirte und<br />
der Gesellschaft für die ‚Problematik’ ökologischer Güter (Oppermann & Gujer (Hrsg.) 2003).<br />
Bisher findet eine ergebnisorientierte Honorierung ökologischer Leistungen der Landwirtschaft<br />
lediglich im Bereich des Arten- und Biotopschutzes Anwendung. Dabei wird die Honorierung an<br />
Pflanzenarten geknüpft. Der Anwendungsbereich erstreckt sich dabei auf, aus Naturschutzsicht,<br />
wertvolles Grünland. Darüber hinaus werden Vorschläge gemacht, die Erfahrungen für den<br />
Grünlandbereich auch auf Ackerstandorte anzuwenden. Fischer et al. (2003: 392) gehen soweit,<br />
den Anwendungsbereich der ergebnisorientierten Honorierung lediglich im biotischen Bereich<br />
zu sehen: „Grundsätzlich können ökologische Güter im Bereich sowohl des biotischen als auch<br />
abiotischen Ressourcenschutzes erzeugt werden. Jedoch erfüllt nur die pflanzliche Artenvielfalt<br />
die notwendigen Voraussetzungen für ergebnisorientiert definierte ökologische Güter, da sie<br />
ordnungsrechtlich nicht fixiert ist, sich den einzelnen landwirtschaftlichen Betrieben zuordnen<br />
lässt und ein transparentes Ergebnis ökologischer Leistungen darstellt.“<br />
Dieser Einschränkung bzgl. des Einsatzgebietes der ergebnisorientierten Honorierung muss<br />
jedoch nicht gefolgt werden, wenn man, wie innerhalb dieser Arbeit, ergebnisorientierte<br />
Honorierung nicht darüber definiert, dass die Zahlung an konkrete Umweltzustände geknüpft ist<br />
(vgl. Zustands-Indikatoren Abbildung 18), sondern dass dem Landwirt genügend
48 Kapitel 4<br />
Handlungsalternativen bleiben, das nachgefragte ökologische Gut zu produzieren. Damit<br />
gewinnen quantifizierbare Immissionen oder z. B. auch Bodenabtrag neben den Zustands-<br />
Indikatoren an Bedeutung für die ergebnisorientierte Honorierung. Zieht man zudem modellierte<br />
Indikatoren mit in die Betrachtung ein (Ausweg aus der Unsicherheit, vgl. Kap. 6.3.5.1),<br />
vergrößert sich der mögliche Einsatzbereich für ergebnisorientierte Honorierung und wird auch<br />
für den abiotischen Ressourcenbereich relevant (vgl. Beispiel in Kap. 8.1). Dem Argument, dass<br />
die Eigentumsrechte im Bereich des abiotischen Ressourcenschutzes klar zu Gunsten der<br />
Gesellschaft verteilt sind, kann ebenfalls nicht so eindeutig gefolgt werden, wie in Fischer et al.<br />
(2003) dargestellt.
Eigentumsrechte als Voraussetzung für die Honorierung ökologischer Leistungen 49<br />
5 Eigentumsrechte als Voraussetzung für die Honorierung ökologischer Leistungen<br />
5.1 Definition und Aufgabe von Eigentumsrechten<br />
Ökonomische Eigentumsrechte (property rights) regeln die Beziehungen zwischen den Menschen<br />
bezüglich knapper Ressourcen (Alchian & Demsetz 1973: 17). Die Ökonomie bezieht sich nach<br />
der Theorie der property rights auf die Eigentumsrechte an knappen Gütern und nicht auf die<br />
Güter im eigentlichen Sinne (Lerch 1996: 64). Den Blick auf die spezifischen ökonomischen<br />
Eigentumsrechte zu lenken und damit in ein Grenzgebiet zwischen Ökonomie, Recht und<br />
Philosophie vorzustoßen, hat das Verständnis des ökonomischen Geschehens außerordentlich<br />
erweitert (Coase 1960, Richter & Furubotn 1996, Hampicke 2000b).<br />
‚Eigentumsrechte’ oder ‚Verfügungsrechte’ sind durch ökonomische Institutionen (Regeln)<br />
definiert, die den Rahmen für Märkte bilden. Sie sind die Basis für Produktion, Tausch und<br />
Verteilung. Mit Eigentum an einer Sache ist das „Bündel an Rechten“ gemeint, welches festlegt,<br />
was mit dem Eigentum alles gemacht werden kann; das Ausmaß, inwieweit sich eine bestimmte<br />
Sache überhaupt besitzen, gebrauchen, abändern, übertragen oder vor dem Zugriff Dritter<br />
bewahren lässt (Kobler 2000: 22). „When one has a right in something it means that the benefit<br />
stream arising form that situation is explicitly protected by some authority system. The authority<br />
system gives and takes away rights by its willingness – or unwillingness – to agree to protect<br />
one´s claims in something. To have a property right, therefore, is to have secure control over a<br />
future benefit stream. And it is to know that the authority system will come to your defence<br />
when that control is threatened“ (Bromley 1997b: 3).<br />
Die formalen Kontroll- und Ertragsrechte an einer Sache definieren das ökonomische Eigentum<br />
an eben dieser Sache. Sie bilden den Spielraum, innerhalb dessen der Eigentümer einer Sache<br />
frei über deren Gebrauch entscheiden kann. Verleiht die Gesellschaft etwa dem Landwirt<br />
uneingeschränkte Macht über seinen Boden, so kann er darüber nach Belieben verfügen. Er<br />
besitzt das Dominium (von lat. dominus = Herr bzw. lat. dominare = herrschen). Der Landwirt<br />
kann nicht daran gehindert werden, den Boden so zu nutzen, dass dieser z. B. seine<br />
Bodenfurchtbarkeit verliert (Hampicke 2000a: 43).<br />
Das Eigentum kann jedoch auch dahingehend eingeschränkt sein, dass der Landwirt den Boden<br />
nutzen darf, jedoch der Nachwelt weitergeben muss, also diesen nicht zerstören darf. Der<br />
Landwirt besitzt dann das Patrimonium (Erbgut, Erbvermögen, von lat. pater = Vater), er darf<br />
den Boden nutzen (usus), die Erträge aus der Nutzung des Bodens einbehalten (usus fructus) und<br />
den Boden jemand anderem überlassen oder übertragen, nicht jedoch den Boden zerstören<br />
(abusus) (vgl. Furubotn & Pejovich 1974: 4, Lerch 1996: 16 f., Hampicke 2000a).
50 Kapitel 5<br />
Abbildung 7 stellt die beschriebenen Beziehungen verschiedener Systematisierungen von<br />
Eigentumsrechten dar.<br />
abusus<br />
Kontrollrechte<br />
Überlassung/<br />
Übertragung<br />
usus<br />
Ertragsrechte<br />
usus fructus<br />
Abbildung 7: Systematisierung verschiedener Eigentumsrechte und deren Beziehung zueinander<br />
Eigentumsrechte können eindeutig und von allen akzeptiert, vage, strittig oder gar nicht definiert<br />
sein, sie können formal-juristisch definiert sein (de jure Eigentumsrechte) aber auch auf Sitten,<br />
Konventionen und Gebräuchen beruhen (de facto Eigentumsrechte) (vgl. Hampicke 2000b: 7).<br />
Es kann auch der Fall auftreten, dass de jure Eigentumsrechte nicht durchgesetzt werden, sie also<br />
de facto nicht gelten. Der individuelle Nutzen der Eigentumsrechte hängt nicht von ihrer de jure<br />
Existenz ab, sondern davon, ob sie de facto gelten (Kobler 2000: 55).<br />
Das Eigentum an einer Sache ist die ‚Summe’ der damit in Verbindung stehenden absoluten und<br />
relativen Eigentumsrechte 28 (Kobler 2000: 24). Unter absoluten Eigentumsrechten werden jene<br />
Rechte verstanden, die von jedermann zu beachten sind. Sie werden durch den allgemeinen<br />
institutionellen Rahmen definiert. „Das Schaffen von Institutionen des Eigentums- und<br />
28 Die Bezeichnung ‚absolute’ und ‚relative’ Eigentumsrechte für Eigentums- und Vertragsrechte („property rigthts“<br />
und „contract rights“) stammt von Richter & Furubotn (1996).
Eigentumsrechte als Voraussetzung für die Honorierung ökologischer Leistungen 51<br />
Vertragsrechts ist nichts anderes als das Abschließen eines Vertrages, an den alle Mitglieder<br />
eines Staates gebunden sind“ (ebd.: 51).<br />
Relative Eigentumsrechte entstehen, wenn eine institutionelle Vereinbarung über die Transaktion<br />
von absoluten Eigentumsrechten abgeschlossen wird. Sie gelten nur für die in das<br />
Vertragsverhältnis involvierten Parteien. Relative Eigentumsrechte sind die rechtskräftigen, das<br />
heißt durch den Staat gesicherten, vertraglichen Abmachungen (Richter & Furubotn 1996: 87<br />
ff.). Relative Eigentumsrechte verhindern ex post opportunistisches Verhalten in einer<br />
Vertragsbeziehung und erlauben somit beidseitig vorteilhafte Tauschhandlungen, die sonst nicht<br />
stattfinden würden (Kobler 2000: 85). Die Honorierung ökologischer Leistungen über Verträge<br />
stellt ein Beispiel für eine Vertragsbeziehung auf der Grundlage von relativen Eigentumsrechten<br />
dar.<br />
Die Schaffung und Durchsetzung von Eigentumsrechten erweist sich für ökologische Güter als<br />
der entscheidende Schritt, diese in wirtschaftliche Entscheidungen zu integrieren. Effiziente<br />
Eigentumsrechte sorgen für eine möglichst effiziente Ressourcenallokation (Kobler 2000: 64).<br />
Dies bedeutet jedoch in gleicher Weise, dass sich die Notwendigkeit zur Schaffung oder<br />
Änderung von Eigentumsrechten in dem Moment stellt, wenn der Markt nicht in der Lage ist,<br />
eine effiziente Allokation zu organisieren, es also zum Marktversagen kommt. Die liberale<br />
ökonomische Theorie, die privaten Eigentumsrechten in der Tradition Lockes einen<br />
grundlegenden Stellenwert einräumt, fordert Begründung für Schaffung von Eigentumsrechten<br />
(verstanden als Entzug von de facto Eigentumsrechten und Schaffung von de jure<br />
Eigentumsrechten) und Änderung von Eigentumsrechten (verstanden als Entzug von de jure<br />
Eigentum) (vgl. Kap. 5.5). Marktversagen stellt diese Begründung dar.<br />
Die Bedeutung von Eigentumsrechten als ökonomische Institutionen liegt darin, notwendige<br />
Regeln für wirtschaftliche Entwicklung zu schaffen. Bezogen auf das Leitbild der Nachhaltigen<br />
Entwicklung kann geschlussfolgert werden, dass Nachhaltige Entwicklung die Schaffung und<br />
Durchsetzung von Eigentumsrechten an knappen Gütern bedeutet und dadurch eine effiziente<br />
Allokation und gerechten Distribution dieser Güter unter Berücksichtigung zukünftiger<br />
Generationen gewährleistet wird (vgl. in diesem Sinne Lerch 1999: 402). Gemäß der klassischen<br />
Staatslehre nach Montesquieu ist die Legislative für die Schaffung von Eigentumsrechten<br />
verantwortlich. Aber auch die Judikative schafft Eigentumsrechte: Neben der Interpretation der
52 Kapitel 5<br />
Gesetze durch Gerichte (z. B. in Deutschland) haben in Ländern mit einer Gewohnheitsrechts-<br />
tradition bestimmte Gerichtsurteile Gesetzescharakter (Kobler 2000: 54) 29 .<br />
Abbildung 8 soll die zentrale Stellung der Eigentumsrechte für die Nachhaltige Entwicklung<br />
verdeutlichen. Dabei wird das Grundmodell der Theorie des institutionellen Wandels nach North<br />
1990) aufgegriffen. „Die Menschen bilden Organisationen im Rahmen der von den Institutionen<br />
eröffneten Wahlmöglichkeiten, um diese Möglichkeiten besser zu nutzen. Organisationen<br />
wiederum wirken über direkte oder indirekte Einflussnahme auf die (formalen bzw. informellen)<br />
Institutionen zurück, um ihre Handlungsmöglichkeiten durch Veränderung der Institutionen zu<br />
erweitern. Dieses Modell erklärt Institutionen- und Organisationen-Wandel als wechselseitigen<br />
Prozess, der darüber hinaus pfadabhängig ist. Eine wichtige Rolle spielen dabei Lernvorgänge<br />
der Beteiligten, die in ihrer Richtung durch die Wahlmöglichkeiten, die das institutionelle<br />
Gefüge jeweils eröffnet, beeinflusst werden“ (Bahner 1996: 49).<br />
29 „Es ist Aufgabe des Staates, diese Konzeption der Umweltgüter als ‚freie Güter’ – jedenfalls partiell – zu<br />
beseitigen, indem er den Zugriff auf sie rechtlich ordnet ... . Umweltrecht wird unter diesen Umständen insoweit zu<br />
einem Zuteilungsrecht. ... Die dem Staat hier erwachsende Zuständigkeit zur Verrechtlichung und ‚Zuteilung’ von<br />
Umweltgütern, seine Kompetenzen zur Überbürdung von Finanzierungslasten und ggf. zur Marktermöglichung und<br />
-organisation im Umweltschutzbereich zeigen, dass gewisse Ähnlichkeiten mit der Stellung des Staates im Bereich<br />
der Wirtschaftsintervention vorhanden sind. ... Dennoch sind die wesentlichen Ähnlichkeiten nur begrenzt. Findet<br />
der Staat im Bereich der Wirtschaftsintervention einen Markt bzw. einen Kreislauf ökonomischer Güter vor, so steht<br />
der Staat im Umweltschutzbereich vor dem Problem, ökonomisch relevante ‚Güter’ erst schaffen und sie marktfähig<br />
machen bzw. in Marktmechanismen einordnen zu müssen“ (Kloepfer 1979: 142).
Eigentumsrechte als Voraussetzung für die Honorierung ökologischer Leistungen 53<br />
Politische<br />
Akteure<br />
Abbildung 8: Stellung der Eigentumsrechte als ökonomische Institutionen im Prozess der Nachhaltigen<br />
Entwicklung (Quelle: in Anlehnung an Kobler 2000)<br />
5.2 Ökologische Güter als Ansatzstelle der Eigentumsrechte an individuellen und<br />
ökosystemaren Fähigkeiten<br />
Die Frage der Eigentumsrechte soll im Folgenden genauer für den Bereich der ökologischen<br />
Güter diskutiert werden. Es wird die spezielle Problematik ökologischer Güter erläutert und<br />
darauf aufbauend gezeigt, dass es bei der Verteilung von Eigentumsrechten an ökologischen<br />
Gütern um die Verteilung der Eigentumsrechte an ökosystemaren Fähigkeiten geht, diese Güter<br />
zu produzieren.<br />
Ökonomische<br />
Akteure<br />
Politische<br />
Institutionen<br />
Staat Märkte und<br />
Unternehmen<br />
Nachhaltige<br />
Entwicklung<br />
Property<br />
Rights<br />
Die Produktion von ökologischen Gütern baut auf zwei verschiedene Fähigkeiten auf,<br />
individuellen (menschlichen) und ökosystemaren Fähigkeiten.<br />
Der Einsatz von individuellen Fähigkeiten begründet Privateigentum. Jedes Individuum hat ein<br />
uneingeschränktes Verfügungsrecht über sich selbst, den eigenen Körper, die eigenen<br />
Fähigkeiten, die eigene Arbeitskraft. Dies ist grundlegender Gedanke einer liberalen<br />
Eigentumstheorie und Grundgedanke unserer Verfassung. Diese Prämisse kann als self-
54 Kapitel 5<br />
ownership bezeichnet werden (Cohen 1986). Es liegt im Ausgangszustand also ein Patrimonium<br />
über die eigenen individuellen Fähigkeiten vor. Patrimonium und nicht Dominium liegt vor, da<br />
es Regeln gibt, die den Menschen entgegen seinem Willen ‚vor sich selbst’ schützen können<br />
(vgl. z. B. Eidenmüller 1995).<br />
Weikard (1995) verdeutlicht Grenzen dieses Eigentums am Beispiel der guten Schwimmerin<br />
Franziska, die bei einem Spaziergang zufällig auf einen Ertrinkenden trifft. Wird von ihr<br />
verlangt, Hilfe zu leisten, so wird über ihre Arbeitskraft, ihre Fähigkeit als gute Schwimmerin,<br />
verfügt. Aus ihrer Sicht ist die Rettungsaktion Zwangsarbeit (in Lerch 1999: 407). Die<br />
Gesellschaft muss (und kann dies nach unserem Recht auch) self-ownership zugunsten eines<br />
Prinzips gegenseitiger Unterstützung einschränken können. Damit ist jedoch nicht die self-<br />
ownership-These abzulehnen 30 . Der Zugang zur individuellen Fähigkeit ist selbstbestimmt<br />
geregelt, dadurch wird eine Schädigung dieser Fähigkeit (etwa durch Sklaverei oder<br />
Zwangsarbeit) ausgeschlossen. „Unter Ansehung der self-ownership-These ist die Gesellschaft<br />
nicht berechtigt, das Individuum zur Nutzung einer bestimmten Fähigkeit zu zwingen“ (Lerch<br />
1999: 412).<br />
Es handelt sich dabei nicht um ein unantastbares Recht. Die Gesellschaft steht jedoch in der<br />
Begründungspflicht bei der Änderung dieses Eigentumsrechtes. Die Gesellschaft muss Regeln<br />
aufstellen, wenn sie den Zugang zu den individuellen Fähigkeiten anders als über die dezentrale<br />
Steuerung ‚Markt’ organisieren will. Die Sozialpflichtigkeit, wie im Beispiel die Pflicht zur<br />
Hilfeleistung, kann sinnvoll, sollte jedoch Ausnahme sein.<br />
Der Einsatz individueller Fähigkeiten zur Produktion kulturbestimmter ökologischer Güter führt<br />
ohne spezielle Regel zu Privateigentum an diesem Gut, das der Leistungserbringerin bei<br />
entsprechender Nachfrage abgekauft werden muss. Der Markt ist die Organisationsform, die den<br />
Zugang zu individuellen Fähigkeiten dezentral über Anreize regelt.<br />
Das Problem, aus dem die Verknappung von kulturbestimmten ökologischen Gütern herrührt, ist<br />
nicht das von fehlenden Eigentumsrechten bzgl. individueller Fähigkeiten bzw. an den<br />
ökologischen Gütern, sondern das der fehlenden Durchsetzung. Der Landwirt kann seine<br />
30 „Ohne dieses Axiom fällt es nämlich schwer, bestimmte Grundrechte zu begründen und die fremde Verfügung<br />
über ein Individuum überzeugend zurückzuweisen. Die Self-ownership-These ist ja vor allem auch deshalb intuitiv<br />
so einleuchtend, weil sie ein überzeugendes Argument nicht nur gegen Sklaverei und Zwangsarbeit, sondern auch<br />
gegen andere Formen des Missbrauchs von Menschen liefert“ (Lerch 1999: 412).
Eigentumsrechte als Voraussetzung für die Honorierung ökologischer Leistungen 55<br />
Ertragsrechte (usus fructus), die mit dem Einsatz seiner Fähigkeit in Verbindung stehen,<br />
aufgrund des ungeregelten Zugangs zu den ökologischen Gütern nicht durchsetzen.<br />
Es geht bei knappen kulturbestimmten ökologischen Gütern also primär um die Durchsetzung<br />
der Ertragsrechte. Diese Ertragsrechte beeinflussen die rationale Entscheidung des Eigentümers<br />
bzgl. des zielgerichteten Einsatzes seiner Fähigkeit. Die individuellen Fähigkeiten werden durch<br />
ökonomische Anreize idealer Weise entsprechend der Nachfrage eingesetzt.<br />
Eine vollkommen andere Situation zeigt sich bei ökosystemaren Fähigkeiten. Die ökosystemaren<br />
Fähigkeiten ökologische Güter zu produzieren, können im Ausgangszustand von allen Menschen<br />
genutzt werden. Im Ausgangszustand liegt hier also ein open access vor, der Zugang zu den<br />
ökosystemaren Fähigkeiten ist nicht geregelt. Von daher kann es hier im Gegensatz zu<br />
individuellen Fähigkeiten ohne spezielle Regelungen prinzipiell zur Schädigung bzw. zur<br />
Zerstörung der ökosystemaren Fähigkeiten kommen.<br />
Eigentumsrechte an ökologischen Gütern müssen daher zwei wesentliche Aspekte beachten.<br />
Eigentumsrechte müssen den Zugang zu den ökologischen Gütern und den Zugang zu den<br />
ökosystemaren Fähigkeiten regeln. Es muss wie beim Einsatz individueller Fähigkeiten gelingen,<br />
über die Eigentumsrechte an ökologischen Gütern eine Sicherung der ökologischen Fähigkeiten<br />
zu gewährleisten. Die selbst erhaltende Vernunft des Individuums, im Hinblick auf den Einsatz<br />
der individuellen Fähigkeit, muss bei ökosystemaren Fähigkeiten durch die Gesellschaft<br />
‚vernünftig’ geregelt werden.<br />
Ökosystemare Fähigkeiten sind zu erhalten, da es eine Illusion sein dürfte, dass derartig<br />
komplexe Prozesse 31 substituierbar sind (vgl. z. B. Goodland & Daly 1995) 32 . Komplexität führt<br />
in großem Maße zur Ungewissheit bei Aussagen zur Substituierbarkeit. Wenn für den Erhalt von<br />
ökosystemaren Fähigkeiten plädiert wird, so hat dies nichts mit „der Logik des Marienkultes“ 33<br />
31 Komplexität liegt bei der Existenz vieler voneinander abhängiger Merkmale in einem Ausschnitt der Realität vor.<br />
(vgl. Dörner (1997); weiterführend vgl. Kap. 6.3.5.1).<br />
32 „Ein gewichtiges Argument gegen die Substituierbarkeit von Naturkapital bezieht sich auf die Multifunktionalität<br />
vieler ökologischer Systeme. Es müsste ja für jede einzelne ökologische Funktion ein artifizielles Substitut<br />
angegeben werden. Man verdeutliche sich dieses Problem am Beispiel eines Waldes oder eines aquatischen<br />
Ökosystems. Daher wird man den konkreten Nachweis der Substituierbarkeit aller Funktionen im Einzelfall fordern<br />
dürfen. Die Substitute müssen nachweislich vorhanden und nicht nur denkmöglich sein bzw. in den Fluchtlinien<br />
technologischer Hoffnungen liegen. Sie sollten auch nicht mit neuen Risiken behaftet sein, die das zu<br />
Substituierende nicht aufweist. Darüber hinaus müssen sie funktional wirklich gleichwertig sein“ (Ott 2002: 12).<br />
33 Radkau (1994: 12) merkte kritisch zum Wert der unberührten Natur an: „Aber wozu auch dieser Kult der<br />
Unberührtheit? Diese Prämisse, dass die unberührte Natur die wahre Natur sei, fußt eher auf der Logik des<br />
Marienkults als auf der der Wissenschaft.“
56 Kapitel 5<br />
zu tun. Vielmehr geht es hierbei um moralisch rationalen Umgang mit Ungewissheit (vgl. dazu<br />
Kap. 6.3.5.1 und 6.3.5.2).<br />
Dabei kann das false-negative/false-positive-Kriterium zum Einsatz kommen (Cranor 1995 34 ).<br />
Mit Hilfe dieses Kriteriums kann sich vor Augen geführt werden, welcher von zwei möglichen<br />
Irrtümern moralisch akzeptabler ist. Es sollte die Option gewählt werden, durch die sich das<br />
moralisch akzeptabelste Ergebnis einstellt, wenn man sich in der empirischen Dimension irrt.<br />
Gorke & Ott (2003) kommen bzgl. vieler Naturgüter zu dem Ergebnis, dass die moralischen<br />
Schäden eines false-positive-Ergebnisses höher sind als die, eines false-negative-Ergebnisses.<br />
Bei letzterem wird durch Naturschutz auch Naturkapital geschützt, das nicht zum ‚kritischen’,<br />
d. h. zum absolut unverzichtbaren Naturkapital gezählt wird, während ein irreversibles false-<br />
positive-Ergebnis den zukünftigen gesellschaftlichen „Stoffwechsel“ 35 mit der Natur stark<br />
beeinträchtigen könnte. Vereinfacht kann geschlussfolgert werden: Es sollte im Zweifelsfall<br />
lieber zu viel als zu wenig Naturkapital geschützt werden (Ott 2002). Gorke & Ott (2003) weisen<br />
aber auch darauf hin, dass nicht dogmatisch bei allen Gütern von dem gleichen Risiko<br />
ausgegangen werden kann. Vielmehr wird für einen gemäßigten Tutorismus 36 plädiert (ebd.).<br />
Die Anwendung dieses Kriteriums beruht auf einer moralischen Intuition. Es handelt sich um ein<br />
Kriterium der sittlichen Vernunft oder auch moralischer Rationalität (vgl. Gorke & Ott 2003).<br />
Es besteht breiter Konsens darin (im Sinne moralischer Rationalität), dass Ungewissheiten in<br />
Verbindung mit Begründungslastregeln in praxi auf die Kernforderung starker Nachhaltigkeit<br />
hinauslaufen müssten (Ott 2002). Betrachtet man allerdings die Diskrepanz zwischen<br />
politischem Anspruch und praktischer Verwirklichung der Nachhaltigen Entwicklung, dann wird<br />
deutlich, dass kollektives Handeln unter Unsicherheit mit besonderen Problemen verbunden ist<br />
(vgl. in diesem Sinne zur vorsorgenden Umweltpolitik Schuldt 1997). „Aber wenn wir<br />
Menschen bleiben wollen, dann gibt es nur einen Weg, den Weg in die offene Gesellschaft 37 .<br />
Wir müssen ins Unbekannte, ins Ungewisse, ins Unsichere weiterschreiten und die Vernunft, die<br />
34 vgl. das ‚false-negative/false-positive’-Kriterium in Cranor (1995)<br />
35 Karl Marx nannte die menschliche Arbeit einen „Prozess, worin der Mensch seinen Stoffwechsel mit der Natur<br />
durch seine eigene Tat vermittelt, regelt und kontrolliert“ (Marx 1970: 192)<br />
36 Der Begriff ‚Tutorismus’ stammt aus der katholischen Sündenlehre und besagt, dass man im Zweifelsfall ‚auf der<br />
sicheren Seite’ bleiben sollte. Der Tutorismus fordert u.a. einen (bedingten) Vorrang der schlechten Prognosen vor<br />
den guten (Gorke & Ott 2003).<br />
37 „Die Gesellschaftsordnung aber, in der sich Individuen persönlichen Entscheidungen gegenübersehen, nennen wir<br />
die Offene Gesellschaft” (Popper 1970: 333).
Eigentumsrechte als Voraussetzung für die Honorierung ökologischer Leistungen 57<br />
uns gegeben ist, verwenden, um, so gut wir es eben können, für beides zu planen: nicht nur für<br />
Sicherheit, sondern zugleich auch für Freiheit“ (Popper 1970: 268).<br />
In dieser Arbeit wird vom Ansatz her dem Konzept der starken Nachhaltigkeit gefolgt 38 . Das<br />
Konzept der starken unterscheidet sich von dem der schwachen Nachhaltigkeit im Wesentlichen<br />
dadurch, dass das Naturkapital und vor allen Dingen die natürlichen Prozesse prinzipiell nicht als<br />
durch menschliches Handeln substituierbar angesehen werden 39 . Im Konzept der starken<br />
Nachhaltigkeit soll Naturkapital über die Zeit hinweg konstant gehalten werden (constant<br />
natural capital rule). Im Gegensatz dazu kann im Konzept schwacher Nachhaltigkeit Natur-<br />
durch Sachkapital prinzipiell unbegrenzt substituiert werden. In diesem Konzept kommt es nur<br />
darauf an, dass der Durchschnittsnutzen dauerhaft erhalten wird (non declining utility rule). „Es<br />
wäre dann in der Konsequenz auch eine weitgehend artifizielle Welt mit Grundsätzen<br />
intergenerationeller Gerechtigkeit vereinbar, d. h. es wäre nicht prinzipiell unfair, eine Welt ohne<br />
Natur zu hinterlassen“ (Ott 2002).<br />
Substitution von Umweltstrukturen und selbst von Umweltprozessen kann jeoch nicht<br />
vollkommen ignoriert werden. Substitution ist Realität und ermöglicht Freiheit menschlichen<br />
Handelns im Popper’schen Sinne (s. o.). „Auch Umweltgüter und natürliche Ressourcen müssen<br />
sich einem Kosten-Nutzen-Vergleich unterziehen. Ökologie und Ökonomie sind in ein<br />
Knappheitsproblem eingebunden, das zum Wohle der Menschen gelöst werden muss. ...<br />
Nutzenabwägung und die damit implizierten Bewertungen der verschiedenen Güterkategorien<br />
sind in gewissem Maße unumgänglich“ (Cansier 1997: 50). Die Risikoaversion im Sinne des<br />
oben beschriebenen false-negative/false-positive-Kriteriums wird derart verstanden, dass der<br />
Wert der Sicherheit bejaht wird und im Grundsatz eine Risikominimierung gilt, nicht jedoch eine<br />
völlige Risikovermeidung gelten kann (vgl. Gorke & Ott 2003). Die „Strategie des minimalen<br />
Eingreifens“ (vgl. dazu auch Roweck 1995) spiegelt diesen Gedanken wider.<br />
Das neue Bundesnaturschutzgesetz greift ebenfalls den Gedanken der Erhaltung der<br />
ökosystemaren Fähigkeiten in diesem Sinne auf. Sowohl bei den Zielen (§ 1 BNatSchG) als auch<br />
38 Beide Konzepte bauen auf dem Ansatz (Definition) der Nachhaltigkeit der WCED-Komission auf: „Sustainable<br />
Development is development that meets the needs of the present without compromising the ability of future<br />
generations to meet their own needs” (WCED 1987). Zum Konzept der starken und schwachen Nachhaltigkeit u. a.<br />
Dobson 2000, Atkinson et al. 1997, Neumayer 1999, Ott 2001b.<br />
39 Das Verhältnis von künstlichem und natürlichem Kapital wird als Komplementaritätsbeziehung gedeutet (vgl.<br />
Daly 1999). Eine solche Beziehung liegt immer dann vor, wenn man zur Schaffung von Gütern oder Nutzen auf<br />
zwei Relate A und B angewiesen ist und der Gesamtnutzen nicht durch eine einseitige Steigerung von A auf Kosten<br />
von B oder umgekehrt erhöht werden kann (vgl. Ott 2002: 11).
58 Kapitel 5<br />
bei den Grundsätzen (§ 2 BNatSchG) wird wiederholt auf die Erhaltung der Leistungs- und<br />
Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes 40 hingewiesen. Dabei wird dem Ansatz der<br />
Risikovermeidung gefolgt. In § 4 BNatSchG heißt es für die Beachtung der Ziele und<br />
Grundsätze des Naturschutzes: Jeder soll nach seinen Möglichkeiten zur Verwirklichung der<br />
Ziele und Grundsätze des Naturschutzes und der Landschaftspflege beitragen und sich so<br />
verhalten, dass Natur und Landschaft nicht mehr als nach den Umständen unvermeidbar<br />
beeinträchtigt werden. Dass Minimierungsstrategien noch keine Handlungskonzepte darstellen,<br />
wird Kapitel 6.2 zeigen.<br />
Wird dem Konzept der starken Nachhaltigkeit gefolgt, bedeutet dies als Prämisse, dass<br />
Eigentumsrechte an ökosystemaren Fähigkeiten im Sinne des Patrimoniums verteilt werden<br />
(dabei jedoch nicht de facto Substitutionsmöglichkeiten ausgeblendet werden). Die<br />
Eigentumsrechte an den ökosystemaren Fähigkeiten begründen Privat- oder Gemeineigentum an<br />
ökologischen Gütern. Eigentumsrechte an ökosystemaren Fähigkeiten können mit Hilfe von<br />
ökologischen Gütern durchgesetzt werden.<br />
Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass es bei knappen öffentlichen ökologischen<br />
Gütern zur Schaffung und Durchsetzung von Verfügungsrechten in Form des Patrimoniums an<br />
ökosystemaren Fähigkeiten und zur Durchsetzung von Ertragsrechten an individuellen<br />
Fähigkeiten kommen muss. Ökologische Güter sind die ‚Ansatzstelle’ für die Eigentumsrechte –<br />
geschaffen und durchgesetzt werden damit die Eigentumsrechte an den Fähigkeiten zur<br />
Produktion der ökologischen Güter (Abbildung 9). Wenn im Folgenden von Eigentumsrechten<br />
an ökologischen Gütern gesprochen wird, ist dies stets zu berücksichtigen.<br />
individuelle/<br />
ökosystemare<br />
Fähigkeiten<br />
ökologische<br />
Güter<br />
Eigentumsrechte<br />
Abbildung 9: Ökologische Güter als Ansatzstelle für die Eigentumsrechte an individuellen und<br />
ökosystemaren Fähigkeiten<br />
40 Naturhaushalt im Sinne des BNatSchG § 10 Abs. 1 S. 1: seine Bestandteile Boden, Wasser, Luft, Klima, Tiere<br />
und Pflanzen sowie das Wirkungsgefüge zwischen ihnen.
Eigentumsrechte als Voraussetzung für die Honorierung ökologischer Leistungen 59<br />
Deutlich wird im Zusammenhang mit der Schaffung und Verteilung der Eigentumsrechte die<br />
herausragende Stellung von ökologischen Gütern. Denn tatsächlich wird bei diesem Ansatz<br />
immer nur der Zugang zu den ökosystemaren Fähigkeiten geregelt, die nachgefragte ökologische<br />
Güter erbringen, deren Nutzen also aus heutiger Sicht erkannt ist, ihnen also mindestens ein<br />
Optionswert zuerkannt wird (vgl. Kap. 6.2.2). Die Problematik der Nachhaltigkeit ist auf der<br />
Ebene der Bewertung ökologischer Güter angekommen. Auf dieser Ebene sind die drei Säulen<br />
der Nachhaltigkeit zu vereinen. Eine Präzisierung der Zielsetzung der Nachhaltigkeit verlangt<br />
eine Bewertung der Güter und Leistungen der Natur (Jörissen et al. 1999).<br />
5.3 Notwendigkeit der Schaffung und Durchsetzung von Eigentumsrechten bei<br />
Verknappung von ökologischen Gütern unter open access<br />
In ökonomischer Sicht machen Eigentumsrechte überhaupt erst Sinn, wenn Menschen um<br />
knappe Güter konkurrieren (Lerch 1996: 16). Vor diesem Hintergrund soll die Notwendigkeit<br />
der Schaffung und Durchsetzung von Eigentumsrechten für ökologische Güter erläutert werden.<br />
Wie in Kapitel 4.1 dargestellt, ist der Zugang zur Nutzung der ökologischen Güter nicht<br />
eingeschränkt, es tritt die Situation des open access auf (vgl. Musgrave 1976, Bromley 1991,<br />
Ostrom 1998). Open access bedeutet, dass keine Eigentumsrechte bestehen, niemandem kann der<br />
Zugang verwehrt werden. „There are no property rights in open access, there is only the rule of<br />
first capture. Unlike property regimes where individuals and groups have both rights and duties,<br />
open-access regimes are fundamentally situation of no law” (Bromley 1997b: 11).<br />
Dieser Zustand stellt solange kein Problem dar, wie die Nutzung der Güter nicht zum Verbrauch<br />
der Güter führt oder der Verbrauch ohne ökonomische Anreize wieder kompensiert wird und<br />
dadurch das zweite Kriterium ökologischer Güter erfüllt ist (keine Rivalität im Konsum, vgl.<br />
Kap. 4.1). ‚Öffentliche’ ökologische Güter sind oft gerade durch eine Reproduktion bestimmt,<br />
indem diese verbrauchten Güter durch den kostenlosen Einsatz von ökosystemaren Fähigkeiten<br />
oder durch den Einsatz individueller, menschlicher Fähigkeiten wieder ersetzt werden. In<br />
gewissem Sinne erfüllen viele ökologische Güter damit die Kriterien öffentlicher Güter nach<br />
Samuel (1954). Typisch für ökologische Güter ist jedoch nicht, dass keine Rivalität in der<br />
Nutzung auftritt (es gibt selbstverständlich Nutzungen bei denen keine Rivalität auftritt, wie z. B.<br />
das Betrachten einer bunten Wiese), sondern dass der Einsatz ökosystemarer und individueller<br />
Fähigkeiten den Verbrauch bis zu einem gewissen Maße kompensiert (vgl. Kap. 4.1).
60 Kapitel 5<br />
Der open access-Zustand bei ökologischen Gütern bedeutet die uneingeschränkte bzw.<br />
ungeregelte Nutzung ökosystemarer und individueller Fähigkeiten. So lange die Fähigkeiten<br />
ausreichen, liegen positive Wohlfahrtseffekte vor. In dieser Situation gibt es ein Naturrecht im<br />
Sinne von Locke auf die Aneignung von Ressourcen, da auch die naturrechtlichen<br />
Beschränkungen (in der Literatur als „Locke’sche Bedingungen“) gegeben sind, wonach:<br />
• bei jeder Aneignung genügend für andere übrig bleiben muss und<br />
• jeder sich nur soviel aneignen dürfe, wie er selbst verbrauchen kann.<br />
„Niemand dürfe sich mehr aneignen und dadurch anderen etwas vorenthalten“ (Lerch 1999:<br />
405).<br />
Wenn es jedoch zu einer Steigerung der Nachfrage kommt und die Fähigkeit nicht mehr<br />
ausreicht, das notwendige Angebot bereitzustellen (vgl. Kap. 4.1), werden die Güter knapp und<br />
die ‚Locke’schen Bedingungen’ gelten nicht mehr 41 (vgl. Kap. 5.6.2.1)! Gelten die ‚Locke’schen<br />
Bedingungen’ nicht, treten bei open access die in der ökonomischen Literatur vielfach<br />
diskutierten Probleme der Übernutzung und bei Nichtrivalität das Problem des suboptimalen<br />
(geringen) Angebots und damit das in der ökonomischen Literatur viel behandelte Problem des<br />
N-Personen-Gefangenen-Dilemmas auf. Strategisches Verhalten führt bei Rivalität im Konsum<br />
zur tragedy of commons (grundlegend vgl. Hardin 1968, 1982).<br />
Ein N-Personen-Gefangenen-Dilemma kann am Beispiel von Landwirten in einem<br />
Trinkwassereinzugsgebiet (Annahme: Es gibt keine Regeln.) bzgl. der Gülledüngung erläutert<br />
werden. Eine theoretische Entscheidungssituation der Landwirte gestaltet sich derart (‚überhöht’,<br />
zur Illustration des Problems), dass sie die Wahl zwischen der Strategie ‚uneingeschränkter<br />
Einsatz von Gülle und Verschmutzung des Grundwassers’ und der Strategie ‚kein Gülleeinsatz<br />
und einen Beitrag zum Grundwasserschutz leisten’ haben. Der einzelne Landwirt stellt nun<br />
folgende Überlegung an: Wenn nur ich auf die Gülle verzichte, so ist mein Beitrag zum<br />
Grundwasserschutz relativ gering, da alle anderen weiterhin mit Gülle düngen. Meine<br />
‚Einschränkungen’, die ich in Kauf nehmen muss, sind aber gravierend. Würden andererseits alle<br />
anderen auf die Nutzung der Gülle verzichten, so wäre dies für mich optimal. Ich kann weiterhin<br />
41 „Unterstellen wir egoistische Individuen in einer Welt der Knappheit an materiellen und immateriellen<br />
Ressourcen, so ist eine regellose individuelle Gesellschaft, in der jedes Individuum seinen Neigungen nachgeht,<br />
ohne anderen zu schaden, logisch unmöglich. Jeder Nutzen, den ich mir durch Konsumtion eines knappen Gutes<br />
erlaube, muss Nutzen bei anderen verhindern, muss andere schädigen, denn ich nehme anderen etwas weg“<br />
(Hampicke 1992: 39).
Eigentumsrechte als Voraussetzung für die Honorierung ökologischer Leistungen 61<br />
Gülle düngen und kann außerdem nitratarmes Grundwasser nutzen. Für die Landwirte ist<br />
demnach die beste Strategie, sich nicht an der Grundwasser schonenden Maßnahme zu beteiligen<br />
und die ‚Freifahrerposition’ einzunehmen. Durch das unkooperative Verhalten kommt es jedoch<br />
zu einer Nitratanreicherung im Grundwasser, zu einer für alle schlechteren Umweltsituation.<br />
„Die Möglichkeit oder gar Zwangsläufigkeit einer Selbstschädigung der Subjekte bei eng-<br />
rationalem Verhalten musste eine kritische Diskussion des bis dahin unverfänglich scheinenden<br />
Begriffs der ‚Rationalität’ zur Folge haben. Was ist das für eine Rationalität, die einem schadet,<br />
wenn man nach ihr handelt, die einem aber auch schadet, wenn man nicht nach ihr handelt,<br />
sofern es denn die anderen tun?“ (Hampicke 1992: 35). Eine analytische Formalisierung im<br />
Rahmen der Spieltheorie erfuhr die tragedy of the commons durch Dawes (1973, 1975), der diese<br />
als N-Personen-Gefangenen-Dilemma charakterisierte (vgl. Lerch 1996).<br />
In dieser Situation bedarf es der Zuweisung von Eigentumsrechten (Kobler 2000, Lerch 1999).<br />
Der Zusammenhang zwischen der Verknappung ökologischer Güter und der Entstehung von<br />
Eigentumsrechten wurde bereits von Demsetz (1967) in dem so genannten Demsetz-Wagner-<br />
Prinzip dargelegt. „Nach dieser Theorie entwickeln sich exklusive Eigentumsrechte an<br />
Ressourcen als Reaktion auf Veränderungen beim Nutzen sowie bei den Durchsetzungskosten<br />
solcher Rechte; d. h. neue Eigentumsrechte entwickeln sich, wenn – z. B. durch technologischen<br />
Fortschritt – der Nutzen aus solchen Rechten steigt und/oder die Kosten zu ihrer Durchsetzung<br />
sinken“ (Lerch 1996: 66).<br />
So ergab die Auswertung anthropologischer Untersuchungen durch Demsetz, dass die Jagd auf<br />
Biber durch die Montagnais-Indianer in Labrador und Quebec erst ein Problem wurde, nachdem<br />
die Nachfrage und damit der Wert der Biberfelle mit dem Auftreten von französischen<br />
Pelzhändlern Ende des 17. und Anfang des 18. Jahrhunderts rapide anstieg (vgl. Lerch 1996: 67).<br />
Die Nachfrage war größer als das Angebot, das durch die ökologischen Fähigkeiten des Systems<br />
bereitgestellt werden konnte. Es wurden damit nicht nur die Biberfelle (also die individuelle<br />
Fähigkeit des Jägers den Biber zu erlegen), sondern bereits die lebenden Biber, also die<br />
Fähigkeit der ökologischen Systeme, die Biber zu ‚produzieren’ wurde knapp und nachgefragt.<br />
Durch diesen Zustand sahen sich die Indianer genötigt, Eigentumsrechte an den zuvor allen frei<br />
zugänglich lebenden Bibern zu definieren. Ziel der Verteilung der Eigentumsrechte war es, den<br />
open access zu den lebenden Bibern durch einen geregelten Zugang (im Folgenden in<br />
Anlehnung an den weit verbreiteten Begriff des open access als well-regulated access<br />
bezeichnet) zu ersetzen, einen Zustand effizienter Allokation.
62 Kapitel 5<br />
Dazu stehen prinzipiell zwei Alternativen zur Verfügung.<br />
1. Am Beispiel der Montagnais-Indianer besteht die erste Alternative darin, die Jagdreviere zu<br />
privatisieren und den Zugang und damit die Rivalitäten über den Markt regeln zu lassen. Die<br />
ökonomischen Regeln des Marktes bestimmen den Zugang zur Ressource und sollten das<br />
Angebot so lange sicherstellen, wie es eine Nachfrage gibt. Unter Voraussetzung rationalen<br />
Handelns dürfte dies idealer Weise gelingen und die Empirie beweist in unendlichen Beispielen<br />
das gute Funktionieren privater Verfügungsrechte.<br />
Es gibt jedoch hinreichend Beispiele, dass, selbst wenn eine Privatisierung möglich ist, diese<br />
nicht selbstverständlich auch den oben beschriebenen Anforderungen der Allokation gerecht<br />
wird, sondern es aufgrund der besonderen Eigenschaften ökologischer Systeme und einem nicht<br />
‚rational-gerechten’ Restzins trotzdem zu einer Übernutzung und dauerhaften Schädigung der<br />
ökologischen Güter kommen kann 42 . Die Grenzen des Marktes sind eine der wesentlichen<br />
Ursachen für die Entstehung der Ökologischen Ökonomik. Myopie (Kurzsichtigkeit) als ein<br />
doch eher irrationales Handeln spielt bei der Entstehung des Zinses und der dadurch forcierten<br />
Übernutzung natürlicher Ressourcen eine gewichtige Rolle. Neben irrationalem Verhalten sind<br />
bounded rationality und hohe Transaktionskosten als Grenzen des Marktes im Zusammenhang<br />
mit ökonomischen Instrumenten zu nennen (vgl. Kap. 5.4.1).<br />
2. Die zweite Alternative besteht darin, den Zugang zu den gemeinschaftlichen Jagdrevieren<br />
durch gemeinschaftliche Regeln zu steuern. Gelingt dies, haben wir auch hier einen well-<br />
regulated access. Dem Markt und dem Preis steht als alternatives gesellschaftliches<br />
Koordinierungsinstrument die Norm gegenüber (Weise 1994).<br />
Dieser Zustand wird als Gemeineigentum (common property) bezeichnet und unterscheidet sich<br />
kategorisch von Eigentumslosigkeit mit open access (vgl. Bromley 1997b, Lerch 1996).<br />
Abbildung 10 stellt die grundsätzlichen Unterschiede zwischen der Eigentumslosigkeit auf der<br />
42 „Je höher der Zins, um so schneller werden in der Forstwirtschaft die Bäume gefällt, um so geringer ist die<br />
Restpopulation genutzter Arten, wie z. B. Meerestiere, und um so schneller werden nicht erneuerbare Ressourcen,<br />
wie z. B. Erdöl, verbraucht. ... Sobald der Zins die Höhe der biologischen Wachstumsrate s erreicht, wird die<br />
optimale Restpopulation N*= 0, d.h. die Population wird selbst von einem Eigentümer, der prinzipiell an die<br />
Zukunft denkt (nicht der Allmende-Fall!) ausgerottet. Die Wale oder worum es sich handeln mag, sind der<br />
Konkurrenz durch die neue, schnellwachsende Spezies ‚Kapital’ nicht mehr gewachsen und werden darwinistisch<br />
verdrängt. Das ‚Kapital’ wächst schneller auf der Bank als in Gestalt der Wale, letztere haben ökonomisch<br />
ausgedient“ (Hampicke 1992: 403) (vgl. auch grundsätzlich Hotelling (1931) zur Preisbildung auf Märkten mit<br />
erschöpfbaren Ressourcen (so genannte Hotelling-Regel), demnach der Schattenpreis einer erschöpfbaren<br />
natürlichen Ressource im Zeitablauf mit dem Zins ansteigt). Zur Bedeutung des Zinses und der Diskontierung vgl.<br />
auch aus der neueren Literatur Hampicke & Ott (eds.) (2003).
Eigentumsrechte als Voraussetzung für die Honorierung ökologischer Leistungen 63<br />
einen Seite und dem Privateigentum und Gemeineigentum auf der anderen Seite anhand der<br />
Kriterien (i) Zugangsbeschränkung und (ii) Nutzungsbeschränkung dar. Privateigentum,<br />
Gemeineigentum und Eigentumslosigkeit stellen idealtypische Regelungen dar. Reale<br />
Verfügungsrechtsstrukturen besitzen meist Eigenschaften mehrerer Idealtypen.<br />
Zugangsbeschränkung <br />
Nutzungsbeschränkung<br />
Abbildung 10: Vergleich der Zugangsbeschränkung und der Nutzungsbeschränkung bei den<br />
unterschiedlichen Eigentumsinstitutionen (Quelle: in Anlehnung an Lerch 1996)<br />
Abbildung 11 verdeutlicht das Problem der Verknappung ökologische Güter und macht deutlich,<br />
dass die open-accesss-Situation erst zum Problem wird, wenn Rivalität in der Nutzung auftritt.<br />
Das Problem kann gelöst werden, indem der open access durch die Verteilung der property<br />
rights in einen well-regulated access überführt wird. Das Ergebnis einer solchen Verteilung<br />
muss das Stoppen der weiteren Verknappung der ökologischen Güter sein, besser noch zur<br />
„Entknappung“ (vgl. Hampicke 1997), mit anderen Worten zu einer effizienten Allokation<br />
führen.<br />
Well-regulated access<br />
eine Person<br />
rationale<br />
Entscheidung<br />
Mitglieder<br />
Regeln<br />
Mitglieder<br />
keine<br />
Open access<br />
keine<br />
keine
64 Kapitel 5<br />
Gemeingüter<br />
‚open access’<br />
Ökologische<br />
Güter<br />
Knappe<br />
ökologische Güter<br />
Umweltprobleme<br />
Individualgüter<br />
‚well-regulated access’<br />
Abbildung 11: Zusammenhang zwischen ökologischen Gütern und Umweltproblemen in Abhängigkeit vom<br />
Zugang zu den Gütern und auftretender Rivalität<br />
Ein well-regulated access kann in Anlehnung an den Markt so definiert werden, dass sich ein<br />
Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage an ökologischen Gütern organisiert. Am<br />
Beispiel der Indianer kann dies sowohl durch Jagdregeln für eine bestimmte Anzahl von Nutzern<br />
geschehen (Verfügungsrechte werden eingegrenzt und es entsteht Gemeineigentum) als auch<br />
durch die Privatisierung der Jagdreviere. Es hängt jeweils von den ganz speziellen Bedingungen<br />
ab, welche Vorgehensweise sinnvoll ist. Jede Zuweisung und Durchsetzung von privaten oder<br />
gemeinschaftlichen Eigentumsrechten ist aus ökonomischer Sicht mit Kosten verbunden. „Von<br />
diesen Transaktionskosten im spezifischen Einzelfall hängt es ab, welche eigentumsrechtliche<br />
Option eine effiziente Ressourcennutzung sicherstellt und gewählt wird“ (Lerch 1996: 78, vgl.<br />
auch bereits Backhaus 1982). Transaktionskosten im weiteren Sinne können definiert werden als<br />
Kosten die notwendig sind, um ein ökonomisches System ‚am Laufen zu halten’ (Arrow 1969).<br />
Bei kulturbestimmten ökologischen Gütern wie z. B. Kuppelprodukten der Landwirtschaft<br />
verhält es sich bei der Verknappung durch Angebotsrückgang anders als bei naturbestimmten<br />
Gütern. Hier führte der Einsatz individueller Fähigkeiten zur Produktion der Güter. Nach der bis
Eigentumsrechte als Voraussetzung für die Honorierung ökologischer Leistungen 65<br />
heute weitgehend anerkannten Self-ownerschip-These (vgl. Kap. 5.2) bedarf es einer<br />
Begründung, die Verfügung über individuelle Fähigkeiten dem Eigentümer der Fähigkeit zu<br />
entziehen. Der Eigentümer dieser Fähigkeit kann im Normalfall nicht gezwungen werden, seine<br />
Fähigkeit kostenlos einzusetzen (Kap. 5.2 und 5.6.2.2).<br />
Es kann zusammengefasst werden, dass sich die Frage nach den Eigentumsrechten an<br />
ökologischen Gütern immer dann stellt, wenn diese knapp werden. Erst in diesem Moment<br />
müssen Eigentumsrechte (ökonomische Regeln) aufgestellt werden, um eine effiziente<br />
Allokation zu ermöglichen. Auch hier können wir jedoch von einem reziproken Verhältnis<br />
sprechen, denn es kann genauso geschlussfolgert werden, dass es bei jedem knappen<br />
ökologischen Gut zur Schaffung und Durchsetzung von Eigentumsrechten kommen muss. Aus<br />
ökonomischer Sicht macht dies jedoch erst dann Sinn, wenn der Nutzen des knappen<br />
ökologischen Gutes höher ist als die Transaktionskosten zur Schaffung und Durchsetzung der<br />
Eigentumsrechte.<br />
Bei der Schaffung formaler Eigentumsrechte (property rights) sind folgende vier Fragen relevant<br />
(vgl. zu ‚property law’ Kobler 2000: 25):<br />
1. Was kann als Eigentum gehalten werden?<br />
2. Wie sind die Eigentumsrechte festgelegt?<br />
3. Was können die Eigentümer mit ihrem Eigentum machen?<br />
4. Welche Möglichkeiten bestehen zur Durchsetzung der Eigentumsrechte?<br />
Abbildung 12 veranschaulicht die Überführung des open access knapper ökologischer Güter hin<br />
zu einem well-regulated access bei ökologischen Gemein- und Privatgütern.
66 Kapitel 5<br />
eigentumslose<br />
knappe ökologische<br />
Güter<br />
open access<br />
ineffiziente<br />
Allokation<br />
1. Was kann als Eigentum<br />
gehalten werden?<br />
2. Wie sind die<br />
Eigentumsrechte<br />
festgelegt?<br />
3. Was können die<br />
Eigentümer mit ihrem<br />
Eigentum machen?<br />
4. Welche Möglichkeiten<br />
bestehen zur<br />
Durchsetzung von<br />
Eigentumsrechten?<br />
Abbildung 12: Überführung des open access zu einem well-regulated access bei ökologischen Gütern durch<br />
die Schaffung von Eigentumsrechten<br />
Um das gesamtgesellschaftliche Ziel einer effizienten Allokation der knappen Güter zu<br />
ermöglichen, sind vier Kriterien zu beachten (Kobler 2000: 25): (i) Universalität, (ii)<br />
Ausschließlichkeit, (iii) Übertragbarkeit und (iv) Struktur der Eigentumsrechte.<br />
Das Universalitätskriterium weist auf die Bedeutung hin, dass die Verfügungsrechte aller<br />
knappen Ressourcen verteilt sein müssen. Mit der Ausschließlichkeit ist gemeint, dass die<br />
Eigentumsrechte nur einem (einer privaten oder einer juristischen Person) gehören können. Das<br />
Übertragbarkeitskriterium sichert die Möglichkeit der Übertragung von Eigentumsrechten. Das<br />
Strukturkriterium gibt Auskunft, wie Kontroll- und Ertragsrechte verteilt sind (Kobler 2000: 25).<br />
Diese Kriterien spielen für die Ausgestaltung des Instrumentes der Honorierung ökologischer<br />
Leistungen eine entscheidende Rolle, geben sie doch die qualitativen Anforderungen an die<br />
Umweltziele wieder (vgl. Kap. 6.3.3 und 6.3.4).<br />
ökologische<br />
Gemeingüter/<br />
Privatgüter<br />
wellregulated<br />
access<br />
effizientere<br />
Allokation<br />
Die Schaffung und Durchsetzung von Eigentumsrechten ist ein evolutiver Prozess, bei dem es<br />
nicht Ziel ist, alle denkbaren Eigentumsrechte abschließend zu verteilen. Die Beschreibung der<br />
Entstehung von Eigentumsrechten hat vielmehr verdeutlicht, dass die konkreten wirtschaftlichen,<br />
aber auch sozialen Verhältnisse ausschlaggebend sind. Erst das Verknappen von ökologischen<br />
Gütern führt zur Notwendigkeit Eigentumsrechte zu schaffen. Die Schaffung und Durchsetzung<br />
findet dann statt, wenn ökologische Güter so knapp werden, dass die Transaktionskosten für die<br />
Schaffung und Durchsetzung von Eigentumsrechten niedriger sind als der Nutzen aus diesen<br />
Rechten. Dies ist eher als theoretisches Modell zu verstehen, denn bei ökologischen Gütern gibt
Eigentumsrechte als Voraussetzung für die Honorierung ökologischer Leistungen 67<br />
es Grenzen der ökonomischen Bewertung (Monetarisierung), so dass die Transaktionskosten als<br />
Orientierung für die Notwendigkeit der Schaffung von Eigentumsrechten oftmals ausfallen.<br />
Schlüssig ist jedoch, dass aufgrund der Transaktionskosten im gesellschaftlichen Optimum nicht<br />
alle Eigentumsrechte verteilt sind (vgl. Lohmann 1999, Kobler 2000) und dass mit neu<br />
entstehenden Knappheiten an ökologischen Gütern neue Eigentumsrechte geschaffen und<br />
durchgesetzt werden müssen.<br />
Schlussfolgerung<br />
Um auf Umweltprobleme, d. h. die Verknappung von ökologischen Gütern reagieren zu können,<br />
ist es erforderlich, absolute Eigentumsrechte zu schaffen und durchzusetzen. Schaffung und<br />
Durchsetzung von Eigentumsrechten sind die Voraussetzung für eine effiziente Allokation<br />
ökologischer Güter (vgl. weiterführend Kap. 5.6.2.1).<br />
Soll eine effiziente Allokation durch private Eigentumsrechte an ökologischen Gütern<br />
gewährleisten werden, sind relative Eigentumsrechte erforderlich, die einen Tausch über den<br />
Markt ermöglichen (vgl. Kap. 5.1). Die Anforderungen, die an relative Eigentumsrechte gestellt<br />
werden, entsprechen Anforderungen an rationalisierte Umweltziele als Voraussetzung für die<br />
Honorierung ökologischer Leistungen (weiterführend Kap. 6.3.3).<br />
5.4 Notwendigkeit der Änderung von absoluten Eigentumsrechten durch staatliches<br />
Eingreifen<br />
Die Notwendigkeit zur Änderung von absoluten Eigentumsrechten ergibt sich daraus, dass<br />
private Eigentumsrechte aufgrund von Marktversagen nicht zu der erwünschten effizienten<br />
Allokation der ökologischen Güter führen. Ein Eingreifen des Staates wird dann notwendig und<br />
legitim, wenn es gilt, einer ganz bestimmten Form des Marktversagens entgegenzuwirken.<br />
„Voraussetzung für den Schutz der Freiheit ist also die Wirksamkeit ihrer Steuerung durch den<br />
Markt“ (Engel 1998: 6). Das liberale Modell gewährt dem Individuum keine schrankenlose<br />
Freiheit. Vielmehr endet die Entscheidungsfreiheit des Einzelnen dort, „wo Herrschaft ohne
68 Kapitel 5<br />
Haftung entstünde“ (Engel 1998: 6). Regeln im Sinne der Eingrenzung des Freiheitsgrades sind<br />
dort geboten, wo Rechte Dritter bedroht sind 43 .<br />
Dieses Marktversagen kann unterschiedliche Ursachen haben. Drei, im Kontext dieser Arbeit<br />
wesentlichen Ursachen, werden im Folgenden diskutiert.<br />
5.4.1 Bounded rationality und irrationales Verhalten<br />
Bounded rationality<br />
Der scheinbar well-regulated access durch Marktmechanismen baut auf modellhaft rationalen<br />
Entscheidungen des homo oeconomicus auf (vgl. Kap. 3.1). Tatsächlich stößt der well-regulated<br />
access dann an Grenzen, wenn Grundannahmen dieses Modells verworfen werden müssen.<br />
Wenn die Grundannahme von einem homo oeconomicus ausgeht, der die Fähigkeiten besitzt<br />
„alles vorherzusehen, was geschehen könnte, und die möglichen Vorhergehensweisen<br />
gegeneinander abzuwägen und sich zwischen ihnen optimal zu entscheiden, und zwar<br />
augenblicklich und kostenlos“ (Kreps zitiert in Richter & Furubotn 1996: 4), besteht berechtigter<br />
Zweifel daran, dass Individuen tatsächlich diesem Modellathleten entsprechen. Der<br />
‚Modellathlet’ homo oeconomicus ist wohl eher ein Phantom.<br />
Zugesprochen wird Individuen eine begrenzte Rationalität (bounded rationality) (aufbauend auf<br />
Simon 1955, 1957a). Bounded rationality bedeutet in diesem Zusammenhang, dass Menschen<br />
kognitiv limitiert sind, weil sie nicht alle für ihr Verhalten relevanten Informationen besitzen.<br />
Die kognitiven Schranken bedingen, dass nicht notwendigerweise davon auszugehen ist, dass<br />
Individuen optimieren. Bounded rationality ist das Verhalten, das „intendedly rational, but only<br />
limited so“ ist (Simon 1957b: XXIV). Information kann im Zusammenhang mit ökonomischen<br />
Entscheidungen als Wissensbestand über Vergangenheitsereignisse, Ziele und<br />
Handlungsmöglichkeiten, vermehrt um in Märkten erworbene Entscheidungshilfen definiert<br />
werden (Schneider 1997: 73, vgl. Meinhövel 1999: 14). Es handelt sich um „zweckorientiertes<br />
Wissen“ (Wittmann 1959: 14). Die Limitierung der Information, die zur bounded rationality<br />
führt, kann nach Simon (1982) (in Lübbe 1999: 17) unterschieden werden in Begrenzungen<br />
(constraints) bzgl.:<br />
43 vgl. ausführlich dazu aus kontrakttheoretischer Sicht Buchanan (1975)
Eigentumsrechte als Voraussetzung für die Honorierung ökologischer Leistungen 69<br />
• „perceived characteristics (of the environment)“,<br />
• “(fixed) characteristics of the organism itself”.<br />
Die Begründung für die erste Beschränkung kann so umschrieben werden, dass nicht alles<br />
Erkennbare berücksichtigt wird, was für das rationale Ergebnis notwendig gewesen wäre. Die<br />
Begründung für die zweite Beschränkung beschreibt die menschliche Unfähigkeit, alles zu<br />
berücksichtigen, was notwendig gewesen wäre.<br />
Beide Begrenzungen spielen gerade im Umgang mit ökologischen Gütern wegen der<br />
Prognoseunsicherheit (z. B. durch stochastische Ereignisse) und Komplexität ökologischer<br />
Systeme eine herausragende Rolle.<br />
Aufgrund der Informationsbeschränktheit entspricht das geplant rationale Verhalten<br />
wirtschaftlicher, aber auch politischer Akteure oft nicht dem des „Modellathleten“ homo<br />
oeconomicus. Das Menschenbild des homo psychologicus (vgl. u.a. Piaget 1976) greift diese<br />
Beschränkung auf und lässt sich in vier Punkten zusammenfassen (Kobler 2000: 172 f., vgl.<br />
Meier & Mettler 1988: 13 f.):<br />
• Individuen können die komplexe Umwelt gar nicht vollständig erfassen und besitzen daher<br />
kognitive Strukturen, anhand derer Informationen selektiert, interpretiert und<br />
Handlungsmöglichkeiten abgeleitet werden.<br />
• Die kognitiven Strukturen sind von Mensch zu Mensch unterschiedlich und werden<br />
hauptsächlich durch eigene Erfahrungen geprägt (Alter, Ausbildung, Umweltsituation).<br />
• Widersprechen Informationen den eigenen kognitiven Strukturen (kognitive Dissonanz),<br />
werden die Strukturen angepasst.<br />
• Da dieser Anpassungsprozess aufwendig ist, benutzt das Individuum verschiedene<br />
Hilfeleistungen wie Informationsvermittler (Medien), das Verhalten anderer Menschen und<br />
Deutungshilfen von Organisationen und Institutionen.<br />
Die Psychologie verweist darauf, dass Menschen die meisten Entscheidungen gerade nicht<br />
rational treffen. Im Gegenteil werden dafür als kognitive Strukturen ganz einfache Heuristiken<br />
genutzt. Es wird nur ein ganz kleiner Teil der Wirklichkeit wahrgenommen. Einige wenige<br />
Kriterien genügen zur Entscheidung. Oft werden diese Kriterien sogar lexikographisch geordnet.<br />
Die Verwendung von Heuristiken ist für das Individuum oft mehr als ein Akt der Klugheit. Die<br />
Begrenztheit des menschlichen Verstands lässt ihm keine andere Wahl (Engel 2001 ausführlich<br />
in Gigerenzer & Todd 1999). Die kognitiven Schranken bedingen, dass nicht notwendigerweise<br />
von optimierenden Individuen auszugehen ist. Vielmehr werden sie sich möglicherweise damit
70 Kapitel 5<br />
zufrieden geben, dass ein bestimmtes, von ihnen selbst vorgegebenes Anspruchsniveau<br />
(‚aspiration level’) erfüllt ist (Weck-Hannemann 1999: 83).<br />
Trotz all dieser Begrenzung gegenüber dem modellhaft rationalen Verhalten, soll daraus nicht<br />
geschlussfolgert werden, dass Menschen irrational handeln. „Eingeschränkt rationales Verhalten<br />
ist rationales und nicht irrationales Verhalten“ (Kirchgässner 1999: 35). Die ‚moderne’ Version<br />
des homo oeconomicus berücksichtigt, dass dieser nicht immer optimiert. „Im Rahmen des<br />
ökonomischen Verhaltensmodells wird unterstellt, dass das Individuum sich für die ihm am<br />
vorteilhaftesten erscheinende(n) Handlungsalternative(n) entscheidet, nachdem es vor dem<br />
Hintergrund seines augenblicklichen, begrenzten Informationsstandes die Vor- und Nachteile<br />
bzw. Kosten und Nutzen der einzelnen Alternativen gegeneinander abgewogen hat.<br />
Menschliches Verhalten wird entsprechend diesem Modell damit als Nutzenmaximierung unter<br />
Nebenbedingungen bzw. als ‚rationale Auswahl’ aus den zur Verfügung stehenden Alternativen<br />
interpretiert“ (Kirchgässner 1999: 32) 44 .<br />
Die Frage bzgl. bounded rationality ist nun, ob mit dem Wissen um die gegebene Begrenztheit<br />
das ökonomische Modell geändert werden soll, diese Beschränkungen also endogenisiert werden<br />
müssen, wenn damit z. B. Aussagen über die allokative Wirkung von realen Märkten getroffen<br />
werden sollen. Ohne die Berücksichtigung der Begrenzungen ist das ökonomische Leitbild<br />
„‚substantiell’ nur in dem (rationalitätstheoretisch zunächst uninteressanten) Sinne, dass es einen<br />
Zielzustand auszeichnet – nämlich den Zustand maximalen gesellschaftlichen Nettonutzens. Eine<br />
adäquate Repräsentantin der objektiv relevanten Bedingungen erfolgreicher Verwirklichung<br />
dagegen enthält es in keiner Weise“ (Lübbe 1999: 23). Eine Lösung des Problems könnte sein,<br />
die Rationalitätsannahme als „strikt universale, (allerdings in unterschiedlichem Grade)<br />
falsifizierbare Aussage, die jedenfalls faktisch falsifiziert ist“ (Tietzel 1985: 95) anzusehen oder<br />
mit Popper (1967: 150) als eine „gute Annäherung an die Realität“ (zitiert in Schuldt 1997: 141).<br />
Bedeutsam ist, dass mit der begrenzten Rationalität gerechnet wird.<br />
Wenn bei scheinbar well-regulated access (z. B. private Eigentumsrechte und ökonomische<br />
Instrumente) rationale Entscheidungen des homo oeconomicus vorausgesetzt werden, in der<br />
Realität aber homo psychologicus entscheidet, kann dies zur ineffizienten Allokation führen.<br />
44 Was deutlich wird, ist, dass die entscheidungstheoretisch orientierte Ökonomie die Rationalität einer<br />
Entscheidung nicht an den tatsächlichen, sondern an den in die modelltheoretische Analyse aufgenommenen<br />
Umständen – an eigenen ‚description of (the) environment’ misst. Modellwelten aber sind überraschungsfrei. Daher<br />
fällt die rationalitätstheoretische Notwendigkeit der Differenzierung zwischen ex ante-Perspektive und ex post-<br />
Perspektive nicht auf (Lübbe 1999: 18 f.).
Eigentumsrechte als Voraussetzung für die Honorierung ökologischer Leistungen 71<br />
Dieses Marktversagen aufgrund von bounded rationality kann einen Eingriff in die privaten<br />
Eigentumsrechte notwendig machen. Hierbei handelt es sich um die Änderung von<br />
Eigentumsrechten.<br />
Die Änderung von Eigentumsrechten stellt einen Eingriff in Grundrechte nach Artikel 14 GG<br />
dar. Der Eingriff muss daher aus verfassungsrechtlicher Sicht geeignet sein, „das ökonomische<br />
Effizienzziel zu fördern, er muss zu diesem Zweck erforderlich, das heißt, das mildeste Mittel<br />
sein, und er darf schließlich nur dann erfolgen, wenn die Bedeutung des ökonomischen<br />
Effizienzziels unter Beachtung der Intensität des Eingriffs nicht außer Verhältnis zu der<br />
Bedeutung des Grundrechtes steht. Wann letzteres der Fall ist, lässt sich nicht allgemein<br />
formulieren. Es kommt auf den jeweiligen Einzelfall an, bei dem im Rahmen einer Abwägung<br />
von geschütztem Grundrechtsinteresse und ökonomischem Effizienzziel eine Vorrangrelation<br />
gebildet werden muss“ (Eidenmüller 1995: 447).<br />
Irrationales Verhalten<br />
Neben dieser bounded rationality gibt es jedoch auch ‚echte’ irrationale Entscheidungen, die zur<br />
ineffizienten Allokation führen können.<br />
Ein Beispiel von irrationalem Verhalten spielt besonders in einem für ökologische Güter<br />
entscheidenden Bereich eine große Rolle, dem der intertemporalen Entscheidungen.<br />
Entscheidungen dieser Art besitzen im Bezug auf ökologische Güter und unter Berücksichtigung<br />
des Ziels der Nachhaltigen Entwicklung eine Schlüsselfunktion. In der Ökonomie, besser gesagt<br />
in neoklassischen Modellen, wird den homo oeconomica rationales Verhalten aber auch „ein in<br />
ihrer Seele eingebauter Ungedulds- (impatience) oder Kurzsichtigkeitsfaktor (myopia)<br />
zugeschrieben, der sie veranlasse, eine Stück Schokolade heute höher zu bewerten als das selbe<br />
Stück morgen, und zwar nur aus dem Grunde, weil ein bestimmtes Quantum Zeit zwischen<br />
beiden Genüssen liegt“ (Hampicke 1992: 137 f.). Individuen gewichten demnach von zwei<br />
identischen Nutzungsstiftungen diejenige, welche ferner in der Zukunft liegt, geringer als die<br />
sofortige und zwar allein wegen der zeitlichen Distanz! Dieses scheinbar rationale Verhalten,<br />
das sich bei Berücksichtigung der zeitlichen Dimension als irrational erweist, weil das<br />
Individuum wissentlich seine „heutige Entscheidung später bereut“ (ebd.), kann im<br />
gesellschaftlichen Kontext im Sinne des Rechtes auf Eigenschädigung nicht in jedem Fall<br />
akzeptiert werden. Dies gilt, wenn Myopie z. B. den Zins in starkem Maße beeinflusst und dies<br />
zu irreversiblen Schädigungen ökologischer Güter durch Übernutzung führt (vgl. FN 42)<br />
(Hampicke 1992: 400).
72 Kapitel 5<br />
Zusammenfassung<br />
Aus bounded rationality und irrationalem Verhalten ist zu schlussfolgern, dass die Fähigkeiten<br />
des homo oeconomicus vor dem Hintergrund der Restriktionen neu definiert werden und nach<br />
Möglichkeit das Rationalitätsmodell darauf abgestimmt werden muss. Die Bewertung, ob die<br />
Schaffung und Durchsetzung bzw. das Vorhandensein von privaten Eigentumsrechten an<br />
ökologischen Gütern und deren Allokation über den Markt eine Option für eine effiziente<br />
Allokation der ökologischen Güter darstellt, ist an die Berücksichtigung der bounded rationality<br />
und des irrationalen Verhaltens gebunden.<br />
Dem Modell Markt kann bei Berücksichtigung von bounded rationality und irrationalem<br />
Verhalten nicht uneingeschränkt effiziente allokative Wirkung unterstellt werden. Gerade bei<br />
ökologischen Gütern, deren Bedeutung im intergenerationellen Kontext und in deren Endlichkeit<br />
bzw. Nichtsubstituierbarkeit liegt, kann es geboten sein, den Markt rational (nachhaltig!) zu<br />
beeinflussen. Dies kann über Änderung von ineffizienten Eigentumsrechten geregelt werden. Die<br />
Frage ist „ob und wie auf erkannte Grenzen der Rationalisierbarkeit in ‚vernünftiger’ Weise mit<br />
Rationalisierungskonzepten zweiter Ordnung reagiert werden kann“ (Gawel & Lübbe-Wolff<br />
(Hrsg.) 1999: 8). Genau ein solches Rationalisierungskonzept zweiter Ordnung ist für die<br />
Honorierung ökologischer Leistungen zu entwickeln.<br />
5.4.2 Hohe Transaktionskosten<br />
Die Schaffung von Eigentumsrechten erfolgt in einer gesellschaftlichen Abwägung. Dieser<br />
normative Prozess kann dazu führen, dass Eigentumsrechte im ökonomischen Sinne nicht<br />
‚richtig’ verteilt werden. Bei einer ökonomisch ‚richtigen’ Zuweisung der Eigentumsrechte<br />
müssen diese denjenigen zugewiesen werden, die den höchsten Nutzen daraus ziehen, da es sonst<br />
aufgrund von Transaktionskosten zu einer ineffizienten Verteilung kommen kann (vgl. Kobler<br />
2000: 42).<br />
Transaktionskosten sind Kosten, die entstehen, wenn getauscht wird 45 und sind wie folgt<br />
begründet (vgl. Richter & Furubotn 1996: 51 f.):<br />
45 Die Theorie der Transaktionskosten entwickelte sich im Bereich der Neoklassik aus der Beschäftigung mit der<br />
internen Organisation von Unternehmen (Coase 1937, Williamson 1975) sowie im Zusammenhang mit externen<br />
Effekten in der Produktion (Coase 1960). Sie betrachtet im Unterschied zur Theorie der Verfügungsrechte
Eigentumsrechte als Voraussetzung für die Honorierung ökologischer Leistungen 73<br />
• Such- und Informationskosten (Suche nach Tauschpartner und Tauschobjekt);<br />
• Verhandlungs- und Vertragskosten (durch Aushandlung der relativen Eigentumsrechte und<br />
deren Festhalten in einem expliziten Vertrag);<br />
• Durchsetzungskosten (Ausführung des Tausches und Durchsetzung der relativen<br />
Eigentumsrechte) und darüber hinaus<br />
• ‚Rationalisierungskosten’ (Kosten der Rationalisierung der Umweltziele (vgl. Kap. 6.3)<br />
im Zusammenhang mit ökologischen Gütern).<br />
Zur ineffizienten Verteilung kommt es, wenn die Transaktionskosten höher sind als der zu<br />
erwartende Tauschgewinn. Erhält z. B. ein Landwirt das Recht sein Grünland zu düngen, die<br />
Gesellschaft hat jedoch Interesse an einer artenreichen Wiese mittlerer Standorte auf dieser<br />
Fläche und bewertet diese artenreiche Wiese ökonomisch höher als der Landwirt die<br />
Düngungsrechte, auf die er verzichten müsste, damit die artenreiche Wiese erhalten bleibt,<br />
kommt es in einer Welt ohne Transaktionskosten zur Honorierung ökologischer Leistungen. Die<br />
Gesellschaft kauft dem Landwirt eine ganz bestimmte Art der Nutzung ab und eine effiziente<br />
Allokation liegt vor. Gesetzt den Fall, der erwartete Tauschgewinn (die Höherbewertung der<br />
Gesellschaft) beträgt pro ha 100 €, dann müssen die Kosten, die der zuständigen Behörde o. Ä.<br />
für die Informationsbeschaffung der möglichen Düngung, die Kosten für den Vertrag sowie<br />
dessen Durchsetzung und Kontrolle weniger als 100 € betragen, sonst findet keine Transaktion<br />
statt 46 . „Sobald die Markttransaktionskosten höher als der erwartete Tauschgewinn sind, ist eine<br />
effiziente Allokation der absoluten Eigentumsrechte mittels einer Markttransaktion nicht mehr<br />
möglich, falls diese nicht ex ante durch den institutionellen Rahmen richtig zugeordnet wurden“<br />
(Kobler 2000: 42, vgl. auch Eidenmüller 1995: 81, Coase 1960: 16). Abbildung 13 verdeutlicht<br />
den Zusammenhang zwischen der Verteilung der absoluten Eigentumsrechte und den<br />
Markttransaktionskosten für die effiziente Allokation einer artenreichen Wiese.<br />
Institutionen unter einem Durchführungsgesichtspunkt (vgl. grundlegend Williamson 1985). Einen kompakten<br />
Überblick zur Chronologie und Abgrenzung der Theorien gibt Bahner (1996).<br />
46 Ein anschauliches Beispiel aus der Alltagswelt sind in diesem Zusammenhang Transaktionskosten im Zuge eines<br />
Hauskaufes. Wenn ich als Käuferin eines Hauses bereit bin, 100.000 € zu zahlen, ich aber ein passendes Objekt zum<br />
Preis von 95.000 € nur über einen Makler finde, der eine Provision von 6 % des Objektwertes haben will, und ich<br />
darüber hinaus mit einer Grunderwerbsteuer von 4 % des Objektwertes und mit Notarkosten von 1,5 % rechnen<br />
muss, kann ich das Haus nicht kaufen. Die Transaktion scheitert an den Transaktionskosten.
74 Kapitel 5<br />
Effiziente Allokation der<br />
artenreichen Wiese ist über den<br />
Markt durch die Honorierung<br />
ökologischer Leistungen möglich.<br />
Die anfängliche Zuordnung der<br />
absoluten Eigentumsrechte an der<br />
artenreichen Wiese hat keinen<br />
Einfluss auf deren effiziente<br />
Allokation.<br />
Erwarteter Tauschgewinn<br />
100 €<br />
Effiziente Allokation der<br />
artenreichen Wiese ist über den<br />
Markt durch die Honorierung<br />
ökologischer Leistungen nicht<br />
mehr möglich.<br />
Die anfängliche Zuordnung der<br />
absoluten Eigentumsrechte an der<br />
artenreichen Wiese hat einen<br />
Einfluss auf deren effiziente<br />
Allokation.<br />
0 50 150 200<br />
Markttransaktionskosten für die Behörde in €<br />
Abbildung 13: Möglichkeit einer effizienten Allokation einer artenreichen Wiese durch die Honorierung<br />
ökologischer Leistungen in Abhängigkeit der vorliegenden absoluten Eigentumsrechte (Quelle: in Anlehnung<br />
an Kobler 2000)<br />
Bei der Transaktion von relativen Eigentumsrechten an ökologischen Gütern (Honorierung<br />
ökologischer Leistungen) müssen die Transaktionskosten aufgrund der Komplexität der<br />
ökologischen Systeme als hoch eingestuft werden. Hohe Transaktionskosten spielen damit eine<br />
Rolle für das Marktversagen im Bereich von ökologischen Gütern. Es ist unschwer zu erkennen,<br />
welche Schlüsselposition bei dieser Argumentation die Möglichkeit der genauen<br />
Operationalisierung und Messung von Transaktionskosten hat, wenn damit die Notwendigkeit<br />
des Eingreifens des Staates begründet wird. Die Ermittlung der in einer bestimmten Situation<br />
anfallenden Transaktionskosten ist mit enormen konzeptionellen und praktischen Problemen<br />
verbunden (vgl. Eidenmüller 1995: 92, 290). Die interessante Frage, die nun auftritt, ist die, wie<br />
sich die durch Präsenz von Transaktionskosten ausgelösten Ineffizienzen korrigieren lassen. Hier<br />
pauschal auf den intervenierenden Staat in dem Sinne zu setzen, dass zentral eine derartige<br />
Regelung festgelegt werde, auf die sich rational und eigennützig agierende Verhandlungspartner<br />
bei Abwesenheit von Transaktionskosten geeinigt hätten, hält Eidenmüller angesichts des<br />
„variantenreichen Arsenals an privaten Regelungsmöglichkeiten ... nicht nur für wenig<br />
einfallsreich, sie fällt auch hinter das analytische Niveau zurück, das Coase bereits erreicht hatte“<br />
(Eidenmüller 1995: 96). Diese Kritik kann durchaus als Ausgangspunkt ‚einfallsreicher’<br />
Vereinbarungen bzgl. der Honorierung ökologischer Leistungen der Landwirtschaft angesehen
Eigentumsrechte als Voraussetzung für die Honorierung ökologischer Leistungen 75<br />
werden, die eine hoheitliche Regelung über die Änderung der absoluten Eigentumsrechte<br />
erübrigen oder die Situation unvollständig verteilter Eigentumsrechte überbrücken (vgl.<br />
Lohmann 1999).<br />
5.5 Unterscheidung der Schaffung und Änderung von absoluten Eigentumsrechten<br />
Gestiegene Nachfrage führt bei Marktversagen nicht zur Notwendigkeit einer Änderung von<br />
Eigentumsrechten, sondern zur Notwendigkeit der Schaffung von Eigentumsrechten über das<br />
(neue) nachgefragte knappe ökologische Gut.<br />
Eine klare Unterscheidung der Schaffung und der Änderung der Eigentumsrechte ist<br />
zweckmäßig, da bei der Schaffung von Eigentumsrechten lediglich de facto Eigentumsrechte<br />
vorliegen und ein gesellschaftlicher Abwägungsprozess die Verteilung bestimmt, hingegen bei<br />
der Änderung der Eigentumsrechte bereits (de jure) Eigentumsrechte vorliegen und allein<br />
Effizienzkriterien die Umverteilung bestimmen. Empirischer Besitz darf nicht mit de jure bzw.<br />
gesellschaftlich anerkanntem Eigentum verwechselt werden. Physische Aneignung sei nach Kant<br />
zwar notwendig, um Eigentum zu begründen, aber nicht hinreichend. Empirischer Besitz allein<br />
könne kein Eigentumsrecht begründen, das Wesen des Eigentums sei ja gerade dadurch<br />
bestimmt, dass es fortbestehe, auch wenn der physische Besitz nicht gegeben ist. Ein<br />
gesellschaftlicher Vertrag müsse Eigentum logisch vorausgehen (vgl. Bromley 1991 47 in Lerch<br />
1999). Hervorzuheben ist der Bezug auf das knappe ökologische Gut (Schaffung und Änderung<br />
von Eigentumsrechten am knappen ökologischen Gut). Zwei Beispiele sollen die Unterscheidung<br />
verdeutlichen.<br />
1. Schaffung von absoluten Eigentumsrechten:<br />
Ein Landwirt hatte bisher das de facto Recht (Es war nicht verboten!) Grünland im<br />
überschwemmungsbeeinflussten Auenbereich umzubrechen. Das Bundesnaturschutzgesetz<br />
verbietet einen solchen Umbruch (§ 5 Abs. 4 S. 5 BNatSchG). Intakte Auen sind ein knappes<br />
ökologisches Gut geworden. Gemeinschaftliche Regeln sollen eine weitere Verknappung<br />
verhindern. De facto Eigentumsrechte werden entzogen (Zerstörung von Teilen einer naturnahen<br />
Aue) und de jure Gemeinschaftseigentum wird geschaffen. Die Gesellschaft (der<br />
parlamentarische Gesetzgeber) hat entschieden, dass dies in die Sozialpflichtigkeit fällt.<br />
47 Bromley bezieht sich auf die Eigentumsauffassung Kants, die dieser in „Metaphysische Anfangsgründe der<br />
Rechtslehre“ von 1797 darlegt.
76 Kapitel 5<br />
2. Änderung von absoluten privaten Eigentumsrechten:<br />
Eine Aue wird als Naturschutzgebiet ausgewiesen. Die oberste Naturschutzbehörde kann in der<br />
Schutzgebietsverordnung ‚Inhalt und Schranken’ des Eigentums festlegen (vgl. Kap. 5.6.2).<br />
Durch die Regeln der Schutzgebietsverordnung darf ein betroffener Landwirt nicht mehr düngen,<br />
jeglicher Ackerbau ist untersagt und seine Wiesen dürfen nicht vor Mitte Juli gemäht werden.<br />
Nach der neueren Rechtssprechung kann dem Landwirt in diesem Fall der Entzug seiner de facto<br />
Eigentumsrechte durch die Schaffung von de jure Gemeinschaftseigentum, im Sinne der<br />
ausgleichspflichtigen Inhalts- und Schrankenbestimmung, entschädigt werden. Damit wird ihm<br />
aus Gründen der Verhältnismäßigkeit (gesellschaftliche Abwägung) implizit zunächst de jure<br />
Privateigentum zugestanden, die zugehörigen Rechte jedoch sofort, aufgrund von<br />
Allokationskriterien (Naturschutzgebiet kann nur geschützt werden, wenn genau die Regeln<br />
befolgt werden, die in der Verordnung stehen.) wieder entzogen. In diesen Beispielen werden<br />
Eigentumsrechte somit erst mit der Entscheidung, ob eine Honorierung stattfindet oder nicht,<br />
definiert (vgl. i.d.S. Thöne 2000: 262, Lintz 1994: 61, Gäfgen 1987: 101 ff.).<br />
Tabelle 1 stellt noch einmal die innerhalb dieser Arbeit herausgearbeiteten Unterschiede<br />
zwischen Schaffung und Änderung von absoluten Eigentumsrechten dar.<br />
Tabelle 1: Gegenüberstellung der Schaffung und Änderung von Eigentumsrechten an ökologischen Gütern<br />
Charakterisierung<br />
Begründung für die<br />
Notwendigkeit<br />
Kriterien der<br />
Distribution<br />
Entschädigung für<br />
Entzug der<br />
Nutzungsrechte<br />
Schaffung von absoluten<br />
Eigentumsrechten<br />
an ökologischen Gütern<br />
de facto private Eigentumsrechte werden<br />
entzogen,<br />
de jure Eigentumsrechte werden verteilt<br />
ineffiziente Allokation der ökologischen<br />
Güter<br />
(Marktversagen aufgrund des open<br />
access und auftretender Knappheit bei<br />
ökologischen Gütern)<br />
gesellschaftliche Abwägung<br />
Entzug von de facto Eigentumsrechten<br />
muss nicht entschädigt werden<br />
Änderung von absoluten privaten<br />
Eigentumsrechten<br />
an ökologischen Gütern<br />
de jure Eigentumsrechte werden<br />
entzogen<br />
ineffiziente Allokation der<br />
ökologischen Güter<br />
(Marktversagen aufgrund von bounded<br />
rationality, irrationalem Verhalten,<br />
hohen Transaktionskosten)<br />
effiziente Allokation des<br />
ökologischen Gutes<br />
Entzug von de jure Eigentum<br />
muss entschädigt werden
Eigentumsrechte als Voraussetzung für die Honorierung ökologischer Leistungen 77<br />
5.6 Eigentumsbegründung und Distribution<br />
Es wurde bereits in Kapitel 3.2 auf die enorme praktische Bedeutung der Distribution der<br />
Eigentumsrechte bei der Anwendung von ökonomischen Instrumenten und im Besonderen für<br />
die Honorierung ökologischer Leistungen hingewiesen. Bisher wurde die Schaffung und<br />
Durchsetzung der Eigentumsrechte damit begründet, dass dadurch eine effiziente Allokation der<br />
ökologischen Güter ermöglicht werden soll. Noch nicht eingegangen wurde jedoch auf die<br />
Frage, wer nun die Eigentumsrechte zugeteilt bekommen soll und nach welchen Kriterien. Bei<br />
der Schaffung von Eigentumsrechten gibt es keine Effizienzkriterien für die Auswahl, welcher<br />
der theoretisch unendlich vielen pareto-optimalen Nutzungsmöglichkeiten der Vorrang gegeben<br />
werden soll. Alternative Nutzenaufteilungspfade führen zu alternativen Pareto-Optima (vgl. Kap.<br />
3.1.2). Da für diese Arbeit jedoch weniger Distributionsfragen als vielmehr Allokationsfragen zu<br />
klären sind, sollen an dieser Stelle lediglich eine kurze Darstellung der Distribution im Lichte der<br />
Ökonomie (Kapitel 5.6.1) und, aufgrund der praktischen Bedeutung ausführlicher,<br />
Distributionsentscheidungen bzgl. ökologischer Güter im Rahmen der rechtlichen Eigentums-<br />
dogmatik (Kapitel 5.6.2) diskutiert werden. Dies nicht zuletzt, da diese Distributionsentschei-<br />
dungen den rechtlichen Rahmen für die Anwendung der Honorierungsinstrumente in der Praxis<br />
abgeben.<br />
5.6.1 Distribution in der Ökonomie<br />
Die Frage der Distribution wurde in der Neoklassik seit der Abkehr von der utilitaristischen<br />
Neoklassik des 19. Jahrhunderts als außer-ökonomische Frage betrachtet (vgl. Hampicke<br />
1999) 48 . Erst mit Fragen der intergenerationellen Verteilung im Zuge der Nachhaltigen<br />
Entwicklung wurde „ihr paretanisches Dogma von der Nichtvergleichbarkeit und damit erst recht<br />
Nichtaddierbarkeit der Nutzen unterschiedlicher Personen ohne Nachdenken über Bord“<br />
geworfen (Hampicke 1999: 157, vgl. auch Cansier 1997). Das Prinzip der Nachhaltigen<br />
Entwicklung ist eine Verteilungsforderung (Hampicke 1999). „Entgegen Buchanan ist demnach<br />
die Umweltproblematik nicht nur ein Problem der Neudefinition von Verfügungsrechten,<br />
sondern vor allem (aber nicht nur) im intergenerationellen Kontext zwangsläufig auch ein<br />
48 In der utilitaristischen Neoklassik des 19. Jahrhunderts war es prinzipiell möglich, eine intragenerationell<br />
nutzenmaximierende Verteilung zu postulieren, nämlich bei durchweg rechtsgekrümmten Nutzenfunktionen, die,<br />
bei der alle Gesellschaftsmitglieder einen identischen Grenznutzen genossen. Es ist dann nur ein kleiner Schritt,<br />
diese nutzensummenmaximierende Verteilung auch als die ethisch beste zu definieren, wie es in der betreffenden<br />
Variante des Utilitarismus auch getan wird. Gibt es aber unter Verzicht auf kardinale Nutzenmessungen und<br />
intersubjektive Vergleichbarkeit keine Nutzensumme, so gibt es auch keine höchste Summe und damit keine beste<br />
Verteilung; alle Verteilungen sind ‚gleich gut’ (Hampicke 1999).
78 Kapitel 5<br />
Problem der Verteilung von Eigentumsrechten“ (Lerch 1999: 420, vgl. auch Lerch 1998: 144<br />
ff.).<br />
Die berechtigte Frage, die dann jedoch gestellt werden kann, ist: „Wenn die Subjekte späteren<br />
Generationen durch Sparen, Verzicht, durch Akkumulation und Instandhaltung des natürlichen<br />
Kapitals schenken, tun sie dann nicht genau dasselbe, wie wenn sie ihren bedürftigen<br />
Zeitgenossen schenken“ (Hampicke 1999: 160)? 49<br />
Von Interesse im Zusammenhang von Allokation und Distribution sind Untersuchungen, die zu<br />
dem Schluss führen, dass Distribution Einfluss auf die Allokation hat. Damit wäre Distribution<br />
in diesem Zusammenhang ohne Wenn und Aber Thema der Ökonomie. Unterschiedliche<br />
Distribution führt in diesen Fällen nicht zu ‚gleichwertigen’ pareto-optimalen Zuständen. So<br />
weisen Boyce (1994) und Massarrat (1997) darauf hin, dass eine ungleiche Verteilung des<br />
Reichtums auf der Erde naturgemäß einhergeht mit ebenso ungleicher Verteilung der Macht. In<br />
ähnlicher Richtung argumentiert Kobler. „Je ungleicher ex ante die Vermögens- und<br />
Einkommensverteilung, desto schwächer ist der Staat“ (Kobler 2000: 148). Ein starker Staat ist<br />
laut Kobler jedoch die Voraussetzung für die Schaffung und Durchsetzung von effizienten<br />
Eigentumsrechten (vgl. ebd.). Dies gilt jedoch nur für den Fall, dass der Staat die Verteilung<br />
besser steuern kann und kein Staatsversagen auftritt (vgl. zu dieser Problematik z. B. Petersen &<br />
Müller 1999).<br />
Dass sich die Ökonomie bei der Beschäftigung mit intergenerationellen Allokationsfragen und<br />
im Zusammenhang mit globalen Umweltproblemen mit Distribution beschäftigen muss, dass<br />
hier Allokation und Distribution nicht getrennt werden kann (vgl. dazu grundsätzlich Daly<br />
1992), wird mittlerweile auch von neoklassischen Ökonomen im Bezug auf das Klimaproblem<br />
festgestellt (Lind & Schuler 1998, in Hampicke 1999).<br />
Wie die Ökonomie mit der interessanten Frage der Distribution in den nächsten Jahren umgehen<br />
wird und welche Ansätze bereits zu erkennen sind, ist ohne Frage ein hoch spannendes Thema,<br />
das jedoch den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde.<br />
49 Das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (UNDP) zitiert zu dieser Frage die Worte des Ökonomen<br />
und Nobelpreisträgers Robert M. Solow: „Aber jetzt kann man das mit der Popularität der Nachhaltigkeit<br />
verbundene Paradoxon sehen. Wenn das zugrundeliegende Argument mit der Abneigung gegen Ungleichheit zu tun<br />
hat, gibt es wenigstens einen ebenso starken (möglicherweise einen noch stärkeren) Grund die gegenwärtige<br />
Ungleichheit zu reduzieren, als sich um den ungewissen Status der zukünftigen Generationen zu kümmern.<br />
Diejenigen, die so sehr darauf dringen, der Zukunft Armut nicht zuzumuten, sollen erklären, warum sie nicht eine<br />
noch höhere Priorität auf die Reduzierung der Armut heute setzen“ (UNDP 1996:16).
Eigentumsrechte als Voraussetzung für die Honorierung ökologischer Leistungen 79<br />
5.6.2 Distribution der Eigentumsrechte an ökologischen Gütern im deutschen Recht<br />
5.6.2.1 Distributionskriterien<br />
Wenn es um Fragen der Verteilung der Eigentumsrechte an ökologischen Gütern geht, ist der<br />
Anknüpfungspunkt zur rechtlichen Eigentumsrechtsdogmatik gefunden. An dieser Stelle soll auf<br />
wesentliche Aspekte dieses sehr umfänglichen Themas eingegangen werden 50 . Im Wesentlichen<br />
soll dabei eine Verbindung zwischen der juristischen Eigentumsdogmatik und der ökonomischen<br />
Theorie der property rights (Kapitel 5.2 und 5.5) konstruiert und Schlussfolgerungen für die<br />
Honorierung ökologischer Leistungen gezogen werden.<br />
Das Grundgesetz und die darauf aufbauende Rechtssprechung macht für die Zuteilung der<br />
Eigentumsrechte weitgehende Aussagen, die im Folgenden vor dem Hintergrund ihrer<br />
Bedeutung für die Honorierung ökologischer Leistungen der Landwirtschaft diskutiert werden<br />
sollen. Dabei ist das Verhältnis von grundrechtlich gesichertem Schutz des Privateigentums (vor<br />
allem Artikel 14 Abs. 1 S. 1 GG) und die Berufs- und Gewerbefreiheit (Artikel 12 GG) auf der<br />
einen Seite und der Naturschutz als eine Schranke der Grundrechtsbetätigung (Artikel 14 Abs. 1<br />
S. 2) auf der anderen Seite von besonderem Interesse. Der verfassungsrechtliche Begriff des<br />
Eigentums geht über den bürgerlichen Eigentumsbegriff hinaus. „Unter den Eigentumsschutz des<br />
Artikel 14 Abs. 1 GG fallen alle vermögenswerten Rechte, die dem Berechtigten durch die<br />
Rechtsordnung derart zugeordnet werden, dass er sie zu seinem privaten Nutzen nach eigener<br />
Entscheidung ausüben darf. ... Zum Eigentumsrecht gehören auch das Jagd- und das<br />
Fischereirecht“ (Louis 1999: 181). Es besteht Einigkeit darin, dass ein Anspruch auf Schutz des<br />
privaten Eigentums besteht, aber auch, dass Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich<br />
dem Wohle der Allgemeinheit dienen (Art. 14 Abs. 2 GG). Hier wird die so genannte<br />
Sozialpflichtigkeit, im Zusammenhang mit Eigentum an ökologischen Gütern auch als<br />
„Ökologiepflichtigkeit“ benannt (Czybulka 1988) 51 , beschrieben. Eigentumsrechte im Sinne von<br />
Artikel 14 GG stellen keine absolut vorgegebene Größe dar. Sie werden durch eine Inhalts- und<br />
Schrankenbestimmung vom Gesetzgeber definiert (Art. 14 Abs. 1 S. 2 GG). Die Inhalts- und<br />
50 Parallel zu dieser Arbeit widmete sich im Rahmen des Graduiertenkollegs ‚Integrative Umweltbewertung’ an der<br />
Christian-Albrechts-Universität Kiel die juristische Arbeit von B. Semleit dieser Thematik im Zusammenhang mit<br />
der Honorierung ökologischer Leistungen der Landwirtschaft.<br />
51 Czybulka engt (2002: 90 f.) die ‚Ökologiepflichtigkeit’ für einige Bereiche des Naturschutzes ein, um auf die<br />
Besonderheit im Gegensatz zur allgemeinen ‚Sozialpflichtigkeit’ hinzuweisen. Dabei stützt er sich vor allen Dingen<br />
auf die (zusätzliche) Einführung von Artikel 20a GG, obwohl doch bereits vor dessen Einführung die<br />
Sozialpflichtigkeit (Art. 14 Abs. 2 ) auf den Bereich des Umweltschutzes angewendet wurde. Darüber hinaus<br />
postuliert er einen besonderen Handlungsbedarf in diesem Bereich. Die Einengung bezieht er vor allen Dingen auf<br />
die Bereiche des ‚klassischen Naturschutzes’ (Arten- Biotopschutz) mit der Begründung, dass hier aufgrund der<br />
anderen Wertkonstellation ein besonderer Regelungsbedarf besteht (der Wert speist sich hier nicht primär aus der<br />
Funktion der Ressourcen).
80 Kapitel 5<br />
Schrankenbestimmung des Eigentums gibt dem Gesetzgeber unter Berücksichtigung der<br />
Sozialpflichtigkeit des Eigentums einen Spielraum zur Einschränkung von privaten<br />
Eigentumsrechten (Louis 1999: 180). Die Grenzen der Eigentumsbeschränkungen sind nicht<br />
statisch und für alle Zeiten festgelegt, sondern den veränderten Lebensbedingungen anzupassen<br />
(ebd.). Die Abgrenzung zwischen Sozialpflichtigkeit und Privateigentum ist nichts anderes als<br />
die Abgrenzung zwischen Gemeineigentum und Privateigentum. Die Definition und gegenseitige<br />
Abgrenzung der Verfügungsrechte ist ein normativer und evolutiver Prozess, bei dem eine<br />
Interessenabwägung zwischen Gesellschaft und betroffenen Gruppen stattfinden muss.<br />
Relativ weitreichend ist die Spanne der Auslegung der Sozialpflichtigkeit bzw.<br />
Ökologiepflichtigkeit. Die Grenzen der Nutzung des Eigentums haben sich am Wohl der<br />
Allgemeinheit zu orientieren, das nicht nur Grund, sondern auch Grenze für die dem Eigentümer<br />
auferlegten Beschränkungen ist (vgl. Louis 1999: 185 mit Angaben zu entsprechenden Urteilen).<br />
In der rechtlichen Eigentumsdogmatik weniger behandelt, ist die Ökologiepflichtigkeit bzgl.<br />
kulturbestimmter Güter. Hierbei besteht Ökologiepflichtigkeit nicht im Unterlassen einer<br />
Nutzung, sondern der Einsatz individueller Fähigkeit für die Herstellung der Güter ist<br />
erforderlich. Kann die Gesellschaft also z. B. von einem Landwirt im Rahmen der<br />
Ökologiepflichtigkeit verlangen, eine Wiese alle zwei Jahre zu mähen, ohne ihn dafür zu<br />
bezahlen? Ein Beispiel für ein solches Gebot besteht im § 15b LNatSchG SH. und dem<br />
zugehörigen Erlass zum Erhalt der Knicks in Schleswig-Holstein. Danach ist ein Eigentümer<br />
nicht nur zum Unterlassen von Beeinträchtigungen, sondern auch zum Pflegeschnitt (auf den<br />
Stock setzen) im Abstand von 10 bis 15 Jahren verpflichtet. Die Frage kann also grundsätzlich<br />
mit ja beantwortet werden. Derartige Gebote sind jedoch gerade vor dem Hintergrund unseres<br />
liberalen Eigentumsverständnisses (vgl. auch self-ownership-Theorie Kap. 5.2) problematischer<br />
als Unterlassungsgebote.<br />
Die folgende, aus der Ökologiepflichtigkeit abgeleitete These: „Es gibt keine allgemeine<br />
Umweltverschmutzungsfreiheit“ (Murswiek 1994: 79) ist umstritten. Murswiek begründet seine<br />
These mit der „Voraussetzungshaftigkeit“ der (wirtschaftlichen) Betätigungsfreiheit, die<br />
(jedenfalls) nicht den Zugriff auf Rechtsgüter Dritter (mit)gewährleiste. Dies gelte unstreitig für<br />
den Zugriff auf das Eigentum Dritter. Es sei aber auch maßgeblich für den Zugriff auf<br />
Gemeinschaftsgüter. Er gewährt demnach Gemeinschaftsgütern den gleichen Schutz wie<br />
Privatgütern. „Die Belastung der Gemeinschaftsgüter Luft, Wasser und Boden, zu denen auch<br />
die Folgewirkungen u.a. auf Tiere oder Pflanzen gezählt werden können, sei nicht lediglich<br />
Freiheitsausübung, sondern Teilhabe. Diese aber müsse verfassungsrechtlich ausdrücklich
Eigentumsrechte als Voraussetzung für die Honorierung ökologischer Leistungen 81<br />
gewährleistet oder wenigstens ableitbar sein“ (Murswiek 1994: 79 erläutert in Czybulka 1999: 9<br />
f.). Murswiek unterscheidet demnach den Zustand der bloßen „Freiheitsausübung“ von dem der<br />
„Teilhabe“ am Gemeinschaftseigentum.<br />
An dieser Stelle sollen die interessanten Parallelen zu Kants Eigentumsauffassung 52 , aber auch<br />
zu den ‚Locke’schen Bedingungen’ 53 verdeutlicht werden. Bereits seit Kant wird einer<br />
‚naturrechtlichen Eigentumsbegründung’, nach der die hier betrachteten Fähigkeiten<br />
ökologischer Systeme unabhängig von der Zustimmung der Gesellschaft als privates Eigentum<br />
angesehen werden können, widersprochen. Lerch legt eindrucksvoll dar, dass bei genauerer<br />
Betrachtung private Eigentumsrechte an knappen Ressourcen ohne Rückgriff auf<br />
kontrakttheoretische Legitimation, also unabhängig von gesellschaftlicher Zustimmung, nicht zu<br />
begründen sind, da weder die „Locke’schen Bedingungen“ noch die Interpretation Nozicks 54 als<br />
„Paretoverbesserung“ für knappe Güter gelten (Lerch 1999: 402 ff.) 55 .<br />
Vor diesem Hintergrund kann ‚Freiheitsausübung’ als Nutzung der Gemeinschaftsgüter unter<br />
den „Locke’schen Bedingungen“ interpretiert werden. Kommt es jedoch zur Rivalität kann von<br />
‚Teilhabe’ gesprochen werden. Interessant ist die Argumentation, dass eine Teilhabe<br />
verfassungsrechtlich ausdrücklich gewährleistet oder wenigstens ableitbar sein muss. Dies<br />
stimmt mit der in dieser Arbeit vertretenen Unterscheidung von Schaffung und Änderung von<br />
Eigentumsrechten überein (vgl. Kap. 5.5). Die Übertragung dieser interessanten Gedanken von<br />
Murswiek auf den Bereich des verfassungsrechtlichen Naturschutzes steht noch aus (Czybulka<br />
1999).<br />
Das Eigentum von Nutzern ökologischer Güter, hervorgehoben sei hier die Landwirtschaft, ist<br />
verfassungsrechtlich mehrfach beschränkbar. Dies betrifft etwa das Grundwasser und den<br />
gesamten Wasserhaushalt, der einer öffentlich-rechtlichen Benutzungsordnung unterworfen ist,<br />
52<br />
Die skizzierte Eigentumsauffassung Kants bezieht sich auf seine Überlegungen in „Metaphysische Anfangsgründe<br />
der Rechtslehre“ von 1797.<br />
53<br />
Locke postuliert nicht nur das Naturrecht auf die Aneignung von Ressourcen, sondern auch immer eine<br />
naturrechtliche Beschränkung des Eigentums, „wonach erstens bei jeder Aneignung genügend für andere übrig<br />
bleiben muss und zweitens jeder sich nur soviel aneignen dürfe, wie er selbst verbrauchen kann. Niemand dürfe sich<br />
mehr aneignen und dadurch anderen etwas vorenthalten“ (Lerch 1999: 405).<br />
54<br />
Nozick verbindet die Locke’sche Bedingung mit dem Pareto-Kriterium derart, dass durch die Aneignung<br />
niemandes Position verschlechtert werden darf (Nozick 1974 in Lerch 1999).<br />
55<br />
De facto gestaltet sich dies jedoch anders. Jeder Verbrauch öffentlicher ökologischer Güter ist grundsätzlich so<br />
lange erlaubt, wie nicht umweltpolitisch dagegen vorgegangen wird. Damit kommt dem ‚implizitem<br />
Gemeinlastprinzip’ in der umweltpolitischen Praxis eine durchaus große Rolle zu (vgl. Thöne 2000).
82 Kapitel 5<br />
die Privatnützigkeit aber auch völlig aufheben kann 56 . Darüber hinaus hat der Gesetzgeber<br />
weitgehende Möglichkeiten, ‚Inhalt und Schranken’ des Eigentums zu bestimmen.<br />
Schranken bzgl. der landwirtschaftlichen Nutzung (der Eigentumsrechte) hat der Gesetzgeber<br />
z. B. im Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) und auch im neuen Bundesnaturschutzgesetz<br />
(BNatSchG) durch Vorschriften zur „Guten fachlichen Praxis der Landwirtschaft“ (§ 17<br />
BBodSchG als Konkretisierung von § 7 bzw. § 5 BNatSchG) eingeführt. Es ist aber gerade für<br />
die Nichtjuristen darauf hinzuweisen, dass derartige ‚ökologische Schranken’ oftmals weit davon<br />
entfernt sind, direkt operativ in dem Sinne zu sein, dass man unmittelbare Verpflichtungen<br />
daraus ableiten kann. So weist (Lübbe-Wolff 2000) darauf hin, dass § 7 BBodSchG für die<br />
Eigentümer, Besitzer und Bearbeiter von Grundstücken zwar eine allgemeine Verpflichtung<br />
statuiert, Vorsorge gegen die Entstehung schädlicher Bodenveränderungen zu treffen, die<br />
Konsequenzen jedoch sehr bescheiden sind. „Wer dies unbefangen liest, wird meinen, damit sei<br />
eine umfassende, durchsetzbare Rechtspflicht zu vorsorgendem Bodenschutz geschaffen. Dass<br />
diese Verpflichtung z. B. der Landwirtschaft als dem größten Verursacher problematischer<br />
Bodenveränderungen nur im Wege der Beratung nahe gebracht werden soll, der Sache nach<br />
insoweit also gar keine rechtliche Verpflichtung, sondern nur ein guter Rat verankert ist, kann<br />
der fortgeschrittene Jurist aus einem späteren Gesetzesabschnitt über die landwirtschaftliche<br />
Bodennutzung und dessen Vergleich mit anderen, besser instrumentierten Teilen des Gesetzes<br />
entnehmen. Die Verpflichtungsrhetorik des § 7 hat damit in weiten Teilen nur symbolischen<br />
Charakter: Sie ist Bestandteil eines showbusiness, mit dem der Gesetzgeber dem Bürger (und,<br />
diesen Eindruck wird man nicht los, ein Stück weit auch sich selbst) den Eindruck des<br />
Wohlgeordneten zu verschaffen sucht“ (ebd.). Da verwundert es wenig, dass Anforderungen aus<br />
dem BBodSchG keine Rolle bei der Beschreibung der Kriterien der Guten fachlichen Praxis zur<br />
Abgrenzung von honorierungswürdigen ökologischen Leistungen der Landwirtschaft im<br />
Rahmen der Verordnung VO (EG) 1257/1999 gespielt haben (vgl. Kap. 7.2.2.2 sowie Anlage A-<br />
1 im Anhang).<br />
Die verfassungsrechtlichen Bestimmungen bzgl. möglicher Distribution der Eigentumsrechte<br />
spielen für die Honorierung ökologischer Leistungen der Landwirtschaft eine außerordentliche<br />
Rolle, da hiermit die Grenze zwischen honorierungswürdigen Leistungen (Voraussetzung von<br />
privaten Eigentumsrechten an ökologischen Gütern) und der Ökologiepflichtigkeit (bestimmt<br />
durch Regeln des Gemeineigentums) gezogen wird. Die durchaus schwierigen und teilweise<br />
56 vgl. BVerfGE 58, 300 – Nassauskiesungsbeschluss
Eigentumsrechte als Voraussetzung für die Honorierung ökologischer Leistungen 83<br />
ungeklärten Fragen, die damit bis heute verbunden sind, sollen daher an dieser Stelle<br />
detailliertere Betrachtung finden. Es verbergen sich unter der Oberfläche eigentumsrechtlicher<br />
Gemeinplätze ungelöste Probleme (Breuer 1999: 167).<br />
Abbildung 14 stellt die im Folgenden beschriebenen Distributionsentscheidungen a) bis c) im<br />
Überblick dar.<br />
Distribution verfassungsrechtlich begründet<br />
Distribution politisch<br />
begründet (gebilligt)<br />
Situationsgebundenes Eigentum an ökologischen Gütern<br />
Art. 14 Abs. 1 S. 1 GG<br />
de jure<br />
Privateigentum<br />
z.B.<br />
§ 39<br />
HeNatG<br />
„eingeschränktes“<br />
de jure<br />
Privateigentum<br />
de jure Gemeineigentum<br />
z.B.<br />
§ 71 IV<br />
BbgNat<br />
SchG<br />
.<br />
„eingeschränktes“<br />
de facto Privateigentum/<br />
de jure Gemeineigentum<br />
Art. 14<br />
Abs. 1<br />
S. 2/<br />
Abs. 2<br />
GG<br />
de jure Gemeineigentum<br />
de jure<br />
Gemeineigentum<br />
Abbildung 14: Distributionsentscheidungen im Zuge der Verteilung der Eigentumsrechte an ökologischen<br />
Gütern nach deutschem Recht<br />
a) Distributionsentscheidung ‚Sozialpflichtigkeit’<br />
Der Verfassung lässt sich keine Verpflichtung entnehmen, dem ökonomischen Effizienzziel<br />
Rechnung zu tragen (Eidenmüller 1995: 445). „Andererseits setzt die Verfassung einer<br />
derartigen Rechtspolitik aber auch nur in begrenztem Maße Schranken. Abgesehen von<br />
unverhältnismäßigen Eingriffen in höchstpersönliche Rechtsgüter, besitzt der Gesetzgeber einen
84 Kapitel 5<br />
relativ weiten Spielraum, wenn es darum geht, Rechtsnormen nach ökonomischen<br />
Gesichtspunkten zu gestalten“ (ebd.: 449).<br />
„Der Inhalt des Eigentums kann nicht beliebig definiert oder reduziert werden. Als<br />
Schutzgegenstand des Rechtsinstitutes sowie des Grundrechts nach Artikel 14 Abs. 1 Satz 1 GG<br />
muss das Eigentum ein verfassungsfestes Mindestmaß an Nutzungs- und Verfügungsfreiheit und<br />
an Privatnützigkeit behalten“ (Breuer 1999: 167). Wird dieses verfassungsfeste Mindestmaß<br />
eingeschränkt, handelt es sich um Enteignung. Distributionskriterium für die Aufteilung von<br />
Privateigentum und Gemeineigentum ist die Sozialpflichtigkeit bzw. Ökologiepflichtigkeit.<br />
Einschränkungen des Privateigentums halten sich im Rahmen der Sozialbindung, wenn ein<br />
vernünftiger und einsichtiger Eigentümer diese von sich aus mit Rücksicht auf die gegebene<br />
Situation hinnehmen würde 57 . Die Sozialbindung von Grundstücken ergibt sich aus ihrem<br />
Zustand und ihrer Lage im Verhältnis zur Umgebung. Die privaten Nutzungsmöglichkeiten<br />
(Eigentumsrechte) müssen sich an der jeweiligen ‚Lage’, seiner ‚Situation’ und den daraus<br />
resultierenden Interessen orientieren. Die ‚Situationsgebundenheit’ eines Grundstücks bildet den<br />
Grad der Inhalts- und Schrankenbestimmungen nach Artikel 14 Abs. 1 S. 2 GG und der<br />
Gemeinwohlverpflichtung nach Artikel 14 Abs. 2 GG (Louis 1999: 186). „Auf jedem<br />
Grundstück lasten gleichsam aus seiner Situationsgebundenheit abzuleitende immanente<br />
Beschränkungen der Rechte des Eigentümers, aus denen sich die Schranken seiner Nutzungs-<br />
und Verfügungsmacht ergeben. Eine situationsbedingte Belastung des Grundstücks kann<br />
angenommen werden, wenn ein – als Leitbild gedachter – vernünftiger und einsichtiger<br />
Eigentümer, der das Wohl der Allgemeinheit nicht aus den Augen verliert, von sich aus von der<br />
geplanten Nutzung absehen würde“ 58 . Sozialbindung des Eigentums stellt keinen<br />
„subsumtionsfähigen verfassungsrechtlichen Tatbestand dar, sondern ist die Umschreibung einer<br />
Aufgabe an den Gesetzgeber“ (Osterloh 1991: 910). Mit welchen juristischen und<br />
administrativen Instrumenten und mit welcher Tarierung der konfligierenden Rechte und<br />
Pflichten die gebotene Balance zwischen Privateigentum und Schaffung von Gemeineigentum<br />
hergestellt wird, ist grundsätzlich dem parlamentarischen Gesetzgeber überlassen (Breuer 1999:<br />
172).<br />
57 BGH, NVwZ 1984, 819<br />
58 BGH, NVwZ 1984, 819, 821; NuR 1989, 407; OLG Celle, U. v. 21.4.1989
Eigentumsrechte als Voraussetzung für die Honorierung ökologischer Leistungen 85<br />
Eine Naturschutzgebietsverordnung, die die Nutzbarkeit eines Grundstücks situationsbedingt<br />
einschränkt, ist keine Enteignung im Sinne des Artikel 14 Abs. 3 GG, sondern eine Bestimmung<br />
von Inhalt und Schranken des Eigentums im Sinne des Artikel 14 Abs. 1 S. 2 (vgl. Breuer 1999).<br />
Obwohl Nutzungsbeschränkungen auf der Grundlage des Naturschutzes grundsätzlich zulässige<br />
Inhaltsbestimmungen des Eigentums darstellen, muss es im Einzelfall bei unzumutbarer<br />
Belastung zu einer Entschädigung kommen 59 (Hötzel 1994, Kimminich 1994). Damit kommen<br />
wir zu den ausgleichspflichtigen Inhalts- und Schrankenbestimmungen.<br />
b) Distributionsentscheidung ‚Verhältnismäßigkeit’<br />
Schranken des Privateigentums bestimmen das Gemeineigentum. Auch dieses ist<br />
verfassungsrechtlich gesichert (Art. 14 Abs. 1 Satz 2 GG). Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch<br />
soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen (Art. 14 Abs. GG). Wird durch diese<br />
Schranken, durch die Schaffung von Gemeineigentum, unverhältnismäßig in Privateigentum<br />
eingegriffen, kann der Gesetzgeber dazu veranlasst werden, eine finanzielle Entschädigung zu<br />
gewähren. „Damit ist die problematische Rechtsfigur der so genannten ausgleichspflichtigen<br />
Inhaltsbestimmung ins Spiel gebracht“ (Breuer 1999: 156). Derartige gesetzliche<br />
Entschädigungsansprüche, die dem Verhältnismäßigkeitsausgleich dienen, sind nach Meinung<br />
des BVerwG keine vermögensrechtlichen Ansprüche aus Aufopferung für das gemeine Wohl 60<br />
(ebd.).<br />
Der ökonomische Blick auf das Problem kann so interpretiert werden, dass aus<br />
verfassungsrechtlicher Sicht der Gemeinschaft zugeteiltes Eigentum in Privateigentum<br />
umverteilt wird (Distributionsentscheidung), für eine effiziente Allokation jedoch<br />
Gemeineigentum notwendig ist, also eine Änderung des absoluten Privateigentums notwendig<br />
wird (vgl. Kap. 5.5). Distributions- und Allokationsentscheidung fallen hier zusammen 61 . Man<br />
könnte diese ‚Zwitterform’ als ‚eingeschränktes’ Privateigentum bezeichnen. Das<br />
Distributionskriterium für derartiges Privateigentum ist die Verhältnismäßigkeit. Erst wenn<br />
durch die verfassungsrechtliche Zuweisung von Eigentum an die Gemeinschaft dem betroffenen<br />
59 BGHZ 125, 242, BVerwGE 94, 1<br />
60 BVerwGE 94, 1 (7 f.).<br />
61 Zur Rolle des Verhältnismäßigkeitsprinzips als ‚Brücke’ zwischen Recht und Ökonomik vgl. z. B. Ewringmann<br />
(1999: 400): „Der Zweckrationalität, die in der Ökonomik als nutzenmaximierende Ressourcen- und<br />
Güterverteilung, als kostenminimale Zielerreichung oder einfach als Effizienz zum Ausdruck gebracht wird,<br />
entspricht nämlich im Recht weitgehend die Verhältnismäßigkeit mit ihren Teilkriterien.“ (vgl. auch Koenig 1994)
86 Kapitel 5<br />
Privaten ein „Sonderopfer“ abverlangt wird, das eine erhebliche Belastung darstellt, muss eine<br />
Umverteilung erfolgen (vgl. Czybulka 1999: 9). Alle Bundesländer haben Regelungen zu den<br />
Inhalts- und Schrankenbestimmungen des Eigentums in ihren Gesetzen (vgl. Tabelle A-1 im<br />
Anhang).<br />
Vorgebrachte Kritik an dieser ‚Rechtsfigur’ lautet, dass eine gesetzliche Inhalts- und<br />
Schrankenbestimmung, welche die Sozialpflichtigkeit des Eigentums in eine vollziehbare<br />
Rechtsgestalt gießt und dadurch aktualisiert, dem Eigentümer nicht abgekauft zu werden braucht<br />
(Breuer 1999: 173). (Breuer erkennt also nur die Distributionsentscheidung aufgrund der<br />
Ökologiepflichtigkeit an.) Die Figur der ausgleichspflichtigen Inhaltsbestimmung weckt die<br />
Fehlvorstellung, dass die gesetzliche Inhalts- und Schrankenbestimmung des Eigentums jenseits<br />
einer gewissen Opferschwelle im Ergebnis ebenso oder ähnlich wie eine Enteignung<br />
entschädigungspflichtig sei. Verfassungsrechtlich trifft dies nicht zu (ebd.).<br />
c) Distributionsentscheidung ‚Erschwernis-/Härteausgleich’<br />
Neben diesen rechtlich obligatorischen Distributionsentscheidungen kommt es in den letzten<br />
Jahren gerade im Bereich Landwirtschaft und Naturschutz noch zu einer ‚politisch gebilligten’<br />
Änderung der rechtlich abgesicherten Distribution. Es handelt sich dabei um so genannten<br />
Erschwernis- oder Härteausgleich. Die Umverteilung baut auf Ermessensvorschriften auf, die<br />
keinen Rechtsanspruch der Landwirte auf Ausgleichszahlungen begründen. Als Grenze für<br />
mögliche Zahlungen wird oft die so genannte ‚Gute fachliche Praxis’ im Sinne der<br />
allgemeinverbindlichen Regelungen in Gesetzen (z. B. PflSchG, BBodSchG) als Referenzwert<br />
genutzt. Einschränkungen des Privateigentums, die z. B. in Naturschutzgebieten oberhalb der<br />
Guten fachlichen Praxis liegen, können unter bestimmten Voraussetzungen ausgeglichen<br />
werden. Es wird damit die Situationsgebundenheit ausgehebelt. Auf die Probleme, die mit dieser<br />
Rechtsfigur in Zusammenhang stehen, wird ausführlich in Kapitel 7.2.2.2 eingegangen.<br />
Eine erneute Betrachtung im Lichte der ökonomischen Eigentumsrechte lässt erkennen, dass<br />
dabei eine de facto Umverteilung von Gemeineigentum in Privateigentum unter bestimmten<br />
Voraussetzungen und in Abhängigkeit von Haushaltsmitteln vorgenommen wird. Dabei erfolgt<br />
die (diesmal nur politisch gebilligte) Umverteilung wie bei den ausgleichspflichtigen Inhalts-<br />
und Schrankenbestimmungen mit der Auflage, die de facto Eigentumsrechte der Gemeinschaft<br />
wieder zu verkaufen.<br />
Mehrere Bundesländer sehen die Möglichkeit entsprechender Umverteilungen vor, z. B. Bayern,<br />
Brandenburg und Niedersachsen (vgl. Tabelle A-1 im Anhang). Ein genereller Vorrang des
Eigentumsrechte als Voraussetzung für die Honorierung ökologischer Leistungen 87<br />
Vertragsnaturschutzes, wie ihn Sachsen vorsieht (§ 39 SächsNatSchG), ist ebenfalls hier<br />
einzuordnen. Politisch begründet werden diese Zahlungen mit der Multifunktionalität der<br />
Landwirtschaft, aber auch mit der besonderen Bindung der Landwirtschaft an die Fläche.<br />
Gewarnt wird in diesem Zusammenhang davor, dass dieser Billigkeitsausgleich möglicherweise<br />
auf Dauer die Rechtssprechung beeinflussen wird (Czybulka 1999: 9).<br />
Ein weiteres Problem, das mit derartigen Billigkeitszahlungen in Verbindung steht, ist die<br />
Verdrängung von intrinsischen Motivationen im Sinne von Umweltmoral bzgl. des<br />
Umweltschutzes. Recht ist in der Lage, Präferenzen der Individuen zu verändern (Engel 2001:<br />
7ff.) 62 . Dieses positive Potential des Rechtes kann jedoch durch den Einsatz von extrinsisch<br />
motivierenden Maßnahmen, wie z. B. ökonomische Anreize, verdrängt oder gar zerstört<br />
werden 63 . Neben der Änderung von Präferenzen kann auch die Möglichkeit des Rechts<br />
Gerechtigkeitsvorstellungen zu verändern, indem es direkt an die soziale Identität appelliert<br />
(ebd.), durch ökonomische Anreize abgeschwächt werden.<br />
Akzeptanz von Rechtsnormen aufgrund der Legitimation 64 kann durch zusätzliche extrinsische<br />
Maßnahmen gefährdet sein. Akzeptiert wird dann nur das, was bezahlt wird. Daraus kann sich<br />
eine Subventionsmentalität bilden, wie sie teilweise der Landwirtschaft vorgeworfen wird (vgl.<br />
Kap. 7.2.2.2).<br />
5.6.2.2 Typisierung von positiven ökonomischen Anreizen entsprechend der<br />
zugewiesenen Eigentumsrechte<br />
In welchem Zusammenhang stehen Distributionsentscheidungen und die Honorierung<br />
ökologischer Leistungen (der Landwirtschaft)? In Kapitel 4.1 wurde aufgezeigt, dass eine<br />
Honorierung ökologischer Leistungen daran geknüpft ist, dass die Eigentumsrechte beim<br />
62 Es kommt gar nicht selten vor, dass Normen, ökonomisch gesprochen, die Präferenzen ihrer Adressaten<br />
verändern, wenn es der Norm gelingt, den Adressaten zu überzeugen. Die abstrakte Regel wird in einem zweiten,<br />
rechtsstaatlichen Verfahren angewendet. In diesem Verfahren tritt die Rechtsordnung in den offenen Diskurs mit<br />
dem Adressaten, der zu veränderten Präferenzen führen kann (ausführlich in Engel 2001: 7). Darüber hinaus führt<br />
der Abbau von kognitiver Dissonanz zur Änderung von Präferenzen. Wenn sich der Normadressat der Norm nicht<br />
entziehen kann, ist die Anpassung der Präferenzen ein Mittel, das Selbstwertgefühl zu stabilisieren (vgl. Engel 2001<br />
mit weiteren Literaturangaben).<br />
63 zum Verdrängen oder Zerstören von intrinsischer Motivation durch extrinsische Maßnahmen siehe Frey 1992,<br />
1997, Frey & Busenhart 1995, Weck-Hannemann 1999; zur Relativierung der Bedeutung von Verdrängung<br />
intrinsischer Werte aber auch Kirchgässner 1999<br />
64 Der Adressat der Norm befolgt diese, obwohl er an seinen abweichenden Präferenzen und<br />
Gerechtigkeitsvorstellungen festhält. Er akzeptiert den Normbefehl, weil er die Norm für einen legitimen Akt<br />
staatlicher Herrschaft hält (Engel 2001: 8).
88 Kapitel 5<br />
Leistungsempfänger liegen. Es muss privates Eigentum am ökologischen Gut vorliegen. Darüber<br />
hinaus kann unterschieden werden, ob die Änderung der Eigentumsrechte durch freiwillige<br />
Transaktion erfolgt, absolute Eigentumsrechte also mit Hilfe von relativen Eigentumsrechten<br />
getauscht werden (‚Vertragsnaturschutz’), oder ob die Transaktion im Sinne der beschriebenen<br />
Änderung der absoluten Eigentumsrechte hoheitlich erzwungen wird, weil der Markt zur<br />
Organisation einer effizienten Allokation der Eigentumsrechte ausfällt (Entschädigung). Dies<br />
kann gerade im Fall effizienter Allokation ökologischer Güter notwendig sein.<br />
Im Rahmen dieser Arbeit werden alle Zahlungen für Transaktionen von privaten<br />
Verfügungsrechten an ökologischen Gütern als Honorierung ökologischer Leistungen<br />
bezeichnet, unabhängig von der Organisationsform (Markt oder gesellschaftliche Regeln). Damit<br />
werden in dieser Arbeit Transaktionen von Rechten an ökologischen Gütern durch die Schaffung<br />
und Durchsetzung von relativen Eigentumsrechten (‚Vertragsnaturschutz’) sowie hoheitlich<br />
erzwungene Änderungen von absoluten privaten Eigentumsrechten als Honorierung<br />
ökologischer Leistungen definiert.<br />
Zahlungen im Rahmen des Erschwernis- und Härteausgleichs sind demnach keine Honorierung<br />
ökologischer Leistungen, da der Zahlungsbezieher kein absolutes Privateigentum an den Gütern<br />
besitzt. Derartige Zahlungen stellen Subventionen im Sinne der Typisierung in Abbildung 3 dar.<br />
Würde jede politische Billigung einer Zahlung als Änderung der de jure Eigentumsrechte gelten,<br />
wäre jede Subvention gerechtfertigt. Das Verursacherprinzip wäre nicht anwendbar.<br />
Abbildung 15 stellt die unterschiedlichen Typen von Zahlungen für die Erbringung ökologischer<br />
Leistungen entsprechend der Eigentumsrechte an ökologischen Gütern und in Abhängigkeit der<br />
Organisation der Transaktion im Überblick dar. Eine effiziente Allokation der ökologischen<br />
Güter kann, wie in Kapitel 5.3 ausführlich beschrieben, durch zwei Organisationsformen<br />
geregelt werden, den Markt, als in unserer liberalen Gesellschaft präferierten, und den Staat, der<br />
gemeinschaftliche Regeln aufstellt, die bei Marktversagen notwendig sind. Alle Zahlungen für<br />
ökologische Leistungen, unabhängig der für die Transaktion notwendigen Organisationsform<br />
(freiwillig oder erzwungen), werden als Honorierung ökologischer Leistungen betrachtet.
Rationalisierte Umweltziele als Ansatzstelle für die Honorierung ökologischer Leistungen 89<br />
...wird durch Schaffung und<br />
Durchsetzung relativer<br />
Eigentumsrechte gewährleistet<br />
de jure Privateigentum<br />
am ökologischen Gut<br />
Artikel 14 Abs. 1 S. 1 GG<br />
Agrarumweltmaßnahmen<br />
Abbildung 15: Typen der Zahlungen für ökologische Leistungen entsprechend der Eigentumsrechte und in<br />
Abhängigkeit der Allokationsform<br />
Für die Ausgestaltung der Honorierung ökologischer Leistungen der Landwirtschaft ist die<br />
formalrechtliche Unterscheidung von Entschädigung aus Enteignung und Entschädigung<br />
aufgrund der Verhältnismäßigkeit bei Inhalts- und Schrankenbestimmungen des Eigentums von<br />
großer Bedeutung. Eine Enteignung nach Artikel 14 Abs. 3 GG darf nur durch Gesetz oder<br />
aufgrund eines Gesetzes erfolgen, das zugleich Art und Ausmaß der Entschädigung regelt<br />
(Junktimklausel). Für eine Inhalts- und Schrankenbestimmung gilt die Junktimklausel nicht; die<br />
Regelungen über die erforderliche Ausgleichspflicht sind nicht an Artikel 14 Abs. 3 GG zu<br />
messen 65 (Louis 1999: 179 f.). Dies gewährt für die Honorierung ökologischer Leistungen der<br />
Landwirtschaft im Sinne von ausgleichspflichtiger Inhalts- und Schrankenbestimmungen Raum<br />
für neue Gestaltungsmöglichkeiten der Transaktion.<br />
65 BGH, UPR 1992, 232<br />
„eingeschränktes“<br />
de jure Privateigentum<br />
am ökologischen Gut<br />
(ausgleichspflichtiges<br />
Gemeineigentum)<br />
Entschädigung<br />
Honorierung ökologischer Leistungen<br />
...wird über Änderung absoluter Eigentumsrechte gewährleistet<br />
„eingeschränktes“<br />
gebilligtes de facto<br />
Privateigentum am<br />
ökologischen Gut<br />
(de jure Gemeineigentum)<br />
Erschwernis-/<br />
Härteausgleich<br />
Subventionen<br />
de jure<br />
Gemeineigentum am<br />
ökologischen Gut<br />
Artikel 14 Abs. 1 S. 2 GG
90 Kapitel 6<br />
6 Rationalisierte Umweltziele als Ansatzstelle für die Honorierung ökologischer<br />
Leistungen<br />
6.1 Definition und Bedeutung rationalisierter Umweltziele<br />
Ohne präzise, quantifizierte und messbare Ziele ist der Versuch, das Leitbild einer Nachhaltigen<br />
Entwicklung in die gesellschaftliche Realität der Bundesrepublik Deutschland umzusetzen, zum<br />
Scheitern verurteilt (vgl. UBA 1997a: 32, Barth & Köck (Hrsg.) 1997).<br />
Umweltziele stellen im ökonomischen Sinne Stellvertreter einer sich über den Markt nicht<br />
äußernden individuellen Nachfrage dar (vgl. Kap. 5). Der Ruf nach Leitbildern und daraus<br />
abgeleiteten Umweltzielen in den letzten Jahren, besonders im Bereich des klassischen<br />
Naturschutzes, ergibt sich im ökonomischen Verständnis aufgrund des Marktversagens im<br />
Bereich der ökologischen Güter. Die Notwendigkeit der Zielentwicklung kann ökonomisch<br />
begründet werden und sollte nicht als Planungs- oder Regulierungswut der heutigen Gesellschaft<br />
missverstanden werden. Gesellschaftliche Ziele sind immer dort notwendig, wo die individuelle<br />
Nachfrage über den Markt nicht die aktuellen Präferenzen der Gesellschaft (Normen<br />
eingeschlossen) widerspiegelt (widerspiegeln kann), wo Kollektiventscheidungen notwendig<br />
sind 66 .<br />
Mit dem Eingeständnis, dass wirtschaftliche Entwicklung der maßgebliche Motor für die<br />
Entwicklung der Natur- und Kulturlandschaft ist 67 , dass z. B. der aus heutiger Sicht positive<br />
Einfluss der Landwirtschaft im Hinblick auf die Artenvielfalt in der Kulturlandschaft im letzten<br />
Jahrhundert Nebenprodukt einer nach Effizienz strebenden Landwirtschaft war, kann daraus die<br />
Schlussfolgerung gezogen werden, Umweltprobleme müssen als ökonomische Probleme<br />
wahrgenommen und gelöst werden, Naturkapital muss ökonomisches Entscheidungskriterium<br />
werden. Das Primat des Ökonomischen (Adam 1996) ist lediglich das Primat zweckrationaler<br />
Entscheidungen im Sinne des methodologischen Individualismus. Auf das Primat des<br />
Ökonomischen kann es nur eine Antwort geben: Es müssen inhaltlich fassbare Typen von<br />
66 „Oft müssen alle etwas Unterschiedliches tun – einer muss eine Feuchtwiese mähen, ein anderer einen Wald<br />
naturnah bewirtschaften usw. – dies gelingt nur nach einem gemeinsamen, vorher gefassten Plan. Wir sahen<br />
wiederholt, dass Kollektivanstrengungen und Pläne dem Prinzip des Individualismus keineswegs entgegenstehen<br />
müssen. ... Die Antithese zur Individualität ist nicht die Kollektivität, sondern die Despotie, die Ausnutzung<br />
kollektiver Arrangements zum Zwecke der Machtausübung, die ungerechtfertigten Einschränkungen des freien<br />
Willens anderer“ (Hampicke 1992: 384).<br />
67 „Wir versuchen erst seit vergleichsweise kurzer Zeit, die Entwicklung zukünftiger Landschaften durch Gedanken<br />
des Natur- und Umweltschutzes zu beeinflussen und können dabei mit wachsenden Kenntnissen über ökologische<br />
Zusammenhänge zwar immer präziser Aussagen zu Chancen der Potentialförderung und Störungsminderung treffen,<br />
dieses Wissen stellt aber im besten Fall ein flexibles Gegengewicht dar; den Umfang der Realisierung bestimmten<br />
vor allem ökonomische Voraussetzungen und politische Strukturen“ (Roweck 1996: 137).
Rationalisierte Umweltziele als Ansatzstelle für die Honorierung ökologischer Leistungen 91<br />
Naturkapital (vgl. Ott 2001) in Form von ökologischen Gütern wenigstens ansatzweise positiv<br />
bestimmt werden. Die ökologischen Güter sind quasi die Grundeinheit einer Nachhaltigen<br />
Entwicklung. In dieser Grundeinheit findet eine Verknüpfung der drei Säulen der Nachhaltigkeit<br />
‚Ökologie’, ‚Ökonomie’ und ‚Soziales’ statt (vgl. Kap. 5.2). Die pessimistische Ausrichtung auf<br />
die „Spielräume“ 68 , die die wirtschaftliche Entwicklung dem Naturschutz überlässt, lässt Natur-<br />
und Umweltschutz in der reaktiven Rolle verbleiben. Der Natur- und Umweltschutz hat im<br />
ökonomischen Sinne (vgl. Internalisierungsansatz bzw. öffentliche Güter) weitaus bessere<br />
Argumente und sollte sich nicht mit dem ‚Lückenfüller’ zufrieden geben. In Kapitel 3.1.3 wurde<br />
vielmehr gezeigt, dass die Ökonomie im Sinne des Standard-Preis-Ansatzes auf das ‚Primat’<br />
anderer Disziplinen angewiesen ist. „Rationale Umweltsteuerung setzt also zunächst ganz<br />
allgemein voraus, dass umweltschützender Staatsinterventionismus auf bestimmte<br />
gesellschaftliche Zielvorstellungen des Umweltressourcengebrauchs ausgerichtet werden kann,<br />
kurz: dass operationale Zielgrößen der Steuerung überhaupt existieren“ (Gawel 1999: 243 f.).<br />
„Unter Operationalisierung versteht man die Übersetzung von theoretischen Konstrukten in<br />
Beobachtungsbegriffe, wir ersetzen also etwas, was wir nicht beobachten können, durch etwas,<br />
was unseren Sinnen oder unseren Messgeräten zugänglich ist“ (Romahn 2003: 183).<br />
Rationalisierte Ziele stellen operationalisierte ‚vernünftige’ Ziele (normative Vorgaben) dar, die<br />
den Zweck einer Ziel-Mittel-Rationalität erfüllen. Zweckrationalität wird mit ökonomischen,<br />
aber auch mit ordnungsrechtlichen Instrumenten verfolgt. „Ökonomik und Rechtswissenschaft<br />
folgen gleichermaßen einem Konzept der Zweckrationalität. Unterschiedliche Beurteilungen von<br />
umweltpolitischen Instrumenten aus ökonomischer und rechtlicher Sicht müssen daher entweder<br />
auf unterschiedlichen Zielen bzw. Zwecken beruhen oder aber auf unterschiedliche Hypothesen<br />
über instrumentelle Wirkungen zurückzuführen sein“ (Ewringmann 1999: 399). Der Zweck<br />
bestimmt die Anforderungen, die rationale Ziele erfüllen müssen. Die Rationalisierbarkeit der<br />
Ziele bestimmt umgekehrt den Zweck, den diese erfüllen können. Genau dieser Dualismus muss<br />
bei der Entwicklung von Mitteln (Instrumenten) zur Erreichung von Zielen Beachtung finden.<br />
Die einzelnen umweltpolitischen Instrumente weisen eine „höchst unterschiedliche Zielreferenz“<br />
auf (Gawel 1999: 249).<br />
68 „Wenn der Umfang des Machbaren ohnehin nur wenig von den Ereignissen ökologischer Forschung abhängt,<br />
macht es Sinn, auch unsere Bewertungssysteme auszurichten auf eine maximale Nutzung der sich durch wechselnde<br />
ökonomische Rahmenbedingungen auftuenden Spielräume. Wenn Naturschutz im Wesentlichen als Lückenfüller<br />
agiert, dann sollte dies wenigstens auf eine Art und Weise geschehen, bei der zur Verfügung stehende Freiräume<br />
maximal genutzt werden können“ (Roweck 1996: 137).
92 Kapitel 6<br />
Die Honorierung ökologischer Leistungen als ökonomisches Instrument bedarf einer<br />
Rationalisierung im Sinne einer strikten Ziel-Mittel-Orientierung (Gawel 1999). Das<br />
Anspruchsniveau umweltökonomischer Instrumente, wie der Honorierung ökologischer<br />
Leistungen, ist faktisch höher als z. B. beim Ordnungsrecht (vgl. zur umweltpolitischen<br />
Mengensteuerung Maier-Rigaud 1994: 17). Es müssen verbindliche substitutionale<br />
Zielstrukturen geschaffen werden, die es gestatten würden, „bei der Mikroallokation<br />
definitionsgemäß alles zuzulassen, was nur per Saldo mit der Zielbedingung vereinbar ist“<br />
(Gawel 1999: 245) (vgl. Kap. 6.3.4) 69 . Ordnungsrecht kann sich unbestimmter Rechtsbegriffe<br />
bedienen und damit formal regeln. Die Spezifizierung wird an die untergesetzliche Ebene<br />
weitergeleitet bzw. von einer Einzelfallentscheidung abhängig gemacht. Einzelfallentschei-<br />
dungen haben den Vorteil, dass man in vielen Fällen erst auf der Objektebene der Komplexität<br />
ökologischer Systeme, der regionalen oder sogar lokalen naturräumlichen Vielfalt, gerecht<br />
werden kann. Einschränkend muss jedoch auch berücksichtigt werden, dass damit in vielen<br />
Fällen lediglich der Schein des ‚Geregelten’ aufgebaut, Recht geschaffen, aber aufgrund der<br />
Unbestimmtheit teilweise nicht vollzogen wird (vgl. dazu auch ‚Symbolisches Umweltrecht’<br />
Lübbe-Wolff 2000). Denn mit dem Rückgriff auf unbestimmte Rechtsbegriffe ist gerade noch<br />
nicht der Schritt zu positivem Recht vollzogen. Umweltgesetze werden fast immer erst durch<br />
Umweltstandards vollzugsreif. Vor allem unbestimmte Rechtsbegriffe, die den<br />
aufrechtzuerhaltenden oder anzustrebenden Umweltzustand umschreiben, sind ohne solche<br />
Konkretisierung nicht handhabbar. Deshalb kommt es entscheidend darauf an, von wem und in<br />
welchem Verfahren etwa technische Regeln, Grenzwerte, Messverfahren festgelegt werden<br />
(Salzwedel 1987, zu Grenzwerten grundlegend Winter (Hrsg.) 1986). Für den Naturschutz wies<br />
Czybulka (2000: 17) darauf hin, dass nur das gut geschützt werden kann, was gut definiert ist.<br />
Während im Ordnungsrecht also mit Hilfe unbestimmter Rechtsbegriffe formal eine Steuerung<br />
erfolgen kann, sind für die Anwendung ökonomischer Instrumente verbindliche substitutionale<br />
Zieldefinitionen erforderlich. Die Zieleinhaltung selbst garantiert dann annahmegemäß auch<br />
zugleich ökologische Effektivität (vgl. Gawel 1999). Ist z. B. das umweltpolitische Ziel eine<br />
Verminderung der Emission von Stickstoff um 50 % in einem definierten Honorierungsgebiet, so<br />
darf es für die Effektivität (ökologische Wirkung) keinen Unterschied machen, wo die Emission<br />
verringert wird. Die möglichen Allokationen müssen einander ökologisch äquivalent sein und<br />
69 Bei ökonomischen Instrumenten, wie der Honorierung ökologischer Leistungen, sind abschließende Verträge<br />
notwendige und keine relationalen Verträge (vgl. zu relationalen Verträgen, in denen lediglich die „Beherrschung<br />
und Überwachung“ von Vertragsbeziehungen geregelt werden, Williamson 1990: 36).
Rationalisierte Umweltziele als Ansatzstelle für die Honorierung ökologischer Leistungen 93<br />
dies in räumlicher, zeitlicher und sachlicher Dimension (vgl. u. a Michaelis 1996, SRU 1994,<br />
Huckestein 1993).<br />
Derart rationalisierte Ziele, die eine Ziel-Mittel-Orientierung erlauben, haben Eigenschaften von<br />
Indikatoren im Sinne von Umweltindikatoren.<br />
In dieser Arbeit wird folgende Definition von rationalisierten Umweltzielen verwendet:<br />
Umweltziele. Die Agrarumweltindikatoren sind dabei repräsentative Mess- und Kenngrößen von<br />
Qualitätszielen der durch die agrarische Nutzung modifizierten Umwelt, die rationales Handeln<br />
ermöglichen. Das Umweltziel ist das Indikandum (Sinn des Indikators), der Zweck der<br />
Indikatoren ist die Verbindung von Ziel und Mittel zur Erreichung des Ziels.<br />
Das Problem der Rationalisierung von Umweltzielen spitzt sich im Bereich der Honorierung<br />
ökologischer Leistungen der Landwirtschaft auf die Entwicklung von Agrarumweltindikatoren<br />
zu, die rationales Handeln ermöglichen. Agrarumweltindikatoren im hier diskutierten<br />
Zusammenhang sollen es ermöglichen, die angestrebte Allokation ökologischer Güter (nützliche<br />
Umweltziele) auf kürzestem Wege zu erreichen (zum zugrunde liegenden Verständnis von<br />
„rationalem Handeln“ vgl. Fechner, 1956: 98). Dies entspricht bei Erweiterung des<br />
Effizienzkriteriums um das Distributionskriterium der ‚Gerechtigkeit’ nicht nur dem<br />
‚ökonomischen’, sondern auch dem ‚juristischen’ Rationalitätsverständnis, wonach gesetzliche<br />
Regulierung dann rational ist, „wenn es ihr gelingt, die intendierten Ziele auf möglichst<br />
(ressourcen-)schonendem Wege zu erreichen und dabei der Gerechtigkeitsidee 70 zu entsprechen“<br />
(Führ 1999: 195). Als Voraussetzung für eine effiziente Allokation ökologischer Güter wurde in<br />
Kapitel 5 die Schaffung bzw. Änderung sowie die Durchsetzung von Eigentumsrechten<br />
diskutiert. Die hier diskutierten Agrarumweltindikatoren müssen demnach den Zweck der<br />
Schaffung und Durchsetzung von Eigentumsrechten erfüllen (vgl. Kap. 6.3.3). Die Zuweisung<br />
der Eigentumsrechte an ökologischen Gütern ermöglicht erst eine Einbeziehung dieser Güter in<br />
rationale Entscheidungen, ermöglicht eine „Investition in Naturkapital“ (vgl. Daly 1999).<br />
Der Ansatz, Umweltziele über eine ökonomische Integration zu realisieren, ist alles andere als<br />
neu. Vielmehr ist dieser Ansatz im Sinne des ‚Internalisierungskonzeptes’ in der Ökologischen<br />
70 Die Gerechtigkeitsidee im Einzelfall mit Leben zu füllen bedeutet „für den konkreten Regelungsbereich eine<br />
jeweils spezifische Balancierung zu suchen von Gleichheit und Gegenseitigkeit vor dem Hintergrund des Prinzips<br />
der Verallgemeinerung; mithin eine Balancierung jener Elemente, die Kant im kategorischen Imperativ<br />
zusammenführt (Führ 1999: 194, vgl. auch Hruschka 1987).
94 Kapitel 6<br />
Ökonomie aber auch in der Ressourcenökonomie im Zusammenhang mit der Nachhaltigen<br />
Entwicklung das zentrale Thema. Das Integrationskonzept hebt sich von dem so genannten<br />
Säulen-Modell (Umwelt, Soziales, Ökonomie) der Nachhaltigen Entwicklung ab (vgl. Enquete-<br />
Kommission „Schutz des Menschen und der Umwelt“ 1998). Als Fehler des Säulen-Modells<br />
kann angesehen werden, dass es die Ebene der eigentlichen Konzeptionalisierung überspringt.<br />
Dadurch ist es trotz seiner vordergründigen politischen Anschlussfähigkeit wohl auch für die<br />
Politik letztlich nur als rhetorische Mehrzweckfloskel im Dienste symbolischer Umweltpolitik<br />
(kritisch zur symbolischen Umweltpolitik Lübbe-Wolff 2000) attraktiv. Im ernsthaften<br />
politischen Geschäft ist es unklar, worin der Mehrwert der Nachhaltigkeitsidee gegenüber den<br />
etablierten Feldern der Wirtschafts-, Wissenschafts-, Sozial-, Bildungs- und Umweltpolitik<br />
sowie der Integration von Zielen im Rahmen der Ressortabstimmung liegt. Das Konzept öffnet<br />
der Beliebigkeit Tür und Tor. Die Säulen fungieren gleichsam wie „Wunschzettel“ (Brand &<br />
Jochum 2001: 75), in die unterschiedliche Akteure ihre Positionen und Interessen eintragen<br />
können (Ott 2002, SRU 2002a). In gleicher Richtung argumentiert der Rat von Sachverständigen<br />
für Umweltfragen, indem er kritisch anmerkt, dass die Nachhaltigkeitsidee untergraben werde,<br />
wenn die Idee jeweils in den drei Säulen Ökologie, Ökonomie und Soziales unabhängig<br />
voneinander realisiert werden soll (vgl. SRU 1994). Versteht man Nachhaltigkeit als eine Art<br />
von Dach, das von den diversen Säulen getragen wird, erhöht dies die Verwirrung nur (Ott<br />
2002). Maßgebende Indikatorensysteme für eine Nachhaltige Entwicklung setzen sich daher über<br />
die eindimensionale Zielsetzung ‚Ökonomie’, ‚Ökologie’ und ‚Soziales’ hinweg und bilden<br />
gezielt mehr als eine Dimension durch mehrere Indikatoren ab (vgl. UN 2001, Jörissen et al.<br />
1999). Schlüsselwort für das Gesamtkonzept der Nachhaltigkeit ist in den international<br />
ausschlaggebenden Dokumenten (Brundtland-Bericht, Agenda 21, UN-Indikatoren)<br />
„Integration“ und nicht „Kompromiss“ (vgl. Morosini et al. 2001b).<br />
Dass ein Integrationskonzept jedoch bei fehlender Möglichkeit der individuellen<br />
Präferenzermittlung auf eine Umweltzielqualifikation mit hohen Ansprüchen angewiesen ist,<br />
wird vielfach zu wenig diskutiert 71 . „Mit den Fragen, ob eine derartige Zielstruktur jeweils<br />
überhaupt existiert oder auch nur sinnvoll errichtet werden kann, hat sich die Ökonomik bisher<br />
freilich kaum auseinandergesetzt. Stattdessen werden entsprechende ‚Gegebenheiten’ für den<br />
Einsatz ökonomischer Modellinstrumente kurzerhand postuliert“ (Gawel 1999: 245). Dies ist<br />
71 Eingehender diskutiert wird hingegen im Rahmen der Umweltökonomie das Problem der Rationalisierung aus<br />
dem Blickwinkel der Politischen Ökonomie vgl. u.a. Endres & Finus 1997, Franke 1996, Kirsch 1997, Zimmermann<br />
2000.
Rationalisierte Umweltziele als Ansatzstelle für die Honorierung ökologischer Leistungen 95<br />
besonders verwunderlich, da das Fehlen derartiger quantifizierbarer Indikatoren im Sinne von<br />
rationalisierten Umweltzielen im Bereich des Ordnungsrechtes seit Jahrzehnten in der<br />
Rechtswissenschaft diskutiert wird (vgl. z. B. Breuer 2000).<br />
Von Seiten der ökosystemaren Forschung liegt in den Anforderungen, die rationalisierte<br />
Umweltziele erfüllen müssen, das größte Hindernis, das einer Internalisierung entgegensteht.<br />
Eine Nachhaltige Entwicklung in dem hier vertretenen Verständnis ist jedoch ohne rationalisierte<br />
Ziele nicht möglich. Den Anforderungen und damit verbundenen Problemen der<br />
Rationalisierung von Zielen im Sinne der Entwicklung der oben beschriebenen Indikatoren<br />
widmet sich Kapitel 6.3. Im Kapitel 8 wird anhand aktueller Beispiele demonstriert, dass eine<br />
Rationalisierung der Ziele und die Verknüpfung selbst mit ergebnisorientierten<br />
Honorierungsinstrumenten sowohl im biotischen als auch abiotischen Bereich möglich sind.<br />
6.2 Minimierungsstrategie als Alternative zur umweltzielorientierten Strategie<br />
6.2.1 Abgrenzung der Minimierungsstrategie von der umweltzielorientierten<br />
Strategie<br />
Eine Alternative zur umweltzielorientierten Strategie stellt die Minimierungsstrategie dar 72 (vgl.<br />
z. B. Roweck 1995). Im Weiteren soll der grundsätzliche Ansatz dieser Minimierungsstrategie<br />
diskutiert werden.<br />
Die Minimierungsstrategie unterscheidet sich von der umweltzielorientierten Strategie dadurch,<br />
dass kein Bezug zu Umweltzielen hergestellt wird. Bei der Minimierungsstrategie erfolgt eine<br />
Ausrichtung an Mitteln statt an Zielen (vgl. Rehbinder 1997: 313). Ansatzstelle der Steuerung<br />
sind keine Maßnahmen-Indikatoren sondern Maßnahmen. Damit entziehen sich<br />
Minimierungsmaßnahmen einer systematischen Erfolgskontrolle. Die Maßnahmen sind Ziel und<br />
zugleich Mittel. Der Erfolg muss als gegeben betrachtet werden, wenn die Maßnahme korrekt<br />
durchgeführt wurde. Eigentumsrechte setzen an Maßnahmen an.<br />
Im Gegensatz dazu sind Maßnahmen zu sehen, die zu Umweltqualitätszielen in direkter<br />
Verbindung im Sinne einer Ziel-Mittel-Beziehung stehen. Werden Eigentumsrechte an derartige<br />
Maßnahmen geknüpft, stehen die Maßnahmen zu den Umweltqualitätszielen in einer Indikator-<br />
Indikandum-Beziehung (vgl. Kap. 6.1). Werden Eigentumsrechte an derartige Maßnahmen-<br />
72 Minimierung im Verständnis einer Reduktion des Eingreifens.
96 Kapitel 6<br />
Indikatoren geknüpft, wird die Schaffung der Eigentumsrechte der umweltqualitätsziel-<br />
orientierten Strategie zugeordnet. Eine Effizienzbetrachtung und Erfolgskontrolle ist prinzipiell<br />
möglich. In Abbildung 16 wird die Unterscheidung der umweltzielorientierten Strategie und der<br />
Minimierungsstrategie auf der Grundlage der Ansatzstelle für Eigentumsrechte dargestellt.<br />
ja<br />
Abbildung 16: Vorsorgestrategien der Umweltpolitik und deren mögliche Ansatzstellen für entsprechende<br />
Eigentumsrechte<br />
Die Begründung für die Verknüpfung von Eigentumsrechten mit Maßnahmen-Indikatoren<br />
anstelle von Zustands-Indikatoren liegt aus ökonomischer Sicht bei den Transaktionskosten.<br />
Neben Transaktionskosten der Zielentwicklung sind weitere Transaktionskosten des<br />
„Institutionellen“ (Gawel 1996: 23) für eine Schaffung und Durchsetzung von effizienten<br />
absoluten Eigentumsrechten notwendig. Neben den Kosten für die Zielentwicklung spielen vor<br />
allen Dingen Überwachungskosten eine entscheidende Rolle (vgl. z. B. Huckestein 1993). Bei<br />
der Schaffung und Durchsetzung von relativen Eigentumsrechten als Voraussetzung für<br />
ökonomische Instrumente kommen weitere Kostengesichtpunkte hinzu (z. B. Kosten für die<br />
Koordination über Märkte – Suchkosten). Die Bedeutung von Transaktionskosten wurde bereits<br />
ausführlich in Kapitel 5.4.2 diskutiert.<br />
nein<br />
Umweltqualitätszielorientierte Strategie Minimierungsstrategie<br />
Ansatzstelle der<br />
Eigentumsrechte:<br />
Zustands-Indikator<br />
Bezug zu rationalisierten Umweltqualitätszielen<br />
Ansatzstelle der<br />
Eigentumsrechte:<br />
Maßnahmen-Indikator<br />
Ansatzstelle der<br />
Eigentumsrechte:<br />
Maßnahmen<br />
Umwelthandlungsziele können eine Alternative zu Umweltqualitätszielen darstellen, wenn diese<br />
nicht quantitativ ausgedrückt werden können. In diesen Fällen können Maßnahmen, die einen<br />
Beitrag zum Erreichen des Ziels leisten, zur Konkretisierung des Umweltziels herangezogen<br />
werden (Köck 1997b). In diesem Verständnis operationalisieren die Maßnahmen die
Rationalisierte Umweltziele als Ansatzstelle für die Honorierung ökologischer Leistungen 97<br />
Umweltqualitätsziele (Rehbinder 1997). Dabei können den Zustands-Indikatoren auch<br />
Immissions-Indikatoren und den Maßnahmen-Indikatoren Emissions-Indikatoren zugeordnet<br />
werden (vgl. Kap. 6.3.1).<br />
Wenn eine Indikator-Indikandum-Beziehung zwischen der Maßnahme und dem Umweltziel<br />
vorliegt, kann die ‚Ansatzstelle’ Maßnahmen-Indikator bei Berücksichtigung aller<br />
Transaktionskosten die effiziente sein.<br />
Formell ist strikt zwischen der Minimierungsstrategie, bei der Eigentumsrechte an Maßnahmen<br />
geknüpft werden, und der umweltzielorientierten Strategie, bei der die Eigentumsrechte an<br />
Zustands- oder Maßnahmen-Indikatoren geknüpft werden, zu unterscheiden (vgl. Abbildung 16).<br />
Diese Unterscheidung spielt gerade für die Anwendung von ökonomischen Instrumenten zur<br />
effizienten Allokation der Eigentumsrechte eine entscheidende Rolle, wie die in Kapitel 6.2.2<br />
folgenden Betrachtungen zeigen.<br />
6.2.2 Minimierungsstrategie – tatsächlich eine Alternative zur umweltzielorientierten<br />
Strategie?<br />
Das Verständnis, dass rationale Umweltpolitik lediglich an qualifizierten Zielen ansetzen kann,<br />
steht in einem gewissen Widerspruch zur realen (Agrar-)Umweltpolitik. Tatsächlich findet<br />
sowohl im Ordnungsrecht als auch im Bereich der Honorierungsinstrumente der Landwirtschaft<br />
überwiegend eine Orientierung auf die Minimierungsstrategie statt.<br />
Der Minimierungsstrategie liegen keine (es bedarf dieser nicht!) im Voraus exakt festgelegten<br />
Umweltqualitätsziele zugrunde, sondern das Ziel ist z. B. im zentralen Bereich der Stoffeinträge<br />
darauf gerichtet, „einzelbezogene Stoffeintragsreduktion nach technischer Möglichkeit zu<br />
verfügen“ (vgl. Köck 1999a: 331). Allgemeiner formuliert, wird mit dieser<br />
Minimierungsstrategie beabsichtigt, die mit menschlichen Aktivitäten verbundenen negativen<br />
Auswirkungen auf die ‚Ökosysteme’ so gering wie möglich zu halten. Dass es dabei nicht um<br />
eine Totalvermeidung gehen kann, ist rechtlich festgelegt. Die in Artikel 20a GG begründete<br />
Pflicht des Staates zum Umweltschutz beinhaltet nicht, dass der Gesetzgeber normativ<br />
verpflichtet wäre, jeden Umweltschaden zu verhindern oder gar jede Gefahr eines<br />
Umweltschadens im Vorfeld abzuwehren. „Umweltschutz ist nicht ein absolutes bzw. prioritäres,<br />
sondern ein relatives, im Verhältnis zu anderen Schutzgütern auszubalancierendes und<br />
auszugleichendes Schutzgut“ (Scholz 1996: Rn 41, vgl. statt vieler Murswiek 1996). Es bedarf in<br />
der Konsequenz einer Referenz, erst dadurch erhält die Minimierungsstrategie ihren<br />
Umsetzungsbezug. Wenn die Antwort auf die Frage „Wie viel Natur brauchen wir denn
98 Kapitel 6<br />
eigentlich?“ die ist: „So viel wie möglich“ (Roweck 1996: 129), wird der Referenzbedarf<br />
überdeutlich 73 .<br />
In der Praxis orientieren sich Minimierungsgebote daher regelmäßig an der wirtschaftlichen<br />
Vertretbarkeit und dem ‚Stand der Technik’ bzw. dem ‚Stand der Wissenschaft und Technik’<br />
(vgl. UBA 1994). Die Minimierungsstrategie wird auch als ‚technikorientierte Strategie’<br />
bezeichnet. Eine Legaldefinition zum ‚Stand der Technik’ gibt z. B. das Bundes-<br />
Immissionsschutzgesetz: „Entwicklungsstand fortschrittlicher Verfahren, Einrichtungen oder<br />
Betriebsweisen, der die praktische Eignung einer Maßnahme zur Begrenzung von Emissionen<br />
gesichert erscheinen lässt“ (§ 3 Abs. 6 S. 1 BImSchG), oder das Wasserhaushaltsgesetz: „Stand<br />
der Technik ... ist der Entwicklungsstand technisch und wirtschaftlich durchführbarer<br />
fortschrittlicher Verfahren, Einrichtungen oder Betriebsweisen, die als beste verfügbare<br />
Techniken zur Begrenzung von Emissionen praktisch geeignet sind“ (§ 7a S. 5 WHG). Dabei ist<br />
neben der Fortschrittlichkeit und der Gewähr für die praktische Eignung einer technischen<br />
Maßnahme insbesondere auch die wirtschaftliche Durchführbarkeit zu berücksichtigen. Es reicht<br />
nach § 7 a WHG nicht mehr aus, dass die praktische Eignung einer Maßnahme zur<br />
Emissionsbegrenzung als gesichert erscheint. Es wird explizit verlangt, dass die Techniken<br />
praktisch geeignet sind, das heißt, neben den wissenschaftlich-technischen Kriterien muss auch<br />
die wirtschaftliche Durchführbarkeit sichergestellt sein (Pennekamp 1999).<br />
Rückblickend auf die Überlegungen zur starken Nachhaltigkeit (vgl. Kap. 5.2) kann die<br />
Minimierungsstrategie prinzipiell unterstützt werden, die Frage ist jedoch, ob bei der Referenz<br />
‚Stand der Technik’ tatsächlich ‚so viel wie möglich Natur’ vor dem Hintergrund<br />
wirtschaftlicher Entwicklung erhalten bleibt? Es ist klar, dass Referenzen wie ‚Stand der<br />
Technik’ einer Präzisierung bedürfen. Dies geschieht im Rahmen der Standardsetzung in<br />
Verordnungen und Verwaltungsvorschriften. Dabei weist Gawel (2000: 114) auf das Problem<br />
hin, dass das Ordnungsrecht nicht nur u. U. entbehrliche Individualisierungen umweltpolitischer<br />
Allokationsvorgaben schafft, sondern darüber hinaus sogar zur Fixierung konkreter technischer<br />
Lösungen neigt, dem Normadressaten also zugleich den Weg zur Erfüllung der ihm gestellten<br />
Anforderungen vorschreibt. Die Emissionsstrategie wird zum großen Teil über<br />
Referenztechnologien umgesetzt. Selbst wenn es zu Emissionswerten als Richt- oder Grenzwerte<br />
kommt, stellen diese „lediglich Konkretisierungen bestimmter Techniklösungen“ dar. „Sie<br />
73 Diese Forderung resultiert aus der Erkenntnis der Vielfalt ökologischer Systeme und der damit verbundenen<br />
Unsicherheit bzgl. von Aussagen zur Entwicklung sowie Aussagen auf der Typusebene. Gerade diese sind jedoch in<br />
den meisten Fällen Voraussetzung für aktive Steuerung (vgl. auch Kap. 6.3.5.1).
Rationalisierte Umweltziele als Ansatzstelle für die Honorierung ökologischer Leistungen 99<br />
müssen auch durch entsprechend machbare Lösungen konkret gedeckt sein, gerade weil sie<br />
umweltqualitätsunabhängig eingefordert werden und dem Verhältnismäßigkeitsgebot<br />
unterliegen“ (ebd.: 116). Merkel (1989: 66) beschreibt das Dilemma, in dem sich die<br />
Gesetzgeber bei der Verordnung von Grenzwerten nach dem ‚Stand der Technik’ befinden: „Die<br />
Technik schreibt dem Recht vor, welche Grenzen das Recht der Technik vorschreiben darf“<br />
(zitiert in Michaelis 1996: 50). Dabei kommt es zum viel beschriebenen „Stagnationskartell der<br />
Insider“ (Endres 1994: 131). Der technologische Wettbewerb ist nicht an der bestmöglichen<br />
Vermeidung von Belastungen ausgerichtet, sondern auf die kostenminimierende Einhaltung von<br />
administrativ vorgegebenen Technologienormen reduziert. „Das Erfordernis der wirtschaftlichen<br />
Durchführbarkeit verleiht dem Normadressaten Macht, die Entwicklung grundlegender<br />
umwelttechnischer Neuerungen zu blockieren und betriebliche Informationen über verfügbare<br />
Potentiale einer verbesserten Emissionsvermeidung nicht zur Weiterentwicklung des Standes der<br />
Technik zu nutzen. Daher ist von einem passiven Verhalten der Anbieter relevanter<br />
Informationen auszugehen, das sich primär auf die Erfüllung des durch Verwaltungsvorschriften<br />
determinierten technischen Status quo beschränkt“ (Pennekamp 1999: 220). Praktische<br />
Umweltpolitik der Minimierungsstrategie stellt sich „als mengenweiche Richtungs-<br />
(Demeritorisierungs-)Politik dar, die ihre ‚impliziten Ziele’ an technische Machbarkeitsnormen<br />
der Rückhaltetechnik überantwortet (‚Stand der Technik’) und ihre Zielerfüllung an die<br />
Leistungen eines dezentralen, einzelfallorientierten Vollzugsapparates delegiert“ (Gawel 1999:<br />
250, vgl. auch Gawel 1995: 217 ff.). Die technikorientierte Vorsorgestrategie ist das Gegenteil<br />
einer ökonomischen Preis- und Mengensteuerung (Meßerschmidt 1999: 366). Von Seiten der<br />
Ökonomie, aber auch der Rechtswissenschaft werden gegen diese Minimierungsstrategie immer<br />
wieder Vorbehalte und Effizienzvorwürfe geäußert (z. B. Rehbinder 1989, Kloepfer & Reinert<br />
1995, Steinberg 1998, Gawel 1994, Gawel 1999, Gawel 2000 74 ). Stellvertretend für die<br />
Effizienzkritik: „Emissionsströme werden nicht wirkungsorientiert gesteuert, sondern im Wege<br />
pauschaler Minderungen, die mancherorts zu gering, mancherorts dagegen übertrieben ausfallen<br />
dürfen. Fälschlicherweise gehen schadstofffixierte Steuerungsmuster oft einher mit einer<br />
fallweisen Regulierungspräferenz zugunsten einzelner Sektoren. So provoziert sie<br />
sektorspezifische Lösungen, obwohl eine ökonomisch rationale Zielfindung eine<br />
sektorübergreifende Sicht erfordert. Nur so wäre gewährleistet, dass derjenige zur<br />
Emissionsminderung beiträgt, der dies am kostengünstigsten bewerkstelligen kann. Damit sind<br />
74 bzgl. der Vorgabe der Mittel (Referenztechnologie) vgl. auch die Kritik zur maßnahmenorientierten Honorierung<br />
(Kap. 4.2.2)
100 Kapitel 6<br />
die volkswirtschaftlichen Kosten der Emissionsorientierung insgesamt hoch“ (Ewers & Hassel<br />
2000: 49).<br />
Wird die Minimierungsstrategie im Lichte der Eigentumsrechte betrachtet, so werden hierbei<br />
stets unvollständige Eigentumsrechte an dem knappen Gut verteilt. Erlaubt ist alles was nicht<br />
verboten ist. Allgemein trifft jedoch zu, was Gawel (1994: 89) über Eigentumsrechte im Zuge<br />
von Genehmigungen ausführte. Wie bei traditionellen Genehmigungsbescheiden werden<br />
wirtschaftliche Handlungsrechte über Umweltmedien gewährt. Diese stellen jedoch keine Lizenz<br />
(‚Zertifikat’) im wirtschaftstheoretischen Sinne dar. Der Abstand eines traditionellen<br />
Genehmigungsbescheides von vollkommen spezifizierten, unabgeschwächten und vollkommen<br />
zugewiesenen Verfügungsrechten „im Sinne des property rights-Paradigmas bedarf erst noch der<br />
detaillierten Klärung und bleibt eine Herausforderung für die umweltökonomische Forschung“<br />
(Gawel 1994: 89).<br />
Mit jeder Änderung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, die Auswirkungen auf das<br />
knappe ökologische Gut haben, muss von Seiten des Staates überprüft werden, ob<br />
gegebenenfalls neue Verfügungsrechte geschaffen werden müssen. Der zentrale<br />
Regulierungsbedarf ist als hoch anzusehen. Die zentrale staatliche Anpassung ist der<br />
wirtschaftlichen Entwicklung nachgeschaltet. Es kann von einer zentralen, reaktiven Strategie<br />
gesprochen werden, für deren Durchsetzung jedoch ein dezentraler, einzelfallorientierter<br />
Vollzugsapparat notwendig ist (s.o.).<br />
Würden effiziente, vollkommene Eigentumsrechte an den knappen ökologischen Gütern<br />
vergeben, muss der Staat lediglich bei auftretenden Knappheiten bzw. entsprechender Nachfrage<br />
nach dem ökologischen Gut Eigentumsrechte schaffen. Die Eigentumsrechte bestimmen dann<br />
die künftige wirtschaftliche Entwicklung bzgl. des knappen Gutes. Die jeweiligen<br />
wirtschaftlichen Anpassungsvorgänge erfolgen durch die Wirtschaftssubjekte dezentral. Es kann<br />
von einer dezentralen, reaktiven Strategie gesprochen werden. Diese Strategie ist davon<br />
abhängig, ob die Eigentumsrechte das jeweils knappe ökologische Gut vollständig erfassen.<br />
Dabei müssen die Eigentumsrechte an den ökologischen Gütern gewährleisten, dass die<br />
ökosystemaren Fähigkeiten zur Produktion dieser Güter erhalten bleiben (vgl. Kap. 5.2). Diese<br />
vollständige Erfassung kann an den Eigenschaften ökologischer Güter und den Problemen im<br />
Zuge des Ermittlungsvorgangs (Umweltzielentwicklung) scheitern (vgl. Kap. 6.3.5). Von daher<br />
besteht auch hier die Möglichkeit von Ineffizienz. Der zentrale Regulierungsbedarf, der dadurch<br />
auftritt, dürfte jedoch geringer sein als bei der Minimierungsstrategie.
Rationalisierte Umweltziele als Ansatzstelle für die Honorierung ökologischer Leistungen 101<br />
Was macht jedoch den Charme der Minimierungsstrategie in Politik und auch in der<br />
Wissenschaft aus? Was ist der Grund, dass dieser Ansatz das aktuelle Ordnungsrecht bestimmt<br />
und, wie sich noch zeigen wird, selbst bei ‚ökonomischen’ Instrumenten, wie der Honorierung<br />
(bei der Eigentumsrechte an Maßnahmen und nicht an Maßnahmen-Indikatoren geknüpft<br />
werden) ökologischer Leistungen, angewendet wird (vgl. Kap. 7.2.2.4)? „Und doch beweisen<br />
Technikregeln erstaunliches Beharrungsvermögen nicht nur wegen der Bedienung wichtiger<br />
Regulierungsinteressen auf politischer, administrativer und Adressatenseite, sondern betören<br />
auch aufgrund ihrer intuitiven Nachvollziehbarkeit: Die ‚Magie des technisch Möglichen’<br />
(Bonus 1985: 368), die ‚Faszination des Unmittelbaren’ (SRU 1978), die ‚verlockende<br />
intellektuelle Einfachheit’ (Hansmeyer 1988: 241) oder der ‚Charme des Unverbindlichen’<br />
(Gawel & Ewringmann 1994: 296) sind auch von Ökonomen – halb bewundernd, halb<br />
schauernd – poetisch besungen worden“ (Gawel 1999: 25).<br />
Ein unbestreitbarer Vorzug des Minimierungsansatzes ist die Möglichkeit, nicht vorhersehbare<br />
bzw. nicht quantifizierbare Risiken berücksichtigen zu können. „Die technikorientierte Strategie<br />
bietet in Risikosituationen erhebliche Vorteile: Sie erlaubt es, Maßnahmen zu treffen, bevor<br />
festgestellt wird, welches Ausmaß das Risiko tatsächlich besitzt“ (Steinberg 1998: 106) (vgl.<br />
auch Kap. 6.3.5). Die Minimierungsstrategie wird von daher auch als ‚juristische Antwort’ auf<br />
den allgemeinen umweltpolitischen Grundsatz des ‚Vorsorgeprinzips’ angesehen (in diesem<br />
Sinne vgl. Niederstadt 1998). Das Vorsorgeprinzip drückt aus, dass sich Umweltpolitik nicht in<br />
der Beseitigung eingetretener Schäden und der Abwehr drohender Gefahren erschöpft, sondern<br />
außerdem die langfristige Bewahrung und schonende Inanspruchnahme der natürlichen<br />
Lebensgrundlage umfasst (Deutsche Bundesregierung 1986). Es werden zwei sich nicht<br />
gegenseitig ausschließende Bedeutungsvarianten vertreten. Die eine Variante betrachtet das<br />
Vorsorgeprinzip im Sinne der Minimierungsstrategie unter dem Sicherheitsaspekt als Risiko-<br />
bzw. Gefahrenvorsorge, die auf die (auch langfristige) Steuerung von Risiken oberhalb der<br />
Gefahrenabwehr hinausläuft (vgl. u. a. Köck 1999b). Die zweite „bewirtschaftungsrechtliche<br />
Variante“ (Kloepfer & Reinert 1995: 88) verbindet mit dem Vorsorgeprinzip die Funktion,<br />
Umweltressourcen im Interesse künftiger Nutzungen zu schonen und im Hinblick auf diese<br />
Nutzungen ‚Freiräume’ zu schaffen für künftige Lebensräume (Räume für Besiedlung und<br />
Erholung, auch für Naturschutz und Landschaftspflege), aber auch als Belastbarkeitsreserven für<br />
zukünftige Industrieansiedlungen. „Gerade die Vorhaltung von Belastbarkeitsreserven setzt aber<br />
eine langfristige Sicherung der ökologischen Funktionen der Umweltmedien und der Erhaltung<br />
des natürlichen Regenerationspotentials voraus. Das Vorsorgeprinzip könnte in dieser Auslegung<br />
durchaus als Stütze für eine gegenüber dem bisherigen Stand sehr viel weitergehende, an der
102 Kapitel 6<br />
natürlichen Assimilationskapazität orientierte Belastungsminimierung, dienen“ (Kloepfer &<br />
Reinert 1995: 88 f).<br />
Aus juristischer Sicht hat das Vorsorgeprinzip eine Funktion als umweltrechtliches<br />
Strukturprinzip bzw. als allgemeines Rechtsprinzip (z. B. Art. 34 EV) und findet konkrete<br />
Ausgestaltung in umweltrechtlichen Normen (z. B. § 1a Abs. 1 Satz 6, 7a WHG). Die rechtliche<br />
Festschreibung in Artikel 34 EV hat das Prinzip zwar bundesrechtlich verankert, es ist aber<br />
zweifelhaft, ob dies spürbare Folgen für das besondere Umweltrecht hat (Kloepfer & Reinert<br />
1995).<br />
Die Minimierungsstrategie mit der Referenz ‚Stand der Technik’ als alleiniges Mittel des<br />
juristischen Vorsorgeprinzips wird jedoch von juristischer Seite kritisiert. Besonders kritisch<br />
gesehen wird dabei, wenn das Vorsorgeprinzip zum Gebot der wirkungsunabhängigen<br />
Emissionsminimierung führt (vgl. v. Lersner 1994). Wenn sich Emissionsminimierung nicht<br />
wenigstens ansatzweise an den Wirkungen orientiert, können selbst Eingriffszunahmen noch als<br />
Minimierungsstrategie verkauft werden. Das Beispiel des Klimaschutzprogramms der USA<br />
verdeutlicht die Schwächen der an den Emissionen orientierten Minimierungsstrategie. So sollen<br />
die spezifischen Emissionen der USA pro $ Bruttoinlandsprodukt zwischen 2002 und 2012 um<br />
insgesamt 18 % gesenkt werden, d. h. die Energieeffizienz soll um 18 % steigen. Dieses Ziel ist<br />
wenig ehrgeizig, denn die Energieeffizienz wäre bei einem Fortschreiben der bisherigen<br />
Produktivitätsentwicklung voraussichtlich ohnehin um ca. 15 % angestiegen. Wenn die<br />
Wirtschaft in den USA weiter wächst, wird die angestrebte Energieeffizienzsteigerung nivelliert<br />
oder sogar überkompensiert. Bei einem angenommenen Wirtschaftswachstum von 3 % pro Jahr,<br />
werden die absoluten Emissionen der USA im Jahr 2012 trotz der Energieeffizienzsteigerungen<br />
um 24,5 % über denen von 1990 liegen. Zum Vergleich: Nach dem Kyoto-Protokoll wird die EU<br />
bis 2012 ihre Emissionen um 8 % unter das Niveau von 1990 bringen, Japan leistet eine<br />
Reduktion von 6 % und das ursprüngliche Kyoto-Ziel für die USA, das US-Präsident Clinton<br />
1997 akzeptierte, war eine Reduktion um 7 %.<br />
In dieser Art bleibt die Minimierungsstrategie in einem permanenten Krisenmanagement stecken<br />
und versagt besonders in den Fällen, wo sich verschiedene Umweltbelastungen in einem Raum<br />
summieren und Gefahrenschwellen überschritten werden (Volkmann 1999). Prinzipiell wird<br />
anerkannt, dass die bisher dominierende Variante des Vorsorgeprinzips seine Berechtigung hat.<br />
In Frage gestellt wird allerdings die Durchschlagskraft, wenn es um den Zweck des umfassenden<br />
„Naturhaushaltsschutzes“ geht: „Im Hinblick auf einen ökosystemaren Ansatz wäre die<br />
Entwicklung der bewirtschaftungsrechtlichen Variante des Vorsorgeprinzips zu einem Gebot der
Rationalisierte Umweltziele als Ansatzstelle für die Honorierung ökologischer Leistungen 103<br />
Belastungsminimierung wünschenswert, das sich an der natürlichen Belastungskapazität<br />
orientiert“ (Steinberg 1998: 107). Referenz wäre hier also an Stelle des ‚Stand der Technik’ die<br />
‚natürliche Belastungskapazität’. ‚Natürliche Belastungskapazität’ macht jedoch nur Sinn als<br />
Aufrechterhaltung der Fähigkeit ökologischer Systeme, ökologische Güter zu produzieren (vgl.<br />
Kap. 5.2). Damit würde der Aspekt der Vorsorge wegfallen, bei dem es um ökologische Güter<br />
geht, für die weder Angebot noch Nachfrage zu bestimmen sind, denen aber ein Optionswert<br />
zugesprochen werden kann.<br />
An dieser Stelle soll der Ansatz der ‚Ökologischen Integrität’ (Barkmann et al. 2001) als<br />
Leitlinie zur Vorsorge vor unspezifischen ökologischen Risiken im Rahmen Nachhaltiger<br />
Entwicklung als umweltzielorientiertes Gegenüber der technisch orientierten Minimierungs-<br />
strategie kurz betrachtet werden. Die Leitlinie soll darauf abzielen, die Leistungsfähigkeit des<br />
Naturhaushalts als natürliche Lebensgrundlage des Menschen langfristig zu erhalten, indem die<br />
ökosystemaren Prozesse und Strukturen, die die Voraussetzung für die Selbstorganisations-<br />
fähigkeit von Ökosystemen bilden, geschützt werden. Ausgangspunkt ist ein dynamisches<br />
Ökosystemkonzept. Die Ableitung der Selbstorganisationsfähigkeit baut auf Erkenntnissen der<br />
thermodynamischen Ökosystemtheorie auf. Es werden acht Indikatoren des Selbstorganisations-<br />
grades bzw. der Selbstorganisationsfähigkeit von Ökosystemen abgeleitet. Dieser Ansatz<br />
verdient schon von daher Beachtung, da er eine Erfassung der unspezifischen Risiken anstrebt,<br />
also die Lücke zu füllen versucht, die aufgrund der Unsicherheit beim Ansatz der ökologischen<br />
Güter immer bestehen wird. Andererseits zeigen sich die Grenzen einer derartigen Leitlinie zur<br />
Vorsorge relativ schnell und es bleibt abzuwarten, ob derartige Ansätze praxisrelevant werden<br />
können.<br />
Von Optionswert soll im Zusammenhang mit ökonomischer Bewertung unter Unsicherheit<br />
gesprochen werden (zur Definition von Optionswert vgl. z. B. Weisbrod 1964, Smith 1987,<br />
Marggraf & Streb 1997) 75 . Unsicherheit bedeutet, dass die Folgen von individuellem oder<br />
kollektivem Tun oder Unterlassen auch von Einflüssen abhängen, die weder (voll) kontrollierbar<br />
noch in konkreter Ausprägung im Voraus bekannt sind, sei es, dass zwar die direkten, nicht aber<br />
die jeweils konkret eintretenden Folgen im Voraus bekannt sind, oder dass nicht alle denkbaren<br />
Folgen bekannt sind, weil bisher Unbekanntes auftreten kann (Holzheu 1987: 12). Unsicherheit<br />
beschreibt eine Situation, in der dem Individuum keine objektiven Wahrscheinlichkeiten bekannt<br />
75 Dabei wird davon ausgegangen, dass der Zinssatz auf den Preisreferenzsatz ‚reduziert’ ist, der Zinssatz also nicht<br />
die Unsicherheit abfängt.
104 Kapitel 6<br />
sind oder aber nur sehr geringes Vertrauen in die Wahrscheinlichkeit besteht (Schuldt 1997:<br />
148) 76 . Ein Optionswert ergibt sich in Anlehnung an Weisbrod (1964), im Zusammenhang mit<br />
Unsicherheit über die künftige Nachfrage nach dem ökologischen Gut und aus der Unsicherheit<br />
bzgl. des künftigen Angebotes (vgl. Schneider 2001). Er beinhaltet den Wert, den Menschen der<br />
Aufrechterhaltung von Optionen beimessen und ist damit entscheidend vom Risikoverhalten<br />
abhängig 77 . Die Existenz von Unsicherheit über zukünftige Nutzungsmöglichkeiten eines<br />
ökologischen Gutes erhöht den Nettonutzen des betreffenden Gutes bzw. reduziert den<br />
Nettonutzen umweltbelastender Aktivitäten (vgl. Arrow & Fischer 1974).<br />
Dass die Minimierungsstrategie die bisher einzige Möglichkeit ist, auf Optionswerte zu<br />
reagieren, bringt die tatsächliche Bedeutung dieser Strategie zum Ausdruck. Es wurde in Kapitel<br />
6.1 darauf hingewiesen, dass bei zielorientierten Ansätzen immer erst dann Handeln möglich<br />
wird, wenn Knappheitsverhältnisse aufgedeckt sind und Ziele als Stellvertreter individuell<br />
nachgefragter ökologischer Güter entwickelt sind. Die Minimierungsstrategie kommt ohne<br />
derartige Ziele aus, das heißt, eine Rationalisierung der Ziele, wie sie in Kapitel 6.1 als<br />
Voraussetzung einer rationalen Umweltpolitik formuliert wurden, ist nicht notwendig. Ist die<br />
Minimierungsstrategie aufgrund des fehlenden Zielbezuges irrational?<br />
Aufgrund der Eigenschaften von Gütern mit Optionswert (bei Unsicherheit von Angebot und<br />
Nachfrage) muss die Minimierungsstrategie bei ökologischen Gütern, denen lediglich ein nicht<br />
quantifizierbarer Optionswert zugeordnet werden kann, als rational, da alternativlos, bezeichnet<br />
werden. Für alle anderen Fälle ist die Minimierungsstrategie irrational. Diese simpel anmutende<br />
Einteilung erweist sich bei genauerer Betrachtung als schwierig. Der Optionswert wurde nach<br />
bisherigen Überlegungen an die Unsicherheit über zukünftige Gegebenheiten geknüpft (s. o.).<br />
Die Unsicherheit kann als begrenzte Rationalität (bounded rationality vgl. Kap. 5.4.1)<br />
interpretiert werden, die es verhindert, zukünftige Gegebenheiten abzuleiten. Was ist jedoch mit<br />
der bounded rationality gegenüber aktuellen Gegebenheiten? Ökologische Systeme entziehen<br />
sich oftmals auch der rationalen Ermittlung des aktuellen Angebots und der Nachfrage<br />
(Rationalisierung i.e.S. vgl. Kap. 6.1 und Kap. 6.3). Da der Zeitpunkt der möglichen<br />
76 Demgegenüber kann im Verständnis von Knight (1965) Risiko als ein Zustand beschrieben werden, in dem die<br />
Ergebnisse einer Handlungsalternative zwar nicht mit Sicherheit bekannt sind, aber es möglich ist, den einzelnen<br />
Handlungsergebnissen unter Rückgriff auf empirische Werte oder statistische Darstellungen objektive<br />
Wahrscheinlichkeiten zuzuordnen.<br />
77 Neben diesem Optionswert wird das Konzept des Quasi-Optionswertes diskutiert. Der Quasi-Optionswert ist im<br />
Gegensatz zum eigentlichen Optionswert unabhängig von der Risikoaversion des Entscheidungsträgers. Der Quasi-<br />
Optionswert beschreibt den zusätzlichen Nutzen von Informationen bei unsicheren und irreversiblen<br />
Nutzungsentscheidungen (vgl. Arrow & Fisher 1974, Mäler 1984).
Rationalisierte Umweltziele als Ansatzstelle für die Honorierung ökologischer Leistungen 105<br />
Inanspruchnahme des ökologischen Gutes für die Bildung des Optionswertes keine Bedeutung<br />
hat – „ ... for simplicity we compress all of the future into a single period and assume that the<br />
marginal rate of time preference is zero. Therefore discounting between the present or planning<br />
period and the future into a single period and assume that the marginal rate of time preference is<br />
zero. Therefore discounting between the present or planning period and the future can be<br />
ignored.” (Cicchetti & Freemann III 1971: 530); kann auch ökologischen Gütern mit<br />
Unsicherheit bzgl. der aktuellen Nachfrage und des aktuellen Angebotes ein Optionswert<br />
zugesprochen (vgl. hierzu auch Kapitel 5.2 mit den Ausführungen zum rationalen Umgang mit<br />
Unsicherheit) und die Minimierungsstrategie als rationales Mittel angesehen werden.<br />
Während die Unsicherheit über die künftige Nachfrage nach ökologischen Gütern in vielen<br />
Bereichen gegen unendlich geht, diese Unsicherheit als gegeben und unabänderlich anzusehen<br />
ist und dies in etwas differenzierter Weise auch für das künftige Angebot gelten muss, ist das<br />
Problem der Unsicherheit bei der aktuellen Nachfrage und dem aktuellen Angebot theoretisch<br />
eine Frage von Transaktionskosten. Dabei ist unbestritten, dass auch diese bei ökologischen<br />
Systemen gegen unendlich tendieren können, da die Grenzen der Umweltzielentwicklung<br />
weniger am fehlenden Wissen über ökosystemare Strukturen und Prozesse als vielmehr ‚in der<br />
Natur der Sache’ liegen und „hundert weitere Jahre ökosystemarer Grundlagenforschung“ nicht<br />
zur Überwindung dieser grundsätzlichen Probleme führen werden (vgl. i.d.S. Roweck 1995: 29)<br />
(vgl. Kap. 6.3.5.1). Prinzipiell ist die Unsicherheit jedoch von der Entscheidung abhängig, wie<br />
viel Geld für die Ermittlung des Wertes, für die Ermittlung des Angebots und der Nachfrage an<br />
ökologischen Gütern aufgebracht wird bzw. aus ökonomischer Sicht sinnvoll ist. In Kapitel 5.3<br />
wurde darauf hingewiesen, dass die Transaktionskosten der Schaffung und Durchsetzung der<br />
Eigentumsrechte nicht höher sein sollten als der Wert des ökologischen Gutes. Vor dieser<br />
theoretischen Überlegung ist es einleuchtend, dass Eigentumsrechte in einer Welt mit<br />
Transaktionskosten nicht immer vollständig geschaffen werden. Damit ist die Entscheidung, ob<br />
die Minimierungsstrategie ein rationales Mittel ist, abhängig von den Transaktionskosten (vgl.<br />
i.d.S. auch Köck 1999a: 331 ff.) im Vergleich zum Wert des ökologischen Gutes. Auf eine<br />
Erläuterung der Bildung des Optionswertes soll an dieser Stelle verzichtet werden, da der<br />
Optionswert in dem hier vorgestellten Zusammenhang lediglich veranschaulichen soll, dass<br />
Risikoaversion, auch bei Unsicherheit bzgl. der ökonomischen Bewertung, umweltpolitisches<br />
Eingreifen ökonomisch rechtfertigen kann.<br />
Mit der oben beschriebenen Unsicherheit verbunden ist jedoch gerade, dass die<br />
Transaktionskosten und der Wert des Gutes als Entscheidungshilfen ausfallen. Der<br />
Transaktionskostenansatz gibt lediglich eine ‚grobe’ Orientierung.
106 Kapitel 6<br />
Die Ausführungen zum Optionswert führen zu der Schlussfolgerung, dass der<br />
Minimierungsstrategie auch bei ‚aktuellen’ Gütern aufgrund der bounded rationality sowie der<br />
prinzipiellen Schwierigkeit der Zielentwicklung nicht pauschal Irrationalität vorgeworfen<br />
werden kann (vgl. i.d.S. auch Rehbinder 1997, Köck 1997a, 1999 aber auch Gawel 1999).<br />
Aufgrund der Ungewissheit bleibt „materiell ‚rationale Vorsorge’ ein Konstrukt, das in seiner<br />
Informationspräsentation dem tatsächlichen Ausmaß an Ungewissheit nicht gerecht werden<br />
kann“ (Gawel 1999: 264, vgl. in diesem Sinn auch Bechmann et al. 1994, Ladeur 1995).<br />
Abbildung 17 abstrahiert den Zusammenhang zwischen der Möglichkeit der Präferenzermittlung<br />
in Abhängigkeit der bounded rationality und den damit verbundenen Transaktionskosten der<br />
Präferenzermittlung und der rationalen Instrumentenwahl. Dabei wird verdeutlicht, dass auch<br />
hier keine feste Grenze definiert werden kann, ab der die Minimierungsstrategie die rationale<br />
Instrumentwahl darstellt. Je schwieriger die Umweltziele/Präferenzen operationalisiert bzw.<br />
ermittelt werden können oder, ökonomisch ausgedrückt, je höher die Transaktionskosten der<br />
Rationalisierung sind, je rationaler ist die Wahl der Minimierungsstrategie gegenüber der<br />
umweltzielorientierten Strategie.<br />
Aktueller Wert<br />
Rationale Instrumentenwahl<br />
Optionswert<br />
0 8<br />
Bounded rationality<br />
Transaktionskosten der Präferenzermittlung<br />
Umweltzielorientierte<br />
Instrumente<br />
Minimierungsorientierte<br />
Instrumente<br />
Abbildung 17: Abhängigkeit der rationalen Instrumentenwahl von der bounded rationality und den darauf<br />
aufbauenden Transaktionskosten der Präferenzermittlung<br />
Für das ökonomische Instrument der Honorierung ökologischer Leistungen kann unter<br />
Berücksichtigung der in Kapitel 4.1 hergeleiteten Charakterisierung jedoch festgestellt werden,<br />
dass es sich um ein Instrument zur Umsetzung der umweltzielorientierten Strategie handelt. Eine<br />
ökonomische Leistung muss einen Beitrag zur Verringerung von Knappheiten leisten.
Rationalisierte Umweltziele als Ansatzstelle für die Honorierung ökologischer Leistungen 107<br />
Voraussetzung sind demnach bereits aktuell ermittelte Knappheiten. Die Vorsorge vor<br />
unbestimmten Knappheiten im Sinne der Minimierungsstrategie sollte mit Hilfe anderer<br />
Steuerungsinstrumente wie dem Ordnungsrecht bzw. ökonomischer Steuerungsinstrumente wie<br />
Verschmutzungslizenzen umgesetzt werden.<br />
6.3 Rationalisierung der Umweltziele durch Indikatoren<br />
In Kapitel 6.1 wurde dargestellt, dass eine Rationalisierung von Umweltzielen mit dem Zweck<br />
der Schaffung und/oder Durchsetzung von Eigentumsrechten mit Hilfe von Indikatoren erfolgt.<br />
Im letzten Jahrzehnt gab es eine breite Diskussion um Indikatoren als wesentliche Messgrößen<br />
politisch gesteuerter komplexer Ziele. In Kapitel 6.3.1 erfolgt auf der Basis bestehender<br />
Indikatorensysteme eine Einordnung und erste Charakterisierung von Indikatoren als<br />
Voraussetzung für die Schaffung von relativen Eigentumsrechten. Indikatoren, die Umweltziele<br />
derart operationalisieren, dass sie mit Umsetzungsinstrumenten wie der Honorierung<br />
ökologischer Leistungen der Landwirtschaft ‚verbunden’ werden können, müssen allgemeine<br />
Anforderungen erfüllen (vgl. Kap. 6.3.2 zur Validität und 6.3.4 zur Objektivität und Reliabilität)<br />
und besondere Eigenschaften wie z. B. ‚Normierbarkeit’ aufweisen (vgl. Kap. 6.3.4), um diesem<br />
Zeck zu entsprechen.<br />
Der Indikatorenentwicklung können dabei folgende Worte vorangestellt werden: “The use of any<br />
indicator requires a leap of inferential faith” (Moxey et al. 1998: 265).<br />
6.3.1 Einordnung der Indikatoren in bestehende Indikatorensysteme<br />
In den letzten zehn Jahren wuchs, nicht zuletzt aufgrund der Verabschiedung des<br />
Aktionsprogramms ‚Agenda 21’ auf der Rio-Konferenz (UNCED – United Nations Conference<br />
on Environment and Development 1992) mit der programmatischen Einigung auf eine<br />
Nachhaltige Entwicklung, die politische Notwendigkeit an Indikatoren, die den komplexen<br />
Sachverhalt der Nachhaltigen Entwicklung (politisches Ziel) unter verschiedenen<br />
Fragestellungen fassen können und die Möglichkeit einer kontrollierten Steuerung dieser<br />
Entwicklung ermöglichen. Aufgrund der Komplexität des Themas der Nachhaltigen<br />
Entwicklung war es unabhängig von den konkreten Fragestellungen und dem konkreten Zweck<br />
der zu entwickelnden Indikatoren notwendig, Strukturen zu entwickeln, die eine Systematik der<br />
Indikatoren ermöglichen. Vor diesem Hintergrund entstanden Indikatorensysteme, die eine
108 Kapitel 6<br />
Systematisierung und Zusammenstellung von Indikatoren nach einem bestimmten<br />
konzeptionellen Ansatz ermöglichen sowie jeweils die Wechselbeziehung von Mensch und<br />
Umwelt berücksichtigen und nicht bei der Abbildung des Umweltzustandes stehen bleiben.<br />
Dabei gibt es prinzipiell zwei Ebenen der Strukturierung. Zum einen die Systematisierung in<br />
Abhängigkeit von dem inhaltlich abzubildenden Problembereich, z. B. für den<br />
Agrarumweltbereich Agrarumweltindikatoren, zum anderen eine Themen übergreifende<br />
Systematisierung nach der Art der Indikatoren im Kontext der Mensch-Umweltbeziehung.<br />
Hierunter fällt der Driving forces-Pressure-State-Response-Ansatz (DPSR) der OECD (OECD<br />
1997, 1998, 1999) (aufbauend auf den Pressure-State-Response-Ansatz (PSR), vgl. OECD 1993,<br />
1994a). Dabei handelt es sich um ein im Umweltbereich weit verbreitetes Konzept zur<br />
Darstellung der Umweltbelastungen durch menschliche Aktivitäten und ihrer Folgen. Ihm liegt<br />
die Vorstellung eines kausalen Zusammenhanges zugrunde: Menschliche Aktivitäten sind<br />
Antriebskräfte für Veränderungen der Umwelt (Driving forces), diese führen zu einem Einfluss<br />
oder Druck (Pressure) und führen somit zur Änderung der Umweltqualität bzw. von Quantität<br />
und Qualität natürlicher Ressourcen (State). Die Gesellschaft reagiert auf diese Änderungen<br />
durch entsprechende Maßnahmen (Response).<br />
In einer Weiterentwicklung auf EU-Ebene wurde dieser Ansatz durch die Einführung<br />
zusätzlicher Differenzierungen zum DPSIR-Ansatz (Driving forces-Pressure-State-Impact-<br />
Response) ausgebaut (EEA 1999). Dabei werden neben ‚Driver-Indikatoren’ (z. B. Aktivitäten<br />
und Strukturen von Industrie oder Landwirtschaft) und ‚Pressure-Indikatoren’ (z. B. Emissionen)<br />
auch ‚State-Indikatoren’ (z. B. Zustand der Medien Luft, Wasser, Boden, Biodiversität) und<br />
‚Impact-Indikatoren’ (z. B. Gesundheit, Verlust von Biodiversität) unterschieden.<br />
Wie alle Klassifizierungen sind auch diese nicht unproblematisch. „The boundaries between<br />
driving forces, state and response are unclear in some cases, as certain indicators can be<br />
considered as both, driving forces and responses, for example changes in management practices<br />
and systems adapted by farmers (OECD 2001b: 23). So kann die Vegetationsbedeckung eines<br />
Stück Landes einerseits als Zustands-Indikator betrachtet werden, der von anderen Driving<br />
forces-Indikatoren beeinflusst werden kann. Andererseits ist die Vegetation an sich ein<br />
Driving forces-Indikator für andere Zustands-Indikatoren wie z. B. Bodeneigenschaften (Moxey<br />
1999).<br />
Entscheidender als das offensichtliche Klassifizierungsproblem sind die Grenzen derartiger<br />
Ansätze aufgrund der notwendigen Vereinfachung der Zusammenhänge. Ökologische<br />
Zusammenhänge und die Wechselwirkungen zwischen Gesellschaft und Umwelt sind wesentlich
Rationalisierte Umweltziele als Ansatzstelle für die Honorierung ökologischer Leistungen 109<br />
komplexer als in den, in Indikatorensystemen notwendigerweise vereinfachten Kausalketten<br />
dargestellt werden kann. Der DPSR-Ansatz und der DPSIR-Ansatz dürfen daher nicht im Sinne<br />
eines ökologischen Modells missinterpretiert werden, da die kausalen Zusammenhänge zwischen<br />
den einzelnen Bereichen (Driving forces, State usw.) nicht in jedem Fall erfasst werden. Es<br />
handelt sich in erster Linie um Klassifizierungsmodelle. „Insbesondere kann ein Pressure-State-<br />
Response-Ansatz nicht den Anspruch erheben, die vielfältigen kausalen Beziehungen zwischen<br />
Pressure und State abzubilden, sondern führt diese Kategorien aus Klassifikationsgründen in das<br />
Umweltindikatorensystem ein“ (vgl. Walz et al. 1997: 37). „Es wird zum Beispiel nie möglich<br />
sein, mit den ‚bewährten’ Mitteln und Methoden einfache Beziehungen zwischen bestimmten<br />
Inputs und bestimmten ökologischen Wirkungen herzustellen, denn in ökologischen Systemen<br />
herrschen keine Wirkungsketten, sondern Wirkungsnetze, in denen sich vielfältige Kausalitäten<br />
komplex überlagern“ (Müller & Wiggering 2004: 230).<br />
Aktuell bauen viele Indikatorenberichte auf den DPSR- bzw. DPSIR-Ansatz auf (vgl. Überblick<br />
über Umweltreporte der EU-Staaten in EEA 1999). Einen Überblick über die Fülle an<br />
Indikatorenkonzepten und deren Anwendung gibt z. B. das Umweltbundesamt (Walz et al.<br />
1997), der Rat von Sachverständigen für Umweltfragen (SRU 1998), die Europäische<br />
Umweltagentur (EEA 1999), das Bundesamt für Naturschutz (Bürger & Dröschmeister 2001)<br />
sowie die Akademie für Technikfolgenabschätzung in Baden-Württemberg (Morosini et al.<br />
2001a, b, 2002). Die Indikatorenansätze werden aktuell im weiteren Rahmen der<br />
Umweltberichterstattung/Monitoring verwendet. Der aktuelle Zweck der Indikatoren ist in den<br />
meisten Fällen die Abbildung des Einflusses menschlichen Handelns auf die Umwelt (deskriptiv)<br />
und auf die Bewertung der Erreichung von Umweltzielen (normativ). Für diesen Zweck ist die<br />
oben angegebene Begrenztheit bzgl. der kausalen Zusammenhänge unbedingt zu<br />
berücksichtigen, stellt aber keine Grenze in der Anwendung dar.<br />
Diese Begrenztheit der Kausalität gewinnt im Zuge des Einsatzes von Indikatoren im Rahmen<br />
der Schaffung und/oder Durchsetzung von Eigentumsrechten (insbesondere von relativen<br />
Eigentumsrechten) an Bedeutung, spielt demnach eine entscheidende Rolle für die Entwicklung<br />
von Instrumenten der Honorierung ökologischer Leistungen der Landwirtschaft. Wenn auf ihrer<br />
Grundlage Eigentumsrechte getauscht werden (Honorierung ökologischer Leistungen), sind<br />
höhere Anforderungen an Validität bzw. spezifischere Anforderungen zu stellen, als wenn diese<br />
einem Monitoring im Zuge der Umweltberichterstattung dienen. Die Validität bedingt für<br />
Driving forces-, Pressure- und Response-Indikatoren jedoch die Kausalität zwischen eben diesen<br />
und dem Indikandum ‚Umweltziel’. Wenn in der Gesellschaft eine Nachfrage nach artenreichen<br />
Wiesen vorhanden ist und daher die Bereitschaft besteht, den Landwirt für eine bestimmte Art
110 Kapitel 6<br />
der Bewirtschaftung zu honorieren, muss sie sich sicher sein können, dass das Ziel mit dieser<br />
Maßnahme zu erreichen ist, dass eine Kausalität zwischen Maßnahme und Ziel besteht. Aber<br />
auch bei den State-Indikatoren sind Kausalitätsbeziehungen entscheidend für die speziellen<br />
Anforderungen, da das ökologische Gut (Umweltziel) so zu erfassen ist, dass die Sicherstellung<br />
der notwendigen ökosystemaren Fähigkeiten zur Produktion des Gutes gewährleistet wird (vgl.<br />
Kap. 5.2 und 6.3.2). Mit der Abnahme der Validität wächst das Risiko der Gesellschaft, für die<br />
Bezahlung nicht das nachgefragte Gut zu erhalten, wobei aufgrund der notwendigen Kausalität<br />
zwischen Driving forces-, Pressure- und Response-Indikatoren und dem Umweltziel das Risiko<br />
der Gesellschaft als Nachfrager bei diesen Indikatoren höher ist (vgl. weiterführend Kap. 6.3.2<br />
und 6.3.5.1).<br />
Eine Klassifizierung der im Rahmen der Schaffung und Durchsetzung von relativen<br />
Eigentumsrechten notwendigen Indikatoren auf der Grundlage des weit verbreiteten DPSR-<br />
Ansatzes verdeutlicht den im Rahmen dieser Arbeit vorgestellten Ansatz der Unterscheidung der<br />
ergebnis- und maßnahmenorientierten Honorierung (vgl. Abbildung 18).
Rationalisierte Umweltziele als Ansatzstelle für die Honorierung ökologischer Leistungen 111<br />
Ursache<br />
Driving forces-<br />
Indikatoren<br />
Maßnahmen-<br />
Indikatoren<br />
z.B.<br />
Extensive<br />
Grünlandnutzung<br />
Emissions-<br />
Indikatoren<br />
z.B.<br />
N-Emission<br />
Indikatoren als Ansatzstelle für<br />
maßnahmenorientierte Honorierung<br />
Pressure-<br />
Indikatoren<br />
Wirkungen<br />
Immissions-<br />
Indikatoren<br />
z.B.<br />
N-Immission<br />
ins Grundwasser<br />
State-<br />
Indikatoren<br />
Indikatoren als Ansatzstelle für<br />
ergebnisorientierte Honorierung<br />
• Wirkungspfad individueller rationaler Entscheidungen wird länger<br />
(Effizienzgewinne können realisiert werden)<br />
• Risikoverlagerung vom Nachfrager zum Anbieter<br />
(vgl. jedoch Wirkung von Modellen)<br />
Ökologisches<br />
Gut<br />
Zustands-<br />
Indikatoren<br />
z.B.<br />
Anzahl von<br />
Zielarten auf<br />
dem Schlag<br />
Abbildung 18: Einordnung der Typen von Indikatoren einer ergebnis- und maßnahmenorientierten<br />
Honorierung in den Indikatorenrahmen der OECD<br />
Tatsächlich wird die ergebnisorientierte Honorierung ökologischer Leistungen der<br />
Landwirtschaft nicht darauf eingeengt, an klassische Umweltzustände (Zustands-Indikatoren)<br />
anzuknüpfen, sondern an quantifizierbare Merkmale mit speziellen Eigenschaften (vgl. Kap.<br />
6.3.2), die dem Landwirt ökonomische Handlungsalternativen eröffnen und damit<br />
Effizienzgewinne erwarten lassen. Die Handlungsalternativen bei der Verknüpfung mit<br />
Zustands-Indikatoren sind prinzipiell größer als bei den anderen Indikatorentypen, allerdings<br />
können bestimmte Umweltzustände (Spezifizierungsgrad) die Handlungsalternativen<br />
vollkommen einengen (vgl. Kap. 4.2.1). Erfordern beispielsweise definierte Zielarten (Zustands-<br />
Indikatoren) einer Grünlandfläche, an deren Vorkommen eine Honorierung geknüpft ist, einen<br />
permanent hohen Grundwasserstand von max. 0,20 cm unter Flur, so wäre der Landwirt in<br />
diesem Fall in seiner Handlungsfreiheit stark eingeschränkt. Eine Knüpfung der Zahlung an die<br />
Zustands-Indikatoren kann selbst in diesem Fall aufgrund der Transaktionskosten Sinn machen<br />
(Kosten für die Kontrolle der Einhaltung des Vertrages). Die in Kapitel 4.2.2 beschriebenen<br />
Effizienzvorteile könnten jedoch nicht realisiert werden. Von daher würde es sich nicht um eine
112 Kapitel 6<br />
ergebnisorientierte Honorierung ökologischer Leistungen im Verständnis des hier vertretenen<br />
Ansatzes handeln.<br />
Auf der anderen Seite kann mit bestimmten Pressure-Indikatoren der Anspruch auf die<br />
Handlungsalternativen erfüllt werden. Im Bereich der Honorierung ökologischer Leistungen der<br />
Landwirtschaft wäre dies z. B. eine Knüpfung der Honorierung an Immissionen und Emissionen.<br />
Entscheidend ist dabei, dass gerade Emissionen in den meisten Fällen keine validen Indikatoren<br />
für die mit dem reduzierten Produktionsmitteleinsatz angestrebten Umweltziele darstellen.<br />
Definiert das Bundesland Brandenburg z. B. sauberes Grundwasser als ein ökologisches Gut, zu<br />
dessen Produktion ein Beitrag der Landwirtschaft notwendig ist (gezielter Nutzungsverzicht vgl.<br />
Kap. 4.1, Abbildung 2), kann die Honorierung nicht an die Qualität des Grundwassers geknüpft<br />
werden, da die Grundwasserqualität, die von einem Landwirt beeinflusst wird, nicht quantifiziert<br />
werden kann (vgl. Kap. 6.3.2). Von daher sind klassische Zustands-Indikatoren ausgeschlossen.<br />
Eine Alternative zu einer Honorierung, die an konkrete Maßnahmen (z. B. aktuell im Rahmen<br />
der Agrarumweltmaßnahmen Zahlungen für extensive Grünlandnutzung und extensive<br />
Ackerbauverfahren) geknüpft wird, stellt die Bindung der Honorierung an Emissionen in Form<br />
von Stickstoffsalden (z. B. Hoftorbilanzen) dar (Vorschlag v. Alvensleben 2002). Dies räumt<br />
dem Landwirt Freiheiten ein, die Reduzierung von Stickstoff derart umzusetzen, dass sie am<br />
wenigsten Kosten verursachen. Im Hinblick auf die ökologische Effektivität ist jedoch<br />
entscheidend, dass die Wirkungen räumlich und zeitlich äquivalent sind. Dies ist bei der<br />
Wirkung von Stickstoffemissionen nicht der Fall. Tatsächlich ist die Wirkung der eingesparten<br />
Emission auf das Grundwasser in hohem Maße standortabhängig. Der betriebliche<br />
Stickstoffsaldo, als ein Emissionsindikator, ist damit nicht valide (vgl. Kap. 6.3.2). Eine<br />
Alternative wäre, die Honorierung an die Immissionen in das Grundwasser zu knüpfen. Ein<br />
derartiger Indikator kann als Pressure-Indikator klassifiziert werden (vgl. Abbildung 18). Die<br />
Immissionen sind praxisrelevant nicht als Messwert zu quantifizieren. Allerdings besteht die<br />
Möglichkeit, diese Werte zu modellieren (vgl. Kap. 6.3.5.1 und 8.1). Eine an modellierte<br />
Immissionen geknüpfte Honorierung ökologischer Leistungen der Landwirtschaft räumt dem<br />
Landwirt Handlungsalternativen ein und es kommen die Vorteile der ergebnisorientierten<br />
Honorierung zum Tragen (vgl. Kap. 4.2.2.2).<br />
Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass im Rahmen der Honorierung ökologischer<br />
Leistungen der Landwirtschaft als Agrarumweltindikatoren prinzipiell sowohl Driving forces-<br />
und Pressure- als auch State-Indikatoren genutzt werden können, zumal eine strikte Trennung<br />
zwischen den Indikatoren nicht gegeben ist (vgl. Abbildung 18). Abbildung 18 stellt dar, dass
Rationalisierte Umweltziele als Ansatzstelle für die Honorierung ökologischer Leistungen 113<br />
diesen Kategorien die vier Indikatorentypen Zustands-Indikatoren, Immissions-Indikatoren,<br />
Emissions-Indikatoren und Maßnahmen-Indikatoren zugeordnet werden können, die für die<br />
Honorierung ökologischer Leistungen der Landwirtschaft prinzipiell relevant sind. Aufgrund der<br />
Komplexität ökologischer Systeme (vgl. dazu Kap. 6.3.5.1) ist der Kausalitätsnachweis von<br />
Emissions-Indikatoren und Maßnahmen-Indikatoren bzgl. des Indikandums ‚Ökologisches<br />
Gut/Umweltziel’ oft kaum möglich und daher nimmt die potentielle Validität der Indikatoren<br />
von Zustands-Indikatoren über Immissions- und Emissions-Indikatoren zu Maßnahmen-<br />
Indikatoren ab (vgl. dazu auch Kap. 6.3.2). Allerdings verlagert sich das Problem der<br />
Komplexität ökologischer Systeme bei den Zustands-Indikatoren lediglich auf die Ebene der<br />
Problemäquivalenz bzw. der Äquivalenz in Raum und Zeit (vgl. Kap. 6.3.4).<br />
Für die ergebnisorientierte Honorierung kommen sowohl Zustands-Indikatoren als auch<br />
Immissions-Indikatoren in Frage. Beide verlängern den Wirkungspfad für individuelle rationale<br />
Entscheidungen so weit, dass von ergebnisorientierter Honorierung gesprochen werden kann.<br />
Eine Knüpfung der Honorierung an Emissions-Indikatoren wird vor der Betrachtung zu den<br />
damit verbundenen Freiheitsgraden eher der maßnahmenorientierten Honorierung zugeordnet<br />
(vgl. Abbildung 18). Bzgl. der Eignung als Indikatoren ist keine pauschale Aussage zur<br />
Vorzüglichkeit von Zustands- oder Immissions-Indikatoren zu treffen, vielmehr ist die Eignung<br />
problemabhängig (s. o.). In Kapitel 8 werden Beispiele für ergebnisorientierte<br />
Honorierungsansätze mit Hilfe von Immissions-Indikatoren (Kap.8.1) und Zustands-Indikatoren<br />
(Kap. 8.2) gegeben.<br />
6.3.2 Validität – Sinn der Indikatoren<br />
Indikatoren werden hier als zentrale und stellvertretende Kennziffern zur Charakterisierung<br />
komplexer ‚Umweltziele’ bzw. ‚ökologischer Güter’ verstanden, die sonst nur sehr schwer<br />
darstellbar wären (vgl. i.d.S. Jänicke & Zieschank 2004). Das komplexe Umweltziel kann nicht<br />
mit Hilfe von Merkmalen im engeren Sinne typisiert werden, sondern nur mit Hilfe von<br />
Indikatoren.<br />
Es wurde in Kapitel 6.3.1 bereits auf die Bedeutung der Validität der Indikatoren im<br />
Zusammenhang mit der Honorierung ökologischer Leistungen eingegangen. An dieser Stelle soll<br />
das Problem der Validität von Zielindikatoren noch einmal kritisch diskutiert werden. Validität<br />
meint die Gültigkeit der Beziehung zwischen dem Indikator und dem Indikandum.
114 Kapitel 6<br />
(1) Wenn durch den Indikator das ‚ökologische Gut’ bzw. ‚Umweltziel’ gemessen wird, dann ist<br />
der Indikator valide. (2) Die Validität der Indikatoren ist gegeben, wenn bei dem Vorhandensein<br />
der indikatorischen Merkmale (Zustands-Indikatoren, Immissions-Indikatoren) bzw. beim<br />
Ablauf der Prozesse aufgrund veränderten menschlichen Verhaltens (Emissions-Indikatoren,<br />
Maßnahmen-Indiktoren) dann das indizierte Umweltziel erreicht ist.<br />
Erkenntnistheoretisch entspricht eine derartige Hypothesenbildung in Anlehnung an Schröder<br />
(1998, 2003) einer empirischen Erklärung, nämlich einer logischen Ableitung einer normativen<br />
Aussage aus einem normativen Obersatz (‚Dann-Aussage’) und einem empirischen Untersatz<br />
(‚Wenn-Aussage’). „Demnach übernimmt der normative Obersatz die Funktion der empirischen<br />
Hypothese im Explanans 78 , denn in ihm wird einer Klasse von Objekten oder Sachverhalten x,<br />
die bestimmte Merkmalsausprägungen Mn aufweisen, ein bestimmter Wert (z. B.<br />
umweltverträglich), und nicht eine empirische Eigenschaft, zugeordnet. Der empirische<br />
Untersatz ist der Randbedingung im Explanans funktional äquivalent, denn er enthält die<br />
Feststellung, dass ein spezielles Objekt bzw. ein spezieller Sachverhalt x die o. a.<br />
Merkmalsausprägungen Mn besitzt und deswegen Element der mit dem Wertprädikat<br />
ausgezeichneten Objekt- bzw. Sachhaltsklasse ist. Die Schlussfolgerung hieraus, den speziellen<br />
Gegenstand bzw. Sachverhalt wie die anderen Elemente der Klasse der mit dem Wertprädikat<br />
versehenen Wertträger zu bewerten, ist das logische Korrelat des Explanandums in empirischen<br />
Erklärungen. Der Wahrheitsgehalt des empirischen Untersatzes kann weder logisch erschlossen<br />
noch normativ begründet werden, sondern ist nur durch eine empirische Hypothesenprüfung<br />
näherungsweise feststellbar“ (Schröder 2003: 8, vgl. auch unter „Angemessenheit der<br />
Operationalisierung“ Romahn 2003: 103).<br />
Die Validität der hier diskutierten Indikatoren (der Wahrheitsgehalt des empirischen<br />
Untersatzes) kann nur dann im Sinne eines statistischen Wahrscheinlichkeitsmaßes geprüft<br />
werden, wenn der normative Obersatz per Annahme (Werturteil) in einen empirischen Obersatz,<br />
im Sinne ‚empirischer’ Merkmale (vgl. wissenschaftliche Hypothese z. B. Schröder 1994),<br />
überführt wird. Überprüft wird dann die Korrelation zwischen den Indikatoren und den<br />
definierten empirischen Merkmalen des Umweltziels (vgl. auch weiterführend indirekt<br />
operationalisierte Ziele Kap. 6.3.5.3).<br />
78 Erklärungen beruhen auf der logischen Deduktion des zu Erklärenden (Explanandum) aus dem Explanans<br />
(Schröder 2003).
Rationalisierte Umweltziele als Ansatzstelle für die Honorierung ökologischer Leistungen 115<br />
Praxisrelevant ist dies jedoch nur dann, wenn die empirischen Merkmale zwar prinzipiell das<br />
Umweltziel operationalisieren, jedoch nicht den speziellen Zweck der Indikatoren erfüllen.<br />
Würden die definierten ‚empirischen’ Merkmale die Eigenschaften besitzen, um z. B. als<br />
Ansatzstelle für Honorierungsinstrumente zu fungieren, wären sie selbst die Indikatoren.<br />
Tatsächlich können Indikatoren nur sinnvoll durch ihre spezielle Funktion von Parametern<br />
(Merkmalen) abgegrenzt werden (Schramek et al. 1999a).<br />
Die Operationalisierung knapper ökologischer Güter über Indikatoren ist immer nur für einen<br />
bestimmten Raum valide möglich. Im Zusammenhang mit dem Zweck der Indikatoren in dieser<br />
Arbeit ist dies entscheidend, da somit auch der aus Effektivitätsüberlegungen notwendige<br />
Regelungsraum bestimmt wird (vgl. Raumäquivalenz Kap. 6.3.4.1). Während im Zuge der<br />
Ableitung von Umweltzustands-Indikatoren und Immissions-Indikatoren dieser Raumbezug<br />
bereits im Zuge der Definition der Indikatoren zwingend berücksichtigt werden muss, verleiten<br />
Emissions- bzw. Maßnahmen-Indikatoren dazu, diese Abhängigkeit nicht genügend zu<br />
berücksichtigen. Entgegen des neoklassischen Paradigmas kommt es bei ökologischen Gütern<br />
„fast nie allein darauf an, dass etwas getan oder unterlassen wird, sondern wo dies der Fall ist.<br />
Seltene Pflanzen und Tiere werden nicht wie fungible Güter an der Börse gehandelt, sondern<br />
müssen dort geschützt werden, wo sie vorkommen. ... Beim Erhalt der Biosphäre fallen nicht<br />
isolierten Subjekten isolierte Aufgaben zu, sie müssen sich vielmehr koordinieren“ (Hampicke<br />
1992: 328).<br />
Wenn das ökologische Gut die Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit ist, so ist die Maßnahme<br />
(Maßnahmen-Indikator!) ‚Untersaat’ nur ein valider Indikator in Gebieten, wo Erosion<br />
stattfindet, da das knappe ökologische Gut das Indikandum ist. Wo keine Gefährdung von<br />
Bodenabtrag durch Erosion stattfindet, liegt keine Verknappung vor. Ein Maßnahmen-Indikator<br />
für den Erhalt der Bodenfruchtbarkeit wäre demnach nicht die Maßnahme ‚Untersaat’, sondern<br />
nur die Maßnahme ‚Untersaat in erosionsgefährdeten Gebieten’. Ein anderes Beispiel ist, dass<br />
die Maßnahme ‚Später Grünlandschnitt’ nur dort als Maßnahmen-Indikator für das Umweltziel<br />
‚Erhaltung der Wiesenbrüter’ fungieren kann, wo Wiesenbrüter (potentiell) vorkommen und<br />
dieser Indikator auch die anderen Anforderungen erfüllt.
116 Kapitel 6<br />
6.3.3 Zweck der Indikatoren<br />
Es gibt keine idealen Indikatoren (vgl. u. a OECD 1999a), vielmehr nur ideale Indikatoren für<br />
einen bestimmten Zweck 79 (OECD 1993, Münchhausen & Nieberg 1997, Moxey et al. 1998,<br />
Walz et al. 1997). Agrarumweltindikatoren zur Rationalisierung von Umweltzielen sollen es<br />
ermöglichen, eine angestrebte Allokation ökologischer Güter (nützliche Umweltziele) auf<br />
kürzestem Wege zu erreichen (vgl. Kap. 6.1). Die Steuerung der Allokation erfolgt über die<br />
Schaffung und/oder vor allen Dingen durch die Durchsetzung von Eigentumsrechten an den<br />
Fähigkeiten zur Produktion dieser Güter (vgl. ausführlich Kap. 5.1). Die Indikatoren im Sinne<br />
quantifizierbarer Merkmale 80 sind die Voraussetzung zur Durchsetzung von Eigentumsrechten an<br />
individuellen und ökosystemaren Fähigkeiten, sind Ansatzstelle für die Instrumente. Dies gilt für<br />
die Durchsetzung von absoluten Eigentumsrechten in gleicher Weise wie für die Durchsetzung<br />
von relativen Eigentumsrechten. Im Zusammenhang mit der Durchsetzung von absoluten<br />
Eigentumsrechten z. B. mit Hilfe des Ordnungsrechtes sind die Indikatoren Voraussetzung für<br />
Umweltstandards (vgl. i.d.S. Schröder 2003), die als Notwendigkeit für die Durchsetzung von<br />
Ordnungsrecht genannt werden (vgl. Kap. 6.1). Abbildung 19 abstrahiert den Zweck der hier<br />
besprochenen Indikatoren (vgl. zu relativen Eigentumsrechten auch Kapitel 5.1).<br />
individuelle/<br />
ökosystemare<br />
Fähigkeiten<br />
Ökologische<br />
Güter<br />
Indikatoren<br />
Relative<br />
Eigentumsrechte Transaktion<br />
Abbildung 19: Für die Durchsetzung von Ertragsrechten an individuellen und ökosystemaren Fähigkeiten<br />
werden Indikatoren benötigt, die die durch diese Fähigkeiten erzeugten ökologischen Güter für<br />
Transaktionen rationalisieren<br />
79 Im engeren Sinn ist der Zweck das, was durch absichtliche Anwendungen von Handlungsmitteln geplant und<br />
verfolgt wird. Wenn ein Ziel mit absichtlicher Erwägung von Mitteln verfolgt wird, so ist es mit dem Begriff Zweck<br />
gleichzusetzen (vgl. Ulfig 1997: 493).<br />
80 Indikator = Bemessungsgrundlage bei ökonomischen Betrachtungen der staatlichen Nachfrage
Rationalisierte Umweltziele als Ansatzstelle für die Honorierung ökologischer Leistungen 117<br />
Im Kontext dieser Arbeit haben Indikatoren folgenden Zweck zu erfüllen:<br />
Bei der Honorierung ökologischer Leistungen der Landwirtschaft müssen mit Hilfe von<br />
Indikatoren die absoluten Eigentumsrechte an Erträgen aus individuellen und ökosystemaren<br />
Fähigkeiten so gefasst werden, dass eine Transaktion dieser Rechte mit Hilfe institutioneller<br />
Vereinbarungen (relative Eigentumsrechte) stattfinden kann.<br />
6.3.4 Zweckgebundene Anforderungen<br />
Mit dem Einsatz von Agrarumweltindikatoren für die Honorierung ökologischer Leistungen der<br />
Landwirtschaft müssen neben der Validität die allgemein gültigen wissenschaftlichen<br />
Gütekriterien der Objektivität und Reliabilität zu erfüllen sein (Schröder 1996: 455). Objektivität<br />
und Reliabilität beziehen sich jeweils auf ein Vorgehen. Als objektiv wird ein Vorgehen dann<br />
bezeichnet, wenn es unter Berücksichtigung derselben Grundlagen zu Ergebnissen führt, die<br />
unabhängig vom Bewerter (vgl. Bernotat et al. 2002), also intersubjektiv nachvollziehbar sind<br />
(Romahn 2003).<br />
Objektivität und Reliabilität von Indikatoren im hier diskutierten Zusammenhang sind gegeben,<br />
wenn das Ergebnis der Transaktion der absoluten Eigentumsrechte mit Hilfe der Indikatoren<br />
unabhängig von den jeweiligen Vertragspartnern unter gleich bleibenden Bedingungen das<br />
Gleiche ist.<br />
Im Folgenden wird erläutert, welche konkreten Eigenschaften die Agrarumweltindikatoren im<br />
Rahmen der Honorierung ökologischer Leistungen aufweisen müssen. Dabei werden auch<br />
Anforderungen diskutiert, die sich auf der Grundlage der aktuellen Rahmenbedingungen für die<br />
Honorierung ökologischer Leistungen der Landwirtschaft ergeben. In diesem Zusammenhang ist<br />
insbesondere zu berücksichtigen, dass der aktuelle und auch künftig größte Anteil von<br />
Honorierungen für ökologische Leistungen im Rahmen von EU-kofinanzierten<br />
Agrarumweltprogrammen angeboten wird (akutell nach VO (EG) 1257/1999). Damit verbunden<br />
ist eine relativ rigide Verwaltung und Kontrolle im Rahmen des Integrierten Verwaltungs- und<br />
Kontrollsystems (InVeKoS) (vgl. Durchführungsbestimmungen zum InVeKoS<br />
(VO (EG) 2419/2001). Die sich aus diesem System ergebenden Restriktionen werden innerhalb<br />
der Arbeit nicht in jedem Fall als solche behandelt. Um jedoch zu praxisrelevanten Ergebnissen<br />
für Honorierungsinstrumente zu kommen, können die aktuellen agrarpolitischen<br />
Rahmenbedingungen nicht ausgeblendet werden.
118 Kapitel 6<br />
6.3.4.1 Raumäquivalenz<br />
Im Zusammenhang mit der Verwendung der Indikatoren für die Schaffung und Durchsetzung<br />
relativer Eigentumsrechte (Instrumente zur Honorierung ökologischer Leistungen) im Bereich<br />
Landwirtschaft sind zwei räumliche Bezüge zu diskutieren:<br />
1. Raumbezug für die Qualifizierung der Indikatoren (Raum in dem die Indikatoren valide<br />
sind),<br />
2. Raumbezug für die Quantifizierung (Normierung) der Indikatoren (zweckgebundener<br />
Raumbezug der Normierung).<br />
Unter Punkt 1 wird der Raum verstanden, in dem ein Indikator valide ist, das heißt ein Gebiet<br />
mit gleichen Umweltzielen, die über die gleichen Umweltzustands-Indikatoren abgebildet<br />
werden können oder innerhalb des Raumes mit den gleichen Maßnahmen (inklusive Emissionen<br />
und Immissionen) erreicht werden können. In diesem Verständnis entspricht der Raumbezug für<br />
die Qualifizierung der Indikatoren dem so genannten Regelungsraum. Kennzeichnend für diesen<br />
Regelungsraum ist, dass innerhalb des Raumes ein nach Art und Dosierung einheitlicher<br />
Instrumenteneinsatz gilt und umweltrelevante Aktivitäten nach privatwirtschaftlichen<br />
Erwägungen räumlich verteilt oder kumuliert werden dürfen (Scheele et al. 1993; vgl. auch<br />
Kap. 3.1.3 zu den Baumol-Instrumenten sowie Kap. 6.1 zu substitutionalen Zielstrukturen als<br />
Voraussetzung für Honorierungsinstrumente).<br />
In Anlehnung an die Funktion der Indikatoren zur Schaffung und Durchsetzung effizienter<br />
Eigentumsrechte an den ökosystemaren und individuellen Fähigkeiten zur Produktion der<br />
ökologischen Güter sei noch einmal ausdrücklich darauf hingewiesen, dass in dieser Arbeit von<br />
einer funktionalen Raumabgrenzung ausgegangen wird.<br />
Eine Frage, die sich im Zusammenhang mit der Honorierung ökologischer Leistungen stellt, ist,<br />
ob sich aus dem Zweck der Indikatoren spezielle Anforderungen an den Bezugsraum ergeben?<br />
Unter dem Aspekt der Effektivität der Honorierung würde das Kriterium der Validität der<br />
Indikatoren nicht nur den Bezugsraum für den Indikator definieren, sondern gleichzeitig das<br />
ausschlaggebende Kriterium für die Bestimmung des optimalen Regelungsraumes darstellen.<br />
Wenn die Abgrenzung des Regelungsraumes sich ausschließlich an der Validität der Indikatoren<br />
orientiert (der (die) Indikator(en) ist (sind) im gesamten Raum 100 % valide), wird der dadurch<br />
bestimmte Raum als effektiver Regelungsraum bezeichnet. Praktisch heißt dies für die<br />
Honorierung ökologischer Leistungen, dass diese 100 % effektiv sind.
Rationalisierte Umweltziele als Ansatzstelle für die Honorierung ökologischer Leistungen 119<br />
Eine derartige Raumabgrenzung ist jedoch nur in einer Welt ohne Transaktionskosten realistisch.<br />
Effizienzüberlegungen werden in den allermeisten Fällen zu einer anderen Abgrenzung des<br />
Regelungsraumes führen. „In particular, the more precise the design of the management<br />
prescription and the designation of areas eligible for their implementation, the more effective<br />
will be the scheme, and the lower the potential for contractors to economic rents. However, the<br />
higher will be the administrative costs. Hence there is a trade-off to resolve: administrative costs<br />
should be optimized jointly with other costs (namely payments to farmers) to fulfil all the<br />
objectives of policy-making” (Falconer et al. 2001: 84). Unter Berücksichtigung der<br />
Transaktionskosten ist die ‚policy-off’ Situation zu ermitteln (Falconer et al. 2001: 84, vgl. auch<br />
Falconer 2000). Derartige ‚policy-offs’ spiegeln den normativen Ansatz des Fiskalföderalismus 81<br />
wider.<br />
Dabei werden für die Bestimmung des optimalen politischen Regelungsraumes nicht nur die<br />
Kosten für die Schaffung und Durchsetzung der relativen Eigentumsrechte im effektiven<br />
Regelungsraum berücksichtigt, sondern auch die Kosten aufgrund der Heterogenität der<br />
Angebots- und Nachfrageseite (vgl. für den agrarumweltpolitischen Bereich Ewers & Hassel<br />
2000, Rudolff & Urfei 2000, Karl & Urfei 1995). Eine perfekte Synchronisiation im Sinne des<br />
perfect mapping ist dabei illusorisch (valider Indikatorenraum = optimaler politischer<br />
Regelungsraum). Perfect mapping würde bedeuten, dass für jedes ökologische Gut der<br />
funktionale (valide) Regelungsraum definiert wird (vgl. zum perfect mapping grundlegend<br />
Breton 1965). Als theoretischer Bezugsrahmen verliert der effektive Regelungsraum daher beim<br />
Versuch seiner praktischen Umsetzung einiges an Attraktivität und Bestimmtheit. Unabhängig<br />
davon stellt er jedoch den „Fixstern“ bei der Ableitung des effizienten Regelungsraumes dar und<br />
ist die „ökologisch und ökonomisch richtige Analyseeinheit“ (vgl. Ewers & Hassel 2000: 108).<br />
Jeder andere Regelungsraum muss sich daran messen lassen, ob die realisierten<br />
Kosteneinsparungen den Verlust an Treffsicherheit (Validität) aufwiegen (vgl. Ewers & Hassel<br />
2000).<br />
81 Diese klassische Theorie des Fiskalföderalismus ist dadurch gekennzeichnet, dass für jede Gebietskörperschaft<br />
eine Regierung unterstellt wird, die als perfekter Sachwalter der regionalen Bürgerinteressen fungiert. Die<br />
Regierung verhält sich wie ein wohlmeinender Sozialplaner. Abzugrenzen davon sind neuere Ansätze, welche die<br />
Annahme eines Sozialplaners aufgeben. In der klassischen Theorie des Fiskalföderalismus stehen drei Kriterien für<br />
die Zuweisung von allokativen Staatsaufgaben auf verschiedene Gebietskörperschaften im Vordergrund: der<br />
regionale Einzugsbereich von Politikmaßnahmen, das Vorliegen von Skalenerträgen und die Präferenzunterschiede<br />
zwischen den Regionen (grundlegend Oates 1972).
120 Kapitel 6<br />
Im hier diskutierten Zusammenhang ist wesentlich, dass sich der Raumbezug für Indikatoren<br />
ökologischer Güter nicht ausschließlich nach Effektivitätskriterien richten kann, sondern unter<br />
dem Postulat der Berücksichtigung der Transaktionskosten erfolgt. Wenn die Transaktionskosten<br />
für die Ermittlung und die Administrierung des validen (100 %) Raumes höher sind als der Preis<br />
des Gutes muss die Gesellschaft bereit sein, Risiko für die fehlenden Validität zu übernehmen.<br />
Ob der Tausch, die Honorierung ökologischer Leistungen, das geeignete Allokationsinstrument<br />
ist, hängt entscheidend von dem Funktionsverlauf der Transaktionskosten und der<br />
Risikobereitschaft der Gesellschaft ab.<br />
Pauschale Aussagen zur optimalen Größe des Bezugsraumes in dem Sinne, je größer der<br />
Bezugsraum, je geringer die Transaktionskosten können nicht getroffen werden, wenn man die<br />
gesamten Kosten (also auch Verhandlungskosten, Informationskosten usw.) mit berücksichtigt.<br />
Sowohl theoretische Erkenntnisse zum optimalen Zentralisierungsgrad im Bereich der<br />
Föderalismustheorie (vgl. z. B. Frey & Kirchgässner 1994) als auch empirische Erhebungen zu<br />
Transaktionskosten im Rahmen von unterschiedlich ausgestalteten Agrarumweltprogrammen<br />
lassen solche pauschalen Aussagen nicht zu (vgl. Falconer 2000, Rodgers & Bishop 1999).<br />
Was jedoch abgeleitet werden kann, ist, dass die Transaktionskosten für den Tausch geringer<br />
werden, wenn der Raum für verschiedene Transaktionen derselbe ist, das heißt, wenn<br />
Agrarumweltmaßnahmen jeweils im gleichen Raum angeboten werden und sich sowohl die<br />
Transaktionskosten für die Verwaltung als auch für die Landwirte verringern (vgl. „one-stop<br />
shops for management agreements” Falconer 2000, Rodgers & Bishop 1999). Oft stellen<br />
administrative Einheiten einen potentiellen Kompromiss des Raumbezuges unter dem Aspekt der<br />
Transaktionskosten dar, da dadurch z. B. Suchkosten für die Raumbildung und Verwaltung<br />
entfallen. Untersuchungen zu Agrarumweltmaßnahmen in England mit naturräumlich definierten<br />
Gebietskulissen, den so genannten ESA (Environmental Sensitive Areas), zeigen jedoch, dass<br />
sich die Transaktionskosten für Maßnahmen mit der Dauer der Anwendung verringern (Falconer<br />
et al. 2001) und dadurch der potentielle Kostenvorteil der administrativen Gebietskulissen sinkt.<br />
Für die praktische Verwendung von Indikatoren im hier diskutierten Zusammenhang kann<br />
‚allgemeingültig’ lediglich geschlussfolgert werden, je weniger die Validität der Indikatoren vom<br />
Raum (Standort) abhängt, desto potentiell besser sind die Indikatoren geeignet.<br />
Unter Punkt 2 (s. S. 118) wird der Raumbezug betrachtet, der für die Normierung der<br />
Indikatoren entscheidend ist und durch den jeweiligen Zweck bestimmt wird. Im Zusammenhang<br />
mit der Honorierung ökologischer Leistungen der Landwirtschaft muss sich die Normierung der
Rationalisierte Umweltziele als Ansatzstelle für die Honorierung ökologischer Leistungen 121<br />
Indikatoren auf die landwirtschaftliche (Betriebs-)Fläche beziehen lassen bzw. auf den räumlich<br />
funktionalen Wirkungskreis der landwirtschaftlichen Nutzung. Den Landwirten können nur<br />
Eigentumsrechte abgekauft werden, die sie aufgrund der Bewirtschaftungsrechte der jeweiligen<br />
Betriebsfläche haben. Die Quantifizierung der Driving forces-Indikatoren und Pressure-<br />
Indikatoren muss daher immer auf die landwirtschaftliche (genutzte) Fläche zu beziehen sein.<br />
Am Beispiel verdeutlicht heißt dies, dass die Verminderung der Nährstoffemissionen (i.S.v.<br />
Pressure-Indikator für das Ziel Grundwasserschutz) oder auch der Anbau von Untersaaten (i.S.v.<br />
Driving forces-Indikator für das Ziel Erosionsschutz) pro Hektar honoriert wird. Ein Pressure-<br />
Indikator, der sich auf die gesamte Betriebsfläche bezieht, wären z. B. die Hoftor-Bilanzen für<br />
Stickstoff oder klimarelevante Gase wie CO2 (diese werden dann wieder auf die bewirtschaftete<br />
Fläche bezogen, wenn daran Zahlungen geknüpft werden sollen).<br />
Umweltzustands-Indikatoren werden in den meisten Fällen ebenfalls auf die landwirtschaftliche<br />
Fläche normiert. Ein Beispiel ist das Vorkommen bestimmter Pflanzenarten auf dem Grünland<br />
als Indikator des Umweltziels ‚Erhaltung standorttypischer Artenvielfalt des extensiv genutzten<br />
Grünlandes’. Hier kann, wie im aktuell angewendeten Beispiel des MEKA II (vgl. Kap. 4.2.3.2),<br />
der Grünlandschlag als Bezugsgröße für die Normierung genutzt werden. In der Anleitung zur<br />
Beurteilung eines Grünlandschlages wird aufgeführt: „1. Das Grundstück ist entlang einer der<br />
beiden Diagonalen (bei Dreiecksform entlang der Seitenhalbierenden) zu durchschreiten. Dabei<br />
ist die Wegstrecke gedanklich in 3 gleich lange Abschnitte zu teilen. 2. Jeder dieser 3 Abschnitte<br />
ist im Bereich der seitwärts ausgestreckten Arme auf Kennarten zu kontrollieren. Die zu<br />
beurteilenden Flächen sind je ein Streifen links und rechts der ‚Ganglinie’ von etwa 80 bis 90<br />
cm“ (MLR (Hrsg.) 1999).<br />
Ein möglicher Umweltzustandsindikator mit Bezug zur Betriebsfläche wäre der Anteil<br />
wertvoller Saumstrukturen (operationalisiert über klar definierte Merkmalsklassen) an der<br />
Betriebsfläche als Indikator für das Ziel ‚Erhalt/Verbesserung der Artenvielfalt’.<br />
Bei Zustands-Indikatoren muss der Indikator jedoch nicht in jedem Fall auf die<br />
landwirtschaftliche Fläche normiert werden. Wenn als Umweltziel z. B. für das pleistozäne<br />
Hügelland der Uckermark (Brandenburg) definiert ist, Sölle (anhand geschlossener<br />
Merkmalsklassen definiert) aufgrund ihrer hohen Bedeutung für viele Arten zu erhalten, könnte<br />
ein Landwirt dafür honoriert werden, die (durch bestimmte Indikatoren operationalisierten) Sölle<br />
zu erhalten. Die Honorierung kann direkt an die Umweltzustands-Indikatoren geknüpft werden,<br />
wenn diese Indikatoren auch die anderen Anforderungen erfüllen, die in Abbildung 20 (Kap.
122 Kapitel 6<br />
6.3.4.7) im Überblick dargestellt sind 82 . Bezugsraum der Normierung wäre in diesem Fall also<br />
das Soll (vgl. dazu jedoch auch Problemäquivalenz Kap. 6.3.4.2).<br />
Die aktuellen Rahmenbedingen für die Honorierungsinstrumente unter VO (EG) 1257/1999<br />
schließen eine Honorierung für Flächen/Objekte (z. B. Soll im oberen Beispiel) außerhalb der<br />
landwirtschaftlich genutzten Fläche in Deutschland aus. Allerdings können seit 2000 bestimmte<br />
Anteile von Landschaftsstrukturen als landwirtschaftliche Fläche in das InVeKoS-System<br />
aufgenommen werden (vgl. Verordnung VO (EG) 2721/2000) und wären dadurch ebenfalls für<br />
die Anwendung von Honorierungsinstrumenten relevant. Mit der ‚Integration’ dieser Flächen in<br />
die landwirtschaftliche Fläche könnten auch für diese Flächen die Honorierungsinstrumente<br />
genutzt werden. Allerdings wird aktuell in Deutschland davon noch kein Gebrauch gemacht.<br />
Für die praktische Verwendung von Indikatoren im hier diskutierten Zusammenhang kann<br />
geschlussfolgert werden, dass die Indikatoren für landwirtschaftliche Flächen (z. B. Hektar,<br />
Schlag, Betriebsfläche) normierbar sein müssen (administrativ als landwirtschaftliche Fläche<br />
ausgewiesen).<br />
6.3.4.2 Problemäquivalenz<br />
Die Indikatoren sollen es Landwirten ermöglichen, Eigentumsrechte an ökosystemaren und<br />
individuellen Fähigkeiten zu tauschen, um die Produktion ökologischer Güter zu gewährleisten.<br />
Die Indikatoren müssen die Gütereigenschaften definieren, die durch die Eigentumsrechte<br />
bestimmt sind. Die Indikatoren müssen im Fall der Honorierung ökologischer Leistungen<br />
gegenüber der Art der landwirtschaftlichen Nutzung eines Landwirtes sensibel und gegenüber<br />
anderen Einflussfaktoren robust sein. Wenn ein sauberes Fließgewässer ein knappes<br />
ökologisches Gut in einem bestimmten Gebiet darstellt (als gesellschaftliches Umweltziel<br />
definiert ist), so kann dies z. B. über den Saprobienindex indikatorisch operationalisiert<br />
werden 83 .<br />
Das Problem besteht in der allgemein bekannten Tatsache, dass das nachgefragte Gut<br />
(operationalisiert über Saprobienindex ) nicht nur durch die Eigentumsrechte des Landwirtes mit<br />
angrenzenden Flächen beeinflusst wird, sondern von den verschiedenen Nutzern<br />
82 Das Problem der Ermittlung des Wertes der ökologischen Leistung soll an dieser Stelle nicht diskutiert werden.<br />
83 Es wird unterstellt, dass der Saprobienindex das nachgefragte ökologische Gut valide abbildet.
Rationalisierte Umweltziele als Ansatzstelle für die Honorierung ökologischer Leistungen 123<br />
(Eigentumsrechten) im gesamten Einzugsgebiet des Fließgewässers abhängt. Das handelbare<br />
ökologische Gut ist also nicht die nachgefragte Umweltstruktur ‚sauberes Fließgewässer’,<br />
sondern lediglich die durch den einzelnen Vertragspartner beeinflusste Fließgewässerqualität.<br />
Der Nachfrager (z. B. die Gesellschaft) muss sich bewusst sein, dass er mit<br />
Honorierungsinstrumenten lediglich für die mit den Eigentumsrechten erfassten Eigenschaften<br />
sein Geld investiert.<br />
Die Herausforderung im Zusammenhang mit effizienten Honorierungsinstrumenten besteht<br />
demnach darin, dass der durch die landwirtschaftliche Nutzung beeinflusste Teil der<br />
nachgefragten ökologischen Güter durch Indikatoren gefasst werden muss und zwar derart, dass<br />
für den Landwirt idealer Weise Handlungsalternativen zur Produktion dieser Güter offen stehen.<br />
Diese Betrachtungen führen in jedem einzelnen Fall zur kritischen Diskussion, ob<br />
Honorierungsinstrumente das geeignete Mittel sind, um die Produktion der ökologischen Güter<br />
zu gewährleisten. Sind die Indikatoren nicht problemäquivalent, geht bei vertraglich geregelten<br />
Transaktionen von Eigentumsrechten einer der Vertragspartner ein Risiko ein. Bei Zustands-<br />
Indikatoren, die nicht robust gegenüber anderen Einflüssen als der selbst gesteuerten<br />
landwirtschaftlichen Nutzung sind, trägt der Landwirt das Risiko, kein Geld zu bekommen,<br />
obwohl er bestimmte Maßnahmen durchgeführt hat (z. B. die Düngung reduziert hat). Bei<br />
Immissions-Indikatoren muss zwischen zwei Situationen unterschieden werden, je nachdem, ob<br />
die Immission als Wirkung oder Ursache definiert wird. Der Anbieter (z. B. ein einzelner<br />
Landwirt) trägt das Risiko, wenn die Immissionen nicht problemäquivalent reagieren und der<br />
Nachfrager (z. B. Gesellschaft) trägt das Risiko, wenn die Immission nicht problemäquivalent<br />
wirkt (vgl. auch Kap. 6.3.5.1). Bei Emissions- und Maßnahmen-Indikatorenarten trägt die<br />
Gesellschaft das Risiko, ihr Geld in die Maßnahmen zu investieren, ohne das nachgefragte<br />
ökologische Gut zu erhalten (vgl. Tabelle 2)<br />
Tabelle 2: Träger des Vertragsrisikos bei nicht problemäquivalenten Indikatoren im Rahmen der<br />
Honorierung<br />
Indikatorentyp Risikoträger bei fehlender Problemäquivalenz der Indikatoren<br />
Zustands-Indikatoren Anbieter<br />
Immissions-Indikatoren Anbieter oder Nachfrager<br />
Emissions-Indikatoren Nachfrager<br />
Maßnahmen-Indikatoren Nachfrager
124 Kapitel 6<br />
Für die praktische Verwendung von Indikatoren im hier diskutierten Zusammenhang kann<br />
geschlussfolgert werden, dass die Indikatoren gegenüber der landwirtschaftlichen Nutzung eines<br />
Vertragspartners sensibel und gegenüber den anderen Nutzungen robust sein müssen. Fehlende<br />
Problemäquivalenz bei Indikatoren bedeutete in jedem Fall für einen Vertragspartner das Risiko,<br />
knappe Ressourcen umsonst zu investieren.<br />
6.3.4.3 Zeitäquivalenz<br />
Die Indikatoren müssen in einem Zeitraum sensibel sein, der vertraglich gebundene<br />
Transaktionen ermöglicht. Prinzipiell können dies sehr lange Zeiträume sein (vgl. z. B. im<br />
Forstbereich). In der Landwirtschaft funktionieren derartige Vertragslaufzeiten jedoch nicht.<br />
Landwirtschaftliche Betriebe sind derart strukturiert, dass die Erträge aus Leistungen auf ihren<br />
Flächen möglichst jährlich anfallen. Verträge können und werden zwar auch langfristiger<br />
abgeschlossen, die Erträge fließen jedoch in der Regel zeitnah zu den entgangenen<br />
Alternativerträgen. Die meisten der aktuell abgeschlossenen Verträge zur Honorierung<br />
ökologischer Leistungen haben eine Vertragslaufzeit von 5 Jahren, wobei für jedes Jahr<br />
kontrollierbare Indikatoren vorliegen, auf deren Grundlage die jährliche Zahlung erfolgt. Auch<br />
unter der Annahme, dass durch die äußeren agrarpolitischen Rahmenbedingungen große<br />
Flexibilität bei der Ausgestaltung von Verträgen besteht (was de facto in den meisten Fällen<br />
aktuell und in absehbarer Zeit nicht zutrifft), dürfen die Umweltprobleme, die mit der<br />
Honorierung ökologischer Leistungen der Landwirtschaft gelöst werden sollen, nicht auf eine<br />
mittlere bis langfristige Vertragslaufzeit angewiesen sein. Das heißt, die Indikatoren müssen<br />
relativ kurzfristig reagieren (Zustands-Indikatoren) bzw. kurzfristig wirken (Immissionens-<br />
Emissions- und Maßnahmen-Indikatoren). Honorierungsinstrumente sind besonders dort<br />
geeignet, wo kurz- und mittelfristige Ziele erreicht werden sollen.<br />
Wenn keine Indikatoren für die knappen ökologischen Güter definiert werden können, die in<br />
‚vertragstauglichen’ Zeiträumen sensibel sind, ist das Umweltproblem nicht (allein) mit<br />
Honorierungsinstrumenten zu lösen. Es sind Anreize notwendig, um zu gewährleisten, dass die<br />
Vertragslaufzeit mit der inhärenten Systemzeit der ökologischen Systeme übereinstimmt 84 . Die<br />
inhärente Systemzeit ist die dem ökologischen System eigene Zeitskala. Diese ergibt sich aus der<br />
84 Die inhärente Systemzeit kann zu den in der ökonomischen Literatur als ‚Wirkungs- und Erkennungslags’<br />
bezeichneten Verzögerungen führen (vgl. Andel 1998).
Rationalisierte Umweltziele als Ansatzstelle für die Honorierung ökologischer Leistungen 125<br />
Reproduktionszeit, bei Lebewesen also die Generationszeit, bei höheren Systemen die Dauer, bis<br />
diese auf die Störung bzw. Maßnahme reagieren (Kümmerer 2000).<br />
Sind derartige Anreize da, besteht also Aussicht darauf, dass die Maßnahmen ökologisch<br />
äquivalent durchgeführt werden, kann die ‚Etappenleistung’ auf dem Weg zum tatsächlichen<br />
Ziel indikatorisch abgebildet und daran eine Honorierung geknüpft werden. „Führt eine<br />
Maßnahme ... erst nach vielen Jahren zu dem angestrebten Zustand, so müsste als ‚Leistung’<br />
nicht die beobachtbare Einstellung dieses Zustandes, sondern schon seine jetzige Vorbereitung<br />
gewertet werden“ (Hampicke 1996: 84). Ähnlich wie bei der Problemäquivalenz (vgl.<br />
Kap. 6.3.4.2) kann es demnach notwendig sein, dass die direkt nachgefragten, jedoch nur<br />
langfristig zu erreichenden Umweltziele (zu produzierende ökologische Güter) nicht durch<br />
Transaktionen von Eigentumsrechten zu erreichen sind und daher Etappenziele im Sinne von<br />
handelbaren, kurz- bzw. mittelfristig zu produzierenden ökologischen Gütern definiert werden.<br />
Wie bei fehlender Problemäquivalenz ergibt sich auch bei fehlender zeitlicher Sensibilität ein<br />
Risiko für einen der Vertragspartner.<br />
Wird die Honorierung an Zustands-Indikatoren geknüpft, trägt der Landwirt oder die<br />
Gesellschaft das Risiko, je nachdem ob das ökologische Gut erhalten oder erst entwickelt werden<br />
muss. Sind z. B. in einem bestimmten Raum wiesenbrütende Limikolen (Watvögel) knappe<br />
ökologische Güter, so kann die ökologische Leistung darin bestehen, (i) derartige Limikolen zu<br />
erhalten oder (ii) einen Beitrag zur (Weiter)Entwicklung der Population zu leisten.<br />
Wird die Honorierung ökologischer Leistungen zur Erhaltung der Limikolen an Zustands-<br />
Indikatoren geknüpft (z. B. direkt an die definierte Anzahl bestimmter Limikolenart pro Fläche),<br />
trägt die Gesellschaft im Wesentlichen das Risiko, das bei fehlender zeitlicher Sensibilität<br />
auftritt. Arten können z. B. mit zeitlicher Verzögerung auf Änderungen ihres Standortes<br />
reagieren bzw. haben ein langes Verharrungsvermögen (z. B. Großer Brachvogel). Die<br />
Limikolen können also noch für eine Generation (Großer Brachvogel z. B. über 20 Jahre) auf<br />
Flächen vorkommen, deren Standortbedingungen (ökologische Fähigkeiten!) jedoch eine<br />
Reproduktion nicht mehr in ausreichendem Maße gewährleisten. Ergebnisse zum<br />
Reproduktionserfolg des Großen Brachvogels in Brandenburg sollen diesen Zusammenhang<br />
beispielhaft verdeutlichen.<br />
In Tabelle 3 sind die Anzahl der näher kontrollierten Brutpaare (BP) und der<br />
Reproduktionserfolg des Großen Brachvogels für verschiedene Zeitreihen und verschiedene<br />
europäische Vogelschutzgebiete ‚Specially Protected Area’ (SPA) in Brandenburg dargestellt.
126 Kapitel 6<br />
Vergleicht man den tatsächlichen Reproduktionserfolg mit den Angaben der Literatur zur<br />
notwendigen Reproduktion von 0,4 flüggen Jungtieren (fl. Juv.) pro Brutpaar (den Boer 1995)<br />
zeigt sich, dass der tatsächliche Reproduktionserfolg im überwiegenden Teil nicht ausreicht, um<br />
die Population langfristig zu erhalten. Dieser fehlende Reproduktionserfolg spiegelt sich jedoch<br />
nur unzureichend in den vorkommenden Brutvogelpaaren wider (vgl. Tabelle 3). Die Anzahl der<br />
Brutvogelpaare ist kein zeitlich sensibler Indikator. Mit Bezug auf die Ausführungen zur<br />
Validität kann für diesen Fall auch geschlussfolgert werden, dass der Indikator ‚Anzahl der<br />
Individuen/Brutpaare’ nicht valide ist, da das Umweltziel die Erhaltung/die Bereitstellung der<br />
notwendigen ökosystemaren und individuellen Fähigkeiten zur Produktion der ökologischen<br />
Güter ist (vgl. Kap. 6.3.2).<br />
Tabelle 3: Anzahl der Brutpaare (BP) (kontrolliert) und des Reproduktionserfolges des Großen Brachvogels<br />
auf Grünland in drei Brandenburger Vogelschutzgebieten<br />
Europäisches<br />
Vogelschutzgebiet (SPA)<br />
Untere Havelniederung<br />
(Gr. Grabenniederung)<br />
Belziger Landschaftswiesen<br />
Malxe-Niederung<br />
Jahr<br />
*erforderliche Reproduktion (nach Boer 1995): 0,4 fl. Juv./BP<br />
Datenquelle: LUA N2 (2003)<br />
Anzahl näher<br />
kontrollierter BP<br />
Reproduktionserfolg<br />
fl. Juv./BP*<br />
2000 5 0,2<br />
2001 5 0,0<br />
2002 5 0,2<br />
1998 21 0,24<br />
2000 20 0,05<br />
2001 20 0,45<br />
2002 20 0,0<br />
1998 13 0,15<br />
1999 12 0,17<br />
2000 11 0,0<br />
2001 11 0,0<br />
Eine andere Situation ergibt sich, wenn die Honorierung an Zustands-Indikatoren geknüpft wird,<br />
diese jedoch einen zu entwickelnden Zielzustand abbilden (ii). So könnte der Landwirt dafür<br />
honoriert werden, dass sich auf seiner Wiese die Anzahl der Brutpaare des Großen Brachvogels<br />
verdoppelt. In diesem Fall trägt der Landwirt das Risiko, wenn der Indikator nicht zeitlich<br />
sensibel (entsprechend vertraglichen Regelungen) reagiert (Annahme: valide und<br />
problemäquivalent). Bei dem gewählten Beispiel des Großen Brachvogels ist diese Sensibilität
Rationalisierte Umweltziele als Ansatzstelle für die Honorierung ökologischer Leistungen 127<br />
nicht gegeben, da die Ansiedlung von neuen Brutpaaren in hohem Maße von den individuellen<br />
standörtlichen Gegebenheiten abhängt (z. B. der historischen Nutzung, der Populationsdichte im<br />
Gebiet usw.).<br />
Bei Immissions-Indikatoren liegt das Risiko beim Anbieter oder Nachfrager, je nachdem ob<br />
Immissionen nicht zeitäquivalent reagieren oder wirken (vgl. Kap. 6.3.4.3). Wird die<br />
Honorierung an Emissions- oder Maßnahmen-Indikatoren geknüpft, trägt die Gesellschaft in<br />
jedem Fall das Risiko, wenn die Maßnahmen nicht in der Vertragszeit Wirkung zeigen. Tabelle 4<br />
stellt noch einmal die Verteilung des Risikos bzgl. der Zeitäquivalenz für die Indikatorenarten im<br />
Überblick dar.<br />
Tabelle 4: Träger des Vertragsrisikos bei nicht zeitäquivalenten Indikatoren im Rahmen der Honorierung<br />
Indikatorentyp<br />
Risikoträger bei fehlender zeitlicher Sensibilität der Indikatoren<br />
Erhaltungsziel Entwicklungsziel<br />
Zustands-Indikatoren Nachfrager Anbieter<br />
Immissions-Indikatoren kein Risiko* Anbieter oder Nachfrager<br />
Emissions-Indikatoren kein Risiko* Nachfrager<br />
Maßnahmen-Indikatoren kein Risiko* Nachfrager<br />
* Annahme: Indikatoren sind valide/problemäquivalent<br />
Für die praktische Verwendung von Indikatoren im hier diskutierten Zusammenhang kann<br />
geschlussfolgert werden, dass die Indikatoren in vertragstauglichen Zeiten sensibel sein müssen.<br />
Dabei gilt, je schneller die Indikatoren Wirkung anzeigen bzw. Wirkung verursachen, desto<br />
besser sind diese geeignet (desto flexibler können Verträge gestaltet werden). Fehlende<br />
Zeitäquivalenz bei Indikatoren bedeutet in jedem Fall für einen Vertragspartner das Risiko,<br />
knappe Ressourcen umsonst zu investieren.<br />
6.3.4.4 Normierbarkeit<br />
Mit den Indikatoren (dem Indikator) muss eine Grenzziehung in gleicher Weise möglich sein wie<br />
mit einem Grenzwert im Bereich des Ordnungsrechtes. „Ein ... Grenzwert digitalisiert das<br />
Problem, er ist eine Form mit zwei Seiten, deren eine den Bereich des Verbotenen, deren andere<br />
den Bereich des Erlaubten bezeichnet. Auf geschickte Weise wird dadurch das Verbotene und
128 Kapitel 6<br />
das Erlaubte in einer einzigen Markierung zusammengefasst, und diese Markierung kann zudem<br />
verschoben werden, wenn Veränderungen des Erkenntnisstandes oder politische Pressionen dies<br />
nahe legen“ (Luhmann 1991: 1777, zitiert in Schröder 1996). Die Indikatoren müssen eine<br />
Standardisierung ermöglichen, die honorierungswürdige von nicht honorierungswürdigen<br />
Leistungen trennt. Dies ist durch die Bildung einer geschlossenen Merkmalsklasse möglich (vgl.<br />
Operationalisierung i.d.S. in Romahn 2003: 81). Die Einstufung z. B. einer einzelnen<br />
landwirtschaftlich genutzten Fläche als honorierungswürdig oder nicht honorierungswürdig<br />
entspricht einer einfachen Ja-/Nein-Entscheidung. Dies setzt voraus, dass bei der Subsumtion des<br />
konkreten Einzelfalls unter die geschlossene Merkmalsklasse eine objektive ex ante-<br />
Bewertungsregel besteht (i.d.S. vgl. auch Romahn 2003 zur Subsumtionstheorie in der<br />
Bewertung). Bei der Subsumtion des einzelnen Objekts ist festzustellen, ob dieses zu der<br />
entsprechend bewerteten Klasse gehört, wobei die Zuordnung der einzelnen Objekte zur<br />
Wertklasse durch das Verfahren zweifelsfrei bestimmt ist (vgl. Bernotat et al. 2002: 369,<br />
Romahn 2003: 71 f.).<br />
Die aktuellen politischen Rahmenbedingungen für die Anwendung der Honorierung<br />
ökologischer Leistungen bedingen eine sehr präzise und einfache Möglichkeit der Kontrolle von<br />
Zahlungen für ökologische Leistungen. Das heißt, die Ja-/Nein-Entscheidung muss anhand<br />
einfacher und klar nachvollziehbarer Indikatoren normiert sein. Da aktuell und wohl auch<br />
künftig der größte Anteil der Honorierungsinstrumente im Rahmen von EU-kofinanzierten<br />
Agrarumweltprogrammen angeboten wird (vgl. Kap. 7.2), sind die EU-weit geltenden strengen<br />
Rahmenbedingungen einzuhalten. Die Mitgliedstaaten sind zuständig für die korrekte<br />
Durchführung der Agrarumweltmaßnahmen. Die Kommission (und der Europäische<br />
Rechnungshof) prüfen bei 5 % der Teilnehmer an Agrarumweltmaßnahmen im Rahmen von<br />
Vor-Ort-Kontrollen jedes Jahr die Durchführung. Wird dabei festgestellt, dass zu Unrecht<br />
honoriert wurde, kann die Kommission dem Mitgliedstaat diese Mittel ‚in Rechnung stellen’,<br />
also anlasten. Entscheidend für die Administration der Mitgliedstaaten ist dann der Grund der zu<br />
unrecht gezahlten Honorierung. Es können zwei Situationen unterschieden werden. (i) Ist der<br />
Verstoß z. B. durch falsche Angaben des Landwirtes entstanden, der die Honorierung erhalten<br />
hat, so kann der Mitgliedstaat sich – nach Maßgabe der verwaltungsrechtlichen Bestimmungen –<br />
sein Geld dort wiederholen. (ii) Große Geldbeträge an Anlastungen kommen zustande, wenn die<br />
Kommission bei ihren Prüfungen zu der Erkenntnis kommt, dass das Verwaltungsverfahren des<br />
Mitgliedstaats nicht den rechtlichen Anforderungen genügt. Dann kann sie einen bestimmten<br />
Prozentsatz der insgesamt für eine Maßnahme gezahlten Beihilfen vom Mitgliedstaat<br />
zurückfordern. Dies erfolgt auch dann, wenn nicht fahrlässig gehandelt wurde, sondern die<br />
Administration nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt hat. Je komplizierter also die
Rationalisierte Umweltziele als Ansatzstelle für die Honorierung ökologischer Leistungen 129<br />
Anforderungen an das Verwaltungsverfahren und je höher das Beihilfevolumen, desto höher das<br />
Anlastungsrisiko, das aktuell bei Agrarumweltmaßnahmen in Größenordnungen von Millionen €<br />
liegen kann.<br />
Für die praktische Verwendung von Indikatoren im hier diskutierten Zusammenhang kann<br />
geschlussfolgert werden, dass die Indikatoren eine klare Grenzziehung zwischen honorierungs-<br />
würdiger und nicht honorierungswürdiger Leistung ermöglichen müssen.<br />
6.3.4.5 Formulier- und Kommunizierbarkeit<br />
Aktuell und wohl auch in der näheren Zukunft sind die Instrumente der Honorierung<br />
ökologischer Leistungen nachfrageorientiert. Die Nachfrage muss so gestaltet sein, dass die<br />
Landwirte, als Adressaten, die damit verbundene Zielsetzung verstehen. Dies bedeutet nichts<br />
anderes, als dass sich die Validität auch den Landwirten als Adressaten erschließt. Dies kann als<br />
wesentliche Voraussetzung für die Akzeptanz derartiger Instrumente angesehen werden. Den<br />
Anwendern muss deutlich werden, was die Indikatoren abbilden, welches Ziel mit diesen<br />
erreicht werden soll. Aktuell wird die Honorierung ökologischer Leistungen in den meisten<br />
Fällen an bestimmte Maßnahmen (nur teilweise im Sinne von Maßnahmen-Indikatoren)<br />
geknüpft (vgl. Kap.7.2.2.4). Für diesen Fall muss die Kausalkette zwischen Maßnahme und Ziel<br />
für den Landwirt nachvollziehbar sein. Menschen halten Normen (im Beispiel bestimmte<br />
Bewirtschaftungsauflagen) eher ein, wenn sie einen Sinn darin sehen. Das gilt auch für die<br />
Bereitschaft zum freiwilligen Tausch von Eigentumsrechten im Rahmen von<br />
Agrarumweltmaßnahmen. Eine europaweite Untersuchung über die Gründe der Teilnahme von<br />
Landwirten an freiwilligen Agrarumweltmaßnahmen kam z. B. zu dem Ergebnis, dass gerade bei<br />
den deutschen Landwirten (untersucht wurden die Bundesländer Bayern, Sachsen und<br />
Schleswig-Holstein) ein wesentlicher Grund der Nichtteilnahme die Überzeugung war, dass<br />
damit kein Nutzen für die Umwelt entsteht (vgl. Drake et al. 1999). 63 % der befragten<br />
Landwirte in Bayern und 33 % der Landwirte in Sachsen gaben als einen Grund der<br />
Nichtteilnahme an, dass sie durch die Maßnahmen keine Verbesserung für die Umwelt erwarten<br />
(Falconer 2000) (vgl. Tabelle A-2 im Anhang). Die Einsicht in die Ziele und den Zweck von<br />
Agrarumweltmaßnahmen dürfte um so mehr zählen, wenn die Maßnahmen gleichzeitig eine<br />
Einschränkung anderer produktiver Handlungsalternativen (sinnvoller Ziele) bedeuten. Auch<br />
Zustands-Indikatoren sowie Emissions- und Immissions-Indikatoren müssen für den Landwirt
130 Kapitel 6<br />
nachvollziehbar und sinnvoll sein 85 . Diese Erkenntnisse bestätigen auch Untersuchungen zu den<br />
Akzeptanzfaktoren von Natur- und Landschaftsschutzmaßnahmen (Knierim & Siebert 2003,<br />
Schenk 2000). Darüber hinaus gilt: „Je schwieriger die Kontrollierbarkeit und je weniger<br />
einsichtig die Bewirtschaftungsauflagen, desto höher ist der Anreiz für einen Vertragsbruch“<br />
(Baur 1998: 11, vgl. auch Kuhlmann 1997, Rapp 1998).<br />
Die aktuell angewendete Honorierung im Rahmen von Agrarumweltprogrammen wird von<br />
unterschiedlichen Ebenen administriert. Dies reicht von der Europäischen Kommission in<br />
Brüssel über das Bundesministerium für Verbraucherschutz und Landwirtschaft (bei<br />
Maßnahmen im Rahmen GAK), die hauptverantwortlichen Landesministerien und die<br />
dazugehörigen Landesanstalten und Ämter bis hin zu den regionalen Stellen wie<br />
Landwirtschaftsämter als direkte Ansprechpartner der Landwirte (vgl. Kap. 7.1.3). Für eine<br />
effiziente Ausgestaltung und Umsetzung der Honorierungsinstrumente ist dabei Voraussetzung,<br />
dass die Anwender die operationalisierten Ziele der Instrumente inhaltlich und funktionell<br />
verstehen, d. h. die Indikatoren als wesentliche Größe anwendergerecht sind.<br />
Werden wieder die gegebenen Rahmenbedingungen betrachtet, so ist unter dem Aspekt der<br />
Formulierbarkeit gerade die Kommunikation und Abhängigkeit der unterschiedlichen<br />
Verwaltungsebenen entscheidend. Die Bundesländer müssen die Agrarumweltprogramme durch<br />
die EU förmlich bestätigen lassen. Für die Bewertung dieser Programmplanungen durch die<br />
Kommission wird es immer wichtiger, dass die Honorierung an klar definierte Merkmale<br />
(Indikatoren) geknüpft wird, um damit Ziele und Mittel transparent darzustellen und einer<br />
Bewertung unter verschiedenen Kriterien (z. B. Kohärenz der Maßnahmen) zugänglich zu<br />
machen. Die zunehmende Bedeutung dieses Anspruchs, insbesondere auch die Verbesserung der<br />
Transparenz gegenüber der Öffentlichkeit, wird in der steigenden Zahl von Evaluierungen<br />
deutlich. Die Anforderungen an die Evaluierung der Agrarumweltmaßnahmen im Zuge der<br />
Halbzeitbewertung der Pläne zur ländlichen Entwicklung verdeutlichen den Anspruch an<br />
deutlich formulierte Maßnahmen mit klarem und nachvollziehbarem Zielbezug (vgl. Guidelines<br />
der Kommission zur Halbzeitbewertung COM 1999a, COM 2000b, COM 2002b).<br />
Für die praktische Verwendung von Indikatoren im hier diskutierten Zusammenhang kann<br />
geschlussfolgert werden, dass die Indikatoren adressatengerecht und anwendergerecht<br />
formuliert sein müssen.<br />
85 ausführlich zur Bedeutung der ‘Motivation’ bei der Einhaltung von Umweltrecht Ekardt 2001
Rationalisierte Umweltziele als Ansatzstelle für die Honorierung ökologischer Leistungen 131<br />
6.3.4.6 Praktische Erhebbarkeit und Überprüfbarkeit<br />
Die Instrumente zur Honorierung ökologischer Leistungen werden nur dann eingesetzt, wenn die<br />
Transaktionskosten nicht höher sind als der Wert der gehandelten Eigentumsrechte. Praktisch<br />
bedeutet dies, dass der Erhebungsaufwand finanziell in einem angemessenen Verhältnis zum<br />
Wert der erbrachten Leistungen bzw. der Güter stehen muss (zur Bedeutung der<br />
Transaktionskosten für die Instrumentenwahl vgl. z. B. Falconer & Whitby 1999: 84). Geht man<br />
dabei wieder von den aktuellen Rahmenbedingengen für Honorierungsinstrumente aus, muss die<br />
Erhebung im Rahmen des Integrierten Verwaltungs- und Kontrollsystems (InVeKoS) der EU<br />
(VO (EG) 2419/2001) möglich sein. Im Anhang ist dieses relativ aufwendige Verfahren der<br />
Verwaltungskontrolle in Abbildung A-2 dargestellt. Die Erhebung der Indikatoren erfolgt durch<br />
die Administration bzw. die Landwirte (durch Nichtspezialisten im Umweltbereich). Für<br />
Maßnahmen-Indikatoren bedeutete dies, dass die Maßnahmen beobachtbar oder im Zuge der<br />
Buchhaltung nachvollziehbar sein müssen. Aus diesem Anspruch heraus hat die EU-<br />
Kommission z. B. die Kofinanzierung von Agrarumweltmaßnahmen abgelehnt, bei denen eine<br />
Verringerung des Einsatzes von mineralischem Stickstoffdünger um x % honoriert werden sollte.<br />
Derartige Auflagen sind nicht nachvollziehbar zu erheben.<br />
Umweltzustände (Strukturen) oder auch Immissionen und Emissionen müssen mit einem<br />
praktisch realisierbaren Aufwand zu erheben sein. Der Aufwand zur Erhebung muss in einem<br />
angemessenen Verhältnis zum Wert der ökologischen Güter stehen. Allgemein gilt auch in<br />
diesem Fall wieder, je einfacher die Indikatoren zu erheben sind, desto geringer ist das<br />
Anlastungsrisiko (vgl. S. 129).<br />
Für die praktische Verwendung von Indikatoren im hier diskutierten Zusammenhang kann<br />
geschlussfolgert werden, dass die Indikatoren mit möglichst geringem Aufwand erhebbar sein<br />
müssen.<br />
6.3.4.7 Anforderungsprofil im Überblick und Diskussion<br />
In Kapitel 6.3.4 werden die Anforderungen an Indikatoren erläutert, die sich aus dem besonderen<br />
Zweck ergeben, nämlich die Möglichkeit zu eröffnen, Eigentumsrechte an ökosystemaren und<br />
individuellen Fähigkeiten zur Produktion knapper ökologischer Güter zu tauschen, um damit die<br />
Produktion dieser Güter zu gewährleisten. Die formulierten Anforderungen gelten sowohl für<br />
Zustands-Indikatoren als auch für Immissions- und Emissions-Indikatoren sowie für<br />
Maßnahmen-Indikatoren. Die Anforderungen müssen in einem gegenseitigen Abwägungsprozess
132 Kapitel 6<br />
bei der Entwicklung der Indikatoren berücksichtig werden. Abbildung 20 stellt die diskutierten<br />
Anforderungen noch einmal im Überblick dar.<br />
Anforderungen an Agrarumweltindikatoren<br />
als Anknüpfungsstelle für die Honorierung ökologischer Leistungen der Landwirtschaft<br />
raumäquivalent problemäquivalent zeitäquivalent<br />
Indikatoren müssen auf der<br />
Betriebsebene oder größerem<br />
räumlichen Maßstab wie<br />
Feldblock/ Schlag/ ha<br />
landwirtschaftlicher Fläche<br />
normierbar sein.<br />
Ein komplexer<br />
naturwissenschaftlicher<br />
Sachverhalt muss auf eine<br />
Ja/Nein-Entscheidung zu<br />
reduzieren sein.<br />
Indikatoren müssen sich<br />
gegenüber der<br />
landwirtschaftlichen Nutzung<br />
eines Vertragspartners sensibel<br />
und anderen Einflüssen<br />
gegenüber robust verhalten.<br />
normierbar formulierbar praktisch erhebbar<br />
• adressatengerecht -<br />
(Verständlichkeit bei den<br />
Landwirten)<br />
• anwendergerecht (Vollzieh-<br />
barkeit durch die Verwaltung und<br />
Kontrollfähigkeit durch die<br />
Rechtsprechung)<br />
Abbildung 20: Anforderungen an Agrarumweltindikatoren im Rahmen der Honorierung<br />
ökologischer Leistungen<br />
Die Auseinandersetzung mit den Anforderungen an Agrarumweltindikatoren und die<br />
Übertragung dieser Erkenntnisse auf Agrarumweltmaßnahmen führt nicht zuletzt zu<br />
Lernprozessen und Erkenntnissen, welche Umweltprobleme mit Hilfe von ökonomischen<br />
Instrumenten gelöst werden können, welche Produktion von ökologischen Gütern mit Hilfe von<br />
ökonomischen Anreizen gesteuert werden kann. Der Lernprozess als wichtiger Output der<br />
Auseinandersetzung mit operationalisierten Zielen wurde bereits vor mehreren Jahren<br />
hervorgehoben: „Mitunter drängt sich gar der Eindruck auf, dass der gesellschaftliche und<br />
politische Lernprozess als bedeutsamer erachtet wird als die eigentliche Festlegung der Ziele und<br />
damit die Umsetzung konkreter Maßnahmen“ (Sandhövel 1997: 26).<br />
Die Reaktionszeit bzw.<br />
zeitliche Sensibilität der<br />
Indikatoren muss im<br />
Rahmen sinnvoller<br />
Vertragsgestaltung liegen.<br />
Indikatoren müssen mit<br />
einem möglichst geringen<br />
Aufwand zu erheben sein.<br />
Der kritische Zielbezug erlaubt überhaupt erst die Auseinandersetzung über die ‚wahren’<br />
politischen Ziele von Maßnahmen, nämlich, ob damit Distributions- oder tatsächlich
Rationalisierte Umweltziele als Ansatzstelle für die Honorierung ökologischer Leistungen 133<br />
Allokationsziele verfolgt werden, ob hinter der Steuerung ein Akt symbolischer Umweltpolitik<br />
steckt, der ökologisch orientierte Wähler und Landwirtschaftslobby gleichermaßen gewinnt (vgl.<br />
Eckardt 2001: 491).<br />
Wird die Entwicklung von Agrarumweltmaßnahmen unter diese Anforderungen gestellt, werden<br />
die aktuellen Agrarumweltmaßnahmen also als Maßnahmen-Indikatoren aufgefasst, müssten<br />
viele der aktuellen Agrarumweltprogramme kritisch überarbeitet werden. Die Halbzeitbewertung<br />
der Agrarumweltprogramme war ein erster Schritt in die Richtung, musste doch mit der<br />
Bewertung ein eindeutiger Zielbezug der einzelnen Maßnahmen (erstmals) hergestellt und die<br />
Wirkung der Maßnahme für diese Umweltziele abgeschätzt werden. Damit wurden zwangsläufig<br />
Fragen der Raum- und der Zeitäquivalenz aufgeworfen. Im Rahmen der Bewertung der<br />
Akzeptanz und der administrativen Umsetzung flossen die Anforderungen ein, die unter der<br />
Normier-, Formulier- und praktischen Erhebbarkeit in den Kapiteln 6.3.4.4 bis 6.3.4.6 diskutiert<br />
wurden (vgl. z. B. Berichte zur Halbzeitbewertung der EPLR).<br />
6.3.5 Probleme der Indikatorenentwicklung und deren Konsequenzen<br />
Die Entwicklung von Indikatoren, die den in Abbildung 20 beschriebenen Anforderungen<br />
gerecht werden, stößt auf drei wichtige, miteinander verbundene Probleme (vgl. Abbildung 21).<br />
An erster Stelle steht die Komplexität sowie das auftretende nicht deterministische Verhalten<br />
ökologischer Systeme und die damit verbundene Unsicherheit bzgl. der aktiven Steuerung<br />
derartiger Systeme (Kap. 6.3.5.1). Gepaart mit dem Problem der Normativität der<br />
Indikatorenentwicklung (Kap. 6.3.5.2) und der Diversität der Umweltziele (Kap. 6.3.5.3)<br />
bestimmt die Indikatorenentwicklung die Grenzen einer umweltzielorientierten Honorierung<br />
(vgl. Abbildung 21). Während Emissions- und Maßnahmen-Indikatoren durch ‚bloße’<br />
Maßnahmen im Sinne der Minimierungsstrategie (vgl. Kap. 6.2.2) prinzipiell ausgetauscht<br />
werden können, wenn die Gesellschaft dazu bereit ist, das nicht definierbare Risiko potentiell<br />
fehlender Wirkung zu tragen, definieren die Probleme der Komplexität und des nichtlinearen<br />
Verhaltens ökologischer Systeme im Bereich der Zustands-Indikatoren die faktische Grenze der<br />
ergebnisorientierten Honorierung, da kaum ein Landwirt bereit sein wird, ein unkalkulierbares<br />
Risiko einzugehen (vgl. zur Risikobereitschaft Rapp 1998, Baur 2003).
134 Kapitel 6<br />
Abbildung 21: Hauptprobleme bei der Entwicklung von Indikatoren als Ansatzstelle für die Honorierung<br />
ökologischer Leistungen (Quelle: Matzdorf 2004)<br />
6.3.5.1 Problem der Komplexität und des nicht deterministischen Verhaltens<br />
ökologischer Systeme und das damit verbundene finanzielle Risiko<br />
Der Indikatorenentwicklung liegt prinzipiell deterministisches Denken zugrunde. Ökosysteme<br />
sind jedoch komplex 86 und in vielen Fällen durch stochastisch und nicht linear 87 ablaufende<br />
Prozesse bestimmt und daher nicht deterministisch, sondern chaotisch (vgl. z. B. Cramer 1989,<br />
Briggs & Peat 1990, Breckling 1992, 2000, Ekschmitt et al. 1996: 419). Alle belebten Systeme<br />
sind komplexer als alle unbelebten (Vollmer 1990, vgl. auch Cramer 1979). Es sollen an dieser<br />
Stelle nicht die genannten Eigenschaften der ökologischen Systeme erläutert werden, sondern<br />
lediglich auf die aufgeführte Literatur verwiesen werden. Wesentlich für die<br />
Indikatorenentwicklung sind allerdings die Schlussfolgerungen, die daraus gezogen werden<br />
können.<br />
Diversität<br />
der Umweltziele<br />
Normativität<br />
des Prozesses<br />
Komplexität<br />
ökologischer Systeme<br />
“Dem Kausalitätsprinzip als Grundlage einer funktionalistischen Betrachtung kommt daher nur<br />
die Bedeutung eines partiell brauchbaren Gedankengebäudes zu, dessen Tragfähigkeit in der<br />
86 Es ist im Allgemeinen nicht möglich, Ökosysteme in der Komplexität ihrer Wirkmechanismen durch eine<br />
endliche Zahl von Merkmalen vollständig zu erfassen (vgl. z. B. Überkomplexität Berg & Scheringer 1994,<br />
anschauliches Beispiel in Gorke & Ott 2003: 96).<br />
87 Zufällige Ereignisse sowie kleinste Änderungen der Anfangsbedingungen, die eine entscheidende Wirkung auf<br />
den Endzustand eines Systems haben können, bestimmen die Prozesse in Ökosystemen (z. B. Mosekilde &<br />
Mosekilde (Hrsg.) 1991, anschauliche Beispiele auch in Breckling 2000).
Rationalisierte Umweltziele als Ansatzstelle für die Honorierung ökologischer Leistungen 135<br />
Ökologie im Einzelfall zu diskutieren ist“ (Breckling 2000: 101). Vor diesem Hintergrund kann<br />
nicht von validen Immissions-, Emissions- und Maßnahmen-Indikatoren sowie problem-<br />
kompatiblen Zustands-Indikatoren ausgegangen werden. Diese sind in gleicher Weise ein<br />
idealisiertes Gedankenkonstrukt, dem man sich versuchen muss anzunähern. Breckling fasst die<br />
Problematik treffend zusammen: „In ihrer Gesamtheit ist die belebte Natur also weder als<br />
deterministischer Ablauf funktional vorstellbar noch ist sie durchgängig unberechenbar<br />
handelnde Instanz. Ihre Unvorhersehbarkeit ist ebenso vorhersehbar wie ihre Vorhersehbarkeit<br />
überraschen kann“ (Breckling 2000: 112).<br />
Die Schlussfolgerung daraus ist, dass jeder Versuch der aktiven Steuerung von Ökosystemen<br />
Entscheidungen unter Unsicherheit verlangt (z. B. Schröder 1996, Jaeger 2000, Gorke & Ott<br />
2003). „Je komplexer ein Sachverhalt ist, desto schwieriger ist es, eine generell verbindliche,<br />
auch Einzelfällen gerecht werdende Regelung zu formulieren“ (v. Mutius & Stüber 1998: 125).<br />
Unsicherheit beschäftigt Wissenschaft und Philosophie seit jeher, was aktuell neu ist, ist die<br />
Tatsache, dass z. B. im Zuge aktueller Umweltprobleme dieser Unsicherheit nicht ausgewichen<br />
werden kann, Unsicherheit „cannot be tamed or ignored“ (Fjelland 2002: 161).<br />
Unsicherheit in der Steuerung ökologischer Systeme bedeutet für die Honorierung ökologischer<br />
Leistungen, dass ein finanzielles Risiko entsteht, das je nach Ausgestaltung des Instrumentes von<br />
der Gesellschaft als Nachfrager oder den Landwirten als Anbieter getragen werden muss.<br />
Risiken beschreiben den Tatbestand, dass als Konsequenz von menschlichen<br />
Handlungsentscheidungen negativ bewertete Ereignisse eintreten können (Zimmermann & Pahl<br />
1999), im vorliegenden Fall die Entstehung von Kosten.<br />
Das finanzielle Risiko tritt aufgrund von Unsicherheit in drei unterschiedlichen<br />
Ausgangsituationen auf, die sich vor allen Dingen in ihrer Kalkulierbarkeit des finanziellen<br />
Risikos unterscheiden. Es tritt eine Risikosituation i.e.S. auf, bei der die relevanten<br />
landwirtschaftlichen Maßnahmen zur Produktion des ökologischen Gutes genauso bekannt sind<br />
wie die Eintrittswahrscheinlichkeit der Wirkung im relevanten Vertragszeitraum. Diese<br />
Risikosituation wird in Anlehnung an den Begriff ‚Risiko’ aus der Risikoforschung definiert<br />
(Schadensereignis und Eintrittswahrscheinlichkeit bekannt, vgl. zur Definition Bechmann 1990).<br />
Neben dieser Risikosituation treten zwei Formen von ungewissen Situationen mit unbekanntem<br />
oder intrinsisch unsicherem Ereignisraum auf (vgl. zur Unterscheidung von Ungewissheit in der<br />
Risikoforschung auch Jaeger 2000). Diese werden gefasst als Unsicherheit i.e.S. und<br />
Unbestimmtheit. Bei der Unsicherheit i.e.S. sind die relevanten landwirtschaftlichen Maßnahmen<br />
(Ursachen) und deren Wirkungen bekannt, allerdings lässt sich die Eintrittswahrscheinlichkeit
136 Kapitel 6<br />
der Wirkungen nicht kalkulieren. Bei der Unsicherheit sind sowohl die relevanten Maßnahmen<br />
als auch die Eintrittswahrscheinlichkeit nicht bekannt. In allen drei Situationen sind jedoch die<br />
ökologischen Güter bekannt. Nur unter diesen Bedingungen ist das Instrument der Honorierung<br />
ökologischer Leistungen relevant (vgl. Kap. 6.2.2).<br />
In Abbildung 22 sind die drei Situationen, die zu einem finanziellen Risiko im Zuge der<br />
Honorierung ökologischer Leistungen führen, noch einmal im Überblick dargestellt:<br />
Risikosituation i.e.S. und die Situation der Ungewissheit, die sich unterteilt in Unsicherheit i.e.S.<br />
und in Unbestimmtheit. Damit wird der sich auch in der juristischen Literatur durchzusetzende,<br />
umfassende Risikobegriff angenommen (vgl. Wahl 1995, Kleihauer 1999). Bei der Typisierung<br />
ist zu beachten, dass es keine klaren Grenzen zwischen den Typen gibt, sondern dass fließende<br />
Übergänge bestimmend sind (vgl. auch dazu Nida-Rümelin 1996).<br />
Relevante positive und negative<br />
landwirtschaftliche Maßnahmen<br />
(Ursachen) und deren Wirkungen<br />
bzgl. ökologischem Gut<br />
Eintrittswahrscheinlichkeit der<br />
Wirkung<br />
bekannt<br />
Abbildung 22: Finanzielles Risiko unterschieden nach drei unterschiedlichen Formen der Kalkulierbarkeit<br />
Was bedeutet dies für die Indikatorenentwicklung bzw. welche Indikatorentypen kommen in den<br />
drei unterschiedlichen Situationen im Zuge der Honorierung ökologischer Leistungen der<br />
Landwirtschaft in Frage? Die Antwort liefert gleichzeitig den Möglichkeitsraum für die<br />
Anwendung von ergebnisorientierten Honorierungsansätzen.<br />
Kalkulierbarkeit sinkt<br />
Unsicherheit steigt<br />
Finanzielles Risiko<br />
Risiko i.e.S. Ungewissheit<br />
bekannt<br />
Unsicherheit i.e.S. Unbestimmtheit<br />
bekannt<br />
unbekannt<br />
unbekannt<br />
unbekannt
Rationalisierte Umweltziele als Ansatzstelle für die Honorierung ökologischer Leistungen 137<br />
Situation ‚Risiko i.e.S.’<br />
Die Steuerung in der Situation Risiko i.e.S. ist prinzipiell unproblematisch. Es kann rational<br />
entschieden werden, ob das auftretende Risiko der Eintrittswahrscheinlichkeit der<br />
landwirtschaftlich initiierten Wirkung dem Risiko übernehmenden Vertragspartner zu groß ist<br />
oder ob er es eingehen will. Je nach Problemkonstellation, je nach den Eigenschaften des<br />
ökologischen Gutes kann die Zahlung an Zustands-, Immissions-, Emissions- oder Maßnahmen-<br />
Indikatoren gebunden werden. Es ist also sowohl eine ergebnisorientierte als auch eine<br />
maßnahmenorientierte Honorierung ökologischer Leistungen möglich. Die Wahl der Indikatoren<br />
und damit der Art der Honorierung hängt von der Risikobereitschaft der Vertragspartner ab<br />
(Tabelle 5). Neben einer Situation ohne jegliche Unsicherheit (praktisch kaum relevant) bietet<br />
die Risikosituation i.e.S. die besten Voraussetzungen für die Anwendung der<br />
ergebnisorientierten Honorierung ökologischer Leistungen der Landwirtschaft.<br />
Situation ‚Unsicherheit i.e.S.’<br />
In der Praxis kommen jedoch weit häufiger Situationen vor, bei denen die<br />
Eintrittswahrscheinlichkeit nur annäherungsweise oder nicht zu bestimmen ist, es sich also um<br />
Unsicherheit i.e.S. handelt (vgl. Abbildung 22). Es ist vordergründig nicht entscheidend, welcher<br />
Typ von Indikatoren genutzt wird, bei allen, auch bei validen Zustands-Indikatoren, müssen die<br />
Kausalzusammenhänge und die Wirkungsdauer bekannt sein, um das Lenkungswissen zu<br />
generieren, wie die folgenden Ausführungen verdeutlichen.<br />
Trotz der Komplexität kann es prinzipiell möglich sein, den Zielzustand anhand einfacher<br />
Zustands-Indikatoren valide abzubilden. Komplexe, nicht lineare Systeme können in ihrem<br />
Aussehen durchaus geordnet erscheinen (vgl. iterierte Funktionssysteme bei Breckling 2000, vgl.<br />
auch Mandelbrot 1977). Entscheidend für die Funktion der Indikatoren ist jedoch die Frage nach<br />
dem ‚wie’ und nicht nur nach dem ‚was’. Wie erhalte ich den Zielzustand bzw. wie entwickle ich<br />
diesen Zustand, oder anders gefragt, welche ökosystemaren und individuellen Fähigkeiten sind<br />
für die Erhaltung oder Entwicklung des ökologischen Gutes erforderlich. Wenn die Gesellschaft<br />
z. B. einen bestimmten artenreichen Wiesentyp nachfragt, der durch eine bestimmte Anzahl von<br />
Arten indikatorisch gefasst werden kann, müssen dem Landwirt mindestens die Wirkungen<br />
seines Handelns bekannt sein. Mit hoher Wahrscheinlichkeit möchte der Landwirt jedoch nicht<br />
nur, dass ihm die Wirkungen an sich bekannt sind, sondern dass er auch deren<br />
Eintrittswahrscheinlichkeit kennt, um überhaupt rational entscheiden zu können, ob er das
138 Kapitel 6<br />
Risiko eingeht, seine individuellen und die ihm zugeteilten ökosystemaren Fähigkeiten gegen<br />
Geldwert zu tauschen.<br />
Es ist prinzipiell davon auszugehen, dass der Landwirt unter Bedingungen der Unsicherheit i.e.S.<br />
nicht bereit ist, das finanzielle Risiko einzugehen, es sei denn, die Rentenerträge sind sehr hoch.<br />
Es gilt demnach die Annahme eines Landwirtes, der prinzipiell bereit ist, kalkulierbares Risiko<br />
zu übernehmen. Zustands-Indikatoren sind von daher in Situationen der Unsicherheit nicht bzw.<br />
nur sehr bedingt geeignet (vgl. Tabelle 5). Es gibt jedoch eine Möglichkeit, das Risiko von dem<br />
Anbieter auf den Nachfrager zu übertragen, indem die nachgefragten Umweltzustände modelliert<br />
werden (s. u. Modellnutzung).<br />
In Situation der Unsicherheit i.e.S. ist für die Eignung von Immissionsindikatoren entscheidend,<br />
an welcher Kausalstelle die Ungewissheit besteht. Wenn Ungewissheit darüber besteht, mit<br />
welcher Wahrscheinlichkeit die relevanten landwirtschaftlichen Maßnahmen bzgl. der<br />
Immissionen Wirkung zeigen, das unkalkulierbare Risiko also beim Landwirt liegt, wird der<br />
Landwirt nicht bereit sein (Annahme siehe oben), seine Honorierung an Immissionen zu knüpfen<br />
(vgl. Tabelle 5).<br />
In Situationen, bei denen das unkalkulierbare Risiko bei den Landwirten liegt und von daher eine<br />
freiwillige Transaktion per Annahme ausgeschlossen wird, können Modelle helfen, wenigstens<br />
einen Teil der in Kapitel 4.2.2.2 beschriebenen Vorteile zu nutzen. In Modellen kann die<br />
landwirtschaftlich beeinflusste Qualität dargestellt werden und die übrigen Einflussgrößen per<br />
Definition festgelegt werden. Damit ist es möglich, das Risiko von dem Landwirt (Anbieter) auf<br />
die Gesellschaft zu übertragen und trotzdem wesentliche Effizienzgewinne der<br />
ergebnisorientierten Honorierung zu gewährleisten. Die Kosten der Ungewissheit zur Wirkung<br />
der nicht modellierten Einflussgrößen trägt dann die Gesellschaft (vgl. Abbildung 23).<br />
Ein Beispiel für einen modellierten Zustands-Indikator ist der modellierte flächenhafte<br />
Bodenabtrag pro Hektar nach der Allgemeinen Bodenabtragsgleichung (ABAG) (Schwertmann<br />
et al. 1990) als Indikator für das Umweltziel ‚Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit’. Dieser<br />
Indikator ist abhängig von Einflussfaktoren, die naturräumlich bestimmt sind (R-Faktor<br />
berücksichtigt den Einfluss des Niederschlages, K-Faktor berücksichtigt den Einfluss des<br />
Bodens, L- und S-Faktor berücksichtigen den Einfluss von Hanglänge und Hangneigung) und<br />
von Faktoren, die der Landwirt beeinflussen kann (z. B. der C-Faktor, der den Einfluss der<br />
Fruchtfolge und der Bodenbearbeitung berücksichtigt und der P-Faktor, der den Einfluss der<br />
Konturnutzung und des Streifenanbaus berücksichtigt) (vgl. anschaulich in Feldwisch et al.<br />
1998). Theoretisch wäre es möglich, den Landwirt je verringerter Tonne Bodenabtrag pro Hektar
Rationalisierte Umweltziele als Ansatzstelle für die Honorierung ökologischer Leistungen 139<br />
gegenüber einem Referenzwert zu honorieren. Damit würden die Standortunterschiede zur<br />
Entscheidungsgrundlage des Landwirtes gehören und somit Effektivitätsgewinne realisiert<br />
werden.<br />
Ein Beispiel für einen modellierten Immissions-Indikator sind N-Einträge ins Grundwasser bzw.<br />
in Oberflächengewässer in Abhängigkeit von standörtlichen und landwirtschaftlich zu be-<br />
einflussenden Faktoren. Der Ansatz zur Knüpfung der Honorierung an modellierte N-<br />
Immissionen wird in Kapitel 8.1 diskutiert.<br />
Die Vorteile von Modellen sind, dass<br />
• das unkalkulierbare Risiko nicht beim Anbieter liegt und damit die Akzeptanz steigt,<br />
• die landwirtschaftlich steuerbaren Einflussgrößen gezielt als Faktoren des Modells genutzt<br />
werden können (z. B. auch Anwendungsdauer),<br />
• mit den Modellfaktoren gleichzeitig die Ergebnis beeinflussenden Steuergrößen für den<br />
Landwirt definiert sind.<br />
Auf der anderen Seite können beim Einsatz von Modellen nicht in jedem Fall alle Vorteile der<br />
ergebnisorientierten Honorierung (vgl. Kapitel 4.2.2.2) realisiert werden. So entsteht durch<br />
modellierte Immissions-Indikatoren kein Anreiz, neues Wissen zur Verringerung der<br />
Immissionen zu generieren, das Innovationspotential wird nicht erhöht.<br />
Gemessene<br />
Umweltzustände/<br />
Immissionen<br />
Risiko beim<br />
Anbieter<br />
(z.B. Landwirt)<br />
Modellentwicklung:<br />
Steuerungsgrößen entsprechen<br />
einzelbetrieblich steuerbarer<br />
landwirtschaftlich Nutzung<br />
(problemkompatibel)<br />
Risiko wird übertragen<br />
Modellierte<br />
Umweltzustände/<br />
Immissionen<br />
Risiko beim<br />
Nachfrager<br />
(z.B. Gesellschaft)<br />
Abbildung 23: Modelle als Möglichkeit des Übertrages von nicht kalkulierbaren Risiken von Landwirten auf<br />
die Gesellschaft
140 Kapitel 6<br />
Unsicherheit i.e.S. bei Immissions-Indikatoren kann jedoch auch dadurch verursacht werden,<br />
dass Unsicherheit darüber besteht, ob mit den honorierten Immissionen tatsächlich die<br />
Produktion des ökologischen Gutes unter den vertraglichen Rahmenbedingungen gewährleistet<br />
wird. In diesem Fall trägt die Gesellschaft das finanzielle Risiko und damit kann eine<br />
ergebnisorientierte Honorierung relevant werden (vgl. Tabelle 5). Genau dorthin ist auch das<br />
Risiko durch die problemkompatiblen modellierten Immissionen verschoben worden (vgl.<br />
Abbildung 23).<br />
Eine Knüpfung der Honorierung an Emissions- und Maßnahmen-Indikatoren ist bei Übernahme<br />
des Risikos durch die Gesellschaft als aktueller Nachfragerin potentiell möglich. Prinzipiell gilt,<br />
dass das gesellschaftliche Risiko bei Immissions-Indikatoren potentiell geringer ist als bei<br />
Emissions- und Maßnahmen-Indikatoren, da die Kausalketten zwischen Ursache und Wirkung<br />
direkter sind (vgl. Abbildung 18). Die Gesellschaft kann sich trotz der nicht kalkulierbaren<br />
Eintrittswahrscheinlichkeit rational für eine Honorierung entscheiden, da sie keine andere Wahl<br />
hat, wenn sie sich für eine Steuerung entscheidet. Kleihauer schlussfolgert für die<br />
Risikobewertung der Freisetzung gentechnisch veränderter Pflanzen: „Wenn aber keine<br />
Entrittswahrscheinlichkeiten gebildet werden können, muss die Beschreibung einer bloßen<br />
Möglichkeit (in Form plausibler Hypothesen) für diese Bereiche ausreichend sein“ (Kleihauer<br />
1999: 60). Ex ante-Forschung kann erhebliche Kosten verursachen und muss irgendwann<br />
abgebrochen werden (s.o. – faktische Grenzen aufgrund der Eigenschaften ökologischer<br />
Systeme). In dieser Situation ist es wichtig, aus Beobachtung und Erfahrung zu lernen und<br />
Anreize zur dezentralen Wissensgenerierung zu schaffen. Dabei können entscheidende Impulse<br />
für die relevanten Steuerungsgrößen, gerade unter den Bedingungen der Unsicherheit i.e.S., aus<br />
der Praxis (in unserem Fall von den Landwirten) kommen. So sehen Hauhs und Lange (1996)<br />
zwar das Rekonstruktionsproblem komplexer ökologischer Systeme, weisen aber gleichzeitig<br />
darauf hin, dass damit nicht in jedem Fall gleichzeitig eine Bedienungskomplexität einhergeht.<br />
Vielmehr funktioniert die Bedienung der Ökosysteme in vielen Fällen in gewünschter Weise. In<br />
einem derartig abstrakten Verständnis von Ökosystemen „ergibt sich eine ungewohnte Allianz<br />
von Praktikern der Ökosystemnutzung auf der einen und Theoretikern der Ökosystemforschung<br />
auf der anderen Seite. Beide Gruppen verbindet, dass sie nicht nur von der Notwendigkeit,<br />
sondern auch von der Existenzberechtigung einfacher Modelle überzeugt sind, die zur Lösung<br />
der modernen Umweltrisiken beitragen“ (Hauhs und Lange 1996: 61 f.).<br />
Begleitende bzw. ex post-Forschung sollte vor diesem Hintergrund gerade in Situationen der<br />
Unsicherheit i.e.S. fester Bestandteil im Rahmen der Honorierung ökologischer Leistungen sein.<br />
Aus den Überlegungen zu den Indikatoren kann für den Einsatz der ergebnisorientierten
Rationalisierte Umweltziele als Ansatzstelle für die Honorierung ökologischer Leistungen 141<br />
Honorierung abgeleitet werden, dass diese in der Situation der Unsicherheit i.e.S. dort möglich<br />
ist, wo die Gesellschaft das unkalkulierbare Risiko übernimmt, indem das Risiko durch<br />
Modellierung der Honorierung nachgelagert auftritt (vgl. Abbildung 23).<br />
Situation ‚Unbestimmtheit’<br />
Prinzipiell liegen in der Situation der Unbestimmtheit ähnliche Ausgangsbedingungen vor wie<br />
unter den Bedingungen der Unsicherheit i.e.S. (vgl. Tabelle 5). Allerdings ist hierbei das<br />
finanzielle Risiko noch weniger vorhersagbar, da nicht allein Wissen über die<br />
Eintrittswahrscheinlichkeit der Wirkung bestimmter landwirtschaftlicher Maßnahmen fehlt,<br />
sondern die notwendigen Maßnahmen/die Wirkungen von Maßnahmen bzgl. des Umweltgutes<br />
an sich nicht bekannt sind (vgl. Abbildung 22). Unter der Bedingung der Unbestimmtheit sind<br />
definierte Umweltziele für die Anwendung der Honorierung ökologischer Leistungen<br />
entscheidend. Der Nachfrager trägt ein hohes finanzielles Risiko, das aus der Unbestimmtheit<br />
erwächst und muss mindestens ex post in der Lage sein, den Nutzen der eingesetzten Mittel zu<br />
prüfen, um daraufhin rational entscheiden zu können, ob die Investition gegenüber den<br />
Alternativen (z. B. anderen Maßnahmen) gerechtfertig ist (vgl. im Gegensatz dazu<br />
Eingriffsminimierung als Vorsorgestrategie Kap. 6.2.2).<br />
Tabelle 5: Praktische Relevanz der Indikatorentypen im Rahmen der Honorierung unter Unsicherheit<br />
Indikatorentyp Risiko i.e.S. Unsicherheit i.e.S. Unbestimmtheit<br />
Zustands-Indikatoren (+) (-) (-)<br />
Immissions-Indikatoren (+) (-)* (+/-)** (-)* (-/+)**<br />
Emissions-Indikatoren (+) (+/-) (-/+)<br />
Maßnahmen-Indikatoren (+) (+/-) (-/+)<br />
(+) = relevant, (+/-) = bedingt relevant, (-) = nicht relevant<br />
*Unsicherheit bzgl. Kausalität – landwirtschaftlicher Maßnahme (Ursache)/Immission (Wirkung)<br />
**Unsicherheit bzgl. Kausalität – Immission (Ursache)/ökologisches Gut (Wirkung)<br />
(Annahme: Anbieter (Landwirte) bereit für kalkulierbares Risiko, Nachfrager (Gesellschaft) u. U. bereit, auf nicht<br />
kalkulierbares Risiko einzugehen)<br />
ergebnisorientierte Honorierung relevant
142 Kapitel 6<br />
Schlussfolgerungen<br />
Das finanzielle Risiko der Vertragspartner im Zuge der Honorierung ökologischer Leistungen ist<br />
bestimmt durch die Komplexität und das chaotische Verhalten von ökologischen Systemen. Die<br />
Kalkulierbarkeit des Risikos bestimmt die mögliche Art der Indikatoren, die sich für eine<br />
Transaktion von Eigentumsrechten im Rahmen der Honorierung ökologischer Leistungen eignen<br />
und damit auch, ob eine ergebnisorientierte Honorierung angewendet werden kann oder lediglich<br />
eine maßnahmenorientierte Honorierung in Frage kommt. Dabei wird davon ausgegangen, dass<br />
Anbieter bei einer freiwilligen Transaktion unter den gegebenen Rahmenbedingungen nicht<br />
bereit sind, unkalkulierbares Risiko zu übernehmen, wie es in den Situationen der<br />
Unsicherheit i.e.S. und Unbestimmtheit auftritt bzw. ihnen u. U. das kalkulierte Risiko in der<br />
Situation ‚Risiko i.e.S.’ zu hoch ist.<br />
Der Anbieter (Landwirt) trägt jeweils das Risiko bis zum Indikator, der Nachfrager das Risiko<br />
auf dem Wirkungspfad zwischen Indikator und ökologischem Gut (vgl. auch Abbildung 18).<br />
Dementsprechend wächst das Risiko für den Anbieter parallel zu den entstehenden<br />
Freiheitsgraden von den Maßnahmen- bis hin zu den Zustands-Indikatoren. Ergebnisorientierte<br />
Honorierung bedeutet immer ein stärkeres Risiko beim Anbieter (Landwirt) und ist von daher<br />
nur eingeschränkt unter den Bedingungen der Unsicherheit i.e.S. und Unbestimmtheit möglich.<br />
Bei Emissions-Indikatoren wächst der Freiheitsgrad der Landwirte, nicht jedoch das finanzielle<br />
Risiko, da die Wirkung zwischen Maßnahme und Emission unabhängig vom ökologischen<br />
System und damit für den Landwirt kalkulierbar ist. Dies ist Vorteil und Nachteil zugleich.<br />
Einerseits wird die Akzeptanz einer an Emissionen gebundenen Transaktion bei Landwirten<br />
genauso hoch sein wie bei Maßnahmen und dies bei potentiell steigender Effizienz. Auf der<br />
anderen Seite entsteht die Verbesserung der ökologischen Effektivität gerade durch die<br />
Bewältigung der Komplexität und des chaotischen Verhaltens ökologischer Systeme auf der<br />
dezentralen Ebene des Anbieters.<br />
Immissions-Indikatoren führen dazu, dass je nach Problemstellung das ökologische System mit<br />
in das rationale Entscheidungskalkül einbezogen wird. Damit können potentielle<br />
Effizienzgewinne im Sinne der ergebnisorientierten Honorierung realisiert werden, jedoch ist<br />
damit auch das finanzielle Risiko (bis zur Immission) beim Anbieter (Landwirt).<br />
Die Gesellschaft kann sich in der Situation der Ungewissheit (Unsicherheit i.e.S. und<br />
Unbestimmtheit) dafür entscheiden, das unkalkulierbare Risiko einzugehen und eine<br />
Honorierung an Maßnahmen- bzw. Emissions-Indikatoren zu knüpfen oder aber das
Rationalisierte Umweltziele als Ansatzstelle für die Honorierung ökologischer Leistungen 143<br />
unkalkulierbare Risiko von den Landwirten bei der Knüpfung an Zustands- und Immissions-<br />
Indikatoren durch Modellierung zu übernehmen, um wenigstens teilweise die Effizienzgewinne<br />
aus der ergebnisorientierten Honorierung zu realisieren. Nach welchen Kriterien die Gesellschaft<br />
das Risiko übernehmen sollte, ist ein ethisches und kein ökonomisches Problem (vgl. u. a. Nida-<br />
Rümelin 1996, Ott 1998a, Gorke & Ott 2003).<br />
Wichtig für eine rationale Ausgestaltung von Honorierungsinstrumenten ist in der Situation der<br />
Ungewissheit, dass die Umweltziele bzw. die ökologischen Güter so definiert sind, dass<br />
wenigstens ex post eine Bewertung über den Erfolg der eingesetzten Mittel möglich ist. Ist dies<br />
nicht der Fall, sollte eine Honorierung ökologischer Leistungen nicht erfolgen, sondern im Sinne<br />
der Vorsorgestrategie die Eingriffsminimierung über andere Instrumente umgesetzt werden (vgl.<br />
Kap. 6.2.2).<br />
6.3.5.2 Problem der Normativität aufgrund der Ungewissheit<br />
Das Problem der Ungewissheit führt dazu, dass es sich bei der Rationalisierung von<br />
Umweltzielen um ein ethisches Problem handelt, „denn es ist eine normative Frage, wie unter<br />
Bedingungen von Ungewissheit entschieden werden soll“ (Gorke & Ott 2003: 110). Solange die<br />
Rationalisierung von Umweltzielen von Unsicherheit geprägt ist, ist die Entwicklung von<br />
Indikatoren auch 88 ein Entscheidungsprozess und eben nicht nur ein Erkenntnisprozess; sie<br />
überschreitet damit die Grenzen der empirischen wissenschaftlichen Forschung. Die<br />
Rationalisierung von Umweltzielen entspricht so lange einer Ermittlung von Präferenzen, wie<br />
Abwägungen notwendig sind, das heißt, so lange ein normativer Input erforderlich ist. Eine<br />
Antwort darauf kann nur in einer Forderung nach demokratischen Strukturen für den<br />
Entscheidungsprozess münden (Funtowicz & Ravetz 1993, Schuldt 1997, Ott 1998b, auch<br />
Jörissen et al. 1999). Gorke und Ott kommen daher bzgl. der Ungewissheit im Bereich der<br />
Umweltsteuerung zu der Aussage, dass die Waffen der Ethik unter diesen Bedingungen nicht<br />
stumpf geworden sind (vgl. Bechmann 1991: 231) sondern, „dass durch wissenschaftliche<br />
Ungewissheit der Ethik ein zusätzliches Gewicht zukommt“ (Gorke & Ott 2003: 118).<br />
88 Das ‚auch’ ist von großer Bedeutung, denn ansonsten kann vom „normativistischen Fehlschluss“ gesprochen<br />
werden. Höffe (1981: 16) bezeichnet damit „die dem naturalistischen Fehlschluss entgegengesetzte Vorstellung,<br />
allein aus normativen Überlegungen ließen sich spezifische oder gar konkrete Verbindlichkeiten ableiten“ (zitiert in<br />
Gorke 1999: 103)
144 Kapitel 6<br />
In Abhängigkeit von dem Grad an Ungewissheit können prinzipiell zwei Situationen innerhalb<br />
der Indikatorenentwicklung unterschieden werden. Die Rationalisierung von gesellschaftlichen<br />
Zielen im Sinne des ‚Herunterbrechens’ in quantifizierbare, geschlossene Merkmalsklassen<br />
bedarf<br />
1. Entscheidungen auf der Grundlage von Erkenntnissen (Entscheidungsprozess), kann<br />
2. auf der Grundlage von Erkenntnissen erfolgen (Erkenntnisprozess).<br />
Im ersten Fall bedarf es der beschriebenen demokratischen Entscheidungsstrukturen, die<br />
Rationalisierung erfolgt direkt im politischen Raum. Derart rationalisierte Ziele „sind mehr oder<br />
weniger politisch gesetzte Definitionen mit starken Rückkoppelungen zum wissenschaftlichen<br />
Erkenntnisfortschritt und zum wissenschaftlich-politischen Beratungsprozess“ (Sandhövel 1997:<br />
28). Indikatoren, die aus einem Entscheidungsprozess hervorgegangen sind, werden in dieser<br />
Arbeit als normative Indikatoren bezeichnet (vgl. Abbildung 24).<br />
Im zweiten Fall erfolgt im gesellschaftlichen Raum eine Zieldefinition derart, dass die weitere<br />
Beschreibung dieses Zielsystems keiner normativen Entscheidungen mehr bedarf (indirekt<br />
rationalisierte Umweltziele), also von der Wissenschaft im letzten Schritt durch die Ableitung<br />
quantifizierbarer geschlossener Merkmalsklassen (Indikatoren) erfolgen kann. Dies ist immer<br />
dann der Fall, wenn Umweltziele unter ökologische Sachmodelle 89 subsumiert werden können<br />
und Naturwissenschaft somit die Umweltziele ohne naturalistischen Fehlschluss (vgl. Eser &<br />
Potthast 1999) 90 mit Hilfe ‚ökologischer’ Sachmodellmerkmale beschreiben kann (vgl.<br />
Abbildung 24). 91<br />
89 „Es gibt keinen ‚Wald’ als objektiv fest bestimmte Umwelt, sondern es gibt nur einen Förster-, Jäger-, Botaniker-,<br />
Spaziergänger-, Naturschwärmer-, Holzleser-, Beerensammler- und einen Märchenwald, in dem Hänsel und Gretel<br />
sich verirren“ (Uexküll 1935, zitiert in Morosini et al. 2002).<br />
90 kritische Diskussion des naturalistischen Fehlschlusses in Romahn 2003: 40 ff.<br />
91 „Sowohl der Strang der Zielentwicklung als auch der der Datenerfassung müssen Ergebnisse hervorbringen, die in<br />
der „gleichen Sprache“ gehalten sind, d.h. gleiche Maßgrößen und gleiche raum-zeitliche Bezugsskalen haben“<br />
(Bröning & Wiegleb 1999: 2).
Rationalisierte Umweltziele als Ansatzstelle für die Honorierung ökologischer Leistungen 145<br />
Umweltziel/<br />
ökologisches Gut<br />
direkt rationalisiertes<br />
Umweltziel<br />
normativer<br />
Indikator<br />
indirekt rationalisiertes<br />
Umweltziel<br />
ökologischer<br />
Indikator<br />
politische<br />
Rationalisierung<br />
(auf Erkenntnis aufbauende<br />
Entscheidung)<br />
wissenschaftliche<br />
Rationalisierung<br />
(Erkenntnis)<br />
Abbildung 24: Idealisierte Darstellung der Normativität innerhalb des Prozesses der Entwicklung von<br />
Indikatoren für Umweltgüter<br />
Ist das nachgefragte ökologische Gut z. B. eine ‚farbenfrohe Blumenwiese des Mittelgebirges’,<br />
kann die statistische Auswertung wissenschaftlich beschriebener Wiesengesellschaften des<br />
Mittelgebirges zu der Erkenntnis führen, dass die farbenfrohesten Wiesenflächen dem<br />
wissenschaftlich gefassten Typus der Pflanzenassoziation Geranio sylvatici-Trisetum<br />
flavescentis KNAP ex OBERD. 57 entsprechen. Je eindeutiger der wissenschaftliche Typus<br />
durch eine geschlossene Merkmalsklasse definiert ist, desto einfacher ist es dann, aus der<br />
Beschreibung dieser Pflanzengesellschaft entweder Zustands-Indikatoren oder aus den<br />
Erkenntnissen von Wirkungen bestimmter Nutzungen auf die Pflanzengesellschaft<br />
(Kausalzusammenhänge) auch Maßnahmen-Indikatoren abzuleiten. Es soll an dieser Stelle nicht<br />
das Problem erläutert werden, dass die Typisierung von Pflanzengesellschaften nicht auf der<br />
Grundlage geschlossener Merkmalsklassen erfolgt und damit die Subsumtion konkreter Flächen<br />
keinen messanalogen Vorgang darstellt (vgl. dazu Kap. 8.2.1.2). Tatsächlich bringt jedoch die<br />
Subsumtion des ökologischen Gutes unter ein Sachmodell den Vorteil, dass die darüber<br />
vorliegenden naturwissenschaftlichen Erkenntnisse (und Erkenntnislücken) nun für die<br />
Produktion des ökologischen Gutes genutzt werden können. Die Wissenschaftler können sagen,<br />
wie geschützt werden soll, aber nicht, was genau und wie viel (Marzelli 1994). Nach der<br />
Subsumtion des ökologischen Gutes unter ein naturwissenschaftliches Sachmodell stellt sich die<br />
empirische Frage, die durchaus eine Frage an die Naturwissenschaft ist, ob Eigentumsrechte an
146 Kapitel 6<br />
Pflanzen- und Tierarten zu akzeptablen Kosten durchgesetzt werden können (vgl. Lerch 1996)<br />
(vgl. Ausführungen zu Transaktionskosten in Kapitel 5.4.2).<br />
Die Indikatorenentwicklung verliert die normative, bewertende Dimension. „Das<br />
Bewertungsproblem wird somit auf seine messtechnische Dimension reduziert, vorausgesetzt es<br />
gelingt, die wertgebenden Kriterien 92 widerspruchsfrei (als wissenschaftlicher Anspruch) und<br />
akzeptabel (als sozialer Anspruch) in das Leitbild einzubauen“ (Bröning & Wiegleb 1999: 2).<br />
Bei aller Zurückhaltung von Naturwissenschaft bzgl. normativer Aussagen ist die Bedeutung der<br />
Naturwissenschaft für die Formulierung von Indikatoren und die Aufdeckung von<br />
Kausalzusammenhängen für das Beispiel des ökologischen Gutes ‚farbenfrohe Blumenwiese des<br />
Mittelgebirges’ hoch. Da gerade im Bereich der biotischen Güter das Typisierungsproblem<br />
besonders schwer wiegt (mit Ausnahme konkreter Arten), wird in dieser Arbeit eine Subsumtion<br />
eines ökologischen Gutes unter eine Pflanzengesellschaft auf Assoziationsebene bei allen<br />
Typisierungsschwierigkeiten als politisch rationalisiert definiert (vgl. Kap. 8.2.1.2). Die noch<br />
notwendigen Entscheidungen wären in diesem Fall durch ökologische Forschung zu treffen, der<br />
normative Input könnte dann durch die Wissenschaft geleistet werden (z. B.<br />
Expertenkommissionen), da der Erkenntnisraum weitaus größere Bedeutung als der<br />
Entscheidungsraum hat. Wesentlich dabei ist, den normativen Gehalt deutlich zu machen, das<br />
heißt, die noch verbliebenen Entscheidungskriterien offen zu legen. Abbildung 25 verdeutlicht<br />
die Zunahme der normativen Ladung von Indikatoren (NL) bei zunehmender Abweichung (a)<br />
des ökologischen Gutes von einem wissenschaftlich gefassten Typus (Sachmodell) und die damit<br />
sinkende Verantwortung der Naturwissenschaft für die Indikatorenentwicklung. Dabei wird von<br />
einem exponentiellen Bedeutungszuwachs der Naturwissenschaft ausgegangen. Die<br />
Verantwortung der Wissenschaft wächst mit der Bedeutung der Erkenntnisse für die<br />
Entscheidung, wächst in dem Maße, wie die Erkenntnisse den Freiheitsgrad der Entscheidung<br />
eingrenzen. Die in Abbildung 24 dargestellten, indirekt rationalisierten Ziele stellen eher ein<br />
idealisiertes Konstrukt dar.<br />
92 wertgebende Kriterien = Indikatoren
Rationalisierte Umweltziele als Ansatzstelle für die Honorierung ökologischer Leistungen 147<br />
1<br />
NV(a) NV = naturwissenschaftliche Verantwortung für Indikatorenentwicklung<br />
a = Abweichung des ökologischen Gutes von naturwissenschaftlich<br />
gefasstem Phänomen (Sachmodell)<br />
NL(NI) NL = normative Ladung der Indikatoren des ökologischen Gutes<br />
NI = notwendiger normativer Input für die Entwicklung der Indikatoren<br />
NI(a)<br />
NV(a)<br />
NV = 0 bis 1<br />
NL(a)<br />
NL = 0 bis 1<br />
100 a in %<br />
Abbildung 25: Abstrahierte Abhängigkeit der normativen Ladung der Indikatoren von der Abweichung des<br />
Umweltziels von einem naturwissenschaftlich gefassten Phänomen (Sachmodell)<br />
Dies ist gerade im Zusammenhang mit der Diskussion um die Schwierigkeiten der<br />
Indikatorenentwicklung bedeutsam. Tatsächlich stellt die Indikatorenentwicklung im<br />
gesellschaftlichen Raum aufgrund der notwendigen Abstimmungsprozesse immer eine<br />
besondere Herausforderung dar und bedarf spezifischer Entscheidungsstrukturen, von denen die<br />
Integration wissenschaftlicher Erkenntnisse in den Entscheidungsprozess nur ein Schritt ist. „Ob<br />
und inwieweit Internalisierung nötig und möglich ist und auch geschieht, ist sicherlich auch eine<br />
(unpolitische) Frage der Information und Transaktionskosten, zuvorderst aber eine Frage der<br />
politischen Ökonomie; das was umweltpolitisch geschieht, fällt ja nicht als Weisheit und<br />
Geschenk eines allwissenden Wohlfahrtsmaximierers vom Himmel, sondern ist in Zielen und<br />
Instrumenten(-dosierungen) ein Ergebnis von Verhandlungsprozessen eigeninteressierter<br />
Gruppen (inkl. der Politiker und Bürokraten) untereinander und auf dem Hintergrund<br />
supportbietender oder -verweigernder Öffentlichkeit – eben ein Ergebnis der Interaktion von<br />
Menschen und nicht von Heiligen“ (Zimmermann 2000: 40). Hinweise zu den Problemen einer<br />
demokratischen Ableitung von Indikatoren geben die Erfahrungen zur Konkretisierung der<br />
unbestimmten Rechtsbegriffe. Diese erfolgt nicht durch das demokratisch gewählte Parlament,<br />
sondern durch die Exekutive in untergesetzlichen Regelwerken. Dies hat den Vorteil schnellerer<br />
Berücksichtigung neuester Erkenntnisse, jedoch bestehen u. a. hinsichtlich des Demokratie- und<br />
Rechtsstaatsprinzips Bedenken (Böhm 1994, 1996, Lübbe-Wolff 1993, Rehbinder 1997).
148 Kapitel 6<br />
An dieser Stelle soll das wichtige und entscheidende, aber eben auch sehr umfangreiche<br />
Problem, durch wen und in welcher Art und Weise die Rationalisierung ökologischer Güter bzw.<br />
der relevanten Umweltziele erfolgen kann, nicht zur Diskussion stehen 93 . Es sei lediglich darauf<br />
hingewiesen, dass gerade die in Deutschland vorhandene Fülle an Planungsinstrumenten,<br />
angefangen von der Regionalplanung über Agrarstrukturelle Vorplanung bis hin zur<br />
Landschaftsplanung ein Potential für eine Rationalisierung darstellen. Gerade der<br />
Landschaftsplanung könnte bei entsprechendem Planungsauftrag eine besondere Rolle<br />
zukommen, nicht zuletzt, da sie die unterschiedlichen räumlichen Ebenen, angefangen von der<br />
Landesebene, über die regionale und kommunale Ebene abdeckt. Mit der Einbindung der bereits<br />
vorhandenen Planungsstrukturen verknüpft ist die Chance, die bereits etablierten<br />
Bürgerbeteiligungen auch und gerade für die wichtigen Entscheidungen bzgl. der Honorierung<br />
ökologischer Leistungen weiter zu stärken und damit nicht zuletzt den politischen<br />
Verpflichtungen der Aarhus-Konvention 94 nachzukommen.<br />
6.3.5.3 Problem der Diversität von Umweltzielen<br />
Im Umweltbereich besteht in vielen Fällen eine große Anzahl von Umweltzielen, zwischen<br />
denen teilweise keine Kohärenz besteht bzw. die sich gegenseitig auf derselben Fläche<br />
ausschließen. Derartige Situationen treten z. B. bereits bei unterschiedlichen Habitatansprüchen<br />
verschiedener gefährdeter Arten auf. Wenn z. B. für ein bestimmtes Gebiet aus dem<br />
übergeordneten Ziel ‚Erhalten der Biodiversität’ 95 im gesellschaftlichen Raum das Ziel auf die<br />
Ebene ‚Erhaltung der gefährdeten Arten’ herunter gebrochen wurde, ist dieses Umweltziel<br />
aufgrund der teilweise unterschiedlichen Ansprüche der Arten noch nicht im Sinne der<br />
Abbildung 24 politisch rationalisiert. Im Zuge der Rationalisierung von Umweltzielen müssen<br />
die internen Zielkonflikte gelöst werden, andernfalls müssen diese Konflikte spätestens auf der<br />
tatsächlichen Steuerungsebene, also im Zuge der Schaffung und/oder Durchsetzung der<br />
93 Es sei an dieser Stelle lediglich auf die Forschungen im Bereich der Neuen Institutionenökonomie verwiesen und<br />
dort im Speziellen auf die Bedeutung von „Governance Stuctures der Umweltkoordination“ (Hagedorn 2004).<br />
94 Die Aarhus-Konvention (UN-ECE-Übereinkommen über den Zugang zu Informationen, die<br />
Öffentlichkeitsbeteiligung an Entscheidungsverfahren und den Zugang zu Gerichten in Umweltangelegenheiten)<br />
wurde 1998 von Deutschland unterzeichnet. Bezüglich der Einbeziehung der Öffentlichkeit bei der Vorbereitung<br />
umweltbezogener Pläne und Programme schreibt die Konvention eine angemessene Berücksichtigung vor (Artikel 7<br />
Aarhus-Konvention). Die Art der Öffentlichkeitsbeteiligung ist in Artikel 7 nicht im Detail vorgegeben. Die<br />
Ermittlung der „Öffentlichkeit, die sich beteiligen kann“, darf den zuständigen Behörden überlassen werden.<br />
„Daraus ist zu schließen, dass nicht notwendigerweise eine Beteiligungsmöglichkeit für jedermann eröffnet werden<br />
muss“ (SRU 2002a: 114).<br />
95 Artenvielfalt im Sinne des politischen Konzeptes
Rationalisierte Umweltziele als Ansatzstelle für die Honorierung ökologischer Leistungen 149<br />
entsprechenden Eigentumsrechte entschieden werden, was mit einem erheblichen normativen<br />
Input verbunden ist. Scholtissek hebt vor diesem Hintergrund die Bedeutung der Lösung interner<br />
Naturschutzkonflikte im Zuge der Leitbildentwicklung in der Landschaftsplanung hervor:<br />
„Planerische Leitbilder sollen eine raum- und sachkonkrete Zielformulierung sein, die nach<br />
geordnete Umweltziele abwägend und widerspruchsfrei zusammenfasst. Sinn ist demnach das<br />
Entscheiden bzw. Beschließen von relevanten Zielen und das Klären von internen Konflikten bei<br />
konkurrierenden Naturschutzzielen“ (Scholtissek 2000: 95).<br />
Das Problem der Normativität gelangt durch die notwendige Abwägung zwischen verschiedenen<br />
ökologischen Gütern in den Rationalisierungsprozess und erschwert diesen.
150 Kapitel 7<br />
7 Positive ökonomische Anreize im Rahmen der Agrarumweltmaßnahmen und des<br />
Artikel 16 der VO (EG) 1257/1999<br />
7.1 Agrar-politische Rahmenbedingungen<br />
Aktuell findet ein institutioneller Wandel im Bereich der Landwirtschaft statt, dessen Übergang<br />
durch Unsicherheit geprägt ist, der jedoch auch Chancen für eine effiziente (und gerechte)<br />
Ausgestaltung der Eigentumsrechte bietet. Dieser institutionelle Wandel bildet die Grundlage für<br />
mögliche Honorierungsinstrumente. Er wird beeinflusst durch politische und ökonomische<br />
Entscheidungen und Rahmenbedingungen auf globaler (vgl. Kap. 7.1.1), europäischer (vgl.<br />
Kap. 7.1.2) und nationaler (Kap. 7.1.3) Ebene. Bevor in Kapitel 7.2 und 7.3 die aktuelle<br />
Ausgestaltung von Honorierungsinstrumenten vor dem Hintergrund der bisherigen<br />
Ausführungen zur Schaffung und Durchsetzung effizienter Eigentumsrechte analysiert wird,<br />
sollen die politischen Rahmenbedingungen kurz dargestellt werden, um das Verständnis für den<br />
aktuellen Status quo zu verbessern.<br />
7.1.1 Verhandlungen der World Trade Organisation<br />
Im Zuge der Globalisierung, verbunden mit der forcierten Liberalisierung des Welthandels, sind<br />
für die Honorierung ökologischer Leistungen die politischen und ökonomischen internationalen<br />
Rahmenbedingungen von Interesse. Diese beeinflussen den institutionellen Wandel und die<br />
damit verbundene Entwicklung von Honorierungsinstrumenten auf der Ebene der EU und sind<br />
dadurch von durchschlagender Bedeutung bis hin zur regionalen Ebene. Zahlungen für<br />
ökologische Leistungen der Landwirtschaft sind Bestandteil der EU-Stützungsmaßnahmen<br />
(Subventionspolitik) und müssen vor diesem Hintergrund einer Prüfung bzgl. potentiell<br />
handlungsverzerrender Wirkung standhalten.<br />
Für den Bereich der Landwirtschaft spielen dabei die Vereinbarungen auf der Ebene der WTO<br />
(World Trade Organisation 96 ) eine zentrale Rolle. Die wichtigste Aufgabe der WTO besteht<br />
darin, die Rahmenbedingungen für einen freien Welthandel zu schaffen, aber auch in<br />
zunehmendem Maße handelsbezogene Fragen, wie z. B. Standards im Umweltbereich, zu klären<br />
(zum Einbringen von Umweltstandards vgl. z. B. Biermann 1999). Auf die Chancen aber auch<br />
Schwierigkeiten für den Umweltschutz im Zusammenhang mit einer Marktliberalisierung soll an<br />
dieser Stelle nicht eingegangen werden (vgl. dazu u. a. Burney 1999, Potter et al. 1999). Die<br />
96 Die WTO wurde im Jahre 1995 als multilaterale Handelsorganisation gegründet. Sie trat an die Stelle des GATT<br />
aus dem Jahr 1948. Im Gegensatz zum GATT ist die WTO eine eigenständige internationale Organisation.
Aktuelle Anwendung im Rahmen der Agrarumwelt- und Artikel 16-Maßnahmen 151<br />
Bedeutung des Welthandels für die EU im Agrarbereich verdeutlicht die Tatsache, dass die EU<br />
2001 den weltweit bedeutendsten Importeur von Agrarprodukten darstellte und bei den Exporten<br />
nach den USA den zweiten Platz einnahm (COM 2002a). Im Verlauf der agrarpolitischen<br />
Debatte wurde es immer schwerer, nachvollziehbare Begründungen für pauschale<br />
Direktzahlungen an die Landwirtschaft zu finden (Henning et al. 2001).<br />
Im Agrarübereinkommen der Uruguay-Runde verpflichteten sich die WTO-Mitglieder, im<br />
Agrarbereich den Einfuhrschutz und die Stützungsmaßnahmen über einen Zeitraum von sechs<br />
Jahren (1995-2001) schrittweise zu verringern. Dabei standen und stehen bisher nicht alle<br />
internen Stützungsmaßnahmen zur Disposition. Vielmehr werden diese nach ihrer<br />
handelsverzerrenden Wirkung in drei Gruppen (so genannte boxes) kategorisiert: amber box,<br />
blue box und green box (vgl. Abbildung 26) (AoA 1994).<br />
amber box<br />
produktionsbezogene<br />
Maßnahmen<br />
mit deutlicher<br />
handelsverzerrender<br />
Wirkung, z.B.<br />
Marktpreisstützung<br />
unterliegen Abbaupflicht<br />
(Verpflichtung zu 20 %<br />
Senkung in der Zeit von<br />
1995-2001)<br />
blue box<br />
direkte<br />
Einkommensbeihilfen<br />
mit geringere<br />
handelsverzerrende<br />
Wirkung. (Tier- und<br />
Flächenprämien aus der<br />
EU-Agrarreform von 1992)<br />
unterliegen bisher keiner<br />
Abbaupflicht<br />
green box<br />
Maßnahmen, die keine<br />
oder nur geringe<br />
Handelsverzerrungen oder<br />
Auswirkungen auf die<br />
Produktivität haben (z.B.<br />
Strukturanpassungshilfen,<br />
Agrarumweltmaßnahmen)<br />
unterliegen keiner<br />
Abbaupflicht<br />
Abbildung 26: Kategorisierung unterschiedlicher Einkommensbeihilfen nach dem Grad ihrer<br />
handelsverzerrenden Wirkung im Rahmen der WTO-Verhandlungen<br />
Mit hoher Priorität wird der Abbau der ‚amber box-Maßnahmen’, die Marktpreisstützungen,<br />
gefordert und politisch angegangen. Bis Ende 2003 war in einer so genannten Friedensklausel<br />
für die beiden anderen Maßnahmengruppen ausgehandelt, dass diese nicht (‚green box-<br />
Maßnahmen’) bzw. nur eingeschränkt (sonstige Stützungsmaßnahmen, einschließlich der ‚blue<br />
box-Maßnahmen’ und Exportsubventionen) von den Vorschriften des allgemeinen WTO-<br />
Subventionsübereinkommens angreifbar sind. Die im Jahre 2003 ausgelaufene Friedensklausel<br />
machte neue Verhandlungen dringend notwendig, da sonst den EU-Staaten langwierige<br />
Streitschlichtungsverfahren mit ungewissem Ausgang hätten bevorstehen können (BML 2000a).
152 Kapitel 7<br />
Derartige Streitschlichtungsverfahren, die aufgrund fehlender Übereinkommen im Rahmen der<br />
WTO aktuell laufen, sind z. B. das Verfahren von Australien, Thailand und Brasilien gegen die<br />
EU-Zuckermarktordnung zu nennen (BMVEL 2004). Die umfangreichen Verhandlungen im<br />
Jahr 2003 endeten mit einem Abbruch auf der WTO-Ministerkonferenz in Cancún im<br />
September.<br />
Die EU fährt bei den WTO-Verhandlungen bisher zweigleisig. Einerseits kämpft sie für die<br />
Anerkennung von höheren Standards, z. B. im Bereich Umwelt und Tierschutz, und rechtfertigt<br />
damit die Stützungs- und Schutzmaßnahmen: „Das europäische Landwirtschaftsmodell mit<br />
seinen multifunktionalen Merkmalen und den hohen Qualitäts- und Sicherheitsstandards ist der<br />
Ausgangspunkt einer Politik der Nachhaltigkeit im Agrarbereich. Es ist deshalb bei den WTO-<br />
Verhandlungen und anderen internationalen Vereinbarungen ein Rahmen zu schaffen, durch den<br />
die für die europäischen Landwirte und Verbraucher geltenden Auflagen und Standards<br />
international anerkannt und abgesichert werden können“ (BML 2000b). Andererseits wird der<br />
Ausbau der so genannten green box weiter forciert, nicht zuletzt aufgrund der privilegierten<br />
Behandlung dieser Zahlungen im Rahmen der WTO-Verhandlungen. Während der Abbau der<br />
Einkommensbeihilfen der blue box von vielen WTO-Staaten gefordert wird, blieb die green box<br />
bisher unangetastet. Allerdings soll hier künftig noch stärker erkennbar sein, dass die<br />
Maßnahmen auf der Grundlage eines klaren Umweltprogramms entwickelt sind und sich auf<br />
konkrete Umweltzustandsziele beziehen bzw. eine wissenschaftlich nachgewiesene Verbindung<br />
zwischen Umweltziel und Maßnahme hergestellt werden kann. 97 Auf der Grundlage des<br />
Umweltprogramms müssen in Zukunft klare Abgrenzungskriterien herangezogen werden, um<br />
Umweltförderung und Handelsprotektion zu unterscheiden. Es muss klar erkennbar sein, dass es<br />
sich bei den Umweltmaßnahmen nicht um Handelsprotektion handelt (vgl. Ausführungen SRU<br />
2004). Darin wird die Bedeutung der umweltzielorientierten Strategie (vgl. Kap. 6.1) auch in<br />
diesem Kontext deutlich.<br />
Die Positionen der einzelnen WTO-Mitglieder zu den zukünftigen Regelungen im Agrarbereich<br />
liegen noch sehr weit auseinander, aber es ist ersichtlich, dass der Gestaltungsspielraum für die<br />
Agrarpolitik der Staaten kleiner wird (WTO 2003b). Der aktuelle Vorschlag der EU für die<br />
Ausgestaltung der Agrarsubventionen zeigt deutlich, in welche Richtung die weitere<br />
Entwicklung gehen soll. Die EU setzt weiterhin neben den ‚green box-Maßnahmen’ auf<br />
modifizierte ‚blue box-Maßnahmen’ (Direktzahlungen) und flexibel ausgestaltete Zollabkommen<br />
97 vgl. Restriktionen der green box nach dem „Harbinson-Papier“ (WTO 2002, 2003a).
Aktuelle Anwendung im Rahmen der Agrarumwelt- und Artikel 16-Maßnahmen 153<br />
(BMVEL 2004: 93). Im Hinblick auf die modifizierten ‚blue box-Maßnahmen’ ist für die<br />
Honorierung ökologischer Leistungen der Landwirtschaft vor allen Dingen eine weitere<br />
Verlagerung der Gelder von Preisstützungen hin zu Flächenprämien bedeutsam. Diese sind<br />
künftig EU-weit an bestimmte Auflagen gebunden, so genanntes cross compliance.<br />
Mit diesen Standards, bei denen es sich im weiteren Sinne um Umweltstandards (inklusive<br />
Tierschutz) handelt, kann die Verhandlungsposition für die Maßnahmen der blue box verbessert<br />
werden (höhere Standards als Rechtfertigung für Transferzahlungen). Aus eigentumsrechtlicher<br />
Sicht setzt die EU mit Hilfe von cross compliance bereits geschaffene Eigentumsrechte<br />
(Ordnungsrecht) der Gesellschaft (bzw. Sozialpflichtigkeit der Landwirte) mit Hilfe von<br />
finanziellen Sanktionsmechanismen durch bzw. versucht die Durchsetzung zu verbessern. Als<br />
relevante Voraussetzung für die ‚blue box-Maßnahmen’ (Flächenprämien) gelten<br />
ordnungsrechtliche Vorgaben, die ab 2005 bis 2007 stufenweise verbindlich mit den<br />
Direktzahlungen zu verknüpfen sind. Diese Vorgaben stellen eine Konkretisierung oder auch<br />
Operationalisierung von bereits bestehenden EU-Verordnungen und -Richtlinien dar (vgl.<br />
Tabelle A-3 im Anhang). Darüber hinaus sind Regeln aufzustellen, die die Erhaltung<br />
landwirtschaftlicher Flächen in gutem landwirtschaftlichem und ökologischem Zustand<br />
gewährleisten (Konkretisierung auf nationaler Ebene für die Bereiche Bodenerosion, Erhaltung<br />
organischer Substanz im Boden, Erhaltung Bodenstruktur u. a.).<br />
Ausgehend von diesem Ordnungsrecht werden Standards eingeführt, die dann im Rahmen des<br />
InVeKoS künftig mit kontrolliert werden und bei Verstoß durch Kürzung der Flächenprämien<br />
sanktionierbar sind. Es wird sich zeigen, inwieweit EU-weite Standards formuliert werden<br />
können, die mittels cross compliance helfen, Ordnungsrecht umzusetzen. Prinzipiell müssen<br />
diese Standards ähnliche Anforderungen erfüllen wie die Indikatoren für eine Honorierung<br />
ökologischer Leistungen (vgl. Kap. 6.3.4). Des relativ hohen verwaltungstechnischen, aber auch<br />
einzelbetrieblichen Aufwands für das cross compliance ist sich die EU bewusst; sie fordert und<br />
fördert gleichzeitig mit der Einführung dieser cross compliance-Maßnahmen<br />
‚Umweltberatungssysteme’ für die Betriebe. Die Bundesregierung fördert vor diesem<br />
Hintergrund die betriebliche Einführung von freiwilligen Beratungssystemen für Betriebsinhaber<br />
zu den Fragen von cross compliance im Rahmen der GAK (zur GAK vgl. Kap. 7.1.3.2).<br />
Die Kategorisierung und Konkretisierung von Maßnahmen im ‚box-System’ stellt die Schaffung<br />
und/oder Durchsetzung von Eigentumsrechten dar und ist von daher ein so schwieriges und<br />
heikles Thema. Es ist eben nicht nur ein Allokationsproblem, sondern ein Distributionsproblem.<br />
Es führen z. B. bestimmte Maßnahmen, die für die Produktion von ökologischen Gütern
154 Kapitel 7<br />
notwendig sind, entsprechend ihrer Einteilung als cross compliance-Maßnahme oder als<br />
Agrarumweltmaßnahme entweder zu einer finanziellen Sanktion bei Nichtdurchführung (cross<br />
compliance-Standards) oder aber zu einer Honorierung bei der Durchführung<br />
(Agrarumweltmaßnahmen). Im ersten Fall werden de jure vorhandene gesellschaftliche<br />
Eigentumsrechte de facto durchgesetzt, im zweiten Fall werden de facto private Eigentumsrechte<br />
de jure geschaffen und durchgesetzt.<br />
Anbieter und Nachfrager von ökologischen Leistungen sind sich dieser schwierigen<br />
Konstellation bewusst. So hebt die Bundesregierung bzgl. der Standards im Bereich cross<br />
compliance im aktuellen Agrarbericht hervor: „Es ist das Ziel der Bundesregierung, dass durch<br />
die Ausgestaltung der Anforderungen im Rahmen von cross compliance die<br />
Fördermöglichkeiten im Bereich der Agrarumweltmaßnahmen und der Ausgleichszulage nicht<br />
unangemessen eingeschränkt werden“ (BMVEL 2004: 90). Bisher wurde von daher auch keine<br />
Verbindung zwischen den Standards der Guten fachlichen Praxis und den cross compliance-<br />
Regelungen konstruiert. Vielmehr scheint es, dass bewusst verschiedene Kriterien (Indikatoren!)<br />
genutzt werden, um die Gute fachliche Praxis und cross compliance zu operationalisieren (vgl.<br />
weiterführend zur Abgrenzung der Sozialpflichtigkeit bzw. zur Bestimmung der<br />
Honorierungswürdigkeit in Kap. 7.2.2.2 und 7.3.2.2). Der Umweltrat fordert allerdings in seinem<br />
aktuellen Gutachten zu Recht eine Vereinheitlichung der Kriterien der Guten fachlichen Praxis<br />
und des cross compliance (SRU 2004).<br />
7.1.2 Europäische Rahmenbedingungen<br />
7.1.2.1 Gemeinsame Agrarpolitik (GAP)<br />
Bei der Entwicklung von Instrumenten zur Transaktion von Eigentumsrechten an ökologischen<br />
Gütern sind die Rahmenbedingungen auf der EU-Ebene entscheidend, wenn Instrumente<br />
entwickelt werden sollen, die mittelfristig praxisrelevant werden können. Dabei müssen die<br />
aktuellen Vorgaben nicht grundsätzlich als feste Restriktionen behandelt werden, bestimmte<br />
Rahmenbedingungen werden jedoch mittelfristig die Ausgestaltung von Honorierungs-<br />
instrumenten auf nationaler und regionaler Ebene prägen und sollen daher kurz dargestellt<br />
werden.<br />
Die EU-Regelungen stellen aus zwei Gründen relevante Rahmenbedingungen nicht nur für die<br />
konkreten honorierungswürdigen Leistungen, sondern auch für die Ausgestaltung der<br />
Instrumente dar:
Aktuelle Anwendung im Rahmen der Agrarumwelt- und Artikel 16-Maßnahmen 155<br />
1. Ein ‚Eingriff’ in das hoch komplizierte EU-Agrarsubventionssystem bedarf in jedem Fall<br />
einer ‚EU-Kompatibilität’. Die Agrarpolitik fällt in weiten Teilen in die ausschließliche<br />
Kompetenz der EU; eine von der EU unabhängige Agrarpolitik kann von einzelnen<br />
Mitgliedstaaten also nicht betrieben werden.<br />
2. Aufgrund der Prioritätensetzungen der Länderhaushalte ist in den meisten Fällen eine<br />
Honorierung ökologischer Leistungen im gegenwärtigen Umfang nur mit Hilfe einer EU-<br />
Kofinanzierung zu gewährleisten.<br />
Die Ausgaben der EU für den gesamten Agrarbereich belaufen sich auf einen Anteil von über<br />
50 % an den Gesamtausgaben der EU (ca. 97,5 Mrd. € jährlich) (vgl. Abbildung 27). Hauptfonds<br />
ist dabei der Europäische Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Landwirtschaft (EAGFL).<br />
Haushaltstechnisch werden die Agrarausgaben von den Abteilungen EAGFL-Garantie 98 und<br />
EAGFL-Ausrichtung 99 abgewickelt.<br />
Die finanziellen Anteile der beiden Abteilungen sind in Abbildung 28 für das Jahr 2003<br />
dargestellt. Der EAGFL-Garantie kommt insgesamt die größte Bedeutung zu (91 % im Jahr<br />
2003). Über diese Abteilung werden die gesamten Maßnahmen der Marktordnung abgewickelt.<br />
Diese haben einen Umfang von 82 % der Ausgaben im Bereich Landwirtschaft (vgl. Abbildung<br />
28).<br />
98 Die Abteilung Garantie muss insbesondere die Ausgaben im Zusammenhang mit der gemeinsamen Organisation<br />
der Agrarmärkte, die Maßnahmen zur Entwicklung des ländlichen Raums, die flankierend zur Marktpolitik<br />
durchgeführt werden, die Maßnahmen für den ländlichen Raum außerhalb der Ziel-1-Regionen, bestimmte<br />
Ausgaben im Veterinärbereich und die Maßnahmen zur Information über die gemeinsame Agrarpolitik finanzieren.<br />
99 Die Abteilung Ausrichtung muss sonstige Ausgaben für die ländliche Entwicklung finanzieren (die nicht vom<br />
EAGFL, Abteilung Garantie übernommen werden).
156 Kapitel 7<br />
Forschung und<br />
technologische<br />
Entw icklung<br />
Strukturmaßnahmen<br />
(ohne EAGFL, ohne FIAF)<br />
EU-Ausgaben Haushalt 2003<br />
Verw altungsausgaben<br />
(alle Organe)<br />
Maßnahmen in Drittländern<br />
(inkl. Vorbeitrittshilfen, Außen-<br />
und Sicherheitspolitik)<br />
Sonstiges (u.a.<br />
transeuropäische Netze,<br />
Energie, Bildung, Reserven)<br />
und Ausgleichszahlungen<br />
für Beitrittsländer<br />
97,5<br />
Mrd. €<br />
50,1 %<br />
Agrarbereich<br />
gesamt<br />
(EAGFL, FIAF,<br />
sonstige)<br />
Abbildung 27: Ausgaben der EU für das Haushaltsjahr 2003<br />
(eigene Darstellung, Datenquelle: BMVEL 2004)<br />
Verteilung der Finanzmittel des EAGFL (2003)<br />
Abteilung<br />
Ausrichtung<br />
7,2 %<br />
Abteilung<br />
Garantie<br />
91,4 %<br />
Mio. €<br />
Sonstige 675 €<br />
Abbildung 28: Verteilung der Ausgaben des EAGFL<br />
(eigene Darstellung, Datenquelle: BMVEL 2004)<br />
'Zweite Säule'<br />
Ländliche Entwicklung<br />
8110 Mio. € (17 %)<br />
Agrarumweltmaßnahmen (4 %)<br />
'Erste Säule'<br />
Marktordnung<br />
39759 Mio. € (82 %)
Aktuelle Anwendung im Rahmen der Agrarumwelt- und Artikel 16-Maßnahmen 157<br />
Neben der Marktordnungspolitik als erster Säule (first pillar) des EU-Agrarsubventionssystems<br />
wird seit 1992 eine zweite Säule (second pillar), die so genannte ländliche Entwicklung, als<br />
wesentlicher Bestandteil des Agrarsubventionssystems aufgebaut. Einer der entscheidenden<br />
Unterschiede besteht darin, dass die Maßnahmen der ersten Säule zu 100 % von den Vorgaben<br />
der EU bestimmt, aber auch finanziert werden, während die Maßnahmen der zweiten Säule<br />
durch die EU lediglich kofinanziert werden. Die Mitgliedstaaten haben nach dem<br />
Subsidiaritätsprinzip bei den Maßnahmen der zweiten Säule mehr Freiräume und Verantwortung<br />
und müssen sich an den Kosten in unterschiedlicher Art und Weise beteiligen (vgl. zur<br />
finanziellen Beteiligung im Rahmen der Agrarumweltmaßnahmen in Deutschland Abbildung 30<br />
in Kapitel 7.1.3.2).<br />
Für die Finanzierung ist, in Abhängigkeit vom regionalen Rahmen und der Art der Maßnahmen,<br />
entweder der EAGFL-Garantie oder der EAGFL-Ausrichtung zuständig. So gehen die Beihilfen<br />
für die Vorruhestandsregelung, für Agrarumweltmaßnahmen und für die Aufforstung<br />
landwirtschaftlicher Nutzflächen zu Lasten des EAGFL-Garantie, die übrigen Maßnahmen zur<br />
Förderung der ländlichen Entwicklung werden bei Ziel-1-Regionen aus dem EAGFL-<br />
Ausrichtung und in den übrigen Gebieten aus dem EAGFL-Garantie finanziert. Die Maßnahmen<br />
zur Anpassung und Entwicklung ländlicher Gebiete, die die Dorferneuerung und -entwicklung,<br />
den Schutz und die Erhaltung des ländlichen Kulturerbes, die Diversifizierung der ländlichen<br />
Tätigkeiten und die Verbesserung der Infrastrukturen für die Entwicklung der Landwirtschaft<br />
betreffen und nicht aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) im Rahmen<br />
von Ziel 1 bzw. Ziel 2 oder von Übergangsregelungen finanziert werden, gehen ebenfalls zu<br />
Lasten des EAGFL (vgl. Abbildung 28).<br />
Im Zusammenhang mit der Honorierung ökologischer Leistungen der Landwirtschaft ist die<br />
Tatsache relevant, dass unabhängig des regionalen Kontextes die Agrarumweltmaßnahmen über<br />
die EAGFL-Garantie abgewickelt werden und seit 2000 verpflichtend in allen EU-Staaten<br />
angeboten werden müssen. Damit werden in allen EU-Staaten im Rahmen der<br />
Entwicklungspläne für den ländlichen Raum (EPLR) (s.u.) spätestens seit 2000<br />
Agrarumweltmaßnahmen angeboten. Aktuell werden knapp über 4 % der EU-Ausgaben für<br />
Agrarumweltmaßnahmen genutzt (vgl. Abbildung 28).
158 Kapitel 7<br />
Rechtsgrundlage<br />
Die für die Honorierung ökologischer Leistungen entscheidende Verordnung<br />
VO (EG) 1257/1999 bildet seit dem 1. Januar 2000 den Rahmen für die gesamte<br />
gemeinschaftliche Förderung der Entwicklung des ländlichen Raums und ersetzt u. a. die<br />
VO (EWG) 2078/1992. Relevanz hat die Verordnung für den Planungszeitraum 2000-2006. Mit<br />
ihr werden die anderen Instrumente der Gemeinsamen Agrar- und Strukturpolitik flankiert und<br />
ergänzt (wesentlich sind hier Marktpreisstützungen und Flächenprämien). Erklärtes politisches<br />
Ziel der Verordnung ist die Einführung einer integrierten Politik für den ländlichen Raum mit<br />
Hilfe eines einzigen Rechtsinstruments, das eine größere Kohärenz zwischen der Entwicklung<br />
des ländlichen Raums und der Preis- und Marktpolitik im Rahmen der Gemeinsamen<br />
Agrarpolitik (GAP) sicherstellt und alle Elemente der ländlichen Entwicklung durch stärkere<br />
Einbeziehung aller lokalen Akteure fördert. Zu diesem Zweck verfolgt diese neue, mit den<br />
landwirtschaftlichen Tätigkeiten und ihrer Umstrukturierung verknüpfte Politik folgende Ziele:<br />
• Modernisierung der landwirtschaftlichen Betriebe;<br />
• Sicherheit und Qualität der Nahrungsmittel;<br />
• angemessene und stabile Einkommen für die Landwirte;<br />
• Berücksichtigung der umweltpolitischen Herausforderungen;<br />
• Schaffung alternativer Beschäftigungsmöglichkeiten zur Eindämmung der Landflucht und<br />
Stärkung der wirtschaftlichen und sozialen Struktur des ländlichen Raums;<br />
• Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen und Förderung der Chancengleichheit. 100<br />
Auf der Grundlage dieser Verordnung entwickelten die einzelnen EU-Staaten auf der geeigneten<br />
geographischen Ebene (in Deutschland jeweils in den einzelnen Bundesländern) konkrete<br />
Programme und Maßnahmen, die dann von der EU kofinanziert werden können und bei<br />
Flächenmaßnahmen, wie den Agrarumweltmaßnahmen, über das Integrierte Verwaltungs- und<br />
Kontrollsystem (InVeKoS) der EU verwaltet werden müssen. Diese Programme zur Förderung<br />
der ländlichen Entwicklung stützen sich auf Pläne, die für einen Zeitraum von sieben Jahren<br />
(2000-2006) aufgestellt werden. Sie enthalten die Beschreibung der derzeitigen Lage des<br />
betreffenden ländlichen Raums, die vorgeschlagene Strategie, die erwartete Wirkung, die<br />
Finanzplanung, die beabsichtigten Maßnahmen einschließlich der Agrarumweltmaßnahmen, die<br />
100 vgl. Ausführungen der EU-Kommission zur Förderung der ländlichen Entwicklung<br />
http://europa.eu.int/scadplus/leg/de/lvb/l60006.htm (09.05.2004)
Aktuelle Anwendung im Rahmen der Agrarumwelt- und Artikel 16-Maßnahmen 159<br />
erforderlichen Studien und technischen Unterstützungsmaßnahmen, die Benennung der<br />
zuständigen Behörden und Einrichtungen sowie die Bestimmungen, die die effiziente und<br />
ordnungsgemäße Durchführung der Pläne gewährleisten sollen.<br />
Aktuell sind zwei Programmplanungen entscheidend. Dabei handelt es sich um die<br />
Entwicklungspläne für den ländlichen Raum (EPLR), die alle Maßnahmen der ländlichen<br />
Entwicklung außerhalb der Förderkulisse ‚Ziel 1’ 101 und ‚Ziel 2’ 102 enthalten. Innerhalb der Ziel<br />
1- und Ziel 2-Gebiete werden einige Maßnahmen zur Entwicklung des ländlichen Raums im<br />
Rahmen anderer Programme abgewickelt, wobei die Operationellen Programme (OP) hierbei<br />
vom Umfang her den bedeutendsten Anteil ausmachen. Die Aufteilung der Maßnahmen zur<br />
ländlichen Entwicklung in Ziel 1-Gebieten ist in Abbildung 29 dargestellt. Grau unterlegt sind<br />
die Bereiche, die für die Honorierung ökologischer Leistungen von Bedeutung sind. Neben den<br />
Agrarumweltmaßnahmen (ausführlich in Kap. 7.2) sind es seit 2000 mögliche<br />
Ausgleichszahlungen in Gebieten mit umweltspezifischen Einschränkungen aufgrund von EU-<br />
Umweltrecht. Aktuell fallen hierunter mögliche Ausgleichszahlungen für ordnungsrechtliche<br />
Auflagen in Natura 2000-Gebieten (vgl. Kap. 7.3).<br />
Tabelle 6 zeigt die für den aktuellen Förderzeitraum 2000-2006 aufgelegte hohe Anzahl an<br />
Programmen in den EU-Staaten und deren Kofinanzierung durch die EU. In jedem der 68<br />
Entwicklungspläne für den ländlichen Raum sind Agrarumweltmaßnahmen obligatorischer<br />
Bestandteil. Allein die Anzahl der Pläne gibt einen Hinweis auf die potentielle Fülle an<br />
Honorierungsinstrumenten für ökologische Leistungen.<br />
101 Ziel 1-Gebiete sind Regionen mit Entwicklungsrückstand (BIP < 75 % des Gemeinschaftsdurchschnitts)<br />
102 Ziel 2-Gebiete sind ländliche oder städtisch und industriell geprägte Gebiete mit Strukturproblemen (Kriterien für<br />
Auswahl sind z. B. niedrige Bevölkerungsdichte, hoher Anteil der Beschäftigten in der Landwirtschaft, hohe<br />
Arbeitslosenquote, Bevölkerungsrückgang).
160 Kapitel 7<br />
Gemeinschaftsinitiativen<br />
LEADER +<br />
Abteilung<br />
Ausrichtung<br />
Agrarstrukturpolitik<br />
Abbildung 29: Aufteilung der Maßnahmen zur ländlichen Entwicklung auf die unterschiedlichen Planungsinstrumente<br />
am Beispiel der Ziel 1-Gebiete (Hervorgehoben sind die Bereiche, die für die Honorierung<br />
ökologischer Leistungen der Landwirtschaft von Bedeutung sind.)<br />
Tabelle 6: Überblick über die verschiedenen Programme im Bereich ländlicher Entwicklung (EU-15)<br />
Programme im Bereich ländliche<br />
Entwicklung*<br />
Entwicklungspläne für den ländlichen<br />
Raum (EPLR)<br />
Ziel 2-Programme mit Maßnahmen zur<br />
ländlichen Entwicklung<br />
Ziel 1-Programme mit Maßnahmen zur<br />
ländlichen Entwicklung<br />
Operationelle Programme (OP)<br />
*nicht dargestellt: Leader+-Programme<br />
Quelle: COM 2003c<br />
Strukturmaßnahmen<br />
Investitionen<br />
in landwirtschaftlichen Betrieben<br />
Niederlasssung<br />
von Junglandwirten<br />
Berufsbildung<br />
Verarbeitung/Vermarktung<br />
landwirtschaftlicher Erzeugnisse<br />
Forstwirtschaft<br />
Entwicklung von<br />
ländlichen Gebieten<br />
OP<br />
EAGFL<br />
VO (EG) 1257/1999<br />
Anzahl der<br />
Programme<br />
Flankierende Maßnahmen<br />
Benachteiligte Gebiete und<br />
G. umweltspez. Einschränkungen<br />
Agrarumweltmaßnahmen<br />
Aufforstung<br />
landwirtschaftlicher Flächen<br />
EPLR<br />
Abteilung<br />
Garantie<br />
Kofinanziert durch<br />
EAGFL-Abteilung<br />
68 Garantie<br />
20 Garantie<br />
Marktorganisationen<br />
Direktzahlungen<br />
EU-Anteil<br />
(EUR Bill.)<br />
32,9<br />
69 Ausrichtung 17,5<br />
7.1.2.2 Vorgaben und Förderflächenumfang im Rahmen der VO (EG) 1257/1999<br />
Im Folgenden sollen im Überblick zwei, für die Honorierung ökologischer Leistungen<br />
wesentliche Fördermaßnahmen der VO (EG) 1257/1999 in ihrer konzeptionellen Ausgestaltung<br />
beschrieben werden. Es handelt sich dabei um zwei der flankierenden Maßnahmen (vgl.
Aktuelle Anwendung im Rahmen der Agrarumwelt- und Artikel 16-Maßnahmen 161<br />
Abbildung 29), die Agrarumweltmaßnahmen nach Artikel 22-24 (AUM) und die<br />
Ausgleichzahlungen in Gebieten mit umweltspezifischen Einschränkungen durch europäisches<br />
Recht (kurz Artikel 16-Maßnahmen). Bei beiden Maßnahmen handelt es sich um Zahlungen für<br />
flächenhafte, jährliche Maßnahmen.<br />
Nach der Definition honorierungswürdiger ökologischer Leistungen (vgl. Kap. 4.1) stellen<br />
selbstverständlich auch investive Maßnahmen, wie z. B. Anschaffung von Niederdruckreifen,<br />
(zum Vermindern von Bodenverdichtung) potentiell honorierungswürdige, ökologische<br />
Leistungen dar, sofern damit knappe ökologische Güter bereitgestellt werden. Das gleich gilt<br />
auch für Maßnahmen wie das Anlegen von Hecken u. ä., die z. B. im Rahmen der Entwicklung<br />
von ländlichen Gebieten (Artikel 33-Maßnahmen) honoriert werden können. Die Einbeziehung<br />
derartiger Maßnahmen würde jedoch den Rahmen dieser Arbeit zu weit stecken.<br />
Im Weiteren werden lediglich die Vorgaben aus der Verordnung (EG) 1257/1999 für die<br />
Agrarumweltmaßnahmen und die Artikel 16-Maßnahmen dargestellt. Die aktuelle Umsetzung<br />
dieser Vorgaben wird für die Agrarumweltmaßnahmen in Deutschland in Kapitel 7.2 und für die<br />
Umsetzung der Artikel 16-Maßnahmen in Kapitel 7.3 näher betrachtet.<br />
Agrarumweltmaßnahmen (Artikel 22-24 der VO (EG) 1257/1999)<br />
Als Agrarumweltmaßnahmen (AUM) sind laut Verordnungstext alle flächengebundenen<br />
Maßnahmen zu fassen, die dem abiotischen und biotischen Ressourcenschutz sowie landschafts-<br />
ästhetischen Zielen dienen.<br />
Landwirte, die mindestens fünf Jahre lang umweltverträgliche und landschaftschützende<br />
Erzeugungsverfahren (Agrarumweltmaßnahmen) anwenden, können eine Honorierung (Beihilfe)<br />
erhalten (Artikel 23). Diese soll dazu dienen, die umweltverträgliche Bewirtschaftung und ein<br />
planvolles Vorgehen im Agrarumweltbereich, die Extensivierung der landwirtschaftlichen<br />
Erzeugung, die Erhaltung von ökologisch wertvollen Gebieten und die Landschaftspflege zu<br />
fördern.<br />
Die VO (EG) 1257/1999 gibt in Artikel 22 fünf Ziele für die Agrarumweltmaßnahmen vor:<br />
• eine Bewirtschaftung der landwirtschaftlichen Flächen zu fördern, die mit dem Schutz und<br />
der Verbesserung der Umwelt, der Landschaft und ihrer Merkmale, der natürlichen<br />
Ressourcen, der Böden und der genetischen Vielfalt vereinbar ist;
162 Kapitel 7<br />
• eine umweltfreundliche Extensivierung der Landwirtschaft und eine Weidewirtschaft<br />
geringer Intensität zu fördern;<br />
• bedrohte, besonders wertvolle landwirtschaftlich genutzte Kulturlandschaften zu erhalten;<br />
• die Landschaft und historische Merkmale auf landwirtschaftlichen Flächen zu erhalten;<br />
• die Umweltplanung in die landwirtschaftliche Praxis einzubeziehen.<br />
Die Höhe der Honorierung (Preis) ökologischer Leistungen richtet sich nach den anfallenden<br />
Kosten und nicht nach dem Wert des ökologischen Gutes. Bei der Ermittlung werden die<br />
Einkommenseinbußen und die zusätzlich anfallenden Kosten berücksichtigt. Diese Vorgaben<br />
sind im Zusammenhang mit den internationalen Verhandlungen der WTO zu sehen, da die bisher<br />
einzigen nicht zur Disposition stehenden Maßnahmen der green box keine Einkommenseffekte<br />
verursachen dürfen. 103<br />
Aktuell darf vor diesem Hintergrund nur ein Anreiz von nicht mehr als 20 % der ermittelten<br />
Kosten gezahlt werden, um die Landwirte zur Teilnahme (Tausch der Eigentumsrechte) zu<br />
motivieren. Die Beihilfen dürfen jedoch bei einjährigen Kulturen und bestimmten Dauerkulturen<br />
600 € bzw. 900 € jährlich nicht überschreiten. Jede sonstige Bodennutzung wird mit höchstens<br />
450 € je ha jährlich unterstützt (Art. 24). Die tatsächlich angewendete Prämie belief sich auf<br />
durchschnittlich 89 €/ha (COM 2003a). Dabei wurden zwischen den Mitgliedstaaten große<br />
Unterschiede verzeichnet, was zum Teil die Bandbreite der ergriffenen Agrarumweltmaßnahmen<br />
und die verschiedenen Standortbedingungen widerspiegelt (ebd.), aber auch Hinweis darauf gibt,<br />
dass die Ermittlung des Preises für die Honorierung ökologischer Leistungen auf der Grundlage<br />
der Kosten relativ breite Spielräume eröffnet (vgl. Kap. 7.2.2.3).<br />
Die Abgrenzung der Honorierungswürdigkeit erfolgt mit Hilfe des unbestimmten<br />
Rechtsbegriffes der Guten fachlichen Praxis (vgl. Kap. 7.2.2.2) und schließt eine<br />
Doppelförderung aus. „Die Verpflichtungen bezüglich der Agrarumweltmaßnahmen gehen über<br />
die Anwendung der Guten fachlichen Praxis im üblichen Sinne hinaus. Sie betreffen<br />
Dienstleistungen, die im Rahmen anderer Fördermaßnahmen, wie Marktstützungsmaßnahmen<br />
und den Ausgleichszulagen, nicht vorgesehen sind“ (Art. 23 (2)).<br />
103 Die Bindung des Preises an die Einkommenseinbuße ist ein wesentlicher Grund für die geringe Umsetzung der<br />
ergebnisorientierten Honorierungen. So wurde die ergebnisorientierte Honorierung in BW nur genehmigt, wenn<br />
Maßnahmenauflagen daran geknüpft sind (Oppermann & Gujer 2003: 178).
Aktuelle Anwendung im Rahmen der Agrarumwelt- und Artikel 16-Maßnahmen 163<br />
Ausgehend von den Daten, die für 2001 von den Mitgliedstaaten zu ihren Programmen für die<br />
Entwicklung des ländlichen Raums vorgelegt wurden, betrug die Vertragsfläche in EU-15<br />
19,3 Mio. ha. Dabei wurden für 1,3 Mio. ha Verträge für den Ökologischen Landbau<br />
abgeschlossen (COM 2003a).<br />
Gebiete mit umweltspezifischen Einschränkungen (Artikel 16 VO (EG) 1257/1999)<br />
Neben der seit vielen Jahren angewendeten Ausgleichszahlung für Landwirte in naturräumlich<br />
benachteiligten Gebieten (z. B. Berggebieten) kann seit der VO (EG) 1257/1999 auch<br />
Landwirten in Gebieten mit umweltspezifischen Auflagen eine Ausgleichszahlung gewährt<br />
werden. Ziel ist es, die Kosten und Einkommenseinbußen auszugleichen, die ihnen durch die<br />
Umsetzung gemeinschaftlicher Umweltvorschriften (EU-Recht) entstehen (Artikel 16 (1)).<br />
Aktuell werden diese Maßnahmen für Auflagen in Natura 2000-Gebieten angewandt (vgl.<br />
Kap. 8.2).<br />
Die Höhe des Ausgleichs hat sich an den verursachten Kosten zu orientieren (Artikel 16 (2)) und<br />
durfte bisher 200 € pro Hektar und Jahr nicht überschreiten 104 . Eine Überkompensation ist zu<br />
vermeiden (Artikel 16 (3)). Anreize wie bei den AUM sind nicht erlaubt.<br />
Von der Ausgleichszahlung für benachteiligte Gebiete aufgrund von umweltspezifischen<br />
Einschränkungen haben bisher lediglich einige Bundesländer in Deutschland Gebrauch gemacht<br />
(COM 2002c). Der Anwendungsumfang wird daher im Überblick in Kapitel 7.3.1 dargestellt<br />
(zur potentiellen Bedeutung dieser Maßnahme vgl. auch Kap. 8.2.2).<br />
7.1.3 Nationale Rahmenbedingungen in Deutschland<br />
7.1.3.1 Föderale Strukturen in Deutschland und deren Konsequenz<br />
Die konkrete Ausgestaltung und der Umfang der Zahlungen für ökologische Leistungen obliegen<br />
in Deutschland den einzelnen Bundesländern. Es gibt in Deutschland 16 Pläne zur ländlichen<br />
Entwicklung (EPLR) inklusive 16 Agrarumweltprogrammen (vgl. Kap. 7.1.2.1,<br />
Agrarumweltmaßnahmen als verpflichtender Bestandteil der EPLR) und 6 operationelle<br />
Programme in den neuen Bundesländern. Auch die Artikel 16-Maßnahmen sind, falls<br />
104 Ab dem Jahr 2004 können bis zu 500 € pro Hektar gezahlt werden, wobei diese hohen Ausgleichszahlungen<br />
lediglich zur Abfederung der ökonomischen Wirkungen in der Aufbauphase des Natura 2000-Netzes genutzt werden<br />
dürfen und danach wieder sukzessiv bis auf 200 € zurückgenommen werden müssen.
164 Kapitel 7<br />
angewendet, jeweils Bestandteil der länderspezifischen EPLR. Selbstverständlich obliegt es den<br />
Bundesländern neben der Honorierung ökologischer Leistungen im Rahmen der Gemeinsamen<br />
Europäischen Agrarpolitik nationale Honorierungsinstrumente zu etablieren. Diese müssen<br />
lediglich bei der EU angezeigt werden und bestimmte Grundanforderungen erfüllen (z. B.<br />
Ausschluss der Doppelförderung). Die Bundesländer haben also relativ breiten Spielraum,<br />
eigene Honorierungsinstrumente zu entwickeln und machen davon auch teilweise Gebrauch,<br />
indem sie europaunabhängige Vertragsnaturschutzprogramme anbieten, wie bisher z. B. das<br />
Land Brandenburg. Damit ist eine größere Flexibilität gegeben, aber es ist auch der Nachteil<br />
einer vollständigen Finanzierung aus dem Landeshaushalt damit verbunden. Dies ist ein<br />
wesentlicher Grund, warum derartige Programme immer mehr an Bedeutung verlieren und in die<br />
Agrarumweltprogramme überführt werden, die aktuell im Rahmen der VO (EG) 1257/1999<br />
laufen (vgl. Osterburg 2002).<br />
Da die Agrarumweltmaßnahmen, wie alle Maßnahmen der zweiten Säule, einer Finanzierung<br />
durch die Bundesländer bedürfen (vgl. auch Abbildung 30), ist der Umfang der Förderung<br />
entscheidend von der Haushaltslage der einzelnen Bundesländer abhängig und bringt sehr große<br />
Unterschiede bzgl. der zur Verfügung stehenden Mittel mit sich.<br />
7.1.3.2 Gemeinschaftsaufgabe ‚Verbesserung der Agrarstruktur und des<br />
Küstenschutzes’ (GAK)<br />
Der Bund nimmt über die Option zur Kofinanzierung bestimmter Maßnahmen im Rahmen der<br />
Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und Küstenschutz (GAK) in gewisser Weise Einfluss auf<br />
die Maßnahmen zur ländlichen Entwicklung, insbesondere, wenn die Bundesländer auf eine<br />
derartige Kofinanzierung angewiesen sind.<br />
Abbildung 30 zeigt die mögliche Aufteilung der Finanzierung von Agrarumweltmaßnahmen mit<br />
und ohne Geld der GAK im Rahmen der VO (EG) 1257/1999 in Ziel 1-Gebieten (neue<br />
Bundesländer) und außerhalb der Ziel 1-Gebiete. Über die GAK können 30 % des national zu<br />
finanzierenden Anteils übernommen werden.
Aktuelle Anwendung im Rahmen der Agrarumwelt- und Artikel 16-Maßnahmen 165<br />
100%<br />
75%<br />
50%<br />
25%<br />
0%<br />
Abbildung 30: Finanzierung der Agrarumweltmaßnahmen in Deutschland (bis zum Jahr 2004)<br />
Der Plan der GAK entspricht gemäß der VO (EG) 1257/1999 einer Rahmenregelung (s. Art. 40<br />
Abs. 4) und ist damit nicht so differenziert wie die Entwicklungspläne der Bundesländer, die<br />
einem Programmplan (s. Art. 40 Abs. 1-3) entsprechen.<br />
Mit der GAK werden folgende allgemeine Grundsätze verfolgt:<br />
• Gewährleistung einer leistungsfähigen, auf künftige Anforderungen ausgerichtete Land- und<br />
Forstwirtschaft,<br />
• Sicherstellung der Wettbewerbsfähigkeit im gemeinsamen Markt der Europäischen<br />
Gemeinschaft,<br />
• Verbesserung des Küstenschutzes.<br />
Finanzierung der AUM in Deutschland<br />
ohne GAK mit GAK ohne GAK mit GAK<br />
Bundesland<br />
Bund (GAK optional für bestimmte Maßnahmen)<br />
EU<br />
Nicht Ziel 1-Gebiet Ziel 1-Gebiet<br />
Die Gemeinschaftsaufgabe ist im Rahmen des Gesetzes zur Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur<br />
und Küstenschutz (GAKG) festgelegt. Um die Gemeinschaftsaufgabe umzusetzen, wird für den<br />
Zeitraum der Finanzplanung (3 Jahre) ein gemeinsamer Rahmenplan aufgestellt und jedes Jahr<br />
sachlich geprüft und fortgeführt. Der Rahmenplan enthält die je Haushaltsjahr durchzuführenden<br />
Maßnahmen mit den zugrunde liegenden Zielvorstellungen, die zugehörigen Fördergrundsätze<br />
sowie Art und Höhe der Zuwendung. Darüber hinaus werden auch die Mittel von Bund und<br />
Ländern pro Jahr des Planungszeitraums aufgeführt, die bereitgestellt werden sollen. Der Bund
166 Kapitel 7<br />
erstattet jedem Land bei Durchführung der Maßnahmen des Rahmenplans 60 % der entstandenen<br />
Ausgaben bzw. 70 % für Maßnahmen des Küstenschutzes. Die Förderung kann als Zuschuss,<br />
Darlehen, Zinszuschuss oder Bürgschaft erfolgen. Die Länder können darüber entscheiden,<br />
welche Maßnahmenangebote sie aus dem Rahmenplan der GAK in ihre ‚Ländlichen<br />
Entwicklungsprogramme’ übernehmen. Diese können sie präzisieren und durch eigene<br />
Ländermaßnahmen ergänzen.<br />
Im Zuge der Neuausrichtung der Ernährungs- und Agrarpolitik in Richtung auf die Förderung<br />
der ländlichen Räume wurden auch bei der GAK neue Akzente gesetzt. Konkret hat hierbei eine<br />
stärkere Ausrichtung auf eine umwelt-, natur- und tiergerechte Qualitätsproduktion stattgefunden<br />
(BMVEL 2002). Der Bereich der Agrarumweltmaßnahmen im Kapitel ‚Markt- und<br />
standortangepasste Landwirtschaft’ (MSL) wurde ergänzt.<br />
Eine entscheidende Einschränkung für die Honorierung ökologischer Leistungen ist jedoch, dass<br />
die GAK bisher nicht für ‚reine’ Naturschutzmaßnahmen genutzt wird. Eine Öffnung für stärker<br />
naturschutzorientierte Maßnahmen wäre aus Sicht der Kofinanzierung von effektiven<br />
Maßnahmen wünschenswert (vgl. SRU 2002b, SRU 2004), diese Möglichkeit unterliegt jedoch<br />
aufgrund der ursprünglichen Zielsetzung der Gemeinschaftsaufgabe (Grundlage Art. 91a GG)<br />
nach herrschender Rechtsauffassung gewissen Einschränkungen. Aktuell sind multifunktionale<br />
Maßnahmen, die gleichermaßen der Förderung der Agrarstruktur und der Verfolgung<br />
naturschutzbezogener Ziele dienen, nach herrschender Rechtsauffassung möglich (Rehbinder &<br />
Schmihing 2004). Diese Einschränkung wird allerdings durch die überwiegende Meinung der<br />
verfassungsrechtlichen Literatur relativiert. Demnach liegt nicht die vorrangige, sondern erst die<br />
ausschließliche Verfolgung von Natur- und Umweltschutzzwecken (‚reine’<br />
Naturschutzmaßnahmen) außerhalb des verfassungsrechtlichen Rahmens der GAK (Rehbinder &<br />
Schmihing 2004). Trotz der rechtlich bestehenden Möglichkeit der Öffnung der GAK für<br />
gezieltere Naturschutzmaßnahmen fehlt es aktuell am politischen Willen.<br />
Folgende Agrarumweltmaßnahmenbereiche erfahren daher eine Förderung über die GAK 105 :<br />
• Förderung extensiver Produktionsverfahren im Ackerbau oder bei Dauerkulturen,<br />
• Förderung extensiver Grünlandnutzung,<br />
• Förderung ökologischer Anbauverfahren,<br />
• Förderung umwelt- und tiergerechter Haltungsverfahren.<br />
105 GAK-Rahmenplan 2004
Aktuelle Anwendung im Rahmen der Agrarumwelt- und Artikel 16-Maßnahmen 167<br />
Da den Ländern jeweils ein fester Betrag für das gesamte Paket der GAK-Maßnahmen zugeteilt<br />
ist, nutzen Länder wie Baden-Württemberg oder Bayern die Kofinanzierung für<br />
Agrarumweltmaßnahmen nicht, sondern setzen die Mittel im Bereich ‚Benachteiligte Gebiete’<br />
oder ‚Flur’- und ‚Dorferneuerung’ ein. Andere Länder können auf die Kofinanzierung nicht<br />
verzichten und sind damit daran gebunden, die Agrarumweltmaßnahmen ‚GAK-kompatibel’<br />
auszugestalten.<br />
7.1.4 Mittelfristige Weiterentwicklung der politischen Rahmenbedingungen<br />
7.1.4.1 Mid-Term-Review-Reform<br />
Am 26. Juni 2003 einigte sich der Ministerrat in Luxemburg im Rahmen der<br />
Zwischenbegutachtung der Agenda 2000, dem so genannten Mid-Term-Review (MTR), auf eine<br />
Neuausrichtung der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) (vgl. COM 2003b), die bis zum Jahre<br />
2013 Bestand haben soll (formelle Verabschiedung der Rechtstexte am 29. September 2003: VO<br />
(EG) 1782/2003). Ziel der eingeleiteten Agrarreform der EU (MTR-Reform) war es, die WTO-<br />
Kompatibilität der GAP zu verbessern, indem die Produktion der Landwirte stärker durch<br />
marktwirtschaftliche Elemente bestimmt wird. Die Wettbewerbsfähigkeit der Agrarproduktion<br />
soll verbessert und die Finanzierbarkeit der Gemeinsamen Agrarpolitik vor dem Hintergrund der<br />
EU-Osterweiterung sichergestellt werden. Ferner soll den neuen gesellschaftlichen<br />
Anforderungen in den Bereichen Lebensmittelsicherheit, Tier- und Umweltschutz Rechnung<br />
getragen und damit die Legitimation der Agrarpolitik gefestigt werden.<br />
Die Kernelemente der Beschlüsse des Ministerrates zur zukünftigen Agrarpolitik können im<br />
Wesentlichen in die drei Bereiche Entkoppelung, cross compliance und Modulation<br />
zusammengefasst werden. Ein Überblick über die wichtigsten Änderungen ist Tabelle A-4 im<br />
Anhang zu entnehmen. Für die Agrarumweltmaßnahmen genauso wie für die Artikel 16-<br />
Maßnahmen ist bei der Entkoppelung die Einführung von Grünlandprämien von großer<br />
Bedeutung, da damit einige horizontale Grünlandextensivierungsmaßnahmen, die auf den<br />
Grünlanderhalt abzielten (vgl. Kap. 7.2.1) sowie pauschale Grünlandprämien über Artikel 16<br />
(vgl. Kap. 7.3.1) obsolet werden können (vgl. auch Kap. 7.3.2.2). Die Umsetzung der<br />
VO (EG) 1782/2003 ist für bestimmte zu präzisierende Maßnahmen in Deutschland im Gesetz<br />
zur Umsetzung der Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik für den Bereich Entkoppelung<br />
(Betriebsprämie) in Artikel 1, dem Betriebsprämiendurchführungsgesetz (BetrPrämDurchfG)<br />
und für cross compliance im Artikel 2, dem Direktzahlungen-Verpflichtungengesetz<br />
(DirektZahlVerpflG) geregelt.
168 Kapitel 7<br />
7.1.4.2 Finanzielle Mittel für die Honorierung ökologischer Leistungen<br />
Im Rahmen der nationalen Ausgestaltung der betriebsbezogenen Zahlungen (Entkoppelung)<br />
können bis zu 10 % der einzelbetrieblichen Prämienrechte aus der ersten Säule gewährt werden,<br />
um spezifische Formen der Landwirtschaft zu fördern, die für die Umwelt oder eine<br />
Qualitätserzeugung und Vermarktung wichtig sind (Artikel 69 der VO (EG) 1782/2003).<br />
Richtlinien für die förderfähigen Maßnahmen in diesem so genannten 10 %-Modell liegen<br />
allerdings noch nicht vor (SRU 2004: 212). Prinzipiell eröffnet sich damit die Möglichkeit,<br />
bestimmte ökologische Leistungen aus Geldern der ersten Säule zu finanzieren, wodurch eine<br />
nationale Kofinanzierung entfällt.<br />
Bis zum Jahre 2007 kommt es zur Schrittweisen Umschichtung von Mitteln der ersten Säule in<br />
die zweite Säule der GAP (Modulation). Dadurch werden in allen Mitgliedstaaten zusammen in<br />
Zukunft mehr Finanzmittel für die ländliche Entwicklung, den Umweltschutz, Tierschutz und<br />
Verbraucherschutz im Rahmen der EU-Agrarpolitik zur Verfügung stehen. Die<br />
Modulationsmittel werden im Jahre 2007 5 % der Direktzahlungen an die Betriebe (oberhalb<br />
eines Freibetrages von 5.000 € pro Betrieb) betragen. In Deutschland wird ab 2005 die<br />
fakultative Modulation durch die obligatorische ersetzt. Damit entfallen die im Rahmen der<br />
fakultativen Modulation bestehenden Beschränkungen, die Mittel nur für neue Maßnahmen<br />
anzuwenden. Dies verursachte beim Einsatz für Agrarumweltmaßnahmen vor allen Dingen dort<br />
Schwierigkeiten, wo bereits eine große Bandbreite an Maßnahmen entwickelt wurde.<br />
Die Aufteilung der Mittel auf die Mitgliedstaaten der EU erfolgt nach Kohäsionskriterien<br />
(landwirtschaftliche Fläche, Beschäftigte in der Landwirtschaft sowie das relative Einkommens-<br />
niveau). Jeder Mitgliedstaat erhält aber mindestens 80 % seiner Mittel zurück. Deutschland<br />
erhält zusätzlich 10 % der gekürzten Mittel als Ausgleich für den Wegfall der<br />
Roggenintervention. Nach Deutschland fließen daher in Zukunft 90 % der hier im Rahmen der<br />
Modulation anfallenden Mittel wieder zurück. Tabelle 7 stellt die durch die Modulation<br />
auftretenden Finanzströme für Deutschland dar. Zu beachten ist, dass die zurückfließenden<br />
Mittel jeweils einer nationalen Kofinanzierung bedürfen und dies in Anbetracht der<br />
Haushaltslage vieler Länder problematisch ist.<br />
Förderlich für die Investition der umgeschichteten Mittel in Agrarumweltmaßnahmen dürfte die<br />
Tatsache sein, dass der Kofinanzierungsanteil der EU von derzeit 50 % außerhalb von Ziel 1-<br />
Gebieten auf 60 % und in Ziel 1-Gebieten von derzeit 75 % auf max. 85 % erhöht wird (vgl. zur<br />
bisherigen Kofinanzierung Abbildung 30).
Aktuelle Anwendung im Rahmen der Agrarumwelt- und Artikel 16-Maßnahmen 169<br />
Tabelle 7: Modulationsbedingte Verschiebung der EU-Beihilfen von der ersten in die zweite Säule in<br />
Deutschland<br />
Kürzungssatz je Kalenderjahr<br />
Kürzungsvolumen der<br />
Direktzahlungen<br />
(erste Säule)<br />
Jahr % Mio. € (geschätzt)<br />
Rückfluss in die zweite Säule<br />
(flankierende Maßnahmen)<br />
nach Deutschland<br />
darunter für<br />
Roggengebiete<br />
2005 3 117,3 106,5 10,6<br />
2006 4 168,9 152,0 15,2<br />
2007 5 211,1 190,0 19,0<br />
Quelle: BMVEL 2004, Übersicht 33<br />
7.1.4.3 Cross Compliance und Institutionenwandel<br />
Im Zuge der cross compliance-Regelung werden Umweltstandards eine entscheidende Rolle<br />
spielen. Künftig (beginnend ab 2005) wird mit der entkoppelten Direktzahlung die Einhaltung<br />
von Mindestumweltauflagen verbunden sein. Die cross compliance-Regelung lässt sich in drei<br />
Bereiche gliedern:<br />
• Umsetzung von 18 einschlägigen EU-Regelungen (vgl. Tabelle A-3 im Anhang)<br />
• Regeln zur Erhaltung landwirtschaftlicher Flächen in gutem landwirtschaftlichen und<br />
ökologischen Zustand (national zu konkretisieren, Schwerpunkt Boden, vgl. BMVEL 2004)<br />
• Umbruchverbot für Flächen, die im Jahr 2003 als Dauergrünland genutzt wurden.<br />
Ziel der cross compliance-Regelung ist es, neben einer verbesserten Position im Rahmen der<br />
WTO-Verhandlungen (vgl. Kap. 7.1.1), in erster Linie bestehendes (europäisches)<br />
Ordnungsrecht mit Hilfe der Androhung von Sanktionen im Subventionsbereich besser<br />
durchzusetzen, also den Vollzug zu verbessern. In Anbetracht der Probleme des Vollzuges von<br />
Umweltordnungsrecht (vgl. im europäischen Maßstab z. B. Albin 1999, Lübbe-Wolff 1995, im<br />
nationalen z. B. Lübbe-Wolff 1993, Graf 2002), scheint dies, ein zu befürwortender Ansatz zu<br />
sein. „Die Androhung des Verlustes von Betriebsprämien ist – jedenfalls im Falle höherer<br />
Prämien – ein starkes Motiv für die Einhaltung der Auflagen“ (SRU 2004: 215 f.).<br />
Die Frage, die sich stellt, ist jedoch, wie die Anforderungen nach möglichst einheitlichen<br />
Standards für alle EU-Staaten (vgl. BMVEL 2004) in der Praxis sinnvoll umzusetzen sind. Wie<br />
bereits diskutiert, liegt das Umsetzungsdefizit von Ordnungsrecht unter anderem in der<br />
fehlenden Operationalisierung/Standardisierung aufgrund der oftmals notwendigen
170 Kapitel 7<br />
Einzelfallentscheidung (vgl. Kap. 6.1). Die Erarbeitung von sinnvollen Standards, bei denen die<br />
positiven Umweltwirkungen stärker zu gewichten sind als der steigende Verwaltungsaufwand<br />
und damit verbundene Transaktionskosten, stellt eine, unter den gegebenen Rahmenbedingungen<br />
gerade für den Umweltbereich, riesige Herausforderung dar. Es bleibt kritisch zu beobachten, ob<br />
die Befürchtung des SRU (2004: 216) sich bewahrheitet und cross compliance lediglich als neue<br />
Legitimation für die Direktzahlungen der ersten Säule dient, ohne Umweltziele wirklich effizient<br />
zu erreichen.<br />
Prinzipiell stellen die notwendigen Standards die in Kapitel 6.3 diskutierten Indikatoren dar und<br />
müssen idealer Weise die gleichen Anforderungen erfüllen (vgl. zu den Anforderungen im<br />
Überblick Abbildung 20). Es ist abzuwarten, wie eine Operationalisierung der allgemeinen<br />
Vorgaben (vgl. Tabelle A-3 im Anhang) im politischen Prozess der nächsten Jahre erfolgt. Zu<br />
hohe Erwartungen sollten nicht gestellt werden, wenn man sich z. B. die sehr pragmatischen<br />
Prüfkriterien der Guten fachlichen Praxis als Vergleich heranzieht. Diese Kriterien sollen u. a<br />
dazu dienen, honorierungswürdige ökologische Leistungen von nicht honorierungswürdigen zu<br />
trennen (vgl. VO (EG) 1257/1999). In der Praxis stellen sie aktuell jedoch Mindeststandards als<br />
Voraussetzung für die Teilnahme an bestimmten Maßnahmen der ländlichen Entwicklung dar<br />
und sind im diesem Sinne die aktuellen cross compliance-Maßnahmen z. B. für<br />
Agrarumweltmaßnahmen oder Ausgleichszulagen für benachteiligte Gebiete (vgl. Kap. 7.2.2.2<br />
und 7.3.2.2).<br />
Cross compliance-Maßnahmen sind besonders vor dem Hintergrund der Auswirkungen auf die<br />
Verteilung der Eigentumsrechte zu diskutieren und in diesem Zusammenhang entscheidend für<br />
die Entwicklung von Instrumenten zur Honorierung ökologischer Leistungen. Aus<br />
eigentumsrechtlicher Sicht ist zu unterscheiden, ob die cross compliance-Maßnahmen die<br />
Direktzahlungen legitimieren sollen und sich damit als Honorierung etablieren werden oder<br />
lediglich eine Sanktionierungsmöglichkeit für bestehendes Ordnungsrecht darstellen. Bei einer<br />
Etablierung als ‚Honorierung’ wäre langfristig zu befürchten, dass bei fortschreitender<br />
Liberalisierung der Agrarmärkte und dem Abbau der Direktzahlungen die cross compliance-<br />
Maßnahmen (nach dem Abbau der Direktzahlungen) von den Landwirten nicht mehr<br />
entschädigungslos akzeptiert werden. Dies ist vor allen Dingen vor dem Hintergrund der<br />
Aushöhlung der Sozialpflichtigkeit (vgl. dazu Kap. 5.6.2) bedenklich, da die Eigentumsrechte<br />
bzgl. der cross compliance-Maßnahmen in den meisten Fällen de jure bei der Gesellschaft liegen<br />
(durch das Ordnungsrecht festgelegt). Unter diesen Voraussetzungen müssen nach dem<br />
Verursacherprinzip die Landwirte die Kosten für die Einhaltung der Umweltauflagen tragen und<br />
zwar ohne finanziellen Ausgleich.
Aktuelle Anwendung im Rahmen der Agrarumwelt- und Artikel 16-Maßnahmen 171<br />
In gewissem Maße bekommt jedoch das Verständnis, dass cross compliance-Maßnahmen<br />
honorierungswürdig sind, dadurch Auftrieb, dass in den aktuellen Regelungen sowohl<br />
Eigentumsrechte an ökosystemaren Fähigkeiten als auch an individuellen Fähigkeiten der<br />
Landwirte angesprochen sind (vgl. zu dieser Unterscheidung der Fähigkeiten Kap. 4.1). Es<br />
werden einerseits cross compliance-Umweltregelungen aufgestellt, die einen Nutzungsverzicht<br />
bzgl. ökosystemarer Fähigkeiten betreffen (z. B. Verbot von Grünlandumbruch), andererseits<br />
jedoch auch das Nutzungsgebot und der damit verbundenen Pflicht zum Einsatz von<br />
individuellen Fähigkeiten, wie die Auflagen zur Offenhaltung des Grünlandes. Unter Rückgriff<br />
auf die Überlegungen zu Eigentumsrechten in Kapitel 5.1 wäre eine generelle Verpflichtung zur<br />
Pflege des Grünlandes, zumindest ohne einen finanziellen Ausgleich, nicht vertretbar. Diese<br />
Mischung bei der Ausgestaltung von cross compliance-Maßnahmen ist für eine klare Definition<br />
von Eigentumsrechten schwierig. Hinzu kommt das taktische Verhandeln der EU im Rahmen der<br />
WTO. Im Zusammenhang mit dem europäischen Konzept der multifunktionalen Landwirtschaft<br />
sollen die cross compliance-Maßnahmen dazu beitragen, eine Rechtfertigung für die weitere<br />
Aufrechterhaltung der Direktzahlungen zu liefern. Diese gezielte Argumentation nach ‚außen’<br />
wird auch nach ‚innen’ wirken und das Verständnis der Landwirte forcieren, dass<br />
Direktzahlungen als Honorierung (Ausgleich) für die ordnungsrechtlichen Standards dienen.<br />
Tatsächlich zeigt sich, dass aktuell ein Institutionenwandel (Schaffung, Änderung und<br />
Durchsetzung von Eigentumsrechten) im Bereich der Landwirtschaft und Umwelt stattfindet, der<br />
sich durch komplexe internationale, europäische und nationale Rahmenbedingungen als äußerst<br />
schwierig erweist und das Problem der Globalisierung für eben diesen Prozess verdeutlicht. Die<br />
z. B. in Deutschland seit langem geführte Diskussion um die Situationsgebundenheit von<br />
Eigentum, aber auch um die Regelungen zu ausgleichspflichtigen Inhalts- und Schranken-<br />
bestimmungen des Eigentums oder um die Härteausgleichsregelungen spielt sich in gewisser<br />
Weise nun auf dem internationalen Parkett im Rahmen der WTO-Verhandlungen ab. Der<br />
deutsche (europäische) Landwirt in einem Naturschutzgebiet mit Bewirtschaftungs-<br />
beschränkungen befindet sich eigentumsrechtlich in einer ähnlichen Situation gegenüber den<br />
nationalen Landwirten außerhalb von Schutzgebieten wie der deutsche (europäische) Landwirte<br />
im internationalen Vergleich gegenüber Landwirten in Ländern ohne Umweltstandards. Nach<br />
deutscher Rechtsauffassung kann man von Sozialpflichtigkeit bzw. Ökologiepflichtigkeit<br />
sprechen, solange diese Anforderungen nicht unverhältnismäßig hoch sind (vgl. zur<br />
Eigentumsdogmatik im deutschen Recht Kap. 5.6.2). In Kapitel 7.2.2.2 wird die Problematik in<br />
Deutschland anhand der Rechtsfigur Gute fachliche Praxis noch einmal diskutiert.
172 Kapitel 7<br />
Cross compliance-Regelungen sind aus einem zweiten Grund besonders relevant. Denn<br />
tatsächlich bestimmen sie auch die Grenze zu Agrarumweltmaßnahmen. Cross compliance- und<br />
Agrarumweltmaßnahmen (AUM) verhalten sich „wie kommunizierende Röhren ... alles was<br />
nicht über cross compliance vorgegeben wird, kann und muss ggf. als AUM angeboten werden<br />
und umgekehrt“ (SRU 2004: 216).<br />
Diese Betrachtungen zeigen, dass bei der Durchsetzung von Ordnungsrecht mit Hilfe von<br />
ökonomischen Instrumenten besonderes Augenmerk darauf gelegt werden muss, dass damit<br />
nicht dem Verursacherprinzip widersprochen wird, das heißt ökonomische Anreize konform mit<br />
den zugeteilten Verfügungsrechten angewendet werden. Auch wenn z. B. zweigleisige<br />
Argumentation im Rahmen der WTO-Verhandlungen kurzfristig politische Erfolge verspricht<br />
und die Verhandlungsposition der EU bzgl. der Beibehaltung von Flächenprämien verbessert,<br />
mittel- und langfristig können daraus enorme Probleme bzgl. der Durchsetzungsfähigkeit von<br />
Ordnungsrecht entstehen und das wichtige Instrument der Honorierung ökologischer Leistungen<br />
bekommt oder behält den ‚Beigeschmack’ einer Subvention.<br />
Cross compliance-Maßnahmen sollten klar als Sanktionsmechanismus für bestehendes<br />
Ordnungsrecht gesellschaftlich diskutiert werden. Dies bedarf bzgl. der Positionierung im Zuge<br />
der WTO-Verhandlungen einer klaren Trennung zwischen Umweltstandards, die<br />
ordnungsrechtlich fixiert sind, und der Honorierung für multifunktionale (inkl. ökologische)<br />
Leistungen der Landwirtschaft. „Das Instrument ist aber nicht dazu geeignet, eine Vielzahl neuer<br />
Umweltanforderungen für den Agrarsektor einzuführen und insgesamt umweltgerechte<br />
Anbaumethoden zu fördern. Es sollte darauf geachtet werden, eine klare Trennlinie zwischen<br />
obligatorischen, nicht förderfähigen Umweltanforderungen an die Landwirtschaft und<br />
honorierten Umweltleistungen aufrechtzuerhalten“ (SRU 2004: 234).<br />
Wenn sich die Entwicklung fortsetzt, dass Umweltordnungsrecht stärker mit positiven<br />
ökonomischen Steuerungsmitteln wie Subventionen verknüpft wird, könnte dies nicht nur zu<br />
dem beschriebenen Problem führen, dass Auflagen nur noch bei finanziellem Ausgleich<br />
akzeptiert werden, sondern wird in Anbetracht der knappen Haushaltslagen auch die<br />
Gesellschaft, vertreten durch die Legislative und Exekutive, möglicherweise davon abhalten,<br />
sinnvolle und notwendige Regelungen bzgl. knapper ökologischer Güter zu schaffen und<br />
durchzusetzen, da damit die Verpflichtungen zu Ausgleichszahlungen verbunden sein können.<br />
Andererseits ist auch das ‚Sanktionsmodell’ (Kürzung von Subventionen bei Nichteinhaltung<br />
von Ordnungsrecht) durchaus kritisch zu sehen, da dadurch die Auseinandersetzung im Zuge der<br />
Aufstellung von Ordnungsrecht verschärft werden könnte.
Aktuelle Anwendung im Rahmen der Agrarumwelt- und Artikel 16-Maßnahmen 173<br />
7.1.5 Zusammenfassung und Schlussfolgerungen<br />
Die Entwicklung von praxistauglichen Instrumenten zur Honorierung ökologischer Leistungen<br />
kann nur gewährleistet werden, wenn die politischen und ökonomischen Rahmenbedingungen<br />
berücksichtigt werden. Dabei ist es wenig sinnvoll, jede aktuelle Vorgabe der EU oder nationaler<br />
Fördervoraussetzungen im Rahmen der GAK als Restriktion anzunehmen. Genauso wenig<br />
sinnvoll ist es jedoch, die Rahmenbedingungen auszublenden, sofern das Ziel ist, umsetzungs-<br />
und flächenrelevante Ansätze zu entwickeln.<br />
Im Folgenden werden wesentliche Rahmenbedingungen noch einmal zusammengefasst, an<br />
denen sich mittelfristig die Ausgestaltung der Honorierung ökologischer Leistungen orientieren<br />
sollte.<br />
Die Anforderungen aus der WTO werden für die Zukunft vermutlich einen weiteren Abbau von<br />
weitgehend voraussetzungslosen Direktzahlungen an die Landwirtschaft verlangen. Hinzu<br />
kommen die hier nicht weiter diskutierten Rahmenbedingungen aufgrund der EU-<br />
Osterweiterung, die in gleicher Richtung wirken.<br />
Die Bedeutung der Honorierung ökologischer Leistungen der Landwirtschaft wird im Hinblick<br />
auf den Mitteleinsatz und den absoluten Anteil dieser Förderung am Gewinn der Betriebe künftig<br />
steigen. Diese Entwicklung wird sich bei Zunahme der Marktliberalisierung weiter vollziehen.<br />
An Stelle einer ungezielten Globalförderung nahezu aller landwirtschaftlich genutzten Flächen<br />
über Direktzahlungen und Preisstützung wird eine gezielte, standortspezifische Förderung an<br />
Bedeutung gewinnen. Auswirkungen, wie z. B. das Brachfallen auf marginalen Standorten,<br />
müssen vor dem Hintergrund umweltpolitischer Ziele bewertet werden, um gegebenenfalls die<br />
gezielte Nutzung bzw. Pflege zu honorieren (Gay et al. 2003, Breustedt 2003, Holm-Müller &<br />
Witzke 2002, SRU 2004). Die finanzielle Bedeutung der Agrarumweltmaßnahmen für die<br />
Landwirte wird im Durchschnitt der Betriebe im Vergleich zur eigentlichen landwirtschaftlichen<br />
Produktion und im Vergleich zu den sonstigen Stützungen mittelfristig weiterhin eher eine<br />
untergeordnete Rolle spielen, für bestimmte Landwirte jedoch hohe Bedeutung haben.<br />
Die Diskussion um cross compliance-Regelungen zeigt, wie schwierig es sich in der Praxis<br />
gestaltet, Honorierungsinstrumente von Subventionen zu trennen und wie wichtig daher die klare<br />
Definition von Zielen ist, um ein transparentes und stringentes Instrument zur Honorierung<br />
ökologischer Leistungen aufzubauen, das dem internationalen Druck der Marktliberalisierung<br />
auch längerfristig standhalten kann.
174 Kapitel 7<br />
Das Prinzip der Subsidiarität und die Verantwortung für die Ausgestaltung und Umsetzung der<br />
Agrarumweltmaßnahmen auf der angemessenen räumlichen Ebene wird es weiter ermöglichen,<br />
auf standortspezifische Gegebenheiten relativ flexibel einzugehen. Die Vielfalt der Programme<br />
und Maßnahmen (vgl. Tabelle 6) wird sich unter dem Druck der stärkeren Zielausrichtung eher<br />
noch erhöhen.<br />
7.2 Aktuelle Agrarumweltmaßnahmen am Beispiel der deutschen<br />
Agrarumweltprogramme nach VO (EG) 1257/1999<br />
7.2.1 Überblick über aktuellen Anwendungsumfang<br />
Auf schätzungsweise 5 der 17 Mio. ha landwirtschaftlicher Fläche wenden landwirtschaftliche<br />
Betriebe in Deutschland Agrarumweltmaßnahmen an. Im Jahr 2002 wurden<br />
Agrarumweltmaßnahmen in Deutschland von rund 310 000 antragstellenden Landwirten in<br />
einem Umfang von rund 689 Mio. € gefördert. Damit konnten die Maßnahmen im Vergleich<br />
zum Stand von 2000 weiter ausgebaut werden, als zwar 400 000 Anträge gestellt wurden, jedoch<br />
nur ein Fördervolumen von rund 538 Mio. € investiert wurde. Die Mittel entstammen je nach<br />
Maßnahme aus den Haushalten von EU, Bund und Ländern (BMVEL 2004).<br />
Seit Einführung der Agrarumweltmaßnahmen im Jahre 1993 wurden die Flächen bis 1997<br />
ständig ausgeweitet und waren dann leicht rückläufig. Trotz eines Systemwechsels im<br />
Monitoring seit 2001 deutet sich an, dass die in Agrarumweltmaßnahmen einbezogene Fläche<br />
inzwischen wieder deutlich zunimmt (BMVEL 2004).<br />
Der Anwendungsumfang von Agrarumweltprogrammen ist in den 16 Bundesländern sehr<br />
unterschiedlich. Abbildung 31 zeigt die großen Unterschiede auf der Grundlage der<br />
durchschnittlich geplanten Finanzmittel pro Hektar landwirtschaftlicher Fläche (LF) in den<br />
Bundesländern. Neben den Agrarumweltmaßnahmen (AUM) sind die Ausgleichszahlungen in<br />
Natura 2000-Gebieten nach Artikel 16 sowie Projektmittel nach Artikel 33 (z. B. für die Anlage<br />
von Hecken) dargestellt.
Aktuelle Anwendung im Rahmen der Agrarumwelt- und Artikel 16-Maßnahmen 175<br />
€/ha LF<br />
120<br />
100<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
0<br />
SH NI NW HE RP BW BY SL BB MV SN ST TH D<br />
Abbildung 31: Geplante jährliche Finanzmittel für die Honorierung ökologischer Leistungen der<br />
Landwirtschaft in den Bundesländern im Planungszeitraum 2004-2006 (eigene Darstellung, Datenquelle:<br />
Osterburg & Stratmann 2002)<br />
Es werden z. B. für Agrarumweltmaßnahmen in Bayern (BY), bezogen auf die gesamte LF,<br />
104 € pro Hektar LF eingeplant, während in Mecklenburg-Vorpommern (MV) im<br />
Landesdurchschnitt lediglich 17 € zur Verfügung stehen. Im bundesdeutschen Durchschnitt (D)<br />
ergibt sich daraus, dass pro Hektar LF 44 € für Agrarumweltmaßnahmen nach<br />
VO (EG) 1257/1999 eingeplant werden (Abbildung 31). Die Ungleichverteilung der eingesetzten<br />
Finanzmittel ist nicht durch unterschiedliche Bedarfe, sondern ausschließlich durch die<br />
unterschiedlichen Haushaltslagen in den einzelnen Bundesländern zu erklären (SRU 2004: 254).<br />
Die größte Bedeutung bzgl. des Anwendungsumfangs haben die so genannten horizontalen<br />
Extensivierungsmaßnahmen, wie der Ökologische Landbau und die Förderung der extensiven<br />
Grünlandnutzung (vgl. Abbildung 32).<br />
AUM gesamt (Art. 22 VO (EG) 1257/1999)<br />
naturschutzorientierte AUM (Art. 22 VO (EG) 1257/1999)<br />
Art. 16-Maßnahmen (VO (EG) 1257/1999)<br />
Naturschutzprojekte (Art. 33 VO (EG) 1257/1999)
176 Kapitel 7<br />
Maßnahmengruppe 1994 1998 1999<br />
Wiesen- und Weideflächen 999 969 1 967 805 1 925 563 = ca. 40 % GL<br />
Ackerflächen 521 685 1 387 408 1 423 216 = ca. 12 % AL<br />
Dauerkulturen und Wein 48 293 57 356 59 440<br />
Ökologische Anbauverfahren 69 257 360 363 392 296 = ca. 3,2 % LF<br />
Besonders naturschutzwürdige Flächen 13 018 81 670 75 024<br />
Langfristige Flächenstilllegung (20 Jahre) 203 1 942 2 631<br />
Pflege aufgegebener Flächen 1 543 2 421 2 126<br />
Traditionelle Landbewirtschaftungsformen 23 351 31 107 28 284<br />
Umweltbezogene Grundförderung 2 849 789 1 096 370 836 811<br />
Insgesamt 4 527 108 4 986 442 4 745 391<br />
Abbildung 32: Entwicklung der Agrarumweltmaßnahmen nach VO 2078/1992 von 1994-1999<br />
(eigene Darstellung, Datenquelle: BMVEL 2002)<br />
Horizontale Agrarumweltmaßnahmen werden ohne Gebietskulisse angeboten, der Mittelabfluss<br />
ist entsprechend hoch. Stärker auf Naturschutzziele orientierte Maßnahmen sind<br />
Programmbestandteil aller Bundesländer außer Berlin. Derartige Maßnahmen unterliegen<br />
meistens einer Gebietskulisse (aktuelle Zusammenstellung der Agrarumweltmaßnahmen der<br />
Länder vgl. Hartmann et al. 2003). In Abbildung 32 wird die Entwicklung der<br />
Agrarumweltmaßnahmen dargestellt und der Unterschied im Anwendungsumfang zwischen den<br />
in der Breite angewendeten horizontalen Maßnahmen und den gezielten Naturschutzmaßnahmen<br />
besonders hervorgehoben. Es wird deutlich, dass 1999 insgesamt zwar ein relativ großer Anteil<br />
der LF mit Agrarumweltmaßnahmen belegt war (40 % des Grünlandes, 12 % des Ackerlandes),<br />
jedoch die gezielten Agrarumweltmaßnahmen auf lediglich 2,3 % der Vertragsfläche relevant<br />
sind (vgl. weiterführende Betrachtungen im Kap. 7.2.2.4).<br />
An dieser grundsätzlichen Situation hat sich auch nach Einführung der neuen Programme nach<br />
VO (EG) 1257/1999 nichts entscheidend geändert, wie anhand der geplanten Mittel für den<br />
anstehenden Zeitraum 2004-2006 aus Abbildung 31 hervorgeht (vgl. Osterburg & Stratmann<br />
2002).<br />
Fläche (ha) unter Agrarumweltmaßnahmen in Deutschland<br />
Gezielt naturschutzorientierte Maßnahmen 1999 gesamt:<br />
10.8065 ha = 2,3 % der gesamten Förderflächen
Aktuelle Anwendung im Rahmen der Agrarumwelt- und Artikel 16-Maßnahmen 177<br />
7.2.2 Analyse der aktuellen Agrarumweltmaßnahmen<br />
Im folgenden Kapitel werden die bestehenden Agrarumweltmaßnahmen systematisiert. Kriterien<br />
dieser Systematisierung sind Betrachtungen zur Verteilung der Eigentumsrechte (Kap. 7.2.2.2),<br />
zur Ermittlung des Preises für die Honorierung (Kap. 7.2.2.3), zum Zielbezug (Kap. 7.2.2.4),<br />
zum Prozess der Entwicklung (Kap. 7.3.2.5) sowie zur Indikatorenart (Kap. 7.2.2.6).<br />
7.2.2.1 Ansatz und Methode<br />
Mit der Systematisierung werden die theoretischen Überlegungen zum Instrument der<br />
Honorierung ökologischer Leistungen der Landwirtschaft (Kap. 4 bis 6) auf die aktuellen<br />
Honorierungsinstrumente angewendet. Eine Klassifizierung in Typen mit geschlossenen<br />
Merkmalsklassen ist dabei nicht möglich. Wie fast immer bei komplexeren Sachverhalten sind<br />
die Übergänge graduell. Von daher werden jeweils die beiden gegensätzlich besprochenen<br />
Kategorien als die beiden Enden einer Achse definiert und es erfolgt eine Verortung der<br />
aktuellen Agrarumweltmaßnahmen auf dieser Achse.<br />
Mit Hilfe der Kriterien und vorhandener Literatur erfolgt eine kritische Diskussion der aktuellen<br />
Agrarumweltmaßnahmen. Datengrundlage bilden die aktuellen Rechtsgrundlagen sowie die<br />
Planungsdokumente zu den Agrarumweltprogrammen der 16 Bundesländer. Darüber hinaus wird<br />
die Analyse durch Daten, die im Rahmen der Halbzeitbewertung des Brandenburger<br />
Agrarumweltprogramms ‚KULAP’ erhoben wurden, untermauert. Eine Befragung von 140<br />
KULAP-Teilnehmern im Rahmen der Halbzeitbewertung (Matzdorf et al. 2003) wurde dazu<br />
genutzt, Landwirte bzgl. ihrer Bereitschaft zur aktiven Teilnahme an der Entwicklung von<br />
Agrarumweltmaßnahmen sowie zu ihrer Bereitschaft bzgl. ergebnisorientierter<br />
Honorierungsansätze zu befragen. Die Ergebnisse dieser Befragung ergänzen die Analyse.<br />
7.2.2.2 Zahlungstyp – Honorierung oder Subvention<br />
Vom konzeptionellen Ansatz kann eine Zuordnung der Agrarumweltmaßnahmen zu den<br />
Honorierungsinstrumenten erfolgen (vgl. Kap. 5.6.2.2, Abbildung 15), das heißt, die Landwirte<br />
erhalten eine Zahlung für den Einsatz individueller Fähigkeiten oder den Verzicht auf ihnen<br />
zugeteilte ökosystemare Fähigkeiten (vgl. zur Unterscheidung individueller und ökosystemarer<br />
Fähigkeiten Kap. 4.1). In der Praxis ist es allerdings weniger eindeutig, ob es sich tatsächlich um<br />
eine Honorierung ökologischer Leistungen handelt oder doch um eine Subvention. Der Grund<br />
dafür liegt in den in vielen Fällen nicht eindeutig verteilten Eigentumsrechten ex ante.
178 Kapitel 7<br />
Tatsächlich werden die Eigentumsrechte in vielen Fällen gerade erst mit der Entwicklung von<br />
Agrarumweltmaßnahmen verteilt. Diese Tatsache wird im Folgenden diskutiert.<br />
Von Subvention wird gesprochen, wenn die Eigentumsrechte, die zur Produktion des<br />
ökologischen Gutes notwendig sind, de jure bei der Gesellschaft liegen. Mit einer Subvention im<br />
hier diskutierten Zusammenhang wird der Landwirt dafür honoriert, dass er seiner<br />
Sozialpflichtigkeit nachkommt (vgl. Abbildung 15 und Erläuterungen in Kap. 5.6.2.2).<br />
In der relevanten Europäischen Verordnung für die aktuellen Agrarumweltmaßnahmen, in der<br />
VO (EG) 1257/1999, gilt als Voraussetzung für die Honorierung, dass die Zahlungen nur für<br />
Leistungen erfolgen dürfen, die „über die gute landwirtschaftliche Praxis im üblichen Sinne<br />
hinausgehen“. Gute landwirtschaftliche Praxis 106 im üblichen Sinne ist laut Durchführungs-<br />
verordnung (VO (EG) 445/2002) „der gewöhnliche Standard der Bewirtschaftung, die ein<br />
verantwortungsbewusster Landwirt in der betreffenden Region anwenden würde“. Aus<br />
eigentumsrechtlicher Sicht muss die Gute landwirtschaftliche Praxis die Eigentumsrechte klar<br />
verteilen.<br />
Folgende Probleme treten bei der Abgrenzung der Honorierungswürdigkeit mit Hilfe der<br />
Rechtsfigur Gute fachliche Praxis auf:<br />
Mit der Guten fachlichen Praxis sind selbst innerhalb der Verordnung zwei verschiedene<br />
Funktionen verbunden. Erstens definiert sie die Grenzen für die Honorierungswürdigkeit und<br />
zweitens definiert sie Mindeststandards als Voraussetzung von Zahlungen (vgl. Ausführungen<br />
zur Guten fachlichen Praxis in Anlage A-1 im Anhang). Sie stellt in diesem Sinne die cross<br />
compliance-Regelungen für Agrarumweltmaßnahmen dar (vgl. cross compliance-Regelungen in<br />
Kap. 7.1.4.3). Dieser Doppelfunktion kann der unbestimmte Rechtsbegriff ‚Gute fachliche<br />
Praxis’ kaum gerecht werden.<br />
Abgrenzung der Honorierungswürdigkeit<br />
Die Formulierung ‚über die Gute fachliche Praxis hinaus’ suggeriert ein falsches Bild der<br />
überwiegend vorhandenen Eigentumsrechtslage. Demnach müsste zum Zeitpunkt der<br />
Entwicklung von Agrarumweltmaßnahmen ein zweigeteilter klar begrenzter ‚Eigentumrechts-<br />
raum’ vorliegen. Die Eigentumsrechte sind in diesem Verständnis bereits vollkommen<br />
106 ‚Gute landwirtschaftliche Praxis’ und ‚Gute fachliche Praxis’ werden synonym verwendet.
Aktuelle Anwendung im Rahmen der Agrarumwelt- und Artikel 16-Maßnahmen 179<br />
geschaffen. Es existiert ein ‚Eigentumsrechtsraum’ des Gemeineigentums, definiert durch die<br />
Gute fachliche Praxis und ein ‚Eigentumsrechtsraum’ des Privateigentums, definiert als Rest<br />
‚oberhalb’. Die Visualisierung würde einem Bündel an Eigentumsrechten entsprechen, wobei für<br />
jeden ‚Strang’ (operationalisiert durch Indikatoren, vgl. Kap. 6.3.3) der Anteil an<br />
Sozialpflichtigkeit – also die Gute fachliche Praxis – definiert ist. Tatsächlich gibt es derart<br />
definierte Eigentumsrechte und zwar jeweils dort, wo ordnungsrechtliche Standards festgesetzt<br />
wurden, deren Inhalt auch für Agrarumweltmaßnahmen relevant sein kann. Ein Beispiel dafür im<br />
deutschen Recht sind die in der Düngeverordnung (DüngeVO) 107 enthaltenen Standards, die die<br />
Vorschriften des Düngemittelgesetzes DüngeMG operationalisieren. So sind hier eindeutige<br />
Standards für die maximal einzusetzenden Stickstoffmengen pro Hektar definiert. Diese liegen<br />
für Ackerland bei 170 kg/ha und Jahr und bei Grünland bei 210 kg/ha und Jahr 108 . Wenn für die<br />
Produktion von ökologischen Gütern, z. B. bestimmte artenreiche mesophile Grünlandgesell-<br />
schaften, eine Düngerreduzierung notwendig ist, stellt die Produktion dieser<br />
Grünlandgesellschaft eine honorierungswürdige ökologische Leistung dar. Die Eigentumsrechte<br />
sind bzgl. des durchschnittlichen Umfangs an Stickstoffdünger mit Hilfe des Indikators kg<br />
N/ha/Jahr und den ‚Grenzwerten’ eindeutig normiert (vgl. dazu Anforderung der Normierbarkeit<br />
an Indikatoren in Kap. 6.3.4.4).<br />
In praxi existiert für die meisten relevanten Bereiche keine derartige Eigentumsrechtslage und<br />
zwar aus zwei Gründen. Zum einen werden Honorierungsinstrumente dort eingesetzt, wo aktuell<br />
Knappheiten auftreten, der Handlungsbedarf also erst aktuell entstanden ist. Zum anderen erfolgt<br />
gerade im Umweltbereich eine ‚Schaffung’ von Gemeineigentum über Ordnungsrecht mit Hilfe<br />
von unbestimmten Rechtsbegriffen, wie bereits diskutiert (vgl. Kap. 6.1). Die unbestimmten<br />
Rechtsbegriffe können aus eigentumsrechtlicher Sicht nicht nur ein Mittel sein, um einer<br />
Einzelfallgerechtigkeit Genüge zu tun, sondern vielmehr als ein Mittel angesehen werden, um in<br />
Zeiten des institutionellen Wandels (z. B. aufgrund von sich ändernden Knappheiten,<br />
Gerechtigkeitsvorstellungen, wissenschaftlichen Erkenntnissen) handlungsfähig zu sein und zu<br />
bleiben. In diesem Verständnis sind mit unbestimmten Rechtsbegriffen noch keine<br />
durchsetzungsfähigen Eigentumsrechte geschaffen, sondern der Rechtsrahmen für die<br />
Einzelfallentscheidung vorgegeben. Die Schaffung und Durchsetzung von Eigentumsrechten<br />
erfolgt im Zuge der Einzelfallentscheidung durch die Verwaltung und ist im ordnungsrechtlichen<br />
Bereich gerichtlich überprüfbar.<br />
107 Düngeverordnung vom 26. Januar 1996, BGBl 1996, S. 118.<br />
108 kg N pro Hektar und Jahr ist der Indikator, 170 kg N pro Hektar und Jahr ist der Standard.
180 Kapitel 7<br />
Im Prinzip stellt die Entwicklung von Agrarumweltmaßnahmen ein Bündel an Einzelfällen dar.<br />
Einzelfall bedeutet, dass, jeweils ausgehend von knappen ökologischen Gütern, die relevanten<br />
ökosystemaren Fähigkeiten, die zur Produktion dieser Güter notwendig sind, zu identifizieren<br />
und zu operationalisieren (Indikatorenentwicklung) sind. Auf der Grundlage relevanter<br />
ordnungsrechtlicher Vorgaben (zum Teil mit Hilfe unbestimmter Rechtsbegriffe definiert) sind<br />
danach bereits bestehende Gemeinschaftsrechte an den relevanten ökosystemaren Fähigkeiten zu<br />
normieren. Ein derartiges Vorgehen ist jeweils in den Fällen angesagt, in denen die<br />
ordnungsrechtlichen Auflagen auf dieselben Knappheiten abzielen wie die möglichen<br />
Agrarumweltmaßnahmen. In den anderen Fällen erfolgt im Zuge der Instrumentierung der<br />
Honorierung ökologischer Leistungen die Schaffung und Durchsetzung von Eigentumsrechten.<br />
Das Resultat dieses Prozesses würde dann erst der Strang an klar definierten Eigentumsrechten<br />
sein, der nach dem obigen Verständnis bereits ex ante vorliegt. „Die theoretischen Grundlagen<br />
(Coase) für Kompensationen 109 , die einen institutionellen Wandel ankündigen, sind zu erweitern.<br />
Es ist nicht so, dass die Nutzungs- und Eigentumsrechte bereits geregelt sein müssen, damit<br />
Kompensationen gesprochen werden können, sondern mit neuen Kompensationen werden die<br />
Nutzungs- und Verfügungsrechte implizit neu definiert, d. h. über die Einführung der<br />
Kompensation können Rechtstitel neu verteilt werden. ... Institutionenökonomisch können darum<br />
Kompensationen als Gradmesser für den institutionellen Wandel verstanden werden“ (Kissling-<br />
Näf 2000: 19).<br />
Wenn jedoch geschlussfolgert wird, dass mit der Honorierung die Zuteilung von<br />
Eigentumsrechten verbunden ist, muss der Prozess der Institutionenbildung dem damit<br />
verbundenen Anspruch an demokratischer Legitimation gerecht werden. Eine Abgrenzung von<br />
Subvention und Honorierung ist ansonsten, gerade unter den teilweise offen definierten<br />
Eigentumsverhältnissen, nicht möglich.<br />
Vor allem in diesem Punkt zeigen sich aktuell große Schwächen. Den Ansprüchen an<br />
Institutionenbildung wird der Prozess der Aufstellung von Agrarumweltprogrammen nicht<br />
gerecht. Vielmehr handelt es sich um eine fast ausschließlich behördeninterne Festlegung, die<br />
wesentlich von Einzelpersonen in den zuständigen Fachbehörden bestimmt wird. Es gibt zwar in<br />
gewisser Weise Beteiligungsverfahren (vgl. die aktuellen Berichte zur Halbzeitbewertung der<br />
EPLR), jedoch kein formalisiertes Beteiligungsverfahren, das eine juristische Überprüfbarkeit<br />
109 Im Beitrag wird „etwas salopp formuliert“, dass mit Kompensationen „für etwas eine Entschädigung gezahlt<br />
wird, was nicht mehr so ist, wie es war oder so bleiben soll wie es ist“ (Kissling-Näf 2000: 2 f.). Unter<br />
Kompensationen werden hier also alle positiven ökonomischen Anreize subsummiert.
Aktuelle Anwendung im Rahmen der Agrarumwelt- und Artikel 16-Maßnahmen 181<br />
beinhalten würde, wie es z. B. im deutschen Bauplanungsrecht geregelt ist. Tatsächlich scheint<br />
hier der größte Handlungsbedarf zu liegen. Wenn die Entwicklung von Instrumenten zur<br />
Honorierung ökologischer Leistungen als Zuteilung von Eigentumsrechten verstanden wird,<br />
muss dieser Prozess auch den dafür notwendigen demokratischen Legitimationsprozess<br />
durchlaufen.<br />
Aktuell wird dieser Prozess der Institutionenbildung im Rahmen der Instrumentierung<br />
vollkommen unterbewertet. Es erfolgt weder eine systematische Berücksichtigung und<br />
Normierung der relevanten Rechtsvorschriften für den Einzelfall noch ein für diese<br />
Anforderungen legitimierter Prozess. Tatsächlich kann dies unter den gegebenen<br />
Rahmenbedingungen auch kaum bewältigt werden, und einer klassischen Einzelfallprüfung sind<br />
unter Berücksichtigung der Transaktionskosten Grenzen gesetzt. Zu hohe Anforderungen<br />
würden dazu führen, dass in vielen Fällen ein Austausch von Eigentumsrechten aufgrund der<br />
beträchtlichen Transaktionskosten nicht stattfinden würde. Nicht zuletzt dürfte unter<br />
Berücksichtigung der Erkenntnisse der Politischen Ökonomie klar sein, dass Situationen, in<br />
denen es direkt um die Schaffung von Voraussetzungen für mögliche Zuwendungen geht, relativ<br />
ungeeignet sind, Standards des Gemeineigentums zu normieren, die dann den Zugang zu<br />
Zahlungen versperren.<br />
So ist es nicht verwunderlich, dass in den Entwicklungsplänen für den ländlichen Raum (EPLR)<br />
und den dort enthaltenen Agrarumweltprogrammen der Bundesländer keine ‚situationsbedingte’<br />
Normierung von ordnungsrechtlichen Vorgaben zur Guten fachlichen Praxis vorgenommen<br />
wurde. Zweckmäßig wäre dies z. B. bei § 17 BBodSchG (vgl. Ausführungen zur Guten<br />
fachlichen Praxis im Anhang, Anlage A-1). Die Zielsetzung dieses Paragraphen ist identisch mit<br />
vielen Agrarumweltmaßnahmen (Linderung der gleichen Knappheiten). Hier wäre also im<br />
Einzelfall zu prüfen, wieweit die Sozialpflichtigkeit laut § 17 BBodSchG reicht. Tatsächlich<br />
erfolgte dies in keinem EPLR. Dies ist auch künftig unter den gegebenen Rahmenbedingungen<br />
nicht zu erwarten.
182 Kapitel 7<br />
Gute fachliche Praxis als Mindeststandard (cross compliance-Regelungen)<br />
Zusätzlich erschwerend wirkt, dass die Gute fachliche Praxis neben der Grenze der<br />
Honorierungswürdigkeit auch noch Mindestanforderungen darstellt, die die Landwirte erfüllen<br />
müssen, um überhaupt an Agrarumweltmaßnahmen teilnehmen und in den Genuss von<br />
Ausgleichszulagen für benachteiligte Gebiete kommen zu können (vgl. Anlage A-1 im Anhang).<br />
Sie stellen also die cross compliance-Regelungen für diese Maßnahmen dar (vgl. Kap. 7.1.4.3).<br />
Als derartige Maßnahmen werden noch einmal besonders hohe Anforderungen an die<br />
Formulierbarkeit (vgl. Kap. 6.3.4.5), die praktische Erhebbarkeit und Überprüfbarkeit gestellt<br />
(vgl. Kap. 6.3.4.6).<br />
Die EU verlangt von den Mitgliedsländern im Rahmen der Pläne zur Entwicklung des ländlichen<br />
Raums (EPLR) eine nähere Bestimmung der Guten landwirtschaftliche Praxis und insbesondere<br />
eine Umformung in überprüfbare Standards (Art. 29 der VO (EG) 445/2002). Materieller<br />
Mindestgehalt dieser Standards ist gemäß Artikel 29 der VO (EG) 445/2002 die Einhaltung von<br />
verpflichtenden allgemeinen Umweltauflagen. Wie bei der Prüfung der Einhaltung der<br />
Fördervoraussetzungen für die Agrarumweltmaßnahmen selbst, müssen die Kriterien der Guten<br />
fachlichen Praxis im Sinne der Mindeststandards bei 5 % der Teilnehmer im Rahmen einer Vor-<br />
Ort-Kontrolle überprüft werden (vgl. Anlage A-2 im Anhang).<br />
Es ist illusorisch, zu erwarten, dass die Exekutive beim Aufstellen der Pläne zur ländlichen<br />
Entwicklung eine Standardisierung vollbringt, die zuvor im Rahmen des<br />
Gesetzgebungsverfahrens und der Auflegung von Durchführungsverordnungen nicht<br />
stattgefunden hat, zumal hierbei eine routinemäßige Überprüfung finanzierbar sein muss.<br />
Die EPLR werden auf Landesebene aufgelegt. Prinzipiell wäre es möglich, die Standards z. B.<br />
räumlich differenziert festzulegen, um die räumliche Äquivalenz (vgl. Kap. 6.3.4.1) zu<br />
ermöglichen. Auf der einen Seite kann das Argument der Transaktionskosten einer derart<br />
regionalisierten Standardisierung entgegenstehen. Aktuell entscheidend ist jedoch, dass regional<br />
differenzierte Standards im politischen Raum nicht durchsetzbar sind. Vielmehr wird politisch<br />
eine Gleichbehandlung der Landwirte bei den Anforderungen der Guten fachlichen Praxis<br />
angestrebt. Dieser Widerspruch, die zu berücksichtigende Standortabhängigkeit im Zuge der<br />
Entwicklung und Normierung der Indikatoren auf der einen Seite und die verteilungspolitischen<br />
Überlegungen der ‚Gleichbehandlung der Landwirte’ auf der anderen Seite, ist nicht<br />
befriedigend auflösbar. Der Aspekt der ‚Gleichbehandlung’ muss auch vor dem Hintergrund<br />
gesehen werden, dass bisher Landwirte, die ‚nur’ Direktzahlungen erhalten, keinerlei Standards
Aktuelle Anwendung im Rahmen der Agrarumwelt- und Artikel 16-Maßnahmen 183<br />
als Voraussetzung einhalten müssen. Damit werden von Landwirten in benachteiligten Gebieten<br />
bzw. denen, die bereit sind, Agrarumweltmaßnahmen anzuwenden, höhere Kontrollauflagen<br />
gegenüber der breiten Masse an Landwirten abverlangt. Unter diesen Bedingungen nun noch<br />
besonders hohe Hürden aufzubauen, dürft wenig zielführend sein. Hinzu kommt, dass gemäß<br />
Artikel 19 der Durchführungsverordnung (VO (EG) 445/2002) die Einhaltung der Guten<br />
fachlichen Praxis im gesamten Betrieb eine Voraussetzung für die Zahlung von Beihilfen für<br />
Agrarumweltmaßnahmen auf einer Teilfläche ist. Diese Voraussetzung verdeutlicht, dass die<br />
Indikatoren, die für die Standardisierung des Begriffs der Guten fachlichen Praxis genutzt<br />
werden, sich auf den Gesamtbetrieb beziehen müssen.<br />
Diese Rahmenbedingungen führten in Deutschland dazu, dass sich die Länderarbeitsgemein-<br />
schaft auf eine deutschlandweit einheitliche indikatorische Überprüfung der Guten fachlichen<br />
Praxis als Fördervoraussetzung für Agrarumweltmaßnahmen und Ausgleichszulagen geeinigt hat<br />
und darüber hinaus auf bestehendes Ordnungsrecht und deren Sanktion verweist (Ausführungen<br />
zur Guten fachlichen Praxis in Anlage A-1 im Anhang).<br />
Mit Hilfe derartiger Standards mag es möglich sein, Ordnungsrecht besser zu vollziehen, da ein<br />
zusätzlicher finanzieller Anreiz besteht. Hilfreich für die Abgrenzung der Honorierungswürdig-<br />
keit sind diese Standards nicht, obwohl dies durch die Mehrfachfunktion des Begriffs Gute<br />
fachliche Praxis suggeriert wird.<br />
Schlussfolgerung<br />
Die Diskussion zur Guten fachlichen Praxis zeigt, wie schwierig eine Einordnung der<br />
Agrarumweltmaßnahmen bzgl. der Aussage ‚Honorierung’ oder ‚Subvention’ in der Praxis ist.<br />
Dem komplexen Prozess der Schaffung und Durchsetzung von Eigentumsrechten kann nur mit<br />
einem möglichst hohen Maß an Transparenz im Zuge der Institutionenbildung und geeigneten<br />
demokratischen Strukturen begegnet werden. Die aktuelle Vorgehensweise (vgl. Ausführungen<br />
in den Planungsdokumenten und den Berichten zur Halbzeitbewertung der EPLR) zeigt hier<br />
hohen Handlungsbedarf auf. Vor diesem Hintergrund werden die Agrarumweltmaßnahmen auf<br />
einer Achse von Subvention auf der einen Seite und Honorierung auf der anderen Seite zwar<br />
eher der Honorierung zugeordnet, jedoch kann keine eindeutige Zuordnung erfolgen (vgl.<br />
Abbildung 33).
184 Kapitel 7<br />
Subvention<br />
Abbildung 33: Typisierung der aktuellen Agrarumweltmaßnahmen (AUM) als Subvention oder Honorierung<br />
auf der Grundlage der Verteilung der Eigentumsrechte (Subvention = Eigentumsrechte nicht beim<br />
Leistungserbringer; Honorierung = Eigentumsrechte beim Leistungserbringer)<br />
7.2.2.3 Preistyp – Kosten oder Nutzen<br />
Die Preise für ökologische Leistungen werden bisher durch die Nachfrager nach ökologischen<br />
Gütern bestimmt 110 . Die Vorgaben zur Preisermittlung für Agrarumweltmaßnahmen im Rahmen<br />
der VO (EG) 1257/1999 sind relativ eindeutig. Die Ermittlung hat auf der Grundlage der Kosten<br />
zu erfolgen, die bei der Produktion entstehen. Dabei ist ein Spielraum von 20 % Anreiz erlaubt.<br />
Bedeutsam für die Ermittlung des Preises ist darüber hinaus, dass keine investiven Maßnahmen<br />
in die Kostenkalkulation mit einberechnet werden dürfen. Mit der Orientierung an den Kosten<br />
soll ausgeschlossen werden, dass Landwirte eine Rente im Zusammenhang mit der Honorierung<br />
dieser Leistungen erzielen (vgl. rechtliche Grundlagen Kap. 7.1.2.2). Auch diese Vorgaben sind<br />
wiederum im Zusammenhang mit internationalen Verhandlungen im Rahmen der WTO zu sehen<br />
(Vorgaben für die ‚green box-Maßnahmen’ vgl. Kap. 7.1.1).<br />
Honorierung<br />
Diese Vorgaben zu Gunsten einer Orientierung an den Kosten können wenig zu einer<br />
innovativen Weiterentwicklung der Maßnahmen beitragen, da so einer Auseinandersetzung mit<br />
dem tatsächlichen Nutzen der Maßnahmen kein Vorschub geleistet wird. Der Nutzen, also das<br />
Ziel der Maßnahmen, kann ausgeblendet werden. Die Handhabung der Kalkulation führt<br />
außerdem zu einer standortabhängigen Attraktivität der Maßnahmen, die nicht in jedem Fall die<br />
Effektivität der Maßnahmen erhöht. So werden für ein ganzes Bundesland, für den gesamten<br />
Geltungsbereich des Agrarumweltprogramms, durchschnittliche Prämien auf der Grundlage der<br />
110 Der Staat als Stellvertreter der gesellschaftlichen Nachfrager bestimmt den Preis. Eine Diskussion über die<br />
Möglichkeit von Angebotspreisen soll an dieser Stelle nicht geführt werden. Die prinzipielle Möglichkeit, aber auch<br />
die damit verbundenen Schwierigkeiten bzgl. von Angebotspreisen werden z. B. für Bieterverfahren in Latacz-<br />
Lohmann & Hamsvoort (1997) und Holm-Müller et al. (2002) diskutiert.<br />
AUM
Aktuelle Anwendung im Rahmen der Agrarumwelt- und Artikel 16-Maßnahmen 185<br />
entstehenden Kosten ermittelt. Bei Extensivierungsmaßnahmen, bei denen mit den Agrarumwelt-<br />
maßnahmen in jedem Fall Einkommensverluste verbunden sind, sind diese natürlich in hohem<br />
Maße standortabhängig. Gerade auf produktiven Standorten sind umweltentlastende Maßnahmen<br />
oft wenig attraktiv. Dies bestätigen Untersuchungen zur Akzeptanz von<br />
Agrarumweltmaßnahmen z. B. Schramek et al. (1999a), Schramek et al. (1999b), COM (1998),.<br />
Osterburg et al. (1997), Zeddies & Doluschitz (1996).<br />
Trotz der Orientierung an den Kosten ist jedoch ein relativ breiter Spielraum für die Verwaltung<br />
gegeben, der auch von der EU-Kommission akzeptiert wird. Ein Blick auf ausgewählte<br />
Agrarumweltmaßnahmen zweier benachbarter Bundesländer, Brandenburg und Sachsen, zeigt in<br />
Tabelle 8, wie sehr die ermittelten und durch die Kommission genehmigten Prämien für ähnliche<br />
Agrarumweltmaßnahmen voneinander abweichen können.<br />
Tabelle 8: Prämienhöhe für ausgewählte Agrarumweltmaßnahmen (2002) in Brandenburg und Sachsen<br />
Agrarumweltmaßnahmen<br />
Ökologischer Landbau<br />
Ackerland/Grünland<br />
Prämienhöhe in €/ha und Jahr<br />
Brandenburg Sachsen<br />
150/130 230/244<br />
Extensive Grünlandnutzung 130 153<br />
Beweidung Trockenrasen/Heiden<br />
(Schafhutung)<br />
Umwandlung Ackerland in<br />
Grünland<br />
105 410<br />
255 360-450<br />
Die Abweichungen betragen bis zu 400 %. Der Preis für die Leistung ist selbstverständlich eines<br />
der entscheidenden Kriterien für die Teilnahme der Landwirte an Agrarumweltmaßnahmen (vgl.<br />
Tabelle A-2 im Anhang). So führte z. B. die niedrige Prämie (105 €) der Maßnahme ‚Beweidung<br />
Trockenrasen/Heiden’ (Schafweide) in Brandenburg (vgl. Tabelle 8) zu einer geringen<br />
Akzeptanz dieser Maßnahme (Matzdorf et al. 2003). Aufgrund einer neuen Kalkulation wurde<br />
die Prämienhöhe verdoppelt. Die Entscheidungsträger sind, sofern der Haushalt es zulässt,<br />
relativ flexibel in der Prämiengestaltung und können so die Attraktivität bestimmter Maßnahmen<br />
entsprechend auftretender Knappheiten steuern. Diese Flexibilität sollte unbedingt erhalten<br />
bleiben, auch um besonderen Knappheiten mit einem hohen Angebot an Leistungen (Akzeptanz)<br />
begegnen zu können. Aus Rücksicht auf die internationalen Rahmenbedingungen (vgl. OECD
186 Kapitel 7<br />
2001c), aber auch aufgrund der methodischen Probleme der Monetarisierung von Nutzen 111 ist<br />
mittelfristig eine Orientierung an den Kosten eher zweckdienlich. Bei entsprechender Flexibilität<br />
ist dies auch für ergebnisorientierte Honorierung möglich. Prinzipiell sollte die Orientierung an<br />
den Kosten kein Hinderungsgrund für eine ergebnisorientierte Honorierung sein (vgl. Kap. 8).<br />
Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die aktuellen Preise für die Honorierung durch<br />
die Nachfrage bestimmt sind und sich an den entstehenden Produktionskosten orientieren.<br />
Aufgrund möglicher Anreize über die Produktionskosten hinaus (20 %), aber auch aufgrund der<br />
relativ flexiblen Handhabung kann nicht von einer reinen Kostenorientierung die Rede sein (vgl.<br />
Abbildung 34).<br />
AUM<br />
Kostentyp Nutzentyp<br />
Abbildung 34: Typisierung der aktuellen Agrarumweltmaßnahmen im Hinblick auf die Art der Ermittlung<br />
des Preises<br />
7.2.2.4 Strategietyp – Umweltzielorientierte Strategie oder Minimierungsstrategie<br />
In Kapitel 6.1 und 6.2 wurde die Bedeutung der umweltzielorientierten Strategie für rationales<br />
Handeln ausführlich diskutiert. Es wurde jedoch auch darauf hingewiesen, dass in der Praxis in<br />
vielen Fällen der Ansatz der Minimierungsstrategie verfolgt wird, obwohl diese für die<br />
Honorierung ökologischer Leistungen als ein positives ökonomisches Anreizinstrument als nicht<br />
geeignet bewertet wurde (vgl. Kap. 6.2.2).<br />
Die VO (EG) 1257/1999 gibt mit ihren Zielsetzungen für Agrarumweltmaßnahmen (vgl. 7.1.2.2)<br />
bereits Hinweise darauf, inwieweit tatsächlich eine umweltzielorientierte Strategie mit den<br />
Agrarumweltmaßnahmen verfolgt werden muss. Neben klar an Umweltzielen ausgerichteten<br />
Vorgaben (vgl. S. 160) ist als separates Ziel im Artikel 22 VO (EG) 1257/1999 benannt: „... eine<br />
umweltfreundliche Extensivierung der Landwirtschaft und eine Weidewirtschaft geringer<br />
111 vgl. zu den Methoden z. B. Pommerehne & Roemer 1992, weitere Angaben vgl. Kap. 4.1
Aktuelle Anwendung im Rahmen der Agrarumwelt- und Artikel 16-Maßnahmen 187<br />
Intensität zu fördern“. Eine derartige Zielsetzung hebt die Extensivierung von der Mittel- auf die<br />
Zielebene und öffnet die Tür für die Minimierungsstrategie.<br />
Breite, horizontale (nicht räumlich begrenzte) Extensivierungsmaßnahmen finden sich in allen<br />
Agrarumweltprogrammen der Bundesländer zumindest im Bereich des Grünlandes wieder (vgl.<br />
im Überblick Hartmann et al. 2003, Berichte zur Halbzeitbewertung der EPLR) und spielen auch<br />
auf gesamteuropäischer Ebene eine bedeutende Rolle (vgl. Schramek et al. 1999a, Deblitz 1999,<br />
COM 1998). Im Anhang sind die Agrarumweltmaßnahmen von Brandenburg als ein Beispiel für<br />
die Ausgestaltung aufgeführt (vgl. Tabelle A-5 im Anhang). In vielen Fällen nehmen<br />
Extensivierungsmaßnahmen den Hauptteil der Förderflächen ein (vgl. Berichte zur<br />
Halbzeitbewertung der EPLR). Horizontale Extensivierungsmaßnahmen müssen nicht in jedem<br />
Fall der Minimierungsstrategie zugeordnet werden. Tatsächlich zeigen jedoch die historische<br />
Entwicklung und die Planungsdokumente (EPLR), dass mit den Extensivierungsmaßnahmen<br />
teilweise keine konkreten Umweltziele verknüpft sind, in jedem Fall nicht in der Art, dass die<br />
Extensivierungsmaßnahmen auch nur annähernd mit ihnen zugeordneten Umweltzielen in einer<br />
Indikator-Indikandum-Beziehung stehen und den Anforderungen von Maßnahmen-Indikatoren<br />
für die Umweltziele gerecht werden (vgl. Kap. 6.3.2 - 6.3.4).<br />
In Tabelle A-6 im Anhang ist am Beispiel der Agrarumweltmaßnahmen des Bundeslandes<br />
Brandenburg der flächenhafte Förderumfang der Agrarumweltmaßnahmen von 1994-2002<br />
aufgeführt. Dabei zeigt sich, dass horizontale Extensivierungsmaßnahmen von Anfang an<br />
überwogen haben. In Abbildung 35 ist das Verhältnis von eher umweltzielorientierten<br />
Agrarumweltmaßnahmen zu Extensivierungsmaßnahmen in Brandenburg über einen Zeitraum<br />
von 9 Jahren graphisch dargestellt. Hervorgehoben ist dabei der Wechsel der Zielsetzungen der<br />
Agrarumweltmaßnahmen durch VO (EG) 1257/1999. Eine genaue Maßnahmenbeschreibung ist<br />
der Tabelle A-5 im Anhang zu entnehmen.
188 Kapitel 7<br />
Flächenumfang in Tausend ha<br />
400<br />
350<br />
300<br />
250<br />
200<br />
150<br />
100<br />
50<br />
0<br />
Verhältnis von Extensivierungsmaßnahmen zu<br />
stärker zielorientierten Agrarumweltmaßnahmen<br />
in Brandenburg<br />
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002<br />
zielorientierte Agrarumweltmaßnahmen<br />
Extensivierungsmaßnahmen<br />
Abbildung 35: Verhältnis von umweltzielorientierten Agrarumweltmaßnahmen zu Extensivierungsmaßnahmen<br />
in Brandenburg (eigene Berechnung, Datenquelle: Auszahlungsdaten des LVL in<br />
Matzdorf et al. 2003)<br />
An dem Verhältnis von breiten Extensivierungsmaßnahmen zu zielorientierten<br />
Agrarumweltmaßnahmen hat sich im Verlauf der bisherigen Anwendung von<br />
Agrarumweltmaßnahmen nichts geändert. Dies ist vor allen Dingen vor dem Hintergrund<br />
kritisch zu diskutieren, dass bis zur VO (EG) 1257/1999 mit Agrarumweltmaßnahmen neben den<br />
Umweltwirkungen immer das Ziel der Marktentlastung durch Extensivierung stand (nach<br />
VO (EWG) 2078/1992), hierbei also ganz eindeutig ein Fokus auf der Minimierung lag, jedoch<br />
mit dem übergeordneten Ziel der Marktentlastung.<br />
VO (EG) 1257/1999<br />
In der VO (EG) 1257/1999 ist neben umweltzielorientierten Ansätzen eine Extensivierung im<br />
Sinne der Minimierungsstrategie übrig geblieben (s.o.), also Minimierung ohne übergeordneten<br />
operationalisierten Zielbezug. Die Konsequenzen bestätigen die mit einer derartigen Strategie<br />
verbundenen Probleme. Es wurden nahezu alle Maßnahmen, die unter der alten Verordnung
Aktuelle Anwendung im Rahmen der Agrarumwelt- und Artikel 16-Maßnahmen 189<br />
(VO (EWG) 2078/1992) aufgelegt wurden, weiterhin angeboten 112 und, was kritisch zu sehen ist,<br />
es bestand keine Notwendigkeit und kein Anreiz für die verantwortliche Administration, sich<br />
über die konkreten Umweltziele, die mit den Agrarumweltmaßnahmen angestrebt werden<br />
sollten, auseinander zu setzen. Fehlt eine derartige Auseinandersetzung, werden Überlegungen<br />
zur räumlichen und zeitlichen Äquivalenz sowie der Validität bzw. Problemäquivalenz nicht<br />
angestellt.<br />
Diese Einschätzung bestätigen Ergebnisse zur räumlichen Äquivalenz horizontaler Maßnahmen,<br />
die im Rahmen der Halbzeitbewertung des Brandenburger Agrarumweltprogramms ermittelt<br />
wurden. Ein Beispiel aus dieser Halbzeitbewertung ist die Ausgestaltung der<br />
erosionsmindernden Maßnahmen. Maßnahmen, die überwiegend dem Erosionsschutz dienen<br />
sollen, werden für alle Landwirte angeboten, unabhängig der Standortverhältnisse. Das Ergebnis<br />
ist, dass weniger als 50 % dieser Maßnahmen tatsächlich in erosionsgefährdeten Gebieten<br />
stattfinden, wobei der Anteil von AUM in mäßig bis sehr stark gefährdeten Gebieten abnimmt<br />
(vgl. Abbildung 36). Die Auswertung ergab, dass auf lediglich 2,9 % der etwa 375.000 ha<br />
winderosionsgefährdeten Fläche Agrarumweltmaßnahmen zur Verringerung der Erosion<br />
durchgeführt wurden (vgl. Abbildung 37).<br />
112 Einzig die so genannte ‚Grundförderung’ in Bayern und Sachsen wurde nicht mehr angeboten.
190 Kapitel 7<br />
Anteil erosionsmindernder AUM in Brandenburg auf<br />
erosionsgefährdeten Standorten<br />
100%<br />
80%<br />
60%<br />
40%<br />
20%<br />
0%<br />
2000/2001 2001/2002<br />
davon auf mäßig<br />
erosionsgefährdeten<br />
Flächen<br />
davon auf stark<br />
erosionsgefährdeten<br />
Flächen<br />
davon auf sehr stark<br />
erosionsgefährdeten<br />
Flächen<br />
erosionsmindernde AUM<br />
Abbildung 36: Anteil der erosionsmindernden Agrarumweltmaßnahmen (AUM) in Brandenburg auf<br />
erosionsgefährdeten Flächen (eigene Darstellung, Datenquelle: Matzdorf et al. 2003)<br />
Erosionsmindernde Agrarumweltmaßnahmen (ha) in und außerhalb der<br />
winderosionsgefährdeten Gebiete in Brandenburg (2001/2002)<br />
364687,9622<br />
906477,372<br />
10691,0678<br />
11978,9723<br />
Flächen mit erhöhtem<br />
Winderosionsgefährdungspotenzial<br />
Flächen ohne erhöhtes<br />
Winderosionsgefährdungspotenzial<br />
relevante AUM<br />
Abbildung 37: Erosionsmindernde Agrarumweltmaßnahmen in Brandenburg in und außerhalb von<br />
erosionsgefährdeten Gebieten (Quelle: Matzdorf et al. 2003, leicht verändert)
Aktuelle Anwendung im Rahmen der Agrarumwelt- und Artikel 16-Maßnahmen 191<br />
Diese Ergebnisse werden auch durch Daten zur räumlichen Äquivalenz von<br />
Extensivierungsmaßnahmen gegenüber anderen ökologischen Gütern (z.B. Artenvielfalt,<br />
Landschaftsvielfalt) bestätigt (vgl. Matzdorf et al. 2003). Gerade bei den horizontalen<br />
Grünlandextensivierungsmaßnahmen wird deutlich, dass mit zunehmendem politischen Druck<br />
zur Herstellung eines Zielbezuges der Maßnahmen ab 2000 u.U. verschiedene<br />
Umweltzielbezüge konstruiert wurden, die Maßnahmen jedoch den Anforderungen an<br />
Indikatoren für diese Ziele (vgl. Kap. 6.3.2 - 6.3.4) in keiner Weise gerecht werden (Ziele haben<br />
‚Alibifunktion’). Derartige Maßnahmen sind weiterhin der Minimierungsstrategie zuzuordnen,<br />
sofern ersichtlich ist, dass fehlende Validität sowie fehlende Raum-, Problem- und<br />
Zeitäquivalenz keiner bewussten Entscheidung aufgrund der Transaktionskosten entspringt.<br />
Die Halbzeitbewertungen der Agrarumweltmaßnahmen brachten das Problem des fehlenden<br />
Zielbezuges einiger Maßnahmen zu Tage. Bewertung von Agrarumweltmaßnahmen erfordert die<br />
Überprüfung der Indikator-Indikandum-Beziehung und verlangt eine differenzierte Verknüpfung<br />
der Maßnahmen mit den Zielen (vgl. z. B. Matzdorf & Piorr 2003). Erstmals wurden im Zuge<br />
dieser Bewertungen auch auf der politischen Entscheidungsebene eine strukturierte<br />
Auseinandersetzung mit den Umweltzielen der Maßnahmen und die in Kapitel 6.3.4.7<br />
beschriebenen Lernprozesse in Gang gesetzt. Diese Erfahrungen wurden von vielen der mit der<br />
Evaluierung beschäftigten Forschungseinrichtungen geäußert 113 .<br />
Die Agrarumweltprogramme in Deutschland, und natürlich umso mehr im europäischen<br />
Maßstab, sind sehr heterogen. Trotzdem kann zusammenfassend festgestellt werden, dass<br />
horizontale Extensivierungsmaßnahmen eine sehr bedeutende Rolle innehaben. In vielen Fällen<br />
fehlt bisher ein klarer Bezug auf die mit diesen Maßnahmen verbundenen konkreten<br />
Zielsetzungen. Diese sind Voraussetzung für den ökonomisch gesteuerten Tausch von<br />
Eigentumsrechten. Es kann sich durchaus erweisen, dass horizontale Maßnahmen unter<br />
Berücksichtigung der Transaktionskosten effizient sind, indem diese zwar eine geringere<br />
Effektivität bezogen auf einzelne ökologische Güter haben, mit ihnen jedoch mehrere Ziele<br />
kostengünstig erreicht werden (positiver ‚Gießkanneneffekt’). Entscheidend ist, dass die<br />
rationale Entscheidung für den positiven ‚Gießkanneneffekt’ aktuell in vielen Fällen nicht die<br />
Voraussetzung für das Angebot der horizontalen Maßnahmen war. Bezüglich der aktuellen<br />
113 Es fanden mehrmalige Treffen der EvaluatorInnen während der Bewertung und ein ex post-Erfahrungsaustausch<br />
im Rahmen eines Workshops an der FAL zum Thema: „Zwischenbewertung der Programme zur Entwicklung des<br />
ländlichen Raumes nach VO (EG) Nr. 1257/1999 – Erfahrungsaustausch und Verbesserungsansätze“ (vgl. FAL<br />
2004) statt.
192 Kapitel 7<br />
Agrarumweltmaßnahmen kann festgestellt werden, dass diese zu einem erheblichen Teil der<br />
Minimierungsstrategie zugeordnet werden müssen (vgl. auch SRU 2004 114 ). Innovative Ansätze<br />
entwickeln sich unter der Minimierungsstrategie kaum, versteckte Distributionskriterien sind für<br />
die Gesellschaft nicht aufzudecken, die Maßnahmen sind einer Kritik entzogen.<br />
Derartige Maßnahmen würden mit hoher Wahrscheinlichkeit noch nicht einmal die künftigen<br />
Voraussetzungen der ‚green box-Maßnahmen’ erfüllen (vgl. WTO-Verhandlungen Kap. 7.1.1,<br />
vgl. zu dieser Einschätzung auch SRU 2004: 205 f.). Bei vielen der Extensivierungsmaßnahmen<br />
kann jedoch ein Zielbezug hergestellt werden, der dann zu einer Weiterentwicklung der<br />
Maßnahmen führen wird und diese evaluierbar macht. Ein erster entscheidender Schritt erfolgte<br />
im Rahmen der Halbzeitbewertungen, die seit Ende 2003 für alle EU-Staaten vorliegen. Vor dem<br />
Hintergrund dieser Gesamtstudien werden die aktuellen Agrarumweltmaßnahmen auf einer<br />
Skala von Minimierungsstrategie auf der einen Seite und umweltzielorientierter Strategie auf der<br />
anderen Seite aktuell als ungefähr in der Mitte stehend bewertet (vgl. Abbildung 38).<br />
Minimierungsstrategie<br />
AUM<br />
Abbildung 38: Typisierung der aktuellen Agrarumweltmaßnahmen (AUM) im Hinblick auf ihren Zielbezug<br />
7.2.2.5 Rationalisierungstyp – Top down- oder Bottom up-Prozess<br />
Umweltzielorientierte<br />
Strategie<br />
Wenn man sich vergegenwärtigt, dass im Zuge der Honorierung ökologischer Leistungen<br />
durchsetzungsfähige Eigentumsrechte geschaffen werden, gewinnt der Prozess der<br />
instrumentellen Ausgestaltung an Bedeutung (vgl. Kap. 7.2.2.2). Wer entscheidet demnach auf<br />
welcher Grundlage, welche ökologischen Güter knapp sind und daher knappe Mittel zur<br />
Honorierung ökologischer Leistungen für die Produktion dieser Güter eingesetzt werden?<br />
114 „Insbesondere bei den nicht naturschutzorientierten Maßnahmen sind die Auflagen vielfach nicht ausreichend an<br />
den erwünschten Umweltwirkungen orientiert und es fehlt bei den meisten Maßnahmen der notwendige Bezug zu<br />
einem Handlungsbedarf (z. B. aufgrund standörtlicher Empfindlichkeiten)“ (SRU 2004: 205 f.).
Aktuelle Anwendung im Rahmen der Agrarumwelt- und Artikel 16-Maßnahmen 193<br />
Aktuell obliegt es den für die Aufstellung der Pläne zur ländlichen Entwicklung (vgl. Kap.<br />
7.1.2.1) zuständigen Verwaltungsbehörden. Dabei erfolgt auf verschiedenen inhaltlichen und<br />
strukturellen Ebenen eine Koordination. Inhaltlich werden die relevanten Behörden mit<br />
einbezogen (vor allen Dingen Umweltverwaltung), strukturell findet eine Koordination zwischen<br />
den Ländern und der EU sowie dem Bund statt. In allen Ländern wurden in irgendeiner Form die<br />
so genannten Wirtschafts- und Sozialpartner eingebunden. Hierbei gab es z. B. Anhörungen der<br />
Landesbauernverbände oder der Naturschutzverbände (vgl. Matzdorf & Piorr 2003). Ebenfalls<br />
waren wissenschaftliche Einrichtungen beratend tätig. Ein formalisiertes Beteiligungsverfahren,<br />
wie im Rahmen der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange in der Raumordnungsplanung<br />
oder Landschaftsplanung und die damit verbundene Möglichkeit einer gerichtlichen<br />
Überprüfbarkeit von Vorschlägen und Einwänden, gibt es jedoch nicht. Die Transparenz des<br />
Entscheidungsprozesses ist damit abhängig von den jeweiligen Verwaltungen der Länder (vgl.<br />
Berichte zur Halbzeitbewertung der EPLR).<br />
Trotz der unterschiedlichen Handhabung im Detail kann länderübergreifend für Deutschland<br />
festgestellt werden, dass die konkreten honorierungswürdigen Leistungen durch die Verwaltung<br />
auf Landesebene top down definiert werden. Auffällig ist dabei, dass durch den bisher nicht<br />
notwendigen klaren Zielbezug kaum Verbindungen zur räumlichen Umweltplanung<br />
(Landschaftsplanung) und den dort definierten Zielvorstellungen hergestellt werden (vgl.<br />
Programmplanungsdokumente (EPLR) der Länder 115 ), obwohl bei diesen Planungen eine<br />
Partizipation der ‚Planungsbetroffenen’ (also auch der potentiellen Nachfrager nach<br />
ökologischen Gütern) vorgeschrieben ist.<br />
In der Ökonomie diskutierte Ermittlungen von Nachfrage z. B. über<br />
Zahlungsbereitschaftsanalysen (vgl. FN 15) werden in keinem Bundesland angewendet. Die<br />
Einbindung der Anbieter (Landwirte) erfolgt überwiegend über die Bauernverbände.<br />
Bieterverfahren (vgl. FN 110), nicht nur zur Effizienzsteigerung, sondern auch zur Ermittlung<br />
des möglichen Angebots an ökologischen Gütern/Leistungen, finden ebenfalls in keinem<br />
Bundesland Anwendung. Einige Bundesländer sind aufgrund ihrer finanziellen Situation an einer<br />
Kofianzierung der Agrarumweltmaßnahmen über die GAK (vgl. Kap. 7.1.3.2) interessiert. Damit<br />
diese gesichert ist, müssen Vorgaben der GAK bei der inhaltlichen Ausgestaltung beachtet<br />
werden, wodurch die konkreten honorierungswürdigen Umweltleistungen für diese<br />
Agrarumweltmaßnahmen sogar zentral auf der Bundesebene definiert werden.<br />
115 in der Literaturliste aufgeführt
194 Kapitel 7<br />
Eine Befragung unter 140 Brandenburger Landwirten zu ihrer Bereitschaft, an der konkreten<br />
Ausgestaltung von Agrarumweltprogrammen mitzuarbeiten, zeigt, dass sich ein erheblicher<br />
Anteil an Landwirten (58 %) regelmäßig aktiv beteiligen würde. Eine ablehnende Haltung hatten<br />
lediglich 12 % (vgl. Abbildung 39). Untersuchungen zur Ausgestaltung von bottom up-Ansätzen<br />
im Zusammenhang mit der Weiterentwicklung von regionalen Agrarumweltprogrammen im<br />
Vorschungsverbundprojekt GRANO bestätigen die prinzipiell Bereitschaft der Landwirte zur<br />
aktiven Teilnahme und zeigen mögliche Optionen zur Ausgestaltung eines derartigen Prozesses<br />
auf (vgl. Müller et al. (Hrsg.) 2002).<br />
Bereitschaft der Landwirte bei der Weiterentwicklung<br />
von Agrarumweltmaßnahmen aktiv teilzunehmen<br />
nein<br />
12%<br />
weiß nicht<br />
16%<br />
Abbildung 39: Bereitschaft von Brandenburger Landwirten zur aktiven Teilnahme an der Entwicklung von<br />
Agrarumweltmaßnahmen (Datenquelle: schriftliche Befragung (2002) von Teilnehmern (n=140) am aktuellen<br />
Agrarumweltprogramm)<br />
Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die aktuelle ‚Ermittlung’ der<br />
honorierungswürdigen Leistungen top down durch die Administration erfolgt (vgl. Abbildung<br />
40) und nicht zuletzt aufgrund fehlender konkreter Zielbezüge in vielen Fällen wenig transparent<br />
ist. Die bisherigen Betrachtungen sowohl in Kapitel 6.3.5.2 als auch in Kapitel 7.2.2.2 weisen<br />
auf die Bedeutung des demokratischen Prozesses, inklusive der Einbindung wissenschaftlicher<br />
Erkenntnisse, zur Ermittlung der honorierungswürdigen Leistungen hin. Vor diesem Hintergrund<br />
sollten verstärkt Anstrengungen auf die Bildung geeigneter Strukturen zur Ermittlung der<br />
ökologischen Güter und der Indikatoren verwendet werden (vgl. auch Bündelung der Nachfrage<br />
in Bahner 1996).<br />
keine Aussage<br />
14% Frage: Wenn die Möglickeit bestünde,<br />
dass Sie sich als Landwirt an der<br />
Weiterentwicklung der KULAP-<br />
Maßnahmen beteiligen könnten, würden<br />
Sie sich in gewissen Abständen aktiv im<br />
Rahmen von regionalen Gesprächsrunden<br />
beteiligen?<br />
ja<br />
58%
Aktuelle Anwendung im Rahmen der Agrarumwelt- und Artikel 16-Maßnahmen 195<br />
Top-down<br />
Indikatorenentwicklung<br />
Abbildung 40: Typisierung der aktuellen Agrarumweltmaßnahmen (AUM) im Hinblick auf die Art der<br />
Entwicklung der Indikatoren (der konkreten Fördervoraussetzungen)<br />
7.2.2.6 Indikatorentyp – Ergebnis- oder maßnahmenorientierte Honorierung<br />
Trotz der wesentlichen Effektivitäts- und Effizienzvorteile, die eine ergebnisorientierte<br />
Honorierung gegenüber einer maßnahmenorientierten Honorierung erbringen könnte, ist die<br />
aktuelle praktische Anwendung gering. Verstärkte Forschungsbemühungen zeigen jedoch das<br />
große Interesse an der Entwicklung praktikabler Honorierungsansätze in diesem Bereich 116 .<br />
Die geringe Anwendung der ergebnisorientierten Honorierung kann sinnvoller Weise nur im<br />
Zusammenhang mit der in Kapitel 7.2.2.4 beschriebenen fehlenden Ausrichtung auf Ziele<br />
verstanden werden. Der Zielbezug ist im Fall der ergebnisorientierten Honorierung essentielle<br />
Voraussetzung. Darüber hinaus ergibt sich aus der maßnahmenorientierten Honorierung eine<br />
scheinbar bessere Möglichkeit, der Unsicherheit auszuweichen. Tatsächlich trägt der Nachfrager<br />
das finanzielle Risiko (vgl. kritisch Kap. 6.3.5.1). Ein zweiter wesentlicher Grund ist in den EU-<br />
Rahmenbedingungen zu sehen, insbesondere in der Orientierung der Prämienhöhe an den Kosten<br />
(vgl. Kap. 7.1.2.2).<br />
AUM<br />
Praktische Anwendung im Zuge der flächenrelevanten Agrarumweltmaßnahmen über die<br />
VO (EG) 1257/1999 findet die ergebnisorientierte Honorierung aktuell daher in Deutschland<br />
lediglich in einem Bundesland, in Baden-Württemberg im Rahmen des MEKA II (vgl. Kap.<br />
4.2.3.2). Die ergebnisorientierte Honorierung wurde in Baden-Württemberg gut angenommen.<br />
Das Flächenpotential wird auf 100.000 ha bis 120.000 ha geschätzt (Haber 2003). Über 50 %<br />
dieses Potentials wurde bereits nach dem 3. Anwendungsjahr im Rahmen des MEKA II<br />
bewirtschaftet und honoriert (vgl. Tabelle 9).<br />
Bottom-up<br />
Indikatorenentwicklung<br />
116 aktuelle Forschergruppen in Deutschland z. B. Hannover – Prof. Ch. v. Haaren (Dr. E. Brahms) et al.; Bonn –<br />
Prof. Dr. K. Holm-Müller et al.; Göttingen – Prof. Dr. R. Marggraf et al.; Rostock – Prof. Dr. B. Gerowitt et al.; in<br />
Bremen – Dr. B. Wittig et al., darüber seit vielen Jahren und Vorreiter für die praktische Anwendung im Rahmen<br />
des Baden-Württembergischen Agrarumweltprogramms MEKA II – Dr. G. Briemle und Dr. R. Oppermann.
196 Kapitel 7<br />
Tabelle 9: Entwicklung des geförderten Grünlandes nach Einführung der ergebnisorientierten Honorierung<br />
in Baden-Württemberg<br />
Antragsjahr 2000 Antragsjahr 2001 Antragsjahr 2002<br />
Antragsteller 4.600 6.000 9.200<br />
Honorierte Fläche (ha) 36.000 41.800 66.000<br />
Quelle: Haber 2003<br />
Die gute Akzeptanz der ergebnisorientierten Honorierung in Baden-Württemberg sollte Anlass<br />
sein, derartige Maßnahmen auch in anderen Bundesländern einzuführen. Im Rahmen einer<br />
Befragung von 140 an AUM teilnehmenden Landwirten in Brandenburg bzgl. ihrer Bereitschaft<br />
zur Teilnahme an ergebnisorientierter Honorierung ergab ein positives Bild. Mehr als die Hälfte<br />
der Landwirte befürworteten eine derartige Honorierung und lediglich 13 % äußerten eine klare<br />
ablehnende Haltung (vgl. Abbildung 41).<br />
Nein<br />
13%<br />
Bereitschaft zur Teilnahme an<br />
ergebnisorientierter Honorierung<br />
Weiß nicht<br />
14%<br />
Keine Aussage<br />
22%<br />
Ja<br />
51%<br />
Frage: Könnten Sie sich vorstellen, dass<br />
KULAP-Zahlungen an konkrete<br />
angestrebete ökologische Zustände und<br />
Wirkungen gebunden werden und Sie dafür<br />
mehr Flexibilität bzgl. der Bewirtschaftung<br />
erhalten? (Beispiele dafür könnten sein,<br />
dass Sie beim Nachweis des Vorkommens<br />
bestimmter Pflanzenarten auf Ihrem<br />
Grünland dafür eine Honorierung erhalten,<br />
unabhängig der Bewirtschaftung. Ein<br />
anderes Beispiel dafür wäre, dass die<br />
Zahlungen an die Minderung des N-Saldos<br />
in der Hoftorbilanz geknüpft würde, aber die<br />
teilnehmenden Betriebe frei in der Wahl der<br />
Maßnahmen wären, die zur Erreichung<br />
definierter Standardwerte führen.)<br />
Abbildung 41: Bereitschaft von Landwirten zur Teilnahme an ergebnisorientierter Honorierung<br />
(Datenquelle: schriftliche Befragung (n=140) 2002 von Landwirten in Brandenburg, die an dem aktuellen<br />
Agrarumweltprogramm teilnehmen)<br />
Insgesamt kann für alle 16 Agrarumweltprogramme in Deutschland festgestellt werden, dass die<br />
Honorierung bisher fast ausschließlich an Maßnahmen geknüpft ist. Dabei bezieht sich ein<br />
großer Teil der Maßnahmen nicht einmal eindeutig auf Umweltziele (vgl. Kap. 7.2.2.4), stellt<br />
demnach keine Maßnahmen-Indikatoren dar (vgl. Kap. 6.2.1 und 6.3.1). Bezogen auf den
Aktuelle Anwendung im Rahmen der Agrarumwelt- und Artikel 16-Maßnahmen 197<br />
gesamten geschätzten Förderumfang der Fläche, auf der Agrarumweltmaßnahmen stattfinden,<br />
erfolgt eine ergebnisorientierte Honorierung in Deutschland lediglich auf knapp über 1 % der<br />
Förderfläche. Die aktuellen Agrarumweltprogramme sind damit eindeutig maßnahmenorientiert<br />
(Abbildung 42).<br />
Ergebnisorientierte<br />
Honorierung<br />
Abbildung 42: Typisierung der aktuellen Agrarumweltmaßnahmen (AUM) als ergebnisorientierte oder<br />
maßnahmenorientierte Honorierung<br />
7.2.3 Zusammenfassung und Schlussfolgerungen<br />
Die Analyse der bestehenden Agrarumweltmaßnahmen hat relativ großen Handlungsbedarf bzgl.<br />
der Ausgestaltung des Instrumentes der Honorierung ökologischer Leistungen aufgezeigt.<br />
Ursache dafür ist, dass mit der Verknappung der Umweltgüter ein institutioneller Wandel<br />
eingesetzt hat, der sich als ein komplexer Entwicklungsprozess darstellt. Die Honorierung<br />
ökologischer Leistungen ist Bestandteil dieses Prozesses. Der Tausch von Eigentumsrechten<br />
benötigt auf der einen Seite eine ex ante Verteilung der Eigentumsrechten, sind diese nicht<br />
vorhanden wird jedoch auf der anderen Seite auch in den Entwicklungsprozess eingegriffen und<br />
Eigentumsrechte werden nicht nur durchgesetzt, sondern auch geschaffen. Der institutionelle<br />
Rahmen dafür, inklusive der Organisationsstrukturen, muss sich erst entwickeln. Vom Ansatz<br />
her handelt es sich bei Agrarumweltmaßnahmen nach der VO (EG) 1257/1999 um eine<br />
Honorierung ökologischer Leistungen und nicht um eine Subvention. Allerdings ist die<br />
Zuordnung der aktuellen Agrarumweltmaßnahmen nicht zuletzt aufgrund des teilweise fehlenden<br />
Zielbezugs in der Praxis weit weniger eindeutig. Eine Subventionierung wird auch dadurch<br />
möglich, dass die Preisbildung bisher ausschließlich kostenorientiert erfolgt. Die Maßnahmen<br />
sind in vielen Fällen nicht auf konkrete Umweltziele ausgerichtet und wurden bisher<br />
überwiegend durch die Administration in wenig transparenter Weise definiert.<br />
Ergebnisorientierte Honorierung ist die Ausnahme und vom Flächenumfang bisher wenig<br />
bedeutsam.<br />
AUM<br />
Maßnahmenorientierte<br />
Honorierung
198 Kapitel 7<br />
Berücksichtigt werden sollte, dass die Honorierung ökologischer Leistungen erst seit ca. 10<br />
Jahren als Instrument zur Lösung von Umweltproblemen im Bereich der Landwirtschaft<br />
eingesetzt wird. Die Schaffung und/oder Durchsetzung von Eigentumsrechten mit Hilfe der<br />
Honorierung ökologischer Leistungen steckt noch in den ‚Kinderschuhen’.<br />
7.3 Ausgleich ordnungsrechtlicher Auflagen in Natura 2000-Gebieten im Rahmen des<br />
Artikel 16 der VO (EG) 1257/1999<br />
7.3.1 Überblick über aktuellen Anwendungsumfang<br />
Mit der Einführung der VO (EG) 1257/1999 im Jahre 2000 wird den EU-Mitgliedstaaten für den<br />
finanziellen Ausgleich von Einschränkungen durch ordnungsrechtliche Auflagen in Natura 2000-<br />
Gebieten eine Kofinanzierung gewährt. Prinzipiell ist das Instrument zumindest in Deutschland<br />
nicht neu. Vielmehr haben viele Bundesländer Regelungen zu so genannten Erschwernis- oder<br />
Härteausgleichszahlungen bereits in ihren Ländergesetzen aufgenommen. Im Anhang wird in<br />
Tabelle A-1 ein Überblick über derartige Landesregelungen gegeben. Ein derartiger ‚Vorlauf’<br />
könnte Grund dafür sein, dass die Artikel 16-Maßnahmen bisher ausschließlich in Deutschland<br />
umgesetzt worden sind (vgl. zur Umsetzung in Europa COM 2002c). Von den 16 Bundesländern<br />
wenden 7 Länder den Artikel 16 zum Ausgleich von Einkommenseinbußen durch<br />
ordnungsrechtliche Auflagen in Natura 2000-Gebieten an (Berichte zur Halbzeitbewertung der<br />
EPLR). Die Umsetzung des Artikels 16 in den 7 Bundesländern ist sehr unterschiedlich und<br />
damit ein gutes Spiegelbild für die möglichen Optionen, die sich hinter den Artikel 16-<br />
Maßnahmen verbergen. Prinzipiell kann zwischen zwei Formen der Umsetzung unterschieden<br />
werden: Erstens, Länder, die bereits vor Einführung von Artikel 16 so genannte Richtlinien zum<br />
Erschwernis- und Härteausgleich für die Einschränkung landwirtschaftlicher Tätigkeit in<br />
Naturschutz- und Landschaftsschutzgebieten eingeführt haben und diese jetzt im Sinne von<br />
Artikel 16-Maßnahmen anwenden und zweitens, Länder, die neue Maßnahmenrichtlinien<br />
erarbeitet haben.<br />
Die Einführung von Artikel 16 bot die Möglichkeit, sich die bisher freiwillig national gewährten<br />
Ausgleichszahlungen für Landwirte aufgrund ordnungsrechtlicher Auflagen in Schutzgebieten<br />
durch die EU kofinanzieren zu lassen, so lange diese den Anforderungen der Artikel 16-<br />
Maßnahmen entsprachen. Dazu zählte vor allen Dingen eine maximale Höhe der<br />
Ausgleichszulage von 200 € pro Hektar und dass die ordnungsrechtlichen Einschränkungen in<br />
Verbindung mit dem Natura 2000-Netz stehen müssen.
Aktuelle Anwendung im Rahmen der Agrarumwelt- und Artikel 16-Maßnahmen 199<br />
Niedersachsen hat in dieser Art Artikel 16-Maßnahmen eingeführt. Der Erschwernisausgleich in<br />
geschützten Teilen von Natur und Landschaft wurde in Niedersachsen bereits 1997 als<br />
rechtsverbindliches Instrument geschaffen (Grundlage: §§ 50 bis 52 NNatSchG), um Landwirten<br />
einen Ausgleich für hoheitliche Bewirtschaftungseinschränkungen von Grünland in<br />
Naturschutzgebieten, Nationalparken oder auf Flächen in besonders geschützten Biotopen nach<br />
§ 28a,b NNatSchG zu gewähren. Häufige Einschränkungen der landwirtschaftlichen<br />
Bodennutzung in Naturschutzgebieten sind z. B. Verbot des Grünlandumbruchs oder der<br />
Grünlanderneuerung, Verzicht auf Pflanzenschutzmitteleinsatz und Düngung, Verbot einer<br />
Veränderung des Wasserhaushalts oder auch Viehbesatzregelungen (Sander 2003). Der<br />
Förderumfang hält sich in Niedersachsen bereits seit Einführung des Erschwernisausgleiches<br />
1997 mit ca. 15.000 ha Grünland relativ konstant. An dieser Größenordnung hat sich auch nach<br />
Einführung von Artikel 16-Förderungen nichts geändert (Sander 2003).<br />
Neben dieser Möglichkeit, bereits bestehende Verordnungen zur Ausgleichszahlung unter<br />
Rückgriff auf Artikel 16 umzusetzen, haben sechs Länder in Deutschland neue Richtlinien für<br />
die Umsetzung von Artikel 16-Maßnahmen formuliert. Dabei handelt es sich um Brandenburg,<br />
Thüringen, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein, Hamburg und Bremen.<br />
Die konkrete Ausgestaltung unterscheidet sich jedoch stark voneinander. Brandenburg hat einen<br />
Katalog mit konkreten Maßnahmen aufgelegt (Tabelle 10), für die im Fall bestehender<br />
ordnungsrechtlicher Auflagen ein Ausgleich gezahlt wird. Dabei wurde sich stark an den<br />
Agrarumweltmaßnahmen des KULAP (vgl. zu den AUM von Brandenburg Tabelle A-6 im<br />
Anhang) orientiert. In den Jahren 2001 und 2002 wurden Artikel 16-Maßnahmen in Höhe von<br />
ca. 1,4 Mio. € bzw. 1.8 Mio. € finanziert. stellt den Förderumfang für Brandenburg im Überblick<br />
dar. Dabei wird deutlich, dass auch bei den Artikel 16-Maßnahmen die ‚klassische’<br />
Grünlandextensivierungsmaßnahme mit Abstand die größte Bedeutung hat. Im Jahre 2002 waren<br />
von der landwirtschaftlichen Fläche der bis dahin gemeldeten Natura 2000-Flächen in<br />
Brandenburg 8 % mit Artikel 16-Maßnahmen belegt. Wie sich das Verhältnis des Förderumfangs<br />
von Artikel 16 im Vergleich zur Förderung der Agrarumweltmaßnahmen in Natura 2000-<br />
Gebieten verteilt, ist für das Jahr 2002 für Brandenburg in Abbildung 43 dargestellt.
200 Kapitel 7<br />
Tabelle 10: Art und Anwendungsumfang von Artikel 16-Maßnahmen in Brandenburg<br />
(Wirtschaftsjahre 2000/2001 und 2001/2002 )<br />
Maßnahme<br />
geförderte Fläche (ha) geförderte Anträge (Anzahl)<br />
2000/01 2001/02 2000/01 2001/02<br />
extensive Grünlandnutzung 8.327 9.674 181 230<br />
späte, eingeschränkte<br />
Grünlandnutzung<br />
904 1.573 26 40<br />
hohe Wasserhaltung 8 35 1 2<br />
Pflege durch Beweidung 105 1.145 1 4<br />
extensive Ackernutzung 128 109 19 25<br />
insgesamt 9.472 12.536 228 301<br />
Quelle: Laschewski & Schleyer 2003<br />
1.339.000<br />
Landwirtschaftliche Nutzfläche und deren Förderung<br />
in Natura 2000-Gebieten in Brandenburg (2002)<br />
10,5%<br />
140.000<br />
LN gesamt LN in Natura 2000<br />
davon<br />
Abbildung 43: Förderumfang von Artikel 16- und Agrarumweltmaßnahmen an der landwirtschaftlichen<br />
Nutzfläche in Natura 2000-Gebieten in Brandenburg (eigene Darstellung, Datenquelle: MLUR 2003b)<br />
Die übrigen Länder haben weniger differenzierte Maßnahmen. Bremen und Thüringen haben<br />
ihre Artikel 16-Richtlinie so konzipiert, dass die allgemeinen Auflagen anhand konkreter<br />
Bewirtschaftungsauflagen nach einem Punktsystem (Bremen) oder den konkret ermittelten<br />
Einkommensverlusten (Thüringen) konkretisiert werden. Thüringen hat darüber hinaus<br />
pauschale Grünlandprämien in Natura 2000-Gebieten. In Form von derartigen<br />
Grünlandpauschalen wird ebenfalls in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen der Artikel<br />
16 angewendet. Die Ausgleichszulage ist bei den Grünlandpauschalen damit begründet<br />
8%<br />
37%<br />
Art. 16 AUM
Aktuelle Anwendung im Rahmen der Agrarumwelt- und Artikel 16-Maßnahmen 201<br />
(Fördervoraussetzung), dass in den Schutzgebieten generell die Auflage des Grünlanderhaltes<br />
und des Verbotes von bestimmten Meliorationsmaßnahmen besteht. Abbildung 44 stellt die<br />
aktuelle Art und Weise der Anwendung von Artikel 16-Maßnahmen in Deutschland dar. Tabelle<br />
A-7 im Anhang zeigt den aktuellen Förderumfang von Artikel 16-Maßnahmen in Deutschland.<br />
Da lediglich in Deutschland bis 2003 Artikel 16-Maßnahmen angewendet wurden, ist damit<br />
gleichzeitig der Förderumfang für die EU benannt.<br />
Umsetzung von Art. 16 in Deutschland<br />
9<br />
Abbildung 44: Anwendung von Artikel 16-Maßnahmen in Deutschland (Stand 2003)<br />
Da die Mitgliedstaaten die Möglichkeit haben, nach Artikel 10 der FFH-Richtlinie, auch so<br />
genannte Trittsteinbiotope im Zusammenhang mit dem Ziel der Kohärenz des Natura 2000-<br />
Netzes zu fördern, ist die Pflege von Landschaftselementen, die diesem Ziel dienen, ebenfalls<br />
förderfähig. Davon haben einige Bundesländer wie Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen<br />
und Niedersachsen Gebrauch gemacht. Die Länder wenden Ausgleichszahlungen nach Artikel<br />
16 auch für ordnungsrechtliche Auflagen im Grünland für bestimmte geschützte Biotope bzw. in<br />
Naturschutzgebieten außerhalb von Natura 2000-Gebieten unter Rückgriff auf Artikel 10 FFH-<br />
Richtlinie an.<br />
1<br />
Länder, die Artikel 16-Maßnahmen nicht anwenden<br />
6<br />
- Niedersachsen<br />
- Brandenburg<br />
- Thüringen<br />
- Nordrhein-Westfalen<br />
- Schleswig-Holstein<br />
- Bremen<br />
- Hamburg<br />
Länder, die Artikel 16-Maßnahmen anwenden (ohne spez. Richtlinie)<br />
Länder, die Artikel 16-Maßnahmen anwenden (spez. Richtlinie)
202 Kapitel 7<br />
7.3.2 Analyse der aktuellen Artikel 16-Maßnahmen<br />
7.3.2.1 Ansatz und Methode<br />
Im folgenden Kapitel werden die aktuell angewendeten Artikel 16-Maßnahmen systematisch<br />
analysiert. Kriterien dieser Systematisierung sind die gleichen wie für die<br />
Agrarumweltmaßnahmen (vgl. Kap. 7.2.2.1): die Betrachtungen zur Verteilung der<br />
Eigentumsrechte (Kap. 7.3.2.2), die Ermittlung des Preises für die Honorierung (Kap. 7.3.2.3),<br />
ihr Zielbezug (Kap. 7.3.2.4), der Prozess der Entwicklung (Kap. 7.3.2.5) sowie die Indikatorenart<br />
(Kap. 7.3.2.6).<br />
Mit Hilfe der Kriterien und vorhandener Literatur erfolgt eine kritische Diskussion der aktuellen<br />
Artikel 16-Maßnahmen. Datengrundlage bilden die aktuellen Rechtsgrundlagen sowie die<br />
Planungsdokumente der 16 Bundesländer. Darüber hinaus wird die Analyse durch Daten, die im<br />
Rahmen der Halbzeitbewertung der Brandenburger Artikel 16-Maßnahmen erhoben wurden,<br />
untermauert.<br />
7.3.2.2 Zahlungstyp – Honorierung oder Subvention<br />
Voraussetzung für die Zahlungen nach Artikel 16 sind ordnungsrechtliche Auflagen in Natura-<br />
2000-Gebieten in Form von Rechtsverordnungen. Rückblickend auf die Diskussion zur<br />
Eigentumsdogmatik in Kapitel 5.6.2.2 kann festgestellt werden, dass ordnungsrechtliche<br />
Auflagen bzgl. der landwirtschaftlichen Nutzung aufgrund von Naturschutzzielen in der Regel<br />
nicht ausgleichspflichtig sind. Die Einhaltung dieses Ordnungsrechtes wird als<br />
Sozialpflichtigkeit bzw. Ökologiepflichtigkeit von den Landwirten in der Regel<br />
entschädigungslos verlangt, „soweit durch die Norm keine Wettbewerbsverzerrungen<br />
erheblichen Ausmaßes eintreten. Letztlich erfolgt die Steuerung und die Abpufferung der Folgen<br />
über Art. 12 GG und den Gleichheitssatz. Es gilt das ‚Gebot schonender Übergänge’“ 117<br />
(Czybulka 2002: 107). Die Situationsgebundenheit des Eigentums erlaubt eine situations- bzw.<br />
standortabhängige Formulierung von Inhalts- und Schrankenbestimmungen (vgl. Kap. 5.6.2.1)<br />
und demnach die Schaffung von Gemeineigentum. Die Gesellschaft kann jedoch je nach<br />
Finanzlage entscheiden, den Landwirten eine Ausgleichzahlungen politisch zu gewähren (vgl.<br />
Distributionskriterium ‚Erschwernis-/Härteausgleich’ in Kap. 5.6.2.1).<br />
117 Kube, H. (1999): Eigentum an Naturgütern: Zuordnung und Unverfügbarkeit, zitiert in Czybulka (2002)
Aktuelle Anwendung im Rahmen der Agrarumwelt- und Artikel 16-Maßnahmen 203<br />
Im Falle der aktuellen Artikel 16-Zahlungen handelt es sich um eine derartige politisch gebilligte<br />
Zahlung und damit nach der Systematik in Kapitel 5.6.2.2 um eine Subvention (vgl. Abbildung<br />
15). Der Charakter der Zahlung, die hinter Artikel 16 steht, wird nicht zuletzt anhand der<br />
Bewertungskriterien (Bewertungsfragen) deutlich, die die EU im Rahmen der Halbzeitbewertung<br />
der Artikel 16-Maßnahmen vorgeschlagen hat. Bewertet werden sollen nicht etwa die Produktion<br />
ökologischer Güter (Umweltwirkung), sondern der Ausgleich der Einkommensverluste der<br />
Landwirte und die Verbesserung der Einhaltung von Ordnungsrecht durch diese Zahlungen<br />
(COM 2000b). Dabei wird von Seiten der EU keine 100 %-Kompensation angestrebt und eine<br />
Überkompensation untersagt.<br />
Es handelt sich bei Artikel 16-Maßnahmen primär um Anreizinstrumente für die<br />
Konfliktbewältigung zwischen Landwirtschaft und Naturschutz bzw. für die Förderung der<br />
Akzeptanz der Landwirte für europäisches Umweltrecht im Zuge des Natura 2000-Netzes<br />
(finanziell erkaufte Akzeptanz von Gemeineigentum). Nur vor diesem Hintergrund ist auch die<br />
Deckelung der Prämienhöhe für Artikel 16-Maßnahmen von 200 € zu erklären (vgl. Kap.<br />
7.3.2.3). Artikel 16-Maßnahmen stellen jedoch ebenfalls Maßnahmen zur Abfederung der<br />
Auswirkungen aufgrund des institutionellen Wandels dar. Auch die OECD sieht in derartigen<br />
Phasen Subventionen als ein kurzzeitig gerechtfertigtes Instrument an, das dem<br />
Verursacherprinzip nicht widerspricht (vgl. OECD 1999c). Diese Abfederungsfunktion von<br />
Artikel 16-Maßnahmen ist anhand der aktuellen Prämienausgestaltung nachzuvollziehen. Ab<br />
2004 ist in der Initialphase der Anwendung von Artikel 16 eine Zahlung von bis zu 500 €<br />
möglich (vgl. FN 104). Einerseits eröffnen derartige Zahlungen die Möglichkeit, Konflikte<br />
zwischen Landwirtschaft und Naturschutz zu lindern, auf der anderen Seite besteht das Problem,<br />
dass damit eine Art Anspruch auf Entschädigung für eigentlich sozialpflichtige Leistungen<br />
erwachsen kann. Dieses Problem wurde im Zusammenhang mit cross compliance-Maßnahmen<br />
bereits in Kapitel 7.1.4.3 diskutiert.<br />
Im Zusammenhang mit den Natura 2000-Gebieten und deren Zielsetzung muss der Umgang mit<br />
Eigentumsrechten an individuellen Fähigkeiten (vgl. zur Unterscheidung zu ökosystemaren<br />
Fähigkeiten Kap. 4.1) diskutiert werden, deren Einsatz für den Erhalt einiger Lebensraumtypen<br />
nach Anhang I und Arten nach Anhang II Voraussetzung ist. Es wurde in Kapitel 5.6.2.2 bereits<br />
darauf hingewiesen, dass Gebote, die den Einsatz individueller Fähigkeiten verlangen, nur in<br />
Ausnahmefällen stattfinden sollten.<br />
Aufgrund der gesellschaftlich anerkannten Bedeutung und Gefährdung der biologischen Vielfalt<br />
kann die Verpflichtung zur Erhaltung der wertvollen Habitate und Arten der Kulturlandschaft als
204 Kapitel 7<br />
eine mögliche Ausnahme definiert werden, und de facto ist dies auch mit der Verpflichtung der<br />
EU-Staaten zum Erhalt der kulturbestimmten Lebensraumtypen und Arten passiert. Die<br />
Umsetzung der FFH-Richtlinie verlangt die Sicherstellung der Pflege bestimmter<br />
Lebensraumtypen, wie den Grünlandtypen (vgl. Kap. 8.2). Derartige Pflichten können<br />
‚freiwillig’ erfolgen und im Rahmen von Agrarumweltmaßnahmen honoriert werden. Die<br />
Pflichten können und müssen jedoch bei nicht ‚freiwilliger’ Teilnahme an<br />
Agrarumweltmaßnahmen ordnungsrechtlich vorgeschrieben werden. Allerdings spricht viel<br />
dafür, dass derartige Auflagen eher ausgleichspflichtigen Inhaltsbestimmungen des Eigentums<br />
zuzuordnen sind (vgl. Kap. 5.6.2.1, Abbildung 14) und nach der Argumentation innerhalb dieser<br />
Arbeit damit eine Honorierung ökologischer Leistungen darstellen (vgl. Kap. 5.6.2.2). Derartige<br />
Zahlungen wären dann verpflichtend und würden nicht der politischen Abwägung unterliegen.<br />
Artikel 16 wird aktuell nicht in dieser Form angewendet. Insgesamt setzten die Bundesländer<br />
überwiegend auf freiwillige AUM. Es wird sich zeigen, ob und wenn ja, wie die Länder damit<br />
umgehen, wenn das Freiwilligkeitsprinzip versagt.<br />
Die aktuelle Anwendung von Artikel 16 beschränkt sich bis auf eine Ausnahme in<br />
Brandenburg 118 auf Ausgleichszahlungen für ordnungsrechtliche Verbote bestimmter<br />
landwirtschaftlicher Handlungen. Die aktuellen Artikel 16-Zahlungen werden vor diesem<br />
Hintergrund überwiegend den Subventionen zugeordnet (vgl. Abbildung 45), wobei ausdrücklich<br />
auf die Möglichkeit ausgleichspflichtiger Inhaltsbestimmungen und deren Honorierung über<br />
Artikel 16 hingewiesen werden soll.<br />
Subvention<br />
Art.<br />
16<br />
Honorierung<br />
Abbildung 45: Typisierung der aktuellen Artikel 16-Maßnahmen (Art. 16) als Subvention oder Honorierung<br />
auf der Grundlage der Verteilung der Eigentumsrechte (Subvention = Eigentumsrechte nicht beim<br />
Leistungserbringer; Honorierung = Eigentumsrechte beim Leistungserbringer)<br />
118 Bis zum Jahr 2002 war die Maßnahme Pflege durch Beweidung im Katalog der Artikel 16-Maßnahmen.<br />
Aufgrund der Probleme, die mit der Festschreibung von Pflegeverpflichtungen in Schutzgebietsverordnungen<br />
verbunden sind, und der geringen Bedeutung (vgl. Tabelle 10) wurde die Maßnahme ab 2003 aus dem Katalog<br />
gestrichen und über freiwillige Agrarumweltmaßnahmen honoriert.
Aktuelle Anwendung im Rahmen der Agrarumwelt- und Artikel 16-Maßnahmen 205<br />
7.3.2.3 Preistyp – Kosten oder Nutzen<br />
Im Zusammenhang mit der Diskussion zu den Eigentumsrechten im vorangegangenen Kapitel<br />
wurde bereits gezeigt, dass es sich bei Artikel 16-Zahlungen nicht um eine Honorierung für eine<br />
konkrete Leistung, sondern um ein Anreizinstrument handelt. Von daher wird hierbei auch nicht<br />
der Preis einer Leistung ermittelt. Bei der Ermittlung der Anreizhöhe erfolgt zwar eine<br />
Orientierung an den Kosten, die durch ordnungsrechtliche Auflagen bei den Landwirten<br />
entstehen, jedoch lediglich in dem Sinne, dass in jedem Fall keine Überkompensation stattfinden<br />
darf. Insgesamt darf der Anreiz 200 € pro Hektar und Jahr nicht überschreiten (Ausnahme vgl.<br />
FN 104).<br />
7.3.2.4 Strategietyp – Umweltzielorientierte Strategie oder Minimierungsstrategie<br />
Die ordnungsrechtlichen Auflagen in Schutzgebietsverordnungen gehen aus Zielsetzungen der<br />
Schutzgebietsverordnungen hervor. Die verpflichtenden Maßnahmen sollten sich daher auf<br />
konkrete regionalisierte Umweltziele der Gebiete beziehen und können damit prinzipiell einer<br />
umweltzielorientierten Strategie zugeordnet werden (vgl. Abbildung 46). Als Problem im<br />
Zusammenhang mit der Zielorientierung ist zu sehen, dass es sich bei den<br />
Schutzgebietsverordnungen bisher fast ausschließlich um bereits bestehendes Recht handelte.<br />
Die Verordnungen wurden demnach unabhängig von der konkreten FFH-Zielsetzung aufgestellt.<br />
Vor diesem Hintergrund ist zu prüfen, ob die aktuellen Auflagen auch auf die Zielsetzung der<br />
FFH-Richtlinie ausgerichtet sind, also als ‚Maßnahmen-Indikatoren’ den Anspruch an ‚Validität’<br />
bzgl. der aktuellen Ziele erfüllen.<br />
Minimierungsstrategie <br />
Umweltzielorientierte<br />
Strategie<br />
Abbildung 46: Typisierung der aktuellen Artikel 16-Maßnahmen (Art. 16) im Hinblick auf ihren Zielbezug<br />
Art.<br />
16
206 Kapitel 7<br />
7.3.2.5 Rationalisierungstyp – Top down- oder Bottom up-Prozess<br />
Die Ausgleichzahlungen von Artikel 16 beziehen sich auf Einschränkungen aufgrund der<br />
Umsetzung von europäischem Ordnungsrecht und dabei im Speziellen der FFH-Richtlinie. Die<br />
Operationalisierung der wertvollen Habitate und Arten erfolgte durch Expertenwissen und die<br />
jeweiligen Fachbehörden auf europäischer Ebene (vgl. dazu auch Kap. 8.2.1.2). Auf dieser<br />
Grundlage wurden die relevanten Arten der Anhänge II und IV sowie die Lebensraumtypen nach<br />
Anhang I der FFH-Richtlinie festgelegt sowie die Lebensraumtypen in einem Handbuch<br />
beschrieben (vgl. COM 1999b). Dies war die Basis für weitere Spezifizierungen auf nationaler<br />
(für Deutschland vgl. Ssymank et al. 1998) bis hin zur regionalen Ebene (z. B. für Brandenburg<br />
vgl. Beutler & Beutler 2002). Mit den Zielen wurden gleichzeitig Vorschläge für Maßnahmen<br />
zum Erhalt der Lebensraumtypen erarbeitet. Betrachtet man die wertvollen Habitate und Arten<br />
als ökologische Güter, wurde deren Knappheit in einem klassischen Top down-Verfahren<br />
‚ermittelt’. Dies war aufgrund der gesellschaftlich ermittelten Nachfrage nach dem Erhalt<br />
gefährdeter Arten und Lebensräume möglich. Dadurch lag ein indirekt operationalisiertes<br />
Umweltziel vor (vgl. Abbildung 24) und konnte im nächsten Schritt aufgrund<br />
naturschutzfachlicher Kriterien konkretisiert werden. Dass bei der Spezifizierung des<br />
ökologischen Gutes wenig Spielraum 119 im Sinne normativer Entscheidungen besteht, wird nicht<br />
zuletzt durch die klaren Vorgaben der Gebietsauswahl nach ausschließlich naturschutzfachlichen<br />
Kriterien (vgl. Art. 4 FFH-Richtlinie) deutlich 120 .<br />
Dies bezieht sich jedoch ausschließlich auf die Rationalisierung des Umweltgutes mit Hilfe von<br />
Zustands-Indikatoren. Bei der Wahl der Mittel und den konkreten Maßnahmen (Maßnahmen-<br />
Indikatoren) muss mit dem Problem der Unsicherheit umgegangen werden. Der Gesetzgeber<br />
(EU) hat wohl nicht nur aufgrund des Prinzips der Verhältnismäßigkeit, sondern auch aufgrund<br />
der Unsicherheit im Umgang mit ökologischen Systemen bei der Wahl der Maßnahmen zur<br />
Erreichung der Ziele eindeutig Spielräume eingeräumt und dabei auch verlangt, soziale und<br />
ökonomische Kriterien mit in die Entscheidungsfindung einzubinden (vgl. Art. 2 (3) FFH-<br />
Richtlinie sowie COM 2000c).<br />
Die Vorgaben der EU bzgl. der Wahl der geeigneten Maßnahmen zum Erreichen der Natura<br />
2000-Ziele werden bisher im Zusammenhang mit den drei im Gesetz aufgeführten Alternativen<br />
119<br />
Es ist klar, dass in einem gewissen Maß immer normative Entscheidungen getroffen werden müssen (vgl. Kap.<br />
6.3.5.2).<br />
120<br />
Dies wurde auch mehrfach in der Rechtssprechung hervorgehoben, vgl. z. B. Lappel Bank-Urteil des<br />
Europäischen Gerichtshofes vom 11. Juli 1996 – weiterführend siehe Kap. 8.2.1.3.
Aktuelle Anwendung im Rahmen der Agrarumwelt- und Artikel 16-Maßnahmen 207<br />
diskutiert (vgl. COM 2000c, aber auch die Diskussion im politischen Raum 121 ). Den Ländern<br />
steht offen, ob sie geeignete rechtliche, administrative und/oder vertragliche Maßnahmen zur<br />
Zielerreichung nutzen (Art. 6 FFH-Richtlinie). Es wird ausdrücklich auf die Möglichkeit der<br />
Kombination der Maßnahmen verwiesen (COM 2000c). Die konkrete Ausgestaltung der<br />
Maßnahmen und vor allen Dingen die mögliche institutionalisierte Beteiligung der Betroffenen<br />
im Prozess der Maßnahmendefinition wird jedoch bisher zu wenig diskutiert.<br />
Die Ergebnisse einer Befragung von 15 Betrieben in Brandenburg, die einen Ausgleich über<br />
Artikel 16 erhalten, weisen darauf hin, dass sich die Mehrheit der Betriebe nicht genügend<br />
informiert und in den Prozess eingebunden fühlt (vgl. Tabelle 11).<br />
Tabelle 11: Information und Beteiligung der Landwirte im Rahmen der Natura 2000-Gebietsmeldung<br />
Ergebnisse einer schriftlichen Befragung (2002) von Brandenburger landwirtschaftlichen Betrieben (n = 15), die<br />
einen Ausgleich über Artikel 16 erhalten<br />
Frage<br />
Antwortalternativen<br />
Wurden Sie rechtzeitig und umfassend über das Verfahren zur Ausweisung<br />
(Festlegung der Schutzziele, Ausgestaltung der Schutzauflagen und<br />
Ausgleichszahlungen) von Natura 2000-Schutzgebieten auf Ihren Betriebsflächen<br />
informiert?<br />
wurde<br />
rechtzeitig und<br />
umfassend<br />
informiert<br />
wurde nur<br />
unvollständig<br />
informiert<br />
wurde<br />
überhaupt nicht<br />
informiert<br />
weiß nicht keine Angabe<br />
Nennungen 2 6 1 2 4<br />
Frage<br />
Antwortalternativen<br />
Sind Sie der Meinung, dass Sie angemessen in das Verfahren zur Ausweisung von<br />
Natura 2000-Schutzgebieten auf Ihren Betriebsflächen einbezogen wurden?<br />
ja, wurde<br />
angemessen<br />
einbezogen<br />
wurde nur<br />
ungenügend<br />
einbezogen<br />
nein, wurde<br />
überhaupt nicht<br />
einbezogen<br />
weiß nicht keine Angabe<br />
Nennungen 1 6 1 0 7<br />
Quelle: Laschewski & Schleyer 2003<br />
121 Alle Bundesländer behandeln das Thema Natura 2000 auf ihren Internetseiten relativ ausführlich. Die Position<br />
des Bundeslandes Brandenburg kann stellvertretend für die Bundesländer gewertet werden: „Oberste Prämisse für<br />
die Auswahl der unterschiedlichen Instrumente ist, dass bei der Erhaltung der Gebiete das naturschutzfachlich<br />
geeignete und für die Betroffenen am geringsten belastende Mittel eingesetzt wird“ (MLUR unter<br />
http://www.mlur.brandenburg.de/n/n_siche3.htm, 13.07.2004)
208 Kapitel 7<br />
In der ersten Tranche wurden bestehende Schutzgebiete gemeldet, die den Kriterien der FFH-<br />
Richtlinie entsprechen. Die aktuellen Zahlungen im Rahmen des Artikels 16 haben im<br />
Wesentlichen alte Verordnungen als Grundlage. Länder, die Ausgleichszahlungen nach Artikel<br />
16 zahlen wollen, mussten die Maßnahmen derart formulieren, dass diese die Tatbestände der<br />
Ge- und Verbote dieser Schutzgebietsverordnungen treffen.<br />
Erst im Zuge neuer Schutzgebietsverordnungen (zweite und dritte Tranche bzw. Änderung der<br />
bestehenden Verordnungen) kann bereits im Zuge der Konzeption bewusst mit der Möglichkeit<br />
der Ausgleichszahlungen operiert werden. Allerdings ist es prinzipiell schwierig, konkrete<br />
Bewirtschaftungsmaßnahmen mit einem starren Instrument wie dem Ordnungsrecht festzulegen.<br />
In Brandenburg sollen daher z. B. behördenverbindliche Bewirtschaftungserlasse anstelle der<br />
Schutzgebietsverordnungen als flexibleres (und weniger rigides) Instrument zum Einsatz<br />
kommen. Im Zuge der Aufstellung der Bewirtschaftungserlasse soll es zu einer Information und<br />
Anhörung der betroffenen Landwirte kommen. Ob mit diesem ‚weichen’ Instrument tatsächlich<br />
ein dauerhafter Schutz und eine Entwicklung der Natura 2000-Gebiete möglich ist, wird die<br />
Praxis zeigen 122 . Die Maßnahmen, die auf der Grundlage des Bewirtschaftungserlasses definiert<br />
werden, sind keine ordnungsrechtlichen Auflagen und damit nicht über Artikel 16 zu<br />
finanzieren. Hier greifen lediglich freiwillige Instrumente wie Agrarumweltmaßnahmen.<br />
Es kann sowohl für die Rationalisierung der Ziele über Zustands-Indikatoren als auch für die<br />
aktuelle Definition der Maßnahmen zur Erreichung der Ziele für Artikel 16 zusammengefasst<br />
werden, dass diese durch Experten und die Administration top down erfolgten (Abbildung 47).<br />
Top-down<br />
Indikatorenentwicklung<br />
Art.<br />
16<br />
Buttom-up<br />
Indikatorenentwicklung<br />
Abbildung 47: Typisierung der aktuellen Artikel 16-Maßnahmen (Art. 16) im Hinblick auf den Prozess der<br />
Indikatorenentwicklung (der konkreten Fördervoraussetzungen)<br />
122 Derartige Erlasse werden nach Information des LUA einheitlich aufgebaut sein und enthalten die konkreten Ziele<br />
sowie die Instrumente (keine ordnungsrechtlichen Auflagen) für die einzelnen Gebiete.
Aktuelle Anwendung im Rahmen der Agrarumwelt- und Artikel 16-Maßnahmen 209<br />
7.3.2.6 Indikatorentyp – Ergebnis- oder maßnahmenorientierte Honorierung<br />
Bei der Ausgleichszahlung nach Artikel 16 wird ausschließlich maßnahmenorientiert honoriert<br />
(Abbildung 48). Dies wird, noch mehr als bei den Agrarumweltmaßnahmen, durch die<br />
politischen Rahmenbedingungen forciert (vgl. Kap. 7.1.1). Die Zahlungshöhe muss sich nach<br />
den entstehenden Kosten/dem Ertragsausfall der Landwirte richten. Anreize sind nicht erlaubt<br />
(vgl. Kap. 7.1.2.2). Der Typus der Zahlung forciert damit im aktuellen Verständnis und den<br />
aktuellen Ansätzen von Honorierungsinstrumenten geradezu eine maßnahmenorientierte<br />
Honorierung. Hinzu kommt, dass in Schutzgebietsverordnungen die durchschlagende<br />
Rechtsverbindlichkeit über Ge- und Verbote ebenfalls maßnahmen- bzw. handlungsorientiert<br />
formuliert ist. Wenn die Notwendigkeit der ordnungsrechtlichen Auflagen als Voraussetzung für<br />
Zahlungen nach Artikel 16 eng interpretiert wird und ausschließlich konkrete Ge- und Verbote<br />
diesen Tatbestand erfüllen, ist es aktuell schwierig, eine Zahlung allein aufgrund eines<br />
vorkommenden kulturbestimmten Lebensraumtypus zu gewähren (vgl. jedoch Argumentation in<br />
Kap. 8.2.1.5).<br />
Ergebnisorientierte<br />
Honorierung<br />
Abbildung 48: Typisierung der aktuellen Artikel 16-Maßnahmen (Art. 16) als ergebnisorientierte oder<br />
maßnahmenorientierte ‚Honorierung’<br />
7.3.3 Zusammenfassung und Schlussfolgerungen<br />
Neben den Honorierungen für ökologische Leistungen auf freiwilliger Basis über<br />
Agrarumweltmaßnahmen wurden ab dem Jahr 2000 zunehmend, aufgrund der Kofinanzierung<br />
durch die EU im Rahmen des Artikel 16 VO (EG) 1257/1999, die so genannten Erschwernis-<br />
oder Härtezahlungen in Deutschland flächenrelevant. Diese Zahlungen sollen die Umsetzung des<br />
Natura 2000-Netzes unterstützen. Dabei handelt es sich um ein neues Instrument, bei dem<br />
allerdings auf langjährige Erfahrungen (sowie im Rahmen der Eigentumsdogmatik intensiv<br />
diskutierte Probleme) im Umgang mit Härte- und Erschwernisausgleichszahlungen aufgebaut<br />
werden kann.<br />
Art.<br />
16<br />
Maßnahmenorientierte<br />
Honorierung
210 Kapitel 7<br />
Die Analyse der aktuellen Zahlungen haben gezeigt, dass es sich, ausgehend von der Verteilung<br />
der Eigentumsrechte, um Subventionen handelt. Es stellt sich jedoch die Frage, inwieweit Artikel<br />
16-Maßnahmen nicht auch den Tatbestand abdecken, bei dem die Eigentumsrechte (nämlich die<br />
an den individuellen Fähigkeiten) bei den Landwirten liegen, deren Bereitstellung jedoch für die<br />
Produktion der ökologischen Güter (kulturbestimmte Lebensraumtypen nach Anhang I und<br />
Arten nach Anhang II) verpflichtend notwendig ist. In diesem Fall wären Artikel 16-Maßnahmen<br />
eine Honorierung. Die Gesellschaft verpflichtet den Landwirt zum Einsatz der individuellen<br />
Fähigkeiten und wäre selbst verpflichtet, diese Leistung zu honorieren. Artikel 16 in dieser Art<br />
und Weise auszubauen, also nicht allein die Kofinanzierung von Erschwernis- und<br />
Härteausgleich, sondern auch die Kofinanzierung von ausgleichspflichtigen<br />
Inhaltsbestimmungen 123 könnte das Spektrum der möglichen Umsetzungsmaßnahmen sinnvoll<br />
erweitern (vgl. auch Kap. 8.2.1). Dies würde die Planungssicherheit der Landwirte und die<br />
Akzeptanz für Natura 2000-Gebiete verbessern. Eine Ausweitung der ausgleichspflichtigen<br />
Inhaltsbestimmungen auf derartige Pflegeverpflichtungen steht allerdings noch aus (vgl. Kap.<br />
8.2.1.5).<br />
Positiv, gerade im Vergleich zu den Agrarumweltmaßnahmen, ist bei Artikel 16-Maßnahmen zu<br />
werten, dass die Ziele, auf die sich die Maßnahmen beziehen, klar definiert sind und damit die<br />
Effektivität (Validität gegenüber Umweltzielen) evaluiert werden kann. Die Ableitung der<br />
Indikatoren, an die die Zahlungen geknüpft sind, erfolgte bisher top down. Dabei werden<br />
ausschließlich Maßnahmen-Indikatoren verwendet. Die mögliche Flexibilität im Bereich der<br />
Maßnahmen bei verpflichtend definierten Zielen lässt eine ergebnisorientierte Honorierung hier<br />
besonders interessant erscheinen.<br />
123 hier immer als verpflichtender Einsatz individueller Fähigkeiten verstanden
Beispiele für ergebnisorientierte Honorierungsansätze 211<br />
8 Beispiele für ergebnisorientierte Honorierungsansätze<br />
Es werden zwei aktuelle Anwendungsbereiche diskutiert, die für eine ergebnisorientierte<br />
Honorierung ökologischer Leistungen der Landwirtschaft besonders interessant sind. Dabei wird<br />
zum einen dargelegt, warum ergebnisorientierte Honorierung sich in diesen Fällen besonders<br />
eignet und zum anderen wird beispielhaft aufgezeigt, wie auf der Grundlage der jeweiligen<br />
Rahmenbedingungen und der bereits vorhandenen Datenlage Indikatoren für eine<br />
ergebnisorientierte Honorierung abgeleitet und mit Zahlungen verbunden werden können.<br />
8.1 Ergebnisorientierte Honorierung im Rahmen von Agrarumweltmaßnahmen zur<br />
Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie<br />
8.1.1 Rahmenbedingungen – Voraussetzungen für ergebnisorientierte Honorierung<br />
Das europäische Parlament und der Rat haben am 23.10.2000 die ‚Richtlinie 2000/60/EG zur<br />
Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der<br />
Wasserpolitik’, kurz Wasserrahmenrichtlinie (WRRL), verabschiedet. Durch die Wasserrahmen-<br />
richtlinie wird die Wasser- und Gewässerschutzpolitik in Europa neu ausgerichtet. In<br />
Deutschland hat der Bund die EU-Richtlinie für seinen Zuständigkeitsbereich durch die<br />
Änderung des Wasserhaushaltsgesetzes vom 19. August 2002 in nationales Recht umgesetzt. Die<br />
weiteren Umsetzungsschritte obliegen jedoch den Bundesländern.<br />
Ziel der Richtlinie ist es, europaweit die Qualität der Oberflächengewässer und des<br />
Grundwassers deutlich zu verbessern. Alle Mitgliedsländer sollen bis zum Jahr 2015 mindestens<br />
einen ‚guten Zustand’ in allen oberirdischen Gewässern und im Grundwasser erreichen 124 .<br />
Die Aufgaben nach In-Kraft-Treten der Wasserrahmenrichtlinie gliedern sich in vier wesentliche<br />
Bereiche, die innerhalb der ersten 9 Jahre stufenweise zu realisieren sind (vgl. LAWA 2003):<br />
• die Bestandsaufnahme der Gewässersituation innerhalb der Flussgebietseinheit in<br />
wasserwirtschaftlicher, ökologischer und ökonomischer Hinsicht,<br />
• Überwachung des Zustandes der Gewässer,<br />
• die Konkretisierung der in der Flussgebietseinheit zu erreichenden Ziele hinsichtlich des<br />
Zustandes der Gewässer,<br />
124 Die Verlängerung der Frist ist unter bestimmten Voraussetzungen möglich.
212 Kapitel 8<br />
• die Festlegung der zum Erreichen dieser Ziele notwendigen Maßnahmen bzw.<br />
Maßnahmenprogramme.<br />
Die WRRL gibt folgenden Zeitplan für ihre Umsetzung vor:<br />
• bis Ende 2003: Umsetzung der Vorschriften in nationales Recht;<br />
• bis Ende 2004: Bestandsaufnahme der Gewässer;<br />
• ab 2006: Anhörung der Öffentlichkeit zu den Entwürfen der Bewirtschaftungspläne;<br />
• bis Ende 2009: Aufstellung der Bewirtschaftungspläne, einschließlich der<br />
Maßnahmenprogramme;<br />
• bis Ende 2015: Erreichen des Ziels eines guten Gewässerzustandes.<br />
Anschließend sind die Bewirtschaftungspläne im Turnus von 6 Jahren zu überarbeiten und<br />
weitere Maßnahmen umzusetzen.<br />
Der Bewirtschaftungsplan ist das wesentliche Instrument zu Erreichung der Ziele. Nach<br />
Artikel 13 der Wasserrahmenrichtlinie sind für die Flussgebietseinheiten Bewirtschaftungspläne<br />
zu erstellen. Die WRRL enthält einen ganzheitlichen Ansatz, der eine Gewässerbewirtschaftung<br />
nach Flussgebietseinheiten von der Quelle bis zur Mündung vorschreibt. Der Regelungsraum ist<br />
auf das zu lösende Problem zugeschnitten und nicht an bestehende administrative Einheiten<br />
angepasst. Die Ausrichtung der Bezugsräume auf Flussgebiete und Flussgebietseinheiten, die<br />
kombinierte Betrachtung naturwissenschaftlicher und sozioökonomischer Aspekte sowie der<br />
hohe Stellenwert der Öffentlichkeitsbeteiligung zeigen den integrativen Planungsansatz. Der<br />
Bewirtschaftungsplan soll Programme zur Überwachung der Gewässerqualität und<br />
Maßnahmenprogramme zur Verbesserung des Gewässerzustandes enthalten. Nach Anhang VII<br />
der Wasserrahmenrichtlinie enthält der Bewirtschaftungsplan u. a.:<br />
• eine allgemeine Beschreibung der Flussgebietseinheit, d. h. der Oberflächengewässer und des<br />
Grundwassers,<br />
• eine Zusammenfassung aller signifikanten Belastungen und anthropogenen Einwirkungen,<br />
• eine Kartierung der Schutzgebiete, Karten des Überwachungsnetzes für die Oberflächen-<br />
wasserkörper, die Grundwasserkörper und die Schutzgebiete,<br />
• eine Liste der Umweltziele für die Gewässer,<br />
• eine Zusammenfassung der wirtschaftlichen Analyse,<br />
• eine Zusammenfassung aller Maßnahmen und Maßnahmenprogramme gem. Artikel 11,<br />
• eine Auflistung der zuständigen Behörden und<br />
• eine Zusammenfassung der Maßnahmen zur Information und Anhörung der Öffentlichkeit.
Beispiele für ergebnisorientierte Honorierungsansätze 213<br />
Die Gewässer werden auf der Grundlage ganzheitlicher Ansätze bewertet. Für<br />
Oberflächengewässer sind zukünftig sowohl der gute ökologische als auch der gute chemische<br />
Zustand als Ziele definiert. Insbesondere die in den Gewässern vorhandene Fauna und Flora<br />
sowie das Vorhandensein bestimmter prioritärer Stoffe sind insoweit zukünftig für die Qualität<br />
der Gewässer von maßgebender Bedeutung. Für das Grundwasser stellen der ‚gute chemische’ 125<br />
und der ‚gute mengenmäßige Zustand’ 126 die zu erreichenden Ziele dar. Die WRRL verstärkt<br />
damit die Bewirtschaftung der Gewässer nach Immissionsaspekten (LAWA 2001). Zustands-<br />
Indikatoren zur Bewertung der Gewässer müssen zur Operationalisierung der Ziele entwickelt<br />
werden.<br />
Bei der Festlegung der Ziele kommt der Koordinierung in der gesamten Flussgebietseinheit eine<br />
besondere Bedeutung zu. Zunächst sind die übergeordneten Ziele für die gesamte<br />
Flussgebietseinheit zwischen den beteiligten Staaten/Ländern abzustimmen und auf die<br />
Bearbeitungsgebiete 127 zu übertragen. Die Detailziele in den Bearbeitungsgebieten sind an den<br />
übergeordneten Zielen auszurichten. In den Bearbeitungsgebieten dürfen keine Ziele verfolgt<br />
werden, die die übergeordneten Ziele für die gesamte Flussgebietseinheit infrage stellen können<br />
oder gar unmöglich machen. Eigenständige Ziele in den Bearbeitungsgebieten können ansonsten<br />
unabhängig von den Gesamtzielen der Flussgebietseinheit verfolgt werden. Sie müssen jedoch<br />
nur soweit im Bewirtschaftungsplan erfasst und durch die von der Wasserrahmenrichtlinie<br />
vorgegebenen Maßnahmen abgearbeitet werden, wie sie der Erreichung der übergeordneten<br />
Ziele dienen (LAWA 2003).<br />
Mit dieser Operationalisierung der Ziele liegen die Voraussetzungen für umweltzielorientierte<br />
Strategien vor und Honorierungsinstrumente können unter Berücksichtigung der Eigentums-<br />
rechte eingesetzt werden, da in jedem Fall ex post die Möglichkeit besteht, den Erfolg der<br />
eingesetzten Mittel zu prüfen (vgl. 6.3.5.1).<br />
Im Falle des guten chemischen Zustandes der landwirtschaftlich beeinflussten Gewässerqualität<br />
können die über Zustands-Indikatoren operationalisierten Umweltziele jedoch direkt<br />
125 ‚guter chemischer Zustand des Grundwassers’: der chemische Zustand eines Grundwasserkörpers, der alle in<br />
Tabelle 2.3.2 des Anhangs V aufgeführten Bedingungen erfüllt (Art. 2 (25) WRRL<br />
126 ‚mengenmäßiger Zustand’: eine Bezeichnung des Ausmaßes, in dem ein Grundwasserkörper durch direkte und<br />
indirekte Entnahme beeinträchtigt wird (Art. 2 (26) WRRL<br />
127 Bei größeren Flussgebietseinheiten kann es zweckmäßig sein, diese in Bearbeitungsgebiete/Teileinzugsgebiete zu<br />
untergliedern. Die Aufteilung in die Bearbeitungsgebiete ist Aufgabe der an einem Flussgebiet beteiligten Länder<br />
bzw. Staaten. Die Bearbeitungsgebiete müssen nach hydrografischen, nur in begründeten Ausnahmen nach<br />
verwaltungstechnischen oder anderen Gesichtspunkten ausgerichtet sein.
214 Kapitel 8<br />
rationalisiert, das heißt derart definiert werden, dass Eigentumsrechte an diesen rationalisierten<br />
Zielen ansetzten können (vgl. Kap. 6.1 und 8.1.3.3). Mit Hilfe von modellierten,<br />
landwirtschaftlich verursachten Immissionen können Eigentumsrechte geschaffen und getauscht<br />
werden, da diese die Anforderungen an Indikatoren als Ansatzstelle für Eigentumsrechte erfüllen<br />
(vgl. Abbildung 20 sowie Kap. 6.3.4). In Abhängigkeit der Zielvorgaben für die<br />
Gewässerqualität können für die jeweiligen Regelungsgebiete, z. B. für die Bearbeitungsgebiete,<br />
Ziele bzgl. der landwirtschaftlich verursachten Immissionen aus den Gebieten in die relevanten<br />
Gewässer definiert werden. Hervorzuheben ist, dass diese modellierten Immissionen nicht die<br />
Zustands-Indikatoren ersetzten können, da sie für diesen Zweck (Monitoring) nicht valide genug<br />
sind.<br />
Die Maßnahmen der Maßnahmenprogramme, als zweiter wesentlicher Baustein der<br />
Bewirtschaftungspläne, können direkt an den Immissionen ansetzen. Für die Honorierung<br />
ökologischer Leistungen der Landwirtschaft heißt dies, dass die Honorierung für die<br />
Verminderung von Nährstoffeinträgen ergebnisorientiert gestaltet werden kann. Ob und für<br />
welche Bereiche derartige Instrumente eingesetzt werden, hängt jedoch wesentlich von der<br />
Verteilung der Eigentumsrechte ab.<br />
Im Zuge der Maßnahmenprogramme müssen Eigentumsrechte definiert werden. „Die<br />
Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie wird zweifellos Konkretisierungen zu den<br />
Begriffsinhalten der guten fachlichen Praxis erforderlich machen“ (Quast et al. 2002: 204). Die<br />
mit Hilfe von modellierten Immissionen rationalisierten Ziele können je nach Zuteilung der<br />
Eigentumsrechte zur Durchsetzung gesellschaftlicher Eigentumsrechte (Sozialpflichtigkeit des<br />
Eigentums der Landwirte) oder zur Durchsetzung privater Eigentumsrechte mit Hilfe<br />
ökonomischer Instrumente genutzt werden. Im ersten Fall wäre dies z. B. mit Abgaben möglich,<br />
im zweiten Fall z. B. durch die Honorierung für Leistungen oberhalb der Sozialpflichtigkeit. Es<br />
zeigt sich, dass im Zuge der Erarbeitung der Bewirtschaftungspläne und der Wahl der<br />
Instrumente Eigentumsrechte geschaffen und durchgesetzt werden. Vor diesem Hintergrund ist<br />
eine institutionalisierte Beteiligung der Öffentlichkeit ein wichtiger Baustein, um diesen Prozess<br />
demokratisch zu gestalten.
Beispiele für ergebnisorientierte Honorierungsansätze 215<br />
8.1.2 Bedeutung von Agrarumweltmaßnahmen für N-Immissionsminderung im Zuge<br />
der Umsetzung der WRRL<br />
Die landwirtschaftliche Nutzung wird über die Berücksichtigung der diffusen Belastungen 128 in<br />
den Regelungsbereich der Wasserrahmenrichtlinie einbezogen. Die Landwirtschaft in<br />
Deutschland verursacht ca. 48 % der Nitrateinträge aus diffusen Quellen in die<br />
Oberflächengewässer (Isermann 1990). Dies zählt umso mehr, da der Anteil der diffusen Quellen<br />
an dem gesamten Nitrateintrag für Deutschland auf ca. 60 % geschätzt wird (UBA 1997b). Dabei<br />
ist der Austrag von Nitrat mit dem Sickerwasser im Wesentlichen vom Nitratgehalt im<br />
Oberboden und der Wasserspeicherung oder Wasserbewegung im Boden abhängig (Bäumer<br />
1992). „Ein Erreichen der in der WRRL verankerten Ziele wird daher in vielen Fällen nur bei<br />
Änderung der gegenwärtigen landwirtschaftlichen Praxis möglich sein. Die von der<br />
Bundesregierung angestrebte Neuausrichtung der Agrarpolitik stellt eine Chance dar, durch<br />
Verknüpfung von Agrarumwelt- und Fördermaßnahmen mit den Zielen der<br />
Wasserrahmenrichtlinie zu einem verbesserten Gewässerschutz zu gelangen“ (LAWA 2002: 4,<br />
vgl. auch Quast et al. 2002).<br />
Agrarumweltmaßnahmen, die zu einer Verminderung des Eintrages von Nährstoffen oder<br />
Pflanzenschutzmitteln führen, können einen Beitrag zur Umsetzung der Ziele der<br />
Wasserrahmenrichtlinie leisten und werden im Zuge der Aufstellung von Maßnahmen in den<br />
Bewirtschaftungsplänen je nach Problemlage eine mehr oder weniger bedeutende Rolle spielen.<br />
Die LAWA (2002) schlägt z. B. umweltschonenden Maisanbau, den Anbau von<br />
Zwischenfrüchten, konservierende Bodenbearbeitung und extensive Fruchtfolgen als<br />
Agrarumweltmaßnahmen zur Förderung der Zielerreichung der WRRL vor.<br />
Die Frage ist, ob aus der WRRL eine flächendeckende Nachfrage an Zwischenfruchtanbau oder<br />
an einer flächendeckenden konservierenden Bodenbearbeitung abzuleiten ist, für die die<br />
Gesellschaft bereit ist, erhebliche finanzielle Mittel einzusetzen? Ein Blick auf die aktuell in<br />
Brandenburg eingesetzten AUM, die zu einer Verminderung des Nährstoffeinsatzes führen 129 ,<br />
soll die Problematik verdeutlichen.<br />
Insgesamt wurden im Wirtschaftsjahr 2001/2002 auf 220.115 ha Agrarumweltmaßnahmen<br />
durchgeführt, die mit einem verminderten Einsatz von Nährstoffen verbunden waren. Zum einen<br />
unterscheiden sich die Maßnahmen hinsichtlich ihrer Reduzierung an Nährstoffen. So wurde im<br />
128 nicht genau lokalisierbare bzw. flächenhafte Stoffeinträge<br />
129 Extensive Grünlandnutzung (A1, A2), Integrierter Obst- und Gemüsebau (B1), Ökologischer Landbau (B3),<br />
Umwandlung von Ackerland in Grünland (B5) vgl. Erläuterungen in Tabelle A-5 im Anhang
216 Kapitel 8<br />
Rahmen der Halbzeitbewertung der AUM in Brandenburg eine Reduzierung des<br />
Stickstoffeinsatzes gegenüber den Nichtteilnehmern an AUM von 68 % bei der extensiven<br />
Grünlandnutzung, um 72 % beim Ökologischen Landbau und um ca. 20 % beim Integrierten<br />
Obst- und Gemüsebau ermittelt (Matzdorf et al. 2003). Zum anderen ist entscheidend, ob die<br />
Einsparung überhaupt eine ökologische Leistung darstellt, das heißt, ob die Maßnahmen dort zu<br />
einer Reduzierung führen, wo Knappheiten auftreten, im hier diskutierten Beispiel, wo eine<br />
Austragsgefährdung besteht und eine Eintragsverminderung in die Gewässer für die Erhaltung<br />
oder Entwicklung der nachgefragten Gewässerqualität notwendig ist. In dem Fall wären die<br />
Agrarumweltmaßnahmen räumlich äquivalente Indikatoren für die Umweltziele (vgl. 6.3.4.1).<br />
Als Ausgangspunkt für eine derartige Bewertung kann die naturräumlich bedingte<br />
Nitrataustragsgefährdung der Standorte genutzt werden. Die Daten dazu liefert eine digitale<br />
Karte von Kersebaum et al. 2004, die in Abbildung A-3 im Anhang dargestellt ist und als<br />
Datengrundlage für die Ableitung von Indikatoren einer ergebnisorientierten Honorierung noch<br />
einmal in Kapitel 8.1.3.2 erläutert wird. Die Auswertung der InVeKoS-Daten (2002) auf<br />
Flurebene ergibt, dass von den ca. 1,3 Mio. ha landwirtschaftlich genutzter Fläche 130 24 % in<br />
Fluren liegen, die als relevant für N-Einträge ins Grundwasser (Stufe 2-4, vgl. Abbildung A-3 im<br />
Anhang) bewertet wurden und 74 % in Fluren deren Relevanz als gering bewertet wurde 131 .<br />
Bzgl. der Lage von eintragsmindernden Agrarumweltmaßnahmen in relevanten Gebieten zeigt<br />
sich, dass auch hierbei die Mehrzahl der Agrarumweltmaßnahmen in Fluren ohne Relevanz liegt.<br />
Insgesamt finden auf 17 % der LF relevante Agrarumweltmaßnahmen statt wobei 13 % in Fluren<br />
stattfinden, deren Relevanz für N-Immissionen ins Grundwasser mit gering bewertet wurden und<br />
4 % auf Fluren mit mittlerer bis sehr hoher Relevanz für N-Immissionen (Abbildung 49). Das<br />
bedeutet, dass mehr als 75 % der eintragsminimierenden AUM auf Flächen stattfinden, die als<br />
nicht bzw. gering relevant bewertet wurden.<br />
130 Angaben aus InVeKoS 2002 im GIS auf Flurebene (Matzdorf et al. 2003)<br />
131 Eine Erläuterung der Bildung der Relevanzklassen erfolgt in Kapitel 8.1.3.2.
Beispiele für ergebnisorientierte Honorierungsansätze 217<br />
20%<br />
4%<br />
Nitrateintragsvermindernde AUM in und außerhalb<br />
von sensiblen Gebieten<br />
13%<br />
2%<br />
61%<br />
LF in nicht sensiblen<br />
Gebieten gesamt<br />
LF in sensibelen Gebieten<br />
gesamt<br />
AUM nit. in sensiblen<br />
Gebieten<br />
AUM nit. in nicht sensiblen<br />
Gebieten<br />
LF nicht bewertet<br />
Abbildung 49: Eintragsvermindernde Agrarumweltmaßnahmen (AUM) in Brandenburg innerhalb und<br />
außerhalb von sensiblen Gebieten für N-Immissionen ins Grundwasser (eigene Berechnungen, Datengrundlage:<br />
Kersebaum et al. 2004 und InVeKoS-Daten 2002)<br />
Unter der hypotetischen Annahme, dass mit den betrachteten AUM überwiegend ein Beitrag zum<br />
Gewässerschutz geleistet werden soll, stellt sich die Frage, ob die Maßnahmenausgestaltung in<br />
dieser Art effizient ist oder ob die Honorierung nicht an andere Indikatoren als lediglich an die<br />
Maßnahmen geknüpft werden sollte, um einen Beitrag für das Erreichen der Ziele der WRRL zu<br />
leisten. Tatsächlich kann der Beitrag von Agrarumweltmaßnahmen bzgl. der Realisierung der<br />
Ziele der WRRL auf eine Verminderung der Immissionen ins Gewässer eingeengt werden. Von<br />
daher liegt es nahe, die Honorierung an eben diese Immissionen zu knüpfen.<br />
8.1.3 Modellierte Stickstoffimmissionen als Anknüpfung für eine ergebnisorientierte<br />
Honorierung am Beispiel des Landes Brandenburg<br />
8.1.3.1 Standortverhältnisse und Bearbeitungsgebiete nach Wasserrahmenrichtlinie<br />
Das Bundesland Brandenburg umfasst eine Fläche von 29.477 km². Die Einwohnerdichte ist mit<br />
88 Einwohnern je km² im Vergleich zu anderen Bundesländern gering. Fast die Hälfte der<br />
Landesfläche Brandenburgs wird landwirtschaftlich genutzt. Im Jahre 2002 betrug die<br />
landwirtschaftliche Nutzfläche 1.339.100 ha und unterteilte sich in 77,5 % Ackerfläche, 22,1 %<br />
Grünland sowie 0,4 % Dauerkulturen. Die Anbaustruktur war 2002 insgesamt durch einen hohen<br />
Anbauumfang an Getreide charakterisiert. Der Getreideanteil an der gesamten Ackerfläche des
218 Kapitel 8<br />
Landes Brandenburg betrug 54,4 %, der Ölfruchtanteil 12,7 % und der Anteil des Feldfutterbaus<br />
12,7 %. Im Jahr 2000 bewirtschafteten in Brandenburg 440 Betriebe 87.217 ha (6,5 % der LF)<br />
nach den Richtlinien des Ökologischen Landbaus. Damit liegt Brandenburg weit über dem<br />
Bundesdurchschnitt von ca. 2 %. Etwa 40 % der Landesfläche Brandenburgs sind als<br />
Schutzgebiete ausgewiesen, davon 5,1 % als Naturschutz- und 32,2 % als<br />
Landschaftsschutzgebiete (LUA 2002).<br />
Mit einer Wasserfläche von 3,4 % der Landesfläche ist Brandenburg eines der gewässerreichsten<br />
Bundesländer. Aufgrund des hohen Redox- und Denitrifikationspotentials in den<br />
Grundwasserleitern kommt es nur in Einzelfällen zu Nitratproblemen im Grundwasser (MLUR<br />
2000).<br />
Das Land Brandenburg ist als gewässerreich, aber niederschlagsarm zu charakterisieren. 34 %<br />
der LN sind als grundwasserferne Sandstandorte geringer Bonität anzusprechen, die sich durch<br />
geringe Wasserhaltefähigkeit auszeichnen und auf längere Trockenperioden mit Ertragsausfällen<br />
reagieren. Ein weiteres Drittel der LN stellen Grundwasser beeinflusste Niedermoorstandorte<br />
dar. In den letzten Jahren wurde dort mit zunehmender extensiver Grünlandnutzung (u.a. durch<br />
AUM) wieder eine höhere Wasserhaltung möglich (MLUR 2003a). Etwa 10 % des<br />
Wasserdargebots der LN werden in Niederungsgebieten durch Entwässerung für eine optimale<br />
landwirtschaftliche Nutzung abgeführt. Insgesamt ist der Landschaftswasserhaushalt in<br />
Brandenburg durch Defizite gekennzeichnet (MLUR 2003a).<br />
Durch den hohen Anteil gut durchlässiger Böden (ca. 60 % Sandstandorte an der LF) und<br />
grundwasserbeeinflusster Standorte (ca. 25 % der LF) besteht eine durchschnittliche<br />
Stoffaustragsgefährdung ins Grundwasser bzw. Oberflächengewässer (Matzdorf & Piorr 2003).<br />
Wenigstens ein Drittel der LF kann für die Belastung von Oberflächengewässern durch diffusen<br />
Nitrataustrag relevant sein. Von diesen so genannten sensiblen Flächen gelangt Nitrat aus dem<br />
Sickerwasser in das Grundwasser und von dort innerhalb weniger Jahre in die Gewässer, wobei<br />
ggf. nur eine geringe Denitrifikation im Grundwasser stattfindet. Hinzu kommen<br />
landwirtschaftliche Flächen mit Rohrdränungen, die ebenfalls als sensibel einzustufen sind.<br />
Diese befinden sich in Brandenburg vorwiegend in der Uckermark und der Prignitz sowie auf<br />
den Grundmoränenplatten Barnim und Lebus (Matzdorf & Piorr 2003).<br />
Die Fließgewässergüte liegt überwiegend in den Güteklassen II-III (kritisch belastet 44,6 % bis<br />
stark verschmutzt 15,5 %). Untersuchungen aus den Jahren 1993/1994 und 1998/1999 zur<br />
Saprobie der Fließgewässer belegen eine deutliche Verbesserung der Gewässergüte<br />
brandenburgischer Flüsse im Zeitraum 1990 bis 2001. Insbesondere die Fließgewässer der
Beispiele für ergebnisorientierte Honorierungsansätze 219<br />
Güteklassen III-IV und IV, die 1990 noch 11,4 % aller untersuchten Abschnitte ausmachten,<br />
haben sich um bis zu drei Gütestufen verbessert (Anteil der Fließgewässer mit Güteklasse III-IV<br />
und IV 0,5 % in 2001). Hinsichtlich der Gewässerstrukturgüte wurde konstatiert, dass kein Fluss<br />
als „unverändert“ oder „gering verändert“ bezeichnet werden kann. Fünf Flüsse sind als „mäßig<br />
verändert“, elf als „deutlich verändert“, sechs als „stark verändert“ und drei als „sehr stark<br />
verändert“ einzustufen. Die Situation hinsichtlich der Entwicklung der Gewässertrophie,<br />
stellvertretend untersucht an der Havel als größtem brandenburgischen Fließgewässer und der<br />
Spree als bedeutendstem Nebenfluss der Havel, hat sich ebenfalls positiv entwickelt. Die<br />
Trophiestufen in den einzelnen Abschnitten verbesserten sich im Zeitraum 1991 bis 2001 um ein<br />
bis zwei Stufen und liegen in den Trophieklassen II (eutroph) bis III-IV (polythroph bis<br />
saprotroph) (LUA 2002). Insgesamt sind 3.710 km des Fließgewässernetzes des Landes<br />
Brandenburg als sensible Fließgewässer eingestuft, von denen 1.719 km einen hohen Schutzwert<br />
(Schutzwertstufe 1-3) haben (LUA 1998).<br />
An den zehn im Rahmen der Wasserrahmenrichtlinie in Deutschland einzurichtenden<br />
Flussgebietseinheiten (Donau, Rhein, Maas, Ems, Weser, Elbe, Oder, Schlei/Trave,<br />
Warnow/Peene und Eider) hat Brandenburg Anteil an Elbe, Oder und Warnow/Peene. Die<br />
Abbildung A-4 im Anhang zeigt die Koordinierungsräume und die im Entwurf vorliegenden<br />
Bearbeitungsgebiete Brandenburgs im Überblick.<br />
8.1.3.2 Methodik und Datengrundlage<br />
Bei der Steuerung der Nährstoffimmissionen aus der Landwirtschaft in die Gewässer ist eine<br />
Unterscheidung der landwirtschaftlichen Nährstoffeintragspfade geboten, da sich die<br />
Eintragspfade hinsichtlich der Stoffkonzentrationen und der den Einträgen zugrunde liegenden<br />
Prozesse stark voneinander unterscheiden. Prinzipiell können vier verschiedene Pfade<br />
unterschieden werden (Behrendt et al. 1999: 47):<br />
• Nährstoffeinträge in die Gewässer über die direkt auf die Wasseroberfläche eines Gebietes<br />
fallenden Niederschläge (atmosphärische Deposition),<br />
• Nährstoffeinträge, die über den Oberflächenabfluss in die Gewässer gelangen,<br />
• Nährstoffeinträge, die an den hypodermischen Abfluss (interflow) bzw. eine schnelle<br />
unterirdische Abflusskomponente gebunden sind, und<br />
• Nährstoffeinträge über das Grundwasser (Basisabfluss) bzw. eine langsame unterirdische<br />
Abflusskomponente.
220 Kapitel 8<br />
In Abbildung 50 wird verdeutlicht, für welchen Eintragspfad im Folgenden die<br />
ergebnisorientierte Honorierung diskutiert wird. Betrachtet werden die Nitrateinträge (als N-<br />
Immission) aus der landwirtschaftlichen Nutzung über das System Boden in das Grundwasser<br />
und von dort aus in die Flusssysteme.<br />
Diese Einengung macht Sinn, da damit für einen bedeutenden Nährstoff sowohl das im Rahmen<br />
der WRRL formulierte Schutzgut ‚Grundwasser’ angesprochen werden kann als auch einer der<br />
wesentlichen Eintragspfade für das Schutzgut ‚Oberflächengewässer’ diskutiert wird. Der<br />
Eintragspfad über das Grundwasser stellt bei Stickstoff mit über zwei drittel den bedeutendsten<br />
Pfad innerhalb der diffusen Quellen dar (vgl. Abbildung 51). Die LAWA empfiehlt daher auch<br />
bei der Ermittlung der signifikanten anthropogenen Belastungen durch diffuse Quellen für<br />
Stickstoff „bei der Stickstoffbelastung die Verhältnisse der Zuleitung aus den<br />
Grundwasserkörpern in die Oberflächengewässer heranzuziehen“ (LAWA 2003: Teil 3, 24). Der<br />
Eintragspfad über den interflow (vgl. Abbildung 50) kann aufgrund der sehr komplizierten<br />
Quantifizierung nicht berücksichtigt werden. Die prinzipielle Wirkung von Dränung wird<br />
bewertet, kann jedoch aufgrund fehlender Daten in die räumliche Bewertung nicht einfließen.
Beispiele für ergebnisorientierte Honorierungsansätze 221<br />
Erosion Erosion Erosion<br />
Erosion<br />
Um- Um- Um- und und und Ablagerung<br />
Ablagerung<br />
Ablagerung<br />
Um- und Ablagerung<br />
landwirtschaftlichen Nutzfläche<br />
Nährstoffüberschuss im Oberboden<br />
Nährstoffauswaschung<br />
aus der Wurzelzone<br />
Basisabfluss<br />
Basisabfluss<br />
Basisabfluss<br />
Basisabfluss<br />
Nährstoffbilanz auf der<br />
Sorption, Sorption, Sorption, Sorption, Desorption Desorption Desorption Desorption Abschwemmung Abschwemmung Abschwemmung Abschwemmung<br />
interflow interflow interflow interflow<br />
Retention und Verluste<br />
in der<br />
ungesättigten Zone<br />
Nährstoffeinträge in<br />
das Grundwasser<br />
Retention und Verluste<br />
im Grundwasser<br />
Nährstoffeintrag in die Flusssysteme<br />
Nährstoffretention und -verluste in den Flusssystemen<br />
Nährstofftransport in den Flüssen<br />
Nährstoffeintrag in die Meere<br />
Abbildung 50: Punktuelle und diffuse Eintragspfade und Prozesse in Flussgebieten Deutschlands<br />
Hervorgehoben ist der Pfad für den eine ergebnisorientierte Honorierung in dieser Arbeit diskutiert wird.<br />
(Quelle: in Anlehnung an Behrendt et al. 1999)<br />
Dränage Dränage Dränage Dränage<br />
atmosphärische atmosphärische Deposition Deposition<br />
atmosphärische Deposition<br />
versiegelte versiegelte urbane urbane Flächen Flächen<br />
versiegelte urbane Flächen<br />
Punktquellen<br />
Punktquellen<br />
Punktquellen
222 Kapitel 8<br />
Diffuse Stickstoffeinträge aus Deutschland<br />
nach Eintragspfaden (1993-97)<br />
Abschwemmung<br />
2%<br />
Dränagen<br />
21%<br />
Erosion<br />
2%<br />
Atmosph.<br />
Deposition<br />
2%<br />
Urbane<br />
Flächen<br />
6%<br />
Abbildung 51: Stickstoffeinträge nach Eintragspfaden<br />
(eigene Darstellung, Datenquelle: Behrendt et al. 1999)<br />
Der Transport von Nitrat von den landwirtschaftlichen Flächen in die Flusssysteme erfolgt zum<br />
großen Teil vertikal im ungesättigten Bereich und lateral im Grundwasser. Ausgehend von den<br />
vier ‚Stufen’ des N-Eintragspfades aus der landwirtschaftlichen Nutzung in das Grundwasser<br />
und die Fließgewässer (vgl. Abbildung 52) werden drei ‚Stufen’ diskutiert, auf denen N-<br />
Immissionen quantifiziert bzw. bewertet werden und damit potentiell mit einer Honorierung<br />
verknüpft werden können: die N-Immissionen in die ungesättigte Zone, die N-Immissionen in<br />
das Grundwasser und die N-Immissionen in die Flusssysteme. In Abbildung 52 sind die<br />
Ansatzstellen für die Honorierung, die in dieser Arbeit diskutiert werden, sowie die verwendeten<br />
Modelle bzw. Daten dargestellt 132 .<br />
Grundwasser<br />
67%<br />
132 Die Quantifizierung der Immissionen auf den Oberboden, das heißt die N-Saldenberechnung der<br />
Produktionssysteme, ist ebenfalls, in Verbindung mit Standortdaten, ein lohnender Ansatz, wird jedoch in dieser<br />
Arbeit nicht diskutiert.
Beispiele für ergebnisorientierte Honorierungsansätze 223<br />
Ursache<br />
(1)<br />
(2)<br />
(3)<br />
(4)<br />
Wirkung<br />
Abbildung 52: Stufen des landwirtschaftlichen N-Eintrages als Ansatzstelle für eine ergebnisorientierte<br />
Honorierung (Aufgeführt sind vorhandene Datengrundlagen für Brandenburg.)<br />
Unter der Annahme, dass die Landwirte nicht bereit sind, unkalkulierbares Risiko zu<br />
übernehmen (vgl. Diskussion in Kap. 6.3.5.1) und der prinzipiellen Schwierigkeit, N-<br />
Immissionen zu messen, erfolgt die Indikatorendiskussion für modellierte N-Immissionen. Was<br />
in dieser Diskussion nicht geleistet werden kann, ist eine ausführliche Bewertung des<br />
verwendeten Modells. Prinzipiell ist dieser Aspekt entscheidend für das Risiko, das die<br />
Gesellschaft vom Landwirt durch modellierte Indikatoren übernimmt (vgl. Kap. 6.3.5.1). Von<br />
daher ist die Diskussion zur Validität der Modelle selbstverständlich für den tatsächlichen Erfolg<br />
der Honorierung bzgl. der ökologischen Güter (landwirtschaftlich beeinflusste Qualität des<br />
Grundwassers und der Oberflächengewässer) entscheidend.<br />
Es sollte sich bei der Verwendung des Modells vor Augen geführt werden, dass die Variabilität<br />
der realen Produktionsverfahren sowie der Standortverhältnisse sehr stark vereinfacht werden.<br />
So werden die Anbauverfahren über standardisierte Fruchtfolgen erfasst (vgl. Kersebaum 1995,<br />
Kersebaum & Beblik 2001), die im Einzelfall, auf der Objektebene, stark von den tatsächlichen<br />
Anbauverhältnissen abweichen können. In Verbindung mit dem grundsätzlichen Problem der<br />
Operationalisierung der Standortvielfalt werden die Grenzen der Validität für den Einzelfall sehr<br />
deutlich.<br />
Stufen des landwirtschaftlichen N-Eintrages<br />
N-Emissionen aus dem<br />
landwirtschaftlichen Verfahren<br />
N-Emissionen aus der<br />
Wurzelzone<br />
N-Emissionen aus der<br />
ungesättigten Zone<br />
N-Emissionen aus dem<br />
Grundwasser<br />
N-Immissionen auf den<br />
Oberboden<br />
N-Immissionen in die<br />
ungesättigte Zone<br />
N-Immissionen in das<br />
Grundwasser<br />
N-Immissionen in die<br />
Flusssysteme<br />
Diskutierte Ansatzstellen für die<br />
Honorierung<br />
Modellierung des N-Austrags aus der<br />
Wurzelzone mit Hilfe des Modell<br />
HERMES (Kersebaum 1989, 95)<br />
Quantifizierte N-Immissionen in<br />
die ungesättigte Zone<br />
digitale Standortdaten<br />
(Kersebaum et al. 2004)<br />
Bewertete N-Immissionen in das<br />
Grundwasser<br />
digitale Standortdaten<br />
(Steidl et al. 2003)<br />
Bewertete N-Immissionen in die<br />
Flusssysteme
224 Kapitel 8<br />
Für die Nutzung von Modellen für ergebnisorientierte Honorierungsansätze sind daher die<br />
Weiterentwicklung der Modelle sowie die wissenschaftliche Diskussion zur Validität der<br />
Modelle entscheidend (vgl. z. B. Umweltbundesamt 1997). 133<br />
Ausgangpunkt für das in dieser Arbeit diskutierte Beispiel sind für Brandenburg flächendeckend<br />
vorhandene Daten. Diese Einschränkung wurde bewusst gewählt, um den Ansatz auf der<br />
aktuellen Planungsebene für Agrarumweltprogramme, dem Bundesland, diskutieren zu können.<br />
Folgende Daten werden genutzt:<br />
• Modellierte Nitrateinträge aus den landwirtschaftlichen Flächen Brandenburgs in die<br />
ungesättigte Zone mit Hilfe des Modells HERMES unter vier Szenarien: konventionelle<br />
Ackernutzung, Ökologischer Landbau, konventionelle Grünlandnutzung, extensive<br />
Grünlandnutzung (Kersebaum 2004),<br />
• Fluren Brandenburgs, die aufgrund der naturräumlichen Standortbedingungen für die<br />
Belastung von Grundwasser durch diffusen Nitrateintrag aus der Landwirtschaft relevant<br />
sind (Kersebaum et al. 2004),<br />
• Landwirtschaftliche Standorte Brandenburgs, die aufgrund der naturräumlichen Standort-<br />
bedingungen für die Belastung von Oberflächengewässern durch diffusen Nitrateintrag<br />
relevant sind (Steidl et al. 2003),<br />
• InVeKoS (2002): Datenbestand – Integriertes Verwaltungs- und Kontrollsystem auf<br />
Flurebene (LVL). 134<br />
Modellierung der N-Immissionen in die ungesättigte Zone (N-Emission aus der<br />
Wurzelzone) mit HERMES<br />
Für den Bereich der Stickstoffdynamik liegen Modellansätzen vor (Übersicht z. B. in Diekkrüger<br />
et al. 1995, Engel et al. 1993). Für die vorliegende Arbeit konnte für Brandenburg der<br />
flächendeckend modellierte Nitrataustrag aus der Wurzelzone (= N-Immissionen in die<br />
133 Dem hier etwas sorglosen Umgang mit dem Problem sei ein Diskussionsbeitrag von Hofreither auf dem<br />
Workshop „Stoffbilanzierung in der Landwirtschaft – ein Instrument für den Umweltschutz?!“ vorangestellt: „Es<br />
wird erst eine Änderung geben, wenn die gesellschaftlichen Präferenzen in diese Richtung gehen. Wenn<br />
Grundwasser in der Prioritätenreihung ganz vorn ist, haben wir die Lösung. Wir müssen also Argumente haben, um<br />
das aufzubereiten. Ob unsere Messmethoden dabei exakt sind oder um 3 oder um 17 % abweichen, interessiert die<br />
95 % der Österreicher, die mit Landwirtschaft nichts zu tun haben, nicht“ (in Umweltbundesamt 1997).<br />
134 gekoppelt an digitale Flurübersichtskarte des Landes Brandenburg. Stand 27.03.2002 (Nutzung mit<br />
Genehmigung der LGB, GB-G I/99) (LvermA)
Beispiele für ergebnisorientierte Honorierungsansätze 225<br />
ungesättigte Zone) für vier verschiedene landwirtschaftliche Verfahren genutzt werden<br />
(Kersebaum 2004). Die Modellierung erfolgte mit dem Modell HERMES (Kersebaum 1989,<br />
1995). Das Modell HERMES stellt ein prozessorientiertes deterministisch-empirisches Modell<br />
zur Simulierung der N-Dynamik dar (Kersebaum 1989). Das Modell berücksichtigt die<br />
wesentlichen Prozesse der N-Dynamik im System Boden-Pflanze. Simuliert werden in<br />
Abhängigkeit von Boden, Witterung und Bewirtschaftung der Wasserhaushalt (Verdunstung,<br />
Wasserflüsse, Sickerwasserbildung bzw. kapillarer Aufstieg), die N-Mineralisation aus<br />
organischer Substanz des Bodens und aus Ernteresiduen, die Denitrifikation, der N-Transport mit<br />
dem Sickerwasser sowie die N-Aufnahme der Pflanzen. Einfache Abschätzungen werden zu<br />
NH3-Verlusten und dem Anteil der N2-Fixierung an der Gesamtaufnahme der Pflanze gemacht.<br />
Die Simulation liefert Aussagen über die durchschnittliche Grundwasserneubildung und<br />
jährliche Nitratauswaschungen ganzer Fruchtfolgen. Zur Abbildung der unterschiedlichen<br />
Kulturarten wurden pflanzenspezifische Parameter zu Wachstum und Pflanzenentwicklung<br />
verwendet, die jedoch mit Ausnahme der Getreidearten bislang nur grob justiert sind. Eine<br />
detaillierte Beschreibung des Modells ist in Kersebaum (1995) sowie in Kersebaum & Beblik<br />
(2001) zu finden.<br />
Mit dem Modell HERMES wurden für ganz Brandenburg der Stickstoffhaushalt in der<br />
durchwurzelten Zone und die N-Emissionen mit dem Sickerwasser durch die Kombination von<br />
Bodentypen, Grundwasserstand, Klimaregionen und Fruchtfolgen für landwirtschaftliche<br />
Standortklassen für den Nitrataustrag aus der Wurzelzone über die gesamte LF unter<br />
• konventioneller Ackernutzung (AL konv.),<br />
• Ackernutzung im Ökologischen Landbau (AL öL),<br />
• konventionelle Grünlandnutzung (GL konv.) und<br />
• extensive Grünlandnutzung (GL ext.)<br />
simuliert. Datenbasis dafür waren die natürlichen Standorteinheiten und Grundwasserstufen der<br />
Mittelmaßstäbigen landwirtschaftlichen Standortkartierung (MMK 1:10000), mittlere jährliche<br />
Niederschlagshöhen, hydrologische Karten zum Grundwasserflurabstand und zu entwässerten<br />
Gebieten sowie die Biotoptypen- und Landnutzungskartierung von Brandenburg (MUNR 1995)<br />
zur räumlichen Verteilung von Acker-, Grünland und Wald 135 . Es wurden standort- und<br />
135 Eine Prüfung der Übereinstimmung des räumlichen Anteils von AL und GL über ‚CORINE land cover’ mit<br />
aktuellen Flächenangaben zur landwirtschaftlichen Nutzung (InVeKoS 2002) auf Flurebene und der Biotoptypen-<br />
und Landnutzungskartierung Brandenburgs und den InVeKoS-Daten ergab eine bessere Korrelation bei den Daten<br />
aus der Biotoptypenkartierung (Prüfung erfolgte im Rahmen der Halbzeitbewertung des EPLR Brandenburgs).
226 Kapitel 8<br />
nutzungssystemspezifische elementare Fruchtfolgen für Ökologischen und konventionellen<br />
Landbau definiert. Die fruchtartenspezifischen Düngungsaufwendungen für den konventionellen<br />
Landbau wurden in Abhängigkeit von standortspezifisch geschätzten Erträgen angesetzt (Piorr<br />
1999, vgl. auch Kersebaum et al. 2003). Die ökologischen Anbauverfahren orientieren sich an<br />
der EU-Verordnung zum Ökologischen Landbau (VO (EG) 1257/1991). Die durchschnittlichen<br />
Effekte der Kombinationen von Boden und Produktionssystem sowie Grundwasser und<br />
Produktionssystem sind für die vier Nutzungsvarianten (s.o.) in Kersebaum et al. (2003b) für das<br />
Elbeeinzugsgebiet von Brandenburg dargestellt.<br />
Fluren von Brandenburg, die aufgrund der naturräumlichen Standortbedingungen für die<br />
Belastung des Grundwassers durch diffusen Nitrateintrag aus der Landwirtschaft relevant<br />
sind (Kersebaum et al. 2004)<br />
Das Reduktionspotential in der ungesättigten Zone wird als eher gering bis unbedeutend<br />
eingeschätzt (z. B. Becker 1999). Schwierigkeiten bereiten jedoch die Prozesse im Bereich des<br />
interflow (Behrendt et al. 1999). Bedeutung für den jeweiligen Grundwasserkörper hat die<br />
Grundwasserbedeckung, da sie den darunter liegenden Grundwasserkörper vor vertikalen<br />
Einträgen aus der Fracht des Sickerwassers schützt (Dannowski et al. 2002). In bedeckten<br />
Grundwasserkörpern ist zudem häufig ein reduzierendes Milieu anzutreffen, das den Nitratabbau<br />
im Grundwasser begünstigt (Wendland & Kunkel 1999).<br />
Auf der Grundlage von Standorttypen der MMK, Klima (Niederschlagsklassen) und<br />
Grundwasserflurabstand wurde die mittlere Austauschhäufigkeit des Bodenwassers in der<br />
Wurzelzone berechnet und in Verbindung mit der Grundwasserdeckung die potentielle<br />
Nitrateintragsgefährdung ins Grundwasser nutzungsunabhängig und konturenbezogen bewertet.<br />
Durch die Kombination von Austauschhäufigkeit und Grundwasserdeckung erfolgte eine<br />
Bewertung der Standorte in fünf Relevanzklassen, von äußerst relevant bis sehr wenig relevant<br />
(vgl. Tabelle 12). Die Bewertung der Austauschhäufigkeit ist angelehnt an die Bewertung nach<br />
DIN 19732 136 .<br />
136 DIN 19732: Bestimmung des standörtlichen Verlagerungspotentials von nichtsorbierbaren Stoffen. Juni 1997.
Beispiele für ergebnisorientierte Honorierungsansätze 227<br />
Tabelle 12: Beschreibung der Relevanzklassen von landwirtschaftlichen Standorten für die N-Immissionen<br />
ins Grundwasser<br />
Bedeckung des<br />
Grundwasserleiters<br />
Austauschhäufigkeit 1*a -1 in %<br />
< 70 70-100 100-150 150-250 > 250<br />
bedeckt sehr gering sehr gering gering gering mittel<br />
wechselhaft sehr gering gering mittel mittel sehr<br />
unbedeckt sehr gering gering mittel sehr äußerst<br />
Quelle: Kersebaum et al. 2004<br />
Die Daten der landwirtschaftlichen Nutzung (InVeKoS-Daten) liegen für Brandenburg auf der<br />
Flurebene vor (Flurübersichtskarte LvermA 2002). Damit stellt die Flur die kleinste gemeinsame<br />
geographische Einheit von naturräumlichen und landwirtschaftlichen Daten dar (durchschnittlich<br />
120 ha). Auf der Grundlage der bewerteten naturräumlichen Standortdaten zur N-<br />
Immissionsgefährdung (Konturenbezug) erfolgte eine Bewertung auf der Flurebene. Dieses ‘up-<br />
scaling’ erfolgte mit Hilfe der Methode VERMOST (Vergleichsmethode Standort) (vgl. Thiere<br />
et al. 1991, Deumlich et al. 1997). Ergebnis sind Fluren, die die naturräumliche Relevanz der<br />
landwirtschaftlichen Fläche (ohne aktuelle Nutzung) für N-Immissionen ins Grundwasser<br />
darstellen (Abbildung A-3 im Anhang).<br />
Landwirtschaftliche Standorte Brandenburgs, die aufgrund der naturräumlichen<br />
Standortbedingungen für die Belastung von Oberflächengewässern durch diffusen<br />
Nitrateintrag relevant sind (Steidl et al. 2003)<br />
Die Zeitspannen für den Transport von N-Emissionen über den Pfad Boden, Versickerung und<br />
Grundwasser in die Oberflächengewässer differieren für die Standorte eines Flussgebietes<br />
erheblich. Hinzu kommen standortabhängige Abbau- und Umwandlungsprozesse. In die<br />
Bewertung der Relevanz von Standorten für die Gewässerbelastung durch Nitrateintrag sind<br />
folgende Standorteigenschaften eingegangen (Steidl et al. 2002a):<br />
• Hydrologisches Standortregime (Versickerungsfähigkeit, Staunässe- und<br />
Grundwassereinfluss),<br />
• Wasserspeichervermögen des Standortes,<br />
• Entwässerung durch Grundwasserregulierungsanlagen oder Rohrdränungen,
228 Kapitel 8<br />
• Eintragszeit des Stofftransfers von der Wurzelzone in die Entlastungsgewässer oder die<br />
begleitenden Niederungen,<br />
• Landnutzungsklasse des Standortes (Acker, Grünland, Siedlung usw.).<br />
Für die Bewertung der Relevanz der Standorte für N-Immissionen in das Flusssystem ist die<br />
Austragszeit ab dem Emissionsort (Grundwasser) die wichtigste, da mit der Dauer der<br />
Austragszeit die Abbauprozesse länger wirken können. Im Gegensatz zu den aeroben<br />
Bedingungen (ungesättigte Zone) findet unter anaeroben Bedingungen (Grundwasser) auf vielen<br />
Standorten mikrobieller Nitratabbau statt (Obermann 1982, Böttcher et al. 1989). Wendland &<br />
Kunkel (1999) haben für den überwiegenden Teil des Lockergesteinsbereiches des<br />
Elbeeinzugsgebietes nitratabbauende Bedingungen ausgewiesen.<br />
Die Austragszeit umfasst die Zeitspanne des Stofftransports von der Sickerwasserbildung bis zur<br />
Exfiltration in ein Entlastungsgewässer oder dessen begleitende Niederungen, wobei für die hier<br />
vorgenommene Bewertung die Zeitspanne ab dem Eintritt ins Grundwasser relevant ist.<br />
Maßgeblich für die Austragszeit sind die Länge des Transportweges vom Emissionsort zum<br />
Entlastungsgewässer, die Durchlässigkeit der grundwasserleitenden Gesteinseinheiten, die Höhe<br />
der Grundwasserneubildung und das sich einstellende Grundwassergefälle (Steidl et al. 2002b:<br />
93). Je nach der Entfernung zwischen Emissionsort und Entlastungsgewässer oder begleitenden<br />
Niederungen kann der Stofftransit im Grundwasser also Jahre, Jahrzehnte bis Jahrhunderte<br />
dauern. Unter Annahme einer Halbwertzeit von Nitrat unter anaeroben Bedingungen von fünf<br />
Jahren und unter Rückgriff auf die autotrophe Denitrifikationsgleichung von Böttcher et al.<br />
(1985, 1989) haben Steidl et al. (2002b) die Standorte entsprechend der Austragszeit in vier<br />
Klassen eingestuft (vgl. Tabelle 13). Darüber hinaus wurden landwirtschaftliche Standorte mit<br />
einem potentiellen Grundwasserflurabstand von weniger als 10 dm und einer ausgeglichenen<br />
oder negativen klimatischen Wasserbilanz als ‚kaum relevant’ bewertet (vgl. Tabelle 13). Die<br />
Bewertung der Standorte liegt auf Konturebene vor und wurde bisher noch nicht auf Flurebene<br />
aggregiert (Abbildung A-5 im Anhang).
Beispiele für ergebnisorientierte Honorierungsansätze 229<br />
Tabelle 13: Beschreibung der Relevanzklassen von landwirtschaftlichen Standorten für die N-Immissionen in<br />
die Oberflächengewässer<br />
Relevanzklasse Beschreibung<br />
sehr relevant<br />
relevant<br />
gering relevant<br />
nicht relevant<br />
Quelle: Steidl et al. 2003, leicht verändert<br />
landwirtschaftliche Standorte mit einem transitpfadbezogenen Retentionspotential<br />
von höchstens 50 % (das bedeutet Transitzeiten von weniger als 5 bis 10 Jahren)<br />
sowie auch<br />
• landwirtschaftliche Standorte in Gewässernähe (< 50 m) und einem potentiellen<br />
Grundwasserflurabstand von mehr als 10 dm<br />
• landwirtschaftliche Standorte mit einem potentiellen Grundwasserflurabstand von<br />
weniger als 10 dm und einer positiven klimatischen Wasserbilanz<br />
• landwirtschaftliche Standorte mit Dränanlagen (können aus Gründen der<br />
Datenverfügbarkeit aktuell nicht berücksichtigt werden)<br />
landwirtschaftliche Standorte mit einem transitpfadbezogenen Retentionspotential<br />
von mehr als 50 % aber höchstens 90 % (das bedeutet Transitzeiten zwischen 15 und<br />
30 Jahren)<br />
• landwirtschaftliche Standorte mit einem transitpfadbezogenen<br />
Retentionspotential von mehr als 90 %, aber höchstens 99 % (das bedeutet<br />
Transitzeiten zwischen 30 bis 55 Jahren)<br />
• landwirtschaftliche Standorte mit einem potentiellen Grundwasserflurabstand von<br />
weniger als 10 dm und einer ausgeglichenen oder negativen klimatischen<br />
Wasserbilanz<br />
landwirtschaftliche Standorte mit einem transitpfadbezogenen Retentionspotential<br />
von mehr als 99 % (das bedeutet Transitzeiten von mehr als 55 Jahren)<br />
8.1.3.3 Ermittlung der N-Immissionen<br />
N-Immissionen erfüllen prinzipiell die Anforderungen an Agrarumweltindikatoren als Scharnier<br />
zwischen Umweltzielen und Honorierungsinstrumenten (vgl. Kap. 6.3.4). Sie genügen dem<br />
Anforderungskriterium der räumlichen Äquivalenz, denn sie sind auf landwirtschaftliche Fläche<br />
(ha) normierbar und sind prinzipiell in allen Räumen valide gegenüber der durch die<br />
Landwirtschaft beeinflussten Gewässerqualität. Was sich in den Räumen unterscheidet, sind die<br />
Zielwerte. Dies hat Einfluss auf die praktische Erhebbarkeit. Die fehlende Problemkompatibilität<br />
wird durch die Modellierung aufgehoben. Das Gleiche gilt für die Zeitäquivalenz 137 .<br />
Immissionen sind sowohl den Landwirten als auch der Gesellschaft anschaulich vermittelbar und<br />
sehr gut normierbar. Bei der Normierung ergibt sich allerdings für modellierte Indikatoren das<br />
Problem, dass die modellierten Eingangsvariablen im Rahmen des EU-Prüfverfahrens bestehen<br />
137 Damit ist nicht die fehlende Validität aufgehoben, vgl. Diskussion in Kapitel 8.1.3.2!
230 Kapitel 8<br />
müssen (vgl. auch Anlastungsrisiko S. 129). Die praktische Erhebbarkeit stellt auch bei<br />
modellierten Indikatoren ein Problem bzgl. des Aufwandes und der notwendigen Daten dar.<br />
Gerade in diesem Bereich lässt jedoch die kurzfristige Entwicklung, bezogen auf die<br />
naturräumlich bedingten Eingangsvariablen der Modelle, wesentliche Verbesserung erwarten<br />
(vgl. Kap. 8.1.3.5).<br />
Quantifizierung der N-Immissionen in die ungesättigte Zone<br />
Dem Landwirt stehen prinzipiell zwei Handlungsebenen zur Verfügung, auf denen er agieren<br />
kann, um die N-Immissionen zu vermindern:<br />
1. das landwirtschaftliche Verfahren,<br />
2. die Wahl des Standortes.<br />
Auf diese beiden ‚Stellschrauben’ muss auch im Zuge der Modellierung reagiert werden. Für ein<br />
Modell wie HERMES, das für die N-Immissionen in die ungesättigte Zone bereits beide<br />
Parameter verknüpft, entsteht dadurch das Problem, dass sich die zu modellierenden<br />
Handlungsalternativen stark erhöhen.<br />
Mit dem Modell HERMES können N-Immissionen in kg N/(ha a) in die ungesättigte Zone über<br />
eine Fruchtfolge errechnet werden. Damit können einerseits in der Quantifizierung<br />
Standortparameter berücksichtigt werden, auf der anderen Seite stehen dem Landwirt damit aber<br />
auch nur ‚vorgedachte’ Bewirtschaftungsalternativen zur Verfügung, nämlich die, für die die<br />
Immissionen modelliert worden sind. Das heißt, die Schaffung von Handlungsalternativen,<br />
zwischen denen der Landwirt entscheiden kann, sind für die erste ‚Schraube’, die Wahl der<br />
landwirtschaftlichen Verfahren, relativ eng begrenzt. Für den Modellierungsansatz von<br />
HERMES spricht jedoch, dass die modellierten N-Immissionen Durchschnittswerte über eine<br />
Fruchtfolge darstellen. Eine Honorierung lediglich an einen einjährig ermittelten Saldo zu<br />
knüpfen, würde nur dann sinnvoll sein, wenn das ökonomische Instrument so ausgestaltet wird,<br />
dass es in beiden Richtungen wirkt. Um einen Referenzwert herum müsste ein Saldo, der<br />
oberhalb liegt, mit einer Abgabe geahndet und ein unterhalb liegender Saldo honoriert werden.<br />
Würde dies nicht berücksichtigt werden, könnten die Landwirte sich die Verringerung von<br />
Emissionen für bestimmte Fruchtfolgeglieder honorieren lassen und dennoch aufgrund von<br />
Kulturen mit hohen Emissionen in den Folgejahren eine N-Austragserhöhung verursachen.<br />
Es werden im Folgenden die Potentiale an N-Immissionsverminderung in die ungesättigte Zone<br />
für drei landwirtschaftliche Szenarien standortabhängig auf der Konturebene berechnet und im
Beispiele für ergebnisorientierte Honorierungsansätze 231<br />
zweiten Schritt auf die Flurebene aggregiert. Ziel ist es, für ganz Brandenburg für die<br />
ökologische Ackernutzung 138 , die extensive Grünlandnutzung und die Umwandlung von<br />
konventionell genutztem Ackerland in extensiv genutztes Grünland auf Flurebene das Potential<br />
an Verminderung der N-Immissionen pro ha und Jahr in die ungesättigte Zone darzustellen.<br />
Ergebnis ist die Verminderung von N-Immissionen in die ungesättigte Zone in kg/(ha a) für drei<br />
Verfahren auf einer großmaßstäbigen administrativen, landwirtschaftlichen Einheit (Flur), die in<br />
Brandenburg bereits aktuell über GIS-Systeme mit den InVeKoS-Daten verknüpft ist.<br />
Ausgangspunkt sind die modellierten N-Immissionen (jeweils über die gesamte LF, jedoch nach<br />
AL und GL unterscheidbar) auf Konturenebene (Kersebaum 2004) von:<br />
• konventioneller Ackernutzung (AL konv.),<br />
• ökologischer Ackernutzung (AL öL),<br />
• konventioneller Grünlandnutzung (GL konv.) und<br />
• extensiver Grünlandnutzung (GL ext.).<br />
Es wurden für die Standortvarianten die N-Immissionen in die ungesättigte Zone berechnet. Für<br />
Brandenburg entstanden 422.606 räumlich verortete Konturen, denen neben den modellierten N-<br />
Immissionen pro kg N/(ha a) für die vier Varianten auch der aktuelle Nutzungstyp (Grünland<br />
oder Ackerland) auf der Grundlage der Biotoptypen- und Landnutzungskartierung von<br />
Brandenburg (MUNR 1995) zugeordnet wurde.<br />
Ausgehend von diesen Daten, wurde im ersten Schritt die N-Immission in kg N/(ha a) errechnet,<br />
die jeweils bei einer konventionellen und bei einer ökologischen Ackernutzung der<br />
Brandenburger Ackerflächen anfällt.<br />
Die durchschnittliche N-Immission über ganz Brandenburg beträgt bei der konventionellen<br />
Ackernutzung 47,4 kg N/(ha a) und bei ökologischen Ackernutzung 27,4 kg N/(ha a). Dabei<br />
schwanken die Austräge von 0 bis 87 kg N/(ha a) bei der konventionellen und von 0 bis 67,6<br />
kg N/(ha a) bei der ökologischen Ackernutzung. Für die zwei Grünlandvarianten konnten<br />
Durchschnittswerte von 9,3 (0 bis 45,1) kg N/(ha a) für konventionell und 1,6 (0-14,4)<br />
138 ökologische Ackernutzung = Ackerbau des Ökologischen Landbaus
232 Kapitel 8<br />
kg N/(ha a) für extensiv genutztes Grünland für Brandenburg ermittelt werden. Die Ergebnisse<br />
der räumlichen Verteilung der Austräge für ganz Brandenburg sind in den Abbildungen A-6 bis<br />
A-9 im Anhang für die vier Nutzungsvarianten dargestellt.<br />
Um das N-Immissionsverminderungspotential, das aufgrund der Verfahrens- und Standort-<br />
kombination entsteht, räumlich differenziert zu ermitteln, wurden drei Szenarien auf<br />
Konturenebene berechnet:<br />
Szenario 1: die Umstellung von konventioneller Ackernutzung auf ökologische Ackernutzung<br />
für alle Ackerstandorte (AL ökol. - AL konv.);<br />
Szenario 2: die Umstellung von konventioneller Grünlandnutzung auf extensive<br />
Grünlandnutzung für alle Grünlandstandorte (GL ext. - GL konv.);<br />
Szenario 3: die Umstellung von konventioneller Ackernutzung auf extensive Grünlandnutzung<br />
für alle AL-Standorte (GL ext. - AL konv.).<br />
Die jeweiligen Differenzen stellen das Verminderungspotential der einzelnen Konturen dar. Die<br />
jeweiligen Konturen wurden flächengewogen pro Flur gemittelt und stehen nun als Information<br />
pro Flur zur Verfügung. Die Heterogenität der Konturen innerhalb einer Flur ist beispielhaft in<br />
Abbildung A-10 im Anhang dargestellt. Die Ergebnisse der räumlichen Verteilung sind für<br />
Flurklassen für die drei Verfahren in den Abbildungen A-11 bis A-13 im Anhang demonstriert.<br />
Wie zu erwarten war, sind die größten Potentiale im Szenario 3 zu erkennen und die geringsten<br />
im Szenario 2. So kann auf 35 % der Fluren durch eine Umwandlung von konventionell<br />
genutzten Ackerflächen in extensives Grünland mehr als 50 kg N/(ha a) an Immissionen<br />
vermindert werden. Derartig hohe Potentiale werden durch die ökologische gegenüber der<br />
konventionellen Ackernutzung nur auf unter 2 % der Fluren und durch die extensive<br />
Grünlandnutzung gegenüber der konventionellen gar nicht erreicht. In Abbildung 53 ist die<br />
Verteilung der Fluren in den Potentialklassen für alle drei Szenarien dargestellt.
Beispiele für ergebnisorientierte Honorierungsansätze 233<br />
kg N/ (ha a)<br />
100%<br />
80%<br />
60%<br />
40%<br />
20%<br />
0%<br />
Verteilung der Fluren (n = 9.507) bzgl. ihrer<br />
modellierten N-Immissionsverminderung<br />
AL ökol. GL ext.<br />
AL konv. in GL<br />
ext.<br />
> 80 0,00 0,00 0,00<br />
> 65 und 50 und 35 und 20 und 0 und
234 Kapitel 8<br />
die spätere Verknüpfung mit der Honorierung von Interesse, da damit die Steuerungswirkung<br />
einer ergebnisorientierten Honorierung bewertet werden kann (vgl. Kap. 8.1.3.4).<br />
AL in Tausend ha<br />
Anteil der Ackerflächen und der Fluren in<br />
N-Immissionsverminderungsgebieten durch ökologischen<br />
Ackerbau<br />
250,00<br />
200,00<br />
150,00<br />
100,00<br />
50,00<br />
0,00<br />
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65<br />
Verminderung der N-Immission in kg/ (ha a)<br />
Abbildung 54: Verteilung der Potentialflächen für die Verminderung von N-Immissionen unter Szenario 1<br />
(eigene Berechnungen, Datenquelle: Kersebaum 2004 und InVeKoS-Daten 2002)<br />
GL in Tausend ha<br />
100,00<br />
90,00<br />
80,00<br />
70,00<br />
60,00<br />
50,00<br />
40,00<br />
30,00<br />
20,00<br />
10,00<br />
0,00<br />
InVeKoS-Fläche AL 2002 Anzahl der Fluren<br />
Anteil der Grünlandflächen und der Fluren in<br />
N-Immissionsverminderungsgebieten durch<br />
extensive Grünlandnutzung<br />
0 5 10 15 20 25 30 35 40<br />
Verminderung der N-Immission in kg/ (ha a)<br />
InVeKoS-Fläche GL 2002 Anzahl der Fluren<br />
Abbildung 55: Verteilung der Potentialflächen für die Verminderung von N-Immissionen unter Szenario 2<br />
(eigene Berechnungen, Datenquelle: Kersebaum 2004 und InVeKoS-Daten 2002)<br />
0<br />
2500<br />
2000<br />
1500<br />
1000<br />
500<br />
0<br />
2500<br />
2000<br />
1500<br />
1000<br />
500<br />
Anzahl der Fluren<br />
Anzahl der Fluren
Beispiele für ergebnisorientierte Honorierungsansätze 235<br />
AL in Tausend ha<br />
Anteil der Ackerflächen und der Fluren in<br />
N-Immissionsverminderungsgebieten durch Umw andlung von<br />
konventionellem AL in extensives GL<br />
160,00<br />
140,00<br />
120,00<br />
100,00<br />
80,00<br />
60,00<br />
40,00<br />
20,00<br />
0,00<br />
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80<br />
Abbildung 56: Verteilung der Potentialflächen für die Verminderung von N-Immissionen unter Szenario 3<br />
(eigene Berechnungen, Datenquelle: Kersebaum 2004 und InVeKoS-Daten 2002)<br />
Auf der Grundlage dieser Daten wurde ein flächengewogener Mittelwert des N-<br />
Verminderungspotentials pro ha der aktuellen Potentialfläche für die drei Bewirtschaftungs-<br />
varianten berechnet. Demnach können durch die ökologische Ackernutzung im Durchschnitt<br />
20,1, durch die extensive Grünlandnutzung 5,8 und durch die Umstellung von Ackerland auf<br />
extensiv genutztes Grünland 44,0 kg N/(ha a) Immissionen in die ungesättigte Zone vermindert<br />
werden (siehe Abbildung 57). Die Ermittlung der maximalen N-Immissionsverminderung für<br />
Brandenburg ergibt, dass mit der ökologischen Ackernutzung 19.712 Tonnen im Jahr gegenüber<br />
einer konventionellen Nutzung, durch die extensive Nutzung des gesamten Grünlandes 1.563<br />
Tonnen im Jahr gegenüber einer konventionellen Nutzung und durch die Umwandlung des<br />
gesamten Ackerlandes in extensiv genutztes Grünland 43.829 Tonnen N pro Jahr erreicht werden<br />
könnten (vgl. Abbildung 57). 46.769 ha Ackerland und 28.760 ha Grünland wurden allerdings<br />
nicht mit berücksichtigt 139 , da für diese Flächen keine Angaben zum Verminderungspotential auf<br />
Flurebene vorlagen. Nimmt man für die InVeKoS-Flächen dieser Fluren den jeweiligen<br />
Mittelwert an, würden sich die absoluten N-Immissionsverminderungen pro Jahr noch einmal<br />
139 Angaben zu AL und GL (MLUR 2003b)<br />
Verminderung der N-Immission in kg/ (ha a)<br />
InVeKoS-Fläche AL 2002 Anzahl der Fluren<br />
1400<br />
1200<br />
1000<br />
800<br />
600<br />
400<br />
200<br />
0<br />
Anzahl der Fluren
236 Kapitel 8<br />
um 940 für Ökologischen Landbau, 166 für extensive Grünlandnutzung und 2.057 Tonnen pro<br />
Jahr für die Umwandlung von Ackerland in Grünland erhöhen.<br />
Die Auswertung der InVeKoS-Daten pro Flur bzgl. der im Jahr 2002 angewendeten<br />
Agrarumweltmaßnahmen ergab, dass mit diesen im Durchschnitt des Ökologischen Landbaus<br />
19,1, mit der extensiven Grünlandnutzung 6,1 und mit der Umwandlung von Ackerland in<br />
Grünland 50,8 kg N/(ha a) Immissionen verhindert werden 140 (vgl. Werte in Klammern in<br />
Abbildung 57). Damit bestätigt sich, dass die Maßnahmen wenig zielgerichtet sind, sondern eher<br />
die Durchschnittswerte von Brandenburg erreichen. Lediglich bei der Umwandlung von<br />
Ackerland in Grünland zeigen die Werte, dass die aktuellen Maßnahmen überdurchschnittlich<br />
effektiv sind.<br />
t N pro Jahr<br />
50000<br />
45000<br />
40000<br />
35000<br />
30000<br />
25000<br />
20000<br />
15000<br />
10000<br />
5000<br />
0<br />
N-Immissionsverminderungspotential von drei Szenarien für<br />
Brandenburg<br />
44,3<br />
20,1 (19,1)<br />
19712<br />
aktuell genutztes Ackerland wird<br />
ökologisch genutzt<br />
N-Immissionsreduzierungspotential in t N/ a<br />
43829<br />
Abbildung 57: N-Immissionsverminderung für drei Szenarien<br />
In Klammern sind die Werte für die aktuell stattfindenden Agrarumweltmaßnahmen aufgeführt. (eigene<br />
Berechnungen, Datenquelle: Kersebaum 2004 und InVeKoS-Daten 2002)<br />
Mit diesen Daten kann die Honorierung für die drei Verfahren prinzipiell ergebnisorientiert bzgl.<br />
des Ziels N-Immissionsverminderung gestaltet werden. Allerdings sind die dargestellten<br />
Immissionen nur Indikatoren für die ungesättigte Zone. Die eigentlichen Schutzgüter<br />
140 B3 AL = Ökologischer Landbau, A1, A2, B3 GL = extensive Grünlandnutzung, B5 = Umwandlung von<br />
Ackerland in extensiv genutztes Grünland, vgl. Tabelle A-5 im Anhang<br />
5,8<br />
(6,1)<br />
1563<br />
aktuelles Grünland wird extensiv<br />
genutzt<br />
Flächengewogenes Mittel des N-Immissionsreduzierungspotentials in kg N/ (ha a)<br />
(50,8)<br />
aktuelles Ackerland wird in Grünland<br />
umgewandelt<br />
50<br />
45<br />
40<br />
35<br />
30<br />
25<br />
20<br />
15<br />
10<br />
5<br />
0<br />
kg N pro ha und Jahr
Beispiele für ergebnisorientierte Honorierungsansätze 237<br />
‚landwirtschaftlich beeinflusste Qualität des Grundwassers’ und ‚landwirtschaftlich beeinflusste<br />
Qualität der Fließgewässer’ werden damit noch nicht indikativ abgebildet. Dazu sind die<br />
Immissionen in eben diese beiden Schutzgüter zu quantifizieren oder mindestens zu bewerten.<br />
Bewertung der N-Immissionen in das Grundwasser<br />
Bisher liegen für die Quantifizierung der Immissionen in das Grundwasser keine<br />
flächenrelevanten Modelle vor. Für Brandenburg erfolgte eine Bewertung der<br />
landwirtschaftlichen Standorte bzgl. ihrer Relevanz für Einträge ins Grundwasser aus der<br />
Kombination der Austauschhäufigkeit im Bodenwasser und der Grundwasserbedeckung<br />
(Kersebaum et al. 2004) (vgl. Kap. 8.1.3.2). Diese Bewertung liegt auf Flurebene vor, so dass<br />
damit die modellgestützten quantifizierten durchschnittlichen Immissionen in die ungesättigte<br />
Zone bewertet werden könnten. Dem entgegen steht jedoch, dass das Kriterium<br />
‚Austauschhäufigkeit des Bodenwassers’ für Immissionen in die ungesättigte Zone auch in der<br />
Modellierung berücksichtigt worden ist (vgl. Abbildung 58). Die vorliegende Bewertung der<br />
standörtlichen Relevanz für N-Immissionen ins Grundwasser bietet damit ideale<br />
Voraussetzungen für die Verknüpfung der Ergebnisse aus N-Bilanzen der Produktionsverfahren<br />
(Schlagbilanzen).<br />
Wurzelzone<br />
ungesättigte Bodenzone<br />
gesättigte Bodenzone<br />
(Grundwasser)<br />
Modell HERMES<br />
(Kersebaum et al. 2004)<br />
Relevanz für Immissionen ins<br />
Grundwasser (Kersebaum et al. 2004)<br />
Relevanz für Immissionen in die<br />
Oberflächengewässer (Steidl et al. 2003)<br />
Abbildung 58: Berücksichtigung der Retention und Verluste auf dem N-Eintragspfad im Rahmen der<br />
verwendeten Modelle bzw. Bewertungsansätze
238 Kapitel 8<br />
Als Variable zur Bewertung der hier verwendeten modellierten N-Immissionen kann die<br />
Information zu den Grundwasserdeckschichten direkt genutzt werden. Unter Bildung von<br />
Gewichtungsfaktoren für die drei Situationen ‚bedeckt’, wechselhaft’ und ‚unbedeckt’ (vgl.<br />
Tabelle 12) ist eine Bewertung der Immissionsverminderung in das Grundwasser prinzipiell<br />
möglich. Eine Gewichtung der Relevanzklasse ist unter Definition des Risikoverhaltens durch<br />
Experten vorzunehmen 141 .<br />
Bewertung der N-Immissionen in das Flusssystem<br />
Grundlage ist die Bewertung der Standorte nach Steidl et al. (2003) (vgl. Kap. 8.1.3.2). Eine<br />
Quantifizierung der Reduktionspotentiale ist in jedem Fall nur als Abschätzung möglich (Steidl<br />
et al. 2002b: 96). Bezüglich der Standortklassen, die aufgrund des Kriteriums ‚Austragszeit’<br />
bewertet wurden (vgl. Tabelle 13) ist eine Abschätzung des Nitratabbaus bis zum Immissionsort<br />
(Entlastungsgewässer) möglich. Es ergibt sich nach der Methode, die der Bewertung nach Steidl<br />
et al. zugrunde liegt, eine Nitratkonzentration beim Erreichen der Entlastungsgewässer nach 5<br />
Jahren von 50 %, nach 10 Jahren von 25% und nach 50 Jahren von weniger als 0,1 % der<br />
ursprünglichen Konzentration am Emissionsort (Steidl et al. 2002b). Auf dieser Grundlage<br />
können Gewichtungsfaktoren für die N-Immissionen in die Oberflächengewässer definiert<br />
werden, da damit direkt an die modellierten N-Immissionen in die ungesättigte Zone angeknüpft<br />
werden kann (vgl. Abbildung 58). Dies gilt unter der Annahme, dass kein Nitratabbau und kein<br />
interflow auf dem Weg zum Grundwasser stattfindet. In Tabelle 14 sind Vorschläge für<br />
Gewichtungsfaktoren in Abhängigkeit der Bewertungsklassen definiert. Der Gewichtungsfaktor<br />
für die Bewertung ‚gering relevant’ (vgl. Tabelle 13) wurde einheitlich gewählt, fußt jedoch auf<br />
der austragszeitabhängigen Bewertung. Die grobe Stufung verdeutlicht die Unsicherheit, die mit<br />
der Bewertung der Standorte verbunden ist.<br />
141 Es wäre zu prüfen, ob die deutschlandweit vorliegenden Daten (ebenfalls modelliert) zum baseflow-Index nicht<br />
ebenfalls oder besser geeignet sind (Neumann & Wycisk 2003).
Beispiele für ergebnisorientierte Honorierungsansätze 239<br />
Tabelle 14: Vorschlag für Gewichtungsfaktoren in Anlehnung an die geschätzten N-Immissionen in das<br />
Flusssystem<br />
Relevanzklasse für N-Immissionen in<br />
die Flusssysteme<br />
Gewichtungsfaktor für die Bewertung der modellierten<br />
Immissionen in die ungesättigte Zone<br />
sehr relevant 1<br />
relevant 0,5<br />
gering relevant 0,25<br />
nicht relevant 0<br />
Quelle: in Anlehnung an Vorschläge für Gewichtungsfaktoren in Steidl et al. 2002b<br />
8.1.3.4 Honorierungsverfahren<br />
Prinzipiell stehen mit den rationalisierten N-Immissionen auf Flurebene Optimierungsgrößen für<br />
verschiedene Honorierungsinstrumente zur Verfügung, so z. B. auch für Bieterverfahren.<br />
Im Rahmen dieser Arbeit wird ein sehr pragmatisch gewähltes Beispiel für die Nutzung der N-<br />
Immissionen als Anreizkomponente im Rahmen des europäischen Honorierungssystems (aktuell<br />
nach VO (EG) 1257/1999) gewählt. Der Ansatz zeichnet sich vor allen Dingen dadurch aus,<br />
unter den gegebenen Rahmenbedingungen der EU (vgl. Kap. 7.1.2) und der WTO (vgl. Kap.<br />
7.1.1) kurzfristig in der Praxis umsetzbar zu sein und damit aktuell flächenrelevant werden zu<br />
können. Es wurde mehrmals auf die entscheidende aktuelle und wohl auch künftige Restriktion<br />
hingewiesen, dass sich der Preis an den Herstellungskosten zu orientieren hat und dass aktuell<br />
lediglich ein Anreiz von 20 % dieser Herstellungskosten zugelassen wird. Dies wurde als feste<br />
Restriktion angenommen. Darüber hinaus wurden die modellierten Immissionen in die<br />
ungesättigte Zone Ansatzstelle für die Honorierung genutzt. Die weitere Bewertung, im<br />
Speziellen die Bildung von Faktoren bzgl. der Immissionen ins Grundwasser und in die<br />
Flusssysteme bedarf erst einer weiteren Diskussion und Festlegung durch Experten.<br />
Folgender Ansatz wird vorgeschlagen:<br />
Die Honorierung ökologischer Leistungen setzt sich zusammen aus einer maßnahmenorientierten<br />
Grundvergütung und einer ergebnisorientierten Qualitätshonorierung. Dieser Ansatz wird den<br />
Rahmenbedingungen am besten gerecht und ist auch für die Honorierungsansätze geeignet, bei<br />
denen die ergebnisorientierte Honorierung an Zustands-Indikatoren ansetzt und damit eine<br />
Risikoübernahme vom Landwirt verlangt (vgl. Kap. 6.3.5.1). Die Grundvergütung stellt einen<br />
kalkulierbaren Preisanteil dar.
240 Kapitel 8<br />
Wie ein derartiger Ansatz für die ergebnisorientierte Honorierung der Verminderung der N-<br />
Immissionen in die Gewässer aussehen kann, wird für die drei Maßnahmen ökologische<br />
Ackernutzung, extensive Grünlandnutzung und die Umwandlung von Ackerland in Grünland<br />
aufgezeigt. Dabei wird folgendermaßen vorgegangen:<br />
1. Bestimmung der Relevanz der Maßnahmen für das Ziel der N-Immissionsverminderung in<br />
die Gewässer,<br />
2. Feststellung des Handlungsbedarfs,<br />
3. Bestimmung des Preises pro kg N Immissionsverminderung im Jahr.<br />
Schritt 1<br />
Die Relevanz wird auf der Grundlage des flächengewogenen Mittelwertes der N-Verminderung<br />
pro ha und Jahr festgestellt. Wie in Abbildung 57 dargestellt, unterscheidet sich dieser Wert stark<br />
innerhalb der einzelnen Maßnahmen. Während mit der ökologischen Ackernutzung und der<br />
Umwandlung von konventionellem Ackerland in extensives Grünland mit 20 und 44 kg/(ha a)<br />
eine relevante Größe realisiert werden kann, sind die Effekte der extensiven Grünlandnutzung<br />
gering. Für die durchschnittlichen 5,8 kg N/(ha a) lohnt sich, allein aus Gründen der<br />
Transaktionskosten, keine ergebnisorientierte Honorierung der N-Immissionsverminderung, so<br />
dass diese Maßnahme im Folgenden nicht weiter berücksichtigt wird. Die Flächenverteilung der<br />
Potentialflächen beim Ökologischen Landbau (vgl. Abbildung 55) deutet darauf hin, dass die<br />
Effektivitätsverbesserung durch eine ergebnisorientierte Honorierung bei dieser Maßnahme<br />
geringer ist als bei der Ackerumwandlung (vgl. Abbildung 56), da sich der größte Anteil der<br />
Potentialfläche beim Ökologischen Landbau im Bereich des Durchschnittes befindet. Ein<br />
Effektivitätssteigerungspotential wird jedoch beiden zugesprochen.<br />
Schritt 2<br />
Auf der Grundlage der aktuellen Daten der angewendeten Maßnahmen wird der<br />
Handlungsbedarf bestimmt. Ausgangspunkt dafür sind flächengewogene Mittelwerte der<br />
Immissionsverminderung der aktuell durchgeführten Maßnahmen gegenüber dem Durchschnitt<br />
des jeweiligen Regelungsraums. Liegt der Mittelwert der aktuellen Maßnahmen bereits deutlich<br />
oberhalb des räumlichen Mittelwertes, besteht wenig Handlungsbedarf, ergebnisorientierte<br />
Honorierung einzusetzen. Bezogen auf Brandenburg zeigen die Daten, dass die aktuellen<br />
Flächen des Ökologischen Landbaus im Durchschnitt mit 19,1 kg N/(ha a) noch unter dem Wert<br />
der Brandenburger Flächen mit 20,1 kg N/(ha a) liegen. Die Umwandlung von Ackerland in
Beispiele für ergebnisorientierte Honorierungsansätze 241<br />
extensives Grünland wird hingegen überdurchschnittlich effektiv angewendet (vgl. Abbildung 57<br />
und deren Erläuterung). Bei beiden Maßnahmen zeigen die Daten jedoch, dass noch<br />
Effektivitätsgewinne möglich sind und eine ergebnisorientierte Anreizkomponente sinnvoll ist.<br />
Schritt 3<br />
Insgesamt darf die Honorierung nicht 120 % der ermittelten Kosten für die Erbringung der<br />
Leistung übersteigen. Mit dem jeweils sehr genau ermittelten Mittelwert der N-<br />
Immissionsverminderung durch die Maßnahmen liegt ein Wert vor, der als Ausgangspunkt für<br />
die Bestimmung der Prämie pro kg N genutzt werden kann. Dieser Mittelwert kann den<br />
durchschnittlichen Kosten für die Maßnahme gegenübergestellt werden. Das heißt, Landwirte,<br />
die den N-Immissionsverminderungsdurchschnitt erreichen, sind berechtigt, die volle Prämie zu<br />
erzielen (normative Annahme). Da 20 % Anreiz für die Verteilung der Immissionen oberhalb des<br />
Durchschnittes zur Verfügung stehen, kann 20 % der Prämie auf die durchschnittliche N-<br />
Immissionsverminderung angerechnet werden. Daraus ergibt sich folgende Gleichung für die<br />
Bestimmung der Prämie pro kg N/a.<br />
PN =<br />
PFla * 20/100<br />
MNM<br />
PN = Prämie in €/ (kg N)<br />
PFla = Aktuelle Flächenprämien in €/ (ha a)<br />
MNM = Flächengewogener Mittelwert der N-Immissionsverminderung<br />
der Maßnahme in kg N/ (ha a)<br />
Um die Steuerungswirkung unter den gegebenen Rahmenbedingungen und bei gleichem Budget<br />
zu verbessern, erhalten die Landwirte 80 % der aktuellen Flächenprämie (80 % der<br />
durchschnittlichen Kosten der Maßnahme) als Sockelbetrag maßnahmenorientiert und 40 %<br />
ergebnisorientiert. Ist für eine Maßnahme die gesellschaftliche Nachfrage, für die die Prämie<br />
gezahlt wird, multifunktional, wird eine ergebnisorientierte Honorierung nur als Anreiz von 100-<br />
120 % eingesetzt. Dies trifft für den Ökologischen Landbau zu 142 . Aus Gründen der Effizienz<br />
wird eine einheitliche Prämie für alle Maßnahmen pro kg N-Immissionsverminderung gezahlt.<br />
Die Prämie richtet sich nach den geringsten Vermeidungskosten bzw. dem preiswertesten<br />
142 Es ist erklärtes politisches Ziel, die Fläche des ökologischen Landbaus zu erhöhen (BMVEL).
242 Kapitel 8<br />
Angebot. Im Vergleich der beiden Maßnahmen ergibt sich, dass das kg N an<br />
Immissionsverminderung nach der obigen Formel bei den aktuellen Prämien in Brandenburg für<br />
die ökologische Ackernutzung 1,50 € und für die Umwandlung von Ackerland in Grünland<br />
1,16 € kostet (vgl. Tabelle 15).<br />
Tabelle 15: Prämienkalkulation pro kg verminderter N-Immission für zwei Agrarumweltmaßnahmen<br />
Maßnahme Aktuelle<br />
Flächenprämienhöhe<br />
ökologische<br />
Ackernutzung<br />
Umwandlung von<br />
Ackerland in extensiv<br />
genutztes Grünland<br />
in €/(ha a)<br />
Durchschnittliche N-<br />
Immissionsverminderung<br />
in kg N/(ha a)<br />
Prämie pro N-<br />
Immissionverminderung<br />
in €/(kg N)<br />
150 20 1,50<br />
255 44 1,16<br />
Das Verfahren lässt sich in dem vorgegebenen Rahmen sehr gut variieren und an die Akzeptanz<br />
bzw. die aktuell auftretenden Knappheiten anpassen. Soll der Spielraum des 20 %igen Anreizes,<br />
den die EU bisher zulässt, voll ausgenutzt werden, kann sich die Prämie pro kg N-<br />
Immissionsverminderung an den teuersten Vermeidungskosten orientieren. Für die preiswerteren<br />
Maßnahmen bzgl. der N-Immissionsvermeidung muss die Prämie dann bei 120 % der<br />
Maßnahmenkosten gedeckelt werden. Durchschnittsprämien aus allen relevanten Maßnahmen<br />
sind in gleicher Weise umsetzbar. Was dem Konzept der ergebnisorientierten Honorierung<br />
entgegen wirkt, ist eine maßnahmenabhängige Prämienhöhe.<br />
Für die Maßnahmen ökologische Ackernutzung und Umwandlung von Ackerland in extensives<br />
Grünland ergeben sich nach dem beschriebenen Verfahren die in Abbildung 59 dargestellten<br />
Förderungssätze. Die Deckelung im Fall der Variante ‚Orientierung an den hohen<br />
Vermeidungskosten’ für die Umwandlung von Acker- in Grünland bewirkt, dass bei der<br />
vorgeschlagenen Honorierung jede weitere Immissionsvermeidung ab 68 kg N/(ha a) nicht mehr<br />
honoriert wird. Allerdings gilt dies nur, wenn die gesamte Umwandlungsfläche hoch effektiv ist<br />
(mehr als 68 kg N Immissionsvermeidung pro ha und Jahr). Ansonsten dürfte aus der EU-<br />
Rechtslage nichts gegen eine Ausnutzung des Puffers sprechen, der aufgrund der gesamten<br />
Umwandlungsfläche gegebenenfalls besteht. Des Weiteren ist zu beachten, dass bei einer Prämie<br />
von 1,5 €/kg N bereits für Flächen in Fluren mit einer Verminderung von 34 statt 44 kg N/(ha a)<br />
Beträge gezahlt werden, die 100 % der kalkulierten Kosten entsprechen. In den Abbildungen
Beispiele für ergebnisorientierte Honorierungsansätze 243<br />
A-14 und A-15 im Anhang sind für die ökologische Ackernutzung und die Umwandlung von<br />
konventionellem Ackerland in extensives Grünland die Fluren dargestellt, auf denen die<br />
Landwirte bei einer Prämie von 1,5 €/kg N überdurchschnittlich honoriert werden würden.<br />
Prozent der kalkulierten Kosten der Maßnahme<br />
120<br />
100<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
0<br />
Abbildung 59: Vorschlag für eine ergebnisorientierte Honorierung der N-Immissionsverminderung für zwei<br />
Agrarumweltmaßnahmen unter Nutzung von zwei Optimierungsstrategien<br />
8.1.3.5 Diskussion und Ausblick<br />
Die ergebnisorientierten Anreize werden für die Entscheidung eines Landwirtes zur Umstellung<br />
auf Ökologischen Landbau in der Praxis in Brandenburg wahrscheinlich aufgrund der<br />
Flächenverteilung (s. S. 240), aber auch aufgrund der Tatsache, dass eine derartige<br />
Betriebsentscheidung von einer Vielzahl an Faktoren bestimmt wird, relativ geringen Einfluss<br />
haben. Die Umwandlung von Ackerland in Grünland ist jedoch sehr gut für ergebnisorientierte<br />
Honorierung geeignet, nicht zuletzt, da hierbei Einzelflächen eines Betriebes gezielt ausgewählt<br />
werden können.<br />
Prämie pro kg<br />
N-Immissionsverminderung resultiert aus<br />
geringsten<br />
höchsten<br />
Vermeidungskosten<br />
Vermeidungskosten<br />
1,16 €/kg N<br />
ab 20 kg N/ ha<br />
150<br />
€/ha<br />
1,16 €/kg N<br />
204<br />
€/ha<br />
1,5 €/kg N ab<br />
20 kg N/ ha<br />
150<br />
€/ha<br />
1,5 €/kg N<br />
bis max.<br />
102 €/ha<br />
204<br />
€/ha<br />
AL ökol. Al in GL AL ökol. AL in GL<br />
ergebnisorienterte<br />
Honorierung<br />
maßnahmenorientierte<br />
Honorierung<br />
Eine ergebnisorientierte Honorierung kann dabei gezielt dort eingesetzt werden, wo aus der<br />
Bestandsaufnahme der Wasserrahmenrichtlinie Handlungsbedarf abgeleitet wurde, also dort, wo<br />
die gesellschaftliche Nachfrage besteht. Einer differenzierten Nachfrage kann durch
244 Kapitel 8<br />
unterschiedliche Ausgestaltung und damit Steuerungswirkung der Anreize begegnet werden<br />
(s. o. diskutierte Wirkung unterschiedlicher Prämienhöhe pro kg N-Verminderung). Die<br />
Regelungsräume ergeben sich aus den künftigen Gebieten, für die die Bewirtschaftungspläne<br />
erstellt werden. Ob dies für Koordinierungsräume oder einzelnen Bearbeitungsgebiete in<br />
Brandenburg stattfindet, wird sich nicht zuletzt aus der Bestandsaufnahme ergeben, die Ende<br />
2004 abgeschlossen werden wird.<br />
Die hier vorgestellte Methode zur ergebnisorientierten Honorierung bietet insbesondere für die<br />
horizontalen Ackermaßnahmen, die aktuell im Rahmen der Modulation angeboten werden,<br />
Möglichkeiten der Effektivitäts- und Effizienzsteigerung (z. B. für Fruchtfolgen mit<br />
Zwischenfrüchten und Untersaaten, vgl. für Brandenburg aktuelle Fördertatbestände des<br />
KULAP). Dies gilt insbesondere, da das Ziel dieser Maßnahmen neben der Erosionsvermeidung<br />
hauptsächlich auf die Verminderung von Stoffeinträgen in die Gewässer abzielt. Von daher wäre<br />
eine Modellierung derartiger Fruchtfolgen, wie sie aktuell gefördert werden, besonders<br />
interessant, um diese für eine ergebnisorientierte Honorierung zu rationalisieren. Dabei könnten<br />
Prämienkalkulationen für derartige Maßnahmen auch zu 50 % und mehr ergebnisorientiert<br />
gestaltet werden, sofern der politische Wille, das heißt versteckte Distributionskriterien, dem<br />
nicht entgegenstehen. Die Modulationsmaßnahmen sollten in jedem Fall nicht dazu dienen, das<br />
in der ersten Säule eingesparte Geld unter dem Deckmantel von Umweltmaßnahmen wieder<br />
‚gerecht’ über das Land zu verteilen.<br />
Für die Weiterentwicklung derartiger Ansätze werden aktuell sehr gute Bedingungen geschaffen,<br />
indem in ganz Europa das Integrierte Verwaltungs- und Kontrollsystem (InVeKoS) an GIS-<br />
Systeme 143 gekoppelt werden und dies auf einer Maßstabsebene, die ergebnisorientierte<br />
Honorierungsansätze sehr gut unterstützen würde. Die kleinste räumliche Einheit, der künftig die<br />
Fördertatbestände zugeordnet werden, ist mindestens der Feldblock (in Deutschland alle Länder<br />
außer Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland) oder noch<br />
großmaßstäbigere Einheiten (in Deutschland Feldstück in Bayern sowie Schlag in Baden-<br />
Württemberg, Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland). Der Feldblock ist definiert als die<br />
landwirtschaftlich nutzbare Fläche innerhalb von naturräumlichen und/oder urbanen Grenzen,<br />
also innerhalb der so genannten Außengrenze der Landwirtschaft 144 .<br />
143 vgl. aktuelle Anforderungen an das InVeKoS laut VO (EG) 1593/2000 und VO (EG) 118/2004<br />
144 Der Feldblock wird in der Regel vollständig von nicht landwirtschaftlich nutzbaren Flächen umgeben (Wege,<br />
Gräben, Straßen, Ortschaften usw.) Ein Feldblock kann in Feldstücke oder Schläge gegliedert sein, beinhaltet jedoch<br />
immer nur eine bestimmte Bodennutzungskategorie, d. h. entweder Ackerland oder Grünland oder Dauerkulturen.
Beispiele für ergebnisorientierte Honorierungsansätze 245<br />
Die hier vorgestellte Methode der mittleren N-Immissionsminderung pro Flur für die einzelnen<br />
Maßnahmen kann in gleicher Weise auf die Ebene des Feldblocks angewendet werden und die<br />
Zielgenauigkeit bzw. die Validität der Immissions-Indikatoren weiter verbessern.<br />
8.2 Ergebnisorientierte Honorierung im Rahmen von Artikel 16-Maßnahmen zur<br />
Umsetzung der FFH-Richtlinie<br />
8.2.1 Rahmenbedingungen – Voraussetzungen für ergebnisorientierte Honorierung<br />
8.2.1.1 Natura 2000-Netzwerk<br />
Mit dem Naturschutzkonzept ‚Natura 2000’ verfolgt die Europäische Union das Ziel, ein<br />
flächendeckendes Netz von Schutzgebieten in allen Mitgliedstaaten zu errichten. Mit Hilfe der<br />
Schutzgebiete soll die biologische Vielfalt in Europa bewahrt werden (z. B. Ssymank 1994,<br />
Gellermann 1998, Ssymank et al. 1998).<br />
Natura 2000 basiert auf zwei Richtlinien der Europäischen Union, der Vogelschutzrichtlinie<br />
(79/409/EWG) aus dem Jahr 1979 und der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-Richtlinie)<br />
(92/43/EWG) aus dem Jahr 1992. Die beiden Richtlinien verpflichten die Mitgliedstaaten,<br />
naturschutzfachlich geeignete Gebiete als Natura 2000 auszuweisen. Die Gebiete werden<br />
ausgewählt anhand von gefährdeten Lebensraumtypen (LRT), die im Anhang I der FFH-<br />
Richtlinie aufgeführt sind, und von Tier- und Pflanzenarten, die im Anhang II der FFH-<br />
Richtlinie bzw. im Anhang I der Vogelschutzrichtlinie benannt sind. Sobald die<br />
gemeinschaftliche Liste aller Natura 2000-Gebiete vom Europäischen Rat beschlossen worden<br />
ist, sind die Mitgliedstaaten verpflichtet, die gemeldeten Gebiete unter den Schutz des nationalen<br />
Rechts zu stellen. Das Natura 2000-Netzwerk wird sich aus ‚Special Protection Area’ (SPA) für<br />
wildlebende Vogelarten infolge der Umsetzung der Vogelschutz-Richtlinie und ‚Special Areas<br />
of Conservation’ (SAC) als Umsetzung der FFH-Richtlinie zusammensetzen. Der Aufbau des<br />
Natura 2000-Netzes und eine Erläuterung der Gebietskategorien ist in Abbildung A-16 im<br />
Anhang dargestellt.<br />
Der EuGH hat klargestellt, dass die Auswahl der Gebiete allein den naturschutzfachlichen<br />
Kriterien der Richtlinie genügen muss und keine Handlungsspielräume für politische, soziale<br />
oder wirtschaftliche Abwägung lässt. Es hängt selbstverständlich trotzdem in hohem Maß von<br />
der Willfähigkeit und der Durchsetzungsfähigkeit der verantwortlichen Behörden der<br />
Mitgliedstaaten ab, diese Anforderung im politischen Raum umzusetzen. Die zögerliche<br />
Meldung, die Diskrepanz zwischen den durch die Bundesländer gemeldeten Listen und den
246 Kapitel 8<br />
Schattenlisten von Naturschutzverbänden sowie Rechtsstreite sind Ausdruck für die Problematik<br />
bereits im Zuge der Meldung.<br />
Nach dem weitgehenden Abschluss der Gebietsmeldung der EU-Staaten an die EU im Jahr<br />
2004 145 steht aktuell die Festlegung der konkreten Erhaltungsmaßnahmen in den besonderen<br />
Schutzgebieten (SAC) 146 auf der Agenda der Mitgliedstaaten. Artikel 6 Absatz 1 der FFH-<br />
Richtlinie beschreibt ein allgemeines Erhaltungssystem, das von den Mitgliedstaaten für die<br />
SAC festzulegen ist. Dabei sind die Mitgliedstaaten zur Festlegung von Erhaltungsmaßnahmen<br />
verpflichtet. Diese Maßnahmen müssen den ökologischen Erfordernissen der natürlichen LRT in<br />
Anhang I und der Arten in Anhang II, die in dem betreffenden Gebiet vorkommen, genügen. Die<br />
ökologischen Erfordernisse umfassen alle für die Gewährleistung eines günstigen<br />
Erhaltungszustands 147 erforderlichen ökologischen Faktoren. Sie lassen sich nur für den jeweils<br />
konkreten Fall und auf der Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse bestimmen.<br />
Der Artikel 6, Absatz 1 der FFH-Richtlinie gibt die Art der möglichen Erhaltungsmaßnahmen<br />
vor, die von den Mitgliedstaaten genutzt werden können. Als Erhaltungsmaßnahmen sind „ ...<br />
geeignete Maßnahmen rechtlicher, administrativer oder vertraglicher Art … “ und<br />
„gegebenenfalls geeignete ... Bewirtschaftungspläne“ genannt. Der Begriff „gegebenenfalls“<br />
bezieht sich ausschließlich auf die Bewirtschaftungspläne und nicht auf die rechtlichen,<br />
administrativen oder vertraglichen Maßnahmen. Die Entscheidung, ob auf dem konkreten Gebiet<br />
rechtliche, administrative oder vertragliche Maßnahmen oder auch Bewirtschaftungspläne<br />
Anwendung finden, bleibt den Mitgliedstaaten überlassen. Jedoch müssen die Mitgliedstaaten<br />
wenigstens eine der drei Kategorien (Maßnahmen rechtlicher, administrativer, vertraglicher Art)<br />
auswählen. Bei der Auswahl der geeigneten Maßnahmen sind auch die in Artikel 2 Absatz 3<br />
genannten sozioökonomischen Forderungen zu berücksichtigen 148 .<br />
Die Umsetzung des Natura 2000-Schutzgebietssystems in nationales Recht erfolgte im April<br />
1998 durch eine Novelle des BNatSchG.<br />
145<br />
Aktuell läuft allerdings noch einmal eine Nachmeldung (so genannte dritte Tranche), zu der einige Bundesländer<br />
von der EU verpflichtet wurden.<br />
146<br />
Artikel 6 Abs. 1 bezieht sich nur auf die Special Area of Conservation (SAC) nach Artikel 4 Abs. 4 der FFH-<br />
Richtlinie und nicht auf Special Protection Areas (SPA) nach Artikel 4 Abs. 1 Vogelschutzrichtlinie (vgl. zur<br />
Unterscheidung Abbildung A-16 im Anhang).<br />
147<br />
zur Definition von günstigem Erhaltungszustand vgl. Artikel 1 e) und i) FFH-Richtlinie<br />
148<br />
„Die aufgrund dieser Richtlinie getroffenen Maßnahmen tragen den Anforderungen von Wirtschaft, Gesellschaft<br />
und Kultur sowie den regionalen und örtlichen Besonderheiten Rechnung“ (Art. 2, Abs. 3 FFH-Richtlinie)
Beispiele für ergebnisorientierte Honorierungsansätze 247<br />
Das Bundesnaturschutzgesetz geht davon aus, dass die FFH- und Vogelschutzgebiete im<br />
Regelfall unter Schutz gestellt werden, indem die SPA und SAC, einschließlich etwaiger<br />
Pufferzonen, als Schutzgebiet nach einer der im Bundesnaturschutzgesetz vorgesehenen<br />
Schutzgebietskategorien ausgewiesen werden.<br />
Die Besonderheit der Unterschutzstellung als Natura 2000-Gebiet besteht nach § 33 Abs. 3<br />
BNatSchG darin, dass die Schutzgebietsverordnung auf den speziellen Schutzzweck des Arten-<br />
und Habitatschutzes ausgerichtet wird. Es genügt demnach nicht, eine Standard-<br />
Schutzverordnung zu erlassen. Vielmehr sind die in der Schutzgebietsverordnung enthaltenen<br />
Ver- und Gebote an die Bedürfnisse der zu schützenden Arten nach Anhang II und LRT nach<br />
Anhang I der FFH-Richtlinie anzupassen. Erlaubnisvorbehalte und Befreiungsmöglichkeiten<br />
sind so auszugestalten, dass sie den Anforderungen des § 34 BNatSchG entsprechen. Sofern<br />
bestehende Schutzgebiete zum Natura 2000-Gebiet erklärt werden, sind die bestehenden<br />
Schutzgebietsverordnungen zu überarbeiten. In jedem Fall sind die Erhaltungsziele für das<br />
Gebiet konkret zu benennen und das Vorkommen prioritärer Arten oder Lebensräume<br />
darzustellen (§ 33 Abs. 3 Sätze 1, 2 BNatSchG).<br />
Das Bundesnaturschutzgesetz weist in diesem Zusammenhang auf die Möglichkeit hin, von einer<br />
ordnungsrechtlichen Unterschutzstellung absehen zu können, wenn „nach anderen<br />
Rechtsvorschriften, nach Verwaltungsvorschriften, durch die Verfügungsbefugnis eines<br />
öffentlichen oder gemeinnützigen Trägers oder durch vertragliche Vereinbarungen ein<br />
gleichwertiger Schutz gewährleistet ist“ (§ 33 BNatSchG).<br />
Andere Rechtsvorschriften können z. B. Verordnungen/Satzungen über Wasserschutzgebiete,<br />
Überschwemmungsgebiete oder Schutz-, Bann- und Schonwälder sein. Diese Rechtsvorschriften<br />
sind ebenfalls an die Erhaltungsziele des Natura 2000-Gebietes anzupassen. Als geeignete<br />
Rechtsvorschriften kommen auch Vorschriften des Raumplanungsrechts in Betracht, so etwa die<br />
Festsetzung als Vorranggebiet nach § 7 Abs. 4 Nr. 1 Raumordnungsgesetz. Dieses Instrument ist<br />
sinnvoll, wenn Kulturlandschaften großflächig wegen des Schutzes einer bestimmten Art zum<br />
Natura 2000-Gebiet erklärt werden.<br />
Verwaltungsvorschriften, die den einzelnen Bürger nicht binden, kommen als gleichwertiges<br />
Schutzinstrument nur in Frage, wenn der Staat selbst Eigentümer der Flächen ist. So kann die<br />
den Erhaltungszielen des Natura 2000-Gebietes entsprechende Bewirtschaftung von<br />
Staatswäldern oder Bundesforsten mittels interner Verwaltungsvorschriften geregelt werden.
248 Kapitel 8<br />
Die Verfügungsbefugnis öffentlicher oder gemeinnütziger Träger dürfte für sich genommen nur<br />
ausnahmsweise ausreichen, um einen gleichwertigen Schutz sicherzustellen (z. B.<br />
Nationalparkflächen, die von einer Nationalparkverwaltung betreut werden). In jedem Falle ist<br />
zu gewährleisten, dass das Verschlechterungsverbot beachtet wird und Bewirtschaftungspläne<br />
für das Gebiet eingehalten werden. Diese Ziele können auch durch ergänzende vertragliche<br />
Vereinbarungen erreicht werden.<br />
Auch rein vertragliche Vereinbarungen reichen in vielen Fällen nicht aus, um den<br />
Anforderungen des § 33 Abs. 4 BNatSchG Genüge zu tun (vgl. Schmidt-Moser 2000). Die<br />
Verträge sind darüber hinaus so auszugestalten, dass die öffentliche Hand wirksam auf die<br />
Vertragsdurchführung Einfluss nehmen und Vertragsverstöße sanktionieren kann.<br />
Jedoch reichen für bestimmte kulturbestimmte LRT nach Anhang I (Wiesen und Weiden) und<br />
Arten nach Anhang II, die in diesen Habitaten leben, nach Meinung der EU-Kommission<br />
Vereinbarungen mit den Landwirten im Rahmen der VO (EG) 1257/1999 als vertragliche<br />
Maßnahmen in den meisten Fällen aus, um einen ‚günstigen Erhaltungszustand’ der LRT und<br />
Arten zu bewahren. Es wird jedoch auch darauf verwiesen, dass der Mitgliedstaat, der<br />
vertragliche Maßnahmen wählt, stets verpflichtet ist, die erforderlichen Erhaltungsmaßnahmen<br />
auf eine dauerhafte Art und Weise umzusetzen (vgl. COM 2000d).<br />
Die verschiedenen Instrumente zur Unterschutzstellung der Natura 2000-Gebiete können<br />
miteinander kombiniert werden. Teilweise dürfte erst die Kombination verschiedener<br />
Maßnahmen und Vorschriften dafür sorgen, dass die Ziele für Natura 2000-Gebiete praktisch<br />
erreicht werden.<br />
Mit dem Artikel 16 der VO (EG) 1257/1999 (vgl. Kap. 7.1.2.2) wird der Ansatz eines<br />
Instrumentenmixes aufgegriffen, in dem ordnungsrechtliche Auflagen und Zahlungen<br />
miteinander verbunden werden. Neben den freiwilligen Agrarumweltmaßnahmen fördert die EU<br />
damit gezielt die Umsetzung der FFH-Richtlinie im Zusammenhang mit landwirtschaftlich<br />
genutzten Flächen.<br />
Im Zuge der Umsetzung der FFH-Richtlinie kann die ergebnisorientierte Honorierung für<br />
ökologische Leistungen in Natura 2000-Gebieten in der Praxis an Bedeutung gewinnen, da sich<br />
diese gerade im Zusammenspiel von ordnungsrechtlichen Auflagen und ökonomischen<br />
Instrumenten als besonders geeignet erweist. Im Folgenden wird die besondere Eignung der<br />
ergebnisorientierten Honorierung im Zuge der Umsetzung der FFH-Richtlinie erläutert.
Beispiele für ergebnisorientierte Honorierungsansätze 249<br />
8.2.1.2 Rationalisierte Umweltziele<br />
Die FFH-Richtlinie und die darauf aufbauenden Handbücher (vgl. COM 1999b, Ssymank et al.<br />
1998, Beutler & Beutler 2002) definieren die Schutzziele auf der Ebene von Arten und LRT.<br />
Arten und LRT stellen weitgehend operationalisierte Zielkategorien dar. Damit ist auch bei der<br />
FFH-Richtlinie, wie bei der WRRL-Richtlinie, eine Grundvoraussetzung für den Einsatz von<br />
ökonomischen Instrumenten gegeben.<br />
Bei Arten handelt es sich um einen wissenschaftlich vergleichsweise klar definierten Typus (vgl.<br />
z. B. Reck 2004) und damit um ein operationalisiertes Ziel. Allerdings erfüllen die Zielarten 149<br />
nicht in jedem Fall die Kriterien von Indikatoren als Ansatzstelle für relative Eigentumsrechte<br />
(vgl. Abbildung 20), stellen also nicht in jedem Fall rationalisierte Ziele dar. So können z. B.<br />
Populationsschwankungen oder auch ein starkes Verharrungsvermögen einer Verknüpfung mit<br />
der Honorierung entgegenstehen, da sie nicht in vertragstauglicher Zeit reagieren (vgl. Beispiel<br />
des Großen Brachvogels in Kap. 6.3.4.3).<br />
Neben den Zielarten können auch die LRT, wenn auch weniger eindeutig und nicht bei allen<br />
LRT, als wissenschaftlicher Typus, als wissenschaftliches Sachmodell, gefasst werden. Eine<br />
eindeutige Verknüpfung des gesellschaftlichen Zieltyps ‚LRT x’ zu einem objektiv definierten<br />
‚Vegetationstyp y’ im Sinne LRT x = Vegetationstyp y ist prinzipiell konstruierbar (vgl. Kap.<br />
6.3.5.2 sowie Ausführungen S. 114). Im Zuge der Beschreibung der LRT durch die EU (COM<br />
1999b), den Bund (Ssymank et al. 1998) und die Länder (z. B. Brandenburg Beutler & Beutler<br />
2002) erfolgte bereits einer Verknüpfung. Allerdings nicht in der oben aufgeführten<br />
Gleichsetzung, sondern in einer Subsumtion beschriebener pflanzensoziologischer Einheiten<br />
unter die jeweiligen LRT. Dabei wurde unterschieden, ob eine bestimmte Pflanzengesellschaft<br />
vollständig (v) 150 unter den LRT oder nur teilweise (pp) 151 unter den LRT subsumiert wird (vgl.<br />
Anlagen A-3.1 und A-3.2, Steckbriefe für zwei LRT im Anhang). Diese Verknüpfung begründet<br />
sich nicht zuletzt darin, dass die Typisierung der LRT wesentlich auf das europäische System der<br />
Biotoptypen ‚CORINE biotopes’ aufbaut, bei dem sich stark an vegetationskundlichen Einheiten<br />
nach der ‚Braun-Blanquet-Schule’ orientiert wurde (vgl. COM 1989, 1991, 1992, 1999b). Von<br />
daher war die ‚Konstruktionsleistung’ weniger schwierig. Dass es sich dabei tatsächlich um eine<br />
Konstruktionsleistung handelt, wird anhand der unterschiedlichen Zuordnung von<br />
149 im Sinne von ‚Zielart für sich’ (Brauns et al. 1997, vgl. auch Reck 2004), also kein Indikator für ein<br />
‚übergeordnetes’ Ziel<br />
150 v= vollständig<br />
151 pp= pars partim (teilweise)
250 Kapitel 8<br />
Pflanzengesellschaften zu den LRT in den Handbüchern oder Monitoringempfehlungen deutlich.<br />
Es werden verschiedene (verschieden benannte) Pflanzengesellschaften zur Beschreibung der<br />
Vegetation der LRT genutzt, die im pflanzensoziologischen System als Assoziationen<br />
nebeneinander stehen oder einander synonym sind (vgl. Ssymank et al. 1998, Fartmann et al.<br />
2001, Beutler & Beutler 2002). Besonders Lebensräume der Kulturlandschaft sind nur sehr<br />
schwer ohne einen bestimmten Zweck, streng analytisch, allein auf der Grundlage der<br />
floristischen Ähnlichkeit, zu typisieren, wie dies in der Pflanzensoziologie der ‚Braun-Blanquet-<br />
Schule’ der Fall ist. Dies zeigt die große Diversität an pflanzensoziologisch typisierten<br />
Pflanzengesellschaften im Bereich des Grünlandes oder des Ackerlandes 152 . Wenn für jede<br />
Assoziation mindestens eine Charakterart Bedingung ist, so wird man nur noch auf sehr<br />
trockenen, nassen, salzreichen oder in anderer Richtung extremen Standorten gute Assoziationen<br />
finden und große Flächen „in einen Topf werfen“ müssen (Ellenberg 1996: 143). Das<br />
„’Charakterartenprinzip’ lässt sich für die Grundeinheiten des pflanzensoziologischen Systems,<br />
die Assoziation“ kaum noch anwenden (ebd.). „Wir wissen, dass die Übertragung von auf<br />
Ökosystemtypen bezogenen Daten auf Ökosystemindividuen zu umso größeren Ungenauigkeiten<br />
führt, je abhängiger dieses System von variablen Standortfaktoren ist. Große typenbezogene<br />
Individualität zeigen z. B. Auen, Gewässer und Niedermoore (ohne die ausgesprochenen<br />
oligotrophen Typen) und praktisch alle Biotoptypen der Kulturlandschaft mit mittlerer bis mäßig<br />
hoher Nutzungsintensität; geringe typenbezogene Individualität haben Hochmoore, Dünen,<br />
Watt-Ökosysteme, oligotrophe Gewässer und Niedermoore und wenige hochintensiv genutzte<br />
und/oder monostrukturelle Biotoptypen der Kulturlandschaft“ (Roweck 1995: 32).<br />
Pflanzengesellschaften erfüllen daher in den meisten Fällen nicht Indikatorenfunktion sondern<br />
können lediglich einen Beitrag zur Operationalisierung der Ziele leisten 153 .<br />
Die Subsumtion beschriebener Pflanzengesellschaften unter die LRT erfolgte durch die Bundes-<br />
und Landesfachbehörden und von denen beauftragte Forschungseinrichtungen, um dadurch eine<br />
bessere Basis für die Normierung der LRT zu haben (vgl. zur Nutzung der<br />
Pflanzengesellschaften z. B. Fartmann et al. 2001). Die Normierung ist Voraussetzung für das<br />
Monitoring und die Berichtspflicht zu den Lebensraumtypen (vgl. Kap. 8.2.1.4). Dabei muss die<br />
Normierung nicht nur eine eindeutige Subsumtion realer Lebensräume (Objekte) unter den<br />
152<br />
vgl. Grundlagenwerke von Passarge 1964 (nicht eindeutig der ‚Braun-Blanquet-Schule’ zuzuordnen), Oberdorfer<br />
(Hrsg.) 1977-1992, Pott 1995<br />
153<br />
Tatsächlich spricht aus ökonomischer Sicht die mögliche Verminderung von Transaktionskosten für den Versuch<br />
einer analytischen Gliederung, wenn durch derartige Typen die Informationskosten für Regelungen (Tausch)<br />
geringer ausfallen, als wenn jeweils für den konkreten Regelungstatbestand eine ‚eigene’ Typisierung erfolgt.
Beispiele für ergebnisorientierte Honorierungsansätze 251<br />
Lebensraumtyp, sondern eine qualitative Bewertung entsprechend den Anforderungen der FFH-<br />
Richtlinie ermöglichen 154 . Aufbauend auf den Arbeiten von Rückriem & Roscher (1999) sowie<br />
Fartmann et al. 2001 wurden in Bund-Länder-Arbeitskreisen der Arbeitsgemeinschaft<br />
‚Naturschutz’ der Landes-Umweltministerien (LANA) Empfehlungen zur Operationalisierung<br />
der Lebensraumtypen für das Monitoring/die Berichtspflicht erarbeitet und in den Ländern<br />
jeweils konkretisiert. Für die Lebensraumtypen wurden drei Bewertungskriterien definiert:<br />
1. Vollständigkeit der lebensraumtypischen Habitatstruktur,<br />
2. Vollständigkeit des lebensraumtypischen Arteninventars und<br />
3. Beeinträchtigungen.<br />
Die Erläuterungen sind im Anhang als Anlage A-2 zu finden. Es werden für alle drei Kriterien<br />
Qualitätsstandards definiert, um damit die Bewertung konkreter Lebensräume als einen<br />
messanalogen Vorgang gestalten zu können (vgl. Normierung in Kap. 6.3.4.4). Dabei werden<br />
drei Qualitäten der LRT unterschieden: ‚hervorragende Ausprägung’, ‚gute Ausprägung’ und<br />
‚mäßige bis durchschnittliche Ausprägung’ (vgl. Anlage A-2 im Anhang).<br />
Bei dem lebensraumtypischen Arteninventar wird auf Pflanzenarten zurückgegriffen (vgl. Kap.<br />
8.2.3.2). Pflanzen bieten aufgrund ihrer vergleichsweise einfachen Erfassung beste<br />
Voraussetzungen als Indikatoren (Müller-Hohenstein & Beierkuhnlein 1999, Reck 2004). Die<br />
‚Zielarten’ sind in diesem Sinne Indikatoren für den jeweiligen Lebensraumtyp 155 .<br />
Wenn es möglich ist, Umweltziele indikativ über Pflanzenarten zu erfassen, sind die Ziele<br />
operationalisiert. Es hängt von den Eigenschaften der indikativen Arten ab, ob diese die Ziele für<br />
die Verknüpfung mit Honorierungsinstrumenten auch rationalisieren (Anforderungen vgl. Kap.<br />
6.3.4) und damit eine ergebnisorientierte Honorierung ermöglichen. Kapitel 8.2.3 diskutiert die<br />
Möglichkeit für zwei Grünlandlebensraumtypen.<br />
154 vgl. dazu die Vorgaben einer dreistufigen Bewertung von Lebensräumen bei der Erfassung der besonderen<br />
Schutzgebiete über Standard-Datenbogen (COM 1994)<br />
155 Allerdings ist hierbei ein gewisser Dualismus nicht zu verkennen, denn die FFH-Richtlinie begreift den<br />
Gebietsschutz als primäres Mittel des Artenschutzes (Czybulka 1996). Mit den Lebensräumen sollen natürlich die<br />
dort lebenden Arten erhalten werden.
252 Kapitel 8<br />
8.2.1.3 Gebietsabgrenzung<br />
Die Auswahl und die Gebietsabgrenzung der Schutzgebiete haben allein naturschutzfachlichen<br />
Kriterien zu genügen (Art. 4 sowie Anhang III der FFH-Richtlinie). Dies hat der EuGH<br />
mehrfach in seiner ständigen Rechtssprechung klargestellt 156 . So entschied der Gerichtshof im<br />
November 2000 157 , dass ein „Mitgliedstaat den Anforderungen von Wirtschaft, Gesellschaft und<br />
Kultur sowie den regionalen und örtlichen Besonderheiten nicht Rechnung tragen darf, wenn er<br />
über die Auswahl und Abgrenzung der Gebiete entscheidet, die der Kommission zur<br />
Bestimmung als Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung vorgeschlagen werden sollen“.<br />
Ferner ging der Gerichtshof im September 2001 158 noch weiter und entschied, dass der<br />
Ermessensspielraum, über den die Mitgliedstaaten bei der Auswahl der Gebiete verfügen, von<br />
der Einhaltung der in der Richtlinie festgelegten Kriterien abhängt. Die vorzuschlagenden<br />
Gebiete dürften nur aufgrund wissenschaftlicher Kriterien ausgewählt werden, die Liste müsse<br />
vollständig sein und die Gebiete müssten eine homogene, für das gesamte Hoheitsgebiet jedes<br />
Mitgliedstaats repräsentative, geografische Erfassung gewährleisten, damit die Kohärenz und das<br />
Gleichgewicht des daraus entstehenden Netzes Natura 2000 sichergestellt sind (COM 2004).<br />
Die FFH-Richtlinie liefert jedoch keine konkreten Vorgaben für eine funktionale<br />
Gebietsabgrenzung (funktional im Sinne, dass z. B. bei Mooren oder Fließgewässern deren<br />
Einzugsgebiete in das Schutzgebietskonzept integriert werden), so dass es zu sehr<br />
unterschiedlicher Handhabung in den einzelnen Mitgliedstaaten kam. Es gibt<br />
Gebietsabgrenzungen, die praktisch nur das Vorkommen der LRT des Anhangs I bzw. der<br />
Populationen der Arten des Anhangs II einschließen, auf der anderen Seite jedoch auch<br />
Abgrenzungen, die funktionale Aspekte mit berücksichtigten (vgl. Ssymank et al. 1998). Wird<br />
jedoch von einer überwiegend ‚naturschutzfachlich optimalen’ Gebietsabgrenzung ausgegangen,<br />
liegen gute Voraussetzungen für ergebnisorientierte Honorierungsansätze vor, da alle<br />
Eigentumsrechte, die für die Produktion der ökologischen Güter Voraussetzung sind, optimal<br />
verteilt werden können 159 .<br />
Zusätzlich positiv ist hervorzuheben, dass rechtlich die Möglichkeit besteht, „bei<br />
unvorhersehbaren negativen Fremdeinwirkungen einen wirkungsvollen Schutz durchzusetzen<br />
und direkten Einfluss auf angrenzende Nutzungen zu nehmen“ (Ssymank et al. 1998: 409).<br />
156 erstmals im so genannten Lappel Bank-Urteil (Europäischer Gerichtshof 1996) für die Vogelschutzrichtlinie<br />
157 Rechtssache C-371/98, First Corporate Shipping Ltd.<br />
158 Rechtssachen C-67/99, C-71/99 und C-220/99<br />
159 Negative Wirkungen (externe Effekte) auf die ökologischen Güter durch Dritte außerhalb des Regelungsraums<br />
dürften ausgeschlossen sein.
Beispiele für ergebnisorientierte Honorierungsansätze 253<br />
8.2.1.4 Monitoring und Berichtspflicht<br />
Alle sechs Jahre sind die EU-Mitgliedstaaten laut Artikel 17 FFH-Richtlinie verpflichtet, über<br />
den Zustand der Bestandteile des Natura 2000-Netzes in ihrem Zuständigkeitsbereich Bericht zu<br />
erstatten. „Es handelt sich hierbei um die erste umfassende gesetzliche Regelung zur<br />
Erfolgskontrolle im Naturschutz“ (Rückriem & Roscher 1999). Gemäß Artikel 17 der FFH-RL<br />
sind damit von den Mitgliedstaaten ab dem Jahr 2000 alle sechs Jahre Berichte zu erstellen. Zur<br />
Erfüllung dieser Berichtspflicht ist ein Monitoring gemäß Artikel 11 der FFH-Richtlinie<br />
aufzubauen. Für alle FFH-Gebiete ist im Rahmen des Monitorings zu prüfen, inwieweit die<br />
Erhaltungs- und Wiederherstellungsmaßnahmen ihr Ziel erreicht haben bzw. welche Änderungen<br />
zur Erhaltung der FFH-Gebiete vorgenommen werden müssen. Die Ergebnisse werden nach<br />
einem EU-einheitlichen Modell in einem Bericht zusammengefasst, der durch die<br />
Bundesregierung der EU-Kommission übermittelt und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht<br />
wird. Des Weiteren muss alle zwei Jahre ein Bericht zum Artenschutz im Zusammenhang mit<br />
den genehmigten Ausnahmen erstellt werden.<br />
Durch das Monitoring und die Berichtspflicht werden über GIS erfasste und bewertete Flächen<br />
von Lebensräumen vorliegen. In den meisten Ländern erfolgt bzw. erfolgte die erste<br />
Bestandsaufnahme und Bewertung über terrestrische Kartierungen. Für den Einsatz der<br />
Honorierungsinstrumente bedeutet dies, dass das Problem der Subsumtion einer konkreten<br />
Fläche unter einen bestimmten Lebensraumtyp und deren flächenhafte Abgrenzung bereits ex<br />
ante gelöst ist.<br />
Durch die Berichtspflicht und die Monitoringpflicht ist ein hoher wissenschaftlicher,<br />
administrativer und finanzieller Input notwendig. Dieser Input kann für eine Verknüpfung der<br />
gesetzlichen Verpflichtungen mit innovativen Honorierungsinstrumenten genutzt werden. Im<br />
Gegensatz zur WRRL, bei der die Indikatoren des Monitorings (z. B. Zustands-Indikatoren der<br />
Gewässerqualität) nicht direkt für die Verknüpfung mit einer ergebnisorientierten Honorierung<br />
genutzt werden können (vgl. Kap. 8.1.1), ist dies für das Kriterium ‚Vollständigkeit des<br />
lebensraumtypischen Arteninventars’ wenigstens teilweise möglich. Mit einer Nutzung der<br />
Monitoring-Indikatoren für die Honorierungsinstrumente können wesentliche Synergieeffekte<br />
realisiert und Kosten gespart werden. Diese Synergieeffekte könnten zusätzlich dadurch<br />
verbessert werden, dass die Zeiträume der Berichtspflicht bei der Ausgestaltung von<br />
Honorierungsinstrumenten berücksichtigt werden.
254 Kapitel 8<br />
8.2.1.5 Verteilung der Eigentumsrechte und Auswahl geeigneter Instrumente<br />
Die klare Rechtssprechung des EuGH bzgl. der Auswahl der Gebiete für das Natura 2000-Netz<br />
verdeutlicht, dass es bei den Zielen der FFH- und Vogelschutzrichtlinie keinen<br />
Ermessensspielraum gibt. Lediglich bei der Wahl der Mittel zur Erreichung der Ziele können<br />
und sollen ökonomische und soziale Belange berücksichtigt werden. Die Länder sind<br />
verpflichtet, mit den Maßnahmen die Ziele zu erreichen (vgl. Kap. 8.2.1.1).<br />
Aus eigentumsrechtlicher Sicht (Distributionskriterium) kann für ordnungsrechtliche<br />
Einschränkungen der landwirtschaftlichen Tätigkeit in Natura 2000-Gebieten nach deutschem<br />
Recht in den meisten Fällen die Sozial- bzw. Ökologiepflichtigkeit analog zur Rechtssprechung<br />
in Naturschutzgebieten geltend gemacht werden. Das bedeutet, dass aus verfassungsrechtlicher<br />
Sicht dem Einsatz von Ordnungsrecht als Instrument zur Umsetzung für den größten Teil der<br />
landwirtschaftlichen Einschränkungen nichts entgegensteht und Entschädigungszahlungen nicht<br />
fällig werden (vgl. Kap. 5.6.2 und 7.3.2.2). „Trotz der für den Naturschutz an sich günstigen<br />
verfassungsrechtlichen Ausgangslage fehlt es weitgehend am politischen Willen, diese<br />
verfassungsrechtlichen Möglichkeiten zugunsten des Naturschutzes durchzusetzen. Obwohl die<br />
für den Naturschutz wertvollen Flächen oftmals ohnehin keine intensive landwirtschaftliche<br />
Nutzung zulassen, ihre Situationsgebundenheit also ihren Verkehrswert mindert, werden im<br />
Wege freiwillig gezahlter Billigkeitsentschädigungen oder durch vertragliche Regelungen<br />
unterhalb der verfassungsrechtlich gebotenen Entschädigungspflicht Zahlungen an die Landwirt<br />
geleistet“ (Czybulka 1999: 9).<br />
Der von Czybulka (1999) beschriebene Weg der Zahlungen oberhalb des verfassungsrechtlich<br />
Gebotenen wird auch bei der Umsetzung der Maßnahmen in Natura 2000-Gebiete von vielen<br />
Ländern gewählt. Ein großer Teil der Länder setzt auf die freiwillige Teilnahme der Landwirte<br />
an Agrarumweltmaßnahmen in Natura 2000-Gebieten. Aus eigentumsrechtlicher Sicht bedeutet<br />
dies jedoch, dass den Landwirten das Recht an den Fähigkeiten zur Produktion der LRT und der<br />
Arten nach Anhang II der FFH-Richtlinie zugeteilt worden ist und die Gesellschaft nun diese<br />
Rechte abkaufen muss. De jure sind die Eigentumsrechte anders verteilt, da mit den Richtlinien<br />
die Gesellschaft jeder Zeit das Recht hat, die Ziele zum großen Teil auch allein über<br />
ordnungsrechtliche Auflagen umzusetzen, sofern ein freiwilliger Tausch nicht zur gewünschten<br />
Allokation führt. Damit ist der Tausch, also die Agrarumweltmaßnahmen, weit weniger<br />
freiwillig als suggeriert. In diesem Verständnis spiegeln ordnungsrechtliche Auflagen, deren<br />
Kosten für die betroffenen Landwirte dann ausgeglichen werden, wie im Rahmen von Artikel 16,<br />
die de jure Eigentumsrechte eher wider und suggerieren nicht das Prinzip der Freiwilligkeit. Das<br />
Prinzip der Freiwilligkeit hat selbstverständlich positive psychologische Effekte. „Die Bauern
Beispiele für ergebnisorientierte Honorierungsansätze 255<br />
müssen wollen können. Nur wenn sie nicht müssen, wollen sie tun, was sie können“ (Gujer<br />
2003: 69). Die Freiwilligkeit zur Teilnahme wird immer wieder als Argument für erfolgreiche<br />
Maßnahmen gesehen (vgl. Baur 2003, Schenk 2000). Mit dem Prinzip der Freiwilligkeit<br />
verbunden ist jedoch, dass gesellschaftliche Kosten für die Zahlungen entstehen. Die<br />
Sozialpflichtigkeit wird weiter ausgehöhlt (vgl. Kap. 5.6.2.1 und 7.1.4.3) und es setzt ein<br />
Verständnis ein, dass Landwirte die Rechte an den ökosystemaren Fähigkeiten, die zur<br />
Produktion der ökologischen Güter notwendig sind, besitzen 160 . Empirischer Besitz allein<br />
begründet jedoch kein Eigentumsrecht, das Wesen des Eigentums ist es, fortzubestehen, auch<br />
wenn der physische Besitz nicht gegeben ist. Ein gesellschaftlicher Vertrag müsse Eigentum<br />
logisch vorausgehen (vgl. Kap. 5.5).<br />
Hinzu kommt, dass freiwillige Agrarumweltmaßnahmen nicht für jeden Regelungstatbestand<br />
geeignet sind (vgl. Schmidt-Moser 2000). „Von den Zielen des Naturschutzes lassen sich also<br />
nicht alle durch Verträge umsetzen. Sinnvoll sind Verträge dort, wo die bisherige Nutzung der<br />
Flächen im Prinzip beibehalten werden soll oder eine Form der Pflege angestrebt wird, für die<br />
der derzeitige Nutzungsberechtigte besonders qualifiziert ist“ (Rapp 1998: 58).<br />
Auf der anderen Seit ist es in der Regel nicht möglich, in einer Schutzgebietsverordnung<br />
detaillierte und kleinräumige Regelungen zur landwirtschaftlichen Nutzung aufzunehmen, die<br />
den vielfältigen Standortsituationen gerecht werden. Nicht zuletzt sind Schutzgebiets-<br />
verordnungen relativ starre Instrumente. Notwendige Anpassungen an geänderte Rahmen-<br />
bedingungen, neue Erkenntnisse usw. wären nur über eine aufwändige Änderung der<br />
Verordnung möglich (vgl. Schmidt-Moser 2000). Distributionsentscheidungen haben, aufgrund<br />
der unterschiedlichen Instrumente zur Durchsetzung der zugeteilten Eigentumsrechte, also<br />
Einfluss auf die effiziente Allokation.<br />
Die Eigentumsrechtslage wird darüber hinaus dadurch erschwert, dass, wie mehrfach ausführlich<br />
dargestellt (Kap. 4.1 und 5.1), für die Zielerreichung in Natura 2000-Gebieten eine<br />
landwirtschaftliche Nutzung, also der Einsatz individueller Fähigkeiten, notwendig sein kann. Es<br />
ist prinzipiell möglich, Landwirte zum Einsatz individueller Fähigkeiten zu verpflichten (vgl.<br />
Kap. 5.6.2.1). Damit wird der Einsatz von de jure Eigentumsrechten an individuellen<br />
Fähigkeiten erzwungen, was nur in Ausnahmefällen geschehen sollte (vgl. self-ownership-<br />
Theorie, Kap. 5.2). Unter Anerkennung der de jure Eigentumsrechte an individuellen<br />
160 vgl. Diskussion zur Zerstörung intrinsischer Motivation auch Kap. 5.6.2.1, S. 129
256 Kapitel 8<br />
Fähigkeiten kann aus einer Verpflichtung zum Tausch eine Verpflichtung zur Honorierung<br />
begründet werden. Für Natura 2000-Gebiete kann aufgrund der besonderen Bedeutung der LRT<br />
und der Arten nach Anhang II der FFH-Richtlinie und Anhang I der Vogelschutzrichtlinie eine<br />
Bereitstellungspflicht der Landwirte zum Einsatz individueller Fähigkeiten abgeleitet werden.<br />
Dieser Einsatz muss unter den oben aufgeführten Argumenten jedoch honoriert werden. In<br />
juristischem Verständnis würde es sich damit um ausgleichspflichtige Inhaltsbestimmungen des<br />
Eigentums handeln.<br />
Es zeigt sich, dass sowohl die Agrarumweltmaßnahmen als auch herkömmliche<br />
Schutzgebietsverordnungen der besonderen Situation in Natura 2000-Gebieten gerecht werden.<br />
Innerhalb der beschriebenen schwierigen Eigentumsrechtslage und der ansonsten bestimmenden<br />
Rahmenbedingungen (vgl. Kap. 8.2.1.1 bis 8.2.1.4) eröffnet eine ergebnisorientierte Honorierung<br />
teilweise Möglichkeiten der institutionellen Lösung. Insbesondere für die Maßnahmen zum<br />
Erhalt und zur Entwicklung der kulturbestimmten Lebensraumtypen ist dieser Ansatz in der<br />
Kombination von ordnungsrechtlichen Auflagen und einer Honorierung ökologischer Leistungen<br />
von Interesse.<br />
Czybulka (2002) schlägt bei der Beschreibung der Inhalts- und Schrankenbestimmung des<br />
Eigentums für den Bereich der Ökologiepflichtigkeit den Begriff der ‚ökologischen<br />
Inhaltsprägung’ vor: „Zum Bereich der Inhaltsbestimmung könnten insbesondere definitorische<br />
und klassifikatorische Normen zählen, die das Eigentumsobjekt, von der ökologischen Funktion<br />
her gesehen den Schutzgegenstand näher beschreiben. Diese Inhaltsbestimmung ist nicht<br />
zwangsläufig identisch mit einer Schrankenziehung; die Norm kann z. B. die bloße<br />
Zielvorstellung einer auch um ihrer selbst willen zu schützenden Natur vermitteln, sie kann die<br />
Kohärenz als Merkmal ökologischer Entwicklungsgebiete verankern, geschützte Arten und<br />
Lebensgemeinschaften aufzählen und schließlich Eigentumsobjekte oder Teile davon von der<br />
(privatrechtlichen) Eigentumsordnung abspalten bzw. ihr zuordnen“ (Czybulka 2002: 95). Nach<br />
Artikel 14 GG kann das Bündel an Eigentumsrechten damit an die ‚Eigentumsobjekte’ geknüpft<br />
werden und so der Inhalt des Eigentums definiert werden. Das bedeutet, den konkreten<br />
Umweltzustand zu beschreiben, der das Eigentum darstellt. Czybulka selbst wählt das Beispiel<br />
eines Lebensraumtyps der ‚Borstgrasrasen’. „Wenn der Gesetzgeber oder der europäische<br />
Normgeber (und damit letztlich auch der Mitgliedstaat) sich dazu entschließt, Borstgrasrasen<br />
unter gesetzlichen Schutz zu stellen, so sind damit jedenfalls in der neueren Gesetzgebung die<br />
empirischen Vorgaben als Tatbestände vorhanden, an die angeknüpft werden kann“ (Czybulka<br />
2002: 105). Das heißt, aus juristischer Sicht ist hierbei ein Typus ausreichend genau normiert.
Beispiele für ergebnisorientierte Honorierungsansätze 257<br />
Aufbauend auf diesen Argumenten wären in FFH-Gebieten die Eigentumsrechte bzgl. der LRT<br />
auf der Grundlage der Qualitätsbeschreibung der LRT justiziabel. Demnach können die ohnehin<br />
durch die FFH-Richtlinie festgelegten Zielsetzungen in Schutzgebietsverordnungen verankert<br />
werden und würden rechtswirksam. Damit ist die Voraussetzung für die Anwendung von<br />
Ausgleichszahlungen nach Artikel 16 gegeben, ohne dass konkrete Handlungsanweisungen (Ge-<br />
und Verbote) in die Schutzgebietsverordnung aufgenommen werden müssen. Durch die<br />
schlüssige Darstellung, dass für das Erreichen dieser Ziele bestimmte landwirtschaftliche<br />
Handlungen notwendig sind, ist die Fördervoraussetzung von Artikel 16 erfüllt, ohne dass starre<br />
Ge- und Verbote im Sinne von Maßnahmen-Indikatoren ordnungsrechtlich festgelegt werden<br />
müssen. Schutzgebietsverordnungen würden so die Ansprüche an Flexibilität erfüllen. Die<br />
‚ökologische Inhaltsprägung’ kann derart rationalisiert werden, dass eine ergebnisorientierte<br />
Honorierung daran geknüpft werden kann (vgl. Kap. 8.2.1.2). Die Landwirte haben damit die<br />
maximalen Freiheitsgrade, die die de jure Verteilung der Eigentumsrechte ermöglicht. Die<br />
Risikoübernahme durch die Landwirte ist gering, da die Honorierung auf den Erhalt der<br />
gegebenen Qualität ausgerichtet und der Entwicklungsaspekt über zusätzliche Anreize erfasst<br />
werden kann (vgl. Kap. 6.3.4.3).<br />
8.2.2 Bedeutung von Artikel 16-Maßnahmen im Zuge der Umsetzung der FFH-<br />
Richtlinie<br />
Das Natura 2000-Netzwerk wird in großen Teilen durch menschliche Aktivitäten direkt<br />
beeinflusst. Gerade große Gebiete wie z. B. in Spanien (SCI von mehr als 100.000 ha Größe)<br />
werden zu erheblichen Teilen durch produktiv genutzte Flächen bestimmt. Auch in Deutschland<br />
findet innerhalb der Natura 2000-Gebiete in weiten Bereichen eine private land- oder<br />
forstwirtschaftliche Nutzung statt.<br />
Es liegen noch keine Daten darüber vor, wie hoch der Anteil an landwirtschaftlicher Fläche in<br />
Natura 2000-Gebieten in Deutschland ist. Die für Brandenburg vorliegenden Daten geben jedoch<br />
Hinweise auf den potentiellen Umfang. Rund 140.000 ha landwirtschaftlich genutzter Fläche<br />
(10,5 % der LF) liegen in Natura 2000-Gebieten (MLUR 2003b). Demzufolge werden ca. 46 %<br />
der Natura 2000-Flächen in Brandenburg landwirtschaftlich genutzt. Bereits im Jahr 2002<br />
wurden auf der Grundlage des Artikel 16 der VO (EG) 1257/1999 für 8 % dieser<br />
landwirtschaftlich genutzten Fläche Ausgleichszahlungen gezahlt und auf 37 % der Fläche<br />
fanden Agrarumweltmaßnahmen (AUM) statt (vgl. Abbildung 43). Die Verteilung der Natura<br />
2000-Gebiete in Brandenburg ist der Abbildung A-17 im Anhang zu entnehmen.
258 Kapitel 8<br />
Nimmt man für eine grobe Schätzung einen Anteil von 50 % landwirtschaftlich genutzter<br />
Flächen in Natura 2000-Gebiete an, ergäbe dies für Deutschland 1,1 Mio. ha landwirtschaftlich<br />
genutzter Fläche in Natura 2000-Gebieten. Die tatsächlichen Zahlen dürften allerdings darunter<br />
liegen, da in Brandenburg durch die großen Vogelschutzgebiete und den darin befindlichen<br />
hohen Grünlandanteil die landwirtschaftliche Fläche in Natura 2000 im Deutschlandvergleich<br />
überdurchschnittlich hoch ist. Trotzdem wird deutlich, welche vergleichsweise hohe Bedeutung<br />
der Instrumentenentwicklung für den Bereich der landwirtschaftlich genutzten Flächen in<br />
Natura 2000-Gebieten beigemessen werden sollte.<br />
Die landwirtschaftliche Nutzung hat positive und negative Wirkungen in Natura 2000-Gebieten.<br />
Auf der einen Seite sind einem Gebiet wie Europa, das kaum noch menschlich unbeeinflusste<br />
Gebiete aufweist, extensiv genutzte und über Jahrhunderte entwickelte halbnatürliche<br />
Lebensräume Träger der Biodiversität und Sekundärlebensraum vieler Arten, deren natürliche<br />
Standorte nahezu nivelliert sind. Der Erhalt vieler LRT nach Anhang I ist von einer extensiven<br />
Bewirtschaftung abhängig. Darüber hinaus spielt die intensive Landwirtschaft als<br />
Gefährdungsursache für Schutzziele des Natura 2000-Konzeptes eine große Rolle. In Zahlen<br />
bedeutet dies im europäischen Raum, dass rund ein Drittel der LRT durch eine Intensivierung<br />
der Landwirtschaft und rund ein Siebtel durch eine Aufgabe der bestehenden extensiven<br />
landwirtschaftlichen Nutzung gefährdet sind (WWF 1999). In diesem Spannungsfeld müssen<br />
geeignete Maßnahmen ergriffen werden.<br />
Artikel 16-Maßnahmen sind insbesondere im Zusammenhang mit LRT von Interesse, für deren<br />
Erhalt eine landwirtschaftliche Nutzung bzw. Pflege notwendig ist. Führen ordnungsrechtliche<br />
Auflagen hier zum Rückzug der Landwirtschaft, kann das Ziel der FFH-Richtlinie nicht erreicht<br />
werden. In derartigen Fällen bietet sich insbesondere eine Kombination aus ordnungsrechtlichen<br />
Auflagen und einer Honorierung an (vgl. Kap. 8.2.1.5). Prinzipiell kommen hier auch freiwillige<br />
Agrarumweltmaßnahmen in Frage, allerdings nur dann, wenn so ein dauerhafter Schutz erreicht<br />
werden kann (vgl. Kap. 8.2.1.5).<br />
In Deutschland entfällt ca. ein Viertel der Fläche der LRT nach Anhang I der FFH-Richtlinie auf<br />
kulturbestimmte LRT. Für einige weitere LRT ist eine Pflege auf sekundären Standorten<br />
notwendig (Ssymank 1997). In Abbildung 60 sind auf der Grundlage von Schätzungen des<br />
Gesamtbestandes der LRT nach Anhang I der FFH-Richtlinie der Umfang der kulturbestimmten<br />
LRT dargestellt. Ausgehend von den LRT, die einer ein- bis zweimaligen Nutzung bedürfen,<br />
wären lediglich ca. 3,5 % des Grünlandes in Deutschland Flächen von LRT nach Anhang I der<br />
FFH-Richtlinie.
Beispiele für ergebnisorientierte Honorierungsansätze 259<br />
Abschätzung des Flächenumfangs (ha) von LRT, für<br />
deren Erhalt eine Pflege/Nutzung notwendig ist<br />
153600<br />
57570<br />
68690<br />
183700<br />
66740<br />
79590<br />
Deutschland min. Deutschland max.<br />
Extensive Nutzung (1-2malige Mahd) 1<br />
Extensive Pflege (Mahd, Beweidung) 2<br />
Offenhaltung 3<br />
Abbildung 60: Ermittelter Gesamtbestand von kulturbestimmten Lebensraumtypen (LRT) in Deutschland<br />
LRT in ha (geschätzt als minimaler und maximaler Flächenumfang) inner- und außerhalb der FFH-Gebiete für deren<br />
Erhalt (landwirtschaftliche) Pflegemaßnahmen bzw. eine Nutzung notwendig sind; 1 LRT: 6440, 6510, 6520; 2 LRT:<br />
6210, 6230, 6240, 6410, 3 LRT: 2310, 2320, 2330, 4030, 5130, 6120 (eigene Darstellung, Datenquelle: Ellwanger<br />
et al. 2000)<br />
Die Bestandsaufnahme von drei kulturbestimmten LRT innerhalb der gemeldeten Natura 2000-<br />
Gebiete, ergab für beispielhafte Bundesländer im Jahre 2003 einen sehr unterschiedlichen<br />
Flächenumfang, der selbstverständlich die Größe, aber auch die landwirtschaftlichen und<br />
naturräumlichen Bedingungen der Bundesländer widerspiegelt (vgl. Tabelle 16). Kein<br />
Zusammenhang ist zwischen dem Flächenumfang der LRT und der Anwendung von Artikel 16-<br />
Maßnahmen zu erkennen. So wenden die beiden Länder Bayern und Sachsen-Anhalt, mit den<br />
höchsten Anteilen an landwirtschaftlich genutzten LRT, keine Artikel 16-Maßnahmen an,<br />
während Schleswig-Holstein mit einer sehr geringen Fläche von 200 bis max. 630 ha dieser LRT<br />
bereits im Jahre 2002 2.444 ha Grünland über Artikel 16 förderte. Die Daten zeigen, dass Artikel<br />
16-Maßnahmen potentiell eine wichtige Rolle als Instrument zur Umsetzung der Ziele der FFH-<br />
Richtlinie spielen können, auf der anderen Seite gibt die zögerliche Anwendung Hinweis darauf,<br />
dass die konkrete Ausgestaltung durchaus schwierig ist 161 .<br />
161 Es zeigt sich, dass die meisten Länder im Zusammenhang mit der landwirtschaftlich genutzten Fläche in FFH-<br />
Gebieten versuchen, überwiegend freiwillige Agrarumweltmaßnahmen zu nutzen (vgl. auch Kap. 8.2.1.5).
260 Kapitel 8<br />
Tabelle 16: Flächenumfang von drei kulturbestimmten Grünland-Lebensraumtypen (LRT) in vier<br />
Bundesländern<br />
Land<br />
Gemeldete Fläche an landwirtschaftlich genutzten LRT (ha) 1<br />
Magere Flachland-/<br />
Berg-Mähwiesen<br />
(LRT 6510)<br />
Berg-<br />
Mähweiden<br />
(LRT 6520)<br />
Brenndolden-<br />
Auenwiesen<br />
(LRT 6440)<br />
Summe über<br />
LRT<br />
Artikel 16-geförderte<br />
extensive GL-Nutzung<br />
2002 2 (ha)<br />
BB 3.728 - 1.201 4929 9.674<br />
SH 100 (400) - 60 (70) 160 (470) 2.444<br />
ST 6.400 - 1.400 7.800 -<br />
BY 7.600 5.000 30 16.930 -<br />
1<br />
Die Angaben wurden durch die zuständigen Landesbehörden gegeben und können sich durch die terrestrische<br />
Kartierung der FFH-Gebiete noch ändern.<br />
2<br />
Quelle: Berichte zur Halbzeitbewertung der EPLR<br />
8.2.3 Pflanzenarten von Grünlandlebensraumtypen als Anknüpfung für eine<br />
ergebnisorientierte Honorierung am Beispiel des Landes Brandenburg<br />
8.2.3.1 Beschreibung der diskutierten Lebensraumtypen (LRT)<br />
Es werden zwei Grünlandlebensraumtypen Brandenburgs beschrieben, für deren Erhalt eine<br />
extensive Nutzung notwendig ist und deren Fläche aktuell zum großen Teil als Dauergrünland<br />
landwirtschaftlich genutzt werden: Brenndolden-Auenwiesen (LRT 6440) und Magere<br />
Flachland-Mähwiesen (LRT 6510). Da die Pfeifengraswiesen (LRT 6410) in Brandenburg<br />
aktuell zum größten Teil nicht genutzt werden (Beutler & Beutler 2002), sollen diese hier nicht<br />
betrachtet werden. Eine ergebnisorientierte Honorierung der Pflegemaßnahmen ist bei diesem<br />
LRT genauso wie bei den wertvollen Sand-, Kalk-Trocken-, Borstgras- und Steppen-<br />
Trockenrasen (LRT 6120, 6210, 6230, 6240) möglich und sinnvoll 162 .<br />
Brenndolden-Auenwiesen (LRT 6440)<br />
Bei dem Lebensraum der Brenndolden-Auenwiesen handelt es sich um artenreiche Wiesen (ca.<br />
30 Pflanzenarten pro Vegetationsaufnahme) auf potentiellen Auenwaldstandorten der großen<br />
Fluss- und Stromtäler vor allem von Oder, Elbe und Havel. Im Steckbrief als Anlage A-3 im<br />
162 Allerdings müssen unter den veränderten Rahmenbedingungen für derartige Pflegeflächen gesonderte<br />
Honorierungsansätze entwickelt werden, sofern diese Flächen nicht als Grünland gemeldet sind (vgl. Kap. 7.1.4.1).
Beispiele für ergebnisorientierte Honorierungsansätze 261<br />
Anhang ist die Verbreitung des LRT in Brandenburg dargestellt. Der Flächenumfang der<br />
Brenndolden-Auenwiesen in FFH-Gebieten Brandenburgs beträgt 1.201 ha 163 .<br />
Entscheidender Standortfaktor für das Vorkommen des Lebensraumtyps sind wechselfeuchte<br />
Bedingungen (je nach relativer Höhe zum Fluss wechselfeucht bis wechselnass) und Überflutung<br />
bzw. in ausgepolderten Bereichen Überstauung oder Durchfeuchtung durch Drängewasser (vgl.<br />
Steckbrief, Anlage A-3.1 im Anhang). Die Standorte von Brenndolden-Auenwiesen sind<br />
extremen Wasserstandsschwankungen im Jahresverlauf unterworfen (vgl. Balatova-Tulackova<br />
1966, Burkart 1998, Fartmann et al. 2001). In Abhängigkeit von der mittleren Hochwasserlinie<br />
(MHW) kann eine trockene (oberhalb der MHW) und eine feuchte Variante (unterhalb der<br />
MHW) unterschieden werden (Burkart 1998).<br />
Neben der Namen gebenden Art Cnidium dubium sind die Brenndolden-Auenwiesen floristisch<br />
durch das Vorkommen von Stromtalarten charakterisiert (vgl. charakteristische Pflanzenarten<br />
Steckbrief, Anlage A-3.1 im Anhang), das heißt Pflanzen mit subkontinentaler Verbreitung, die<br />
an große Flussauen gebunden sind (vgl. Burkart 2001). Im Steckbrief sind<br />
Pflanzengesellschaften aufgeführt, die von Beutler & Beutler (2002) teilweise bzw. völlig unter<br />
den Lebensraumtyp der Brenndolden-Auenwiese subsumiert werden (Anlage A-3.1 im Anhang).<br />
Allerdings schließen sich Fartmann et al. 2001 den Ausführungen von Zaluski 1995 und Burkart<br />
1998 an, die die gesamten Brenndolden-Auenwiesen des nordostdeutschen Flachlands in einer<br />
Assoziation der Cnidio-Deschampsietum HUNDT ex PASSARGE 1960 zusammenfassen. Diese<br />
‚internen’ Zuordnungsdifferenzen sind jedoch für die Abgrenzung des LRT ‚Brenndolden-<br />
Auenwiese’ nicht relevant, da die gesamte Assoziation Cnidio-Deschampsietum ebenfalls unter<br />
den LRT subsumiert werden kann 164 .<br />
Entsprechend der Dynamik des Fließgewässers können die Vegetationsbestände des LRT von<br />
Jahr zu Jahr starken Veränderungen unterliegen. „So treten die Cnidion-Arten im Jahr nach<br />
einem ausgedehnten Sommerhochwasser nur noch mit verminderter Vitalität auf, erholen sich in<br />
den Jahren danach aber wieder schnell. Somit ist bei der Interpretation der Daten zunächst zu<br />
beurteilen, ob sich Verschiebungen der Deckungsgrade, der Nekromasseanteile oder der<br />
Artenzahlen auf natürliche Prozesse zurückführen lassen oder anthropogen verursacht wurden<br />
(Fartmann et al. 2001: 548).<br />
163 LUA 2004 Abt. Ö2, schriftliche Mitteilung<br />
164 teilweise können die Gesellschaften synonym verwendet werden, vgl. Diskussion zu den Pflanzengesellschaften<br />
in Kap. 8.2.1.2
262 Kapitel 8<br />
Wesentliche Gefährdungsursachen ist die Zerstörung der natürlichen Überflutungsdynamik<br />
durch Flussregulierung, Deichbauten, Polderung und Entwässerung. Die landwirtschaftliche<br />
intensive Nutzung führt selbst auf den natürlich nährstoffreicheren Auenstandorten der<br />
Brenndolden-Auenwiese durch hohe Düngungsintensität sowie Vielschnittnutzung bzw.<br />
Intensivweide zur Artenverarmung (Burkart et al. 2004). Erkenntnisse zur optimalen<br />
landwirtschaftlichen Nutzung im Sinne der Erhaltung artenreicher Brenndolden-Auenwiesen<br />
sind bisher kaum veröffentlicht. Der Verzicht auf eine Düngung als Erhaltungsmaßnahme ist<br />
jedoch unstrittig. Im Gegensatz zu den Empfehlungen von Beutler & Beutler (2002) spricht sich<br />
Burkart (2003 mdl.) dafür aus, dass der erste Schnitt so früh erfolgen kann, wie aus<br />
landwirtschaftlichen Erwägungen sinnvoll ist. Fast alle charakteristischen Arten der<br />
Brenndolden-Auenwiesen blühen spät, in der Regel im zweiten Aufwuchs im Sommer.<br />
Entscheidend ist dass die Hochsommerblüte geschont wird. Starre Vorgaben zum Pflegeregime<br />
erscheinen demnach nicht gerechtfertigt, was den Ansatz einer ergebnisorientierten Honorierung<br />
unterstützt. Positiv für den Ansatz der ergebnisorientierten Honorierung ist außerdem zu werten,<br />
dass die Bestände der Brenndolden-Auenwiesen schnell, also in vertragstauglicher Zeit, auf eine<br />
landwirtschaftliche Übernutzung reagieren (vgl. Fartmann et al. 2001).<br />
Magere Flachland-Mähwiesen (LRT 6510)<br />
Bei diesem LRT handelt es sich um artenreiche Wiesenfuchsschwanz- (feuchtere Standorte) und<br />
Glatthaferwiesen (trockenere Standorte) des Flachlandes. Im Steckbrief als Anlage A-3 im<br />
Anhang ist die Verbreitung des Lebensraumtyps in Brandenburg dargestellt. Der Flächenumfang<br />
der Mageren Flachland-Mähwiesen in FFH-Gebieten Brandenburgs beträgt 3.728 ha 165 .<br />
Das häufigste Vorkommen erstreckt sich auf vorentwässerte Standorte oder Sekundärstandorte<br />
wie Dämme und Deiche (Beutler & Beutler 2002, vgl. Steckbrief, Anlage A-3.2 im Anhang).<br />
Die Vegetation dieses LRT gehört pflanzensoziologisch zum Verband des Arrhenatherion. Für<br />
Fartmann et al. ist die Subsumtion eines Bestandes unter den Verband notwendiges Kriterium für<br />
die Typisierung als LRT: „Diese Abbaustadien der Glatthaferwiesen gehören nicht mehr zum<br />
Arrhenatherion und sind folglich kein Bestandteil des LRT Flachland-Mähwiese“ (Fartmann et<br />
al. 2001: 550). Im Steckbrief sind Pflanzengesellschaften aufgeführt, die von Beutler & Beutler<br />
(2002) teilweise bzw. völlig unter den Lebensraumtyp der Mageren Flachland-Mähwiesen<br />
subsumiert werden (Anlage A-3.2 im Anhang).<br />
165 LUA 2004 Abt. Ö2, schriftliche Mitteilung
Beispiele für ergebnisorientierte Honorierungsansätze 263<br />
Das Arrhenatherion hat im Großen und Ganzen eine ähnliche Verbreitung wie die von Rotbuche<br />
beherrschten Waldgesellschaften. Die artenreichsten und am besten charakterisierten Bestände<br />
findet man dort, wo sie entsprechend der traditionellen Nutzung zweimal im Jahr gemäht und nur<br />
mit Stallmist gedüngt werden (Ellenberg 1996). Die Pflanzenartenzahlen dieses LRT sind in<br />
nordostdeutschen Gebieten wesentlich geringer (25-38 Arten pro Vegetationsaufnahme) als in<br />
Süd- und Mitteldeutschland (37-53) (Fartmann et al. 2001). Die Pflanzenartenzahl liefert<br />
wichtige Hinweise zum Erhaltungszustand des LRT (Fartmann et al. 2001, Liesbach & Peppler-<br />
Liesbach 1996). Typische Pflanzen- und Tierarten sind im Steckbrief im Anhang aufgeführt<br />
(Anlage A-3.2 im Anhang).<br />
Gefährdungsfaktoren sind vor allen Dingen eine intensivere Nutzung und intensive Beweidung,<br />
für die feuchteren Ausprägungen eine weitere Absenkung des Grundwasserpegels auf<br />
Niedermoorböden sowie eine Aufgabe der Nutzung, verbunden mit Verbrachung und<br />
Verbuschung.<br />
8.2.3.2 Ableitung von Pflanzenarten als Indikatoren<br />
Im Folgenden wird eine Methode vorgestellt, wie und auf welcher Datengrundlage die<br />
Entwicklung von Pflanzenarten der LRT für eine ergebnisorientierte Honorierung für die<br />
Brenndolden-Auenwiesen und die Mageren Flachland-Mähwiesen stattfinden kann.<br />
Insbesondere wird diskutiert, inwieweit die aktuellen Indikatorenvorschläge und deren<br />
Normierung im Rahmen des Monitorings nach Artikel 11 der FFH-Richtlinie für eine<br />
ergebnisorientierte Honorierung für Brenndolden-Auenwiesen und Magere Flachland-<br />
Mähwiesen genutzt werden können.<br />
In den Kapiteln 8.2.1.2 und 8.2.1.4 wurde bereits beschrieben, welche grundsätzliche<br />
Datenqualität mit dem Monitoring als Ausgangspunkt vorliegt. Die LRT-Flächen sind digital im<br />
Gelände erfasst und deren Erhaltungszustand bewertet. Die terrestrische Kartierung ergänzt<br />
dabei die bereits für Großschutzgebiete vorliegenden Erhebungen.<br />
In Brandenburg wurden LRT-typische Pflanzenarten und deren Normierung ausgewählt, die auf<br />
den Beschlüssen der LANA (vgl. Anlage A-2) und den in der LANA-Arbeitsgruppe ‚Grünland’<br />
erarbeiteten Vorschlägen basieren. Diese liegen als Entwurf vor 166 und sind im Anhang als<br />
166 Erarbeitung durch das LUA Abt. Ö2
264 Kapitel 8<br />
Tabelle A-8 für die Brenndolden-Auenwiesen und Tabelle A-9 für die Mageren Flachland-<br />
Mähwiesen dargestellt. Die einzelnen Bestände der Lebensraumtypen werden demnach auf der<br />
Grundlage von drei Kriterien anhand einer dreistufigen Skala bewertet. Auf der Grundlage dieser<br />
Einzelbewertung erfolgt eine Aggregation für die Gesamtbewertung des Bestandes. Der Modus<br />
für die Aggregation ist in Anlage A-2 im Anhang dargestellt (vgl. auch Doerpinghaus et al.<br />
2003). Dabei handelt es sich um einen sehr pragmatischen Ansatz, bei dem die drei<br />
Bewertungskriterien gleich gewichtet werden und der darauf abzielt, ein möglichst einheitliches<br />
Vorgehen der Länder zu gewährleisten.<br />
Für eine ergebnisorientierte Honorierung ökologischer Leistungen der Landwirtschaft ist<br />
insbesondere das Kriterium der ‚Vollständigkeit des lebensraumtypischen Arteninventars’ als<br />
Ansatz geeignet. Das aktuelle Arteninventar ist am besten geeignet, die landwirtschaftlich<br />
beeinflusste Qualität des Lebensraums, ausgehend von einer Status-quo-Bewertung, indikativ<br />
abzubilden und damit für die Honorierung zu rationalisieren. Es wird damit dem Ansatz der<br />
ÖQV der Schweiz und des MEKA II gefolgt, indem ausschließlich „Positivzeigerarten“ (BLW<br />
2001) genutzt werden (keine, die eine Beeinträchtigung anzeigen). Die generelle Eignung von<br />
Pflanzenarten des Grünlandes als Indikatoren für eine ergebnisorientierte Honorierung kann<br />
mittlerweile als empirisch bewiesen gelten (vgl. Kap. 4.2.3.1. und 4.2.3.2).<br />
Die Normierung des Arteninventars im Rahmen des Monitorings könnte prinzipiell direkt für die<br />
Verknüpfung mit einer ergebnisorientierten Honorierung genutzt werden. Allerdings müssen die<br />
im Zuge des Monitoringkonzeptes definierten Arten vor dem Hintergrund der gesamten<br />
Anforderungen an Indikatoren als Scharnier zwischen dem ökologischen Gut und der<br />
Honorierung bewertet werden.<br />
In Kapitel 6.3.4 wurde ausführlich diskutiert, dass die Indikatoren zur Erfüllung des speziellen<br />
Zwecks vielfältige Anforderungen erfüllen müssen. Insbesondere vor dem Hintergrund der<br />
Akzeptanz und der Förderung von Eigenmotivation sind die Kriterien der Formulierbarkeit und<br />
der praktischen Erhebbarkeit als wesentlich zu betrachten (Kap. 6.3.4). Die Landwirte sollen als<br />
Produzenten ‚ihre’ ökologischen Güter kennen. Der guten Erkennbarkeit der Indikatorenarten ist<br />
daher nicht nur aufgrund der praktischen Erhebbarkeit besondere Bedeutung beizumessen.<br />
Dieses Anforderungskriterium spielte jedoch bei der Entwicklung der LRT-typischen Arten<br />
keine Rolle. Der Anforderung kann nicht einfach dadurch gerecht werden, dass aus dem Katalog<br />
der Monitoringarten die gut erkennbaren ausgewählt werden, da diese nur teilweise mit der<br />
ausreichenden Stetigkeit in den Beständen der jeweiligen Qualität vorkommen können.
Beispiele für ergebnisorientierte Honorierungsansätze 265<br />
Es wird empfohlen, bei der Ableitung der Indikatoren für eine ergebnisorientierte Honorierung<br />
für die Grünlandlebensraumtypen wie folgt vorzugehen (vgl. Abbildung 61 und Abbildung 62):<br />
Schritt 1 – Zusammenstellung der Datenbasis<br />
Datengrundlagen liefern aktuelle Vegetationsaufnahmen aus Brandenburg, ergänzt durch<br />
geeignete Bestandserhebungen im Rahmen der terrestrischen FFH-Kartierung und der Status-<br />
quo-Bewertung der LRT-Flächen im Zuge des Monitorings. Dabei kann bei den Brenndolden-<br />
Auenwiesen auf eine gute Datenbasis durch mehrere vegetationskundliche Untersuchungen in<br />
den letzten Jahren zurückgegriffen werden (Burkart 1998, Fartmann et al. 2001, vgl. auch Leyer<br />
2002 für Sachsen-Anhalt). Brenndolden-Auenwiesen sind als Gesellschaft eines so genannten<br />
‚Extremstandortes’ relativ gut zu typisieren.<br />
Schwieriger gestaltet sich die Datenlage bei den Mageren Flachland-Mähwiesen. Diese<br />
Wiesengesellschaft der ‚mittleren’ Standorte ist weit weniger klar pflanzensoziologisch definiert<br />
(vgl. Diskussion Kap. 8.2.1.2) und Vegetationsaufnahmen, die die gesamte ‚Breite’ dieses LRT<br />
widerspiegeln, sind aktuell für Brandenburg nicht verfügbar. Eine Prüfung der Verwendbarkeit<br />
der Daten aus der Erfolgskontrolle des Vertragsnaturschutzes und der Agrarumweltmaßnahmen<br />
zu nutzen, erwies sich als nicht möglich. Die Erfolgskontrolle erfolgt durch die Erhebung<br />
bestimmter „Indikatorarten bzw. naturschutzrelevanter Arten verschiedener Grünlandtypen, die<br />
Aussagen über Extensivierungsgrad, Sukzessionsstufe, Nährstoffsituation, Wasserverhältnisse<br />
und Störungen der Untersuchungsflächen zulassen“ (LUA & LAGS 2001). Tabelle A-10 im<br />
Anhang zeigt, dass über die Hälfte der lebensraumtypischen Arten im Rahmen der<br />
Brandenburger Erfolgskontrolle zum Vertragsnaturschutz nicht erfasst werden 167 . Für die<br />
Mageren Flachland-Mähwiesen wird es notwendig sein, die Status-quo-Erhebung im Zuge des<br />
FFH-Monitorings für die Entwicklung von Indikatorenarten einer ergebnisorientierten<br />
Honorierung zu nutzen. Zu prüfen ist, inwieweit die FFH-Kartierung eine Genauigkeit erreicht,<br />
die die Nutzung dieser Daten für die Ableitung der Indikatoren erlaubt.<br />
167 Dieses Beispiel zeigt, dass es aus Gründen der Transaktionskosten vorteilhaft sein kann, eine Erhebung der<br />
Vegetation nach pflanzensoziologischen Methoden durchzuführen, um diese für verschiedene Zwecke nutzen zu<br />
können, auch wenn die Erhebung im ersten Moment einen Mehraufwand bedeutet.
266 Kapitel 8<br />
Schritt 2 – Qualitative Bewertung der Datenbestände<br />
Die unter Schritt 1 beschriebene Datenbasis kann anhand der Qualitätsnormierung des LRT<br />
bewertet werden. Grundlage sind die jeweils LRT-typischen Pflanzenarten. Die Normierungen<br />
für die zwei LRT sind in Abbildung 61 und Abbildung 62 dargestellt. Neben den Pflanzenarten<br />
kann bei nicht ‚eindeutigen’ Beständen bei den Mageren Flachland-Mähwiesen noch das<br />
Kriterium der Deckung der Kräuter hinzugezogen werden. Bei Brenndolden-Auenwiesen kann<br />
die Artenzahl zusätzlich zu den LRT-typischen Pflanzenarten zur Qualitätsbestimmung genutzt<br />
werden.<br />
Trotz der Qualitätsnormierung bedarf es eines gewissen Maßes an ‚Intuition’ auf der Grundlage<br />
fundierter Kenntnisse der realen Vielfalt, um diese Subsumtion der Bestände unter die<br />
Qualitätstypen am grünen Tisch durchzuführen. Diese Arbeit sollte daher durch ausgewiesene<br />
Kenner der Brandenburger Vegetation erfolgen. Die Vielfalt der realen Vegetation führt dazu,<br />
dass sich dem Ideal einer Bewertung als messanalogem Vorgang nur angenähert werden kann.<br />
Entscheidend ist, dass die Bewertung intersubjektiv nachvollziehbar ist (vgl. dazu Kap. 6.3.4).<br />
Die Normierung der Qualitäten operationalisiert jedoch die Qualitätszuweisung weitgehend. 168<br />
Die Bestände sind nach dieser Bewertung eindeutig den Qualitätstypen A, B oder C zugeordnet.<br />
Die kritische Qualitätsbewertung der Datenbasis durch Experten kann und sollte zur<br />
Verifizierung der definierten LRT-typischen Arten genutzt werden (vgl. Abbildung 61 und<br />
Abbildung 62).<br />
Schritt 3 – Ableitung von Indikatorenarten für die ergebnisorientierte Honorierung<br />
Die qualitativ bewerteten Bestände können hinsichtlich differenzierender Arten statistisch<br />
ausgewertet werden. Von Interesse sind dabei nur noch die Qualitäten A und B. Die Gruppe C ist<br />
jedoch zur Definition abgrenzender Arten sehr hilfreich. Selbst über Arten standardisiert werden<br />
muss diese Gruppe nicht (C ist als Rest definiert).<br />
Die Arten müssen eine Treue zur jeweiligen Qualität aufweisen und mit einer ausreichenden<br />
Stetigkeit in den Beständen vorkommen. Die Arten müssen keine Merkmale von<br />
168 Bei der Erarbeitung der Schweizer ÖQV war ein Expertenurteil durch lokale Kenner notwendig, um die<br />
grundlegende Bewertung der Vegetationsaufnahmen als Ausgangspunkt für die Entwicklung der Indikatoren<br />
vorzunehmen. Durch Expertenwissen musste die Frage beantwortet werden: „Ist der Bestand würdig, gefördert zu<br />
werden?“, schriftliche Mitteilung durch Christian Hedinger (vgl. UNA 2001).
Beispiele für ergebnisorientierte Honorierungsansätze 267<br />
pflanzensoziologischen Charakterarten haben, denn die Typuszugehörigkeit muss nicht mit Hilfe<br />
dieser Arten angezeigt werden. Mit hoher Wahrscheinlichkeit werden die jeweiligen LRT<br />
standörtlich unterschieden werden müssen. Insbesondere die Wasserversorgung dürfte eine<br />
Differenzierung notwendig machen (vgl. Beschreibung der LRT in Kap. 8.2.3.1).<br />
Resultat sind mindestens zwei Masterlisten zu Pflanzenarten pro LRT, die die Qualität indikativ<br />
abbilden. Die statistische Auswertung kann zeigen, dass die zwei Qualitäten nicht über<br />
verschiedene Pflanzenarten indikativ zu differenzieren sind, sondern möglicherweise ‚nur’<br />
anhand der Anzahl qualitätszeigender Arten. Aufgrund der sich in der Artenzusammensetzung<br />
durchschlagenden Standortverhältnisse der Wasserversorgung ist von insgesamt vier<br />
Masterlisten pro LRT auszugehen. Qualität A für trockene und feuchte Standort und Qualität B<br />
für trockene und feuchte Standorte (vgl. Abbildung 61 und Abbildung 62).<br />
Die differenzierenden Arten müssen in einem zweiten Schritt hinsichtlich ihrer guten<br />
Erkennbarkeit bewertet werden. Dabei kann zum einen auf die Erfahrungen in der Schweiz und<br />
im MEKA II zurückgegriffen werden (vgl. Kap. 4.2.3, vgl. auch Schiess-Bühler 2003), zum<br />
anderen konnten in den letzten Jahren auch in Brandenburg im Rahmen der Erfolgskontrolle des<br />
Vertragsnaturschutzes Erfahrungen zur Erkennung von ausgewählten Arten in<br />
Grünlandbeständen durch ‚Nichtfachleute’ gesammelt werden. In Brandenburg wurden für die<br />
Erfolgskontrolle von gefördertem, extensivem Grünland Naturwächter der Großschutzgebiete<br />
geschult.<br />
Sofern die Indikatorenarten des Monitorings den Anforderungen der Indikatoren einer<br />
ergebnisorientierten Honorierung gerecht werden, sollten diese genutzt werden, da den<br />
Landwirten dadurch die direkten Zielarten ‚näher gebracht’ werden und darüber hinaus die<br />
Synergieeffekte zwischen Monitoring nach Artikel 11 der FFH-Richtlinie und der<br />
Administration der Honorierungsinstrumente am besten genutzt werden können.<br />
Die indikative Wirkung und die Praktikabilität der ausgewählten Arten ist nach den ersten<br />
Anwendungen zu verifizieren und gegebenenfalls zu überarbeiten.<br />
Die Aufnahmemethode ist im Zuge der Indikatorenentwicklung und in Zusammenarbeit mit den<br />
Landwirten bzw. Kontrollpersonen zu erarbeiten. Dabei können die Erfahrungen genutzt werden,<br />
die mit der Transektmethode im Rahmen des MEKA II (vgl. S. 121) bzw. mit der eher<br />
flächenhaften Erfassung nach dem Schweizer Modell (vgl. BLW 2001) gemacht wurden.
268 Kapitel 8<br />
Verifizierung der LRT-typischen Pflanzenarten<br />
Verifizierung der Indikatorenliste<br />
Bewertung der Bestände auf der Grundlage von LRT-typischen Pflanzenarten<br />
*Achillea salicifolia, *Allium angulosum, *Cnidium dubium, Deschampsia caespitosa, Galium boreale, *Gratiola<br />
officinalis, *Inula britannica, Iris sibirica, Lathyrus palustris, Ranunculus auricomus agg., Sanguisorba officinalis,<br />
Serratula tinctoria, *Scutellaria hastifolia, Senecio aquaticus, Silaum silaus, *Thalictrum lucidum, *Th. flavum,<br />
*Pseudolysimachium longifolium, *Viola stagnina sowie weiteren typischen Arten der Feuchtwiesen<br />
(* = Stromtalarten)<br />
mindestens 6 LRT-Arten<br />
(artenreiche Wiesen<br />
> 30 Pflanzenarten)<br />
A - Bestände mit<br />
vollständigem<br />
lebensraumtypischen<br />
Arteninventar<br />
Statistische Auswertung nach Arten mit charakteristischen Eigenschaften für die jeweilige<br />
Qualität bzw. trennende Zeigereigenschaften zwischen den Qualitäten<br />
Gegebenenfalls sind die Indikatorenarten standörtlich zu differenzieren, z.B. feuchte und trockene<br />
Ausprägung (Wiesenfuchsschwanzwiesen und Glatthaferwiesen).<br />
Zusätzliche Eigenschaft der Arten:<br />
• Einfach/eindeutig zu erkennen<br />
• LRT-typische Arten werden bevorzugt<br />
Liste A – feucht<br />
z.B. Talictrum flavum<br />
…<br />
Brenndolden-Auenwiesen (LRT 6440)<br />
Datenbasis der Bewertung<br />
vorhandene (aktuelle) Vegetationsaufnahmen<br />
Burkart 1998<br />
Fartmann et al. 2001<br />
Leyer 2002<br />
mindestens 3 LRT-Arten<br />
(mittlere Artenzahl)<br />
Datenbasis der Indikatorenentwicklung<br />
B - Bestände mit<br />
weitgehend vorhandenem<br />
lebensraumtypischen<br />
Arteninventar<br />
Qualitätszeigende Indikatorenarten(anzahl)<br />
(standortdifferenziert: feucht/trocken)<br />
weniger als 3 LRT-Arten<br />
(Arten des<br />
Intensivgrünlandes)<br />
C - Bestände mit<br />
teilweise vorhandenem<br />
lebensraumtypischen<br />
Arteninventar<br />
Liste A – trocken Liste B – trocken<br />
Liste B – feucht<br />
(kann mit A identisch sein,<br />
dann Differenzierung über<br />
Artenanzahl)<br />
Abbildung 61: Verfahren zur Ableitung der Indikatoren für eine ergebnisorientierte Honorierung für den<br />
Lebensraumtyp (LRT) Brenndolden-Auenwiese
Beispiele für ergebnisorientierte Honorierungsansätze 269<br />
Verifizierung der LRT-typischen Pflanzenarten<br />
Verifizierung der Indikatorenliste<br />
vorhandene<br />
Vegetationsaufnahmen<br />
des Arrhenatherion<br />
für Brandenburg<br />
mindestens 15 Arten<br />
(- Magerkeitszeiger (*)<br />
- Gesamtdeckungsgrad<br />
der Kräuter: basenreich:<br />
> 40% basenarm: > 30%)<br />
A - Bestände mit<br />
vollständigem<br />
lebensraumtypischen<br />
Arteninventar<br />
Datenbasis der Bewertung<br />
vorhandene Erhebungen<br />
der FFH-Kartierung des<br />
LRT 6510<br />
Bewertung der Bestände auf der Grundlage von LRT-typischen Pflanzenarten<br />
Achillea millefolium, Anthoxanthum odoratum*, Arrhenatherum elatius, Avenula pubescens*, Alopecurus pratensis, Campanula patula,<br />
Centaurea jacea, Crepis biennis, Daucus carota, Festuca prat., Festuca rubra, Galium album, Geranium pratense, Heracleum sphondylium,<br />
Holcus lanatus, Knautia arvensis, Lathyrus prat., Leucanthemum vulgare, Leontodon autumnalis, Leontodon hispidus*, Lotus<br />
corniculatus, Luzula campestris*, Pastinaca sativa, Phleum pratense, Pimpinella major, Pimpinella saxifraga*, Plantago lanceolata, Poa<br />
trivialis, Ranunculus bulbosus*, Ranunculus repens, Ranunculus acris, Rumex thyrsiflorus, Sanguisorba officinalis, Saxifraga granulata*,<br />
Silaum silaus, Stellaria graminea*, Tragopogon pratensis, Trifolium pratense, Veronica chamaedrys, Vicia cracca, Vicia sepium<br />
(eventuell noch ergänzen)<br />
mindestens 8 LRT-Arten<br />
(- Magerkeitszeiger (*)<br />
- Gesamtdeckungsgrad der<br />
Kräuter: basenreich: 30-<br />
40% basenarm: 15-30%)<br />
Datenbasis der Indikatorenentwicklung<br />
B - Bestände mit<br />
weitgehend vorhandenem<br />
lebensraumtypischen<br />
Arteninventar<br />
Status Quo-Erhebung<br />
im Rahmen des<br />
Monitorings<br />
weniger als 8 LRT-Arten<br />
(- Gesamtdeckungsgrad der<br />
Kräuter: basenreich: < 30%<br />
basenarm: < 15%)<br />
C - Bestände mit<br />
teilweise vorhandenem<br />
lebensraumtypischen<br />
Arteninventar<br />
Statistische Auswertung nach Arten mit charakteristischen Eigenschaften für die jeweilige<br />
Qualität bzw. trennende Zeigereigenschaften zwischen den Qualitäten<br />
Gegebenenfalls sind die Indikatorenarten standörtlich zu differenzieren, z.B. feuchte und trockene<br />
Ausprägung (Wiesenfuchsschwanzwiesen und Glatthaferwiesen).<br />
Zusätzliche Eigenschaft der Arten:<br />
• einfach/eindeutig zu erkennen<br />
• LRT-typische Arten werden bevorzugt<br />
Liste A – feucht<br />
z.B. Pimpinella major<br />
…<br />
Magere Flachland-Mähwiesen (LRT 6510)<br />
Qualitätszeigende Indikatorenarten(anzahl)<br />
(standortdifferenziert: feucht/trocken)<br />
Liste A – trocken Liste B – trocken<br />
Liste B – feucht<br />
(kann mit A identisch sein,<br />
dann Differenzierung über<br />
Artenanzahl)<br />
Abbildung 62: Verfahren zur Ableitung der Indikatoren für eine ergebnisorientierte Honorierung für den<br />
Lebensraumtyp (LRT) Magere Flachland-Mähwiese
270 Kapitel 8<br />
8.2.3.3 Honorierungsverfahren<br />
Es wird ein Verfahren vorgestellt, wie eine ergebnisorientierte Honorierung im Rahmen von<br />
Artikel 16 VO (EG) 1257/1999 für die LRT Brenndolden-Auenwiese und Magere Flachland-<br />
Mähwiese umgesetzt werden kann. Eine ergebnisorientierte Honorierung ist selbstverständlich in<br />
gleicher Weise im Rahmen von Agrarumweltmaßnahmen für die LRT anwendbar, mit Artikel 16<br />
kann man jedoch der besonderen Eigentumssituation und der Problemstruktur in FFH-Gebieten<br />
besser gerecht werden (vgl. Kap. 8.2.1.5).<br />
Mit der Ausweisung als SAC-Gebiete sind die Eigentumsrechte an den LRT der Gesellschaft<br />
zugesprochen. Die Staaten sind sogar verpflichtet, alle notwendigen Maßnahmen für die<br />
Umsetzung der Ziele zu ergreifen. Der Inhalt des Eigentums ist anhand der ‚ökologischen<br />
Inhaltsprägung’ (vgl. Czybulka 2002 in Kap. 8.2.1.5) beschrieben. Damit kann argumentiert<br />
werden, dass keine gesonderten Maßnahmen in den Schutzgebietsverordnungen festgelegt<br />
werden müssen, um die Fördervoraussetzungen nach Artikel 16 zu erfüllen, sofern für den Erhalt<br />
bzw. die Entwicklung der LRT eine Einschränkung der landwirtschaftlichen Tätigkeit bzw. eine<br />
bestimmte Art der Nutzung notwendig ist.<br />
Es wurde in Kapitel 8.2.1.5 argumentiert, dass es sich bei der Notwendigkeit des Einsatzes von<br />
individuellen Fähigkeiten zum Erhalt und zur Entwicklung der ‚ökologischen Inhaltsprägung’<br />
um eine ausgleichspflichtige Inhaltsbestimmung handelt, sofern den Landwirten mit der<br />
Verpflichtung zum Erhalt der ‚ökologischen Inhaltsprägung’ Kosten entstehen (keine<br />
Kuppelproduktion). Artikel 16-Zahlungen sind im Rahmen dieser Argumentation eine<br />
Honorierung und die Gesellschaft ist verpflichtet, die Landwirte für ihre Leistung zu<br />
honorieren 169 . Unter Berücksichtigung der Eigentumsrechtslage ist eine Deckelung der Prämie<br />
bei 200 € (bzw. 500 € in den ersten Jahren) für LRT und Arten, die einer landwirtschaftlichen<br />
Bewirtschaftung bedürfen, nicht zu rechtfertigen. Die Höhe sollte mindestens zum Ausgleich der<br />
Kosten führen. Darüber hinaus würde die Möglichkeit der Zahlung von zusätzlichen Anreizen<br />
(z. B. wie bei Agrarumweltmaßnahmen 20 %) mehr Spielraum bei der Entwicklung einer<br />
effizienten Honorierung bringen. Die gesellschaftliche Verpflichtung zur Zahlung verschafft<br />
dem Landwirt (und der Gesellschaft) Planungssicherheit.<br />
169 Aktuell wird Artikel 16 jedoch nicht in dieser Art und Weise angewendet (vgl. Kap. 7.3.2.2).
Beispiele für ergebnisorientierte Honorierungsansätze 271<br />
Die Landwirte erhalten eine Grundprämie für die Erhaltung der Qualität der jeweiligen<br />
Bestände der Brenndolden-Auenwiesen und der Mageren Flachland-Mähwiesen 170 . Damit<br />
entfällt das Risiko für die Landwirte, das entstehen würde, wenn die Honorierung an ein<br />
Entwicklungsziel geknüpft ist, das von anderen als der aktuellen Nutzung abhängt (z. B.<br />
historische Nutzung, Samenbank u.a.) bzw. nicht in vertragstauglicher Zeit zu erreichen ist (vgl.<br />
Kap. 6.3.4.2 und 6.3.4.3). Diese Prämie wird für die Bestände mit einem vorhandenen bzw.<br />
weitgehend vorhandenen typischen Arteninventar ergebnisorientiert auf der Grundlage der<br />
Indikatorenarten der Liste A und B (vgl. Abbildung 61 und Abbildung 62) gestaltet. Für die<br />
Bestände, deren Qualität nur mit C bewertet wird, sind ‚Positivindikatoren’ (vgl. Kap. 8.2.3.2)<br />
nicht sinnvoll und daher wird eine maßnahmenorientierte Honorierung empfohlen (vgl. Tabelle<br />
17 und Tabelle 18).<br />
Tabelle 17: Art der Honorierung in Abhängigkeit von der Lebensraumqualität<br />
jährliche Grundprämie<br />
5-jährige/6-jährige<br />
Zusatzprämie<br />
Qualität des LRT-Bestandes<br />
A B C<br />
ja<br />
ergebnisorientiert für<br />
Erhaltung<br />
(ja)<br />
ergebnisorientiert für<br />
Erhaltung<br />
ja<br />
ergebnisorientiert für<br />
Erhaltung<br />
ja<br />
ergebnisorientiert für<br />
Entwicklung<br />
ja<br />
maßnahmenorientiert<br />
ja<br />
ergebnisorientiert für<br />
Entwicklung<br />
jahrliche Beratung ja ja ja<br />
Schulung zu den<br />
Indikatorenarten<br />
ja ja nein<br />
170 Es wird als sinnvoll erachtet, dass den Landwirten die Zahlung nicht zwangsläufig bei einer einmaligen<br />
Unterschreitung der Norm gekürzt wird.
272 Kapitel 8<br />
Tabelle 18: Ergebnisorientierte Honorierung im Rahmen von Artikel 16 für Brenndolden-Auenwiesen und<br />
Magere Flachland-Mähwiesen<br />
Turnus Was wird<br />
erhoben?<br />
jährlich Indikatorenarten<br />
Kontrollperson Was wird<br />
honoriert?<br />
Landwirte/<br />
Gutachter<br />
jährlich - -<br />
5-jährig 1 /<br />
6-jährig 2<br />
Initialjahr<br />
Vollständigkeit des<br />
LRT-typischen<br />
Arteninventars<br />
(FFH-Monitoring)<br />
ausgewiesene<br />
Fachleute (LUA)<br />
Erhaltung der<br />
Ausgangsqualität<br />
Beratung durch<br />
Umweltberater<br />
Verbesserung der<br />
Ausgangsqualität<br />
Schulung zu<br />
Indikatorenarten<br />
Prämienhöhe Anspruch der<br />
Landwirte<br />
auf Zahlung 3<br />
kostendeckend ja<br />
kostendeckend nein<br />
Anreiz<br />
(politisch<br />
auzuhandeln)<br />
nein<br />
kostendeckend nein<br />
1 im Turnus der Programmlaufzeiten der EPLR<br />
2 im Turnus der FFH-Berichtspflicht<br />
3 Annahme: Einsatz individueller Fähigkeiten führt zu Eigentumsrechten der Landwirte an dem ökologischen Gut<br />
Die Zahlung kann wie bisher jährlich im Rahmen der Agrarförderung erfolgen und orientiert sich<br />
aufgrund der aktuellen Rahmenbedingungen an den Kosten. Dazu wird jeweils eine<br />
‚Standardmaßnahmenvariante’ definiert, die für den Erhalt der Qualität angenommen wird. Die<br />
Landwirte haben auf die Zahlung für die Erhaltung der Lebensraumqualität unter der im Rahmen<br />
dieser Arbeit geführten Argumentation einen Rechtsanspruch. Allerdings macht eine<br />
ergebnisorientierte Honorierung nur Sinn, wenn das Gesamtkonzept zur Umsetzung der FFH-<br />
Richtlinie darauf abgestimmt ist. Wenn, wie aktuell, in bestehenden Verordnungen z. B. die<br />
Nutzung des Grünlandes ordnungsrechtlich vorgeschrieben ist, kann keine ergebnisorientierte<br />
Honorierung erfolgen, wenn die ‚Standardmaßnahmenvariante’ (s.o.) nicht über die<br />
ordnungsrechtlichen Auflagen hinausgeht. Dies gilt umso mehr in Brandenburg, da die<br />
Landwirte z.Z. für das gesamte Grünland in FFH-Gebieten mit entsprechenden<br />
Schutzgebietsauflagen eine Prämie erhalten, die die gesamten Kosten ausgleichen 171 .<br />
Neben dieser Grundprämie können Anreize geschaffen werden, die das Interesse der Landwirte<br />
an der Qualitätsverbesserung der Bestände erhöhen. Selbst die aktuellen Rahmenbedingungen,<br />
die mit einer Deckelung der Prämie bei 200 € verbunden sind, bieten die Möglichkeit in der<br />
Initialphase bis zu 500 € pro ha an Ausgleichszahlungen zu gewähren (vgl. FN 104). Diese<br />
171 In den Schutzgebietsauflagen ist in den allermeisten Fällen die Grünlandnutzung eingeschränkt.
Beispiele für ergebnisorientierte Honorierungsansätze 273<br />
Prämienhöhe gibt in jedem Fall in der Initialphase genügend Spielraum für Anreize und vor allen<br />
Dingen für die Beratung der Landwirte bzgl. ihres ‚neuen’ Gutes. In einer begleitenden Beratung<br />
wird ein wichtiger Baustein für eine erfolgreiche ergebnisorientierte Honorierung gesehen und<br />
diese sollte daher wesentlicher Bestandteil des Gesamtkonzeptes sein (vgl. Tabelle 18).<br />
Aus Sicht der Transaktionskosten ist es vorteilhaft, den Zahlungsrhythmus und das FFH-<br />
Monitoring nach Artikel 11 bzw. die Berichterstattung nach Artikel 17 der FFH-Richtlinie<br />
aufeinander abzustimmen 172 und die zusätzliche Prämie an das Qualitätsergebnis des<br />
Monitorings zu knüpfen. Eine derartige zusätzliche Prämie unter den gegebenen<br />
Rahmenbedingungen (Kostenorientierung) ist damit zu rechtfertigen, dass der<br />
Aushagerungsprozess, als wesentliche Voraussetzung einer Qualitätsverbesserung, einen<br />
besonderen Pflegeaufwand verursacht. Darüber hinaus müssen sich die Landwirte mit den<br />
‚Produktionsfaktoren’ der Güter intensiv auseinander setzen, um die richtige Strategie zu<br />
entwickeln (Suchkosten für die optimale Pflege). Es ist darüber hinaus auch ein Anreiz für die<br />
Erhaltung der höchsten Qualität zu diskutieren.<br />
Die Erhebung der Pflanzenarten als Voraussetzung für die Honorierung kann für die<br />
Grundprämie durch geschulte Gutacher oder, wie im Rahmen des MEKA II, durch die Landwirte<br />
selbst erfolgen 173 . Es spricht jedoch einiges dafür, die Aufnahme durch geschulte Gutachter und<br />
Landwirte gemeinsam vornehmen zu lassen und dies mit einer gleichzeitigen Beratung der<br />
Landwirte zu verbinden. Auf diese Art und Weise würde nicht zuletzt die Zusammenarbeit<br />
zwischen den Vertretern des Naturschutzes und der Landwirte intensiviert werden.<br />
8.2.3.4 Diskussion und Ausblick<br />
Es spricht viel dafür, gerade in FFH-Gebieten eine ergebnisorientierte Honorierung für die LRT<br />
anzuwenden, für deren Erhalt eine landwirtschaftliche Nutzung Voraussetzung ist.<br />
Die Anwendung einer ergebnisorientierten Honorierung würde erleichtert werden, wenn im<br />
Rahmen der neuen EU-Förderperiode ab 2007 (vgl. Kap. 7.1.2) eine Änderung der<br />
Förderbedingungen für Artikel 16 erfolgen würde. Es spricht aus eigentumsrechtlicher Sicht viel<br />
172 Die Berichterstattung nach Artikel 11 der FFH-Richtlinie liegt bereits im gleichen Planungsrhythmus wie die<br />
Maßnahmen zur ländlichen Entwicklung und demzufolge der Artikel 16-Maßnahmen. Die nächste Berichterstattung<br />
erfolgt im Jahr 2006.<br />
173 Es erfolgt im Rahmen der 5 %-Vorortkontrolle eine Überprüfung der Angaben (vgl. Abbildung A-2 im Anhang).
274 Kapitel 8<br />
dafür, Artikel 16 zu differenzieren und zwischen politisch gebilligten Ausgleichszahlungen<br />
(Subventionen im aktuellen Verständnis von Artikel 16) für die Einschränkung<br />
landwirtschaftlicher Tätigkeit (Schrankenbestimmungen) auf der einen Seite und<br />
ausgleichspflichtigen Inhaltsbestimmungen (Honorierungen) für den Erhalt von LRT-Qualitäten<br />
durch eine landwirtschaftliche Nutzung auf der anderen Seite zu unterscheiden, wie die<br />
Diskussion in dieser Arbeit gezeigt hat.<br />
Auf dieser Grundlage können für die ‚ausgleichspflichtigen Inhaltsbestimmungen’<br />
ergebnisorientierte Ansätze erarbeitet werden. Eine Kombination von Ordnungsrecht und<br />
Honorierungsinstrumenten bedarf einer Planungssicherheit, da mit dem Ordnungsrecht weniger<br />
Flexibilität gegeben ist. Von daher ist es in der Phase der Festlegung der ordnungsrechtlichen<br />
Bestimmungen wichtig, ein Gesamtkonzept für die Umsetzung der Ziele der FFH-Richtlinie<br />
vorliegen zu haben.<br />
Die Erarbeitung von ergebnisorientierten Honorierungsansätzen verspricht am erfolgreichsten zu<br />
sein, wenn die Erarbeitung als ein iterativer und transdisziplinärer Prozess gestaltet wird, in den<br />
die Landwirte eingebunden werden. Dabei können die Erfahrungen, die im Zuge der ÖQV und<br />
des MEKA II gemacht wurden, genutzt werden (vgl. Kap. 4.2.3 und Oppermann & Gujer (Hrsg.)<br />
2003). In FFH-Gebieten können dieser Prozess und die Zusammenarbeit bei der Anwendung der<br />
ergebnisorientierten Honorierung einen Beitrag zum besseren Verständnis und zu einer<br />
Erhöhung der Akzeptanz für das Natura 2000-Netzwerk bei den Landnutzern vor Ort leisten. Die<br />
teilweise von den Landwirten bisher vermisste Einbindung (vgl. Tabelle 11 sowie COM 2004)<br />
kann durch eine offensive Beteiligung bei der Entwicklung der Umsetzungsinstrumente für die<br />
FFH-Richtlinie ‚nachgeholt’ werden. Eine ergebnisorientierte Honorierung kann bei<br />
Landwirtschaft und Naturschutz zu einer win-win-Situation führen und Vorbehalte abbauen.
Zusammenfassung 275<br />
9 Zusammenfassung<br />
Der Honorierung ökologischer Leistungen der Landwirtschaft wird im gesellschaftlichen Raum<br />
in den letzten Jahren eine wachsende Bedeutung beigemessen. Drei Gründe sind im<br />
Wesentlichen für diesen Bedeutungszuwachs verantwortlich. Zum einen wird darin eine<br />
Möglichkeit gesehen, die landwirtschaftlich verursachten Umweltprobleme und damit die<br />
Konflikte zwischen Landwirtschaft und Naturschutz zu vermindern, zum anderen die<br />
gesellschaftliche Nachfrage nach einer bestimmten Art von Kulturlandschaft zu befriedigen,<br />
indem die Landwirtschaft als Produzent dieser ‚kulturbestimmten’ ökologischen Güter honoriert<br />
wird. Nicht zuletzt forcieren die politischen Rahmenbedingungen, insbesondere der<br />
internationalen Druck im Zuge der WTO-Verhandlungen, eine Hinwendung zu ökologischen<br />
Gütern. Die Effizienz von Honorierungsinstrumente ist jedoch entscheidend von deren<br />
Ausgestaltung abhängig.<br />
In dieser Arbeit wird im Wesentlichen der Frage nachgegangen, wie das Instrument der<br />
Honorierung ökologischer Leistungen ausgestaltet sein muss, um eine effiziente Allokation von<br />
ökologischen Gütern zu gewährleisten und welche Probleme einer optimalen Ausgestaltung<br />
entgegen stehen. Im Mittelpunkt steht dabei insbesondere das ‚Scharnier’ zwischen dem<br />
nachgefragten Gut und der Zahlung. Die Effizienz der Honorierung ist entscheidend davon<br />
abhängig, ob es gelingt, dieses ‚Scharnier’ derart zu fassen, dass das rationale<br />
Entscheidungskalkül des Landwirtes tatsächlich auf das ökologische Gut gerichtet ist. Es wird<br />
aufgezeigt, dass vor dem Hintergrund dieses Kriteriums die ergebnisorientierte Honorierung<br />
gegenüber einer maßnahmenorientierten Honorierung ein höheres Effizienzpotential aufweist.<br />
Als wesentlicher Anspruch an beide Honorierungsansätze wird herausgearbeitet, dass die mit der<br />
Honorierung durchgesetzten Eigentumsrechte, die Erhaltung der ökosystemaren Fähigkeiten, als<br />
Voraussetzung einer nachhaltigen Produktion ökologischer Güter, gewährleisten müssen.<br />
Auf der Grundlage der theoretischen Betrachtungen zu einer effizienten Ausgestaltung von<br />
Honorierungsinstrumenten erfolgt die Analyse der aktuellen Honorierung ökologischer<br />
Leistungen der Landwirtschaft im europäischen Kontext. Abschließend werden im<br />
Zusammenhang mit der Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie und der FFH-Richtlinie zwei<br />
Beispiele für ergebnisorientierte Honorierung vorgestellt, die das aktuelle Anwendungspotential<br />
dieses Ansatzes aufzeigen.<br />
Kapitel 3 diskutiert zwei Ansätzen ökonomischer Instrumente, den Internalisierungsansatz im<br />
Sinne von Pigou sowie den Standard-Preis-Ansatz nach Baumol. Es werden die Stärken<br />
ökonomischer gegenüber anderen Steuerungsinstrumenten aufgezeigt, die im Wesentlichen in
276 Kapitel 9<br />
der dezentralen Problemlösung durch die Beeinflussung rationaler Entscheidungen von<br />
Individuen begründet sind. Die Charakteristik der umweltökonomischen Instrumente liefert die<br />
Basis für die Effizienzbetrachtungen bzgl. des Instrumentes der ‚Honorierung ökologischer<br />
Leistungen der Landwirtschaft’ in Kapitel 4.<br />
In Kapitel 4 erfolgt die umfassende Charakterisierung des Instrumentes ‚Honorierung<br />
ökologischer Leistung der Landwirtschaft’ als umweltökonomisches Instrument. In dieser Arbeit<br />
wird das Instrument darüber definiert, dass Leistungen der Landwirtschaft zur Bereitstellung von<br />
individuell oder von der Gesellschaft als Umweltziele nachgefragten naturbestimmten und<br />
kulturbestimmten Umweltstrukturen honoriert werden, sofern der Landwirt über die<br />
entsprechenden Eigentumsrechte an den Fähigkeiten zur Produktion dieser Güter verfügt. Dabei<br />
kann eine Leistung durch einen derartigen Nutzungsverzicht erbracht werden, dass die<br />
ökosystemaren Fähigkeiten ausreichen, die naturbestimmten und kulturbestimmten<br />
Umweltstrukturen zu (re)produzieren und/ oder dadurch, dass durch den Einsatz individueller<br />
Fähigkeiten die knappen kulturbestimmten Umweltstrukturen gezielt bereit gestellt werden.<br />
Inwieweit mit dem Instrument die Produktion effizient gesteuert werden kann, hängt<br />
entscheidend von der konkreten Ausgestaltung des Instrumentes ab. Dabei werden in der<br />
gesellschaftlichen Diskussion seit mehreren Jahren immer wieder zwei Honorierungsansätze<br />
einander gegenüber gestellt, die ergebnisorientierte und die maßnahmenorientierte Honorierung.<br />
Die ergebnisorientierte Honorierung wird bisher im Wesentlichen darüber definiert, dass die<br />
Zahlung direkt an einen bestimmten Umweltzustand, z. B. bestimmte Pflanzenarten, gebunden<br />
ist, während bei der maßnahmenorientierten Honorierung die Zahlung an landwirtschaftliche<br />
Bewirtschaftungsverfahren geknüpft wird.<br />
Innerhalb dieser Arbeit wird jedoch das Unterscheidungskriterium der beiden Ansätze aus der<br />
Analyse der Wirkung effizienter ökonomischer Instrumente abgeleitet. Die ergebnisorientierte<br />
Honorierung wird von der maßnahmenorientierten Honorierung ausschließlich anhand des<br />
Kriteriums der dem Landwirt zur Verfügung stehenden Handlungsalternativen unterschieden.<br />
Die dezentrale Suche nach der effizientesten Alternative ist ursächlich für die positive Wirkung,<br />
die ökonomischen Instrumenten per Annahme unterstellt wird.<br />
Bei der ergebnisorientierten Honorierung kann der Landwirt entscheiden, in welcher Art und<br />
Weise er ein nachgefragtes ökologisches Gut produziert, er hat damit Anreiz zur Suche nach<br />
Handlungsalternativen. Mit der maßnahmenorientierten Honorierung wird dem Landwirt nicht<br />
das Ziel, sondern der Weg vorgegeben. Der Anreiz der Zahlung beeinflusst lediglich eine<br />
Entscheidung, die vorgegebene Maßnahme durchzuführen oder nicht. Das Augenmerk des
Zusammenfassung 277<br />
Landwirtes liegt im Gegensatz zur ergebnisorientierten Honorierung nicht auf dem Ergebnis<br />
seiner Arbeit.<br />
Es werden folgende Vorteile der ergebnisorientierten gegenüber der maßnahmenorientierten<br />
Honorierung erarbeitet: Förderung des Eigeninteresses, höheres Innovationspotential, Abbau von<br />
Informationsasymmetrien, Förderung von Kontinuität, Förderung kooperativen Handelns,<br />
Förderung intrinsischer Motivation und nicht zuletzt eine veränderte gesellschaftliche<br />
Risikoverteilung.<br />
Die Praxisbeispiele zur ergebnisorientierten Honorierung aus den letzten Jahren zeigen, dass eine<br />
Anwendung ergebnisorientierter Honorierung selbst im größeren Rahmen und eingebettet in die<br />
europäische Agrarförderung prinzipiell möglich ist. Bisher findet eine ergebnisorientierte<br />
Honorierung ökologischer Leistungen der Landwirtschaft jedoch lediglich im Bereich des Arten-<br />
und Biotopschutzes, durch die Bindung der Zahlungen an das Vorkommen bestimmter<br />
Pflanzenarten, statt.<br />
In Kaptitel 5 wird die Honorierung ökologischer Leistungen vor dem Hintergrund der Theorie<br />
der property rights diskutiert. Nach der Theorie der property rights, bezieht sich die Ökonomie<br />
auf die Eigentumsrechte an knappen Gütern und nicht auf die Güter im eigentlichen Sinne. Mit<br />
dem Instrument der Honorierung ökologischer Leistungen werden Eigentumsrechte geschaffen<br />
oder geändert und/oder durchgesetzt. Da ein Tausch der Eigentumsrechte Voraussetzung für den<br />
Einsatz ökonomischer Instrumente ist, müssen relative Eigentumsrechte geschaffen werden, die<br />
ex post opportunistisches Verhalten in einer Vertragsbeziehung verhindern und somit beidseitig<br />
vorteilhafte Tauschhandlungen erlauben.<br />
Als entscheidend im Zusammenhang mit ökologischen Gütern wird heraus gearbeitet, dass mit<br />
der Schaffung und Durchsetzung der Eigentumsrechte die Fähigkeit zur Produktion der<br />
ökologischen Güter aufrechterhalten werden muss. Das bedeutet, dass mit Eigentumsrechten der<br />
Zugang zu den Fähigkeiten geregelt werden muss. Es werden in dieser Arbeit zwei Fähigkeiten<br />
unterschieden, die für die Produktion von ökologischen Gütern Voraussetzung sind: individuelle<br />
(menschliche) und ökosystemare Fähigkeiten. Der Einsatz von individuellen Fähigkeiten<br />
begründet im Regelfall Privateigentum. Im Falle des Einsatzes von individuellen Fähigkeiten<br />
müssen keine Eigentumsrechte geschaffen werden, diese sind bereits dem Individuum zugeteilt.<br />
Diese Prämisse wird als self-ownership bezeichnet. Die Gesellschaft kann die self-ownership<br />
zugunsten eines Prinzips gegenseitiger Unterstützung einschränken, steht jedoch in der<br />
Begründungspflicht bei der Änderung dieses Eigentumsrechtes. Der Zugang zur individuellen
278 Kapitel 9<br />
Fähigkeit ist selbstbestimmt geregelt, dadurch wird eine Schädigung dieser Fähigkeit (etwa<br />
durch Sklaverei oder Zwangsarbeit) ausgeschlossen.<br />
Eine andere Situation ergibt sich bei den ökosystemaren Fähigkeiten, ökologische Güter zu<br />
produzieren. Es wird aufgezeigt, dass im Ausgangszustand hier ein open access vorliegt, der<br />
Zugang zu den ökosystemaren Fähigkeiten ist nicht geregelt. Von daher kann es hier, im<br />
Gegensatz zu individuellen Fähigkeiten, ohne spezielle Regelungen prinzipiell zur Schädigung<br />
bzw. zur Zerstörung dieser Fähigkeiten kommen. Es wird daher geschlussfolgert, dass sich die<br />
Ökonomie bei ökologischen Gütern mit der Verteilung der Eigentumsrechte an den<br />
ökosystemaren Fähigkeiten zur Produktion der knappen Güter beschäftigen muss.<br />
Der open access kann durch die Verteilung der property rights in einen well-regulated access<br />
überführt werden. Dies ist prinzipiell gleichermaßen durch die Schaffung und Durchsetzung von<br />
Gemein- oder Privateigentum möglich. Die Zuteilung der Eigentumsrechte ist eine normative<br />
Distributionsentscheidung. Grundlegende Distributionsentscheidungen zu Eigentumsrechten sind<br />
in Deutschland im Artikel 14 des GG festgelegt und wurden juristisch im Zuge der<br />
Eigentumsdogmatik und der Abgrenzung der Sozialpflichtigkeit des Eigentums konkretisiert.<br />
Ausgehend von der Verteilung verfassungsrechtlich gebotener und politisch gebilligter<br />
Eigentumsrechte werden die aktuellen Zahlungen für ökologische Leistungen systematisiert und<br />
auf dieser Grundlage Subventionen von Honorierungen unterschieden.<br />
Kapitel 6 beschreibt die Voraussetzungen, die für eine effiziente Honorierung notwendig sind.<br />
Als entscheidende Voraussetzung werden rationalisierte, das heißt mit Hilfe von<br />
Agrarumweltindikatoren operationalisierte Umweltziele identifiziert Die Agrarumweltindi-<br />
katoren werden definiert als: repräsentative Mess- und Kenngrößen von Qualitätszielen der<br />
durch die agrarische Nutzung modifizierten Umwelt, die rationales Handeln ermöglichen. Mit<br />
Hilfe der Indikatoren müssen die absoluten Eigentumsrechte an Erträgen aus individuellen und<br />
ökosystemaren Fähigkeiten so gefasst werden, dass eine Transaktion dieser Rechte mit Hilfe<br />
institutioneller Vereinbarungen stattfinden kann. Dies ist nur möglich, wenn die Indikatoren den<br />
Kriterien der Objektivität und Reliabilität entsprechen, wenn also das Ergebnis der Transaktion<br />
der absoluten Eigentumsrechte mit Hilfe der Indikatoren unabhängig von den jeweiligen<br />
Vertragspartnern unter gleich bleibenden Bedingungen das Gleiche ist.<br />
Die Indikatoren müssen folgende Anforderungen erfüllen: raumkompatibel, das heißt im<br />
politischen Regelungsraum (Transaktionskosten in jedem Fall geringer als Wert des<br />
ökologischen Gutes) valide sowie für landwirtschaftliche Flächeeinheit quantifizierbar,<br />
problemkompatibel, das heißt gegenüber der landwirtschaftlichen Nutzung eines
Zusammenfassung 279<br />
Vertragspartners sensibel und gegenüber den anderen Nutzungen robust, zeitkompatibel, das<br />
heißt in vertragstauglichen Zeiten sensibel, normierbar, das heißt eine klare Grenzziehung<br />
zwischen honorierungswürdiger und nicht honorierungswürdiger Leistung ermöglichen,<br />
kommunizierbar, das heißt adressatengerecht und anwendergerecht formuliert und prüfbar, das<br />
heißt mit möglichst geringem Aufwand (Transaktionskosten in jedem Fall geringer als Wert des<br />
ökologischen Gutes) erhebbar sein. Für die ergebnisorientierte Honorierung können Zustands-<br />
sowie Immissions-Indikatoren und für eine maßnahmenorientierte Honorierung Emissions- und<br />
Maßnahmen-Indikatoren genutzt werden.<br />
Drei wesentliche Problembereiche erschweren bzw. verhindern die Rationalisierung der<br />
Umweltziele: die Komplexität ökologischer Systeme, die Normativität der Indikatoren-<br />
entwicklung und die Diversität der Umweltziele.<br />
Ökosysteme sind komplex und in vielen Fällen durch stochastische und/ oder nicht linear<br />
ablaufende Prozesse bestimmt. Daher ist eine indikative Erfassung als Voraussetzung von<br />
Steuerung immer mit Unsicherheit verbunden. Entscheidend für die Anwendung der<br />
Honorierung ist, wer das finanzielle Risiko trägt, das aus dieser Unsicherheit erwächst. Es<br />
werden drei Risikosituationen in Abhängigkeit ihrer Kalkulierbarkeit unterschieden:<br />
Risikosituation i.e.S. und die Situationen der Ungewissheit, die sich unterteilt in Situation in<br />
Unsicherheit i.e.S. und in Unbestimmtheit. Bei der ergebnisorientierten Honorierung muss der<br />
Landwirt wenigstens einen Teil des Risikos tragen, von daher kommt eine derartige Honorierung<br />
nur in Frage, wenn ein kalkulierbares Risiko besteht. Um die Anwendung der ergebnisorien-<br />
tierten Honorierung jedoch auch bei unkalkulierbarem Risiko zu ermöglichen, kann die<br />
Gesellschaft durch den Einsatz von Modellen das Risiko übernehmen.<br />
Der Prozess der Indikatorenentwicklung bedarf normativer Entscheidungen und demzufolge<br />
entsprechender Entscheidungsstrukturen. Eine Vielzahl von teilweise konkurrierenden<br />
Umweltzielen muss im Zuge der Rationalisierung berücksichtigt und teilweise gegeneinander<br />
abgewogen werden.<br />
In Kapitel 7 werden die politischen Rahmenbedingungen für die Honorierung ökologischer<br />
Leistungen dargestellt und deren Konsequenz für die Entwicklung von Honorierungsinstru-<br />
menten diskutiert. Die internationale Entwicklung im Rahmen der WTO-Verhandlungen führt<br />
einerseits zu einer Erhöhung der Bedeutung von Honorierungen für ökologische Leistungen,<br />
forciert darüber hinaus eine klare Zielformulierung und fordert einen klarer Zusammenhang<br />
zwischen Ziel und Mittel ein. Andererseits werden gerade ergebnisorientierte<br />
Honorierungsansätze dadurch erschwert, dass im Rahmen der WTO deutlich gefordert wird, dass
280 Kapitel 9<br />
sich der Preis für die ökologische Leistung an den Vermeidungskosten zu orientieren hat und die<br />
Landwirte keine Renten aus derartigen Zahlungen ziehen dürfen. Innerhalb dieser internationalen<br />
Rahmenbedingungen treibt die EU einen weiteren Ausbau der ‚Maßnahmen zur ländlichen<br />
Entwicklung’ voran. Damit ist ein Ausbau im Bereich der Honorierung ökologischer Leistungen<br />
zu erwarten. Agrarumweltmaßnahmen sind verpflichtende Bestandteile der Pläne zur ländlichen<br />
Entwicklung für alle EU-Länder. Es darf dabei jedoch nicht übersehen werden, dass aktuell<br />
lediglich 4 % der europäischen Finanzmittel des EAGFL in die Agrarumweltmaßnahmen<br />
investiert werden.<br />
Die teilweise sehr detaillierten Vorgaben der EU zur Ausgestaltung und Kontrolle der<br />
Honorierung ökologischer Leistungen der Landwirtschaft im Rahmen von Agrarumwelt-<br />
maßnahmen haben durchschlagende Wirkung bis hin zu regionalisierten Programmen, da kaum<br />
ein Land auf die Kofinanzierung durch die EU verzichten kann.<br />
Die Analyse deutscher Agrarumweltprogramme und Artikel 16-Maßnahmen zeigt<br />
Handlungsbedarf bzgl. einer effektiveren und effizienteren Ausgestaltung auf.<br />
In Kapitel 8 werden zwei Beispiele für die Anwendung von ergebnisorientierter Honorierung<br />
gegeben, die aufzeigen, dass ein derartiger Ansatz, trotz der vielfältigen Probleme und<br />
politischen Restriktionen, möglich und für die Umsetzung wichtiger, aktueller europäischer<br />
Richtlinien besonders interessant ist. Sowohl durch die Wasserrahmenrichtlinie als auch die<br />
FFH-Richtlinie sind bzw. werden sehr gute Voraussetzung geschaffen, um ergebnisorientierte<br />
Honorierungsansätze anzuwenden. Für die Umsetzung von Maßnahmen im Zuge der<br />
Wasserrahmenrichtlinie können ergebnisorientierte Honorierungsinstrumente entwickelt werden,<br />
die an modellierten Immissionen ansetzen. Mit dem Brandenburger Beispiel für eine<br />
ergebnisorientierte Honorierung der Verminderung von N-Immissionen wird eine Möglichkeit<br />
der Ausgestaltung einer derartigen Honorierung dargestellt.<br />
Die Anwendung im Rahmen der Umsetzung der FFH-Richtlinie bietet sich insbesondere an, da<br />
im Zuge des Monitorings und der Berichtspflicht bereits Indikatoren entwickelt wurden, die<br />
direkt für die Verknüpfung mit Zahlungen genutzt werden können, um die Zahlungen zur<br />
Erhaltung bestimmter Grünlandlebensraumtypen ergebnisorientiert zu gestalten. Die Zahlungen<br />
können hierbei an bestimmte Grünlandpflanzenarten geknüpft werden, wie im Brandenburger<br />
Beispiel dargestellt wird. Nicht zuletzt wird neben dem bereits entwickelten Indikatorensystem<br />
die besondere eigentumsrechtliche Situation in FFH-Gebieten als Grund für die Anwendung<br />
einer ergebnisorientierte Honorierung herausgearbeitet.
Zusammenfassung 281<br />
Mit dieser Arbeit wird auf der einen Seite aufgezeigt, welche komplexen Rahmenbedingungen<br />
die Entwicklung eines effizienten Instrumentes zur Honorierung ökologischer Leistungen der<br />
Landwirtschaft beeinflussen. Auf der anderen Seite werden die Voraussetzungen für effiziente<br />
Honorierungsinstrumente ausführlich dargestellt, die ihrerseits als Ansprüche an die<br />
Rahmenbedingungen gewertet werden können. Im Spannungsfeld dieser gegenseitigen<br />
Abhängigkeit werden Möglichkeiten und Grenzen der Lösung von Umweltproblemen im<br />
Bereich Landwirtschaft und Naturschutz mit Hilfe der Honorierung ökologischer Leistungen<br />
dargestellt.
282 Kapitel 9<br />
Summary<br />
Growing importance in a social sense has been attached to remuneration for farmers for<br />
implementing environmentally sound practices in agriculture over the past few years. There are<br />
essentially three causes for this growing importance. Firstly, the remuneration is seen as a<br />
possibility for decreasing the environmental problems caused by agriculture and the conflicts<br />
between agriculture and environmental protection. Secondly, it is seen as a chance to satisfy the<br />
social demand for a certain type of cultural landscape, insofar as farmers are rewarded as<br />
producers of these ‘culturally defined’ environmental goods. Last but not least, the political<br />
conditions are pushing this turn towards environmental products, especially the international<br />
pressure brought about by WTO negotiations. However, the efficiency of such remuneration<br />
instruments is entirely dependent upon the form they take.<br />
Essentially, this thesis sets out to answer the question of how the implementation of the<br />
remuneration to farmers for environmentally sound practices needs to be designed, in order to<br />
ensure an efficient allocation of environmental goods. Also, the problems that hinder an optimal<br />
form of implementation will be examined. Especially central to this issue is the ‘hinge’ between<br />
the goods in demand and the payments to the farmers. The efficiency of the remuneration is most<br />
decidedly dependent on whether this hinge is designed in a way that the farmer’s rational<br />
decision-making is in fact directed towards the production of environmental goods. It will be<br />
shown that against the backdrop of this criterion the result oriented remuneration has a higher<br />
potential for efficiency as compared to the application oriented remuneration. It will be shown<br />
that an essential requirement for both remuneration approaches is that ownership rights, which<br />
are asserted through remuneration, have to ensure the preservation of a capable ecological<br />
system as a condition for the sustained production of environmental goods.<br />
An analysis of the current remuneration of environmental achievements in a European context<br />
has resulted from theoretical views of an efficient model of remuneration instruments. In<br />
conclusion two examples of result-oriented remuneration, which demonstrate the application<br />
potential of this approach, will be introduced along with the implementation of the water<br />
framework directives and the FFH directives.<br />
Chapter 3 discusses two environmental policy approaches, the internalisation approach as<br />
described by Pigou as well as the standard price approach by Baumol. The strengths of these<br />
environmental instruments will be demonstrated as compared to other regulatory instruments,<br />
which are essentially based on decentralised solutions influenced by rational, individual<br />
decisions. The characteristic of environmental instruments offers the basis for the views on
Zusammenfassung 283<br />
efficiency, regarding the instruments of the ‘remuneration of environmental achievements in<br />
agriculture’ in chapter 4.<br />
An extensive characterisation of the instruments ‘remuneration of environmental achievements<br />
in agriculture’ as environmental instruments comes in chapter 4. Policy will be defined in this<br />
paper by how the agricultural achievements in the preparation of individual or social<br />
environmental goals of desired, naturally defined and culturally defined environmental structures<br />
are rewarded. This requires that the farmer has the necessary ownership rights over the means of<br />
production for these goods. This being said, the farmer can achieve this goal by forgoing further<br />
usage of these means of production once the capabilities of the ecological system are sufficient<br />
enough to (re)produce the naturally and culturally defined environmental structures and/or in<br />
such a way that through the implementation of individual capabilities (abilities) the concise<br />
culturally defined environmental structures can be quite deliberately put into place.<br />
To what extent the production can be efficiently regulated through these instruments depends<br />
quite heavily on the specific form of the policy. Over the past few years two remuneration<br />
approaches have been continually compared in social debates, the result oriented and the<br />
application oriented remuneration. The result oriented approach has essentially been defined by<br />
the fact that the payments correlate directly to specific environmental conditions, i.e. certain<br />
types of plants. On the other hand, the payments through application oriented approach are<br />
associated with agriculture management.<br />
However, in this paper the criteria for the differentiation between the two approaches taken from<br />
the analysis on the effect of environmental instruments. The result oriented remuneration will be<br />
distinguished from the application oriented remuneration only according to the various<br />
operational alternatives the farmer has at his disposal. The decentralised search for the most<br />
efficient alternative brings about the positive effect under which the economical instruments are<br />
(assumingly) subordinated.<br />
Under the result oriented remuneration, the farmer is able to decide in what way he produces the<br />
desired goods. Therefore, he has the incentive to search for operational alternatives. With the<br />
application oriented remuneration the specific path and not the result is given to the farmer.<br />
Incentive through the payments received influences solely one decision; whether these measures<br />
are carried out or not. In contrast to the result oriented remuneration, the farmer’s attention is not<br />
directed towards the results of his work.
284 Kapitel 9<br />
The following advantages of the result oriented over the application remuneration will be<br />
demonstrated, the promotion of self-interest; a higher potential for innovation; the dismantling of<br />
information symmetries; the promotion of continuity; the encouragement of more cooperation;<br />
the promotion of intrinsic motivation; and last but not least a realignment of risk sharing.<br />
The practical examples of the result oriented remuneration in the last few years have shown that<br />
the application of the result oriented remuneration is in principle even possible in the wider<br />
context of and imbedded in the European agricultural policy. However, until now the result<br />
oriented remuneration of environmental achievements in agriculture has only been applied to the<br />
area of plant and biotope protection, in that the payments have been directed towards ensuring<br />
the further existence of certain species of plants.<br />
In chapter 5 the remuneration of environmental achievements will be discussed in the context of<br />
the theory of property rights. According to the theory of property rights economy refers to the<br />
property rights on demand goods and not on goods in the truest sense of the word. Through the<br />
policy of remuneration of environmental achievements property rights are created or altered<br />
and/or enforced. As exchange of property is a requirement of the application of economic<br />
instruments, relative property rights (contract rights) need to be created, which will hinder later<br />
opportunism in contractual relations, therefore allowing an exchange advantageous to both<br />
parties.<br />
Decisive in regards to environmental goods, it will be shown that the ability to produce<br />
environmental goods must be maintained by the creation and implementation of the property<br />
rights. That means that access to these capabilities must be regulated through property rights. In<br />
this paper two capabilities will be distinguished, which are requirements for the production of<br />
environmental goods, individual (human) capabilities and those of the eco-system. The<br />
application of individual capabilities is generally based on private ownership. In the case of<br />
individual capabilities, property rights do not need to be created, for they have already been<br />
given to the individual. This premise is referred to as self-ownership. The society can limit self-<br />
ownership in favour of the principle of mutual support; however, it has the responsibility to give<br />
reason for the change in these property rights. The access to individual capabilities is regulated<br />
by the individual; therefore abuse of these capabilities (i.e. slavery or forced labour) is out of the<br />
question.<br />
Another situation for producing environmental goods is to be found in the eco-system<br />
capabilities. It will be demonstrated that in the opening stages there is an ‘open access’, as the<br />
access to the eco-system capabilities is not regulated. For this reason, in contrast to the individual
Zusammenfassung 285<br />
capabilities, without special regulations in place, these capabilities could in principle be damaged<br />
or destroyed. Therefore, it has been concluded that the economy in regards to environmental<br />
goods must closely examine the distribution of property rights for eco-system capabilities for the<br />
production of demand goods.<br />
Open access can through the distribution of property rights be converted into a well-regulated<br />
access. In principle, this is equally possible through the creation and enforcement of either<br />
common or private property. The distribution of property rights is a normative decision. The<br />
most basic decisions of distribution in Germany are set out article 14 of the German Constitution<br />
(GG) and have legally been put into more concrete terms in the course of ownership dogmatic<br />
and the definition of ‘social responsibilities’ in conjunction with ownership. Accepting the<br />
distribution of constitutionally necessary and politically acceptable property rights, the current<br />
payments for environmental achievements have been systemised and in this sense subvention<br />
and remuneration have been differentiated.<br />
Chapter 6 describes the requirements necessary for efficient remuneration. Decidedly important<br />
for the remuneration, rationalised, operationalised environmental targets have been identified by<br />
using agri-environmental indicators. Global agri-environmental indicators are defined as:<br />
representative measurement categories for an environment, modified through agriculture<br />
applications, which make rational actions possible. Through the use of these indicators, the<br />
absolute ownership rights over the proceeds from eco-system and individual capabilities need to<br />
be devised in such a way as to allow a transfer of these rights with the assistance of institutional<br />
agreements. This is only possible when the indicators fulfil the criteria of objectivity and<br />
reliability. Therefore, it is necessary that the result of the transfer of absolute ownership rights,<br />
attained by using these indicators, is non-partisan and that under the same conditions it remains<br />
the same.<br />
The indicators have to fulfil the following demands; spatial compatibility, which means valid<br />
within the scope of regulations (The costs of the transfer are most certainly less than the value of<br />
the environmental goods.), as well as quantifiable for an agricultural unit of measure (i.e. acre);<br />
problem compatibility, which means the agricultural application is sensible for the contractual<br />
partner and robust as compared to other applications; time compatibility, which means the<br />
contracted period of time is realistic; standardisation ability, which means it is possible create a<br />
clear dividing line between achievements which should and should not be remunerated;<br />
communicable, meaning it is both suitable for the target group as well as the application and<br />
testable, indicating that it is leviable with very little time, energy and expenditure (The transfer
286 Kapitel 9<br />
costs are certainly lower than the value of the environmental goods.). State as well as immission<br />
indicators can be used for the result oriented remuneration, whereas emission and driving forces<br />
indicators can be used for the application oriented remuneration.<br />
Three essential problem areas complicate or hinder the rationalisation of the environmental<br />
targets; the complexity of eco-systems, the normativity of the indicator development and the<br />
diversity of environmental goals.<br />
Eco-systems are complex and in many cases defined by stochastic and/or non-linear processes.<br />
For this reason an indicative compilation, as a requirement for regulating, always contains a<br />
degree of uncertainty. Crucial for remuneration is the question of who will carry the financial<br />
risk, which stems from this uncertainty. Three risk scenarios are discernable, irregardless of their<br />
calculability; risk scenario and the uncertain scenario, which are subdivided into uncertainty (in<br />
its proper sense) and vagueness. Under the result oriented remuneration the farmer has to accept<br />
at least some of the financial risk, therefore this type of remuneration can only be considered<br />
when there is a calculable risk. In order to make the result oriented remuneration feasible even<br />
with these un-calculable risks, the society can take on this risk through the use of models.<br />
The process of developing indicators requires a normative decision and therefore also the<br />
corresponding decision framework. A large number of competing environmental targets must be<br />
weighted out in the course of rationalisation and sometimes against each other.<br />
Chapter 7 presents the political conditions for the remuneration of environmental achievements<br />
and their consequences for the development of the remuneration instruments are discussed. The<br />
international development under the framework of the WTO discussions has led on the on hand<br />
to a rise in the importance of remuneration for environmental achievements. Furthermore, it has<br />
pushed for a clearer formulation of goals and promoted a closer connection between the means<br />
and the ends. On the other hand, the result oriented remuneration has been made more<br />
complicated by the conditions clearly promoted by the WTO and that the price for environmental<br />
achievements is based on the avoidance costs. The farmer is also not permitted to profit from<br />
these payments. Within these international conditions, the EU is moving forward on further<br />
expansion measures for rural development. Under these plans, expansion in the area of<br />
remuneration of environmental achievements is to be expected. Global agricultural measures are<br />
obligatory elements of the plans for rural development in all EU countries. One must not<br />
overlook the fact that currently only 4 % of the European EAGGF financial investment goes<br />
towards global agri-environmental measures. The sometimes rather detailed EU allowances for<br />
the shaping and control of remuneration of environmental achievements in agriculture in the
Zusammenfassung 287<br />
context of global agri-environmental measures have a very strong effect all the way down to the<br />
regional programmes, as there are hardly any countries that can refuse co-financing from the EU.<br />
The analysis of German global agri-environmental programmes and the measures set out in<br />
article 16 has shown the need for action, as in more effective and efficient shaping of these<br />
programmes.<br />
In chapter 8 two examples of the application of result oriented remuneration are presented, in<br />
order to demonstrate that this approach, in spite of the variety of problems and political<br />
restrictions, is possible and more important for the implementation. It is especially interesting in<br />
view of current European directives. The water framework directives as well as the FFH<br />
directives have created and are continuing to create very good conditions for the application of<br />
the result oriented remuneration. Result oriented remuneration instruments can be developed,<br />
based on modelled immissions, so that implemented measures fall in line with the water<br />
framework directives. The example of result oriented remuneration in Brandenburg shows<br />
through a decrease of N-immissions a possible form of this type of remuneration.<br />
The application in the context of the implementation of the FFH directives presents a rather good<br />
possibility, for in the course of monitoring and obligatory implementation reports the indicators<br />
have already been developed. These indicators can be directly used for a connecting to the<br />
payments, in order to make them more result oriented so as to preserve certain types of rural<br />
areas. Furthermore, the payments can be linked to certain species of plants in rural areas, as<br />
shown in the Brandenburg example. Finally, alongside the indicator system, this has already<br />
been developed, the special property rights in FFH areas as a base for the application of result<br />
oriented remuneration is being worked on.<br />
On the one hand, in this thesis it has been shown, what types of complex general conditions<br />
influence the development of instruments for the remuneration of environmental achievements in<br />
agriculture. On the other hand, the requirements for an efficient remuneration instrument have<br />
been thoroughly presented, which could also be seen as demands for the general conditions. This<br />
thesis offers many of the possibilities and limits of the solution to environmental problems in the<br />
area of agriculture and environmental protection through the use of remuneration of<br />
environmental achievements, a field of conflict full of interdependencies.
288 Kapitel 9
Literatur 289<br />
Literatur<br />
Adam, T. (1996): Mensch und Natur: das Primat des Ökonomischen – Entstehung, Bedrohung und Schutz<br />
von Kulturlandschaften aus dem Geiste materieller Interessen. Natur und Landschaft 71 (4): 155-159.<br />
Agra-Europe (2002): Leistungen der Bauern honorieren. 29/2002.<br />
Ahrens, H. (1992): Gesellschaftspolitische Aspekte der Honorierung von Umweltleistungen der<br />
Landwirtschaft – Untersuchungen zur Definition und Quantifizierung von landschaftspflegerischen<br />
Leistungen der Landwirtschaft nach ökologischen und ökonomischen Kriterien. Materialienband 84 des<br />
BayStMLU: 117-150.<br />
Albert, H. (1978): Traktat über rationale Praxis. Die Einheit der Gesellschaftswissenschaften 22.<br />
Tübingen.<br />
Albin, S. (1999): Die Vollzugskontrolle des europäischen Umweltrechts. Schriften zum Europäischen<br />
Recht 61. Berlin.<br />
Alchian, A., Demsetz, H. (1973): The Property Right Paradigm. Journal of Economic History 33: 16-27.<br />
Alvensleben, R. v. (2002): Leitbilder einer zukünftigen Landwirtschaft – Anmerkungen aus der Sicht der<br />
Umweltökonomie und der Marktforschung. Vortrag bei der Akademie der ländlichen Räume Schleswig-<br />
Holsteins am 19.03.2002 in Rendsburg.<br />
Andel, N. (1998): Finanzwissenschaft. Tübingen.<br />
AoA (Agreement on Agriculture) (1994): Conclusion of the Uruguay Round of Multilateral Trade<br />
Negotiations. General Agreement on Tariffs and Trade ministerial meeting. Marrakesh, Morocco. 12.-15.<br />
April.<br />
Arni, J.-L. (1994): Handlungserklärung – Handlungsrationalität. In: Nida-Rümelin (Hrsg.): Praktische<br />
Rationalität. Grundlagenprobleme und ethische Anwendungen des rational choice Paradigmas. Berlin,<br />
New York: 31-108.<br />
Arrow, J.K., Fisher, A.C. (1974): Environmental Preservation, Uncertainty, and Irreversibility. Quarterly<br />
Journal of Economics 88: 312-319.<br />
Arrow, K. (1969): The Organisation of Economic Activity. Issues Pertinent to the Choice of Market<br />
Versus Non-Market Allocation. The Analysis and Evaluation of Public Expenditure: The PPB System.<br />
Volume 1, US Joint Economic Committee, 91 st Congress, Washington DC. US Government Printing<br />
Office.<br />
Atkinson, G., Dubourg, W.R., Hamilton, K., Pearce, D.W., Munasinghe, M., Young, C. (1997):<br />
Measuring Sustainable Development – Macroeconomics and Environment. Aldershot.<br />
Backhaus, J. (1982): Gemeineigentum: Eine Anmerkung. In: Backhaus, J., Nutzinger, H.G. (Hrsg.):<br />
Eigentumsrechte und Partizipation. Frankfurt a.M.: 103-124.<br />
Bahner, T. (1996): Landwirtschaft und Naturschutz – vom Konflikt zur Kooperation. Eine<br />
institutionenökonomische Analyse. Frankfurt a.M. u.a.<br />
Balatova-Tulackova, E. (1966): Synökologische Charakteristik der südmährischen<br />
Überschwemmungswiesen. Rozpravy CSAV 76: 1-40. Praha.<br />
Balks, M. (1995): Umweltpolitik aus Sicht der Neuen Institutionenökonomik. Wiesbaden.<br />
Barkmann, J., Baumann, R., Meyer, U., Müller, F., Windhorst, W. (2001): Ökologische Integrität –<br />
Ökologische Risikovorsorge als Aufgabe eines nachhaltigen Landschaftsmanagements. Gaia 10(2): 97-<br />
108.<br />
Barth, S., Köck, W. (Hrsg.) (1997): Qualitätsorientierung im Umweltrecht. Umweltqualitätsziele für<br />
einen nachhaltigen Umweltschutz. Berlin.<br />
* Karten- und Datengrundlagen
290<br />
Bartmann, H. (1996): Umweltökonomie – Ökologische Ökonomie. Stuttgart u.a.<br />
Bäumer, K. (1992): Allgemeiner Pflanzenbau. 3. Auflage. Stuttgart.<br />
Baumol, W.J., Oates, W.E. (1971): The Use of Standards and Prices for Protection of the Environment.<br />
Swedish Journal of Economics 73: 42-54.<br />
Baumol, W.J., Oates, W.E. (1988): The Theory of Environmental Policy. Cambridge u.a.<br />
Baur, P. (1998): Ökologischer Ausgleich durch Direktzahlungen – Denkanstöße für eine zielgerechte<br />
Weiterentwicklung. Schriftenreihe ETH Zürich, Institut für Agrarwirtschaft Zürich.<br />
Baur, P. (2003): Milch und Blumen – Schritte auf dem Weg zur Professionalisierung der Produktion von<br />
ökologischen Leistungen durch die Landwirtschaft. In: Oppermann, R., Gujer, H.U. (Hrsg.): Artenreiches<br />
Grünland bewerten und fördern – MEKA und ÖQV in der Praxis. Stuttgart:160-171.<br />
Bechmann, G. (1990): Großtechnische Systeme, Risiko und gesellschaftliche Unsicherheit. In: Halfmann,<br />
J., Japp, K.P. (Hrsg.): Riskante Entscheidungen und Katastrophenpotentiale – Elemente einer sozialen<br />
Risikoforschung. Opladen: 129-149.<br />
Bechmann, G. (1991): Risiko als Schlüsselkategorie der Gesellschaftstheorie. Kritische<br />
Vierteljahresschrift für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft 3/4: 212-240.<br />
Bechmann, G., Coenen, R., Gloede, F. (1994): Umweltpolitische Prioritätensetzung –<br />
Verständigungsprozesse zwischen Wissenschaft, Politik und Gesellschaft. Wiesbaden.<br />
Becker, K.-W. (1999): Nährstoffumsatz und Transport in der Dränzone landwirtschaftlich genutzter<br />
Böden, Beispiele: Stickstoff, Schwefel, Kalium. Werkstattgespräch „Umsatz von Nährstoffen und<br />
Reaktionspartnern unterhalb des Wurzelraumes und im Grundwasser – Bedeutung für die<br />
Wasserbeschaffenheit“, 25.-26.März 1999. TU Dresden, Inst. f. Grundwasserwirtschaft: 21-30.<br />
Behrendt, H., Huber, P., Opitz, D., Schmoll, O., Scholz, G., Uebe, R. (1999): Nährstoffbilanzierung der<br />
Flussgebiete Deutschlands. UBA-Texte 75. Berlin.<br />
Berg, M., Scheringer, M. (1994): Problems in environmental risk assessment and the need for proxy<br />
measures. Fresenius environmental bulletin 3 (8): 487-492.<br />
Bernotat, D., Schlumprecht, C., Brauns, C., Jebram, J., Müller-Motzfeld, G., Riecken, U., Scheurlen, K.,<br />
Vogel, M. (2002): Gelbdruck „Verwendung tierökologischer Daten“. In: Plachter, H., Bernotat, D.,<br />
Müssner, R., Riecken, U. (Hrsg.): Entwicklung und Festlegung von Methodenstandards im Naturschutz.<br />
Schriftenreihe für Landschaftspflege und Naturschutz 70: 109-218.<br />
Bertke, E., Hespelt, S.-K., Tute, Ch. (2003): Ergebnisorientierte Honorierung ökologischer Leistungen<br />
der Landwirtschaft. In: Nottmeyer-Linden, K., Müller, St., Pasch, D. (Bearb.): Angebotsnaturschutz –<br />
Vorschläge zur Weiterentwicklung des Vertragsnaturschutzes. Tagungsbericht der gleichlautenden<br />
Fachtagung 23.-24. Oktober 2002 in Wuppertal. BfN-Skripten 89: 27-39.<br />
Bertke, E., Isselstein, J., Gerowitt, B. (2002): Ökologische Güter der pflanzlichen Biodiversität in einem<br />
Konzept zur ergebnisorientierten Honorierung ökologischer Leistungen der Landwirtschaft. In: Korn, H.,<br />
Feit, U. (Bearb.): „Treffpunkt Biologische Vielfalt II“. Tagungsband zur gleichnamigen Tagung vom<br />
23.-27. Juli 2001 an der Internationalen Naturschutzakademie Insel Vilm. Bonn-Bad Godesberg.<br />
Beutler, H., Beutler, D. (Hauptbearbeiter) (2002): Katalog der natürlichen Lebensräume und Arten der<br />
Anhänge I und II der FFH-Richtlinie.– Naturschutz und Landschaftspflege in Brandenburg, Jg. 11. (1, 2).<br />
Biermann, F. (1999): Eine ökologische Reform der Welthandelsorganisation – Die Umweltverbände des<br />
Nordens im Konflikt mit den Entwicklungsländern. Zeitschrift für angewandte Umweltforschung. Jg. 12<br />
(4): 465-479.<br />
Blümel, W., Pethig, R., v.d. Hagen, O. (1986): The Theory of Public Goods: A survey of Recent Issues.<br />
Journal of Institutional and Theoretical Economics/ Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft 2: 241-<br />
309.<br />
* Karten- und Datengrundlagen
Literatur 291<br />
BLW (Bundesanstalt für Landwirtschaft) (2001): Technische Ausführungen zum Anhang 1 der<br />
Verordnung über die regionale Förderung der Qualität und der Vernetzung von ökologischen<br />
Ausgleichsflächen in der Landwirtschaft (Öko-Qualitätsverordnung: ÖQV).<br />
BML (Bundesministerium für Landwirtschaft, jetzt BMVEL) (Hrsg.) (2000a): Landwirtschaft und WTO<br />
– Agrarrelevante Aspekte der Welthandelsorganisation. Bonn.<br />
BML (Bundesministerium für Landwirtschaft, jetzt BMVEL) (Hrsg.) (2000b): Nachhaltigkeitsstrategie<br />
für die Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft in Deutschland (Stand: 7. Februar 2000).<br />
BMU (Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit) (Hrsg.) (1997): Ökologie.<br />
Grundlage einer nachhaltigen Entwicklung in Deutschland. Tagungsband zum Fachgespräch,<br />
29.-30.04.1997. Wissenschaftszentrum Bonn-Bad Godesberg.<br />
BMVEL (Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft) (2002):<br />
Ernährungs- und agrarpolitischer Bericht 2002 der Bundesregierung. Bonn.<br />
BMVEL (Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft) (2004):<br />
Ernährungs- und agrarpolitischer Bericht 2004 der Bundesregierung. Bonn.<br />
Boer, T.E. den (1995): Weidevogels: feiten voor bescherming. Technisch rapport no. 16.<br />
Vogelbescherming Nederland. Zeist.<br />
Böhm, M. (1994): Rechtliche Probleme der Grenzwertfindung im Umweltrecht. Umwelt- und<br />
Planungsrecht 4: 132-138.<br />
Böhm, M. (1996): Möglichkeiten und Grenzen einer Prozeduralisierung des Umweltrechts. In: Roßnagel,<br />
A., Neuser, U. (Hrsg.): Reformperspektiven im Umweltrecht. Baden-Baden: 193 ff.<br />
Bohm, P., Russell, C.S. (1985): Comparative analysis of alternative policy instruments. In: Knesse, A.V.,<br />
Sweeney, J.L. (Hrsg.): Handbook of natural resource and energy economics I. Amsterdam: 395-460.<br />
Bonus, H. (1985): Wirtschaftliches Interesse und Ideologie im Umweltschutz. In: Milde, H., Monissen,<br />
H.G. (Hrsg.): Rationale Wirtschaftspolitik in komplexen Gesellschaften. Stuttgart, Berlin: 359-373.<br />
Bosshard, A. (1999): Renaturierung artenreicher Wiesen auf nährstoffreichen Böden. Ein Beitrag zur<br />
Optimierung der ökologischen Aufwertung der Kulturlandschaft und zum Verständnis mesischer Wiesen-<br />
Ökosysteme. Dissertationes Botanicae 303. Stuttgart.<br />
Böttcher, J., Strebel, O., Duynisveld, W.H.M. (1985): Vertikale Stoffkonzentrationsprofile im<br />
Grundwasser eines Lockergesteinsaquifers und deren Interpretation (Beispiel Fuhrberger Feld). Z. dt.<br />
geol. Ges. 136: 543-552.<br />
Böttcher, J., Strebel, O., Duynisveld, W.H.M. (1989): Kinetik und Modellierung gekoppelter<br />
Stoffumsetzungen im Grundwasser eines Lockergesteinsaquifers. Geol. Jb., Reihe C 51: 3-40.<br />
Boyce, J.K. (1994): Inequality as a Cause of Environmental Degradation. Ecological Economics 11: 169-<br />
178.<br />
Braband, D., Elsen, Th. v., Oppermann, R., Haack, S. (2003): Ökologisch bewirtschaftete Ackerflächen –<br />
eine ökologische Leistung? – Ein ergebnisorientierter Ansatz für die Praxis. In: Freyer, B. (Hrsg.):<br />
Beiträge zur 7. Wissenschaftstagung zum Ökologischen Landbau der Zukunft. Wien: 153-156.<br />
Brahms, E. (2003): Ergebnisorientierte Honorierung für regionstypisches Grünland im WSG Fuhrberger<br />
Feld/Niedersachsen. In: Oppermann, R., Gujer, H.U. (Hrsg.): Artenreiches Grünland bewerten und<br />
fördern – MEKA und ÖQV in der Praxis. Stuttgart: 138-146.<br />
Brand, K. W., Jochum G. (2001): Der deutsche Diskurs nachhaltiger Entwicklung. MPS-Texte 1/2000.<br />
München.<br />
Brandt, R. (1974): Eigentumstheorien von Grotius bis Kant. Stuttgart Bad Cannstatt.<br />
* Karten- und Datengrundlagen
292<br />
Brauns, C., Jebram, J., Niermann, I. (1997): Zielarten in der niedersächsischen Landschaftsplanung – am<br />
Beispiel des Landkreises Holzminden. 4. Projekt am Institut für Landschaftspflege und Naturschutz der<br />
Universität Hannover.<br />
Breckling, B. (1992): Uniqueness of ecosystems versus generalizability and predictability in ecology.<br />
Ecological Modelling 63: 13-27.<br />
Breckling, B. (2000): Funktionalität und Ungewissheit in einfachen Modellen ökologischer Prozesse. In:<br />
Jax, K.: Funktionsbegriff und Unsicherheit in der Ökologie. Theorie in der Ökologie 2. Frankfurt a.M.<br />
u.a.: 99-114.<br />
Breckling, B., Latus, C., Müller, F., Mathes, K. (1997): Konzepte zur Untersuchung ökologischer<br />
Komplexität: Der Bezug zwischen Kausalität, Skalierung, Rekursion, Hierarchie und Emergenz.<br />
Tagungsband zum Arbeitstreffen „Theorie in der Ökologie“ der Gesellschaft für Ökologie. Aktuelle<br />
Reihe der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus 4: 106-124.<br />
Breton, A. (1965): A theory of government grants. Canadian Journal of Economics and Political Science<br />
31: 175-187.<br />
Breuer, R. (1999): Naturschutz, Eigentum und Entschädigung. Jahrbuch f. Naturschutz und<br />
Landschaftspflege 50: 151-178.<br />
Breuer, R. (Hrsg.) (2000): Regelungsmaß und Steuerungskraft des Umweltrechts. Symposion aus Anlass<br />
des 70. Geburtstages von Prof. Dr. Jürgen Salzwedel. Köln u.a.<br />
Breustedt, G. (2003): Grundsätzliche Überlegungen zu einer Entkoppelung der Direktzahlungen in der<br />
EU. Agrarwirtschaft 52 (3): 149-156.<br />
Briggs, J., Peat, F.D. (1990): Die Entdeckung des Chaos. Eine Reise durch die Chaos-Theorie. München,<br />
Wien.<br />
Bromley, D.W. (1991): Environment and Economy: Property Rights and Public Policy. Oxford.<br />
Bromley, D.W. (1997a): Environmental benefits of agriculture: concepts. In: OECD (Hrsg.):<br />
Environmental benefits from agriculture – Issues and policies. The Helsinki Seminar. Organisation for<br />
Economic Co-Operation and Development. Paris: 35-54.<br />
Bromley, D.W. (1997b): Property Regimes in Environmental Economics. In: Folmer, H., Tietenberg, T.<br />
(Hrsg.): The International Yearbook of Environmental and Resource Economics 1997/1998: 1-27.<br />
Bröning, U., Wiegleb, G. (1999): Leitbilder in Naturschutz und Landschaftspflege. In: Konold, W.,<br />
Böcker, R., Hampicke, U. (Hrsg.): Handbuch für Naturschutz und Landschaftspflege. Landsberg am<br />
Lech.<br />
Brubaker, E. (1995): Property Rights in the Defence of Nature. Earthscan London.<br />
Buchanan, J.M. (1975): The Limits of Liberty. Between Anarchy and Leviathan. Chicago, London.<br />
Bundesamt für Landwirtschaft (1998): Verordnung über die Direktzahlungen an die Landwirtschaft<br />
(Direktzahlungsverordnung, DVZ). http//:www.bk.admin.ch/ch/d/sr/c910_13.html.<br />
Bürger, K., Dröschmeister, R. (2001): Naturschutzorientierte Umweltbeobachtung in Deutschland: Ein<br />
Überblick. Natur und Landschaft 76 (2): 49-57.<br />
Burkart, M. (1998): Die Grünlandvegetation der unteren Havelaue in synökologischer und<br />
syntaxonomischer Sicht. Archiv naturwissenschaftlicher Dissertationen 7. Martina Galunder-Verlag<br />
Wiehl.<br />
Burkart, M. (2001): River corridor plants (Stromtalpflanzen) in Central European lowland: a review of a<br />
poorly understood plant distribution pattern. Global Ecol. Biogeogr. 10: 449-468.<br />
* Karten- und Datengrundlagen
Literatur 293<br />
Burkart, M., Dierschke, H., Hölzel, N., Nowak, B., Fartmann, T. (2004): Molinio-Arrhenatheretea (E1) –<br />
Kulturgrasland und verwandte Vegetationstypen, Teil 2: Molinietalia – Futter- und Streuwiesen feuchtnasser<br />
Standorte. Synopsis der Pflanzengesellschaften Deutschlands 9. Göttingen.<br />
Burney, J. (1999): Liberalisation of trade in agricultural sector and its effects on biodiversity in England:<br />
is there a win-win solution? Paper presented at the Royal Institute of International Affairs on the<br />
environment in the Millenium Round, 5-6 July 1999, London.<br />
Busch, A. (2001): Grenzen des Einsatzes monetärer Bewertung zur Operationalisierung von nachhaltiger<br />
Entwicklung. Mainz.<br />
Cansier, D. (1993): Umweltökonomie. Stuttgart, Jena.<br />
Cansier, D. (1997): Volkswirtschaftliche Grundlagen der Nachhaltigkeit. In: BMU (Hrsg.): Ökologie<br />
Grundlage einer nachhaltigen Entwicklung in Deutschland. Tagungsband zum Fachgespräch, 29.-30.<br />
April 1997. Bonn: 47-56.<br />
Cicchetti, C.J., Freemann III, A.M. (1971): Option Demand and consumer Surplus, Further Comment.<br />
Quarterly Journal of Economics 85: 528-539.<br />
Coase, R.H. (1937): The Nature of the Firm. Economica 4: 386-405.<br />
Coase, R.H. (1960): The Problem of Social Cost. Journal of Law and Economics 3: 1-44.<br />
Cohen, G.A. (1986): Self-ownership, world-ownership and equality. In: Lacash, F. (Ed.): Justice and<br />
Equality Here and Now. Ithaca: 108-135.<br />
COM (Commission of the European Communities) (1989): CORINE Biotopes – Technical Handbook,<br />
volume 1, p. 73-109, Corine/Biotopes/89-2.2, May 1988, partially updated 14 February 1989.<br />
COM (Commission of the European Communities) (1991): CORINE Biotopes manual, Habitats of the<br />
European Community. EUR 12587/3, Office for Official Publications of the European Communities.<br />
COM (Commission of the European Communities) (1992): Relation between the Directive 92/43/EEC<br />
Annex I habitats and the CORINE habitats list 1991 ( EUR 12587/3). Version 1-Draft, November 1992.<br />
CEC-DG XI, Task Force Agency (EEA-TF).<br />
COM (Commission of the European Communities) GD VI (1998): Evaluation von<br />
Agrarumweltprogrammen – Anwendungen der Verordnung (EWG) 2078/1992. Arbeitsdokument der<br />
Kommission VI/7655/98.<br />
COM (Commission of the European Communities) (1999a): Evaluation of rural development<br />
programmes 2000-2006 supported from the European Agricultural Guidance and Guarantee Fund –<br />
Guidelines’. Doc. STAR VI/8865/99-Rev.<br />
COM (Commission of the European Communities) (1999b): The Interpretation Manual of European<br />
Union Habitats. Scientific reference document, version 2 was adopted by the Habitats Committee on 4.<br />
October 1999.<br />
COM (Commission of the European Communities) (2000a): Die Auswirkungen der<br />
Agrarumweltmaßnahmen. Mitteilung der Direktion Landwirtschaft.<br />
COM (Commission of the European Communities) (2000b): Common Evaluation Questions with Criteria<br />
and Indicators – Evaluation of rural development programmes 2000-2006 supported from the European<br />
Agricultural Guidance and Guarantee Fund’. Doc. STAR VI/12004/00-Final, part A-D.<br />
COM (Commission of the European Communities) (2000c): Managing Natura 2000 Sites. The provisions<br />
of Article 6 of the ‚Habitat’ Directive 92/43/EEC. Office of Official Publications of the European<br />
Commission. Luxemburg.<br />
COM (Commission of the European Communities) (2000d): Managing Natura 2000 Sites. The provisions<br />
of Article 6 of the ‚Habitat’ Directive 92/43/EEC. Office of Official Publications of the European<br />
Commission. Luxemburg.<br />
* Karten- und Datengrundlagen
294<br />
COM (Commission of the European Communities) (2002a): Fakten und Zahlen zum Handel mit<br />
Agrarerzeugnissen in der EU: ein offener Handel, offen für Entwicklungsländer. DN: MEMO/02/296.<br />
Brüssel, 16. Dezember 2002.<br />
COM (Commission of the European Communities) (2002b): Guidelines for the mid-term evaluation of<br />
rural development programmes 2000-2006 supported from the European Agricultural Guidance and<br />
Guarantee Fund. Doc. STAR VI/43517/02.<br />
COM (Commission of the European Union) (2002c): Final Report on Financing NATURA 2000 –<br />
Working Group on Article 8 of the Habitats Directive.<br />
COM (Commission of the European Communities) (2003a): Überblick über die Umsetzung der Politik<br />
zur Entwicklung des ländlichen Raums im Programmplanungszeitraum 2000-2006 – Daten und Fakten.<br />
Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften. Luxemburg.<br />
COM (Commission of the European Communities) (2003b): CAP Reform – A Comparison of Current<br />
Situation, MTR Communication (July 2002), Legal Proposals (January 2003) and Council Compromise<br />
(June 2003). Online im Internet: http://europa.eu.int/comm/agriculture/capreform/avap_en.pdf.<br />
COM (Commission of the European Communities) (2003c): Rural Development in the European Union –<br />
Fact Sheet. Office for Official Publications of the European Commission. Luxemburg.<br />
COM (Commission of the European Union) (2004): Report from the Commission on the implementation<br />
of the Directive 92/43/EEC on the conservation of natural habitats and of wild fauna and flora.<br />
COM(2003) 845 final.<br />
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/en/dpi/rpt/doc/2003/com2003_0845en01.doc<br />
Cramer, F. (1979): Fundamental complexity, a concept in biological science and beyond. Interdisciplinary<br />
Science Reviews 4: 132-139.<br />
Cramer, F. (1989): Chaos und Ordnung – die komplexe Struktur des Lebendigen. Stuttgart.<br />
Cranor, C. F. (1995): Toxic Substances and Agenda 21. In: Lemons, J. & Brown, D. (Hrsg.): Sustainable<br />
Development – Science, Ethics, and Public Policy. Kluwer Verlag, Dordrecht, Boston: 215-253.<br />
Czybulka, D. (1988): Eigentum an Natur. Natur und Recht 10: 214-220.<br />
Czybulka, D. (1996): Rechtspflichten des Bundes und der Länder zur Ausweisung und Erhaltung von<br />
Schutzgebieten nach nationalem, europäischem und internationalem Recht. In: Defabio, U., Marburger,<br />
P., Schröder, M.: Jahrbuch des Umwelt- und Technikrechts 1996. Schriftenreihe des Instituts für Umwelt-<br />
und Technikrecht der Universität Trier 36: 235-268.<br />
Czybulka, D. (1999): Naturschutz und Verfassungsrecht. In: Konold, W., Böcker, R., Hampicke, U.<br />
(Hrsg.): Handbuch Naturschutz und Landespflege. Landsberg, ecomed: III-5.1: 1-9.<br />
Czybulka, D. (2000): Einführung zum Thema Erkennen, Bewerten, Abwägen und Entscheiden im<br />
Naturschutzrecht. In: Czybulka, D. (Hrsg.): Erkennen, Bewerten, Abwägen und Entscheiden. Rostocker<br />
Schriften zum Seerecht und Umweltrecht. Baden-Baden: 15-24.<br />
Czybulka, D. (2002): Zur „Ökologiepflichtigkeit“ des Eigentums. Herausforderung für Dogmatik und<br />
Gesetzgeber. In: Bauer, H., Czybulka, D., Kahl, W., Vosskuhle, A. (Hrsg.): Umwelt, Wirtschaft und<br />
Recht. Tübingen: 89-109.<br />
DAF (Dachverband Wissenschaftlicher Gesellschaften der Agrar-, Forst-, Ernährungs-, Veterinär- und<br />
Umweltforschung e.V.) (Hrsg.) (1995): Ökologische Leistungen der Landwirtschaft, Definition,<br />
Beurteilung und ökonomische Bewertung. Agrarspectrum 24. Frankfurt a.M.<br />
Daly, H.E. (1992): Allocation, Distribution, and Scale: Toward an Economics that is Efficient, Just, and<br />
Sustainable. Ecological Economics 6: 185-194.<br />
Daly, H.E. (1999): Wirtschaft jenseits von Wachstum. Salzburg, München.<br />
* Karten- und Datengrundlagen
Literatur 295<br />
Dannowski, R., Steidl, J., Fritsche, S. (2002): Geschütztheit des Grundwassers vor Stoffeinträgen. In:<br />
Müller, K., Toussaint, V., Bork, H.-R., Hagedorn, K., Kern, J., Nagel, U. J., Peters, J., Schmidt, R.,<br />
Weith, T., Werner, A., Dosch, A., Piorr, A. (Hrsg.): Nachhaltigkeit und Landschaftsnutzung: neue Wege<br />
kooperativen Handelns. Weikersheim: 285-286.<br />
Dawes, R. M. (1973): The Commons Dilemma Game: An N-Person Mixed-Motive Game with a<br />
Dominating Strategy for Defection. ORI Research Bulletin 13: 1-12.<br />
Dawes, R. M. (1975): Formal Models of Dilemmas in Social Decision Making. In: Kaplan, M.F.,<br />
Schwartz, S. (Eds.): Human Judgement and Decision Processes. New York: 87-107.<br />
Deblitz, C. (1999): Vergleichende Analyse der Ausgestaltung und Inanspruchnahme der<br />
Agrarumweltprogramme zur Umsetzung der VO (EWG) 2078/92 in ausgewählten Mitgliedstaaten der<br />
EU. Landbauforschung, Wissenschaftl. Mitt. d. FAL, Sonderheft 195.<br />
Degenhardt, S., Gronemann, S. (1998): Die Zahlungsbereitschaft von Urlaubsgästen für Naturschutz.<br />
Theorie und Empirie des Embedding-Effektes. Frankfurt a.M.<br />
Degenhardt, S., Gronemann, S. (2000): Was darf Naturschutz kosten? – Ein Meinungsbild. In: Konold,<br />
W., Böcker, R., Hampicke, U. (Hrsg.): Handbuch Naturschutz und Landespflege. 2. erg. Lfg. 7/00.<br />
Landsberg, ecomed IX-3: 1-9.<br />
Degenhardt, S., Hampicke, U., Holm-Müller, K., Jaedicke, W., Pfeiffer, C. (1998): Zahlungsbereitschaft<br />
für Naturschutzprogramme. Schriftenreihe Angewandte Landschaftsökologie 25. Bundesamt für<br />
Naturschutz. Bonn-Bad Godesberg.<br />
Demsetz, H. (1964): The exchange an Enforcement of Property Rights. Journal of Law and Economics 7:<br />
11-26.<br />
Demsetz, H. (1967): Toward a Theory of Property Rights. American Economic Review 2: 347-359.<br />
Deumlich, D., Thiere, J., Völker, L. (1997): Vergleich zweier Methoden zur Beurteilung der<br />
Wassererosionsgefährdung von Wassereinzugsgebieten. Wasser und Boden 5: 46-51.<br />
Deutsche Bundesregierung (1971): Umweltprogramm der Bundesregierung vom 29.9.1971. Bundestags-<br />
Drucksache 6/2710.<br />
Deutsche Bundesregierung (1986): Leitlinien der Bundesregierung zur Umweltvorsorge durch<br />
Vermeidung und stufenweise Verminderung von Schadstoffen (Leitlinien Umweltvorsorge). Bundestags-<br />
Drucksache 10/6028.<br />
Deutscher Rat für Landespflege (Hrsg.) (2000): Honorierung von Leistungen der Landwirtschaft für<br />
Naturschutz und Landschaftspflege. Schriftenreihe des Deutschen Rates für Landespflege 71.<br />
Diekkrüger, B., Söndgerath, D., Kersebaum, K.-C., McVoy, C.W. (1995): Validity of agroecosystem<br />
models. A comparison of results of different models applied to the same data set. Ecological Modelling<br />
81: 3-29.<br />
Dobson, A. (1996): Environmental Sustainabilities: An Analysis and a Typology. Environmental Politics,<br />
Vol. 5, No. 3: 401-428.<br />
Dobson, A. (2000): Drei Konzepte ökologischer Nachhaltigkeit. Natur und Kultur 2: 62-85.<br />
Dörner, D. (1997): Die Logik des Misslingens. Strategisches Denken in komplexen Situationen. Reinbeck<br />
bei Hamburg.<br />
Dörpinghaus, A., Verbücheln, G., Schröder, E., Westhus, W., Mast, R., Neukirchen, M. (2003):<br />
Empfehlungen zur Bewertung des Erhaltungszustands der FFH-Lebensraumtypen: Grünland. Natur und<br />
Landschaft 78 (8): 337-342.<br />
Drake, L., Bergström, P., Svedsäter, H. (1999): Farmers’ attitudes to and uptake of Countryside<br />
Stewardship Policies. Draft Final Report to the STEWPOL Project, Chapter 5, FAIR 1/CT95/0709,<br />
University of Uppsala, Sweden.<br />
* Karten- und Datengrundlagen
296<br />
Dreier, S., Hofer, G., Herzog, F. (2002): Qualität der Wiesen im ökologischen Ausgleich. Agrarforschung<br />
9: 140-145.<br />
EEA (European Environment Agency) (1999): Environmental indicators: typology and overview.<br />
Technical report No 25, Office for Official Publications of the European Communities Luxembourg.<br />
Eidenmüller, H. (1995): Effizienz als Rechtsprinzip – Möglichkeiten und Grenzen der ökonomischen<br />
Analyse des Rechts. Tübingen.<br />
Ekardt, F. (2001): Steuerungsdefizite im Umweltrecht. Ursachen unter besonderer Berücksichtigung des<br />
Naturschutzrechts und der Grundrechte. Zugleich zur Relevanz religiösen Säkularisat im öffentlichen<br />
Recht. Baden-Baden.<br />
Ekschmitt, K., Breckling, B., Mathes, K. (1996): Unsicherheit und Ungewissheit bei der Erfassung und<br />
Prognose von Ökosystementwicklung. Verh. Ges. Ökol. 27: 495-500.<br />
Ellenberg, H. (1996): Vegetation Mitteleuopas mit den Alpen. 4. Aufl., Ulmer Stuttgart.<br />
Ellwanger, G., Balzer, S., Hauke, U., Ssymank, A. (2000): Nationale Gebietsbewertung gemäß FFH-<br />
Richtlinie: Gesamtbestandsermittlung für die Lebensraumtypen nach Anhang I in Deutschland. Natur und<br />
Landschaft 75 (12): 486- 493.<br />
Endres, A. (1994): Umweltökonomie. Eine Einführung. Darmstadt.<br />
Endres, A., Finus, M. (1997): Umweltpolitische Zielbestimmung im Spannungsfeld gesellschaftlicher<br />
Interessengruppen. Ökonomische Theorie und Empirie. In: Siebert, H. (Hrsg.): Elemente einer rationalen<br />
Umweltpolitik. Expertisen zur umweltpolitischen Neuorientierung. Tübingen: 35-133.<br />
Engel, Ch. (1998): Die privatnützige Enteignung als Steuerungsinstrument. Reprints aus der Max-Planck-<br />
Projektgruppe Recht der Gemeinschaftsgüter 2/1998. Bonn: www.mpp-rdg.mpg.de.<br />
Engel, Ch. (2000): Die Grammatik des Rechts – Funktionen der rechtlichen Instrumente des<br />
Umweltschutzes im Verbund mit ökonomischen und politischen Instrumenten. Preprints aus der Max-<br />
Planck-Projektgruppe der Gemeinschaftsgüter 2000/3. Bonn: www.mpp-rdg.mpg.de.<br />
Engel, Ch. (2001): Rechtliche Entscheidungen unter Unsicherheit. Preprints aus der Max-Planck-<br />
Projektgruppe Recht der Gemeinschaftsgüter 2001/9. Bonn: www.mpp-rdg.mpg.de<br />
Engel, T., Klöcking, B., Priesack, E., Schaaf, T. (Hrsg.) (1993): Simulationsmodelle zur<br />
Stickstoffdynamik – Analyse und Vergleich. Agrarinformatik 25. Stuttgart.<br />
Enquete-Kommission „Schutz des Menschen und der Umwelt“ (1998): Abschlussbericht der Enquete-<br />
Kommission „Schutz des Menschen und der Umwelt“ – Ziele und Rahmenbedingungen einer nachhaltig<br />
zukunftsverträglichen Entwicklung. BT-Drs. 13/11200.<br />
Eser, U., Potthast, Th. (1999): Naturschutzethik – Eine Einführung für die Praxis. Baden-Baden.<br />
Ewers, H.-J., Hassel, Ch. (2000): Agrarumweltpolitik nach dem Subsidiaritätsprinzip: Ziele,<br />
Ordnungsrahmen und instrumentelle Alternativen. In: Ewers, H.-J., Henrichsmeyer, W. (Hrsg.): Schriften<br />
zur Agrarforschung und Agrarpolitik Band 2. Berlin.<br />
Ewringmann, D. (1999): Ökonomisch rationale Umweltpolitik – rechtswidrig? Die ökonomische Sicht.<br />
In: Gawel, E., Lübbe-Wolf, G. (Hrsg.) (1999): Rationale Umweltpolitik – rationales Umweltrecht.<br />
Konzepte, Kriterien und Grenzen rationaler Steuerung im Umweltschutz. Schriftenreihe Recht, Ökonomie<br />
und Umwelt 8. Baden-Baden: 387-409.<br />
Faber, M. Stephan, G. (1987): Umweltschutz und Technologiewandel. In Henn, R. (Hrsg.): Technologie,<br />
Wachstum und Beschäftigung. Festzeitschrift für Lothar Späth. Berlin: 933-949.<br />
FAL (Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft), Institut für Betriebswirtschaft, Agrarstruktur und<br />
ländliche Räume (2004): Arbeitsbericht zum Workshop „Zwischenbewertung der Programme zur<br />
Entwicklung des ländlichen Raumes nach der Verordnung (EG) Nr. 1257/1999 – Erfahrungsaustausch<br />
und Verbesserungsansätze vom 27./28. Januar 2004 in Braunschweig: http://www.bw.fal.de/default.htm<br />
* Karten- und Datengrundlagen
Literatur 297<br />
Falconer, K. (2000): Farm-level constraints on agri-environmental scheme participation: a transactional<br />
perspective. Journal of Rural Studies 16: 379-394.<br />
Falconer, K., Dupraz, P., Whitby, M. (2001): An Investigation of Policy Administrative Costs using Panel<br />
Data for the English Environmental Sensitive Areas. Journal of Agricultural Economics. Vol. 52, No. 1:<br />
83-103.<br />
Falconer, K., Whitby, M. (1999): The invisible costs of scheme implementation and administration. In:<br />
Huylenbroeck, G. van, Whitby, M. (Eds.): Countryside Stewardship: Farmers, Policies and Markets.<br />
Amsterdam: 67-89.<br />
Fartmann, T., Gunnemann, H., Salm, P., Schröder, E. (2001): Berichtspflichten in Natura 2000-<br />
Gebieten – Empfehlungen zur Erfassung der Arten des Anhangs II und Charakterisierung der<br />
Lebensraumtypen des Anhangs I der FFH-Richtlinie. Angewandte Landschaftökologie 42. Münster.<br />
Fechner, E. (1956): Rechtsphilosophie. Soziologie und Metaphysik des Rechts. Tübingen.<br />
Feldwisch, N., Frede, H.-G., Hecker, F. (1998): Kapitel 3: Verfahren zum Abschätzen der Erosions- und<br />
Auswaschungsgefahr. In: Frede, H.-G., Dabbert, S. (Hrsg.): Handbuch zum Gewässerschutz in der<br />
Landwirtschaft. Landsberg: 22-57.<br />
Fischer, A., Hespelt, S.K., Marggraf, R. (2003): Ermittlung der Nachfrage nach ökologischen Gütern der<br />
Landwirtschaft – Das Nordheim-Projekt. Agrarwirtschaft 52: 390-399.<br />
Fischler, F. (1999): Das europäische Agrarmodell auf dem Prüfstand der WTO. Rede auf dem CEA<br />
Congress in Verona am 24. September 1999.<br />
Fjelland, R. (2002): Facing the problem of uncertainty. Journal of Agricultural and Environmental Ethics<br />
15: 155-169.<br />
Franke, S. F. (1996): (Ir)rationale Politik? Grundzüge und politische Anwendung der „Ökonomischen<br />
Theorie der Politik“. Marburg.<br />
Fränzle, O., Jensen-Huss, K., Daschkeit, A., Hertling, Th., Lüschow, R., Schröder, W. (1993):<br />
Grundlagen zur Bewertung der Belastung und Belastbarkeit von Böden als Teile von Ökosystemen.<br />
UBA-Texte 59/93.<br />
Frey, B., Kirchgässner, G. (1994): Demokratische Wirtschaftspolitik: Theorie und Anwendung. München.<br />
Frey, B.S. (1992): Umweltökonomie. Göttingen.<br />
Frey, B.S. (1997): Markt und Motivation. Wie ökonomische Anreize die (Arbeits-)Moral verdrängen.<br />
München.<br />
Frey, B.S., Busenhart, I. (1995): Umweltökonomie: Ökonomie oder Moral? In: Diekmann, A., Franzen,<br />
A. (Hrsg.): Kooperatives Umwelthandeln – Modelle, Erfahrungen, Maßnahmen. Chur u. Zürich: 9-20.<br />
Frey, R.L., Blöchlinger, H. (1991): Schützen oder Nutzen. Ausgleichszahlungen im Natur- und<br />
Landschaftsschutz. Zürich.<br />
Führ, M. (1999): Rationale Gesetzgebung, Systematisierung verfassungsrechtlicher Anforderungen. In:<br />
Gawel, E., Lübbe-Wolf, G. (Hrsg.): Rationale Umweltpolitik – Rationales Umweltrecht. Konzepte,<br />
Kriterien und Grenzen rationaler Steuerung im Umweltschutz. Schriftenreihe Recht, Ökonomie und<br />
Umwelt 8. Baden-Baden: 193-226.<br />
Funtowicz, S., Ravetz, J. (1993): The Emergence of Post-Normal Science. In: Schomberg, R. v. (Hrsg.):<br />
Science, Politics, and Morality. Dordrecht, Boston: 85-123.<br />
Furubotn, E.G., Pejovich, S. (Eds.) (1974): The Economics of Property Rights. Cambridge.<br />
Gäfgen, G. (1987): Ökonomie und Ökologie – Gegensätze und Vereinbarkeiten. In: Wildenmann, R.<br />
(Hrsg.): Umwelt, Wirtschaft, Gesellschaft – Wege zu einem Grundverständnis. Gerlingen: 89-111.<br />
* Karten- und Datengrundlagen
298<br />
Gassner, E. (1993): Methoden und Maßstäbe für die planerische Abwägung. Theorie und Praxis<br />
abgeleiteter Bewertungsnormen. Köln.<br />
Gawel, E. (1993): Vollzug als Problem ökonomischer Theoriebildung: Leistungsfähigkeit und Grenzen<br />
einer ökonomischen Theorie des Vollzuges im Umweltschutz. Zeitschrift für Wirtschafts- und<br />
Sozialwissenschaften 113: 597-628.<br />
Gawel, E. (1994): Umweltallokation durch Ordnungsrecht – ein Beitrag zur ökonomischen Theorie<br />
regulativer Umweltpolitik. Tübingen.<br />
Gawel, E. (1995): Zur Politischen Ökonomie von Umweltabgaben. Tübingen.<br />
Gawel, E. (1996): Institutionentheorie und Umweltökonomik, Forschungsgegenstand und Perspektiven.<br />
In: Gawel, E. (Hrsg.): Institutionelle Probleme der Umweltpolitik. Berlin: 11-25.<br />
Gawel, E. (1999): Umweltordnungsrecht – Ökonomisch irrational? Die ökonomische Sicht. In: Gawel, E.,<br />
Lübbe-Wolf, G. (Hrsg.): Rationale Umweltpolitik – rationales Umweltrecht. Konzepte, Kriterien und<br />
Grenzen rationaler Steuerung im Umweltschutz. Schriftenreihe Recht, Ökonomie und Umwelt 8. Baden-<br />
Baden: 237-322.<br />
Gawel, E. (2000): Effizienzprobleme der Technikorientierung des Ordnungsrechts. Zeitschrift für<br />
angewandte Umweltforschung (ZAU) 1/ 2: 114-125.<br />
Gawel, E., Ewringmann, D. (1994): Lenkungsabgaben und Ordnungsrecht – Zur allokativen Logik der<br />
Restverschmutzungsabgabe. Steuer und Wirtschaft 71: 295-311.<br />
Gawel, E., Lübbe-Wolf, G. (Hrsg.) (1999): Rationale Umweltpolitik – rationales Umweltrecht. Konzepte,<br />
Kriterien und Grenzen rationaler Steuerung im Umweltschutz. Schriftenreihe Recht, Ökonomie und<br />
Umwelt 8. Baden-Baden.<br />
Gay, S.H., Osterburg, B., Schmidt, T. (2003): Szenarien der Agrarpolitik – Untersuchungen möglicher<br />
agrarstruktureller und ökonomischer Effekte unter Berücksichtigung umweltpolitischer Zielsetzungen.<br />
Braunschweig.<br />
Gellermann, M. (1998): Natura 2000 – Europäisches Habitatsschutzrecht und seine Durchführung in der<br />
Bundesrepublik Deutschland. Blackwell-Verlag Berlin.<br />
Gigerenzer, G., Todd, P.M. (1999): Simple Heuristics that Make us Smart. New York.<br />
Goodland, R., Daly, H. (1995): Universal Environmental Sustainability and the Principle of Integrity. In:<br />
Westra, L. & Lemons, J. (Hrsg.): Perspectives on Ecological Integrity. Boston: 102-124.<br />
Gorke, M. (1999): Artensterben. Von der ökologischen Theorie zum Eigenwert der Natur. Stuttgart.<br />
Gorke, M., Ott, K. (2003): Wie weit reicht "ökologische Rationalität"? Zum Problem des<br />
verantwortungsvollen Umgangs mit der Natur unter Bedingungen von Ungewissheit. In: Astroh, M.<br />
(Hrsg.): Grenzen rationaler Orientierung. Philosophische Texte und Studien, Bd. 68. Hildesheim u. a.: 91-<br />
145.<br />
Graf, I. (2002): Vollzugsprobleme im Gewässerschutz – Zwischen verfassungsrechtlichem Anspruch und<br />
Realität. Baden-Baden.<br />
Gujer, H.U. (2003): Die Öko-Qualitätsverordnung (ÖQV). In: Oppermann, R., Gujer, H.U. (Hrsg.):<br />
Artenreiches Grünland bewerten und fördern – MEKA und ÖQV in der Praxis. Stuttgart: 65-70.<br />
Haber, N. (2003): Erfahrungen mit ergebnisorientierter Förderung im MEKA II und Möglichkeiten der<br />
Weiterentwicklung. Vortrag auf dem Expertenworkshop zum F+E-Vorhaben „Naturschutz in der GAK“<br />
am 25.06.2003 im Bundesamt für Naturschutz, Bonn.<br />
Hagedorn, K. (2004): Institutionen der Nachhaltigkeit. UFZ-Bericht 07/2004: 7-26.<br />
Hagedorn, K. (Ed.) (2002): Environmental Co-operation and Institutional Change: Theories and policies<br />
for European Agriculture. Cheltenham.<br />
* Karten- und Datengrundlagen
Literatur 299<br />
Hampicke, U. (1992): Ökologische Ökonomie, Individuum und Natur in der Neoklassik. Natur in der<br />
Ökonomischen Theorie: Teil 4. Opladen.<br />
Hampicke, U. (1995): Theorie und Praxis in der Ökonomie des Naturschutzes. In: Dachverband<br />
Wissenschaftlicher Gesellschaften der Agrar-, Forst-, Ernährungs-, Veterinär- und Umweltforschung e.V.<br />
(Hrsg.) (1995): Ökologische Leistungen der Landwirtschaft, Definition, Beurteilung und ökonomische<br />
Bewertung. Agrarspectrum 24. Frankfurt a.M.: 109-121.<br />
Hampicke, U. (1996): Perspektiven umweltökonomischer Instrumente in der Forstwirtschaft insbesondere<br />
zur Honorierung ökologischer Leistungen. Materialien zur Umweltforschung. Metzler-Poeschel Stuttgart.<br />
Hampicke, U. (1997): Wandel des volkswirtschaftlichen Handelns über die Zeit und in der Qualität. In:<br />
BMU (Hrsg.): Ökologie Grundlage einer nachhaltigen Entwicklung in Deutschland. Tagungsband zum<br />
Fachgespräch, 29.-30. April 1997. Bonn: 39-45.<br />
Hampicke, U. (1998): Ökonomische Bewertungsgrundlagen und die Grenzen einer Monetarisierung der<br />
Natur. In: Theobald, W. (Hrsg.): Integrative Umweltbewertung. Berlin u.a.: 95-117.<br />
Hampicke, U. (1999): Verteilung in der Neoklassischen und Ökologischen Ökonomie. Jahrbuch<br />
Ökologische Ökonomik 1. Zwei Sichtweisen auf das Umweltproblem: Neoklassische Umweltökonomik<br />
versus Ökologische Ökonomik. Metropolis-Verlag Marburg: 153-188.<br />
Hampicke, U. (2000a): Möglichkeiten und Grenzen der Bewertung und Honorierung ökologischer<br />
Leistungen in der Landschaft. Schriftenreihe d. Deutschen Rates für Landespflege 71: 43-49.<br />
Hampicke, U. (2000b): Ökonomie und Naturschutz. In: Konold, W., Böcker, R., Hampicke, U. (Hrsg.):<br />
Handbuch Naturschutz und Landschaftspflege. 1. Erg. Lfg. 3/00, Landsberg: II-8, 1-11.<br />
Hampicke, U., Ott, K. (Eds.) (2003): Reflections on Discounting. International Journal of Sustainable<br />
Development – Special Issue 6 (1).<br />
Hanf, C.-H. (1993): Ökonomische Überlegungen zur Ausgestaltung von Verordnungen und Verträgen mit<br />
Produktionsauflagen zum Umwelt- und Naturschutz. Agrarwirtschaft 43: 138-147.<br />
Hansjürgens, B. (2001): Das Verursacherprinzip als Effizienzregel. In: Gawel, E. (Hrsg.): Effizienz im<br />
Umweltrecht. Grundsatzfragen wirtschaftlicher Umweltnutzung aus rechts-, wirtschafts- und<br />
sozialwissenschaftlicher Sicht. Baden-Baden: 381-396.<br />
Hansmeyer, K.-H. (1977): Transferzahlungen an Unternehmen (Subventionen). In: Neumark, F. (Hrsg.):<br />
Handbuch der Finanzwissenschaft. Vol. I, Tübingen: S. 960 ff.<br />
Hansmeyer, K.-H. (1988): Marktwirtschaftliche Elemente in der Umweltpolitik – Eine Zusammenfassung<br />
der Argumente: Zeitschrift für Umweltpolitik und Umweltrecht 11: 231-241.<br />
Hansmeyer, K.-H., Schneider, H.K. (1992): Umweltpolitik – Ihre Entwicklung unter marktsteuernden<br />
Aspekten. Göttingen.<br />
Hardin, G. (1968): The Tragedy of the Commons. Science 1962: 1243-1248.<br />
Hardin, G. (1982): Collective Action. London.<br />
Hartmann, E., Frieder, Th., Luick, R., Bierer, J., Poppinga, O. (2003): Kurzfassungen der nach<br />
Verordnung (EG) 1257/1999 kofinanzierten Agrarumweltprogramme der Bundesländer. BfN-Skripten<br />
87, Bonn.<br />
Hauhs, M., Lange, H. (1996): Ökologie und Komplexität. In: Köster, B., Vogt, M. (Hrsg.): Mensch und<br />
Umwelt – Eine komplexe Beziehung als interdisziplinäre Herausforderung. Forum für Interdisziplinäre<br />
Forschung 16: 45-64.<br />
Heißenhuber, A., Katzek, J., Meusel, F., Ring, H. (1994): Landwirtschaft und Umwelt. Bonn.<br />
Henning, C.H.C.A., Glauben, T., Wald, A. (2001): Die Europäische Agrarpolitik im Spannungsfeld von<br />
Osterweiterung und WTO-Verhandlungen. Agrarwirtschaft 50: 147-152.<br />
* Karten- und Datengrundlagen
300<br />
Henselt, M., Holm-Müller, K., Möseler, B. M., Vollmer, I. (2003): Möglichkeiten der Einführung<br />
ergebnisorientierter Komponenten in den Vertragsnaturschutz in Nordrhein-Westfalen. In: Nottmeyer-<br />
Linden, K., Müller, St., Pasch, D. (Bearb.): Angebotsnaturschutz – Vorschläge zur Weiterentwicklung des<br />
Vertragsnaturschutzes. Tagungsbericht der gleichlautenden Fachtagung 23.-24. Oktober 2002 in<br />
Wuppertal. BfN-Skripten 89: Anhang.<br />
Herrmann, A. (1995): Wechselfeuchte Stromtalwiesen im Naturschutzgebiet „Untere Havel“ –<br />
Naturschutzwert und Schutzbedürftigkeit. Untere Havel Naturk. Berichte 4: 37-45.<br />
Höffe, O. (1981): Sittlich-politische Diskurse. Frankfurt a.M..<br />
Hofmann, H., Rauh, R., Heißenhuber A., Berg, E. (1995): Umweltleistungen der Landwirtschaft:<br />
Konzepte zur Honorierung. Leipzig.<br />
Holm-Müller, K., Radke, V., Weis, J. (2002): Umweltfördermaßnahmen in der Landwirtschaft –<br />
Teilnehmerauswahl durch Ausschreibung? Agrarwirtschaft 8 (2): 112-119.<br />
Holm-Müller, K., Witzke H.-P. (2002): Das moderne Konzept der internen Subventionierung als<br />
Kriterium zur Identifizierung von Wettbewerbsverzerrungen bei europäischen Agrarumweltmaßnahmen.<br />
Agrarwirtschaft 5: 231-238.<br />
Holzheu, F. (1987): Die Bewältigung von Unsicherheit als ökonomisches Grundproblem. In: Bayrische<br />
Rückversicherung AG (Hrsg.): Gesellschaft und Unsicherheit. Karlsruhe.<br />
Hotelling, H. (1931): The Economics of Exhaustible Resources. Journal of Political Economy 39: 137-<br />
175.<br />
Hötzel, H.-J. (1994): Der Boden zwischen Sozialbindung und Privatnutzen. In: Agrarsoziale Gesellschaft<br />
e.V. (Hrsg.): Die Zukunft der landwirtschaftlichen Flächen – Nutzungen, Wertungen, Prognosen.<br />
Göttingen: 26-38.<br />
Hruschka, J. (1987): Die Konkurrenz von goldener Regel und Prinzip der Verallgemeinerung in der<br />
juristischen Diskussion des 17./18. Jahrhundert als geschichtliche Wurzel von Kants kategorischem<br />
Imperativ. Juristenzeitung 42: 941-952.<br />
Huckestein, B. (1993): Umweltlizenzen – Anwendungsbedingungen einer ökonomisch effizienten<br />
Umweltpolitik durch Mengensteuerung. Zeitschrift für Umweltpolitik und Umweltrecht 16: 1-29.<br />
InVeKoS (1998)*: Datenbestand – Integriertes Verwaltungs- und Kontrollsystem. Landesamt für<br />
Verbraucherschutz und Landwirtschaft (LVL) Brandenburg. Frankfurt (Oder) und Teltow/Ruhlsdorf.<br />
InVeKoS (2001)*: Datenbestand – Integriertes Verwaltungs- und Kontrollsystem. Landesamt für<br />
Verbraucherschutz und Landwirtschaft (LvL) Brandenburg. Frankfurt (Oder) und Teltow/Ruhlsdorf.<br />
InVeKoS (2002)*: Datenbestand – Integriertes Verwaltungs- und Kontrollsystem. Landesamt für<br />
Verbraucherschutz und Landwirtschaft (LvL) Brandenburg. Frankfurt (Oder) und Teltow/Ruhlsdorf.<br />
Isermann, K. (1990): Share of agriculture in nitrogen and phosphorus emissions into the surface waters of<br />
Western Europe against the background of their eutrophication. Fertilizer Research 26: 353-269.<br />
Jaeger, J. (2000): Zur Unterscheidung zwischen verschiedenen Arten von Unsicherheit bei der Bewertung<br />
von Landschaftseingriffen. In: Jax, K.: Funktionsbegriff und Unsicherheit in der Ökologie. Theorie in der<br />
Ökologie 2. Frankfurt a.M. u.a.: 115-134.<br />
Jakobsson, K.M., Dragun A.K. (1996): Contingent Valuation and Endangered Species. Cheltenham.<br />
Jänicke, M., Zieschank, R. (2004): Zielbildung und Indikatoren in der Umweltpolitik. In: Wiggering, H.,<br />
Müller, F. (2004): Umweltziele und Indikatoren – Wissenschaftliche Anforderungen an ihre Festlegung<br />
und Fallbeispiele. Berlin u.a: 39-62.<br />
Jörissen, J., Kopfmüller, V., Brandl, V., Paetau, M. (1999): Ein integratives Konzept nachhaltiger<br />
Entwicklung. Forschungszentrum Karlsruhe.<br />
* Karten- und Datengrundlagen
Literatur 301<br />
Karl, H. (1997): Der Einfluss von Informationsasymmetrien auf die ökonomische Effizienz von<br />
Agrarumweltpolitik. Schriftenreihe d. Gesell. f. Wirtschafts- und Sozialwissenschaften des Landbaus e.V.<br />
33: 397-406.<br />
Karl, H., Urfei, G. (1995): Konzepte dezentralisierter Umweltpolitik und Informationsinstrumente zur<br />
Bewertung umweltschonender Landnutzung. Vorstudie im Auftrag des Ministeriums für Umwelt,<br />
Raumordnung und Landwirtschaft des Landes Nordrhein-Westfalen. Bonn.<br />
Kersebaum, K.-C. (1989): Simulation der Stickstoff-Dynamik von Ackerböden. Diss. Univ. Hannover.<br />
Kersebaum, K.-C. (1995): Application of a simple management model to simulate water and nitrogen<br />
dynamics. Ecological Modelling 85: 145-156.<br />
Kersebaum, K.-C. (2000): Model based evaluation of land use and management strategies in a nitrate<br />
polluted drinking water catchment in North-Germany. In: Lal, R. (ed.): Integrated Watershed<br />
management in the Global Ecosystem. Boca Raton, USA Fl.: 223-238.<br />
Kersebaum, K.-C. (2004)*: Modellierte Nitrataustragsgefährdung aus der Wurzelzone der<br />
landwirtschaftlichen Flächen Brandenburgs mit Hilfe des Modells HERMES unter fünf Szenarien:<br />
konventionelle Ackernutzung, ökologischer Landbau, konventionelle Grünlandnutzung, extensive<br />
Grünlandnutzung sowie Stilllegung. Daten des Leibniz-Zentrums für Agrarlandschafts- und<br />
Landnutzungsforschung, unveröffentlicht.<br />
Kersebaum, K.-C., Beblik, A.J. (2001): Performance of a nitrogen dynamics model applied to evaluate<br />
agricultural management practices. In: Shaffer, M.J., Ma, L., Hansen, S. (eds.): Modelling Carbon and<br />
Nitrogen Dynamics for Soil Management. Boca Raton, USA Fl.: 549-569.<br />
Kersebaum, K.-C., Steidl, J., Bauer, O., Piorr, H.-P. (2003): Modelling scenarios to assess the effects of<br />
different agricultural management and land use options to reduce diffuse nitrogen pollution into the river<br />
Elbe. Physics and Chemistry of the Earth 28: 537-545.<br />
Kersebaum, K.-C., Steidl, J., Kiesel, J. (2004)*: Landwirtschaftliche Fluren Brandenburgs, die für die<br />
Belastung von Grundwasser durch diffusen Nitrataustrag relevant sind. Daten des Leibniz-Zentrums für<br />
Agrarlandschafts- und Landnutzungsforschung, unveröffentlicht.<br />
Kimminich, O. (1994): Die Eigentumsgarantie in Natur- und Denkmalschutz. Natur und Recht 6: 261-<br />
270.<br />
Kirchgässner, G. (1991): Homo oeconomicus: Das ökonomische Modell individuellen Verhaltens und<br />
seine Anwendung in den Wirtschafts- und Sozialwissenschaften. Tübingen.<br />
Kirchgässner, G. (1999): Rationalitätskonzepte in der Umweltökonomik. In: Gawel, E., Lübbe-Wolff, G.<br />
(Hrsg.): Rationale Umweltpolitik – rationales Umweltrecht. Konzepte, Kriterien und Grenzen rationaler<br />
Steuerung im Umweltschutz. Schriftenreihe Recht, Ökonomie und Umwelt 8. Baden-Baden: 29-55.<br />
Kirsch, G. (1997): Neue Politische Ökonomie. Düsseldorf.<br />
Kissling-Näf, I. (2000): Kompensation als Gradmesser des institutionellen Wandels. Zeitschrift für<br />
Umweltpolitik & Umweltrecht (ZfU) 1: 1-22.<br />
Kleihauer, S. (1999): Ein Verfahren zur Risikoabschätzung und Risikobewertung – dargestellt am<br />
Beispiel der Gentechnik. In: Hansjürgens, B. (Hrsg.): Umweltrisikopolitik. Zeitschrift für angewandte<br />
Umweltforschung (ZAU), Sonderheft 10: 50-62.<br />
Klemmer, P. (1990): Gesamtgesellschaftliche Effekte ökonomischer Instrumente im Umweltschutz. In:<br />
Wagner, G.R. (Hrsg.): Unternehmung und ökologische Umwelt. München: 262-282.<br />
Klemmer, P., Lehr, U., Loebbe, K. (1999): Umweltinnovationen – Anreize und Hemmnisse. Berlin.<br />
Kloepfer, M. (1989): Umweltrecht. München.<br />
* Karten- und Datengrundlagen
302<br />
Kloepfer, M., Reinert, S. (1995): Die Umweltfrage als Verteilungsproblem in rechtlicher Sicht. Zeitschrift<br />
für Umweltpolitik und Umweltrecht (ZfU): 273-298. Veröffentlicht in Brandner, T., Messerschmidt, K.<br />
(2000): Umweltschutz im Recht: Grundlagen, Verfassungsrahmen und Entwicklungen, ausgewählte<br />
Beiträge aus drei Jahrzehnten von Michael Kloepfer. Berlin: 79-107.<br />
Knauer, M. (1989): Katalog zur Bewertung und Honorierung ökologischer Leistungen der<br />
Landwirtschaft. In: Streit, M.E., Wildemann, J., Jesinghaus, J. (Hrsg.): Landwirtschaft und Umwelt:<br />
Wege aus der Krise. Studien zur gesellschaftlichen Entwicklung 3. Baden-Baden: 179-202.<br />
Knauer, N. (1992): Honorierung „ökologischer Leitungen“ nach marktwirtschaftlichen Prinzipien.<br />
Zeitschrift für Kulturtechnik und Landentwicklung 33: 65-76.<br />
Kneese, A., Schulze, Ch. (1975): Pollution, Prices and Public Policy. Washington D.C.<br />
Knight, F. (1965): Risk, Uncertainty and Profit. New York.<br />
Knierim, A., Siebert, R. (2003): Towards multi-functional agriculture – what motivates German farmers<br />
to realise biodiversity conservation? In: Knierim, A., Siebert, R., Brouwer, F., Fernandez-Sañudo, P.,<br />
Garcia-Montero, G., Gil, T., Graveland, C., de Lucas, C., Manzanera, J.-A., Mnatsakanian, R., Nieminen,<br />
M., Pascual, C., v. Rheenen, T., Szekér, K.S., Toogood, M., Urbano, J.: An Assessment of factors<br />
affecting farmers’ willingness and ability to cooperate with biodiversity policies. Report of the BIOfACT<br />
WP 2, Nov. 2003.<br />
http://www.ecnc.nl/doc/projects/biofact/activities.html<br />
Kobler, M. (2000): Der Staat und die Eigentumsrechte. Die Einheit der Gesellschaftswissenschaften –<br />
Studien in den Grenzbereichen der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 110. Paul Siebeck Tübingen:<br />
309.<br />
Köck, W. (1997a): Rechtsfragen der Umweltzielplanung. Natur und Recht 19: 528-536.<br />
Köck, W. (1997b): Umweltqualitätsziele und Umweltrecht. Die neue Umweltzieldebatte und ihre<br />
Bedeutung für das regulative Umweltrecht. Zeitschrift für Umweltrecht 8: 79-87.<br />
Köck, W. (1999a): Umweltordnungsrecht – ökonomisch irrational? Die juristische Sicht. In: Gawel, E.,<br />
Lübbe-Wolf, G. (Hrsg.): Rationale Umweltpolitik – rationales Umweltrecht. Konzepte, Kriterien und<br />
Grenzen rationaler Steuerung im Umweltschutz. Schriftenreihe Recht, Ökonomie und Umwelt 8. Baden-<br />
Baden: 323-359.<br />
Köck, W. (1999b): Grundzüge des Risikomanagements im Umweltrecht. In: Bora, A. (Hrsg.):<br />
Rechtliches Risikomanagement. Form, Funktion und Leistungsfähigkeit des Rechts in der<br />
Risikogesellschaft. Berlin: 129-191.<br />
Koenig, Ch. (1994): Internalisierung des Risikomanagement durch neues Umwelt- und Technikrecht? Ein<br />
Plädoyer für die Beachtung ordnungsrechtlicher Prinzipien in der umweltökonomischen Diskussion. Neue<br />
Zeitschrift für Verwaltungsrecht 13: 937-942.<br />
Kuhlmann, D. (1997): Varianten direkter Einkommensübertragungen in der Landwirtschaft –<br />
Verwaltungsaufwand und einzelbetriebliche Wirkungen, Cuvillier Verlag Göttingen.<br />
Kümmerer, K. (2000): Zeiten der Natur – Zeiten des Menschen. In: Held, M., Geißler, K.A. (Hrsg.):<br />
Ökologie der Zeit. Hirzel Stuttgart: 85-104.<br />
Ladeur, K.-H. (1995): Das Umweltrecht der Wissensgesellschaft. Berlin.<br />
Laschewski, L., Schleyer, Ch. (2003): Kapitel 3 – Gebiete mit umweltspezifischen Einschränkungen. In:<br />
ZALF Müncheberg (Projektleitung): Halbzeitbewertung des Plans zur Entwicklung des ländlichen Raums<br />
des Landes Brandenburg (im Auftrag des Ministeriums für Landwirtschaft, Umweltschutz und<br />
Raumordnung des Landes Brandenburg): 36-76.<br />
Latacz-Lohmann, U., Hamsvoort, C. v.d. (1997): Auctioning conservation contracts: a theoretical analysis<br />
an application. American Journal of Agricultural Economics 79: 407-418.<br />
* Karten- und Datengrundlagen
Literatur 303<br />
LAWA (Länderarbeitsgemeinschaft Wasser) (2001): Handlungskonzept zur Umsetzung der<br />
Wasserrahmenrichtlinie. http://www.lawa.de/pub/kostenlos/wrrl/Handlungskonzept.pdf<br />
LAWA (Länderarbeitsgemeinschaft Wasser) (2002): Gemeinsamer Bericht von LAWA und LABO zu<br />
Anforderungen an eine nachhaltige Landwirtschaft aus Sicht des Gewässer- und Bodenschutzes vor dem<br />
Hintergrund der Wasserrahmenrichtlinie. Hannover.<br />
http://www.lawa.de/pub/kostenlos/wrrl/Landwirtschaftspapier-Stand_24-04-02neu.pdf<br />
LAWA (Länderarbeitsgemeinschaft Wasser) (2003): Arbeitshilfe zur Umsetzung der EG-<br />
Wasserrahmenrichtlinie. http://wasserblick.net/servlet/is/195/AH-2003-10-23-oh-Teil-4.pdf<br />
LAWA (Länderarbeitsgemeinschaft Wasser) (2003): Arbeitshilfe zur Umsetzung der EG-<br />
Wasserrahmenrichtlinie. http://www.lawa.de/pub/kostenlos/wrrl/Arbeitshilfe_30-04-2003.pdf<br />
LBL (Landwirtschaftliche Beratungszentrale) (2000): Kontrollierbarkeit der ökologischen Qualität von<br />
ökologischen Ausgleichsflächen: Test mit möglichen Kontrollpersonen aus der Landwirtschaft in den<br />
Kantonen Bern, S. Gallen, Waadt, Zürich. Bericht LBL im Auftrag des NföA, Bearbeiterin: Schiess-<br />
Bühler, C. (unveröffentlicht).<br />
Lerch, A. (1996): Verfügungsrechte und biologische Vielfalt. Marburg.<br />
Lerch, A. (1998): Verfügungsrechte und Umwelt. Zur Verbindung von ökologischer Ökonomie und<br />
ökonomischen Theorien der Verfügungsrechte. In: Nachhaltigkeit in der ökonomischen Theorie. Jahrbuch<br />
Ökonomie und Gesellschaft 14. Frankfurt a.M., New York: 126-163.<br />
Lerch, A. (1999): Nachhaltigkeit und Verfügungsrechte. Jahrbuch Ökologische Ökonomik 1. Zwei<br />
Sichtweisen auf das Umweltproblem: Neoklassische Umweltökonomik versus Ökologische Ökonomik.<br />
Marburg: 401-421.<br />
Lersner, H. v. (1994): Vorsorgeprinzip. In: Kimmnich, O., Lersner, H. v., Storm, P.-C. (Hrsg.):<br />
Handwörterbuch des Umweltrechts. Bd. 2. Berlin.<br />
Leyer, I. (2002): Auengrünland der Mittelelbe-Niederung – Vegetationskundliche und -ökologische<br />
Untersuchungen in der rezenten Aue, der Altaue und am Auenrand der Elbe. Dissertationes Botanicae<br />
363.<br />
Lind, R.C., Schuler, R.E. (1998): Equity and Discounting in Climate-Change Decisions. In: Nordhaus,<br />
W.D. (Ed.): Economics and Policy Issues in Climate Change. Washington D.C.: 59-103.<br />
Lintz, G. (1994): Vom Verursacherprinzip zum Aufteilungsprinzip – Ein Plädoyer für eine differenzierte<br />
Betrachtung der umweltpolitischen Kostenzurechnungsprinzipien. Zeitschrift für Umweltpolitik &<br />
Umweltrecht (ZfU) 1: 57-73.<br />
Lisbach, I., Lisbach-Peppler, C. (1996): Magere Glatthaferwiesen im Südöstlichen Pfälzerwald und im<br />
Unteren Werraland. – Ein Beitrag zur Untergliederung des Arrhenatheretum elatioris Braun 1915.<br />
Tuexenia 16: 311-336.<br />
Lohmann, D. (1999): Umweltpolitische Kooperationen zwischen Staat und Unternehmen aus Sicht der<br />
Neuen Institutionenökonomik. Marburg.<br />
Louis, H. (1999): Eigentum und Entschädigung. Jahrbuch f. Naturschutz und Landschaftspflege 50: 179-<br />
192.<br />
LUA (Landesumweltamt Brandenburg) (1998): Die sensiblen Fließgewässer und das<br />
Fließgewässerschutzsystem im Land Brandenburg. Studien und Tagungsberichte 15. Potsdam.<br />
LUA (Landesumweltamt Brandenburg) (2002): Umweltdaten aus Brandenburg. Bericht 2002 des<br />
Landesumweltamtes.<br />
LUA (Landesumweltamt) (2000)*: Natura 2000-Gebiete des Landes Brandenburg. Stand 2000.<br />
* Karten- und Datengrundlagen
304<br />
LUA (Landesumweltamt Brandenburg), LAGS (Landesanstalt für Großschutzgebiete) (2001):<br />
Handlungsanleitung zur Erfolgskontrolle von Vertragsnaturschutz und Agrarumweltprogrammen in<br />
Brandenburg. Teil: Vegetation (unveröffentlicht).<br />
LUA (Landesumweltamt) (2004)*: Digitale Daten zu den Koordinierungsräumen und<br />
Bearbeitungsgebieten zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie im Land Brandenburg. Stand<br />
07.07.2004.<br />
LUA N2 (Landesumweltamt Brandenburg, Abteilung N2) (2003): Bewertung der<br />
Agrarumweltmaßnahmen des KULAP 2000 aus avifaunistischer Sicht. Kurzgutachten der<br />
Vogelschutzwarte im Rahmen der Halbzeitbewertung des EPLR Brandenburg. Bearbeiter: Hielscher, K.,<br />
Ryslavy, T. (unveröffentlicht).<br />
LUA Ö2 (Landesumweltamt, Abteilung Ö2) (2004)*: FFH-Lebensraumtypen in Brandenburg. Bewertung<br />
des Erhaltungszustandes im Rahmen des Monitorings (Entwurf), Stand 06.07.2004.<br />
LUA (Landesumweltamt Brandenburg), LAGS (Landesanstalt für Großschutzgebiete) (2001):<br />
Handlungsanleitung zur Erfolgskontrolle von Vertragsnaturschutz und Agrarumweltprogrammen in<br />
Brandenburg. Teil: Vegetation. unveröff.<br />
Lübbe, W. (1999): Eine ratio – viele Rationalitäten? Ökonomische und andere Rationalitäten in der<br />
umweltrechtspolitischen Debatte. In: Gawel, E., Lübbe-Wolff, G. (Hrsg.): Rationale Umweltpolitik –<br />
rationales Umweltrecht. Konzepte, Kriterien und Grenzen rationaler Steuerung im Umweltschutz.<br />
Schriftenreihe Recht, Ökonomie und Umwelt 8. Baden-Baden: 13-28.<br />
Lübbe-Wolff, G. (1993): Vollzugsprobleme der Umweltverwaltung. Natur und Recht 15: 217-229.<br />
Lübbe-Wolff, G. (2000): Erscheinungsformen symbolischen Umweltrechts. In: Hansjürgens, B., Lübbe-<br />
Wolff, G. (Hrsg.): Symbolische Umweltpolitik. Frankfurt a. Main: 25-62.<br />
Lübbe-Wolff, G. (Hrsg.) (1995): Der Vollzug des europäischen Umweltrechts. Berlin.<br />
Luhmann, N. (1986/1990): Ökologische Kommunikation. Opladen.<br />
Luhmann, N. (1991): Soziologie des Risikos. Berlin, New York.<br />
LVermA (Landesvermessungsamt Brandenburg) (2002)*: Digitale Flurübersichtskarte des Landes<br />
Brandenburg. Stand 27.03.2002 (Nutzung mit Genehmigung der LGB, GB-G I/99).<br />
Maier-Rigaud, G. (1994): Umweltpolitik mit Mengen und Märkten. Lizenzen als konstituierendes<br />
Element einer ökologischen Marktwirtschaft. Marburg.<br />
Mäler, K.G. (1984): Risk, Uncertainty and the Environment. Stockholm.<br />
Mandelbrot, B. (1977): The Fractal Geometry of Nature. New York.<br />
Marggraf, R., Streb, S. (1997): Ökonomische Bewertung der natürlichen Umwelt – Theorie, politische<br />
Bedeutung, ethische Diskussion. Heidelberg.<br />
Marx, K. (1970): Das Kapital, Band I. Berlin.<br />
Marzelli, S. (1994): Zur Relevanz von Leitbildern und Standards für die ökologische Planung. Laufener<br />
Seminarbeiträge 4: 11-23.<br />
Massarrat, M. (1997): Sustainability through cost internalization. Theoretical rudiments for the analysis<br />
and reform of global structures. Ecological Economics 22: 29-39.<br />
Matzdorf, B. (2004): Ergebnisorientierte Honorierung ökologischer Leistungen der Landwirtschaft –<br />
Vorteile, Voraussetzungen und Grenzen des Instrumentes (Beitragsserie: Integrative Umweltbewertung).<br />
UWSF – Zeitschrift für Umweltchemie und Ökotoxiologie 2. 125-133.<br />
* Karten- und Datengrundlagen
Literatur 305<br />
Matzdorf, B., Piorr, A. (2003): Kapitel 2 – Beschreibung des Programms. In: ZALF Müncheberg<br />
(Projektleitung): Halbzeitbewertung des Plans zur Entwicklung des ländlichen Raums des Landes<br />
Brandenburg (im Auftrag des Ministeriums für Landwirtschaft, Umweltschutz und Raumordnung des<br />
Landes Brandenburg): 9-34 + Anhang.<br />
Matzdorf, B., Piorr, A., Sattler, C. (2003): Kapitel 4 – Agrarumweltmaßnahmen (Art. 22-24VO (EG)<br />
1257/999). In: ZALF Müncheberg (Projektleitung): Halbzeitbewertung des Plans zur Entwicklung des<br />
ländlichen Raums des Landes Brandenburg (im Auftrag des Ministeriums für Landwirtschaft,<br />
Umweltschutz und Raumordnung des Landes Brandenburg): 77-218 + Anhang.<br />
Meier, A., Mettler, D. (1988): Wirtschaftspolitik. Kampf um Einfluss und Sinngebung – Grundzüge einer<br />
neuen Theorie der Wirtschaftspolitik. Bern.<br />
Meinhövel, H. (1999): Defizite der Principal-Agent-Theorie. Lohmar Köln.<br />
Merkel, R. (1989): „Die Placebo-Paragraphen“. Die Zeit 43: 66.<br />
Meßerschmidt, K. (1999): Ökonomisch rationale Umweltpolitik – rechtswidrig? Die juristische Sicht. In:<br />
Gawel, E., Lübbe-Wolff, G. (Hrsg.): Rationale Umweltpolitik – rationales Umweltrecht. Konzepte,<br />
Kriterien und Grenzen rationaler Steuerung im Umweltschutz. Schriftenreihe Recht, Ökonomie und<br />
Umwelt 8. Baden-Baden: 361-386.<br />
Meyer, W. (1981): Entscheidungen und ökonomische Erklärungen des Verhaltens. In: Tietz, R. (Hrsg.):<br />
Wert- und Präferenzprobleme in den Sozialwissenschaften. Berlin, München.<br />
Michaelis, P. (1996): Ökonomische Instrumente in der Umweltpolitik. Eine anwendungsorientierte<br />
Einführung. Heidelberg.<br />
MLR (Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum Baden-Württemberg) (Hrsg.) (1999):<br />
Artenreiches Grünland. Anleitung zur Einstufung von Flächen für die Förderung im MEKA II. Faltblatt.<br />
MLUR (Ministerium für Landwirtschaft, Umweltschutz und Raumordnung des Landes Brandenburg)<br />
(2000): Landschaftsprogramm Brandenburg. Potsdam.<br />
MLUR (Ministerium für Landwirtschaft, Umweltschutz und Raumordnung des Landes Brandenburg)<br />
(2003a): Projektgruppe Landschaftswasserhaushalt: Landschaftswasserhaushalt in Brandenburg.<br />
Kurzfassung zum Sachstandsbericht mit Konzeption. Potsdam.<br />
MLUR (Ministerium für Landwirtschaft, Umweltschutz und Raumordnung des Landes Brandenburg)<br />
(2003b)*: Lagebericht (mit gemeinsamer Indikatorentabelle) zur Durchführung des Planes der<br />
Entwicklung des ländlichen Raumes im Ziel 1-Gebiet Brandenburg im Zeitraum 2000-2006. Potsdam<br />
(unveröffentlicht).<br />
Morard, V., Sanson, S. (1995): Ecoculture in Champagne: implementation of agri-environmental method<br />
in cereal farming. 47 th International symposium on crop protection. Gent, Belgium, May 9 th , 1995: 771-<br />
780.<br />
Morosini, M., Schneider, C., Kochte-Clemens, B., Losert, C., Waclawski, N., Ballschmiter, K. (2001a):<br />
Umweltindikatoren. Gegenüberstellung, Bewertung und Auswahl. Band 2. Arbeitsbericht Nr. 185,<br />
Akademie für Technikfolgenabschätzung, Stuttgart.<br />
Morosini, M., Friebe, E., Schneider, C., Röhm, M., Ballschmiter, K. (2001b): Umwelt- und<br />
Nachhaltigkeitsberichte. 61 Profile. Band 3. Arbeitsbericht Nr. 185, Akademie für<br />
Technikfolgenabschätzung, Stuttgart.<br />
Morosini, M., Schneider, C., Röhm, M., Grünert, A., Ballschmiter, K. (2002): Umweltindikatoren –<br />
Grundlagen, Methodik, Relevanz. Band 1. Arbeitsbericht Nr. 185, Akademie für<br />
Technikfolgenabschätzung, Stuttgart.<br />
Mosekilde, E., Mosekilde, L. (Eds.) (1991): Complexity, Chaos, and Biological Evolution. NATOR ASI<br />
Series B: Physics Vol. 270. New York.<br />
* Karten- und Datengrundlagen
306<br />
Moxey, A. (1999): Cross-Cutting Issues in developing agri-environmental indicators. In OECD (ed.):<br />
Environmental indicators for agriculture – volume 2, Issues and design. The York workshop Paris.<br />
Moxey, A., Whitby, P., Lowe, P. (1998): Agri-environment indicators, issues and choices. Land Use<br />
Policy Bd. 15/4: 265-269.<br />
Moyle, B. (1998): Species conservation and the principal-agent problem. Ecological Economics 26: 313-<br />
320.<br />
Müller, F., Wiggering, H. (2004): Erfahrungen und Entwicklungspotentiale von Ziel- und<br />
Indikatorensystemen. In: Wiggering, H., Müller, F. (2004): Umweltziele und Indikatoren –<br />
Wissenschaftliche Anforderungen an ihre Festlegung und Fallbeispiele. Berlin u.a.: 221-234.<br />
Müller, K., Toussaint, V., Bork, H.-R., Hagedorn, K., Kern, J., Nagel, U. J., Peters, J., Schmidt, R.,<br />
Weith, T., Werner, A., Dosch, A., Piorr, A. (Hrsg.): Nachhaltigkeit und Landschaftsnutzung: neue Wege<br />
kooperativen Handelns. Weikersheim.<br />
Müller-Hohenstein, K., Beierkuhnlein, C. (1999): Biogeographische Raumbewertung mit Pflanzen. In:<br />
Schneider-Sliwa, R., Gerold, G., Schaub, D. (Hrsg.): Angewandte Landschaftsökologie – Grundlagen und<br />
Methoden. Springer Berlin u.a.: 426-450.<br />
Münchhausen, H. v., Nieberg, H. (1997): Agrar-Umweltindikatoren: Grundlagen,<br />
Verwendungsmöglichkeiten und Ergebnisse einer Expertenbefragung. In: Diepenbrock, W., Kaltschmitt,<br />
M., Nieberg, H., Reinhardt, G. (Hrsg.): Umweltverträgliche Pflanzenproduktion. Zeller Verlag<br />
Osnabrück: 11-29.<br />
MUNR (Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Raumordnung des Landes Brandenburg, jetzt MLUR)<br />
(1995)*: Daten zur Umweltsituation im Land Brandenburg, Biotoptypen- und Landnutzungskartierung<br />
Brandenburg aus CIR-Luftbildern. Potsdam.<br />
Murswiek, D. (1994): Privater Nutzen und Gemeinwohl im Umweltrecht. Deutsches Verwaltungsblatt<br />
109: 76-88.<br />
Murswiek, D. (1996): Kommentierung zu Art. 20a GG. In: Sachs, M. (Hrsg.): Grundgesetz-Kommentar.<br />
München: 653-668.<br />
Mutius, A. v., Stüber, S. (1998): Umweltbewertung – Rechtliche Bewertungsgrundlagen und<br />
Steuerungsmöglichkeiten des Rechts. In: Theobald, W. (Hrsg.): Integrative Umweltbewertung – Theorie<br />
und Beispiele aus der Praxis. Berlin u.a.: 119-142.<br />
Neumann, J., Wycisk, P. (2003): Mittlere jährliche Grundwasserneubildung. In: BMU (Hrsg.):<br />
Hydrologischer Atlas Deutschlands. 3. Lieferung. Bonn, Berlin.<br />
Neumayer, E. (1999): Weak versus Strong Sustainability. Cheltenham.<br />
Nida-Rümelin, J. (1994): Das rational choice-Paradigma: Extensionen und Revisionen. In: Nida-Rümelin<br />
(Hrsg.): Praktische Rationalität. Grundlagenprobleme und ethische Anwendungen des rational choice<br />
Paradigmas. Berlin, New York: 3-29.<br />
Nida-Rümelin, J. (1996): Ethik des Risikos. In: Nida-Rümelin, J. (Hrsg.): Angewandte Ethik. Stuttgart:<br />
806-831.<br />
Niederstadt, F. (1998): Ökosystemschutz durch Regelungen des öffentlichen Umweltrechts. Berlin.<br />
North, D.C. (1990): Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge University<br />
Press.<br />
Nozick, R. (1974): Anarchie, Staat, Utopia. Moderne Verlagsgesellschaft München. Engl. Original:<br />
Anarchy, State, and Utopia. New York.<br />
Nutzinger, H.G. (1999): Ökologie und Gerechtigkeit als Grenzen ökonomischer Rationalität. In: Gawel,<br />
E., Lübbe-Wolff, G. (Hrsg.): Rationale Umweltpolitik – Rationales Umweltrecht. Schriftenreihe Recht,<br />
Ökonomie und Umwelt 8. Baden-Baden: 57-65.<br />
* Karten- und Datengrundlagen
Literatur 307<br />
Oates, W. E. (1972): Fiscal federalism. Harcourt/Brace/Jovanovich New York.<br />
Oberdorfer, E. (Hrsg. und Mitarb.) (1977-1992): Süddeutsche Pflanzengesellschaften. Teil I-Teil IV.<br />
Stuttgart.<br />
Obermann, P. (1982): Hydrochemische/hydromechanische Untersuchungen zum Stoffgehalt von<br />
Grundwasser bei landwirtschaftlicher Nutzung. Bes. Mitt. z. Dtsch. Gewässerkundlichen Jahrbuch 42,<br />
Bonn.<br />
OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) (1993): OECD core set of Indicators<br />
for Environmental performance reviews – A synthesis report by the Group on the State of the<br />
Environment. Environment Monographs N° 83. Paris.<br />
OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) (1994a): Environmental indicators –<br />
OECD Core set. Paris.<br />
OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) (1994b): Managing the<br />
Environment: The Role of Economic Instruments. Organisation for Economic Co-operation and<br />
Development. Paris.<br />
OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) (1997): Environmental indicators for<br />
agriculture, Volume 1 – concepts and framework. Paris.<br />
OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) (1998): Towards sustainable<br />
development – environmental indicators. Paris.<br />
OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) (1999a): Environmental indicators<br />
for agriculture, Volume 1 – concepts and framework. Paris.<br />
OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) (1999b): Environmental indicators<br />
for agriculture, Volume 2 – issues and design. The York Workshop. Paris.<br />
OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) (1999c): Landwirtschaft und<br />
Umwelt – Problematik und strategische Ansätze. Paris.<br />
OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) (2001a): Multifunctionality:<br />
Executive Summary: Towards an Analytical Framework (Main authors: Maier, L., Shobayashi, M.).<br />
Paris.<br />
OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) (2001b): Environmental indicators<br />
for agriculture, Volume 3 – Methods and results. Paris.<br />
OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) (2001c): Production effects of agrienvironmental<br />
policy measures: reconciling trade and environmental objectives.<br />
COM/AGR/ENV(2000)133/Final., unclassified.<br />
Oppermann, R., Briemle, G. (2002): Blumenwiesen in der landwirtschaftlichen Förderung. Erste<br />
Erfahrungen mit der ergebnisorientierten Förderung im baden-württembergischen Agrar-<br />
Umweltprogramm MEKA II. Naturschutz und Landschaftsplanung 7: 203-209.<br />
Oppermann, R., Gujer, H.U. (2003) (Hrsg.): Artenreiches Grünland bewerten und fördern. Ulmer<br />
Stuttgart.<br />
Oppermann, R., Gujer, H.U. (2003): Vergleich der Förderung artenreichen Grünlands in Baden-<br />
Württemberg und in der Schweiz. In: Oppermann, R., Gujer, H.U. (2003) (Hrsg.): Artenreiches Grünland<br />
bewerten und fördern. Ulmer Stuttgart: 178-181.<br />
Osterburg, B. (2002): Analyse der Bedeutung von naturschutzorientierten Maßnahmen in der<br />
Landwirtschaft im Rahmen der Verordnung (EG) 1257/1999 über die Förderung der Entwicklung des<br />
ländlichen Raums. Unveröffentlichter Endbericht für ein Forschungsvorhaben im Auftrag des<br />
Sachverständigenrates für Umweltfragen Braunschweig.<br />
* Karten- und Datengrundlagen
308<br />
Osterburg, B., Stratmann, U. (2002): Die regionale Umweltpolitik in Deutschland unter dem Einfluss der<br />
Förderangebote der Europäischen Union. Agrarwirtschaft Jg. 51: 259-279.<br />
Osterburg, B., Wilhelm, J., Nieberg, H. (1997): Darstellung und Analyse der regionalen Inanspruchnahme<br />
von Agrarumweltmaßnahmen gemäß Verordnung (EWG) 2078/1992 in Deutschland. Arbeitsbericht 8/87<br />
der Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft, Institut für Betriebswirtschaft Braunschweig-<br />
Völkenrode.<br />
Osterloh, L. (1991): Eigentumsschutz, Sozialbindung und Enteignung bei der Nutzung von Boden und<br />
Umwelt. DVBl 1991: 910.<br />
Ostrom, E. (1998): The Institutional Analysis and Development Approach. In: Tusak-Loehman, E.,<br />
Kilgour, D.M. (Eds.): Designing Institutions for Environmental and Resources Management. Cheltenham:<br />
68-90.<br />
Ott, K. (1998a): Ethik und Wahrscheinlichkeit. Zum Problem der Verantwortbarkeit von Risiken unter<br />
Bedingungen wissenschaftlicher Ungewissheit. Nova Acta Leopoldina NF 77, 304: 111-128.<br />
Ott, K. (1998b): Über den Theoriekern und einige intendierte Anwendungen der Diskursethik. Zeitschrift<br />
für philosophische Forschung 2: 268-291.<br />
Ott, K. (2001): Eine Theorie 'starker' Nachhaltigkeit. Natur und Kultur 1: 55-75.<br />
Ott, K. (2002): Nachhaltigkeit des Wissens – was könnte das sein?<br />
Beitrag zum Kongress "Gut zu Wissen" der Heinrich-Böll-Stiftung. In: Heinrich-Böll-Stiftung (Hrsg.):<br />
Gut zu Wissen, Westfälisches Dampfboot: 1-24.<br />
Passarge, H. (1964): Pflanzengesellschaften des nordostdeutschen Flachlandes I. Jena.<br />
Pearce, D.W., Turner, R.K. (1990): Economics of Natural Resources and the Environment. New York<br />
u.a.<br />
Pearson, S. (2003): Entwicklung einer Methode zur Beurteilung der biologischen Qualität von Wiesen des<br />
ökologischen Ausgleichs. In: Oppermann, R., Gujer, H.U. (Hrsg.): Artenreiches Grünland bewerten und<br />
fördern – MEKA und ÖQV in der Praxis. Stuttgart: 70-75.<br />
Pennekamp, M. (1999): Technischer Fortschritt und Umweltrecht: Die Vorschriften des § 7a WHG aus<br />
ökonomischer Sicht. Zeitschrift für angewandte Umweltforschung (ZAU) 2: 218-224.<br />
Petersen, H.-G., Müller, K. (1999): Volkswirtschaftspolitik. München.<br />
Pevetz, W. (1990): Quantifizierung von Umweltleistungen der österreichischen Landwirtschaft.<br />
Schriftenreihe Bundesanstalt für Agrarwirtschaft 60. Wien.<br />
Piaget, J. (1976): Die Äquilibration kognitiver Strukturen. Stuttgart.<br />
Pigou, A.C. (1978): The Economics of Welfare. New York, AMS Press, Reprint after the 4 th ed. London,<br />
Macmillan 1932.<br />
Piorr, P. (1999): Standortspezifische Biomassebildung, N-Fixierung und Nährstoffentzüge im<br />
ökologischen Landbau. In: Hoffmann H. & S. Müller (Hrsg.): Beiträge zur 5. Wissenschaftstagung zum<br />
Ökologischen Landbau, Humboldt-Universität zu Berlin: 329 –332.<br />
Plankl, R. (1999): Synopse zu den Agrarumweltprogrammen der Länder in der Bundesrepublik<br />
Deutschland: Maßnahmen zur Förderung umweltgerechter und den natürlichen Lebensraum schützender<br />
landwirtschaftlicher Produktionsverfahren gemäß VO (EWG) 2078/92. Arbeitsbericht aus dem Institut für<br />
Strukturforschung der Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft Braunschweig-Völkenrode.<br />
Pommerehne, W.W., Roemer, A.U. (1992): Ansätze zur Erfassung der Präferenzen für öffentliche Güter.<br />
Jahrbuch für Sozialwissenschaft 43: 171-210.<br />
Popper, K.R. (1967): Le rationalité et le statut du principe de rationalité. In: Claasen, E.-M. (Hrsg.): Les<br />
fondements philosophiques des systèmes économique. Paris: 142 ff.<br />
* Karten- und Datengrundlagen
Literatur 309<br />
Popper, K.R. (1970): Die offene Gesellschaft und ihre Feinde, Bd. 2, Falsche Propheten. Bern.<br />
Popper, K.R. (1995). In: Miller, D. (Hrsg.): Lesebuch: Ausgewählte Texte zu Erkenntnistheorie,<br />
Philosophie der Naturwissenschaften, Metaphysik, Sozialphilosophie. Tübingen.<br />
Pott, R. (1995): Die Pflanzengesellschaften Deutschlands. 2. Aufl. Stuttgart.<br />
Potter, C., Lobley, M., Bull, R., (1999): Agricultural liberation and its environmental effects. Wye<br />
College, University of London.<br />
Quast, J., Steidl, J., Müller, K. Wiggering, H. (2002): Minderung diffuser Stoffeinträge. In: Keitz, S. v.<br />
Schmalholz, M. (Hrsg.): Handbuch der EU-Wasserrahmenrichtlinie: Inhalte, Neuerungen und<br />
Anregungen für die nationale Umsetzung. Berlin: 177-219.<br />
Radkau, J. (1994): Was ist Umweltgeschichte? In: Abelshauser, W. (Hrsg.): Umweltgeschichte.<br />
Göttingen: 11-28.<br />
Rapp, N. (1998): Optimale Gestaltung von Naturschutzverträgen – Umsetzung der Verordnung (EWG)<br />
2078/92 durch Grünlandverträge Schleswig-Holsteins. Aachen.<br />
Reck, H. (2004): Das Zielartenkonzept – Ein integrativer Ansatz zur Erhaltung der biologischen Vielfalt.<br />
In: Wiggering, H., Müller, F. (Hrsg.): Umweltziele und Indikatoren –Wissenschaftliche Anforderungen<br />
an ihre Festlegung und Fallbeispiele. Berlin u.a.: 311-343.<br />
Rehbinder, E. (1989): Grenzen und Chancen einer ökologischen Umorientierung des Rechts. Sozialökologische<br />
Arbeitspapiere 25. Frankfurt a.M.<br />
Rehbinder, E. (1997): Festlegung von Umweltzielen. Begründung, Begrenzung, Instrumentelle<br />
Umsetzung. Natur und Recht 19: 313-328.<br />
Rehbinder, E., Schmihing, Ch. (2004): Naturschutz in der Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der<br />
Agrarstruktur und des Küstenschutzes – Rechtliche Bewertung der Rechtsgrundlagen und Empfehlungen.<br />
Kurzfassung.<br />
Richter, R., Furubotn, E. (1996): Neue Institutionenökonomik. Tübingen.<br />
Rodgers, C., Bishop, J., (1999): Management agreements of promoting nature conservation. Royal<br />
Institute of Chartered Surveyors. London.<br />
Rodi, M. (2000): Die Subventionsrechtsordnung. Die Subvention als Instrument öffentlicher<br />
Zweckverwirklichung nach Völkerrecht, Europarecht und deutschem innerstaatlichen Recht. Tübingen.<br />
Romahn, K. (2003): Rationalität von Werturteilen im Naturschutz. Theorie in der Ökologie, Band 8.<br />
Frankfurt a.M. u.a.<br />
Roweck, H. (1993): Zur Naturverträglichkeit von Naturschutz-Maßnahmen. Verhandlungen der<br />
Gesellschaft für Ökologie 22: 15-20.<br />
Roweck, H. (1995): Landschaftsentwicklung über Leitbilder? Kritische Gedanken zur Suche nach<br />
Leitbildern für die Kulturlandschaft von morgen. LÖBF-Mitt. 4: 25-43.<br />
Roweck, H. (1996): Möglichkeiten der Einbeziehung von Landnutzungssystemen in naturschutzfachliche<br />
Bewertungsverfahren. Beitr. Akad. Natur- u. Umweltschutz Bad.-Württ. 23: 129-142.<br />
Rückriem, C., Roscher, S. (1999): Empfehlungen zur Umsetzung der Berichtspflicht gemäß Artikel 17<br />
der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie. Angewandte Landschaftsökologie 22. Bundesamt für Naturschutz,<br />
Bonn-Bad Godesberg.<br />
Rudolff, B., Urfei, G. (2000): Agrarumweltpolitik nach dem Subsidiaritätsprinzip – Kategorisierung von<br />
Umwelteffekten und Evaluierung geltender Politikmaßnahmen. In: Ewers, H.-J., Henrichsmeyer, W.<br />
(Hrsg.): Schriften zur Agrarforschung und Agrarpolitik, Band 3. Berlin.<br />
* Karten- und Datengrundlagen
310<br />
Salzwedel, J. (1987): Risiko im Umweltrecht. NVwZ 276. In: Breuer, R. (Hrsg.) (2000): Regelungsmaß<br />
und Steuerungskraft des Umweltrechts. Symposion aus Anlass des 70. Geburtstages von Prof. Dr. Jürgen<br />
Salzwedel. Köln u.a.<br />
Samuelson, P.A. (1954): The Pure Theory of Public Expenditure. Review of Economics and Statistics 36:<br />
387-389.<br />
Sander, A. (2003): Benachteiligte Gebiete und Gebiete mit umweltspezifischen Einschränkungen –<br />
Kapitel V der VO (EG) Nr. 1257/1999. In: FAL (Projektleitung): Halbzeitbewertung von PROLAND<br />
NIEDERSACHSEN – Programm zur Entwicklung der Landwirtschaft und des ländlichen Raumes.<br />
http://www1.ml.niedersachsen.de/proland/frameindex.htm.<br />
Sandhövel, A. (1997): Die Zieldiskussion in der Umweltpolitik – politische und rechtliche Aspekte. In:<br />
Barth, S., Köck, W. (Hrsg.): Qualitätsorientierung im Umweltrecht. Umweltqualitätsziele für einen<br />
nachhaltigen Umweltschutz. Berlin.<br />
Schanzenbächer, B. (1995): Ermittlung externer ökologischer Effekte der Landwirtschaft und<br />
ökonomische und ökologische Auswirkungen von Maßnahmen zu deren Internalisierung: dargestellt am<br />
Beispiel der Ackerbauregion Kraichgau. Europäische Hochschulschriften 42, Bd. 17. Frankfurt a.M. u.a.<br />
Scheele, M., Isermeyer, F. (1989): Umweltschutz und Landschaftspflege im Bereich der Landwirtschaft –<br />
Kostenwirksame Verpflichtung oder neue Einkommensquelle? Berichte über Landwirtschaft 67: 86-110.<br />
Scheele, M., Isermeyer, F., Schmitt, G. (1993): Umweltpolitische Strategien zur Lösung der<br />
Stickstoffproblematik in der Landwirtschaft. Agrarwirtschaft 42: 294-313.<br />
Schenk, A. (2000): Relevante Faktoren der Akzeptanz von Natur- und Landschaftsschutzmassnahmen.<br />
Ergebnisse qualitativer Fallstudien. Publikation der Ostschweizerischen Geographischen Gesellschaft.<br />
Neue Folge 5. St. Gallen.<br />
Schiess-Bühler, C. (2003): Erste Erfahrungen mit der Umsetzung der ÖQV in den Kantonen – Interviews<br />
mit Beratern und Landwirten. In: Oppermann, R., Gujer, H.U. (Hrsg.): Artenreiches Grünland bewerten<br />
und fördern – MEKA und ÖQV in der Praxis. Stuttgart: 84-94.<br />
Schmidt-Moser, R. (2000): Vertraglicher Flächenschutz statt Naturschutzgebiete? Können Verträge das<br />
Ordnungsrecht ersetzen? Welche Rolle spielen Flächenankäufe? Natur und Landschaft 75 (12): 481-485.<br />
Schneider, D. (1997): Betriebswirtschaftslehre. Band 3: Theorie der Unternehmung. München, Wien.<br />
Schneider, J. (2001): Die ökonomische Bewertung von Umweltprojekten – Zur Kritik an einer<br />
umfassenden Umweltbewertung mit Hilfe der Kontingenten Evaluierungsmethode. Heidelberg.<br />
Scholtissek, B. (2000): Naturschutzziele in der Landschaftsplanung – Analyse des<br />
landschaftsplanerischen Leitbildbegriffs und Herleitung von Bewertungsnormen am Beispiel Schleswig-<br />
Hosteins. Uetersen.<br />
Scholz, R. (1996): Kommentar zu Art. 20a GG. In: Maunz, Th., Dürig, G. (Hrsg.): Grundgesetz-<br />
Kommentar (Loseblatt). München.<br />
Schramek, J., Biel, D., Buller, H., Wilson, G. (Eds.) (1999a): Implementation and effectiveness of agrienvironmental<br />
schemes established under regulation 2078/92. Final consolidated report, Vol. I: Main<br />
report, Vol. II: Annexes. Frankfurt a.M. (unveröffentlicht).<br />
Schramek, J., Knickel, K., Grimm, M. (1999b): Bewertung und Begleitung der hessischen<br />
Umweltschutzmaßnahmen in der Landwirtschaft (HEKUL und HELP). Bericht im Auftrag des<br />
Hessischen Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft und Forsten (unveröffentlicht).<br />
Schröder, W. (1994): Erkenntnisgewinnung, Hypothesenbildung und Statistik. In: Schröder, W., Vetter,<br />
L., Fränzle, O. (Hrsg.): Neuere statistische Verfahren und Modellbildung in der Geoökologie.<br />
Braunschweig, Wiesbaden: 1-16.<br />
* Karten- und Datengrundlagen
Literatur 311<br />
Schröder, W. (1996): Ökologie und Umweltrecht in Forschung und Lehre. Grundlagen einer<br />
interdisziplinären Methodologie (Habilitationsschrift). Kiel.<br />
Schröder, W. (1998): Ökologie und Umweltrecht als Herausforderung natur- und sozialwissenschaftlicher<br />
Forschung und Lehre. In: Daschkeit, A., Schröder, W. (Hrsg.): Perspektiven integrativer<br />
Umweltforschung. Berlin (...) (Umweltnatur- und Umweltsozialwissenschaften UNS; Bd. 1; hrsg. v. A.<br />
Daschkeit, O. Fränzle, V. Linneweber, J. Richter, R.W. Scholz und W. Schröder): 329-357.<br />
Schröder, W. (2003): Umweltstandards. Funktionen, Strukturen und naturwissenschaftliche Begründung.<br />
In: Fränzle, O., Müller, F., Schröder, W. (Hrsg.): Handbuch der Umweltwissenschaften. Grundlagen und<br />
Anwendungen der Ökosystemforschung. Landsberg am Lech, München, Zürich, Kap. VI-1.3, 9. Erg. Lfg.<br />
Schuldt, N. (1997): Rationale Umweltvorsorge: Ökonomische Implikation einer vorsorgenden<br />
Umweltpolitik. Bonn.<br />
Schwertmann, U., Vogl, W., Kainz, M. (1990): Bodenerosion durch Wasser – Vorhersage des Abtrags<br />
und Bewertung von Gegenmaßnahmen. Stuttgart.<br />
Seidl, I., Gowdy, J. (1999): Monetäre Bewertung von Biodiversität: Schritte, Probleme und Folgerungen.<br />
GAIA 2: 102-112.<br />
Siebert, H. (1976): Analyse der Instrumente der Umweltpolitik. Göttingen.<br />
Simon, H.A. (1955): A behavioral Model of Rational Choice. Quarterly Journal of Economics 69: 99-118.<br />
Simon, H.A. (1957a): Models of Man. New York.<br />
Simon, H.A. (1957b): Administrative Behavior – A Study of Decision-making Processes in<br />
Administrative Organisation. New York.<br />
Simon, H.A. (1982): Models of Bounded Rationality. Band II. Cambridge.<br />
Smeets, E., Weterings, R. (1999): Environmental Indicators: Typology and Overviews. Technical Report<br />
No 25. European Environmental Agency (EEA). Copenhagen.<br />
http://binary.eea.eu.int:80/t/tech_25_text.pdf<br />
Smith, V.K. (1987): Uncertainty, Benefit-Cost Analysis, and the Treatment of Option Value. Journal of<br />
Environmental Economics and Management 14: 283-292.<br />
Spiess, M. (2003): Ökologischer Ausgleich aus der Schweiz – Ziele erreicht? Ergebnisse der<br />
Effizienzforschung. In: Nottmeyer-Linden, K., Müller, S., Pasch, D. (Bearb.): Angebotsnaturschutz –<br />
Vorschläge zur Weiterentwicklung des Vertragsnaturschutzes. Tagungsbericht der gleichlautenden<br />
Fachtagung 23.-24. Oktober 2002 in Wuppertal. BfN-Skripten 89: 41-52.<br />
Spiess, M., Marfurt, Ch., Birrer, S. (2002): Evaluation der Ökomassnahmen mit Hilfe von Brutvögeln.<br />
Agrarforschung 4 (9): 158-163.<br />
SRU (Der Rat von Sachverständigen für Umweltfragen) (1978): Umweltgutachten 1978. Stuttgart u.<br />
Mainz.<br />
SRU (Der Rat von Sachverständigen für Umweltfragen) (1985): Umweltprobleme der Landwirtschaft.<br />
Sondergutachten. Stuttgart.<br />
SRU (Der Rat von Sachverständigen für Umweltfragen) (1994): Umweltgutachten 1994. Stuttgart.<br />
SRU (Der Rat von Sachverständigen für Umweltfragen) (1996): Konzepte einer dauerhaftumweltgerechten<br />
Nutzung ländlicher Räume. Sondergutachten. Stuttgart.<br />
SRU (Der Rat von Sachverständigen für Umweltfragen) (1998): Umweltgutachten 1998. Stuttgart.<br />
SRU (Der Rat von Sachverständigen für Umweltfragen) (2002a): Umweltgutachten 2002. Stuttgart.<br />
SRU (Der Rat von Sachverständigen für Umweltfragen) (2002b): Für eine Stärkung und Neuorientierung<br />
des Naturschutzes. Sondergutachten. Stuttgart.<br />
* Karten- und Datengrundlagen
312<br />
SRU (Der Rat von Sachverständigen für Umweltfragen) (2004): Umweltgutachten 2004. Stuttgart.<br />
Ssymank, A. (1997): Anforderungen an die Datenqualität für die Bewertung des Erhaltungszustandes<br />
gemäß den Berichtspflichten der FFH-Richtlinie. Natur u. Landschaft 11: 477-480.<br />
Ssymank, A., Hauke, U., Rückriem, Ch., Schröder, E. (1998): Das europäische Schutzgebietssystem<br />
NATURA 2000. BfN-Handbuch zur Umsetzung der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie und der<br />
Vogelschutzrichtlinie. Schriftenreihe für Landschaftspflege und Naturschutz. Münster.<br />
Steidl, J., Bauer, O., Dietrich, O., Kersebaum, K.-C., Quast, J. (2002a): Möglichkeiten zur Minderung der<br />
Gewässerbelastung aus diffusen landwirtschaftlichen Quellen im pleistozänen Tiefland. In: Wittenberg,<br />
H., Schöniger, M. (Hrsg.): Wechselwirkungen zwischen Grundwasserleitern und Oberflächengewässern.<br />
Forum für Hydrologie und Wasserwirtschaft 1: 114-119.<br />
Steidl, J., Kersebaum, K.-C. Bauer, O. (2002b): Wasser- und Stoffrückhalt im Tiefland des<br />
Elbeeinzugsgebietes – Schlussbericht zum BMBF-Forschungsprojekt, Kapitel II-2.1.2 Unterirdischer<br />
Nährstoffaustrag (unveröffentlicht).<br />
Steidl, J., Dannowski, R., Fritsche, S. (2003)*: Landwirtschaftliche Standorte Brandenburgs, die für die<br />
Belastung von Oberflächengewässern durch diffusen Nitrataustrag relevant sind. In: Matzdorf, B., Piorr,<br />
A., Sattler C. (2003): Kaptitel 4 – Agrarumweltmaßnahmen (Art. 22-24 VO (EG) 1257/999). In: ZALF<br />
Müncheberg (Projektleitung): Halbzeitbewertung des Plans zur Entwicklung des ländlichen Raums des<br />
Landes Brandenburg (im Auftrag des Ministeriums für Landwirtschaft, Umweltschutz und Raumordnung<br />
des Landes Brandenburg): 77-218 + Anhang.<br />
Steidl, J., Neubert, G., Kersebaum, K.-C., Bauer, O., Thiel, R. (2004): Mögliche Minderungen der<br />
Gewässerbelastung aus diffusen landwirtschaftlichen Quellen am Beispiel des Stickstoffaustrages. In:<br />
Becker, A., Lahmer, W. (Hrsg.) (2004): Wasser- und Nährstoffhaushalt im Elbegebiet und Möglichkeiten<br />
zur Stoffeintragsminderung. Konzepte für die nachhaltige Entwicklung einer Flusslandschaft, Bd. 1.<br />
Berlin: 284-300.<br />
Steinberg, R. (1998): Der ökologische Verfassungsstaat. Frankfurt a.M.<br />
Streit, M., Wildenmann, R., Jesinghaus, J. (Hrsg.) (1989): Landwirtschaft und Umwelt: Wege aus der<br />
Krise. Studien zur gesellschaftlichen Entwicklung 3. Nomos Baden-Baden.<br />
Succow, M., Jeschke, L. (1990): Moore in der Landschaft. Entstehung, Haushalt, Lebewelt, Verbreitung,<br />
Nutzung und Erhaltung der Moore. Leipzig, Jena, Berlin.<br />
Suchanek, A. (2000): Normative Umweltökonomik. Die Einheit der Gesellschaftswissenschaften 111.<br />
Tübingen.<br />
Sukopp, H., Trautmann, W. (Hrsg.) (1976): Veränderung der Flora und Fauna in der Bundesrepublik<br />
Deutschland. Schriftenreihe für Vegetationskunde 10. Bonn-Bad Godesberg.<br />
Thiere, J., Altermann, M., Lieberoth, I., Rau, D. (1991): Zur Beurteilung landwirtschaftlicher Nutzflächen<br />
nach technologisch wirksamen Standortbedingungen. Archiv für Acker- und Pflanzenbau und<br />
Bodenkunde 3: 171-183.<br />
Thöne, M. (2000): Subventionen als umweltpolitisches Instrument: zwischen institutioneller<br />
Rechtfertigung und europäischer Beihilfekontrolle. In: Bizer, K., Linscheidt, B., Truger, A. (Hrsg.):<br />
Staatshandeln im Umweltschutz, Perspektiven einer institutionellen Umweltökonomik. Berlin: 251-278.<br />
Tietzel, M. (1985): Wirtschaftstheorie und Unwissen. Überlegungen zur Wirtschaftstheorie jenseits von<br />
Risiko und Unsicherheit. Tübingen.<br />
Trepel, M. (1996): Niedermoore in Schleswig-Holstein. Gegenwärtiger Zustand und<br />
Entwicklungsmöglichkeiten. Literaturstudie im Auftrag des Ministeriums für Natur, Umwelt und Forsten<br />
des Landes Schleswig-Holstein.<br />
* Karten- und Datengrundlagen
Literatur 313<br />
UBA (Umweltbundesamt) (1994): Umweltqualitätsziele, Umweltqualitätskriterien und -standards. UBA-<br />
Texte 64/94. Berlin.<br />
UBA (Umweltbundesamt) (1997a): Nachhaltiges Deutschland – Wege zu einer dauerhaft<br />
umweltgerechten Entwicklung. Berlin.<br />
UBA (Umweltbundesamt) (1997b): Daten zur Umwelt – Der Zustand der Umwelt in Deutschland. Berlin.<br />
Uexküll, J. v. (1935): Der Hund kennt nur Hundedinge. Hamburger Fremdenblatt 172: 9.<br />
Ulfig, A. (1997): Lexikon der philosophischen Begriffe. Wiesbaden.<br />
Umweltbundesamt Österreich (Hrsg.) (1997): Stoffbilanzierung in der Landwirtschaft – Ein Instrument<br />
für den Umweltschutz? Workschop 20.-21. Juni 1996. Tagungsberichte, Vol. 20/Bd. 20. Wien.<br />
UN (United Nations) (2001): Indicators of sustainable development – Guidelines and methodologies.<br />
United Nations. New York. http://www.un.org/esa/sustdev/natlinfo/indicators/indisd/indisd-mg2001.pdf<br />
UNA (Atelier für Naturschutz und Umweltfragen) (2001): Feststellung der Mindestqualität für wenig<br />
intensiv genutzte Wiesen, extensiv genutzte Wiesen und Streueland: Vegetationsschlüssel und Vorgehen<br />
zur Feststellung der Qualität. Bericht 18.01.01 im Auftrag des NföA, Bearbeiter: Hedinger, Ch.,<br />
Eggenberg, S., Leibundgut, M. (unveröffentlicht).<br />
UNDP (United Nations Development Programme) (1996): Human Development Report. Oxford<br />
University Press. New York, Oxford.<br />
Volkmann, U. (1999): Qualitätsorientiertes Umweltrecht – Leistungsfähigkeit, Probleme und Grenzen.<br />
Deutsches Verwaltungsblatt 9: 579-587.<br />
Vollmer, G. (1990): Naturwissenschaft Biologie (I). Aufgaben und Grenzen. Biologie heute 371: 3-7.<br />
Wahl, R. (Hrsg.) (1995): Prävention und Vorsorge. Von der Staatsaufgabe zu den verwaltungsrechtlichen<br />
Instrumenten. Bonn.<br />
Walz, R., Block, N., Eichhammer, W., Hiessl, H., Nathani, C., Ostertag, K., Schön, M., Herrchen, M.,<br />
Keller, D., Köwener, D., Rennings, K., Rosemann, M. (1997): Grundlagen für ein Nationales<br />
Umweltindikatorensystem – Weiterentwicklung von Indikatorensystemen für die<br />
Umweltberichterstattung. Texte 37/97, Umweltbundesamt (Hrsg.).<br />
WCED (World Commission for Environment and Development) (1987): Our Common Future. Oxford.<br />
Weck-Hannemann, H. (1999): Rationale Außensteuerung menschlichen Umweltverhaltens –<br />
Möglichkeiten und Grenzen. In: Gawel, E., Lübbe-Wolf, G. (Hrsg.): Rationale Umweltpolitik – rationales<br />
Umweltrecht. Konzepte, Kriterien und Grenzen rationaler Steuerung im Umweltschutz. Schriftenreihe<br />
Recht, Ökonomie und Umwelt 8. Baden-Baden: 67-92.<br />
Weikard, H.-P. (1995): Instrumente zur Durchsetzung von Umweltauflagen. Zeitschrift für Umweltpolitik<br />
und Umweltrecht 3: 365-376.<br />
Weiland, R. (1999): Ökologisierte Subventionspolitik? Ansatz und Grenzen ökologisch motivierter<br />
Subventionen in der aktuellen Umweltpolitik. Zeitschrift für angewandte Umweltforschung (ZAU) 1:<br />
120-130.<br />
Weisbrod, B.A. (1964): Collective-Consumption Services of Individual-Consumption Goods. Quarterly<br />
Journal of Economics 78: 471-477.<br />
Weise, P. (1994): Natur, Normen, Effizienz: Prozesse der Normbildung als Gegenstand der<br />
ökonomischen Theorie. In: Biervert, B., Held, M. (Hrsg.): Das Naturverständnis der Ökonomik. Campus,<br />
Frankfurt a.M.: 106-123.<br />
Wendland, F., Kunkel, R. (1999): Das Nitratabbauvermögen im Grundwasser des Elbeeinzugsgebietes.<br />
Schriften des Forschungszentrums Jülich. Reihe Umwelt/Environment 13.<br />
* Karten- und Datengrundlagen
314<br />
Wiggering, H., Müller, K., Werner, A., Helming, K. (2003): Sustainable Development of Multifunctional<br />
Landscapes. In: Helming, K., Wiggering, H. (Eds.): The concept of Multifunctionality in Sustainable<br />
Land Development. Springer Berlin/Heidelberg/New York: 3-18.<br />
Williamson, O.E. (1975): Markets and Hierarchies. Analysis and Antitrust Implications. Free Press New<br />
York.<br />
Williamson, O.E. (1985): The Economic Institutions of Capitalism. New York.<br />
Williamson, O.E. (1990): Die ökonomischen Institutionen des Kapitalismus. Tübingen.<br />
Winter, G. (Hrsg.) (1986): Grenzwerte. Interdisziplinäre Untersuchungen zu einer Rechtsfigur des<br />
Umwelt-, Arbeits- und Lebensmittelschutzes. Düsseldorf.<br />
Wittmann, W. (1959): Unternehmung und unvollkommene Information. Köln, Opladen.<br />
WTO (World Trade Organisation) (2002): Negotiation on Agriculture. First Draft of Modalities for the<br />
Further Commitments. Revision. Dokument TN/AG/W/1. http://www.wto.org<br />
WTO (World Trade Organisation) (2003a): Negotiation on Agriculture. First Draft of Modalities for the<br />
Further Commitments. Revision. Dokument TN/AG/W/Rev.1. http://www.wto.org<br />
WTO (World Trade Organisation) (2003b): Summary Report on the Seventeenth Meeting of the<br />
Committee on Agriculture. Special Session, held on 28 February 2003. Note by the Secretariat.<br />
TN/AG/R/7. http://www.docsonline.wto.org<br />
WWF (World Wide Fund for Nature) (1999): Natura 2000 – Chancen und Hemmnisse. Environmental<br />
policy.<br />
Zaluski, T. (1995): Laki selernicowe (zwiazek cnidion dubii Bal..-Tul. 1966) w Polsce. Lodz. Monogr.<br />
Bor. 77.<br />
Zeddies, J., Doluschitz, R. (1996): Marktentlastungs- und Kulturlandschaftsausgleich (MEKA) –<br />
Wissenschaftliche Begleituntersuchung zu Durchführung und Auswirkungen. Agrarforschung in Baden-<br />
Württemberg 25. Stuttgart.<br />
Zimmermann, H., Pahl, T. (1999): Unbekannte Risiken – Innovationsbezug und umweltpolitische<br />
Aufgabe. In: Hansjürgens, B. (Hrsg.): Umweltrisikopolitik. Zeitschrift für angewandte Umweltforschung<br />
(ZAU), Sonderheft 10: 107-122.<br />
Zimmermann, K.W. (2000): Internalisierung als Nirwana-Kriterium der Umweltpolitik. In: Bizer, K.,<br />
Linscheidt, B., Truger, A. (Hrsg.): Staatshandeln im Umweltschutz, Perspektiven einer institutionellen<br />
Umweltökonomik. Berlin: 21-42.<br />
* Karten- und Datengrundlagen
Literatur 315<br />
Gesetze, Verordnungen und Richtlinien<br />
BBodSchG: Gesetz zum Schutz des Bodens vom 17. März 1998 (BGBl. I S. 502) geändert am 9.<br />
September 2001 (BGBl. I 2331).<br />
BetrPrämDurchfG: Gesetz zur Umsetzung der Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik,<br />
Art. 1: Betriebsprämiendurchführungsgesetz vom 26. Juli 2004.<br />
BImSchG: Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen,<br />
Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (BImSchG – Bundes-Immissionsschutzgesetz) vom<br />
26. September 2002.<br />
BNatSchG: Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz – BNatSchG) vom<br />
25. März 2002 (BGBl. I S.1193), zuletzt geändert durch Art. 5 des Gesetzes v. 24.6.2004 (BGBl. I 1359).<br />
DirektZahlVerpflG: Gesetz zur Umsetzung der Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik,<br />
Art. 2: Direktzahlungen-Verpflichtungengesetz vom 26. Juli 2004.<br />
DüngeMG: Düngemittelgesetz vom 15. November 1977.<br />
Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-Richtlinie): Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur<br />
Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tier und Pflanzen.<br />
GG: Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland vom 23. Mai 1949, zuletzt geändert durch<br />
Bundesgesetz vom 27.10.1994.<br />
LNatSchG Sch.-H.: Gesetz zum Schutz der Natur (Landesnaturschutzgesetz – LNatschG) vom 18. Juli<br />
2003.<br />
NNatSchG: Niedersächsisches Naturschutzgesetz in der Fassung vom 11. April 1994, GVBl., zuletzt<br />
geändert durch Gesetz vom 19.2.2004.<br />
PflSchG: Gesetz zum Schutz der Kulturpflanzen (Pflanzenschutzgesetz – PflSchG) vom 14. Mai 1998.<br />
SächsNatSchG: Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Sächsisches Naturschutzgesetz –<br />
SächsNatSchG), Fassung vom 11. Oktober 1994, zuletzt geändert am 5. Mai 2004.<br />
Verordnung (EG) 118/2004 zur Änderung der Verordnung (EG) 2419/2001 mit<br />
Durchführungsbestimmungen zum mit der Verordnung (EWG) 3508/1992 des Rates eingeführten<br />
integrierten Verwaltungs- und Kontrollsystem für bestimmte gemeinschaftliche Beihilferegelungen vom<br />
23. Januar 2004.<br />
Verordnung (EG) 1593/2000 zur Änderung der Verordnung (EWG) 3508/1992 des Rates eingeführten<br />
integrierten Verwaltungs- und Kontrollsystem für bestimmte gemeinschaftliche Beihilferegelungen vom<br />
17. Juli 2000.<br />
Verordnung (EG) Nr. 1257/1999 des Rates vom 17. Mai 1999 über die Förderung der Entwicklung des<br />
ländlichen Raums durch den Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Landwirtschaft<br />
(EAGFL) und zur Änderung bzw. Aufhebung bestimmter Verordnungen.<br />
Verordnung (EG) Nr. 1750/1999 der Kommission vom 23. Juli 1999 mit Durchführungsvorschriften zur<br />
Verordnung (EG) Nr. 1257/1999 des Rates über die Förderung der Entwicklung des ländlichen Raums<br />
durch den Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Landwirtschaft (EAGFL).<br />
Verordnung (EWG) Nr. 2078/92 des Rates vom 30. Juni 1992 für umweltgerechte und den natürlichen<br />
Lebensraum schützende landwirtschaftliche Produktionsverfahren Amtsblatt Nr. L 215 vom 30/07/1992<br />
S. 0085 – 0090.<br />
Vogelschutz-Richtlinie: Richtlinie des Rates vom 2. April 1979 über die Erhaltung der wildlebenden<br />
Vogelarten (79/409/EWG), geändert durch die Richtlinie 97/49/EG der Kommission vom 29. Juli 1997.<br />
WHG: Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz – WHG) vom 19. August 2002.
316<br />
EPLR der Länder<br />
BB – MLUR (Ministerium für Landwirtschaft, Umweltschutz und Raumordnung des Landes<br />
Brandenburg): Plan zur Entwicklung des ländlichen Raums des Landes Brandenburg<br />
(Stand: 29.09.2000).<br />
BE – Berliner Senat (Senatsverwaltung für Wirtschaft und Technologie und Senatsverwaltung für<br />
Stadtentwicklung): Entwicklungsplan für den ländlichen Raum (Berlin)<br />
(Stand: 29.05.2001).<br />
BW – MLR (Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum): Entwicklungsplan für den ländlichen<br />
Raum in Baden-Württemberg (Stand: 7.09.2000).<br />
BY – STMLF (Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten): Plan zur<br />
Förderung der Entwicklung des ländlichen Raumes in Bayern (Stand: 7.09.2000).<br />
HB – Bremer Senat – SWH (Senator für Wirtschaft und Häfen): Plan des Landes Bremen zur<br />
Entwicklung des ländlichen Raumes (Stand: 4.10.2000).<br />
HE – MULF (Hessisches Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Forsten): Entwicklungsplan für<br />
den ländlichen Raum im Land Hessen (Stand: 29.09.2000).<br />
HH – Hamburger Senat (Wirtschaftsbehörde – Abteilung Landwirtschaft): Programm für die Entwicklung<br />
des ländlichen Raums in der Region Hamburg (Stand: 18.09.2000).<br />
MV – LM (Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Fischerei Mecklenburg-<br />
Vorpommern: Entwicklungsplan für den ländlichen Raum im Land Mecklenburg-Vorpommern (Stand:<br />
29.09.2000).<br />
NI – ML (Niedersächsisches Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten): Proland –<br />
Entwicklungsprogramm für den ländlichen Raum im Land Niedersachsen (Stand 29.09.2000).<br />
NW – MUNLV (Ministerium für Umwelt und Naturschutz Landwirtschaft und Verbraucherschutz des<br />
Landes Nordrhein-Westfalen): Plan des Landes Nordrhein-Westfalen zur Entwicklung des ländlichen<br />
Raums (Stand: 7.09.2000).<br />
RP – MWVLW (Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau des Landes<br />
Rheinland-Pfalz: Entwicklungsplan für den ländlichen Raum im Land Rheinland-Pfalz (Stand:<br />
29.09.2000).<br />
SH – (MUNL) (Ministerium für Umwelt, Natur und Forsten des Landes Schleswig-Holstein, vorh.<br />
Ministerium für ländliche Räume, Landesplanung, Landwirtschaft und Tourismus des Landes Schleswig-<br />
Holstein): Plan des Landes Schleswig-Holstein zur Entwicklung des ländlichen Raumes (Stand:<br />
8.09.2000).<br />
SL – MUEV (Ministerium für Umwelt, Energie und Verkehr des Saarlandes): Entwicklungsplan für den<br />
ländlichen Raum im Saarland (Stand: 29.09.2000).<br />
SN – SMUL (Sächsischen Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft): Entwicklungsplan für den<br />
ländlichen Raum in Sachsen (Stand: 7.09.2000).<br />
ST – MRLU (Ministerium für Raumordnung, Landwirtschaft und Umwelt): Programm des Landes<br />
Sachsen-Anhalt zur Förderung der Entwicklung des ländlichen Raums (Stand: 7.09.2000).<br />
TH – TMLNU (Thüringer Ministerium für Landwirtschaft, Naturschutz und Umwelt): Entwicklungsplan<br />
für den ländlichen Raum im Land Thüringen (Stand: 29.09.2000).
Literatur 317<br />
Berichte zur Halbzeitbewertung der EPLR in Deutschland (nicht vollständig)<br />
BB – ZALF Müncheberg (Projektleitung): Halbzeitbewertung des Plans zur Entwicklung des ländlichen<br />
Raums des Landes Brandenburg (im Auftrag des Ministeriums für Landwirtschaft, Umweltschutz und<br />
Raumordnung des Landes Brandenburg).<br />
http://www.mlur.brandenburg.de/cms/media.php/2317/halbzeit.pdf<br />
BE – ZALF Müncheberg (Projektleitung): Halbzeitbewertung des Plans zur Entwicklung des ländlichen<br />
Raums des Landes Berlin (im Auftrag des Landes Berlin).<br />
BW – Universität Hohenheim (Projektleitung): Halbzeitbewertung des EPLR Baden-Württembergs (im<br />
Auftrag des Ministeriums für Ernährung und Ländlichen Raum).<br />
http://www.infodienst-mlr.bwl.de/mlr/fachinfo/mepl/ZBBWOkt03Kap1_5.pdf<br />
BY – TU München, Wirtschaftslehre des Landbaus (Projektleitung): Evaluierung der bayerischen<br />
Agrarumweltprogramme "Kulturlandschaftsprogramm" (KULAP A) und "Vertragsnaturschutzprogramm"<br />
(VNP) (im Auftrag des Bayerischen Ministeriums für Landwirtschaft und<br />
Forsten).<br />
HB – FAL Braunschweig, Institut für Betriebswirtschaft, Agrarstruktur und ländliche Räume<br />
(Projektleitung): Halbzeitbewertung des Plans des Landes Bremen zur Entwicklung des ländlichen Raums<br />
(im Auftrag des Senators für Wirtschaft und Häfen der Freien Hansestadt Bremen).<br />
HE – FAL Braunschweig, Institut für Betriebswirtschaft, Agrarstruktur und ländliche Räume<br />
(Projektleitung): Halbzeitbewertung des Hessischen Entwicklungsplans für den ländlichen Raums (im<br />
Auftrag des Hessischen Ministeriums für Umwelt, ländlichen Raum und Verbraucherschutz).<br />
HH – FAL, Institut für Betriebswirtschaft, Agrarstruktur und ländliche Räume (Projektleitung):<br />
Halbzeitbewertung des Plans des Landes Hamburg zur Entwicklung des ländlichen Raums (im Auftrag<br />
der Behörde für Wirtschaft und Arbeit der Freien und Hansestadt Hamburg).<br />
NI – FAL, Institut für Betriebswirtschaft, Agrarstruktur und ländliche Räume (Projektleitung):<br />
Halbzeitbewertung von PROLAND Niedersachsen (im Auftrag des Niedersächsischen Ministeriums für<br />
den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz).<br />
http://www1.ml.niedersachsen.de/proland/Aktuelles.htm<br />
NW – FAL, Institut für Betriebswirtschaft, Agrarstruktur und ländliche Räume (Projektleitung):<br />
Halbzeitbewertung des NRW-Programms Ländlicher Raum (im Auftrag des Ministerium für Umwelt und<br />
Naturschutz Landwirtschaft und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen).<br />
RP – Institut für Ländliche Strukturforschung Frankfurt a.M. (Projektleitung): Bewertung des rheinlandpfälzischen<br />
Entwicklungsplans „Zukunftsinitiative für den ländlichen Raum“ (ZIL) (im Auftrag des<br />
Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau des Landes Rheinland-Pfalz).<br />
SH – FAL, Institut für Betriebswirtschaft, Agrarstruktur und ländliche Räume (Projektleitung):<br />
Halbzeitbewertung des Programms „Zukunft auf dem Land“ (ZAL) (im Auftrag des Innenministeriums<br />
des Landes Schleswig-Holstein).<br />
TH – Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft (Projektleitung): Halbzeitbewertung des EPLR<br />
Thüringen (im Auftrag des Thüringer Ministeriums für Landwirtschaft, Naturschutz und Umwelt).
318
Erster Schritt: Bestimmung des regionalen Potentials<br />
Liste A<br />
Mindestens 3 Indikatoren der Liste A sind auf der Parzelle<br />
Alpenhelm, Arnika, Betonie, Enziane, blau/violett, Herbstzeitlose, Klappertopf, Mehlprimel, Sterndolde, Sumpf-<br />
Herzblatt, Teufelskralle, Trollblume, Wollgräser<br />
JA<br />
Die Fläche hat ein hohes biologisches Potential.<br />
Benutzen Sie Liste B zur Bestimmung der Qualität<br />
der Parzelle<br />
Mindestens 6 Indikatoren<br />
der Liste B sind auf der Testfläche<br />
Alpenhelm Margerite<br />
Arnika* Mehlprimel*<br />
Aufrechte Trespe* Mittlerer Wegerich<br />
Betonie Orchideen*<br />
Blutwurz Salbei<br />
Dost Schlaffe Segge<br />
(inkl. Wirbeldost Seggen*<br />
Enziane, blau/violett* (ohne Schlaffe Segge)<br />
Esparsette* Sterndolde<br />
Gelbe Primeln Sumpfdotterblume<br />
Glockenblumen Sumpf-Herzblatt*<br />
Gräser; borstenblättrig, Teufelskralle<br />
horstwüchsig* Thymian<br />
(ohne Festuca rubra) Trollblume<br />
Habermark Wiesenknopf<br />
Hainsimsen (kleiner und großer)<br />
Herbstzeitlose Witwenblumen/<br />
Klappertopf Scabiose<br />
Knolliger Hahnenfuss Wollgräser*<br />
Kohldistel Zypressenblättrige<br />
Mädesüss Wolfsmilch<br />
JA<br />
Die Testfläche weist<br />
die erforderliche<br />
Mindestqualität auf.<br />
Zweiter Schritt: Qualitätstest<br />
NEIN<br />
Die Fläche hat ein mittleres biologisches<br />
Potential. Benutzen Sie Liste C zur Bestimmung<br />
der Qualität der Parzelle<br />
Liste B Liste C<br />
NEIN<br />
Die Testfläche weist<br />
die erforderliche<br />
Mindestqualität<br />
nicht auf.<br />
Bitte der kantonalen Fachstelle für Naturschutz die<br />
Parzellen melden, die<br />
- 1 oder 2 Arten mit * mit hoher Deckung oder<br />
- 3 Arten mit * aufweisen<br />
Mindestens 6 Indikatoren<br />
der Liste C sind auf der Testfläche<br />
Alpenhelm Habermark, Gänsedistel,<br />
Arnika* Alpen-Greiskraut)<br />
Aufrechte Trespe* Kuckuckslichtnelke<br />
Betonie Leimkräuter, weiss<br />
Blutwurz Mädesüss<br />
Dost (inkl. Wirbeldost) Margerite<br />
Enziane, blau/violett* Mehlprimel*<br />
Esparsette* Mittlerer Wegerich<br />
Flaumhafer Orchideen*<br />
Flockenblumen Platterbsen, gelb<br />
Gelb blühender Klee, Ruchgras<br />
grossköpfig Salbei<br />
Gelbe Primeln Schlaffe Segge<br />
Glockenblumen Seggen*<br />
Gräser, borstenblättrig, (ohne Schlaffe Segge)<br />
horstwüchsig* (ohne Sterndolde<br />
Festuca rubra) Sumpfdotterblume<br />
Habermark Sumpf-Herzblatt*<br />
Hainsimsen Teufelskralle<br />
Herbstzeitlose Thymian<br />
Hopfenklee Trollblume<br />
Klappertopf Vogel-Wicke<br />
Knolliger Hahnenfuss* Wiesenknopf<br />
Kohldistel (kleiner und grosser)<br />
Korbblütler, gelb, ein- Witwenblumen/<br />
köpfig (ohne Löwen- Scabiose<br />
zahn, Schwarzwurzel, Wollgräser*<br />
Arnika, und Habermark) Zittergras<br />
Korbblütler, gelb, mehr- Zypressenblättrige<br />
köpfig (ohne Arnika, Wolfsmilch<br />
JA<br />
Die Testfläche weist<br />
die erforderliche<br />
Mindestqualität auf.<br />
NEIN<br />
Die Testfläche weist<br />
die erforderliche<br />
Mindestqualität<br />
nicht auf.<br />
Bitte der kantonalen Fachstelle für Naturschutz die<br />
Parzellen melden, die<br />
- 1 oder 2 Arten mit * mit hoher Deckung oder<br />
- 3 Arten mit * aufweisen<br />
Anhang<br />
Abbildung A-1: Technische Ausführungsbestimmungen zum Anhang der ÖQV: Mindestanforderungen an<br />
die biologische Qualität; Schlüssel für die Alpennordseite (Gujer & Oppermann 2003, leicht verändert)
Anhang<br />
Anlage A-1: Die Regeln der Guten fachlichen Praxis als Voraussetzung für die Honorierung ökologischer<br />
Leistungen<br />
1 Rechtsgrundlagen<br />
Durch den Erlass der EG (VO) 1257/1999 wurde die Gute fachliche Praxis Förderungsvoraussetzung für mehrere<br />
Maßnahmen:<br />
• Ausgleichszulage für das benachteiligte Gebiet,<br />
• Ausgleichszahlungen für Gebiete mit umweltspezifischen Einschränkungen,<br />
• Agrarumweltmaßnahmen,<br />
• Förderung im Rahmen des Agrarinvestitionsprogramms (AFP).<br />
Die Verordnung ‚Ländlicher Raum’ enthält zusätzliche folgende Regelungen:<br />
• Ein Landwirt, der für einen Teil seines Betriebes eine Agrarumweltverpflichtung eingeht, muss im gesamten<br />
landwirtschaftlichen Betrieb mindestens die Anforderungen der guten landwirtschaftlichen Praxis im üblichen<br />
Sinne erfüllen.<br />
• Die Kontrollen vor Ort erstrecken sich jährlich auf mindestens 5 % der Begünstigten.<br />
• Die Mitgliedstaaten bestimmen ein System der Sanktionen für Verstöße. Die Sanktionen müssen wirksam,<br />
verhältnismäßig und abschreckend sein.<br />
Eine Konkretisierung der Guten fachlichen Praxis erfolgt auf europäischer Ebene im Art. 29 der VO (EG) 445/2002,<br />
der diese als den „gewöhnlichen Standard der Bewirtschaftung, die ein verantwortungsbewusster Landwirt in der<br />
betreffenden Region anwenden würde“, definiert.<br />
2 Standardisierung der Guten fachlichen Praxis in Deutschland<br />
In Deutschland wurde unter Federführung des zuständigen Bundesministeriums in Abstimmung mit den Ländern<br />
(Bund-Länder-Arbeitsgruppe) ein Katalog von Indikatoren entwickelt, der bei der Prüfung zur Einhaltung der Guten<br />
fachlichen Praxis angewendet wird. Dabei handelt es sich um folgende Indikatoren:<br />
• Bodenuntersuchungen für jeden Schlag größer als 1 ha und nicht älter als sechs Jahre oder neun Jahre bei<br />
Grünlandextensivierung,<br />
• Untersuchungen über den Stickstoffbedarf von Ackerland und Grünland,<br />
• Nährstoffvergleiche auf Betriebsbasis,<br />
• Sachkundenachweis für Pflanzenschutz,<br />
• Prüfplakette auf der Feldspritze und das Prüfzeugnis.<br />
Darüber hinaus wird auf das Ordnungsrecht verwiesen und zwar insbesondere auf die Regelungen der<br />
Düngeverordnung (DüngeVO) und des Gesetzes zum Schutz der Kulturpflanzen (PflSchG).<br />
3 Kontrolle der Guten fachlichen Praxis<br />
3.1 Aufdeckung im Rahmen der obligatorischen Vor-Ort-Kontrolle<br />
Der Indikatorenkatalog wird im Rahmen der obligatorischen 5 %igen Vor-Ort-Kontrolle durch den Technischen<br />
Prüfdienst der EG-Zahlstelle abgeprüft. Dabei wird von dem Prüfer eine sogenannte Indikatorenkontrolle<br />
vorgenommen, das heißt, es werden unter anderem die auf dem Betrieb vorhandenen Unterlagen gesichtet und auf<br />
Vollständigkeit kontrolliert. Es erfolgt keine tiefergehende fachliche Prüfung, sondern es werden die dargestellten<br />
Voraussetzungen hinsichtlich ihres Vorhandenseins geprüft. Kommt es bei einer Indikatorenkontrolle des<br />
Technischen Prüfdienstes zur Guten fachlichen Praxis zu einer Beanstandung, so wird der entsprechende Prüfbericht<br />
an die Fachbehörde weitergeleitet. Die Fachbehörde führt daraufhin eine eingehende fachliche Prüfung durch und<br />
meldet das Ergebnis an die für die Prämie zuständige Bewilligungsstelle zurück. Diese entscheidet dann auf<br />
Grundlage der Prüfung durch die Fachbehörde über eine eventuelle Sanktion des Prämienantrages. Die Bund-<br />
Länder-Arbeitsgruppe hat festgelegt, dass die Sanktion zusätzlich zu den eventuell durch die Fachbehörde<br />
verhängten Bußgeldern erfolgen muss. Die Zahlungen sollen mindestens in Höhe der Bußgelder zusätzlich gekürzt
Anhang<br />
werden. Der Ablauf der Prüfung der Guten fachlichen Praxis im Rahmen der 5 %igen Vor-Ort-Kontrolle ist in der<br />
folgenden Abbildung für Nordrhein-Westfalen dargestellt.<br />
Landwirte<br />
Zusätzliche<br />
Kürzung<br />
der Prämie<br />
mind. in Höhe<br />
des Bußgeldes<br />
Rückmeldung<br />
an die<br />
Prämienbehörde<br />
Prüfung der Guten Fachlichen Praxis in NW<br />
Stand: 18.09.2000<br />
Quelle: http://www.agrar.de/aktuell/praxis.htm#einh (leicht verändert)<br />
Antrag auf Ausgleichszulage<br />
und Agrarumweltmaßnahmen<br />
Auswahl von 5 % zur Vor-Ort-Kontrolle<br />
durch den Technischen Prüfdienst:<br />
Betriebe werden zur Zahlung gesperrt<br />
Allg. Prüfung durch Technischen Prüfdienst,<br />
zusätzlich Fragen zur Guten fachlichen Praxis,<br />
Prüfen von Indikatoren<br />
kein Verstoß<br />
Freischaltung des Betriebes<br />
und Auszahlung der Prämien<br />
an die Landwirte<br />
Feststellen<br />
eines Verstoßes<br />
Prüfung durch Fachbehörde<br />
keine Bestätigung<br />
des Verstoßes<br />
keine Verhängung<br />
eines Bußgeldes<br />
3.2 Aufdeckung im Rahmen der Prüfung der relevanten Fachgesetze<br />
Bestätigung<br />
des Verstoßes<br />
Fragen/Indikatoren:<br />
- Standardbodenuntersuchung<br />
(P, K)<br />
- Bodenuntersuchung<br />
bei Ackerland (N)<br />
- Nährstoffausgleich<br />
- Sachkundenachweis<br />
Pflanzenschutz<br />
- Prüfplakette an der<br />
Spritze<br />
- sonstige Hinweise<br />
für Verstöße<br />
Verhängung<br />
eines Bußgeldes<br />
Unabhängig von den Kontrollen des Technischen Prüfdienstes der EG-Zahlstelle werden von den zuständigen<br />
Fachreferaten eigenständige Kontrollen durchgeführt. In Deutschland werden die Bewirtschaftungsstandards durch<br />
die Düngemittelverordnung und das Pflanzenschutzgesetz festgelegt und auch schon seit längerem durch die<br />
zuständigen Fachbehörden kontrolliert (z.B. durch die Fachreferate der Landwirtschaftskammer).<br />
Werden Verstöße gegen die Düngemittelverordnung oder das Pflanzenschutzgesetz von der für die Kontrollen<br />
zuständigen Behörde festgestellt und als Ordnungswidrigkeit geahndet, so wird die Fördersumme um den Betrag des<br />
Buß- und Verwarnungsgeldes gekürzt. Diese Kürzung erfolgt zusätzlich, betroffene Unternehmen müssen also zum<br />
einen das Buß- oder Verwarnungsgeld zahlen, zum anderen erhalten sie nur die gekürzte Fördersumme. Die<br />
möglichen Verstöße sind abhängig von der Betriebsstruktur und der Betriebsgröße.
Anhang<br />
Tabelle A-1: Gesetzliche Regelung der Bundesländer zur Enteignung, ausgleichspflichtigen Inhalts- und<br />
Schrankenbestimmungen (ISB), Erschwernis- und Härteausgleich<br />
Gesetzliche Regelungen der Bundesländer<br />
Enteignung ausgleichspflichtige ISB* Erschwernisausgleich<br />
BB § 70 I-III BbgNatSchG § 71 I-III BbgNatSchG<br />
§ 71 IV<br />
BbgNatSchG<br />
Härteausgleich<br />
BE § 46 NatSchGBln § 47 I, II NatSchGBln § 48 NatSchGBln<br />
BW § 47 II NatSchG BW<br />
BY Art. 35 BayNatSchG Art. 36 I BayNatSchG<br />
HB § 37 BremNatSchG § 38 I, III BremNatSchG<br />
HE § 38 HeNatG § 39 HeNatG<br />
HH § 38 HmbNatSchG § 39 I HmbNatSchG<br />
Art.36a<br />
BayNatSchG<br />
MV § 49 LNatG M-V § 50 LNatG M-V § 50 VII LNatG M-V<br />
NI § 49 NNatSchG §§ 50, 51 NNatSchG § 52 I NNatSchG § 52 II NNatSchG<br />
NW § 7 I, V LG § 7 II-V LG<br />
RP § 39 IV, V LPflG § 39 I, II, V LPflG<br />
SL § 37 I, II, IV SNG, § 39 I, II SNG<br />
SN § 37 SächsNatSchG § 38 II-V SächsNatSchG<br />
§ 38 VI<br />
SächsNatSchG<br />
Besonderheit in Sachsen: Vorrang des Vertragsnaturschutzes (§ 39), soweit vertragliche Vereinbarung<br />
dem Schutzzweck in gleicher Weise dient<br />
SH § 41 LNatSchG Sch.-H.<br />
ST § 41 NatSchG LSA<br />
§ 42 I, III-V LNatSchG<br />
Sch.-H.<br />
§ 42 I, II, IV-VI NatSchG<br />
LSA<br />
§ 43 I NatSchG<br />
LSA<br />
TH § 48 ThürNatG §§ 49, 50 I, II ThürNatG § 51 ThürNatG<br />
* Inhalts- und Schrankenbestimmungen<br />
§ 43 LNatSchG<br />
Sch.-H.<br />
§ 43 II NatSchG LSA
Tabelle A-2: Gründe der Nicht-Teilnahme an Agrarumweltmaßnahmen (Anteil in % der Beantworter)<br />
Antrag<br />
abgelehnt<br />
Kein positiver<br />
Umwelteinfluss durch<br />
AUM erwartet<br />
Kompensation<br />
für AUM zu<br />
gering<br />
Bereits Teilnehmer<br />
an anderen<br />
Maßnahmen<br />
Anwendung der<br />
AUM ist zu teuer<br />
Nicht genügend<br />
Wissen über die<br />
AUM<br />
Belgien 13 17 27 0 10 22 5<br />
Frankreich 0 1 10 1 1 8 1<br />
Deutschland<br />
Bayern<br />
Deutschland<br />
Sachsen<br />
Deutschland<br />
Schleswig-Holstein<br />
0 63 50 0 0 0 0<br />
67 33 33 0 0 0 0<br />
10 9 55 0 0 3 23<br />
Griechenland 0 4 27 1 4 24 4<br />
Italien 11 4 19 2 14 52 7<br />
Schweden 9 4 13 4 33 9 0<br />
Großbritannien 10 11 45 2 58 17 25<br />
gesamt 14 10 33 3 21 49 9<br />
Datenquelle: STEWPOL Projekt, Internal Summary Report, in Falconer 2000<br />
Verunsicherung bzgl.<br />
künftiger Entwicklung der<br />
AUM
KOMPLEX 1 KOMPLEX 2<br />
KOMPLEX 3<br />
ALB<br />
jährlich zum Stichtag<br />
31.12. aktualisiert<br />
Ergebnisse der<br />
Flurstücksidentifizierung<br />
programmtechnischer<br />
ALB-Abgleich<br />
Vorhandensein und Größe<br />
sowie doppelte Flurstücke<br />
- kreisübergreifend<br />
- länderübergreifend<br />
Ablehnung im Falle<br />
von Doppelbeantragung<br />
Antrag Agrarförderung<br />
- Gesamtflächen- und Nutzungsnachweis<br />
- Pflicht des Antragstellers zu wahrheitsgemäßen Angaben<br />
- Hinweis, dass beantragte Fläche des Flurstücks nur<br />
kleiner oder gleich der Katasterfläche (ALB) sein kann<br />
Verwaltungskontrolle I<br />
- Prüfung Vollständigkeit der Angaben<br />
Verwaltungskontrolle II<br />
- Schnelldatenerfassung<br />
- flurstücksgenaue Erfassung<br />
- Bestätigung der ordnungsgemäßen<br />
Erfassung<br />
Verwaltungskontrolle III<br />
- Prüfung aller Kriterien für flächen-<br />
bezogene Maßnahmen<br />
Bewilligung<br />
Risikoanalyse<br />
(bundeseinheitlich)<br />
Vor-Ort-Kontrolle<br />
nach<br />
bundeseinheitlichen<br />
Vorgaben<br />
- Vermessung<br />
- visuelle Prüfung<br />
Prüfung nach<br />
Flurkarten<br />
Statistischer Bericht über Ergebnisse der Verwaltungs- und VOK<br />
Abbildung A-2: Überblick über die Verwaltungskontrolle der Maßnahmen im Bereich Ausgleichszulage<br />
sowie der Agrarumweltmaßnahmen (Quelle: Matzdorf & Piorr 2003)<br />
Anhang<br />
Ergebnisse VOK<br />
ggf. Erhöhung<br />
Prüfdichte
Anhang<br />
Tabelle A-3: Cross Compliance – Anforderungen an die Betriebsführung (Quelle: Tabelle 75; BMVEL 2004)<br />
Ab dem 1.01.2005 anwendbar<br />
Umwelt<br />
Richtlinie 79/409/EWG des Rates vom 2. April 1979 über die Erhaltung der wild<br />
lebenden Vogelarten<br />
(ABl. L 103 vom 25. April 1979, S. 1)<br />
Richtlinie 80/68/EWG des Rates vom 17. Dezember 1979 über den Schutz des<br />
Grundwassers gegen Verschmutzung durch bestimmte gefährliche Stoffe (ABl. L 20<br />
vom 26. Januar 1980, S. 43)<br />
Richtlinie 86/278/EWG des Rates vom 12. Juni 1986 über den Schutz der Umwelt<br />
und insbesondere der Böden bei der Verwendung von Klärschlamm in der<br />
Landwirtschaft (ABl. L 181 vom 4. Juli 1986, S. 6)<br />
Richtlinie 91/676/EWG des Rates vom 12. Dezember 1991 zum Schutz der<br />
Gewässer vor Verunreinigung durch Nitrat aus landwirtschaftlichen Quellen (ABl. L<br />
375 vom 31. Dezember 1991, S. 1)<br />
Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen<br />
Lebensräume sowie der wild lebenden Tiere und Pflanzen (ABl. L 206 vom 22. Juli<br />
1992, S. 7)<br />
Gesundheit von Mensch und Tier<br />
Kennzeichnung und Registrierung von Tieren<br />
Richtlinie 92/102/EWG des Rates vom 27. November 1992 über die Kennzeichnung<br />
und Registrierung von Tieren<br />
(ABl. L 355 vom 5. Dezember 1992, S. 32)<br />
Verordnung (EG) Nr. 2629/97 der Kommission vom 29. Dezember 1997 mit<br />
Durchführungsvorschriften zur Verordnung (EG) Nr. 820/97 des Rates im Hinblick<br />
auf Ohrmarken, Bestandsregister und Pässe im Rahmen des Systems zur<br />
Kennzeichnung und Registrierung von Rindern<br />
(ABl. L 354 vom 30. Dezember 1997, S. 19)<br />
Verordnung (EG) Nr. 1760/2000 des Europäischen Parlaments und des Rates vom<br />
17. Juli 2000 zur Einführung eines Systems zur Kennzeichnung und Registrierung<br />
von Rindern und über die Etikettierung von Rindfleisch und Rindfleischerzeugnissen<br />
sowie zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 820/97 des Rates<br />
(ABl. L 204 vom 11. August 2000, S. 1)<br />
Ab dem 1.01.2006 anwendbar<br />
Gesundheit von Mensch, Tier und Pflanze<br />
Richtlinie 91/414/EWG des Rates vom 15. Juli 1991 über das Inverkehrbringen von<br />
Pflanzenschutzmitteln<br />
(ABl. L 230 vom 19. August 1991, S. 1)<br />
Richtlinie 96/22/EG des Rates vom 29. April 1996 über das Verbot der Verwendung<br />
bestimmter Stoffe mit hormonaler bzw. thyreostatischer Wirkung und von ß-<br />
Agonisten in der tierischen Erzeugung und zur Aufhebung der Richtlinien<br />
81/602/EWG, 88/146/EWG und 88/299/EWG (ABl. L 125 vom 23. Mai 1996, S. 3)<br />
Verordnung (EG) Nr. 178/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28.<br />
Januar 2002 zur Festlegung der allgemeinen Grundsätze und Anforderungen des<br />
Lebensmittelrechts, zur Errichtung der Europäischen Behörde für<br />
Lebensmittelsicherheit und zur Festlegung von Verfahren zur Lebensmittelsicherheit<br />
(ABl. L 31 vom 1. Februar 2002, S. 1)<br />
Verordnung (EG) Nr. 999/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22.<br />
Mai 2001 mit Vorschriften zur Verhütung, Kontrolle und Tilgung bestimmter<br />
transmissibler spongiformer Enzephalopathien (ABl. L 147 vom 31. Mai 2001, S. 1)<br />
Artikel 3, Artikel 4,<br />
Absätze 1, 2 und 4,<br />
Artikel 5, 7 und 8<br />
Artikel 4 und 5<br />
Artikel 3<br />
Artikel 4 und 5<br />
Artikel 6, 13, 15 und<br />
Artikel 22,<br />
Buchstabe b)<br />
Artikel 3, 4 und 5<br />
Artikel 6 und 8<br />
Artikel 4 und 7<br />
Artikel 3<br />
Artikel 3, 4, 5 und 7<br />
Artikel 14, 15,<br />
Artikel 17 Absatz 1,<br />
Artikel 18, 19 und 20<br />
Artikel 7, 11, 12, 13<br />
und 15
Meldung von Krankheiten<br />
Richtlinie 85/511/EWG des Rates vom 18. November 1985 zur Einführung von<br />
Maßnahmen der Gemeinschaft zur Bekämpfung der Maul- und Klauenseuche (ABl.<br />
L 315 vom 26. November 1985, S.11)<br />
Richtlinie 92/119/EWG des Rates vom 17. Dezember 1992 mit allgemeinen<br />
Gemeinschaftsmaßnahmen zur Bekämpfung bestimmter Tierseuchen sowie<br />
besonderen Maßnahmen bezüglich der vesikulären Schweinekrankheit (ABl. L 62<br />
vom 15. März 1993, S. 69)<br />
Richtlinie 2000/75/EG des Rates vom 20. November 2000 mit besonderen<br />
Bestimmungen für Maßnahmen zur Bekämpfung und Tilgung der<br />
Blauzungenkrankheit (ABl. L 327 vom 22. Dezember 2000, S. 74)<br />
Ab dem 1.01.2007 anwendbar<br />
Tierschutz<br />
Richtlinie 91/629/EWG des Rates vom 19. November 1991 über<br />
Mindestanforderungen für den Schutz von Kälbern (ABl. L 340 vom 11. Dezember<br />
1991, S. 28)<br />
Richtlinie 91/630/EWG des Rates vom 19. November 1991 über<br />
Mindestanforderungen für den Schutz von Schweinen (ABl. L 340 vom 11.<br />
Dezember 1991, S. 33)<br />
Richtlinie 98/58/EG des Rates vom 20. Juli 1998 über den Schutz<br />
landwirtschaftlicher Nutztiere (ABl. L 221 vom 8. August 1998, S. 23)<br />
Artikel 3<br />
Artikel 3<br />
Artikel 3<br />
Artikel 3 und 4<br />
Artikel 3 und 4<br />
Absatz 1<br />
Artikel 4<br />
Da für den Bereich des Bodenschutzes zurzeit noch keine entsprechende EU-Regelung existiert, hat die<br />
Verordnung zunächst nur Gegenstände definiert, welche von den Mitgliedstaaten jeweils national zu<br />
konkretisieren sind (BMVEL 2003: 89).<br />
Hierzu gehören:<br />
1. Schutz des Bodens vor Bodenerosion, Erhaltung der organischen Substanz im Boden und Erhaltung der<br />
Bodenstruktur<br />
2. Regelungen für ein Mindestmaß an Instandhaltung von landwirtschaftlichen Flächen<br />
3. Regelungen zur Vermeidung einer Zerstörung von Lebensräumen festzulegen.<br />
4. Darüber hinaus gilt ein Umbruchverbot für Flächen, die im Jahr 2003 als Dauergrünland genutzt wurden.<br />
Anhang
Anhang<br />
Tabelle A-4: Status quo der Agrarpolitik und Mid-term Review<br />
Betriebsprämie <br />
Regionalisierung <br />
Wahloptionen <br />
Stilllegung<br />
Cross<br />
Compliance<br />
Beratung<br />
Modulation <br />
Finanzdisziplin<br />
2.Säule<br />
Getreide<br />
Status quo Mid-Term Review<br />
Direktzahlungen an Fläche bzw. Tierzahl<br />
gebunden; Produktion notwendig.<br />
Stillegung in Höhe von 10 % der<br />
prämierten Ackerkulturen; freiwillige<br />
Stillegung bis 33 %; Anbau von<br />
nachwachsenden Rohstoffen erlaubt.<br />
Wahlweise Reduzierung der<br />
Direktzahlung, um Umweltgesetzgebung<br />
und spezielle Umweltanforderungen<br />
umzusetzen.<br />
Wahlweiser Aufbau eines<br />
Beratungssystems.<br />
Wahlweise Reduzierung der<br />
Direktzahlungen um bis zu 20 %; Dieses<br />
Geld verbleibt im Mitgliedsstaat für die<br />
Finanzierung von begleitenden<br />
Maßnahmen.<br />
Kofinanzierte Maßnahmen im Bereich<br />
Agrarumwelt, Investitionsbeihilfe,<br />
Junglandwirte, Aufforstung etc.; EU-<br />
Anteil 50 % bzw. 75 % in z.B. den neuen<br />
Bundesländern.<br />
Interventionspreis 101,31 €/t;<br />
Direktzahlungen 63 €/t multipliziert mit<br />
Referenzertrag; monatliche Aufschläge<br />
auf den<br />
Interventionspreis (7 mal 0,93 €/t).<br />
Entkoppelte Betriebsprämie ab 2005 enthält<br />
Ackerbauprämien, Rinderprämien und ab 2006/07<br />
Milchprämie; Basisperiode 2000-2002; Einlösung nur<br />
mit Nachweis von landwirtschaftlicher Fläche; Feldobst,<br />
Gemüse und Speisekartoffeln sind bis zum Umfang der<br />
Basisperiode förderfähig.<br />
Regionalisierung kann zur Einführung einer<br />
einheitlichen Flächenzahlung benutzt werden oder einer<br />
Grünland- und Ackerbauprämie; Umverteilung zwischen<br />
Regionen möglich; ein Mitgliedsland mit weniger als<br />
3 Mio. ha kann eine Region sein.<br />
Mitgliedsländer können auf nationaler oder regionaler<br />
Ebene bis zu 25 % der Ackerbauprämie, bis zu 50 % der<br />
Schaf- und Ziegenprämie und wahlweise 75 % der<br />
Bullenprämie, 100 % der Schlachtprämie oder 100 % der<br />
Mutterkuhprämie und 40 % der Schlachtprämie an die<br />
Produktion koppeln; zusätzlich können 10 % des<br />
Gesamtprämienvolumens an spezielle<br />
Produktionsverfahren gebunden werden.<br />
Flächenstilllegungszahlungen müssen durch Stilllegung<br />
aktiviert werden; 10 % der in der Basisperiode<br />
prämierten Ackerfläche; Anbau von nachwachsenden<br />
Rohstoffen möglich; Ökolandbau von Stilllegungsverpflichtung<br />
ausgenommen. Stilllegung (mit Pflege) bis<br />
100 % der Flächen möglich.<br />
Reduktion der Direktzahlungen, wenn EU-Standards im<br />
Bereich Umwelt, Lebensmittelsicherheit und Tierschutz<br />
nicht eingehalten werden oder das Land nicht in guter<br />
landwirtschaftlicher und ökologischer Kondition<br />
gehalten wird.<br />
Mitgliedsländer müssen ein Beratungssystem ab 2007<br />
aufbauen; Beratungsteilnahme durch die Landwirte<br />
freiwillig.<br />
Modulation ab einem Freibetrag von 5000 € um 3 % in<br />
2005, um 4 % in 2006 und um 5 % ab 2007; Verwendung<br />
für Maßnahmen zur ländlichen Entwicklung;<br />
Verteilung nach objektiven Kriterien, wobei mindestens<br />
80 % in dem geldgebenden Mitgliedsstaat verbleibt.<br />
Ab 2007 werden die Direktzahlungen gekürzt, wenn es<br />
sich abzeichnet, dass die Budgetlimitierung bei einer<br />
Sicherheitsmarge von 300 Mio. € nicht eingehalten<br />
werden kann.<br />
Ölsaaten Gleiche Flächenzahlung wie bei Getreide Entkopplung<br />
Zusätzliche Maßnahmen im Bereich<br />
Lebensmittelqualität und Tierschutz; Anhebung des EU-<br />
Anteils um jeweils 10 % für Agrarumweltmaßnahmen<br />
(kein fixer Kofinanzierungssatz, sondern Obergrenze).<br />
Keine Veränderung des Interventionspreises; Halbierung<br />
der monatlichen Aufschläge; Entkopplung; Abschaffung<br />
der Roggenintervention, aber Kompensation durch<br />
erhöhte Gelder aus der Modulation.
Rindfleisch<br />
Milch<br />
Quelle: COM 2003b<br />
Grundpreis von 2 224 €/t mit privater<br />
Lagerhaltung bei 103 % dieses Preises;<br />
Ochsenprämie zweimal 150 €,<br />
Bullenprämie 210 €, Mutterkuhprämie<br />
200 €, Schlachtprämie 80 € bzw. 50 € für<br />
Kälber; allgemeine Limitierung auf 1,8<br />
LU/ha und 90 Tiere;<br />
Extensivierungsprämie von 100 € bei<br />
weniger als 1,4 LU/ha.<br />
Milchquoten gelten bis 2008;<br />
Interventionspreiskürzung um 15 % ab<br />
2005/06; Milchprämie ab 2005/06 steigt<br />
schrittweise auf 25,86 €/t; Anstieg der<br />
Milchquote um 2,39 %.<br />
Anhang<br />
Regionale Anpassungen; Rinderprämien werden Teil der<br />
Betriebsprämie, wobei Wahloptionen bestehen<br />
Milchquoten verlängert bis 2014/15; Interventionspreis<br />
für Butter wird um 25 % von Magermilchpulver um 15<br />
% von 2004 bis 2007 gekürzt; Milchprämie steigt von<br />
11,81 €/t in 2004 auf 35,5 €/t in 2006; danach Teil der<br />
Betriebsprämie; Milchquotenausweitung teilweise<br />
aufgeschoben.
Tabelle A-5:‚KULAP 2000’ von Brandenburg - Beispiel für Agrarumweltmaßnahmen (AUM) eines ‚klassischen’ Agrarumweltprogramms<br />
Gegenstand<br />
Abk. (detaillierte<br />
Untergliederung)<br />
Grünlandmaßnahmen<br />
A1 Extensive<br />
Grünlandnutzung<br />
A2 Extensive<br />
Bewirtschaftung sowie<br />
Pflege von<br />
überflutungsgefährdetem<br />
Flussauengrünland<br />
A3 Späte und eingeschränkte<br />
Grünlandnutzung<br />
A4 Mosaikartige<br />
Grünlandnutzung<br />
wesentliche Beihilfevoraussetzungen<br />
• max. 1,4 GV mindestens 0,3 GV<br />
• Weidebesatzstärke von max. 1,4 RGV/ha Grünland<br />
• keine chemisch-synthetische Stickstoffdüngung<br />
• keine PSM (Ausnahmen auf Antrag)<br />
• mindestens einmalige Nutzung jährlich<br />
(Beweidung/Mahd mit Beräumung)<br />
• mind. 30 % GL an LF des Betriebes<br />
• keine Düngung<br />
• keine PSM<br />
• kein GL-Umbruch<br />
Aufsattelmaßnahme auf A1, A2 oder B3 GL<br />
• kein GL-Umbruch<br />
• Bewirtschaftungsmaßnahmen vor dem ersten Nutzungstermin nur in<br />
Abstimmung mit UNB<br />
• erster Nutzungstermin: a) nicht vor dem 16.06.<br />
b) nicht vor dem 01.07.<br />
c) nicht vor dem 16.07.<br />
Aufsattelmaßnahme auf A1, A2 oder B3 GL<br />
• gestaffelte Mäh- oder Weidenutzung<br />
• spezielle Mahdvorschriften<br />
• kein Umbruch<br />
• zusätzlich Doppelmessermähbalken<br />
Beihilfehöhe<br />
(€/ha)<br />
130<br />
130<br />
45<br />
90<br />
125<br />
110<br />
+20<br />
Gebietskulisse<br />
keine<br />
GL im Bereich von Gewässern<br />
I. Ordnung<br />
Wiesenbrüterschutzgebiete mit<br />
tatsächlichem Vorkommen spezieller<br />
Arten/<br />
Biotoptypen des Feuchtgrünlandes und<br />
Binnensalzstellen<br />
Wiesenbrüterschutzgebiete mit<br />
tatsächlichem Vorkommen spezieller<br />
Arten/<br />
Biotoptypen des Feuchtgrünlandes und<br />
Binnensalzstellen
Abk.<br />
Gegenstand<br />
(detaillierte<br />
Untergliederung)<br />
A5 Erschwerte<br />
Bewirtschaftung und<br />
Pflege von<br />
Spreewaldwiesen<br />
A6 Pflege von<br />
ertragsschwachem<br />
Grünland und Heiden<br />
mittels Beweidung<br />
A7 Pflege von<br />
Streuobstwiesen<br />
Ackermaßnahmen<br />
B1 Integrierter Obst- und<br />
Gemüsebau<br />
B2 Extensive<br />
Produktionsverfahren im<br />
Ackerbau<br />
wesentliche Beihilfevoraussetzungen<br />
Aufsattelmaßnahme auf A1 oder B3 GL<br />
a) Mähnutzung mit Technikeinsatz und Landtransport (Form 1)<br />
b) wie Form 1, jedoch Flächen nur über Wasserweg erreichbar (Form 2)<br />
c) Handmahd von mind. 50 % der Fläche (Form 3)<br />
d) Standweide, ansonsten wie Form 1 (Form 4)<br />
e) Standweide ohne Maschineneinsatz und Erreichbarkeit der Flächen nur<br />
über Wasserweg (Form 5)<br />
• mindestens einmal jährliche Beweidung bis 20.09. nach Weideplan<br />
• Aufzeichnungspflicht der Beweidungsmaßnahmen<br />
• extensive Wiesennutzung<br />
(Verzicht auf chemisch-synthetische Düngung, keine PSM, mindestens<br />
einmalige Mahd mit Beräumung des Mähgutes/Beweidung nicht vor dem<br />
15.06. bis spätestens 20.09.)<br />
• Auflagen zur Baumpflege<br />
a) Grundförderung Obst/Baumschule (PSM – ohne W-Aufl. – nach<br />
Schadschwellen, N min nach Sollwert, Beschränkung für<br />
Wachstumsregulatoren)<br />
b) a + ohne Herbizide<br />
c) a + ohne Insektizide, Akarizide<br />
d) Grundförderung Gemüse u.a. (N min nach Sollwert, nach Möglichkeit<br />
resistentes Saatgut)<br />
e) Grundförderung Beeren in geschütztem Anbau (N min nach Sollwert,<br />
nach Möglichkeit resistentes Saatgut)<br />
nicht geöffnet und ab 2003 aus dem KULAP genommen<br />
Beihilfehöhe<br />
(€/ha)<br />
75<br />
180<br />
380<br />
50<br />
230<br />
105<br />
75<br />
max. 825<br />
385<br />
+150<br />
+100<br />
300<br />
510<br />
Gebietskulisse<br />
innerhalb der festgelegten<br />
Gemeindefluren der Spreewaldregion<br />
pflegebedürftiges Biotop (Bestätigung<br />
durch UNB)<br />
keine<br />
-
Abk.<br />
Gegenstand<br />
(detaillierte<br />
Untergliederung)<br />
B3 Ökologischer Landbau<br />
B4<br />
Erosionsmindernde/<br />
bodenschonende<br />
Maßnahmen<br />
B5 Umwandlung von AL in<br />
extensives GL<br />
B6<br />
Dauerstilllegung von<br />
Ackerland auf ökologisch<br />
sensiblen Flächen<br />
Erhaltung genetischer Vielfalt<br />
C1<br />
C2<br />
Züchtung/Haltung vom<br />
Aussterben bedrohter<br />
Rassen<br />
Erhaltung bedrohter<br />
regionaler Kulturpflanzen<br />
wesentliche Beihilfevoraussetzungen<br />
• Auflagen des ökologischen Landbaus nach VO (EG) 2092/91 bei<br />
Ackerland (AL), Grünland (GL), Gemüse (G) und Dauerkulturen (D).<br />
• GL wie A1, außer Mindestanteil an GL muss nicht eingehalten werden<br />
A/B) Zwischenfrüchte/Untersaaten mit speziellen Auflagen<br />
Beihilfehöhe<br />
(€/ha)<br />
150 AL<br />
130 GL<br />
400 G<br />
615 D<br />
+ 50 Einf.<br />
60/40<br />
Gebietskulisse<br />
C) Anbau kleinkörniger Leguminosen in Reinsaat und Grasgemisch 310 keine<br />
D) Anbau kleinkörniger Leguminosen in Reinsaat und Grasgemisch auf<br />
Kippenflächen (Rekultivierungsauflagen)<br />
• nach Umwandlung extensive Bewirtschaftung des GL wie unter A1<br />
• max. Anteil GL an LF Betrieb 30 %<br />
• 0,05-0,3 ha zusammenhängende Fläche<br />
• keine Nutzung/Pflege zu bestimmten Zeiten möglich (Vorgaben durch<br />
UNB)<br />
• keine Düngung/kein PSM<br />
• Selbstbegrünung<br />
förderfähig sind aktuell:<br />
a) Schwarzbuntes Rind (alte Zuchtrichtung),<br />
b) Deutsches Sattelschwein,<br />
c) Skudden<br />
340<br />
255<br />
300-520<br />
-100 wenn<br />
Flächen<br />
> 0,3 ha<br />
pro Anzahl<br />
a) 135<br />
b) 55-80<br />
c) 25<br />
die aktuell direkt förderfähigen Arten/Sorten sind in einer Liste definiert 130-425<br />
keine<br />
keine<br />
Rekultivierungsflächen<br />
keine<br />
Sensibel Flächen<br />
-<br />
-
Abk.<br />
Gegenstand<br />
(detaillierte<br />
Untergliederung)<br />
Extensive Teichwirtschaft<br />
D<br />
Pflege und Erhaltung von<br />
Teichlandschaften<br />
wesentliche Beihilfevoraussetzungen<br />
• Erhaltung und Pflege der Teichanlagen<br />
• Erhaltung und Pflege der Dämme<br />
• Räumung der Fischgruben<br />
• Verhinderung der Teichverlandung (Entschilfung) nach Pflegeplan durch<br />
zwei Schnitte:<br />
o vor dem 15. Juni<br />
o nach dem 15. Juni<br />
Beihilfehöhe<br />
(€/ha)<br />
bis 100<br />
bis 85<br />
bis 70<br />
bis 25<br />
bis 45<br />
Gebietskulisse<br />
keine
Tabelle A-6: Flächenumfang der im Rahmen des Agrarumweltprogramm geförderten Maßnahmen in<br />
Brandenburg für die Jahre 1994-2002<br />
Anhang<br />
Agrarumweltmaßnahmen<br />
Förderumfang ha/Jahr in Brandenburg<br />
und Art. 16 Maßnahmen 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002<br />
A1 ext. GL 47449 80415 95477 111349 109846 111058 108727 108466 106213<br />
A2 ext. GL in Auen* 2482 11060 11235 12396 13910 12776 7593 7265 6583<br />
A3 ext. GL später Schnitt* 0 0 12824 27859 29502 32048 30006 18013 4925<br />
A5 ext. GL Spreewald* 1933 1537 1599 1626 1703 2232 1510 1545 2251<br />
A6 Trockenes GL/Heiden* 0 0 0 0 0 0 0 1654 1919<br />
A7 Streuobstwiesen* 0 0 102 214 235 302 319 255 190<br />
FP 42 Pflege braches GL* 5051 3859 4765 5597 5663 2966 1426 947 375<br />
B1 IOGB 0 0 6232 5716 6008 6474 7112 7298 7242<br />
B2 ext. AL 7896 14769 28157 31895 30998 23342 12992 606 0<br />
B3 Ökolandbau 1676 4738 7458 33624 47317 56670 57553 68939 77269<br />
B4<br />
Bodenschonende<br />
Maßnahmen<br />
0 0 24226 95957 94289 109909 116706 76882 14254<br />
B5 Umwandlung AL in GL* 2675 6936 10685 17009 17016 16532 13990 11197 5487<br />
* eher umweltzielorientierte Maßnahmen<br />
ext. AL = extensiver Ackerlandnutzung, ext. GL = extensive Grünlandnutzung, IOG = Integrierter Obst- und<br />
Gemüsebau; Erläuterung der Maßnahmen im Anhang Tabelle A-5<br />
Datenquelle: LVL Brandenburg
Anhang<br />
Tabelle A-7: Inanspruchnahme der Ausgleichszahlungen nach Artikel 16 im Jahr 2002 in Deutschland<br />
Land Anz. Betriebe Fläche (ha)<br />
Brandenburg 241 12.536 (10.928*)<br />
Bremen 77 1.263<br />
Hamburg 31 242<br />
Niedersachsen 1.733 15.506<br />
Nordrhein-Westfalen 1.442 13.769<br />
Schleswig-Holstein 256 2.444<br />
Thüringen 354 14.670<br />
* ohne Aufsattelmaßnahmen
Klassen der Relevanz<br />
0 (sehr wenig relevant)<br />
1 (wenig relevant)<br />
2 (mittel relevant)<br />
3 (sehr relevant)<br />
4 (äußerst relevant)<br />
Keine Nutzung<br />
Anhang<br />
Kersebaum, Steidl, Kiesel<br />
Abbildung A-3: Fluren Brandenburgs, die aufgrund der naturräumlichen Standortbedingungen für die<br />
Belastung von Grundwasser durch diffusen Nitrataustrag unter landwirtschaftlicher Nutzung relevant sind<br />
(Kersebaum et al. 2004)
Anhang<br />
Flussgebietseinheiten<br />
Elbe: Koordinierungsraum Havel<br />
Elbe: Koordinierungsraum Mittelelbe/Elde<br />
Elbe: Koordinierungsraum Mulde/Elbe/Schwarze Elster<br />
Oder: Oder, Neiße<br />
Warnow-Peene: Ucker<br />
Kilometer<br />
Abbildung A-4: Koordinierungsräume und Bearbeitungsgebiete (Entwurf) zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie im<br />
Land Brandenburg; Stand 07.07.2004 (Datengrundlage: LUA)
Klassen der Relevanz<br />
sehr relevant<br />
relevant<br />
gering relevant<br />
gering relevant, wenn GW-<br />
Flurabstand ordnungsgemäß<br />
gehalten<br />
nicht relevant<br />
keine landwirtschaftlichen Standorte<br />
(inklusive Berlin Ost)<br />
nicht bewertet (z. B. Einfluss durch<br />
Bergbau, keine Landesfläche)<br />
Anhang<br />
Steidl, Dannowski, Fritsche<br />
Abbildung A-5: Landwirtschaftliche Standorte Brandenburgs, die aufgrund der naturräumlichen<br />
Standortbedingungen für die Belastung von Oberflächengewässern durch diffusen Nitrateintrag relevant sind<br />
(Steidl et al. 2003, leicht verändert)
Anhang<br />
N-Austrag (kg/ha*a) aus der Wurzelzone<br />
Keine Ackernutzung/ keine Daten<br />
0<br />
0 - 20<br />
20 - 35<br />
35 - 50<br />
50 - 65<br />
65 - 80<br />
> 80<br />
Kilometer<br />
Abbildung A-6: Modellierte N-Immissionen in die ungesättigte Bodenzone (Emissionen aus der Wurzelzone) der<br />
Ackerstandorte Brandenburgs unter konventioneller Nutzung<br />
(eigene Darstellung, Datengrundlage: Kersebaum 2004)
N-Austrag (kg/ha*a) aus der Wurzelzone<br />
Keine Grünlandnutzung/ keine Daten<br />
0<br />
0 - 20<br />
20 - 35<br />
35 - 50<br />
50 - 65<br />
Kilometer<br />
Anhang<br />
Abbildung A-7: Modellierte N-Immissionen in die ungesättigte Bodenzone (Emissionen aus der Wurzelzone) der<br />
Grünlandstandorte Brandenburgs unter konventioneller Nutzung<br />
(eigene Darstellung, Datengrundlage: Kersebaum 2004)
Anhang<br />
N-Austrag (kg/ha*a) aus der Wurzelzone<br />
Keine Ackernutzung/ keine Daten<br />
0<br />
0 - 20<br />
20 - 35<br />
35 - 50<br />
50 - 65<br />
65 - 80<br />
> 80<br />
Kilometer<br />
Abbildung A-8: Modellierte N-Immissionen in die ungesättigte Bodenzone (Emissionen aus der Wurzelzone) der<br />
Ackerstandorte Brandenburgs unter ökologischer Nutzung<br />
(eigene Darstellung, Datengrundlage: Kersebaum 2004)
N-Austrag (kg/ha*a) aus der Wurzelzone<br />
Keine Grünlandnutzung/ keine Daten<br />
0<br />
0 - 20<br />
20 - 35<br />
35 - 50<br />
50 - 65<br />
Kilometer<br />
Anhang<br />
Abbildung A-9: Modellierte N-Immissionen in die ungesättigte Bodenzone (Emissionen aus der Wurzelzone) der<br />
Grünlandstandorte Brandenburgs unter extensiver Nutzung<br />
(eigene Darstellung, Datengrundlage: Kersebaum 2004)
Anhang<br />
Kilometer<br />
Kilometer<br />
Abbildung A-10: Veranschaulichung der Heterogenität des modellierter N-Austrag aus der Wurzelzone am<br />
Beispiel der ackerbaulich genutzten Standorte Brandenburgs unter konventioneller Nutzung in der Flur<br />
(Ausschnitt nordöstliches Brandenburg)
Verringerung der N-Immissionen in kg/ (ha*a)<br />
Keine Ackernutzung/ keine Daten<br />
0<br />
0 - 20<br />
20 - 35<br />
35 - 50<br />
50 - 65<br />
65 - 80<br />
Kilometer<br />
Anhang<br />
Abbildung A-11: Verringerung landwirtschaftlich verursachter N-Immission in die ungesättigte Bodenzone durch<br />
die Umstellung von konventionell genutztem auf ökologisch genutztes Ackerland, dargestellt auf Flurebene<br />
(eigene Berechnungen, Datengrundlage: Kersebaum 2004)
Anhang<br />
Verringerung der N-Immission (kg/ ha*a)<br />
Keine Grünlandnutzung/ keine Daten<br />
0<br />
0 - 20<br />
20 - 35<br />
35 - 50<br />
Kilometer<br />
Abbildung A-12: Verringerung landwirtschaftlich verursachter N-Immission in die ungesättigte Bodenzone durch<br />
die Umstellung von konventionell genutztem Grünland auf extensiv genutztes Grünland, dargestellt auf Flurebene<br />
(eigene Berechnungen, Datengrundlage: Kersebaum 2004)
Verringerung der N-Immissionen in kg/ (ha*a)<br />
Keine Ackernutzung/ keine Daten<br />
0<br />
0 - 20<br />
20 - 35<br />
35 - 50<br />
50 - 65<br />
65 - 80<br />
Kilometer<br />
Anhang<br />
Abbildung A-13: Verringerung landwirtschaftlich verursachter N-Immission in die ungesättigte Bodenzone durch<br />
die Umstellung von konventionell genutztem Ackerland auf extensiv genutztes Grünland, dargestellt auf Flurebene<br />
(eigene Berechnungen, Datengrundlage: Kersebaum 2004)
Anhang<br />
kein zusätzlicher Anreiz<br />
1,50 bis 10,- €<br />
11,- bis 20,- €<br />
21,- bis 29,- €<br />
30,- €<br />
keine Ackernutzung<br />
Kilometer<br />
Abbildung A-14: Fluren, auf denen eine ökologische Ackernutzung unter Verwendung des Verfahrens zur<br />
ergebnisorientierten Honorierung (kg N-Verminderung pro Jahr = 1,5 €) zu einem zusätzlichen Anreiz gegenüber<br />
der aktuellen, rein kostenorientierten Honorierung führen würde<br />
(eigene Berechnungen, Datengrundlage: Kersebaum 2004 und InVeKoS 2002)
kein zusätzlicher Anreiz<br />
1,50 bis 10,- €<br />
11,- bis 20,- €<br />
21,- bis 30,- €<br />
31,- bis 40,- €<br />
41,- bis 50,- €<br />
51,- €<br />
keine Ackernutzung<br />
Kilometer<br />
Kilometer<br />
Anhang<br />
Abbildung A-15: Fluren, auf denen eine Umwandlung von konventionellem Ackerland in Grünland unter<br />
Verwendung des Verfahrens zur ergebnisorientierten Honorierung (kg N-Verminderung pro Jahr = 1,5 €) zu einem<br />
zusätzlichen Anreiz gegenüber der aktuellen, rein kostenorientierten Honorierung führen würde<br />
(eigene Berechnungen, Datengrundlage: Kersebaum 2004 und InVeKoS 2002)
Anhang<br />
Vorschlag der<br />
Mitgliedsstaaten an die<br />
Europäische Kommission<br />
Festlegung durch die<br />
Europäische Kommission<br />
Ausweisung der Gebiete<br />
durch die Mitgliedsstaaten<br />
SPA<br />
Vogelschutzrichtlinie FFH-Richtlinie<br />
Natura 2000-Gebiete<br />
Vorschlag der<br />
Mitgliedsstaaten an die<br />
Europäische Kommission<br />
pSCI<br />
Gebietsbewertung und<br />
Festlegung durch die<br />
Europäische Kommission<br />
Abbildung A-16: Aufbau des Natura 2000-Netzes (Rückriem & Roscher 1999, leicht verändert)<br />
pSCI = proposed Site of community Interest (vorgeschlagenes Gebiet gemeinschaftlicher Bedeutung)<br />
SCI = Site of Community Interest (Gebiet gemeinschaftlicher Bedeutung)<br />
SAC = Special Area of Conservation (besondere Schutzgebiete)<br />
SPA = Special Protection Area (besondere Schutzgebiete)<br />
SCI<br />
Ausweisung der Gebiete<br />
durch die Mitgliedsstaaten<br />
SAC
Anlage A-2: Beschlüsse der Arbeitsgemeinschaft „Naturschutz“ der Landes-Umweltministerien (LANA)<br />
Anhang<br />
Die LANA hat auf ihrer 81. Sitzung (September 2001 in Pinneberg) die vom AK „Umsetzung der FFH-Richtlinie“<br />
vorgelegten „Mindestanforderungen für die Erfassung und Bewertung von Lebensräumen und Arten sowie die<br />
Überwachung“ beschlossen. Daher werden diese Vorgaben als Grundlage für weitergehende Konzepte<br />
herangezogen. Diese Vorgaben beinhalten sowohl ein Bewertungsschema für die Lebensraumtypen als auch für die<br />
Arten. Demnach wird der Erhaltungszustand anhand von drei Parametern in die Kategorien A, B und C eingestuft.<br />
Tabelle 1: Allgemeines Bewertungsschema zum Erhaltungszustand der FFH-LRT (LANA 2001)<br />
Vollständigkeit der<br />
lebensraumtypischen<br />
Habitatstrukturen<br />
Vollständigkeit des<br />
lebensraumtypischen<br />
Arteninventars<br />
Beeinträchtigung<br />
A<br />
hervorragende<br />
Ausprägung<br />
A<br />
lebensraumtypisches<br />
Arteninventar<br />
vorhanden<br />
A<br />
gering<br />
B<br />
gute Ausprägung<br />
B<br />
lebensraumtypisches<br />
Arteninventar<br />
weitgehend<br />
vorhanden<br />
B<br />
mittel<br />
Die für die drei Parameter zu vergebenden Bewertungskategorien werden zu einem Gesamtwert zusammengefasst.<br />
Hierbei werden folgende Algorithmen angewandt:<br />
Tabelle 3: Algorithmen für die Ermittlung des Gesamtwertes (LANA 2001)<br />
C1<br />
mäßige bis<br />
durchschnittliche<br />
Ausprägung<br />
C1<br />
lebensraumtypisches<br />
Arteninventar nur in<br />
Teilen vorhanden<br />
Habitatstruktur<br />
Habitatqualität<br />
A A A A A B B<br />
Arteninventar<br />
Population<br />
B A B C A B C<br />
Beeinträchtigung C B B C C C C<br />
Gesamtwert B A B C B B C<br />
Der LANA-Arbeitskreis hat außerdem festgehalten, dass die Richtlinie keine Beschränkung des Monitorings auf die<br />
Natura 2000-Gebiete vorsieht. Die Mindestanforderungen an die Überwachung des Erhaltungszustandes sehen daher<br />
vor, dass die Bundesländer Daten zur Bestandsituation der Lebensraumtypen und Arten innerhalb und außerhalb der<br />
Gebiete erheben und über die Ergebnisse berichten. Des Weiteren müssen die Länder sicherstellen, dass auch<br />
Aussagen zur Bestandssituation der Arten der Anhänge IV und V getroffen werden können.<br />
C1<br />
stark<br />
C2 irreversibel<br />
gestört; nicht<br />
regenerierbar<br />
Tabelle 2: Allgemeines Bewertungsschema zum Erhaltungszustand der FFH-Arten (LANA 2001)<br />
Habitatqualität<br />
(artspezifische<br />
Strukturen)<br />
Zustand der<br />
Population<br />
(Populationsdynamik<br />
und –struktur)<br />
Beeinträchtigung<br />
A<br />
hervorragende<br />
Ausprägung<br />
A<br />
gut<br />
A<br />
gering<br />
B<br />
gute Ausprägung<br />
B<br />
mittel<br />
B<br />
mittel<br />
C1<br />
mäßige bis<br />
durchschnittliche<br />
Ausprägung<br />
C1<br />
schlecht<br />
C1<br />
stark<br />
C2 irreversibel<br />
gestört; nicht<br />
regenerierbar
Anhang<br />
Abbildung: A-17: Natura 2000-Gebiete Brandenburgs (Stand 2000) (Quelle: LUA)
Anlage A-3: Steckbriefe der behandelten Lebensraumtypen Brandenburgs<br />
(Beutler & Beutler 2002)<br />
Anhang<br />
Subsumtion der Biotoptypen Brandenburgs und Vegetationseinheiten (Pflanzengesellschaften) unter die<br />
LRT:<br />
v = Vegetationseinheiten oder Biotope, die in der Regel vollständig zu einem Lebensraumtyp gehören<br />
p.p. = (pars partim) Vegetationseinheiten oder Biotope, die teilweise zu einem Lebensraumtyp gehören<br />
Anlage A-3.1: Brenndolden-Auenwiesen (Cnidion dubii)<br />
Code - Natura 2000: 6440 Alluvial meadows of river valleys of Cnidium dubii<br />
BfN-Handbuch: Brenndolden-Auenwiesen der Stromtäler<br />
Code - Biotopkartierung Brandenburg:<br />
05104 Wechselfeuchtes Auengrünland pp<br />
051042 Wechselfeuchtes Auengrünland, kraut- und seggenreich (GFAK) pp<br />
05131 Grünlandbrachen feuchter Standorte (GAF) pp<br />
051316 von sonstigen Süßgräsern dominiert (GAFG) pp<br />
051319 sonstige Grünlandbrachen feuchter Standorte (GAFX) pp<br />
05134 Grünlandbrachen, wiedervernässt (GAN) pp<br />
Naturraum: D03, D05, D06, D07, D08, D09, D10, D12<br />
Beschreibung:<br />
Artenreiche Wiesen an potentiellen Auenwaldstandorten der großen Fluss- und Stromtäler vor allem von<br />
Oder und Elbe, in abgewandelter Form entlang der Mittel- und Unterläufe von Havel und Spree sowie der<br />
Unterläufe von Schwarzer Elster und Neiße, im Jahresverlauf stark schwankende Bodenfeuchte (je nach<br />
relativer Höhe zum Fluss wechselfeucht bis wechselnass) mit periodischer Überflutung<br />
(Überflutungsdauer zwischen einem und vier Monaten im Frühjahr oder Frühsommer, im Sommer stark<br />
austrocknend) und in ausgepolderten Bereichen Überstauung oder Durchfeuchtung durch Dränagewasser,<br />
gekennzeichnet durch das Vorkommen der in Mitteleuropa an großen Flussauen gebundenen Arten<br />
subkontinentaler Verbreitung –Stromtalpflanzen (*).
Anhang<br />
Vegetation:<br />
Molinietalia caeruleae W. KOCH 1926 pp<br />
Deschampsion cespitosae HORVATIC 1935 (syn. Cnidion dubii BAL.-TUL. 1966) pp<br />
Sanguisorba officinalis-Silaetum silai KLAPP 1951 v<br />
Ranunculo auricomi-Deschampsietum caespitosae SCAM. 1955 v<br />
Pflanzenarten:<br />
*Achillea salicifolia, *Allium angulosum, *Cnidium dubium, Deschampsia caespitosa, Alopecurus<br />
pratensis, Galium boreale, *Gratiola officinalis, *Inula britannica, Iris sibirica, Lathyrus palustris,<br />
Ranunculus auricomus agg., Sanguisorba officinalis, Serratula tinctoria, *Scutellaria hastifolia, Senecio<br />
aquaticus, Silaum silaus, *Thalictrum lucidum, Thalictrum flavum, *Pseudolysimachia longifolia, *Viola<br />
stagnina u.a.<br />
(* = Stromtalarten)<br />
Tierarten:<br />
Vögel: Wachtelkönig, Tüpfelralle, Löffel-, Schnatter-, Knäkente, Wiesenpieper, Schafstelze,<br />
Rotschenkel, Brachvogel, Kampfläufer, Bekassine, Kiebitz, Uferschnepfe<br />
Heuschrecken: Chorthippus albomarginatus, Corthippus dorsatus, Chrysochraon dispar, Stethophyma<br />
grossum, Metrioptera roeseli<br />
Schmetterlinge: Maculinea nausithous u.a.<br />
Käfer: Cynegetis impunctata, Grypus brunnirostris, Lixus iridis, Nephus redtenbachi, Pelenomus<br />
waltoni, Phyllotreta exclamationis u.a.<br />
Hautflügler: Bombus muscorum u.a.<br />
Spinnen: Allomengea scopigera, A. vidua Lophomma punctatum, Pachygnatha clercki, Pardosa div.<br />
spec., Pelecopsis mengei, Robertus arundineti, Savignya frontata, Tibellus maritimus u.a.<br />
Weichtiere: Succines putris u.a.<br />
Kartierungshinweise:<br />
Signifikante Vorkommen von Stromtalpflanzen wesentliche; fehlende Überflutung infolge Ausdeichung<br />
oder Abflussregulierung kein Ausschlusskriterium, sofern noch hydrologischer Kontakt zum Fluss<br />
besteht; Übergangsformen zu LRT 6410 und zu nährstoffreichen Feuchtwiesen in den Auen der kleineren<br />
Flüsse sowie zu LRT 6510 als Brenndolden-Auenwiesen erfassen, wenn Stromtalarten in signifikanten<br />
Populationsgrößen vorhanden; Einschluss von Brachestadien, die noch Fragmente des typischen<br />
Arteninventars aufweisen, als Entwicklungsflächen<br />
Ökologische Erfordernisse für einen günstigen Erhaltungszustand:<br />
Artenreiche, floristisch nach kleinräumigen Standortunterschieden (Substrat, Relief, Hydroregime)<br />
differenzierte, extensiv ohne Düngung genutzte Wiesen und Mähweiden auf lehmigen bis tonigen, zum<br />
Teil sandüberlagerten Auenböden mit schwankendem Überflutungs- bzw. Drängewassereinfluss<br />
Kennzeichen und Indikatoren für die Verschlechterung des Erhaltungszustandes:<br />
Strukturverarmung und signifikanter Rückgang der charakteristischen Arten bei gleichzeitiger<br />
Ausbreitung nitrophiler Pflanzen des Wirtschaftsgrünlandes und der Ruderalfluren (insbesondere Gräser<br />
wie Alopecurus pratensis, Poa div.spec., Agropyron repens u. a.). zunehmende Trockenheit mit<br />
Rückgang von Feuchte- und Nässezeigern; Vergrasung und Verbuschung bei Nutzungsauflassung<br />
Gefährdungsfaktoren und Ursachen:<br />
Eingriffe in die Überflutungsdynamik durch Fließgewässerausbau, Stauhaltung mit Steuerung der Durch-<br />
und Abflussmengen sowie Maßnahmen zum Hochwasserschutz (z.B. Ausdeichung). Grundwasserabsenkung<br />
in den Flussauen durch hydromeliorative Eingriffe (Gräben, Drainagen, Reliefnivellierung);<br />
Aufgabe oder Intensivierung (Vielschnittwiese, intensive Beweidung Düngung, Umbruch, Ansaaten) der<br />
Grünlandnutzung; dem biologischen Zyklus der Vegetation unangepasste Nutzungszeiten (z.B. Mahd zur<br />
Hauptblütezeit in VII/VIII); Bepflanzung und Aufforstung
Anhang<br />
Grundsätze für Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen:<br />
Erhaltung oder Wiederherstellung der essentiellen Standortbedingungen (standorttypischer<br />
Wasserhaushalt mit Überflutungsregime, Mesorelief). Extensive einschürige düngungsfreie Mahd, ggf.<br />
extensive Beweidung mit Nachmahd. Biotopspezifische Nutzungstermine (Juni und/oder September).<br />
Maximal 2 Weidegänge oder 2 Schnitte je Jahr können insbesondere in wiederherzustellenden Beständen<br />
(Aushagerung) toleriert werden<br />
Monitoring:<br />
Vegetation (insbesondere Stromtalarten), Fauna, Grundwasserpegel und Wasserstandsdynamik,<br />
Nutzungen und Nutzungsintensität hinsichtlich ihrer standortspezifischen Verträglichkeit (Unterschiede<br />
durch örtlich stark variierende Standortparameter), Effizienzkontrolle von Managementmaßnahmen<br />
Literaturhinweise:<br />
VENT, W. & BENKERT, D. (1984): Verbreitungskarten brandenburgischer Pflanzenarten. 2. Reihe:<br />
Stromtalpflanzen (1). Gleditschia 12: 213-238.
Anhang<br />
Anlage A-3.2: Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)<br />
Natura 2000-Code: 6510 Lowland hay meadows<br />
(Aopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)<br />
BfN-Handbuch: Extensive Mähwiesen der planaren bis submontanen Stufe<br />
(Arrhenatherion, Brachypodion-Centaureion nemoralis)<br />
Code - Biotopkartierung Brandenburg:<br />
05110 Frischwiesen und Frischweiden (GM) pp<br />
05112 Frischwiesen (GMF) pp<br />
051121 typische Ausprägung (GMFR) v<br />
05131 Grünlandbrachen feuchter Standorte (GAF) pp<br />
051316 von sonstigen Süßgräsern dominiert pp<br />
05132 Grünlandbrachen frischer Standorte (GAM) pp<br />
051321 artenreich (typische Grünlandarten) (GAMR) pp<br />
07170 flächige Obstbestände (Streuobstwiesen) (BS) pp<br />
07171 genutzte Streuobstwiesen (BSG) pp<br />
07173 aufgelassene Streuobstwiesen (BSA) pp<br />
Naturraum: D03, (D04), D05, D06, D07, D08, D09, D10, D11, D12<br />
Beschreibung:<br />
Artenreiche, durch zweischürige Mahd entstandene und erhaltene Wiesenfuchs-schwanz- und<br />
Glatthaferwiesen des Flach- und Hügellandes (Verband Arrhenatherion); in Brandenburg meist in<br />
trockenen oder feuchten Ausbildungen, häufig auf vorentwässerten Standorten oder auf<br />
Sekundärstandorten (Dämme und Deiche)<br />
Vegetation:<br />
Arrhenatheretalia elatioris PAWL. 1928 pp<br />
Arrhenatherion elatioris (BR.BL. 1925) W. KOCH 1926 pp<br />
Dauco Arrhenatheretum elatioris BR.-BL. 1915 v<br />
Heracleo-Arrhenatheretum (Tx. 1937) PASS. 1964 v<br />
Centaureo scabiosae-Arrhenatheretum (FARTMANN 1997) ass. Nov. v<br />
Chrysanthemo-Rumicetum thyrsiflori WALTHER ap. R. TX.1955 ex WALTHER 1977 v<br />
Alopecurion pratensis PASS. 1964 v<br />
Alopecuretum pratensis REGEL 1925 v<br />
Pflanzenarten:<br />
Typische Arten: Arrhenatherum elatius, Pastinaca sativa, Alopecurus pratensis, Galium album,<br />
Campanula patula, Crepis biennis, Knautia arvensis, Sanguisorba officinalis, Tragopogon pratensis,<br />
Leucanthemum vulgare, Daucus carota, Festuca rubra, Anthoxanthum odoratum, Holcus lanatus,<br />
Ranunculus bulbosus, Poa trivialis, Ranunculus repens, Silaum silaus, Achillea millefolium, Pimpinella<br />
major, Centaurea jacea, Luzula campestris, Veronica chamaedrys, Plantago lanceolata u.a.<br />
Tierarten:<br />
Vögel: Wiesenpieper, Braunkehlchen, Schafstelze, Feldlerche, Wachtelkönig, Rebhuhn, Wachtel<br />
Heuschrecken: Tettigonia cantans, Tettigonia viridissimus. Conocephalus dorsalis, Tetrix subulata u.a.<br />
Schmetterlinge: Adscita statices, Brenthis ino, Coenonympha glycerion, Lycaena dispar, Maculinea<br />
nausithous, (Maculinea teleius: nur, wenn sehr feucht!), Maniola jurtina, Melanargia galathea, Ochlodes<br />
venatus, Thymelicus lineola u.a.
Anhang<br />
Käfer: Agonum mülleri, Agriotes lineatus, Agriotes obscurus, Altica palustris, Aphthona lutescens<br />
Ctenicera pectinicornis, Phyllotreta exclamationis, Poecilus versicolor, Rhinoncus bosnicus u.a.<br />
Hautflügler: Andrena div. spec., Bombus muscorum, Epheoloides coecutiens, Macropis labiata, Melitta<br />
nigricans,. u.a.<br />
Spinnen: Allomengea vidua, Arctosa leopardus, Lophomma punctatum, Oedothorax fuscus, Pelecopsis<br />
mengei, Savignya frontata, Pardosa amentata, Pardosa prativaga, Pirata piraticus, Tibellus maritimus,<br />
u.a.<br />
Weichtiere: Carychium minimum, Cochlicopa lubrica, Euconulus fulvus, Nesovitrea hammonis, Vallonia<br />
costata, Vertigo pygmaea, Vitrina pellucida u.a.<br />
Kartierungshinweise:<br />
Kriterium für die Zuordnung - artenreiche Bestände mit einem signifikanten Anteil an Wiesenstauden<br />
(z.B. Centaurea jacea); Graseinsaaten aus Alopecurus pratensis auf intensiv bewirtschafteten nicht<br />
zugehörig<br />
Ökologische Erfordernisse für einen günstigen Erhaltungszustand:<br />
Ungedüngte nährstoffreiche, mild-humose Standorte auf Mineralböden oder entwässerten<br />
Niedermoorböden, frisch bis mäßig trocken<br />
Kennzeichen und Indikatoren für die Verschlechterung des Erhaltungszustandes:<br />
Drastischer Artenrückgang, insbesondere bei Blütenpflanzen und Verbuschung mit Gehölzen (z.B. Erle -<br />
Alnus glutinosa, Weiden – Salix spec., Faulbaum - Frangula alnus, auch Robinie - Robinia pseudoacacia,<br />
Wald-Kiefer - Pinus sylvestris sowie weitere Laubhölzer). Entwicklung von Schilf-Landröhrichten<br />
(Phragmites australis) und von Hochstaudenfluren durch verstärkte Einwanderung von Filipendula<br />
ulmaria, Epilobium-Arten, Anthriscus sylvestris, Aegopodium podagraria und anderen Arten; verstärktes<br />
Aufkommen von Eutrophierungszeigern, (z.B. Urtica dioica)<br />
Gefährdungsfaktoren und Ursachen:<br />
Nutzungsaufgabe oder Änderung der traditionellen Nutzung (zweischürige Mahd) durch Intensivierung<br />
mit Umbruch, Düngung, der Umstellung auf Weidewirtschaft und der Pferchung von Weidevieh, weitere<br />
Absenkung des Grundwasserpegels auf Niedermoorböden; Verbuschung von Brachestadien durch<br />
natürliche Sukzession; Gehölzanpflanzungen bzw. Aufforstungen<br />
Grundsätze für Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen:<br />
Erhaltung der Vegetation durch Fortsetzung der traditionellen Nutzung als dauerhaft zweischürige<br />
Mähwiese, Anpassung der Nutzung an jeweilige Standortbedingungen ohne oder mit geringer Düngung<br />
(Stickstoff), erster Schnitt nach 15.VI. des Jahres; ggf. extensive Nachbeweidung kurzfristige möglich;<br />
nach Maßgabe Gehölzbeseitigung durch Entbuschung<br />
Monitoring:<br />
Vegetation und Fauna, Nutzungen und Nutzungsintensität in ihrer Verträglichkeit am konkreten Standort<br />
mit örtlich sehr unterschiedlichen Bedingungen; Effizienzkontrolle von Managementmaßnahmen
Anhang<br />
Tabelle A-8: Entwurf für die Bewertung des Erhaltungszustandes der Brenndolden-Auenwiesen<br />
(LUA 2004 Abt. Ö2)<br />
6440 Brenndolden-Auenwiesen (Cnidion dubii)<br />
Vollständigkeit der<br />
lebensraumtypischen<br />
Habitatstrukturen<br />
Vollständigkeit des<br />
lebensraumtypischen<br />
Arteninventar<br />
A – hervorragend B – gut C – mittel bis schlecht<br />
Biotoptypen:<br />
05104 wechselfeuchtes Auengrünland (GFA) pp<br />
051042 wechselfeuchtes Auengrünland, kraut- und/oder seggenreich (GFAK) pp<br />
05131 Grünlandbrachen feuchter Standorte (GAF) pp<br />
051316 von sonstigen Süßgräsern dominiert (GAFG) pp<br />
051319 sonstige Grünlandbrachen feuchter Standorte (GAFX) pp<br />
05134 Grünlandbrachen, wiedervernässt (GAN) pp<br />
Charakteristische Vegetationstypen:<br />
Deschampsion cespitosae pp<br />
Sanguisorbo officinalis-Silaetum silai v<br />
Ranunculo auricomi-Deschampsietum cespitosae v<br />
Cnidio dubii-Deschampsietum caespitosae v<br />
Standortangepasste Nutzung, mind.<br />
regelmäßig überflutet oder mit<br />
Drängewassereinfluß, Auenstrukturen<br />
vorhanden (temporäre Wasserstellen,<br />
Rinnen u. ä.)<br />
Gelegentliche Überflutung; verarmt an<br />
typischen Strukturen<br />
Verbrachung, Streuschicht<br />
aus den Vorjahren vorhanden;<br />
keine typischen<br />
Auenstrukturen; Übergang zu<br />
Intensivgrünland<br />
A – vorhanden B – weitgehend vorhanden C – in Teilen vorhanden<br />
Charakteristische Pflanzenarten: *Achillea salicifolia, *Allium angulosum, *Cnidium dubium, Deschampsia<br />
caespitosa, Galium boreale, *Gratiola officinalis, *Inula britannica, Iris sibirica, Lathyrus palustris, Ranunculus<br />
auricomus agg., Sanguisorba officinalis, Serratula tinctoria, *Scutellaria hastifolia, Senecio aquaticus, Silaum<br />
silaus, *Thalictrum lucidum, *Th. flavum, *Pseudolysimachium longifolium, *Viola stagnina sowie weiteren<br />
typischen Arten der Feuchtwiesen<br />
(* = Stromtalarten)<br />
Lebensraumtypische Arten ≥ 6<br />
(artenreiche Wiesen<br />
Lebensraumtypische Arten 5-3,<br />
mittlerer Artenreichtum<br />
(mit Arten des Wirtschaftsgrünlandes)<br />
Lebensraumtypische Arten<br />
2-1, artenärmer (zahlreiche<br />
Arten des Intensivgrünlandes<br />
oder Brachezeiger)<br />
Vorkommen bestimmter Tierarten (stark gefährdet, von besonderer arealgeographischer Bedeutung, mit<br />
Indikatorfunktion für besondere Standortqualität) sind wertsteigernd.<br />
Beeinträchtigungen A – gering B – mittel C – stark<br />
- Eingriffe in die Überflutungsdynamik (z. B. durch Fließgewässerausbau, Stauhaltung, Maßnahmen zum Hochwasserschutz)<br />
- Grundwasserabsenkung (z. B. durch Gräben, Drainagen, Reliefnivellierungen)<br />
- Aufgabe oder Intensivierung der Grünlandnutzung (z. B. Vielschnittwiese, intensive Beweidung, Düngung,<br />
Umbruch, Ansaaten)<br />
- unangepasst Nutzungszeiten (z. B. Mahd zur Hauptblütezeit in VII/VIII)<br />
- Bepflanzung und Aufforstung<br />
- natürliche Sukzession mit aufkommender Verbuschung<br />
Nicht erkennbar; Gehölze < 10% Nutzungszustand durch Brachfallen,<br />
unangepasste Nutzung oder<br />
Intensivierung beeinträchtigt; Standort<br />
durch Eingriff in Hydrologie verändert;<br />
Brache- oder Eutrophierungs-/<br />
Ruderalisierungszeiger 5-10 %,<br />
Gehölzanteil 10-40 % u.ä.<br />
LRT durch Intensivierung,<br />
unangepasste Nutzung oder<br />
Verbrachung (Zeiger > 10 %<br />
Deckung)nur noch fragmentarisch,<br />
Standort durch<br />
Eingriff in die Hydrologie<br />
deutlich verändert;<br />
Gehölzanteil 40-70 % u.ä.<br />
Anmerkung: Übergangsformen zu LRT 6410 und 6510 sind bei signifikanten Vorkommen von Stromtalarten<br />
eingeschlossen.
Tabelle A-9: Entwurf für die Bewertung des Erhaltungszustandes der Mageren Flachland-Mähwiesen<br />
(LUA 2004 Abt. Ö2)<br />
6510 Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)<br />
Vollständigkeit der<br />
lebensraumtypischen<br />
Habitatstrukturen<br />
Vollständigkeit des<br />
lebensraumtypischen<br />
Arteninventar<br />
Anhang<br />
A – hervorragend B – gut C – mittel bis schlecht<br />
Biotoptypen:<br />
05110 Frischwiesen und Frischweiden (GM) pp<br />
05112 Frischwiesen (GMF) pp<br />
051121 artenreiche Ausprägung (GMFR) v<br />
05131 Grünlandbrachen feuchter Standorte (GAF) pp<br />
051316 von sonstigen Süßgräsern dominiert (GAFX) pp<br />
05132 Grünlandbrachen frischer Standorte (GAM) pp<br />
051321 artenreich (typische Grünlandarten) (GAMR) pp<br />
07171 genutzt Streuobstwiesen (BSG) pp<br />
07173 aufgelassene Streuobstwiesen (BSA) pp<br />
Charakteristische Vegetationstypen:<br />
Arrhenatherion elatioris pp<br />
Dauco-Arrhenatheretum elatioris v<br />
Heracleo-Arrhenatheretum v<br />
Centaureo scabiosae-Arrhenatheretum v<br />
Chrysanthemo-Rumicetum thyrsiflori v<br />
Alopecurion pratensis v<br />
Alopecuretum pratensis v<br />
Wiesennarbe gleichmäßig aus<br />
Ober-, Mittel- und Untergräsern<br />
aufgebaut, Gesamtdeckungsgrad der<br />
Kräuter: basenreich: > 40 %<br />
basenarm: > 30 %; natürliche<br />
Standort- und Strukturvielfalt,<br />
nahezu natürliches Relief<br />
Obergräser zunehmend, Mittel-<br />
und Untergräser weiterhin stark<br />
vertreten, Gesamtdeckungsgrad<br />
der Kräuter: basenreich: 30-40 %<br />
basenarm: 15-30 %; leichte<br />
Verbrachungserscheinungen,<br />
mäßige Strukturvielfalt, Relief<br />
verändert<br />
Durch Dominanz weniger Arten monoton<br />
bzw. faziell strukturiert;<br />
Gesamtdeckungsgrad der Kräuter:<br />
basenreich: < 30 % basenarm: < 15 %<br />
auch jüngere Brachen oder Struktur<br />
deutlich beeinträchtigt, Relief stark<br />
verändert<br />
A – vorhanden B – weitgehend vorhanden C – in Teilen vorhanden<br />
Charakteristische Pflanzenarten: Achillea millefolium, Anthoxanthum odoratum*, Arrhenatherum elatius, Avenula<br />
pubescens*, Alopecurus pratensis, Campanula patula, Centaurea jacea, Crepis biennis, Daucus carota, Festuca prat.,<br />
Festuca rubra, Galium album, Geranium pratense, Heracleum sphondylium, Holcus lanatus, Knautia arvensis,<br />
Lathyrus prat., Leucanthemum vulgare, Leontodon autumnalis, Leontodon hispidus*, Lotus corniculatus, Luzula<br />
campestris*, Pastinaca sativa, Phleum pratense, Pimpinella major, Pimpinella saxifraga*, Plantago lanceolata, Poa<br />
trivialis, Ranunculus bulbosus*, Ranunculus repens, Ranunculus acris, Rumex thyrsiflorus, Sanguisorba officinalis,<br />
Saxifraga granulata*, Silaum silaus, Stellaria graminea*, Tragopogon pratensis, Trifolium pratense, Veronica<br />
chamaedrys, Vicia cracca, Vicia sepium u.a.<br />
*=Magerkeitszeiger<br />
Lebensraumtypische Arten: ≥ 15,<br />
artenreiche Wiesen mit deutlichem<br />
Anteil an Magerkeitszeigern<br />
Lebensraumtypische Arten: 8-14,<br />
mittlerer Artenreichtum mit<br />
vereinzelt auftretenden<br />
Magerkeitszeigern<br />
Lebensraumtypische Arten: < 7, mäßig<br />
artenreiche Fragmentgesellschaft oder<br />
partiell durch Dominanz einzelner Arten<br />
gekennzeichnet, ohne Magerkeitszeiger<br />
Vorkommen bestimmter Tierarten (stark gefährdet, von besonderer arealgeographischer Bedeutung, mit Indikatorfunktion<br />
für besondere Standortqualität) sind wertsteigernd.<br />
Beeinträchtigungen A – gering B – mittel C – stark<br />
- Nutzungsaufgabe oder Änderung der traditionellen Nutzung (zweischürige Mahd) (z. B. durch Intensivierung mit<br />
Umbruch, Düngung, Umstellung auf Weidewirtschaft, Pferchung von Weidevieh, Einsaat )<br />
- Absenkung des Grundwasserpegels auf Niedermoorböden<br />
- Verbuschung von Brachestadien<br />
- Gehölzanpflanzungen und Aufforstungen<br />
- fehlende Mahdgutbeseitigung<br />
Gering bis keine Auftreten von gesellschaftsuntypischen<br />
Artengruppen, z. B.<br />
Eutrophierungs-, Ruderal-,<br />
Brachezeiger und/oder<br />
Beweidungszeiger mit geringem<br />
Flächenanteil (5-10 %) u.ä.<br />
Eutrophierungs-, Ruderal-, Brache-<br />
und/oder Beweidungszeiger in<br />
großen Flächenanteilen (10-30 %),<br />
Nachsaat, Nutzungsintensivierung<br />
u.ä.
lebensraumtypische Arten des LRT 6510<br />
Tabelle A-10: Einordnung des lebensraumtypischen Arteninventars des LRT Magere Flachland-Mähwiesen (LUA Ö2 2004) in das Indikatorensystem zur<br />
Erfolgskontrolle der extensiv genutzten Grünlandflächen unter Vertragsnaturschutz bzw. Agrarumweltmaßnahmen in Brandenburg (LUA & LAGS 2001)<br />
Indikatorenarten der Erfolgskontrolle für Vertragsnaturschutz und Agrarumweltmaßnahmen in Brandenburg (LUA & LAGS 2001)<br />
keine Indikatoren nährstoffarme<br />
Frischstandorte<br />
Achillea millefolium,<br />
Crepis biennis,<br />
Festuca prat.,<br />
Festuca rubra,<br />
Geranium pratense,<br />
Heracleum sphondylium,<br />
Lathyrus prat.,<br />
Leontodon hispidus*,<br />
Leucanthemum vulgare,<br />
Lotus corniculatus,<br />
Pastinaca sativa,<br />
Pimpinella major,<br />
Plantago lanceolata,<br />
Ranunculus acris,<br />
Ranunculus bulbosus*<br />
Rumex thyrsiflorus,<br />
Sanguisorba officinalis,<br />
Silaum silaus,<br />
Stellaria graminea*,<br />
Veronica chamaedrys,<br />
Vicia cracca,<br />
Vicia sepium<br />
Campanula patula,<br />
Centaurea jacea,<br />
Daucus carota,<br />
Galium album,<br />
Knautia arvensis,<br />
Leontodon autumnalis,<br />
Luzula campestris*,<br />
Saxifraga granulata*<br />
nährstoffreiche<br />
Frischstandorte<br />
Arrhenatherum<br />
elatius,<br />
Phleum pratense,<br />
Tragopogon<br />
pratensis,<br />
Trifolium<br />
pratense<br />
Aushagerungszeiger<br />
Anthoxanthum<br />
odoratum*<br />
Avenula<br />
pubescens*<br />
basen, kalkreiche,<br />
nährstoffarme<br />
Standorte<br />
Pimpinella<br />
saxifraga*<br />
*= als Magerkeitszeiger, also besonders indikative Arten im Rahmen des FFH-Monitorings für Magere Flachland-Mähwiesen ausgewiesen<br />
sehr nährstoffreiche<br />
Feuchtstandorte/<br />
Stickstoffzeiger<br />
Wechselnässe,<br />
Wechselfrischezeiger<br />
Poa trivialis Alopecurus<br />
pratensis,<br />
Ranunculus<br />
repens<br />
sonstige<br />
auffällige<br />
Arten<br />
Holcus<br />
lanatus