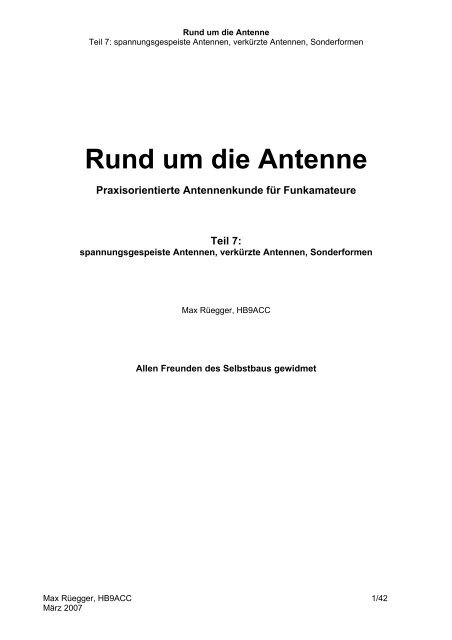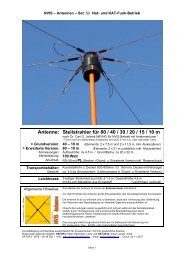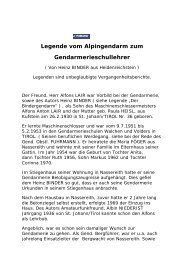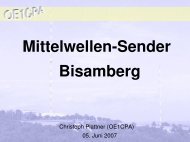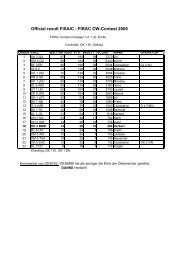Rund um die Antenne - QTH.at
Rund um die Antenne - QTH.at
Rund um die Antenne - QTH.at
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Rund</strong> <strong>um</strong> <strong>die</strong> <strong>Antenne</strong><br />
Teil 7: spannungsgespeiste <strong>Antenne</strong>n, verkürzte <strong>Antenne</strong>n, Sonderformen<br />
<strong>Rund</strong> <strong>um</strong> <strong>die</strong> <strong>Antenne</strong><br />
Praxisorientierte <strong>Antenne</strong>nkunde für Funkam<strong>at</strong>eure<br />
Teil 7:<br />
spannungsgespeiste <strong>Antenne</strong>n, verkürzte <strong>Antenne</strong>n, Sonderformen<br />
Max Rüegger, HB9ACC<br />
Allen Freunden des Selbstbaus gewidmet<br />
Max Rüegger, HB9ACC 1/42<br />
März 2007
<strong>Rund</strong> <strong>um</strong> <strong>die</strong> <strong>Antenne</strong><br />
Teil 7: spannungsgespeiste <strong>Antenne</strong>n, verkürzte <strong>Antenne</strong>n, Sonderformen<br />
Max Rüegger, HB9ACC 2/42<br />
März 2007
<strong>Rund</strong> <strong>um</strong> <strong>die</strong> <strong>Antenne</strong><br />
Teil 7: spannungsgespeiste <strong>Antenne</strong>n, verkürzte <strong>Antenne</strong>n, Sonderformen<br />
Inhaltsverzeichnis<br />
7 <strong>Rund</strong> <strong>um</strong> <strong>die</strong> <strong>Antenne</strong>, Teil 7<br />
Seite<br />
Vorwort 5<br />
7.1 Resonante spannungsgespeiste <strong>Antenne</strong>n 7<br />
7.1.1 Ankopplung über einen geerdeten Schwingkreis 9<br />
7.1.2 Die Zeppelin-<strong>Antenne</strong> oder Ankopplung über eine λ/4 Leitung 10<br />
7.1.3 Ankopplung mittels einer koaxialen Stichleitung 11<br />
7.1.4 Die Fuchs-<strong>Antenne</strong> 13<br />
7.1.5 Drahtlängen spannungsgekoppelter <strong>Antenne</strong>n 16<br />
7.1.6 Spannungsgekoppelte Vertikal-<strong>Antenne</strong>n 17<br />
7.1.7 Multiband Anpassgerät 3.5 – 28 MHz 17<br />
7.2 <strong>Antenne</strong>n verkürzen 20<br />
7.2.1 Verkürzung mittels Spulen 21<br />
7.2.3 Wendelantennen 26<br />
7.2.4 Verkürzung mittels kapazitiver Belastung 27<br />
7.2.5 Verkürzung durch Umbiegen der Enden 30<br />
7.2.6 Verkürzung mittels Umwegleitungen 33<br />
7.3 Spezialformen verkürzter <strong>Antenne</strong>n 34<br />
7.3.1 Die magnetische <strong>Antenne</strong> 35<br />
7.3.2 Die ISOTRON-<strong>Antenne</strong> 39<br />
7.3.3 <strong>Antenne</strong>n mit Widerstands-Abschluss 40<br />
7.3.4 EH-<strong>Antenne</strong>n 42<br />
Max Rüegger, HB9ACC 3/42<br />
März 2007
<strong>Rund</strong> <strong>um</strong> <strong>die</strong> <strong>Antenne</strong><br />
Teil 7: spannungsgespeiste <strong>Antenne</strong>n, verkürzte <strong>Antenne</strong>n, Sonderformen<br />
Max Rüegger, HB9ACC 4/42<br />
März 2007
<strong>Rund</strong> <strong>um</strong> <strong>die</strong> <strong>Antenne</strong><br />
Teil 7: spannungsgespeiste <strong>Antenne</strong>n, verkürzte <strong>Antenne</strong>n, Sonderformen<br />
Vorwort<br />
Die erste Version <strong>die</strong>ses Dok<strong>um</strong>entes, damals unter dem Namen „Drahtantennen Praktik<strong>um</strong>“,<br />
ist zu dem Zeitpunkt entstanden als allen YL’s und OM’s deren Funkverkehr sich<br />
bisher auf Frequenzen oberhalb 30 MHz beschränkt h<strong>at</strong> damals neu den Zugang zur<br />
Kurzwelle erhalten haben.<br />
Ich habe das Dok<strong>um</strong>ent damals meinen Freunden und Am<strong>at</strong>eurfunker-Kollegen zur Verfügung<br />
gestellt. Das grosse Echo, das dadurch ausgelöst wurde h<strong>at</strong>, h<strong>at</strong> mich bewogen das<br />
Dok<strong>um</strong>ent laufend zu überarbeiten und weitere Erfahrungen einfliessen zu lassen.<br />
Einige Bemerkungen z<strong>um</strong> Dok<strong>um</strong>ent:<br />
• Dieses Dok<strong>um</strong>ent ersetzt kein <strong>Antenne</strong>nbuch und es enthält keine Kochrezepte.<br />
Mein Ziel war es <strong>die</strong> M<strong>at</strong>erie von der praktischen Seite her anzugehen. Über<strong>die</strong>s ist<br />
es ein Ziel von mir das Verständnis für <strong>Antenne</strong>n im allgemeinen und Drahtantennen<br />
im speziellen zu wecken. Die dazugehörigen Formeln, <strong>die</strong> es einem erlauben<br />
<strong>die</strong> Drahtlängen zu berechnen, findet man in jedem <strong>Antenne</strong>nbuch. In jedem<br />
<strong>Antenne</strong>nbuch finden sich auch jede Menge Formeln deren Herleitung wohl nur für<br />
wenige von uns nachvollziehbar ist. Ich versuche mit Betrachtungen über den<br />
Spannungs- und Stromverlauf auf <strong>Antenne</strong>n das Verständnis für Probleme der<br />
Anpassung, SWR etc. zu wecken.<br />
• Das Dok<strong>um</strong>ent enthält auch Inform<strong>at</strong>ion rund <strong>um</strong> <strong>die</strong> <strong>Antenne</strong>, also M<strong>at</strong>erialkunde,<br />
Inform<strong>at</strong>ionen über Speiseleitungen, Baluns, nützliche Messgeräte etc.<br />
• Das Dok<strong>um</strong>ent befasst sich nicht mit Mehrelementantennen, wie Yagis, Mehrelement<br />
Quads, etc. Es beschränkt sich weitgehend auf <strong>Antenne</strong>nformen <strong>die</strong> vom<br />
„ganz normalen OM“ im Selbstbau erstellt werden können.<br />
• Dieses Dok<strong>um</strong>ent enthält wahrscheinlich nichts was man nicht auch anderswo<br />
nachlesen könnte.<br />
• Dieses Dok<strong>um</strong>ent h<strong>at</strong> keinen kommerziellen Hintergrund. Ich habe mir deshalb<br />
gest<strong>at</strong>tet für gewisse Darstellungen auf vorhandene Schemas, Zeichnung, Skizzen<br />
etc. zurückzugreifen.<br />
• Ich verwende im Text häufig den Ausdruck OM. Damit sind n<strong>at</strong>ürlich auch alle YL’s<br />
und XYL’s gemeint. Der Ausdruck OM h<strong>at</strong> einfach meine Schreibarbeit vereinfacht.<br />
Man verzeihe mir das.<br />
Auch wenn <strong>die</strong>ser Beitrag z<strong>um</strong> Thema <strong>Antenne</strong>n nicht vor m<strong>at</strong>hem<strong>at</strong>ischen Formeln und<br />
algebraischen Abhandlungen strotzt, ich persönlich habe als Fernmelde-Ingenieur keine<br />
Berührungsängste mit der Theorie und der M<strong>at</strong>hem<strong>at</strong>ik. Ganz im Gegenteil. Ich selbst<br />
versuche immer wieder <strong>die</strong> Aussagen <strong>die</strong> ich mache m<strong>at</strong>hem<strong>at</strong>isch und von der Theorie her<br />
zu unterlegen.<br />
Ich habe aber volles Verständnis für alle OM’s <strong>die</strong> mit der M<strong>at</strong>hem<strong>at</strong>ik nicht unbedingt auf<br />
Du und Du sind und <strong>die</strong> sich lieber mit den praktischen Belangen auseinandersetzen. Wer<br />
einmal <strong>die</strong> grundlegenden Elemente der <strong>Antenne</strong>ntechnik verstanden h<strong>at</strong>, der ist in der<br />
Lage irgendwo auf der Welt, ohne grosse Hilfsmittel, lediglich mit einem Metermass in der<br />
Hand <strong>Antenne</strong>n zu erstellen <strong>die</strong> funktionieren.<br />
Es ist mir wichtig Erklärungen und Anregungen zu geben <strong>die</strong> den Freunden des Selbstbaus<br />
weiterhelfen.<br />
Max Rüegger, HB9ACC 5/42<br />
März 2007
<strong>Rund</strong> <strong>um</strong> <strong>die</strong> <strong>Antenne</strong><br />
Teil 7: spannungsgespeiste <strong>Antenne</strong>n, verkürzte <strong>Antenne</strong>n, Sonderformen<br />
Das Dok<strong>um</strong>ent ist in 7 Teil-Dok<strong>um</strong>ente aufgegliedert:<br />
• Teil 1<br />
- allgemeine Hinweise<br />
- M<strong>at</strong>erialkunde<br />
- Blitzschutz<br />
- Sicherheit<br />
- Masten<br />
• Teil 2<br />
- Speisekabel<br />
- SWR<br />
• Teil 3<br />
- <strong>Antenne</strong>nkoppler<br />
- SWR-Meter<br />
- Instr<strong>um</strong>ente<br />
- Baluns<br />
• Teil 4<br />
- <strong>Antenne</strong>n-Theorie<br />
- <strong>Antenne</strong>n-Simul<strong>at</strong>ion<br />
• Teil 5<br />
- Dipole<br />
- Windom-<strong>Antenne</strong>n<br />
- Trap-<strong>Antenne</strong>n<br />
- Langdraht-<strong>Antenne</strong>n<br />
• Teil 6<br />
- Ganzwellen-Dipol<br />
- L-<strong>Antenne</strong>n<br />
- Sloper<br />
- Schleifenantennen<br />
- Vertikal-<strong>Antenne</strong>n<br />
• Teil 7<br />
- spannungsgespeiste resonante <strong>Antenne</strong>n<br />
- verkürzte <strong>Antenne</strong>n<br />
- Sonderformen verkürzter <strong>Antenne</strong>n<br />
Wichtiger Hinweis:<br />
Die in <strong>die</strong>ser Dok<strong>um</strong>ent<strong>at</strong>ion gemachten Angaben zu Schaltungen und Verfahren etc.<br />
werden ohne Rücksicht auf <strong>die</strong> P<strong>at</strong>entlage mitgeteilt. Sie sind ausschliesslich für Am<strong>at</strong>eur-<br />
und Lehrzwecke bestimmt und dürfen nicht gewerblich genutzt werden. Der Autor h<strong>at</strong> <strong>die</strong><br />
Angaben mit grösster Sorgfalt und nach bestem Wissen und seinen Erfahrungen zusammengestellt.<br />
Der Autor weist darauf hin, dass er weder Garantie noch <strong>die</strong> juristische Verantwortung<br />
oder irgendeine Haftung für Folgen <strong>die</strong> auf fehlerhafte Angaben oder Auslegung<br />
direkt oder indirekt zurückgehen übernehmen kann.<br />
Ich wünsche allen OM’s, YL’s und XYL’s viel Erfolg und Befriedigung mit unserem<br />
welt<strong>um</strong>spannenden schönen gemeinsamen Hobby Am<strong>at</strong>eurfunk.<br />
März 2007 73 de Max Rüegger / HB9ACC<br />
Max Rüegger, HB9ACC 6/42<br />
März 2007
<strong>Rund</strong> <strong>um</strong> <strong>die</strong> <strong>Antenne</strong><br />
Teil 7: spannungsgespeiste <strong>Antenne</strong>n, verkürzte <strong>Antenne</strong>n, Sonderformen<br />
7.1 Resonante spannungsgespeiste <strong>Antenne</strong>n<br />
hochohmige<br />
Speisung<br />
niederohmige<br />
Speisung<br />
<strong>Antenne</strong>n werden üblicherweise, wenn es sich <strong>um</strong> einen Dipol handelt, in der Mitte eingespeist.<br />
Bei einer Windom <strong>Antenne</strong> erfolgt <strong>die</strong> Einspeisung bei ca. 1/3 der Drahtlänge. Mancher<br />
OM wird sich schon überlegt haben wie einfach es doch wäre wenn man den <strong>Antenne</strong>ndraht<br />
einfach an einem Ende speisen könnte, ohne dass man sich noch lange Gedanken<br />
machen muss wegen Erdleitungen <strong>die</strong> mitstrahlen etc.<br />
Wie schon anderweitig ausgeführt:<br />
Definition:<br />
<strong>Antenne</strong>n lassen sich an einer beliebigen Stelle speisen,<br />
alles ist lediglich eine Frage der Anpassung.<br />
Wenn wir bei einem resonanten Dipol <strong>die</strong><br />
Speisestelle von der Mitte an das Ende des<br />
<strong>Antenne</strong>ndrahtes verlegen, dann haben wir<br />
immer noch dasselbe schwingungsfähige<br />
Gebilde. Allerdings h<strong>at</strong> sich nun <strong>die</strong> Impedanz<br />
am <strong>Antenne</strong>nspeisepunkt von „niederohmig“<br />
bei Speisung in der Mitte auf „hochohmig“<br />
bei Speisung an einem Ende verändert.<br />
Das Verhalten der <strong>Antenne</strong> im praktischen<br />
Betrieb ist mit dem eines normalen Dipols<br />
identisch. Resonante spannungsgespeiste<br />
<strong>Antenne</strong>n verhalten sich also genau gleich<br />
wie resonante stromgespeiste <strong>Antenne</strong>n.<br />
Man darf also von der Art der Speisung keine<br />
Wunder erwarten.<br />
Unter einer resonanten spannungsgespeisten <strong>Antenne</strong> versteht man eine<br />
<strong>Antenne</strong> <strong>die</strong> eine Länge von λ/2 oder Vielfache davon aufweist<br />
und <strong>die</strong> in einem Spannungsbauch eingespeist wird.<br />
Ein klassischer Spannungsbauch tritt jeweils an einem der Enden auf.<br />
Max Rüegger, HB9ACC 7/42<br />
März 2007
<strong>Rund</strong> <strong>um</strong> <strong>die</strong> <strong>Antenne</strong><br />
Teil 7: spannungsgespeiste <strong>Antenne</strong>n, verkürzte <strong>Antenne</strong>n, Sonderformen<br />
Spannungsgespeiste <strong>Antenne</strong>n wurden im Am<strong>at</strong>eurfunk bis etwa 1960 … 1970 gerne eingesetzt.<br />
Mit der zunehmenden Verwendung von Koaxialkabel als Speiseleitung sind <strong>die</strong><br />
spannungsgespeisten <strong>Antenne</strong>n (auch spannungsgekoppelte <strong>Antenne</strong>n genannt) etwas in<br />
Vergessenheit ger<strong>at</strong>en. Unsorgfältige Auslegungen, z.B. mit strahlenden Feederleitungen<br />
etc. haben ab und zu zu BCI und vor allem zu TVI geführt. Ab ca. 1970 tauchte in <strong>Antenne</strong>nbüchern<br />
immer wieder der Kommentar auf: „Spannungsgespeiste <strong>Antenne</strong>n führen zu<br />
BCI/TVI“.<br />
Spannungsgespeiste <strong>Antenne</strong>n sind typische <strong>Antenne</strong>n, <strong>die</strong> man immer dann verwendet<br />
wenn man unauffällig Funkverkehr abwickeln will. Die <strong>Antenne</strong> besteht aus einem einzigen<br />
Draht, den man sehr dünn und unauffällig wählen kann. Man hängt den Draht z<strong>um</strong> Fenster<br />
raus und befestigt das andere Ende an einem passenden Aufhängepunkt. Wenn man z.B.<br />
von einem Hotelzimmer aus funken will, dann ist das <strong>die</strong> geeignete <strong>Antenne</strong>. Solange sich<br />
ein Fenster auch nur einen Spalt breit öffnen lässt kann man den Draht raushängen. Die Anpassmimik<br />
bleibt im Innern, gleich neben dem Fensterrahmen. Den Draht klemmt man einfach<br />
im Fensterrahmen ein. Wenn jemand fragt: „Was gibt denn das ?“ … dann erzählt man<br />
„man habe einen Kurzwellen-Weltempfänger“ dabei und man wolle <strong>die</strong> Nachrichten aus der<br />
Heim<strong>at</strong> hören. Der Frager nickt verständnisvoll und <strong>die</strong> Sache ist erledigt. Wie wir später sehen,<br />
wenn man <strong>die</strong> <strong>Antenne</strong> richtig konzipiert und speist, dann ist <strong>die</strong> <strong>Antenne</strong> „resonant“<br />
und strahlt <strong>die</strong> volle Energie ab. Im Gegens<strong>at</strong>z zur „unechten Langdrahtantenne“ braucht es<br />
hier keine Erdverbindung und es gibt keine vagabun<strong>die</strong>rende HF.<br />
Wer sich mit spannungsgespeisten <strong>Antenne</strong>n befasst läuft leider in Gefahr von seinen Kollegen<br />
als „Spinner“ abgetan zu werden. Wer an einem Funker Stamm davon erzählt der wird<br />
jeweils jede Menge selbsternannter Experten finden <strong>die</strong> ihm erklären,<br />
- so etwas gehe sowieso nicht<br />
- das erzeuge nur BCI und TVI<br />
- <strong>die</strong> Ankopplungsmethode sei ohnehin ineffizient<br />
- ohne Erdung gehe es doch nicht<br />
- etc. … etc. … etc.<br />
Lasst <strong>die</strong>se Experten ruhig ihren Sermon von sich geben und vergesst anschliessend alles<br />
was sie gesagt haben. Wenn man <strong>die</strong>sen Herren nämlich auf <strong>die</strong> Finger klopft und wissen<br />
will woher sie denn ihre Weisheiten haben und ob sie schon praktische Erfahrung mit solchen<br />
<strong>Antenne</strong>n gesammelt haben usw. dann folgt meist betroffenes Schweigen. Die beste<br />
Antwort <strong>die</strong> man kriegt lautet etwa: „Das weiss man doch!“. Keiner <strong>die</strong>ser OM’s h<strong>at</strong> je selbst<br />
mit einer spannungsgekoppelten <strong>Antenne</strong> gearbeitet. Ihre Weisheiten beruhen alle auf<br />
„hören sagen“.<br />
Am<strong>at</strong>eurfunk ist ja ein Experimental-Funk<strong>die</strong>nst. Also dürfen wir OM’s auch ruhig mal etwas<br />
ausprobieren von dem andere sagen „es geht nicht“.<br />
Ich selbst habe seit Beginn meiner Am<strong>at</strong>eurfunker-Karriere (Jan 1962) mit wenigen Jahren<br />
Unterbruch immer spannungsgespeiste <strong>Antenne</strong>n in Betrieb gehabt. Auch heute verwende<br />
ich in meinem Home-<strong>QTH</strong> immer noch eine endgespeiste 40 m Drahtantenne, <strong>die</strong> auf allen<br />
Bändern von 80 – 10 m, inkl. den WARC-Bändern, mit Spannungskopplung arbeitet. Auf<br />
dem 160 m Band wird derselbe Draht als λ/4-Strahler verwendet. Hier n<strong>at</strong>ürlich mit Stromspeisung.<br />
Als Gegengewicht für das 160 m Band verwende ich alle Kupferkragen einer ganzen<br />
Zeile von Reihenhäusern.<br />
Da ich mit <strong>die</strong>ser etwas verfemten und nicht immer richtig verstandenen <strong>Antenne</strong>nform<br />
immer gute Erfahrungen gemacht habe gest<strong>at</strong>te man mir, dass ich etwas näher auf <strong>die</strong>ses<br />
Thema eingehe.<br />
Max Rüegger, HB9ACC 8/42<br />
März 2007
<strong>Rund</strong> <strong>um</strong> <strong>die</strong> <strong>Antenne</strong><br />
Teil 7: spannungsgespeiste <strong>Antenne</strong>n, verkürzte <strong>Antenne</strong>n, Sonderformen<br />
7.1.1 Ankopplung über einen geerdeten Schwingkreis<br />
Dies ist eine der klassischen Arten der Anpassung einer spannungsgespeisten <strong>Antenne</strong>.<br />
Das Bild stammt aus dem ARRL Antenna Book.<br />
Dazu wird bemerkt:<br />
• Der Schwingkreis muss auf <strong>die</strong> Sendefrequenz abgestimmt sein.<br />
• Da der Schwingkreis ein hochohmiges Gebilde ist kann <strong>die</strong> <strong>Antenne</strong> auch an einer<br />
„schlechten Erde“ betrieben werden, ohne dass übermässige Erdverluste auftreten.<br />
Allerdings ist das gezeigte Bild idealisiert. Ausser an einem Field Day <strong>QTH</strong> wird es wohl<br />
ka<strong>um</strong> einmal vorkommen, dass der Schwingkreis gleich neben dem „Erdpfahl“ steht. Unter<br />
Erdpfahl verstehe ich <strong>die</strong> Erdverbindung, wie sie auch immer gemacht ist. Es kann sich auch<br />
<strong>um</strong> eine Netz von Radials handeln, <strong>die</strong> auf dem Boden ausgelegt sind. Bei der „physikalischen“<br />
Betrachtung der Anordnung müsste man noch einen Widerstand in Serie zur Erdleitung<br />
zeichnen, den Erdübergangswiderstand.<br />
Im praktischen Betrieb wird <strong>die</strong> „Erdleitung“ zwischen dem Schwingkreis und der Erde immer<br />
eine gewisse Länge aufweisen. Wenn wir <strong>die</strong> <strong>Antenne</strong> am Dachgiebel abspannen und den<br />
Schwingkreis in der Nähe pl<strong>at</strong>zieren, dann kann es sich <strong>um</strong> mehrere Meter Draht handeln.<br />
7 … 10 m „Erdleitung“ h<strong>at</strong> man noch bald einmal beisammen.<br />
Die gezeigte Form der Ankopplung über einen geerdeten Parallelschwingkreis funktioniert<br />
eigentlich nur sauber wenn das kalte Ende des Schwingkreises wirklich direkt geerdet ist.<br />
Sobald einige Meter Draht zur „Erde“ führen, dann strahlt <strong>die</strong>ser Draht und bildet einen Teil<br />
der <strong>Antenne</strong>. Am Übergang zur Erde tritt ein Strombauch auf. Der Draht bildet schon wieder<br />
eine merkliche Impedanz. Der Parallelschwingkreis liegt mit seinem „kalten Ende“ nicht mehr<br />
auf Erdpotential und <strong>die</strong> ganze Ankopplung stimmt nicht mehr. Auch der Mantel des Speisekabels<br />
der ja am Schwingkreis selbst mit dem „kalten Ende“ verbunden wird liegt nicht mehr<br />
auf Erdpotential und das Speisekabel h<strong>at</strong> deshalb eine Strahlungs-Tendenz. Dies dürften<br />
Gründe sein, war<strong>um</strong> spannungsgekoppelte <strong>Antenne</strong>n in Verruf ger<strong>at</strong>en sind.<br />
Ist <strong>die</strong>se Anordnung wirklich <strong>die</strong> einzige Art wie man eine <strong>Antenne</strong> in einem Spannungsbauch<br />
einspeisen kann ?<br />
Wie wir sehen gibt es noch andere Arten der Speisung.<br />
Max Rüegger, HB9ACC 9/42<br />
März 2007
<strong>Rund</strong> <strong>um</strong> <strong>die</strong> <strong>Antenne</strong><br />
Teil 7: spannungsgespeiste <strong>Antenne</strong>n, verkürzte <strong>Antenne</strong>n, Sonderformen<br />
7.1.2 Die Zeppelin-<strong>Antenne</strong><br />
oder Ankopplung über eine λ/4 Leitung<br />
Was heute ka<strong>um</strong> noch jemand weiss, <strong>die</strong> Zeppelin-<strong>Antenne</strong> stammt t<strong>at</strong>sächlich vom Luftschiff<br />
„Zeppelin“ ab. Als man <strong>die</strong> ersten Funkst<strong>at</strong>ionen von Ballonen oder Zeppelinen aus<br />
betreiben wollte h<strong>at</strong>te man ein Problem. Deutschland h<strong>at</strong>te damals keinen Zugang z<strong>um</strong> unbrennbaren<br />
Heli<strong>um</strong>-Gas, sodass Ballone und Zeppeline mit dem hochexplosiven Wasserstoff-Gas<br />
gefüllt wurden. Die Sender konnte man zwar in gasdichte Gehäuse einbauen, <strong>die</strong><br />
<strong>Antenne</strong> musste aber irgendwie angeschlossen werden. An <strong>die</strong>ser Stelle wollte man ja keine<br />
hohen Spannungen <strong>die</strong> allfällig austretendes Gas zur Explosion bringen konnten.<br />
Also kam ein findiger Kopf auf <strong>die</strong> Idee mit der Impedanztransform<strong>at</strong>ion über eine λ/4-<br />
Leitung.<br />
Ich fand in einem der ersten Bücher <strong>die</strong> ich mir z<strong>um</strong> Thema „Ham-Radio“ gekauft habe („Der<br />
Kurzwellenam<strong>at</strong>eur“ von Karl Schultheiss DL1QK, Ausgabe 1960) eine sehr anschauliche<br />
Erklärung der Zeppelin-<strong>Antenne</strong>:<br />
Man sieht hier ganz klar den Stromverlauf und man sieht auch ganz klar wieso <strong>die</strong>se Art der<br />
Einspeisung funktioniert.<br />
Auf der λ/4-Leitung geschieht <strong>die</strong> Transform<strong>at</strong>ion von niederohmig zu hochohmig. Die λ/4-<br />
Max Rüegger, HB9ACC 10/42<br />
März 2007
<strong>Rund</strong> <strong>um</strong> <strong>die</strong> <strong>Antenne</strong><br />
Teil 7: spannungsgespeiste <strong>Antenne</strong>n, verkürzte <strong>Antenne</strong>n, Sonderformen<br />
Leitung ist eine symmetrische Speiseleitung <strong>die</strong> selbst nicht strahlt. Der einzige Zweck besteht<br />
darin, <strong>die</strong> Impedanztransform<strong>at</strong>ion vorzunehmen und den λ/2-langen <strong>Antenne</strong>ndraht zu<br />
erregen.<br />
Ich denke es ist jedem Leser aufgefallen:<br />
Hier ist nirgends eine „Erde“ im Spiel !<br />
Der <strong>Antenne</strong>ndraht mit einer Länge von λ/2 ist ja ein in sich resonantes d.h. schwingungsfähiges<br />
Gebilde. Er braucht nicht zwingend eine Erdverbindung <strong>um</strong> seinen Zweck zu erfüllen.<br />
Alles was er braucht ist etwas das ihn in Schwingung versetzt. Im Falle der Zeppelin-<br />
<strong>Antenne</strong> ist <strong>die</strong>s eine λ/4-lange Anpassleitung, <strong>die</strong> zwar schwingt aber selbst nicht abstrahlt,<br />
sondern nur am antennenseitigen Ende <strong>die</strong> Energie in hochohmiger Form zur Verfügung<br />
stellt und so den <strong>Antenne</strong>ndraht zur Schwingung auf der Resonanzfrequenz anregt.<br />
7.1.3 Ankopplung mittels einer koaxialen Stichleitung<br />
Eine weitere Art wie man eine spannungsgekoppelte <strong>Antenne</strong> einspeisen kann ist <strong>die</strong> Verwendung<br />
einer koaxialen Stichleitung. Diese Art der Ankopplung wird in den meisten <strong>Antenne</strong>nbüchern<br />
kurz erwähnt. Leider findet man ganz selten in einem <strong>Antenne</strong>nbuch wirklich<br />
brauchbare Erklärungen wie <strong>die</strong>se Art der Ankopplung denn überhaupt funktioniert.<br />
Dies ist <strong>die</strong> typische Art wie <strong>die</strong> „koaxiale Stichleitung“ in fast allen <strong>Antenne</strong>nbücher dargestellt<br />
wird. Das ganze sieht ungeheuer wissenschaftlich und kompliziert aus. Leider ist nicht<br />
für jeden OM sofort ersichtlich was hier eigentlich vorgeht.<br />
Max Rüegger, HB9ACC 11/42<br />
März 2007
<strong>Rund</strong> <strong>um</strong> <strong>die</strong> <strong>Antenne</strong><br />
Teil 7: spannungsgespeiste <strong>Antenne</strong>n, verkürzte <strong>Antenne</strong>n, Sonderformen<br />
Dar<strong>um</strong> eine von mir <strong>um</strong>gezeichnete Version, <strong>die</strong> vermutlich etwas verständlicher ist.<br />
Es handelt sich nämlich <strong>um</strong> nichts anderes als eine λ/4 Leitung <strong>die</strong> als Impedanz-Transform<strong>at</strong>or<br />
wirkt. Der Anschluss des Kabels z<strong>um</strong> Transceiver erfolgt geometrisch an dem Ort an<br />
dem eine Impedanz von ca. 50 Ω auftritt.<br />
Wer nun den Eindruck h<strong>at</strong> das ganze sei doch ganz ähnlich aufgebaut wie <strong>die</strong> Zeppelin-<strong>Antenne</strong>,<br />
der liegt absolut richtig. Es handelt sich nämlich <strong>um</strong> gar nichts anderes als <strong>um</strong> <strong>die</strong><br />
gute alte Zeppelin-<strong>Antenne</strong>. Bei der klassischen Zeppelin-<strong>Antenne</strong> besteht der λ/4-Anpassteil<br />
aus einem Stück Hühnerleiter. Hier ist <strong>die</strong>ses Stück Hühnerleiter durch ein funktionell<br />
identisches Gebilde aus Koax-Kabel ersetzt. Die Länge A des Koaxialkabels ist also nicht<br />
einfach ein Stück Koax-Kabel das z<strong>um</strong> Transport von Energie benützt wird, es ist in <strong>die</strong>sem<br />
Falle ein Schwingkreis dessen Resonanzfrequenz durch <strong>die</strong> Länge des Koax-Kabels bestimmt<br />
ist. Erst das Koax-Kabel das vom T-Stück in Richtung Transceiver geht ist eine reine<br />
Speiseleitung.<br />
Die Längen berechnen sich wie folgt:<br />
A = λ/4 x V<br />
B = 0.034 λ x V<br />
oder<br />
B = 13.6 % von A<br />
Der Faktor V ist der Verkürzungsfaktor des Koaxialkabels. Bei den meisten gebräuchlichen<br />
Kabeln ist V = 0.666, es gibt aber auch andere Werte. Jede Liste mit technischen D<strong>at</strong>en der<br />
Koaxialkabel gibt darüber Auskunft.<br />
Am <strong>Antenne</strong>nseitigen Ende des elektrisch λ/4 langen Koaxialkabels finden wir einen Spannungsbauch.<br />
Dort schliessen wir den <strong>Antenne</strong>ndraht an, der bei einer Länge von λ/2 (oder<br />
einem Vielfachen davon) an seinem Endpunkt ebenfalls einen Spannungsbauch aufweist.<br />
N<strong>at</strong>ürlich bedingt <strong>die</strong>se Art der Anpassung für jedes Band eine eigene Anpassleitung mit der<br />
korrekten Länge A und der Anzapfung am Punkt B. Die Leitung A kann man aus 2 Stücken<br />
Max Rüegger, HB9ACC 12/42<br />
März 2007<br />
TX
<strong>Rund</strong> <strong>um</strong> <strong>die</strong> <strong>Antenne</strong><br />
Teil 7: spannungsgespeiste <strong>Antenne</strong>n, verkürzte <strong>Antenne</strong>n, Sonderformen<br />
Koaxialkabel herstellen <strong>die</strong> mit Koaxialsteckern versehen sind. Nach der Länge B, vom<br />
Kurzschluss aus gesehen, fügt man ein T-Stück ein. Am unteren „kalten Ende“ schraubt<br />
man eine Koax-Buchse ein, bei der man zwischen Seele und Mantel einen Kurzschluss<br />
eingefügt h<strong>at</strong>.<br />
Das Koaxial-Kabel A, das den λ/4 Reson<strong>at</strong>or darstellt, kann irgendeine Impedanz aufweisen.<br />
Es muss also nicht zwingend 50 Ω Kabel verwendet werden, ein 75 Ω Kabel geht genau<br />
so gut. Das Kabel z<strong>um</strong> Transceiver muss n<strong>at</strong>ürlich schon ein 50 Ω Kabel sein, sonst<br />
stimmt <strong>die</strong> Formel zur Berechnung das Anschlusspunktes (T-Stück) nicht mehr. Etliche<br />
OM’s haben auch schon herausgefunden, dass bei dem von ihnen verwendeten Koax-Kabel<br />
der Anschlusspunkt leicht verschoben werden musste <strong>um</strong> eine optimale Anpassung mit<br />
SWR 1:1 auf dem Speisekabel zu erzielen. Auch dazu gibt es eine logische Erklärung.<br />
Koax-Kabel sind industriell hergestellte Produkte. Wie alle industriell hergestellten Produkte<br />
sind auch Koax-Kabel bei der Herstellung gewissen Toleranzen unterworfen sind. Auch<br />
wenn <strong>die</strong> D<strong>at</strong>entabelle behauptet es handle sich <strong>um</strong> ein 50 Ω Kabel kann es doch in der<br />
Realität vorkommen, dass <strong>die</strong> korrekte Impedanz des vorhandenen Kabels <strong>um</strong> ein weniges<br />
von 50 Ω abweicht. Dann ist schon der Moment da, wo das SWR Meter „ein wenig SWR“<br />
anzeigt.<br />
Etwas muss noch erwähnt werden:<br />
Bei der Zeppelin-<strong>Antenne</strong> mit der Speisung über eine λ/4 lange Hühnerleiter müssen wir <strong>die</strong><br />
Hühnerleiter sorgfältig auslegen. Wir müssen sie auch von allem fernhalten was <strong>die</strong> Symmetrie<br />
der Leitung stören würde.<br />
Bei der Anpassung mittels einem abgestimmten Koaxialkabel, das eine elektrische Länge<br />
von λ/4 aufweist, spielt <strong>die</strong>s gar keine Rolle. Die gesamte Anpassung spielt sich im Innern<br />
des Koaxialkabels mit der Länge A ab. Strahlung dringt keine nach draussen. Deshalb kann<br />
<strong>die</strong>ses Stück Koaxialkabel in irgendeiner Form verlegt werden. Im Extremfall kann man es<br />
ganz einfach aufrollen. Das am T-Stück abzweigende Kabel z<strong>um</strong> Transceiver kann eine beliebige<br />
Länge haben, es ist ja auf 50 Ω angepasst.<br />
Auch bei <strong>die</strong>ser Art der Ankopplung einer spannungsgekoppelten <strong>Antenne</strong> braucht es<br />
keine Erdung.<br />
Das Ganze ist in sich resonant und es besteht für <strong>die</strong> HF-Energie kein Anlass sich irgendwo<br />
auf wilde Weise einen Ausgleich zu suchen.<br />
7.1.4 Die Fuchs-<strong>Antenne</strong><br />
Die Fuchs-<strong>Antenne</strong> wurde im Jahre 1927 von Dr. J. Fuchs,OE1JF, zu ersten Mal beschrieben<br />
und z<strong>um</strong> P<strong>at</strong>ent angemeldet.<br />
Anstelle einer λ/4-Anpassleitung wird ein Parallelschwingkreis zur Erregung des λ/2 langen<br />
<strong>Antenne</strong>ndrahtes verwendet. Es spielt ja keine Rolle wie wir <strong>die</strong> Anpassung auf „hochohmig“<br />
realisieren, der Parallelschwingkreis tut das ebenso gut wie eine abgestimmte λ/4-Leitung.<br />
Der Parallelschwingkreis soll, der ursprünglichen Beschreibung nach, über ein hohes LC-<br />
Verhältnis (kleines C, grosses L) verfügen. Nach meinen eigenen praktischen Erfahrungen<br />
kann man hier etwas grosszügig sein, es funktioniert trotzdem.<br />
Max Rüegger, HB9ACC 13/42<br />
März 2007
<strong>Rund</strong> <strong>um</strong> <strong>die</strong> <strong>Antenne</strong><br />
Teil 7: spannungsgespeiste <strong>Antenne</strong>n, verkürzte <strong>Antenne</strong>n, Sonderformen<br />
Das obige Bild zeigt 2 verschiedene Möglichkeiten der Ankopplung von spannungsgekoppelten<br />
<strong>Antenne</strong>n.<br />
Die Variante a) funktionierte mit Röhrensendern mit einem Parallelschwingkreis in der Endstufe.<br />
Wenn man an der Spule genügend Anzapfungen anbringt, dann findet man unabhängig<br />
von der Länge des <strong>Antenne</strong>ndrahtes immer eine Anzapfung, wo <strong>die</strong> Impedanz auf der<br />
Spule mit der Impedanz der <strong>Antenne</strong> in etwa übereinstimmt. Diese Art der Ankopplung würde<br />
ich nicht unbedingt empfehlen. Es ist etwas das man macht wenn ein ausgeprägter Bauteilemangel<br />
herrscht und man trotzdem in <strong>die</strong> Luft gehen muss. Über<strong>die</strong>s, der Koppelkondens<strong>at</strong>or<br />
muss hochspannungsfest sein, sonst führt der <strong>Antenne</strong>ndraht <strong>die</strong> volle Anodenspannung<br />
der Endröhre und das kann je nach Sendeleistung einige tausend Volt sein.<br />
Die Variante b) ist <strong>die</strong> Erfindung des OM’s Fuchs, und zwar <strong>die</strong> Originalschaltung wie sie in<br />
seinem P<strong>at</strong>ent beschrieben wird.<br />
Er arbeitet also mit einem Zwischenkreis der induktiv an <strong>die</strong> Endstufe angekoppelt ist. Es ist<br />
n<strong>at</strong>ürlich nicht zwingend den Zwischenkreis direkt an der Endstufe anzubringen. Das P<strong>at</strong>ent<br />
stammt aus dem Jahre 1927, also lange bevor <strong>die</strong> ersten Koaxialkabel Verwendung fanden.<br />
Diese kamen erst gegen Ende der 1930’er Jahre für militärische Anwendungen in Gebrauch.<br />
Für zivile Anwendungen kannte man bis z<strong>um</strong> Ende des 2. Weltkrieges ka<strong>um</strong> etwas anderes<br />
als „Hühnerleitern“. Dann wurden aus Surplus-Beständen Koaxialkabel zu günstigen Preise<br />
auf den Markt geworfen und auch <strong>die</strong> Funkam<strong>at</strong>eure fanden bald gefallen an <strong>die</strong>sen neuartigen<br />
Kabeln.<br />
Wenn man den Fuchskreis mit Koaxialkabel speist, dann benützt man eine kleine Koppelspule.<br />
Das sieht dann wie folgt aus:<br />
L = λ/2<br />
Die Abstimmung des sog. Fuchs-Kreises erfolgt wie bei der Variante b) gezeigt entweder<br />
mittels einem HF-Amperemeter im Schwingkreis oder eines Glühlämpchens im <strong>Antenne</strong>ndraht.<br />
Auch das SWR-Meter im <strong>Antenne</strong>nkabel zeigt uns wann wir den Fuchs-Kreis auf Resonanz<br />
abgestimmt haben. Mit der Windungszahl der Koppelspule muss man etwas expe-<br />
Max Rüegger, HB9ACC 14/42<br />
März 2007
<strong>Rund</strong> <strong>um</strong> <strong>die</strong> <strong>Antenne</strong><br />
Teil 7: spannungsgespeiste <strong>Antenne</strong>n, verkürzte <strong>Antenne</strong>n, Sonderformen<br />
rimentieren. Es findet sich immer eine Windungszahl <strong>die</strong> zu einem SWR besser als 1:1.5<br />
führt.<br />
Auch hier: KEINE ERDUNG !<br />
Den Fuchs-Kreis kann man in Form eines<br />
Drehkondens<strong>at</strong>ors und einer Luftspule aufbauen<br />
oder man kann als Spule ein Toroid<br />
verwenden. Wenn man ein Toroid verwendet,<br />
dann sollte man unbedingt einen Kern<br />
nehmen der 1 – 2 N<strong>um</strong>mern grösser ist als<br />
man vermutet. Im Fuchs-Kreis fliessen recht<br />
grosse Ströme und ich habe mich auch<br />
schon verschätzt. Wenn der Kern warm wird,<br />
dann muss man einen grösseren Kern einsetzen.<br />
Das nebenstehende Bild zeigt einen<br />
Fuchskreis den ich mit einem selbstgebauten<br />
10 W<strong>at</strong>t Transceiver für das 40 Meter Band<br />
verwende.<br />
In neueren <strong>Antenne</strong>nbücher wird der Fuchskreis häufig so gezeichnet, dass das kalte Ende<br />
an Erde gelegt wird. Leider wurde auch in den neueren Ausgaben von Rothammels <strong>Antenne</strong>nbuch<br />
<strong>die</strong>ser Qu<strong>at</strong>sch übernommen. In den Originalen „Rothammel“ Büchern, <strong>die</strong> noch<br />
vom Militärverlag der DDR gedruckt wurden, ist der Fuchs-Kreis korrekt und ohne Erdung<br />
dargestellt, denn OM Rothammel, Y21BK / DM2ABK, kannte den korrekten Sachverhalt.<br />
Wenn wir den Fuchs-Kreis erden, dann haben wir keinen Fuchs-Kreis mehr, sondern wir<br />
haben eine Ankopplung über einen „geerdeten“ Parallelschwingkreis, wie er im ARRL Antenna<br />
Book gezeigt wird.<br />
Wir haben dann zwar dem guten alten OM Fuchs ein Schnippchen geschlagen, aber zugleich<br />
haben wir uns eine strahlende Erdverbindung eingehandelt, mit allem was dazu gehört<br />
� TVI, BCI, „heisse Hände“ am Transceiver (muss nicht sein, kann aber sehr wohl<br />
sein), etc.<br />
Bei den von mir betriebenen spannungsgekoppelten <strong>Antenne</strong>n haben jedes Mal dann <strong>die</strong><br />
Probleme begonnen, wenn ich einmal versuchsweise den guten alten „Fuchs-Kreis“ geerdet<br />
habe. Ich habe jedes Mal rasch wieder den „ungeerdeten“ Zustand hergestellt.<br />
Max Rüegger, HB9ACC 15/42<br />
März 2007
<strong>Rund</strong> <strong>um</strong> <strong>die</strong> <strong>Antenne</strong><br />
Teil 7: spannungsgespeiste <strong>Antenne</strong>n, verkürzte <strong>Antenne</strong>n, Sonderformen<br />
7.1.5 Drahtlängen spannungsgekoppelter <strong>Antenne</strong>n<br />
• Bei spannungsgekoppelten <strong>Antenne</strong>n müssen <strong>die</strong> Drahtlängen zwingend auf den zu<br />
verwendenden Bändern „Halbwellenresonanz“ aufweisen. Dies bedeutet, dass auf<br />
dem <strong>Antenne</strong>ndraht eine oder mehrere Halbwellen Pl<strong>at</strong>z haben.<br />
• Die Länge des <strong>Antenne</strong>ndrahtes ist also auf dem untersten Band mit der Länge eines<br />
Dipols für <strong>die</strong>ses Band identisch. Im Gegens<strong>at</strong>z z<strong>um</strong> Dipol der zusätzlich zur<br />
Grundfrequenz nur auf ungeraden Oberwellen erregt werden kann spielt <strong>die</strong>s bei einer<br />
spannungsgekoppelten <strong>Antenne</strong> keine Rolle. Sie kann sowohl auf geraden wie<br />
auch auf ungeraden Oberwellen erregt werden.<br />
• Eine symph<strong>at</strong>ische Eigenschaft spannungsgekoppelter <strong>Antenne</strong>n ist <strong>die</strong> T<strong>at</strong>sache,<br />
dass sie bezüglich der exakten Drahtlänge rel<strong>at</strong>iv tolerant sind. Abweichungen innerhalb<br />
+/- 5 % des Sollwertes spielen überhaupt keine Rolle. Die Impedanz am Ende<br />
des <strong>Antenne</strong>ndrahtes ist immer noch hochohmig genug <strong>um</strong> Energie zu transferieren.<br />
Wer z.B. eine ca. 40 m lange spannungsgekoppelte <strong>Antenne</strong> für das 80 m<br />
Band verwendet und mittels einem Fuchskreis ankoppelt, der kann Betrieb auf der<br />
vollen Bandbreite von 3.5 – 3.8 MHz machen. Das einzige was er tun muss ist den<br />
Fuchskreis etwas nachstimmen wenn er vom CW Teil in den SSB Teil wechselt und<br />
<strong>um</strong>gekehrt.<br />
Welches sind nun vernünftige Drahtlängen ?<br />
• Für Einbandbetrieb: Länge wie für einen Halbwellendipol<br />
• 40 m Drahtlänge (Toleranzbereich ca. 38 – 43 m)<br />
Mit <strong>die</strong>ser Drahtlänge ist <strong>die</strong> Bedingung der „Resonanz“ auf allen Am<strong>at</strong>eurfunk<br />
bändern zwischen 80 m und 10 m gegeben, inkl. der WARC Bänder.<br />
80 m Band Grundwelle<br />
40 m Band 2. Oberwelle<br />
30 m Band 3. Oberwelle<br />
20 m Band 4. Oberwelle<br />
17 m Band 5. Oberwelle<br />
15 m Band 6. Oberwelle<br />
12 m Band 7. Oberwelle<br />
10 m Band 8. Oberwelle<br />
Als weiteren Bonus kann man mit <strong>die</strong>ser Drahtlänge auch das 160 m Band abdekken.<br />
Man muss dann allerdings <strong>die</strong> <strong>Antenne</strong> am Speisepunkt erden. Man erhält<br />
dann einen halben Dipol, den man gegen Erde betreibt.<br />
• 20 m Drahtlänge (Toleranzbereich ca. 19.5 – 21.5 m)<br />
40 m Band Grundwelle<br />
20 m Band 2. Oberwelle<br />
15 m Band 3. Oberwelle<br />
10 m Band 4. Oberwelle<br />
• 10 m Drahtlänge (Toleranzbereich ca. 10 - 11 m)<br />
20 m Band Grundwelle<br />
10 m Band 2. Oberwelle<br />
Wie man sieht, wer Mehrband-Betrieb machen will der verwendet am besten eine Drahtlänge<br />
in der Gegend von 40 m. Damit können alle heute zugelassenen KW-Am<strong>at</strong>eurfunkbänder<br />
betrieben werden.<br />
Max Rüegger, HB9ACC 16/42<br />
März 2007
<strong>Rund</strong> <strong>um</strong> <strong>die</strong> <strong>Antenne</strong><br />
Teil 7: spannungsgespeiste <strong>Antenne</strong>n, verkürzte <strong>Antenne</strong>n, Sonderformen<br />
7.1.6 Spannungsgekoppelte Vertikal-<strong>Antenne</strong>n<br />
Wie bereits unter dem Thema „Vertikal-<strong>Antenne</strong>n“ erwähnt ist es n<strong>at</strong>ürlich nicht verboten<br />
vertikale <strong>Antenne</strong>n mit einer Länge von λ/2 am unteren Ende mittels Spannungskopplung zu<br />
speisen. Welche Art der Einspeisung man wählt bleibt dem einzelnen OM überlassen. Funktionieren<br />
tun alle Speisungsarten etwa gleich gut.<br />
Bei Verwendung der Ankopplung mittels einer koaxialen Stichleitung h<strong>at</strong> man den Vorteil,<br />
dass man nicht einmal ein „Anpass-Kästchen“ benötigt.<br />
Häufig wird bei solchen <strong>Antenne</strong>n ein Fuchskreis eingesetzt. Vor allem auf den langwelligen<br />
Bändern 160 m und 80 m h<strong>at</strong> <strong>die</strong>s den Vorteil, dass man den Fuchskreis auf das gewünscht<br />
Bandsegment abstimmen kann. Wenn ein CW-Contest ansteht, dann stimmt man den<br />
Fuchskreis auf den CW Teil des Bandes ab. Wenn ein SSB-Contest st<strong>at</strong>tfindet, dann stimmt<br />
man den Fuchskreis auf <strong>die</strong> SSB Frequenzen ab. N<strong>at</strong>ürlich nehmen Halbwellen-Strahler für<br />
<strong>die</strong>se Bänder Längen an für <strong>die</strong> man ka<strong>um</strong> einen passenden Ba<strong>um</strong> findet, geschweige denn<br />
über einen so hohen Mast verfügt. Die ganz erfolgreichen low-band-DX’er ziehen dann den<br />
<strong>Antenne</strong>ndraht an einem Wetterballon in <strong>die</strong> Höhe. Dieser wirkt dann als Fesselballon und<br />
hält den <strong>Antenne</strong>ndraht mehr oder weniger in der Vertikalen. Nach dem Contest Weekend<br />
wird der Ballon wieder eingeholt.<br />
Keine Regel ohne Ausnahme:<br />
Wer einen Fuchskreis verwendet und <strong>die</strong> Box mit dem Fuchskreis wirklich auf den Erdboden<br />
stellt, der kann das „kalte Ende“ des Fuchskreises erden. Achtung: kurze Erdleitung !<br />
Vertikalantennen sind im Vergleich mit horizontalen <strong>Antenne</strong>n ohnehin anfälliger auf „Man-<br />
Made-Noise“ und „st<strong>at</strong>ische Aufladungen“. Durch „Erdung“ wird z<strong>um</strong> mindestens <strong>die</strong><br />
st<strong>at</strong>ische Aufladung abgeleitet. Die <strong>Antenne</strong> wird dadurch etwas ruhiger.<br />
7.1.7 Multiband Anpassgerät 3.5 – 28 MHz<br />
Als praktisches Beispiel einer in der Realität existierenden <strong>Antenne</strong>nanlage, <strong>die</strong> auf 8 Bändern<br />
mit Spannungsspeisung betrieben wird, beschreibe ich <strong>die</strong> in meinem Home-<strong>QTH</strong> verwendete<br />
<strong>Antenne</strong>nanlage sowie <strong>die</strong> dazugehörige Ankopplungs-Schaltung.<br />
Wie bereits anderweitig bemerkt, mit Ausnahme weniger Jahre habe ich seit meiner Lizenzierung<br />
im Jahre 1962 in meinen HB9’er <strong>QTH</strong>’s immer eine ca. 40 - 42 m lange resonante<br />
Max Rüegger, HB9ACC 17/42<br />
März 2007
<strong>Rund</strong> <strong>um</strong> <strong>die</strong> <strong>Antenne</strong><br />
Teil 7: spannungsgespeiste <strong>Antenne</strong>n, verkürzte <strong>Antenne</strong>n, Sonderformen<br />
endgespeiste <strong>Antenne</strong> in Betrieb. Diese <strong>Antenne</strong>nform ist unauffällig und wird von Besuchern<br />
und Nachbarn nicht als störend empfunden. Die praktischen Erfahrungen sind durchwegs<br />
gut. BCI/TVI waren bisher nie ein Thema. Ein ca. 40 – 42 m langer Draht ist auf allen<br />
klassischen Am<strong>at</strong>eurbändern von 3.5 – 28 MHz resonant. Um <strong>die</strong>sen <strong>Antenne</strong>ndraht an einem<br />
Ende einzuspeisen benötigen wir einen Parallelschwingkreis den man auf allen Bändern<br />
von 3.5 – 28 MHz auf Resonanz abgleichen kann.<br />
Gibt es einen solchen Schwingkreis ?<br />
In einem damaligen ARRL Antenna Book (Ausgabe 1960) habe ich eine solche Schaltung<br />
gefunden <strong>die</strong> auf der Basis eines Doppeldrehkos und 2 Spulen t<strong>at</strong>sächlich den Bereich von<br />
3.5 – 28 MHz stufenlos abdeckt.<br />
Das obige Bild zeigt <strong>die</strong> entsprechende Schaltung. C1/C2 ist ein Mehrfachdrehko aus einem<br />
alten Röhrenradio. C3 ist der Koppelkondens<strong>at</strong>or an das Koax-Kabel, also ein kapazitiver<br />
Spannungsteiler. L1 und L2 sind <strong>die</strong> beiden Spulen deren Werte ich empirisch bestimmt habe.<br />
Die Box mit der ganzen Mimik befindet sich auf dem Dach. Ein kleiner Motor <strong>die</strong>nt als<br />
Fernabstimmung des Mehrfachdrehkos C1/C2. Ein Potentiometer, das mit der Achse des<br />
Doppeldrehko’s verbunden ist, liefert eine Inform<strong>at</strong>ion bezüglich der Stellung des Drehkos.<br />
Eine Fernsteuerung des Drehko’s C3 war nicht zwingend notwendig. Für den Drehko C3<br />
habe ich eine Stellung gefunden <strong>die</strong> von 7 bis 28 MHz eine vorzüglich Anpassung erlaubt<br />
(SWR < 1:1.5). Auf 3.5 MHz ist das SWR rel<strong>at</strong>iv hoch, auf <strong>die</strong>sem Band benötige ich einen<br />
<strong>Antenne</strong>nkoppler. Mit einer Fernsteuerung von C3 liesse sich das vermeiden. Als vor Jahren<br />
<strong>die</strong> WARC Bänder eingeführt wurden habe ich mit kleiner Leistung versucht herauszufinden<br />
ob man auch auf den neuen Bändern mit <strong>die</strong>ser Anordnung Energie transferieren kann.<br />
Mein Erstaunen war gross, als sich beim Durchdrehen von C1/C2 für jedes der WARC Bänder<br />
(10 – 18 – 24 MHz) eine Stellung finden liess <strong>die</strong> ein ansprechendes SWR auf dem<br />
Speisekabel ergab. Zugleich meldete ein auf dem Dach angebrachter Feldstärkezeiger dass<br />
wirklich Energie abgestrahlt wird. Wenn man <strong>die</strong> Oberwellen-Situ<strong>at</strong>ion eines 42 m langen<br />
Drahtes etwas näher untersucht kommt man dem Geheimnis auf <strong>die</strong> Spur. Auf der 3. Oberwelle<br />
liegt <strong>die</strong> Resonanz bei 10.65 MHz, auf der 5. Oberwelle ist man bei 17.75 MHz und bei<br />
der 7. Oberwelle kommt man auf 24.8 MHz. Diese Resonanzfrequenzen liegen gar nicht so<br />
weit von den Bändern 10 MHz (10.1 – 10.15 MHz), 18 MHz (18.068 – 18.168 MHz) und 24<br />
MH7 (24.89 – 24.99 MHz) entfernt und der durchstimmbare Schwingkreis ist immer noch in<br />
der Lage genügend Energie auf den <strong>Antenne</strong>ndraht zu transferieren. Die vielen QSO’s auf<br />
allen Bändern, inkl. der WARC Bänder, sind der beste Beweis dafür, dass <strong>die</strong>se Art Ankopplung<br />
einwandfrei funktioniert.<br />
Wer das oben gezeigte Schema etwas näher betrachtet kommt z<strong>um</strong> Schluss, dass es sich<br />
bei <strong>die</strong>ser Schaltung <strong>um</strong> nichts anderes als <strong>die</strong> Schaltung eines vielfach bewährten <strong>Antenne</strong>nkopplers<br />
handelt, den man heute als Z-M<strong>at</strong>ch bezeichnet. Bei <strong>die</strong>sem <strong>Antenne</strong>nkoppler<br />
wird <strong>die</strong> Energie üblicherweise über eine Koppelspule auf ein Koax-Kabel oder auf eine<br />
symmetrische Speiseleitung ausgekoppelt. Bei der Spannungskopplung, wie ich sie verwende,<br />
wird <strong>die</strong> Energie ganz einfach am „heissen Ende“ des Schwingkreises ausgekoppelt.<br />
Die gesamte <strong>Antenne</strong>nanpassvorrichtung ist im Betrieb nicht geerdet. Von der <strong>Antenne</strong>nabstimmung<br />
weg in Richtung <strong>Antenne</strong> sind bei mir noch 2 kräftige Starkstromschütze eingebaut.<br />
Der eine Schaltschütz <strong>die</strong>nt dazu den <strong>Antenne</strong>ndraht bei Nichtgebrauch über einen<br />
Ruhekontakt an Erde zu legen. Der zweite Schaltschütz <strong>die</strong>nt dazu den <strong>Antenne</strong>ndraht auf<br />
<strong>die</strong> Seele eines zweites Koax-Kabels <strong>um</strong>zuschalten. Der Mantel <strong>die</strong>ses separ<strong>at</strong>en Koax-<br />
Kabels ist mit den Kupferkragen des Flachdachs des Wohnhauses verbunden. 40 m Draht<br />
stellen bekanntlich auf dem 160 m Band einen „λ/4-Strahler“ dar. Dies ergibt Stromkopplung<br />
auf dem 160 m Band. Diese Vorrichtung erlaubt mir auch auf dem 160 m Band QRV zu sein.<br />
Solche Anpassgeräte für resonante endgespeiste <strong>Antenne</strong>n sind n<strong>at</strong>ürlich reine Selbstbauprojekte,<br />
kein Hersteller h<strong>at</strong> sich ihrer bisher angenommen.<br />
Max Rüegger, HB9ACC 18/42<br />
März 2007
<strong>Rund</strong> <strong>um</strong> <strong>die</strong> <strong>Antenne</strong><br />
Teil 7: spannungsgespeiste <strong>Antenne</strong>n, verkürzte <strong>Antenne</strong>n, Sonderformen<br />
Das Schema des unten gezeigten <strong>Antenne</strong>nanpassgerätes.<br />
Der <strong>Antenne</strong>nkoppler selbst ist im Gehäuse eines ausge<strong>die</strong>nten Elektrizitätszählers eingebaut.<br />
Zusätzlich ist <strong>die</strong> ganze Anordnung in einem <strong>um</strong>gestülpten Kunststoff-Container aus<br />
dem Ba<strong>um</strong>arkt eingebaut. Die Anlage betreibe ich mit Sendeleistungen zwischen 100 und<br />
200 W<strong>at</strong>t. Probleme sind in all den Jahren bisher keine aufgetreten.<br />
Max Rüegger, HB9ACC 19/42<br />
März 2007
<strong>Rund</strong> <strong>um</strong> <strong>die</strong> <strong>Antenne</strong><br />
Teil 7: spannungsgespeiste <strong>Antenne</strong>n, verkürzte <strong>Antenne</strong>n, Sonderformen<br />
7.2 <strong>Antenne</strong>n verkürzen<br />
Wir leben alle in einem Umfeld und häufig ist unser Umfeld „etwas beengt“. Dies ist eines<br />
der grössten Probleme aus der Sicht des Funkam<strong>at</strong>eurs. Jeder hätte am liebsten eine<br />
Ranch in Texas, <strong>um</strong> darauf nach Herzenslust <strong>Antenne</strong>n errichten zu können.<br />
Nun, wie es so geht. Wir werden alle von der Realität eingeholt. Es fehlt uns an allen Ecken<br />
und Enden an Pl<strong>at</strong>z <strong>um</strong> <strong>Antenne</strong>n aufzuspannen. Aus <strong>die</strong>ser Situ<strong>at</strong>ion heraus erklärt sich<br />
der Wunsch alle Funkam<strong>at</strong>eure (und vor allem der XYL’s), dass <strong>Antenne</strong>n klitzeklein zu sein<br />
haben.<br />
Von <strong>die</strong>sem Wunsch nach Mini<strong>at</strong>urisierung lebt heute ein ganzer Geschäftszweig mit recht<br />
gutem Erfolg. Man verkauft dem geplagten OM alle möglichen und auch viele unmögliche<br />
<strong>Antenne</strong>n in verkleinerter Bauart. Jede <strong>die</strong>ser <strong>Antenne</strong>n wird in hellsten Tönen gelobt.<br />
Es gilt da den gesunden Menschenverstand einzusetzen und das Mögliche vom Unmöglichen<br />
zu separieren.<br />
Welche Methoden gibt es <strong>um</strong> eine <strong>Antenne</strong> elektrisch zu verkürzen:<br />
1. Verlängerungs-Spulen<br />
2. Kapazitive Belastung (Endkapazitäten)<br />
3. Die Enden abbiegen<br />
4. Umwegleitungen<br />
Dies sind <strong>die</strong> gebräuchlichen Methoden auf <strong>die</strong> man zurückgreift wenn es dar<strong>um</strong> geht eine<br />
<strong>Antenne</strong> elektrisch zu verkürzen. Leider gibt es keine Rosen ohne Dornen. Auch bei <strong>Antenne</strong>n<br />
ist <strong>die</strong>s nicht anders. Wenn man in Bezug auf Länge etwas tun will, dann handelt man<br />
sich mit jeder Massnahme auch etwas ein.<br />
Jede elektrische Verkürzung einer <strong>Antenne</strong> h<strong>at</strong> folgende Auswirkungen:<br />
• Absinken der Speisepunktimpedanz<br />
Bei einem moder<strong>at</strong> verkürzten Dipol liegt der Realanteil bald einmal bei 25 Ω<br />
und weniger, der Imaginäranteil liegt bei der Resonanzfrequenz recht tief. Sobald<br />
man <strong>die</strong> Resonanzfrequenz verlässt steigt der Realanteil moder<strong>at</strong> an,<br />
während der Imaginäranteil rasant ansteigt.<br />
• Verminderung der Bandbreite<br />
Dies ergibt sich aus dem Absinken der Speisepunktimpedanz.<br />
• Zusätzliche Verluste<br />
Keines der Mittel <strong>die</strong> zur Verkürzung einer <strong>Antenne</strong> angewendet werden arbeitet<br />
verlustlos. In der Praxis geht es immer dar<strong>um</strong>, <strong>die</strong>jenige Art der Verkürzung<br />
zu finden, <strong>die</strong> bei den gegebenen Verhältnissen realisierbar ist und dabei <strong>die</strong><br />
kleinsten Verluste ergibt.<br />
• Weniger Strom der strahlt<br />
Regel 3 besagt „Strom strahlt“. Dies gilt auch hier. Bei einer Verkürzung der <strong>Antenne</strong>nlänge<br />
reduzieren wir zwangsläufig einen Teil der <strong>Antenne</strong>nlänge und<br />
Max Rüegger, HB9ACC 20/42<br />
März 2007
<strong>Rund</strong> <strong>um</strong> <strong>die</strong> <strong>Antenne</strong><br />
Teil 7: spannungsgespeiste <strong>Antenne</strong>n, verkürzte <strong>Antenne</strong>n, Sonderformen<br />
deren Stromanteil. Dieser steht nicht mehr zur Abstrahlung zur Verfügung.<br />
• vermindertem Wirkungsgrad<br />
All <strong>die</strong> oben angeführten Nachteile führen zu einer Verminderung des Wirkungsgrades<br />
der <strong>Antenne</strong>.<br />
Wie bereits erwähnt geht es in der Praxis dar<strong>um</strong> <strong>die</strong>jenige Lösung zu finden <strong>die</strong> man an<br />
einem gegebenen Standort realisieren kann und <strong>die</strong> am wenigsten Nachteile aufweist.<br />
7.2.1 Verkürzung mittels Spulen<br />
Die Verkürzung von <strong>Antenne</strong>n mittels „Verlängerungsspulen“ ist wohl <strong>die</strong> bekannteste und<br />
populärste Massnahme. Leider ist es auch <strong>die</strong> „verlustreichste“ Methode.<br />
Das nachstehende Bild zeigt das Prinzip der Verkürzung mittels Spulen:<br />
Der Strom im blauen Feld<br />
wird in der Spule konzentriert<br />
und steht für <strong>die</strong> Abstrahlung<br />
nicht mehr zur Verfügung. = Verlängerungsspule<br />
Die wichtigste Erkenntnis der obigen Darstellung ist:<br />
Derjenige Teil des Stromes den wir in den Spulen konzentrieren<br />
steht uns für <strong>die</strong> Abstrahlung nicht mehr zur Verfügung.<br />
Max Rüegger, HB9ACC 21/42<br />
März 2007
<strong>Rund</strong> <strong>um</strong> <strong>die</strong> <strong>Antenne</strong><br />
Teil 7: spannungsgespeiste <strong>Antenne</strong>n, verkürzte <strong>Antenne</strong>n, Sonderformen<br />
Wenn wir uns mit längenverkürzenden Massnahmen<br />
befassen müssen wir uns unbedingt<br />
an <strong>die</strong> Regel 3 erinnern, <strong>die</strong> besagt „Strom<br />
strahlt“. Wenn wir schon Verlängerungsspulen<br />
einfügen, dann nach Möglichkeit nicht gerade<br />
im Strombauch. Der Einfluss der Position<br />
der Verlängerungsspule ist in nebenstehendem<br />
Bild gut sichtbar. Manchmal geht es<br />
nicht anders, z.B. bei Mobilantennen. Bei<br />
einem Dipol liegt der Strombauch in der Mitte,<br />
beim Speisepunkt. Wenn es irgendwie<br />
anders geht, dann sollten wir es unbedingt<br />
vermeiden eine Verlängerungsspule genau<br />
dort einzufügen wo der höchste Strom fliesst.<br />
Auch hier, alles ist ein Kompromiss. Eine Spule <strong>die</strong> weiter aussen liegt h<strong>at</strong> eine höhere Induktivität<br />
und wird demzufolge grösser und schwerer. Eine Spule ganz aussen, also im<br />
Spannungsbauch ist nicht realisierbar, sie müsste eine unendlich hohe Induktivität aufweisen.<br />
In der Oktober 2003 Ausgabe der Zeitschrift QST der ARRL ist ein Beitrag von OM Luiz<br />
Duarte Lopes, CT1EOJ, veröffentlicht, der sich mit der Konzeption verkürzter <strong>Antenne</strong>n<br />
befasst. Er h<strong>at</strong> den Problemkreis übersichtlich dargestellt und ich möchte gerne auf einige<br />
Auszüge aus seinem Artikel zurückgreifen:<br />
Hier sehen wir <strong>die</strong> Stromverteilung auf einem Dipol, wobei CT1EOJ <strong>die</strong> beiden Dipolhälften<br />
in je 3 Sektoren à 30° eingeteilt h<strong>at</strong>. Dies zur besseren Übersicht bei den nachfolgenden<br />
Betrachtungen.<br />
Max Rüegger, HB9ACC 22/42<br />
März 2007
<strong>Rund</strong> <strong>um</strong> <strong>die</strong> <strong>Antenne</strong><br />
Teil 7: spannungsgespeiste <strong>Antenne</strong>n, verkürzte <strong>Antenne</strong>n, Sonderformen<br />
Version A:<br />
Hier werden in jeder Dipolhälfte Verlängerungsspulen eingefügt, <strong>die</strong> präzise den Sektor B<br />
verkürzen. Die Full-Size-<strong>Antenne</strong>nlänge eines 40 m Dipols beträgt 21.2 m. Dank Einfügen<br />
von Verlängerungsspulen von je 15 µH reduziert sich <strong>die</strong> Länge auf 14.14 m. Der Sektor A,<br />
also der Sektor in dem der grösste Strom fliesst, ist unangetastet geblieben. Er trägt zur<br />
guten Abstrahlung bei.<br />
Version B:<br />
Hier wurden bei der gleichen <strong>Antenne</strong> <strong>die</strong> Verlängerungsspulen vergrössert. Ihr Wert beträgt<br />
nun je 40 µH. Die Länge derselben <strong>Antenne</strong> reduziert sich nun auf 10.6 m. Die Verlängerungsspulen<br />
tun ihre Wirkung weiter aussen, also dort wo ohnehin der Strom abnimmt, was<br />
auf <strong>die</strong> Abstrahlung und den Wirkungsgrad <strong>die</strong>ser <strong>Antenne</strong> wenig Einfluss h<strong>at</strong>. Der Sektor A<br />
mit dem grössten Strom bleibt unangetastet. Der Wirkungsgrad <strong>die</strong>ser Version nimmt gegenüber<br />
der Version A nur wenig ab.<br />
Max Rüegger, HB9ACC 23/42<br />
März 2007
<strong>Rund</strong> <strong>um</strong> <strong>die</strong> <strong>Antenne</strong><br />
Teil 7: spannungsgespeiste <strong>Antenne</strong>n, verkürzte <strong>Antenne</strong>n, Sonderformen<br />
Version C:<br />
Bei <strong>die</strong>ser Variante werden Verlängerungsspulen von je 25 µH verwendet. Die Länge der<br />
<strong>Antenne</strong> beträgt wie beim vorherigen Beispiel 10.6 m. Allerdings wurde jetzt der Sektor A,<br />
der den grössten Strom führt, von 30° auf 22.5° reduziert. Der Sektor C, der ohnehin wenig<br />
Strom führt wurde vergrössert. Trotz gleicher <strong>Antenne</strong>nlänge h<strong>at</strong> <strong>die</strong> Version B gegenüber<br />
der Version C einen höheren Wirkungsgrad. Version B h<strong>at</strong> mit der Sektion A, <strong>die</strong> volle 30°<br />
überstreicht, mehr Draht in der Luft der wirklich strahlt. Bei gleicher Gesamtlänge wäre also<br />
der Version B den Vorzug zu geben.<br />
Im übrigen gilt es noch zu beachten:<br />
Je grösser <strong>die</strong> Reduktion der <strong>Antenne</strong>nlänge, d.h. je kürzer <strong>die</strong> <strong>Antenne</strong> wird, desto<br />
schmalbandiger wird sie. Bei extremer Verkürzung darf man sich nicht wundern wenn man,<br />
vor allem auf den langwelligeren Bändern, nur noch nutzbare Bandbreiten von 5 … 15 kHz<br />
erreicht. Man kann zwar einen <strong>Antenne</strong>nkoppler verwenden, aber man ist dann dauernd am<br />
nachstimmen.<br />
Max Rüegger, HB9ACC 24/42<br />
März 2007
<strong>Rund</strong> <strong>um</strong> <strong>die</strong> <strong>Antenne</strong><br />
Teil 7: spannungsgespeiste <strong>Antenne</strong>n, verkürzte <strong>Antenne</strong>n, Sonderformen<br />
Oben sehen wir noch einen Vorschlag für <strong>die</strong> praktische Konstruktion einer Verlängerungsspule.<br />
Am elegantesten ist es <strong>die</strong> Spule mit demselben Draht wie man ihn für <strong>die</strong> <strong>Antenne</strong><br />
benützt zu „konstruieren“. Wenn man dann <strong>die</strong> genaue Windungszahl auf einem bestimmten<br />
Wickelkörper kennt, dann „opfert“ man noch einmal eine Ladung des teuren <strong>Antenne</strong>ndrahtes.<br />
Man fertigt dann den <strong>Antenne</strong>ndraht inklusive der Windung auf der oder den Verlängerungsspulen<br />
aus einem Stück. Man kann so <strong>die</strong> Übergangswiderstände, <strong>die</strong> sich beim Anschluss<br />
der Spulen ergeben, eliminieren. Man darf nicht vergessen, der <strong>Antenne</strong>ndraht sowie<br />
<strong>die</strong> Verlängerungsspulen hängen ja im Freien und sind Wind und Regen ausgesetzt.<br />
Als Spulenkörper eignet sich z.B. dünnes Abflussrohr<br />
aus dem Ba<strong>um</strong>arkt. Man sollte aber<br />
darauf achten das „graue“ Abflussrohr zu<br />
nehmen und nicht das „schwarze“ Abflussrohr,<br />
das eine dickere Wandstärke aufweist.<br />
Das schwarze Abflussrohr h<strong>at</strong> schlechte<br />
<strong>die</strong>lektrische Eigenschaften.<br />
Das nebenstehende Bild zeigt eine weitere<br />
Art wie man eine Verlängerungsspule herstellen<br />
kann ohne den <strong>Antenne</strong>ndraht<br />
aufzutrennen.<br />
Wer mit Spulen verkürzte <strong>Antenne</strong>n mittels einem <strong>Antenne</strong>nsymul<strong>at</strong>ionsprogramm rechnet,<br />
der ist erstaunt wie wenig <strong>die</strong> Verlängerungsspule den Wirkungsgrad (Gain) der <strong>Antenne</strong><br />
beeinträchtig.<br />
Wenn man <strong>Antenne</strong>nsymul<strong>at</strong>ionsprogramme verwendet, dann rechnet man häufig der Bequemlichkeit<br />
halber mit sog. Default-Einstellungen. Man rechnet so unter Umständen mit<br />
einem verlustfreien Draht, man rechnet mit verlustfreien Verlängerungsspulen etc.. Hier<br />
muss man schon aufpassen, dass man der Realität irgendwie in <strong>die</strong> Nähe kommt. Verlängerungsspulen<br />
sind in der Praxis keinesfalls verlustfrei und deren Q (Güte) ist in der Praxis<br />
niemals auch nur annäherungsweise so hoch wie der OM glaubt. Also hier immer den gesunden<br />
Menschenverstand walten lassen und sich keinen Illusionen hingeben.<br />
T<strong>at</strong>sache ist aber auch, dass man in der Praxis mit <strong>Antenne</strong>n<br />
deren Länge man mittels Verlängerungsspulen verkürzt h<strong>at</strong>,<br />
durchwegs QSO’s fahren kann.<br />
Beste Beispiele sind Mobilantennen für <strong>die</strong> unteren Bänder.<br />
Dort h<strong>at</strong> man in der Praxis ja gar keine andere Wahl als <strong>die</strong><br />
<strong>Antenne</strong> mittels Verlängerungsspule auf Resonanz zu bringen.<br />
Die beiden nebenstehenden Bilder zeigen Hersteller von<br />
Mobilantennen <strong>die</strong> Verlängerungsspulen anordnen.<br />
Üblicherweise sitzt <strong>die</strong> Verlängerungsspule an der Basis der<br />
<strong>Antenne</strong>. Dies ist aus konstruktiven Gründen notwendig,<br />
denn eine Verlängerungsspule irgendwo oben in der <strong>Antenne</strong><br />
ist bei Mobilantennen eine etwas gefährliche Angelegenheit,<br />
da das Gewicht der Verlängerungsspule <strong>die</strong> <strong>Antenne</strong><br />
gewaltig belastet.<br />
Max Rüegger, HB9ACC 25/42<br />
März 2007
<strong>Rund</strong> <strong>um</strong> <strong>die</strong> <strong>Antenne</strong><br />
Teil 7: spannungsgespeiste <strong>Antenne</strong>n, verkürzte <strong>Antenne</strong>n, Sonderformen<br />
7.2.3 Wendelantennen<br />
Die „Wendelantenne“ ist eine Sonderform der<br />
mittels Spulen verkürzten <strong>Antenne</strong>n. Ich<br />
weiss, es gibt auch in der UHF-Technik eine<br />
Wendelantenne. Der Ausdruck Wendelantenne<br />
ist für HF-<strong>Antenne</strong>n eigentlich falsch, <strong>die</strong><br />
präzise Bezeichnung lautet nämlich „verkürzte<br />
Vertikalantenne mit verteilter Induktivität". Im<br />
Volksmund h<strong>at</strong> man <strong>die</strong>sem Ding aber seit jeher<br />
Wendelantenne gesagt.<br />
Rothammels <strong>Antenne</strong>nbuch sagt zu <strong>die</strong>ser <strong>Antenne</strong>nform:<br />
Eine eng bewickelte und damit extrem kurze<br />
Spulenantenne h<strong>at</strong> sehr schlechte Strahlungseigenschaften.<br />
Wird <strong>die</strong> Spule aber so weit<br />
auseinandergezogen, dass ihre mechanische<br />
Länge in <strong>die</strong> Grössenordnung einer verkürzten<br />
Vertikalantenne kommt, sind ihre Strahlungseigenschaften<br />
denen einer gleich langen Vertikalantennen<br />
mit Verlängerungsspule mindestens<br />
ebenbürtig.<br />
Solche Spulenantennen stellen oftmals <strong>die</strong><br />
brauchbarste Lösung für einen Fahrzeugstrahler<br />
dar.<br />
Bei <strong>Antenne</strong>n für <strong>die</strong> langwelligeren Bänder<br />
(z.B. 80 m) h<strong>at</strong> sich <strong>die</strong> gezeigte Bewicklungsart<br />
bewährt. Eng bewickelte und weit bewikkelte<br />
Zonen wechseln sich ab.<br />
Max Rüegger, HB9ACC 26/42<br />
März 2007
<strong>Rund</strong> <strong>um</strong> <strong>die</strong> <strong>Antenne</strong><br />
Teil 7: spannungsgespeiste <strong>Antenne</strong>n, verkürzte <strong>Antenne</strong>n, Sonderformen<br />
Auch solche Gebilde, <strong>die</strong> ebenfalls im weitesten<br />
Sinne zur Familie der Wendelantennen gehören,<br />
wurden schon versucht.<br />
Funktioniert h<strong>at</strong>’s, aber der konstruktive Aufwand<br />
h<strong>at</strong> wahrscheinlich <strong>die</strong> meisten OM’s<br />
vom Nachbau solcher Gebilde abgehalten.<br />
So etwas könnte ich mir noch ehestens als<br />
Estrichantenne vorstellen wo das Ganze versteckt<br />
ist. Der konstruktive Aufbau muss in<br />
einem solchen Falle auch keinen Schönheitswettbewerb<br />
gewinnen.<br />
7.2.4 Verkürzung mittels kapazitiver Belastung<br />
Die Verkürzung einer <strong>Antenne</strong> mittels kapazitiver Belastung ist eine beliebte Art Vertikalstrahler<br />
(speziell für das 80 m oder 160 m Band) zu verkürzen. Weniger bekannt ist, dass<br />
sich <strong>die</strong>se Art der Verkürzung auch bei horizontalen <strong>Antenne</strong>n anwenden lässt.<br />
Grundsätzlich gilt:<br />
Theorie:<br />
Die Verkürzung mittels kapazitiver Belastung bringt bedeutend<br />
weniger Verluste als das Einfügen von Verlängerungsspulen.<br />
Die kapazitive Belastung im Spannungsmaxim<strong>um</strong> bildet eine zusätzliche Kapazität gegen<br />
Erde. Wie bei einen Schwingkreis, dessen Resonanzfrequenz durch das Hinzufügen einer<br />
Zus<strong>at</strong>zkapazität niedriger wird, tritt auch bei einer <strong>Antenne</strong> durch das Anfügen einer Endkapazität<br />
eine Verkleinerung der Resonanzfrequenz auf.<br />
Rothammels <strong>Antenne</strong>nbuch schreibt dazu:<br />
Solange <strong>die</strong> Grösse der Endkapazität in bestimmten Grenzen bleibt, kann eine kapazitiv<br />
Max Rüegger, HB9ACC 27/42<br />
März 2007
<strong>Rund</strong> <strong>um</strong> <strong>die</strong> <strong>Antenne</strong><br />
Teil 7: spannungsgespeiste <strong>Antenne</strong>n, verkürzte <strong>Antenne</strong>n, Sonderformen<br />
belastete <strong>Antenne</strong> keineswegs als Kompromisslösung betrachtet werden. Solche <strong>Antenne</strong>n<br />
haben durch <strong>die</strong> konstante Stromverteilung sogar einen grösseren Strahlungswiderstand<br />
als unbelastete Vertikalantennen gleicher Länge und damit auch einen besseren Wirkungsgrad.<br />
In der Praxis stellt meistens <strong>die</strong> Herstellung der Dachkapazität <strong>die</strong> grösste Schwierigkeit<br />
dar. Das obige Bild gibt einige Hinweise auf mögliche Ausführungsformen.<br />
Speziell 80 m und 160 m DX’er greifen gerne zu <strong>die</strong>ser <strong>Antenne</strong>nform. Die Verwendung<br />
einer Vertikalantenne bringt <strong>die</strong> gewünschte flache Abstrahlung und vermindert gleichzeitig<br />
den Steilstrahlanteil.<br />
Die obige Skizze zeigt eine 1.8 MHz Vertikal-<strong>Antenne</strong> nach G3TXQ. Die Mastlänge beträgt<br />
13.5 m, <strong>die</strong> Dachkapazität besteht aus 6 Stck. 10 m langen Leitern <strong>die</strong> untereinander<br />
verbunden sind. Sie <strong>die</strong>nen zugleich als Teil der Abspannseile für den Mast. N<strong>at</strong>ürlich ist<br />
bei <strong>die</strong>ser Art <strong>Antenne</strong> ein effizientes Radialnetz notwendig. Ebenso benötigt man einen<br />
Mastfuss-Isol<strong>at</strong>or. Da kommerzielle Mastfuss-Isol<strong>at</strong>oren nicht mehr so leicht erhältlich sind<br />
bietet sich als Ers<strong>at</strong>z eine Champagner-Flasche an. Man muss dann einfach <strong>die</strong> „Siegesfeier"<br />
etwas vorverlegen.<br />
Die nächste Skizze zeigt eine andere populäre Art eine Vertikal-<strong>Antenne</strong> mit kapazitiver<br />
Belastung zu realisieren. Die Voraussetzungen sind bei jedem OM gegeben der über einen<br />
Metallmast mit aufgesetztem Beam verfügt. Die Metallkonstruktion des Beam’s stellt nämlich<br />
einen idealen Kapazitäts-Hut dar.<br />
Da der Mast a) bereits steht und b) geerdet ist (Blitzschutz) kann in solchen Fällen ka<strong>um</strong> ein<br />
Mastfuss-Isol<strong>at</strong>or eingebaut werden. Deshalb greift man auf eine andere Art der Anpassung<br />
zurück, nämlich auf den Gamma-M<strong>at</strong>ch. Je nach Mastlänge und gewünschtem Frequenzbereich<br />
der Vertikal-<strong>Antenne</strong> ergeben sich verschiedene Kombin<strong>at</strong>ionen der Anpassschaltung.<br />
Wer sich dafür interessiert findet <strong>die</strong> entsprechenden Angaben in allen guten <strong>Antenne</strong>nbüchern.<br />
Das Bild stammt übrigens aus dem ARRL Antenna Book.<br />
Max Rüegger, HB9ACC 28/42<br />
März 2007
<strong>Rund</strong> <strong>um</strong> <strong>die</strong> <strong>Antenne</strong><br />
Teil 7: spannungsgespeiste <strong>Antenne</strong>n, verkürzte <strong>Antenne</strong>n, Sonderformen<br />
N<strong>at</strong>ürlich benötigen solche Vertikal-<strong>Antenne</strong>n immer ein effizientes Netz von Radials. In der<br />
Praxis stellt das Erstellen eines Radial-Netzes fast immer das grössere Problem dar als der<br />
Mast und <strong>die</strong> Anpassung. Wer h<strong>at</strong> schon so viel Pl<strong>at</strong>z <strong>um</strong> eine grosse Anzahl z.B. 16 Stück<br />
(oder mehr) Drähte von λ/4 Länge, bezogen auf <strong>die</strong> tiefste Betriebsfrequenz, entweder auf<br />
der Erde auszulegen oder zu vergraben. Die Dinger zu vergraben bedingt einen grossen<br />
Aufwand. Wenn man <strong>die</strong> Radials lediglich auf dem Boden auslegt und in Abständen von<br />
einigen Metern jeweils mit Draht-Aggraffen am Boden sichert, dann h<strong>at</strong> man Stolperdrähte.<br />
Unter Draht-Aggraffen verstehe ich dünne Armiereisen, ca. 50 – 60 cm lang, <strong>die</strong> man in der<br />
Mitte zu einer Art Aggraffe <strong>um</strong>biegt. Diese schlägt man dann in den Boden <strong>um</strong> <strong>die</strong> Drähte<br />
zu befestigen. Auf dem Boden spriesst dann Gras. Das Gras zu mähen wird z<strong>um</strong> Problem.<br />
Mäher irgendwelcher Art kann man nicht einsetzen, sonst h<strong>at</strong> man Radial-Ragout. Meinen<br />
Erfahrungen zufolge (mit Install<strong>at</strong>ionen kommerzieller und militärischer Funk<strong>die</strong>nste) gibt es<br />
nur eine Lösung, nämlich Schafe weiden zu lassen. Schafe weiden solche mit Drahtverhau<br />
versehenen Flächen perfekt ab und lassen <strong>die</strong> Drähte, Kabel, Erdpfähle, Verteilkästen etc.<br />
in Ruhe. Dies ist der Grund war<strong>um</strong> ich bei meinen Am<strong>at</strong>eurfunk-Install<strong>at</strong>ionen kein grosser<br />
Fan von <strong>Antenne</strong>n bin <strong>die</strong> ein Radial-Netz bedingen.<br />
Hier noch 3 Bilder <strong>die</strong> zeigen wie kommerzielle <strong>Antenne</strong>nhersteller von kapazitiver<br />
Belastung Gebrauch machen <strong>um</strong> ihre <strong>Antenne</strong>n zu kürzen.<br />
Ob man <strong>die</strong>se Dinger schön findet sei jedem einzelnen überlassen. Für uns Funkam<strong>at</strong>eure<br />
ist es meistens jedoch wichtiger, dass auch <strong>die</strong> lieben Nachbarn gefallen (oder z<strong>um</strong>indest<br />
Toleranz) für unsere <strong>Antenne</strong>n empfinden. So ein Ding zuoberst auf einem Hochhaus mag<br />
ja unauffällig sein, in den Garten eines Reihenhäuschens würde ich so etwas nicht stellen<br />
ohne mich vorher mit den Nachbarn abgesprochen zu haben.<br />
Max Rüegger, HB9ACC 29/42<br />
März 2007
<strong>Rund</strong> <strong>um</strong> <strong>die</strong> <strong>Antenne</strong><br />
Teil 7: spannungsgespeiste <strong>Antenne</strong>n, verkürzte <strong>Antenne</strong>n, Sonderformen<br />
7.2.5 Verkürzung durch Umbiegen der Enden<br />
Eine weitere Art wie man <strong>Antenne</strong>n bei rel<strong>at</strong>iv bescheidenen Verlusten verkürzen kann ist<br />
das Umbiegen der Enden.<br />
Ab ca. 50 % der Länge einer Dipolhälfte darf man <strong>die</strong> <strong>Antenne</strong>ndrähte <strong>um</strong>biegen ohne dass<br />
ein nennenswerter Wirkungsgradverlust eintritt. Regel 3, <strong>die</strong> besagt „Strom strahlt“, ist hier<br />
erfüllt. Mit den Enden der <strong>Antenne</strong> wird <strong>die</strong> Resonanz abgeglichen. Die <strong>um</strong>gebogenen Enden<br />
tragen jedoch fast nichts mehr zur Abstrahlung bei.<br />
Wie man den <strong>Antenne</strong>ndraht abbiegt spielt keine grosse Rolle. Man richtet sich nach den<br />
örtlichen Gegebenheiten. Man kann <strong>die</strong> Enden herunterhängen lassen. Man kann sie auch<br />
schräg und wenn nötig seitwärts nach unten ziehen und abspannen. Man kann sie sogar,<br />
z.B. im Falle einer „Inverted Vee“, horizontal wieder nach innen ziehen.<br />
Max Rüegger, HB9ACC 30/42<br />
März 2007
<strong>Rund</strong> <strong>um</strong> <strong>die</strong> <strong>Antenne</strong><br />
Teil 7: spannungsgespeiste <strong>Antenne</strong>n, verkürzte <strong>Antenne</strong>n, Sonderformen<br />
Ich selbst verwende in meinem 2. <strong>QTH</strong> eine <strong>Antenne</strong> für das 160 m Band, bei der wie oben<br />
im unteren Bild gezeigt, <strong>die</strong> Enden nach Innen z<strong>um</strong> Mittelmast geführt sind. Sie führen in der<br />
Mitte sogar in eine Relais Box. Auf 80 m schliesst ein Relais <strong>die</strong> beiden Enden des 160 m<br />
Dipols kurz und derselbe <strong>Antenne</strong>ndraht wird zu einer Ganzwellenschleife. Auf 160 m habe<br />
ich mit <strong>die</strong>ser Anordnung bisher mit Ausnahme von Südamerika alle Kontinente, inkl.<br />
Australien, gearbeitet. In Richtung USA komme ich mit <strong>die</strong>ser <strong>Antenne</strong> bis in eine Linie von<br />
den „Gre<strong>at</strong> Lakes“ bis Texas. Ich habe bisher ca. 15 St<strong>at</strong>es sowie eine ganze Anzahl kanadischer<br />
Provinzen bestätigt. Wie <strong>die</strong>ses Beispiel zeigt kann der Wirkungsgradabfall wegen<br />
des Umbiegens der Enden wirklich keinen grossen Einfluss gegenüber einem full-size Dipol<br />
haben.<br />
Das obige Bild zeigt einen Dipol mit <strong>um</strong>gebogenen, bzw. herunterhängenden Ende. Wie<br />
man sieht steht der grösste Teil des Stromes zur ungetrübten Abstrahlung zur Verfügung.<br />
Der an den Ende noch zur Verfügung stehenden Strom trägt ebenfalls noch etwas zur Abstrahlung<br />
bei. Der hauptsächliche Zweck der an den Enden herunterhängenden Drähte besteht<br />
jedoch darin <strong>die</strong> Resonanz herzustellen.<br />
TX<br />
Eine ganz extreme Methode des Umbiegens<br />
der Enden besteht darin <strong>die</strong> Enden eines<br />
Dipols rel<strong>at</strong>iv nahe zueinander zurückzufalten.<br />
Auch <strong>die</strong>ses Prinzip funktioniert und wird<br />
in der Praxis angewandt.<br />
Um <strong>die</strong>se Prinzip näher zu erläutern,<br />
nachstehend ein Beispiel eines 80 m Dipols,<br />
dessen Länge dank Zurückfalten der Drähte<br />
auf total 24 m verkürzt wurde.<br />
Max Rüegger, HB9ACC 31/42<br />
März 2007
<strong>Rund</strong> <strong>um</strong> <strong>die</strong> <strong>Antenne</strong><br />
Teil 7: spannungsgespeiste <strong>Antenne</strong>n, verkürzte <strong>Antenne</strong>n, Sonderformen<br />
Dies <strong>die</strong> Ansicht des Draht-Layout’s.<br />
Strom im<br />
<strong>um</strong>gefaltete<br />
n Teil links<br />
Strom im durchgehenden Teil<br />
gelbe Fläche = resultierender und für <strong>die</strong> Abstrahlung wirksamer Strom<br />
Strom im<br />
<strong>um</strong>gefalteten<br />
Teil rechts<br />
Max Rüegger, HB9ACC 32/42<br />
März 2007
<strong>Rund</strong> <strong>um</strong> <strong>die</strong> <strong>Antenne</strong><br />
Teil 7: spannungsgespeiste <strong>Antenne</strong>n, verkürzte <strong>Antenne</strong>n, Sonderformen<br />
Was geschieht in einer solchen Extremsitu<strong>at</strong>ion ?<br />
Da wir einen grossen Teil des Dipols zurückgefaltet haben teilt sich nun in jeder Dipolhälfte<br />
der Strom auf<br />
• in einen Strom der im durchgehenden Teil der Dipolhälfte erzeugt wird und<br />
• in einen Strom der vom zurückgefalteten Teil der Dipolhälfte erzeugt wird.<br />
• Diese beiden Ströme kompensieren sich nach Massgabe ihrer Grösse<br />
• Da der Strom in der durchgehenden Dipolhälfte schon per Definition höher ist als in<br />
der zurückgefalteten Dipolhälfte resultiert in jedem Fall ein „positiver“ Strom der<br />
effektiv zur Abstrahlung zur Verfügung steht.<br />
Dies geht ganz klar aus der Skizze hervor bei der <strong>die</strong> Fläche <strong>die</strong> der resultierende Strom<br />
einnimmt eingefärbt ist.<br />
l = λ/2<br />
Faltdipol<br />
ACHTUNG:<br />
7.2.6 Verkürzung mittels Umwegleitungen<br />
TX<br />
Die Art des zurückgefalteten Dipols darf nicht<br />
mit einem Faltdipol verwechselt werden.<br />
Der Faltdipol ist ein „ausgewachsener“ Dipol<br />
mit einer Länge von λ/2 dessen einer Leiter<br />
in der Mitte den Anschluss trägt und dessen<br />
zweiter Leiter über <strong>die</strong> ganze Dipollänge<br />
durchgeht. Die Speisepunktimpedanz eines<br />
Faltdipols liegt bei ca. 300 Ω.<br />
Faltdipole werden im Am<strong>at</strong>eurfunk auf KW<br />
nur sehr selten verwendet.<br />
Eine weitere Art wie man <strong>Antenne</strong>n rel<strong>at</strong>iv verlustfrei elektrisch verkürzen kann ist <strong>die</strong> Umwegleitung.<br />
<strong>Antenne</strong>n mit Umwegleitungen haben, verglichen mit gleich langen <strong>Antenne</strong>n<br />
<strong>die</strong> mit Spule verkürzt wurden, immer eine grössere nutzbare Bandbreite. Über<strong>die</strong>s ist eine<br />
Umwegleitung immer mit weniger Verlusten behaftet als eine Spule.<br />
Umwegleitungen realisiert man wie folgt:<br />
• Selbstbau: Man verwendet Kunststoff-Spreizer <strong>die</strong> <strong>die</strong> Drähte<br />
in ca. 10 cm Abstand parallel halten.<br />
Max Rüegger, HB9ACC 33/42<br />
März 2007
<strong>Rund</strong> <strong>um</strong> <strong>die</strong> <strong>Antenne</strong><br />
Teil 7: spannungsgespeiste <strong>Antenne</strong>n, verkürzte <strong>Antenne</strong>n, Sonderformen<br />
• Man verwendet als Umwegleitung ein Stück symmetrische 450 Ω Leitung von<br />
Wireman.<br />
Eine selbstgebaute Umwegleitung h<strong>at</strong> meines Erachtens weniger Verluste als <strong>die</strong> Verwendung<br />
von symmetrischer 450 Ω Leitung. Diese h<strong>at</strong> bereits wieder ein Dielektrik<strong>um</strong> zwischen<br />
den Drähten. Die Praxis zeigt aber, dass <strong>die</strong> 450 Ω Leitung ohne weiteres eingesetzt werden<br />
kann. Der Konstruktionsaufwand ist auf jeden Fall geringer als beim Selbstbau, über<strong>die</strong>s<br />
sieht es weniger auffällig aus.<br />
Umwegleitungen können prinzipiell für alle <strong>Antenne</strong>nformen verwendet werden, also auch<br />
für Schleifenantennen, Vertikalantennen etc.<br />
Wer sich für <strong>die</strong>se Art elektrischer Verlängerung speziell interessiert, dem empfehle ich das<br />
Buch „Die Cubical-Quad und ihre Sonderformen“ von OM K. Weiner, DJ9HO. In seinem<br />
Buch ist <strong>die</strong>se Technik ausführlich beschrieben.<br />
7.3 Spezialformen verkürzter <strong>Antenne</strong>n<br />
Es ist eine bekannte T<strong>at</strong>sache:<br />
Ein geschlossener Schwingkreis<br />
strahlt nicht.<br />
Eine weniger bekannte T<strong>at</strong>sache ist:<br />
Jede Zwischenform <strong>die</strong> vom<br />
geschlossenen Schwingkreis<br />
abweicht bis z<strong>um</strong> Dipol<br />
h<strong>at</strong> Potential zu strahlen.<br />
Von <strong>die</strong>ser T<strong>at</strong>sache wird bei zwei<br />
Spezialformen von verkürzten <strong>Antenne</strong>n<br />
Gebrauch gemacht, nämlich bei<br />
• der magnetischen <strong>Antenne</strong><br />
• der ISOTRON-<strong>Antenne</strong><br />
Max Rüegger, HB9ACC 34/42<br />
März 2007
<strong>Rund</strong> <strong>um</strong> <strong>die</strong> <strong>Antenne</strong><br />
Teil 7: spannungsgespeiste <strong>Antenne</strong>n, verkürzte <strong>Antenne</strong>n, Sonderformen<br />
7.3.1 Die magnetische <strong>Antenne</strong><br />
Die magnetische <strong>Antenne</strong> ist im Prinzip<br />
ein<br />
Einwindungs-Schwingkreis<br />
Das elektrische Feld bleibt im<br />
Kondens<strong>at</strong>or konzentriert,<br />
während ein ausgedehntes<br />
magnetisches Feld aus der<br />
grossen Ringschleife austritt.<br />
Der Schwingkreis wird auf der gewünschten<br />
Frequenz auf Resonanz<br />
gebracht. Dies geschieht mittels einem<br />
Drehkondens<strong>at</strong>or, der meistens mit<br />
einer Fernsteuerung versehen ist.<br />
Das untenstehende Bild zeigt das<br />
elektrische Schema der <strong>Antenne</strong>. Der<br />
Drehkondens<strong>at</strong>or wird an dem der<br />
Speisung entgegengesetzten Ende<br />
angeordnet. Er sitzt im oberen Bild im<br />
Kästchen zuoberst an der <strong>Antenne</strong>.<br />
Die Ankopplung erfolgt über eine<br />
kleine Koppelspule aus Koaxialkabel.<br />
Zur exakten SWR Anpassung kann<br />
man <strong>die</strong> Koppelspule etwas verbiegen.<br />
Das ist auf dem Bild der <strong>Antenne</strong> ganz<br />
gut ersichtlich. Es gibt auch noch<br />
andere Formen der Ankopplung <strong>die</strong><br />
aber alle aufwendiger sind.<br />
Bei der Konstruktion einer solchen<br />
<strong>Antenne</strong> sind folgende Problemkreise<br />
zu beachten:<br />
-<br />
• das Beherrschen der mechanischen<br />
Konstruktion<br />
• <strong>die</strong> hohen Ströme bzw. der<br />
kleine Strahlungswiderstand,<br />
sowie <strong>die</strong> Verlustwiderstände<br />
der Einwindungsspule.<br />
• der Anschluss des Drehkondens<strong>at</strong>ors.<br />
Mit solch hohen<br />
Strömen ist der Schleifer des<br />
Drehkondens<strong>at</strong>ors bald überordert.<br />
(Kommerzielle Ausführungen<br />
verwenden deshalb<br />
einen Schmetterlings-Drehko,<br />
der ohne Schleifer auskommt)<br />
Max Rüegger, HB9ACC 35/42<br />
März 2007
<strong>Rund</strong> <strong>um</strong> <strong>die</strong> <strong>Antenne</strong><br />
Teil 7: spannungsgespeiste <strong>Antenne</strong>n, verkürzte <strong>Antenne</strong>n, Sonderformen<br />
Die Praxiserfahrungen mit <strong>die</strong>ser <strong>Antenne</strong>nform sind gemischt. Ich selbst habe noch nie<br />
Gelegenheit gehabt mit einer solchen <strong>Antenne</strong> zu funken. Ich kenne jedoch einige Kollegen<br />
<strong>die</strong> sich magnetische <strong>Antenne</strong>n selbst gebaut haben. Die Praxiserfahrung lief jedes Mal<br />
etwa nach folgendem Schema ab:<br />
• Phase 1: Die <strong>Antenne</strong> ist fertig und wird getestet.:<br />
Kommentar:<br />
Die <strong>Antenne</strong> funktioniert prima, wirklich etwas ganz interessantes.<br />
Das muss ich unbedingt weiterverfolgen.<br />
• Phase 2: Die <strong>Antenne</strong> ist 3 Mon<strong>at</strong>e in Betrieb.<br />
Kommentar:<br />
Ja, <strong>die</strong> <strong>Antenne</strong> ist ja ganz interessant. Aber weisst Du,<br />
<strong>die</strong> Drahtantennen sind meistens eben doch besser.<br />
• Phase 3: Nach ca. 6 Mon<strong>at</strong>en.<br />
Kommentar:<br />
Ich werde <strong>die</strong> magnetische <strong>Antenne</strong> demnächst wieder abbauen<br />
und für Ferien-Einsätze etc. auf <strong>die</strong> Seite stellen. Die Drahtantennen<br />
sind doch einfacher zu handhaben und liefern halt doch <strong>die</strong> besseren<br />
Signale.<br />
Ich bin der Meinung, dass magnetische <strong>Antenne</strong>n absolut ihre Daseinsberechtigung haben.<br />
Für denjenigen der gar keine Aussenantenne erstellen kann ist es oft <strong>die</strong> einzige Möglichkeit<br />
QRV zu sein. Ebenso könnte ich mir vorstellen, dass das <strong>die</strong> ideale <strong>Antenne</strong> ist wenn<br />
man mit einem Wohnmobil unterwegs ist. Wenn es dar<strong>um</strong> geht eine <strong>Antenne</strong> unsichtbar zu<br />
machen ist es auch eine gute Lösung. Ich habe einmal einen Bericht gelesen und Bilder<br />
einer magnetischen <strong>Antenne</strong> gesehen, deren „Windung“ aus Al<strong>um</strong>ini<strong>um</strong>folie (Küchenfolie)<br />
bestand, <strong>die</strong> auf <strong>die</strong> vergipste Wand geklebt wurde. Nachher wurde das ganze mit Tapete<br />
überklebt. Der Drehkondens<strong>at</strong>or und <strong>die</strong> Koppelspule wurden in Möbeln versteckt.<br />
Interessant ist auch <strong>die</strong> Geschichte der magnetischen <strong>Antenne</strong>n:<br />
Abgestimmte Schwingkreise, sog. Rahmenantennen wurden seit den ersten Tagen der<br />
Funktechnik verwendet. Sie liefern zwar nur kleine Empfangsspannungen aber deren<br />
Richtwirkung erlaubt es Störer auszublenden und das Nutzsignal hervorzuheben.<br />
In den 1960’er Jahren sind dann findige Köpfe auf <strong>die</strong> Idee gekommen es mit einem abgestimmten<br />
Schwingkreis in Form einer Einwindungsspule für Sendezwecke zu versuchen.<br />
Theoretische Überlegungen sagten <strong>die</strong>ser <strong>Antenne</strong> ein gutes „Preis/Leistungsverhältnis“<br />
voraus. Unter „Preis“ muss man dabei nicht den „Herstellungspreis“ verstehen sondern <strong>die</strong><br />
T<strong>at</strong>sache, dass man eine <strong>Antenne</strong> in Mini<strong>at</strong>urausführen erhält <strong>die</strong> trotzdem einen guten<br />
Wirkungsgrad versprach.<br />
Versuche mit <strong>die</strong>ser <strong>Antenne</strong>nform wurden mehr oder weniger gleichzeitig an zwei Orten<br />
durchgeführt:<br />
• In den USA durch das US Army Signal Corps<br />
• In der Schweiz durch <strong>die</strong> Swiss Army in Zusammenarbeit mit der Firma Zellweger,<br />
Uster<br />
Max Rüegger, HB9ACC 36/42<br />
März 2007
<strong>Rund</strong> <strong>um</strong> <strong>die</strong> <strong>Antenne</strong><br />
Teil 7: spannungsgespeiste <strong>Antenne</strong>n, verkürzte <strong>Antenne</strong>n, Sonderformen<br />
Der Auslöser für <strong>die</strong>se Versuche waren gleich gelagerte Probleme im militärischen Funkverkehr,<br />
nämlich<br />
• der Funkverkehr aus tiefen Tälern heraus, was Steilstrahlantennen nötig macht,<br />
und<br />
• Funklinien über rel<strong>at</strong>iv kurze Distanzen (50 … 200 km), was <strong>die</strong> Verwendung tiefer<br />
Frequenzen (1.7 – max. 4 MHz) nötig macht.<br />
Bei der Swiss Army ist der Fall klar, beide Arg<strong>um</strong>ente treffen in der Schweiz zu. Bei der US<br />
Army muss man berücksichtigen, dass damals der Vietnam Krieg tobte. Im Dschungel Vietnams<br />
war eben das Aufstellen von Funkmasten und das Aufziehen langer Drahtantennen<br />
noch ungleich schwieriger als in der Schweiz.<br />
Max Rüegger, HB9ACC 37/42<br />
März 2007
<strong>Rund</strong> <strong>um</strong> <strong>die</strong> <strong>Antenne</strong><br />
Teil 7: spannungsgespeiste <strong>Antenne</strong>n, verkürzte <strong>Antenne</strong>n, Sonderformen<br />
Das Titelbild der Ausgabe März 1968 der ARRL Publik<strong>at</strong>ion QST zeigt eine solche <strong>Antenne</strong>,<br />
<strong>die</strong> von der ARRL gemäss den Angaben <strong>die</strong> über <strong>die</strong> „militärische“ Magnet-<strong>Antenne</strong> vorlagen,<br />
nachgebaut wurde. Die Versuche waren nicht sehr erfolgreich. Man h<strong>at</strong>te einfach <strong>die</strong><br />
militärische Version 1:1 kopiert. Die militärische <strong>Antenne</strong> musste für den vorgesehenen Verwendungszweck<br />
leicht und in handliche Stücke zerlegbar sein. Deshalb h<strong>at</strong> man anst<strong>at</strong>t der<br />
Kreisform <strong>die</strong> Form eines Oktagons gewählt. Das Bild zeigt auch, dass <strong>die</strong> einzelnen Seiten<br />
des Oktagons zusammengeklemmt waren und genau da lag der Pferdefuss <strong>die</strong>ser <strong>Antenne</strong>nentwicklung.<br />
Die Militärs h<strong>at</strong>ten der Story zufolge zu „gold pl<strong>at</strong>ing“ gegriffen <strong>um</strong> <strong>die</strong><br />
Übergangswiderstände in den Griff zu kriegen. In der Praxis zeigte aber <strong>die</strong> militärische<br />
Ausführung der <strong>Antenne</strong> trotz „gold-pl<strong>at</strong>ing“ keine so überzeugenden Vorteile, dass <strong>die</strong>se<br />
<strong>Antenne</strong>nform in der Praxis echt eingesetzt wurde. Man h<strong>at</strong> es einfach nicht fertiggebracht<br />
<strong>die</strong> Übergangswiderstände so zu reduzieren, dass <strong>die</strong> <strong>Antenne</strong> einen anständigen Wirkungsgrad<br />
h<strong>at</strong>te. Die <strong>Antenne</strong> war also sowohl bei der Swiss Army wie auch bei den Amis<br />
ein Flop und ist nicht über das Experimentierstadi<strong>um</strong> herausgekommen.<br />
Später haben sich dann <strong>die</strong> Funkam<strong>at</strong>eure<br />
der Idee angenommen und daraus brauchbare<br />
magnetische <strong>Antenne</strong>n entwickelt. Die<br />
sind zwar nicht in handliche Stücke zerlegbar<br />
aber sie funktionieren.<br />
Das Bild zeigt eine käufliche Version einer<br />
Magnetantenne hergestellt von MFJ.<br />
Ich habe schon diverse QSO’s mit OM’s<br />
gehabt <strong>die</strong> Magnetantennen verwendet<br />
haben. Deren Signale waren jedes Mal im<br />
Rahmen des üblichen, d.h. Mittelmass.<br />
Max Rüegger, HB9ACC 38/42<br />
März 2007
<strong>Rund</strong> <strong>um</strong> <strong>die</strong> <strong>Antenne</strong><br />
Teil 7: spannungsgespeiste <strong>Antenne</strong>n, verkürzte <strong>Antenne</strong>n, Sonderformen<br />
7.3.2 Die ISOTRON-<strong>Antenne</strong><br />
Die ISOTRON-<strong>Antenne</strong> ist <strong>die</strong> Umkehrung des bei den magnetischen <strong>Antenne</strong>n angewendeten<br />
Prinzips.<br />
Das magnetische Feld bleibt in der Spule konzentriert, während ein<br />
ausgeprägtes elektrisches Feld aus dem geöffneten Kondens<strong>at</strong>or austritt.<br />
Diese <strong>Antenne</strong>nart wird von der US-Firma ISOTRON hergestellt und vertrieben. Es dürfte<br />
aber auch möglich sein <strong>die</strong>se <strong>Antenne</strong>nart selbst herzustellen.<br />
Es liegt in der N<strong>at</strong>ur der Sache, dass es sich bei <strong>die</strong>ser <strong>Antenne</strong>nform <strong>um</strong> reine Ein-Band-<br />
<strong>Antenne</strong>n handelt. ISOTRON stellt für jedes Band zwischen 160 m und 10 m solche <strong>Antenne</strong>n<br />
her.<br />
Die Praxiserfahrungen sind gemischt. Es gibt aber diverse glaubhafte Berichte <strong>die</strong> bestätigen,<br />
dass man mit ISOTRON-<strong>Antenne</strong>n t<strong>at</strong>sächlich QSO abwickeln kann.<br />
Das nebenstehende Bild zeigt zwei<br />
ISOTRON <strong>Antenne</strong>n im Multipack<br />
links = 40 m Ausführung<br />
rechts = 20 m Ausführung<br />
IISOTRON ist übrigens der Name des<br />
Herstellers solcher <strong>Antenne</strong>. Meines<br />
Wissens h<strong>at</strong> sich sonst noch kein anderer<br />
Hersteller <strong>die</strong>ses <strong>Antenne</strong>nprinzips<br />
angenommen.<br />
Ich denke für experimentierfreudige<br />
OM’s dürfte auch ein Selbstbau möglich<br />
sein.<br />
Max Rüegger, HB9ACC 39/42<br />
März 2007
<strong>Rund</strong> <strong>um</strong> <strong>die</strong> <strong>Antenne</strong><br />
Teil 7: spannungsgespeiste <strong>Antenne</strong>n, verkürzte <strong>Antenne</strong>n, Sonderformen<br />
7.3.3 <strong>Antenne</strong>n mit Widerstands-Abschluss<br />
<strong>Antenne</strong>n mit Widerstands-Abschluss funktionieren<br />
t<strong>at</strong>sächlich.<br />
Der Widerstand muss für<br />
ca. 35 - 40 % der Sendeleistung<br />
ausgelegt sein.<br />
Im nebenstehenden Beispiel h<strong>at</strong> der Widerstand<br />
einen Wert von 200 Ω und man kann<br />
seitlich eine beliebige Länge Draht benützten.<br />
Im untenstehenden Beispiel h<strong>at</strong> der Widerstand<br />
einen Wert von 650 Ω und <strong>die</strong> Länge der<br />
<strong>Antenne</strong> wird mit 14.35 m angegeben.<br />
Diese Art <strong>Antenne</strong>n weisen alle generell folgende Vor- und Nachteile auf:<br />
• Vorteile:<br />
- Breitbandigkeit, d.h. innerhalb einem Frequenzverhältnis von etwa 5:1 erhält<br />
man eine rel<strong>at</strong>iv flache SWR Kurve.<br />
• Nachteile:<br />
- ein Teil der Leistung wird verbr<strong>at</strong>en<br />
- der Wirkungsgrad verschlechtert sich bei tiefen Frequenzen dram<strong>at</strong>isch, <strong>die</strong>s<br />
infolge zu kurzer Drahtlänge im Vergleich zur Wellenlänge<br />
<strong>Antenne</strong>n mit Widerstandsabschluss sind sehr populär bei kommerziellen Funk<strong>die</strong>nsten.<br />
Die Senderausgänge sind ohnehin alle auf 50 Ω ausgelegt. Das Personal besteht ka<strong>um</strong><br />
mehr aus qualifizierten Funkern. Deshalb muss man <strong>die</strong>sen Leuten eine <strong>Antenne</strong> in <strong>die</strong><br />
Hand geben, <strong>die</strong> sie einfach einstecken können und dann geht’s.<br />
Kommerzielle Ausführungen solcher <strong>Antenne</strong>n stammen häufig aus Australien. Überall dort<br />
wo das Handy sagt „keine Verbindung“ beginnt in Australien der Outback. Wenn man dort<br />
Max Rüegger, HB9ACC 40/42<br />
März 2007
<strong>Rund</strong> <strong>um</strong> <strong>die</strong> <strong>Antenne</strong><br />
Teil 7: spannungsgespeiste <strong>Antenne</strong>n, verkürzte <strong>Antenne</strong>n, Sonderformen<br />
mit jemandem Verbindung aufnehmen will hilft nur noch Short-Wave. Man h<strong>at</strong> dann z.B. im<br />
Auto einen kleinen HF-Transceiver und eben eine solche Drahtantenne mit Widerstandsabschluss.<br />
Das ist dann „Funken für D<strong>um</strong>mies“, aber es funktioniert ganz prima. Man will ja<br />
kein DX erzielen, man will lediglich mit einer der im ganzen Land verteilten kommerziellen<br />
Funkst<strong>at</strong>ionen Verbindung aufnehmen, <strong>die</strong> einem auf das Telefonnetz weiterschalten.<br />
Auch im Am<strong>at</strong>eurfunk kann es ab und zu Situ<strong>at</strong>ionen geben wo eine solche <strong>Antenne</strong> Sinn<br />
macht.<br />
Bei einem lieben Bekannten h<strong>at</strong>ten wir folgende Situ<strong>at</strong>ion:<br />
• Mehrfamilienhaus mit Eigent<strong>um</strong>swohnungen.<br />
• keine Chance ein Bewilligung z<strong>um</strong> Anbringen einer Aussenantenne zu erwirken.<br />
• Balkon ist vorhanden, allerdings wohnt eine Etage darüber noch ein anderer<br />
Eigentümer.<br />
Mein Bekannter, der OM, h<strong>at</strong> sich dann mit dem über ihm wohnenden Nachbarn geeinigt,<br />
dass er z<strong>um</strong> Zwecke des Funkens einen Fiberglasmast aus seinem Balkon schräg nach<br />
aussen anbringen darf. Der Nachbar im oberen Stock h<strong>at</strong> <strong>die</strong>s akzeptiert. Wenn nicht<br />
gefunkt wird, dann wird der Fiberglasmast wieder eingezogen.<br />
Soweit so gut. Versuche mit dem Fiberglastmast, ca. 10 m lang, und Gegengewichten im<br />
Balkon haben mit verschiedenen Ankopplungsmethoden zu keinen vernünftigen Result<strong>at</strong>en<br />
geführt. Das SWR war nicht zu bändigen und es tr<strong>at</strong> BCI / TVI auf. Ich habe dann als letztes<br />
Mittel mal versuchsweise eine Box nach der zuerst gezeigten Schaltung mitgebracht. Darin<br />
befinden sich ein Balun 1:4 (sog. 50 Ω/200 Ω) sowie auf der 200 Ω ein Ballastwiderstand<br />
200 Ω der eine Leistung von ca. 40 … 50 W<strong>at</strong>t vernichten kann. Mit <strong>die</strong>ser Box, einem 10 m<br />
langen Draht am Fiberglasmast sowie einem ca. 10 m langen Gegengewichtsdraht, der<br />
sehr zur Freude seiner Lebenspartnerin durch ihre Geranienkistchen verlegt wurde, liess<br />
sich nun Funkbetrieb durchführen. Das SWR hielt sich in Grenzen und BCI / TVI tritt auch<br />
nicht mehr auf. Zweck erreicht, der OM kann funken.<br />
Solche <strong>Antenne</strong>n sind zwar niemals Hochleistungsantennen und ich empfehle immer zuerst<br />
alle anderen Möglichkeiten auszuloten. Aber, wenn’s nicht anders geht, dann sind solche<br />
„Heizöfeli“-Schaltungen immer noch besser als „nicht funken“.<br />
Max Rüegger, HB9ACC 41/42<br />
März 2007
<strong>Rund</strong> <strong>um</strong> <strong>die</strong> <strong>Antenne</strong><br />
Teil 7: spannungsgespeiste <strong>Antenne</strong>n, verkürzte <strong>Antenne</strong>n, Sonderformen<br />
7.3.4 EH-<strong>Antenne</strong>n<br />
Es handelt sich dabei <strong>um</strong> eine neue Form<br />
stark verkürzter <strong>Antenne</strong>n. Die ersten Publik<strong>at</strong>ionen<br />
dazu erschienen Ende der 1990’er<br />
Jahre. Den Publik<strong>at</strong>ionen zufolge geben <strong>die</strong><br />
Erfinder und Hersteller solcher <strong>Antenne</strong>n<br />
bekannt <strong>die</strong>se <strong>Antenne</strong>form sei mit einem<br />
Dipol vergleichbar.<br />
Im Internet findet man rel<strong>at</strong>iv viel Inform<strong>at</strong>ion<br />
zu <strong>die</strong>ser Art <strong>Antenne</strong>. Die Kommentar aus<br />
der Praxis sind gemischt. Es gibt OM‘s <strong>die</strong><br />
<strong>die</strong> <strong>Antenne</strong> nachgebaut haben <strong>die</strong> aussagen:<br />
„Man kann zwar damit QSO‘s fahren, aber<br />
jeder Dipol ist weit wirkungsvoller.“<br />
Hier der Vollständigkeit halber noch das<br />
elektrische Schaltbild einer EH <strong>Antenne</strong>.<br />
Ich selbst habe leider noch nie Gelegenheit<br />
gehabt eine solche <strong>Antenne</strong> zu sehen oder<br />
damit zu Arbeiten.<br />
Aus <strong>die</strong>se Grunde bin ich nicht in der Lage<br />
dazu einen weitergehenden Kommentar<br />
abzugeben.<br />
Max Rüegger, HB9ACC 42/42<br />
März 2007