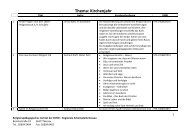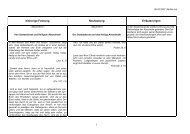Garscha, Elisabeth - RPI der EKHN
Garscha, Elisabeth - RPI der EKHN
Garscha, Elisabeth - RPI der EKHN
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Elisabeth</strong> von Thüringen im Unterricht <strong>der</strong> Sek I<br />
von Jörg <strong>Garscha</strong><br />
Es ist keinesfalls einfach, die Bedeutung <strong>Elisabeth</strong>s<br />
für heute einzuschätzen. Denn bereits mit ihrem Tod<br />
beginnt eine »Vermarktung« ihrer Person. Ein Sinnbild<br />
dafür ist <strong>der</strong> kostbare goldene Schrein, in dem ihre<br />
Gebeine in <strong>der</strong> <strong>Elisabeth</strong>kirche zu Marburg aufbewahrt<br />
wurden. Er steht in krassem Gegensatz zu ihrem Umgang<br />
mit Gold und Geld. Auch wenn <strong>Elisabeth</strong> bewusst<br />
ihren fürstlichen Stand verlassen hatte, um in Armut<br />
und von ihrer eigenen Hände Arbeit zu leben, wurde sie<br />
nach ihrem Tod als »Königstochter« nachträglich von<br />
Kaiser Friedrich II gekrönt und als »Ahnfrau« <strong>der</strong> hessischen<br />
Fürsten zum Symbol fürstlicher Herrschaftsansprüche<br />
gemacht.<br />
Typisch ist auch das Schicksal<br />
des von ihr gegründeten Hospitals.<br />
<strong>Elisabeth</strong> hatte es zur Betreuung <strong>der</strong><br />
Armen und Kranken aus Marburg<br />
und Umgebung errichtet. Nach<br />
Übernahme durch den Deutschen<br />
Orden wurde es – entgegen <strong>der</strong> ursprünglichen<br />
Absicht – im 15. Jahrhun<strong>der</strong>t<br />
zu einem <strong>der</strong> bedeutendsten<br />
Deutschordenshospitale für die<br />
Pflege von Ordensbrü<strong>der</strong>n und begüterter<br />
Kranken. Schon diese<br />
»Nutzung« <strong>Elisabeth</strong>s, die bis in die<br />
Gegenwart reicht, könnte Thema<br />
des Unterrichts sein und damit an<br />
einem Beispiel Grundfragen des<br />
christlichen Glaubens und seiner gesellschaftlichen<br />
Auswirkungen behandeln.<br />
An <strong>Elisabeth</strong> von Thüringen entzünden<br />
sich Fragen, die trotz mancher<br />
historischer Unklarheiten auch<br />
für die Gegenwart Bedeutung haben.<br />
Sechs solcher Fragenkomplexe<br />
sind:<br />
Buch und Lernzirkel zu <strong>Elisabeth</strong> von Thüringen<br />
1. »Die peinliche Frage« – <strong>Elisabeth</strong><br />
protestiert gegen Unrecht.<br />
Ausgehend von <strong>der</strong> Überlieferung,<br />
dass <strong>Elisabeth</strong> es als Fürstin demonstrativ<br />
vermied, Speisen zu sich zu<br />
nehmen, die aus unrechtmäßigem<br />
Erwerb stammten, kann die Frage<br />
nach Formen des Wi<strong>der</strong>standes gegen<br />
Unrecht gestellt werden. Auch<br />
ist es denkbar, sich daran anknüpfend<br />
mit <strong>der</strong> Arbeit <strong>der</strong> Weltläden,<br />
und <strong>der</strong> Frage nach <strong>der</strong> Herkunft von<br />
Lebensmitteln und Kleidungsstücken<br />
heute zu beschäftigen.<br />
2. »Contraria contrariis curare« –<br />
<strong>Elisabeth</strong> überwindet Gegensätze<br />
<strong>Elisabeth</strong> hat in Überwindung<br />
bestehen<strong>der</strong> Standesunterschiede<br />
selbst die Pflege von Kranken übernommen<br />
und damit die übliche Armenfürsorge<br />
durch Almosengeben<br />
mit einem Akt bewusster Gleichstellung<br />
erweitert. Damit ist die Frage<br />
nach <strong>der</strong> Überbrückung von Gegensätzen<br />
zwischen Menschen gestellt,<br />
die in Blick auf Armut und Reichtum<br />
in Deutschland und in <strong>der</strong> Welt sowie<br />
auf das Leben von Obdachlosen<br />
konkretisiert werden könnte.<br />
3. Abstieg von <strong>der</strong> Burg –<br />
Durch Verzicht gewinnen<br />
<strong>Elisabeth</strong> hat nach dem Tod ihres<br />
Mannes bewusst auf ein standesgemäßes<br />
Leben verzichtet. Daher kann<br />
an ihr die Frage des Verzichts (z.B.<br />
Fasten, Simplify your life) bzw. des<br />
Lebens in Armut (z.B. Roger Schutz,<br />
Klöster) gestellt werden.<br />
Zu den hier genannten sechs Fragenkomplexen liegen ausgearbeitete Unterrichtseinheiten/Stationen<br />
vor in dem Buch: Jörg <strong>Garscha</strong>, Hartmuth Koch, Jutta Soltendieck-<br />
Vuraldi: <strong>Elisabeth</strong> von Thüringen, Lernzirkel für den Religionsunterricht in <strong>der</strong> Sekundarstufe,<br />
Auerverlag, Donauwörth 2006, (ISBN 978-3-403-03384-8).<br />
Die sechs Stationen sind eingebettet in zwei Einstiegsmodule, durch die die Schülerinnen<br />
und Schüler über Bil<strong>der</strong> ihre Kenntnisse zum Mittelalter und zu <strong>Elisabeth</strong> zusammentragen<br />
können und ein Abschlussmodul, das zu einer Auseinan<strong>der</strong>setzung mit einem<br />
<strong>Elisabeth</strong>bild heute anregt. Dabei wurde die Grundstruktur des von Reinhard Kunz<br />
im Auerverlag veröffentlichten Unterrichtsentwurfes zu Franz von Assisi übernommen<br />
(Donauwörth 2002, ISBN 3-403-03384-8).<br />
Die Aufgabenstellung zu je<strong>der</strong> Station besteht zunächst aus einer kurzen Information<br />
über <strong>Elisabeth</strong> und einem entsprechenden Bild. Dann folgt über einen Quellentext (aus<br />
dem Libellus) eine Basisinformation und die Formulierung einer Fragestellung (Sachlage/Problematik)<br />
zum Gespräch für die Schüler. Dann werden mehrere Wahlaufgaben<br />
zur Vertiefung gestellt und durch weiteres Material Hintergrundinformationen gegeben.<br />
Schließlich werden durch Anregungen für häusliche Eigenarbeit weitere Aspekte <strong>der</strong><br />
jeweiligen Thematik aufgegriffen.<br />
Teilstück aus <strong>Elisabeth</strong>s Reliquienschrein<br />
in Marburg (1236-1249).<br />
4. Freiwilliger Gehorsam –<br />
<strong>Elisabeth</strong> und Konrad<br />
Einer <strong>der</strong> schwierigsten Aspekte<br />
an <strong>Elisabeth</strong> ist ihre freiwillige<br />
Unterwerfung unter Konrad und den<br />
damit verbundenen Demütigungen.<br />
Auch heute gibt es Formen des Gehorsams,<br />
<strong>der</strong> Abhängigkeit und <strong>der</strong><br />
Begleitung, mit denen sich Jugendliche<br />
auseinan<strong>der</strong>setzen müssten.<br />
5. »Mutter <strong>der</strong> caritas« –<br />
<strong>Elisabeth</strong> gründet das Hospital<br />
Dass <strong>Elisabeth</strong> ein Hospital gründete,<br />
ist auch für die damalige Zeit<br />
nichts Ungewöhnliches. Trotzdem ist<br />
sie zum Vorbild für eine persönliche<br />
Zuwendung zu Kranken und Armen<br />
geworden. Daraus ergibt sich die<br />
Frage nach Motiven, die zu einer solchen<br />
Haltung beitragen und nach<br />
dem Vorbildcharakter <strong>Elisabeth</strong>s bis<br />
in unsere Zeit.<br />
6. »<strong>Elisabeth</strong> wird zur Heiligen« –<br />
Was bleibt von <strong>Elisabeth</strong>?<br />
Niemand kann sich mit <strong>Elisabeth</strong><br />
beschäftigen, ohne zu berücksichtigen,<br />
dass sie heilig gesprochen wurde.<br />
Infolgedessen muss es bei <strong>Elisabeth</strong><br />
auch um Reliquienverehrung,<br />
den protestantischen Protest dagegen,<br />
um das unterschiedliche Verständnis<br />
von Heiligen in <strong>der</strong> katholischen<br />
und evangelischen Kirche und<br />
um das mo<strong>der</strong>ne Phänomen des<br />
Starkultes gehen. Siehe dazu M1.<br />
Dr. Jörg <strong>Garscha</strong> ist Religionspädagogischer<br />
Studienleiter des Pädagogisch-<br />
Theologischen Instituts in Marburg.<br />
Er wird im August 2007 in den Ruhestand<br />
gehen. Wir bedanken uns hier<br />
ganz herzlich für die hervorragende<br />
Zusammenarbeit! (Harmjan Dam)<br />
24 Schönberger Hefte 2|07
M1<br />
<strong>Elisabeth</strong>-Bil<strong>der</strong><br />
Niemand weiß heute genau, wie <strong>Elisabeth</strong> von Thüringen wirklich ausgesehen hat. Aber in den vergangenen Jahrhun<strong>der</strong>ten schufen Künstler verschiedene <strong>Elisabeth</strong>-Bil<strong>der</strong>.<br />
1. Vergleiche die drei unterschiedlichen <strong>Elisabeth</strong>-Bil<strong>der</strong>. Wie ist <strong>Elisabeth</strong> auf den einzelnen Bil<strong>der</strong>n gekleidet? Was hält sie jeweils in ihren Händen? Wem wendet sie sich<br />
jeweils zu, wen sieht sie an?<br />
2. Wie charakterisieren die Künstler jeweils <strong>Elisabeth</strong>? Gebt jedem Bild einen kurzen Titel.<br />
3. Vielleicht habt ihr eine eigene Vorstellung, ein eigenes Bild von <strong>Elisabeth</strong>. Welches <strong>der</strong> Bil<strong>der</strong> <strong>der</strong> Künstler kommt eurer Vorstellung, eurem <strong>Elisabeth</strong>-Bild am nächsten?<br />
Wählt eines <strong>der</strong> drei <strong>Elisabeth</strong>-Bil<strong>der</strong> aus und begründet eure Entscheidung.<br />
Materialblatt Schönberger Hefte 2|07<br />
Abb. 1: Glasgemälde, Graz um 1320 Abb. 2: L. Juppe, <strong>Elisabeth</strong>kirche Marburg um 1510 Abb. 3: B. Kühlen, Mönchengladbach um 1905<br />
<strong>Garscha</strong>/Koch/Soltendieck-Vuraldi: <strong>Elisabeth</strong> von Thüringen, Auerverlag GmbH, Donauwörth