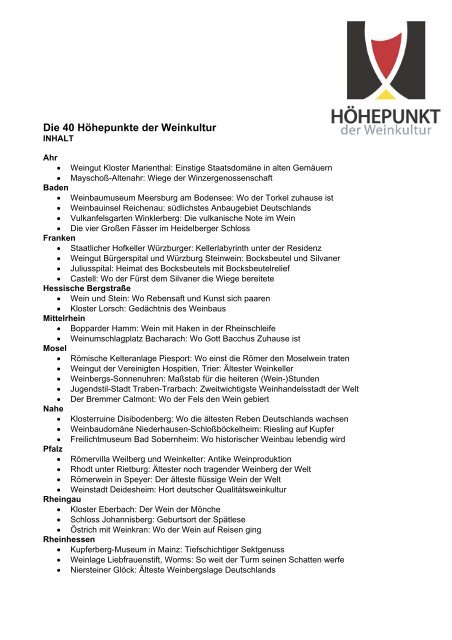Die 40 Höhepunkte der Weinkultur
Die 40 Höhepunkte der Weinkultur
Die 40 Höhepunkte der Weinkultur
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Die</strong> <strong>40</strong> <strong>Höhepunkte</strong> <strong>der</strong> <strong>Weinkultur</strong><br />
INHALT<br />
Ahr<br />
• Weingut Kloster Marienthal: Einstige Staatsdomäne in alten Gemäuern<br />
• Mayschoß-Altenahr: Wiege <strong>der</strong> Winzergenossenschaft<br />
Baden<br />
• Weinbaumuseum Meersburg am Bodensee: Wo <strong>der</strong> Torkel zuhause ist<br />
• Weinbauinsel Reichenau: südlichstes Anbaugebiet Deutschlands<br />
• Vulkanfelsgarten Winklerberg: <strong>Die</strong> vulkanische Note im Wein<br />
• <strong>Die</strong> vier Großen Fässer im Heidelberger Schloss<br />
Franken<br />
• Staatlicher Hofkeller Würzburger: Kellerlabyrinth unter <strong>der</strong> Residenz<br />
• Weingut Bürgerspital und Würzburg Steinwein: Bocksbeutel und Silvaner<br />
• Juliusspital: Heimat des Bocksbeutels mit Bocksbeutelrelief<br />
• Castell: Wo <strong>der</strong> Fürst dem Silvaner die Wiege bereitete<br />
Hessische Bergstraße<br />
• Wein und Stein: Wo Rebensaft und Kunst sich paaren<br />
• Kloster Lorsch: Gedächtnis des Weinbaus<br />
Mittelrhein<br />
• Boppar<strong>der</strong> Hamm: Wein mit Haken in <strong>der</strong> Rheinschleife<br />
• Weinumschlagplatz Bacharach: Wo Gott Bacchus Zuhause ist<br />
Mosel<br />
• Römische Kelteranlage Piesport: Wo einst die Römer den Moselwein traten<br />
• Weingut <strong>der</strong> Vereinigten Hospitien, Trier: Ältester Weinkeller<br />
• Weinbergs-Sonnenuhren: Maßstab für die heiteren (Wein-)Stunden<br />
• Jugendstil-Stadt Traben-Trarbach: Zweitwichtigste Weinhandelsstadt <strong>der</strong> Welt<br />
• Der Bremmer Calmont: Wo <strong>der</strong> Fels den Wein gebiert<br />
Nahe<br />
• Klosterruine Disibodenberg: Wo die ältesten Reben Deutschlands wachsen<br />
• Weinbaudomäne Nie<strong>der</strong>hausen-Schloßböckelheim: Riesling auf Kupfer<br />
• Freilichtmuseum Bad Sobernheim: Wo historischer Weinbau lebendig wird<br />
Pfalz<br />
• Römervilla Weilberg und Weinkelter: Antike Weinproduktion<br />
• Rhodt unter Rietburg: Ältester noch tragen<strong>der</strong> Weinberg <strong>der</strong> Welt<br />
• Römerwein in Speyer: Der älteste flüssige Wein <strong>der</strong> Welt<br />
• Weinstadt Deidesheim: Hort deutscher Qualitätsweinkultur<br />
Rheingau<br />
• Kloster Eberbach: Der Wein <strong>der</strong> Mönche<br />
• Schloss Johannisberg: Geburtsort <strong>der</strong> Spätlese<br />
• Östrich mit Weinkran: Wo <strong>der</strong> Wein auf Reisen ging<br />
Rheinhessen<br />
• Kupferberg-Museum in Mainz: Tiefschichtiger Sektgenuss<br />
• Weinlage Liebfrauenstift, Worms: So weit <strong>der</strong> Turm seinen Schatten werfe<br />
• Niersteiner Glöck: Älteste Weinbergslage Deutschlands
Saale-Unstrut<br />
• Steinernes Bil<strong>der</strong>buch: Albumblätter für den Wein<br />
• Rotkäppchen Sektkellerei: 150 Jahre Sektgeschichte mit Cuvéefass<br />
• <strong>Die</strong> Weinbergshäuschen von Saale-Unstrut – Ensemble Schweigenberg<br />
Sachsen<br />
• Staatsweingut Schloss Wackerbarth: älteste Sektkellerei Sachsens<br />
• Hoflößnitz: Sachsenkeule und Weinfeste <strong>der</strong> Kurfürsten<br />
Württemberg<br />
• Kessler in Esslingen: Älteste Sektkellerei Deutschlands<br />
• Pfedelbach: Fürstenfass und Herrschaftskelter
Ahr<br />
Mayschoß-Altenahr: Wiege <strong>der</strong> Winzergenossenschaft<br />
<strong>Die</strong> Wiege <strong>der</strong> Winzergenossenschaften, sie steht in Mayschoß an <strong>der</strong> Ahr. Im Jahr 1868,<br />
genau am 20. Dezember, wurde hier von 18 Winzern die erste Winzergenossenschaft <strong>der</strong><br />
Weinbaugeschichte aus <strong>der</strong> Taufe gehoben. <strong>Die</strong> Vereinigung wurde ein Jahr später unter<br />
dem Namen „Winzer Verein zu Mayschoß – Eingetragene Genossenschaft“ in das<br />
Handels- und Genossenschaftsregister in Koblenz eingetragen. Erster Präsident wurde<br />
Nikolaus Näkel.<br />
Es war eine Geburt aus <strong>der</strong> Not heraus: Seit etwa 1860 war <strong>der</strong> Weinbau an <strong>der</strong> Ahr in<br />
einer tiefen Krise, verursacht durch Missernten, die Reblaus und den Zusammenbruch des<br />
Weinhandels zwischen den preußischen Gebieten und den europäischen Nachbarn. Der<br />
Zusammenschluss versprach Hilfe in <strong>der</strong> Not, bis zum Ende des 19. Jahrhun<strong>der</strong>ts wurden<br />
an <strong>der</strong> Ahr rund 20 Winzergenossenschaften gegründet. Noch heute sind 90 Prozent <strong>der</strong><br />
Ahr-Winzer in zwölf Winzergenossenschaften organisiert.<br />
<strong>Die</strong> Mayschoßer Genossenschaft wuchs schnell, bereits 1881 wurden 141 Mitglie<strong>der</strong><br />
gezählt. 1873 hatten die Winzer begonnen, erste Gänge eines großen Gewölbekellers zu<br />
errichten. 1888 und 1889 kam dann <strong>der</strong> zweite und größte Kellergang zur Fasslagerung<br />
hinzu, ebenso <strong>der</strong> erste Stock des heutigen Bürogebäudes. 1968 feierten bereits 2<strong>40</strong><br />
Mitglie<strong>der</strong> das 100-jährige Bestehen <strong>der</strong> Genossenschaft. 1982 wurde die Fusion mit <strong>der</strong><br />
Winzergenossenschaft von Altenahr beschlossen, seitdem lautet <strong>der</strong> Name<br />
Winzergenossenschaft Mayschoß-Altenahr. An die Geschichte des Weinbaus in <strong>der</strong><br />
Region erinnert in den Kellergewölben ein kleines Weinbaumuseum. Hier sind allerlei<br />
Geräte aus <strong>der</strong> Traubenbereitung zu sehen, etwa Kiepen, Handwagen zum<br />
Traubentransport, Scheren-Modelle, eine Traubenmühle aus dem Jahr 1900, eine<br />
Handkorkmaschine und eine halbautomatische Flaschenspülmaschine.<br />
<strong>Die</strong> Winzervereinigung hat heute 320 Mitglie<strong>der</strong>, die eine Rebfläche von 121 Hektar<br />
bewirtschaften. 60 Prozent davon sind im Rotwein-Land Ahr mit Spätburgun<strong>der</strong><br />
bewachsen, auf 20 Prozent wachsen Rieslingtrauben. Mit einer Jahresproduktion von<br />
mehr als einer Million Litern gehört die Winzergenossenschaft zu den mittelgroßen in<br />
Deutschland - und zu den besten: 2000 wurde die Genossenschaft im renommierten Gault<br />
Millau zur "Entdeckung des Jahres" gekürt und wird dort als einzige Genossenschaft mit<br />
drei Trauben geführt. Zum 1<strong>40</strong>. Jubiläum <strong>der</strong> Genossenschaft im Jahr 2008 gab es einen<br />
Jubiläumswein, gekeltert aus dem sehr guten Jahrgang 2007 – natürlich ein<br />
Spätburgun<strong>der</strong>.<br />
Infokasten<br />
Winzergenossenschaft Mayschoß-Altenahr eG<br />
Ahrrotweinstraße 42<br />
53508 Mayschoß/Ahr<br />
Telefon: +49 2643 – 9360-0<br />
Fax: +49 2643 – 9360-93<br />
www.winzergenossenschaft-mayschoss.de<br />
Öffnungszeiten:<br />
Mai bis Oktober<br />
täglich von 9:00 bis 18:30 Uhr,<br />
auch Sonn- und Feiertags<br />
November bis April<br />
Montags bis Freitags von 8:00 bis 18:00 Uhr<br />
Samstags, Sonn- und Feiertags von 10:00 bis<br />
18:00 Uhr.
Weingut Kloster Marienthal: Einstige Staatsdomäne in alten Gemäuern<br />
Es war einst das älteste Kloster an <strong>der</strong> Ahr, <strong>der</strong> Nonnenkonvent <strong>der</strong> Augustinerinnen bei<br />
Dernau. 1137 wurde das Kloster Marienthal gegründet, und für die religiösen Frauen war<br />
das Leben offenbar nicht leicht: Von Prozessen und Ärger mit den Nachbargemeinden ist<br />
in alten Annalen die Rede, auch sorgte <strong>der</strong> Hubach für häufige Überschwemmungen.<br />
Sieben Werkstätten beherbergte das Kloster, darunter auch eine Brennerei und ein<br />
Gästehaus – und natürlich besaß man "Weingärten". Heute blüht in den Ruinen <strong>der</strong> alten<br />
Mauern wie<strong>der</strong> neues Leben: 2004 kaufte ein Zusammenschluss von Winzern <strong>der</strong><br />
Marienthaler Umgebung die ehemalige Staatsdomäne. Kloster Marienthal wurde wie<strong>der</strong> zu<br />
einem privaten Weingut.<br />
Bis zum Dreißigjährigen Krieg konnten sich die Nonnen in Marienthal halten, dann – im<br />
Jahr 1646 – plün<strong>der</strong>ten die Schweden das Kloster, 1646 brannten die Franzosen es<br />
endgültig nie<strong>der</strong>. Der Wie<strong>der</strong>aufbau begann 1699, <strong>der</strong> Garten wurde erweitert und bekam<br />
im Jahr 1762 sogar einen Gartenpavillon, <strong>der</strong> bis heute erhalten ist. Doch 1802 kam das<br />
endgültige Aus: Der französische Kaiser Napoleon Bonaparte verfügte nach <strong>der</strong><br />
Eroberung <strong>der</strong> Lande die Säkularisierung <strong>der</strong> Klöster, danach wurden die Gebäude<br />
verkauft, das Gotteshaus verfiel zur Ruine. Zum Zeitpunkt <strong>der</strong> Auflösung hatte das Kloster<br />
einen Küfer samt Gesellen beschäftigt, so berichten es die Annalen, dazu "vier <strong>Die</strong>ner für<br />
die Weinbergskultur".<br />
Wein wurde auch danach weiter angebaut, von wechselnden Besitzern. 1910 ließ einer<br />
von ihnen ein großes Herrenhaus errichten, das bald von <strong>der</strong> Ahrtalbahn als<br />
Verwaltungsgebäude gekauft wurde. 1925 wurde das Anwesen zur Preußisch Staatlichen<br />
Weinbaudomäne Marienthal. 1952 wurde ein Teil <strong>der</strong> 19 Hektar Rebhänge in eine<br />
Versuchsanstalt des Landes Rheinland-Pfalz zur Züchtung neuer Rebsorten<br />
umgewandelt. Von 2004 an entstand in den alten Ruinen von 1137 ein mo<strong>der</strong>nes Weingut,<br />
das von den Winzergenossenschaften Dagenova und Mayschoß-Altenahr sowie den<br />
privaten Weingütern Brogsitter und Meyer-Näkel gemeinsam betrieben wird.<br />
Infokasten<br />
Weingut Kloster Marienthal<br />
Franz-Josef Appel<br />
Klosterstraße 3-5<br />
53507 Marienthal<br />
Telefon (0 26 41) 9 80 60<br />
Fax (0 26 41) 98 06 20<br />
Email: mail@weingut-kloster-marienthal.de<br />
Internet: www.weingut-kloster-marienthal.de<br />
Ahr Rhein Eifel Tourismus & Service GmbH<br />
Klosterstraße 3-5<br />
53507 Marienthal<br />
Tel.: 02641/ 9773-0<br />
Fax: 02641/9773-73<br />
E-Mail: info@ahr-rhein-eifel.de<br />
Internet: www.ahr-rhein-eifel.de
Baden<br />
Weinbaumuseum Meersburg am Bodensee: Wo <strong>der</strong> Torkel zuhause ist<br />
Von <strong>der</strong> "Torkel", <strong>der</strong> Weinkelter, hat dieses Museum seinen Namen: "Heilig Geist Torkel".<br />
Das kleine Museum wurde 1961 in den Räumen des ehemaligen Meersburger Heilig-<br />
Geist-Spitals eingerichtet. Im Untergeschoss befand sich einst <strong>der</strong> Torkel, eine Weinkelter,<br />
die noch heute erhalten ist: <strong>der</strong> Heilig-Geist-Torkel von 1607 ist die wohl älteste noch<br />
erhaltene und funktionsfähige Kelter des Bodenseegebietes. Bis 1922 war diese wuchtige<br />
Baumkelter noch in Betrieb. Sie ist ein Denkmal <strong>der</strong> Jahrhun<strong>der</strong>te alten <strong>Weinkultur</strong> am<br />
Bodensee und vor allem seiner Weinstadt Meersburg.<br />
Prähistorische Funde am Bodensee legen nahe, dass es erste Wildreben hier schon lange<br />
vor den Römern gab. <strong>Die</strong> brachten später neue Sorten wie den Elbling und Begriffe wie<br />
den „Torkel“ mit: Das Wort kommt von „torquere“ für drehen und wurde zum Fachwort für<br />
die mächtigen Weinpressen. <strong>Die</strong> erste dokumentierte <strong>Weinkultur</strong> wird Karl Martell<br />
zugeschrieben, dem Hausmeier <strong>der</strong> Merowinger, <strong>der</strong> um 724 erste Reben bei Ermatingen<br />
am Untersee Reben gepflanzt haben soll.<br />
In Meersburg ist <strong>der</strong> Weinbau seit 1324 urkundlich belegt, die Fläche umfasst heute rund<br />
120 Hektar und liefert etwa eine Million Liter Wein. Möglich macht den Weinanbau in<br />
dieser immerhin bis zu 500 Meter hohen Gegend das beson<strong>der</strong>e Seeklima: Der Bodensee<br />
wirkt als riesiger Wärmespeicher, <strong>der</strong> das Klima mild macht. Von <strong>der</strong> Wasserreflexion<br />
profitieren dazu beson<strong>der</strong>s die Hanglagen am See – ihre Blätter erhalten mehr Licht. Dazu<br />
sorgt die Höhenlage aber auch für kühle Nächte, das bringt die beson<strong>der</strong>e Fruchtigkeit in<br />
die Weine.<br />
Das Gebäude des Meersburger Heilig-Geist-Spitals wurde im 17. Jahrhun<strong>der</strong>t errichtet.<br />
Der Weinbau diente zur Finanzierung <strong>der</strong> karitativen Einrichtung. <strong>Die</strong> Gegenstände des<br />
Museums sammelte in den 1950er Jahren <strong>der</strong> damalige Kellermeister des<br />
Staatsweingutes Meersburg, Willy Stingl. Zu sehen sind etwa schön geschnitzte<br />
Fassböden, eine Flaschensammlung, ein alter „Buttenkarren“ – ein Traubenwagen –<br />
sowie zahlreiche traditionelle Küferwerkzeuge. Hauptattraktionen aber sind das<br />
"Türkenfass", ein reich verziertes Weinfass <strong>der</strong> Deutsch-ordenskommende Mainau, mit<br />
einem Fassungsvermögen von rund 50 000 Litern – und eben <strong>der</strong> Heilig-Geist-Torkel.<br />
Infokasten<br />
Weinbaumuseum<br />
Vorburggasse 11<br />
88709 Meersburg<br />
Telefon: 0 75 32 / 4 <strong>40</strong>-<strong>40</strong>0<br />
www.meersburg.de/ceasy/modules/cms/main.php5?cPageId=160<br />
Öffnungszeiten:<br />
Geöffnet von April bis Oktober<br />
<strong>Die</strong>nstag, Freitag und Sonntag<br />
jeweils von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr<br />
Eintrittspreise:<br />
Eintritt 2,00 €<br />
mit Gästekarte 1,50 €<br />
Kin<strong>der</strong> bis 6 Jahre frei<br />
Freier Eintritt mit <strong>der</strong> Bodensee Erlebniskarte<br />
Weitere Informationen<br />
www.bodenseetouren.de/portrait/wein-und-winzer-auf-hoehenfluegen
Weinbauinsel Reichenau: südlichstes Anbaugebiet Deutschlands<br />
Mitten im Bodensee wachsen die südlichsten Weinreben Deutschlands: auf <strong>der</strong> Insel<br />
Reichenau. Heute ist sie mehr bekannt als "Gemüseinsel", doch <strong>der</strong> Weinanbau bildete<br />
über Jahrhun<strong>der</strong>te hinweg die wirtschaftliche Grundlage für die Bauern auf <strong>der</strong> Insel. <strong>Die</strong><br />
ersten Reben pflanzte Abt Hatto I. vom Kloster Reichenau auf <strong>der</strong> Bodenseeinsel, das war<br />
im Jahr 818. Erst 724 war die Insel überhaupt besiedelt worden. Der Wan<strong>der</strong>bischof<br />
Priminius errichtete auf dem Urwald artig bewachsenen Gelände das erste<br />
Benediktinerkloster. Schon Abt Walahfrid Strabo musste, so erzählt es die Geschichte,<br />
Mitte des 9. Jahrhun<strong>der</strong>ts zahlreiche Rebleute auf die Insel holen, um die Arbeit zu<br />
bewältigen.<br />
Der Bodensee ist "schuld" an dem Erfolg <strong>der</strong> Reichenau-Weine: <strong>Die</strong> Wasserfläche rund<br />
um die Insel wirkt als großer Wärmespeicher und Lichtreflektor, <strong>der</strong> beson<strong>der</strong>s im Herbst<br />
und Winter seine Wärme an die Rebhänge abgibt. Wie eine natürliche Klimaanlage sorgt<br />
<strong>der</strong> See für geringe Temperaturschwankungen und verhin<strong>der</strong>t Frühjahrs- und Herbstfröste.<br />
Dazu kommt die hohe Sonnenscheindauer – ein ideales Klima für den Weinbauanbau. Bis<br />
zu 1<strong>40</strong> Hektar Rebflächen wurden hier einst bewirtschaftet, <strong>der</strong> Höhepunkt im Jahr 1913.<br />
In dem Jahrhun<strong>der</strong>t zuvor hatten auch die Reichenauer Winzer unter schlechten Ernten,<br />
Rebschädlingen und dem allgemeinen Preisverfall beim Wein zu leiden gehabt. 1896<br />
gründete deshalb <strong>der</strong> Reichenauer Pfarrer Meinrad Meier zusammen mit 62 Winzern den<br />
Winzerverein Reichenau, heute die kleinste selbstständige Winzergenossenschaft in<br />
Baden. Sie bewirtschaftet noch 18 Hektar Rebflächen auf <strong>der</strong> Klosterinsel, die seit dem<br />
Jahr 2000 Unesco-Weltkulturerbe ist. <strong>Die</strong> Weine werden heute noch im alten Klosterkeller<br />
gekeltert – natürlich nach neuesten Erkenntnissen. Probieren kann man die Ergebnisse<br />
unter an<strong>der</strong>em beim Wein- und Fischerfest im August – und natürlich im Weinverkauf.<br />
Infokasten<br />
Winzerverein Insel Reichenau eG<br />
Münsterplatz 4<br />
78479 Reichenau<br />
Telefon: 0049 (0) 7534 293<br />
Telefax: 0049 (0) 7534 998662<br />
E-Mail: info@winzerverein-reichenau.de<br />
www.winzerverein-reichenau.de<br />
Öffnungszeiten für den Weinverkauf:<br />
Mo / Di / Do / Fr:<br />
9- 12 Uhr und 14 - 17.30 Uhr<br />
Mi / Sa:<br />
9 - 12 Uhr
Vulkanfelsgarten Winklerberg: <strong>Die</strong> vulkanische Note im Wein<br />
Auf den Resten eines vor 15 Millionen Jahren erloschenen Vulkans wächst in Ihringen am<br />
Kaiserstuhl <strong>der</strong> Wein. Zwei Lavaströme, poröses Auswurfgestein, Lavabomben - <strong>der</strong><br />
Winklerberg hat alles, was ein alter Vulkan braucht. Berühmt aber ist er durch das, was<br />
auf <strong>der</strong> Lava so hervorragend gedeiht: Seit 962 wird in <strong>der</strong> Gemeinde am Kaiserstuhl Wein<br />
angebaut – mindestens. Wahrscheinlich waren schon die Römer in Sachen Weinbau hier<br />
aktiv, schließlich ist <strong>der</strong> Kaiserstuhl das sonnenreichste und wärmste Rebengebiet in<br />
Deutschland.<br />
Schon im Jahr 962 war Ihringen eine beachtliche Rebengemeinde, heute gehört die<br />
Gemeinde westlich von Freiburg mit ihren rund 600 Hektar Rebflächen zu einer <strong>der</strong><br />
größten Weinbaugemeinden Deutschlands. Ihre berühmteste Lage ist <strong>der</strong> Winklerberg,<br />
<strong>der</strong> seinen Namen von dem verwinkelten Charakter seiner Rebanlagen hat. <strong>Die</strong> steilen<br />
Vulkanverwitterungsböden mit Kalkeinschlüssen sind heute in Terrassen gezähmt und<br />
ergeben gehaltvolle, mineralische Weine.<br />
Natur und Weine in höchster Qualität - unter diesem Motto steht denn auch <strong>der</strong> im<br />
Oktober 2006 eingeweihte Rundweg durch den Vulkanfelsgarten im Winklerberg. Entlang<br />
des beschil<strong>der</strong>ten Rundwegs gibt es allerlei Geschichten rund um Geologie, Natur und vor<br />
allem den Wein zu erfahren. Der Weg führt vorbei am Alten Rebhäusle, dem<br />
"Winklerbergbrünnele", und einem historischen Treppenweg, allesamt Zeugnisse einer<br />
alten <strong>Weinkultur</strong>. Zu <strong>der</strong> gehört auch die Pioniertat des Winzers Georg Ernst Lythin: Der<br />
pflanzte 1813 am Winklerberg erstmals Edelsorten wie Burgun<strong>der</strong>, Traminer und<br />
Muskateller – die Geburtsstunde des Kaiserstühler Edelweinbaus – Dank des<br />
Vulkangesteins.<br />
Infokasten<br />
Vulkanfelsgarten Winklerberg<br />
Beginn in Ihringen hinter dem jüdischen Friedhof<br />
www.ihringen.de/servlet/PB/menu/1335773_l2/index.html<br />
Gemeinde Ihringen<br />
Bachenstraße 42<br />
79241 Ihringen am Kaiserstuhl<br />
Tel.: 0 76 68 / 71 08 - 0<br />
Fax: 0 76 68 / 71 08 - 50<br />
Email: gemeinde@ihringen.de<br />
www.ihringen.de<br />
Weitere Informationen<br />
http://www.kaiserstuhl.eu/Orte/Ihringen/ihringen.htm<br />
Projektpartner<br />
Weingut Dr. Heger<br />
Bachenstr. 21, 79241 Ihringen, 0 76 68/78 33<br />
Ecovin-Weingut Hubert Lay<br />
Scherkhofenstr. 52, 79241 Ihringen, 0 76 68/18 70<br />
Winzergenossenschaft Ihringen<br />
Winzerstr. 6, 79241 Ihringen, 0 76 68/9 03 60
<strong>Die</strong> vier Großen Fässer im Heidelberger Schloss<br />
Sie sind legendär und ein Publikumsmagnet, auch wenn heute nur noch das letzte<br />
Exemplar zu sehen ist: die vier Großen Fässer im Heidelberger Schloss. <strong>Die</strong><br />
Bewun<strong>der</strong>ung war schon 1595 groß: "Viele kommen daher aus <strong>der</strong> Ferne/ Zu guten<br />
Freunden, um dieses Fass/ Sehen zu können, gleichwie ich selbst kürzlich tat./ Und<br />
fürwahr, dieses Werk ist bei Gott wert, dass man’s/ Besichtigt, wenn sich eine passende<br />
Gelegenheit ergibt./ Solch ein Gefäß mit so großer Gabe des Weinstocks, glaub’ ich,/<br />
Gibt’s nicht, soweit <strong>der</strong> riesige Erdkreis reicht." So schrieb damals <strong>der</strong> Theologe und<br />
Hexenbekämpfer Anton Praetorius nach einem Besuch in Heidelberg.<br />
Bewun<strong>der</strong>t hatte Praetorius indes nur das erste von vier Fässern, die zwischen 1591 und<br />
1751 entstanden. Das älteste, das Praetorius bestaunte, ist das so genannte Johann-<br />
Casimir-Fass, erbaut vom Küfer Michael Werner aus Landau und benannt nach Pfalzgraf<br />
Johann Casimir. Was den Theologen so zum Staunen brachte, war das<br />
Fassungsvermögen von 127 000 Litern, eine enorme Größe auch noch für die heutige<br />
Zeit. Bewun<strong>der</strong>n können wir es nicht mehr: Das Casimir-Fass wurde im Dreißigjährigen<br />
Krieg zerstört, sein Holz verfeuert.<br />
Ersatz kam 1664: Da ließ Kurfürst Karl Ludwig unter Leitung des Heidelberger<br />
Kellermeisters Johannes Meyer ein noch größeres Fass bauen: 195 000 Liter fasste das<br />
Holzgebilde, und hatte sogar einen Tanzboden oben drauf. Das Karl-Ludwig-Fass<br />
überstand die Zerstörung des Schlosses im Pfälzer Erbfolgekrieg in den Jahren 1689 und<br />
1693. 1702 wurde eine Reparatur durchgeführt - ohne grundlegende Verbesserung des<br />
Zustands des Fasses.<br />
So entstand 1728 Fass Nummer drei – noch eine Nummer größer: 202 000 Liter fasste<br />
das von Kurfürst Karl Philipp in Auftrag gegebene Werk und war damit rund 4700 Liter<br />
größer als das alte. Doch das Fass wurde immer wie<strong>der</strong> undicht, so dass schon 17<strong>40</strong> ein<br />
Neubau geplant wurde. Der wurde 1751 unter Kurfürst Karl Theodor vollendet und fasste<br />
stolze 221 726 Liter Wein. Heute gehen nur noch 219 000 Liter ins Fass – das Holz ist<br />
eingetrocknet. Gefüllt wurde das Große Fass ohnehin nur drei Mal, es war ständig undicht.<br />
Befüllt wurde es durch ein großes Loch in <strong>der</strong> Decke mit Hilfe eines Schlauchs. Es ist<br />
dieses Karl-Theodor-Fass, das heute noch im Heidelberger Schloss zu bestaunen ist.<br />
Bewacht wird es von dem Fasswächter Perkeo, <strong>der</strong> Statue von Karl Philipps Hofnarren.<br />
Der brachte <strong>der</strong> Legende nach den nur rund einen Meter großen, aber 100 Kilogramm<br />
schweren Zwerg aus Tirol mit, machte ihn zum Hofnarren und fragte ihn eines Tages, ob<br />
er das Große Fass allein austrinken könne. Der Narr antwortete - wie auf alles an<strong>der</strong>e -<br />
„Perché no?“, was auf Italienisch bedeutet: warum nicht? So bekam <strong>der</strong> Fasswächter<br />
seinen Namen. Er soll ein idealer Bewacher des Weins gewesen sein, berichtete doch die<br />
Legende, dass Perkeo seit seiner Kindheit als einziges Getränk Wein zu sich genommen<br />
hatte. Als er im hohen Alter erstmals krank wurde, riet ihm sein Arzt dringlich von<br />
Weingenuss ab und empfahl ihm, Wasser zu trinken. Perkeo nahm den Rat an - und starb<br />
am nächsten Tag<br />
Infokasten<br />
Heidelberger Schloss<br />
Service-Center<br />
Telefon (0 62 21) 53 84 31 und (0 62 21) 65 57 16<br />
info@service-centerschloss-heidelberg.com<br />
www.schloss-heidelberg.de<br />
Öffnungszeiten Schlosshof, Großes Fass<br />
täglich 8.00 - 17.30 Uhr<br />
Eintrittspreise<br />
Kombikarte (Bergbahn, Schlosshof, Großes Fass,<br />
Deutsches Apothekenmuseum)<br />
Erwachsene 5,00 €, Ermäßigte 3,00 €<br />
Audioguide zusätzlich zum Eintritt: 4,00 €<br />
Führungen zusätzlich zum Eintritt<br />
Erwachsene 4,00 €, Ermäßigte 2,00 €, Familienkarte 10,00 €<br />
Gruppen (ab 20 Personen) pro Person 3,60 €<br />
Schlosskasse, Telefon (0 62 21) 53 84 21
Franken<br />
Staatlicher Hofkeller Würzburg: Kellerlabyrinth unter <strong>der</strong> Residenz<br />
<strong>Die</strong>ser Keller hat Rekord verdächtige Ausmaße: Auf 4557 Quadratmeter Größe erstreckt<br />
sich <strong>der</strong> Weinkeller unter <strong>der</strong> Bischöflichen Residenz in Würzburg. Das mächtige Gebäude<br />
über dem Boden ist das außergewöhnlichste aller Barockschlösser und mit seinem<br />
Spiegelkabinett und seinem Treppenhaus mit den Tiepolo-Deckenfresken 1981 von <strong>der</strong><br />
Unesco zum Weltkulturerbe erhoben worden. Doch auch die Kellergewölbe darunter sind<br />
ein Teil des Weltkulturerbes: Der berühmte Baumeister Balthasar Neumann konstruierte<br />
die Gewölbe mit ihren bis zu fünf Meter dicken Mauern gemeinsam mit dem oberirdischen<br />
Bau 1720 bis 1744.<br />
Der Hofkeller selbst geht auf eine Schenkungsurkunde des Würzburger Bischofs Embricho<br />
aus dem Jahr 1128 zurück und ist damit das älteste urkundlich belegte Weingut in<br />
Deutschland, das sich seit <strong>der</strong> Gründung ohne Unterbrechung im Besitz <strong>der</strong> jeweiligen<br />
regierenden Macht befindet. Der fürstbischöfliche Weinbau hat Bestand bis zur<br />
Säkularisation, 1814 fällt <strong>der</strong> gesamte Weinbergsbesitz an die Bayerische Krone, <strong>der</strong><br />
Keller nennt sich fortan “Königlich Bayerischer Hofkeller”. Das Ende <strong>der</strong> Monarchie in<br />
Bayern 1918 leitet über zum selbstständigen bayerischen Staatsweingut “Staatlicher<br />
Hofkeller Würzburg”. Mit einer Rebfläche von 120 Hektar in ganz Franken und einer<br />
Jahresproduktion von etwa 850 000 Flaschen zählt es zu den großen Weingütern in<br />
Deutschland.<br />
Seinen Sitz hat das VDP-Weingut im Würzburger Rosenbachpalais – und darunter. 891<br />
Meter lang, bis zu sechs Meter hoch - <strong>der</strong> Hofkeller ist eine gigantische Unterwelt für sich.<br />
Sieben verschiedene Keller und ein Tunnel erstrecken sich unter den beiden Flügeln <strong>der</strong><br />
Residenz: Rondellkeller, Kammerkeller, Rotweinkeller und <strong>der</strong> berühmte Stückfasskeller<br />
mit seinen 100 Holzfässern zu je 1200 Litern. In <strong>der</strong> "Bacchusecke" befindet sich die<br />
Schatzkammer, im "Beamtenkeller" stehen die drei riesigen “Beamtenweinfässer”, erbaut<br />
1784: Aus ihnen floss vor über 200 Jahren nichts Geringeres als <strong>der</strong> flüssige Sold <strong>der</strong><br />
Hofbediensteten.<br />
Hier steht auch das sogenannte Schwedenfass: 1631 wollten die Würzburger Bürger ihren<br />
Jahrtausendjahrgang von 15<strong>40</strong> vor den anrückenden schwedischen Truppen in Sicherheit<br />
bringen – und vergruben den Wein im Wald. 1684 wird er durch Fürstbischof Konrad von<br />
Wernau zufällig entdeckt, <strong>der</strong> ein Fass für den Wein bauen lässt – eben jenes<br />
Schwedenfass. Bei einer Verkostung 1966 wurde festgestellt, dass <strong>der</strong> Wein noch immer<br />
trinkbar ist.<br />
Das Lager mit den mo<strong>der</strong>nen Stahltanks unter dem Südflügel und den Holzfasskeller unter<br />
dem Nordflügel verbindet heute ein 63 Meter langer Gang aus den 1960er Jahren, quer<br />
unter dem Ehrenhofplatz durch. 2004 wurde er im Zuge des Vinothek-Neubaus als<br />
"Geschichtstunnel" gestaltet, in dem mehr als 875 Jahre Weinbaugeschichte lebendig<br />
werden. <strong>Die</strong> neue, preisgekrönte Vinothek erhielt eine stählerne Verkostungslounge, die<br />
wie eine Weinlaube anmutet, mo<strong>der</strong>ne Schauvitrinen und "Steintabletts" – ein mo<strong>der</strong>nes<br />
Lesebuch <strong>der</strong> Kulturgeschichte des Weins.<br />
Infokasten<br />
Staatlicher Hofkeller<br />
Residenzplatz 3<br />
97070 Würzburg<br />
Tel. 0931/3050929<br />
Fax 0931/3050966<br />
www.hofkeller.de
Weingut Bürgerspital und Würzburg Steinwein: Bocksbeutel und<br />
Silvaner<br />
Der eine ist <strong>der</strong> älteste Weinberg mit eigener Lagenbezeichnung, das an<strong>der</strong>e das älteste<br />
Spitalweingut Deutschlands: Der Wein vom Stein in Würzburg wurde Jahrhun<strong>der</strong>te lang im<br />
Bürgerspital zum Heiligen Geist weiter verarbeitet, und noch heute gehen die beiden Orte<br />
alter <strong>Weinkultur</strong> eine enge Symbiose ein - im Bürgerspital lagert einer <strong>der</strong> ältesten noch<br />
flüssigen Weine Deutschlands: ein "Steinwein" aus dem Jahrtausendjahrgang 15<strong>40</strong>.<br />
Den Wein vom Stein nannte schon Johann Wolfgang von Goethe seinen Lieblingswein,<br />
und auch sonst hat <strong>der</strong> Hang über dem Mainufer mit seiner seltenen Konstellation von<br />
Neigung, Richtung, Geländeform und Flussnähe Geschichte geschrieben: Bereits um das<br />
Jahr 779 wuchsen hier Reben, damit ist die 85 Hektar große Lage nicht nur die größte<br />
Einzellage Deutschlands, son<strong>der</strong>n auch die älteste Weinlage mit eigener Bezeichnung.<br />
1665 pflanzte hier <strong>der</strong> Zisterzienserabt Aberich Degen erstmals Silvaner-Reben an. 1965<br />
wurde bei <strong>der</strong> Flurbereinigung ein Gedenkstein dafür gefunden - er ist heute im Keller des<br />
Bürgerspitals zu besichtigen. Hier lagert auch <strong>der</strong> älteste erhaltene Wein Frankens, die<br />
letzte Flasche eines 15<strong>40</strong>er. Als <strong>der</strong> Weinkritiker Hugh Johnson diesen Weißwein 1961 in<br />
London verkostete, stellt er überrascht fest, er sei tatsächlich „noch lebendig“ - und lasse<br />
„sogar seinen deutschen Ursprung ahnen.“<br />
<strong>Die</strong> Geschichte des Bürgerspitals beginnt im Jahr 1316, als <strong>der</strong> noble Würzburger Patrizier<br />
Johannes und seine Frau Mergardis von Steren ihr Anwesen <strong>der</strong> Stadt überlassen. Der<br />
Zweck: die Aufnahme pflegebedürftiger Menschen in dem "Neuen Spital", das ab dem 16.<br />
Jahrhun<strong>der</strong>t „Bürgerspital zum Heiligen Geist“ genannt wird. Durch weitere Stiftungen<br />
reicher Würzburger Bürger wächst das Spital weiter, 1334 kommen die ersten Weinberge<br />
zur Finanzierung des Stifts dazu – und zur Deckung des eigenen Bedarfs. 1598 etwa<br />
bekamen die Spitalbewohner, Männer wie Frauen, täglich ein Maß Wein, das entsprach<br />
für damalige Verhältnisse maßvollen 1,22 Litern.<br />
Bald finanzierte das Bürgerspital aus den Reberträgen, <strong>der</strong> Landwirtschaft und <strong>der</strong><br />
Vermögensverwaltung seine wohltätigen Unternehmungen. Der Weinbau aber erlebte<br />
immer wie<strong>der</strong> Krisen – 1726 sieht man etwa die Notwendigkeit, sich gegen "böswillige<br />
Machenschaften" zu schützen, in diesem Fall die Weinpanscherei. So ließ <strong>der</strong> Stadtrat<br />
"Auf gnädige, fürstliche Anordnung hin die im Keller des Bürgerspitals zum Hl. Geist<br />
lagernden Steinweine ab dem Jahrgang 1718 in Bocksbeuteln mit 1 Maß Inhalt abfüllen<br />
und mit dem Stadtwappen versiegeln." <strong>Die</strong> Maßnahme war erfolgreich: Der Preis für ein<br />
Fu<strong>der</strong> stieg daraufhin von 100 auf 500 Reichstaler. Zugleich war dies die Geburtsstunde<br />
<strong>der</strong> Bürgerspital-Weine im Bocksbeutel. Heute kann man hier eine Sammlung historischer<br />
Bocksbeutelflaschen bestaunen – und dazu den größten Holzfasskeller Deutschlands mit<br />
rund 200 wertvollen, teils verzierten Eichenholzfässern.<br />
Durch den Stein führt ein etwa vier Kilometer langer Stein-Wein-Pfad, ein Panorama-<br />
Rundweg, <strong>der</strong> am Weingut am Stein mit seiner außergewöhnlichen Architektur endet.<br />
Deren Besitzer Ludwig Knoll hält einige Parzellen im "Stein" – <strong>der</strong> Großteil gehört zu je<br />
einem Drittel dem Juliusspital, dem Staatlichen Hofkeller und eben dem Bürgerspital.<br />
Infokasten<br />
Stiftung Bürgerspital z. Hl. Geist<br />
Theaterstraße 19, D-97070 Würzburg<br />
Telefon: +49 (0)931 3503-441
Telefax: +49 (0)931 3503-444<br />
E-Mail: weingut@buergerspital.de<br />
Internet: www.buergerspital.de<br />
Stein-Wein-Pfad Würzburg<br />
http://uploa<strong>der</strong>.wuerzburg.de/stein-wein-pfad/<br />
Weingut am Stein<br />
Ludwig Knoll<br />
Mittlerer Steinbergweg<br />
97080 Würzburg 5<br />
Tel.: 0931 / 25808 Fax: 0931 / 25880<br />
E-Mail: mail@weingut-am-stein.de<br />
www.weingut-am-stein.de
Juliusspital: Heimat des Bocksbeutels mit Bocksbeutelrelief<br />
Es ist die wohl älteste mo<strong>der</strong>ne Darstellung eines Bocksbeutels: Auf dem Gründungsrelief des<br />
Weinguts Juliusspital im Herzen von Würzburg ist tatsächlich genau in <strong>der</strong> Bildmitte, zwischen den<br />
Füßen <strong>der</strong> vielen Besucher, eine kleine kolbenartige Flasche zu sehen. Vielleicht steht sie für ein<br />
medizinisches Heilgefäß, vielleicht aber auch für einen Bocksbeutel, das Relief gilt jedenfalls als<br />
ältester Beleg für das Vorkommen einer Bocksbeutel-ähnlichen Flasche in <strong>der</strong> Neuzeit. <strong>Die</strong><br />
Hauptbotschaft des Reliefs im Jahr 1576 war allerdings eine an<strong>der</strong>e: Es ist die Gründungsurkunde<br />
des Juliusspitals.<br />
Der Würzbürger Fürstbischof Julius Echter von Mespelbrunn stiftete 1576 das Spital mit seinem<br />
Privatvermögen. Er kaufte eine große Garten- und Seenlandschaft vor den Toren <strong>der</strong> Stadt auf –<br />
alles für das neue Stift. Nach dem Willen des Bischofs sollten hier "allerhand Sorten Arme, Kranke,<br />
unvermugliche, auch schadhafte Leut, die Wund- und an<strong>der</strong>er Arznei notdürftig sein, desgleichen<br />
verlassen Waysen und dann füruberziehende Pilgram und dörftige Personen" behandelt und<br />
betreut werden. Der Grundstein für den Spitalbau wurde am 12. März 1576 gelegt, im<br />
Stiftungsbrief sicherte <strong>der</strong> Fürstbischof den Unterhalt <strong>der</strong> Anlage durch Überschreibung von<br />
Grundbesitz wie Äcker, Wäl<strong>der</strong>n – und Weinbergen, auch solche in <strong>der</strong> weltberühmten Lage<br />
Würzburger Stein.<br />
Das Juliusspital betreut noch heute viele Kranke und Alte – in einem Krankenhaus <strong>der</strong><br />
Schwerpunktversorgung, mit 365 Betten, einem Seniorenzentrum und einer Beratungsstelle für<br />
Menschen mit Epilepsie. Ergänzt werden diese Leistungsbereiche durch eine Akademie für<br />
Palliativmedizin, Palliativpflege und Hospizarbeit, je eine Fachschule für Kranken- und Altenpflege<br />
sowie eine Weiterbildungsstätte für Intensivpflege. Auch ein Tagungszentrum gehört zu <strong>der</strong><br />
Stiftung, ebenso wie eine großer landwirtschaftlicher Gutshof und ein ausgedehnter Waldbesitz –<br />
und natürlich das Weingut, das heute mit 172 Hektar Rebflächen das zweitgrößte in Deutschland<br />
ist. Herzstück <strong>der</strong> Kellerei ist <strong>der</strong> 250 Meter lange Holzfasskeller unter dem Fürstenbau von<br />
Antonio Petrini aus dem Jahre 1699. Hier werden die großen Weine des Gutes hergestellt, die<br />
Weltruhm genießen: So wurde bei <strong>der</strong> Krönung von Königin Elizabeth II. im Jahr 1953 eine 1950er<br />
Riesling Auslese des Juliusspitals aus <strong>der</strong> Lage Iphöfer Julius-Echter-Berg ausgeschenkt.<br />
Natürlich befand sich auch dieser Wein in einer Bocksbeutel-Flasche – dem heute traditionellen<br />
Frankenweingefäß. <strong>Die</strong> Flaschenform selbst ist bereits uralt: Ein keltisches Tongefäß aus <strong>der</strong> Zeit<br />
um 1<strong>40</strong>0 vor Christus in Form einer Flachkugelflasche gilt als Urahn – gefunden auf fränkischem<br />
Boden bei Wenigumstadt. Auch die Römer pflegten die Bocksbeutelform bereits als Feldflasche,<br />
im Mittelalter war sie als Pilgerflasche beliebt: Geformt wie ein "flacher, run<strong>der</strong> Käse", konnte sie<br />
am Gürtel getragen werden, ohne den Träger allzu sehr zu behin<strong>der</strong>n. 1726 bestimmte <strong>der</strong> Rat <strong>der</strong><br />
Stadt den Bocksbeutel zum Gütezeichen im Kampf gegen die weit verbreitete Weinpanscherei und<br />
ließ die ersten Exemplare im Bürgerspital einlagern. 1862 heißt es, ein Bocksbeutel sei "eine<br />
gedrückte, runde, nach Art des Beutels o<strong>der</strong> Hodensacks <strong>der</strong> Böcke geformte Flasche zum<br />
Einfüllen und Versenden des Steinweins." Heute ist <strong>der</strong> Bocksbeutel das Markenzeichen des<br />
Frankenweins und seit 1989 auch für Qualitäts- und Prädikatsweine aus Franken urheberrechtlich<br />
geschützt.<br />
Infokasten<br />
Weingut Juliusspital<br />
Klinikstr. 1<br />
97070 Würzburg<br />
Tel.: 0931/ 393-1<strong>40</strong>0<br />
Fax: 0931/ 393-1414<br />
E-Mail: weingut@juliusspital.de<br />
www.juliusspital.de
Castell: Wo <strong>der</strong> Fürst dem Silvaner die Wiege bereitete<br />
Ein Meilenstein in <strong>der</strong> Geschichte des fränkischen Ortes Castell war <strong>der</strong> 6. April 1659: Da<br />
ließ <strong>der</strong> Amtmann des Gräflichen Gutes <strong>der</strong>er zu Castell, Georg Körner, am Fuße des<br />
Schlossbergs in Castell neue Reben pflanzen – allerdings nicht irgendwelche Reben: „25<br />
Österreicher Fechser“ hatte am Tag zuvor ein Bote vom Dorf Obereisenheim nach Castell<br />
gebracht, so ist es im umfangreichen Archiv des Fürstlich Castell’schen Domänenamts zu<br />
lesen. Anschließend wurden die Fechser – die Stecklinge - im Schloßberg zum<br />
„ausbüßen“ verwandt. Es war die Wiege eines großen Erfolges: von hier trat <strong>der</strong> Silvaner<br />
seinen Siegeszug quer durch Deutschland und insbeson<strong>der</strong>e Franken an.<br />
Der Silvaner gehört zu den ältesten heute noch kultivierten Reben – bereits <strong>der</strong> römische<br />
Dichter Gaius Plinius Secundus beschrieb im ersten Jahrhun<strong>der</strong>t eine Sorte mit den<br />
gleichen Eigenschaften. Im 17. Jahrhun<strong>der</strong>t gelangte die Rebsorte wahrscheinlich aus<br />
dem Donauraum nach Deutschland - vermutlich mit den Ebracher Zisterzienser-Mönchen,<br />
die ihn aus ihren Töchter-Klöstern in Österreich nach Obereisenheim mitbrachten.<br />
Entstanden ist <strong>der</strong> Silvaner durch eine Kreuzung aus Traminer und 'Österreichisch-Weiß',<br />
nach seinem Ursprung im Alpenraum wurde er deshalb lange als "Österreicher"<br />
bezeichnet.<br />
1659 trieben die Fürsten von Castell schon seit über <strong>40</strong>0 Jahren Weinbau: 1224 werden<br />
erstmals Weinberge erwähnt, die Castell dem Kloster Ebrach schenkte. <strong>Die</strong><br />
Weinbergslagen in Castell selbst tauchen erstmals 1266 in einer Urkunde auf, es ist aber<br />
wohl nicht anzunehmen, dass die Fürsten <strong>40</strong> Jahre lang auf Wein vor <strong>der</strong> Haustür<br />
verzichteten. <strong>Die</strong> Weinbergslagen wuchsen, im späten Mittelalter ist Wein Volksgetränk<br />
und natürlich Pachtzahlungsmittel. Erst ab 1600 verursacht die "kleine Eiszeit" einen<br />
erheblichen Rückgang <strong>der</strong> Mostmengen und eine Häufung von Missernten.<br />
Dem Silvaner ebnet diese und eine an<strong>der</strong>e Katastrophe den Weg: Der 30-jährige Krieg hat<br />
ganze Landstriche verwüstet und zu einer Aufgabe von bis zu 75 Prozent <strong>der</strong> damals <strong>40</strong><br />
000 Hektar großen Rebfläche in Franken geführt. Dazu kommt die Klimaverän<strong>der</strong>ung, für<br />
den Wie<strong>der</strong>aufbau <strong>der</strong> Weinberge werden deshalb Reben gesucht, die den Winterfrösten<br />
wi<strong>der</strong>stehen, durch späten Austrieb den Frühjahrsfrösten entgehen, und dank einer<br />
zügigen Reifeentwicklung zu guten Ernten führen konnten - Kriterien, die <strong>der</strong> Silvaner<br />
erfüllte.<br />
So erfolgreich war das Experiment, dass Johann Christian Fischer 1791 in seinem<br />
Standardwerk „Der Fränkische Weinbau auf dem Felde und im Keller“ riet, jeden zehnten<br />
Stock mit "Österreichern" zu besetzen. Das wie<strong>der</strong>um müssen viele Winzer beherzigt<br />
haben, denn 1833 beobachtete Johann Philipp Bronner, <strong>der</strong> Silvaner werde so häufig „wie<br />
das Salz in den Speisen angetroffen“. Mit dem Aufkommen <strong>der</strong> sortenreinen Pflanzung im<br />
19. Jahrhun<strong>der</strong>t konnte <strong>der</strong> Silvaner seine Stellung als Botschafter des Frankenweins<br />
ausbauen –hier wurde und wird er in die besten Weinbergslagen gepflanzt und zu<br />
wahrhaft „Großen Weinen“ veredelt. Das Fürstlich Castell’sche Domänenamt pflegt diese<br />
Tradition bis heute: auf den 70 Hektar Rebflächen wachsen zu <strong>40</strong> Prozent Silvanerreben.<br />
Infokasten<br />
Fürstlich Castell’sches Domänenamt<br />
Schlossplatz 5 - 97355 Castell<br />
Telefon: 09325 601-60<br />
Telefax: 09325 601-88<br />
E-Mail: weingut@castell.de, www.castell.de<br />
Öffnungszeiten:<br />
Montag bis Freitag 8.00 bis 18.00 Uhr<br />
Samstag 10.00 bis 16.00 Uhr<br />
o<strong>der</strong> je<strong>der</strong>zeit nach Vereinbarung
Hessische Bergstraße<br />
Wein und Stein: Wo Rebensaft und Kunst sich paaren<br />
Hier gehen Wein und Kunst eine einmalige Verbindung ein: Auf dem Erlebnispfad "Wein und<br />
Stein" in Heppenheim an <strong>der</strong> Bergstraße wird die Kulturgeschichte des Weins in Kunstwerken<br />
erzählt. Auf 6,9 Kilometern Länge finden sich hier insgesamt 70 Stationen zum Thema Weinbau –<br />
das dürfte europaweit ein einmaliger Rekord sein. Hier kann man Tage zubringen, und hat noch<br />
immer nicht ausgelernt: Das Jahr des Winzers, die römische Geschichte, Erhaltungszüchtung,<br />
Rebenernährung, Reblaus, Weinbergshäuschen - es gibt kein Thema, das hier nicht informativ und<br />
spannend aufbereitet ist. Höhepunkt des Rundwegs aber sind 14 Kunstwerke, die zentrale<br />
Stationen <strong>der</strong> Weinbaugeschichte an <strong>der</strong> Bergstraße in künstlerische Formen gießen.<br />
Bereits vor 2000 Jahren entdeckten die Römer die Schönheit und das milde Klima <strong>der</strong> "strata<br />
montana", <strong>der</strong> Bergstraße. Sie pflanzten die ersten Reben auf den sonnenbeschienenen Hügeln,<br />
die erstmals in einer Urkunde von 755 erwähnt werden – natürlich im Kodex des Kloster Lorschs.<br />
Damit ist Heppenheim die älteste Weinbaugemeinde <strong>der</strong> Bergstraße – und die größte: Allein 230<br />
Hektar <strong>der</strong> gerade 450 Hektar großen Rebfläche des Anbaugebietes Hessische Bergstraße finden<br />
sich in Heppenheim und seinen eingemeindeten Stadtteilen. Ihren Sitz hat hier auch <strong>der</strong> größte<br />
Weinproduzent des Anbaugebietes, die 1904 gegründete Bergsträßer Winzergenossenschaft, in<br />
<strong>der</strong> rund 500 Winzerfamilien entlang <strong>der</strong> gesamten Bergstraße etwa 265 Hektar Weinberge<br />
bewirtschaften.<br />
Heppenheim war also die logische Wahl für den am 27. April 2007 eröffneten Erlebnispfad "Wein<br />
und Stein". In Zusammenarbeit mit dem Unesco Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald und den<br />
Bergsträßer Winzern entstand ein einmaliges Projekt. Startpunkt ist <strong>der</strong> 1967 erbaute Winzerbrunnen,<br />
von da geht es durch die Weinlage Steinkopf, Centgericht und Stemmler kreuz und quer<br />
durch die Heppenheimer Weinberge. Dabei darf natürlich auch die Starkenburg nicht fehlen, die<br />
einst zum Schutz des Klosters Lorsch errichtet wurde. Und dann geht es los: Bodenprofile, die<br />
Abstammung <strong>der</strong> Weinrebe, Bodenerhaltung, integrierter Weinbau, autochthone Rebsorten,<br />
Eichenholzfässer, Korkeichen und Klimawandel – über alles informieren ausführliche und<br />
übersichtlich gestaltete Schautafeln entlang des Weges.<br />
Dazwischen aber ziehen immer wie<strong>der</strong> Kunstwerke die Augen <strong>der</strong> Wan<strong>der</strong>nden auf sich: Da wird<br />
<strong>der</strong> Zyklus <strong>der</strong> Natur in einem überdimensionalen Kreisgebilde dargestellt, <strong>der</strong> "Strata Montana"<br />
und den alten Rebsorten ein Denkmal in Stein gesetzt, <strong>der</strong> "Dank an die Reben" ganz sinnbildlich<br />
verdeutlicht, und das Thema Wein und Stein wörtlich genommen: Eines <strong>der</strong> Kunstwerke montiert<br />
Weinflaschen in den Stein hinein – die wörtliche Verbindung von Terroir und Reben. Dazu wird den<br />
Römern an <strong>der</strong> Bergstraße ein Denkmal in Form eines Centurios gesetzt, und dem Sieg über die<br />
Reblaus gedacht: Eine überdimensionale Laus ragt, aufgespießt auf einen Stab, weit über die<br />
Weinberge. Und schließlich erklärt eine riesige Wein- und Steinflasche ganz handfest die Hauptgesteinsarten<br />
<strong>der</strong> Georegion Bergstraße – ein echtes Sinnbild <strong>der</strong> Verknüpfung von Wein und<br />
Stein.<br />
Infokasten<br />
Erlebnispfad Wein und Stein im Internet:<br />
www.weinundstein.net/<br />
BERGSTRÄSSER WINZER eG<br />
Darmstädter Strasse 56<br />
D-64646 Heppenheim / Bergstrasse<br />
Telefon: 06252 / 7994-0<br />
Telefax: 06252 / 7994-51<br />
E-mail: info@bweg.de<br />
www.bergstraesserwinzer.de<br />
Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald e.V.<br />
Nibelungenstraße 41<br />
64653 Lorsch<br />
Tel: 06251/707990 - Erdgeschoss<br />
Fax: 06251/7079915<br />
Tel: 06251/7079920 - 2. Obergeschoss<br />
Fax: 06251/7079925<br />
E-mail: info@geo-naturpark.de<br />
www.geo-naturpark.de
Kloster Lorsch: Gedächtnis des Weinbaus<br />
Wohl kein Ort in Deutschland hat so viel zum Erhalt <strong>der</strong> Weinbau-Historie getan, wie das Kloster Lorsch an<br />
<strong>der</strong> hessischen Bergstraße. Unzählige Orte bis hinunter nach Baden, hinüber nach Franken und<br />
Rheinhessen können ihre Weinbaugeschichte bis ins frühe Mittelalter zurückverfolgen – Dank des Klosters<br />
Lorsch. Hier nämlich entstand Endes 12. Jahrhun<strong>der</strong>ts <strong>der</strong> Codex Laureshamensis, ein gigantisches<br />
Verzeichnis von Weinbergslagen, Schenkungen und Besitzverhältnissen. Der Lorscher Kodex wurde so zum<br />
wohl wichtigsten Gedächtnis <strong>der</strong> Weinbaugeschichte – und zeigt die Bedeutung <strong>der</strong> Klöster für den<br />
Weinbau.<br />
Kloster Lorsch selbst wird 764 gegründet, zunächst als sogenanntes Eigenkloster des Alemannischen<br />
Grafen Cancor und seiner Mutter Williswinth, die die Neugründung gleich an einen Verwandten<br />
verschenkten: Erzbischof Chrodegang von Metz ist in dieser Zeit <strong>der</strong> einzige Erzbischof nördlich <strong>der</strong> Alpen.<br />
Chrodegang, ein einflussreicher Kirchenmann mit besten Verbindungen zum fränkischen Fürstenhof,<br />
schickte die ersten Mönche nach Lorsch. Plötzlich rückt das kleine Kloster ins Rampenlicht <strong>der</strong> „großen“<br />
Geschichte – und es erhält Reliquien aus Rom: die Überreste des Märtyrerheiligen Nazarius.<br />
Der Heilige bringt Besucher und wachsende Bedeutung nach Lorsch, schon wenige Jahrzehnte nach seiner<br />
Gründung gehört das Benediktinerkloster zu den reichsten Grundbesitzern östlich des Rheins, mit<br />
Besitzungen von <strong>der</strong> heute nie<strong>der</strong>ländischen Nordseeküste bis hinunter in die heutige Schweiz. Der<br />
Reichtum weckte Begehren, und so wurde Kloster Lorsch 771 zum Schutz Karl dem Großen persönlich<br />
unterstellt und war damit fortan Reichs- und Königskloster mit angeschlossener Kaiserpfalz. Dem Zentrum<br />
<strong>der</strong> Kloster- und Geisteskultur machte die Reformation den Garaus: 1564 hob die Kurpfalz, inzwischen<br />
Eigentümerin von Lorsch, das Kloster auf. In den Kriegen blieb lediglich die "Königshalle" unversehrt, sie<br />
verhalf 1991 dem Kloster zur Anerkennung als UNESCO-Weltkulturerbe.<br />
Der Klosterbesitz aber war durch Schenkungen gewachsen, und darin waren meist Weinberge enthalten.<br />
<strong>Die</strong> Quellen berichten, Kloster Lorsch habe schon um 850 an über hun<strong>der</strong>t Orten mehr als 900 Weinlagen<br />
besessen, mit einer Konzentration im Mainzer Raum und an <strong>der</strong> Hessischen Bergstraße. Gleich mit <strong>der</strong><br />
Gründung 764 ist als Schenkung eine Weinlage im rheinhessischen Hahnheim verzeichnet. Bis um das Jahr<br />
1100 sind an mindestens 170 Orten Erträge von mehr als 923 Weingärten verzeichnet, vermutlich waren es<br />
noch mehr.<br />
Enthalten ist all dies im Codex Laureshamensis, dem Lorscher Kodex, einer umfassenden Aufstellung <strong>der</strong><br />
Rechte und Besitztümer des Klosters. Das zwischen 1167 und 1190 erstellte Werk enthält 3836<br />
Eintragungen samt Urkunden und erwähnt mehr als 1000 Orte – ein wahres Gedächtnis, auch für die<br />
Weinbaugeschichte. Der Codex selbst ist heute in Würzburg zu sehen, Kloster Lorsch aber kann besichtigt<br />
werden, und im Museumsshop gibt’s heute wie<strong>der</strong> "Klosterwein" zu kaufen.<br />
Infokasten<br />
Kuratorium Weltkulturdenkmal Kloster Lorsch<br />
Verein zur För<strong>der</strong>ung des Weltkulturdenkmals e. V.<br />
Nibelungenstraße 32<br />
64653 Lorsch<br />
www.kuratorium-weltkulturdenkmal.de<br />
BERGSTRÄSSER WINZER eG<br />
Darmstädter Strasse 56<br />
D-64646 Heppenheim / Bergstrasse<br />
Telefon: 06252 / 7994-0<br />
Telefax: 06252 / 7994-51<br />
E-mail: info@bweg.de<br />
www.bergstraesserwinzer.de<br />
Museumszentrum Lorsch<br />
Nibelungenstraße 32<br />
D 64653 Lorsch<br />
Telefon 0 62 51/ 51446 (Sprechstunde)<br />
Telefon: 06251/ 10382 - 11 (Empfang)<br />
Fax: 06251/ 5871 <strong>40</strong><br />
E-mail muz@kloster-lorsch.de<br />
www.kloster-lorsch.de
Boppar<strong>der</strong> Hamm: <strong>Die</strong> größte Wein-Rheinschleife<br />
Inmitten <strong>der</strong> größten Schleife des Rheins liegt auch das größte zusammenhängende<br />
Weinbaugebiet des Mittelrheins: <strong>der</strong> Boppar<strong>der</strong> Hamm. Der Name leitet sich wohl vom<br />
lateinischen Wort "hamus" ab, was soviel wie Haken bedeutet und auf die S-Form <strong>der</strong><br />
berühmten Rheinschleife anspielt. Schon die Römer bauten hier wohl Wein an – in<br />
Boppard wurde 370 nach Christus ein römisches Kastell errichtet, und <strong>der</strong> Wein war Teil<br />
<strong>der</strong> Truppenverpflegung. Erstmals urkundlich erwähnt wird <strong>der</strong> Weinbau in Boppard im<br />
Jahr 643, bis weit in die Neuzeit hinein blieb Wein das Hauptwirtschaftsgut <strong>der</strong> kleinen<br />
Stadt im engen Mittelrheintal. Seit 2002 ist das Tal Unesco-Weltkulturerbe, in Boppard hat<br />
man einen <strong>der</strong> schönsten Ausblicke in das Rheintal.<br />
75 Hektar Fläche umfasst die Weinlage Boppar<strong>der</strong> Hamm heute. <strong>Die</strong> Südlage weist einen<br />
idealen Neigungswinkel zur Sonne auf, <strong>der</strong> Hang nutzt die Wasserfläche des Flusses als<br />
Wärmespeicher, und das Schiefergestein ist ideal für große Rieslingweine mit feiner<br />
Mineralität und Aromen von Apfel, Minze und an<strong>der</strong>en Gewürzen.<br />
Das Tagwerk <strong>der</strong> Winzer in den aufwändigen Steillagen ist noch immer von viel<br />
Handarbeit geprägt. Sechzehn Vollerwerbswinzer bewirtschaften zurzeit die Weinberge im<br />
Boppar<strong>der</strong> Hamm, die Jahresproduktion liegt bei ungefähr 600 000 Litern – fast<br />
ausschließlich <strong>der</strong> Vorzeigesorte Riesling. Denn sie war und ist noch heute die mit<br />
Abstand am meisten angebaute Rebsorte im Boppar<strong>der</strong> Hamm sowie des gesamten<br />
Mittelrheins.<br />
Einen Höhepunkt <strong>der</strong> Weinbergserkundung mit ausgesprochen kulinarisch-vinologischem<br />
Charakter stellt am letzten Aprilsonntag <strong>der</strong> „Mittelrheinische Weinfrühling“ dar. Rund ein<br />
Dutzend Boppar<strong>der</strong> Winzerbetriebe bieten in Abwechslung mit feinen kleinen Speisen ein<br />
ganz beson<strong>der</strong>s sinnliches Rhein- und Weinerlebnis an.<br />
Wer größere sportliche Herausfor<strong>der</strong>ungen sucht, dem sei <strong>der</strong> Mittelrhein-Klettersteig<br />
empfohlen, <strong>der</strong> in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Alpenverein geschaffen wurde. Mit<br />
einem spektakulären Blick von oben auf den Boppar<strong>der</strong> Hamm gilt es in etwa drei Stunden<br />
insgesamt 11 Kletterpassagen an steilen Felswänden zu überwinden.<br />
Infokasten<br />
Tourist Information Boppard<br />
Marktplatz<br />
D-56154 Boppard<br />
Tel.: +49-(0)6742-3888<br />
E-Mail: tourist@boppard.de,<br />
www.boppard-tourismus.de<br />
Mittelrhein-Klettersteig:<br />
http://www.boppard.de/2001/html/Klettersteig/allgemein.htm<br />
Weitere Informationen zum Mittelrhein-Wein<br />
www.mittelrhein-wein.com<br />
www.mittelrhein-weinfuehrer.de/Boppard.html
Weinumschlagplatz Bacharach: Wo Gott Bacchus Zuhause ist<br />
<strong>Die</strong>se Stadt trägt den Bacchus schon im Namen: <strong>der</strong> Name Bacharach kommt, so heißt<br />
es, von dem keltischen "Baccaracum" – das hieße dann das Landgut des Baccarus - o<strong>der</strong><br />
dem lateinischen "Bacchi ara" – und das bedeutet "Altar des Bacchus". Der Gott des<br />
Weins hat wahrlich diese kleine Stadt im Mittelrheintal geprägt, wie kaum eine an<strong>der</strong>e. Im<br />
Mittelalter war Bacharach ein wichtiger Umschlagplatz für Wein. Das lag vor allem an dem<br />
berüchtigten "Binger Loch": <strong>Die</strong> felsige Engstelle im Rhein war damals für große Schiffe<br />
nicht befahrbar. So wurde <strong>der</strong> Wein hier von kleineren Lastkähnen, die rheinabwärts<br />
kamen, auf die großen Schiffe umgeladen – <strong>der</strong> Wein hieß von hier ab deshalb "<strong>der</strong><br />
Bacharacher".<br />
<strong>Die</strong> Weingeschichte hat auch das Stadtbild geprägt: Zahlreiche alte Fachwerkhäuser rund<br />
um den historischen Marktplatz spiegeln dies wi<strong>der</strong>. Das älteste davon ist das 1368<br />
erbaute "Alte Haus", ein mittelalterliches Fachwerkhaus, das eine berühmte Weinstube<br />
beherbergt, die sogar Schauplatz einer Operette von Robert Stolz wurde. Im 1585<br />
erbauten "Haus Utsch" residierte zwei Jahrhun<strong>der</strong>te später Friedrich Wilhelm Utsch, <strong>der</strong><br />
den "Jäger aus Kurpfalz" erdichtete. Das Städtchen im romantischen Mittelrheintal – heute<br />
Unesco-Weltkulturerbe - galt denn auch im 19. Jahrhun<strong>der</strong>t als eine <strong>der</strong> schönsten Städte<br />
<strong>der</strong> Welt. Das war zur Hochzeit <strong>der</strong> Rheinromantik, und Bacharach wurde ihr<br />
Wahrzeichen.<br />
Grund waren vor allem zwei Markenzeichen: die mittelalterliche Burg Stahleck oberhalb<br />
des Ortes – heute eine Jugendherberge – und die Wernerkappelle. Der Legende nach soll<br />
hier am Gründonnerstag des Jahres 1287 ein 16 Jahre alter christlicher Tagelöhner mit<br />
Namen Werner von Juden ermordet worden sein, die sein Blut für das Passah-Fest<br />
verwenden wollten. <strong>Die</strong> Geschichte vom Ritualmord war falsch, dennoch löste sie eine<br />
Verfolgungswelle gegen Juden aus, die bis an die Mosel und den Nie<strong>der</strong>rhein schwappte.<br />
In <strong>der</strong> Folge wurde die Wernerkapelle im gotischen Stil errichtet, jedoch nie vollendet. Mit<br />
ihrer markanten Ruinensilhouette wurde sie zu dem rheinromantischen Wahrzeichen<br />
überhaupt. Dem Wein aber wird heute in zahlreichen Weinstuben in Bacharach gedacht.<br />
Infokasten<br />
Rhein-Nahe Touristik<br />
Oberstr. 45<br />
55422 Bacharach<br />
Tel.: 06743-919303<br />
E-Mail: info@rhein-nahe-touristik.de<br />
www.bacharach.de<br />
Weitere Infos<br />
www.bacharach.mittelrhein.net<br />
www.mittelrheintal.de/posthof<br />
www.regionalgeschichte.net<br />
www.rheinreise.de
Mosel<br />
Römische Kelteranlage Piesport: Wo einst die Römer den Moselwein<br />
traten<br />
Hier traten einst die Römer den Moselwein mit den Füßen – buchstäblich: in Piesport an<br />
<strong>der</strong> Mosel wurde die größte römische Kelteranlage nördlich <strong>der</strong> Alpen gefunden. 1985 war<br />
das, im Zuge <strong>der</strong> Flurbereinigung. Direkt zu Füßen <strong>der</strong> berühmten Steillage "Piesporter<br />
Goldtröpfchen" trat eine 44 mal 20 Meter große Anlage aus dem 4. Jahrhun<strong>der</strong>t nach<br />
Christus zutage. Bis zu 130 Arbeiter waren hier einst an den sechs Becken <strong>der</strong> Anlage mit<br />
dem Auspressen des Weins beschäftigt, bis zu 60 000 Liter Wein wurden hier verarbeitet.<br />
<strong>Die</strong> Anlage beweist, wie alt die Weinbautradition an <strong>der</strong> Mosel ist. Eigentlich bauten ja<br />
schon die Kelten hier Wein an, doch es waren die Römer, die den Weinbau an <strong>der</strong> Mosel<br />
professionell in großen Weingütern betrieben. Niemand an<strong>der</strong>s als <strong>der</strong> Feldherr Gaius<br />
Julius Caesar eroberte um 50 vor Christus das Moseltal, nur wenige Jahrzehnte später<br />
entsteht mit Augusta Treverorum, dem heutigen Trier, die Römermetropole und spätere<br />
Hauptstadt des weströmischen Reiches an <strong>der</strong> Mosel. Das Moseltal ist damit die älteste<br />
Weinregion Deutschlands.<br />
1992 wurde in Piesport noch eine zweite Römerkelter gefunden, 15 mal 6 Meter groß, mit<br />
vier Becken und aus dem 2. Jahrhun<strong>der</strong>t. Auch in Erden, Brauneberg und Maring-Noviand<br />
wurden antike Kelteranlagen ausgegraben und für die Nachwelt gesichert. <strong>Die</strong> Anlage in<br />
Erden hatte gleich sieben Räume und wurde zwischen dem 3. Jahrhun<strong>der</strong>t nach Christus<br />
und dem 7. Jahrhun<strong>der</strong>t mehrfach neu errichtet. Heute kann sie auch für Veranstaltungen<br />
genutzt werden – für Weinproben o<strong>der</strong> auch für Kochkurse mit antiker römischer Küche.<br />
Auch die Römerkelter in Piesport kann heute besichtigt werden, sie umfasst noch die alten<br />
Maischebecken, das Fumarium, die Räucherkammer – und die große Baumkelter. <strong>Die</strong><br />
Anlage ist wie<strong>der</strong> voll funktionstüchtig, zu Besichtigen ist das (nicht nur) beim Römischen<br />
Kelterfest jedes Jahr Anfang Oktober. Dann werden hier wie<strong>der</strong> Trauben gepresst – wie zu<br />
Römer's Zeiten.<br />
Infokasten<br />
Römerkelter<br />
Führungen nach Vereinbarung im Verkehrsbüro Piesport<br />
o<strong>der</strong> nach Absprache mit örtlichen Winzern und WeinErlebnisBegleitern<br />
Wissenschaftliche Informationen zu den Römerkeltern<br />
http://www.guenter-hauenstein.de/dehio/HISTE.html#Erden<br />
Tourist-Information Piesport/Minheim<br />
Heinrich-Schmitt-Platz 1<br />
54498 Piesport<br />
Tel: 06507/2027<br />
Fax: 06507/2026<br />
Email: info@piesport.de<br />
www.piesport.de<br />
Verkehrsbüro Erden<br />
Hauptstrasse 72, 54492 Erden<br />
Tel.: 06532-2549, Fax: 06532-1585<br />
Email: info@erden.de, www.erden.de
Weingut <strong>der</strong> Vereinigten Hospitien, Trier: Ältester Weinkeller<br />
Das Erbe <strong>der</strong> Römerzeit – hier ist es mit den Händen zu greifen: <strong>Die</strong> Ursprünge des<br />
Weinkellers im Weingut <strong>der</strong> Vereinigten Hospitien in Trier reichen zurück bis ins Jahr 330.<br />
Damals standen hier am Moselufer zwei große Lagerhäuser, die sogenannten Horrea.<br />
Hier wurde <strong>der</strong> Wein gelagert, <strong>der</strong> die Mosel hinauf kam, unter an<strong>der</strong>em von den Keltern<br />
entlang <strong>der</strong> Mosel. 70 Meter lang und 20 Meter breit waren die Lagerhäuser zur<br />
Römerzeit. Ein Teil <strong>der</strong> bis zu acht Meter hohen Mauern ist noch heute erhalten – und<br />
bildet einen Teil des heutigen Hospitien-Weinkellers, <strong>der</strong> damit <strong>der</strong> älteste Weinkeller<br />
Deutschlands sein dürfte. Den Eingangsbereich schmückt <strong>der</strong> sehr gut erhaltene römische<br />
Ziegelboden.<br />
<strong>Die</strong> Vereinigten Hospitien entstanden 1805 durch ein Edikt des französischen Kaisers<br />
Napoleon Bonaparte. Er säkularisierte die Klöster und fasste in seinem Edikt mehrere<br />
ehemals katholische Einrichtungen zu einer Einrichtung <strong>der</strong> Alten- und Krankenpflege<br />
zusammen. <strong>Die</strong> Vereinigten Hospitien übernahmen bei ihrer Gründung von den Klöstern<br />
und Stiften auch <strong>der</strong>en Weinbergsbesitz, einige <strong>der</strong> besten Lagen an Saar und<br />
Mittelmosel.<br />
<strong>Die</strong> Vereinigten Hospitien sind heute eine gemeinnützige Stiftung öffentlichen Rechts, die<br />
ein Alten- und Pflegeheim sowie mehrere geriatrische Einrichtungen unterhält. <strong>Die</strong><br />
Weinberge werden von einem eigenen Weingut betrieben, das auch den ältesten<br />
Nachweis für den Rieslinganbau an <strong>der</strong> Mosel hütet: 1464 wurde in einem<br />
Rechnungsbuch des damaligen Hospitals St. Jakob <strong>der</strong> Riesling erwähnt. Auf den 25<br />
Hektar Rebflächen, die das Weingut heute verwaltet, wachsen denn auch zu 90 Prozent<br />
Rieslingtrauben. Zu den berühmten Lagen des VDP-Weinguts zählen Weinberge im<br />
Piesporter Goldtröpfchen, sowie <strong>der</strong> Trierer Augenscheiner, die Wiltinger Hölle an <strong>der</strong><br />
Saar sowie <strong>der</strong> Saarfel<strong>der</strong> Schlossberg in Serrig, die alle komplett im Alleinbesitz des<br />
Weinguts sind.<br />
Infokasten<br />
Weingut <strong>der</strong> Vereinigten Hospitien Trier<br />
Krahnenufer 19<br />
54290 Trier<br />
Telefon: +49 (651) 9451210<br />
Fax: +49 (651) 9452060<br />
http://weingut.vereinigtehospitien.de/<br />
Öffnungszeiten: Montag bis Freitag für Besucher offen.<br />
Weinproben im ältesten Weinkeller Deutschlands nach Vereinbarung<br />
Vereinigte Hospitien<br />
-Stiftung öffentlichen Rechts-<br />
Krahnenufer 19<br />
54290 Trier<br />
Telefon: 0651-945-0<br />
Telefax: 0651-945-1217<br />
www.vereinigtehospitien.de
Weinbergs-Sonnenuhren: Maßstab für die heiteren (Wein-)Stunden<br />
Sie sind Maßstäbe für das Fortschreiten des Tages und so alt wie die Menschheit: Bis<br />
zum Beginn des 19. Jahrhun<strong>der</strong>ts waren Sonnenuhren das Synonym für Uhren überhaupt<br />
– an<strong>der</strong>e gab es nicht. Das Prinzip ist einfach: Parallel zur Erdachse wird ein Stab<br />
verankert, dessen Schattenwurf zeigt dann auf <strong>der</strong> Fläche darunter den Stand <strong>der</strong> Sonne,<br />
und damit Stunden o<strong>der</strong> Minuten an. <strong>Die</strong> Steillagen <strong>der</strong> Mosel, oft gen Süden ausgerichtet,<br />
boten also ideale Voraussetzungen für Sonnenuhren. In den Zeiten bevor Taschen- o<strong>der</strong><br />
gar Armbanduhren verfügbar waren, dienten sie den Weinbergsarbeitern als Zeitmesser<br />
ihrer Tage.<br />
Mehrere Hun<strong>der</strong>t dieser meist steinernen Zeitmesser dürfte es an <strong>der</strong> Mosel heute noch<br />
geben. So markant waren viele von ihnen, dass sie sogar den Weinbergslagen ihren<br />
Namen gaben. Der Zusammenhang ist klar: Wo eine Sonnenuhr steht, gedeiht auch<br />
erstklassiger Wein, denn es handelt sich um eine sonnenverwöhnte Südlage. <strong>Die</strong><br />
berühmtesten heißen Wehlener Sonnenuhr, die nur wenige hun<strong>der</strong>t Meter entfernte<br />
Zeltinger Sonnenuhr sowie die Brauneberger Juffer-Sonnenuhr. Weitere Sonnenuhren gibt<br />
es in Ürzig im Turm einer ehemaligen Burganlage, die zwischen Weinreben in die Felsen<br />
gebaut wurde. Aber auch in Neumagen, in Maring und in Pommern sind die meist weithin<br />
sichtbaren Zeitmesser in den steilen Weinhängen zu sehen.<br />
In Wehlen wurde die berühmte Sonnenuhr im Weinberg zum Wahrzeichen des Ortes.<br />
Errichtet wurde sie 1842 von dem Weinbergsbesitzer Jodocus Prüm. Sie zeigt, wie alle<br />
alten Sonnenuhren, die wahre Ortszeit an: Wenn also die Sonne ihren Höchststand über<br />
Wehlen erreicht, fällt <strong>der</strong> Zeigerschatten genau auf zwölf Uhr. Im Vergleich zur<br />
Mitteleuropäischen Zeit (MEZ), die 1893 verbindlich eingeführt wurde, gibt es allerdings<br />
einen Unterschied von 32 Minuten - die Sonnenuhr geht also um rund eine halbe Stunde<br />
nach. Um das Jahr 1900 wurde die Weinbergslage dann nach <strong>der</strong> berühmten Uhr<br />
"Wehlener Sonnenuhr" benannt.<br />
Wehlen hat sich heute zum Ziel gesetzt, Ort <strong>der</strong> 100 Sonnenuhren zu werden. Mehr als 50<br />
gibt es bereits, die ältesten stammen aus dem 17. Jahrhun<strong>der</strong>t. Doch auch neue Uhren<br />
entstehen, in unterschiedlichster Ausprägung: Da gibt es horizontale Sonnenuhren, etwa<br />
auf alten Weinfässern, vertikale Uhren an Hauswänden, Äquatorial-Sonnenuhren, die<br />
aussehen wie ein Globus, und digitale Sonnenuhren, bei denen nicht ein Zeiger wan<strong>der</strong>t,<br />
son<strong>der</strong>n die Sonne durch ein Zahlenband scheint und so die Uhrzeit auf den Untergrund<br />
projiziert. Ein Überblick im Internet listet alle Sonnuhren in Wehlen auf. Und wer weiß,<br />
vielleicht inspirierten die Sonnenuhren <strong>der</strong> Mosel die alte Schlager-Zeile: "Mach' es wie die<br />
Sonnenuhr, zähl' die heitren Stunden nur."<br />
Infokasten<br />
Fundort: diverse Steillagen an <strong>der</strong> Mosel<br />
Bekannteste Sonnenuhren:<br />
Wehlen; Zeltingen, Ürzig, Brauneberg<br />
Wehlener Sonnenuhren<br />
Internet: www.wehlen.de/sonnenuhren.html<br />
Wehlen, Wein und Wiesen e.V.<br />
www.wehlen.de
Jugendstil-Stadt Traben-Trarbach: Zweitwichtigste Weinhandelsstadt<br />
<strong>der</strong> Welt<br />
Ein wahres Denkmal für die Bedeutung des Weinhandels an <strong>der</strong> Mosel, das ist die<br />
Jugendstil-Stadt Traben-Trarbach an <strong>der</strong> Mittelmosel. Um 1900 war die kleine Stadt im<br />
Moseltal die wichtigste Weinhandelsstadt <strong>der</strong> Welt – nach dem französischen Bordeaux.<br />
Es war die Hochzeit des Moselweins, <strong>der</strong> von hier in die ganze Welt verschifft wurde. Mehr<br />
als einhun<strong>der</strong>t Kellereien und Weinhandlungen hatten hier ihren Sitz und verschifften von<br />
Traben-Trarbach aus ihren Tropfen nach England, Russland und natürlich auch quer<br />
durchs Deutsche Reich.<br />
Der Reichtum aus dem Weinhandel zeigte sich schnell auch in <strong>der</strong> Architektur des Ortes:<br />
<strong>Die</strong> reichen Weinhändler und Weingutsbesitzer ließen sich von prominenten Architekten<br />
wie dem Berliner Professor Bruno Möhring prachtvolle Villen im Jugendstil sowie<br />
Kellereigebäude und weitläufige Kelleranlagen errichten. Eine komplette Route führt durch<br />
den Ort zu den schönsten Jugendstil-Villen wie etwa die Villa Huesgen, erbaut 1904 für<br />
den Weinhändler Adolph Huesgen im formvollendeten Jugendstil, o<strong>der</strong> die ein Jahr später<br />
errichtete Villa Breucker, ein kubisch-verschachtelter Jugendstilbau für den Weinhändler<br />
Gustav Breucker.<br />
Zum Markenzeichen für die Jugendstil-Epoche <strong>der</strong> Stadt wurde das Brückentor, 1899<br />
ebenfalls von Möhring errichtet. Es markierte die erste Straßenbrücke, die es zwischen<br />
Bernkastel und Koblenz gab. Nebenan erbaute Richard Feist nach den Plänen Möhrings<br />
1903 das Hotel "Clauss-Feist", das schnell zu legendärem Ruf kam. In dem Bau finden<br />
sich zahlreiche Elemente mit Bezug zum Wein, nicht zuletzt wurde <strong>der</strong> Turm dem Hals<br />
einer Sektflasche nachempfunden –Drahtverschluss und Korken inklusive.<br />
Mehrere <strong>der</strong> alten Kellereien sind noch – o<strong>der</strong> wie<strong>der</strong> – in Betrieb. So führt noch heute ein<br />
Adolph Huesgen die Weinhandlung "Wildbad Wein" in historischen Gebäuden – samt<br />
einem Riesling <strong>der</strong> Marke "Villa Huesgen". Und wem das oberirdische Traben-Trarbach<br />
nicht reicht, <strong>der</strong> geht in den Untergrund: Im Zuge des Erfolgs des Moselweins wurden<br />
nämlich in <strong>der</strong> zweiten Hälfte des 19. Jahrhun<strong>der</strong>ts große Flächen des Stadtkerns<br />
unterkellert, teilweise in mehreren Stockwerken untereinan<strong>der</strong>. Auch das spiegelt die<br />
Bedeutung von Traben-Trarbach als <strong>der</strong> einst bedeutenden Weinhandelsstadt <strong>der</strong> Welt<br />
wie<strong>der</strong>.<br />
Informationen<br />
Tourist-Information Traben-Trarbach<br />
Am Bahnhof 5<br />
D-56841 Traben-Trarbach<br />
Tel: 0 65 41 - 8 39 80<br />
Fax 0 65 41 - 83 98 39<br />
E-Mail: info@traben-trarbach.de<br />
www.traben-trarbach.de<br />
www.bellevue-hotel.de<br />
Ausflüge in die Unterwelt:<br />
jeden letzten Freitag im Monat um 18.00 Uhr<br />
Dauer: ca. 1,5 Stunden<br />
Kosten: 5 Euro (inkl. 1 Glas Wein)<br />
Gruppenführungen (max. <strong>40</strong> Pers.):<br />
nach Terminabsprache je<strong>der</strong>zeit möglich<br />
Kosten: 70 Euro (deutsch), 92 Euro (englisch)<br />
Auch Weinproben möglich.
Der Bremmer Calmont: Wo <strong>der</strong> Fels den Wein gebiert<br />
Steiler geht es nicht einmal an <strong>der</strong> Mosel: Mit einer Hangneigung von bis zu 60 Grad ist<br />
<strong>der</strong> Calmont <strong>der</strong> steilste Weinberg Europas. Der gut 290 Meter hohe Hang zwischen den<br />
Moselorten Bremm und Ediger-Eller entstand vor <strong>40</strong>0 Millionen Jahren in <strong>der</strong> Erdzeit<br />
Devon und besteht aus Schiefer und Grauwacke-Verwitterungsgestein. Der Steilhang<br />
sorgt für eine optimale Sonneneinstrahlung und damit ideale Wachstumstemperaturen für<br />
den hier wachsenden Riesling. Hohe Schiefermauern, quer zum steilen Hang gebaut,<br />
sichern die weichen Tonschieferböden vor dem Abrutschen und prägen den<br />
Terrassenweinbau in Europas steilstem Weinberg. Als "Natur-Amphitheater, wo auf<br />
schmalen, hervorragenden Kanten <strong>der</strong> Weinstock zum allerbesten gedieh" beschrieb<br />
schon <strong>der</strong> Dichter Johann Wolfgang von Goethe den berühmten Weinberg.<br />
Tatsächlich hat <strong>der</strong> Calmont eine schon Jahrtausende währende Anbautradition. Der<br />
älteste sichere Beleg stammt aus dem epischen Gedicht „De navigo suo“, geschrieben um<br />
588 von Venantius Fortunatus, dem Bischof von Poitiers. Der begleitete damals den<br />
Merowingerkönig Childebert II. auf einer Schiffsreise von Metz nach An<strong>der</strong>nach am Rhein.<br />
Schon damals gab es Schiffsreisen auf <strong>der</strong> Mosel, und schon damals fielen dem Auge des<br />
Betrachters die dichtgedrängten Rebstöcke zwischen den Felsen des Steilhanges auf:<br />
"Dort, wo steiles Geklüft kostbarste Süße <strong>der</strong> Beeren zeugt", schwärmte Venantius, "wo<br />
Weinberge belaubt aufstreben zu kahlen Berghöhen", dort "sammelt die Ernte <strong>der</strong><br />
gefärbten Trauben <strong>der</strong> Winzer, selbst am Felshang hänget er, lesend die Frucht." So steil<br />
seien die Hänge und so kahl <strong>der</strong> Schiefer, dass hier wohl "selbst <strong>der</strong> Felsen gebiert und es<br />
entströmet <strong>der</strong> Wein."<br />
Der schroffe und steile Fels verlangt den Winzern allerdings bis heute harte Handarbeit<br />
ab, bis zu 1800 Stunden sind es pro Hektar. <strong>Die</strong> Trauben müssen auf dem Rücken den<br />
steilen Hang hinunter zum Erntewagen getragen werden. Seit den 90er Jahren hilft eine<br />
Monorack-Zahnradbahn bei <strong>der</strong> Arbeit, auch sie ist ein Stück sehenswerte <strong>Weinkultur</strong>.<br />
Trotzdem bleibt die Arbeit hart, weshalb heute nur etwa 13 <strong>der</strong> insgesamt 22 Hektar<br />
Fläche bewirtschaftet werden. Der Name Calmont soll sich denn auch von lateinisch<br />
"calidus" = warm und "mons" = Berg ableiten – o<strong>der</strong> aber vom keltischen "kal" = hart –<br />
also <strong>der</strong> Felsenberg. Erfahren kann man beides auf dem Klettersteig des Calmont, einem<br />
spektakulären Kletterweg, <strong>der</strong> auch "die Eigernordwand <strong>der</strong> Weinberge" genannt wird.<br />
Infokasten<br />
Tourist-Information Bremm<br />
Moselstraße 27<br />
56814 Bremm (Mosel)<br />
Telefon: (0 26 75) 3 70 zu<br />
E-Mail: tourist@bremm-mosel.de<br />
www.bremm-mosel.de<br />
www.bremmer-calmont.de
Nahe<br />
Klosterruine Disibodenberg: Wo die ältesten Reben Deutschlands<br />
wachsen<br />
Er ist berühmt durch Hildegard von Bingen, doch <strong>der</strong> Disibodenberg in O<strong>der</strong>nheim an <strong>der</strong> Nahe hat<br />
auch eine uralte Weinbau-Geschichte: Spuren weisen auf römische Reben am Südhang des<br />
Disibodenbergs hin, seit dem 11. Jahrhun<strong>der</strong>t trägt <strong>der</strong> Klosterweinberg ununterbrochen Reben.<br />
Weingut und Klosterruine befinden sich seit 1753 im Besitz <strong>der</strong> Familie von Racknitz, die noch<br />
heute das Weingut unterhalb <strong>der</strong> alten Klosterruine betreibt. Hier sorgte im Jahr 2008 ein<br />
sensationeller Fund für Aufhorchen: Auf dem Disibodenberg wurden fünf Rebstöcke <strong>der</strong> Sorte<br />
Weißer Orleans gefunden – eine eigentlich ausgestorbene Sorte. Rebsortenkundlern zufolge<br />
dürfte es sich um die ältesten Reben Deutschlands handeln.<br />
Der Orleans war bis ins 19. Jahrhun<strong>der</strong>t in Deutschland verbreitet, vor allem am Rüdesheimer<br />
Berg im Rheingau, wo man die späte, sehr säurebetonte Rebsorte schätzte. <strong>Die</strong> fünf verwil<strong>der</strong>ten<br />
Reben des Weissen Orleans am Disibodenberg überlebten an <strong>der</strong> äußeren Mauerkante. Quellen<br />
im Weingut von Racknitz belegen, dass die Reben aus <strong>der</strong> Zeit zwischen 1108 und <strong>der</strong> Aufgabe<br />
des Klosters in 1559 stammen müssen.<br />
Gegründet wurde das Kloster am Zusammenfluss zwischen Nahe und Glan von dem irischen<br />
Wan<strong>der</strong>mönch Disibod, <strong>der</strong> zunächst eine Kappelle und eine Klause errichtete. An <strong>der</strong> verwil<strong>der</strong>ten<br />
Stelle errichtete <strong>der</strong> Mainzer Erzbischof Willigis ein Stift, das einer seiner Nachfolger, Ruthard,<br />
1108 in ein Benediktinerkloster umwandelte. Im Jahr 1112 trat in dieses Kloster ein junges<br />
Mädchen namens Hildegard ein. Sie wird <strong>40</strong> Jahre bleiben und später als Hildegard von Bingen<br />
mit ihren Schriften zu Ethik, Welt, Mensch und ihren Visionen Berühmtheit erlangen. Auch dem<br />
Wein sprach die Heilerin eine bedeutende Rolle zu: "Ein Wein von <strong>der</strong> Rebe, wenn er rein ist,<br />
macht dem Trinker das Blut gut und gesund."<br />
Das Kloster wurde nach <strong>der</strong> Reformation geschlossen und verfiel zu einem romantischen<br />
Ruinenpark, wie er noch heute zu sehen ist. Seit 1998 gehört das Klostergelände einer Stiftung.<br />
<strong>Die</strong> beson<strong>der</strong>e Atmosphäre des Disibodenbergs mit den alten Klostermauern und seinen uralten<br />
Weinbergen zieht noch heute Besucher in ihren Bann. Genießen kann man sie mit einem Picknick-<br />
Korb, den das Weingut von Racknitz zusammenstellt – ein Riesling vom Disibodenberg inklusive.<br />
Über das Kloster selbst informiert ein kleines Museum am Eingang zum Klosterberg. Hildegard von<br />
Bingen aber erwähnte als eine <strong>der</strong> ersten den "Hunnischen Wein", zu dem auch <strong>der</strong> Hartheunisch<br />
alias Gelber Orleans gehörte.<br />
Infokasten<br />
Klosterruine und Scivias-Stiftung Disibodenberg<br />
Ansprechpartner: Andrea Hein<br />
Tel.: 06755/9699188<br />
Telefax +49 (0)6755 1653<br />
E-Mail: stiftung@disibodenberg.de<br />
www.disibodenberg.de<br />
Öffnungszeiten und Preise<br />
Klosterruine: je<strong>der</strong>zeit über ein Drehkreuz mit Ticketautomat<br />
Preis: pro Person 3,- Euro<br />
Gruppen ab 10 Personen je 2,50 Euro/pro Person<br />
Führungen<br />
Offene Führungen im Sommer jeweils am 2. und 4. Sonntag im Monat um 14.00 Uhr<br />
Gruppenführungen nach schriftlicher Voranmeldung<br />
Museum: 1. April bis 31. Oktober:<br />
<strong>Die</strong>nstag bis Freitag 9 – 18 Uhr,<br />
Samstag und Sonntag 11 – 17 Uhr<br />
Montags geschlossen<br />
Im Winter Führungen nach Vereinbarung
Weinbaudomäne Nie<strong>der</strong>hausen-Schloßböckelheim: Riesling auf Kupfer<br />
Wo heute herausragen<strong>der</strong> Riesling wächst, wurden einst Kupfererze geschürft: <strong>Die</strong><br />
Weinbergslage Schlossböckelheimer Kupfergrube war bis 1901 genau das – eine<br />
Kupfergrube. 1901 kaufte <strong>der</strong> preußische Staat das Gelände, ebnete das alte<br />
Haldenmaterial ein, baute Terrassen und pflanzte darauf einen Weinberg. 1914 war <strong>der</strong><br />
Versuchsweinberg fertig, weltberühmt wurde er im Jahr 1921: In dem legendären Weinjahr<br />
wurde auf dem Kupferberg eine Riesling Trockenbeerenauslese mit sagenhaften 308 Grad<br />
Öchsle geerntet.<br />
Bis heute ist <strong>der</strong> Riesling das Hauptthema <strong>der</strong> Weinbaudomäne Nie<strong>der</strong>hausen-<br />
Schlossböckelheim. Den Weinbau brachten <strong>der</strong> Überlieferung zufolge die Römer an die<br />
Nahe, urkundlich verbrieft ist er für das Jahr 1128: In einem Güterverzeichnis des Klosters<br />
Rupertsberg wird erstmals Weinbau im damals Böckelheim genannten Ort erwähnt. 1901<br />
hatte <strong>der</strong> preußische Staat damit begonnen, an <strong>der</strong> Nahe steiles, zerklüftetes und felsiges<br />
Gelände aufzukaufen. Dem Weinbau in Deutschland ging es damals schlecht, Krankheiten<br />
und Schädlinge, vor allem die Reblaus, hatten zu einem regelrechten Weinbausterben<br />
geführt. <strong>Die</strong> preußischen Weinbaudomänen wurden gegründet, um wirtschaftliche und<br />
qualitativ hochwertige Musterbetriebe zu schaffen – und den Ruf des deutschen Weins zu<br />
retten.<br />
<strong>Die</strong> ersten Rodungsmaßnahmen für die Weinbaudomäne an <strong>der</strong> Nahe begannen 1902,<br />
1903 wurden die ersten Rieslingreben gepflanzt. 1907 erfolgte die erste Lese eines noch<br />
recht rohen Jungweins. 1911 konnte aber bereits <strong>der</strong> erste herausragende Jahrgang<br />
gekeltert werden. Mit dem legendäre 1921er Jahrgang reihte sich die Domäne dann in die<br />
Riege <strong>der</strong> besten Weingüter Deutschlands ein. Auch war man Gründungsmitglied des<br />
heutigen Verbands <strong>der</strong> Prädikatsweingüter im Jahr 1910 – bis heute ist das Weingut<br />
Mitglied in dem erlesenen Kreis.<br />
Auch als Staatsdomäne des Landes Rheinland-Pfalz von 1946 an widmete man sich hier<br />
<strong>der</strong> Forschung in Sachen Qualität und Fortschritt. Hier wurden erstmals Versuche mit <strong>der</strong><br />
Kaltvergärung durchgeführt, Versuche zu Düngemitteln und Spritzmitteln unternommen,<br />
und <strong>der</strong> berühmte Rieslingklon DN 500 selektioniert. Bis heute ist dieser Rieslingklon für<br />
seine hohe Mostgewichts- und Ertragsleistung sowie seine fruchtbetonte Art bekannt.<br />
Heute heißt die ehemals preußische Weinbaudomäne Gut Hermannsberg, benannt nach<br />
<strong>der</strong> Toplage Nie<strong>der</strong>häuser Hermannsberg und ist seit Sommer 2009 im Besitz des<br />
Unternehmers Jens Reidel. Auf den sechs als Erste Lagen klassifizierten Weinbergen<br />
wachsen zu 95 Prozent Riesling. Das alte Kellerei- und Verwaltungsgebäude aus dem<br />
Jahr 1910 wurde mit seinen schönen Jugendstilelementen neu hergerichtet. Darunter<br />
erstrecken sich zwei 90 Meter lange Keller, in denen bis heute <strong>der</strong> Wein ausgebaut und so<br />
mancher Schatz gehütet wird: In <strong>der</strong> Schatzkammer neben dem Holzfasskeller lagern<br />
Weine seit dem Jahr 1907.<br />
Infokasten<br />
Gutsverwaltung Nie<strong>der</strong>hausen-Schlossböckelheim<br />
55585 Nie<strong>der</strong>hausen an <strong>der</strong> Nahe<br />
Telefon: 06758 / 9250 – 0<br />
Telefax: 06758 / 9250 – 19<br />
Email: info@riesling-domaene.de<br />
www.riesling-domaene.de
Freilichtmuseum Bad Sobernheim: Wo historischer Weinbau lebendig<br />
wird<br />
Weinbau vom Mittelalter an bis heute – nirgendwo wird das anschaulicher präsentiert als im<br />
Freilichtmuseum von Bad Sobernheim an <strong>der</strong> Nahe. Das 1973 gegründete Museum im<br />
idyllischen Nachtigallental ist mit einer Fläche von 35 Hektar und rund 60 000 Besuchern pro<br />
Jahr das größte seiner Art in Rheinland-Pfalz. Knapp <strong>40</strong> historische Bauten, die aus allen<br />
Landesteilen stammen, zeigen hier ganz lebendig, wie die Rheinland-Pfälzer früher<br />
gewohnt, gearbeitet und gelebt haben. Dass dazu auch <strong>der</strong> Weinbau gehört, ist im größten<br />
Weinbau treibenden Bundesland selbstverständlich: Weinbau und <strong>Weinkultur</strong> sind im<br />
Museum ein wichtiges Thema – präsentiert natürlich zum Anfassen.<br />
In mehreren alten Winzerhäusern aus den Moselorten Zell-Merl und Ürzig, sowie aus<br />
Weinsheim an <strong>der</strong> Nahe, können die Besucher hautnah nachvollziehen, wie die Weinbauern<br />
in verschiedenen Epochen gewohnt haben und wie ihre Weinkeller aussahen. Zwei teilweise<br />
aus dem späten Mittelalter stammende Kelterhäuser aus Bruttig und aus Brie<strong>der</strong>n an <strong>der</strong><br />
Mosel sind mit verschiedenen Keltern ausgestattet, darunter eine Baumkelter von 1726,<br />
verschiedene Spindelkeltern des 19. Jahrhun<strong>der</strong>ts aus Holz und Keltern mit Metallspindeln<br />
aus dem 20. Jahrhun<strong>der</strong>t – Beispiele <strong>der</strong> Entwicklung <strong>der</strong> Keltertechnik.<br />
<strong>Die</strong> verschiedenen Arbeiten im Weinberg wie<strong>der</strong>um können auf dem 2200 Quadratmeter<br />
großen Museumsweinberg nachvollzogen werden. Auf dem 1983, in Steillage angelegten<br />
Wingert sind die verschiedenen Reberziehungsarten - Pfahlerziehung,<br />
Drahtrahmenerziehung in Bockschnitt sowie Ein- und Mehrbogenanschnitt – zu sehen, ein<br />
historisches Weinbergshäuschen lädt zum Verweilen ein. Bewirtschaftet wird <strong>der</strong> Weinberg<br />
von <strong>der</strong> Winzergenossenschaft Rheingrafenberg e.G. aus dem benachbarten Med<strong>der</strong>sheim,<br />
angebaut werden die traditionellen Rebsorten Gewürztraminer, Riesling, Portugieser,<br />
Rulän<strong>der</strong>, Müller-Thurgau und Silvaner.<br />
Der daraus entstehende "Museums-Schoppen" ist natürlich im Laden erhältlich, in <strong>der</strong><br />
Gaststätte und <strong>der</strong> historischen Kegelbahn können die Nahe-Weine verkostet werden.<br />
Beson<strong>der</strong>es Highlight ist auch <strong>der</strong> jedes Jahr Mitte Mai stattfindende Wein- und Winzertag,<br />
ein Aktionstag im Museum, bei dem sich alles um den Weinbau dreht. In Vorführungen wird<br />
gezeigt, wie <strong>der</strong> Weinberg früher gepflügt, Weinfässer aus den Weinkellern geschrotet<br />
wurden o<strong>der</strong> Sekt degorgiert wird. Bis Ende 2011 entsteht zudem auf dem Gelände des<br />
Freilichtmuseums das "Haus <strong>der</strong> rheinland-pfälzischen <strong>Weinkultur</strong>" mit Vinothek und einem<br />
mo<strong>der</strong>nen Informationszentrum zur Geschichte, Gegenwart und Zukunft des Weinbaus.<br />
Infokasten<br />
Stiftung Rheinland-Pfälzisches Freilichtmuseum<br />
Nachtigallental / Postfach 18<br />
D-55560 Bad Sobernheim / Nahe<br />
Tel.: 06751-38<strong>40</strong> Fax: 06751 - 1207<br />
Email: info@freilichtmuseum-rlp.de<br />
Internet: www.freilichtmuseum-rlp.de<br />
Öffnungszeiten<br />
1. April bis 31. Oktober, täglich außer montags 9 - 17 Uhr
Pfalz<br />
Römervilla Weilberg und Weinkelter: Antike Weinproduktion<br />
Unter einem roten Dach liegt in den Weinbergen am Rand <strong>der</strong> Kur- und Kreisstadt Bad-<br />
Dürkheim ein wahrer Schatz verborgen: eine fast 2000 Jahre alte Kelteranlage aus <strong>der</strong><br />
Römerzeit. <strong>Die</strong> Anlage ist die einzige ihrer Art zwischen <strong>der</strong> Südpfalz und <strong>der</strong> Mosel. Ihr<br />
Fund bei Grabungsarbeiten im Rahmen <strong>der</strong> Flurbereinigung in unmittelbarer Nähe des<br />
Stadtteils Ungstein im Jahr 1981 war nichts weniger als eine Sensation: Mit <strong>der</strong> Römerkelter<br />
von Ungstein konnten die Archäologen endlich auch beweisen, dass die Römer an den<br />
Hängen <strong>der</strong> Pfalz Weinbau betrieben.<br />
Vor allem die große Römervilla, etwas oberhalb <strong>der</strong> Kelter gelegen, ließ die Experten<br />
staunen: Das gewaltige Anwesen aus dem 1. Jahrhun<strong>der</strong>t nach Christus, erbaut von einem<br />
reichen Römer aus Worms, wies einst drei Stockwerke auf. 70 Meter maß allein die Front<br />
des Herrenhauses, das Gebäude war 15 Meter tief und hatte je zwei vorgezogene<br />
Seitenschiffe. <strong>Die</strong> Villa war <strong>der</strong> erste gefundene römische Großbau in <strong>der</strong> Pfalz und wies<br />
nach: Auch hier betrieben die Römer Landwirtschaft im großen Stil. Gut 75 000<br />
Quadratmeter umfasste das Gut, angebaut wurde Getreide – und Wein.<br />
Gekeltert wurde <strong>der</strong> in den drei unscheinbaren Becken im Nebengebäude. Deren Funktion<br />
wurde den Archäologen erst durch weitere Funde klar: Ein Rebmesser aus <strong>der</strong> Antike, eine<br />
Sichel, eine Weinbergshacke, dazu zahlreiche Rebsamen alter Weinsorten fanden die<br />
Forscher in und neben den Becken. <strong>Die</strong> wissenschaftliche Untersuchung ergab: Es handelte<br />
sich um Wildreben sowie um frühe Formen von Riesling-, Traminer- und Burgun<strong>der</strong>-<br />
Trauben. Damit war <strong>der</strong> Nachweis erbracht, dass hier schon die Römer die Trauben mit den<br />
Füßen traten.<br />
<strong>Die</strong> Trauben wurden in die beiden äußeren Becken gefüllt und dort zertreten, <strong>der</strong> Most floss<br />
in das etwas tiefere mittlere Becken, wo er ausgeschöpft und in Fässer gefüllt wurde. Etwa<br />
200 000 Liter konnte hier nach Schätzungen <strong>der</strong> Experten pro Jahr produziert werden. Am<br />
25. Oktober 1991 wurde in dem antiken Kelterhaus nach rund 1500 Jahren Betriebspause<br />
wie<strong>der</strong> die Produktion aufgenommen: In den restaurierten Becken wurden erneut Trauben<br />
mit Füßen getreten und <strong>der</strong> Rebensaft zu Wein verarbeitet. Auch <strong>der</strong> Weinbau selbst ist bis<br />
heute geblieben: Ein reaktivierter römischer Weinberg trägt heute wie<strong>der</strong> Trauben - mit<br />
mo<strong>der</strong>ner amtlicher Prüfnummer. Römisches Leben herrscht ansonsten wie<strong>der</strong> Ende Juni<br />
eines jeden Jahres im Weingut Weilberg - wenn das "Weinfest an <strong>der</strong> Römerkelter" gefeiert<br />
wird.<br />
Infokasten<br />
www.ungstein.de<br />
http://www.archaeopro.de/Archaeopro/Strukturen/UngsteinR.htm<br />
Achtung: Ansprechpartner ergänzen!!
Rhodt unter Rietburg: Ältester noch tragen<strong>der</strong> Weinberg <strong>der</strong> Welt<br />
<strong>Die</strong>se Reben sind wahrlich Veteranen: Mehr als <strong>40</strong>0 Jahre hat <strong>der</strong> "Rhodter Rosengarten"<br />
bereits auf dem Buckel – und liefert noch immer Wein. Der Wingert im Weinort Rhodt unter<br />
Rietburg soll <strong>der</strong> mündlichen Überlieferung zufolge bereits vor dem 30-jährigen Krieg<br />
existiert haben, und <strong>der</strong> fand von 1618 bis 1648 statt. Damit ist <strong>der</strong> Rosengarten <strong>der</strong> älteste<br />
noch immer Reben tragende Weinberg zumindest <strong>der</strong> Pfalz – wenn nicht <strong>der</strong> Welt.<br />
<strong>40</strong>0 Rebstöcke stehen bis heute auf den rund 900 Quadratmetern Fläche, zumeist sind es<br />
Traminerreben mit einzelnen Silvanerstöcken dazwischen. Wer sie einst pflanzte, ist nicht<br />
bekannt. Wein wurde aber in Rhodt unter Rietburg wohl schon seit <strong>der</strong> Römerzeit angebaut<br />
– bekannt ist <strong>der</strong> Ort jedenfalls bereits im Mittelalter für seinen Traminer. 1603 erwarb <strong>der</strong><br />
Markgraf Ernst Friedrich von Baden den Ort, bis 1801 herrschten die Badener hier – und<br />
machten den kleinen Ort unterhalb <strong>der</strong> 1200 erbauten Rietburg durch den Weinhandel reich.<br />
<strong>Die</strong> Folge: stattliche Winzerhäuser entstanden. Bis heute sind die alten Höfe mit ihren alten<br />
Torbögen zu sehen – fast 80 Prozent des Ortes steht unter Denkmalschutz.<br />
Wie schön es hier in <strong>der</strong> "Toskana des Nordens" war, wusste auch ein an<strong>der</strong>er Herrscher:<br />
König Ludwig I. von Bayern erbaute 1846 oberhalb des Ortes seine Sommerresidenz, die<br />
Villa Ludwigshöhe. Von welcher Bedeutung <strong>der</strong> Weinbau für den Ort war, zeigt die lokale<br />
Spezialität: Neben dem üblichen Pfälzer Weinschoppen von 0,5 Liter Größe wird hier <strong>der</strong><br />
Wein auch im "Rhodter Piff" ausgeschenkt - ein Schoppen in einem Ein-Liter-Glas.<br />
Im Rosengarten aber, am östlichen Ortsrand gegenüber <strong>der</strong> Gebietswinzergenossenschaft<br />
Rietburg, stehen noch heute - knorrig-pittoresk und steinhart - die wurzelechten Reben in<br />
dem Uralt-Wingert. Jahr für Jahr liefern sie bis zu 500 Liter Wein, <strong>der</strong> daraus entstehende<br />
Gewürztraminer ist natürlich die Spezialität des Weinguts Arthur Oberhofer in Edesheim,<br />
den Besitzern des Wingerts. Der Wein betört allein schon durch seine Herkunft, aber auch<br />
durch das für Gewürztraminer typische Rosenaroma – passend zum Lagennamen “Rhodter<br />
Rosengarten”.<br />
Infokasten<br />
Fremdenverkehrsverein Rhodt unter Rietburg e.V.<br />
Durlacher Hof/Weinstr. 44,<br />
76835 Rhodt,<br />
Tel. 06323-980079,<br />
Fax -980769,<br />
Email: tourismus@rhodt.de<br />
www.rhodt.de<br />
Weingut Arthur Oberhofer<br />
67483 Edesheim<br />
Am Linsenberg 1<br />
Telefon: 06323- 94 49- 0<br />
Fax: 06323- 94 49- 49
Römerwein in Speyer: Der älteste flüssige Wein <strong>der</strong> Welt<br />
Es ist <strong>der</strong> älteste erhaltene Traubenwein <strong>der</strong> Welt – und er ist noch flüssig. Das Historische<br />
Museum <strong>der</strong> Pfalz in Speyer hütet einen <strong>der</strong> größten weinkulturellen Schätze Deutschlands:<br />
Einen Wein etwa aus dem Jahr 325 n. Christus, erhalten in einer grünlich-gelben,<br />
zylin<strong>der</strong>förmigen Glasflasche mit zwei angesetzten Henkeln in Delphinform. Das Gefäß<br />
wurde im Jahr 1867 bei Ausgrabungen in Speyer in einem Grab entdeckt, in dem man zwei<br />
Steinsarkophage fand – Gräber für einen Mann und eine Frau aus dem frühen 4.<br />
Jahrhun<strong>der</strong>t.<br />
Ingesamt sechs Glasgefäße fand man in dem Frauengrab, zehn Gefäße sogar in dem<br />
Sarkophag des Mannes. Sie alle dürften einmal Flüssigkeiten enthalten haben, Wegzehrung<br />
für die Verstorbenen für ihre lange Reise in die Unterwelt. Doch nur in einer blieb eine<br />
Flüssigkeit erhalten, in eben jener Weinflasche. Sie enthält einen flüssig-klaren Bodensatz<br />
und – zu etwa zwei Dritteln - ein festes, harziges Gemisch. Analysen ergaben, dass es sich<br />
zumindest bei einem Teil <strong>der</strong> Flüssigkeit um Wein gehandelt haben muss. Alkohol ist darin<br />
heute aber sicher nicht mehr enthalten.<br />
Dass sich <strong>der</strong> Wein in ausgerechnet dieser einen Flasche erhalten hat, erklären die<br />
Experten mit <strong>der</strong> Zusammensetzung <strong>der</strong> Flüssigkeit: Der (wenige) Wein wurde einst<br />
zusammen mit einer Würzmischung in die Glasflasche gegossen, darüber kam dann eine<br />
größere Menge Olivenöl, um den Wein von <strong>der</strong> Luft abzuschließen. <strong>Die</strong> Ölmenge war so<br />
groß und so dicht, das es in seiner verharzten Form schließlich sogar ausreichte, um den<br />
"Römerwein" bis heute zu konservieren – mehr als 1680 Jahre lang.<br />
Der "Römerwein" ist nicht das einzige Zeugnis für die 2000 Jahre lange Weingeschichte in<br />
<strong>der</strong> Pfalz: Das "Weinmuseum", eine Unterabteilung des Historischen Museums <strong>der</strong> Pfalz,<br />
dokumentiert mit zahlreichen weiteren Exponaten wie Weinpressen und Prunk-Weinfässern<br />
die Geschichte des Weinbaus am Rhein und drüber hinaus: Hier steht auch die 1913 am<br />
Steinauer Weinberg bei Naumburg an <strong>der</strong> Saale gefundene Weinflasche des Jahrgangs<br />
1678 – die älteste vollständig gefüllte Weinflasche Deutschlands.<br />
Infokasten<br />
Historisches Museum <strong>der</strong> Pfalz<br />
Domplatz<br />
67346 Speyer<br />
Zentrale<br />
Telefon: 06232 13 25 0<br />
Fax: 06232 13 25 <strong>40</strong><br />
E-Mail: info@museum.speyer.de<br />
Information<br />
Telefon: 06232 13 25 0<br />
Führungsbuchung:<br />
Telefon: 06232 62 02 22<br />
Fax: 06232 62 02 23<br />
Öffnungszeiten<br />
<strong>Die</strong>nstag bis Sonntag 10 bis 18 Uhr
Weinstadt Deidesheim: Hort deutscher Qualitätsweinkultur<br />
Hier wurde <strong>der</strong> erste Qualitätswein <strong>der</strong> Pfalz hergestellt, von hier aus die deutsche<br />
Weinbaupolitik maßgeblich mitgestaltet – kaum eine an<strong>der</strong>e Stadt darf sich so sehr zu Recht<br />
"Hüter <strong>der</strong> Weinbaukultur" nennen wie das pfälzische Deidesheim. 85 professionelle<br />
Weinbau-Betriebe gibt es heute – darunter die ganz großen Namen <strong>der</strong> Weinbauzunft wie<br />
Bassermann-Jordan und Reichsrat von Buhl. <strong>Die</strong> Weine des Reichsrats rühmte einst<br />
Reichskanzler von Bismarck, mit diesen Weinen wurde zur Einweihung des Suez-Kanals<br />
angestoßen – die Tropfen des Reichsrats gehörten einst zu den teuersten Weinen <strong>der</strong> Welt.<br />
Es ist kein Zufall, dass ausgerechnet Deidesheim zu einem Hort höchster deutscher<br />
<strong>Weinkultur</strong> wurde: <strong>Die</strong> Lage im Schutz des Pfälzerwaldes bringt wenig Nie<strong>der</strong>schläge und<br />
eine hohe Sonnenscheindauer mit sich – ein fast mediterranes Klima, in dem Feigen,<br />
Mandeln, Bitterorangen und natürlich <strong>der</strong> Wein gedeihen. So wurden bei Ungstein, rund<br />
zehn Kilometer nördlich von Deidesheim 4,5 Millionen Jahre alte Reste von Wildreben<br />
gefunden. Den Kulturweinbau brachten die Römer, in Deidesheim wurden Weinamphoren<br />
und eine Glaskanne in Fassform gefunden.<br />
Im Mittelalter gehörte <strong>der</strong> Ort im Wesentlichen dem lothringischen Adligen Erimbert und<br />
dessen Nachfahren – darunter einige Grafen von Metz, oberlothringischen Herzögen und<br />
Saliern – bis das Domstift von Speyer1086 Eigentümer wurde, samt <strong>der</strong> um 700 erstmals<br />
erwähnten Weinberge. Mit dem so genannten „Ungeld“, einer Steuer auf Wein, wurden Bau<br />
und Instandhaltung <strong>der</strong> Stadtmauer finanziert. Das Stadtrecht erhält man 1395, es folgen<br />
Kriege, Plün<strong>der</strong>ungen und Brände. Der Weinbau bleibt die Konstante: 1504 wird die<br />
Rebsorte Gänsfüßer verzeichnet, es ist die früheste Nennung einer Rebsorte in Deidesheim.<br />
Seine Blütezeit erlebt das Städtchen aber zu Beginn des 19. Jahrhun<strong>der</strong>ts: 1802 produziert<br />
hier <strong>der</strong> Gutsbesitzer Andreas Jordan als erster Qualitätswein nach strengen<br />
Auslesekriterien und führt die Spätlese ein. Jordan verwendet auch als erster Jahrgang,<br />
Rebsorte und Lagenbezeichnung zur Kennzeichnung seiner Weine und setzt damit den<br />
Trend, <strong>der</strong> Deidesheim weltweit berühmt macht. 1848 stirbt Jordan, sein enormer Besitz wird<br />
im Zuge <strong>der</strong> "Jordanschen Teilung" aufgeteilt: es entstehen die Weingüter Geheimer Rat Dr.<br />
von Bassermann-Jordan, Reichsrat von Buhl und Dr. Deinhard. Auch Jordans Erben<br />
engagieren sich für den Weinbau: Jordans Enkel Ludwig Bassermann-Jordan hatte großen<br />
Anteil an <strong>der</strong> Neufassung des Weingesetzes von 1909 und war maßgeblich an <strong>der</strong><br />
Gründung des "Vereins <strong>der</strong> Naturweinversteigerer <strong>der</strong> Rheinpfalz“ beteiligt, dem heutigen<br />
Verband <strong>der</strong> Prädikatsweingüter VDP.<br />
Franz Armand Buhl, ein weiterer Nachfahre, war Grün<strong>der</strong> und Präsident des deutschen<br />
Weinbauverbandes und Hauptverfasser des Reblausgesetzes 1873. Quer durch<br />
Deidesheim kann man noch heute die Zeugnisse dieser großen Zeit sehen: Das Weingut<br />
Bassermann-Jordan im 1770 erbauten Ketschauer Hof, das alte Schloss, das einstige Spital<br />
o<strong>der</strong> das Gasthaus zu Kanne, das einst als Anwesen <strong>der</strong> Zisterzienser errichtet wurde und<br />
seit 1374 nachgewiesenermaßen als Gasthaus betrieben wird – das älteste <strong>der</strong> Pfalz. <strong>Die</strong><br />
Weingeschichte von Deidesheim aber lässt das 1986 eröffnete Museum für <strong>Weinkultur</strong> im<br />
Historischen Rathaus lebendig werden.<br />
Infokasten<br />
Weingut Geheimer Rat Dr. von Bassermann-Jordan<br />
Kirchgasse 10, 67146 Deidesheim<br />
Tel +49 (0) 6326-6006, Fax +49 (0) 6326-6008<br />
info@bassermann-jordan.de, www.bassermann-jordan.de<br />
Reichsrat von Buhl<br />
Weinstraße 16<br />
D-67146 Deidesheim<br />
Tel.: 0 63 26 / 96 50 19<br />
Fax: 0 63 26 / 96 50 24<br />
E-Mail: info@reichsrat-von-buhl.de<br />
www.reichsrat-von-buhl.de
Rheingau<br />
Kloster Eberbach: Der Wein <strong>der</strong> Mönche<br />
Hier liegt wohl die Wiege des Weinbaus im Rheingau und kaum ein Gemäuer steht so sehr<br />
für eine Jahrhun<strong>der</strong>te alte <strong>Weinkultur</strong> wie Kloster Eberbach bei Eltville im Rheingau. 13<br />
Mönche hielten hier einst im Jahre des Herrn 1136 Einzug in dem abgelegenen Rheingautal<br />
– ein Jahr zuvor hatten <strong>der</strong> berühmte Zisterzienserabt Bernhard von Clairvaux zusammen<br />
mit dem Mainzer Erzbischof Adalbert das idyllische Tal besucht, als vor ihnen aus <strong>der</strong> Hecke<br />
ein Eber über den Bach sprang. Ob Kloster Eberbach wirklich so zu seinem Namen kam, ist<br />
nicht belegt, die Franzosen aber waren echt: Direkt aus Clairvaux in Burgund gründeten sie<br />
im Kisselbachtal eine neue Abtei – und sie brachten Wein mit.<br />
Kloster Eberbach entwickelte sich schnell zu einem <strong>der</strong> größten und bedeutendsten Klöster<br />
Deutschlands – wohl auch dank des Rebensaftes. <strong>Die</strong> aus dem Burgund mitgebrachten<br />
Reben <strong>der</strong> Sorte Pinot Noir werden jedenfalls zum ersten Exportschlager <strong>der</strong> Rheingauer<br />
<strong>Weinkultur</strong>: Weil die Mönche vom Zoll auf dem Rhein befreit waren, dominierten sie den<br />
Weinhandel bis hinauf nach Köln, ein äußerst lukratives Geschäft. 1162 besaß das Kloster<br />
in Köln gar ein von Papst Alexan<strong>der</strong> IIII. privilegiertes Lagerhaus.<br />
Gegen Ende des 15. Jahrhun<strong>der</strong>ts wurden klösterliche Räume wie die Fraternei und das<br />
Laienrefektorium in Weinkeller umgewandelt – da lebten bis zu 150 Priestermönche und 600<br />
Laienbrü<strong>der</strong> in dem Kloster. In den Kriegen <strong>der</strong> nächsten Jahrhun<strong>der</strong>te erleidet das Kloster<br />
erheblichen Schaden, <strong>der</strong> Weinbau jedoch blüht weiter. 1730 etwa richten die<br />
Zisterziensermönche für ihre kostbarsten Kreszenzen eigens eine Weinschatzkammer ein –<br />
ein Eltviller Zimmermann schrieb die Rechnung für den „cabernedt keller“. Bis heute lagern<br />
in dem Cabinet-Keller wertvolle Schätze längst verflossener Jahrzehnte.<br />
Mit <strong>der</strong> Säkularisierung von 1803 endet das Klosterleben, nicht aber <strong>der</strong> Weinbau. Seine<br />
Tradition wird von weltlichen Besitzern fortgeführt, erst dem Herzog von Nassau, ab 1866<br />
von den Preußen und schließlich seit 1945 vom Land Hessen. Heute verwaltet das Weingut<br />
Kloster Eberbach sechs Staatsdomänen im Rheingau und an <strong>der</strong> Hessischen Bergstraße,<br />
und ist mit 200 Hektar Rebflächen <strong>der</strong> größte Weinbaubetrieb Deutschlands. <strong>Die</strong> Rotweine<br />
aus Kloster Eberbach selbst sind ein Markenzeichen geblieben, auf 32 Hektar wächst hier<br />
noch immer Spätburgun<strong>der</strong>.<br />
Im Sommer 2008 wurde nur wenige hun<strong>der</strong>t Meter unterhalb <strong>der</strong> alten Klosteranlage mit<br />
dem Steinbergkeller eine <strong>der</strong> mo<strong>der</strong>nsten Weinproduktionsstätten Europas eingeweiht. Pro<br />
Tag können hier bis zu 7000 Liter Traubensaft verarbeitet werden, die Kellerräume reichen<br />
auf 5000 Quadratmetern mehrere Ebenen in die Tiefe – direkt unter den Steinberg, <strong>der</strong><br />
ältesten und ersten Lage in Eberbach. Umgeben ist <strong>der</strong> Weinberg von einer 3000 Meter<br />
langen mittelalterlichen Bruchsteinmauer, die den Rieslingreben zu einem beson<strong>der</strong>en<br />
Mikroklima verhilft - man sagt, <strong>der</strong> Steinberg sei <strong>der</strong> Lieblingsweinberg <strong>der</strong> Mönche<br />
gewesen. <strong>Die</strong> Ergebnisse können in <strong>der</strong> Vinothek im Kloster Eberbach verkostet werden –<br />
o<strong>der</strong> bei einer <strong>der</strong> zahlreichen Weinproben.<br />
Infokasten<br />
Stiftung Kloster Eberbach<br />
65346 Eltville am Rhein<br />
Telefon: +49 (0) 6723 / 9178-100<br />
sowie -111, -112 o<strong>der</strong> -113
Fax: +49 (0) 6723 / 9178-101<br />
E-Mail: info@klostereberbach.de<br />
Internet: www.klostereberbach.de<br />
Öffnungszeiten:<br />
April bis Oktober, täglich 10 bis 18 Uhr<br />
November bis März täglich von 11.00 - 17.00 Uhr<br />
(letzter Einlass jeweils 30 Min. vor Kassenschluss )<br />
Hessische Staatsweingüter GmbH<br />
Kloster Eberbach<br />
Schwalbacher Straße 56-62<br />
65343 Eltville am Rhein<br />
Tel.: +49 (0) 6123 92 300<br />
Fax: +49 (0) 6123 92 30 90<br />
E-Mail: info@weingut-kloster-eberbach.de<br />
Internet: www.weingut-kloster-eberbach.de
Schloss Johannisberg: Geburtsort <strong>der</strong> Spätlese<br />
<strong>Die</strong>s war das Ziel des legendären Spätlesereiters: Schloss Johannisberg bei Geisenheim im<br />
Rheingau. Seit dem Jahr 817 wird hier Wein angebaut, seit rund 300 Jahren dominiert <strong>der</strong><br />
Riesling. Damit ist das Weingut ein monumentales Gedächtnis für die Verbreitung des<br />
Rieslings. Im Weinbaulexikon von 1930 zum Thema Riesling ist kurz und bündig vermerkt:<br />
„Heimat: Deutschland. Wahrscheinlich ein Sämling aus dem Rheingau.“ Eines stimmt in<br />
jedem Fall: Schloss Johannisberg ist eine gigantische Schatzkammer des Rieslings und ein<br />
Hort <strong>der</strong> <strong>Weinkultur</strong>.<br />
Der Legende nach geht die Anlage des Weinbergs auf Karl den Großen zurück – er soll vom<br />
rheinhessischen Ingelheim aus beobachtet haben, dass <strong>der</strong> Schnee auf dem Johannisberg<br />
als erster schmolz. Möglich wäre es, in jedem Fall wird die Lage am Elsterbach 817 erstmals<br />
in einer Urkunde erwähnt. Um das Jahr 1100 gründen hier, genau auf dem 50. Breitengrad,<br />
die Mönche des Mainzer Benediktinerklosters Sankt Alban eine neue Gemeinschaft und<br />
erbauen um 1130 eine Basilika. Das neue Kloster wird dem heiligen Johannes geweiht, in<br />
<strong>der</strong> Mitte des 12. Jahrhun<strong>der</strong>ts erscheint erstmals die Bezeichnung „Sankt Johannisberg“ für<br />
den Besitz.<br />
Ab 1716 gehört das Weingut dem Fürstbischof in Fulda, <strong>der</strong> 1715 das große, dreiflügelige<br />
Schloss erbauen lässt. 1720 werden in den Weinbergen 294 000 Riesling-Reben gepflanzt.<br />
Es ist eine Initialzündung, die den Kellermeister Odo Staab notieren lässt: „In dem ganzen<br />
Rheingau darf keine an<strong>der</strong>e Traubensorte zur Verfertigung <strong>der</strong> Weine gepflanzt werden, als<br />
nur Rüßlinge.“ Es ist auch die Geburt des "Johannisbergers", in den folgenden Jahrzehnten<br />
wird er zum Inbegriff für Qualitätswein schlechthin – bis heute ist "Johannisberg Riesling" in<br />
den USA ein Synonym für Riesling.<br />
Dazu trägt 1775 ein inzwischen legendärer "Unfall" bei: Der Kurier, <strong>der</strong> in Fulda die<br />
Erlaubnis zum offiziellen Beginn <strong>der</strong> Weinlese einholen musste, verspätete sich um einige<br />
Wochen. Als er endlich in Johannisberg eintrifft, wiesen die Trauben an den Rebstöcken<br />
bereits die - bis dahin unbekannte - Edelfäule auf. Der beherzte Kellermeister lässt trotzdem<br />
ernten – es ist die Geburtsstunde <strong>der</strong> Spätlese, die vom Johannisberg aus ihren Siegeszug<br />
um die Welt antritt. Ein Denkmal vor <strong>der</strong> Vinothek erinnert an diese erste späte Lese von<br />
edelfaulen Traube, die fortan zur Regel auf dem Johannisberg wird.<br />
Der Johannisberg aber wird 1816 vom österreichischen Kaiser seinem berühmten<br />
Außenminister Clemens Fürst von Metternich geschenkt, bis heute ist das Gut in Händen<br />
<strong>der</strong> Familie Metternich – Weinzehnt an Österreich inklusive. Auf den 35 Hektar Weinbergen<br />
wächst weiter ausschließlich Riesling – und die „Bibliotheca subterranea“, die berühmte<br />
unterirdische Schatzkammer im Weinkeller, hütet Raritäten bis zurück ins Jahr 1848.<br />
Infokasten<br />
Schloss Johannisberg<br />
65366 Geisenheim-Johannisberg<br />
Telefon: +49 (0) 6722 / 70090<br />
Fax: +49 (0) 6722 / 700933<br />
E-Mail: info@schloss-johannisberg.de<br />
Internet: www.schloss-johannisberg.de<br />
Täglich ab 11.30 Uhr geöffnet, ohne Ruhetag.
Oestrich mit Weinkran: Wo <strong>der</strong> Wein auf Reisen ging<br />
Er ist das Wahrzeichen <strong>der</strong> Weinstadt Oestrich-Winkel: <strong>der</strong> Weinverladekran am Rheinufer<br />
ist <strong>der</strong> einzig erhaltene Zeuge <strong>der</strong> früheren Technik zum Be- und Entladen von Schiffen. Von<br />
hier aus ging <strong>der</strong> Wein auf die Reise, hier kamen die neuen Fässer an. Bis 1926 war <strong>der</strong> von<br />
Menschenkraft angetriebene Kran noch in Betrieb, um den Rheingauer Wein auf Schiffe zu<br />
verladen. Erbaut wurde <strong>der</strong> Kran zwischen April 1744 und Februar 1745, für das mächtige<br />
Fundament mussten 170 Kubikmeter Sandstein herangeschafft werden – ein enormes<br />
Denkmal <strong>der</strong> <strong>Weinkultur</strong> am Rhein.<br />
Der Betrieb eines Krans war zu jener Zeit ein erzbischöfliches Privileg, die Gebühren, die<br />
<strong>der</strong> Kranmeister erheben durfte, waren exakt festgelegt. So genossen auch nur wenige<br />
Städte im Rheingau das Recht, eine solche Anlage zu betreiben. Im 15. Jahrhun<strong>der</strong>t<br />
besaßen lediglich Eltville, Rüdesheim und später auch Lorch ein <strong>der</strong>artiges Privileg.<br />
<strong>Die</strong> Konstruktion beruht auf einer 2000 Jahre alten Technik, die bereits zur Zeit <strong>der</strong> Römer<br />
auf Baustellen verwendet worden war: Zwei mächtige Mühlrä<strong>der</strong> wurden durch das<br />
Vorwärtstreten zweier im Inneren laufen<strong>der</strong> Kranknechte in Bewegung versetzt und zogen<br />
an Ketten die Lasten empor. Das Oberteil des Krans mit dem Kranarm war beweglich und<br />
konnte gedreht werden, so konnten die Lasten dann entwe<strong>der</strong> auf ein Schiff o<strong>der</strong> von<br />
diesem an Land gehievt werden. Verladen wurden in Oestrich vorwiegend Baumstämme –<br />
und vor allem Weinfässer. Oestrich-Winkel rühmt sich nicht umsonst, die größte Weinstadt<br />
Hessens zu sein: <strong>der</strong> Wein spielt hier seit Jahrhun<strong>der</strong>ten die Hauptrolle. Zahllose<br />
Weinstuben und Gutsschänken zeugen davon im Ort.<br />
Stadt ist man allerdings erst seit 1972, als die Orte Oestrich, Winkel und Mittelheim<br />
zusammengelegt wurden und die Stadtrechte verliehen bekamen. <strong>Die</strong> Weinbautradition ist<br />
aber natürlich erheblich älter: In Winkel fand man bei Ausgrabungen ein römische<br />
Rebenmesser – <strong>der</strong> Name Winkel könnte denn auch vom lateinischen "Vini cella",<br />
Weinkeller, abstammen. Erstmals historisch erwähnt wird Winkel im Jahr 850, als <strong>der</strong><br />
berühmte Kirchenmann Rhabanus Maurus die Leitung des Erzbistums Mainz übernahm,<br />
und in seiner Diözese Winkel eine Armenspeisung durchführte. Das sogenannte "Graue<br />
Haus" soll Maurus' Wohnsitz gewesen sein, heute gilt es als das älteste steinerne<br />
Wohngebäude Deutschlands.<br />
Im östlich davon gelegenen Oestrich – möglicherweise kommt daher <strong>der</strong> Name – bauten im<br />
17. und 18. Jahrhun<strong>der</strong>t zahlreiche begüterte Familien ihre Herrensitze an <strong>der</strong> Rheinfront.<br />
Das berühmte Schloss Vollrads, aber auch Schloss Reichartshausen, heute Sitz <strong>der</strong><br />
European Business School, zeugen noch davon. Das Wahrzeichen aber ist <strong>der</strong> Weinkran<br />
geblieben, eine einfache dunkle Bretterverschalung verbirgt die Technik vor dem Auge. Das<br />
Innere kann an Wochenenden und in den Sommermonaten kostenlos besichtigt werden, um<br />
die alte Technik zu bestaunen. Den Wein dazu gibt’s gleich nebenan – in einer <strong>der</strong> vielen<br />
Weinausschanks direkt am Rheinufer.<br />
Infokasten<br />
Tourist-Information<br />
An <strong>der</strong> Basilika 11a<br />
65375 Oestrich-Winkel<br />
Telefon 06723 - 19433<br />
e-Mail: touristinfo@oestrich-winkel.info<br />
www.oestrich-winkel.de
Rheinhessen<br />
Kupferberg-Museum in Mainz: Tiefschichtiger Sektgenuss<br />
Prickeln<strong>der</strong> Sektgenuss hat in Mainz eine lange Tradition – und eine tiefschürfende: 60<br />
Keller in sieben Etagen unter <strong>der</strong> Erde nennt die Kupferberg Sektkellerei auf dem Mainzer<br />
Kästrich ihr Eigen – es sind die tiefstgeschichteten Sektkeller <strong>der</strong> Welt. <strong>Die</strong> alten Gärkeller<br />
stammen zum großen Teil noch aus dem Mittelalter, bis in die Zeit <strong>der</strong> Römer reichen die<br />
hier zutage geför<strong>der</strong>ten Funde: Weinamphoren, Krüge und Trinkschalen, gut 2000 Jahre alt.<br />
Ein guter Grund und Boden für die wohl berühmteste Sektkellerei in Deutschland: 1850<br />
wurde sie von dem Exportkaufmann Christian Adalbert Kupferberg in Mainz als "Fabrication<br />
moussiren<strong>der</strong> Weine" gegründet. Bereits 1852 ließ man sich den Namen "Kupferberg Gold"<br />
schützen, er ist damit eine <strong>der</strong> ältesten Marken in Deutschland. Der Firmengrün<strong>der</strong><br />
präsentierte seine Sekte auf <strong>der</strong> Weltausstellung in London 1862, pflegte persönliche<br />
Verbindungen zu Reichskanzler Otto von Bismarck und zur französischen Champagne.<br />
Bereits seit 1872 ist Kupferberg eine Aktiengesellschaft, 1978 erwarb die Binger Firma<br />
Racke den Großteil <strong>der</strong> Aktien. 2004 wurde die Marke „Kupferberg“ an die Sektkellerei<br />
Henkell verkauft, die zur Oetker-Gruppe gehört.<br />
<strong>Die</strong> alte Kellerei auf dem Mainzer Kästrich aber steht bis heute – und beherbergt ein<br />
einmaliges Museum mit <strong>der</strong> weltweit größten Sammlung von Sekt- und Champagnergläsern.<br />
Auch Pioniere <strong>der</strong> Werbung waren die Kupferbergs, davon zeugt die Ausstellung ebenfalls.<br />
Dazu kommt <strong>der</strong> "Traubensaal", ein für die Weltausstellung 1900 in Paris entworfener<br />
Pavillon aus schmiedeeisernem Weinlaub, Trauben und Ranken – ein Meisterwerk des<br />
Jugendstils. Und natürlich sind die historischen Kelleranlagen zu besichtigen, in <strong>der</strong>en<br />
prunkvoll verzierten Fässern zum Teil heute noch Wein für die Sektbereitung lagert.<br />
Edle Sektproben dürfen da nicht fehlen, im Kupferberg-Park finden regelmäßig Konzerte<br />
statt. 2008 wurde das Programm rund um Sekttradition und <strong>Weinkultur</strong> mit dem "Best of<br />
Weintourism-Award" <strong>der</strong> Vereinigung <strong>der</strong> Great Wine Capitals ausgezeichnet.<br />
Infokasten<br />
Kupferberg-Museum<br />
Kupferbergterrasse 17-19<br />
55116 Mainz<br />
Telefon: 0 61 31/9 23-0<br />
Fax: 0 61 31/9 23-2 22<br />
E-Mail: info@kupferbergterrasse.de<br />
www.kupferbergterrasse.de<br />
Öffnungszeiten <strong>der</strong> Verkaufsboutique: Mo - Sa. 10 -18 Uhr
Weinlage Liebfrauenstift, Worms: So weit <strong>der</strong> Turm seinen Schatten werfe<br />
Im Ausland war sie lange das Synonym für den deutschen Wein überhaupt: die<br />
Liebfraumilch. Ihren Ursprung hat sie in <strong>der</strong> Weinlage Liebfrauenstift rund um die Wormser<br />
Liebfrauenkirche. Schon im Mittelalter bauten hier die Mönche Wein an, mitten zwischen den<br />
Weinbergen aber stand die katholische Pfarrkirche "Liebfrauen" – eine kleine gotische<br />
Basilika wie aus dem Bil<strong>der</strong>buch – mit Doppelturmfassade, figurengeschmücktem<br />
Westportal und einem schmucken Chorgang. Von 1267 bis 1465 wurde sie erbaut, vor allem<br />
als Stifts- und Wallfahrtskirche. Dem überlebensgroßen Madonnenbild aus dem 13.<br />
Jahrhun<strong>der</strong>t wurden Wun<strong>der</strong> zugeschrieben, schnell wurde das Bildnis Ziel einer großen<br />
Marienwallfahrt.<br />
Den Pilgern zum Wallfahrtsort Liebfrauenstift aber kredenzten die Mönche <strong>der</strong> Legende<br />
nach den Wein, <strong>der</strong> um die Kirche herum wuchs. Und <strong>der</strong> kam den Pilgern so lieblich vor,<br />
als schmeckten sie "die Milch unserer lieben Frau". <strong>Die</strong> Lage wurde, so sagt es die<br />
Legende, daraufhin "Liebfraumilch" benannt. Schriftlich erwähnt wurde <strong>der</strong> Name erstmals in<br />
einem Reisebericht eines Englän<strong>der</strong>s aus dem Jahr 1687 – <strong>der</strong> Name Liebfraumilch und <strong>der</strong><br />
mit ihm verbundene deutsche Wein vom Rhein trat von hier aus seinen Siegeszug um die<br />
Welt an.<br />
England war ein wichtiger Exportpartner <strong>der</strong> Wormser Winzer, insbeson<strong>der</strong>e des<br />
Weinhandelshauses J.P. Valckenberg, gegründet 1786. Valckenberg nennt sich das älteste<br />
Familiengeführte Weinhandelshaus in Deutschland, ihm gehören heute noch 90 Prozent <strong>der</strong><br />
Weinbergslagen rund um die Liebfrauenkirche. 1908 schuf Nikolaus Valckenberg mit <strong>der</strong><br />
Liebfraumilch "Madonna" den ersten deutschen Markenwein. Der Name "Liebfraumilch"<br />
selbst war nicht geschützt – 1834 schrieb <strong>der</strong> Weinbaupionier Philipp Bronner die Regel<br />
nie<strong>der</strong>, die damals galt: „… man sagt, nur so weit <strong>der</strong> Turm seinen Schatten werfe, wachse<br />
die eigentliche Liebfrauenmilch.“<br />
Der Erfolg <strong>der</strong> Liebfraumilch zog indes Nachahmer nach sich: Auch an<strong>der</strong>e Winzer sprangen<br />
auf den erfolgreichen Zug auf und produzierten "Liebfrauenmilch"-Weine, die oft mit dem<br />
Ursprung nichts mehr gemein hatten. Seit 1971 ist nach dem deutschen Weinbaugesetz<br />
eine Liebfraumilch ein lieblicher weißer Qualitätswein aus den Anbaugebieten Nahe, Pfalz,<br />
Rheingau und Rheinhessen, <strong>der</strong> zu mindestens 70 Prozent aus Trauben <strong>der</strong> Rebsorte<br />
Riesling hergestellt wird. Seine Restsüße darf nicht unter 18 Gramm pro Liter liegen. <strong>Die</strong><br />
Originallage um die Liebfrauenkirche heißt heute "Liebfrauenstift-Kirchenstück", umfasst 17<br />
Hektar und ist als Lage "Großes Gewächs Rheinhessen" beim Spitzenverband <strong>der</strong><br />
Deutschen Weingüter, dem VDP, klassifiziert. Und natürlich wächst hier vor allem eine<br />
Sorte: <strong>der</strong> Riesling.<br />
Infokasten<br />
Kath. Pfarrkirche Liebfrauen<br />
Liebfrauenring 21, 67541 Worms<br />
Tel. 06241-44267<br />
E-Mail: info@liebfrauen-worms.de<br />
www.liebfrauen-worms.de<br />
Öffnungszeiten <strong>der</strong> Kirche:<br />
Sonntag, 14 – 16 Uhr und nach Absprache<br />
Weinhaus P.J. Valckenberg<br />
Ältestes Familiengeführtes<br />
Weinhandelshaus in Deutschland<br />
Weckerling Platz 1<br />
67547 Worms<br />
Telefon: +49 (0)6241 91110<br />
Fax: +49 (0)6241 9111-60/61<br />
Email: info@valckenberg.com<br />
www.valckenberg.de<br />
Weitere Informationen im Internet:<br />
http://www.worms.de/deutsch/tourismus/sehenswuerdigkeiten/liebfrauen.php?navid=5
Niersteiner Glöck: Älteste Weinbergslage Deutschlands<br />
Eine Urkunde beweist es: die "Niersteiner Glöck" ist die älteste namentlich bekannte<br />
Weinbergslage in Deutschland. Es war im Jahr 742, als <strong>der</strong> Karolinger Karlmann –<br />
Nachfolger von Karl Martell und Onkel Karls des Großen – dem Bistum Würzburg eine<br />
Kirchenbesitzung am Rhein schenkte. Gemeint war die Pfarrei <strong>der</strong> St. Marienkirche in<br />
Nierstein, und zu ihr gehörte ein Weinberg – <strong>der</strong> Glöck.<br />
Seinen Namen hatte <strong>der</strong> Weinberg zweifellos von <strong>der</strong> Kirche und ihren Glocken – ob es<br />
allerdings vom Geläut her stammt, o<strong>der</strong> weil <strong>der</strong> Kirchenglöckner mit dem Wein aus <strong>der</strong><br />
Lage bezahlt wurde, ist heute unklar. Fest steht: an den Bischof von Würzburg war fortan<br />
<strong>der</strong> Zehnte zu entrichten, und das blieb über viele Jahrhun<strong>der</strong>te hinweg so. Heute grenzt die<br />
St. Kilianskirche an den Weinberg, die Nachfolgerin <strong>der</strong> einstigen Marienkirche.<br />
<strong>Die</strong> "Glöck" selbst ist heute im Besitz <strong>der</strong> Staatlichen Weinbaudomäne Oppenheim. Nur 2,1<br />
Hektar klein ist die berühmte Lage, auf <strong>der</strong> zurzeit Riesling und Gewürztraminer wachsen.<br />
<strong>Die</strong> Weine zeichnen sich durch ihr Spiel aus Fruchtigkeit und Mineralität aus, sie wachsen<br />
auf einem Lehm-Löss-Gemisch unmittelbar am Rhein. Der Fluss sorgt für das beson<strong>der</strong>e<br />
Klima, die Hangneigung von 20 Prozent – und eine Jahrhun<strong>der</strong>te alte Mauer, die den<br />
Weinberg vollständig umgibt. <strong>Die</strong> Mönche im Mittelalter bauten solche Mauern um ihre<br />
Weinberge zum Schutz vor kalten Winden, bis heute sorgen die alten Mauern für ein<br />
beson<strong>der</strong>es Kleinklima. 1992 wurde die Mauer um den "Glöck" im mediterran anmutenden<br />
Stil renoviert.<br />
<strong>Die</strong> Lage selbst ist beim Verband <strong>der</strong> Prädikatsweingüter VDP als "Großes Gewächs<br />
Rheinhessen" klassifiziert. Ihre Weine kann man in <strong>der</strong> Staatlichen Weinbaudomäne<br />
verkosten.<br />
Infokasten<br />
Staatliche Weinbaudomäne Oppenheim<br />
Wormser Straße 162<br />
55276 Oppenheim<br />
Tel.: 06133 / 930-305<br />
E-Mail: info@domaene-oppenheim.de<br />
www.domaene-oppenheim.de<br />
Öffnungszeiten:<br />
Montag - Donnerstag 9.00 - 12.00 und 13.00 - 16.00 Uhr;<br />
Freitag 9.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 18.00 Uhr
Saale-Unstrut<br />
Steinernes Bil<strong>der</strong>buch: Albumblätter für den Wein<br />
Es war in <strong>der</strong> Zeit des Rokoko große Mode: das geschriebene o<strong>der</strong> gemalte Albumblatt, das<br />
sich dem Wein widmete o<strong>der</strong> <strong>der</strong> Jagd. Vor den Toren von Naumburg, im Blütengrund beim<br />
Stadtteil Großjena, liegt ein solches Album in <strong>der</strong> wohl ungewöhnlichsten Form: An einer<br />
großen Sandstein-Terrassenmauer, inmitten eines Weinbergs, prangen zwölf mehr als<br />
mannshohe Bildreliefs in <strong>der</strong> Steinwand. Das Steinerne Bil<strong>der</strong>buch ist eines <strong>der</strong><br />
ungewöhnlichsten Denkmäler für den Wein, und das größte Bildrelief im europäischen<br />
Raum, das je in ein stehendes Felsgestein gearbeitet wurde.<br />
Urheber war <strong>der</strong> Juwelier Johann Christian Steinauer, <strong>der</strong> ab 1705 in Naumburg als<br />
Hoflieferant von Herzog Christian II. von Sachsen-Weißenfels zu Reichtum kam. So<br />
beschloss Steinauer um 1720, einen Weinberg zu erwerben. Als Huldigung an den Herzog<br />
aber kam ihm aus Anlass von dessen zehnjährigem Thronjubiläum die Idee, ein Relief aus<br />
den Felsen seines Weinbergs heraus arbeiten zu lassen. Der Bildhauer ist unbekannt, doch<br />
er schuf ein Meisterwerk: Auf einer Länge von 150 Metern entstanden zwölf Szenen, von<br />
denen zehn Geschichten aus <strong>der</strong> Bibel darstellen – die beiden übrigen zeigen eine<br />
Fuchsjagd sowie das Reiterbild Herzog Christians.<br />
Sechs <strong>der</strong> Reliefs drehen sich um Weingeschichten aus <strong>der</strong> Bibel. Da wird die Berauschung<br />
Lots durch seine Töchter dargestellt, Noah als erster Weinbauer, Christus in <strong>der</strong> Kelter,<br />
Josua und Kaleb, die mit einer schweren Weintraube zurückkehren sowie das Gleichnis von<br />
den Arbeitern im Weinberg des Herrn. Bild Nummer fünf zeigt die Hochzeit zu Kanaa, wo<br />
Jesus <strong>der</strong> Bibel nach Wasser in Wein verwandelte – samt einer Inschrift: "Gott macht immer<br />
aus Wasser Wein/ Gesegnet ist die Frucht/ Verdammt soll <strong>der</strong> Mischer sein/ <strong>der</strong> nicht<br />
Erquickung sucht."<br />
Im Fundament von Steinauers Villa oberhalb des Weinbergs aber wurde im Jahr 1913 ein<br />
spektakulärer Fund gemacht: Vier Flaschen Wein <strong>der</strong> Jahrgänge 1678, 1680 und zwei Mal<br />
1687 kamen zutage. <strong>Die</strong> Flasche des Jahres 1678 steht seither als älteste gefüllte<br />
Weinflasche aus Deutschland im Weinmuseum in Speyer. Eine Flasche des Jahrgangs<br />
1687 wurde in Berlin verkostet, die aus dem Jahr 1680 in Naumburg. <strong>Die</strong> letzte Flasche<br />
behielt <strong>der</strong> damalige Eigentümer Me<strong>der</strong> – sie ist seither verschwunden. <strong>Die</strong> "Naumburger<br />
Flasche" von 1680 befindet sich heute im Besitz des Stadtmuseums Naumburg.<br />
Infokasten<br />
Steinernes Bil<strong>der</strong>buch<br />
Max-Klinger-Straße/ Im Blütengrund<br />
06618 Großjena<br />
Informationen im Internet: http://home.arcor.de/okrim22/Sehen/NRelief.html<br />
Tourist- und Tagungsservice<br />
Markt 12<br />
06618 Naumburg<br />
Tel. 03 44 5 / 27 31 25<br />
Fax: 03445 / 27 31 28<br />
e-mail: info@naumburg-tourismus.de<br />
www.naumburg-tourismus.de
Rotkäppchen Sektkellerei: 150 Jahre Sektgeschichte mit Cuvéefass<br />
Der Sekt mit <strong>der</strong> roten Kappe ist ein Markenzeichen für Deutschland: Rotkäppchen Sekt. <strong>Die</strong><br />
Brü<strong>der</strong> Moritz und Julius Kloss gründeten zusammen mit ihrem Freund Carl Foerster am 26.<br />
September 1856 die Weinhandlung Kloss & Foerster in Freyburg an <strong>der</strong> Unstrut. <strong>Die</strong> ersten<br />
6000 Flaschen wurden in einer Wohnung im Hinterhaus <strong>der</strong> Familie Kloss abgefüllt – die<br />
erste Flasche Sekt wurde zur Heirat von Julius Kloss mit seiner Verlobten Emma Gabler am<br />
17. Juni 1858 geöffnet. Das Unternehmen war enorm erfolgreich - schon zehn Jahre später,<br />
1867, konnten die Freyburger Winzer die erfor<strong>der</strong>liche Menge an Wein nicht mehr liefern, es<br />
musste Most aus Württemberg und Baden zugekauft werden. 1870 wurden bereits 120 000<br />
Flaschen produziert.<br />
1894 lieferte sich ein französisches Champagnerhaus einen Rechtsstreit mit Kloss &<br />
Foerster um den Namen "Monopol" – die Bezeichnung für die erfolgreichste Sektlinie. Der<br />
Name ging an die Franzosen und Kloss & Foerster benannten fortan ihren Sekt nach <strong>der</strong><br />
roten Kapsel, die Geburtsstunde <strong>der</strong> Marke Rotkäppchen, und ließen sie am 15. Juli 1895<br />
als Warenzeichen eingetragen. Nach dem Zweiten Weltkrieg wird die Familie Kloss im Juli<br />
1948 enteignet, die Sektkellerei als Volkseigener Betrieb Rotkäppchen-Sektkellerei<br />
Freyburg/Unstrut weiter geführt. Im Jahr 1988 werden allein 15 Millionen Flaschen abgefüllt.<br />
Nach <strong>der</strong> Wende droht Rotkäppchen in <strong>der</strong> Versenkung zu verschwinden – im 2. Halbjahr<br />
1990 werden nur noch 1,8 Millionen Flaschen verkauft. <strong>Die</strong> Sektkellerei arbeitet erst einmal<br />
unter <strong>der</strong> Treuhand weiter, bis 1993 Leitende Mitarbeiter mit <strong>der</strong> Unterstützung <strong>der</strong> Familie<br />
Harald Eckes-Chantré den Schritt eines Management Buy Out wagen. Der Mut und <strong>der</strong><br />
große Einsatz zahlte sich in den Folgejahren aus: Rotkäppchen gehört heute wie<strong>der</strong> zu den<br />
größten Sektkellereien in Deutschland und seit 2002 konnten von „Deutschlands Haus aus<br />
Sekt, Spirituosen und Wein“ Sektmarken wie Mumm und Spirituosenmarken wie Chantré<br />
übernommen werden.<br />
<strong>Die</strong> Architektur <strong>der</strong> Kellerei spiegelt bis heute ihre Geschichte: <strong>Die</strong> Gebäude in <strong>der</strong><br />
Freyburger Sektkellereistraße 5 sind ein Industriedenkmal allerersten Ranges. Beson<strong>der</strong>s<br />
beeindruckend ist <strong>der</strong> 1893 erbaute, rund eintausend Quadratmeter große Lichthof mit<br />
seinem freitragenden Glasdach, damals und auch heute noch eine architektonische<br />
Sensation. Auch die Keller sind sehenswert: 1887 wurde mit dem Bau begonnen, fünf<br />
Stockwerke tief reichen sie in das Muschelkalk-Gestein hinunter und bietet 13 000<br />
Quadratmeter Platz. Im 1896 angebauten Domkeller steht das Prunkstück des Hauses: Das<br />
größte geschnitzte Cuvéefass Deutschlands. Das riesige Fass wurde 1896 von dem Küfer<br />
Georg Feldmann aus dem Holz von 25 Eichen erbaut. Fortan konnten 120 000 Liter Wein<br />
auf einmal vermischt werden, die jeweils 160 000 Flaschen einer Sektsorte füllten. Mit über<br />
100.000 Besuchern pro Jahr ist die Sektkellerei in Freyburg ein großer Besuchermagnet.<br />
Infokasten<br />
Rotkäppchen Sektkellerei<br />
Sektkellereistraße 5<br />
06623 Freyburg (Unstrut)<br />
Tel. 034464 - 34 0<br />
Fax. 034464 – 27237<br />
Email: info@rotkaeppchen.de<br />
www.rotkaeppchen.de
<strong>Die</strong> Weinbergshäuschen von Saale-Unstrut – Ensemble Schweigenberg<br />
Sie sind das Markenzeichen <strong>der</strong> Weinbauregion Saale-Unstrut: die Weinbergshäuser. Wohl<br />
in keiner Region in Deutschland gibt es eine so hohe Dichte von Häusern, Hütten und<br />
manchmal sogar richtigen Villen. Mehrere Hun<strong>der</strong>t Weinbergshäuschen werden in <strong>der</strong><br />
ganzen Region geschätzt, darunter regelrechte Kleinode ihrer jeweiligen Epoche. Als<br />
ältestes datiertes Beispiel gilt ein Fachwerk-Türmchen in <strong>der</strong> Lage Steinmeister bei<br />
Rossbach, <strong>der</strong> "Steinkauz" aus dem Jahre 1555.<br />
<strong>Die</strong> höchste Dichte an Weinbergshäusern aber weist <strong>der</strong> Freyburger Schweigenberg auf:<br />
allein hier finden sich auf rund 20 Hektar Fläche ganze 90 Weinbergshäuschen, entstanden<br />
zwischen 1700 und 1800.<br />
Der Freyburger Schweigenberg ist <strong>der</strong> wohl bekannteste Terrassenweinberg <strong>der</strong> Region:<br />
<strong>Die</strong> rund 25 Hektar große Fläche ist in fünf bis zehn übereinan<strong>der</strong>liegende Terrassen gestuft<br />
und in zahlreiche kleine und kleinste Parzellen unterglie<strong>der</strong>t – ein wahres Kulturdenkmal für<br />
diese traditionelle Bewirtschaftungsform. Mehr als <strong>40</strong> Winzer bewirtschaften heute auf 65<br />
Flurstücken insgesamt rund zwölf Hektar bestockte Rebfläche. Auf ihnen finden sich rund<br />
zehn Kilometer Trockenmauern, etwa fünf Kilometer Umfassungsmauer, einige hun<strong>der</strong>t<br />
Meter Treppenanlagen – und eben die rund 90 Weinbergshäuser, Gebäude und Hütten.<br />
Sie dienten ursprünglich natürlich zum Schutz <strong>der</strong> Arbeiter im Weinberg, zur Rebenwacht<br />
und zur Aufbewahrung von Arbeitsmaterialien. Das erklärt auch die hohe Dichte im<br />
Schweigenberg: weil <strong>der</strong> Berg in viele kleine Parzellen unterteilt war und viele Winzer hier<br />
arbeiteten, errichtete je<strong>der</strong> sein eigenes Häuschen. Weil <strong>der</strong> Schweigenberg nie Opfer <strong>der</strong><br />
Flurbereinigung wurde, haben sich die Häuser in ihrer Vielzahl erhalten.<br />
Später entwickelten sich die Weinbergshäuschen zu Orten <strong>der</strong> Geselligkeit, oft fanden hier<br />
Weingesellschaften des Besitzers statt. Mit <strong>der</strong> Zeit entstanden Bauten, die nach<br />
repräsentativen Vorstellungen und Baustilen geformt wurden, und zuweilen entstanden reine<br />
Repräsentations- o<strong>der</strong> Wohngebäude. Dazu gehört etwa die 1722 erbaute Villa des<br />
Hofjuweliers Carl Gottlieb Steinauer, <strong>der</strong> dieses repräsentative Wohnhaus über seinem<br />
Weinberg errichten ließ. Zu Repräsentationszwecken wurde auch die pompöse<br />
„Schlifterhütte“ im Freyburger Schlifterweinberg erbaut, von den Besitzern <strong>der</strong> Rotkäppchen<br />
Sektkellerei Förster und Kloss. Zu den beeindruckendsten Vertretern gehört außerdem das<br />
Rokokoweinbergshaus im Herzoglichen Weinberg in Freyburg. Das um 1774 vom<br />
kursächsischen Steuereinnehmer Carl Gottlieb Barthel erbaute sechseckige Gebäude<br />
besticht durch sein Fachwerk, sein französisches Dach und ein tonnengewölbtes<br />
Kellergeschoss.<br />
Das berühmteste aller dieser Weinbergshäuser aber ist das "Toskanaschlösschen", gelegen<br />
im Freyburger Schweigenberg: das Kleinod wird <strong>der</strong>zeit restauriert und ist zum Wahrzeichen<br />
<strong>der</strong> Weinbergshäuser überhaupt geworden. Wo die Weinbergshäuser liegen und welche<br />
besichtigt werden können, ist beim Weinbauverband Saale-Unstrut zu erfahren.<br />
Infokasten<br />
Weinbauverband Saale-Unstrut e. V.<br />
Querfurter Str. 10<br />
06632 Freyburg<br />
Telefon: 034464 / 26110<br />
Telefax: 034464 / 29416<br />
Email: info@natuerlich-saale-unstrut.de<br />
www.natuerlich-saale-unstrut.de
Sachsen<br />
Staatsweingut Schloss Wackerbarth: älteste Sektkellerei Sachsens<br />
Adel verpflichtet – das war auf Schloss Wackerbarth schon immer Lebensmotto. Das<br />
beginnt mit dem Erbauer des Schlosses, Generalfeldmarschall und Reichsgraf Christoph<br />
August von Wackerbarth, reicht über königliche Lebenslust und endet noch lange nicht<br />
beim heutigen Weingut: Schloss Wackerbarth ist weit über die Grenzen Sachsens hinaus<br />
bekannt – nicht nur für seine Weine, auch für seinen erstklassigen Sekt. Als Erbe <strong>der</strong><br />
traditionsreichen Marke Bussard ist Wackerbarth heute die älteste Sektekellerei Sachsens<br />
– und die zweitälteste von ganz Deutschland.<br />
<strong>Die</strong> Geschichte von Schloss Wackerbarth hat ihren Ursprung 1727 mit dem Erwerb von<br />
Grund und Weinbergen durch den Grafen von Wackerbarth. Von Landesbaumeister<br />
Johann Christoph Knöffel lässt sich <strong>der</strong> Minister Augusts des Starken und Gouverneur von<br />
Dresden zwischen 1727 und 1730 "Schloss Wackerbarth's Ruh'" erbauen – ein Weingut<br />
mit barockem Herrenhaus, großzügiger Gartenanlage und einem Lusthäuschen, dem<br />
Belve<strong>der</strong>e, errichtet gar vom berühmten Architekten Matthäus Daniel Pöppelmann<br />
persönlich. <strong>Die</strong> Legenden berichten von rauschenden Festen des kurfürstlichen Hofes,<br />
Schloss Wackerbarth wurde schnell zum Tempel <strong>der</strong> Lebenslust, und natürlich des Weins.<br />
<strong>Die</strong> Geschichte des Schlosses gestaltete sich wechselvoll, <strong>der</strong> Wein aber blieb. 1836<br />
wurde ganz in <strong>der</strong> Nähe <strong>der</strong> "Actienverein zur Fabrikation moussieren<strong>der</strong> Weine"<br />
gegründet – die Geburt <strong>der</strong> Sektkellerei Bussard, wie sie ab 1897 hieß. <strong>Die</strong> Fabrik in<br />
Nie<strong>der</strong>lößnitz machte mit ihrer Sektherstellung im klassischen Flaschengärverfahren<br />
Furore, im Jahr 1846 wurde eine Höchstleistung von 150 000 Flaschen erreicht. Bis nach<br />
dem zweiten Weltkrieg bestand sie, dann wurde Bussard 1972 enteignet und in den<br />
Volkseigenen Betrieb Weinbau Radebeul integriert – <strong>der</strong> Beginn <strong>der</strong> Kooperation mit<br />
Schloss Wackerbarth. Bis heute führt das Schlossweingut die Bussardsche Tradition fort –<br />
eine <strong>der</strong> Radebeuler Steillagen im Steinrücken heißt heute Bussardberg.<br />
Schloss Wackerbarth selbst wurde 1928 Staatsweingut, ab 1950 "Volksweingut Radebeul"<br />
– und ist seit 1992 wie<strong>der</strong> Sächsisches Staatsweingut. Seitdem wird hier konsequent<br />
mo<strong>der</strong>nisiert und auf Qualität gesetzt, sichtbares Zeichen dafür ist <strong>der</strong> 2002 eingeweihte<br />
Neubau mit großem Weinkeller darunter. Seitdem ist Schloss Wackerbarth das erste<br />
Erlebnisweingut Europas: In den alten barocken Häusern finden heute Weinseminare,<br />
Veranstaltungen und wie<strong>der</strong> zahlreiche Feste statt. Schloss Wackerbarth bietet<br />
Weinerlebnis mit allen Sinnen - natürlich mit den Weinen aus rund 90 Hektar<br />
Weinbergslagen und den Sekten <strong>der</strong> Marken Schloss Wackerbarth, Bussard und August<br />
<strong>der</strong> Starke. Adel verpflichtet eben.<br />
Öffnungszeiten Markt: Täglich 9.30 bis 20.00<br />
Infokasten<br />
Uhr<br />
Sächsisches Staatsweingut GmbH<br />
Schloss Wackerbarth<br />
Wackerbarthstraße 1<br />
01445 Radebeul<br />
Tel. 03 51.89 55-0<br />
Fax 03 51.89 55-150<br />
www.schloss-wackerbarth.de<br />
Führungen mit Verkostung<br />
Montag bis Freitag:<br />
14.00 Uhr Wein-Führung<br />
17.00 Uhr Sekt-Führung<br />
Samstag:<br />
12.00, 14.00, 16.00 Uhr Wein-Führung<br />
13.00, 15.00, 17.00 Uhr Sekt-Führung<br />
Sonntag:<br />
12.00, 14.00, 16.00 Uhr Wein-Führung<br />
13.00, 17.00 Uhr Sekt-Führung<br />
15.00 Uhr Schloss- und Garten-Führung
Hoflößnitz: Sachsenkeule und Weinfeste <strong>der</strong> Kurfürsten<br />
<strong>Die</strong>s ist wahrlich die Wiege des sächsischen Weinbaus: Auf dem Weingut Hoflößnitz<br />
feierten die sächsischen Kurfürsten ihre Weinlese, und hier wurde die berühmte<br />
Sachsenkeule erfunden – und hier ist eine 600-jährige Weinbautradition zuhause. Bereits<br />
für das Jahr 1271 ist <strong>der</strong> Weinbau in <strong>der</strong> Lößnitz belegt. Am 8. Mai 1<strong>40</strong>1 erwarb Markgraf<br />
Wilhelm <strong>der</strong> Einäugige von Meißen das Presshaus nebst umliegendem Gelände für eine<br />
Kaufsumme von 1660 Schock Meißnischer Groschen. Damit brachte das Fürstenhaus <strong>der</strong><br />
Wettiner den verstreuten Weinbergbesitz <strong>der</strong> Umgebung für fast fünf Jahrhun<strong>der</strong>te - bis<br />
1889 - unter seine Kontrolle. Bis ins 19. Jahrhun<strong>der</strong>t war <strong>der</strong> Hof <strong>der</strong> Mittelpunkt des<br />
herrschaftlichen Weinbaus und Stätte höfischer Festlichkeiten.<br />
Der heutige Name "Hoflößnitz" findet urkundlich zum ersten Male mit dem Datum des 14.<br />
Januars 1622 seine Erwähnung. 1650 ließ Kurfürst Johann Georg I. ein Schlösschen<br />
neben das Presshaus bauen, das Berg- und Lusthaus. Sein Sohn Johann Georg II. feierte<br />
hier alljährlich die Weinlese. Dessen Hofmaler war <strong>der</strong> Nie<strong>der</strong>län<strong>der</strong> Albert Eckhout, er<br />
schmückte den Festsaal mit einem riesigen Leinwanddeckengemälde, ein Meisterwerk,<br />
das 80 brasilianische Vögel zeigt. Auch die Holzwände sind mit Tafelmalereien über und<br />
über geschmückt.<br />
Wie sehr sich hier alles im 17. Jahrhun<strong>der</strong>t um den Weinbau drehte, zeigt das Klein-<br />
Viniculturbüchlein, das <strong>der</strong> kurfürstliche Weinbergsverwalter und Bauschreiber Johann<br />
Paul Knohll 1667 in <strong>der</strong> Hoflössnitz verfasste. Es war ein Kommentar zu <strong>der</strong> Kurfürstlich<br />
Sächsischen Weingebürgsordnung vom 23. April 1588 und enthielt den Kanon <strong>der</strong> 24<br />
feststehenden Regeln zu den Weinbergsarbeiten, ergänzt durch eigene Erfahrungen. Bis<br />
in das 19. Jahrhun<strong>der</strong>t hinein war es das Standardwerk sächsischer Winzerei. Kurfürst<br />
August <strong>der</strong> Starke (1677–1733) lud seine Jagdgesellschaften nach Hoflößitz ein und<br />
veranstaltete Tanzfeste mit Weinausschank – rauschende Winzerfeste sollen es gewesen<br />
sein. In seiner Zeit entstand auch das Winzerhaus, in dessen Weinkeller sich eine<br />
Probierstube, die Kellerstube, für den Kurfürsten befand.<br />
1843 erhielt die Hoflössnitz den Status eines Staatsweingutes und blieb es bis zum<br />
Nie<strong>der</strong>gang des Weinbaus in <strong>der</strong> Lößnitz, verursacht vor allem durch die Reblaus im Jahr<br />
1889. <strong>Die</strong> Weinbau-Tradition wurde 1911 wie<strong>der</strong>aufgenommen, als eine<br />
Rebveredelungsstation eingerichtet wurde. Ihr Leiter war seit 1916 <strong>der</strong> Landwirtschaftsrat<br />
Carl Pfeiffer, <strong>der</strong> Vater <strong>der</strong> Wie<strong>der</strong>belebung des Weinanbaus in Sachsen. Er rebte von<br />
1913 an die Lößnitz mit <strong>der</strong> neuen Propfrebe wie<strong>der</strong> auf und übernahm 1916 die Leitung<br />
<strong>der</strong> Rebenveredlungsstation, aus <strong>der</strong> 1927 die Weinbau-Versuchs- und Lehranstalt<br />
hervorging. In Pfeiffers Zeit fällt auch die Erfindung einer Beson<strong>der</strong>heit: Um die Attraktivität<br />
<strong>der</strong> Elbtalweine zu steigern, wurde hier auf Hoflößnitz 1931 die Sachsenkeule erfunden,<br />
eine grüne Flasche in Keulenform.<br />
<strong>Die</strong> weinkulturelle und weinbauliche Tradition setzen heute die 1998 gegründete Stiftung<br />
Weingutmuseum Hoflössnitz sowie Stiftung Weingut- und Schoppenstube Hoflössnitz<br />
GmbH fort. Das Weingut bewirtschaftet knapp acht Hektar Rebflächen nach den<br />
Richtlinien des kontrolliert ökologischen Weinbaus. Das frühere Lustschloss beherbergt<br />
heute ein Museum zum Weinbau im Elbtal und zum ehemaligen kurfürstlichen Weingut.<br />
Infokasten<br />
Stiftung Weingutmuseum Hoflössnitz<br />
Knohlweg 37, 10445 Radebeul<br />
Telefon: +49 (0)351-8 39 83 33<br />
Telefax: +49 (0)351-8 39 83 30<br />
Email: info@hofloessnitz.de<br />
www.hofloessnitz.de<br />
www.weinmuseum.de
Württemberg<br />
Kessler in Esslingen: Älteste Sektkellerei Deutschlands<br />
Hier stand die Champagnermarke Veuve Cliquot persönlich Pate: Am 1. Juli 1826<br />
gründete Georg Christian von Kessler in Esslingen am Neckar die erste Sektkellerei<br />
Deutschlands. Gelernt hatte <strong>der</strong> Unternehmer sein Handwerk in <strong>der</strong> Champagne: Von<br />
1807 an war Kessler bei <strong>der</strong> berühmten Firma Veuve Cliquot-Fourneaux & Cie. als<br />
Buchhalter beschäftigt, 1815 war er bereits Mitglied <strong>der</strong> Geschäftsführung. Kessler führte<br />
die Champagnerkellerei zu enormen Erfolgen, vor allem durch das Auslandsgeschäft, das<br />
er aufbaute. Doch Intrigen verhin<strong>der</strong>ten, dass er 1824, wie geplant, das Unternehmen<br />
übernehmen durfte.<br />
Gut für Esslingen und gut für Deutschland: Kessler kehrte in seine Heimatstadt zurück,<br />
und gründete dort 1826 die G.C. Kessler & Compagnie in <strong>der</strong> ehemaligen Kelter des<br />
Kaisheimer Pfleghofes. Aus Frühburgun<strong>der</strong> wurden die ersten <strong>40</strong>00 Flaschen<br />
Schaumwein hergestellt und unter dem bescheidenen Namen "schäumen<strong>der</strong><br />
Württemberger Wein" in den Handel gebracht. Der Schaumwein nach Champagnerart<br />
hergestellt, machte schnell Furore: In den ersten zehn Jahren verkaufte Kessler rund eine<br />
halbe Million Flaschen seines moussierenden Weines. 1829 exportierte Kessler bereits<br />
nach Russland, Großbritannien und in die Vereinigten Staaten, Hauptabsatzgebiet blieb<br />
aber Württemberg und sein Königshaus.<br />
1832 erfolgte <strong>der</strong> Kauf <strong>der</strong> ersten Gewölbekeller im Speyrer Pfleghof. Der eindrucksvolle<br />
frühere Zehnthof wurde wohl um das Jahr 1213 errichtet und ist bis heute Firmensitz und<br />
Produktionsstandort <strong>der</strong> Sektmanufaktur Kessler. In Kesslers Todesjahr 1842 verkauft das<br />
Unternehmen bereits 46 500 Flaschen – das Unternehmen führte Carl Weiss weiter. Auf<br />
<strong>der</strong> Leipziger Messen im Jahr 1850 erschien dann zum ersten Mal die Marke „Kessler<br />
Cabinet“ - die älteste bekannte Sektmarke Deutschlands. Auch im 20. Jahrhun<strong>der</strong>t ging<br />
die Erfolgsgeschichte weiter: Kessler-Sekt wurde während <strong>der</strong> Weltfahrt des Luftschiffes<br />
„LZ 127 Graf Zeppelin“ kredenzt, Konrad Adenauer machte ihn 1956 zum Sekt <strong>der</strong><br />
Bundesregierung für Staatsempfänge.<br />
Dennoch musste das Traditionsunternehmen im Dezember 2004 Insolvenz anmelden, ein<br />
Neustart unter dem Esslinger Betriebswirt Christopher Baur verhin<strong>der</strong>te 2005 das Aus.<br />
Und so können die zwei Kellner mit dem Sektkühler – das Markenzeichen <strong>der</strong> Firma –<br />
noch heute Kessler-Sekt servieren. Gezeichnet wurden sie übrigens vom Simplicissimus-<br />
Karikaturist Josef Benedict Engl im Jahr 1904. Heute heimst Kessler-Sekt wie<strong>der</strong> Preise<br />
ein – Dank seines eigenen Stils, ganz in <strong>der</strong> Tradition Veuve Cliquots. Zu besichtigen ist<br />
das im neuen Kessler-Karree 18 mitten in Esslingen mit Bar, Verkostungsraum und<br />
historischem Gewölbekeller.<br />
Infokasten<br />
Kessler Sekt GmbH & Co. KG<br />
Marktplatz 21 - 23<br />
73728 Esslingen<br />
Telefon 0711 310593-0<br />
Fax: 0711 3508751<br />
www.kessler-sekt.de<br />
Kessler Karree 18<br />
Telefon: +49-(0)711 31 05 93-41<br />
Montag bis Freitag 11 bis 19 Uhr<br />
Samstag: 10 bis 16 Uhr
Pfedelbach: Fürstenfass und Herrschaftskelter<br />
In dieser Landschaft markieren Weinkeltern die Wege, und das ganz buchstäblich:<br />
Zwischen Öhringen und Pfedelbach standen einst acht Weinkeltern. Sie hießen<br />
Pfaffenkelter, Meisenkelter o<strong>der</strong> Wachol<strong>der</strong>kelter, die meisten sind heute verschwunden,<br />
doch Keltersteine erinnern noch an sie – und eine Kelterrunde, ein Wan<strong>der</strong>weg, <strong>der</strong> die<br />
alten Stätten verbindet. Sie sind Marksteine einer wohl 2000 Jahre alten Weinbaukultur,<br />
denn wahrscheinlich brachten schon die Römer den Weinbau in die Region. Der Weinort<br />
Pfedelbach entstand wohl im 11. Jahrhun<strong>der</strong>t, 1037 wird er erstmals in einer Urkunde<br />
erwähnt. <strong>Die</strong> Römer waren aber schon um das Jahr 150 nach Christus hier: Durch<br />
Pfedelbach verläuft <strong>der</strong> Obergermanisch-Raetische Limes, <strong>der</strong> seit 2005 Weltkulturerbe<br />
<strong>der</strong> Unesco ist.<br />
Der Weinbau kann keine kleine Rolle gespielt haben, im Jahre 1604 entsteht jedenfalls <strong>der</strong><br />
"Lange Bau", ein langgestrecktes Fachwerkhaus mit einem 70 Meter langen und 12 Meter<br />
breiten Herrenkeller - groß genug, um darin mehrere hun<strong>der</strong>ttausend Liter Wein zu lagern.<br />
Heute dokumentiert hier das Pfedelbacher Weinbaumuseum die Geschichte des<br />
Rebenanbaus in <strong>der</strong> Region. Das Prunkstück ist das drittgrößte Weinfass Deutschlands:<br />
das Fürstenfass von 1752, in Auftrag gegeben von Fürst Joseph von Hohenlohe<br />
Bartenstein - mit sagenhaften 64 664 Litern Fassungsvermögen. Letztmals wurde es 1828<br />
mit dem Zehntwein für den Fürsten gefüllt, <strong>der</strong> ihn an seine Truppen ausgab.<br />
Hier, im historischen Fürstenfass-Keller, wurde 1950 die Weinkellerei Hohenlohe<br />
gegründet, von damals 14 Winzern. 450 Weingärtner aus 16 Weinbauorten kultivieren<br />
heute ihre Trauben für die "Fürstenfass-Weine", die Kellerei selbst hat ihren Sitz in<br />
Bretzfeld-Adolzfurt.<br />
Der Weg <strong>der</strong> Keltern aber hört am Weinbaumuseum noch lange nicht auf: Im<br />
Pfedelbacher Ortsteil Heuholz steht eine <strong>der</strong> ältesten noch erhaltenen Herrschaftskeltern<br />
in Nordwürttemberg. <strong>Die</strong> Fürstlich-Hohenlohische Herrschaftskelter entstand im Jahr 17<strong>40</strong><br />
als Gemeinschaftskelter <strong>der</strong> Fürstenhäuser Hohenlohe-Waldenburg und Hohenlohe-<br />
Öhringen. <strong>Die</strong> stützenfreie Dachkonstruktion über einer Grundfläche von 15 mal 18 Metern<br />
war eine zimmermannstechnische Meisterleistung. <strong>Die</strong> Kelter ist heute im Eigentum eines<br />
Privatmannes und wurde 1990 aufwändig saniert.<br />
Infokasten<br />
Keltern-Runde: http://www.hohenlohe.de/showpage.php?SiteID=268<br />
Weinbaumuseum Pfedelbach<br />
Im Fürstenkeller<br />
Baierbacher Str. 12<br />
74629 Pfedelbach<br />
Öffnungszeiten:<br />
Mai bis Oktober: Sonn- und Feiertage von 14 00 Uhr bis 16 00 Uhr und nach Voranmeldung<br />
Eintritt: frei<br />
Ansprechpartner:<br />
Bürgermeisteramt Pfedelbach<br />
Hauptstraße 17<br />
74629 Pfedelbach<br />
Tel. 0 79 41 / 60 81 11<br />
http://www.hohenlohe.de/showpage.php?SiteID=148
Weingut Burg Hornberg: Der Götz und das zweitälteste Weingut <strong>der</strong><br />
Welt<br />
Hier trieb einst <strong>der</strong> legendäre Götz von Berlichingen Weinbau: 45 Jahre lang lebte <strong>der</strong><br />
berühmt-berüchtigte fränkische Reichsritter mit <strong>der</strong> eisernen Hand auf Burg Hornberg bei<br />
Neckarzimmern. Was viele aber nicht wissen: Der durch seine Kämpfe im schwäbischen<br />
Bauernkrieg bekannt gewordene Ritter trieb auch Weinbau auf seiner 1517 erworbenen<br />
Burg Hornberg, und zwar so erfolgreich, dass er – wie die Annalen berichten – seinen<br />
"Neckarwein - Schleckerwein" bis an den Kaiserhof <strong>der</strong> Donaumetropole Wien verkaufte.<br />
<strong>Die</strong> Burg Hornberg wird erstmals 1184 in einem durch Kunrad von Hohenstaufen,<br />
Pfalzgraf bei Rhein, verfassten Dokument erwähnt – samt Weingut und Weinbergen. Doch<br />
die Experten sind sich heute sicher, dass dies nicht <strong>der</strong> Beginn des Weinbaus am<br />
Hornberg war: Auf dem Gebiet <strong>der</strong> „Unteren Au“ und des zur Burg Hornberg gehörenden<br />
Stockbronner Hofes wurden 1893 zwei römische Villae Rusticae gefunden. Auffallend<br />
viele Scherben von teils großen Keramikgefäßen legen eine Verbindung <strong>der</strong> beiden<br />
Landgüter zum Weinbau nahe – damit dürfte in <strong>der</strong> Gegend, durch die auch <strong>der</strong> Limes<br />
führte, schon im 2. Jahrhun<strong>der</strong>t Weinbau betrieben worden sein.<br />
In jedem Fall gilt das Weingut Burg Hornberg allein schon wegen <strong>der</strong> Urkunde von 1184<br />
als das zweitälteste noch existierende Weingut <strong>der</strong> Welt - und als das älteste Weingut in<br />
Baden-Württemberg. Eigentlich liegt das Weingut auf badischem Gebiet und galt auch bis<br />
in die 1980er Jahre als badisches Weingut. Seitdem wird die Lage an <strong>der</strong> Grenze zu<br />
Württemberg jedoch als württembergisch geführt. Auf insgesamt zehn Hektar Rebfläche<br />
werden eine Vielzahl von Weinen angebaut, darunter auch historische Weinsorten wie<br />
Muskateller und Traminer - auch auf den steilen Terrassen des Burgberges in den Lagen<br />
Burg Hornberger Wallmauer und Burg Hornberger Götzhalde.<br />
Über neun Kilometer Natursteinmauern sorgen für einen thermischen Ausgleich im<br />
Weinberg, weil das Mauerwerk tagsüber die Wärme <strong>der</strong> Sonne speichert und nachts die<br />
Wärme an die Rebstöcke abgibt. Noch heute wird das Traubengut vom Weinberg direkt in<br />
die Kelter des unterhalb bei Neckarzimmern liegenden, <strong>40</strong>0 Jahre alten Schlosses zur<br />
Verarbeitung gebracht. Der Ausbau <strong>der</strong> Weine erfolgt im alten Schlosskeller mit seinem <strong>40</strong><br />
Meter langen und über 6 Meter hohen, freitragenden Gewölbe. <strong>Die</strong> Weinproben finden in<br />
<strong>der</strong> Romanischen Unteren Burg statt, dem größten Wohngebäude aus <strong>der</strong> Staufferzeit<br />
nördlich <strong>der</strong> Alpen. Der offizielle Gutsausschank befindet sich in <strong>der</strong> Alten Neckarmühle in<br />
Gundelsheim. Oenologe und Burgherr ist heute Baron Dajo von Gemmingen-Hornberg –<br />
in 12. Generation Erbe des Freiherrn von Gemmingen, <strong>der</strong> 1612 Burg Hornberg kaufte,<br />
und Bewahrer einer rund 1500-jährigen Weinbautradition. Götz von Berlichingen-Hornberg<br />
war 1562 mit 82 Jahren gestorben – seine Originalrüstung ist bis heute auf <strong>der</strong> Burg zu<br />
sehen.<br />
Infokasten<br />
Burgherr Baron Dajo von Gemmingen-Hornberg<br />
Burg Hornberg 1<br />
74865 Neckarzimmern<br />
Telefon: 06261-5001 (ab 10:00 Uhr)<br />
Telefax: 06261-2348<br />
Mobil: 0172-1030167<br />
E-Mail: Info@Burg-Hornberg.de<br />
Homepage: www.Burg-Hornberg.de