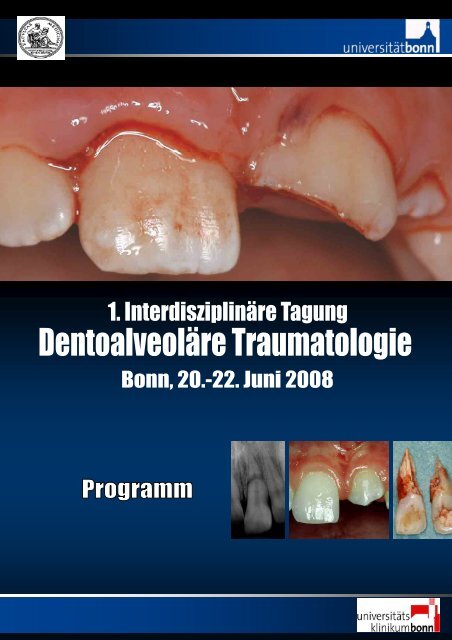pluradent – Ihr Partner für Erfolg
pluradent – Ihr Partner für Erfolg
pluradent – Ihr Partner für Erfolg
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
STRAUMANN<br />
ZUVERLÄSSIGKEIT AUF JEDEM NIVEAU<br />
Rufen Sie uns an!<br />
Mehr Informationen unter<br />
0761/4501-333
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen!<br />
Begrüßung<br />
Zahn- und Kieferverletzungen sind häufig, komplex und variabel. Eine<br />
adäquate Behandlung setzt Wissen aus allen zahnmedizinischen<br />
Fachgebieten voraus.<br />
Die spezielle Situation verletzter Zähne unterscheidet sich deutlich<br />
von der anderer Zahnerkrankungen. Insbesondere die mögliche<br />
Interaktion zwischen Endodont und Parodont kompliziert die Heilung.<br />
Die Verletzungsfolgen können aus medizinischer, psychologischer und<br />
ästhetischer Sicht dramatisch sein. Zahntraumata verursachen sehr<br />
hohe Kosten.<br />
Durch die Variabilität werden die einzelnen Verletzungstypen nicht so<br />
häufig in der Praxis gesehen, dass Zahnärztinnen und Zahnärzte<br />
Routine in Diagnostik und Behandlung aufbauen könnten. Erhebliche<br />
Erweiterungen des Wissens in den letzten Jahren sind zudem noch<br />
nicht ausreichend bis in die Praxis durchgedrungen. Sehr schnell<br />
werden die Grenzen des eigenen Wissens und Könnens erreicht.<br />
Zahn-, Kieferverletzungen wurden von wissenschaftlicher Seite bisher kaum fokussiert. Umso<br />
erfreulicher ist es, dass überraschend viele Vortrags- und Posteranmeldungen eingegangen sind.<br />
Die nachrückende Generation scheint sich der Traumatologie nicht mehr ausschließlich durch<br />
Fallberichte annehmen zu wollen, auch wenn wir immer noch <strong>–</strong> das sei Aufforderung zu mehr<br />
Studien zu verstehen <strong>–</strong> von guten Fallberichten noch vieles lernen können.<br />
Die Lehre wird dadurch erschwert, dass Zahn-, Kieferverletzungen in ihrer Komplexität häufig alle<br />
Disziplinen der Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde fordern, der interdisziplinäre Austausch aber nicht<br />
überall ausreichend etabliert ist. Es ist aber der fachübergreifende Ansatz, der die Dentoalveoläre<br />
Traumatologie weiter voranbringt und neue Impulse setzt. Zahntraumazentren können den<br />
interdisziplinären Gedanken und die Zusammenarbeit zwischen den beteiligten Kliniken und<br />
Polikliniken befördern. Das Etablieren einer überregionalen, interdisziplinär ausgerichteten<br />
Vereinigung ist darüber hinaus überfällig, die Diskussion innerhalb fachspezifischer Gruppierungen<br />
wird der Dentoalveolären Traumatologie niemals gerecht werden.<br />
Mit dieser Tagung haben wir uns zwei Ziele gesetzt. Sie soll einerseits mit praktischen Hinweisen<br />
den niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen helfen, dentoalveoläre Verletzungen adäquat<br />
behandeln zu können, mit dem Ziel eines dauerhaften und komplikationsfreien Zahnerhaltes. Das<br />
gilt insbesondere <strong>für</strong> die Kinder und Jugendlichen, <strong>für</strong> die im Wachstumsalter oft keine definitiven<br />
Behandlungen nach Zahnverlust möglich sind.<br />
Die Tagung soll aber auch die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aller Disziplinen <strong>für</strong> einen<br />
fachübergreifenden Austausch zusammenbringen. Wir hoffen, dass junge Kolleginnen und Kollegen<br />
an der Thematik so viel Gefallen finden, dass sie sich in ihrer wissenschaftlichen Orientierung der<br />
dentoalveolären Traumatologie zuwenden. Wer erst einmal “infiziert” ist von diesem Thema, kommt<br />
so leicht nicht mehr davon los: Es ist faszinierend, die Komplexität des Traumas beherrschen zu<br />
lernen, und befriedigend, Unfallopfern, Kindern und Jugendlichen zumal, adäquat helfen zu können.<br />
Ich wünsche uns eine informative Tagung, eine angeregte, auch kontroverse Diskussion über das<br />
Dentoalveoläre Trauma <strong>–</strong> und ich wünsche uns (nicht nur zahn-) unfallfreie Tage.<br />
1
2<br />
Aussteller und Sponsoren<br />
Unfallverletzungen zu behandeln bedeutet viel Enthusiasmus und Engagement. So sollte<br />
wenigstens diese Tagung zu möglichst günstigen Konditionen stattfinden, damit<br />
möglichst viele Kolleginnen und Kollegen die Chance zu Austausch und Information<br />
nutzen können. Umso wichtiger ist die Unterstützung der Tagung durch die Industrie, bei<br />
der wir offene Ohren <strong>für</strong> unser Anliegen gefunden haben. Für dieses Entgegenkommen<br />
möchten wir uns ganz herzlich bedanken. Die Unterstützung der Tagung wird letztlich<br />
unseren meist jungen Patienten zugute kommen, die als Unfallopfer oft unverschuldet<br />
erheblich verletzt werden und häufig mit lebenslangen Folgen belastet sind.<br />
Aussteller 3M Espe AG<br />
Aesculap AG & Co. KG<br />
Bredent Medical<br />
CAMLOG Biotechnologies<br />
DCI-Dental Consulting GmbH<br />
Helmut Zepf Medizintechnik GmbH<br />
Heraeus Kulzer GmbH<br />
J. Morita Mfg. Corp.<br />
Kaniedenta GmbH & Co. KG<br />
Medartis GmbH<br />
Medical Factoring Reiss GmbH<br />
Quintessenz Verlags-GmbH<br />
Sanofi-Aventis GmbH Deutschland<br />
Straumann GmbH<br />
Sponsoren Colgate-Palmolive GmbH<br />
ERBACHER Wirtschaftsdienste<br />
<strong>für</strong> Zahnärzte und Ärzte<br />
GABA GmbH<br />
GEBR. BRASSELER GmbH & Co. KG<br />
Ivoclar Vivadent GmbH<br />
Kinderdent GmbH<br />
Pluradent AG & Co KG<br />
Inserenten 3M Espe AG Umschlagseite 3<br />
CAMLOG Biotechnologies Rückseite<br />
GEBR. BRASSELER GmbH & Co. KG Seite 10<br />
KaVo GmbH Seite 8<br />
Pluradent AG & Co KG Seite 14<br />
Straumann GmbH Umschlagseite 2
Inhalt<br />
Aussteller und Sponsoren ..............................................................................................2<br />
Programmübersicht ......................................................................................................4<br />
Lageplan • Zahnklinik ...................................................................................................5<br />
Abendveranstaltung .....................................................................................................6<br />
Reise-Informationen .....................................................................................................6<br />
Lageplan • Umgebung ..................................................................................................7<br />
Hauptprogramm ..........................................................................................................9<br />
Kurzvorträge ............................................................................................................. 11<br />
Posterpräsentation ..................................................................................................... 12<br />
Hands-On-Kurse und Seminare .................................................................................... 15<br />
Referenten und Erstautoren......................................................................................... 17<br />
Die Tagung und die Kurse werden nach den Leitsätzen und der Punktebewertung von BZÄK und DGZMK<br />
durchgeführt.<br />
Für die Teilnahme an der Tagung werden 16 Fortbildungspunkte erlangt.<br />
Für die Teilnahme an den Kursen und Seminaren werden je Kurs 2 Punkte erlangt sowie 1 Zusatzpunkt je<br />
Halbtag und 1 Zusatzpunkt <strong>für</strong> Lernerfolgskontrolle.<br />
Wissenschaftliches Komitee<br />
Fr. Prof. Dr. Sabine Ruf, Gießen<br />
Prof. Dr. Kurt Ebeleseder, Graz<br />
Prof. Dr. Andreas Filippi, Basel<br />
Dr. Gabriel Krastl, Basel<br />
Priv.-Doz. Dr. Yango Pohl, Bonn<br />
Organisationskomitee<br />
Priv.-Doz. Dr. Yango Pohl, Bonn<br />
Dr. Alexander Schafigh, Bornheim<br />
Fr. Lydia Lagody, Bonn<br />
Fr. Dr. Katrin Bongert, Bonn<br />
Fr. Dr. Anne-Katrin Eisenbeiß, Bonn<br />
Dr. Hani El-Nahass, Bonn<br />
Dr. Andreas Hansen, Bonn<br />
Dr. Martin Moses, Bonn<br />
Fr. Dr. Mai-Trinh Winterfeld, Bonn<br />
3
4<br />
Programmübersicht<br />
Tagungsprogramm Kurse Kurse<br />
Raum großer Hörsaal Mehrzweckraum Phantomkursraum Zelte<br />
Freitag<br />
9:00 Kurzvorträge 1<br />
10:30 Pause<br />
11:30 Kurzvorträge 2<br />
13:00 Mittagspause<br />
14:30<br />
Begrüßung<br />
Einführung<br />
15:00 Hauptprogramm 1<br />
16:00 Pause<br />
16:30 Hauptprogramm 2<br />
18:15 Ende Tagesprogramm<br />
B-H1 Restauration<br />
9:00-11:00<br />
A-H2 Schienung<br />
11:15-13:15<br />
19:00 Abendveranstaltung (Hotel Hilton)<br />
Samstag<br />
9:00 Hauptprogramm 3<br />
10:15 Pause<br />
10:45 Hauptprogramm 4<br />
12:30 Mittagspause<br />
14:00 Hauptprogramm 5<br />
15:15 Pause<br />
15:45 Hauptprogramm 6<br />
17:00 Hauptprogramm 7<br />
17:30 Ende der Tagung<br />
Sonntag<br />
C-S1 Mundschutz<br />
8:45-10:45<br />
9:00 B-H1 Restauration<br />
9:00-11:00<br />
11:15 A-H2 Schienung<br />
11:15-13:15<br />
A-H1 Replantation<br />
9:00-11:00<br />
B-H2 Refixation<br />
11:15-13:15<br />
A-H1 Replantation<br />
9:00-11:00<br />
B-H2 Refixation<br />
11:15-13:15<br />
Poster<br />
Industrieausstellung<br />
Industrieausstellung
Stadtbahn<br />
Wilhelm(s)platz<br />
Linie 61<br />
Hauptbahnhof<br />
6 min.<br />
Linie 61<br />
Innenministerium<br />
7 min.<br />
Umsteigen in<br />
Flughafenbus<br />
Taxi<br />
Poster-<br />
Ausstellung<br />
Catering<br />
Industrie-<br />
Ausstellung<br />
Registrierung<br />
Garderobe<br />
Mehrzweckraum<br />
(1. OG)<br />
großer Hörsaal<br />
WC<br />
(UG)<br />
Phantomkurs<br />
(3. OG)<br />
Catering<br />
Industrie-Ausstellung<br />
Registr.<br />
Vorträge<br />
Lageplan • Zahnklinik<br />
Kölnstraße<br />
Poster<br />
A-H1<br />
B-H2<br />
A-H2<br />
B-H1<br />
C-S1<br />
Wilhelmplatz<br />
ZMK Bonn<br />
Wachsbleiche<br />
5
6<br />
Abendveranstaltung<br />
Freitag, 21. Juni 2008 • 19:00 Uhr • Hotel Hilton • Plaza (Terrasse) oder Restaurant<br />
Am Freitag treffen wir uns nach der Tagung gegen 19°° im Hotel Hilton und<br />
lassen den arbeitsreichen Tag ausklingen mit einem Barbecue. Bei schönem<br />
Wetter werden wir die Plaza mit Rheinblick nutzen.<br />
Für die nötige Entspannung sorgt das Andreas Kremer Trio „AKT“. An was Sie<br />
dabei auch immer denken mögen: „AKT“ steht <strong>für</strong> die Liebe zum Jazz - von<br />
Mainstream bis Fusion. Vorsicht Elektrifizierung!<br />
Empfohlener Weg: Die Straße nördlich der Zahnklinik (Wachsbleiche) bis zum Rhein und die<br />
Uferpromenade entlang nach Süden bis zum Hotel Hilton. Etwa 1000 m. Siehe nebenstehende Karte.<br />
Die Teilnahmegebühr von 50 € umfasst Sektempfang, Barbecue und eine Runde Mineralwasser. Die<br />
Kosten <strong>für</strong> die weiteren Getränke bitte individuell begleichen.<br />
CGN A<br />
Köln/Bonn<br />
ICE B<br />
Siegburg/Bonn<br />
Hauptbahnhof<br />
670<br />
Flughafenbus<br />
66<br />
„Telekomexpress“<br />
Reise-Informationen<br />
Fahrtzeit<br />
von/nach<br />
Kosten<br />
20-25 min. ZMK 40-50 €<br />
20 min. 1<br />
26 min. 2<br />
6,30 €<br />
15-20 min. ZMK 30-40 €<br />
19 min. 5<br />
23 min.<br />
C 5-8 min. ZMK 5-10 €<br />
4<br />
Haltestelle nur Ausstieg<br />
Haltestelle nur Einstieg<br />
Zubringer zum Flugh.-Bus<br />
4,10 € Regio Ticket 3<br />
61 5 min. 3 1,50 € Kurzstreckenticket<br />
(max. 4 Stationen)<br />
Ausschilderung Richtung Beethovenhalle folgen<br />
Freitag Nutzen Sie die Parkhäuser<br />
oder die Straßen um die Zahnklinik<br />
Samstag/<br />
Sonntag<br />
Parkplatz der Zahnklinik (kostenfrei)<br />
Bushaltestelle Stadtbahnhaltestelle
61<br />
Ludwigsplatz 3<br />
Stadthaus<br />
61<br />
66<br />
Innenministerium 1<br />
61<br />
4<br />
565<br />
BN - Auerberg<br />
BN - Nord<br />
Kölnstraße<br />
Oxfordstr.<br />
Stadtmitte<br />
Fußgängerzone<br />
C<br />
Hauptbahnhof<br />
Lageplan • Umgebung<br />
ZMK<br />
Welschnonnen<br />
Stiftsplatz<br />
Beethoven-<br />
Halle<br />
Beethovenhalle/SWB 2<br />
66<br />
Bertha v. Suttner 5<br />
61<br />
66<br />
638<br />
551<br />
670 Flughafenbus<br />
638<br />
551<br />
3<br />
B<br />
2<br />
A<br />
CGN A<br />
Köln/Bonn<br />
Brüdergasse /<br />
Bertha v. Suttner<br />
6<br />
15-20 min.<br />
5 min.<br />
25 min.<br />
7 min.<br />
30 min.<br />
Rhein<br />
5<br />
ICE B<br />
Siegburg/Bonn<br />
66<br />
7-10 min.<br />
5-7 min.<br />
7
KaVo 3D eXam<br />
KaVo 3D eXam,<br />
der Gold-Standard<br />
in 3D<br />
Digitales 3D-Cone-Beam-Röntgen<br />
vom Marktführer<br />
• Leicht zu bedienen<br />
• Bilder höchster Qualität durch<br />
fortschrittlichste Sensortechnologie<br />
• Größte Aufnahmeformate<br />
(Ø 23 x 17 cm) nach Belieben<br />
eingrenzbar<br />
• Kürzeste Scan- und Rekonstruktionszeit<br />
(typ. < 1 Min)<br />
• Freie Implantatplanung<br />
• Geringster Platzbedarf<br />
(1,1 x 1,2 m)<br />
KaVo Dental GmbH · D-88400 Biberach/Riß · Telefon +49 7351 56-0 · Fax +49 7351 56-1488 · www.kavo.com
Hauptprogramm<br />
Alfred Kantorowicz-Hörsaal (großer Hörsaal)<br />
Freitag, 20. Juni 2008<br />
14:30 Begrüßung, Einführung<br />
Gerhard Wahl, Bonn • Karl-Rudolf Stratmann, Köln • Yango Pohl, Bonn<br />
HV 1<br />
15:00<br />
HV 2<br />
15:30<br />
HV 3<br />
16:45<br />
HV 4<br />
17:15<br />
HV 5<br />
17:45<br />
Prävention von Zahnverletzungen und von Spätfolgen<br />
Andreas Filippi, Basel<br />
Restaurative Versorgung traumatisierter Zähne<br />
Gabriel Krastl, Basel<br />
Was heißt hier Endodontie?<br />
David Sonntag, Marburg<br />
Milchzahnverletzungen<br />
Norbert Krämer, Dresden<br />
Kinder als Unfallpatienten<br />
Kurt Ebeleseder, Graz<br />
Samstag, 21. Juni 2008Uhr<br />
HV 6<br />
09:00<br />
HV 7<br />
09:30<br />
HV 8<br />
10:45<br />
HV 9<br />
11:15<br />
HV 10<br />
11:45<br />
HV 11<br />
14:00<br />
HV 12<br />
14:30<br />
HV 13<br />
15:45<br />
HV 14<br />
16:15<br />
Heilung nach schwerem Zahntrauma - Implikationen <strong>für</strong> Prävention und<br />
Therapie<br />
Yango Pohl, Bonn<br />
Die Transreplantation. Eine neue Methode zur Erhaltung elongierter,<br />
höchstgradig gelockerter und kurz vor dem Spontanausfall stehender Zähne<br />
Thomas Hiedl, Straubing<br />
Schienentherapie nach dentoalveolären Traumata - Indikation und Techniken<br />
Christine Berthold, Erlangen<br />
Wurzelfraktur - eine Verletzung verliert ihren Schrecken<br />
Kurt Ebeleseder, Graz<br />
Replantation traumatisierter Zähne<br />
Yango Pohl, Bonn<br />
Dentoalveoläres Trauma: Probleme und Lösungsmöglichkeiten aus<br />
kieferorthopädischer Sicht<br />
Sabine Ruf, Gießen<br />
Adhäsivprothetische Versorgung<br />
Matthias Kern, Kiel<br />
Transplantation nach traumabedingtem Zahnverlust in der Oberkieferfront<br />
Andreas Filippi, Basel<br />
Aspekte der Implantation im Frontzahnbereich<br />
Gerhard Wahl, Bonn<br />
17:00 Fallpräsentationen <strong>–</strong> Fordere die Experten<br />
Teilnehmer<br />
9
© 03/2008 · BRA/0 · 404077V0<br />
Ab jetzt übernehmen wir die Haftung<br />
DentinBuild | DentinBond | DentinPost Coated<br />
die perfekte Ergänzung zum ER-System<br />
Ihnen <strong>Ihr</strong>e Arbeit zu erleichtern, ist eine<br />
Herausforderung, der wir uns täglich<br />
stellen. Die aktuellste Innovation aus<br />
dem Hause KOMET ist ein perfekt aufeinander<br />
abgestimmtes, vollständiges<br />
Stiftaufbausystem <strong>–</strong> basierend auf dem<br />
bewährten ER-System. Eine Besonderheit<br />
ist dabei das glasfaserverstärkte<br />
Material von Stift und Composite, das<br />
eine hohe Belastbarkeit und dentinähnliche<br />
Eigenschaften garantiert.<br />
Zum System zählen das einfach zu<br />
applizierende Composite DentinBuild,<br />
das sich sowohl zur Stiftbefestigung<br />
als auch zum Stumpfaufbau einsetzen<br />
lässt, sowie die werkseitig vollständig<br />
beschichtete Ausführung eines unserer<br />
<strong>Erfolg</strong>sstifte: DentinPost Coated.<br />
Zusammen mit diesen beiden Komponenten<br />
und dem anwendungsfreundlichen<br />
Adhäsivsystem DentinBond<br />
erreichen Sie einen optimalen Verbund.<br />
GEBR. BRASSELER GmbH & Co. KG · Telefon 05261 701-700 · www.kometdental.de<br />
Qualität zahlt sich aus
Kurzvorträge<br />
Alfred Kantorowicz-Hörsaal (großer Hörsaal)<br />
Freitag, 20. Juni 2008 • 9:00 Uhr<br />
V 1<br />
09:00<br />
V 2<br />
09:13<br />
V 3<br />
09:26<br />
V 4<br />
09:39<br />
V 5<br />
09:52<br />
V 6<br />
10:02<br />
V 7<br />
10:15<br />
Frontzahntrauma bei syrischen Kindern mit unterschiedlichen Gebiss-<br />
Anomalien<br />
Bashar M. Muselmani, Latakia, Syrien • Stefan Kopp, Frankfurt<br />
Milchfrontzahntrauma und Folgen <strong>für</strong> die bleibende Dentition<br />
Sabine Sennhenn-Kirchner, Göttingen<br />
Reproduzierbarkeit von Periotestmessungen vor und nach Eingliederung<br />
zweier Zahntraumaschienen an unverletzten Probanden<br />
Christine Berthold, Erlangen • Alexander Dörr, Erlangen • Johannes Schmitt, Erlangen •<br />
Stefan Holst, Erlangen<br />
Proliferation von Pulpazellen nach direkter Überkappung mit Kalziumhydroxid,<br />
ProRoot MTA und Gluma Comfort Bond in vivo<br />
Till Dammaschke, Münster • Udo Stratmann, Münster • Edgar Schäfer, Münster • Klaus<br />
H. R. Ott, Münster<br />
Wiederbefestigung eines autologen Zahnfragmentes nach unkomplizierter<br />
Kronenfraktur<br />
Hans-Peter Freitag, Tübingen<br />
Apexifikation traumatisierter Zähne unter Verwendung von Mineral Trixoxide<br />
Aggregate (MTA)<br />
Katharina Bücher, München • Jan Kühnisch, München • Christoph Kaaden, München •<br />
Reinhard Hickel, München<br />
Digitaler Frontzahntraumabogen als Basis <strong>für</strong> Dokumentation und<br />
wissenschaftliche Auswertungen<br />
Puria Parvini, Frankfurt am Main • Georg-Hubertus Nentwig, Frankfurt am Main<br />
Freitag, 20. Juni 2008 • 11:30 Uhr<br />
V 8<br />
11:30<br />
V 9<br />
11:43<br />
V 10<br />
11:56<br />
V 11<br />
12:09<br />
V 12<br />
12:22<br />
V 13<br />
12:35<br />
V 14<br />
12:48<br />
Zahnverletzungen bei Miniplattenosteosynthese: Einteilung,<br />
Therapiemanagement, Komplikationen und Prognose<br />
Tobias Vollkommer, Regensburg • Gottfried Schmalz, Regensburg • Torsten E. Reichert,<br />
Regensburg • Oliver Driemel, Regensburg<br />
Das verminderte alveoläre Trauma bei der Zahnlängsextraktion<br />
Benno Syfrig, Luzern<br />
Intrusive Dislokationsverletzungen - Therapieoptionen und potentielle<br />
Schwierigkeiten -<br />
Gregor Castrillón-Oberndorfer, Heidelberg<br />
Zahnreplantation - bei langzeitavulsierten und trocken gelagerten Zähnen?<br />
Christine Schwerin, Magdeburg • Klaus-Louis Gerlach, Magdeburg<br />
Replantation von 45 avulsierten bleibenden Zähnen: 1 Jahres Follow-up Studie<br />
Vivianne Chappuis, Bern • Thomas von Arx, Bern<br />
Langzeitergebnisse nach autoalloplastischer Replantation avulsierter<br />
bleibender Zähne bei Patienten im Wachstumsalter<br />
Yango Pohl, Bonn • Andreas Filippi, Basel<br />
Lückenschluss durch Mesialisation der Milcheckzähne - eine Alternative nach<br />
traumatischem Frontzahnverlust?<br />
Niko Bock, Gießen • Sandra Morton, Gießen • Sabine Ruf, Gießen<br />
11
12<br />
Posterpräsentation<br />
Zelt (Parkplatz ZZMK)<br />
Die Poster sind während der Tagung von Freitag, 9:00 Uhr bis Samstag, 16:00 Uhr ausgestellt.<br />
Am Freitag von 10:30 Uhr bis 11:30 Uhr Diskussion am Poster.<br />
Freitag, 20. Juni 2008 • 10:30 Uhr <strong>–</strong> 11:30 • Diskussion am Poster<br />
P 1 Dreidimensionale radiologische Diagnostik von Zahntraumata und ihren<br />
Spätfolgen<br />
Dorothea Berndt, Basel • Gabriel Krastl, Basel • Andreas Filippi, Basel<br />
P 2 140 Jahre zahnärztliche Traumatologie an der Martin-Luther-Universität Halle-<br />
Wittenberg<br />
Felix Schneider, Halle/Saale<br />
P 3 Belastung juveniler Incisivi bei der stiftprothetischen Versorgung<br />
Sebastian Mues, Bonn<br />
P 4 Bruchlastverhalten von Stiftaufbauten bei Zähnen mit nicht abgeschlossenem<br />
Wurzelwachstum<br />
Anett Mues, Bonn<br />
P 5 Komplizierte Kronenfrakturen der beiden mittleren oberen Schneidezähne -<br />
Therapie von Komplikationen nach Erstversorgung<br />
Berit Muselmani, Jena • Eike Glockmann, Jena<br />
P 6 Konservierende Versorgung eines komplexen dentalen Traumas - Ergebnis<br />
nach vier Jahren<br />
Jan Kühnisch, München • Katharina Bücher, München • Christoph Kaaden, München •<br />
Reinhard Hickel, München<br />
P 7 Therapie externer entzündlicher Wurzelresorptionen nach Avulsion - Ein<br />
Fallbericht<br />
Thomas Ebert, Erlangen • Christine Berthold, Erlangen<br />
P 8 <strong>Erfolg</strong>reiche Apexifikation nach komplizierter Frontzahnfraktur und<br />
mehrtägiger Pulpaexposition.<br />
Clemens Bottenberg, Euskirchen<br />
P 9 Langzeitkontrollen nach apikaler MTA-Applikation zur einzeitigen Apexifikation<br />
bei traumatisch geschädigten Zähnen<br />
Benjamin Blome, Bonn • Victor Sobarzo, Bonn<br />
P 10 Replantation von parodontal kompromittierten Zähnen nach extraoraler<br />
Wurzelkanalbehandlung und unter Anwendung von Emdogain<br />
Benjamin Blome, Bonn • Yango Pohl, Bonn<br />
P 11 Sofortimplantation bei Frontzahntrauma. Ein komplexer Fallbericht.<br />
Steffen Schneider, Berlin • Axel Bumann, Berlin<br />
P 12 Sofortbelastung eines Implantates in Regio 21 zwei Tage nach traumatisch<br />
bedingtem Zahnverlust<br />
Puria Parvini, Frankfurt am Main • Misha Krebs, Frankfurt am Main • Georgia Trimpou,<br />
Frankfurt • Georg-Hubertus Nentwig, Frankfurt<br />
P 13 Replantation avulsierter und frakturierter Zähne nach atraumatischer<br />
Extraktion mit dem Benex® Extraktions-Set<br />
Puria Parvini, Frankfurt am Main • Georg-Hubertus Nentwig, Frankfurt am Main<br />
P 14 Transplantation von Prämolaren bei ausgeprägtem Knochendefizit - eine<br />
interdisziplinäre Aufgabe<br />
Yango Pohl, Bonn • Sandra Morton, Gießen • Silke Marie Nies, Gießen • Sabine Ruf,<br />
Gießen
P 15 Kindliches Frontzahntrauma mit Früh- und Spätfolgen - ein Patientenbericht<br />
Susanne Wriedt, Mainz • Bilal Al-Nawas, Mainz • Katy Al-Nawas, Mainz • Joachim<br />
Wegener, Mainz<br />
P 16 Frontzahnverletzungen mit Parodontbeteiligung im Patientengut der ZMK-<br />
Klinik Mainz von 1997 bis 2006<br />
Susanne Wriedt, Mainz • Monika Martin, Mainz • Heiner Wehrbein, Mainz<br />
P 17 Langzeitfolgen nach kindlichem Zahntrauma - eine Kontrolluntersuchung von<br />
41 Patienten<br />
Susanne Wriedt, Mainz • Monika Martin, Mainz • Heiner Wehrbein, Mainz<br />
P 18 Spätfolgen nach Frontzahntrauma im Milchgebiss - Fallbericht<br />
Ina Manuela Schüler, Jena • Berit Muselmani, Jena • Roswitha Heinrich-Weltzien, Jena<br />
P 19 Ursachen und Häufigkeit dentoalveolärer Verletzungen unter besonderer<br />
Beachtung der Avulsionen<br />
Christin Müller, Greifswald • Axel Schriewer, Greifswald • Wolfgang Sümnig, Greifswald<br />
P 20 Bewährung eines Zahnrettungskonzeptes an Schulen in Hessen<br />
Dimitrios Rokas, Bonn • Horst Kirschner, Gießen • Andreas Filippi, Basel • Yango Pohl,<br />
Bonn<br />
P 21 Heilung einer nach Avulsion und Replantation existenten Gingivarezession: ein<br />
Fallbericht<br />
Hans-Peter Freitag, Tübingen<br />
P 22 Einstellung eines nach Trauma ankylosierten Zahnes mittels<br />
Distraktionsosteogenese - ein Fallbericht<br />
Sonja Behrens, Mainz • Bilal Al-Nawas, Mainz • Wilfried Wagner, Mainz • Heiner<br />
Wehrbein, Mainz<br />
P 23 Fallbericht einer indirekten Zahnwurzelschädigung bei<br />
Miniplattenosteosynthese einer Unterkieferfraktur<br />
Markus Hullmann, Regensburg • Gottfried Schmalz, Regensburg • Torsten E. Reichert,<br />
Regensburg • Oliver Driemel, Regensburg<br />
P 24 Potentielle Schwierigkeiten in der Initialtherapie kombinierter dentoalveolärer<br />
Traumata - ein Fallbericht<br />
Gregor Castrillón-Oberndorfer, Heidelberg • Joao Frankmann Pricoli, Heidelberg<br />
P 25 Kieferorthopädische Frühbehandlung nach ausgeprägter intrusiver Dislokation<br />
- ein Fallbericht<br />
Julia von Bremen, Gießen • Sabine Ruf, Gießen<br />
P 26 Kieferorthopädische Sofortbehandlung nach traumatischer Frontzahnintrusion<br />
- ein Fallbericht<br />
Susanne Wriedt, Mainz • Dan Brüllmann, Mainz • Bernd d'Hoedt, Mainz • Heiner<br />
Wehrbein, Mainz<br />
P 27 Die provisorische Versorgung des Frontzahntraumas<br />
Stefan Bayer, Bonn • Helmut Stark, Bonn • Norbert Enkling, Bern • Sebastian Mues,<br />
Bonn<br />
P 28 Direkte glasfaserverstärkte Brücke zum Ersatz eines Unterkiefer-Frontzahnes<br />
nach Zungenpiercing-Trauma - ein Fallbericht<br />
Cornelia Schach, Heidelberg • Diana Wolff, Heidelberg<br />
P 29 VALPLAST®-Monoreduktoren als Alternative zur Immediatprothese nach<br />
Frontzahntraumata: Fallberichte einer klinischen Vorstudie<br />
Dominik Kraus, Bonn • Verena Voigt, Bonn • Karolin Kiesgen, Bonn • Hubert<br />
Roggendorf, Bonn<br />
13
<strong>pluradent</strong> <strong>–</strong> <strong>Ihr</strong> <strong>Partner</strong> <strong>für</strong> <strong>Erfolg</strong><br />
Wer als Zahnarzt oder Dentallabor auch in Zukunft erfolgreich sein will, muss neue<br />
Wege gehen. Nutzen Sie die Chancen, die der Wandel im Dentalmarkt bietet, um<br />
neue Ziele <strong>für</strong> <strong>Ihr</strong>e Praxis und <strong>Ihr</strong> Labor zu definieren.<br />
Pluradent unterstützt Sie dabei und hilft Ihnen, diese Ziele zu realisieren. Mit<br />
Ihnen gemeinsam entwickeln wir individuelle, zukunftsweisende Konzepte, die den<br />
<strong>Erfolg</strong> <strong>für</strong> Sie als Zahnarzt oder Dentallabor sicherstellen.<br />
Pluradent ist Deutschlands führender herstellerunabhängiger Dentalfachhändler<br />
mit der Kompetenz in Materialien, Geräten und Einrichtungen. Und unser Wissen und unsere Erfahrung, verbunden<br />
mit individueller Beratung und exzellentem Service stellen wir in den Dienst einer einzigen Sache: <strong>Ihr</strong>en <strong>Erfolg</strong>!<br />
Sprechen Sie uns an <strong>–</strong> Sie dürfen mehr erwarten.<br />
Pluradent AG & Co KG · Stiftsplatz 1-3 · 53111 Bonn · Tel. 02 28 / 7 26 35-0 · Fax 02 28 / 7 26 35-55 · E-Mail: bonn@<strong>pluradent</strong>.de
Mehrzweckraum: Hörsaaltrakt, 1. OG<br />
Phantomkurssaal: Mitteltrakt, 3. OG<br />
Hands-On-Kurse und Seminare<br />
A-H1 Replantation und Transplantation von Zähnen<br />
Andreas Filippi, Basel • Yango Pohl, Bonn • Alexander Schafigh, Bornheim<br />
Hands-On-Kurs<br />
Freitag und Sonntag<br />
retrograde Stiftinsertion / sofortige endodontische Behandlung 09:00-11:00<br />
Phantomkurssaal<br />
A-H2 Schienentherapie nach dentoalveolären Traumata<br />
Christine Berthold, Erlangen<br />
Hands-On-Kurs<br />
Anlegen verschiedener Schienen<br />
Freitag und Sonntag<br />
11:15-13:15<br />
Mehrzweckraum<br />
B-H1 Restauration nach Kronenfraktur - perfekte Ästhetik mit Komposit<br />
Gabriel Krastl, Basel<br />
Hands-On-Kurs<br />
Freitag und Sonntag<br />
Rekonstruktion frakturierter Kronen mit Schichttechniken<br />
09:00-11:00<br />
Mehrzweckraum<br />
B-H2 Refixation frakturierter Kronenfragmente / Mikroamputation bei Pulpa aperta<br />
Kurt Ebeleseder, Graz<br />
Hands-On-Kurs<br />
Freitag und Sonntag<br />
Anfügen frakturierter Kronenfragmente / Mikroamputation bei 11:15-13:15<br />
exponierter Pulpa<br />
Phantomkurssaal<br />
C-S1 Individuell angefertigter Sport-Mundschutz<br />
Andreas Filippi, Basel • Herr Schaffert (Fa. Erkodent), Pfalzgrafenweiler<br />
Seminar / Live-Demonstration<br />
Samstag<br />
Herstellung eines individuellen Mundschutzes<br />
08:45-10:45<br />
Mehrzweckraum<br />
Die Kurse werden mit Material, Geräten und Instrumenten unterstützt von<br />
3M Espe AG<br />
Erkodent GmbH<br />
GEBR. BRASSELER GmbH & Co. KG<br />
Ivoclar Vivadent GmbH<br />
Medartis GmbH<br />
Pluradent AG & Co KG<br />
15
16<br />
Abstracts Hauptvorträge<br />
HV 1 Prävention von Zahnverletzungen und von Spätfolgen<br />
Andreas Filippi, Universitätskliniken <strong>für</strong> Zahnmedizin Basel<br />
Jedes zweite Kind in Europa erleidet heute ein Zahntrauma, bevor es das 16. Lebensjahr<br />
erreicht hat. Mit über 70% werden hierbei die mittleren Schneidezähne des Oberkiefers verletzt.<br />
Unfallbedingte Farb- und Formveränderungen (Kronenfrakturen, Pulpanekrosen) können heute<br />
in vielen Fällen von entsprechend ausgebildeten Zahnärzten fast perfekt korrigiert werden. Im<br />
Gegensatz dazu resultieren schwere parodontale Verletzungen (Intrusion, palatinale<br />
Dislokation, Avulsion) vor Abschluss des Kieferwachstums, das heisst bei Kindern und<br />
Jugendlichen, häufig in Ankylose und Ersatzgewebsresorption. Dies führt nicht nur definitiv zum<br />
Zahnverlust, sondern auch zu einem sofortigen Stopp des lokalen Kieferwachstums. Der<br />
betroffene Zahn gerät zunehmend in Infraposition, was Knochen- und Gingivaverlust zur Folge<br />
hat: je jünger die Kinder beim Unfall, umso drastischer sind die Folgen. Das Tragen einen<br />
individuell beim Zahnarzt angefertigten Zahnschutzes sowie ein richtiges Verhalten am Unfallort<br />
können irreversible parodontale Spätfolgen deutlich reduzieren.<br />
HV 2 Restaurative Versorgung traumatisierter Zähne<br />
Gabriel Krastl, Universitätskliniken <strong>für</strong> Zahnmedizin Basel<br />
Eine Verletzung im (sichtbaren) Mundbereich kann zum einschneidenden Erlebnis <strong>für</strong> den<br />
Betroffenen, oftmals ein Kind, werden. Während <strong>für</strong> den Patienten zunächst die Beseitigung der<br />
unmittelbaren Unfallfolgen im Vordergrund steht, muss der Behandler die oftmals<br />
weitreichenden Konsequenzen einzelner Therapieoptionen berücksichtigen. Einerseits gilt es<br />
negative Auswirkungen auf das Kieferwachstum zu vermeiden -andererseits der noch hohen<br />
Lebenserwartung der Patienten Rechnung zu tragen.<br />
Bei der Therapie von Zahnfrakturen stehen endodontische und restaurative Aspekte im<br />
Vordergrund.<br />
Da bei vorliegenden Dentinwunden mit einer hohen Infektionsgefahr des endodontischen<br />
Systems zu rechnen ist, muss im Rahmen der Primärversorgung ein Wundverband erfolgen.<br />
Unter diesen Voraussetzungen kann die restaurative Versorgung auch zu einem späteren<br />
Zeitpunkt erfolgen. Zur Wiederherstellung von Funktion und Ästhetik kann das frakturierte<br />
Zahnfragment adhäsiv wiederbefestigt werden. Wenn aufgrund multipler oder fehlender<br />
Bruchstücke diese schwer oder nicht reponierbar sind, bieten aktuelle Komposite hervorragende<br />
Möglichkeiten zur restaurativen Versorgung. Zumindest bei Zähnen mit nicht abgeschlossenen<br />
Wurzelwachstum (und großer Ausdehnung der koronalen Pulpa) sind minimalinvasive<br />
Kompositrestaurationen den invasiveren laborgefertigten Restaurationen vorzuziehen.<br />
Die restaurative Versorgung von Kronen-Wurzel-Frakturen ist durch die partiell subgingival<br />
liegenden Defektgrenzen und oftmals durch weitere kleinere Dentinaussprengungen im<br />
Wurzelbereich massiv erschwert. Eine Beurteilung der Situation ist meistens erst nach<br />
Entfernung des beweglichen aber im Bereich palatinaler Parodontalfasern noch befestigten<br />
koronalen Fragments möglich. Zur Herstellung der biologischen Breite bietet sich als Alternative<br />
zur chirurgischen Kronenverlängerung die Extrusion der verbliebenen Wurzel an. Diese kann<br />
entweder kieferorthopädisch oder chirurgisch im Sinne einer intraalveolären Transposition<br />
erfolgen. Die ästhetische Rehabilitation schließt - in Abhängigkeit von der verbliebenen<br />
Restzahnsubstanz - alle Möglichkeiten der restaurativen Versorgung vom Kompositaufbau bis<br />
zur Überkronung mit ein. Oftmals ist eine intrakanaläre Verankerung erforderlich. Eine<br />
komplette Fassung der ursprünglichen Defektgrenzen ist insbesondere bei steilem<br />
Frakturverlauf nicht zwingend erforderlich. Wenn auch die Therapie von Kronen-Wurzel-<br />
Frakturen zu den technisch anspruchsvollsten Maßnahmen in der zahnärztlichen Traumatologie<br />
zählt und vielfach eher als langzeitprovisorische Versorgung gilt, ist bereits der Zahnerhalt bis<br />
ins implantationsfähige Alter als <strong>Erfolg</strong> zu werten.<br />
HV 3 Was heißt hier Endodontie?<br />
David Sonntag, Philipps-Universität Marburg<br />
Bei traumatischen Verletzungen des gesunden Endodonts, beispielsweise bei einer<br />
Kronenfraktur mit Eröffnung der Pulpa kann die vollständige Entfernung dieses funktionellen<br />
physiologischen Systems nur die Ultima Ratio sein. So stellt die partielle Pulpotomien stellt bei<br />
sachgerechter Indikationsstellung und Durchführung eine hervorragende vitalerhaltende<br />
Maßnahmen dar, die <strong>Erfolg</strong>squoten von ca. 95% erwarten lässt. Die Applikation biologisch<br />
kompatibler Werkstoffe wie CaOH oder dem aktuell zunehmend eingesetzten MTA erhält dem<br />
Zahn des betroffenen Patienten damit ein vollständiges Abwehrsystem. Mechanische<br />
Aufbereitungen des Kanalsystems, zumeist am Wochenende im Notdienst begonnen, erscheinen
nur sehr kurzfristig als Alternative zur Vitalerhaltung. Mit einer konventionellen<br />
Wurzelkanalbehandlung versehene Zähne sind nach internationalen Studien in ca. 60% als<br />
erfolgreich zu bezeichnen. Bei sehr einfacher und schneller Therapie der partiellen Pulpotomie<br />
ist somit ein signifikant besseres Langzeitergebnis als bei einer konventionellen Aufbereitung<br />
und Obturation zu erwarten.<br />
Bei extrusiven oder intrusiven Luxationsverletzungen ist eine vitalerhaltende Therapie jedoch<br />
selbst bei jungen Patienten mit offenem Apex und intakter Wurzel häufig nicht möglich. Der<br />
Zahnarzt trifft hier auf zahlreiche Erschwernisse durch einen potentiell weit offenen Apex sowie<br />
nicht vollständig durchgetretene und/oder frakturierte Zahnkronen. Noch vor wenigen Jahren<br />
hatte bei nekrotischer Pulpa und offenem Apex die Apexifikation durch häufige Einlagewechsel<br />
mit CaOH Präparaten vor Durchführung einer Wurzelfüllung hohe Priorität. Nachteile dieses<br />
Verfahrens können heute durch die schnellere und besser vorhersagbare Therapie mit MTA<br />
vermieden werden. So kann heute unter Sicht ein apikaler Verschluss gesetzt werden und<br />
bereits am folgenden Tag die abschließende Obturation des Kanalsystems erfolgen. Leider<br />
stellen auch modernste Wurzelfüllmaterialien noch immer nicht mehr als einen Füllkörper dar,<br />
mit dem lediglich vorhandene Hohlräume in ihrer Größe reduziert werden können. So kommt<br />
insbesondere bei jungen Patienten der aseptischen Arbeitsweise und dem dauerhaft<br />
speicheldichten Verschluss eine überaus hohe Bedeutung <strong>für</strong> den langfristigen <strong>Erfolg</strong> der<br />
endodontischen Therapie zu.<br />
HV 4 Milchzahnverletzungen<br />
Norbert Krämer, Zentrum <strong>für</strong> Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde Dresden<br />
Jedes Jahr verunglücken in Deutschland ungefähr 1,6 Mill. Kinder- und Jugendliche. Im<br />
Kleinkindalter machen dabei Beeinträchtigen im Kopfbereich und Milchzahnverletzungen etwa<br />
40% aller traumatischen Ereignisse aus. Klein- und Vorschulkinder sind dann immer<br />
Notfallpatienten. Die Versorgung verlangt ein schnelles Eingreifen und spezielle Kenntnisse.<br />
Darauf muss sich jeder Zahnarzt einstellen, um das Risiko <strong>für</strong> spätere Komplikationen zu<br />
minimieren. Insbesondere die Gesunderhaltung der bleibenden Dentition stellt eine besondere<br />
Herausforderung dar.<br />
Die Anamnese und Diagnostik unterscheidet sich grundsätzlich nicht von den bekannten<br />
Vorgaben aus der bleibenden Dentition. Je nach Verletzungsart und Kooperationsfähigkeit des<br />
Kindes werden Röntgenbilder ggf. in einer 2. Ebene gefordert. Ziel ist nicht nur den Schaden<br />
am und um den Milchzahn abzuschätzen, sondern auch die Lage und die Gefährdung <strong>für</strong> den<br />
korrespondierenden Zahnkeim zu diagnostizieren.<br />
Grundsätzlich darf die therapeutische Maßnahme nach einem Milchzahntrauma den Zahnkeim<br />
nicht noch zusätzlich verletzen. Insofern haben Luxations- und speziell die<br />
Intrusionsverletzungen die höchste Komplikationsrate. Bei unkomplizierten Kronenfrakturen<br />
kann je nach Mitarbeit des Kindes der Milchzahn adhäsiv aufgebaut oder die scharfe Kante<br />
geglättet werden. Falls die Pulpa exponiert ist, muss abgewägt werden, ob eine direkte<br />
Überkappung, Pulpotomie oder Pulpektomie möglich ist. Bei ungünstiger Frakturlinie bleibt nur<br />
die Extraktion des verletzten Zahnes. Die Prognose nach einer Wurzelfraktur hängt von der<br />
Lokalisation der Verletzung ab. Liegt eine erhöhte Mobilität des koronalen Fragmentes vor,<br />
bleibt nur seine Entfernung. Bei Alveolarfortsatzfrakturen sollte das Fragment repositioniert<br />
werden und eine Schienung angepasst werden. Häufig ist da<strong>für</strong> die Behandlung unter<br />
Allgemeinanästhesie indiziert.<br />
Sollte der Milchzahn nur geringgradig extrusiv disloziert (< 3mm) sein, kann je nach Mitarbeit<br />
des Kindes der Zahn vorsichtig reponiert werden. Bei einer stärkeren Extrusion ist die<br />
Extraktion des Milchzahnes Mittel der Wahl. Lateral dislozierten Frontzähne, die eine regelrechte<br />
Okklussion nicht zu lassen, sollten unter Lokalanästhesie vorsichtig reponiert, ansonsten kann<br />
die spontane Reposition abgewartet werden. Bei einer starken Kippung der Krone nach labial<br />
oder bei Intrusionsverletzung des Frontzahnes in Richtung zum Zahnkeim ist die Extraktion des<br />
Milchzahnes Mittel der Wahl. Nach einer Avulsion des Milchzahnes ist die Replantation<br />
grundsätzlich nicht indiziert. Jedes Milchzahntrauma verlangt heute klinische und radiologische<br />
Nachuntersuchungen über mindestens ein Jahr. Auch in diesem Zusammenhang hat die<br />
Gesunderhaltung der bleibenden Dentition eine wichtige Bedeutung.<br />
HV 5 Kinder als Unfallpatienten<br />
Kurt Ebeleseder, Universitätsklinik <strong>für</strong> Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde Graz<br />
Zahnunfälle sind bei Kindern nicht selten Ausdruck spezieller Verhaltensweisen und Neigungen,<br />
die auch auf die Zahnbehandlung Einfluss nehmen. Hierzu zählen Hyperaktivität,<br />
Aufmerksamkeitsstörungen und Aggressionsneigung. In der Regel sind die Eltern an dieses<br />
Verhalten gewöhnt und reagieren befremdet auf eine distanziertere Betrachtungsweise. Diese<br />
ist aber aus der Sicht des Zahnarztes unerlässlich, um den immer dringenden, oft schwierigen<br />
und zumeist komplexen Behandlungsbedarf zu erfüllen.<br />
In dieser grundlegenden Situation liegt ein erhebliches Potential <strong>für</strong> eine Polarisierung der<br />
17
18<br />
Rollen, welche unbewusst durch die Beteiligten eingenommen werden: auf der einen Seite das<br />
verletzte, hilfe- und schutzbedürftige Kind, dem ein liebevoller, tröstender Elternteil zur Seite<br />
steht, auf der anderen Seite ein mit Spritze, Bohrern und Assistentin bewaffneter Zahnarzt, der<br />
ungerührt tut, was zu tun ist und das Kind zu überfordern scheint. Dieses wendet sich in dieser<br />
Situation automatisch vom Zahnarzt ab und den Eltern zu, worauf diese zumeist den Trost<br />
verstärken.<br />
Dieser Basiskonflikt wird durch die individuelle Eltern-Kind-Beziehung modifiziert, welche<br />
heutzutage nicht selten eine dominante Rolle des Kindes aufweist. Eine allgemeine<br />
Verunsicherung bezüglich elterlicher Autorität, aber auch die häufiger gewordene Position als<br />
Einzelkind kann hier<strong>für</strong> als ursächlich angesehen werden. Es ergeben sich typische<br />
gruppendynamische Abläufe, die in der vorliegenden Präsentation archetypisiert werden, um sie<br />
einem Lösungsansatz zuzuführen. Speziell soll zwischen gewollter Dramatisierung durch das<br />
Kind (Erlebniskonsum oder Trotz) und ungewollter (Angst) unterschieden werden.<br />
Generell ist immer eine Entspannung im Verhalten des Kindes zu beobachten, wenn es gelingt,<br />
es aus der elterlichen Umklammerung zu lösen und der ärztlichen Behandlung zuzuwenden.<br />
Dies gilt sowohl <strong>für</strong> erzieherisch behebbare als auch <strong>für</strong> tiefenpsychologisch verursachte<br />
Kooperationsstörungen.<br />
HV 6 Heilung nach schwerem Zahntrauma - Implikationen <strong>für</strong> Prävention und<br />
Therapie<br />
Yango Pohl, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn<br />
Heilung und Zahnerhalt nach schweren Zahnverletzungen werden vornehmlich bedingt durch<br />
Schäden an Parodont und Endodont. Heilungsmöglichkeiten im Endodont umfassen<br />
Vitalitätserhalt oder Pulpanekrose. Unter bestimmten Bedingungen kann es nach Pulpanekrose<br />
zur Revaskularisation kommen. Das einsprossende Gewebe wird mineralisiert und imponiert<br />
dann als Obliteration des Pulparaumes. Als Ersatzgewebe ist es funktionell minderwertig und<br />
nicht befähigt, adäquat auf Reize zu reagieren. Karies und Präparationen bis in das Dentin<br />
müssen daher vermieden werden.<br />
Pulpanekrosen lassen sich prinzipiell durch adäquate Wurzelkanalbehandlung therapieren. Die<br />
Bedingungen am traumatisierten Zahn erfordern jedoch eine perfekte Wurzelkanalbehandlung<br />
über die ganze Wurzellänge und bevor es zu einer Infektion im Endodont gekommen ist.<br />
Konventionelle, zudem meist verzögert einsetzende Wurzelkanalbehandlungen sind oft nicht<br />
erfolgreich. Einzig sofort oder früh angefertigte Wurzelkanalfüllungen können die ge<strong>für</strong>chteten<br />
infektionsbedingten Resorptionen sicher verhindern.<br />
Gewebsverluste im Parodont sind, wenn überhaupt, nur sehr begrenzt ausgleichbar. Dem<br />
Vermeiden bzw. Begrenzen von Schäden im Parodont kommt daher eine überragende<br />
Bedeutung zu. Avulsierte Zähne müssen adäquat gerettet werden. Schäden an schwer<br />
traumatisierten Zähnen sind auch durch die speziellen Heilungsabläufe bedingt. Sie müssen<br />
durch Vor- und Begleitbehandlung (ART: antiresorptiv-antiinflammatorisch-regenerative<br />
Therapie) minimiert werden. Dann können die Chancen auf funktionsgerechte Heilung mit<br />
Reetablieren eines regulären Parodonts erhöht werden. Größerflächige Schädigungsareale<br />
unterliegen bei Infektionsfreiheit im Endodont einer Fusion mit Alveolarknochen; die<br />
Wurzelsubstanzen werden im Zuge des Knochenumbaues durch Knochen ersetzt (Ankylose und<br />
Ersatzresorption). Folgen sind Zahnverlust nach mehreren Jahren und - bei wachsenden<br />
Patienten - das Sistieren des alveolären Wachstums.<br />
HV 7 Die Transreplantation. Eine neue Methode zur Erhaltung elongierter,<br />
höchstgradig gelockerter und kurz vor dem Spontanausfall stehender Zähne<br />
Thomas Hiedl, Straubing<br />
Die Entfernung einzelner elongierter Zähne mit zirkulärem Knochenabbau und Lockerungsgrad<br />
lll, in einer ansonsten intakten Zahnreihe konfrontiert den Patienten wie den Behandler mit<br />
einer Vielzahl kostenintesiver und aufwändiger Folgemaßnahmen. Es sind massiv einfallende<br />
Alveolarfortsätze zu erwarten, die eine Implantation schwierig bis unmöglich machen. Für eine<br />
alternativ angedachte Brückenversorgung müssen meist intakte, gesunde Nachbarzähne<br />
beschliffen werden, mit einer ästhetisch wenig befriedigenden Brückengliedgestaltung. Daher<br />
wurde vor zehn Jahren durch den Autor zum ersten Mal ein derart hoffnungsloser Zahn<br />
vitalexstirpiert, extrahiert und seine gesamte Wurzel kürettiert. Nach Entfernung des putriden<br />
Entzündungsgewebes und Kürettage der kompletten Alveole, sowie deren Tieferlegung mit einer<br />
Knochenfräse, wurde dieser Zahn nach Beschichtung mit Emdogain ( Fa. Straumann ) an seine<br />
funktionell wie ästhetisch korrekte Position transreplantiert und mittels Säureätztechnik und<br />
einem Composit an die Nachbarzähne geschient.<br />
Die hochakuten Entzündungen des Parodonts verschwanden wenige Tage postoperativ.In<br />
keinem Fall wurden Antibiotika verabreicht. Alle 25 bisher so versorgten Zähne wurden klinisch<br />
stabil, bei fehlenden Lockerungsgraden. Die Taschentiefen reduzierten sich von präoperativ 10<br />
bis 12 mm auf 2 bis maximal 4 mm postoperativ. Auch die röntgenologisch erfassbare
knöcherne Verankerung konnte sich von einem Fünftel der Wurzellänge auf durchschnittlich<br />
zwei Drittel der Wurzellänge verbessern.<br />
An drei Zähnen wurden nach jeweils 5 bis 6 Jahren Resorptionen, ausgehend von der<br />
Bindegewebsmannschette festgestellt. Die Ursachen da<strong>für</strong> bleiben spekulativ. Die längste<br />
Liegezeit beträgt mittlerweile mehr als zehn Jahre.<br />
Es konnte somit gezeigt werden, dass die Methode der Transreplantation geeignet ist, einzelne<br />
elongierte und extrem gelockerte Zähne an ihre ästhetisch, wie funktionell korrekte Position<br />
zurückzustellen und über viele Jahre dauerhaft zu stabilisieren. Die dazu notwendige<br />
Vorgehensweise ist denkbar einfach und von jedem Zahnarzt beherrschbar. Aufwändige und<br />
kostenintensive Folgebehandlungen können so vermieden werden.<br />
HV 8 Schienentherapie nach dentoalveolären Traumata - Indikation und Techniken<br />
Christine Berthold, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen<br />
Einen Bestandteil der Behandlung dentoalveolärer Verletzungen (Dislokationsverletzungen,<br />
Wurzel- und Alveolarfortsatzfrakturen) stellt die indikationsbezogene Immobilisation der<br />
verletzten Strukturen durch verschiedene Schienungsmaßnahmen dar. Ziel der Schienung ist<br />
es, die Zähne in ihrer anatomischen Position funktionell zu fixieren und damit einerseits eine<br />
Aspiration oder ein Verschlucken des betroffen Zahnes zu verhindern und andererseits eine<br />
Wiederaufnahme der intraoralen Hygiene sowie der oralen Ernährung zu ermöglichen.<br />
In Abhängigkeit von Art und Schweregrad der Verletzung ist die Starrheit der einzu-gliedernden<br />
Schiene, welche von niedrig (flexibel) bis hoch (rigide) rangieren kann, auszuwählen. Dabei gilt,<br />
dass Dislokationverletzungen der Zähne einer relativ kurzzeitigen flexiblen Schienung von ein<br />
bis drei Wochen bedürfen, um eine <strong>für</strong> die Heilung notwendige Weiterleitung funktioneller Reize<br />
an das verletzte Parodont zu gewährleisten. Ähnliche Bedingungen gelten <strong>für</strong><br />
Wurzelquerfrakturen im mittleren und unteren Wurzeldrittel, wohingegen intraalveoläre<br />
Wurzelfrakturen im zervikalen Drittel rigide geschient werden. Alveolarfortsatzfrakturen werden<br />
in der Regel wie alle knöchernen Verletzungen rigide <strong>für</strong> 4-6 Wochen immobilisiert.<br />
Als Zahntraumaschienen eigenen sich verschiedene Verstärkungsmaterialien, wie<br />
kieferorthopädische Drähte oder konfektionierte Schienen (Titanium Trauma Splint,<br />
Titanringklebeschiene), die adhäsiv mittels fließfähiger Komposite an den verletzen sowie den<br />
gesunden Nachbarzähnen befestigt werden können. Die Rigidität der Schienen lässt sich<br />
indikationsbezogen durch die Wahl des Verstärkungsmaterials oder durch die Ausdehnung der<br />
Klebepunkte steuern.<br />
Zusammenfassend kann man feststellen, dass Zahntraumaschienen nach dentoalveolären<br />
Verletzungen aus forensischen Gründen und zur Verbesserung des Patientenkomforts und damit<br />
Förderung der Heilung indiziert sind. Diese Schienen sollten funktionell und hygienefähig<br />
gestaltet sein und so kurz wie möglich und nur so lang wie nötig in situ verbleiben.<br />
HV 9 Wurzelfraktur - eine Verletzung verliert ihren Schrecken<br />
Kurt Ebeleseder, Universitätsklinik <strong>für</strong> Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde Graz<br />
Das Prinzip der Heilung ist bei Wurzelfrakturen nicht anders zu sehen als bei den anderen<br />
Geweben des Körpers: In der Akutphase kommt es zu Einblutung, Hämostase und Ausbildung<br />
eines Fibrinklotzes an der Stelle der Schädigung. In der ersten reparativen Phase müssen eben<br />
dieses Fibrin, avitale Zellen und traumatisierte interzelluläre Substanzen resorbiert werden. Die<br />
entstandenen Hohlräume sind durch ein gefäß- und stammzellenreiches Gewebe<br />
("Granulationsgewebe" = Wound healing module [WHM]) zu besetzen. Die Stammzellen<br />
bestimmen, welches Ersatzgewebe anschließend gebildet wird, falls nicht neue Schäden, z.B.<br />
permanent anwesende Bakterien, den Situs immer wieder auf die Stufe des WHM zurückwerfen.<br />
Die Fähigkeiten der Stammzellen selbst, anatomische Verhältnisse und funktionelle Reize<br />
bestimmen schließlich das Endprodukt der Heilung.<br />
Im Falle der Zahnwurzelfraktur stehen Fibroblasten der Pulpa, odonto-, zemento- und<br />
osteoblastische Progenitorzellen <strong>für</strong> die Reparatur zur Verfügung. Je originärer die anatomische<br />
und biologische Situation geblieben ist, umso wahrscheinlicher bleibt der typische schichtweise<br />
Aufbau der Zahnwurzel auch in der Heilung erhalten: im Idealfall wird pulpaseitig die Fraktur<br />
durch Tertiärdentin und parodontseitig von reparativem Zement überbrückt ("Dentin-Zement-<br />
Kallus", "Hartsubstanzheilung"). Eine Diastase der Fragmente begünstigt sowohl anatomisch als<br />
auch funktionell (wegen der höheren Beweglichkeit des kronentragenden Fragmentes [kF]) die<br />
Einwanderung parodontaler Fibroblasten. Als Resultat werden die Frakturenden abgerundet, mit<br />
Zement überzogen und mittels eines rudimentären Parodonts miteinander verbunden<br />
("Interposition von Bindegewebe"), wobei auch ein trennendes Alveolarknochenseptum<br />
entstehen kann ("Interposition von Alveolarknochen"). Die Pulpa reagiert im apikalen Fragment<br />
häufig mit einer Obliteration, die vermutlich durch eine Zerrung beim Trauma und die daraus<br />
folgende Schädigung der Odontoblasten ausgelöst wird. Diese drei Heilungstypen betreffen<br />
insgesamt etwa 66% aller Zahnwurzelfrakturen. Therapeutisch ist lediglich eine Reposition des<br />
kF und eine Schienung vonnöten, deren Dauer derzeit kontrovers beurteilt wird.<br />
19
20<br />
Völlig anders zu betrachten ist die Situation bei einer Pulpanekrose (ca. 34% alle<br />
Wurzelfrakturen). Diese betrifft nur das dislozierte kF, welches nach FM Andreasen endodotisch<br />
wie ein verkürzter Zahn ohne Foramen apikale zu betrachten ist. Die Pulpanekrose wird daher<br />
mit steigender Länge und stärkerer Dislokation des kF wahrscheinlicher, anstelle der<br />
periapikalen Aufhellung entwickelt sich das Granulationsgewebe um das apikale Ende des kF<br />
(zirkuläre Parodontitis um den und im Bruchspalt) und drängt die Fragmente auseinander. Die<br />
endodontische Behandlung beschränkt sich auf das kF, welches apexifiziert werden muss. Eine<br />
anhhaltende erhöhte Mobilität kann mittels eines kieferorthopädischen Retainers neutralisiert<br />
werden. Alternativ bietet sich die Stabilisierung des Zahnes mittels Kirschner-Methode an.<br />
Hierbei werden alle Fragmente extrahiert und das kronentragende mitttels eines retrograd<br />
zementierten Titanstiftes gleichzeitig endodontisch abgedichtet und auf eine stabilisierende<br />
Länge gebracht.<br />
Eine endgültige Extraktion ist nur dann vonnöten, wenn der Frakturspalt bleibend mit dem<br />
Oralmilieu kommuniziert. Dies ist bei sehr schrägen oder verästelten Frakturverläufen oder<br />
parodontal vorgeschädigten Zähnen der Fall und umfasst etwa 5% aller wurzelfrakturierter<br />
Zähne.<br />
HV 10 Replantation traumatisierter Zähne<br />
Yango Pohl, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn<br />
Avulsierte und deutlich dislozierte Zähne können replantiert werden. Die Behandlung zielt<br />
zunächst darauf, vom Endodont ausgehende, infektionsbedingte Komplikationen sicher zu<br />
vermeiden. Als Methode wird die sofortige, extraorale Wurzelkanalbehandlung mit retrograder<br />
Insertion von Titanstiften in den Wurzelkanal favorisiert.<br />
Weiteres Ziel ist, die parodontale Heilung zu unterstützen durch spezielle<br />
Behandlungssystematiken und topische und systemische Medikation. Die Verfahren erbringen<br />
günstigere Voraussetzungen <strong>für</strong> Heilung und Überleben schwer verletzter Zähne.<br />
Insbesondere wurzelunreife Zähne profitieren von einer Behandlung, die auf<br />
Komplikationsvermeidung zielt: Das Hoffen auf Revaskularisation wird meist enttäuscht,<br />
Pulpanekrose und infektionsbedingte Resorptionen resultieren in dramatisch schlechten<br />
Ergebnissen. Abhängig von den Risiken auf Pulpanekrose wird die prophylaktische<br />
Wurzelkanalbehandlung mit retrograder Stiftinsertion empfohlen auch bei wurzelunreifen<br />
Zähnen.<br />
Bei wachsenden Patienten verursachen Zahnankylosen ein Sistieren des alveolären Wachstums<br />
mit der Folge von vertikalen Gewebsdefiziten, die auch mit umfangreichen Augmentationen<br />
kaum auszugleichen sind. Ankylosierte Zähne dürfen daher bei wachsenden Patienten nicht<br />
unkritisch belassen werden. Sinnvolle Behandlungen umfassen vor allem die Transplantation<br />
von Prämolaren und Milcheckzähnen sowie die Dekoronation. Die Situation darf aber auch nicht<br />
dazu führen, Zähne unkritisch nicht zurückzupflanzen. So ist die Transplantation erheblich<br />
einfacher bei einer durch einen replantierten Zahn horizontal erhaltenen Alveole. Nach<br />
Dekoronation ist der Erhalt der Knochenbreite ohne Behinderung der vertikalen<br />
Knochenentwicklung vorteilhaft gegenüber der Situation nach Zahnverlust oder<br />
Zahnentfernung, die zumindest horizontalen Knochenverlust bedeuten.<br />
HV 11 Dentoalveoläres Trauma: Probleme und Lösungsmöglichkeiten aus<br />
kieferorthopädischer Sicht<br />
Sabine Ruf, Justus Liebig Universität Gießen<br />
Ein Frontzahntrauma bleibender Inzisivi tritt bei 13-45% aller Kinder auf. Der Traumazeitpunkt<br />
liegt vor allem zwischen dem 7. und 15. Lebensjahr und somit vor oder während der<br />
Hauptaltersperiode <strong>für</strong> eine kieferorthopädische Behandlung. In der überwiegenden Zahl der<br />
Fälle (70-90%) sind die oberen mittleren Inzisivi vom Trauma betroffen. Kieferorthopädische<br />
prädisponierende Faktoren <strong>für</strong> ein Frontzahntrauma sind ein vergrößerter Overjet in<br />
Kombination mit einem inkompetenten Lippenschluß. Je nach Ausmaß des dentoalveolären<br />
Traumas wird eine zahnärztliche Behandlung erforderlich sein. Obwohl der therapeutische<br />
Ansatz in den meisten Fällen nicht primär kieferorthopädisch sein wird, wird ein dentoalveoläres<br />
Trauma dennoch, unabhängig von der zugrundeliegenden Dysgnathie, häufig die<br />
kieferorthopädische Therapie sowohl kurz- als auch langfristig beeinflussen. Ziel dieses<br />
Vortrages ist es, die aus einem dentoalveolären Trauma kurz- und langfristig resultierenden<br />
Probleme unter Berücksichtigung der kieferorthopädischen Lösungsmöglichkeiten darzustellen<br />
sowie kieferorthopädische Prophylaxemöglichkeiten aufzuzeigen.<br />
Die Folgen eines dentoalveolären Traumas hängen aus kieferorthopädischer Sicht vor allem von<br />
Ausprägungsgrad des Traumes, der Art und Anzahl der betroffenen Zähne und dem Zeitpunkt<br />
des Traumas ab. Ein Milchfrontzahntrauma kann zu einer Dilazeration sowie einer Retention und<br />
Verlagerung des bleibenden Nachfolgers führen, deren Therapie oft durch Platzmangel infolge<br />
einer Stützzonenaufwanderung kompliziert wird. Posttraumatische Komplikationen oder neue<br />
dentoalveoläre Traumata während einer laufenden kieferorthopädischen Behandlung bedingen
häufig Therapieänderungen oder eine Beeinträchtigung des Behandlungsergebnisses. Liegt der<br />
Traumazeitpunkt vor der kieferorthopädischen Behandlung, so gilt es bei Intrusionstraumen und<br />
Kronenwurzelfrakturen im bleibenden Gebiss therapeutisch zwischen einer normalen Extrusion<br />
und einer forcierten Extrusion zu differenzieren. Bei traumatischem Zahnverlust oder<br />
Nichterhaltungswürdigkeit des Zahnes infolge endodontischer oder resorptiver Komplikationen<br />
stellt sich die Frage nach kieferorthopädischem Lückenschluss oder Lückenöffnung sowie die<br />
Frage nach der Art der Lückenversorgung mittels Prothetik, Zahntransplantation oder<br />
Implantaten. Ob es allerdings vor dem Hintergrund der noch ausstehenden Wachstums- und<br />
Entwicklungsvorgänge überhaupt sinnvoll ist, eine Implantatversorgung bei Jugendlichen zu<br />
planen, soll im vorliegenden Vortrag diskutiert werden.<br />
HV 12 Adhäsivprothetische Versorgung<br />
Matthias Kern, Universitätsklinikum Schleswig-Holstein - Campus Kiel<br />
Zweiflügelige Adhäsivbrücken sind eine inzwischen etablierte Therapieoption zum Ersatz<br />
fehlender Frontzähne im jugendlichen Gebiss mit kariesfreien Pfeilerzähnen. Besonders<br />
innovativ sind jedoch einflügelige Adhäsivbrücken, die weniger invasiv sind und inzwischen auch<br />
überzeugende klinische Ergebnisse aufweisen.<br />
Bei jugendlichen Patienten mit traumatischem Einzelzahnverlust stellen einflügelige<br />
Adhäsivbrücken, die aus Metallkeramik oder hochfesten Vollkeramiken hergestellt werden<br />
können, nach Ansicht des Referenten heute sogar die Therapie der Wahl dar. Da bei solchen<br />
einflügeligen Brücken keine Verblockung von Pfeilerzähnen vorgenommen wird, können diese<br />
im jungen Alter auch schon vor Abschluss des Kieferwachstums zum Einsatz kommen. Die bei<br />
mehrflügeligen Adhäsivbrücken ge<strong>für</strong>chtete unbemerkte Loslösung eines einzelnen Klebeflügels<br />
kommt bei der einflügeligen Variante nicht vor, da sich hier ja immer die gesamte Restrauration<br />
löst. Im Gegensatz zu konventionellen Freiendbrücken mit Kronenpfeilern scheint bei Freiend-<br />
Adhäsivbrücken ein unverblockter Pfeilerzahn auszureichen, da dieser Zahn ja durch die<br />
Adhäsivpräparation und den Klebeflügel nur geringfügig geschwächt wird. Im engen<br />
Unterkieferfrontzahnbereich sind sie aber auch bei Erwachsenen in der Regel dem<br />
Einzelzahnimplantat vorzuziehen.<br />
Die empfohlene schmelzbegrenzte Zahnpräparation unterscheidet sich bei metallischen und<br />
vollkeramischen Klebeflügeln. Um bei den flexibleren dünnen Metallflügeln das Gerüst zu<br />
versteifen und die Klebung vor abschälenden Kräften zu schützen, sollten feine approximale<br />
Retentionsrillen mit einem leicht konischen Separierdiamanten angelegt werden. Bei<br />
Adhäsivbrücken aus Vollkeramik kann auf solche Retentionsrillen verzichtet werden, da die<br />
Keramikflügel per se eine hohe Steifigkeit aufweisen. Stattdessen wird zusätzlich ein seichter<br />
approximaler Kasten (ca. 0,5 mm tief, 2 x 2 mm breit) auf der Pontic-Seite präpariert, wodurch<br />
die Keramik an dieser kritischen Stelle verstärkt wird und zusätzlich eine eindeutige<br />
Positionierung des Klebeflügels sichergestellt ist.<br />
Die Stärke der Klebeflügel bei Adhäsivbrücken sollte mindestens 0,5 mm, besser noch 0,7 mm<br />
betragen, um bei Metall eine ausreichende Steifigkeit und bei Keramik eine ausreichende<br />
Festigkeit zu erzielen. Vor- und Nachteile sowie klinisches und laborstechnisches Vorgehen der<br />
Versorgung des traumatischen Zahnverlustes mit metall- und vollkeramischen Adhäsivbrücken<br />
werden dargestellt.<br />
HV 13 Transplantation nach traumabedingtem Zahnverlust in der Oberkieferfront<br />
Andreas Filippi, Universitätskliniken <strong>für</strong> Zahnmedizin Basel<br />
Die Transplantation von Zähnen hat heute in der Zahnmedizin ihren festen Stellenwert als<br />
Alternative zu prothetischen, kieferorthopädischen oder implantologischen Versorgungen bei<br />
Nichtanlage oder vorzeitigem Verlust bleibender Zähne durch Trauma oder als Folge von Karies<br />
oder Parodontitis. Die biologischen Abläufe nach Zahntransplantation (Heilung von Pulpa und<br />
Parodont) sind heute gut wissenschaftlich dokumentiert. Ebenso bekannt sind die jeweiligen<br />
Risikofaktoren <strong>für</strong> den Misserfolg (Pulpanekrose, infektionsbedingte Wurzelresorption, invasive<br />
zervikale Resorption, Ankylose). Zahntransplantationen bieten die Möglichkeit, nicht<br />
erhaltungswürdige oder fehlende Zähne auf biologische Weise zu ersetzen. Als erfolgreiche<br />
Zahntransplantate im Bereich der Oberkiefer-Frontzähne haben sich Prämolaren und<br />
Milcheckzähne etabliert. Neben frühem Zahnverlust durch Caries profunda und Nichtanlage von<br />
Zähnen gehören heute traumatologische Gründe zu den häufigsten Indikationen <strong>für</strong> eine<br />
Zahntransplantation. Viele Zahnärztinnen und Zahnärzte erkennen hier den Behandlungsbedarf<br />
häufig erst, wenn bereits sehr viel Knochen und Weichgewebe im ästhetisch wichtigen<br />
Frontzahnbereich verloren gegangen ist. Ankylosierte Zähne im wachsenden Kiefer müssen in<br />
der Regel umgehend und konsequent entfernt werden. Spezielle Therapieformen wie<br />
Dekoronation oder intentionelle Replantation ankylosierter Zähne sollten spezialisierten Zentren<br />
vorbehalten bleiben. Ein kieferorthopädischer (bilateraler) Lückenschluss sollte lediglich nach<br />
Ankylose bzw. Verlust der beiden mittleren Schneidezähne diskutiert werden. Einseitiger<br />
Lückenschluss produziert oftmals Kompromisse (Verschiebung der Mittellinie, asymmetrisches<br />
Austrittsprofil des schmaleren lateralen Inzisivus, Rekonturierung und Farbkorrektur des<br />
21
22<br />
Eckzahnes, erforderliche Weichgewebskorrekturen marginal, ect.), die insbesondere bei hoher<br />
Lachlinie kaum tolerierbar sind. An die Stelle des ankylosierten (desmodont-toten) Zahnes<br />
sollte bei Kindern vor dem Wachstumsschub grundsätzlich ein Zahn mit vitalem Desmodont<br />
transplantiert werden, der den Fortschritt des Kieferwachstums stimuliert, auf diese Weise<br />
Knochen und Weichgewebe erhält und gleichzeitig ästhetischen sowie funktionellen Ansprüchen<br />
genügt.<br />
HV 14 Aspekte der Implantation im Frontzahnbereich<br />
Gerhard Wahl, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn<br />
Die Implantation im Frontzahnbereich zählt insbesondere unter dem Aspekt der Ästhetik zu den<br />
schwierigsten Versorgungen mit implantatgestütztem Zahnersatz. Ist schon der Zahnverlust<br />
alleine mit den nachfolgenden involutiven Prozessen im Bereich des Alveolarfortsatzes ein nicht<br />
zu unterschätzendes Problem, wird dieses durch Verlust von Teilen des Alveolarfortsatzes im<br />
Rahmen eines Frontzahntraumas therapeutisch immer schwieriger und bedarf nicht selten eines<br />
primären Augmentates, um eine zufriedenstellende Implantatversorgung nach einem solchen<br />
dentoalveolärem Trauma sicherzustellen. Nicht zuletzt aber spielt auch die Anatomie der<br />
Ausgangssituation prinzipiell eine wichtige Rolle. Nicht immer sind die anatomischen<br />
Verhältnisse auch bei noch erhaltener Knochensubstanz <strong>für</strong> eine Implantatpositionierung<br />
geeignet. Hier spielt die präimplantologische Diagnostik eine wichtige Rolle und nicht zuletzt<br />
auch die Frage, wann ein Implantat nach einem Zahnverlust im Frontzahnbereich eingesetzt<br />
werden sollte.<br />
Zu unterscheiden ist die Sofortimplantation unmittelbar nach traumatischem Zahnverlust oder<br />
Extraktion, die verzögerte oder Frühimplantation, etwa 6 - 8 Wochen nach dem Zahnverlust,<br />
oder die Spätimplantation, wenn die Alveolarfortsatzverhältnisse 3 Monate oder länger<br />
ausgeheilt sind. Neben der Frage des Implantationszeitpunktes ist gleichzeitig auch das<br />
Belastungskonzept zu berücksichtigen, wobei verständlicherweise der Patientenwunsch immer<br />
auf eine sofortige Versorgung ausgerichtet sein wird. Dennoch ist zu prüfen, ob bei einer<br />
solchen Direktversorgung eine sofortige Belastung erfolgen kann oder eine provisorische<br />
Versorgung ohne Okklusionskontakt eingesetzt wird. Die konventionelle Belastung erfolgt<br />
zweiphasig nach entsprechender Einheilungszeit je nach Vorgabe des Systems oder evtl. auch<br />
als Frühbelastung in voller Okklusion. Bei der Frühbelastung ist nach der bisherigen Definition<br />
eine extreme Zeitspanne von mehr als 48 Stunden nach der Implantation bis hin zu 3 Monaten<br />
nach der Implantation per Definition angegeben.<br />
Schon in der präimplantologischen Phase ist auch zu klären, in welcher Position das Implantat<br />
einzubringen ist, wobei sowohl <strong>für</strong> die vertikale Positionierung als auch <strong>für</strong> die mesio-distale und<br />
die oro-vestibuläre Implantatpositionierung Empfehlungen zu Mindestabständen und -tiefen<br />
existieren, die möglichst einzuhalten sind. Die früher häufig geäußerte Empfehlung, Implantate<br />
möglichst tief zu setzen, um ein optimales Emergenzprofil <strong>für</strong> die Kronenversorgung herstellen<br />
zu können, gefährdet nicht nur die knöcherne Situation im crestalen Implantatbereich, sondern<br />
ebenso den Erhalt des papillenstützenden Alveolarknochens an den Nachbarzähnen. Zu dem ist<br />
zu bedenken, dass bei Versenkung unter das kortikale Knochenniveau eine völlig andere<br />
Implantatdynamik vorliegt, die nicht nur die Ausbildung von tiefen Knocheneinbrüchen<br />
provoziert, sondern auch unter biomechanischen Aspekten zu Einschränkungen der<br />
Langzeitprognose führt. Entsprechende Daten und Modelle zu den verschiedenen<br />
vorbereitenden Aspekten einer Versorgung im Frontzahnbereich mit Implantaten sowie auch die<br />
neueren Implantatkonfigurationen mit "platform switching" werden diskutiert.
V 1<br />
09:00<br />
V 2<br />
09:13<br />
V 3<br />
09:26<br />
Abstracts Kurzvorträge<br />
Frontzahntrauma bei syrischen Kindern mit unterschiedlichen Gebiss-<br />
Anomalien<br />
Bashar M. Muselmani, Latakia, Syrien • Stefan Kopp, Frankfurt<br />
Das Frontzahntrauma ist die häufigste traumatische Läsion des Mund-, Kiefer- und<br />
Gesichtsbereiches. Die zunehmende Anzahl an traumatisch verletzten Zähnen insbesondere im<br />
Kindes- und Jugendalter stellt auch <strong>für</strong> Kieferorthopäden eine große therapeutische<br />
Herausforderung dar.<br />
Material und Methode: Es wurden insgesamt 1375 Schulkinder im Alter von 7 bis 13 Jahren auf<br />
ein vorhandenes Frontzahntrauma untersucht. Dazu erfolgte eine anamnestische Befragung<br />
sowie eine klinische und radiologische Untersuchung der Patienten. Analog zu Andreasen<br />
stützte sich die Studie auf die von der WHO 1978 vorgestellte systematische Einteilung zur<br />
Frontzahntraumatologie.<br />
Ergebnisse: 205 der evaluierten Patienten hatten ein Frontzahntrauma erlitten, d.h. etwa 15 %.<br />
Es zeigte sich, dass männliche Probanden mit etwa 71 % häufiger ein Frontzahntrauma erlitten<br />
als weibliche. Ferner konnte aus den Ergebnissen gefolgert werden, dass eine vergrößerte<br />
sagittale Schneidekantenstufe ein prädisponierender Faktor <strong>für</strong> das Auftreten von<br />
Frontzahntraumata darstellt. Die statistische Analyse ergab zudem einen Zusammenhang von<br />
sozialer Herkunft und Prävalenz von Frontzahntraumata.<br />
Schlussfolgerung: Heutzutage tragen besonders zahnunfallträchtige Sportarten zum<br />
vermehrten Auftreten von Zahnverletzungen bei. Neben den unmittelbaren Auswirkungen<br />
kommt es nicht selten zu Spätfolgen mit erheblicher Komplikationsrate. Der Aufklärungsbedarf<br />
in Syrien ist groß, da Eltern und Betreuern oft jegliche Kentnisse über Zahnverletzungen und<br />
deren Prävention fehlen.<br />
Milchfrontzahntrauma und Folgen <strong>für</strong> die bleibende Dentition<br />
Sabine Sennhenn-Kirchner, Göttingen<br />
Die vorgestellte Untersuchung evaluiert Zusammenhänge zwischen Art und Zeitpunkt<br />
traumatischer Milchzahnverletzungen und Häufigkeit und Schweregrad von Schäden an der<br />
nachfolgenden bleibenden Dentition.<br />
40% der betroffenen Kinder (200 betroffene Zähne) konnten nachuntersucht werden, von<br />
denen wies wiederum ein Viertel mehr oder weniger ausgeprägte Schädigungen der bleibenden<br />
Zähne auf. Die Hälfte der Schädigungen betraf ausschließlich den Schmelz im Form von<br />
Verfärbungen oder milden Formen von Hypoplasie. Die restlichen 50% der Schäden umfassten<br />
schwere Folgen wie Deformierungen von Krone und/oder Wurzel, Stagnation des<br />
Wurzelwachstums oder Zahnretentionen.<br />
Zwar waren durchschnittlich eher ältere Kinder von Milchzahntraumen betroffen, jedoch waren<br />
66% der Folgeerscheinungen an den bleibenden Zähnen einem Traumazeitpunkt in der frühen<br />
Kindheit zuzuordnen. Ein eindeutiger Zusammenhang war zwischen der Art des Traumas und<br />
der Schwere der Folgen herzustellen. Nur nach Intrusionsverletzungen traten Missbildungen in<br />
der bleibenden Dentition auf.<br />
In Übereinstimmung mit anderen Arbeitsgruppen kann anhand der vorgestellten Ergebnisse<br />
gefolgert werden, dass die verschiedenen Folgen <strong>für</strong> die bleibenden Zähne nur radiologisch oder<br />
nach Durchbruch der klinischen Kronen festgestellt werden können .<br />
Außerdem sind regelmäßige Kontrolluntersuchungen und Röntgenkontrollen unerläßlich um<br />
Folgen frühzeitig zu diagnostizieren und entsprechende Maßnahmen rechtzeitig ergreifen zu<br />
können.<br />
Reproduzierbarkeit von Periotestmessungen vor und nach Eingliederung<br />
zweier Zahntraumaschienen an unverletzten Probanden<br />
Christine Berthold, Erlangen • Alexander Dörr, Erlangen • Johannes Schmitt, Erlangen<br />
• Stefan Holst, Erlangen<br />
Einleitung<br />
Das Periotest-Verfahren stellt eine non-invasive Methode zur objektiven Bestimmung der<br />
Dämpfungseigenschaften des Parodonts dar. Indirekt können Rückschlüsse auf die<br />
Zahnbeweglichkeit gezogen werden. Neben seinem Einsatz in der Implantologie und<br />
Parodontologie findet das Periotest-Verfahren Anwendung in der Verlaufskontrolle nach<br />
dentoalveolären Verletzungen. Weiterhin kann es zur Bestimmung der Rigidität von<br />
Zahntraumaschienen genutzt werden.<br />
23
V 4<br />
09:39<br />
24<br />
Ziel<br />
Ziel dieser in vivo Studie war es, die Reproduzierbarkeit von Periotest-Messungen an Zähnen<br />
unverletzter Probanden vor und nach Eingliederung zweier Draht-Komposit-Schienen (DKS) zu<br />
untersuchen. Weiterhin sollte im Rahmen dieser Studie die Rigidität der eingesetzten Schienen<br />
evaluiert werden.<br />
Material und Methode<br />
In die Studie wurden 33 Zahnmedizinstudenten (männlich n=13, weibliche n=20;<br />
Durchschnittsalter 24,7 Jahre; min.19,8 J. max. 36,5 J.) eingeschlossen, die zum Zeitpunkt der<br />
Untersuchung die geforderten Kriterien erfüllten. Die einzugliedernden DKS (DKS 1 = Dentaflex<br />
0.45 mm; DKS 2 = Protheseneinlagen 0,8 x 1,8 mm) sowie eine Tiefziehschiene zur<br />
Übertragung reproduzierbarer Messpunkte wurden <strong>für</strong> jeden Probanden an individuellen<br />
Modellen vorbereitet.<br />
Die Bestimmung der Mobilität aller Schneide- und Eckzähne im Oberkiefer erfolgte mit dem<br />
Periotest-Gerät. Pro Serie wurden drei Messungen pro Zahn durchgeführt. Jede Serie wurde<br />
dreimal im Abstand von 15 min gemessen. Folgende Messungen wurden sowohl in horizontaler<br />
[h] und vertikaler [v] Dimension durchgeführt: a) Periotest-Werte vor Eingliederung [PTW pre]<br />
der DKS1 und DKS2 sowie b) Periotest-Werte nach Eingliederung [PTW post] der DKS 1 und<br />
DKS 2. Der horizontale und vertikale Schienungseffekt [SE] wurde als Änderung der<br />
Zahnbeweglichkeit definiert (SE = ΔPTW = PTW pre- PTW post).<br />
Die gewonnen Daten wurden zur statistischen Analyse in SPSS übertragen. Es wurden die intra-<br />
und interseriellen Reproduzierbarkeit (Friedman-Test; p < 0.001) evaluiert, PTW pre S1 und<br />
PTW pre 2 (Wilcoxon_Test; p < 0,001) und PTW pre und PTW post (Wilcoxon_Test; p < 0,001)<br />
wurden verglichen, weiterhin erfolgte ein Vergleich des Schienungseffektes beider Schienen<br />
(Whitney-Mann-U-Test; p
V 5<br />
09:52<br />
replizierte DNA des Zellkerns eingebaut) wurden die Ratten sakrifiziert. Durch eine<br />
Antikörperfärbung (APAAP) konnten die proliferierten Zellen bestimmt werden. Drei Tiere (= 6<br />
Molaren) dienten als Kontrollen und wurden nicht weiter behandelt. Ein statistischer Vergleich<br />
wurde mittels Mann-Whitney-U-Test durchgeführt. Für eine herkömmliche LM-Auswertung<br />
wurde im Bereich der Kronenpulpa das Ausmaß von bakterieller Infektion, Entzündungszellen<br />
und Nekrose evaluiert. Die beobachteten Veränderungen wurden mit Zahlen von 1 bis 4<br />
bewertet: 1 = nicht vorhanden, 2 = leicht, 3 = moderat, 4 = profund. Die statistische<br />
Auswertung erfolgte mittels ANOVA-Test.<br />
Einen Tag nach direkter Überkappung waren in der GCB-Gruppe signifikant mehr Zellen<br />
angefärbt als in der KH und MTA-Gruppe (p < 0,025). Nach drei Tagen waren in der Gruppe<br />
GCB signifikant mehr Zellen markiert als in der KH-, MTA- und der Kontrollgruppe ohne OP (p <<br />
0,01). Die markierten Zellen wurden am Tag 1 und 3 sowie in der Kontrollgruppe ohne OP als<br />
Fibroblasten sowie Endothelzellen identifiziert. Am Tag 7 nach der direkten Überkappung ließen<br />
sich zusätzlich Höhlzellen nachweisen, wobei es in der Gruppe GCB signifikant weniger waren<br />
als in den Gruppen KH und MTA. Das Ausmaß der bakteriellen Infektion (nach 1 d, 3 d und 7 d)<br />
und Entzündung (nach 1 d und 7 d) war <strong>für</strong> GCB signifikant höher als <strong>für</strong> KH und MTA (p <<br />
0,05). Im Vergleich zu KH und GCB zeigte das mit MTA überkappte Pulpagewebe nach 1 d und<br />
3 d signifikant geringere Zeichen einer Nekrose (p < 0,05).<br />
GCB führte im Vergleich zu KH und MTA bei der direkten Überkappung zur Bildung von<br />
signifikant mehr Granulationsgewebe aufgrund einer bakteriellen Infektion und<br />
Entzündungsreaktion. MTA zeigte gleich guten Ergebnissen wie KH.<br />
Wiederbefestigung eines autologen Zahnfragmentes nach unkomplizierter<br />
Kronenfraktur<br />
Hans-Peter Freitag, Tübingen<br />
Bei Kronenfrakuren bietet sich als minimalinvasive Therapie ein "Reattachment" des /der<br />
Fragments(e) an.<br />
Ausgangssituation:<br />
Ein 10-jähriger Patient stellte sich mit seinen Eltern am 11.02.07 in unserem Notdienst<br />
aufgrund eines beim Sport erlittenen Frontzahntraumas, vor. Drei Stunden zuvor sei der Junge<br />
bei einem Handballspiel mit einem Kontrahenten zusammengestoßen. Ein Stück des rechten<br />
oberen Schneidezahnes sei abgebrochen, als das Knie des Gegenspielers auf die<br />
Oberkieferfrontzähne traf.<br />
Befunde:<br />
Zahn 11 zeigt eine Schmelz-Dentin-Fraktur ohne Pulpaeröffnung. Der Zahn 11 reagiert auf den<br />
Kältetest, die Sulkussondierungstiefen waren zirkulär ohne pathologischen Befund, der<br />
Perkussionstest war leicht positiv. Zahn 21 wies einen Lockerungsgrad von 0 auf. Der Zahnfilm<br />
von Zahn 11 zeigt eine Schmelz-Dentin-Fraktur.<br />
Das mitgebrachte Zahnfragment war bereits bei der Anmeldung des Patienten nach Säuberung<br />
mittels 0,2%iger Chlorhexidindigluconat-Lösung in physiologische Kochsalzlösung eingelegt.<br />
Das Zahnfragment von Zahn 11 war gut repositionierbar.<br />
Therapie:<br />
Nach der Farbauswahl erfolgte eine Infiltrationsanästhesie mit 1,7 ml Ultracain® DS und die<br />
Kofferdamapplikation mittels Zahnseide-Ligaturen. Anschließend erfolgte die Reinigung und<br />
Desinfektion des Zahnes 11 mittels 0,2%iger Chlorhexidindigluconat-Lösung. Nach nochmaliger<br />
Überprüfung der Passgenauigkeit wurden der Zahn 11 und das Zahnfragment mit<br />
Phosphorsäure-Gel Ultra-Etch® (35%ig) konditioniert. Es erfolgte die Wiederbefestigung des<br />
Bruchstückes mit einem gefüllten Dentinadhäsiv Optibond FL®. Kleine Inkongruenzen zwischen<br />
Zahnfragment und Zahn wurden mit Tetric Ceram® ausgefüllt. Die Ausarbeitung wurde mit<br />
einem sichelförmigen Skapell durchgeführt. Nach Entfernung des Kofferdams erfolgte<br />
abschießend eine Politur mit einer siliziumcarbidhaltigen Polierkelch (Okklubrush®) und die<br />
Fluoridierung des Zahnes mit Elmex Gelee®.<br />
12 Monate nach dem Unfall stellte sich der Patient nochmals zur klinischen Kontrolle in unsere<br />
Klinik vor. 1 Jahr nach Trauma war der klinische Befund des Zahnes 11 unauffällig.<br />
Konklusion:<br />
Im Rahmen eines Fallberichtes wird die Behandlung eines 10-jährigen Patienten mit<br />
unkomplizerter Schmelz-Dentin-Fraktur eines oberen Inzisivi geschildert. Das durch den<br />
Patienten mitgebrachte Zahnfragment war mittels “Reattachment” wiederbefestigt worden. Der<br />
Zeitpunkt einer invasiveren restaurativen Versorung zugunsten des adhäsiven Verbunds eigener<br />
Zahnhartsubstanz hinausgezögert werden.<br />
25
V 6<br />
10:02<br />
V 7<br />
10:15<br />
26<br />
Apexifikation traumatisierter Zähne unter Verwendung von Mineral Trixoxide<br />
Aggregate (MTA)<br />
Katharina Bücher, München • Jan Kühnisch, München • Christoph Kaaden, München •<br />
Reinhard Hickel, München<br />
Einleitung: Die Pulpanekrose stellt eine häufige Komplikation an verunfallten Zähnen dar und<br />
erfordert in der Regel eine endodontische Behandlung An bleibenden Zähnen mit nicht<br />
abgeschlossenem Wurzelwachstum muss zunächst aufgrund des weiten Foramen apicale eine<br />
Apexifikation durchgeführt werden, bevor eine definitive Wurzelkanalfüllung erfolgen kann.<br />
Immer häufiger wird die klassische Methode der Induktion einer Hartsubstanzbarriere mittels<br />
Kalziumhydroxid durch die Verwendung von Mineral Trioxide Aggregate (MTA) als apikalen Stop<br />
trotz erhöhten technischen und finanziellen Aufwandes abgelöst. Von Vorteil insbesondere beim<br />
jungen Patienten liegen in der Reduktion des Gesamtbehandlungszeitraumes, die sich in einer<br />
Verminderung der Anzahl an Behandlungssitzungen und der Frakturgefahr der medikamentös<br />
gefüllten Zähne niederschlägt.<br />
Da zur MTA-Apexifikation an traumatisierten Zähnen nur wenige<br />
Längsschnittuntersuchungsergebnisse vorliegen, war es Ziel der Arbeit unsere klinischen<br />
Ergebnisse hierzu zusammenzufassen.<br />
Material & Methode: Insgesamt wurde an 17 verunfallten Frontzähnen bei 15 Patienten im Alter<br />
von 6 bis 12 Jahren eine Apexifikation mit MTA nach einem standardisierten<br />
Behandlungsprotokoll durchgeführt und systematisch nachuntersucht. Neben dem offenen<br />
Foramen apikale (>0,6mm) wurden nur Zähne, deren Vitalitätsverlust traumatisch bedingt war,<br />
eingeschlossen.<br />
Ergebnisse: Über den Beobachtungszeitraum von durchschnittlich 16 Monaten (±6) zeigten 16<br />
Zähne (94%) einen unkomplizierten Heilungsverlauf. Lediglich ein Zahn mit vorausgegangener<br />
Kronen-Wurzel-Fraktur entwickelte eine Parodontitis apicalis mit Fistelbildung und musste<br />
extrahiert werden. Ursächlich <strong>für</strong> den Zahnverlust waren die im µ-CT festgestellten Mikrorisse,<br />
ein Zusammenhang mit der Behandlung wird daher ausgeschlossen.<br />
Zusammenfassung: Aufgrund der sehr hohen <strong>Erfolg</strong>srate der Apexifikation mit MTA in dem<br />
betreuten Patientenkollektiv, stellt diese Methode aus heutiger Sicht die primäre<br />
Behandlungsoption <strong>für</strong> avitale Frontzähne mit nicht abgeschlossenem Wurzelwachstum dar.<br />
Digitaler Frontzahntraumabogen als Basis <strong>für</strong> Dokumentation und<br />
wissenschaftliche Auswertungen<br />
Puria Parvini, Frankfurt am Main • Georg-Hubertus Nentwig, Frankfurt am Main<br />
Da es sich bei traumatischen Verletzungen der Frontzähne meist um eine Notfallsituation<br />
handelt und die Maßnahmen der Primärversorgung die Langzeitprognose der betroffenen<br />
Gewebe entscheidend beeinflussen, empfiehlt sich <strong>für</strong> die Erhebung der Anamnese, Befund,<br />
Diagnostik und Therapiedokumentation die Verwendung eines da<strong>für</strong> konzipierten,<br />
standardisierten Frontzahntraumabogens. Dieser dient gleichzeitig als "Checkliste" <strong>für</strong> den<br />
behandelnden Arzt.<br />
In der Poliklinik <strong>für</strong> Zahnärztliche Chirurgie und Implantologie Frankfurt wurde zunächst ein<br />
Bogen zur ausführlichen Dokumentation <strong>für</strong> Frontzahntraumen entworfen und praxisnah<br />
getestet.<br />
Um über die Dokumentation der Fälle relevante wissenschaftliche Auswertungen sowie<br />
Statistiken zu erhalten, wurde dieser in Kooperation mit der Firma solutio GmbH digitalisiert.<br />
Der digitale Frontzahntraumabogen und die daraus entwickelte Datenbank garantieren den<br />
schnellen Zugriff auf die erhobenen Daten.<br />
Neben der erwähnten Funktion eines Leitfadens <strong>für</strong> die Notfallbehandlung soll es dem<br />
Behandler vereinfacht werden, Versicherungen oder Gerichten Auskünfte zu erteilen sowie<br />
Röntgenbilder und Fotodokumentationen patientenbezogen über den Recall-Zeitraum zu<br />
archivieren. Es wurden folgende Parameter erhoben:<br />
1. Patientenangaben<br />
2. Anamnese<br />
3. Befunderhebung<br />
4. Diagnose und Therapie:<br />
5. Unterstützende Maßnahmen<br />
6. Recall
V 8<br />
11:30<br />
V 9<br />
11:43<br />
V 10<br />
11:56<br />
V 11<br />
12:09<br />
Zahnverletzungen bei Miniplattenosteosynthese: Einteilung,<br />
Therapiemanagement, Komplikationen und Prognose<br />
Tobias Vollkommer, Regensburg • Gottfried Schmalz, Regensburg • Torsten E.<br />
Reichert, Regensburg • Oliver Driemel, Regensburg<br />
Hintergrund: Bei der Miniplattenosteosynthese besteht trotz monokortikaler Konzeption die<br />
Gefahr sowohl einer direkten Verletzungen der Zahnwurzeln als auch einer indirekten<br />
Zahnschädigung durch Unterbrechung der apikalen Blutversorgung.<br />
Ziel der Untersuchung: Die vorliegende retrospektive Studie klassifiziert unterschiedliche Typen<br />
von Zahnwurzelschädigungen durch monokortikale Miniplattenosteosynthese bei<br />
Unterkieferfrakuren, schlägt diagnoseabhängige Therapiemöglichkeiten vor und dokumentiert<br />
die Überlebenswahrscheinlichkeit der geschädigten Zähne sowie deren Prognose.<br />
Patienten und Methoden: Über einen Zeitraum von 11 Jahren waren 380 Patienten mit<br />
Unterkieferfrakturen im bleibenden Gebiss mit Miniplatten osteosynthetisch versorgt worden,<br />
wobei es bei 29 Patienten zu einer direkten oder indirekten Zahnwurzelschädigung gekommen<br />
war. Diese Patienten wurden klinisch und radiologisch über einen Zeitraum von mindestens 38<br />
Monaten nachverfolgt.<br />
Ergebnisse: Bei den 29 Patienten konnten 4 Verletzungsmuster unterschieden werden: 13<br />
Pulpaverletzungen oberhalb des apikalen Wurzeldrittels (Typ Ia), 6 Pulpaverletzungen im<br />
apikalen Wurzeldrittel oder extradentale Schädigungen der apikalen Blutversorgung (Typ Ib), 4<br />
Defekte im zentralen Wurzeldentin ohne Pulpabeteiligung (Typ II) und 6 Verletzungen des<br />
peripheren Wurzeldentins und Wurzelzements (Typ III).<br />
Typ Ia-Verletzungen entwickelten in 5 von 13 Fällen periapikale Entzündungen und<br />
Desmodontalspalterweiterungen. Hier wurde einmal endodontisch behandelt, dreimal eine<br />
Wurzelspitze reseziert und ein Zahn musste extrahiert werden. Bei drei weiteren Typ Ia-<br />
Verletzungen und bei 2 Typ Ib-Verletzungen wurden Zahnwurzelresorptionen beobachtet,<br />
welche in zwei Fällen eine Vitalexstirpation bedingten. Eine von sechs Typ Ib-Verletzungen<br />
erforderte aufgrund einer periapikalen Entzündung eine endodontische Therapie. Eine von vier<br />
Typ II-Verletzungen verursachte eine Zahnwurzelresorption ohne Therapiebedarf. Nach Typ III-<br />
Verletzungen wurden keine therapeutisch relevanten, pathologischen Prozesse identifiziert.<br />
Schlussfolgerungen: Direkte oder indirekte Zahnschädigungen bei der Miniplattenosteosynthese<br />
sind häufiger als bis dato angenommen. Das Verletzungsmuster der Zahnwurzeln nach<br />
Miniplattenosteosynthese zusammen mit der klinischen und radiologischen Kontrolle bestimmt<br />
den therapeutischen Behandlungsbedarf, die Komplikationsrate und die Wahrscheinlichkeit des<br />
Verbleibs der betroffenen Zähne.<br />
Das verminderte alveoläre Trauma bei der Zahnlängsextraktion<br />
Benno Syfrig, Luzern<br />
Die Zahnextraktion verursacht immer ein alveoläres Trauma. Mit der Längsextraktion kann<br />
diese<br />
Extraktionsverletzung vermindert werden, das alveoläre Weich- und Hartgewebe wird geschont.<br />
Gezeigt wird ein Bericht über die 6-jährige Erfahrung- und Anwendung der Längsextraktion mit<br />
dem<br />
Benex-System.<br />
Intrusive Dislokationsverletzungen - Therapieoptionen und potentielle<br />
Schwierigkeiten -<br />
Gregor Castrillón-Oberndorfer, Heidelberg<br />
Bei intrusiven Dislokationsverletzungen treten massive Gewebeschäden auf. Aufgrund der<br />
Schwere des Traumas, zusätzlicher Verletzungen oder einer auffälligen Allgemeinanamnese<br />
kann sich die akute Sofortbehandlung schwierig gestalten. Nach einer Übersicht über die<br />
aktuellen Therapieempfehlungen sollen mögliche auftretende Problemstellungen anhand von 4<br />
Fallbeispielen dargestellt und deren Lösungsmöglichkeiten aufgezeigt und besprochen werden.<br />
Zahnreplantation - bei langzeitavulsierten und trocken gelagerten Zähnen?<br />
Christine Schwerin, Magdeburg • Klaus-Louis Gerlach, Magdeburg<br />
Die Replantation avulsierter Zähne nach mehrstündiger trockener Aufbewahrung hat im<br />
Allgemeinen eine schlechte Prognose. Durch eine chemische Behandlung der Wurzeloberfläche<br />
und extraorale Wurzelfüllung sind aber in Einzelfällen gute Langzeitergebnisse möglich.<br />
Methode: Nach Trepanation, Pulpaexstirpation und Wurzelkanalaufbereitung des Zahnes sowie<br />
Entfernung der Wurzelhaut wird der zu replantierende Zahn in 2%iger Natriumfluoridlösung pH<br />
5 <strong>für</strong> 20 Minuten gelagert und nach einer Wurzelfüllung mit Guttapercha replantiert und flexibel<br />
geschient.<br />
Es wurden bisher bei 7 Patienten 10 Zähne erfolgreich auf diese Weise behandelt. Während<br />
27
V 12<br />
12:22<br />
V 13<br />
12:35<br />
28<br />
einer Nachbeobachtungszeit von mindestens 1 bis zu 6 Jahren konnte in allen Fällen ein<br />
funktionell und ästhetisch gutes Ergebnis ohne Ersatzresorptionen bzw. Ankylosen festgestellt<br />
werden. Röntgenologische Verlaufskontrollen bei einem Patienten über 6 Jahre demonstrieren<br />
die Möglichkeit eines Langzeiterfolges nach 24stündiger trockener Aufbewahrung des<br />
avulsierten Zahnes. Fotodokumentationen zeigen beispielhaft die Wertigkeit dieser<br />
Verfahrensweise auf.<br />
Diese bereits von ANDREASEN beschriebene Methode ist in den Fällen zu empfehlen, bei denen<br />
eine adäquate Sofortreplantation bzw. Aufbewahrung in einem physiologischen Medium nicht<br />
erfolgte und zudem eine Implantatinsertion aus Kostengründen nicht möglich ist. Der mit<br />
Natriumfluorid behandelte und replantierte Zahn stellt im bleibenden Gebiss eine mögliche<br />
Langzeitversorgung dar. Er kann im Wechselgebiss zumindest als Platzhalter bis zu einer<br />
definitiven Implantatversorgung dienen.<br />
Replantation von 45 avulsierten bleibenden Zähnen: 1 Jahres Follow-up<br />
Studie<br />
Vivianne Chappuis, Bern • Thomas von Arx, Bern<br />
35 Patienten mit 45 avulsierten bleibenden Zähnen wurden ein Jahr beobachtet. Alle Zähne<br />
wurden vor der Replantation in Tetrazyklin-Lösung eingelegt. Es wurden zusätzlich Schmelz-<br />
Matrix Proteine verwendet wenn die trockene Lagerungsdauer 30 Minuten überschritten hatte.<br />
Die Zähne schiente man mit einer nicht starren Schiene zwischen 7-10 Tagen. Während der<br />
Schienungszeit leitete man bei allen Zähnen mit einem geschlossenen Apex eine<br />
Wurzelbehandlung ein. Bei Zähnen mit einem offenen Apex und einer idealen<br />
posttraumatischen Lagerungszeit wurde vorerst auf eine Wurzelbehandlung verzichtet. Alle<br />
Patienten erhielten eine systemische Antibiose mit Tetrazyklin <strong>für</strong> 10 Tage. Die Überlebensrate<br />
der replantierten bleibenden Zähne betrug 95.6% nach einem Jahr. In 82.2% wurde eine<br />
Wurzelbehandlung durchgeführt. Die Pulpa überlebte in keinem Fall, aber in drei Fällen konnte<br />
eine Pulpaobliteration beobachtet werden. Parodontale Heilung wurde in 57.7% beobachtet;<br />
42.3 % der Zähne zeigten eine externe Wurzelresorption (28.9% replacement resorption, 6.7%<br />
infection-related resorption, 6.7% surface resorption). Das Auftreten einer Replacement<br />
Resorption korrelierte mit der trockenen extraoralen Lagerungszeit. Verglichen mit anderen<br />
Studien zeigte sich in dieser Untersuchung ein höherer Prozentsatz von parodontaler Heilung.<br />
Dieses günstige Behandlungsergebnis hängt möglicherweise mit dem strikten Protokoll <strong>für</strong> eine<br />
frühzeitige Wurzelbehandlung, den Einsatz von topischen und systemischen Tetrazyklinen und<br />
die hohe Anzahl von ideal gelagerten Zähnen unmittelbar nach der Avulsion. Demgegenüber<br />
steht, dass sich die Follow-up Studie nur über ein Jahr erstreckt.<br />
Langzeitergebnisse nach autoalloplastischer Replantation avulsierter<br />
bleibender Zähne bei Patienten im Wachstumsalter<br />
Yango Pohl, Bonn • Andreas Filippi, Basel<br />
Avulsierte bleibende Zähne bei Patienten im Wachstumsalter wurden nach extraoraler<br />
retrograder Stiftinsertion replantiert. Die Zähne wurden prospektiv nachuntersucht.<br />
Es wurden bei 29 Patienten 36 Zähne replantiert, die über mindestens 12 Monate<br />
nachkontrolliert wurden oder die Heilungskomplikationen zeigten. Die Patienten waren zum<br />
Zeitpunkt des Unfalls im Schnitt 10,8 Jahre alt (Median: 9,9 Jahre; 7,1- 17,6 Jahre).<br />
Wurzelunreif waren 11 Zähne, wurzelreif 25 Zähne.<br />
Die Beobachtungszeit betrug im Mittel 35,8 Monate (Median: 25,5 Monate; 5,1 - 100,2<br />
Monate). 12 Zähne zeigten funktionsgerechte Heilung, 21 Zähne Ankylose/Ersatzresorption. 3<br />
Zähne zeigten nach einem infektionsfreien Intervall von mindestens 15 Monaten späte<br />
infektionsbedingte Resorptionen. Alle umgehend in der Zahnrettungsbox geretteten Zähne<br />
heilten funktionsgerecht ein, unabhängig von der Lagerungsdauer (2 bis 53 Stunden). Das<br />
sofortige physiologische Retten war signifikant mit dem Heilungsergebnis korreliert.<br />
Nach durchschnittlich 31,4 Monaten (5,1 - 89,6 Monate) wurden 11 nicht funktionsgerecht<br />
eingeheilte Zähne in geplanten Operationen entfernt. In 8 Fällen war die Indikation zur<br />
Extraktion eine vorgesehene Transplantation von Prämolaren oder Milcheckzähnen, in den<br />
anderen Fällen sollte die durch Zahnankylose verursachte Wachstumshemmung des betroffenen<br />
Kieferabschnittes aufgelöst werden. Durch akute Infektion oder Fraktur diktierte, ungeplante<br />
Extraktionen waren nicht erforderlich. Funktionsgerecht eingeheilte Zähne gingen nicht<br />
verloren.<br />
Die Kaplan-Meier-Überlebenszeitschätzung über alle Replantate betrug im Mittel 66,7 Monate<br />
(Median: 89,6 Monate). Als einziger Faktor mit signifikantem Einfluss auf das Überleben<br />
verblieb die geplante Folgebehandlung Transplantation. Eine nach konventioneller Systematik<br />
beschriebene schlechtere Prognose wurzelunreifer Zähne im Vergleich zu wurzelreifen Zähnen<br />
wurde nicht beobachtet.<br />
Die Systematik der sofortigen Wurzelkanalbehandlung mit der Methodik der extraoralen,<br />
retrograden Insertion von Titanstiften hat sich in der Langzeitbeobachtung bewährt. Frühe
V 14<br />
12:48<br />
infektionsbedingte Resorptionen können vollständig vermieden werden. Eine negative<br />
Beeinflussung der parodontalen Heilung durch die längere extraorale Verweildauer bzw. die<br />
Behandlungsabläufe wurde nicht beobachtet. Wurzelunreife Zähne profitieren in besonderem<br />
Maße. Die Replantation unter Hoffnung auf Revaskularisation sollte vor dem Hintergrund einer<br />
vorhersagbar sicheren und erfolgreichen endodontischen Sofortbehandlung auch bei<br />
physiologisch geretteten Zähnen ausgesprochen kritisch hinterfragt werden.<br />
Lückenschluss durch Mesialisation der Milcheckzähne - eine Alternative nach<br />
traumatischem Frontzahnverlust?<br />
Niko Bock, Gießen • Sandra Morton, Gießen • Sabine Ruf, Gießen<br />
Einleitung: Jugendliche Patienten mit traumatischem Verlust mehrerer bleibender Frontzähne<br />
stellen eine große zahnmedizinische Herausforderung dar. Wie auch bei Patienten mit<br />
Nichtanlagen im Frontzahnbereich ist therapeutisch abzuwägen, ob die Lücke <strong>für</strong> eine spätere<br />
prothetische bzw. implantologische Versorgung offen gehalten werden soll, oder ob es besser<br />
ist die Lücken zu schließen. Beim Fehlen mehrerer Frontzähne in einem Quadranten ist ein<br />
Lückenschluss mit bleibenden Zähnen jedoch meist nicht möglich. Eine Alternative wäre ein<br />
Lückenschluss durch Mesialisation der Milcheckzähne.<br />
Fallbericht: Im Folgenden wird ein achtjähriges Mädchen mit Nichtanlage der Zähne 13,12, 22<br />
und 23 vorgestellt. Die Zähne 52 und 62 waren bereits vorzeitig verloren gegangen, die Zähne<br />
53 und 63 jedoch in situ. Die Patientin wies außerdem ein sie ästhetisch stark<br />
beeinträchtigendes Diastema mediale von 6mm auf. Der Behandlungsplan sah vor, das<br />
Diastema mittels Multibracketapparatur zu schließen und die Zähne 53 und 63 zu mesialisieren,<br />
um eine Resorption derselben durch die durchbrechenden Zähne 14 und 24 zu verhindern. Die<br />
Milcheckzähne sollten nachfolgend so lange wie möglich als Lückenhalter in Regio 12 und 22<br />
erhalten werden. Nach 12 Monaten konnte die interzeptive Behandlung beendet werden.<br />
Diskussion: Durch diese interzeptive Frühbehandlung konnte <strong>für</strong> die Patientin ein enormer<br />
Gewinn an fazialer Ästhetik, eine Verbesserung der Abbeißfunktion sowie Erhalt des alveolären<br />
Knochens im Bereich der Nichtanlagen sicher gestellt werden. Einschränkend muss eingeräumt<br />
werden, dass über die Langzeitprognose kieferorthopädisch bewegter persistierender<br />
Milcheckzähne keine wissenschaftlichen Daten vorliegen.<br />
29
30<br />
Abstracts Poster<br />
P 1 Dreidimensionale radiologische Diagnostik von Zahntraumata und ihren<br />
Spätfolgen<br />
Dorothea Berndt, Basel • Gabriel Krastl, Basel • Andreas Filippi, Basel<br />
Zahnunfälle sind bei Kindern und Jugendlichen häufig und erfordern schnelle und kompetente<br />
diagnostische Entscheidungen. Das Ausmaß der Verletzungen, insbesondere der Hartgewebe<br />
(Zahnhartsubstanzen und Knochen) sind bei der klinischen Inspektion nicht ersichtlich und<br />
benötigen die radiologische Darstellung. Bisher war im Frontzahnbereich des Oberkiefers der<br />
(Einzel-) Zahnfilm das bildgebende Verfahren der Wahl. Bei ausgedehnten Verletzungen wurden<br />
Schädelübersichts- oder Panoramaschichtaufnahmen angefertigt. Für die Darstellung der zweiten<br />
Ebene konnten Aufbissaufnahmen oder konventionelle Tomographien ergänzend erstellt werden.<br />
Die digitale Volumentomographie ermöglicht als hochauflösendes Verfahren bei Zahnunfällen eine<br />
genaue Diagnostik, welche die Art und den Umfang der Verletzungen sicher und mit einer einzigen<br />
Aufnahme darstellen kann.<br />
Zahnunfälle sind <strong>für</strong> Kinder und Jugendliche strapaziöse Ereignisse, so dass die Geduld und die<br />
Ausdauer zur Mitarbeit eingeschränkt sind. Die digitale Volumentomographie stellt durch ihren<br />
geringen Zeitaufwand in diesem Zusammenhang ein sinnvolles Verfahren dar, um eine gute<br />
Kooperation der Patienten <strong>für</strong> die nach der Diagnostik anstehende Behandlung zu erreichen. Der<br />
Zahnfilm ist nach wie vor im Frontzahnbereich des Oberkiefers das radiologische<br />
Standardverfahren. Bei zusätzlichen Aufnahmen oder beim initialen Verdacht auf Frakturen sollte<br />
der digitalen Volumentomographie ergänzend oder als primäre Aufnahme der Vorzug gegeben<br />
werden.<br />
Die digitale Volumentomographie hat sich ebenfalls zur Darstellung und Beurteilung von<br />
Spätfolgen nach Zahnunfällen (wie Oberflächenresorptionen, zervikalen Resorptionen und<br />
Ersatzgewebsresorptionen) als sinnvolles bildgebendes Verfahren erwiesen und stellt heute die<br />
Basis <strong>für</strong> die Entscheidung zum Abwarten, zur Zahntransplantation, intentionellen Replantation<br />
und Decoronation dar.<br />
Im Folgenden soll die radiologische dreidimensionale Darstellung von verschiedenen Zahnunfällen<br />
und deren Spätfolgen mit dem 3D-Accuitomo (Morita, Kyoto, Japan) vorgestellt werden.<br />
P 2 140 Jahre zahnärztliche Traumatologie an der Martin-Luther-Universität Halle-<br />
Wittenberg<br />
Felix Schneider, Halle/Saale<br />
Möglichkeiten der Prophylaxe von dentoalveolären Verletzungen sowie Erkenntnisse der zellulären<br />
Heilungsvorgänge am Zahnhalteapparat und der Hartgewebsheilung spielen in der modernen<br />
dentoalveolären Traumatologie unter dem Aspekt der Zahnrettung und Zahnerhaltung eine<br />
zunehmende Rolle. Wo liegen die Wurzeln dieser zahnärztlichen Spezialdisziplin und wie verlief<br />
ihre Entwicklung?<br />
Der Blick zurück auf 140 Jahre an einer Universitätseinrichtung soll uns diese Frage klären helfen.<br />
Beginnend mit der ersten Habilitation <strong>für</strong> Zahnheilkunde an der Vereinigten Friedrichs-Universität<br />
Halle-Wittenberg am 20.01. 1868 durch Anton Rudolf Hohl (1838-1872) und mit dessen<br />
praktischer und wissenschaftlicher Tätigkeit in der zahnärztlichen Traumatologie wird die<br />
Entwicklung dieses Spezialgebietes an der Universität in Halle bis in die Gegenwart verfolgt. Dabei<br />
wird schlaglichtartig u.a. das Wirken der Professoren Ludwig Heinrich Holländer (1833-1897),<br />
Hans Wilhelm Körner (1862-1929), Erwin Reichenbach (1897-1973), Wolfgang Müller (geb.1933)<br />
und Detlef Schneider (geb. 1941) und ihre Bedeutung <strong>für</strong> die zahnärztliche Traumatologie<br />
besonders in der universitären Lehre und Ausbildung beleuchtet.<br />
Fotos und bedeutsame wissenschaftliche Literaturhinweise vervollständigen den kurzen<br />
historischen Abriss.<br />
P 3 Belastung juveniler Incisivi bei der stiftprothetischen Versorgung<br />
Sebastian Mues, Bonn<br />
Ziel dieser Arbeit war es zu untersuchen, welchen Temperatur- und Dehnbelastungen einwurzelige<br />
Zähne mit nicht abgeschlossenem Wurzelwachstum und Zustand nach tiefer Kronenfraktur<br />
während der stiftprothetischen Versorgung ausgesetzt sind, um die getesteten Systeme auf ihre<br />
Eignung <strong>für</strong> die Versorgung strukturell geschwächter Zähne zu untersuchen.<br />
Die extrahierten Zähne wurden vorbereitet, mit einem Dehnungsmessstreifen und einem<br />
Thermoelement versehen und gruppenspezifisch versorgt. Füllungskomposit, konfektionierte<br />
Karbon-, Glasfaser- und Zirkondioxidkeramikstifte sowie individuell modellierte und gegossene<br />
Metallstiftaufbauten kamen zum Einsatz.<br />
Bei allen im üblichen Procedere einer Stiftprothetischen Behandlung auftretenden Arbeitsschritten
wurden die Auftretenden Temperaturänderungen sowie die Dehnung des Zahnes gemessen.<br />
Die zum Teil hohen ermittelten Werte <strong>für</strong> Temperatur und Dehnung lassen es zu, Empfehlungen<br />
hinsichtlich des verwendeten Stiftsystems <strong>für</strong> den Praxisalltag auszusprechen.<br />
P 4 Bruchlastverhalten von Stiftaufbauten bei Zähnen mit nicht abgeschlossenem<br />
Wurzelwachstum<br />
Anett Mues, Bonn<br />
Ziel dieser Studie war es, die Frakturfestigkeit von endodontisch versorgten Zähnen mit nicht<br />
abgeschlossenem Wurzelwachstum und Zustand nach Kronenfraktur mit fünf unterschiedlichen<br />
Aufbauten zu vergleichen, um Empfehlungen hinsichtlich der schwierigen prothetischen<br />
Versorgung geben zu können.<br />
Die extrahierten Zähne wurden vorbereitet und gruppenspezifisch versorgt. Füllungskomposit,<br />
konfektionierte Karbon-, Glasfaser- und Zirkondioxidkeramikstifte sowie individuell modellierte<br />
und gegossene Metallstiftaufbauten kamen zum Einsatz.<br />
Nach dem Zementieren der Stifte und der Modellation eines Aufbaus wurden in einer<br />
Universalprüfmaschine die Bruchlastwerte der jeweiligen Versorgungsart ermittelt.<br />
Der Frakturwiderstand aber auch die typischen Versagensmuster der jeweiligen Restaurationsform<br />
lassen auf eine unterschiedliche Eignung <strong>für</strong> die genannte Indikation schließen.<br />
P 5 Komplizierte Kronenfrakturen der beiden mittleren oberen Schneidezähne -<br />
Therapie von Komplikationen nach Erstversorgung<br />
Berit Muselmani, Jena • Eike Glockmann, Jena<br />
In der Literatur werden als Ursachen <strong>für</strong> dentale Traumata hauptsächlich Stürze und<br />
Verkehrsunfälle, gefolgt von Spiel-und Sportunfällen angegeben (Adekoya-Sofowora 2001).<br />
Im vorliegenden Fall suchte ein 13-jähriges Mädchen nach einem Schwimmbadunfall den<br />
zahnärztlichen Notdienst auf. An den beiden oberen mittleren Schneidezähnen war es infolge des<br />
Traumas zur Kronenfraktur gekommen. Der Defekt umfasste Schmelz und Dentin und wies eine<br />
breitflächige Eröffnung der Pulpa auf.<br />
Im Rahmen der Notfalltherapie wurden beide Zähne mittels direkter Überkappung und<br />
Kompositaufbau versorgt. Vier Monate später veranlasste die Hauszahnärztin aufgrund<br />
persistierender Beschwerden die Überweisung an die Poliklinik <strong>für</strong> Konservierende Zahnheilkunde<br />
des Universitätsklinikums Jena.<br />
Bei den in unserer Poliklinik durchgeführten klinischen und radiologischen Untersuchungen wurden<br />
ein verbreiterter Parodontalspalt an den Zähnen 11, 12 sowie 21 festgestellt. Zudem imponierte<br />
der insuffiziente Kompositaufbau an 21. Die Sensibilitätsprüfung mittels Kältespray der beiden<br />
mittleren Schneidezähne ergab eine verstärkte Reaktion, zudem wiesen beide Zähne eine axiale<br />
Perkussionsempfindlichkeit auf. Der karies- und füllungsfreie Zahn 21 zeigte hingegen auf die<br />
Kältespraytestung eine normale Reaktion, die apikale Palpation war jedoch schmerzauslösend.<br />
Alle Zähne erschienen parodontal gesund, es bestand keine Lockerung. Zum Zeitpunkt der<br />
Erstuntersuchung wiesen die Zähne keine Verfärbung auf. Der Patientin mit gutem<br />
Allgemeinzustand und unauffälliger allgemeiner Anamnese gelang es nicht, den die Beschwerden<br />
verursachenden Zahn genau zu lokalisieren.<br />
Über die Befunde, daraus ableitbare Therapiemöglichkeiten und die mit dem Versuch einer<br />
Erhaltung der Zähne 11, 12 und 21 verbundene Prognose wurden die Patientin und die sie<br />
begleitende Mutter aufgeklärt.<br />
Die Indikationsstellung <strong>für</strong> eine Wurzelkanalbehandlung erforderte im vorliegenden Fall eine<br />
differenzierte Betrachtungs- bzw. Vorgehensweise. Während 4 Monate nach dem Unfall die<br />
endodontische Therapie <strong>für</strong> den Erhalt der mittleren Schneidezähne das Mittel der Wahl darstellte,<br />
kommt der engmaschigen Kontrolle und Nachsorge des Zahnes 12 eine entscheidende Rolle zu.<br />
P 6 Konservierende Versorgung eines komplexen dentalen Traumas - Ergebnis<br />
nach vier Jahren<br />
Jan Kühnisch, München • Katharina Bücher, München • Christoph Kaaden, München •<br />
Reinhard Hickel, München<br />
Ziel des vorliegenden Fallberichtes ist es, neben der Darstellung der Primärversorgung auch die<br />
Notwendigkeit eines engmaschigen Recalls zu unterstreichen. Die Erstvorstellung des 15-jährigen<br />
Patienten an der Poliklinik <strong>für</strong> Zahnerhaltung erfolgte fünf Tage nach dem Verkehrsunfall, der<br />
unfallchirurgischen Erstversorgung der linksseitigen Oberarm-/Schulterfrakturen sowie nach<br />
Draht-Komposit-Schienung der gelockerten Zähne durch die MKG-Chirurgie. Mit der klinischenröntgenologischen<br />
Befundaufnahme wurden folgende Diagnosen gestellt: Zahn 11 - komplizierte<br />
Kronenfraktur, Fraktur im mittleren Wurzeldrittel; Zahn 21 und 22 - unkomplizierte<br />
Kronenfraktur. Die Zahnlockerung wurde mit Grad 1 <strong>für</strong> Zahn 11 und Grad 2 <strong>für</strong> Zahn 21 durch<br />
den erstversorgenden Behandler angegeben. Die konservierende Versorgung erfolgte in<br />
mehrenden Etappen. 1.) Bei der Erstvorstellung 5 Tage post-traumatisch wurde die direkte<br />
31
32<br />
Überkappung an Zahn 11 (Ca(OH)2-Suspension, Ca(OH)2-Liner und adhäsive Abdeckung der<br />
Dentinwunde) vorgenommen. Die pulpanahen Dentinwunden der Zähne 21 und 22 wurden in<br />
Adhäsivtechnik erstversorgt. 2.) An die Entfernung der Draht-Komposit-Schienung sieben Wochen<br />
post-traumatisch schloss sich die direkte Kompositrestauration der Zahnkronen an. 3.) Im<br />
Rahmen der weiteren Betreuung stand die Verlaufskontrolle der verunfallten Zähne im<br />
Vordergrund. Nach 14 Monaten wurde der Vitalitätsverlust des Zahnes 21 mit einer begleitenden<br />
Parodontitis apicalis chronica gesichert. Die Trepanation des Zahnes 21 offenbarte eine<br />
vollständige Pulpanekrose. Nach Aufbereitung, Reinigung, Desinfektion und Obturation des<br />
Wurzelkanals erfolgte die vollständige Ausheilung der apikalen Entzündung. 4.) Die weiteren<br />
Kontrolluntersuchungen ergaben keine weiteren Hinweise auf mögliche Komplikationen bzw.<br />
weitere Unfallfolgen. Der Fallbericht verdeutlicht einerseits, dass die konservative,<br />
pulpaerhaltende Versorgung des Zahnes 11 vier Jahre post-traumatisch als erfolgreich eingestuft<br />
werden kann und anderseits engmaschige Kontrolluntersuchungen notwendig sind, um mögliche<br />
Spätfolgen frühzeitig zu erkennen.<br />
P 7 Therapie externer entzündlicher Wurzelresorptionen nach Avulsion - Ein<br />
Fallbericht<br />
Thomas Ebert, Erlangen • Christine Berthold, Erlangen<br />
Anamnese<br />
Die Patientin erlitt im Oktober 2005 im Alter von 8,5 Jahren eine Avulsion aufgrund eines<br />
Badeunfalls. Der Zahn wurde laut Anamnese nach 90minütiger trockener Lagerung replantiert und<br />
<strong>für</strong> sechs Wochen mittels Drahtbogenschiene fixiert, eine endodontische Therapie sowie<br />
Verlaufskontrollen erfolgten nicht. Anfang April wurde die Patientin wegen einer Schwellung im<br />
Vestibulum in regio 11 bei ihrem Hauszahnarzt vorstellig, es erfolgte eine Stichinzision und die<br />
Extraktion des Zahnes wurde geplant.<br />
Ausgangssituation<br />
Mit der Bitte um eine zweite Meinung wurde die Patientin in unserer Poliklinik vorgestellt. Die<br />
klinische Untersuchung ergab einen positiven Perkussionstest sowie einen dumpfen<br />
Perkussionston am Zahn 11 bei gleichzeitiger negativer Sensibilität sowie eine Lockerung II°. Im<br />
angefertigten Röntgenbild zeigten sich eine apikale Aufhellung sowie ausgeprägte externe<br />
entzündliche Wurzelresorptionen insbesondere in der apikalen Region mit Reduktion der<br />
Wurzellänge auf etwa zwei Drittel. Nach Aufklärung der Eltern über die Ausgangssituation sowie<br />
möglicher Behandlungsoptionen (Versuch des Erhaltes durch Endodontie, Milcheckzahn- oder<br />
Prämolarentransplantation, Decoronation, Extraktion) wurde die endodontische Therapie<br />
eingeleitet.<br />
Therapie<br />
Der Zahn wurde trepaniert und nach endometrischer Längenbestimmung und Reinigung des<br />
Kanals wurde Kalziumhydroxid als medikamentöse Einlage platziert. Nach einer Woche war die<br />
Patientin beschwerdefrei, die medikamentöse Einlage wurde nochmals gewechselt. Über einen<br />
Zeitraum von 21 Monaten wurden Langzeiteinlagen mit Kalziumhydroxid mit dem Ziel der<br />
Apexifikation, der Desinfektion des endodontischen Systems sowie der Ausheilung der apikalen<br />
Parodontis durchgeführt. Nach erfolgreicher Ausheilung der knöchernen apikalen Läsion, jedoch<br />
unvollständiger Bildung einer apikalen Hartsubstanzbarriere wurde diese mittels eines apikalen<br />
Plugs aus MTA generiert. Nach erfolgter Aushärtung des MTA wurde zur Prävention einer<br />
Querfraktur des vorgeschädigten Zahnes ein individuell angepasster Glasfaserstift adhäsiv<br />
befestigt.<br />
Ergebnis und Prognose<br />
Durch die endodontische Therapie erfolgte eine röntgenologisch und klinisch nachweisbare<br />
vollständige Ausheilung der apikalen knöchernen Läsion, eine Stagnation der externen<br />
Wurzelresorptionen sowie die Ausbildung eines normalen Parodontalspaltes. Die Lockerung des<br />
Zahnes ist seit Therapiebeginn rückläufig, derzeit differieren die Periost-Werte lediglich um drei<br />
Einheiten im Vergleich zum unverletzten Nachbarzahn. Perkussionston und -empfindlichkeit sind<br />
unauffällig und entsprechen den Nachbarzähnen, Anzeichen einer<br />
Alveolarfortsatzwachstunshemmung infolge einer Ankylose sind nicht vorhanden.<br />
Der zum Zeitpunkt der Erstvorstellung zur Extraktion terminierte Zahn 11 konnte bisher zwei<br />
Jahre erhalten werden. Aufgrund der Ergebnisse der Nachuntersuchung ist von einer günstigen<br />
Langzeitprognose auszugehen unter der Voraussetzung, dass keine Ersatzresorptionen auftreten<br />
oder ein Folgetrauma stattfindet. Weitere Verlaufskontrollen sind im drei- bis sechsmonatigen<br />
Abstand geplant.<br />
Diskussion<br />
Nach Avulsion führt die retrograder Infektion des Wurzelkanalsystems zu entzündlichen externen<br />
Wurzelresorptionen, die ohne endodontische Intervention progressiv fortschreiten. Im<br />
vorliegenden Fall waren die Resorptionen hauptsächlich apikal lokalsiert mit der Folge eines weit<br />
offenen Foramen apicale. Eine klassische Wurzelkanalfüllung war nicht möglich. Mit dem Ziel der
Hartsubstanzbarrierebildung wurde eine Langzeitapexifikation mittels Kalziumhydroxid versucht<br />
und nachfolgend durch die Applikation eines MTA-Plugs vervollständigt. Vorteil der Apexifikation<br />
mittels MTA im Vergleich zu Kalziumhydroxideinlagen ist eine einzeitige Generierung der<br />
Hartsubstanzbarriere, Nachteile sind mögliche Verfärbungen, Materialkosten sowie eine relativ<br />
anspruchsvolle Applikationstechnik. Nachteile der Langzeitapexifikation mittels Kalziumhydroxid<br />
sind die erhöhte Frakturanfälligkeit der Zähne sowie die notwendige Patientencompliance. Eine<br />
adhäsive interne Stabilisierung dieser Zähne mittels Komposit oder adhäsiv befestigter<br />
Glasfaserstifte erscheint daher sinnvoll.<br />
Im Rahmen der Nachkontrollen wurde kein Hinweis auf eine Ankylose gefunden, die jedoch nach<br />
90miütiger trockener Lagerung des Zahnes vor Replantation sicher zu erwarten wäre.<br />
Möglicherweise konnte die Interposition von Granulationsgewebe im Rahmen der Entzündung die<br />
Entwicklung von Ersatzresorptionen verhindern und die Ausbildung eines neuen parodontalen<br />
Ligaments begünstigen.<br />
P 8 <strong>Erfolg</strong>reiche Apexifikation nach komplizierter Frontzahnfraktur und<br />
mehrtägiger Pulpaexposition.<br />
Clemens Bottenberg, Euskirchen<br />
Der vorliegende Fall beschreibt den klinischen Verlauf eines kompliziert frakturierten Frontzahnes,<br />
dessen adäquate zahnmedizinische Versorgung erst nach 3 Tagen stattfand.<br />
Das Problem der meisten Zahntraumata liegt erfahrungsgemäß in der Lokalisation der<br />
zahnmedizinischen Erstversorgung und dem Alter der Patienten. Außerhalb der universitären<br />
Institution ist die Traumatologie in der freien Praxis wirtschaftlich kaum vertretbar, die<br />
eingeschränkte Compliance der jugendlichen Patienten lässt zumeist nur zeitintensive oder<br />
eingeschränkte Behandlung zu.<br />
Auch im vorliegenden Fall empfahl der notdiensthabende Zahnarzt die Extraktion.<br />
In der vorliegenden Falldarstellung möchte der Autor zeigen, dass es selbst unter ungünstigen<br />
Voraussetzungen (mehrtägige Pulpaexposition, kein Kofferdam) möglich war, den im Alter von<br />
sieben Jahren frakturierten 21 mit offenem foramen bis zur vollständigen Apexifikation zu<br />
erhalten.<br />
Die Behandlung erfolgte durchweg konservativ. Nach Vitalamputation des coronalen<br />
Pulpengewebes wurde durch Calciumhydroxid (Calxyl) überkappt, mit Harvard ein<br />
bakteriendichter Wundverschluß geschaffen und mittels Flow-Composit provisorisch versorgt. Im<br />
Laufe einer mehrjährigen Verlaufskontrolle kam es sowohl im coronalen Pulpenbereich zur<br />
Ausbildung einer Hartsubstanzbrücke, als auch im apikalen Bereich zur Ausbildung eines foramen<br />
apikale.<br />
Es wurden nur die in den meisten Zahnarztpraxen vorhandenen Materialien verwendet und selbst<br />
die eingeschränkte Compliance ließ sich, zugegebener Maßen zeitintensiv, überwinden.<br />
P 9 Langzeitkontrollen nach apikaler MTA-Applikation zur einzeitigen Apexifikation<br />
bei traumatisch geschädigten Zähnen<br />
Benjamin Blome, Bonn • Victor Sobarzo, Bonn<br />
Bei Zähnen mit nicht abgeschlossenem Wurzelwachstum, deren Pulpagewebe irreversibel<br />
geschädigt wurde, stellt sich meistens eine Unterbrechung in der Wurzelausbildung ein. In einem<br />
solchen Fall ist ein iatrogener Verschluss des Apex nötig, eine Apexifikation.<br />
Diese Fallberichtserie beinhaltet 9 Fälle von Oberkieferinzisivi und einen Unterkieferprämolaren<br />
bei 10 Patienten zwischen 7 und 14 Jahren mit einer irreversiblen Schädigung der Pulpa der<br />
entsprechenden Zähne. Bei allen 10 Fällen war eine Trepanation der Zähne notwendig und das<br />
Wurzelwachstum nicht abgeschlossen.<br />
In der letzten Untersuchung nach mindestens 25 Monaten waren alle Zähne frei von klinischen<br />
Symptomen und im Röntgenbild waren keine Anzeichen apikaler Entzündungssymptome zu<br />
erkennen. Ebenso war bei keinem Zahn eine Resorption der Wurzeloberfläche erkennbar.<br />
Die einzeitige Apexifikation mit MTA kann bei Zähnen mit nicht abgeschlossenem Wurzelwachstum<br />
und offenem Apex eine erfolgreiche zeitsparende Alternative zu der mehrzeitigen Behandlung mit<br />
Calciumhydroxid darstellen.<br />
P 10 Replantation von parodontal kompromittierten Zähnen nach extraoraler<br />
Wurzelkanalbehandlung und unter Anwendung von Emdogain<br />
Benjamin Blome, Bonn • Yango Pohl, Bonn<br />
Parodontal stark vorgeschädigte Zähne sind aufgrund ihres hohen Lockerungsgrades, oft<br />
vollständig fehlenden knöchernen Attachments und einer teilweise vorzufindenden Supraposition<br />
sehr schwierig zu erhalten. Die Möglichkeit, diese Zähne durch intentionelle Replantation zu<br />
erhalten, ist mehrfach in der Literatur beschrieben.<br />
Es werden 4 Fallberichte präsentiert. Die betroffenen Zähne waren stark gelockert, wiesen fast<br />
kein knöchernes Attachment mehr auf und standen alle in deutlicher Supraposition. Die Erhaltung<br />
33
34<br />
durch konventionelle Behandlungen war nicht mehr gegeben. Die Zähne wurden extrahiert und<br />
extraoral mit einer orthograden Wurzelkanalfüllung (Thermafil) versehen. Die Wurzeloberflächen<br />
wurden vollständig kürettiert und mit Pref-Gel konditioniert. Die Restalveole wurde von<br />
Granulationsgewebe befreit, der Fundus mit chirurgischen Bohrern vertieft. Nach Applikation von<br />
Emdogain auf die Wurzeloberfläche und in die Alveole wurden die Zähne in geringe Infraposition<br />
replantiert und geschient.<br />
Die Fälle wurden bis zu 18 Monate klinisch und radiologisch nachkontrolliert. Kein Zahn ging<br />
bisher verloren. Die Heilung gestaltete sich komplikationslos. Nach mehreren Wochen zeigten die<br />
Zähne klinische Anzeichen einer Ankylose. Resorptionen der Zahnwurzeln waren frühestens nach<br />
12 Monaten radiologisch zu beobachten und nur periapikal lokalisiert. Die Sondierungstiefen<br />
waren deutlich reduziert. Kein Patient berichtete in der Folgezeit über Schmerzen an den<br />
behandelten Zähnen. Alle Patienten waren hochzufrieden mit dem Ergebnis.<br />
Extraktion und Replantation ermöglichen ein vollständiges Debridement der Wurzel und das<br />
Einstellen des Zahnes in ein reguläres Okklusionsniveau. Die extraorale Wurzelkanalbehandlung<br />
verhindert eine Infektion im Endodont und damit infektionsbedingte Resorptionen. Die Ankylose<br />
ist gewollt und dient der Stabilisierung des Zahnes. Die Anwendung von Emdogain soll die zu<br />
erwartenden Ersatzresorptionen minimieren bzw. deren Voranschreiten verlangsamen. Die<br />
Methode ermöglicht den temporären, wahrscheinlich mehrjährigen Erhalt von Zähnen, die aus<br />
parodontalen Gründen verloren wären.<br />
P 11 Sofortimplantation bei Frontzahntrauma. Ein komplexer Fallbericht.<br />
Steffen Schneider, Berlin • Axel Bumann, Berlin<br />
Um bestmögliche ästhetische Ergebnisse im Frontzahnbereich zu erreichen, wird die<br />
Sofortimplantation als Therapiealternative genauso häufig diskutiert wie favorisiert. Als<br />
Sofortimplantation wird dabei das Einbringen eines Implantates in die frische Extraktionsalveole<br />
verstanden. Ziel ist es, hiermit die Knochenresorption zu reduzieren und dadurch die natürliche<br />
Weichgewebskonfiguration zu erhalten.<br />
Die wichtigste Indikation <strong>für</strong> Sofortimplantate stellen traumatisch bedingte Zahn- oder<br />
Zahnwurzelfrakturen sowie Luxationen dar. Dem Oberkiefer-Frontzahnbereich kommt hierbei die<br />
größte Bedeutung zu.<br />
Die klinische Falldarstellung beschreibt das Vorgehen von der präoperativen Planung bis zur<br />
definitiven Versorgung von zwei oberen zentralen Schneidezähnen bei einer jugendlichen Patientin<br />
infolge komplizierter Zahnwurzelfrakturen mit Certain-Prevail-Implantaten (Biomet 3i). Besonders<br />
die Bedeutung der präoperative Diagnostik mittels 3D-Verfahren (i-Cat) und die Möglichkeiten der<br />
definitiven Versorgung von Implantaten mit individualisierten Keramikabutments und<br />
Zirkonkronen wird dabei dargestellt und kritisch bewertet.<br />
P 12 Sofortbelastung eines Implantates in Regio 21 zwei Tage nach traumatisch<br />
bedingtem Zahnverlust<br />
Puria Parvini, Frankfurt am Main • Misha Krebs, Frankfurt am Main • Georgia Trimpou,<br />
Frankfurt • Georg-Hubertus Nentwig, Frankfurt<br />
Einleitung<br />
Das folgende klinische Fallbeispiel demonstriert eine einfache Möglichkeit, nach traumatisch<br />
bedingtem Zahnverlust sowohl die beteiligten Weich- als auch Hartgewebsstrukturen zu erhalten.<br />
Material und Methodik<br />
Ein 42-jähriger Patient verlor Zahn 21 aufgrund eines Traumas. Da wegen inadäquater<br />
Aufbewahrung (>24h trockene Lagerung) eine ankylotische Einheilung bevorstand, lehnte der<br />
Patient die Reposition ab. Zahn 21 wurde auf Gingivaniveau dekapitiert und über der<br />
Extraktionsalveole an einer Drahtbogen-Kunststoffschiene befestigt, die gleichzeitig zur<br />
Stabilisierung des gelockerten Zahns 11 diente. Dadurch wurde ein Kollaps der marginalen<br />
Gingivamanschette vor der bevorstehenden Implantation vermieden, die zwei Tage später<br />
erfolgte. Die dekapitierte Zahnkrone wurde von retrograd ausgehöhlt und mit selbsthärtendem<br />
Acrylat ausgefüllt, bevor sie als provisorischer Kronenersatz auf ein im Vorfeld ausgewähltes<br />
Ankylos®-Standard-Abutment zementiert wurde. Das Provisorium stand während der<br />
Einheilungsphase außer Okklusion. Aufgrund des dünnen Phänotyps der marginalen Gingiva<br />
wurde ein CERCON®-Abutment aus Zirkoniumoxid verwendet, um später eine vollkeramische<br />
Krone eingliedern zu können.<br />
Ergebnisse<br />
Das Ergebnis der chirurgisch-prothetischen Therapie ist eine ästhetische Restauration des oberen<br />
Inzisivus mit Erhaltung des Emergenzprofiles, das durch den natürlichen Zahn als befestigte<br />
provisorische Krone definiert und ausgeformt wurde.
P 13 Replantation avulsierter und frakturierter Zähne nach atraumatischer<br />
Extraktion mit dem Benex® Extraktions-Set<br />
Puria Parvini, Frankfurt am Main • Georg-Hubertus Nentwig, Frankfurt am Main<br />
Einleitung<br />
Nahezu jedes Frontzahntrauma geht mit der Verletzung der Zahnhartsubstanzen, des Parodonts<br />
und des Alveolarknochenes einher. Daher steht die Erhaltung und Schonung der umgebenden<br />
Strukturen bei der Erstversorgung im Vordergrund. Der folgende Fall demonstriert eine neue<br />
technische Methode, die die schonende Entfernung eines frakturierten Wurzelrestes vor<br />
Replantation des koronalen Zahnanteils ermöglicht.<br />
Material und Methoden<br />
Ein 16-jähriger Patient, der durch einen Stoß gegen die beiden rechten oberen Inzisivi getroffen<br />
worden war, stellte sich mit avulsiertem Zahn 12 und im apikalen Drittel frakturiertem Zahn 11 in<br />
unserer Abteilung vor. Der totalluxierte Zahn war in einem speziellen Nährmedium (Dentosafe®)<br />
gelagert.<br />
Zunächst wurde das koronale Fragment von 11 entfernt und der apikale Anteil mit Hilfe des<br />
Benex®-Sets extrahiert, bevor Im koronalen Anteil eine Bohrung ange-legt und in diese ein<br />
normierter Titanstift inseriert wurde.<br />
Der avulsierte Zahn wurde danach in seiner ursprüng-lichen Position replantiert und unter<br />
Berücksichtigung der Antagonisten und Nachbarzähne ausgerichtet.<br />
Die Schienung der Frontzähne <strong>für</strong> 10 bis 14 Tage erfolgte mit einem adhäsiv befestigtem<br />
Metallsplint. Im Anschluß wurde eine endodontische Behandlung des seitlichen Inzisivus<br />
durchgeführt.<br />
Ergebnisse<br />
Die parodontale Heilung des replantierten Zahns 21 wird aufgrund der physiologischen Lagerung<br />
in der Zahnrettungsbox (Dentosafe®) begünstigt. Das Benex® -System erwies sich als hilfreich<br />
bei der schonenden Entfernung des apikalen Frabmentes 11, was ebenfalls der parodontalen<br />
Regeneration des durch den Wurzelstift stabilisierten koronalen Fragmentes zugute kommt.<br />
Schlußfolgerung<br />
Die Langzeitprognose von Zähnen nach Replantation hängt davon ab, ob im weiteren Verlauf<br />
Wurzelresorptionen vermieden werden können. In Fällen wie dem hier vorgestellten bietet das<br />
gewählte Vorgehen optimale Voraussetzungen <strong>für</strong> eine physiologische, parodontale Regeneration.<br />
P 14 Transplantation von Prämolaren bei ausgeprägtem Knochendefizit - eine<br />
interdisziplinäre Aufgabe<br />
Yango Pohl, Bonn • Sandra Morton, Gießen • Silke Marie Nies, Gießen • Sabine Ruf,<br />
Gießen<br />
Komplikationen nach Frontzahntrauma sind häufig. Zahnverluste, Infektionen und - im<br />
Wachstumsalter - ankylosebedingtes Sistieren der alveolären Vertikalentwicklung können zu<br />
ausgeprägten Knochen- und Weichgewebsdefiziten führen. Vor späteren, meist erst nach<br />
Abschluss des Wachstums möglichen implantologischen oder prothetischen Therapien müssen die<br />
Gewebsdefizite, sofern überhaupt möglich, mit sehr komplexen und aufwändigen Augmentationen<br />
ausgeglichen werden.<br />
Unter bestimmten Bedingungen können Prämolarentransplantate verlorene oder absehbar<br />
verloren gehende Oberkieferinzisiven ersetzen. Die Entscheidung zur Transplantation ist dann<br />
einfach, wenn ein Engstand das Entfernen von Prämolaren notwendig macht. Ohne eine solche<br />
Indikation besteht das Dilemma, dass in der Donorregion gesunde Zähne entfernt werden, die bei<br />
der Transplantation prinzipiell einem Verlustrisiko unterliegen. Bereits die Indikationsstellung<br />
erfordert eine interdisziplinäre Abschätzung der Vor- und Nachteile der verschiedenen<br />
Therapieoptionen im Oberkieferfrontzahngebiet unter Berücksichtigung von Funktion, Ästhetik und<br />
Aufwand sowie patienten- und behandlerimmanenten Faktoren. Die fachübergreifende<br />
Zusammenarbeit ist auch zwingend bei Therapieplanung und -durchführung. Mehrere Fallberichte<br />
demonstrieren die Chancen, die sich durch die Transplantation von Prämolaren in ausgeprägte<br />
Defektsituationen ergeben: Ohne jegliche Augmentation wird vertikaler Knochenzugewinn von<br />
mehreren Millimetern beobachtet, Interdentalpapillen sind meist exzellent ausgebildet.<br />
Prämolarentransplantationen sind auch bei ausgeprägten Gewebsdefiziten eine verlässliche und<br />
vergleichsweise einfache Therapieoption. Die Transplantate induzieren Knochenwachstum,<br />
Augmentationen sind nicht erforderlich. Die Langzeitergebnisse sind überragend. Mit den Vorteilen<br />
des relativ einfachen Ausgleichs der Gewebsverluste, der erreichbaren Ästhetik und der frühen<br />
Rehabilitation in der Oberkieferfront sind Prämolarentransplantationen auch dann sinnvoll, wenn<br />
keine kieferorthopädische Extraktionsindikation gegeben ist und Zahnersatz in der Donorregion<br />
notwendig wird. Eine enge, fachübergreifende Zusammenarbeit zwischen den zahnmedizinischen<br />
Disziplinen ist Voraussetzung <strong>für</strong> adäquate Entscheidungsfindung und erfolgreiche Therapie.<br />
35
P 15 Kindliches Frontzahntrauma mit Früh- und Spätfolgen - ein Patientenbericht<br />
Susanne Wriedt, Mainz • Bilal Al-Nawas, Mainz • Katy Al-Nawas, Mainz • Joachim<br />
Wegener, Mainz<br />
Fragestellung:<br />
Gehen als Früh- oder Spätfolgen eines Frontzahntraumas Zähne verloren, so stellt sich die Frage<br />
des kieferorthopädischen Lückenschlusses durch Mesialisieren der distalen Zähne oder des<br />
Offenhaltens der Lücke <strong>für</strong> eine prothetische Versorgung. Je nach kieferorthopädischer Anomalie,<br />
noch ausstehendem Kieferwachstum, sowie Aussehen und Lage der benachbarten Zähne wird die<br />
Entscheidung pro oder kontra Lückenschluss fallen.<br />
Patientenbericht:<br />
Nach einem Unfall wurde bei einem 9-jährigen Jungen der Verlust des Zahnes 22 und eine<br />
anschließende beginnende Resorption der Wurzel des Zahnes 21 diagnostiziert. Ein Jahr später<br />
stellte sich der Patient zur kieferorthopädischen Beratung vor. Da aufgrund gravierender<br />
Engstände eine kieferorthopädische Extraktionstherapie angezeigt war, wurden die Zähne 14, 34<br />
und 44 entfernt. Nach Steuerung des Zahndurchbruchs und Einstellung der Bisslage mittels FKO-<br />
Gerät, erfolgte der Lückenschluss mittels festsitzender Multibracketapparatur. Bei der Korrektur<br />
der Frontzahnstellung wurden bewusst die oberen Frontzähne auf gleicher Höhe und nicht im<br />
Sinne der Ackermannschen Stufe aufgestellt, um die Asymmetrie durch die Einstellung des<br />
Zahnes 23 an die Stelle 22 ästhetisch zu kompensieren. Bei der Positionierung des Zahnes 23<br />
wurde auf die Einstellung einer regelrechten Gruppenführung geachtet. Das erreichte Ergebnis<br />
wurde mittels Retentionsplatten retiniert. Bei einer Kontrolluntersuchung 13 Jahre nach dem<br />
Trauma war die Resorption der Wurzel des Zahnes 21 so weit fortgeschritten, dass eine Lockerung<br />
Grad II vorlag. Es wurde eine Sofortimplantation vorgenommen.<br />
Schlussfolgerung:<br />
Sowohl Früh- als auch Spätfolgen nach kindlichem Frontzahntrauma können ohne nennenswerte<br />
Wachstumshemmung funktionell und ästhetisch gut behoben werden, wenn die Therapie in enger<br />
interdisziplinärer Absprache durchgeführt wird und eine engmaschige Kontrolle, besonders in<br />
Bezug auf Wurzelresorptionen oder Ankylosen, bis zum Wachstumsende gewährleistet ist.<br />
P 16 Frontzahnverletzungen mit Parodontbeteiligung im Patientengut der ZMK-<br />
Klinik Mainz von 1997 bis 2006<br />
Susanne Wriedt, Mainz • Monika Martin, Mainz • Heiner Wehrbein, Mainz<br />
Fragestellung:<br />
Anhand einer retrospektiven Untersuchung sollten Häufigkeit, Art und Verteilung verschiedener<br />
Frontzahnverletzungen mit Schädigung des Parodontiums eruiert werden.<br />
Material und Methode:<br />
Aus computererfassten Daten der ZMK-Klinik der Universität Mainz konnten aus den Jahren 1997<br />
bis 2006 die Erstversorgungen von 734 Patienten mit insgesamt 1361 traumatisch geschädigten<br />
Front- und Eckzähnen entnommen werden.<br />
Ergebnisse:<br />
Während 87% der Traumata das bleibende Gebiss betrafen, wurden in 13% der Fälle das<br />
Milchgebiss geschädigt. Knapp 2/3 der verunfallten Patienten waren Jungen; bei 87% aller<br />
Patienten waren die Zähne des Oberkiefers betroffen. Mit 65,3% waren die oberen mittleren<br />
Inzisiven die am häufigsten betroffenen Zähne. Während im Oberkiefer vor allem laterale<br />
Luxationen (37%) gefolgt von Subluxationen zu finden waren, lagen im Unterkiefer in 48%<br />
Subluxationen vor. Auch bei traumatisierten Milchfrontzähnen wurden in knapp der Hälfte aller<br />
Fälle laterale Luxationen festgestellt.<br />
Schlussfolgerung:<br />
Obere mittlere Inzisiven bei unter 15-jährigen Jungen sind die am stärksten durch ein Trauma<br />
gefährdeten Zähne. Da in der dann noch ausstehenden pubertären Wachstumsphase<br />
Traumafolgen (Zahnverlust, Ankylose) weitreichende Folgen haben können, sollte schon<br />
prophylaktisch durch Tragen eines passenden Mundschutzes bei sportlicher Betätigung und durch<br />
kieferorthopädische Korrektur der Frontzahnstellung versucht werden, typische Unfallrisiken<br />
auszuschalten. Sollten dennoch Traumata auftreten, so sind sorgfältige Diagnostik und<br />
interdisziplinäre Therapie notwendig.<br />
P 17 Langzeitfolgen nach kindlichem Zahntrauma - eine Kontrolluntersuchung von<br />
41 Patienten<br />
Susanne Wriedt, Mainz • Monika Martin, Mainz • Heiner Wehrbein, Mainz<br />
Fragestellung:<br />
Es sollte bei Kontrollen nach Abschluss des Wachstums geklärt werden, wie häufig nach einem<br />
kindlichen Trauma Hemmungen der Kieferentwicklung zu finden sind. Außerdem sollte die<br />
Überlebensrate der traumatisierten Zähne und die ästhetische Rehabilitation beurteilt werden.<br />
36
Material und Methode:<br />
87 Patienten, die bis zum Alter von 9 Jahren ein Frontzahntrauma mit Parodontalbeteiligung<br />
erlitten hatten und die nun mindestens 16 Jahre alt waren, wurden nach positiver Ermittlung der<br />
Adresse angeschrieben. 41 Patienten mit insgesamt 68 traumageschädigten bleibenden Zähnen<br />
konnten klinisch und mit Modell- und Fotodokumentation nachuntersucht werden. Die Stellung<br />
des traumatisierten Zahnes im Bezug zur Gegenseite wurde in den 3 Ebenen anhand von Modellen<br />
quantifiziert. Sensibilitätsprobe, Perkussionsschall und -empfindlichkeit, Form und Farbe der<br />
traumatisierten Zähne wurden bestimmt.<br />
Ergebnisse:<br />
82% der Traumata betrafen die obere Dentition. 45% der traumatisierten Zähne wurden<br />
subluxiert, fast 30% luxiert.; 16% erlitten eine Avulsion. Zur Zeit der Nachkontrolle (MW 17,0<br />
Jahre nach Traumaereignis) befanden sich noch 57% der traumatisierten Zähne in situ. Direkt<br />
posttraumatisch gingen 7,4% der Zähne verloren; die anderen 35,6% mussten im Laufe der Zeit<br />
(bis zu 16 Jahre post Trauma) aufgrund von fehlgeschlagenen Wurzelfüllungen,<br />
Wurzelresorptionserscheinungen oder Ankylosen entfernt werden. Es fanden sich keine<br />
nennenswerten funktionellen Abweichungen. Auch Wachstumshemmungen im Alveolarbereich<br />
waren meist nicht zu finden; ein Patient, dessen traumatisierte Zähne einen helleren<br />
Perkussionsschall aufwiesen, zeigte eine Infraposition der betroffenen Zähne. Bezüglich der<br />
ästhetischen Gestaltung der prothetischen Arbeiten und der Farbe traumatisierten Zähne waren<br />
die Patienten mit dem Ergebnis zufrieden; 3 Zähne, die allerdings Hinweise auf eine Pulpanekrose<br />
bzw. auf Wurzelkanalobliteration zeigten, wichen stärker in ihrer Farbgebung von den<br />
Nachbarzähnen ab.<br />
Schlussfolgerung:<br />
Nach einem kindlichen Frontzahntrauma lassen sich bei zeitgerechter, dem Trauma<br />
entsprechender interdisziplinärer Behandlung und häufigen Kontrollen bis zum Wachstumsende,<br />
besonders bezüglich auftretender Ankylosen, negative Folgen <strong>für</strong> Wachstum, Funktion und<br />
Ästhetik so weit minimieren, dass <strong>für</strong> ein Patient und Behandler zufriedenstellendes Ergebnis<br />
erreicht werden kann.<br />
P 18 Spätfolgen nach Frontzahntrauma im Milchgebiss - Fallbericht<br />
Ina Manuela Schüler, Jena • Berit Muselmani, Jena • Roswitha Heinrich-Weltzien, Jena<br />
Eine 9jährige Patientin wurde vom städtischen zahnärztlichen Bereitschaftsdienst nach Inzision<br />
eines Abszesses in regio 12 - 22, Drainage und Antibiose in unsere Klinik überwiesen. Das<br />
klinische Bild zeigte eine leichte Schwellung der Oberlippe, einen fehlenden Zahn 11 und ein nach<br />
anterior abgeknicktes Kronenfragment, das weniger als ein Drittel der gesamten klinischen<br />
Kronenlänge des Zahnes 21 ausmachte. Die seitlichen Schneidezähne waren regelrecht und dem<br />
Alter entsprechend durchgebrochen. Alle Milch- und vorhandenen bleibenden Zähne waren<br />
kariesfrei. Anamnestisch wurde ein Frontzahntrauma im Alter von 1,5 Jahren eruiert. Nach<br />
Angaben der Mutter der Patientin hatte der Hauszahnarzt bislang keine Behandlungsmaßnahmen<br />
auf Grund des fehlenden Zahnes 11 und des partiellen und seit Jahren stagnierenden Durchbruchs<br />
des Zahnes 21 ergriffen.<br />
Der Zahnfilm ließ in regio 11 ein Mehrfachgebilde und in regio 21 einen regelrecht ausgebildeten<br />
Zahn mit einem hartgeweblich verbundenen abgewinkelten Kronenfragment erkennen, was<br />
ebenfalls klinisch sichtbar war. Das koronale Pulpakavum wies einen röntgendichten<br />
kugelförmigen Schatten auf; eine apikale Aufhellung lag nicht vor. Nach der operativen<br />
Entfernung des Mehrfachgebildes von drei verbackenen Zahnkronenanteilen kam es nach guter<br />
Wundheilung in regio 11 zu einer Fistelbildung am Zahn 21.<br />
Nach der Trepanation des Zahnes wurde im Rahmen der Wurzelkanalbehandlung ein Dentikel aus<br />
dem Pulpakavum entfernt. Da die Fistel trotz wiederholter Spülungen (Natriumhypochlorit) und<br />
medikamentöser Einlagen (Kalziumhydroxid) persistierte, wurde nach Rücksprache mit dem<br />
Kieferorthopäden der Zahn extrahiert und temporär eine Kinderprothese eingegliedert.<br />
Therapieziel ist ein orthodontischer Lückenschluss mit nachfolgender adhäsiver Umgestaltung der<br />
seitlichen Schneide- und Eckzähne sowie die erforderlichen Ausgleichsextraktionen im Unterkiefer.<br />
Die Fraktur des abgeknickten Kronenfragmentes des Zahnes 21 offenbarte eine klinisch<br />
strukturgestörte Zahnhartsubstanz. Die therapierefraktäre Fistelbildung lässt daher vermuten,<br />
dass mikrostrukturelle Kommunikationen zwischen dem Pulpakavum und der Mundhöhle<br />
bestanden haben könnten, die weder klinisch noch röntgenologisch diagnostizierbar waren. Die<br />
histologische Aufarbeitung des Zahnes 21 soll über mögliche morphologische Veränderungen<br />
Aufschluss geben. Weiterhin wird die histologische Befundung des Mehrfachgebildes und des<br />
Dentikels die Struktur der beteiligten Zahnhartgewebe aufzeigen.<br />
37
P 19 Ursachen und Häufigkeit dentoalveolärer Verletzungen unter besonderer<br />
Beachtung der Avulsionen<br />
Christin Müller, Greifswald • Axel Schriewer, Greifswald • Wolfgang Sümnig, Greifswald<br />
Problem und Zielstellung:<br />
Ein traumatischer Frontzahnverlust zieht häufig Beeinträchtigungen der Sprache, der<br />
Physiognomie, der Kaufähigkeit, der Ästhetik und auch der Psyche besonders bei Kindern und<br />
Jugendlichen nach sich. Ziel der vorliegenden Arbeit war es, anhand des traumatologischen<br />
Patientengutes des Zentrums <strong>für</strong> Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten der Ernst-Moritz-Arndt-<br />
Universität Greifswald, die Ursachen und die Häufigkeit des Auftretens sowie Arten der<br />
dentoalveolären Verletzungen und deren Therapie darzustellen. Dabei wurde den Avulsionen der<br />
Frontzähne besondere Aufmerksamkeit gewidmet.<br />
Material und Methode:<br />
Die Untersuchung umfasste den Zeitraum von 1993 bis 2003. Es wurden alle zahnärztlich,<br />
kieferorthopädisch und kieferchirurgisch behandelten Patienten nach folgenden Kriterien<br />
ausgewählt: Zahnverlust, Zahnhartsubstanzverletzungen, Wurzelfrakturen, In- und Extrusion,<br />
laterale Luxation, Subluxation und deren Kombinationen. Die Daten wurden sowohl den<br />
ambulanten als auch stationären Unterlagen entnommen.<br />
Ergebnisse:<br />
Insgesamt wurden 172 Patienten mit dentoalveolären Verletzungen registriert und ausgewertet.<br />
In der Mehrzahl der Fälle waren mehrere Zähne mit unterschiedlichen Diagnosen betroffen<br />
(n=454). Am häufigsten waren Zahnlockerungen mit 45% zu beobachten. Es zeigte sich, dass<br />
vorwiegend männliche Individuen von Frontzahntraumen betroffen sind.<br />
Die Anzahl dentoalveolärer Verletzungen bei jugendlichen Patienten unter 18 Jahren entspricht<br />
etwa der der Erwachsenen Bei isolierter Betrachtung der Avulsionen überwiegt dagegen die<br />
Häufigkeit bei den Kindern und Jugendlichen deutlich. Als Ursache von Verletzungen mit<br />
Avulsionen sind am häufigsten Roheitdelikte zu benennen, zu 14% Haushalt und Freizeit,<br />
Verkehrsunfälle und Fahrradstürze folgen mit je 12%.<br />
Schlussfolgerung:<br />
Als Folgebehandlung nach Frontzahntraumen steht der Einsatz von Implantaten im Vordergrund,<br />
da avulsierte Zähne oft nicht wiedergefunden werden oder eine Replantation durch die gleichzeitig<br />
vorhandene Schädigung der Alveole nicht möglich ist. Der nachgewiesene Einsatz der<br />
Zahnrettungsbox war noch auffallend gering. Hier besteht noch unverändert weiterer<br />
Aufklärungsbedarf in der Bevölkerung.<br />
P 20 Bewährung eines Zahnrettungskonzeptes an Schulen in Hessen<br />
Dimitrios Rokas, Bonn • Horst Kirschner, Gießen • Andreas Filippi, Basel • Yango Pohl,<br />
Bonn<br />
Über die Unfallkasse Hessen wurden seit 1997 zunächst ausgewählte, dann alle Schulen in Hessen<br />
mit Zahnrettungsboxen ausgestattet. In einer Kooperation von Arbeitskreis Jugendzahnpflege <strong>für</strong><br />
Frankfurt am Main und den Main-Taunus-Kreis, Unfallkasse Hessen und den Universitäten Gießen<br />
und Bonn wurde das Projekt wissenschaftlich begleitet. Dazu wurden den Zahnrettungsboxen<br />
Fragebögen beigegeben, die von Patient und Zahnarzt ausgefüllt und zurückgesandt werden<br />
sollten. Weitere Boxen wurden an weitere Einrichtungen (Kindergärten, Sportstätten) verteilt.<br />
Mit Bezug auf Unfälle in Schulen wurden 560 Bögen zurückgesandt. Nicht alle Bögen waren<br />
vollständig ausgefüllt. Insgesamt 808 in der Zahnrettungsbox gerettete avulsierte Zähne und<br />
frakturierte Zahnanteile wurden mit den Bögen dokumentiert. Innerhalb von 10 Minuten waren<br />
75,3 % der Zähne bzw. Fragmente, innerhalb von 20 Minuten waren 91,2% der Zähne bzw.<br />
Fragmente in der Rettungsbox aufgenommen. Dieser Wert erhöhte sich auf 96,2%, wenn sich der<br />
Unfall auf dem Schulgelände ereignete. Kam es auf dem Schulweg zur Zahnverletzung, wurden<br />
nur 77,8 % innerhalb von 20 Minuten gerettet.<br />
Auf dem Schulhof traten mit 36,7% die meisten Zahnverletzungen auf, im Schulgebäude (inkl.<br />
Klassenzimmer) mit 19,1 % und in der Sporthalle mit 16,3% deutlich weniger. Die Rettungszeiten<br />
unterschieden sich nicht. Allerdings waren zu 25,1 % die Ortsangaben unspezifisch ("Schule").<br />
In 61,5% der Fälle konnte ein Zahnarzt innerhalb von einer Stunde erreicht werden, innerhalb<br />
von 4 Stunden wurde <strong>für</strong> 93,9% der Verletzten die zahnärztliche Behandlung begonnen.<br />
Das Zahnrettungskonzept hat sich bewährt. Die Zahnrettungsboxen wurden von Laien ohne<br />
besondere Instruktionen korrekt genutzt. Professionelle Hilfe, z.B. telefonisch erfragtes Verhalten,<br />
war nicht erforderlich, wertvolle Minuten konnten gespart werden. Die Reaktionszeiten waren sehr<br />
kurz, wenn die Zahnrettungsboxen nahe am Unfallort aufbewahrt wurden. Die Prognose<br />
avulsierter Zähne wird damit nicht durch zu lange unphysiologische Aufbewahrung beeinträchtigt.<br />
Die Rettungsboxen sollten an Orten mit hoher Unfallhäufigkeit bevorratet werden.<br />
38
P 21 Heilung einer nach Avulsion und Replantation existenten Gingivarezession: ein<br />
Fallbericht<br />
Hans-Peter Freitag, Tübingen<br />
Problemstellung:<br />
Welche Heilungschance hat eine nach Avulsion und Replantation existente parodontale Rezession<br />
eines Frontzahnes?<br />
Ausgangssituation:<br />
Ein 26jähriger Mann stellt sich 12 Tage nach Avulsion und Replantation des Zahnes 21 und<br />
Schienung der Zähne 13-23 mit einer SÄT-Klebeschiene durch einen zahnärztlichen Notdienst in<br />
unserer Ambulanz vor. Die extraorale Verweildauer von Zahn 21 soll (trocken gelagert) 1,5<br />
Stunde betragen haben, die Replantation erfolgte angeblich ohne antiresorptive - regenerative<br />
Maßnahmen an der Wurzel bzw. der Alveole. An Zahn 21 ist eine in Abheilung befindliche<br />
Rezession auszumachen; die faziale Rezessionstiefe beträgt 8 Millimeter. Zahn 21 weist<br />
Lockerungsgrad I auf und reagiert nicht auf den Kältetest.<br />
Therapie:<br />
Nach Schienenentfernung (12 Tage nach Replantation) wird eine Wurzelkanalbehandlung an Zahn<br />
21 durchgeführt [Kofferdam, Trepanation von Zahn 21, elektrische Längenmessung mit Root ZX®<br />
(Morita), Röntgenmessaufnahme von Zahn 21 □ ISO 25/24 mm /Referenzpunkt (RP)=<br />
Inzisalkante (IK), standardisierte manuelle Aufbereitung mit K-Feilen bis ISO 70/24 mm unter<br />
intermittierender Spülung mit 1%iger NaOCl-Lösung,medikamentöse Einlage: Ca(OH)2,<br />
Verschluss: Cavit®].<br />
Nach 4 Wochen wird der Wurzelkanal von Zahn 21 mittels lateraler Kondensation von Guttapercha<br />
[Kofferdam, Masterpointaufnahme bei Zahn 21; Sealer: AH plus® obturiert und die<br />
Zugangskavität mit Tetric Ceram® A1 SÄT, Optibond FL®, Röntgenkontrollaufnahme von Zahn<br />
21] verschlossen. Klinische und röntgenologische Kontrollen erfolgten 4 Wochen, 6 Monate, 9<br />
Monate, 14 Monate und 20 Monate nach Zahntrauma.<br />
Ergebnisse:<br />
Im bisherigen Heilungsverlauf (Beobachtungszeitraum = 24 Monate) hat sich eine kontinuierliche<br />
Reduktion der Rezessionstiefe ergeben. Sie beträgt aktuell noch 2mm, bei einem Lockerungsgrad<br />
von 0. Die labiale Sondierungstiefe liegt durchweg bei 2 mm. Zahn 21 weist seit der 6<br />
Monatskontrolle einen metallischen Perkussionschall auf. Der Zahn 21 ist seit über 24 Monaten in<br />
Funktion; keine Stufenbildung zwischen den Inzisalkanten der Zähne 11 und 21. Radiologisch<br />
ergibt sich erst 14 Monate nach Trauma ein Anhalt <strong>für</strong> Ersatzgewebsresorption.<br />
Konklusion:<br />
Obwohl davon auszugehen ist, dass die nach Replantation der Mundhöhle gegenüber freiliegende<br />
Wurzeloberfläche von avitalem Wurzelzement bedeckt ist bzw. aus exponierten Dentin besteht,<br />
hat sich <strong>–</strong> unbehandelt - eine (teilweise) Rezessionsdeckung im Sinne eines Creeping Attachment<br />
einstellt.<br />
P 22 Einstellung eines nach Trauma ankylosierten Zahnes mittels<br />
Distraktionsosteogenese - ein Fallbericht<br />
Sonja Behrens, Mainz • Bilal Al-Nawas, Mainz • Wilfried Wagner, Mainz • Heiner<br />
Wehrbein, Mainz<br />
Einleitung:<br />
Auch nach nicht vom Patienten wahrgenommenen Frontzahntraumen kann nach Jahren aufgrund<br />
einer Ankylose eine vertikale Wachstumshemmung im Alveolarfortsatz auftreten.<br />
Fallbericht:<br />
Eine 16-jährige Patientin stellte sich im Januar 2007 nach früherer kieferorthopädischer<br />
Behandlung vor. Es scheint ein Frontzahntrauma im Kindesalter vorgelegen zu haben, an das sich<br />
die Patientin nicht erinnerte. Intraoral imponierte eine Mesialbisslage mit frontal offenem Biss und<br />
7mm infraokkludiertem Zahn 21. Zahn 21 war Vipr.+, Perk- und wies einen hellen Klopfschall auf.<br />
Ein zusätzlich angefertigtes DVT konnte den Verdacht einer Ankylose nicht definitiv bestätigen.<br />
Nach Dehnung des Oberkiefers mittels chirurgisch unterstützter GNE wurde palatinal von 21 ein<br />
Knöpfchen geklebt und eine Gummikette zur Extrusion des Zahnes an den frontal-palatinal<br />
konzipierten Ausleger der GNE-Apparatur angebracht. 14 Wochen wurde versucht, Zahn 21 auf<br />
das Okklusionsniveau der OK-Frontbezahnung zu bewegen. Nachdem diese Maßnahme erfolglos<br />
blieb, wurde im Januar 2008 mittels Piezo-Chirurgie eine Segmentosteotomie des Zahnes 21<br />
vorgenommen. 4 Tage nach dem Eingriff wurde wieder eine Krafteinwirkung (150-200 cN) zur<br />
Extrusion des Zahnes mittels Gummikette eingesetzt. Im Abstand von 2-3 Tagen wurde die<br />
Apparatur kontrolliert, bzw. aktiviert. Innerhalb von 11 Tagen wurde der Zahn so um eine Strecke<br />
von 3,5mm extrudiert. Danach fand keine weitere Bewegung statt, obwohl der Zahn in<br />
orovestibulärer Richtung weiterhin sehr mobil war. Nach weiteren 14 Tagen wurde die<br />
kieferorthopädische extrusive Krafteinwirkung beendet, um bereits aufgetretene Nebenwirkungen<br />
39
40<br />
an den Nachbarzähnen, wie Kippung und Intrusion, zu eliminieren. 2 Wochen später ließ die<br />
Mobilität des Zahnes 21 deutlich nach. Der Zahn wird nun in seiner jetzigen Position belassen und<br />
bei der später anstehenden Dysgnathie-OP mit erneuter Segmentosteotomie und chirurgischer<br />
Fixation in die korrekte Lage gebracht.<br />
Schlussfolgerung:<br />
Durch interdisziplinäres Vorgehen konnte ein Teilerfolg erreicht werden und die Ausgangssituation<br />
<strong>für</strong> die spätere definitive Versorgung, gerade im Hinblick auf das Weichgewebsmanagement,<br />
wesentlich verbessert werden.<br />
P 23 Fallbericht einer indirekten Zahnwurzelschädigung bei<br />
Miniplattenosteosynthese einer Unterkieferfraktur<br />
Markus Hullmann, Regensburg • Gottfried Schmalz, Regensburg • Torsten E. Reichert,<br />
Regensburg • Oliver Driemel, Regensburg<br />
Hintergrund: Miniplatten-Osteosynthesesysteme minimieren durch die monokortikale Konzeption<br />
das Risiko einer Zahnwurzelschädigung bei der Frakturversorgung von Unterkieferfrakturen.<br />
Dennoch sind hierbei sowohl direkte als auch indirekte Verletzungen der Zahnwurzeln und der<br />
Pulpa beschrieben. Der vorliegende Fallbericht soll die indirekte Schädigung der<br />
Unterkieferfrontzähne (Typ Ib nach Driemel et al.) als mögliche Komplikation der<br />
Miniplattenosteosynthese dokumentieren.<br />
Fallbericht: Bei einer 44jährigen Patientin war eine paramediane Unterkieferfraktur in regio 41/42<br />
mit einer Miniplatte und einer Zugschraube osteosynthetisch versorgt worden. Nach anfänglich<br />
komplikationslosem Verlauf wurde die Patientin drei Monate postoperativ wegen pulpitischer<br />
Beschwerden in der Unterkieferfront erneut vorstellig. Die Zähne 41, 42 und 43 reagierten im<br />
Kälteprovokationstest negativ und waren perkussionsempfindlich, so dass eine endodontische<br />
Therapie mit CaOH2 eingeleitet wurde. Vier Monate später erforderten die anhaltenden<br />
Beschwerden Wurzelspitzenresektionen der Zähne 41-43 mit orthograder Wurzelfüllung.<br />
Zeitgleich wurde das Osteosynthesematerial entfernt. Einen weiteren Monat später entwickelte<br />
sich eine irreversible Pulpitis des Zahnes 31, die ebenfalls endodontisch therapiert wurde. Nach<br />
drei Monaten wurden Wurzelspitzenresektionen an den Zähnen 31 und 41 mit retrograder<br />
Wurzelfüllung erforderlich. Nach einem weiteren Monat, also ein Jahr nach Frakturversorgung,<br />
mussten die Zähne 31, 41 und 42 nach Inzision und Drainage eines submukösen Abszesses<br />
extrahiert werden.<br />
Schlussfolgerung: Bei der Miniplattenosteosynthese kann es durch Unterbrechung der apikalen<br />
Blutversorgung zu einer indirekten Zahnwurzelschädigung kommen. Im Rahmen dieser Typ Ib-<br />
Verletzung können eine Pulpitis und konsekutiv eine apikale Parodontitis auftreten, welche zum<br />
Verlust des betroffenen Zahnes führen kann.<br />
P 24 Potentielle Schwierigkeiten in der Initialtherapie kombinierter dentoalveolärer<br />
Traumata - ein Fallbericht<br />
Gregor Castrillón-Oberndorfer, Heidelberg • Joao Frankmann Pricoli, Heidelberg<br />
Bei intrusiven Dislokationsverletzungen treten massive Gewebeschäden auf. Aufgrund der<br />
Schwere des Traumas, zusätzlicher Verletzungen oder einer auffälligen Allgemeinanamnese kann<br />
sich die akute Sofortbehandlung schwierig gestalten.<br />
Der folgende Fallbericht beinhaltet eine dentale Kombinationsverletzung bestehend aus einer<br />
intrusiven Dislokationsverletzung der oberen Scheidezähne (12-22), einer Alveolarfortsatzfraktur<br />
des Oberkiefer-segmentes regio 11, 21 und einer komplizierten Kronenfraktur der Zähne 11 und<br />
21. Es werden die Schwierigkeiten der Initialversorgung sowie deren Lösungsmöglichkeiten<br />
aufgezeigt.<br />
P 25 Kieferorthopädische Frühbehandlung nach ausgeprägter intrusiver Dislokation<br />
- ein Fallbericht<br />
Julia von Bremen, Gießen • Sabine Ruf, Gießen<br />
Im Folgenden wird ein 9 Jahre alter Patient vorgestellt, welcher bei einem Schwimmbadunfall auf<br />
die Oberkieferfront gestürzt war. Die Zähne 11 und 21 erlitten dabei eine ausgeprägte intrusive<br />
Dislokation nach vestibulär sowie eine Schmelz-Dentinfraktur ohne Pulpabeteiligung. Fünf Monate<br />
nach dem Unfall stellte der Patient sich erstmals in der Poliklinik <strong>für</strong> Kieferorthopädie der Justus-<br />
Liebig-Universität vor, da eine Spontaneruption der traumatisierten Zähne ausgeblieben war. Im<br />
Rahmen der kieferorthopädischen Behandlung wurden 11 und 21 vorsichtig mobilisiert und<br />
extrudiert, zunächst mittels vertikaler Gummizüge an einer Oberkieferplatte. Die Feineinstellung<br />
erfolgte durch Teilbebänderung im Oberkiefer mit abschließender konservierender<br />
Kronenrekontruktion. Die Einordnung der traumatisierten Zähne verlief komplikationslos unter<br />
Erhalt der Vitalität.
P 26 Kieferorthopädische Sofortbehandlung nach traumatischer Frontzahnintrusion<br />
- ein Fallbericht<br />
Susanne Wriedt, Mainz • Dan Brüllmann, Mainz • Bernd d'Hoedt, Mainz • Heiner<br />
Wehrbein, Mainz<br />
Fragestellung:<br />
Nach traumabedingter zentraler oder lateraler Luxation oberer Frontzähne ohne abgeschlossenes<br />
Wurzelwachstum sollten die geschädigten Zähne in einer schnellen, kieferorthopädisch<br />
unterstützten Extrusionsbehandlung wieder in den Zahnbogen eingeordnet werden, da ein<br />
Abwarten der natürlichen Durchbruchskräfte mit der Gefahr der ankylotischen Fixierung der<br />
geschädigten Zähne und folgender Wachstumshemmung des umgebenden Alveolarknochens<br />
verbunden sind.<br />
Patientenbericht:<br />
Bei einem Schwimmbadunfall erlitt ein 8-jähriger Patient eine zentrale Luxation (Intrusion) der<br />
bisher stark protrudiert stehenden Zähne 12 bis 21. Nach 11 Tagen war die umgebende<br />
Schwellung so reduziert, dass kieferorthopädische Attachments auf die Zähne geklebt werden<br />
konnten. Durch langsame kieferorthopädische Extrusion der Zähne mit Gummizügen (150 cN)<br />
gegen eine Plattenapparatur und später mittels festsitzendem Utility-Bogen wurden die Zähne<br />
binnen 15 Monaten wieder repositioniert und in den Zahnbogen eingeordnet. Der beim Trauma<br />
verlorene Sensibilitätsverlust der Zähne 11 und 21 war irreversibel, so dass 4 Monate nach<br />
Trauma am Zahn 11 und 2 Jahre nach Traum am Zahn 21 eine Apexifikation und<br />
Wurzelbehandlung erfolgte. 3 Jahre nach Trauma erscheinen die Zähne fest und voll belastbar.<br />
Resorptionserscheinungen sind auf der Röntgenkontrollaufnahme nicht zu erkennen. Die Zähne<br />
scheinen bisher dem Vertikalwachstum der Alveolarkamms zu folgen, so dass keine Hinweise auf<br />
Ankylosen feststellbar sind.<br />
Schlussfolgerung:<br />
Wenn auch der endgültige Erhalt der traumatisch geschädigten Zähne auf Dauer nicht gesichert<br />
ist, so stellt doch das Belassen der Zähne bis zum Wachstumsende als Langzeitprovisorium - auch<br />
aus psychologischen Gründen - die natürlichste und beste Lösung dar, sofern nicht starke<br />
Wurzelresorptionserscheinungen oder Wachstumshemmungen nach späterer Ankylose ein<br />
früheres Eingreifen unumgänglich machen.<br />
P 27 Die provisorische Versorgung des Frontzahntraumas<br />
Stefan Bayer, Bonn • Helmut Stark, Bonn • Norbert Enkling, Bern • Sebastian Mues,<br />
Bonn<br />
Die immer neuen Methoden der Versorgung des Frontzahntraumas mit und ohne Zahnverlust<br />
erfordern, bedingt durch die teilweise lange Abheilungsphase, bzw. den Zeitraum bis zur<br />
Reevaluation und Neubeurteilung des Zahnes bezüglich der dauerhaften Erhaltbarkeit, eine<br />
Vielzahl unterschiedlicher provisorischer Rekonstruktionen des stomatognathen Systems. Diese<br />
Restaurationen müssen eine möglichst bakteriendichte Versorgung und eine ausreichende<br />
Funktion und Ästhetik <strong>für</strong> einen längeren Zeitraum gewährleisten, ohne dabei weitere Schäden an<br />
den oralen Strukturen und insbesondere den ohnehin im Rahmen des Traumas geschädigten<br />
Zähnen zu verursachen. Die Differentialindikation provisorischer Restaurationen und<br />
Lösungsmöglichkeiten werden <strong>für</strong> verschiedene Problemstellungen aufgezeigt.<br />
P 28 Direkte glasfaserverstärkte Brücke zum Ersatz eines Unterkiefer-Frontzahnes<br />
nach Zungenpiercing-Trauma - ein Fallbericht<br />
Cornelia Schach, Heidelberg • Diana Wolff, Heidelberg<br />
In den letzten Jahren finden direkte Klebebrücken unter Verwendung von glasfaserverstärkten<br />
Kompositsträngen vermehrt Verwendung in der Zahnheilkunde. Eine Langzeitprognose <strong>für</strong> die<br />
Haltbarkeit kann derzeit noch nicht gegeben werden und muss in erster Linie auf einzelnen<br />
exemplarischen Fallberichten beruhen.<br />
Gezeigt wird die Herstellung einer direkten glasfaserverstärkten Kompositbrücke unter<br />
Verwendung des Originalzahnes 41 als Pontic und nicht-invasiver Behandlung der Pfeilerzähne 31<br />
und 42 nach traumatischen Verlust des Zahnes durch ein Zungenpiercing.<br />
Dargestellt sind die Ausgangsbefunde, die einzelnen Behandlungsschritte und Behandlungsmittel<br />
sowie Abschluss- und Reevaluationsbefunde, welche mit Hilfe von Abbildungen und Schemata<br />
verdeutlicht werden sollen.<br />
Die hier dargestellte Vorgehensweise stellt eine ästhetisch ansprechende Behandlungsoption dar.<br />
Der Lückenschluss wurde sehr zeit- und kostensparend durchgeführt, wobei die die Lücke<br />
begrenzenden Zähne nicht verletzt wurden. Unter gegebenen Voraussetzungen ermöglicht die<br />
Verwendung von glasfaserverstärkten Kompositsträngen eine nicht-invasive Versorgung von<br />
Einzelzahnlücken.<br />
41
P 29 VALPLAST®-Monoreduktoren als Alternative zur Immediatprothese nach<br />
Frontzahntraumata: Fallberichte einer klinischen Vorstudie<br />
Dominik Kraus, Bonn • Verena Voigt, Bonn • Karolin Kiesgen, Bonn • Hubert<br />
Roggendorf, Bonn<br />
Zielsetzung<br />
Ziel dieser Vorstudie war die subjektive und objektiv-visuelle Bewertung von zahnärztlichprothetischen<br />
Versorgungen von Patienten nach Frontzahntrauma mit konventionellen<br />
Immediatprothesen sowie mit flexiblen Monoreduktoren aus Polyamid (Nylon®) der Marke<br />
VALPLAST® (Firma Weithas GmbH).<br />
Material und Methode<br />
Im Rahmen der Vorstudie wurden ein Dutzend Probanden mit Schaltlücken im Front- und<br />
Seitenzahnbereich rekrutiert und mittels VALPLAST®-Prothesen versorgt. Die Lücken umfassten<br />
maximal drei zu ersetzende Zähne. Bei zwei Probanden war der Frontzahnverlust traumatogenen<br />
Ursprungs. Diese Patientenfälle sind nebenstehend dokumentiert. Die VALPLAST®-Prothesen<br />
bestehen aus flexiblem und unzerbrechlichem Polyamid 6.6, welches sich überdies durch seine<br />
nicht-allergenen Eigenschaften auszeichnet. Die Verarbeitung des thermoplastischen<br />
Prothesenmaterials erfolgte bei ca. 300° C mit einem Druck von 5 Tonnen. VAPLAST® ermöglicht<br />
eine metallfreie Verankerung an den Nachbarzähnen. VALPLAST® Prothesenkunststoff ist in drei<br />
Farbvarianten erhältlich (transparent, light pink, standard). Alle Patienten wurden im Rahmen der<br />
Nachkontrolle bzgl. der Zufriedenheit befragt.<br />
Ergebnisse<br />
Ein Patient war zunächst unversorgt, der zweite Patient erhielt zunächst eine PMMA-<br />
Interimsprothese. Beide Patienten zeigten eine hohe Zufriedenheit und eine gute Ästhetik im<br />
Frontzahnbereich mit den VALPLAST®-Monoreduktoren. Der Vergleich der OHIP-G 14-Fragebögen<br />
vor und nach Insertion der VALPLAST®-Prothesen zeigte z.T. signifikante Unterschiede.<br />
Schlussfolgerung<br />
Der Vorstudie zufolge lassen die objektiv-visuellen Ergebnisse und die subjektiven Eindrücke der<br />
Probanden eine hohe Zufriedenheit mit dieser Art von prothetischer Versorgung erwarten. Eine<br />
klinische Hauptstudie mit einem größeren Probandenkollektiv sowie eine werkstoffkundliche<br />
Studie werden in Kürze starten. Wir dürfen schlussfolgern, dass VALPLAST® <strong>für</strong> den<br />
Frontzahnbereich eine mögliche Alternative zu acrylatbasierten Interimsprothesen darstellen<br />
könnte.<br />
Anmerkungen<br />
Eine Bezuschussung durch die gesetzlichen Krankenkassen besteht aufgrund des Beschlusses der<br />
KZBV derzeit noch nicht. Des weiteren ist der labortechnische Aufwand (Duplikatmodell, Küvette,<br />
etc.) deutlich höher als bei herkömmlichem Interimsersatz. Die Unterfütterbarkeit dieser<br />
Prothesen ist derzeit noch Gegenstand der Untersuchungen.<br />
42
Autoren<br />
Al-Nawas, Bilal, PD Dr. Dr.<br />
Klinik <strong>für</strong> MKG-Chirurgie, Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Augustusplatz 2, 55131 Mainz<br />
al-nawas@mkg.klink.uni-mainz.de<br />
Al-Nawas, Katy, Dr.<br />
Poliklinik <strong>für</strong> Prothetik, Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Augustusplatz 2, 55131 Mainz<br />
al-nawas@mkg.klink.uni-mainz.de<br />
Bayer, Stefan, Dr.<br />
Poliklinik <strong>für</strong> Zahnärztliche Prothetik, Propädeutik und Werkstoffwissenschaften, Rheinische Friedrich-<br />
Wilhelms-Universität Bonn, Welschnonnenstraße 17, 53111 Bonn<br />
sbayer@uni-bonn.de<br />
Behrens, Sonja, Dr.<br />
Poliklinik <strong>für</strong> Kieferorthopädie, Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Augustusplatz 2, 55131 Mainz<br />
behrens@kieferortho.klinik.uni-mainz.de<br />
Berndt, Dorothea, Dr.<br />
Klinik <strong>für</strong> zahnärztliche Chirurgie- , Radiologie-, Mund- und Kieferheilkunde, Universitätskliniken <strong>für</strong><br />
Zahnmedizin Basel, Hebelstrasse 3, 4056 Basel<br />
dorothea.berndt@unibas.ch<br />
Berthold, Christine, Dr.<br />
Poliklinik <strong>für</strong> Zahnerhaltung und Parodontologie, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen, Glückstr.<br />
11, 91054 Erlangen<br />
niniberthold@hotmail.com<br />
Blome, Benjamin, Dr.<br />
Poliklinik <strong>für</strong> Parodontologie, Zahnerhaltung und Präventive Zahnheilkunde, Rheinische Friedrich-<br />
Wilhelms-Universität Bonn, Welschnonnenstraße 17, 53111 Bonn<br />
BennyBlome@gmx.net<br />
Bock, Niko, Dr.<br />
Poliklinik <strong>für</strong> Kieferorthopädie, Justus-Liebig-Universität Gießen, Schlangenzahl 14, 35392 Gießen<br />
niko.c.bock@dentist.med.uni-giessen.de<br />
Bottenberg, Clemens<br />
Auf dem Wingert 6, 53881 Euskirchen<br />
info@bottenberg.eu<br />
Brüllmann, Dan, Dr.<br />
Poliklinik <strong>für</strong> Zahnärztliche Chirurgie, Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Augustusplatz 2, 55131<br />
Mainz<br />
bruellmann@oralchir.klinik.uni-mainz.de<br />
Bücher, Katharina, Dr. med.dent.<br />
Poliklinik <strong>für</strong> Zahnerhaltung und Parodontologie, Ludwig-Maximilians-Universität München,<br />
Goethestraße 70, 80336 München<br />
kbuecher@dent.med.uni-muenchen.de<br />
Bumann, Axel, Prof. Dr.<br />
IKV Berlin, Georgenstr. 25, 10117 Berlin<br />
info@kfo-berlin.de<br />
Castrillón-Oberndorfer, Gregor<br />
Klinik und Poliklinik <strong>für</strong> Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie, Universitätsklinikum Heidelberg, Im<br />
Neuenheimer Feld 400, 69120 Heidelberg<br />
gregor.castrillon-oberndorfer@med.uni-heidelberg.de<br />
Chappuis, Vivianne, Dr. med. dent.<br />
Klinik <strong>für</strong> Oralchirurgie und Stomatologie, Universität Bern, Freiburgstrasse 7, 03010 Bern<br />
vivianne.chappuis@bluewin.ch<br />
Dammaschke, Till, Priv.-Doz. Dr.<br />
Poliklinik <strong>für</strong> Zahnerhaltung, Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Waldeyerstr. 30, 48149<br />
Münster<br />
tillda@uni-muenster.de<br />
d'Hoedt, Bernd, Prof. Dr.<br />
Poliklinik <strong>für</strong> Zahnärztliche Chirurgie, Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Augustusplatz 2, 55131<br />
Mainz<br />
sekretariat@oralchir.klinik.uni-mainz.de<br />
43
Dörr, Alexander<br />
Poliklinik <strong>für</strong> Zahnerhaltung und Parodontologie, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen<br />
Erlangen, Glückstr. 11, 91054 Erlangen<br />
alex_kaba@gmx.de<br />
Driemel, Oliver, PD Dr. Dr.<br />
Klinik und Poliklinik <strong>für</strong> Mund-, Kiefer-, Gesichtschirurgie, Universitätsklinikum Regensburg, Franz-<br />
Josef-Strauss-Allee 11, 93053 Regensburg<br />
torsten.reichert@klinik.uni-regensburg.de<br />
Ebeleseder, Kurt, Prof. Dr.<br />
Klinische Abteilung <strong>für</strong> Zahnerhaltungskunde, Universitätsklinik <strong>für</strong> Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde<br />
Graz, Auenbruggerplatz 12, 8036 Graz<br />
kurt.ebeleseder@meduni-graz.at<br />
Ebert, Thomas, Dr.<br />
Poliklinik <strong>für</strong> Zahnerhaltung und Parodontologie, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen, Glückstr.<br />
11, 91054 Erlangen<br />
thomasebert@yahoo.com<br />
Enkling, Norbert, Dr. Dr.<br />
Klinik <strong>für</strong> Zahnärztliche Prothetik, Universtät Bern, Freiburgstr.7, 3010 Bern<br />
norbert.enkling@zmk.unibe.ch<br />
Filippi, Andreas, Prof. Dr.<br />
Zahnunfall-Zentrum / Klinik <strong>für</strong> zahnärztliche Chirurgie- , Radiologie-, Mund- und Kieferheilkunde,<br />
Universitätskliniken <strong>für</strong> Zahnmedizin, Universitätskliniken <strong>für</strong> Zahnmedizin Basel, Hebelstraße 3,<br />
4056 Basel<br />
Andreas.Filippi@unibas.ch<br />
Frankmann Pricoli, Joao<br />
Klinik und Poliklinik <strong>für</strong> Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie, Universitätsklinikum Heidelberg, Im<br />
Neuenheimer Feld 400, 69120 Heidelberg<br />
joao.frankmann@med.uni-heidelberg.de<br />
Freitag, Hans-Peter, Dr.<br />
Poliklinik <strong>für</strong> Zahnerhaltung, Universität Tübingen, Osianderstrasse 2-8, 72076 Tübingen<br />
hanspeterfreitag@gmx.de<br />
Gerlach, Klaus-Louis, Prof. Dr. Dr.<br />
Klinik <strong>für</strong> Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie, Universitätsklinikum Magdeburg, Leipziger Str. 44,<br />
39120 Magdeburg<br />
Glockmann, Eike, Prof. Dr.<br />
Poliklinik <strong>für</strong> Konservierende Zahnheilkunde, Friedrich-Schiller-Universität Jena, An der alten Post 4,<br />
07743 Jena<br />
Glockmann@med.uni-jena.de<br />
Heinrich-Weltzien, Roswitha, Prof. Dr.<br />
Präventive Zahnheilkunde, Universitätsklinikum Jena, Bachstraße 18, 07743 Jena<br />
roswitha.heinrich-weltzien@med.uni-jena.de<br />
Hickel, Reinhard, Prof. Dr. med.dent.<br />
Poliklinik <strong>für</strong> Zahnerhaltung und Parodontologie, Ludwig-Maximilians-Universität München,<br />
Goethestraße 70, 80336 München<br />
hickel@dent.med.uni-muenchen.de<br />
Hiedl, Thomas, Dr.<br />
Ludwigsplatz 36, 94315 Straubing<br />
info@dr-hiedl.de<br />
Holst, Stefan<br />
Poliklinik <strong>für</strong> Zahnärztliche Prothetik, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen, Glückstr. 11, 91054<br />
Erlangen<br />
Hullmann, Markus<br />
Klinik und Poliklinik <strong>für</strong> Mund-, Kiefer-, Gesichtschirurgie, Universitätsklinikum Regensburg, Franz-<br />
Josef-Strauss-Allee 11, 93053 Regensburg<br />
markus.hullmann@rz.uni-regensburg.de<br />
Kaaden, Christoph, Dr. med.dent.<br />
Poliklinik <strong>für</strong> Zahnerhaltung und Parodontologie, Ludwig-Maximilians-Universität München,<br />
Goethestraße 70, 80336 München<br />
kaaden@dent.med.uni-muenchen.de<br />
44
Kern, Matthias, Prof. Dr.<br />
Klinik <strong>für</strong> Zahnärztliche Prothetik, Propädeutik und Werkstoffkunde, Universitätsklinikum Schleswig-<br />
Holstein - Campus Kiel, Arnold-Heller-Str. 16, 24105 Kiel<br />
mkern@proth.uni-kiel.de<br />
Kiesgen, K.<br />
Poliklinik <strong>für</strong> Zahnärztliche Prothetik, Zahnärztliche Propädeutik und Werkstoffwissenschaften,<br />
Welschnonnenstraße 17, 53111 Bonn<br />
karolin.kiesgen@hotmail.de<br />
Kirschner, Horst, Prof. em. Dr.<br />
Justus-Liebig-Universität Gießen, Richard-Wagner-Straße 24, 35392 Gießen<br />
Kopp, Stefan, Prof. Dr.<br />
Poliklinik <strong>für</strong> Kieferorthopädie, Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt, 60596 Frankfurt<br />
Krämer, Norbert, Prof. Dr. Dr.<br />
Abteilung <strong>für</strong> Kinderzahnheilkunde, Zentrum <strong>für</strong> Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde Dresden,<br />
Fetscherstraße 74, 01307 Dresden<br />
norbert.kraemer@uniklinikum-dresden.de<br />
Krastl, Gabriel, Dr.<br />
Zahnunfall-Zentrum / Klinik <strong>für</strong> Parodontologie, Endodontologie und Kariologie, Universitätskliniken<br />
<strong>für</strong> Zahnmedizin Basel, Hebelstraße 3, 4056 Basel<br />
Gabriel.Krastl@unibas.ch<br />
Kraus, Dominik, Dr.<br />
Poliklinik <strong>für</strong> Zahnärztliche Prothetik, Zahnärztliche Propädeutik und Werkstoffwissenschaften,<br />
Welschnonnenstraße 17, 53111 Bonn<br />
dominik_kraus@hotmail.com<br />
Krause, Antje, Dr.<br />
Kieferorthopädische Praxis, München, Steinkirchner Str. 28, 81475 München<br />
Krebs, Misha, Dr.<br />
Poliklinik <strong>für</strong> Zahnärztliche Chirurgie und Implantologie, Zentrum <strong>für</strong> Zahn-Mund-und-<br />
Kieferheilkunde, Johann-Wolfgang-Goethe-Universität Frankfurt, Theodor-Stern-Kai 7, 60590<br />
Frankfurt am Main<br />
mkrebs@em.uni-frankfurt.de<br />
Kühnisch, Jan, Dr. med. dent.<br />
Poliklinik <strong>für</strong> Zahnerhaltung und Parodontologie, Ludwig-Maximilians-Universität München,<br />
Goethestraße 70, 80336 München<br />
jkuehn@dent.med.uni-muenchen.de<br />
Linsenmann, Robert, Dr. Dr.<br />
Praxisklinik <strong>für</strong> MKG-Chirurgie, München, Sauerbruchstr. 48, 81377 München<br />
Martin, Monika<br />
Poliklinik <strong>für</strong> Kieferorthopädie, Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Augustusplatz 2, 55131 Mainz<br />
mail@monikamartin.de<br />
Morton, Sandra, Dr.<br />
Poliklinik <strong>für</strong> Kieferorthopädie, Justus-Liebig-Universität Gießen, Schlangenzahl 14, 35392 Gießen<br />
sandra.morton@dentist.med.uni-giessen.de<br />
Mues, Anett, Dr.<br />
Poliklinik <strong>für</strong> zahnärztliche Prothetik, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn,<br />
Welschnonnenstr. 17, 53111 Bonn<br />
smues@uni-bonn.de<br />
Mues, Sebastian, Dr. MSc.<br />
Poliklinik <strong>für</strong> Zahnärztliche Prothetik, Propädeutik und Werkstoffwissenschaften, Rheinische Friedrich-<br />
Wilhelms-Universität Bonn, Welschnonnenstraße 17, 53111 Bonn<br />
smues@uni-bonn.de<br />
Müller, Christin<br />
Klinik und Poliklinik <strong>für</strong> MKG-Chirurgie, Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald, F.-Sauerbruch-<br />
Straße Bettenhaus, 17475 Greifswald<br />
christin.mueller@uni-greifswald.de<br />
Muselmani, Bashar M., Dr.<br />
Faculty of Dentistry, Tishreen University Latakia, Syrien, PO Box 2601, Latakia, Syrien<br />
BMuselmani@web.de<br />
45
Muselmani, Berit, Dr.<br />
Poliklinik <strong>für</strong> Konservierende Zahnheilkunde, Universitätsklinikum Jena, An der alten Post 4, 07743<br />
Jena<br />
Berit.Muselmani@med.uni-jena.de<br />
Nentwig, Georg-Hubertus, Prof. Dr.<br />
Poliklinik <strong>für</strong> Zahnärztliche Chirurgie und Implantologie, Zentrum <strong>für</strong> Zahn-Mund-und-<br />
Kieferheilkunde, Johann-Wolfgang-Goethe-Universität Frankfurt am Main, Theodor-Stern-Kai 7,,<br />
60590 Frankfurt am Main<br />
g.h.nentwig@em.uni-frankfurt.de<br />
Nies, Silke Marie, Dr.<br />
Poliklinik <strong>für</strong> Kinderzahnheilkunde, ustus-Liebig-Universität Gießen, Schlangenzahl 14, 35392 Gießen<br />
Silke.M.Nies@dentist.med.uni-giessen.de<br />
Nolte, Dirk, Prof. Dr. Dr.<br />
Praxisklinik <strong>für</strong> MKG-Chirurgie, München, Sauerbruchstr. 48, 81377 München<br />
dirk.nolte@mkg-praxisklinik.com<br />
Ott, Klaus H. R., Prof. Dr.<br />
Poliklinik <strong>für</strong> Zahnerhaltung, Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Waldeyerstr. 30, 48149<br />
Münster<br />
Parvini, Puria, Dr.<br />
Poliklinik <strong>für</strong> Zahnärztliche Chirurgie und Implantologie, Zentrum <strong>für</strong> Zahn-Mund-und-<br />
Kieferheilkunde, Johann-Wolfgang-Goethe-Universität Frankfurt am Main, Theodor-Stern-Kai 7,,<br />
60590 Frankfurt am Main<br />
parvini@med.uni-frankfurt.de<br />
Pohl, Yango, Priv.-Doz. Dr.<br />
Poliklinik <strong>für</strong> Chirurgische Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, Rheinische Friedrich-Wilhelms-<br />
Universität Bonn, Welschnonnenstraße 17, 53111 Bonn<br />
yango.pohl@ukb.uni-bonn.de<br />
Reichert, Torsten E., Prof. Dr. Dr.<br />
Klinik und Poliklinik <strong>für</strong> Mund-, Kiefer-, Gesichtschirurgie, Universitätsklinikum Regensburg, Franz-<br />
Josef-Strauss-Allee 11, 93053 Regensburg<br />
torsten.reichert@klinik.uni-regensburg.de<br />
Roggendorf, Hubert<br />
Poliklinik <strong>für</strong> Zahnärztliche Prothetik, Zahnärztliche Propädeutik und Werkstoffwissenschaften,<br />
Welschnonnenstraße 17, 53111 Bonn<br />
hroggend@uni-bonn.de<br />
Rokas, Dimitrios<br />
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, Bergerstrasse 79, 51145 Bonn<br />
D.Rokas@gmx.de<br />
Ruf, Sabine, Prof. Dr.<br />
Poliklinik <strong>für</strong> Kieferorthopädie, Justus-Liebig-Universität Gießen, Schlangenzahl 14, 35392 Gießen<br />
Sabine.ruf@dentist.med.uni-giessen.de<br />
Schach, Cornelia, Dr.<br />
Poliklinik <strong>für</strong> Zahnerhaltungskunde, Universität Heidelberg, Im Neuenheimer Feld 400, 69120<br />
Heidelberg<br />
cornelia.schach@med.uni-heidelberg.de<br />
Schäfer, Edgar, Prof. Dr.<br />
Poliklinik <strong>für</strong> Zahnerhaltung, Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Waldeyerstr. 30, 48149<br />
Münster<br />
Schafigh, Alexander, Dr.<br />
Königstr. 59, 53332 Bornheim<br />
schafigh@web.de<br />
Schmalz, Gottfried, Prof. Dr.<br />
Poliklinik <strong>für</strong> Zahnerhaltung und Parodontologie, Universitätsklinikum Regensburg, Franz-Josef-<br />
Strauss-Allee 11, 93053 Regensburg<br />
gottfried.schmalz@klinik.uni-regensburg.de<br />
Schmitt, Johannes<br />
Poliklinik <strong>für</strong> Zahnärztliche Prothetik, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen, Glückstr. 11, 91054<br />
Erlangen<br />
46
Schneider, Felix<br />
Poliklinik <strong>für</strong> Zahnärztliche Prothetik/Zentrum <strong>für</strong> ZMK-Heilkunde, Martin-Luther-Universität<br />
Halle/Saale, Große Steinstraße 19, 06108 Halle/Saale<br />
felix.schneider@medizin.uni-halle.de<br />
Schneider, Steffen<br />
Zahnarztpraxen im Torhaus, Robert-Koch-Platz 11, 10115 Berlin<br />
zahnheilkunde@berlin.de<br />
Schriewer, Axel, Dr.<br />
Klinik und Poliklinik <strong>für</strong> MKG-Chirurgie, Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald, F.-Sauerbruch-<br />
Straße Bettenhaus, 17475 Greifswald<br />
axel.schriewer@uni-greifswald.de<br />
Schüler, Ina Manuela, Dr. medic (RO)<br />
Konservierende Zahnheilkunde, Universitätsklinikum Jena, An der Alten Post 4, 07743 Jena<br />
Ina.Schueler@med.uni-jena.de<br />
Schwerin, Christine, Dr.med. Dr. med. dent.<br />
Klinik <strong>für</strong> Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie, Universitätsklinikum Magdeburg, Leipziger Str. 44,<br />
39120 Magdeburg<br />
fchschwerin@hotmail.com<br />
Sennhenn-Kirchner, Sabine, Dr.<br />
Mund-, Kiefer-, Gesichtschirurgie, Universität Göttingen, Robert- Koch Strasse 40, 37075 Göttingen<br />
se.ki@med.uni-goettingen.de<br />
Sobarzo, Victor, Dr.<br />
Poliklinik <strong>für</strong> Parodontologie, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, Welschnonnenstr. 17,<br />
53111 Bonn<br />
Sonntag, David, Priv.-Doz. Dr.<br />
Abteilung <strong>für</strong> Zahnerhaltungskunde, Philipps-Universität Marburg, Georg-Voigt-Straße 3, 35039<br />
Marburg<br />
sonntag@mailer.uni-marburg.de<br />
Stark, Helmut, Prof. Dr.<br />
Poliklinik <strong>für</strong> Zahnärztliche Prothetik, Propädeutik und Werkstoffwissenschaften, Rheinische Friedrich-<br />
Wilhelms-Universität Bonn, Welschnonnenstraße 17, 53111 Bonn<br />
hstark@uni-bonn.de<br />
Stratmann, Udo, Prof. Dr.<br />
Institut <strong>für</strong> Anatomie, Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Vesaliusweg 2 - 4, 48149 Münster<br />
Sümnig, Wolfgang, Prof. Dr.<br />
Klinik und Poliklinik <strong>für</strong> MKG-Chirurgie, Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald, Rotgerberstraße 8,<br />
17475 Greifswald<br />
suemnig@uni-greifswald.de<br />
Syfrig, Benno, Dr. med., med. dent.<br />
Praxis <strong>für</strong> Oralchirurgie, Luzern, Kauffmannweg 12, 06003 Luzern<br />
benex@gmx.ch<br />
Trimpou, Georgia, Dr.<br />
Poliklinik <strong>für</strong> Zahnärztliche Chirurgie und Implantologie, Zentrum <strong>für</strong> Zahn-Mund-und-<br />
Kieferheilkunde, Johann-Wolfgang-Goethe-Universität Frankfurt, Theodor-Stern-Kai 7, 60590<br />
Frankfurt<br />
trimpou@em.uni-frankfurt.de<br />
Voigt, V.<br />
Poliklinik <strong>für</strong> Zahnärztliche Prothetik, Zahnärztliche Propädeutik und Werkstoffwissenschaften,<br />
Welschnonnenstraße 17, 53111 Bonn<br />
dr.vvoigt@web.de<br />
Vollkommer, Tobias<br />
Klinik und Poliklinik <strong>für</strong> Mund-, Kiefer-, Gesichtschirurgie, Universitätsklinikum Regensburg, Franz-<br />
Josef-Strauss-Allee 11, 93053 Regensburg<br />
tobias.vollkommer@klinik.uni-regensburg.de<br />
von Arx, Thomas, PD Dr. med. dent.<br />
Klinik <strong>für</strong> Oralchirurgie und Stomatologie, Universität Bern, Freiburgstrasse 7, 03010 Bern<br />
von Bremen, Julia, Dr.<br />
Poliklinik <strong>für</strong> Kieferorthopädie, Justus Liebig Universität Gießen, Schlangenzahl 14, 35392 Gießen<br />
julia.v.bremen@dentist.med.uni-giessen.de<br />
Wagner, Wilfried, Prof. Dr. Dr.<br />
Klinik <strong>für</strong> MKG-Chirurgie, Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Augustusplatz 2, 55131 Mainz<br />
47
Wahl, Gerhard, Prof. Dr.<br />
Poliklinik <strong>für</strong> Chirurgische Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, Rheinische Friedrich-Wilhelms-<br />
Universität Bonn, Welschnonnenstraße 17, 53111 Bonn<br />
Gerhard.Wahl@ukb.uni-bonn.de<br />
Wegener, Joachim, Dr.<br />
Poliklinik <strong>für</strong> Prothetik, Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Augustusplatz 2, 55131 Mainz<br />
wegener@prothetik.klinik.uni-mainz.de<br />
Wehrbein, Heiner, Prof. Dr. Dr.<br />
Poliklinik <strong>für</strong> Kieferorthopädie, Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Augustusplatz 2, 55131 Mainz<br />
wehrbein@kieferortho.klinik.uni-mainz.de<br />
Wolff, Diana, Dr.<br />
Poliklinik <strong>für</strong> Zahnerhaltungskunde, Universität Heidelberg, Im Neuenheimer Feld 400, 69120<br />
Heidelberg<br />
Wriedt, Susanne, Dr.<br />
Poliklinik <strong>für</strong> Kieferorthopädie, Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Augustusplatz 2, 55131 Mainz<br />
wriedt@kieferortho.klinik.uni-mainz.de<br />
48
Die neue Bestmarke: < 1% Volumenschrumpf! *<br />
Vorteile, die es noch nie gab.<br />
Die von unserem 3M ESPE Forscherteam entwickelte revolutionäre Silorane-Technologie<br />
in Kombination mit dem abgestimmten Systemadhäsiv macht’s möglich:<br />
• Niedrigster Volumenschrumpf mit 0,9 % *<br />
- verbessert die Randdichte und verringert das Risiko von Sekundärkaries<br />
• Deutlich reduzierter Polymerisationsstress<br />
- reduziert das Risiko von Schmelzrissen und postoperativen Sensitivitäten<br />
• Exzellente Stabilität gegenüber Umgebungslicht<br />
- <strong>für</strong> bis zu 9 Minuten variable Bearbeitungszeit unter voller OP-Beleuchtung<br />
* Geprüft unter Anwendung der „Bonded Disc Methode“ (Watts et. al., Dental Materials 281, 1991). Weitere Informationen unter:<br />
3M ESPE AG · ESPE Platz · 82229 Seefeld · Freecall: 0800 - 2 75 37 73 · info3mespe@mmm.com · www.3mespe.de<br />
Filtek <br />
Silorane<br />
Niedrigschrumpfendes<br />
Seitenzahn-Composite<br />
3M, ESPE und Filtek sind Marken<br />
von 3M oder 3M ESPE AG.<br />
© 3M 2007. Alle Rechte vorbehalten.
www.sahara.de<br />
Mit Sicherheit erfolgreicher.<br />
Bei den entscheidenden Punkten besser abschneiden.<br />
Das kann auch <strong>Ihr</strong>e Praxis: Plus machen mit CAMLOG!<br />
Pluspunkte.<br />
CAMLOG Vertriebs GmbH<br />
Maybachstraße 5, D-71299 Wimsheim<br />
info.de@camlog.com, www.camlog.de<br />
Profitieren Sie mit uns.<br />
In nur sechs Jahren hat CAMLOG den 2. Platz* unter allen<br />
Implantatsystemen in Deutschland erobert.<br />
Für unseren <strong>Erfolg</strong> sprechen die entscheidenden Punkte,<br />
die mit Sicherheit auch <strong>Ihr</strong>e Praxis erfolgreicher machen:<br />
<strong>–</strong> Der Preis ist ausgezeichnet <strong>–</strong> und schneidet bei<br />
jedem seriösen Vergleich überzeugend ab.<br />
<strong>–</strong> Die Qualität ist vorbildlich <strong>–</strong> auf stets hohem Niveau<br />
„Made in Germany“.<br />
<strong>–</strong> Der Service ist exzellent <strong>–</strong> so komplett und so individuell<br />
wie Sie es sich wünschen.<br />
Machen Sie die CAMLOG Pluspunkte jetzt einfach zu <strong>Ihr</strong>em<br />
Verdienst: Es lohnt sich mit Sicherheit.<br />
Besuchen Sie uns unter<br />
www.camlog.de<br />
oder rufen Sie uns an<br />
Telefon 0 70 44 - 94 45 100<br />
* Basis: Anzahl verkaufter Implantate je Implantatsystem