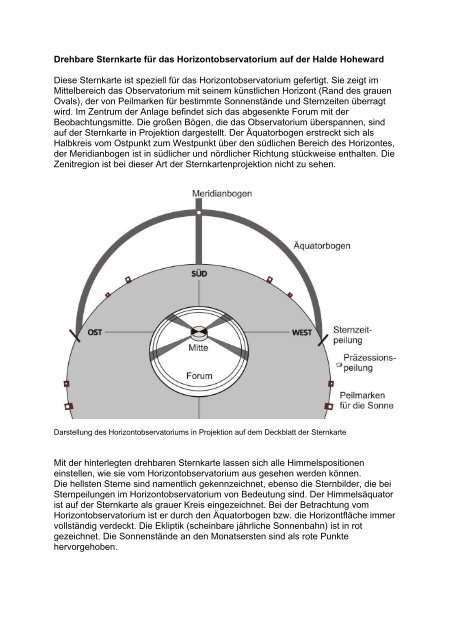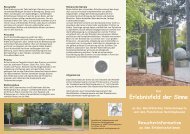Drehbare Sternkarte - Westfälische Volkssternwarte und ...
Drehbare Sternkarte - Westfälische Volkssternwarte und ...
Drehbare Sternkarte - Westfälische Volkssternwarte und ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Drehbare</strong> <strong>Sternkarte</strong> für das Horizontobservatorium auf der Halde Hoheward<br />
Diese <strong>Sternkarte</strong> ist speziell für das Horizontobservatorium gefertigt. Sie zeigt im<br />
Mittelbereich das Observatorium mit seinem künstlichen Horizont (Rand des grauen<br />
Ovals), der von Peilmarken für bestimmte Sonnenstände <strong>und</strong> Sternzeiten überragt<br />
wird. Im Zentrum der Anlage befindet sich das abgesenkte Forum mit der<br />
Beobachtungsmitte. Die großen Bögen, die das Observatorium überspannen, sind<br />
auf der <strong>Sternkarte</strong> in Projektion dargestellt. Der Äquatorbogen erstreckt sich als<br />
Halbkreis vom Ostpunkt zum Westpunkt über den südlichen Bereich des Horizontes,<br />
der Meridianbogen ist in südlicher <strong>und</strong> nördlicher Richtung stückweise enthalten. Die<br />
Zenitregion ist bei dieser Art der <strong>Sternkarte</strong>nprojektion nicht zu sehen.<br />
Darstellung des Horizontobservatoriums in Projektion auf dem Deckblatt der <strong>Sternkarte</strong><br />
Mit der hinterlegten drehbaren <strong>Sternkarte</strong> lassen sich alle Himmelspositionen<br />
einstellen, wie sie vom Horizontobservatorium aus gesehen werden können.<br />
Die hellsten Sterne sind namentlich gekennzeichnet, ebenso die Sternbilder, die bei<br />
Sternpeilungen im Horizontobservatorium von Bedeutung sind. Der Himmelsäquator<br />
ist auf der <strong>Sternkarte</strong> als grauer Kreis eingezeichnet. Bei der Betrachtung vom<br />
Horizontobservatorium ist er durch den Äquatorbogen bzw. die Horizontfläche immer<br />
vollständig verdeckt. Die Ekliptik (scheinbare jährliche Sonnenbahn) ist in rot<br />
gezeichnet. Die Sonnenstände an den Monatsersten sind als rote Punkte<br />
hervorgehoben.
Sonnenaufgänge <strong>und</strong> Sonnenuntergänge im Horizontobservatorium<br />
Die Ekliptik schneidet den Horizont an jedem Tag des Jahres bei Sonnenauf- <strong>und</strong> -<br />
untergang an einer anderen Stelle. Durch Drehung der <strong>Sternkarte</strong> lässt sich dieser<br />
Bereich der möglichen Auf- <strong>und</strong> Untergangsorte der Sonne auf dem Horizont<br />
abfahren. Zwischen den Extremständen bei der Sommer- <strong>und</strong> der<br />
Wintersonnenwende liegt ein Winkel von 80°, den der in der Mitte des<br />
Observatoriums auf dem zentralen Sitzblock postierte Beobachter anhand der beiden<br />
großen Sonnenwendmarken <strong>und</strong> der Gestaltung des Sitzpodestes erkennen kann.<br />
Gestaltung des Sitzpodestes in der Mitte des Observatoriums.<br />
Der Aufgangsbereich der Sonne zwischen Sommer- <strong>und</strong><br />
Wintersonnenwende überdeckt einen Sektor von 80°<br />
(Untergangsbereich analog).<br />
Die besonderen Daten bzw. Sonnenstände, die im Horizontobservatorium durch<br />
Peilmarken angezeigt werden, sind durch acht Sonnensymbole auf der Ekliptiklinie<br />
der drehbaren <strong>Sternkarte</strong> hervorgehoben. Es handelt sich dabei um die<br />
Sonnenwenden am 21. Juni <strong>und</strong> am 21./22. Dezember, die Tag-Nacht-Gleichen am<br />
21. März <strong>und</strong> 23. September, sowie die Quartalstage am 5. Februar, 6. Mai, 5.<br />
August <strong>und</strong> 5. November, die zeitlich genau in der Mitte zwischen den<br />
Sonnenwenden <strong>und</strong> den Tag-Nacht-Gleichen liegen. Durch Drehen der <strong>Sternkarte</strong><br />
kann man diese acht Sonnenstände an den betreffenden Daten mit den Peillöchern<br />
auf dem Horizont zur Deckung bringen. Die großen Sonnenwendpeilmarken sind in<br />
einer Höhe von 2° über dem Horizont angelegt, die kleineren Peilmarken für die<br />
Quartalstage in einer Höhe von 1°.<br />
Peilmarken für bestimmte Sonnenstände.<br />
Die großen Marken mit dem großen Loch<br />
dienen der Anzeige der Sonnenwenden<br />
(hier Aufgang der Sommersonne am 21.<br />
Juni). Die kleineren Peilmarken mit dem<br />
kleinen Loch zeigen die Sonnenbahnen an<br />
den Quartalstagen an (hier Aufgang der<br />
Sonne am 6. Mai bzw. am 5. August)
Bestimmung der Zeitpunkte bestimmter Ereignisse<br />
Zur Bestimmung der Zeitpunkte dieser oder anderer Ereignisse wie z.B. beliebiger<br />
Sonnenaufgänge oder Meridiandurchgänge stellt man die <strong>Sternkarte</strong> so ein, dass<br />
das betreffende Ereignis (z.B. Durchgang der Sommersonne am 21. Juni durch das<br />
Loch der nordöstlichen großen Sonnenwendmarke in 2° Höhe) dargestellt ist <strong>und</strong><br />
liest an den äußeren Skalen Datum <strong>und</strong> Uhrzeit ab (in diesem Beispiel 4.04 Uhr am<br />
21. Juni). Bei der Uhrzeit auf dem Deckblatt der <strong>Sternkarte</strong> handelt es sich um die<br />
sog. Wahre Ortszeit (WOZ), die erst noch durch Anbringung einer<br />
datumsabhängigen Korrektur in die Mitteleuropäische Zeit MEZ oder<br />
Mitteleuropäische Sommerzeit MESZ (gilt vom letzten Sonntag im März bis zum<br />
letzten Sonntag im Oktober) umzuwandeln ist. Die folgende Tabelle listet diese<br />
Korrekturwerte für die Monatsersten auf. Für den 21. Juni entnimmt man + 1h 33min,<br />
die zur <strong>Sternkarte</strong>nablesung in WOZ hinzuzurechnen sind, um zur MESZ zu<br />
gelangen. Man erhält demnach für das Ereignis (Sommersonne im Loch der<br />
nordöstlichen Sonnenwendpeilmarke) den Zeitpunkt 5.37 Uhr MESZ.<br />
Die Korrektur setzt sich zusammen aus einem festen Anteil von +31 Minuten, der auf<br />
den Längengradunterschied zum 15. östlichen Längengrad, den Bezugsmeridian der<br />
Mitteleuropäischen Zeitzone, zurückgeht <strong>und</strong> einen im Laufe des Jahres zwischen<br />
+14 <strong>und</strong> -16 Minuten schwankenden Wert, die sog. Zeitgleichung, die von der<br />
Neigung der Erdachse <strong>und</strong> der nicht ganz kreisförmigen Erdbahn herrührt, die von<br />
der Erde mit ständig wechselndem Tempo durchlaufen wird.<br />
Tabelle zur Umwandlung der WOZ in die MEZ oder MESZ<br />
1. Januar + 35 min<br />
1. Februar + 45 min<br />
1. März + 44 min<br />
1. April + 1 h 35 min<br />
1. Mai + 1 h 28 min<br />
1. Juni + 1 h 29 min<br />
1. Juli + 1 h 35 min<br />
1. August + 1 h 38 min<br />
1. September + 1 h 31 min<br />
1. Oktober + 1 h 21 min<br />
1. November + 15 min<br />
1. Dezember + 20 min<br />
Die großen Bögen des Horizontobservatoriums<br />
Die markanten Bögen des Observatoriums stellen Koordinaten am Himmel dar. Der<br />
Meridianbogen teilt den Himmel in eine östliche Hälfte (aufsteigende<br />
Gestirnsbahnen) <strong>und</strong> eine westliche (absinkende Gestirnsbahnen). Bei der<br />
gewählten Kartenprojektion ist die Darstellung des gesamten Meridianbogens nicht<br />
möglich. Gezeigt sind ein großes Stück des Südmeridians <strong>und</strong> ein kleines Teilstück<br />
des Nordmeridians (am unteren Rand der Karte).Täglich kommt es um 12 Uhr WOZ<br />
zum Sonnenhöchststand im Süden. Im Observatorium ist die Sonne dann für einige<br />
Minuten hinter dem Meridianbogen verborgen. Die Korrekturwerte der obigen Tabelle<br />
geben an, um welche Uhrzeit in ME(S)Z dieses Ereignis im Laufe des Jahres
stattfindet. Man rechnet sie einfach zu 12 Uhr WOZ hinzu <strong>und</strong> erhält die<br />
Kulminationszeiten der Sonne in ME(S)Z.<br />
Der Äquatorbogen teilt den Himmel in eine nördliche <strong>und</strong> eine südliche Hemisphäre.<br />
Er erhebt sich im Ostpunkt über dem Horizont <strong>und</strong> senkt sich im Westpunkt in ihn<br />
hinein. Die Zeitskala, die sich am Rand des Deckblatts der <strong>Sternkarte</strong> befindet<br />
(St<strong>und</strong>enzählung in WOZ) ist im Horizontobservatorium auf dem Äquatorbogen<br />
angebracht. Mit ihrer Hilfe lässt sich die Wanderung der Gestirne am Himmel<br />
verfolgen, was mit der drehbaren <strong>Sternkarte</strong> durch Drehung der hinterlegten<br />
<strong>Sternkarte</strong> im Uhrzeigersinn simuliert wird.<br />
Im Schnittpunkt der beiden Bögen befindet sich ein Sehrohr, welches den Blick auf<br />
die Sonne an den Tag-Nacht-Gleichen zur Ortsmittagszeit (12 Uhr WOZ) eröffnet. Es<br />
sind die einzigen Zeitpunkte, zu denen die Sonne an den Tag-Nacht-Gleichen (21.<br />
März <strong>und</strong> 23. September) im Observatorium sichtbar ist.<br />
Sternzeitbestimmung im Horizontobservatorium<br />
Mit der drehbaren <strong>Sternkarte</strong> lassen sich beliebige Stellungen des Himmels in Bezug<br />
zum Horizont einstellen. Jeder Position des Himmels wird eine sog. "Sternzeit"<br />
zugeordnet. Maßgeblich für den Wert der Sternzeit ist die Stellung des<br />
Frühlingspunktes (Schnittpunkt der nach Norden aufsteigenden Ekliptik mit dem<br />
Himmelsäquator, auch Sonnenposition am 21. März). Steht der Frühlingspunkt im<br />
Süden, Westen, Norden oder Osten, so spricht man von den Hauptsternzeiten 0, 6,<br />
12 <strong>und</strong> 18 Uhr.<br />
Zur Anzeige der vier Hauptsternzeiten sind im Observatorium Sternpeilungen auf die<br />
Sterne Beteigeuze im Sternbild Orion <strong>und</strong> Capella im Sternbild Fuhrmann gesetzt.<br />
Die drei Masten für diese Sternzeitpeilungen sind auf dem Deckblatt der drehbaren<br />
<strong>Sternkarte</strong> als schwarze Striche sichtbar, die den Horizont im Osten, Westen <strong>und</strong><br />
Norden überragen.<br />
Steht der Stern Beteigeuze an der Spitze des östlichen (westlichen) Mastes, so<br />
beträgt die Sternzeit 0 Uhr (bzw. 12 Uhr). Steht der Stern Capella an der Spitze des<br />
nördlichen Mastes, so ist die Sternzeit 18 Uhr. Die vierte Hauptsternzeit - 6 Uhr - tritt<br />
ein, wenn der Stern Beteigeuze nach seinem Meridiandurchgang wieder rechts des<br />
Meridianbogens sichtbar wird.<br />
Jeden Tag treten alle vier Zeitpunkte ein, jedoch sind einige davon jeweils nicht<br />
sichtbar, da sie jahreszeitenabhängig am Tage stattfinden können. Mit der drehbaren<br />
<strong>Sternkarte</strong> kann man die Zeitpunkte der sichtbaren Hauptsternzeiten bestimmen.<br />
Man stellt die Hauptsternzeiten mit der <strong>Sternkarte</strong> ein <strong>und</strong> bestimmt ihre Zeitpunkte<br />
am ausgewählten Datum in WOZ. Ist die Sonne am ausgewählten Datum über dem<br />
Horizont bzw. in Horizontnähe so ist Tag bzw. Dämmerung <strong>und</strong> die Sterne sind nicht<br />
sichtbar. Für die sichtbaren Ereignisse, die in der dunklen Nacht eintreten, bestimmt<br />
man den Zeitpunkt in ME(S)Z durch Anbringung der Zeitkorrektur (siehe obige<br />
Tabelle) an die WOZ. Am 1. Mai z.B. erhält man folgende Zeitpunkte in MESZ für die<br />
Hauptsternzeiten:<br />
Sternzeit WOZ MESZ Sternpeilung möglich<br />
0 9.28 10.56 nein<br />
6 15.27 16.55 nein<br />
12 21.26 22.54 ja<br />
18 3.25 4.53 ja
Am 1. Mai sind nur die Sternpeilungen für die Hauptsternzeiten 12 Uhr (Beteigeuze<br />
an der Spitze des westlichen Sternmastes) <strong>und</strong> 18 Uhr (Capella an der Spitze des<br />
nördlichen Stermastes) möglich. Die beiden anderen Ereignisse (0 Uhr, Beteigeuze<br />
am östlichen Sternmast; 6 Uhr, Beteigeuze direkt rechts neben dem Meridian) finden<br />
am Tag statt, wie man auf der <strong>Sternkarte</strong> anhand der Position der Sonne auf der<br />
Ekliptik am 1. Mai erkennen kann. Die Sonne ist dann jeweils oberhalb des<br />
Horizontes.<br />
Nachweis der Präzessionsbewegung der Erdachse im Horizontobservatorium<br />
Die Erdachse deutet derzeit in Richtung eines Sterns, der "Polarstern" genannt wird.<br />
Wegen einer sehr langsamen Taumelbewegung der Erdachse, die als<br />
"Präzessionsbewegung" bezeichnet wird, bewegt sie sich in 25800 Jahren einmal<br />
ganz auf einem Kegelmantel herum. Infolgedessen verändern alle Sterne ihre Lage<br />
systematisch in Relation zur Äquatorebene der Erde. Jeder Stern wird deshalb im<br />
Laufe der Zeit auf anderen Bahnen als heute über den Himmel wandern.<br />
Taumelbewegung der Erdachse<br />
Peilung auf den Stern Arktur zum Nachweis der<br />
Taumelbewegung der Erdachse.<br />
Zum Nachweis dieser Bahnverlagerung befindet sich im Horizontobservatorium eine<br />
besondere Peileinrichtung. Da die Verlagerung sehr langsam erfolgt, kann ihre<br />
Auswirkung mit einer einfachen Peilung <strong>und</strong> bloßem Auge frühestens nach Ablauf<br />
von Jahrzehnten beobachtet werden. Die Peilung im Horizontobservatorium basiert<br />
auf der mehrmaligen Verschwindung des Sterns Arktur im Sternbild Bärenhüter<br />
hinter den Zinken eines genau justierten Kamms.<br />
Derzeit wird Arktur auf seiner Bahn fünfmal von den Zinken des Kamms überdeckt. In<br />
zehn Jahren, wenn sich seine Bahn aufgr<strong>und</strong> der Taumelbewegung der Erdachse<br />
etwas nach unten verlagert hat, beobachtet man nur noch drei Verschwindungen <strong>und</strong><br />
in 20 Jahren nur noch eine.<br />
Die Peilung auf den Stern Arktur im Sternbild Bärenhüter ist auf der drehbaren<br />
<strong>Sternkarte</strong> ebenfalls berücksichtigt. Da diese Peilung im Horizontobservatorium vom<br />
Rand der Fläche erfolgt, mit Blick durch das Loch der nordöstlichen Quartalsmarke<br />
auf den Zinkenkamm, ist sie in ihrer realen Gestalt jedoch auf der <strong>Sternkarte</strong> nicht
darstellbar. Die <strong>Sternkarte</strong> geht immer von einer Beobachtung aus dem Mittelpunkt<br />
des Observatoriums aus. Stattdessen wurde nur die Himmelsposition des<br />
Zinkenkamms, der tatsächlich auf dem nördlichen Sternmast für die Capella-<br />
Sternzeitpeilung sitzt, auf dem Deckblatt der <strong>Sternkarte</strong> eingetragen (rechts unterhalb<br />
des Westpunktes).<br />
Mithilfe der drehbaren <strong>Sternkarte</strong> lässt sich die Zeit bestimmen, zu der an einem<br />
bestimmten Tag Arktur hinter dem Zinkenkamm vorbeiläuft. Dazu dreht man die<br />
<strong>Sternkarte</strong>, bis Arktur sich in der richtigen Position hinter dem Kamm befindet <strong>und</strong><br />
liest zum gewünschten Datum die Uhrzeit in WOZ ab. Diese ist noch mit der obigen<br />
Tabelle in eine ME(S)Z umzuwandeln. Zu beobachten ist diese Arkturpeilung<br />
natürlich nur dann, wenn es zu diesen Zeiten Nacht ist. Am 1. November z.B. steht<br />
Arktur um 18.41 WOZ hinter dem Zinkenkamm, also um 18.56 MEZ.<br />
Sonnenuntergang ist am 1. November um 16.49 WOZ bzw. 17.04 Uhr MEZ. Die<br />
Dämmerung ist gegen 18.20 Uhr MEZ beendet <strong>und</strong> somit ist Arktur sichtbar, wenn er<br />
um 18.56 Uhr MEZ hinter dem Zinkenkamm steht.<br />
Bastelanleitung für die <strong>Sternkarte</strong><br />
Beide Teile der drehbaren <strong>Sternkarte</strong> - die farbige <strong>Sternkarte</strong> <strong>und</strong> das Deckblatt -<br />
ausdrucken. Das Deckblatt mit einem Kopierer auf eine transparente Kopierfolie<br />
übertragen. Die Kartenblätter jeweils entlang der äußeren Kreislinie ausschneiden<br />
<strong>und</strong> im Mittelpunkt mit einem Druckknopf verbinden. Fertig ist die drehbare<br />
<strong>Sternkarte</strong> für das Horizontobservatorium auf der Halde Hoheward!<br />
<strong>Westfälische</strong> <strong>Volkssternwarte</strong> <strong>und</strong> Planetarium Recklinghausen<br />
Initiativkreis Horizontastronomie im Ruhrgebiet e.V.<br />
Stadtgarten 6<br />
45657 Recklinghausen<br />
www.sternwarte-recklinghausen.de<br />
www.horizontastronomie.de
6<br />
7<br />
5<br />
8<br />
4<br />
9<br />
3<br />
11<br />
12 Uhr<br />
SÜD<br />
OST WEST<br />
2<br />
10<br />
1<br />
NORD<br />
24<br />
13<br />
23<br />
14<br />
22<br />
15<br />
21<br />
16<br />
20<br />
17<br />
19<br />
18
2010<br />
Dez<br />
1<br />
1<br />
20<br />
2010<br />
Jan<br />
Nov<br />
10<br />
Wega<br />
1<br />
Deneb<br />
1<br />
Atair<br />
20 10<br />
Feb<br />
20<br />
21./22. 12.<br />
Okt<br />
Bärenhüter<br />
1. 1.<br />
1. 12.<br />
Arktur<br />
1<br />
Antares<br />
5. 11.<br />
1. 2.<br />
5. 2.<br />
10<br />
1. 11.<br />
Spica<br />
1. 3.<br />
1<br />
1. 10.<br />
2010<br />
März<br />
23. 9.<br />
21. 3.<br />
2010<br />
1. 4.<br />
Sep<br />
1<br />
1. 9.<br />
Regulus<br />
1<br />
2010<br />
1. 5.<br />
Sirius<br />
5. 8.<br />
Rigel<br />
6. 5.<br />
Apr<br />
1. 8.<br />
2010<br />
Orion<br />
Procyon<br />
Aldebaran<br />
Aug<br />
Kastor<br />
Pollux<br />
Beteigeuze<br />
1. 6.<br />
1. 7.<br />
1<br />
21. 6.<br />
1<br />
Fuhrmann<br />
20 10<br />
Capella<br />
Mai<br />
2010<br />
Juli<br />
1<br />
1<br />
2010<br />
Juni
2010<br />
Dez<br />
1<br />
1<br />
20<br />
2010<br />
Jan<br />
Nov<br />
10<br />
Wega<br />
1<br />
Deneb<br />
1<br />
Atair<br />
20 10<br />
Feb<br />
20<br />
21./22. 12.<br />
Okt<br />
Bärenhüter<br />
1. 1.<br />
1. 12.<br />
Arktur<br />
1<br />
Antares<br />
5. 11.<br />
1. 2.<br />
5. 2.<br />
10<br />
1. 11.<br />
Spica<br />
1. 3.<br />
1<br />
1. 10.<br />
2010<br />
März<br />
23. 9.<br />
21. 3.<br />
2010<br />
1. 4.<br />
Sep<br />
1<br />
1. 9.<br />
Regulus<br />
1<br />
2010<br />
1. 5.<br />
Sirius<br />
5. 8.<br />
Rigel<br />
6. 5.<br />
Apr<br />
1. 8.<br />
2010<br />
Orion<br />
Procyon<br />
Aldebaran<br />
Aug<br />
Kastor<br />
Pollux<br />
Beteigeuze<br />
1. 6.<br />
1. 7.<br />
1<br />
21. 6.<br />
1<br />
Fuhrmann<br />
20 10<br />
Capella<br />
Mai<br />
2010<br />
Juli<br />
1<br />
1<br />
2010<br />
Juni