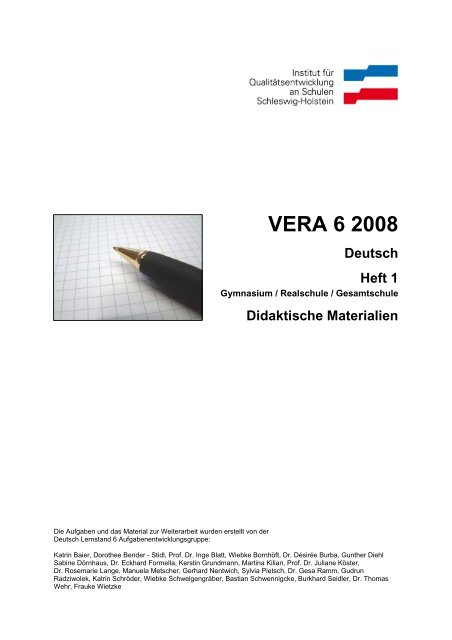Lernstand 6 - VERA 3
Lernstand 6 - VERA 3
Lernstand 6 - VERA 3
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Die Aufgaben und das Material zur Weiterarbeit wurden erstellt von der<br />
Deutsch <strong>Lernstand</strong> 6 Aufgabenentwicklungsgruppe:<br />
<strong>VERA</strong> 6 2008<br />
Deutsch<br />
Heft 1<br />
Gymnasium / Realschule / Gesamtschule<br />
Didaktische Materialien<br />
Katrin Baier, Dorothee Bender - Stidl, Prof. Dr. Inge Blatt, Wiebke Bornhöft, Dr. Désirée Burba, Gunther Diehl<br />
Sabine Dörnhaus, Dr. Eckhard Formella, Kerstin Grundmann, Martina Kilian, Prof. Dr. Juliane Köster,<br />
Dr. Rosemarie Lange, Manuela Metscher, Gerhard Nentwich, Sylvia Pietsch, Dr. Gesa Ramm, Gudrun<br />
Radziwolek, Katrin Schröder, Wiebke Schwelgengräber, Bastian Schwennigcke, Burkhard Seidler, Dr. Thomas<br />
Wehr, Frauke Wietzke
<strong>Lernstand</strong> 6 – Deutsch: Didaktische Materialien 2008<br />
Vorbemerkungen<br />
Die Testaufgaben für das Fach Deutsch sind an den Bildungsstandards für den<br />
Hauptschul- und den Mittleren Schulabschluss (HS bzw. MA) orientiert und unter Berücksichtigung<br />
der Lehr- und Rahmenpläne für Jahrgangsstufe 6 aller beteiligten<br />
Länder entwickelt worden. Inhaltlich repräsentieren sie drei der vier Kompetenzbereiche<br />
der KMK-Bildungsstandards für das Fach Deutsch:<br />
� Schreiben<br />
� Lesen – mit Texten und Medien umgehen<br />
� Sprache und Sprachgebrauch untersuchen<br />
Die Testaufgaben zu den Kompetenzbereichen weisen Anforderungen auf der Ebene<br />
aller drei in den KMK-Bildungsstandards formulierten Anforderungsbereiche aus:<br />
I Wiedergeben<br />
II Zusammenhänge herstellen<br />
III Reflektieren und Bewerten<br />
Testaufgaben folgen anderen Gesetzen als Lernaufgaben. Lernaufgaben dienen<br />
dem Kompetenzerwerb, während die Testaufgaben die erworbenen Kompetenzen<br />
überprüfen. Daher unterscheiden sich auch die Aufgabenformate bzw. die Häufigkeit<br />
ihrer Anwendung. So werden für den Kompetenzerwerb in der Lernsituation im Gegensatz<br />
zur Testsituation vor allem offene Aufgabenformate genutzt.<br />
Die Testaufgaben enthalten neben geschlossenen Aufgaben wie Ankreuzaufgaben<br />
(Multiple-Choice-Aufgaben und Richtig/Falsch-Aufgaben) und Zuordnungsaufgaben<br />
auch halboffene Aufgaben (Kurzantworten oder Lückentexte) und offene Aufgaben,<br />
in denen frei zu formulierende Antworten gefordert sind.<br />
Die Aufgabenlösungen werden mit Hilfe von Kodieranleitungen ausgewertet. Für die<br />
Kodierung der offenen Aufgaben werden außer den Kriterien auch Beispiele für richtige/falsche<br />
Lösungen geliefert, die aus Schülerantworten aus der Pilotierung der<br />
Aufgaben stammen. Damit sollen die Bewerterinnen und Bewerter darin unterstützt<br />
werden, zu möglichst objektiven Urteilen zu kommen. Die zum Teil zeitaufwändige<br />
Form der Auswertung anhand detaillierter Kodieranleitungen ist erforderlich, um zu<br />
verlässlichen Ergebnissen der <strong>Lernstand</strong>serhebung zu gelangen.<br />
VORBEMERKUNGEN<br />
2
1. Kompetenzbereich: Schreiben<br />
Auf der Basis des den Bildungsstandards zu Grunde liegenden Kompetenzbegriffs<br />
nutzt die Aufgabenentwicklung zum Kompetenzbereich Schreiben einen bewährten<br />
theoretischen Ansatz der Deutschdidaktik, und zwar das Schreibentwicklungsmodell<br />
von Bereiter 1 . Dieses definiert eine voll ausgebildete Textschreibkompetenz als Zusammenspiel<br />
von fünf Teilfähigkeiten:<br />
- Assoziatives Schreiben (Ideen entwickeln, aufschreiben)<br />
- Performatives Schreiben (Schreibkonventionen einhalten)<br />
- Leserbezogenes Schreiben (die Perspektive des Lesers einnehmen)<br />
- Textgestaltendes Schreiben (Sprach/Stilmittel einsetzen und Textmuster nutzen,<br />
die dem Thema, dem Schreibziel und dem Adressaten angemessen sind)<br />
- Epistemisches/Heuristisches Schreiben (Schreiben zur Gedankenentwicklung<br />
und zur Reflexion nutzen).<br />
Die ersten vier Teilfähigkeiten lassen sich den in der Beurteilung von Schülertexten<br />
bewährten Bereichen Inhalt, Aufbau, Sprache/Stil und Rechtschreibung/Grammatik<br />
zuordnen.<br />
- Inhalt – leserbezogenes Schreiben:<br />
Inhalte können in einem Text so ausgewählt sein, dass sie das Bedeutsame des<br />
Themas herausstellen und das Vorwissen und das Interesse des Lesers berücksichtigen.<br />
Hieran zeigt sich im Gegensatz zur assoziativen Aneinanderreihung<br />
die Fähigkeit zum leserbezogenen Schreiben.<br />
- Aufbau – textgestaltendes Schreiben:<br />
Der Aufbau wird danach beurteilt, ob er die Merkmale der in der Aufgabe vorgegebenen<br />
Textsorte aufweist.<br />
- Sprache / Stil – textgestaltendes Schreiben:<br />
Sprache und Stil sind positiv zu beurteilen, wenn sie dem Thema, dem Adressaten<br />
und der Textsorte angemessen sind.<br />
- Rechtschreibung / Grammatik – Performatives Schreiben:<br />
Die Einhaltung der Schreibkonventionen fördert das Textverständnis. Bei der<br />
Beurteilung kommt es auf das Verhältnis der Textlänge und der korrekt geschriebenen<br />
Wörter sowie der grammatisch korrekten Ausdrucksweise an.<br />
Das epistemische/heuristische Schreiben kann auf Grundlage eines Textes nicht abgeprüft<br />
werden, es kann lediglich während des Schreibprozesses beobachtet und im<br />
Gespräch reflektiert werden. Auch wenn diese Kompetenz nicht objektiv abprüfbar<br />
ist, sollten Schülerinnen und Schüler ermuntert werden, das Schreiben zum Entwickeln<br />
ihrer Gedanken zu nutzen. Das setzt voraus, dass sie ihre Texte abschnittweise<br />
schreiben, während des Prozesses bereits mehrfach lesen, überarbeiten und sich<br />
mit anderen darüber austauschen.<br />
1 Bereiter (1980), vgl. dazu Kliewer / Pohl 2006, Bd. 2, S. 656 f.<br />
VORBEMERKUNGEN<br />
3
2. Kompetenzbereich: Lesen – mit Texten und Medien umgehen<br />
Die den Testaufgaben zugrunde liegenden Texte sind sowohl literarische als auch<br />
Sach- und Gebrauchstexte in kontinuierlicher und nicht kontinuierlicher Form.<br />
Die Leseaufgaben stellen an die Schülerinnen und Schüler geistige Anforderungen<br />
und verlangen unterschiedliche Tätigkeiten.<br />
Anforderungen<br />
Zur präzisen und detaillierten Verortung von Leseanforderungen bietet sich das<br />
PISA-Lesekompetenzmodell an. Die drei PISA-Teildimensionen beziehen sich auf<br />
das Lokalisieren (Informationen ermitteln), Verknüpfen von Informationen auf Text-<br />
bzw. Textabschnittsebene (textbezogen interpretieren) und darauf, den Text mit Vorwissen<br />
ausdrücklich in Beziehung zu setzen (reflektieren und bewerten).<br />
Die drei Aspekte der Textverstehensleistung nach PISA<br />
� Informationen ermitteln<br />
� textbezogen interpretieren<br />
� reflektieren und bewerten<br />
Informationen ermitteln<br />
Diese Anforderung setzt kein Gesamtverständnis des Textes voraus. In einigen Aufgaben<br />
wird z.B. gefordert, im Text einzelne Informationen zu ermitteln. Dabei können<br />
diese ausdrücklich (explizit) im Text genannt oder versteckt (implizit) sein, sodass sie<br />
durch schlussfolgerndes Denken aus dem Text ermittelt werden müssen. Explizite<br />
Informationen sind leichter zu ermitteln als implizite, auffällige leichter als eingebettete.<br />
Aufgaben in diesem Bereich beziehen sich häufig auf das Ermitteln von Reihenfolgen,<br />
Figuren, Orten, Zeit, Merkmalen etc.<br />
Textbezogen interpretieren<br />
Damit ist die Anforderung verbunden, ein Gesamtverständnis des Textes zu entwickeln<br />
(Globalverstehen). Die entsprechenden Aufgaben zielen auf die Sicherung des<br />
inhaltlichen Zusammenhangs eines Textes und bei literarischen Texten ggf. auf die<br />
Konstruktion von Sinnvarianten.<br />
Aufgaben in diesem Bereich beziehen sich häufig auf inhaltliche Zusammenfassungen,<br />
Intentionen eines Textes etc.<br />
Reflektieren und Bewerten<br />
In diesem Bereich wird der jeweilige Text in Beziehung gesetzt zu einem anderen<br />
Text oder zu einer anderen Position (z. B. auf der Ebene des Wissens: Stimmt das?<br />
Auf der Ebene der Überzeugung: Halte ich das für richtig?). Gegebenenfalls sind die<br />
beim Bewerten getroffenen Entscheidungen von den Schülerinnen und Schülern zu<br />
begründen.<br />
Aufgaben in diesem Bereich setzen in der Regel verstehendes Lesen voraus und<br />
greifen immer ausdrücklich auf Vorwissen zurück.<br />
Diesen drei Leseanforderungen entsprechend erfassen die Testaufgaben zum Leseverstehen<br />
vor allem folgende auf die KMK-Bildungsstandards bezogene Kompetenzen:<br />
VORBEMERKUNGEN<br />
4
� wesentliche Elemente eines Textes erfassen/Informationen zielgerichtet<br />
entnehmen<br />
� zentrale Inhalte erschließen/Intentionen eines Textes erkennen<br />
� eigene Deutungen des Textes entwickeln/begründete Schlussfolgerungen<br />
ziehen<br />
Tätigkeiten<br />
Alle Aufgaben fordern - unsichtbare - kognitive Tätigkeiten, die durch materielle Tätigkeiten<br />
„sichtbar“ gemacht werden. Schon das Ankreuzen in einer Multiple-Choice-<br />
Aufgabe kann sehr unterschiedliche geistige Leistungen anzeigen. Folglich sagen<br />
z. B. Aufträge, etwas anzukreuzen, noch nichts über die erforderlichen geistigen Tätigkeiten<br />
aus, die durch das Kreuz sichtbar gemacht werden.<br />
Die in den verschiedenen Aufgabenformaten enthaltenen Leseanforderungen zeigen<br />
sich vor allem in folgenden Tätigkeiten:<br />
� Wiedererkennen<br />
� einfache Schlussfolgerungen ziehen (auf Satzebene)<br />
� komplexe Schlussfolgerungen ziehen (auf Textebene)<br />
� komplexe Schlussfolgerungen ziehen (auf der Basis von Vorwissen)<br />
3. Kompetenzbereich: Sprache und Sprachgebrauch untersuchen<br />
Die Bildungsstandards betonen die fundamentale Bedeutung des Kompetenzbereiches<br />
Sprache und Sprachgebrauch untersuchen für die übrigen Kompetenzbereiche<br />
des Deutschunterrichts – Sprechen und Zuhören, Schreiben und Lesen - mit<br />
Texten und Medien umgehen 2 . Die im Sprachunterricht zu erwerbende Sprachkompetenz<br />
bildet die Grundlage für Textverstehen und Textproduktion – mündlich<br />
wie schriftlich, was vor allem in den beiden zentralen Bildungsstandards des Kompetenzbereichs<br />
Sprache und Sprachgebrauch untersuchen zum Ausdruck kommt:<br />
o Textbeschaffenheit analysieren und reflektieren (MA/HS)<br />
o Leistungen von Sätzen und Wortarten kennen und für Sprechen, Schreiben<br />
und Textuntersuchung nutzen (MA)<br />
Die Sprachkompetenz gliedert sich grundsätzlich in die drei Bereiche Wort, Satz und<br />
Text. Diese sind zur Überprüfung der Kompetenz in der folgenden Übersicht entsprechenden<br />
Inhalten zugeordnet.<br />
2 Siehe Bildungsstandards im Fach Deutsch für den Mittleren Schulabschluss und den Hauptschulab-<br />
schluss: Grafik S. 8<br />
VORBEMERKUNGEN<br />
5
Sprachkompetenz Inhalte zur Überprüfung der Kompetenz<br />
Wortebene<br />
Die Schüler erfassen Struktur und<br />
Funktion der Wortschreibung und<br />
Wortbildung und bilden einen umfassenden<br />
Wortschatz aus.<br />
Satzebene<br />
Die Schüler erfassen die Satzstruktur<br />
und bauen ein Satzverständnis auf.<br />
Dies schließt die satzbezogene Großschreibung,<br />
die Ermittlung von Satzgliedern<br />
und Satzverknüpfungen und<br />
die Zeichensetzung ein.<br />
Textebene<br />
Die Schüler verknüpfen Sätze sinnvoll<br />
zu einem Textganzen und können die<br />
dazu eingesetzten sprachlichen Mittel<br />
im Text analysieren und verstehen.<br />
Begrifflichkeiten in den Aufgabenstellungen:<br />
Rechtschreibung: Wortschreibung, Großschreibung<br />
nach Wortarten<br />
Wortbildung und -bedeutung: Ableitung, Kompositabildung,<br />
Wortarten, Wortfamilien, Wortfelder<br />
Großschreibung im Satzzusammenhang<br />
Grammatische Proben zur Ermittlung der Satzglieder:<br />
Umstell-, Erweiterungs-, Weglass- und Ersatzprobe<br />
Prädikat/Konjugation<br />
Subjekt-Prädikat-Kongruenz<br />
Zeitenbildung<br />
Satzzeichen<br />
Satzverknüpfungen: Konjunktionen, Relativanschluss<br />
Mittel zur Textverknüpfung: Pronomen, Adverbien,<br />
Konjunktionen, sinnverwandte Wörter, Ober- und Unterbegriffe<br />
Die Begrifflichkeit im Kompetenzbereich Sprache und Sprachgebrauch untersuchen<br />
unterscheidet sich in Sprachbüchern, Bundesländern und Schulformen (Grundschule<br />
/Sekundarstufe 1).<br />
Nach Absprache unter den beteiligten Ländern werden in den Vergleichsarbeiten<br />
folgende alphabetisch geordnete Begriffe verwendet:<br />
Ableitung (Wortbildung mit Vor- und Nachsilben), Adjektiv, Infinitiv, Kasus, Konjunktion,<br />
Nachsilbe (Suffix), Nomen, Partizip, Prädikat, Pronomen, Relativpronomen, Satzglied,<br />
Substantivierung, Umstellprobe, Verb, Vorsilbe (Präfix), Wortart, Wortfamilie,<br />
Wortfeld, Wortstamm, Zeitform, Zusammensetzung (Kompositum)<br />
Literaturhinweise<br />
Augst, G. (1998): Wortfamilienwörterbuch der deutschen Gegenwartssprache (broschiert). Tübingen:<br />
Niemeyer.<br />
Becker-Mrotzek, M. & Böttcher, I. (2006): Schreibkompetenz entwickeln und beurteilen. Berlin: Cornelsen.<br />
Bertschi-Kaufmann, Andrea (Hrsg.) (2007): Lesen - Das Training 1: Lehrerband. Klasse 5-6. Seelze:<br />
Friedrich.<br />
Beste, G. (2007). Fachmethodik: Deutsch-Methodik. Berlin: Cornelsen.<br />
Böttcher, I. & Becker-Mrotzek, M. (2003): Texte bearbeiten, bewerten und benoten. Schreibdidaktische<br />
Grundlagen und unterrichtspraktische Anregungen. Berlin: Cornelsen.<br />
Eisenberg, P. & Fuhrhop, N. (2007): Schulorthographie und Graphematik. Zeitschrift für Sprachwissenschaft,<br />
26, 15-41.<br />
Hinney, G. & Menzel, W. (1998): Didaktik des Rechtschreibens. In: Lange, G., Neumann, K. & Ziesenis,<br />
W. (Hrsg.): Taschenbuch des Deutschunterrichts. 6. vollständig überarbeitete Auflage. Baltmannsweiler:<br />
Schneider Verlag Hohengehren.<br />
Kliewer, H.-J. & Pohl, I. (Hrsg.) (2006): Lexikon Deutschdidaktik. Baltmannsweiler: Schneider Verlag<br />
Hohengehren.<br />
Menzel, W. (1987): Basisartikel Wortfelder. Praxis Deutsch, 85, 8-16.<br />
Rosebrock, C. & Nix, D. (2008): Grundlagen der Lesedidaktik und der systematischen schulischen<br />
Leseförderung. Baltmannsweiler: Schneider.<br />
Schoenbach, R., Greenleaf, C., Cziko, C. & Hurwitz, L. (2006): Lesen macht schlau. Neue Lesepraxis<br />
für weiterführende Schulen. Berlin: Cornelsen.<br />
VORBEMERKUNGEN<br />
6
Testheft 1<br />
Aufgaben<br />
Lösungen<br />
Didaktische Kommentare<br />
Hinweise<br />
VORBEMERKUNGEN<br />
7
Kompetenzbereich<br />
Schreiben<br />
8
Aufgabe: Einen Brief auf eine Anzeige für eine Brieffreundschaft<br />
schreiben<br />
Du liest in der Jugendzeitschrift Geolino folgende Anzeige für eine Brieffreundschaft:<br />
Hallo! Ich heiße Rabea und bin elf Jahre alt. Ich suche Brieffreunde, egal ob<br />
Mädchen oder Junge. Meine Hobbys sind Wellenreiten, Schwimmen, Einrad<br />
fahren, Fußball spielen und Lesen. Ich wohne seit fünf Jahren in Honolulu<br />
auf Hawaii und ziehe in zwei Jahren zurück nach Deutschland.<br />
Du möchtest Rabea unbedingt als Brieffreundin. Du vermutest aber, dass sie<br />
sehr viele Briefe erhält. Schreibe ihr einen Brief und lass dir etwas besonders<br />
Gutes einfallen, damit sie dir zurück schreibt.<br />
Schreibe so, dass Rabea deinen Brief gut lesen und verstehen kann.<br />
(Die Schülerinnen und Schüler hatten 1,5 Seiten zur Verfügung)<br />
Erfasste Kompetenz<br />
laut Bildungsstandards<br />
Anforderungsbereich<br />
Erläuterung<br />
Hinweise zur Weiterarbeit<br />
Besondere Hinweise<br />
Schreiben<br />
Die Aufgabe überprüft die Textschreibkompetenz der<br />
Schülerinnen und Schüler unter Berücksichtigung von<br />
Teilfähigkeiten und Fähigkeitsniveaus auf der Grundlage<br />
ihrer Schreibprodukte.<br />
Erfasst werden alle drei Anforderungsbereiche<br />
(AB I, II, III).<br />
Bei der Schreibaufgabe handelt es sich um ein offenes<br />
Aufgabenformat. Die Überprüfung der Teilfähigkeiten<br />
und Fähigkeitsniveaus sowie die Kodieranweisungen<br />
orientieren sich an den Bildungsstandards zum Kompetenzbereich<br />
Schreiben.<br />
s. u.<br />
Auswahl der Textsorte und Aufgabenstellung<br />
Orthografie, Grammatik und Schriftbild werden nur in<br />
soweit berücksichtigt, wie sie die Lesbarkeit beeinträchtigen.<br />
Der Brief ist die älteste medial schriftliche Kommunikationsform mit kulturgeschichtlicher<br />
Tradition. Die Kommunikationspartner befinden sich in räumlicher<br />
Distanz, so dass ein schriftlicher Dialog im Wechsel geführt wird. Die Antworten erfolgen<br />
in einem zeitlichen Abstand, verknüpft mit ggf. neuen Impulsen, so dass ein<br />
Briefwechsel entstehen kann.<br />
KOMPETENZBEREICH: SCHREIBEN<br />
9
Die Schreibaufgabe hat einen relevanten Lebensweltbezug für die Schülerinnen und<br />
Schüler. Neben den neuen schriftlichen Kommunikationsformen SMS und E-Mail hat<br />
auch der traditionelle Brief nach wie vor Bedeutung, besonders wenn es darum geht,<br />
Kontakt zu unbekannten Personen aufzunehmen. Kinder- und Jugendzeitschriften<br />
sowie elektronische Medien bieten Kontaktbörsen für Brieffreundschaften an, die bei<br />
ihren Lesern beliebt sind. Der Reiz von Brieffreundschaften liegt vermutlich darin,<br />
dass die einander fremden Briefpartner sich und ihre Welt allmählich immer genauer<br />
kennen lernen. Dabei steuern die jeweiligen – an den Interessen der Briefpartner<br />
ausgerichteten - Impulse den schriftlichen Dialog. So kann eine Brieffreundschaft von<br />
unterschiedlicher Dauer entstehen.<br />
In der Testschreibaufgabe geht es um die Kontaktaufnahme zu einem Mädchen, das<br />
einen Briefpartner / eine Briefpartnerin sucht. Ein besonderer Anreiz, einen aussagekräftigen<br />
Brief zu schreiben, wird dadurch gegeben, dass das aus Deutschland stammende<br />
Mädchen für eine bestimmte Zeit mit ihrer Familie in Honolulu wohnt.<br />
Ausgewertet wird das Schreibprodukt anhand von definierten, theoriebasierten Kriterien.<br />
Die Schreibaufgabe eröffnet den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, sie auf<br />
unterschiedlichem Niveau zu bearbeiten. Das Schreibprodukt gibt Auskunft über die<br />
Teilfähigkeiten ihrer Textkompetenz. Aus dem Schreibentwicklungsmodell von Bereiter<br />
(vgl. Lexikon der Deutschdidaktik 2006, Bd. 2) werden vier Teilfähigkeiten als<br />
Bewertungskategorien herangezogen: Eine einfache Schreibfähigkeit liegt dann vor,<br />
wenn Ideen zur Schreibaufgabe assoziativ aneinander gereiht werden (assoziatives<br />
Schreiben). Von einer höher ausgebildeten Schreibfähigkeit zeugen der Leserbezug<br />
und die sprachliche Gestaltung (leserbezogenes und textgestaltendes Schreiben). In<br />
diesem Fall werden Inhalte unter Berücksichtigung der Interessen und des Vorwissens<br />
des Lesers ausgewählt und sprachlich so dargeboten, dass sie für den Leser<br />
verständlich und interessant und der Textsorte und der Schreibintention angemessen<br />
sind. Werden die formalen Konventionen (Rechtschreibung, Grammatik, formaler<br />
Aufbau) eingehalten, so zeigt sich daran die Fähigkeit des performativen Schreibens.<br />
Die Teilfähigkeiten bilden sich nicht in aufeinanderfolgenden Stufen aus, sondern<br />
können sich gleichzeitig entwickeln und ein unterschiedlich hohes Niveau aufweisen.<br />
Den Schreibanlass liefert eine Anzeige „Rabeas“, die eine Brieffreundin / einen Brieffreund<br />
sucht. Ein Leserbezug ist dann gegeben, wenn die Angaben Rabeas aufgegriffen<br />
und daran anknüpfend Informationen zur eigenen Person gegeben werden.<br />
Ein formales Kriterium ist die Briefform (leserbezogenes Schreiben).<br />
Eine Textgestaltung ist danach zu bewerten, inwieweit die verwendeten sprachlichen<br />
Mittel dem Alter, der Kontaktaufnahme und dem schriftlich geführten Dialog entsprechen.<br />
Das erfordert, dass alle Angaben in dem Brief sprachlich so klar ausgedrückt<br />
werden, dass sie für den räumlich entfernten Adressaten verständlich sind (textgestaltendes<br />
Schreiben).<br />
Als assoziativ wird eingestuft, wenn ein Leserbezug und eine sprachliche Gestaltung<br />
nicht ersichtlich sind (assoziatives Schreiben).<br />
Durch die definierten Kriterien zur Auswertung des Schreibprodukts kann der<br />
Schreibstand der Schülerin / des Schülers differenziert bestimmt werden. Die gewonnenen<br />
Erkenntnisse können dazu genutzt werden, im Schreibunterricht gezielt<br />
Schwerpunkte zu setzen und einzelne Schülerinnen und Schüler individuell zu fördern.<br />
KOMPETENZBEREICH: SCHREIBEN<br />
10
Kodieranweisung mit Hinweisen zur Weiterarbeit<br />
Der Text des Schülers/der Schülerin wird anhand der folgenden Kriterien bewertet.<br />
Bitte jeweils das Vorhandensein des Aspektes mit „ja“ oder „nein“ kodieren.<br />
Kategorie „ungültig“:<br />
Als „ungültig“ wird ein Brief bewertet, wenn die Aufgabenstellung nicht ernst genommen<br />
wurde.<br />
Pauschal „nein“:<br />
Ein Text wird in allen Aspekten pauschal mit „nein“ kodiert, wenn der in keiner Weise<br />
den Anforderungen entspricht, z. B.:<br />
• Weniger als vier Sätze<br />
• Wenn kein Brief, sondern eine andere Textsorte produziert wird<br />
1. Inhalt<br />
1) Bezugnahme zu Angaben der Briefpartnerin<br />
a) Wohnort<br />
Mit „ja“ wird auch indirekter Bezug kodiert, z. B.:<br />
• Wo du lebst<br />
• Ich wohne auch am Wasser<br />
entsprechend dem Beispiel vorhanden → ja<br />
nicht vorhanden → nein<br />
b) Hobbys<br />
Beispiele für richtige Lösungen:<br />
• … ähnliches Hobby wie du…<br />
• Frage nach weiteren Hobbys<br />
• Ich spiele auch gerne Fußball<br />
• Ich gehe auch gerne schwimmen<br />
entsprechend dem Beispiel vorhanden → ja<br />
nicht vorhanden → nein<br />
KOMPETENZBEREICH: SCHREIBEN<br />
11
2) Ausführungen zu den eigenen Angaben<br />
a.) Erläuterung / Kommentierung / Beispiele zur eigenen Person, Wohnort,<br />
Hobbys, Eigenschaften<br />
Mit „ja“ wird kodiert, z.B.:<br />
• Ich habe mich als Hawaiimädchen verkleidet<br />
• Ich wohne in … und da ist viel los<br />
• Ich habe keine Freundin, ich bin Single<br />
• Nennung von Geschwistern, Eltern<br />
Mit „nein“ wird kodiert, z. B.:<br />
x Die reine Angabe eines Sachverhaltes<br />
x … ähnliches Hobby wie du<br />
x Ich bin 11 Jahre alt<br />
entsprechend dem Beispiel vorhanden → ja<br />
nicht vorhanden → nein<br />
b) Etwas Außergewöhnliches aus dem eigenen Leben wird berichtet, um Rabeas<br />
Interesse an der Brieffreundschaft zu wecken,<br />
z.B.:<br />
• “… lasse sehr gerne Drachen fliegen, aber das Ungewöhnliche an der Sache<br />
ist, dass ich meinen Drachen aus dem Wasser heraus starte, weil ich<br />
auch sehr nah am Wasser wohne (Skytesurfen)“.<br />
entsprechend dem Beispiel vorhanden → ja<br />
nicht vorhanden → nein<br />
KOMPETENZBEREICH: SCHREIBEN<br />
12
3) Ausführungen zur Bezugnahme auf die Briefpartnerin<br />
a) Besonderes Interesse an Rabea: Fragen zu ihren Angaben<br />
Mit „ja“ wird kodiert, z.B.:<br />
• Direkte und indirekte Fragen<br />
• Wie ist es eigentlich so auf einem Surfbrett zu stehen und eine Welle zu reiten?<br />
Das muss doch ein Supergefühl sein oder?<br />
• Wie kamen du und deine Eltern eigentlich auf die Idee nach Hawaii zu ziehen?<br />
Ich finde das cool!<br />
• Wenn du nach Deutschland zurückkommst, wo werdet ihr denn wohnen?<br />
Oder wisst ihr das noch nicht?<br />
• Vielleicht hast du ja auch eine Webcam? Das wäre natürlich ganz toll, denn<br />
dann könnten wir uns ja mal sehen.<br />
• Denn es interessiert mich, was du noch so alles machst und wie man auf<br />
Hawaii so lebt.<br />
• In welchem Verein spielst du?<br />
• Ich frage mich, ob es toll Ist, Einrad zu fahren.<br />
Mit „nein“ wird kodiert, z.B.:<br />
x Wie geht es dir?<br />
x Ich finde es sehr interessant, dass du in Honolulu wohnst und würde auch<br />
gerne mal dich besuchen kommen.<br />
x Ich möchte wissen, was du in der Freizeit machst.<br />
entsprechend dem Beispiel vorhanden → ja<br />
nicht vorhanden → nein<br />
KOMPETENZBEREICH: SCHREIBEN<br />
13
Hinweise zur Weiterarbeit<br />
1. Schreibaufgabe verstehen lernen:<br />
Aufgabenanweisungen inhaltlich und strukturell analysieren:<br />
Was ist vorgegeben – was wird verlangt?<br />
2. Perspektivwechsel üben<br />
Dazu eignen sich vor allem literarische Texte. Mit Hilfe analytischer und handlungs-<br />
und produktionsorientierter Verfahren können Schüler lernen, verschiedene<br />
Rollen zu übernehmen und sich in unterschiedliche Menschen, deren Situation,<br />
Anschauungen und Interessen hineinzuversetzen.<br />
Interaktionsspiele / -methoden: Kugellager, Planspiel, szenisches Spielen (Typenkarten)<br />
3. Zielgerichtete Dialogführung trainieren<br />
Dies kann schriftlich und mündlich geschehen (z.B. Interviews), ausgehend von<br />
einer Fragestellung oder auf der Grundlage literarischer und Sachtexte.<br />
4. Auskunft über die eigene Person geben: Portfolio der eigenen Person, Visitenkarte<br />
zu bestimmten Kategorien ausfüllen, Freundschaftsbuch erstellen, Kommentare<br />
zu Fotos; Spiele wie: Wer bin ich? Tabu<br />
5. Ähnliche Schreibaufgaben stellen, wobei auch die Schüler in die Aufgabenentwicklung<br />
einbezogen werden können: Ideen aus Kinder- und Jugendzeitschriften gewinnen;<br />
Beteiligung an Foren, Flaschen-/Ballonpost, etc. heranziehen<br />
KOMPETENZBEREICH: SCHREIBEN<br />
14
2. Aufbau (Textsorte Brief)<br />
a) Anrede / Begrüßungsformel<br />
Mit „ja“ wird kodiert, z.B.:<br />
• Anrede jeder Art auch wenn sie in einer Zeile mit dem ersten Satz steht<br />
• Hallo, ich heiße…<br />
• Meine Liebe<br />
• Liebe Rabea<br />
• Hi<br />
Mit „nein“ wird kodiert, z.B.<br />
x Keine Anrede<br />
x Wenn ein falscher Name genannt wird<br />
entsprechend dem Beispiel vorhanden → ja<br />
nicht vorhanden → nein<br />
b) Hauptteil (Angaben und Ausführungen zum Thema)<br />
Mit „ja“ wird kodiert, wenn folgende Voraussetzung erfüllt ist:<br />
• Der Hauptteil muss mindestens drei Sätze umfassen. Zählung unabhängig<br />
von den Satzschlusszeichen.<br />
entsprechend der Erläuterung vorhanden → ja<br />
nicht vorhanden → nein<br />
c) Abschied (Verabschiedung bzw. Grußformel)<br />
Mit „ja“ wird kodiert, z.B.:<br />
• Gruß, ..<br />
• Tschüss, …<br />
• Ich würde mich freuen, wenn ich wieder von dir höre.<br />
• Naja, mir fällt nichts mehr ein.<br />
• Aloa<br />
• Bis bald<br />
• Bye bye<br />
• Hdgdl<br />
entsprechend dem Beispiel vorhanden → ja<br />
nicht vorhanden → nein<br />
KOMPETENZBEREICH: SCHREIBEN<br />
15
d) Unterschrift<br />
Mit „ja“ wird kodiert, z.B.:<br />
• Name und auch Initialen<br />
• Auch wenn der Name nachträglich durchgestrichen ist<br />
Mit „nein“ wird kodiert, z.B.:<br />
x Nur Nennung der Adresse<br />
entsprechend dem Beispiel vorhanden → ja<br />
nicht vorhanden → nein<br />
Hinweise zur Weiterarbeit<br />
Die formalen Konventionen der Textsorte Brief kennen lernen und in unterschiedlichen<br />
Zusammenhängen einüben:<br />
• Begrüßungs- bzw. Abschiedsformeln, Aufbau<br />
• Briefe zu verschiedenen Anlässen schreiben (Einladung, Danksagung, Bittbrief,<br />
Entschuldigung,…)<br />
• Historische Briefe oder Briefe in der Jugendliteratur kennen lernen, untersuchen,<br />
Veränderungen in den Konventionen herausarbeiten (Stil, Formeln)<br />
KOMPETENZBEREICH: SCHREIBEN<br />
16
3. Sprache / Stil<br />
1) Zur Erläuterung/Kommentierung /Begründung<br />
a) Verben, die das eigene Denken und Fühlen explizit ausdrücken, z. B.: ich<br />
finde / meine / hoffe / bin interessiert / sich freuen / etc…<br />
Mit „ja“ wird kodiert, z.B.:<br />
• Ich finde es sehr interessant, …<br />
• Denn es interessiert mich, …<br />
• Da ich deine Hobbys richtig cool finde und …<br />
• Ich stelle mir vor, …<br />
entsprechend dem Beispiel vorhanden → ja<br />
nicht vorhanden → nein<br />
b) Wertung durch Adjektive<br />
Mit „ja“ wird kodiert, z.B.:<br />
• … traumhaft schön<br />
• … wahnsinnig gern<br />
• … kleines Dorf<br />
• Auch: Am liebsten …<br />
Mit „nein“ wird kodiert, z.B.:<br />
x Adverbien<br />
x Ich möchte gern dein Freund sein<br />
x Ich möchte gerne mal wissen<br />
entsprechend dem Beispiel vorhanden → ja<br />
nicht vorhanden → nein<br />
KOMPETENZBEREICH: SCHREIBEN<br />
17
c) Nachgestellte Erklärung und Erläuterung<br />
Mit „ja“ wird kodiert, z.B.:<br />
• Langballig ist ein Ort in der Nähe von Flensburg, der nördlichsten Stadt<br />
Deutschlands.<br />
• Ich spiele gerne fubba. Fußball nennt man bei uns fubba.<br />
• Ich wohne in … Dort ist viel los.<br />
• Seit ich …, also seit der 5. Klasse.<br />
Mit „nein“ wird kodiert, z.B.:<br />
x Zu meinen Hobbys gehören: …<br />
x Ich bin beim Fasching gewesen und habe mich als Hawaiimädchen verkleidet.<br />
[Grund: kein Rückbezug zum Fasching]<br />
entsprechend dem Beispiel vorhanden → ja<br />
nicht vorhanden → nein<br />
2) Sprachliche Komplexität<br />
a) Satzgefüge (Haupt-Nebensatz-Verbindungen)<br />
Achtung: Kommasetzung spielt hier keine Rolle.<br />
Mit „ja“ wird kodiert, z.B.:<br />
• Das kleine Dorf, in dem ich wohne, ist ….<br />
• Ich schreibe, weil …<br />
• Ich habe mir gedacht, Dir einen Brief zu schreiben.<br />
entsprechend dem Beispiel vorhanden → ja<br />
nicht vorhanden → nein<br />
b) Konjunktionen komplexe Beziehung, z.B.:<br />
• falls, ob, obwohl, trotzdem, aber, wenn … dann<br />
entsprechend dem Beispiel vorhanden → ja<br />
nicht vorhanden → nein<br />
c) Anschluss mit Relativ- oder Fragepronomen, z.B.:<br />
• der, die, das, welche, welcher, welches, wer, wie, was, wieso, weshalb, warum,<br />
wo, in dem, mit dem, womit, wodurch, darüber, darauf, hierüber, worauf,<br />
worüber<br />
entsprechend dem Beispiel vorhanden → ja<br />
nicht vorhanden → nein<br />
KOMPETENZBEREICH: SCHREIBEN<br />
18
Hinweise zur Weiterarbeit<br />
Sprachliche und stilistische Mittel erweitern<br />
1. Wortebene<br />
Wortschatzarbeit: Wortfamilien, Wortfelder zu allen Wortarten; Synonyme,<br />
Begriffsbildung (Ober / Unterbegriffe), Metaphern.<br />
Wörter stilistisch beurteilen lernen (Sprachniveau, sachliche Bedeutung, Vorstellungsgehalt)<br />
Hilfsmittel: Lexikon, Wörterbücher, PC, Texte<br />
2. Satzebene<br />
Satzbildung und Satzgefüge mit zunehmender Komplexität analysieren und produzieren:<br />
syntaktische Proben, Konjunktionen, Nebensatzarten, Satzstrukturen visualisieren.<br />
3. Textebene<br />
Sprachliche Mittel zur Verknüpfung von Sätzen und Absätzen in Texten kennen,<br />
anwenden und auf ihre textgestaltende Wirkung untersuchen: Pronomen, Adverbien,<br />
bedeutungsähnliche Wörter, Ober-/Unterbegriffe. Verknüpfungen in Texten<br />
erproben und Bedeutungsänderungen erkennen. Textüberarbeitungsmethoden<br />
kennen und anwenden.<br />
4. Pragmatik<br />
Sprachregister kennen lernen und auf ihre Angemessenheit für den Gesprächs-/<br />
Schreibanlass beurteilen (Jugendsprache, Alltagssprache, Hochsprache, gesprochene<br />
Sprache, Schriftsprache).<br />
Kommunikations- und Stilmittel und ihre Wirkung kennen und anwenden: rhetorische<br />
Mittel, Paraphrase, Argumentation.<br />
KOMPETENZBEREICH: SCHREIBEN<br />
19
4. Rechtschreibung, Grammatik, Schrift<br />
a) Der Schülertext ist im Bereich Rechtschreibung und Grammatik verständlich<br />
Die Lesbarkeit wird durch die Rechtschreibung und<br />
Grammatik nicht beeinträchtigt.<br />
Die Lesbarkeit wird durch die Rechtschreibung und<br />
Grammatik beeinträchtigt.<br />
KOMPETENZBEREICH: SCHREIBEN<br />
→ ja<br />
→ nein<br />
b) Die Schrift ist leserlich, so dass der Text zu verstehen ist.<br />
Mit „nein“ wird kodiert, z.B.:<br />
leserlich → ja<br />
nicht leserlich → nein<br />
20
Hinweise zur Weiterarbeit<br />
1. Rechtschreibsicherheit stärken<br />
● Einsichten in die Wortstruktur gewinnen durch Vermittlung von Strategien:<br />
Wortbausteine und Komposita analysieren und Wörter aus Wortbausteinen und<br />
Grund- und Bestimmungswort bilden; Flexionsmorpheme kennen und anwenden<br />
(Konjugation, Deklination, Steigerung)<br />
● Strategien zur Kontrolle von Schreibungen: Analyse der Bausteine, Regelanwendung,<br />
Wörterbucharbeit: kritischer und reflektierter Umgang mit PC-<br />
Korrekturprogrammen<br />
2. Äußere Form in ihrer Bedeutung für die Leserfreundlichkeit einschätzen:<br />
● Schriftbild, Schriftgröße, ästhetische Funktion von Schrift, Reflexion über die<br />
eigene Schrift<br />
● Aufteilung des Textes auf dem Schreibblatt (Überschrift, Absätze, Rand),<br />
grafische Gestaltung (Dekorelemente, Illustrationen)<br />
KOMPETENZBEREICH: SCHREIBEN<br />
21
Kompetenzbereich<br />
Lesen – Mit Texten und Medien umgehen<br />
22
Aufgabe „Die ziemlich intelligente Fliege“: Lösungen und<br />
Hinweise<br />
Lies den Text.<br />
1<br />
5<br />
10<br />
Die ziemlich intelligente Fliege<br />
Eine große Spinne hatte in einem alten Haus ein schönes Netz gewoben,<br />
weil sie Fliegen fangen wollte. Jedes Mal, wenn eine Fliege sich auf dem<br />
Netz niederließ und darin hängen blieb, verzehrte die Spinne sie<br />
schleunigst, damit andere Fliegen, die vorbeikamen, denken sollten, das<br />
Netz sei ein sicherer und gemütlicher Platz. Eines Tages schwirrte eine<br />
ziemlich intelligente Fliege so lange um das Netz herum, ohne es zu<br />
berühren, dass die Spinne schließlich hervor kroch und sagte: „Komm, ruh<br />
dich ein bisschen bei mir aus.“ Aber die Fliege ließ sich nicht übertölpeln.<br />
„Ich setze mich nur an Stellen, wo ich andere Fliegen sehe“, antwortete sie,<br />
„und ich sehe bei dir keine anderen Fliegen.“ Damit flog sie weiter, bis sie<br />
an eine Stelle kam, wo sehr viele Fliegen saßen. Sie wollte sich gerade zu<br />
ihnen gesellen, als eine Biene ihr zurief: „Halt, du Idiot, hier ist Fliegenleim.<br />
Alle diese Fliegen sitzen rettungslos fest.“ „Red keinen Unsinn“, sagte die<br />
Fliege. „Sie tanzen doch.“ Damit ließ sie sich nieder und blieb auf dem<br />
Fliegenleim kleben wie all die anderen Fliegen. [...]<br />
Angaben, die für alle Items gelten:<br />
Textsorte Fabel<br />
KOMPETENZBEREICH: LESEN – MIT TEXTEN UND MEDIEN UMGEHEN<br />
Mit freundlicher Genehmigung des Rowohlt Verlages<br />
James Thurber, 75 Fabeln für Zeitgenossen, S. 8<br />
© 1967 Rowohlt Verlag Hamburg<br />
Kompetenzbereich Lesen – mit Texten und Medien umgehen<br />
Lösung Siehe entsprechende Aufgaben<br />
23
Bearbeite die folgenden Aufgaben.<br />
Aufgabe 1<br />
Ordne den Tieren die unten stehenden Handlungen zu.<br />
Handlungen:<br />
verzweifelter Befreiungsversuch – Nahrungsfang – Ratschläge ablehnen –<br />
Warnung<br />
Tier Handlung<br />
A die Spinne Nahrungsfang<br />
B die ziemlich intelligente Fliege Ratschläge ablehnen<br />
C die Biene Warnung<br />
D die anderen Fliegen<br />
Auswertung: Für alle Zeilen insgesamt<br />
KOMPETENZBEREICH: LESEN – MIT TEXTEN UND MEDIEN UMGEHEN<br />
verzweifelter<br />
Befreiungsversuch<br />
Alle Zeilen entsprechend dem vorgegebenen Muster ausgefüllt → richtig<br />
Inhaltlich falsche / sonstige falsche Antworten → falsch<br />
Keine Antwort → falsch<br />
Hinweis: Rechtschreibung wird nicht gewertet.<br />
Aufgabenformat Geschlossen – Zuordnungsaufgabe<br />
Anforderungsbereich I<br />
Bildungsstandard<br />
wesentliche Elemente eines Textes<br />
erkennen<br />
Leseanforderung Informationen ermitteln<br />
Beschreibung der<br />
Leseanforderung<br />
Tätigkeit<br />
Hinweise zur Weiterarbeit<br />
Unterschiedliche Einzelinformationen, die<br />
explizit im Text genannt sind, miteinander<br />
sinnvoll kombinieren<br />
Einfache Schlussfolgerungen auf Textebene<br />
ziehen<br />
Zuordnungsübungen anhand von Texten mit<br />
komplexen Informationen, d.h. das<br />
Zuordnen von Eigenschaften auf Figuren;<br />
z.B. Kombinationen Figur-Verhalten, Länder-<br />
Merkmale, Pflanzen-Nutzen<br />
24
Aufgabe 2<br />
Kreuze an, ob die folgenden Aussagen richtig oder falsch sind.<br />
A Die Spinne ist hinterhältig. X<br />
KOMPETENZBEREICH: LESEN – MIT TEXTEN UND MEDIEN UMGEHEN<br />
richtig falsch<br />
B Die Spinne hat auf ihrem Netz Fliegenleim aufgetragen. X<br />
Auswertung: Für alle Zeilen insgesamt<br />
Alle Zeilen nach vorgegebenem Antwortmuster angekreuzt → richtig<br />
Jedes andere Antwortmuster angekreuzt → falsch<br />
Keine Antwortalternative angekreuzt → falsch<br />
Aufgabenformat Geschlossen - Richtig/Falsch-Ankreuzverfahren<br />
Anforderungsbereich<br />
Bildungsstandard<br />
Leseanforderung<br />
Beschreibung der<br />
Leseanforderung<br />
Tätigkeit<br />
Hinweise zur Weiterarbeit<br />
A: III<br />
B: II<br />
A: eigene Deutungen des Textes entwickeln<br />
B: zentrale Inhalte erschließen<br />
A: Reflektieren und Bewerten<br />
B: Textbezogen Interpretieren<br />
A: Dem Schüler muss die Bedeutung des Wortes<br />
hinterhältig bekannt sein. Diese muss sinnvoll auf<br />
das Verhalten der Spinne angewendet werden.<br />
B: Der Schüler muss die beiden Textabschnitte<br />
(Textabschnitt „Spinne“ und Textabschnitt<br />
„Biene“) sinnvoll inhaltlich voneinander trennen<br />
können.<br />
A: Komplexe Schlussfolgerungen auf der Basis<br />
von Vorwissen ziehen<br />
B: Komplexe Schlussfolgerungen auf Textebene<br />
ziehen<br />
A: Wortbedeutungen üben, indem zu einem Wort<br />
unterschiedliche Texte geboten werden, die<br />
sinnvoll zugeordnet werden sollen<br />
B: Bearbeitung von Texten, die unklare Zäsuren<br />
aufweisen, welche die Schüler markieren müssen<br />
25
Aufgabe 3<br />
Ordne die folgenden Handlungsabschnitte so an, wie sie im Text erscheinen.<br />
Schreibe die Nummern von 1 bis 7 in das jeweils passende Kästchen.<br />
A die Spinne will die Fliege überreden, sich bei ihr auszuruhen 3<br />
B die Spinne webt ein Netz 1<br />
C die Biene warnt die Fliege 5<br />
D die Fliege sieht das Spinnennetz als Gefahr an 4<br />
E die Fliege schlägt die Warnung aus 6<br />
F die Fliege klebt fest 7<br />
G die Spinne frisst die gefangenen Fliegen 2<br />
Auswertung: Für alle Zeilen insgesamt<br />
Alle Zeilen entsprechend dem vorgegebenen Muster ausgefüllt → richtig<br />
Inhaltlich falsche / sonstige falsche Antworten → falsch<br />
Keine Antwort → falsch<br />
Aufgabenformat Geschlossen - Ordnungsaufgabe<br />
Anforderungsbereich II<br />
Bildungsstandard zentrale Inhalte erschließen<br />
Leseanforderung Textbezogen Interpretieren<br />
Beschreibung der<br />
Leseanforderung<br />
Tätigkeit<br />
Hinweise zur Weiterarbeit<br />
Textbausteine vor dem Hintergrund der Fabel in<br />
einen sinnvollen Zusammenhang bringen<br />
Wiedererkennen sowie komplexe<br />
Schlussfolgerungen auf Textebene ziehen<br />
1. Einfachere und aufsteigend komplexe Texte<br />
in einzelne Textbausteine zergliedern und diese<br />
von den Schülern ordnen lassen<br />
2. Überschriften für einzelne Textblöcke finden<br />
lassen<br />
KOMPETENZBEREICH: LESEN – MIT TEXTEN UND MEDIEN UMGEHEN<br />
26
Aufgabe 4<br />
Welche List hat sich die Spinne ausgedacht?<br />
Kreuze die richtige Antwort an.<br />
A : Sie hat ein besonders schönes Netz gewebt.<br />
B : Sie überredet jede einzelne Spinne, in das Spinnennetz zu kommen.<br />
C : Ihr Netz ist immer leer und stellt deshalb keine Gefahr dar.<br />
D : Sie hat sich in einem alten Haus niedergelassen, wo es besonders viele<br />
Fliegen gibt.<br />
Auswertung:<br />
Vorgegebenes Antwortmuster angekreuzt → richtig<br />
Jedes andere Antwortmuster angekreuzt → falsch<br />
Keine Antwortalternative angekreuzt → falsch<br />
Aufgabenformat Geschlossen – Multiple-Choice-Aufgabe<br />
Anforderungsbereich II<br />
Bildungsstandard zentrale Inhalte erschließen<br />
Leseanforderung Textbezogen Interpretieren<br />
Beschreibung der<br />
Leseanforderung<br />
Tätigkeit<br />
Hinweise zur Weiterarbeit<br />
Die Schüler müssen explizit dargebotene<br />
Inhalte paraphrasieren und sie in einen<br />
sinnvollen Zusammenhang bringen.<br />
Einfache Schlussfolgerungen auf Satzebene<br />
ziehen<br />
Komplexere Sätze vorgeben, die paraphrasiert<br />
werden müssen<br />
KOMPETENZBEREICH: LESEN – MIT TEXTEN UND MEDIEN UMGEHEN<br />
27
Aufgabe 5 ,<br />
Was bedeutet das Wort „übertölpeln“ in dem Satz „Aber die Fliege ließ sich<br />
nicht übertölpeln.“?<br />
Kreuze die richtige Antwort an.<br />
A : überreden<br />
B : reinlegen<br />
C : einladen<br />
D : erpressen<br />
Auswertung:<br />
Vorgegebenes Antwortmuster angekreuzt → richtig<br />
Jedes andere Antwortmuster angekreuzt → falsch<br />
Keine Antwortalternative angekreuzt → falsch<br />
Aufgabenformat Geschlossen – Multiple-Choice-Aufgabe<br />
Anforderungsbereich III<br />
Bildungsstandard eigene Deutungen des Textes entwickeln<br />
Leseanforderung Reflektieren und Bewerten<br />
Beschreibung der<br />
Leseanforderung<br />
Tätigkeit<br />
Hinweise zur Weiterarbeit Synonyme üben<br />
Dem Schüler muss die identische Bedeutung<br />
der beiden Worte geläufig sein, damit die<br />
Intention des Textes durch die Wortwahl nicht<br />
verändert wird.<br />
Komplexe Schlussfolgerungen auf der Basis<br />
von Vorwissen ziehen<br />
KOMPETENZBEREICH: LESEN – MIT TEXTEN UND MEDIEN UMGEHEN<br />
28
Aufgabe 6<br />
Welche andere Überschrift passt zur Fabel?<br />
Kreuze die richtige Antwort an.<br />
A :<br />
B :<br />
C :<br />
D :<br />
Die Biene, die gemein und listig ist<br />
Die Fliege, die glaubt clever zu sein<br />
Die Spinne, die alle Fliegen überlistet<br />
Der Fliegenleim, der Glück bringt<br />
Auswertung:<br />
Vorgegebenes Antwortmuster angekreuzt → richtig<br />
Jedes andere Antwortmuster angekreuzt → falsch<br />
Keine Antwortalternative angekreuzt → falsch<br />
Aufgabenformat Geschlossen – Multiple-Choice-Aufgaben<br />
Anforderungsbereich II<br />
Bildungsstandard zentrale Inhalte erschließen<br />
Leseanforderung Textbezogen Interpretieren<br />
Beschreibung der<br />
Leseanforderung<br />
Um die passende Überschrift zu finden, muss die<br />
Gesamtaussage und die Intention des Textes<br />
verstanden werden.<br />
Tätigkeit Komplexe Schlussfolgerungen auf Textebene ziehen<br />
Hinweise zur Weiterarbeit<br />
den Schülern Texte darbieten, zu denen sie<br />
Überschriften finden sollen<br />
KOMPETENZBEREICH: LESEN – MIT TEXTEN UND MEDIEN UMGEHEN<br />
29
Aufgabe 7<br />
Welche Lehre könnte die Fabel vermitteln?<br />
Kreuze die richtige Antwort an.<br />
A :<br />
B :<br />
C :<br />
D :<br />
E :<br />
F :<br />
Nicht alles, was sicher aussieht, ist ungefährlich.<br />
Höre immer darauf, was andere dir raten.<br />
Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein.<br />
Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen.<br />
Übung macht den Meister.<br />
Der Klügere gibt nach.<br />
Auswertung:<br />
Vorgegebenes Antwortmuster angekreuzt → richtig<br />
Jedes andere Antwortmuster angekreuzt → falsch<br />
Keine Antwortalternative angekreuzt → falsch<br />
Aufgabenformat Geschlossen – Multiple-Choice-Aufgaben<br />
Anforderungsbereich III<br />
Bildungsstandard eigene Deutungen des Textes entwickeln<br />
Leseanforderung Reflektieren und Bewerten<br />
Beschreibung der<br />
Leseanforderung<br />
Tätigkeit<br />
Hinweise zur Weiterarbeit<br />
Um die passende Aussage/Lehre zu finden,<br />
müssen die Gesamtaussage und die Intention<br />
des Textes verstanden werden. Der Sinn der<br />
angebotenen Sprichwörter muss verstanden und<br />
sinnvoll auf den Text angewendet werden.<br />
Komplexe Schlussfolgerungen auf der Basis von<br />
Vorwissen ziehen<br />
1. Fabeln interpretieren üben<br />
2. Bedeutungen von Sprichwörtern klären<br />
KOMPETENZBEREICH: LESEN – MIT TEXTEN UND MEDIEN UMGEHEN<br />
30
Aufgabe 8<br />
Schreibe in einem Satz auf, was die Biene gedacht haben könnte, als die Fliege<br />
am Fliegenleim kleben blieb.<br />
Richtige Lösung:<br />
Für die richtige Lösung muss zum Ausdruck gebracht werden, dass die Biene das<br />
Verhalten der Fliege reflektiert: Richtig sind<br />
• alle Gedanken, welche die Fliege als dumm bezeichnen.<br />
• alle Gedanken, die der Fliege die Schuld an ihrer eigenen Situation geben.<br />
• alles, was auf die vorherige Warnung der Biene verweist.<br />
Die Nennung eines Aspekts genügt.<br />
Beispiele für richtige Lösungen:<br />
• Hätte sie nur auf mich gehört. / Das hat sie nun davon!<br />
• Die Fliege ist wirklich dumm / ein Idiot.<br />
• Ist die doof. Ich hatte sie doch gewarnt.<br />
• Selber Schuld. Ich hatte es ihr gesagt, aber sie wollte nicht hören.<br />
• Wer nicht hören will, muss fühlen.<br />
Beispiele für falsche Lösungen:<br />
x Mist, warum habe ich mich da nur hingesetzt?<br />
x Die Fliege tut mir Leid.<br />
x Alle Antworten, die sich auf eine mögliche Rettung beziehen.<br />
x Alle Antworten, die sich nur auf Mitleid beziehen.<br />
Auswertung:<br />
Antwort entsprechend dem vorgegebenen Muster → richtig<br />
Inhaltlich falsche Antwort/ sonstige falsche Antworten → falsch<br />
Keine Antwort → falsch<br />
KOMPETENZBEREICH: LESEN – MIT TEXTEN UND MEDIEN UMGEHEN<br />
31
Aufgabenformat offen<br />
Anforderungsbereich III<br />
Bildungsstandard<br />
eigene Deutungen des Textes<br />
entwickeln/begründete Schlussfolgerungen ziehen<br />
Leseanforderung Reflektieren und Bewerten<br />
Beschreibung der<br />
Leseanforderung<br />
Tätigkeit<br />
Perspektivwechsel zur Biene vor dem Hintergrund<br />
der Informationen des Gesamttextes<br />
Komplexe Schlussfolgerungen auf der Basis von<br />
Vorwissen ziehen<br />
Hinweise zur Weiterarbeit Perspektivwechsel üben anhand geeigneter Texte<br />
KOMPETENZBEREICH: LESEN – MIT TEXTEN UND MEDIEN UMGEHEN<br />
32
Aufgaben zu Witzen: Lösungen und Hinweise<br />
Für jeden dieser Witze sind drei Lösungen vorgeschlagen.<br />
Kreuze die witzigste Lösung an.<br />
Aufgabe 1<br />
„Was ist denn mit dir los, Justin? Du machst im Unterricht immer so einen schläfrigen<br />
Eindruck", beklagt sich der Lehrer. - „Machen Sie sich keine Sorgen. Das ist das<br />
große Talent,<br />
A :<br />
B :<br />
C :<br />
das in mir schlummert."<br />
das in mir tobt."<br />
das in mir klagt."<br />
Auswertung:<br />
Vorgegebenes Antwortmuster angekreuzt → richtig<br />
Jedes andere Antwortmuster angekreuzt → falsch<br />
Keine Antwortalternative angekreuzt → falsch<br />
Aufgabe 2<br />
Kevin und Serim gehen zum Arzt. „Na, was fehlt euch denn?" - Kevin antwortet: „Ich<br />
habe eine Kugel verschluckt." - „Und was fehlt dir, Serim?"<br />
A : „Die Kugel."<br />
B : „Ich habe Husten.“<br />
C : „Der Schreiber.“<br />
Auswertung:<br />
Vorgegebenes Antwortmuster angekreuzt → richtig<br />
Jedes andere Antwortmuster angekreuzt → falsch<br />
Keine Antwortalternative angekreuzt → falsch<br />
33
Aufgabe 3<br />
„Ben, wenn ich dir fünf Äpfel gebe und du sollst sie mit deinem kleinen Bruder teilen,<br />
wie viele Äpfel bekommt er dann?“<br />
„Zwei, Herr Lehrer!“<br />
„Ben, du kannst nicht rechnen!“ tadelt der Lehrer<br />
„Doch, ich schon“, entgegnet Ben,<br />
D : „aber mein kleiner Bruder!"<br />
E : „aber Sie nicht!“<br />
F : „aber mein kleiner Bruder nicht!"<br />
Auswertung:<br />
Vorgegebenes Antwortmuster angekreuzt → richtig<br />
Jedes andere Antwortmuster angekreuzt → falsch<br />
Keine Antwortalternative angekreuzt → falsch<br />
Aufgabe 4<br />
Der Besitzer eines Autos sieht gerade, wie ein Polizist einen Strafzettel unter den<br />
Scheibenwischer seines Autos klemmen will; da sagt der Besitzer dem Polizisten:<br />
„Sie sind doch Polizist, Freund und Helfer,…<br />
A :<br />
B :<br />
C :<br />
man macht das unter Freunden."<br />
macht man das unter Freunden?"<br />
mach das man unter Freunden!"<br />
Auswertung:<br />
Vorgegebenes Antwortmuster angekreuzt → richtig<br />
Jedes andere Antwortmuster angekreuzt → falsch<br />
Keine Antwortalternative angekreuzt → falsch<br />
Aufgabe 5<br />
Im Zirkus ruft der Dompteur der Löwengruppe nach einem tapferen Zuschauer, der<br />
sich traut, in den Käfig zu gehen. Er bietet 100 Euro. „Ich", ruft Tino,<br />
A : „aber lassen Sie nachher die Löwen raus."<br />
B : „aber lassen Sie vorher die Löwen raus."<br />
C : „aber lassen Sie vorher die Löwen rein."<br />
Auswertung:<br />
Vorgegebenes Antwortmuster angekreuzt → richtig<br />
Jedes andere Antwortmuster angekreuzt → falsch<br />
Keine Antwortalternative angekreuzt → falsch<br />
KOMPETENZBEREICH: LESEN – MIT TEXTEN UND MEDIEN UMGEHEN<br />
34
Aufgabe 6<br />
Fragt die Oma den kleinen Sohn des Eisenbahnschaffners: „Nun, wie war denn dein<br />
erster Schultag?“<br />
„Ach, Omi, alles Betrug!<br />
A :<br />
B :<br />
C :<br />
An der Tür steht 1. Klasse, und drinnen gibt es doch nur harte Holzstühle!“<br />
An der Tür steht 1. Klasse, und ich bin doch schon in der 2. Klasse!“<br />
An der Tür steht 1. Klasse, und ich kann doch noch gar nicht lesen!“<br />
Auswertung:<br />
Vorgegebenes Antwortmuster angekreuzt → richtig<br />
Jedes andere Antwortmuster angekreuzt → falsch<br />
Keine Antwortalternative angekreuzt → falsch<br />
Aufgabe 7<br />
Lehrer: „Andrej, konjugiere mal das Verb 'spazieren'.“ Andrej: „Ich spaziere … du<br />
spazierst … er spaziert …“ – „Etwas schneller, bitte!“ –<br />
A : „Wir rennen, ihr rennt …“<br />
B : „Wir rannten, ihr ranntet…“<br />
C : „Wir spazieren, ihr spaziertet“<br />
Auswertung:<br />
Vorgegebenes Antwortmuster angekreuzt → richtig<br />
Jedes andere Antwortmuster angekreuzt → falsch<br />
Keine Antwortalternative angekreuzt → falsch<br />
Aufgabe 8<br />
Der Startschuss ertönt.<br />
Alle Motorräder donnern los, bis auf eins.<br />
Fragt der Starter: „Weshalb fahren Sie denn nicht los?“<br />
Da antwortet der Fahrer:<br />
A : „Warum denn? Sie haben mir in den Reifen geschossen!“<br />
B : „Wann denn? Sie haben mir in den Reifen geschossen!“<br />
C : „Wie denn? Sie haben mir in den Reifen geschossen!“<br />
Auswertung:<br />
Vorgegebenes Antwortmuster angekreuzt → richtig<br />
Jedes andere Antwortmuster angekreuzt → falsch<br />
Keine Antwortalternative angekreuzt → falsch<br />
KOMPETENZBEREICH: LESEN – MIT TEXTEN UND MEDIEN UMGEHEN<br />
35
Aufgabe 9<br />
Eine Regenwurmdame fragt eine andere: „Wo ist eigentlich dein Mann? Ich habe ihn<br />
schon lange nicht mehr gesehen.“ Die andere schluchzt:<br />
A : „Er ist zum Spielen gegangen.“<br />
B : „Er ist zum Segeln gegangen.“<br />
C : „Er ist zum Angeln gegangen.“<br />
Auswertung:<br />
Vorgegebenes Antwortmuster angekreuzt → richtig<br />
Jedes andere Antwortmuster angekreuzt → falsch<br />
Keine Antwortalternative angekreuzt → falsch<br />
Aufgabe 10<br />
Der Kunde zur Verkäuferin: „Ich möchte gern die grüne Hose da im Schaufenster<br />
anprobieren.“ Darauf die Verkäuferin:<br />
A : „Sie dürfen aber auch die blaue Hose anprobieren.“<br />
B : „Sie dürfen aber auch eine Kabine benutzen.“<br />
C : „Sie dürfen auch gleich ein passendes Hemd anprobieren.“<br />
Auswertung:<br />
Vorgegebenes Antwortmuster angekreuzt → richtig<br />
Jedes andere Antwortmuster angekreuzt → falsch<br />
Keine Antwortalternative angekreuzt → falsch<br />
KOMPETENZBEREICH: LESEN – MIT TEXTEN UND MEDIEN UMGEHEN<br />
36
Angaben, die für alle Items gelten:<br />
Textsorte Witze<br />
Aufgabenformat Geschlossen – Multiple-Choice<br />
Anforderungsbereich II und III<br />
Kompetenzbereich Lesen – mit Texten und Medien umgehen<br />
Bildungsstandard<br />
Leseanforderung<br />
Beschreibung der<br />
Anforderung<br />
Tätigkeit<br />
Hinweise zur<br />
Weiterarbeit<br />
Wesentliche Elemente eines Textes<br />
erfassen/Informationen zielgerichtet entnehmen<br />
Textbezogen interpretieren<br />
Reflektieren und bewerten<br />
Es geht darum, Textschlüsse unter dem Aspekt ihrer<br />
komischen Wirkung auf der Grundlage von Sprachwissen<br />
zu erfassen und zu bewerten.<br />
Komplexe Schlussfolgerungen ziehen (auf Basis<br />
Vorwissen)<br />
Es ist sinnvoll, Schülerinnen und Schüler Witze erzählen<br />
zu lassen und über deren komische Wirkung zu<br />
sprechen.<br />
Hilfreich kann es sein, Witze für die Untersuchung<br />
sprachlicher Phänomene heranzuziehen.<br />
KOMPETENZBEREICH: LESEN – MIT TEXTEN UND MEDIEN UMGEHEN<br />
37
Aufgabe „Fahrrad“: Lösungen und Hinweise<br />
Lies den Zeitungsartikel.<br />
Die Internationale Fahrradmesse IFMA ist gestern<br />
in Köln mit zahlreichen Zweirad-Neuheiten<br />
an den Start gegangen. Bis Sonntag zeigen 750<br />
Aussteller neue Modelle bei Renn- und<br />
Tourenrädern, Mountain- und Citybikes oder<br />
auch bei E-Bikes mit Elektroantrieb und<br />
Liegerädern. Zum Auftakt der größten<br />
Fahrradschau Europas wurde der Münchner<br />
Oberbürgermeister Christian Ude (SPD) als<br />
„fahrradfreundlichste Persönlichkeit 2006“<br />
geehrt. Das Fahrrad als individuelles<br />
Verkehrsmittel gewinne ständig an Bedeutung,<br />
so der Zweirad-Industrie-Verband (ZIV). Als<br />
Gründe nannte der ZIV wachsende<br />
gesundheitliche Vorsorge, stärkeren Einsatz der<br />
Fahrräder im Tourismus oder auch die<br />
gestiegenen Energiekosten. Der lange Winter<br />
und die Fußball-WM hätten aber Spuren<br />
hinterlassen, so dass für 2006 mit einem leichten<br />
Rückgang der Verkaufszahlen zu rechnen sei.<br />
Noch werden, wie die Grafik zeigt, die meisten in<br />
Deutschland verkauften Fahrräder auch hier<br />
produziert. Allerdings: Rahmen, Schaltungen<br />
und andere zentrale Bestandteilekommen meist<br />
aus dem Ausland. Am Wochenende ist die<br />
Messe auch für das Publikum geöffnet.<br />
Mit freundlicher Genehmigung der Kieler Nachrichten<br />
Kieler Nachrichten, 15. September 2006<br />
(Wortveränderungen im Text vorgenommen) 38
Angaben, die für alle Items gelten:<br />
Textsorte Sachtext – kontinuierlich und nicht kontinuierlich<br />
Kompetenzbereich Lesen – mit Texten und Medien umgehen<br />
Lösung Siehe entsprechende Aufgaben<br />
Aufgabe 1<br />
„Deutschland fährt Rad“ lautet die Überschrift der Grafik. Worüber informiert die<br />
Grafik?<br />
Kreuze die richtige Antwort an.<br />
A:<br />
B:<br />
C:<br />
D:<br />
über die Anzahl der Fahrräder in Deutschland<br />
über das Kaufverhalten von Kunden<br />
über den Gebrauch von Fahrrädern<br />
über die Anzahl von Radfahrern in Deutschland<br />
Auswertung:<br />
Vorgegebenes Antwortmuster angekreuzt → richtig<br />
Jedes andere Antwortmuster angekreuzt → falsch<br />
Keine Antwortalternative angekreuzt → falsch<br />
Aufgabenformat Geschlossen – Multiple Choice<br />
Anforderungsbereich II<br />
Bildungsstandard Intentionen eines Textes erkennen<br />
Leseanforderung Textbezogen interpretieren<br />
Beschreibung der<br />
Anforderung<br />
Die Information ist nicht explizit gegeben, sondern auf<br />
Textebene zu erschließen.<br />
Tätigkeit Komplexe Schlussfolgerungen auf Textebene<br />
Hinweise zur Weiterarbeit<br />
Aufgabe 2<br />
Eine stimmige, zusammenhängende Vorstellung von<br />
Schaubildern als Ganzem entwickeln<br />
Was bedeutet die Textüberschrift: „Das Fahrrad fährt bergauf“?<br />
Kreuze die richtige Antwort an.<br />
A :<br />
B :<br />
Mit Fahrrädern kann man bergauf fahren.<br />
Neue Erfindungen erleichtern das Radfahren.<br />
C : Das Interesse an Fahrrädern steigt.<br />
D :<br />
Es gibt viele Neuheiten auf dem Fahrradmarkt.<br />
KOMPETENZBEREICH: LESEN – MIT TEXTEN UND MEDIEN UMGEHEN<br />
39
Auswertung:<br />
Vorgegebenes Antwortmuster angekreuzt → richtig<br />
Jedes andere Antwortmuster angekreuzt → falsch<br />
Keine Antwortalternative angekreuzt → falsch<br />
Aufgabe 3<br />
Was haben die gestiegenen Energiekosten mit der wachsenden Bedeutung des<br />
Zweirades zu tun?<br />
Kreuze die richtige Antwort an.<br />
A :<br />
B :<br />
C :<br />
D :<br />
Fahrräder verbrauchen viel zu viel Energie.<br />
Zweiräder helfen durch Energiesteigerung gesund und fit zu bleiben.<br />
Bei der Nutzung von Rädern können Energiekosten gespart werden.<br />
Die Produktion von Fahrrädern lässt die Energiekosten ansteigen.<br />
Auswertung:<br />
Vorgegebenes Antwortmuster angekreuzt → richtig<br />
Jedes andere Antwortmuster angekreuzt → falsch<br />
Keine Antwortalternative angekreuzt → falsch<br />
Aufgabenformat Geschlossen – Multiple Choice<br />
Anforderungsbereich II<br />
Bildungsstandard zentrale Inhalte erschließen<br />
Leseanforderung Textbezogen interpretieren<br />
Beschreibung der<br />
Anforderung<br />
Die Information ist nicht explizit gegeben, sondern auf<br />
Textebene zu erschließen.<br />
Tätigkeit Komplexe Schlussfolgerungen auf Textebene<br />
Hinweise zur Weiterarbeit<br />
Verknüpfungen zwischen inhaltlich aufeinander<br />
bezogenen Informationen herstellen : z.B.<br />
Zuordnungsaufgaben nach Grund und Folge, Anlass<br />
und Wirkung etc.<br />
KOMPETENZBEREICH: LESEN – MIT TEXTEN UND MEDIEN UMGEHEN<br />
40
Aufgabe 4<br />
Die meisten Räder wurden 2005…<br />
Kreuze die richtige Antwort an.<br />
A : im Internet bestellt.<br />
B : im Versandhandel bestellt.<br />
C : im Fachhandel gekauft.<br />
D :<br />
anderswo gekauft.<br />
Auswertung:<br />
Vorgegebenes Antwortmuster angekreuzt → richtig<br />
Jedes andere Antwortmuster angekreuzt → falsch<br />
Keine Antwortalternative angekreuzt → falsch<br />
Aufgabenformat Geschlossen – Multiple Choice<br />
Anforderungsbereich I<br />
Bildungsstandard Informationen zielgerichtet entnehmen<br />
Leseanforderung Informationen ermitteln<br />
Beschreibung der<br />
Anforderung<br />
Tätigkeit Wiedererkennen<br />
Hinweise zur Weiterarbeit<br />
Aufgabe 5<br />
Was bedeutet die Abkürzung ZIV?<br />
Kreuze die richtige Antwort an.<br />
A :<br />
Quelle: ZIV<br />
B : Zweirad-Industrie-Verband<br />
C :<br />
Zweirad internationaler Verband<br />
D : zentraler-internationaler-Verband<br />
Die Information ist explizit gegeben<br />
Detailinformationen in Schaubildern lokalisieren und<br />
markieren<br />
Auswertung:<br />
Vorgegebenes Antwortmuster angekreuzt → richtig<br />
Jedes andere Antwortmuster angekreuzt → falsch<br />
Keine Antwortalternative angekreuzt → falsch<br />
KOMPETENZBEREICH: LESEN – MIT TEXTEN UND MEDIEN UMGEHEN<br />
41
Aufgabenformat Geschlossen – Multiple Choice<br />
Anforderungsbereich I<br />
Bildungsstandard Informationen zielgerichtet entnehmen<br />
Leseanforderung Informationen ermitteln<br />
Beschreibung der<br />
Anforderung<br />
Tätigkeit Wiedererkennen<br />
Hinweise zur Weiterarbeit<br />
Aufgabe 6<br />
Welche Absicht verfolgen Grafik und Text?<br />
Kreuze die richtige Antwort an.<br />
A :<br />
B :<br />
C :<br />
D :<br />
Die Information ist explizit gegeben<br />
Detailinformationen in Texten lokalisieren und<br />
markieren<br />
Sie werben für das Radfahren in der Stadt mit dem Cityrad.<br />
Sie fordern zur Nutzung eines Zweirades auf.<br />
Sie begründen den Gebrauch von Zweirad-Neuheiten.<br />
Sie informieren über den Fahrradmarkt und die Messe.<br />
Auswertung:<br />
Vorgegebenes Antwortmuster angekreuzt → richtig<br />
Jedes andere Antwortmuster angekreuzt → falsch<br />
Keine Antwortalternative angekreuzt → falsch<br />
Aufgabenformat Geschlossen – Multiple Choice<br />
Anforderungsbereich II<br />
Bildungsstandard Intentionen eines Textes erkennen<br />
Leseanforderung Textbezogen interpretieren<br />
Beschreibung der<br />
Anforderung<br />
Die Information ist nicht explizit gegeben, sondern durch<br />
Verknüpfung zahlreicher Informationen auf Textebene zu<br />
erschließen.<br />
Tätigkeit Komplexe Schlussfolgerungen auf Textebene<br />
Hinweise zur<br />
Weiterarbeit<br />
Angebote unterschiedlicher Intentionen in einer Liste<br />
anbieten und überprüfen lassen<br />
KOMPETENZBEREICH: LESEN – MIT TEXTEN UND MEDIEN UMGEHEN<br />
42
Aufgabe 7<br />
Woran erkennst du, welche Räder am meisten genutzt werden?<br />
Kreuze die richtige Antwort an.<br />
A :<br />
B :<br />
C :<br />
D :<br />
wird im Text beschrieben<br />
an der Färbung des Abschnittes im Reifen<br />
an der Aufzählung<br />
an der Länge der Markierung im Reifen<br />
Auswertung:<br />
Vorgegebenes Antwortmuster angekreuzt → richtig<br />
Jedes andere Antwortmuster angekreuzt → falsch<br />
Keine Antwortalternative angekreuzt → falsch<br />
Textsorte Sachtext – kontinuierlich und nicht kontinuierlich<br />
Aufgabenformat Geschlossen – Multiple Choice<br />
Anforderungsbereich II<br />
Kompetenzbereich Lesen – mit Texten und Medien umgehen<br />
Bildungsstandard Zentrale Inhalte erschließen<br />
Leseanforderung Textbezogen interpretieren<br />
Beschreibung der<br />
Anforderung<br />
Tätigkeit<br />
Möglichkeiten zur<br />
Unterstützung<br />
Aufgabe 8<br />
Eine Persönlichkeit wurde auf der Messe geehrt.<br />
Kreuze die richtige Antwort an.<br />
A :<br />
B :<br />
C :<br />
D :<br />
E :<br />
Die Information ist zwar explizit in der Grafik gegeben,<br />
muss aber noch in sprachliche Information überführt<br />
werden.<br />
Komplexe Schlussfolgerungen auf der Basis von<br />
Vorwissen<br />
Informationen aus Grafiken in Sprache übersetzen –<br />
auch umgekehrt, z. B. : Balkendiagramm,<br />
Tortendiagramm etc.<br />
als freundliche Person anderen Menschen gegenüber<br />
als fahrradfreundlichste Persönlichkeit 2006<br />
als Münchener Oberbürgermeister<br />
als Aussteller zahlreicher Zweirad-Neuheiten<br />
als Veranstalter der internationalen Fahrradmesse<br />
KOMPETENZBEREICH: LESEN – MIT TEXTEN UND MEDIEN UMGEHEN<br />
43
Auswertung:<br />
Vorgegebenes Antwortmuster angekreuzt → richtig<br />
Jedes andere Antwortmuster angekreuzt → falsch<br />
Keine Antwortalternative angekreuzt → falsch<br />
Textsorte Sachtext – kontinuierlich und nicht kontinuierlich<br />
Aufgabenformat Geschlossen – Multiple Choice<br />
Anforderungsbereich I<br />
Kompetenzbereich Lesen – mit Texten und Medien umgehen<br />
Bildungsstandard Informationen zielgerichtet entnehmen<br />
Leseanforderung Informationen ermitteln<br />
Beschreibung der<br />
Anforderung<br />
Tätigkeit Wiedererkennen<br />
Möglichkeiten zur<br />
Unterstützung<br />
Aufgabe 9<br />
Kreuze in jeder Zeile die richtige Antwort an.<br />
Dem Text oder der Grafik kann man entnehmen…<br />
Die Information ist explizit im Text gegeben.<br />
Unterschiedlich tief eingebettete Informationen aus<br />
dem Text ermitteln und markieren<br />
A …wo die meisten Räder 2005 gekauft wurden. x<br />
B<br />
…welche Gründe für die steigende Bedeutung des<br />
Zweirades angeführt werden.<br />
Auswertung: Für alle Zeilen insgesamt<br />
Alle Zeilen nach vorgegebenem Antwortmuster<br />
angekreuzt<br />
→ richtig<br />
Jedes andere Antwortmuster angekreuzt → falsch<br />
Keine Antwortalternative angekreuzt → falsch<br />
KOMPETENZBEREICH: LESEN – MIT TEXTEN UND MEDIEN UMGEHEN<br />
richtig falsch<br />
x<br />
44
Textsorte Sachtext – kontinuierlich und nicht kontinuierlich<br />
Aufgabenformat Geschlossen – Richtig/Falsch-Ankreuzverfahren<br />
Anforderungsbereich II<br />
Kompetenzbereich Lesen – mit Texten und Medien umgehen<br />
Bildungsstandard Zentrale Inhalte erschließen<br />
Leseanforderung Textbezogen interpretieren<br />
Beschreibung der<br />
Anforderung<br />
Tätigkeit<br />
Möglichkeiten zur<br />
Unterstützung<br />
Aufgabe 10<br />
Kreuze in jeder Zeile die richtige Antwort an.<br />
Dem Text oder der Grafik kann man entnehmen…<br />
Die Information ist für Teil A nicht explizit und für Teil B<br />
explizit gegeben.<br />
Komplexe Schlussfolgerungen auf der Ebene von Text-<br />
Bild-Kombinationen ziehen<br />
Orientierungsaufgaben zu Text-Bild-Kombinationen<br />
anbieten<br />
KOMPETENZBEREICH: LESEN – MIT TEXTEN UND MEDIEN UMGEHEN<br />
richtig falsch<br />
A …welche Neuigkeiten erfunden wurden. x<br />
B …wohin die Entwicklung des modernen Rades führt. x<br />
Auswertung: Für alle Zeilen insgesamt<br />
Alle Zeilen nach vorgegebenem Antwortmuster<br />
angekreuzt<br />
→ richtig<br />
Jedes andere Antwortmuster angekreuzt → falsch<br />
Keine Antwortalternative angekreuzt → falsch<br />
45
Textsorte Sachtext – kontinuierlich und nicht kontinuierlich<br />
Aufgabenformat Geschlossen – Richtig/Falsch-Ankreuzverfahren<br />
Anforderungsbereich II<br />
Kompetenzbereich Lesen – mit Texten und Medien umgehen<br />
Bildungsstandard Zentrale Inhalte erschließen<br />
Leseanforderung Textbezogen interpretieren<br />
Beschreibung der<br />
Anforderung<br />
Tätigkeit<br />
Möglichkeiten zur<br />
Unterstützung<br />
Die Text-Bild-Kombination muss hinsichtlich der<br />
gesuchten Informationen durchmustert werden. Die<br />
gesuchten Informationen sind in der Text-Bild-<br />
Kombination nicht enthalten.<br />
Einfache Schlussfolgerungen auf der Satzebene und<br />
komplexe Schlussfolgerungen auf der Ebene von Text-<br />
Bild-Kombinationen ziehen<br />
Durchmusterungsaufgaben zu Text-Bild-<br />
Kombinationen anbieten<br />
KOMPETENZBEREICH: LESEN – MIT TEXTEN UND MEDIEN UMGEHEN<br />
46
Kompetenzbereich<br />
Sprache und Sprachgebrauch untersuchen<br />
47
Aufgabe zur Wortfamilie „sprech“: Lösungen und Hinweise<br />
Eine Wortfamilie ist eine Gruppe von Wörtern mit demselben Stamm. Eine<br />
Wortfamilie bildet man, indem man Vor- oder Nachsilben an den Stamm anfügt oder<br />
Stämme zusammensetzt, wie in dem folgenden Beispiel:<br />
Beispiel: Wortfamilie „lach“<br />
Wörter, die zur Wortfamilie gehören, sind unterstrichen.<br />
lächerlich, witzig, lustig, lachhaft<br />
Scherz, Lachanfall, Clown, Lachkrampf<br />
Unterstreiche die Wörter, die zur Wortfamilie „sprech“ gehören!<br />
Wortfamilie „sprech“<br />
1 Lehrersprechtag, flüstern, Geheimsprache, meckern,<br />
2 Äußerung, Arztsprechstunde, zweisprachig, vortragen,<br />
3 sich artikulieren, sich aussprechen, sich äußern, reden,<br />
4 gesprochen, unterhalten, Sprechsilbe, sprachlich,<br />
5 Spruch, Sprecherin, Aussprache, Sprechfunkgerät,<br />
6 spricht, sagt, widersprüchlich, Wortschatz<br />
KOMPETENZBEREICH: SPRACHE UND SPRACHGEBRAUCH UNTERSUCHEN<br />
48
Erfasste Kompetenz<br />
laut<br />
Bildungsstandards<br />
Grammatische Kategorien (hier der Wortstamm) und ihre<br />
Leistungen in situativen und funktionalen<br />
Zusammenhängen kennen und nutzen<br />
Anforderungsbereich II – Wörter nach Wortfamilien klassifizieren<br />
Erläuterung<br />
Hinweise zur<br />
Weiterarbeit<br />
Die Schülerinnen und Schüler müssen den Wortstamm<br />
erkennen, um die Wörter der Wortfamilie korrekt zu<br />
unterstreichen.<br />
Fehlerschwerpunkte in der Erprobung war die sechste<br />
Zeile, bei den Wörtern, deren Stamm sich durch<br />
Umlautung oder Ablautung ändert und deshalb schwer<br />
zu erkennen ist.<br />
Zur Weiterarbeit:<br />
Übungen zu unregelmäßigen Verben (Ablautreihen, wie<br />
reiten, ritt – der Reiter, der Ritt), zur Umlautbildung<br />
(Plural, 2./3. Person Singular, wie Maus, Mäuse –<br />
Mauseloch, Mäuslein; fallen, du fällst, er fällt – der Fall,<br />
gefällig)<br />
Grundlegenden Unterschied von Wortfeld und<br />
Wortfamilie verdeutlichen<br />
KOMPETENZBEREICH: SPRACHE UND SPRACHGEBRAUCH UNTERSUCHEN<br />
49
Beispiel:<br />
Aufgabe zu Wortarten und Wortfamilien (B): Lösungen und<br />
Hinweise<br />
Die drei Wörter einer Zeile sollen – wie in dem folgenden Beispiel – zu einer<br />
Wortfamilie gehören.<br />
Vervollständige die Tabelle. Verwende keine Substantivierungen (lieben – das<br />
Lieben), keine Zusammensetzungen (Liebesbrief), keine Partizipien (liebend,<br />
geliebt).<br />
A: Verben B: Nomen C: Adjektive<br />
ruhen<br />
1.B verbinden<br />
2.A<br />
mangeln,<br />
bemängeln,<br />
ermangeln<br />
3.A/ 3.B ab-/angrenzen<br />
4.A/4.C<br />
5.A/5.B<br />
6.A/6.B<br />
verlängern, aus-/ be-/ an-<br />
/ er-/ durch-/ ge-/<br />
zulangen<br />
(zu-/ab-/weg-/ge-/mit-/<br />
ver-/an-)hören,<br />
(aus-/ab-)horchen<br />
be-/er-/an-/aus-/ab-/<br />
trinken<br />
7.B/7.C pfeifen<br />
8.A/8.C<br />
9.A/9.B<br />
sichten, be(ab)sichtigen,<br />
(ab-/ auf-/ um-/ vorher-/<br />
über-/ ver-/ zu-/ nach-/<br />
vor-/ ein-/ durch-) sehen<br />
(er-)freuen<br />
10.A/10.B (ab-/ein-/ver-) kürzen<br />
Ruhe ruhig<br />
Verbindung,<br />
Verbindlichkeit, Verband,<br />
Verbund(enheit),<br />
Verbündeter<br />
KOMPETENZBEREICH: SPRACHE UND SPRACHGEBRAUCH UNTERSUCHEN<br />
verbindlich<br />
Mangel mangelhaft<br />
Grenze(r), Ab-/Um-/<br />
Begrenzung,<br />
Grenzenlosigkeit<br />
Länge<br />
(Zu-/Mit-)Hörer, Gehör,<br />
Verhör, Anhörung,<br />
Gehorsam<br />
Trank, Trunkenheit<br />
(Um-)Trunk, Getränk,<br />
Betrunkene/r, Trinker/in<br />
(Ab-/ An-)Pfiff, Pfeife,<br />
(der) Pfeifer, Pfiffikus<br />
Sicht<br />
Freude, Freudigkeit,<br />
Freudlosigkeit<br />
Kürze,<br />
(Ab-/Ver-)Kürzung,<br />
Kürzel<br />
grenzenlos<br />
lang, länglich, langsam,<br />
belanglos<br />
hörbar<br />
trinkbar<br />
pfiffig<br />
(un-)sichtbar, um-/ein-/<br />
vor-/ nach-/ durchsichtig,<br />
(ab-/ über-/ zuver-) sichtlich,<br />
versehentlich<br />
freudig<br />
kurz<br />
50
Erfasste Kompetenz<br />
laut<br />
Bildungsstandards<br />
Anforderungsbereich<br />
Erläuterung<br />
Hinweise zur<br />
Weiterarbeit<br />
Besondere Hinweise<br />
Leistungen von Sätzen und Wortarten kennen und für<br />
Sprechen, Schreiben und Textuntersuchung nutzen<br />
II – Wortarten verändern, Wörter morphologisch<br />
klassifizieren<br />
Gefordert ist aus Wortstämmen Wortfamilienmitglieder<br />
zu generieren und drei unterschiedlichen Wortarten<br />
zuzuordnen.<br />
Eine Fundgrube für Wortstammübungen:<br />
Augst, Gerhard (1998): Wortfamilienwörterbuch der<br />
deutschen Gegenwartssprache (broschiert). Tübingen:<br />
Niemeyer.<br />
Hilfreich können Übungen sein, Wörter mit<br />
wortartbildenden Suffixen zu bilden bzw. zu analysieren:<br />
Nomen z.B. auf -ung, -nis, -heit, -keit, Adjektive z.B. auf<br />
-ig, -isch, -bar, -sam, -los, usw.<br />
Für viele Schülerinnen und Schüler ist die Abgrenzung<br />
von Partizipien und Adjektiven schwierig. Es helfen<br />
Übungen weiter:<br />
Partizipien zu bilden und die Partizipformen auf<br />
Grundlage ihrer Flexionsmorpheme zu klassifizeren<br />
(Partizip Präsens: -end; Partizip Perfekt: Vorsilbe ge-<br />
und -t / -en)<br />
Partizipien aus Sätzen und Texten auf Grundlage der<br />
Flexionsmorpheme herauszusuchen<br />
Partizipien als Attribute in Sätzen zu verwenden<br />
aus einem Wortstamm Verben mit Partizipformen und<br />
Adjektive zu bilden: lieben, liebend, geliebt, lieb, lieblich,<br />
lieblos etc.<br />
Die Rechtschreibung und Artikelfehler werden bei diesen<br />
Aufgaben nicht bewertet, es sei denn der Artikel ist<br />
explizit vorgegeben, z. B.: die Frische.<br />
KOMPETENZBEREICH: SPRACHE UND SPRACHGEBRAUCH UNTERSUCHEN<br />
51
Aufgabe zu Verben – Störtebeker: Lösungen<br />
und Hinweise<br />
In dem Text „Klaus Störtebeker“ fehlen die Verben. Sie stehen<br />
in der Grundform in dem Kasten. Trage sie der Reihe nach in<br />
der Vergangenheitsform in die entsprechenden Lücken ein,<br />
wie in dem ersten Beispiel.<br />
verstecken, gehen, machen, nennen, aufteilen, kapern, erobern, plündern, fallen,<br />
sein, haben, machen, verziehen, ausräumen, umziehen, verfügen, bieten, werden<br />
Klaus Störtebeker ����<br />
1<br />
2<br />
3<br />
4<br />
5<br />
6/7<br />
8<br />
9<br />
10<br />
11/12<br />
13/14<br />
15<br />
16<br />
17<br />
Wo ___versteckte___ der „Rote Teufel“ seine Schätze?<br />
Als „Roter Teufel“ ___ging_______ der rotbärtige Pirat Klaus Störtebeker in die<br />
Geschichte ein:<br />
Er ___machte_____ Ende des 14. Jahrhunderts mit seinen „Likedeelern“, den<br />
„Gleichteilern“, die Nord- und Ostsee unsicher. Sie ___nannten______ sich<br />
„Likedeeler“, da sie ihre Beute stets zu gleichen Anteilen ___aufteilten_______ .<br />
Zusammen mit seinen Kumpanen Godeke Michels und Magister Wigbold<br />
___kaperten_______ Störtebeker insbesondere die Handelsschiffe der Hanse. Sie<br />
__eroberten________und __plünderten_______ sogar reiche Städte, wie Bergen in<br />
Norwegen. Dabei __fielen_______ große Mengen an Handelsgütern und Gold- und<br />
Silbergeräte in ihre Hände. Zuerst ___waren_______ die Seeräuber in der Ostsee<br />
aktiv.<br />
Dort___hatten_______ sie zahlreiche Schlupfwinkel auf den Inseln Rügen und<br />
Usedom und sogar einen eigenen „Staat“ auf der Insel Gotland. Als die Hansestädte<br />
verstärkt Jagd auf die Piraten __machten_______, ___verzog________sich<br />
Störtebeker mit seiner Piratenbande in das Gebiet der Nordsee.<br />
Da Störtebeker und seine Kumpane wahrscheinlich alle ihre Schatzverstecke<br />
__ausräumten____________, als sie von der Ost- in die Nordsee „_umzogen__“,<br />
muss der größte Teil seines Besitzes im Nordseeraum verborgen sein. Dass er über<br />
große Mengen Gold ___verfügte_______, kann man aus folgender Bemerkung<br />
entnehmen: Nachdem er gefangen und verurteilt worden war, ____bot_______ er der<br />
Stadt Hamburg eine Kette aus Gold an, die die ganze Stadt umspannen könne, wenn<br />
man ihn nicht enthaupten, sondern leben ließe. Bereits kurz nach seinem Tod<br />
__wurde_______ intensiv nach möglichen Schatzverstecken in Marienhafe und auf<br />
Helgoland gesucht. Gefunden hat man aber nichts.<br />
KOMPETENZBEREICH: SPRACHE UND SPRACHGEBRAUCH UNTERSUCHEN<br />
Text leicht verändert aus: WAS IST WAS, Band 96,<br />
Schatzsuche, Tessloff Verlag, Nürnberg.<br />
52
Erfasste Kompetenz<br />
laut<br />
Bildungsstandards<br />
Textbeschaffenheit analysieren und reflektieren<br />
Anforderungsbereich II – Flexion und Zeitenbildung im Kontext<br />
Erläuterung<br />
Hinweise zur<br />
Weiterarbeit<br />
Besondere Hinweise<br />
Vorgegebene Verben müssen in die Vergangenheitsform<br />
gesetzt werden. Dabei ist die Subjekt-Prädikat-<br />
Kongruenz zu beachten.<br />
Fehlerschwerpunkte in der Erprobung waren die Lücken<br />
5, 12, 16. Sinnvoll könnte die Zeitenbildung starker<br />
Verben auch ohne den Satzkontext geübt werden (bieten<br />
- bot, ziehen - zog), z.B. mit Wortlistentraining,<br />
Sprachspielen.<br />
Rechtschreibung wird nicht gewertet, solange man das<br />
Wort noch erkennt:<br />
z. B. nanten, kapperte, filen…<br />
Falsch wäre z.B. gäng, gingte, nennten<br />
KOMPETENZBEREICH: SPRACHE UND SPRACHGEBRAUCH UNTERSUCHEN<br />
53
Aufgabe zu Konjunktionen – Handy:<br />
Lösungen und Hinweise<br />
Setze in die Lücken eine passende Konjunktion aus<br />
dem Kasten ein, wie in dem folgenden Beispiel.<br />
Verwende jede Konjunktion nur einmal.<br />
aber, weil, dass, und, deshalb, während, obwohl, da, bevor, sondern, damit, sodass<br />
Beispiel: Heute habe ich endlich das nötige Geld zusammengespart, sodass ich<br />
1/2<br />
mir ein Handy kaufen kann.<br />
Weil/Da die Auswahl sehr groß ist und ich<br />
nicht alles überblicken kann, habe ich meinen großen Bruder mitgenommen.<br />
Schon nach kurzer Zeit haben wir uns entschieden.<br />
3 Während wir uns im Geschäft aufhalten, wartet mein<br />
Freund draußen.<br />
4/5 Obwohl er keine Zeit hat, da/weil er<br />
zum Training muss, wartet er, bis wir fertig sind.<br />
6 Bevor ich überhaupt etwas sagen kann, will er schon<br />
meine Nummer haben.<br />
7 Aber ich kann sie doch nicht auswendig.<br />
8/9 Deshalb suche ich im neuen Handy meine Nummer,<br />
damit er sie aufschreiben kann.<br />
KOMPETENZBEREICH: SPRACHE UND SPRACHGEBRAUCH UNTERSUCHEN<br />
54
Erfasste Kompetenz<br />
laut<br />
Bildungsstandards<br />
Anforderungsbereich<br />
Erläuterung<br />
Hinweise zur<br />
Weiterarbeit<br />
Besondere Hinweise<br />
Textbeschaffenheit analysieren und reflektieren<br />
II – Zusammenhänge herstellen (Klassifizierung und<br />
Transfer)<br />
Verknüpfungen in Satzreihen und einfachen<br />
Satzverbindungen sinngemäß ergänzen zu können, ist<br />
eine grundlegende Kompetenz. Den Schülerinnen und<br />
Schülern sollte bekannt sein, welchen<br />
Sinnzusammenhang die einzelnen Konjunktionen<br />
ausdrücken.<br />
Es bietet sich an, Schülertexte unter der Fragestellung<br />
zu untersuchen, welche Konjunktionen sinnvollerweise<br />
zur Verknüpfung von Sätzen genutzt werden können.<br />
Die Kenntnis der Austauschprobe ist wichtig, um<br />
verschiedene Konjunktionen einsetzen und deren<br />
Funktion für den Sinnzusammenhang zu erfassen.<br />
Weiterführende Aufgaben können darauf abzielen,<br />
unverbundene Sätze mit Konjunktionen zu verbinden<br />
und adverbiale Bestimmungen in Nebensätze<br />
umzuwandeln (bzw. umgekehrt).<br />
Fehlerschwerpunkt in der Erprobung war Lücke vier.<br />
Konjunktionen, die einen Konzessivsatz einleiten,<br />
könnten gesondert geübt werden.<br />
„Da“ und „weil“ darf jeweils nur einmal verwendet<br />
werden. Die Rechtschreibung wird nicht gewertet.<br />
KOMPETENZBEREICH: SPRACHE UND SPRACHGEBRAUCH UNTERSUCHEN<br />
55