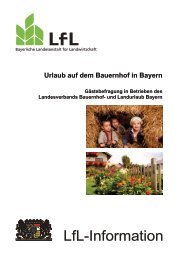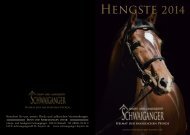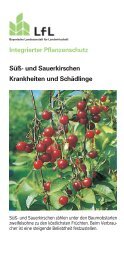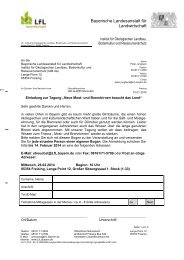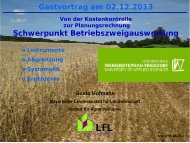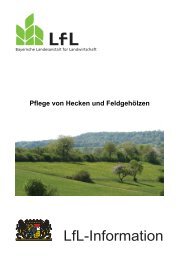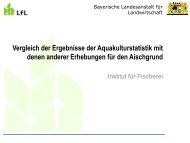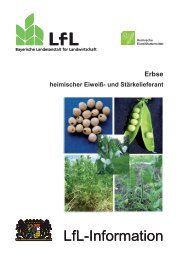Perspektiven der integrierten Hähnchen-, Puten - Bayerische ...
Perspektiven der integrierten Hähnchen-, Puten - Bayerische ...
Perspektiven der integrierten Hähnchen-, Puten - Bayerische ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Bayerische</strong> Landesanstalt für Landwirtschaft<br />
<strong>Perspektiven</strong> <strong>der</strong><br />
<strong>integrierten</strong> <strong>Hähnchen</strong>-,<br />
<strong>Puten</strong>- und Pekingentenproduktion<br />
in Bayern<br />
13<br />
2008<br />
Schriftenreihe ISSN 1611-4159
Impressum:<br />
Herausgeber: <strong>Bayerische</strong> Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL)<br />
Vöttinger Straße 38, 85354 Freising-Weihenstephan<br />
Internet: http://www.LfL.bayern.de<br />
Redaktion: <strong>Bayerische</strong> Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL)<br />
Lehr-, Versuchs- und Fachzentrum für Schweine und Geflügelhaltung<br />
Mainbernheimer Straße 101, 97318 Kitzingen<br />
E-Mail: LVFZ-Kitzingen@lfl.bayern.de<br />
Tel.: 09321/39008-0<br />
1. Auflage November / 2008<br />
Druck: ES-Druck, 85356 Tüntenhausen<br />
Schutzgebühr: 10.- €<br />
© LfL
<strong>Perspektiven</strong> <strong>der</strong> <strong>integrierten</strong><br />
<strong>Hähnchen</strong>-, <strong>Puten</strong>- und Pekingenten-<br />
produktion in Bayern<br />
Dipl. Ing. agr. A. Tischler, Dr. K. Damme,<br />
Prof. Dr. S. Graser<br />
Schriftenreihe <strong>der</strong> <strong>Bayerische</strong>n Landesanstalt für Landwirtschaft
Inhalt<br />
1 Einleitung ..................................................................................................................9<br />
2 Marktsituation in Deutschland und Bayern ........................................................10<br />
2.1 Versorgungssituation in Deutschland ......................................................................10<br />
2.2 Entwicklung des Verbrauchs in Deutschland ..........................................................11<br />
2.3 Erzeugerpreis und Verbraucherpreis in Deutschland ...............................................16<br />
2.3.1 Erzeugerpreis............................................................................................................16<br />
2.3.2 Verbraucherpreis ......................................................................................................18<br />
2.4 Marktstruktur und Marktsituation in Bayern ...........................................................19<br />
2.4.1 Marktstruktur ...........................................................................................................19<br />
2.4.2 Marktsituation ..........................................................................................................22<br />
2.5 Chancen und Risiken am Geflügelmarkt .................................................................22<br />
3 Rahmenbedingungen .............................................................................................23<br />
3.1 Richtlinien und freiwillige Vereinbarungen zur Geflügelhaltung ...........................23<br />
3.1.1 Freiwillige Vereinbarung und EU-Richtlinie zur Haltung von Masthähnchen .......24<br />
3.1.2 Freiwillige Vereinbarung für die <strong>Puten</strong>haltung........................................................26<br />
3.1.3 Freiwillige Vereinbarung für die Pekingentenhaltung .............................................26<br />
3.2 Baurecht ...................................................................................................................27<br />
3.3 Zoonosenverordnung- Salmonellen .........................................................................29<br />
4 Geflügelschlachtereien für Bayern .......................................................................31<br />
4.1 Wiesenhof ................................................................................................................31<br />
4.2 Süddeutsche Truthahn AG .......................................................................................33<br />
4.3 Velisco Geflügel GmbH & Co. KG .........................................................................34<br />
4.4 Wichmann Enten GmbH ..........................................................................................35<br />
5 Produktions- und Investitionsbedingungen .........................................................37<br />
5.1 Verfahrenstechnik ....................................................................................................37<br />
5.1.1 <strong>Hähnchen</strong>mast ..........................................................................................................37<br />
5.1.2 <strong>Puten</strong>mast .................................................................................................................38<br />
5.1.3 Pekingentenmast ......................................................................................................39<br />
5.2 Produktionskennzahlen ............................................................................................40<br />
5.3 Arbeitszeitaufwand <strong>der</strong> laufenden Produktion .........................................................41<br />
5.4 Investitionsbedarf eines Neubaus .............................................................................46<br />
5.5 Direktkosten in <strong>der</strong> Geflügelmast ............................................................................49<br />
5.6 Auswirkungen von Kosten- und Erlösverän<strong>der</strong>ungen .............................................50<br />
6 Betriebswirtschaftliche Wertung <strong>der</strong> Geflügelmast ...........................................51
6.1 Betriebszweigabrechnung für die gewerbliche <strong>Hähnchen</strong>mast ...............................51<br />
6.2 Betriebszweigabrechnung für die gewerbliche <strong>Puten</strong>mast ......................................54<br />
6.3 Betriebszweigabrechnung für die gewerbliche Pekingentenmast ............................58<br />
6.4 Nicht berücksichtigte Kosten und weiter Umsatzerlöse ..........................................61<br />
6.4.1 Vergünstigungen und Prämien .................................................................................61<br />
6.4.2 MwSt.-Vorteil ..........................................................................................................62<br />
6.4.3 Einzelbetriebliche Investitionsför<strong>der</strong>ung .................................................................63<br />
6.4.4 Maschinenkosten ......................................................................................................63<br />
6.4.5 Bewertung des Geflügelmistes .................................................................................64<br />
7 Abschlussbetrachtung <strong>der</strong> Chancen und Risiken in <strong>der</strong> Geflügelmast ............65<br />
7.1 Direktkostenfreie Leistungen <strong>der</strong> Mastverfahren pro m 2 Stallnutzfläche im<br />
Dreijahresvergleich ..................................................................................................67<br />
7.2 Einzelbetrachtung <strong>der</strong> Mastverfahren ......................................................................69<br />
7.2.1 <strong>Puten</strong>mast im 18-Wochenrhythmus als Umtriebsverfahren ....................................70<br />
7.2.2 <strong>Puten</strong>mast im 24-Wochenrhythmus als Rein-Raus-Verfahren ................................70<br />
7.2.3 <strong>Hähnchen</strong>mast als Splittingverfahren ......................................................................71<br />
7.2.4 Pekingentenmast als Umtriebsverfahren ..................................................................72<br />
7.3 Begrenzen<strong>der</strong> Faktor Arbeit und Kapital .................................................................73<br />
7.4 Nicht berücksichtigte Kosten und weiter Umsatzerlöse pro m 2<br />
Stallnutzfläche ..........................................................................................................74<br />
8 Fazit <strong>der</strong> Geflügelmast in Bayern .........................................................................76<br />
9 Zusammenfassung ..................................................................................................78<br />
Roadmap: Der Weg in die Geflügelmast .........................................................................79<br />
Literaturverzeichnis ..........................................................................................................82
Abbildungsverzeichnis<br />
Abbildung 1: Pro-Kopf-Verbrauch von Geflügelfleisch in Deutschland (Graser, Groß,<br />
Damme, & Schmidtlein, 2004)(Böttcher W. , 2008) ............................................12<br />
Abbildung 2: Pro-Kopf-Verbrauch nach Geflügelarten (Böttcher W. , Beck, Bilsing, &<br />
Schmidt, 2007), (Böttcher W. , 2008)(Graser, Groß, Damme, &<br />
Schmidtlein, 2004) ...............................................................................................13<br />
Abbildung 3: <strong>Hähnchen</strong>einkäufe nach Einkaufsstätten 2004 und 2007 (Beck,<br />
Marktanalyse zum GfK Haushaltspanel, 2008) ...................................................14<br />
Abbildung 4: <strong>Puten</strong>einkäufe nach Einkaufsstätten 2004 und 2007 (Beck, Marktanalyse<br />
zum GfK Haushaltspanel, 2008) ..........................................................................15<br />
Abbildung 5: Enteneinkäufe nach Einkaufstätten 2005 und 2006 (Beck, Der<br />
Entenmarkt wächst weiter, 2007) .........................................................................16<br />
Abbildung 6: Blick in einen <strong>Hähnchen</strong>maststall ........................................................................37<br />
Abbildung 7: Blick in einen Offenstall für die <strong>Puten</strong>mast .........................................................38<br />
Abbildung 8: Blick in einen Pekingentenmaststall ....................................................................39<br />
Abbildung 9: Prozentuelle Verteilung <strong>der</strong> einzelnen Arbeitsschritte pro Durchgang<br />
(Erstellt aus eigener Umfrage) .............................................................................43<br />
Abbildung 10: Arbeitszeitspitzen in <strong>der</strong> <strong>Hähnchen</strong>mast bei einem Splittingverfahren<br />
(Eigene Auswertung von 6 befragten Landwirten) ..............................................44<br />
Abbildung 11: Arbeitszeitspitzen in <strong>der</strong> Pekingentenmast bei einem Umtriebsverfahren<br />
(Eigene Auswertung von 3 befragten Landwirten) ..............................................45<br />
Abbildung 12: Arbeitszeitspitzen in <strong>der</strong> <strong>Puten</strong>mast bei einem 18-Wochenrhythmus<br />
(Eigene Auswertung von 3 befragten Landwirten) ..............................................46<br />
Abbildung 13: Direktkosten <strong>der</strong> Pekingenten- <strong>Hähnchen</strong> und <strong>Puten</strong>mast in 100% (eigene<br />
Berechnung) .........................................................................................................50<br />
Abbildung 14: Dkf L. je <strong>Hähnchen</strong>-MP im Verlauf von 2002-2007 ...........................................54<br />
Abbildung 15: Dkf L. je <strong>Puten</strong>-MP im Verlauf von 2002-2007 ..................................................58<br />
Abbildung 16: Dkf L. je Pekingenten-MP im Verlauf von 2006-2008 ........................................61<br />
Abbildung 17: Direktkostenfreie Leistungen und Betriebszweiggewinn pro Jahr und m 2<br />
Stallnutzfläche ......................................................................................................68<br />
Abbildung 18: Dkf L. abzüglich Arbeit und FK II pro m 2 Stallnutzfläche .................................69<br />
Abbildung 19: Zusätzliche Einkünfte und Kosten pro m 2 Stallnutzfläche (Punkt: 8.4) ..............75
Tabellenverzeichnis<br />
Tabelle 1: Versorgungsbilanz Geflügelfleisch in Deutschland 2007 ...............................10<br />
Tabelle 2: Erzeugerpreise für Geflügelfleisch ..................................................................17<br />
Tabelle 3: Jahresdurchschnittsbörsenpreise für Futtermittel in Deutschland in<br />
€/100 kg ...........................................................................................................18<br />
Tabelle 4: Verbraucherpreise für Geflügelfleisch ............................................................19<br />
Tabelle 5: Anzahl <strong>der</strong> Geflügelhalter in Bayern ...............................................................19<br />
Tabelle 6: Geflügelbestand in Bayern in 1.000 Stück ......................................................20<br />
Tabelle 7: Bestandsgrößenstruktur in <strong>der</strong> Junghühnermast 2007 .....................................20<br />
Tabelle 8: Durchschnittliche Geflügelbestände in Stück je Halter ...................................21<br />
Tabelle 9: Mastgeflügelerzeugung nach Schlachtgewicht in Bayern in 1.000 t * ............22<br />
Tabelle 10: Differenz aus eigenerzeugtem Schlachtgewicht und Verbrauch in<br />
Bayern ..............................................................................................................22<br />
Tabelle 11: Richtzahlen für Tränken bei <strong>der</strong> Aufzucht von Pekingenten ..........................27<br />
Tabelle 12: Grenzen für ein immissionsschutzrechtliches Genehmigungsverfahren .........28<br />
Tabelle 13: EU-Richtlinien und gesetzliche Regelungen für ein<br />
Baugenehmigungsverfahren ............................................................................29<br />
Tabelle 14: Anhang I <strong>der</strong> EU-Zoonosenverordnung ..........................................................30<br />
Tabelle 15: Zugelassende Geflügelschlachtbetriebe in Bayern ...........................................31<br />
Tabelle 16: Durchschnittliche Produktionskennzahlen von Broiler, Pute und<br />
Pekingente im Jahr 2007 ..................................................................................41<br />
Tabelle 17: Arbeitszeitbedarf in <strong>der</strong> Geflügelmast .............................................................42<br />
Tabelle 18: Beschreibung <strong>der</strong> Festkostenberechnung ........................................................47<br />
Tabelle 19: Gebäudefestkosten für die einzelnen Mastformen ..........................................48<br />
Tabelle 20: Überblick über die Direktkosten in <strong>der</strong> Geflügelmast ohne MwSt. ................49<br />
Tabelle 21: Än<strong>der</strong>ung verschiedener Faktoren und <strong>der</strong>en Auswirkungen auf die<br />
Deckungsbeitragsrechnung ..............................................................................51<br />
Tabelle 22: Mastkennzahlen und Direktkosten <strong>der</strong> <strong>Hähnchen</strong>mast <strong>der</strong> 25% besten<br />
Betriebe von 2007 und über einen Zeitraum von 2002 bis 2007, alle<br />
Kosten ohne MwSt. .........................................................................................52<br />
Tabelle 23: Betriebszweigabrechnung für die <strong>Hähnchen</strong>mast im Splittingverfahren<br />
ohne MwSt. ......................................................................................................53<br />
Tabelle 24: Werte <strong>der</strong> 25% besten Betriebe von 2007 und über einen Zeitraum von<br />
2002 bis 2007 ohne MwSt. ..............................................................................55<br />
Tabelle 25: Betriebszweigabrechnung für die <strong>Puten</strong>mast mit einem 24-<br />
Wochenrhythmus ohne MwSt. ........................................................................56<br />
Tabelle 26: Betriebszweigabrechnung für die <strong>Puten</strong>mast mit einem 18-<br />
Wochenrhythmus ohne MwSt. ........................................................................57
Tabelle 27: Werte <strong>der</strong> 30% besten Betriebe und über einen Zeitraum von 2006-<br />
2008 .................................................................................................................59<br />
Tabelle 28: Betriebszweigabrechnung für die Pekingentenmast im<br />
Umtriebsverfahren ohne MwSt. ......................................................................60<br />
Tabelle 29: Vergünstigungen <strong>der</strong> Integrationsbetriebe, Schlachthöfe und Zulieferer ........62<br />
Tabelle 30: MwSt.-Vorteil mit den aktuellen Steuersätzen unter Verwendung <strong>der</strong><br />
∅-Kosten und -Erlösen <strong>der</strong> letzten Jahre bei <strong>der</strong> <strong>Hähnchen</strong>-, <strong>Puten</strong>und<br />
Pekingentenmast ......................................................................................63<br />
Tabelle 31: Maschinenkosten .............................................................................................64<br />
Tabelle 32: Reinnährstoffpreise für N, P2O5 und K2O .....................................................64<br />
Tabelle 33: Dungwertberechnung .......................................................................................65<br />
Tabelle 34: Begrenzen<strong>der</strong> Faktor Arbeit mit 2.000 Akh ....................................................73<br />
Tabelle 35: Begrenzen<strong>der</strong> Faktor Kapital mit 400.000 Euro ..............................................73
Einleitung 9<br />
1 Einleitung<br />
Das Wirtschaftsjahr 2007/2008 war geprägt von deutlich gestiegenen landwirtschaftlichen<br />
Rohstoffpreisen mit oft entgegengesetzten ökonomischen Konsequenzen für die Betriebe.<br />
Während die Ackerbauern gute Erlöse für ihre Getreideernte realisieren konnten, hatten<br />
die Veredelungsbetriebe durch die sehr stark gestiegenen Futtermittelpreise mit hohen<br />
Produktionskosten zu kämpfen. Die Gründe für die erhöhten Getreidepreise sind vielfältig.<br />
Zum einen gewinnen die Rohstoffmärkte nach den Enttäuschungen in an<strong>der</strong>en Börsenbereichen<br />
für Spekulanten immer mehr an Attraktivität, auf <strong>der</strong> an<strong>der</strong>en Seite führt die stetig<br />
wachsende Weltbevölkerung und ihr Bedarf nach veredelten Produkten zu einem ansteigenden<br />
Nahrungsmittelverbrauch. Hinzu kommt die weltweit wachsende Produktion von<br />
erneuerbaren Energien, wodurch Flächen gebunden werden, die <strong>der</strong> Erzeugung von Futtergetreide<br />
fehlen. Schreiten diese Entwicklungen weiter voran, wird die Versorgung <strong>der</strong><br />
Weltbevölkerung mit pflanzlichen und tierischen Produkten ein zunehmendes Problem.<br />
Für die Versorgung mit tierischem Eiweiß hat das Geflügel ideale Voraussetzungen, um<br />
kostengünstig und effizient erzeugt zu werden. Gerade bei dem entscheidenden Kostenfaktor<br />
Futter ist das Geflügel aufgrund <strong>der</strong> sehr guten Futterverwertung an<strong>der</strong>en Produktionszweigen,<br />
wie z.B. <strong>der</strong> Rin<strong>der</strong>- o<strong>der</strong> <strong>der</strong> Schweinemast, überlegen. Auch bei den Verbrauchern<br />
erfreut sich das Geflügelfleisch, sowohl wegen <strong>der</strong> einfachen und schnellen<br />
Zubereitung, als auch wegen des geringen Fett- und hohen Proteingehalts wachsen<strong>der</strong> Beliebtheit.<br />
Zudem wird <strong>der</strong> Verzehr von Geflügelfleisch von religiösen Gemeinschaften<br />
nicht als bedenklich angesehen. Aus diesen Gründen spielt <strong>der</strong> Verbrauch von Geflügelfleisch<br />
nicht nur weltweit, son<strong>der</strong>n auch in Deutschland eine immer wichtigere Rolle. Allein<br />
in den letzten Jahren stieg <strong>der</strong> Pro-Kopf-Verbrauch um knapp 10% an. Wie attraktiv<br />
sich die Geflügelhaltung für einen Mäster in Bayern darstellt und welche Mastverfahren<br />
am erfolgversprechendsten sind, soll mit Hilfe <strong>der</strong> folgenden Betrachtungen geklärt werden.<br />
In <strong>der</strong> vorliegenden Studie wurde die integrierte Kettenproduktion von <strong>Hähnchen</strong>,<br />
<strong>Puten</strong> und Pekingenten in den Mittelpunkt <strong>der</strong> Betrachtung gestellt, nachdem die Schlachtung<br />
von Geflügel in bäuerlichen Betrieben mit Direktvermarktung nur noch eine regionale<br />
Bedeutung hat und <strong>der</strong> Marktanteil <strong>der</strong> ökologischen Geflügelproduktion <strong>der</strong>zeit unter<br />
0,5% liegt.
10 Marktsituation in Deutschland und Bayern<br />
2 Marktsituation in Deutschland und Bayern<br />
2.1 Versorgungssituation in Deutschland<br />
Eine Betrachtung <strong>der</strong> Marktsituation in Bayern ist nur eingeschränkt möglich, da es keine<br />
genauen Daten über den regionalen Verbrauch von Geflügelfleisch gibt. Eine Analyse <strong>der</strong><br />
gesamten Versorgungssituation in Deutschland ist deshalb notwendig.<br />
Der deutsche Geflügelmarkt hat sich gemäß <strong>der</strong> ZMP (Zentrale Markt- und Preisberichtstelle<br />
GmbH) im Jahr 2007 wie<strong>der</strong> von dem Tief des Jahres 2006 erholt, welches durch die<br />
Vogelgrippe ausgelöst wurde. Die Bruttoeigenerzeugung bei Geflügel steigerte sich um<br />
über 7% gegenüber dem Vorjahr. Ein weiteres Wachstum <strong>der</strong> Geflügelfleischproduktion<br />
wird im Jahr 2008 erwartet, dieses soll vor allem die Produktion in <strong>der</strong> <strong>Hähnchen</strong>mast<br />
betreffen.(Böttcher W. , Beck, Bilsing, & Schmidt, 2008)<br />
In <strong>der</strong> Tabelle 1 ist die Versorgungsbilanz 2007 von Geflügelfleisch in Deutschland dargestellt.<br />
Sie zeigt die Bruttoeigenerzeugung in Höhe von 1,27 Mio. Tonnen. Die Nettoerzeugung<br />
eines Landes wird errechnet, indem zur Menge <strong>der</strong> im Inland produzierten Produkte,<br />
also zur Bruttoeigenerzeugung, die Einfuhr <strong>der</strong> lebenden Tiere hinzugerechnet und<br />
die Ausfuhr von lebenden Tieren subtrahiert wird. Diese Zahl sagt aus, wie viel Schlachtgewicht<br />
(SG) aus heimischem und importiertem Geflügel zur Verfügung steht. Der Verbrauch<br />
wird ermittelt, indem von <strong>der</strong> Nettoerzeugung <strong>der</strong> Export von Fleisch abgezogen<br />
und <strong>der</strong> Import hinzuaddiert wird. Der Verbrauch pro Kopf errechnet sich aus dem Verbrauch<br />
geteilt durch die Einwohnerzahl Deutschlands. Der Selbstversorgungsgrad ergibt<br />
sich, indem die Bruttoeigenerzeugung durch den Verbrauch dividiert wird.<br />
Tabelle 1: Versorgungsbilanz Geflügelfleisch in Deutschland 2007<br />
Einheiten<br />
Geflügelfleisch<br />
gesamt<br />
Hühner<br />
gesamt<br />
davon<br />
Jungmasthühner<br />
Enten Gänse<br />
<strong>Puten</strong> u. sonst.<br />
Geflügel<br />
Bruttoeigenerzeugung 1.000 t SG* 1.267,5 876,5 X 55,0 4,0 332,0<br />
Einfuhr, lebend 1.000 t SG* 70,5 18,5 X 0,0 0,0 52,0<br />
Ausfuhr, lebend 1.000 t SG 196,0 190,0 X 2,0 0,0 4,0<br />
Nettoerzeugung 1.000 t SG 1.142,0 705,0 657,0 53,0 4,0 380,0<br />
Einfuhr, Fleisch 1.000 t SG 872,1 536,3 513,3 45,0 41,7 249,1<br />
Ausfuhr, Fleisch 1.000 t SG 534,3 381,9 359,9 19,1 7,4 126,0<br />
Verbrauch 1.000 t SG 1.479,7 859,4 810 78,9 38,3 503,1<br />
Verbrauch je Kopf kg 18 10,4 9,9 1,0 0,5 6,1<br />
Selbstversorgungsgrad % 85,7 102,0 X 69,7 10,4 66,0<br />
*Schlachtgewicht<br />
Quelle: (Böttcher W. , Beck, Bilsing, & Schmidt, 2008)<br />
Die Bruttoeigenerzeugung von Geflügel konnte in den letzten 5 Jahren um 23,5% zulegen.<br />
Nach dem leichten Rückgang im Jahr 2006 aufgrund <strong>der</strong> Vogelgrippe betrug <strong>der</strong> Anstieg<br />
von 2006 auf 2007 etwas mehr als 7%. Die Nettoerzeugung nahm in den letzten fünf Jahren<br />
um 28 Prozent zu. Der Pro-Kopf-Verbrauch blieb im gleichen Zeitraum bis auf den<br />
Einbruch 2006 auf hohem Niveau relativ stabil. Im Jahr 2007 wurde mit 18,0 kg das beste
Marktsituation in Deutschland und Bayern 11<br />
Ergebnis seit <strong>der</strong> BSE-Krise erreicht.<br />
In <strong>der</strong> Bruttoeigen- und Nettoerzeugung verzeichnete das Marktsegment <strong>der</strong> Hühner in<br />
den letzten Jahren die höchste Steigerung. Diese Erhöhung ist fast ausschließlich den<br />
Jungmasthühnern zuzuschreiben. Die Hühner erreichten als einziges Geflügel seit dem<br />
Jahr 2006 einen Selbstversorgungsgrad von über 100 Prozent. Im Jahr 2007 stieg <strong>der</strong><br />
Selbstversorgungsgrad weiter an, da die Bruttoeigenerzeugung stärker gewachsen ist als<br />
<strong>der</strong> Verbrauch. Nachdem die Ein- und Ausfuhr von Geflügelfleisch im Jahr 2006 stagnierte,<br />
konnten beide Bereiche nach Überwindung <strong>der</strong> Vogelgrippe im Jahr 2007 wie<strong>der</strong> zulegen.<br />
Im Vergleich zum Vorjahr wurde die Einfuhr um 16% erhöht, die Ausfuhr von Geflügelfleisch<br />
hingegen um 30%.<br />
Bei Enten stieg <strong>der</strong> Selbstversorgungsgrad in den Jahren 2002 bis 2007 von 59% auf<br />
knapp 70%. Dies lag vor allem an <strong>der</strong> gewachsenen Bruttoeigenerzeugung. Der Pro-Kopf-<br />
Verbrauch bei Enten blieb die letzten fünf Jahren relativ konstant zwischen 0,9 bis 1 kg<br />
pro Kopf. Lediglich im Vogelgrippejahr 2006 sank dieser Wert auf 0,8 kg. Auch im Jahr<br />
2007 wurden keine lebenden Enten nach Deutschland eingeführt. Der Export von in<br />
Deutschland gemästeten Enten sank 2007 um über 50% gegenüber dem Vorjahr. Hingegen<br />
konnte <strong>der</strong> Export von Entenfleisch um gut 22% gesteigert werden. Der Verbrauch<br />
von Entenfleisch erholte sich vom vogelgrippebedingten Einbruch sehr gut und lag 2007<br />
so hoch wie seit dem Jahr 2003 nicht mehr. Vor allem eine Verbrauchssteigerung von Entenfleisch<br />
von den Monaten Januar bis August um 37,2% lässt eine Etablierung von Entenfleisch<br />
als Ganzjahresprodukt erhoffen.(Beck, Der Entenmarkt wächst weiter, 2007)<br />
Bei den <strong>Puten</strong> wurde <strong>der</strong> negative Verbrauchstrend <strong>der</strong> Jahre 2005 und 2006 unterbrochen.<br />
Die Bruttoeigenerzeugung hingegen sank seit 2002 um 21.200 Tonnen. Der Selbstversorgungsgrad<br />
ging um 2,1% zurück und erreichte den niedrigsten Wert <strong>der</strong> letzten fünf Jahre.<br />
Die Ursache hierfür ist, dass <strong>der</strong> Verbrauch stärker angestiegen ist als die Bruttoeigenerzeugung.<br />
Im Gegenzug stieg <strong>der</strong> Import stärker als <strong>der</strong> Export.(Böttcher W. , Beck,<br />
Bilsing, & Schmidt, 2007).<br />
2.2 Entwicklung des Verbrauchs in Deutschland<br />
In <strong>der</strong> Abbildung 1 ist <strong>der</strong> Pro-Kopf-Verbrauch von Geflügelfleisch in Deutschland von<br />
1995 bis 2007 dargestellt. Betrachtet man diesen Zeitraum, lässt sich bis 2004 ein stetiger<br />
Anstieg beobachten. Das Jahr 2001 ist aufgrund <strong>der</strong> BSE-Krise unter beson<strong>der</strong>en Vorzeichen<br />
zu betrachten. Der Konsumeinbruch im Jahr 2006 wurde durch das Auftreten <strong>der</strong><br />
Vogelgrippe verursacht, war allerdings nur von kurzer Dauer. In an<strong>der</strong>en Län<strong>der</strong>n war die<br />
Verbraucherreaktion auf den Geflügelpestausbruch weit aus heftiger, in Italien und Frankreich<br />
z. B. ging <strong>der</strong> Verbrauch zeitweise auf die Hälfte zurück (Uffelmann, 2007).
12 Marktsituation in Deutschland und Bayern<br />
kg pro Kopf<br />
19<br />
18<br />
17<br />
16<br />
15<br />
14<br />
13<br />
12<br />
11<br />
10<br />
13,4<br />
14,1<br />
14,8<br />
15,2<br />
BSE-Krise<br />
15,3<br />
16<br />
Abbildung 1: Pro-Kopf-Verbrauch von Geflügelfleisch in Deutschland<br />
(Graser, Groß, Damme, & Schmidtlein, 2004)(Böttcher W. , 2008)<br />
Um die Stagnation des Verbrauchs in den letzten fünf Jahren besser analysieren zu können,<br />
ist eine genauere Betrachtung des Pro-Kopf-Verbrauchs <strong>der</strong> einzelnen Geflügelarten<br />
notwendig wie in Abbildung 2 dargestellt. Hier wird ersichtlich, dass <strong>der</strong> Pro-Kopf-<br />
Verbrauch von Gänsen und Enten bereits über einen längeren Zeitraum stagniert. Bei den<br />
<strong>Puten</strong> lässt sich zwar ausgehend vom Jahr 1997 noch ein Anstieg im Konsum verzeichnen,<br />
allerdings sank <strong>der</strong> Verbrauch von 2004 bis 2006 um jeweils 300g. Dieser Negativtrend<br />
konnte im Jahr 2007 mit einer Steigerung von 200g unterbrochen werden. Trotz dieses<br />
Rückgangs liegt <strong>der</strong> deutsche <strong>Puten</strong>fleischverbrauch noch in <strong>der</strong> EU-Spitzengruppe mit<br />
Österreich und Frankreich. (Böttcher W. , Beck, Bilsing, & Schmidt, 2007) Der Pro-Kopf-<br />
Verbrauch <strong>der</strong> Jungmasthühner konnte jedes Jahr zulegen, wenn das durch die BSE-Krise<br />
begünstigte Jahr 2001 außer acht gelassen und <strong>der</strong> vogelgrippebedingte Einbruch des Jahres<br />
2006 nicht mitberücksichtigt wird. Der Bereich <strong>der</strong> Hühner und Althähne verliert hingegen<br />
von Jahr zu Jahr mehr an Bedeutung beim Verbrauch.<br />
18,2<br />
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007<br />
Jahre<br />
17,2<br />
17,6<br />
17,7<br />
Geflügelpest<br />
17,5<br />
16,7<br />
18,0
Marktsituation in Deutschland und Bayern 13<br />
kg pro Kopf<br />
20,0<br />
18,0<br />
16,0<br />
14,0<br />
12,0<br />
10,0<br />
8,0<br />
6,0<br />
4,0<br />
2,0<br />
0,0<br />
7,8<br />
8,0 7,9<br />
1,0 1,0 0,9<br />
0,9 1,0 0,9<br />
0,4 0,4<br />
0,4<br />
4,8 4,9 5,1<br />
8,2<br />
0,9<br />
0,9<br />
0,4<br />
5,6<br />
9,6<br />
0,9 0,9 0,8 0,8<br />
1,0<br />
0,4<br />
0,9<br />
0,3<br />
1,0<br />
0,4<br />
0,9<br />
0,4<br />
6,3 6,4 6,4 6,5 6,2 5,9 6,1<br />
Abbildung 2: Pro-Kopf-Verbrauch nach Geflügelarten<br />
(Böttcher W. , Beck, Bilsing, & Schmidt, 2007), (Böttcher W. , 2008)<br />
(Graser, Groß, Damme, & Schmidtlein, 2004)<br />
Die eingekaufte Menge an Geflügelfleisch nach Einkaufsstätten geben einen weiteren<br />
Aufschluss über die Tendenzen am Geflügelmarkt.<br />
Am <strong>Hähnchen</strong>markt konnte <strong>der</strong> Absatz 2007 im Vergleich zum Vorjahr um 10,3% gesteigert<br />
werden. Somit beträgt die Einkaufsmenge <strong>der</strong> privaten Haushalte im Jahr 2007<br />
231.906 t. In Abbildung 3 ist die Verteilung dieser Menge nach den Einkaufsstätten dargestellt.<br />
Zudem sind die privaten Einkäufe nochmals unterteilt in den Kauf von Tiefkühlkost-<br />
(TK-) Ware und in frische, nicht eingefrorene Ware. Der Trend geht in diesem Bereich<br />
in Richtung <strong>der</strong> Frischware, wie <strong>der</strong> Zugewinn von frischem <strong>Hähnchen</strong>fleisch von<br />
2004 bis 2007 um 8,3% zeigt. Bei <strong>der</strong> TK-Ware halten die Discounter (mit Aldi) über<br />
52% des Marktanteils. Werden die Discounter zusammen betrachtet sind Unterschiede<br />
zwischen dem Jahr 2004 und dem Jahr 2007 kaum feststellbar. Wird Aldi separat analysiert,<br />
ist ein Verlust des Marktanteils im TK-Sektor von 6,9% festzustellen. Diese Marktanteile<br />
wurden unter den Verbrauchermärkten und den an<strong>der</strong>en Discountern ohne Aldi<br />
aufgeteilt. Auch bei Frischfleisch haben die Discounter mit Aldi über 40% des Marktanteils.<br />
Hier ist <strong>der</strong> Anstieg des Marktanteils bei Aldi erstaunlich. Dieser begann erst 2004 in<br />
8,7<br />
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007<br />
Jahre<br />
<strong>Puten</strong>, sonst. Geflügel Gänse Enten Hühner und Althäne Jungmasthühner<br />
9,0<br />
9,2<br />
9,3<br />
0,7<br />
0,9<br />
0,4<br />
9,0<br />
0,6<br />
0,8<br />
0,4<br />
9,9<br />
0,6<br />
1,0<br />
0,5
14 Marktsituation in Deutschland und Bayern<br />
einigen Testmärkten als Frischgeflügelfleischanbieter mit einem Marktanteil von 1,9%<br />
und brachte es innerhalb von drei Jahren auf 12,7%. Diese Entwicklung bei Aldi ging allem<br />
Anschein nach zu Lasten des TK-Sektors. Aldi beschreibt die allgemeine Marktsituation,<br />
die sich weg vom gefrosteten Griller mit 1.000 bis 1.050g, hin zu frischer Ware mit<br />
Teilstücken bewegt. Von 1998 bis 2007 stieg <strong>der</strong> Anteil <strong>der</strong> <strong>Hähnchen</strong>schlachtungen in<br />
<strong>der</strong> Angebotsform frisch von 49,1% auf 71,4%. Dies hatte auch eine Umstellung bei den<br />
Landwirten von Kurzmast auf Splitting plus Schwermast mit 2.100g bis 2.300g zur Folge.<br />
Prozent<br />
100%<br />
90%<br />
80%<br />
70%<br />
60%<br />
50%<br />
40%<br />
30%<br />
20%<br />
10%<br />
0%<br />
10,8 10,7<br />
28,3<br />
26,3 19,4 1,9<br />
28,4<br />
31,4<br />
33,1<br />
6,2 5,3<br />
Anteil TK-Ware<br />
2004 2007<br />
50% 41,7%<br />
30,9 27,9<br />
Abbildung 3: <strong>Hähnchen</strong>einkäufe nach Einkaufsstätten 2004 und 2007<br />
(Beck, Marktanalyse zum GfK Haushaltspanel, 2008)<br />
19,7<br />
32<br />
5,3<br />
10,1<br />
Die <strong>Puten</strong>fleischeinkäufe sanken im Vergleich zum Vorjahr um 3,8%. Zieht man das Jahr<br />
2005 als Vergleichsjahr heran, reduzierten sich die Einkäufe sogar um 12,5%. Insgesamt<br />
wurde im Jahr 2007 94.106 t <strong>Puten</strong>fleisch verkauft. In <strong>der</strong> folgenden Abbildung 4 sind die<br />
<strong>Puten</strong>einkäufe nach Einkaufsstätten von 2004 und 2007 dargestellt.<br />
Der Tiefkühlmarkt bei <strong>Puten</strong>fleisch zeigt das gleiche Phänomen, wie <strong>der</strong> <strong>Hähnchen</strong>markt.<br />
Aldi verliert in diesem Marktbereich mehr als 15% und gewinnt beim Frischfleischsektor<br />
innerhalb von drei Jahren einen Marktanteil von über 14,5% zu Lasten aller an<strong>der</strong>en<br />
Markteilnehmer im Frischfleischsektor. Da gefrostetes <strong>Puten</strong>fleisch weniger als 14% vom<br />
Gesamtverkauf ausmacht, konnte vor allem Aldi in den letzten Jahren seine Marktmacht<br />
im <strong>Puten</strong>fleischsektor ausdehnen. Beim <strong>Puten</strong>fleisch im Allgemeinen geht <strong>der</strong> Trend in<br />
Richtung <strong>der</strong> Weiterverarbeitung. Vor allem die Veredlung zu Wurstwaren und <strong>Puten</strong>spezialitäten<br />
spielt eine immer größere Rolle.<br />
18,3<br />
25,2<br />
12,7<br />
4,4<br />
11,4<br />
Anteil frische Ware<br />
2004 2007<br />
50% 58,3%<br />
Supermarkt/Kleiner. LEH<br />
Verbrauchermarkt/SB-Warenh.<br />
Aldi<br />
Discounter ohne Aldi<br />
Wochenmarkt<br />
Sonstige
Marktsituation in Deutschland und Bayern 15<br />
Prozent<br />
100%<br />
90%<br />
80%<br />
70%<br />
60%<br />
50%<br />
40%<br />
30%<br />
20%<br />
10%<br />
0%<br />
10,3 11,3<br />
30,7<br />
19,2<br />
29,3<br />
36,6<br />
3,9<br />
35,4<br />
10,5 12,9 14,3 11,1<br />
Anteil TK-Ware<br />
2004 2007<br />
17,6% 13,7%<br />
*Zu den gefrorenen <strong>Puten</strong>teilen wurden die ganzen, frischen und gefroren <strong>Puten</strong> hinzugerechnet, da keine Einzelzahlen vorlagen und<br />
die frischen, ganzen <strong>Puten</strong> nur einen verschwindenden Teil ausmachen<br />
Abbildung 4: <strong>Puten</strong>einkäufe nach Einkaufsstätten 2004 und 2007<br />
(Beck, Marktanalyse zum GfK Haushaltspanel, 2008)<br />
18,8<br />
32,4<br />
1,7<br />
29,0<br />
3,8<br />
Von den deutschen Haushalten wurde im Jahr 2006 18.600 t Entenfleisch gekauft. Im<br />
Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies eine Steigerung von 16,3% (Beck, Der Entenmarkt<br />
wächst weiter, 2007). Bei <strong>der</strong> Verteilung auf die Einkaufsstätten kann bei den Enten nur<br />
auf Daten von 2005 und 2006 zurückgegriffen werden. Eine Unterteilung in gefrorene und<br />
frische Ware ist wegen <strong>der</strong> fehlenden Datengrundlage ebenso nicht möglich. Die genaue<br />
Verteilung <strong>der</strong> Einkaufstätten ist in <strong>der</strong> folgenden Abbildung 5 dargestellt.<br />
Bei Entenfleisch ist das Einkaufsverhalten <strong>der</strong> Verbraucher etwas an<strong>der</strong>s als bei Hühner-<br />
und <strong>Puten</strong>fleisch. Enten wurden 2006 zu 46% im traditionellen Lebensmitteleinzelhandel<br />
o<strong>der</strong> in Supermärkten gekauft. Die Discounter sind mit 23% nur die zweit wichtigste Verkaufsform.<br />
Bei <strong>der</strong> Vermarktung setzten die Discounter überwiegend auf Ententeile. Diese<br />
machen 46% in ihrem Entenfleischsortiment aus. Bei an<strong>der</strong>en Einkaufstätten sind die Ententeile<br />
im Schnitt nur mit 29,5% im Sortiment enthalten. Die Verkäufe auf dem Wochenmarkt<br />
und die damit eingeschlossenen Verkäufe vom Erzeuger direkt an den Kunden<br />
verlieren 2%. Dennoch spielt diese Absatzform im Vergleich zu an<strong>der</strong>en Geflügelarten<br />
eine große Rolle (9% im Jahr 2006).(Beck, Der Entenmarkt wächst weiter, 2007)<br />
14,8<br />
28,4<br />
16,3<br />
25,8<br />
3,7<br />
Anteil frische Ware<br />
2004 2007<br />
82,4% 86,3%<br />
Supermarkt/Kleiner. LEH<br />
Verbrauchermarkt/SB-Warenh.<br />
Aldi<br />
Discounter ohne Aldi<br />
Wochenmarkt<br />
Sonstige
16 Marktsituation in Deutschland und Bayern<br />
Prozent<br />
100%<br />
90%<br />
80%<br />
70%<br />
60%<br />
50%<br />
40%<br />
30%<br />
20%<br />
10%<br />
0%<br />
Abbildung 5: Enteneinkäufe nach Einkaufstätten 2005 und 2006<br />
(Beck, Der Entenmarkt wächst weiter, 2007)<br />
Der Zuwachs <strong>der</strong> Discounter im Geflügelfleischbereich geht vor allem zu Lasten des traditionellen<br />
Metzgerhandwerks und <strong>der</strong> Bedienungstheken in den großen Super- und Verbrauchermärkten.<br />
Auch für die sonstigen Einkaufsstätten, wie die Wochen- und Erzeugermärkte,<br />
wirkt sich <strong>der</strong> Zugewinn <strong>der</strong> Discounter negativ aus. Mit diesem Umstieg auf<br />
die Discounter geht ebenso eine Verän<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Verkaufsform einher. Während vorverpackte<br />
Selbstbedienungsware, wie z. B. Wurst, schon lange etabliert ist, zeigt sich bei<br />
Frischfleisch ein rascher Umstieg des Verbrauchers von loser auf fertig abgepackte Ware.<br />
Diese Entwicklung wurde zwar durch die Vogelgrippe und Gammelfleischskandale etwas<br />
gestoppt, tendenziell wird sich diese Entwicklung allerdings fortsetzen. (Uffelmann, 2007)<br />
2.3 Erzeugerpreis und Verbraucherpreis in Deutschland<br />
2.3.1 Erzeugerpreis<br />
48<br />
12<br />
3<br />
20<br />
11 9<br />
7<br />
In den letzten zwei Jahren erlebte <strong>der</strong> Erzeugerpreis rege Schwankungen. Wie sich die<br />
Durchschnittspreise über die Jahre 2001-2007 hinweg entwickelt haben, ist in <strong>der</strong> folgenden<br />
Tabelle 2 ersichtlich. In <strong>der</strong> dargestellten Übersicht sind die Erzeugerpreise für <strong>Hähnchen</strong>,<br />
<strong>Puten</strong> und Pekingenten tabellarisch und grafisch dargestellt.<br />
In den Jahren bis 2005 blieb <strong>der</strong> Preis für <strong>Hähnchen</strong> relativ konstant. Die Vogelgrippe<br />
wirkte sich erst 2006 auf den Jahresdurchschnittspreis bei <strong>Hähnchen</strong> aus, obwohl <strong>der</strong><br />
Markt von <strong>der</strong> Krankheit vom letzten Quartal 2005 bis zum 2. Quartal 2006 beeinflusst<br />
wurde. Im Jahr 2007 gab es für die Erholung des Erzeugerpreises laut <strong>der</strong> Marktanalyse<br />
<strong>der</strong> ZMP verschiedene Gründe. Der Pro-Kopf-Verbrauch von <strong>Hähnchen</strong>fleisch, als Indikator<br />
für die Inlandsnachfrage, konnte 2007 wie<strong>der</strong> um 900g zulegen und erreichte sogar ein<br />
46<br />
9<br />
4<br />
23<br />
2005 2006<br />
TK- und Frischware<br />
Jahre<br />
8<br />
Supermarkt/Trad. LEH<br />
Verbrauchermarkt<br />
Metzgerei<br />
Discounter<br />
Wochenmarkt<br />
Sonstige
Marktsituation in Deutschland und Bayern 17<br />
höheres Niveau als im Jahr 2001. Außerdem legten die <strong>Hähnchen</strong>schlachtungen im Jahr<br />
2007 kräftig zu und zudem erweiterten die inländischen Geflügelschlachtereien ihre<br />
Schlachtkapazitäten. Dies führte zeitweise zu starker Konkurrenz <strong>der</strong> Schlachtereien um<br />
die Mäster und zu einem Preisanstieg gegenüber dem Vorjahr von 18%.(Beck,<br />
Rückschau/Vorschau Geflügelfleisch: Verbrauch 2007 erholt, 2007)<br />
Der <strong>Puten</strong>preis bewegte sich bis zum Jahr 2006 zwischen 0,89 €/kg und 1,04 €/kg, wenn<br />
das Ausnahmejahr 2001 aufgrund <strong>der</strong> BSE-Krise unberücksichtigt bleibt. Der Preisanstieg<br />
2007 kann nicht, wie beim <strong>Hähnchen</strong>fleisch, mit einer angestiegenen Nachfrage erklärt<br />
werden, da das <strong>Puten</strong>fleisch zwar zu Beginn des Jahres rege nachgefragt wurde, sich aber<br />
<strong>der</strong> Verbrauch aufgrund <strong>der</strong> verregneten Grillsaison nicht über das Vorjahr steigern konnte.<br />
Die Preisdifferenz zwischen 2006 und 2007 ist durch die Verknappung des internationalen<br />
Angebots und durch eine konstant bleibende Nachfrage zu erklären. In den EU-15<br />
Län<strong>der</strong>n ging die <strong>Puten</strong>produktion in den letzten 5 Jahren um 15% zurück, allein beim<br />
größten EU-Produzenten Frankreich war die Produktion 2007 um 10% gefallen.(Beck,<br />
Rückschau/Vorschau Geflügelfleisch: Verbrauch 2007 erholt, 2007)<br />
Tabelle 2: Erzeugerpreise für Geflügelfleisch<br />
Erzeugerpreis in Euro pro kg<br />
1,30<br />
1,25<br />
1,20<br />
1,15<br />
1,10<br />
1,05<br />
1,00<br />
0,95<br />
0,90<br />
0,85<br />
0,80<br />
0,75<br />
0,70<br />
0,65<br />
0,60<br />
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Jun. 08<br />
<strong>Hähnchen</strong> bis 1,5 kg (€/kg) 0,71 0,71 0,71 0,67 0,80 0,90<br />
<strong>Hähnchen</strong> bis 1,7 kg (€/kg) 0,68 0,69 0,69 0,66 0,78 0,87<br />
<strong>Puten</strong> ♀ mit 8,5 kg (€/kg) 1,03 0,89 0,94 0,96 0,89 0,89 1,06 1,25<br />
<strong>Puten</strong> ♂mit 18,5 kg (€/kg) 1,13 0,97 1,02 1,04 0,98 0,97 1,13 1,32<br />
Pekingenten (€/kg) 1,02 1,02 1,02 0,99 1,02 0,97 1,07 1,18<br />
Quelle: (Böttcher W. , Beck, Bilsing, & Schmidt, 2007), (Böttcher W. , Beck, Bilsing, & Schmidt, 2008)<br />
Neben <strong>der</strong> positiven Erzeugerpreisentwicklung dürfen die gestiegenen Produktionskosten<br />
nicht vernachlässigt werden. Der Hauptkostenfaktor ist das Futter. Es macht sowohl in <strong>der</strong><br />
<strong>Puten</strong>- und Pekingentenproduktion, als auch in <strong>der</strong> <strong>Hähnchen</strong>produktion 60% <strong>der</strong> Direktkosten<br />
aus. Zudem wirken sich die gestiegenen Futterkosten auch auf die Kükenpreise aus.<br />
Deshalb ist ein Blick auf die Entwicklung <strong>der</strong> Futtermittelpreise gerade bei <strong>der</strong> Geflügelmast,<br />
die überwiegend Fertigmischfutter verwendet, enorm wichtig. Die Preisentwicklung<br />
von wichtigen Futterkomponenten für Mischrationen ist in <strong>der</strong> Tabelle 3 zu sehen. Der
18 Marktsituation in Deutschland und Bayern<br />
Preis für Sojaschrot ist innerhalb eines Jahres um 32%, <strong>der</strong> Preis für Körnermais um 40%<br />
und <strong>der</strong> Preis für Futterweizen sogar um 53% gestiegen. Die Januarnotierung 2008 dieser<br />
Futtermittel liegt sogar noch höher. Die Ursachen für den rapiden Preisanstieg lassen sich<br />
analog zu den Entwicklungen am Getreidemarkt beschreiben. Die schlechte Ernte im Jahr<br />
2007 sowie die Börsenspekulationen mit Agrarrohstoffen bzw. die Subventionierung <strong>der</strong><br />
nachwachsenden Rohstoffe zur Energiegewinnung stehen dafür beispielhaft. Dieser Preisanstieg<br />
<strong>der</strong> Einzelkomponenten wirkt sich wie<strong>der</strong>um auf die Preisentwicklung für Mischfutter<br />
aus. Die Gewinne <strong>der</strong> Mäster wurden trotz <strong>der</strong> höheren Auszahlungspreise im Jahr<br />
2007 durch die höheren Futtermittelpreise gedämpft.<br />
Tabelle 3: Jahresdurchschnittsbörsenpreise für Futtermittel in Deutschland in €/100 kg<br />
Sojaschrot, Hamburg<br />
in €/100 kg<br />
(Inland, 44%Protein)<br />
Körnermais<br />
€/100 kg<br />
(Bundesdurchschnitt)<br />
Futterweizen<br />
€/100 kg<br />
(Bundesdurchschnitt)<br />
2006 2007 Januar 2008<br />
17,66 23,38 31,04<br />
13,52 18,89 23,02<br />
12,17 18,57 24,35<br />
Quelle: (ZMP, Preisspiegel <strong>der</strong> Woche Erzeugerpreise, Großhandelseinstandspreise, Verbraucherpreise, 2008)<br />
2.3.2 Verbraucherpreis<br />
Ein wichtiges Kriterium für die Nachfrage in Deutschland ist <strong>der</strong> Verbraucherpreis und<br />
dessen Entwicklung. Die Verbraucherpreise für bestimmte Geflügelfleischvermarktungsformen<br />
im Verlauf von 2001 bis 2007 sind in <strong>der</strong> Tabelle 4 ausgewiesen und abgebildet.<br />
Sowohl beim <strong>Hähnchen</strong>-, als auch beim <strong>Puten</strong>fleisch sind die Preise von 2001 bis 2005<br />
jährlich gesunken, erst seit 2006 ist dieser Trend gestoppt. Erstaunlich ist, dass die Verbraucherpreise<br />
für Geflügelfleisch anziehen konnten, obwohl sich die Ausläufer <strong>der</strong> Vogelgrippe<br />
bis ins zweite Quartal 2006 erstreckten. Die Preise für bratfertige und gefrorene<br />
Ententeile sind im Verlauf <strong>der</strong> letzten Jahre ebenso gesunken. Allerdings zeichnet sich<br />
auch hier seit Ende des Jahres 2007 eine Trendwende ab.<br />
Für die Erzeuger von Geflügel ist vor allem wichtig, dass ein Teil <strong>der</strong> entstandenen Mehrkosten<br />
durch die gestiegenen Futterpreise an den Verbraucher weiter gegeben werden<br />
konnte. Die Verbraucherpreise, die von <strong>der</strong> ZMP im Februar 2008 ermittelt wurden, liegen<br />
bei allen Produkten über den ermittelten Durchschnittswerten von 2007. Der Verteuerung<br />
beim <strong>Puten</strong>schnitzel könnte schon bald eine Grenze gesetzt sein, da diese seit Anfang des<br />
Jahres 2007 nicht nur teurer als Schweineschnitzel, son<strong>der</strong>n auch seit Ende 2007 teurer als<br />
<strong>Hähnchen</strong>schnitzel geworden sind. Es besteht deshalb die Möglichkeit, dass die Verbraucher<br />
als Substitut auf das billigere <strong>Hähnchen</strong>fleisch ausweichen.<br />
Für die steigende Nachfrage von Geflügel sprechen trotz etwas gestiegener Preise verschiedene<br />
Vorteile. Das Fleisch ist einfach und schnell zuzubereiten. Außerdem liegt Geflügel,<br />
aufgrund des geringen Fettgehalts und des hohen Eiweißgehalts im Trend <strong>der</strong> gesunden<br />
Ernährung. Zudem weist die in den letzten Jahren gestiegene Nachfrage an Convenience-Produkten,<br />
Geflügelwurst und fertig abgepackten, frischen Teilstücken in Discountern<br />
neue Absatzwege auf.
Marktsituation in Deutschland und Bayern 19<br />
Tabelle 4: Verbraucherpreise für Geflügelfleisch<br />
10,00<br />
9,50<br />
9,00<br />
8,50<br />
8,00<br />
7,50<br />
7,00<br />
6,50<br />
6,00<br />
5,50<br />
5,00<br />
4,50<br />
4,00<br />
3,50<br />
3,00<br />
2,50<br />
2,00<br />
1,50<br />
1,00<br />
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007<br />
gefrorene <strong>Hähnchen</strong> (€/kg) 2,02 1,92 1,77 1,55 1,54 1,61 1,79<br />
frische <strong>Hähnchen</strong> (€/kg) 3,79 3,56 3,35 2,62 2,64 2,66 2,87<br />
<strong>Hähnchen</strong>schnitzel (€/kg) 9,44 8,51 7,9 6,6 6,43 6,54 6,81<br />
<strong>Puten</strong>schnitzel (€/kg) 8,98 7,87 7,76 6,41 5,69 5,89 6,55<br />
Ententeile (bratfertig, gefroren in<br />
€/kg)<br />
2,77 2,84 2,59 2,23 2,52 2,32 2,4<br />
Quelle: (Böttcher W. , Beck, Bilsing, & Schmidt, 2007), (Böttcher W. , Beck, Bilsing, & Schmidt, 2008)<br />
2.4 Marktstruktur und Marktsituation in Bayern<br />
2.4.1 Marktstruktur<br />
Die Zählung von Geflügel erfolgte seit 1999 im Abstand von zwei Jahren. Aufgrund einer<br />
Modifizierung <strong>der</strong> Agrarstatistik im Jahre 2003 findet eine Viehzählung für Geflügel nur<br />
noch alle vier Jahre statt. Die Anzahl <strong>der</strong> Geflügelhalter in Bayern ist in <strong>der</strong> Tabelle 5 dargelegt.<br />
Tabelle 5: Anzahl <strong>der</strong> Geflügelhalter in Bayern<br />
Halter von 1999 2001 2003 2007<br />
Masthähnchen<br />
<strong>Puten</strong><br />
Enten<br />
Gänsen<br />
Verbraucherpreise in Euro pro kg<br />
1.009<br />
356<br />
1.579<br />
764<br />
889<br />
360<br />
1.264<br />
605<br />
764<br />
305<br />
1.115<br />
528<br />
Quelle: (Böttcher W. , Beck, Bilsing, & Schmidt, 2007), (GENESIS-Online, Code 41121-301r, 2008)<br />
866<br />
435<br />
2196<br />
971<br />
Für die folgenden Prozentangaben dient das Jahr 1999 als Ausgangsjahr. Die Halter bei<br />
Masthähnchen nahmen bis 2007 um 14% ab. Die an<strong>der</strong>en Geflügelhalter konnten sich<br />
hingegen in ihrer Anzahl sogar steigern. Die Gruppe <strong>der</strong> Entenhalter wuchs um 39%, die<br />
<strong>der</strong> Gänsehalter um 27% und die <strong>der</strong> <strong>Puten</strong>halter um 22%. Der Rückgang <strong>der</strong> Zahl <strong>der</strong><br />
bayrischen Masthähnchenhalter erklärt sich aus dem Ausstieg <strong>der</strong> Halter, die nur wenige<br />
Tiere besaßen. Dieser Strukturwandel wurde durch die Vogelgrippe noch zusätzlich beschleunigt.<br />
Die starke Zunahme <strong>der</strong> Halterzahlen bei Gänsen wie<strong>der</strong>um lässt den Schluss<br />
zu, dass gerade dieses Geflügel sich großer Beliebtheit bei Kleintierhaltern erfreut. Die<br />
Entwicklung <strong>der</strong> Geflügelbestände wird in <strong>der</strong> Tabelle 6 aufgezeigt.
20 Marktsituation in Deutschland und Bayern<br />
Tabelle 6: Geflügelbestand in Bayern in 1.000 Stück<br />
Geflügelart 1999 2001 2003 2007<br />
Masthähnchen<br />
<strong>Puten</strong><br />
Enten<br />
Gänse<br />
3.893<br />
719<br />
219<br />
26<br />
3.948<br />
768<br />
171<br />
20<br />
4.308<br />
784<br />
182<br />
15<br />
Quelle: (Böttcher W. , Beck, Bilsing, & Schmidt, 2007), (GENESIS-Online, Code 41121-306r, 2008)<br />
4.719<br />
761<br />
253<br />
11<br />
Aus dieser Tabelle wird ersichtlich, dass fast alle Geflügelbestände in Bayern, ausgehend<br />
vom Jahr 1999, in ihrem Umfang zulegen konnten. Die größte Zunahme im Zeitraum<br />
1999 bis 2007 ist bei den Masthähnchen mit 21% zu beobachten. Die Enten liegen mit<br />
knapp 16% auf dem zweiten Platz und die <strong>Puten</strong> mit nur 5,8% auf Platz drei. Einzig die<br />
Gruppe <strong>der</strong> Gänse haben mit 58% einen erheblichen Rückgang zu verzeichnen, allerdings<br />
werden die Geflügelbestände in Bayern im Mai erhoben. Die Gössel für die Weidegänsehaltung<br />
sind zu diesem Zeitpunkt zum großen Teil noch nicht eingestallt, sodass die aufgeführten<br />
Daten <strong>der</strong> Viehzählung die Realität beim Wassergeflügel nicht exakt wi<strong>der</strong>spiegeln.<br />
In INVEKOS werden 2007 51.858 Gänse angegeben; 2005 waren es nur 45.044<br />
Stück.<br />
Ein weiterer guter Anhaltspunkt, um die Geflügelproduktion besser verstehen zu können,<br />
ist eine Analyse <strong>der</strong> Bestandsgrößenstruktur. Diese Struktur wird für Junghühner in Tabelle<br />
7 dargestellt.<br />
Tabelle 7: Bestandsgrößenstruktur in <strong>der</strong> Junghühnermast 2007<br />
Bestandsgrößenklassen<br />
von... bis... Masthühnern<br />
Mäster Masthühner<br />
Anzahl % Stück %<br />
1- 99 630 72,7 12.328 0,3<br />
100- 999 117 13,5 25.188 0,5<br />
1.000- 9.999 21 2,4 62.184 1,3<br />
10.000- 19.999 15 1,7 214.096 4,51<br />
20.000 und mehr 83 9,6 4.405.477 93,4<br />
Insgesamt 866 100 4.719.273 100<br />
Quelle: (Feil & Wloch, 2008)<br />
Bei <strong>der</strong> Junghühnerproduktion spielen die Halter mit nur wenigen Tieren bezüglich <strong>der</strong><br />
Marktversorgung eine untergeordnete Rolle. Allein 93,4% <strong>der</strong> gemästeten Junghühner<br />
wird von Mästern mit mehr als 20.000 Tieren gehalten. Der Grund hierfür ist die geringe<br />
Gewinnspanne pro Tier. Deshalb sind größere Bestände notwendig, um ein ausreichend<br />
hohes Betriebseinkommen zu erwirtschaften. Zurzeit liegt keine genauere Bestandsgrößenstruktur<br />
über die Verteilung von Haltern mit mehr als 20.000 Tieren vor. Es ist daher<br />
schwierig einen aussagekräftigen Vergleich mit ganz Deutschland o<strong>der</strong> mit an<strong>der</strong>en EU-<br />
Län<strong>der</strong>n zu treffen. Nach <strong>der</strong> Auswertung von 2003 lag Bayern mit 33% Anteil <strong>der</strong> Betriebe,<br />
die über 100.000 Masthühner halten, noch 10% hinter dem deutschen, 11% hinter<br />
dem schwedischen und sogar 26% hinter dem dänischen Durchschnitt. (Graser, Groß,<br />
Damme, & Schmidtlein, 2004). Hierzu sei angemerkt, dass die 83 bayrischen <strong>Hähnchen</strong>mäster<br />
mit mehr als 20.000 Tieren im Durchschnitt 53.000 Tiere halten. Die Hauptproduktion<br />
<strong>der</strong> Masthähnchen findet in Nie<strong>der</strong>bayern und <strong>der</strong> Oberpfalz statt.<br />
Die <strong>Puten</strong>erzeugung hat seit 2003 keine nennenswerte Ausweitung erfahren. Laut <strong>der</strong><br />
Viehzählung im Jahr 2007 mästen 435 Betriebe 761.000 <strong>Puten</strong>. Davon haben 67 Betriebe<br />
mindestens 250 Mastputen und produzieren 99% <strong>der</strong> bayrischen Erzeugung. Das bedeutet,
Marktsituation in Deutschland und Bayern 21<br />
dass ein bayrischer <strong>Puten</strong>mäster mit mehr als 250 Tieren im Schnitt 11.200 Tiere hält.<br />
Laut <strong>der</strong> Tabelle 6 werden in Bayern 253.000 Enten gehalten, nach den Angaben <strong>der</strong> Erzeugergemeinschaft<br />
für Pekingenten liegt die Zahl <strong>der</strong> gehaltenen Enten in Bayern wesentlich<br />
höher, etwa bei 500.000. Eine genauere Aussage über die Haltungszahlen liegt<br />
nicht vor (Feil & Wloch, 2008).<br />
Interessant in diesem Zusammenhang ist auch, wie sich <strong>der</strong> Geflügelbestand in Stück pro<br />
Halter in den letzten Jahren entwickelt hat. Dies ist in Tabelle 8 dargestellt. In Bayern<br />
setzt sich <strong>der</strong> Trend von steigenden Haltungszahlen bei den Masthähnchen <strong>der</strong>zeit nicht<br />
weiter fort. Der durchschnittliche Bestand eines Masthühnerhalters hat sich vom Jahr 2003<br />
auf das Jahr 2007 um 3,4% verkleinert. Dies liegt vor allem an <strong>der</strong> stark gestiegenen Zahl<br />
<strong>der</strong> Halter in diesem Zeitraum. Bei den übrigen Geflügelrassen geht <strong>der</strong> Trend in die gleiche<br />
Richtung. Während <strong>der</strong> durchschnittliche Gänsehalter schon über die letzten 8 Jahre<br />
hinweg immer weniger Gänse hält, ist <strong>der</strong> Einbruch bei den Enten um fast 30% und bei<br />
den <strong>Puten</strong> um 32% eine neue Entwicklung. Dieser Rückgang ist dadurch zu erklären, dass<br />
bei Enten und <strong>Puten</strong> die Anzahl <strong>der</strong> erfassten Halter stärker gestiegen ist als die Anzahl<br />
<strong>der</strong> Tiere. Der Rückgang beim Wassergeflügel liegt vor allem an den erschwerten Haltungsbedingungen<br />
aufgrund <strong>der</strong> Vogelgrippe. Die Halter sind bei Freilandhaltung wegen<br />
<strong>der</strong> Wi<strong>der</strong>standsfähigkeit des Wassergeflügels dazu verpflichtet regelmäßige Vogelgrippekontrollen<br />
durchzuführen o<strong>der</strong> Hühner als Indikator für die Krankheit mitlaufen zu lassen.<br />
Tabelle 8: Durchschnittliche Geflügelbestände in Stück je Halter<br />
Anzahl <strong>der</strong> Geflügelart<br />
je Halter<br />
1999 2001 2003 2007<br />
Masthühner 3858 4441 5639 5449<br />
<strong>Puten</strong> 2020 2134 2571 1749<br />
Enten 139 136 164 115<br />
Gänse 33 33 28 11<br />
Quelle: Eigene Berechnungen<br />
Für die Entwicklung <strong>der</strong> bayrischen Geflügelproduktion ist das erzeugte Schlachtgewicht<br />
von Mastgeflügel aus <strong>der</strong> Tabelle 9 ein ebenso wichtiges Merkmal. Die Geflügelfleischproduktion<br />
konnte von 2000 bis 2007 jedes Jahr zulegen. Während zwischen 2000 bis<br />
2003 eine Expansion zwischen 7.000 und 10.000 Tonnen pro Jahr zu beobachten war, hat<br />
sich dieser Trend zwischen 2003 und 2006 verlangsamt. Vom Jahr 2006 auf das Jahr 2007<br />
fand jedoch eine Erholung statt und die bayrischen Schlachtereien konnten die Produktion<br />
wie<strong>der</strong> um 7500 t steigern. Die größte Steigerung erreichten hier die Masthähnchen. Allein<br />
aus dieser Sparte stammen 5.300 Tonnen <strong>der</strong> insgesamt 7.500 Tonnen, um die sich die<br />
Kapazität <strong>der</strong> Schlachthöfe in dem letzten Jahr erweitert hat. Die gestiegenen Schlachtungen<br />
sind auch ein Zeichen dafür, dass sich die Geflügelbranche vom Krisenjahr 2006 wie<strong>der</strong><br />
erholt hat.
22 Marktsituation in Deutschland und Bayern<br />
Tabelle 9: Mastgeflügelerzeugung nach Schlachtgewicht in Bayern in 1.000 t *<br />
Geflügelart 1995 2000 2001 2002 2003 2006 2007<br />
Masthähnchen 32,1 38,8 42,9 48,1 52,3 55,4 60,7<br />
Suppenhühner 12,7 11,7 12,6 12,4 12,1 12,9 13,4<br />
Übriges Ge-<br />
24,1 12,6 15,0 20,2 24,9 27,0 28,7<br />
flügel**<br />
Insgesamt 68,9 63,1 70,5 80,7 89,3 95,3 102,8<br />
* Geflügelschlachtereien mit einer monatlichen Schlachtkapazität ab 2000 Tieren<br />
**Enten, Gänsen; <strong>Puten</strong> und Perlhühnern<br />
Quelle: (Graser, Groß, Damme, & Schmidtlein, 2004), (Georg, 2008)<br />
2.4.2 Marktsituation<br />
Für die Analyse <strong>der</strong> Marktversorgung in Bayern mit Geflügelfleisch werden Erzeugung<br />
und Verbrauch ermittelt. In <strong>der</strong> Tabelle 10 wird die Unter- bzw. Überversorgung an Geflügelfleisch<br />
insgesamt und nach Masttierarten errechnet. Für Bayern gibt es keine eigene<br />
Ermittlung des Pro-Kopf-Verbrauches an Geflügelfleisch, deshalb findet <strong>der</strong> gesamtdeutsche<br />
Pro-Kopf-Verbrauch Anwendung. Dieser wird mit <strong>der</strong> bayerischen Bevölkerungszahl<br />
von rund 12,5 Mio. multipliziert und so <strong>der</strong> Gesamtverbrauch an Geflügelfleisch<br />
kalkuliert. Die Differenz aus Verbrauch und Erzeugung ergibt die Unter- bzw.<br />
Überversorgung von Geflügelfleisch.<br />
Tabelle 10: Differenz aus eigenerzeugtem Schlachtgewicht und Verbrauch in Bayern<br />
Erzeugtes<br />
Pro-Kopf-<br />
Schlachtgewicht<br />
Verbrauch in kg<br />
in t *<br />
Bevölkerung in<br />
Millionen<br />
Unter- bzw.<br />
Gesamtver- Überversorgung<br />
brauch an Ge- an Geflügelflügelfleisch<br />
in t fleisch<br />
in t<br />
Masthähnchen 60.700 9,9 12,5 123.750 -63.050<br />
Suppenhühner 13.400 0,6 12,5 7.500 +5.900<br />
Sonstiges Geflügel<br />
28.700 7,5 12,5 93.750 -65.050<br />
Gesamt 102.800 18,0 12,5 225.000 -122.200<br />
Quelle: *(Georg, 2008)<br />
Aus <strong>der</strong> Tabelle wird ersichtlich, dass Bayern bei allen wichtigen Geflügelarten eine geringe<br />
Eigenversorgung hat. Um den Eigenbedarf zu decken, muss aus an<strong>der</strong>en Län<strong>der</strong>n<br />
und Regionen Fleisch eingeführt werden. Insgesamt führt Bayern rechnerisch 122.000 t<br />
Geflügelfleisch ein. Von dem in Bayern verbrauchten Geflügelfleisch wird 51% des Junghühnerfleisches,<br />
sowie fast 70% des sonstigen Geflügels eingeführt. Nur bei den Suppenhühnern<br />
erreicht Bayern eine Überversorgung von 79%. Insgesamt hat Bayern eine Unterversorgung<br />
an Geflügelfleisch von 54%. Bei den <strong>Puten</strong> liegt die Selbstversorgung bei<br />
knapp 40%, also unter dem Bundesdurchschnitt von 66%.(Feil & Wloch, 2008) Genauere<br />
Angaben über die Herkunft des bayerischen Geflügelfleisches lassen sich nur schwer treffen,<br />
da die Transporte von Fleisch und Schlachtgeflügel zwischen den einzelnen Bundeslän<strong>der</strong>n<br />
nicht erfasst werden.<br />
2.5 Chancen und Risiken am Geflügelmarkt<br />
Eines <strong>der</strong> größten Probleme für die Geflügelbranche ist das hochpathogene H5N1-Virus<br />
<strong>der</strong> avieren Influenza. Dieses sorgte 2006 für einen rückläufigen Pro-Kopf-Verbrauch und<br />
für einen sinkenden Erzeugerpreis. Die Gefahr des H5N1-Virus ist in <strong>der</strong> EU noch keinesfalls<br />
überwunden. Nach Angaben des Friedrich-Löffler-Instituts Deutschland gab es im
Rahmenbedingungen 23<br />
Verlauf des Jahres 2007 Krankheitsausbrüche bei Nutzgeflügel in Frankreich, dem Vereinigten<br />
Königreich, in Rumänien, <strong>der</strong> Tschechischen Republik, Ungarn und Polen. Allerdings<br />
verloren diese Meldungen über die Vogelgrippe an Medienattraktivität, was dazu<br />
führte, dass über die Ausbrüche weit weniger emotional berichtet wurde und sich die Verbraucher<br />
in ihrem Konsumverhalten nicht mehr beeinflussen ließen. Infolge dessen blieben<br />
die Auswirkungen dieser Ausbrüche stets zeitlich und regional begrenzt. (Beck, EU:<br />
<strong>Hähnchen</strong>markt war Motor <strong>der</strong> Produktionserholung, 2008). Eines <strong>der</strong> aktuelleren Beispiele<br />
hierfür ist <strong>der</strong> Ausbruch des H5N1-Virus bei Enten im September 2007 in Deutschland.<br />
Die Haushaltseinkäufe bei Enten gingen im Vergleich zum Vorjahresmonat um weniger<br />
als 1% zurück. Im Oktober erzielten die Verkäufe bereits wie<strong>der</strong> ein Plus von 27,8%<br />
verglichen mit dem Vorjahr.(Beck, Der Entenmarkt wächst weiter, 2007)<br />
Im Jahr 2008 rechnen Experten mit einer EU-weit sinkenden Geflügelproduktion. Der<br />
<strong>Hähnchen</strong>fleischmarkt ist allerdings in diesem Zusammenhang separat zu betrachten. Diese<br />
Branche dürfte noch mit einem leichten Wachstum rechnen. Eins <strong>der</strong> wichtigsten Themen<br />
2008 werden die gestiegenen Futterkosten für Geflügel sein, da sie rund 60% <strong>der</strong><br />
Aufwendungen für den Mäster ausmachen. Allerdings gingen die gestiegenen Futterkosten<br />
bisher nicht zu Lasten <strong>der</strong> Rentabilität, da die Mehrkosten durch gestiegen Erzeugerpreise<br />
aufgefangen werden konnten. Auch die Verbraucherpreise sind gestiegen und dies trotz<br />
des hohen Marktanteils <strong>der</strong> Discounter bei den Einkaufsstätten. Auf lange Sicht gesehen<br />
wird die Geflügelfleischproduktion bei wachsenden Futterkosten ihre Bedeutung steigern<br />
können, da <strong>der</strong> günstigere Veredlungskoeffizient, vor allem bei <strong>Hähnchen</strong>fleisch gegenüber<br />
an<strong>der</strong>en Tierarten einen erheblichen Wettbewerbsvorteil bietet. Die Futterverwertung<br />
bei <strong>Hähnchen</strong> liegt zwischen 1,55 bis 1,75 kg Futter für ein kg Fleisch, die Futterverwertung<br />
beim Schwein ist mit 2,9 kg um über 1 kg deutlich schlechter. Für die Europäische<br />
Union insgesamt wird laut einer Projektion <strong>der</strong> Europäischen Kommission ein Wachstum<br />
<strong>der</strong> Geflügelerzeugung bis 2013 von 7% als wahrscheinlich erachtet.(Beck, EU:<br />
<strong>Hähnchen</strong>markt war Motor <strong>der</strong> Produktionserholung, 2008) Der Trend des gestiegenen<br />
Frischfleischverzehrs bei Geflügel kommt den europäischen und den deutschen Landwirten<br />
entgegen, da die Billigproduzenten, wie Brasilien und Thailand, aufgrund <strong>der</strong> weiten<br />
Entfernung hauptsächlich gefrostete, zubereitete und gesalzene Ware in die EU liefern<br />
können und dies zusätzlich durch steigende Transportkosten verteuert wird. Deutschland<br />
importiert von den über 872.000 t Geflügelfleisch den Großteil aus <strong>der</strong> EU. Die restliche<br />
importierte Menge stammt größten Teils aus Israel, Argentinien, Brasilien, Chile und<br />
Thailand. 62.000 Tonnen <strong>der</strong> importierten Ware sind gesalzenes Geflügelfleisch und fast<br />
180.000 t Geflügelfleischzubereitungen, die überwiegend aus Brasilien und Thailandstammen<br />
und primär für die Weiterverarbeitung verwendet werden.(Böttcher W. , Beck,<br />
Bilsing, & Schmidt, 2008)<br />
3 Rahmenbedingungen<br />
3.1 Richtlinien und freiwillige Vereinbarungen zur Geflügelhaltung<br />
Im Folgenden werden die wichtigsten Eckpunkte <strong>der</strong> freiwilligen Vereinbarungen zwischen<br />
dem bayerischen Staatsministerium für Landwirtschaft und Forsten und dem Landesverband<br />
<strong>der</strong> bayerischen Geflügelwirtschaft und <strong>der</strong> EU-Richtlinie zur Haltung von<br />
Masthähnchen aufgezeigt. Die Bestimmungen für die Geflügelarten im Einzelnen sind<br />
jeweils in <strong>der</strong> EU-Richtlinie (Richtlinie 2007/43/EG DES RATES , 2007) und in den<br />
freiwilligen Vereinbarung (<strong>Bayerische</strong>s Staatsministerium für Gesundheit, 2002)<br />
(<strong>Bayerische</strong>s Staatsministerium für Gesundheit, 2003) nachzulesen. Zusätzlich sind die<br />
allgemeinen tierschutzrechtlichen Bestimmungen bei <strong>der</strong> Haltung zu berücksichtigen.
24 Rahmenbedingungen<br />
3.1.1 Freiwillige Vereinbarung und EU-Richtlinie zur Haltung von Masthähnchen<br />
3.1.1.1 Freiwillige Vereinbarung zur Haltung von Masthähnchen<br />
Bis zum 30. Juni 2010 gelten in den meisten Bundeslän<strong>der</strong>n Deutschlands die freiwilligen<br />
Vereinbarungen zur Haltung von Masthähnchen. Die wichtigsten Punkte <strong>der</strong> Vereinbarung,<br />
die von den Haltern gefor<strong>der</strong>t werden, sind im Weiteren aufgeführt.<br />
Licht<br />
• 3% Tageslichteinfall bezogen auf die Stallgrundfläche<br />
• 20 Lux während <strong>der</strong> Hellphase<br />
• 2 Lux maximal während <strong>der</strong> Dunkelphase<br />
• 2 ununterbrochene Dunkelphasen mit mindestens 4 Stunden<br />
Lüftung<br />
• Luftaustausch von 4,5 m 3 pro kg Lebendmasse und Stunde<br />
• Ammoniakgehalt dauerhaft nicht über 20 ppm im Tierbereich<br />
• Anzustreben<strong>der</strong> Ammoniakgehalt von unter 10 ppm im Tierbereich<br />
Besatzdichte<br />
• In <strong>der</strong> Mastendphase nicht mehr als 35 kg Lebendgewicht pro m 2<br />
3.1.1.2 EU-Richtlinie zur Haltung von Masthühnern<br />
Bis spätestens zum 30. Juni 2010 ist die neue EU-Richtlinie 2007/43/EG vom 28. Juni<br />
2007 für Masthühner in allen EU-Mitgliedsstaaten in nationales Recht umzusetzen. Diese<br />
Richtlinie gilt für alle Betriebe mit Masthühnern über 500 Tieren. Bei einem Neubau ist zu<br />
empfehlen, sich bis zum in Kraft treten <strong>der</strong> deutschen Verodnung an <strong>der</strong> freiwilligen Vereinbarung<br />
zu orientieren, denn die EU-Richtlinie ist als eine Mindestanfor<strong>der</strong>ung an die<br />
EU-Staaten zu sehen. Im Einzelnen kann die Richtlinie noch durch die Län<strong>der</strong> verschärft<br />
werden. Zum Beispiel ist laut EU kein Tageslichteinfall im Masthähnchenstall gefor<strong>der</strong>t,<br />
bei <strong>der</strong> Umsetzung <strong>der</strong> Richtlinie in Deutschland kann diese For<strong>der</strong>ung allerdings wie<strong>der</strong><br />
aufgenommen werden. Aus diesem Grund ist es empfehlenswert bei <strong>der</strong> Planung eines<br />
Neubaus den Tageslichteinfall weiterhin vorzusehen.<br />
Die wichtigsten Eckpunkte, welche <strong>der</strong> Landwirt laut EU-Richtlinie einhalten muss, lauten<br />
wie folgt.<br />
Licht<br />
• 20 Lux während <strong>der</strong> Hellphase<br />
• Ausleuchtung <strong>der</strong> Stallnutzfläche von mindestens 80%<br />
• 6-stündige Dunkelphase mit mindestens einer ununterbrochenen 4-stündig Dunkelperiode<br />
Lüftung<br />
• Lüftung muss ausreichen, um Hitzestress zu vermeiden und erfor<strong>der</strong>lichenfalls mit<br />
einem Heizsystem kombiniert werden, um überschüssige Luftfeuchtigkeit abzuleiten
Rahmenbedingungen 25<br />
Besatzdichte<br />
• In <strong>der</strong> Endmastphase nicht mehr als 33 kg/m 2<br />
• Es gibt nach <strong>der</strong> Richtlinie auch die Möglichkeit eine höhere Besatzdichte als 33<br />
kg/m 2 zu fahren. Besatzdichten von 39 kg/m 2 bis hin zu maximal 42 kg/m 2 sind<br />
möglich. Um in <strong>der</strong> Besatzdichte über 33 kg/m 2 gehen zu können, ist die Einhaltung<br />
von mehreren zusätzlichen Auflagen notwendig.<br />
Damit <strong>der</strong> Betrieb 39 kg/m 2 halten darf, sind folgende zusätzliche Anfor<strong>der</strong>ungen zu erfüllen.<br />
Persönliche Melde- und Aufzeichnungspflicht<br />
Erhöhung über 33 kg/m 2 nur mit einer Mitteilung an die zuständigen Behörden<br />
• Genaue Angabe <strong>der</strong> Besatzdichte und Meldung einer jeden Än<strong>der</strong>ung mindestens<br />
15 Tage vor dem Einstallen<br />
• Führen eines Bestandsbuches und Vorzeigepflicht auf Verlangen <strong>der</strong> zuständigen<br />
Behörden<br />
• Än<strong>der</strong>ungen des Stalls, <strong>der</strong> Stallausstattung o<strong>der</strong> <strong>der</strong> Betriebsabläufe mit Auswirkung<br />
auf das Wohlergehen <strong>der</strong> Tiere sind meldepflichtig<br />
Stallklima<br />
• Max. Ammoniakkonzentration 20 ppm und max. Kohlendioxidkonzentration 3.000<br />
ppm in Kopfhöhe <strong>der</strong> Tiere<br />
• Bei einer Außentemperatur von 30 °C darf die Innentemperatur des Stalls max. 3<br />
°C höher sein<br />
• Die durchschnittliche in 48 Stunden gemessene relative Luftfeuchtigkeit darf 70%<br />
nicht überschreiten, bei einer Außentemperatur von unter 10 °C<br />
Für eine Besatzdichte von 42 kg/m 2 sind zu den vorher genannten Anfor<strong>der</strong>ungen für 39<br />
kg/m 2 folgende Zusatzanfor<strong>der</strong>ungen zu erfüllen.<br />
• Kein festgestellter Mangelzustand im Hinblick auf die EU-Richtlinien durch die<br />
zuständigen Behörden innerhalb <strong>der</strong> letzten 2 Jahre<br />
• Die Leitlinien <strong>der</strong> guten fachlichen Praxis auf dem Betrieb sind zu beachten<br />
• Bei sieben aufeinan<strong>der</strong>folgenden Beständen darf die nachträglich geprüfte, kumulative,<br />
tägliche Gesamtmortalitätsrate nicht über 1% plus 0.06% multipliziert mit<br />
dem Schlachtalter des Bestandes in Tagen liegen<br />
Wenn auf dem Betrieb in den letzten zwei Jahren durch die zuständigen Behörden keine<br />
Überprüfung auf einen Mangelzustand stattgefunden hat, ist dies nachzuholen. Der Betrieb<br />
mit einer höheren Mortalitätsrate kann trotzdem die Genehmigung erhalten, wenn hinreichend<br />
nachgewiesen o<strong>der</strong> erklärt werden kann, dass sich die Ursache dem Einfluss des<br />
Eigentümers o<strong>der</strong> des Halters entzieht.
26 Rahmenbedingungen<br />
3.1.2 Freiwillige Vereinbarung für die <strong>Puten</strong>haltung<br />
Die Mindestanfor<strong>der</strong>ungen <strong>der</strong> freiwilligen Vereinbarung, die für den Landwirt schon bei<br />
<strong>der</strong> Planung eines neuen Stalls eine wichtige Rolle spielen, werden im Folgenden kurz<br />
aufgeführt.<br />
Licht<br />
• 3% Tageslichteinfall bezogen auf die Stallgrundfläche<br />
• 20 Lux während <strong>der</strong> Hellphase<br />
• Dunkelphasen nach dem natürlichen Tag-Nacht-Rhythmus mit möglichst 8 Stunden<br />
Lüftung<br />
• Gewährleistung eines ausreichenden Luftaustauschs bei einer Enthalpie von bis zu<br />
67 kJ pro kg trockener Luft<br />
• Ammoniakgehalt dauerhaft nicht über 20 ppm im Tierbereich<br />
• Anzustreben<strong>der</strong> Ammoniakgehalt unter 10 ppm im Tierbereich<br />
Besatzdichte<br />
• In <strong>der</strong> Endmastphase 45 kg Lebendgewicht (LG) pro m 2 bei Hennen und bei Hähnen<br />
50 kg LG pro m 2<br />
Bei <strong>der</strong> Einhaltung von bestimmten Zusatzanfor<strong>der</strong>ungen können 52 kg LG pro m 2 bei<br />
Hennen und bei Hähnen 58 kg LG pro m 2 gehalten werden.<br />
• Nachweis einer land- o<strong>der</strong> tierwirtschaftlichen Ausbildung und zweijährige Führung<br />
eines <strong>Puten</strong>bestandes in Eigenverantwortung<br />
• Anfertigung eines monatlichen Protokolls über die Tiergesundheit und Pflege <strong>der</strong><br />
<strong>Puten</strong> von einem Tierarzt<br />
• Tiere mit gestörtem Allgemeinbefinden sind in einem Krankenstand mit einer max.<br />
Besatzdichte von 45 kg/m 2 zu separieren<br />
• Bei tierärztlicher Feststellung eines Problems im Management o<strong>der</strong> in <strong>der</strong><br />
Schlachtgeflügeluntersuchung innerhalb zwei aufeinan<strong>der</strong>folgen<strong>der</strong> Durchgänge<br />
o<strong>der</strong> in drei Durchgängen innerhalb von zwei Jahren ist die Besatzdichte auf die<br />
Standardbesatzdichte zu reduzieren.<br />
Die Reduzierung auf die Standardbesatzdichte wegen eines festgestellten Problems wird<br />
aufgehoben, wenn ein Tierarzt bestätigt, dass in zwei aufeinan<strong>der</strong>folgenden Durchgängen<br />
kein Problem mehr aufgetreten ist.<br />
3.1.3 Freiwillige Vereinbarung für die Pekingentenhaltung<br />
In <strong>der</strong> Entenmast gibt es wie bei <strong>der</strong> <strong>Puten</strong>mast freiwillige Vereinbarungen, die <strong>der</strong> Mäster<br />
beim Einstieg in die Pekingentenmast und beim Bau eines Stalls berücksichtigen sollte.<br />
Die wichtigsten Mindestanfor<strong>der</strong>ungen werden im Weiteren aufgeführt.<br />
Licht<br />
• 3% Tageslichteinfall bezogen auf die Stallgrundfläche<br />
• 20 Lux während <strong>der</strong> Hellphase<br />
• 2 Lux maximal während <strong>der</strong> Dunkelphase
Rahmenbedingungen 27<br />
• Einhaltung des natürlichen Tag-Nacht-Rhythmus und einer 8-stündigen Dunkelphase<br />
ab dem 21. Lebenstag<br />
Lüftung<br />
• Luftaustausch von 4,5 m 3 pro kg Lebendmasse und Stunde<br />
• Die Luftgeschwindigkeit darf im Normalfall 0,3 m/sec in Tierhöhe nicht überschreiten<br />
• Ammoniakgehalt dauerhaft nicht über 20 ppm im Tierbereich<br />
• Anzustreben<strong>der</strong> Ammoniakgehalt unter 10 ppm im Tierbereich<br />
Besatzdichte<br />
• In <strong>der</strong> Aufzucht- und Mastphase dürfen nicht mehr als 20 kg LG pro m 2 nutzbarer<br />
Stallfläche gehalten werden<br />
Beson<strong>der</strong>s wichtig ist in <strong>der</strong> Pekingentenmast die Wasserversorgung. In Tabelle 11 sind<br />
die Lebenstage angegeben und die dazugehörige Anzahl an Nippeltränken, bzw. die entsprechend<br />
nutzbare Tränkenseitenlänge je kg Lebendmasse, die einzuhalten sind.<br />
Außerdem ist bei den Enten zu beachten, dass während <strong>der</strong> Mast täglich nachzustreuen ist<br />
und in den letzten 3 bis 5 Tagen täglich zweimal nachgestreut werden muss. Ebenso dürfen<br />
die perforierten Böden nur maximal 25% <strong>der</strong> Stallfläche ausmachen und müssen einen<br />
sicheren Stand und Lauf <strong>der</strong> Tiere gewährleisten.<br />
Tabelle 11: Richtzahlen für Tränken bei <strong>der</strong> Aufzucht von Pekingenten<br />
Lebenstag Nippeltränke<br />
Nutzbare Tränkenseitenlänge<br />
(Tier/Nippel)<br />
je kg Lebendmasse (in cm)<br />
1 –5 25 3,2<br />
6 – 21 15 1,6<br />
ab 22 10 0,5<br />
Quelle: (<strong>Bayerische</strong>s Staatsministerium für Gesundheit, 2003)<br />
3.2 Baurecht<br />
Bei einem Neu- o<strong>der</strong> Umbau sind verschiedene bau- und umweltrechtliche Rahmenbedingungen<br />
zu erfüllen, deshalb sollte <strong>der</strong> Bauherr gute Kenntnisse über diese Regelungen<br />
besitzen, o<strong>der</strong> sich gegebenenfalls beraten lassen, um eine schnellstmögliche Genehmigung<br />
seines Bauvorhabens zu erlangen.<br />
Grundsätzlich gibt es folgende Arten von Genehmigungsverfahren:<br />
• nach Baurecht<br />
• nach Immissionsschutzrecht (Bundesimmissionsschutzgesetz (BimSchG)) - Än<strong>der</strong>ungsanzeige<br />
• nach Immissionsschutzrecht (BimSchG) – Än<strong>der</strong>ungsgenehmigung<br />
• nach Immissionsschutzrecht (BimSchG) – Neugenehmigung<br />
Zusätzlich ist zu prüfen, ob nach dem Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVPG) eine<br />
• UVP Vorprüfung o<strong>der</strong><br />
• eine obligatorische UVP erfor<strong>der</strong>lich ist und<br />
• das Verfahren ohne o<strong>der</strong> mit Öffentlichkeitsbeteiligung durchzuführen ist.<br />
• (Damme, Geflügeljahrbuch 2008, 2007)
28 Rahmenbedingungen<br />
Welches Genehmigungsverfahren einzuleiten ist, hängt davon ab, ob die Verordnung des<br />
Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchV) betroffen ist. Wird keine Grenze <strong>der</strong><br />
BImSchV überschritten, wird die Baugenehmigung von den zuständigen Baugenehmigungsbehörden<br />
erteilt. Werden die Grenzen überschritten, ist ein immissionsschutzrechtliches<br />
Genehmigungsverfahren notwendig. Außerdem gibt es ein vereinfachtes Verfahren<br />
ohne Öffentlichkeitsbeteiligung und ein förmliches mit Öffentlichkeitsbeteiligung. Das<br />
vereinfachte Verfahren und dessen Ablauf sind im §19 <strong>der</strong> BImSchV zu finden. Der genaue<br />
Ablauf des förmlichen Verfahrens mit Öffentlichkeitsbeteiligung ist im §10 <strong>der</strong><br />
BImSchV beschrieben.<br />
Zusätzlich zu dem förmlichen Genehmigungsverfahren aufgrund <strong>der</strong> BImSchV ist eine<br />
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) durchzuführen, wenn nach dem Gesetz <strong>der</strong> Umweltverträglichkeitsprüfung<br />
(UVPG) bestimmte Grenzwerte für eine solche Prüfung erreicht<br />
werden. Die Grenzen für die Verfahren sind in Tabelle 12 aufgezeigt.<br />
Tabelle 12: Grenzen für ein immissionsschutzrechtliches Genehmigungsverfahren<br />
Tierart<br />
Bundesimmissionsschutzgesetz UVP-Gesetz<br />
förmliches Genehmigungsverfahren<br />
mit<br />
Öffentlichkeitsbeteiligung<br />
ab ... Tieren<br />
vereinfachtes Genehmigungsverfahren<br />
ohne<br />
Öffentlichkeitsbeteiligung<br />
ab ... Tieren<br />
BImSchV mit UVP und<br />
Öffentlichkeitsbeteiligung<br />
ab ... Tieren<br />
Hennen 40.000 15.000 60.000<br />
Junghennen 40.000 30.000 85.000<br />
Mastgeflügel 40.000 30.000 85.000<br />
<strong>Puten</strong> 40.000 15.000 60.000<br />
Quelle: (Neser, 2007)<br />
In bestimmten Fällen kann eine allgemeine o<strong>der</strong> eine standortbezogene Vorprüfung im<br />
Einzelfall schon bei geringeren Geflügelbeständen nach UVPG durchzuführen sein. Diese<br />
Fälle sind im § 3 c des UVPG näher erläutert.<br />
Die Dauer des Genehmigungsverfahrens hängt von <strong>der</strong> Art des Verfahrens ab. Im Regelfall<br />
ist mit folgende Fristen zu rechnen.<br />
• Unterlagenerarbeitung mit einem Genehmigungsantrag und Gutachten zwischen 3<br />
bis 8 Monate<br />
• Vollständigkeitsprüfung bei den Behörden zwischen 1 bis 3 Monate<br />
• Nachbearbeitung von evtl. Nachfor<strong>der</strong>ung mit circa einem Monat<br />
• Genehmigungsverfahren mit Öffentlichkeitsbeteiligung (ab Vollständigkeitserklärung<br />
des Antrages durch die Genehmigungsbehörde bis zu <strong>der</strong>en Entscheidung)<br />
circa 8 bis 12 Monate<br />
Es kann daher zu Fristen von 12 bis 24 Monaten kommen, von <strong>der</strong> Auftragserteilung bis<br />
zur Genehmigung nach BimSchG und dem UVPG. Eine reine Baugenehmigung ohne<br />
UVP und BImSchV kann von <strong>der</strong> Bearbeitung bis zur Genehmigung zwischen 5 bis 20<br />
Monaten dauern. Wenn während dem Verfahren Probleme, Klagen o<strong>der</strong> Wie<strong>der</strong>sprüche<br />
auftauchen, ist die Dauer des Verfahrens schwer abzuschätzen. Wichtig für die Genehmigungsfähigkeit<br />
sind die Größe <strong>der</strong> Anlage, die Anlagenkonzeption, sowie die Umweltauswirkungen<br />
verbunden mit den genauen Standortbedingungen.(Damme, 2007)<br />
Die Genehmigungsfähigkeit des Antrages hängt davon ab, inwiefern alle umweltrelevanten<br />
gesetzlichen Regelungen und Richtlinien <strong>der</strong> EU, die für die Geflügelhaltung relevant
Rahmenbedingungen 29<br />
sind, eingehalten werden. Hierbei sind folgende gesetzliche Regelungen aus Tabelle 13 zu<br />
beachten.<br />
Tabelle 13: EU-Richtlinien und gesetzliche Regelungen für ein Baugenehmigungsverfahren<br />
Richtlinien <strong>der</strong> EU mit Relevanz für die Geflügelhaltung<br />
• Richtlinie zum Schutz <strong>der</strong> Gewässer<br />
vor Verunreinigungen<br />
•<br />
durch Nitrat aus landwirtschaftlichen<br />
Quellen (Nitrat-Richtlinie)<br />
Richtlinie über die integrierte<br />
Vermeidung und Vermin<strong>der</strong>ung<br />
<strong>der</strong> Umweltverschmutzung (IUV-<br />
Richtlinie)<br />
• Richtlinie über die Umweltverträglichkeitsprüfung<br />
bei bestimmten<br />
und öffentlichen und privaten<br />
Projekten (UVP-Richtlinie)<br />
• Fauna, Flora, Habitat Richtlinie<br />
(FFH-Richtlinie)<br />
• Richtlinie über nationale Emissionshöchstgrenzen<br />
für bestimmte<br />
Luftschadstoffe (Ziel u. a. NH3-<br />
Min<strong>der</strong>ung auf 550Tt/Jahr für<br />
Deutschland)<br />
• Richtlinie zur Tierhaltung<br />
Quelle: (Damme, 2007)<br />
3.3 Zoonosenverordnung- Salmonellen<br />
Wichtige umweltrelevante gesetzliche Regelungen<br />
• Bundes-Immissionsschutzgesetz<br />
(BImSchG)<br />
• Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz<br />
(UVPG)<br />
• Baugesetzbuch (BauGB)<br />
• Wasserhaushaltsgesetz (WHG)<br />
• Kreislaufwirtschafts-/Abfallgesetz<br />
(KrW-/AbfG)<br />
• Abwasserabgabegesetz (AwAG)<br />
• Bundesnaturschutzgesetz<br />
(BNatSchG)<br />
• Umwelthaftungsgesetz (UMG)<br />
• Tierschutzgesetz<br />
• Tierseuchengesetz<br />
• Bundeswaldgesetz<br />
• Düngemittelgesetz<br />
Die Zoonosenverordnung <strong>der</strong> EU hat folgende Grundlagenregelungen zur koordinierten<br />
Zoonosenbekämpfung aufgestellt. Als erstes ist eine Prävalenzstudie zu erstellen, diese<br />
Studie gibt Auskunft, wie viel Prozent <strong>der</strong> Tiere eines Tierbestandes mit den untersuchten<br />
Erregern infiziert sind. Die Untersuchung dient als Grundlage zur Erstellung und Genehmigung<br />
eines nationalen Programms zur Eindämmung <strong>der</strong> Salmonellen. Für die Erstellung<br />
<strong>der</strong> Studie und für die Umsetzung gibt es in <strong>der</strong> Zoonosenverordnung <strong>der</strong> EU Zeitpläne,<br />
die in <strong>der</strong> Tabelle 14 dargelegt sind.<br />
Die Prävalenzstudie beim Masthähnchen, die vom 01.10.2005 bis zum 30.09.2006<br />
deutschlandweit erstellt wurde, kam zu folgendem Ergebnis. Von den 378 untersuchten<br />
Herden, wurden bei 2,9% die Erreger Salmonella Enteritidis (S.E.) und Salmonella Typhimurium<br />
(S.T.) festgestellt, die für den Menschen gefährlich sind.(Bundesinstitut für<br />
Risikobewertung, 2006) Das erklärte Ziel ist es bis zum 31.12.2011 eine Verringerung <strong>der</strong><br />
beiden Haupterreger auf 1% o<strong>der</strong> weniger zu erreichen. Die EU verlangt von ihren Mitgliedsstaaten,<br />
dass in Zukunft alle Masthähnchenherden vor <strong>der</strong> Schlachtung untersucht<br />
werden müssen, außer die Herde ist kleiner als 5.000 Tiere. Die zuständigen Amtstierärzte<br />
sollen zusätzlich 10% <strong>der</strong> <strong>Hähnchen</strong>mastbetriebe beproben, die nicht von <strong>der</strong> Untersuchungspflicht<br />
ausgeschlossen sind. Die Probe ist drei Wochen vor dem Abtransport <strong>der</strong><br />
Schlachttiere zu nehmen und kann vom Landwirt selbst gezogen werden, falls dieser an
30 Rahmenbedingungen<br />
einer entsprechenden Schulung teilgenommen hat.(Verordnung (EG) Nr. 646/2007, 2007)<br />
Wie bei einem positiven Befund dieser Untersuchung verfahren wird und welche Auswirkungen<br />
dies auf den Mäster hat, lässt sich noch nicht mit Sicherheit sagen. Die Prävalenzstudie<br />
<strong>der</strong> Masthähnchen fiel allerdings weit positiver aus, als die bereits veröffentlichte<br />
Studie über die Legehennen. Trotzdem werden weitere Maßnahmen beschlossen, um das<br />
festgelegte Ziel <strong>der</strong> Studie zu erreichen. Wie dies im Detail aussehen wird ist noch nicht<br />
bekannt.<br />
Im Zuge <strong>der</strong> seit Anfang März 2008 abgeschlossenen Prävalenzstudie bei <strong>Puten</strong> wurden in<br />
Deutschland vom Bundesinstitut für Risikobewertung 300 Mastputenherden und 98<br />
Zuchtputenherden untersucht. In den Zuchtputenbeständen wurden keine Salmonellen<br />
nachgewiesen. Bei den Mastputen wurden in 31 Herden Salmonellen nachgewiesen, dies<br />
entspricht 10,3% <strong>der</strong> untersuchten Herden. Die beiden häufigsten Verursacher S.T. und<br />
S.E für eine Salmonellenerkrankung beim Menschen wurden in 3,1% <strong>der</strong> untersuchten<br />
Mastbetriebe gefunden. Diese Studie wird die Grundlage für weitere Maßnahmen zur Bekämpfung<br />
gegen Salmonellen in <strong>der</strong> <strong>Puten</strong>mast sein. (Bundesinstitut für Risikobewertung,<br />
2008)<br />
Tabelle 14: Anhang I <strong>der</strong> EU-Zoonosenverordnung<br />
Zoonose/Zoonose-<br />
erreger<br />
S.E., S.T., Salmonella<br />
ha<strong>der</strong>, Salmonella<br />
virchow, Salmonella<br />
infantis<br />
Salmonella<br />
Enteritidis, Salmonella<br />
Typhimurium<br />
Salmonella<br />
Enteritidis, Salmo-<br />
nella Typhimurium<br />
Alle Salmonella-<br />
Serotypen von Belang<br />
für die öffentli-<br />
che Gesundheit<br />
Tierpopulation<br />
Gallus-gallus-<br />
Zuchtherden<br />
Legehennen<br />
Masthähnchen<br />
<strong>Puten</strong><br />
Stufe <strong>der</strong> Lebensmittelkette <br />
Primärproduktion <br />
Primärproduktion <br />
Primärproduktion <br />
Primärproduktion<br />
Ziel festzulegen<br />
bis (1) :<br />
1% als Ziel festgelegt<br />
in VO (EG)<br />
Nr. 1003/2005<br />
Verringerung um<br />
30 %<br />
VO (EG) Nr.<br />
1168/2006<br />
Max. 1%<br />
31.12.2011<br />
VO(EG) 646/2007<br />
4. März 2008<br />
Untersuchungen<br />
verbindlich vorgeschrieben<br />
ab:<br />
01.01.2007<br />
01.02.2008<br />
01.01.2009<br />
Voraussichtlich<br />
01.01.2010<br />
(1) Diese Fristen setzen voraus, dass spätestens sechs Monate vor Festlegung des betreffenden Ziels vergleichbare Daten über die<br />
Prävalenz vorliegen. Sollte dies nicht <strong>der</strong> Fall sein, so wird die Frist für die Festlegung des Ziels entsprechend verlängert.<br />
Quelle: Vortrag über Salmonellenbekämpfung beim Masthähnchen.(Zwingmann & Schnei<strong>der</strong>, 2006)
Geflügelschlachtereien für Bayern 31<br />
4 Geflügelschlachtereien für Bayern<br />
In Bayern gibt es insgesamt 15 zugelassene Geflügelschlachtbetriebe die in <strong>der</strong> folgenden<br />
Tabelle aufgeführt sind.<br />
Tabelle 15: Zugelassende Geflügelschlachtbetriebe in Bayern<br />
Ort ESG-Nr.<br />
Großhöhenrain 43<br />
Ingolstadt BY 45<br />
Neufahrn (Nie<strong>der</strong>bayern) 48<br />
Bogen 50<br />
Wassertrüdingen 59<br />
Wachenroth 60<br />
Bobingen 62<br />
Ampfing BY 101<br />
Moosburg 115<br />
Aufhausen BY 30033<br />
Freudenberg-Hiltensdorf 227<br />
Gablingen 231<br />
Trostberg 306<br />
Pleiskirchen BY 15 001<br />
Massing BY 20 006<br />
Quelle: (Bundschuh, Pfundmair, & Eisenbeiner, 2008) Die aktuell zugelassenen Geflügelschlachtbetriebe findet man auf <strong>der</strong> Internetseite<br />
des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (http://btl.bvl.bund.de/btl/index.jsp).<br />
Im Folgenden werden die größten Geflügelschlachtereien, die für die bayrischen Mäster<br />
die größte Bedeutung haben, näher beschrieben. Die Schlachtbetriebe von Wiesenhof, <strong>der</strong><br />
Süddeutschen Truthahn AG und die Wichmann Enten GmbH liegen in Bayern, lediglich<br />
die Velisco Geflügel GmbH & Co. KG hat ihren Standort in Baden-Württemberg. Velisco<br />
wird in diesem Zusammenhang mit aufgenommen, da dieser Schlachthof für die bayrischen<br />
<strong>Puten</strong>mäster von großer Bedeutung ist.<br />
4.1 Wiesenhof<br />
Die Marke Wiesenhof gehört zur PHW-Gruppe in Rechterfeld. Die weiteren verschiedenen<br />
mittelständischen Unternehmen, die <strong>der</strong> PHW<br />
Gruppe angehören, konzentrieren sich auf den Bereich<br />
<strong>der</strong> Geflügelspezialitäten. Wiesenhof selbst<br />
beschäftigt 2.900 Mitarbeiter und erwirtschaftet 65%<br />
des Gesamtumsatzes <strong>der</strong> PHW-Gruppe.<br />
Im Jahr 2007 besaß Wiesenhof einen Marktanteil<br />
beim Frischgeflügel von 53,9 Prozent. Vor allem <strong>der</strong><br />
Verkauf von frischem Geflügel gewinnt bei Wiesenhof<br />
immer mehr an Bedeutung. Im Jahr 2007 war<br />
Quelle: Wiesenhof
32 Geflügelschlachtereien für Bayern<br />
64,7% des verkauften Geflügelfleisches frische Ware. Der wichtigste Posten sind bei <strong>der</strong><br />
frischen Ware die Geflügelteile mit 84,9%.<br />
Die Wiesenhofschlachterei in Bogen existiert seit 1978. Im Zuge einer Konzentration<br />
wurde die <strong>Hähnchen</strong>schlachtungen von den Standorten Freystadt, Gangkofen und Weilheim/Teck<br />
in Bogen zusammengefasst. In Bogen werden täglich 180.000 Tiere geschlachtet<br />
und auch weiterverarbeitet. Insgesamt verkauft die Schlachterei monatlich 800t Griller<br />
o<strong>der</strong> Brathähnchen und 4.500t <strong>Hähnchen</strong>teile. Das Angebot von Wiesenhof reicht von<br />
frischen und gefrorenen <strong>Hähnchen</strong> bis hin zu marinierten Grillspießen. Diese Produkte<br />
werden in Deutschland hauptsächlich in Bayern und Baden-Württemberg verkauft und an<br />
das angrenzende Ausland, wie Österreich, Schweiz, Polen, Frankreich, bis hin nach Spanien<br />
und Portugal.<br />
Die Beson<strong>der</strong>heiten bei <strong>der</strong> Schlachtung selbst ist die automatische Be- und Entladung <strong>der</strong><br />
Tiere. (Bild unten links) Sie vermeidet unnötige Bewegungen vor dem Schlachten, zudem<br />
ist dieser Bereich voll klimatisiert, um so Stress für die Masthähnchen zu vermeiden. Außerdem<br />
werden schlachtungsbedingte Fehler, wie Blutungen im Filet, nahezu vermieden.<br />
Eine weitere Beson<strong>der</strong>heit ist die Dampfbrühung im gesättigten Warmluftstrom, durch sie<br />
wird die Keimbelastung reduziert und ein längeres Verbrauchsdatum erreicht.<br />
Des Weiteren wird <strong>der</strong> mikrobiologische Status verbessert. Durch die Vorkühlung werden<br />
die <strong>Hähnchen</strong> innerhalb von 2,5 Stunden auf 1°C gekühlt, dies verbessert ebenso den mikrobiologischen<br />
Status und vermeidet eine Nachkühlung, wodurch ein schnellerer Produktionsablauf<br />
gewährleistet wird. (Bild unten rechts)<br />
Quelle: Wiesenhof<br />
Quelle: Wiesenhof<br />
Die Schlachterei wird von den Erzeugergemeinschaften <strong>der</strong> EG Bogen/Nittenau, EG Südwest<br />
und EG Gangkofen beliefert. Ein Hauptaugenmerk ist auf die Qualität und Sicherheit<br />
<strong>der</strong> erzeugten Lebensmittel gerichtet. Damit diese Qualität garantiert werden kann, legt<br />
Wiesenhof großen Wert auf ein 5D-Konzept. Die 5D stehen für Elterntierherden, Brütereien,<br />
Vertrags-Aufzucht, Futtermühlen, Schlachtereien und Verarbeitung in Deutschland.<br />
Damit dieses Konzept gewährleistet werden kann, liefert MEGA <strong>der</strong> Mischfutterhersteller<br />
von Wiesenhof das Futter und die Brüterei Süd die Küken an die Vertragsaufzüchter.<br />
Beim Mischfutter wird auf tierisches Eiweiß und genetisch verän<strong>der</strong>tes Soja verzichtet.<br />
Ebenso steht Wiesenhof für ein salmonellenfreies Futter seit 2002. Die Marke garantiert<br />
eine Produktion in Deutschland und eine lückenlose Herkunftsgarantie. Das Institut für<br />
Tiergesundheit und Agrarökologie (ifta) mit dem Geschäftssitz in Berlin Quelle: Wiesenhof<br />
kontrolliert als neutrale Einrichtung diese Qualitätskriterien.<br />
In den letzten Jahren konnte Wiesenhof Zuwachsraten in <strong>der</strong> Produktion von 5% bis 7%<br />
verzeichnen. Mit dieser Wachstumsrate liegt die Schlachterei über dem durchschnittlichen<br />
Marktwachstum. Dennoch geht Herr Loibl <strong>der</strong> Prokurist bei Wiesenhof davon aus, dass<br />
aufgrund des Sortimentausbaus <strong>der</strong> Discounter bei <strong>der</strong> SB-Ware und dem großen Marktanteil<br />
in diesem Bereich die Zuwachsrate in den nächsten Jahren weiter gehalten werden
Geflügelschlachtereien für Bayern 33<br />
kann. Aufgrund dieser Prognose ist ein Neubau <strong>der</strong> Verarbeitung bereits geplant. Innerhalb<br />
<strong>der</strong> nächsten 2 bis 3 Jahre will man in Bogen auf eine Schlachtkapazität und Verarbeitung<br />
von 300.000 Tieren täglich erweitern. Aufgrund <strong>der</strong> stetig wachsenden Nachfrage<br />
an <strong>Hähnchen</strong>fleisch, möchte Wiesenhof durch die Erweiterung sicherstellen, dass die<br />
Kunden gemäß ihrer Wünsche ausreichend versorgt werden können, um ein abwan<strong>der</strong>n<br />
<strong>der</strong> Kunden zu Konkurrenzunternehmen im In- und Ausland zu vermeiden. Im Zuge dieses<br />
Ausbaus sucht Wiesenhof weitere Erzeuger, die in die <strong>Hähnchen</strong>mast investieren wollen,<br />
um die Ausweitung <strong>der</strong> Schlachtzahlen auch realisieren zu können.(Loibl, 2008)<br />
4.2 Süddeutsche Truthahn AG<br />
Die Süddeutsche Truthahn AG, die seit dem 9 September 1993 besteht, gründete 2002 mit<br />
52 Mastbetrieben aus Bayern und Baden-Württemberg den <strong>Puten</strong>schlacht- und Zerlegebetrieb<br />
in Ampfing. (Bild unten) Im Jahr 2005 wurde das Unternehmen vom österreichischen<br />
Familienunternehmen Hubers Landhendl übernommen. Die Familie Huber konnte somit<br />
das Angebot von Broilern um den <strong>Puten</strong>sektor erweitern und verbesserte dadurch ihre<br />
Wachstumschancen im deutschen und österreichischen Markt. „Durch die Möglichkeit<br />
<strong>Hähnchen</strong> und Pute gemeinsam aus eigener Produktion in unseren Heimmärkten Deutschland<br />
und Österreich anbieten und verkaufen zu können, sind wir in den letzten Jahren ein<br />
sehr leistungsfähiges Unternehmen geworden, welches keinen Vergleich zu scheuen<br />
braucht!“(Bockhorn, 2008), stellt Dieter Bockhorn, Vorstand <strong>der</strong> Süddeutschen Truthahn<br />
AG, im Gespräch fest. Seit <strong>der</strong> Übernahme durch die Familie Huber stiegen die <strong>Puten</strong>schlachtungen<br />
jährlich an und erreichten im Jahr 2007 2 Millionen geschlachtete Tiere. Im<br />
Jahr 2009 werden es 2,6 Millionen <strong>Puten</strong> sein. Derzeit arbeiten 48 Angestellte und 70<br />
Werkslohnunternehmer in <strong>der</strong> Schlachterei in Ampfing. Die AG erwirtschaftet einen jährlichen<br />
Umsatz von ungefähr 40 Mio. Euro.<br />
Quelle: Süddeutsche Truthahn AG<br />
Die Beson<strong>der</strong>heiten bei <strong>der</strong> <strong>Puten</strong>schlachtung in Ampfing sind die automatische Entnahme<br />
<strong>der</strong> Transportbehälter und die CO2 Betäubungsanlage. Die automatischen Entnahmebän<strong>der</strong><br />
beför<strong>der</strong>n die <strong>Puten</strong> schonend aus den Transportkisten, somit werden Verletzungen<br />
und Stress für das Tier vermieden. Die einzigartige CO2 Betäubungsanlage vermeidet<br />
Stresssituationen für das Tier und ermöglicht ein besseres Ausbluten. Dies wie<strong>der</strong>um<br />
bringt zum einen eine bessere Konsistenz und längere Haltbarkeit des Fleisches und ver-
34 Geflügelschlachtereien für Bayern<br />
meidet Bluteinschlüsse. Die automatische Absaugung von Darminhalten während <strong>der</strong><br />
Schlachtung verhin<strong>der</strong>t Verunreinigungen des Schlachtkörpers mit Coli-Bakterien. Die<br />
Schlachterei verkauft die zerlegten Produkte ausschließlich in frischer Form, o<strong>der</strong> über<br />
Hubers Landhendl an namhafte große und kleinere Kunden in Deutschland und Österreich.<br />
Die zuliefernden Erzeugergemeinschaften (EZG) <strong>der</strong> <strong>Puten</strong>schlachterei sind die EZG Höhenrain,<br />
EZG Südhof w.V. in Wertingen, Süddeutsche EZG in Ulm und PEG in Rot am<br />
See. Die Erzeugerpreise verhandelt die Schlachterei direkt mit den Gemeinschaften.<br />
Es gibt bei <strong>der</strong> <strong>Puten</strong>schlachterei in Ampfing keine Integration. Die Erzeuger, die sich <strong>der</strong><br />
QS-Zertifizierung unterziehen müssen, können ihr Futter und ihre Küken frei beziehen.<br />
Eine Voraussetzung ist jedoch, dass das Futter ausschließlich aus QS-Futtermühlen zugekauft<br />
wird. Die Küken kommen zum überwiegenden Teil von zwei deutschen Traditionsbrütereien<br />
dem Moorgut Kartzfehn und den Gebrü<strong>der</strong>n Böcker. Die Einstall- und<br />
Schlachttermine werden von Ampfing aus direkt mit den Erzeugern geplant.<br />
Aufgrund <strong>der</strong> vielschichtigen Absatzmöglichkeiten und <strong>der</strong> Kapazität <strong>der</strong> Süddeutschen<br />
Truthahn AG wird <strong>der</strong> mo<strong>der</strong>ne Betrieb <strong>der</strong>zeit in den Bereichen Schlachtung, Zerlegung,<br />
Verpackung, Kommission und den Kühlmöglichkeiten bis zum Ende des Jahres erweitert.<br />
„Landwirtschaftliche Betriebe, die Interesse an einem Einstieg in die <strong>Puten</strong>mast als langfristige<br />
Option haben, sind je<strong>der</strong>zeit willkommen; sprechen Sie doch einfach mit uns!“<br />
(Bockhorn, 2008), so Vorstand Dieter Bockhorn abschließend.(Bockhorn, 2008)<br />
4.3 Velisco Geflügel GmbH & Co. KG<br />
Velisco besitzt mit dem Betrieb Mutzschen Truthahn GmbH & Co. KG (MTZ), <strong>der</strong> 1961<br />
gegründet wurde und mit dem Gut Stetten GmbH & Co. KG bei Rot am See, das 1967 in<br />
Betrieb ging, zwei Standorte. Diese sind seit 1991 in einem Verbund vereint. Seit dem<br />
Jahr 2003 werden alle Erzeugnisse <strong>der</strong> Betriebe über die Velisco Geflügel GmbH & Co.<br />
KG vermarktet. Velisco rechnet dieses Jahr mit einem Umsatz von 210 Millionen Euro.<br />
Am Schlachthof Rot am See werden in diesem Jahr 5 Mio. <strong>Puten</strong> und in MTZ 3 Mio. <strong>Puten</strong><br />
geschlachtet und verarbeitetet. (Bild unten) Der Vorteil <strong>der</strong> Velisco Geflügel GmbH &<br />
Co. KG liegt in den zwei Standorten und in <strong>der</strong> Zusammenarbeit mit dem Heidemark<br />
Mästerkreis. Diese beiden Firmen zusammen besitzen einen gemeinsamen Lebendtierpool<br />
von etwa 16 Millionen Tieren. Dieser Pool wird so aufgeteilt, dass die Tiere möglichst<br />
regional und logistisch sinnvoll nach ihrem Bestimmungsort geschlachtet werden. Dies<br />
ermöglicht eine bessere Auslastung <strong>der</strong> Standorte und garantiert eine Schlachtung <strong>der</strong> Tiere<br />
selbst dann, wenn einer <strong>der</strong> Betriebe in ein Engpasssituation kommt, da die an<strong>der</strong>en<br />
Schlachtereien die <strong>Puten</strong>schlachtungen übernehmen können und dem Mäster die Abnahme<br />
seiner <strong>Puten</strong> zu je<strong>der</strong> Zeit gewährleistet werden kann.<br />
Quelle: Velisco Gefügel Gmbh & Co.<br />
KG
Geflügelschlachtereien für Bayern 35<br />
Velisco bietet vom Frischfleisch bis hin zu veredelten Produkten ein umfangreiches Sortiment.<br />
Bei <strong>der</strong> Produktentwicklung liegt ein Hauptaugenmerk auf <strong>der</strong> Verarbeitung des<br />
Rotfleisches <strong>der</strong> Pute, da im Bereich <strong>der</strong> <strong>Puten</strong>brustvermarktung schon ein hoher Veredelungsstand<br />
erreicht ist. Beson<strong>der</strong>e Produkte, die <strong>der</strong>zeit in Rot am See produziert werden,<br />
sind das <strong>Puten</strong>kassler aus <strong>der</strong> Oberkeule und die Brustfleischspieße. Die Produkte werden<br />
an Discounter, SB-Warenhäuser und Großhandelszentralen in Deutschland, Österreich,<br />
Schweiz, Slowenien, Benelux und Tschechien geliefert.<br />
Rot am See wird schwerpunktmäßig von <strong>der</strong> EZG Württemberg Fränkische <strong>Puten</strong>erzeugergemeinschaft<br />
beliefert. Weitere Erzeugergemeinschaften von Velisco sind die Nordwest,<br />
Münsterland, Oldenburg, F+W, KBK und auch Einzelvertragsmäster. Die EZG handeln<br />
in <strong>der</strong> Regel mit <strong>der</strong> Schlachterei die Preise für ein kg geliefertes Lebendgewicht aus.<br />
Die Ermittlung des <strong>Puten</strong>lebendgewichts am Schlachthof erfolgt sofort nach Ankunft <strong>der</strong><br />
Tiere. Die Mäster haben die Wahl bei welcher Brüterei sie ihre Küken bestellen und sie<br />
können das von Velisco konzipierte Futtermittel frei bei den gelisteten Herstellern beziehen.<br />
Die Listung <strong>der</strong> Futtermittelhersteller nimmt Velisco gemeinsam mit den EZG vor.<br />
Das konzipierte Futter darf keine antibiotischen Leistungsför<strong>der</strong>er enthalten. Die Qualitätsstandards<br />
bei Velsico gehen bei allen Erzeuger- und Verarbeitungsstufen über die Anfor<strong>der</strong>ungen<br />
des QS-Siegels <strong>der</strong> CMA hinaus. Zudem bietet Velsico auch das 5D-<br />
Zertifikat an bei dem die Elterntiere, die Küken und die Futtermühle aus Deutschland<br />
stammen und zudem die Aufzucht und die Schlachtung <strong>der</strong> Tiere in Deutschland erfolgen<br />
muss. Die Vermarktungsbereiche, die GVO-freie Rohkomponenten erfor<strong>der</strong>n, kann Velisco<br />
mit Hilfe von ausgewählten Mästern und Futtermittelherstellern bedienen.<br />
Für die Mäster und solche die Interesse an <strong>der</strong> <strong>Puten</strong>mast haben, bietet Velsico eine kostenlose<br />
Beratung an. Diese betrifft die Standortfindung eines Neubaus, die Bauberatung,<br />
die Investitionsplanung, sowie eine begleitende Betreuung während <strong>der</strong> Durchgänge vom<br />
Einstallen bis zum Ausstallen. Das Unternehmen betont hierbei seine Unabhängigkeit in<br />
<strong>der</strong> Beratung, weil es selbst keine Ambitionen als Zulieferer an die Landwirte hat, son<strong>der</strong>n<br />
lediglich als Abnehmer <strong>der</strong> erzeugten <strong>Puten</strong> in Erscheinung tritt.<br />
Der Standort Rot am See verfügt zurzeit über eine Schlacht- und Zerlegekapazität von<br />
20.000 <strong>Puten</strong> am Tag im Einschichtsystem. Eine Verdoppelung <strong>der</strong> Kapazität ist räumlich<br />
kein Problem. Für Son<strong>der</strong>fälle (Krisensituationen in <strong>der</strong> Branche) können für einen befristen<br />
Zeitraum 40.000 Tiere verarbeitet werden. Zudem sollen die Feinkostverarbeitung,<br />
Verpackungsanlagen und Kommissionierung mo<strong>der</strong>nisiert und erweitert werden.<br />
Das Unternehmen ist bemüht die Aufzucht und die Schlachtung in einer Region durchzuführen,<br />
damit dies weiterhin umgesetzt werden kann, sind neue Mäster am Standort Rot<br />
am See erwünscht.(Ehret, 2008)<br />
4.4 Wichmann Enten GmbH<br />
Die Familie Wichmann, die das Unternehmen in <strong>der</strong> 3 Generation leitet, begann mit <strong>der</strong><br />
Produktion von Wassergeflügel im Jahr 1934. Die Zweigstelle für die Kükenproduktion in<br />
Warmersdorf wurde im Jahr 1965 gegründet. (Bild unten) Der Ausbau des Standortes zu<br />
einem Schlachthof resultierte aus dem rückläufigen Kükenabsatz im Jahr 1971 und <strong>der</strong><br />
Überlegung sich ein zweites Standbein zu schaffen. Seit 2003 werden in Warmersdorf<br />
ausschließlich Enten geschlachtet. Innerhalb von 5 Jahren konnten die jährlichen Schlachtungen<br />
um 2 Millionen Enten auf 6 Millionen Enten pro Jahr gesteigert werden. Der Konzern<br />
hat <strong>der</strong>zeit einen Jahresumsatz von 70 Millionen Euro und in etwa 350 Beschäftigte,<br />
davon arbeiten in Bayern am Standort Warmersdorf etwa 140 Angestellte.
36 Geflügelschlachtereien für Bayern<br />
Quelle: Wichmann Enten GmbH Warmersdorf<br />
Das Warenangebot <strong>der</strong> Firma reicht von frischer Ware bis zur Tiefkühlware. Die TK-<br />
Ware macht mit einem Anteil von 95% das Kerngeschäft aus. Verkauft werden ganze und<br />
gefrorene Enten, sowie Teilstücke und auch Convenience Produkte. Die Convenience<br />
Produkte machen etwa 20% des Handels aus, angeboten werden tiefgefrorene, entbeinte<br />
und gewürzte Gourmeenten und Entengrillpfannen. In diesem Bereich wird bei Wichmann<br />
auch weiterhin ein steigendes Wachstum erwartet. Der Vertrieb des Entenfleischs reicht<br />
von Europa bis nach Asien.<br />
Die Vertragslandwirte <strong>der</strong> Wichmann Enten GmbH liegen nicht weiter als 4 Transportstunden<br />
von <strong>der</strong> Schlachterei Warmersdorf entfernt, das entspricht in etwa 300 Kilometer.<br />
Alle Mäster des Schlachthofs in Warmersdorf sind Mitglie<strong>der</strong> <strong>der</strong> Süddeutschen EZG für<br />
Enten. Die EZG und Wichmann trifft sich alle 3 Monate mit ihren Mästern, um die Auszahlungspreise<br />
neu zu verhandeln und Erfahrungen auszutauschen.<br />
Die Wichmann Enten GmbH ist ein Integrationsbetrieb. Der Pekingentenmäster erhält<br />
seine Küken von <strong>der</strong> hauseigenen Brüterei, das Futter hingegen wird für alle bayrischen<br />
Mäster von Wichmann bei ausgewählten Futtermittelherstellern gekauft. Das Futter wird<br />
nach einer bestimmten Rezeptur für alle Landwirte gleich hergestellt. Damit sich die Inhaltsstoffe<br />
und <strong>der</strong> Energiegehalt des Futters nie wesentlich unterscheiden, führt Wichmann<br />
auf eigene Kosten Futtermittelanalysen durch. Die Schlachtung erfolgt bei Wichmann<br />
nach festen Abnahmeverträgen mit einer Länge von 3 bis zu 12 Monaten. Die Mastverträge<br />
handelt <strong>der</strong> Mäster individuell mit dem Unternehmen aus. Zusätzlich bietet<br />
Wichmann für alle Mäster und Interessenten kostenlose Beratungen an. Diese reicht von<br />
<strong>der</strong> Informationsfindung, über die Genehmigung eines Bauvorhabens bis hin zu einer unterstützenden<br />
Betreuung bei <strong>der</strong> laufenden Mast. Die Finanzierung des Futters und <strong>der</strong><br />
Entenküken, welche die größten Umlaufkosten darstellen, erfolgt bei Wichmann über ein<br />
Gutschriftverfahren. Diese Kosten werden vom Landwirt erst beglichen, nachdem die Lieferung<br />
<strong>der</strong> gemästeten Tiere an den Schlachthof erfolgt ist. Somit muss <strong>der</strong> Landwirt dieses<br />
Umlaufvermögen nicht vorfinanzieren.<br />
Das Unternehmen nimmt zur Qualitätssicherung an dem Zertifizierungssystem IFS (International<br />
Food Standard) und DIN EN ISO 9001:2000 und QS für sichere Lebensmittel<br />
teil. Außerdem wird bei Wichmann bei <strong>der</strong> Produktion auf die 5D großen Wert gelegt.<br />
Garantiert wird dies durch die eigene Brüterei und Elterntierhaltung in Ermke. Das Futtermittel<br />
stammt ausschließlich von deutschen Mühlen und die Mast, sowie die Schlachtung<br />
finden in Deutschland statt. Außerdem wird die Mast ohne Antibiotika durchgeführt.<br />
Die Schlachtkapazität in Warmersdorf soll innerhalb <strong>der</strong> nächsten 2 Jahre auf etwa 8 Millionen<br />
geschlachtete Enten erweitert werden. Des Weiteren wird eine eigene Mühle in<br />
Bayern für das Unternehmen gesucht, um die Herstellung eines stets qualitativ hochwerti-
Produktions- und Investitionsbedingungen 37<br />
gen Mischfutters für die Mäster besser gewährleisten zu können. Für die Ausweitung <strong>der</strong><br />
Produktion werden bei <strong>der</strong> Wichmann Enten GmbH weiterhin Landwirte gesucht, die sich<br />
einen Einstieg in die Entenproduktion vorstellen können.(Wichmann, 2008)<br />
5 Produktions- und Investitionsbedingungen<br />
5.1 Verfahrenstechnik<br />
Die in 7.2 erklärten Verfahrenstechniken sind im Geflügeljahrbuch 2008 nachzulesen.<br />
(Damme, 2007)<br />
5.1.1 <strong>Hähnchen</strong>mast<br />
Abbildung 6: Blick in einen <strong>Hähnchen</strong>maststall<br />
Splittingverfahren<br />
Das häufigste Verfahren in <strong>der</strong> Broilermast in Bayern ist das Splittingverfahren. Das Splittingverfahren<br />
ist eine Zwischenform von Kurzmast und Mittellangmast. Es werden die für<br />
die Kurzmast üblichen 23 Tiere pro m 2 eingestallt. Damit allerdings die maximale Besatzdichte<br />
von 35 kg/m 2 nicht überschritten wird, werden 20% bis 30 % <strong>der</strong> Tiere zwischen<br />
dem 30. und 32. Masttag herausgefangen. Die restlichen Tiere sind je nach Zielgewicht<br />
nach durchschnittlich 38 o<strong>der</strong> 40 Tagen auszustallen. Mit diesem Verfahren wird <strong>der</strong> Festkostenanteil<br />
pro kg produzierter Lebendmasse reduziert, da mehr kg pro m 2 Stallfläche<br />
erzeugt werden.<br />
Kurzmast<br />
Ein an<strong>der</strong>es Verfahren ist die Kurzmast. Diese dauert zwischen 30 und 32 Masttagen.<br />
Beim Ausstallen haben die Broiler ein Gewicht zwischen 1500 g und 1550 g. Durch kürzere<br />
Belegzeiten und mehrere Durchgänge im Jahr wird <strong>der</strong> Stall häufiger gereinigt und<br />
desinfiziert, wodurch sich die Hygiene verbessert. Weitere Vorteile sind die geringeren
38 Produktions- und Investitionsbedingungen<br />
Verlustraten und die höheren Auszahlungspreise pro kg produziertes Lebendgewicht<br />
Durch die häufigeren Auszahlungen vom Schlachthof wird außerdem die Liquidität des<br />
Landwirts gesteigert.<br />
5.1.2 <strong>Puten</strong>mast<br />
Abbildung 7: Blick in einen Offenstall für die <strong>Puten</strong>mast<br />
Aufgrund <strong>der</strong> immer weiter ansteigenden Nachfrage nach <strong>Puten</strong>teilstücken werden in<br />
Bayern überwiegend weiße, schwere Zerlegeputen (Big 6 BUT) in Langzeitmast gehalten.<br />
In <strong>der</strong> Langzeitmast erreichen die Hähne in 19–22 Wochen ein Gewicht von 18-22 kg und<br />
die Hennen erreichen in 15–17 Wochen ein Gewicht von 9–11 kg. Aufgrund des stark<br />
ausgeprägten Geschlechterdimorphismus werden die männlichen und weiblichen <strong>Puten</strong><br />
nur in <strong>der</strong> Aufzuchtphase gemeinsam gehalten, während die Mast geschlechtergetrennt<br />
verläuft. Für die <strong>Puten</strong>mast gibt es verschiedene Verfahren, die von <strong>der</strong> zur Verfügung<br />
stehenden Aufzucht und Mastfläche abhängig sind.<br />
24-Wochen-Rhythmus<br />
Dieses Verfahren wird verwendet, wenn dem Mäster nur ein Stall zur Verfügung steht.<br />
Hennen und Hähne werden schon als Eintagsküken, o<strong>der</strong> erst als Jungputen im Alter von<br />
4-5 Wochen in verschiedene Abteile o<strong>der</strong> Ställe gesperrt. Etwa 60% <strong>der</strong> Stallfläche wird<br />
mit Hähnen und etwa 40% mit Hennen besetzt. Nach etwa 16 Wochen werden die Hennen<br />
ausgestallt, so haben die Hähne für die verbleibende Mastzeit ausreichend Platz, um die<br />
maximalen Besatzdichte nicht zu überschreiten. Nach <strong>der</strong> Ausstallung <strong>der</strong> Hähne wird<br />
gereinigt und desinfiziert. Das all-in-all-out Verfahren garantiert eine Unterbrechung <strong>der</strong><br />
Infektionskette, allerdings können maximal 2,2 Durchgänge pro Jahr erreicht werden, wodurch<br />
die Rentabilität im Vergleich zu den an<strong>der</strong>en Verfahren leidet.<br />
18-Wochen-Rhythmus<br />
Dies ist ein kontinuierliches Verfahren. Es werden anfänglich männliche und weibliche<br />
Küken zusammen in einem Aufzuchtstall gehalten. Nach etwa 4 bis 5 Wochen werden die
Produktions- und Investitionsbedingungen 39<br />
Hähne in einen Maststall umgesetzt und die Hennen verbleiben im Aufzuchtstall. Nach<br />
<strong>der</strong> Schlachtung <strong>der</strong> Hennen in <strong>der</strong> 16. Woche wird <strong>der</strong> Stall gereinigt, desinfiziert und<br />
kann nach einer ausreichenden Leerzeit mit einem neuen Durchgang etwa in <strong>der</strong> 19. Woche<br />
bestückt werden. Die Hähne werden mit 19-22 Wochen aus dem Maststall ausgestallt,<br />
wodurch ein Umstallen <strong>der</strong> neu eingesetzten Hähne aus dem Aufzuchtstall nach <strong>der</strong> Reinigung<br />
und Desinfektion des Maststalls in <strong>der</strong> 24.-25. Woche möglich ist. Dieser Rhythmus<br />
ermöglicht eine Auslastung von 2,9 Durchgängen im Jahr. Ein Problem besteht lediglich<br />
bei <strong>der</strong> Hygiene, da vorübergehend zwei Altersstufen von <strong>Puten</strong> auf dem Betrieb gehalten<br />
werden. Dieses Hygieneproblem kann durch einen ausreichenden Abstand von Aufzuchtund<br />
Maststall vermieden werden.<br />
13-Wochen-Rhyhtmus<br />
Die Hähne und Hennen werden gemeinsam in einen Aufzuchtstall eingesetzt. Die Hennen<br />
werden bereits nach 5 Wochen in einen Maststall umgesetzt, indem sie bis zur Schlachtung<br />
verbleiben. Die Hähne kommen erst nach 10 Wochen vom Aufzuchtstall in einen<br />
extra Maststall. Deshalb benötigt dieser Rhythmus separate Mastställe für Hennen und<br />
Hähne. Der Aufzuchtstall ist nach <strong>der</strong> Umstallung <strong>der</strong> Hähne geräumt und wird nach den<br />
üblichen Hygienemaßnahmen in <strong>der</strong> 13 Woche neu besetzt. Somit werden bis zu 4 Durchgänge<br />
im Jahr erreicht. Aus ökonomischer Sicht sind mehrere Durchgänge im Jahr zwar<br />
interessant, jedoch birgt die Mast von verschiedenen Altersgruppen aus verschiedenen<br />
Kükenbeständen an einem Standort ein hygienisches Risiko.<br />
8-Wochen-Rhythmus<br />
Der 8-Wochen-Ryhtmus ist lediglich für große Betriebe interessant, da für einen solchen<br />
Rhythmus mehrere Mastställe benötigt werden. Dieser Rhythmus ist für einen Einsteiger<br />
nicht nur aus finanzieller Sicht, son<strong>der</strong>n auch aus mangeln<strong>der</strong> Erfahrung nicht zu empfehlen.<br />
Bei diesem Verfahren wird ein Stall als reiner Aufzuchtstall genutzt. Die <strong>Puten</strong> aus<br />
dem Aufzuchtstall werden in die Mastställe umgestallt, so dass alle 8 Wochen neue Küken<br />
eingesetzt werden können.<br />
5.1.3 Pekingentenmast<br />
Abbildung 8: Blick in einen Pekingentenmaststall
40 Produktions- und Investitionsbedingungen<br />
Die Pekingentenmast in Bayern ist durch einen hohen Integrationsgrad gekennzeichnet.<br />
Die Lieferung <strong>der</strong> Küken, des Futters und die Schlachtung <strong>der</strong> Tiere liegen in <strong>der</strong> Hand<br />
eines Unternehmens. Bei <strong>der</strong> Pekingentenmast werden zwei Phasen unterschieden, die<br />
Aufzucht- und Mastphase. Die Aufzuchtphase dauert etwa 21 Tage, sie findet in einem<br />
Aufzuchtstall statt, <strong>der</strong> sehr gut isoliert sein muss, um Heizkosten zu sparen, da die Tiere<br />
in ihrem ersten Lebensabschnitt über keine ausreichende Thermoregulation verfügen. Im<br />
Anschluss daran werden die Pekingenten in einen Maststall o<strong>der</strong> ein Mastabteil umgestallt.<br />
Dort verweilen die Tiere 40 bis 47 Lebenstage bis ihr gewünschtes Mastendgewicht<br />
von 3- 3,2 kg erreicht ist. Pekingentenmast werden entwe<strong>der</strong> im All-in-all-out- o<strong>der</strong> im<br />
Umtriebsverfahren gemästet.<br />
All-in-all-out-Verfahren<br />
Beim All-in-all-out-Verfahren erreicht <strong>der</strong> Mäster bis zu 9 Durchgänge pro Jahr. Die Anzahl<br />
<strong>der</strong> eigestallten Tiere richtet sich nach <strong>der</strong> erlaubten Besatzdichte von 20kg/m 2 und<br />
entspricht 6,6 Tieren/m 2 Stallnutzfläche. Der Mäster stallt so viele Tiere ein, wie er auf <strong>der</strong><br />
gesamten Stallfläche einschließlich des Aufzuchtstalls Tiere halten darf. Die Tiere verbringen<br />
die ersten Lebenstage im Aufzuchtstall. Wenn die Jungenten 20kg Lebendmasse<br />
pro m 2 Stallfläche überschreiten, wird den Tieren die Fläche des Aufzucht- und Maststalls<br />
zur Verfügung gestellt. Der hygienische Vorteil des Verfahrens ist, dass keine zwei Altersgruppen<br />
<strong>der</strong> Tiere auf <strong>der</strong> Hofstelle gehalten werden. Der wirtschaftliche Nachteil ist,<br />
dass weniger gemästete Tiere im Jahr die Hofstelle verlassen.<br />
Umtriebsverfahren<br />
Beim Umtriebsverfahren werden die Enten, wie beim All-in-all-out-Verfahren zunächst in<br />
den Aufzuchtstall eingesetzt. Der Unterschied ist, dass alle Tiere von <strong>der</strong> Aufzucht in den<br />
Maststall umgestallt werden und <strong>der</strong> Aufzuchtstall nach <strong>der</strong> Reinigung und Desinfektion<br />
mit neuen Küken besetzt wird. Aufgrund des Umstallens werden so viele Tiere in <strong>der</strong><br />
Aufzucht eingestallt, dass im Maststall die 20 kg Lebendmasse pro m 2 Stallfläche laut<br />
freiwilliger Vereinbarung nicht überschritten werden. Dieses Verfahren erlaubt dem Mäster<br />
13 bis zu maximal 15 Durchgänge pro Jahr, wodurch trotz geringerer Kükenzahl pro<br />
Einstallung eine größere Stückzahl an gemästeten Enten pro Jahr erreicht wird. Hygienisch<br />
gesehen, hat das Umtriebsverfahren den Nachteil, dass zwei Generationen von Pekingenten<br />
zur gleichen Zeit auf <strong>der</strong> Hofstelle gemästet werden. Dieses Problem kann<br />
durch einen örtlich vom Maststall getrennten Aufzuchtstall vermieden werden.<br />
5.2 Produktionskennzahlen<br />
Um einen kurzen Überblick über die wichtigsten Produktionskennzahlen <strong>der</strong> Geflügelhaltung<br />
zu bekommen, sind in <strong>der</strong> folgenden Tabelle die durchschnittlichen Produktionskennzahlen<br />
von Broiler, Pute und Pekingente dargestellt. Diese Durchschnittswerte <strong>der</strong><br />
Tabelle 16, die sich auf das Jahr 2007 beziehen, dienen als Grundlage für spätere Berechnungen.
Produktions- und Investitionsbedingungen 41<br />
Tabelle 16: Durchschnittliche Produktionskennzahlen von Broiler, Pute und Pekingente<br />
im Jahr 2007<br />
<strong>Hähnchen</strong> Pute Pekingente<br />
Verfahren<br />
Lebendgewicht<br />
Normalmast Splitting weiblich männlich Umtriebsmast<br />
(LG) am Ende<br />
<strong>der</strong> Mast in kg<br />
1,59 (1) 2,06 (3) 10,6 (5) 21,0 (5) 3,0 (6)<br />
Masttage 31 (1) 35,4 (3) 111 (5) 145 (5) 44 (6)<br />
tägliche Zunah-<br />
51 (1) 57,4 (1) 96 (5) 145 (5) 68,4 (6)<br />
men in g<br />
Futterverwertung<br />
(FVW) in kg<br />
Futter/kg LG<br />
1,58 (2) 1,71 (3) 2,67 (5) 2,32 (6)<br />
Verluste in % 5,0 (2) 5,9 (3) 4,1 (5) 10,4 (5) 4,9 (6)<br />
Durchgänge im<br />
Jahr (DG)<br />
8,7 (2) 7,43 (4) 2,9 (5) /2,2 (4) 2,9 (5) /2,2 (4) 13,2 (6)<br />
Kükenpreise in<br />
Euro<br />
0,31 (3) 0,31 (3) 1,72 0,69 (6)<br />
Besatzdichte in<br />
Tiere je m 2 23 (8) 23 (8) 5,6 (5) 3,2 (5) 6,6 (7)<br />
Erzeugerpreis in<br />
Euro ohne MwSt.<br />
0,735 (2) 0,691 (2) 1,03 (5) 1,12 (5) 1,02 (6)<br />
Quelle: (1) (Sachsenhauser, 2008)<br />
(2) (Gotthart, 2008)<br />
(3) (Schöllhammer, 2008), Kükenpreis ohne MwSt. und Verluste<br />
(4) (Damme, 2008)<br />
(5) (Schmitz-Du-Mont, 2008)<br />
(6) (Adleff, 2008)<br />
(7) Besatzdichte laut freiwilligen Vereinbarungen (<strong>Bayerische</strong>s Staatsministerium für Gesundheit, 2003, S. 27) geteilt<br />
durch das Schlachtgewicht(Adleff, 2008) (Damme, 2007)<br />
5.3 Arbeitszeitaufwand <strong>der</strong> laufenden Produktion<br />
Der Arbeitszeitaufwand in <strong>der</strong> Geflügelmast ist stark davon abhängig welches Geflügel<br />
gemästet wird. In dieser Branche sind neugebaute Ställe so konzipiert, dass die manuelle<br />
Arbeit auf ein Minimum reduziert wird. Die arbeitsintensivste Tätigkeit ist das Ausstallen.<br />
Dieser Arbeitsgang wird in <strong>der</strong> Regel mit Fremdarbeitskräften bewältigt. Die Arbeitszeit<br />
des Ausmistens hängt von <strong>der</strong> maschinellen Ausstattung des Betriebes und auch von <strong>der</strong><br />
Bauweise des Stalls ab. Durch einen geschliffenen Boden o<strong>der</strong> eine Kehrmaschine kann<br />
auf manuelle Arbeit bei <strong>der</strong> Trockenreinigung fast verzichtet werden. Die täglichen Arbeiten<br />
sind durch eine automatische Fütterung, Tränkwasserbereitstellung, Temperatur- und<br />
Lüftungsregelung bereits auf ein Minimum reduziert. Lediglich bei den <strong>Puten</strong> und Pekingenten<br />
besteht ein Einsparungspotential beim Nachstreuen von Stroh, dass in <strong>der</strong> Regel<br />
von zwei Arbeitern erledigt werden muss. Aufgrund des bereits hohen Mechanisierungsstandards<br />
sind weitere Zeiteinsparungen in <strong>der</strong> Geflügelmast sehr kostenintensiv. In <strong>der</strong><br />
Tabelle 17 wird <strong>der</strong> Arbeitszeitbedarf für die Bestandsgrößen und Verfahren ermittelt, die<br />
für folgende Berechnungen benötigt werden.
42 Produktions- und Investitionsbedingungen<br />
Tabelle 17: Arbeitszeitbedarf in <strong>der</strong> Geflügelmast<br />
Verfahren<br />
<strong>Hähnchen</strong>mast <strong>Puten</strong>mast<br />
Kurzmast<br />
(Normalmast)<br />
Splitting<br />
Rein Raus<br />
24 Wochenrhythmus <br />
Umtriebsverfahren<br />
18 Wochenrhythmus <br />
Pekingentenmast <br />
Umtriebsverfahren<br />
Bestandesgröße 40.000 40.000 7.600 20.000 6.000<br />
Anzahl <strong>der</strong> Durchgänge 8,7 7,43 2,2 2,9 13,2<br />
Akmin/100 Tiere und Durch-<br />
17,6 (1) 18,7 (1) 305 (2) 275 (2) 114 (3)<br />
gang<br />
Akh/Durchgang 117 124 386 917 114<br />
Akh/Jahr<br />
Arbeitskosten für 100 Tier in<br />
1.020 920 850 2.660 1.500<br />
€ (bei einem Stundenlohnansatz<br />
von 15 €/Akh)<br />
4,40 4,64 76,25 68,75 28,50<br />
Arbeitskosten pro Mastplatz<br />
in € (bei 15 € Stundenlohn)<br />
0,38 0,35 1,68 1,99 3,76<br />
Quelle: (1) (Kuratorium für Technik und Bauwesen in <strong>der</strong> Landwirtschaft e. V., 2006) Ohne Arbeitszeit für Weizenbeigabe<br />
(keine Relevanz) und für das Ausstallen (Fremd-AK)<br />
(2) (Damme, 2007)<br />
(3) (Müller & Hiller, 2002)<br />
In Abbildung 9 wird gezeigt, welche Arbeiten prozentual die meiste Zeit bei den verschiedenen<br />
Mastverfahren in Anspruch nehmen. Die Abbildung resultiert aus <strong>der</strong> Auswertung<br />
einer selbst durchgeführten Befragung von 6 <strong>Hähnchen</strong>-, 3 Enten- und 3 <strong>Puten</strong>mästern.<br />
In <strong>der</strong> <strong>Puten</strong>- und <strong>Hähnchen</strong>mast nimmt <strong>der</strong> tägliche Kontrollgang die meiste Arbeitszeit<br />
mit insgesamt über 49% <strong>der</strong> Gesamtarbeitszeit pro DG in Anspruch. Beim Ausstallen wird<br />
ebenso für beide Mastverfahren eine ähnliche Zeitspanne von 14% und 17% benötigt. Der<br />
große Unterschied zwischen den Tierarten liegt im Zeitbedarf für das Einstreuen. Bei den<br />
Enten ist nahezu tägliches Einstreuen und bei den <strong>Puten</strong> ein Nachstreuen alle 5 bis 7 Tage<br />
unerlässlich. Bei <strong>der</strong> <strong>Hähnchen</strong>mast hingegen muss während eines Mastdurchgangs nicht<br />
nachgestreut werden. Aus diesem Grund sind die Reinigung und die Vorbereitung zum<br />
Einstallen, sowie das Einstallen selbst wichtiger, da diesen Arbeiten im Verhältnis zu den<br />
an<strong>der</strong>en ein größerer Stellenwert zukommt. Bei den Pekingenten lässt sich das Einstreuen<br />
aufgrund <strong>der</strong> Häufigkeit während <strong>der</strong> Aufzuchtsphase und vor allem während <strong>der</strong> Mast zu<br />
den täglichen Arbeiten rechnen. Der Arbeitsaufwand <strong>der</strong> täglichen Arbeiten ist deshalb<br />
prozentual betrachtet, da bei <strong>der</strong> Pekingenten-, <strong>Puten</strong>- und <strong>Hähnchen</strong>mast fast identisch.
Produktions- und Investitionsbedingungen 43<br />
Prozent<br />
100%<br />
90%<br />
80%<br />
70%<br />
60%<br />
50%<br />
40%<br />
30%<br />
20%<br />
10%<br />
0%<br />
14<br />
3<br />
8<br />
55<br />
27<br />
2<br />
37<br />
Arbeitszeitverteilung<br />
15<br />
5<br />
2<br />
7<br />
0,3<br />
8<br />
0,3<br />
3<br />
1<br />
3<br />
1<br />
7<br />
3<br />
4<br />
8<br />
1<br />
10<br />
1<br />
4<br />
Pute Pekingente Masthähnchen<br />
Abbildung 9: Prozentuelle Verteilung <strong>der</strong> einzelnen Arbeitsschritte pro Durchgang<br />
(Erstellt aus eigener Umfrage)<br />
Bisher wurde aufgezeigt welche Arbeiten in einem Durchgang die meiste Zeit beansprucht.<br />
Im Folgenden wird veranschaulicht, wie sich die einzelnen Arbeitsschritte über das<br />
Jahr verteilt und wie häufig sie zu bewältigen sind. Die Abbildung 10 zeigt beispielhaft,<br />
wie die Planung einer <strong>Hähnchen</strong>mast im Splittingverfahren und 7,5 Durchgängen pro Jahr<br />
aussehen kann.<br />
17<br />
4<br />
49<br />
Ausstallen (Fangen, Verladen)<br />
Umstallung/Rausfangen<br />
Einstreuen<br />
Kontrollgang (Fütterung, Stallklima,<br />
Tier)<br />
Einstallen<br />
Vorbereitung zum Einstallen + Einstreu<br />
Desinfektion<br />
Nassreinigung<br />
Trockenreinigung<br />
Ausmisten
44 Produktions- und Investitionsbedingungen<br />
Arbeitsstunden<br />
35<br />
30<br />
25<br />
20<br />
15<br />
10<br />
5<br />
0<br />
1<br />
2<br />
3<br />
4<br />
01. Jan 01. Feb 01. Mrz 01. Apr 01. Mai 01. Jun 01. Jul 01. Aug 01. Sep 01. Okt 01. Nov 01. Dez<br />
1: Vorbereitung zum Einstallen + Einstallen<br />
2: tägliche Arbeiten<br />
3: Rausfangen <strong>der</strong> leichten Broiler<br />
4: Ausstallen<br />
5: Ausmisten + Waschen + Desinfizieren<br />
6: Leerzeit Maststall<br />
5<br />
2<br />
6<br />
<strong>Hähnchen</strong>mast Splitting<br />
Monate<br />
Abbildung 10: Arbeitszeitspitzen in <strong>der</strong> <strong>Hähnchen</strong>mast bei einem Splittingverfahren<br />
(Eigene Auswertung von 6 befragten Landwirten)<br />
Der Arbeitsablauf eines Durchgangs beginnt mit <strong>der</strong> Vorbereitung zum Einstallen. Dieser<br />
Arbeitsschritt kann von einer Person erledigt werden. Für das Einstallen selbst werden<br />
Helfer benötigt, da die Küken in einer kurzen Zeitspanne in den Stall eingesetzt werden<br />
müssen, um sie keinem Stressrisiko, wie Temperaturschwankungen, auszusetzen. Vier bis<br />
fünf Helfer brauchen für das Einstallen von 40.000 Küken nicht länger als eine Stunde.<br />
Die täglichen Kontrollgänge nehmen in etwa 2 Stunden am Tag in Anspruch. Beim Rausfangen<br />
<strong>der</strong> leichten Broiler nach etwa 31 Tagen, sowie das Ausstallen <strong>der</strong> restlichen Masttiere<br />
zwischen dem 37.-39. Tag, wird bei den meisten Mästern von Fangtrupps erledigt.<br />
Vom Landwirt allein kann diese Tätigkeit aufgrund des Zeitdrucks, in <strong>der</strong> die Lastkraftwagen<br />
beladen werden müssen, nicht bewältigt werden. Das Ausmisten, Waschen und<br />
Desinfizieren nimmt etwa 16 Arbeitsstunden in Anspruch. Dies kann von einer Person in<br />
zwei Tagen erledigt werden. Bei dieser Arbeit ist Eile geboten, um längere Leerzeiten des<br />
Stalls zu erreichen und somit die Keimbelastung des Stalls weiter zu verringern.<br />
In <strong>der</strong> Abbildung 11 ist <strong>der</strong> beispielhafte Jahresarbeitszeitablauf in <strong>der</strong> Pekingentenmast<br />
bei einem Umtriebsverfahren mit 14 Durchgängen gezeigt.
Produktions- und Investitionsbedingungen 45<br />
Arbeitsstunden<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
2 4<br />
1 3 5<br />
6<br />
Pekingentenmast Umtriebsverfahren<br />
01. Jan 01. Feb 01. Mrz 01. Apr 01. Mai 01. Jun 01. Jul 01. Aug 01. Sep 01. Okt 01. Nov 01. Dez<br />
Monate<br />
1: Leerzeit Maststall<br />
2: Vorbereitungen zum Umstallen in den Maststall und Ausmisten + Waschen + Desinfizieren<br />
des Aufzuchtstalls<br />
3: Leerzeit Aufzuchtstall<br />
4: Vorbereitung zum Einstallen + Einstallen des Aufzuchtstalls<br />
5: tägliche Arbeit mit Mast und Aufzucht + Nachstreuen<br />
6: Ausstallen des Maststalls + Ausmisten + Waschen + Desinfizieren<br />
Abbildung 11: Arbeitszeitspitzen in <strong>der</strong> Pekingentenmast bei einem Umtriebsverfahren<br />
(Eigene Auswertung von 3 befragten Landwirten)<br />
Bei <strong>der</strong> Pekingentenmast sind die Arbeiten in diejenigen einzuteilen, die von einer Person<br />
erledigt werden können, wie das Ausmisten, Waschen, Desinfizieren, die täglichen Kontrollgänge<br />
und in diejenigen Arbeiten, die nicht allein bewältigt werden können, wie z. B.<br />
dem Umstallen. Beim Ausstallen ist Hilfe unbedingt von Nöten, da dies alleine, wegen <strong>der</strong><br />
Eile beim Tiertransport, nicht zu schaffen ist. Außerdem ist die Arbeit des Ausstallens bei<br />
einem Umtriebsverfahren 13-15-mal zu bewältigen, zudem handelt es sich hierbei um eine<br />
sehr anstrengende Arbeit und daher wird in <strong>der</strong> Regel auf Fangtrupps zurückgegriffen. Für<br />
das Einstreuen werden auch zwei Personen gebraucht, da ein Helfer die Tiere während des<br />
Einstreuens durch einen Traktor vor dem Überfahren schützen muss.<br />
Die Abbildung 12 zeigt die <strong>Puten</strong>mast in einer Beispielsplanung eines 18-Wochen-<br />
Rhythmus mit 2,9 Durchgängen im Jahr. Zu beachten ist hierbei, dass bei einem angenommenen<br />
18-Wochen-Rhythmus wesentlich mehr Stallnutzfläche zu bearbeiten ist, als<br />
bei den an<strong>der</strong>en Geflügelmastverfahren. Da für dieses Mastverfahren bei einem Aufzuchtstall<br />
mit 1.900 m 2 und zwei Mastställe mit jeweils 1600 m 2 benötigt werden. Diese<br />
großen Stallnutzflächen erfor<strong>der</strong>n einen größeren Arbeitsaufwand als bei einem <strong>Hähnchen</strong>-<br />
o<strong>der</strong> Pekingentenmaststall. In <strong>der</strong> Grafik zeigt sich <strong>der</strong> Arbeitsmehraufwand nicht in<br />
<strong>der</strong> Höhe, son<strong>der</strong>n in <strong>der</strong> Breite <strong>der</strong> Spitzen.
46 Produktions- und Investitionsbedingungen<br />
Arbeitsstunden<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
01. Jan 01. Feb 01. Mrz 01. Apr 01. Mai 01. Jun 01. Jul 01. Aug 01. Sep 01. Okt 01. Nov 01. Dez<br />
1: Vorbereiten des Aufzuchtstalls zum Einstallen + Einstallen<br />
2: tägliche Betreuung von Hennen und Hähnen + Nachstreuen<br />
3: Ausstallen <strong>der</strong> <strong>Puten</strong>hähne aus dem Maststall + Ausmisten + Waschen + Desinfizieren<br />
4: Leerzeit Maststall<br />
5: Vorbereitung und Einstreuen des Maststalls + Umstallen <strong>der</strong> Hähne aus dem Aufzuchtstall in<br />
den Maststall<br />
6: Ausstallen <strong>der</strong> Hennen aus dem Aufzuchtstall + Ausmisten + Waschen + Desinfizieren<br />
7: tägliche Kontrolle <strong>der</strong> Hähne im Maststall + Nachstreuen<br />
Abbildung 12: Arbeitszeitspitzen in <strong>der</strong> <strong>Puten</strong>mast bei einem 18-Wochenrhythmus<br />
(Eigene Auswertung von 3 befragten Landwirten)<br />
Bei den <strong>Puten</strong> gibt es beim 18-Wochenrhythmus nur wenige Arbeitsspitzen, diese sind<br />
jedoch mit einem hohen Arbeitsaufwand und Einsatz verbunden. Das Vorbereiten des<br />
Aufzuchtstalls gegebenenfalls mit dem Aufbau <strong>der</strong> Kükenringe, dem Einstreuen usw.<br />
nimmt 2 bis 3 Tage in Anspruch. Das Ausmisten, Waschen und Desinfizieren des Aufzucht-<br />
und Maststalls dauert ebenso 2 bis 3 Tag. Je schneller diese Arbeiten erledigt werden,<br />
desto besser ist dies für die Hygiene im Stall, da die Keimbelastung durch eine längere<br />
Ruhezeit des Stalls gesenkt wird. Das Ausstallen selbst wird, wie bei allen Produktionsausrichtungen<br />
in <strong>der</strong> Geflügelmast üblich, von Fangtrupps übernommen. Für das Umstallen<br />
<strong>der</strong> Hähne wird ein weiterer Helfer benötigt, ebenso beim Einstreuen, damit die Tiere<br />
von <strong>der</strong> Einstreutechnik ferngehalten werden und so das Verletzungsrisiko <strong>der</strong> Tiere minimiert<br />
wird. Die Häufigkeit des Einstreuens variiert und ist von den Tieren des jeweiligen<br />
DG abhängig, in Regel wird alle 3-5 Tage nachgestreut.<br />
5.4 Investitionsbedarf eines Neubaus<br />
1<br />
2<br />
Pute 18-Wochenrhythmus<br />
3<br />
4<br />
5<br />
Monate<br />
Für die Höhe <strong>der</strong> Festkosten sind die Baukosten des Stalls die entscheidende Größe. Die<br />
Gebäudekosten selbst sind von vielen Faktoren abhängig. Bei <strong>der</strong> <strong>Hähnchen</strong>- und Pekingentenmast<br />
werden meist isolierte Fertigställe mit Stahl- o<strong>der</strong> Holzrahmenbin<strong>der</strong>, mit Fenstern<br />
und einer geregelten Unterdrucklüftung gebaut. Bei <strong>der</strong> <strong>Puten</strong>mast hingegen war die<br />
vorherrschende Bauform <strong>der</strong> Offenstall mit freier Lüftung und einer Zusatzlüftung für den<br />
Sommer. Die neugebauten Aufzuchtställe für die <strong>Puten</strong>mast sind geschlossene Ställe mit<br />
2<br />
6<br />
7
Produktions- und Investitionsbedingungen 47<br />
Zwangslüftung und einer Heizung. Zudem spielt die Größe sowie die technische Ausstattung<br />
eines solchen Stalls (automatische Wiegeeinrichtung, Sprühkühlung, Klimasteuerung,<br />
Lüftung, etc.) eine entscheidende Rolle für die Investitionssumme. Ebenso wird die<br />
Inneneinrichtung pro m 2 Stallnutzfläche billiger, je länger <strong>der</strong> Stall ist. Die Silos, die Motoren<br />
für die Futterspiralen, die elektrischen Steuereinheiten für die Fütterung des Stalls<br />
sind für einen 15 Meter langen Maststall genauso teuer wie für einen Stall mit 80 Metern<br />
Länge. Die Mehrkosten für einen längeren Stall bestehen hauptsächlich in einer längeren<br />
Futter- und Wasserleitung mit den dazugehörigen Futterschalen und Tränkenippeln.<br />
Um die Baukosten zu errechnen, werden Musterställe angenommen, die im oberen Teil<br />
<strong>der</strong> Tabelle 19 beschrieben sind. Die Größe <strong>der</strong> Musterställe beruht bei <strong>der</strong> <strong>Hähnchen</strong>mast<br />
auf den Kalkulationen von Wiesenhof (Gotthart, 2008), bei den <strong>Puten</strong> auf den Kalkulationen<br />
vom Moorgut Kartzfehen von Kameke GmbH & Co. KG (Holz, 2007) und bei den<br />
Pekingenten auf die LfL-Schrift über „Die <strong>Perspektiven</strong> und Möglichkeiten <strong>der</strong> Geflügelfleischproduktion<br />
in Bayern“(Graser, Groß, Damme, & Schmidtlein, 2004). Die Stallkosten<br />
errechnen sich aus <strong>der</strong> Basis einer Befragung von 3 <strong>Puten</strong>-, 3 Pekingenten- und 6<br />
<strong>Hähnchen</strong>mästern, zusätzlich werden bei den <strong>Puten</strong> (KTBL: Kakulationsdaten, 2004) und<br />
<strong>Hähnchen</strong> (KTBL: Kalkulationsdaten, 2003) die Daten des Kuratoriums für Technik und<br />
Bauwesen in <strong>der</strong> Landwirtschaft (KTBL) mitberücksichtigt. Die verschiedenen Baujahre<br />
<strong>der</strong> Gebäude werden auf das heutige Niveau mit Hilfe des Baukostenindex des bayerischen<br />
Landesamtes für Statistik angeglichen(<strong>Bayerische</strong>s Landesamt für Statistik und<br />
Datenverarbeitung, 2008). Die Baukosten in € pro m 2 ergeben sich aus dem Durchschnitt<br />
dieser Auswertung. Die Ergebnisse <strong>der</strong> Tabelle 19 dienen als Kalkulationshilfe. Im Einzelfall<br />
differieren die Kosten, da die Aufwendungen für ein Gebäude von <strong>der</strong> Ausstattung,<br />
den verschiedenen Bauformen, den Auflagen, dem Dahrlehenszins (D-Zins) und von weiteren<br />
Faktoren, wie <strong>der</strong> Eigenleistung, beeinflusst werden.<br />
Um einen Eindruck zu gewinnen, wie sich verschiedene Än<strong>der</strong>ungen auf die jährliche<br />
Finanzlast auswirken, werden drei Festkostenansätze (FK) berechnet. Für diese FK werden<br />
verschiedene Abschreibungszeiträume in Jahren (AfA), verschiedene Darlehenszinsen<br />
(D-Zins) verwendet und Kostenansätze gewählt. Den genauen Aufbau <strong>der</strong> Festkosten I, II<br />
und III zeigt Tabelle 18.<br />
Tabelle 18: Beschreibung <strong>der</strong> Festkostenberechnung<br />
Festkosten I<br />
Festkosten II<br />
(FK I)<br />
(FK II)<br />
- AfA Gebäudehülle 25 Jahre - AfA Gebäudehülle 20 Jahre<br />
- AfA Inneneinrichtung 10 Jahre - AfA Inneneinrichtung 10 Jahre<br />
- D-Zins 5%<br />
- D-Zins 6%<br />
Festkosten III<br />
(FK III)<br />
- AfA und D-Zins wie bei FK II<br />
- Ansatz für Erschließung-,<br />
Bauneben- und Grundstückskosten<br />
mitberücksichtigt<br />
Tabelle 19 zeigt die Eckdaten des jeweiligen Baus, wie Tierplatzzahl, die Stallnutzfläche<br />
in m 2 und die Stallmaße. Darauf folgen die Produktionskennzahlen <strong>der</strong> Verfahren und die<br />
Kosten pro m 2 Stallnutzfläche sowie die Gesamtkosten <strong>der</strong> Gebäudehülle und <strong>der</strong> Inneneinrichtung.<br />
Die Aufschlüsselung nach Inneneinrichtung und Gebäudehülle ist aufgrund<br />
<strong>der</strong> verschiedenen Abschreibungszeiträume notwendig. Die Gesamtinvestitionssumme<br />
und die Investitionssumme pro Mastplatz (MP) sind ebenso berechnet. Die jährlichen<br />
Zins- und Tilgungszahlungen bestimmen die Kosten pro Tier.
48 Produktions- und Investitionsbedingungen<br />
Tabelle 19: Gebäudefestkosten für die einzelnen Mastformen<br />
Verfahren Kurzmast Splitting<br />
<strong>Hähnchen</strong> <strong>Puten</strong> Pekingenten<br />
24-Wochen-<br />
Rhythmus<br />
18-Wochen-<br />
Rhythmus<br />
Umtriebsverfahren<br />
Stallmaße (m) 20 x 85 20 x 85 20 x 95 18 x 91,5 19 x 75<br />
20 x 95<br />
Stallnutzfläche<br />
(m 2 )<br />
1.700 1.700 1.900 3.300/1.900 1.430<br />
Tierplätze 40.000 40.000 7.600 20.000<br />
Geschlechterverhältnis<br />
45%♀/55%♂ 45%♀/55%♂<br />
6.000 Küken/<br />
6000 MP<br />
DG/Jahr 8,7 7,43 2,2 2,9 13,2<br />
Tiere/m 2<br />
23 23 3,8 3,8 6,6<br />
Gebäudehülle<br />
(€/m 2 )<br />
Gebäudehülle<br />
gesamt (€)<br />
Inneneinrichtung<br />
(€/m 2 )<br />
Inneneinrichtung<br />
gesamt (€)<br />
170 170 170 145 205<br />
289.000 289.000 323.000 801.500 293.150<br />
64 64 50 35 55<br />
108.800 108.800 95.000 210.500 78.650<br />
Gesamtinvestition<br />
in €<br />
397.800 397.800 418.000 1.012.000 371.800<br />
je MP 10 10 55 51 62<br />
Jährliche<br />
Tilgung (€)<br />
Jährlicher Zins<br />
(€)<br />
FK I je Tier in<br />
Cent<br />
Jährliche Tilgung<br />
(€)<br />
Jährlicher Zins<br />
(€)<br />
FK II je Tier in<br />
Cent<br />
22.440 22.440 22.420 53.100 19.600<br />
12.160 12.160 12.800 31.000 11.400<br />
10 11,6 211 145 40<br />
25.300 25.300 25.650 61.130 22.500<br />
14.600 14.600 15.420 37.350 13.700<br />
11,5 13,4 246 170 46<br />
Erschließungskosten<br />
23.000 23.000 25.000 50.000 18.800<br />
Baunebenkosten<br />
9.000 9.000 10.500 30.000 9.500<br />
Grundstück 7.500 7.500 8.550 23.400 6.400<br />
Gesamtinvestition<br />
(€)<br />
Kosten je MP<br />
(€)<br />
Jährliche<br />
Tilgung (€)<br />
Jährlicher<br />
Zins(€)<br />
FK III je Tier in<br />
Cent<br />
Quelle: Eigene Berechnung<br />
437.300 437.300 462.050 1.115.400 406.500<br />
11 11 60,8 51,07 67,75<br />
27.300 27.300 27.850 66.300 24.260<br />
16.100 16.100 17.060 41.200 15.000<br />
12,5 14,6 269 185 50
Produktions- und Investitionsbedingungen 49<br />
5.5 Direktkosten in <strong>der</strong> Geflügelmast<br />
Im Weiteren geht es um die Direktkosten (DK) <strong>der</strong> einzelnen Mastverfahren. Als wichtigste<br />
Faktoren sind hier die Futterkosten und die Kükenkosten zu nennen. Sie machen mit<br />
einem prozentualen Anteil von 80% und mehr den Großteil <strong>der</strong> Mastkosten aus. Allerdings<br />
sind an<strong>der</strong>e Kosten, wie die Energie-, Medizin- und Fremdlohnkosten nicht zu vernachlässigen.<br />
Um einen Einblick in die Kostenstruktur zu erhalten, zeigt die Tabelle 20<br />
die DK pro 100 Tiere und je 100 kg erzeugtes Lebendgewicht (LG) auf.<br />
Tabelle 20: Überblick über die Direktkosten in <strong>der</strong> Geflügelmast ohne MwSt.<br />
Produktionszweig <strong>Hähnchen</strong>mast<br />
<strong>Puten</strong>mast<br />
55% ♂/45% ♀<br />
Pekingentenmast<br />
Lebendgewicht (kg) 2,06 (1) 14,82 (2) 2,965 (3)<br />
FVW (kg Futter/<br />
kg Lebendmasse)<br />
1,71 (1) 2,67 (2) 2,3 (3)<br />
Futtermittelpreis (€/dt) 26.13 (4) 23.72 (2) 20,69 (3)<br />
Verlustrate (%) 5,9 (1) 7,89 (2) 4,9 (3)<br />
Kükenkosten (€) 30,9 (1) 1,72 (2) 0,66 (3)<br />
Direktkosten<br />
Produktionskosten je 100 Tiere 100 kg LG 100 Tiere 100 kg LG 100 Tiere<br />
100 kg<br />
LG<br />
Futter (€) 92,0 (6) 44,7 942 (2) 63,2 147 (3) 49,6<br />
Küken (€) 32,7 (1) 15,9 185 (2) 12,4 69 (3) 23,4<br />
Heizung (€) 3,6 (1) 1,7 26 (2) 1,7 6,1 (8) 2,1<br />
Strom (€) 1,5 (1) 0,7 12 (2) 0,8 4,1 (8) 1,4<br />
Wasser (€) 0,6 (1) 0,3 4 (2) 0,3 2,6 (8) Veterinär, Medika-<br />
0,9<br />
mente,Desinfektionsmittel(€) 3,6 (1) 1,7 85 (2) 5,7 1,5 (8) 0,5<br />
Einstreu (€) 0,4 (5) 0,2 28 (2) 1,8 4,8 (8) 1,6<br />
Fremdlohn 2,0 (1) 1,0 35 (7)<br />
2,8 (7) 6,1 (8) 2,0<br />
Sonstige Kosten (€) 2,5 (1) 1,2 32 (2) 2,4 5,1 (8) 1,7<br />
DK gesamt (€) 139 67 1349 91 246 83<br />
Quelle: (1) (Schöllhammer, 2008) je 100 Tiere<br />
(2) (Schmitz-Du-Mont, 2008)<br />
(3) (Adleff, 2008)<br />
(4) Errechnet aus ∅ Kosten für Starter-, Mast- und Endmastfutter für das Jahr 2007 (Schöllhammer, 2008) und dem<br />
Futterkomponentenverbrauch nach (Damme & Hildebrand, 2002)<br />
(5) (Kuratorium für Technik und Bauwesen in <strong>der</strong> Landwirtschaft e. V., 2006)<br />
(6) Futterpreis x FVW x Schlachtgewicht<br />
(7) Bei den <strong>Puten</strong> einschließlich einem Zinsansatz für das Umlaufvermögen<br />
(8) (Wichmann, 2008) korrigiert um die Daten aus den eigenen Befragungen<br />
Aus Tabelle 20 lässt sich schnell ablesen, wie viel die Produktion von einem kg Lebendgewicht<br />
des jeweiligen Geflügels kostet, indem die DK in <strong>der</strong> Einheit Cent betrachtet werden.<br />
Ein kg <strong>Hähnchen</strong> lässt sich am billigsten produzieren, gefolgt von <strong>der</strong> Ente und <strong>der</strong><br />
Pute. Die Produktionskosten von <strong>Hähnchen</strong>fleisch sind vor allem wegen <strong>der</strong> günstigen<br />
Futterverwertung auf einem so niedrigen Niveau, obwohl <strong>der</strong> Mischfutterpreis bei den<br />
Broilern im Vergleich am höchsten ist. Die Kükenkosten sind bezogen auf ein kg produziertes<br />
LG bei <strong>der</strong> Ente am teuersten. Die Heiz-, Strom- und auch die Wasserkosten sind<br />
bei den Pekingenten ebenso höher. Die medizinischen Kosten sind bei den Pekingenten<br />
aufgrund <strong>der</strong> Robustheit <strong>der</strong> Tiere am niedrigsten. Ein Medikamenteneinsatz während <strong>der</strong><br />
Mast ist in <strong>der</strong> Regel nicht notwendig. Die Enten und <strong>Puten</strong> haben die hohen Einstreukosten<br />
gemeinsam, da bei diesen Verfahren ein Nachstreuen während <strong>der</strong> Durchgänge uner-
50 Produktions- und Investitionsbedingungen<br />
lässlich ist. Bei den <strong>Puten</strong> sind die Fremdlohnkosten erhöht, da in diesem Kostenpunkt ein<br />
Ansatz für das gebundene Umlaufkapital enthalten ist. Bei den <strong>Hähnchen</strong> und Pekingenten<br />
ist dieser Ansatz aufgrund <strong>der</strong> geringen Bindungszeit des Kapitals vernachlässigt, da die<br />
Bindungszeit durch die häufigeren Mastdurchgänge pro Jahr stark verkürzt wird. Zudem<br />
bieten die Integrationen im <strong>Hähnchen</strong>- und Pekingentenbereich an, dass die Küken und<br />
Futterkosten erst nach <strong>der</strong> Schlachtung <strong>der</strong> Tiere bezahlt werden müssen. Da Futter- und<br />
Kükenkosten mit zusammen über 80% die größten Kostenfaktoren sind, kann ein Ansatz<br />
für die Verzinsung des Umlaufkapitals unberücksichtigt bleiben. In Abbildung 13 ist diese<br />
prozentuale Aufteilung <strong>der</strong> Direktkosten <strong>der</strong> einzelnen Mastformen getrennt voneinan<strong>der</strong><br />
dargestellt.<br />
Prozent<br />
100%<br />
90%<br />
80%<br />
70%<br />
60%<br />
50%<br />
40%<br />
30%<br />
20%<br />
10%<br />
0%<br />
3,2<br />
2,6<br />
4,4<br />
5,0<br />
6,3<br />
5,2<br />
4,6<br />
0,6<br />
7,3<br />
23,5 13,7<br />
66,2<br />
69,8<br />
Abbildung 13: Direktkosten <strong>der</strong> Pekingenten- <strong>Hähnchen</strong> und <strong>Puten</strong>mast in 100%<br />
(eigene Berechnung)<br />
5.6 Auswirkungen von Kosten- und Erlösverän<strong>der</strong>ungen<br />
Bei einer allgemeinen Erlös- und Kostenrechnung wird von bestimmten Annahmen ausgegangen,<br />
die meistens einem Durchschnittswert von mehreren Betrieben entsprechen.<br />
Der einzelne Betrieb weicht von diesen Durchschnittswerten aus verschiedenen Gründen<br />
ab. Die Abweichung wirkt sich auf die Kosten und Erlöse. Die Verän<strong>der</strong>ung je 100 Tiere<br />
ist in <strong>der</strong> Tabelle 21 dargestellt.<br />
27,7<br />
59,9<br />
<strong>Hähnchen</strong> Pute Pekingente<br />
Sonstige Kosten<br />
Gesundheit<br />
Heizung, Strom, Wasser, Einstreu<br />
Küken<br />
Futter
Betriebswirtschaftliche Wertung <strong>der</strong> Geflügelmast 51<br />
Tabelle 21: Än<strong>der</strong>ung verschiedener Faktoren und <strong>der</strong>en Auswirkungen auf die<br />
Deckungsbeitragsrechnung<br />
Faktor Variation<br />
<strong>Hähnchen</strong>mast<br />
Splittingverfahren<br />
<strong>Puten</strong>mast Pekingentenmast<br />
Umtriebsverfahren<br />
24 WR 18 WR<br />
Variable Kostenän<strong>der</strong>ung in € je 100 Tiere<br />
Kükenpreis +/- 0,1 € 10,6 ( * ) 10,8 ( * ) 10,5 ( * )<br />
Verluste +/- 1% 1,4 13,5 2,5<br />
Futtermittelpreis +/- 1 €/dt 3,5 39,6 6,8<br />
FVW<br />
+/- 0,1 (bei 20 €/dt<br />
Futtermittelpreis)<br />
4,1 29,6 5,9<br />
FVW<br />
+/- 0,1 (bei 25 €/dt<br />
5,2 37,1 7,4<br />
Futtermittelpreis)<br />
FVW<br />
+/- 0,1 (bei 30 €/dt<br />
Futtermittelpreis)<br />
6,2 44,5 8,9<br />
Festkosten- und Erlösän<strong>der</strong>ungen in € je 100 Tiere<br />
Festkosten II<br />
10% geringere<br />
Baukosten auf<br />
Inneneinrichtung<br />
und Bauhülle<br />
1,3 24,6 17,0 4,5<br />
Zinssatz für Festkosten<br />
II<br />
+/- 0.5 % 0,4 8,6 6,0 1,6<br />
Auszahlungspreis +/- 1 cent/ kg LG 2,1 14,8 3,0<br />
(*)Unterschied aufgrund <strong>der</strong> eingerechneten Verlustrate in den Kükenpreisen<br />
Quelle: Eigene Berechnung, als Basis dienen die Zahlen aus Tabelle 19 und 20<br />
6 Betriebswirtschaftliche Wertung <strong>der</strong> Geflügelmast<br />
Wenn ein Landwirt beabsichtigt in ein neues Projekt zu investieren, steht für ihn die Rentabilität<br />
dieses Vorhabens im Vor<strong>der</strong>grund. Jedoch lässt sich diese Rentabilität im Vorfeld<br />
schwer abschätzen. In diesem Abschnitt werden die direktkostenfreien Leistungen (Dkf<br />
L.) und <strong>der</strong> Gewinn des Betriebszweigs (BZG) <strong>der</strong> einzelnen Geflügelbranchen mit Hilfe<br />
von verschiedenen Betriebszweigauswertungen (BZA) errechnet. Für jede Geflügelart<br />
wird eine Vollkostenrechnung für das Jahr 2007, weiter eine auf den Betriebszweigauswertungen<br />
<strong>der</strong> jeweiligen Geflügelart basierende Gewinnermittlung <strong>der</strong> besten Betriebe im<br />
Jahr 2007 und drittens jeweils eine Auswertung über mehrere Jahre erstellt. Alle Direktkosten<br />
und festen Kosten und die Erlöse wurden ohne Mehrwertsteuer (MwSt.) errechnet,<br />
so dass die ausgewiesenen Dkf L. einer gewerblichen Geflügelmast entsprechen. Integrationsbetriebe<br />
bieten zusätzliche Vergünstigungen an, wie eine Treueprämie, Skonto o<strong>der</strong><br />
Kükenzugabe. Diese Vergünstigungen werden allerdings in den Ergebnistabellen nicht<br />
mitberücksichtigt. Die jeweils in <strong>der</strong> ersten Spalte angegebenen BZA für das Jahr 2007<br />
wurden mit Hilfe <strong>der</strong> Direktkosten aus <strong>der</strong> Tabelle 20 errechnet. Die BZA <strong>der</strong> besten Betriebe<br />
in 2007 in Spalte zwei und die BZA über mehrere Jahre in <strong>der</strong> dritten Spalte basieren<br />
auf <strong>der</strong> Tabelle 22, 24 bzw. 27, in denen die Mastkennzahlen und Direktkosten für die<br />
jeweilige Tierart aufgelistet sind.<br />
6.1 Betriebszweigabrechnung für die gewerbliche <strong>Hähnchen</strong>mast<br />
Der Durchschnitt <strong>der</strong> 25 % besten Betriebe nach <strong>der</strong> FVW beruht auf <strong>der</strong> Auswertung <strong>der</strong><br />
Landwirtschaftskammer Nie<strong>der</strong>sachen (Schierhold & Pieper, 2008) und ist in Tabelle 22<br />
nachzulesen. Es wurden die Leistungsdaten sowie alle Kosten bis auf die Futter- und Kükenkosten<br />
dieser Auswertung entnommen. Es konnte nicht die gleiche Studie für die BZA
52 Betriebswirtschaftliche Wertung <strong>der</strong> Geflügelmast<br />
des Jahres 2007 verwendet werden, da die Studie des Regierungsbezirks Stuttgart und<br />
Tübingen keine Auswertung über die 25% schlechtesten und besten Betriebe enthält. Damit<br />
die zwei Kostenrechnungen des Jahres 2007 vergleichbar sind, ist <strong>der</strong> Futtermittelpreis<br />
mit Hilfe <strong>der</strong> Futterverwertung und <strong>der</strong> Kükenpreis mit Hilfe <strong>der</strong> Verlustrate aus Tabelle<br />
20 errechnet.<br />
Der Durchschnitt über den Zeitraum 2002 bis 2007 ist auf <strong>der</strong> Datenbasis des Regierungsbezirks<br />
Stuttgart und Tübingen erstellt. Alle Kosten und physiologischen Leistungsmerkmale<br />
sind aus dieser Quelle übernommen, bei den Futterkosten ist die Weizenbeifütterung<br />
mitberücksichtigt und nicht, wie für die zwei Auswertungen des Jahres 2007, herausgerechnet.<br />
Die Kosten <strong>der</strong> Einstreu sind aus Tabelle 20 übernommen, da diese bei keiner<br />
Betriebszweigauswertung mitberücksichtigt sind. Für die Auswertung über mehrere Jahre<br />
wurde <strong>der</strong> Kostenansatz für Stroh nicht angepasst, da sich dieser aufgrund seiner geringen<br />
Höhe über die Jahre kaum verän<strong>der</strong>t hat.<br />
Tabelle 22: Mastkennzahlen und Direktkosten <strong>der</strong> <strong>Hähnchen</strong>mast <strong>der</strong> 25% besten<br />
Betriebe von 2007 und über einen Zeitraum von 2002 bis 2007, alle Kosten<br />
ohne MwSt.<br />
Zeitraum<br />
Durchschnitt <strong>der</strong> 25% besten<br />
Betriebe nach FVW<br />
Durchschnitt über einen Zeitraum<br />
von 2002 bis 2007<br />
je 100 Tiere je 100 Tiere<br />
Leistungsdaten<br />
Futterverwertung in kg/ kg SG 1,66 (1) 1,72 (2)<br />
∅ Verluste in % 4,1 (1) 6,1 (2)<br />
∅ Tageszunahmen in g 56 (1) 53,5 (2)<br />
Masttage 35,8 (1) 35,3 (2)<br />
Futter (€) 87,6<br />
Direktkosten je 100 Tiere<br />
(5) (3) (2)<br />
70,2<br />
Küken (€) 32,2 (5) 30,2 (2)<br />
Heizung (€) 2,4 (1) 4,6 (2)<br />
Strom (€) 1,5 (1) 1,4 (2)<br />
Wasser (€) 0,7 (1) 0,8 (2)<br />
Veterinär, Medikamente,<br />
Desinfektionsmittel(€)<br />
3,9 (1) 3,9 (2)<br />
Einstreu (€) 0,4 (4) 0,4 (4)<br />
Fremdlohn (€) 2,5 (1) 2,6 (2)<br />
Sonstige Kosten (€) 1,5 (1) 2,8 (2)<br />
Direktkosten je Tier (€) 133 117<br />
Quelle: (1) (Schierhold & Pieper, 2008)<br />
(2) (Schöllhammer, 2008), Auswertung ohne MwSt.<br />
(3) Futterkosten mit Weizenbeifütterung<br />
(4) (Kuratorium für Technik und Bauwesen in <strong>der</strong> Landwirtschaft e. V., 2006)<br />
(5) Grundlage für die Berechnung <strong>der</strong> Kosten für Küken und Futter ist <strong>der</strong> Futterpreis und Kükenpreis für die Hähn<br />
chenmast aus Tabelle 20
Betriebswirtschaftliche Wertung <strong>der</strong> Geflügelmast 53<br />
In <strong>der</strong> folgenden Tabelle ist die BZA für die <strong>Hähnchen</strong>mast dargestellt. Als Grundlage für<br />
die folgende BZA dienen die Tabelle 17, 19,20 und 22.<br />
Tabelle 23: Betriebszweigabrechnung für die <strong>Hähnchen</strong>mast im Splittingverfahren ohne<br />
MwSt.<br />
Zeitraum 2007<br />
Durchschnitt <strong>der</strong> 25%<br />
besten Betriebe 2007<br />
nach FVW<br />
Erlös<br />
Über einen Zeitraum<br />
von 2002 bis 2007<br />
Tierplätze 40.000 40.000 40.000<br />
Durchgänge im Jahr 7,54 (3) 7,77 (2) 7,55 (3)<br />
Schlachtgewicht in kg 2,06 kg (1) 2,02 (2) 1,89 (1)<br />
Verkaufspreis 0,78 €/kg LG (1) 0,78 €/kg LG (1) 0,704 €/kg LG (1)<br />
Jahreserlös in € 484.600 489.700 401.800<br />
Kosten<br />
Futterkosten in € 277.500 272.300 212.000<br />
Kükenkosten in € 98.600 100.100 91.200<br />
Heizung, Strom,<br />
Wasser in €<br />
17.200 14.300 20.500<br />
Veterinär, Desinfektion<br />
Medikamente in €<br />
Sonstige Kosten<br />
10.900 12.100 11.800<br />
(Einstreu, Versicherungen,<br />
Fremdlohn usw.) in €<br />
14.800 13.700 17.500<br />
DK gesamt in € 419.000 412.500 353.000<br />
Direktkostenfreie Leistung und Gewinn des Betriebszweiges<br />
Dkf L. 65.600 77.200 48.800<br />
FK I 34.600 34.600 30.200 (4)<br />
BZGFK I 31.000 42.600 18.600<br />
FK II 39.900 39.900 34.800 (4)<br />
BZG FK II 25.700 37.300 14.000<br />
FK III 43.400 43.400 37.800 (4)<br />
BZG FK III 22.200 33.800 11.000<br />
Entlohnung pro Stunde<br />
Akh pro Jahr 920 920 920<br />
€/Akh bei BZG FK I 33,7 46,3 20,2<br />
€/Akh bei BZG FK II 27,9 40,5 15,2<br />
€/Akh bei BZG FK III 24,1 36,7 12,0<br />
Quelle: (1) (Schöllhammer, 2008)<br />
(2) (Schierhold & Pieper, 2008)<br />
(3) Masttage (Schöllhammer, 2008)+ 13 Tage Leerzeit (Kuratorium für Technik und Bauwesen in <strong>der</strong> Landwirtschaft<br />
e. V., 2006)<br />
(4) Mit Hilfe des Baukostenindex (<strong>Bayerische</strong>s Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung, 2008) auf das Aus<br />
gangsjahr 2001 zurückgerechnet<br />
In <strong>der</strong> folgenden Abbildung 14 sind die Direktkosten freien Leistungen (Dkf L.) als Linien,<br />
die Festkosten und <strong>der</strong> Lohnansatz je Mastplatz (MP) als Farbflächen gezeigt. Der<br />
Verlauf <strong>der</strong> Linien <strong>der</strong> Dkf L. über die Jahre zeigt, ob die jährlichen Zins und Tilgungszahlungen<br />
beglichen und die Arbeit entlohnt werden konnte. Liegt die betrachtete Linie<br />
über den Flächen <strong>der</strong> Festkosten und des Lohnansatzes, erzielt <strong>der</strong> Betrieb einen kalkulatorischen<br />
Gewinn, da auch seine eigene Arbeit entlohnt ist. Liegt die Linie auf <strong>der</strong> grünen<br />
Fläche, konnten zwar die Festkosten, nicht aber <strong>der</strong> kalkulatorische Lohn bezahlt werden.<br />
Wenn die Linie auf <strong>der</strong> Fläche <strong>der</strong> Festkosten ist, lebt <strong>der</strong> Betrieb von seiner Abschreibung.<br />
Es werden jeweils drei Dkf L. als Linien in verschiedenen Farben in <strong>der</strong> folgenden<br />
Grafik gezeigt. Die rote Linie stellt die schlechtesten Betriebe nach ihren Dkf L. dar. Die
54 Betriebswirtschaftliche Wertung <strong>der</strong> Geflügelmast<br />
schwarze Linie steht für die Dkf L. <strong>der</strong> durchschnittlichen Betriebe und die grüne Linie<br />
steht für die <strong>der</strong> besten Betriebe.<br />
Euro pro MP<br />
3,00<br />
2,50<br />
2,00<br />
1,50<br />
1,00<br />
0,50<br />
0,00<br />
2002 2003 2004-2005<br />
Jahre<br />
2005-2006 2006-2007<br />
Lohnansatz je MP Festkosten II je MP<br />
Dkf L. je MP <strong>der</strong> 25% ++ Betriebe<br />
Dkf L. je MP im Durchschnitt<br />
Dkf L. je MP <strong>der</strong> 25% -- Betriebe<br />
Abbildung 14: Dkf L. je <strong>Hähnchen</strong>-MP im Verlauf von 2002-2007<br />
6.2 Betriebszweigabrechnung für die gewerbliche <strong>Puten</strong>mast<br />
Als Grundlage für die Tabelle 24 dient die Auswertung <strong>der</strong> <strong>Puten</strong>mast des Landes Nord-<br />
Rhein-Westfallen (Schmitz-Du-Mont, 2008). Bei <strong>der</strong> Zeitraumauswertung ist bei den Kosten<br />
des Fremdlohns und <strong>der</strong> sonstigen Kosten aus Datenmangel nur <strong>der</strong> Durchschnitt von<br />
2005 bis 2007 ermittelt.
Betriebswirtschaftliche Wertung <strong>der</strong> Geflügelmast 55<br />
Tabelle 24: Werte <strong>der</strong> 25% besten Betriebe von 2007 und über einen Zeitraum von 2002<br />
bis 2007 ohne MwSt.<br />
Zeitraum<br />
Durchschnitt <strong>der</strong> 25% besten<br />
Betriebe nach DB 2007<br />
Durchschnitt über einen Zeitraum<br />
von 2002 bis 2007<br />
Leistungsdaten<br />
Futterverwertung in kg Futter/<br />
kg SG<br />
2,61 2,7<br />
∅ Verluste in % 7,69 8,1<br />
∅ Tageszunahmen in g 95 ♀ 148♂ 92 ♀ 141♂<br />
Masttage 110 ♀ 146♂ 111 ♀ 145♂<br />
Direktkosten je 100 Tiere<br />
Futter (€) 1032 819<br />
Küken (€) 193 189<br />
Heizung (€) 21 26<br />
Strom (€) 11 10<br />
Wasser (€) 6 4<br />
Veterinär, Medikamente,<br />
Desinfektionsmittel(€)<br />
82 68<br />
Einstreu (€) 32 28<br />
Fremdlohn (€) 42 33 ( * )<br />
Sonstige Kosten (€) 29 29 ( * )<br />
Direktkosten je Tier (€)<br />
(*)Durchschnittswert nur von 2005 bis 2007<br />
Quelle: (Schmitz-Du-Mont, 2008)<br />
14,48 12,06
56 Betriebswirtschaftliche Wertung <strong>der</strong> Geflügelmast<br />
Die Tabelle 25 und 26 zeigen zwei BZA für einen 24-Wochenrhythmus und für einen 18-<br />
Wochenrhythmus. Als Grundlage für die BZA dienen die Tabelle 17, 19, 20 und 24.<br />
Tabelle 25: Betriebszweigabrechnung für die <strong>Puten</strong>mast mit einem 24-Wochenrhythmus<br />
ohne MwSt.<br />
Zeitraum 2007<br />
Durchschnitt <strong>der</strong> 25%<br />
besten Betriebe nach<br />
Dkf L. 2007<br />
Erlös<br />
Über einen Zeitraum<br />
von 2002 bis 2007<br />
Tierplätze 7.600 7.600 7.600<br />
Durchgänge im Jahr 2,2 2,2 2,2<br />
Schlachtgewicht in kg 14,9 (2) 15,51 (2) 14,54 (2)<br />
Verkaufspreis 1,10 €/kg LG (2) 1,17 €/kg LG (2) 0,96 €/kg LG (2)<br />
Jahreserlös in € 274.000 303.400<br />
Kosten<br />
233.400<br />
Futterkosten in € 157.500 172.600 137.000<br />
Kükenkosten in € 30.900 32.300 31.600<br />
Heizung, Strom,<br />
Wasser in €<br />
7.000 6.400 6.700<br />
Veterinär, Desinfektion<br />
Medikamente in €<br />
Sonstige Kosten<br />
14.200 13.700 11.400<br />
(Einstreu, Versicherungen,<br />
Fremdlohn usw.) in €<br />
15.900 17.200 15.000<br />
DK gesamt in € 225.500 242.200 201.700<br />
Direktkostenfreie Leistung und Gewinn des Betriebszweiges<br />
Dkf L. 48.500 61.200 31.700<br />
FK I 35.200 35.200 30.700 (1)<br />
BZG FK I 13.300 26.000 1.000<br />
FK II 41.100 41.100 35.800 (1)<br />
BZG FK II 7.400 20.100 -4.100<br />
FK III 44.900 44.900 39.100 (1)<br />
BZG FK III 3.600 16.300 -7.400<br />
Entlohnung pro Stunde<br />
Akh pro Jahr 850 850 850<br />
€/Akh bei BZG FK I 15,7 30,1 1,2<br />
€/Akh bei BZG FK II 8,7 23,6 -4,8<br />
€/Akh bei BZG FK III 4,2 19,2 -8,7<br />
Quelle: (1) Mit Hilfe des Baukostenindex (<strong>Bayerische</strong>s Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung, 2008) auf das Ausgangsjahr<br />
2001 zurückgerechnet<br />
(2) (Schmitz-Du-Mont, 2008)
Betriebswirtschaftliche Wertung <strong>der</strong> Geflügelmast 57<br />
Zusätzlich wird ein 18-Wochenrhythmus in <strong>der</strong> Tabelle 26 berechnet, da die Festkosten<br />
pro Tier hier wesentlich geringer sind.<br />
Tabelle 26: Betriebszweigabrechnung für die <strong>Puten</strong>mast mit einem 18-Wochenrhythmus<br />
ohne MwSt.<br />
Zeitraum 2007<br />
Durchschnitt <strong>der</strong> 25%<br />
<strong>der</strong> besten Betriebe<br />
nach DB 2007<br />
Über einen Zeitraum<br />
von 2002 bis 2007<br />
Erlös<br />
Tierplätze 20.000 20.000 20.000<br />
Durchgänge im Jahr 2,9 2,9 2,9<br />
Schlachtgewicht in kg 14,9 (2) 15,51 (2) 14,54 (2)<br />
Verkaufspreis 1,10 €/kg LG (2) 1,17 €/kg LG (2) 0,96 €/kg LG (2)<br />
Jahreserlös in € 950.600 1.052.500 809.600<br />
Kosten<br />
Futterkosten in € 546.400 598.600 475.000<br />
Kükenkosten in € 107.300 111.900 109.600<br />
Heizung, Strom,<br />
Wasser in €<br />
24.400 22.000 23.200<br />
Veterinär, Desinfektion<br />
49.300 47.600 39.400<br />
Medikamente in €<br />
Sonstige Kosten<br />
(Einstreu, Versicherungen,<br />
Fremdlohn usw.) in €<br />
55.100 59.700 52.200<br />
DK gesamt in € 782.500 839.800 699.400<br />
Direktkostenfreie Leistung und Gewinn des Betriebszweiges<br />
Dkf L. 168.100 212.700 110.200<br />
FK I 84.100 84.100 73.300 (1)<br />
BZG FK I 84.000 128.600 36.900<br />
FK II 98.500 98.500 86,000 (1)<br />
BZG FK II 69.600 114.200 24.200<br />
FK III 107.500 107.500 93.700 (1)<br />
BZG FK III 60.600 105.200 16.500<br />
Entlohnung pro Stunde<br />
Akh pro Jahr 2.660 2.660 2.660<br />
€/Akh bei BZG FK I 31,6 48,3 13,9<br />
€/Akh bei BZG FK II 26,2 42,9 9,1<br />
€/Akh bei BZG FK III 22,8 39,5 6,2<br />
Quelle: (1) Mit Hilfe des Baukostenindex (<strong>Bayerische</strong>s Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung, 2008) auf das Ausgangsjahr<br />
2001 zurückgerechnet<br />
(2) (Schmitz-Du-Mont, 2008)
58 Betriebswirtschaftliche Wertung <strong>der</strong> Geflügelmast<br />
Die Abbildung 12 zeigt die Verdienstaussichten in <strong>der</strong> <strong>Puten</strong>mast im 18-WR. Die Daten<br />
für die Dkf L. sind dem Arbeitskreis <strong>Puten</strong>mast des Bundeslandes Nord-Rhein-Westfallen<br />
entnommen(Schmitz-Du-Mont, 2008). Die Erläuterung zur Abbildung 12 ist analog zur<br />
Abbildung 11 und im Punkt 8.1 nachzulesen.<br />
Euro pro MP<br />
14<br />
12<br />
10<br />
8<br />
6<br />
4<br />
2<br />
0<br />
2002 2003 2004 2005 2006 2007<br />
Jahre<br />
Lohnansatz je MP Festkosten II eines 18 Wochenrhythmus je MP<br />
Dkf L. je MP <strong>der</strong> 25% ++ Betriebe Dkf L. je MP <strong>der</strong> 25% -- Betriebe<br />
Dkf L. je MP im Durchschnitt<br />
Abbildung 15: Dkf L. je <strong>Puten</strong>-MP im Verlauf von 2002-2007<br />
6.3 Betriebszweigabrechnung für die gewerbliche Pekingentenmast<br />
Für die Werte <strong>der</strong> 30% besten Betriebe im Jahr 2007 laut FVW und für die Zeitraumauswertung<br />
<strong>der</strong> Wirtschaftsjahre 2006 bis 2008 dient <strong>der</strong> wirtschaftliche Vergleich all-in-allout<br />
zu Umtriebsverfahren(Adleff, 2008). Hier musste bei den folgenden Tabellen auf 30%<br />
<strong>der</strong> besten und schlechtesten Betriebe erweitert werden, da nur 10 Betriebe an <strong>der</strong> Betriebszweigauswertung<br />
teilnehmen. Für die DK sind aus diesem wirtschaftlichen Vergleich<br />
nur die Futterkosten und Kükenkosten entnommen, da an<strong>der</strong>e DK in <strong>der</strong> Pekingentenauswertung<br />
nicht aufgeschlüsselt enthalten sind. Aus diesem Grund wird Tabelle 27<br />
mit den Werten aus Tabelle 20 ergänzt.
Betriebswirtschaftliche Wertung <strong>der</strong> Geflügelmast 59<br />
Tabelle 27: Werte <strong>der</strong> 30% besten Betriebe und über einen Zeitraum von 2006-2008<br />
Zeitraum<br />
Durchschnitt <strong>der</strong> 30% besten<br />
Betriebe nach FVW<br />
Durchschnitt über einen Zeitraum<br />
von 2006 bis 2008<br />
je 100 Tiere je 100 Tiere<br />
Leistungsdaten<br />
Futterverwertung in kg/ kg SG 2,03 (1) 2,27 (1)<br />
∅ Verluste in % 4,8 (1) 4,7 (1)<br />
∅ Tageszunahmen in g 71 (1) 70,1 (1)<br />
Masttage 41 (1) 43 (1)<br />
Direktkosten je 100 Tiere<br />
Futter (€) 131 (1) 150 (1)<br />
Küken (€) 69 (1) 69 (1)<br />
Heizung (€) 6,1 (2) 6,1 (2)<br />
Strom (€) 4,1 (2) 4,1 (2)<br />
Wasser (€) 2,6 (2) 2,6 (2)<br />
Veterinär, Medikamente,<br />
1,5 (2) 1,5 (2)<br />
Desinfektionsmittel(€)<br />
Einstreu (€) 4,8 (2) 4,8 (2)<br />
Fremdlohn (€) 6,1 (2) 6,1 (2)<br />
Sonstige Kosten (€) 5,1 (2) 5,1 (2)<br />
Direktkosten je Tier (€) 2,29 2,49<br />
Quelle: (1) (Adleff, 2008)<br />
(2) Kosten aus <strong>der</strong> Tabelle 20 übernommen, da keine an<strong>der</strong>en Werte vorhanden
60 Betriebswirtschaftliche Wertung <strong>der</strong> Geflügelmast<br />
Die letzte BZA wird für die Pekingentenmast erstellt und ist in Tabelle 28 dargestellt. Als<br />
Grundlage für die Vollkostenrechnungen dienen die Tabelle 17, 19, 20 und 27. Bei <strong>der</strong><br />
Betrachtung des Jahres 2007 muss bei <strong>der</strong> Entenmast die Auswirkung <strong>der</strong> Vogelgrippe in<br />
diesem Jahr mitberücksichtigt werden.<br />
Tabelle 28: Betriebszweigabrechnung für die Pekingentenmast im Umtriebsverfahren<br />
ohne MwSt.<br />
Zeitraum 2007<br />
Durchschnitt <strong>der</strong> 30%<br />
besten Betriebe nach<br />
FVW im Jahr 2007<br />
Über einen Zeitraum<br />
von 2006-2008<br />
Erlös<br />
Tierplätze 6.000 6.000 6000<br />
Durchgänge im Jahr 13,2 (1) 13,7 (1) 13,2 (1)<br />
Schlachtgewicht in kg 2,965 (1) 2,900 (1) 2,96 (1)<br />
Verkaufspreis 1,02 €/kg LG (1) 1,02 €/kg LG (1) 1,04 €/kg LG (1)<br />
Jahreserlös in € 239.500 243.100 243.800<br />
Futterkosten in €<br />
Kosten pro Jahr<br />
116.400 107.700 118.800<br />
Kükenkosten in € 54.600 56.700 54.600<br />
Heizung, Strom,<br />
Wasser in €<br />
10.100 10.100 10.100<br />
Veterinär, Desinfektion<br />
Medikamente in €<br />
Sonstige Kosten<br />
1.200 1.100 1.200<br />
(Einstreu, Versicherungen,<br />
Fremdlohn usw.) in €<br />
12.700 13,200 12.700<br />
DK gesamt in € 195.000 188.800 197.400<br />
Direktkostenfrei Leistung und Gewinn des Betriebszweiges<br />
Dkf L. I 44.500 54.300 46.400<br />
FK I 31.000 31.000 28.100 (2)<br />
BZG FK I 13.500 23.300 18.300<br />
FK II 36.200 36.200 32.900 (2)<br />
BZG FK II 8.300 18.100 13.500<br />
FK III 39.300 39.300 35.700 (2)<br />
BZG FK III 5.200 15.000 10.700<br />
Entlohnung pro Stunde<br />
Akh pro Jahr 1.500 1.500 1.500<br />
€/Akh bei BZG FK I 9,0 15,5 12,2<br />
€/Akh bei BZG FK II 5,5 12,1 9,0<br />
€/Akh bei BZG FK III 3,5 10,0 7,1<br />
Quelle: (1) (Adleff, 2008)<br />
(2) Mit Hilfe des Baukostenindex (<strong>Bayerische</strong>s Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung, 2008) auf das Aus<br />
gangsjahr 2005 zurückgerechnet<br />
Die Abbildung 16 zeigt die Verdienstaussichten <strong>der</strong> Pekingentenmast. Die Erlöse und Futterkosten<br />
pro Tier sowie die Kükenkosten für die Berechnung <strong>der</strong> Dkf L. stammen aus<br />
dem wirtschaftlichen Vergleich all-in-all-out zu Umtriebsverfahren (Adleff, 2008). Die<br />
übrigen variablen Kosten zur Berechnung <strong>der</strong> Dkf L. stammen aus Tabelle 20, da keine<br />
Daten über diese Kosten vorhanden sind. Die Erläuterung zu Abbildung 13 ist analog zu<br />
Abbildung 11und unter dem Punkt 8.1 nachzulesen.
Betriebswirtschaftliche Wertung <strong>der</strong> Geflügelmast 61<br />
Euro pro MP<br />
12<br />
10<br />
8<br />
6<br />
4<br />
2<br />
0<br />
2005-2006 2006-2007<br />
Jahre<br />
2007-2008<br />
Lohnansatz je MP Festkosten II je MP<br />
Dkf L. je MP <strong>der</strong> 30% -- Betriebe Dkf L. je MP im Durchschnitt<br />
Dkf L. je MP <strong>der</strong> 30% ++ Betriebe<br />
Abbildung 16: Dkf L. je Pekingenten-MP im Verlauf von 2006-2008<br />
6.4 Nicht berücksichtigte Kosten und weiter Umsatzerlöse<br />
6.4.1 Vergünstigungen und Prämien<br />
Bei den Integrationsbetrieben gibt es für die Mäster verschiedene Vergünstigungen. Die<br />
Wichmann Enten GmbH z.B. stellt dem Landwirt 2% <strong>der</strong> angelieferten Küken nicht in<br />
Rechnung. Die PHW Gruppe gibt ein Skonto auf Futter und Küken sowie eine Kükenzugabe,<br />
zusätzlich wird ein halber Cent pro kg SG als Treueprämie am Ende des Jahres an<br />
den Mäster ausbezahlt. Eine Nutzung des Skontos von <strong>der</strong> PHW Gruppe lohnt sich, wenn<br />
die Ersparnisse durch das Skonto über ein Jahr gesehen höher sind als durch eine alternative<br />
Geldanlage des durchschnittlich gebundenen Kapitals für ein Jahr Zinsen erwirtschaftet<br />
werden kann. Bei einem Prozent Skonto auf die Futterkosten und einem Prozent auf die<br />
Kükenkosten müsste die Verzinsung des durchschnittlich gebundenen Kapitals für ein<br />
Jahr bei einer Bank höher als 7,6 % sein. Wie sich die Vergünstigungen auf das Betriebsergebnis<br />
auswirken ist in Tabelle 29 gezeigt.<br />
Aber auch in <strong>der</strong> <strong>Puten</strong>mast gibt es Vergünstigungen, wie 3% Kükenzugabe sowie 3%<br />
Skonto auf die Küken bei einer Zahlung innerhalb einer Woche. Velisco bezahlt an die<br />
Mäster, insofern alle Küken innerhalb eines Jahres von einer Brüterei stammen, einen zusätzlichen<br />
Bonus von 3 Cent für jedes gekaufte Küken in einem Jahr an seinen Mäster.<br />
Auch gewähren die meisten Futtermühlen ein Skonto von 2%, wenn innerhalb einer Woche<br />
für das Futter bezahlt wird.
62 Betriebswirtschaftliche Wertung <strong>der</strong> Geflügelmast<br />
Tabelle 29: Vergünstigungen <strong>der</strong> Integrationsbetriebe, Schlachthöfe und Zulieferer<br />
Vergünstigung<br />
Neuer Preis mit eingerechneter<br />
Vergünstigung für<br />
100 Tiere in €<br />
Zusätzlicher Verdienst<br />
bzw.<br />
Ersparnis für 100<br />
Tiere in €<br />
Ersparnis auf ein<br />
Jahr bezogen die<br />
Zeitraumauswertung<br />
von Tabelle 23, 26<br />
und 28<br />
Wichmann (Pekingenten)<br />
2% Kükenzugabe 67,60 1,38 (*) 1.100<br />
PHW-Gruppe (<strong>Hähnchen</strong>mast)<br />
2% Ermäßigung bei den<br />
Kükenkosten durch Skonto +<br />
29,60 0,60<br />
Zugabe<br />
(*) 1.800<br />
1% Skonto auf den Futtermittelpreis<br />
69,50 0,70 (*) 2.100<br />
Treueprämie 0,5 Cent/kg SG<br />
mehr Einnahmen<br />
70,90 0,95 (*) 2.850<br />
Kartzfehen, Velsico und Futtermühlen (Pute im 18 WR)<br />
3% Kükenzugabe<br />
und 3% Skonto<br />
177,60 11,40 6.600<br />
Treueprämie von 3 cent pro<br />
Küken aus <strong>der</strong> gleichen Brüterei<br />
Von den meisten Futtermühlen<br />
1,86 3,00 1.740<br />
2% Skonto auf<br />
den Futtermittelpreis<br />
802,60 16,38 9.500<br />
Quelle: (*)Zeitraumauswertung <strong>der</strong> Tabelle 23, 26 und 28 verrechnet mit den Vergünstigungen<br />
6.4.2 MwSt.-Vorteil<br />
Den MwSt.-Vorteil können nur Landwirte nutzen, die nach dem Pauschalsteuersatz besteuert<br />
werden. Ein pauschalieren<strong>der</strong> Landwirt zahlt die Vorsteuer für die gekauften Betriebsstoffe,<br />
ohne die Vorsteuer gegen die anfallende Umsatzsteuer verrechnen zu dürfen.<br />
Im Gegenzug behält er die Umsatzsteuer, die beim Verkauf <strong>der</strong> Waren anfällt. Der pauschalierende<br />
Geflügelwirt bezahlt 7% Vorsteuer für Küken, Futter und Stroh, 19% Vorsteuer<br />
muss für die übrigen Betriebsmittel bezahlt werden. Die Umsatzsteuer von 10,7%<br />
behält <strong>der</strong> Mäster ein. Da die Futterkosten und Kükenkosten, wie aus <strong>der</strong> Abbildung 13<br />
hervorgeht, über 80% <strong>der</strong> Direktkosten ausmachen, sind die Einnahmen durch die Umsatzsteuer<br />
beim Verkauf des Mastgeflügels höher, als die Ausgaben durch die Vorsteuer<br />
beim Kauf <strong>der</strong> laufenden Betriebsmittel. Der erwähnte Umsatzsteuersatz gilt seit dem 1.<br />
Januar 2007, vor diesem Datum war <strong>der</strong> Umsatzsteuersatz für pauschalierende Betriebe<br />
9%, die Vorsteuer war 7% für Küken, Futter und Stroh und 16% für die Vorsteuer <strong>der</strong><br />
übrigen Betriebsmittel. Wie hoch <strong>der</strong> MwSt.-Vorteil bei <strong>der</strong> <strong>Hähnchen</strong>-, <strong>Puten</strong>- und Pekingentenmast<br />
unter Verwendung <strong>der</strong> aktuellen Steuersätze mit den ∅-Kosten und<br />
-Erlösen <strong>der</strong> letzten Jahre aus <strong>der</strong> Tabelle 23, 25, 26 und 28 ausfallen, zeigt Tabelle 30.<br />
Die 19% MwSt., die <strong>der</strong> pauschalierende Landwirt im Gegensatz zu einem gewerblichen<br />
Landwirt zusätzlich zur Bausumme zahlen muss, ist von dem MwSt.-Vorteil abzuziehen.
Betriebswirtschaftliche Wertung <strong>der</strong> Geflügelmast 63<br />
Tabelle 30: MwSt.-Vorteil mit den aktuellen Steuersätzen unter Verwendung <strong>der</strong> ∅-<br />
Kosten und -Erlösen <strong>der</strong> letzten Jahre bei <strong>der</strong> <strong>Hähnchen</strong>-, <strong>Puten</strong>- und<br />
Pekingentenmast<br />
<strong>Hähnchen</strong> <strong>Puten</strong> Pekingenten<br />
Verfahren Splitting (1) 24-Wochenrhythmus<br />
(2)<br />
18-Wochenrhythmus<br />
(3)<br />
Umtriebsverfahren<br />
(4)<br />
Umsatzsteuereinnahmen (10,7% für Mastgeflügelverkauf)<br />
Verkaufte Tiere in € 43.000 25.000 86.600 26.100<br />
Vorsteuerausgaben (7% für Küken, Futter, Stroh/19% übrige Betriebskosten)<br />
Küken/Futter/<br />
Stroh mit 7% MwSt. in €<br />
21.300 12.100 42.100 12.400<br />
übrige DK mit 19%<br />
MwSt. in €<br />
9.200 5.400 18.700 3.800<br />
MwSt.-Vorteil ohne Vorsteuer auf die Baukosten<br />
nach Verfahren in € 12.500 7.500 25.800 9.900<br />
Vorsteueraufwand bedingt durch 19 % MwSt. beim Stallbau<br />
nach Verfahren in € 7.600. 7.800 18.700 6.900<br />
MwSt.-Vorteil mit Baukosten<br />
nach Verfahren in € 4.800 -300 7.100 3.000<br />
je 100 Tiere in € 1.59 -1,79 12,24 3,79<br />
Quellen: (1) Tabelle 23<br />
(2) Tabelle 25<br />
(3) Tabelle 26<br />
(4) Tabelle 28<br />
6.4.3 Einzelbetriebliche Investitionsför<strong>der</strong>ung<br />
Die höheren Baukosten aufgrund <strong>der</strong> MwSt. bei einem pauschalierenden Landwirt können<br />
durch die einzelbetriebliche Investitionsför<strong>der</strong>ung aufgefangen werden. Der Basisför<strong>der</strong>satz<br />
<strong>der</strong>zeit liegt bei 20% und <strong>der</strong> Basisför<strong>der</strong>satz bei erstmaliger Aussiedelung bei 25%<br />
<strong>der</strong> för<strong>der</strong>fähigen Bauleistungen. För<strong>der</strong>fähige Bauleistungen sind die Bauhülle sowie die<br />
Inneneinrichtung des Geflügelstalls. Grundstücks-, Baugenehmigungs- und Erschließungskosten<br />
sind nicht för<strong>der</strong>ungsfähig. Bei einer För<strong>der</strong>ung nach erstmaliger Aussiedelung<br />
muss das geför<strong>der</strong>te Objekt zum bisherigen Hofstellengrundstück mindestens 100 m<br />
entfernt sein. Die genauen Voraussetzungen und Bedingungen für eine einzelbetriebliche<br />
För<strong>der</strong>ung können bei den Ämtern für Landwirtschaft und Forsten erfragt werden. Diese<br />
För<strong>der</strong>ung macht in etwa den Vorsteueraufwand beim Stallbau aus. Die jährliche Ersparnis<br />
durch diese För<strong>der</strong>ung entspricht in etwa dem Vorsteueraufwand beim Stallbau aus Tabelle<br />
30.(Sachsenhauser, 2008)<br />
6.4.4 Maschinenkosten<br />
Ein Kostenfaktor <strong>der</strong> bisher noch nicht berücksichtigt wurde, sind die in <strong>der</strong> Geflügelmast<br />
eingesetzten Maschinen. In Tabelle 31 werden die Maschinen und ihre jeweiligen Kosten<br />
aufgeführt. Für das Ausmisten wird ein Frontla<strong>der</strong> angesetzt mit den durchschnittlichen<br />
Stunden, die für das Ausmisten beim jeweiligen Verfahren nach eigener Umfrage von 6<br />
<strong>Hähnchen</strong>-, 3 <strong>Puten</strong>- und 3 Entenmästern ermittelt wurden. Die Kosten pro Stunde sind<br />
die gemittelten Kosten eines Leihschleppers mit 83 kW und einem Frontla<strong>der</strong>. Die Anschaffungskosten<br />
des Strohhäckslers, des Hochdruckreinigers und <strong>der</strong> Kadaverkühlung<br />
ergeben sich auch aus <strong>der</strong> Umfrage. Für den Kaufpreis (KP) des Strohhäckslers werden<br />
15.000 Euro veranschlagt. Die Nutzungsdauer wird auf 10 Jahre mit einem Fremdkapitalzins<br />
von 6% festgesetzt. Hinzu kommen eine Kadaverkühlung mit einem Wert von 2.000<br />
Euro und ein Hochdruckreiniger mit 2.500 Euro. Für beide Maschinen wird eine Nut-
64 Betriebswirtschaftliche Wertung <strong>der</strong> Geflügelmast<br />
zungsdauer von 5 Jahren unterstellt. Aufgrund des geringeren Kapitalaufwands wird kein<br />
Ansatz für das Fremdkapital unterstellt.<br />
Tabelle 31: Maschinenkosten<br />
<strong>Hähnchen</strong>mast <strong>Puten</strong>mast Pekingentenmast<br />
Verfahren Splitting<br />
24-Wochenrhythmus18-Wochenrhythmus<br />
Umtriebsverfahren<br />
Benötigte Maschinen, <strong>der</strong>en Kosten und Stundenleistung im Jahr<br />
Frontla<strong>der</strong> (83kW/Ausmisten)<br />
Kosten pro Stunde (1) 29,5 (1) 29,5 (1) 29,5 (1) 29,5 (1)<br />
Stunden im Jahr (2) 60 (2) 18 (2) 60 (2) 56 (2)<br />
Entmistungskosten in € 1.770 530 1.770 1.650<br />
Hochdruckreiniger, KP 2.500 Euro, AfA 5, Zinssatz 6%<br />
Reinigung € im Jahr 500 500 500 500<br />
Strohhäcksler (Einstreu), KP. 15.000 € (2) , AfA 5 Jahre, Zinssatz 6%<br />
Einstreu € im Jahr 2000 2.000 2.000 2.000<br />
Kadaverkühlung, KP 2000 € (2) AfA5 Jahre, Zinssatz 6%<br />
Kadaverkühlung im<br />
Jahr<br />
400 400 400 400<br />
Notstromaggregat (11kW, Diesel), KP 6.800 €, AfA 15 Jahre, Zinssatz 6%<br />
(1)<br />
Notstrombereitstellung<br />
im Jahr<br />
660 660<br />
Maschinenkosten gesamt<br />
660 660<br />
pro Jahr in € 5.330 4.090 5.330 5.210<br />
pro 100 Tiere im Jahr<br />
in €<br />
1,76 24.46 9,19 6,58<br />
Quelle: (1) (Kuratorium für Technik und Bauwesen in <strong>der</strong> Landwirtschaft e. V., 2006)<br />
(2) Eigene Befragung von 6 <strong>Hähnchen</strong>-, 3 <strong>Puten</strong>- und 3 Entenmästern<br />
6.4.5 Bewertung des Geflügelmistes<br />
Der Dungwert je Masttier des Geflügelmistes errechnet sich, indem <strong>der</strong> Preis des Reinnährstoffs<br />
aus Tabelle 32 mit dem Nährstoffgehalt des jeweiligen Geflügelmists multipliziert<br />
wird. Eine Bewertung kann in den nächsten Jahren in <strong>der</strong> Nutztierhaltung immer<br />
wichtig werden, wenn die Preise für den Mineraldünger weiter steigen.<br />
Tabelle 32: Reinnährstoffpreise für N, P2O5 und K2O<br />
Nährstoff N P2O5 K2O<br />
Reinnährstoffpreise in<br />
Euro je kg<br />
Quellen: (Goldhofer, Reisenweber, & Zickgraf, 2008)<br />
1,30 1,52 0,62<br />
In <strong>der</strong> Tabelle 33 sind die drei wichtigsten Nährstoffe N, P2O5 und K2O nach Nährstoffen<br />
in kg pro Tonne (t) Frischmasse im Mist für <strong>Hähnchen</strong> und <strong>Puten</strong> aufgezählt. Mit Hilfe<br />
dieses Wertes lässt sich <strong>der</strong> anfallende Nährstoffgehalt für 100 Mastplätze (MP) ermitteln<br />
und wenn dieser mit dem Reinnährstoffpreis multipliziert wird, ergibt sich <strong>der</strong> Dungwert<br />
für 100 MP und pro Masttier. Bei den Pekingenten stammen die Nährstoffgehalte des<br />
Dungs aus einer Erhebung im Rahmen eines KTBL-Projekts. Da diese Erhebung noch<br />
nicht vollständig abgeschlossen ist, wurde <strong>der</strong> Nährstoffgehalt in kg pro t Frischmasse aus<br />
<strong>der</strong> Anlage 5 <strong>der</strong> Düngeverordnung (DVO) verwendet und mit dessen Hilfe <strong>der</strong> Dungwert<br />
berechnet.
Abschlussbetrachtung <strong>der</strong> Chancen und Risiken in <strong>der</strong> Geflügelmast 65<br />
Tabelle 33: Dungwertberechnung<br />
<strong>Hähnchen</strong>mast <strong>Puten</strong>mast Pekingentenmast<br />
Nährstoffgehalt in kg pro Tonne (t) Frischmist<br />
N 28 (1) 23 (1) 9,5 (2)<br />
P2O5 24 (1) 20 (1) 5,0 (2)<br />
K2O 23 (1) 20 (1) 5,5 (2)<br />
in t pro 100 Mastplätze<br />
auf ein Jahr in <strong>der</strong><br />
Frischmasse<br />
N<br />
(50% N angerechnet<br />
wegen Ausbringverlusten<br />
laut DVO)<br />
0,7<br />
Mistanfall<br />
(1) 4,0 (1) 7,2 (2)<br />
Düngewert in € für 100 Mastplätze auf ein Jahr<br />
12,74 59,80 44,46 (3)<br />
P2O5 25,54 121,60 54,72 (3)<br />
K2O 9,98 49,60 24,55 (3)<br />
Gesamtdungwert für 100<br />
Mastplätze<br />
48,26 231,00 123,73<br />
Dungwert pro Masttier<br />
in Cent<br />
6,4 79,7 (4) 18,75<br />
Quelle: (1) (Kuratorium für Technik und Bauwesen in <strong>der</strong> Landwirtschaft e. V., 2006)<br />
(2) Bayrische Erhebung im Rahmen des KTBL Projekts: Wirtschaftsdünger in <strong>der</strong> Geflügelmast<br />
(3) (Bekanntgabe <strong>der</strong> Neufassung <strong>der</strong> Düngeverordnung, 2007)<br />
(4) 18-Wochenrhythmus mit 2,9 Durchgängen<br />
7 Abschlussbetrachtung <strong>der</strong> Chancen und Risiken in <strong>der</strong><br />
Geflügelmast<br />
Zur Entscheidung, ob sich eine Investition in die Geflügelmast lohnt, ist es notwendig die<br />
einzelnen Teilbereiche, die in den vorangegangenen Punkten angesprochen wurden, zusammenfassend<br />
zu betrachten.<br />
Die Marktsituation im Geflügelfleischbereich ist für die <strong>Puten</strong>, Pekingenten und Broiler<br />
sehr unterschiedlich. Die Broiler konnten in den letzten Jahren mit dem größten Wachstumspotential<br />
aufwarten. Sie konnten nicht nur über die Jahre hin gesehen im Verbrauch<br />
stetig zulegen, son<strong>der</strong>n auch in <strong>der</strong> Erzeugung. Allerdings lässt sich anführen, dass die<br />
<strong>Hähnchen</strong> im Vergleich zu ihrem „Konkurrenzgeflügel“ einen Selbstversorgungsgrad über<br />
100% erreicht haben, somit ist ein Export von <strong>Hähnchen</strong>fleisch notwendig. Deutschland<br />
importiert zwar den größten Teil des Geflügelfleisches aus an<strong>der</strong>en EU-Staaten. Jedoch<br />
sind die Produktionskosten von <strong>Hähnchen</strong>fleisch in Deutschland im Vergleich zu an<strong>der</strong>en<br />
EU-Län<strong>der</strong>n, wie Großbritannien, Spanien und Holland auf dem gleichen Niveau. Zudem<br />
hat Deutschland sehr hohe Produktions- und Qualitätsstandards, die einen Wettbewerbsvorteil<br />
darstellen und zu einer Steigerung des Exports in den letzten Jahren beigetragen<br />
haben. Die Konkurrenz aus dem EU-Ausland, wie z. B. Thailand und Brasilien, produzieren<br />
das <strong>Hähnchen</strong>fleisch sehr viel günstiger. Hier kommt den <strong>Hähnchen</strong> und <strong>Puten</strong> die<br />
Entwicklung <strong>der</strong> Nachfrage zu gute, die weg von tiefgefrorener Ware hin zu frischen, fertig<br />
abgepackten Teilstücken geht. Dieses Marktsegment kann von den Billigproduzenten<br />
aufgrund des weiten Transportes schlecht beliefert werden. Dies gilt allerdings nur für die<br />
gefrorene Ware, im Bereich <strong>der</strong> Geflügelfleischzubereitungen und dem gesalzenen Geflügelfleisch<br />
zur Weiterverarbeitung muss sich Deutschland auch mit <strong>der</strong> Konkurrenz aus<br />
Thailand und Brasilien messen. Die Pute hat mit einem Selbstversorgungsgrad von 66%<br />
in Deutschland noch ein großes Marktpotential, dass ausgeschöpft werden könnte. Zudem
66 Abschlussbetrachtung <strong>der</strong> Chancen und Risiken in <strong>der</strong> Geflügelmast<br />
ist die Ausfuhr von <strong>Puten</strong>fleisch von 2002 bis 2007 um fast 60.000t gesteigert worden,<br />
während die Einfuhr im selben Zeitraum nur um knapp 17.000t zunahm, was eine wachsende<br />
Nachfrage aus dem Ausland belegt.(Böttcher W. , Beck, Bilsing, & Schmidt, 2008,<br />
S. 124). Obwohl <strong>der</strong> deutsche Pro-Kopf-Verbrauch von <strong>Puten</strong>fleisch zur EU-Spitze gehört,<br />
stagnierte <strong>der</strong> heimische Verbrauch in den letzten Jahren. Allerdings ging die Produktion<br />
<strong>der</strong> EU-15 Län<strong>der</strong> in den letzten 5 Jahren um 15% zurück, wodurch sich die Absatzmöglichkeit<br />
im <strong>Puten</strong>markt trotz stagnieren<strong>der</strong> Nachfrage im Inland durch das sinkende<br />
internationale Angebot verbessert. Auf diese Entwicklung weist eben auch die steigende<br />
<strong>Puten</strong>fleischausfuhr hin. Die Enten erreichen mit einem Selbstversorgungsgrad von<br />
knapp 70% Platz zwei in <strong>der</strong> Geflügelmast. Im deutschen Konsum von Geflügelfleisch<br />
spielen die Enten eine eher untergeordnete Rolle. Der Verbrauch verän<strong>der</strong>te sich in den<br />
letzten Jahren augenscheinlich nicht. Allerdings zeigen die aktuellen Verbraucherprognosen<br />
einen Anstieg <strong>der</strong> Haushaltseinkäufe von Entenfleisch vor allem außerhalb <strong>der</strong> Weihnachtssaison.<br />
Dieser Trend zum Ganzjahresgeflügel zeigt neue Möglichkeiten im Absatz<br />
von Entenfleisch auf. Auch die wachsende Teilstückvermarktung, die bei den <strong>Puten</strong> und<br />
<strong>Hähnchen</strong> schon länger eine wichtige Rolle spielt, belegt diese Entwicklung. Der allgemeine<br />
Vermarktungstrend bei <strong>Puten</strong> und <strong>Hähnchen</strong> sind die Selbstbedienungstheken in<br />
Discountern und in den SB-Warenhäusern, in denen die frische Ware fertig abgepackt<br />
zum Verkauf angeboten wird. Das Angebot ist gezielt auf eine schnelle und einfache Zubereitung<br />
ausgelegt, worin auch <strong>der</strong> Vorteil des Geflügelfleisches liegt. Der Produktion<br />
von Wurstwaren kommt ebenso eine wachsende Rolle zu. Allerdings ist dieses Produkt für<br />
die <strong>Puten</strong>vermarktung wegen <strong>der</strong> Fleischbeschaffenheit wichtiger als beim <strong>Hähnchen</strong>.<br />
Gerade für die Produktion von Wurstwaren, finden allerdings die Importe aus Thailand<br />
und Brasilien von Geflügelfleischzubereitungen und das gesalzene Geflügelfleisch statt.<br />
Für die Enten spielt <strong>der</strong> Frischfleischverkauf eine geringe Rolle. Die wachsende Produktvielfalt<br />
bei den Enten ist ebenso auf eine schnellere und einfachere Zubereitung ausgerichtet.<br />
Allerdings hatte im Wirtschaftsjahr 2007/08 jedes Veredelungsverfahren mit den gestiegenen<br />
Futtermittel- und Energiekosten zu kämpfen. Es ist zwar davon auszugehen,<br />
dass die Futtermittelpreise sinken werden, allerdings wird das Preisniveau höher bleiben,<br />
als dass in den Jahren 2003-2006 <strong>der</strong> Fall war. Hierbei sind Verfahren mit einer sehr guten<br />
Futterverwertung, wie das <strong>der</strong> <strong>Hähnchen</strong>mast, gegenüber an<strong>der</strong>en Mastverfahren im Vorteil.<br />
Die <strong>Puten</strong> und Enten schneiden hier zwar schlechter ab, jedoch besser als im Vergleich<br />
zur Schweine- o<strong>der</strong> Rin<strong>der</strong>mast. Zudem hat dieser Kostenanstieg gezeigt, dass nicht<br />
nur die Auszahlungspreise in <strong>der</strong> Geflügelmast an die gestiegenen Produktionskosten angeglichen<br />
werden, son<strong>der</strong>n diese Mehrkosten bis zum Verbraucher weiter gegeben werden.<br />
Ob dies auch bei künftigen Produktionskostensteigerungen umgesetzt werden kann,<br />
ist im Weiteren zu beobachten.<br />
Für die Haltung von Mastgeflügel gelten für die Pekingenten, <strong>Puten</strong> und <strong>Hähnchen</strong> die<br />
freiwilligen Vereinbarungen. Bei <strong>der</strong> <strong>Hähnchen</strong>mast gilt allerdings ab dem 30. Juni 2010<br />
eine EU-Richtlinie, die EU weit geltende Mindestanfor<strong>der</strong>ungen an die Mäster stellt. Diese<br />
Richtlinie kann von den einzelnen Mitgliedsstaaten zusätzlich verschärft werden. Im<br />
Allgemeinen sind die Anfor<strong>der</strong>ungen <strong>der</strong> freiwilligen Vereinbarungen sowie die <strong>der</strong> EU-<br />
Richtlinie von guten Mästern jedoch zu erfüllen.<br />
Ein Neu- o<strong>der</strong> Umbau eines Geflügelmaststalls unterliegt den gleichen Gesetzen wie jede<br />
an<strong>der</strong>e landwirtschaftliche Baumaßnahme. Am wichtigsten sind hier die Grenzen für das<br />
emissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren zu nennen, die in Tabelle 13 dargestellt<br />
sind sowie die Einhaltung <strong>der</strong> allgemeinen Richtlinien und gesetzlichen Regelungen<br />
für ein Baugenehmigungsverfahren aus Tabelle 14. Des Weiteren ist die Zoonosenverordnung<br />
für jeden Geflügelmäster sehr wichtig. In dieser werden die Grundlagen zur Bekämpfung<br />
von Zoonosen, beson<strong>der</strong>s von Salmonellen, festgestellt. Für die <strong>Hähnchen</strong> wur-
Abschlussbetrachtung <strong>der</strong> Chancen und Risiken in <strong>der</strong> Geflügelmast 67<br />
de bereits das Ziel gesetzt, die zwei Haupterreger für Salmonellenerkrankungen beim<br />
Menschen Salmonella Enteritidis und Salmonella Typhimurium auf 1% zu verringern. Für<br />
die <strong>Puten</strong> ist ebenfalls eine Prävalenzstudie erstellt worden, die zur Festlegung eines Bekämpfungszieles<br />
dient. Die Umsetzung <strong>der</strong> Zoonosenverordnung und die Folgen, die sich<br />
daraus für den Mäster ergeben, werden sich in den nächsten Jahren zeigen. Der Geflügelmäster<br />
sollte sich deshalb stets über den aktuellen Stand <strong>der</strong> Entwicklung informieren und<br />
durch Hygieneprophylaxe das Eintragsrisiko minimieren.<br />
Die Infrastruktur in Bayern bringt gute Voraussetzungen für den Einstieg in die Geflügelmast.<br />
Es gibt in Bayern für die Enten, <strong>Puten</strong> und <strong>Hähnchen</strong> Schlachthöfe, an die die Mäster<br />
liefern können. Im Bereich <strong>der</strong> Pekingenten ist es die Wichmann Enten GmbH in<br />
Warmersdorf, bei den <strong>Hähnchen</strong> die Wiesenhofschlachterei in Bogen und bei den <strong>Puten</strong><br />
die Süddeutsche Truthahn AG in Ampfing und <strong>der</strong> Schlachthof bei Rot am See von Velisco.<br />
Zusätzlich existieren noch 12 weitere kleinere EU zugelassene Schlachtbetriebe mit<br />
regionaler Bedeutung.<br />
7.1 Direktkostenfreie Leistungen <strong>der</strong> Mastverfahren pro m 2 Stallnutzfläche<br />
im Dreijahresvergleich<br />
Eine gute Marktsituation und Infrastruktur sind zwei Voraussetzungen für die Mast. Um<br />
aber eine Entscheidung treffen zu können, ob und wie viel investiert werden soll, ist es<br />
wichtig sich über die Kosten und Erlösmöglichkeiten <strong>der</strong> geplanten Investition zu informieren.<br />
Abbildung 17 zeigt die direktkostenfreien Leistungen (Dkf L.) <strong>der</strong> betrachteten<br />
Mastverfahren, sowie den Betriebszweiggewinn (BZG) für einen m 2 Stallnutzfläche. Der<br />
Zeitraum ist bei <strong>der</strong> <strong>Hähnchen</strong>- und <strong>Puten</strong>mast bezogen auf die Wirtschaftjahre (WJ) 2005<br />
bis 2007 und bei <strong>der</strong> Pekingentenmast auf das WJ 2006 bis 2008. Es wurde für die Pekingentenmast<br />
ein an<strong>der</strong>er Zeitraum gewählt, da im WJ 2005 keine Daten erhoben wurden.<br />
Werden die jeweiligen Dkf L. <strong>der</strong> verschiedenen Mastverfahren verglichen, so erhält<br />
<strong>der</strong> Pekingentenmäster bezogen auf die Stallnutzfläche die höchsten Dkf L., gefolgt von<br />
<strong>der</strong> <strong>Hähnchen</strong>mast und <strong>der</strong> <strong>Puten</strong>mast mit einem 18-Wochenrhythmus. Die Höhe <strong>der</strong> Dkf<br />
L. sagt allerdings noch nichts über die Rentabilität einer Investition aus, da die Festkosten<br />
und die eigene Entlohnung noch nicht berücksichtigt werden. Die BZG hingegen lassen<br />
erste Aussagen darüber zu. Die Höhe sagt aus, wie viel dem Landwirt bleibt, wenn er seine<br />
Direktkosten (DK) und seine Festkosten vom Erlös abzieht. Für die Berechnung <strong>der</strong><br />
unten dargestellten BZG werden von den Dkf L. die Festkosten (FK) II aus Tabelle 19<br />
abgezogen. Diese FK II sind mit Hilfe des Baukostenindex (<strong>Bayerische</strong>s Landesamt für<br />
Statistik und Datenverarbeitung, 2008) für die <strong>Puten</strong> und <strong>Hähnchen</strong>mast auf das Jahr 2004<br />
und für die Pekingenten auf das Jahr 2005 zurückgerechnet. Somit sagt <strong>der</strong> BZG aus, wie<br />
viel ein Landwirt im Schnitt über den angegebenen Zeitraum verdient hat, wenn <strong>der</strong> Stall<br />
am Anfang des angegebenen Zeitraums in Betrieb ging. Die Differenz bei den einzelnen<br />
BZG fällt geringer aus, als zwischen den direktkostenfreien Leistungen. Dies liegt an den<br />
hohen Baukosten <strong>der</strong> Pekingentenmast bezogen auf die gehaltenen kg pro m 2 Stallnutzfläche,<br />
im Vergleich zur <strong>Hähnchen</strong>- und <strong>Puten</strong>mast mit einem 18-Wochenrhythmus (WR).<br />
Bei <strong>der</strong> <strong>Puten</strong>mast mit einem 24-WR sind die ermittelten Baukosten aufgrund des teuren<br />
Aufzuchtstalls höher, als die <strong>der</strong> Pekingentenmast. Wenn ein Betrieb die Arbeit, die er<br />
benötigt um einen m 2 Stallnutzfläche zu bewirtschaften, nicht mit bewertet, ist die Pekingentenmast<br />
am lukrativsten, gefolgt von <strong>der</strong> <strong>Hähnchen</strong>mast, <strong>der</strong> <strong>Puten</strong>mast im 18-WR und<br />
<strong>der</strong> <strong>Puten</strong>mast im 24-WR.
68 Abschlussbetrachtung <strong>der</strong> Chancen und Risiken in <strong>der</strong> Geflügelmast<br />
Euro pro m2 Stallnutzfläche und Jahr<br />
60,0<br />
50,0<br />
40,0<br />
30,0<br />
20,0<br />
10,0<br />
0,0<br />
32,0<br />
11,6<br />
20,2<br />
2,6<br />
<strong>Hähnchen</strong>mast Splitting <strong>Puten</strong>mast 24 WR <strong>Puten</strong>mast 18 WR Pekingenten<br />
Umtriebsverfahren<br />
(WJ 2005-07) (WJ 2005-07) (WJ 2005-07) (WJ 2006-08)<br />
Abbildung 17: Direktkostenfreie Leistungen und Betriebszweiggewinn pro Jahr und m 2<br />
Stallnutzfläche<br />
Bei vielen Landwirten ist die Arbeit <strong>der</strong> begrenzende Faktor. Aus diesem Grund sind in<br />
Abbildung 18 die Dkf L., daneben die Festkosten II und darüber die Arbeitskosten bei<br />
einer Stundenentlohnung von 15 Euro als Säulendiagramm dargestellt. Der Unterschied<br />
zwischen den Dkf L. und den FK II ergibt den BZG aus Abbildung 17. Die Arbeitskosten,<br />
die noch zu den FK hinzukommen, verän<strong>der</strong>n die Wirtschaftlichkeit <strong>der</strong> einzelnen Mastverfahren.<br />
Das größte kalkulatorische Betriebszweigergebnis (kalk. BZE), bei dem ein<br />
Ansatz für die eigene Arbeit des Landwirts enthalten ist, wird bei diesem Dreijahresvergleich<br />
mit 3,4 € pro m 2 und Jahr von <strong>der</strong> <strong>Hähnchen</strong>mast erwirtschaftet. Das zweithöchste<br />
kalk. BZE mit 3,2 € pro m 2 Stallnutzfläche und Jahr erzielt <strong>der</strong> 18-WR <strong>der</strong> <strong>Puten</strong>mast. Die<br />
negativen kalk. BZE bei dem 24-WR <strong>der</strong> <strong>Puten</strong>mast und <strong>der</strong> Pekingentenmast bedeuten,<br />
dass eine Stundenentlohnung von 15 € nicht erreicht wird, son<strong>der</strong>n die geleistete Arbeitsstunde<br />
nur mir 6 € beim 24-WR und mit 9 € bei <strong>der</strong> Pekingentenmast entlohnt wird.<br />
26,7<br />
10,6<br />
Direktkostenfreie Leistungen Betriebszweiggewinn<br />
52,6<br />
15,6
Abschlussbetrachtung <strong>der</strong> Chancen und Risiken in <strong>der</strong> Geflügelmast 69<br />
Euro pro m2 Stallnutzfläche und Jahr<br />
70,0<br />
60,0<br />
50,0<br />
40,0<br />
30,0<br />
20,0<br />
10,0<br />
0,0<br />
32,0<br />
8,2<br />
20,4<br />
Dkf L. Weitere<br />
Kosten<br />
20,2<br />
Abbildung 18: Dkf L. abzüglich Arbeit und FK II pro m 2 Stallnutzfläche<br />
7.2 Einzelbetrachtung <strong>der</strong> Mastverfahren<br />
6,2<br />
Dkf L. Weitere<br />
Kosten<br />
Die Abbildung 15 kann zwar eine weitere Hilfestellung für eine Entscheidung sein, trotzdem<br />
sind weitere Aspekte zu berücksichtigen. Denn in dieser Grafik werden nicht alle<br />
wichtigen Punkte, die in <strong>der</strong> Praxis relevant und ausschlaggebend sind, mitberücksichtigt.<br />
Wird das kalk. BZE als Maßstab für die Entscheidung herangezogen, das sich aus Abbildung<br />
18 ergibt, indem von den Dkf L. die FK und die eigene Arbeitsentlohnung abgezogen<br />
werden, so ist die <strong>Puten</strong>mast mit einem 24-WR <strong>der</strong> Pekingentenmast vorzuziehen.<br />
Auch die <strong>Hähnchen</strong>mast erscheint lukrativer als die <strong>Puten</strong>mast. Diese Aussagen relativieren<br />
sich, wenn <strong>der</strong> BZG aus Abbildung 17 durch die Anzahl <strong>der</strong> anfallenden Arbeitsstunden<br />
geteilt wird, um auf diese Weise die Arbeitsentlohnung pro Stunde zu berechnen. Die<br />
Reihung <strong>der</strong> Mastverfahren ist nach dieser errechneten Stundenentlohnung an<strong>der</strong>s. An<br />
erster Stelle steht <strong>der</strong> 18-WR mit 21,6 € pro Stunde, gefolgt von den <strong>Hähnchen</strong> mit 21,2 €.<br />
Die Pekingenten mit über 9 € ist auf Platz drei und <strong>der</strong> 24-WR mit 6 € auf dem letzten<br />
Platz. Bei den <strong>Hähnchen</strong> und dem 18-WR <strong>der</strong> <strong>Puten</strong>mast liegt <strong>der</strong> Positionswechsel daran,<br />
dass bei einem 18-WR bezogen auf einen m 2 Stallgrundfläche weniger Arbeit im Jahr als<br />
bei <strong>der</strong> <strong>Hähnchen</strong>mast investiert werden muss und sich trotz eines etwas geringeren BZG<br />
eine höhere Stundenentlohnung ergibt. Bei den Enten liegt <strong>der</strong> Wechsel am wesentlich<br />
höheren BZG im Vergleich zum 24-WR. Die oben dargestellten Abbildungen können ausschließlich<br />
auf wirtschaftliche Kenngrößen hinweisen. Sie zeigen nicht die Anzahl <strong>der</strong><br />
entlohnten Stunden, o<strong>der</strong> wie viele Arbeitskräfte für einzelne Arbeiten benötigt werden<br />
26,7<br />
7,3<br />
17,7 16,1<br />
Dkf L. Weitere<br />
Kosten<br />
52,6<br />
25,4<br />
37,0<br />
Dkf L. Weitere<br />
Kosten<br />
<strong>Hähnchen</strong>mast Splitting <strong>Puten</strong>mast 24 WR <strong>Puten</strong>mast 18 WR Pekingenten<br />
Umtriebsverfahren<br />
(WJ 2005-07) (WJ 2005-07) (WJ 2005-07) (WJ 2006-08)<br />
Dkf L. Festkosten II Arbeitsentlohnung von 15€
70 Abschlussbetrachtung <strong>der</strong> Chancen und Risiken in <strong>der</strong> Geflügelmast<br />
und auch nicht wie viel Fachwissen <strong>der</strong> Einzelne beim Einstieg in die Mast mitbringen<br />
sollte. Aus diesem Grund werden die Stärken und die Schwächen <strong>der</strong> einzelnen Verfahren<br />
kurz erläutert.<br />
7.2.1 <strong>Puten</strong>mast im 18-Wochenrhythmus als Umtriebsverfahren<br />
Die <strong>Puten</strong>mast verspricht auf den ersten Blick eine gute Stundenentlohnung und ein gutes<br />
Betriebszweigergebnis. Eine voreilige Investition in die <strong>Puten</strong>mast kann sich allerdings als<br />
Fehler erweisen, wenn nicht alle Aspekte berücksichtigt werden. Für einen 18-WR mit 2,9<br />
Durchgängen (DG) im Jahr werden bei diesem Planungsbeispiel ein Aufzucht- und zwei<br />
Mastställe vorausgesetzt. Dieser Rhythmus ermöglicht im Vergleich zum 24-WR eine<br />
Reduzierung <strong>der</strong> Baukosten pro m 2 Stallnutzfläche um 1,6 Euro. Dies wird erreicht, da <strong>der</strong><br />
Maststall günstiger als <strong>der</strong> Aufzuchtstall ist und weil 0,7 DG im Jahr mehr gefahren werden<br />
können als beim Rein-Raus-Verfahren. Die Investition in einen 18-WR ist nur möglich,<br />
wenn sehr viel Investitionskapital zur Verfügung steht. Ein Vorteil dieses Verfahrens<br />
sind die seltenen Arbeitsspitzen, die beim Aus- und Umstallen maximal dreimal im Jahr<br />
entstehen. Diese Arbeitsspitzen sind allerdings im Vergleich zur <strong>Hähnchen</strong>- und Entenmast<br />
mit sehr viel mehr Arbeitsaufwand verbunden. Ein an<strong>der</strong>er Nachteil <strong>der</strong> <strong>Puten</strong>mast<br />
ist, wenn eine zu spät erkannte Krankheit o<strong>der</strong> ein an<strong>der</strong>es Problem im Stall die Leistung<br />
eines Mastdurchgangs schmälert, hat <strong>der</strong> Mäster nur noch zwei Chancen im Jahr dies wie<strong>der</strong><br />
auszugleichen. Der Gewinn o<strong>der</strong> Verlust eines Durchgangs ist ein Drittel des Jahresergebnisses.<br />
Aus diesem Grund erfor<strong>der</strong>t die <strong>Puten</strong>mast viel Aufmerksamkeit und Erfahrung<br />
von dem Mäster. Die großen Gewinnunterschiede <strong>der</strong> einzelnen Betriebe beim 18-WR<br />
rühren auch aus diesem großen Einfluss des Managements. Die 25% besten Betriebe verdienen<br />
ausgehend vom Mittelwert im Schnitt etwa 54% mehr, während die schlechten<br />
Betriebe vom Mittelwert im Schnitt 75% weniger verdienen. Es ist deshalb zu empfehlen<br />
sich gründlich im Vorfeld zu informieren und die Beratung <strong>der</strong> Brütereien, Schlachthöfe<br />
und unabhängigen Beratungsinstitutionen zu nützen.<br />
7.2.2 <strong>Puten</strong>mast im 24-Wochenrhythmus als Rein-Raus-Verfahren<br />
Der 24-WR schneidet bei dieser Berechnung am schlechtesten ab. Er hat die geringsten<br />
Dkf L. pro m 2 Stallnutzfläche und Jahr, da nur 2,2 DG im Jahr erreicht werden. Auch hat<br />
<strong>der</strong> 24-WR den geringsten BZG. Dies liegt vor allem an den hohen Baukosten für den<br />
Aufzuchtstall. Die Folge aus diesen genannten Gründen ist die niedrige Stundenentlohnung<br />
von 6 €. Allerdings muss angemerkt werden, dass dem berechneten 24-WR ebenso<br />
wie dem 18-WR ein Hahn-Hennen-Verhältnis von 55% männlichen zu 45% weiblichen zu<br />
Grunde liegt. Bei einem solchen Verhältnis beim 24-WR haben die Hähne mehr Stallfläche<br />
zur Verfügung als dies durch die freiwillige Vereinbarungen gefor<strong>der</strong>t wird, wenn die<br />
Hennen nach 16 Wochen ausgestallt werden. Dies bedeutet eine nicht optimale Ausnutzung<br />
<strong>der</strong> Stallnutzfläche während eines DG. Ein Hahn-Hennen-Verhältnis von 70% ♂ zu<br />
30% ♀ würde eine bessere Auslastung bewirken und zu mehr produziertem LG pro kg/m 2<br />
im Jahr führen. Die Kalkulation eines besseren Geschlechterverhältnisses war aufgrund<br />
von fehlenden Daten nicht möglich. In den zur Verfügung stehenden Betriebszweigauswertungen<br />
sind lei<strong>der</strong> keine Auswertungen von nur weiblichen o<strong>der</strong> nur männlichen Tieren<br />
vorhanden. Eine solche Auswertung wäre für eine Berechnung eines an<strong>der</strong>en Geschlechterverhältnisses<br />
notwendig. Eine weitere Möglichkeit die Gewinnspanne zu erhöhen,<br />
wäre bei einem 24-WR nur weibliche Tiere zu mästen, um durch die kürzere Mastdauer<br />
2,9 DG im Jahr zu erreichen. Die konkreten Gewinnaussichten hierfür müssten allerdings<br />
erst errechnet und auch das Verfahren mit dem zuständigen Schlachthof abgeklärt<br />
werden. Der 24-WR mit einem Aufzuchtstall ist hauptsächlich als Einstiegsmodell in die<br />
<strong>Puten</strong>mast zu sehen. Auch wenn Verfahren wie in <strong>der</strong> Schweinehaltung vorstellbar wären,
Abschlussbetrachtung <strong>der</strong> Chancen und Risiken in <strong>der</strong> Geflügelmast 71<br />
wie die Spezialisierung als reiner Aufzucht- o<strong>der</strong> Mastbetrieb. Ein reiner Mäster müsste<br />
seinen Stall mit zugekauften Jungputen besetzen. Dadurch könnten die ohnehin günstigen<br />
FK pro MP bei einem Maststall zusätzlich durch häufigere DG im Jahr gesenkt werden.<br />
Die Umsetzung eines solchen Verfahrens ist aber mit Schwierigkeiten verbunden. Um<br />
Erfolg zu haben, dürfen Mäster und Aufzüchter nicht zu weit voneinan<strong>der</strong> entfernt sein.<br />
Lange Transportstrecken bedeuten zum einen hohe Kosten, zum an<strong>der</strong>en eine höhere Verlustrate<br />
während dem Transport und nach dem Transport, bedingt durch den Stress, dem<br />
die Tiere ausgesetzt sind. Anhand <strong>der</strong> genannten Beispiele wird gezeigt, dass die Rentabilität<br />
des 24-WR auf verschiedene Weisen verbessert werden kann. Allerdings beweist die<br />
Berechnung des Aufzuchtstalls, dass die Gewinnaussichten sich durch den Bau eines weiteren<br />
Maststalls erheblich verbessern. Der 24-WR kann als Einstieg in die <strong>Puten</strong>mast, wegen<br />
<strong>der</strong> geringen Arbeitsbelastung von nur 800 Akh im Jahr und <strong>der</strong> Möglichkeit sich mit<br />
den Eigenheiten <strong>der</strong> <strong>Puten</strong>mast vertraut zu machen, in Betracht gezogen werden. Eine weitere<br />
Investition in einen Hahnenmaststall und somit ein Umstieg auf den 18-WR ist jedoch<br />
notwendig.<br />
7.2.3 <strong>Hähnchen</strong>mast als Splittingverfahren<br />
Das beste Verfahren pro m 2 Stallnutzfläche aus Sicht des kalk. BZE und das zweitbeste<br />
Verfahren aus Sicht des BZG ist die <strong>Hähnchen</strong>mast. Im Dreijahresvergleich werden in <strong>der</strong><br />
<strong>Hähnchen</strong>mast auch Gewinne erzielt, wenn ein kalkulatorischer Ansatz von 15 € für die<br />
Arbeit abgezogen wird. Dies gelingt außer <strong>der</strong> <strong>Hähnchen</strong>mast nur <strong>der</strong> <strong>Puten</strong>mast mit einem<br />
18-WR. Die Broilermast weist zusätzlich Vorteile gegenüber ihrer Geflügelkonkurrenz<br />
auf.<br />
Beim Arbeitsverfahren und beim Arbeitszeitbedarf hat die Broilermast Vorteile gegenüber<br />
an<strong>der</strong>en Verfahren. Die <strong>Hähnchen</strong>mast benötigt sehr wenig Arbeitszeit und lässt sich<br />
ebenso in kleineren Einheiten realisieren, wodurch <strong>der</strong> Einstieg in die <strong>Hähnchen</strong>mast als<br />
landwirtschaftlicher Zusatzerwerb überlegenswert wird. Zudem verspricht die Langzeitbetrachtung<br />
<strong>der</strong> Tabelle 23 und <strong>der</strong> Abbildung 14 ein solides und verlässliches Einkommen.<br />
Der Einstieg in die <strong>Hähnchen</strong>mast aufgrund <strong>der</strong> geregelten Struktur und <strong>der</strong> guten Betreuung<br />
bei den Integrationen ist leichter als in <strong>der</strong> <strong>Puten</strong>mast und nicht schwieriger als in <strong>der</strong><br />
Entenmast. Die häufigen Durchgänge im Jahr geben dem Landwirt eine bessere Liquidität<br />
und durch den besseren Ausgleich eines verfehlten Durchgangs auch bessere Planungssicherheit.<br />
Aus arbeitswirtschaftlicher Sicht hat die <strong>Hähnchen</strong>mast als typisches Rein-Raus-<br />
Verfahren den Vorteil, dass während <strong>der</strong> Leerstehzeiten des Stalls keine Arbeit im Bereich<br />
<strong>der</strong> <strong>Hähnchen</strong>mast anfällt und somit beispielsweise die Möglichkeit eines Urlaubs gegeben<br />
ist ohne einen Betriebshelfer zu benötigen. Zusätzlich hat das Rein-Raus-Verfahren<br />
hygienische Vorteile, da zeitweise keine Tiere auf <strong>der</strong> Hofstelle gehalten werden und nicht<br />
wie beim 18-WR und <strong>der</strong> Pekingentenmast zwei Altersgruppen gleichzeitig auf <strong>der</strong> Hofstelle<br />
gehalten werden. Außerdem ist <strong>der</strong> tägliche Arbeitsbedarf geringer als bei den <strong>Puten</strong><br />
und Pekingenten, da ein Nachstreuen während <strong>der</strong> Mast bei den Broilern nicht notwendig<br />
ist. Wird die Arbeitszeit betrachtet um 1 kg <strong>Hähnchen</strong> zu mästen, verdeutlicht sich <strong>der</strong><br />
geringe Arbeitsaufwand. Zudem sind die Direktkosten <strong>der</strong> <strong>Hähnchen</strong>mast bezogen auf ein<br />
kg LG am günstigsten. Wird <strong>der</strong> Unterschied in den Dkf L. zwischen dem Durchschnitt<br />
und dem besten Viertel <strong>der</strong> Betriebe ermittelt so beträgt dieser 39 %. Der Unterschied<br />
zwischen dem Durchschnitt und dem schlechteren Viertel <strong>der</strong> Betriebe beträgt 33%. Das<br />
Risiko ein schlechteres Einkommen zu erzielen ist somit geringer als bei den <strong>Puten</strong>, die<br />
Chance eines sehr guten Betriebs mehr Geld zu verdienen ist allerdings ebenso schlechter.<br />
Das Verhältnis zwischen den guten und den schlechten Betrieben ist in <strong>der</strong> Broilermast<br />
sehr ausgewogen. Betrachtet man zusätzlich den deutschen Markt, so zeigt dieser ein<br />
Wachstum im inländischen Verbrauch, aber auch steigende Exportzahlen von <strong>Hähnchen</strong>f-
72 Abschlussbetrachtung <strong>der</strong> Chancen und Risiken in <strong>der</strong> Geflügelmast<br />
leisch, was die gute Marktsituation in diesem Bereich wie<strong>der</strong>spiegelt. Die <strong>Hähnchen</strong>mast<br />
bietet insgesamt eine solide Basis für eine zukunftsträchtige Investition in den Geflügelfleischsektor.<br />
7.2.4 Pekingentenmast als Umtriebsverfahren<br />
Die Pekingentenmast ist von den Dkf L. und vom BZG pro m 2 Stallnutzfläche und Jahr<br />
am lukrativsten. Das Mastverfahren verliert an Attraktivität durch die Einberechnung des<br />
Arbeitsaufwands. Die Pekingentenmast hat den größten Arbeitszeitbedarf <strong>der</strong> betrachteten<br />
Geflügelarten bezogen auf ein kg produziertes LG. Ein Grund hierfür ist das Umtriebsverfahren,<br />
das aus betriebswirtschaftlicher Sicht dem all-in-all-out Verfahren überlegen ist, da<br />
mehr Tiere im Jahr auf <strong>der</strong> gleichen Stallnutzfläche produziert werden können. Dieses<br />
Umtriebsverfahren führt bei 13-15 DG aber zu häufigen Arbeitsspitzen. Zudem führt das<br />
häufige Nachstreuen während <strong>der</strong> Mast bei den Enten zur im Schnitt höchsten Belastung<br />
bei den täglichen Arbeiten. Außerdem benötigt <strong>der</strong> Landwirt beim Einstreuen einen Helfer,<br />
den er für gut eine Stunde am Tag benötigt. Dennoch erreichen die Pekingenten im<br />
Jahresvergleich eine Stundenentlohnung von gut 9 Euro. Bei <strong>der</strong> Beurteilung des Dreijahresvergleichs<br />
sollte auch mitberücksichtigt werden, dass die Vogelgrippe mit diesem Ergebnis<br />
in engem Zusammenhang steht, da sich bei den Pekingenten die Ausläufer <strong>der</strong> Vogelgrippe<br />
bis ins Jahr 2008 auswirken. Die an<strong>der</strong>en Geflügelbranchen in Bayern waren<br />
davon nicht so stark betroffen gewesen. Wird die Pekingentenmast aus arbeitswirtschaftlichen<br />
Gesichtspunkten betrachtet, wirkt sie unattraktiv für eine Investition. Diese Aussage<br />
trifft allerdings nicht für jeden Betrieb zu. Wenn <strong>der</strong> Landwirt auf Familienarbeitskräfte<br />
zurückgreifen kann, ist die Stundenentlohnung nicht die entscheidende Größe. Allein die<br />
Hilfe eines Familienangehörigen für die tägliche Einstreu, die ebenso mit 9 € Stundenentlohnung<br />
angesetzt wird, reduziert die benötigte Arbeitszeit enorm. Die Entlohnung <strong>der</strong><br />
eigenen Arbeit sind kalkulatorische Kosten. Kalkulatorische Kosten müssen nicht in einer<br />
fixen Höhe entrichtet werden. Die Höhe eines kalkulatorischen Stundenlohns sollte <strong>der</strong><br />
Landwirt durch seine Opportunitätskosten festsetzen. Mit Opportunitätskosten im Bereich<br />
<strong>der</strong> Stundenentlohnung ist <strong>der</strong> Stundenerlös gemeint, den ein Unternehmer verdienen<br />
würde, wenn er statt seiner landwirtschaftlichen Tätigkeit in einem an<strong>der</strong>en Bereich arbeiten<br />
würde. Beispielsweise sollte ein Landwirt, <strong>der</strong> die Möglichkeit hat beim Maschinenring<br />
zu arbeiten o<strong>der</strong> einen neuen Stall zu bauen, dieselbe Stundenentlohnung für die<br />
Stallarbeit wie für die Arbeit beim Maschinenring bekommen. Allerdings ist <strong>der</strong> Verdienst<br />
eines Landwirts größer, wenn er 1.000 Stunden zur Verfügung hat und diese mit 9 Euro<br />
entlohnt werden, als wenn er nur 100 <strong>der</strong> 1.000 Stunden mit 25 € entlohnt bekommt. Die<br />
Verwendung von eigenen Betriebsmitteln sollte ebenso mitberücksichtigt werden. Bei den<br />
Pekingenten können die Direktkosten zum Beispiel durch betriebseigenes Stroh o<strong>der</strong><br />
Brunnenwasser gesenkt werden. Durch die Verwendung von eigenen Betriebsmitteln kann<br />
<strong>der</strong> Betriebszweiggewinn erheblich gesteigert werden. Die Spanne zwischen den schlechten<br />
und den besten Betrieben ist laut Abbildung 16 auf Seite 61 geringer als in <strong>der</strong> <strong>Hähnchen</strong><br />
o<strong>der</strong> <strong>Puten</strong>mast. Das liegt daran, dass für die Pekingentenmast nur ein Teil <strong>der</strong> Direktkosten<br />
als betriebsindividuelles Zahlenmaterial zur Verfügung stand (Verkaufserlöse,<br />
Küken und Futterkosten), die restlichen DK lagen nur als Einheitswert vor. Leichter macht<br />
den Einstieg in die Pekingentenhaltung, dass es sich um ein sehr „unempfindliches und<br />
pflegeleichtes“ Geflügel handelt. Die Verluste liegen oft unter 3%, Impfungen und medizinische<br />
Behandlungen sind in <strong>der</strong> Regel nicht notwendig.
Abschlussbetrachtung <strong>der</strong> Chancen und Risiken in <strong>der</strong> Geflügelmast 73<br />
7.3 Begrenzen<strong>der</strong> Faktor Arbeit und Kapital<br />
In den folgenden zwei Tabellen wird betrachtet welches Mastverfahren zu bevorzugen ist,<br />
wenn ein begrenzen<strong>der</strong> Faktor die geplante Betriebsgröße einschränkt. In Tabelle 34 ist<br />
<strong>der</strong> limitierende Faktor die zur Verfügung stehenden 2.000 Arbeitsstunden. Ein Blick auf<br />
den Betriebszweiggewinn (BZG) zeigt, dass die <strong>Puten</strong>mast mit dem 18-WR am besten<br />
abschneidet. Ebenso ist das Investitionsvolumen am geringsten. Die Gesamtkapitalrentabilität<br />
ist aus diesen Gründen am höchsten, da sie sich errechnet indem <strong>der</strong> BZG mit den<br />
jährlichen Zinsaufwendungen verrechnet und durch die Investitionssumme geteilt wird.<br />
Sie gibt eine Aussage darüber, wie sich das eingesetzte Kapital verzinst. Somit ist bei<br />
2.000 Stunden die <strong>Puten</strong>mast am wirtschaftlichsten. Jedoch ist die <strong>Puten</strong>mast nicht generell<br />
den an<strong>der</strong>en Verfahren überlegen. Stehen dem Landwirt nur 1.000 Arbeitsstunden zur<br />
Verfügung, kann <strong>der</strong> 18-WR mit zwei Mast- und einem Aufzuchtstall in <strong>der</strong> Praxis nicht<br />
umgesetzt werden, son<strong>der</strong>n nur <strong>der</strong> 24-WR mit nur einem Aufzuchtstall. Unter diesem<br />
Umstand ist die <strong>Hähnchen</strong>mast die bessere Alternative.<br />
Tabelle 34: Begrenzen<strong>der</strong> Faktor Arbeit mit 2.000 Akh<br />
<strong>Hähnchen</strong>mast<br />
<strong>Puten</strong><br />
Pekingentenmast<br />
Splitting<br />
18-WR Umtriebsverfahren<br />
Arbeitszeit<br />
Begrenzen<strong>der</strong> Faktor Arbeit<br />
2.000 Akh<br />
Betriebszusammensetzung<br />
MP 84.000 15.000 8.000<br />
Investitionssumme 840.000 700.000 490.000<br />
jährliche Zinsaufwendung<br />
bei 6% auf die FK II<br />
31.100 28.100 18.300<br />
BZG 42.400 43.200 18.400<br />
Gesamtkapitalrentabilität 8,7% 10,2% 7,5%<br />
Quelle: Eigene Berechnung<br />
Das Kapital ist ebenso häufig wie die Arbeit ein limitieren<strong>der</strong> Faktor. In Tabelle 35 wurde<br />
die Investitionssumme auf 400.000 € festgesetzt. Bei dieser Summe ist die <strong>Hähnchen</strong>mast<br />
aufgrund des höchsten BZG und <strong>der</strong> besseren Gesamtkapitalrentabilität die beste Wahl.<br />
Die <strong>Puten</strong>mast mit einem 24-WR liegt in <strong>der</strong> Investitionsreihenfolge an letzter Stelle und<br />
die Pekingentenmast auf Platz zwei. Die Reihenfolge än<strong>der</strong>t sich allerdings auch hier,<br />
wenn mehr Kapital eingesetzt werden kann und somit eine <strong>Puten</strong>mast mit einem 18 WR<br />
möglich wird, die im Dreijahresvergleich am wirtschaftlichsten abschneidet.<br />
Tabelle 35: Begrenzen<strong>der</strong> Faktor Kapital mit 400.000 Euro<br />
<strong>Hähnchen</strong>mast<br />
<strong>Puten</strong><br />
Pekingentenmast<br />
Splitting<br />
24-WR Umtriebsverfahren<br />
Investitionssumme<br />
Begrenzen<strong>der</strong> Faktor Kapital<br />
400.000 Euro<br />
Betriebszusammensetzung<br />
MP 40.000 7.300 6.600<br />
Arbeitszeit 950 810 1650<br />
jährliche Zinsaufwendung<br />
bei 6% auf die FK II<br />
14.800 14.819 15.100<br />
BZG 20.200 5.000 15.100<br />
Gesamtkapitalrentabilität 8,7% 5,0% 7,5%<br />
Quelle: Eigene Berechnung
74 Abschlussbetrachtung <strong>der</strong> Chancen und Risiken in <strong>der</strong> Geflügelmast<br />
7.4 Nicht berücksichtigte Kosten und weiter Umsatzerlöse pro m 2<br />
Stallnutzfläche<br />
Um weiter Aspekte aufzuzeigen, die für eine wirtschaftliche Betrachtung <strong>der</strong> Geflügelmast<br />
eine Rolle spielen, werden in Abbildung 19 weitere Auswirkungen auf die landwirtschaftlichen<br />
Einkünfte dargestellt. Im Punkt 8.4 sind die Berechnungen zu den einzelnen<br />
Punkten nachzulesen. Insgesamt gewinnen alle Mastverfahren zusätzlich an Attraktivität,<br />
wenn die unten dargestellten Kosten und Einkünfte in vollem Umfang miteinan<strong>der</strong> verrechnet<br />
werden. Der Zugewinn bei <strong>der</strong> <strong>Hähnchen</strong>mast beträgt 13,8 € pro qm Stallnutzfläche<br />
und Jahr. Der 18-WR <strong>der</strong> <strong>Puten</strong>mast liegt mit 10,5 € an zweiter und die <strong>Puten</strong>mast im<br />
24-WR mit 7,2 € an dritter Stelle. Den geringsten Zugewinn verzeichnet die Pekingentenmast,<br />
hier wird nur ein Zugewinn von 7,1 € pro qm und Jahr realisiert. Am stärksten wirkt<br />
sich bei allen Verfahren die Berechnung des Dungwertes auf die Mastverfahren aus. Dieser<br />
Dungwert kann allerdings nicht immer im vollen Umfang angerechnet werden. Ein<br />
Landwirt mit ausreichen<strong>der</strong> Ackerfläche kann den anfallenden Dung auf seinen Fel<strong>der</strong>n<br />
meistens vollständig nutzen, da <strong>der</strong> limitierende Faktor bei organischem Dünger zumeist<br />
Phosphor ist und dieser auf den Ackerflächen von Landwirten mit wenig o<strong>der</strong> keiner<br />
Viehhaltung gut verwertet werden kann. Wird auf den betriebseigenen Ackerflächen<br />
schon seit Jahren mit organischem Dünger die Mineralstoffbilanz ausgeglichen, kann<br />
Phosphor zum limitierenden Faktor werden. In diesem Fall ist <strong>der</strong> Dungwert nur für die<br />
Mistmenge zu berechnen, die auf das Feld ausgebracht wird. Durch den übrigen organischen<br />
Dünger entstehen dem Landwirt möglicherweise sogar Kosten, die vom Dungwert<br />
abgezogen werden müssen. Einige Geflügelmäster können mittlerweile ihren Mist an Biogasanlagen<br />
verkaufen, o<strong>der</strong> betreiben selbst eine Anlage. Der Ertragswert für die Verwertung<br />
von Geflügelmist in Biogasanlagen lässt sich allerdings wegen <strong>der</strong> komplexen Vergärungsprozesse<br />
kaum bestimmen. Beim Skonto auf Futter und Küken, die in <strong>der</strong> <strong>Hähnchen</strong>-<br />
und <strong>Puten</strong>mast gewährt werden, ist bereits ein kalkulatorischer Zinsansatz von 4,5% auf<br />
das durchschnittlich gebundene Kapital abgezogen, da bei einer Nichtnutzung des Skontos<br />
das durchschnittlich gebundene Kapital angelegt werden kann und dem Landwirt durch<br />
die Nutzung des Skontos theoretische Zinseinkünfte entgehen. Möglichkeiten für Mehreinnahmen<br />
bestehen des Weiteren durch einen Antrag auf einzelbetriebliche Investitionsför<strong>der</strong>ung,<br />
durch Weizenbeifütterung und die Nutzung <strong>der</strong> Dachflächen für Solarzellen.<br />
Wie hoch die zusätzlichen Einnahmemöglichkeiten o<strong>der</strong> Ersparnisse ausfallen, liegt im<br />
Geschick des einzelnen Landwirts.
Abschlussbetrachtung <strong>der</strong> Chancen und Risiken in <strong>der</strong> Geflügelmast 75<br />
Alle Kosten und Einkünfte in € pro m 2 Stallnutzfläche und Jahr<br />
-5,87<br />
-3,10<br />
-0,98<br />
-1,98<br />
-0,15<br />
1,24<br />
1,31<br />
1,65<br />
0,84<br />
3,38<br />
2,79<br />
2,88<br />
Abbildung 19: Zusätzliche Einkünfte und Kosten pro m 2 Stallnutzfläche (Punkt: 8.4)<br />
8,36<br />
8,50<br />
8,50<br />
Pekingentenmast<br />
18-Wochenrhythmus<br />
11,23<br />
<strong>Hähnchen</strong>mast<br />
-10,00 -5,00 0,00 5,00 10,00 15,00<br />
<strong>Puten</strong>mast<br />
24-Wochenrhythmus<br />
Dungwert Maschinenkosten Mwst-Vorteil Integrationsvergünstigungen
76 Fazit <strong>der</strong> Geflügelmast in Bayern<br />
8 Fazit <strong>der</strong> Geflügelmast in Bayern<br />
Die Mastgeflügelerzeugung erreichte in Bayern 2007 mit rund 103.000 t ihren bisherigen<br />
Höchststand. Trotz dieser positiven Entwicklung konnte <strong>der</strong> Verbrauch nur zu 46 % aus<br />
<strong>der</strong> eigenen Erzeugung gedeckt werden. Der Pro-Kopf-Verbrauch in Deutschland steigerte<br />
sich von 1995 bis 2007 um gut 34 % auf zuletzt 18,0 kg. Nur die BSE-Krise 2001 (18,2<br />
kg/Kopf) und die Vogelgrippe 2006 (16,7 kg/Kopf) unterbrachen diese kontinuierliche<br />
Entwicklung. Die Gründe für den steigenden Verbrauch liegen vor allem in <strong>der</strong> Preiswürdigkeit,<br />
<strong>der</strong> einfachen und schnellen Zubereitung bei zugleich großer Produktvielfalt, dem<br />
geringen Fett- sowie dem hohen Eiweißgehalt von Geflügelfleisch.<br />
Von den untersuchten Geflügelarten bietet die Masthähnchenerzeugung die aussichtsreichste<br />
Perspektive. Zum einen kann <strong>Hähnchen</strong>fleisch am kostengünstigsten erzeugt werden<br />
und zum an<strong>der</strong>en bietet <strong>der</strong> Frischfleischsektor noch weitere Absatzpotenziale. Außerdem<br />
liegt <strong>der</strong> Pro-Kopf-Verbrauch von <strong>Hähnchen</strong>fleisch in Deutschland noch 6,5 kg<br />
unter dem EU-Durchschnitt von 2007. Im Gegensatz dazu haben die Erzeugung und <strong>der</strong><br />
Verbrauch von <strong>Puten</strong>fleisch in den letzten Jahren eher stagniert bzw. waren rückläufig.<br />
Das höhere Preisniveau und ein im EU-Vergleich bereits hoher Pro-Kopf-Verbrauch lassen<br />
auf eine Marktsättigung schließen. Nach den Ergebnissen <strong>der</strong> Viehzählung haben die<br />
Bestände und damit auch die Erzeugung von Entenfleisch in Bayern zugenommen. Der<br />
Pro-Kopf-Verbrauch bewegt sich in den letzten zehn Jahren zwischen 0,8 und 1,0 kg. Die<br />
von Januar bis August 2007 festgestellte Erhöhung des Verbrauchs lässt darauf schließen,<br />
dass sich Entenfleisch vom Saisongeflügel zum Ganzjahresprodukt entwickelt.<br />
Insgesamt bietet die Geflügelfleischerzeugung in Bayern also durchaus Chancen. So stieg<br />
<strong>der</strong> Umsatz <strong>der</strong> Geflügelschlachtereien im Jahr 2007 um 38,6 % auf rund 271 Mio. Euro.<br />
Die Zunahme im Absatz von Frischware bietet einheimischen Erzeugern einen Wettbewerbsvorteil.<br />
Allerdings ist die vertikale Integration dieses Betriebszweiges innerhalb <strong>der</strong><br />
Wertschöpfungskette sehr weit fortgeschritten und beschränkt den unternehmerischen<br />
Handlungsrahmen. Das Risikomanagement bei <strong>der</strong> Absicherung von Preisschwankungen<br />
von Futterkosten und Verkaufspreisen sowie beim Hygiene- und Gesundheitsstatus (Vogelgrippe)<br />
stellen sehr hohe Ansprüche an die Betriebsführung. Außerdem sind die Verfahren<br />
bei Baugenehmigungen oft langwierig und mit hohen Auflagen verbunden.<br />
Die betrieblichen Voraussetzungen für eine rentable und sichere Investition in die Geflügelmast<br />
sind für die hier beschriebenen <strong>Puten</strong>- und <strong>Hähnchen</strong>-, als auch für die Pekingentenmastverfahren<br />
meist gegeben. Die Auswertungen über mehrere Jahre zeigen, dass für<br />
alle drei Mastverfahren ein positiver Betriebszweiggewinn (BZG) zu erwirtschaften ist. In<br />
welches Mastverfahren investiert wird, hängt von vielen Faktoren ab und muss jeweils<br />
von Betrieb zu Betrieb individuell entschieden werden. Für Betriebe, die nach einem zusätzlichen<br />
Einkommen suchen und im Jahr zwischen 800 und 1.000 Stunden leisten können,<br />
ist die <strong>Hähnchen</strong>mast eine attraktive Alternative. Für Landwirte, die bereit sind mehr<br />
Geld als in <strong>der</strong> <strong>Hähnchen</strong>mast zu investieren, sich ein umfangreiches Fachwissen anzueignen<br />
sowie ein größeres Verlustrisiko nicht scheuen, bietet die <strong>Puten</strong>mast die Chance ein<br />
gutes Einkommen zu erzielen. Für die Pekingentenmast spricht, dass sie wie die <strong>Hähnchen</strong>mast<br />
auch in kleineren Einheiten realisiert werden kann. Dies ist für den Landwirt<br />
dann von Bedeutung, wenn ihm eine begrenzte Investitionssumme zur Verfügung steht.<br />
Denn auch mit wenig Kapital lassen sich bei diesem Verfahren gute BZG realisieren. Allerdings<br />
muss <strong>der</strong> Landwirt über genügend Arbeitszeit verfügen und für die tägliche Einstreu<br />
einen Helfer zur Hand haben.
Fazit <strong>der</strong> Geflügelmast in Bayern 77<br />
Für die Investitionsentscheidung sollte sich je<strong>der</strong> Betriebsleiter, unabhängig davon in welchen<br />
Bereich er investieren möchte, genügend Zeit nehmen, vor allem, wenn <strong>der</strong> Einstieg<br />
in einen neuen Produktionszweig geplant ist. Wie in den letzten Jahren die Zahl <strong>der</strong> Neueinsteiger<br />
im Bereich <strong>der</strong> erneuerbaren Energien zeigt, sind Landwirte Unternehmer, die<br />
bereit sind in zunächst betriebsfremde Alternativen zu investieren. Trotzdem sollte die<br />
Entscheidung, sich ein neues Standbein für seinen Betrieb aufzubauen, gut überlegt sein.<br />
Nicht eine mögliche Gewinnaussicht darf den alleinigen Ausschlag geben, auch sind die<br />
Neigung und das Interesse des Betriebsleiters an dem neuen Produktionszweig entscheidend.<br />
Dies gilt insbeson<strong>der</strong>e für die tierische Veredelung. Denn wie durch die Abbildung<br />
14, Abbildung 15 und Abbildung 16 dargestellt wird, nimmt das Management gerade in<br />
<strong>der</strong> Geflügelmast großen Einfluss auf die Verdienstaussichten. Während schlecht wirtschaftende<br />
Betriebe von ihrer Abschreibung leben und deshalb mit <strong>der</strong> Zeit aus <strong>der</strong> Landwirtschaft<br />
ausscheiden, haben erfolgreiche Betriebe hohe Betriebszweiggewinne und erwirtschaften<br />
selbst in Krisenzeiten ausreichende Gewinne. Aus diesem Grund sollte <strong>der</strong><br />
landwirtschaftliche Unternehmer Informationen von mehreren verschiedenen Beratungsstellen<br />
und erfahrenen Mästern einholen, um eine für ihn sinnvolle und zukunftsträchtige<br />
Entscheidung zu treffen.
78 Zusammenfassung<br />
9 Zusammenfassung<br />
Eines <strong>der</strong> landwirtschaftlich bedeutendsten Themen im Wirtschaftsjahr 2007/08 sind die<br />
gestiegenen Futtermittelpreise, welche die Produktionskosten für die Fleischproduktion in<br />
die Höhe schnellen ließen. In diesem Zusammenhang haben Mastverfahren mit einer guten<br />
Futterverwertung, wie die Geflügelmast, Vorteile gegenüber ihrer Konkurrenz, z. B.<br />
<strong>der</strong> Schweine- o<strong>der</strong> Bullenmast. In dieser Arbeit wird Landwirten mit Investitionsinteresse<br />
die Pekingenten-, <strong>Puten</strong>- und <strong>Hähnchen</strong>mast näher gebracht, um ihnen die Möglichkeiten<br />
und Risiken in <strong>der</strong> Geflügelfleischproduktion aufzuzeigen und ihnen eine Grundlage für<br />
eine Investitionsentscheidung zu geben. Dazu wird die <strong>der</strong>zeitige Marktsituation in<br />
Deutschland und Bayern dargestellt sowie die Entwicklung <strong>der</strong> letzten Jahre. Außerdem<br />
werden die Haltungsrichtlinien und –vereinbarungen zu den vorgestellten Mastverfahren<br />
aufgeführt. Weiter werden die baurechtlichen Bestimmungen aufgezeigt und <strong>der</strong> aktuelle<br />
Stand <strong>der</strong> Zoonosenverordnung dargelegt. Eine kurze Beschreibung <strong>der</strong> für bayrische<br />
Mäster infrage kommenden Geflügelschlachthöfe ist ebenso enthalten. Um den Landwirt<br />
auch über die Produktionsbedingungen zu informieren, werden die Verfahrenstechniken,<br />
Produktionskennzahlen, benötigten Arbeitszeiten, entstehenden Festkosten und anfallenden<br />
Direktkosten näher erläutert. Einen Eindruck darüber, welchen finanziellen Umfang<br />
die einzelnen Geflügelmastverfahren jährlich haben, bekommt <strong>der</strong> Landwirt bei <strong>der</strong> Berechnung<br />
eines gewerblich geführten Musterbetriebs für die <strong>Hähnchen</strong>-, <strong>Puten</strong> und Pekingentenmast.<br />
Mit Hilfe einer Betriebszweigabrechnung für jede Geflügelart für das vergangene<br />
Wirtschaftsjahr 2007 und einer Zeitraumauswertung, sowie mittels einer Auswertung<br />
<strong>der</strong> besten und schlechtesten Pekingenten-, <strong>Puten</strong>- und <strong>Hähnchen</strong>betriebe, werden die<br />
Gewinne <strong>der</strong> letzten Jahre und ihre Schwankungen aufgezeigt. In <strong>der</strong> Abschlussbetrachtung<br />
werden die einzelnen Mastverfahren in einem Dreijahresvergleich einan<strong>der</strong> gegenübergestellt.<br />
Im Anschluss wird eine Einzelbetrachtung für jede Geflügelart durchgeführt<br />
in <strong>der</strong> nochmals auf Stärken und Schwächen <strong>der</strong> Mastverfahren hingewiesen wird. Für<br />
welches Wirtschaftsgeflügel sich <strong>der</strong> Mäster entscheidet, sollte aufgrund <strong>der</strong> Gewinnschwankungen<br />
zwischen den besten und schlechtesten Betrieben mehr von den Interessen<br />
und Neigungen des einzelnen Mästers abhängen als von möglichen Gewinnaussichten in<br />
einem Mastverfahren.
Roadmap: Der Weg in die Geflügelmast 79<br />
Roadmap: Der Weg in die Geflügelmast<br />
1. Schritt: Anfrage nach einem Mastvertrag bei dem betreffenden<br />
Schlachthof<br />
<strong>Hähnchen</strong>:<br />
Wiesenhof<br />
Jürgen Loibl (Prokurist)<br />
Hofweinzier 20, 94322 Bogen<br />
Tel: 09422/8520-107, Telefax: 09422/8520-103, E-Mail: juergen.loibl@wiesenhof.de<br />
Pute:<br />
Süddeutsche Truthahn AG<br />
Bockhorn Dieter (Vorstand)<br />
Angerstraße 2, 84539 Ampfing<br />
Tel: 08636/6968-40, Telefax: 08636/6968-70, E-Mail: dieter.bockhorn@truthahn-ag.de<br />
Velisco Geflügel GmbH & Co. KG<br />
Manfred Ehret (Mästerbetreuer)<br />
Steinäckerstraße 16, 74585 Rot am See<br />
Tel: 09865/9415-54, Telefax: 09865/9415-56, E-Mail: manfred.ehret@velisco.de<br />
Enten:<br />
Wichmann Enten GmbH<br />
Horst Wichmann (Geschäftsleitung Betriebe Bayern)<br />
Warmersdorf 60, 96193 Wachenroth<br />
Tel: 09548/9229-0, Telefax: 09548/9229-10, E-Mail: info@enten.de<br />
2. Schritt: Informationen bei Offizial- und Firmenberatung einholen<br />
Offizialberatung:<br />
LfL, Lehr-, Versuchs- und Fachzentrum für Geflügel<br />
Dr. Klaus Damme<br />
Mainbernheimer Str. 101, 97318 Kitzingen<br />
Tel: 09321/39008-8, Telefax: 09321/39008299, E-Mail: klaus.damme@lfl.bayern.de<br />
Fachberater für Geflügel in den Landwirtschaftsämtern<br />
Anna Nagel (Gebietsleitung Nordbayern)<br />
Rüglän<strong>der</strong> Str. 1, 91522 Ansbach<br />
Tel: 0981/8908-148, Telefax: 0981/8908199<br />
Dr. Melanie Hageleit (Gebietsleitung Südbayern)<br />
Stadtgraben 1, 85276 Pfaffenhofen a. d. Ilm<br />
Tel: 08441/867-230 Telefax: 08441/867225<br />
Alfons Wittmann (Oberpfalz)<br />
Hoher Bogen-Str. 10, 92421 Schwandorf<br />
Tel: 09431/721-131 Telefax: 09431/721109
80 Roadmap: Der Weg in die Geflügelmast<br />
Bernhard Stark (Unterfranken/Oberfranken)<br />
Von-Luxburg-Str. 4, 97074 Würzburg<br />
Tel: 0931/7904-711 Telefax: 09321/7904722<br />
Cornelia Gabler (Oberbayern)<br />
Stadtgraben 1, 85276 Pfaffenhofen a. d. Ilm<br />
Tel: 08441/867-231 Telefax: 08441/867225<br />
Helmut Sachsenhauser (Nie<strong>der</strong>bayern)<br />
Klötzlmüllerstr. 3, 84034 Landshut<br />
Tel: 0871/603-191 Telefax: 0871/603118<br />
Günther Zinnecker (Mittelfranken)<br />
Rüglän<strong>der</strong> Str. 1, 91522 Ansbach<br />
Tel: 0981/8908-210 Telefax: 0981/8908199<br />
Lorenz Dirk (Schwaben)<br />
Schulstr. 12a, 86637 Wertingen<br />
Tel:08272/8006-196 Telefax: 08272/8006157<br />
Firmenberatung<br />
<strong>Puten</strong><br />
Moorgut Kartzfehn von Kameke GmbH & Co. KG<br />
Joachim Holz (Stellv. Leiter Vertriebsberatung)<br />
Kartz-v.-Kameke Allee 7, 26219 Bösel<br />
Tel:04494/88188<br />
<strong>Hähnchen</strong><br />
Brüterei Süd<br />
Dr. Josef Bachmeier (Geschäftsführer)<br />
Peter-Henlein-Str. 1, 93128 Regenstauf<br />
Tel: 09402/3010 Telefax: 09402/30-49<br />
Enten<br />
Wichmann Enten GmbH<br />
Horst Wichmann (Geschäftsleitung Betriebe Bayern)<br />
Warmersdorf 60, 96193 Wachenroth<br />
Tel: 09548/9229-0 Telefax: 09548/9229-10<br />
3. Schritt: Kontaktaufnahme zu den Erzeugergemeinschaften<br />
<strong>Puten</strong><br />
Truthahn EZG e.G. Höhenrein<br />
Franz Abinger (1. Vorstand)<br />
Krügling 1, 83620 Feldkirchen-Westerham<br />
Tel: 08063/8434<br />
Süddeutsche Truthahn EZG<br />
Rupert Knäpple (1. Vorstand)<br />
Lausheim 52, 88356 Ostrach<br />
Tel: 07585/3838
Roadmap: Der Weg in die Geflügelmast 81<br />
Südhof EZG<br />
Thomas Palm(1. Vorstand)<br />
Heiligenbronn, 84575 Schronzenberg<br />
Tel: 07939/1360<br />
<strong>Hähnchen</strong><br />
EZG Ganghofen e.V.<br />
Rudolf Breu (1. Vorstand)<br />
Thalhausen 7, 84553 Halsbach<br />
Tel: 08623/1576<br />
EZG Bogen/Nittenau<br />
Josef Kammermeier (1. Vorstand)<br />
Albrecht-Dürer-Str. 8, 94333 Geiselhöring<br />
Tel: 09423/90090<br />
Enten<br />
Süddeutsche Enten EZG<br />
Bernd Adleff<br />
Sägmühlstr. 27, 82140 Olching<br />
Tel: 08142/418640 Fax: 08142/418642<br />
4. Schritt: Bauumsetzung<br />
� Baugenehmigungsverfahren (zuständiges Landratsamt, Veterinäramt)<br />
� För<strong>der</strong>ungen + Betriebsentwicklungsplan<br />
Anna Nagel (Oberpfalz, Unter-, Mittel- und Oberfranken)<br />
Rüglän<strong>der</strong> Str. 1, 91522 Ansbach<br />
Tel: 0981/8908-148-8 Telefax: 0981/8908199<br />
Dr. Melanie Hageleit (Schwaben, Nie<strong>der</strong>- und Oberbayern)<br />
Stadtgraben 1, 85276 Pfaffenhofen<br />
Tel: 08441/867230 Telefax: 08441/867225<br />
BimSchG/UVP (zuständiges Landratsamt)
82 Literaturverzeichnis<br />
Literaturverzeichnis<br />
Adleff, B. (2008). Wirtschaftlicher Vergleich all-in-all-out zu Umtriebsverfahren.<br />
Olching: Landesverband <strong>der</strong> Geflügelwirtschaft e.V.<br />
<strong>Bayerische</strong>s Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung. (April 2008). Preisindizes für<br />
Bauwerke in Bayern im Februar 2008. Abgerufen am 19. Mai 2008 von<br />
https://www.estatistik.eu/veroeffentlichungen/webshop/download/M1400C%202008<br />
41/M1400C%20200841.pdf<br />
<strong>Bayerische</strong>s Staatsministerium für Gesundheit, E. u. (3. April 2003).<br />
Mindestanfor<strong>der</strong>ungen an die Haltung von Pekingenten. München.<br />
<strong>Bayerische</strong>s Staatsministerium für Gesundheit, E. u. (11. Juni 2002). Tierschutz; Haltung<br />
von Masthähnchen und Mastputen. München.<br />
Beck, M. (19. November 2007). Der Entenmarkt wächst weiter. Abgerufen am 19.<br />
Februar 2008 von ZMP:<br />
http://www.zmp.de/gefluegel/vbereich/marktanalysen/marktanalyse_Enten.pdf<br />
Beck, M. (11. Februar 2008). EU: <strong>Hähnchen</strong>markt war Motor <strong>der</strong> Produktionserholung.<br />
Abgerufen am 9. Februar 2008 von ZMP:<br />
http://www.zmp.de/gefluegel/vbereich/marktanalysen/Marktanalysen_EU.pdf<br />
Beck, M. (29. Februar 2008). Marktanalyse zum GfK Haushaltspanel. Abgerufen am 5.<br />
März 2008 von ZMP:<br />
http://www.zmp.de/gefluegel/vbereich/marktanalysen/GfK-Analyse.pdf<br />
Beck, M. (7. Dezember 2007). Rückschau/Vorschau Geflügelfleisch: Verbrauch 2007<br />
erholt. Abgerufen am 9. Februar 2008 von ZMP:<br />
http://www.zmp.de/gefluegel/vbereich/marktanalysen/vor-rueck-06-07.pdf<br />
Bekanntgabe <strong>der</strong> Neufassung <strong>der</strong> Düngeverordnung, Bundesgesetzblatt Jahrgang 2007<br />
Teil I Nr.7 (Bundesminister für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz<br />
27. März 2007).<br />
Bockhorn, D. (18. März 2008). Vorstand <strong>der</strong> Süddeutsche Truthahn AG. (A. Tischler,<br />
Interviewer)<br />
Böttcher, W. (4. Juli 2008). Versorgungsbilanz Geflügelfleisch in Deutschland. Bonn,<br />
Deutschland.<br />
Böttcher, W., Beck, M., Bilsing, M., & Schmidt, U. (2008). ZMP-Marktbilanz Eier und<br />
Geflügel 2008 Deutschland EU Welt.<br />
Bonn: ZMP Zentrale Markt- und Preisberichtstelle GmbH.<br />
Böttcher, W., Beck, M., Bilsing, M., & Schmidt, U. (2007). ZMP-Marktbilanz Eier und<br />
Gelügel 2007 Deutschland Europäische Union Weltmark.<br />
Bonn, Deutschland: ZMP Zentrale Markt- und Preisberichtstelle GmbH.<br />
Bundesinstitut für Risikobewertung. (2006). Endbericht über eine Grundlagenstudie zur<br />
Erhebung <strong>der</strong>Prävalenz von Salmonellen in Gallus-gallus-Broilerbetrieben gemäß<br />
Entscheidung 2005/636/EG und <strong>der</strong> zugehörigen technischen Spezifikation<br />
SANCO/1688/2005. Berlin: Oktober.
Literaturverzeichnis 83<br />
Bundesinstitut für Risikobewertung. (4. März 2008). Grundlagenstudie zur Erhebung <strong>der</strong><br />
Prävalenz von Salmonellen in Truthühnerbeständen. Abgerufen am 23. Mai 2008<br />
von<br />
http://www.bfr.bund.de/cm/208/grundlagenstudie_zur_erhebung_<strong>der</strong>_praevalenz_vo<br />
n_salmonellen_in_truthuehnerbestaenden.pdf<br />
Bundschuh, R., Pfundmair, G., & Eisenbeiner, S. (2008). Fleisch- und Geflügelwirtschaft<br />
in Bayern 2007. München: <strong>Bayerische</strong> Landesanstalt für Landwirtschaft.<br />
Damme, K. (2007). Geflügeljahrbuch 2008. Stuttgart: Eugen Ulmer KG.<br />
Damme, K. (2008). Geflügeljahrbuch 2009. Stuttgart: Eugen Ulmer KG.<br />
Damme, K., & Hildebrand, R. (2002). Geflügelhaltung Legehennen, <strong>Puten</strong>- und<br />
<strong>Hähnchen</strong>mast. Stuttgart: Eugen Ulmer KG.<br />
Ehret, M. (9. April 2008). Mästerbetreuung bei Velisco Geflügel GmbH & Co. KG.<br />
(A. Tischler, Interviewer)<br />
Feil, A., & Wloch, E. (2008). Bayrischer Agrarbericht 2008. (B. S. Forsten, Hrsg.)<br />
Abgerufen am 2. Juli 2008 von http://www.agrarbericht.bayern.de/<br />
GENESIS-Online. (2008). Code 41121-301r. Abgerufen am 21. April 2008 von<br />
https://www.statistikdaten.bayern.de/genesis/online/dException?operation=previous<br />
&levelindex=3&levelid=1208779755208&levelid=1208779577050&step=2<br />
GENESIS-Online. (2008). Code 41121-306r. Abgerufen am 21. April 2008 von<br />
https://www.statistikdaten.bayern.de/genesis/online/dException?operation=previous<br />
&levelindex=2&levelid=1208779188238&levelid=1208779134847&step=1<br />
Georg, H. (4. Juni 2008). Bayrisches Bundesamt für Statistik. (A. Tischler, Interviewer)<br />
Goldhofer, H., Reisenweber, J., & Zickgraf, W. (2008). Berechnung des<br />
Deckungsbeitrages von Winterweizen, Düngung. Abgerufen am 10. Juni 2008 von<br />
Landesanstallt für Landwirtschaft:<br />
http://www.lfl.bayern.de/ilb/db/14249/db_berechnung.php?was=w_weizen<br />
Gotthart, M. (2008). Kalkulation Auszahlungspreis Mast. Wiesenhof.<br />
Graser, S., Groß, S., Damme, K., & Schmidtlein, E. (2004). <strong>Perspektiven</strong> und<br />
Möglichkeiten <strong>der</strong> Geflügelfleischproduktion in Bayern.<br />
Freising-Weihenstephan: Bayrische Landesanstalt für Landwirtschaft.<br />
Holz, J. (2007). Lehr- und Versuchsanstalt Kitzingen. Kitzingen: Moorgut Kartzfehn von<br />
Kameke GmbH & Co. KG.<br />
KTBL: Kakulationsdaten. (2004). Mastputen, TYP MP010013.<br />
Abgerufen am 13. Mai 2008 von http://daten.ktbl.de/baukost/<br />
KTBL: Kalkulationsdaten. (2003). Masthähnchen, TYP MH03003.<br />
Abgerufen am 13. Mai 2008 von http://daten.ktbl.de/baukost/<br />
Kuratorium für Technik und Bauwesen in <strong>der</strong> Landwirtschaft e. V. (2006).<br />
Betriebsplanung Landwirtschaft 2006/07. Darmstadt: KTBL.<br />
Loibl, J. (7. April 2008). Prokurist bei Wiesenhof. (A. Tischler, Interviewer)<br />
Müller, K., & Hiller, P. (April 2002). Arbeitszeitbedarf: Flug- und Pekingentenmast<br />
getrennt bewertet. DGS , S. 46-48.<br />
Neser, S. (2007). Inovationen in <strong>der</strong> Schweinemast. Landesanstalt für Landwirtschaft.
84 Literaturverzeichnis<br />
Oltmanns, H. (16. April 2008). Kükenpreise, Schlachtpreise, Futterpreise. (W. E. GmbH,<br />
Hrsg.) Warmersdorf, Deutschland.<br />
Richtlinie 2007/43/EG DES RATES , Mit Mindestvorschriften zum Schutz von<br />
Masthühnern (Amtsblatt <strong>der</strong> Europäischen Union 28. Juni 2007).<br />
Sachsenhauser, H. (2008). Auswertung <strong>der</strong> Schlachtkennzahlen von <strong>Hähnchen</strong>mästern.<br />
Landwirtschaftsamt Landshut.<br />
Schierhold, S., & Pieper, H. (2008). Horizontaler Betriebsvergleich in <strong>der</strong> <strong>Hähnchen</strong>mast.<br />
Landwirtschaftskammer Nie<strong>der</strong>sachsen.<br />
Schmitz-Du-Mont, M. (2008). Arbeitskreis <strong>Puten</strong>mast. Landwirtschaftskammer NRW.<br />
Schöllhammer, H. (2008). BZA Broiler. Regierungsbezirk Stuttgart und Tübingen.<br />
Uffelmann, W. (2007). Entwicklungen <strong>der</strong> internationalen Agrarmärkte und <strong>der</strong>en<br />
Konsequenzen für die (bayrische) Fleischwirtschaft. München: Bayrische<br />
Landesanstalt für Landwirtschaft.<br />
Verordnung (EG) Nr. 646/2007, Der Kommission, zur Durchführung <strong>der</strong> Verordnung<br />
(EG) Nr. 2160/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates über ein<br />
Gemeinschaftsziel zur Senkung <strong>der</strong> Prävalenz von Salmonella enteritidis und<br />
Salmonella typhimurium bei Masthähnchen und zu Aufhebung <strong>der</strong> V (12. Juni<br />
2007).<br />
Wichmann Enten GmbH. (2008). Kalkulation Pekingenten. Warmersdorf.<br />
Wichmann, H. (15. April 2008). Geschäftsleitung Betriebe Bayern bei <strong>der</strong> Wichmann<br />
Geflügelproduktionsgesellschaft mbH. (A. Tischler, Interviewer)<br />
ZMP. (28. Januar 2008). Der deutsche Geflügelmarkt hat sich erholt. Abgerufen am 19.<br />
Februar 2008 von<br />
http://www.zmp.de/presse/agrarwoche/marktgrafik/2008_01_28_zmpmarktgrafik.asp<br />
ZMP. (Februar 2008). Monatliche Haushaltseinkäufe von Geflügelfleisch, in t. Abgerufen<br />
am 15. Februar 2008 von Geflügel Online:<br />
http://www.zmp.de/gefluegelvbereich/getpage.asp?Aufruf=p&Ziel=dokumentatione<br />
n/Mafo_Haehnchen.pdf<br />
ZMP. (15. Januar 2008). Preisspiegel <strong>der</strong> Woche Erzeugerpreise, Großhandelseinstandspreise,<br />
Verbraucherpreise. Abgerufen am 14. Februar 2008 von Geflügel Online:<br />
http://www.zmp.de/gefluegelvbereich/preisspiegel.asp<br />
Zwingmann, W., & Schnei<strong>der</strong>. (2006). Zoonosenbekämpfung in <strong>der</strong> Primärproduktion.<br />
Referat für Tierseuchenangelgenheiten. Bonn: Bundesministerium für Ernährung,<br />
Landwirtschaft und Verbraucherschutz.